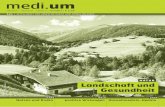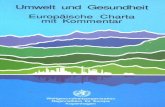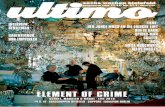gesundheit - Welthaus Bielefeld
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of gesundheit - Welthaus Bielefeld
dezember 2009g
esu
nd
hei
t
welthaus b ie lefe ld in foEs weihnachtet sehr...
Motiv 1: »Da geht´s lang«
An
zeig
e
Motiv 2: Winterlandschaft Motiv 3: Alpha und Omega
Mo
tiv
4:
Die
he
ilig
e T
ierf
am
ilie
Mo
tiv
6:
Win
terl
an
dsc
ha
ft 2
Mo
tiv
5:
Frie
de
nst
au
be
Bereits zum zweiten Mal bietet das Welthaus Bielefeld
in diesem Jahr Weihnachtskarten an. Sie sind von dem
Bielefelder Künstler Luitbert von Haebler liebevoll ge-
staltet und gestiftet – und sie sind für eine gute Sache.
Und mit dem Erlös aus dem Verkauf werden unsere
Projekte für "Eine Welt im Gleichgewicht" unterstützt.
Die Karten im Klappformat A6, 300 Gramm Karton, kön-
nen direkt im Welthaus Bielefeld gekauft oder bestellt
werden, fon 0521. 986 480. Ein Set mit sechs Motiven
kostet 8,50 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer
und 4 Euro Versand. Wer mehr nimmt, spart sogar.
Mehr Infos auf www.welthaus.de
Eine Welt im Gleichgewicht: Die Spenden-kampagne des Welthaus Bielefeld läuftweiter: Spendenkonto 90 894 | SparkasseBielefeld | BLZ 480 501 61 | Stichwort:Gleichgewicht
31
inhaltSchwerpunkt »Gesundheit«
�Ohne Gesundheit keine EntwicklungGesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht Seite 4
�Zu viel und zu wenig zugleich Die Schattenseiten der Arzneimittelversorgung Seite 5
�Bildung für blinde Kinder in Kenia Ananse e.V. hilft beim Aufbau eines Förderzentrums Seite 8
�Zum ersten Mal das Meer sehen weltwärts-Freiwillige über Gesundheitssysteme Seite 9
�Diagnose MalariaEine Gedankenreise nach Ghana Seite 11
�Ein Mädchen stirbt, ein Junge kommt zum Arzt Über den Kampf peruanischer Bauern in den Anden Seite 12
�weltwärts mit dem Welthaus Bielefeldweltwärts-Freiwillige ziehen Bilanz Seite 15
�Globale Ungleichheit der GeschlechterVier Frauen aus Lateinamerika berichten Seite 17
�Das globale KasinoFinanzkrise hat systemische Ursachen Seite 18
�Kein Rettungspaket für AfrikaAuswirkungen der Krise in Afrika lebensbedrohlich Seite 20
�»Ich bin Aguti, der kleine Nager«Neuer Ideenschatz zum globalen Lernen Seite 22
�»Wenn Reiskörner sprechen könnten«Neues Bildungsprojekt zeigt biologische Vielfalt Seite 24
�Apartheidopfer contra deutsche KonzerneUnternehmen, die mit Apartheid Geschäfte machten Seite 26
�Zimbabwe zwischen Macht und Ohnmacht
Zimbabwe-Netzwerk diskutiert Perspektiven Seite 27
�»Jede Oma zählt«Ausstellung »Stille Heldinnen« in Herford Seite 29
�Stiftung Welthaus Bielefeld gegründetNeue Stiftung soll Arbeit absichern Seite 30
Info 02/2009
Der Ortsvorstand der IG Metall Bielefeld hatte be-schlossen, im Rahmen einer bundesweiten Frage-bogenaktion der IG Metall-Kampagne „Gemein-sam für ein gutes Leben“ die Arbeit des WelthausBielefeld zu unterstützen. Für jeden ausgewerte-ten Fragebogen aus dem Bereich der IG MetallBielefeld spendete die Gewerkschaft einen Euro andas Welthaus. So kamen nach der Aktion insge-samt 2.500 Euro zusammen.
Geburtstagsspenden
Wir bedanken uns sehr bei Norbert Eulering fürseine Geburtstagsspende sowie bei Moema und Jo-hannes Augel, die anlässlich ihres (gemeinsamen)140jährigen Geburtstages zu Spenden für dasWelthaus-Brasilienprojekt CAMM aufgerufenhaben. Allen Geburtstagskindern herzliche Glück-wünsche nachträglich!
Die IG Metall Bielefeld unterstützt „Eine Welt im Gleichgewicht“. Auch Geburtstagsspenden sind im Welthaus Bielefeld eingegangen
Aktiv fürs Welthaus
Das Titelbild zeigt ein Motiv aus dem aktuellenWeihnachtsspendenaufruf des Welthaus Biele-feld zum Thema Gesundheit.
Verteilt im Welthaus-Info finden Sie auch immerwieder BotschafterInnen für die Welthaus-Spen-denkampagne „Eine Welt im Gleichgewicht”.
Unsere neue 41-jährige Kollegin Su-sanne Schmeier war selbst jahrelang alsEhrenamtliche tätig. Geboren und auf-gewachsen im Ruhrpott absolvierte siedort auch ihre Ausbildung als Betriebs-wirtin. Danach ging Susanne zum Stu-dium der Diplom-Regionalwissenschaf-ten/Lateinamerika an die Universität zuKöln. Nach dem Studium sammelte siezunächst Erfahrungen in der privatenWirtschaft. Bei einem der weltweit
größten Automobilzulieferer arbeitetesie unter anderem in der Personalent-wicklung und im internationalen Pro-jektmanagement. „Zwar hat mir die an-spruchsvolle Tätigkeit in internationa-len Teams gut gefallen, aber jetzt wardie Zeit reif für eine gravierende Verän-derung“, betont Susanne.
Ausschlaggebend für ihren Entschlusswar die jahrelange sinnstiftende ehren-amtliche Arbeit in einem Mentoren-projekt für Grundschulkinder und eineFortbildung im Bereich „Social Ma-nagement“. Sie möchte nun endlich aneiner gerechteren Welt mitwirken undnachhaltige Projekte umsetzen.
Das neue „Projekt Ehrenamt“ möchtedurch die Qualifizierung der Beteiligtendas entwicklungspolitische Ehrenamtfördern und stärken. Susanne ist für dieBeratung, Koordinie-rung und Qualifikationder Ehrenamtlichenverantwortlich und
Ute Herkströter und Harry Domnik übergeben den Spendenscheck an IrmaHerrmann (Vorstand des Bielefelder Welthaus e.V. – 1. von links), Ulrike Mann(Geschäftsführung Welthaus – 2. von links) und Doris Frye (Fundraising undMitgliederbetreuung beim Welthaus – rechts).
Neue Mitarbeiterinnen im WelthausAnn-Christin Busse heißt die neue Auszubildende. Susanne Schmeier betreut das neueWelthaus Projekt Ehrenamt
www.ecoshopper.de schafft Markttransparenz für „öko-bio-fair“
Zwei Jahre online
„Verbraucher haben ein Recht auf Transparenz – und trans-parente Märkte entwickeln sich besser“. Diese Prinzipienwendet das grüne Verbraucherportal an, um das Wachstumder öko-bio-fairen Konsumgütermärkte zu fördern. Mit Er-folg: „Die ökologisch motivierte Produktsuche hat sich im In-ternet etabliert. Wir verzeichnen bislang über 600.000 Be-sucher. Diese können 100.000 Produkte aus hunderten öko-logischer oder fair gehandelter Sortimente onlinedurchsuchen und dabei Preise und Leistungen vergleichen“,sagt Sprecher Helmut Hagemann, der früher im WelthausBielefeld in Ladengruppe und Brasiliengruppe aktiv war.
Mode von Hess Natur oder Waschbär, Energiespargeräte, Öko-strom im Preisvergleich, Naturkosmetik, Ökobabybedarf – dasalles kann „mit einem Klick“ bequem bestellt werden. WennUmsätze entstehen, erhält EcoShopper eine kleine Erfolgs-provision, die vollständig gemeinnützigen Zwecken zufließt,ein Teil davon auch dem Welthaus Bielefeld. „Für die Zukunftversprechen wir: der Besuch bei EcoShopper bleibt spannend– durch neue Produkte, neue Shops, und neue Leistungen fürunsere Besucher. Das ist unser Beitrag zu einer grüneren undmenschenfreundlicheren Konsumwelt“, resümiert Hagemann.
freut sich darauf, möglichst viele Helferzu motivieren und zu unterstützen.
Ann-Christin Busse freut sich, ab Au-gust 2009 für drei Jahre die neue Aus-zubildende im Verwaltungsbereich desWelthaus zu sein. Nach den guten Welt-haus-Erfahrungen mit ihrem VorgängerAnatoliy Gerun wird sie ebenfalls vonHolger Jantzen zur Bürokauffrau aus-gebildet. Ann-Christin wird sowohl inder Verwaltung als auch im Service tätigsein. Als 1988 geborene Bielefelderingehen ihre ersten Kontakte zum Welt-haus zurück auf einen schulischen Ein-satz beim Carnival der Kulturen. Ann-Christin hat sich bereits in die Belegab-lage und die Buchungen im Welthauseingearbeitet, betreut die „Weltwärts“-Kontierung und wird auch die Adress-verwaltung kennen lernen.
An
zeig
e
3
Liebe Freundinnen und Freunde des
Welthauses,
Im Jahr 2000 haben sich alle Mitglieds-staaten der Vereinten Nationen aufacht Entwicklungsziele – die Millen-nium Development Goals (MDGs) – ge-einigt, um eine zukunftsfähige undnachhaltige Weltentwicklung zu ge-währleisten. Diese Ziele sollen bis 2015
erreicht sein. So soll die Sterblichkeitvon Kindern unter fünf Jahren um zweiDrittel gesenkt werden. Die Mütter-sterblichkeit soll um drei Viertel ge-senkt werden. Die Ausbreitung vonHIV/Aids soll gestoppt werden. Auchder Ausbruch von Malaria und andererschwerer Krankheiten soll unterbundenwerden.
Neun Jahre sind seit diesem UN-Be-schluss vergangen. Dieses Welthaus-Info versucht einerseits eine Bilanz zuziehen und andererseits notwendigeweitere Initiativen und Aktivitäten auf-zuzeigen. Welche Rolle spielen Phar-makonzerne, WHO und internationaleAbkommen in der Gesundheitsvor-sorge und Versorgung? Gibt es Alterna-tiven zu den umstrittenen Patenten, dieden Pharmakonzernen hohe Preise ga-rantieren? Wie werden Medikamenteeigentlich getestet? Welche Rolle spieltdie EU mit ihrer Patentgesetzgebung?Welchen Restriktionen sind Produktionund Handel mit Generika unterworfen?
Aber nicht immer wäre allein eine ge-rechte Medikamentenversorgung aus-
zu gast
vorwort
Isidore Bio, Benin
reichend. Viele Erkrankungen gehen aufArmut und soziale Ungerechtigkeit zu-rück. Das Menschenrecht auf gesundeLebensbedingungen beinhaltet darumin entwickelten Ländern genauso wie inEntwicklungsländern, die negativenFolgen wirtschaftlicher Globalisierung,ungerechte Welthandelsstrukturenund ungerechte Einkommensverhält-nisse zu thematisieren und zu bekämp-fen.
Gesundheit ist überall auf der Welt einewesentliche Voraussetzung, um zumBeispiel Bildungsangebote wahrzuneh-men, um den Lebensunterhalt selbstverdienen zu können, um sich an ge-sellschaftlichen und politischen Prozes-sen zu beteiligen und um Verände-rungsprozesse zu initiieren.
Unterstützen Sie darum die Welthaus-Projekte, lernen Sie unsere Bildungs-materialien kennen, informieren Siesich über die Pharma-Kampagne, wer-den Sie aktiv!
Christiane Wauschkuhn
Vorstand Welthaus Bielefeld
Gesundheit ist überall auf der Welt wichtig
„Das Land Benin sagt der Armut den Kampf an.
Dabei setzen wir auf geeignete Reformen, insbe-
sondere die Förderung der Bildung, die Bemü-
hungen um ein flächendeckende Gesundheitsver-
sorgung sowie die Förderung der Frauen als
wichtige Akteure der lokalen Wirtschaft. Unser
Land ist auch offen für die Zusammenarbeit mit
nicht-staatlichen Organisationen wie dem Welt-
haus Bielefeld. Aber auch die Kulturarbeit des
Welthaus Bielefeld hat mich sehr beeindruckt.“
Seine Exzellens, Botschafter Isidore Bio beieinem Besuch im Welthaus Bielefeld (Bild-mitte). An dem Gespräch nahmen auch Mit-glieder der Welthaus-Gruppe „InitiativenAfrika e.V.“ teil.
4 schwerpunkt gesundheit
Mehr als die Abwesenheit von Krankheit: Gesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht und Basis für Entwicklung. Von Ulrike Mann
Ohne Gesundheit keine Entwicklung
„Gesundheit für alle" – so war die Dekla-ration von Alma Ata überschrieben, derKonferenz im September 1978, in der dieLeitlinien für die Gesundheitspolitik derWeltgesundheitsorganisation (WHO)festgeschrieben wurden. Das in der Men-schenrechtsdeklaration von 1948 ver-kündete Recht auf Gesundheit sollteauch in der Praxis realisiert werden. DerWeg zu einer „Gesund-heit für alle“ sollte überdie Primary Health Care(Basisge sund heits pflege)erreicht werden, der einneues Denken und einneues Verständnis vonGesundheit zugrundelag, das weit über reinmedizinische Zusam-menhänge hinausreichte.Es handelte sich vielmehrum ein umfassendes so-zialpolitisches Programm, in dem etwadie Förderung von sozialer und ökono-mischer Gerechtigkeit als eine notwen-dige Voraussetzung für Gesundheit defi-niert wurde.
Umgesetzt wurden die Prinzipien derPHC (Primary Health Care = Basisge-sundheitspflege), „Gerechtigkeit –Gleich-heit – Partizipation“, seither allenfalls
punktuell – gefährden sie doch das tradi-tionelle hierarchische Modell der medi-zinischen Versorgung ebenso wie lokaleHerrschaftsstrukturen. Dennoch erhältdie PHC-Strategie nach 30 Jahren nunwieder Aufwind: nicht nur als eine Stra-tegie für Entwicklungsländer speziell zurVersorgung der armen Bevölkerung, son-dern auch für die Industrieländer. In vie-
len von Ihnen, so auchin Deutschland, ist esnicht gelungen gegendie Interessen des tra-ditionellen Gesund-heitssystems und derGesundheitspolitik diepräventive Medizin ge-genüber der kurativenzu stärken und denAbbau gesundheitli-cher Ungleichheitensowie die Schaffung ge-
sundheitsfördernder Lebenswelten alsHauptaufgabe der Gesundheitspolitik zubenennen.
Ohne eine gesunde Bevölkerung istkaum Entwicklung möglich – ausdieser einfachen Erkenntnis heraus be-treffen auch drei der Millenniumsent-wicklungsziele (MDGs) direkt den Ge-sundheitsbereich: Verringerung der
Kindersterblichkeit (Ziel 4), Ver besse-rung der Gesundheit der Mütter (Ziel 5)und die Bekämpfung von HIV/Aids,Malaria und weitere Krankheiten (Ziel 6).Trotz mancher Erfolge der Entwick-lungszusammenarbeit im Gesundheits-sektor sterben noch immer jährlich fastsechs Millionen Menschen an Erkran-kungen, die leicht zu vermeiden wären. Die Entwicklungsausgaben zur Förde-rung der weltweiten Gesundheit zu er-höhen, ist dringend erforderlich. Fastnoch wichtiger erscheint es jedoch, diestrukturellen Gründe für die schlechteGesundheitssituation der Armen zu ver-deutlichen und zu bekämpfen. Die Fi-nanzkrise hat 100 Millionen Menschenunter die Armutsgrenze gedrückt –neben Bildung sind es die Ausgaben fürGesundheit, die jetzt unerschwinglichsind, bei gleichzeitig gestiegenen Krank-heitsfaktoren wie schlechter Ernährung,kein Zugang zu sauberem Wasser odergesundheitsgefährdenden Arbeitsbedin-gungen. Gleichzeitig setzen globale Han-delsabkommen und multinationale Kon-zerne Regierungen unter Druck, teureMedikamente zu importieren statt ihnenzu erlauben, bezahlbare Nachahmerpro-dukte (Generika) selbst herzustellen.
Das Welthaus zeigt diese Zusammen-hänge auf und leistet konkrete Solida-ritätsarbeit mit den Betroffenen. InSchulprojektwochen lernen Kinder dieBedeutung der biologischen Vielfaltkennen, schauen Gentechnikern überdie Schulter und gehen mit Biopiratenauf Kaperfahrt. Die Ausstellung „StilleHeldinnen“ ist den Großmüttern Afri-kas in ihrem Kampf gegen Aids undihren Einsatz für ihre Enkelkinder ge-widmet. Projektpartner in Afrika undLateinamerika werden unterstützt inder lokal verwalteten Basisgesundheits-versorgung, der Aids-Prävention, demAnbau lokaler Heilpflanzen und in derpsycho-sozialen Arbeit mit traumati-sierten Kindern und Jugendlichen, dieihr Heimatland verlassen mussten.
Info Mehr zum Thema:www.globaleslernen.de
„Erfolgreicher als es durch die
Volksheilstätten geschieht, führt
der Kampf gegen die Tuberku-
lose schon heute das Proletariat
selbst, in dem es sich bessere
Arbeits- und Existenzbedingun-
gen erkämpft.“ (Ludwig Teleky,
1872 – 1957, österreichischer
Sozialmediziner)
5
Eines vorweg: Medikamente sind nurein kleiner Baustein in der Verbesse-rung der gesundheitlichen Lage derMenschen in armen Ländern. Ausrei-chende Ernährung, sauberes Trinkwas-ser, bessere hygienische Bedingungen,Bildung, soziale Gerechtigkeit unddamit letztlich auch demokratischeTeilhabe spielen eine viel größere Rolle.Dennoch gilt es Krankheiten zu behan-deln – und wo möglich und sinnvollauch z.B. durch Impfungen zu verhin-dern. Der südafrikanische Arzt AndyGray verglich das Gesundheitssystemeinmal mit einem Tisch: „Medikamentesind nur ein Standbein, aber ohne siekippt der Tisch um.“
Warum ist es so wichtig, sich mit derArzneimittelversorgung im Süden aus-einander zu setzen? Es geht dabei nichtnur um Menschenleben und himmel-schreiende Ungerechtigkeit, sondernauch um unsere konkrete Verantwor-tung in Deutschland. Denn kein ande-res Land der Welt exportiert so vieleMedikamente. Die Auseinandersetzung
Die im Welthaus ansässige BUKO Pharma-Kampagne setzt sich mit den Schattenseiten derArzneimittelversorgung in Süd und Nord auseinander. Jörg Schaaber gibt einen Überblick
mit den Geschäftspraktiken der Phar-maindustrie bedeutet, sich mit struktu-rellen Abhängigkeiten und deren Fol-gen zu beschäftigen.
Nutzen und Schaden
In den 1980er Jahren lag der Schwer-punkt der Pharma-Kampagne zunächstauf dem „zu viel“. Berichte von Exper-tInnen und zurückgekehrten Entwick-lungshelferInnen wiesen auf gravie-rende Probleme mit unsinnigen undteilweise gefährlichen Arzneimittelnvon deutschen Herstellern in Asien,Afrika und Lateinamerika hin. Erste Re-cherchen bestätigtendie schlimmsten Be-fürchtungen: Mittel,die hierzulandewegen ihrer Risikenlängst verbotenwaren, wurden im Süden einfach weiterverkauft. Unsinnige Mixturen, die inDeutschland längst aus den Apothe-kenregalen verschwunden waren oderkaum noch ein Arzt verschrieb, weil sie
medizinisch überholt waren, wurdenmassiv beworben.
Dabei war es anfangs keineswegs ein-fach, mit dieser Botschaft durchzudrin-gen. Es galt als eine gute Tat, Medika-mente in arme Länder zu schicken.Dass es zentral darauf ankommt, umwelche Medikamente es sich handeltund welche überhaupt gebraucht wer-den, war noch nicht ins Bewusstseinvorgedrungen. Der Ruf Deutschlandsals „Apotheke der Welt“ war noch un-gebrochen. Es war nicht schwierig, vonPartnern im Süden reichlich Beispielefür das gewissenlose Verhalten multina-
tionaler Pharmakon-zerne zu bekommen.Doch die angegriffe-nen Firmen wusstensich zu wehren. Eshandele sich nur um
Einzelbeispiele, die nicht typisch wären.Schwarze Schafe gäbe es überall. Des-halb entschloss sich die Kampagne, daskomplette Sortiment eines Konzernsunter die Lupe zu nehmen. Nach ein-
Zu viel und zu wenig zugleich
Mittel, die hier verboten
waren, wurden im Süden
einfach verkauft
6 schwerpunkt gesundheit
US-Dollar). Und die Gründung derWelthandelsorganisation (WTO) mitihrem bindenden Vertragswerk TRIPSführte dazu, dass viele arme Ländererstmals Patente auf Arzneimittel ein-führen mussten. Beides stellte viele Län-der vor ein unlösba-res Problem, dennschon vorher reichtendie Arzneimittelbud-gets nicht aus, dennotwendigen Bedarfzu decken. Wohersollte das zusätzlicheGeld kommen?
Im Ergebnis konnten vor zehn Jahrenweniger als ein Prozent der AIDS-Kran-ken in Afrika mit antiretroviralen Me-dikamenten behandelt werden. EinSkandal, der eine internationale Pro-testwelle auslöste. Die notwendigen
jähriger Recherche wurde das Ergebnisunter dem Titel „Macht Hoechstkrank?“ an die Öffentlichkeit gebracht.Die Bewertung der Fachleute über dasAngebot des damals weltgrößten Phar-makonzerns in 27 Ländern der DrittenWelt war deprimierend. Rund dieHälfte der Produkte musste als „irratio-nal“ bezeichnet werden: wenig wirk-sam, unsinnig zusammengesetzt odergar gefährlich. Weitere Studien, die sichmit der Vermarktungspolitik aller deut-schen Firmen beschäftigten, folgten.Das blieb nicht ohne Folgen: Musstenin der ersten (1985) noch zwei Drittelaller Mittel negativ bewertet werden,waren es 2003 „nur noch“ 39 Prozent.
Was wird gebraucht?
Dass Arzneimittel im Prinzip wirksamund sicher sein sollten (also „rational“),ist aber nur eine Mindestanforderung.Wichtig ist, was in einem Land wirklichgebraucht wird. Als Hilfestellung dazuhat die Weltgesundheitsorganisation(WHO) bereits 1977 eine Liste unent-behrlicher Arzneimittel entwickelt.Viele Länder griffen das Konzept auf,und schufen daran angelehnt nationaleListen für ihren Bedarf. Nach diesemKriterium sah es für die deutschen Fir-men noch schlechter aus. Der Anteilvon unentbehrlichen Arzneimittel amAngebot deutscher Firmen in armenLändern wuchs von mageren 11Prozent(1984) auf ganze 27 Prozent in 2004.
Die Preisfrage
Auch die sinnvollsten Medikamentenützen nichts, wenn sie keiner bezahlenkann. Früh wies die BUKO-Pharma-kampagne auf das Problem hin. Dasvon Merck und Bayer vertriebene Mit-tel Praziquantel gegen die verbreiteteBilharziose veranlasste die Kampagne,einen Werbeslogan des Pharmaindu-strieverbands umzudrehen: „Ein Men-schenleben ist teuer, Medikamente sindoft unbezahlbar“. Immerhin erreichtedie BUKO-Pharmakampagne durch dieAktion eine Halbierung des Preises.
Die Preisfrage bekam durch zwei Ent-wicklungen immer stärkere Bedeutung.Mit dem Anwachsen der AIDS-Epide-mie, vor allem in Afrika, gab es erstmalsMillionen von PatientInnen, die enormteure Medikamente benötigten (proPerson und Jahr im Wert von 10.000
Mittel wurden von nordamerikani-schen und europäischen Konzernenvermarktet, obwohl ein bedeutenderTeil der Entwicklung der AIDS-Medi-kamente von öffentlichen Forschungs-einrichtungen geleistet worden war.
Doch die Firmen lie-ßen sich zunächstnicht zu Preisreduk-tionen erweichen. ImGegenteil, sie ver-suchte – oft mit Un-terstützung der Re-gierungen reicherLänder – mit Macht
zu verhindern, dass Länder die Schutz-klauseln des TRIPS-Vertrags anwende-ten. In Südafrika klagten gut zwei Dut-zend Hersteller, darunter auch deutscheFirmen, gegen die Regierung und ver-hinderten so drei Jahre jeden Fort-
Was die Medikamtenfirmen
in den Industrieländern
groß werden ließ, wir armen
Ländern nicht gewährt
7
schritt. Die Pharma-Kampagne betei-ligte sich an den Protesten und er-reichte, dass die Bundesregierung dieFirmen öffentlich zum Klagerückzugaufforderte. Auch Brasilien und Thai-land gerieten unter massiven Druck, alssie begannen, AIDS-Medikamente sel-ber zu produzieren. Das Schutzschildinternationaler Solidarität von untentrug wesentlich dazu bei, dass die Län-der ihre vorbildliche AIDS-Politik fort-setzen konnten.
Indien spielt besondere Rolle
Eine besondere Rolle in der Versorgungarmer Länder spielt Indien. Schätzungs-weise zwei Drittel aller in Afrika verwen-deten AIDS-Medikamente stam men vondort. Die Standardtherapie kostet in-zwischen nur noch rund 70 US-Dollar.Indien hat den TRIPS-Vertrag erst spätratifiziert und konnte so lange patent-frei produzieren ein wesentlicher Fak-tor für das Wachstum der dortigenPharmaindustrie. Doch was auch inden Industrieländern die Medikamen-tenfirmen erst groß werden ließ, näm-lich eine patentfreie Umgebung, sollarmen Ländern nun nicht gewährt wer-den. Wirkstoffpatente für Medikamentewurden in den meisten reichen Ländernerst in den 1960er und 1970er-Jahreneingeführt.
Erhard Kiezewski, Ehrenmitglieddes Industrie- und HandelsclubOWL, Bankdirektor i.R.: „Einegute Möglichkeit, die oft armseli-gen Lebensbedingungen vielerKinder in der Welt, zum Beispielin Afrika und Südamerika, zu ver-bessern, ist die durch Bildung.Gerade hier können schon kleineSpendenbeträge zu einer wesent-lichen Erhöhung der persönlichenChancen, zu mehr Gerechtigkeitbeitragen. Seien wir uns dessenimmer wieder bewusst, dass wirin „einer“ Welt leben, die sichkeineswegs im Gleichgewicht be-findet, vielmehr erhebliche Bil-dungsdefizite bei Kindern auf-weist. Darum ist es außerordent-lich wichtig, die Arbeit desWelt haus Bielefeld zu unterstüt-zen, das sich zielstrebig auch fürden Abbau dieser Lücke einsetzt.Jeder von uns ist angesprochenund kann helfen!”
Jetzt versuchen multinationale Kon-zerne mit allen rechtlichen Mitteln dielokale Produktion neuer Medikamentein Indien zu sabotieren. Während dieStandardmittel gegen AIDS in Indienkeinen Patentschutz genießen, sieht dasfür verbesserte Medikamente und dieZweitlinientherapie anders aus. Da un-gefähr 10 Prozent der AIDS-PatientIn-nen pro Jahr umgestellt werden müs-sen, weil die Standardbehandlung nichtmehr wirkt, ein ernstes Problem.
Auch für andere Krankheiten stehenteilweise nur patentierte Arzneimittelzur Verfügung – oder fast gar keine. DieBehandlung der Tuberkulose zum Bei-spiel wird mit Medikamenten betrie-ben, die 50 Jahre und älter sind. Das istwegen der dadurch notwendigen lan-gen Behandlungsdauer und einerhohen Rate von PatientInnen, die ihreTherapie nicht zu Ende führen, ein gro-ßes Problem. Deswegen setzt sich diePharma-Kampagne auch für mehr öf-fentliche Forschung gegen Armuts-krankheiten ein.
Nach den neuesten Zahlen werden inAfrika südlich der Sahara inzwischen 44Prozent der AIDS-Kranken behandelt.Ein Riesenfortschritt – und doch nochviel zu wenig. Es gibt also noch viel zutun.
�Weitere BotschafterInnen undBotschafter für eine Welt imGleichgewicht finden Sie auf denInternetseiten des Welthaus Bielefeld: www.welthaus.de
In allen Entwicklungsländern ist derAnteil von Sehbehinderten und Blindensehr hoch. Ein Beispiel dafür ist Kenia.Rund 1,2 Millionen Menschen sinddavon in dem ostafrikanischen Landbetroffen. Das ist um ein zehnfacheshöher als in vielen Industrieländern.
Die häufigste Ursache ist Katarakt, dergraue Star. Eine Krankheit, bei der dieLinse eintrübt. Aus noch ungeklärtenUrsachen erleiden das in Kenia relativviele junge Menschen. Daneben iststark vertreten die Infektionserkran-kung Trachom, die zu spät oder unbe-handelt zu schwerwiegender Schädi-gung bzw. Erblindung führt.
Weitere Sehschädigungen entstehenauch durch Onchozerkose (Flussblind-heit), Glaukom (grüner Star), Lepra,Masernkeratitis, Vitamin-A-Mangel(Xerophthalmie) oder Verletzungen.Durch frühe medikamentöse und teil-weise chirurgische Maßnahmen wärendie Folgen einzudämmen bzw. zu ver-
meiden. Aber die Chance dazu habenvielen Menschen nicht.
Armut fördert Sehschäden
Die Erkrankungen, ihr schwerer Verlaufund die Folgen entstehen durch man-gelhafte hygienische Bedingungen,schlechte Wasserversorgung. Auchhaben die meisten Menschen kaumeinen Arzt in ihrer Nähe. Das sind Fak-toren, die in engem Zusammenhangmit Armut stehen. Diese Menschen sindalso doppelt benachteiligt, durch dieLebensbedingung „Armut“ und durchdie Lebensbedingung „Sehschädigung“.
Um diesen Teufelskreis zu durchbre-chen, müssen gerade blinde und hoch-gradig sehbehinderte Menschen Zu-gang zur Bildung haben. Sie müssen Ar-beit haben, um für sich und ihreFamilie sorgen zu können. Nur so kön-nen sie aus der Armut herausfinden.
Genau hier setzen die Projekte der ke-nianischen Organisation Salus Oculi
Kenya in Zusammenarbeit mit demVerein Ananse an. Sie unterstützen Pro-jekte, die Kindern und Jugendlichenmit einer Sehschädigung Bildung er-möglichen. Dies kann durch den Auf-bau eines Förderzentrums sein, durchVersorgung mit notwendigen Hilfsmit-teln wie Braillemaschinen oder Lupen,aber auch durch spezielle Ausbildungder Lehrer/innen oder Finanzierung desSchulgeldes.
Aktuell benötigt Ananse noch dringendSpenden für ein Förderzentrum in derwestkenianischen Stadt Kapsowar, dasbis zum Ende des Jahres aufgebaut wer-den soll.
Info Mehr Informationen: www.ananse.org/Projekte_Kenia/Kapsowar
8
Bildung für blinde Kinder in Kenia Der Verein Ananse hilft beim Aufbau eines Förderzentrums für junge Menschen. Susanne Holms, Mitarbeiterin des Vereins, berichtet
Riziki lebt in großer Armut. Oft gibt esnicht genug zu Essen für die sieben-köpfige Familie. Schulgeld für die wei-terführende Schule können die Elternnur für zwei Söhne aufbringen. Dannerfährt Riziki von der Mädchenschulein Kilifi, die sie auch als blinde Schüle-rin besuchen darf. Sie bemüht sichsehr um Unterstützung für das Schul-geld und bekommt ein Stipendium. Ri-ziki arbeitet hart. Ihr Ziel ist es zu stu-dieren und eines Tages selbst Lehrerinzu werden, um anderen blinden Mäd-chen auf ihrem Weg in die Selbststän-digkeit und Unabhängigkeit zu helfen.
Sonderschullehrerin mit blinder Schülerin und Skripttafel.
Ambulante Sonderschullehrer Luca und Philomena bei ihrer Arbeit mit Blinden.
Mädchenschule als Chance
schwerpunkt gesundheit
„Wo genau in Afrika liegt eigentlich Ni-caragua?“ –diese Frage musste JannikKohl Freunden und Bekannten mehrals einmal beantworten, bevor er abdem Sommer 2008 im Rahmen von‚weltwärts’ ein Jahr in dem lateinameri-kanischen Land verbracht hat. Insge-samt 48 junge Menschen hat das Welt-haus Bielefeld in einer ‚ersten Runde’nach Lateinamerika entsendet, die imAugust dieses Jahres zurückkehrten.Darunter auch Lina Krafeld, die wieJannik von ihren Erfahrungen in ihremProjekt und von den Eindrücken er-zählt, die sie vom Umgang mit Krank-heit und Gebrechen in ihrem Gastlandgesammelt hat.
Jannik erscheint etwas müde und über-nächtigt zum Gespräch. „Ich chatte jedeNacht bis drei Uhr früh mit meinenGasteltern und meinen Freunden in Ni-
caragua – und am liebsten würde ichsofort wieder dorthin zurückfliegen“,gibt er unumwunden zu. Zurück nachCondega, zu ‚seinem’ Projekt, in demgemeinsam mit der Stadt- und Landbe-völkerung zu sozialen und gesundheit-lichen Themen gearbeitet wird: AIDS-und Gewalt-Prävention, Familienpla-nung, Programme mit Kindern undvieles mehr.
Eine Arbeit, in die Jannik im Laufe desvergangenen Jahres hineingewachsenist, innerhalb derer er mit seinemimmer besser werdenden Spanischimmer mehr Aufgaben übernehmenkonnte und durch die er viel gelernthat: „Ich habe mich zu jeder Zeit sehrwohl dort gefühlt und viel von denMenschen dort kennen und schätzengelernt: ihre Kultur, ihre Sprache, ihreOffenheit.“
Zum ersten Mal das Meer sehen
Jannik Kohl und Lina Krafeld arbeiteten ein Jahr „weltwärts“ in Nicaragua und Peru. Sie lernten viel über die dortigen Gesundheitssysteme. Andrea Konschake hat mit ihnen gesprochen
Zurückgeben konnte Jannik Computer-und Englisch-Kenntnisse, die er ineinem Kurs selbst unterrichtet hat –„und ich hatte ein kleineres eigenesProjekt zum Thema ‚Papierrecycling’.Mir war von Beginn an klar, dass ichmit meinem Engagement nur kleineImpulse setzen und nicht die ganzeWelt retten konnte – darüber wurdenwir vom Welthaus bereits beim erstenTreffen aufgeklärt: dass wir eben Abitu-rienten sind und keine ausgebildetenEntwicklungshelfer.“
Und so traf ihn seine erste Begegnungmit dem Gesundheitssystem in Nicara-gua auch recht unvorbereitet. Gleich zuAnfang musste Jannik wegen massiverMagenbeschwerden und Durchfall inein ‚Centro del salud’ und war völligüberrascht darüber, wie schnell er be-handelt wurde und dass sogar die Me-
9
Angenehmer Nebeneffekt: Bei der Tournee des Theaterprojektes konnten manche Kinder das erste Mal das Meer erleben.
Bielefeld-Bethel. Und doch ist in Peruvieles anders: „Generell werden behin-
derte Menschen indiesem Land oftversteckt, ihrLeben gilt nichtwirklich als lebens-wert und manschämt sich für sie.In Cajamarca ge-
hören sie allerdings zum Straßenbildund werden aufgrund der Einrichtun-gen eher akzeptiert.“
In ‚Santa Dorotea’ wird im Gegensatz zuDeutschland nicht unterschieden, obdie Kinder körperlich oder zum Teilschwer geistig behindert sind. In derSchule und im Heim leben und arbei-ten sie zusammen und helfen sich ge-genseitig. „Das klingt zwar erstmalnett“, sagt Lina, “ist in der Praxis aller-dings nicht immer nur schön. Wenn ein14jähriger ein schwerstmehrfachbehin-dertes Kind füttern soll, dann geht dasnicht immer nur liebevoll zu ... “
Auch Lina hat sich in ‚ihrem Projekt’rundum wohl gefühlt. Nur zu Weih-nachten hatte sie – genau wie Jannik –ein bisschen Heimweh. Etwas gewöh-nungsbedürftig fand sie das Essen, dennin Peru wird viel Meerschweinchen ge-gessen („geschmacklich eine Mischungaus Hühnchen und Kaninchen“).
Von der Arbeit mit den Kindern begeistert
Doch von der Arbeit mit den Kindernist Lina nach wie vor begeistert: „WieTaubstumme und Blinde zusammenspielen können, das hat mich immerfasziniert. Einmal habe ich sogar beob-achtet, wie zwei Jungs zusammen Fahr-rad gefahren sind; der eine konntenichts sehen, der andere weder hörennoch sprechen. Und es hat funktio-
10 schwerpunkt gesundheit
dikamente kostenlos waren. Wenig spä-ter staunte Jannik darüber, wie unbe-kümmert die Bevölke-rung in Nicaragua mitMedikamenten umgeht.So hat er Tabletten-Ver-kaufsveranstaltungen inöffentlichen Bussen be-obachtet und auch,„dass die Leute nachjedem Verzehr von Schweinefleisch einePille schlucken, um mögliche Bakterienabzutöten. Keiner weiß, was genau indiesen Medikamenten drin ist – und ichglaube, viele Menschen werden nurkrank, weil sie so viele Tabletten ein-werfen“, vermutet er.
Nebenwirkungen unbekannt
Wie recht Jannik mit dieser Vermutunghat, weiß Lina Krafeld, die ihr Welt-wärtsjahr in den peruanischen Andenzusammen mit behinderten Kindernverbracht hat. Dabei hat sie erfahren,„dass Kinder, die hier als Neugeborenegegen eine Erkältung Tabletten bekom-men haben, daraufhin taubstumm wur-
den. Gerade die ärmere Bevölkerungweiß oft gar nicht, was in den Medika-menten drin ist, die Nebenwirkungensind nicht bekannt. Und Antibiotikumwird sehr viel verabreicht“, erzählt sie.
Die ‚Asociación Santa Dorotea’ ist einenichtstaatliche Einrichtung, die Kinderund Jugendliche bis 18 Jahre mit Be-hinderungen aller Art betreut, und auchmit schwer erziehbaren Kindern aus derStadt Cajamarca und aus entfernten Re-gionen wird gearbeitet. Zur Einrichtunggehören eine Schule, ein Heim, ein öko-logischer Bauernhof und ein kleinesHotel. Eine fast schon vertraute Infra-struktur für Lina, die inmitten solcheroder zumindest ähnlicher Einrichtun-gen großgeworden ist und dort auchschon Praktika absolviert hat: Sie lebt in
Jannik staunte darüber, wie
unbekümmert die Menschen
mit Medikamenten
umgehen
Lina KrafeldDie 21-jährige Abitu-rientin aus Bielefeldlebte und arbeitetefür ein Jahr in Caja-marca in Peru in der‚Asociación SantaDo rotea’. Sie möchteKunst und Spanischstudieren.
Jannik Kohl Der 20-jährige Abitu-rient aus Schloß-Holte/Stukenbrock en ga-gierte sich ein Jahr langin Condega in Nicara-gua im ‚Instituto depromoción humano’.Er möchte Soziologieund Romanische Kul-turen studieren.
niert!“ Ein ganz besonderes Projekt warfür Lina und 15 Kinder das Einstudie-ren und spätere Aufführen des Theater-stücks ‚Der Rattenfänger von Hameln’.Diese Erzählung, und darüber war Linasehr überrascht, ist in Peru sehr popu-lär und bekannt. Als Sondermaßnahmevom BMZ finanziell unterstützt, konntedie Theatertruppe sogar auf Tourneegehen und ihr Stück neben Cajamarcaauch in Tingo Maria im Regenwald undin Lima an der Küste aufführen – undso sahen manche Kinder zum ersten
mal in ihrem Leben das Meer! Gut zweiWochen waren sie unterwegs, das erstemal weg von Zuhause, alleine aufstehen,Zähne putzen – und zusammen mit an-deren Kindern aus anderen Freiwilli-gen-Projekten auf der Bühne stehen.Denn dieses Theater-Projekt dienteauch der Vernetzung der Welthaus-Frei-willigen untereinander.
Einsatz war richtig und wichtig
Lina ist davon überzeugt, dass ihr Ein-satz in den peruanischen Anden richtigund wichtig war: “Die drei Pflegerinnenin dem Heim schaffen gar nicht mehrals die täglichen Routine-Arbeiten. WirFreiwilligen dagegen hatten Zeit, ummit den Kindern Schwimmen zugehen, den Bauernhof zu besuchen, Ku-chen zu backen und spazieren zu gehen– das wäre sonst alles flachgefallen.“ Sieselbst hat sich in diesem Jahr in neuen,anderen Situationen kennen gelernt,und es hat sie darin bestärkt, auf Lehr-amt zu studieren und später möglicher-weise in einer Schule mit integrativemAnsatz zu arbeiten.
Und eins ist für Lina genauso klar wiefür Jannik: Sobald es ihre finanziellenMöglichkeiten zulassen, werden sie wie-der nach Peru und Nicaragua fliegen!
11
Was wäre wenn…? Heute bin ich froh,dass ich nicht die Wahl habe! Würde ichihn ziehen, den Zettel, der unter jedemStuhl der angehenden LehrerInnen hierim Welthaus Bielefeld klebt? Der Zettelmit der Diagnose, Malaria zu habenoder nicht?
Diese Wahl haben jetzt die Referenda-rInnen, die sich auf eine Gedankenreiseeinlassen. Sie können wählen, ob sie eswissen wollen. Und die meisten trauensich, nur Sven Häuser nicht*. Auchseine Hand zuckt, doch im letzten Mo-ment schreckt er zurück. Lieber nicht.Lieber beobachten, was hier vorgehenwird… Und die anderen? Sie haben siealle, die Malaria. Aber niemand weißvoneinander. Und sie dürfen sich nichtmitteilen. Das ist die Regel.
Das Studienseminar ist zur Fortbildunghier. Die jungen Frauen und Männerlernen einen Unterrichtsvorschlag zumThema Malaria kennen. Malaria, eineTropenkrankheit, die mit ausreichen-den Medikamenten zumeist behandel-bar und heilbar ist. Trotzdem erkrankenjährlich etwa dreihundert bis fünfhun-dert Millionen Menschen Ich erkrankenicht. Mehr als eine Million Menschensterben jährlich an Malaria. Ich nicht.Am schlimmsten trifft es Sub-Sahara-Afrika mit 90 Prozent aller Todesfälle.Wie viele Menschen sind das eigentlich?
Krankheit verbreitet sich weiter
Trotz des Versprechens der VereintenNationen, Malaria bis 2015 wirksam zubekämpfen, verbreitet sich diese Krank-heit immer weiter, nicht zuletzt auchwegen der zunehmenden Resistenz derParasiten gegenüber den Medikamen-ten und den Insektiziden. Pharmafor-schung für Afrika rentiert sich nicht. Daist nichts zu verdienen. Und wo nichtszu verdienen ist, wird nicht oder kaumgeforscht. Ob das überall so ist? Wennich könnte, wie ich wollte, ich würdeforschen… Dürfte ich wohl?
Aber zurück zu Sven Häuser. Täuscheich mich oder ist er erleichtert so wie
ich, die Gott sei Dank jetzt auf einemdiagnosefreien Stuhl sitzt? Ich, die Lern-begleiterin, die diese Situation initiierthat und sich wünscht, dass die Teilneh-merinnen und Teilnehmer genau dasauch später mit „ihren“ Jugendlichenwagen. Diese Brisanz der Inszenierung,die vielleicht zweifelhaft ist, diese Zu-mutung, auf einmal malariakrank zusein, dieses Nicht-Wissen, wie dieGruppe reagieren wird oder – nochdavor – ob und wie sie sich einlassenwird.
Es geht los - ich beginne: „Wie geht esIhnen? Jetzt mit dieser Diagnose? Wiefühlen Sie sich? …Wohnen Sie in einemarmen Land südlich der Sahara? (Ja! Siealle „mit Diagnose“ leben in Ghana!).Ihre Heilungschancen sind gut, wennSie schnell zu einer Ärztin, zu einemArzt oder in ein Krankenhaus kommen.Was ist mit Ihnen, wenn Sie auf demLand wohnen und der Fußmarsch fastzwei Stunden beträgt? Sie sind schwach.
Was, wenn eine Ärztin allein für 16.000Menschen zuständig ist?“
Meine Gedanken schweifen ab. 16.000Patienten auf einen Arzt? Ein Glück,hier in Deutschland betreut eine Ärztinstatistisch knapp 300 Menschen. Okay,ich bin dabei! Ich bin versorgt! Ichkenne eine sympathische Tropenärztingleich hier in der Nähe… mein Gott...Nur weil ich geburtszufällig hier aufge-wachsen bin…
„Ein Händler kommt zu Ihnen. Er willIhr Haus mit einem Mittel behandeln,das die Moskitos abwehrt. Auf derSprühflasche können Sie ‚DDT’ entzif-fern. Sie haben davon gehört, dass miteinem mal Sprühen ein drei- bis sechs-monatiger Schutz vor Malariamückengewährleistet ist. Drei bis sechs Monate!Sie wissen auch, dass in vielen Ländernder Welt DDT als stark giftiges Insekti-zid verboten ist, weil es die Menschenschrecklich krank macht. Auch wenndie Weltgesundheitsorganisation DDT
Diagnose MalariaDani Fries, Bildungsreferentin im Welthaus, nimmt angehende Lehrkräfte mit auf eine Gedankenreise nach Ghana
Die Anopheles-Mücke kann Malaria übertragen.
12
weiterhin empfiehlt. Wem sollen Sieglauben? Sechs Monate? Giftig für Sie?Werden Sie dennoch das Mittel inIhrem Haus sprühen lassen?“Ich bin so froh, dass ich nur „vor-lese“, dass ich den angehendenLehrerInnen eine Phantasie-reise anbiete, bei der ich feinraus bin. Ich meine, alle wis-sen hier doch, dass DDT garnicht geht. Das weiß fast jedesKind hier. Da gibt es doch garnichts mehr zu diskutieren.Das soll die Weltgesundheits-organisation noch weiter emp-fehlen?
Und dennoch: Wenn mein Einfüh-lungsvermögen so weit reicht, ichstelle mir vor, ich wäre mit den Teilneh-merInnen in Ghana, ich würde es sprü-hen lassen! Ja! Ich meine, wenn es dochwirksam ist. Sechs Monate? Eine langeZeit. Ich habe Schutz. Noch wichtigergerade… meine Kinder… DDT undseine Auswirkungen… das kommt spä-ter… Also, ich würde sprühen lassen.Nein, würde ich nicht. Ich bin ja nichtdabei. Das ist ja nur so eine Vorstellung.Ich bin draußen. Für mich ist es nichtwirklich. Aber wirklich ist: „The poorhave fewer options if any“. Die Armenhaben keine Wahl(freiheit). So heißt esdoch in den Papieren der UN. Jetztahne ich …
»Der Diagnosefreie hat sich infiziert«
Keine Ahnung, worauf sich die Mitre-ferendare und -referendarinnen vonSven Häuser einlassen. Ob sie nochdabei sind. Ob sie eine Entscheidungtreffen. Ein kurzer Blick zu Sven Häu-ser beruhigt mich. Selbst er lässt sichein. Der Diagnosefreie hat sich infiziert.Ohne den Zettel zu ziehen. Ein leichtesLächeln huscht über meine Lippen. Ichfreue mich. Sven ist dabei. Auch ohneDiagnose.
Nun, wie geht es weiter? Ich hole sie zu-rück aus ihrer Gedankenreise: „Kom-men Sie wieder zurück. Sie fühlen denStuhl unter sich. Sie rutschen ein wenighin und her. Sie nehmen Ihren Nach-barn wahr. Sie schauen sich an … undlangsam sind Sie wieder ganz hier. Hierim Welthaus Bielefeld. Suchen Sie sichbitte einen malaria-infizierten Ge-sprächspartner oder treffen Sie sich in
einer malaria-positiven Gruppe. Erzäh-len Sie einander, wie es Ihnen ergangenist. Diejenigen, die keinen Zettel gezo-gen haben, gesellen sich dazu.“
Sven Häuser und ich – wir gesellen unsnicht. Wir beide trollen uns und suchenuns für einen Moment einen ungestör-ten Ort. Der Moment dauert. Unwei-gerlich nehmen wir Anteil. Es ist laut.Es wird so viel geredet. Es wird so vielmitgeteilt. Selbst nach einer geschlage-nen Viertelstunde scheint kein Ende inSicht. Ich muss unterbrechen. Uns läuftdie Seminarzeit davon. Schade…
Heftige Rückmeldungen
Die Rückmeldungen sind heftig. Sie rei-chen von Empörung über dieses Szena-rio bis zum freundlichen Ratschlag, denErzählfluss offener zu lassen und nichtso viele konkrete Anhaltspunkte undZahlen zu liefern. Das irritiere und störedie Phantasie. Sie reichen von berüh-render Betroffenheit über die Malaria-Katastrophe bis zur sachlich-analyti-schen Kritik, ob ein Lernerfolg der zu-künftigen SchülerInnen mit solcheinem Unterrichtsvorschlag nicht docheher unwahrscheinlich sei.
Die Studiengruppe lernt noch ein Weil-chen die Fortsetzung dieses Modulskennen, aber irgendwie habe ich dasGefühl, sie sind nicht mehr richtigdabei. Sie sind woanders. In Ghana? Beiihrer künstlichen Krankheit? Bei ihrerplötzlich erkannten Gnade, woanders in
schwerpunkt gesundheit
die Welt geworfen worden zu sein? Beiden vielen Millionen Malaria-Infizier-
ter? Bei ihrem Antrieb, wie sie end-lich bald selbst mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern hierüberdiskutieren können? Viel-leicht bei ihrem eigenen En-gagement und dem Zu-trauen, die Verhältnisse zuändern? Ich weiß es nicht.Ich frage auch Sven Häusernicht.
Aber alle machen ihre an-onymen Kreuzchen auf der
Zielscheibe, eine Kurz-Eva-luation zu dieser Veranstaltung
hier. Und endlich kann ich michfreuen. Die Gruppen-Atmosphäre
hat ihnen gefallen. Sie haben den In-halt verstanden und viel gelernt. Auchdie Lernmethoden finden viel Zustim-mung. Die meisten meinen, sie habenihre Zeit gut genutzt und die Ergebnisseseien für sie auch gut gewesen. Aber wiefast immer gibt es einen Ausreißer inder Befragung: „Will ich hierzu selbstetwas tun, aktiv werden?“ Eher nein.
Schade. Verständlich. Unverständlich.Auf ein Neues! Willkommen im Welt-haus Bielefeld!
* Name von der Redaktion geändert
Info Weitere Praxisbausteine für dieschulische und außerschulische Bil-dungslandschaft zum erfahrungsbe-zogenen Lernen sind mit der Bro-schüre „GhanAfrika“ ab sofort imWelthaus Bielefeld erhältlich.
Auch für fachliche Fortbildungen zumGlobalen Lernen steht das Bildungs-Team gern zur Verfügung, fon 0521.9 86 48 13, eMail bildung@welt -haus.de
„Ein gemeinsamer Gedanke, ein ge-meinsames Gefühl, eine gemeinsameKraft!“ Mit diesen Worten schlossenCarlos ... und Hidelia ... immer ihreVorträge und hinterließen bei ihren Zu-hörerInnen einen tiefen Eindruck vomLeben der Bauern in den Dörfern derRuna Simi, der quechua-sprechendenBevölkerung in den ZentralandenPerus. Auf Einladung des Welthaus unddes Vereins Fokus sowie gefördertdurch das Bundesministerium für wirt-schaftliche Zusammenarbeit und Ent-wicklung, waren beide drei Wochen inDeutschland zu Gast.
Die Indígena Hidelia ... ist Präsidentindes Bauernverbandes ADECAP. Carlos.... ist Gründer und Direktor der Orga-nisation. ADECAP ist der Zusammen-schluss von 92 Bauerngemeinden ineiner der ärmsten Provinzen Perus, derProvinz Huancavelica. Das Leben derAndenregion ist gekennzeichnet durchgroße Armut, mangelnde Bildung, eineextrem hohe Kinder- und Müttersterb-lichkeit, Lebensmittelknappheit und
Abwanderung in die Städte und denRegenwald. Mit einfachen Mitteln abergelingt es seit Jahren die Lebensverhält-nisse zu verbessern. Mit der Herstellungorganischen Düngers und Verzicht aufPestizide erreicht man etwa eine ge-sunde und ausgewogene Ernährung.
Fokus arbeitet seit 1985 mit dem Ver-band zusammen, der mit seinen selbst-verwalteten Strukturen erhebliche Ver-besserungen erreicht hat. Vor allem dieoftmals benachteiligten Frauen sind diePromotorinnen von Veränderungen,die sie mit viel Mut und Überzeugungangehen.
Für Jungen gibt es ein Fest
„Wenn ein Mädchen geboren wird,sagen die Eltern: Oh, besser ist es, wennes stirbt“, erklärt Hidelia. „Wenn einJunge geboren wird, geben die Elternein Fest. Ist der Junge krank, wird erzum Heiler gebracht, zum Gesund-heitsposten oder ins Krankenhaus. EinMädchen überlässt man ihrem Schick-sal.“ Auch in der Schulbildung wird der
Die drei Ebenen der andinen Weltsicht:die Unterwelt der Wurzeln und Klein-tiere, die Welt der Menschen, Tiere undPflanzen und die Welt der Apus, derBerggötter.
Junge bevorzugt. Das Mädchen heiratetja doch und geht der Stammfamilie ver-loren.“
Hidelia ... beklagt diesen Missstand. Sieselbst hat es geschafft Lesen und Schrei-ben zu lernen und ihren Mann davonzu überzeugen, dass ihre Aufgabe imRahmen des ADECAP-Präsidiumswichtig ist und allen Bauerngemein-schaften zugute kommt. Ihr ist es ge-lungen, ihren Mann davon zu überzeu-gen, dass er sich während ihres Europa-Aufenthaltes um die vier Kinder,Haushalt und Vieh kümmert. Mit festerStimme berichtete sie, wie ihr arbeits-reicher Tag abläuft, wie sie sich in dieOrganisation eingebracht hat und wiestolz sie darauf ist, dass sich das Lebenin den Gemeinden verbessert hat.
Gemeinsam mit Carlos ... erklärt sie dieSchautafeln, anhand derer die Familienlernen, ihr Haus und ihr Grundstück zu„ordnen“, gesunde Lebensverhältnissezu schaffen. Viele Krankheiten wieDurchfall, Infektionen oder Asthma
13
Ein Mädchen stirbt, ein Junge kommt zum Arzt
In Perus Anden kämpft ein Bauernverband gegen Armut und Diskriminierung. Zwei Gäste haben darüber in Bielefeld berichtet. Von Sigrid Graeser-Herf
14 auslandsprojekte
Hidelia Cahuaya Paucar berichtet beimFreundeskreis „Amigos del Peru“ in Mülheim an der Ruhr.
Ergreifend waren die Schilderungenüber das Schicksal der Menschen, dieaus irgendeinem Grund keinen Perso-nalausweis besitzen. Ohne gültiges Do-kument gibt es den Menschen nicht; erkann seine bürgerlichen Rechte nichtausüben; er ist ausgeschlossen von denpolitischen Wahlen, von den Ämtern alsDorfvorsteherIn und von der staatli-chen Gesundheitsfürsorge, die jetztKindern und Alten offen steht. DieGründe sind für uns schwer nachvoll-ziehbar. Da schreibt ein Angestellter derStadtverwaltung eine Geburtsurkundeaus, die als Geburtsjahr 1924 statt 1994angibt. Den Fehler zu berichtigen, ko-
allem die Mutter Erde, die Pacha Mama,als Heilige wichtig. Erst allmählich wer-den die Kleinen an die spanische westli-che und christlich geprägte Kultur her-angeführt, die in Peru dominiert. DieKinder der Indigenen sollen sich in bei-den Kulturkreisen, dem christlichen wiedem indigenen, stolz und selbstbewusstbewegen können.
können durch geeignete Maßnahmenverhindert werden. Sauberes Trinkwas-ser, eine erhöhte, mit einem Abzug ver-sehene Kochstelle, die Trennung vonMensch und Tier, eine Latrine undOrdnung in den Küchenutensilien kön-nen wesentlich dazu beitragen, Erkran-kungen vorzubeugen. Aber auch das Er-kennen von gravierenden Symptomengehört zu den Kursen, die die Promoto-rinnen von ADECAP gemeinsam mitÄrzten und Krankenschwestern des Ge-sundheitsministeriums durchführen.
Adecap bietet neue Gesundheits-und Bildungsprojekte
Besonders beeindruckend ist der Ar-beitsansatz im Bildungsbereich. DieKinder der Region Tayacaja wachsenquechuasprachig auf; wenn sie in dieSchule kommen, treffen sie auf Leh - rerinnen, die nicht aus der Regionstammen: sie kennen die Lebenswirk-lichkeit der Kinder nicht, sprechen nurSpanisch. Die Kinder werden sozusagenin die Schule „geworfen“ und lernen oftWörter wie „Elefant“ oder „Flugzeug“.Dies führt zu Lernversagen und zu Fru-stration, so dass viele nicht oder nurunregelmäßig den Unterricht besuchen.Der Dialog mit den Eltern misslingt,denn auch sie fühlen sich im Spani-schen nicht sicher. Dementsprechendniedrig ist die Rate der Kinder, die eineweiterführende Schule besuchen.
ADECAP setzt dem staatlichen Bil-dungssystem das Konzept der bilingua-len und interkulturellen Erziehungentgegen. Die Lehrenden sprechen Que-chua, gelernt wird an der Lebenswirk-lichkeit der Kinder, spielerisch und mitallen Sinnen. In ihrem familiären Umfeldsind die Berge, die Flüsse, die Seen, über
Die Ausstellung zur nachhaltigen Landwirtschaft inden Anden Perus ist gedacht für Schulen, Bibliothe-ken, Volkshochschulen, Kirchengemeinden, Eine-Welt-Gruppen, Umweltgruppen, Unternehmen, land-wirtschaftliche Vereinigungen. Sie enthält 15 selbst-stehende Tafeln (roll-ups), die sich in wenigenMinuten aufstellen lassen. Der Transport erfolgt inzwei großen Transportkoffern. Dazu gibt es in ge-wünschter Zahl Plakate und Faltblätter sowie eineDVD. Die Entleihe ist kostenlos, Transportkosten müs-sen übernommen werden. Eine Spende für das Pro-jekt ADECAP ist erwünscht.
Kontakt: Fokus e.V. / Peru-Solidarität im Welthaus Bie-lefeld, Sigrid Graeser-Herf und Hermann Herf, Jochen-Klepper-Str. 2, 33615 Bielefeld, fon 0521. 1 09 32 6 odereMail [email protected]
stet Zeit und Geld und die Betroffenenmüssen viele Demütigungen über sichergehen lassen. Ähnliches geschieht,wenn ein Name falsch geschriebenwurde, oder ein Sekretär verändert ein-fach den Quechua-Namen eines Dorfesin einen spanischen Namen, wie imFalle Hidelias geschehen. Nur mit gro-ßem Protest hat sie ihre Geburtsur-kunde richtig stellen können. Stolz er-zählte sie uns von der Autorität, die sienun als Präsidentin von ADECAP beiden lokalen Behörden genießt.
Bauern streiten um grundlegende Rechte
Besonders tragisch ist es für eine Dorf-gemeinschaft, die ja nach altem Rechtnur kollektiven Landbesitz kennt, wennein findiger Großgrundbesitzer mitWinkelzügen versucht, der ComunidadIndígena ein Stück Land zu stehlen. An-gesichts der weit verbreiteten Korrup-tion ist es für die Hacendados ein Leich-tes, Besitztitel zu fälschen und vor Ge-richt dementsprechend Recht zubekommen. Seit den 20er Jahren ver-sucht eine Familie so der ComunidadIndígena von Huaranhuay ein Gebietvon mehr als 400 Hektar zu entreißen.Mit einem Anwalt will ADECAP denRechtsstreit zugunsten der Bauernge-meinde entscheiden.
Mut und Einsatz lohnen sich also. Undsie werden auch international wahrge-nommen, stellten Carlos und Hidelia inBielefeld fest. Ein Höhepunkt für siewar die hiesige Eröffnung der Ausstel-lung über ADECAP „Wo die Saat auf-geht“. Dort sahen sie plötzlich – in einerganz anderen Umgebung platziert –sich selbst und ihre Landsleute in ihrertraditionellen Tracht.
Leuchtende Augen auf der Apfelplantage
Beeindruckt waren beide natürlichauch vom Leben hier, von großen Städ-ten wie Köln und Berlin. Doch am mei-sten leuchteten ihre Augen beim Besucheiner Apfelplantage, der Besichtigungdes Bio-Hofes Bobbert in Quelle undbeim Gang durch das Freilichtmuseumin Detmold. Carlos fasste seine Ein-drücke so zusammen: „Es ist erstaun-lich –und das ist mir jetzt so richtig klargeworden – in welch kurzer Zeit derMensch rasante technische Fortschrittegemacht hat. Auch wir werden Fort-schritte machen, und gemeinsam mitEuch wird es gelingen“.
Fotoausstellung „Wo die Saat aufgeht“
Gespannte Gesichter bei der Eröffnungder Ausstellung in Bielefeld.
15
weltwärts mit dem Welthaus BielefeldDie Vorbereitungen für den dritten weltwärts-Jahrgang laufen. Knapp 100 junge Menschenkonnten bereits vom Welthaus Bielefeld entsendet werden
Das Welthaus Bielefeld ist bereits in denVorbereitungen für den dritten Welt-wärts-Jahrgang. Im Rahmen desentwicklungspolitischen Freiwilligen-programms „weltwärts“ des Bundesmi-nisterium für wirtschaftliche Zusam-men arbeit und Entwicklung (BMZ),werden junge Menschen in Entwick-lungsländer entsandt, um dort in ver-schiedensten sozialen und ökologischen
Projekten mitzuarbeiten und Erfahrun-gen zu sammeln. Im weltwärts- Jahr2008/2009 entsendete das Welthaus 42Freiwillige, davon sechs nach Guate-mala, zwei nach Mexiko, zehn nach Ni-caragua (davon eine frühzeitige Rück-kehrerin) und 24 Freiwillige nach Peru(davon zwei frühzeitige RückkehrerIn-nen). Durch eine einmalige Koopera-tion mit der Fachhochschule Bielefeld,
konnten wir im Jahr 2008 außerdemsechs Freiwillige für ein halbes Jahr indie Länder Mexiko (4) und Chile (2)entsenden.
Zur Zeit, im weltwärts- Jahr 2009/ 2010,befinden sich 57 Freiwillige im Ausland,davon 13 Freiwillige in Mexiko, 14 Frei-willige in Nicaragua, 30 Freiwillige inPeru (davon eine, die ihren Dienst umein Jahr verlängert hat).
Im nächsten Jahr weitere 50 bis 60 Freiwillige
Im weltwärts-Jahr 2010/2011 planenwir die Entsendung von etwa 50 bis 60Freiwilligen, in die Länder Mexiko, Ni-caragua, Peru, Mosambik und Süd-afrika. Im Winter 2009/2010 werdendiese Freiwilligen ausgewählt, und imFrühjahr 2010 auf ihren Einsatz vorbe-reitet.
Ein besonderer Dank gilt den haupt-amtlichen und ehrenamtlichen Mitar-beiterInnen des Welthaus Bielefeld, denvielen PraktikantInnen, sowie denMentorInnen vor Ort, ohne deren in-tensive Arbeit die Durchführung desweltwärts-Programms nicht möglichist.
Ein Treffen mittelamerikanischer Partnerorganisationen von weltwärts, an demauch Freiwillige beteiligt waren, fand im April 2009 in Guarjila, El Salvador, statt.
Wiebke Hagemeier (Peru)
Lena Löhr (Nicaragua)
„Viele Erinnerungen und Erfahrungen“Die weltwärts-Freiwilligen des Jahrgangs 2008/09 sind zurück. Sie haben Bilanz gezogen
Abschied„Ich lasse Vieles hier zurück, was mirwichtig geworden ist in meinem Alltag:Freunde und Bekannte, Orte voller Er-innerungen, Kolleginnen und Kollegen,Kinder und Jugendliche, Gerüche undGeräusche und Vieles mehr. Ich werdewohl hoffentlich eines Tages auf einenBesuch zurückkehren, doch so wie jetztwird es dann nicht mehr. Bei all dentraurigen Abschieden denke ich aber
auch daran, was mir die Menschen hieralles gegeben haben: Das ganze Lebenund alles was so passiert mit sehr vielGelassenheit und Humor zu nehmen,die Fähigkeiten die man hat zu nutzenund das Beste daraus zu machen, dieFreundlichkeit Fremden gegenüber.“
keit abgenommen und Freiraum ge-schaffen für ein tieferes Verständnis undVerständigung. Sowohl mit dem „An-deren“ als auch mit mir. Und so allge-mein das formuliert ist, so überzeugtbin ich davon, dass meine Erfahrungen,die ich in diesem Jahr gemacht habe,mir nicht nur helfen werden mit Perua-nern, oder vielleicht Südamerikanern(oder in welche politischen, geografi-schen oder kulturellen Gruppen manMenschen nun einteilen möchte) inKontakt und Austausch treten zu kön-
Lernen fürs Leben„Ich glaube gedachte Selbstverständ-lichkeiten haben an Selbstverständlich-
16
Sebastian Schöttler (Guatemala)
Carolin Moch (Peru)
Laura Burzywoda (Peru) Jessica Seyler (Mexico)
Erinnerungen„Das Wichtigste das mir aus Mexikobleibt, sind viele Erinnerungen und Er-fahrungen. Das sind Erinnerungen andie vielen schrecklichen Schicksale derFrauen, aber auch die Erfahrung, wieviel Lebensfreude die meisten Müttertrotzdem haben. Es sind Erinnerungenund Erfahrungen mit den Kindern, mitFreunden und des Alltages. Ich nehmeaber auch viele Kenntnisse mit. Dassind neben den Sprachkenntnissen inerster Linie Kenntnisse im Umgang mitKindern, einer anderen Kultur und me-dizinischen Wissens, denn die Kran-kenschwestern haben mir sehr viel ge-zeigt. Selber habe ich mich darüber ge-wundert, dass ich mich sehr für dieArbeit der Krankenschwestern interes-siert habe, wo ich doch vorher kein In-teresse auf diesem Gebiet gezeigt habe.Wie viel ich dem Heim geben konntekann ich schlecht sagen, aber ich hoffe,dass sie auch von mir mehr lernenkonnten, als dass Europa auch nicht dieschöne heile Welt ist.“
Harry Domnik, 1. Bevollmächtig-ter der IG Metall Bielefeld: “Dieglobale Wirtschaftskrise öffnetdie Schere zwischen Arm undReich immer weiter. Dagegen set-zen wir auf eine soziale und ge-rechte Gesellschaft, in der Wertewie Freiheit, Solidarität und Re-spekt herrschen. Eine Gesell-schaft, in der Menschen von ihrerArbeit in Würde leben können.Wir kämpfen gemeinsam für eingutes Leben und unterstützendas Welthaus Bielefeld. Machenauch Sie mit!”
Resümee?„Es ist schwer ein Resümee über einganzes Jahr zu schreiben. Beim Rück-kehrerseminar habe ich bereits gesagt:„Die Leute fragen oft: Wie war’s? Aberwie soll man darauf bitte antworten?“Meine Antwort ist dann meistens: „Eswar gut, ich habe eigentlich nur gute Er-fahrungen gemacht“ und das ist, denkeich auch das beste Resümee, das ichüber mein Jahr machen kann. Ich habeVieles gelernt und vielleicht haben auchein paar Menschen etwas von mir ge-lernt. Ich werde das Jahr sicher nicht
Vom Lernenden zum Lehrenden„So wie wir über die peruanische Men-talität und Gewohnheiten und Lebens-weisen lernen, lernen auch unsere Mit-menschen durch uns, über uns; erwei-tern ihrerseits ihren Horizont,bekommen neue Ideen, Vergleiche undentdecken so vielleicht ganz neue An-sichten und entwickeln für bestimmteThemen ein neues Verständnis.“
Zurück in Deutschland„Auf jeden Fall hat meine Zeit in Gua-temala auch dazu geführt, aufmerksa-mer zu sein, was Nachrichten und Me-dien, aber auch Einstellungen angeht.Mittlerweile betrachte ich Projekte, wiez.B. das Aufstellen von riesigen Solar-anlagen in der Sahara anders, als ich esvor einem Jahr getan hätte. Man könntevielleicht sagen, dass sich die Betrach-tung um eine Dimension erweitert hat.Man achtet einfach auf andere Aspekte,
nen, sondern allgemein jeder Form von„Andersartigkeit“ offen und interessiertentgegentreten zu können.“
Lena Löhr liest vor: Dies gehörte zu ihren Aufgaben in ihrem Projekt Funarte.
wie z.B. dem Nutzen für die Länderdort. Wer gewinnt, wer verliert? Warumwerden afrikanische Ressourcen vonEuropäern erschlossen, die den Stromvorerst nicht selbst nutzen, sondern andie Länder vor Ort verkaufen wollen?Außerdem lernt man das erste Malschätzen, welche Möglichkeiten manselbst hier hat, welche Sicherheiten undPerspektiven.“
vergessen und einige Geschichtenimmer wieder erzählen. Auch wenn dieGeldquelle umstritten ist, denke ich,dass es eine sehr gute Investition ist,jungen Menschen die Chance zu geben,sich für neues zu öffnen und die Weltnicht aus Urlaubshotels kennen zu ler-nen, sondern von den Menschen ausge-hend.“
In ihren Heimatländern arbeiten NuryRoxana García Córdova, Marlene CruzGonzález, Angela del Carmen PeraltaGonzález und Marisol Iglesias Jímenezin unterschiedlichen Projekten, in diedas Welthaus Bielefeld junge Menschenim Rahmen des Lern- und Freiwilligen-programms ‚weltwärts’ entsendet: Sieunterstützen und fördern mit ihrer Ar-beit benachteiligte Frauen und Kindersowie die ländliche Bevölkerung. Im Maidieses Jahres sind die vier Frauen nachDeutschland gereist, um 47 Freiwilligeauf ihren einjährigen Aufenthalt in denLändern des Südens vorzubereiten. Ineinem Seminar, das speziell für diesenZweck konzipiert wurde, setzte man sichmit Themen der Geschlechterverhält-nisse auseinander. Ziel des Seminars wares, die Freiwilligen für diese Thematik zusensibilisieren und zu befähigen, mit all-täglichen Problemen in den jeweiligenGastländern besser zurecht zu kommen.
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Reisenach Bielefeld war der Austausch mitvielen verschiedenen Institutionen –auch in Berlin, denn fünf Tage langschauten sich die Gäste aus Lateiname-rika die Hauptstadt an. Insgesamt werte-ten die vier Frauen ihren Aufenthalt inDeutschland als eine große Chance,neues Wissen zum Thema ‚Geschlech-terverhältnisse’ zu erwerben. Eines istihnen dabei ganz besonders deutlich ge-worden: Die Benachteiligung von Frauenist ein Problem, das nicht nur die ‚armenLänder’ der Erde betrifft – sondern auchDeutschland, angeblich eine der eman-zipiertesten Gesellschaften der Welt.
Über das Ausmaß der Einschränkungenund Diskriminierungen von Frauenhierzulande waren die Besucherinnenaus Lateinamerika sehr überrascht.Auch wenn in ihren Heimatländern Ge-walt gegen Frauen, Arbeitslosigkeit undArmut zum Alltag gehören, waren sieerstaunt, dass auch in einem scheinbaremanzipierten Land wie Deutschlandzu viele Frauen von häuslicher Gewaltbetroffen sind. Belegt doch eine reprä-sentative Studie des ‚Bundesministeri-ums für Familie, Senioren, Frauen undJugend’, dass 25 Prozent der 10.000 be-fragten Frauen im Alter von 16 bis 85Jahren mindestens einmal körperlicheoder sexuelle Übergriffe durch einenaktuellen oder früheren Beziehungs-partner erlebt haben. Auch in der Be-rufswelt erleben Frauen Benachteili-
gungen. So hat zum Beispiel die ‚Hans-Böckler-Stiftung’ im Rahmen einer Stu-die im Jahr 2007 herausgefunden, dassFrauen trotz gleicher Qualifikation 23Prozent weniger verdienen als Männer.Außerdem haben sie schlechtere Auf-stiegsmöglichkeiten und besetzen weni-ger attraktive Posten als ihre männli-chen Kollegen.
Gemeinsam für Gleichberechtigung kämpfen
Gegen Ende ihres Aufenthaltes inDeutschland zieht Marlene Cruz Gon-zález stellvertretend für ihre Mitreisen-den ein klares Fazit: „Wir sollten unszusammenschließen und alle gemein-sam dafür kämpfen, dass Frauen undMänner in einer Welt der Gleichbe-rechtigung leben können.“
Info An dem Austausch nahmen fol-genden Bielefelder Institutionen teil:‚AWO Frauenhaus’ ,’man-o-mannmännerberatung’, ‚Autonomes Frau-enhaus’, ‚BellZett’ und das ‚Internatio-nales Begegnungszentrum (IBZ)’sowie die Institutionen der Stadt Ber-lin: ‚Internationales FrauenzentrumS.U.S.I.’, ‚Xochicuicatl e.V. Lateinameri-kanischer Frauen’ und das ‚For-schungs- und Dokumentationszen-trum Chile-Lateinamerika (FDCL)’.
Globale Ungleichheit der Geschlechter Vier Frauen aus Lateinamerika setzten sich während ihres Besuchs im Welthaus Bielefeld mitdem Thema Geschlechterverhältnisse auseinander. Natalie Junghof berichtet
17
Die vier Frauen aus dem Süden� Nury Roxana García Córdova aus Huamachuco in Peru, Mitarbeiterin des
Projekts ‚Amigo’, sie engagiert sich für arbeitende Kinder und Jugendliche.� Marlene Cruz González aus Guarjila in El Salvador, Gesundheitspromote-
rin in der Klinik ‚Ana Manganero’ und Gemeindeverwalterin.� Angela del Carmen Peralta González aus Estelí in Nicaragua,
Mitarbeiterin des Vereins ‚MIRIAM’, sie setzt sich für das Recht auf Bildung und gegen Gewalt an Frauen und Kindern ein.
� Marisol Iglesias Jímenez aus Chiapas in Mexiko, sie betreut als Koordinatorin mit dem Projekt ‚Enlace, Comunicación y Capacitación A. C.’indigene Frauen aus kleinen Gemeinden.
Suchten den Austausch (v.l.): Marisol Iglesias Jímenez, Angela del Carmen PeraltaGonzález, Marlene Cruz González und Nury Roxana García Córdova
18 globale wirtschaft
Die globale Finanzkrise ist der vorläufigeHöhepunkt einer Entwicklung, die be-reits in den 70er Jahren begann. DerCrash war vorhersehbar - und ist auchvorhergesehen worden. Er ist nicht ein-fach ein Unfall, sondern hat systemischeUrsachen. Er ist Resultat einer dreißig-jährigen Entwicklung, in der das Finanz-system – um den Begriff von Keynes zubenutzen – zum „Kasino“ mutierte.
Das Kasino-System war nach dem Endeder Nachkriegs-Wirtschaftsordnungvon Bretton Woods entstanden. An dieStelle fester Wechselkurse traten freieKurse, der Kapitalverkehr wurde libera-lisiert und dereguliert, Kapitalverkehrs-kontrollen abgeschafft. Das Kapitalwurde zum mobilsten Produktionsfak-tor – ein komparativer Vorteil, den esweidlich nutzte. So stieg der weltweiteDevisenumsatz börsentäglich von 120Milliarden US-Dollar 1980 auf überzwei Billionen 2005 – eine Steigerungum das Siebzehnfache. 90 Prozentdavon sind spekulative Geschäfte.
Die „Finanzialisierung“ der Märkte
Die Finanzmärkte wurden der dyna-mischste Sektor der Weltwirtschaft. Hier
ließen sich höchste Profite erzielen. Dassein Unternehmen einfach nur rentabelarbeitete, reichte nicht, es musste dieHöchstrendite sein. Die Shareholder-Orientierung wurde zum Maß allerDinge, die auch auf die übrige Wirtschaftübertragen wurde. „Innovationen“ wieVerbriefung, Derivate und neue Ak-teurstypen, wie Hedge Funds und Pri-vate Equity Funds haben das Finanzsy-stem grundlegend transformiert. Die Fi-nanzmärkte waren nicht länger derRealwirtschaft nach- und untergeordnet,sondern zur eigenständigen und überle-genen Quelle der Akkumulation gewor-den. Es war ein neues System entstanden,das einige als „Finanzialisierung“ bezeich-nen, andere als vermögenszentrierteWirtschaft. Wieder andere sprech en vomFinanzmarkt kapitalismus.
Dass dieses System extrem instabil istund zum Crash führen musste, habeninzwischen auch seine Befürworter ler-nen müssen. Dabei kommt aber immernoch zu kurz, dass dieses „Monster“(Horst Köhler) nicht nur ein Stabilitäts-risiko sondern auch eine gewaltige Um-verteilungsmaschine und eine Bedro-hung der Demokratie ist.
Die Finanzkrise hat systemische Ursachen. Sie wurden seit Jahrzehnten hingenommen oder gefördert, erklärt Peter Wahl
Das globale Kasino
Die Umverteilungsmaschine
Der Finanzkapitalismus verstärkt die so-ziale Polarisierung, das heißt die Ein-kommens- und Vermögensentwicklungist im oberen Bereich sehr dynamisch,während sie nach unten hin abnimmtund schließlich in Stagnation undRückgang übergeht. So sinken in denmeisten Industrieländern die Reallöhne,während Kapitaleinkommen rasant ge-stiegen sind. Die Reichen werden rei-cher, die Armen ärmer. Ein interessan-ter Indikator dafür ist die Entwicklungvon Kapitalvermögen, die sich in denzehn Jahren von 1996 bis 2006 weltweitvon 16 auf 32 Billionen Dollar verdop-pelten.
Die Umverteilung von unten nach obenkommt über mehrere Faktoren zu-stande. So führen die hohen Profite imFinanzsektor zu struktureller Unterin-vestition in die Realwirtschaft, mit ent-sprechenden Effekten auf Wachstum,Beschäftigung und die daran hängendenSozialsysteme.
Darüber hinaus wird die Finanzindu-strie mit dem Argument, den Finanz-standort zu stärken, steuerlich entlastet.Während indirekte Steuern, etwa dieMehrwertsteuer, erhöht werden. Mas-sensteuern aber wirken degressiv. Sietreffen die unteren Einkommensschich-ten stärker.
Staatsverschuldung ist kein Generationenproblem
Wird die öffentliche Hand so um einenTeil ihrer Steuerbasis gebracht, meint sieprompt sparen zu müssen. Gerechtfer-tigt wird dies mit der Staatsverschul-dung, die nicht nur akut, sondern auchfür zukünftige Generationen ein Pro-blem sei. Dies ist ein Trugschluss, dennmakroökonomisch ist Verschuldung einNullsummenspiel: jedem Cent anSchulden steht ein Gläubiger gegenüber.Es gibt also Profiteure der Staatsver-schuldung, die man durch progressiveBesteuerung an der Verbesserung derstaatlichen Einnahmen beteiligen muss.
19
Staatsverschuldung ist ein Verteilungs-problem, kein Generationenkonflikt.Die Austeritätspolitik schlägt dann al-lerdings auf die materielle und sozialeInfrastruktur – Bildung, Gesundheitund weiteres – durch. ÖffentlicheDienstleistungen werden entweder zu-rückgefahren, verteuert oder privati-siert. Dies alles führt zu sekundärenUmverteilungseffekten zuungunsten derunteren Schichten und hier tatsächlichzu einer Belastung zukünftiger Genera-tionen.
Kommt es zur Krise, werden die Verlustesozialisiert, das heißt der Steuerzahlerwird zur Kasse gebe-ten, sofern die gigan-tischen Rettungspa-kete nicht streng andas Verursacherprin-zip, dem „speculatorpays principle“, ge-knüpft sind.
Die Umverteilungsdynamik wirkt auchzwischen Nord und Süd. Den Entwick-lungs- und Schwellenländern werdenüber spekulative Geschäftsmodelle wie„Carry Trade“ , die ständigen Wechsel-kursschwankungen, oder über Steuer-paradiese und Offshore-Zentren per-manent Mittel entzogen. Besonders dra-matisch ist die Spekulation mitNahrungsmitteln, die 2008 zu einer Ver-dopplung der Preise geführt hat. Das hatwesentlich dazu beigetragen, dass dieAnzahl der Hungernden wieder aufüber eine Milliarde gestiegen ist.
Durch das Übergreifen der Finanzkriseauf die Realwirtschaft entsteht jetzt er-neut schwerer Schaden für die Entwick-lungsländer. Der Handel geht zurück,Entwicklungsländer können wenigerabsetzen, es kommt zu Wachstumsein-brüchen.
Erosion der Demokratie
„Anleger müssen sich nicht mehr nachden Anlagemöglichkeiten richten, dieihnen ihre Regierung einräumt, viel-mehr müssen sich die Regierungen nachden Wünschen der Anleger richten“, soder Ex-Chef der Deutschen Bank, Rolf-E. Breuer (Die Zeit, 18.5.2000). In An-lehnung an Montesquieus Theorie derGewaltenteilung weist er neben denklassischen drei Gewalten (und den Me-dien als vierte Gewalt) den Finanz-märkten die Rolle einer fünften Gewalt
ImpressumWelthaus Bielefeld (Hrsg.)
August-Bebel-Straße 62, 33602 Bielefeldfon 0521. 986 48 0 | fax 0521. 637 89eMail [email protected] | www.welthaus.de
Redaktionsgruppe:
Christoph Beninde (verantw.), Doris Frye, Heike Grebe, An-drea Konschake, Ulrike Mann, Uwe Pollmann, und StefanieWalter
Layout und Satz: Manfred HornDruck: AJZ-Druck
Spendenkonten:
Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit: Kto. 90 894 | Auslands-projekte: Konto Nr. 106 666; beide Sparkasse Bielefeld, BLZ480 501 61
Bildnachweise:
Welthaus S. 1,2, 3 (2x), 7, 12 rechts, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25(2x); WHO S. 4, 5, 6, 7, 20; Ananse S. 8 (2x), Lina Krafeld S. 9,10 links und Mitte, Jannik Kohl S. 10 rechts; Hermann HerfS. 13, 14 (2x); Ilka Johanning S. 14 und 17, S. 26 KOSA, S. 27Zimbabwe Netzwerk, S. 29 HelpAge
Für die Förderung dieses Heftesdanken wir dem EvangelischenEntwicklungsdienst, EED, Bonn
Das Welthaus Bielefeld trägt dasDZI Spendensiegel für sparsameHaushaltsführung und transpa-rente Verwendung der Spenden!
Kontakte zu den Welthaus-GruppenBitte erfragen Sie die Gruppentermine bei den Kontakten
Ananse – support of people with special needsKontakt: Rüdiger Gailing | � 0521. 801 633 2 | [email protected]
Arbeitsgemeinschaft Solidarische KircheKontakt: Erika Stückrath | � 0521. 89 04 06 | [email protected]
BrasiliengruppeKontakt: Klaus Kortz | � 0521. 988 198 5 | [email protected] oder Marianne Koch | � 0521. 986 48 32
El Salvador GruppeKontakt: Heiner Wild | � 0521. 13 27 41 | [email protected]
FIAN – Food First Informations- und Aktionsnetz-werk [email protected]
Gruppe Südliches AfrikaKontakt: Gisela Feurle | � 0521. 68 607 | [email protected]
Initiativen AfrikaKontakt Bärbel Epp | � 0521. 16 42 829 | [email protected]
Korimá GruppeKontakt: Ellen Schriek � 05203. 69 49 | [email protected]
Ladengruppe – Karibuni-WeltladenKontakt: Angelika Niemeyer | � 0521. 98648 70 | [email protected]
Nicaraguagruppe | Birgit Wolf | �0521. 986 48 41 | [email protected] oder [email protected]
FOKUS – Perusolidarität im WelthausKontakt: Sigrid Graeser-Herf | � 0521. 1093 26 | [email protected]
Regeneraid e.V.|Kontakt: Sven Detering | � 0170. 410 07 19 | [email protected]
Woza-Chor Kontakt: Christoph Beninde,� 0521.986 485 2 | [email protected]
Öffnungszeiten Mediothek: montags bis freitags, 15 - 18.30 UhrKaribuni-Laden: montags bis mittwochs, 15 - 18.30,donnerstags und freitags 10 - 18.30 Uhr, samstags 11 bis 14 Uhr
zu. Joschka Fischer bestätigte aus Regie-rungsperspektive die Behauptung: „Wirkönnen nicht Politik gegen die Finanz-märkte machen und uns abkoppelnvom Rest der europäischen und globa-len Wirtschaft.“ (Frankfurter Rund-schau, 30.9.2003).Nun ist es keineswegs so, dass dieseBankrotterklärung der Politik gegen-über der „Fünften Gewalt“ völlig aus derLuft gegriffen wäre. Wie alle Ideologie,muss sie ein Moment der Realität tref-fen, weil sie sonst wirkungslos wäre.
So führt die Globalisierung tatsächlichzu einer Veränderung in der Rolle des
Nationalstaates. Die-ser war seit 200 Jahrender bestimmendeRahmen von Verge-sellschaftung undkonnte alle wichtigengesellschaftlichen Vor-gänge kontrollieren
und steuern. Doch infolge der Liberali-sierung verschwanden die nationalenGrenzen für Kapital und Waren. Es ent-standen transnationale Räume, die sichder nationalstaatlichen Regulierung ent-ziehen. Das gilt für die Finanzmärkteebenso wie für das Internet.
Allerdings ist dies kein alternativlosesSchicksal, sondern war das Resultat be-wusster Politik, die von Reagan undThatcher eingeleitet wurde und dannvon den anderen übernommen wurde.Noch 2002 erlaubte die Bundesregie-rung hochspekulative Geschäfte wieLeerverkäufe, um sie dann unter demEindruck des aktuellen Crashs wieder zuverbieten.
Das Kasino schließen
Jetzt, da der Kasinokapitalismus imwahrsten Sinne des Wortes bankrott ist,bietet sich die Chance eine neue Finanz-architektur zu etablieren. Dabei kann esnicht darum gehen, das Kasino für dieSpieler sicherer zu machen. Es muss ge-schlossen werden. Das ist, angesichts sei-ner Krisenanfälligkeit, nicht nur einökonomischer Imperativ. Wenn dieMärkte dem Primat der Politik unter-worfen werden, bedeutet das Demokra-tisierung und Humanisierung unsererGesellschaft.
Info Peter Wahl ist Mitarbeiter vonWeltwirtschaft, Ökologie & Entwick-lung (WEED) in Berlin.
Es entstanden
transnationale Räume, die
sich der nationalstaatlichen
Regulierung entziehen
20
Die Finanzkrise ist laut Bundeskanzle-rin Angela Merkel erst überwunden,wenn sich die Wirtschaft in Deutsch-land wieder auf dem Stand vor derKrise befindet. Aber ist das nicht zukurz gedacht? Von einem Ende derWirtschafts- und Finanzkrise kann ehr-licherweise erst dann gesprochen wer-den, wenn weltweit eine Erholung ein-getreten ist und die Verschlechterungender Lebensbedingungen vor allem invielen „Entwicklungsländern“ kompen-siert sind. Davon aber sind die meistenStaaten, insbesondere Afrika, weit ent-fernt.
Finanzkrise im Norden, Wirtschaftskrise im Süden
Mit der Finanzkrise ist es wie beim Ein-nehmen von Rizinus-Öl; wir ahnen,dass da irgendetwas kommen wird, aberwir spüren es noch nicht. Die „größteWirtschaftskrise seit 1945“ ist bisher fürdie meisten Menschen in Deutschlandeher ein gedankliches Konstrukt. Wirsehen und fühlen ihre Auswirkungennoch nicht, weder eine erhöhte Arbeits-losigkeit (hinausgezögert vor allemdurch die Kurzarbeitsverlängerung)noch die Folgen einer gigantischen
Staatsverschuldung, die trotz allenWahlkampfgeschwätzes zur spürbarenEinschränkung staatlicher Leistungenführen wird.
Spürbar und erfahrbar hingegen sinddie Auswirkungen der Finanzkrise aufdie Weltwirtschaft. Geringeres Wachs-tum, stagnierende Exporte mit rückläu-figen Exporteinnahmen, weniger Fi-nanzzuflüsse und Investitionen und einRückgang bei den „Gastarbeiter-Über-weisungen“ zeigen, dass die Finanzkrisein der Realwirtschaft vieler „Entwick-lungsländer“ angekommen ist. DieseEntwicklung trifft vor allem jene Län-der hart, die nur wenige Ressourcenhaben, solche „externen Schocks“ abzu-federn. Die ärmsten Länder – vor allemin Afrika (südlich der Sahara) - könnensich nicht durch Konjunkturpakete vordem ökonomischen Niedergang be-wahren. Den sinkenden Exporteinnah-men, den ausfallenden oder stark rück-läufigen Krediten und Investitionen,dem Rückgang der Überweisungen,welche viele afrikanische Migranten ausder Diaspora in ihre Heimat schicken,oder den ausbleibenden Touristen fol-gen unmittelbare ökonomische und so-ziale Verwerfungen.
Nach einer UN-Aufstellung (Stand:März 2009) haben die Regierungen derWelt zur Bewältigung der Finanz- undWirtschaftskrise mehr als 2,6 BillionenDollar an Steuergeldern ausgegeben,um ökonomisches Wachstum zu stimu-lieren und ihren Volkswirtschaften mitantizyklischen Staatsausgaben auf dieBeine zu helfen. Afrikanische Länder(Ausnahme: Südafrika) sind nicht dar-unter. Sie müssen erleben, wie die öko-nomische Erholung der letzten Jahremit beachtlichen Wachstumszahlen vonjährlich 5 bis 6 Prozent zusammen-bricht.
Noch weniger für Bildung, Gesundheit und Ernährung
Der ökonomische Niedergang hat un-mittelbare soziale Folgen. Auch wenn
Während wir noch wenig von der Finanzkrise spüren, sind die Auswirkungen auf afrikanischeLänder schon jetzt lebensbedrohlich, berichtet Georg Krämer, Mitarbeiter im Bildungsbereich
Kein Rettungspaket für Afrika
globale wirtschaft
men Gesundheits- und Bildungsausga-ben zusammen streicht. Die Weltbankschätzt, dass in 2009 die Regierungender ärmeren Länder ihre sozialen Dien-ste um 11,6 Milliarden US-Dollar redu-zieren werden.
Solche ökonomischen Veränderungenhaben unmittelbare Konsequenzen fürLeben und Zukunft der Ärmsten. LautKinderhilfswerk Unicef folgt einemRückgang des Wirtschaftswachstumsum ein Prozent in Afrika ein Anstiegder Kindersterblichkeit um ein Prozent.Das bedeutet, dass am Ende des Jahreseinige zehntausend Kinder zusätzlichgestorben sein werden – Opfer einerWirtschaftskrise, die ein schrankenloserFinanzkapitalismus verursacht hat, andem Afrika (fast) keinen Anteil hat.Hinzu kommt, dass sich auch die Zu-kunftsaussichten drastisch verschlech-tern. Geringeres Haushaltseinkommenbedeutet, dass die Kinder mangeler-nährt aufwachsen, weniger zur Schulegehen oder keine Gesundheitsdienste inAnspruch nehmen. Je ärmer die Men-schen sind, desto verwundbarer sind siegegenüber ökonomischen Schocks.
Die weltweite Perspektive für Entwick-lung hat sich durch die Finanz- undWirtschaftskrise deutlich verschlechtert.Das Versprechen der Staatengemein-schaft („Millenniumsentwicklungs-ziele“), bis 2015 die extreme Armut zuhalbieren und in zahlreichen sozialenFeldern substantielle Verbesserungen zuerreichen, wird wohl nicht eingelöst. An-gesichts der Wirtschaftskrise ist dies lautUNCTAD „so gut wie unmöglich“. DieWeltbank rechnet für 2009 und 2010 miteiner Zunahme der Zahl der extrem
Armen (weniger als 1,25 US-Dollar proTag) um jeweils 90 Millionen.
Armutsbekämpfung ist nicht ausreichend
Was kann aus der Wirtschaftskrise füh-ren oder zumindest die sozialen Folgenabmildern? Was sind die politischenPrioritäten – sowohl der Regierungenin den „armen Ländern“ als auch derinternationalen Staatengemeinschaft?Beide Seiten geben der Armutsbekämp-fung noch immer kein entsprechendesGewicht. Die „sozialen Dienste“ habenin den meisten afrikanischen Staateneinen zu geringen Stellenwert und müs-sen hinter fragwürdigen Regierungs-projekten zurückstehen. Die Krise hatdaran wenig geändert.
Die internationale Politik glänzt bisherin der Krise vor allem mit Versprechun-gen. 50 Milliarden Dollar haben dieG20-Staaten als Finanzhilfe für diearmen Länder (Frühjahr 2009) zuge-sagt. Das wären immerhin 2 Prozentder Summe, die durch Rettungspaketein Industrie- und Schwellenländer auf-gebracht werden. Doch die Summe istlediglich versprochen. Ob das Geld zu-sätzlich zur üblichen „Entwicklungs-hilfe" fließt und hilft, den Einnahme-ausfall zumindest ein Stück weit zukompensieren, ist unklar.
Versprechungen werden nicht gehalten
Die Erfahrung, dass Versprechen nichteingehalten werden, ist nicht neu. DieEU hat vor einigen Jahren zugesagt, ihreMittel für Entwicklungshilfe bis zumJahr 2015 auf 0,7 Prozent des Brutton-ationaleinkommens zu steigern. Bis2010 soll eine Quote von 0,51 Prozenterreicht werden. Man darf gespanntsein, wie ernst die neue Bundesregie-rung das Versprechen nimmt. Siemüsste 2010 den Entwicklungsetat umfast zwei Milliarden Euro erhöhen. An-gesichts der hohen Staatsverschuldungund der zugesagten Steuererleichterun-gen dürfen Wetten angenommen wer-den, ob sie dazu tatsächlich bereit ist. Esändert wohl wenig, dass laut einer Um-frage für 60 Prozent der Deutschen dieHilfe für die „Dritte Welt“ ein wichtigesWahlkriterium ist.
Der Nachhaltigkeitspreis ‚ZeitzeicheN’rückt beispielhaftes Engagement füreine lebenswerte Zukunft ins öffentli-che Bewusstsein. In der Kategorie‚Ideen’ wurde in diesem Jahr die inter-aktive Ausstellung „Klima verändert“des Welthaus Bielefeld prämiert; eineMitmach-Ausstellung, die das Engage-ment für eine nachhaltige Entwick-lung in besonderer Weise fördert.
Das Ausstellungsprojekt, das vom Bun-desministerium für wirtschaftliche Zu-sammenarbeit und Entwicklung (BMZ)und der Stiftung der Stadtwerke Biele-feld finanziell unterstützt wird, thema-tisiert Aspekte des Klimawandels mitbesonderem Fokus auf drei Länder Mit-tel- und Südamerikas: Peru, Nicaraguaund Mexiko. Das Projekt setzt auf dieVernetzung verschiedener Akteure.Freiwillige von „weltwärts“ recherchier-ten in den Projektpartner-Ländern desWelthaus Bielefeld zum Thema Klima-wandel und dokumentierten persönli-che Erfahrungen von EinwohnerInnenin Bild und Wort. Studierende der Uni-versität Bielefeld entwickelten im Rah-men eines Seminars das pädagogischeBegleitprogramm. Die Erstellung derAusstellung geschieht in Zusammenar-beit mit MitarbeiterInnen der Arbeits-gemeinschaft Regenwald Artenschutze.V. und des Bielefelder Naturkundemu-seum namu. Die Ausstellung wird imSeptember 2010 im namu eröffnet unddort vier Monate zu besuchen sein.
Info Mehr per eMail: [email protected] oder [email protected] oder fon 0521. 98648 0
Nachhaltigkeitspreis fürdas Welthaus Bielefeld
Preisverleihung (v.l.): Prof. Dr. Rolf Krei-bich (Institut für Zukunftsstudien undTechnologiebewertung gGmbH), Elisa-beth Neske, Vera Bellenhaus, ChristianSchebaum (alle Welthaus Bielefeld e.V.),Eberhard Neugebohrn (Stiftung Umweltund Entwicklung NRW), Stefan Richter(GRÜNE LIGA Berlin e.V.)
21
Wirtschaftswachstum keine hinrei-chende Bedingung für Entwicklung ist,so bedeutet die Schwächung doch, dassfinanzielle Ressourcen ausfallen, diezum Überleben dringend gebrauchtwerden. Dies betrifft Kleinbauern, diefür ihre Agrarprodukte jetzt noch weni-ger bekommen, ebenso wie den Staat,der aufgrund geringerer Steuereinnah-
Subsahara: Einbruch beim Wirtschaftswachstum
2007 2008 2009
6% 5,1% 1%Quelle: Weltbank
„Mmmh, schnuppert doch einmal…Das ist Zimt. Zimt riecht sooo gut. UndZimt-Tee hilft, gesund zu werden, wennihr erkältet seid. Als ich auf Sansibarwar, das ist eine große Insel vor der Ost-küste von Tansania, da habe ich echteZimtbäume gesehen und geschnuppert.Sansibar ist einfach eine schöneSchnupper-Insel. Hier wachsen nochviele andere Gewürze, auch Nelken.Kennt ihr Nelken?...“, so beginnt einAktionsvorschlag im neuen Handbuch„KITA GLOBAL. Das Praxisbuch.“ vomWelthaus Bielefeld. Das kleine NagetierAguti erzählt aufgeregt weiter: „Undjetzt habe ich euch ein ganz leckeres Re-zept mitgebracht, den Chai-Tee aus In-dien, den ganz viele Kinder lieben. Dasind auch Zimt und Nelken drin. Viel-leicht Zimt und Nelken aus Sansibar?...Kommt, wir schauen einmal auf derWeltkarte nach, wo Sansibar und Indienliegen…“ Wie auch in diesem Kapitel„Was uns schmeckt und gut tut“ erhal-ten Erzieherinnen und andere Pädago-gInnen der frühkindlichen Bildung Ak-
tionsvorschläge und Anregungen zumGlobalen Lernen für ihre Alltagspraxis.Gleichzeitig finden sie Hintergrundin-formationen zu Themen der Einen Weltund zum Fairen Handel. Gemeinsammit ihren Kindergartenkindern lernensie die heilende Wirkung der Gewürzekennen und freuen sich daran, wenn dieMädchen und Jungen „echten Chai“zubereiten und dabei Gewürze aus allerWelt mit allen Sinnen selbst erkunden.
Mit allen Sinnen dabei sind auch diezwölf Mädchen und Jungen aus dem Ja-kobus-Kindergarten in Bielefeld. Auf-geregt sitzen sie auf ihren Bodenkissenund hören gebannt dem kleinen Agutizu. Aguti, dem kleinen Nagetier ausGhana, das die beiden PraktikantinnenAnnet und Jenny flink aus einer Sockezum Leben erweckt haben. Unser klei-ner Handpuppen-Aguti, beseelt mit
Stimme, Mimik und Gestik, nimmt dieKinder nun mit auf Schoko-Expeditionnach Ghana... Sie sind fasziniert vonAguti und von den Gerüchen der Ka-kaobohnen. Daraus soll Schokoladewerden? Der kleine Kevin und Marie,das Beinahe-Schulkind, fragen Aguti:„Hmm, Fairer Handel – was ist das?“Und Aguti nimmt sie mit auf die Plan-tage von Tante Ashanti, die für den Fai-ren Handel arbeitet. Und der kleineNager fragt pfiffig zurück: „Marie, wasmeinst du denn - was ist ‚fair’ für dich?“Und so entwickelt sich ein Gesprächrund um Fragen von gerechter Vertei-lung, von gesundem, ökologischemAnbau und Verantwortung. Frei nachdem Motto „Naschen ist ausdrücklicherlaubt!“ probieren die Kindergarten-kinder alle Kakao- und Schokoladenbe-standteile: „Igitt, das ist bestimmt keineSchokolade!“ – prustend verzieht Paulsein Gesicht, und die zerkaute Bohnelandet in vielen kleinen Bröseln aufdem Fußboden. Aguti muss lachen –
22
»Ich bin Aguti, der kleine Nager«
Annika Meiwald und Dani Fries stellen den neuen Ideenschatz zum Globalen Lernen fürdie pädagogische Bildungsarbeit im Kindergarten und in der ersten Schulzeit vor
23bildung
der ‚fernen’ Welt zu verknüpfen. (...) In[...] alltäglichen Erkundungen liegenvielfältige Fragen und Themen des glo-balen und nachhaltigen Lernens. Siemüssen nur erschlossen werden.“ UndProfessor Dr. Rainer Dollase, seit vielenJahren renommiert im Bereich der Ele-mentarpädagogik, fügt in seinem Vor-wort zu „KITA GLOBAL. Das Praxis-buch.“ hinzu: „Kinder lernen in kon-kreten Situationen und von konkretenPersonen - deswegen sind die Projektedieses Buchs konkret, praxisnah undkindgerecht. Kein pädagogischer Pro-zess ist mit dem Ende eines Projektesoder eines Programms zu Ende. JedeBotschaft muss tagtäglich gelebt werden
und verliert dabei sein Wackelbein. Nunschreien alle Kinder vor Entzücken undrufen wild durcheinander: „Der istdoch gar nicht echt aus Ghana! Aguti,bist du echt?“ Der kleine Socken-Agutiquietscht vor Vergnügen und fragt zu-rück: „Bin ich echt? Meint ihr, dass ichecht bin? - Na klar bin ich echt“. Undso findet die aufregende Schoko-Expe-dition einen fröhlichen Abschluss, dervon einer ganz besonderen persönli-chen Urkunde für jedes Kind gekröntwird. Stolz hält Paul seinen Ausweis inden Händen und verkündet: „Ich binjetzt fairer Schokoforscher!“
Auch diese erprobte Aktion mit einerBastelanleitung für Aguti und denSchoko-Ausweis findet sich in „KITAGLOBAL. Das Praxisbuch.“ im Kapitelzur Projektarbeit über den Fairen Han-del mit Eltern, Schule und Stadtteil wie-der.
Schlüsselthemen der Zukunft werden behandelt
Alle Ideenschätze zum Forschen undPhilosophieren, Feiern und Phantasie-ren, Tanzen und Toben, Backen undBauen aus aller Welt behandeln in kind-gerechter Form verschiedene Schlüssel-themen der Zukunft. Ob Gesundheit,Kinderrechte, Fairer Handel, Klima,Vielfalt von Lebensstilen, Migrationoder Mobilität – erstmals bietet ein Pra-xisbuch den MitarbeiterInnen an, denBildungsauftrag der KITAS zur Weltof-fenheit frühzeitig und regelmäßig mitThemen der Einen Welt im Alltag ein-zubinden. Wie wichtig es ist, Kindernsolche Erfahrungen zu ermöglichen,damit sie sich später in einer globali-sierten Welt zurechtfinden, bestätigtauch Frau Dr. Preissing, Expertin zumSituationsansatz und zum Konzept dervorurteilsbewussten Erziehung (diver-sity) im Praxisbuch: „Die globalen Er-eignisse und Zusammenhänge der gro-ßen weiten Welt sind längst in den lo-kalen Lebenswelten der Kinder, ihrerFamilien und ihren Nachbarschaftenangekommen. Menschen mit den un-terschiedlichsten Sprachen aus allerWelt leben in Deutschland. Kunstge-genstände, Musik, Kleidung, Obst, Ge-müse und Gewürze aus vielen Länderngehören längst zum Alltag. (...) Es gibtalso genügend Anknüpfungspunkte,um die nahen Welten der Kinder mit
Ideal für die Weihnachtszeit und auch an kalten Wintertagen –Chai-Tee selbst gemacht. Zutaten für 8 Tassen: 6 Tassen Wasser, 4Tassen Milch, 6 ganze grüne Kardamonkapseln, 4 Nelken, 1 EL Fen-chelsamen, 1 TL Anis, 1 Zimtstange, 1/2 TL frische, feingehackte Ing-werwurzel, 6 EL Zucker (evtl. weniger nach Wunsch),4 EL schwarzerTee oder Rotbuschtee für Kinder.
Alle Zutaten (Gewürze nach Geschmack) bis auf den Tee in einemTopf zum Kochen bringen, umrühren und dann bei geringer Hitze imoffenen Topf eine Minute köcheln lassen. Den Tee hinein geben undalles noch einmal aufkochen. Dann sofort auf kleinste Stufe stellenund 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Den Gewürztee anschließenddurch ein Sieb direkt in die Tassen oder in eine Kanne gießen.
Alle Zutaten aus dem Fairen Handel sind im Karibuni-Laden imWelthaus Bielefeld erhältlich.
Chai-Tee selbst gemacht
Die Kinder des Jakobus-Kindergarten hören gespannt Aguti zu.
- die Veränderung der Realität ist diebeste Pädagogik.“
Info „KITA GLOBAL. Das Praxisbuch.Ideenschatz zum Globalen Lernen fürdie pädagogische Bildungsarbeit imKindergarten und in der ersten Schul-zeit.“, Loseblattsammlung A4, 106 Sei-ten, vierfarbig illustriert, Ringbuchfor-mat mit Lesezeichen zur gezieltenKompetenzförderung, gedruckt auf100 Prozent Recycling-Papier. 19,95Euro. Welthaus Bielefeld 2009. Im Er-scheinen. Mehr Infos bei Dani Fries,Referentin Globales Lernen und Regio-nalkoordinatorin für entwicklungspo-litische Bildungsarbeit des LandesNRW, fon 0521.9 86 48-0/-13.
Das ist für die Viertklässler der Bielefel-der Eichendorffschule schon komisch.Die Schulstunde sollte sich um biologi-sche Vielfalt drehen. Aber dann müssendie 19 Jungen und Mädchen einenTurm aus Stiften bauen. Danach ziehtjeder einen Stift nach dem anderen ausdem fragilen Konstrukt heraus. DerTurm zerfällt in seine Einzelteile. Aberwas hat das nun mit der biologischenVielfalt zu tun? Nachdenkliche Gesich-ter und dann ein Gedankenblitz: „DieNatur gerät aus dem Gleichgewicht,wenn eine Pflanze oder ein Tier fürimmer verschwindet!“ strahlt Milan.
Die Vielfalt der Pflanzen bestimmt unseren Alltag
Aha, so ist das also. Der erste Schritt istgemacht. Nun beginnen die Grund-schüler die bunte Welt der biologischenVielfalt, der „Biodiversität“, zu entdek-ken. Sie versuchen eine Verbindung zwi-schen Fliegenpilz und Pinguin oderTiger und Ananas herzustellen.
Schnell finden sie heraus, dass sie dieVielfalt in der Pflanzenwelt in vielen Be-reichen ihres Alltags – meist unbewusst– direkt nutzen: als Nahrungsmittel,Baumaterial oder Treibstoff. Und dabei
ist gleich klar, wo das Leben der Men-schen besonders stark von der Vielfaltder Pflanzen abhängt? „Na klar, beimEssen“, sagt Finja. „Denn wenn es nurwenige oder keine Pflanzen gäbe, dannkönnte ich keine Tomaten, keine Pa-prika, Kartoffeln oder Zucchini essen.Und auch die Tiere hätten nichts zuessen und ich deshalb keine Salami,keine Milch und keinen Joghurt. Undich müsste Plastikschuhe und –pullovertragen.“
Es wird aber auch bald deutlich, dassnicht überall auf der Welt Gemüse, Spa-ghetti, Kartoffelbrei, Obst oder ein Kä-sebrot auf den Teller kommen. Das wäreja langweilig. Außerdem: Was wäre,wenn alle Kartoffeln, aller Weizen, alleÄpfel und Bananen oder alle Milchküheaussterben würden? Zum Glück habensich in den vielen Ländern der Welt ganzunterschiedliche Esskulturen entwickelt.Besonders in asiatischen Ländern essendie Menschen zu (fast) jeder Mahlzeitnur eins: Reis. Je nachdem, wie gut eseiner Familie geht, kann sie sich zusätz-lich noch Gemüse oder ein Stück Fleischleisten. Aber Reis ist immer mit dabei.Da staunen selbst die Grundschüler undüberlegen, wie sie es finden würden,jeden Tag nur Käsebrot essen zu müssen.
24
Ein kleines Korn ernährt die Welt
Woher aber kommt eigentlich der Reis?In kleinen Forscherteams versuchen dieSchüler und Schülerinnen das zu er-gründen. Wie viele Reissorten es frühergab und wie viele heute noch haupt-sächlich angebaut werden. Das WelthausBielefeld und die Lehrer geben ihnenHilfsmittel an die Hand: Fiktive Reis-bauern nehmen die Kinder mit auf ihreReisfelder, zeigen ihnen ihre Ernte underzählen von ihren ganz eigenen Züch-tungen. Diese haben sie über viele Jahre,teilweise Generationen übergreifend, ge-züchtet. Jede Sorte hat sich dabei ganzindividuell an die jeweiligen herrschen-den klimatischen und Umweltbedin-gungen, also die Bodenbeschaffenheitoder das Wasservorkommen, angepasst.
Die Familie Ching berichtet, dass sieohne den Anbau verschiedener Reissor-ten fast vom Hunger bedroht gewesenwären. Denn vor ein paar Jahren hat einschädlicher Pilz einen großen Teil derErnte vernichtet. Übrig blieben zweiSorten, die sich dem Pilz widerständigzeigten und so die Kleinbauern vor demHunger bewahrte. Doch viel wichtigerist der philippinischen Reisbauernfami-lie der Erhalt alter Traditionen. Manche
Das Welthaus bringt Kindern die weltweite biologische Vielfalt in einem neuen Bildungsprojektnäher. Lena Schoemaker, Mitarbeiterin des Bildungsbereiches, berichtet, wie das geht
„Wenn Reiskörner sprechen könnten“
rechtzufinden. Aktuell soll das Thema„Biodiversität“ aus der Biologieeckeherausgeholt und allen zugänglich ge-macht werden. Je nach Altersstufe liegendie Schwerpunkte bei den Themen Kli-mawandel, Biopiraterie oder Gentech-nik. Im Mittelpunkt steht immer die ei-gene kindliche bzw. jugendliche Lebens-welt.
Zu einer facettenreichen Auseinandersetzung eingeladen
Die Projekte laden die Lernenden zueiner facettenreichen Auseinanderset-zung mit globalrelevanten Themen einund zeigen gleichzeitig: Auch du kannstetwas tun! Im Rahmen von vier Pro-jektwochen, einem Bildungs-Bag, einerBroschüre für Lernbegleiterinnen undLernbegleiter bringt das Welthaus-Bil-dungsprojekt „Biodiversität weltweit –Vielfalt erhalten!“ Kindern, Jugendli-chen, Lehrerinnen und Lehrern sowieanderen außerschulischen Interessiertendas komplexe Thema näher.
Den Abschluss des Bildungsprojektesbildet eine für das Frühjahr 2010 ge-plante Plakataktion. Studierende desFachbereichs Gestaltung der Fachhoch-schule Bielefeld entwerfen großforma-tige Plakate, die dann in Bussen undBahnen sowie im öffentlichen RaumBielefelds und in OWL zu sehen seinwerden.
unserer Reissorten sind schon viele hun-dert Jahre alt. „Schade, dass Reiskörnernicht sprechen können“, sinniert Patri-cia.
Biodiversität ist bedroht
Die Kinder entdecken, dass nicht nurder einseitige Konsum von Nahrungs-mitteln oder die Ausbreitung einesSchädlings mit dem Verlust von Vielfaltzu tun hat. Sie sehen, dass auf anderenReisfeldern Kräuter, Insekten, Spinnenund Fische ihre Lebensräume verlieren,weil der Großgrundbesitzer hem-mungslos Insektizide und Herbizideversprüht, den Boden überdüngt unddamit das Wasser verseucht.
Und dann ist da noch die Sache mit demKlimawandel. Verwirrung zeigt sich inden Gesichtern der Kinder. Müssen siedoch feststellen, dass die Familie Chingdurch ihren Reisanbau zum Klimawan-del beiträgt und gleichzeitig von ihm be-troffen ist. „Was sollen die Chings dennnun machen?“ fragt sich Philipp. Da zei-gen sich die Herausforderungen, vor diedie Globalisierung nicht nur Erwach-sene sondern auch Kinder und Jugend-liche fortan stellt. Diese Herausforderung nimmt der Bil-dungsbereich im Welthaus Bielefeld aufund erarbeitet seit vielen Jahren Bil-dungsmaterialien, die es jungen Men-schen erleichtern soll, sich in einerimmer komplexer werdenden Welt zu-
25
Rowen Fernandez, Torhüter beiArminia Bielefeld: “Es ist nurfair, wenn die Verursacher fürden Klimawandel auch etwas da-gegen tun. Und nicht die Men-schen in Afrika darunter leidenmüssen, indem sie von Dürrenund Überschwemmungen heim-gesucht werden. Das WelthausBielefeld bringt das auf denPunkt. Deshalb ist es eine guteSache, es zu unterstützen.”
26 kampagnen
Ausarbeitung und Einhaltung ethischerStandards für international tätige Kon-zerne dar: Basierend auf allgemein ak-zeptierten Normen des InternationalenRechts legt das New Yorker Gerichtgrundlegende Prinzipien fest, nachdenen „sekundäre Akteure“ zur Verant-wortung gezogen werden können.
Noch versuchen die Firmen, die Ent-scheidung über die Zulassung der Klageanzufechten, aber seitdem die Südafri-kanische Regierung die Klage unter-stützt, scheinen die Möglichkeiten eineraußergerichtlichen Einigung gestiegenzu sein.
Das Welthaus unterstützt gemeinsammit der Koordination Südliches Afrika(KOSA) seit 1998 die Bemühungen derApartheidopfer. Wir setzen uns dafürein, dass transnationale Konzerne, ihreTochterunternehmen und auch Zuliefe-rer im weltweiten Handeln die Men-schenrechte sowie international verein-barte soziale und ökologische Normeneinhalten. Es müssen verbindliche undwirklich umsetzbare Instrumente jen-seits der gesetzlichen Grundlagen in denUSA entwickelt werden, mit denen dieseUnternehmen verpflichtet werden, dieMenschenrechte sowie internationalanerkannte soziale und ökologischeNormen und Standards zu respektieren.
„Sie müssen zahlen“
Ganz wie Bischof Desmond Tutu schonsagte: „Sie sagten, Geschäft ist Geschäft.Redet mit uns nicht über Moral. Siehätten wohl auch Geschäfte mit demTeufel gemacht. Alle Unternehmen, diemit dem Apartheidregime Geschäftegemacht haben, müssen wissen, dass siein der Schusslinie stehen. Sie müssenzahlen, sie können sich das leisten. Undsie sollten es mit Würde tun. Dies wirdKonzernen einen Anreiz bieten, künftigGeschäftspartner in Ländern vorzuzie-hen, die eine bessere human rights re-cord haben.“
Info Mehr unter: www.kosa.org/thema_entschaedigung.html
Während der Arbeit der Wahrheits-und Versöhnungskommission, die von1996 bis 1998 in Südafrika versuchte,Opfer und Täter in einen Dialog zubringen, hatten die internationalenKonzerne die Möglichkeit, ihre Rollewährend der Apartheid zu thematisie-ren, entsprechende Konsequenzen zuziehen und Verantwortung zu überneh-men. Sie ließen die Chance ungenutzt.Unter anderem auch deswegen be-schlossen die Opfer 2002, in den USAKlage gegen diese Firmen einzureichen.
Nach jahrelangen Verzögerungen undVerweisungen an andere Instanzenwurde am 8. April 2009 von einem NewYorker Gericht die Klage gegen letztlichfünf Firmen angenommen: Daimler,Ford, General Motors, IBM und Rhein-metall. Sie müssen sich nun vor Gerichtwegen Beihilfe zu schweren Menschen-rechtsverletzungen verantworten.
Die Unternehmen haben das Apartheid-system nicht erfunden, das heißt sie sindnicht primär dafür verantwortlich. Abersie haben sich stark um Geschäfte imund mit dem Apartheidstaat bemüht, sodie Argumentation der Richterin. DerHinweis darauf, dass sie die Landesge-setze in Südafrika befolgen mussten, ent-hebe sie nicht der Verantwortung. Dieinternationale Gemeinschaft in derForm der UN-Vollversammlung und desUN-Sicherheitsrats haben Apartheidviele Male als „Verbrechen an derMenschheit“ bezeichnet. Zudem gab esseit 1977 ein verpflichtendes Rüstungs-embargo und seit 1986 Wirtschaftssank-tionen. Banken und Unternehmen, diemit Südafrika und staatlichen Konzer-nen profitable Geschäfte machten, wuss-ten, was sie taten. Sie waren Helfershelfereines kriminellen Systems.
Die Entscheidung der New Yorker Rich-terin weckt Hoffnung: Nicht nur beiden Apartheid-Opfern, die durch diejuristische und gesellschaftliche Aufar-beitung als Opfer sozial anerkannt wer-den und damit einen Anspruch aufEntschädigung erhalten. Es stellt aucheinen Meilenstein bei der zukünftigen
Am 11. November 2002 reichten An-waltskanzleien aus Südafrika und denUSA in New York Entschädigungsklagengegen 22 internationale Konzerne ein.Darunter Firmen wie IBM, General Mo-tors, Daimler, Rheinmetall, DeutscheBank, Dresdner Bank und Commerz-bank. Kläger waren 91 SüdafrikanerIn-nen, die während der Apartheid Opferschwerer Menschenrechtsverletzungengeworden waren. Ein weiterer Kläger wardie Khulumani Support Group, eineSelbsthilfeorganisation, die rund 45.000Apartheidopfer vertritt.
Den beklagten Unternehmen wurdevorgeworfen, jahrzehntelang das rassi-stische Apartheidsystem in Südafrikaunterstützt zu haben, das bereits 1966von der Vollversammlung der VereintenNationen als „Verbrechen an derMensch heit“ bezeichnet wurde. Rhein-metall und Daimler lieferten Waffenund Fahrzeuge, die von Militär und Si-cherheitskräften gegen die Bevölkerungeingesetzt wurden. IBM lieferte Compu-ter und Technik für Justiz, Polizei undMilitär, was die systematische Überwa-chung und Unterdrückung der Bevölke-rung erst ermöglichte. Banken gaben seitden 60er Jahren großzügig Kredite, diedazu beitrugen, den staatlichen Haus-halt, die allgemeine Wirtschaftslage unddamit das Regime zu unterstützen.
Apartheidopfer contra deutsche KonzerneNew Yorker Gericht lässt eine Klage gegen mehrere Unternehmen zu, die einst im Apartheid-regime Geschäfte machten. Dieter Simon berichtet
27
Zimbabwe galt einst als Hoffnungsträ-ger im südlichen Afrika. Heute jedochleidet das Land unter Hunger undElend. Herbeigeführt durch eine kor-rupte Elite unter dem Präsidenten undDespoten Robert Mugabe (ZANU).Eine Einheitsregierung mit seinem Wi-dersacher Morgan Tsvangirai (MDC)als Ministerpräsident sollte die Lageverändern. Doch die gemeinsame Re-gierung ist seit Oktober beendet. Anlasswar die Verhaftung des MDC-Finanz-chefs und designierten stellvertretendenLandwirtschaftsministers Roy Bennett,einem weißen Farmer. Wie aber findetdas Land zu normalen Verhältnissenzurück?
Das Zimbabwe Netzwerk (mit Sitz imWelthaus) hat die Lage in einem bun-desweiten Seminar diskutiert. ZwischenSkepsis, Ablehnung und Anerkennungschwankten die Einschätzungen zur Re-gierung der nationalen Einheit (GNU).Professor Brian Raftopoulos aus Süd-afrika macht auf manche Klippe in denersten sieben Monaten der Regierungder nationalen Einheit (GNU) aufmerk-sam. Als Zwang zur Einigung sieht er vorallem die ökonomische Krise und denregionalen Druck der SADC – der Staa-tengemeinschaft im Südlichen Afrika.Doch von Beginn an gab es das Gerangelum ausstehende Posten im Finanz- undSicherheitsapparat (Reserve Bank, Justiz)und um die Kontrolle des Sicherheitsap-parats (Polizei und Militär).
Anhaltende Gewalt, große Armut
Die anhaltende Gewalt gegen MDC-Abgeordnete deutete auf die Ohnmachtder ehemaligen Opposition hin. Dem-gegenüber steht eine ökonomische Bes-serung der Versorgung durch die Inter-nationalisierung der Währung mit US-Dollar und südafrikanischem Rand.Doch auch da gibt es Kritik an dem feh-lenden Zugang der ärmeren Familienzur Fremdwährung. Sie haben nur dieMöglichkeit zum Tauschhandel. Hierdroht die Vergrößerung der Armut.Brian Raftopoulos sieht aber eine Er-
weiterung politischer Spielräume fürmanche Nichtregierungsorganisationenbeim Verfassungsdiskurs und bei öf-fentlichen Anhörungen. Hindernis isthier aber weiterhin die Blockade durchdie ZANU. Sie will eine neue Verfassungverhindern. Auch die Bestandsauf-nahme der Landreform kommt kaumvoran.
Unklar ist ebenso, ob sich in der Partei-enlandschaft entscheidende Verände-rungen ergeben. Interessant ist, dass esim Matabeleland anscheinend eine ArtWiederbelebung der ZAPU gibt, derehemaligen Widersacher von Mugabenach der Unabhängigkeit. Das wäreeine Bedrohung für die ZANU. Demge-genüber gibt es noch immer zweiMDC-Fraktionen, die sich bekämpfen.Weiterhin ungelöst bleibt die Nachfol-gefrage bei der ZANU: Mugabe ist dieeinzige Kraft, die die Partei zusammen-hält. Sollte er abdanken (müssen), dro-hen ernste Spaltungen in der ZANUund beim Militär. Das könnte das ganzeLand destabilisieren. Die Nachfolge-
Zimbabwe zwischen Macht und OhnmachtDer Despot Mugabe lässt keine Öffnung zu. Was man tun soll, diskutierte das deutsche Zimbabwe Netzwerk. Christoph Beninde fasst die Diskussion zusammen
frage ist nicht nur ein Problem derZANU sondern ein nationales Problem.
Keine internationale Strategiebei Sanktionen
Auch die marode Ökonomie sucht nachLösungen. Der formale Sektor ist zer-stört, weiterhin sinkt die Produktionund dazu kommt ein dramatischer An-stieg der Staatsschulden. Was sollte dieinternationale Gemeinschaft tun? Einentscheidender Hebel für das Gelingendes „Global Policy Agreement“ (GPA)vom September 2008 war die Rolle derMDC, finanzielle Mittel und Entwick-lungshilfe ins Land zubringen. Doch hierbieten das „Emergency Recovery Pro-gramme“ vom März für den Bildungs-und Gesundheitsbereich und auch der„Multi-Donor-Trust Funds“ nur einetemporäre Lösung. Viele internationaleGelder können zudem von der ZANUmissbraucht oder in parallele Strukturenabgezweigt werden. Zu welchen Bedin-gungen also soll sich die internationaleGemeinschaft engagieren?
Intensive Diskussion (v.l.): Referent Prof. Brian Raftopoulos, Petra Stammen/ZIN,Referent Goodhope Ruswa.
Die Lage ist verfahren. Zum einen be-kommt Zimbabwe kein internationalesGeld mehr, seitdem die Schuldentil-gung gegenüber Weltbank und IWFEnde der 90er Jahre zusammengebro-chen ist. Zum anderen haben EU undUSA Sanktionen beschlossen (nicht je-doch die UN). Die EU hält an ihrer Po-sition fest: solange die kritisierten Be-dingungen fortbestehen, gibt es keineEntwicklungshilfe sondern nur huma-nitäre Hilfe. Doch dabei kann mankaum stehen bleiben. Sanktionen undihr Sinn sowie die Frage der Schuldenmüssen weiterhin diskutiert werden.Brian Raftopoulos sieht das Dilemma,dass die Position der EU auf Dauer dieHardliner der ZANU stärkt. Er hofftdeshalb, dass die Einheitsregierung eine
Für die meistenvon uns sind Hun-ger und Unterer-nährung weitweg. Ein Thema,das uns nicht be-rührt. Ein Themaaus einer anderenWelt. Wir hierkennen pralle Su-permärkte oderprächtige Vielfaltauf Wochenmärk-ten. Doch dasSchlaraffenlanddes Überflusses
wird bald kleiner und kleiner. Wennfrüher die Weltgetreidevorräte nochfür Jahre reichten, ist das heute nochknapp ein Monat.
Bis 2050 müssten auf den Äckern dop-pelt so viele Erträge erwirtschaftetwerden, sagt die Welternährungsorga-nisation. Schon jetzt hungern eineMilliarde Menschen. In den nächstenJahrzehnten könnte ein „Gau auf denNahrungsmittelmärkten“ auf uns zu-kommen, der einem apokalyptischenSzenario gleichkommt, warnt der Jour-nalist Wilfried Bommert in seinemBuch „Kein Brot für die Welt – Die Zu-kunft der Welternährung“.
Lösungsansätze werden aufgezeigt
Sollen wir da weiter Pflanzen für Spritproduzieren? Sollen wir unsere Arten-vielfalt reduzieren? Sollen wir weiterBoden vernichten? Wo ist die Agrarfor-schung gegen den Hunger und für dieArmen? Und: wer stoppt die verbre-cherische Spekulation mit Nahrungs-mitteln? Bommert analysiert die Lageund zeigt Lösungsansätze auf. Jetztkommt es darauf an, die Prioritätender Welternährung auch gegenüberden Interessen der Weltkonzernedurchzusetzen. Das ist eine große Her-ausforderung für die gesamteMenschheit, die hierzulande seit Jahr-zehnten mit Erfolg ignoriert wird.
Info Wilfried Bommert „Kein Brot fürdie Welt – Die Zukunft der Welternäh-rung“, Riemann Verlag, München2009, 352 S., 19,95 Euro.
28
Option bleibt und damit neue Spiel-räume gewonnen werden. Dazu ist aberein größeres Engagement der interna-tionalen Gemeinschaft notwendig. Dassei zwar ein Risiko, doch man müsse eseingehen. Die soziale Basis der Opposi-tion sei geschrumpft. Die wachsendeArmut radikalisiert nicht, sondernmacht die Leute weniger handlungsfä-hig. Für die MDC ist internationale Un-terstützung überlebensnotwendig.
Ohne Hilfe leidet auchdie Opposition
Ein großes Problem jedoch ist: Interna-tional greift die SADC nicht ein, auchSüdafrika wird keine eigenständigeRolle spielen. Für den Referenten siehtes nach einem langen „dreckigen“ oder„schmuddeligen“ Prozess aus. Auch inden von manchen geforderten Neu-wahlen sieht er keine Lösung, vielmehrwürde sich die ZANU ähnlich wie 2008verhalten. Das heißt, die Opposition
„Kein Brot für die Welt“
Buchtipp muss sich der Realität der Machtver-hältnisse stellen.
Brian Raftopoulos fordert nicht die Auf-hebung der Sanktionen, aber er sprichtsich ganz dringend für Entwicklungshilfeder internationalen Gemeinschaft aus,humänitäre Hilfe reicht nicht. Die inter-nationale Gemeinschaft müsse sich wohloder übel auch in einer Situation enga-gieren, wo die demokratischen Kriteriennicht erfüllt werden. Keine Hilfe zur Ent-wicklung schwächt die Opposition.
Der zweite Referent Goodhope Ruswahält die Einrichtung einer Landkom-mission für unbedingt notwendig umBewegung in die Landfrage zu bekom-men. Bis heute herrschen hier chaoti-sche Verhältnisse. Weiterhin gibt esLandaneignungen durch Mitglieder der
Elite. Das Agreement legt allerdings fest,der Landprozess sei nicht revidierbar –eine heftig umstrittene Position. Hier isteine Lösung ohne internationale Betei-ligung kaum möglich. Auf dem Landwie in den Städten ist Gewalt lautGoodhope Roswa weiterhin ein großesProblem. Dennoch: die Bewegungsfrei-heit der Nichtregierungsgruppen seietwas größer geworden. Das NGO-Ver-bot ist aufgehoben, es gibt Demonstra-tionen. Insgesamt finde mehr Diskus-sion und Dialog statt.
Nichtsdestotrotz ist die Zivilgesellschaftmarginalisiert und gespalten. Die zu-nehmenden Menschenrechtsverletzun-gen ab 2000 müssten unbedingt doku-mentiert werden. Die Menschenrechtemüssten eingeklagt werden. Es bleibtdie Frage, wie die Zivilgesellschaft denSpielraum nutzen kann? Als Hauptauf-gabe bleibt es dabei: auch für die Um-setzung des Agreement (GPA) muss ge-kämpft werden.
Vereidigung von Premierminister Morgan Tsvangirai durch Staatspräsident RobertMugabe im Februar 2009.
29kultur
AIDS ist in Afrika die Haupttodesursa-che für Menschen zwischen 15 und 49Jahren. Immer mehr Familien werdendadurch zerstört. 15 Millionen Kinderbeklagen bereits weltweit den Verlustihrer Eltern, 12 Millionen davon imsüdlichen Afrika. Oft sorgen dann dieGroßmütter für Hilfe – ein weltweiterTrend. Doch sie sind oft genug überfor-dert. Es fällt schwer, die Pflege derKranken zu übernehmen und das Geldund die Kraft aufzubringen die Enkelzu versorgen.
Die Fotoausstellung "Stille Heldinnen –Afrikas Großmütter im Kampf gegenHIV/AIDS" gibt den vergessenen Groß-müttern ein Gesicht. Das Welthaus zeigtdie Ausstellung zusammen mit Help -Age Deutschland und dem Verein Bao-bab vom 7. November an im Bürger-zentrum „Haus unter den Linden“ inHerford. Sie läuft noch bis zum 6. De-zember. Die eindrucksvollen Aufnah-men des Fotografen Christoph Gödandrücken vor allem eines aus: Würde imKampf gegen die Krankheit und fürihre Enkel.
Ein Veranstaltungsprogramm hat ne-benher bereits viele Informationen ge-boten. Der Kino-Thriller „Der ewigeGärtner“ brachte den Zuschauern dasThema Patentrechte und den schwerenZugang zu HIV/AIDS-Medikamentenin Entwicklungsländern nahe. Eine Re-ferentin der Bielefelder Pharma-Kam-pagne informierte „Patente, Profite undAids“. Eine Theatergruppe präsentierte„Eine Geschichte zum Thema Aids“.Die Schauspielerin Hannelore Hoger,HelpAge-Schirmherrin der Kampagne„Jede Oma zählt“ las Märchen vonOscar Wilde. Ende November referierteMichael Bünte von HelpAge unter demTitel „Die Welt wird alt“ über das Lebender Senioren in anderen Weltregionen.
Am 1. Dezember gibt es ab 19 UhrTheater und Vorträge zum Welt-AIDS-Tag. Die Theatergruppe Hebe-bühne präsentiert Ihre Inszenierung zuKurzgeschichten aus dem Buch „28 sto-
ries über AIDS in Afrika“ von StefanieNolen. Referentin Dr. Christiane Fi-scher der Pharma-Kampagne wirdeinen Vortrag zum Thema HIV/AIDSin Afrika halten. Peter Struck von derAIDS-Hilfe Bielefeld spricht über„AIDS, Kultur und Tabu – AIDS-Prä-vention mit und für Migrantinnen ausafrikanischen Ländern“.
Erlös an AIDS-Projekte in Afrika
Der Erlös der Veranstaltungen geht zu-gunsten der AIDS-Projekte von Hel-pAge in Tansania, Mosambik und Süd-afrika und zugunsten dem AIDS-Auf-klärungsprojekt „Revida“ des WelthausBielefeld. Die finanzielle Unterstützung
der Großeltern-Haushalte wirkt sich invielen Bereichen positiv aus: Die Enkelerreichen die Grundschulbildung, ihreGesundheitssituation verbessert sichwesentlich und die Bekämpfung vonHIV/AIDS wird gefördert.
Info Die Ausstellung ist noch zusehen bis 6. Dezember 2009, Bürger-zentrum Haus unter den Linden, Unterden Linden 12, 32052 Herford, Öff-nungszeiten: Mo. bis Fr.: 10 bis 17 Uhr,So.: 14 bis 17 Uhr.
Nähere Infos: Christiane Ebmeier, fon0521. 986 48 33, eMail [email protected]
„Jede Oma zählt“Die Ausstellung „Stille Heldinnen“ in Herford erzählt noch bis 6. Dezember über den Kampfafrikanischer Großmütter gegen AIDS
30 welthaus
Zeichen setzen für eine solidarische undgerechte Welt. Das ist der Sinn der „Stif-tung Welthaus Bielefeld“. Die Idee undder Wunsch nach einer eigenen Stiftungzur langfristigen Absicherung derArbeit hat schon mehrere Vorstandsge-nerationen des Welthaus Bielefeld um-getrieben. Dank intensiver ehrenamtli-cher Beratungs- und Vorbereitungstä-tigkeit war es im Sommer 2009 endlichso weit: sechs Erststifter und –stifterin-nen legten mit einer Mindesteinlagevon jeweils 5.000 Euro den Grundstockan Stiftungskapital. In einer kleinenFeier wurden die Stiftungsverträge un-terzeichnet. Somit konnte die StiftungWelthaus Bielefeld als rechtlich nicht-selbständige Stiftung in Treuhänder-schaft des Vorstands des Welthaus Bie-
lefeld mit einem Gründungskapital von35.000 Euro beim Amtsgericht einge-tragen werden.
Der Dank für diesen ersten Schritt gehtan die Stifter und Stifterinnen Mari-anne Schult, Peter Krämer, Sigrid Grae-ser-Herf, Hermann Herf, Georg Krämerund Christoph Beninde.
Die Ziele der Stiftung Welthaus Biele-feld sind entsprechend ihrer Satzungdie Förderung von Entwicklungszu-sammenarbeit und Völkerverständi-gung. Vor allem sollen die Verwirkli-chung der Menschenrechte und einesozial gerechte Weltwirtschaftsordnung,der Abbau von Rassismus und der Dia-log zwischen den Kulturen unterstütztwerden. Zur Verwirklichung dieser
Ziele verfolgt sie Stiftung den Zweck,Mittel für das Welthaus Bielefeld bereit-zustellen.
Die Stiftung Welthaus Bielefeld soll die-ses Wirken langfristig und dauerhaftabsichern. Das Vermögen der Stiftungwird dabei unter ethischen Gesichts-punkten angelegt, welche der Stiftungs-rat in seinen Leitlinien definiert hat.Diese schließen u.a. Finanzanlagen aus,welche die Herstellung oder den Han-del mit Kriegswaffen beinhalten. Posi-tive Anlageformen werden gesucht, bei-spielsweise durch soziale Unterneh-mensverantwortung oder den Einsatzfür nachhaltiges Wirtschaften.
Natalie Junghof studiert im 3. SemesterKommunikationsmanagment an derFachhochschule Osnabrück. Sie unter-stützte die Arbeit der Verwaltung imBereich Öffentlichkeitsarbeit vom 15.Juni bis zum 4. September. SebastianKlarzyk war vom 1. April bis zum 10.Juni im Kulturbereich aktiv. Er studiertPolitikwissenschaft an der UniversitätBielefeld. Simone Albrecht war vom 15.Juni bis zum 23. Oktober Praktikantinim Bereich Fundraising. Sie macht eineschulische Ausbildung zur Kaufmänni-schen Assistentin.
Sabine Kulik, Studentin der Spanien-und Lateinamerikastudien in Bielefeld,machte vom 18. Mai bis zum 31. Juli einPraktikum im „weltwärts“ Freiwilligen-dienst. Sie war für Übersetzungen undder Kommunikation mit Partnern inLateinamerika zuständig. Im gleichenBereich arbeitete Israel Basurto Sotovom 20. August bis zum 14. Oktober. Erstudiert Soziologie an der Universität
Bielefeld. Auch Isabel Thile arbeitetevom 4. Mai bis zum 31. Juli beim „welt-wärts“ Freiwilligendienst. Sie war vorallem im Bereich gender aktiv.
Amelie Kirberg und Annika Meiwaldhaben ihr Praktikum am 1. Septemberbegonnen. Amelie, die ab dem Winter-semester 2009/10 Romanistik in Bam-berg studiert, war bis zum 9. Oktoberfür die Gestaltung der „weltwärts“- In-ternetseite verantwortlich. Annika warbis Ende November, unter anderem mitder Bewerbung des Projekts „Kita-Glo-bal“, im Bildungsbereich beschäftigt.
Im Bildungsbereich praktizierten au-ßerdem Christian Scheebaum, AntjeTumbusch und Nicolas Pieper. Chri-stian studiert Erziehungswissenschaftenin Bielefeld und war vom 3. Juni biszum 30. Oktober in das Ausstellungs-projekt „Klimawandel in Mittel- undLateinamerika“ involviert. Antje stu-diert Ethnologie in Bonn und war vom15. April bis Ende März im Welthaus
Bielefeld beschäftigt. Nicolas fängt jetztsein Studium der Sozialwissenschaftenan und war vom 25. Juni bis zum 30.September im Projekt „Biodiversitätweltweit“ aktiv.
Weiterhin absolviert André Nölle vom1. September bis zum 31.Januar 2010sein Praktikum im Bildungsbereich. Erist unter anderem für die Vermarktungder Bildungsbags und den Aufbau derInternetseite dieser, verantwortlich. So-phia Brink studiert International Mi-gration und Interkulturelle Beziehun-gen an der Universität Osnabrück undunterstützte vom 30. März drei Monatelang die Bereiche Auslandsprojekte undGeschäftsführung. Laura Blomenkem-per absolvierte ihr siebenwöchigesPraktikum vom 17. August bis zum 2.Oktober bei KOSA. Leonie Heygster,Studentin des BA-Studiengangs Kultur-wirtschaft in Passau war vom 18. Au-gust bis zum 9. Oktober bei der Ge-schäftsführung tätig.
Stiftung Welthaus Bielefeld gegründetEine Stiftung soll die Arbeit des Welthaus langfristig absichern. Der Grundstock von 5.000 EuroStiftungskapital ist gelegt, das Geld wird unter ethischen Gesichtspunkten angelegt
Wertvolle PraktikantInnenAuch in den vergangenen Monaten waren wieder zahlreiche PraktikantInnen im Welthaus aktiv