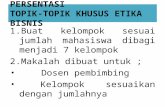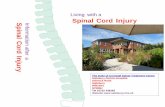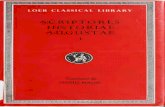Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum…und die historiae Johanns von Salisbury
-
Upload
uni-muenster -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum…und die historiae Johanns von Salisbury
ORDOStudien zur Literatur und Gesellschaftdes Mittelalters und der frühen Neuzeit
Herausgegeben von
Ulrich Ernst und Christel Meier-Staubach
Band2
Peter von MoosGeschichte als Topik
Ges
D!r
und d
GeorgHildesheim'
Verlagh ' New York
r996OlmsZir\c
o:::t
Hi
Peter von Moos
Geschichte als Topik
Das rhetorische Exemplumvon der Antike zur Neuzeit
und die historiae im ,,Policratictts"Johanns von Salisburv
Zweite Auflage
r996Georg Olms Verlag
Hildesheim' Zürich ' New York
o=t
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Das Werk ist urheberrechtlich geschuta.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urhebenechtsgesetzes ist ohne ZustimmungdesVerlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere fiir Vervielftiltigungen,Übersetzungen, Mikroverfi lmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitungin elektronischen Svstemen.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-EinheitsaufnahmeMoos, Peter von:
Geschichte als Topik: das rhetorische Exemplum von derAntike zur Neuzeit und die historiae im ..Policraticus"
Johanns von Salisbury/Peter von Moos. -
2. Aufl.. - Hildesheim; Zürich; New York: Olms 1996(Ordo; Bd. 2)
ISBN 3-487-09087-2NE: GT
2. Auflage , Hildesheim 1996O Georg Olms AG, Hildesheim 1996
Alle Rechte vorbehaltenPrinted in Germany
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierUmschlagentwurf: Professor Paul König, HildesheimHerstellung: WS Druckerei GmbH, 55294 Bodenheim
rssN 0178-1316rsBN 3-487-09087-2
,Quis leget haec?' (Persius Sat. I) [. . .] iecompte sur peu de Lectanrs, et n'aqire qu'äqueQues uffmges Si ces pensöes ne phisentä penonne, elles pourront n'?tre que man-vaises; mais ie les tiens pour dätestables, sielles phisent a tout Ie monde.
Diderot, PenSes philophiquesMotto und Vorspruch
Nur immq ein Buch herauvugeben, wennman etwas Rundes zu sgen hat, ist mensh-Iicher Stolz, gibt es denn nicht noch mdtrFiguren als die Ründe die alle auch schönsind, die Schlangen-Linie halte ich fiir einBuch fu die dienlichste und ich hatte schonin dieser Linie gerchrieben, ehe bh wugte,da$ Hogarth etv'as über dieselben gerchri*ben lutte, oder ehe Tristom Shandy seineManier en Ziczac oder Ziczac ä double Zic-zac bekannt machte, so ungeföhr:
Uchtenberg, Sudelbücher(München 1968, B l3 l )
I
INHALT
Vorwort zur zweiten Auflage ................................................................................................................ VII
Vorwort ................................................................................................................................................ IX
I. Im Vorfeld einer Definition
A) Beispiele für das Beispiel ................................................................................................................. 1
Präzedenzfälle als praktische Entscheidungshilfen in Briefen Johanns von Salisbury (§ 1) und in derParadeigma-Theorie des Aristoteles (§ 2).
B) Geschichte und Exemplum.............................................................................................................. 7
Historia magistra vitae (§ 3), statischer Geschichtsbegriff und prognostisches Vergangenheitsinteresse(§ 4).
C) Das Problem: historischer Realitätsgehalt literarischer Exempla ................................................... 13
Die Memorabilien des Policraticus u.ä. Werke als „bloße Literatur“ (§ 5). Was ist „Wirklichkeit“?(§ 6). Wiederverwendbare und einmalige Geschichtsanalogien (§ 7). Das illustrative Exemplum des„didaktischen“ Mittelalters und das induktive Exemplum der „empirischen“ Renaissance: einPeriodisierungskriterium? (§ 8).
II. Zur Begriffsgeschichte und Definition
A) Intentionale Aspekte (Beispiel, Exempel, Fall: Exemplum) .......................................................... 22
Das Exemplum zwischen Rhetorik und Philosophie (§ 9). Dantes Francesca zwischen E.R. Curtius undH. Friedrich (§ 10). Beispiel, Exempel, Fall seit Kant: Möglichkeiten und Grenzen der Subsumption(§ 11). Geschichten in rhetorischer Anwendung und als Vorrat (§ 12). Infinite und finite Exempla(§ 13). Lessings „Lehrfabel“ in der Kritik: die „Handlungsfabel“ nach Herder, „rhetorische GleichnisseJesu“ nach Jülicher und der ainos als Ur-Fabel nach K. Meuli (§ 14). Induktionsübungen mit tradiertenExempla machen „klug für ein andermal“ (§ 15).
B) Formale Aspekte (Geschichtsvergleich oder Erzählung) ................................................................ 39
Schwierigkeiten einer mediävistischen Definition des Exemplums: rhetorische Funktion oderhomiletische Erzählgattung? (§ 16)
1. Das Exemplum in der antiken Rhetorik ................................................................................. 48
Die beweisenden Vergleiche bei Aristoteles und Quintilian: historisches Beispiel, Gleichnis, Fabel (§ 17).Der argumentative Geschichtsvergleich und der stilistische Naturvergleich (§ 18). Rei gestaecommemoratio als Erzählung oder als Namensvermerk (§ 19). Argumentative und moralische Beispiele(§ 20).
2. Zur Entwicklung des rhetorischen Exemplums von der Antike zum Mittelalter........................ 69
a) Römische exempla virtutis ..................................................................................................... 69
Die Verbindlichkeit römischer exempla virtutis aufgrund der realen Gegenwart der maiores (§ 21). Zumtheoretischen Problem der Verbindlichkeitsgrade aller
II
„lebendigen“ Identifikationsbeispiele: ein Klärungsversuch mit Hilfe der rhetorischen Unterscheidungkünstlicher und unkünstlicher Beweise (§ 22). Spätantike Auflösung der exempla maiorum insDemonstrative: unterhaltsame Anekdotisierung und ideologische Inszenierung (§ 23).
b) Exemplum Christi und sanctorum exempla ............................................................................ 81
Die nova et vera exempla des Christentums als radikal historische Beweise für die Heilswirklichkeit(§ 24). Die „Vernunft des Glaubens“ gegen Gewohnheit und Brauch römischer Exempla (§ 25). Christusexemplum: Erlösungsbeweis und Vollkommenheitsgebot; antike Exempla-Rhetorik als Metapher derInkarnation und Heilspädagogik (§ 26). Die Kirche als Beispielgemeinschaft der Heiligen und dieWunder als Real-Exempla für die Imitabilität (§ 27). Entheroisierung des Exemplums: bekannte undunbekannte Zeugen für Gottes Heilswirken, illustriert an der Ponticianus-Episode der ‚Confessiones‘(§ 28) und dem ‚Epitaphium matris‘ des Petrus Venerabilis (§ 29). Innerchristliche und außerchristlicheExempla: typologische Bezüge und exempla imparia, indikativische und imperativischeSteigerungsformen (§ 30). Theoretische Fragen zur Vermischung antiker und christlicher Exempla:„Polymythie“ und „Monomythie“ (§ 31), Notorietät und Anonymität (§ 32), „Weltdeutung undWeltersatz“ (§ 33).
3. Das „Predigtmärlein“ des späteren Mittelaltersim Verhältnis zum rhetorischen Exemplum .......................................................................... 113
Das „volkstümliche“ Exemplum mittelalterlicher Prediger als bestimmter historischer Sonderfall desparänetisch-illustrativen Jedermannsbeispiels (§ 34), d. h. einer ebenso universalen Identifikationsformwie das argumentativ-induktive Heldenbeispiel (§ 35). Hypothesen zur Entwicklung und Interaktiondieser stets nebeneinander gepflegten Beispielarten von der Antike zur Renaissance (§ 36), im früheren(§ 37) und im späteren Mittelalter (§ 38).
4. Der Policraticus als Umschlagplatz für alleArten des Exemplums.......................................................................................................... 134
Zur gattungs- und rezeptionsgeschichtlichen Vermittlungsposition der im Traktat eingebettetenGeschichtensammlung zwischen dem rhetorischen Exemplum der Antike und den unterhaltsam-didaktischen Kurzerzählungsformen des Spätmittelalters (§ 39).
III. Das Exemplum bei Johann von Salisbury
A) Terminologie.............................................................................................................................. 144
Exemplum: ein Allgemeinbegriff für Gegenstand und Darstellung (§ 40); historia: ein Erzählbegriff(§ 41).
B) Zur Theorie und Methode des Exemplum-Gebrauchs................................................................... 153
1. Moralphilosophische Grundlegung: Das Vorbild-Exemplum fürdie Einheit von Lehre und Leben, Reden und Handeln ........................................................ 153
„Historiographische“ Motivation des Policraticus: denkwürdige auctores werden durch Überlieferungder Geschichtlichkeit entrissen (§ 42). Exemplum: Tat oder Ausspruch eines auctor/einer auctoritas(§ 43). Das Exemplum unterscheidet sich von der Fabel wie die Chrie von der Sentenz: durch„Personhaftigkeit“ (§ 44). Das Ideal der Übereinstimmung von Theorie und Praxis auf biblischer undantiker Grundlage als Motiv für die Kombination von dicta und facta (§ 45). Das Anekdotische als dasHumane in der Tradition der Philosophen-
III
Viten (§ 46). Anekdote/Apophthegma und Exemplum als memorabile factum/dictum (§ 47). Zurliterarischen Technik der Verbindung von Zitat und Erzählung, Autorensprache und Figurensprache(§ 48). Zur Poetik und Hermeneutik der „Geschichte als Beispielphilosophie“ für das Gute und das Böseund zur Mehrdeutigkeit von Exempla im Verhältnis zur Auslegungskompetenz des Lesers (§ 49).
2. Argumentationstheoretischer Ausbau: Das historische Exemplum alsBeweismittel und Denkbild in literarischen Gebrauchs- undVorratsfunktionen ................................................................................................................ 188
a) Die philosophisch-rhetorische Induktionsmethode............................................................... 188
Kommentar einer theoretischen Hauptstelle Johanns zum Exemplum aufgrund antikerInduktionslehren: der logische und der rhetorische Schluß vom Einzelnen (über Allgemeines) aufEinzelnes (§ 50); Sokrates als Meister des Beispiels bei Aristoteles, Cicero und Quintilian (§ 51);Johanns umfassendes Rhetorikverständnis schließt den dialektisch-stringenten und den persuasiv-sokratischen Induktionsschluß ein (§ 52), steht jedoch dem affektstimulierenden „Schau“-Beispielsinnlicher Eindeutigkeit fern (§ 53); zwei Haupterfordernisse der aristotelischen Induktion: sachlicheAdäquatheit und evidenzerzeugende Bekanntheit der Beispiele werden im allgemeinen Sinn literarischerBildungsideale verstanden (§ 54). Der Beglaubigungswert der notiores historiae illustriert anklimaxbildenden Exempla-Reihen (§ 55). Die Schutzfunktion der Exempla als entsubjektivierendeauctoritates (§ 56).
b) Historische „Wahrheit“, Glaubwürdigkeit und Denkwürdigkeit ............................................ 208
Das Paradox der Indifferenz und Überlieferungswürdigkeit divergierender „Historikermeinungen“ (überdas historische Detail) erklärbar als rhetorisches Plausibilitätsmotiv (§ 57). Die „historische Kunst“glaubhafter Fiktion aufgrund des (nicht nur mittelalterlichen) Begriffs einer philosophisch bedeutsamen„virtuellen Realität“ (§ 58). Fabula und historia bei Petronius, Johann von Salisbury und Petrarca(§ 59). Zwei Legitimaionen für das autobiographische Exemplum: Johann „zitiert“ ein persuasivesZeugnis aus dem „Buch“ der Menschennatur; Petrarca berichtet eine (prätendiert) tatsächlicheBergbesteigung mit subjektiv folgenreichem Lektüreerlebnis (§ 60).
c) ‚Verba auctorum‘ und das neue „Denken in Alternativen“.................................................. 238
Die Riesenkraft der magna nomina antiquitatis: über den rhetorischen Sinn des Gleichnisses von denjungen Zwergen auf den Schultern der alten Riesen (§ 61). Rhetorische und dialektische „Logik“ imGeiste humanistischer Topik (§ 62). Das Probedenken in utramque partem und die lerntechnischenFiktionen der Schule (§ 63). Thesis und Hypothesis (§ 64). Widerspruchsbehebungsmethoden der neuenWissenschaften (§ 65). Abaelards Sic et non-Prolog oder die Lust an der Auslegungsschwierigkeit (§ 66).Rechtskasuistik der Kanonisten und Glossatoren (§ 67). Über den wissenschaftlichen und literarischen„Spielernst“ des Mittelalters (§ 68).
d) Johanns ‚logica probabilis‘ und „akademische“ Skepsis .................................................... 286
Seine Traktate als Sammlungen philosophischer quaestiones und rhetorischer causae; als argumentative„Kriegsspiele“ und engagierte Streitschriften (§ 69), als agonale Diatriben gegen den Zwiespalt von„Kunstlehre“ und „Kunst“ in der politischen und ethischen „Lebenskunst“ (§ 70). JohannsSelbstdarstellung im Dienste einer kritischen Geschichte der Philosophen bis zur Gegenwart (§ 71). DerProbabilismus als spezifisch humane und zugleich christliche Wissenschaftstheorie in der„humanistischen“ Tradition zwischen Cicero und Vico (§ 72).
IV
e) Das Exemplum als Waffe und Reflexionsgegenstand............................................................ 309
Die „schlauen“ strategemmata und die „freie Rede“ im Policraticus (§ 73). Auslegungsbedürftigkeit undhermeneutische Konflikthaltigkeit aller Exempla (§ 74). Exempla der „Lasterbeschönigung“ undmittelalterliche Ideologiekritik (§ 75). Das Exemplum zwischen rhetorischer und exegetischer Methodeals (kontextuell bestimmte) Funktion ohne historischen Eigenwert (§ 76). Hauptvorbilder Johanns:Seneca und Hieronymus (§ 77). Das Exemplum als Qualitäten-Synekdoche, „Denkbild“ und vestigium(§ 78).
f) ‚copia exemplorum‘: der Reiz der Vielfalt und Unordnung ................................................. 342
Exempla-Sammlungen im Dienste der inventio locorum und die Trivialisierung der Topik (§ 79).Vermeintliche Widersprüche im Policraticus aufgrund der Verkennung des topisch-funktionalenCharakters von Exempla (§ 80). Glossierend-exegetische Denkform, kasuistische Gelehrsamkeit undÄsthetik der varietas in einem Beispiel: Brutus – Kindsmörder oder Patriot? (§ 81). Literarische undphilosophisch-theologische Traditionsgrundlagen des hermeneutischen Vielfaltsprinzips (§ 82).
g) Schöpfungswelt und Literaturwelt: die Theorie der „Literaturbeherrschung“ ....................... 368
Über Offenheit und Sinnreichtum aller Literatur als „Gottes Wort“ und die Naturunterwerfungs- undSpeisemetaphorik (§ 83). Die literarische Aufgabe der auctores-Einverleibung und das philosophischeIdeal des prophylaktischen „Alles-Lesens“ im Hinblick auf künftigen Erkenntnisfortschritt (§ 84).Rhetorische multiplicitas und topischer Aspektereichtum (§ 85). Das „humanistische“ Paradox vonNaturbeherrschung und Naturverständnis in bildungstheoretischer Metaphorik: Literaturausbeutung oderEhrfurcht vor dem Wort? (§ 86). Die clientes-Metapher für die Verbindung von geistiger Selbständigkeitund Traditionsabhängigkeit, von interpretatio christiana und imitatio auctorum (§ 87). Apologie für das„Zitieren“ apokrypher und fiktiver Autoren mit Hilfe antiker Theorien zu fabula, argumentum undcomedia (§ 88).
h) Unphilologischer Humanismus: Exempla zwischen Kompilatorik und Topik ....................... 412
Johann von Salisbury: der Spitzenhumanist des 12. Jahrhunderts? (§ 89) Die Topik als Schlüssel zuseinem Traditions-Verständnis: konsensstiftende auctores und Exempla (§ 90). Exemplum und Topos:der formale locus ab exemplo (§ 91); der materiale Topos als Rahmen einer Exempla-„Füllung“ (§ 92)oder als Vergleichsfall und Problembeispiel (§ 93).
C) Exempla im Dienst der „einen Wahrheit“ oder der Konkordanz von Antike und Christentum .... 435
Konkurrenzloses Heilswissen und ergänzendes Bildungswissen (§ 94). Naturideal und Universalität derWahrheit (§ 95). Zum Problem der zeitlosen Einheit wahren Wissens und des Wissensfortschritts vonden antiqui zu den moderni (§ 96). Integrationsmethoden der traditionellen interpretatio christianaheidnischer Literatur, vor allem das exemplum impar (§ 97). Umgekehrte Methoden der „interpretationaturalis“ und Traditionskombinatorik: Christliches in antikem Gewand (§ 98); Antikes in christlicherAufmachung (§ 99). „Reliteralisierte“ Bibelallegorien und nicht geistlich ausgelegteGlaubensgeheimnisse: spielerische Formen moralphilosophisch-rhetorischer Meta-Allegorese (§ 100).Verlegenheit wissenschaftlicher Beschreibungstermini: Manierismus, Säkularisation, Blasphemie,Synkretismus u. ä. versus „préciosité“ und „subtilité“ (§ 101). Ein apokryphes Paulus-Exemplum alsJohanns Legitimation des Konkordanzprinzips (§ 102). Extensive Bibelauslegung und Ausklammerungzentraler Glaubensinhalte: zwei Formen
V
hypothetisch-praeterspiritueller Ethik und Lebensweisheit (§ 103). Johanns Boethius-Lob (§ 104).
IV. Das Exemplum zwischen Philosophie und Geschichtsinteresse imMittelalter und in der Renaissance ...................................................................................... 503
Das „Intelligible“, die ewige veritas rerum und die Unvollkommenheit sinnlicher Erkenntnis (§ 105).Die Theatermetapher für die Scheinhaftigkeit der Geschichte (§ 106). Die Simultaneität aller historiaevor dem philosophischen Auge (§ 107). „Gleichförmigkeiten in der Geschichte“ als anthropologischeBasis des Exemplums (§ 108). Vermeintliche Epochenunterschiede mit Bezug auf das Exemplum:„zyklische und lineare Geschichtsauffassung“ (§ 109); „didaktisches Mittelalter und induktiveRenaissance“ (§ 110). Humanistische Autopsie-Versuche in der Forschungsdiskussion um die „Neuheit“der Renaissance (§ 111). Die anachronistisch integrierte Antike des Mittelalters und die Entdeckunghistorischer „Alterität“ in der Renaissance: eine Regel mit Ausnahmen (§ 112). Johanns Exempla alsKampfmittel der Gegenwartskritik, Petrarcas Exempla als Trostmittel der Gegenwartsflucht (§ 113).Das Exemplum und Johanns philosophische Leistung (§ 114).
Exkurse
I. Der Titel des Policraticus ........................................................................................................... 556
Forschungsbericht (§ 115). Zur mittelalterlichen Tradition der „Vielbuch“-Titel und zurKompilationstheorie (§ 116). Die Radix poli- im Sprachgebrauch Johanns (§ 117). Der zentraleHerrschaftsbegriff im Policraticus und der Policraticus-Rezeption (§ 118). Policraticus-Prolog und -Epilog im Hinblick auf die moralische Weltherrschaft der litterae und der philosophia (§ 119). Die„polycratia“ der Philosophie (§ 120).
II. „Imago“: ein Phantom der Exemplaforschung........................................................................... 583
Der Unterschied von exemplum und imago als „Beispielerzählung und Beispielfigur“ bei E.R. Curtius(§ 121). Vorgeschichte: Dornseiff und Alewell (§ 122). Folgen: Konstruktion des Wesensunterschiedszwischen dem antiken, „bildnishaften“ und dem mittelalterlichen, narrativ-homiletischen Exemplum(§ 123).
III. Geschichtenerzählen im 12. Jahrhundert und die Unterhaltungverschiedener sozialer Gruppen................................................................................................... 598
IV. Zur Verteilung der Exempla im Policraticus ................................................................................ 603
Abkürzungsverzeichnis........................................................................................................................ 604
Auswahlbibliographie........................................................................................................................... 607
Register............................................................................................................................................... 621
Errata ................................................................................................................................................. 657
VII
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Dem Autor, dessen Buch in vergleichsweise kurzer Zeit vergriffen ist, geht es heute wie dem Maler, dessennicht eben volkstümlichen Bilder – nach jahrelanger Arbeit voll einsamer Selbstzweifel – an einer einzigenAusstellung alle verkauft werden: er findet keine Worte.
Daß diese Neuauflage unverändert bleiben muß, liegt weniger an verlegerischem Kalkül als an einer Aporie desVerfassers. Es ist mir unmöglich, dem Werk nachträglich die angemessene Form zu geben, bzw. die eingangsbeschriebene Entstehungsgeschichte rückgängig zu machen. Verbesserungen und Ergänzungen (nach demneuesten Forschungsstand) würden einen Vorwurf verdienen, wie ihn Wilhelm Leibl auf sich zog: das Ganzeam Ende „totgemalt“ zu haben. Viel eher hätte die Arbeit einer kräftigen Straffung bedurft. Doch auch sowäre ein vollkommen anderes Buch entstanden, vielleicht ein Taschenbuch.
Von den zahlreichen gedruckten Reaktionen auf die erste Auflage möchte ich nur die substantiellsteerwähnen: Walter Haugs kritische Würdigung von 1992. Entgegen der erklärten Absicht kann sie sehr wohlals Leseanleitung dienen1. Dieser Hinweis erübrigt eine weitere lange Vorrede. Unentbehrlich ist einzig einekleine Warnung vor allzu weitgespannten Erwartungen. Wie dem hierarchisch gegliederten Titel zuentnehmen ist, heißt das Hauptthema nicht: „Jahann von Salisbury (ca. 1115/1120–1180), sein Leben, seineWerke und seine Zeit“. Dazu wäre eine gewaltige Monographie (etwa nach dem Vorbild der monumentalenArbeit von Jacques Le Goff über Ludwig IX.2) oder eine umfassende, von einem geistigen Zentrum ausdurchdachte und geleitete interdisziplinäre Sammelpublikation vonnöten. Bis heute gibt es keine solcheSynthese. Sie ist durchaus wünschenswert, weil bisher so gut wie alle Arbeiten über Johann, auch solche, diesich als Gesamtdarstellungen anboten, immer nur Einzelaspekte dieser vielschichtigen Persönlichkeit in dieMitte gerückt haben (etwa Humanismus, Rezeption der Antike, „Schule von Chartres“, Bildungsgeschichteder Frühscholastik, Gesellschaftstheorie u. a. m.). Die Stunde der Ernte und des Überblicks rückt näher, abersie ist in diesem Buch noch nicht gekommen. Es behandelt nicht einmal gleichmäßig alle Werke dieses„philosophischen Laien“ und geht sogar nur am Rand auf dessen Hauptwerk, das ‘Metalogicon’ ein. Es istdem ‘Policraticus’ gewidmet, aber nur insofern, als dieses komplexe Werk u. a. auch eineAnekdotensammlung darstellt und ein Exempel für das Exemplum sowie für das exemplarisch-topischeGeschichtsverständnis der Vormoderne abgeben kann. Einzig auf dieses problemorientierte Interesse an der„longue durée“ verweist der großgedruckte Titel.3
Paris, den 10. April 1996 Peter von Moos
1. Kritik der topischen Vernunft. Zugleich keine Leseanleitung zu ‘Geschichte als Topik’ von Peter vonMoos, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 114, 1992, S. 47–56.
VIII
2. „Saint Louis“, Paris (Gallimard) 1996.
3. Neue Aspekte zum Thema und einzelne Revisionen dieser Arbeit habe ich in folgenden Aufsätzennachgetragen:
La retorica dell’exemplum, in: ‘Retorica e poetica tra XII e XIV secolo’, hg. von Cl. Leonardi, A.M.U.L,Perugia 1988, S. 53–78.
Das argumentative Exemplum und die „wächserne Nase“ der Autorität im Mittelalter, in: ‘Exemplum etsimilitudo, Alexander the Great and other heroes as points of reference in medieval literature’, hg. von W.J.Aerts/M. Gosman, Groningen 1988, S. 55–84.
Die Kunst der Antwort, Exempla und dicta im lateinischen Mittelalter, in: ‘Exempel undExempelsammlungen’, hg. von W. Haug et B. Wachinger, 2. Tagung des Arbeitskreises „Spätmittelalter undfrühe Neuzeit“, (Fortuna Vitrea 2), Tübingen 1991, S. 24–58.
L’exemplum et les exempla des prêcheurs, in: J. Berlioz/M.A. Polo de Beaulieu (Hg.), ‘Les exemplamédiévaux: nouvelles perspectives’, Colloque de St-Cloud, Sept. 1994 (im Druck durch Champion, Paris).
IX
VORWORT
Gott erlöse dich, Leser, von langen Vorreden. Das Zitat stammt ausQuevedo, der – um keinen Anachronismus zu begehen, der schließlichdoch entdeckt werden würde – nie die von Shaw gelesen hat.
J.L. Borges, Vorrede zu:David Brodies Bericht
Der paradoxe Obertitel ist kein Verlegereinfall, sondern (unprätentiöse) Autorabsicht: Das Singuläre,Unwiederholbare, Unvertauschbare der Geschichte enthält allgemeine, anerkannte Gesichtspunkte, die derVerständigung dienen. Topik hat hier (um dieses Mißverständnis sofort zu verhindern) nichts mit dem vonE.R. Curtius in die geisteswissenschaftliche Terminologie eingeführten Hilfsbegriff zu tun, sondern bedeutetungefähr, was mittelalterliche Aristoteleskenner unter logica probabilis verstanden: ein im System derAllgemeinbildung gelehrtes Verfahren zur kommunikativen Bewältigung von Problemen und Aporien durchmeinungsmäßiges Wissen, im Gegensatz zum zwingenden, meinungsunabhängigen Beweis (genauere Definitions. unten §§ 72, 90–3).
Die Verbindung der Begriffe Geschichte und Topik verliert ihre scheinbare Widersprüchlichkeit, wenn maneine Überlegung A.N. Whiteheads nachvollzieht (Wissenschaft und moderne Welt, Frankfurt 1984, 34 ff.):Mathematik beruht auf der vollständigen und absoluten Abstraktion von allen Einzelfällen und Arten vonEinzelwesen, auf einer totalen „Idee“. Als solche genuin platonische Wissenschaft vertritt sie nachWhitehead die für die abendländische technische Rationalität „fortschrittlichste“ Tendenz. Demgegenüber seiAristoteles mit seinen Klassifizierungen des Seienden auf halbem Weg zwischen Einzelfall und Abstraktionstehen geblieben, und die ihm folgende Scholastik habe die neuzeitliche Naturwissenschaft durch zu wenigAbstraktionsfähigkeit (nicht etwa durch zuviel empirieferne Logik) verzögert. Die genetischen,physikgeschichtlich gültigen Aspekte einmal dahingestellt – sie gehören in eine Vorgeschichte unseresheutigen, spezifischen Doppelinteresses am Einzelnen, Faktischen und am Allgemeinen, Abstrakten – ist hierdie klare Antithese von zwei Arten des Allgemeinen grundlegend: eines „notwendigen“ Allgemeinen, dasSinguläres absolut ausschließt, und eines Allgemeinen, das es in einem relativen Sinn einschließt. Letzteres, das„individuelle Allgemeine“ (um Schleiermachers Formulierung zu gebrauchen), ist auch das Beispiel. So wie sichdas Beispiel auf der einen Seite von der reinen Abstraktion unterscheidet, so hebt es sich auf der anderen abvom individuum ineffabile, das wissenschaftlich (weil sprachlich) nicht zugänglich ist;
X
das uns daran erinnert, daß schon unsere Sprache „beispielhaft“ ist. Als Beispiel stellt das Einzelne mehr darals sich selbst, mehr als seine tatsächliche, unsagbare Einzigkeit, nämlich mindestens noch ein zweites,vergleichbares Einzelnes, aber potentiell auch jede höhere Allgemeinheit bis zum Ganzen. Als solchergeneralisierbarer Teil der Geschichte kann es topisches Verständigungsmittel und (auf höchster Stufe)Ausgangspunkt philosophischer Wissensbildung werden (s. §§ 52 ff.).
„Geschichte“ bedeutet hier nur menschliches Geschehen, noch vor jeder Strukturierung, Symbolisierung,„Sinngebung des Sinnlosen“. In seinen vielen Apologien für die vorhistoristisch-philosophische Beschäftigungmit Geschichte hat Karl Löwith (Anm. 1000) betont, daß alle griechischen Historiker und zahlreiche„vormoderne“ Autoren „Geschichten im Plural“ erzählt hätten, weil sie sich für die allgemeineMenschennatur interessierten und eine einheitliche „Weltgeschichte“ im Sinne Hegels noch nicht kannten, janicht einmal den Begriff (den Kollektivsingular „Geschichte“) dafür hatten. Damit hat er den Idealtypus deshistorischen Beispiels charakterisiert: ein nicht um seiner selbst willen, auch nicht als Zwischenglied in einerEntwicklungskette erzähltes denk-würdiges Ereignis, ein memorabile. Das Geschichtsbeispiel besteht dennochnicht nur aus Einzelereignissen und einzelnen Menschen. Auch nach beliebigen Kriterien gebildeteEreignisfolgen, Perioden, Prozesse, auch Menschengruppen, Strömungen, Gemeinschaften, Völker, ja sogardie (wie immer teleologisch mit Sinn ausgestattete) ganze Menschheit können Beispiele sein, anderesbedeuten als „Geschichte“ im Sinne kausaler Entwicklungslogik. Der Status des „individuellen Allgemeinen“bleibt auch in der Erweiterung vom persönlichen zum kollektiven Individuellen gewahrt. Wichtig ist stets dasSymbolische und Wiederholbare, nicht das Unwiederbringliche, Einmalige.
Der Untertitel erwähnt, vom allgemeinen Erkenntnisinteresse aus betrachtet, tatsächlich Untergeordnetes:das Erkenntnismittel; aber in Anwendung des eben theoretisch Gesagten doch den eigentlichen Gegenstand,das „Besondere“, das der besonderen Fachkompetenz zur Verfügung stand. (Im Gegensatz zum Philosophen,den Odo Marquard als „Inkompetenzkompensationsstrategen“ definiert, bleibt dem Philologen wohl oder übelnur die unkompensierte Kleinkompetenz). Im Unterschied zu anderen Arten, am historisch Einzelnenallgemeine Gesichtspunkte zu bilden (etwa ästhetischen, poetischen, religiösen, spekulativen, ethischen,psychologischen, onirischen, astrologischen usw.) ist das rhetorische Exemplum durch die gesellschaftlicheSituation und die persuasive Intention gekennzeichnet. Durch seinen funktionalen Charakter entzieht es sichvon vornherein jeglicher inhaltlicher Festlegung und morphologischen Einordnung (etwa als Archetyp oder„einfache Form“). Es wendet sich an ein Gegenüber und sucht Zustimmung zu erlangen. Im engeren undeigentlichen Sinn der Rhetorik dient es (als Präzedenzfall) der strategischen Durchsetzung des eigenenPareiinteresses bei einem
XI
Publikum oder gegen einen Gegner vor einem Richter; im weiteren, die philosophische Dialektikeinschließenden Sinn des Rhetorischen führt es (als Demonstrations- und Induktionsmittel) zwei oder mehrGesprächspartner zu gemeinsamer Erkenntnis. Dieser in der Sache begründeten Begriffserweiterung (s.§§ 62–4) steht hier die durch die Not der Stoffbegrenzung bedingte Verengung des Exemplumbegriffs auf denargumentativen Teil der Rhetorik gegenüber: Das epideiktische und illustrative Exemplum interessieren nurbeiläufig, und die elocutionelle, stilistische oder grammatikalische Exemplum-Figur eines Vergleichs mit Hilfemenschlicher oder ereignishafter Vergleichsträger fällt so gut wie außer Betracht (s. § 17 f.).
Es ist leicht, nach Abschluß einer Arbeit eine elegante Definition an den Anfang zu setzen und vorzugeben,man sei schon bei Arbeitsbeginn von ihr ausgegangen; als wäre nicht jede Definition, die mehr ist als einedezisionistische Arbeitsfeldbegrenzung, nur in mühsamem Kampf mit Widersprüchen und Mehrdeutigkeitengewonnen, von denen zuletzt noch etwas hängen bleiben mag. Dennoch sei das Resultat für potentielle Leser,die wissen möchten, worauf sie sich einlassen, kommentarlos vorweggenommen: Exemplum ist ein inpragmatischer, strategischer oder theoretischer Absicht zur Veranschaulichung, Bestätigung,Problemdarlegung und Problemlösung, zur Reflexion und Orientierung aus dem ursprünglichen Kontext adhoc isolierter, meist (in einer historia) erzählter oder nur anspielend erwähnter (commemoratio)Ereigniszusammenhang aus dem wirklichen oder vorgestellten menschlichen Leben naher oder fernerVergangenheit. Was die Definition alles einschließt, wird ausführlich zu zeigen sein (§§ 9–20); was sieausschließt, sei hier ein für allemal zusammengefaßt: 1. eine in historiographischer Absicht zum Zweck reinerErinnerung berichtete Geschichte; 2. eine in belletristischer Absicht als „offenes Kunstwerk“ der Vielfalt derLeser und Lesarten ausgesetzte Erzählung (die erhabene Form dessen, was für die Rhetorik Unterhaltung,narratio a causis remota, ist). Nicht aus Gründen der Definition, sondern der eigenen Inkompetenz bleibenüberdies außersprachliche Erinnerungszeichen unbeachtet, die in einem weiteren Sinn durchaus als historischeExempla zu gelten haben: Kunstdenkmäler wie Standbilder, Porträts, Historiengemälde u. dgl. Daraufwenigstens hinzuweisen, ist deshalb angezeigt, weil das Exemplum weithin einzig als literarische Erzählgattungdefiniert zu werden pflegt (s. §§ 16, 34 ff.).
Die Titelerläuterung führt in der deduktiven, den eigentlichen Arbeitsgang umkehrenden Reihenfolgeschließlich zur kleinsten Beispieleinheit, dem Policraticus. Daß Johann von Salisbury beispielhaft,repräsentativ für das Mittelalter oder auch nur für das zwölfte Jahrhundert sei, läßt sich nicht ohne weiteresbehaupten. Als ich vor Jahren in angeregter Konversation beweisen wollte, daß ein erstaunlicher Gedanke imMittelalter tatsächlich gedacht wurde, und Johann von Salisbury zitierte, tat Christine Mohrmann dieexclamatio: „Aber der ist doch eine große Ausnahme, ein mittelalterlicher Humanist!“
XII
Einer der besten Johann-Kenner, Christopher Brooke, fand hingegen, er sei bei aller Originalität, nicht vominnovativen Range eines Anselm oder Abaelard, sondern eher ein kenntnisreicher Vermittler: „John’s fame isas a mirror of his age“ (The World of John 1). Beides mag zutreffen. Begriffe wie durchschnittlich,außergewöhnlich, repräsentativ, exemplarisch oder paradigmatisch sind ohnehin problematisch für einZeitalter, von dem wir nur eine Elite und von dieser Elite nur wenige für deren eigene Zwecke geschriebeneund zufällig überlieferte Zeugnisse kennen (abgesehen davon, daß die wirkungsgeschichtliche und diesoziologische Bedeutung des Repräsentativen immer leicht durcheinandergeraten). Mag Johann nach demeinen Aspekt typisch (gewöhnlich), nach dem anderen singulär (führend) gewesen sein: von einem „ZeitalterJohanns von Salisbury“ wird allerdings niemand sprechen wollen. Dies wäre übrigens auch keine allseits gültigeAuszeichnung. „Jahrhundertvertreter“ waren meist Täter und Kämpfer, nicht Intellektuelle, Vermittler undWarner; Luther, nicht Erasmus; Bernhard von Clairvaux, nicht Johann von Salisbury stehen für ihre Zeiten.Repräsentativ war mir Johann in einem persönlicheren Sinn: Ohne daß dies ursprünglich beabsichtigt war,habe ich im Laufe der Jahre in denen ich mit Johanns Texten lebte, zusehends erfahren, daß meine Lektüreparadigmatisch wurde und Befunde ermöglichte, die das ganze Mittelalter und dessen Bedeutung für unsbetreffen.
Damit spreche ich aus, was der Titel an letzter Stelle (emphatisch und prüde zugleich) verschweigt, daß diesesBuch entgegen der ursprünglichen monographischen Absicht – wie ich jetzt sehe – ein Buch über dasMittelalter geworden ist. Zwei Epochen werden mit Wertbegriffen beim Namen genannt, die dritte, nachihrer puren Zwischenzeitlichkeit mit einem Verlegenheitsbegriff bezeichnete, mag wenigstens an dieser gutsichtbaren Stelle anonym bleiben, damit die Mittlerrolle und unersetzliche Brückenhaftigkeit des Mittelaltersim gesamteuropäischen Zusammenhang besser in Erscheinung trete. Es gibt freilich bedenklicheEpochenmetaphern, die vergessen lassen, daß die Zeitalter wertfrei sind und im Grunde weder angeklagt nochverteidigt werden können. Werden Epochen gerechtfertigt („Die Legitimität der Neuzeit“) oder abgetan (indem antimodernistischen, alles Periodisieren ad absurdum führenden Konstrukt „Postmoderne“), sind niediese Zeitalter selbst, sondern die mit und über ihnen errichteten substantialistischen Metaphern gemeint, diepositiv oder negativ aufgeladenen Hypostasierungen, die Sympathien und Idiosynkrasien erregen. Wer solcheZeitbegriffe nur als das verwendet, was sie sind: konventionelle und ungenaue Einteilungsbehelfe, und von derAufgabe überzeugt ist, sie so weit wie möglich von ihrem werthaften Überbau, ihren Fortschritts- undNiedergangsassoziationen, ja ihrer teleologischen oder heilsgeschichtlichen „Bedeutung“ zu befreien, wirdHemmungen haben, nach den vielen Widerlegungen des „Schlagworts vom finsteren Mittelalter“ nun von der„Modernität des Mittelalters“ zu sprechen. Abgesehen davon, daß die Moderne inzwischen auch einiges anGlanz verloren hat und einstmals umstrittene,
XIII
im Grunde ähnliche Metaphorisierungen wie die „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ nach dem Abgang desneu-humanistischen Bildungsideals Staub anzusetzen beginnen, muß der Mittelalterforscher heute seineKenntnisse vordringlich dazu einsetzen, neuen romantischen Aktualisierungen des Mittelalters ebensoinformativ zu begegnen wie vor fünfzehn Jahren einer vermeintlich fortschrittlichen Mittelalterverachtung;umso mehr, als beides nur auf zwei entgegengesetzte Wertungen derselben, offenbar unausrottbarenPauschalurteile vom naturnahen, sinnvoll gewachsenen, hierarchisch gegliederten, kosmisch geordneten,christlich geschlossenen Zeitalter hinausläuft. Demgegenüber stehe hier vor dem Eingang die Warnung: „Dusollst dir vom Mittelalter kein Bild machen!“
Die im Titel objektsprachlich gemeinte Leitidee der Verbindung von historisch Einzigartigem mitphilosophisch Allgemeinem läßt auch eine subjektbezogene Deutung zu. Sie weist auf eine doppelteUnfähigkeit: zur reinen Theorie und zur reinen Gelehrsamkeit; aktiv gesagt, auf ein doppeltes tiefesMißtrauen gegen die Synthese im Chaos des historisch Bunten, Zufälligen, und gegen das ziellose Bereitstellen,Aufarbeiten, Speichern im Meer der Einzeldaten, gegen zwei Formen inhumaner, weil nicht mehrhermeneutischer Geisteswissenschaft, den neuen „Beschreibungs“ -Szientismus und den alten Sammel-Alexandrinismus, deren Vertreter sich gegenseitig unter irreführenden Kampfparolen bekriegen: die einenrufen „Theorie“, wenn sie technokratisch verallgemeinern, die anderen „sauberes Handwerk“, wenn sie überpositivistische Borniertheit nicht hinauskommen und darum das Mittel normativ über den Zweck stellen.Beide Seiten verdecken damit nur, wie gut sie in ihrer stumpfen Subjektlosigkeit zusammenpassen. Vor dieserSkylla und Charibdis geistloser Wissenschaftsgläubigkeit rettet der Glaube an den Erkenntniswert des Beispiels,der induktive Versuch, mundus in gutta, das Ganze im Teilchen einzufangen. Dabei gelte hier das Mittelalterin seiner Bedeutung für die Gegenwart als diese „Welt“, und als der „Tropfen“, in dem sie sich spiegelt, magdie besondere Art dienen, wie einer der gebildetsten „Repräsentanten“ des 12. Jahrhunderts mit derGeschichtswirklichkeit oder vielmehr mit den Ausschnitten, Splittern, „Tröpfchen“ seiner eigenen Weltumging, um sich zu orientieren und verständlich zu machen. Das historische Beispiel ist also nicht nur dervorrangige Gegenstand, sondern das methodische Prinzip dieser Studie; bescheidener ausgedrückt: derVerfasser selbst zog es vor, exemplarisch vorzugehen, da ihm zum selbstzwecklichen Ausmalen eines weißenFleckchens im riesigen Vergangenheitsgemälde der historischen Wissenschaften die Geduld fehlte und er sichdoch im tatsachenleeren Raum der Weltgeistfragen aufgrund eines anerzogenen und unverbesserlichen Hangszur Analyse unwohl gefühlt hätte.
Thema und Methode führen an einen neuralgischen Punkt heran: Diesseits und jenseits des Universalienstreitsgibt es in der europäischen Denkgeschichte eine grundlegende Ambivalenz der erkenntnistheoretischenModelle,
XIV
die Spannung zwischen dem Intelligiblen und dem Konkreten, zwischen „Idee“ und „Fleisch“, zwischengriechischer Wissenschaft als Erkenntnis des Allgemeinen und Notwendigen, römischem Lernen aus derGeschichte als praktischer Identifikation mit Vorbildern und dem jüdisch-christlichen Heilswissen von derkörperlich sichtbaren Verwirklichung des Reichs Gottes in der Geschichte. Für diese an sich unvereinbarenepistemologischen Vorgaben hatte das Beispiel immer eine Vermittlerfunktion. Es stand bald „anarchisch“gegen die Vorherrschaft des Einen, Allgemeinen und Abstrakten (etwa gegen teleologischeGeschichtskonstruktionen), bald warnte es philosophisch vor der Sinnlosigkeit des Vielen und Beliebigen(etwa vor dem Selbstverlust an die Feststellbarkeit scheinhafter Phänomene). Es ist schwer zu sagen, welchervon beiden Aufgaben es heute mehr dient oder dienen sollte. Für die Gegenwart zuständige Philosophenbeklagen entweder den „neuen Kontextualismus“, die Vorherrschaft des Plurals über die Einheit, dasGrundmißtrauen gegen Systematisierung und Übergeneralisierung (J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit,Frankfurt 1985, 133) oder befürchten im Gegenteil die monoman totalisierenden Züge neuer individuellerKompromißlosigkeit, die Sehnsucht nach dem absoluten, „sensationellen Sinn“ in Verkennung der„entlastenden“ kleinen Sinnantworten (O. Marquard, Zur Diätik der Sinnerwartung, in: G.B. Achenbach,Philosophische Praxis, Köln 1984, 155 ff.), oder sie loben jenes noch in den skurrilsten Formen derMusealisierung sich überall meldende Bedürfnis nach Verlangsamung des Fortschritts, ja nach dem Beharrenim status quo und nach „Halt“ durch „Vergangenheitsvergegenwärtigungen“ aller Art angesichts derunaufhaltsamen „Dynamisierung unserer Lebenswelt“, der fast exponentiellen Beschleunigung deszivilisatorischen Wandels (H. Lübbe, Zeit-Verhältnisse, Zur Kulturphilosophie des Fortschritts, Graz 1983,33 ff.). So gern der philosophisch interessierte Zeitgenosse in die Diskussion über diese Gegenwartsdeutungen– die alle von der Antithese des Allgemeinen und des Individuellen handeln, nicht vom „Beispiel“ – einsteigenwürde, muß ich mich hierzu auf einen einzigen Aspekt beschränken, der auch die Aktualität desmittelalterlichen Geschichtsexemplums berührt.
Die erwähnten Zeitströmungen sind, wie immer man sie bewerte, selbst in ihren abwegigen und exzessivenFormen sicher als Symptome zu kurz gekommener Bedürfnisse, als Reaktionen auf vorangegangeneEinseitigkeiten ernstzunehmen. Wie tiefgreifend der unter dem stupiden Reizwort „Postmoderne“ derzeitbeschworene kulturelle Wandel tatsächlich ist, mag dahingestellt bleiben; in diesem Anspruch einersynkretistischen Wende äußert sich jedenfalls vorrangig der Wunsch nach der Vertauschbarkeit derPhänomene und – auf die Geschichte bezogen – nach der Auflösung selbstverständlicher Sukzessions- undEntwicklungsvorstellungen zugunsten imaginärer Gleichzeitigkeit alles Vergangenen. Darin liegt eine reaktive(teilweise nur modische) Abkehr von geschichtstheoretischen Einheitsvisionen und teleologischenZwangsvorstellungen des 19. Jahrhunderts, die gegenüber allen anderen
XV
möglichen Geschichtsmodellen eine fraglose Monopolstellung erlangt haben. Nach dem Studium einer darobvergessenen historischen Denkform, des vormodernen Exemplums, bezweifle ich jedoch grundsätzlich, daßjene Synchronisierung der „Geschichten“ nur entwicklungsgeschichtlich zu erklären ist, daß sie etwa einerbestimmten (primitiven, archaischen, vorwissenschaftlichen) Kulturstufe angehört und in späteren Zeiten wieder unseren notwendig nur noch anachronistisch, regressiv, nostalgisch oder bestenfalls parodistisch unddekorativ verwendet werden kann. Die zugrundeliegende ahistoristische oder antihistoristische Denkformverweist vielmehr auf ein verdrängtes Erkenntnisinteresse, das sich heute gegen die seit etwa 200 Jahrenherrschende, allein wissenschaftlich vertretbare Geschichtsbetrachtung wieder durchzusetzen sucht. Eineüberhebliche Art, auf mittelalterliches Denken herabzusehen, findet sich seltsamerweise oft bei Historikern, jasogar Mediävisten, die auch nur mit halbem Herzen in unserer Zeit stehen: Sie erheitern sich banausisch ander ernstgemeinten Vertauschung vergangener und zeit-genössischer Helden im Mittelalter wie an einer etwasinfantilen Maskerade und würden dieselben „Zeitensprünge“ bei einem modernen satirischen Autor vielleichtschulmeisterlich als absurde Verletzung der „historischen Wahrheit“ ankreiden. Übersehen wird in beidem die„Wahrheit des Beispiels“.
So könnte man, Kurt Hübners Titel „Die Wahrheit des Mythos“ abwandelnd, eine rationalere Art desverdrängten Orientierungswissens nennen, die den prozeßhaften Geschichtsbegriff, ja in einem gewissen Sinnsogar die Zeit in der ewigen Simultaneität aller Geschichten aufhebt. Neben der Einbahnstraße kausalerEreignisfolgen liegt das offene Spielfeld eines sozusagen geschichtslosen thesaurus historiarum, aus dem diegroßen materiellen und geistigen „Tatsachen“ aller Zeiten wie die Teile eines unsichtbaren, zeitlosen Ganzen,die Buchstaben eines Alphabets, die Lexeme einer Universalenzyklopädie ad libitum abgerufen, herbeizitiertund kombiniert werden können. Exempla sind die geschichtlichen Elemente einer „generativen Grammatik“.An die Stelle der Metaphern vom „Geschichtsdrama“ und vom „Rad der Geschichte“ rückt die Geschichte alsWortschatz, als Sprache. Geschichte ist in der Tat ein reiches, vieldeutiges, unabsehbar variierbaresZeichensystem.
Diese Sprache wird hier zwar nur an mittelalterlichen historiae, ja sogar monographisch an denen eineseinzigen Autors illustriert; das theoretische Ergebnis, das sich aus beliebigen anderen Textanalysen auchgewinnen ließe (dies soll kein Forschungsdesiderat anmelden), liegt jedoch in der Feststellung, daß es immerein Bedürfnis gegeben hat und noch gibt, Geschichte als eine publica materies – so nannte die antike Rhetorikallen darstellbaren Stoff – zu benützen, als einen allgemeinen, jederzeit zugänglichen Wissensfundus, einenEinfallsspeicher, ein Bildwörterbuch zum Nutzen des sich vergleichenden „Menschen, wie er ist und immerwar und sein wird“ (J. Burckhardt, „Weltgeschichtliche Betrachtungen“, ed. P. Ganz, München 1982, 226).
XVI
Die Burckhardt-Reminiszenz scheint auf den ersten Blick unpassend für den rhetorisch-philosophischenBeispielgebrauch des Mittelalters, der sich weniger nach der Faktentreue als nach dem unmittelbaren Nutzenfür eine Situation oder einen Kontext richtet. Dennoch hat Jacob Burckhardt als Historiker überzeugender, alsein Philosoph dies vermöchte, die nicht überholbare theoretische Dignität einer von der Antike zum 18.Jahrhundert vorherrschenden Betrachtungsweise verteidigt: „Wir betrachten das sich Wiederholende,Constante, Typische, als ein in uns Anklingendes, und Verständliches“ (a.a.O. 227). Er nennt diese„Betrachtung“ als sein „einzig mögliches Centrum“ eine „pathologische“, womit er zweifellos methodischStrengeres meint, als was vor der „historischen Schule“ unter dem (die gleiche Menschennaturvoraussetzenden) Topos historia magistra vitae verstanden wurde. Aber das erkenntnisleitende Prinzip istdasselbe. Er spitzt es sogar noch zu, indem er es von der Klugheitslehre auf die Weisheitslehre ausdehnt (vgl.unten Anm. 95) und so noch einmal die Geschichtswissenschaft als ancilla philosophiae legitimiert; umsoironischer, als er damit gerade die (Hegelsche) Geschichtsphilosophie zu verwerfen sucht. Burckhardt ist hieraber auch deshalb ein glaubwürdiger Zeuge, weil er diesen das alteuropäische Exemplum tragendenGesichtspunkt der anthropologischen Konstanz vor der einseitigen Herrschaft historisierender,evolutionistischer Erklärungsmodelle rettet, ohne deswegen historistische Errungenschaften im methodischenBereich preiszugeben. Daß, wie er sagt, „alles Geistige eine geschichtliche Seite […] und alles Geschehen einegeistige Seite habe“, d. h. „Wandlung“ und „Unvergänglichkeit“ nicht zu trennen seien, läßt sich nicht nuridealistisch verstehen, sondern auf die doppelte Legitimität von Entwicklungs- und Beispielgeschichtebeziehen: auf das Modell der Diachronie, den Topos von den Fakten, die nicht ungeschehen gemacht werdenkönnen und die, mögen sie so geringfügig wie die Nase der Kleopatra sein, alles bis zur Gegenwart kausalfestlegen, aber gleicherweise auf das komparative Denkmuster, den Topos von der geistigen Gleichzeitigkeitaller bedeutsamen Ereignisse. Selbstverständlich sind wir heute in der historisch-philologischen Methode ganzdem ersten Modell verpflichtet. Auch diese Arbeit beruht auf der Überzeugung, daß geschichtliche Abläufenachzuzeichnen und zu gliedern sind. (Wozu diente sonst die hier zentrale Frage nach Epochenunterschieden?Oder was besagte sonst die Feststellung einer in vielen Bereichen extrem langsamen, fast stillstehendenKulturentwicklung vom 12. zum 18. Jahrhundert, die hier eine Reihe ungewohnter Analogien kreuz und querdurch die Zeiten herzustellen erlaubte?) Doch das synchrone Modell der Geschichtsbetrachtung ist etwaswesentlich anderes; es läßt sich aus der entwicklungsgeschichtlichen Perspektive weder rechtfertigen noch inFrage stellen. Es wird von dem bestimmt, was Burckhardt in einem emphatischen Sinn „historischeErkenntnis“ nennt, was er abhebt vom bloßen „Erinnern“ an „Bedingtheiten“ und „vorübergehendeMomente“: „Was einst Jubel und Jammer war, muß nun Erkenntnis werden, wie eigentlich auch im Leben des
XVII
Einzelnen“ (230). Beide Geschichtsmodelle sind inkommensurabel. Werden sie aneinander gemessen, soentstehen die traditionellen Verzerrungen: Philosophen setzen die am zufälligen Detail klebenden Historikerherab, und Historiker schmähen die um runder Theorien willen die Tatsachen fälschenden Philosophen. Diemoderne Geschichtswissenschaft bedarf kaum einer Apologie mehr, wohl aber die von ihr weitgehendverdrängte Möglichkeit der Geschichtserkenntnis durch Beispiele für das Gleiche, „der archimedische Punktaußerhalb der Vorgänge“. Da jedes Beispiel nur einen Einzelaspekt von pragmatischer oder theoretischerBedeutung zu Vergleichszwecken aus dem Ganzen eines historischen Erinnerungsbildes auswählt (s. unten§ 78), vernachlässigt es notwendig alle anderen Details und „verfälscht“ in diesem engen Sinn die Fakten, aberdieser eine vergleichbare Aspekt, diese „Bedeutung“ kann die „Dinge geistig überwinden helfen“, was fürBurckhardt und zahlreiche Historiker seit der Antike die „große Gesamtaufgabe der Geschichte“ ausmacht(228). Der Basler Kulturhistoriker hat damit bewiesen, daß der geschichtswissenschaftliche Positivismus des19. Jahrhunderts die Geschichte der Denkwürdigkeiten nicht in den Trivialitäten des Faktischen begrabenkonnte (ebenso wenig wie die etwa gleichzeitig entdeckte Photographie der Kunst Schaden zufügte).
In der Gegenwart spricht die Literatur deutlicher als die Wissenschaft von der Erkenntnis durch dashistorische (und pseudohistorische) Beispiel, abgesehen davon, daß (nach Aristoteles) das individuelleAllgemeine die (philosophische) Dichtung grundsätzlich stets mehr beschäftigt als die (unphilosophische)Historiographie (Anm. 492–5). J.L. Borges hat in mehreren Erzählungen das Problem der Einmaligkeit undWiederholbarkeit von Geschichte vor Augen geführt. Auf einer ganz phantastischen Ebene finden wir hier diewissenschaftliche Grundidee Burckhardts von der „wandelbaren“ und „unvergänglichen Seite“ desGeschichtlichen wieder: So wie der noch bevorstehende Tod die Menschen „kostbar und pathetisch macht“ –„Alles hat bei den Sterblichen den Wert des Unwiederbringlichen und des Gefährdeten“ –, so verleiht derwirkliche und vergangene Tod eine Art semiotischer Unsterblichkeit, weil das Gedächtnis auswählt,abstrahiert, vereinfacht, symbolisiert, Kanten abschleift, Unterschiede verwischt, bis zuletzt verschiedeneMenschen verschiedener Zeiten in ein unendliches Verweissystem eingehen und identisch werden; bis sichjedes in jedem spiegelt. „Bei den Unsterblichen dagegen ist jede Handlung (und jeder Gedanke) das Echo vonanderen, die ihr in der Vergangenheit ohne ersichtlichen Grund vorangigen, oder zuverlässige Verheißunganderer, die sie in der Zukunft bis zum Taumel wiederholen werden.“ (Das Aleph, in: Ges. Werke, Hanser-Ausg. 3/II, 1981, 20). Achilles kehrt wieder in Alexander und dieser in Karl XII. von Schweden (ebd. 98).„Ich bin Homer gewesen, nicht lange, so werde ich wie Odysseus Niemand sein; nicht lange, so werde ich allesein; ich werde tot sein“, sagt der fiktive Erzähler eines fiktiven Reiseberichts über die Stadt derUnsterblichen (ebd. 23). Dazu erscheint eine Fußnote: „Giambattista Vico […]
XVIII
vertrat die Auffassung, Homer sei eine sinnbildliche Figur wie Pluton oder Achilles“, und kurz davor steht diesublim ironische Selbstkorrektur, die das übliche Verhältnis von Dichtung und Geschichtsschreibung auf denKopf stellt: „Ich habe […] diese Seiten durchgesehen. Daß sie wahrheitsgemäß sind, steht für mich außerZweifel, doch meine ich […] eine Unstimmigkeit zu bemerken: schuld daran ist vielleicht das mißbräuchlicheAnführen von Nebenumständen, ein Darstellungsverfahren, das ich den Dichtern abgesehen habe und das allesmit Falschheit ansteckt, insofern zwar die Tatsachen mit einer Fülle von Einzelzügen aufwarten, nicht aberdie Erinnerung an sie“ (ebd. 22; vgl. auch unten § 58). In der Geschichte von den spätantikenTheologenstreitigkeiten über den linearen und den zyklischen Geschichtsbegriff (ebd. 31 ff.) stehen sich diezwei Thesen gegenüber, daß es so wenig zwei gleiche Augenblicke im Weltganzen gebe wie zwei sich völliggleiche Gesichter, sowie, daß „nichts ist, was nicht gewesen ist und sein wird“. Die Vertreter dieserWahrheiten, bzw. Irrlehren, werden jedoch nach ihrem Tod, „wo es keine Zeit gibt“, von Gott verwechselt,bzw. als ein und dieselbe Person aufgefaßt. Ähnlich beginnt die wahre Bruderliebe zwischen Kain und Abel impostmortalen Vergessen, wo keiner von beiden mehr weiß, wer den anderen umgebracht hat. Bei aller Artistikdieses poeta doctus unserer Zeit meint Borges mit solchen Bildern der Vertauschbarkeit geschichtlicher„Namen“ offenbar mehr als eine antiquarische Kuriosität (für die diese Studie zahlreiche authentische Belegeaus dem Mittelalter beibringen wird); er scheint so in bewußter Frontstellung gegen den heuteselbstverständlichen Geschichtsbegriff von der dramatischen oder epischen Sukzession einmaliger,beispielloser Individuen und Handlungen die alte topische Vorstellung einer Universalbibliothek allerGeschichten, einer Sprach- und Traditionsgemeinschaft der Memorabilien (Exempla) wenigstens poetischwieder erneuern zu wollen. Der (ironisch gebrochenen) metaphysischen Begründung läßt sich BurckhardtsGedanke der historischen Erkenntnis durch Distanz und Sedimentierung einstiger Affekte zur Seite stellen:Der Tatsachenfetischismus der Historiker, der teleologische „Irrtum, unsere Zeit sei die Erfüllung allerZeiten“, die entsprechend prozeßhaft zu strukturieren seien, verraten dramatisierende Aufgeregtheit inconspectu mortis, während die Beispielvergleiche der Dichter und Philosophen den höheren Standpunkt subspecie aeternitatis vertreten, aber auch auf die nihilistische Weisheit des Kohelet angesichts des endgültigenIdentitätsverlusts in der universalen Todesruhe verweisen (vgl. unten §§ 105–108).
Auf den Spuren Borges‘ wandert bekanntlich auch U. Eco in seinem Erfolgsroman ‚Der Name der Rose‘;weniger bekannt ist das geschichtstheoretische Nachfolgeverhältnis. Ich komme an anderer Stelle auf diemediävistischen Aspekte des Werks zurück (Umberto Ecos offenes Mittelalter, in: „…eine finstere und fastunglaubliche Geschichte“ Mediävistische Notizen zu… Der Name der Rose, Darmstadt i. Ersch.) und möchtehier nur beiläufig erwähnen, daß es als Ganzes auch eine Art Exemplum darstellt, ein Großgleichnis
XIX
(s. Anm. 986), in dem die Gegenwart nicht weniger das Mittelalter als das Mittelalter die Gegenwart„bezeichnet“ und „abbildet“, weil ein anthropologisches tertium comparationis alle Verfremdungen,Vexierbilder, Spiegelungen und Versteckspiele durchdringt. In diesem keineswegs „lehrhaft eindeutigen“Roman, einem Beispiel für die opera aperta (vgl. Anm. 709), findet sich wenigstens die eine paradoxe„Lehre“, daß die Wirklichkeit der Menschen, auch wenn Philosophen sich mit ihr abmühen und vielerleiSinnwelten über ihr errichten, doch zu allen Zeiten labyrinthisch, chaotisch und vielleicht absurd bleibt. Es isteine je nach dem Blickpunkt tröstliche, komische oder tragische Lehre, die aus abgründiger sokratischerSkepsis gegenüber jener „Weltgeschichte“ stammt, die (vor Hegel) Johann von Salisbury ein groteskesSchaubudenstück für höhere Zuschauer (§ 105) und (nach Hegel) Friedrich Dürrenmatt einen schlechtenAbenteuer- und Kolportageroman genannt haben (Stoffe I–III, 1981, 64). In einem seiner letzten Werke,‚Achterloo‘, hat der Schweizer Dramatiker übrigens dasselbe wie der argentinische Erzähler und seinitalienischer Nachfolger „gelehrt“: Indem er Geschichtsfragmente verschiedenster Zeiten, Figuren,Anekdoten durch künstliche Synchronisierung oder „Zeitensprünge“ durcheinanderwirbelt, setzt er allesinnvollen oder gar gesetzmäßigen Ereignisketten der Menschheitsgeschichte außer Kraft. Der literarischeVerfremdungsreiz wäre hier ohne unseren Glauben an die historische Entwicklung ebenso wenig möglich wiedie ‚Cena Cypriani‘ ohne heilsgeschichtliche Voraussetzungen (vgl. Anm. 949). Eco beseitigt die epochalenTrennwände der Historiker mit anderen Mitteln: Eine lineare, auf einer Zeitebene erzählte Geschichte, einscheinbarer Geschichtsroman, bildet die diachrone „Verhüllung“, die für den, der es wissen will, diehintergründige Synchronie überall durchscheinen läßt.
Mit diesen dilettantischen Randnotizen zur Gegenwartsliteratur sollte die im weiteren nur noch an Zeugnissender fernen Vergangenheit dargestellte, aber im Grunde anthropologisch ubiquitäre Denkform einmal mitmodernen Parallelen nahegebracht werden. Die Frage nach dem Unterschied von Fiktion und Wirklichkeit,Dichtung und Geschichtsschreibungbleibe hier einstweilen offen; sie gehört als eine immanente (nicht nur imMittelalter ungelöste) Aporie zum Wesen des historischen Beispiels und zu den Hauptthemen dieses Buches(s. §§ 57 f., 88). Vorwortgemäß ist dagegen eine Überlegung zum Nutzen (status utilitatis) des Exemplums aufder aktuellen Diskursebene, worüber uns wieder die Literatur des 20. Jahrhunderts besser unterrichtet als dieGeschichtswissenschaft. Grundlegende Betrachtungen Thomas Manns über eine psychologische Art desmenschlichen horror vacui vor allem Einmaligen, Unbekannten, Beispiellosen und über das elementareBedürfnis nach dem Wiedererkennen alles Neuen im Altvertrauten werden in § 108 zu bedenken gegeben. ZurAbrundung seien hier noch einige vergleichbare (ebenso mediävistische wie moderne) Gedanken UmbertoEcos nachgetragen. Im ‚Namen der Rose‘ fragt sich der junge Adso von Melk nach seinem erstenLiebeserlebnis, wie es komme, daß die mystische Todesextase, wie sie die geistlichen
XX
Texte beschreiben, der „sündigen“ Extase des irdischen Sinnengenusses gleiche und warum sich beide mitdenselben Worten benennen lassen; versucht vergeblich eine Erklärung in der patristischen Theorie derZeichenpolyvalenz (dazu s. unten §§ 49, 83 ff.) und sagt bestürzt (wie Anm. 767, 251 f.): „È che la giustezzadell’interpretazione non può essere fissata che dall’autorità dei padri, e nel caso di cui mi cruccio non hoauctoritas a cui la mia mente obbediente possa rifarsi, e bruccio nel dubbio“. Mit anderen Worten: WoAutoritäten fehlen – und echte Beispiele haben im Mittelalter immer den Status von Autoritäten – beginntder Boden der Wirklichkeit zu schwanken (s. auch Anm. 1005a). Nun ist es seit dem 16. Jahrhundert üblich,das Mittelalter als traditionsgeleitetes, autoritätenhöriges, unmündiges und besonders deshalb „finsteres“Zeitalter zu betrachten, weil in dem neuzeitlichen Perzeptions- und Denkmodell das Neue, die Entdeckungund Erfindung von Neuem, an sich als Wert gilt und nichts mehr verachtet wird als die Monotonie derWiederholung und des „déjà-vu“. Eco hat in anderem Zusammenhang (Auf dem Weg zu einem NeuenMittelalter, wie Anm. 723, 25 ff.) eine semiotische „Ehrenrettung“ des Denkens in Autoritäten, ausgehendvon dem Riesen-Zwerge-Gleichnis (unten Anm. 538), unternommen und es dem heutigen Zerfall derromantisch-idealistischen Originalitätsvorstellung (die er als scheinpluralistische Verbrämungsideologie füreinheitliche ökonomische Herrschaft deutet) so entgegengestellt: „Das war nicht nur Dogmatismus (auchwenn es oft einer wurde), sondern es war die Art und Weise, in welcher der Mensch des Mittelalters auf dasChaos und den kulturellen Zerfall des untergehenden Römertums reagierte, auf das Gewimmel von Ideen,Religionen, Verheißungen, Sprachen und Redeweisen der hellenistischen Welt, in der sich jeder mit seinemSchatz an Wissen allein fand. Das erste, was damals getan werden mußte, war das Wiederherstellen einerThematik, einer Rhetorik und eines gemeinsamen Wortschatzes, an dem man sich zu erkennen vermochte,andernfalls hätte man nicht mehr kommunizieren können…“ Wir gelangen damit auf anderem Weg zurückzur Bedeutung des historischen Beispiels als Element einer Sprache, diesmal nicht unter dem philosophischenAspekt der Erkenntnis, sondern dem rhetorischen der Orientierung und Kommunikation. Das Exemplum –als Präzedenzfall definitionsgemäß eine Autorität – ist ein Instrument gegen Vereinzelung, Vereinsamung,Verzweiflung und Barbarei, ein Bestandteil jenes freien, scharfsinnigen, vielfältig variierbaren Spiels mit derrelative festen, unanfechtbaren „Grammatik“ eines kulturellen Grundkonsenses. Das Neue, das niemand alssolches sucht, entsteht in Wirklichkeit von selbst. Da es auf dieser Sprache aufbaut, sich aus ihrherausdifferenziert, erzeugt es weder Verwirrung noch Erschrecken – und schon gar nicht jenes böse Erwachenüber ungewollte Erfindungsfolgen, die beim Erfinden um des Erfindens willen notgedrungen entstehen. (Zudiesem Aspekt vgl. neuerdings meinen Beitrag: Das argumentative Exemplum und die „wächserne Nase“ derAutorität im Mittelalter, in: Exemplum et similitudo, hg. v. W.J. Aerts/M. Gosman, Groningen i. Ersch.).
XXI
Diese Einsicht in den „Nutzen“ des Geschichtsbeispiels „für das Leben“, die sich nachträglich wie ein idealerFluchtpunkt aller Gedanken dieser Arbeit ausnimmt, ist keineswegs zielstrebig oder methodisch, sondern aufvielen krummen Wegen und fast zufällig erreicht worden. Nicht um den Leser mit der Absolvierung einerVorwortkonvention zu langweilen, sondern weil mir die grundsätzliche Betrachtung einigerWerkstattprobleme für das Verständnis des Folgenden hilfreich scheint, möchte ich – gewissermaßen alsAutorenexemplum – kurz die Entstehungsgeschichte des Buchs erzählen und kommentieren. Ganz ähnlicheÜberlegungen, wie sie kürzlich O. Marquard (Die Wiederkehr der Mündlichkeit und die Chance des Buchs, in:Der Altsprachliche Unterricht 28, 1985, 88–89) und eindringlicher J. Mittelstraß (Bibliothek undGeisteswissenschaftliche Forschung, Neue Methoden – alte Probleme, in: NZZ 27.6.86, Nr. 145; Kurzfassungeines noch unveröffentlichten Beitrags) zu meiner Freude über die offenbar in der Luft liegende„Wachstumsproblematik“ der Wissenschaft angestellt haben, können damit aus der Sicht eines unmittelbarBetroffenen veranschaulicht und vielleicht noch verschärft werden.
Diese Arbeit hat die Fehler und Vorzüge aller zu lange liegengebliebenen oder gereiften Projekte. Sie wurdemehrfach ergänzt, revidiert und umgeschrieben, bis sich das ursprüngliche Forschungsinteresse in einer völligneuen, weiteren Konzeption aufhob. Vergleichbar ist sie nicht mit einem mathematischen oderkriminalistischen Beweisverfahren, sondern mit einem harmlosen Spaziergang, der allmählich zur Reise undschließlich zu einer gefährlichen Expedition wird – nämlich dann, wenn die zurückgelegte Wegstrecke schonzu groß ist, um bei plötzlich eintretendem Orientierungsverlust noch umkehren zu können. DieAbenteuerlichkeit dieser „work in progress“-Methode ist nicht etwa durch neu hinzukommendes Materialbedingt – man kann sein Stoffgebiet jederzeit quantitativ neu eingrenzen –, sondern durch die theoretischenÜberraschungen, die uns dank unvermeidlicher Teilnahme am „Fortgang“ der Forschung die Einsichtenanderer positiv oder negativ bereiten. Sie können im schlimmsten Fall jahrelange Arbeit auf einmal zerstören,etwa wenn sie eine bislang sinnvolle Fragestellung ad absurdum führen. Ich hatte insgesamt das Glück, daß siemir zusehends halfen, den Reichtum meines Themas von immer neuen Seiten zu bewundern, bis ich zuletztsorgenvoll feststellte, daß es in bedeutsame Einzelthemen fast unendlich teilbar ist, dann aber tröstlicherweiseauch bald begriff, daß es gerade darum jederzeit willkürlich (etwa durch Terminzwang) verlassen werden kann,ja mehr noch: daß die zuletzt bewußt gewordene Unerschöpflichkeit der Sache wohltuend vom Masochismusperfektionistischer Wissenschaft erlöst.
Im einzelnen kam dies so: 1979 wünschte David Luscombe, dem hier als „erstursächlichem“ Inspirator ersterDank gebührt, einen Kongreßbeitrag zum 800. Todestag Johanns von Salisbury. Nach einem Blick in denPolicraticus
XXII
nahm ich diese Pflichtarbeit an, ohne zu ahnen, was mir bis 1986 bevorstand. Seit langem kannte ich einebesondere mittelalterliche Ausprägung der in H. Lausbergs Rhetorik-Handbuch nach vornehmlich antikenQuellen vortrefflich systematisierten Stil- und Argumentationsform des historischen Exemplums. Bei vielenAutoren, mit denen ich zu tun hatte (Hildebert, Abaelard, Petrus Venerabilis, Bernhard von Clairvaux u. a.)fiel mir eine Art auf, in gewissermaßen ikonenhaften Geschichtsbezügen und Anekdoten zu denken. GanzeDenkabläufe wurden statt mit sog. „Vernunftgründen“ durch eine Kumulation von Beispielgeschichten undBeispielfiguren bestritten. Über dieses in mehreren altphilologischen Arbeiten beschriebene Exemplum fandich so gut wie keine mediävistische Untersuchung. Selbst der große E.R. Curtius schrieb darüber als einem Teilder von ihm so genannten „Topik“ eher Verwirrliches (s. §§ 10, 121–3). Zuletzt bin ich auf die rhetorischeDenkfigur des geschichtlichen Beispiels im Zusammenhang mit den literarischen Vorschriften undGewohnheiten der Trostrede (1972) sowie der eigenartigen Verzettelung und Funktionalisierung bestimmterHeldenepisoden aus Lucans ‚Pharsalia‘ eingegangen und hatte in einem Kapitel des ‚Policraticus‘ (VIII 23)eine der selbständigsten und geistreichsten Aktualisierungen des Bürgerkriegsthemas (als Beispiel für einbevorstehendes Schisma) analysiert (1979). Die bisherige Mittelalterforschung war einerseits fastausschließlich von dem (1927 durch J.-Th. Welter aus der Taufe gehobenen) volksmissionarisch-homiletischen „Exemplum“-Begriff besetzt, von dem das argumentative Exemplum unbedingt zuunterscheiden war; andererseits war die alte Streitfrage um den „Humanismus“ oder Klassizismus Johanns vonSalisbury auch nach Hans Liebeschütz‘ bahnbrechender Monographie immer noch nicht zur Ruhe gekommen(J. Martin und M. Kerner), und eine Konzentration auf die Policraticus-Exempla versprach hier neueErkenntnisse.
Die eigentliche Herausforderung zur Kombination beider Themen war K. Stierles gut geschriebenerExemplum-Beitrag für den Konstanzer ‚Poetik und Hermeneutik‘-Band über die Geschichtstheorie (1973).Stierle hatte die These aufgestellt, das mittelalterliche Exemplum, das er ganz mit dem Predigtmärlein derBettelmönche identifizierte, habe einer eher simplen didaktischen Illustrationsfunktion gedient, während erstdie frühe Neuzeit den eigenen Erfahrungswert des historischen Beispiels entdeckt habe, das Exemplum derartgewissermaßen zu sich selbst gekommen sei als jenes eigene Medium historisch-philosophischer Erkenntnis(das der Pädagogiktheoretiker Günther Buck in mehreren Arbeiten überzeugend beschrieben und unsererLebenspraxis empfohlen hat). Diese Mittelalter-Neuzeit-Konfrontation erregte auf Anhieb mediävistischeEntrüstung. Ich gebe den emotionellen Einstieg in das Thema heute gerne zu: Nach der hoffentlicheinsehbaren Kritik an einigen Verzerrungen Stierles, dessen Leitidee zum epochengeschichtlichen Wandel desWirklichkeitsbegriffs ich am Ende in anderer Form selbst vertreten habe (§ 112), zeigt dieser Beginn einmalmehr, daß Übertreibungen, Mißverständnisse, ja sogar Irrtümer die Forschung oft weiter bringen als
XXIII
sogenannte Ausgewogenheit. Es genügte mir zunächst, an Beispielen Johanns von Salisbury zu demonstrieren,daß das, was Cicero unter einem induktiven Exemplum verstand, im Mittelalter nicht derart verloren ging,daß es Boccaccio und Petrarca wiederentdecken mußten, und daß diese Denkform wenig mit einer narrativenPredigteinlage zu tun hat. Dies war die Quintessenz des 1980 gehaltenen und (nach langer Wartezeit auf derRedaktion der Church History Society) 1984 endlich erschienenen Vortrags („The use of exempla …“).
Nach dem Kongreß von Salisbury gedachte ich, die deutsche Vorlage in ein paar Wochen mit Anmerkungenzu versehen und alsbald zu publizieren. Doch bei der Zusammenstellung sog. Belege und Parallelen stieß ichdank des „Forschungsfortschritts“ auf eine solch beeindruckende Menge neuer Gesichtspunkte, daß die Arbeitjahrelang nachbehandelt werden mußte. Den wichtigsten Revisionsanlaß boten zwei Neuerscheinungen derfrühen 80er Jahre: der Kongreßbericht von J. Berlioz und J.-M. David, „Rhétorique et histoire, L’exemplum…“ sowie der in der ‚Typologie des sources du moyen âge‘ erschienene Exemplum-Band von C. Brémond, J.Le Goff und J.-C. Schmitt. Ich glaubte, alles Nötige zur logischen Unvergleichbarkeit des argumentativenExemplums und des „Predigtmärleins“ gesagt zu haben (gedruckt war allerdings noch nichts), und nun tratenganze Institutionen, Projektgruppen mit „großen Namen“ für die Einebnung des Unterschieds ein. Erst heuteerfahre ich durch die Projektleiter selbst, daß die allgemeine Geschichte und Theorie des Exemplums vonAristoteles zu Caesarius von Heisterbach nicht das von der Mehrheit der Beteiligten angestrebte Ziel war,sondern die Untersuchung der homiletischen Kurzgeschichte des späteren Mittelalters (über die in beidenArbeiten tatsächlich Vorzügliches vorgelegt wurde.) Diese Kurzgeschichte heißt in der Mediävistik nun einmal„Exemplum“. Im Grunde erlaubte eine Homonymie, ein identischer flatus vocis für verschiedene Dinge (mehrdazu unten §§ 34 ff.), diese großangelegte interdisziplinäre Kooperation. Bei Forschungsunternehmungen, dieim Industriezeitalter überall nach Gesichtspunkten der „big science“ gefördert werden, sollten ohnehin keineallzu strengen Maßstäbe an die Logik der Zusammensetzung gelegt werden. Da ich dies 1982 noch nichtwußte, verunsicherten mich die beiden Bände. Ich hatte aufgrund der rhetorischen Exemplum-Definition dasPredigtmärlein kaum beachtet. Ein früherer, mit den meisten „volksliterarischen“ oder homiletischenExemplumbegriffen erbarmungslos aufräumender Forschungsbericht von R. Schenda schien mir dazu allesBemerkenswerte zu enthalten. Nun mußte ich mir zugeben, daß grundsätzlich wenigstens einige dieser„Exempla“ genannten Predigt-narrationes – dies entspricht schon der anthropologischenVerallgemeinerungsfähigkeit der aristotelischen Exemplum-Definition – doch nicht ganz aus der rhetorischenBestimmung herausfallen können. Ich machte mich also an die Artes praedicandi und Materialsammlungender Mendikanten sowie an die ganze uferlose Sekundärliteratur über homiletische Exempla. (Schenda schriebmir hierzu später, man
XXIV
könnte ohne weiteres einen eigenen Lehrstuhl für Exemplaforschung einrichten.) Was ich dabei lernte undvor allem dank des kleinen, sehr anregenden Artikels in der ‚Enzyklopädie des Märchens‘ aus der Feder vonChristoph Daxelmüller entdeckte, war die Dialektik und Interdependenz von Exemplum und Kasus, Beispiel-und Problemfall in der frühen Neuzeit. Diese besondere didaktisch-kasuistische Doppelfunktion des Beispielswurde mir zum zentralen Gesichtspunkt, unter dem sich antike, mittelalterliche und neuzeitliche Exempla als„Denkbilder“, in rezeptionsgeschichtlicher Hinsicht aber auch volksmissionarische Predigtexempla,hofgebundene Fürstenspiegelexempla, bürgerliche Hausväterexempla usw., in gattungsgeschichtlicher Hinsichtrömische exempla maiorum, hellenistische Aretalogien, christliche Wüstenvätergeschichten, Legenden,Mirakel, Memorabilien, Anekdoten, Apophthegmen, Novellen und totum hoc fabularum genus (Anm. 506)vergleichen und theoretisch meditieren ließen. So gelangte ich auch in die dem Mediävisten sonstverschlossene (und doch noch vor allem so mittellateinisch anmutende) Welt der reformatorischen undgegenreformatorischen Humanisten und Jesuiten, der Moralisten, Prudentisten, Polyhistoren usw. mit ihrenimmer vollkommeneren Techniken der inventio locorum, mit ihren „scharfsinnigen Klugheitsreden“ undeindrücklichen „Historien“. Das wichtigste Ergebnis dieser Phase war für mich die thematisch bedeutsameSchärfung des Blicks für bestimmte kulturelle Kontinuitäten jenseits der künstlich errichteten national- undepochenbedingten Fachgrenzen; ich entdeckte für das Mittelalter, was Wolfgang Brückner für die Barockzeitim Sinne eines Desiderats feststellte: „… auf bestimmten Gebieten zeigt sich eine andere Epocheneinheit, […]eine viel engere Verwandtschaft bisher getrennt gedachter Jahrhunderte, nämlich das halbe Jahrtausend vomspäten Mittelalter bis zur Aufklärung, vom 14. bis zum 18. Jahrhundert“ (Kurzprosa, wie Anm. 164, 111 f.),wobei ich die untere Grenze sogar noch um gute zweihundert Jahre zurückverlegen würde, um mit Jacques LeGoff das „lange Mittelalter“ zu postulieren.
Zur Sache selbst – zur Definition des Exemplums – möchte ich hier, unmittelbar bevor ich das Manuskriptendgültig aus den Händen gebe, den 1983 geschriebenen Ausführungen (§§ 16 ff.) ein paar Worte aus heutiger Sichtnachträglich beifügen. Ausführlicher komme ich darauf zurück in einem Beitrag (Sulla retorica dell’exemplum) fürden Kongreßbericht ‘Retorica e poetica tra XII e XIV secolo’ (A.M.U.L. Spoleto i. Ersch.), in dem auch J. Le GoffsVortrag ‘L’exemplum et la rhétorique de la prédication aux XIIIe–XIVe siècles‘ erscheinen wird. Schon aus diesenzwei Beiträgen ist eine größere Annäherung der Standpunkte ersichtlich, als das Kapitel §§ 34 ff. in dieser Arbeiterwarten läßt, das ich heute erst recht versöhnlicher formulieren würde. Ich halte wissenschaftsterminologischeAuseinandersetzungen grundsätzlich für unergiebig und habe nicht vor, die eingebürgerte Bezeichnung „Exemplum“für „Predigtmärlein“ abzuschaffen. Möge jeder homiletische Kurzgeschichten Exempla nennen, wenn aus demKontext ohnehin hervorgeht, daß nicht römische exempla maiorum oder juristische Präzedenzfälle gemeint sind.Sollte dies nicht klar sein, so genügt es, das Beiwort „homiletisch“ davorzusetzen. Ebenso läßt sich mit demmittelalterlichen Gegenstück zum Exemplum etwa der Rhetorica ad Herennium verfahren; nur in Zweifelsfällenbraucht es durch Adjektive wie „rhetorisch“, „argumentativ“ oder „historisch“ ausgezeichnet
XXV
zu werden. Wichtig ist allein, daß man sich vor Vermengungen und Verwechslungen hütet. Auch J. Le Goff undseine „équipe“ haben sich ernstlich um die Klarheit dieser Unterscheidung bemüht. Warum unsere Resultate dennochteilweise stark voneinander abweichen, dürfte metasprachlich zu erklären sein: Wir bewegen uns mit eigenenFrageansätzen auf ganz verschiedenen Diskursebenen: Wo der Historiker „beschreibt“ und systematisiert, aus vielenEinzeldaten eine Kategorie oder Gattung durch Synthese zu gewinnen sucht, da „abstrahiert“ der theoriegeschichtlicharbeitende Literaturwissenschaftler und sucht Formgesetze. Die Sprachbarriere beginnt schon bei der Verwendungdes Begriffs „rhetorisch“, sei es für eine aktuelle oder eine virtuelle Persuasion: Für den einen gehören zur Rhetorikbeschreib- und nacherzählbare Vorgänge in tatsächlichen strategischen Arrangements etwa von Dominikanerngegenüber einem Laienpublikum; für den anderen gilt Rhetorik als eine Ars, eine Methodenlehre undHandlungsanleitung mit formalen Techniken für irgendwelche Reden und Schriften, wobei die Diachronie derRegeln gleicherweise wie diejenige der Anwendungen historisches Interesse verdient. Will nun der eine „dasExemplum im Mittelalter“ definieren, so geht er von einer Gruppe von Texten (z. B. homiletischenExemplasammlungen) und Textelementen (homiletischen Exempla) aus, die er nach irgendeiner approximativenVor-Definition ausgewählt hat (z. B. „Exempla sind narrative Volkspredigteinlagen“). Er sucht nun sein Arbeitsfeld,seine Quellenbasis genauer gegen andere Textphänomene abzugrenzen, indem er Merkmale deskriptiv auflistet undkategorial zusammenfaßt, und gelangt so zu der etwas detaillierten Schlußdefinition (die nach dem „hermeneutischenZirkel“ in der Substanz schon immer gegeben war): „Ein Exemplum ist eine als wahr ausgegebene Kurzgeschichte ineiner Rede (im allgemeinen einer Predigt), die dazu bestimmt ist, eine Zuhörerschaft von einer auf das Seelenheilbezüglichen Lehre zu überzeugen“ (Le Goff/Brémond/Schmitt 36). Der andere fragt danach, was überhaupt(anthropologisch, linguistisch, rhetorisch usw.) ein Beispiel ist, findet eine erste Antwort in der antikenExemplumtheorie seit Aristoteles, die er durch die Jahrhunderte verfolgt, sieht dann auf deren Realisierung in derLiteraturpraxis und schließt, das Exemplum sei (auch im Mittelalter) eine rhetorische Funktion, mit der vergangenesGeschehen in persuasiver Absicht auf einen gegenwärtigen Problemfall bezogen wird (oder auch wie oben S. XI).Beide Definitionen gehören einem eigenen Bezugssystem an, sind also inkommensurabel und brauchen sich nichtauszuschließen. Selbstverständlich sind viele homiletische Exempla – die exempla historialia aus Bibel,Hagiographie und „Taten der Heiden“ – auch Exempla nach der zweiten Definition. Die Schwierigkeiten beginnenerst bei den falschen Brücken und scheinbaren Übereinstimmungen, zu denen eine Programmformel wie „dasExemplum im antiken und mittelalterlichen Diskurs“ (s. Berlioz/David) leicht verführen kann.Erst nach der Lektüre des neuesten Beitrags von Jacques Berlioz über Vergil in der mittelalterlichen Exemplaliteratur(1985, s. Bibliogr. s. l.) ist mir eines der gravierendsten, aber auch subtilsten Mißverständnisse bewußt geworden,die durch eine Vermengung beider Definitionen entstehen können: Berlioz stellt in diesem wichtigen Aufsatzaufgrund einiger Vergilexempla bei Vinzenz von Beauvais, Johannes von Wales, Walter Burley und JohannesColonna (die übrigens mehr, als er angibt, dem Policraticus verdanken) fest, daß nicht die Gestalt Vergils selbst,nicht der zum „Philosophen“ und „Zauberer“ gewordene Dichter als positiver oder negativer „Held“ die „heilsameLehre“ zu ziehen erlaube, sondern immer nur eine Episode aus seiner Geschichte. Eine Anekdote sei der Träger desExemplums. Der Ereignisbericht zähle allein, nicht der modellhafte Charakter des Helden. Ganz ähnlich hatte schonLe Goff wiederholt betont, daß nicht (wie bei den römischen Exempla) die „vorbildliche Person“, sondern dieexemplarische Tat, bzw. der Bericht davon das mittelalterliche Exemplum ausmache (a.a.O. 28 ff. u. ö.). Berliozkann aber schließlich doch nicht umhin, Ausnahmen von dieser „Regel“ festzustellen: Übergangsformen zwischenden personhaften exempla maiorum pragmatischer Historiographie, den exempla imitabilia, und den lehrreichenPredigtanekdoten, und zu bemerken, die „Stellung antiker Gestalten“ in den verschiedenen Gattungen sei „sehrkomplex“ und bleibe weiterer Forschung anheimgestellt (101 f.). Das damit angesprochene Problem läßt sichvielleicht eher lösen, wenn man es von der thematischen Ebene (Person oder Einzelereignis?) auf die funktionale
XXVI
verlagert (totum an pars?); dann wird nämlich das zentrale, im Folgenden dauernd illustrierte Grundprinzip des(rhetorischen) Exemplums: die restlose Kontextabhängigkeit, sichtbar. Was Le Goff und Berlioz alsBedeutungslosigkeit der historischen Gestalt im Vergleich zur lehrhaften Bedeutung der daran geknüpften dicta etfacta bezeichnen, entspricht genau der allgemeinen pragmatischen oder gar „philosophischen“ Art vorhistorischerGeschichts-„Benützung“, der Gewohnheit, aus dem „Buch der Geschichte“ memorabilia zu gegenwärtigem Nutzeneinseitig zweckhaft zu „zitieren“; und dieses Verfahren ist weder auf das Mittelalter noch auf eine bestimmteLiteraturgattung beschränkt. Verständlich wird es aber nur, wenn wir uns von modernen Vorstellungen wiehistorischer Faktizität und biographischer Individualität lösen, weil sich so die Alternative zwischen dem Heldenund einzelnen Aspekten oder Geschichten dieses Helden aufheben läßt. Der Held ist vor dem 18. Jahrhundert immermehr oder weniger ein „Knotenpunkt“, „Kräftefeld“, ein „Ort“ oder „Gefäß“ (locus) der aus ihm ableitbarenEigenschaften, ihm zuschreibbaren Taten, von ihm anführbaren Aussprüche, nicht eine in unserem Sinne„wirkliche“, unverwechselbare, unteilbare Persönlichkeit. Dies heißt aber keineswegs, daß er in dieser topischen,atomisierbaren Erscheinungsform keinen Vorbildlichkeitswert hätte; im Gegenteil: Je unpersönlicher (im modernenSinn also „unhistorischer“) er wird, desto mehr wächst seine allgemeine modellhafte Potentialität in den Mythoshinein (vgl. Anm. 662). „Das Exemplum bezeichnet nie einen Menschen“, sagt Le Goff (a.a.O. 28). Dies trifft –und zwar nicht nur für das homiletische Exemplum – in dem Sinne zu, daß nicht der Einzelne als konkreteganzheitliche, biographisch darstellbare Persönlichkeit modellhaft ist, sondern die Vielfalt der Evokationen, die erjeweils ad hoc zuläßt. Aber daß das mittelalterliche Exemplum im Unterschied etwa zum römischen sich nicht aufMenschen beziehe, wäre eine absurde Annahme. Sogar viele homiletische, durch das narrative Element definierteExempla haben als Ereignisträger handelnde Menschen, gleichviel ob diese anonym bleiben oder die„Namensautorität“ römischer Exempla ausstrahlen. (Alexander d. Gr. ist ein eminentes Predigtexemplum). DerBegriff der „menschlichen Person“ ist also in Bezug auf das Exemplum ambivalent; er läßt im Unklaren, welchergeschichtstheoretischen Vorgabe er folgt: ob er vom Persönlichkeitsbild der modernen Geschichtsforschung odervom menschlichen „Denkbild“ (von den Steinen, unten Anm. 664) der vormodernen Geschichtsbetrachtung abhängt.Daß die Predigtexemplum-Forschergruppe um J. Le Goff hier mit ihrer eigenen Definition in Konflikt gerät, ist keinZufall, da Historiker – große Ausnahmen wie R. Koselleck oder A. Demandt bestätigen die Regel – natürlicherweiseMühe haben, die spezifisch neuzeitlichen Grundlagen ihrer Wissenschaft zu bedenken und diese selbst historisch zurelativieren. Aber selbst ein Nichthistoriker, der freundlicherweise eine frühere Fassung dieser Arbeit gelesen hatte,Karl Bertau, schrieb mir Folgendes über die Schwierigkeit, Exemplum und historische Person zu assoziieren: „Alsich die Lektüre des Manuskrips begann, stolperte ich […] gleich zu Anfang über eine syntaktische Gleichsetzungvon Mensch und Exempel […] bis ich schließlich begriffen zu haben meine, daß für Johannes von SalisburyExempla Menschen sind, die nicht in ihrer Alterität wahrgenommen werden können.“ Wenn man das letzte Wortdurch „sollen“ ersetzt, ist damit etwas sehr Wichtiges über das Exemplum aller Zeiten gesagt. Die Fähigkeit, vom„zufällig“ oder „unersetzbar“ Einmaligen eines Menschen, von der persönlichen Identität, um einer universellenBedeutung willen abzusehen, ist heute offenbar so wenig selbstverständlich, wie sich vor dem Historismusumgekehrt der Sinn für das Anderssein kulturell oder zeitlich ferner Menschen von selbst verstand. Durch denHistorismus haben wir jedoch gelernt, sogar die historische Methode historisch zu relativieren, um die ihrentgegengesetzte Denkform des Exemplums zu verstehen.
Doch ich komme zurück zu meinem „Arbeitsexemplum“: Aus dem einstigen Aufsatz war 1983 ein Buchgeworden, das die Wissenschaftliche Buchgesellschaft im Frühsommer dieses Jahres in ihr Verlagsprogrammaufnahm. Noch fehlten die neuen Anmerkungen, die ich bald nachzuliefern gedachte. Nun wiederholte sichdas Schicksal von 1980: Trotz des festen Willens, nur noch
XXVII
die ganz unentbehrlichen Neuerscheinungen zu berücksichtigen, gelangte ich durch deren „Wegweiser“ zueiner Reihe weiterzuverfolgender Pfade. Auch bei diesem zweiten Durchgang war das Wachstum des Buchesnicht aufzuhalten. An zahlreichen Stellen bildeten sich korallenartig Ablagerungen, da die Disposition indiesem späten Stadium nicht mehr geändert werden konnte. Für diese immerhin gut mittelalterlicheBastelmethode möchte ich mich hiermit beim modernen Leser in aller Form entschuldigen, umso mehr als dievielen auf die Unordnung des Policraticus bezüglichen Glossen (S. 15, 355 f.) auf diese Arbeit viel besserzutreffen. In den Text gelangte nur noch, was den Zusammenhang nicht unzumutbar sprengte, alles andere,und leider nicht das Unwichtigste – Kommentare, Kurzessays, Kurzrezensionen, Gegenmeinungen,Infragestellungen, ja sogar potentielle Widerlegungen des Texts (immerhin keine definitiven retractationes) –landete in den Fußnoten, die damit an vielen Stellen zu einer Art Meditation über eine frühere Stufe desErkenntnisprozesses wurden. Diese Methode des ständig wiederholten Zugriffs ließe sich freilich mit gutenGründen verteidigen: als bewußte Selbstentzweiung des Autors durch Reflexion, Glosse und Revision (s. untenS. 352 ff.). Als ein solcher „discours déconcertant“ zwischen „glose“ und „lettre“ sind Montaignes Essaisentstanden (Anm. 658. Dies hat P. Rieß in seinen ‚Vorstudien zu einer Theorie der Fußnote‘, Berlin 1983, zusagen vergessen, obwohl ich und mei similes seine Fußnotentypologie als Warntafel sehr wohl gebrauchenkönnen. Eine Kostprobe aus dem Inhaltsverzeichnis: Vorsichts-, Dedikations-, Nebenaufsatz-, Nachtrags-,Vorsichts-, Abrück-, Meinungsstreit-, Vergeßlichkeits-, Kartell- und Ringfußnoten, Weihrauch-,Selbstbespiegelungs-, Tarnfußnoten, Fußnotenneurose usw. Diese Klammer z. B. wäre eine „apokrypheFußnote“.) Der Prozeß der wunderbaren Anmerkungsvermehrung dauerte im übrigen noch zwei Jahre, bis dasWerk das Doppelte des vereinbarten Volumens erreichte und (nachdem entsprechende Verhandlungen überdiesen Vertragsbruch gescheitert waren) den Verlag wechseln mußte, ja, er setzte sich noch in denDruckfahnen fort. Die letzten Autorkorrekturen leistete ich mir im August 1986. Wie sinnvoll oderillusorisch der zuletzt nur noch im Kleingedruckten ausgefochtene Kampf um den aktuellen Forschungsstandgewesen sein wird, hängt ganz vom Zeitpunkt des tatsächlichen Erscheinens dieser 1983 erstmals für denDruck vorgelegten Arbeit ab. Der Leser wird beurteilen können, wo die Verantwortung des Autors endet.
Heute, da ich dieses Vorwort schreibe, liegt es auf der Hand, daß das ganze Buch noch eine dritte Totalrevisionverdienen würde. Die Umarbeitung der Anmerkungen zu Darstellungstext allein würde es nochmals aufdoppelten Umfang bringen und die materia tractandi ergäbe überdies noch ein paar Aufsätze alsNebenprodukt. Diese Vorstellung – ein Alptraum – führt mich zu einigen grundsätzlichen Gedanken über denSinn wissenschaftlicher Schriftstellerei, mit denen die Legitimität einer Arbeit wie der vorliegendenzusammenhängt. Ein Gemeinplatz lautet, aus jedem Thema lasse sich eine
XXVIII
Lebensarbeit machen, wenn man sich nur intensiv genug damit beschäftigt. Die wahre Problematik liegtjenseits solch psychologischer Maximen: in der ständig wachsenden Informationsflut, der (wie die ganzeLebenswelt) auch die Wissenschaft derart ausgesetzt ist, daß wir ob der Speicherung immer mühsamer zurVerarbeitung und im schlimmsten Fall schon gar nicht mehr zu eigener Forschung und Kreativität kommen(die m. E. mehr ist als Informationsverarbeitung). Gleichviel, ob die immer perfektere SpezialisierungUrsache oder Wirkung der Informationsüberschwemmung ist, der Kräfteverschleiß im Kampf mit den immerweniger zu bewältigenden Sekundärliteraturstoffmassen wird uns von Jahr zu Jahr spürbarer. Man könnte(analog zur demographischen) von einer bibliographischen Explosion sprechen. Wer vor zwanzig Jahren(vielleicht damals schon etwas kühn) annahm, es sei möglich, ein relativ sauber abgrenzbares Thema inKenntnis aller dazu bestehenden neueren Forschungsergebnisse zu behandeln, wäre heute, hätte er seineMeinung nicht geändert, ein Träumer. Angesichts des Umfangs dieser Arbeit frage ich mich z. B. ernsthaft,ob ich mich mehr beim Leser für die unzähligen bibliographischen Fußnoten entschuldigen soll oder bei denvielen, namentlich amerikanischen Gelehrten, deren Beiträge ich trotz aller Anstrengung, „à jour“ zu bleiben,nicht gesehen habe. Vollständigkeit auf diesem Gebiet wird erst recht illusorisch, wenn ein Thema wie das hierbehandelte zu bedeutsam ist, um absolut „steril“ in der fachlichen Isolierstation gegen kontaminierendeNachbarfächer bearbeitet werden zu können. Elektronische Geräte können hier in der Sammelphase oderinventio zweifellos eine große Hilfe sein (daß sie auch einige emsige „Kärrner“ in der Wissenschaft brotlosmachen könnten, wäre kein Unglück); doch diesen Rationalisierungsvorteil hebt auf der anderen Seite dieVermehrung des Lesestoffs wieder auf. Denn im Unterschied zum menschlichen Gedächtnis hat derunbarmherzige Computer, wie H.G. Gadamer einmal tiefsinnig bemerkte, den Nachteil, daß er nichts vergißtoder übersieht. Das Problem, das heute jeder Forscher kennt, wird damit also nur noch verschärft: Man liestsich durch Berge von Aufsätzen, vielfach geschrieben von Leuten, die existentiell darauf angewiesen sind, ihreSchriftenverzeichnisse zu verlängern, die sich gegenseitig nur unzulänglich zur Kenntnis nehmen, alsoAmerika immer wieder neu entdecken. Dabei bleibt man schlimmstenfalls an irgendeinem zufällig geradedebattierten Kontroverspunkt (etwa einer Authentizitätsdebatte) hängen, wird von wesentlichen Sachfragenabgelenkt, die sich bei intensiver und andächtiger Beschäftigung mit den Primärtexten von selbst gezeigthätten, und merkt, wenn es schon zu spät ist, daß man gar nicht seine eigene Arbeit gemacht hat, sondern vorirgendwelchen anonymen, obenauf liegenden Forschungs-interessen „fremdbestimmt“ worden ist.
Was ist zu tun? Fast wie aus einer anderen Welt klingen Sätze zum Thema Information und Erkenntnis,„Gelehrsamkeit und Selbstdenken“, die Schopenhauer als eine Art Aparte bei seiner Lebensarbeit (nicht etwaam grünen Tisch philosophischer Wissenschaftstheorie) sprach: „Studierende und Studierte
XXIX
aller Art und jedes Alters gehn in der Regel nur auf Kunde aus, nicht auf Einsicht […]. Daß die Kunde einbloßes Mittel zur Einsicht sei, an sich aber wenig, oder keinen Werth habe, fällt ihnen nicht ein […] Bei derimposanten Gelehrsamkeit jener Vielwisser sage ich mir bisweilen: o, wie wenig muß doch Einer zu denkengehabt haben, damit er so viel hat lesen können! […] Wie die zahlreichste Bibliothek, wenn ungeordnet,nicht so viel Nutzen schafft, als eine sehr mäßige, aber wohlgeordnete; eben so ist die größte Menge vonKenntnissen, wenn nicht eigenes Denken sie durchgearbeitet hat, viel weniger werth, als eine weit geringere,die aber vielfältig durchdacht worden“ (Parerga und Paralipomena §§ 245, 257). Man ist heute bereits dahingekommen, daß man – eine Art wissenschaftlicher Postkutschenromantik? – die Informationslücken undBibliotheksmiseren früherer Gelehrter (noch solcher der 40er und 50er Jahre unseres Jahrhunderts) – sichelegisch zurückwünscht und Erich Auerbach nicht ohne Neid bewundert, da er eines der bedeutendstengeisteswissenschaftlichen Werke des 20. Jahrhunderts nahezu nur mit einer Klassikerhandbibliothek zuschreiben vermochte, ja sogar selbst bekannte: „Es ist übrigens sehr möglich, daß das Buch seinZustandekommen eben dem Fehlen einer großen Fachbibliothek verdankt; hätte ich versuchen können, michüber alles zu informieren, was über so viele Gegenstände gearbeitet worden ist, so wäre ich vielleicht nichtmehr zum Schreiben gekommen.“ (Mimesis, Bern 1946, 518). Dürfen wir nun hingehen und dieses sogünstige informationsarme Klima, das sich Auerbach nicht aussuchen konnte, freiwillig und künstlichherstellen? Sollen wird, um ein Beispiel dieses Buchs zu nehmen (§ 106), Augustinus, Dante, Shakespeare„lesen und nochmals lesen“ (Anm. 744), die ganze unabsehbare Forschungsliteratur zu einem Begriff wie„Welttheater“ von der Antike zur Neuzeit aber beiseiteschieben? Soll man die ganze Johann von Salisbury-Bibliothek der letzten hundert Jahre bis in die verstaubtesten Winkel durchstöbern und verzetteln, oder nichtviel besser einen Ausflug zu den großen, dem scepticus academicus aus Salisbury so ähnlichen „Moralisten“der frühen Neuzeit unternehmen? Soll man über die Fachgrenzen hinausdenken und dem eigenen Fach Energieabziehen? Das seien falsche Alternativen, lautet der billige Trost jener, die nie diese Qual der Wahl, ja, dieseGewissensfrage verspürten. Auch die nonchalante Altersweisheit, die großzügig über alle Neuerscheinungen„junger Adepten“ hinwegzusehen empfiehlt, hilft nicht jedem und ist überdies ein unverschämt überheblicherVerstoß gegen die Goldene Regel geisteswissenschaftlicher Schriftsteller: Wer schreibt, also auch gelesen seinwill, sollte niemandem willentlich das Nichtgelesenwerden antun.
Nein, es gibt, wo ein Thema wie das vorliegende exemplarisch auf Allgemeines verweist, auch nur eineadäquate Behandlungsweise: den exemplarischen Umgang sowohl mit der Primär- wie mit derSekundärliteratur. Dies erfordert mehr als den vielbeschworenen Mut zur Unvollständigkeit (meist einobligater Demutstopos): den Mut nämlich, jenseits eigener Fachgrenzen
XXX
unbedenklich als Dilettant aufzutreten. „In den Wissenschaften dagegen“, schrieb Burckhardt vor überhundert Jahren (Weltgeschichtl. Betr. a.a.O. 253), „kann man nur noch in einem begrenzten Zweige Meistersein, nämlich als Specialist, und irgendwo soll man dieß sein. Soll man aber nicht die Fähigkeit der allgemeinenÜbersicht […] einbüßen, so sei man noch an möglichst vielen andern Stellen Dilettant, […] sonst bleibt manin Allem was über die Specialität hinausliegt, ein Ignorant und unter Umständen im Ganzen ein roher Geselle.Dem Dilettanten aber, weil er die Dinge liebt, wird es vielleicht im Lauf seines Lebens möglich werden, sichauch noch an verschiedenen Stellen wahrhaft zu vertiefen.“ Würden möglichst viele auf möglichst vielenGebieten den Mut zu diesem Dilettantentum haben, kämen wir wirklich eines Tages zu der theoretisch allseitsanerkannten interdisziplinären Offenheit, die allein wesentliche, neue Fragestellungen zu entdecken erlaubt.Damit soll bei Leibe nicht jener Art von Dilettantismus das Wort geredet werden, die gerade aus der Kunstbesteht, ungewohnte Fragen durch eingefahrene Pauschalurteile zuzudecken. Im Vergleich zu den stereotypund apodiktisch verkündeten „Schmähworten“ vieler Neuzeitforscher über das Mittelalter – um diesenzentralen Punkt hier nur zu streifen –, nehmen sich die seltenen schüchternen Versuche einiger Mediävisten,auch einmal ein Wörtchen zur Neuzeit zu sagen, wie echte („dumme“) Fragen aus, die den Experten, weil erhier vielleicht noch nicht nachgedacht hat, sokratisch in Verlegenheit bringen könnten. Das wissenschaftlichverantwortbare Dilettantentum (vgl. auch Schopenhauer, Parerga … § 249 und unten S. XXXIV) setzt einenphilosophisch anspruchsvolleren Wissenschaftsbegriff voraus als den des theoretisch überholten, praktisch(als „gesunkenes Theoriegut“) noch zählebigen Positivismus: eine Art Radikalhermeneutik. Wer von derUnabgeschlossenheit jeder geisteswissenschaftlichen Diskussion grundsätzlich überzeugt ist, denkt in derheutigen Wissenschaftslandschaft radikal (vgl. Anm. 709). Eine ungewöhnliche Annäherung einesNaturwissenschaftlers an diese Radikalität zeigt Konrad Lorenz, wenn er sich das folgende Dictum zumLeitspruch macht: „Wahrheit ist derjenige Irrtum, der sich als der beste Wegweiser zum nächst kleinerenerweist“ (Die Rückseite des Spiegels, 1973/81, 256 mit Bezug auf Pater Adalbert Martini). Dennoch bleibtdarin ein „positiver“ Rest. Der Forscher glaubt als „Fallibilist“ an einen wie immer langsamen, aber sicherenund irreversiblen Erkenntnisfortschritt zu den immer kleineren, tendenziell der Auflösung zustrebendenIrrtümern. (Ein Glaube, der übrigens, wie in §§ 83 f. gezeigt, im 12. Jahrhundert entstanden ist.) In denhermeneutischen Disziplinen gilt jedoch über dieses fortschrittsoptimistische Widerlegungsprogramm hinausein nur ihnen eigenes, weniger objektives, unteleologisches Revisionsprinzip, das am besten mit demBeispielsatz Jacob Burckhardts erläutert wird: „Es kann sein, daß im Thucydides z. B.: eine Thatsache erstenRanges liegt, die erst in hundert Jahren Jemand bemerken wird“ (A.a.O. 252). Prägnant und anschaulich istdamit gesagt, daß der Gegenstandsbereich und unsere Subjektivität zur Erkenntnis
XXXI
konvergieren müssen. Was vor Jahrtausenden ein Denker gedacht hat, kommt nicht (nach irgendeinerimaginären Entelechie) durch die Zeiten der Rezeption allmählich zu sich selbst, wird also nie definitiv besserverstanden als zuvor; es ist da: unserer Reflexion, unserem Gespräch (auch dem Selbstgespräch) überlassen, dasnicht allein von Thukydides, sondern von seinen Lesern bis zu Burckhardt und irgendwelchen künftigenGesprächsteilnehmern bestimmt wird. Weil immer neue Zeiten neue Fragen stellen, wird Thukydides nieendgültig, erschöpfend, sondern immer nur zeitadäquat richtig verstanden. GeisteswissenschaftlichenFortschritt gibt es nur im Vorfeld der Hilfswissenschaft, im Atelier, wo die Texte konserviert und restauriertwerden (man nennt dies mit einem merkwürdig hochtrabenden Archaismus „Textkritik“), in der Bibliothek,wo Wissensbestände vereint, geordnet, indexiert werden. Fortschritt in der Deutung einer Platonstelle, einesJesusworts, eines Danteverses mag es in einem – dem Textbereinigungsverfahren analogen – Umfeld geben,nämlich der sog. „inneren Kritik“ (die vor der eigentlichen Hermeneutik eine eher äußerliche ist), etwa imVermeiden krasser Mißverständnisse dank methodischer Anwendung der status interpretationis -Technik(Anm. 486, 636, 560). Aber eigentliche Hermeneutik ist ein für jede Zeit legitimerweise neuer, den früherenDialogen ebenbürtiger Dialog mit demselben Text. Wenn ein Naturwissenschaftler dies eine Sisyphusarbeit,ein resultatloses Kreisen um den immer gleichen Punkt nennt, so können wir solches Mißverständnis (als dieErfinder eines höheren perpetuum mobile) ertragen; problematisch werden solche Ansichten erst im Mundevon Historikern und Philologen. Kürzlich fragte mich ein befreundeter guter Kenner des 12. Jahrhunderts(allerdings kein Gadamer-Leser) arglos und sicher aus echter Neugier, was ich denn zu Johann von SalisburyNeues entdeckt habe, da doch über dieses Thema schon so viel geschrieben worden sei. Er konnte aus seinerErziehung und seinem kumulativen Wissenschaftsverständnis heraus nicht ahnen, daß diese „positive“ Fragehermeneutisch gar nicht zu beantworten ist, da ich nur das Alte neu gelesen habe. „Nous sommes sur lamaniere, non sur la matiere du dire“ (Montaigne, Essai III 8; s. auch oben S. XXIX zum Unterschied von„Kunde“ und „Einsicht“).
Wenn alle nur nach neuen Quellen, zusätzlichen Materialien und Informationen suchen oder wenn alle nurUnediertes oder schlecht Ediertes kritisch (bzw. noch kritischer) herausgeben, wer liest die Texte und denktdarüber nach? Das karolingische Zeitalter gleicht in dieser Hinsicht dem 19. Jahrhundert: Es war eine Epochereger und zuverlässiger philologisch-kompilatorischer Kleinarbeit. Doch die längst vorhandenen, kopierten,konservierten Texte wurden danach wenig gelesen; um von den Philologen der italienischen Renaissance zuschweigen, mußten bereits im 12. Jahrhundert Männer wie Johann von Salisbury diese Schriften – nicht etwanur „edieren“, sondern, wie er mit einem schönen „Renaissance“-Bild sagt (Anm. 442) – „gleichsam aus demSchlaf oder Tod aufwecken“. So wird es den besten Werken der lateinischen Literatur des Mittelaltersergehen, die auch längst da sind und,
XXXII
von hervorragenden Philologen aufgearbeitet, unsere Bibliotheken zieren: sie werden eines Tages wieder,„geweckt“ werden müssen – aber durch wen? –, wenn wir uns heute den Luxus leisten, sie in denantiquarischen Goldschreinen perfekter Editionen vermodern zu lassen. (Wo kämen wir andererseits hin,wenn wir warten müßten, bis ein Werk wie Vinzenz‘ Speculum maius kritisch ediert ist, damit wir endlich dieBildungstradition des Mittelalters in diesem „Zentralspiegel“ studieren dürfen?) Wo die Textphilologenaufhören, beginnt die hermeneutische Hauptmahlzeit der Mediävistik, bei der man sich, was die Textqualitätbetrifft, oft nach Hildeberts Maxime richten muß: Non omnia contemnenda sunt, quibus multa reperiripossunt meliora (Ep. I 12, 175 D; vgl. z. B. Anm. 538). Aaron Gurjewitsch sagt als Historiker substantielldasselbe so (wie Anm. 313, 372 f.): „Die Denkmäler sind längst veröffentlicht, und nichts ist leichter, als siezu nehmen und zu studieren […] Wir klagen manchmal über das Fehlen notwendiger Überlieferungen. Dochist es bei genauer Prüfung nicht so, daß wir uns arm fühlen, obwohl wir auf den Reichtümern sitzen?“ Dieerwähnte Frage nach Neuem wäre also mit dem geflügelten Astronomenwort zu beantworten: „Kennen EureMajestät denn schon das Alte?“
Wer das „positive“, additiv alexandrinische Wissenschaftskonzept hermeneutisch hinter sich gelassen hat,verfährt nicht mehr so, daß er zu einem Thema unbekanntes Beweismaterial sammelt, wie zu einemkriminalistischen Fall neue Zeugen einvernimmt oder daß er Bausteine zu einem babylonischen Bau beiträgt.Er findet sich in guter Gesellschaft mit den großen „Historikern ohne Problem“ (Anm. 568 zu Huizinga), denSpaziergängern unter den Gipfelstürmern. Er wird seine Leser lieber die Fragen selber suchen lassen, auf diesein Buch vielleicht eine provisorische Antwort gibt, als eine stringente Beweisführung zu inszenieren, nur umnachzuweisen, welche Probleme für alle Zeiten „erledigt“ sing; ja, er wird sogar die toten Antworten derForschung unbekümmert vorzeigen, die ihm wieder zu lebendigen Fragen geworden sind. Er sucht überallwissenschaftliche Konsenskristallisationen in den flüssigen Zustand zurückzubefördern. Entsprechend ist seineKritik an anderen niemals persönlich oder destruktiv, sondern (wie seine Selbstkritik) eine beispielhafte,provokative Strategie gegen die Erlahmung des unendlichen Diskurses der eigenen und fremden Revisionen.Sein Hauptziel aber ist es, beim Gang durch die Texte und Interpretationen den Eindruck zu verhindern, daß eroder sonst jemand ans Ziel gekommen sei. Im Grunde gilt dasselbe auch für den biographischen Mikrokosmoseines Gelehrten: Was einer vor zwanzig Jahren über einen Text verantwortlich gedacht hat, wird durch das,was er heute nicht weniger verantwortlich darüber anders denkt, nicht automatisch überholt wie in denNaturwissenschaften, sondern höchstens in den drei Hegelschen Sinnen „aufgehoben“. Wo keine sachlichenIrrtümer zu korrigieren sind, werden Meinungen, die damals richtig waren, für heute umgedacht (nicht etwanur einem „neuen Zeitstil angepaßt“). Darum kann es durchaus auch heute noch sinnvoll sein, inmittelalterlicher Glossatorenweise den ganzen
XXXIII
Prozeß einer Interpretationsgeschichte durch Kommentare und Superkommentare zu dokumentieren undselbst die Folge seiner eigenen ersten, zweiten und dritten Gedanken nicht zu verheimlichen. Denn es gehörtzum Gesprächsklima, in dem wir arbeiten, daß mein Dialog mit einem Text und der Dialog eines anderen mitdemselben Text und mit mir nicht simultan, sondern zeitverschoben geführt werden müssen, so daß fruchtbareAnstöße für den andern nicht notwendig von meiner letzten, der sog. „Resultat“-Stufe ausgehen, sonderngegebenenfalls auch von einer früheren hermeneutischen Phase.
Das schwierigste und heute wohl weniger denn je lösbare Problem liegt in der Wahl des Mediums für solcheMitteilungen. Der Verfechter des hermeneutischen Grundprinzips unserer Forschung gelangt hier zumerkwürdig ähnlichen Schlüssen wie der moderne Künstler oder Schriftsteller auf der verzweifelten Suchenach einer möglichst unmittelbaren, durch keinen „Zwischenhandel“ (Institutionen, Museen, „öffentlicheHäuser“, Marktmechanismen) verstellten Mitteilungsform. Auch er möchte Erlebnisse im richtigenAugenblick spontan und anstiftend weitergeben, nicht Ergebnisse zur Verwahrung oder für den Konsumabliefern. Von allen Arten der Kommunikation über hermeneutische Fragen ist zweifellos das mündlicheFachgespräch – am besten unter vier Augen, oder auch auf kleinen Tagungen – die spontanste und damit auchwissenschaftlich fruchtbarste. Den zweiten Rang in der Hierarchie der Unmittelbarkeit nimmt der Brief oderdie schriftliche Fixierung eines Gesprächs ein (etwa Diskussionsprotokolle in Kongreßakten). An dritter Stellefolgt die bald nach Erscheinen eines Buchs veröffentliche Rezension, weil hier in der Auseinandersetzungnoch ein Rest von Dialog nistet. Dann kommt der kurze, schnell erscheinende Zeitschriften aufsatz, dieMiszelle, gefolgt vom großen Jahrbuchbeitrag, wobei der Drucklegungsaufschub hier schon bedenklich zurEntdialogisierung beiträgt. Ganz am Ende steht das wissenschaftliche Buch, das als monumentum aereperennius, als Mausoleum des lebendigen Geistes einstiger Diskussion oder als Haushaltsvorrat für spätereKonsultationen ins Regal gestellt wird (und dort vielleicht ungelesen stehen bleibt). Das Buch täuscht amwirksamsten von all diesen Medien über den vorläufigen Charakter geisteswissenschaftlicher Erkenntnishinweg; denn es fixiert eine Momentaufnahme des Erkenntnisprozesses als Resultat und gibt vor, hier seinicht weiterzudenken.
Diese Reihenfolge kehrt die offizielle Werthierarchie, die bekanntlich nicht „mobile“ Erkenntnis, sondernWissens-Immobilien prämiert, gerade um. Die gesamte Wissenschaftsorganisation scheint sich gegen dieHermeneutik verschworen zu haben. Die wichtigsten, die personalpolitischen und finanziellen Entscheidungenfallen größtenteils nach den quantitativen Gesichtspunkten meßbarer Wissenschaftsproduktion. Kein jungerForscher, wäre er noch so genial und anerkannt, könnte gefahrlos mit der Nonchalance Peter Bichselsverkünden, er sei – im Namen der Qualität – zum „Wenigschreiber“ berufen.
XXXIV
Der Hochschullehrer hat die Aufgabe, zu lehren und zu forschen. Den Unterricht sieht jeder; die Forschung istzuerst und vor allem unsichtbares Nachdenken. Unter den „Weisheitsschlüsseln“ Bernhards von Chartres fürangehende „scholars“ (Anm. 940) findet sich keiner über das Bücherschreiben, ja nicht einmal über: „Wissenverpflichtet zur Mitteilung“, aber an vierter Stelle liest man: scrutinium tacitum, „schweigende Forschung“.Wie soll solche „Forschung“ gemessen werden? Unsere Forschungsberichte enthalten nur was gedruckt, nichtwas gelesen, diskutiert, korrespondiert oder ganz einfach gedacht wurde. So stehen alle – von Promovendenund Habilitanden ganz zu schweigen – unter einem nur für die seltenen Faulen heilsamen, für weitaus diemeisten aber psychisch und intellektuell ungesunden Publikationsdruck.
Noch in dem Zwischenstadium von 1983, als dieses Buch nur halb so umfangreich war wie heute, sagte mir einVerleger sinngemäß: Was brauchen Hochschullehrer solche „Wälzer“ drucken zu lassen, da doch bereits soviele Pflichtarbeiten (Dissertationen und Habilitationsschriften waren gemeint) nur mit größter Mühe verlegtwerden können, und diese doch immerhin einem existentiellen Bedürfnis entsprechen. Nun kam ich mirvollends wie ein „Dilettant“ vor und hatte noch einen weiteren Grund, an Schopenhauers Glosse (Parerga …§ 249) zu denken: „Dilettanten, Dilettanten! – so werden die, welche eine Wissenschaft oder Kunst, aus Liebezu ihr und Freude an ihr, per il loro diletto, treiben, mit Geringschätzung genannt von Denen, die sich desGewinnes halber darauf gelegt haben […] Diese Geringschätzung beruht auf ihrer niederträchtigenÜberzeugung, daß keiner eine Sache ernstlich angreifen werde, wenn ihn nicht Noth, Hunger, oder sonstwelche Gier dazu anspornt.“
Einen utopischen Ausweg suchend, schrieb ich Karl Bertau in ähnlichem Zusammenhang: „Je mehr von unsReader, Grundkurse, Einführungen und Synthesen aller Digest-Arten verlangt werden, desto trotzigerverweigere ich mich dem Markt. Wir sollten zurück zur Gelehrtenrepublik und das Wenige, was wirklichgelesen wird, den wenigen Lesern im Briefverfahren senden.“ Er antwortete, daß er diesen Gedankenunabhängig von mir gedacht und sogar in gedruckter Form (Wolfram von Eschenbach, München 1983, 13)mitgeteilt habe, nämlich so: „… Sonderdrucke ersetzen in gewissem Sinne die gelehrte Korrespondenz desXVIII. und frühen XIX. Jahrhunderts, und die Zeitschriften sind im Grunde nur Sammlungen von solchenhalbprovaten, gelehrten Korrespondenzen, die als Ganzes höchstens einen überpersönlichen Adressatenhaben, den Geist der betreffenden Wissenschaft.“ Ich unterdrückte den zynischen Gedanken an das Geld, dasdieser Geist kostet, und antwortete nur: „Meine Konsequenz daraus ist Zweifel an der Kommunikation mit derMehrheit der Zeitgenossen, Rückzug in die so gemütliche Gelehrtenrepublik, in der wir hier gerade plaudern.“
XXXV
Dies alles möge nicht als sterile Klage über Unabänderliches verstanden werden, sondern als Verdeutlichungeines allgemeinen Problems, für das eine allgemeine Lösung noch gefunden werden muß. Wo nicht eineLösung, so doch provisorische Entlastung bieten folgende Zitate (aus der Feder zweier Bibliothekare), die ich– um ein zweifellos verdientes argumentum ad hominem wenigstens teilweise zu entkräften – mir in Zukunftzu Herzen nehmen möchte, Sätze, die als optimistische Maximen insofern eher in den Prolog meinesetwaigen nächsten (vielleicht fußnotenlosen) Buchs gehören: „Der gute Schriftsteller, er sei von welcherGattung er wolle, wenn er nicht bloß schreibet, seinen Witz, seine Gelehrsamkeit zu zeigen, hat immer dieErleuchtetsten und Besten seiner Zeit und seines Landes in Augen, und nur was diesen gefallen […] kann,würdigt er zu schreiben“ (G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie I 1, 1. Mai 1767). – „Er arbeitete nicht fürdie Nachwelt, nicht einmal für Gott, über dessen literarische Vorlieben er nichts wußte. Peinlich genau,unbeweglich, geheim spann er in der Zeit sein hohes unsichtbares Labyrinth“ (J.L. Borges, Kunststücke,a.a.O. I 214). Man kann diese Stellen als Sic et non gegeneinander richten oder die zweite alsnegativmystische Transposition der ersten lesen; eines jedoch haben sie gemein: Sie erlösen von der kleinlichnarzißtischen Frage nach Leserzielgruppen, Buchhandelstrends und Rezeptionsgewohnheiten, die uns bei derArbeit – einem scrutinium tacitum – in der Tat nur stören können.
Die Geschichte der verschiedenen Redaktionsphasen erklärt den etwas kaleidoskopischen, labyrinthischenGesamteindruck der nun ne varietur vorliegenden Arbeit. Dagegen bieten die bewußt ausführlichenInhaltsstichworte vor jedem Kapitel sowie das detaillierte Register einen gewissen Ausgleich. Zwei weitereOrientierungshilfen mögen hier folgen: ein kurzgefaßter „roter Faden“ durch die Darstellung (bis S. XXXVI)und eine Zusammenfassung methodenkritisch-theoretischer Stellungnahmen die das Buch durchziehen(S. XXXVII–XLVI).
Das Gerippe der Komposition bildet die Struktur des Vortrags von 1980 (oben S. XXI), der wie folgt erweitertwurde: Im 1. Kapitel werden die unmittelbar durch den Policraticus angeregten (arbeitsgeschichtlichfrühesten) Fragen präsentiert (§§ 1–8): Welches Verhältnis besteht zwischen den größtenteils alsLiteraturzitate zeichenhaft eingesetzten historiae Johanns und den stärker empirisch orientierten Exemplaoder Präzedenzfällen in vor- und nachmittelalterlichen Geschichtsanalogien? Läßt sich der unterschiedlicheBeispielgebrauch auf epochenspezifische Wirklichkeitsbegriffe zurückführen? Das 2. Kapitel besteht aus einerliteraturtheoretischen und theoriegeschichtlichen Erläuterung der Exemplumdefinition auf anthropologischerund rhetorischer Basis (§§ 9–20) sowie aus einem kurzen Abriß der Geschichte des Exemplums von der Antikezum Mittelalter (§§ 21–33). Im Zentrum des Interesses steht dabei die Unterscheidung zweier Haupttypen,des illustrativen und des induktiven Exemplums, mit der einerseits die undifferenzierte
XXXVI
Verwendung des Terminus „Exemplum“ für das spätmittelalterliche Predigtmärlein in Frage gestellt(§§ 34–5), andererseits eine gemeinsame thematische Tradition beider Exemplumarten von den antikenMemorabilien zu den homiletischen Anekdoten der Bettelmönche (insbesondere an der Quellen- undWirkungsgeschichte des Policraticus) nachgewiesen werden kann (§§ 36–39). Das dritte, ausführlichsteKapitel bildet das analytisch-deskriptive Hauptstück der Policraticus-Interpretation mit mehreren assoziativangeknüpften Exkursen allgemein kulturgeschichtlicher Art. Nach der terminologischen Unterscheidung derBegriffe exemplum und historia in Johanns Sprachgebrauch für Inhalt und Form der Beispiele (§§ 40 f.) folgteine Untersuchung der ethischen Modell- und Gegenmodellbedeutung der Policraticus-Anekdoten mit einemAusblick auf Johanns Ideal der praktischen Philosophie im Geiste der „akademischen“ Skepsis (§§ 42–49).Johanns Exemplum als dialektisches und rhetorisches „Argument aus der Geschichte“ wird danach unterfunktionalen Gesichtspunkten aufgrund der aristotelischen und ciceronianischen Tradition dermittelalterlichen „Logiken“ beschrieben (§§ 50–78). Dies motiviert einen längeren Einschub (§§ 61–8) überden hochmittelalterlichen Beginn neuzeitlicher Wissenschaft in einer vom zetetischen Zweifel und vomagonalen Spiel getragenen Hermeneutik der Widerspruchsbehebung. Das Exemplum als Teil eines topischen„Vorrats“ für die inventio und als kasuistischer Übungsstoff für das iudicium wird sodann im Zusammenhangmit der besonderen mittelalterlichen Auffassung von der literarischen Arbeit als enzyklopädischer„Materialbeherrschung“ und ars utilis scharfsinniger Variation des verfügbaren Traditionsguts charakterisiert(§§ 79–88), was einige grundsätzliche Bemerkungen über Johanns „unphilologische“ Rezeption antikerAutoren nötig macht (§§ 89–93). Abschließend werden inhaltliche Gesichtspunkte der Policraticus-Exemplaangesprochen, die sich aus der Frage nach dem überaus komplexen Verhältnis von „Antike und Christentum“in Johanns Sprache ergeben (§§ 94–100); von hier gelangen wir zur theoretischen Problematik deswissenschaftlichen Beschreibungsrepertoires für spielerische Phänomene im vor-tridentinischen Christentum(§§ 101–4). Das 4. Kapitel bildet die Conclusio und gleichzeitig die Transposition der vielfältigenEinzelbeobachtungen auf die philosophische und anthropologische Ebene: Mittelalterliche„Letztbegründungen“ des Exemplums als Spur des Ewigen in der Nichtigkeit der Geschichte werden mit einerallgemeinen, bis zur Gegenwart reichenden Geschichtsauffassung verglichen, die sich einzig am Konstantenorientiert und das historische Detail als Nebenumstand geringschätzt (§§ 105–108), und daraus folgenAntworten auf die eingangs gestellten Fragen nach dem Wirklichkeitsbegriff des Mittelalters und der Neuzeit(bzw. der Renaissance), die, wie oben gezeigt (S. XV f.), besser als neue Fragen an unseren Historismus zuverstehen wären (§§ 109–114). Die Exkurse sind klar strukturiert und bedürfen keines Ariadne-Fadens, da sieim Unterschied zu allem anderen normal in einem Wurf geschrieben wurden.
XXXVII
Jürgen Mittelstraß schreibt in dem oben (S. XXI) angeführten Beitrag. die „Fußnotentypologie“ von P. Rieß(S. XXVII) zusammenfassend: „Je mehr Aufgelesenes, desto besser, scheint die Devise zu sein. StattGelehrtheit, die bei all dem zu dokumentieren beabsichtigt ist, viel Leerlauf. Das Nötige geht im Unnötigenunter, das Belangvolle im Belanglosen, Wissen in Information. Es ist zu befürchten, daß dies erst so richtiggroßartig wird, wenn Fußnoten ihr eigenes Informationsnetz gefunden haben. Dann werden Fußnoten nachoben wachsen, zum Kopf, aus Fußnoten Bücher werden, aus Texten Kopfnoten.“ Gegen diesebedenkenswerten Sätze dürfte im vorliegenden Fall die oben erzählte Vorgeschichte eine gewisse, wenn auchnicht vollständige Entlastung bedeuten. Da die Darstellung vorab gedruckt wurde, während die Anmerkungenweiterwuchsen, muß ich nochmals darauf hinweisen, daß deren Reflexionsstand stellenweise erheblich überdenjenigen des Textes hinausgereift ist und eigentlich gerade angemessen nach „oben“ hätte dringen müssen.Im Vorwort können aber unmöglich alle diese neuen Einsichten zusammengefaßt werden. Etwas anderes ist andieser Stelle sinnvoll und ökonomisch: eine Standortbestimmung des Autors im Koordinaten-systemmediävistischer Erkenntnisinteressen. Damit kann ich „Belangvolles“ im Zusammenhang offen an den Taglegen, das sich in vielen verstreuten und kontextgebundenen Einzelbemerkungen (auch im Text, abervermehrt in den Fußnoten) verkriecht und verliert; ich meine vor allem meine latente Auseinandersetzungmit drei Gegenpositionen, die mir bei der Arbeit immer wieder wie eine „herrschende Meinung“, eindominantes Mittelalterbild der Mediävistik erschienen sind: mit der nationalphilologisch-„populistischen“Betrachtungsweise, der weltanschaulich-„identifikationistischen“ und der rhetorikfeindlich-„thematistischen“. – Die erste hinderliche Sehweise stammt aus der romantischen und nationalenGründungszeit deutscher, ganz auf Volkskultur und Volkssprache ausgerichteter Mediävistik im 19.Jahrhundert. Sie ist trotz Ernst Robert Curtius, der ein Paradigma europäischer Literaturwissenschaftaufstellen wollte, noch immer die vorherrschende; ja, in Verbindung mit einer bestimmten neuenSozialgeschichtsforschung erscheint sie heute sogar etablierter zu sein denn je. Schon muß sich derMittellateinische Philologe, wenn er seinen bildungssprachlichen und klerikalen Objektbereich, die über einJahrtausend führende Literatur Europas, auch nur beschreibt, vorwerfen laasen, er vergesse die übrige„Gesellschaft“, insbesondere das stumme Volk, er gebe den elitären Teil für das Ganze aus und sei womöglichselbst ein überheblicher, asozialer „clerc“ (d. h. Intellektueller). Wenn er sich schon mit jenen (im modernendemographischen Sinn tatsächlich) nicht repräsentativen Blüten einer Schulstubenpoesie wie allegorischenWeltentstehungsepen, mit dialektischen Spiegelfechtereien wildgewordener Sophisten oder langweiligenSchulmeister-Traktaten über weltfremde Moral-probleme befasse, so solle er sich doch wenigstensvornehmlich auf jene Schnitt- und Berührungspunkte konzentrieren, in denen das illiterate Volk dargestelltoder angesprochen wird, etwa auf Predigten, Schwänke, „Vagantenlyrik“, Fabliaux, „Exempla“, Novellen.
XXXVIII
Bedenkt man, daß die ganze wissenschaftliche Literatur bis ins 18. Jahrhundert „europäisch“, d. h. lateinischgeschrieben wurde, versteht man diese Einstellung besser als einen fernen Nachklang jenes seit derFranzösischen Revolution ganz selbstverständlichen Mißtrauens gegen gelehrte Latinität, die Feindin allerVolks- und Allgemeinbildung. Vielleicht ist noch nicht ganz überholt, was Schopenhauer (a.a.O. § 255) 1850dagegen vorbrachte: „Die Abschaffung des Lateinischen als allgemeiner Gelehrtensprache und die dagegeneingeführte Kleinbürgerei der Nationalliteraturen ist für die Wissenschaften in Europa ein wahres Unglückgewesen […]. Die Barbarei kommt wieder, trotz Eisenbahnen, elektrischen Drähten und Luftballons. Endlichgehn wir dadurch des Vortheils verlustig, den alle unsere Vorfahren genossen haben. Nämlich nicht bloß dasRömische Alterthum schließt das Lateinische uns auf, sondern eben so unmittelbar das ganze Mittelalter allerEuropäischen Länder und die neuere Zeit bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts herab. Daher reden z. B.Skotus Erigena aus dem 9. Jahrhundert, Johannes von Salisbury aus dem 12., Raimund Lullus aus dem 13.,nebst hundert Anderen, zu mir unmittelbar in der Sprache, die ihnen, sobald sie an wissenschaftlicheGegenstände dachten, natürlich und eigen war. Daher treten sie noch jetzt ganz nahe an mich heran: ich binin unmittelbarer Berührung mit ihnen und lerne sie wahrhaft kennen. Was würde es seyn, wenn Jeder vonihnen in seiner Landessprache, wie sie zu seiner Zeit war, geschrieben hätte?! Nicht die Hälfte würde ich auchnur verstehn und eine eigentliche geistige Berührung mit ihnen wäre unmöglich: ich sähe sie wieSchattenbilder am fernen Horizont, oder gar durch das Teleskop einer Übersetzung.“ Wir haben heute nichtmehr den Untergang der lateinischen Gelehrtensprache zu beklagen, wohl aber den Verlust der „europäisch-lateinischen“ Dimension aus dem allgemeinen Bewußtsein und Geschichtsbild, nachdem es Curtius 1948 nochgelang, eine weitere Öffentlichkeit daran zu erinnern. (Ob U. Ecos überaus breitenwirksames „Mittelalter-integumentum“ in dieser latinistischen Hinsicht ähnlich nützlich war, wage ich trotz der vielen unübersetztenlateinischen Zitate im Roman zu bezweifeln.) Nur noch die wenigsten machen sich heute bewußt, daß an derWurzel beider moderner Entwicklungen: der Verabschiedung des Lateinischen als eines wissenschaftlichen und„humanen“ Verkehrsmittels sowie als eines komparatistischen Instruments historischer, zeitenverbindenderHermeneutik, dasselbe Grundmotiv liegt; Schopenhauer nennt es den „Patriotismus im Reiche derWissenschaften“, einen „schmutzigen Gesellen“. Heute, da „Patriotismus“ (wenn auch aus anderen Gründen)schon fast wieder ein Schimpfwort geworden ist und die schlimmsten Auswüchse des „nationalen Gedankens“wohl endgültig hinter uns liegen, dürften die meisten Nationalphilologen die Herleitung ihres Spezialfachs auseinem der Patriotismen des letzten Jahrhunderts nur noch als von „historischem“ (d. i. antiquarischem)Interesse ansehen und aktuelle Schlußfolgerungen daraus auf ihre erkenntnisleitenden Gesichtspunkte undSelektionskriterien als eine Zumutung empfinden. Die forschungspraktische Erfahrung
XXXIX
zeigt jedoch nicht selten merkwürdige, wie immer indirekte und subtile Abhängigkeiten der nationalenMittelalterphilologien von deren Ursprungsinteressen, zu denen eben u. a. auch jene (antifeudale,antiaristokratische, antiklerikale, populistische, nationalistische usw.) Lateinverachtung des bürgerlichenZeitalters gehört. Daß, wer solches ausspricht, als „reaktionär“ eingestuft zu werden riskiert, beweist geradedie Virulenz des Kritisierten (vgl. Anm. 313 und den in der Stoßrichtung ähnlichen, in Anm. 530 genanntenBeitrag von M. Fuhrmann).
Es ist entsprechend auch nicht erstaunlich, daß das lateinische Mittelalter heute keine Chance hat, von einergewissen modischen Mittelalterbegeisterung beachtet zu werden, die sich (gepaart mit sog. „Mittelalter-Rezeptions-Forschung“) mehr um Richard Wagner als um mittelalterliche Rationalität kümmert. Selbstinnerhalb des eigenen Fachs dominiert (seitdem es als historische Hilfswissenschaft der Quellenedition inDeutschland entstanden ist) eine auffällige Vorliebe für Nationales, Volkshaftes, Germanisches und für alles,was an germanistische Themen anknüpfbar ist (vgl. Anm. 570a). Es geht hier nicht um natürliche regionaleSonderentwicklungen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob wir hinter den Historismus zurückgehen unduns ein Zeitalter nach unseren eigenen Präferenzen, Normen und Sympathien zurechtlegen dürfen, so daß wiralles, was uns bestätigt und ankündigt, mit größtem Eifer erforschen, und am Wegrand liegen lassen, was unsabstoßend, fremdartig, überholt, d. h. „mittelalterlich“ erscheint. Norbert Elias, der nicht im Rufe derStubengelehrsamkeit steht, hat in einem Interview vor kurzem mit Nachdruck betont, es gehöre zu seinemWissenschaftsethos, dem „Unsympathischen“ – für ihn also dem höfischen „ancien régime“ – größereAufmerksamkeit zuzuwenden als dem leicht Zugänglichen, Identischen. Dies läßt sich unschwer auf das Gebietder „indoktrinierend dogmatischen“, „geistlich-weltverachtenden“, „aristokratisch-hermetischen“,„manieristischen“, „sophistischen“, „formalistischen“ usw. Literatur des lateinischen Mittelalters beziehen.(Merkwürdigerweise fällt allerdings dem, der mit aller Selbstüberwindung die „Alterität“ sucht, dann widerErwarten doch manche „Modernität“ auf.) Erstaunlich ist im übrigen die Prätention, von Gesellschaft undVolkskultur zu reden, als wären wir nicht an die vornehmlich von Klerikern geschriebenen Quellen gebunden;ja, als wären wir in einer hypothetischen „oral culture“ selbst dabeigewesen. Damit sollen in keiner Weise dieVerdienste einer um die Rekonstruktion der materiellen Lebensbedingungen und der Alltagskultur bemühtenSozialgeschichte geschmälert werden; es geht hier nur um die Legitimität der Auswertung dessen, was dielateinische Bildungswelt von sich selbst gedacht hat.
Doch auch für dieses Prinzip gilt ein ne quid nimis, jenseits dessen die zweite hier zu besprechendeSichtbehinderung beginnt: Was für den einen als „offizielle“ klerikale Kultur keinen Verstehenswert zu habenscheint, wird für den anderen zum Kultobjekt des reinen Verstehens. Die Selbstdarstellung
XL
dieser Kultur wird in einer gewissen Mediävistik (meist stillschweigend) als etwa auch heute Maßgeblichesbehandelt, dem nachzustreben oder nachzutrauern wäre, als etwas, womit wir uns identifizieren könnten. Diebewußte oder unbewußte Überbetonung der Kontinuität zwischen mittelalterlichem und heutigem Christentummacht wie kein anderes Vorurteil demjenigen, der nur schon heuristisch ohne Distanz vom historischenObjekt wissenschaftlich nicht arbeiten kann, die mediävistische Atemluft schwer (vgl. z. B. Anm. 276, 906,910 u. ö.). Merkwürdigerweise oder eher bezeichnenderweise fehlt dieser Identifikationskomplex so gut wieganz in der theologischen Forschung zum Mittelalter. Dem (idealen) Theologen geht es zuletzt um den Sinndes heutigen Christentums, nicht um eine verkappte Wiederentdeckung des christlichen Mittelalters (einesheute für viele eher peinlichen und belastenden Erbes); darum unterscheidet er oft genauer als andereMediävisten zwischen historischer Arbeit und aktueller Sinnsuche. Aus anderen Gründen tritt derIdentifikationismus auch in der Romanistik nur schwach in Erscheinung. Der alte Universalanspruch desFachs, das ganze Gebiet einer Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart abzudecken (dem praktisch nurwenige wie Auerbach, Curtius, Spitzer gerecht geworden sind), scheint hier ein gewisses neutralisierendesGegengewicht gegen die weltanschauliche Vorherrschaft einzelner Epochen geschaffen zu haben, abgesehendavon, daß die Literatur des französischen Mittelalters tatsächlich insgesamt weniger „erbaulich“ ist als etwadie alt- und mittelhochdeutsche. Besonders lehrreich ist die Haltung der ursprünglich eher laikal-humanistischen Altertumskunde zum Problem der christlichen Kultur im Übergang von der Spätantike zumFrühmittelalter; denn in den mit „Antike und Christentum“ befaßten Disziplinen wird im allgemeinen ganzoffen, oft sogar polemisch über die Gefahren des anachronistischen Mißverständnisses durch positive, aberauch negative Identifikation gestritten (vgl. z. B. Anm. 276). In der Altgermanistik hingegen, die derMittellateinischen Philologie hierzulande am nächsten steht, kann man eine fast ungebrochene Vorherrschaftdes erbaulichen Denkmusters beobachten. Nicht selten geht es hier obendrein eine merkwüdige Legierung mitdem erwähnten „populistischen“ Modell ein. Es führt uns dann auf der Ebene objektiver Tatsächlichkeit die„Ründe“ des Mittelalters vor Augen: eine zwar spannungsvolle, aber letztlich immer harmonisch geordneteWelt der (Volks-)Frömmigkeit, aus der nur ganz wenige – etwa der untypische, weil lateinisch gebildete (oderverbildete) Gottfried von Straßburg – herausfallen. Nicht zu bestreiten ist, daß die volkssprachliche Literaturdes Mittelalters ihre Entstehung und Legitimation wesentlich den anfallenden Verkündigungs- undUnterweisungsaufgaben verdankt, aber gerade dies zeigt ihre funktionale Einseitigkeit, die sich zuExtrapolationen auf „das“ Mittelalter nicht eignet. Pastoraltheologie und christliche Philosophie sind zweiWelten, und auf letztere geht nichts weniger als unsere moderne Rationalität, Säkularisierung und Aufklärungzurück, wie einer der berufensten Kenner des mittelalterlichen Christentums, Wolfgang Kluxen (gegenBlumenberg) scharf hervorhebt:
XLI
„Es scheint mir keine geschichtliche Legitimation für unsere heutige Wissenschaft möglich, die das 12.Jahrhundert überspringt oder auch nur es nicht zum Ausgangspunkt nimmt“ (Der Begriff der Wissenschaft, in:Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jh., Zürich 1981, 287). Die klare Unterscheidung zwischen dem„frommen Mittelalter“ der Germanisten und dem rationalen Mittelalter der Philosophiehistoriker – einemZeitalter der nicht gegen, sondern durch die Logos-Religion autonom werdenden Vernunft – ist deshalb sowichtig, weil Neuzeitforscher, deren Interesse an allem „Profanen“ (zunftbedingt) oft ebenso borniert ist wieder erbauliche Blickwinkel vieler Mediävisten, das Klischee vom dogmatischen und ignorantistischenMittelalter – noch immer als Folie für ihre Säkularisations- und Fortschrittskonstruktionen benützen. Es sinddieselben freidenkenden Apologeten der Neuheit, die gern übersehen, daß etwa die Entdeckung neuer Erdteileim 16. Jahrhundert kein neues Weltbild, sondern neue Missionsprobleme mit sich brachte (Lucien Febvre, Leproblème de l’incroyance au XVIe siècle, 1942/68, 422). Es ist im Grunde gleichgültig, ob man (mit H.R.Jauß) die Modernität des Mittelalters verkündet oder die Moderne an ihr Alter erinnert, ob man (mit O.Marquard) vom Mittelalter als der „Neuzeit vor der Neuzeit“ spricht oder von der Neuzeit negativ als dem„das Mittelalter überschießenden Mittelalter“ (P. Boglioni, wie untem Anm. 313, 36 über Aberglaube undInquisition der Barockzeit): Man bleibt mit solcher Botschaft allein oder nur im kleinen Kreis derer, denen sielängst bekannt ist. Solange das Bild des Mittelalters von konfessionell befangenen Erforschern der„Volksliteratur“, das der Antike und Neuzeit von freigeistigen Spezialisten der bildungssprachlichen Kultur-und Ideengeschichte bestimmt und verbreitet wird, können sich die letzteren noch immer bequem auf dieersteren berufen, um die Legende vom „finsteren Mittelalter“ am Leben zu erhalten. An diesen verkapptenEpochenideologien haben, wie hier zu zeigen sein wird, die grundverschiedenen, aber sich gegenseitigstützenden Exemplumbegriffe einzelner Fächer teil: Nur aus der offenbar allgemein hingenommenenUnkenntnis der wissenschaftlichen Bildung des lateinischen Mittelalters erklären sich jene eigenartigenGruppierungen einer mediävistischen Volksliteraturforschung, die allem Gelehrten und Intellektuellenfernsteht, und einer Humanismusforschung, die sich allein der hervorragenden Geistesprodukte annimmt,sowie das von beiden Seiten unabhängig voneinander und doch in gleicher Weise aufgebaute Vorurteil, daserbaulich-dogmatische Lehrexemplum des Mittelalters sei in der Renaissance ein philosophisch offenesProblembeispiel historischer Wirklichkeitserfahrung geworden.
Von jedem Standpunkt aus ist hier historische Erkenntnis möglich, nur nicht aus der Standpunktlosigkeitheraus. Trotz dieser hermeneutischen Grundregel gibt es verschiedene Arten, Überzeugungen bei derhistorischen Arbeit einzusetzen, methodisch fruchtbare und sterile: Man kann den Kontrast, das Andere, dieüberraschende Vielfalt des Geschichtlichen ernst nehmen und „hinzulernen“, oder man findet in derVergangenheit nur immer wieder sich
XLII
selbst wieder. Es spielt keine Rolle, welchem Zeitalter und welcher Geistesrichtung der Vergangenheit wir unszuwenden, sofern wir dabei den „historischen Sinn“ nicht verlieren, der sich wesentlich vomKontinuitätsdenken unterscheidet. „Die den Zusammenhang des eigenen Seins wahrende Memnosyne, dasErinnern, in dem gegenwärtig bleibt, was zur Gegenwart als ihre eigene Größe und ihr eigenes Geschickgehört“ (J. Ritter, Subjektivität, Frankfurt 1974/80, 127), ist nämlich der diametrale Gegensatzwissenschaftlicher historischer Beschäftigung, die vielmehr nach H. Blumenbergs prägnanter Formel(Schiffbruch, wie Anm. 423, 81) „schlichte Sistierung von Gegenwart als Selbstverständlichkeit“ zu sein hat,also auch jene Gegenwart arbeitstechnisch suspendieren muß, die in der zustimmungsfähigen Form des zubewahrenden „Erbes“ zu erscheinen pflegt oder die „in direkter Linie“ bis zu irgendwelchen heiligenGründungsvätern zurückverfolgt werden kann.
Darum ist es aber für jeden auf den ersten Blick schwieriger, über einen seiner vertrauten Welt nahestehendenGegenstand historische Erkenntnis zu gewinnen als über einen fremdartigen, vereinnehmender Identifikationsich entziehenden. Da in einer pluralistischen Gesellschaft jedoch jeder seine eigenen „Traulichkeiten“ undBefremdlichkeiten anderswo findet, kommt vielmehr alles auf eine lebendige Diskussion an, in der dieverschiedenen Identifikations- und Projektionsgefahren kontrolliert und wissenschaftlich überprüft werden.Dies aber setzt eine freie Kommunikation voraus, insbesondere den Verzicht auf den Mißbrauch des an sichunanfechtbaren Postulats von der historischen „Einfühlung“, das als eine Art Bannformel oft einen sofalschen, drohenden und repressiven Klang erhält.
Das historische Gebot, gegenwärtige – also möglicherweise auch religiöse – Gesichtspunkte so weit wiemöglich aus dem Verstehensprozeß herauszuhalten, wird sonst sogar in sein Gegenteil: in einIdentifikationsgebot, verkehrt. Man sagt, das mittelalterliche Christentum dürfe nur aus sich selbst herausverstanden, nicht in modernen Beschreibungskategorien analysiert werden, und meint ein sacrificiumintellectus, spaltet als vermeintlich modernen Anachronismus ab, was landläufigen „religiösen Gefühlen“zuwiderläuft, verbietet also Alteritätserkenntnis. Die Perversion des Historismus besteht wie anderswo in derobjektivistischen Illusion, man könne Fremdes ohne unser Zutun aus sich selbst sprechen lassen, womit derHang zur Selbstbespiegelung sich oft erst recht entfalten kann. Dabei gäbe es bewährte Techniken derwissenschaftlichen Kritik, etwa die diagnostische und prophylaktische Selbstkontrolle des Subjekts durch dasVorverständnisse aufdeckende Gespräch; oder die bei Ethnologen und Kulturanthropologen unentbehrlicheKlarlegung des jeweils eingeschlagenen Wegs in der Doppelstrategie des „emischen“ Vorgehens aus der Sichtder Stammeskulturen heraus (in der Objektsprache) oder des „etischen“ Zugangs aus der klassifizierendenSicht des Beschreibenden (in der Beobachtersprache); schließlich wären mutatis mutandis sogarmittelalterliche Verfahren im hermeneutischen Umgang mit
XLIII
nicht mehr unmittelbar verständlichen Texten brauchbar, von der littera zum sensus führendeMehrphasentheorien, aus denen sich insbesondere die klare Scheidung der Operationen: Verstehen,Vergleichen und Beurteilen lernen läßt. Solche Techniken dürften eher als die vage Zauberformel von derKunst des „Sich-Hineinversetzens“ auf die Spur des Fremden, Befremdenden, den eigenen HorizontSprengenden führen. Eine gewisse Mediävistik scheint sie geringzuschätzen, weil sie sich rückwärtsgewandtapologetisch als bewahrende memoria untergehender Tradition versteht, nicht vorwärtsblickend als ars utiliskompensierender Bereitstellung von historischem Orientierungswissen für eine „von ihren Herkunftsweltenemanzipierte, geschichtslose Gesellschaft“ (J. Ritter, a.a.O.).
Den Eindruck, daß „Technisches“ in der Mittelalterforschung wenig zählt, habe ich als dritten Hauptaspektmeines Unbehagens genannt. Nach dem eben Ausgeführten wird dabei eine Chance vertan: Gerade weil dassachliche Gespräch durch weltanschauliche und emotionale Blockierungen erschwert ist, sollten wir diesenBoden größerer Konsensfähigkeit bevorzugen. Die formengeschichtliche Bibeltheologie beider Konfessionenkönnte hier als Vorbild „heiliger Nüchternheit“ im technischen, d. h. „unfrommen“ Zugang zur HeiligenSchrift vorleuchten. (Den Ausdruck „unfromm“ entnehme ich dankbar einer Briefstelle Heinrich Lausbergsim Zusammenhang mit den in Anm. 956 erwähnten „Subtilitäten“.) Auch für Mediävisten wärebeherzigenswert, was Adolf Jülicher seinen Kollegen, die ob der „würdigen“ Inhalte, die „unwürdigen“ Formenglaubten vernachlässigen zu dürfen, grimmig zugerufen hat (117 f.): der Gottessohn habe „nicht neueSchläuche, sondern neuen Wein“ mitgebracht. Die Mediävistik, die keine Offenbarungen sondern nur „alteSchläuche“ menschlicher Tradition zum Objekt hat, sollte sich a fortiori auf Formen, Funktionen, Methoden,Regeln, Zeichen, mathematische Kategorien des Mittelalters richten: weniger auf die individuellen Aussagender „parole“ als auf die allgemeinen, variiert wiederkehrenden Figuren der „langue“; weniger auf Aspekte des„Literarischen“ im heutigen Sinn (etwa Echtheit der Subjektivität) als auf die Struktur des gesellschaftlichgeprägten Rhetorischen; weniger auf Erzählstoffe (s. Tubachs Index exemplorum) als auf das Erzählen selbstals Mittel des Unterhaltens und Argumentierens; weniger auf die genialen Leistungen großer Denker als auf dieDenkformen und logischen Instrumente der Wissensbildung; weniger auf die Bewußtseinsinhalte dergeschichtlichen Erfahrung (daran klebt die „Ereignisgeschichte“ der Historiker) als auf die„Bewußtseinsgewohnheiten“ der Wirklichkeitswahrnehmung und Wirklichkeitsbewertung (A. Gurjewitsch, wieAnm. 313,17). All diese und viele andere formale Kategorien sind Gegenstand eines vollwertigen historischenInteresses, brauchen also nicht irgendeinem ahistorisch-strukturalistischen Spieltrieb anheimzufallen. DerMediävist, der sich erst mühsam die anachronistischen Interpretationsmuster neuzeitlicher Gefühls- undAusdruckskultur abgewöhnen muß, wird durch die spröde Technizität mittelalterlicher Rede- undKommunikationsformen oft am unmittelbarsten zur
XLIV
„Sistierung“ seiner eigenen Prämissen geführt. Doch gerade dagegen wehrt sich wiederum das ungezügelteIdentifikationsbedürfnis.
Die Rezeption des Mittelalterbuchs von Ernst Robert Curtius in den letzten dreißig Jahren gibt auch in dieserHinsicht zu denken, da (bei allem Lob des nach dem Krieg ohnehin in der Luft liegenden „abendländischenGedankens“) der methodologische und methodengeschichtliche Neuansatz – Aufwertung der Elemente undFormen der Bildungstradition, Absage an unangemessene Gefühlsästhetik und werkimmanente Interpretation– vorwiegend zwiespältige, halbherzig kritische oder offen polemische Reaktionen auslöste. Ironischerweiseerhielt Curtius – auf anderem Feld ein engagierter Verehrer klassischer Genie- und „Höhenkamm“-Literatur –Tadel hauptsächlich von der „falschen Seite“, von Ausdrucksästheten, die ihm Verkennung „poetischerIndividualität“ vorwarfen (s. § 10). Die sichtbarste unmittelbare Wirkung seines Buchs war eine modische„Materialisierung“ des Toposbegriffs, also auch eine Verlagerung vom Technischen auf das Inhaltliche, wiesie sich in einer Welle von Abhandlungen über epideiktische Klischees bei mittelalterlichen poetae minores(u. dgl.) zeigte. Als Reaktion darauf kamen erneut die von Curtius verspotteten „geistesgeschichtlichen“Untersuchungen zum Zug, allerdings mit jener in Vorworten fast obligaten Generalklausel über dieEigenständigkeit, Echtheit, Originalität individueller Funktionalisierung jener sog. (Curtiusschen) Topoi. Diefür Mediävisten so heilsame Botschaft von einer literaturwissenschaftlichen „Chemie“, die ihre Stoffe mitden „Reagenzien“ technischer Betrachtungsweise „in ihre Strukturen auflöst“ (vgl. ELLM 25), hatteabgesehen von einigen vornehmlich romanistischen Ausnahmen (wie Paul Zumthor) insgesamt zu wenigforschungspraktische Folgen. Dagegen gilt, um in der naturwissenschaftlichen Metaphorik zu verbleiben, alsdas beliebteste und erfolgreichste Modell mediävistischen Vorgehens das der Pflanzenklassifizierung nachLinné: Die ganze unabsehbare Vielfalt des Seienden läßt sich in Ordnungssysteme mit Unterabteilungen,Unregelmäßigkeiten und Ausnahmen aufteilen, wobei diese Kategorien (im Unterschied zu denen Linnés)ständig verändert und umverteilt werden können. Die Methode hat den Vorteil, daß sie „Positivisten“ und„Theoretiker“ (vgl. S. XIII) friedlich zusammenführt: Die einen schaffen immer neues Material herbei, damitdie anderen ihre a posteriori gebildeten Einteilungen immer wieder umstoßen und neuen Gegebenheitenanpassen können (wie die endlose Diskussion über die literarischen „Gattungen“ im Mittelalter schön zeigt).Demgegenüber bleibt die eigentliche (in einem weniger abgeleiteten Sinn) theoretische Frage nach den imMittelalter selbst gültigen Prinzipien, Formgesetzen, Darstellungsmethoden, modi tractandi weitgehendunbeantwortet. Mittelalterliche Typen der Erzählung etwa werden morphologisch nach Stoffen, nichtfunktional nach situativen Absichten und Strategien betrachtet. Dies zeigen die ziemlich unabhängigvoneinander durchgeführten Untersuchungen zur Fabel, zur Parabel und zur Beispielgeschichte: Die Diskussionkreist um Definitions- und Zuordnungsprobleme nach inhaltlichen
XLV
Merkmalen, kaum um rhetorische Aspekte. Viel ist zu lesen über eine auf mythischen Urmotiven wurzelndeTiergeschichte, wenig über die Fabel als schlaues Überzeugungsmittel (s. § 14); viel über das Gleichnis alssemantische Urform religiösen Sprechens, wenig über das sokratische Gleichnisargument einer hypothetischvorgestellten Alltagserfahrung; viel über das „Exemplum“ als eine dem Mutterwitz des Volkes entstammendeunterhaltsam belehrende Geschichte, wenig über das Exemplum als argumentative Parallele aus derVergangenheit.
Hat die Forschung die Wahl zwischen einer morphologischen oder einer methodengeschichtlichen, einernarratologischen und einer argumentations-rhetorischen, einer mythengeschichtlichen und einerdenkgeschichtlichen Perspektive, so wird meist die zuerst genannte Möglichkeit bevorzugt. Symptomatischerscheint mir die mündliche Bemerkung eines führenden französischen Exemplum-Spezialisten, die Definitiondes (homile tischen) Exemplums sei heute noch nicht möglich; sie werde es erst sein, wenn alle nochunedierten Exemplasammlungen des späteren Mittelalters vorliegen. Als „Definition“ gilt hier offenbar soetwas wie der statistische Mittelwert aus allem stofflich Vorhandenen. Eine logische Definition müßte nachWhiteheads Glosse über die aristotelischen Kategorien (oben S. IX) wenigstens die halbe Wegstrecke zurAbstraktion erreichen, was ohne ein formales Kriterium schwer möglich ist. Formen finden wir nicht durchAnsammeln und Auszählen von Fakten, sondern durch methodengeschichtliches Denken, für das beliebigeBeispiele immer schon ausreichend Meditationsstoff bieten und Anlaß, vom Einzelnen vertiefend zum„Allgemeinen und Notwendigen“ vorzustoßen. Man muß nicht alles, was es „positiv“ von einem Phänomengibt, versammeln, um herauszufinden, welche Mechanismen diesem Phänomen zugrundeliegen. Auch hierrächt sich der Verstoß gegen Ockhams Ökonomie-prinzip (entia non sunt multiplicanda praeternecessitatem) und gegen das wissenschaftstheoretische suum cuique (im „Reich der Qualität“ hat dieQuantität ihr Recht verloren): Die vollständige Summe ergibt keine Formel für ein Funktionsgesetz.
Eine andere Art von Inhaltsbezogenheit – paradoxerweise eine ästhetische – verhindert in dermediävistischen Literaturwissenschaft wichtige methoden-geschichtliche Fragen: die bedenkenloseÜbertragung unseres modernen, auf Kunstautonomie und Ausdrucksästhetik beruhenden Literaturbegriffs – alswäre er überzeitlich, allgemeinmenschlich – auf eine Epoche, die „Literatur“ in diesem Sinn weder dem Wortnoch der Sache nach kannte. Der allgemeine Wandel wissenschaftsmethodischer Leitvorstellungen von der„Kunst der Interpretation“ zur „Sozialgeschichte der Literatur“ hat zwar auch die Mediävistik erfaßt –anachronistische Deutungen artifizieller oder ritueller Gebilde wie Liebesgedichte oder Hymnen aus dem Geistbürgerlicher Innerlichkeit sind kaum mehr zu finden –, doch das inadäquate Kriterium der Gefühlsechtheitoder Originalität ist noch keineswegs aus allen Interpretationen
XLVI
mittelalterlicher, weitgehend kollektiven Zwecken dienender Werke verschwunden. Noch immer finden sichbiographische und psychologische Erklärungen mittelalterlicher Dichtung und gleichsam „touristische“Vergnügungsfahrten in das fremde, doch nicht allzu fremde Land der mittelalterlichen Seele angesichts einerLiteratur, die weder ein „lyrisches“ noch ein eigentlich autobiographisches Ich, sondern nur ein ecce homo:beispielhaft für die Menschheit sprechende Subjektivität kennt (s. Anm. 528–30). Doch weit gravierender istwiederum ein Defizit an „historischem Sinn“: das undifferenzierte und bequeme Sprechen von „Literatur“,mit dem der Unterschied zwischen moderner Belletristik und vor-modernem „Schrifttum“ zugedeckt wird (s.Anm. 570a). Dabei wäre das Fehlen eines eigenen ästhetischen Literaturbegriffs im Mittelalter gerade einzentraler, weit über die Fachgrenzen hinaus bedeutsamer Reflexionsgegenstand mediävistischerLiteraturwissenschaft; denn er bietet die besondere Chance, die Relativität und Bedingtheit unserer kaumzweihundert Jahre alten Kunstauffassung durch andere (nicht zweckfreie oder subjektivistische) Möglichkeitendes Ästhetischen zu vergegenwärtigen. Das Interesse müßte sich dabei von selbstverständlichen, durch unserBildungssystem habitualisierten Fragen befreien, sich abwenden von allen vermeintlich den „Ausdruck“bestimmenden Empfindungen, Gefühlen, Anliegen, Gedanken, d. h. von den (persönlichen) Intentionen;nicht um in einen leeren Beschreibungsformalismus zu fallen, sondern um sich dem Rätsel einer Ästhetik desDienstes und Gebrauchs, der „Verzweckung“ und Funktionalität zuzuwenden und nach Erklärungen aus denPerzeptionsformen, Einstellungsmustern, Denkformen, Imitationstechniken, Kommunikationsformen der(kollektiven) Intentionalität zu suchen. Wenn die Form auch sonst „das wahrhaft Soziale“ an der Literaturist, so gilt ihr gegenüber in der Mediävistik umso mehr, daß das eigentliche Instrument literaturgeschichtlicherErkenntnis die Rhetorik ist.
Abschließend möchte ich all denen danken, die mir durch Dialog die Lust an einsamer Arbeit zu bewahrenhalfen, den regelmäßigen, periodischen, seltenen oder einmaligen Gesprächspartnern, die durch ihr Interesse,ihre Anregungen, Fragen, Einwände, ihr Querdenken, ihre Kritik und Zustimmung zur Entstehung diesesBuches beitrugen, vor allem: Jacques Berlioz, Karl Bertau, Lothar Bornscheuer, Alexandru Cizek, Lodewijk J.Engels, Kurt Flasch, Stephen Jaeger, Max Kerner, Fritz Peter Knapp, Rolf Köhn, Heinrich Lausberg, JacquesLe Goff, Wolfgang Maaz, Janet Martin, Christel Meier-Staubach, Gisela von Moos-Kaminski, BenediktVollmann, Fritz Wagner und Max Wehrli. Viel bedeuten mir Kongresse, auf denen ich Themen dieser Arbeitins Gespräch bringen konnte, und ich danke Christopher Brooke, Claudio Leonardi und M.J. Aerts für dieentsprechenden Einladungen nach Salisbury 1980 (The World of John of Salisbury), nach Trient 1985(Retorica e poetica tra XII e XIV secolo) und Groningen 1986 (Exemplum et similitudo).
XLVII
Den Herausgebern Ulrich Ernst und Christel Meier-Staubach, habe ich für die Aufnahme dieses Buches in dieReihe ‚Ordo‘ und der Deutschen Forschungs-gemeinschaft für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses zudanken.
Münster, im August 1986 Peter von Moos
Postscriptum zu den Übersetzungen: Der Not gehorchend – um nicht wie E.R. Curtius gelehrterPublikumsverachtung beschuldigt zu werden – habe ich fremdsprachige Stellen im Text (auch solche derSekundärliteratur) weitgehend übersetzt. Die se Übersetzungen stammen also, wo nicht anders vermerkt, vom Autor.Da nie zwei Übersetzungen außer in Belanglosem dasselbe gleich wiedergeben, habe ich mir erlaubt, im Rahmenlegitimer Freiheit stets die Variante vorzuziehen, die den im Kontext der Abhandlung angesprochenen Aspekt ambesten heraushebt. Darum kann u. U. ein und dasselbe Zitat an verschiedenen Stellen dieser Arbeit unterschiedlichübersetzt sein. Meine ad hoc-Übersetzungen sind Interpretationen, die wie alles andere der hermeneutischenDiskussion anheimgestellt werden. (Der beigegebene Originaltext macht sie nachprüfbar.)Zum Verweissystem: Aufgrund eines bedauerlichen Versehens konnten nach dem Umbruch nicht mehr alleBlockaden aufgelöst werden, was zu einigen Verkürzungen der werkinternen Querverweise führte. Man beachte, daßdie Abkürzung „S.“ sich generell auf Seitenzahlen in dieser Arbeit bezieht (auch wenn Angaben „s. unten“, „vgl.oben“ fehlen sollten) und daß Verweise auf eigene Anmerkungen uneinheitlich mit „Anm.“ und „A.“ abgekürztwerden mußten. Bei anderen Literaturverweisen werden Seitenzahlen allein in Ziffern angegeben („p./pp.“ erscheintnur ausnahmsweise für Seitenzahlen in Werken mit Paragraphen-Einteilung).
1
I. IM VORFELD EINER DEFINITION
Quand la raison nous faut, nous y employons l’experience,Per varios usus artem experientia fecit:Exemplo monstrante viam,
qui est un moyen plus foible et moins digne; mais la verité est chose sigrande que nous ne devons desdaigner aucune entremise qui nous yconduise.
Montaigne, Essais III 13 in. (Manilius I 59).
A) BEISPIELE FÜR DAS BEISPIEL
Präzedenzfälle als praktische Entscheidungshilfen in Briefen Johanns von Salisbury (§ 1) und in der Paradeigma-Theorie desAristoteles (§ 2).
1. In einem 1167 geschriebenen Brief zu konkreten Zeitfragen der Kirchenpolitik bemerkt Johann vonSalisbury beiläufig:1
Wenn man mich um Rat fragt, […] sage ich, was ich in allen schweren Zweifelsfällen für tunlich halte: Wir sollenzuallererst untersuchen, was das Göttliche Gesetz zur Sache vorschreibt; ergibt sich dabei keine sichere Lösung, sonehme man seine Zuflucht bei den Canones und den Exempla der Heiligen, und wenn sich auch da nichts Sicheresfindet, so möge man zuletzt die Entscheidungsmotive gottesfürchtiger Weiser erforschen; hier aber sind diejenigenvorzuziehen – seien sie zahlreich oder nicht! –, die Gottes Ehre über alle persönlichen Vorteile stellen.
In einer Reihe von Orientierungshilfen für praktische Zweifelsfälle stehen hier exempla sanctorum parallel zubiblischen Geboten und Gesetzen des Kirchenrechts. Dabei werden die Exempla als hagiographisch beglaubigteTaten den präskriptiv-normativen Autoritäten wertmäßig nachgestellt, jedoch höher eingeschätzt als eineandere Art von Beispielen: die in aporetischen Präzedenzfällen gefaßten und als Ratschlägewiederverwendbaren Beschlüsse
1 Ep. 217, II (= The Letters of John of Salisbury, vol. II, ed. W.J. MILLOR, C.N.L. BROOKE, Oxford 1979) 364/366:Quod si meum consilium interim quaeritur, ecce coram Deo […], respondeo quod in omni ardua dubietate censeofaciendum, scilicet, ut primo omnium quaeramus et sequamur quid super hoc lex divina praescripserit; quae si nichilcertum exprimit, recurratur ad canones et exempla sanctorum, ubi, si nichil certum occurrit, tandem explorentur ingenia etconsilia sapientum in timore Domini [Eccli. 9,21–2] illique, seu pauciores seu plures sint, ceteris praeferantur qui honoremDei commodis omnibus anteponunt. Zum historischen Kontext vgl. ebd. Introduction XXXIII. Zu dieser Stelle und anderenAussagen Johanns über das Exemplum vgl. Georg MICZKA, Das Bild der Kirche bei Johannes von Salisbury (Bonner hist.Forsch. 34) Bonn 1970, 36 f.
2
einsichtiger und kompetenter Menschen (consilia)2. Die beiden Entscheidungshilfen exempla und consiliatreten ergänzend neben das abstrakte Gesetz und erklären Sonderfälle oder Gesetzeslücken durch konkretenVergleich3. Sie haben eine aus dem späteren englischen „case law“ bekannte
2 Quintilian verweist innerhalb der probationes inartificiales (unten S. 73 f., 332 f.) auf das Verhältnis von Autoritäten undExempla, indem er (Inst. V 2, 1) die praeiudicia oder „schon einmal so entschiedenen Fälle“ bestimmt: … rebus quaealiquando ex paribus causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur. Vgl. dazu Hélène PÉTRÉ, L’exemplum chezTertullien, Paris 1940, 16 f.; Heinrich LAUSBERG, Hb. d. lit. Rhetorik, München 1960, § 353, p. 192 unten Anm. 375.Zum weiteren, die zitierbaren praeiudicia-Belege wie verba/dicta einschließenden, und zum engeren, ausschließlich aufEreignisse und Handlungen (facta/res) bezogenen Exemplum-Begriff s. S. 158 ff. Die Rangfolge entspricht der traditionellenHierarchie von ratio und exempla (unten S. 87 f., 318 ff.), wie sie etwa (wegen des Nachsatzes mit vorligender Stellevergleichbar) Augustinus, Civ. 1,22 (CC 47, 24.28) formuliert: Sane quippe ratio anteponenda etiam exemplis est, cuiquidem et exempla concordant, sed illa, quae tanto digniora sunt imitatione, quanto excellentiora pietate. Auch in derBenediktiner-Regel erscheint ähnlich die Abfolge von Gesetz und Beispiel (Reg. Ben. 7,55): Der Mönch solle nichts tun, nisiquod communis monasterii regula vel maiorum cohortantur exempla. Die Rangfolge gehört auch in den weiterenZusammenhang der drei theologisch-kanonistischen Erkenntnisstufen: ratio, auctoritas, consuetudo, bzw. lex, ratio,consuetudo (s. unten § 74). – Zu consilia vgl. A. LHOTSKY. Über das Anekdotische in spätmittelalterlichenGeschichtswerken Österreichs, in: Arch. f. Österr. Gesch. 125 (1966) 70–95, hier 76 f., 86 f.: consilia, eine Art Exemplaneben dicta und facta; Geschichtslehren, die aus deliberativen Situationen und Lösungen (Beweggründen, Zielen, auchcausae genannt) gewonnen werden. Wolfgang BRÜCKNER, Historien und Historie, in: Volkserzählung und Reformation,Berlin 1974, 65 zur Dreiteilung der frühneuzeitlichen loci communes historici in deliberative Präzedenzfälle (consilia),Musterzitate (dicta) und Lebensvorbilder (facta).3 Zum kompensatorischen Aspekt der Exempla bei Gesetzeslücken s. unten S. 29, 454 f., 491 ff. Als Teil der consuetudo(S. 84 ff., 318 ff.) galt auch für sie das von Gratian (D. 1 c. 5) ins kanonische Recht übernommene Prinzip Isidors, Etym. 2.10.2: Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex. Vgl. auch GratiansDecretum D. 9 c. 7 (Aug. Ep. LXXXVI ad Casulanum): In his rebus, de quibus nihil certi statuit divina scriptura, mospopuli Dei et instituta maiorum pro lege tenenda sunt. – In der römischen Rechtswissenschaft waren neben Gesetzeslückenwidersprüchliche und mehrdeutige Gesetze die drei Hauptprobleme, die sowohl durch die persönliche auctoritas exempli (imSinne von: stat pro ratione auctoritas) sowie durch die topische Methode im allgemeinen zu lösen gesucht wurden. Dieswird e contrario bestätigt durch eine Regel, nach der beispielhafte und topische Argumentationen die eindeutig gegebenen,positiven Gesetze nicht entkräften sollen (im Codex Justiniani 7.14.13): non exemplis, sed legibus iudicandum est (vgl.unten Anm. 64). Allgemein vgl. Theodor VIEHWEG, Topik und Jurisprudenz, München5 1974, 59 ff., 67; JohannesSTROUX, Röm. Rechtswissensch. und Rhetorik, Potsdam 1949, 25 ff.; s. auch unten S. 271 ff., 313, 432 f.
3
Bedeutung, die allerdings schon wesentlich im Römischen Recht angelegt war. Man könnte sie insofernFallbeispiele oder casus nennen4.
Johann von Salisbury, ebenso Rechtsgelehrter wie Moralphilosoph, versteht unter Exempla nicht nurargumentative Belege, sondern auch ethische Vorbilder, Persönlichkeiten, die sich in ähnlich schwierigerSituation richtig und integer entschieden haben. Wichtig an der Analogie zum gegenwärtigen Fall ist nicht dieHäufigkeit bestimmter Ratschlüsse, sondern die Relevanz, der ethisch-religiöse Verallgemeinerungswert, deran der Selbstlosigkeit hervorragender
4 Vgl. Kurt GEBIEN, Die Geschichte in Senecas philosophischen Schriften, Diss. Konstanz 1969, 55: [Das Exemplum]„kam dem konservativen Empfinden der Römer entgegen, und da es ein Problem in konkreter Situation umreißt, befriedigtees das Bedürfnis nach unspekulativer, kasuistischer Betrachtungsweise, die ihren prägnantesten Ausdruck in der römischenJurisprudenz gefunden hat.“ V. PÖSCHL, Augustinus und die römische Geschichtsauffassung, in: Augustinus magister,Paris 1955, I, 957–63, hier 957 f.: „Bei jeder wichtigen politischen, juristischen und moralischen Entscheidung sucht sichder Römer an Vorentscheidungen zu orientieren, die von großen Persönlichkeiten der Vergangenheit in analogen Situationengetroffen wurden. Maßgebend ist dabei die Persönlichkeit, die auctoritas dessen, der die Entscheidung traf.“ Allgemein zurrömisch-rechtlichen Tradition des Exemplums vgl. F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, München 1934, 125 f.;M. KASER, Röm. Rechtsgeschichte, Göttingen2 1967, 61, 130, 171 f. Zur kirchenrechtlich-patristischen Tradition, in derdas Exemplum zunächst als Beweis zur Begründung eines Verhaltens bei fehlendem Gesetz oder fehlender Bibelstelle diente,vgl. unten S. 455 und Ludwig BUISSON, Die Entstehung des Kirchenrechts, in ZRG kanon. Abt. 52 (1966) 1–175,bes. 102 ff.; ders., Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter (Forsch. z. kirchl. Rechtsgesch. und zumKirchenrecht 2) Köln/Graz 1958, 27 ff.; PÉTRÉ 15 f., 23 ff. Zum Mittelalter, insbesondere zur Rechtstopik innerhalb dersog. „romanistischen“ Renaissance des 12. Jahrhunderts, an der auch Johann von Salisbury teilhat (unten S. 271), vgl.VIEHWEG 62 ff.; A. LANG, Rhetorische Einflüsse auf die Behandlung des Prozesses in der Kanonistik des 12.Jahrhunderts, in: Festschr. E. EICHMANN, Paderborn 1940, 69–97, bes. 69 ff. Johannes GRÜNDEL, Die Lehre von denUmständen der menschlichen Handlung im Mittelalter (Beitr. z. Gesch. d. Philos. u. Theol., des MA’s 39.5), Münster-W.1963, 103 ff. und unten S. 260). Zum casus-Begriff s. S. 27 f. – Zur eigenständigen Entwicklung beider Rechte immittelalterlichen England, wo die gerichtspraktische Orientierung an casus und Präzedenzien dem römischen Recht entsprach,jedoch gerade dadurch einer akademischsystematischen Rezeption des Corpus iuris im scholastischen Geist der Glossatorenentgegenwirkte, vgl. Peter CLASSEN, Die königlichen Richter des Common Law: Rechtswissenschaft und Rechtsstudiumohne Universität, in: ders., Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg. J. FRIED (MGH Schriften 29) Stuttgart 1983,197–237; S. KUTTNER/E. RATHBONE, Anglo-Norman Canonists of the Twelfth Century, An Introductory Study, in:Traditio 7 (1949/51) 279–358, hier 279 ff. – Zur Bedeutung der Jurisprudenz für Johanns Leitideen vgl. Max KERNER,Johannes von Salisbury und die logische Struktur seines Policraticus, Wiesbaden 1977, 84 ff., 152 ff. und unten S. 271 ff.,313, 431 f.
4
Einzelner sichtbar wird. Abgesehen von dem wortnahen Anklang der Parenthese: „seien sie zahlreich odernicht“, scheint der ganze Passus den Beginn der aristotelischen ‚Topik‘ abzuwandeln. Johann zitiert inanderem Zusammenhang die Stelle über die ‚Endoxa‘ (I 1) mit dem interessanten Zusatz des Boethius: „Alswahrscheinlich bezeichnen die Philosophen das, was allen ‚den meisten oder den Weiseren oder [aber] demFachmann auf seinem Gebiet so erscheint“.5Zur Behandlung der dubitabilia übernehmen anstelle der Topoi –nach Aristoteles „wahrscheinliche Sätze, die allen, den meisten oder den Weisen wahr scheinen“ – dieMenschen als anerkannte Exempla richtigen Lebens und weiser deliberatio die Funktion desWahrscheinlichkeitserweises. Unter der Hand stellt sich Johann (in der Rolle des konsultierten „Fachmanns“an seine bisherige Problemlösungspraxis erinnernd) sogar selbst als ein Exemplum hin: nicht für einebestimmte Weisheit, sondern für die kluge Methode des Beispielgebrauchs.6
5 Aristoteles, ‚Topik‘ I 1 (100 b 21–22). – Ioannis Saresberiensis […] Policratici sive de nugis curialium et vestigiisphilosophorum libri VIII, ed. C.C.I. WEBB, London 1909, repr. Frankfurt a.M. 1965 (= Pol. lb. II cap. 22, vol. I,p. 122.19 sqq. (= II 22, 122.19) zu den stoischen Paradoxa: … nos pingui (ut dicitur) Minerva agentes nichil eorumapprobamus, quae omnibus aut pluribus aut sapientibus singulis in facultate sua probabilioribus falsa esse videntur.Ebd. III 5. (I) 182.21: Nempe philosophi probabile dicunt quod videatur vel omnibus vel pluribus aut sapientioribus autquod in propria facultate artifici. Siehe auch Metalogicon IV, ed. C.C.I. WEBB, Oxford 1929 (= Met.) II 3, 65 unten inAnm. 583 und Ep. 209, (II) 320: Opinio tamen in alteram partem potest et debet esse proclivior, ut quod omnibus autpluribus aut maxime notis atque praecipuis aut unicuique probato artifici secundum propriam videtur facultatem, faciliusadmittatur. Vgl. Aristot. Top. 100b, 20 ff., interpr. Boeth., ed. L. MINIO-PALUELLO (Aristoteles latinus V 1–3,Brüssel–Paris 1969) 5.14 ff.: Sunt […] probabilia autem quae videntur omnibus aut pluribus aut sapientibus, et his velomnibus vel pluribus vel maxime notis et probabilibus; ebd. 104 a 7 ff., interpr. Boeth. (ebd.) 15.17 ff.: Est autempropositio dialectica interrogatio probabilis aut omnibus aut pluribus aut sapientibus et his vel maxime notis… Boeth., Dedifferentiis Topicis I (PL 64) 1180 C–D: Probabile vero est quod videtur vel omnibus, vel pluribus, vel sapientibus, et hisvel omnibus, vel pluribus, vel maxime notis atque praecipuis, vel quod unicuique artifici secundum propriam facultatem…Zu letzterem Zusatz vgl. Aristoteles, Rhet. II 23 (1398 b) zu den Endoxa aufgrund des Urteils von Sachverständigen. Zu denBezügen zwischen Topos und Paradeigma seit Aristoteles s. unten §§ 72, 91, S. 193, 421 ff. Den inneren Zusammenhangbeider Beweisfunktionen beleuchtet Ruth SCHIAN, Untersuchungen über das ‚argumentum e consensu omnium‘,(Spudasmata 28), Hildesheim 1973, 116 f. hinsichtlich der Konsensbildung durch evidente Tatsachen nach der ‚Eudem.Ethik‘ I (1216 b).6 Zum rhetorischen Begriffspaar dubietas – certum (oben Anm. 1) und zum Schluß vom Unbezweifelbaren auf Zweifelhaftess. unten S. 62, 201, 555, vgl. LAUSBERG § 419, p. 230. Cicero begründet den Topos aus der Suche nach dem Argumentquae rei dubiae faciat fidem (Top. II 8) und definiert die Induktion (Inv. I 31.51) als oratio quae rebus non dubiis captatassensiones eius quicum instituta est; quibus assensionibus facit ut illi dubia quaedam res propter similitudinem earumrerum quibus assensit probetur. Ähnlich Quintilian, Inst. I, 6.7 zum Analogieschluß: … id quod dubium est ad aliquidsimile, de quo non quaeritur referat, ut incerta certis probet.
5
In einem anderen Brief aus derselben Zeit kommt Johann auf Weltpolitisches zu sprechen: Papst AlexanderIII. sei mit der Absetzung und Bannung Friedrich Barbarossas dem Beispiel seines Vorgängers, Gregors VII.,gefolgt, der Kaiser Heinrich IV. seinerzeit gleicherweise verurteilt habe. Die Feststellung, daß dieser frühereUrteilsspruch „Erfolg gehabt“, den Kaiser in das bekannte Unglück gestürzt hat, berechtigt denGeschichtsbetrachter, ähnlich böse Folgen für den gegenwärtigen „teutonischen Tyrannen“ Barbarossaanzunehmen oder auch nur im „wishful thinking“ vorwegzunehmen.7 Hier liegt – abgesehen vom sakralenBezug auf die unmittelbar von Gott kommende Wirkung kirchlicher Exkommunikation – ein historisch-prognostisches Exemplum vor, wie es zu allen Zeiten gepflegt worden ist: Eine Handlung, deren Ausgang mannoch nicht kennt, wird über einen Analogieschluß mit einer ähnlichen
7 Ep. 242 (II) 474 an Wilhelm Brito:… in quo secutus est exemplum Gregorii septimi, decessoris sui, qui nostra aetateHenricum imperatorem ecclesiae privilegia convellentem deponens in concilio Romano simili sententia condempnavit. Etquidem illa sententia effectum sortita est; et hanc de privilegio Petri latam videtur ipse Dominus confirmasse. In denEditions-Anmerkungen betont BROOKE zur „Absetzung“ Barbarossas 1167, daß hierfür keine anderen historischenQuellenzeugnisse bestehen, und vermutet, daß Johann einem Wunschdenken folge; T. REUTER, John of Salisbury, and theGermans, in: The World of John of Salisbury, ed. M. WILKS (Studies in Church History, Subsidia 3), Oxford 1984 (=World of John) 415.26, hier 417 ff. (zu Ep. 242), zeigt jedoch, daß Johann trotz der rhetorischen Zweckhaftigkeit der Stellegute Gründe hatte, bona fide Barbarossa für abgesetzt zu halten. Zum Kontext des Briefes vgl. auch MICZKA 39. Zuteutonicus tyrannus vgl. die Hauptstellen der Kaiserkritik Johanns bei R.L. BENSON, Political Renovation: Two Modelsfrom Roman Antiquity, in: Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, ed. R.L. BENSON, G. CONSTABLE,Oxford 1982 (= Renaissance and Renewal), 339–86, hier 379 f. – Den Aspekt einer Verquickung des Wunsches mit derPrognose zeigt allerdings auch Johanns subtil insinuatorische Lobpreisung des jungen Heinrich II. in Pol. VI 18, (II) 49–54.Nach einer langen Aufzählung vorbildlicher Herrscher von Caesar über Brennus zu Heinrich I. wird zu verstehen gegeben, derNachfolger stehe verheißungsvoll in dieser Tradition, was seine ersten Taten zu beweisen scheinen. Zuletzt wird diePanegyrik aber so gebrochen (p. 54.1): Nec ego viribus meis arrogo, in quo, si iuxta praecedentis gratiae cursum sibi diusuccesserint prospera, sudare poterunt Orosius Egesippus et Trogus. Ceterum adolescentiae exitus aliquibus suspectus est,et utinam frustra a bonis timeatur. Vgl. auch unten S. 204 f. zu dieser Stelle; S. 178, 517 ff. zu prognostischen undS. 207 f. zu insinuatorischen Exempla.
6
Handlung der Vergangenheit, deren Ausgang man kennt, verglichen und dadurch als tunlich oder untunlicherwiesen.8
2. Voraussetzung ist eine deliberative Situation, wie sie Aristoteles in der Erläuterung des Paradeigmabeschreibt9: Wenn ein Redner das Volk davon überzeugen wolle, daß man im Interesse Griechenlands denPerserkönig daran hindern müsse, Ägypten zu erobern, dann könne er etwa sagen:
8 Zur Definition s. unten § 43 und F. DORNSEIFF, Literarische Verwendungen des Beispiels, in: Vorträge der BibliothekWarburg 4 (1924/5) 206–28, hier 215; Jos. MARTIN, Antike Rhetorik, (Hb. d. Altertumswiss. II 3), München 1974, 120und z. B. Anaximenes (Ps-Aristot.), Rhet. ad Alexandrum 8.1 (1429 a); anon. Rhetorica ecclesiastica (12. Jh.), ed L.WAHRMUND, Quellen zur Geschichte des römischkanonischen Prozesses im Mittelalter, I 4, Innsbruck/Aalen 1905/1962 (=Rhet. eccl.) p. 39: Exemplum est dictum aut factum alicuius vel aliquarum personarum introducto simile negotio. Et ad hocin causa introducitur, ut id, de quo agitur, faciendum vel non faciendum adstruatur. Dieser im Folgenden noch oftverwendete, in der literaturwissenschaftlichen Mediävistik so gut wie unbekannte Text ist nach 1160 (in Hildesheim)entstanden und gilt in der Geschichte des kanonischen und zivilen Rechts als seltenes Zeugnis für eine bestimmteÜbergangsstufe des Rechtsunterrichts: Im 12. Jh. wurde die Jurisprudenz allmählich von einem Zweig der Rhetorik imTrivium zu einer selbständigen Fachlehre umgebildet oder professionalisiert. Die Rhet. eccl. ist aufgrund der Verbindung derälteren mit der neuen Unterrichtspraxis von Interesse. Sie stellt ebensosehr einen Rhetoriktraktat (mit ausführlicherBehandlung der Exemplatechnik) wie ein das Decretum Gratiani und legistische Quellen verarbeitendes, kanonisches undrömisches Recht kombinierendes Lehrbuch über die Regeln des Prozeßverfahrens (ordo iudiciarius) dar. Die Beliebtheitdieses Handbuchs im Unterricht bezeugen zwei Versfassungen (von Eilhard von Bremen, ed. WAHRMUND a.a.O. 15,1906/62, und Altmann von St. Florian). Vgl. Emil OTT, Die Rhetorica ecclesiastica, in: SB Wien 125 (1892) 8. Abh.;LANG (wie Anm. 4) 97; NÖRR (wie Anm. 558) 388; Winfried STELZER, Gelehrtes Recht in Österreich, Von denAnfängen bis zum frühen 14. Jh., (MIÖG Erg.-Bd. 26) Wien 1982, 59, 192 ff.; L. FOWLER-MAGERL, Ordo iudiciorumvel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung (Ius commune, Sonderh. 19) Frankfurt 1984, 45 ff. Zu Rhetorik undJurisprudenz s. auch unten §§ 65, 67.9 Rhet. II 20, (1393 a–b. 26–30); vgl. DORNSEIFF 216 f.; W.L. BENOIT, Aristotle’s Example: The Rhetorical Induction,in: Quarterly Journal of Speech 66 (1980) 182–192, hier 189 f. Ein anderes berühmtes Beispiel für das Beispiel ist Rhet. I 2(1357 b), wonach Dionysius als Tyrann erscheint, weil er (wie vor ihm schon Peisistratos und Theagenes) eine Leibwacheforderte. Denn „wer nach Gewaltherrschaft trachtet, fordert eine Leibwache.“ Iulius Victor kommentiert dies in seiner Arsrhetorica (Rhet. lat. min., ed. C. HALM) VI 3, p. 399: Si custodes corporis Dionysio dederitis, idem faciet quodPisistratus, qui quum a suis civibus custodes corpori postulasset, tyrannidem occupavit. Hoc enim manifestum est dePisistrato, dubium autem erat de Dionysio. Vgl. oben Anm. 6 zum Bezug dubium-certum. Zum aristotelischen Paradeigmavgl. auch unten § 17.
7
Auch früher ist Dareios nicht eher herübergekommen, als bis er Ägypten an sich gebracht hatte. Und ebenso hatXerxes nicht eher angegriffen, als bis er es hatte; und als er es hatte, ist er herübergekommen. Darum wird auch derjetzige König, wenn er es an sich gebracht hat, herüberkommen; folglich muß man ihn daran hindern.
Wir könnten leicht Hunderte ähnlicher Beispiele aus unserem eigenen politischen Alltag oder aus derGegenwartspresse zitieren: Kern des Exemplums ist immer ein Analogieschluß, mit dem aus empirischen oderhistorischen Daten eine fragliche praktische Entscheidung überprüft, bekräftigt oder abgelehnt werden kann,d. h. eine „Methode der Wirklichkeitsbewältigung.“10
B) GESCHICHTE UND EXEMPLUM
Historia magistra vitae (§ 3), statischer Geschichtsbegriff und prognostisches Vergangen-heitsinteresse (§ 4).
3. Das so bestimmte Beispiel hat anthropologisch universale Bedeutung. Von Geschichtstheoretikern wird esals Hauptverfahren der „Geschichte als Argument“ oder als „schlechthinniges Modell des historischenWissens“ bezeichnet.11 Gemeint ist damit allerdings nur, daß das Exemplum das Rückgrat jenerGeschichtsauffassung bildet, die vor der modernen selbstzwecklichen Geschichtswissenschaft die alleinige warund seit dem 19. Jahrhundert, als vorwissenschaftlich oder gar unhistorisch abgewertet, auf niedrigererBildungsstufe ungebrochen populär geblieben ist. Mit umgekehrtem Vorzeichen läßt sich ausliteraturtheoretisch-rhetorischer Sicht sagen, daß der Nutzen der Geschichte für das nicht-geschichtswissenschaftliche Interesse primär bis ausschließlich
10 „Methode …“: Chr. DAXELMÜLLER, Art. ‚Exemplum‘, in: EM, Berlin 1983, s. l., 627–59, hier 643. – Auf die immerund überall gültigen vorwissenschaftlichen Voraussetzungen dieses prognostischen Beispielschlusses oderErinnerungsvergleichs in Entscheidungs- und Beurteilungssituationen weisen hin DORNSEIFF 207; GEBIEN 17,95; HansLIPPS, Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalles zum Gesetz, in: ders., Die Verbindlichkeit der Sprache,Frankfurt a.M.3 1958, 39–65, hier 45 f.; M. FUHRMANN, Das Exemplum in der antiken Rhetorik, in: Poetik undHermeneutik V: ‚Geschichte – Ereignis und Erzählung‘, München 1973, 449–52, hier 449; Ch. PERELMAN, L’empirerhétorique, Rhétorique et argumentation, Paris 1977, 119; vgl. auch unten S. 22 ff., § 108.11 „Geschichte als Argument“: unter diesem Titel hielt Alexander DEMANDT einen in Universitätsreden 46, Konstanz 1972erschienenen Vortrag; s. hier bes. 13 ff. – „Schlechthinniges …“: Ernesto GRASSI, Die Macht der Phantasie. Zur Geschichtedes abendländischen Denkens, Königstein 1979, 111. – Zur exemplarischen Geschichte bis zur Neuzeit s. untenS. 19,521 ff., 533 f.; vgl. auch M. HAHN, Art. Geschichte, pragmatische, in: HWGPh III (1974), s. 1. 401 f.; S.BATTAGLIA, La coscienza letteraria del medio evo, Neapel 1965, 480 f.; Hans Robert JAUß, Ästhetische Erfahrung undliterarische Hermeneutik, Frankfurt a.M. 1982, 344 ff.
8
im „lebensweltlichen“ Exemplum liegt. Pragmatisch schreibt dazu der Verfasser der Rhetorica adHerennium:12
Unerfahrene, die zu einem jeden Sachverhalt nicht Beispiele früherer Ereignisse heranziehen können, werden sehrleicht und, ehe sie sich’s versehen, hinters Licht geführt. Wer aber weiß, was anderen geschieht, kann leicht ausfremden Geschehnissen für eigene Argumente Vorsorge treffen.
Es mag aufgrund der konventionellen Vorstellung einer „reinen Information“, die ihren Zweck in sich selbsthat und einen eigenen Wert darstellt, befremdlich erscheinen, daß es Zeiten gab, die zu einer solchenAbstraktion und Isolierung des Zwecklosen („Sinnlosen“) aus den Verzweckungen des wirklichen Handelns undRedens nicht fähig oder nicht willens waren; Zeiten, für die Geschichte und Exemplum ineinander aufgingen.Dem Geschichtsforscher gilt die Frage nach dem, „was geschehen ist“, nicht diejenige nach dem, was zugeschehen hat, als das eigentliche Motiv seines Tuns.13
Darum muß betont werden, daß das Exemplum im Mittelalter die Geschichte gewissermaßen zudeckt und daßauch Johann von Salisbury, wo immer er sich auf Geschichte bezieht, Exemplarisches und Paradigmatischesmeint (am unmittelbarsten, wie in den beiden angeführten Stellen, in den Briefen).14 TheoretischeBegründungen für den Exempla-Gebrauch gibt Johann vor allem innerhalb seiner bekannten Erziehungs- undBildungslehre im Metalogicon, zum einen in der von Aristoteles bestimmten Argumentationstheorie zumanderen in Bezug auf eine praxisorientierte Pädagogik der Einübung und Nachahmung von Vorbildern.15 Diespezifisch historiographische Bedeutung
12 Rhet. ad Her. IV 9, 13: rerum inperiti, qui unius cuiusque rei de rebus ante gestis exempla petere non possunt, ii perinprudentiam facillime deducuntur in fraudem: at ii, qui sciunt, quid aliis acciderit, facile ex aliorum euentis suisrationibus possunt prouidere.13 Zur Tradition der Unterscheidung von factum und faciendum s. S. 87 f., 318. Eine bloße Beschäftigung mit den Tatsachenkennt die Antike im literarisch-elocutionellen Bereich der historischen narratio, die ein reines Abschildern der res gestaeohne Parteinahme darstellen soll (vgl. unten Anm. 719) und sich insofern von der rhetorischen probatio unterscheidet.Dennoch kennen Rhetorik und Philosophie in geschichtstheoretischer Hinsicht nur die exemplarisch-pragmatische Historie.Zu graduellen Unterschieden innerhalb dieses Grundmodells von der platten Prognostik und direkten Nutzanwendung vonGeschichtsgesetzen bis zur philosophischen Geschichtsbetrachtung als Menschenkenntnis s. Jaqueline de ROMILLY,L’utilité de l’histoire selon Thucydide, in: Entretiens sur l’Antiquité classique, Fondation Hardt 4: ‚Histoire et historiensdans l’Antiquité‘, Genf 1958, 39–82, hier 42 ff. (aufgrund von ROMILLYS Monographien: Histoire et raison chezThucydide, Paris 1956; Thucydide et l’impérialisme athénien, Paris 1947).14 Vgl. auch MICZKA 36 ff.; KERNER 39 und unten § 42, S. 154 f., 503 ff.15 Met. III 10, 153 ff.; II 20, 99 f., 111 ff. vgl. unten § 50. – Zur aristotelischen, auf Induktion beruhenden Erkenntnis- undArgumentationstheorie s. Daniel D. McGARRY, Educational Theory in the Metalogicon of John of Salisbury, in: Spec. 23(1948) 659–75, bes. 665 ff.; Ursula ODOJ, Wissenschaft und Politik bei Johannes von Salisbury, Diss. München 1974,11 ff., 38 ff., 114. Zu der wesentlich von Quintilian bestimmten pragmatischen Erziehungstheorie s. S. 167 f., 376 f.; vgl.McGARRY 672 ff.; ODOJ 46 f.; James J. MURPHY, Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley-Los Angeles-London 1974,128 ff.
9
des Exemplums umschreibt er elementar im Prolog zu seiner Historia pontificalis, einem Meisterwerkmittelalterlicher Zeitgeschichtsschreibung:16 „Wie der Heide sagt, ist das Leben der anderen unserLehrmeister; und wer nichts von der Vergangenheit weiß, eilt blind in die Zukunft.“ Nam, ut ait ethnicus,‚aliena vita nobis magistra est‘ et qui ignarus est praeteritorum quasi cecus in futurorum prorumpit eventus.
4. Über das Formelhafte dieses in vielen Varianten geläufigen Prologmotivs der Historiker17 hinaus führt eine„wahrnehmungspsychologische“ Feststellung Johanns zum Wert der Induktion:18 „Da es – wie Plato inseinem ‚Staat‘ bemerkt – leicht ist, die Geheimnisse der Natur aus dem, was immer
16 The Historia Pontificalis of John of Salisbury, ed. M. CHIBNALL, London 1956/1965 (= Hist. pont.) 3 mit DistichaCatonis III 13. Zum Kontext s. unten Anm. 980; vgl. dazu auch die nächstliegende Quelle der Dist. Catonis: Sen. Nat.Quaest. III praef. über den der Natur gleichzustellenden moralischen Wert der Geschichte, die aliena mala zur Verhütungeigener Übel tradiere. Zu Johanns historiographischer Begabung vgl. S. 503 f. Zum Begriff aliena vita s. Rhet. ad Her. IV9,13 oben Anm. 12. Vgl. auch Arnulfs Lucan-Glosse (Arnulfi Aurelianensis glosulae super Lucanum, ed. B. MARTI, Rom1958) zu IX 888: Cato ‚vincit casus‘, id est eventum fortune […] non solum in suo pectore sed in ALIENO, sc. in militibussuis et in posteris per exemplum, quia dedit exemplum vincendi dolores per patientiam. Interessant ist hier auch der Prologzu Hugos von St. Victor ‚De tribus maximis circumstantiis gestorum‘ (ed. W.M. GREEN, in: Spec. 18 [1943] 491), wodieselbe Terminologie zur Unterscheidung von historia als bloßer Erzählung im Literalsinn und tropologia sive moralitasverwendet wird: Unde etiam recte tropologia, id est sermo conversus sive locutio replicata, nomen accepit, quia nimirumalienae narrationis sermonem ad nostram tunc eruditionem convertimus, cum facta aliorum legendo ea nobis ad exemplumvivendi conformamus.17 Prologtopos: s. Benoit LACROIX, L’historien au moyen âge, Montréal–Paris 1971, 168 ff. Joachim EHLERS, Hugo vonSt. Viktor, Studien zum Geschichtsdenken und zur Geschichtsschreibung des 12. Jhs., Wiesbaden 1973, 152, 173; G.SIMON, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jhs., in:Arch. f. Diplomatik 4 (1958), 59–119 (= I) 5/6 (1959/60) 73–153 (= II), hier II 103 ff. Zu dem dahinter stehenden, in derklassischen Formulierung Cic. De orat. II 36 im Mittelalter wenig bekannten historia magistra vitae-Satz s. unten S. 19,521 ff.18 Met. IV 10, 176.7–10: Et quia, ut in Politia ait Plato, facile est assequi naturalia archana ex his quae frequenteraccidunt, imaginem eorum que future sunt, concipit ex qualitate eorum que presentialiter sentit vel aliquando sensit. ZumKontext s. unten Anm. 874.
10
wieder geschieht, zu verstehen, erfaßt unsere Vorstellung Zukünftiges nach dem Muster gegenwärtiger odervergangener Wahrnehmungen …“. Dieses Zitat aus Chalcidius19 steht im Zusammenhang einerWissensbegründung aus der Verarbeitung von wiederholten Sinneseindrücken zu „Abbildern“ (imagines) undErfahrungen im Schatzhaus des Gedächtnisses zum Nutzen der Einbildungskraft (imaginatio), die aus ihnenihrerseits wieder neue, ähnliche Vorstellungen entstehen läßt.20 Was Johann in der vermeintlich platonischenStelle vom erkennenden Subjekt sagt, bezieht Aristoteles wortnah, aber im objektbezogenen Sinn auf dashistorische Paradeigma:21 „Wirksamer […] ist es, bei der beratenden Rede durch den Verweis auf historischeFakten zu argumentieren; denn für gewöhnlich ist das, was geschehen soll, dem Geschehenen ähnlich.“ Wenndie hier angesprochene Analogie von Vergangenem und Zukünftigem nach dem heutigen altertumskundlichenForschungsstand nicht mehr uneingeschränkt auf eine vermeintlich grundlegende
19 Calcidius, Comm. in Tim., § 231, ed. J.H. WASZINK, Plato Latinus IV, London– Leiden 1962, nr. 268, p. 245 f.: Exconiectura siquidem nascitur opinio, ex opinione intellectus, ut idem Plato docuit in Politia [Respubl. 533d 7 ff.;cf. 244.21 ff., 344.19 ff.]. Facile est assequi naturalia arcana ex his quae frequenter accidunt, omnes quippe corporeaepassiones mentem deliberationemque eius impediunt non nisi in capite proveniunt. Platos ‚Staat‘ wird also nicht als Quelledes von Johann gemeinten, sondern des unmittelbar vorangehenden Satzes zitiert. Chalcidius bezieht sich auf kritischbeschreibende Stellen Platos (wie Respubl. III 395 b, X 606 b; Leg. II 653 a) über Erfahrung und Gewohnheit. Vgl. dazuauch KOSELLECK (wie Anm. 37) 136 über den prognostischen Nutzen der Vergangenheit (laut Leg. 691 b, 692 b–c) mitdem hypothetischen Gedanken, daß man aus der Geschichte nur lerne, was hätte geschehen sollen, wenn man damals dieFolgen hätte voraussehen können (vgl. auch Anm. 214, 874, 1000).20 Aufgrund von Aristot. Metaph. A 1.980 a entwickelt Johann seine psychologische Theorie in Met. IV 8–12. HansLIEBESCHÜTZ (Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury, London 1950/Nendeln 1968) betont(S. 76) mit Recht, daß Johann trotz seiner Beziehung zu Bernhard von Chartres und der sog. „Schule von Chartres“ ein striktaristotelischer Verfechter der induktiven Logik und Erkenntnistheorie gegen die platonische Ideenlehre war; dazu vgl. auchMario DAL PRÀ, Giovanni di Salisbury, Milano 1951, 70 ff.; McGARRY 666 f.; ODOJ 46 ff. und unten S. 147, 434,542.21 Rhet. II 20, 1394 a 8 (ähnlich auch I 35, 1368 a 38: „Die Beispiele aber gehören in den Bereich der Beratungsrede; dennaus dem Geschehenen beurteilen wir weissagend das Zukünftige.“). Vgl. THROM (wie Anm. 545) 12 zu Anal. pr. 70 a 10:Was sich meistens, aber nicht notwendig in einer bestimmten Weise verhält, ist bei Aristoteles der Inbegriff desWahrscheinlichen und Gegenstand der Rhetorik, nicht der „Wissenschaft“. – Vgl. auch die von Aristot. Rhet. I 35; II 20abhängige Begründung des Exemplums für die Suasorie bei Quintilian, Inst. 3.8.66: usum exemplorum nulli materiae magisconvenire merito fere omnes consentiunt, cum plerumque videantur respondere futura praeteritis habeaturque experimentumvelut quoddam rationis testimonium.
11
„zyklische Geschichtsauffassung der Griechen“ zurückgeführt werden kann, so dürfte dieses Erklärungsmusterauf die breite mittelalterliche Rezeption der entsprechenden loci communes über Vergleichbarkeit oderÄhnlichkeit aller Zeiten und über den prognostischen Wert des Geschichtsstudiums erst recht nicht zutreffen.Dieses Defizit wird uns im Folgenden als Problem mehrfach beschäftigen und nach differenzierterenDeutungskategorien suchen lassen.22
Die Exemplarität der Geschichte preist Johann auch so:23 Historisches Wissen sei wichtigstesErkenntnismittel nach dem Offenbarungswissen. „Nach der Gnade und dem Gesetz Gottes ist für die Lebendenkeine Lehre zuverlässiger und solider als die Kenntnis von den Taten der Vorfahren.“ Die Brücke von dieserreligiösen – die Erstoffenbarung Gottes durch die Schöpfungsnatur voraussetzenden – Wertschätzung derGeschichte hinüber zum pragmatischen Motiv der Zukunftserkundung aus Vergangenheitskenntnissen bildetdas, was Richard W. Southern in seiner grundlegenden Studie über die Geschichtsschreibung im Mittelalter denprophetischen Geschichtsbegriff – „history as prophecy“ – genannt hat:24 der Glaube, daß Gott, der alleEreignisse bis um Ende der Zeiten geplant hat und vorausweiß, dem Menschen durch Zeichen mittelbar oderdurch wunderbares Eingreifen ins Weltgeschehen unmittelbar einzelne Durchblicke auf den providentiellenGesamtplan gestattet. Als signa und „Fingerzeige“ Gottes galten so auch vergangene Geschehnisse, sofern esdem Historiker – dem „rückwärtsgewandten Propheten“ im eigentlichen Sinne des Wortes – gelang, sie „imGeiste“ richtig zu deuten.25
22 Zum zyklischen und linearen Geschichtsbegriff s. unten §§ 108 f. Zur literarisch-rhetorischen Tradition dieser Topoi vgl.etwa Quint. 3.8.66 in Anm. 21; Seneca Ep. 83,2: consilium futuri ex praeterito venit; ebd. 76,35; 82,2. HildebertusCenom., Ep. II 27 (PL 171) 246 A: Plerumque fit ut ex praeteritis eventum colligamus futurorum; usw. Vgl. C.B.WELLES, Isocrates‘ View of History, in: ‚The Classical Tradition‘, FS H. CAPLAN, New York 1966, 14 (allgemeinakzeptierte Geschichten über Vergangenes bestätigen die Gegenwart, diese aber bestätigt die Erzählungen der Historiker);GEBIEN 30 f., BATTAGLIA 451 f.; Rüdiger LANDFESTER, Historia magistra vitae, Untersuchungen zur humanistischenGeschichtstheorie des 14. bis 16. Jhs. (Travaux d’Humanisme et Ren. 123), Genf 1972, 152 ff.23 Hist. pont. 3 f.: Nichilque post gratiam et legem Dei viventes rectius et validius instruit quam si gesta cognoverintdecessorum.24 R.W. SOUTHERN, Aspects of the European Tradition of Historical Writing, III: History as Prophecy, in: Transactions ofthe Royal Hist. Soc., Vth Ser., vol. 22 (London 1972) 159–80, hier bes. 168 ff.25 Vgl. Hist Pont. 11 zu den signa Dei, vgl unten S. 155, 519 f.; allgemein N.F. PARTNER, Serious Entertainments, TheWriting of History in Twelfth Century England, Chicago–London 1977, 212 ff.; G. MELVILLE, System und Diachronie,Untersuchungen zur theoretischen Grundlegung geschichtsschreiberischer Praxis im Mittelalter, in: HJb 95 (1975) 33–76,308–41, hier 38 ff. u. ö.; Bernard GUENÉE, Histoire et Culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980, 20 ff.; L.BOEHM, Der wissenschafts-theoretische Ort der historia im früheren Mittelalter, in: Speculum historiale, Festschr. J.SPÖRL, Freiburg–München 1965, 663–93, hier 687 ff.; Hans BLUMENBERG, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a.M.1981, 69 ff.
12
Gerade das Zwölfte Jahrhundert zeigt auf den verschiedensten Gebieten ein starkes Bedürfnis nach Voraussagekünftiger Dinge, das einerseits zu abergläubischen und magischen – von Johann, gerade weil sie so beliebtwurden, heftig kritisierten26 – Deutungspraktiken führte; das andererseits zur Intensivierung desGeschichtsstudiums beitrug, wozu auch das Auswerten tradierter Exempla gehörte, und das schließlichvermehrtes Interesse an Visionserfahrungen und wunderbaren Erscheinungen weckte, deren Kunde sich schnellüber weite Teile Europas verbreitete. Es paßt vielleicht schlecht zur etablierten Vorstellung vom„aufgeklärten“ Humanisten aus Salisbury, ist aber ein hervorragendes Zeugnis für eine echt pragmatische,zeitgeschichtliche Neugierde, daß Johann in einem Brief von 116627 seinen gelehrten
26 Vgl. Barbara HELBLING-GLOOR, Natur und Aberglaube im Policraticus des Johannes von Salisbury, Diss. Zürich,Einsiedeln 1956, passim u. 27 ff.; KERNER 170 ff. Johann kritisiert menschliche Eigenmächtigkeit und überheblichecuriositas, d. h. ein Verkennen der Erkenntnisgrenzen, bestreitet jedoch nicht die Realität okkulter Phänomene innerhalb derSchöpfungsordnung (s. z. B. Pol. II 2,70). Dies entspricht SOUTHERNS genereller Feststellung (168 f.), daß nicht Naivität,sondern „a too ambitious view of the knowledge which is accessible to man“ gerade Gelehrte zu einem abergläubischenNatur- und Geschichtsverständnis führte. Entsprechend läßt sich auch die von T. GREGORY hervorgehobene Paradoxieverstehen, daß die Ablösung der symbolischen Kosmos-Deutung durch das Modell wissenschaftlicher Kausalerklärungen imZusammenhang mit dem kosmologischen Platonismus im 12. Jhs. zur Beliebtheit der Astrologie und später der Alchemiebeitrug: eine frühe „Dialektik der Aufklärung“! (T.G., La nouvelle idée de nature et de savoir scientifique au XIIe siècle, in:J.E. MURDOCH et al., ‚The Cultural Context of Medieval Learning‘, Dordrecht 1975, 194–218). Vgl. z. B. BernhardSilvestris, Cosmographia I 3 (ed. P. DRONKE 1978) 104 f. Vs. 31–73: eine von Vergil inspirierte poetische Umkehrunghistorischer Beispiele zu Vorhersagebeispielen aus der Sicht eines fiktiven Ursprungs und als Beleg für die lex fatalis. Dazuvgl. auch VON DEN STEINEN, Bernhard Silvestris (wie Anm. 569) 232 ff.27 Ep. 185, (II) 224 f.: De cetero communicate michi, si placet, novorum aliquid quae in expilatis invenitur armariis, si nonaliud occurrit, quod nostratibus desit, saltem visiones et oracula beatae illius et celeberrimae Hildegardis apud vos sunt[…] Explorate etiam diligentius et rescribite an ei sit de fine huius scismatis aliquid revelatum. Praedixit enim in diebusbeati Eugenii quod non esset nisi in extremis diebus pacem et gratiam in urbe habiturus. Zu Girardus Pucella, mit demJohann in Paris Philosophie studiert hatte und der danach als Magister beider Rechte in Paris eine auch politischeinflußreiche Rolle spielte, vgl. CLASSEN, Studium (wie Anm. 4) 144; KUTTNER/RATHBONE (wie Anm. 4) 296 ff.; J.SPÖRL, Rainald von Dassel in seinem Verhältnis zu Johann von Salisbury, in: HJb 60 (1940) 250–7 und unten Anm. 564.– Die angeführte Stelle befindet sich am Ende des Briefes in der Art eines Nachtrags diverser Einzelheiten (in der Bitte um„Neuigkeiten“). Zu dieser Stelle und zu Johanns Benützung der Merlin-Weissagungen im Becket-Konflikt s. SOUTHERN,Aspects 168–70. – Johanns Interesse an Hildegard wird allerdings aufgrund des neu erarbeiteten Hildegard-Bildes vonChristel MEIER verständlicher; zu der in produktions- und rezeptions-geschichtlicher Hinsicht bisher weitgehend verkanntenintellektuellen Bedeutung der wahrscheinlich über Rupert von Deutz durch Eriugena wesentlich beeinflußten Hildegard-Visionen vgl. MEIER, Eriugena im Nonnenkloster? Überlegungen zum Verhältnis von Prophetentum und Werkgestalt in denfigmenta prophetica Hildegards von Bingen, in: FMSt 19(1985) 466–497; dieselbe, Prophetischer Geist und literarischeForm, Untersuchungen zur Ästhetik der mittelalterlichen Vision (Studien zu Hildegard von Bingen, Bd. 1) i. Ersch.
13
Freund, den damals in Köln weilenden englischen Kirchenrechtslehrer Girardus Pucella in den OffenbarungenHildegards von Bingen nach einem einschlägigen Hinweis zum genauen Zeitpunkt der ersehnten Beilegung desdamaligen Schismas zu forschen bat. Die Prophetie hatte also wie das Exemplum die Funktion einer Erhellungkonkreter Gegenwartsprobleme.
C) DAS PROBLEM: HISTORISCHER REALITÄTSGEHALT LITERARISCHER EXEMPLA
Die Memorabilien des Policraticus u. ä. Werke als „bloße Literatur“. (§ 5) Was ist „Wirklichkeit“? (§ 6) Wiederverwendbareund einmalige Geschichtsanalogien. (§ 7) Das illustrative Exemplum des „didaktischen“ Mittelalters und das induktiveExemplum der „empirischen“ Renaissance: ein Periodisierungskriterium? (§ 8)
5. In der Forschung ist längst anerkannt, daß Johann von Salisbury einen außergewöhnlichen Sinn fürhistorische Zusammenhänge und politische Zeitfragen entwickelt hat, daß er als „praktischer Philosoph“besonderen Wert auf die Realisierung von Ideen gelegt und eine ausgesprochene Abneigung gegen alles nurGedachte empfunden hat. Er steht gewissermaßen als Prototyp des englischen Pragmatikers vor uns.28 DiesesBild, das hier gewiß in
28 Vgl. z. B. KERNER 24 ff., 205 u. ö.; DAL PRÀ 37, 45, 60 f., 146, 153 u. ö.; Clemens I.C. WEBB, John of Salisbury,London 1932, 176 ff.; LIEBESCHÜTZ, Med. Humanism. 1, 79, 90; ders., Das zwölfte Jahrhundert und die Antike, in:AKG 35 (1953), 247–71, hier 263; ders., Chartres und Bologna, Naturbegriff und Staatsidee bei Johannes von S., in:AKG 50 (1968) 3–32, hier 8 f.; Georg MISCH, Geschichte der Autobiographie III 2, Frankfurt a.M. 1962: Johannes vonSalisbury und das Problem des mittelalterl. Humanismus, 1157–1295, hier 1250; R.W. SOUTHERN, The Place of Englandin the Twelfth Century Renaissance, In: History 45 (1960) 201–16, hier 205 f. (auch in: ders., Medieval Humanism andOther Studies, Oxford 1970, 158–180); G. SCHOLTZ, Art. Geschichte, in: HWbPh III 349; B. MUNK-OLSEN,L’Humanisme de Jean de S., un cicéronien du XIIe siècle, in: Entretiens sur la Renaissance du XIIe siècle, ed. M. deGANDILLAC/E. JEAUNEAU, Paris 1968, 53–83, hier 56, usw., auch unten S. 503 f.
14
einigem bestätigt werden kann, scheint sich jedoch eher aus vielen seiner anderen schriftlichen Zeugnisse zuergeben als gerade aus seinem Hauptwerk, dem Policraticus, der insofern ein Problem darstellt. Die Forschunghat den darin vorherrschenden Exemplagebrauch im allgemeinen mehr getadelt als gelobt, weil er aus rein„literarischen“ Beispielgeschichten, Anekdoten, Apophthegmen, Anspielungen auf berühmtePersönlichkeiten der Geschichte und auf deren Aussprüche besteht, kaum aber aus jenen echt historischenoder empirischen Daten, die definitionsgemäß zu praktischer Orientierungshilfe in deliberativen Situationengeeignet sind. Etwa die Hälfte des Gesamttextes enthält in der Tat historische Kurzgeschichten ausStandardwerken der rhetorischen Vorratsliteratur (wie Valerius Maximus) und aus einigen im Mittelalterweniger oder kaum bekannten Memorabilienquellen ähnlichen Zuschnitts, denen offensichtlich Johannsbesonderer Sammeleifer galt.29 Die Kritik bemängelt vor allem, daß solche literarischen Exempla sowohleinem wirklich historischen Interesse an der Vergangenheit als auch einem konkreten, lebendigenGegenwartsbezug entgegenstehen. Das eine rügte etwa Hans Liebeschütz:30 Für Johann sei die Antike bloß„eine Art Bilderbuch zur Illustration typischer Lebensformen des 12. Jahrhunderts“. Den anderen Vorwurferhob in repräsentativer Weise Johan Huizinga:31 „Wir möchten,
29 Zu diesem Sammeleifer vgl. J. MARTIN, John of Salisbury’s Manuscripts of Frontinus and of Gellius, in: JWCI 40(1977) 1–26; dieselbe, Uses of Tradition: Gellius, Petronius and John of S., in: Viator 10 (1979) 58–76 und unten S. 136.30 LIEBESCHÜTZ, Humanism 94; vgl. auch ebd. 58, 70 ff. Vornehmlich Altphilologen und an der klassischen Traditioninteressierte Mediävisten äußern diese Kritik; vgl. noch Janet MARTIN, John of Salisbury and the Classics (ungedr. Diss.),Cambridge Mass. 1968, 196 nach einem Zitat bei KERNER 32: „John’s interest in ancient history was of the mostsuperficial kind …“; R.R. BOLGAR, The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge 1954/1973, 199 f.: „… Johnknew many of the facts of ancient history. But did his knowledge amount to a real understanding? […] The classicalanecdotes torn from their context have a purely rhetorical character […] John’s work is typical […] His classical knowledge isnot narrow, but it is fragmentary and it influences his view of the world from the outside […] widening his experience butnot as yet providing the kernel of his thought.“31 J. HUIZINGA., Zwei prägotische Geister: Abaelard – Johannes von Salisbury (1933/1935), Geschichte und Kultur, Ges.Aufsätze, hrsg. K. KÖSTER, Stuttgart 1954, 161–211, hier 200 f. Die Stelle wird auch angeführt von Claus UHLIG(Hofkritik im England des Mittelalters und der Renaissance, Berlin 1973, 42), der (ebd. 27–54, 109) seine Enttäuschungüber den Mangel an konkreter zeithistorischer Information äußert. Diese Art von Kritik, die vom Primat modernerFragestellungen gegenüber Johanns wirklichen Intentionen zeugt, wird auf die Spitze getrieben in der militärgeschichtlichenArbeit von Roman W. BRÜSCHWILER. (Das 6. Buch des ‚Policraticus‘ von Johannes Saresbiriensis [John of Salisbury],Ein Beitrag zur Militärgeschichte Englands im 12. Jh., Diss. Zürich 1975), der (S. 104) festhält: „für das Militärwesenkönnen wir ihn wirklich nur (und eben noch) als Theoretiker gelten lassen, der nicht als Zeuge aktueller Zustände sprechenkann.“ (Der Autor hätte wohl gern im Sinne von Sternes ‚Uncle Toby‘ etwas über Befestigungsanlagen gelesen.) G. MISCHstellt – überdies einem eingewurzelten romantischen Vorurteil gegen mittellateinische Literatur nachgebend – Johanns„Ausweichen aus der drangvollen Lebenswirklichkeit“ ins Literarische sowie eine einseitige Überschätzung der totenlateinischen Kultur gegenüber der lebendigen (volkssprachlichen) Sprachkunst der eigenen Zeit fest (III 2, 1184, 1188). –Demgegenüber hat LIEBESCHÜTZ mehrfach feinsinnig auf eine gewisse Distanz Johanns zum Zeitgeschehen durch taktischoder deskriptiv motivierte „Zwischenschaltung der Antike“ hingewiesen (vgl. wie Anm. 28: Das 12. Jahrhundert, 268;Humanism 6, 108, 47; Chartres und Bologna 4); zur Kritik am Vorwurf der Gegenwartsferne s. auch KERNER 191 f.
15
daß er uns mehr von seiner eigenen Zeit und weniger antike Figuren und Exempel, von denen der Policraticusvoll ist, gegeben hätte.“ Beide Ansichten widersprechen sich nur scheinbar; der Stein des Anstoßes istderselbe: die mangelnde Wirklichkeitsnähe im neuzeitlichen Sinn.32 Hinzu kommt ein dritter kritischerPunkt: Seitdem Justus Lipsius den Policraticus eine „Mosaikarbeit der buntesten Zusammensetzung“, einen„Cento vieler Purpurlappen und Fragmente aus einem besseren Zeitalter“ genannt hat,33 wird unablässigwiederholt, die Kompositionslogik des Werks lasse zu wünschen übrig, werde von den vielfältigenKurzerzählungen an allen Enden durchkreuzt und verwirrt.34 Christopher Brooke schloß daraus auf einepersönliche Eigenschaft des Autors:35 „Ihm fehlte eines: die Fähigkeit, ein Buch zu schreiben.“
32 Zur Diskussion dieser Ermessensfrage s. unten S. 529 f., 546.33 Vgl. FABRICIUS, Notitia litteraria (Bibl. med. et inf. lat. VI 131) in PL 199, col. XIII C–D: Polycraticus […] opusvarium jucundumque lectu, et in quo centone multos pannos purpurae et fragmenta melioris aevi agnovit Lipsius. (inseinem Tacitus-Kommentar zu XII 63). Dabei ist einschränkend anzumerken, daß die Auffassung des horazischenPurpurlappens durch Lipsius und Fabricius noch nicht wie in der späteren Rezeption dieses Zitats etwa bei C.SCHAARSCHMIDT (Johannes Saresberiensis nach Leben und Studien, Schriften und Philosophie, Leipzig 1862, 86 f.)negativ gemeint sein dürfte, sondern auf die eingewobenen „Kleinodien“ der Antike und auf Johanns Fähigkeit zur variatiound imitatio zu beziehen ist. Dazu vgl. F. QUADLBAUER, Purpureus pannus. Zum Fortwirken eines horazischen Bildes inSpätantike und lateinischem Mittelalter, in: MlatJb 15 (1980) 1–32 und unten S. 556, 565.34 Vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 1 f. 6 („the impression of logical deficiency“), 51, 71 ff.; ders. Chartres (wie Anm. 28)4, 13; UHLIG 41 („ein Werk, dem man einheitliche Gedankenführung absprechen muß“); W. ULLMANN, John ofSalisbury’s Policraticus in the Later Middle Ages, in: Festschr. H. LÖWE, Geschichtsschreibung und geistiges Leben imMittelalter, Köln/Wien 1978, 519–45, hier 520 („the examples are dexterously invoked, sometimes admittedly in a diffusemanner which is apt to detract from the main topic“); D. KNOWLES, The Evolution of Medieval Thought, London 1963,137 (Johanns Werk sei „very discursive and without sequence of topic and crescendo of interest“). – Eine kritischeAuseinandersetzung mit dieser opinio communis bei KERNER 186 ff., 129, 198 f. Vgl. auch unten S. 355 f.35 The Letters of John Salisbury I, London 1955, Introduction XLV; daselbst werden Policraticus und Metalogicon als „twofragments of a vast encyclopedia of the liberal arts, of philosophy and politics“, „a museum of matter ancient and modern[…] cluttered with junk and only slightly organised“ bezeichnet. Ebd. XLII: „a warehouse of examples, muffled in the haloof the Christian ethical tradition …“
16
6. Johann scheint also im Policraticus unsere Erwartungen, die wir aufgrund seines Ruhms als Historiker und„Pragmatiker“ an sein Werk stellen zu dürfen glauben, irgendwie enttäuscht zu haben. Abgesehen von derFrage nach dem Sinn solcher Erwartungen, müßte untersucht werden, wie er selbst sich das Verhältnis vonhistorischer und gegenwärtiger Lebenswirklichkeit zum literarischen, aus der Literatur stammenden, alsLiteratur tradierten Exemplum vorgestellt hat. Der Unterschied zwischen Lebenswirklichkeit, Empirie undLiteratur ist allerdings relativ; nach strengeren erkenntnistheoretischen Kriterien gibt es ihn letztlich nicht,da alle Wirklichkeit eine „gesellschaftlich konstituierte, konstruierte, sprachlich zeichenhaft und rhetorischvermittelte Sinnwelt“ oder einfacher „einen Kontext“ darstellt. Hans Blumenberg setzt, auf die antikeVerschmelzung von Philosophie und Rhetorik Bezug nehmend, Konsens und Realität so gut wie gleich:36
„Wirklich ist immer das, worauf man sich unmittelbar berufen kann, ohne einer Beweisforderung gewärtigsein zu müssen.“ Damit wird zugleich die historische Dimension, auf die hier alles ankommt, angesprochen:Jedes Zeitalter hat seine eigenen „Selbstverständlichkeiten“. Der Geschichtswissenschaft als beschreibenderDisziplin obliegen Unterscheidungen wie die zwischen einem exegetischen Wahrnehmungsverständnis, demdie Welt wie ein Buch lesbar ist, und einem auf direkte experimentelle Erfahrbarkeit der Natur ausgerichtetenErwartungshorizont, zwischen einer „Verunwirklichung der Jetztwelt der Phänomene“ im Hinblick auf eineeigentliche künftige Heilswelt und einer Diskriminierung des Metaphysischen als Überbau und Fiktionaufgrund erfahrbarer materieller Eigentlichkeit.37 Gerade der mühsame, oft genug befremdliche
36 H. BLUMENBERG, Kritik und Rezeption antiker Philosophie in der Patristik, in: Studium Generale 12 (1959) 485–497,hier 487. – Zu der hier zusammengefaßten Begrifflichkeit zum Realitätsproblem s. auch H. BLUMENBERG,Wirklichkeiten, in denen wir leben, Stuttgart 1981, 108 f.; ders. Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans, in:Poetik und Hermeneutik I, ‚Nachahmung und Illusion‘, München 1969, 9 ff., 21; O. MARQUARD, Kunst als Antifiktion –Versuch über den Weg der Wirklichkeit ins Fiktive, in: Poetik und Hermeneutik X, ‚Funktionen des Fiktiven‘, München1983, 35–54, bes. 39 ff.; Peter L. BERGER/Th. LUCKMANN, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit,Stuttgart 1971 passim. Das Vorwort zu dieser Arbeit von H. PLESSNER und andere wichtige Beiträge zumWirklichkeitsbegriff finden sich in: ‚Ideologie – Wissenschaft – Gesellschaft‘, hrsg. v. H.-J. LIEBER, (WdF 347), Darmstadt1976, 81–92.37 Vgl. BLUMENBERG, Lesbarkeit 10, 18 f. und MARQUARD, Kunst … (wie Anm. 36) 39 ff., 43. – Zu der heuterelativierten Grenze zwischen Fiktion und Geschichte s. z. B. auch J. RÜSEN, Die vier Typen des historischen Erzählens, in:Formen der Geschichtsschreibung, Theorie der Geschichte 4, München 1982, 514–606, hier 526 f.; H.R. JAUß, DerGebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und Darstellung der Geschichte, ebd. 415–452, bes. 418 ff.; ders., Ästhet.Erfahrung 344 ff., 324; H. LÜBBE, Was sind Geschichten und wozu werden sie erzählt? Rekonstruktion der Antwort desHistorismus, in: Erzählforschung, ed. E. LÄMMERT, Stuttgart 1982, 620–29, bes. 626 f.; ebd. zu andern Beiträgenzusammenfassend H.M. BAUMGARTNER,/J. RÜSEN, Erzählung und Geschichte 519 ff., 691 ff. Reinhart KOSELLECK,Standortbindung und Zeitlichkeit (1977), in: ders., Vergangene Zukunft, Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurta.M. 1979, 176–207, bes. 184 ff. (hier auch zur Brillenmetaphorik seit Comenius, 1623). Vgl. auch unten §§ 57 f., 105,112.
17
Vergleich solcher Wirklichkeitsbegriffe, Wirklichkeitskonstruktionen, „Sinnbildungsleistungen“ schützt vordem erkenntnistheoretisch naiven Absolutheitsanspruch irgendeines „Realismus“ – sei er platonisch oderpositivistisch. Wer sich bewußt macht, daß er die Welt durch eine Brille sieht, weiß mehr über dieNotwendigkeit aller Brillen für Sehschwache als über den besonderen Wert oder Unwert einzelner Brillen, überden nicht die Historiker, sondern die Philosophen zu befinden haben.
7. Die Frage nach dem Wirklichkeitsgehalt von Exempla hat nicht nur für Johann von Salisbury oder für dasMittelalter Bedeutung. Betrachtet man beliebige wissenschaftliche Äußerungen zum Gebrauch von Exemplaseit der Antike, so zeigt sich bald eine gewisse Stereotypie in den negativen Urteilen über die verschiedensten,keineswegs nur zweitrangigen Autoren aller Zeiten:38 Exempla gelten weitgehend als gelehrt, angelesen,anekdotisch, dekorativ,
38 Die meisten Zensuren dürfte der Ahnherr der Gattung, Valerius Maximus, auf sich vereinigt haben. Nach E. NORDEN,Kunstprosa I 303 eröffnet er „die lange Reihe der durch ihre Unnatur bis zur Verzweiflung unerträglichen Schriftstellerlateinischer Sprache.“ E. BICKEL, rügt in seinem Lehrbuch der Gesch. d. röm. Lit. (1937, 374) die gewaltsameKomposition als „eine Spitzenleistung erzwungener Übergänge“. Roberto GUERRINI, Studi su Valerio Massimo, Pisa1981, 11 ff. spricht von einer „irreparabile mediocrità“ des Autors, den Erasmus nicht grundlos „einen Esel“ genannt habe;A.D. LEEMAN (Orationis ratio, The Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators Historians and Philosophers,Amsterdam, 2 Bde. 1963, I 40, 254) findet das in der Gesamtstilisierung, besonders aber in den Überleitungen manifestiertePathos, mit dem das spröde Handbuchmaterial von „cut-and-dried examples“ präsentiert, d. h. auch formal „exemplarisch“ fürden Wiedergebrauch zubereitet wird, ein Zeugnis für die in der Kaiserzeit verbreitete „kind of inflated puerility“ (vgl. auch§ 20). Weiterhin Tadel zitieren M. FLECK, Untersuchungen zu den Exempla des Val. Max., Diss. Marburg 1974, 60 ff.,119 ff. und Rob. HONSTETTER Das Exemplum zwischen Rhetorik und Literatur, Zur gattungsgeschichtlichenSonderstellung von Valerius Maximus und Augustinus, Diss. Konstanz 1977, 8 ff. (zu dessen gut gemeintemRehabilitationsversuch s. jedoch unten Anm. 710). – Allgemein Negatives zur Exempla-Literatur auch bei NORDEN,Kunstprosa I 275 f., 598 f.; H.I. MARROU, S. Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1958, 140 ff.; H. CANCIK,Untersuchungen zu Senecas Epistolae morales (Spudasmata 18) Heidelberg 1967, 80 ff.; E.R. CURTIUS, ELLM 90 ff. (diehier spöttisch angeführten „Trosttopoi“ karolingischer Dichter sind insgesamt Exempla); Ed. FUETER, Geschichte derneueren Historiographie, München–Berlin (1911) 1936, 186 f.: Melanchtons Rückfall in theologisch-pädagogischeVerzweckung der Geschichte durch Exempla; ebd. zum vielbenützten, historiographisch „ganz unbedeutenden“, weil nur AlteGeschichte verwertenden Exempla-Handbuch des Sabellicus (1507); J. HUIZINGA, Erasmus, übs. E. KAEGI, Basel 1951,48 ff. zur Verteilung des klassischen Goldes in Kleingeld und einer noch ohne „geistige Dysepsie“ verdauten Überfülle vonWissen in den Adagia, Colloquia u. ä.: „Was gehen uns […] diese endlosen Einzelheiten an über unbekannte Gestalten ausder antiken Gesellschaft[…]?“ Auch diese Liste kritischer Urteile mit eigener Metaphorik könnte im Sinne des Gerügten„endlos“ werden. Zu dem besonderen Punkt der Monopolisierung der Römischen Geschichte als Exempla- undGeschichtsquelle bis ins 18. Jh. s. unten Anm. 1004.
18
aufgesetzt, herbeigezwungen, digressorisch, additiv-kompilatorisch aufgehäuft, vor allem aber als lebensfern,antiquarisch, inhaltsarm und inkonsistent. So fragwürdig solche Bewertung sein mag, läßt sie sich doch mit derwertfreien Feststellung erklären, daß ein „finit“ geschaffener, d. h. für eine konkrete Entscheidungs- undHandlungssituation bestimmter, vielleicht sogar vorliterarisch entstandener Geschichtsvergleich bei derTransposition in die allgemein „infinite“ Ebene des Literarischen seinen Charakter wesentlich verändert;beim Übergang von der „Verbrauchs-“ in die „Wiedergebrauchsrede“ verliert er das Salz der spezifischlebenspraktischen Induktion und wird zum probaten, abrufbaren Geschichtsbild. Stofflich gleiche Exemplakönnen sich insofern wesentlich – nicht bloß in einem gattungsformalen Sinn – voneinander unterscheiden,wenn sie etwa in einem Brief ad hoc aktualisiert oder aber in einem Traktat bloß exemplarisch zur Verfügunggestellt werden. Die ersteren verlangen – um die berühmte „Bildhälften“-Unterscheidung Jülichers zu denGleichnisreden Jesu aufzugreifen – „als Ergänzung nicht einen allgemeinen Satz, der in ihnen steckt oder überihnen liegt, sondern einen gerade so besonderen Fall aus der Gegenwart wie der, den sie aus grauer Vorzeitberichten.“39 Diese Grundunterscheidung zwischen aktuellen und virtuellen, einmalig applizierten, eindeutigenund für immer verfügbaren, potentiell vieldeutigen Geschichtsanalogien40 läßt sich insofern auf die erwähnteAbwertung der älteren literarischen Exemplapraxis beziehen, als dabei (implizit) stets die wiederverwendbarenan den situations-gebundenen, die infiniten an den finiten Beispielen gemessen und als zu „didaktisch“ oder„exemplarisch“ befunden werden. Naturgemäß unterliegt vor allem die Gattung der Exempla-Sammlung, dievon vornherein (ausschließlich oder teilweise) Wiedergebrauchsbedürfnisse befriedigt, dem Verdikt,
39 Adolf JÜLICHER, Die Gleichnisreden Jesu I, Tübingen 1919, 100.40 Siehe unten § 9–15, Zur Terminologie s. H. LAUSBERG, Elemente der literarischen Rhetorik, München3 1967, 15 ff.
19
nur Plattheiten und Ersatzstücke zu bieten, wobei heutige Forscher schon deshalb zu diesem Eindruckgelangen, weil sie sich widerwillig einer fortlaufenden Lektüre unterziehen, für die solche Handbuchliteraturnicht geschaffen wurde.41
8. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die eigenartig ungleiche Bewertung desselbenPhänomens, wenn es in verschiedenen Epochen begegnet. Die beiden Kategorien der nur „scheinbaren“(didaktisch-infiniten) und der „echten“ (pragmatisch-finiten) Exempla werden nämlich häufig im Sinne einerprogressiven Entwicklung so gesondert, daß die einen ganz dem Mittelalter, die anderen ganz der Neuzeitzufallen, als gäbe es seit der Renaissance keine eintönigen Beispielkompilationen und keine existentiellbedeutsamen Geschichtsvergleiche im Mittelalter. In mehreren Arbeiten über das Renaissancezeitalter,namentlich über Salutati, Petrarca und Boccaccio, Valla und Montaigne finden wir die Behauptung, daß zwardas moralische historia magistra vitae-Prinzip alle Geschichtsbetrachtung von der Antike zur frühen Neuzeitbestimmt habe,42 und dennoch erst die großen Renaissance-Humanisten aus einem echten Erkenntnisdrangheraus eine bewußt empirische, induktive Methode beim Studium der als vorbildlich geltenden Muster gepflegthätten; daß erst sie am konkreten Einzelfall Problemreflexion im Sinne einer ernstzunehmenden„praktischen Philosophie“ getrieben hätten, um aus den Exempla nachahmenswertes Verhalten zu lernen.Das Mittelalter kenne demgegenüber nur eine schein-induktive, letztlich deduktive Illustrationsmethode.Mittelalterliche Exempla seien keine Erkenntnismedien, sondern Beweis- und Überzeugungsmittel; sie dientender Vermittlung, Veranschaulichung und psychagogischen Intensivierung einer schon bekannten oder gardogmatisch fixierten Wahrheit.43 Auf eine einfache Formel gebracht:
41 Zu den Exempla-Sammlungen s. unten § 79, S. 45, 125, 138 f.42 Was Friedr. v. BEZOLD (Zur Entstehungsgeschichte der historischen Methodik, in: ders., Aus Mittelalter undRenaissance, München 1918, 363–83, hier 365) zur Geschichtstheorie der humanistischen Historiker der frühen Neuzeitschreibt, gilt nahezu uneingeschränkt auch von deren modernen Erforschern: „Bis zum Überdruß wurden vor allem jenemonumentalen Worte seiner [Ciceros] Schrift de oratore (II 36) nachgebetet, in welchen er die Geschichte als die Zeugin derZeiten, das Licht der Wahrheit, das Fortleben der Vergangenheit, die Lehrmeisterin des Lebens gefeiert hatte.“ Belege s.unten Anm. 1005.43 Allgemein vgl. LANDFESTER 10, 20, 59, 134 ff., 147; G. BUCK, Art. ‚Beispiel‘, HWbPh I (1971) s. 1., 819 f. zumVorrang sinnlicher Erkenntnis und Augenzeugenschaft in der Neuzeit gegenüber mittelalterlicher Deduktion; GRASSI, Macht… 103 ff. zu Abaelards Geschichtsblindheit (s. S. 532 f.); K. HEITMANN, Das Verhältnis von Dichtung undGeschichtsschreibung in älterer Theorie, in: AKG 52 (1970), 244–79, hier 270 ff. – Zu monographischen Themen vgl.Eckhardt KESSLER, Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung bei F. Petrarca, in: AKG 51 (1969) 109–36, 112 f.; ders.,Petrarca und die Geschichte, München 1978, 108 ff.; ders., Das Problem des frühen Humanismus, Seine philosophischeBedeutung bei Coluccio Salutati, München 1968, 189 ff.; Peter M. SCHON, Vorformen des Essays in Antike undHumanismus, Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Essais von Montaigne, Wiesbaden 1954, 21 ff. zum fehlendensokratischen Problemdenken im Mittelalter; A. von MARTIN, Col. Salutati und das humanistische Lebensideal, (1916)Hildesheim 1973, 266 ff.; Jan LINDHARDT, Rhetor, poeta, historicus, Studien über rhetorische Erkenntnis undLebensanschauung im italienischen Renaissancehumanismus, Köln-Leiden 1979, 15 ff. (Forschungsbericht zu Salutati);Dietrich HARTH, Philologie und praktische Philosophie, Untersuchungen zum Sprach- und Traditionsverständnis desErasmus von Rotterdam, München 1970, 16 ff.; Hanna-B. GERL, Rhetorik als Philosophie, Lorenzo Valla, München 1974,248; D.R. KELLEY, Foundations of Modern Historical Scholarship …, New York/London 1970, 20, 27 f. (Valla).Boccaccio: unten § 110, S. 228. In subtiler Weise wirkt hier oft der alte romantisch-historistische, anti-rhetorische Literatur-und Geschichtsbegriff trotz aller Hypostasierung der „Rhetorik“ zur Weltanschauung nach; virulent bleibt die Dichotomie vonreiner „Belletristik“ und „Gebrauchsliteratur“, selbstzwecklicher Geschichtsforschung und pragmatisch-utilitaristischerHistorie, nur wird die Polarisierung spezifisch auf die christliche Kultur bezogen in der Variante: „klassisch schöne Form“,„echter Wirklichkeitssinn“ versus „geistlicher Zweckcharakter“, oder noch verkappter: „Induktion“ versus „Deduktion“. Vgl.zu diesem Klischee die kritische Bemerkung von P.L. SCHMIDT, Zur Typologie und Literarisierung des frühchristlichenlateinischen Dialogs, in: Christianisme et formes littéraires …, Entretiens zur l’Antiquité class. (Fond. Hardt 23) Genf 1977,101–190, hier 127 f., 172.
20
Das Mittelalter habe „die Geschichte als Exemplum“ oder Beleg benützt, die Renaissance aber „das Exemplumals Geschichte“ oder Erfahrungswirklichkeit ernstgenommen.44
Die hier absichtlich etwas zugespitzt formulierte These von der Epochendifferenz bleibe einstweilendahingestellt, damit das Problem selbst besser sichtbar werde: Wenn Johann von Salisbury ein „VorläuferPetrarcas“ und ein dem Mittelalter vorauseilender Geist gewesen sein soll,45 dann muß sich dies
44 Vgl. K. STIERLE, Geschichte als Exemplum – Exemplum als Geschichte, in: Poetik und Hermeneutik 5, ‚Geschichte –Ereignis und Erzählung‘, München 1973, 347–75 (stützt sich hauptsächlich auf die Thesen NEUSCHÄFERS zu Boccaccio:s. unten § 110); vgl. auch die Einwände von M. FUHRMANN ebd. 450 ff. – Dieser Vortrag wurde dank der Übersetzung in‚Poétique‘ 10 (1972) 176–98 auch in Frankreich rezipiert und dürfte einen gewissen Einfluß auf die „aspects structuraux“ derneuesten Gemeinschaftswerke von J. BERLIOZ, J.-M. DAVID und C. BRÉMOND sowie J. LE GOFF/J.-C. SCHMITTausgeübt haben; dazu ausführlich unten § 26. LE GOFF (wie unten Anm. 58) 46 schreibt mit Berufung auf das Vorwort vonJ.M. DAVID (wie unten Anm. 97) 13, der sich seinerseits auf die Diskussion in Poet. u. Herm. 5 beruft: „l’exemplummédiéval … ‚illustre‘ (disons ‚sert‘) un système déjà constitué alors que l’exemplum antique le fixe dans son énoncé même.“45 So etwa CURTIUS, ELLM 86 f.; D. BUSH, The Renaissance and English Humanism, Toronto 1939, 60; E. SANDYS,The Cambridge History of English Lit. I 1907, 185; H. WADDELL, The Wandering Scholars, London/New York 1926,XIII, XXII; Pietro P. GEROSA, Umanesimo cristiano del Petrarca, Influenza agostiniana, attinenze medievali, Torino 1966,204 f.: „forse nessun altro scrittore del Medioevo gli [al Petrarca] rassomiglia tanto“. Kritisches zu dieser gelehrten Traditionbei MISCH 1164, 1167 f., 1178; MURPHY, Rhet. 112; vgl. auch unten §§ 59 f., 112 f., Anm. 341, 518 ff., 1016 ff.
21
auch ganz besonders vor der Frage prüfen lassen, ob sein Exempla-Gebrauch wirklich nur didaktischenIllustrationszwecken, nicht auch einer echten philosophischen und historischen Erkenntnisintention diente;ob er bloß an sub specie aeternitatis längst gegebene Antworten erinnere oder ob er strittige Probleme dereigenen Zeit durch historischen Vergleich als solche bewußt mache und so einer Lösung zuführe. Wenn er alsein repräsentativer Vertreter jener besonderen Tradition des Denkens und Schreibens in Exempla rezipiertworden ist, zu der auch so verschiedene Autoren der Weltliteratur wie Cicero, Plutarch, Petrarca, Montaigne,Gracián, Bacon und einige „Moralisten“ und „Prudentisten“ des 17. und 18. Jahrhunderts gehören, so führtder Policraticus auch zur Frage nach dem Wirklichkeitsbegriff einer ganzen uns oft antiquarisch und stereotypanmutenden Traktatliteratur und Essayistik kompilatorischer Machart, die sich selbst theoretisch durchwegauf den Wert unmittelbarer Erfahrung und konkret-historischer Einzelfallanalyse für die politische undmoralische Lebensklugheit, auf die „Geschichte als Beispielphilosophie“ beruft.46 Welchen Sinn hatte dasSammeln und oft unsystematische Zusammensetzen bunter Anekdoten unter dem Postulat der„Kontingenzbewältigung“ für lebensweltliche Probleme, die durch allgemeine Regeln nicht mehr lösbarsind?47 Was ist schließlich an dieser Paradoxie besonders mittelalterlich, was alt-europäisch?48
46 Vgl. Claus UHLIG, Hofkritik im England des Mittelalters und der Renaissance, Berlin 1973, 4–9; BRÜCKNER,Historien 82 u. ö.; Theodor VERWEYEN, Apophthegma und Scherzrede, Die Geschichte einer einfachen Gattungsform undihre Entfaltung im 17. Jh., Bad Homburg 1970, und unten S. 124, 129 ff., 161, 355 ff.47 Vgl. JAUß, Ästhetische Erfahrung 350.48 Die Paradoxie stellt M.I. FINLEY bereits bei den Attischen Rednern fest (Myth, Memory and History, in: M.I.F., TheUse and Abuse of History, London 1975, 29 f.): trotz der Fähigkeit, laufende Probleme der Zeitgeschichte genau unddetailliert darzustellen, wurde alles Vergangene unpräzise und mit „commonplace references“ dargestellt.
22
II. ZUR BEGRIFFSGESCHICHTE UND DEFINITION
A) INTENTIONALE ASPEKTE (BEISPIEL, EXEMPEL, FALL: EXEMPLUM)
Das Exemplum zwischen Rhetorik und Philosophie (§ 9). Dantes Francesca zwischen E.R. Curtius und H. Friedrich (§ 10).Beispiel, Exempel, Fall seit Kant: Möglichkeiten und Grenzen der Subsumption (§ 11). Geschichten in rhetorischerAnwendung und als Vorrat (§ 12). Infinite und finite Exempla (§ 13). Lessings „Lehrfabel“ in der Kritik: die„Handlungsfabel“ nach Herder, „rhetorische Gleichnisse Jesu“ nach Jülicher und der ainos als Ur-Fabel nach K. Meuli (§ 14).Induktionsübungen mit tradierten Exempla machen „klug für ein andermal“ (§ 15).
9. Die Unterscheidung zwischen illustrierender und empirisch-praktischer Exempla-Konzeption ist – ganzunabhängig von ihrer Inanspruchnahme für Epochenvergleiche – grundsätzlich wichtig. Bereits mit Isokratesund den Sophisten beginnt ein Werturteilsstreit über die Grundantinomie des Exemplums, das ebenso dererläuternden, ausschmückenden, verstärkenden, manipulierenden Durchsetzung einer Parteimeinung beieinem Publikum wie der einsamen oder dialogischen Wahrheitsfindung am Beispiel des Konkret-Einzelnendienen kann. Es hat von Anfang an teil am Konflikt zwischen Rhetorik und Philosophie.49
Die dieser Auseinandersetzung zugrundeliegenden Gesichtspunkte finden sich schon in der früheren Dichtung.So hat Bruno Snell im Zusammenhang mit der Entwicklung vom Mythos zum Logos gezeigt, daß schon beiHomer der veranschaulichende, schmückende Vergleich vom empirisch-praktischen Selbstbesinnungsvergleichklar zu unterscheiden sei.50 Letzterer entspringe dem menschlichen „Bedürfnis, vergleichend einzuordnen unddadurch Halt und Gewißheit selbst zu gewinnen oder einem andern zu geben.“ Dieses Beispiel des mythischenVergleichs, das noch heute in Form von „historischen
49 Zur Ambivalenz des Exemplums als Illustrations- oder Manipulationsmittels und als Erkenntnismittels seit Isokrates vgl.GEBIEN 33 f.; G. SCHMITZ-KAHLMANN, Das Beispiel der Geschichte im politischen Denken des Isokrates, (PhilologusSuppl. 31.4) 1939; WELLES (wie Anm. 22) 3 ff.; BLUMENBERG, Wirklichkeiten … (wie Anm. 36) 104 bietet auf wenigZeilen einen prägnanten Abriß des Konflikts von Rhetorik und Philosophie, der auch innerhalb des Christentums wirksamblieb: Die Antithese eines Exemplums als Hilfsmittels der Wahrheitsverkündigung und eines Exemplums als Gegenstandsethisch-religiöser Reflexion gehört dazu. Vgl. auch M. FUHRMANN, Die antike Rhetorik, (Artemis-Einführungen)München–Zürich 1984, 30 ff. und unten §§ 29–33, 70, S. 525 ff.50 B. SNELL, Gleichnis, Vergleich, Metapher, Analogie. Der Weg vom mythischen zum logischen Denken, in: ders., DieEntdeckung des Geistes, Göttingen4 1975, 178–204, hier 188 f. Zum mythischen Beispiel so auch unten §§ 49, 108,S. 50 ff.
23
Parallelen“ weiterbestehe, wird mit Rembrandts Selbsterfahrung durch die Darstellung alttestamentlicherGestalten sowie mit Goethes Dialog zwischen Antonio und Tasso beleuchtet:51
(A) Und wenn du ganz dich zu verlieren scheinst,Vergleiche dich! Erkenne was du bist!
(T) Ja, du erinnerst mich zur rechten Zeit! –Hilft denn kein Beispiel der Geschichte mehr?Stellt sich kein edler Mann mir vor die Augen,Der mehr gelitten als ich jemals litt,Damit ich mich mit ihm vergleichend fasse?
Diese auf der einsamen Selbstreflexion beruhende Geschichtsanalogie – die Urform des philosophischenBeispiels – kann auch der Überzeugungsrede dienen, geht dann jedoch in einen Zwischenbereich von Rhetorikund Philosophie, Kommunikationsstrategie und Besinnungsappell über. (Wir werden darauf imZusammenhang mit einer hintersinnigen Geschichte des Odysseus zurückkommen.)51a
Für eine eindeutige Charakterisierung des Gegenbegriffs, des bloß illustrativ erläuternden, verstärkenden,ausweitenden – vermeintlich besonders mittelalterlichen – Lehrbeispiels eignet sich (um bei Goethe-Zitatenzu bleiben) folgender Ausschnitt aus den burlesken Knittelversen „Erklärung eines alten Holzschnittesvorstellend Hans Sachsens poetische Sendung“:52
Wie nun der liebe Meister sichAn der Natur freut inniglich,Da seht ihr an der andern SeitenEin altes Weiblein zu ihm gleiten:Man nennet sie Historia,Mythologia, Fabula;Sie ist rumpfet, schrumpfet, bucklet und krumb,Aber eben ehrwürdig darumb.Sie schleppt mit keuchend wankenden SchrittenEin‘ große Tafel, in Holz geschnitten;
51 ‚Tasso‘ V. 5, 3419–3425. – Die Vorstellung: „Halt durch Vergleich“ schließt die zwei Nuancen des Beispieltrostes und derErmutigung durch heroische Vorbilder ein: zum Trostmotiv de communi condicione hominum vgl. P. von MOOS,Consolatio (III), München 1972, Bd. 3, 115 ff., §§ 552 ff.; unten § 108. Dem heroischen Stimulus entspricht andererseitsgenau, was Nietzsche als den Nutzen „monumentalischer“ Historie definiert (Unzeitgemäße Betrachtungen II: Vom Nutzenund Nachteil der Historie für das Leben, Kap. 2, Kröner-Ausg., Stuttgart 1930, 114): „… daß das Große, das einmal da war,jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl wieder einmal möglich sein wird“ Vgl. auch unten S. 127, 217,229 ff., 322 f.51a Unten § 14.52 Hamburger Ausg. 1, München 1981, 137, V 73–104 (aus dem Jahre 1770). Zu den Begriffen Historia, Mythologia,Fabula s. unten § 59, S. 50 ff. Zu der im letzten Vers anklingenden „Autopsie“-Vorstellung s. unten § 60, S. 232 f., 529 f.
24
Drauf seht ihr mit weiten Ärmeln und FaltenGott Vater Kinderlehre halten,Adam, Eva, Paradeis und Schlang‘,Sodom und Gomorras Untergang,Könnt auch die zwölf durchlauchtigen FrauenDa in ein’m Ehrenspiel schauen;Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord,Der Zwölf Tyrannen Schanden-Port,Auch allerlei Lehr‘ und gute Weis‘,Könnt sehen Sankt Peter mit der Geiß,Über der Welt Regiment unzufrieden,Von unserm Herrn zurecht beschieden.Auch war bemalt der weite RaumIhres Kleids und Schlepps und auch der SaumMit weltlich Tugend- und Laster-Geschicht.
Unser Meister dies all ersichtUnd freut sich dessen wundersam,Denn es dient wohl in seinen Kram.Von wannen er sich eignet sehrGut Exempel und gute Lehr‘,Erzählt das alles fix und treu,Als wär‘ er selbst gesyn dabei.
10. Als hermeneutisches Kriterium für das Geschichtsverständnis einzelner Autoren hat vor allem HugoFriedrich den Wesensunterschied zwischen deduktivem und induktivem Umgang mit Exempla fruchtbargemacht. Seine unschätzbare Montaigne-Darstellung liest sich wie eine Apologie für den Erkenntniswert desSingulären und Irreduktiblen am historischen Beispiel.53 Dantes exemplarische Vergegenwärtigung einesBeispielfalls der Zeitgeschichte suchte er nicht weniger überzeugend als „Begegnung“ mit einer „wirklichenGestalt“ darzutun und bestätigte damit, daß auch das Mittelalter unter Exemplum nicht nur Illustration undBeleg für etablierte übergeordnete Ideen zu verstehen vermochte. Ernst Robert Curtius hat in seinerausführlichen, übertrieben polemischen Besprechung von Friedrichs Dante-Buch (die inzwischen in derExempla-Forschung berühmter geworden sein dürfte als
53 H. FRIEDRICH, Montaigne, Bern 1949, bes. 246 ff. In diesem Sinne auch lobend erwähnt von R. KOSELLECK,Historia magistra vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, in: Natur undGeschichte, Festschr. K. LÖWITH, Stuttgart/Berlin/Mainz 1967, 196–219, hier 197 = auch in: ders. Vergangene Zukunft(wie Anm. 37) 38–66, hier 39, im Zusammenhang eines Vergleiches der Montaigneschen Extremposition mit der von Bodingepflegten Reduktion der Geschichte auf allgemeine Regeln; vgl. auch von MOOS, Consolatio … Bd. I/II je § 38 zuFRIEDRICHS Montaigne-Analyse hinsichtlich des Verhältnisses von Allgemeinem und Einmaligem im Todesgedanken. –Zur Problematik der Generalisierbarkeitsgrade des Exemplums s. unten § 10, S. 536.
25
der Rezensionsgegenstand)54 die Unterscheidung von Beispiel und „Begegnung“ ungewollt bekräftigt, indem erbeanstandete, daß so Inkommensurables verglichen und unter dem abgenutzten Allerweltbegriff „Exemplum“auf einen Nenner gebracht werde. Die „Beispielfigur“, imago, d. h. die bloße Nennung etwa von Dido,Kleopatra, Helena, sei „rhetorischer Schmuck der geläufigsten Art“; die Francesca-Szene aber sei „eine dergrößten Neuschöpfungen Dantes […], die uns bei ihm so tief erschüttern wie sonst nichts vor Shakespeare“,und verdiene nicht, mit dem schulrhetorischen Terminus technicus „Exemplum“ banalisiert und bagatellisiertzu werden. Damit verrät der große Wegbereiter der Rhetorikforschung des letzten Vierteljahrhunderts durchseinen eingeschränkten Exemplum-Begriff (der wie sein allzu berühmter Topos-Begriff in den Bereich desKlischeehaften, Trivialen fällt) paradoxerweise seine letztlich abschätzige Vorstellung von Rhetoriküberhaupt und (trotz seiner Kritik an werkimmanenter Romantisierung Dantes) sein eigenes tief romantischesVorverständnis: Hier sieht er den aller spröden Redetechnik überlegenen genialen Klassiker, da die Masse derkleinen nachäffenden Rhetoriker und Schulpoeten mit ihren immer gleichen Stoffen und Kniffen.55
Demgegenüber ist Friedrichs Deutung in einem allgemeinen Sinn
54 H. FRIEDRICH, Die Rechtsmetaphysik der göttlichen Komödie. Francesca da Rimini, Frankfurt a.M. 1942, bes. 47 f.,58 ff. – E.R. CURTIUS, Zur Danteforschung, in: RF 56 (1942) 3–22, bes. 12 f., 17 f. Andere kritische Punkte dieserFRIEDRICH-Rezension: 1. radikaler Unterschied von imago/Beispielfigur und exemplum/erzählter Geschichte,2. Unvergleichbarkeit von rhetorischen Exempla der Antike und mittelalterlichen Predigtexempla, kommen unten §§ 121 ff.,S. 64 zur Sprache.55 Auf dieses Vorurteil geht im übrigen auch die unter Anm. 710 besprochene Trennung von „Rhetorik“ und „Literatur“ inBezug auf die Exempla bei Valerius Maximus und Augustinus durch HONSTETTER zurück. – Die CURTIUS-Kritik hierzudokumentiert E.J. RICHARDS, Modernism, Medievalism and Humanism, A Research Bibliography on the Reception of theWorks of Ernst Robert Curtius, (Beih. zur ZfRPh 196), Tübingen, 14 u. ö. (z. B. bei FRIEDRICH, AUERBACH,BEZZOLA, FARAL als Ablehnung der Vorstellung von den topischen „Ketten der Mittelmäßigkeit“); ebd. Nr. 385 (G.R.CARR zur JASPERS-CURTIUS-Kontroverse um die Aktualität Goethes und um den Geniekult). RICHARDS‘Bibliographie raisonnée ist nützlich, wirkt aber leider an manchen Stellen etwas zu apologetisch, ja „hagiographisch“ und istzudem in den nicht-romanistischen Bereichen unvollständig. Es fehlen gerade in unserem Zusammenhang wichtige Beiträgewie: W. von den STEINEN, Rezension ELLM, in: Zs. f. Schweiz. Gesch. 29 (1949) 407 ff. zum negativenTraditionsbegriff, oder M. FINLEY, The Heritage of Isocrates, in: ders. The use and abuse … 193 ff. (zum eskapistischelitären Neuhumanismus und dessen phobischem, aus Angst vor dem Trivialen entstandenen Geniekult, wie ihn CURTIUSrepräsentiert); außerdem Rezensionen aus rechtshistorischer, historischer und theologischer Sicht: H. COING, in: SZRom. 89, N.F. 69 (1952) 530–33; K. PIVEC, in: MIÖG 60 (1952) 415 f.; J. de GHELLINCK, in: Nouv. rev. theologique71 (1949) 883 f. – Zum Toposbegriff von CURTIUS vgl. S. 425. Wie unversöhnlich für CURTIUS die Begriffe„Exemplum“ und „Begegnung“ gewissermaßen als Repräsentationen von Rhetorik und Literatur gewesen sein müssen, zeigenauch Stellen aus ELLM: Man vergleiche etwa das S. 429 besprochene beinahe karikaturistische Kapitel über topischeTrostbeispiele (p. 90 ff.) mit folgender fast hymnischer Lobpreisung (p. 363): „Die Conception der Commedia beruht aufeiner geistigen Begegnung mit Virgil. Es gibt im Umkreis der europäischen Literatur wenig, was sich mit diesem Phänomenvergleichen ließe […] Die Erweckung Virgils durch Dante ist ein Flammenbogen, der von einer großen Seele zu einer anderenüberspringt. Die Tradition des europäischen Geistes kennt keine Situation von so ergreifender Höhe, Zartheit, Fruchtbarkeit.Es ist die Begegnung der zwei größten Lateiner. Historisch: die Besiegelung des Bundes, die das lateinische Mittelalterzwischen Antike und moderner Welt gestiftet hat. Nur wenn wir fähig sind, Virgil wieder in seiner vollen dichterischenGröße zu erfassen, die uns Deutschen seit 1770 verloren ging, werden wir Dante ganz würdigen.“ Daß ich den letzten Satz inder Sache richtig finde, versuche ich grundsätzlich (etwas weniger dithyrambisch) unten Anm. 846 nicht nur für Vergil undDante zu formulieren. Hier geht es einzig um die fast schizophrene Haltung, in der die deutsche Kultur „seit 1770“ mitGrundideen des 19. Jhs., wie der erlebnisästhetischen Innerlichkeit, des neuhumanistischen Klassikerkults, der „poésie pure“u. dgl. verurteilt wird, während die eigentliche geschichtliche Umwälzung, die um 1800 zu solchen Idealen führte, (derNiedergang der repräsentativen Öffentlichkeit und der rhetorischen Kultur) ganz unerwähnt bleibt (s. auch S. 235). AndereAspekte derselben Widersprüchlichkeit zeigt neuerdings feinsinnig Max WEHRLI auf: Literatur im deutschen Mittelalter.Eine poetologische Einführung, Stuttgart 1984, 133 ff.
26
nachdrücklich zu verteidigen: Es gibt in der Literatur des rhetorischen Exemplums auf der einen Seitemythische und historische Gestalten oder Ereignisse, die als lebendige Probleme, tragische Fälle,Memorabilien Anlaß zum Nachdenken, zur Selbstbesinnung geben und zu einer vielleicht unzulänglichen,diskussionswürdigen, stets aber spezifisch sinnlich erfahrbaren Erkenntnis führen; auf der anderen Seite gibt eserfundene oder wahre „Geschichten“ und typische Figuren, die eine bereits fertige, zweifelsfreie Erkenntnisoder Wahrheit erläutern, belegen, ausschmücken, Unkundigen pädagogisch näherbringen.56
11. Die grundlegende Unterscheidung zwischen induktivem und illustrierendem Beispiel ist in der neuerenBegriffsgeschichte oft thematisiert und in diverse Terminologien gekleidet worden, die zur Verdeutlichung desGemeinten kurz erwähnt werden müssen. Berühmt ist Kants (nicht unproblematischer) Definitionsversuch ausder ‚Metaphysik der Sitten‘:57
56 Vgl. unten § 35, S. 117 ff., 526, 533.57 Metaphysik der Sitten II § 52 (Akademie Ausg. VI p. 479), auch im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder J. und W.GRIMM I (1854) Sp. 1395 angeführt. Dazu vgl. G. BUCK, Art. Beispiel, HWbPh I (1971) 819 f.; ders., Über dieIdentifizierung von Beispielen, Bemerkungen zur Theorie der Praxis, in: Poetik und Hermeneutik VIII, ‚Identität‘, München1971, 61–81, hier 68 f. (auch in: ders., Hermeneutik und Bildung, München 1981, 95 ff., hier 104 ff.), ders., Lernen undErfahrung. Zum Begriff der didaktischen Induktion, Stuttg./Berlin/Köln 1969, 124 ff.; ders., Kants Lehre vom Exempel, in:Arch. f. Begriffsgesch. 11 (1967), 148 ff.; ders., Literarischer Kanon und Geschichtlichkeit, in: DVJs 3 (1983) 351–65, hier361 ff.; DORNSEIFF 206.
27
Beispiel ist mit Exempel nicht von einerlei Bedeutung. Woran ein Exempel nehmen und zur Verständlichkeit einesAusdrucks ein Beispiel anführen sind ganz verschiedene Begriffe. Das Exempel ist ein besonderer Fall von einerpraktischen Regel, sofern diese die Thunlichkeit oder Unthunlichkeit einer Handlung vorstellt. Hingegen einBeispiel ist nur das Besondere (concretum), als unter dem Allgemeinen nach Begriffen (abstractum) enthaltenvorgestellt, und blos theoretische Darstellung eines Begriffs.
Die für den heutigen Sprachgebrauch überscharfe Unterscheidung der inzwischen nahezu synonym gewordenenTermini – sie mag in Wendungen wie „ein Exempel statuieren“ und „ein Beispiel für eine grammatische Regelgeben“ noch anklingen – sucht vornehmlich die moralisch-praktische und die intellektuell-theoretischeBedeutung auseinanderzuhalten. Der Weg führt entweder vom „besonderen Fall“ zur Erkenntnis desTunlichen (das aus bestimmten Voraussetzungen unglücklich mit der „Regel“ aus dem postuliertenSittengesetz gleichgesetzt wird), oder der Weg führt vom notwendigen Axiom zum beliebigen Illustrations-und Applikationsbeispiel. Man geht zur Regel hin oder kommt von der Regel her. In der Polarität fehltjedoch das unter ein Allgemeines nicht oder nur partiell subsumierbare Partikuläre (individuum est ineffabile),das gerade nicht durch Regelhaftigkeit, sondern durch Außergewöhnlichkeit lebenspraktische Bedeutungerlangt. Entsprechend wird der zentrale Unterschied zwischen dem lehrhaft erläuternden Beispiel und dempragmatisch aufschlußreichen Sonderfall, zwischen dem subsumierbar-deduktiven und dem inventiv-induktivenExemplum nur angedeutet. Diese Leerstelle in der Definition haben Hans Lipps und Andre Jolles um 1930mit alternativen und erweiternden Bestimmungen zu besetzen gesucht. Beide philosophisch-anthropologischarbeitende Gelehrte betonten unabhängig voneinander den Begriff des „Falls“ oder „Kasus“/casus als problem-orientierten Gegenpol zu dem illustrativ auf die vorgegebene Regel, auf das unantastbare Gesetz verweisendenBeispiel.58
58 LIPPS (wie Anm. 10) 39 ff.; A. JOLLES, Einfache Formen, Tübingen 1930/Darmstadt 1969, 177 ff. – Der Casus-Begriffdürfte in dem hier gemeinten Sinn von JOLLES etabliert worden sein (die antike Rhetorik versteht darunter anderes: s.LAUSBERG II p. 657). JOLLES setzt an Stelle von Exempel und Beispiel den Unterschied von „Beispiel“ (was auf einGesetz hinweist) und „Kasus“ (was auf eine Gesetzeslücke hinweist). Die sog. „einfache Form“ Kasus entspricht einemgroßen Teil der hier zu untersuchenden kasuistischen Exempla, wie insbesondere JOLLES‘ Zitat (p. 198) aus Ignaz vonDÖLLINGER, Gesch. der Moralstreitigkeiten in der röm.-kath. Kirche seit dem 16. Jh., Nördlingen 1889, zumProbabilismus schön zeigt: „In manchen Fällen ist keine Gewißheit über die Pflichtmäßigkeit, Erlaubtheit oder Unerlaubtheitzu erlangen; es stehen sich dann zwei Ansichten gegenüber, von denen jede sich auf Gründe stützt, keine certa, jede nurprobabilis ist …“ Vgl. § 66, S. 3 f., 184 ff., 322 ff. Interessanterweise erwähnen C. BRÉMOND/J. LE GOFF/J.-C.SCHMITT (L‘„exemplum“, Typologie des sources du moyen âge occidental, ed. L. GÉNICOT, 40, Turnhout 1982, 46) denKasus von JOLLES im speziellen Zusammenhang mit der Kanonistik seit Gratian, um ihn als eine andere Art vonExemplum aus der Untersuchung auszuschließen; vgl. unten §§ 34, 66, 74, 78. Zur Profilierung des Unterschieds beiderExempla-Arten habe ich den Gegensatz von Subsumption und Individualität bewußt akzentuiert. Streng genommen, handeltes sich dabei jedoch nur um einen Gradunterschied. Die Skala der innerhalb der Exemplum-Definition möglichenVerhältnisse von Allgemeinem und Besonderem endet logischerweise auf der einen Seite beim reinen Individuum, auf deranderen beim Gesetz. PERELMAN (wie Anm. 10) 119 ff. definiert das Beispiel darum von einem anderen Blickwinkel herals absoluten Gegensatz des „unique“ und schreibt: „Argumenter par l’exemple, c’est présupposer l’existence de certainesrégularités dont les exemples fourniraient une concrétisation. Ce qui pourrait être discuté, […] c’est la portée de la règle […],non le principe même de la généralisation.“ Vgl. auch S. 567 zum Gegenbegriff der „Beispiellosigkeit“. Gleichzeitigunterscheidet aber auch PERELMAN innerhalb des variablen Geltungsbereichs des Beispiels regelkonforme und nicht-regelkonforme Möglichkeiten: 1. das eigentlich produktive Induktionsbeispiel („l’exemple“), das eine Regel erzeugt,begründet oder entkräftet (im Sinne POPPERS sogar „falsifiziert“); 2. das Illustrationsbeispiel („l’illustration“), das einegültige Regel ex post bestätigt, erläutert und vergegenwärtigt; 3. das positive oder negative Identifikationsbeispiel („modèle àimiter/antimodèle“). Über die Sonderstellung der letzteren (existentiellen) Kategorie des „Vorbilds“ oder „Warnbilds“ imRahmen einer Argumentationstheorie ließe sich streiten. Zur Schwierigkeit der Trennung von Induktions- undIdentifikationsbeispielen s. auch §§ 16, 19, 21. Jedenfalls schwingt fast immer etwas vom werthaft- moralischen Charakterdes „Modell/Antimodell“-Begriffs mit, wo die Bedeutung des induktiven gegenüber dem illustrativen Beispiel herausgestelltwird (so vor allem in den oben Anm. 57 erwähnten Arbeiten von G. BUCK). Auch die von H.R. JAUß (Negativität [wieAnm. 103] 313 ff.; vgl. auch Anm. 283) nach Kants ‚Kritik der Urteilskraft‘ (§ 32) getroffene Unterscheidung der ästhetisch-moralischen Identifikationsweisen: „freie Nachfolge eines Beispiels“ (d. h. Vorbilds) – „mechanisch unfreie Nachahmungeiner Regel“ zeigt eine Analogie zu dem logisch-rhetorischen Unterschied von kreativer Induktion und nachgelieferterIllustration.
28
Während Exempel als pragmatische Vorbilder, Beispiele als Verständnishilfen auf das Allgemeingültige oderden Allgemeinbegriff verweisen, ist der „Fall“ eine ungewöhnliche Abweichung von Norm und Begriff; ererschwert oder verhindert die Subsumption, stellt das Allgemeine auf die Probe, zeigt Schwachstellen desGesetzes und konkurrierende Prinzipien. Er ist somit eo ipso „strittig“ und bedarf „kasuistischer“Behandlung.59 Diese wichtige Unterscheidung zwischen einem normenkonformen und einemnormensprengenden Beispiel hat in der literaturwissenschaftlichen Diskussion allerdings zu einer vorwiegenddidaktischen Auffassung der im kantischen Sinn verstandenen
59 Vgl. LIPPS (wie Anm. 10) 48.
29
Termini „Exempel“ und „Beispiel“ als pure Gegensatzbegriffe zu „Fall“ oder „Kasus“ geführt und damit –einer skeptisch-empirischen Grundeinstellung des 20. Jahrhunderts durchaus adäquat – zu einer gewissenAbwertung der Exemplum-Vorstellung im Sinne eines erbaulichen historia docet verleitet. (Ähnlich wird dereinst viel weitere „Fabel“-Begriff heute üblicherweise im eingeschränkten Sinn eines affirmativ-normenkonformen Lehrstücks verwendet.)60 In Anbetracht der antiken bis ins 18. Jahrhundert hineinweitgehend gültig gebliebenen rhetorisch-philosophischen Terminologie besteht jedoch kein Anlaß, auf denvielschichtigen Schlüsselbegriff „Exemplum“ für alle Arten des historischen Induzierens undExemplifizierens, d. h. auf den Oberbegriff für alle hier zu erwägenden Arten (wie Exempel, Beispiel, Fall) zuverzichten.61
Die Unterscheidung zwischen Beispiel und Fall läßt sich hinsichtlich des Problemcharakters des letzteren nochpräziser fassen. Der Fall als Sonderfall ist entweder nicht oder nur durch Sonderbehandlungen (wie Diskussionund Reflexion) auf ein Allgemeines zu beziehen; er kann entweder „als Frage im Raum stehen bleiben“ oderein zuletzt lösbares Problem darstellen, einen „außergewöhnlichen, aber doch vorkommenden Fall“, der alssolcher „eine Lektion“ erteilt.62 Auf eine Gesetzeslücke oder eine Gesetzeskollision wird man durch denkonkreten „ausgefallenen“ Fall gestoßen.63 Dieser Casus interessiert nicht für sich, sondern nur als ein zuaktualisierendes Bezugselement der Regel. Wenn die Aktualisierung gelingt, kann er selbst zum Beispielfalloder Präzedenzfall werden oder als praeiudicium, d. h. „schon einmal so entschiedener Fall“ gesetzgeberischproduktiv wirken.64 Dieser Casus hat also noch wesentlich mit der Unterordnung unter ein herrschendesAllgemeines zu tun, auch wenn er sich anfänglich dagegen sperrt. Er steht insofern dem Exempel im SinneKants (aus dem die praktische Regel gelernt werden kann) näher als eine andere, rein aporetische, paradoxe,„unauslotbare“ Art von Casus, die wir aus den großen „Fällen“ der Literatur kennen, aus Dantes „Begegnung“mit Francesca da Rimini65 oder aus Boccaccios der Um- und Nachwelt zur Debatte gestellter Griselda-Novelle.66 Hier wird das Abweichende
60 Vgl. unten § 14.61 Vgl. unten § 16.62 LIPPS (wie Anm. 10) 47 f.63 Ebd. 49.64 Vgl. S. 2, 73, 318; Quint. V 1.2, V 2.1: praeiudicia als exempla; PERELMAN (wie Anm. 10) 121 zur„gesetzgeberischen“ Möglichkeit des Beispiels. Das oben Anm. 3 angeführte Justinianische Rechtsprinzip (Codex 7.14.13):non exemplis sed legibus iudicandum est, beweist nicht das Gegenteil, sondern warnt den Richter davor, demNormierungsprozeß eigenmächtig vorzugreifen. Zur Antithese lex – exemplum s. auch unten Anm. 621.65 Vgl. oben § 10, unten S. 584 f.66 Vgl. unten S. 228.
30
und Besondere nicht als eine zu behebende Verlegenheit vor irgendeinem Gesetz empfunden, sondern geradezum zentralen Gegenstand einer Betrachtung erhoben, die Gesetzmäßigkeiten und Denkgewohnheiten in Fragestellen, die Belastbarkeit von Normen hypothetisch-experimentell überprüfen will.67 Die beiden Fall-Artenunterscheiden sich also wie Mittel und Zweck: Die eine dient der Regelfindung und Abstraktionsbildung; dieandere ist das Erkenntnisziel eines eigenen Erfahrungswissens. Die eine ist zwar nicht Beleg eines schongegebenen Gesetzes oder Illustration eines Theorems, wird aber auf ein normatives System hin angelegt undgeprüft; die andere will „durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen“, sträubt sich gegen Klassifizierungen undempfiehlt sich in historischer Einmaligkeit der lebenspraktischen Erwägung.68 Diese Unterscheidung istgerade deshalb methodisch unerläßlich, weil in den hier zu untersuchenden Texten immer wieder zeitbedingteÜberschneidungen, Vermischungen und widersprüchliche Verbindungen beider Typen des Casus begegnenwerden.69 Den Gegenpol zum didaktischen Illustrationsbeispiel bildet nicht einfach der „Fall“ alsDiskussionsmaterie, sondern eine ganze Palete von induktiv bedeutsamen Fällen.
12. Die juristisch orientierte Rhetorik der Antike hat in den declamationes (suasoriae und controversiae)eine spielhafte Übungstechnik zur normativen Bewältigung komplizierter Rechtsfälle geschaffen. Dieses„Simulations“-Verfahren bestand in der Konstruktion möglichst ausgefallener causae, Gerichtssituationen undGesetze, die dem Redner helfen sollten, weniger schwierige Fälle der Wirklichkeit elegant und routinemäßig zubehandeln.
67 Vgl. H.-J. NEUSCHÄFER, Epochenspezifische Erzählformen (Einführung), in: E. LÄMMERT (Hrsg.), Erzählforschung… (wie Anm. 37) 359 zur Novelle.68 H.R. JAUß hat in diesem Zusammenhang den von JOLLES (Einfache Formen, wie Anm. 58, 200 ff.) eigenwilliggebrauchten Begriff „Memorabile“ für eine nicht lehrhafte „Erfahrung der unaufhebbaren Kontingenz des geschichtlichenLebens“ verwendet (Erfahrung … [wie Anm. 11] 351 ff. zu einer Analyse von Hebels „Brand in Moskau“; vgl. auchBRÜCKNER, Historien … 19; I.-M. GREVERUS, Die Chronikerzählung, in: Festschr. Kurt Ranke, Göttingen 1968,37–80; Otto GÖRNER, Vom Memorabile zur Schicksalstragödie, Berlin 1931). So anregend die Bestimmung in der Sacheist, wird dieser Terminus in Anbetracht der viel weiteren Bedeutung von memorabile in der antiken Literatur (s. unten S. 62,110 f., 131 f., 161, 560) hier nicht weiter berücksichtigt.69 Christoph DAXELMÜLLER, der das Verdienst hat, erstmals das casus-hafte Exemplum gegen den verbreiteten narrativenExemplum-Begriff der Mediävistik und Folkloristik gesetzt zu haben (vgl. besonders Exemplum und Fallbericht [wieAnm. 102] 155 ff.), scheint die Differenz der beiden Fallarten zu übersehen: Für ihn gibt es nur den „Fallbericht alswissenschaftlichen Beleg und Diskussionsgegenstand“. Näher an das hier Gemeinte führt seine Unterscheidung (Art.Exemplum 632) in „adhäsive“ Beleg- und Illustrationsbeispiele und „inhäsive“ Diskussionsbeispiele, wobei er letztere alseigentliche wissenschaftliche Themen versteht. Vgl. dazu auch unten § 64, S. 431 f.
31
Der ursprünglichen Intention nach gehören Casus wie die „fiktizischen Klagen“ des Römischen Rechts zurkasuistischen Kategorie der normativ einzuordnenden Fälle.70 In der Entwicklung und vor allem in deraußerjuristischen Wirkungsgeschichte der Deklamationen zeigen sich jedoch Übergänge zum literarischenExemplum als Problemfall. Schon bei den „Konzertrednern“ der Spätantike verselbständigte sich die Übung ineinem literarästhetischen Sinn und wurde zu einer virtuosen Unterhaltungskunst (deren intellektuelle Reizestrukturell mit denen des modernen Kriminalstücks vergleichbar sind).
Auch nach dem Auszug der declamatio aus der kulturellen Öffentlichkeit in die frühmittelalterlicheKlosterschule blieb sie als mündlich und schriftlich gepflegte Schulübung ein wichtiger Nährboden literarischerEinbildungskraft und gelehrter Problemphantasie, aus dem seit dem 11. Jahrhundert eine neue, vielfältige undweit über die Schule hinaus wirksame Produktion hypothetischer Denkversuche in Literatur und Wissenschafthervorgehen sollte.71
Spätestens hier ließe sich nun mit strenger rhetorischer Logik einwenden, der um seiner selbst willeninteressante Problemfall gehöre nicht mehr zum Exemplum, weil er „zweifelhaft“ sei, also nicht als certumund gewisses Vergleichsmittel einen gegenwärtigen Zweifel beheben könne.72 Der Einwand trifft auf dasArgumentations-Exemplum in actu in der Tat zu. Im Sinne des frei verfügbaren, virtuellen Exemplums derinventio, das je nach Aspekt und Deutung verschiedenen Beweiszielen dienen kann, gehört jedoch derproblematische Casus durchaus in den Vorratsbereich der rhetorischen copia rerum et verborum, aus demheraus sich Beispiele für oder gegen eine Sache jeweils eindeutig und zweifelsfrei aktualisieren lassen. DieserEinsatz im Ernstfall einer bestimmten Argumentation ist aber nur dann unangreifbar, wenn der Redner alleAspekte seines Exemplums, gerade auch die spezifisch casus-haften und paradoxen zuvor kennengelernt underwogen hat. Darum gehören auch psychologisch-historische Fallstudien zur Ausbildung in der Kunst derinventio.
Der Casus steht also, gleichviel ob er, angewandt, zur Offenheit der „bleibenden Frage“ oder durchparadigmatische Übertragung zu einem ad hoc-Vergleich führt, in einer Vorphase des Beispielgebrauchs. Dochgerade von seiner Wirksamkeit hängt die Unterscheidung von induktiven und illustrativen Exemplaentscheidend ab. Daß der singuläre historische Fall wenigstens in der Fragestellung und Erkundung als einechter ‚denkwürdiger‘ Wissensgegenstand ernstgenommen wird, unterscheidet das daraus abgeleitete Beispielvon allen Verdeutlichungs-, Kinderlehr- und Indoktrinationsbeispielen.
70 Vgl. M. FUHRMANN, Die Fiktion im Römischen Recht, in: Poetik und Hermeneutik 10: ‚Funktionen des Fiktiven‘,München 1983, 413–415; unten § 67.71 Vgl. unten S. 279 ff.72 Vgl. oben Anm. 6.
32
13. Diese Polarität kann auch aufgrund der erwähnten Gegensatzbegriffe der „finiten“ und der „infiniten“Funktion weiter erhellt werden.73 Wie verhält sich die erste aktuelle Anwendung eines Beispiels zu dessenWiederverwendungs- und Konservierungsformen? Rezeptionsgeschichtlich dürfte jede neue Einbettung einesBeispiels in bestimmte Lebenszusammenhänge Spuren hinterlassen. Diese können sich kreuzen, stören,überlagern oder auch verwischen und gegenseitig auslöschen. Ist ein allmählicher Abschleifungsprozeßanzunehmen, bei dem ein Exemplum durch Wiedergebrauch sein spezifisch induktives Profil verliert undzuletzt zur infiniten „Lehre aus der Geschichte“ wird? Enthält der für die inventio bereitgestellte Schatz anexemplifizierbaren Erfahrungen und Geschichtskenntnissen – etwa in Exempla-Sammlungen – grundsätzlichnur noch trivial-illustrative Schulweisheit, oder hat sich auch in dieses Überlieferungsstadium hinein etwas vonder situationsbezogenen „Schlagkraft“ bereits einmal erfolgreich angewandter Geschichten hinübergerettet?Bildet die Vielfalt der Applikationen die Gewähr dafür, daß ein Beispiel etwas vom diskussionswürdigen Casusbewahrt hat?
14. Solche zweifellos nicht generell beantwortbaren Fragen wurden in der Forschung nicht zum historischenBeispiel, sondern zu den beiden seit Aristoteles damit verbundenen Beispielarten: der Fabel und der Parabel,gestellt. Den Anstoß bildete Lessings einseitige These von der allgemeinen moralischen Lehrhaftigkeit derFabel, zu der schon Herder in seiner Würdigung Lessings kritisch anmerkte:74
Lessings und Äsops Fabeln sind einander so unähnlich als die Zeiten beider; und der Hauptgrund des Unterschiedsist, wie mich dünkt, augenscheinlich. Äsop machte seine Fabeln bei wirklichen Vorfällen im gemeinen Leben, alsokonnte auch die Lehre, die er einkleidete, kein fein abstrahierter Satz, sondern eine praktische Lehre und Bemerkungfür eben das gemeine Leben sein, aus dem sie abgesondert war. Eine solche Lehre zeigt sich also auch meistens inwirklicher Handlung […] nicht bloß in einer feinen Veränderung von Gedanken: so mußte also auch die Darstellungderselben in der Fabel sein.
Auf diese Stelle berief sich 1899 der Begründer der Gleichnis-Jesu-Forschung, Adolf Jülicher, um seine Thesevon der argumentativ-rhetorischen
73 Vgl. LAUSBERG, Elemente … p. 38 f.74 G.E. Lessing, Abhandlungen über die Fabel (1759); J.G. Herder, ‚Gotthold Ephraim Lessing‘ (1781), weitere StellenLessings und Herders s. bei P.L. SCHMIDT, Politisches Argument und moralischer Appell: Zur Historizität der antikenFabel im frühkaiserzeitlichen Rom, in: Deutschunterricht 31 (1979) 74–88, hier 76; L. KOEP, Art. Fabel, RAC VII (1969)Sp. 129–154, hier 131; K. MEULI, Herkunft und Wesen der Fabel, Basel 1954, 7, 11 ff. (Diese Autoren teilen HerdersKritik in der Substanz.)
33
Bedeutung der Parabeln Jesu zu untermauern:75 Diese Gleichnisse seien zu besonderem Anlaß in bestimmterAbsicht vorgetragen worden; dann aber habe sich ihre ursprüngliche Situation in der Überlieferung verloren,sie selbst seien allgemeingültig umformuliert, ja „allegorisiert“ und damit hermeneutisch verfälscht worden.„Der Nagel, an den Jesus selbst seine Parabel gehängt hatte, ist ausgerissen und verloren gegangen“.76Dieseunter Theologen umstrittene These enthält einen für die Literaturwissenschaft unbestreitbaren, methodischzentralen Gesichtspunkt zur Beurteilung exemplarischnarrativer Kleinformen: Deren Sinn erschließt sich nurvom räumlich und zeitlich punktuellen „Sitz im Leben“, d. h. von der rhetorischen Intention. Er wandelt sichgrundlegend, wenn er sich von dieser historischen Bindung löst, „frei zu schweben“ beginnt. Aus einem„gereiften Urteil“ über eine bestimmte konkrete Aporie des Lebens wird dann leicht ein „frostigesEpimythium“ oder „eine langweilige abstrakte Morallehre“ für alle Zeiten.77
Unabhängig von Jülicher ist Karl Meuli, ein Gelehrter, der Altphilologie und Volkskunde in seltenerPersonalunion verband, zu fast gleichen Resultaten wie der Gleichnisforscher gelangt, bei dem Versuch,„Herkunft und Wesen der Fabel“ zu bestimmen.78 Auch er geht von Herders Lessing-Kritik aus, die er nochergänzt um eine bemerkenswerte Verwerfung morphologisch-anthropologischer Vorurteile der Romantik (wiederjenigen vom Ursprung der Fabel in der Volksseele oder von der reinen Urpoesie der Völker). Vor allemwendet er sich gegen das verbreitete, auch heute noch vorherrschende Interesse an den Fabelstoffen, das blindmache für die Hauptfrage nach dem, was er „soziologische Funktion“ nennt, d. h. nach der rhetorischenKontextualität der Fabel in konkreten Situationen (wer, wem, was, wann, wie und wozu
75 JÜLICHER, (wie Anm. 39) I 98 f.: „Selbst einem Lessing gegenüber, den auch hier Herder in Feinfühligkeit übertraf,werden wir als Fundament den Satz festhalten […], daß die Fabel nicht dem Dichter ihren Ursprung verdankt, sondern demRedner. Nicht gesungen oder geschrieben worden sind die ältesten Fabeln, sondern gesprochen, erfunden im Augenblick undfür den Augenblick und nicht um eine Weisheitsregel oder einen ethischen Lehrsatz anschaulich vorzutragen, sondern um eineschwierige Situation, in der sich der Redner befand, zu klären, um ihr die Auffassung und Beurteilung, die er wünschte, zusichern.“76 Ebd. 104.77 Ebd. 99 f. – In der Linie JÜLICHERS vgl. noch W. HARNISCH, Die Ironie als Stilmittel in den Gleichnissen Jesu, in:Ev. Theol. 32 (1972) 421–36; ders. Die Sprachkraft der Gleichnisse Jesu, in: Studia Theologica 28 (1974) 1–20; ders.; DieGleichniserzählungen Jesu, Göttingen 1985. Die semasiologische Gegenposition vertritt (nach P. RICOEUR, La métaphorevive, Paris 1975) etwa Hans WEDER, Die Gleichnisse Jesu als Metapher, Göttingen 1978. – Im übrigen sieht JÜLICHERsowohl bei der Fabel im allgemeinen wie bei der Tradition der Gleichnisse Jesu eine Dekadenz von der rhetorischen Paränesezu einer Poetisierung und Verselbständigung der Bildlichkeit.78 Vgl. oben Anm. 74 (erschien auch in K. MEULI, Gesammelte Schriften II, Basel 1975, 731 ff.).
34
erzählt).79 Nach dieser grundsätzlichen Klärung geht Meuli auf die ältesten Formen der Fabel in dergriechischen Literatur ein und weist in der „hintergründig bedeutsamen“ Geschichte, dem a¡noq , diefunktionale Kernform der Gattung nach. Dieser „verhüllte Vergleich“ tarnt eine rhetorische Absicht, eineBitte oder Warnung, die ohne die Hülle einer anscheinend abschweifenden Erzählung verletzen könnte oderwenig Erfolg hätte. So bittet der zurückgekehrte, noch unerkannte Odysseus den Schweinehirten Eumaios umeine Decke für die kalte Nacht, indem er eine parallele Geschichte von einem listenreichen Einfall, der schoneinmal dem Frierenden zum Mantel verholfen hat, erzählt, und erhält prompt das Gewünschte, „weil derainos tadellos ist“.80Meuli faßt die aus diesem und anderen Beispielen gewonnene Erkenntnis so zusammen:81
„Der alte ainos, die ursprüngliche lebendige Fabel“ sei „zunächst keineswegs Träger einer allgemeinenWahrheit, einer Moral, die irgendwann und allezeit belehren und bessern soll“, sondern „der diplomatischeVermittler einer ganz speziellen, sozusagen akuten Wahrheit, die einen bestimmten Hörer in einembestimmten Zeitpunkt unmittelbar treffen, im einzelnen, konkreten Fall unmittelbar wirken soll.“ Dasgemeinsame Kennzeichen der vorgeführten ainos-Beispiele, die stofflich betrachtet, das geschichtlicheExemplum und die fiktive Tierfabel unterschiedslos ein begreifen, ist ihre delikate Funktion in der Hand einesSchwachen, ein mächtiges und gefährliches Publikum, etwa einen Richter, einen Fürsten oder Tyrannen oder(in der Volksrede) den launenhaften, stets „geschichtensüchtigen“ Demos82 rhetorisch durch Rat, Kritik oderBitte zu einer Situationsänderung zu bewegen. Dieses narrative Mittel der „Klugheitsrede“ gehört ebenso indie Fürstenberatungs-, Gesandten- und Hofnarrenkunst wie zur geschäftlichen Überlistungstaktik und in dieZauberlehre der Demagogie.83 Auf den schon in der Antike nicht eben verbreiteten Terminus ainos(apologatio84) kommt
79 MEULI (wie Anm. 74) 8 f., 12, 26 f. – In der fast uferlosen Fabel-Forschung, auf die hier nicht eingegangen werden kann,scheint MEULIS Ansatz kein besonderes Ansehen zu genießen. Die jüngste umfassende Arbeit zum Mittelalter von KlausGRUBMÜLLER, Meister Esopus, Untersuchungen zur Geschichte und Funktion der Fabel im Mittelalter, Zürich–München1977, erwähnt MEULI nicht.80 Od. 14, 457 ff., 508; MEULI 13 f. – Zum Ainos vgl. auch O. CRUSIUS in: RE I 1 (1893) s. 1.; E. HOFMANN, Quaratione ‘poq, m†uoq, a¡noq, løgoq […] in antiquis Graecorum sermonibus […] adhibita sint, 1922, 49 ff.81 MEULI 17, 25 f.; zum Aspekt der Berufung auf frühere Leistung vgl. auch DORNSEIFF 213 f.82 MEULI 18 zum Spott des Aristophanes über die Geschichtensucht der Geschworenen in den ‚Wespen‘ sowie mit demHinweis auf Aristoteles, Rhet. II 20, wonach die Fabel besonders für das Volk geeignet sei (dazu s. unten S. 51 ff.).83 MEULI 15 f. zur Hofnarrenkunst nach einer Lutherstelle.84 Vgl. Quint. V 11.20.
35
es hier nicht an; die Sache selbst, der wir unter Ausdrücken wie strategemma, scomma, apologus, Decembrilibertas oder vafre dicta noch begegnen werden,85 ist von höchster Bedeutung für ein funktionales Verständnisder Exempla-Praxis.
15. Die Überlieferung solcher durch ihre Hülle zugleich eindrücklicher und rücksichtsvoller wirkendenGeschichten wurde nun wesentlich durch das allen literarischen Techniken oder artes zugrundeliegendeLernbedürfnis bestimmt: Gerade eine so subtile Kunstform wie die „Wahrheitsrede, die Klugheit, Witz undPhantasie braucht“, läßt sich nur an konkreten Musterbeispielen vermitteln und üben. Meuli verweist auf diegriechische Tradition, in der „die für einen bestimmten Fall glücklich geprägte Geschichte wieder und wiedergebraucht“ wurde, „wenn ein ähnlicher Fall sich wiederholte.“ „Es gibt sich weiterhin ganz von selbst, daß diefür den einen Fall ausgesprochene Wahrheit auch höhere, allgemeine Gültigkeit haben, daß sie eine ‚Moral‘sein kann“.86Damit scheint mir ein Kriterium für die Beurteilung des jeweiligen Verhältnisses von finit-aktualisierten und infinit-wiederverwendbaren Beispielen angesprochen: Brauchbare Geschichten, seien siehistorisch oder fiktiv, werden nicht wie Sentenzen wegen ihrer immergültigen Lehre, also aus inhaltlichenMotiven gesammelt und wiedererzählt, sondern ihr Nutzen kann auch rein methodischer Art sein, in einemBeispiel für Scharfsinn, Bauernschläue, diplomatische Behutsamkeit liegen, für Fähigkeiten, derenmustergültige Anwendung bewundert und nachgeahmt werden kann. Deshalb sind viele Gleichnisse undTierfabeln aller Zeiten in der Art des historischen Ausspruch-Beispiels (Anekdote, Apophthegma, Chrie) ausAnlaß einer erfolgreichen Anwendung bei einer tatsächlichen (oder vermeintlichen) Begebenheit überliefert.Das wohl berühmteste Beispiel, die Fabel vom Magen und den Gliedern, begegnet schon bei Solon und ist inder dem Menenius Agrippa zugeschriebenen Fassung87, durch Quintilian als Muster für die Volksredner-Fabelverewigt,88 auch als Wanderanekdote ein in immer wieder neuen konkret politischen Problemlagenaktualisierbares historisches Exemplum
85 Siehe unten § 73, S. 224 ff. Zur argumentativen Funktion des Erzählens vgl. grundsätzlich auch Harald WEINRICH,Erzählstrukturen des Mythos, in: ders., Literatur für Leser, Stuttgart 1968, 137–149, bes. 137 ff. zur besonderen griechischenRede- und Denkweise in der Fähigkeit, philosophisch-theoretische Gegenstände, über die wir heute „räsonnieren“ würden,„erzählend anzugehen“, d. h. überhaupt zur Sprache zu bringen, statt nur zu illustrieren.86 MEULI 17.87 Livius II 32.7–33.1.88 Quint. V 11.19–20 nennt dies und Horaz Ep. 1.1.73 mit der lat. Übersetzung für ainos: apologatio.
36
geblieben.89 Daneben ist die Erzählung aber auch als illustratives und eher triviales Gleichnis für dieUnabänderlichkeit gesellschaftlicher Einrichtungen ins Repertoire aller möglichen Moralprediger geraten.Dieses Beispiel ist semantisch sowohl Fabel, weil Körperteile nicht reden können, als auch Gleichnis, weil einausgebauter Vergleich zwischen Staatswesen und Körper vorliegt; unter dem rhetorischen Gesichtspunkt aberist es in erster Linie ein Beispiel aus der Geschichte, ein Exemplum, dessen eigentlicher Sinn in der tatsächlichgeglückten Verhinderung eines Volksaufstandes durch die richtige Erzählung im richtigen Augenblick liegt.Jülicher hat darin einen hervorragenden Beweis für den rhetorischen Ursprung der Fabel gesehen.90
Um nochmals auf seine Gleichnistheorie zurückzukommen, ist in Anbetracht der spezifischen Bedeutung desainos doch auch eine Differenzierung angebracht: Im Blickwinkel der Theologen nimmt sich die Ablösung derGleichnisse Jesu aus ihrer ersten Zweckbindung begreiflicherweise als „hermeneutische Verfälschung“ der zurekonstruierenden Ursprungssituation aus.91 Steht jedoch die gesamte Tradition eines rhetorischen Beispielsim Blickfeld, so gilt das abschätzige Urteil über die didaktische Trivialisierung freischwebend-allgemeingültiggewordener Exempla nur noch partiell: Nicht schon dadurch, daß sie aus dem historischen Zusammenhang derersten Anwendung gelöst werden, erhalten sie jenen „langweiligen“ Charakter; dieser wird ihnen vielmehrdurch eine erbaulich-lehrhaft orientierte Wiederverwendung aufgesetzt, bei der sie sterilisiert, vom Störfaktordes historisch Einmaligen gereinigt werden. Dieselben Exempla können in der Rezeption durchaus, wo nichtdie Bedeutung ihres Ursprungszwecks beibehalten, so doch analog dazu einem anderen rhetorischen Zweck alsinduktiv konkretes Vergleichsmittel dienen. Naturgemäß geschieht dies am ehesten in Texten zu bestimmtenAnlässen, wie in Briefen und Reden, weniger in der Wiedergebrauchsliteratur, in der die historische Situationder Beispiele oft als Zufall und Nebensache
89 Siehe S. 226 ff. – MEULI 27 f.; H. GOMBEL, Die Fabel vom Magen und den Gliedern in der Weltliteratur (Beih. derZRPh 80) 1934. W. NESTLE, Die Fabel des Menenius Agrippa, in: Klio 21 (1927) 350 ff. = ders., Griech. Studien, 1948,502 zum Ursprung der Fabel. – SCHMIDT (wie Anm. 74) 75 f. bezieht diese Art des Fabel-Erzählens ausdrücklich aufAristoteles, Rhet. II. 20 (s. S. 51 ff.), wo die Fabel eine Unterart des Paradeigmas bildet, und betont den geschichtlichenCharakter solcher „Geschichten“, die „unter der Oberfläche einer eingestandenen Fiktionalität die Wirklichkeit sozusagenmittelbar transparent machen.“ Auf Arist., Rhet. II 20 verweist auch MEULI 20, weil danach der spezifische Empfänger derFabel das weniger geschichtskundige als geschichtenfreudige Volk ist (vgl. unten S. 53 ff.).90 JÜLICHER (wie Anm. 39) I 99; weitere historisch finite Fabeln finden sich im Alten Testament: z. B. Judd. 9.7–15; IVReg. 14.9–11 zu Io(a)tham und Io.91 Vgl. WEDER (wie Anm. 77) passim.
37
unterschlagen wird. Insbesondere haben Exempla-Sammlungen die Tendenz, Konkretheit der Typisierung zuopfern, aus unwiederholbaren Momentaufnahmen der Vergangenheit „geflügelte Worte“ für immerherauszuschlagen. Sie dienen dem meist auch offen eingestandenen Hauptzweck der Bereitstellungillustrativen Materials für Redner auf der Suche nach anschaulichen Parallelen sowie dem heimlichenNebenzweck reiner Unterhaltung. Dennoch kann sogar diese Kompilationsliteratur, die ihrem Wesen nachnicht zur Verbrauchsrede gehört, sondern nur Beispiele für den Gebrauch anbietet, die einmaligenCharakteristika kluger Handlungen und Aussprüche der Vergangenheit in pädagogisch-übungstechnischem Sinnals Potential aufbewahren und einen praktischen „Transfer“ auf vergleichbare Situationen ermöglichen. Auchhier „sind die Grenzen zwischen Verbrauchsrede und Wiedergebrauchsrede fließend“.92
Wir gelangen damit zum Ausgangspunkt der Unterscheidung illustrativer und induktiver Exempla zurück undkönnen nun entschiedener die induktiv-pragmatische Grundfunktion des Beispiels hervorheben: Exempla sindim wesentlichen
92 LAUSBERG, Elemente § 19. – Neben dem hier untersuchten lateinischen Modellfall Policraticus wäre einausgezeichnetes Mittelalterliches Beispiel volkssprachlicher Literatur für die argumentationstechnische Kombination dererwähnten finiten und infiniten Aspekte das 1335 vom kastilischen Infanten Don Juan Manuel verfaßte Erzählwerk ‚El condeLucanor‘ (‚El libro de los exxiemplos del conde Lucanor et de Patronio‘, ed. H. KNUST, Leipzig 1900; übs. v. Jos. vonEichendorff, 1840, hrsg. v. A. STEIGER, Zürich 1983); ‚Libro del Conde Lucanor‘, krit. Ausg. jetzt von ReinaldoAYERBE-CHAUX, Madrid 1983). Diese aus historischen Exempla, Gleichnissen Fabeln (z. T. orientalischen Ursprungs)gemischte „Apologen“-Sammlung vergegenwärtigt überlieferten „lehrhaften“ Stoff in einer reizvollen, keineswegs lehrhaftenForm: Die Komposition – eine durchdachte Verschachtelung funktional unterschiedlicher Erzähltypen – scheint geradezudaraufhin angelegt zu sein, Allgemeingültiges nicht als solches in Erscheinung treten zu lassen, sondern pragmatischeVergleiche zwischen den Einzelfällen zu stimulieren. Der Autor, der sich in dritter Person als Vermittler oder „Finder“ derGeschichten präsentiert, gibt durch seine Vorrede und durch die alle Erzählungen proverbial beschließenden Versepimythieneinen autobiographisch gefärbten Rahmen, der das grundlegende Paradox der Unähnlichkeit und Vergleichbarkeit derIndividuen in Erinnerung rufen soll: Zwar gleiche kein Mensch dem anderen, wie „kein Gesicht dem anderen“ gleiche (vgl.auch S. 453), und doch hätten alle Menschen Gemeinsames, insbesondere sei allen die Freude an Geschichten gemein, ausdenen mehr zu lernen sei als aus gelehrten Büchern (vgl. S. 177 ff.). Darum „wäre es erstaunlich, wenn jemand zu irgendeinerSache, die einem Menschen zustoßen kann, nicht in diesem Buch das Gegenstück finden würde, das einmal einem anderengeschehen ist.“ Auf einer zweiten Ebene berichtet Don Juan Manuel die einfache Rahmenhandlung, ein Gespräch, daszwischem dem jungen Graf Lucanor und seinem Ratgeber Patronio, der dem Ratsuchenden mit 51 Exempla besonnenen undschlauen Verhaltens bestimmte Fragen im Sinne der Lebensweisheit oder politischen Klugheit beantwortet. Eine dieProblemsituation schildernde Erzählung leitet mit der historischen Analogieformel (wie: „Euch scheint es ähnlich zu ergehen,wie einst jenem …“) jeweils zu der Haupterzählung des Antwort- oder Orientierungs-Exemplums über. Der derart indirekt,gewissermaßen „sokratisch“ Angeleitete (vgl. S. 188 ff.) zieht daraus selbst induktiv die Schlußfolgerung für seine eigeneLage und „fährt damit wohl“, wie die ihm geltende Parallelgeschichte berichtet. Das überlieferte Erzählgut wird durch diesefeinsinnige Konstruktion einer historiographischen Berichterstattung von einem Meister-Schüler-Dialog (bzw. einemErzähler-Publikum-Verhältnis) als ein Schatz erprobter, in immer wieder neuen Situationen individuell hilfreicher Beispielevorgestellt. Die Finitisierung verhindert den Eindruck automatischer „Deduktion“ aus ewigen Prinzipien oder derunspezifischen Wiederholung moralischer Gebrauchsstücke (obwohl sich unter den Exempla auch berühmteste äsopischeFabeln befinden).
38
auf menschliche Tätigkeit in einer bestimmten geschichtlichen Situation bezogen; sie gehen von derAnnahme aus, daß dem Tätigen Erfahrungen anderer eher weiterhelfen als allgemeine Prinzipien. Wo siedennoch zum Akzidens, zur Illustration von Prinzipien werden, erfüllen sie ihre rhetorische Bestimmung nurnoch bedingt, in einem abgeleiteten Sinn, und geraten semantisch in die Nähe bloßer Metaphorik undtropischer Rede.93
Da die Induktion des Rückgrat des echten Exemplums bildet, muß dazu noch ein mögliches Mißverständnisbeseitigt werden: Nach der umfassenden humanistisch-pädagogischen Rhetorikdefinition, die seit Cicero undQuintilian die Bildungstheorie für Jahrhunderte bestimmt hat, gibt es eine hermeneutisch-erfahrungsmäßigeInduktion, die individuelle Fälle auch unter sich, ohne den Umweg über das „philosophisch Allgemeine“ zuvergleichen erlaubt. Selbst Aristoteles, der seine erkenntnistheoretische Stufenleiter vom niedrigen sinnlichenWahrnehmen hinauf zur höchsten abstrakten Erkenntnis des Allgemeinen als eine logische Induktionverstand, hat in seiner Rhetorik (gerade in der Theorie des Beispiels) ausdrücklich einen wesentlich anderenEpagoge-Begriff entwickelt und hier auch die erfahrungsmäßige Deutung des Einzelfalls durch gleichartigeEinzelfälle als induktives Verfahren gewertet.94 Nicht der Aufstieg von den Fällen zu der universalen Regel,der im Grunde nur eine verkappte umgekehrte Deduktion darstellt, sondern der pragmatische Vergleich desBesonderen mit dem Besonderen als dem Nicht-Systematisierbaren macht seit der Antike die eigeneantirationalistisch-antiszientistische Bedeutung des Exemplums aus. Nicht die „Weisheit“ der Theorie,sondern die „Klugheit“ der Praxis ist der eigentliche „Nutzen“ von Exempla, und er ist umso höher, jekonkreter „der Mensch in seinem Widerspruch“
93 Siehe unten S. 49 ff., 63 ff.94 Renate ZOEPFFEL, Historia und Geschichte bei Aristoteles (Abhandlungen der Heidelberger Akad. d. Wiss., phil.-hist.Kl.) 1975. 2. Abh., 17 ff. zur Inkonsequenz der Induktionsdefinitionen in der Topik, Analytik und Nikomach. Ethik (nachdem Aufstiegsmodell vom Partikulären zum Allgemeinen) und in der Rhetorik (nach dem Fall-Vergleichs-Modell); vgl.unten § 50.
39
dabei sichtbar wird. In Umkehrung der Burckhardtschen Sentenz, die ihrerseits nur eine vermeintlich„bescheidene“ Umwandlung des Satzes Historia vitae magistra darstellt, wollen Exempla zuerst nur „klug fürein andermal“ und erst dann – vielleicht – auch noch „weise für immer“ machen. Sie sind weniger im Bereichder Wahrheitssuche und Wahrheitsverkündung beheimatet als in dem des Wahrscheinlichkeitswissens und derKonsens-bildung.95
B) FORMALE ASPEKTE (GESCHICHTSVERGLEICH ODER ERZÄHLUNG)
Schwierigkeiten einer mediävistischen Definition des Exemplums: rhetorische Funktion oder homiletische Erzählgattung?(§ 16)
16. Die bisher erwogenen anthropologischen Gesichtspunkte gilt es nun auf eine literaturwissenschaftlicheDefinition hin zu orientieren und mit anderen, rein formalen in Beziehung zu setzen. Das Exemplum istsowohl exemplarisches Ereignis als auch dessen Erzählung, sowohl moralisches Vorbild (bzw. abschreckendesWarnbild) als auch Beleg und Beweis für einen Gedanken, sowohl ein vorbildlicher Mensch als auch einemustergültige Tat.96 Alle diese
95 Vgl. Jacob BURCKHARDT, Weltgeschichtliche Betrachtungen, hrsg. P. GANZ, München 1982, 230 (168): „Damiterhält auch der Satz: Historia vitae magistra einen höheren und zugleich bescheidnern Sinn. Wir wollen durch Erfahrung nichtso wohl klug (für ein andermal) als weise (für immer) werden.“ – Zur grundlegenden Verschiedenheit der beidenInduktionsbegriffe vgl. die anregenden, auf Vico bezüglichen Ausführungen von D. HARTH, Christian Wolffs Begründungdes Exempel- und Fabelgebrauchs im Rahmen der praktischen Philosophie, in: DVJs 52 (1958) 43–62, bes. 51 f., 58 f.96 Zur Begrifflichkeit Johanns von Salisbury s. unten §§ 40 f., 50. – Die bisherigen Definitionen der Forschung sind bei R.SCHENDA, Stand und Aufgaben der Exemplaforschung, in: Fabula 10 (1969) 69–85 und BRÉMOND/LEGOFF/SCHMITT (wie Anm. 58) 27–36 mehrheitlich referiert. Die Hauptmerkmale lassen sich anonym so zusammenfassen:1. Das Exemplum ist eine literarische Erscheinung und/oder eine Vokabel (d. h. wie das Wort Beispiel in „zum Beispiel“);2. eine literarische Gattung (kleine narrative Elementarform) und/oder eine literarisch-rhetorische Funktion; 3. eine Erzählungund/oder ein vorbildlicher Mensch mit seinem Verhalten; 4. ein sich exemplarisch verhaltender Mensch und/oder dieErzählung von einem solchen; 5. es handelt von Menschen und/oder von Tieren und Naturdingen; 6. von historischen(mythischen) und/oder erfundenen Menschen und Ereignissen; 7. von Helden und/oder beliebigen Alltagsmenschen; 8. isteine Erzählung und/oder ein Vergleich (Gleichnis); 9. erzählt ein Ereignis und/oder nennt einen Handlungsträger; 10. ist einHandlungsbericht und/oder ein Zitat (Ausspruch, Autorität); 11. eine Kurzerzählung und/oder eine längere Erzählung; 12. einmahnendes/abschreckendes Beispiel für die Lebensführung und/oder ein Beweismittel und Beleg; 13. ein Beweismittel/eineDenkfigur und/oder ein Schmuckmittel/eine Redefigur; 14. ein Persuasionsmittel und/oder ein demonstrativesBeschreibungs- und Amplifikationsmittel (der Panegyrik oder Beschimpfung); 15. ein (nur/nicht nur) in Predigten, sondernauch/keineswegs aber in allen andern Gattungen vorkommendes Verfahren; 16. eine lehrhaft-erbauliche und/oderunterhaltsame Geschichte; 17. ein rein christliches Literaturphänomen, auf das ewige Heil und die letzten Dinge bezogen,und/oder ein universelles, auf jegliche Tunlichkeit gerichtetes Überzeugungsmittel; 18. ein normbegründender Präzedenzfallund/oder ein strittiger normauflösender Problemfall; 19. eine historisch einmalige Erscheinung des späteren Mittelalters odereine abendländisch, bzw. anthropologisch allgemeine Grundform des Denkens und Redens. – Schon aus dieser Aufzählungdürfte deutlich werden, daß die engen und die weiten Exemplum-Begriffe nicht in ein und derselben Definition Platz habenkönnen. SCHENDA (p. 81) vollzieht darum zu Recht eine durch Substraktion negative Synthese: „Das Exemplum ist nichtimmer eine Erzählung. Exempla kommen nicht nur in Predigten, sondern auch in Lesebüchern vor. Das Exemplum verbindethäufig lehrhafte Züge mit unterhaltsamen. Das Exemplum ist von der griechisch-römischen Antike bis zur Gegenwartliterarisch nachweisbar. Es will zu allen Zeiten moralisch aufbauen.“ Was übrig bleibt, ist die klassische Definition aus derRhet. ad Her. IV 49, 62 (unten Anm. 374), die einzige, die dank theoretischer Allgemeinheit SCHENDAS m. E. völligberechtiger Generalabrechnung mit den bestehenden spezialistischen Mauselochperspektiven der Exemplaforschung standhält.LE GOFF, der (in BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT, wie Anm. 58, 35) SCHENDAS Bestimmung „évidemment beaucouptrop vague“ findet, gelangt selbst (37) zu einer Kompromißformel, die eigentlich nur das spätmittelalterlichePredigtexemplum meint, aber die allgemein-rhetorische Definition nicht offen ausschließt: „un récit bref donné commevéridique et destiné à être inséré dans un discours (en général un sermon) pour convaincre un auditoire par une leçonsalutaire.“ Klarer war immerhin seine Definition von 1974 (J. LE GOFF, Préf. des ‚Propos de St. Louis‘, p. 17: „unehistoriette dont on truffe un sermon pour faire passer auprès d’un auditoire une leçon morale, une vérité religieuse, enl’amusant […]“
40
Merkmale müssen in eine weite, arbeitshypothetisch brauchbare Begriffsbestimmung eingehen, die dasZusammenwirken der vielfältigen Beispielarten in einer bestimmten Literatur des Mittelalters (hier durchJohann von Salisbury repräsentiert) beschreibbar macht und die gegebenenfalls am Ende der Analyse engeroder genauer gefaßt werden kann. Vor einer einengenden „präliminaren Definition“ warnt nicht nur allgemeinKants methodische Regel, daß „angemessene Deutlichkeit“ ein Werk eher beschließen als eröffnen soll,sondern in diesem besonderen Fall auch eine fachspezifische Unklarheit über den Terminus „Exemplum“, dieweniger auf ein Sachproblem als auf merkwürdige wissenschaftsgeschichtliche Gewohnheiten oder„Engramme“ zurückzuführen ist: Während Philologen und Rhetorikforscher von der rhetorischen Praxis derAntike her unter Exemplum vornehmlich einen Helden, eine historische Beispielfigur aus der Galerie großermaiores (wie Cato, Regulus, Fabricius), ergänzt um die nachahmenswerten Gestalten der
41
Bibel und die christlichen Heiligen, verstehen,97 können Volkskundler und Erzählforscher darin nur diehomiletische Kurzerzählung, das sog. Predigtmärlein sehen, ein nicht notwendig historisches, jedenfallsunterhaltsam erbauliches Geschichtchen, verwandt mit Fabel, Schwank, Märchen oder Novelle.98
Die Spezialistengruppen kommen nur mühsam ins Gespräch und zeigen wenig Bereitschaft zu einergemeinsamen Fragestellung oder gar Definition. Der vorherrschende Eindruck beim Lesen beiderleiForschungsliteratur ist der von zwei nicht ineinander übersetzbaren Sprachen. Es scheint Gelehrte zu geben,die es geradezu als eine Zumutung von sich weisen, sei es in die Niederungen des volkstümlichen, auchvolkssprachigen Schwanks hinabzusteigen, sei es zu den Kunstformen einer gelehrt-elitärenArgumentationstechnik in lateinischer Sprache hinaufzusteigen.99
Andere sind in ihrer jeweiligen Spezialisierung verunsichert durch die Weitläufigkeit des Begriffs und„dekretieren“ ihre eingeschränkte Bestimmung als die allein richtige oder interessante. Dies trifft vor allemauf eine Gruppe von Volkskundlern und Sozialhistorikern zu, die literaturtheoretische Probleme schnell alseine Art müßiger Rabulistik hinter sich bringen möchten, um zur Sache zu kommen, d. h. die homiletischenExempla als ergiebige historische Stoffquelle auszuwerten.100 Schließlich besteht noch die Möglichkeit, das
97 Die wichtigste Literatur zum antiken Exemplum verzeichnen J. BERLIOZ/J.-M. DAVID, Rhétorique et histoire,L’exemplum et le modèle de comportement dans le discours antique et médiéval, (Mélanges de l’Ecole française de Rome,Moyen Age-Temps modernes 92, 1) 1980, 15–23; BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT (wie Anm. 58) 20. Zumpersonalisierten Exemplum überhaupt vgl. S. 70 f.98 Zur Bibliographie s. BERLIOZ/DAVID 23–32; BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 24 ff.; Ernst Heinrich REHERMANN,Das Predigtexempel bei protestantischen Theologen des 16. und 17. Jahrhunderts, Göttingen 1977, 7 ff.99 Zu solcher Vermutung geben etwa Anlaß Fritz P. KNAPP, Similitudo, Wien/Stuttgart 1975, 78 hinsichtlich dervolkstümlichen Erzählung; J. BERLIOZ, Le récit efficace, l’exemplum au service de la prédication (XIIIe–XVe s.), in:BERLIOZ/DAVID 113–146, hier 118 hinsichtlich der rhetorischen Tradition. Das ältere Hauptwerk zum homiletischenExemplum, J.-Th. WELTER, L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen âge, Paris/Toulouse1927/Genf 1973, läßt das Exemplum überhaupt erst mit der Predigt Jesu beginnen. (Eine einzige Anmerkung 10 erwähnteinige römische Autoren als „quantité négligeable“.) – Das Problem solch isolierender Betrachtungsweise sehen kritisch:DAXELMÜLLER, Exemplum 633; A. VITALE-BROVARONE, Persuasione e narrazione, l’exemplum tra due retoriche,VI–XII secolo, in: BERLIOZ/DAVID, Rhet. et hist. 87–112, bes. 91.100 So berechtigt auf der Gegenseite die Klage des polnischen Sozialhistorikers Bronis-law GEREMEK (L’exemplum et lacirculation de la culture au moyen âge, in: BERLIOZ/DAVID, Rhét. et hist. 153–179, hier 155) zur Editionslage mal.Predigt-exempla ist, die von Literaturhistorikern um des Pittoresken und Schwankhaften willen oft ungebührend selektivherausgegeben wurden, muß hier folgende Mißlichkeit festgestellt werden: Wenn in der von L. GÉNICOT herausgegebenen,im allgemeinen ausgezeichneten Reihe ‚La Typologie des sources du moyen âge occidental‘ ein Band „L’exemplum“erscheint, darf darin eine Definition des Wortes Exemplum erwartet werden, die nicht allein an einem sozialhistorischenErgiebigkeitsbegriff orientiert ist, sondern sprach- und formgeschichtliche Forschungsergebnisse adäquat berücksichtigt. DerHauptautor des Bandes, Jacques LE GOFF teilt nun (p. 27) nach einer eher rudimentären Definition von Th. F. CRANE(The ‚exempla‘ … of Jacques de Vitry, London 1890, p. XVIII) den immensen Bereich dessen, was Exemplum in sprach-und literaturhistorischer Hinsicht bedeutet, in die zwei Gruppen „our ‚example‘ in a general sense“ und „an illustrative story“ein, wobei letztere Bedeutung „nicht vor dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts“ entstanden sei. Nur diesem„phénomène historiquement défini entre le XIIe et le XVe siècle“ will er sich annehmen. Daß damit aber nicht bloß einelegitime Abgrenzung im Sinne wissenschaftlicher Spezialisierung vorgenommen wird, zeigt der ganzheitliche Anspruch desBuches mit seiner steten Thematisierung der römischen und rhetorischen Exempla-Tradition, die nach einem unerkennbarenKriterium bald zu Vergleichen und Ableitungen herangezogen, bald als unvergleichbar ausgeschlossen wird. (Einiges dürfteauch auf die von L. GÉNICOT in seinem Geleitwort zwischen den Zeilen angedeutete Verständigungsproblematik der dreiAutoren LE GOFF, BRÉMOND und SCHMITT zurückzuführen sein.) Unmittelbar nach zitierter Absichtserklärung (p. 7)wird die Einbeziehung allgemeiner Gesichtspunkte als zu meidende „confusion“ disqualifiziert. Das „exemple en général“aber wird als „lebendes Beispiel“, „vorbildliche Person“ mit dem antiken und antik-christlichen kurzerhand gleichgesetzt.Darauf folgt in m.E. apologetisch beschwörendem Ton (p. 28): „Il faut d’entrée en jeu, dire que l’exemplum médiéval, ausens où nous l’entendons, ne désigne jamais un homme mais un récit …“. Im Weiteren erkennt man bald, daß dieKomplexität der Sache als Wirrwarr der Forschung ausgegeben werden soll und gerade die interessantesten Probleme (als„Feinde der Klarheit“) bewußt abgewehrt werden. So geht LE GOFF (33 f.) an der grundlegenden wortgeschichtlichen
42
literaturtheoretische Problem zu leugnen oder zu übersehen, eine gattungsgeschichtliche Kontinuität zwischenantikem und spätmittelalterlichem Exemplum aufgrund der gleichen Bezeichnung weniger nachzuweisen alsdurch Einebnung manifester Unterschiede vorauszusetzen und zu behaupten, etwa indem man einleitend dieGeschichte des volksliterarischen
Untersuchung von H. KORNHARDT (Exemplum, Diss. Göttingen 1936) als „trop inspiré par l’exemplum antique“ vorbeiund disqualifiziert praktisch die gesamte Forschung zum patristischen Exemplum, die er nicht erwähnt, weil „ce typed’exemplum“ im „sens général“ gebraucht werde, „qui ne se s’applique pas au sens spécifique, le seul dont nous traitons ici.“Die Beschränkung stellt LE GOFF andererseits (18) als ein „Risiko“ der Definition dar, um sich von A. VITALE-BROVARONE (wie Anm. 99) zu distanzieren, der in einer umsichtigen theoretischen Untersuchung zu dem Schluß gelangtist (91), daß das Exemplum der Historiker mit dem Exemplum der „Dialektiker“ nichts zu tun habe, und ein gängigerlogischer Grundfehler der Forschung zu meiden sei, nämlich die Kombination der textwissenschaftlich anthropologischenStrukturfrage nach der allgemeinen Persuasionsform des Exemplums mit der partikulären kulturhistorischen Frage nachhomiletischen Themen und Methoden der spätmittelalterlichen Bettelmönche (unten §§ 34 ff.). Das im Folgenden behandelteExemplum der lateinischen rhetorischen Tradition war im ganzen Mittelalter als literarisches Verfahren, nicht bloß als„Beispiel im allgemeinen Sinn“, unter dem Terminus exemplum mindestens ebenso etabliert wie das späte Predigtexempel.Es ist darum eine unzulässige Generalisierung von spezifischen Merkmalen des homiletischen Exemplums, wenn LE GOFF(34 f.) das Exemplum durch die „leçon salutaire“, d. h. die religiös heilspädagogische Sinngebung, ja noch enger durch „lesouci des fins dernières […] un gadget eschatologique“ definiert (37) und einem besonders radikal um Definitionsklarheitbemühten Forscher wie SCHENDA glaubt vorwerfen zu müssen (35): „Il ignore le caractère essentiellement religieux del’usage de l’exemplum.“ Ironischerweise zielt der Hauptvorwurf von Chr. DAXELMÜLLER (628) gerade in dieGegenrichtung: SCHENDA habe trotz seiner Kritik an der Reduktion des Exemplums auf das Predigtexemplum selber einenzu eingeschränkten, nicht wirklich universell funktionalen Exemplumbegriff und bleibe einer didaktischmoralischenVorstellung verhaftet (s. unten Anm. 110).
43
Predigtexempels ab ovo bei Aristoteles beginnen läßt,101 oder indem man einer altphilologischen Darstellungdes rhetorischen Exemplums einen
101 Goswin FRENKEN definierte in seiner Dissertation (Die Exempla des Jacob von Vitry, München 1914), einereinflußreichen Pionierarbeit auf unserem Gebiet, die Exempla ganz im homiletischen Sinne des späteren Mittelalters (p. 5)als „Erzählungen, die einen moralischen Satz bildhaft in fortschreitender Handlung – das allgemeine im besonderen –darstellen sollen und sich moralisch ausdeuten lassen; […] jede kurze Erzählung, die geeignet ist und angewandt wird, imZusammenhang einer Predigt die theologische und moralische Deduktion durch den sie induktiv beweisenden Bericht einesinteresseerregenden Vorgangs abzulösen.“ Er sah darin zugleich eine (Fabel und Gleichnis umgreifende)literaturanthropologische Urform (repräsentiert durch Pantschatantra, Talmud, Koran und Bibel). Die Merkmale des Predigt-exemplums leitet er dennoch aus der antiken Rhetorik seit Aristoteles ab, was ihm nur gelingt, weil er ein Neben- undAusnahmephänomen der Exemplum-Theorie: die äsopische Fabel, zur Regel und Hauptsache erklärt (unten §§ 24 ff.). –WELTER hat in seiner monumentalen Arbeit nur die homiletische „historiette“ als spezifisch christliche Literaturformuntersucht. Da jedoch die Erzählthemen der Prediger „tout le fond narratif et descriptif du passé et du présent“, also auchheidnisches Material einschließen (p. 2) und andererseits die Kirchenväter als Wegbereiter vorgestellt werden, ist das antikerhetorische Exemplum in der Untersuchung unablässig präsent, ohne daß WELTER dies offenbar bewußt war. JederRückgriff auf die patristische Literatur führt notgedrungen auch zur Tradition des römischen Heldenexemplums (vgl.S. 50 ff.). Dabei fallen die Vertreter einer rein homiletischen Exemplum-Definition (neben WELTER auch LE GOFF [wieAnm. 58] 29 f., 34 f., 43 f., 48) leicht in Selbstwidersprüche. Auch die Sammelpublikation „Rhétorique et Histoire“ ed.BERLIOZ/DAVID von 1980 (wie Anm. 97) bleibt trotz vieler sehr wertvoller Einzelbeiträge (gerade auch zurbegriffsgeschichtlichen Diskussion) im letzten eine „Buchbindersynthese“: Zwei altphilologische Arbeiten zum Exemplumder Rhetorik erscheinen darin merkwürdig beziehungslos neben den 5 Beiträgen des Hauptteils über das spätmittelalterlichePredigtmärlein. (Einer der Autoren äußert selbst Unbehagen darüber; vgl. oben Anm. 100 zu VITALE-BROVARONE).
44
Anhang über das mittelalterliche Fortleben in der homiletischen Tradition beigibt.102
Zunächst ist die einfache Feststellung zu wiederholen, daß das Exemplum, wie immer man es fasse,ursprünglich einen literarisch-rhetorischen Funktionsbegriff darstellt, nicht aber einen Gattungsbegriff.103
Exempla sind Teile verschiedener sie verwendender Gattungen. Gleichviel ob „Histörchen“ oder historischeGestalten: Exempla sind stets auf den sinngebenden argumentativen Kontext angewiesen. Seit der Antikewerden sie entsprechend in eigenen
102 Dies gilt von der ansonsten vorzüglichen Konstanzer Dissertation zum antiken Exemplum (namentlich bei Seneca) vonKurt GEBIEN (wie Anm. 4), der den hohen gesamtlatinistisch-rezeptionsästhetischen Anforderungen ManfredFUHRMANNS gerecht zu werden versuchte (vgl. dessen, zusammen mit H. TRÄNKLE herausgegebene Programmschrift‚Wie klassisch ist die klassische Antike?‘, Zürich 1970, 18 ff.). GEBIENS Kapitel über „das Exempel im Mittelalter“ (78 ff.)bietet eine seltsame Kombination der konventionellen altertumskundlichen Nachleben-Philologie mit einer Aufbereitung eherveralteter mediävistischer Sekundärliteratur zum Predigtmärlein und läßt den Leser der vorangehenden nützlichen Analyse desrhetorischen Exemplums von Aristoteles zu den Kirchenvätern ratlos vor jenem völlig anderen schwankhaften Geschichtchenspätmittelalterlicher Volksmission stehen, ohne daß die vorhandenen Brücken etwa von Seneca zu Hieronymus und der sog.Renaissance des 12. Jhs., d. h. die mittelalterlichen Analogien zu dem, was etwa Cicero und Quintilian unter exemplumverstanden, sichtbar würden. Dazu s. unten §§ 36–8.103 Vgl. in diesem Sinne auch C. DAXELMÜLLER, Exemplum 627; ders., Exemplum und Fallbericht, in: Jb. f.Volkskunde NF 5 (1982) 149–159, bes. 150 f.; BRÜCKNER, Historien (wie Anm. 2) 22; SCHENDA (wie Anm. 96) 81;H.D. OPPEL, Exemplum und Mirakel, in: AKG 58 (1976) 96–114, hier 103 (gegen F.C. TUBACH) u.a.m. – LE GOFF(BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 36) definiert das Exemplum demgegenüber als Erzählung, „ce qui conduit à replacercelui-ci dans l’étude des genres et formes littéraires narratifs du moyen âge.“ – Diskutiert wird in diesem Zusammenhangauch JOLLES‘ (wie Anm. 58) Begriff der „einfachen Form“: die vorliterarisch „ubiquitäre Urform“ und„Geistesbeschäftigung“, die jeder Gattungsbildung vorausliegt. (Zur Kritik vgl. DAXELMÜLLER ‚Exemplum‘ 627; Herm.BAUSINGER, Formen der ‚Volkspoesie‘, Berlin 1968/1980, 60 f.) JOLLES selbst hat (177) das literarisch voll entwickelteExemplum definitionsgemäß aus dem Katalog der einfachen Formen ausgeschlossen; es gehört in der Tat zu den „operativenBegriffen, deren Wesen es ist, in unthematischer Weise zu fungieren“ („gekonnte Griffe“), wie H. LIPPS (Untersuchungen zueiner hermeneutischen Logik, 1938, 56) formuliert. H.R. JAUß hat die „einfachen Formen“ zu literarischen „Möglichkeiten“und „heuristischen Kategorien“ im Sinne seines eigenwilligen Gattungsbegriffs modifiziert oder umdefiniert (Alterität undModernität der mal. Lit., München 1977, 38 ff.) und darunter auch das Exemplum subsumiert (ebd. 44; vgl. auch ders.,Negativität und Identifikation, in: Poetik und Hermeneutik VI, ‚Positionen der Negativität‘, München 1975, 311 ff.), das erneben Sprichwort, Parabel, Allegorie, Fabel, Legende, Märchen, Schwank, Novelle zu den „kleinen literarischen Gattungender exemplarischen Rede“ rechnet. Auf die weitläufige Debatte über eine allgemeine Gattungstheorie des Mittelalters kannhier nicht eingegangen werden; hervorzuheben ist einzig, daß das Exemplum darin kaum je uneingeschränkt als„Erzählgattung“ erscheint, sondern als ein Proteus zwischen „Funktion“, „einfacher Form“, anthropologischer „Urform“,„Elementarform“, „Konzeption“ und ähnlich vagen Kategorien.
45
Sammlungen für den vielfältigen kontextuellen Wiedergebrauch zur Verfügung gestellt. SolcheExemplasammlungen bilden in der Tat eine Gattung, nicht aber deren einzelne Bestandteile.104
Ob trotzdem das spätere Mittelalter in einer eigenartigen Extrapolation das Exemplum zu einer erzählendenGattung im strikten Sinn – wie etwa Fabel oder Märchen – erhoben habe, kann hier dahingestellt bleiben.Unbestreitbar wurde seit dem 13. Jahrhundert eine beliebige Erzählung (mit oder ohne moralische Pointe),namentlich in homiletischem Zusammenhang gelegentlich exemplum genannt, womit sowohl die berichteteres wie die berichtende historia gemeint sein konnten.105 Eingeschränkt wird der Wert diesersprachgeschichtlichen Feststellung durch die Unzahl von anderen Bedeutungen, die das Wort sonst und geradeauch als homiletischer Fachterminus (insbesondere
104 Sosehr sich das antike und das spätmittelalterlich-homiletische Exemplum unterscheiden, haben sie doch die Möglichkeitvorliterarisch-mündlicher Verwendung mit den „einfachen Formen“ gemein: Es gibt das Exemplum als virtuellesGebrauchselement, das erst „unter der Hand“ des Benützers zum aktuell literarischen wird. Der Stoff liegt in mündlicherTradition oder in Exemplasammlungen gleicherweise rudimentär der Funktionalisierung zum Exemplum voraus, weshalb inder Forschung über das homiletische Exemplum beklagt zu werden pflegt, daß wir von den meisten in Sammlungenvorkommenden Exempla die wirkliche Gestaltung in Predigten nicht kennen (BERLIOZ [wie Anm. 99] 115; VITALE-BROVARONE [wie Anm. 99] 89 ff.; J.-Cl. SCHMITT, Recueils franciscains d’exempla et perfectionnement des techniquesintellectuelles du XIIIe au XVe s., In: Bibl. de L’Ecole des Chartes 135 [1977] 5–21, hier 20 f.), während KORNHARDT(wie Anm. 100) 86 zu den in Sammlungen vorliegenden im Vergleich mit den (etwa bei Cicero) ausgestalteten antikenExempla sagt, sie hätten „von jeher etwas Minderwertiges“: „Die literarische Leistung lag auf seiten der Benutzer, nicht derVerfasser solcher Sammlungen“. Vgl. auch GEBIEN 79 zu Dante und den Exemplasammlungen.105 Vgl. oben Anm. 110 zu CRANE XVIII: seit rund 1200 Parallelität und leichte Verwechselbarkeit der BedeutungenBeispiel/Vorbild und „illustrative story“. OPPEL (wie Anm. 103) 101 verweist auf den Titel exemplum neben historia,narratio, fabula, miraculum, moralizatio in homiletischen Exempla-Sammlungen. – Zur Ungeschiedenheit der Ereignis-und Erzähl-Bedeutung s. unten §§ 36, 42. – Bereits J.A. MOSHER (The Exemplum in the Early Religious and DidacticLiterature of England, New York 1911, 5) hat auf die Vieldeutigkeit des exemplum-Begriffs hingewiesen, obwohl er glaubte,ein exemplum als Gattung klar definieren und vom exemplum im weiten Sinne von „any illustration“ abheben zu können:„Exemplum […] was pretty generally applied to figures of speech and analogies, even after the exemplum had become a well-defined form of religious and didactic literature“ (vgl. unten Anm. 287). Ein einziges Zitat mag die semantische Komplexitätbeleuchten: Humbert von Romans erinnert in seiner Predigtlehre ‚Liber de abundantia exemplorum‘ (s, WELTER 72) an diebekannte Anekdote Bedas (Prol., ed. GEBIEN 174): Ein gebildeter Bischof habe trotz subtilitas die hartnäckigen Schottennicht bekehrt, wohl aber ein weniger gebildeter Prediger utens exemplis et parabolis. Ebenso habe Barlaam Josaphat bekehrt,und Augustinus sei zum Christentum gelangt plus motus ad exemplum mire conversationis beati Antonii heremite […] quamad sermones beati Ambrosii, quam ad preces et ad fletus matris […] (dazu s. unten S. 97 ff.) Hier werden als exempla(parallel zu Gleichnissen) literarische Erscheinungen, aber gleichzeitig auch vorbildlich handelnde (nicht nur redende)Menschen bezeichnet. Ja, im gleichen Satz (ebd. 175) kommen beide Bedeutungen zusammen: Exemplo Gregorii qui insermone unum vel duo exempla interserebat. Wie soll man dementsprechend folgende Stelle der Vorrede zum Alphabetumnarrationis (Hist. Litt. 20 [1842] 273) verstehen: Antiquorum patrum exemplo didici nonnullos ad virtutes fuisse inductosnarrationibus aedificatoriis et exemplis? Hier wird zwischen Erzählungen und lebenden Vorbildern (wie imBekehrungsbeispiel Humberts) unterschieden, und doch könnte der Mediävist im Banne des homiletischenExemplumbegriffs darin auch die Unterscheidung zweier literarischer Formen (bzw. exemplarischdidaktischer Verfahren)sehen (so bei GRUBMÜLLER, Meister Esopus [wie Anm. 79] 99).
46
für Arten des Vergleichs) haben konnte.106 Erwähnt sei hier die sonderbare, aus dem romanischenSprachgebrauch (von essample) stammende Bedeutung einer von Mund zu Mund gehenden, herumerzähltenBegebenheit oder Geschichte mit dem Beiklang von Gespött, Geschwätz, Gerücht, Legende, „Mär“, fastsynonym zu dem bekannteren (auch in die Vulgata eingegangenen)
106 Der in der Exemplaforschung selten zitierte Predigtforscher G.R. OWST hat schon 1933 die bis anhin beliebte Definitionvon MOSHER als zu eng kritisiert (Literature and Pulpit in Medieval England, Cambridge 1933/Oxford 1961, 152): Das inPredigten und Predigthandbüchern geläufige exemplum sei „the general allusive term for any kind of homiletic simile orillustration“; der Begriff umfasse Vergleiche, Metaphern, Allegorien, Erwähnungen von Heiligen, Legenden, Anekdoten;fiktive Geschichten geistlicher oder weltlicher Herkunft, aus dem Leben Jesu ebenso wie aus Tierfabeln. M.a.W. wird hieraufgrund der Belege klar, daß ein solcher Universalterminus gerade im homiletischen Bereich sich schlecht zumGattungsbegriff eignet. Allerdings muß ergänzt werden, daß exemplum in der rhetorischen Theorie der Antike und in derenmal. Überlieferung bis hinein in die artes praedicandi trotzdem ein präziser technisch-funktionaler Spezialterminus gebliebenist; s. S. 144 ff, Anm. 364. Zur Gleichsetzung von exemplum und similitudo in der Predigttheorie vgl. auch WernerZILTENER, Studien zur bildungsgeschichtlichen Eigenart der höfischen Dichtung … (Romanica Helvetica 83) 1972, 74 f.
47
Wort fabula von fari. Der Abschätzige Sinn eines solchen „im Umlauf befindlichen“ exemplum, einersolchen fabula, „favola“ oder „fable convenue“ wurde im Mittelalter auch mit weniger glaubwürdigen„Geschichtchen“ geschwätziger Prediger in Verbindung gebracht; dies wird aber nicht ernsthaft alsGattungsbezeichnung gelten können.107 Selbst wenn exemplum im Mittelalter präziser auf eine „unterhaltenderbauliche Geschichte als Predigteinlage“ bezogen gewesen wäre, so ließe eine solche wortgeschichtlicheFeststellung die gattungsgeschichtliche Folgerung schwerlich zu, daß „Exemplum“ eine eigentliche (gar mitGregor dem Großen beginnende) Literaturgattung des Mittelalters bilde.108
Es soll hier nun keineswegs der altphilologische (argumentative oder monumentale) Exemplumbegriff gegenden in der Mediävistik vorherrschenden enger volkskundlich-narratologischen verteidigt werden.109
Angestrebt ist vielmehr ein (wenigstens paradigmatischer) Hinweis auf echte Vermittlungsmöglichkeitenzwischen beiden Bereichen, wobei die Hypothese voranstehen muß, daß die antike Beispielgestalt und dasspätmittelalterliche Predigtexemplum
107 Vgl. CURTIUS, Danteforschung (wie Anm. 54) 12 zu essample im afr. Alexiuslied (v. 1821 ff.) und Rolandslied(v. 1014, 1016, 3979). Bisher nicht gesehen wurde die biblische Verwendung von Job 17.6: … in proverbium vulgi, etexemplum sum… Möglich wäre auch eine Übertragung der ethymologischen Sonderbedeutung von fabula auf exemplum;Petronius bringt beide Termini in diesem Sinne ironisch zusammen (Sat. 111.3.5): complorataque singularis exempli feminaab omnibus […] Una igitur in tota civitate fabula erat […], verum pudicitiae amorisque exemplum (gemeint ist die Witwevon Ephesus; s. S. 222 ff.) Bei Seneca (Ep. 24.6) heißen heroische Exempla decantatae fabulae nicht wegen ihrerUnwahrheit, sondern wegen ihrer Verbreitung und Abgedroschenheit (s. unten Anm. 168). Fabula in diesem Sinne findetsich auch in der Bibel: Deut 28.37: perditus in proverbium ac fabulam; Tob. 3.4: in fabulam traditi. Zur negativenBedeutung von fabula (Geschwätz, Ammenmärchen). s. auch unten S. 131 ff., 200 f., 221 f., 221 ff., Anm. 168, 203 a,507.108 Symptomatisch ist etwa Carlo DELCORNO, L’exemplum nella predicazione volgare di Giordano da Pisa,Firenze/Venezia 1973, 7: Es zeige sich eine Entwicklung vom argumentativen Exemplum der römischen Rhetorik über dasExemplum „già usato in modo generico“ bei Gregor d. Gr. bis zur spezifischen Gattungsbezeichnung seit dem späten 12. Jh.(„un particolare genere letterario“). – Zu den vermeintlichen Anfängen bei Gregor s. S. 94, 122 ff. Im übrigen stelltBERLIOZ (wie Anm. 97) 114 zur französischen Forschungsgeschichte fest, daß der Terminus „Exemplum“ für „homiletischeErzähleinlage“ erst nach 1927 (dank WELTER) die bisher geläufigen Begriffe „anecdote, conte amusant, récit authentique oulégendaire“ verdrängt habe.109 Vgl. W. BRÜCKNER, „Narrativistik“, Versuch einer Kenntnisnahme theologischer Erzählforschung, in: Fabula 20(1979) 18–33; unten Anm. 163.
48
trotz aller Unterschiedlichkeit im Sinne allgemeiner Rhetorik doch mehr miteinander gemein haben als denNamen.110
1. Das Exemplum in der antiken Rhetorik
Die beweisenden Vergleiche bei Aristoteles und Quintilian: historisches Beispiel, Gleichnis, Fabel (§ 17). Der argumentativeGeschichtsvergleich und der stilistische Naturvergleich (§ 18). Rei gestae commemoratio als Erzählung oder alsNamensvermerk (§ 19). Argumentative und moralische Beispiele (§ 20).
17. Quintilian ist in Anbetracht der überlieferungsgeschichtlichen Lücke zwischen Aristoteles und derHerenniusrhetorik im 1. Jahrhundert v. Chr. der für die meisten Fragen der rhetorischen Theorie maßgeblicheAutor, weil er
110 Damit soll ein Beitrag zur Verwirklichung des noch kaum in die Tat umgesetzten Programms von R. SCHENDA (wieAnm. 96) geleistet werden (74): „Auf den Zusammenhang zwischen antiker Verwendung des Exemplums undmittelalterlicher Exemplum-Theorie ist nur sporadisch hingewiesen worden […] Leider fehlt eine […] gründliche Studie überdas ohne Zweifel mächtige Fortwirken der antiken Theorien in mittelalterlichen Exempelbüchern, obwohl doch Ernst RobertCurtius, Salvatore Battaglia, Ludwig Buisson und Hélène Pétré auf die Fusion und Kontinuität von antikem und biblischemExemplum über die Exempla der Kirchenväter und über den Juristen Gratian bis zum Spätmittelalter hingewiesen haben.“Anerkennung fand dieses Programm, wie ich sehe, nicht bei Mediävisten, sondern bei Neuzeitgermanisten undaufgeschlossenen Volkskundlern: vgl. H. BAUSINGER, Exemplum und Beispiel, in: Hess. Blätter f. Volkskunde 59 (1968)31–43, hier 33; W. BECK, Protestantischer Exempelgebrauch am Beispiel der Erbauungsbücher Johann Jacob Othos, in: Jbf. Volkskunde NF 3 (1980), 75–88, hier 77; DAXELMÜLLER, Exemplum und Fallbericht (wie Anm. 102) 150 f.; KNAPE(wie Anm. 353) 192. – Prinzipielle Bedenken gegen die Integration der beiden Exemplum-Begriffe meldet einerseitsVITALE-BROVARONE (wie Anm. 99) 91 an, obwohl seine Unterscheidung der gegensätzlichen Forschungsinteressenmethodisch durchaus förderlich ist. Auf der Gegenseite schließt LE GOFF (wie Anm. 58; vgl. Anm. 100) echte, über diebloße philologische Quellenkunde hinausgehende Vermittlungsmöglichkeiten aufgrund des von ihm behaupteten Monopolsder homiletischen Definition zu Unrecht aus (ähnlich auch BERLIOZ [wie Anm. 99] 23 oder Seb. LO NIGRO, L’Exemplume la narrativa popolare del sec. XIII, in: La letteratura popolare, Atti IIIº Convegno di Studi sul folklore Padano, Firenze1972, 319–28, hier 319 f.). Dies fällt umso mehr auf, als bereits 1979 J. FONTAINE im Anschluß an LE GOFFS Vortrag:„Vita“ et pre-exemplum“ dans le 2e livre des „Dialogues“ de Grégoire le Grand“ (in: ‚Hagiographie‘. Cultures et sociétés,Actes du Colloque Nanterre–Paris 1979, Paris 1981, 105–120, hier 119 f.) den Autor gefragt hat: „Je voudrais savoir si l’onpeut faire un lien entre votre citation de la Rhetorica ad Herennium [sc. IV 49, 62], les oeuvres rhétoriques de Cicéron, lesrhetores latini minores, et la Renaissance du XIIe siècle, le circéronianisme de Jean de Salisbury […] N’y a-t-il par là unevoie par laquelle le lien entre l’Antiquité classique et peut-être surtout le Moyen Age du XIIe siècle pourrait être établi defaçon plus précise?“ LE GOFF hat die Frage kaum ernst genommen, sonst hätte er spätestens im „Exemplum“-Band der‚Typologie des Sources …‘ eine differenziertere Antwort gegeben als die damalige Globalerklärung, das antike Exemplum seieben „oratoire et judiciaire“, und das mittelalterliche sei (weil Staats- und Gerichtsrede verschwanden) „essentiellementhomilétique“ (Hagiographie a.a.O. 120). Vgl. auch unten Anm. 321.
49
die Tradition am vollständigsten zusammenfaßt.111 Er behandelt das Exemplum im 5. Buch der ‚Institutiooratoria‘ über die Beweisgründe.112 In der ausführlichen Einleitung über die ältere griechische und lateinischeTerminologie legt er vor allem klar, daß es einen weiteren Beispielbegriff gebe, der alle Arten des beweisendenVergleichs einschließt, und einen besonderen, der ausschließlich das historische Exemplum meint. Für beidehätten die Griechen nur den einen Begriff parådeigma . Er selbst will ihn ebenfalls im doppelten Sinn mitdem einen Wort exemplum übersetzen, stellt jedoch vorweg die Verwechslungsgefahren heraus.113 Similitudo,das lateinische Äquivalent zu paradeigma als Oberbegriff, steht für die weite, alle argumentativen Vergleicheeinschließende Bedeutung von „Induktion“. Similitudo ist ihm aber zu vieldeutig. Das Wort könnte nämlichmit dem engeren („eigentlichen“) Sinn des im Griechischen parabsl¸ genannten Vergleichs (Gleichnis,Parabel, Bildanalogie) verwechselt werden. Zudem bedeutet es unter dem hier nicht passenden Aspekt desstilistischen ornatus einen schmückenden Vergleich metaphorischer Art.114
111 Vgl. March Howard McCALL, Ancient Rhetorical Theory of Simile and Comparison, Cambridge Mass. 1970, 53 f.,178. Obwohl Quintilian im Mittelalter wenig bekannt war, ist er uns als Quelle für die gesamte antike Tradition wichtigerals viele epigonale und konfuse Rhetoriker der Spätantike, die von ihren mittelalterlichen Kollegen fleißig und unselbständigausgeschrieben wurden. Zu Johanns ungewöhnlicher Quintilian-Kenntnis s. unten S. 168, 225, 417 f.112 Quint. V 11.1–31; vgl. McCALL 178 ff.113 Quint. V 11.1–5; vgl. McCALL 187 ff., 192 ff.; LAUSBERG § 422.114 Quint. V 11.1: Tertium genus ex iis quae extrinsecus adducuntur in causam [s. S. 73 f., 332 ff.], Graeci vocantparådeigma, quo nomine et genaraliter usi sunt in omni similium adpositione et specialiter in iis, quae rerum gestarumauctoritate nituntur. Nostri fere similitudinem vocare maluerunt, quod ab illis <proprie> parabsl¸ dicitur, hoc alterumexemplum quamquam et hoc simile et illud exemplum. Vgl. McCALL 187 ff. (auch zur Unentbehrlichkeit der KonjekturRADERMACHERS: ‚proprie‘) Zum engeren Begriff parabole (bei Cicero collatio) vgl. S. 51 ff. zum weiteren Begriffsimilitudo vgl. S. 55 ff. (Quint. V 11.5). Vgl. auch LAUSBERG § 442: „Das exemplum ist ein seinem Inhalt nach auf dieres gestae geschichtlicher oder literarischer Quelle beschränkter Sonderfall der allgemeinen similitudo, die jedes ähnlichePhänomen (also nicht nur das der res gestae, sondern auch das des Naturgeschehens usw.) mit der causa in einen aufGlaubwürdigkeit zielenden Vergleichszusammenhang bringt.“ (Zur res gestae und zu Naturgeschehen s. unten S. 54 ff.,57 ff.). Die wichtigsten terminologischen Divergenzen bei den einzelnen Autoren lassen sich schematisch sozusammenfassen:
Autor Aristoteles Quintilian Cicero Rhet. adHerenn.
Oberbegriff für Vergleichs- paradeigma exemplum similitudo/ –argumente (Beispiele im (similitudo, comparabileweitesten Sinn) inductio)
Unterbegriffe1. historisches Beispiel paradeigma exemplum exemplum exemplum2. „künstliche“ Beispielea) Gleichnis, Vergleich, parabole similitudo, collatio, similitudo,
Bildparallel collatio imago imagob) Mythos, Fabel logos fabula poetica, – –
fabella
50
Damit ist das terminologische Vorfeld umrissen, und Quintilian kommt zu seinem Thema, dem exemplum imengeren Sinn, das im Griechischen ebenfalls paradeigma (aber als Unterbegriff) heißt, mit folgenderprägnanter Definition:115 „Was wir im eigentlichen Sinn Exemplum nennen, ist die Erinnerung an ein zurÜberzeugung von dem, worauf es dir ankommt, nützliches, wirklich oder angeblich geschehenes Ereignis“. …quod proprie vocamus exemplum, id est rei gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id quod intenderiscommemoratio. Quintilian versteht also unter einem Exemplum einen historischen oder als historischgeltenden Vergleich. Unter angeblich Geschehenem versteht er primär den Mythos der poeticae fabulae.(Beispiel: das Eingreifen der Göttin Athene zugunsten des Orest bei Aischylos.)116 Diese Auffassung istunproblematisches antikes Gemeingut: Das rhetorische Exemplum wird stets bestimmt durch den Bezug zurGeschichte im weitesten – den Mythos einschließenden – Sinn.117
115 Quint V.11.6; zu commemoratio s. unten § 19; zu res prout gestae Anm. 147 (nach Cicero, Inv. I 19.27); auch in Inst. V11.1 wird der allgemeine Begriff paradeigma = similitudo (simile) vom speziellen paradeigma unterschieden: obenAnm. 114.116 Quint. V 11.17/8: Eadem ratio est eorum quae ex poeticis fabulis ducuntur, nisi quod iis minus adfirmationisadhibetur: cuius usus qualis esse deberet, idem optimus auctor ac magister eloquentiae ostendit. Nam huius quoque generiseadem in oratione reperietur exemplum: ‚itaque hoc, iudices, non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi hominesmemoriae prodiderunt, eum, qui patris ulciscendi causa matrem necavisset… Das Beispielzitat aus Cicero (pro Milone 3.8)über den von den Areopagrichtern bei Stimmengleichheit aufgrund der göttlichen Stimme freigesprochenen Muttermörder(nach den ‚Eumeniden‘) zeigt gut den quasi-historischen Charakter des Vergleichs. Zu poetica fabula = Mythos in derTragödie oder „hohe Klasse der fabula“ (im Unterschied zur niederen fabella; s. unten Anm. 118) vgl. LAUSBERG § 413,228 f.117 Vgl. unten Anm. 125.
51
Auffällig ist nun aber, daß Quintilian zur rei ut gestae commemoratio der Exemplumdefinition auch eine(wenigstens für uns) fiktive Vergleichsart rechnet: die auf niedriger Stilebene für das einfache Volk geeignetesog. „äsopische Fabel“ (fabella, „das Fabelchen“) und andere Fabelarten (insbesondere auch den mitapologatio übersetzten ainos).118 Quintilian betont zwar ausdrücklich die geringere Beweiskraft der pseudo-historischen oder literarischen im Verhältnis zu den rein historischen Exempla,119 erklärt damit aber nicht,wie die „Fabel“ in die Kategorie „geschehene Ereignisse“ gelangt. Eine mögliche Begründung läge in derAnnahme, daß er ältere Gliederungen mehr der theoriegeschichtlichen Vollständigkeit als der praktischenBedeutung wegen übernommen hat, da er wie kein anderer Rhetoriker der Antike versuchte, die in vielemobsolet gewordene aristotelische Systematik des Paradeigma römisch zu erneuern.120
Wir verlagern damit das Fabel-Problem zurück zur Quelle: Wie Quintilian behandelt Aristoteles im 2. Buchder Rhetorik das Beweisverfahren und die Beweismittel, die entweder aus Enthymemen oder Beispielenbestehen.121 Dabei wird der Beispielbegriff (ebenfalls wie bei Quintilian) zunächst als Oberbegriff für alleArten der Beweisanalogie oder der rhetorischen Induktion verwendet. Diese bestehen einerseits austatsächlichen Geschichtsbeispielen, den paradeigmata im engeren Sinn (wie wir dies eingangs bereitsillustriert haben122) und andererseits aus den vom Redner selbst erstellten Beispielen, von denen es wiederumzwei Unterarten gibt: parabol¸ im allgemeinen
118 Quint. V 11.19: Illae quoque fabellae, quae […] nomine Aesopi maxime celebrantur ducere animos solent praecipuerusticorum et imperitorum qui et simplicius quae ficta sunt audiunt, et capti voluptate facile iis, quibus delectantur,consentiunt: si quidem et Menenius Agrippa plebem cum patribus in gratiam traditur reduxisse nota illa de membrishumanis adversus ventrem discordantibus fabula. Ebd. 20 zu den griechischen Fabelarten. – Zum Aspekt desBildungsstandes s. unten S. 53 ff., 61 ff., 128, 417 f.; LAUSBERG §§ 412 f., 416; zu apologatio/apologus s. oben S. 34unten S. 149, 221; KOEP (wie Anm. 74) 130 f.; RE II 1 167–170; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 18 f., 259 f.; KNAPP(wie Anm. 99). 78, 80.119 Oben Anm. 116, vgl. auch Cicero unten Anm. 141.120 Vgl. McCALL (wie Anm. 111) 187 f. und unten S. 54 ff.121 Rhet. II 20, 1393 a–b.24–30 (andere Stellen zum rhetorischen Beispiel sind Rhet. I 2, 1355 b–1357 b; I 9, 1368 a); vgl.S. 188 ff. Aus der reichen Sekundärliteratur ist McCALL (wie Anm. 111) 24 ff., und 188 ff. (Quintilian–Aristoteles)besonders hilfreich, vgl. etwa noch GEBIEN (wie Anm. 4) 27 ff.; BENOIT (wie Anm. 9) bes. 189 ff. und passim (mitweiterführender Bibliogr.); BATTAGLIA (wie Anm. 11) 448 ff.; H.G. COENEN, Argumentieren mit Fabeln, in: GrazerLinguist. Studien 10 (1979) 7–18; K. ALEWELL, Das rhetorische Paradeigma, (Diss. Kiel), Leipzig 1913; WernerSCHMIDT, Theorie der Induktion. Die prinzipielle Bedeutung der Epagoge bei Aristoteles, München 1970.122 Oben §§ 1–2.
52
und løgoq (Fabel) für die Volksrede. In qualitativer Hinsicht unterscheidet Aristoteles diese Vergleichsartenso: Die historischen Beispiele sind „schwerer zu finden“, aber beweiskräftiger; die selbsterfundenen sindleichter herzustellen, aber weniger überzeugend. Überdies dürften Gleichnisse und Fabeln, was ihreÜberzeugungskraft betrifft, in absteigender Rangfolge hintereinander stehen.123 Während alle Arten desParadeigma von „der ästhetischen Evidenz des Anschaulichen“ leben, zeichnet sich das historische Beispielzudem durch die „höhere Kraft des Faktischen aus“.124
Das Begriffspaar „geschichtlich vorgegeben“ – „selbst erstellt“ (erfunden) begegnet häufig in der rhetorischenTheorie des Beispiels und dürfte bei vielen Theoretikern nahezu kanonische Gültigkeit gehabt haben. DasProblem der nicht-historischen Exempla betrifft auch bei Aristoteles keineswegs den überlieferten Mythos,der als Teil der „geschehenen Dinge“ der vergangenen Wirklichkeit im eigentlichen, historischen Paradeigmaintegriert ist.125 Frei erfunden sind Parabeln, „wie Sokrates sie brauchte“: Es werde z. B. einsichtig, daßStaatsämter nicht nach dem Los zugeteilt werden dürfen, wenn der Redner zeigt, wie es käme, wenn aus derSchiffsmannschaft das Los den
123 Rhet. II 20, 1394 a; vgl. JÜLICHER (wie Anm. 39) I 100; GEBIEN (wie Anm. 4) 28 ff.; MARTIN (wie Anm. 8) 122.124 Zitat: JAUß, Negativität … (wie Anm. 103) 311.125 Vgl. FINLEY, Myth, Memory and History, in: The Use… (wie Anm. 47) 14 ff.; K. MAURER, Für einen neuenFiktionsbegriff, in: Erzählforschung (wie Anm. 37) 527–551; hier 527 ff.; ZOEPFFEL (wie Anm. 94) 16 f.; F.W.WALBANK, History and Tragedy, in: Historia 9 (1960) 216–34; W. RÖSLER, Die Entdeckung der Fiktionalität in derAntike, in: Poetica 12 (1980) 283–319, bes. 290 ff. zu den Mythen als „traditional stories“ der (historisch wahren) „mémoirecollective“; J.W. WASZINK, Il concetto del MéUOS nella teoria poetica da Aristotele a Orazio, in: Festschr. E.PARATORE, ‚Letterature comparate‘ I, Bologna 1981, 193–204, hier 193, 198 ff. Zum Übergang von einem frühen nichtfiktionalen zu einem späteren fiktionalen Mythos-Begriff und der Ausbildung der 3 Realismusgrade historia, plasma, mythos(s. S. 60 f.). Hervorzuheben ist danach, daß für Aristoteles (Poet. 6) der „überlieferte oder ererbte“ Mythos zur „altenGeschichte“ gehört, also das Gegenteil einer frei erfundenen Geschichte darstellt. Diese Unterscheidung hat Platon noch kaumgetroffen, da für ihn auch Gleichnisreden wie die Steuermannsparabel im ‚Staat‘ (487 e, 488 a–489 d) als Mythen gelten (vgl.Hans WILLMS, EIKVN, Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonismus, I: Philon von Alexandreia, Diss.Münster–W. 1935, 2 ff.; H. DÖRRIE, Der Mythos und seine Funktion in der antiken Philosophie, [Innsbrucker Beitr. z.Kulturwiss. H 2] Innsbruck 1972, 10 f.) – Zum mythischen Exemplum der griechischen Lit. s. Rob. OEHLER,Mythologische Exempla in der älteren griechischen Dichtung, (Diss. Basel), Aarau 1925. B. SNELL (wie Anm. 50) 188 f.betont, daß für die Griechen der mythische Vergleich dem Tiervergleich gewissermaßen „historisch“ überlegen war, weil sichder Mensch mit den mythischen Personen auch faktisch verbunden fühlte.
53
Steuermann bestimmte.126 Die Fabeln andererseits werden durch Tiergeschichten in bestimmten historischenSituationen exemplifiziert (also nicht im Sinne der allgemeinen Moral Lessings, sondern als besondererBeweis in der ursprünglichen äsopischen Art).127 Diese Feststellung trifft auch auf Quintilians Musterbeispielfür den Fabel-Begriff zu, auf die als historisch angeführte Anekdote von Menenius Agrippa.128 Die für unsbefremdliche Assoziation von Gleichnissen und Fabeln mit historischen Beispielen könnten folgendeAnnahmen klären: Weder Aristoteles noch Quintilian waren im Rahmen einer Darstellung der Beweismittelan stofflichen Fragen wie dem Unterschied von Wirklichkeit und Fiktion besonders interssiert. (Aristoteleshat bekanntlich in der Mimesis-Theorie der ‚Poetik‘ nicht mit rhetorischer, sondern mit betontphilosophischer Wertung zugunsten der Dichtung gegen die Geschichtsschreibung Stellung genommen.)129 Indiesem Zusammenhang geht es primär um den Überzeugungseffekt, der beim Publikum durch Vergleiche
126 Rhet. II 20, 1393 b; vgl. Anm. 125 (Platon), McCALL (wie Anm. 111) 27 und unten Anm. 130 zu der hier bewußtgewählten konditionalen Umformulierung: parabole ist eine hypothetische Parallele. Quintilian erwähnt Sokrates in Inst. V11.3, in dem einleitenden Passus über alle Beispielvergleiche im rhetorischen Induktionsbeweis (qua plurimum est Socratesusus), nicht aber zum speziellen Beispielvergleich der Parabel. Er verschiebt also das Sokrates-Merkmal sinnvoll vomUnterbegriff parabole bei Aristoteles zum Oberbegriff epagoge/paradeigma. Ähnlich erinnert Cicero (Top. 10.41–2) anSokrates als Meister der Induktion. Dazu vgl. unten § 51. – Im übrigen ist das Steuermannsbeispiel als Vergleichshypotheseim Sinne Jülichers (s. oben § 14) unter dem Gesichtspunkt der rhetorischen Beweisführung mit den Gleichnissen Jesuzusammenzusehen. Zur Diskussion dieses Punktes s. auch unten S. 58 ff., 65.127 Rhet. II 20, 1393 b–1394 a; s. oben S. 51 ff.128 Quint. V. 11.19; s. oben § 35 u. Anm. 118. – Vgl. SCHMIDT (wie Anm. 74) 74 ff. zur Fassung bei Livius 2.32.7–33.1und besonders den interessanten Hinweis (78) auf die dort in mythische Vorzeit verlegte Herkunft der Geschichte, in eineZeit, in der die Glieder noch sprechen konnten (vgl. Isid. Etym. I 40.1: fabulae loquendo fictae). Dies würde gleichsam eine„historische“ Nobilitierung durch den Mythos und das Alter in dem oben Anm. 125 erläuterten Sinn bedeuten.129 Poet. 9, 1451 b. – Die wenig historiographiefreundliche Haltung heben (entgegen neueren Versuchen, den Stagiriten zumGeschichtstheoretiker umzuwerten) entschieden hervor: ZOEPFFEL (wie Anm. 94) 12 ff. und FINLEY (wie Anm. 47) 11 ff.;vgl. auch Karl LÖWITH, Sämtliche Schriften II, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1983, 348 ff., 432, 468.; s.auch §§ 58, 109. – Versuche, Poet. 9 und Rhet. II 20 aufeinander zu beziehen, sind aufgrund der radikal verschiedenenFragestellungen heikel: SCHMIDT (wie Anm. 74) 76 f. bezieht die Idee des philosophischen Allgemeinheitsgrades derDichtung in Poet. 9 auf die Fabel in Rhet. II 20; für JÜLICHER (wie Anm. 39) 72 f. sind die Fabeln den geschichtlichenBeispielen von Rhet. II 20 an Aussagekraft überlegen, was ein pointiert neuplatonischer Aphorismus von Gregor von Nazianzim Geiste von Poet. 9 dartun soll: „Was sich nie und nirgends begeben hat, das allein ist ewig wahr.“
54
mit „Ereignissen“ erreicht wird: Ereignissen der fernen oder nahen Vergangenheit oder des unmittelbarenAlltags, hypothetischen Ereignissen – wie im Als-ob-Beispiel von der Steuermannswahl –, die so konkretvorstellbar sind wie tatsächliche, oder schließlich auch fiktiven Ereignissen, die wie jene berühmte Geschichte– nota illa fabula – vom Magen und den Gliedern schon früher einmal überzeugend gewirkt haben.130
Quintilian rechnet in anderem Zusammenhang (einer Empfehlung umfassender Geschichtskenntnisse für denRedner) auch die von großen Dichtern im Interesse der Lebensweisheit erdachten Beispiele zu den(quasihistorischen) Exempla; denn, was ihnen gegenüber den rein historischen an Zeugniswert abgeht, dasersetzen sie durch die auctoritas des höheren Alters. Die glaubwürdige Tradition ist der Faktizitätebenbürtig.131 Bei Aristoteles ist zudem der „statische“ Geschichtsbegriff zu berücksichtigen, der ausdrücklichauf das historische Beispiel bezogen wird – „was geschehen soll, ist gewöhnlich dem Geschehenen ähnlich“–132und der eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Unterschied von tatsächlichen, vergangenen,gegenwärtigen oder immer möglichen Ereignissen (einschließlich der äsopischen Tierverkleidung) bedingthaben mag: In einem rhetorischen Sinne sind diese „Ereignisse“ alle wirklich und wirksam; sie sind geschehen,oder sie pflegen zu geschehen.
18. Restlos können diese Erklärungsversuche nicht befriedigen. Doch das Problem der fiktiven Exempla istinsofern „akademisch“, als sich die aristotelische
130 Quint. V 11.19 oben Anm. 118. – Zur Ereignis-Bedeutung von Fabeln vgl. oben § 14; SCHMIDT (wie Anm. 74) 75 ff.Zum Aspekt der Wiederverwertbarkeit einer schon einmal erfolgreiche Geschichte s. S. 3 ff. und MEULI 18, 25 f.; zum Altervon Exempla s. nächste Anm.; zur Als-ob-Parallele s. Anm. 126, 145 und McCALL 90, 101, 116 (constitutio coniecturalisbei Cic. Inv. 2.5.19, De orat. 2.40.168, Top. 3.15).131 Quint. XII 4.1–2: In primis vero abundare debet orator exemplorum copia cum veterum tum etiam novorum, adeo ut nonea modo quae conscripta sunt historiis aut sermonibus velut per manus tradita quaeque cotidie aguntur, debeat nosse,verum ne ea quidem quae sunt a clarioribus poetis ficta, neglegere. Nam illa quidem priora aut testimoniorum aut etiamiudicatorum optinent locum, sed haec quoque aut vetustatis fide tuta sunt aut ab hominibus magnis praeceptorum loco fictacreduntur. Zu vetustatis fide s. S. 238 ff., zu copia exemplorum s. § 85, 79, 92. Zu der ebenfalls angesprochenenmündlichen Tradition von Exempla und Alltagsgeschichten sowie zu der tatsächlichen Praxis der „Geschichtendarbietung“nach Petron. Sat. 110, wo der Fabulator die Geschichte von der Matrone von Ephesus so einführt: ne se tragedias veterescurare aut nomina saeculis nota, sed rem sua memoria factam, vgl. C. SALLES, ‚Assem para et accipe auream fabulam‘,Quelques remarques sur la littérature populaire et le répertoire des conteurs publics dans le monde romain, in: Latomus 40(1981) 3–20, hier 8 ff., und unten S. 221 ff., Anm. 354 (zu histrio).132 Rhet. II 20, 1394 a; s. oben Anm. 21. – „Statischer“ Geschichtsbegriff: vgl. ZOEPFFEL (wie Anm. 94) 66 f. und untenS. 524.
55
Einteilung der Beispiele in der Antike nicht praktisch durchgesetzt hat (Quintilian also auch hier eher alsspäter theoretisch-restaurativer Aristotelesnachfolger gelten muß). Die tatsächliche Literaturpraxis und derGroßteil der rhetorischen Theorien kennen eigentlich nur das historische Exemplum und allenfalls auch dasdarin enthaltene mythische.133 Insbesondere die Kategorie „Fabel“ blieb (wohl aufgrund ihrerDoppeldeutigkeit als Gattungsbezeichnung und Fiktionskriterium) für das Exemplum irrelevant.134 Wie einKenner der antiken Fabel hervorhebt,135 war exemplum als tatsächliches Geschehen im allgemeinen vielmehrder Gegensatzbegriff zur (fiktiven) Fabel-Erzählung.
Eine weitere Erklärung für das Problem der Fabel-Zuordnung zur quasi-historischen „Ereignis-Erinnerung“läßt sich hier anschließen: Im Zusammenhang mit den Ähnlichkeitsgraden zwischen Vergleichsbeispiel undVerglichenem erscheint bei Quintilian auch der Begriff der exempla similia. Dabei fühlt sich der Theoretikergenötigt, ein terminologisches Mißverständnis auszuräumen:136 „Similitudo, der Vergleich, wird gelegentlichauch zur Verschönerung der Rede verwendet. Doch dazu kommen wir später an geeigneter Stelle. Jetzt will ichnur behandeln, was zum Beweis gehört.“ Das Versprechen löst er im 8. Buch zum stilistischen ornatus ein.(Auch hier folgt er übrigens Aristoteles, der die erfundene parabsl¸ als Beweismittel des Paradeigmas vomstilistisch verschönernden Vergleich oder e˝k√n getrennt behandelt.)137 Hält man die Musterbeispiele für dasexemplum im 5. Buch neben
133 Vgl. ALEWELL (wie Anm. 121) 18 ff. zum Ausschluß der Fabel aus der Paradeigma-Definition seit Cicero (Quintilianals Ausnahme); GEBIEN 28 f.; DORNSEIFF 218., MARTIN (wie Anm. 8) 120 f.134 Vgl. unten § 88 und Anm. 147.135 M. NØJGAARD, La fable antique, Kopenhagen 1964, 82; vgl. auch GEBIEN 19. LAUSBERG § 421 (zum Gegensatzvon historischer „Ernstbedeutung“ des Exemplums und übertragenen Bedeutungen in Fabeln und Allegorien);DAXELMÜLLER, Exemplum 629 f.; KOEP, Fabel (wie Anm. 74) 131, 146 und S. 58 ff., 119 ff., 82 ff. SCHMIDT (wieAnm. 74) 77 f. nennt als Gründe für den Vorrang und schließlich die Monopolstellung des historischen Exemplumsgegenüber dem Fabelargument: die Dekadenz der griechischen Rhetorik, die Trivialisierung der Fabel in der hellenistischenSchulpädagogik und Moralpredigt der Popularphilosophen sowie die pragmatische römische Faktengläubigkeit, die Fiktionmit Unwahrheit gleichsetzte und darum der griechischen Argumentations-Fabel anhaltend fremd blieb.136 Quint. V 11.5: Similitudo adsumitur interim et ad orationis ornatum. Sed illa cum res exiget: nunc ea, quae adprobationem pertinent, exsequar. Zu den exempla similia s. unten Anm. 914. Zum zentralen Unterschied von ornatus-Vergleichen und Beweis-Vergleichen s. McCALL (wie Anm. 111) 192, 257 ff.137 Quint. VIII 3.72–81. – Aristoteles trennt parabole vom eikon: Rhet. 1406 b–1407 b, 1412 b–1413 a; vgl. WILLMS (wieAnm. 125) 4 f.; McCALL 29 ff., 51 f., 192 und unten Anm. 145. Die ganze sehr aufschlußreiche Arbeit von McCALL läuftletztlich auf eine Geschichte des Wesensunterschieds zwischen dem Vergleich (und seinen Arten) in der Stiltheorie einerseitsund in der Beweistheorie andererseits hinaus. Für moderne Semantik-Begriffe befremdlich ist die wichtige Feststellung, daßin der antiken rhetorischen Theorie der Vergleich nicht etwa mit der Metapher zusammenhängt, sondern mit dem historischenBeispiel, und das similitudo und exemplum ein Paar nahe verwandter Beweise bilden (vgl. 26, 18 ff., 257 f.).
56
diejenigen für die similitudo im 8. Buch der Institutio, so zeigt sich unverkennbar der Wesensunterschiedzwischen dem argumentativen Beispielbegriff und dem unspezifisch zur übertragenen Rede gehörigenVergleichsbegriff der Tropen oder Sinnfiguren:138 Vergleichsmittel des Exemplums sind persuasiv verwertbaremenschliche Ereignisse aller Art (einschließlich der anthropomorphen Tiervergleiche), während diestilistische similitudo wie auch die Metapher über den Humanbereich der personae und negotia hinaus dieganze Fülle der Naturdinge als Vergleichsträger benutzen kann. Im weitesten Sinn stehen sich also exemplumund similitudo wie spezifisch Menschliches und Dingwelt (res gestae und res), Geschichte und Naturgegenüber.139
So klar wie Quintilian, der die beiden funktional und stofflich verschiedenen Vergleichsarten kontextuellgetrennt behandelt, haben andere Theoretiker den Unterschied zwischen exemplum und similitudo allerdingsnicht betont. Doch auch Cicero und der Auctor ad Herennium, die beide Begriffe nebeneinander verwendenund damit am Anfang einer in Spätantike und Mittelalter immer verwirrender werdenden Geschichte derKombination von beweisenden und stilistischen Kriterien stehen,140 lassen keinen Zweifel am
138 Vgl. auch LAUSBERG §§ 442 ff. und unten S. 592 f.139 Zum menschlich-geschichtlichen oder anthropozentrischen Wirklichkeitsgrad von Fiktionen wie Fabeln und Parabeln vgl.GRUBMÜLLER (wie Anm. 79), DORNSEIFF 207, SNELL (wie Anm. 50) 189 f.140 Zum Beginn dieser Entwicklung bei Cicero und dem Auctor ad Herennium vgl. McCALL 57 ff., 87 ff. Cicero kennttrotz seines primär historisch-sachbezogenen und argumentativen Exemplum-Begriffs auch einen elocutionellen, der poetischeFiktionen und pathoserregende Ausschmückungen (wie Ethopoeie und Propsopopoeie) einbegreift. Vgl. etwa De orat. 2.169über Vergleichsarten ex dissimilitudine: ‚si barbarorum est in diem vivere, nostra consilia sempiternum tempus spectaredebent‘. Atque utroque in genere et similitudinis et dissimilitudinis exempla sunt ex aliorum factis aut dictis aut eventis etfictae narrationes saepe ponendae. Ebd. 3.205–6: personarum ficta inductio vel gravissimum lumen augendi; descriptio,erroris inductio, […] tum duo illa, quae maxime movent: similitudo et exemplum. Siehe auch Rhet. ad Herenn. II 29.46 überden ornatus der Vergleiche: Exornatio constat ex similibus et exemplis et amplificationibus; ebd. IV 49.62: exemplum […]sumitur isdem causis quibus similitudo, rem ornatiorem facit. Zur Verwirrung trägt insbesondere die Rhet. ad Herenn. (IV45.59–49.62) bei, die 4 causae dicendi für similitudo aller Art – also auch für das Exemplum – nennt undnebeneinanderstellt: ornandi, probandi, apertius dicendi, ante oculis ponendi (sc. causa). Dazu vgl. McCALL 66 ff.,LEEMAN 40 f.; ZILTENER (wie Anm. 106) 54.
57
gleicherweise argumentativen und historischen Charakter des Exemplums im Gegensatz zu den vielfältigenTropen oder uneigentlichen Redensarten. Cicero betont darum mehrfach die Überlegenheit des Beispiels alsBeweismittels, – maximam fidem facit – gegenüber dem bloß schmückenden Vergleich.141
Dem Mittelalter war dieser Unterschied von exemplum und similitudo vor allem aus der ‚Rhetorica adHerennium‘ bekannt,142 in der klar gesagt wird, daß sich das Beispiel gegenüber dem Vergleich und all seinenArten durch die historische Vergangenheit einer Einzelpersönlichkeit (alicuius facti aut dicti praeteritipropositio) auszeichne. Die Unterscheidung von rei gestae exemplum und rei similitudo klingt noch in Isidors‚Differentiae‘ nach:143 „Beispiel
141 Cic., Part. Or. 40: Maximam autem fidem facit ad similitudinem veri primum exemplum, deinde introductae reisimilitudo. Vgl. auch Or. 34.120: commemoratio autem antiquitatis exemplorumque prolatio summa cum delectatione etauctoritatem orationi affert et fidem (zu commemoratio s. unten Anm. 149 a). Zu Ciceros Ideal der „Sachkundigkeit“ vgl.unten S. 385 f. und etwa Top. X 44–5, wo den Juristen historische Exempla, nicht erfundene (poetische) empfohlen werden:Ficta enim exempla similitudinis habent vim; sed ea oratoria magis sunt quam vestra. Vgl. auch GEBIEN 58 f.,LAUSBERG § 422, BATTAGLIA 458, McCALL 111 f. Auf derselben Linie liegt auch exempla maiorum als pädagogischeVorbilder gegenüber den Göttern. – Zur Terminologie: Anstelle des Oberbegriffs für beweisende Vergleicheparadeigma/exemplum/similitudo (s. oben Anm. 113) setzt Cicero comparabile und unterteilt dieses (Inv. 1.30.49) in imago,conlatio, exemplum: Comparabile autem est quod in rebus diversis similem aliquam rationem continet. Eius partes sunttres: imago, collatio, exemplum. Imago est oratio demonstrans corporum aut naturarum similitudinem. Collatio est oratiorem cum re ex similitudine conferens. Exemplum est quod rem auctoritate aut casu alicuius hominis aut negotii confirmataut informat. Vgl. McCALL 96 f. – Die Rhetorica ad Herennium (IV 34.46 ff.) behandelt die similitudo (identisch mitsimile) als eine Art der exornationes sententiarum im Rahmen einer Vielzahl nicht durchweg logisch verbundener, sondern z.T. aus Überklassifizierung entstandener Unterbegriffe. In dieser additiven Reihe erscheint beiläufig auch die Triade Ciceros:similitudo (für conlatio), exemplum, imago. Vgl. die scharfsinnige Analyse der unsystematischen Komposition durchMcCALL 65 ff., 76 ff. und unten §§ 121 ff. zu imago.142 Rhet. ad Herenn. IV 49.62, unten Anm. 374 zitiert. Vgl. McCALL 78 f., 96. Analog betont die Herennius-Rhetorik dieHistorizität der Exempla in IV 9.13:… de rebus ante gestis exempla petere (s. oben Anm. 12) und III 5.9: Conclusionibusfere similibus in his et in iudicialibus causis uti solemus, nisi quod his maxime conducit quam plurima rerum antegestarum exempla proferre.143 Differentiae 193, (PL 83) 1329. Isidor zitiert im übrigen die Definition der Rhet. ad Herenn. IV 49.62 in der Tropenlehrezum sog. paradeigma, Etym. I 37.34: exemplum dicti vel facti alicuius, aut ex simili aut ex dissimili genere, convenienseius, quam proponimus, rei ita: Tam fortiter periit apud Hipponem Scipio quam Uticae Cato.
58
und Vergleich unterscheiden sich dadurch, daß das Beispiel eine Geschichte ist, der Vergleich durch einenSachverhalt dargetan wird.“ Inter exemplum et similitudinem hoc interest quod exemplum historia est,similitudo re adprobatur. Die Stelle betont nicht nur den Erzählcharakter des Exemplums, wie häufigeinseitig gelesen wird, sondern eo ipso auch dessen Bezug zur erzählten und überlieferten Geschichte; d. h.Isidor setzt wie vor ihm Quintilian (rei gestae commemoratio) den historischen Wirklichkeitsgehalt desBeispiels dem nicht-historischen Naturvergleich entgegen.144 Diese Differenzierung entspricht vor allemeiner Tradition der Grammatik, in der auch Isidor steht. In der Tropenlehre der spätantiken Grammatiker undderen mittelalterlichen Nachfolger von Donat über Isidor und Beda bis zu den Artes dictandi desHochmittelalters hält sich die Dreiteilung der homoiosis/similitudo genannten Vergleichsarten:145
icon/imago, parabola/comparatio
144 Narratologische Deutung von Diff. 93 etwa bei LE GOFF, in BREMOND/LE GOFF/SCHMITT 31; F. TUBACH,Exempla in the Decline, in: Traditio 18 (1962) 407–17, hier 409 oder VITALE-BROVARONE (wie Anm. 99) 100 f.Letzterer verkennt übrigens die Isidorische Herkunft des Satzes, den er aus einem anonymen Grammatiktraktat des 9. Jhs.(Gramm. lat., ed H. KEIL IV 284.7–8) zitiert. Letztere Version ist jedoch in unserem Zusammenhang klarer als dieursprüngliche: Inter exemplum et similitudinem hoc interest, quod exemplum historia, similitudo re adprobatur. Hier „ist“das Exemplum nicht „eine Geschichte“, sondern „wird durch Geschichte“ glaubwürdig, so wie der Vergleich „durch Natur“glaubwürdig wird. VITALE-BROVARONE folgert daraus entwicklungsgeschichtlich, im 9. Jh. sei die antikegeschichtsbezogene Exemplum-Definition (rei praeteritae ralatio) endgültig aufgelöst und durch eine rein erzähltechnische(narratio) ersetzt worden. Daß die Übersetzung historia = narratio in diesem Zusammenhang nicht überzeugt, ergibt sichaus den zahlreichen Zeugnissen zur grammatikalisch-rhetorischen Tropenlehre seit der Spätantike, in denen es stets darumgeht, ob Ähnlichkeit aus dem Natur-oder aus dem Geschichtsbereich genommen wird; vgl. dazu Ulrich KREWITT, Matapherund tropische Rede in der Auffassung des Mittelalters (Beiheft z. MlatJb 7), Ratingen (…) 1970, 95 ff. Vgl. immerhin auchS. 148 zur unauflöslichen Doppelbedeutung von historia als narratio rei gestae bei Isid. Etym. I 41.1.145 Vgl. KREWITT (wie Anm. 144) 96 ff., 155 f., 406 f.; KNAPP, Similitudo … 66 ff.; Hennig BRINKMANN,Mittelalterliche Hermeneutik, Tübingen 1980, 164 ff.; Jacques FONTAINE, Isidore de Séville et la culture classique dansl’Espagne Wisigothique, Paris 1959, 143 ff. – Die Geschichte dieses Theorems bezeugt die verhängnisvolle Vermischung dernacharistotelischen Theorie der Beweisverfahren mit einer stilistischen ornatus-Lehre und einer grammatikalischenBedeutungslehre, ein Amalgam, das überdies zu einer höchst undurchsichtigen, uneinheitlichen Gattungstheorie desMittelalters beigetragen hat. Grundsätzlich zu diesem Beispiel alexandrinisch additiver Überklassifizierung vgl. McCALL 67,80 und unten § 81. Louis HOLTZ (Donat et la tradition de l’enseignement grammatical, Etude sur l’Ars Donati et sadiffusion [IVe–IXe s.] et éd. crit., CNRS, Paris 1981, 201 f., und: Grammairiens et rhéteurs romains en concurrence pourl’enseignement des figures de rhétorique, in: La rhétorique à Rome, [Caesarodunum, Beiheft 14 bis, Calliope I, Paris 1979]207–220) sieht in der Vermengung der Tropen mit rhetorischen Figuren eine Folge der spätantiken Unterordnung derGrammatik unter die Rhetorik. Während die Grammatiker unter tropus mit Donat (Ed. a.a.O. 667) eine dictio translata apropria significatione ad non propriam similitudinem verstehen, machen die Rhetoriker daraus einen vieldeutigenUniversalbegriff, der so gut wie jeden beliebigen „écart“ vom üblichen Sprachgebrauch oder von der normalenGedankenabfolge bezeichnet. – Zum aristotelischen Hintergrund der Homoeosis-Theorie bei Donat (ebd. 673 f.) s. HOLTZ,Donat 215: Die Lehre der vergleichenden Beweise (Rhet. II 20, 1393a 25, 1393b 3 (oben § 17) getrennt behandelt gegenübereikon, Metapher im Rahmen der Stilmittel-Lehre (Rhet. III 4. 1406b 20; s. auch oben Anm. 137 und Exkurs II §§ 121 ff).Eine relativ klare Zusammenfassung der Homoeosis-Arten von der rhetorischen elocutio-Lehre her bietet Macrob, Sat. IV5.1–5 unter dem Stichwort: loci […] ad pathos movendum, qui dicuntur circa rem […] ex quibus primus est a simili:exemplum, parabola, imago. Die Illustrationsbeispiele stammen durchweg aus Homer und Vergil und zeigen die poetisch-stilistische Seite des Verfahrens. (Zum exemplum etwa: Orpheus erregt Mitleid; zur parabola: der „brüllende Stier“ erregtZorn, zur imago: die Beschreibung Skyllas erregt Entsetzen). Die Abhängigkeit von Aristoteles fällt in der rhetorischenSchultradition besonders da auf, wo die Dreiteilung aus Rhet. II 20, mit imago kombiniert, eine Vierteilung ergibt: z. B. beiIulius Victor VI 3 (Rhet. lat. min., ed. HALM) 399, der die loci circa rem a simili in exemplum, parabola, fabula, imagoeinteilt und im übrigen Illustrationsbeispiele von Aristoteles bezieht. Zu imago in solchen Klassifizierungs-Schemata s. auchunten Exkurs II § 122. – Was die Exempla in dieser Schematik betrifft, geht ihr auch hier stets gewahrter historischer (odermythologischer) Charakter am besten aus den Anwendungsbeispielen hervor. Vgl. z. B. Beda, De tropis (HALM) 618: fürparabola das evangelische Gleichnis vom Senfkorn, für paradigma der geduldige Elias und Loths Weib; Isidor, Etym. I 37(De tropis) 31–35: für parabola ein auf Caesar bezogener Löwenvergleich aus Lucan (I 205–6), für paradigma der VergleichScipios mit Cato. Vgl. S. 65 ff., Anm. 143, 381, 418. – Parabole bedeutet im allgemeinen ebenso den beweisendenVergleich wie die sinnbildliche Rede überhaupt (s. oben Anm. 114 zur analogen Doppeldeutigkeit von similitudo) und
59
(conlatio), paradigma/exemplum, d. h. Vergleich, Gleichnis, Beispiel. Auch hier hebt sich das Beispiel durchseinen Geschichtsbezug von den anderen, den Naturbereich (fiktiv) umsetzenden Vergleichsarten klar ab. DerRhetoriker Julius Rufinianus (4. Jh.) schreibt lapidar:146 paradigma facit vera
überdies den engeren Begriff eines hypothetischen Ereignisvergleichs (wie S. 53 zum Steuermann-Vergleich). Vgl.PERELMAN (wie Anm. 10) 123; McCALL 116, 190. Diese Mehrdeutigkeit ist durchaus antik und hat sich in denBibelübersetzungen nur wiederholt. Es ist darum nicht nötig, die Aufnahme der Gleichnisse Jesu ins Illustrationsmaterial derTropenlehre der Grammatiker und Rhetoriker als besondere mittelalterliche Ungereimtheit zu tadeln (ZILTENER 62; s. auchoben Anm. 126 unten Anm. 158).146 HALM, Rhet. lat. min. 44 nach Aristot., Rhet. II 20, 1393a; vgl. ZILTENER 60; GUERRINI 13 f. Zu beachten ist, daßdamit zwei Oberbegriffe gemeint sind, unter denen erst die erwähnte Triade erscheint. Paradigma besteht hier 1. aushistorischen Personen, 2. Aussprüchen, 3. Kombinationen von 1 und 2 (Näheres s. S. 162 ff.). Parabola aber entspricht demstilistischen similitudo-Begriff, der sich aufteilt in 1. eikon, 2. homoion, 3. epagoge. – Der Geschichtsbezug von paradigmakommt in allen Zeugnissen zur Sprache; vgl. etwa noch Victorinus I 30 (HALM) 238 f. mit der Definition nach Cic. Inv. I49 (oben Anm. 141): quo rem aliquam alicuius hominis aut negotii auctoritate vel casu aut hortamur aut dehortamur.Dazu vgl. auch unten Anm. 418.
60
exempla, parabole ficta ostendit. – Daß das Exemplum im strengen Sinn Beispiel aus der Geschichte ist, spieltschließlich noch eine Rolle in der Erzählformen-Einteilung nach dem „Wahrheitsgrad“ (genauer: nach demRealismusgrad), in der es, von einigen Ausnahmen abgesehen, antagonistisch zu fabula, poetischer Fiktion,auf der Seite der historia (res gestae) oder des argumentum (res ut gestae) steht.147
19. Dem induktiven Prinzip der Persuasion durch vertraute, anerkannte, unbestrittene Vergleichsgegenständeentspricht von vornherein eine Reduktion des für Exempla geeigneten Geschichtsmaterials auf wenigehervorragende Ereignisse oder berühmte Personen. Die allgemeinen traditionsgebundenenBildungsgewohnheiten der Antike sowie die vom römischen Ahnenkult bestimmte Vorliebe für heroischeEinzelgestalten führten zur Kanonbildung und Typisierung weniger wiederholbarer und gegebenenfalls auchnur andeutungsweise abrufbarer Exempla (wie Sokrates, Cato oder Regulus).148 Zu diesem induktiven
147 Zu den genera narrationum vgl. unten § 58, S. 406 f., 410 ff. und K. BARWICK, Die Gliederung der Narratio in derrhetorischen Theorie und ihre Bedeutung für die Geschichte des antiken Romans, in: Hermes 63 (1928) 261–86; WASZINK(wie Anm. 125) 197 f.; R. REITZENSTEIN, Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906, 92 ff.; FONTAINE, Isidore… (wie Anm. 145) 174 f.; LAUSBERG (p. 220 f. §§ 411, 414, 416) behandelt das Schema als Teilstück der Lehre vomExemplum. – Diese Erzählarten-Theorie ist eine weitere seltsame Blüte der kategorialen Zusammenlegung verschiedenerDisziplinen. Schon die Formulierung ut rei gestae commemoratio in Quintilian Exemplum-Definition (V 11 oben S. 50)erinnert an Ciceros berühmte Formulierung (Inv. I 19.27): Narratio est rerum gestarum aut ut gestarum expositio […]Fabula est in qua nec verae nec verisimiles res continentur, […] Historia est gesta res, ab aetatis nostrae memoria remota[…] Argumentum est ficta res, quae tamen fieri potuit. Vgl. auch Rhet. ad Herenn. 1.9.16 unten Anm. 492; 1.8.13: Fabulaest quae neque veras neque veri similes continet res, ut eae sunt, quae tragoedis traditae sunt. Historia est gesta res, sed abaetatis nostrae memoria remota. Argumentum est ficta res, quae tamen fieri potuit, velut argumenta comoediarum. (So auchfast wörtlich bei Martian. Cap. 5.46 [HALM] 486.16–21; vgl. z. B. auch Isidor Etym. I 44.5 unten Anm. 493; Joh. vonGarlandia, Poetria [ed. T. LAWLER, 1974] 100.312 ff.). Quintilian behandelt die Dreiteilung nicht unter demGesichtspunkt der „Wahrheitsgrade“, sondern wie üblich unter demjenigen der narrativen Gattungsbezüge (narrationumspecies) in Inst. II 4.2; fabula in Tragödie und Lyrik, argumentum, in der Komödie, historia in der Historiographie. Zudieser überaus komplizierten Theorie vgl. KNAPP, Similitudo… 78 ff. und ders., Historische Wahrheit und poetische Lüge.Die Gattungen weltlicher Epik und ihre theoretische Rechtfertigung im Hochmittelalter, in: DVJs 54 (1980) 581–635, hier607 ff.; Joachim SUCHOMSKI, Delectatio und utilitas, Ein Beitrag zur Verständnis mal. komischer Lit., Bern/München1975, 82 ff. Im übrigen erinnert die Zusammenlegung von res gestae/factae und res ut gestae/quasi factae, die dasExemplum konträr zur fiktiven fabula definiert, auch an die traditionelle Annäherung von Historie und Epos, Geschichte undMythos, wie in der einflußreichen Servius-Stelle (zu Aen. I 235); argumentum hoc est historiam; vgl. KNAPP, Hist.Wahrheit a. O. 593 ff. Andererseits kommt in der verästelten und verwirrlichen Geschichte dieser Theorie auch dieGleichsetzung von fabula und argumentum dem Sinne nach vor; Priszian, Praeexerc. 1.2.4 (HALM) 55.1.10–552.9: Fabulaest oratio ficta verisimili dispositione imaginem exhibens veritatis […] et fit verisimilis, si res quae subiectis acciduntpersonis apte reddantur. […] Sciendum vero est quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti (gemeint sindTierfabeln). Unmittelbar danach, ebd. 2.5 (552.11 ff.) folgt diese Aufteilung der species narrationum in narratio fabularis,fictilis, historica und civilis: Fabularis est ad fabulas supra dictas pertinens, fictilis ad tragoedias sive comoedias ficta,historica ad res gestas exponendas, civilis quae ab oratoribus in exponendis sumitur causis. – Remigius von Auxerre,Martianus Capella-Kommentar (ed. C. LUTZ, Leiden II, 1965, 111): Fabula est fictae rei narratio quae nec vera est necveri similis, sed ponitur in argumentis, quia licet numquam factum sit, tamen si fuisset, ita utique fuisset. Um dasDurcheinander noch zu vervollständigen, hat die moderne Forschung auch häufig argumentum im Sinne von „Beweis“ mitargumentum als dem „virtuell wahren Geschichtsbericht“ verwechselt (so etwa paradigmatisch CURTIUS, ELLM 448 ff.) Inder mal. Tradition sind Unsicherheiten in der Zuordnung des Exemplums zu historia/argumentum einerseits, zu fabulaandererseits, auf die hier nicht eingegangen werden kann, methodisch in jedem Einzelfall von der Frage her anzugehen, obfabula eine Gattungsbezeichnung (Tierfabel) oder ein „Wahrheitskriterium“ (historiographischer oder ideeller Art) darstellt.Wie wenig Klarheit über das Theorem noch im späteren Humanismus herrschte, zeigt paradigmatisch Agrippa vonNettersheim, der (in: ‚Die Eitelkeit und Unsicherheit der Wissenschaften‘, ed., F. MAUTHNER II, München 1913, 47) sagt,die Dichter haben „von Natur oder durch Kunst artig zu lügen geübt, mit ihren scheinbaren Argumenten fabulische Historiengeschrieben“ (zitiert nach G. KAISER, Zum Literaturbegriff des hohen Mittelalters, in: Romanist. Zs. für Literaturgesch. 2[1978] 275–97, hier 281).148 Vgl. GEBIEN 38, 69 f.; unten S. 339 ff. zur Typisierung durch Evidenz: „Ein den Hörern wenig geläufiges Paradeigma,mochte es auch noch so gut zum vorliegenden Fall passen, mußte seinen Zweck verfehlen.“ LAUSBERG 228 Anm. 1 zumhistoriographischen Selektionsprinzip gemäß „der bereits erfolgten Literarisierung und Notorietät.“ – Zur
61
Grundsatz (Absicherung einer strittigen causa durch ein ähnliches Beispiel) paßt nach rhetorischer Theoriedie relative Kürze des Exemplums. Eine Darstellung, die ausführlicher wird, als für das Verständnis
bildungsgeschichtlichen Eigenart des griechisch-römischen Exemplums vgl. MARROU, Erziehung … 246 ff., 331. ZurBedeutung des römischen maiores-Kults für die Verbindlichkeit (auctoritas) literarischer Exempla vgl. § 21.
62
der res certa unbedingt notwendig, läuft Gefahr, von der zentralen res dubia abzulenken oder gar das vonvornherein evidente Beispiel, das lediglich evoziert werden soll, durch Umständlichkeit zu verwässern.149 Obein Exemplum in einer gewissen Breite „erzählt“ oder durch bloße Anspielung oder Nennung nur „erwähnt“wird, steht innerhalb der rhetorischen Definition frei zur Wahl. (Quintilians Allgemeinbegriff commemoratioumfaßt beides.)149a Dies hängt wesentlich von der Rezeptionsmöglichkeit, vom Bildungshorizont und derGeschichtskenntnis des Adressaten ab. Jedenfalls ändern der Umfang
149 Vgl. GEBIEN 40 ff. zum Ideal der Kürze. – Zu res certa/dubia: S. 4 f., 31 ff., 201, 555, A 232. Allerdings gehört dasExemplum wie die similitudo im Rahmen des stilistischen ornatus zu den Amplifikations- und Digressionsmitteln; vgl.unten § 81, S. 200, 350 ff., 363, 356 f., 332 ff. und McCall 58 ff. zu Rhet. ad Herenn. II 29.46 (wie oben Anm. 140).149a Quint. V.11.6: S. 50; vgl. LAUSBERG § 415, p. 229; das Exemplum unter dem „unentschiedenen Sammelnamencommemoratio […] kann die längere Form der narratio oder die kürzere Form der Anspielung in einem Satzgliedübernehmen.“ – In der Definition Quintilians hat commemoratio den mehr zielgerichteten Sinn „Erwähnung“, „Anführung“ad persuadendum id quod intenderis. Bei Cicero Or. 34.120 bedeutet das Wort mehr inhaltsbezogen „Erinnerung“: Nescireautem quid ante quam natus sis, acciderit, id est semper esse puerum; quid enim est aetas hominis, nisi ea memoria rerumveterum cum superiorum aetate contexitur? Commemoratio autem antiquitatis exemplorumque prolatio summa cumdelectatione et auctoritatem orationi affert et fidem. Zu einer weiteren technischen Bedeutung von commemoratio (erweiterteChrie, Apomnemoneuma) s. unten Anm. 380. Im Zusammenhang mit dem commemoratio-Begriff steht andererseits auch dieGattungsbezeichnung memorabile, wie dies etwa die Praefatio des Valerius Maximus zeigt: facta simul ac dicta memoratudigna […] digerere constitui. Vgl. § 43, S. 119, 541 f. Vgl. auch SCHON 63 f. zur Beliebtheit der res memoriae dignae-Formel in der Titelgebung von Exempla-Sammlungen der Renaissance; unten § 42, S. 560 zum Policraticus. Andererseitskönnte Isidors berühmte historia-Definition in Etym. 1.41: Haec disciplina ad grammaticam pertinet, quia quidquid dignummemoria est, litteris mandatur sich spezifisch auf den im progymnasmatischen Unterricht besonders wichtigen Auswahl- undDignitäts-Aspekt beziehen: Val. Max. galt als der selektive Historiker, der nicht alles, sondern nur „Denk-Würdiges“aufzeichnete (s. unten Anm. 299). Zur Bedeutung der Isidor-Stelle in der Forschungsdiskussion über den mal.Geschichtsbegriff vgl. zusammenfassend H.-W. GOETZ, Die „Geschichte“ im Wissenschaftssystem des Mittelalters, in: F.-J.SCHMALE, Funktion und Formen mal. Geschichtsschreibung, Darmstadt 1985, 165–213, hier 170 f.
63
und Allusionsgrad nichts an der grundlegenden Geschichtsbezogenheit des Exemplums.150 Der Historiker PaulKirn schrieb:151
Der Vergleich mit typischen Figuren ist noch heute unentbehrlich. Nennen wir jemand eine Hamlet-Natur oder einenzweiten Napoleon, eine Kleopatra oder eine Frau Pompadour, so ersparen wir uns lange Ausführungen.Dementsprechend verfuhren schon die alten und mittelalterlichen Geschichtsschreiber. Nach Thomas BecketsErmordung wird Heinrich II. von England ein Nero, Herodes, Julian und Judas genannt…
Auch Kurzformen der genannten Art sind im besten Sinne des Wortes Exempla. Die bloße Nennung(metaphorisches Exemplum, von Curtius mißverständlich
150 Zu der seit der antiken Rhetorik verbreiteten Methode der Kurzanspielung durch Reduktionsformen des Exemplums vgl.DAXELMÜLLER, Art. Exemplum 638; KNAPP, Similitudo 61, 176; LAUSBERG §§ 415–18; Erich KLEINSCHMIDT,Herrscherdarstellung. Zur Disposition mittelalterlichen Aussageverhaltens, untersucht an Texten über Rudolf I. vonHabsburg, Bern/München 1974, 105 („Ereignisvermerk“); FRIEDRICH 41; GEBIEN 65 f., 70 f.; E. ALBERTINI, Lacomposition dans les ouvrages philosophiques de Sénèque, Paris 1923, 216 (Einteilung der Exempla Senecas in dreiKategorien: ausgeführte Exempla, Kurzanekdoten, bloße Namen in Exempla-Reihen). J.M. DAVID, Maiorum exempla sequi:L’exemplum historique dans les discours judiciaires de Cicéron, in: BERLIOZ/DAVID, Rhét. et hist. 67–86, hier 72 f.:bloße Namen anstelle erzählter Exempla werden in semiotischer Terminologie als kurze „dénotations“ aufgrund allgemeiner„connotations“ des „imaginaire collectif“ bezeichnet. V. PÖSCHL, Mythologisches in den Horazoden 1.7, 3.11 und 3.27, in:Würzburg. Jb. f. Altertumswiss. NF 7 (1981) 139–47 zu subtilen Abbreviaturen und bewußt fragmentarischen Hindeutungenauf berühmte Exempla. – Die theoretische Hauptstelle ist Quint. V. 11.15–6: Quaedam autem ex iis, quae gesta sunt, totanarrabimus […] quaedam significare satis erit […] Haec ita dicentur, prout erunt vel utilitas causae aut decor postulabit.LAUSBERG 414, p. 230: „Welche Form gewählt wird, hängt vom aptum, insbesondere vom Informationsstand desPublikums ab.“ – Im übrigen sind sämtliche Anwendungsbeispiele bei Quint. V 11.7 ff. reine Nennungen (sicut Gracchi)oder ganz kurze „Ereignisvermerke“ (Brutus occidit liberos). – Mit der soziologischen Implikation der rhetorischen Theorie,daß kürzere Exempla und höheres Bildungsniveau sich gegenseitig bedingen, stimmt die volkskundlich-literaturanthropologische These von H. BAUSINGER (Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen, in: Fabula 9[1967] 118–136, hier 121) in bemerkenswerter Weise überein: Kurzformen stellen entgegen romantischem Vorverständnis(vgl. S. 112) insofern nicht eine „ursprüngliche“, sondern eine späte Erscheinung der Erzählliteratur dar, als mit zunehmenderkultureller Entwicklung auch die Fähigkeit zur skizzenhaften, pointierten, witzigen Anspielung wächst. Die gedrängte „shortstory“ kann mithin ebenso spätzeitlich sein wie die „breite Roman“.151 P. KIRN, Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke, Göttingen 1955, 68.
64
imago getauft),152 die Antonomasie oder Anspielung ohne Nennung (ille qui…),153 die metonymischesignificatio („eine Messalina“, „ein Goliath“),154die sog. Vossianische Antonomasie oder Ineinssetzung vonVergleichendem und Verglichenem (mea Venus, alter Achilles),155 ja sogar noch Kondensate der christlichenTypologie (wie novus David, alter Ionas)156 und andere rhetorische Kürzel zwischen Vergleich und Metapherhaben den Charakter der historischen Analogie bei der Verdichtung nicht eingebüßt. Sie sind ebenso,‚historisch‘ wie die Kurzerzählungen des Valerius Maximus und ähnlicher Anekdoten über außergewöhnliche,oft absonderliche Begebenheiten. Sie sind alle dadurch Exempla, daß sie sich auf denselben allgemeinanerkannten Bildungsfundus des obligaten geschichtlichen Wissens beziehen, der Autorität und Beweiskraftverleiht.157
Parabeln und Tierfabeln setzen keine besonderen Kenntnisse voraus. Der Redner kann sie darum – wieAristoteles sagt – „leichter finden“, bequemer
152 GEBIEN 70 f. prägt den glücklichen Sammelbegriff „metaphorisches Exemplum“ für die bloßen Nennungen: „Entwederkann (der Autor) das Exempel erzählen, ohne den Namen, zu nennen, oder er nennt den Namen, ohne die Geschichte näherauszuführen. Der Name wird somit zu einer Metapher für bestimmtes Verhalten.“ Belege für ersteres: Cic. 5.64; Sen.Helv. 10.7–8; De clem. 1.3.5; letzteres wird vor allem nach dem wichtigen Aufsatz von A. NORDH: Historical exempla inMartial, in: Eranos 52 (1954) 224–238, mit der Epigrammatik Martials beleuchtet (z. B. 1.62.6 über eine scheinbar ehrbareGattin am Kurort: Penelope venit, abit Helene). – Zu der unhaltbaren Behauptung von E.R. CURTIUS, nach antik-mittelalterlicher Rhetorik seien nur Erzählungen Exempla, Nennungen und Anspielungen hingegen imagines, siehe untenExkurs II.153 Vgl. LAUSBERG § 416, GEBIEN 70, GUERRINI 16: Voraussetzung ist in der Antike die größtmögliche Bekanntheitdes Exemplums. Zu einer völlig anderen, vor allem mittelalterlichen Art der Anonymität s. unten § 34 f.154 Vgl. LAUSBERG § 581.155 Ebd. §§ 581, 1244 s. v. exemplum; s. unten S. 596.156 Ebd. §§ 581, 901; ders. Elemente §§ 404, 424; KREWITT 450 f. – Zum Verhältnis von Exemplum und Typologie s.§ 100 f., 107, S. 147, 333, Anm. 185, 207, 252–8, 913–6. Nicht bedeutungslos blieb die Vulgata-Übersetzung von t¥poqmit exemplum in I Tim. 4.12; Tit. 2.7.1; vgl. BUISSON, Potestas … 28 f.; Ph. ROLLINSON, Classical Theories ofAllegory and Christian Culture, London 1981, 32 f.157 C. BOSCH, Die Quellen des Valerius Maximus, Stuttgart 1929, 111: „Tausenderlei Klatsch geht um, willkürlicheAltersangaben, die irgendeiner einmal errechnete, wilde Diadochai, die erfundenen Todesarten hermippisch-meanthischerPhantasie, die Erzeugnisse römischer Familieneitelkeit, die von der Priesterschaft propagierten göttlichen Wunder,Volkssagen, Anekdoten, daneben gute historische Nachrichten.“ – Zum Konsens über Historizität und Memorabilität s. unten§§ 35, 42 f., S. 132 ff., 540.
65
für ein breiteres Publikum („das Volk“) einsetzen.158 Denn die Autorität liegt nicht in ihnen selbst; sieveranschaulichen vielmehr eine Evidenz oder
158 Siehe oben S. 51 ff. Der Band‚Rhétorique et histoire‘ (ed. BERLIOZ/DAVID) trägt vieles zur Begriffsklärung bei, wennman überall da, wo das „antike“ dem „mittelalterlichen“ Exemplum entgegengesetzt wird, „historisches Exemplum“ und„nicht-historischen Vergleich“ (Fabel und Parabel) konfrontiert; vgl. insbesondere BERLIOZ 13 f.: „Dans l’exemplumantique, c’est le héros qui donne son poids au précédent. Dans l’exemplum médiéval, en revanche, on cite l’informateur etc’est lui qui donne son crédit à l’anecdote. Dans les deux cas, l’autorité tient surtout à la référence.“ (Vgl. auch 74 ff., 107,118, 122 ff.) – Die in der Germanistik übliche Gleichsetzung von Exempel und Fabel (s. 119 ff.) ist nach demUnterscheidungskriterium zu beurteilen: Sie ist sinnvoll auf der Ebene des aristotelischen Paradeigma-Oberbegriffs, unterdem sich die induktiven Argumentationsvergleiche methodisch subsumieren lassen (vgl. oben § 17); sie ist widersinnig,wenn damit die materielle Differenz der Vergleichsträger negiert werden soll. Zum wesentlich nicht-historischen Personal derFabel vgl. MARTIN, Ant. Rhet. 122, oben § 18, unten § 88. Zur Parabel vgl. § 17, S. 53, 58 f., 119, 192. Auch hier warder nicht-historische Charakter gemäß der Tropenlehre (s. oben Anm. 145) ein zentrales Kriterium zur Bestimmung derGleichnisse Jesu im Mittelalter. Während JÜLICHER (I 113 f., 93, II 585 u.ö.) die „Gleichnisreden“ in die drei für dieBibelforschung maßgeblichen Kategorien „Gleichnisse, aufgrund eines Sachverhalts, der immer so ist“, „Parabeln, dieerzählen, was einmal jemand getan hat“ und „Beispielerzählungen, die eine religiösen Gedanken unangreifbar […] in derForm eines besonders günstig gewählten Einzelfalls veranschaulichen, ohne daß erst eine Übertragung auf das religiöseGebiet stattzufinden hätte“, begnügte sich Petrus Manducator mit der vergleichsweise simplen Feststellung (Historiascholastica 103 [PL 198] 1589–90), daß das Gleichnis Jesu vom reichen Prasser und vom armen Lazarus korrekterweisenicht parabola, sondern exemplum heißen müsse, weil Lazarus wirklich gelebt und die Geschichte sich tatsächlich zugetragenhabe. Damit nimmt er JÜLICHERS Aussonderung der sog. „Beispielerzählungen“ des Lukasevangeliums (neben dieser„Geschichte“ auch die vom barmherzigen Samariter, vom reichen Toren und vom Pharisäer und Zöllner, d. h. Lc. 16.19–31,10.30–7, 12.16–21; 18.9–14) in nuce vorweg. – Wie stark andererseits der seit der Antike bloß sinnbildlicheVergleichscharakter der parabole (im weitesten Sinn identisch mit „Vergleich“ überhaupt) auch die Bedeutung derGleichnisse Jesu eingefärbt hat, zeigt gut deren Gleichsetzung mit dem von JÜLICHER verachteten Begriff „Allegorie“ undalieniloquium in der mittelalterlichen Tradition. Vgl. BRINKMANN, (wie Anm. 145) 166 ff.; Joachim DYCK, Athen undJerusalem, Die Tradition der argumentativen Verknüpfung von Bibel und Poesie im 17. u. 18. Jh., München 1977, 36 zuneuzeitlichen Folgeerscheinungen und zu Petrarca, EP. fam. X.4, 1–2 (ROSSI II, 301): Theologia quidem minime adversapoetica est. Miraris? Parum abest quia dicam theologiam poeticam esse de Deo: Christum modo agnum modo vermem dici,quid nisi poeticum est? Mille talia in Scripturis Sacris invenies que persequi longum est. Quid vero aliud paraboleSalvatoris in Evangelio sonant, nisi sermonem a sensibus alienum sive, ut uno verbo exprimam: alieniloquium, quamallegoriam usitatiori vocabulo nuncupamus? Atque huius sermonis genere poetica omnis intexta est.
66
eine Lehre, die feststeht oder durch die Person des Lehrenden verkörpert wird.159 Exempla habendemgegenüber dank ihrer Geschichtlichkeit und Notorietät autoritativen Eigenwert. Man kann darum sagen,daß sie nicht für eine Wahrheit stehen, sondern – unter dem jeweiligen historischen Vergleichspunkt – selbstdie Wahrheit sind. Dies gilt ganz besonders für das in der römischen Tradition mit den Ahnenbildnissen aufStatuen und Büsten (imagines) assoziierte metaphorische exemplum virtutis,160 , die bloße, aber wirksameNennung eines großen Römers. Doch auch das Anekdotische vieler Philosophen- und Herrschergeschichten,das wie unterhaltsame Abschweifung erscheinen mag, hat grundsätzlich keine geringere historischeBeweiskraft, da gerade die eine Geschichte von einem besonderen oder gar singulären Vorkommnis – dasimmer wieder erzählte biographische Detail oder „geflügelte Wort“ – das Bekannteste an dem Helden ist undsich somit als etwas allgemein Akzeptiertes in topischer Argumentationsweise verwenden läßt.161 Noch heutekursieren Namen, die im allgemeinen Bildungsbewußtsein einzig an den Ausspruch einer sonst bedeutungslosenPersönlichkeit erinnern (wie General Cambronne, dessen Ruhm sich nicht einmal an das offizielle „letzteWort“ vor der Niederlage: „La garde meurt et ne se rend pas“ heftet, sondern an das lakonische, dieseheroische Version zusammen mit aller Kriegsberichterstattung und Historiographie desavouierende:„Merde!“)
159 Vgl. BERLIOZ 13 f., VITALE-BROVARONE 107.160 Vgl. unten § 129, Exkurs II; DAVID, Maiorum exempla … 73; B. BALDWIN, Biography at Rome, in: Festschr. C.DEROUX, Studies in Latin Literature and Roman History, (Coll. Latomus 164), Brüssel 1979, 100–118, hier 102 ff.;Friedr. KLINGNER, Römische Geschichtsschreibung, in: ders., Röm. Geisteswelt, München 1965/1979, 66–89, hier 68 ff.,82. – Aufgrund der römischen Tradition ist eine vom griechischen Mythos auf die antike Erzählhaltung überhauptübertragene Feststellung WEINRICHS (wie Anm. 85) 143 zu redimensionieren: WEINRICH sieht einen grundlegendenUnterschied der Kulturen darin, daß die Antike das Wesentliche des Mythos der Erzählung anvertraue, das Mittelalterdagegen die Hauptsache „als Moral der Geschichte“ außerhalb der Erzählung in argumentierendem Diskurs vorbringe undderart den „Ereignischarakter des Mythos zum symbolhaften Resultatcharakter“ eines „statischen“ „Bildes“ immobilisiere, dasman buchstäblich an die Wand malen könnte. Letzteres trifft aber ebensogut, vielleicht sogar besser auf das römischeexemplum virtutis (das historische und das mythologische) zu, dessen ikonographische Tradition ein kunstgeschichtlichesThema darstellt (s. unten Exkurs II, Anm. 1190).161 DAVID (Rhet. et hist., Présentation) 13 möchte diesen Aspekt allein für das antike Exemplum gelten lassen: „L’orateurantique peut proposer à l’identification une véritable image exemplaire d’un héros que tous connaissent. Le prédicateurmédieval raconte à son public une histoire qui lui est souvent inconnue mais dont il partage la morale.“ Vgl. jedoch unten§ 35.
67
Nach dem Muster einer mehr oder weniger umfassenden, mehr oder weniger historisch gerechten Synekdochevertritt die berühmte Anekdote in nuce, den berühmten Mann, gelegentlich sogar ein ganzes berühmtesLeben. Der Name meint nichts anderes als diese Anekdote.162
Aus alldem geht hervor, daß nicht die Darstellungsart – Erzählung oder bloße Nennung – das Exemplumlogisch zum Exemplum macht, sondern die Absicht, menschliche Vergangenheit für einen aktuellen Zweck(argumentativ oder moralisch pädagogisch) zu nutzen.163 Die Unterscheidung von Erzähl- und Bildbeispiel(gelegentlich exemplum und imago genannt) mag für bestimmte linguistisch-grammatikalisch-semiotischeForschungsfragen berechtigt sein, trifft aber, soweit die bestehende rhetorische Tradition seit der Antike fürdie Allgemeine Rhetorik repräsentativ ist, weder eine Gattungsnoch eine Funktionsdifferenz vonliteraturgeschichtlich-hermeneutischer Relevanz.
20. Auch der Unterschied zwischem dem Beweis- oder Belegbeispiel (der confirmatio) und dem erzieherischenVorbild- oder Warnbeispiel (der exhortatio/admonitio oder dehortatio) ist schon wegen der manifestenÜberschneidungsmöglichkeiten kein Wesensunterschied, nach dem in einer Definition das eine alsursprünglich echt, das andere als abgeleitet und sekundär vorgestellt werden dürfte.164 Was die antikeEntwicklung des Exemplums
162 Synekdoche: vgl. unten § 78, LAUSBERG §§ 572 f., 581: Antonomasie als Synekdoche für Eigennamen (genus prospecie, species pro individuo); Vossianische Antonomasie als umgekehrte Synekdoche (proprium pro communi). – ZurAnekdotisierung und Privatisierung der Geschichte (u. a. am Beispiel Cambronnes) vgl. grundsätzlich W. von denSTEINEN, Kitsch und Wahrheit in der Geschichte (1952), in: ders. Geschichte als Lebenselement, Bern 1969, 102 ff.; H.L.MIKOLETZKY, Geschichtsschreiber und Geschichtenschreiber (in Beispielen), in: Festschr. E. DUPRÉ THESEIDER I,Rom 1974, 401–24, hier 402.163 Vgl. JAUß, Erfahrung (wie Anm. 11) 344 ff. gegen eine modische hypertrophe Narratologie, der das pränarrative Wesendes Exemplums, d. h. dessen „Sinnkonstitution aus geschichtlicher Erfahrung“ entgehen müsse.164 Zur suasiv/dissuasiven Doppelfunktion s. S. 184 ff., A. 912. In der grammatikalischen Homoeosis-Dreiteilung (obenAnm. 145) erhält paradigma häufig die zusätzliche Bestimmung durch exhortatio und dehortatio: s. unten Anm. 1192. ZurAmbivalenz der erzieherisch-moralischen und der argumentativ-bezeugenden Bedeutung vgl. DAXELMÜLLER, Art.Exemplum 632; ders., Exemplum u. Fallbericht 155 ff.; GUERRINI 14 f.; A. LUMPE, Art. Exemplum, in: RAC VI (1966)1229–57, hier 1230, 1234 f.; GEBIEN 17 (Exemplum zugleich Richtschnur, Analogiebeweis, Illustration eines Satzes);BUISSON, Potestas… 26 ff.; vgl. §§ 48 f., S. 84, 90 f. Die Überschneidung beider Funktionen zeigt schon die Vorrede desValerius Maximus, der den documenta sumere volentibus Belege für moralische Leitsätze, aber auch für die Lösungpraktischer Problemfälle bereitstellen will. Beide Tendenzen beherrschen die Tradition der zahlreichen sich auf ihn berufendenExempla-Sammlungen bis zur Neuzeit (vgl. SCHON 65, FRIEDRICH 24 f.). – Eine Kombination beider Aspekte inkirchenrechtlichem Zusammenhang zeigt die eingangs (oben Anm. 1) zitierte Briefstelle Johanns. – Auch theoretisch läßtsich geltend machen, daß das Exemplum primär imitatio bewirken will: Der Richter, der in der deliberatio von einemPräzedenzfall bestimmt wird, „folgt“ dann dem überzeugendsten Argument (der einschlägigsten Parallele). Umgekehrt ist einmoralisches Exemplum stets auch ein Beweis: Das Vorbild erregt die Erkenntnis, daß ein Verhalten möglich und tunlich ist,und spornt so zur Nachfolge an (s. S. 96, 127, 229 f., 322 ff. Zudem sind im Mittelalter viele hagiographische Exemplasowohl „Beweis“ für die Wundertaten Gottes als auch Vorbild (§§ 26, 29 f., vgl. W. BRÜCKNER, Erzählende Kurzprosades geistlichen Barock, Aufriß eines Forschungsprojekts am Beispiel der Marienliteratur des 16. bis 18. Jhs., in: Österr. Zs.f. Volkskunde 37 (1983) 101–148, hier 105, 130 ff.) – Ein großzügiger Begriff des aller Rhetorik zugrundeliegenden Zielsder persuasio umschließt ohnehin demonstratio und comprobatio (vgl. Rhet. ad Herenn. IV 44.57 u. oben Anm. 140 zu dencausae dicendi in IV 45.59–49.62), die erhärtende und die „monumentale“ Funktion der commemoratio (ad persuadendum:Quint. V 11.6, s. oben Anm. 115, 149 a). Persuasio hat im übrigen in Antike und Mittelalter einerseits mehr mit probatioals (wie in der Neuzeit) mit Affektstimulation, andererseits mehr mit ethisch-pragmatischem Impuls als mit formaler Logikzu tun (vgl. unten § 53). Roger Bacon hebt entsprechend hervor, das Schwierigste für den Redner sei nicht, den Glauben zustärken oder eine Sache vor Gericht zu vertreten, sondern Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun (Moral. philos. V. XXX2.6–8, ed. E. MASSA [Thesaurus Mundi] Zürich 1953, 254–5).
68
betrifft, wurde häufig auf den in der römischen Literatur vorherrschenden moralischen Modellcharakter(auctoritas exempli) gegenüber den stärker argumentativen Zielen der griechischen Paradeigma-Technikhingewiesen.165 Die geläufigste Anwendungsart des römischen Exemplums kann sogar als eine vomAhnenkult bewirkte Verkümmerung des griechischen Paradeigmas bezeichnet werden, da es die vielfältigenMöglichkeiten der „Geschichte als Argument“ inhaltlich auf die moralisch vorbildliche Beispielgestalt undformal auf das metaphorische exemplum virtutis reduziert.166 Die erwähnte, dem Exemplum immanenteSchematisierungs- und Reduktionstendenz167
165 Vgl. Cicero De or. 3.137: ut virtutis a nostris sic doctrinae sunt ab illis [sc. Graecis] exempla petenda. Val. Max. II7.6: nostra urbs […] omni genere mirificorum exemplorum totum terrarum orbem replevit (dazu vgl. auch unten Anm. 373).– Vgl. J. GAILLARD ‚Auctoritas exempli‘: practique rhétorique et idéologie au Ier siècle avant J.-Chr., in: REL 56 (1978)30–4; PÖSCHL, Augustinus (wie Anm. 4) 957 f.; BUISSON, Potestas… 26 f.; ders. Entstehung… 103; LEEMAN (wieAnm. 38) 67; KLINGNER (wie Anm. 160) 68 f.; M. JENNIGS, Lucan’s Mediaeval Popularity: The Exemplum Tradition,in: Rivista di cultura class. e medioev. 16 (1974) 213–33, hier 217; unten Anm. 395.166 Vgl. DORNSEIFF 218 f.167 Oben S. 61 ff.
69
verschärfte sich in der späteren römischen Literatur soweit, daß der Exemplagebrauch zusehends in den Rufdes Abgestandenen, Abgedroschenen kam. Diese ästhetische Abwertung wurde von den Christen übernommen.Sie gipfelte zuletzt im Vorwurf des ideologisch Überalterten.168 Der Katalog von immer gleichenexemplifizierbaren Heroen- und Ahnentaten erregte das Bedürfnis nach Abwechslung und anekdotischerAuflockerung, dem in vielem bereits Valerius Maximus mit seiner umfangreichen Sammlung entgegenkam,und das zusehends durch unterhaltsame novellistische Histörchen hellenistischer Prägung befriedigt wurde.169
2. Zur Entwicklung des rhetorischen Exemplums von der Antike bis zum Mittelalter
a) Römische exempla virtutis
Die Verbindlichkeit römischer exempla virtutis aufgrund der relativen Gegenwart der maiores (§ 21). Zum theoretischenProblem der Verbindlichkeitsgrade aller „lebendigen“ Identifikationsbeispiele: ein Klärungsversuch mit Hilfe der rhetorischenUnterscheidung künstlicher und unkünstlicher Beweise (§ 22). Spätantike Auflösung der exempla maiorum insDemonstrative: unterhaltsame Anekdotisierung und ideologische Inszenierung (§ 23).
21. Die Eigenart des römischen Exemplums läßt sich weder aus der eben skizzierten immanenten„Verfallsgeschichte“ verstehen noch gar aus der Perspektive des von außen destruktiv einwirkendenChristentums. Gegenüber anderen Arten des Beispielgebrauchs zeichnet es sich vor allem durch die
168 Antike Kritik: Seneca Ep. 24.6 spricht von decantatae in omnibus scholis fabulae und meint damit nicht Fabeln (s. § 59,S. 47 ff., 127, 82 f.), sondern übliche Exempla wie die gegen die Todesfurcht zitierten Anekdoten von Plato und Cato.Ebd. 24.9: non in hoc exempla congero, ut ingenium exerceam… weist auf das selbstzwecklich-virtuose Spiel mit Exemplain den declamationes (vgl. unten §§ 63 ff.); der Kontext von Ep. 24 zeigt die Kritik allerdings als einen Einwand desLucilius, den Seneca mit dem Gedanken widerlegt, daß solche scheinbar abgedroschenen Exempla ihre existentielleBedeutsamkeit nie verlieren). Weiteres gegen die Trivialität bestimmter Exempla s. z. B. bei Seneca d. Ä., Contr. 7.5.12–3;Symmach. Ep. III 6.3; Juvenal 2.40; Martial 11. 104.1–2. Vgl. ALEWELL 95; NORDEN, Kunstprosa I 275 f.; GEBIEN38 f., 57 f., 69 f.; von MOOS, Consolatio I–II § 197 a, III §§ 1352–3. Zur christlichen Kritik s. unten §§ 24 f.169 Vgl. unten § 33, S. 132 f., 137, 124, Anm. 410, 710, 921. – Valerius Maximus verfaßte seine Sammlung u. a. auch alsHilfsmittel zur Variation der bereits etwas zu eintönig gewordenen Methode, auf die sich II 10.8 bezieht: … quae quidemeffecit ut quisquis egregium civem significare velit, sub nomine Catonis definiat. Zur „historischen Trivialliteratur“ (DictysCretensis, Julius Valerius, ‚Historia Augusta‘ u. a.) als Unterhaltung für ein breites, nach Ammian bis in die Senatskreisehineinreichendes „literarisches Banausentum“ vgl. A. DEMANDT, Geschichte in der spätantiken Gesellschaft, in:Gymnasium 89 (1982) 255–72, hier 256 ff.
70
besondere Verbindlichkeit der zur persönlichen Bewährung und Rechtfertigung vorgestelltenIdentifikationsmodelle aus. In bedeutsamer Weise übersteigt es damit auch die Funktion bloßer moralischerVorbildlichkeit. Die virtutis exempla sind ihrer Herkunft nach Familienbeispiele und insofern eine wesentlichaltrömische Erscheinung. Sie sollen in erster Linie an die hervorragenden Ruhmestaten großer Ahnen desGeschlechts erinnern. Diese Erinnerung wird mit Stolz wie eine Erbschaft gehütet, erzieherisch denNachkommen weitergegeben und mit verschiedenen Vergegenwärtigungsmitteln – imagines (im Atrium oderbei Leichenfeiern), Tituli, Grabinschriften, laudationes funebres, identischer Namengebung, imitatorischenInszenierungen und Äußerungen eines „zitathaften Lebens“ – immer wieder wachgerufen.170 In diesemgenealogischen, rituellen oder kultischen Rahmen bildete sich die Gewohnheit heraus, Exempla als Besitz,Schatz an „lebenden Beispielen“, Spiegelbildern für die Selbstbesinnung oder aber als Arsenal anunvergänglichen Ruhmesbeweisen für die eigene Selbstbehauptung zu betrachten. Diese Sehweise wurde in derFolge politisch ausgeweitet, patriotisch auf die großen Gestalten der Republik oder der gesamten altrömischen
170 Vgl. KORNHARDT 15 ff.; V. PÖSCHL, Die römische Auffassung der Geschichte, in: Gymnasium 63 (1965) 190–206= in: ders., Literatur und geschichtliche Wirklichkeit, Heidelberg 1983, 60–77, hier 68 ff.: die „Macht des Beispiels“, die„prägende Kraft des Vorbilds“ werden gerade durch die besondere Anstrengung Augustins, römische Exempla zu widerlegen,bestätigt; ders., in: Augstinus Magister (wie Anm. 4) I 957 ff. und ebd. III 206 (Diskussionsvotum zum Beitrag von H.I.MARROU): „S’il est vrai que tous les peuples font appel aux exempla maiorum, il y a une différence remarquable chez lesRomains: c’est l’autorité qui est donnée aux exemples comme règle de conduite!“ Beispiele seien Tiberius, der keineEntscheidungen im eigenen Namen trifft, sondern stets nur als imitatio Augusti, oder Cicero, der seine eigensten politischenErfahrungen so ausdrückt, als stammten sie von Platon; Horaz, der in seinen persönlichsten Gedichten wie Epikur spricht. E.von IVANKA, Römische Ideologie in der ‚Civitas Dei‘, ebd. III. 411–17.; O. SEEL, Römertum und Latinität, Stuttgart1964, 183 ff. zu Beispielen des „Sterbens nach Modell“ wie Senecas Sokrates-Imitation: „… eine Modellhaltung, welchedazu führt, daß die Person im Exemplum aufgehoben, überhöht, verfremdet, in ein archaisches Übermaß transponierterscheint“. Vgl. auch ebd. 125, 313, 341; J. VOGT, Ciceros Glaube an Rom, Würzburg 1925/Darmstadt 1963, 2 ff.; F.G.MAIER, Augustin und das antike Rom, Stuttgart 1955, 78 ff.; H. DREXLER, Die moralische Geschichtsauffassung derRömer, in: Gymnasium 61 (1954) 168–90; BALDWIN (wie Anm. 160) 102 ff.; P. SCHUNCK, Römisches Sterben,Studien zu Sterbeszenen in der kaiserzeitlichen Literatur …, Diss. Heidelberg 1955; KLINGNER (wie Anm. 160) 102 ff.;H.I. MARROU, Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum, Freiburg–München3 1957, 337 ff.; vgl. auch S. 52 ff.,80. – Der Ausdruck „zitathaftes Leben“ stammt von Thomas Mann aus dem Vortrag ‚Freud und die Zukunft‘ (1936) in: Adeldes Geistes, Stockholm 1945 und Ges. Werke IX, Frankfurt 1960/1974, 478–501; s. dazu auch unten Anm. 186 und 998.
71
Vergangenheit übertragen und schließlich – namentlich durch Cicero – auch im philosophischen Sinnumgedeutet und allgemein auf Vorbilder der Tugend und Weisheit bezogen.171
Jeder Nachkomme oder Nachfolger stand aufgrund dieser Denkform in irgendeiner verpflichtenden Tradition,die ihn selbst zum Vorfahren und Vorgänger machte und sein beispielhaftes Wirken für die Nachweltforderte.172 So bildeten die Familiengeschichten und nach ihrem Muster die römische Geschichte als ganzeoder schließlich auch Sondergeschichten173 (wie etwa die Geschichte philosophischer Schulen) eigenebiographische Exempla-Ketten, in die sich die Lebenden selbst als letzte Glieder hineingestellt sahen. Dasliterarische Beispiel erschien darum nicht bloß als eines von vielen heroischen Vorbildern, sondern alsRepräsentant der bestimmten zum Angesprochenen hinführenden, ja dessen Identität einbeziehendenTraditionsreihe. Das Exemplum erlangte so gewissermaßen die unmittelbare Überzeugungskraft einesargumentum ad hominem.
Dies ist in groben Zügen die eigentümliche Entwicklungform des rhetorischen Beispiels in Rom. Wie jedesExemplum konnte natürlich auch das römische der von Aristoteles allgemeingültig beschriebenenBeweisfunktion dienen. (Es gibt grundsätzlich einen argumentativen Einsatz situationsgerecht ausgelegterIdentifikationsmodelle der Vergangenheit zugunsten gegenwärtiger „Tunlichkeit“). Das Spezifische derrömischen Beispielkonzeption liegt jedoch in dem konservativen Glauben an das tatsächliche (oderwenigstens symbolhaft ernstzunehmende) Weiterleben der maiores in der Gegenwart. Die Vorfahrenüberleben in den Nachfahren einerseits als Mahnmal der Wesensgemäßheit, der Treue zum eigenen Geschlechtund zur persönlichen Identität, der Wiederherstellung der prisca virtus, andererseits als eine zuverherrlichende Realität bei neuen (wirklichen oder vermeintlichen) Ruhmestaten und damit stets auch alsideologische Rechtfertigung des Faktischen, sei es durch die Handelnden
171 Vgl. J. GAILLARD, Auctoritas exempli (wie Anm. 165) 30 ff.; ders., Regulus selon Cicéron. Autopsie d’un mythe, in:REL 50 (1972) 46–9; DAVID, Maiorum exempla 73 ff. und oben Anm. 170.172 Vgl. LAUSBERG § 245, 134 zur Rubrik der Lobrede nach dem locus ex exemplo posteris tradito (z. B. Quint. III7.17–8.21).173 Vgl. Hieronymus zu berufsspezifischen Exempla in Ep. 58.5: Habet unumquodque propositum principes suos: Romaniduces imitentur Camillos, Fabricios, Regulos, Scipiones; philosophi proponant sibi Pythagoram, Socratem, Platonem,Aristotelem; poetae aemulentur Homerum…“ usw. bis zu der Schlußfolgerung, die christlichen Priester mögen den Aposteln,die Mönche („wir“) den Eremiten Paulus und Antonius folgen. Dazu vgl. H. HAGENDAHL, Latin Fathers and the Classics,Göteborg 1958, 189 f.; A. REIFF, ‚Interpretatio, imitatio, aemulatio‘. Begriff und Vorstellung literarischer Abhängigkeit beiden Römern, Diss. Würzburg 1959, 121 f.
72
selbst, sei es durch deren Lobredner.174 Entscheidend ist jedenfalls immer eine normativ verbindliche,objektiv gegebene Beziehung zwischen Exemplum und vorliegender Situation. Das Beispiel dient hier nichtnur als Präzedenzfall in dem allgemeinen Sinne, daß irgendeine frühere Situation mit der gegenwärtigen kraftihrer Analogie in dem entscheidenden Punkt zusammengebracht wird. (Dabei kann gerade die bisherunbemerkte „verblüffende Ähnlichkeit“, durch kluge Beobachtung, Geschichtssinn und kombinatorischePhantasie herausgestellt, besonders anschaulich und rhetorisch wirksam sein.) Das römische Exemplum istvielmehr eine verpflichtend in die Gegenwart hineinragende „Präexistenz“, ein historisches Symbol, das alssolches in jederlei Hinsicht schon Autorität hat. Über dessen jeweiligen (positiven) Aktualisierungsaspekt darfzwar gestritten werden – in der Auslegung liegt hier die Leistung der Einbildungskraft –, doch „die reale Machtdes geschichtlichen Beispiels“ selbst ist unanfechtbar.175
22. Diese Feststellung kann nun, so sehr das römische Beispiel einen kulturgeschichtlichen Sonderfalldarstellt, doch auf vergleichbare Erscheinungen des gruppenspezifischen (genealogischen, dynastischen,politischen und religiösen) Identifikationsbeispiels anthropologisch übertragen werden. Frantisek Graus hatdafür den ebenso einfachen wie treffenden Sammelbegriff „lebendige Vergangenheit“ geprägt.176 Nicht nur dievon ihm untersuchten neuzeitlichen, vor allem nationalistischen und konfessionellen Traditionsbildungenmittelalterlicher Herkunft – besonders augenfällig etwa das „Nachleben“ von Wilhelm Tell und Jeanne d’Arc– stellen den Rezeptionsforscher
174 Vgl. KLINGNER (wie Anm. 160) 82 zur Ambivalenz der Aristien zwischen Erziehung und Verherrlichung;HONSTETTER 110 ff. insbesondere zu Claudians Restaurations-Ideen; unten Anm. 175 und S. 80.175 Zitat: PÖSCHL, Augustinus (wie Anm. 4) 961. – Der Begriff „Präexistenz“ bei KLEINSCHMIDT 37 ff.; historischesSymbol: A. HEUSS, Alexander der Gr. und die polit. Ideologie des Altertums, in: Antike und Abendland 4 (1975) 65–104,hier 143. – Zum Interpretationsstreit über das an sich sakrosankte Exemplum s. HONSTETTER 89 f., 96 f., 191; DAVID,Maiorum exempla 67, 74, 76; VITALEBROVARONE 107 und unten §§ 77 f.176 F. GRAUS, Lebendige Vergangenheit, Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter,Köln–Wien 1975: Mit dem Titel vergleichbar ist derjenige Arno BORSTS für sein Mittelalterbuch „Lebensformen imMittelalter“ (Frankfurt 1973/1979), der ausdrücken soll, daß das Leben „formbar“ sei im Sinne der platonischenLebensmuster (ebenfalls paradeigmata), der cireronischen forma vivendi und der augustinischen heilsgeschichtlichen formafuturi, wobei auch die Vergangenheit als Modell, Vorbild und Präexistenz das Leben „prägt“ (14 ff.). Vgl. auch PÖSCHL,Literatur (wie Anm. 170) 68 f. zum römischen Geschichtsverständnis, nach dem alles Vollkommene grundsätzlich in derVergangenheit, nicht in der Zukunft liegt, einer Vergangenheit, die nicht als einmaliges Geschehen, sondern als immerwiederkehrende Möglichkeit und Verpflichtung gilt.
73
vor heikle Wertungsprobleme: Mehr oder weniger alle „lebendigen“, zu Gruppensymbolen „mythisierten“Geschichtsbeispiele führen in ein Grenzgebiet zwischen Geschichte, Rhetorik und „Weltanschauung“.177Zurrhetorischen Klärung ist hierzu die wichtige Unterscheidung der antiken Rhetorik zwischen „technischen“(„künstlichen“) und „untechnischen“ („unkünstlichen“) Beweisen hilfreich.178 Technisch sind Gründe, die derRedner selbst mit seiner Redekunst auf den Fall bezieht (alle Vergleiche oder Analogiearten); untechnischhingegen sind alle jene Argumente, die unabhängig vom Redner schon im Fall selbst liegen und aus diesem nurnoch hermeneutisch und rhetorisch herausgeholt werden müssen (z. B. Indizien im Strafprozeß). Nach diesemSchema gehört das Exemplum nominell zu den künstlichen Beweisen. Es hängt – von Fiktionen zu schweigen– bei aller historischen Realität mit dem Fall nicht geschichtlich und tatsächlich zusammen, sondern muß überein passendes tertium comparationis „künstlich“, ingeniös auf diesen bezogen werden. Auch wenn es nicht(wie in der Allegorie) mit Hilfe eines Zweitsinns auf das Thema projiziert, sondern proprie als vergangeneTatsache historiographisch konkret erfaßt und aktualisiert wird, bleibt der Bezug insofern willkürlich, als esaus einem Magazin vergleichbarer Fälle frei ausgewählt und unter dem einschlägigen Aspekt mit der Sacheverknüpft wird. Versucht man nun das „lebendige“ Identifikationsbeispiel im erwähnten römischen undallgemeinen Sinn entsprechend einzuordnen, so wird die Klammer zwischen vergangenem und gegenwärtigemEreignis zur Standpunktfrage. Wer Exemplum und Fall als zwei Glieder derselben realen Geschichtsverkettungernst nimmt, verwendet das Beispiel im Sinne eines „unkünstlichen Beweises“. Wer die Wirklichkeit dieserKontinuität nur vortäuscht oder nicht einmal voraussetzt, benützt das Exemplum im reinenAnalogieverfahren als „künstlichen Beweis“. Unter dem Gesichtspunkt einer „realistischen“, „unkünstlichen“Verknüpfung von vorausliegendem und
177 Siehe unten S. 75 ff.178 Vgl. FUHRMANN, Rhet. (wie Anm. 49) 90 ff. bes. zu Aristot. Rhet. I 2, II 20–2; LAUSBERG §§ 350 f., 411 zumExemplum als künstlichem Beweis, der dem unkünstlichen „nahesteht“ nach Aristot. Rhet. I 2 und Quint. V 1.1; V 2.1 (s.oben Anm. 2): exemplum als praeiudicium bei den probationes inartificiales; dagegen V 9.1: omnis […] probatioartificialis constat aut signis aut argumentis aut exemplis. Vgl. auch ebd. V 11.43: fuerunt qui exempla et has auctoritates[gemeint sind facta und dicta, die der Richter oder die Gegenseite im gleichen Prozeß angeführt haben] inartificialiumprobationum esse arbitrarentur, quod ea non inveniret orator, sed acciperet. In der loci-Lehre gehört das Exemplum zurargumentatio artificialis; vgl. z. B. Julius Victor VI 5 (HALM) 403; Fortunatian, ebd. 115.26; Martianus Capella ebd. 489;s. auch HALMS Register zu den Rhet. lat. min. s. 1 argumentum/probatio artificialis – Das üblicherweise reinargumentationstechnisch verstandene Schema (s. unten S. 332), wird im Folgenden bewußt anthropologisch auszulegengesucht.
74
nachfolgendem Ereignis finden sich zum altrömischen und genealogischen Exemplum etwa folgende (sonstunter sich unvergleichbare) Strukturparallelen: die kosmologische Vorstellung von der ewigen Wiederkunft desGleichen in der Antike (Apokatastasis, Metempsychose und dgl.),179 die germanische Heldensage alsFamiliensage,180 die dynastische Identifikation eines Nachfolgers mit einem Vorgänger in verschiedenenKulturen,181 die Abstammungsmythen ganzer Völker,182 die Selbstvergewisserung des „auserwählten Volkes“Israel durch Paradigmen früherer Wohltaten Jahves,183 der christliche Glaube an die Kirche als corpus Christimysticum aller in der gleichen Nachfolge Jesu bis zum Jüngsten Tag untereinander verbundenen Glieder184
oder die Typologie als Zusammenschau alttestamentlicher und neutestamentlicher Geschehnisse zu einemEreignispaar, in dem das Spätere das Frühere in Christus steigert und erfüllt.185 All diese und viele andereGeschichtsbezüge,186
179 Vgl. Gerhart B. LADNER, The Idea of Reform, Cambridge Mass. 1959, 9 ff.; ders., Art. Erneuerung, in: RAC 6 (1966)240–75, hier 240 f.180 H. FICHTENAU (Vom Verständnis der römischen Geschichte bei deutschen Chronisten des Mittelalters, in: Festschr.P.E. SCHRAMM, I, Wiesbaden 1964, 401–19, hier 409) zieht diesen Vergleich mit den römischen exempla maiorum.181 Vgl. etwa HEUSS (wie Anm. 175) 103 f. u. ö.; GUENÉE, Histoire et culture hist. 332 ff., 346 ff.; ders. Les généalogiesentre l’histoire et la politique: la fierté d’être Capétien en France, au Moyen Age (1978), in: ders., Politique et histoire aumoyen âge, Paris 1981, 341–68; G.M. SPIEGEL, Political Utility in Medieval Historiography, in: History and Theory 14(1975) 314–25, bes. 324 ff.: mal Genealogie als biologisches Äquivalent zur religiösen Typologie; G. LADNER, Terms andIdeas of Renewal, in: Renaissance and Renewal (wie Anm. 7) 1–33, bes. 17 f.; J. EHLERS, Gut und Böse in derhochmittelalterl. Historiographie, in: Miscellanea Mediaevalia, Köln 11 (1977) 27–71, hier 33 f.; KIRN 160 ff.; LADNER,Erneuerung (wie Anm. 179) 240; sowie unten § 101, S. 75 ff., 80 ff., 124, 127, 326 f.182 Vgl. GUENEE, Histoire et culture hist. 348 ff.; SPIEGEL (wie Anm. 181) 324 ff.183 Vgl. DORNSEIFF 213 ff.; F. MAASS, Von den Ursprüngen der rabbinischen Schriftauslegung, in: Zeitschr. f. Theol. u.Kirche 52 (1955) 129–61, hier 137 ff.; LUMPE 1240 f.; Peter JENTZMIK, Zu Möglichkeiten und Grenzen typologischerExegese in mittelalterl. Predigt und Dichtung (Göppinger Arbeiten z. Germanistik 112), Göppingen 1973, 117 ff. (alshebräische Voraussetzung christlicher Typologie).184 Vgl. LUMPE 1244, 1252 und unten § 26.185 Dazu vgl. §§ 30, 97, S. 84, 475 ff., 513 ff. Robert W. HANNING (The Vision of History in Early Britain, NewYork/London 1966/1969, 14) unterscheidet „prophetische“ selbstlegitimierende Gegenwartsdeutungen aufgrund des AltenTestaments, wie sie in der Alten Kirche praktiziert wurden, mit Recht von bloß vergleichenden, allerdings irrig „typologisch“genannten und wohl besser allegorisch zu nennenden Bezügen: „The fourth kingdom of Nebuchadnezzar’s dream was not atype of Rome, it was Rome.“ Nichts anderes sagt JENTZMIK (wie Anm. 183) 23 f. von der Typologie: Der Typus sei nichtein ins Ereignis hineingetragener, sondern bereits real im Ereignis vorhandener Sinn. Daß solche Feststellungen ohneStandortangabe etwas leicht Mißverständliches haben, zeigt auf der Gegenseite DEMANDT (Geschichte in der spätantikenGesellschaft [wie Anm. 169] 264), der römische ex eventu-Prophezeiungen im Zusammenhang mit Selbstlegitimationen ausdem Ahnenkult strukturell mit der christlichen Figuraldeutung vergleicht.186 Weiteres s. in dem überaus vielseitigen Beitrag von DORNSEIFF. – Auch die Selbststilisierung gewisser Renaissance-Humanisten als „alte Römer“ bis hin zur Wiederaufnahme der exempla maiorum-Methode – etwa die Ahnengalerie alsmustergültige viri illustres-Galerie am Anfang des modernen Museums bei Paolo Giovio – gehört anthropologisch in diesenZusammenhang. Vgl. G. MICZKA, Antike und Gegenwart in der italien. Geschichtsschreibung des frühen Trecento, in:Miscellanea Mediaevalia, Köln IX (Antiqui und moderni…), Berlin 1974, 221–35. – In dem oben Anm. 170 zitiertenVortrag von 1936 hat Thomas Mann einen Hauptaspekt dieses „lebendigen“ Beispiels unter Begriffen wie „zitathaftes Leben“(497), „Leben im Mythos“, „Leben aus Nachfolge, als In-Spur-Gehen, als Identifikation“ (492) auf anthropologischerGrundlage eindrücklich beleuchtet. Unter seinen Beispielen findet sich Napoleon (s. oben Anm. 181), der sich sowohl mitAlexander „mythisch verwechselt“ hat als auch lapidar „erklärte: ‚Ich bin Karl der Große‘, wohl gemerkt, nicht: ‚Ich erinnerean ihn‘, nicht: ‚Meine Stellung ist der seinen ähnlich‘. Auch nicht: ‚Ich bin wie er‘, sondern einfach: ‚Ich bin’s‘.“ Angeführtwerden ferner die der ägyptischen Göttin Ichtar in der Todesart nachfolgende Kleopatra und schließlich Jesus, der imKreuzestod den Anfang des 22. Psalms zitierend und erfüllend, sich als der Messias erwies.
75
die von einer Überzeugungs- oder Glaubensgemeinschaft als real anerkannt werden, sind als solche dem Rednerobjektiv vorgegeben, müssen von ihm nicht erst ausgedacht werden und haben entsprechend größere Autoritätund Überzeugungskraft als frei hergestellte Geschichtsvergleiche.
Ob ein „unkünstlicher“ Beweis im dargelegten extensiven Sinn grundsätzlich noch in die Kompetenz derRhetorik fällt, ist eine Ermessensfrage. Mit einem gewissen Recht wird von Verfechtern eines ausschließlichnarrativen Exempels eingewandt, große, zur Nachfolge verpflichtende Persönlichkeiten würden nicht ineinem literarischen, sondern in einem existentiellen Sinne „Beispiele“ genannt und seien als solche nichtliteraturwissenschaftliche, sondern geschichtswissenschaftliche, psychologische, philosophische odertheologische Themen.187 Das Problem ist der rhetorischen Theorie jedoch nicht fremd: Wenn dasblutbefleckte Kleid nicht selbst der rhetorische Gegenstand der probatio ist, sondern dessen Verwendung vordem Richter als Indiz für einen Mord, so gilt auch etwa von einer animistischen Reinkarnationsvorstellung,daß erst deren intentionale Applikation etwa im Herrscherlob, in der
187 So vor allem LE GOFF, in BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 28 ff., 45 ff.; s. auch unten § 34.
76
Kriegspropaganda oder in der Mahnrede zur Rhetorik gehört.188 Ebenso wird Brutus, der legendäre Begründerder Republik und Ahnherr der Bruti in einem Appell an einen späteren Brutus, dem Namen wiederum Ehre zumachen, nur durch seine Hinordnung auf die admonitio zum rhetorischen Exemplum, nicht aber wegen seinerfür uns fiktiven, damals aber realen „Präexistenz“.189Grundsätzlich liegt nichts anderes vor, wenn einmittelalterlicher Kreuzzug als Erfüllung einer alttestamentlichen Präfiguration verherrlicht wird:190 Auch hierbeginnt die rhetorische Sinngebung erst jenseits der behaupteten realen Ereigniswiederholung, bei derIntention der Ereignisverknüpfung. Im übrigen hat jedes Sprechen neben vielen Aspekten auch einerhetorische Seite. Sogar Exempla in magisch, religiös oder ideologisch konstatierenden Aussagen, inZaubersprüchen, Hymnen und Siegesfeiern gehen unmerklich vom demonstrativen in das deliberative Genusüber, wo sie als bildhafte Erinnerungen jenen Beschwörungen und Überzeugungsversuchen dienen, mit denendas Numen durch Beweise früherer Gunst, das Volk und der Herrscher durch „Schicksalsbeweise“ununterbrochener Sieghaftigkeit zur Wiederholung derselben Handlungen gedrängt werden.191
Die zwei Arten der geschichtlichen Verknüpfung von exemplum und causa, Beispiel und Anwendungsfallwerden hier vorsorglich um der methodischen Klarheit willen auseinandergehalten. Der Unterschied zwischender wirklichen (objektiven, wahren, natürlichen, unkünstlichen) und der „gemachten“ (ausgedachten,konstruierten, künstlichen) Beziehung stellt in der hermeneutischen Praxis allerdings oft unlösbare Probleme,namentlich wenn die eigene (vielleicht auch nur unbewußt, gewohnheitsmäßig eigene) Weltanschauung
188 Vgl. LAUSBERG §§ 351–4, 191 f. Das Beispiel cruenta vestis bei Quint. V 9.1 unter den signa oder Indizienbeweisenals Grenzfall zwischen künstlichen und unkünstlichen Argumenten.189 Vgl. SEEL (wie Anm. 170) 125 f., 183 ff. zu existentiellen, vorliterarischen Affinitäten des Verhaltens.190 Vgl. L. BOEHM, (wie Anm. 25) 687 ff. zu Guibert von Nogent, Gesta Dei per Francos VIII 4, (PL 156) 806–7;SPIEGEL 316 ff., 326 anregend zur tatsächlichen Verhaltensdetermination durch die Vergangenheit im Mittelalter und zu denparadoxerweise gerade darin liegenden Neuerungsmöglichkeiten („the past as vehicle for change“) aufgrund eines tiefexegetisch aktualisierenden (oft manipulativen) Verhältnisses zur sakrosankten Tradition der Exempla. Beachtenswert hierauch die fällige Kritik an einer bagatellisierenden anachronistisch-modernen Einschätzung solch lebendiger Rekurrenz als sog.„topische“ Klischeehaftigkeit (im Sinne CURTIUS‘) bei vielen Mediävisten.191 Vgl. DORNSEIFF 213 ff., LUMPE 1231; W. THEILER, Art. Erinnerung, in: RAC 6 (1966) 43–54, hier 44; D. deCHAPEAUROUGE, Die Rettung der Seele, Biblische Exempla und mittelalterliche Adaption in: H. REINITZER (Hrsg.),Vestigia Bibliae II, Hamburg 1980, 35–88, vornehmlich zum Paradigmengebet.
77
sich mit dem Beschreibungsgegenstand derart im Einklang befindet, daß Distanzlosigkeit die historischeObjektivierung verhindert. Gerade im Mittelalter häufen sich Grenzfälle zwischen realer, inkarnierter,wiedererstandener Präsenz eines geschichtlichen Beispiels und der bloß vorgestellten, vergleichsweiseherangezogenen Parallele, dem nur „beispielsweise“ angeführten Präzedenzfall. Besonders heikel wird dieUnterscheidung, wenn die ursprünglich ernst gemeinte Realisierung einer Beispielgestalt nachträglich zumhistorischen Kostüm neutralisiert, als Analogie, Vergleich oder Metapher entkörperlicht oder auch als Spieloder Parodie verfremdet wird.191a
191a Vgl. unten §§ 75, 101, S. 252 f., 277 ff., 345 zu Spiel und Ernstfall. – Ein in dieser Arbeit kaum behandelter Aspekt dererwähnten Problematik möchte ich weiterer Forschung empfehlen: Wie ernst sind in bestimmten Textsorten und Einzelstellendie Vorstellungen von Herrscher-„Reinkarnationen“ (wie novus Alexander, alter Caesar u. dgl.) gemeint? Zwischen der reindekorativen, panegyrischen oder fürstenspiegelhaften Redeweise vom widererstandenen oder wiederherzustellendenAmtsvorgänger und dem geglaubten oder als Aberglaube bekämpften Seelenwanderungsphänomen (Apokatastasis, Endkaiser-und Kyffhäusersage u. ä.) sind viele Bezüge und Übergänge denkbar. Der Stellenwert vieler kritischer oder apologetischerAussagen zur Metempsychose ist oft unklar. Verwandt mit der Diskussion über Fortuna/fortuna als Wort oder Sache (s.unten Anm. 973), ist die quaestio, wie weit Christen von einem rex redivivus sprechen dürfen, ohne eine heidnischeSeelenlehre zu vertreten. Die Verbreitung dieser „Thesis“ läßt grundsätzlich zwei Deutungen zu: Entweder bestand eineNotwendigkeit, wirklich vorhandene pagane Relikte zu bekämpfen, oder das Thema gehört in den unabsehbaren Bereicheigengesetzlich gewordener „gelehrter Fragen“, die durch keine aktuellen Zustände motiviert sind, sondern rein schulintern,akademisch weitergereicht werden (s. S. 211 ff. 357 ff.). Zum Methodischen vgl. die oben Anm. 181 genannten Arbeiten. Zueinzelnen Beispielen aus einem nahezu uferlosen Gebiet vgl. die Diskussion über Ernst KANTOROWICZ‘ „Mythenschau“(in seinem ‚Friedrich II.‘) in der Aufsatzsammlung ‚Stupor mundi‘ hrsg. v. G. WOLF, (WdF 101), Darmstadt 1966; R. M.KLOOS, Alexander d. Gr. und Kaiser Friedrich II, in; AKG 50 (1968) 181–199; W. KIRSCH, Kaiser Friedrich II. – Einneuer Alexander, ebd. 56 (1974) 217–20; W. KAEGI, Vom Nachleben Constantins, in: Schweiz. Zs. f. Gesch 8 (1958)298–326, bes. zu Chlodwig als neuem Alexander, Apostelnachfolger und neuem Konstantin aufgrund symbolisch gedeckterRealpolitik; A. BORST, Babarossas Erwachen, Zur Geschichte der deutschen Identität, in: Poet. u. Herm. 8, München 1979,18–60 zur „Wiederkehr“ in der Kaisersage; SPIEGEL (wie Anm. 181) 320 ff.: Philipp II. August als Nachfolger Karls d. Gr.bis in seine praktischen Handlungsmotive hinein; HEITMANN, Zur Antike-Rezeption (wie Anm. 264) 97 ff. zu Karl d.Kühnen als Cäsar und Pompeius mit Bezug auf die doppelseitige Fortuna; KOSELLECK, Vergangene Zukunft (wieAnm. 37) 17–37 zu Alexander in der Neuzeit bis zu Napoleon, usw. Im Hinblick auf den Policraticus hervorzuheben ist dasZeugnis des Wilhelm von Malmesbury über eine denkwürdige Cäsar-Analogie des englischen Königs Wilhem Rufus (Gestareg. Angl. IV 320 [STUBBS II] 373 ff.). Inhaltlich wird hier kaum mehr gesagt, als daß der König seinem Feind, demgefangenen Grafen Helias von Maine, die Freiheit wiedergegeben habe mit einem Wort, das an Cäsars Großmut erinnere. DieFormulierung stellt den modernen Leser jedoch vor die Frage, ob der Autor mehr seine gelehrten Kenntnisse ausbreiten oderein profanes Wunder berichten wollte: Tunc Willelmus prae furore fere extra se positus, et obuncans Heliam, Tu, inquit,nebulo! tu quid faceres? Discede, abi, fuge! concedo tibi ut facias quicquid poteris: et per vultum de Luca! nihil, si meviceris, pro hac venia tecum paciscar. Nec inferius factum verbo fuit, sed continuo dimisit evadere miratus potius quaminsectatus fugientem. Quis talia de illiterato homine crederet? Et fortassis erit aliquis qui Lucanum legens, falso opinaturWillelmum haec exempla de Julio Caesare mutuatum esse: sed non erat ei tantum studii vel otii ut litteras unquam audiret;immo calor mentis ingenitus et conscia virtus, eum talia exprimere cogebant. Et profecto, si Christianitas nostra pateretur,sicut olim anima Euforbii transisse dicta est in Pythagoram Samium, ita possit dici quod anima Julii Caesaris transierit inregem Willelmum. (Zu Pythagoras und Euphorbus nach Ov., Meth. XV 160–2 s. auch ähnlich Pol. VII 10 [II] 134. 1 ff.).Wilhelm von Malmesbury legte wohl seinem Helden das Cäsar-Wort an Domitius bei Lucan II 515 nach Art der Historiker-argumenta in den Mund, verleiht der Fiktion jedoch dadurch zusätzliche Glaubwürdigkeit, daß er sich wundert, wie diefrappante Ähnlichkeit der Worte des rex illiteratus, der die Pharsalia nicht lesen und zitieren konnte, mit dem AusspruchCäsars zustande gekommen ist, wobei die Frage, ob Cäsar in Lucans Versen gesprochen habe, den gänzlich inTextvorstellungen denkenden Historiker nicht berührte (vgl. unten §§ 48, 58). Es bleibt einzig die Vermutung, daß die SeeleCäsars nach pythagoreischem Muster in den König übergegangen sei, was allerdings unter christlichem Vorbehalt – als„Redewendung“ – wieder halb zurückgenommen wird. Zu einer ähnlichen heroisierenden Verwendung derSeelenwanderungsidee in der ‚Philippis‘ des Wilhem Brito vgl. von MOOS, Poeta und historicus 113. Gegen dieMetempsychose vgl. auch Johanns Polemik in Pol. VII 10 (II) 134, und Pol. VIII 21 (II) 392 zu Julian d. Abtrünnigen:Confidebat enim magicis artibus, et, arbitratus secundum Pithagoream opionem animas diversa corpora peragrare, secredebat possidere animam Alexandri aut quod potius in altero corpore esset alius Alexander.
78
Montaigne vollzieht mit den berühmtesten Identifikationsbeispielen der Weltgeschichte einen ganzgewöhnlichen empirischen Induktionsschluß im Sinne des argumentativen Paradeigmas so, daß gerade dieAuflösung der üblichen Ernstbedeutung überrascht und Aufmerksamkeit erregt:192 „Wer hat dir armemNarren, die Länge deines Lebens versichert? Du verläßt dich auf die
192 Montaigne, Essays, I 2, ed. A. THIBAUDET/M. RAT (Pléiade), Paris 1932, 83: „… pauvre fol que tu es, qui t’a establyles termes de ta vie? Tu te fondes sur les contes des Medecins […] Regarde plustot l’effect et l’experience. Par le communtrain des choses […] tu as passé les termes accoustumez de vivre […] Il est plein de raison et de pieté de prendre exemple del’humanité mesme de Jesus-Christ: or il finit sa vie à trente et trois ans. Le plus grand des hommes simplement homme,Alexandre, mourut aussi a ce terme.“ In der ersten Ausgabe hatte Montaigne noch beigefügt: „Et ce fameux Mahomet aussi“,was darauf schließen läßt, daß er Religionsstifter und Halbgötter unter dem hierfür paradoxen Stichwort der communisconditio hominum (s. Anm. 997) versammeln wollte. Mohammed hat er in der zweiten Auflage, da er erfuhr, daß der Propheterst mit sechzig Jahren gestorben war, wieder gestrichen.
79
Märchen der Ärzte. Siehe vielmehr auf Tat und Erfahrung. Nach dem ordentlichen Gang der Dinge […] hastdu die übliche Lebensgrenze bereits überschritten […] Es ist der Vernunft wie der Frömmigkeit höchstangemessen, von der menschlichen Natur Jesu Christi selbst ein Beispiel zu nehmen: Nun, er starb mitdreiunddreißig Jahren. Der größte unter den Menschen, soweit er nur Mensch war, Alexander, starb ebenfallsin demselben Alter.“ Man mag hier renaissancehafte Freigeistigkeit heraushören, doch dasExemplumverfahren der Entmythologisierung, Entheroisierung oder Entspiritualisierung zu Beweiszweckenist auch im christlichen Mittelalter durchaus gängig. Derlei Übergänge zwischen Ernst und Spiel, Symbol undArgument können der Mediävistik zu (oft unschlichtbaren) Streitfällen geraten, wie wir hier noch sehenwerden. Vielleicht gelingt es dennoch, sie sine ira et studio zu analysieren, wenn das Fremde an denPhänomenen beharrlich gesucht und behutsam dargestellt wird.193
23. Die Kenntnis der Verbindlichkeitsgrade des historischen Beispiels erlaubt uns, die Entwicklungsgeschichtedes römischen Exemplums nun mit differenzierterer Optik wiederaufzugreifen. Wie bereits angedeutet,194
wurde der Beispielgebrauch der Spätantike zusehends anekdotischer. Dies entsprach u. a. den besonderenPropagandamotiven der popularphilosophischen Diatribe, die sich an ein breiteres, wenigergeschichtskundiges Publikum richtete. Schon vor dem Christentum gab es volkspredigthafte Exempla.195
Novellistische Erzählungen, memorabilia und mirabilia mit vielen kuriosen, sensationellen, exotischen undwunderbaren Ereignissen hefteten sich an die traditionellen Heldengestalten und überwucherten, ja ersetztendie stereotyp, abgedroschen oder dekorativ gewordenen exempla maiorum. Die lebendige Gegenwart derVorfahren erstarrt im literarischen Standbild; die abgenützte Form wird mit bunten erzählerischen Arabeskenkünstlich am Leben erhalten. Während das klassische Exemplum (etwa bei Cicero) als relevantes Symbol desconsensus omnium allein schon von der Nennung oder Kurzanspielung leben kann, bedarf das spätantikehellenistische Exemplum offenbar vermehrt der tota narratio und der Ausschmückung durch das pikante oderabsonderliche Detail.196 Denn die Lehre oder Idee, die es vertreten muß, wird wichtiger als die unmittelbarvon ihm selbst ausgehende Überzeugungskraft des Anschaulichen. Die Entwicklung wird so allerdings etwasschematisiert,
193 Siehe unten § 101, S. 513.194 Siehe oben S. 69.195 Vgl. GEBIEN 50 ff., LUMPE 1245 und unten § 36.196 Zu diesen rhetorischen Begriffen s. oben Anm. 150 (Quint. V 11.15).
80
da zweifellos neben dem anekdotischen stets auch das monumentale Exemplum weitergepflegt worden ist; dieTendenz ist jedoch eindeutig: Nachdem die „Ernstbedeutung“ von historischen Modellgestalten „verbraucht“ist, spaltet sich eine zweite Tradition ab, in der das Exemplum literarisiert, enthistorisiert und trivialisiertzum „Geschichtchen“ wird. Der Held wird dabei immer unverbindlicher: Schon als eine hyperbolischeVerkörperung aller nur denkbaren Maximalvorstellungn (wie der populäre Übermensch des Alexanderromans)ist er im Grunde austauschbar; dann verliert er auch diese symbolische Bedeutung, bildet nur noch denVorwand zum unterhaltsamen Fabulieren und entschwindet zuletzt ganz in der Anonymität „irgendeinesvortrefflichen Bürgers“.197Der innerliterarischen Auflösung des römischen Exemplums im Trivialexemplum„für das Volk“ (nicht im Volksexemplum) entspricht die gleichzeitige politische Entwertung des exemplumvirtutis als Lebensform: Aus der Pflicht zur kompromißlosen Exemplatreue wurde ein Anspruch aufAnerkennung eigener, propagandistisch durch Exempla gestützter Nobilität. Im Beispiel läßt sich dies soverdeutlichen: Weil der Konsul P. Decius Mus den römischen Sieg über die Latiner im Jahr 340 durch seinefreiwillige Selbstaufopferung herbeigeführt hatte, ging sein gleichnamiger Sohn als Konsul mit gleicher devotiound gleichem Erfolg im Jahre 295 gegen die Gallier in den Opfertod, und dieselbe Heldentat wird auch nochdessen Sohn, dem dritten Träger des Namens und Urenkel des ersten P. Decius Mus zugeschrieben, der 279 v.Chr. fiel.198 Vom Ursprung solch existenzlegitimierender Handlungsketten haben sich die nach demUntergang der Republik modisch werdenden Selbstinszenierungen und Machtdemonstrationen immer weiterentfernt. Zahlreiche Alexanderposen von Pompeius, Caligula, Nero, Caracalla u. a. sind nach Alfred HeussMusterbeispiele „politischer Ideologie des Altertums.“199
197 Vgl. unten § 32 und oben Anm. 169 (Val. Max. II 10.8). – Zu kaiserzeitlichen Erstarrungs- undSchematisierungserscheinungen vgl. HONSTETTER 91 ff.; zu Restaurationstendenzen den maiorum exempla gegenüber alsRealitätsflucht und Nostalgie nach heroischer Vergangenheit im 3. Jh. vgl. ebd. 109 ff.; zur Anekdotisierung der Exempla-Tradition vgl. SALLES 10 ff. und passim; KLINGNER (wie Anm. 160) 77; R. HERZOG, Orosius oder Die Formulierungeines Fortschrittskonzepts aus der Erfahrung des Niedergangs, in: Niedergang, Studien zu einem geschichtl. Thema hrsg. R.KOSELLECK/P. WIDMER, Stuttgart 1980, 79–102, hier 83.198 Vgl. RE IV 2, 2279 ff., V 277 ff.; Liv. 8.6.9.–11; 10.26–30; Cic. Tusc. I 89; Rhet. ad Herenn. IV 44.57 u. a. Vgl. auchSEEL (wie Anm. 170) 125 f., 183 ff. („Sterben nach Modell“); DAVID, Maiorum exempla 67.199 Siehe oben Anm. 175.
81
b) Exemplum Christi und sanctorum exempla
Die nova et vera exempla des Christentums als radikal historische Beweise für die Heilswirklichkeit (§ 24). Die „Vernunftdes Glaubens“ gegen Gewohnheit und Brauch römischer Exempla (§ 25). Christus exemplum: Erlösungsbeweis undVollkommenheitsgebot; antike Exempla-Rhetorik als Metapher der Inkarnation und Heilspädagogik (§ 26). Die Kirche alsBeispielgemeinschaft der Heiligen und die Wunder als Real-Exempla für die Imitabilität (§ 27). Entheroisierung desExemplums: bekannte und unbekannte Zeugen für Gottes Heilswirken, illustriert an der Ponticianus-Episode der‚Confessiones‘ (§ 28) und dem ‚Epitaphium matris‘ des Petrus Venerabilis (§ 29). Innerchristliche und außerchristlicheExempla: typologische Bezüge und exempla imparia, indikativische und imperativische Steigerungsformen (§ 30).Theoretische Fragen zur Vermischung antiker und christlicher Exempla: „Monomythie“ und „Polymythie“ (§ 31), Notorietätund Anonymität (§ 32), „Weltdeutung und Weltersatz“ (§ 33).
24. Auf der Suche nach geeigneten Ausdrucksformen für die neue Glaubensbotschaft findet das Christentumein Spätstadium der hier umrissenen Entwicklung vor. Daß die Kirchenväter sowohl die ursprünglichnormative Bedeutung der genealogischen exempla virtutis als auch deren Verfallsformen (besonders imKaiserkult) ablehnten und daß sie diese gezielt als Argument gegen jene kehrten, versteht sich von selbst.200
Die schwindende Verbindlichkeit des mos maiorum erleichterte die Kritik. Was einst die Ernstbedeutung derExempla war und nun kaum mehr bestand (oder allenfalls gerade in antichristlichem Konservativismuswiederbelebt wurde):201 die Wirklichkeit der Gracchi, Bruti und Scipiones konnte mühelos als falscher Glanzentlarvt werden, nachdem auch der Spott der Komödiendichter und Satiriker auf diesem Feld vorgearbeitethatte. Im übrigen liegt es in der Logik der historischen Wesensbestimmung des Beispiels, daß inweltanschaulichen Auseinandersetzungen zu allererst die Wirklichkeit und ethische Wirksamkeit der Exemplades Gegners als Irrealität, Illusion und Märchen hingestellt werden
200 Vgl. LUMPE 1248.201 Zur Frage des Konflikts und der Koexistenz, gegenseitiger Abstoßung und Befruchtung heidnischer und christlicherLiteraturformen vgl. BLUMENBERG, Patristik (wie Anm. 36) 487 ff.; A. CAMERON, Paganism and Literature in LateFourth Century Rome, in: Christianisme et formes littéraires de l’antiquité tardive en Occident, (Entretiens sur l’antiquitéclassique, Fondation Hardt 23) Genf 1977, 1–40. F. VITTINGHOFF, Zum geschichtlichen Selbstverständnis der Spätantike,in: HZ 198 (1964) 529–74, hier 566 ff.; M. FUHRMANN, Die Romidee der Spätantike, ebd. 207 (1968) 529–61, hier560 f. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann dieses Problem nicht diskutiert werden. Die römische Exempla-Traditionscheint in der Spätantike zwar an den von Heiden und Christen gleicherweise getadelten Ermüdungserscheinungen zu leiden,aber doch noch Kraft genug zu besitzen, um den Kirchenvätern Anlaß zu intensiver Polemik zu bieten (s. oben Anm. 170).
82
müssen.202 Es gilt, eine neue Wirklichkeit an ihre Stelle zu setzen. So verdrängten nova und vera exempla derHeilsgeschichte – die Auferstehung Christi, Totenerweckungen und andere Wundertaten – die historischenoder quasi-historischen (d. h. mythischen) Heldenexempla der Antike, die als Fabeleien und Lügen abgetanwurden: „Nicht mit erdichteten Fabeln, wie die Philosophen disputierten, sondern mit den unbedingt wahrenBeispielen der Gerechten“ will Ambrosius lehren.203 Dabei entspricht solche Wahrheitsbetonung derheidnisch-antiken Auffassung, daß fabula weniger beweiskräftige Beispiele enthält als die Geschichte.203a DasHeidentum soll mit seinen eigenen
202 Zum Wirklichkeitsanspruch der Exempla s. oben §§ 6, 21 ff. Er ist im Grunde nur Teil des Wirklichkeitsanspruchs derRhetorik überhaupt. BLUMENBERG, Patristik (wie Anm. 36) 496 f. weist am Beispiel von Lactanz nach, daß die Berufungauf die vis veritatis der christlichen Heilstatsachen genau der traditionellen (als Kompensation für das stilistische Handicapder Bibelsprache besonders hilfreichen) Verstärkungsformel des Redners entspricht, der „auf die Wirkung der Sache selbst“vertraut. Alle Rhetorik „will sich nicht als Instrument, sondern als Ausdruck der Wahrheit verstanden wissen.“ Ähnlich auchH. RAHN, Die rhetorische Kultur der Antike, in: Der Altsprachliche Unterricht 10 (1967) 23–49, hier 44: Catos rem teneverba sequentur als Grundwort „rhetorischer Kultur“ in Opposition gegen alle Schulrhetorik.203 Amb., De officiis ministr. III 5, 29 (PL 16) 154 A: quod non fictis fabulis ut philosophi disputabant, sed verissimisiustorum virorum exemplis docere possumus, mit Bezug auf Cic. Off. III 38 (Gyges). Vgl. dazu Friedrich OHLY,Außerbiblisch Typologisches zwischen Cicero, Ambrosius und Aelred von Rievaulx (1976), in: ders., Schriften zurmittelalterl. Bedeutungskunde, Darmstadt 1977, 388–60, hier 343 f. Ambrosius war in Bezug auf die Profan-Exempla sowieauf den inflationären Gebrauch des Wortes exemplum in der zeitgenössischen Literatur besonders rigoros: vgl. HERZOG,Orosius (wie Anm. 197) 85; J.R. BASKIN, Job as Moral Exemplar in Ambrose, in: Vigiliae Christianae 35 (1981)222–231, hier 222. – Zur Bedeutung der Exempla als „Auferstehungsbeweise“ vgl. LUMPE 1246 f. EinschränkendBLUMENBERG, Patr. (wie Anm. 36) 485 f. in dem Sinn, daß das propagandistische Selbstverständnis der Kirchenväternicht als Legitimation für das romantische Vorurteil vom urgewaltigen Einbruch des „jungen“ Christentums in einealtersschwache heidnische Welt mißbraucht werden dürfe. – Zur Assoziation von novitas und veritas, „Modernität“ und„Realismus“ in der christlich lateinischen Literatur vgl. auch unten Anm. 964, sowie Hans Gerd RÖTZER, Traditionalitätund Modernität in der europäischen Literatur, Darmstadt 1979, 26 ff. und die für Augustins Exemplum-Begriff grundlegendeArbeit von B. STUDER, Sacramentum et exemplum chez saint Augustin, in: Recherches Augustiniennes 10 (1975) 87–141,hier 114 ff.203a Dieses persuasive Kriterium gilt auch für den nicht fiktionalen, quasi-historischen Mythosbegriff; vgl. S. 47, 50 ff., 55,64 f., 69; KOEP 129 f., 146 f.; A. HORSTMANN, Der Mythosbegriff vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, in:Arch. f. Begriffsgesch. 23 (1979) 7–54, bes. 7 ff., u. a. auch zur bewußten Überbetonung der negativen antiken Bedeutungvon fabula (Altweibergeschwätz) in Relation zur alten mythos-Bedeutung. Erst in der Schule von Alexandrien wird derüberlieferte antike Mythos rehabilitiert (als exoterische Einkleidung esoterischer Wahrheit). Zu den positiven Bezeichnungenfür diesen allegorisch aufgewerteten Mythos gehören danach und im Mittelalter weniger fabula (allenfalls fabulosa narratioin der Tradition Macrobs) als einerseits (im engeren Sinn) integumentum, involucrum u. ä. (s. unten § 49, S. 367, A. 822,913) und andererseits (im weiteren Sinn) exemplum oder historia. Die christliche Fortsetzung der Abwertung von fabulagegenüber historia zeigt sich am deutlichsten in der im Mittelalter traditionellen Antithese: historiae divinae – saecularesfabulae für Bibel versus Profanliteratur (z. B. bei Bernhard von Utrecht) und in der darauf gründenden Ausgrenzung jedesnicht mit „geistlichem Sinn“ gedachten, gesagten oder gelesenen Wortes als fabula, wie bei Hugo von Trimberg, Solsequium(ed. K. LANGOSCH), Epilog v. 149–51: Nam sanctus Gregorius/verbum ociosum/esse dicit, quod et dici/potestfabulosum/quod utilitatis pie/caret intencione. Dazu vgl. GRUBMÜLLER 257; KNAPE 85 (Bernhard von Utrecht) u. a.unten in Anm. 353. Zum Verhältnis von historia und fabula vgl. auch §§ 41, 46, 59 f.
83
Waffen geschlagen werden. Die Strategie aber wird dadurch verschleiert, daß das Christentum sich als Antwortauf ungelöste heidnische Fragen ausgibt.204 Ambrosius geht in dem Bemühen, die höhere Realität derchristlichen Exempla glaubhaft zu machen, noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt:205 „Ich will nichterfundene (stellvertretend) für wahre Beispiele bringen, sondern wahre an Stelle der erfundenen […] Denn ichkann aus den Dingen selbst [d. h. den Tatsachenbeweisen] lehren.“ Den nur philosophischen Wahrheitenunter mythischer Hülle stehen die Erlösungstat Christi, die Wundertaten der Heiligen, die Heldentaten derMärtyrer, die ganze Offenbarungswirklichkeit und eschatologische Verheißung gegenüber wie geschichtlichBezeugtes dem bloß Gedachten und Erdachten. „Plato und Aristoteles“, sagt Laktanz in einer im Mittelalterbeliebten Stelle,206 „konnten nur mit Worten und Vorstellungen die Gerechtigkeit ausmalen, die ihnen nichttatsächlich vor Augen war, und nicht mit gegenwärtigen Exempla erhärten, was sie behaupteten.“ DerVerbindlichkeitsgrad des exemplum Christi und der exempla sanctorum übertrifft aus dieser Sicht selbst dieauthentischste historische auctoritas heidnischer Exempla. Den genealogischen,
204 Vgl. BLUMENBERG, Patr. (wie Anm. 36) 487 ff.205 Amb. De off. min. III 5 (PL 16) 154 C: non fabulosa pro veris, sed vera pro fabulosis exemplar proferam […] cumpossim docere ex rebus. (Die unterschiedliche Übersetzung von pro nimmt auf die antike Fabeltheorie von der„Wahrheitseinkleidung“ Rücksicht.)206 Lact. Div. inst. V 17: Plato et Aristoteles […] enim depingebant verbis et imaginabantur iustitiam que in conspectu nonerat, nec praesentibus exemplis confirmare poterant quae asserebant; so zitiert z. B. in dem anonymen Florileg hrsg. vonG.C. GARFAGNINI, Da Seneca a Giovanni di Salisbury: Auctoritates morali e vitae philosophorum in un manoscrittotrecentesco, in: Rinascimento 20 (1980) 201–47, hier 228.34–6.
84
die Vorfahren vergegenwärtigenden Beispielen der Römer ist die exemplarische Aktualisierungspotenz derhagiographischen Beispiele der Christen als Beweise für die stete Gegenwart Christi bis ans Ende der Tageentschieden überlegen.207 Der Gedanke, daß gerade der Realitätsgehalt, die Substanz der römischen Exemplasich als blosses „Fabelgerede“, als reine Literatur vor der neuen Glaubenswirklichkeit hinstellen ließ, war fürdie apologetisch und missionarisch ausgerichteten Kirchenväter zweifellos das stärkste Motiv, das antikerhetorische Verfahren des Beispielbeweises durch historische Personen und Ereignisse intensivweiterzupflegen.208 Die Methode wurde erneuert und geläutert, in ihrem eigensten historischenGeltungsanspruch überboten: Einerseits durch die Umbesetzung des Heldenpersonals mit „Heiligen undGerechten“,209andererseits durch den expliziten Rückgriff auf die alten Heroen und Vorfahren zum Zweck desantithetischen oder steigernden Vergleichs.210
Das Beispielverfahren hat sich derart verjüngt: Kritische Entrümpelung des monumentalisch erstarrtenrömischen Beispielschatzes stellte das Exemplum als Denkform im ursprünglich argumentativen Sinn wiederher. Waren römische exempla maiorum dank ihrer Historizität und hergebrachten Geltung nicht weiterlegitimationsbedürftig (nur in Bezug auf ihre Anwendung diskussionsfähig), so wurden sie nun gerade alsblosses Herkommen, als „Gewohnheit“ oder gedankenlos mitgeschlepptes Brauchtum der „Vernunft“entgegengesetzt und derart im rhetorischen Sinn als rationale Überzeugungsmittel instrumentalisiert, in derSache der ratio fidei, dem Logos als dem „Wort Gottes“ unterstellt. Wie wichtig die Auseinandersetzung mitdem traditionalistisch-konservativen Exemplum-Begriff der Römer war, zeigen zahlreiche berühmte (späterins Kirchenrecht aufgenommene) Väterstellen über den Vernunftwert des neuen Glaubens, über die höherereligiöse Verbindlichkeit
207 Vgl. JAUSS, Alterität 45; OHLY (wie Anm. 203) 343 f., 367; LUMPE 1247; PÉTRÉ, Art. Exemple, in: DSp IV (1961)s. v. 1880. – Überlegenheit: Diesen Aspekt hebt im Zusammenhang mit der Typologie als messianische Erfüllungalttestamentlicher Realprophetien J.C.L. COPPENS (Vom christlichen Verständnis des Alten Testaments, in: FoliaLovanensia 3/4, 1952, 17) hervor, wenn er diese „nicht sosehr eine imitative Wiederholung als vielmehr eine wahreRepristination“ nennt.208 Vgl. S. 84 ff., 107 ff. § 31. HANNING (wie Anm. 185) betont, daß zwischen der Apostelgeschichte und Eusebius keineeigentliche christliche Geschichtsschreibung nachzuweisen sei, dafür aber eine umso größere Zahl von Exempla in Pastorationund Apologetik.209 Vgl. unten §§ 27, 29, 33, 36. Für LUMPE (1254) gehört die gesamte hagiographisch-biographische Literatur auch zurExempla-Literatur.210 Vgl. oben § 10.
85
des Neuen, des Noch-nie-Dagewesenen überhaupt gegenüber der Herrschaft des Alten und gegen dieÜbermacht sakrosankter Präzedenzfälle.210a
210a Zur Antithese veritas/ratio-consuetudo vgl. LADNER, Erneuerung (wie Anm. 179) 265 f. mit Bibliogr.; WilhelmGEERLINGS, Christus Exemplum, Studien zur Christologie und Christusverkündigung Augustins, (Tübinger theol.Studien 13), Diss. Tübingen 1977, 151 ff., LUMPE 1229 f. – Der oben S. 70 A. 170 hervorgehobene Grundgedanke derauctoritas exempli, d. h. einer Verbindlichkeit des Ahnenbeispiels auch ohne rationale Begründung (vgl. SCHULZ,Prinzipien … [wie Anm. 4] 67 zum Rechtsgrundsatz stat pro ratione auctoritas) macht den apologetischen Nachdruckverständlich, mit dem die Kirchenväter die Autorität der ratio fidei gegen exempla und consuetudo herauszustellen suchten.Nicht mehr das Exemplum besitzt danach auctoritas und wertmäßige Autonomie, sondern die ratio (der Glaube, dieOffenbarung, das Gesetz), und nur in Übereinstimmung mit dieser ratio (rationis auctoritas) erhält es einen relativen Wert.Vgl. HONSTETTER 200 u. ö.; Karl GROSS, Auctoritas–Maiorum exempla. Das Traditionsprinzip der heiligen Regel, in:Stud. u. Mitt. z. Gesch. d. Benediktinerordens… 58 (1940) 59–67. Zur rangmäßigen und oft auch kompositorischenNachstellung der Exempla gegenüber Autoritätszitaten aufgrund solcher Wertung s. Anm. 421, 621. – Die Wiederherstellungdes argumentativen Exemplums, d. h. des finiten Beweises aus einem Präzedenzfall (im Gegensatz zu infinit moralischer undmonumentaler Fixierung) ist am besten aus der Rechtsentwicklung des Mittelalters zu erkennen: s. unten S. 302, 382 ff.,448 ff. und oben § 1. S. KUTTNER (The Revival of Jurisprudence, in: Renaissance and Renewal [wie Anm. 7] 299–323,bes. 316) betont zusammenfassend die fortschrittliche Rolle des Kirchenrechts: Die kirchenrechtliche Methode seigrundsätzlich innovativ auf die „creation of new law“ durch neue Entscheide (Dekrete und Dekretalen) zu konkreten Fällenjuristischer Praxis ausgerichtet gewesen, im Unterschied zu einer immanent konservativen Tendenz der auf Rekonstruktionder Justinianischen Gesetzgebung hin konzipierten Hermeneutik der Legisten. Vgl. auch H. ZIMMERMANN (wieAnm. 550) 771, der festhält, daß kanonisches Recht durch neues Recht wächst, legistisches Recht dagegen nur angepaßt undausgelegt („glossiert“) wird. Den Hauptgrund für diese in der gesamten Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters führendeRolle der Kanonistik (vgl. unten § 65) sieht KUTTNER (a.a.O.) in der dynamischen ekklesiologischen Geschichtskonzeptionmit Überzeugungen wie der reformatio in melius, der Leitung durch den Hl. Geist und der steten Vervollkommung derKirche durch die Zeiten. Vgl. auch J. GILCHRIST, The Reception of Pope Gregory VII into the Canon Law, in: SZ Kan. 90(1973) 35–82; 97 (1980) 192–229; Glenn OLSEN, The Idea of the Ecclesia Primitiva in the Writings of the Twelfth-CenturyCanonists, in: Traditio 25 (1969) 61–86. OLSEN analysiert in dieser (nicht nur rechtsgeschichtlich) wichtigen Arbeit(bes. 78 ff.) Zeugnisse für die erwähnte entwicklungsgeschichtlich prozeßhafte Sehweise, darunter sogar solche, die mildeKritik an der Urkirche üben, und zeigt derart eine (vom altrömischen nicht weniger als vom protestantischen Kult derUrsprünge entfernte) historische Differenzierungsfähigkeit im Mittelalter auf, die man diesem angeblich „traditionalistischen“Zeitalter nicht ohne weiteres zutraut. Vgl. dazu auch unten §§ 38, 65, 84, 95 f.
86
25. Die älteren dieser Zeugnisse klingen oft radikal und exklusiv, wie die schon in der Patristik proverbiale,im Mittelalter seit dem Investiturstreit geradezu geschichtsmächtige Pointierung Tertullians (undCyprians):211 „Der Herr hat nicht gesagt: ‚ich bin die Gewohnheit‘, sondern ‚ich bin die Wahrheit‘“, oder diealle Exempla vor dem einen absoluten exemplum Christi
211 Tert. De virg. vel. I 1, (CC, 2) 1209: Sed Dominus noster Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit (cf.Jo. 14.6). Danach bei Cyprian, Ep. 74.9 und über ihn auch auf dem Konzil von Karthago 256 als sententia 30 (LibosusVagensis) aus den Sententiae LXXIV episcoporum (ed. H. v. SODEN, Nachrichten Gött., phil.-hist. Kl. 1909, 262 f.) sovorgetragen: In evangelio Dominus: ‚Ego sum‘, inquit, ‚veritas‘, non dixit: ‚Ego sum consuetudo‘. Danach Aug. Debaptismo contra Donatistas III, 5–6 (CSEL 51, 203): Qui contempta veritate praesumit consuetudinem sequi, circa fratresinvidus est […] Nam dominus in evangelio: ‚Ego sum‘, inquit, ‚veritas‘, non dixit: ‚ego sum consuetudo‘. Itaque veritatemanifesta cedat consuetudo veritati. Diese Stellen bilden im Mittelalter ein häufig zitiertes Autoritätennetz zusammen mitähnlichen wie: Cypr. Ep. 74.9, 75.19 (CSEL 3) 806, 826: Consuetudo quantumvis vetusta, quantumvis vulgata, veritati estomnino postponenda et usus, qui contrarius est veritati, abolendus; Aug. De bapt. (a.a.O.) IV 5, 228: Frustra quidem quiratione vincuntur, consuetudinem nobis obiiciunt, quasi consuetudo maior sit veritate […] Hoc plane verum est quia ratioet veritas consuetudini praeponenda est. Von den zahlreichen Testimonien vgl. vor allem Gerbert von Aurillac Ep. 217, 207;Gregor VII. Epp. coll. 50 (JL 5277), Mon. Gregoriana (Bibl. rer. Germ. 2) Berlin 1865, 576; Urban II. (JL 5471); Ivo vonChartres, Decretum 4, 213, 235 (PL 161) 311, 315; Panormia 2, 163 166 (ebd.) 1120 f.; Hildebert von Lavardin, Epp. II 15(PL 171) 223 B–C; II 23, 239 B; II 29, 251 B; Abaelard Epp. V (MUCKLE [MSt 12] 1950) 85 f., VII (McLAUGHLIN[MSt 17] 1955) 266; X (ed. E.R. SMITS, Peter Abelard, Letters IX–XIV, Groningen 1983, 243 f.; Gratian, Decr. D 8, c 5(FRIEDBERG 14 f.); Rhet. eccl. (wie Anm. 8) 10,36 usw. Vgl. auch unten § 74 (Wirkungen auf die Kirchenpolitik desHochmittelalters), oben § 1 (Subsidiarität der Exempla bei Gesetzeslücken); LADNER, Idea (wie Anm. 179) 138, 303 ff.,403 ff.; ders., Two Gregorian Letters: On the Sources and Nature of Gregory VII’s Reform Ideology, in: Studi Gregoriani 5(1956) 221–42; OLSEN, Ecclesia primitiva (wie Anm. 210a) 62 f., GEERLINGS 159, 163 f.; PÉTRÉ 25 ff., 87 f.; P. vonMOOS, Hildebert von Lavardin, Stuttgart 1965, 191 ff., 259 f., 310, 314; Gerhard FUNKE, Gewohnheit, (Archiv fürBegriffsgeschichte Bd. III), Bonn 1958, 2Göttingen 1961, 187 f. und ders. Art. Gewohnheit, in: HWbPh 3 (1974) 597–616,hier 610; FUNKE zitiert, ohne die lange und reiche Tradition zu erwähnen, als einen Ausspruch Luthers (Weimarer Ausg. 23,414 ff.: ‚Trost der Christen zu Halle‘): Christus habe nicht gesagt „ich bin Gewohnheit und Brauch, sondern: ich bin dieWahrheit […], wenn die Wahrheit offenbar wird, soll Gewohnheit weichen.“ Dies ist, wörtlich übersetzt, die GratianischeCanones-Kombination D 8, c 5.
87
negierende Formulierung Cyprians:212 „Christus allein ist zu hören, und nicht zu beachten, was irgendjemandvor uns tun zu müssen meinte, sondern, was Christus selbst vor allen und früher als alle anderen tat.“ Diemeisten zusammen mit diesen Stellen in die Canones zum Thema, „Gewohnheit“ und „Beispiel“aufgenommenen auctoritates handeln jedoch eher von einer hierarchischen Umwertung als von einerEntwertung römischer Werte. Da der Glaube sich nicht aus den üblichen historischen Beispielen begründenließ, mußte er als kritische Instanz selbst neue Beispiele begründen. Augustinus hat dies klar und für dieFolgezeit maßgeblich in folgender Zuspitzung formuliert:213 „Befiehlt Gott etwas, was der üblichen Sitte odervereinbarten Ordnung widerspricht, so hat es wo immer zu geschehen, mag es da auch noch nie geschehensein.“ Das, „was zu geschehen hat“, facienda, ist einer seiner wichtigsten Kampfbegriffe gegen die Macht derfacta und Beispiele der Geschichte. Eine andere antithetische auctoritas richtet sich gegen römische Exemplaheroischen Selbstmords:214 „Wir fragen jetzt nicht danach, ob etwas geschehen ist (d. h. getan worden ist),sondern ob das Geschehene tunlich war (d. h. getan werden durfte). Denn die Vernunft ist mehr wert als
212 Cyprian, Ep. 63.14 = Gratian D 8 c. 9 (FRIEDBERG) 15 (z. B. auch in Rhet. eccl. [wie Anm. 8] 10): Si solus Christusaudiendus est, non debemus attendere, quid aliquis ante nos faciendum putaverit, sed quid, qui ante omnes est, Christusprior fecerit. Neque enim hominis consuetudinem sequi oportet sed Dei veritatem cum per Ysaiam prophetam loquatur Deuset dicat [29.13]: Sine causa colunt me, mandata et doctrinas hominum docentes.213 Aug. Conf. III 8.15: Cum autem Deus aliquid contra morem aut pactum quorumlibet iubet, etsi numquam ibi factum est,faciendum est, et si omissum, instaurandum, et si institutum non erat, instituendum est […] Sicut enim in potestatibussocietatis humanae maior potestas minori ad oboediendum praeponitur, ita Deus omnibus. (= Gratian D 8, c 2,FRIEDBERG 14). Zur Bedeutung Augustins für die Umwertung der Exempla vgl. §§ 26 ff., 74; HONSTETTER 107 ff.,123 ff., 200; GEERLINGS und STUDER, passim.214 Aug. Civ. I 22 (CC 47, 1955) 24.26–30: Non modo quaerimus utrum sit factum, sed utrum fuerit faciendum. Sanequippe ratio etiam exemplis anteponenda est, cui quidem et exempla concordant, sed illa, quae tanto digniora suntimitatione quanto excellentiora pietate. (= Gratian, D 9, c 11, FRIEDBERG I 18; Ivo, Decr. IV 237 etc.) Vgl. auch obenAnm. 1–3, 13, unten § 74, Anm. 882. Die Antithese factumfaciendum entspricht einer bereits heidnisch-antikenKonfrontation von Geschichtskenntnis und Exemplum, bzw. intellektueller und moralischer Geschichtsauffassung; vgl. etwaSen. Nat. quaest. III praef. 7 über die Nutzlosigkeit der Geschichte und den Nutzen der Ethik: besser sei, quid faciendum sitquam quid factum quaerere. Vielleicht geht der Gedanke auch auf den geschichtstheoretisch bedeutsamen Satz Platonszurück, daß aus Geschehenem nachträglich allemal leicht erkannt werden könne, was damals hätte geschehen sollen; daß dieWeisheit aber darin bestehe, das Tunliche im Hinblick auf Zukünftiges und schwer Vorhersehbares zu erkennen undfestzulegen (Nom. 691 b–c, 692c, 693 b–c; vgl. auch Anm. 18 f., 421). – Aufgrund der augustinischen Terminologie gibtHugo von St. Victor in De III maximis circumstanciis (ed. GREEN [wie Anm. 16] 491) folgende Definition der Tropologieim vierfachen Schriftsinn: Tropologia est cum in eo quod factum audimus, quod nobis sit faciendum agnoscimus. Undeetiam recte tropologia, id est sermo conversus, sive locutio replicata, nomen accepit, quia nimirum divinae narrationissermonem ad nostram tunc eruditionem convertimus, cum facta aliorum legendo ea nobis ad exemplum vivendiconformamus. Für Salutati (Ep. II 289, NOVATI) besteht das Verhältnis der Rhetorik zur Geschichte aus einem ständigenKonflikt zwischen den facta und den facienda; vgl. Myron P. GILMORE, Humanists and Jurists, Six Studies in theRenaissance, Cambridge Mass./London 1963, 19 f. (ohne Kenntnis des augustinischen Hintergrunds); vgl. auch S. 217 zuMontaigne. Zur ratio-exempla-Antithese, bzw. Hierarchie vgl. HONSTETTER 138 ff.; BUISSON, Potestas 27 f.; PÉTRÉ,Art. Exemple 1887; STUDER 123, 140; GEERLINGS 150 f., 177, 184 f.; von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) I/II§ 1127, III §§ 1041, 1049. – DAXEL-MÜLLER (Exemplum 653) belegt die ratio-exemplum-Antinomie bei G.J. Vossius,ohne die lange und intensive, auf die Patristik zurückgehende Tradition zu erwähnen.
88
Beispiele, wenn es auch Beispiele gibt, die mit ihr übereinstimmen und die umso nachahmenswerter sind, jestrahlender an ihnen die Glaubensstärke hervortritt.“ Trotz der unverkennbar zentral christlichen Sinngebungsolch scharfer, oft geistreicher Antithesen, darf nicht vergessen werden, daß auch hier ein antikesDenkmuster des Beispielverfahrens selbst für die nötige Konsenswürdigkeit sorgte: Sosehr die Väter inhaltlichauf das Neue, Diskontinuierliche ihres Beispielverständnisses pochten, so gehört doch das Mittel, die Berufungauf das iudicium, d. h. auf ein rationales Entscheidungsprinzip beim Beispielbeweis durchaus zur probatenrhetorischen Technik; und der höhere Standpunkt einer Einsicht, die Meinungs- und Gewohnheitsmäßigesüberprüft, gehört zur philosophischen Grundausrüstung seit Sokrates.215
Die Entwicklung des antik-christlichen Exemplums ist von Altphilologen, Kirchen- und Theologiehistorikernhinreichend erforscht worden,216 wobei die Akzente naturgemäß standpunktgebunden bald mehr auf derKontinuität, bald mehr auf der Diskontinuität zur heidnischen Antike lagen. Es geht nicht darum, Bekannteszu wiederholen oder gar auf fachfremdem Gebiet überaus delikate Theoriefragen zu diskutieren, sonderndarum, einige in der
215 Zum iudicium vgl. S. 384 f., 422 f. Zur Gewohnheitskritik § 74. Abaelard zitiert neben den oben Anm. 211 aufgezähltenCanones in Ep. X (ed. SMITS, ebd.) 243 auch den Codex Iust. 8.52 (53): Consuetudinis ususque longaevi nec vilisauctoritas est, verum nec usque adeo sui valitura momento, aut rationem vincat aut legem. Zu einer ähnlichenJustinianischen Regel hinsichtlich lex und exemplum (Codex 7.13) s. oben Anm. 64.216 Vgl. insbesondere (nach der Bibliogr.) die Arbeiten von CARLSON, GEERLINGS, GROSS, LUMPE, PÉTRÉ,BUISSON, STUDER, FUHRMANN, HONSTETTER, MARROU, PÖSCHL und DÖRING.
89
Mediävistik weniger beachtete Voraussetzungen der mittelalterlichen Exempla-Tradition vorweg zubeleuchten. Für viele Mediävisten stellt das exemplum Christi offenbar einen semantischen Grenz- undProblemfall des Beispiels dar, da es dem vermeintlich narrativen Wesenskern des Exemplums nicht oder nurbedingt entspricht.217
26. Gerade hier zeigt sich die Revisionsbedürftigkeit eines spezialistisch verengten Exemplumbegriffs, der aufder abstrakten, dem Interpreten praktisch wenig dienlichen Annahme beruht, es gäbe die Erzählung abgelöstvom Vorbild, den Bericht ohne das Ereignis, das Kerygma ohne das Heilsgeschehen, und es ließe sich unterAusschluß der Botschaft mit dem chemisch reinen Medium arbeiten. Das Exemplum hat vielmehrwesensgemäß die Tendenz, den Unterschied von „wirklicher“ und dargestellter Geschichte demAngesprochenen als nicht vorhanden zu suggerieren, die ferne, tote, abwesende Modellgestalt wie einelebende, nachahmenswerte oder Nachfolge heischende Person unmittelbar vor Augen zu stellen.218 Dies gilterst recht von dem (aufgrund der Inkarnation) vollendetsten und gegenwärtigsten exemplum Christi.Augustinus kennzeichnet die im Evangelium berichteten Exempla oder historischen Taten mit dem Paradoxder „sichtbar gewordenen Worte“ (quasi verba visibilia) und betont, daß nicht die erzählenden Sätze, sonderndie „vor die Augen des Herzens gestellten Geschehnisse“ zu befolgen seien.
217 LE GOFF (in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 44 f.) betont, daß im Gegensatz zum mittelalterlichen Exemplum dasantike durch die „qualité du héros“ überzeuge, gerät aber gerade dadurch vor dem „antik-christlichen“ exemplum Christi inVerlegenheit, da es „in einer gewissen Literatur als Verchristlichung des antiken Heldenexemplums“ angesehen werdenkönne. Diese Möglichkeit schließt er jedoch ausdrücklich aus seiner formgeschichtlichen Darstellung aus: „l’exemplumchristologique ou bien se réduit à la notion de modèle en dehors de la forme narrative brève de l’exemplum, ou se développeen des ouvrages de spiritualité encore plus éloignées de l’exemplum.“218 Vgl. Rhet. ad Herenn. IV 49.62: Rem […] probabiliorem [facit] cum magis veri similem facit; ante oculos ponit, cumexprimit omnia perspicue, <ut> res prope dicam manu temptari possit. Vgl. auch §§ 27,40 zum Doppelaspekt ‚Ereignis undErzählung‘; LAUSBERG §§ 810 ff. zu evidentia als „affektiver Sinnfigur“. – GROSS macht (64) darauf aufmerksam, daß inder Regel Benedikts (7, 29, 39, 63) der Begriff exempla maiorum nicht nur terminologisch mit dem altrömischenzusammenfällt, sondern daß darunter literarische und nicht-literarische „Vorbilder“, etwa die noch lebenden älteren Möncheund Vorgesetzten gleicherweise wie tote patres und berühmte Gestalten der Tradition, namentlich die ägyptischenWüstenväter unterschiedslos zusammengefaßt werden. (Vgl. auch J. FONTAINE, La romanité de saint Benoît. Vocables etvaleurs dans la Regula Benedicti, in: REL 58 [1980] 403–27). Diese Gleichstellung aller Beispiele vgl. auch bei Hieronymus(Ep. 125.15), der in der Beispielgemeinschaft den Hauptvorzug des coenobitischen gegenüber dem anachoretischenLebensideal lobt.
90
Dies ist die besondere eloquentia der Heilslehre.219 Auch andere Kirchenväter pflegen neben Augustinus (instärkster Überbietung des Begriffspaars praecepta–exempla220) den Glaubenssatz: „das Wort ist Fleischgeworden“ dahin auszulegen, daß Jesus durch sein Lebensexemplum endgültig die Wertlosigkeit bloßer Lehrenund Worte (d. h. der antiken Philosophie) dargetan habe.221 Quod nos monuit praecepto, demonstravitexemplo.222
Was immer der Exemplum-Begriff im Mittelalter bedeutet, wie weit er sich von solchen theologischenImplikationen entfernt haben mag, so muß die christologische Bedeutung als Ausgangspunkt undGrundvoraussetzung bei jeder mediävistischen Betrachtung berücksichtigt werden. Sie darf nicht allein derTheologiegeschichte überlassen bleiben, weil sie einerseits von früheren Exemplaritätsvorstellungen (wie demjüdischen Nachfolgebegriff, dem platonischen Analogiedenken oder der römischen Beispielspädagogik)223
mitgeprägt ist und weil sie andererseits eine ungeheure Wirkung auf sämtliche literatursprachlichenVerwendungen von exemplum in der christlichen Tradition – am unmittelbarsten in Liturgie undHagiographie224 – gehabt hat und
219 Zum Exemplum Christi vgl. (nach der Bibliogr.) die Beiträge von STUDER, PÉTRÉ (Art. Exempla 1878 ff.);GEERLINGS; BLOMENKAMP 545 ff.; CRISCIANI; von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) III §§ 476 ff. – Aug. Sermo77.5.7 (PL 38) 486: Factum quidem est et, ita ut narratur, impletum: sed tamen etiam ipsa quae a Domino facta sunt,aliquid significantia erant, quasi verba, si dici potest, visibilia […] Vgl. ebd. 99.1 (PL 38) 595: Evangelium enim cumlegeretur, attentissime audistis, et res gesta narrata atque versata est ante oculos cordis vestri. (Zu „Augen des Herzens“vgl. OHLY, Schriften 133, 139, 178 f.) Die Heilsbotschaft bezeichnet Augustinus als quaedam eloquentia movendo affectusdiscedentium accomodata, a visibilibus ad invisibilia, a corporalibus ad spiritualia, a temporalibus ad aeterna inEp. 55.7.13 (CSEL 34/2) 184 f. Vgl. M.D. JORDAN, Words and Word. Incarnation and Signification in Augustine’s Dedoctrina Christiana, in: Augustinian Studies 11 (1980) 177–96, und besonders die vorzügliche Analyse einiger Adaptationender circeronischen Rhetorik in Aug. Doctr. christ. IV (z. B. der Lehre von der captatio benevolentiae, der Einheit vonsapientia und eloquentia) an die für den christlichen doctor vorbildliche Heilspädagogik und „Eloquenz“ Gottes bei DorotheaROTH, Die mittelalterliche Predigttheorie und das Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant, Diss. Basel (BaslerBeiträge zur Geschichtswissenschaft 58), Basel/Stuttgart 1956, 22 ff.220 Siehe unten S. 178.221 Vgl. STUDER 111 f., 115 (u. Anm. 131); GEERLINGS 175 ff., LUMPE 1230 und unten § 45. Hauptstellen: Lact. Div.Inst. 4.13.1–5 (CSEL 19) 316–7; Aug. Util. credendi 15.33 (Bibl. Augustin 8) 286–90.222 Aug. Sermo 119.7 (Pl 38) 676.223 Vgl. Art. Nachfolge, in Hb. theol. Grundbegriffe, H. FRIES (Hrsg.) II, München 1962/3, 202 ff. (s. 1) Zum ExemplumChristi im Mittelalter s. auch S. 322 f., 329, 350, 470, 476 f., 494 f., 501 f.224 Liturgie: s. unten S. 92 f. Hagiographie s. unten §§ 27, 33, S. 100 ff., Anm. 298.
91
auf diesem Weg auch in die offene Region der „langue“ oder des „imaginaire collectif“ eingegangen ist.Kreuzungspunkt der Einflüsse und Wirkungen war vor allem die augustinische Deutung der MenschennaturChristi als Modell aller Arten des Exemplarischen. In Termini der antiken Rhetorik umgesetzt, bietet dasLeben Jesu Beweise und Mahnungen, argumentative demonstratio und pädagogische exhortatio: Einerseits hatChristus „durch das Beispiel der Fleischwerdung heilsam bewiesen“ (incarnationis exemplo salubriterpersuasit), wie nahe Gott den Menschen ist,225 und durch Wunder und Auferstehung wie mit Präzedenziendargetan, daß „auch wir nach der Nacht dieser Zeit auferstehen, da das Haupt als Beispiel vorangegangen ist“(exemplum praecessit).226 Dieses demonstrativ-indikativische Exemplum beweist, „macht glaubwürdig“, waswir hoffen dürfen. Häufig wird es synonym mit sacramentum verwendet. Die Synonymie in der liturgischenFormel sacramentum et exemplum zeigt zugleich die Bedeutungsnuancen des doppelten remedium vonVerheißung und Vorbildlichkeit, Erlösungstat und Bekehrungsanspruch.227 Daß sich Jesus in den Evangelienselbst als Exemplum zur Nachfolge empfiehlt,228 führte andererseits zu einer pädagogisch-exhortativenDeutung der Inkarnationslehre (mit eigenartiger, mehr oder weniger betonter Analogie zu einemneuplatonischen Aufstiegsmodell), die im Mittelalter überaus verbreitet blieb: Augustinus deutet diemenschliche Natur Christi als „das Sinnenhafte der Geschichte“, das wie eine hilfreiche Stütze, oder wie die„Kleinkindermilch“ die Menschen allmählich heranbildet und zum Göttlichen
225 Aug. Ep. 137.312 (CSEL 44) 112 f.: … maxime vero suae incarnationis exemplo id salubriter persuasit ut […] scirenthomines tam proximum esse deum pietati hominum. Ep. 140.9.25 (ebd.) 175: Denique resurrectionem suam, quam non sicutnostram in longum differri oportebat, ut in exemplo carni eius disceremus, quid in nostra carne sperare deberemus, noluitalienis demonstrare, sed suis […] ut igitur exemplo suae carnis exhortaretur fideles suos temporalem pro aeterna felicitatecontemnere, usque ad mortem pertulit persequentes… Ausführliche Deutung dieser u. ä. Stellen durch STUDER, bes. 115 f.– Demonstratio ist auch ein Begriff für die rhetorische Figur der evidentia, des „Vor-Augen-Stellens“ mit Bezug auf dashistorische Exemplum: vgl. LAUSBERG §§ 810 ff.; daher der überhöhende Gegensatz: noluit alienis demonstrare, sed suis.226 Aug. Sermo Wilmart 4.2 (Misc. Agostiniana 1930) 684: Est enim et nobis huius saeculi nocte transacta, resurrectiocarnis ad regnum, cuius capite nostro praecessit exemplum. Vgl. dazu STUDER 108 f. und allgemein GEERLINGS 211 ff.:Das Exemplum als demonstratio der Erlösung.227 Vgl. STUDER (passim) und GEERLINGS 213 ff.; unten Anm. 232.228 Joh. 13.15; 18.23; Matth. 5.48, 8.4, 10.38; Phil. 2.5; I Petr. 2.21 etc. Vgl. Anm. 233; PÉTRÉ 135 ff.; LUMPE1243 f., 1246 f.; STUDER 111 ff. und z. B. Aug. Sermo 218.1 (PL 38) 10.48: … ad salutem nostram et vitae huiustransigendae utilitatem, in his quae passus est ab inimicis Dominus noster, exemplum patientiae nobis praebere dignatusest…
92
und Unsichtbaren hinaufführt.229 Dieses exemplum imitationis230 bedeutet wesentlich mehr als bloßemoralische Vorbildlichkeit: Es stellt imperativisch die Vollkommenheitsforderung: „Ein Vorbild habe ich euchgegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe“ (Joh. 13.15); „Seid also vollkommen, wie euer Vater imHimmel vollkommen ist“ (Matth. 5.48); „Seid heilig, weil ich heilig bin“ (Lev. 19.2).231 Diese im Hinblickauf die göttliche Natur Christi „unmögliche“ Forderung wird für den Menschen allein in der Nachahmung derhumanitas Christi erfüllbar. Augustinus hat in der pelagianischen Kontroverse (in unverkennbarer Anlehnungan die rhetorische Exemplum-Theorie) die historische Vergegenwärtigung der „Taten“ Jesu, insbesondere dieBetrachtung von Passion und Auferstehung doppelt bestimmt als Impuls und Heilmittel, alsVollkommenheitsanspruch und Gnadenbeweis für die christliche Lebensführung. Ihm folgend, deutet Gregor d.Gr. die Ölbergszene als ein heilspädagogisches Exemplum für die Dialektik von infirmitas und fortitudo:232
Zuerst habe Jesus gebetet, der Kelch möge vorübergehen, um Kleingläubige durch ein Beispiel des Zweifels zutrösten; dann habe er durch seinen Gehorsam bis zum Tode ein stärkendes Beispiel für die Unterwerfung deseigenen Willens unter Gottes Willen gegeben. Die Menschwerdung Gottes gibt also dem exemplum Christi denSinn einer Demonstration menschlicher Hinfälligkeit, die ihre Überwindung gnadenhaft in sich schließt.
229 Zitat: GEERLINGS 182. – Vgl. auch T.J. van BAVEL, L’humanité du Christ comme lac parvulorum et comme via dansla spiritualité de saint Augustin, in: Augustiniana 7 (1957) 245–81. – Aug. En. Ps. 119.1 (CC 40) 1777.230 Leo d. Gr. bezeichnet das ganze Wirken Jesu als exemplum imitationis in Sermo 25 (24) 6; vgl. M.B. de SOOS, Lemystère liturgique d’après saint Léon le Grd., in: Liturgiewiss. Quellen u. Forsch. 34 (1958), 93–98, 130. – Vgl. auchCyprian, Ep. 3.2 nach Matth. 8.4 und Joh. 18.23.231 Zum Vollkommenheitsaspekt in der christl. Exempla-Tradition s. PÉTRÉ 135 ff.232 Der Beitrag von B. STUDER ist vornehmlich dem rhetorischen Hintergrund der augustinischen Dialektik von Passionund Auferstehung als Doppelexemplum für Busse und Hoffnung gewidmet: Der in konkreten historischen Fakten vor die„Augen des Glaubens“ gestellte Heilsplan Gottes (ratio sacramenti) bewegt und ermöglicht die Umkehr im Leben (imitatioexempli). Vgl. auch GEERLINGS 190, 211 f. zu Aug. En. Ps. 90 II 1 (CC 39) 1265; ebd. 126.2 (CC 40) 1859; De agoneChrist. 11.12 (CSEL 41) 115. E. AUERBACH, Sermo humilis (1952), in: ders., Literatursprache und Publikum in der lat.Spätantike u. im MA, Bern 1957, 25–53, bes. 35 ff. und Theod. WOLPERS, Die engl. Heiligenlegende des Mittelalters,Tübingen 1964, 22 ff. zu Aug. Civ. 10.29, En. Ps. 96.4 u. a. – Zu Gregor vgl. Mor. III 12.20–1; XII 12.16 (PL 75) 994B–C: Solent iusti viri in eo quod ipsi certum ac solidum sentiunt quasi ex dubietate aliquid proferre, ut infirmorum in severba transferant […] quatenus per hoc quod dubie proferre cernuntur, infirmis aliquatenus condescendant, et per hocquod certam sententiam proferunt, infirmorum mentes dubias ad soliditatem trahant. Quod nimirum dum faciunt exemplumnostri capitis sequuntur. Passioni quippe dominus propinquans infirmantium in se vocem sumpsit dicens: ‚Pater mi, sipossibile‘ […; Matth. 26.39], eorumque timorem abstraheret, suspecit; et rursus per obedientiam vim fortitudinis ostendensait: ‚verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu‘, ut cum hoc imminet, quod fieri nolumus, sic per infirmitatem petamus utnon fiat, quatenus per fortitudinem parati simus, ut voluntas conditoris nostri etiam contra voluntatem nostram fiat. NachAug. En. Ps. 31.2.26 (CC 38) 244; 32 II 1.2 (ebd.) 248. Zum bedeutsamen Einfluß dieser u. ä. Stellen auf die mal.paränetische Literatur vgl. von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) I/II §§ 156 ff.; III § 488; unten S. 322, 350, 433 zurWiderlegung der stoischen Apathia durch Johann von Salisbury (Ep. 276 [II] 384). Eine originelle Abwandlung desAufstiegsmodells gibt Abaelard im Prolog zum Sic et non (wie Anm. 561) 104 (340 ff.): Quae nos etiam proprio exemplomoraliter instruens, circa duodecimum aetatis suae annum sedens et interrogans in medio doctorum inveniri voluit, primumdiscipuli nobis formam per interrogationem exhibens quam magistri per praedicationem, cum sit tamen ipsa Dei plena acperfecta sapientia. Zum Kontext (der zwölfjährige Jesus als Exemplum der inquisitio veritatis) s. unten Anm. 562.
93
27. Über das Wort des Paulus: „Seid meine Nachfolger, wie auch ich Christi Nachfolger bin“ und andereGrundworte der imitatio Christi233 entsteht nun eine neue Traditionskette von Exempla, die von Christus alsVollendung an der Spitze über die Jünger, Apostel, Märtyrer, Bekenner und alle Heiligen bis zur Gegenwarthinabreicht. Die Kirche läßt sich also nicht nur als corpus Christi mysticum und als communio sanctorumverstehen, sondern auch als eine einzige „Beispielgemeinschaft“, die Gott immer wieder aufs neue wunderbarergänzt.234 Ein liturgisches Gebet lautet entsprechend:235 Deus qui in ecclesia tua nova semper instaurasexempla virtutum…, ein anderes: per exempla ad deum gradiamur. So fern diese Exempla dem mosmaiorum inhaltlich zu stehen scheinen, so fällt doch auf, wie stark die Sakralsprache sich noch im Rahmender römischen Terminologie für die genealogischen Beispiele bewegt. Vor allem werden diesen die exemplasanctorum ausdrücklich
233 I Kor. 4.16, II Thess. 3.7, I Thess. 1.7, Phil. 3.17. – Johann v. Salisbury Ep. 288 (II) 642 zum Apostelwort (ICor. 11.1): ‚Estote imitatores mei, sicut et ego Christi‘; alioquin praeter formam Christi se nulli censuit imitandum.Weiteres s. bei PÉTRÉ, Exemple 1880 f.234 Vgl. PÉTRÉ, ebd. 1882 zu Aug. En. Ps. 39.6 (CC 38) 428; BUISSON, Potestas 30 ff.; A. HARNACK, Das LebenCyprians von Pontius, Leipzig 1913, 77 f.; Herbert KECH, Hagiographie als christl. Unterhaltungsliteratur, Studien zumPhänomen des Erbaulichen anhand der Mönchsviten des hl. Hieronymus, (Göppinger Arbeiten z. Germanistik 225)Göppingen 1977, 74 ff.; STUDER 87 ff.; F. OHLY, Typologie als Denkform der Geschichtsbetrachtung, in: ‚Natur,Religion, Sprache‘, Universitätsvorträge 1982/3, Münster 1983, 68–102, hier 74 ff.235 Zu diesen u. ä. liturgischen Formeln s. PÉTRÉ, Exemple 1880 f.; LUMPE 1247.
94
antithetisch oder überbietend als Konkurrenz gegenübergestellt.236 In relativ versöhnlicher Form zieht etwaSulpicius Severus in seiner Martinsvita diesen Vergleich:237 magnorum virorum exempla wie Hektor undSokrates „spornten die Leser nicht wenig zum Nacheifern an. Doch nichts hatte dieses Bemühen mit jenemglückseligen Leben zu tun.“ Der christliche Heilige ist nicht nur vergangenes Vorbild, sondern ständigerFürbitter, gegenwärtiger Beschützer und christomimetischer Fortsetzer des Heilsgeschehens. Da er seine virtusnicht sich selbst verdankt, beweisen seine Wunder als „Zeichen“ oder exempla die göttliche Allmacht, dieimmer wieder in das Naturgeschehen eingreift und so an das Erlösungswunder erinnert.238 Solche Real-Exempla – nicht etwa homiletische Geschichtchen – meint Gregor d. Gr., der angebliche Vater desmittelalterlichen Predigtmärleins,239 wenn er immer wieder
236 Vgl. unten §§ 30–31; BUISSON, Potestas 26 ff.; B.R. VOSS, Berührungen von Hagiographie und Historiographie inder Spätantike, in: FMSt 4 (1970) 53–69, hier 57 ff.; GROSS, passim.237 Vita Martini I 2 (ed. J. FONTAINE, SC 133 [1967] I 250): et suam memoriam […] propagabant et propositismagnorum virorum exemplis non parva aemulatio legentibus excitabatur. Sed tamen nihil ad beatam illam aeternamquevitam haec eorum cura pertinuit. Vgl. VOSS (wie Anm. 236) 58 f. zur Abhängigkeit in der „typisch römischen Steigerungdes Vorbildgedankens“ von der Antonius-Vita des Evagrius.238 Vgl. unten § 29, GEBIEN 92.239 Vgl. § 36, S. 47 und LE GOFF, in: BRÉMONT/LE GOFF/SCHMITT 49 f.: „le père de l’exemple médiéval“; OPPEL98 ff.; TUBACH, Exempla in the Decline (wie Anm. 144) 407 ff. u.a.m. Zu dieser Ansicht ist es vor allem deshalbgekommen, weil hoch- und spätmittelalterliche Prediger und Predigtlehrbuch-Autoren sich unentwegt auf Gregor u. a.Kirchenväter als auctoritates für die verba-exempla-Antithese (nächste Anm.) beriefen, um ihren Gebrauch von Exempla zurechtfertigen. Solche Berufungen werden zur Bestimmung des mittelalterlichen Exemplum immer wieder aufgezählt: z. B.bei WELTER 14 ff.; SUCHOMSKI 310, Anm. 601; GEBIEN 82, 173 f.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 257 f.; vgl. auchunten Anm. 387, 921. Dabei vermengen sich sowohl bei den mittelalterlichen Schriftstellern wie bei den modernenForschern die Begriffe von Ereignis und Erzählung, Vorbild und Bericht derart, daß die zutreffende Feststellung destatsächlichen Einflusses der geistlichen Anekdoten und Wundererzählungen Gregors auf das homiletische „Exemplum“ desMittelalters unmerklich übergeht in die lexikographisch-begriffsgeschichtliche These, Gregor habe die narrativeGattungsbezeichnung exemplum begründet. Auf die Verwechslungsgefahr hat schon CRANE XVIII aufmerksam gemacht. LEGOFF hat im Gegensatz zu obigem Beleg diese Unterscheidung zwischen Gregors Erzähltechnik und dem narrativenExemplum-Begriff des Mittelalters noch in dem Vortrag ‚Vita et pré-exemplum dans le 2e livre des Dialogues… oq; (wieAnm. 110) von 1979 betont (110 f.): „Grégoire n’a pas donné […] de définition de l’exemplum…“; sein Benedikt-Lebenz. B. beziehe den Exemplum-Begriff nicht auf eine Erzählung, sondern auf den Heiligen, „remplaçant les héros qui avaientété a l’origine des exempla antiques.“
95
betont, die „Beispiele“ der Wunderkraft Gottes in seinen Heiligen könnten als sichtbare Taten die Liebe zumunsichtbaren himmlischen Vaterland besser entflammen als bloße Predigten und Worte.240 Die doppelteHeilsfunktion des Exemplum Christi als Beispiel menschlicher Kontingenz und deren Überwindung kehrt imLebensbeispiel vieler Heiliger wieder als Gnadenbeweis für die jedem Menschen mögliche imitatio christlicherHöchstleistungen. Unübersetzbar prägnant schreibt der heilige Bernhard von Clairvaux über den heiligen
240 Mor. 25.17 (PL 76) 329 B–C:… quia ne divina praecepta nos terreant, antiquorum patrum nos exempla confortant, etex eorum comparatione facere nos posse praesumimus, quod ex nostra imbecillitate formidamus. Dial. Prol. I (PL 77)153 A; SC 260.16: Vellem quaerenti mihi de eis [sc. perfectis probatisque viris] aliqua narrares. Neque pro hac reinterrumpere expositionis studium gravis videatur, quia non dispar aedificatio oritur ex memoria virtutum. In expositionequippe qualiter invenienda et tenenda sit virtus, agnoscitur; in narratione vero signorum cognoscimus inventa ac retentaqualiter declaretur. Et sunt nonnulli, quos ad amorem patriae coelestis plus exempla quam praedicamenta succendunt. Fitvero plerumque audientis animo duplex auditorium in exemplis patrum, quia si ad amorem venturae vitae et praecendentiumcomparatione accenditur, etiam si se esse aliquid existimat, dum meliora de aliis cognoverit, humiliatur. Zu den rhetorisch,nicht „narratologisch“ zu verstehenden Begriffen narratio und comparatio s. S. 98 f., 165. Zu solchen Stellen (z. B. nochPL 76 col. 326 C, 328 A, 218 C, 329 B–C, 330 A, 1014, 1290) vgl. LE GOFF, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT49 f.; GEBIEN 82 f.; C.S. JAEGER, The Prologue to the Historia calamitatum and the „Authenticity Question“, in:Euphorion 74 (1980) 1–15 (zum Einfluß auf den ersten Satz der Autobiographie Abaelards). – In Hom. Ev. 38 (PL 76) 1290steht vor der Geschichte von den drei Tanten Gregors, die sich nach der Bekehrung unterschiedlich verhielten: Sed quianonnumquam mentes audientium plus exempla fidelium quam docentium verba convertunt, volo vobis aliquid de proximodicere, quod corda vestra tanto formidolosius audiant, quanto eis hoc de propinquo sonat. Neque enim res longe antegestas dicimus, sed eas de quibus testes existunt, eisque interfuisse se referunt, memoramus. GRUBMÜLLER (wieAnm. 79) 98, stellt zu der verbreiteten Ansicht, daraus lasse sich eine Theorie des homiletischen Exemplums ableiten, mitRecht fest, daß der Text „deutlich auf die Überzeugungskraft von Vorbildern, nicht auf eingestreute Geschichten bezogen“ sei.– Im übrigen verwendet Gregor in seiner literarischen Praxis nicht nur die in der Tat den späteren homiletischenExempelgeschichten verwandten Wundererzählungen (gemäß der Tradition der frühen Mönchsviten und Apophthegmen),sondern regelmäßig auch die personalen exempla virtutis und metaphorischen Exempla, wie sie in der christlichen Spätantikezur rhetorischen Allgemeinbildung gehörten. Vgl. §§ 36, 40; von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) I/II §§ 179–179a,156 f.; III § 488, 1381 zu Mor. XII 12.16 und X 1.1; OHLY, Denkform (wie Anm. 234) 78; A. de VOGÜÉ, Grégoire leGrd., Dialogues, I (SC 251) Paris 1978, Introduction 135 f. zu Dial. II 8 (Benedikt in verschiedenen Lebenslagen mitMoses, David, Elias und Petrus verglichen).
96
Benedikt von Nursia:241 Sermo quidem vivus et efficax exemplum operis est, plurimum faciens suadibilequod dicitur, dum monstrat factibile quod suadetur. Der Heilige selbst ist das Exemplum und als solches eine„lebendige und wirksame Predigt“ – auch diese Metapher hat übrigens nicht das geringste mit einerEmpfehlung des „Predigthistörchens“ zu tun –; seine Taten verleihen der Lehre Überzeugungskraft aufgrundihrer Imitabilität. Die „Machbarkeit“ (factibile) spornt dazu an, das Tunliche zu tun.
28. Das Neue der christlichen Exempla gegenüber den antiken liegt in erster Linie in der Entheroisierung derpersönlichen Leistung zugunsten der Verkündigung göttlicher Gnadenwirkung. Seit dem Bekehrungswundervon Damaskus verweist das Zeugnis – und das Selbstzeugnis – der Exemplarität auf das Paradoxe der felixculpa, der von Gott durchbrochenen Fehlhaltung des Menschen. Seit der Umwertung des antikenRuhmesgedankens durch die christozentrischen „Selbstrühmungen“ des Paulus242 gelten Exempla immer auchals Beweise für die Nachahmbarkeit des Vorbilds, für die Möglichkeit, Christus und den Heiligen, die ihm inununterbrochener Sukzession nachfolgen, jederzeit selbst nachfolgen zu können.243 Deshalb zeigen sie keineübermenschlichen Heldentaten, sondern Gottestaten und Wunder gerade in gewöhnlichen, sich demütig alsSünder bekennenden Menschen. Die latente Gefahr einer enkomiastisch-„sensationellen“ Verselbständigungdes admirabile gegenüber dem schlichten imitabile wurde von vielen Hagiographen gesehen und ausdrücklichzu verhindern gesucht. Johannes Cassianus sagt z. B. in der Einleitung zu seinen Institutiones,244 er lasse„unglaubliche Wundergeschichten“
241 Bern. Clar., Sermo de S. Benedicto 7 (PL 183) 379. Dieses u. a. Beispiele zur Beispielgemeinschaft und communiosanctorum bei PÉTRÉ, Exempla 1880.242 II Kor. 11.30; 12.1.5 ff.; I Kor. 1.31; Röm. 1.16, 5.3; II Thes. 1.4.243 Vgl. den eigenen Zusatz des Evagrius in seiner Übersetzung der Athanasischen Vita Antonii 93 (PG 26): … ut virtuspossibilis esse […] doceatur exemplis et ad beatae vitae imitationem ex fructu laboris optimus quisque appelletur. Vgl.S. 23 oben VOSS (wie Anm. 236) 58; WOLPERS (wie Anm. 232) 44 ff., 48. – Wilhelm von Malmesbury, Vita WulfstaniProl. 2 (ed. R.R. DARLINGTON, London 1928) 2: Multa et, ut nostra fert opinio, innumera sunt in scripturis sanctis,quibus divina dignatio mentes mortalium ad bone vite cultum informat, tum precepta tum exempla. Illis qualiter vivendumsit instruimur; istis innuitur, quantum sint deo iuvante factu facilia que iubentur. Zur Antithese praecepta (für dieTunlichkeit) – exempla (für die Machbarkeit des Gebotenen) vgl. Register 4 s. l. praecepta, Imitabilität.244 Ioh. Cass., Inst. 7 (ed GUY, [SC 109] 1965) 28: Nec plane mirabilium Dei signorumque narrationem studebo contexere.Quae quamvis multa per seniores nostros et incredibilia non solum audierimus, verum etiam sub obtutis nostrisperspexerimus inpleta, tamen his omnibus praetermissis, quae legentibus praeter admirationem nihil amplius adinstructionem perfectae vitae conferunt, instituta eorum tantummodo ac monasteriorum regulas maximeque principaliumvitiorum […] origines et causas curationesque […] fideliter explicare contendam. Vgl. auch S. 101 f., 111 f., 116 f.;WOLPERS (wie Anm. 232) 7 ff., 24 f., 81 zur Legende als nicht primär biographischer, sondern beispielhafter Erzählungund als Objektivierung von Tugenden und Kräften des Heiligen mittels gnadenhafter Wunderbestätigung zum Zweckpraktischer Belehrung. – Im übrigen vgl. S. 214 ff. zu der nicht notwendigen Übereinstimmung von historiographisch-rhetorischer Wahrscheinlichkeit und historischem Augenzeugenbericht über bloß Tatsächliches.
97
– obwohl er solche mit eigenen Augen gesehen habe – bewußt beiseite, da er nicht Bewunderung erregen,sondern „eine Anleitung zum vollkommenen Leben“ geben wolle.
Eine im Mittelalter gern als Begründung der Predigtexempla angeführte Episode aus den Confessiones (VIII6–7) beleuchtet über ihren geistlichen Sinn hinaus auch anthropologisch vortrefflich die Psychologie desBeispiels:245 Augustinus erinnert sich an eine für seine Bekehrung entscheidende Begegnung. Während einerUnterhaltung mit dem Freund Alypius stieß zufällig der schon christliche Hofbeamte Ponticianus hinzu underzählte vom Wüstenvater Antonius, „um den großen Mann den Unwissenden nahezubringen“: „Wir hörtenmit Erstaunen, daß noch vor so kurzer Zeit, fast noch in unseren Tagen, in der rechtgläubigen Kirche Deinebestens bezeugten Wunder noch geschehen.“ Der Besucher berichtete weiter von der beispielhaften Wirkungdes Heiligen, derzufolge die Menschen scharenweise in die Klöster strömten, und fügte eine persönlicheAnekdote bei: In Trier habe er im Hofdienst stehende Freunde getroffen, die während eines Spaziergangs ineiner Hütte – auch dies also ganz zufällig – eine Antonius-Vita fanden und sich nach der Lektüre gemeinsam,der eine vom andern angespornt, in Scham und Zorn
245 Aug., Conf. VIII 6.14–7.17 (ed. M. SKUTELLA, Bibl. Teubneriana 1969, 164–7; übersetzt in Anlehnung an dieÜbertragung von J. BERNHART, München 1955/1966, 386–95): Quodam igitur die […] cum ecce ad nos domum venit adme et Alypium Ponticianus quidam, civis noster, in quantum Afer, praeclare in palatio militans […] Christianus quippe etfidelis erat […] Ortus est sermo ipso narrante de Antonio Aegyptio monacho, cuius nomen excellenter clarebat apud servostuos, nos autem usque in illam horam latebat. Quod ille ubi conperit, inmoratus est in eo sermone insinuans tantum virumignorantibus et admirans eandem nostram ignorantiam. Stupebamus autem audientes tam recenti memoria et prope nostristemporibus testatissima ‚mirabilia tua‘ in fide recta et catholica ecclesia. Omnes mirabamur, et nos, quia tam magnaerant, et ille, quia inaudita nobis erant. […] Unde incidit ut diceret nescio quando se et tres alios contubernales suos,nimirum apud Treveros […] exisse deambulatum in hortos […] atque illic, ut forte combinati spatiabantur, […] inruisse inquandam casam ubi habitabant quidam servi tui […] et invenisse ibi codicem, in quo scripta erat vita Antonii […] quamlegere coepit unus eorum et mirari et accendi […] Tum subito repletus amore sancto et sobrio pudore iratus sibi coniecitoculos in amicum et ait illi: „[…] Amicus autem dei, si voluero, ecce nunc fio.“ Dixit hoc et turbidus parturitione novaevitae reddidit oculos in paginis: et legebat et mutabatur intus […] Narrabat haec Ponticianus. Tu autem, domine, interverba eius retorquebas me ad me ipsum, auferens me a dorso meo, ubi me posueram, dum nollem me adtendere, etconstituebas me ante faciem meam, ut viderem, quam turpis essem […] et tu me rursus opponebas mihi et inpingebas me inoculos meos, ut invenirem iniquitatem meam et odissem […] Tunc vero quanto ardentius amabam illos, de quibus audiebamsalubres affectus […], tanto exsecrabilius me comparatum eis oderam, quoniam multi mei anni mecum effluxerant […] etdifferebam contemta felicitate terrena ad eam investigandam vacare […]. Vgl. dazu Pierre COURCELLE, Les Confessionsde saint Augustin dans la tradition litteraire, Paris 1963, 342 ff., 716 s. l.; ders., Recherches sur les Confessions de S.Augustin, Paris 1950, 175 ff., bes. 180 f. zur Einbettung der Episode in eine bestimmte Tradition: Die christlichgewordenen Intellektuellen erneuern „les fastidieux exempla si chers aux Romains“ durch aktuelle, zeitgenössische Themen;ähnlich lobt Ambrosius später die conversio Paulins von Nola als Exemplum für Alypius.
98
über die Vergeblichkeit ihrer Existenz und „im Gebärdrang eines neuen Lebens“ zur Bekehrung und NachfolgeChristi entschlossen. „So erzählte Ponticianus. Du aber, Herr, wandtest mich während seines Redens zu mirselbst herum, Du holtest hinter meinem eigenen Rücken mich hervor, wo ich mich eingerichtet hatte, damitich mich nicht anschauen sollte, und stelltest mich meinem Angesicht gegenüber, damit ich sähe, wie häßlichich sei […] Du drängtest mich meinen Augen auf, […] und mit umso größerem Abscheu haßte ich mich, wennich mich mit solchen Männern verglich, weil so viele meiner Jahre mit mir geschwunden waren […], undnoch immer schob ich’s hinaus …“246
Die einzelnen Beispiele erscheinen wie zu einem Netz von Bekehrungsmotiven verflochten. Auf höchsterStufe steht die berühmte Persönlichkeit des nicht in ferner heroischer Vorzeit, sondern in unmittelbarerzeitlicher Nähe
246 Zu diesem Passus vgl. auch R. HERZOG, Non in sua voce – Augustins Gespräch mit Gott, in: Das Gespräch, Poet. u.Herm. 11 (1984) 213–250, hier 229 f. – Augustin selbst fand die Geschichte von Ponticianus so überzeugend, daß er siespäter teilweise in eine Predigt einarbeitete (Sermo 76.10–11 [PL 38] 528). Seither wurde sie in der Homiletik zu einemMusterbeispiel. Im Prolog zum Alphabetum narrationum schreibt Stefan von Besançon (CRANE XX nach, ‚Hist. litt.‘ XX273): Antiquorum patrum exemplo didici nonnullos ad virtutes fuisse inductos narrationibus aedificatoriis et exemplis.Refert enim de se ipso Augustinus quod, Pontiano [sic] vitam beati Antonii coram eo recitante, ad imitandum statimexarsit. Narrationes quidem huius (modi) et exempla facilius intellectu capiuntur et memoriae firmius imprimuntur et amultis libentius audiuntur. Diese Abwandlung und Verkürzung der Confessiones-Stelle verweist paradigmatisch auf diemittelalterliche Entwicklung vom gegenständlichen zum literarischen Beispielbegriff: „Erbauungsgeschichte“ wird zwar vom„Vorbild“ getrennt, doch die Umdeutung des Gesprächs mit Ponticianus zu einer „Lesung“ der Vita Antonii zeigt, daßAugustinus primär als Kronzeuge für die anekdotische Kurzbiographie in Legende und „Predigtmärlein“, nicht für personhafteExemplarität „erstaunlicher“ Bekehrungen zitiert wird. Ähnlich sucht Humbert von Romans in der oben Anm. 105angeführten Stelle unter dem Oberbegriff exemplum literarische Anschaulichkeit jeglicher Art (z. B. durch Vergleiche,Parabeln, Fabeln, Geschichten) dem Prediger zu empfehlen, indem er an berühmte Bekehrungen aufgrund vonLebensbeispielen (u. a. auch an die Wirkung des Antonius auf Augustinus) erinnert (vgl. auch Anm. 364). – Zu einer ganzanderen Bedeutung der Ponticianus-Episode (für die Mont-Ventoux-Episode Petrarcas) s. unten S. 233 ff., 548 f.
99
wirkenden neuen Helden, des heiligen Antonius; es folgen unspezifisch die ihm in die Wüste und in daszönobitische Leben nachziehenden Scharen und zuletzt wieder konkrete, aber ungenannte Einzelgestalten, dievon plötzlicher Metanoia ergriffenen Hofbeamten in Trier. Alle Bekehrungen lösen neue Bekehrungen aus.Die Ereignisse sind also nicht nur als solche, sondern als existentielle Medien exempla conversionis. Daß auchhier – in einem bestimmten apostolischen Sinn – „das Medium die Botschaft ist“, zeigen eine Kettesekundärer Bekehrungsbeispiele, die einerseits aus der fama oder dem „Lawineneffekt“ der ägyptischenMönchsbewegung gebildet wird, andererseits aus mehreren eher literarisch-rhetorischen Erscheinungen: ImVordergrund steht der in bewußter Redestrategie vorgetragene Bericht des Ponticianus, im Hintergrund wirkendie herumliegende Antoniusbiographie und die Entscheidungsrede, mit der ein Freund den anderen anspornt,seinem Bekehrungsentschluß zu folgen. Die Wirkung des „großen Mannes“ gelangt wie das exemplum Christiselbst über viele exemplarische Zwischenstufen der imitatio und Vermittlung, die im Augenzeugenbericht mithistorisch-biographischen Umständen konkretisiert werden, zuletzt zum erkennenden und zaudernden Subjektherab. Diesem aber erscheint das komplexe Zusammenspiel der Motivationen als ein einziges exemplumpersuasionis der Providenz, mit dem Gott selbst durch empirische Spiegelbilder den Besinnungsprozeßeinleitet, den sonst das rhetorische Beispiel im Sinne der Aufforderung: „Und wenn du ganz dich zu verlierenscheinst, vergleiche dich!“247 auszulösen hat.
247 Gœthe, Tasso V 5, 3419 f., oben S. 23. Zur Spiegelmetapher vgl. Jac. I 22–4: Estote autem factores verbi et nonauditores tantum fallentes vosmetispsos. Quia si quis auditor est verbi et non factor, sic comparabitur viro considerantivultum nativitatis suae in speculo. Consideravit enim se et abiit et statim oblitus est qualis fuerit. Zur Tradition dersokratischen Metaphorik seit dem Hellenismus s. Pierre COURCELLE, Connais-toi toi-même de Socrate à saint Bernard,(Bd. I), Paris 1974, 71 ff. Vgl. auch S. 170 ff., 534 f., Anm. 337 und die (keineswegsim Sinne des „Predigtmärleins“) aufdie Predigt bezogene christlich-humanistische Bild-Metapher bei Guibert von Nogent, Quo ordine sermo… (PL 156) 27B:Nulla enim praedicatio salubrior mihi videtur quam illa quae hominem sibimet ostendat, et foras extra se sparsum ininteriori suo […] restituat atque eum coarguens quodammodo depictum ante faciem suam statuat.
100
29. Was in den Confessiones den relativen Unterschied zwischen dem berühmten Hauptvorbild und denkleineren nachfolgend-vermittelnden Vorbildern ausmacht, entspricht zwei Grundformen des spezifischchristlichen Beispiels. Auf der einen Seite entsteht in methodischer Analogie und oft auch mit ausdrücklichemBezug zum personalisierten historischen Exemplum der Antike das hagiographische Exemplum desherausragenden, besonders begnadeten Einzelnen; auf der anderen Seite bildet sich die Kategorie desunbekannten Helden oder namenlosen Zeugen für Gottes Wirken in der Geschichte heraus. Wie Augustinsautobiographische Aussage zeigt, liegen beide Arten ursprünglich (aufgrund der chrstozentrischenErnstbedeutung) nahe beieinander: Es ist ein eher gradueller als substantieller Unterschied, ob Antonius,„dessen Name weithin sichtbar leuchtete“ und schon literarisch durch die Evagrius-Übersetzung derathanasischen Vita Antonii verbreitet war, oder ob irgendwelche ungenannte Kollegen des kaiserlichenHofbeamten Ponticianus, der sie vorliterarisch mündlich bekannt machte, als Werkzeuge Gottes denBekehrungsvorgang des Augustinus bewirken und bezeugen. Vor Gott sind alle Beispiele gleich. Dochformgeschichtlich müssen die zwei Exemplaarten als zwei zusehends auseinanderstrebende, sich in eigenensynkretistischen Metamorphosen selbständig entwickelnde, am Ende oft kaum mehr zu vermittelndeFunktionen getrennt beschrieben werden. Die eingangs erwähnten Definitionsschwierigkeiten der Mediävistikdürften hier, in solcher durchaus objektivierbarer Zweipoligkeit ihre Hauptursache haben.
Die erste Art des christlichen Beispiels ist das hierarchische Persönlichkeits-Exemplum: Es bildet nicht bloß(wie jedes historische Exemplum) eine Parallele zwischen Fall und Präzedenzfall, zwischen Angesprochenemund Vorbild, sondern weist über sich selbst hinaus auf andere ungleichrangige Exempla. In jedem Fall verweistes auf das absolute Vorbild Christi und ist diesem notwendig nachgeordnet und unterlegen. Oft steht es auchauf einer bestimmten Stufe innerhalb anderer heilsgeschichtlich deutbarer Beispielbezüge, ermöglicht denabwägenden Vergleich mit mehreren christlichen Parallelen, kann alttestamentliche Beispiele typologischsteigern und erfüllen oder profane Exempla der Antike als „Rivalen“ kontrastierend oder integrativüberwinden.
Die Rangordnung innerchristlicher Exempla kann folgende Stelle aus einem Privatnachruf des 12.Jahrhunderts besser verständlich machen als lange theoretische Ausführungen: Petrus Venerabilis von Clunyschreibt zum Tod seiner Mutter ein briefliches ‚Epitaphium‘ im Sinne verwandtschaftlicher Pietät (dasTotengedächtnis steht grundsätzlich den römischen exempla maiorum nahe), aber auch in der Absicht einerexemplarischen, quasi-hagiographischen Darstellung, indem er zuletzt das Sterben seiner Mutter als einLeucht- und Verklärungswunder schildert.248 Dies ist eine bewußte Übernahme der berühmten Stelle aus derMartins-Vita des Sulpicius Severus.249 Die literarische imitatio wird nun als eine „sachliche“ wie folgtgerechtfertigt:250
248 Petr. Ven. Ep. 53 (…ad germanos suos eiusdem matris epitaphium) ed. G. CONSTABLE, Cambridge Mass. 1967, I153–73 (Kommentar II 133–5); ausführliche Analyse bereits in Consolatio (wie Anm. 51) I/II §§ 586–681.249 Sulp.-Sev. Ep. III ad Bassulam 17, (CSEL 1) 149.250 Petr. Ven. Ep. 53, 170 f.: Sed mirabitur forte aliquis, cur ea quae de magno Martino dicta sunt, mulieri longe impariadaptaverim. Quae si quis cogitaverit, advertat quanta in scripturis canonicis leguntur, quae de Christo principaliterdicta, ad corpus sanctorum cui ipse caput est referuntur. Haec quia innumera sunt ea singillatim referre nolo […] Recolatquanta […] recitentur quae ita servis congruunt, ut domino nichil minuant. Noverit non indignari dominum de indiscretacum servis communione verborum, quibus ipse universa pene nomina sua imposuit, et quaecumque audivit a patre, nota eisfecit. Et ne peccatores iustis aequari scandalizetur, sciat non de meritis quae omnibus incerta sunt, sed de miraculis quaeuniversis nota sunt parem me ferre sententiam. Quid enim? Et si mortuos Christus suscitavit, si leprosos curavit, si caecosilluminavit, si demones effugavit, si et alii mortuos suscitasse, leprosos curasse, caecos illuminasse, demones effugassecreduntur, Christo propter similia opera componi dicuntur? Non est iniuria sed laus nominis dei, cum non in uno sed inmultis ‚mirabilis‘ dicitur ‚deus in sanctis suis.‘ Et ne in hoc faciei miraculo solus putetur iustus esse Martinus, accedat etpeccator Theophilus. Qui ut scriptura apud plures iam usitata narrat, post quadraginta dierum paenitentiam Christicorpore suscaepto facie refulsit ‚ut sol.‘ Vnde quid mirum si post multorum annorum paenitentiam et commendabilemuitam, beatae feminae vultus inusitato candore enituit, cum post paucorum dierum contritionem tantis criminibus deturpatafacies ut sol fulgere praevaluit? Potuit hoc in nostri temporis muliere Christus facere, quod in illius temporis peccatore
101
„Es könnte sich einer wundern, warum ich das vom großen Martin Gesagte auf eine ihm sehr unebenbürtige Fraubeziehe […] Wer so denkt, möge überlegen, wieviel in den kanonischen Schriften zuerst von Christus geschriebensteht, sich danach aber auch auf den Leib der Heiligen, deren Haupt er ist, bezieht. Zahllos sind diese Bezüge, undich will sie nicht einzeln aufführen […] Sie treffen alle derart auf die Knechte zu, daß die Ehre des Herrn nichtgeschmälert wird. Denn er, der als Schöpfer allen Dingen die Namen gab, hat es nicht verschmäht, in derunterschiedslosen Gemeinschaft des Wortes mit den Knechten zu verkehren und ihnen alles, was er vom Vater hörte,bekanntzumachen. Auch möge man an der Gleichstellung von Gerechten und Sündern keinen Anstoß nehmen, dennich sage hier Gleiches nicht von den Verdiensten, über die allgemein Ungewißheit herrscht, sondern von denWunderzeichen, die allen bekannt sind. Was soll’s also? Da Christus Tote erweckte und Aussätzige heilte […], undes heißt, andere haben Tote erweckt, Aussätzige geheilt […] und andere Werke wegen Christus vollbracht, ist eskeine Herabsetzung, sondern ein Lob des Namens Gottes, wenn ‚Gott‘ nicht in einem, sondern ‚in vielen seinerHeiligen wunderbar‘ genannt wird [Ps. 67.36]. Damit man aber nicht glaube, der gerechte Martinus sei alleinigerTräger dieses Verklärungswunders, trete auch der Sünder Theophilus vor die Augen! Wie eine schon weit bekannteund viel gelesene Schrift erzählt,251 hat er am
Theophilo et et iusto Martino voluit demonstrare. Quod si res ipsae consimiles sunt, quid rerum ipsarum consimilia verbaa me reformidanda sunt? Ergo similiter dicatur, quod non dissimiliter actum esse probatur.251 Paulus Diaconus, Historia Theophili (AA SS Febr. I 487, BHL 8121) nach Matth. 17.2. Vgl. E. DORN, Der sündigeHeilige in der Legende des Mittelalters, München 1967, 46 ff.
102
vierzigsten Tag der Buße […] wie die Sonne geleuchtet. Was ist also Erstaunliches an der Tatsache, daß das Antlitzeiner seligen Frau nach vielen Jahren der Buße und einem vorbildlichen Lebenswandel in ungewöhnlicher Klarheiterstrahlte, wenn schon nach wenigen Tagen der Reue das von so großen Verbrechen entstellte Antlitz wie die Sonneund heller als der Blitz erstrahlte? Dasselbe konnte Christus in unseren Tagen in einer Frau vollbringen, was er injener Zeit am Sünder Theophilus und am Gerechten Martin zeigen wollte. Wenn sich also die Geschehnisse in derWirklichkeit gleichen, muß ich mich da scheuen, die gleichen Worte dafür zu verwenden? Es sei also gleichausgedrückt, was anerkannterweise nicht ungleich geschehen ist!“
So wird die Traditionsgebundenheit, ja Stereotypie und Monotonie vieler hagiographischer Darstellungenverständlich als angemessener Ausdruck des kollektiven Ideals eines gemeinsamen Aufgehens in Christus, dasim Sinne des Wortes: „Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir“ (Gal. 2.20) die Entindividualisierung bis zurspirituellen Vertauschbarkeit vorantreiben soll. Während der römische Exempla-Gebrauch Geschichtliches aufeine ausgewählte Zahl von persönlichen Tugendverkörperungen reduziert hat, folgen die innerchristlichhagiographischen Beispiele einem umfassenderen, herausfordernden Vereinheitlichungsprinzip. Sie sind nichtnur Zeugnisse des einen Leibes Christi in allen, „die den Herrn Jesus Christus angezogen“ haben (I Kor. 12.12,Röm. 13.14), sondern bilden in je verschiedenen Einzelzügen immer nur das eine Leben Jesu als Zeichen fürdas fortgesetzte Erlösungswerk wieder ab; ja sie unterstreichen diese christozentrische Einheit und Gleichheituntereinander noch ästhetisch durch die Identität der Formulierungen.252 Kleine Unterschiede, wie sie derVergleich der vierzigtägigen mit
252 Vgl. die ähnlich lautenden Feststellungen der neueren Hagiographieforschung zitiert bei v. MOOS, Consolatio (Anm. 51)I/II § 657, insbesondere J. FONTAINE (ed.), Sulpice Séverè, Vie de S. Martin, I Introd. (Sc 133, Paris 1967) 68: jede Vitaals „une biographie continueé du Christ présent dans les membres les plus parfaits de son corps mystique.“ Vgl. überdiesVOGÜÉ (wie Anm. 240) 135 ff. zu hagiographischen Wiederholungen von konkreten Episoden aus dem Leben Jesu beiGregor d. Gr. als Illustration „der Hauptthese, daß der Herr immer bei uns ist.“ VOSS (wie Anm. 236) 56 verweist auf diegrundlegende und traditionsbildende Absichtserklärung des Athanasios im Einleitungsbrief der Vita Antonii, er wolle„weniger ein individuelles Schicksal vor Augen stellen als vielmehr den Typus eines vorbildlichen Lebens der Askese, daszur Nachahmung anspornen sollte.“ KECH (wie Anm. 234) 74, 77 f. betont (allerdings in mißbräuchlicher Verwendung desTypologiebegriffs) zutreffend, daß der Wiederholungsgedanke der imitatio Christi als bewußtes Stilisierungsmittel jenseitsaller Faktentreue hagiographisch eingesetzt werde, „um dem Leser die Gelegenheit zu verschaffen, in einem Akt suggestivgeweckter Selbstbestätigung die Identifikationsbereitschaft mit dem gezeigten Vorbild zu intensivieren.“ Zur Legende hebtWOLPERS (wie Anm. 232) 22 f., 28 die untergeordnete Bedeutung der geschichtlichen Zeit und des historischen Detailshervor im Vergleich zur Aufgabe, das Bleibende, das immergültige Erlösungswerk im Heiligen durch Wiederholungen undimmer neue Glaubensbestätigungen als ein „Andachtsbild“ darzustellen. Der nicht nur metaphorischen, sondern ikonologisch-kunstgeschichtlichen Bedeutung jener exemplarisch-überzeitlichen christiformitas im Mittelalter hat Wolfram VON DENSTEINEN sein Spätwerk, Homo caelestis, Das Wort der Kunst im Mittelalter, 2 Bde., Bern/München 1965 gewidmet; vgl.auch den programmatischen Aufsatz: Der himmlische und der irdische Mensch, in: Antaios 3 (1961) 138–44. – Anderewichtige Konsequenzen aus dem christomimetischen Wiederholungsgedanken hat Hanno HELBLING in derspätmittelalterlichen Geschichtstheorie und Ekklesiologie herausgearbeitet: Saeculum humanum, Ansätze zu einem Versuchüber spätmittelalterliches Geschichtsdenken, Neapel 1968, z. B. 14 ff. zu scholastischen Theorien über die substantielleIdentität der Kirche bei akzidenteller Veränderbarkeit; 43 ff. zu Franziskus als überindividueller Wiederkehr und ErneuerungChristi oder 69 ff. zum mystischen Satz: semper nascitur, semper natus est Christus und zu der joachimitischenGeschichtsspekulation. Vgl. auch unten S. 504 ff., 519 ff.
103
der lebenslänglichen Buße zeigt, dienen einzig dazu, eine vielleicht anfechtbare Gleichstellung in derGemeinschaft aller Heiligen a fortiori zu befestigen. Obwohl hier berühmte Heilige der enkomiastisch-biographischen Persönlichkeitsdarstellung zugeordnet werden, zeigt auch diese Stelle, wie leicht dasnamentliche Exemplum aufgrund christozentrischer Identifikation – die similitudo miraculorum weist auf dieaequalitas meritorum253 – in das unpersönliche Exemplum übergehen kann.
Ähnliche Beobachtungen erlaubt die zeitliche Dimension der Stelle: Die allen innerchristlichen Exemplagemeinsame Kontinuität der communio sanctorum wird hier in einer extremen, zeitliche Unterschiedeaufhebenden Form aktualisiert, als reine Christozentrik. Der wertende Vergleich von „damals“ und „heute“,von „alt“ und „neu“ wird nur in der Fragestellung erwogen, erweist sich im Ergebnis aber als inadäquatgegenüber dem statischen, immergültigen Angleichungsbild. Individualgeschichte erstarrt oder „verklärt sich“zur Ikone. Neben dieser konsequent atemporalen Anwendung des Kontinuitätsprinzips aufgrund derimmerwährenden Heilsgegenwart Christi in seinen Gliedern kennt die Exemplatradition zwei innerzeitlicheBewegungsmodelle, die sich nicht widersprechen müssen, aber oft in dialektischer Spannung zueinander stehenund divergierende bis konflikthafte Akzente zu setzen erlauben: Wiederkehr und Fortsetzung,Wiederherstellung und Weiterentwicklung, Erneuerung und Verbesserung, reformatio (renovatio, restauratio)und reformatio in melius. Der erste Aspekt setzt einen unbedingt positiven Vergangenheitsbezug voraus: Dieimitatio Christi ist mehr oder weniger erreichbare Nachbildung eines vollkommenen Vorbilds; die Urkirchewirkt im allgemeinen als ursprünglich unverdorbener Zustand exemplarisch; christliche Gemeinschaften allerArt haben sich stets (in Analogie dazu) an ihren Stifterpersönlichkeiten
253 Petr. Ven. Ep. 53, 171 (nach obigem Zitat, Anm. 250): Nec idcirco pares iudicari videbuntur, quia parilitatem non facitsimilitudo miraculorum, sed aequalitas meritorum. Vgl. unten §§ 32, 34, 37 zum Begriff der Anonymität.
104
und Gründungsmodellen orientiert. Insofern sind innerchristliche Exempla den römischen exempla maiorum,die ebenso der Erneuerung des „guten Alten“ dienen, strukturell durchaus verwandt. Dies erklärt zweifellos dieschon frühe Übernahme altrömischer Termini für das Beispiel (und seine Funktionen) in die Mönchregeln undin das Kirchenrecht. Eine Verselbständigung des restaurativen oder konservativen Aspekts verhindert jedochdialektisch der zweite, gegenläufige Gedanke einer kirchengeschichtlichen peregrinatio, die dank derhelfenden Führung des Heiligen Geistes bis zur Parusie (Joh. 14) auch Vervollkommnung einschließt. Aufgrundder „parakletischen“ Kontinuität sind Exempla christlicher Vergangenheit nicht notwendig der Gegenwartüberlegen; sie können als Zeugen einer bestimmten, inzwischen überwundenen Entwicklungsstufe inErinnerung gerufen werden, sind dann zwar Voraussetzung und ehrwürdige „Vorgeschichte“ spätererVeränderung oder „Neuschaffung“, aber nicht mehr absolut verbindliche auctoritas. Innerchristliche Exemplaunterscheiden sich somit auch darin von den römischen (die nicht an sich, sondern nur hinsichtlich ihresGeltungs- oder Anwendungsbereichs bestreitbar waren), daß sie in einem Prozeß dauernder Erneuerung undfortgesetzter Revision überholter consuetudo durch zeitadäquate veritas einen Streit über ihren jeweiligenVerbindlichkeitsgrad möglich machen254.
30. Wenn schon innerhalb der heilsgeschichtlichen Kontinuität des Christentums gegenwärtige Verhältnissenicht problemlos (d. h. nicht ohne kritische Anstrengung der „Vernunft des Glaubens“) durch großePräzedenzfälle abgesichert
254 Zu den verschiedenen Möglichkeiten der Zeitverwertung vgl. allgemein LADNER, Idea (wie Anm. 179) 319 ff.(Mönchregeln), 298 ff.; ders., Art. Erneuerung (wie ebd.) 266 f. (Vorbild der Urkirche analog zu den römischen exemplamaiorum); ders., Die mittelalterliche Reform-Idee und ihr Verhältnis zur Idee der Renaissance, in: MIÖG 60 (1952) 31–59;B. SMALLEY, Ecclesiastical Attitude to Novelty c. 1100–c. 1250, in: Church, Society and Politics, ed. D. BAKER,Oxford 1975, 113–31; Zum renovatio-Aspekt vgl. auch BUISSON, Potestas 26 ff.; ders., Entstehung des Kirchenrechts102 ff.; K. GROSS, Auctoritas–Maiorum exempla, Das Traditionsprinzip der hl. Regel (wie Anm. 210a) 59 ff.; LUMPE1257; Erich AUERBACH, Mimesis, Bern 1946/1963, 188; Hans RALL, Zeitgeschichtl. Züge im Vergangenheitsbildmittelalterlicher, namentlich mittellateinischer Schriftsteller, (Hist. Studien 322) 1937/repr. Vaduz 1965, 296 f.; MagnusDITSCHE, Die ecclesia primitiva im Kirchenbild des hohen und späten Mittelalters, (masch.) Diss. Bonn 1958 passim.OLSEN, Ecclesia primitiva (wie Anm. 210a) 78 ff. mit besonderer Betonung der Perfektibilität und reformatio in melius;OHLY Schriften z. Bedeutungskunde (wie Anm. 203) 367, 343 hebt die ekklesiologisch-eucharistisch-christologischenBezüge als nicht steigernde, sondern „fortsetzende“ von der Typologie ab (rückt aber mit dieser berechtigten Unterscheidungden Entwicklungsaspekt akzentmäßig vielleicht zu stark in den Hintergrund). Vgl. auch §§ 96, 102, S. 84, 105, 318 ff.
105
werden können, so gilt dies erst recht im Bereich kultureller und religionsgeschichtlicher Diskontinuität:Außerchristliche (jüdische und heidnisch-antike) Exempla werden primär im Zeichen des „neuen Menschen“,der den „alten Adam“ überwindet, gesehen und nach der paulinischen Losung (I Kor. 5.17) behandelt: „Wennjemand ein neues Geschöpf in Christus geworden ist, so hat das alte aufgehört; siehe, alles ist neugeworden!“255. Gegenüber den messianischen Vorzeichen in der jüdischen Geschichte ist das Neue typologischerfüllend, gegenüber den profangeschichtlichen Parallelen jedoch antithetisch oder überbietend. Diesertheologisch evidente, zu Beginn tiefgreifende, später aber allmählich schwindende Unterschied zwischenalttestamentlichen und außerbiblischen Beispielen256 läßt sich literaturwissenschaftlich am besten abschätzen,wenn nicht so sehr das Rangverhältnis der Exempla untereinander als deren gemeinsame Funktion demjeweiligen Vergleichsziel gegenüber beachtet wird. Die causa läßt grundsätzlich nur die Alternative zwischensituationskonstatierender und situationsverändernder Rede zu: Entweder wird Vergangenes – sei es einExemplum oder eine Exempla-Reihe – zum Zwecke der Bewunderung oder Verherrlichung indikativischdemonstrativ (z. B. enkomiastisch oder liturgisch) in Erinnerung gebracht, oder aber es wird als Aufforderungzur Nachahmung, Nachfolge oder Befolgung des damit suggerierten Ratschlags imperativisch mahnendvorgestellt. (Letzteres gilt selbstredend auch für Warnung und Abschreckung.257)
255 Vgl. LADNER, Die mal. Reform-Idee (wie Anm. 254) 36 ff.256 Dies ist m. E. die entwicklungsgeschichtliche Formel, die den in der Germanistik ausgebrochenen Streit um F. OHLYSTypologiebegriff beenden könnte. (Vgl. die bibliogr. Übersicht bei JENTZMIK, wie Anm. 183). Während das „Lager“ derPuristen einen restlos innerbiblischen Typologiebegriff aufgrund moderner ad-fontes-Theologie postuliert und (im Grundeanachronistisch) auf das „synkretistische“ Mittelalter zurückprojiziert, ja sogar hagiographischen Vergleichen das Prädikat„typologisch“ versagen möchte, dürfte OHLYS These von antik-christlichen Typologien und einer alles durchdringenden„typologischen Denkform“ im Mittelalter in der Substanz unanfechtbar geblieben sein; denn Gott ist „Herr aller Geschichte“,auch der heidnischen, und eine nicht-heilsgeschichtliche Geschichte ist vor der Neuzeit schlechthin undenkbar (s. unten§§ 83). Dennoch wird sich hier im einzelnen zeigen, daß OHLY den Typologiebegriff gelegentlich überzieht, da er dazuneigt, rhetorische Techniken der Exempla-Steigerung, Synkrisis und Überbietung ebenso wie die Intensität der patristischenGlaubensapologie gegen die umgebende heidnische Kultur und deren rigoristische Nachwirkung auf mittelalterliche (anti-humanistische) Konventionen zu unterschätzen (vgl. unten Anm. 258, 652, 917, 952).257 Die Unterscheidung von situationsverändernden und feststellenden Exempla entspricht derjenigen zwischen den beiden„Arten der Rede überhaupt“, die LAUSBERG, Elemente §§ 3–19 als „Verbrauchs-“ und „Wiedergebrauchsrede“charakterisiert.
106
Die innerchristliche Beispielkette und das christozentrische Einzelbeispiel können (wie schon das ExemplumChristi selbst) in beide Richtungen, „admirativ“ verherrlichend ebenso wie appellativ imitationsförderndverwendet werden. Demgegenüber gelten diese beiden Funktionen für die alttestamentlichen und die antikenExempla im wesentlichen derart, daß typologische Beziehungen primär der konstatierenden Bestätigung undVerherrlichung der neuen Glaubensgehalte dienen, Vergleiche mit außerbiblischen Helden vornehmlichermahnen und anspornen sollen. Während hier spezifisch Christliches als steigernde Erfüllung der imJudentum keimhaft, skizzenhaft angelegten Voraussetzungen gepriesen wird, steht dort das Nichtjüdische undAußerchristliche wesentlich als „Kontrastfolie“ oder bestenfalls als rein menschliche Natur (im Sinn deranima naturaliter christiana) paränetisch zur Verfügung.258 Das bei den Kirchenvätern so beliebte exempluma minore ad maius ductum ruft die nur natürlichen und universalen Tugenden edler Heiden gerade deshalbwach, um die Christen provokativ an ihre höhere spezifische Verpflichtung zu erinnern.259 GregorsFeststellung, daß der heilige
258 Zu diesem „Natur“-Begriff vgl. unten § 95. – Die beiden Exempla-Arten lassen sich auch unter dem oben § 22 erwogenenAspekt des Realitätsgehalts oder der „Ernstbedeutung“ betrachten: In der Typologie hängen die geschichtlichen Ereignisse inre zusammen, müssen also nicht erst durch Interpretation aufeinanderbezogen, sondern nur noch festgestellt werden. Vgl.JENTZMIK (wie Anm. 183) 23 f. und Leonhard GOPPELT, Typos, Die typologische Deutung des Alten Testaments imNeuen, (1939), 2. Aufl. Darmstadt 1981, 242: „Die Typologie […] wird vom NT nicht als eine hermeneutische Kunstformempfunden (auch eine technische Terminologie, entsprechende Ableitungsformel u. ä. fehlen). Sie ist ihrem Wesen nachlediglich die Aufzeigung einer durch die ntl. Heilsgegenwart gegebenen Beziehung“ … „Das Ergebnis der typologischenDeutung sind in erster Linie Aussagen über das ntl. Heil, nicht Aussagen über das AT.“ Das antike Exemplum hängtwesentlich von der Deutung ab, die es einem bestimmten Beweisziel oder einer situationsverändernden Intention unterwirft.Wenn z. B. Guibert von Nogent den ersten Kreuzzug typologisch als Entsprechung zu Zach. 12.1–9 darstellt, so soll derbloße Indikativ das Geschehene heilsgeschichtlich legitimieren (vgl. BOEHM [wie Anm. 25] 688 f. zu Gesta Dei perFrancos VIII 4 [PL 156] 806 ff.). Wenn aber Ambrosius De officiis ministrorum als aemulatio und Überbietung von CicerosDe officiis konzipiert, so dient der Bezug verstärkend dem paränetischen Imperativ als einem moralisch-situationsverändernden tertium comparationis. (Im Unterschied zu OHLY, Denkform [wie Anm. 234] 81 und Schriften z.Bedeutungskunde [wie Anm. 203] 338 ff. vermag ich darin nichts eigentlich Typologisches zu sehen.) Auch die nur schonaus Gattungszwängen unentbehrlichen, sehr verbreiteten „Substitute“ und „Konkurrenzparallelen“ (wie A. DEMANDT [wieAnm. 169] 261 solche Exempla nennt) – z. B. Petrus und Paulus statt Romulus und Remus, Hiob für Cato u. dgl. – sindweitgehend das Gegenteil von Typologie.259 Vgl. unten S. 117, 236, 434 f., 424 f., 458 ff.; LUMPE 1245 f., 1249 f.
107
Benedikt als Gesetzgeber in Christus ein „neuer Moses“ sei, ist etwas grundsätzlich anderes als etwa AugustinsMahnung an die Christen, das, was „tapfere Römer für das irdische Vaterland“ taten, nun „umso williger undfreudiger für das himmlische“ zu tun.260 Das eine beruht auf heilsgeschichtlicher Kontinuität; das anderebetont ausdrücklich den Bruch, die Diskontinuität zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Ordnungals einen radikalen Dimensionswechsel.
31. Das Christentum hat die Exemplatradition der Antike nicht nur umgestaltet, sondern in vielem auch (ausKulturbedingtheit und Verständigungsnotwendigkeit) unverändert übernommen. Es braucht nicht eigenserwähnt zu werden, daß schon seit der Patristik griechisch-römische Exempla der heidnischen Geschichte inbestimmten Bereichen – etwa der Pädagogik oder der Politik – direkt, d. h. ohne jeglichen legitimierenden aminore ad maius-Schluß für christliche Belange gebraucht werden konnten.261 Beachtenswert ist hingegen,daß bereits in der frühesten Mission heidnische Exempla ohne Betonung ihrer Unterlegenheit, inwertneutraler, rein erklärender Funktion verwendet wurden. Sie hatten die Aufgabe, bestimmte, allgemeinakzeptierbare, nicht ganz neue, sondern mit dem mos maiorum partiell übereinstimmende Aspekte derchristlichen Botschaft mit Hilfe einer ebenso allgemein üblichen Überzeugungstechnik vor Augen zu führen.(Der Gesichtspunkt der Selbstaufopferung an politischen und philosophischen Helden konnte etwa alsAnknüpfungspunkt für die Lehre vom Kreuzestod Jesu dienen.)262 Solche Misch- und Übergangsformenwerden passender im analytischen Interpretationsteil behandelt.263 Die hier ermitteltenUnterscheidungsmerkmale begegnen in der literarischen Praxis ohnehin selten so eindeutig, wie dieseeinleitende Systematik sie zu bestimmen sucht. Die vorliegende begriffliche Klärung mag vielmehr dazudienen, die Vielfalt der christlich-nichtchristlichen „Legierungen“, wie wir sie in einem Hauptwerk dermittelalterlichen Exempla-Literatur zu untersuchen haben, beschreibbar zu machen.
260 Greg., Dial. II 8.8. – Aug. Civ. V 16; 18 (s. unten Anm. 915).261 Vgl. unten § 103; LUMPE 1250 (Sexualmoral), 1243 (Erziehung), 1242 (Kirchenrecht); CARLSON, passim.262 Vgl. LUMPE 1242 zum Schreiben der Synode von 378 an die Kaiser Gratian und Valentinian II. über Papst Damasus:non novorum aliquid petit, sed sequitur exempla maiorum (MANSI, Conc. III 627). – Zur missionarisch-apologetischenAnknüpfung an die Tradition antiker Exempla in der frühesten Glaubensverkündigung s. unten § 102 und LUMPE 1245 f.zum 1. Klemensbrief mit einer alttestamentlich-neutestamentlich-profangeschichtlichen Beispielreihe zum Thema derVerfolgung und des Martyriums; A. RONCONI, Art. Exitus illustrium virorum, in: RAC 6 (1966) 1258–68, hier 1267 zuden Märtyrerakten und deren direkter Anknüpfung an die antike Exitus-Literatur aufgrund des Archetyps von Sokrates.263 Vgl. unten §§ 97 f., 102.
108
Die schon frühe Verbreitung personaler Exempla aller Art, das Vorherrschen der rhetorisch-historischenBeispielmethode in der Patristik und noch in der gesamten gelehrten Literatur des Mittelalters (im Gegensatzzum erzählerischen Exemplum)264 dürften letztlich aus der besonderen Problematik der innerchristlichen(neutestamentlichen und hagiographischen) Exempla zu erklären sein. Die Exempla aus dem Evangelium, derApostelgeschichte und der Kirchengeschichte zeichnen sich einerseits wegen der Forderung der NachfolgeChristi gegenüber den außerchristlichen Beispielen durch einen kaum vergleichbaren religiösen Anspruch aus,sind diesen aber andererseits aus eben diesem Grund an Vielfalt, Buntheit, Anschaulichkeit und praktischerVerwertbarkeit zweifellos unterlegen. Wo immer die gleiche christiformitas in einer (freilich bisher niegesehenen) Menge von Beispielen der communio sanctorum gezeigt wird, entstehen grundsätzlich immer nurVarianten der einen Geschichte des Heils. Die Pluralität der „Geschichten“, wie sie die außerchristlicheÜberlieferung zur Verfügung stellt, war jedoch für alle in der einen Geschichte nicht angesprochenen Themendes praktischen Lebens unverzichtbar. So bot der riesige jüdische und heidnische Bestand an historischen undmythischen Geschichten von Helden, Weisen und Gerechten eine notwendige Ergänzung undKompensation.265
264 Im Unterschied zur Erforschung der Patristik gibt es m. W. keine Spezialuntersuchungen zum personhaften Exemplumdes Mittelalters, auch wenn mehrere Untersuchungen zu anderen Themen darauf eingehen; vgl. z. B. (nach der Bibliographie)die Arbeiten von BUISSON, ZIESE, KNAPP (Similitudo), JENNINGS; vgl. überdies von MOOS, Consolatio (wieAnm. 51) und ders., Die Trostschrift des Vinzenz von Beauvais für Ludwig IX. in: MlatJb 4 (1967) 173–218; UweRUBERG, Beredtes Schweigen … (MMS 32) München 1978, 93 ff.; Wolfgang HEMPEL, ‚Übermuot diu alte‘ … Dersuperbia-Gedanke und seine Rolle in der dt. Lit. des MA’s, Bonn 1970, 198 ff.; Hugo STEGER, David rex et propheta,König David als vorbildliche Verkörperung des Herrschers und Dichters im MA, Nürnberg 1961; Giorgio PADOAN, Il pioEnea, l’empio Ulisse, Tradizione classica e intendimento medievale in Dante, Ravenna 1977; H. WOLFRAM, Constantinals Vorbild für den Herrscher des hochmal. Reiches, in: MIÖG 68 (1960) 226–43; Hans Hubert ANTON, Fürstenspiegel undHerrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn 1968, 419 ff.; E. von FRAUENHOLZ, Imperator Augustus in der Geschichte u.Sage des MA’s, in: Hist. Jb 46 (1926) 86–122; Otto EBERHARDT, Via regia, Der Fürstenspiegel Smaragds v. St. Mihielu. seine literarische Gattung (MMS 28), München 1977, 442 f., 472, 604 ff., 628; K. HEITMANN, Zur Antike-Rezeptionam burgundischen Hof: Olivier de la Marche und der Heroen-Kult Karls d. Kühnen, in: ‚Die Rezeption der Antike‘ ed. A.BUCK, Hamburg 1981, 97–118 usw.265 PÉTRÉ (115, 120) zeigt überzeugend, wie Tertullian von der antiken Methode des rhetorischen Exemplums nicht lassenwill, während er inhaltlich die Überwindung der antiken exempla vetera durch die nova exempla des Christentums verkündet,die letzteren jedoch für seine Beweisziele nicht in ausreichender Zahl vorfindet und darum antike Exempla wenigstens durchalttestamentliche zu kompensieren sucht. Zum Aspekt der Kompensation vgl. oben A. 3, unten S. 455; A.W.CAPELLE/H.I. MARROU, Art. Diatribe, in: RAC III (1957) 990–1009, hier 1006 f.; J.M. MEHL, L’exemplum chezJacques de Cessoles, in: MA 84 (1978) 227–46, hier 231; R. THAMIN, S. Ambroise et la morale chrétienne au IVe s., Paris1895, 247 (zur Mühe, die ciceronischen Exempla von De officiis durch christliche zu ersetzen). Interessant ist auch dieambivalente Aussage Augustins (Civ. 1.24), aus der ebenso die Wertschätzung römischer Exempla-Praxis hervorgeht wie dasBedürfnis, den bisherigen Heroen-Kanon jüdisch-christlich abzulösen: nolunt autem isti contra quos agimus, ut sanctum Iob,qui tam horrenda mala in sua carne perpeti maluit quam inlata sibi morte omnibus carne cruciatibus, vel alios sanctos[…] Catoni praeferamus. Zur Übernahme antiker und alttestamentlicher Ergänzungsbeispiele vgl. auch LUMPE 1247 f.
109
32. Neben der grenzüberschreitenden Ausweitung des rein christlichen Exempla-Bestands erweiterte sich, wieschon angedeutet, als zweite Konsequenz der „monomythischen“266Eigenart des christomimetischenBeispiels der innerchristlich beispielhafte Personenkreis auf nicht-heroische, gewöhnliche und namenloseHandlungsträger. Das Überzeugungsziel liegt dabei im Nachweis der göttlichen Gnadenmacht und der durch siegegebenen Möglichkeit zu verbindlichen Taten; das Überzeugungsmaterial hierfür ist primär ein Exemplumgöttlicher Einwirkung, ein Wunder, eine plötzliche Bekehrung, ein erstaunliches Werk oder Opfer und nichtnotwendig (oder erst sekundär) eine bestimmte nennenswerte Persönlichkeit. Dieses Beispiel läßt sich mit derantiken rhetorischen Exemplum-Definition nur noch teilweise oder bedingt in Beziehung bringen. Denn einwesentliches Element derselben war die Bekanntheit und Vertrautheit des geschichtlichen oder mythischenVergleichsgegenstandes, so daß danach ein anonymes historisches Exemplum eine contradictio in adiectowäre. Doch die rhetorisch geschulten Kirchenväter konnten den Heroenkatalog historischer Bildung ohnehinentbehren, wenn sie sich in der Art der popularphilosophischen Diatribe an breitere Volksschichtenwandten.267 Die res certa des unmittelbar evidenten Beispiels war dann das alltäglich Naheliegende, eine dennormalen Lebensumständen ähnliche Ausgangslage.
266 Der Ausdruck stammt von Odo MARQUARD: Lob des Polytheismus, Über Monomythie und Polymythie (1978), in:ders. Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, 91–111. Vgl. auch H. BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, Frankfurt1979, 9 ff.; und ders. Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos, in: Terror und Spiel, Poet. u. Her. 4 (1971)11–66, bes. 20 zu einer Unterströmung mythologischer Liberalität in Konkurrenz zur absoluten Verbindlichkeit und zumdogmatischen Ernst der christozentrischen Perspektive (vgl. auch unten Anm. 431a).267 Vgl. oben § 23, unten S. 124.
110
Während Aristoteles für die Volksrede das selbsterfundene Beispiel (Fabel oder Parabel) empfohlen hatte,268
betonte die christliche Predigt den historischen Charakter ihrer „unheroischen“ Geschichten, oft sogar mitdem ausdrücklichen Hinweis auf Augenzeugen.269 Vielleicht bildete der Historizitätsanspruch einenunentbehrlichen Ersatz für das Grundprinzip des rhetorischen Exemplums: für die Plausibilität des Analogenund Wiederkehrenden in menschlichen Situationen.270 Wo das Außergewöhnliche, das Wunder überzeugensoll, muß es ebensosehr als historische Tatsache bezeugt werden wie als Gnadenbeweis Gottes, der jederzeit undüberall, auch im einfachsten Menschen, erscheinen kann.
33. Für Erfolg und Verbreitung christlicher Kurzgeschichten von mehr oder weniger bekannten Heiligen,Wüstenvätern, Einsiedlern, Mönchen und Büßerinnen sorgte zweifellos auch die formgeschichtliche Analogiezu den erwähnten hellenistischen Diversifikations- und Auflösungserscheinungen des antiken Exemplums. Dievielfältigen Beziehungen zwischen christlichen und profanen Formen des Erzählens im Rahmen derspätantiken Gattungskrisen bzw. Gattungsmischungen zwischen Biographie, Roman, Anekdote undNaturwunderbericht sind in der Hauptsache bekannt und müssen hier nicht ausführlicher dargestellt werden.Nur ein für die Unterscheidung der Hauptfunktionen des Exemplums im Mittelalter wichtiges Kriterium sollbesonders erwähnt werden: Die gesamte spätantike Formenfülle von den heidnischen Philosophenleben,Apophthegmata, Aretalogien, Memorabilien, Abenteuerund Reiseromanen usw. bis zu den christlichenapokryphen Apostelgeschichten, Mönchsviten, Heiligenlegenden, Mirakeln usw.271 kann unter demfunktionalen
268 Vgl. oben S. 51 ff. zu Rhet. II 20.7, 1394a.269 Vgl. LE GOFF, Vita et pré-exemplum 111 f. zu Gregors Berufung auf direkte „Informanten“ als „Autoritäts-Garanten“;WOLPERS (wie Anm. 232) 48 zum Augenzeugenbericht-Topos nach der Antonius-Vita des Evagrius; vgl. auch obenAnm. 240.270 Nach REITZENSTEIN (wie Anm. 147) 6, 19 ff. ist die Berufung auf historische Verbürgtheit und Urkundlichkeit einbesonderes Kennzeichen der vorchristlichen und christlichen Aretalogie.271 Vgl. etwa Carl SCHNEIDER, Geistesgeschichte des antiken Christentums II, München 1954, 28 ff., bes. 33:„Hieronymus schreibt […] Mönchsgeschichten, in denen gehörnte Bocksfüßler auftreten, feurige Wagen in Abgründenverschwinden, der Heilige auf wunderbare Weise einem Rennfahrer zum Sieg in der Rennbahn verhilft, ferner wahnsinnigverliebte Frauen zu Nonnen exorzisiert, Teufel aus Kamelen ausgetrieben, der Wein und die Hülsenfrüchte Geiziger durchWunder ungenießbar gemacht werden.“ Ebd. 35: „… die unheimlich anwachsende Flut von Märtyrer-, Heiligen- undMönchsbiographien, die die ganze Skala von schlichten Lebensbeschreibungen über den überschwenglichen Panegyrikus biszu den albernsten und ekelhaftesten Wundergeschichten in grausiger Geschmacklosigkeit durchläuft.“ (Solche Formulierungenhaben den diskussionsstimulierenden Vorteil herzhafter „Unausgewogenheit“.) Vgl. auch DEMANDT, Geschichte (wieAnm. 169) 265 ff.; O. GIGON, Antike Erzählungen über die Berufung zur Philosophie, in: MH 3 (1946) 1–21; C.H.TALBERT, Biographies of Philosophers and Rulers as Instruments of Religious Propaganda in Mediterranean Antiquity, in:Aufstieg und Niedergang d. röm. Welt (ed. TEMPORINI/HAASE) II 16.2, Berlin 1978, 1619–51; BALDWIN (wieAnm. 160); REITZENSTEIN (wie Anm. 147); VOGÜÉ (wie Anm. 240) 110 ff.; HERZOG, Orosius (wie Anm. 197) 83 f.;J.B. BAUER, Novellistisches bei Hieronymus… in: Wiener Studien 74 (1961) 130–7; KECH (wie Anm. 234); R. SÖDER,Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Lit. der Antike, Stuttgart 1932/Darmstadt 1969, bes. 186 ff.;Arnaldo MOMIGLIANO, The Conflict between Paganism and Christianity in the IVth cent. A.D., Oxford 1963, bes. 77 ff.;A.J. FESTUGIÈRE, Lieux communs littéraires et thèmes de folklore dans l’hagiographie primitive, in: Wiener Studien 73(1960) 123–52; E. PICHÉRY, Jean Cassien, Conférences I (SC. 42) Introd. 60 ff. und vor allem die Beiträge in:‚Christianisme et formes littéraires de l’Antiquité tardive en Occident‘ (Entretiens sur l’Antiquité classique, Fondation Hardt23) Genf 1977, 1–40; A. CAMERON, Paganism and Literature in Late Fourth Century Rome; 41–100: M. FUHRMANN,Die Mönchsgeschichten des Hieronymus, Formexperimente in erzählender Literatur; 413–73: J. FONTAINE; Unité etdiversité du mélange des genres et des tons chez quelques écrivains latins de la fin du IVe s. Vgl. auch oben S. 69, unten§§ 36, 46 f., 82, 101.
111
Oberbegriff „Exemplum“ theoretisch den beiden Zielen der „Weltdeutung“ oder des „Weltersatzes“ (M.Fuhrmann) dienen und läßt sich insofern in Gegensatzpaaren beschreiben wie: Verpflichtung–Entlastung,Erbauung–Unterhaltung, Erkenntnis–Neugierbefriedigung, imitatio/admiratio – delectatio.272 Bei derEinzelinterpretation sind Funktionsunterscheidungen dieser Art jeweils eine Quelle gelehrterAuseinandersetzungen. Für die mittelalterliche Entwicklung kann vorweggenommen werden, daß dieUnterschiede schwerlich gattungsspezifisch auszulegen sind, und etwa „ernste“ Persönlichkeitsexempla nichtohne weiteres trivialen Unterhaltungsanekdoten entgegengesetzt werden dürfen. Der Grad derIndividualisierung oder Anonymität des Handlungsträgers wirkt nicht notwendig auf die Intensität derErnstbedeutung. Ein berühmter Heiliger kann als Wundertäter und „furchterregender Gottesmann“ nurStaunen, aber keine Nachfolge bewirken, und die Anekdote über einen privaten, historisch unbedeutendenVorfall kann exemplarisch effizient zur imitatio anregen. Die Unterscheidung ist sowohl produktions- wierezeptionsästhetisch vor allem deshalb so schwierig, weil die christlichen Exempla insgesamt als Hilfsmittel,Blickfang oder Anreiz der Botschaft
272 Vgl. M. FUHRMANN (wie Anm. 271) 82 ff. (imitatio-admiratio nach Gregors Dialogi), 87 (Weltdeutung–Weltersatz);ders., Wunder und Wirklichkeit, Zur Siebenschläferlegende und anderen Texten aus christlicher Tradition, in: Poet. u.Herm. 10, ‚Funktionen des Fiktiven‘, München 1983, 209–224, bes. 211 ff.; vgl. auch oben Anm. 244 und unten S. 129 ff.
112
unterstellt sind, gleichviel ob sie historische Personen oder beliebige Vorkommnisse darstellen, ob sieunmittelbare Aufforderungen oder sanfte Andeutungen, ernste Mahnungen oder witzige Abschweifungenenthalten. Dieses Instrumentarium des Kerygmas umfaßt alles, was für moderne Vorstellungen ästhetischauseinanderfällt, vom Erhabensten zum Trivialsten, und stellt es weltanschaulich gleich.273 Die Forschungzum Exemplum hat bei aller Uneinheitlichkeit hier doch oft denselben Hang zu irgendeiner falschenEindeutigkeit gemein: Es ist kein Zufall, daß romantisch gestimmte Gelehrte des 19. Jahrhunderts einwesentlich schwankhaftes Exemplum aus der mittelalterlichen Predigtliteratur als ursprünglichevolksliterarische Gattung nachzuweisen versucht haben, indem sie durch unverkennbare Manipulationen denreligiösen Kontext übergingen, während Erforscher der „Volksfrömmigkeit“ gerade solche Schwankexemplaals Dekadenz oder Säkularisierungsphänomen gegenüber dem wahren kerygmatischen christlichen Exemplumhinzustellen suchten.274 Von letzterer Einstellung unterscheiden sich heutige Literaturtheoretiker kaumsubstantiell, die ihre Abneigung gegen die „Traumfabriken“ moderner Kulturindustrie auf die harmloseFabulierfreudigkeit antiker und mittelalterlicher Andekdotenerzähler projizieren und ein vermeintlich nichtmehr imitativ-normgebendes, nur noch rührend unterhaltsames, surrogathaft triviales Exemplumkritisieren.275 Die Zweideutigkeit unterhaltender Belehrung besteht in der christlichen Literatur seit denapokryphen Evangelien. Sie bringt jede nicht-deskriptive, weltanschaulich wertende
273 Vgl. das kritische Diskussionsvotum von J. FONTAINE zum Referat von M. FUHRMANN (wie Anm. 271) 98 f. überdie Koexistenz der drei Ziele imitatio, admiratio und delectatio sowie oben S. 96 f., unten S. 117 f., 228 ff.274 Vgl. SCHENDA, Exemplaforschung … 69 ff. zur romantischen Exemplaforschung des 19. Jhs.; B. GEREMEK,L’exemplum et la circulation de la culture au moyen âge, in: Rhet. et Hist. 153–79, bes. 157 ff. zu TUBACHS „Decline“-Theorie; J.-Cl. SCHMITT, ‚Religion populaire‘ et culture folklorique, in: Annales C.E.S. 1976, 941–52 zu E.DELARUELLE und allgemein zu fragwürdigen Formen der „Volksfrömmigkeits“-Forschung; s. auch unten § 38.275 Diesen Eindruck erwecken stellenweise M. FUHRMANN (oben Anm. 272 f.); R. HERZOG, Metapher–Exegese–Mythos,in: Poet. u. Herm. IV, ‚Terror und Spiel‘, München 1971, 157–85, hier 175 ff.; ders., Probleme der heidnisch-christlichenGattungskontinuität am Beispiel des Paulinus von Nola, in: Christianisme et formes litt. (wie Anm. 271) 273–423, hier377 ff., 394 ff.; H.R. JAUß, Negativität (wie Anm. 102, 313, 321 ff.; ders., Ästh. Erfahrung … 268 ff. (270 mitausdrücklichem Bezug auf die modernen Massenmedien). Als grundsätzliches Gegengift vgl. Umberto ECO, Nachschrift zum‚Namen der Rose‘, München 1984, bes. 76 ff.; W. BRÜCKNER, Art. Erbauung, in: EM s. l. (1983) 108–20, bes. 117 f.(gegen die anachronistische Trennung der drei Funktionen Belehrung, Erbauung, Unterhaltung bzw. Fachliteratur, religiöseLiteratur, Belletristik gerade hinsichtlich des Exemplums).
113
Betrachtung in Verlegenheit oder in die Gefahr anachronistischer Mißverständnisse.276
3. Das „Predigtmärlein“ des späteren Mittelalters im Verhältnis zum rhetorischen Exemplum
Das „volkstümliche“ Exemplum mittelalterlicher Prediger als bestimmter historischer Sonderfall des paränetisch-illustrativenJedermannsbeispiels (§ 34), d. h. einer ebenso universalen Identifikationsform wie das argumentativ-induktive Heldenbeispiel(§ 35). Hypothesen zur Entwicklung und Interaktion dieser stets nebeneinander gepflegten Beispielarten von der Antike zurRenaissance (§ 36), im früheren (§ 37) und im späteren Mittelalter (§ 38).
Guglielmo … rispose: ‚Come nei sermoni per toccare l’immaginazionedelle pie folle occorre inserire exempla, non di rado faceti, cosí ancheil discorso delle immagini deve indulgere a queste nugae …‘, … MaJorge… riprese… a parlare: ‚Nostro Signore non ha avuto bisogno ditante stoltezze per indicarci la retta via. Nulla nelle sue parabolemuove al riso, o al timore.
Umberto Eco, Il nome della rosa(wie Anm. 767) 87, 89.
34. Bei dem Versuch, den Weg des antiken rhetorischen Exemplums in die christliche Literaturnachzuzeichnen, haben wir uns auch einer Vorstufe des späteren mittelalterlichen „Predigtmärleins“ genähert.Wie es zu diesem selbst gekommen ist, welche Zwischenglieder zwischen der Historia Lausiaca, den Verbaseniorum, Vitae patrum oder Gregors Dialogi und dem Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbachoder den Exempla Jakobs von Vitry
276 Einer der letzten Beiträge zum Thema der christlichen Wundergeschichte: Chr. GNILKA, St. Martin und die Möwen, in:Literaturwiss. Jb. d. Görres-Ges. NF 25 (1984) 45–66, beantwortet die Frage der christlichen Unterhaltungsästethik durchdezidierte Ausklammerung. Die punktuell kritisch gegen FONTAINE gerichtete Deutung einer für uns eher befremdlichen,um nicht zu sagen „skurrilen“ Wundergeschichte bei Sulp. Sev. gibt sich prinzipiell als Aufforderung, spätantike undmittelalterliche Erzählungen dieser Art (bis hinauf zu den Franziskus-Legenden) von innen heraus, aus „dem geistigenSystem, dem sie angehören“, aus „dem christlichen Geist“ zu betrachten und die „objektive Grundlage“, ja denWunderglauben der Berichterstatter zu respektieren. An das historische Einführungs-Postulat zu erinnern, mag gegenanachronistisches Verkennen authentischer spiritueller Intention etwa eines Hagiographen berechtigt sein; es greift aber zukurz, wenn der Interpret nach befriedigender Rekonstruktion vergangener Wirklichkeit (deren Objektivität oder Subjektivitäteine außerwissenschaftliche Standpunktfrage ist: s. oben S. 76 f.) nicht vergleichend und urteilend zu sich selbst und seinerWelt zurückkehrt. Verständnis beruht nicht auf Identifikation, sondern auf Intersubjektivität. Die Feststellung, ein Wundersei „geglaubt“ worden, ist wissenschaftlich so viel wert, wie die Ableitung des Wunderberichts aus profanen heidnischenModellen oder die Analyse narrativer Gattungsstrukturen und rhetorischer Strategien. Der in der theologischenBibelforschung längst überwundene Antagonismus zwischen thematischen und technischen Untersuchungen versperrt in denmit christlicher Literatur befaßten Disziplinen leider noch oft den Zugang zu den hermeneutisch aufregendsten Fragen nachder Andersartigkeit früherer Denk- und Wahrnehmungsformen. Wirklich diskussionswürdig ist doch gerade die uns radikalfremde Paarung von Gläubigkeit und ästhetischem Spieltrieb, von religiöser Überzeugung und bedenkenlosem „l’Art pourl’Art“. Vgl. unten §§ 63–8, 100 f., S. 166 f., 335, Anm. 280.
114
liegen, ist für das komparatistische Interesse an einer allgemeinen Geschichte mittelalterlicher Formen desExemplums nur eine Teilfrage. Dieses Sonderproblem ist wohl deshalb noch weitgehend ungelöst, weil einForschungszweig das homiletische Exemplum des späteren Mittelalters als ein Stück autonomer Volksliteraturohne Bezug zu den fernen spätantiken Voraussetzungen und zu den gleichzeitigen rhetorisch-historischenExempla des lateinischen Mittelalters zu betrachten pflegt. Das Entwicklungsproblem kann auch hier nichtgelöst werden, doch soll es etwas differenzierter dargestellt werden.
Während für das rhetorische Exemplum alte Definitionen aus Antike und Mittelalter leicht beigebrachtwerden können, gibt es für das „volkstümliche“ oder homiletische Exemplum fast nur moderne: DieForschung muß sich hier mit selbstgebildeten, d. h. deskriptiv ermittelten und a posteriori synthetisierten(oder konstruierten) Begriffsbestimmungen behelfen, die entsprechend heterogen und widersprüchlichausfallen.277 Damit soll nicht gesagt
277 Vgl. oben Anm. 96. – Das Fehlen einer Theorie des Exemplums in den Artes praedicandi und Exemplasammlungenregistrieren: H. CAPLAN, Rhetorical Invention in Some Medieval Tractates on Preaching, in: Spec. 2 (1927) 284–95, hier294; DELCORNO (wie Anm. 108) 5; BERLIOZ (wie Anm. 99) 118 betont, daß die einzigen Exempla-Definitionen dermittelalterlichen Rhetorik aus der Rhetorica ad Herennium abgeleitet sind (S. 57 f., 158), doch „ces définitions ne rendentabsolument pas compte du sens que ce terme revêt dans le cadre de la prédication médiévale“ (was eher gegen BERLIOZ‘Exemplum-Begriff als gegen die Bedeutung der antiken rhetorischen Definition im Mittelalter spricht). SCHENDA(Exemplaforschung… 77) leitet seine Liste moderner Definitionen so ein: „Bei der Definition des Begriffes Exemplumbeginnt die Fragwürdigkeit der ganzen Forschungsmaterie […] Das Mittelalter hat weder ein Bewußtsein seiner selbst nocheine einheitliche Exempla-Theorie hervorgebracht.“ VITALE-BROVARONE (91) hält die beiden Arten einer Definition, diebegrifflich allgemeingültige oder logisch-strukturale seit Aristoteles und die historisch-konkrete, deskriptiv aus denGepflogenheiten der Bettelmönche abgeleitete für grundsätzlich „unversöhnbar“. Jeder Versöhnungsversuch müsse auf einWortspiel hinauslaufen. So wohltuend sich diese Skepsis von der unreflektierten Selbstverständlichkeit abhebt, mit der dieVolksliteraturforschung von „ihrem“ Exemplum als dem Exemplum schlechthin spricht, könnte derart jegliche allgemeineAussage über historische Einzelphänomene verboten werden. Nichts spricht dagegen, auch das Predigtmärlein als eine Art desExemplifizierens literaturanthropologischkomparatistisch mit anderen historischen Exempla-Formen zu vergleichen. Die„inconciliabilità“ des aristotelischen Paradeigmas und des mittelalterlichen homiletischen Exempels beruht primär auf dererschlichenen Repräsentationsfähigkeit des letzteren für eine allgemeine Exemplum-Definition sowie auf einer „Verfestigungvon wissenschaftlichen Hilfsbegriffen zu Kategorien der Geschichte selbst“ (BRÜCKNER, Historien 22). Sehr richtig fordertdemgegenüber N. ZORZETTI (L‘ „esemplarità“ come problema di „psicologia storica“: un bilancio provvisorio, in: Rhet. ethist. 147–52, hier 147) eine Darstellung des Exemplums als „Kulturgeschichte der induktiven Argumentation“ auf der Basiseines „kategorialen Mentalitätsbereichs, eines anthropologisch gegebenen Feldes, innerhalb dessen jede historisch bestimmteKultur eigene Arten der Induktionsbegründung organisiert.“
115
sein, daß das schwer faßbare Phänomen ein gelehrtes Hirngespinst sei. Bedenklich stimmt nur die Art, mit derauf diesem Gebiet aus kulturgeschichtlichen Einzelbeobachtungen anthropologische und literaturtheoretische„Universalien“ extrapoliert werden. Es wäre methodisch vertretbarer, arbeitshypothetisch einmal von dentraditionellen, mutmaßlich generalisierbaren Definitionen der Rhetorik und philosophischen Hermeneutikauszugehen und dann zu untersuchen, ob und wie stark das spätmittelalterlich-frühneuzeitliche„Predigtermärlein“ davon abweicht.278
Unbestritten sind allerdings einige deskriptiv gewonnene Merkmale dessen, was als homiletisches Exemplumgilt: Es bezieht sich nicht notwendig auf eine berühmte Gestalt der Geschichte, sondern überwiegend auf den„kleinen Mann“, den die ganze Menschheit repräsentierenden anonymen quidam, den Alltagsmenschen.(Selbst wenn geläufige Berühmtheiten wie Alexander oder Salomo nicht fehlen, so sind solche Namen meistvertauschbar und mühelos durch ein unbestimmtes rex quidam zu ersetzen.)279 Von diesem beliebigen
278 Kritik am mediävistischen Hysteron-Proteron des homiletischen Exemplum-Begriffs auch bei SCHENDA,Exemplaforschung … 69 ff.; W. BRÜCKNER, Art. Exempelsammlungen, in: EM, Berlin 1983, s. l. 610;DAXELMÜLLER, Art. Exemplum, ebd. 628, 637; BRÜCKNER, Historien 13 ff. (romantische „Volksseele“- und„Urformen“-Vorstellungen im Gewand moderner strukturaler Erzählforschung); Reiner ALSHEIMER, Das MagnumSpeculum Exemplorum als Ausgangspunkt populärer Erzähltraditionen, Bern 1971, 57 f. Vgl. auch unten Anm. 320.279 Vgl. FRIEDRICH 55 f. zur biographisch-personalen, den ganzen Lebensumfang implizierenden Bedeutung desrömischem Exemplums im Vergleich zu dem ereignishaften, einen Einzelvorfall novellistisch ins Zentrum stellendenmittelalterlichen Exemplum; von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) I/II § 1030 zu der im späteren Mittelalter zubeobachtenden Anonymisierung: ursprünglich bekannte individuelle Exempla der römischen Geschichte oder des AltenTestaments werden namenlos erzählt, nicht im Sinne der kulturellen Anspielung, sondern aufgrund einer Senkung desBildungsniveaus, der pragmatischen Anpassung an Wiederverwendungszwecke oder einer Entheroisierungstendenz,schließlich auch aus der Innovationsabsicht, mit der abgeschliffene Exempla durch Verbergen allzu geläufiger Namen als neuund anekdotisch ausgegeben werden sollen. Vgl. auch G. CARY, The Medieval Alexander, Cambridge 1956, 143 ff., 189 ff.zum klischeehaften Alexanderbild der Prediger. – So allgegenwärtig das quidam in homiletischen Exemplasammlungen ist,gibt es immerhin bereits bei Valerius Maximus (z. B. 3.7 ext. 8, 2.6.8) ein das „Volk“ repräsentierendes quidam; dazu vgl.GUERRINI 16).
116
Helden berichtet das Exemplum aber häufig ganz ungewöhnliche, sonderbare, exzentrische Ereignisse,Kuriositäten und Wunder, die als die „wahre Geschichte“ zu gelten haben und die Folgerung einer moralischnützlichen Lehre erlauben, nicht anders im Grunde als beim memorabile eines bestimmten historischenHelden.280
35. Der entscheidende Unterschied zwischen diesem „volkstümlichen“ und dem „hohen“ Exemplum liegt indem jeweiligen, offenbar wirkungsästhetisch publikumsorientiert eingesetzten Geschichtsbegriff. In derrhetorischen Theorie gibt es einen Hinweis auf diesen Unterschied: Das Paradeigma im engeren Sinn handeltimmer und überall von historischen Personen; diese können gewöhnlich oder außergewöhnlich, „wie du undich“ oder heroisch wie nur Ausnahmen, „der Erwartung gemäß“ oder „gegen die Erwartung“ sein. Daraufberuhen zwei Beispielarten nach dem logischen Schema der
280 Zum Übergang zwischen Wunder und Kuriosität vgl. WOLPERS (wie Anm. 232) 26; Glending OLSON, Literature asRecreation in the Later Middle Ages, Ithaca/London 1982, 57 ff.; DAXELMÜLLER, Exemplum 629; VOGÜÉ (wieAnm. 240) 41 ff. (romanhafte Konzession an den hellenistischen „goût du miracle dans l’élite“ schon bei Gregor d. Gr., undnicht eine „ursprüngliche, volkstümliche“ Erscheinung). – Wenn LE GOFF, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 29 f. dieEntpersonalisierung des mittelalterlichen im Vergleich zum römischen Exemplum eine „réification“ nennt (statt der autenticapersona [s. unten Anm. 375] bestimme alles der lehrreiche Inhalt des dictum oder factum), so übersieht er, daß auch der„vertauschbare“ oder „beliebige“ Mensch der eigentliche Handlungsträger des Identifikationsbeispiels ist. – Zur Ablösung desHelden durch quidam-Menschen vgl. §§ 26 f., 32, 37, 43, 57; DORNSEIFF 209; MOMIGLIANO (wie Anm. 271) 118;MEHL 242; von MOOS, Consolatio (wie Anm. 51) I/II §§ 36 ff. (Tröstlichkeit des Gewöhnlichen). – Zu den Gattungen inder Nachbarschaft des entheroisierten Exemplums vgl. DAXELMÜLLER, Ex. 629; BRÜCKNER, Hist. 20 f. (Kasus,Memorabile, Mirakel, Sage, Legende); ders. Erbauung (wie Anm. 275) 105, 130 ff.; OPPEL, Ex. u. Mirakel, passim;ROTH 33 ff. Vgl. die für das Predigt-Exemplum paradigmatische Empfehlung ungewöhnlicher Vergleiche bei Guibert vonNogent, Lb. quo ordine sermo fieri debeat (PL 156) 30 A: […] non modo in voluminibus divinis, sed etiam pene in hisomnibus quae subiaceant oculis, comparationes satis idoneas in exemplum et significantias utiles illarum quas ex usuassiduo nihili pendimus rerum uberrime venit, […] tanto sunt gratiosiora quanto minus auditoribus usitata. Weitereähnliche Stellen s. unten in Anm. 921.
117
Interdependenz von Teil und Ganzem:281 Was allen oder den meisten zu geschehen pflegt oder für siemöglich ist, das trifft erst recht auf den Einzelnen als Glied einer Allgemeinheit zu; was einem Einzelnenunerwartet geschieht oder möglich ist, das gilt als Möglichkeit grundsätzlich auch für alle anderen seiner Art(wobei die Zugehörigkeit zum genus allerdings zusätzlicher Begründung bedarf.). H.R. Jauß hat in Anlehnungan die aristotelische Poetik einen hier beachtenswerten Unterschied der Identifikationsmöglichkeitenherausgearbeitet: Der Held kann entweder „besser (bzw. schlechter) als wir“ oder „ähnlich wie wir“ sein.Daraus ergibt sich das Gegensatzpaar von Bewunderung und Mitleid, von „admirativer und sympathetischerIdentifikation“ mit den zwei Exempla-Typen des außergewöhnlichen, überragenden Helden oder Heiligen unddes „alltäglichen Helden“ oder „mittleren Menschen“, dem Besonderes, Wunderbares zustößt.282 Man könnteauch von zwei
281 Vgl. die pseudo-aristotelische Rhetorik des Anaximenes von Lampaskos (bei Aristot. 8.1–9.1429a 25–28; 8.9–10,1429b, 26–29) zu den Beispielen k a t Å løgon (mit der Meinung der Hörer einig gehende, selbstverständliche,erwartungsgemäße, der Regel entsprechende) und den Beispielen parÅ løgon (der landläufigen Ansicht zuwiderlaufende,unerwartete, überraschende, die herrschende Meinung stürzende Ausnahmefälle). In der lateinischen Übersetzung (ed. M.GRABMANN, Eine lat. Übersetzung der pseudo-aristotelischen ‚Rhetorica ad. Alexandrum‘ aus dem 13. Jh., in: SB Bayer.Akad. Wiss., phil.-hist. Abt. 1931/2 H. 4, München 1932, 44 f.) heißen die Begriffe der zwei modi exemplorum:secundum/contra rationem. Bei Apsines (Rhet. SPENGEL I 372.28–373.8) wird dasselbe auf historische Personenangewendet, die entweder vertraut, gewohnt oder fremd, merkwürdig und außergewöhnlich sein können. Die Einteilungentspricht der aristotelischen Sentenzen- oder gn©mai-Lehre (Rhet. II 21, 1394 a–b) mit den zwei Gruppen der allgemein-anerkannten, weiter nicht zu begründenden und der paradoxen, umstrittenen Sätze (zu den Endoxa s. S. 4, 196 f., 299 ff.,319 ff., 426). Boethius behandelt in Diff. top. (PL 64) 1191 A (einer im Mittelalter für Logik und Jurisprudenz wichtigenStelle) den Unterschied im Rahmen der Lehre vom dialektischen locus a maiore ad minus und a minore ad maius: Maximapropositio: Si id quod magis videtur inesse, non est, nec id, quod minus videbitur inesse, inerit […] A minoribus veroconverso modo […] Maxima propositio: Si id quod minus videtur inesse, inest, id quod magis videbitur inesse, inerit.Immer ist der Einteilungsgesichtspunkt der rezeptionsbedingte Wahrscheinlichkeitsnachweis aus der Vorstellungswelt desPublikums. Beide Arten können im Streitgespräch sowohl beweisend für wie entkräftend gegen den Bezug von exemplumund causa eingesetzt werden (S. 428). Vgl. MARTIN, Ant. Rhet. 120 ff.; ROLLINSON (wie Anm. 156) 152 f.; GEBIEN25 f.; DORNSEIFF 215; HONSTETTER 191; FUHRMANN, Exemplum … 451 f.; ders., Rhetorik 96 f.; LAUSBERG§ 396 f.; OTTE (wie Anm. 552) 204 ff. und unten §§ 91 f.282 Aristot. Poet. I 2, 1448a; vgl. H.R. JAUSS, Ästhetische Identifikation. Versuch über den literarischen Helden, in: ders.,Ästhetische Erfahrung 244–292, bes. 250 f.; Negativität (wie Anm. 103) 311–39, bes. 316 ff. Die beiden poetischenIdentifikationsmöglichkeiten der Bewunderung und des Mitleids liegen allerdings auf einer anderen Ebene als dierhetorischen Begriffe der Nachfolge (imitatio) und Entlastung (delectatio), können aber mit ihnen zusammenfallen. DasTrostexempulm z. B. verbindet die poetischen und rhetorischen Kategorien insofern, als es durch das Motiv der Gleichheitaller leidenden Menschen sympathetisch beschwichtigt und entlastet (daher die diaktisch illustrative und austauschbareAufzählung von exempla de communi conditione) und andererseits durch bewunderns- und nachahmenswerte Beispieleheroischer Leidüberwindung (exempla fortitudinis historisch individueller Art) aufrichtet. Doch gerade das hier zur imitatioanregende admirabile kann sich vom rhetorischen Ziel ablösen und die bloß ästhetische Funktion der delectatio durchWunder und Sensationen übernehmen. Vgl. §§ 33, 38.
118
Analogiemethoden sprechen, deren jeweilige Wahl literatursoziologisch und historisch zu erklären ist, sosehrbeide anthropologisch generalisierbar sind: Entweder wird vom hervorragenden Einzelnen über ein implizitnormatives, allgemeineres tertium comparationis auf eine partikuläre Situation geschlossen, und es entstehtdas (individual-) historisch-induktive Exemplum; oder aber eine beliebige Allgemeinheit, tendenziell die ganzeMenschheit, demonstriert an einer konkreten, ungewöhnlichen Situation, was allen und jedem ratsam ist, undes bildet sich das didaktisch-paränetische oder volkspredigthafte Exemplum.283
283 Ausdrücklich begründet Hieronymus den sermo simplex für ein ungebildetes Publikum in Ep. 49.4 (CSEL 54) 350 alseine an universo hominum generi gerichtete Rede; vgl. H. BEUMANN, Gregor von Tours und der sermo rusticus, in:‚Spiegel der Geschichte‘, Festschr. M. BRAUBACH, Münster 1964, 69–98, hier 91; SIMON II 75; H. HAGENDAHL,Piscatorie et non Aristotelice, in: Festschr. B. KARLGREN, ‚Septentrionalia et Orientalia‘, Stockholm 1959, 184–93; W.HAUG, Literaturtheorie im deutschen Mittelalter, … Eine Einführung, Darmstadt 1985, 20 ff. – Nach STIERLE (356) istdas Exemplum grundsätzlich (als das implizierte Ziel des „moralischen Satzes“) durch Exemplarität oder Modellhaftigkeitdefiniert; dabei verbinden sich „Satz“ und „Medium“ entweder durch „Expansion“ des Satzes (der allgemeinen Wahrheit, derSentenz) zur Erzählung oder durch „Reduktion“ der Geschichte auf den einschlägigen Ausschnitt, den isolierten Punkt, indem das Allgemeine aufleuchtet. „Expansion der Sentenz“ und „Reduktion der Geschichte“ sind in jedem Exemplumgegeben und ermöglichen überhaupt erst eine gemeinsame Definition des didaktischen und des historisch-induktiven Typs.Die beiden Arten unterscheiden sich nur durch Vorherrschaft der Sentenz oder der Geschichte. DAVID, Présentation zu Rhét.et hist. (12 ff.), unterscheidet die beiden Modalitäten nach den zwei Bedeutungen des Wortes „Geschichte“(„conte“/„histoire“, Erzählmedium/Ereignisfolge), dabei gilt das (allerdings unzulässig zu „dem“ mittelalterlichen Exemplumverallgemeinerte) Predigtexemplum als narrativer „Appell an die Gesamtmenschheit“ („conte“), das historische Exemplum(ebenso einseitig mit dem antiken identifiziert) als Appell an die cives, sich an ihre große Vergangenheit zu erinnern(„histoire“). JAUSS (Ästh. Erfahrung, 351 ff.) nennt die beiden Arten „Memorabile“ (nach JOLLES: dazu oben Anm. 68)und „Exemplum“, wobei letzteres ausschließlich für Lehrstück steht. Das eine will orientieren (induktives Exemplum), dasandere dozieren (didaktisches). Warum hier „Lehre“ so abschätzig im Sinne von Kinderlehre, Lehre aus der Geschichte,Belehrung aufgefaßt wird, wäre eine andere begriffsgeschichtliche Untersuchung wert. Vgl. auch § 14, S. 172 f. zur modernenTrivialisierung der Lehrhaftigkeit hinsichtlich kleiner Gattungen wie Fabel, Parabel, Anekdote; BAUSINGER, Schwank (wieAnm. 150) 119 ff., 124 gegen intellektualistische Verkennung der Vitalität des Didaktischen in der Volkskultur;KOSELLECK, Vergangene Zukunft 137 zur heutigen Verkümmerung des bis ins 18. Jh. selbstverständlichen Sinnes fürVergleichbarkeit und Lernbarkeit alles Geschichtlichen (vgl. auch unten § 107).
119
Der Unterschied berührt (ohne sich mit ihnen zu decken) früher getroffene Unterscheidungen: diejenigezwischen den Arten des „Falls“ in Bezug auf die „Regel“284und diejenige zwischen den Arten des Vergleichs inBezug auf die rhetorische Funktion.285 Hier interessiert der Gegensatz zwischen induktivem und illustrativemBeispiel unter dem Blickpunkt der jeweiligen Aktualisierung des historischen Materials. Im induktivenExemplum ist der Geschichtsbezug wesentlich intensiver, weil das historische Ereignis selbst die Lehredarstellt, auch wenn diese noch interpretativ herausgeholt werden muß. Im paränetischen Exemplum dientHistorizität nur als Beglaubigungsmittel einer allgemeinen Wahrheit, die auch ohne diese Geschichte besteht;die ebenso gut durch andere, nicht-historische Veranschaulichungsformen wie Fabel und Parabel verdeutlichtwerden könnte.286 Da hier die lehrhafte Botschaft so viel
284 Vgl. §§ 11–15.285 Vgl. § 17.286 Zum Verhältnis von Exemplum und Fabel s. §§ 13 f., 17 f., S. 65 ff. STIERLE (356) unterscheidet (im GefolgeLessings) die Funktionen so: „Das Allgemeine erscheint in der Fabel als Besonderes, im Exemplum im Besonderen. DasAllgemeine ist einmal repräsentiert, das andere Mal impliziert.“ Diese Bestimmung läßt sich auf unsere beiden Exemplum-Arten übertragen: Der Fabel entspricht das paränetische Exemplum; STIERLES „Exemplum“ erhält hier das Beiwort„induktiv“. Denn die einfache Unterscheidung Fabel–Exemplum macht die Fabel zu lehrhaft, das Exemplum zu „kasushaft“.Auch PERELMAN (wie Anm. 10) 120 f. setzt das induktive Exemplum mit dem Exemplum überhaupt gleich, das er vonder „illustration“ unterscheidet (vgl. oben Anm. 58), wobei er jedoch mit Kombinationen beider Arten rechnet: „Le passagede l’exemple à l’illustration se fait d’une façon insensible quand il s’agit, d’abord, de justifier une règle avant de l’illustrer.“Wenn es heißt (F.P. KNAPP, Das lat. Tierepos, Darmstadt 1979, 106), die Fabel zeige „keine individuellen Geschöpfe“,sondern „Typen“ als Eigenschaftsverkörperungen, so läßt sich der Fabel eine bestimmte Art des Exemplums beigesellen: dem„typisierten“ Tier entspricht der typisierte Croesus oder Cato. Die üblichen Beschreibungen der pädagogischen Fabel –unterhaltsame, unheroische, ahistorische, derbe Lebensklugheiten lehrende Geschichte vornehmlich von Tieren (vgl. KOEP131 f.) – treffen in vieler Hinsicht auch auf das mittelalterliche Predigtexemplum zu, nicht aber auf das induktive Exemplum.Nicht zufällig heißen die aesopischen Fabeln im deutschen Mittelalter ‚bispel‘. Vgl. H.L. MARKSCHIES, Art. Fabel,RDL I 2 [1958] 433 ff.; H. DE BOOR, Über Fabel und Bispel, SB Bayer. Akad., München 1966 (I). – Zur Parabel s. § 14,S. 53 ff., 58 f., 65, 36.
120
wichtiger ist als die nachgelieferte Illustration, kann sich der historische Bezug bis zur Selbstauflösung inerfundenen Geschichten verflüchtigen und (als Grenzfall) sogar durch den Bericht von Naturereignissen unddurch Naturallegorien ersetzt werden.287 Ein Predigtlehrbuch des 13. Jahrhunderts lehnt
287 Schon in die römischen Exempla-Sammlungen schleichen sich naturwissenschaftliche Kuriositäten ein, die aber stets nochin irgendeinem vagen Zusammenhang mit historischen Gestalten stehen (vgl. KORNHARDT 86). Zur mittelalterlichen undfrühneuzeitlichen Tradition der Verbindung von exempla, mirabilia und curiosa seit Vinzenz von Beauvais und ThomasCantimpratus vgl. BRÜCKNER, Historien 93 f.; Christoph DAXELMÜLLER, Disputationes curiosae, Zum„volkskundlichen“ Polyhistorismus an den Universitäten des 17. und 18. Jhs., Diss. Würzburg 1979, 117 ff. – Die erwähnte,im Mittelalter nicht unbekannte Unterscheidung von similitudo und exemplum (s. S. 56 ff., 146) wird häufig schon deshalbpreisgegeben, weil die similitudo von Naturdingen und das exemplum aus der Geschichte in einem Schöpfungsbegriff, derGott auch zum „Schöpfer“ der Geschichte macht, zusammenfallen. Vgl. unten § 40 f., 83. In vielen Predigtlehrbüchern desspäteren Mittelalters gehört das Exemplum als Teil der similitudo zu den Amplifikations-Topoi; zahlreiche Belege dazu s.bei ROTH (wie Anm. 219) 44 ff., 95 ff. z. B. zu den 11 modi dilatandi materiam bei Jacobus de Fusignano; ebd. 99 zummodus per similitudinem, worunter „ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel“ aufgrund „dreierlei Quellen“ zu verstehen sei: 1.Bibel und Heiligenlegenden, 2. res naturales und artificiales, 3. similitudines sumpte ex aliquibus gestis confictis etfabulosis; ebd. 44 ff., zu den loci communes der Stoffauffindung und Ausweitung bei Wilhelm von Auvergne, der signavisibilia aus dem „Naturbuch“ (unterschiedslos Bilder, Vergleiche, Metaphern, Exempla) für sententiae invisibiliorumaufzählt und unter topischen Aspekten wie contrariorum consideratio, conveniens rerum similitudo u. a. auch exemplificatiode vita sanctorum empfiehlt (d. h. etwa David für Demut, Hiob für Geduld usw., Christus für jedwedes Thema). Vgl. unten§§ 90 ff. zur Topik, §§ 76 ff. zu „Inbegriffs“-Exempla. Humbert von Romans (GEBIEN 173; vgl. auch unten Anm. 364)schreibt in der Einleitung zu seiner aus historischen, fabulösen, allegorischen und schwankhaften Predigtexempla bestehendenSammlung: Altissimus adeo effudit sapientiam super omnes creaturas sensibiles ut etiam secundum Salomonem formicessint nobis exemplum sapientie. Beispiele sind hier bis hin zu den Ameisen alle figurae quae sunt exemplaria verorum. Dieganze Weisheit Salomos sei in proverbiis et parabolis quasi sub [!] quibusdam exemplis enthalten. Quellen der Exemplaseien Bibel und Kirchenväter, aber auch libri philosophorum nominatorum und der liber creaturarum, d. h. das „Buch derNatur“ (175 f.) Exemplum wird derart zum Universalbegriff für Zeichen, Symbol, Naturvergleich, Gleichnis, Bild, schließtaber auch das historisch personhafte Exemplum im engeren Sinne ein. Auf solche Begriffserweiterung trifft LE GOFFSFormel von der „réification“ durchaus zu (oben Anm. 280). Die Mediävistik sollte terminologische Unklarheiten desMittelalters als solche beschreiben, nicht naiv nachvollziehen: Von „tiersymbolischen Exempla“ und „Naturtypen“-Exempladürfte nur im Bewußtsein des kultur- und sprachgeschichtlichen Ausnahmecharakters eines solchen Exemplumbegriffsgesprochen werden. (Vgl. D. SCHMIDTKE, Geistliche Tierinterpretation in der deutschsprachigen Lit. des MA’s. Diss.Berlin 1968, 93 ff. und Chr. GERHARDT, Die Metamorphosen des Pelikans, Exempel und Auslegung in mal. Literatur,Frankfurt/Bern 1979, 8 ff. und unten Anm. 345). Zu den Unterschieden und Übergängen zwischen rhetorischem Exemplumund Allegorie aufgrund einer symbolischen Welt- und Geschichtsauffassung hat die Barockforschung über Emblematik einigeauch mediävistisch interessante Gesichtspunkte herausgearbeitet: Das Emblem hat, obwohl es einen wesentlich weiterenBegriff als das Exemplum darstellt, mit diesem doch einige Charakteristika gemein, die nicht auf jede beliebige erbaulichesignificatio zutreffen: z. B. die argumentative, problembezogene Funktion, die wissenschaftliche Verifizierbarkeit und„potentielle Faktizität“ des ding- oder ereignishaften Sinnbildes oder das Prinzip der Synekdoche oder Vereinzelung (s. unten§ 78). Vgl. Albrecht SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, München2 1960, 18 ff., 28, 45 ff. und J.NOVICKI, Argumenta emblematica bei Petrarca. Einige Bemerkungen zu einem Argumentationsschema humanistischerLiteratur, in: Petrarca, Beiträge zu Werk u. Wirkung, ed. F. SCHALK, Frankfurt a. M. 1975, 209–20, zur Übertragbarkeitdes barocken Begriffs auf die italienische Frührenaissance (was m. E. auch auf den mittelalterlichen Humanismus zutrifft;vgl. unten S. 369 f., Anm. 869.
121
zwar grundsätzlich die poetische Fiktion ab, gestattet sie aber unter dem Vorbehalt, daß sie offen alsUnwahrheit zugegeben und propter significationem eingeführt werde.288 Dies beleuchtet symptomatisch diezentrale Bedeutung eben dieser significatio, des zu lehrenden Inhalts, um den sich das Gespinst der Erzählungranken darf. Aufgrund dieser Stelle könnte man annehmen, der Unterschied der Beispielarten beruhe auf demjeweiligen Beispielmaterial. Genau betrachtet, ist eine solche stoffliche Differenz jedoch eher Folge desgrundlegend verschiedenen Verfahrens, mit dem Vergleichsträger des Partikularen umzugehen. Sogar ein unddasselbe historische Beispiel kann einmal um der höheren „Bedeutung“ willen illustrativ, ein andermalinduktiv als ein in sich lehrreiches Ereignis herangezogen werden.289
288 Humbert von Romans (GEBIEN 175): Sexto circa veritatem: nunquam enim narranda sunt incredibilia vel queprobabilem non continent veritatem et si forte introducatur fabula aliqua que multum est efficatoria [sic] proptersignificationem aliquam quod vel nunquam vel rarissime est faciendum, semper exponenda est quod ita res non sit vera sedpropter significationem inducatur. Grundlage dafür bei Aug., Contra mendac. 12.28 (CSEL 41) 509: …quod utique totumfingitur, ut ad rem quae intenditur, ficta quidem narratione, non mendaci tamen, sed veraci significatione veniatur. DanachIsid. Et. I 40.6: Quod totum utique ad mores fingitur ut ad rem, quae intenditur, ficta quidem narratione, sed veracisignificatione veniatur. Vgl. auch GRUBMÜLLER (wie Anm. 709) 100 f.; OWST (wie Anm. 106) 155. F.P. KNAPP, Vonder antiken Fabel zum lat. Tierepos des Mittelalters in: La fable, Entretiens sur l’Antiquité classique (Fondation Hardt 30),Genf 1984, 253–306, hier 292.289 Siehe Anm. 286 zu PERELMAN.
122
36. Die zwei bisher systematisch betrachteten Grundformen der Analogie werden entwicklungsgeschichtlichmeistens an zwei weit auseinanderliegenden Kulturstufen – dem Zeitalter Ciceros und der Welt derBettelmönche – paradigmatisch so festgemacht, daß ihre substantielle Verschiedenheit außer Frage zu stehenscheint und höchstens der mögliche Wandel vom einem zum anderen Beispieltyp diskussionswürdig bleibt.290
Das klassische personalisierte Exemplum – „Beispielfigur“ oder „Beispielerzählung“ –, das auf der auctoritasgeschichtlicher Glaub- und Denkwürdigkeit beruht,291 steht dem Predigtexempel des späteren Mittelaltersgegenüber, das durch die Anonymität historisch unbedeutender oder typisierter Gestalten sowie durch dieAnschaulichkeit der außergewöhnlichen Situation292 gekennzeichnet ist. Das antike argumentativeExemplum, das wegen seines kulturellen Anspielungscharakters einen gewissen Bildungsstand voraussetzt, wirdals das „hohe“, „gelehrte“ und lateinische mit dem „volkstümlich“ lehrhaften, auf die schlichteVorstellungswelt des „einfachen Mannes“ zurückgreifenden und im Idealfall auch volkssprachigen Exemplumkonfrontiert.293 Zwischen beiden Arten wird sodann irgendeine lineare Entwicklung entweder angenommenoder verworfen – tertium non datur –, Kontinuität oder Diskontinuität postuliert. Nach gängiger Auffassungscheint in der immerhin beträchtlichen Zeitspanne zwischen Gregor dem Großen und dem späten 12.Jahrhundert irgendwo ein „Kulturbruch“ zu liegen, bei dem das mittelalterliche paränetische das antikerhetorisch-historische Exemplum abgelöst hat.
Wie und wann es zu dem postulierten Übergang von den exempla maiorum zu den Predigtexemplagekommen ist, will man dabei offenbar gar nicht so genau wissen; das Interesse konzentriert sich allein auf diegattungsimmanente Frage nach Zwischenstufen und Seitenpfaden (vor allem in frühmittelalterlichenKlöstern), die von Gregor, dem vermeintlichen Begründer der homiletischen Kurzgeschichte, zu deren erstspäteren Blüte und Popularität bei den Bettelmönchen führen.294 Jedenfalls besteht weitgehend Konsens
290 Vgl. unten § 36.291 Vgl. oben § 21.292 Vgl. oben S. 94 ff., 108 ff., 116, unten S. 210.293 Vgl. oben S. 41 ff., 112 ff., unten S. 124 f., 129 f.294 Wenn vom Aussterben (z. B. CRANE XVIII, LE GOFF, in: BRÉMONT/LE GOFF/SCHMIDT 51) oder vomverborgenen Dasein (GEBIEN 84 f.) des Exemplums im Frühmittelalter die Rede ist, kann nur das Exemplum derVolkspredigt gemeint sein. Zur Blüte des rhetorischen Exemplums von Venantius Fortunatus zu den karolingischen Dichternvgl. von MOOS, Cons. (wie Anm. 51) I/II §§ 330 ff.; M. HARL, Diskussionsvotum zur parallelen Tradition literarischer,ikonographischer und liturgischer Exempelreihen in der byzantinischen Kultur als Einwand gegen LE GOFF, Vita et pré-exemplum, 117 f. Aber selbst der durch Gregor berühmt gewordene Anekdotentyp ist im Rahmen monastischerErbauungsliteratur stets gepflegt worden. Vgl. OPPEL, Exemplum und Mirakel 96 ff. und ders., Zur neuerenExemplaforschung, in: DA 28 (1972) 240–43 (gegen F.C. TUBACH) zu Mirakelsammlungen des 11./12. Jhs. alsklösterlicher Vorstufe der Predigtexempla des 13. Jhs. Diese „Vorstufe“ beginnt jedoch schon wesentlich früher, da die ganzeLegenden-, Viten-, Mirakel- und Visionsliteratur an „erbaulich-unterhaltsamen Geschichten“ reich ist. SCHENDA hat darummit Recht dazu angeregt (Exemplaforsch. 79), Exempla vor allem außerhalb der homiletischen Gattung zu suchen und dasWort „Predigt“ grundsätzlich aus der Definition des Exemplums zu verbannen. Anregungen zu diesem weiten Thema bietenJ. Cl. GUY, Paroles des anciens, Apophthegmes des Pères du désert, Paris 1976, 9 ff.; WOLPERS (wie Anm. 232) 24 ff.und Register s. v. exemplum; A. VITALE-BROVARONE, La forma narrativa dei Dialoghi di Gregorio Magno, in: Attidell’Accad. Scienz. die Torino 108 (1973/4) 95–172; ebd. 109 (1974/5) 117–85; S. BOESCH GAJANO, Narratio eexpositio dei Dialoghi di Gregorio Magno, in: Bullettino dell’istituto storico italiano per il Medio Evo e ArchivioMuratoriano 88 (1979) 1–33; ders., Dislivelli culturali e mediazioni ecclesiastiche nei Dialoghi di Gregorio Magno, in:Religione delle classi popolari, Quaderni storici 41 (1979) 398–415; P. CAZIER, Théorie et pédagogie de la religionpopulaire dans l’antiquité tardive: Augustin, Grégoire le Gr., Isidore de Séville, in: La religion populaire, ed. Y.M.HILAIRE, Lille 1981, 11–27.
123
darüber, daß das Ende der Entwicklung sich radikal von deren Anfang beim ciceronischen Exemplumunterscheidet, sofern nicht von vornherein zwei unabhängige Entwicklungen angenommen werden, vondenen eine ausgestorben war, bevor die andere begann.
Damit eine Geschichte des Exemplums im Mittelalter geschrieben werden kann, muß zu allererst die simpleAnnahme aufgegeben werden, eine Beispielart habe die andere auf irgendeine Art „abgelöst“. Da es sichgrundsätzlich um zwei verschiedene logische Möglichkeiten des Beispiels überhaupt handelt, kann vonvornherein ausgeschlossen werden, daß das paränetische Exemplum das induktive jemals zu verdrängenvermochte. Hypothetisch auszugehen ist vielmehr davon, daß beide Arten nicht zwei Zeit- und Kulturstufenangehören, sondern von der Antike bis zur frühen Neuzeit – wenn auch bei wechselnder Beliebtheit und mitgattungsspezifischer Diversifikation, mit jeweiligen kulturgeschichtlichen Glanzzeiten und besonderengesellschaftlichen Trägern – ununterbrochen als funktional verschiedene Persuasionsmittel nebeneinanderexistiert haben. In der antiken Literatur hat das Exemplum „historischer Größe“ gegenüber demparänetischen Jedermanns-Exemplum vorgeherrscht. (Vielleicht scheint dies auch nur so, aufgrundüberlieferungsgeschichtlicher Zufälle.)295 Im Laufe des Mittelalters dürfte sich das Verhältnis quantitativumgekehrt haben. Das paränetische Exemplum war in den verschiedensten Phasen der Volksseelsorge immerbeliebt: Aus propagandistischen Motiven hat sich bereits die kynisch-stoische Diatribe dieses Vortragsmittels
295 Zur Möglichkeit des überlieferungsgeschichtlichen Untergangs eines großen Teils antiker „volkstümlicher“ Erzählliteraturvgl. SALLES 3 ff.
124
bedient, ebenso wie später die erste Laienpastoration im Zeitalter Gregors des Großen und dievolksmissionarische Großoffensive nach dem vierten Laterankonzil.296 Andererseits gehörten historischinduktive Exempla stets auch zum Grundbestand der Bildung an Fürstenhöfen, dienten immer wieder derUnterhaltung, der dynastischen Selbstlegitimation, der Fürsten- und Ämterethik oder der pragmatischenEinübung in die Weltklugheit.297
Sodann spricht allein schon deshalb nichts dafür, daß die beiden Formen des Exemplums je ganz für sich, ohneBerührungen und Überschneidungen gepflegt wurden, weil sowohl im Verteiler- wie im Empfängerbereich dieominöse Grenze zwischen „dem Volk“ und „den Gebildeten“ stets fließend ist.298 Hier sollte dasweitverzweigte Nachleben des Valerius Maximus zu denken
296 Zur Diatribe vgl. OLTRAMARE (wie Anm. 721) passim; CAPELLE/MARROU (mit weiterführender Lit.). ZurKontinuität vom popularphilosophischen Vortrag der Kyniker zur antikchristlichen Predigt und zu den Analogien zwischender Diatribe und der Volkspredigt des späteren Mittelalters vgl. Rudolf BULTMANN, Der Stil der paulinischen Predigt unddie kynisch-stoische Diatribe, Göttingen 1910, bes. 35 ff., 54; PÉTRÉ 16 ff.; DORNSEIFF 219; BERLIOZ 136 ff.;GEERLINGS 150 ff.; LUMPE 1234 f., 1245 und vor allem GEBIEN 29 f., 50 ff., 87 f., dem als Kenner des antikenExemplums und der Seelenführung Senecas die „diatribischen“ Techniken der Bettelmönche besonders auffielen. – Zur„Volksmission“ um 1200 vgl. unter sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Aspekten z. B. GEREMEK 159 ff. undinsbesondere Jacques LE GOFF, La naissance du Purgatoire, Paris 1981, 399 ff. (le purgatoire prêché: les exempla).297 Vgl. § 124, S. 37 f., 131 f., 136 ff., 312 f.; M. CHESNUTT, Art. Exempelsammlungen (im Mittelalter) in: EM, Berlin1983, S. 1 592 ff., hier 601 f. zu der an Fürstenhöfen beliebten didaktischen Erzählliteratur in Volkssprache wie den‚Castigos e documentos para bien vivir‘ (König Sanchos IV. zugeschr.), dem ‚Libro de buen amor‘ des Juan Ruiz, dem‚Conde Lucanor‘ des Infanten Don Juan Manuel (vgl. auch Anm. 92) oder John Gowers Confessio amantis; GUENÉE, Hist.et culture historique 61 ff. zu den ‚Faits des Romains‘ u. ä. Geschichtskompilationen und ebd. 316 f. zu Valerius Maximusals Historiker in fürstlichen Bibliotheken des späteren Mittelalters. Vgl. auch unten S. 132 f., 137.298 Vgl. §§ 58 f., S. 51, 64, 112, 128 ff., 180 ff., 373 f. – Als Musterbeispiel volkstümlicher Exempelgeschichten geltenGregors Dialoge; doch ihr Publikum bestand aus Hofleuten, vornehmlich adeligen Damen, die sich an helenistischenWundergeschichten erfreuten. Dazu vgl. VOGÜÉ (Anm. 240) 41 und S. BOESCH GAIANO im Diskussionsvotum gegenLE GOFF, Vita et pré-exemplum 118 f. Die literarische Tradition der Dialogi-Erzählungen Gregors bildet die keineswegseindeutig volkstümliche, sondern für geschlossene – in einem bestimmten Sinn auch elitäre – Mönchskreise bestimmteVäterliteratur (Viten, Legenden, Apophthegmen etc.; s. oben § 33; vgl. VITALE-BROVARONE, in Rhét. et. Hist. 106;VOGÜÉ a.O. 113 f.), in der allerdings der Topos vom sermo rusticus besonders beliebt war. Sogar Hieronymus will seinehöchst artistisch-romanhafte Paulus-Vita für „Ungebildete“ mit viel Mühe auf ein niedrigeres Stilniveau herabgebracht haben:propter simpliciores […] multum in deiiciendo sermone laboravimus (PL 34, 173). Vgl. BEUMANN (wie Anm. 283)91 ff.; AUERBACH (wie Anm. 232) 215 f.; SÖDER (wie Anm. 271) 186 f. KECH (wie Anm. 234) 9, 81 betont, daßHieronymus einen „Grundstock umlaufender mündlicher und schriftlicher Kurzgeschichten über Eremiten, Philosophen undSonderlinge“ gesammelt und biographisch konzentriert habe und daß die derart synthetisierten „Viten“ die Keimzelle zurVerbreitung unterhaltsamer Mönchsgeschichten durch das ganze Mittelalter darstellen und darüber hinaus noch denpikarischen Roman beeinflußt haben. Auch die Bettelmönche dürften dieser primär oralen Tradition in den Klöstern vielverdankt haben. Andererseits sind auch für den mediävistischen Erforscher des homiletischen Exemplums Warnungen vonBarockforschern vor einer Unterschätzung des Bildungsniveaus sog. „Volkspredigt“-Zuhörer bedenkenswert, da diese jagerade durch das regelmäßige Anhören einer bestimmten Kanzelrhetorik „gebildet“ wurden. „Gelehrt auftretende, ja artistischeLiteratur war nicht volksfremd“ (W. BRÜCKNER, Erbauung [wie Anm. 275] 136; vgl. ders., Historien 19 f., 70; WilfriedBARNER, Barock-Rhetorik, Tübingen 1970, 32).
125
geben: Dieser berühmteste Exempla-Sammler der Antike galt zu allen Zeiten als Hauptmodell für beide Artendes Beispiels. Man darf cum grano salis sogar behaupten, daß die mittelalterliche Tradition des Exemplumsmit der Überlieferung des Valerius Maximus zusammenfällt und den besonderen Doppelcharakter diesesMeisters der „in Geschichten verzettelten Geschichte“ nur noch betont hat: Einerseits wurde er als einHistoriker vom Range eines Livius, Sallust oder Sueton, andererseits als ein Musterautor der fiktivenUnterhaltungs-Kurzerzählung geschätzt (und hatte als solcher auch einen nicht geringen Einfluß auf dieEntstehung der spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Novelle.)299
299 Vgl. nach dem Register 1 s. l. Valerius Maximus. Zu Bedeutung des Val. Max. für die Konstanz des rhetorischenExemplum-Begriffs von der Antike bis ins 18. Jh. vgl. DAXELMÜLLER 634; BRÜCKNER, Hist. 86 ff.; FRIEDRICH25 f., 214; BATTAGLIA 464 ff.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 316 ff. (als Stoffquelle sogar in mal. Fabelsammlungen);K.O. OLSSON, Rhetoric, John Gower, and the Late Medieval Exemplum. In: Mediaevalia et Humanistica 8 (1977) 185–200,hier 190 f.; SCHON 67 ff. (Montaigne); GUERRINI 11 ff. u. passim zur Erzählliteratur und Historien-Malerei deritalienischen Renaissance; GILMORE (wie Anm. 214) 63 f. (Bettelmönche und Prähumanisten von Padua); TheodorVERWEYEN, Apophthegma und Scherzrede, Die Geschichte einer einfachen Gattungsform und ihre Entfaltung im 17. Jh.,Bad Homburg 1970, 36 ff. – Philologisches zur Überlieferung: vgl. L.D. REYNOLDS (Hrsg.), Texts and Transmission, ASurvey of the Latin Classics, Oxford 1983, 482 ff.; D.M. SCHULLIAN, Valerius Maximus, in: Catalogus translationum etcommentariorum V, ed. F.E. CRANZ, Washington D.C. 1984, 287–404; dieselbe, A Preliminary List of Manuscripts ofValerius Maximus, in: Festschr. W. ULLMANN, St. Louis 1960, 811–95; MANITIUS I 500 ff., II 873; H. DIENER,Johannes Cavallini (… 1325–1349), der Verfasser der ‚Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum‘, in: Festschr. E.DUPRÉ THESEIDER, ‚Storiografia e Storia‘, Rom 1974, 151–73 (zu Cavallinis Textvergleich); H.A. HILGERS, DieÜberlieferung der Valerius Maximus-Auslegung Heinrichs von Mügeln, Köln 1973; G. DI STEFANO, Ricerche su Nicolasde Gonesse traduttore di Valerio Massimo nel Trecento, in: Studi Francesi 26 (1965) 201–221; M.T. CASELLA, TraBoccaccio e Petrarca. I volgarizzamenti di Tito Livio e di Valerio Massimo. (Studi sul Petrarca 14) 1982; R.H. LUCAS,Medieval French Translations of the Latin Classics to 1500, in: Spec. 45 (1970) 225–53, hier 247 f.; GUENÉE, Hist. etculture historique 70, 108, 116 f., 250, 274, 198, 307, 315 ff. zur ungeheuren Verbreitung als historiographischer Quelle. –Da Val. Max. in vielem selbst bereits von den „statuenhaften“ exempla maiorum zur Anekdote tendiert (vgl. S. 69, 132 f.),findet LE GOFF (Vita et pré-exemplum 116) seine Geschichten vor-mittelalterlich: „l’exemplum tout en demeurant attaché àdes personnages exemplaires, a évolué de façon décisive vers le sens ‚objectif‘ attaché plus à l’anecdote qu’au héros.“ Zurselben gattungsgeschichtlichen Verlegenheit führte diese Ambivalenz die Germanistik, die sich angesichts der Val. Max.-Tradition mit dem Begriff „Anekdotenprosa“ behilft (vgl. die Polemik BRÜCKNERS, Hist. 86 f.). Eine klugeÜberbrückungsformel fand B. SMALLEY, deren Arbeiten über die humanistisch gebildeten Mendikanten oder „classizisingfriars“ hier stets mit Gewinn benützt werden konnten (Friars [wie Anm. 321] 87 f.): „To Titus Livius from ValeriusMaximus is a long stride. Maximus produced an exempla collection ‚avant la lettre‘: his Facta et dicta memorabilia mighthave been written especially to suit the taste of the middle ages.“ – In der reichhaltigen, oben angeführten Sekundärliteraturist mir folgendes Zeugnis nirgends begegnet: Summa philosophiae (Ps.-Robert Grosseteste, wie Anm. 492) 288 f. (Dehistoriographis): Es gebe jüdische, christliche und heidnische Historiker wie Moses als Protohistoriker, die Evangelisten alsHistoriker der gesta Christi und den trojanischen Augenzeugen Dares Phrygius (nach Isid. Et. I 42). Hinsichtlich desUmfangs der Mitteilung werden vollständige (polyhistor idest multarum historiarum relator) und selektive Historikerunterschieden; Hauptvorbild für die letzteren ist Valerius Maximus, qui accidentia tantum notabilia diversorum temporumconscripsit. Allen Historikern aber sei die rhetorische Methode gemein, die im Verkürzen und Erweitern, Verkleinern undVergrößern, im Unterlassen und Hinzuerfinden des Materials bestehe (s. das Zitat unter Anm. 492).
126
37. Eine Geschichte des Exemplums von der Antike zur Neuzeit würde zweifellos komplexere Resultatezeitigen, als der heute unüberbrückbar scheinende Gegensatz zwischen den altphilologischen und denvolkskundlichen Definitionen erwarten läßt. Besondere Beachtung sollte dabei dem gattungsdeterminierendenBedürfniswandel bestimmter Gruppen in bestimmten Zeiten geschenkt werden. Das frühe Mittelalter setzteinerseits restaurative Tendenzen der Spätantike auf dem Gebiet der panegyrisch-heroisierenden Feier- undHuldigungspoesie dekorativ fort in den oft ausufernden biblischen Beispiel-Priameln, die sowohl die gelehrtenKenntnisse der Dichter zur Schau stellen
127
wie die angesprochenen Glieder der Aristokratie lobend ermahnen, trösten oder beraten sollen.300 Gleichzeitigwirkt sich ein – ebenfalls schon spätantiker – traditionskritischer Hang zur Entheroisierung, Privatisierungund Popularisierung hergebrachter Exempla innovativ aus.301 In der Briefliteratur gibt es heidnische undchristliche Zeugnisse eines Überdrusses an den gewohnten exempla invicti animi. Symmachus etwa lehnt dieüblichen Anekdoten von römischen Staatshelden wie Horatius Pulvillus als Identifikationsmöglichkeit fürgewöhnliche „Privatleute“ ab, „weil solchen Starkmut nur brauchte, wer das Kapitol weihte.“302 Dasheroische Exemplum der Antike hat in der christlichen Fortentwicklung, insbesondere in Teilgebieten wie derMission und Pastoration, am allgemeinen Wandel der Literaturformen im Zeichen des sermo humilisteilgenommen und wurde dabei gewissermaßen demokratisiert.303 An Stelle des unnahbaren, moralischeRekordleistungen vollbringenden römischen Helden tritt der gewöhnliche Mensch, dessen dennochaußergewöhnliches Tun beweist, was einem jeden möglich ist.304 Schon die antike Rhetorik kannte stilistischbesonders „raffinierte Redner“, die „ungefeilt
300 Vgl. CURTIUS, ELLM 90 ff.; von MOOS, Cons. (wie Anm. 51 I/II §§ 330 ff., 196 ff. Auffällig ist die Vorliebe fürbiblisches Exempla-Material. Der Einfluß des Val. Max. beginnt allgemein erst in spätkarolingischer Zeit wirksam zuwerden; vgl. BOLGAR (wie Anm. 30) 125; GUENÉE, Hist. et culture hist. 304 f.301 Vgl. § 33, S. 117 ff. MOMIGLIANO (wie Anm. 271) 118 zur Beziehung zwischen der Vita Antonii und andererchristlicher Viten und den spätantiken Philosophenviten hinsichtlich der Grundidee des allmählich aus bescheidenenAnfängen zum Göttlichen aufsteigenden Helden.302 Symm. Ep. III 6.3: sed hac constantia esse debuit qui Capitolium dedicabat. Dazu vgl. von MOOS, Cons. (wieAnm. 51) I/II § 197a, III § 1119; Constant MARTHA, Etudes morales sur l’Antiquité, Paris 31896, 187 ff.; VITTINGHOFF(wie Anm. 201) 565 ff.: Symmachus suchte den mos maiorum ebenso gegen das neue Christentum wie gegenAbnützungserscheinungen römischer Kultur wiederzubeleben und zu verjüngen.303 Vgl. BAUSINGER, Formen … (wie Anm. 69) 218; AUERBACH, Sermo humilis, (wie Anm. 232) 25 ff., 29 ff.;BEUMANN (wie Anm. 283) 81, 91 f.; F. GRAUS, (wie Anm. 176) 29 ff. und ders., Volk, Herrscher und Heiliger im Reichder Merowinger …, Prag 1965, 66, 447 f.; M.W. BLOOMFIELD, The Problem of the Hero in the Later Medieval Period,in: Concepts of the Hero in the M.A. and the Renaissance, Albany 1975, 22–48.304 Vgl. S. 96 ff., 229 ff. und etwa Haymons Vita Wilhelms von Hirsau (AA SS Boll. Iul. II, 1867, 159–61, n. 23): […]alia quaedam sunt narranda non tam mira quam ad audiendum iucunda et utilia, et humanae fragilitatis ad imitandumpossibilia. – In einem paradoxen Sinn läßt sich diese Art des Beispiels nach rhetorischer Theorie als exemplum imparbezeichnen, da laut Quint. V. 11.9–10 der Heroismus bei niedriger circumstantia (etwa des Geschlechts: admirabilior infemina virtus) umso nachahmenswerter erscheint. Dazu s. unten § 97.
128
sprechen und vorsätzlich den Ungebildeten und Ungeschulten ähneln“.305Sie suchten das„geschichtenhungrige Volk“ erzählend zu überzeugen.306 Dabei verbanden sie redetaktische Überlegungen miteiner sowohl affektpsychologisch wie schichtenspezifisch negativen Vorstellung vom sinnlich erregbarenDurchschnittsmenschen. Das Christentum bewirkte demgegenüber jene weltanschauliche Aufwertung derrusticitas der evangelischen Bauern- und Fischer-Sprache, die grundsätzlich, über das theoretische Bekenntniszum Stilideal der Schlichtheit und Ungezwungenheit hinaus, auch eine echte Rehabilitation der im bestenSinne rhetorischen Einheit von Sache und Ausdruck allgemein hätte durchsetzen können, wären nicht ebensostarke Gegenkräfte in der Kontinuität spätantiker Schulbildungstradition wirksam geblieben, die dafür sorgten,daß das alte Exemplum der diatribischen Volksrede in seiner im Grunde nach wie vor intellektuell verachtetenVeranschaulichungsfunktion erhalten blieb.307 Eine in der Antike ausschließlich für die Fabeln gültigeBestimmung wird somit auf sämtliche Arten des Paradeigmas ausgedehnt: „Auch die Geschichtchen, die […]durch den Namen des Aesop vor allem berühmt sind, pflegen auf die Herzen vor allem der Bauern undUngebildeten zu wirken, die solche Erfindungen in naiver Weise anhören und voll Vergnügen auch mitdenjenigen, denen sie den Genuß verdanken, einverstanden sind.“308
38. Bis zum Hochmittelalter lassen sich Exempla in den beiden Registern antikisierender imitatio auctorumund geistlich-zweckhafter humilitas-Rede in Fülle nachweisen: hier inhaltlich und formal weitgehend denexempla virtutis oder den gelehrten Anspielungsbeispielen der römischen Literatur vergleichbare Exempla,doch oft in weniger induktiver als demonstrativer und dekorativer Funktion als Symbole in einem Ritual zurBestätigung der Kulturzugehörigkeit; dort „einfache Fälle des Lebens“, erbaulich oder rekreativ eingesetzte„Geschichten“ als Hilfsmittel geistlicher Aszetik in Legende, Mirakel, Väter-Apophthegmen usw., nicht nurfür Heidenmission und Laienkatechese, sondern auch bei weniger öffentlichen Anlässen, wie der täglichen
305 Cic. Or. 5–6, 20: […] in eodem genere alii (oratores) callidi sed impoliti et consulto rudium similes et imperitorum.Vgl. VERWEYEN 60 f. zur Diskussion dieser Stelle hinsichtlich der „leichten“, konversationellen Form von Exempla in derfrühen Neuzeit (vgl. unten Anm. 317).306 Vgl. oben S. 51 ff.307 Zur „Sinnlichkeit“ des Exemplums in der Erkenntnispsychologie vgl. § 52 f., S. 192 f., 434, 530 f.; zum sermo humilisS. 118 f. Einen lebenspraktischen Sinn gibt die Regula Benedicti (2.12) der Vorstellung: Was die Worte des Abtes fürGebildete, das bewirken vorbildliche Taten für die simpliciores. VOGÜÉ (31 f.) führt darauf die publikumsorientierteExempla-Begründung Gregors d. Gr. (s. oben Anm. 240) zurück. Vgl. auch ROTH (wie Anm. 219) 32 ff. zu Guibert vonNogent.308 Quint. V. 11.19 oben Anm. 118 zitiert.
129
monastischen Tischlektüre.309 Induktive Exempla begegnen am ehesten in der persönlichen Briefliteratur undin autobiographischen Erfahrungsberichten der confessio-Literatur, die fast immer an die großeBekehrungsdarstellung Augustins anknüpft, jedoch vor dem 12. Jahrhundert eine gattungsmäßigeRanderscheinung des Mittelalters darstellt.310
Die auffällige Zunahme von paränetischen Beispielgeschichten seit dem 13. Jahrhundert ist auf eine neue,veränderten Bedürfnissen entsprechende literarische Situation zurückzuführen. Die Predigtexemplaerleichterten den direkten Appell der Kirche an breitere Bevölkerungsschichten, die damals erstmals vor demVirus der Häresie geschützt werden sollten. Griffige Kurzgeschichten wurden darum als wiederverwendbaresPredigtmaterial in zahlreichen Kompendien bereitgestellt.311 Diese Katechisierungsabsicht wird in den sonstgerade für das Exemplum enttäuschend unergiebigen Prologen der Exempla-Sammlungen undPredigthandbücher des 13. und 14. Jahrhunderts klar formuliert und nicht etwa nur mit dem Vorbild des inGleichnissen predigenden Jesus begründet, sondern auch, ja hauptsächlich mit jener traditionellen, schon fürdie antike Rhetorik der Volksrede maßgeblichen „Psychologie der Unbildung“.312Geradezu ad nauseam wirdder Aspekt der standesmäßigen Eignung des Exemplums, dieses sinnlich anschaulichen Überzeugungsmittels,für einfältige und ungeschulte Laien (simplices, rudes, debiles, agrestes etc.) hervorgehoben. Dies zeigt diewahre Natur der ob ihrer „Volkstümlichkeit“ seit der Romantik vielgerühmten homiletischen Kurzgeschichte:Sie ist bestenfalls dem Volk abgehört, vor allem aber vom Klerus gestaltet und dem Volk von obenverabreicht.313
309 Vgl. unten Anm. 315.310 Vgl. MISCH II 2, 419 ff., 590 ff., III 1, 57 ff. (Otloh), 108 ff. (Guibert), 523 ff. (Abaelard/Heloise); JAEGER (wieAnm. 240, Abaelards Historia calamitatum als Selbst-Exemplum); von MOOS (wie Anm. 51) I/II §§ 262 ff. (Lupus undEinhard im Interpretationsstreit über das Exemplum Davids hinsichtlich der Trauer).311 LE GOFF, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 56 ff. zur massenhaften Bereitstellung autorloser Exempla (nachLECOY DE LA MARCHE „un véritable communisme de la parole, constituant la négation du principe de la propriétélittéraire.“) Vgl. ders., La naissance du purgatoire (wie Anm. 296) 399 ff.; J. DELUMEAU, Le péché et la peur. Laculpabilisation en Occident, XIIIe–XVIIIe siècles, Paris 1983.312 Vgl. Anm. 277, 305, 307, 424 f., 526.313 Die Hauptaspekte der Empfehlung des Anschaulichen sind: „Kleinkindermilch“ für geringe intellektuelle Fassungskraft(WELTER 70, 73, 75 u. ö., GEBIEN 175); Allegorie für Gebildete, Exx. für Ungebildete (WELTER 75, 77; unten S. 152,A. 337, 738); Erleichterung für das Gedächtnis (WELTER 70). Das abschätzig erwähnte „Körperliche und Handgreifliche“(corporalia et palpabilia) und Erfahrungsmäßige (per experientiam) ist nach dem „vulgär-platonischen“ Verständnis Jakobsvon Vitry dem auf Vordergründiges bedachten Volk gemäß (WELTER 68 f., 120, FRIEDRICH 31, CRANE XLI f.;JAUSS, Negativität 313). Vgl. S. 90 ff., 180 f., 196 f. Die (Anm. 287) erwähnte Erweiterung des Exempla-Bereichs über diehistorische Materie hinaus auf sämtliche res und creaturae entspricht einer pädagogischen Deutung der Naturbuch-Idee: AuchAnalphabeten sollen, wo nicht in der Bibel, so doch (wenigstens) in Gottes Erstoffenbarung „lesen“ können. Dazu vgl.BLUMENBERG, Lesbarkeit (wie Anm. 25) 48 ff., 52 (Augustinus und Hugo von St. Victor). – Zu den romantischen oderallgemeiner ausgedrückt: vorwissenschaftlichen Grundlagen des im 19. Jh. begründeten Begriffs eines „volkstümlichen“Exemplums vgl. SCHENDA 69 f. Paradigmatisch zitiert auch GEBIEN 78 die hübsche Stelle von Goswin FRENKEN (wieAnm. 101) 17: „Wenn wir das Ziel und den Zweck der Erforschung dieses Gebietes betrachten, so ist es oft freilich nicht sosehr der innere Wert dieser Literatur, der ihr Studium wünschenswert macht, sondern es führt uns das Bewußtsein dazu, daßwir hier der Seele des mittelalterlichen Volkes sehr nahe kommen können […] und in die Tiefe einfältiger Gemüter schauendürfen.“ Dasselbe Forschungsinteresse äußert sich heute diskreter, aber sozialgeschichtliche oder strukturalistischeTerminologie verdeckt nur die romantische Exemplum-Definition und deren petitio principii einer volkshaftenUrsprünglichkeit. Kritisches und Einschränkendes hierzu s. bei KLEINSCHMIDT 178; BAUSINGER, Volkspoesie (wieAnm. 69) 199 ff.; ders., Schwank (wie Anm. 150) 119; LO NIGRO (wie Anm. 110) 324; BRÜCKNER, Hist. 13 ff.; ders.,‚Exemplasamml. 610; ders., Loci communes (wie Anm. 316) 1 ff.; BERLIOZ 116; ALSHEIMER (wie Anm. 278) 57;GEREMEK 159 ff., 171 ff.; VITALE-BROVARONE 104, 106; OLSSON (wie Anm. 280) 185 f. und vor allem J.-CI.SCHMITT (wie Anm. 274) 948 zu den „récits folkloriques récuprérés par la culture savante, puis ‚baptisés‘, transformés etenfin réintroduits en milieu laïc par le biais da la prédication“; J. BERLIOZ, ‚Quand dire c’est faire dire‘, Exempla etconfession chez Etienne de Bourbon, in: ‚Faire croire‘, Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du
130
Doch auch in der Blütezeit des „volkstümlichen“ Exemplums wurde das rhetorisch-historische Exemplum inklerikalen und aristokratischen Kreisen
XIIe au XVe siècle, Table ronde de l’Ecole française de Rome 1981, 299–335, hier 334 f. zum Kreislauf zwischenVerkündigung durch Beispiele, Interiorisierung des kirchlichen „Zensors“ (im Sinne Freuds) durch denDurchschnittsmenschen und erneute Exemplifizierung aus dem „volkstümlichen“ Bereich des derart präparierten „schlichtenGemüts“. Zu dem sich theoretisch anbahnenden Konsens über die Unmöglichkeit der Rekonstruktion einer reinenVolkskultur vgl. ‚La culture populaire au m.â.‘, ed, P. BOGLIONI, (IVe Colloque de l’Institut des Etudes médiévales),Montréal 1979, bes. die Einleitung von P. BOGLIONI 18 ff. (gegen BACHTINS „dogmatisme imperturbable“ im Glaubenan die „culture populaire“ und die „inoffizielle“ Komik des Volkes im MA) sowie die Rezension von L.M. PATERSON, in:Med. Aev. 52 (1983) 157–9. Die vielleicht überzeugendste Kritik an den modisch gewordenen Thesen BACHTINS gibtAaron J. GURJEWITSCH in seinem 1972 russisch erschienenen Werk „Kategorien der mittelalterlichen Kultur“, dt.: DasWeltbild des mittelalterlichen Menschen, München 1980, 352–400 („Probleme der Volkskultur und der Religiosität imMA“), indem er dem einseitigen Konstrukt einer volkstümlichen „Lach- und Karnevalskultur“ eine Rekonstruktion deswirklichen heidnischen Substrats in der religiösen Praxis selbst mit Hilfe des „kulturellen Palimpsests“ der Poenitentialeentgegenstellt (vgl. auch unten Anm. 871).
131
intensiv gepflegt. Berührungspunkte zwischen beiden Bereichen sind im Spätmittelalter nicht nur durch dieoft gleiche Stoffgrundlage, sondern auch durch die beiden gemeinsame Tendenz zur Verselbständigung desunterhaltsamen narrativen Elements gegeben.314 Das homiletische Schwankexempel entwickelt sich nicht nurgleichzeitig mit den ‚fabliaux‘, sondern auch parallel zu den Memorabilien, ‚faicts et dits‘, Kasus, historischenAnekdoten und Fazetien in Klöstern und an geistlichen oder weltlichen Höfen. Diese bunte Erzählliteratur,die von Predigt- und Hofkritikern gelegentlich mit gleichlautenden Argumenten als Geschwätz und müßigeZerstreuung bekämpft wurde, bildet gleichermaßen den Hintergrund für die frühneuzeitliche Novellistik.315
314 Vgl. z. B. GEREMEK 178 f.; OWST (wie Anm. 106) 178 ff. und unten S. 228 f.315 Zur höfischen Erzählkultur vgl. oben Anm. 297 f.; GUENÉE, Hist. et culture hist. 25 f., 59 ff., 315 f.; ders., La culturehistorique des nobles: le succès des ‚Faits des Romains‘ (XIIIe–XVe s.), in: ‚La Noblesse au M.A.‘, Festschr. R.BOUTRUCHE, Paris 1976, 261–88 = Politique et histoire… (wie Anm. 181) 299–327; unten S. 136 ff., 598 ff. – Zurmonastischen Parallele vgl. GUENÉE, Hist. et culture hist. 57 f.: Johannes von Winterthur z. B. biete „un vivant écho desrécits qui couraient dans cette société merveilleusement bavarde qu’était un couvent franciscain“; Albert WESSELSKI,Mönchslatein. Erzählungen aus geistlichen Schriften des XIII. Jhs., Leipzig 1909, Einl. XLI f. zur ‚Mensa philosophica‘u. a. narrativen Tafelunterhaltungen. – Zur fließenden Grenze zwischen derbem Schwank und humanistischer Fazetie,belehrender und unterhaltender Funktion vgl. BAUSINGER, Schwank (wie Anm. 150) 124; R. BEBERMEYER, Art.Fazetie in: EM 4 (1984) 926–33 (bes. 926 zu Cic. De orat. 2.216–90); Jürgen BEYER, Schwank und Moral,Untersuchungen zum afr. Fabliau und verwandten Formen (Diss. Konstanz 1966), Heidelberg 1969; Mary A. GRANT, TheAncient Theories of the Laughable, The Greek Rhetoricians and Cicero, (Univ. of Wisconsin Studies in Lang. and Lit. 21)Madison 1924, 85 ff. Vgl. S. 162, 314 f., A. 409 f. – Die mal. Kritik an Unernst und Unterhaltung wird gern von modernenExempla-Forschern zugunsten der Dekadenzthese (vom geistlich lehrhaften zum schwankhaften Predigtexempel) ausgelegt:vgl. schon WELTER 444 ff. und vor allem TUBACH, Exempla in the Decline (wie Anm. 144); am bekanntesten sindDantes Verse im ‚Paradiso‘ XXIX 109–10: ‚Non disse Cristo suo primo convento:/Andante, e predicate al mondo ciance!‘;ebd. 115 heißen Exempla ‚motti e iscede‘. Vgl. A. 345, 450, 458. – Die Novelle setzt zweifellos das Exemplum fort, dochnicht, wie meist angenommen, das lehrhaft homiletische, sondern das rhetorische und kasuistische Exemplum derhumanistischen Tradition (vgl. § 65, S. 19 f., 228 f., 314, 526). Die Rennaisance-Humanisten knüpften nicht vornehmlichan die späten schriftlich fixierten Formen des ursprünglich „oralen“ Volks-Exemplums an (so LE GOFF 64), sondern an diegelehrte und höfische Memorabilien- und Anekdotenliteratur nach dem Modell des Val. Max. Zum Verhältnis vonExemplum und Novelle vgl. BATTAGLIA 487–548 (Dall‘ esempio alla novella); H.-J. NEUSCHÄFER, Boccaccio und derBeginn der Novelle, München 1969; ders. Erzählformen (wie Anm. 67); Walter PABST, Novellentheorie undNovellendichtung, Heidelberg2 1967, bes. 10 ff.; J. HEINZLE, Boccaccio und die Tradition der Novelle, Zur Strukturanalyseund Gattungsbestimmung kleinepischer Formen zwischen MA und Neuzeit, in: Wolfram-Studien, hrsg. von W.SCHRÖDER 5, Berlin 1979, 41–62; Maria L. DOGLIO, L’exemplum nella novella latina del ‘400, Torino 1975 (war nichtzugänglich). – Eine hervorragende Bestätigung für die Kontinuität zwischen casus-hafter Erzählliteratur des französischenSpätmittelalters und der frühen Neuzeit (von den „Quinze Joies de Mariage“ zu Marguerite de Navarre) sowie überzeugendeErhellung der gattungsmäßigen Heterogenität vieler zwischen Didaxe, Traktaktliteratur, Roman und Novellistik schwebenderWerke vom 14. zum 16. Jh. bietet jetzt die eben abgeschlossene Münstersche Habilitationsschrift von MargareteZIMMERMANN, Studien zur Frühgeschichte der erzählenden Prosa in Frankreich, Le menagier de Paris – Les Quinze Joiesde Mariage – Les Cent Nouvelles.
132
Die rhetorisch funktional bestimmte Zweigleisigkeit des Exemplums liegt quer zur Vielfalt derErzählgattungen. Sie läßt sich in der Neuzeit weiterverfolgen einerseits in heroisch-tragischen„Memorabilien“, Belegbeispielen gelehrter Kasuistik, „Historien“ und Apophthegmen, loci communeshistorici der Klugheitslehre und des Polyhistorismus, andererseits in den nachreformatorischen, von denmittelalterlichen kaum wesentlich verschiedenen Predigtund Erbauungsexempla; in vielfältiger narrativerKleinliteratur, Postillen, Kalendern, Schulbüchern, „Pädien“ und „Hausvätersammlungen“ bis ins 19.Jahrhundert.316 Es ist bedenkenswert, daß eine schon in Antike und Mittelalter bestehende Unklarheit überden Geschichtsbegriff des Exemplums seit der Renaissance erstmals zum Problem und Streitgegenstand wird:Was unterscheidet das historisch-induktive Exemplum von einer bloßen Fabel oder Erbauungsgeschichte: dieHistorizität oder die Denkwürdigkeit, die Größe oder die Imitabilität des Helden? Seitdem Boccaccio mitgewissermaßen „historiographischer“ Intention kleine Leute der zeitgenössischen Gesellschaft alsnovellistische Fälle berühmt gemacht hatte, kam es immer wieder zum Disput über die Frage, ob dasGeschichtsbeispiel der Bindung an große Persönlichkeiten und insbesondere an „Standespersonen“ bedürfeoder ob nicht vielmehr „gemeine Leute“ (mit Seelenadel), „ja Weiber und Kinder“ als verbürgte Einzelfällenäherliegende und effizientere persönliche Lebenshilfe gewähren können. Für Verfechter der „Große-Männer-Exempla“ war seit Erasmus das Hauptvorbild Plutarch; für die „Kleine-Leute-Beispiele“ wurdeinteressanterweise seit Pontanus gerade Valerius Maximus (wegen des gemischten Personals der Memorabilia)als Kronzeuge angerufen.317 Daß bei
316 Vgl. DAXELMÜLLER, Exemplum, die in Anm. 108, 278, 164, 275 angeführten Arbeiten von Wolfgang BRÜCKNERsowie dessen Beitrag: Loci communes als Denkform. Literarische Bildung und Volkstradition zwischen Humanismus u.Historismus, in: Daphnis 4 (1975) 1–12; VERWEYEN 59 ff.; BAUSINGER, Exemplum … (wie Anm. 110), Formen …(wie Anm. 69) 210 ff. und oben Anm. 68.317 Zur Auseinandersetzung über die Ranghöhe von Exempla vgl. VERWEYEN 36 ff. (zu Harsdörffer, Erasmus undPontanus); KNAPE (wie Anm. 353) 398 f. (zur Geschichtswürdigkeit privater Personen und zur Gattungsgrenze zwischen„Historie“ und Roman). – Die Historizität der „casi e avvenimenti […] ne‘ moderni tempi avvenuti come negli antichi“betont Boccaccio im ‚Proemio‘ zum ‚Decameron‘; dazu vgl. V. BRANCA, Contemporaneizzazione narrativa edespressionismo linguistico nel ‚Decameron‘, in: ‚Letterature comparate‘, Festschr. E. PARATORE III, Bologna 1981,1283–1306, 1283 ff. – Zu Val. Max. vgl. KESSLER, Petrarca 109: Petrarca schreibt seine Rerum memorandarum librigerade als eine puristische, gegen den ihm als zu hochgeschätzt erscheinenden Valerius Maximus gerichtete Neukonzeptiondes Genus, aus dem anekdotisches Geschwätz verbannt werden soll. Vgl. auch unten § 59 zu einer vergleichbaren Einstellungdes Humanisten zu kleinen Erzählformen. – Interessant sind auch die gattungsgeschichtlichen Konsequenzen, die F. NIES(Würze der Kürze – Schichtübergreifende semi-orale Kleingattungen im Frankreich des 17. bis 19. Jhs, in: Erzählforschung[wie oben Anm. 37] 418–434) zieht: „historiette“ enthalte ein auffälliges historisches Ereignis mit Namennennung,„anecdote“ eine Hintertreppengeschichte für die Konversation mit Betonung der Pointe einer historischen Person, während„conte“ (ähnlich wie das Predigtmärlein) keinen Wert auf große Namen der Geschichte lege, sondern zum volkstümlichenAmmen- und Hausväterschatz gehöre. Vgl. §§ 43 f., 47.
133
diesem Streit nicht über die Historizität, sondern allein über den (standesmäßigen) Grad der Denkwürdigkeit,über die Größe oder Nachahmbarkeit des Helden disputiert wurde, zeigt, wie selbstverständlich dasGeschichtsbeispiel von der bloßen Fabel oder (unhistorischen) Erbauungsgeschichte unterschieden wurde.
Damit gelangen wir zum Hauptpunkt zurück: Der Wesensunterschied zwischen dem personalen historisch-induktiven und dem universalen paränetisch-illustrativen Exemplum steht (allen Grenzverwischungen derPraxis zum Trotz) theoretisch weit und klar über nachgeordneten Unterschieden wie denen zwischen „großerGeschichte“ und anekdotischer Tagesgeschichte, zwischen Stoffen der humanistischen Bildung und deralltäglichen Erfahrung, zwischen Erzählformen (etwa ernsten und scherzhaften, kargen oder expansiven) oderzwischen genera dicendi wie dem erhabenen und dem niedrigen Stil. Schon hier kann im übrigen der eingangserwähnte318 Epochenvergleich aufgrund der vermeintlichen Verschiedenheit des humanistischen und desmittelalterlichen Exemplagebrauchs in Frage gestellt werden. Denn die deduktive Illustrationsmethode „des“Mittelalters dürfte sich bei genauerer Betrachtung als die des paränetischen Exemplums aller Zeiten, und die„echte“ Induktionsmethode der Renaissancehumanisten als die des ebenso universellen historischargumentativen Beispiels erweisen. Jedenfalls fanden beide Formen in Mittelalter und Renaissancegleicherweise Verwendung.319 Die hier skizzenhaft hingeworfenen Erwägungen zur Entwicklung des Exemplushaben allerdings noch hypothetischen Charakter. Sie lassen sich nicht theoretisch, sondern nur durcheindringliche und ausgedehnte historisch-philologische
318 Oben § 8.319 Vgl. auch unten § 108.
134
Analysen des Exempla-Gebrauchs bei einzelnen Schriftstellern verschiedener Zeiten überprüfen. In diesemSinn und aus der Überzeugung, daß jegliche Synthese verfrüht wäre,320 habe ich den folgenden Beitrag zumPolicraticus des Johann von Salisbury konzipiert.
4. Der Policraticus als Umschlagplatz aller Arten des Exemplums
Zur gattungs- und rezeptionsgeschichtlichen Vermittlungsposition der im Traktat eingebetteten Geschichtensammlungzwischen dem rhetorischen Exemplum der Antike und den unterhaltsam-didaktischen Kurzerzählungsformen desSpätmittelalters (§ 39).
39. Der Policraticus ist insofern ein besonders dankbarer Untersuchungsgegenstand, als er wie kaum einanderes Zeugnis der mittellateinischen Exempla-Literatur eine Art Brücke oder Kreuzungspunkt für die beidenformgeschichtlichen Traditionen bildet: Einerseits folgt das Werk im Gebrauch der Exempla den rhetorischenGepflogenheiten und stofflichen Quellen der Antike; andererseits ist es jedoch wirkungsgeschichtlich zu einemwahren thesaurus exemplorum, einer Fundgrube aller möglichen kuriosen „Histörchen“ für die predigendenBettelmönche und novellistischen Erzähler des Mittelalters geworden.321 In der entsprechendenSpezialliteratur wird der Policraticus
320 Gegen verfrühte Evolutionsmodelle und für eine analytische Sondierung des Terrains von Autor zu Autor sprechen sich inunserem Zusammenhang auch aus: BAUSINGER, Exemplum 33; VITALE-BROVARONE 88. – Einige linguistisch-semiotisch orientierte Arbeiten behandeln demgegenüber das Exemplum wie eine feste, eindeutig (nach WELTER, MOSHERoder CRANE) definierte Institution, aus der sich weitere Klassifikationen morphologischer Art entwickeln lassen. Den vonGEREMEK (167) angesprochenen Wunsch „nach einem Propp des Exemplums“ dürften bisherige Versuche in dieseRichtung kaum erfüllt haben: z. B.S. SULEIMAN, Le récit exemplaire. Parable, fable, roman à thèses, in: Poétique 32(1977) 468–89; Maurizio DARDANO, Lingua e tecnica narrativa nel Duecento, Rom 1969, 17–37 (L’exemplummediolatino); ZORZETTI (wie Anm. 277).321 Hier liegt die Antwort auf die oben Anm. 110 angeführte Kernfrage von J. FONTAINE an J. LE GOFF nach einem „liende l’Antiquité classique et du Moyen Age“ in der zweigleisigen Exempla-Tradition. – Vgl. Beryl SMALLEY, English Friarsand Antiquity in the Early Fourteenth Century, Oxford 1960, 49, 54, 151 zum Policraticus als Fundgrubespätmittelalterlicher „story tellers“ in der klassizistischen, auf „Charaktere“, nicht auf „Histörchen“ ausgerichteten Tradition;vgl. auch dieselbe, Oxford University Sermons 1290–93, in: ‚Medieval Learning and Literature‘, Festschr. R.W. HUNT,Oxford 1976, 306–27, hier 321 ff. zur Pol.-Wirkung; dieselbe, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1952,325 f., 373 f.: der Policraticus als Handbuch für bibelexegetische und altertumskundliche Fragen bei den Bettelmönchen; A.LINDER, The Knowledge of John of Salisbury in the Late Middle Ages, in: StM 18.2 (1977), 315–366, hier 344 ff. zurBedeutung des Werks für die Exempla-Sammlungen bis hin zu den Gesta Romanorum. Vgl. auch unten Anm. 337 ff.
135
seit den frühen Monographien von Welter und Mosher gern zur Vorgeschichte des homiletischen Exemplumsgerechnet.322 Seitdem die reich verästelte Rezeptionsgeschichte des Werks im Mittelalter eigens untersuchtworden ist, weiß man auch um dessen zentrale Bedeutung als Kompendium rhetorischer Exempla im antikenSinn.323 Insofern darf Johann von Salisbury gewissermaßen als ein hochmittelalterlicher Valerius Maximusgelten.
Als ein überaus belesener Sammler aller greifbaren, historischen, pseudohistorischen, legendären und mündlichkursierenden „Geschichten“, Anekdoten, Apophthegmen gehört er zu einer besonders im England des 12.Jahrhunderts beginnenden literarisch-historiographischen Richtung, die im späteren Mittelalter zusehends zudem führte, was Beryl Smalley einen wuchernden „cult of story telling“ nannte.324 Richard W. Southern325
hat bildungsgeschichtlich festgestellt, daß am Ende dieser Entwicklung fast nur noch die für denPredigtgebrauch oder für Geschichtsenzyklopädien bestimmten „collections
322 Vgl. WELTER 48 ff.; MOSHER 54 f.: „Those curious miscellanies of the twelfth century, such as John of Salisbury’sPolycraticus, Walter Map’s De Nugis curialium and Gervase of Tilbury’s Otia Imperialia were preparing for the later vogue ofillustrative tales“; und speziell zum Policraticus als „curious mosaic of general observation, learning and narrative“, das derhomiletischen Exempla-Praxis des 13./14. Jhs. von all diesen Werken am nächsten komme.323 Neben den in Anm. 321 genannten Arbeiten vgl. auch R.H. und M.A. ROUSE, Preachers, Florilegias and Sermons,Studies on the ‚Manipulus florum‘ of Thomas of Ireland, Leiden 1979, s. l. im Stellenreg. Weitere rezeptionsgeschichtlicheLiteratur verzeichnet KERNER 2 Anm. 7. – CURTIUS (Zur Danteforschung, 16 Anm. 19) verweist auf den Übergang vonder antiken „Beispielfigur“ zum homiletischen Schwankbeispiel in dem vom Policraticus abhängigen und gattungsmäßiggleichartigen Werk De nugis curialium des Walter Map, der es selbst als eine Sammlung von exempla versteht, quibus veliocunditas excitetur vel edificetur ethica (III Prol. 1, ed. JAMES, rev. BROOKE/MYNORS, Oxford 1983, 210). Eineähnliche Absichtserklärung Johanns s. unten Anm. 770 f.324 SMALLEY, Engl. Friars (wie Anm. 321) 21 ff., 26, 42.325 SOUTHERN, Aspects of the European Tradition of Historical Writing, in: TRHS V 21 (1971) 174. Zur Überwucherungder Historiographie durch die Anekdotenerzählung vgl. auch CHESNUTT (wie Anm. 297) 593 f.; GUENÉE, Hist. et culturehistorique 55 ff.; ders., Politique et histoire (wie Anm. 181) 264 f.; KLEINSCHMIDT 78, 82 ff.; E. KESSLER, Dasrhetorische Modell der Historiographie, in: Formen der Geschichtsschreibung (wie Anm. 37) 63 f.; Ursula LIEBERTZ-GRÜN, Gesellschaftsdarstellung und Geschichtsbild in Jans Enikels „Weltchronik“. Mit Notizen zu Geschichtserkenntnisund Geschichtsbild im MA, in: Euphorion 75 (1981) 71–99, hier 85 f. (dieser Aufsatz ist in das hier nicht mehr verwerteteWerk der Autorin: Das andere Mittelalter, Erzählte Geschichte und Geschichtserkenntnis um 1300, Studien zu Ottokar vonSteiermark, Jans Enikel, Seifried Helbling, [Forschungen z. Gesch. d. älteren dt. Lit. 5] München 1984, 71–100eingegangen). Vgl. auch unten Anm. 339.
136
of stories“ bescheidene Geschichtskenntnisse vermittelten. Ein spezifisches Charakteristikum der englischen„Renaissance des 12. Jahrhunderts“ sah er im übrigen gerade in der unbändigen Sammelwut nach „legends andmarvels“, nach Anekdoten, Märchen, Sagen, Wundergeschichten und Merkwürdigkeiten weltlicher undgeistlicher Art.326 Von dieser Leidenschaft waren neben Johann etwa Galfred von Monmouth, Wilhelm vonMalmesbury, Walter Map, Alexander Neckam oder Heinrich von Huntingdon ergriffen; sie trugen „eineunerschöpfliche Materialsammlung“ für die Literatur des späteren Mittelalters zusammen.327 König HeinrichII. förderte die Sammler persönlich. Er ließ u. a. eine Abbreviatio der Naturgeschichte des Plinius anfertigenund begünstigte die historiographische, mythographische und romanhafte Verherrlichung derNationalgeschichte sowie alle Arten der Erzählkunst – gerade auch die sog. kleinen Gattungen.328 In seinemInteresse für
326 SOUTHERN, Aspects (wie Anm. 325) 171; ders., The Place of England. (wie Anm. 28) 212 ff.; vgl. auch P.K.MARSHALL/J. MARTIN/R.H. ROUSE, Clare College Ms. 26 and the Circulation of Aulus Gellius 1–7 in MedievalEngland and France, MSt 42 (1980) 353–94, hier 353, 369 f. (Wilhelm von Malmesbury); P. CLASSEN, Res gestae,Universal History, Apocalypse: Visions of Past and Future, in: ‚Renaissance and Reneval …‘ (wie Anm. 7) 387–420, hier391 f. zu Wilhelms De gestis regum Anglorum: „The chronological flow of events […] is interpreted […] by anecdotes andtales of magic […] By no means all of them have a recognizable moral; often the report of their strangeness is an end initself.“ Ähnliches gilt auf geistlicher Ebene von den Marienmirakeln desselben Wilhelm von Malmesbury; vgl. P. CARTER,The Historical Content of William of Malmesbury’s Miracles of the Virgin Mary, in: Festschr. R.W. SOUTHERN, ‚TheWriting of History in the M.A.‘, ed. R.H. DAVIS et al., Oxford 1981, 127–166, bes. 139 ff.327 Vgl. Chr. N.L. BROOKE, Geoffrey of Monmouth as a Historian, in: ders. et al. (Hrsg.), ‚Church and Government in theM.A.‘, Cambridge 1976, 77–91; V.I.J. FLINT, The Historia regum Britanniae of Geoffrey of Monmouth: Parody and itsPurpose, a Suggestion, in: Spec. 54 (1979) 44–68; HANNING (wie Anm. 185) 121 ff.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 72(Marie de France), 77 (Alexander Neckam); zu Walter Map s. Anm. 323; zu Wilhelm von Malmesbury s. Anm. 826; zuHeinrich von Huntingdon s. Anm. 423, 670. Vgl. außerdem das reiche unedierte Anekdotenmaterial in der längeren Fassungdes Verbum abbreviatum von Petrus Cantor nach den Mitteilungen von J.W. BALDWIN, Masters, Princes and Merchants, 2Bde., New Jersey 1970, I 14 f., 24 u. ö.328 Vgl. SOUTHERN (wie oben Anm. 325); R.R. BEZZOLA, Les origines et la formation de la littérature courtoise enOccident, II 1, Paris 1963, 269 ff., 372; W.F. SCHIRMER, Die kulturelle Rolle des englischen Hofes im 12. Jh., in: ders.u. U. BROICH, Studien z. lit. Patronat im England des 12. Jh., Köln/Opladen 1962, 9–23 = in: LiterarischesMäzenatentum, ed. J. BUMKE, (WdF 598) Darmstadt 1982, 232–247, hier 241 ff. (zum Vorwiegen der „Historiker“ unterden literati am Hof; auch zum Kreis um Eleonore, zu Marie de France, Wace, Galfred v. M., Josephus Iscanus u. a.); VivianH. GALBRAITH, The Literacy of the Medieval English Kings, in: Proceed. of the Brit. Acad. 21 (1935) 201–38.
137
das „story telling“ hatte er viele Nachahmer und Gleichgesinnte unter seinen Thronfolgern und unterzeitgenössischen Fürsten auf dem Festland. Es ist bemerkenswert, daß sich unter den KorrespondentenJohanns von Salisbury auch der bildungsbeflissene Graf Heinrich von Champagne, ein Vetter Heinrichs II. undder Gatte Maries von Champagne (der Mäzenatin Chrétiens von Troyes) befindet, der die Exempla-Sammlung des Valerius Maximus für den Eigenbedarf abschreiben ließ.329 Die aristokratische Vorliebe fürhistorische und scheinhistorische Kurzerzählungen war seit dem Hochmittelalter ein gesamteuropäischesPhänomen geworden. Berühmte Empfänger und Förderer solcher Literatur waren etwa Philipp August vonFrankreich, in dessen Umkreis die ‚Faits des Romains‘ entstanden, oder der deutsche Kaiser Heinrich VI., fürden Gottfried von Viterbo sein, ‚Pantheon‘ zusammenstellte.330 Es wäre eine interessante Aufgabe, dergesamten Tradition der Exempla bis zur frühen Neuzeit unter dem besonderen Aspekt der vielfältigenhöfischartistokratischen Verwendungsmöglichkeiten von Geschichts-Kompilationen als „Geschichtenbücher“nachzugehen (etwa für die Unterhaltung, die Fürstenerziehung, die politische Ethik und für die Vermittlungvon praktischen Klugheitsregeln im geselligen, juristischen, militärischen oder diplomatischenZusammenhang.)331 Für diese in England zweifellos besonders beliebte „Historien“-Literatur, in der dasExemplum nicht weniger wichtig war als in den Gattungen der geistlichen Seelsorge, stellt der Policraticuseines der frühesten mittelalterlichen Muster dar.332
Das Werk ist seiner Intention nach allerdings mehr als ein bloßes Florileg oder eine reine Exempla-Sammlung. Darin unterscheidet es sich zweifellos von einem seiner Hauptvorbilder, den ‚Memorabilien‘ desValerius Maximus. Aufgrund der oft hoch pathetischen Ein- und Überleitungen zu den Exempla (diemerkwürdig von der Absichtserklärung des römischen Geschichtensammlers abstechen, nurwiederverwendbares Material bereitstellen zu wollen) ist zwar versucht worden, dieses Nachschlagewerkrhetorischer Praxis zu einem fortlaufend zu lesenden Literaturwerk narrativer Prosa umzudeuten. Selbst
329 Vgl. Johanns Ep. 209, (II) 314; BEZZOLA (wie Anm. 328); J.F. BENTON, The Court of Champagne as a LiteraryCenter, in: Spec. 36 (1961) 351–91, 573 f., 585 ff. = Der Hof von Champagne …, in: Lit. Mäzenatentum (wie Anm. 328)168 ff., hier 203 f., 222 ff. zu Johann als Heinrichs Korrespondent und zu Heinrichs Vorliebe für Val. Max. und ähnlicheErzählliteratur. Vgl. auch oben Anm. 297.330 Vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique § 6, Bibliogr. zu „profils de patrons“ 379, Nr. 180 ff. sowie oben Anm. 297.331 Vgl. BRÜCKNER, Historien 84 ff.; VERWEYEN, Apophthegma u. Scherzrede … 104 ff. (bes. zu Francis Bacon) undoben Anm. 325–7.332 In einem weiteren Sinn läßt sich allerdings von einer strukturellen Affinität von Herrschern und Geschichtenerzählernsprechen; HONSTETTER (77) erinnert an Suetons Bericht (Div. Aug. 89) von Augustus‘ Vorliebe für das Exzerpieren vonExempla.
138
bei dieser (hier nicht zu diskutierenden) Valerius Maximus-Interpretation333 und auch abgesehen von dermittelalterlichen Policraticus-Rezeption, liegt der intentionale Unterschied beider Werke auf der Hand: DerPolicraticus ist primär ein (wie immer stoffreich-bunter) Traktat mit einer eigenen Gedankenfolge, der dieeingestreuten Geschichten zu dienen haben. Er will ebenso unterrichten, belehren, mahnen, unterhalten wiezitiert und literarisch wiederverwertet werden. Von den Gattungen und Arten, die er berührt, wären zu nennen:Fürstenspiegel, Ämterlehrbuch, politischer Traktat, Hof- und Gesellschaftssatire, zeitkritische Streitschrift,rechtskundliche Kasussammlung, Anstands- und Klugheitslehre, Geschichtskompendium, Erzählstoff- undZitatensammlung, Apophthegemen- und Anekdotenkompilation, Enzyklopädie überhaupt,moralphilosophisches Handbuch, philosophiegeschichtlicher Abriß, Kurzbiographiensammlung und vielesandere mehr. Diese etwas wilde Vielfalt von Gattungsbestandteilen hat – trotz der von Max Kernerüberzeugend nachgewiesenen (im mittelalterlichen Sinne) „logischen Struktur“ des Policraticus334 – in derRezeptionsgeschichte dazu geführt, daß das Werk gewissermaßen dasselbe Schicksal erlitt, das Johann denzahlreichen Büchern seiner Bibliothek und seiner Kenntnis bereitet hat: Es wurde (nach anfänglich geringerVerbreitung) seit dem 13. Jahrhundert als bloße Vorratskammer für Exempla ohne Ansehen des Kontextsfleißig ausgeschrieben, aber selten mit konkreter Quellenangabe zitiert. Symptomatisch für dieWirkungsgeschichte ist nicht nur die verbreitete Unkenntnis dieser so einflußreichen Quelle, sondern auch derWirrwarr von Fehlbenennungen. Der „Policraticus“ wurde etwa aufgrund der Verwechslung von Titel undVerfasser als ein Schriftsteller angeführt, dem einen oder andern Kirchenvater zugeschrieben oder gar fürantik gehalten. Ja man konnte sogar glauben, Augustinus habe Exempla aus diesem vermeintlich früherenWerk geschöpft.335
333 Vgl. Anm. 38, 710.334 Oben Anm. 4; KERNER 121 ff.; vgl. auch unten S. 560 ff.335 Zur Rezeptionsgeschichte vgl. vor allem LINDER (wie Anm. 321) und ders., John of Salisbury’s Policraticus inThirteenth-Century England, in: JWCI 40 (1977) 276–82; ULLMANN (wie Anm. 34) 519 ff. – Zur Verwechslung von Titelund Verfasser s. ULLMANN 523; pseudo-antike Zuschreibung: unten Anm. 922 (Institutio Traiani); pseudo-patristischeZuschreibung: vgl. ULLMANN 540; ROUSE, Preachers (wie Anm. 323) 108, 132, 136, 144 f., 206, 430 (Pol. als Werk desJoh. Chrysostomus im Manipulus florum des Thomas v. Irland; dazu auch V. ROSE, Die Lücke im Diogenes Laertios undder alte Übersetzer, in: Hermes 1 [1866] 394–7); SMALLEY, Engl. Friars 241 f. zu Vital du Four († 1327), Speculummorale (aus Hs.): Unde sicut recitabat Augustinus IV de civitate Dei cap. IV et accipit de tertio libro de nugisphilosophorum (sic); „His picture of St. Augustine thumbing the pages of Policraticus in search of exempla is veryengaging.“ GARFAGNINI, Da Seneca a Giovanni di S. (wie Anm. 206) 233 ff. (in einer Kirchenväterstellen-Sammlungbestreitet Joh., als unde dicit Policratus [sic] eingeführt, neben Augustin, Hieronymus und Laktanz den Hauptteil der Zitate);LINDER (wie Anm. 321) 350 f. (Benützung des Pol. durch Pariser Theologen im 15. Jh. als patristische Autorität aufbeiden Seiten des Disputs für und gegen den Tyrannenmord; R. PALACZ, Les manuscrits du ‚Policraticus‘ de Jean deSalisbury en Pologne, in: Mediaevalia philosophica Polonorum 10 (1961) 55–8 (war nicht zugänglich).
139
Die gelegentlich allzu geringe Kenntnis der Mediävistik von der Vermittler- und Relaisfunktion wichtigerSammelwerke ist eine Folge der mittelalterlichen Gewohnheit, indirekte Zitate als direkte auszugeben, bzw.die älteste und ehrwürdigste Quelle zu nennen, die wirklich benützte aber zu verschweigen.336 – Der wichtigsteKanal für die ungeheure stoffliche Verbreitung der Policraticus-Exempla waren zweifellos die Kompendien desHelinand von Froidmont: Dieser Zisterzienser verwertete in De regimine principi, Chronicon und Demagistratuum moderatione den Policraticus so ausgiebig, daß er sich einen Ehrenplatz in der „Geschichte desPlagiates“ im Mittelalter verdiente. Denn Vinzenz von Beauvais übernahm, wohl ohne den Policraticus unddessen Autor zu kennen (also bona fide), die Helinand-Exzerpte in größtem Ausmaß in sein Speculum maius,d. h. in eines der meistbenützten Werke der europäischen Bildungsgeschichte. Zahlreiche Exempla Johannssind auf diesem Umweg als herrenloses Erzählgut in das spätere Mittelalter und in die Neuzeit gelangt.Insbesondere die humanistisch orientierten loci communes- und Exemplasammlungen der frühen Neuzeit, diesich oft auf den Speculum maius-Frühdruck von Douai (1624) stützten, trugen zu einer unabsehbarenVerbreitung der Policraticus-Exempla bei.337
336 Vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 116 f.; s. auch nächste Anm.337 Vgl. H. HUBLOCHER, Helinand von Froidmont und sein Verhältnis zu Johannes von Salisbury: Ein Beitrag zurGeschichte des Plagiates in der mittelalterlichen Literatur, Regensburg 1913; ULLMANN (wie Anm. 34) 522 ff.; LINDER(wie Anm. 321) 324 ff. – Vinzenz hat Helinand offenbar absichtlich nicht namentlich zitiert. Im Prolog betont erausdrücklich, er wolle nur alte Autoren anführen, jedoch ea que ipse vel a maioribus meis scilicet modernis doctoribusdidici, vel in quorumdam scriptis notabilia repperi, nomine meo i. e. actoris intitulavi (ed. S. LUSIGNAN; Préface au‚Speculum maius‘ de Vincent de Beauvais, réfraction et diffraction, Cahiers d’Et. médiévales 5, Paris 1979, 117). Die Fragenach Plagiat oder bona fides läßt sich darum für den Kompilator schwer ohne anachronistische Implikationen stellen.Oberlehrerhafte Kritik im Sinne HUBLOCHERS ist ebenso fehl am Platz wie die allzu positive Betonung der philologischenRedlichkeit beim Zitieren (so etwa A.D. von den BRINCKEN, Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von Beauvais, DieApologia Actoris zum Speculum maius, in: DA 34 [1978] 410–99, hier 421, 448). Das Ganze stammt meistenseinschließlich der Zitate aus Florilegien von Florilegien, wie dies allgemeinem mal. Usus entsprach. Es ist also durchauswahrscheinlich, daß Vinzenz nicht wußte, daß seine Helinand-Benützung die Policraticus-Ernte in nomine actoris weltweitverbreitete. Vgl. M. PAULMIER–FOUCART, L’Atelier de Vincent de Beauvais, Recherches sur l’état des connaissances auM.A.…, in: MA 85 (1979) 87–99, hier 95 f.: „Hélinand […] n’est pas une source comme les autres, mais la chair meme del’oeuvre de Vincent de Beauvais.“ Vgl. auch ders., Ecrire l’histoire au XIIIe siecle: Vincent de Beauvais et Helinand deFroidmont, in: Annales del’Est (Nancy) 33 (1981) 49–70. Das ganze Speculum maius war als didaktisches Handbuchzuhanden der predigenden Dominikaner intendiert, d. h. als eine Exempla-Sammlung im weitesten Sinne des Wortes. Vgl.M. LEMOINE, L’œuvre encyclopédique de Vincent de Beauvais, in: ‚La pensée encyclopédique au m. â., ed. M. deGANDILLAC et al., Neuchâtel 1966, 77–86, hier 78 f.; Fritz LANDSBERG, Das Bild der alten Geschichte in mal.Weltchroniken, Diss. Berlin 1934, 96 ff. (Vinzenz von Beauvais, Martin von Troppau, Flores temporum alsweltgeschichtliche Exempla-Handbücher). In die Exempla-Tradition im engeren Sinn gehören vornehmlich die lehrhaftenPhilosophenanekdoten (vgl. S. 168 ff.), und sogar der Titel speculum (nach dem Prol., ed. LUSIGNAN 117, aus speculatio= admiratio und imitatio gebildet) meint die Betrachtung von facta und dicta (s. S. 99, 536). Auch das typischhomiletische Motiv des Geschichtenerzählens für schlichte Gemüter wird eigenartigerweise als Hauptziel des ganzen Werks sovorgebracht (ebd. 116): Videbam […] temporibus nostris non tantummodo secularium litterarum verum et divinarumscripturarum ubique multiplicatam esse scientiam, omnesque precipue fratres nostros assidue sacrorum librorum historicisac misticis expositionibus […] insistere, inter hec autem hystorias ecclesiasticas quarum lacte pascebatur antiquorumsimplicitas, quodammodo viluisse et in neglectum venisse, cum tamen non solum utique voluptatis et recreationis spiritus,verum etiam edificationis plurimum in se contineant … Vgl. oben S. 129 ff. Man wird im Speculum jedoch vergeblich nach„Predigtexempla“ im volksliterarischen Sinn suchen; hier wie auch in andern Werken Vinzenz‘ (s. von MOOS, Trostschrift… [wie Anm. 264] 200, 204, 212) finden sich durchweg personale exempla virtutis im historisch-rhetorischen Sinn. Vonsolchen Exempla spricht auch eingehend der Prolog im Abschnitt Apologia de dictis philosophorum et poetarum (ed.LUSIGNAN 122 ff.). – Vinzenz und sein Stab gehörten zur Gruppe der „classicizing friars“ im Sinne SMALLEYS (Engl.Friars 1 ff.), deren Kompilationsmentalität und Gelehrsamkeit das Klischee von den volkstümlich-derben „Bettelmönchen“ad absurdum führen. Zu Geistesverwandten s. auch D. D’AVRAY, Another Friar and Antiquity, in: Religion andHumanism, (Studies in Church History 17) ed. K. ROBBIN, Oxford 1981, 49–58; John TAYLOR, The Universal Chronicleof Ranulfus Higden, Oxford 1966, bes. 72 ff. und nächste Anm. zu Johann von Wales; A.J. MINNIS, Medieval Theory ofAuthorship, Scholastic Literary Attitudes in the Later M.A., London 1984, 154 ff.; L.-J. BATAILLON, Les instruments detravail des predicateurs au XIIIe s., in: ‚Culture et travail intellectuel dans l’Occident medieval‘, (CNRS), Paris 1981,
140
Eine andere wichtige, aber ebenfalls vorwiegend anonyme Überlieferung verdankt der Policraticus dem seitdem 13. Jahrhundert anwachsenden Interesse an Philosophen-Viten der Antike. Diesem vor allem imscholastischen Universitätsmilieu bestehenden Informationsbedürfnis kam das anekdotenreiche Werk in derArt des damals noch kaum bekannten Diogenes Laertios entgegen. Die entsprechenden Exzerpte aus JohannsApophthegmenschatz wanderten so auf diffusen Wegen etwa von Johann von Wales und Walter Burley zuden humanistischen Viri illustres-Biographen. Auch hier wissen viele mittelalterliche
197–209. – Ein Beispiel für die verkannte große indirekte Wirkung des Policraticus als Quelle antiker Exempla ist Jakobsvon Cessoles Liber de moribus hominum ac officiis nobilium super lude scaccorum. J.M. MEHL (L’exemplum chez Jacquesde Cessoles, in: MA 84 [1978] 227–46, hier 235 f.) glaubt an eine direkte Benützung des Policraticus; doch die durchweggleichzeitigen Parallelen zu Helinand und Vinzenz schließen diese Annahme so gut wie aus. – Zur neuzeitlichen Rezeptionvon Vinzenz (und durch ihn von Johanns Policraticus) vgl. etwa BRÜCKNER, Historien 84 ff. (Morhof und dessenNachfolger); ALSHEIMER (wie Anm. 278) 17 ff. (Speculum exemplorum und Magnum speculum exemplorum maßgeblichfür die Verbreitung westlichen Anekdotenmaterials in Polen und Rußland).
141
Schriftsteller und oft auch moderne Gelehrte nicht, daß sie den Policraticus benützen, wenn sie solcheKompilatoren zitieren.338
An dritter Stelle lebten Johanns Exempla in der historiographischen Tradition weiter, wobei der Policraticusgelegentlich auch als authentische Geschichtsquelle galt.339 – Abgesehen von der Gattung der Fürstenspiegelund
338 Vgl. SMALLEY, Friars 51 ff., 54; dieselbe, Oxford Univ. Sermons (wie Anm. 321) 321 f. und: Moralists andPhilosophers in the 13th and 14th, in: Miscellanea Mediaevalia, Köln 2, Berlin 1963, 60–7, hier 63 f.; ULLMANN (wieAnm. 34) 524 f.; W.A. PANTIN, John of Wales and Medieval Humanism, in: Festschr. A. GWYNN, ‚Medieval Studies forA.G.‘, Dublin 1961, 297–319, hier 304; E. JEAUNEAU, Jean de Salisbury et la lecture des philosophes, in: The World ofJohn of 77–108, hier 95 f. u. a. zu Johann und Walter Burley; ROSE, Diogenes Laertios (wie Anm. 335); GARFAGNINI,Da Seneca a Giov. (wie Anm. 206); zur Benützung in der Renaissance unter diesem Aspekt vgl. A. MICHEL, Epicurisme etchristianisme au temps de la Renaissance, in: REL 52 (1974) 356–83. Das Thema der Philosophenexempla und dieBedeutung des Pol. für diese literarische Reihe bedarf weiterer quellenphilosophischer Arbeit. Vgl. auch den neuen Beitragvon J. BERLIOZ, Virgile dans la littérature des exempla …, zu Anekdoten über den „Naturphilosophen“ Vergil bei Vinzenzvon B., Johann von Wales, Walter Burley und Johannes Colonna, wo 85 eine Pol.-Anekdote bei Johann von Walesnachgewiesen wird. Überdies wäre zu erwähnen, daß Johannes Colonna, ein Freund Petrarcas, im Prolog zu seinem De virisillustribus den Pol.-Prol. (unten § 42, Anm. 366) aus irgendeiner Zwischenquelle anführt: exempla et dicta eleganciamemoratu digna […] inserui […] Exempla maiorum que sunt incitamenta et fomenta virtutum (BERLIOZ, Virgile 101 f.nach WELTER 203). Nicht gesehen habe ich: G. PLAIA. Il medioevo e la storiografia filosofica (Studi di filosofia e storiadella filosofia 6) 1983. – Neben den Philosophenviten bestimmte der Pol. Sammlungen von Tyrannen- und Herrscherviten;vgl. LINDER, John of S. (wie Anm. 335) 276 ff.339 Vgl. TAYLOR (wie Anm. 337) 79 f. zum indirekten Einfluß des Pol. dank der Vermittlung Johanns von Wales auf diebei den Predigermönchen überaus beliebte Weltchronik des Ranulfus Higden: „The humanism of the twelfth century reachedthe fourteenth century in an anthologized form“ Vgl. auch LINDER (wie A. 321) 328, 344 f.; SMALLEY, Friars 151, 215;unten S. 366 ff., S. 418 f., 564, A. 481, 485. Zur Anekdotisierung der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung s.S. 135 f.
142
Offizien-Traktate wurde der Policraticus für verschiedene Zweige der moralphilosophischen und juristischenLehrbuch- und Autoritäten-Literatur herangezogen, insbesondere als Kronzeuge in Fragen des (christlich zulegitimierenden oder zu verwerfenden) Tyrannenmords, wie sie in der „baronial opposition“ gegen dieenglische Zentralgewalt am Ende des 13. Jahrhunderts und später – weltanschaulich akuter – in denKonfessionskriegen des 16. Jahrhunderts in Frankreich lebendig wurden.340
Einen nicht unbedeutenden Platz nimmt der Policraticus auch in der frühhumanistischen Briefliteratur ein,insbesondere als außergewöhnliches Zeugnis für die Kontinuität der antiken Bildungstradition in den „finsterenJahrhunderten“.341Nachdem der Minorit Denys Foulechat das Werk 1372 im Auftrage Karls V. insFranzösische übersetzt hatte, wurde es auch in der frühesten Novellistik (etwa bei Antoine de la Sale)benützt.) Chaucers ‚Canterbury Tales‘ sind mehrfach direkt vom Policraticus abhängig.342 (Ob dies auch vonDante gilt, ist allerdings umstritten; doch kannte er nachweislich Policraticus-Stoffe der Helinand-Vinzenz-Tradition, was wiederum die hervorragende
340 Vgl. LINDER (wie Anm. 321) 346 ff. (Richard von Bury, Gervasius von Tilbury, Salutati, Christine de Pisan, Gerson)zur politischen Traktatliteratur. Dazu vgl. auch unten §§ 103, 115. Zur moralphilosophischen Literatur s. SMALLEY, Friars49, 151, LINDER a. O. 343 ff.; zur juristischen: W. ULLMANN, The Influence of John of Salisbury on Medieval ItalianJurists, in: The Engl. Hist. Rev. 59 (1944) 384–92. Zur Tyrannenmord-Behandlung vgl. LINDER, John of S. (wieAnm. 335) 382 („baronial opposition“) 346 ff. (Jean Petit; dazu auch unten Anm. 642, 726)341 Vgl. R.B. DONOVAN, Salutati’s Opinion of Non-Italian Writers of the Middle Ages, in: Studies in the Renaissance 14(1967) 185–201 zu Jean de Montreuil, Salutati und Petrarca); s. auch unten S. 527 f., 517, 602 f., 922.342 Die Übersetzung befindet sich in Hs. Paris, BN fr. 24287; ed. Ch. BRUCKER, Le Policraticus de Jean de S. traduit parDenis Foulechat en 1372, livres I–III, Nancy 1969, livre IV, 1985. – Vgl. LINDER (wie Anm. 321) 334; ULLMANN (wieAnm. 34) 541; unten S. 209, 556, 564 f. – Antoine de la Sale: LINDER a. O. 346 und M. LECOURT, Une sourced’Antoine de la Sale: Simon de Hesdin, in: Romania 76 (1955) 207 zu den Pol.-Beispielen aus der kommentiertenfranzösischen Val. Max.-Übersetzung des Simon de Hesdin. – Chaucer: vgl. LINDER a. O. 345 f.; ULLMAN a. O. 523;D.W. ROBERTSON, A Preface to Chaucer, Princeton (1962) 1969, 272 ff.; R.P. MILLER, Augustinian Wisdom andEloquence in the F-Fragment of the Canterbury Tales, in: Medieaevalia 4 (1978, ed. 1980) 247–75; A.J. MINNIS, Chaucerand Pagan Antiquity, Cambridge 1982, 10 ff., 53 ff. zu direkten und indirekten Wirkungen; R. PRATT, A Note on Chaucerand the Policraticus of John of Salisbury, in: MLN 65 (1950) 243–6 (zu Pol. VIII 1 und ‚The Wife of Bath‘, C.T.III763 ff.); ders., Chaucer and the Hand that Fed Him, in: Speculum 41 (1966) 619–42 zu Johann von Wales alsZwischenstufe.
143
stoffgeschichtliche Bedeutung der Sammeltätigkeit Johanns bestätigt.)343
Der Mittelalterforscher, der sich etwa für die bekannte philosophische, politische oder humanistischeThematik und die argumentative Struktur des Policraticus interessiert, wird die hier kurz zusammengefaßteWirkungsgeschichte als einseitig, abwegig oder gar ungerecht empfinden und die dabei festgestelltekompilatorische Haupttendenz als Zweckentfremdung, Ausbeutung oder Mißbrauch des Werks beklagen.344
Wir können jedoch unter dem (in dieser Arbeit maßgeblichen) methoden- und formgeschichtlichenGesichtspunkt auch von der durchaus zum Policraticus selbst hinführenden Frage ausgehen, womit Johanndiese so heterogene und „utilitaristische“ Rezeption ermöglicht oder gar veranlaßt hat; worin die besondereAttraktivität (das Nützliche, Lehrreiche, Erbauliche, Unterhaltsame, Anschauliche) seiner Exempla liegt;welche Eigenschaften ihnen diese Beliebtheit in so verschiedenen literarischen Traditionen bis hin zu demnach gängigem Verständnis gattungskonträren „Predigtmärlein“ gesichert haben; welche Eigenschaften alljene merkwürdigen Arten der Verselbständigung, Verstofflichung und Ablösung vom ursprünglichenPolicraticus-Kontext bewirkt haben.
343 In diesem Sinn zu Dante LINDER (wie Anm. 321) 324 f., 345; PADOAN (wie Anm. 264) 151 ff., 161. Die Bedeutungder Zwischenstufen verkennen demgegenüber Marino BARCHIESI, Un tema classico e medievale: Gnatone e Taide, Padua1963, 152 ff.; A. PÉZARD, Du Policraticus à la Divine Comédie, in: Romania 70 (1948/9) 1–36, 163–191; CURTIUS,ELLM 369; Gabriella ZANOLETTI, Il bello come vero alla scuola di Chartres: Giovanni di Salisbury, Rom 1979, 113 ff. –Noch kaum untersucht ist im übrigen die Policraticus-Rezeption der Neuzeit: vgl. S. 330 f. zu Sterne und M. CLAYTON,Ben Johnson ‚In Travaile with Expression of Another‘: His Use of John of Salisbury’s ‚Policraticus‘ in ‚Timber‘, in: TheRev. of Engl. Studies, Oxford 30 (1979) 397–108 (u. a. zu Pol. III 8–9, s. unten S. 508).344 In diesem Sinne explizit ULLMANN (wie Anm. 34) 520; vgl. auch S. 417 ff., A. 335.
144
III. DAS EXEMPLUM BEI JOHANN VON SALISBURY
A) TERMINOLOGIE
Exemplum: ein Allgemeinbegriff für Gegenstand und Darstellung (§ 40); historia: ein Erzählbegriff (§ 41).
40. Wie allgemein im Mittelalter üblich, verwendet Johann das Wort exemplum sowohl für einrepräsentatives Ereignis oder eine modellhafte Person als auch für den Bericht davon.345 Belege für einenreinen (erzähltechnischen) Gattungsbegriff lassen sich bei ihm nicht nachweisen; offenbar weil der dominanteexemplarische Objektbereich eine Isolierung des medialen Aspekts nicht zuließ.
Stets impliziert exemplum wie schon in der antiken Wortgeschichte ein „lehrreiches Geschehnis“, wobei derAkzent mehr auf der belehrenden Wiedergabe (documentum, testimonium) liegen kann oder mehr auf demVorfall oder Vorbild, das sich für die imitatio empfiehlt (monimentum, exemplar). In allen untersuchtenStellen des Policraticus steht exemplum entweder ausschließlich ereignis- oder personhaft für Vorbild, Modell,abschreckendes Beispiel (exemplum virtutis/exemplum vitii) wobei es häufig in Antithese zu Begriffen desRedens, Vorschreibens, Theoretisierens erscheint (verba, praecepta, auctoritas, lex, ratio),346 oder aber in 345 Zur Doppelbedeutung (Ereignis und Erzählung) vgl. S. 45 f., 122 ff. Zur antiken Vorgeschichte vgl. KORNHARDT59 ff. mit paradigmatischem Hinweis auf Rhet. ad Her. IV 9.13 (oben Anm. 12 zitiert). Danach heißt exemplum nicht„lehrreiche Erzählung“ und auch nicht „Geschichtsfaktum, aus dem sich eine Lehre hinterher ableiten läßt“, sondern einfach„lehrreiches Geschehnis“. Vgl. auch ThLL s. v. 1331.60 zu exemplum = ipsa res memorabilis und ebd. 1335.70: eximium etpeculiare aliquid quod a rebus gestis […] narrando affertur (und zur Wendung: audire exemplum). In der Mediävistik istdie anachronistische Aufspaltung des einheitlichen Wertbegriffs in eine gegenständliche und eine mediale Bedeutung überausverbreitet, da nur die Isolierung der letzteren den narrativen Gattungsbegriff zu konstruieren erlaubt. Mit Recht sagt VITALE-BROVARONE (97 f.) dazu aufgrund interpretationspraktischer Erfahrung: „Non è mai chiaro se il termine exemplum designiil racconto o il fatto raccontato.“ Symptomatische ist die ebd. zitierte Prologstelle des Johannes von San Gimignano, dereine Sammlung von exempla im Sinne von similitudines rerum (oben S. 152) empfiehlt, inden er sich auf das (vorbildliche)exemplum patris nostri Dominici beruft, dessen Reden und Gespräche reich an rhetorisch wirksamen Erbauungsbeispielenwaren (edificatoriis affluebat sermonibus et habundabat exemplis), und schließlich gewissermaßen spezialistisch betont, erwolle nicht die genugsam bekannten exempla historialia aus Bibel, Heiligenleben und „Taten der Heiden“ – zweifellossowohl historisch-personale Exempla wie „Predigtmärlein“ – nochmals vorbringen, sondern die, wie er meint,vernachlässigten „Naturbeispiele“ des außer-menschlichen res-Bereichs, der Qualitätenallegorese (S. 120). In einem Satz zeigtder Exemplum-Begriff also eine Bedeutungsbreite, die vom außerliterarischen, lebenden Vorbild über die literarische„Exempelfigur“ und Beispielerzählung bis zum grammatikalisch-tropologischen Sinn der Metapher und der übertragenenRede reicht. Wie komplex der mittelalterliche Exemplum-Begriff, wie unhaltbar mithin die narratologische Monopolisierungder Sonderbedeutung narratio aedificatoria ist, zeigt gerade der Meister des homiletischen Exemplums, Jacob von Vitry,wenn er exemplum im Sinne des hagiographischen Vorbilds mit der klassischen Antithese (S. 177 f.) einsetzt: Multi enimincitantur exemplis qui non moventur praeceptis (Vita der hl. Maria v. Oignies, AA SS Boll. Iun. IV, 1707, 636, 23. Juni).Dante, der gegen predigende „Geschichtenerzähler“ polemisiert (Par. 29, 109 f. oben Anm. 315) und dabei von „Geschwätz“,„eitlen Possen“, „dummen Witzen“ spricht, bezieht andererseits als hervorragender Vertreter des historisch rhetorischenExemplums den exemplum-Begriff mit einer evangelischen Wendung (Joh. 13.15; I Petr. 2–21 u. a.) klar sowohl auf eineheroische Person als auch auf eine bestimmte (unlöslich mit dieser verbundene) symbolhafte Anekdote, sowohl auf denmoralischen Vorgang des Beispielgebens als auch die Nachahmung des Vorbilds (Monarchia II 5, ed. G. VINAY, 1950,136/138): Nonne Cincinnatus ille sanctus nobis, reliquit exemplum libere deponendi dignitatem in termino cum […] NonneFabricius altum nobis dedit exemplum avaritie resistendi cum… (Zum Kontext s. unten Anm. 1178). Dantes ganzrhetorischer Exemplum-Begriff zeigt sich auch in der tractatio-Theorie des Briefes an Can Grande (X. 9): Unter den zuÜbungszwecken empfohlenen modi tractandi (narrationem) findet sich an letzter Stelle der modus exemplorum positivus;vgl. LAUSBERG § 1115; H. PFLAUM, Il modus tractandi della Divina Commedia, in: Giornale Dantesco 39 n.s. 9 (1938)153–78, hier 177; unten Anm. 374 (positivus).346 Zu dieser Antithese s. unten §§ 43, 45, S. 178. Zu exempla virtutis s. unten Anm. 336 (Pol. Prol. 12.1–17), obenAnm. 1 (exempla sanctorum in Ep. 217, [II] 364). Weitere Stellen sind z. B. Pol. II 28, (I) 165.12 ff.: Sane si adimpugnandum hunc errorem concursus rationum et […] ecclesiae auctoritas non suppeteret, vel exempla malorum eumsufficiunt extirpare. Ebd. III 14, 223.20 ff.: In quo quantum a virtute maiorum etas nostra degeneraverit, perspicuum est,cum sine patientia aut nullum aut rarum esse opus virtutis verbis docuerint et exemplis. Ebd. III 14 (I) 230.31 f. (nach einer
145
einer doppelsinnigen, sowohl das Geschehnis (res gestae) als auch das Medium der Erzählung (narratio,descriptio)
langen Aufzählung römischer Kaiser): Sed cur patientiae exempla propono … Ebd. IV 6 (I) 252.10 253.17: Quod si ille inhac parte non creditur imitandus [… s. unten Anm. 971] proficiant vel exempla regum illustrium […] Nam de Theodosioquid dicam quem isti [imperatores] virtutis habuerunt exemplar. Ebd. IV 5, (I) 246.17 zur Verantwortung des Vorgesetztenne inferiores corrumpat exemplis. Ebd. VI 22 (II) 63.23: Quod si non noveras, vel Didonis docearis exemplo (Exemplum als„lehrreiche Gestalt“ auch in der Dichtung). Ebd. VII 9, (II) 126.15: malorum exempla proponunt [poetae]; ebd. 128.3:siquidem exemplis saepe magis proficitur quam praeceptis. Mala enim vitantur facilius quo fidelius praecognita fuerint.Ebd. VIII 7 (II) 270.20 f.: Ne tamen vitiorum longe petantur exempla maiorum erroribus suos nostra etas adiecit. Meminimeipsum […] Ebd. VIII 19 (II) 367.6–8 (Nero vor dem Tod): Ac modo Sporum hortabatur ut lamentari inciperet, modoorabat ut se aliquis ad mortem coexemplo animaret. Enth. 1310 ff. (178): Qui titulo regis publicus hostis erat./Poniturexemplar regum populumque regendi/Et bene vivendi formula certa datur.
146
bezeichnenden Bedeutung.347 Auch in den wenigen Fällen einer medialen Verwendung von exemplum ist dieBedeutung nicht narrativ (etwa im Sinne von Anekdote, unterhaltsam-erbauliche Kurzerzählung), sonderngrammatikalisch oder stilistisch und bezieht sich auf Arten der bildlichen Rede wie Analogie, Metapher,Vergleich, Gleichnis (similitudo, homeosis). So sagt Johann etwa von Pythagoras und Plotin, die denSelbstmord verboten haben sollen, weil im Kriegsdienst niemand ohne Erlaubnis des Führers seinen Postenverlassen dürfe: „Ein wahrhaft treffendes Beispiel haben sie verwendet, da doch das Menschenleben auf ErdenKriegsdienst ist.“348 Andererseits schreibt er, Vegetius habe die „Kunst“ der Kriegsführung sorgfältig undverständlich dargetan, aber die „Beispiele“ zu knapp behandelt. Diese Verwendung entspricht dem in derLehrbuchliteratur heimischen Begriffspaar
347 Vgl. unten § 41 (Kombinationen mit historia); KNAPE (wie Anm. 353) 60 (historia sive exemplum). Pol. IV 3 (I)242.32 f. (nach Anekdoten von Kodros und Lykurg, wie unten Anm. 960): His quidem exemplis eo libentius utor quodapostolum Paulum eisdem usum […] invenio. Ebd. IV 4 (I) 244.11 ff.; Sed quid ad emendicata gentium exempla decurro,quae tamen plurima sunt, cum rectius quisque possit ad facienda legibus quam exemplis urgeri. Pol. IV 8 (I) 265.10: Demagistratuum moderatione librum fertur scripsisse Plutarcus, qui […] iustitiae cultum verbis instituisse dicitur et exemplis.Ebd. V 4.292.16 (Plutarch): Multa quoque proponit exempla quibus liquet […] Testatur hoc […] Ebd. VI 15 (II) 40.23 Sedcum omnium gentium exempla revolvo […] Ebd. VI 19 (II) 56.28: Militaria quoque praecepta strenuorum iunioribus saepereferenda sunt ut his ad scientiam instruantur […] Ebd. 57.8: Vegetius […] artem tradidit licet exempla perstrinxerit.Ebd. VII 13, 149.2: ad studium quaerendi non modo domesticis sed etiam extraneis animamur exemplis. Nam Solon […]Ebd. VII 19, 175.10 f. (unten Anm. 643): … concurrentibus exemplis et sanctionibus patrum Ebd. VII 20, 187.7: Ad haecconquisita tyrannorum exempla proponunt, quibus persuadeant potestatibus universa licere […] Ebd. VIII 14, 331.14:Huius rei Temistocles testimonio est et exemplo, qui […] Ebd. VIII 15, 339.9 f.: Suam Philippo vendidit Grecia libertatem.Et in ipsam Valerius Maximus his exemplis invehitur: […]; ebd. 340.15: […] Haec Valerius. Sed possunt etiam nequioraavaritiae inveniri exempla.348 Similitudo: S. 332 ff., 590, Anm. 106, 287. Pol. II 28, (I) 160.1 ff.: Pitagoras et Plotinus prohibitionis huius praeconesomnino illicitum esse dicentes quempiam militiae servientem a praesidio et commissa sibi statione discedere citra ducis velprincipis iussionem. Plane eleganti exemplo usi sunt, eo quod ‚militia est vita hominis super terram‘ (Job 7.1). Zur militia-Metapher vgl. auch A. 986 und (zu deren Funktion in der platonischen Selbstmordkritik) P. COURCELLE, La postéritéchrétienne du ‚Songe de Scipion‘, in: REL 36 (1958) 205–34, hier 229 ff.
147
von Theorie und Anwendungsbeispiel, wie es aus der Gegenüberstellung von Regeln und Illustrationen inGrammatiken am besten bekannt ist.349
Der sonst nie vom signifikanten res-Bereich der Geschichte gelösten Bedeutung von exemplum entsprichtauch die Verwendung des Wortes in typologisch-allegorischem Zusammenhang als Synonym für figura undtypus.350 Diesen insgesamt auf dem Analogie-Begriff beruhenden tropologischen und bibelhermeneutischenSonderbedeutungen von exemplum sind noch einige philosophisch-erkenntnistheoretische zur Seite zu stellen:exemplum ist auch der Gegenbegriff zu exemplar, bedeutet Abbild, Abglanz, Nachbildung, Realisierung,Vergegenwärtigung, Konkretisierung, Repräsentation u. ä. in Relation zu Form, Regel, Idee, Urgestalt, Typus,Archetyp, Vorbild u. ä.351 Im Universalienstreit stellte sich Johann auf eine aristotelische Linie gegenneuplatonische Versuche, den Allgemein- und Gattungsbegriffen Realität zuzusprechen. Dabei kommtexemplum als Träger des Einmalig-Konkreten gegen das bloß Gedachte, Abstrahierte, Generalisierte zurGeltung.352
41. Die Form, in der ein Exemplum erzählt wird, heißt bei Johann nicht exemplum, sondern historia. Historiaist der erzähltechnische Zentralbegriff
349 Pol. VI 18 (II) 57.6 f.: quae Vegetius Renatus, cuius, eo quod elegantissime et diligentissime rei militaris artem tradidit,licet exempla perstrinxerit, plura inserui.350 Vgl. §§ 55, 76, 101, 107, S. 64, 435, 459 f. und ThLL s. v. exemplum 1349.25–28.351 Zu Pol. II 18 und Met. IV 9 ff. sowie zum exemplum in der Erkenntnistheorie (memoria) und in der Induktionslehre vgl.unten § 50, S. 434, 188 ff.352 In Met.II 17,93 ff. kritisert Johann die „realistische“ Gegenposition: Est autem idea, sicut Seneca diffinit, earum quenatura fiunt exemplar eternum [Ep. 58.19 …] proprie et vere dicuntur universalia idee. […] idee, id est exemplares forme,rerum primeve omnium rationes sunt, que nec diminutionem suscipiunt nec augmentum, stabiles et perpetue […] Est autemforma nativa originalis exemplum et que non in mente Dei consistit, sed rebus creatis inheret. Hec Greco eloquio dicitur‚idos‘, habens se ad ideam ut exemplum ad exemplar, (ähnlich Met IV 35, 205). In Met. II 20, 99 vergleicht er die generaund species als Denkrepräsentationen mit grammatikalischen Regeln: Sicut enim in grammatica dicitur: ‚Nomina quae sicdesinunt feminina vel neutra sunt‘: generalis quedam prescribitur ratio, que quasi multorum declinabilium exemplar est,exempla vero in omnibus illius terminationis dictionibus manifesta sunt. Darauf (111 f.) betont er mit Aristoteles, dieabstrakten Gattungsbegriffe seien quasi quaedem figmenta rationis, nachträgliche, heuristische Denkhilfen, Konstruktionendes Menschenverstands, nicht aber, wie Plato meinte, exemplaria singularium oder formae exemplares quae in mente divinaintelligibiliter constiterint antequam prodirent in corpora […]. Das Allgemeine sei nicht außerhalb des Einzelnen zu finden(101): nichil universale est nisi quod in singularibus invenitur. Dies ist auch der Kern von Johanns aristotelischerExemplumtheorie. Zu Johanns Stellung im Universalienstreit vgl. unten S. 291.
148
für unseren Gegenstand.353 Als solcher ist das Wort verwandt mit literarischen Funktions- undGattungsbegriffen wie argumentum, fabula, apologus,
353 Zur Begriffsgeschichte von historia liegt seit kurzem die grundlegende Arbeit von Joachim KNAPE, Historie inMittelalter und früher Neuzeit, begriffs- und gattungsgeschichtliche Untersuchungen im interdisziplinären Kontext, (Saeculaspiritualia 10), Baden-Baden 1984, vor, die mir nach Abschluß dieses Teils der Darstellung bekannt geworden ist. DasFolgende punktuell zu Johann von S. Festgestellte wird dadurch aus weiterer Sicht und in kritischer Berücksichtigung fastder gesamten Forschungsliteratur aufs Schönste ergänzt und bestätigt. Ebenfalls nachträglich erschienen ist die im Ergebnissehr ähnliche Studie von H.-W. GOETZ, Geschichte (wie Anm. 149a), der dem Wort historia dezidiert jegliche Bedeutungvon Geschichte als Ereignis, res gestae, Ereigniszusammenhang, d. h. jeden nicht-medialen Sinn abspricht (bes. 176 f.,182 ff.). – Historia = Einzelgeschichte, Anekdote: vgl. etwa Pol. II 14 (I) 87.10; II 15,91.18; II.4, 71.6 ff.: Vetus referthistoria, sic dicta quod est auctor eius incertus et vetera refert. V 8, 314.30 ff.; IV 12, 276.15; VIII 17, (II) 347.10; VIII19, 371.14 f.; VI 14,39,26; VIII 20.376.2, 377.31–378.1: Hoc tamen cavendum docent historiae […]; VIII 21, 393.30. ZuJohann historia-Begriff vgl. auch MICZKA 33 ff. Zur auch sonst im Mittelalter verbreiteten Bedeutung von„Einzelerzählung“ vgl. KNAPE a. O. 12 ff., 67 (historia = narratio rei gestae); 85 ff. (schulrhetorisch-poetologischerTerminus technicus für alle narrationes von Geschehnissen); 149 ff. („Segmenterzählung“ in Bibel und größeren Werken,Anekdote in Geschichtswerken); 53 ff. (auslegbare selbständige Erzähleinheit überhaupt, = exemplum, fabula, parabola etc.);165 ff. (Kurzbiographie, Vita, Legende, Biographie, autobiographische Konfession und Tatenbericht). In dieserüberzeugenden Darstellung des grundlegend formalen, nicht inhaltlichen Charakters von historia und der (alle modernenGattungssystematiker zur Verzweiflung bringenden) Unschärfe, Vielfalt und Formelhaftigkeit des Begriffs fehlt m. E. nurnoch eine eingehendere Würdigung des bibelexegetischen historia = littera-Komplexes, da die Formalisierung des Begriffsmit der Entsubstantialisierung der Geschichtsrealität zum Bedeutungsträger für höhere, nicht-historische Wahrheitzusammenhängen dürfte (dazu s. unten §§ 42, 74, 94, 105) und J. EHLERS, Historia, allegoria, tropologia – ExegetischeGrundlagen der Geschichtskonzeption Hugos von St. Viktor, in: MlatJb 7 [1972] 153–60); GOETZ, Geschichte (wieAnm. 149a) 202 ff. – Zur Begriffsgeschichte vgl. auch Karl KEUCK, ‚Historia‘, Geschichte des Wortes und seinerBedeutungen in der Antike u.i.d. roman. Sprachen, Münster 1934, 5 ff. (Dominanz des medialen über den gegenständlichenSinn bereits antik), 25 ff., 119 ff. (seit Gellius die oben erwähnte Hauptbedeutung von Kurzerzählung im Mittelalter);HONSTETTER 218 (historiae bei Cic. für argumentative Erzähleinlagen); GUENÉE, Hist. 18 ff. und ders., Histoire,annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au m. â., in: Annales E.S.C. 1973, 997–1016, 1003 f. auch in‚Politique et hist.‘ (wie Anm. 181) 279 ff. (historia als „n’importe quel récit“ im 12. Jh.; Hauptsinn stets „récit“, nicht„événement“); LACROIX 9 ff., 16 ff.; KLEINSCHMIDT 87 ff.; WOLPERS (wie Anm. 232) 9 u. ö. (historiae = Legenden);OPPEL, Exemplum und Mirakel 101 f. (historia als Überschrift neben narratio, gestum, fabula, parabola u. a. inhomiletischen Exemplasammlungen). – Besonders hervorzuheben ist einerseits der einflußreiche historia-Gebrauch durchIsidor und seine Imitatoren (vor allem Hugo von St. Viktor): Etym. I 5.4: partes orationis octo: […] tropi, prosa, metra,fabulae, historiae; ib. I 41.1: Historia est narratio rei gestae, per quam ea quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur;ib. 43: Historiae gentium […] utilia dixerunt. Multi enim sapientes praeterita hominum gesta ad institutionem praesentiumhistoriis indiderunt; Diff. 193: exemplum historia est (A. 143, 361 ff.). Andererseits dürfte Johanns Vorliebe für denErzählbegriff historia von Hieronymus bestimmt sein. Vgl. FUHRMANN, Mönchsgeschichten … 67 ff. zur Übertragungdes für hellenistische Romane und Novellen üblichen Terminus auf die Vita Malchi; s. auch Adv. Iov. 1.41 (PL 23) 282B–C;In Is. 19.23 (PL 24) 187 C; Adv. Iov. (PL 23) 318 B von Johann in Pol. V 17 (I) 359.12 übernommen: Refert Satirus, quivirorum illustrium scribit historias, quod iste Diogenes […] (für eine Philosophenanekdote). Zum Dignitätsgefälle innerhalbder Erzählbegriffe zwischen der hohen historia und der niedrigen fabula vgl. auch § 59, S. 82 ff., 221 ff., 228.
149
facetia, strategemma, narratio u. a.354 Selbst ganz kurze Erwähnungen von Personen in sog. Exempelreihenheißen historiae.355 Dies verweist auf die verbreitete Methode der Kurzanspielung oder des„Ereignisvermerks“, die nach Quintilian einen höheren Bildungsstand des Rezipienten voraussetzt.356
Aufschlußreich sind Stellen, in denen exemplum und historia miteinander verbunden werden. Die dabeimöglichen Beziehungen reichen von der begrifflichen Antithese zwischen „Ereignis“ und „Bericht“ bis zursynonymischen Verwendung (in der exemplum den erwähnten Doppelsinn von Ereignis
354 Fast synonym mit historia verwendet Johann strategemma nach Frontin (s. unten § 73) für eine Geschichte mitmoralischer Pointe; vgl. Pol. V 8 (I) 314.30: Constantia quoque cum ex pluribus strategemmatibus pateat, in virtuteRomanorum maxime claret. Eorum siquidem […] virtute, si omnium gentium historiae revolvantur, nichil clarius lucet (dasBild impliziert gleichzeitig den Sinn von „Geschichtenbüchern“). Zu apologus s. S. 221 ff., 387, 601; zu narratio vgl.Pol. I 10, (I) 48.23 ff.; descriptio für länger ausgeführtes Exemplum: Pol. VIII 13, (II) 327.9. – Entsprechend unterscheidetJohann auch nicht zwischen historiographischen und poetischen historiae; Pol. I 4 (I) 27.5 f.; Si historiis quas suis poetaedecoloravere figmentis fides subtrahitur […]; Pol. I 8, 46.12 f.; histriones […] qui gestu corporis arteque verborum etmodulatione vocis factas aut fictas historias sub aspectu publico referebant (vgl. Isid. Et. 18.48: histriones […] saltandohistorias et res gestas demonstrabant; und oben Anm. 131). Pol. II 27 (I) 145.20 ff. (Überleitung von einem Statius- zueinem Lucan-Zitat); ad notiores transeatur historias, ne falsitatis nota in historias refundatur. Vgl. KNAPE 38 f., 81 f.,KLEINSCHMIDT 87 ff. und unten §§ 57, 59, S. 178 ff.355 Vgl. S. 329 ff. und Pol. VIII 19, (II) 371.14 f.: Decreveram hic subsistere et ad alias a Romanis transire historias […]Ebd. VIII 21, 396.5 ff.: Si quis antiquas nescit historias […] si casus et praecipitia praecedentium non recolit tirannorum[…] (beides im Zusammenhang mit Namenlisten und Aufzählungen).356 Vgl. oben § 19, S. 50 f. – „Ereignisvermerk“; KLEINSCHMIDT 105, 114, 150.
150
und Erzählung bewahrt).357 Auch wenn historia gelegentlich im Sinne eines Allgemeinbegriffs (wie „römischeGeschichte“) erscheint, so ist damit nicht ausschließlich der Objekt- oder Ereignisbereich gemeint, sondern –wie schon die regelmäßig damit verbundenen Vorstellungen der „Wahrheit“ und „Glaubwürdigkeit“ zeigen –auch eine verläßliche historische, oder besser historiographische Tradition, auf die man sich berufen kann.358
In weitaus den meisten Fällen hat historia den Sinn einer erzählten, insbesondere schriftlich fixierten,autorisierten „Geschichte“ und kann darum mit der abgeleiteten Bedeutung des „Geschichtenbuchs“ oder deshistoriographischen Werks verschmelzen.359 Besondere Nuancen zeigt der historia-Begriff
357 Vgl. Pol. II 25 (II) 25.5 ff.: […] michi multorum auctoritate et ratione persuasum est. Quod si tibi persuadere nonpossum […] michique repugnantibus exemplis quae de variis affers historiis […]; VI 6 (II) 18.3 f.: Antiquas et modernasrevolve historias et plane invenies quia […] Ne longe petantur exempla, Nivicollini Britones […]; VI 18 (mit mehrerenÜbergängen im gleichen Zusammenhang einer Exempla-Reihe) 47.4 f.: Et quia Brenni historia alicui forte nimis remotavidebitur ad demonstrandam virtutem […] accedo propius et quae sunt fere omnibus nota […] proponam; 49.8: Ne longepetantur exempla […]; 51.16: Theodosio minore, quem historiae conferunt Alexandro […]; VI 17 (II) 44.21 ff.: Neque enima Romanis et Grecis tantum nobis sunt exempla virtutis, nam et domesticis abundamus. Tradunt historiae Brennum…; VIII18 (II) 363 f.: Haec quidem possunt et apud alios historicos inveniri diffusius, qui tirannorum atrocitate et exitus miserosplenius scribunt. Quae si quis diligentius recenseri voluerit, legat ea quae Trogus Pompeius, Iosephus […] et alii historici,quos enumerare longum est, suis comprehenderent historiis […] Praeter rem tamen non videtur, si haec […] aliquibusastruamus exemplis. Pol. IV 11 (I) 270.21: Quod et historiarum liquet exemplis.358 Vgl. MICZKA 33 ff.; Pol. VIII 20, (II) 373.5 ff.: Sed ne Romanae historiae vilescat auctoritas … Dabei ist übrigens niesicher, ob nicht ein bestimmtes historisches Buch gemeint ist, wie etwa Florus in Pol. IV 16, (I) 43.3: quod de CisalpinisRomana narrat historia, cuius verba sunt haec: […]. Pol. VIII 19 (II) 371.8 ff.: Haec tamen non impediat supputatioveritatem historiae … Ebd. VI 17, 45 11: non modo fides historiae sed celebris traditio est […] (m. E. wird hier einWertbegriff historia = Historizität und Glaubwürdigkeit verstärkt durch den zweiten und davon getrennten Wertbegriff derautoritativen schriftlichen Überlieferung; vgl. S. 214). Pol. II 15, (I) 93.12: ab initio urbis conditae totam revolvathistoriam (im Sinn eines zu beherzigenden Gesamtberichts von der römischen Geschichte). Vgl. jedoch unten Anm. 361 zumFehlen des modernen Kollektivsingulars „die Geschichte“ im Mittelalter. „Gesamtgeschichte“ ist in diesen Beispielen nichtzufällig an den cursus einer Kultur oder Nation gebunden.359 Vgl. allgemein KNAPE 79 ff.; KEUCK 15 ff. (Antike); unten S. 232 ff. zu Pol. VII 1, (II) 93.7: Quaedam vero, quae inlibris auctorum non repperi, ex usu quotidiano et rerum experientia quasi de quadam morum historia excerpsi. (Sogar dieeigene Augenzeugenschaft ist eine Art zitierbares Buch). Vgl. auch S. 208 ff., 360 ff., 369 ff.
151
im Zusammenhang mit der Bibel: In der Einzahl kann er hier die Heilige Schrift als Ganzes, in der Mehrzahleinzelne Bücher oder Kapitel, Abschnitte, Erzähleinheiten bedeuten.360 Überhaupt darf wiederholt werden,daß historia im Mittelalter (weit mehr als exemplum) auf Formales und Innerliterarisches verweist, m.a.W.unserem neuzeitlichen Begriff der objekthaften Faktengeschichte („histoire réalité“) noch ferner steht alsexemplum. Historia ist ein erzähltechnischer Funktions- und Gattungsbegriff, ein grammatikalischer oderrhetorischer Fachterminus, eine Einteilungskategorie im Wissenschaftssystem und vieles andere mehr, aberkeineswegs das, was seit dem 19. Jahrhundert unter „Weltgeschichte“ verstanden wird.361 Wenn Isidorunterscheidend den historiae als literarischen Zeugnissen die gesta als Ereignisse entgegensetzt362
360 Vgl. allgemein KNAPE 79 ff., 149 ff. (biblische „Segmenterzählungen“). – Joh., Ep. 187, (II) 234: Sed quid pauca etparva proponuntur exempla? Scriptura fere tota, quae in historiis digesta est, talibus virorum illustrium referta estmonimentis. Es braucht sich hier nicht, wie MICZKA (36) annimmt, um die eigentlichen Geschichtsbücher des AltenTestaments zu handeln, da historiae entweder einfach Bibelteile sind (vgl. R.D. RAY, Med. Historiography through theTwelfth Century … in: Viator 5 [1974] 33–59, 35) oder, wie der hier explizite Bezug auf personhafte exempla virtutumnahelegt, „lehrreiche, nachahmenswerte Geschichten“. Pol. 14, (I) 27.5 ff.: Quod si historiis, quas suis poetae decoloraverefigmentis fides subtrahitur, illi [sc. historiae] utique credi necesse est, quae ex eo quod scripta est digito Dei irrefragabilem[…] sortita est auctoritatem. Pol. VIII 20, (II) 373.5 f.: Sed ne Romanae historiae vilescat auctoritas […], hoc divinae etfidelis historiae comprobetur exemplis. Pol. II 17, (I) 145.28 f. (Übergang von einem Lucan- zu einem Bibelzitat): Sed nefalsitatis nota in historias […] refundatur, canonica et cui fides incolumis adquiescit discutiatur historia. Ebd. 151.28:Lege libros, revolve historias, scrutare omnes angulos scripturarum […]. Vgl. auch oben Anm. 219 zu den drei Kategoriender historici.361 Vgl. KNAPE 12 ff., 85 ff., 191 ff. (historia im Mittelalter stets primär eine literarische Form und rhetorisch-poetischeKategorie, meist ohne „geschichtstheoretische“ Bedeutung; der Kollektivsingular „Geschichte“ = „Geschichte schlechthin“nicht vor dem späten 18. Jh.). Vgl. auch LAUSBERG s. l. historia II 715; M.D. CHENU, Conscience de l’histoire etthéologie au XIIe s., in: AHDLM 21 (1954) 107–133, 109 zur Deutung des grammatikalischen Terminus historia von Isid.Et. 1.5.4 (oben Anm. 353 zit.) bei Hugo von St. Victor, Didasc. III 4 (appendicia artium: tragediae, comediae, satirae,fabulae, historiae); P. ROUSSET, La conception de l’histoire à l’époque féodale, in: ‚Mél. d’hist. du MA‘., Festschr. L.HALPHEN, Paris 1951, 623–33, hier 625 ff.; ders., Un problème de méthodologie, l’événement et sa perception, in: Mél.R. CROZET 1966, I 315–21; MELVILLE, System 45 f.; KNAPE 75 zur Verbindung des buchhaften Begriffs (wieAnm. 359) mit dem biblischen „Segment“-Begriff in einem Zeugnis des 13. Jhs. über Petrus Comestor: Omnes historiasveteris ac novi testamenti breviavit in unam historiam quam vocavit scolasticam (Der Literaturkatalog von Affligem, ed. N.HÄRING, in: RB 80 [1970] 86 f.). Zu den wesentlichen geschichtstheoretischen Implikationen vgl. KOSELLECK,Vergangene Zukunft 130 ff., 262 f. u. ö.; LÖWITH (wie Anm. 129) 43, 390 u. ö. (bei KNAPE, der mirabile dictuKOSELLECK kaum und LÖWITH überhaupt nicht zitiert, kommen diese philosophischen Aspekte entschieden zu kurz);vgl. unten § 105, 109, sowie § 83 zum „Buch der Natur“ und der damit verbundenen Darstellung der providentiell von Gott„geschriebenen“ Geschichte: Diese Buchmetapher trug zweifellos zum späteren Bedeutungswandel von historia als Erzählungzu historia als Ereignisfolge und „Geschichte überhaupt“ bei.362 Etym. I 43, oben Anm. 353; vgl. auch GUENÉE, Hist. 18 ff.
152
und Papias die historia genannte Unterrichtsdisziplin mit den Mutterbrüsten, die exempla mit dem darausfließenden Nährstoff vergleicht,363 so erklären solche Vorstellungen leicht, warum auch das von modernenErzählforschern einheitlich exemplum getaufte homiletische Geschichtchen im Mittelalter von den Predigernund Predigttheoretikern selbst hinsichtlich der Erzählform häufig historia (und nur hinsichtlich desLehrinhalts exemplum) genannt wird.364
363 Papias, Elementarium doctrinae rudimentum, Venedig 1491/repr. Turin 1966 s. v. aetas: aetates spirituales habetinterior homo non in annis sed provectibus distinctas: primam in uberibus utilis historiae, quae nutrit exemplis. (zu dieserEinordnung in den Anfänger- und Kleinkinderunterricht s. S. 343, Anm. 369).364 Vgl. KNAPE 60, 152 ff. (historia sive exemplum), 192: „Was ein Exempel ist, konnte von der Forschung bislang nochnicht definitiv geklärt werden“ (mit Verweis auf die „noch immer gültige“ Arbeit SCHENDAS ganz in dem oben Anm. 36,110 angesprochenen Sinn). – FRENKEN (wie Anm. 101) 14 behauptet, Guibert von Nogent habe den Begriff exemplum fürPredigtmärlein noch nicht gekannt und dafür historia verwendet; nach Lb. quo ord. sermo fieri debeat (PL 156), 25: placereetiam nonnullis comperimus simplices historias et veterum gestas sermoni inducere. Gerade diese Stelle ist aber eineReminiszenz aus Isid. Etym. I 43 (oben Anm. 353). Daß historia auch lange nach Guibert der Universalbegriff für das durchdie Mediävistik fragwürdig unter „Exemplum“ subsumierte Erzählgut darstellt, zeigen etwa folgende Belege: Humbert vonRomans unterscheidet in De modo prompte cudendi sermones ad omne hominum et negotiorum genus (nach WELTER 71aus Max. Bibl. Patrum, Lyon 1677, XXV 433): Alia est scientia creaturarum. Effudit enim Deus sapientiam suam superomnia opera sua, propter quod beatus Antonius dixit creaturas esse librum. Et ex isto libro eliciunt multa quae multumvalent ad aedificationem […] Alia est scientia historiarum: sunt enim multae, non solum apud fideles, sed etiam apudinfideles quae interdum multum valent in praedicatione ad aedificationem (vgl. auch Anm. 246, 287). Zur Doppelung desVergleichsmaterials in Naturvergleiche und „Geschichten“ vgl. oben Anm. 345, 348. Zum Naturbuch unten § 83. DieAufteilung in Natur- und Geschichtsbeispiele s. auch bei Vinc. Belv., Prol. zum Speculum maius (ed. LUSIGNAN, wie obenAnm. 337) 116, wo die historiae ecclesiasticae aufgrund der infinita bene vivendi exempla, die sie enthalten, bevorzugtwerden. Robert von Basevorn, Forma praedicandi (ed. Th. M. CHARLAND, Artes praedicandi, Paris/Ottawa 1936, 314)empfiehlt, für die Volkspredigt als „Thema“ ein exemplum in drei Schritten zu entwickeln: 1. in natura durch eine Stelle ausdem NT, 2. in figura durch einen typologischen oder allegorischen Bezug zum AT, 3. in historia: per aliquam narrationemauthenticam. Beispiel: Der Satz, daß der König sich vom Tyrannen durch humilitas unterscheide, patet per exemplum innatura, in figura, in historia; zu letzterem wird die historia famosa et mirabilis vom Traum des Nebukadnezar im 4. BuchDaniel empfohlen. Damit wird das (abschreckend) Lehrreiche als exemplum klar von der berichtenden historia unterschieden.
153
Noch in der Neuzeit werden unentwegt historiae, ‚histories‘, ‚istorie‘, ‚histoires‘ und ‚Historien‘ mitmerkwürdigen Beispielgeschichten aus dem Steinbruch der Geschichte und mit dem umfassenden Schatz derErzählliteratur (einschließlich der fiktiven) gleichgesetzt, während die „Lehren aus den Geschichten“ dieExempla und Beispiele sind. Montaigne, der vielleicht bedeutendste neuzeitliche Meister in der reichen, auchden Policraticus einbegreifenden humanistischen Memorabilientradition seit Valerius Maximus, sagtparadigmatisch: „Von den verschiedenen Lehren, welche die Geschichten oft bieten, benütze ich mit Vorliebedie seltenste und denkwürdigste.“365 Im Sinne dieses kurzen begriffsgeschichtlichen Überblicks werden wir unsim Folgenden damit zu beschäftigen haben, wie sich im Policraticus die exempla in historiae umsetzen oderwie aus historiae exempla gewonnen werden.
B) ZUR THEORIE UND METHODE DES EXEMPLAGEBRAUCHS
1. Moralphilosophische Grundlegung: Das Vorbild-Exemplum als Einheit von Lehre und Leben, Reden undHandeln
„Historiographische“ Motivation des Policraticus: denkwürdige auctores werden durch Überlieferung der Geschichtlichkeitentrissen (§ 42). Exemplum: Tat oder Ausspruch eines auctor/einer auctoritas (§ 43). Das Exemplum unterscheidet sich vonder Fabel wie die Chrie von der Sentenz: durch „Personhaftigkeit“ (§ 44). Das Ideal der Übereinstimmung von Theorie undPraxis auf biblischer und antiker Grundlage als Motiv für die Kombinationen von dicta und facta (§ 45). Das Anekdotischeals das Humane in der Tradition der Philosophen-Viten (§ 46). Anekdote/Apophthegma und Exemplum als memorabilefactum/dictum (§ 47). Zur literarischen Technik der Verbindung von Zitat und Erzählung, Autorensprache und Figurensprache(§ 48). Zur Poetik und Hermeneutik der „Geschichte als Beispielphilosophie“ für das Gute und das Böse und zurMehrdeutigkeit von Exempla im Verhältnis zur Auslegungskompetenz des Lesers (§ 49).
42. Schon die ersten Zeilen des Policraticus-Prologs mit jener bekannten Apologie für den Nutzen der litteraegehen auf die theoretischen Grundlagen
365 Montaigne, Essais I 21 (ed. THIBAUDET/RAT, wie Anm. 192) 104: „Et aux diverses leçons qu’ont souvent leshistoires, je prens à me servir de celle qui est la plus rare et memorable“. Zu andern Implikationen dieser Stelle s. S. 217,535 f., A. 1005; vgl. SCHON 27 ff., 63 ff. – Zur Neuzeit vgl. allgemein KNAPE 238 ff.; DAXELMÜLLER, Exemplum635; BRÜCKNER, Historien 38 ff., 48 ff. (Luther, Melanchton), 21 (Boccaccios Novellen als Historien); dazu auch NIES(wie oben Anm. 317); BRÜCKNER Exemplasammlungen 604 f., ders., Kurzprosa (wie Anm. 164) 105 ff., 130(gegenreformatorische Wundergeschichten als Historien).
154
des Exemplums ein:366 Ein Hauptverdienst der Literatur sei, daß sie exempla maiorum „als Ansporn undNährboden der Tugend“ aufbewahre. Durch die Gedächtnisstütze der Schrift, ein remedium menschlicherSchwäche, werden Kontingenz, Vergänglichkeit eingeschränkt oder wenigstens erträglicher. Lebenskürze,Wahrnehmungsschwäche, Unaufmerksamkeit, Zeitverschwendung wirken unheilvoll zusammen mit demInbegriff intellektuellen Ungenügens: mit Oblivio, der „Vergeßlichkeit“. Johann personifiziert sie zur„Erzfeindin
366 Pol. Prol. 12.1–17: Iocundissimus cum in multis, tum in eo maxime est litterarum fructus, quod res scitu dignas situaboleri non patiuntur. Nam et artes perierant, evanuerant iura, fidei et totius religionis officia quaeque corruerant,ipseque recti defecerat usus eloquii, nisi in remedium infirmitatis humanae litterarum usum mortalibus divina miseratioprocurasset. Exempla maiorum, quae sunt incitamenta et fomenta virtutis, nullum omnino erigerent aut servarent, nisi piasollicitudo scriptorum et triumphatrix inertiae diligentia eadem ad posteros transmisisset. Siquidem vita brevis, sensushebes, negligentiae torpor, inutilis occupatio, nos paucula scire permittunt, et eadem iugiter excutit et avellit ab animofraudatrix scientiae, inimica et infida semper memoriae noverca, oblivio. Zu sollicitudo vgl. auch Met. I 23, 18 f.:Praecipua sunt ad totius philosophiae et virtutis exercitium: lectio, doctrina, meditatio et assiduitas operis. Zur angeführtenPrologstelle vgl. J.W.H. ATKINS, English Literary Criticism: The Medieval Phase, Cambridge 1943, 77 ff.; MISCH III 2,1208 ff.; Joh. SPÖRL, Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsschreibung (1935), Darmstadt 1968, 81 f.; BOEHM(wie Anm. 25) 680 f.; LACROIX 170 f.; MEHL 231 f.; MELVILLE, System 37; SMALLEY, Friars 19, 151: LINDER(wie Anm. 321) 344 f. und S. 567, A. 330, 451, 734 zum Einfluß des historiographie- und literaturtheoretisch wichtigenPrologs (meist in Verbindung mit ähnlichen Stellen wie Pol. VII 10) und zur Übernahme im Polychronicon-Prolog desRanulfus Higden von Chester (RBS 41.1) 1 ff., 14.16. – Zum historiographischen Prologtopos der doppelten Aufgabe desAufbewahrens (Herodot) und der Orientierung für künftiges Handeln (Thukydides) meist im moralischen Sinn vgl.ZOEPFFEL 38; ROMILLY (wie Anm. 13) 41 ff.; SPIEGEL 317 f.; SIMON II 97 ff.; LACROIX 167 ff. und unten§§ 108 f. – Zu den literarischen Quellen des Passus (Gellius, N.A.-Prolog) vgl. MARTIN, Manuscripts 11. Begriffe wiedigna memoratu, scitu digna, memoria digna finden sich auch bei Val. Max., Praef.; Macrob Sat. Praef. 3 oder Isidor,Etym. 1.41 (vg. oben Anm. 149a). – Auch vorliegende Stelle ist vom topischen Feld der „historischen Dignität“ her zulesen: Damit ist keineswegs historische Faktizität gemeint, sondern der durch die Tradition erwiesene Wert und weitertradierbare „Nutzen“ einer „Geschichte“. Vgl. RAY (wie Anm. 360) 47; Amos FUNKENSTEIN, Heilsplan und natürlicheEntwicklung, Heilsplan und Geschichtsdenken im MA., München 1965, 70 ff.; LINDHARDT 146; STRUEVER 84, undunten §§ 57 f. Der Passus läßt sich schließlich auch gut den heute von Odo MARQUARD nach David Humes skeptischer‚Enquiry concerning Human Understanding‘ von 1748 entwickelten Gedanken zur „sterblichkeitsbedingten Unvermeidlichkeitvon Traditionen“ (Abschied [wie Anm. 266] 17 ff., 122 f.) zur Seite stellen. Vgl. unten S. 239 ff., 378 ff., 576.
155
und Stiefmutter“ aller memoria oder allen tradierten Wissens. Im Kampf gegen dieses Unwesen stehen dielitterae. Das Aufbewahren von „Denkwürdigem“ gibt gewissermaßen irdischen Ersatz für den verwehrtenparadiesischen Idealzustand der Zeit- und Geschichtslosigkeit, für die unerreichbare Ewige Gegenwart. Ähnlichsagt Johann auch im Prolog zur Historia pontificalis:367 „Alle Historiker haben nur eine Absicht:Denkwürdiges zu berichten, damit durch die Dinge, die geschehen sind – gemacht worden sind (quae factasunt) –, das Unsichtbare Gottes angeschaut werden kann.“ Die Geschichtsschreibung strebt alsoparadoxerweise danach, die Geschichtlichkeit zu überwinden.368 Der pragmatische Grundgedanke dieser Stelleentspricht einem geläufigen historiographischen Prologschema, das hier jedoch durch die Kombination vonRöm. 1.20 – „Sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunftzu erkennen“, – mit dem bereits angeführten, unmittelbar folgenden Disticha Catonis-Zitat über dieLehrhaftigkeit des gesellschaftlichen Lebens (aliena vita nobis magistra est) eine besonderegeschichtsphilosophische Nuance erhält, da der
367 Hist. pont. 3: Horum [sc. cronicorum scriptorum] vero omnium uniformis intentio est scitu digna referre, ut per ea quefacta sunt conspiciantur invisibilia Dei [Rom. 1.20] et quasi propositis exemplis premii vel pene reddant homines in timoreDomini et cultu iustitie cautiores. Zum Kontext vgl. auch oben § 4, unten S. 176, 503 f.368 Zu dieser Paradoxie, die keineswegs auf vermeintliche Geschichtsfremdheit des Mittelalters zurückgeführt werden darf,vgl. LÖWITH (wie Anm. 129) 436: „Der hoffnungsvolle Glaube an Christus befreit von den hoffnungslosen Geschichten derfalsche Erwartungen hegenden Welt“; GOETZ, Otto von Freising (wie Anm. 755) 307 f., 88 ff.; von MOOS, Lucanstragedia … 147 ff.; G. MELVILLE, Wozu Geschichte schreiben? Stellung und Funktion der Historie im MA., in: Formender Geschichtsschreibung (wie Anm. 37) 86–146, 93 ff., 119 f. (zu Otto v. Freising): „Der Zugriff auf die Geschichte erfolgtnur deshalb, um sich von ihr abwenden zu können.“ … „Relevanz des Informationsaktes durch Aufweis der Irrelevanz desInformationsgegenstandes“; 124, 134 auch zu den hier analysierten Stellen Johanns; 145:“ …sich im Durchgang durch dieGeschichte vom Geschichtlichen abheben“. Auf die Instrumentalisierung und tendenzielle Vernachlässigung des „Sichtbaren“und Konkreten zugunsten des „Unsichtbaren“ und philosophisch-theologisch Allgemeinen bei dieser Art von „Induktion“verweisen z. T. mit Bezug auf die angeführte Stelle: M.D. CHENU, La décadence de l’allégorisation … in: Mel. H. deLUBAC II, Paris 1964, 129–35, 134 f.; H.R. SCHLETTE, Die Nichtigkeit der Welt, Der philos. Horizont des Hugo vonSt. Viktor, München 1961, 128 ff.; EHLERS, Hugo … (wie Anm. 18) 82 f., 164; GUENÉE, Hist. 26 f.; PARTNER (wieAnm. 23) 188: „… historians certainly gave way often enough to the temptation to speculate about the eternal, ‚real‘meanings of things before they had nearly exhausted the possibilities of the present and visible.“ Ausführlicher zu diesemKernthema aller Mediävistik unten §§ 83 ff., 105 ff.
156
Paulusstelle der Zweitsinn von „historische Fakten“ für quae facta sunt entlockt wird und so dasgeschichtliche Handeln der Menschen als Teil der Erstoffenbarung Gottes in der Natur verstanden werdenkann.369
Im Policraticus folgen auf das angeführte Lob der Literatur Beispiele für den Wert solcher schriftlichverewigter exempla maiorum:370 Johann beteuert, er habe weder Alexander noch Caesar persönlichkennengelernt, noch Sokrates, Zeno, Plato oder Aristoteles mit eigenen Ohren disputieren gehört; unddennoch sei es ihm dank der Überlieferung der auctores möglich, über diese Menschen und viele andereUnbekannte manch Nützliches in Erfahrung zu bringen und dem Leser weiterzureichen. Dies ist eineanschauliche Lehre über das Verhältnis von Geschichtswirklichkeit und Geschichtswissen („histoire
369 Prologschema: vgl. S. 377 f., Anm. 366, 418; BRÜCKNER, Hist. 37 ff.; LACROIX 19 ff.; GUENEE, Hist. 26 f. – ZuRöm. 1.20 vgl. SCHMIDTKE (wie Anm. 287) 56 ff., 119 ff.; K. GRUBMÜLLER, Überlegungen zum Wahrheitsanspruchdes Physiologus im MA., in: FMSt 12 (1978) 160–77, hier 161 f. – Dist. Cat. III 13: oben 00. Die Assoziation derDisticha Catonis mit der „Geschichtstheorie“ entspricht der traditionell untergeordneten Rolle der historia und derCatonischen Spruchweisheit im Trivium als Materialbasis für den Anfängerunterricht in Grammatik und Rhetorik; vgl. G.A.ZINN, Historia fundamentum est, The Role of History in the Contemplative Life according to Hugh of St. Victor, in:‚Contemporary Reflections on the Med. Christian Tradition‘, Festschr. R.C. PETRY, Durham N.C. 1974, 135–158, hier143 f.; GUENÉE, Hist. 28; KNAPE 52 ff. u. ö.; R. BULTOT, La Chartula et l’enseignement du mépris du monde dans lesécoles et les universités médiévales, in: StM 8 (1967) 787–834, 798 ff.: GOETZ, Geschichte (wie Anm. 149a) 171. – Zurextensiven Auslegung von Bibelstellen in humanistischbildungsoptimistischem Geist durch Johann s. auch unten § 94,S. 371, 496 f. – Zum Begriff facta s. S. 176 ff., 370 ff.; J. PLAGNIEUX/F.J. THONNARD, „Faire“ et ‚créer‘ chez S.Augustin, in: Bibliothèque augustinienne (Oevres de S. Augustin) 22, Paris 1975, 767–774. – Zu der hier geistlichbestimmten Antithese zwischen der suasiven und der dissuasiven Form des Exemplums als exempla praemii vel poenae s.unten § 49 und GUENÉE, Hist. 26 f.; ROUSSET, Conception … (wie Anm. 361) 624.370 Pol. I 12.17 ff. (anschließend an Zitat von Anm. 366): Quis enim Alexandros sciret aut Cesares, quis Stoicos autPeripateticos miraretur, nisi eos insignirent monimenta scriptorum […] Nullus enim umquam constanti gloria claruit, nisiex suo vel scripto alieno. Ebd. 16.13 ff.: Neque enim Alexandrum vidi vel Cesarem; nec Socratem Zenonemve, Platonem autAristotilem disputantes audivi; de his tamen et aliis aeque ignotis ad utilitatem legentium retuli plurima. Dazu vgl. untenS. 534 f., 548, 576 ff. Der disputatio-Begriff ist hier weniger „frühscholastisch“ getönt als durch Macrobs Saturnalia-Prolog14 beeinflußt: Neque enim Cottae, Laelii, Scipiones amplissimis de rebus, quoad Romanae litterae erunt, in veterum librisdisputabunt, Praetextatos vero, Flavianos, Albinos, […] quorum splendor similis […] eodem modo loqui aliquid licitumnon erit. Zur Symposia-Literatur s. unten Anm. 706, 806.
157
réalité“ und „histoire connaissance“). Exempla sind für Johann erklärtermaßen keine außerliterarischenFakten, sondern sprachlich vermittelte Zeugnisse von Ereignissen; „Sinnbildleistungen“ der „Konstitution undKonstruktion“, Gegenstand der Hermeneutik, nicht der Empirie.371
43. Eine andere Beobachtung betrifft die zwei für den Inhalt des Policraticus wesentlichen Personentypen:Herrscher und Philosophen, Eroberer und Weise. Während erstere ihrer Taten wegen erwähnt werden, soletztere wegen ihres „Disputierens“, ihrer Worte und Gedanken.372 Man kann im Policraticus feststellen, daßdie stets in Anlehnung an den Titel des Valerius Maximus als facta und dicta doppelt bestimmten Exemplaauch Zitate einschließen.373
371 Die moderne Terminologie soll hier (wie auch sonst oft) nicht das Mittelalter „aktualisieren“, sondern die Moderne an ihrAlter erinnern: vgl. Roland BARTHES, Historie und ihr Diskurs, in: Alternative 62/3 (1978) 170 ff.; L.M. de RIJK, Factsand Events: The Historian’s Task, in: Vivarium 17 (1979) 1–41; BLUMENBERG, Lesbarkeit (wie Anm. 25) 18 f. und obenAnm. 36 angeführte Arbeiten; H.M. BAUMGARTEN/J. RÜSEN, Erzählung und Geschichte (Symposions-Einführung), in:Erzählforschung (wie Anm. 37) 519–26; N. WÜRZBACH, Art. Fiktionalität, in: EM IV (1984) 1105–11, hier 1105 f. zudemselben Thema in terminologischer „Technifizierung“ für linguistische Insider: faktizitäts- und wahrheitsdifferenteReferenz (Denotation) bei sinnvoller Prädikation (Konnotation). K. STIERLE, Gespräch (wie Anm. 546) 307 schreibt nichtgrundlos dem lateinischen Mittelalter eine „Diskurssprache“ (im Gegensatz zum „Gespräch“) zu und betont, „nicht dasunmittelbare Wort, sondern das überlieferte, bezeugte, in Schriften aufbewahrte, aus der Ferne sprechende Wort“ sei die„mittelalterliche Grunderfahrung des Diskurses“. Seine sich darauf stützende Parteinahme zugunsten neuzeitlicher„Unmittelbarkeit“ gegen mittelalterlichen „Diskurs“ ist subjektiv verständlich (auch wenn die vorliegende Arbeit primärgegen solche Urteile geschrieben wurde); auf keinen Fall ist diese Position besonders „modern“, da wir gerade daran sind, dieIdee eines „unmittelbaren Wortes“ in der Literatur als Fiktion aufzudecken (vgl. S. 235, 335 ff., 536). Zu mittelalterlichenParallelen in der Reflexion über die Unmöglichkeit einer nicht-überlieferungsbedingten Faktenkenntnis vgl. C. MARTIN,Some Medieval Commentaries on Aristotle’s Politics in: History N.S. 36 (1951) 38 (eine ähnliche Konfrontation vonUnkenntnis der historischen Personen und tradiertem Wissen darüber bei Walter Burley); MELVILLE, System 63;FUNKENSTEIN (wie Anm. 366) 70 ff.; SOUTHERN, Aspects (1970) 177 ff. Allgemein zu Fragen des Wirklichkeitsbezugshochmittelalterlicher Literatur vgl. auch die mir erst nach Abschluß der Darstellung bekanntgewordene wichtige Arbeit vonBrian STOCK, The Implications of Literacy, Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and TwelfthCentury, Princeton U.P., New Jersey 1983.372 Oben Anm. 370. – Zum Verhältnis von curia und philosophia, „Politikern“ und „Intellektuellen“, Hofbeamten undKlerikern, einem Hauptthema des Policraticus s. unten §§ 71, 119, S. 336 f., 292 f., 577 ff.373 Vgl. GEBIEN 20: „In der römischen Antike wurde das Apophthegma allgemein zur Gattung der Beispiele gerechnet“. –Quint. (XII 4.1 oben Anm. 131) sieht in der exemplorum copia, die dem Redner zur Verfügung stehen müssen, gleicherweisehistorische Präzedenzfälle wie „die von berühmten Dichtern erfundenen Beispiele“ (d. h. Dichterzitate). Ebd. XII 2.29 zurmnemotechnischen Präsenz von dicta und facta. – Zum Titel Facta et dicta memorabilia s. oben Anm. 149a, 299. – Zumalteuropäischen Legitimationsmotiv der Geschichtsschreibung durch pragmata und dogmata vgl. KOSELLECK, VergangeneZukunft 107 mit dem Hinweis auf Epiktet (Ench. 5): die Menschen seien weniger durch Taten als durch Worte (d. h. Worteüber Taten) zu erschüttern. – Zur häufigen Verwendung der Formel facta et dicta, ‚faicts et dits‘, ‚fatti e detti‘ als synonymfür Exempla im Mittelalter vgl. GUENÉE, Hist. et culture hist. 24 (Wace, Joinville, Vinzenz von Beauvais), SCHENDA77 ff. und etwa Guido da Pisa, ‚Fiore d’Italia‘ (ed. L. MUZZI, Bologna 1824, 4) zur Absicht des „Translatare di latino involgare alquanti memorabili fatti e detti degli antichi e spezialmente de‘ Romani, i quali tutto il mondo di maravigliosiesempli anno illuminato“ (nach Val. Max. II 7.6, oben in Anm. 165).
158
Hierzu sagt der Auctor ad Herennium:374 „Das Exemplum ist die Angabe irgendeines vergangenenGeschehens oder Ausspruchs unter Nennung eines bestimmten Urhebers“ (bzw. „eines unzweifelhaftenGewährsmannes“). Diese in mehreren Poetiken und Artes dictaminis des Hochmittelalters abgewandelteDefinition bezeugt im übrigen, wie verbindlich der antike rhetorische Exemplum-Begriff noch geblieben ist,der anonyme Exempla wie die späteren homiletischen im Grunde ausschließt. Doch hat der ursprünglich aufden Handelnden ebenso wie auf den Redenden bezogene Begriff auctor oft etwas Schillerndes, da er auch imSinne von auctoritas gebraucht wird und so in die Nähe unseres „Autor“ rückt. Dies zeigt die häufigangeführte, ganz vom Interesse an der inventio bestimmte Exemplum-Definition des Johannes vonGarlandia:375 „Betrachten wir nun, was man in Exempla findet! Ein Exemplum ist eine nachahmenswerte 374 Rhet. ad Her. IV 49.62: Exemplum est alicuius facti aut dicti praetertiti cum certi auctoris nomine proposito. Dazu vgl.S. 57 ff. und Anm. 8 (Rhet. eccl.), 110 (J. FONTAINE), Anm. 142 f., 277, 383; GEBIEN 58 f.; LUMPE 1230; GUERRINI15 f. – McCALL übersetzt (78 f.) klugerweise so, daß die Ambivalenz von auctor erhalten bleibt: „from something actuallysaid or done in the past and the person who said or did it will be specified.“ Vgl. auch unten Anm. 477 zu den beiden Artenvon auctores: dem auctor rei gestae und dem auctor narrationis. Zum Begriff propositio im Sinne von Kurzfassung,Anspielung, Erwähnung, Zusammenfassung, thematischer Ankündigung und im Gegensatz zur (ausführlichen) narratio s.Quint. IV 2.4: Sunt autem […] tam breves causae ut propositionem potius habeant quam narrationem. – DieDoppelbedeutung von exemplum als factum und dictum wird in der Rhet. ad Her. noch überlagert durch die zweiverschiedenen Bedeutungen des ästhetisch-literarischen Vorbilds der imitatio auctorum und des moralisch-existentiellenModells der imitatio virtutis. Im 4. Buch über die elocutio bedeuten exempla nämlich vorwiegend Zitate, auctoritates derliterarischen Nachahmung, doch fehlt der historisch-personale Exemplumbegriff deswegen nicht ganz; vgl. ebd. IV 1.2:Etenim cum possimus ab Ennio sumere aut a Gracco ponere exemplum, videtur esse adrogantia illa relinquere, ad suadevenire … Exempla sumere bedeutet hier nichts anderes als „zitieren“, während ponere/afferre exempla sich auch auf diepersonalen facta beziehen läßt. Vgl. auch IV 5.7: Allatis igitur exemplis a Catone, a Graccis, a Laelio, a Scipione, Galba[…] item sumptis aliis a poetis et historiarum scriptoribus […] Während exemplum einen mehr illustrierenden Charakter hat,heißt im Bereich der Zitate der beweisende Beleg testimonium (IV 3.5–6): […] convenit ut testimonia ab hominibusprobatissimis sumi. Primum omnium exempla ponuntur nec confirmandi neque testificandi causa, sed demonstrandi […]Hoc interest igitur inter testimonium et exemplum: exemplo demonstratur id quod dicimus cuiusmodi sit, testimonio esseillud ita, ut nos dicimus, confirmatur. Dies wurde von BATTAGLIA, 455 mißverständlich derart auf das historischeExemplum bezogen, daß es den argumentativen Sinn des Präzedenzfalls zu verlieren und den illustrativen des„Predigtmärleins“ anzunehmen scheint. Trotz der hier und im Folgenden (zur personhaften Chria) betonten Zitathaftigkeit desExemplums muß vor einer Ausdehnung des spezifisch für das apophthegmatische dictum gültigen Exemplumbegriffs auf alleautoritativ-argumentativen oder auch nur stilistisch-elocutionellen Zitate nachdrücklich gewarnt werden. Zitate können ineinem völlig anderen Sinn: dem der poetischen Kostprobe, des Schulbeispiels, der imitablen Musterstelle, des locusclassicus bei einem Musterautor, exempla heißen (s. ThLL sv. 1332, 23 ff.). Dabei hat exemplum auch oft die Bedeutung von„genauer Wortlaut des Zitats“, „dokumentenechte Kopie“ im Gegensatz zur bloß sinngemäßen Wiedergabe oder Paraphrase(sententia). Dazu vgl. P. HAMBLENNE, Exempla Sallustiana, in: Latomus 40 (1981) 67–71. Die Grenze zwischen derstilistischen und der existentiellen imitatio großer Autoren, bzw. Schriftstellerpersönlichkeiten mag zwar gelegentlich –insbesondere bei metaphorischer Verwendung der Begriffe – unscharf werden (vgl. §§ 87 f., S. 174, 385 ff). Dennoch geht esnicht an, die auctoritates-Exempla der Stiltheorie (s. LAUSBERG I § 26, II 699 s. v.; MARTIN, Ant. Rhet. 122;BARNER [wie Anm. 298] 59 ff.) pauschal mit den exempla memorabilia der Inventio und Argumentatio gleichzusetzen. Soentstehen jene fast nicht mehr ausrottbaren Verwechslungen von exempla virtutis mit Klassikerzitaten in der Deutung vonberühmten Stellen wie Cassiod. Inst. 21 (PL 70) 1135 über Hieronymus: gentilium exempla dulcissima varietate permiscuitund Hier. Ep. 70.2.1. zur Legitimation der Verwendung von „exempla“ aus heidnischen Autoren (z. B. so bei LUMPE1251 f.). Die Hieronymus geläufige Bezeichnung exemplum für Zitat zeigt etwa auch Ep. 28.6.2; 46.7.3: longum est descripturis innumerabilia exempla congerere, unum testimonium proferamus:…375 Poetria I (ed. T. LAWLER, 1974) 10.148–9 (ed. G. MARI, RF 1902, 888): Exemplum est dictum vel factum alicuiusautentice persone imitatione dignum. Unde ibi inveniuntur dicta et facta, auctoritates et proverbia. Sed si non habeamusproverbium, utendum est hoc artificio. Ebd. VI (ed. LAWLER) 132.358–361: Exemplum est quando nos proponimus dictavel facta autentica. ‚Arte docens exempla Plato donabit, et eius/Testis Aristotiles qui sua dicta sapit‘. Vgl. KNAPP,Similitudo 85 ff.; MEHL 241; JENNINGS 217. – Zur Gültigkeit des antiken rhetorisch personalen Exemplumbegriffs imMittelalter s. § 30, S. 122, 159 ff. Besonders klar zeigt sie sich in der Kombination von praeiudicia („Urteilssprüchen“; s.oben Anm. 2) und exempla maiorum (im Sinne von autoritativen Vorgängern) in der auf juristische Situationen bezogenenRhetorik des Anticlaudian-Kommentars von Radulf von Longchamp (wie Anm. 508) 149.14 ff., der Mittel der insinuatiobenevolentiae aufzählt und den locus a persona iudicis so beschreibt: Quandoque autem fit a persona iudicum et talis […]
159
Aussage oder Tat einer anerkannten („authentischen“, autoritativen) Person. Hier findet man Aussprücheund Handlungen (dicta et facta), Autoritätszeugnisse und Weisheitssprüche“. Der Hauptakzent liegt auf den„Ausspruchsautoritäten“, nicht auf den „Tatautoritäten“;
est inductio exempli, quomodo aliqui probi iudices de ea re aut consimili aut de maiori aut de minori iudicaverunt. Talisautem comparatio, qua scilicet comparantur iudicibus se maioribus, consimile iudicium insinuat (zu den exempla imparias. unten Anm. 914). – LE GOFF hat versucht, obige, keineswegs auf das „Predigtmärlein“ passende Definition des Johannvon Garlandia so umzudeuten (BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 29): „Une évolution essentielle s’est produite depuis lesdéfinitions antiques. L’exemplum n’est plus la proposition alicuius facti aut dicti, mais ce factum ou ce dictum lui-même.L’authentification par un personnage demeure, mais le vague de la formule ouvre la porte à plusieurs possibilités. Qui seral’autentica persona: le héros de l’anecdote, l’informateur, le locuteur de l’exemplum?“ Die Verlagerung der auctoritas von derhandelnden zur sprechenden Person sowie zum Gewährsmann für den Bericht ist ein bereits mit der Rhet. ad Her.einsetzender Prozeß, der zweifellos im Mittelalter noch verstärkt wurde (vgl. Anm. 374). LE GOFF will aber mit Joh. vonGarlandia beweisen, daß das mal. Exemplum nicht mehr in einer Person, sondern in einem von dieser abgelösten anonymenLehrstück („une recette, une leçon à répéter“) liege. – Zu dem gleicherweise zitathaften wie personalen Sinn von auctoritasvgl. andererseits S. KUTTNER, On auctoritas in the Writing of Medieval Canonists, in: „La notion d’autorité au M.A.“,Paris (P.U.F.) 1982, 69–81.
160
denn als illustrierendes Beispiel wird folgender doxographischer Merkvers zitiert: „Beispiele gibt kunstvollPlato, und sein Zeuge ist Aristoteles, der seine Aussprüche durchdenkt.“ Galfred von Vinsauf bietet eine derHerennius-Rhetorik entsprechende Paraphrase:376 „Mit dem Namen eines unzweifelhaften Urhebers(Gewährsmannes) bringe ich die Sache, die er sagte oder einmal tat, als Exemplum vor.“ Auch hier erweist dasAnwendungsmuster das Exemplum nicht als historischen Präzedenzfall, sondern als einfache Zitat-auctoritas:„Kaum ist es möglich, daß ein Mensch ohne Schuld lebt; darum sagt auch der Morallehrer Cato: ‚Niemand lebtschuldlos‘“.
376 Galfr. Poetria nova 1255–7 (ed. FARAL 236): Vel cum nomine certi/Auctoris rem, quam dixit, vel quam priusegit,/Exemplum pono. Ebd. 1352–4 (FARAL 238): Vix tamen esse potest, ut homo sine crimine vivat:/Ethicus unde Cato:‚Nemo sine crimine vivit‘. Vgl. auch die vergröberte, auf das Prozeßrecht zugeschnittene Fassung der Definitien derHerennius-Rhetorik in der Rhetorica ecclesiastica oben Anm. 8.
161
Die Doppelbedeutung von auctor klingt auch in dem angeführten Prolog-Passus an, da Johann schreibt:377
„Alle in Wort und Tat Philosophierenden, die mir begegnen, halte ich für meine Klienten, ja mache ich mirdienstbar, damit sie sich in ihren überlieferten Zeugnissen an meiner Stelle dem Geschwätz meinerWidersacher entgegenstellen. Denn auch sie zitiere ich (führe ich lobend an) als auctores.“ Abgesehen vonden unten (§ 87) erläuterten Aspekten, zeigt der letzte Satz an, daß die in verbo aut opere philosophantes, diephilosophisch Lebenden, in einem weiteren Sinne auch „Autoren“ sind: nicht nur Textzeugen, die unmittelbarzitiert werden können, sondern auch Gestalten aus tradiertem Anekdotengut, die durch einen besonderenVorfall oder Ausspruch berühmt sind. Von reinen Lehrautoritäten lassen sich die Exempelautoritäten oftnicht leicht unterscheiden, doch verbinden sich die dicta der letzteren stets irgendwie mit einem gestum zueinem wie immer rudimentären erzählerischen Kern.378
44. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wenig das Exemplum mit einer bestimmten Gattung identifiziert werdenkann. Es ist ein konstitutives methodisches Prinzip für verschiedene Gattungen oder – in der bunten Gattungder Kompilationsliteratur zusammengefaßte – literarische Arten wie Anekdoten, Apophthegmen,Apomnemoneumata, Memorabilien, Kurzbiographien, Novellen, „Historien“, „Historietten“, Essays,Facetien, Schwänke, Fabliaux, Witze, Bonmots usw.379 Das Prinzip besteht, formal betrachtet, gerade inirgendeiner Verbindung von Wort und Tat zum Zweck einer Anführung, „Benützung“, „Erwähnung“ fremdenGuts im eigenen Zusammenhang. Deshalb hat die im Mittelalter bekannte antike Theorie der Grammatik undRhetorik ursprünglich auch den Leitbegriff kreºa , usus, commemoratio bevorzugt,
377 Pol. Prol. I 16.9 ff. unten Anm. 780 zitiert. Zum Kontext s. ebd. und Anm. 370 (die dort zitierte Stelle: Neque enimAlexandrum vidi… folgt unmittelbar auf: illos laudo auctores.)378 Formulierung nach RUBERG (wie Anm. 264) 93. Zum Begriff auctor und zum mal. Verständnis literarischerVerfasserschaft, s. unten §§ 50, 56, 87, S. 206 f., 238 ff., 326 f., 365 ff., 372 ff., 400 ff., 408, Anm. 430.379 Zu dieser Gattungsvielfalt vgl. etwa VERWEYEN 75 ff., 154 u. passim; H.C. GOTOFF, Cicero’s Style for RelatingMemorable Sayings, in: Illinois Class. Studies 6 (1981) 294–316; L. DESCHAMPS, L’influence de la Diatribe dansl’oeuvre de Martial, in: Atti del Congresso intern. di Studi Vespasiani, Rieti 1981, 353–368; bes. 356 ff.; K. von FRITZ,Art. Chria, in: RE Suppl. VI (1935) 88 f.; LAUSBERG §§ 540, 1120; SCHON 57 ff., 80 ff.; BRÜCKNER Hist. 21, 47 f.,81 f. und §§ 73, 92, 124, S. 21, 131 ff., 170 ff., 355 ff., 385 ff. Nicht mehr benützen konnte ich leider die kurz vorAbschluß des Anmerkungsteils erschienene grundlegende Arbeit von Elfriede MOSER-RATH: „Lustige Gesellschaft“,Schwank und Witz des 17. und 18. Jhs. in kultur- und sozialgeschichtlichem Kontext, Stuttgart 1984, die reichstesIllustrationsmaterial zur Buntheit der „Textsorten“ auf diesem Gebiet beisteuert.
162
um die Möglichkeiten und Arten einer solchen Verbindung von Ausspruch und Handlung zusystematisieren.380 Es wurde darauf geachtet, in welcher Relation die finiten (historischen,umstandsbedingten, anschaulichen) und infiniten (allgemeingültigen, sentenziösen, abstrakten) Anteile der„Heranziehung“ zueinander stehen: ob die Pointe ausspruchhaft, handlungshaft oder aus Ausspruch undHandlung zusammengesetzt sei, d. h. ob die Handlung den Ausspruch ersetze oder vielmehr impliziere oder obbeide explizit verbunden werden; ob der historisch-okkasionelle Situationsbezug des Ausspruchs in einerAussage oder in einer Antwort auf eine Frage oder Provokation bestehe, ob er durch Umstände bedingt oder(wie im reinen „sagte-Wort“) nicht bedingt sei u.a.m.381 Gleich wie in den Exemplum-Definitionen
380 Vgl. von FRITZ (wie Anm. 379) 88 zur Etymologie: aus „Lebensbedarf“, dem, was man zu etwas braucht oder, was fürden Gebrauch bereitgestellt wird. LAUSBERG §§ 1117–20, 532–40 nach Quint. I 9.4; Sen. Ep. 4.33.7; Isid. Et. II 11.1;Prisc., Praeexerc. 2–3 (HALM) 552 f.: Narratio est expositio rei factae vel quasi factae: quidam tamen kreºan, id estusum, posuerunt ante narrationem […] Usus est, quem Graeci vocant, commemoratio orationis alicuius vel facti velutriusque simul, celerem habens demonstrationem quae utilitatis alicuius plerumque causa profertur. Usuum autem aliisunt orationales, alii activi, alii mixti. Orationales sunt, quibus oratio inest sola […], activi vero, in quibus actus inestsolus […] vel mixti […] Interest autem inter usum et commemorationem hoc quod usus breviter profertur, commemorationesvero, qua Ωpomnhmone¥mata Graeci vocant, longiores sunt. Sententiae vero differt, quod sententia indicative profertur,usus vero saepe etiam per interrogationem et per responsionem: praeterea, quod usus etiam in actu solet inveniri, sententiavero in verbis tantum, et quoniam usus habet omnimodo personam, quae fecit vel dixit, sententia vero sine persona dicitur.Zu commemoratio in der Exemplum-Definition vgl. oben S. 62.381 Zu diesen Einteilungen vgl. auch: LAUSBERG § 1118; ZILTENER 60; GOTOFF (wie Anm. 379) 312 f.; siehe PriscianI 2 (HALM, Rhet. lat. min.) 552 f.: 1. orationales, 2. activi, 3. mixti (Anm. 380); Quint. I 9.3 ff.: 1. in voce simplici(dixit), 2. in respondendo, 3. in factis; Jul. Rufinianus (HALM 44 f.) bietet dieselbe Einteilung nicht für die Chrie, sondernfür paradigma in der Vergleichsarten-Lehre (homoiosis): 1. personae sine sermone, 2. sermo sine personis, 3. simulutrumque. Vergleichbar ist auch die allerdings weniger systematische Einteilung Ciceros in seiner Theorie der Scherze(ridicula, sales, facetiae u. ä.) in De orat. II 216 ff.; bes. II 240 ff. zu den Sach- und Wortwitzen (einerseits Anekdote,Fabel, historia, andererseits ironische Übertreibung, dissimulatio, raffinierter Nonsens u. ä.); vgl. oben Anm. 315. Die obenAnm. 317 nach F. NIES erwähnten Gattungsprobleme neuzeitlicher Kurzerzählungen (‚historiettes, anecdotes, contes‘) ließensich m. E. immer noch vortrefflich nach der antiken (und „allgemein-rhetorischen“) Chria-Theorie klären. Ähnliches gilt vonder endlosen Gattungsdiskussion um Begriffe wie „Schwank“, „Anekdote“, „Witz“, „Bonmot“, „Fazetie“, „Farce“ u. dgl.(zusammenfassend mit Bibliogr.: R. BEBERMEYER, Art. Fazetie, in EM 4 (1984) 926–933; MOSER-RATH, LustigeGes. [wie Anm. 379] 1 ff.).
163
nach der Herennius-Rhetorik wird als differentia specifica der Chrie stets das persönliche Elementhervorgehoben. Exempla zeichnen sich unter den „Geschichten“ wie die Chrien unter den Zitaten dadurchaus, daß sie gegenüber dem Anonymen oder Fiktiven einerseits oder gegenüber dem Allgemeingültigen,Infiniten andererseits einer wirklichen „Urheber-Person“ bedürfen. Insofern ist die Fabel der Gegensatz desExemplums so wie die Gnome oder Sentenz (dictum impersonale) der Gegensatz der Chrie (dictumpersonale).382 Diese Unterscheidung führt im letzten zurück zu der immer wieder neu gestelltenphilosophisch-rhetorischen Frage nach den Beziehungen des Partikulären zum Universalen, der quaestiofinita (Hypothesis) zur quaestio infinita (Thesis), des geschichtlich Kontingenten zum Möglichen undImmergültigen (im aristotelischen Sinn).383
45. Das Hauptanwendungsgebiet für Exemplum und Chrie ist seit der kynisch-stoischen Diatribe und derprogymnasmatischen Pädagogik die Ethik. Hier liegt auch für Johann das Hauptmotiv für die Kombinationvon dicta und facta. Die im Policraticus, vor allem aber in dem stellenweise stark doxographischenMetalogicon erscheinenden Apophthegmen und viele mit bloß dürftiger biographischer Überleitungangeführte „Lehrmeinungen der Philosophen“ können in einem eigenen moralphilosophischen Sinn alsExempla angesehen werden. Damit knüpft Johann in erster Linie an die von den
382 Vgl. Quint. VIII 15.3; Isid. Etym. 2.11.1–2 (De sententia): Sententia est dictum impersonale […] Huic si persona fueritadiecta, chria erit […] Nam inter chrian et sententiam hoc interest, quod sententia sine persona profertur, chria sinepersona numquam dicitur. Unde si sententiae persona adiciatur, fit chria; si detrahatur fit sententia. Die hier zuletzterwähnte gegenseitige Verwandlungsmöglichkeit von finiten und infiniten Sätzen erklärt bestens die unten §§ 48, 59illustrierte Zitat- und Exemplifizierungstechnik Johanns. Die Isidorsche Unterscheidung von sententia und chria wird in deranonymen Rhet. eccl. des 12. Jhs. (wie Anm. 8) 3 ausdrücklich auf den „Fall“ im kanonischen Prozeßrecht bezogen, der (wiedas exemplum der Herennius-Rhetorik) als dictum vel factum certae personae definiert ist. Eine ähnliche Übertragung derExemplum-Definition auf causa und hypothesis vgl. unten Anm. 555 (Radulf von Longchamp). Zum Wesensunterschiedzwischen der persönlich zugeschriebenen Chrie und der Gnome oder allgemeinen Maxime vgl. v. FRITZ (wie Anm. 379)88 f., allerdings da auch der Hinweis auf eine in der spätrömischen Entwicklung festzustellende Sinnverschiebung der Chriein Richtung auf die reine Sentenz und auf den Verlust der Beziehung zum historischen Ursprung.383 Vgl. unten § 64 und LAUSBERG §§ 69, 73, 1117 f., auch zum Zusammenhang von Chrie/Gnome mit derHypothesis/Thesis-Theorie. – GOTOFF (wie Anm. 379) 308 f. weist allerdings darauf hin, daß die aristotelische Rhetorik (II20) zum Paradeigma keine dicta, sondern nur facta kennt und daß die Kombination beider trotz der praktischen Verbreitungder „anecdotal bonmots“ seit Herodot und Platon theoretisch erstmals in der Herennius-Rhetorik IV 49.62 begegnet. Vgl.auch oben Anm. 140 zu einigen Cic.-Stellen.
164
Kirchenvätern vermittelte Tradition der Philosophen-Bioi seit Diogenes Laertius an, in der die facta alsIngrediens persönlicher und lebenspraktischer Unmittelbarkeit zwar unentbehrlich sind, jedoch zweitrangigbleiben gegenüber den weisen Bonmots oder dicta, auf die alle Erzählungen hinzielen.384 So geht Johann inseiner bunt angelegten Darstellung verschiedener Philosophenschulen der Antike nicht systematisch odersystemgeschichtlich vor, sondern setzt biographisch-anekdotisch bei den Gründergestalten an und entfaltetdann ein reiches Florileg von autoritativen Aussprüchen und Sentenzen.385
So künstlich das Gemisch von Lehrmeinungen und einführenden Anekdoten gelegentlich wirkt, entsprichtdiese Kombination doch dem zentralen, auch für Johann maßgeblichen Thema der praktischenPhilosophie:386 Die Richtigkeit
384 Zur Tradition s. § 46, S. 110 f., 138 ff., 292 ff. DÖRING (12 f.) verweist auf die griechische Chriensammlungen als„Fundgrube bei der Suche nach Beispielen“; zu den antiken Anekdoten- und Apophthegmensammlungen vgl. auch HORNA,Art. Gnome, in: RE Suppl. VI (1935) 79–81; H. CHADWICK, Art. Florilegium, in: RAC VII (1969) 1131–60. – ZumVorrang der Aussprüche gegenüber den Handlungen vgl. LHOTSKY 76; VERWEYEN, Art. Apopthegma, bes. 676 zur„Verschwisterung mit Formen des Spruchs“; SMALLEY, Moralists … (wie Anm. 338) zum „dicta-type“ derPhilosophenanekdoten des 13. und 14. Jhs.; AUERBACH, Mimesis … (wie Anm. 254) 205 f. zur italienischenFrührenaissance-Novelle, die in der Nachfolge des Exemplums ebenfalls vorwiegend auf geistreiche Aussprüche hin angelegtist und diese durch erzählerische Situationen illustriert; BRÜCKNER Historien 86 ff. zur konfessionellenApophthegmenliteratur seit Luther und Melanchton, etwa zum ‚Valerius Maximus Christianus‘ des Balthasar Exner, in derdie dicta und colloquia den facta vorgezogen werden; BEBERMEYER (wie Anm. 381) 930 f. zu den Fazetien, die imUnterschied zu Schwänken mehr von dicta als von facta bestimmt seien; dazu vgl. auch BAUSINGER, Schwank (wieAnm. 150) 124 ff.; H. WEBER La facétie et le bon mot du Pogge a Des Periers, in: Humanism in France at the End of theMiddle Ages and the Early Renaissance, Manchester-NY 1970, 82–105. Der humanistisch motivierte „Bonmot“-Begriff gehtauf Ciceros Feststellung in De orat. II 222 zurück: … haec bona dicta, quae salsa sint; nam ea dicta appellantur proprioiam nomine.385 Pol. VII 1–8, 15. Vgl. dazu Ph. DELHAYE, Le bien suprême d’après le Policraticus de Jean de Salisbury, in: RTAM 20(1953) 203–221; ders., Le dossier anti-matrimonial de l’Adversus Jovinianum et son influence sur quelques écrits latins duXIIe siècle, in: MSt 13 (1951) 65–86, hier 79 mit der Feststellung, daß Johann im Vergleich zu andern Benützern desgenannten Traktats von Hieronymus weit mehr Interesse an den Philosophen-Apophthegmen als an den Erzählungen zeigt;KERNER 183 ff. und unten S. 168 ff.386 Vgl. Dal PRÀ, Kap. II, 35 ff.: ‚La filosofia come integrazione pratica del conoscere‘; MICZKA 33 ff.; LIEBESCHÜTZ63 ff.; KERNER 39 ff.; Ph. DELHAYE, ‚Grammatica‘ et ‚Ethica‘ au XIIe siècle, Anal. Mediaev. Namurcensia, hors série 2(= RTAM 25 [1958] 59 ff.), Löwen-Lille 1958, 27 f.; zu diesem in Johanns Werk allgegenwärtigen Thema vgl. auch oben§ 3 und unten §§ 49, 70, S. 208, 361 ff., 510 f., 568 ff.
165
und Vorbildlichkeit einer Theorie wird im Leben durch die Tat, in der Literatur durch das in der historiaerzählte exemplum erwiesen. Dieser Gedanke beruht zunächst auf biblischer Grundlage, wie etwa folgendeBriefstelle Johanns zeigt:387 Seien wir Ausführende der Gebote, keine eitlen Wortklauber! Wahre Philosophiesucht und gewinnt die Sache, nicht Worte. Wie Ihr wißt, habe ich noch nie einer Lehrmeinung aufgrund bloßerWorte zugestimmt. Nicht ‚Hörer des Wortes‘ sind vor Gott gerecht, sondern ‚Täter‘ [Jak. 1.22].“ Dergeistliche Hintergrund ist aber nicht vom antiken zu trennen; dies beleuchtet etwa folgender an ThomasBeckett gerichteter Passus:388 „Ich bezweifle nicht, daß wir die Heiligen und Fürbitter auf unserer Seite haben,wenn wir ‚unsere Wege im Herzen bedacht haben‘ (Hagg. 1.7) und so erfahren in der Meisterschaft desGöttlichen Gesetzes geworden sind, daß wir es nicht weniger auszuführen als zu hören begehren. Denn, wieirgendein Weiser sagt: ‚Die Erfahrung ist die Lehrmeisterin der Einsicht‘.“
Ein bunteres Beispiel für die Verbindung des christlichen und des antiken Ideals moralischer Praxis bildet dasletzte Kapitel (VIII 25), in dem Johann denselben Thomas Beckett persönlich anredet und zur Verwirklichungder Grundgedanken des Policraticus ermahnt. Dabei geht er im Zusammenhang mit den philosophischenTheorien vom „höchsten Gut“ von der im Mittelalter
387 Ep. 185, (II) 224: … simus potius mandatorum executores quam inanium ventilatores verborum. Res enim quaerit, curatet assequitur veritas philosophiae, non verba; et michi quidem numquam placuisse sententiam quae in solis versatursermonibus vobis pridem notum est. Nec auditores verbi nec praecones apud Deum iusti sunt, sed factores‘. – ZurIntensivierung des Exemplum-Prinzips der Überlegenheit von Taten über Worte durch das Christentum s. oben §§ 26 f. Vgl.JAUSS, Alterität 44 f.; ders., Negativität … 311 ff.; JAEGER, (wie Anm. 240) 3 f.; EHLERS, Gut und Böse (wieAnm. 181) 36 f.; Jean LECLERCQ, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris 1957, 146 ff. – Sätze wie diese: validiorasunt exempla quam verba et plus est opere docere quam voce (Leo d. Gr. [Pl 54] 435; Ähnliches bei Gregor d. Gr. s. obenAnm. 240) werden in der Mediävistik seit WELTER (14 ff.) und CRANE (XVIII) unentwegt als literarischeLegitimationsbasis für das narrative Exemplum oder „Predigtmärlein“ zitiert. Dabei handelt es sich durchweg um Aussagenzum existentiellen Ineinandergreifen von Theorie und Praxis, Glaube und Werk, Predigt und Beispielgeben. Wenn darausüberhaupt eine literaturtheoretische Schlußfolgerung gezogen werden darf, dann liegt sie am ehesten auf dem Gebiet derBiographik und Hagiographie, die dem antiken personhaften Exemplum wesentlich näher stehen als das erbaulicheGeschichtchen der Prediger. Vgl. oben §§ 29, S. 110 ff., 122 f.388 Ep. 152 (II) 56: Nec diffido quin eos [sanctos] habeamus propitios, si posuerimus corda nostra super vias nostras et itaversati fuerimus in exercitio legis divinae, ut eam non minus studeamus facere quam audire. Nam ut ait sapiens quidam:‚Rerum experientia intelligentiae magistra est.‘ (vgl. H. WALTHER, Prov. Sent. lat. m. aev., Lat. Sprichwörter …,Göttingen 1963; 9. Nr. 26588a).
166
sonst kaum bekannten echten (d. h. asketischen) Glückseligkeitslehre Epikurs aus und setzt dieser das Zerrbildder nur dem Namen nach „epikureischen“, in ihren Taten den Meister verleugnenden höfischen„Wollüstlinge“ der Gegenwart kritisch entgegen.389 Jobs Ausspruch: „Ich lege die Hand auf meinen Mund“(39.34) wird dabei so ausgelegt, daß die Tat der Rede entsprechen müsse: qui manum apponat ori id est quifaciat quod loquetur. Dies sei auch die Überzeugung der Stoiker und Peripatetiker, auf die sich Johann gegenbequeme Pseudo-Epikureer – ein anderes Wort für „Höflinge“ – am Ende des Policraticus beruft, m.a.W.: amEnde des „Weges“, auf dem er dem Untertitel des Werks gemäß „den Spuren der Philosophen“ gefolgt ist.Dieser „Philosophen-Weg“, auf den sich auch der Haupttitel „Polycraticus“ bezieht (s. unten § 115), wirdzugleich mit dem „Weg zur Glückseligkeit“, die via regia mit der vera philosophia Christi identifiziert. DerWeg ist nach Matthäus (7.13–4) „steil und eng“, voller Hindernisse, aber mit Gottes Gnade führt er zum(jenseitigen) Ziel. Der „Weg“ ist einerseits Christus selbst (Joh. 14.6), andererseits die Tugend derPhilosophen. Er hat zwei Wegränder: „die Erkenntnis“ und „die Ausübung des Guten“, also: Theorie undPraxis. Derart bildet er nach einem Metamorphosen-Vers Ovids (I 168) „die Milchstraße zumHimmel“.390Die Exempla oder „Monumente der Väter“ dienen der Selbsterkenntnis und zeigen, wo wir vomWege abgekommen sind, seitdem erstmals Adam vom „Baum der Erkenntnis“ gegessen und gleichsam dieSünde der reinen Theorie begangen hat.391 Von einem andern Baum hieß die Sibylle Aeneas den ZweigProserpinas brechen, damit er den Vater Anchises
389 Pol. VIII 25, (II) 418–25 in Bezug zu VIII 11, (II) 292 und VII 15, (II) 153–6. Dazu und zu Epikur vgl. DELHAYE, Lebien suprême (wie Anm. 385) 205, 217 ff.; LIEBESCHÜTZ 28 ff., 78 ff.; KERNER 97 f., 185 f.; D.E. LUSCOMBE, TheEthics of Abelard …, in: ‚Peter Abelard‘ (Mediaevalia Lovanensia I 2), Löwen-Den Haag 1974, 69 f.; GARFAGNINI, DaSeneca … (wie Anm. 206) 201 ff.; E. GARIN, Ricerche sull’epicureismo nel Quattrocento (1959), in: ders., La culturafilosofica del Rinascimento italiano, Florenz 1961, 72–92; A. MICHEL, Epicurisme et christianisme … (wie obenAnm. 338) 356 ff. sowie unten S. 462 f.390 Pol. VIII 25, (II) 418.15–419.12. Der schweigende Job als Exemplum gegen Geschwätz und für aktive virtus; auch imSinne des Fürstenspiegels gegen geschwätzige Ratgeber in Pol. V 6, I 302; vgl. RUBERG (wie Anm. 264) 109.391 Pol. VIII 25, (II) 419.12 ff.: Redi ad te, patrum suscipe monimenta et ibi intuere diligenter ubi a via deflexeris gressumet ubi cecideris in errorem [vgl. unten Anm. 405]. Recolo autem nos aberrasse ibi primum ubi impulsus et eversus est homo[…] quando ad vetitum scientiae lignum suadente diabolo temerariam et incautam manum extendit, Ebd. 420.2 ff.: Ergo aligno scientiae dum prohibitus illud ascenderet, a veritate virtute vita cecidit et deviavit homo, nec revertetur ad vitam, nisiad arborem scientiae redeat et inde veritatem in cognitione, virtutem in opere, vitam in iocunditate mutuetur. Vgl. untenAnm. 883.
167
in der Unterwelt besuchen und heil zurückgelangen könne.392 Dies alles und mehrere andere nicht wenigerraffinierte biblisch-antike Anspielungskombinationen untermalen den einen zentralen Gedanken, daß „vomBaum des Wissens der Zweig der guten Werktätigkeit loszureißen“ sei.393
Solch synkretistisch anmutende Stellen über die Verbindung von Erkennen und Handeln sind wohl wenigerbekannt als Johanns humanistische Bekenntnisse zum Bildungsideal Ciceros und Quintilians, d. h. zurUntrennbarkeit von sapientia und eloquentia, Philosophie und Rhetorik394 oder zu der – für die Exempla-Tradition zentralen – Idee der Überlegenheit der (römischen) Praxis über die (griechische) Theorie.395 Dievon Johann gepflegte Tradition
392 Ebd. 420.27–421.12 mit Verg. Aen. VI 136–144 als Zitat. Zur Bedeutung Vergils in diesem Kontext s. S. 178 f. undMARTIN, John of S. as Classical Scholar (wie Anm. 724) 198 ff.393 Ebd. 421.14–16: Plane quid penarum lateat in terrenis vel quid in his possit mereri solus agnoscit qui de arborescientiae ramum bonae operationis avellit.394 Allgemein zum „synkretistischen“ Eindruck s. unten §§ 101 f. – Zum humanistischen Bildungsideal vgl. etwa Met. IProl., 4: De moribus vero nonnulla, scienter inserui; ratus omnia que leguntur aut scribuntur inutilia esse, nisi quatenusafferunt aliquod adminiculum vite. Est enim quelibet professio philosophandi inutilis et falsa, que se ipsa in cultu virtutiset vitae exhibitione non aperit. Pol. VIII 8, (II) 272: Alioquin nichil aliud recte procedit, nisi et ipsa [philosophia] rebusasserat quod verbis docet. Quid enim prodest verbis inanibus ventilare in scolis virtutis officia, si non actibus et vitasolidentur. Pol. VII 12.136: Errant utique et impudenter errant qui philosophiam in solis verbis consistere opinantur;errant qui virtutem verba putant ut lucum ligna. Nam virtutis commendatio consistit ab opere, et sapientiam virtusinseparabiliter comitatur. Ebd. V 9, (I) 321.4–5: Nam in ore frustra volvuntur verba, si virtutis deficiunt opera. Pol. VII 9,(II) 128 f.; Pol. VIII 25, (II) 418; Pol. III 1, (I) 173: Met. II 4, 71 f.; Met. II 9, 76 f. u.a.m.; vgl. J.E. SEIGEL, Rhetoric andPhilosophy in Renaissance Humanism, Princeton 1968, 183 ff. (zu Joh.); Brian P. HENDLEY, Wisdom and Eloquence, ANew Interpretation of the Metalogicon of John of Salisbury, Diss. New Haven 1967, bes. Kap. III; G.C. GARFAGNINI,‚Ratio disserendi‘ e ‚rationandi via‘: il ‚Metalogicon‘ di Giovanni di Salisbury, in: StM 12 (1971) 915–54; MUNK-OLSON(wie Anm. 28) 55 ff.; J.O. WARD, From Antiquity to the Renaissance: Glosses and Commentaries on Cicero’s Rhetorica,in: Medieval Eloquence, ed. J.J. MURPHY, Los Angeles/London 1978, 25–67, hier 46 ff.; CURTIUS ELLM 86 f., 475;MISCH 1250 f.; LIEBESCHÜTZ 79 f., 90 u.a.m. Insbesondere zum Zusammenhang dieses intellektuell-moralischenBildungsideals mit der sog. Schule von Chartres vgl. KERNER 12 ff.; 185 ff.; W. WETHERBEE, Platonism and Poetry inthe Twelfth Cent., Princeton 1972, 24 ff.; COURCELLE, Connais-toi … (wie Anm. 247) 274 ff. – Vgl. auch unten § 69,S. 170 ff.395 Zu dieser spezifisch römischen Nuance vgl. GAILLARD, Regulus (wie Anm. 171); GEBIEN 55 ff.; KORNHARDT 21,MICHEL, Rhétorique et philosophie (wie Anm. 546) 68 ff. und vor allem Quint. XII 2.20; Quantum enim Graeci praeceptisvalent, tantum Romani, quod est maius, exemplis. Cic. De orat. 3.137 (zit. in Anm. 165). – Zu Johann vgl. Pol. VIII 6, (II)261.5; ebd. VIII 7, 267.15 ff. zu griechischer luxuria und römischer Disziplin; ebd. VII 6, 111.7 ff. zu Graecorum fabulaeund historiographischer Verläßlichkeit des Römers Val. Max.; Pol. II 13, (I) 87.16 ff. zum begrifflichen Denken der Griechenim Unterschied zum jüdischen Wunderglauben nach I Cor. 1.32; Pol. II 22, (I) 122.10 ff. in Anm. 581 zitiert. Vgl. auchS. 205, Anm. 463, 485, 582, 798, 955.
168
der Philosophen-Exempla geht in der Tat auf Grundgedanken praktischer Philosophie der Antike zurück: aufdie Idee der Einheit von Lehre und Leben, der Skepsis gegen ethische Systeme, auf den pädagogischen Glaubenan die Macht der Gewohnheit und den Wert der Einübung großer Muster sowie auf die persönliche Forderungzum Beispielgeben, d. h. auch zur autobiographischen Vermittlung moralischer Erfahrungen.396 Johannschließt sich dieser Tradition ausdrücklich an, nicht nur, indem er deren Hauptvertreter Sokrates, Seneca undQuintilian als Kronzeugen lobend anführt,397 sondern auch dadurch, daß er mit entsprechend ausgewähltenExempla mehrere Lehrautoritäten der philosophischen Ethik aufgrund der Übereinstimmung des persönlichenVerhaltens mit den von ihnen verkündeten Theorien bewertet. In diesem Sinne übt er etwa Kritik anAristoteles, Cicero oder Varro und preist Plato, Plutarch, Quintilian, Origenes oder Hieronymus.398 Ingleicher
396 Zur Tradition der praktischen Philosophie (Sokrates, Seneca, Cicero, Quint., Lact., Tert., Aug., Hier. u. a.) vgl.DÖRING 13 f., 18 ff.; GEBIEN 52 ff.; KORNHARDT 26 ff.; CANCIK (wie Anm. 38) 22 f., 71 ff., 107 ff. u. passim;PÉTRÉ 17 f., 28; GEERLING 151 ff.; SEIGEL (wie Anm. 394) 186 ff. u. ö.; sowie unten S. 292 f. Zur Ethik desBeispielgebens vgl. Pol. VII 19 (II) 170.11 ff.; VIII 17 (II) 358; VI 1 (II) 3; Ep. 217 (II) 364; Vita Anselmi (PL 199) 1021C–D. Zum autobiographischen Exemplum s. unten §§ 60, 71, S. 206, 335 ff., 536.397 Sokrates: Met. IV 40, 213. Vgl. S. 175, 205, 331 f., 447, A. 920, Dal PRA 60 f. Seneca: Met. I 22, 51 f.; vgl. Registers. l. – Quintilian: Pol. VII 14, (II) 152; vgl. S. 167, 225, 416 ff. – Zusammenfassend: Pol. V 17, (I) 358 ff.; VIII 25, (II)418 ff. (auch zu andern Philosophen). Vgl. DELHAYE, Grammatica. (wie Anm. 386) 27 f.398 Kritik an Aristoteles: Entheticus, ed. R.E. PEPIN, in: Trad. 31 (1975) 127–194 (= Enth., mit Versangabe), 831 ff., 859,873; vgl. LIEBESCHÜTZ, Chartres (wie Anm. 28) 8 f.; vgl. S. 408 f. zum Verhältnis Plato-Aristoteles. – Cicero:Enth. 1215 ff., 1241 ff. (nach Aug. Conf. III 4.7); vgl. LIEBESCHÜTZ a. O. 8 f., Humanism 79 f.; MUNK-OLSEN (wieAnm. 28) 55 zu einem ähnlichen Urteil von Erasmus; MINNIS, Authorship … (wie Anm. 337) 211 ff. zu Petrarcasvergleichbarer ethischer Cicero-Kritik bei gleichzeitiger literarischer Cicero-Bewunderung. – Varro: Pol. VII 9, (II) 128 f. LobPlatos; Met. II 2, 63; Pol. VII 5, (II) 110; vgl. S. 408 ff., 447 ff. Origines: Pol. VIII 6, (II) 251.12 ff., vgl. MICZKA 47;unten S. 350. Hieronymus: Pol. VII 23, (II) 208; vgl. S. 478 ff. Plutarch: vgl. § 98. Quint.: Pol. VII 14, (II) 153, vgl. A.MOLLARD, La diffusion médiévale de l’Institution oratoire au XIIe siecle, in: MA 44 (1934) 161–75; 45 (1935), 1–8, hier1 ff.; O. SEEL, Quintilian oder die Kunst des Redens und Schweigens, Stuttgart 1977, 240 ff. und unten S. 417 f.
169
Weise mißt er die ästhetische Begabung bestimmter Schriftsteller an deren Fähigkeit, eloquentia undsapientia, ars und moralische utilitas, praecepta und exempla zu verschmelzen, wobei etwa Vegetius gerügt,Homer, Vergil, Lucan, Cicero und Bernhard von Chartres gelobt werden.399
46. Dem modernen Verständnis fällt es allerdings schwer, den proklamierten ethischen Anspruch amtatsächlich verwendeten Anekdotenmaterial des Policraticus nachzuvollziehen. Diese Diskrepanz zwischenIdeal und Veranschaulichungsmittel läßt sich allerdings in der gesamten rhetorischen Tradition desExemplums seit der Antike feststellen. Über Augustins Bildungsprämissen (dessen von Varro beeinflußterPhilosophenkatalog im 19. Buch des ‚Gottesstaats‘ das Muster für das 7. Policraticus-Buch bildet) schriebHenri Irénée Marrou durchaus generalisierbar:400
„Von der Philosophie blieb im Unterricht der Rhetoren herzlich wenig übrig […]. Abgesehen von Lektüre undKommentar der Dialoge Ciceros erwähnten sie höchstens noch einige Philosophennamen, einige charakteristischeLehrmeinungen und Anekdoten,“
und über das besagte Philosophenkapitel Augustins:
„Was bleibt übrig? Wie bei der allgemeinen Geschichte einige sehr simple Ansichten von den ersten Philosophen,den italischen und ironischen Schulbildungen, von der ethischen Lehrweise des Sokrates, banale Kenntnisse ausklassischen Hauptwerken, die jeder Gebildete in der Rhetorenschule gelesen hatte […], vor allem abercharakteristische Anekdoten: Wie Sokrates beim Hund und beim Stein schwört, wie Xenokrates den jungenPolemon zur Philosophie bekehrt, nachdem es diesen frühmorgens nach nächtlichem Gelage völlig betrunken inseine Schule verschlagen hat. Diese Anekdoten gehören ebenfalls zu einer ganzen gelehrten Tradition; seit langemhatte eine bestimmte Anzahl solcher „Geschichten“ bei den Römern Bürgerrecht erlangt. Man hat die Qual der Wahl,will man erraten, von welchem Autor sie zu Augustinus gelangt sein könnten.“
Wir sollten es dennoch nicht bei diesem Hinweis auf die immer dünner und trivialer werdendeHandbuchtradition der Philosophenleben und Philosophenanekdoten
399 Vegetius: Pol. VI 18, (II) 57 f.; vgl. auch oben Anm. 347, 349. – Homer: s. unten § 49. – Vergil, Lucan: Met. I 24, 55;Pol. VIII 23, (II) 404.4 ff.; vgl. P. von MOOS, Poeta und historicus im Mittelalter …, in: Beitr. z. Gesch. der dt. Spra. u.Lit. 98 (1976) 93–130, hier 124 f. – Bernhard v. Ch.: Met. I 24, 53 ff. – Cicero: oben Anm. 395.400 MARROU, Saint Augustin … 115 f.; 134. Vgl. auch A. SOLIGNAC, Doxographie et manuels dans la formation desaint Augustin, in: Recherches Augustiniennes I (1958) 113–148, hier 114, 120 ff., 138 ff. zur Bedeutung Varros fürCiv. VIII 2 und XIX 1 ff. – Die am Ende des zweiten Zitats angesprochene Quellenproblematik betrifft Johann von Salisburya fortiori: Die Xenokrates-Anekdote findet sich bei ihm z. B. in Pol. VIII 9, (II) 282 f. zum Thema „Gastmahl“. Als Quellegibt WEBB Val. Max. VI 9, Ext. 1. MARROU zitiert hier Aug. Ep. 144.2 (PL 33) 591; Contra Julian. Pelag. 1.4 (PL 44)647 und verweist neben Val. Max. auch auf Horaz-Kommentare zu Sat. 2.3.253–4 und auf ein Quellenverzeichnis inZELLERS Philosophiengeschichte. Zu Johanns Quellen vgl. auch unten § 89.
170
von Diogenes Laertios bis hin zur spätantiken und mittelalterlichen Schulbildung bewenden lassen.Policraticus und Metalogicon sind zwar ohne diesen Hintergrund nicht denkbar; die Werke wurden (wiegesehen401) nicht grundlos als philosophiegeschichtliche Anekdotensammlungen rezipiert. Beachtenswerterist jedoch die Feststellung, daß Johanns Vorliebe für Exempla aus einem im Mittelalter selten so starkausgeprägten ethischen Sokratismus und erkenntnistheoretischen „Probabilismus“ stammt. Erkenntnis istdanach nur durch Praxis und Vergleich mit anderen tätigen Subjekten möglich. Prägnant faßt Mario Dal Pràdiesen Grundgedanken zusammen:402 „Je weniger Johann davon überzeugt ist, die absolute Wahrheit zubesitzen, desto gewissenhafter bemüht er sich um die Rekonstruktion fremden Gedankenguts.“ Für diebiographisch-doxographischen Teile des Metalogicon mit den vielen autobiographisch getöntenStellungnahmen zu den wichtigsten Lehrkontroversen des 12. Jahrhunderts leuchtet dies unmittelbar ein.Ähnlich will Johann jedoch auch die dicta und facta im Policraticus verstanden wissen.403 Höchstenphilosophischen Gewinn bringt nicht theoretische Neugierde,
401 Oben S. 141.402 Dal PRÀ 126. Ähnliches wurde vornehmlich im Hinblick auf die philosophische Tradition des skeptischen Denkens derAntike und der Neuzeit festgestellt: vgl. etwa BLUMENBERG, Patristik (wie Anm. 36) 488 f.; ders., Wirklichkeiten (wieAnm. 36) 104 f.; ders., Der Prozeß der theoretischen Neugierde, Frankfurt a. M. 1966, 55 ff.; A. MICHEL, Culture etsagesse: aspects de la tradition classique de Cicéron a Hugues de S. Victor, in: Mél. de Philos., de litt. et d’hist. ancienneofferts a P. BOYANCÉ (Collection ‚Ecole française de Rome‘ 22), Paris 1974, 513–28, hier 514 ff.; SEIGEL (wieAnm. 394) 12 ff., 226 ff. – Zur literarischen Tradition der Philosophenanekdote vgl. die oben Anm. 271 genannten Beiträgesowie DÖRING 13 ff.; J. BOLLACK, Vom System der Geschichte zur Geschichte der Systeme, in: Poet. u. Herm. V:‚Geschichte …‘ München 1973, 11–28 mit den Diskussionsbeiträgen von A. BORST und M. FUHRMANN ebd. 443–7; J.MEJER, Diogenes Laertios and his Hellenistic Background, (Hermes Einzelschriften 40) Wiesbaden 1978. LHOTSKY 78zum weiteren anthropologischen Zusammenhang: Anekdotisch umrahmte Lebensweisheiten berühmter Personen wurden stetsauch außerhalb dieser Tradition gesammelt. Sie verbinden sich mit der Memorabilien-Tradition (Val. Max.) und derbiographischen Tradition (Hyginus, Nepos) zu einer eigenen im Mittelalter beliebten Gattungsmischung, die maßgeblich denPol. bestimmt hat. Vgl. SCHON 65 ff.; oben S. 21, 131 f., 161 f. unten S. 172 ff., 311. Zu Sokrates und Probabilismusvgl. Dal PRÀ 60 f., 125 u. ö.; COURCELLE, Connais-toi (wie Anm. 247) II 774 s. l. Jean de. S.; vgl. nach Reg, 4 s. l.Selbsterkenntnis. Eine beachtenswerte Analogie zu Johanns Hochschätzung der Philosophenanekdote im Geist derpraktischen Philosophie ergibt sich aus der feinsinnigen Analyse der Exempla heidnischer Philosophen in den theologischenWerken Abaelards durch J. JOLIVET, Doctrines et figures … 109 ff.403 Vgl. unten § 69.
171
sondern der Anblick eines Weisen im stoischen Sinn, eines seiner selbst mächtigen, sich selbst immer gleichenund das Schicksal bezwingenden Menschen.404 Wenn Johann mit Seneca lehrt, man solle große Vorbilder alsRichtschnur und Spiegel wählen, um sich an ihnen zu messen und zu verbessern, so bezieht er dies auf Lebendeebenso wie auf literarisch vermittelte Exempla der Vergangenheit.405
Nicht nur als eine Deklaration des „humanistischen Lebensideals“ – was immer man darunter verstehe –,sondern auch als wichtigste moralische Begründung des konkreten Exemplagebrauchs kann folgende Stellegelesen werden:406
404 Pol. V 17, (I) 366. 16 ff.: Fructus siquidem philosophiae eximius est ut noverit quis abundare et penuriam pati, ut letoanimo aequanimiter omnia portet, ut obiecto solidae virtutis obice omnem fortunam exarmet.405 Ep. 144, (II) 32 f. (an Thomas Becket): Differte interim omnes alias occupationes […] Prosunt quidem leges et canones,sed […] non tam devotionem excitant quam curiositatem […] Plus dico scolaris excercitatio interdum scientiam auget ettumorem [cf. I Cor. 8.1], sed devotionem aut raro aut nunquam inflammat. Mallem vos Psalmos ruminare et beati Gregoriimorales libros revolvere, quam scolastico more philosophari. Expedit conferre de moribus cum aliquo spirituali, cuiusexemplo accendamini, quam inspicerce et discutere litigiosos articulos saecularium litterarum (Zur Wissenschaftskritik s.§ 72, S. 361 ff.). Pol. VIII 25, (II) 419.12 ff. oben in Anm. 391 zitiert. Als Parallele, wo nicht als Quelle ist damit zuvergleichen Sen. Ep. 11.8.10: Aliquis vir bonus nobis diligendus est ac semper ante oculus habendus, ut sic tanquam illospectante vivamus et omnia tamquam illo vidente faciamus […] Elige itaque Catonem […], elige Laelium. Elige eum, cuiustibi placuit et vita et oratio et ipse animum ante se ferens vultus: illum tibi semper ostende vel custodem vel exemplum. Sen.Ep. 25.5: ‚Sic fac, inquit, omnia, tamquam spectet Epicurus.‘ Prodest sine dubio custodem sibi imposuisse et habere quemrespicias, quem interesse cogitationibus tuis iudices. Hoc quidem longe magnificentius est, sic vivere tamquam sub alicuiusboni viri ac semper praesentis oculis; sed ego etiam hoc contentus sum, ut omnia sic facias, quaecumque facies, tamquamspectet aliquis: omnia nobis mala solitudo persuadet. Zur Wirkung solcher Stellen im Mittelalter vgl. GARFAGNINI, DaSeneca a Giovanni … (wie Anm. 206) 204 ff.; R.M. THOMSON, William of Malmesbury as Historian and Man of Letters,in: The Journ. of Ecclesiastical Hist. 29 (1978) 387–413, hier 404 (in hagiographischem Zusammenhang); G.G.MEERSSEMAN, Seneca maestro di spiritualita nei suoi opuscoli apocrifi dal XII al XV secolo, in: IMU 16 (1973) 43–135,hier 107 (insgesamt ein grundlegender Beitrag zum Einfluß Senecas auf die monastische Kritik scholastischer Wissenschaftbis zur Devotio moderna und zum Renaissance-Humanismus; vgl. unten Anm. 599, 1026).406 Pol. VIII 23, (II) 401.12 ff.: Dicunt philosophi et verum arbitror nichil in rebus humanis utilius homine. Vgl. Cic.Off. II 3.11: Deos placatos pietas efficiet et sanctitas, proxime autem et secundum deos homines hominibus maxime utilesesse possunt. Hildebert. Cenoman., Ep. I 16 (PL 171) 184 B: Nihil est quod homine sit inutile nisi homo ipse. Ebd. I 7,154 B: Nihil enim est homini bonum nisi se bono. Girald. Cambr., Symbol. elect., Ep. 15 (Opera ed. BREWER I,RBS 21.1, 1861) 245: Nihil est homini bonum sine se bono. Zum Ideal des cultus humanitatis im 12. Jh. s. unten S. 307 f.
172
„Die Philosophen sagen, und es scheint mir wahr, daß in menschlichen Angelegenheiten nichts nützlicher istals der Mensch selbst.“ Es klingt wie ein bescheiden untertreibendes Echo hierzu, wenn der wohl letzteNachfolger des Diogenes Laertios, Wilhelm Weischedel, zu Beginn seiner „Philosophischen Hintertreppe“schreibt:407 „[…] wenn man Glück hat, begegnet man den Philosophen […] als den Menschen, die sie sind:mit ihren Menschlichkeiten und zugleich mit ihren großartigen und ein wenig rührenden Versuchen, über dasbloß Menschliche hinauszugelangen.“
47. Damit vergleichbar ist Plutarchs einleitender Satz zur Alexander-Vita, eine der berühmtesten Stellen zurBiographik überhaupt:408 „Oft verraten eine unbedeutende Handlung, ein Ausspruch oder ein Scherz dieWesensart des Menschen viel deutlicher als die blutigsten Gefechte, die größten Schlachten undBelagerungen.“ Da dieses Zitat auch als grundlegende Bestimmung der Anekdote herangezogen zu werdenpflegt, ist eine Zwischenbemerkung zum intentionalen Unterschied von Exemplum und Anekdoteangebracht:409
407 W. WEISCHEDEL, Die philosophische Hintertreppe, 34 große Philosophen in Alltag und Denken, München (1966),21973, 9.408 Alex. 1.2. Zu Plutarch als Hauptmuster des Exemplums im römischen Sinn vgl. SEEL, Römertum (wie Anm. 170) 341;VERWEYEN 81 f.; LUMPE 1238.409 Zur Anekdote vgl. aus der unabsehbaren Literatur etwa BAUSINGER, Formen (wie Anm. 69) 218 ff.; ders., Schwank(wie Anm. 150) 124 f.; E. MOSER-RATH, Art. Anekdote, in: EM 1 (1977) 528 ff.; H.P. NEUREUTHER, Zur Theorie derAnekdote, in: Jb. d. freien dt. Hochstifts 1973, 458–80; MIKOLETZKY (wie Anm. 162) 402; LHOTSKY, passim; MaxDALITZSCH, Studien zur Gesch. der Anekdote, Diss. Freiburg i. Br. 1922; Heinz GROTHE, Anekdote, 2. durchges. u.erweiterte Aufl. (Samml. Metzler 101), Stuttgart (1971) 1984 (bibliographisch stoffreich, aber für die Zeit vor dem 18. Jh.wenig ergiebig). – Insbesondere zur biographischen Bedeutung seit der Antike vgl. A. DIHLE, Studien zur griech.Biographie, Göttingen 21970, 48 ff.; KECH (wie Anm. 234) 123 ff.; E. HAZELTON HAIGHT, The Roman Use ofAnecdotes, New York 1940; J. ROMEIN, Die Biographie, Bern 1948, 17 ff. In diesem Zusammenhang kaum beachtet istdie anthropologisch aufschlußreiche Arbeit von Ernst KRIS und Otto KURZ, Künstleranekdoten und biographische Motive(1934) in: dieselben, Die Legende vom Künstler, Ein geschichtlicher Versuch, mit einem Vorwort von E.H. GOMBRICH,Frankfurt 1979, 29–36, bes. 31 f.: Entgegen der undifferenziert-umgangssprachlichen Vermengung von Anekdote und Witzoder unterhaltsamem Geschichtchen (Pointe als „Lustgewinn“) wird hier die exemplarische Identifikation mit dem Heldenhervorgehoben, die durch ein „Stück Geheimbiographie“ erleichtert werden soll. Dieses Moment „inoffizieller“Personendarstellung – „die Urzelle aller Biographik“ – rückt die Anekdote sachlich wie etymologisch in die Nähe derNovelle. Denn beide Gattungen beziehen sich auf Neues, Unbekanntes (Ωn™kdoton – ineditum; novella – res nova, inaudita).Dazu vgl. auch unten Anm. 508, 921.
173
Eine Anekdote dient der (biographischen) Charakterisierung eines beachtenswerten Menschen durch einenkleinen, unscheinbaren, vielleicht allzumenschlichen Umstand oder Vorfall aus dem Privatleben und stellt ein„repräsentatives Momentbild“ dieser Persönlichkeit dar. Das Exemplum dagegen will nicht eine Personbiographisch einprägsam vor Augen führen, sondern mit Hilfe der Ereignis- oder Personendarstellung eineargumentative oder lehrhafte Schlußfolgerung für die gegenwärtige Situation ziehen. Das repräsentativehistorische Detail wird in der Anekdote als Synekdoche für das Ganze der Persönlichkeit gesetzt und dientdem biographischen Erzählzusammenhang, während das Exemplum diese Darstellung zum Zwecke einesVergleichs mit einer völlig fremden causa übersteigt. Dasselbe Verhältnis besteht zwischen dem eine Personkennzeichnenden Apophthegma und dem lehrreichen, auf andere Situationen übertragbaren dictum einerExempelgestalt.410 Die Unterscheidung wird in der Interpretationspraxis vor allem deshalb unscharf, weil dieanekdotisch charakterisierte Person als Ganze meist auch exemplarische Bedeutung hat und das Exemplumseine rhetorische Wirksamkeit gerade durch anschauliche Personencharakteristik erlangt. Jede Anekdotekann somit als Exemplum dienen, aber nicht alle Exempla sind anekdotisch, da ihr Stoffgebiet auch die„große“ Geschichte einschließt und vor allem, weil sie aufgrund ihrer instrumentell-funktionalen Definitionüberhaupt nicht mit einer bestimmten Gattung zusammenfallen können.
410 BAUSINGER, Formen (wie Anm. 69) 220 (Zitat). – Nach DALITZSCH (wie Anm. 409) und GROTHE (ebd.) 62gehören auch Valerius Maximus und Gellius zu den Anekdotensammlern. Mit dem Exemplum identisch ist das Verfahrender Eigenschafts-Synekdoche; vgl. GROTHE a. O. 12, 16 u. ö. sowie unten § 78. – Einen interessanten Zusammenhangzwischen dem etymologisch abgedeckten Sinn des „Noch-nicht-Herausgegebenen“, Verborgenen, Unbekannten, Privaten undder „Wirklichkeitsfindung“ als einer tieferen, „subtileren“ Erkenntnis der dem gewöhnlichen Oberflächenanblick entzogenenAspekte der Weltordnung zeigt VERWEYEN (52) aufgrund von Balthasar Graciáns ‚Arte de Ingenio‘ (1642); dazu s. unten§ 101. – Zum Apophthegma vgl. VERWEYEN, passim; W. GEMOLL, Das Apophthegma, Wien/Leipzig 1924;BRÜCKNER, Hist. 44 ff., 81 ff.; SCHON 63 ff.; vgl. auch § 44 zur Chria, und § 73 zum strategemma. – Hinsichtlich desUnterschieds von rhetorischem Exemplum und Predigtmärlein ist hier zu ergänzen, daß letzteres im Prinzip gerade nicht mitanekdotisch vorgestellten Charakteren der Geschichte arbeitet, sondern das anekdotische Detail von der Personendarstellungablöst, es verselbständigt, um es auf beliebig vertauschbare Helden und anonyme Träger übertragen zu können. Für dieAnekdote ist der historische Bezug unabdingbar; sie knüpft an reale Personen und Ereignisse an. Sind diese erfunden, somüssen sie wenigstens „so treffend sein, als ob sie wahr sein könnten“. Dies betont Lutz RÖHRICH (Der Witz, Stuttgart1977, 7) als Unterschied der Anekdote zum grundsätzlich ahistorischen Witz. Das historische Exemplum und dasPredigtmärlein (von RÖHRICH freilich etwas einseitig „Schwank“ genannt) unterscheiden sich weitgehend analog. Vgl. auchSCHON 66 f. zu der definitionsgemäß an berühmte Personen gebundenen „-ana“-oder Witzwortsammlungen (wie„Kreisleriana“) der Neuzeit.
174
48. Aufgrund der pragmatischen Geisteshaltung, die stets das Interesse an der Philosophenanekdote bestimmthat, legt Johann im Policraticus besonderen Wert auf eine möglichst lückenlose Verbindung von dicta undfacta, von Zeugnissen des Denkens und Zeugnissen des Lebens. Dies gelingt nicht ohne einige Kunstgriffe.Eine stilistische Eigenart Johanns besteht darin, daß er Zitate häufig so wendet, daß sie als bestimmteAussprüche autoritativer Gestalten in einer konkreten historischen Situation erscheinen (etwa ein Psalmversals Aussage Davids), oder daß er rein literarische Figuren aus antiken Werken wie Autoren reden läßt (etwaCato und Brutus aus den Pharsalia oder Praetextatus und Portunianus aus den Saturnalia), ohne deneigentlichen Autor im philologischen Sinn (hier also Lucan, bzw. Macrob) zu zitieren.411 Das schon vonVergil auf das politische Naturideal bezogene große Bienengleichnis aus den Georgica schreibt Johannausführlich aus, aber nicht als einfaches Dichterzitat; er betont zwar, daß keine Staatstheoretiker oderpolitischen Historiker das Wesen der vita civilis besser dargestellt hätten als der „gelehrteste der Dichter“,doch bettet er die Verse situativ in ein eigentliches Exemplum ein: Plutarch habe „seinen Traian“ auf dieseVergilstelle
411 Pol. VIII 6, (II) 254 f. Portunianus als Autorität gegen Schlemmerei zitiert. SCHAARSCHMIDT (91) merkt an, eshandele sich dabei um keinen Schriftsteller, sondern um einen Unterredner der Saturnalia. Noch deutlicher sucht Johann denEindruck eines Autors in Pol. VIII 7, (II) 270.20 zu erwecken: Si quis ea nosse desiderat […] percurrat Potuniani civiliainstituta. (Dazu vgl. auch unten Anm. 462). Zu Pol. VIII 23 mit der Darstellung von Brutus und Cato als teilweise von denPharsalia abgelösten Autor-Exempla vgl. von MOOS, Lucans tragedia… 176 ff. – Zur Deutung solcher Phänomene vgl.allgemein H. BRINKMANN, Die Einbettung von Figurensprache in Autorensprache, in: Mel. J. FOURQUET,München/Paris 1969, 21–41 und ders., Zeichen erster und zweiter Ordnung in der Sprache, in: Festschr. H. GIPPER,‚Integrale Linguistik‘, Amsterdam 1979, 1–11, bes. 4 f. zu Macrobs Fiktionsrechtfertigung im Kommentar zum SomniumScipionis aufgrund der in Dialog-Rollen verteilten Mitteilungen Ciceros. Vgl. dazu auch unten S. 401, 406 ff.
175
hingewiesen, damit der Kaiser „von den Bienen das öffentliche Leben lerne“.412In einer langen Reihe vonMächtigen, die Kritik ihrer Untergebenen ertragen konnten, erinnert er an König David. Dabei konstruierter, offenbar um nach vielen antiken Beispielen einen krönenden biblischen Abschluß zu erreichen, aus derPsalmstelle 140.5 ein Exemplum des Alten Testaments:413 „Der gläubige, durch Gottes Gnade erwählte Königaber hinterläßt den Königen und Fürsten – wenn sie es nur beherzigen würden! – ein Beispiel derGerechtigkeit, Demut und Tapferkeit, indem er sagt: ‚Schlägt mich der Gerechte, beschimpft er mich, so istes Güte; das Öl des Sünders aber salbe nicht mein Haupt.“ Anderwärts wird das platonische Sokrates-Wortvom glücklichen Staat, in dem die Philosophen herrschen oder die Herrscher Philosophen sind, so mitProv. 8.15 kombiniert:414 „Sollte dir die Autorität des Sokrates zu gering erscheinen, so höre die Weisheit!‚Durch mich‘, sagt sie, ‚regieren die Könige.‘“ Prov. 1.10 ff. wird zu einer Rede Salomos an seinen Sohn; eineOvidstelle wird in die Situation eines über Freundschaft trauernden „Weisen“ gebracht; Laelius, nicht Cicero,erscheint als Verfasser von De amicitia.415 Plato wird in einer biographischen Überleitung als Autor einesZitats vorgestellt, das in Wirklichkeit aus Macrob stammt. Claudians Panegyricus auf Honorius wird soangeführt, als ob es sich um eine poetische Fassung der ipsissima verba des Theodosius handele.416 Auf solcheWeise hilft Johann der Exemplifizierung, d. h. der Identifizierung von Aussprüchen mit den sprechendenPersonen selbst etwas nach. Dies kann
412 Pol. VI 21, (II) 59–62: ‚Rem publicam ad naturae similitudinem ordinandam et ordinem ab apibus mutuandum; mitGeorg. IV 153–218 ebd. 60 f. – Ebd. 60.5 ff.: Poetarum doctissimus Maro, ad quem Plutarchus suum destinat Traianum utcivilem vitam ab apibus mutuetur. Ebd. 62.1 ff.: Rei publicae omnes auctores percurre, rerum publicarum revolve historias,vita civilis tibi rectius et elegantius nusquam occuret. Zu Traian und Plutarch s. unten § 98; zum Naturideal § 95. Zu civilisvgl. S. 470 ff.; zur politischen Bedeutungstradition des Bienengleichnisses vgl. Dietmar PEIL, Untersuchungen zur Staats-und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart, (MMS 50) München 1983; W.STÜRNER, Die Gesellschaftsstruktur und ihre Begründung bei Johannes von Salisbury, Thomas von Aquin und Marsiliusvon Padua, in: Miscellanea Mediaevalia 12.1 (Soziale Ordnungen…), Berlin 1979, 162–78, hier 164.413 Pol. III 14, (I) 231 f.: Ait ergo rex fidelis, electus in beneplacito Domini, relinquens, si sapiant, regibus et principibusiustitiae humilitatis exemplum et fortitudinis: ‚Corripiet me iustus in misericordia et increpabit me […].’414 Pol. IV 6, (I) 256.23 ff.: Et (si tibi Socratis videtur contempnenda auctoritas): ‚Per me, inquit Sapientia, regesregnant…’ Dazu vgl. unten S. 567 ff., 572, 575.415 Pol. III 7, (I) 187.26 ff. spricht Salomon zu seinem Sohn und ebd. 189.24 trauert „der Weise“ (für Ovid, Pont. II3.19–20); ebd. 189.29 Laelius (für Cic. De amic. 4.15).416 Pol. I 6, (I) 40 (Plato); Pol. IV 6, (I) 254; IV 4, 246 f.; V 5, 297 (Theodosius).
176
so weit gehen, daß er entweder Aussprüche oder Personen ganz erfindet:417 So wichtig ist ihm die anekdotischkonkretisierende Verschmelzung von exempla virtutis und exempla auctorum.
49. Die Funktion der im Policraticus-Prolog angesprochenen exempla maiorum (und zweifellos auch der imWerk selbst häufig verwendeten Geschichten) ist die exhortatio zur Nachahmung moralischer Vorbilder.Andere Exempla sind der dehortatio gewidmet, sollen abschrecken. Naturgemäß verwendet Johann auch denfür die pragmatische Geschichtsschreibung aller Zeiten grundlegenden Prologtopos von der „Nachfolge undMeidung“ guter bzw. böser Beispiele und von den entsprechenden (entweder diesseitigen oder jenseitigen)Folgen: Lohn bzw. Strafe.418 Mehrere Policraticus-Kapitel folgen gattungsmäßig den unter dem jeweilspositiven oder negativen Aspekt selbstständig gewordenen Memorabilienarten und Exemplaregistern wie denerwähnten „Philosophenleben“, den Herrscherkatalogen, De viris illustribus,
417 Vgl. unten §§ 58, 87 f., 98.418 Pol. Prol. 14.25–28, unten Anm. 431; vgl. auch § 3. Hist. Pont. Prol. 3 oben Anm. 367 zitiert. Im Unterschied zu denmeisten der hier zu besprechenden Stellen Johanns beruht die rein historiographische Variante des Topos auf derunmittelbaren Evidenz, d. h. Deutungsunbedürftigkeit der geschichtlichen Exempla (zu den poetischen vgl. unten § 49);z. B. schreibt Wilhelm von Malmesbury, Gesta reg. 2 prol. (RBS 90, I 103): Multis quidem litteris impende operam, sedaliis aliam […] iam vero ethicae partes medullitus rimatus […] quod per se studentibus pateat, et animos ad bene vivendumcomparat: historiam praecipue, quae iocunda quadam gestorum notitia mores condiens, ad bona sequenda vel malacavenda legentes exemplis irritat. – Das Begriffspaar exhortatio-dehoratio ist im übrigen stehender Bestandteil der in dergrammatischen Homoeosis-Lehre traditionellen Definition des paradigma (vgl. oben Anm. 145 f.; VITALE-BROVARONE98; KNAPP, Simil. 66 ff.; KREWITT 96 f., 167 f., 145) und dient häufig dem Thema der „Nutzanwendung“ in denAccessus ad auctores (vgl. von MOOS, Lucans tragedia 135 ff.). Zum suasiv-dissuasiven Doppelsinn aller Literatur undBildungsgüter nach mal. Auffassung vgl. Ph. DELHAYE, Grammatica (wie Anm. 386) 23 f.; ders., L’enseignement de laphilosophie morale au XIIe s., in: MSt 11 (1949) 77–99, hier 89; oben S. 67 f. unten §§ 78, 112, S. 184 ff., A. 912, 1192.Zum Topos der exempla sequenda/cavenda vgl. M. SCHULZ, Die Lehre von der historischen Methode bei denGeschichtsschreibern des Mittelalters, Berlin–Leipzig 1909, 68 f., 75 ff.; SIMON II 106 f. (aedificatio und cautela alsgemina utilitas); GUENÉE, Hist. et culture historique 26 f.; EHLERS, Hugo (wie Anm. 17) 72 f.; HANNING (wieAnm. 185) 46 ff.; HAHN (wie Anm. 11) 402 (doppelte Basis des pragmatischen Geschichtsbegriffs von Thukydides bisMontesquieu); REHERMANN 39 ff.; BRÜCKNER, Hist. 38 f. zu Luthers Vorwort zur Historia Galeatii Capellae: „DieHistorien sind nichts anders denn anzeigung gedechtnis und merckmal Göttlicher werck und urteil, wie er die welt,sonderlich die Menschen, erhelt, regiert, hindert, fördert, straffet und ehret nach dem ein jeglicher verdienet Böses oderGutes.“
177
Exitus illustrium virorum, De mortibus persecutorum, De tyrannis, De casibus illustrium virorum u.a.m.419
Zum Verhältnis zwischen vorbildlichen und abschreckenden Exempla ist folgende Äußerung über den richtigenGebrauch moralisch bedenklicher Dichtung aufschlußreich, da sie sich auf die Wertung aller literarischenExempla ausdehnen läßt:420 Die Dichter, sagt Johann, bieten philosophischen Stoff, indem sie die Lasterbezeichnen, nicht aber lehren (notant, non docent). Sie gehen durch die bösen Sitten hindurch, um der TugendRaum zu schaffen, so wie Odysseus durch allerlei Gefahren in die Heimat zurückgekehrt ist. Die Freunde, dieer auf seinen Irrfahrten verloren
419 Vgl. S. 140, 349, Anm. 262, 462, 696; BRÜCKNER, Hist. 102 ff. (leider erst) zur Barockzeit mit ihrer buntenTitelvielfalt von: Speculum tragicum, Theatrum crudelitatum, Magnatum ruinae, Theatrum historicum illustriumexemplorum, Theatrum Historico-Politicum, Bonorum atque Malorum Exempla historica. Zum Forschungsthema mal.Titelgebung s. unten S. 287, 488 f., 513, 562.420 Pol. VII 9, (II) 127.16–128.3: Poetas et varios scriptores artium aut rerum gestarum solus ille contemptibiles facit quinon veretur contempni. Nam et virtutis habent usum et philosophandi materiam praebent; notant enim, non docent vitia, etaut utilitatis causa grata sunt aut voluptatis. Sic autem per morum discrimina transeunt ut virtuti faciant locum. Nam pertela, per ignes, per maris varias procellas […] pertransiit […] ut ad patriam suam saltem in senectute Ulixes repedaret.Socios variis exilii amisit casibus […] Horum tamen omnium iocunda relatio est. Nam vel amici praevisus casus, etsiamarus sit, proficit ad cautelam, et quo familiarior fuit cum labente societas, eo casus quemque magis absterret. AlsEinleitung zur Ganymed-Geschichte führt Johann in Pol. I 4, (I) 21.13 ff. ähnlich aus: Athenienses et Lacedemonii […]historiarum gesta, naturae morumque mysteria variis figmentorum involucris obtexentes, sic tamen ut ex cautela malorumutilitatem inducerent, aut ex lepore poematis voluptatem. In beiden Fällen wird nicht zwischen „wahrer“ Geschichte undbloßer Mythologie unterschieden, sondern die dehortative utilitas ins Zentrum gerückt. Vgl. von MOOS, Poeta 100 f. undders., Lucans tragedia 135 ff., 171; F.P. KNAPP, Simil. 43 f. u. a. zu Met. 124, 54 und ders., Historische Wahrheit undpoetische Lüge. Die Gattungen weltlicher Epik und ihre theoret. Rechtfertigung im Hochmittelalter, in: DVJs 54 (1980)581–635, hier 591 ff. und unten § 88. Nach Abschluß dieser Darstellung erschienen zum Thema „Dichtung und (historische)Wahrheit“ der Kongreßbericht: Geschichtsbewußtsein in der deutschen Literatur des Mittelalters (Tübinger Colloquium1983), hrsg. von Chr. GERHARDT et al., Tübingen 1985 (s. insbesondere die Beiträge von H. WENZEL 162–4; A.EBENBAUER, 52 ff.) sowie W. HAUG, Literaturtheorie (wie Anm. 283) 222 ff. Der utilitas-Aspekt der dehortatioüberwiegt auch sonst in Johanns poetischen Exempla; vgl. etwa noch Pol. III 7, (I) 186.12 ff.: … ut est in fabulis (quoniamet mendacia poetarum serviunt veritati) Iuno Semelen decepta, in incendium impulisset… Ebd. V 10, (I) 329.25 zumHermaphrodit als Höflings-Symbol: Hac autem poetici nube figmenti nugarum curialium repraesentatur imago. – ZumThema Fiktion und historia vgl. neuerdings auch P. BAGNI, Grammatica e Retorica nella cultura medievale, in: Rhetorica2(1984) 267–280, bes. 271 ff.
178
hat, waren ihm exempla, nützliche Lehren zur Vorsicht. Diese Warnung aus dem Untergang der anderen wirdzu einem metaphorischen Beispiel für das Beispiel: „Exempla sind (für den moralischen Fortschritt) oftnützlicher als praecepta.“ Diese seit der Antike sprichwörtliche Theorie-Praxis-Antithese verbindet Johannunmittelbar mit der stoischen Idee der praemeditatio futurorum malorum:421 „Es ist nämlich desto leichter,Übel zu meiden, je gewissenhafter sie vorausbedacht worden sind.“ Zur Begründung führt er das bekannteSelbstzeugnis des Horaz an, der aus der konkreten Anschaulichkeit des homerischen Epos mehrphilosophischen Nutzen gezogen haben will als aus den abstrakten Lehrsätzen stoischer Philosophen.422
421 Pol. VII 9, (II) 128.3–5: Siquidem exemplis saepe magis proficitur quam praeceptis. Mala enim vitantur facilius quofidelius praecognita fuerint. Vgl. auch Pol. VI 18, (II) 56.28 ff.: Militaria quoque praecepta et exempla strenuorum saepereferenda sunt, ut his ad scientiam instruantur, illis accendantur et animentur ad virtutem. (Zur Fortsetzung der Stelle überden Vorzug von usus gegenüber ars s. unten Anm. 564). – Zu dem in Antike und Mittelalter ubiquitären Begriffspaarpraecepta-(verba)-exempla vgl. etwa die Musterstellen Sen., Ad Marc. II 1: scio a praeceptis incipere omnes qui monerealiquem volunt et in exemplis desinere; Sen. Ep. 6.5: longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla; Cic.Tusc. III 56–8; Suet. Aug. 89.2; Hier., Ep. 66.1; Greg. Moral. 25 (PL 77) 329 B–C; Dial. I (ebd.) 153 A etc.; vgl. auchThLL s. v. Exemplum 1335; s. auch A. 243, 214, 345, 395, 638, 877. ALEWELL 91 f.; GEBIEN 52 f.; KORNHARDT3 ff., 21, 59; GEERLINGS 175; PÉTRÉ 17 f.; von MOOS, Consolatio III §§ 1347 ff.; STUDER 115; WELTER 13 ff.; J.MAROUZEAU, La leçon par l’exemple, in: REL 14 (1936) 58–64; ebd. 26 (1948) 105–8; DÖRING 19; SIMON II 103 ff.;JAEGER (wie Anm. 240) 3 ff.; LANDFESTER 58; HEITMANN, Dichtung (wie Anm. 43) 272 f. – Zum praemeditatio-Gedanken vgl. von MOOS, Consolatio III §§ 1159 ff., IV 144 s. l.; vgl. auch oben Anm. 17–18, unten Anm. 1000.422 Pol. VII 9, (II) 128.7–24 (Fortsetzung der oben Anm. 420 zitierten Stelle): Consonat ei (Ciceroni) si liricum conticentelira dignaris audire, Flaccus – aut, si mavis, Oratius – qui plus honestatis et utilitatis se apud Meonidem invenissegratulatur quam plurium Stoicorum sit praeceptis expressum. Ait enim […] (es folgt Hor. Ep. 1.2. 1–4, 2–11, 15–16, 14).Met. I 22, 51 f.: Sentit hic (Seneca) quod discipline liberales virum bonum non faciunt; ego ei consentio [cf. Sen.Ep. 88.1–3 …] Deprimit artes, sed tamen a philosophia non reicit; neque enim soli philosophi boni viri sunt.‚Grammaticus, inquit, circa curam sermonis versatur; et ut longius evagatur, circa historias; ut longius procedat, circacarmina’. Hoc autem parum non est, sed plurimum prodest ad informationem virtutis, qui facit virum bonum. GloriaturHoratius se virtutis causa relegisse Homerum ‚qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,/pulchrius et meliusCrisippo et Cantore dicit’ [Hor. a. O., Cantore: Crantore]. Poetas philosophorum cunas esse celebre est. Dies ist einekritische Entgegnung auf Sen. Ep. 88.5 gegen die Überbewertung Homers als Philosophen im grammatikalisch-rhetorischenSchulbetrieb, wofür z. B. Quint. X 1.49–50, XII 11.21 zeugt.
179
Diese (vermeintlich renaissancehafte) Vorstellung von der „Geschichte als Beispielphilosophie“ läßt sich auchsonst im Mittelalter belegen: Homer gilt neben den beiden anderen Großepikern Vergil und Lucan als einHistoriker, weil er echte Exempla vor Augen führt, und ist deshalb den bloße sententiae von sich gebendenPhilosophen philosophisch überlegen; und die Seefahrt des Odysseus ist (lange vor Graciáns Criticon) in dermit dem Policraticus beginnenden Tradition der Hofkritik und politischen Moralistik ein Zentralsymbol fürdie Tücken und Illusionen des Hoflebens, d. h. für eine konkrete Gefahrenzone im Sinne praktischerKlugheitsethik, nicht nur für die allgemeine Launenhaftigkeit Fortunas oder für die unspezifischen miseriaedieser bösen Welt.423
423 „Geschichte als Beispielphilosophie“: Vgl. etwa die Übernahme der oben Anm. 422 angeführten Pol.-Stelle (VII 9) durchHeinrich von Huntingdon in den Prolog seiner Historia Anglorum (ed. ARNOLD, RBS 179, 1 f.). Weitere Belege zurpoetisch-historischen Beispielphilosophie bei von MOOS, Poeta 106, 121 ff.; B. SMALLEY, Sallust in the Middle Ages,in: Classical Influences on European Culture A.D. 500–1500, ed. R.R. BOLGAR, Cambridge 1971, 165–75, hier 166;PARTNER (wie Anm. 25) 19 ff.; CURTIUS, ELLM 213; SEIGEL (wie Anm. 394) 319 f.; GILMORE (wie Anm. 214)19 ff.; LACROIX 67 ff.; BRÜCKNER, Hist. 48 f. HEITMANN meint aus mir nicht einsichtigen Gründen (Dichtung [wieAnm. 43] 272 f.), es handele sich hier um einen ganz neuen Gedanken der frühen Neuzeit: „…von derartigen Theorien auswar es nur ein Schritt bis zu der Behauptung, die Dichter und die Historiker seien bessere und geschicktere Philosophen alsdiese selbst. – Ihn tat wieder als einer der ersten Lorenzo Valla.“ – Die sowohl durch die Odyssee wie durch die Aeneisrepräsentierte Vorstellung einer Reise durch Gefahren war bekanntlich eine der wichtigsten Inspirationsquellen für moralischeExempla, integumenta und Allegorien seit der Patristik; vgl. Hugo RAHNER, Griech. Mythen in christl. Deutung, (Zürich1957), Darmstadt 1966, 281 ff.; H. BLUMENBERG, Prozeß (wie Anm. 402) 122, 139 ff.; ders., Schiffbruch mitZuschauer, Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt a.M. 1979; OLSSON (wie Anm. 299) 36 f., 185 ff. (Bernh. Silv.,Chaucer, Gower); PADOAN (wie Anm. 264) 170 ff., 207 ff. (Dante); HORSTMANN (wie Anm. 203a) 11 ff. Johann hat dieDaseinsmetapher in der homerischen Form auch in Pol. VI 28 und III 10, in der seit Fulgentius aus Vergil entwickeltenForm in Pol. VIII 24 und VI 22 ausgeführt; dazu vgl. S. LERER, John of Salisbury’s Virgil, in: Vivarium 20 (1982)24–39; Fiorenzo FORTI, Magnanimitade. Studi su un tema Dantesco, Bologna 1977, 174 f.; DELHAYE, Enseignement(wie Anm. 418) 89 f.; F. BERTINI, Interpreti medievali di Virgilio: Fulgenzio e Bernardo Silvestre, in: Sandalion 6/7(1983/4) 151–164; Johann folgt dabei dem Aeneis-Kommentar des Bernhard Silvestris (ed. J.W., E.F. JONES,Lincoln/London 1977). Auch hier wird im Prolog der Sinn der Dichtung im Aufstellen doppelter exempla gesehen – Aeneasspornt zum Guten an, Dido schreckt vom Bösen ab –, und ebenfalls mit Horaz (A.P. 333; 343) wird der Epiker Vergil alsdichtender „Historiker“ gepriesen, der nicht nur wie die andern Dichter durch Lustspiele „erfreut“ oder durch Satiren„nützlich“ ist, sondern beides, delectatio und utilitas, vereint (2 f.): Poetarum quidam scribunt causa utilitatis ut satirici,quidam causa delectationis ut comedi, quidam causa utriusque ut historici. Im Zusammenhang der von Johann ausBernhard übernommenen Großallegorie (integumentum) der sechs Aeneisbücher für die sechs Lebensalter oderBewährungsetappen auf der Lebensreise des Menschen gilt Vergil durchweg als Philosoph: Bern. Silv. Comm. super VI lb.Eneidos (a. O.) 1, V. 6: in hoc opere poeta et philosophus perhibetur esse Virgilius; ebd. 3.9: scribit ergo in quantum estphilosophus humane vite naturam. Pol. VI 22, (II) 63: procedat tibi poeta Mantuanus qui suo imagine fabularum totiusphilosophiae exprimit veritatem. Ebd. VIII 24, (II) 415.14 ff.:… hoc ipsum divina prudentia in Eneide sua sub involucrofictitii commenti innuisse visus est Maro, dum sex etatum gradus sex librorum distinctionibus prudenter expressit. Quibusconditionis humanae, dum Odisseam imitatur ortum exprimere visus est et processum. Ebd. 417.15 ff. (zum Doppelweg adinferos oder ad arcem beatitudinis): Constat enim […] Maronem geminae doctrinae vires declarasse, dum vanitate figmentipoetici philosophicae virtutis involvit archana. Met. I 24, 55.7: Excute Virgilium et Lucanum et ibi cuiuscumquephilosophie professor sis, eiusdem invenies condituram. Zu dieser Stelle und zum traditionellen Dreigestirn der antikenGroßepiker Homer, Vergil, Lucan vgl. von MOOS, Lucans tragedia 128. – Zur Tradition der Hofkritik vgl. UHLIG 4 f., 9,mit Hinweis auf Graciáns Empfehlung, statt der an Höfen beliebten Cortegiano-Literatur oder Hofmanns-Anstandslehren(d. h. statt positiv suasiver Exemplarik) die viel nützlichere Odyssee über die Gefahren des Meeres als dissuasiveVeranschaulichung der Scheinhaftigkeit des Hofes zu lesen. Vgl. auch unten § 106 zu der Johann ebenfalls mit Graciánverbindenden hofkritischen Theatermetapher. (Der Hispanistik ist das Thema: Policraticus und Gracián dringend zuempfehlen.) Nicht mehr sehen konnte ich: William B. STANFORD, The Ulysses Theme: A Study in the Adaptability of aTraditional Hero, Oxford(2) 1963, repr. 1968.
180
Dem angeführten – in mancher Hinsicht literaturtheoretisch wichtigen Policraticus-Passus entnehmen wirauch die Einsicht, daß das Exemplum grundsätzlich – wie jedes andere schriftliche Zeugnis –auslegungsbedürftig ist. Das richtige Lesen und Verstehen von Exempla hängt, wie Johann betont, vom Standder literarischen Bildung ab. Während die multitudo imperita die Lasterdarstellung schaulustig beim Nennwertnimmt und gar noch imitieren will (wie jener Jüngling der Komödie, der von einem Gemälde mit JupitersSchwängerung der Danae durch Goldregen erotisch stimuliert wird), kann der Weise, der hermeneutischGeschulte, auch ohne Gebrauchsanweisung positive und negative, suasive und dissuasive Exemplaunterscheiden. Die Komödie als reines Vergnügen, die Satire als reine Sittenkritik bewegen ihn weniger als die„Geschichte“, die ästhetische delectatio und ethische utilitas, Sinnlichkeit und Rationalität vermittelt, dasselbständige Denken aktiviert und so „die höheren Seelenkräfte“ erfreut.424
424 Pol. VII 9, (II) 126.1 ff.: Poetas, historicos, oratores, mathematicos […] quis ambigit esse legendos […] Cum tamen inius suum vendicant animum, etsi pollicentur notitiam rerum, virtutis tamen dedocent et submovent cultum […] At illi[poetae…] quas inflammant cupiditates! Hi supra adulteriaque conciliant, varias doli reparant artes, furta rapinasincendia docent, quae sunt aut fuerunt, immo quae fingi possunt, malorum exempla proponunt oculis multitudinisimperitae. Quae incendia celi succensi aut maris inundatio aut terrae hiatus tantas fecit populorum strages quantas istifaciunt morum? Comicus qui prae ceteris placet in Eunucho refert adolescentis libidinem inflammatam, cum tabulampictura videret continentem quo pacto deus […] corruperit Danem. Similes in singulis picturas videt, miratur et laudatmultitudo. (Nach Ter. Eun. III 5.37; zur Fortsetzung dieser Stelle s. oben Anm. 422). Zu Johanns Bewertung der sinnlichenQualität von Exempla s. unten S. 196 ff. Zu dem seit der Patristik auch in geistlichem Zusammenhang beliebten Goldregen-Mythos vgl. Anm. 942 und P.G. VAN DER NAT, Zu den Voraussetzungen der christlich lateinischen Lit., in:Christianisme et formes litt. (wie Anm. 271), 191–234, hier 218 f. (u. a. Lact. Inst. I 11.17 ff.). Zu Komödie, Satire undHistorie im Rahmen der moral-psychologischen Gattungssystematik vgl. unten Anm. 771 (Macrob und Bernhard Silvestris).– Zum mal. System der korrespondierenden Hierarchien der Gesellschaft und der Seele im platonischen Sinn (sinnlicheErkenntnis der rustici, rationale des Adels, geistig-metaphysische des Klerus) vgl. Y. CONGAR, Les laïcs et l’ecclésiologiedes ordines chez les théologiens des XIe et XIIe s., in: I Laici nella Societas christiana dei sec. XI e XII, Mailand 1968,83–117 und unten § 103, Anm. 882, 923, 965.
181
Was die bildungsmäßigen Voraussetzungen der Rezipienten betrifft, hat das Exemplum grundsätzlich immerzwei konträre Funktionen, die sich jedoch nicht notwendig ausschließen, sondern – wie etwa im didaktisch-hermetischen Doppelsinn biblischer Gleichnisse – kombiniert auftreten können: Es kann einmal alsErzählung eine pädagogisch gemeinte induktive Hilfe für Ungebildete sein oder, zweitens, gerade durch dieAndeutung, die verkürzte Darbietung oder durch metaphorisch-allegorische Anspielungsformen alshistoriographisches „Kürzel“ nur der Bildungselite zugänglich sein und esoterisch wirken.425 Beide Funktionenwerden von Johann nicht nur selbstverständlich
425 Zum Verkündigungs- und Ausschlußcharakter der Gleichnisse Jesu vgl. Matth. 13.11 ff., 34 f.; Marc. 4. 10–12;Luc. 8.9–10. Die hochmittelalterliche integumentum-Theorie stützte sich ausdrücklich auf diese Grundlage. Vgl. Abaelard,Introd. ad Theol. I 20 (PL 178) 1023 A–B: veritas ipsa de integumento parabolarum suarum loquitur dicens: ‚Vobis datumest nosse mysterium […] regni Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non videant et audientes non intelligant’(Matth. 13.11). – Hilfe für Ungebildete: vgl. LAUSBERG § 416; WELTER 35, 68 ff., 73, 75, 77, 120 u. ö.; CRANEXLCI ff., XXXIX; KNAPP, Similitudo 80 ff.; BERLIOZ 116; GEBIEN 71, 83 ff.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 99 ff.;PÉTRÉ 19 f.; von MOOS, Consolatio I/III § 160, IV 150 s. l. Situation. – Andeutung für Gebildete: vgl. § 106, S. 63,373 f.; LAUSBERG § 845; P. MICHEL (wie Anm. 910) 534 ff. I. HADOT, Seneca und die griech.-röm. Tradition derSeelenleitung, Berlin 1969, 190 f.; H. DÖRRIE, Spätantike Symbolik u. Allegorese, in: FMSt 3 (1969) 1–12, 3 f.(orphische Arkantheorie); M. FUHRMANN, Obscuritas, Das Problem der Dunkelheit in der rhet. und literarästhet. Theorieder Antike, in: Poet. u. Herm. II, ‚Immanente Ästhetik…’, München 1966, 47–72; GEBIEN 71, 85 f. (Allegorisierunghistorischer Exempla aufgrund der evangel. Gleichnisse); G.G. MEERSSEMAN, In libris gentilium non studeant, L’étudedes classiques interdite aux clercs au m. â.?, in: IMU. 1 (1958) 1–14, hier 3 ff.; BLUMENBERG, Lesbarkeit (wie Anm. 25)51 ff. (Hugo von St. Viktor); Chr. MEIER, Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der Allegorie-Forschung, in: FMSt 10(1976) 1–69, hier 20 f.; dieselbe, Zwei Modelle von Allegorie im MA.: Das allegorische Verfahren Hildegards von Bingenund Alans von Lille, in: ‚Formen u. Funktionen der Allegorie’, ed. W. HAUG, Stuttgart 1979, 70–89, hier 82 f.; L.GOMPF, Figmenta poetarum…, in: Festschr. K. LANGOSCH, ‚Lit. u. Sprache im lat. MA’, Darmstadt 1973, 53–74, hier56 ff. – Gelegentlich wird eine quasi soziologische Aufteilung der sog. Schriftsinne hergestellt: sensus litteralis für dasungebildete Laienvolk und sensus allegoricus für die Bildungselite. Dies führt zu der vergröberungsanfälligen These,Exempla (sc. Predigtmärlein) seien „volkstümlich“ (oder didaktisch-trivial), Allegorien aber „gelehrt“ (oder subtil). Kritischdazu vgl. OLSSON (wie Anm. 299) 185 f.; BRÜCKNER, Kurzprosa (wie Anm. 164) 136. Selbst die meistzitierteBelegstelle aus einer anonymen Predigtlehre bei WELTER (77) betont die wesentlich dem Gleichnis Jesu entsprechendeVerbindung beider Formen: Secundum erit aliquam dulcem exponere allegoriam et aliquid iocundum enarrare exemplum uteruditos delectaret allegorie profunditas et simplices edificet exempli levitas et habeant utrique quod secum reportent.Belege aus der Ars praedicandi über die Verwendung von Allegorien in der Predigt (für das Volk) s. oben Anm. 287, 345,364, und die Kritik des Erasmus an diesem „mittelalterlichen“ Usus s. Anm. 912. Zur höheren Schwierigkeit und Würde dessensus litteralis in der Gestalt von exempla malorum s. S. 187 f. Die einseitige Trivialisierung des mal. Exemplumbegriffsim Sinne besagter „Volkstümlichkeit“ führt andererseits zu der Übertreibung, daß die Renaissance-Humanisten demExemplum neue Dignität verliehen hätten, indem sie es als eine dem vulgus unzugängliche, philosophische Wahrheit unterdem Schleier mythologischer Dichtung verstanden. (So KESSLER, Petrarca 45; vgl. oben § 8, unten § 111). In Wirklichkeitberuht gerade diese Theorie des integumentum/involucrum auf patristisch-mittelalterlicher Grundlage (vgl. Anm. 428) undhatte in den philosophischen Epen des 12. Jhs. ihre literarische Fruchtbarkeit längst bewiesen. Epochengeschichtlichbemerkenswert ist an dieser Stelle viel eher der neue Puritanismus der Humanisten gegenüber der ärgerniserregendenKonkretheit „böser Beispiele“ aus Geschichte und Mythologie, die nicht mehr immer allegorisch oder dissuasiv gedeutetwerden konnten, sondern oft unterdrückt werden mußten. (Vgl. ein Beispiel unten S. 539).
182
nebeneinander verwendet, sondern auch in verschiedenen Zusammenhängen explizit begründet. So schreibt ereinerseits:426 „Wie Palladius sagt, ist es ein Zeichen großer Klugheit, die Person, mit der wir zu tun haben,einschätzen zu können […] Anders muß man mit dem Gebildeten, anders
426 Met. III 10, 162: Est autem, ut ait Palladius [cf. Op. agricult. I 1], magna pars prudentie eius cum quo agitur estimarepersonam. Ergo et aliter cum erudito aliter agendum est cum eo quem rudem nosti; nam eruditus sillogisticis, rudisurgendus est rationibus inductivis. Vgl. auch Pol. IV 3, I 242 f.; s. auch § 50, S. 128, 199, 373 f., 542 f. u. a. zu Aristot.Top. VIII 14, 164 a 12–3, in der Boeth.-Übersetzung ed. MINIO-PALUELLO (Aristot. lat. V 1–3, 1969) 179.1–2:Exercitationem autem assignandum inductivarum quidem ad rudem, syllogisticarum autem ad eruditum. Es geht dabei mehrum die antike Frage der rhetorischen Adäquatheit als um eine soziale Differenzierung von Literaturarten, wie sie im späterenMittelalter zunimmt. Vgl. GEBIEN 84; REIFF (wie Anm. 173) 121 (zu mehr berufs- als standesspezifischen Exempla beiHieronymus); BATTAGLIA 454.
183
mit dem Ungebildeten umgehen; denn der Gebildete ist mit syllogistischen, der Ungebildete mit induktivenArgumenten zu überzeugen“. Andererseits sagt Johann im Entheticus:427 „Die Wahrheit liegt verdeckt unterden Gestalten vielfältiger Dinge. Denn allgemeines Gesetz verbietet, Heiliges zu profanieren. Darum haben dieAlten das Wahre zu eigentümlichen Formen verwoben, damit Wert und Glaubwürdigkeit übereinstimmen.Verborgenes nämlich gefällt; gemeinhin Bekanntes wird wertlos. Was einer sofort versteht, hält er fürnichtswürdig.“ Die elitäre Begründung bezieht sich hier (wie auch sonst oft) auf poetische Exempla im Sinneder integumentum-Theorie.428 In unserem
427 Enth. 189–194: Vera latent rerum variarum tecta figuris,/Nam sacra vulgari publica jura vetant./Haec ideo veterespropriis texere figuris,/Ut meritum possit conciliare fides./Abdita namque placent, vilescunt cognita vulgo,/Qui quod scirepotest, nullius esse putat. Vgl. auch unten Anm. 462 zu Ep. 112 und Anm. 738 zu Pol. VII 10.130 ff. – Die Entheticus-Stelle wird nach O. GRUPPE, Gesch. der klass. Mythologie und Religionsgeschichte während des MA’s, Leipzig 1921/repr.1965, 14 f. gelegentlich einseitig auf die Rezeption der alten Göttermythen bezogen. Auch wenn der Anlaß zu diesen Versendie „Heirat zwischen Merkur und Philologia“ im Sinne des Martianus Capella darstellt, so ist diese Vorstellung doch eineselbstverständliche metonymisch-dekorative Verkleidung, an der im 12. Jh. niemand mehr Anstoß nehmen konnte. Diesübersieht HORSTMANN (wie Anm. 203 a, 11), wenn er zu den angeführten Versen schreibt: Johann „erklärt die Tatsache,daß die antiken Dichter ihre Gedanken verhüllten, mit dem gesetzlichen Verbot, die heiligen Geheimnisse zu veröffentlichen,und der Erkenntnis, daß das Verborgene besonders anzieht.“ Der Grundgedanke ist hier vielmehr ästhetisch. Eine Zeit, dieden ‚trobar clus’ erfand, wird das verbreitete, keineswegs nur elitäre Bedürfnis gekannt haben, halb Verstandenes, Rätselhafteszu genießen. Die rhetorische Seite des Satzes abdita placent hebt der Aphorismus B. Graciáns (Handorakel und Kunst derWeltklugheit, übs. Arthur Schopenhauer, Universal-Bibl. Reclam 2771, Stuttgart 1954, Nr. 150, 75 f.) treffend und wohl imSinne Johanns hervor: „Man muß nie seinen Gegenstand als leicht oder gewöhnlich empfehlen, wodurch er mehr herabgesetztals erleichtert wird: nach dem Ungewöhnlichen haschen alle, weil es für den Geschmack wie für den Verstand anziehenderist.“428 Vgl. M.D. CHENU, Involucrum, Le mythe selon les théologiens médiévaux, in: AHDLMA 30 (1955, erschienen 1956)75–79; DRONKE, Fabula (wie unten Anm. 729) passim (mit ausführl. Bibliogr.); STOCK, Myth (wie Anm. 538) 11–26;Ed. JEAUNEAU, L’usage de la notion d’integumentum à travers les gloses de Guillaume de Conches (AHDLMA 24 [1957]35–100 =), in: ders., Lectio philosophorum, Recherches sur l’Ecole de Chartres, Amsterdam 1973, 125–192; H.BRINKMANN, Verhüllung (integumentum) als literar. Darstellungsform, in: Miscellanea Mediaevalia, Köln 8, Berlin 1971,314–339; ders., Mittelalterliche Hermeneutik, Tübingen 1980, 169 ff. und oben Anm. 423, 425, unten Anm. 728 f., 797,664, 913. Vgl. neuerdings auch Chr. HUBER, Höfischer Roman als Integumentum? Das Votum Thomasins von Zerklaere,in: ZfdA 115 (1986) 79–100 (mit Forschungsbericht).
184
Zusammenhang können die vielfältigen figurae oder Umsetzungsmittel vom Vergleich bis zur Allegorievernachlässigt werden; wichtig ist der moral-philosophisch-rhetorische Grundgedanke, daß dieBildungskompetenz und Verantwortung des Lesers letztlich darüber entscheiden, ob die ambivalentenExempla ad hoc suasiv oder dissuasiv zu nehmen sind, eine Lehre des Guten oder eine Warnung vor demBösen bedeuten, und daß beide Darstellungsmöglichkeiten, die anschaulich-offene sowie die subtil-verhüllteeinen je eigenen persuasiven Reiz enthalten.429 Von Interesse ist hier auch das Kapitel über dieTraumdeutung, die in Analogie zur Bibeldeutung dargelegt wird, insbesondere die Stelle über „die Wahrheit imGegensinn der Dinge“. Johann zeigt hier besonders klar die radikale Bedeutungsambivalenz gleicher Exempla,die im historischen Literalsinn eine Tugend, im allegorischen Sinn aber ein Laster
429 Vgl. LAUSBERG § 421; BATTAGLIA 470; PÉTRÉ 25, 75 ff. zur Ambivalenz der Exempla; vgl. §§ 78, 81, S. 366 ff.Gelegentlich im Verein mit der Allegorie, aber im wesentlichen unabhängig von ihr, bildet die hermeneutische Alternativevon suasiver und dissuasiver Lesart ein wichtiges Prinzip der interpretatio christiana für die Übernahme antiker Kultur; s.unten § 97, Anm. 431a. SPIEGEL (320 f.) hebt bemerkenswerterweise hervor, daß sich Geschichtsexempla des Mittelaltersvon denen Ciceros durch ihre betonte Mehrdeutigkeit und Interpretierbarkeit unterscheiden: Durch den bibelexegetischenUmgang mit der Heilsgeschichte entstand die Gewohnheit, auch moralische Exempla als Bedeutungsträger zuerst auszulegenund erst dann anzuwenden. Dies läßt viele der trivial scheinenden Prologformeln pragmatischer Historiographie vom Nutzender Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft auf den tieferen „essentially prophetic mode of analyzing history“zurückführen. Vgl. auch § 4, S. 91 ff. 517 ff. Ähnlich (wenn auch mit anderer Begründung) sieht KONSELLECK(Vergangene Zukunft 138 f.) in der auf Augustin zurückgehenden Geschichtsauffassung des Mittelalters neben derRelativierung aller „wirklichen“ geschichtlichen Ereignisse dieser falschen Welt auch den Gewinn einer den Römern nochunbekannten kritischen Souveränität und Interpretationsfreiheit in der Vergangenheitsbewertung (s. S. 85 zur christlichenUmwertung historischer Exempla des mos maiorum, § 108, A. 735, 982 zur Geschichtstheorie). Zu einem diametralentgegengesetzten Resultat gelangt BERLIOZ (113, 118) im Banne einer axiomatischen Texttheorie und durch ungebührlicheExtrapolation aus Beobachtungen zum spätmittelalterlichen Predigtmärlein, wenn er dem Exemplum aller Zeiten und Formen„Eindeutigkeit“ als Wesensmerkmal wie folgt zuschreibt: „…l’exemple n’est pas de la littérature. Il lui manque cette pluralitéde sens, cette entropie qui ne s’épuise que lentement, qui ferait de lui un texte ‚scriptible’ (Roland Barthes) ou une ‚oeuvreouverte’ (Umberto Eco).“ Demgegenüber vgl. auch unten §§ 74 ff. zur Ambivalenz und Kasuistik des rhetorischenExemplums.
185
repräsentieren: „Wer ist unter dem Gesichtspunkt historischer Tatsächlichkeit gerechter als Urias? Werliederlicher und grausamer als David, den Bathsebas Schönheit zu Mord und Ehebruch getrieben hat? Wohlan,all das ergibt gegenteiligen geistigen Sinn, da Urias den Teufel, David Christus, Bathseba die von Sündeentstellte Kirche darstellt.“ Die Tugend-Laster-Ambivalenz geht aber weit über den Dimensionswechselzwischen sensus litteralis und sensus spiritualis hinaus; Johann erklärt daraus im Prolog sogar denantithetischen Untertitel des Policraticus: „Das Buch enthält zum einen Teil die Nichtigkeiten der Höflinge,und zum andern Teil berührt es die Fußstapfen der Philosophen. Was im Einzelnen zu meiden, was zubefolgen ist, das überläßt es dem Gutdünken des Weisen.“ Johann will also nicht anhand illustrativer BeispieleLehren erteilen, sondern für sich selbst sprechende oder dem Verständigen evidente Tatbestände vorführenund für die Reflexion bereitstellen. Sein Leser soll mündig bleiben. Er hat das Recht zu lesen, was ihn angeht,und zugleich die Pflicht, zu seinem geistigen „Nutzen“ verantwortlich zu interpretieren. Ihn würde eine demeinfältigeren Leser vielleicht förderliche Eindeutigkeit nur langweilen oder abstoßen.430
430 Pol. II 16 (I) 94 ff., besonders 95.17 ff.: Interdum per antithesim rerum sequenda sunt veritatis vestigia, mit dem David-Beispiel (unten Anm. 636 zitiert). Die Arten der Traumdeutung beschreibt Johann hier und im vorangehenden Kapitel II 15nach Macrobs Comm. somn. Scip. I 3; vgl. dazu SCHEDLER (wie Anm. 616) 138 f. Zu der interessanten Übereinstimmungvon Traumdeutung und Bibelhermeneutik vgl. H. de LUBAC, Exégèse médievale, Les quatres sens de l’Ecriture I, Paris1959, 462; LERER (wie Anm. 423) 26 ff. – Pol. Prol. 14.25–8: Nugas pro parte continet curiales, et his magis insistitquibus urgetur magis. Pro parte autem versatur in vestigiis philosophorum; quid in singulis fugiendum sit aut sequendumrelinquens arbitrio sapientis. Johann versteht unter „Philosophen“ nicht unbedingt „Berufs-Philosophen“, da zahlreiche aufletztere bezügliche Exempla zur negativen, dissuasiven Kategorie gehören, sondern die in Prol. 16.9 (oben S. 161, untenA. 780) erwähnten verbo aut opere philosophantes. Antike Weise, die nur auf sich selbst (statt auf Gott) vertraut haben,entsprechen den ebenso zweideutigen Eroberer-Helden Alexander und Caesar (vgl. Pol. VII 2, [II] 94; VII 13, 146; VII 10,133). Auch sie sind doppeldeutig und je nach Kontext als Mahnung zur Tugendnachfolge oder als Warnung vorintellektueller Hybris aktualisierbar. Vgl. LIEBESCHÜTZ 75 ff., HUIZINGA (wie Anm. 31) 200 f.; unten S. 348 f. – ZurAmbivalenz der Exempla s. unten §§ 74, 78. Den zentralen Gedanken der Leserverantwortung für alle Rezeption (auch oft inder Form einer Verantwortungsdelegation vom Autor auf den Leser) hat Alastair J. MINNIS in der oben Anm. 377 erwähntenfür die Literaturtheorie des späteren MA’s grundlegenden Arbeit von 1984 (ich konnte sie hier leider nur noch marginal inden Anmerkungen berücksichtigen) anhand verschiedener Intentionserklärungen mal. Autoren nachgewiesen: vgl. besonders109, 198 zu Rodulfus Ardens und Jean de Meun (Rom 15.4 als Legitimation der Lasterdarstellung aus der Pflicht desLesers, alles „Geschriebene“ zu seiner „Belehrung“ aufzunehmen); 56, 103 ff., 113 ff. zu Autorenbiographien wie denen derAccessus als negativen Exempla (David, Ovid u. a.) in theoretisch scharfer Trennung von Werk und Leben sowie zu denAutoren als Fachexperten und Spezialkennern bestimmter Sachgebiete (auch verschiedener Sünden); 185 f. zu GowersConfessio amantis als Darstellung divergierender Liebesarten (keuscher und unkeuscher) an suasiven und dissuasivenBeispielen wie Salomo, Ovid u. a. Vgl. §§ 56, 87 zum Autorbegriff, S. 371 ff. zu Rom. 15.4, § 66, S. 275 zur kasuistisch-hermeneutischen difficultas.
186
Mehrdeutigkeit, Schwierigkeit, kunstvoll errichtete Dunkelheit, subtile Unklarheit sind hohe Wertbegriffeantiker Literaturästhetik, die dem Mittelalter zweifellos noch vertrauter waren als dem auf Volks- undAllgemeinbildung bedachten 19. Jahrhundert, dem wir die meisten unserer etablierten literarischenWertbegriffe verdanken. Es fällt darum schwer, die besondere Arbeits-Lust, die Freude an der Anstrengungvorzustellen, die mittelalterlichen Lesern eine enucleatio, elucidatio, expositio, oder wie immer der Akt desLesens, die Beschäftigung mit Texten hieß, erregt haben muß, wenn sogar eine keineswegs zu den Vertreterngelehrter Literatur zählende „Geschichtenerzählerin“ wie Marie de France ihren volkssprachlichen ‚Lais‘ einLob der Schwierigkeit vorausschickt und dabei einen Hauptzweck literarischer Produktion (mit Priszian)gewissermaßen in den Stolpersteinen für nachkommende Rezipienten sieht, die durch auslegungswürdige„Dunkelheiten“ zu intensivem – die Laster fernhaltendem – Literaturstudium, zur wünschenswertenVermehrung der Interpretationen im Rahmen eines allgemeinen Bildungsfortschritts durch die Zeitenangeregt werden.431
431 Les ‚Lais’ de Marie de France, ed. J. RYCHNER, Paris 1977, Prolog v. 9–22: „Custume fu as ancïens,/Ceo testimoinePrecïens,/Es livres ke jadis feseient,/Assez oscurement diseient/Pur ceus ki a venir esteient/E ki aprendre les deveient,/K’ipeüsset gloser la lettre/E de lur sen le surplus mettre./Li philesophe le saveient,/Par eus meismes entendeient,/cum plustrespasserunt le tens,/Plus serreient sutil de sens,/E plus se savreient garder/De ceo k’i ert a trespasser.“ Die endloseForschungsdiskussion über die Frage, ob diese Stelle als Kontrast oder als Parallele zu dem eigenen Vorhaben Maries,anstelle lateinischer Stoffe die „matière de Bretagne“ in Verse zu bringen, gelten soll, berührt meinen Aspekt, die positiveWertung der „Dunkelheit“ nicht. Vgl. G.S. BURGESS, Marie de France: An Analytical Bibliography, London 1977; zuletzterschien: J.-G. DELCLOS, Encore le prologue des lais de Marie de France, in: MA 23 (1984) 223–32 (dessenTextemendationsvorschlag: trespasserunt ich oben übernommen habe). Zur Priszianglosse vgl. A. 538, 541, 755 (imZusammenhang mit dem nani-gigantes-Gleichnis). – Zur Hochschätzung der Mehrdeutigkeit und Dunkelheit (difficiltas,obscuritas) seit der Antike vgl. DÖRRIE, Ambivalenz (wie Anm. 709) 85 ff.; Christel MEIER, Die Rezeption desAnticlaudianus Alans von Lille in Textkommentierung und Illustration, in: dieselbe und U. RUBERG, Text und Bild,Wiesbaden 1980, 408–549, hier 410 f. (Wilhelms von Auvergne Lob der erhöhten Schwierigkeit der Anticlaudian-Dichtungdank der drei „Sinne“: moralis, historialis, allegoricus) sowie unten S. 366 ff., 456 f.
187
Das Wertkriterium der Schwierigkeit, des Widerstands der Texte gegen leichtes Verstehen, läßt sich nun aufdie beiden zur Wahl gestellten Möglichkeiten des suasiven und des dissuasiven Beispiels selbst anwenden. Dieangeführten Stellen über den Untergang der Begleiter des Odysseus oder über den Goldregen in Danaes Schoßzeigen, welche mythologischen Gegenstände Johann als die hermeneutisch anspruchsvolleren,anstrengenderen und darum nobleren ansieht: die Gefahren, Versuchungen und Laster der poetischen Helden.Man darf, gestützt auf seine theoretischen Aussagen über die Kunst, Exempla des Bösen per antithesim zulesen, auch folgern, daß er allgemein die Fähigkeit, aus dem Negativen, aus ethischen Kontrasten zu lernen,als hervorragendes Bildungsprivileg über die direkte Modellnachahmung gestellt, daß er kritisch-distanzierteAuslegung höher geschätzt hat als gewöhnliche Identifikation mit literarischen Objekten, kurz: daß er dasInterpretieren dem „Sehen“ der Beispiele und Bilder vorgezogen hat. Dies sollte nicht einseitig mit derbekannten allegorisierend-hermetischen Mythenrezeption im Mittelalter verknüpft werden. Johann steht ineiner Tradition, die das Überwintern heidnischer, profaner, obszöner Gehalte im Christentum wohlnachhaltiger begünstigt hat als aller Allegorismus und Symbolismus; er benützt ein von der Schule her allenlitterati geläufiges, auf sämtliche kulturellen Gebiete – neben der Mythologie insbesondere auf dieGeschichtsschreibung – anwendbares Hauptprinzip mittelalterlicher Ästhetik und Hermeneutik: Er benütztden locus a contrario, der, in moralischer Intention auf den Literalsinn des Bösen gerichtet, vor keinerAbscheulichkeit, keiner Gotteslästerlichkeit und keiner Häßlichkeit oder Groteske versagt und derart vieleTabuisierungen jüngeren Datums noch erübrigt. Die Gefährlichkeit der exempla malorum für lüsterne undstümperhafte Interpreten, d. h. für moralisch und intellektuell „Ungebildete“ hebt Johann zwar hervor; abernicht um diese imperiti davor zu warnen – mit ihnen redet er nicht –, sondern um den „Weisen“ die ebenso„nützliche“ wie reizvolle Methode schmackhaft zu machen. Der heimkehrende Odysseus, der sich den Sirenenund anderem gefährlichen Sinnentrug aussetzte, ohne Schiffbruch zu erleiden, ist das positive Kern-exemplumfür den klugen Umgang mit allen Sorten des negativen Beispiels. Der Gedanke von der Überlegenheitdissuasiver über suasive Exempla wurde in der Renaissance (immer noch) gepriesen, am geistreichstenvielleicht durch Montaigne: „Ich lerne besser aus dem Gegenbild als aus dem Vorbild, durch Flucht als durchNachfolge. Diese Art der Bildung meinte Cato, als er sagte, daß die Weisen mehr von den Narren lernenkönnen als die Narren von den Weisen.“431a
431a Interpretieren und „Sehen“: vgl. S. 180 f., 199, 530 f. (picturas miratur multitudo). Zum grundlegenden Unterschiedzwischen den beiden auf „Schwierigkeit“ angelegten literarischen Verfahren der allegorischen Hermetik und der rhetorischen(d. h. suasiv/dissuasiven) Ambivalenz vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 103 ff.; unten §§ 66, 97. – Zur Bedeutungbeider Methoden, vor allem jedoch der Kontrastexemplarik (per antithesim) für das Fortleben „profaner“ Informationen vgl.BLUMENBERG, Wirklichkeitsbegriff (wie Anm. 266) 20 f.: „Die Liberalität der Mythologie überlebte nur in denÜbungsstücken der Rhetorik. Aber das war wegen der über die Schulen möglichen Wirksamkeit kein hoffnungsloses Reduit“– Auf „grausige und ekelhafte Motive“, auf die ungeschönte Darstellung von Greueltaten und tragischen Absurditäten in dermittelalterlichen Historiographie habe ich hingewiesen in: Lucans tragedia, bes. 135 ff. (zur dissuasiven Sinngebung),167 ff. zum Policraticus (s. allgemein auch 174 ff.) – Montaigne, Essai III 8, (wie Anm. 192) 899 f.: „[je] m’instruis mieuxpar contrarieté que par exemple, et par fuite que par suite. A cette sorte de discipline regardoit le vieux Caton quand il dictque les sages ont plus a apprendre des fols que les fols des sages.“ (cf. Plutarch, Vita Catonis Cens. I) Dies führt auchPERELMAN 125 als Musterbeispiel für „modèle“ und „antimodéle“ an.
188
2. Argumentationstheoretischer Ausbau: Das historische Exemplum als Beweismittel und Denkbild inliterarischen Gebrauchs- und Vorratsfunktionen
Nichil autem universale est, nisi quod in singilaribus inventur
Met. II 20, 101.15–6.
a) Die philosophisch-rhetorische Induktionsmethode
Kommentar einer theoretischen Hauptstelle Johanns zum Exemplum aufgrund antiker Induktionslehren: der logische und derrhetorische Schluß vom Einzelnen (über Allgemeines) auf Einzelnes (§ 50); Sokrates als Meister des Beispiels beiAristoteles, Cicero und Quintilian (§ 51); Johanns umfassendes Rhetorikverständnis schließt den dialektischstringenten undden persuasiv-sokratischen Induktionsschluß ein (§ 52), steht jedoch dem affektstimulierenden „Schau“-Beispiel sinnlicherEindeutigkeit fern (§ 53); zwei Haupterfordernisse der aristotelischen Induktion: sachliche Adäquatheit und evidenzerzeugendeBekanntheit der Beispiele werden im allgemeinen Sinn literarischer Bildungsideale verstanden (§ 54). – DerBeglaubigungswert der notiores historiae illustriert an klimaxbildenden Exempla-Reihen (§ 55). Die Schutzfunktion derExempla als entsubjektivierende auctoritates (§ 56).
50. Weit wichtiger und häufiger als die moralischen Exempla, von denen bisher hauptsächlich die Rede war,sind im Policraticus die argumentativen, als Beleg, Beweismittel, Zeugnis oder Präzedenzfall verwertetenBeispiele.432 Johann widmet ihnen eine theoretische Darstellung im Metalogicon. Im Zusammenhang mit derStreitdialektik konfrontiert er hier aufgrund des 8. Buches der aristotelischen Topik das Enthymem alsKurzform des Syllogismus und das Exemplum als Kurzform des Induktionsbeweises und fährt so fort:433
432 Zur fließenden Grenze zwischen diesen beiden Arten vgl. jedoch oben Anm. 164.433 Met. III 10.153 ff., bes. 156.20 ff.: vis artis in argumentationibus viget. In ipsis quoque sillogismis violentior est, siveintegritate sui perfectus sit, sive media propositione subtracta ad modum enthimematis conclusionem acceleret. Inductiovero lenior est, sive maturiori incessu a pluribus progrediatur ad unum universale aut particulare, sive acriori impetu abuno, ad exempli formam, inducto, ad unum inferendo prosiliat. Hic autem modus magis oratoribus congruit; interdumtamen ornatus aut explicationis causa conducit et dialectico; magis enim persuasorius est quam urgens. Unde sicut MarcusTullius in Rethoricis testis est, Socrates hoc argumentandi genere sepissime utebatur. Ceterum cum exempla ad probandumquid aut plura feruntur aut singula, convenientia esse debent et ex quibus scimus; qualia Homerus, non qualia Cherillus.Si autem ab auctoribus transumantur, Homero quidem Grecus, Latinus autem Vergilio utatur et Lucano, domestica namqueexempla magis movent, et ignota dubiorum non faciunt fidem. – Zur Parallelisierung von ausführlicher und verkürzterArgumentationsform: Syllogismus und Enthymem einerseits, Induktion und Exemplum andererseits nach Aristot., Top. VIII1–2, 155a–157a; Rhet. II 20, 1393a; I 2, 1356a (vgl. S. 51, Anm. 555, 857), aber direkt aus Boeth. In Topica Ciceronis(PL 64) 1050 und der Boeth.-Übersetzung von Arist. Top. VIII 1–2, 155b, 156b, 157a (Aristot. latinus, ed. L. MINIO-PALUELLO V 1–3, 156–60) sowie Anal. pr. II 24, 68b–69a (ebd. III 1–4, 134 f.) vgl. ROLLINSON 150 ff.; BENOIT190 f. u. ö.; LAUSBERG §§ 357, 419; W.A. de PATER, Les topiques d’Aristote et la dialectique platonicienne, (Thomist.Stud. 10), Fribourg 1965, 197 f.; J. SPRUTE, Topos und Enthymem in der aristotelischen Rhetorik, in: Hermes 103 (1975)68–90, bes. 74 ff.; GEBIEN 28 f.; COENEN 7 ff. – Zu media propositione subtracta s. unten Anm. 435. – Zu maturioriincessu … sive acriori impetu s. S. 197 f. – Zu magis oratoribus s. unten Anm. 437. – Zu Sokrates s. § 51. – covenientia:S. 192 f. – ex quibus scimus: S. 201. Die Übersetzung dieser Stelle entspricht derjenigen von D. McGARRY (TheMetalogicon of John of S., 1971) 193: „they should be relevant, and drawn from things with which we are well acquainted,“da sie sich nach der zugrundeliegenden Quelle: Arist. Top. VIII 1, 157a, 15 richtet. Daraus stammen auch die BeispieleHomer und Choirilos von Samos. In der Boethius-Übersetzung (a.a.O. 160.13–15): Ad explanationem autem exempla etparabolas ferendum, exempla autem convenientia et ex quibus scimus qualia Homerus, non qualia Chaerillus; sic enimplanius erit quod proponitur. Wahrscheinlich schwebte Johann zugleich die berühmte Horaz-Stelle A.P. 357 vor, die dentrotz gelungener einzelner Verse stümperhaften Dichter dem stets „guten, manchmal schlafenden“ Homer (wohl geradeaufgrund dieser Aristoteles-Stelle) entgegensetzt. McGARRYS Übersetzung: „They should be the sort (of examples) thatHomer uses, and not the kind that Choerillus gives“ entspricht wiederum genau dem Sinn der aristotelischen Vorlage.Dennoch dürfte Johann sich von den Dichternamen zu der anschließenden Identifikation von nützlichen Exempla mitberühmten Muster-auctores wie Homer, Vergil und Lucan inspiriert haben lassen, so daß Homer – unter dem Aspekt derBekanntheit – auch den Gegensatz zu dem obskuren und bedeutungslosen Cherillus darstellt. ‚Choerilus’ dürfte im übrigen(neben Ennius oder Mevius) einen festen Ort im Literaturunterricht des Mittelalters als Chiffre für einen unbegabten und
189
Der Induktionsschluß schreitet entweder gemächlich von mehreren Voraussetzungen her zu einer einzigenallgemeinen oder partikulären Sache vor oder erreicht diese unverzüglich durch einen Sprung von einer alsExemplum eingeführten Begebenheit aus. Diese Methode eignet sich eher für Redner, doch auch der Dialektikerkann sie gelegentlich zur Ausschmückung und Erläuterung gebrauchen; denn sie gehört mehr zur Überredungskunstals zur zwingenden Logik. Laut Ciceros Rhetorik hat darum Sokrates diese Argumentationsart überaus häufigverwendet. Doch wenn nun Exempla zu Beweiszwecken vorgebracht werden, müssen sie relevant, sachdienlich seinund aus vertrautem, evidentem Zusammenhang kommen – wie bei Homer, nicht wie bei Choerillus. WerdenExempla aus den auctores übernommen, so sollte ein Grieche Homer, ein Lateiner aber Vergil und Lucan benützen.Heimische Beispiele sind nämlich wirkungsvoller, ungeläufige aber machen Zweifelhaftes nicht gewiß (haben keineBeweiskraft).“
Zu der im einzelnen nicht ganz durchsichtigen Quellenlage ist zunächst anzumerken, daß diese für uns zentraleStelle insgesamt eine Aristoteles-Erklärung mit stark ciceronischem Einschlag bietet. Es geht um das auchheute noch diskutierte Problem des aristotelischen Induktionsbegriffs: Im Unterschied zur reinen Induktionals Aufstieg vom Einzelnen zum Allgemeinen, von erschöpfend
obskuren Dichter gehabt haben; vgl. MEIER, Rezeption des Anticlaudianus (wie Anm. 431) 426 f. In die Galerie derobskuren Autoren gehören auch die unten Anm. 537 aufgezählten Coriscus, Brisso und Melissus.
190
untersuchten gleichartigen Fällen zur universalen Regel, wie sie Aristoteles in der Topik, Analytik undNikomachischen Ethik versteht, stellt seine Rhetorik die epagoge als Deutung des Einzelfalls durchseinesgleichen vor. In der Forschung gilt dies entweder als Inkonsequenz434 oder wird in Analogie zumEnthymem-Verfahren erklärt, wonach das Beispiel den Sonderfall eines verkürzten „Schlusses vom Einzelnenauf Einzelnes“ darstellt unter der stillen Voraussetzung eines vollständigen Schlusses „vom Einzelnen zumGanzen und zurück zum Einzelnen“. Dabei spielt der Gedanke einer repräsentativen Auswahl aus Einzelfällenals „paradigmatisches“, aber nur implizites Allgemeines (tertium comparationis, medietas) mit.435 Johannstellt beide Induktionsarten, die eigentliche oder logische, aus der ausführlichen Aufzählung ähnlicher Fällehervorgehende, und die verkürzte oder
434 Vgl. ZOEPFFEL 17 ff., 22.435 BENOIT 184 ff. (mit weiterführender Bibliogr.); vgl. auch THROM (wie Anm. 545) 28 ff.; GEBIEN 28 f. –Hauptstellen: Top. VIII 1.1.156b–157a; Rhet. I 2, II 20, 1356b, 1357a–b, 1393a (s. oben Anm. 9). Anal. pr. II 24, 68b,69a; vgl. letzteres in der Boethius-Übersetzung (wie Anm. 433) 134–22 ff.: Exemplum autem est quando medio extremuminesse ostenditur per id quod est simile tertio. Oportet autem et medium tertio et primum simili evidentius inesse. Ut sit A‚malum’, B autem ‚contra confines inferre bellum’, in quo autem C ‚Athenienses contra Thebanos’, in quo vero D‚Thebanos contra Phocenses’. Si ergo volumus ostendere quoniam Thebanis pugnare malum est, sumendum quoniam contraconfines pugnare malum. Huius autem fides ex similibus, ut quoniam Thebanis contra Phocenses. Quoniam ergo contraconfines malum, contra Thebanos autem contra confines est, manifestum quoniam contra Thebanos pugnare malum.Quoniam ergo B C et D inest, manifestum (utrumque enim est contra confines inferre bellum), et quoniam A D (Thebanisenim non fuit utile contra Phocenses bellum); quoniam autem A inest B per D ostendetur. Eodem autem modo et si perplura similia fides fiat medii ad extremum. Manifestum igitur quoniam exemplum est neque ut pars ad totum neque ut totumad partem, sed ut pars ad partem, quando ambo quidem insunt sub eodem, evidens autem alterum. Et differt inductionequoniam haec quidem ex omnibus individuis extremum ostendebat inesse medio et ad extremum non copulabat syllogismum,hoc autem et copulat et non ex omnibus ostendit. – Vgl. auch Cassiod. Inst. 3 (PL 70) 1180 D: exemplum quoque inductionisimili ratione et copulatur et ab ea discedit; est enim exemplum quod per particulare propositum particulare quoddamcontendit ostendere, hoc modo: oportet a Tullio consule necari Catilinam, cum a Scipione Gracchus fuerit interemptus. – Inder lexikographischen Literatur des MA’s findet sich im Catholicon des Johannes Balbi (13. Jh., ed. Mainz 1460/repr. 1971)s. v. exemplum folgende Kurzfassung der Analytica priora-Stelle: Item exemplum est quedam species argumentationis etsecundum hoc exemplum est quando fit processus ab uno particulari ad aliud, ut Athenienses pugnare contra Thebanos estmalum, ergo Thebanos contra Focenes est malum. (LE GOFF, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 30 betont dieBedeutung der Stelle für das „Predigtmärlein“, ohne deren aristotelische Herkunft und logische Funktion zu erwähnen.) Zurzentralen Stellung des tertium oder der medietas in der Topik des Boethius vgl. E. STUMP, Boethius’ Theory of Topics andits Place in Early Scholastic Logic, in: Atti: Congresso internaz. di Studi Boeziani, Ed. L. OBERTELLO, Rom 1981,149–62, hier 250 ff.; OTTE (wie Anm. 281) 18 ff.
191
rhetorische, auf dem Vergleich eines bekannten mit einem weniger bekannten Einzelfall beruhende, als zweiMöglichkeiten selbstverständlich nebeneinander, wie dies in der nach-aristotelischen Rhetorik immer wiedergeschieht.436 Nach Cicero ist der Vergleich des Einzelnen mit Einzelnem eher für Redner und Philosophengeeignet als für Juristen, d. h. mehr für die Volks- und Staatsrede sowie die dialogische Seelenführung als für dieGerichtsrede. Ob Johann diese Cicero-Stelle vorschwebte, ist ungewiß. (Er hätte in diesem Fall die „Juristen“durch „Dialektiker“ ersetzt.) Jedenfalls hat er den zugrundeliegenden Gedanken betont: die mehr persuasive,psychagogisch
436 Jos. MARTIN (Ant. Rhet. 119) sieht das Exemplum entweder als eigentliche Induktion durch Aufzählung vieler ähnlicherFälle oder als eine Gegenüberstellung zweier zum gleichen Genos gehöriger Dinge, wovon das eine verständlicher ist als dasandere (nach Anaximenes-Ps. Arist., Rhet. 8.1, 1429a). ROLLINSON 151 verweist auf spätere Rhetoriker (z. B. Longinus-Epitome, SPENGEL I 321.23–322.9) zur Verbreitung der Definition des Exemplums als Vergleich eines bekannten miteinem noch unbekannten Einzelfall. Vgl. auch COENEN 8 f. zu Arist. Rhet. I 2, 1356b über die Terminologie „Induktion“und „Beispiel“ für den dialektischen bzw. rhetorischen Beweis durch Vergleich gleichgelagerter Fälle sowie unten Anm. 555.– Die Nebeneinanderstellung von reiner Induktion (= a pluribus ad unum universale) und rhetorischer Beispielinduktion (=ab uno ad unum) dürfte aufgrund von Cic. Top. X 41–43 zur similitudo (inductio ex pluribus […]; collatio: una res uni […]comparatur) in die Metalogicon-Stelle gelangt sein (s. auch nächste Anm.).
192
Zustimmung bewirkende als zwingend beweisende Funktion des Exemplums (magis persuasorius quamurgens, … magis movent).437
51. Sokrates, auf den er sich mit der Autorität Ciceros ausdrücklich beruft, bestätigt die spezifischpädagogische Eignung der Beispiel-Induktion. Gerade dieses größte Vorbild antiker Seelenführung undethischer Überzeugungskunst zeigt die Wertambivalenz des unter seinem Namen „philosophisch“ geadeltenBeweismittels, das, aristotelisch gesehen, doch auf einer offenbar intellektuell tieferen Stufe steht, der einer„rednerischen Persuasion“, nicht einer „logischen Notwendigkeit“. Was die antike Tradition dieserAmbivalenz betrifft, ist der Unterschied zwischen Aristoteles, Cicero und Quintilian aufschlußreich:Aristoteles erinnert an Sokrates eher beiläufig im Rahmen seiner rhetorischen Lehre vom Paradeigma, bzw.von den Arten des vergleichenden Beweises, einzig als an einen Meister der Gleichnisrede, jenes – wie dasBeispiel der Steuermanns-Wahl durch das Los zeigt – nicht historisch-tatsächlichen, sondern konjekturell-hypothetischen Vergleichs aus dem Bereich des menschlichen Lebens.438 Wesentlich wichtiger ist Sokratesfür die Beispiel-Theorie Ciceros. In De inventione wird er unter dem Gesichtspunkt des spezifischrhetorischen Induktionsbeweises gelobt. Dieser persuasive Analogieschluß (einfach inductio genannt) steht imGegensatz zur deduktiven, syllogistischen, stringenten ratiocinatio und bedeutet die sog. Hebammenkunst oderratio rogandi, ein aus einer Reihe von Fragen bestehendes dialogisches Verfahren, bei dem der Befragte auszuvor gegebenen Antworten als letzte Antwort die Schlußfolgerung selbst ziehen muß.439 In der ‚Topik‘reduziert Cicero die sokratische Methode auf eine Häufung von Parallelen oder collationes im Rahmen des„locus vom Vergleich“ (similitudo als Topos), ähnlich, wie sie Aristoteles auf die Gleichnisrede (parabole) imRahmen
437 Die Kompetenzfrage: magis oratoribus, interdum tamen […] dialectico erinnert ebenfalls stark an Cic. Top. X 41:similitudo patet […] oratoribus et philosophis magis quam vobis (d. h. den Juristen).438 Siehe oben Anm. 126 (zu Rhet. II 20, 1393b: Gleichnis von der Ämterzuteilung durch das Los).439 Cic. Inv. I 31.52–3: Omnis igitur argumentatio aut per inductionem tractanda est aut per ratiocinationem. Inductio estoratio quae rebus non dubiis captat assensiones eius quicum instituta est. [Illustriert wird dies an Aspasias „Kreuzverhör“mit Xenophon und dessen Gattin über die beste Ehe; …] Hoc modo sermonis plurimum Socrates usus est propterea quodnihil ipse afferre ad persuadendum volebat, sed ex eo quod sibi ille dederat quicum disputabat, aliquid conficere malebat,quod ille ex eo quod iam concessisset necessario approbare deberet. Zur Mäeutik s. unten Anm. 441 (Quint.). Zumsokratisch-platonischen Dialog s. auch unten S. 249 ff., 266 ff., 287 ff., 402, 534 f.
193
der Paradeigma-Arten bezogen hatte.440 Quintilian harmonisiert diese Vorstellungen in seinerVergleichsarten-Lehre so, daß er einerseits von Aristoteles den Aspekt der Analogie als „Sokratesmerkmal“übernimmt und auf alle Arten der similitudo (Paradeigma im weiten Sinn), ausdehnt – Sokrates wird ihm alsoder Meister des argumentativen Vergleichs schlechthin – und andererseits im Anschluß an Cicero dieUnterscheidung zwischen logischer ratiocinatio und rhetorischer inductio als Kunst des gezielten Fragensbeifügt. Dabei vertieft und erweitert er den Begriff des induktiv-interrogativen „Heranführens“, indem er ihnvon der Bindung an den Dialog befreit und als Beweismittel der Rede überhaupt (etwa in Form hypothetischerAnnahmen oder „rhetorischer Fragen“), somit auch als Rahmenbegriff für das historische Exemplumeinführt.441
52. Johann ist zweifellos direkt oder indirekt von der gesamten hier skizzierten Tradition abhängig. Auchwenn im Metalogicon eines seiner Hauptziele die Empfehlung des wiederentdeckten gesamten Organon(insbesondere der ‚Topik‘) des Aristoteles ist, beruft er sich doch explizit auf die Aristoteles-Verehrer Ciceround Quintilian.442 Im besonderen Zusammenhang eines Kapitels
440 Vgl. oben Anm. 436 f. und Cic. Top. 10.42: Sunt enim similitudines quae ex pluribus collationibus perveniunt quovolunt hoc modo […] Haec […] appellatur inductio, quae Graece ® p a g v g Ó nominatur qua plurimum est usus insermonibus Socrates.441 Quint. V 11.2–3: … [Cicero] omnem argumentationem dividit in duas partes, inductionem et ratiocinationem […] Namille, qua plurimum est Socrates usus hanc habuit viam <ut> cum plura interrogasset, quae fateri adversario necesse esset,novissime id, de quo quaerebatur, inferret ut simile concessis. Id est inductio. Hoc in oratione fieri non potest, sed quodillic interrogatur, hic fere sumitur. Vgl. McCALL 190; oben Anm. 126.442 Met. III 10, 154 f. unten in Anm. 544 zu Cicero und Quintilian. – Johanns unbestrittene Bedeutung für die Vermittlung,Verbreitung und Diskussion der logica nova des Aristoteles (Analytik, Topik, Elenchik) läßt sich im einzelnen noch nichtendgültig abschätzen, nachdem der kritische Herausgeber des Aristoteles latinus, Lorenzo MINIO-PALUELLO, frühereÜbertreibungen (die in WEBBS Anmerkungen zur Met.-Ausgabe eingegangen sind) relativiert hat. Kein Autor der Antike hatJohann wohl im eigentlichen Sinn philologisch so stark beschäftigt wie Aristoteles. Von der vor dem 12. Jahrhundertunbenützbar gewordenen Analytica posteriora hat er zwei neue Direktübertragungen aus dem Griechischen, diejenige vonJacob von Venedig und eine anonyme (allenfalls einem Johannes zugeschriebene), beide aus der Mitte des 12. Jhs.,miteinander verglichen. Vgl. L. MINIO-PALUELLO, Opuscula, The Latin Aristotle, Amsterdam 1972, 215 ff., 440, 570 ff.und, diese Resultate referierend, KERNER 78 ff. und HUNT, Aristotle (wie Anm. 544a) 96 ff.; nicht gesehen habe ich: R.PALACZ, Bezposrednia recepcja arystotelizmu w Metalogiconie Jana z Salisbury (La réception immédiate de l’aristotélismedans le Metalogicon de Jean de S.), in: Studia Mediewistyczne 5, Warschau (1964) 191–251. E. JEAUNEAU, in: The Worldof John of S. 103 ff. äußert die plausible Hypothese, Johann habe Johannes Sarracenus zu der zweiten Übersetzung angeregt,wie er denselben Übersetzer später vielleicht zur Übersetzung der Ps.-Dionysischen ‚Hierarchien’ motiviert hat. Vgl. A. 544,598. – Alle anderen logischen Schriften des Aristoteles waren, entgegen älterer Forschungsmeinung, schon vor dem 12. Jh.in der Boethius-Übersetzung benützbar (vgl. MINIO-PALUELLO, a.a.O. 328 ff.). Johann hat diese allerdings, wie MINIO-PALUELLO (Aristoteles latinus, V 1–3, Bruges–Paris 1969, XXIX ff.) für die Topica gezeigt hat, in sehr guter undvielleicht von ihm emendierter Handschriftenüberlieferung gekannt (vgl. auch unten Anm. 544). Seine oft mißverstandeneStelle über die Aristoteles-„Renaissance“ seiner Zeit in Met. III V bezieht sich auf das hauptsächlich durch Abaelard, Thierryvon Chartres und Adam Parvipontanus neubelebte Interesse an der gesamten Logik des Stagiriten, nicht aber auf bestimmteNeuübersetzungen. Vgl. auch Met. I 5, 17 zu Abaelard, der als einziger mit Aristoteles ins Gespräch gekommen sei:Peripateticus Palatinus qui logice opinionem preripuit omnibus coetaneis suis, adeo ut solus Aristotilis crederetur ususcolloqui. (Abaelard gilt aber als der letzte große Vertreter der logica vetus). Johann spricht (in Met. III V, 140.6 ff.) von„Vernachlässigung“ und „Wiedererweckung“ namentlich der ‚Topik’, findet die Übersetzung (von wem sie stammt, sagt ernicht) ziemlich wortgetreu und trotzdem verständlich und zitiert einen ihm bekannten süditalienischen Übersetzer, jedochnicht als Übersetzer der ‚Topik’, sondern als eine unmittelbare Fachautorität für das dictum, daß alles auf den „Sinn für dieMehrdeutigkeit der Begriffe“ ankomme, ohne den sogar ein Grieche Aristoteles nicht verstehe: Cum itaque tam evidens situtilitas Topicorum, miror quare cum aliis a maioribus tam diu intermissus sit Aristotilis liber, ut omnino aut fere indesuetudinem abierit, quando etate nostra, diligentis ingenii pulsante studio, quasi a morte vel a somno excitatus est, utrevocaret errantes et viam veritatis querentibus aperiret. Neque enim sermonum aut rerum tanta est difficultas ut astudiosis non possit intelligi […] Satis enim inter cetera, quae translationis artissima lege a Grecis tracta sunt, planus est,ita tamen ut facile sit auctoris sui stilum agnoscere et ab his dumtaxat fideliter intelligatur, qui sequuntur indifferentiaerationem, sine qua nemo unquam nec apud nos nec apud Grecos (sicut Grecus interpres natione Severitanus dicere
194
„Über den Nutzen des achten Buches“ (der ‚Topik‘) überrascht die eher untergeordnete Bedeutung dessokratischen Induktionsbeispiels nicht: Es dient dem Dialektiker als ein eher beiläufiges, „rednerisches“Schmuckund Erläuterungsmittel. Johann befaßt sich an dieser Stelle seiner Einführung in dialektische Logikweder mit der sokratischen Seelenführung, noch mit „der Rede überhaupt“, ja nicht einmal mit der gesamtenTheorie der argumentativen Vergleiche, sondern einzig mit den Methoden der Disputation zwischen zweiGegnern.443 Wird der spezifisch streitdialektische Kontext
consueverat) Aristotelem intellexit. (Zu Severitanus = aus Sancta Severina in Kalabrien, vgl. MINIOPALUELLO Opuscula… a.a.O. 218 f.).443 Met. III 10, 153, wo die Disputation mit der Kriegskunst und Waffenproduktion verglichen wird, sowie unten §§ 65 ff.
195
außer acht gelassen, so entsteht der falsche Eindruck, Johann vertrete jene als „scholastisch“ verschrieeneÜberbewertung der Syllogistik und formalen Logik, die den späteren Humanisten als Inbegriff mittelalterlicherAbscheulichkeiten erschien.444 Abgesehen von seinen vielen anderen im Folgenden näher beleuchtetenAussagen über die Bedeutung nicht-axiomatischer, induktiver, hermeneutischer und probabilistischerErkenntniswege, ergibt schon besagtes Metalogicon-Kapitel selbst ein differenzierteres Bild: Johann wirftgewissermaßen einen Seitenblick auf den logos im Doppelsinn von oratio und ratio, auf die Gesamtheit dermit dem Reden und Denken befaßten artes, wenn er hier vorausschickt, daß die von Aristoteles gelehrte Kunstdes Streitgesprächs zwar aufgrund des dialogischen Charakters zur Dialektik gehöre, aber auch denmethodischen Quellgrund aller Eloquenz bilde und nicht nur von den Rhetoren als Hilfsmittel, sondern vonallen scriptores artium (von allen Lehrern irgendeiner Methode) als Basis angesehen werde.445 Wie schonmehrfach festgestellt wurde, hat Johann aufgrund der circeronianischen Tradition einen ausgesprochen weitenBegriff des „Rhetorischen“, der einerseits die Dialektik und logische Argumentation und andererseits diePhilosophie als Wahrheitssuche und Wahrscheinlichkeitswissen umfaßt.446
444 Vgl. unten Anm. 577, 599, 978, 1022.445 Met. III 10, 154.17 ff. unten Anm. 544 zitiert. – Zu den erkenntnistheoretischen Aspekten s. unten §§ 62, 71 f., 105. Zurciceronischen Entgrenzung der Artes vgl. J. PRÉAUX, Le couple sapientia et eloquentia, in: La rhétorique a Rome,Caesarodunum 14bis (Calliope I), Paris 1979, 171–85; FUHRMANN, Ant. Rhet. 10, 52, 65; W. RÜEGG, Cicero – oratornoster, in: Eloquence et rhétorique chez Cicéron, Entretiens sur l’Ant. class. (Fond. Hardt) 28, Genf 1982, 275–319;BARWICK (wie Anm. 546) 23 ff. sowie §§ 45, 63, 71 f.446 Vgl. J.J. MURPHY, The Arts of Discourse, 1050–1400, in: MSt 23 (1961) 194–204; ders., Rhetoric 104 f. und ders.,Rhetoric and Dialectic in ‚The Owl and the Nightingale’, in: Medieval Eloquence … ed. J.J. MURPHY, Berkeley/LosAngeles/London 1978, 198–230, hier 203 ff.; SEIGEL (wie Anm. 394) 185 ff. zur „Logik“ als Inbegriff aller „arts of thelogos“ nach Met. I 9–10, II 3; ähnlich OTTE (wie Anm. 552) 9 ff. zur Dialektik des 12. Jhs. als „allgemeinerMethodenlehre“, ja als „Allgemeinbildung“, in der die Disputationskunst nur einen Zweig darstellt; ZILTENER 28 undBOSKOFF (wie Anm. 837) 71 zur Sprengung der Grenze zwischen Grammatik und Rhetorik nach Quint. und Met. I 19;ODOJ 46 ff. zur erkenntnistheoretischen Induktion als Basis aller andern Arten der Induktion, vgl. §§ 62 ff., 71 f., S. 434,542, Anm. 1020. Während der Drucklegung wurde mir bekannt: H.-B. GERL, Zum mal. Spannungsfeld von Logik,Dialektik und Rhetorik. Die Programmatik des ‚Metalogicon’ von Johannes von Salisbury, in: Tijdschrift voor filosofie 43e(1981) 306–27; der aus nicht-mediävistischer Sicht (vgl. oben Anm. 43 zu einer früheren Position der Autorin) geschriebeneAufsatz bestätigt tendenziell die im Folgenden und unten §§ 62 ff., 72, 90 ff., 111 angestellten Überlegungen zu Johanns„humanistischem“ oder „hermeneutischem“ Wissenschaftsbegriff. – Ein nochwichtigeres Addendum ist die grundlegende,vornehmlich auf Met.-Stellen aufbauende Arbeit (zur probabilistischen Logik des 12. Jhs. im Unterschied zur demonstrativendes 13.) von A. GIULIANI, L’elemento „giuridico“ nella logica medioevale, in: Jus 15 (1964) 163–190, die alles Folgendehervorragend bestätigt und ergänzt.
196
53. Demgemäß erstreckt sich sein Induktionsbegriff nicht nur auf die beiden Arten der im engeren Sinnelogischen und rhetorischen Methode der Verknüpfung des Einzelnen mit dem Allgemeinen, sondern auch aufden Aufstieg von der sinnlichen Wahrnehmung zum unsinnlichen Intelligiblen nach der aristotelischenErkenntnistheorie, und sein Toposbegriff ist nicht nur wie in vorliegender Stelle im Sinne des Boethius auf dieDisputationslogik bezogen, sondern eher von der aristotelischen Endoxa-Theorie und der ciceronischenPosition „akademischer Skepsis“ bestimmt: Der Topos dient einer Methode des Problemdenkens und derkommunikativen Verständigung (logica probabilis).447 Johanns Terminologie ist freilich nicht ganzkonsequent und muß aus dem jeweiligen Zusammenhang verstanden werden, in dem bald die Rhetorik alsHilfswissenschaft der Dialektik, bald die Dialektik als Dienerin der Rhetorik erscheint. In Bezug auf dassokratische Beispiel ist die Unterscheidung zwischen „Rednern“ und „Dialektikern“ in der besprochenenMetalogicon-Stelle durchaus relativ: Johann hebt einzig die beiden Arten der monologischen und derdialogischen Ausdrucksweise heraus, die sich beide des Exemplums bedienen können, sei es mehr imforensisch-illustrativen Sinn des ornatus, sei es mehr im argumentativen, eigentlich sokratischmäeutischenSinn einer probatio. Wenn der persuasive im Gegensatz zum stringenten Charakter betont wird, so meintmovere keine Affektstimulation im neuzeitlichen Sinn, sondern eine Beweisführung, die den Gegner nichtsyllogistisch gewaltsam „umwirft“ oder gefangennimmt, sondern sanft dahin bringt, daß er sich, durch eineselbst zugestandene Analogie oder durch
447 Vgl. §§ 46 f., 71, S. 38 ff. Zu den trotz der logica nova von Johann selbst hochgeschätzten und auch sonst weiterhinallgemein beliebten Differentiae des Boethius vgl. O. LEWRY, Boethian Logic in the Medieval West, in: Boethius, HisLife, Thought and Influence, ed. M. GIBSON, Oxford 1981, 90–134, hier 109, 113. Zu Johanns aristotelisch-ciceronischerInduktionstheorie vgl. z. B. ODOJ 46 ff.; McGARRY 666 f.; A. SCHNEIDER, Die Erkenntnispsychologie des Johann vonSalisbury, Festschr. G. von HERTLING, Freiburg 1913, 324 ff.; GARFAGNINI, Legittima potestas (wie Anm. 726) 24 f.;KERNER 38 f. Alain MICHEL, La théorie de la rhétorique chez Cicéron: Eloquence et philosophie, in: Eloquence etrhétorique chez Cicéron, Entretiens sur l’Antiquité class. (Fond. Hardt) 28, Genf 1982, 109–147, hier 127 f., 138 zu Johannals hervorragendem Nachfolger Ciceros in der „simplification platonisante de la tradition aristotélicienne“ und in demBestreben, den „esprit d’universalité“ der Philosophie auch gegenüber der „complexité du concret“ der rhetorischen Praxis zuwahren. Nicht zugänglich war: Victor Lyle DOWDELL, Aristotle’s Influence on John of Salisbury, Diss. Ithaca 1930(Abstract Cornell Univ.).
197
mehrere eigene Prämissen genötigt, früher oder später („heranreifend“ oder „sprungartig“) dahin bewegt, woder „Redner-Dialektiker“ ihn haben möchte.448
In der Literatur über das Exemplum, insbesondere über das sog. volkstümlich-homiletische oder pädagogischedes späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit werden häufig die wesentlich sinnlichen, visuellen, jahaptischen Qualitäten dieses rhetorischen Mittels, das eine Botschaft pathetisch vereindringlichen oderlustbetont auflockern soll, als radikaler Gegensatz zur streng logischen Beweisführung hervorgehoben.449 Wirhaben allerdings in dieser Arbeit mit den affektpsychologisch-emotionalen Aspekten der Induktionausgesprochen wenig zu tun. Doch lohnt es sich (wie immer) gerade die Leerstellen, das Schweigen oder dieZurückhaltung der Texte hinsichtlich der von uns erwarteten oder anthropologisch vorausgesetztenPhänomene ernst zu nehmen: Wenn Johann das movere mit den sokratischen Eigenschaften des Exemplumsverbindet, ist unmittelbar einsichtig, daß das Wort sich nicht auf irgendeine Pathos-Erregung oder„Gefühlskultur“ beziehen läßt. Gewiß kennt auch er die traditionell seit der antiken Rhetorik gelobtensinnlichen Vorzüge des Exemplums, wie die demonstratio ad oculos die evidentia, energia, das „Vor-Augen-Stellen“, das Nahe-Heranbringen des Fernen, die pragmatische Stimulation oder Aktivierung, die Müdigkeits-und Langeweilebekämpfung durch Abwechslung und Scherz, die captatio benevolentiae durch vergnüglicherepraesentatio, die allen schmückenden Vergleichen und Tropen zugrundeliegt u.a.m.450 Wie aber schon diewiederholt für exemplum verwendete
448 Zu den monologischen oratores und den dialogischen dialectici vgl. Anm. 544 bes. Met. III 10.155.4 ff.; ebd. 157Hinweis auf die Schmuck- und Erläuterungsfunktion des Exemplums nach Arist. Top. VIII 157a (bei Boethius mitdilucidatio übersetzt), die für „Redner“ geeigneter, für „Dialektiker“ sekundär ist. Unmittelbar darauf wird jedoch dieFunktion des Beweisens (ad probandum) durch Exempla auch innerhalb der disputatorischen Kunst des Fragens undAntwortens behandelt. – Zum Gegensatz von Syllogismus und Induktion s. oben Anm. 433 (Met. III 10, 156.20 ff.),Anm. 426 (ebd. 162).449 Vgl. etwa DAVID, Présentation, in: Rhét. et hist. 13 ff., Maiorum exempla, ebd. 69 f.; CRANE XX f., XLI f.;WELTER 13 ff.; SCHON 64 ff.; ZORZETTI (wie Anm. 277) passim; BRÜCKNER, Hist. 38 ff., Exemplasamml. 604 f.:„visuelle, ja haptisch vermittelte Botschaft“; Klaus DOCKHORN, Macht und Wirkung der Rhetorik, Vier Aufsätze zurIdeengeschichte der Vormoderne, Bad Homburg–Berlin–Zürich 1968, 125 ff. u. ö.; OLSSON (wie Anm. 299) 193;BERLIOZ 122; JÜLICHER I 72; „die streng logische Beweisführung, die vom Allgemeinen auf das Besondere geht, durchSchlüsse, durch Abwägung von Gründen und Gegengründen, wirkt auf die Mehrzahl der Menschen überhaupt wenig;volkstümliche argumentatio ist allein die demonstratio ad oculos.“450 Vgl. LAUSBERG §§ 271, 257, 810 ff.; MARTIN, Ant. Rhet. 119 f.; BENOIT 190 f. (Arist., Top. 157a 19–21; 105a16–19 Induktion für das Volk); W.D. LANGE, El fraile Trobador. Zeit, Leben und Werk des Diego de Valencia de Leon(Analecta Romanica 28), Frankfurt a. M. 1971, 97 ff. (zur delectatio naturalis durch repraesentatio nach Thomas v. Aquinq. I art. IX; 101 art. II); ZILTENER 18 ff. (Lustgefühl durch Tropen bei den Grammatikern); zur „Weckfunktion“ vgl.MEULI 28; GEERLINGS 150; SMALLEY, Friars 42; SUCHOMSKI 73 ff.; S. 531, 601 f., Anm. 921. Rhet. Her. IV49.62 (exemplum) rem ornatiorem facit […]; apertiorem cum id quod sit obscurius, magis dilucidum reddit; […] anteoculos ponit, cum exprimit omnia perspicue, <ut> res dicam manu temptari possit. Ebd. I 6.10: Si defessi erint audiendo,ab aliqua re, quae risum movere possit, ab apologo, fabula […] similitudine, novitate, historia, versu […] (utemur).Quint. 6.3.1–3: risum movendo […] aliquando reficit et a satietati vel a fatigatione renovat […]. Cic., De orat. 2.236: estplane oratoris movere risum […] quod ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei, per quem excitata est (dazu vgl. auchExkurs III). Cic., Part. or. 40: Maximam autem fidem facit ad similitudinem veri primum exemplum deinde introducta reisimilitudo; fabula etiam nonnumquam, etsi sit incredibilis, tamen homines commovet. – Quint. 6.2.32: ®nårgeia quae aCicerone ‚inlustratio‘ et ‚evidentia‘ nominatur, quae non tam dicere videtur quam ostendere, et adfectus non aliter, quam sirebus ipsis intersimus; sequentur ex his visionibus (zu energia/inlustratio vgl. auch Anm. 668). Macr. Sat. 4.5.1–2: Sunt inarte rhetorica ad pathos movendum etiam hi loci, qui dicuntur circa rem, et movendis affectionibus peropportuni sunt. Exquibus primus est a simili: Huius species sunt tres: exemplum, parabola, imago. [Für exemplum gibt er das Beispiel Verg.Aen. VI 119 ff., aus der Bitte des Aeneas, den Vater in der Unterwelt sehen zu dürfen, die Erinnerung an Orpheus undPollux, die Vergleichbares erreichten] … Haec enim omnia misericordiam movent, quoniam indignum videtur negari sibiquod aliis indultum sit. – Zu Johann s. Anm. 433 (Met. III 10, 156: exempla magis movent) und unten § 54, S. 232 f.,235 f., 318.
198
Metonymie des „Tugendanreizes“ (incitamentum virtutis) zeigt, konzentrieren sich solche Vorstellungen aufden ethischen Bereich, was der zentralen Stellung der praktischen Philosophie bei Johann entspricht.451 Dieeigentliche, tiefgreifende Einschränkung der affektbezogenen Exemplum-Theorie kommt jedoch aus einerebenso bildungselitären wie sokratischen Intellektualisierung der Ethik, aufgrund derer die konkret vor Augengeführten
451 Pol. Prol. 12 oben Anm. 366: exempla maiorum […] incitamenta et formenta virtutis; Pol. VI 19, (II) 56 f.: praecepta etexempla […] referenda sunt ut his ad scientiam instruantur, illis accendantur et animentur ad virtutem. Pol. VII 9, (II) 126(nach dem oben Anm. 424 angeführten mythologischen Exemplum von Danae): Similes in singulis picturas videt, miratur etlaudat multitudo. Nam quae virtutis incitamenta sunt, rarus spectator adtendit. – Vgl. auch Aug., Doctr. chr. IV 2.4 zurpraktischen Bedeutung des movere, das im Gegensatz zu bloßem narrare und docere auch zur Tat antreibe; sowie, darauffußend, Abaelard, Comm. in Ep. ad Rom., Prol. (CC med. XI 1969) 41, der die ganze Bibel metaphorisch als GottesPersuasionswerk versteht (vgl. dazu auch oben § 26) und das Alte und Neue Testament in je einen „lehrenden“ und einen„bewegenden“ Teil, d. h. in praecepta und exempla (s. oben Anm. 421) aufteilt (Gesetz Moses – Propheten und historiae;Evangelium – Paulusbriefe und Apostelgeschichte). Dazu vgl. ROTH 22 ff. und MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 61 f.,125 f.
199
historischen Tugendvorbilder, die aller abstrakten Theorie durch sinnliche Wahrnehmbarkeit überlegen seinsollen, als eigentliche „Denk“-Würdigkeiten, subtile Interpretationsgegenstände und Argumentationsmittelgelten, m.a.W. mehr „gelesen“ als „gesehen“ werden sollen.452 Einen scharfen Gegensatz zwischenVeranschaulichen und Beweisen wird man bei Johann vergeblich suchen. Er vermerkt höchstens (wie schondie antike Rhetorik) den elocutionellen und den argumentativen Aspekt des „Vergleichs“.453Klar und imSinne einer Rangfolge unterscheidet er dagegen zwischen einer sinnlich unmittelbaren und einerhintergründigen, durch Denkleistungen zu entschlüsselnden Bildhaftigkeit des Exemplums: Die erstere gehörtals Reizmittel der niederen Seelenkräfte in die Volksparänese oder Kinderpädagogik und ist seine Sache nicht;sein Exemplum ist immer ein auf der gegenseitigen Durchdringung von sinnlicher Wahrnehmung, Gedächtnisund Einbildungskraft beruhender Denkanstoß oder Beweisansatz.454 Es war einer späteren Zeit vorbehalten,der sinnlichen Wahrnehmung, der Erfahrung und insbesondere dem Sehen als eigentlichen „Organen“ für dasBeispiel sowie der Leidenschaft und „Schaulust“ bei der imitatorischen Identifikation eine nicht nurpropädeutisch-pädagogische Köderfunktion auf einer erkenntnismäßigen Anfangsstufe einzuräumen, ihnenvielmehr einen eigenen, durch nichts anderes ersetzbaren, echt empirischen Erkenntniswert sui generis zuverleihen.455
54. Am Ende der Metalogicon-Stelle über die Induktion werden zwei methodische, auch literaturpraktischwichtige Erfordernisse genannt: Sachdienlichkeit (Adäquatheit) und Vertrautheit. – Das erste erinnert an dasaristotelische Postulat, daß Paradeigma und gegenwärtiger Fall, da sie sich wie zwei Teile eines höherenGanzen zueinander verhalten, dem gleichen Sachgebiet entnommen sein müssen.456 Daß Beispiele wirklichmit dem Beweisziel vergleichbar
452 Vgl. § 49, S. 338. – Das intellektualistische ethische Prinzip, das in Pol. III 1.173 ausgesprochen wird, scheint in einemgewissen Widerspruch zu dem unentwegt betonten Vorrang der Praxis zu stehen (vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 83 f.),doch wird hier nicht ars und usus, sondern scientia, agnitio veritatis und cultus virtutis entgegengesetzt: Praecedit ergoscientia virtutis cultum, quia nemo potest fideliter appetere quod ignorat; et malum nisi cognitum sit utiliter non cavetur[…] Agnitio igitur veritatis cultusque virtutis […] incolumitas est. Contrarium vero eius ignorantia et odibilis et inimicapropago eius vitium est. Et recte quidem ignorantia mater vitii est. Demgegenüber s. unten S. 292 f., 307 f. zu ars undusus.453 Vgl. S. 53, 55 ff., 182 f., 188 ff., 192, 196.454 Vgl. S. 128, 180 f., 232 f., 373 ff., 542.455 Vgl. Jürgen MANTHEY, Wenn Blicke zeugen könnten. Eine psychohistorische Studie über das Sehen in Literatur undPhilosophie, München/Wien 1983; s. auch S. 184 ff., 232 ff., 530 ff.456 Vgl. § 74, S. 320, A. 435 f. und besonders A. 143 zum genus Begriff in Isidors bekannter paradigma/exemplum-Definition (Et. 1.37.34; vgl. auch HONSTETTER 191; MARTIN, Ant. Rhet. 119). Nach antiker Theorie war eines derHauptmittel der refutatio die Infragestellung der Sachgemäßheit, Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit gegnerischerBeispiele (vgl. auch unten Anm. 654).
200
sein sollen, nicht aus der Luft gegriffen sein dürfen, ist eine elementare Regel, deren Verletzung sich gerade imStreitgespräch selbst straft und dem Gegner eine Waffe zu leichter Widerlegung zuspielt. Im mittelalterlichenGebrauch und auch bei Johann ist unter dem Leitbegriff convenientia jedoch außerdem etwas eher Stilistischeszu verstehen: das Gegenteil eines nicht zur Sache gehörigen Exkurses.457 (Sogar in den Artes praedicandi hatsich diese – vornehmlich nach der Herennius-Rhetorik formulierte – Bestimmung erhalten. Sie konnte hierals offenbar notwendige Warnung vor exzessivem bloß unterhaltsamem Fabulieren, vor Geschwätzigkeit beimGeschichtenerzählen
457 Zur amplifikatorisch-digressorischen Bedeutung des Exemplums vgl. MARTIN, Ant. Rhet. 121; BATTAGLIA 454;GEBIEN 84, 56 ff.; ALEWELL 29 ff.; LAUSBERG §§ 290.2, 415, 408. Zu den antiken Voraussetzungen in der elocutio s.Cic. Part. or. 55: rerum autem amplificatio sumitur eisdem ex locis omnibus e quibus illa quae dicta sunt ad fidem;maximeque valent […] similitudines et exempla. Wie für alle Arten der amplificatio wird das Gebot des Maßes betont;Quint. V 11.5: Similitudo adsumitur interim et ad orationis ornatum; sed illa cum res exiget […]. Rhet. Her. IV 49.62:Exemplum […] sumitur isdem de causis, quibus similitudo. Rem ornatiorem facit […] Unius cuique generis singulasubiecissemus exempla, nisi <et> exemplum quod genus est, in expolitione demonstrassemus et causas sumendi insimilitudine aperuissemus. Quare noluimus neque pauca, quominus intellegeretur, neque re intellecta plura scribere.Ebd. IV 3.5: Praeterea oportet testimonium cum re convenire, aliter enim rem non potest confirmare (zu testimonium imSinne von Zitat s. oben Anm. 374). Ebd. II 29.46: […] exornatio constat ex similibus et exemplis et amplificationibus […]et ceteris rebus, quae pertinent ad exaugendam et conlocupletandam argumentationem. Exemplum vitiosum est, si autfalsum est ut reprehendatur, aut improbum, ut non sit imitandum, aut maius aut minus quam res postulat. ZurBeschäftigung mit dem Problem der unpassenden Digression in den Artes poeticae und dictaminis des 12. Jhs. vgl.ZILTENER 64; QUADLBAUER, Purpureus pannus (wie Anm. 33) 25 ff. Interessant ist die hier (26) festgestellteLegitimation des Abschweifens bei Johannes von Garlandia; movendi causa an Stelle der traditionellen recreandi oderdelectandi causa (Poetr. 5.29 f., LAWLER 84). Zu ähnlichen Rechtfertigungen im Sinne des demonstrativen stilusgrandiloquus vgl. von MOOS, Poeta 112 ff.; B. MARTI (ed.), Arnulfi Aurelianensis glosulae super Lucanum, Rom 1958,introd. XXXIX ff.; dieselbe, Literary Criticism in the Medieval Commentaries on Lucan, in: Transactions and Procceed. ofthe American Philol. Assoc. 72 (1941) 245–54, hier 253 f. Vgl. auch Anm. 1192 (zu Gervasius von Melkley) und S. 332,351, Anm. 706.
201
dienen.458 Diese Sachdienlichkeitsregel dürfte die eigenartige Feststellung erklären, daß im Policraticus geradeamplifikatorisch-dekorative Exempla-Reihen, die entbehrlich scheinen könnten, mit Legitimationsformelnwie praeter rem non videtur verteidigt werden.459
Das zweite Merkmal, das der Vertrautheit, entspricht ebenfalls einer ursprünglich logischen Funktion desBeispiels bei Aristoteles. Da das Paradeigma – wie gezeigt – in Entscheidungsprozessen die Tunlichkeit einerHandlung durch einen historischen Analogieschluß nachweisen soll, darf das Beweismittel (der Präzedenzfall)nicht selbst so zweifelhaft sein, daß es erst noch bewiesen werden muß; es soll vielmehr unmittelbar einsichtigund von vornherein allgemein akzeptabel sein.460 Was im Mittelalter von dieser Bestimmung übrigblieb, zeigtdas angeführte Zitat symptomatisch: Weniger eine sachliche als eine literarische Bekanntheit steht zur Rede.Das Beispiel gilt dann als vertraut, wenn es aus vertrauter Quelle stammt, etwa aus einem heimischen„Klassiker“; wenn es kanonische Notorietät beanspruchen kann. Das Denkwürdige am Exemplum, das gemäßantiker Doppelbestimmung von einer historischen Person gleicherweise gesagt wie getan werden konnte,wurde
458 Vgl. oben Anm. 457 zu den modi dilatandi sermonem und zu Humbert von Romans, sowie WELTER 73 zu dessen ‚Dehabundancia exemplorum’: Non enim texendum est sermo totus de huiusmodi exemplis, sed moderate utendum est illisexemplis. […] Eligenda sunt de multis exempla magis necessaria et utilitatem continentia evidentem […] solum quod facitad rem est narrandum. Vgl. auch oben Anm. 315, 345 zur Kritik an der Verselbständigung der Unterhaltungsfunktion.459 Z.B. Pol. VIII 19, (II) 364 (als Eröffnungsformel für einen ausführlichen exkursartigen Abriß römischer Geschichte unterdem Gesichtspunkt des bösen Endes der Tyrannen): praeter rem tamen non videtur, si haec quae dicta sunt, aliquibusastruamur exemplis.460 Oben S. 6. Dieses Prinzip betrifft sämtliche induktiven Beweismittel und Analogiearten: vgl. LAUSBERG §§ 413,844 f.; MARTIN, Ant. Rhet. 122 (auctoritates); OLSSON (wie Anm. 299) 188; VITALE-BROVARONE 102 f.:BATTAGLIA 451; DAVID, Présentation 13; SCHIAN (wie Anm. 5) 192; GEBIEN 25, 69; J. KOPPERSCHMIDT,Quintilian De argumentis. Oder: Versuch einer argumentationstheoretischen Rekonstruktion der antiken Rhetorik, in:Rhetorik 2 (1981) 59–74, hier 65: „Die Möglichkeit der Argumentation setzt die Möglichkeit unterstellbarer Gewißheitennotwendig voraus.“ – Quint. VIII 3.73: quo in genere id est praecipue custodiendum, ne id, quod similitudinis gratiaadscivimus, aut obscurum sit aut ignotum: debet enim quod inlustrandae alterius rei gratia adsumitur, ipsum esse clariuseo, quod inluminat. Ebd. I 6.7 (analogia): eius haec vis est, ut id, quod dubium est ad aliquid simile, de quo non quaeriturreferat, ut incerta certis. In der Topik s. Cic. Top. II 8; Boeth., Diff. top. (PL 64) 1185 D. – Rhet. Her. IV 1.2: Non ergooportet hoc nisi a probatissimo sumi, ne, quod aliud confirmare debeat, egeat id ipsum conformationis.
202
im Mittelalter mehr als ein magister dixit denn als ein memorabile factum verstanden.461 Aufgrund derMetalogicon-Stelle über den Vorrang der domestica exempla (seien diese nun „geflügelte Worte“ oderpopuläre „Geschichten“) hat man Johann vorgeworfen, sich im Policraticus praktisch nicht an seine eigenenMaxime gehalten und vielmehr ausgefallene, weit hergeholte Exempla, „Kuriositäten“ in stofflicher wie inquellenmäßiger Hinsicht bevorzugt zu haben. Mag dies zutreffen, so ist doch auch zu beachten, daß er stetssehr sorgfältig darum bemüht ist, seine Quellen und auctores zu nennen, um damit auf einen Bildungs- undLektürekanon zu verweisen, der entweder wirklich bekannt ist oder aber bekannt sein sollte. SeinBildungseifer führt ihn dazu, auf diesem Gebiet seinen Schalk zu treiben: abgelegene Exempla aus vertrauterQuelle zu beziehen oder obskure Autoren so zu zitieren, daß der verblüffte Leser auf seine Unwissenheit übervermeintlich Allbekanntes gestoßen wird.462 Insgesamt läßt sich an der Art, wie Johann seine Exempla
461 Notorietät aufgrund verbürgter Überlieferung ist ein Hauptmerkmal des historischen Wahrheitsbegriffs im MA; vgl. oben§ 43, unten §§ 57 f., 61. GUENÉE, Hist. et. culture historique 350 ff.; MELVILLE, System 63; SMALLEY, Friars 18;FRIEDRICH 28, 39; BATTAGLIA 469 f. Zum konsensbildenden Faktor autoritativer Texte im mal. Topikverständnis s.unten §§ 90 f.462 Zu Johanns Inkonsequenz: KERNER 38 f., vgl. auch oben § 6. – Zur Bildungspropaganda vgl. E.N.L. BROOKE, TheTwelfth Century Renaissance, London 1969, 61: „He enjoyed puzzling his readers by referring them to bogus antiquities, healso enjoyed puzzling them by reference to ancient works of extreme obscurity“; vgl. auch ders., Introd. (wie Anm. 35)XLVIII f. zu Ep. 112 an Peter von Celle; LIEBESCHÜTZ, Chartres (wie Anm. 28) 17; Humanism 22. Mehrere Beispieledieser Methode analysiert feinsinnig MARTIN, Uses of Tradition 62 ff., bes. 67 f. Daselbst auch zur Institutio Traiani(Pol. V–VI), die nochmals mit LIEBESCHÜTZ und gegen KERNER (m. E. überzeugend) als eine Meisterfiktionnachgewiesen wird (s. unten Anm. 922). Zu ergänzen ist, daß Johanns Aufforderung an den Leser, in dieser von ihmangeblich selektiv wiedergegebenen pseudo-plutarchischen Schrift selbst weiterzulesen, nicht etwa ein Argument für dieEchtheit der Institutio darstellt, sondern vielmehr von sublimem Humor zeugt, da nur der wirklich Belesene aus verkapptenAnspielungen merkt, daß es dieses Buch gar nicht gibt. Ähnlich zu verstehen ist die Aposiopese als Aufforderung zumeigenen Lesen, ja „Wiederlesen“ eines kaum bekannten, jedenfalls handschriftlich schwer zugänglichen Autors in Pol. IV 12,II 29: Frontinum relege et usquequaque ita esse invenies, sowie die Empfehlung, in einem nicht existenten Werkweiterzulesen, dessen fiktiver Autor eine dem gelehrten Leser nicht unbekannte Figur aus Macrobs Saturnalia darstellt, inPol. VIII 7, (II) 270.20: Si quis ea nosse desiderat […] percurrat Portuniani civilia instituta (vgl. oben Anm. 411). Zu demverwandten Problem des ‚Flavianus’ aus Macrob und als Autor des De vestigiis sive de dogmate philosophorum s. untenAnm. 509. Möglicherweise gehört auch der Libellus de exitu tyrannorum, den Johann in Pol. VIII 20 (II) 373 (vgl. untenAnm. 696; KERNER 196, 202) als sein eigenes Kompendium oder Florileg erwähnt und als „Ergänzungslektüre“ zuentsprechenden Pol.-Kapiteln empfiehlt, in die Kategorie solcher Mystifikationen. (LINDER, John of S.’s Policraticus …[wie Anm. 335] 276 ff., 281 hat eine Rekonstruktionshypothese hinsichtlich eines anonymen Liber de tyrannis in MSCambridge CCC 469 falsifiziert.) Zum typischen und traditionellen Fiktionsthema De tyrannis aufgrund deklamatorischerSchulpraxis vgl. S. 349 ff., 365 f. Zu weiteren Fiktionen vgl. S. 209, 219 ff., 464 ff. – Die Absicht, für Bildung undBelesenheit zu werben, geht aus Pol.-Prol. 15.20 ff. hervor: quae vero ad rem pertinentia a diversis auctoribus se animoingerebant, dum conferrent aut iuvarent, curavi inserere, tacitis interdum nominibus auctorum; tum quia tibi utpoteexercitato in litteris pleraque plenissime nota esse noveram, tum ut ad lectionem assiduam magis accenderetur ignarus.(Ähnlich versteht Gellius, N.A. praef. 17, sein Werk nur als Anstoß für den Leser, auf dem durch kurze Auszüge gezeigtenWeg weiterzugehen und bei den Quellen selbst gründlichere Belehrung zu suchen.) Das Prinzip der vorgetäuschten auctoritasstimmt auch gut zu der S. 182 ff. dargestellten Ambivalenz einer je nach Rezeptionsniveau offenen oder verschlossenenBildsprache für die sapientes bzw. den vulgus.
203
einleitet, feststellen, daß ihm das Prinzip der Vertrautheit zu einem Prinzip der Verbürgtheit und auctoritasgeworden ist.
55. Gewiß baut er Exempla-Reihen in meist chronologischer Anordnung vom Ferneren zum Näheren undnach Überleitungen, in denen er den notiores historiae größere Beweiskraft zuschreibt. Man kann aus dieserBevorzugung der jüngeren Exempla auf ein persönliches Interesse an historischer und zeitgeschichtlicherUnmittelbarkeit schließen,463 wenn man die obligate literarische Funktion der rhetorischen Steigerung fürExempelreihen mittels traditioneller rahmenbildender Geschichts-Systematisierungen (Typologie, Synkrisis,translatio studii u. dgl.) dabei nicht außer acht läßt: Primär geht es hier stets um den höherenBekanntheitsgrad bestimmter Texte und Zeugen und um den damit erzielten höheren Persuasionseffekt. Sosteigert Johann eine Exempelreihe von David, Ezechias und Iosias (nur noch formal typologisch, in der Sacheaber rhetorisch) zu Constantinus noster, Theodosius, Justinian und anderen Christianissimi principes, nichtetwa nur, weil das christliche Vorbild dem Gläubigen mehr bedeutet, sondern vor allem auch, damit die zuvorangeführten alttestamentlichen Exempla nicht als „allzu fern“ und deshalb „weniger befolgenswert“erscheinen oder gar als gänzlich „fremd und profan“ verschmäht werden.464 Die christlichen Fürsten lehren
463 So etwa KERNER 147 zur Höherstellung christlicher Kaiser des römischen Reiches gegenüber alttestamentlichenKönigen; LIEBESCHÜTZ 63 f. zur Überlegenheit lateinischer Kultur über die griechische nach der Betonung eigenerTradition: nostra latinitas, noster Cicero, Seneca noster, arbiter noster, Constantinus noster u. dgl. (s. oben 167 f., 188 ff.unten Anm. 485, 582.)464 Pol. IV 6, (I) 252.28 ff.: Et ne illorum remota videantur exempla et ex eo sequenda minus […] ne illorum quasi alienaaut prophana contempnantur exempla, Constantinus noster, Theodosius, Iustinianus et Leo et alii Christianissimiprincipes principem possunt instruere Christianum. Das verbreitete Einteilungs- und Steigerungsverfahren war in derrömischen Form einer Konfrontation heimischer und auswärtiger, vor allem griechischer Beispiele (exempla domestica undexterna) aus Cicero, Seneca, Valerius Maximus u. a. wohlbekannt (vgl. LUMPE 1238 f., GEBIEN 60, ALEWELL 38 f.). Inder Patristik ersetzten heidnische (seltener alttestamentliche) Beispiele die externa und christliche die domestica exempla. Vorallem die von Hieronymus gepflegte Verknüpfung von Beispielen ex scriptura und e saeculi historiis war allgemein beliebt;dazu vgl. Paul ANTIN, Saint Jerôme et son lecteur, in: ders., Recueil sur S. Jerôme, Brüssel 1968, 349–51; WELTER 24;CARLSON 93 ff.; W. TRILLITZSCH, Hieronymus und Seneca, in: MlatJb 2 (1965), 42–54, hier 48; PÉTRÉ 26 f.; Ch.FAVEZ, La consolation latine chrétienne, Paris 1937, 105, 172 f.; von MOOS, Cons. III §§ 1345 ff. und oben Anm. 433,unten Anm. 466. – Siehe z. B. Hier. Ep. 39.5–4; Sen. De ira 3, 18; Ep. 24.11.
204
nämlich dasselbe wie ihre Vorgänger. Sie unterstützen als näherer Beleg die Lehre eines David. Keineinhaltliche, aber eine rhetorische, auf Vollständigkeit zielende Steigerung liegt etwa vor, wenn Johann nacheiner Aufzählung heidnischer Tyrannen chronologisch ad tempora Christiana weitergeht, einzig, weil esüberall und allezeit Tyrannen gibt.465 Nach einem berühmten antiken Verfahren der Klimaxbildung verfährter gerade da, wo er auf die englische Geschichte bis hin zur unmittelbaren Gegenwart verweist:466 „Nicht nurvon den Römern und Griechen haben wir Tugendbeispiele; in Fülle besitzen wir auch heimische. Von Brennusberichten die Geschichten […]“. Nach dem Brennus-Exemplum folgt eine dieses überhöhende und es zugleich(aufgrund der inhaltlichen Identität mit allen anderen Exempla) durch Bekanntheit autorisierendeTransitio:467 „[…] und da die Brennus-Geschichte jemandem vielleicht als allzu abgelegen erscheinen könnte,komme ich der Sache näher und bringe zum Beweis der Tugend des Volkes […] vor, was fast jedem bekanntist.“ Es folgt ein Exemplum Knuths d. Gr. und danach – ad tempora nostra descendo – dasjenige des WilhelmRufus sowie
465 Pol. VIII 21 (II) 381.14 f.: Ad tempora transeo Christiana, quoniam in omni gente et populo manifesta est nequitiatyrannorum et evidens pena. Vgl. auch unten § 105 zur Wiederholbarkeit und Statik der Ereignisse in JohannsGeschichtsbegriff.466 Pol. VI 17, (II) 44.21 ff.: Neque enim a Romanis et Grecis tantum nobis sunt exempla virtutis, nam et domesticisabundamus. Tradunt historiae Brennum […]467 Pol. VI 18, (II) 47.4 ff.: Et quia Brenni historia alicui forte nimis remota videbitur, ad demonstrandum virtutem gentis[…] accedo propius et ea quae sunt fere omnibus nota compendioso sermone proponam.
205
abschließend das allernächstliegende:468 der derzeit regierende Heinrich II. „Schließlich, um nicht lange nachExempla herumzusuchen, hat dessen Neffe, der beste König […]“, lautet die Überleitung.
Sehr klangvoll hört sich die Steigerung der Reihe an, die von den größten Philosophen Griechenlands zu demdank „unserer Latinität“ so viel vertrauteren Seneca führt:469 „Was uns Zeno, Sokrates, Plato, Aristotelesund der Chor aller Philosophen über das Mäßigkeitsgebot hinterlassen haben, könnte hier genügen. Doch weildie Namen dieser Autoritäten überaus alt, deren Lehren vielleicht nicht so weltberühmt sind, möge man lieberunseren Seneca hören […]“. Nicht sachlich, sondern der „Berühmtheit“ wegen ist es nötig, diePhilosophenreihe mit Seneca fortzuführen. – In einem anderen Fall470 wird schon durch den Auftakt: „Dochgehen wir nun zu bekannteren Geschichten über!“ klar, welche rhetorische Geschichtsvorstellung die Feder
468 Ebd. 49.7: Postremo ne longe petantur exempla, nepos illius […] rex optimus … Zum historischen Zusammenhang derStelle s. R.H. u. M.A. ROUSE, John of S. and the Doctrine of Tyrannicide, in: Spec. 42 (1967) 693–709 = übs. M.KERNER, in: ders., Ideologie und Herrschaft im MA, WdF 530, Darmstadt 1982, 241–67: Johann von Salisbury und dieLehre vom Tyrannenmord, hier 257 f. Die nachfolgende Lobpreisung des jungen Heinrich ist eine den Wunsch auf bessereZukunft verkleidende Insinuatio: vgl. ebd. 54.3 ff.: Si iuxta praecedentis gratiae cursum sibi diu successerint prospera […]Ceterum adolescentiae exitus aliquibus suspectus est, et utinam frustra a bonis timeatur. Zu der hier nicht ideologisch,sondern insinuatorisch bestätigenden demonstrativ-deliberativen Doppelfunktion des Exemplums s. oben Anm. 7, vgl.S. 74 ff., 79 ff.469 Pol. VIII 13, (II) 318.16 ff.: Possunt ad commendationem eius [sc. frugalitatis …] sufficere quae Zeno, quae Socrates,quae Plato, quae Aristotiles, quae omnium philosophorum chorus de frugalitate servanda tradiderunt. Sed quia haecpervetusta sunt nomina aut eorum non sunt praecepta celebria, vel Seneca noster audiatur […] Daß das Einteilungsschemanur einer von vielen rhetorischen Gesichtspunkten ist, zeigt (natürlich ganz widerspruchslos) der andere Gesichtspunkt derstets venerabilior antiquitas oder das Schema: „je älter, desto gewichtiger und einleuchtender“; vgl. unten §§ 61 ff.470 Pol. II 27, (I) 145 (nach den Exempla Croesus und Pyrrhus): Ad notiores transeatur historias: Apius, cum unica etsingularis civilis belli tempestas orbem concuteret, docente Phebo in sinu Euboico quietem quaerit et mortem invenit.Oraculum quidem auctore Lucano celebre est […; hier folgt Lucan V 194–6]. Sed ne falsitatis nota in historias, nonoracula refundatur, canonica, et cui fides incolumis adquiescit, discutiatur historia: Saul […] Vgl. oben Anm. 423 zuLucan und zum Wahrheitsgehalt „historischer“, bzw. epischer Dichtung. Hier wird nicht etwa die Wahrheit antikerGeschichtsschreibung (zu der auch die Pharsalia gehört) in Zweifel gezogen, wohl aber deren im Vergleich zur biblischenGeschichtsschreibung geringere Geltung stillschweigend vorausgesetzt.
206
führt: Auf die Beispiele des Croesus und des Pyrrhus (für einen Mann, der sich durch abergläubisches Vertrauenin ein Orakel zugrunde richtet) folgt dasjenige des Apius aus Lucans Epos; dabei wird noch betont: „DasOrakel ist nämlich nach der Aussage Lucans berühmt.“ Doch auch dieses Zeugnis läßt sich – nicht inhaltlich,aber durch größere Bekanntheit – überbieten: „[…] damit nicht etwa den (hier erzählten) Geschichten,sondern den Orakeln der Schandfleck der Lügenhaftigkeit anhafte, möge nun eine kanonische Geschichte, diesich unverbrüchlicher Authentizität erfreut, zur Diskussion stehen!“ Es folgt das Beispiel von SaulsHexenbeschwörung als Mahnung vor dem Unsinn der Wahrsagerei.471
56. Das Johann Geschichte und Literaturgeschichte im wesentlichen als einen Schatz vonBeglaubigungsmitteln für seine Ideen begreift, geht aus einigen grundsätzlichen Aussagen hervor. Er ruftParallelen, Analogien als argumenta wie Bundesgenossen im Kampf um die Wahrheit herbei, damit er nichtselbst, im eigenen Namen, als unbedeutender, unberühmter Zeuge sprechen muß. „Dies ist nicht meine,sondern aller Weisen Rede“, ruft er aus oder: „Wenn du mir nicht glaubst, so lese doch genau die Consolatiodes Boethius!“, oder: „[…] so bemühe deine Ohren für unseren Juvenal!“472 Noch höher geht es beigeistlichen Zeugen: „[…] und damit du nicht etwa glaubst, ich sei über eine einzige Lehrmeinung schwankend,so bringe ich als den auctor, bei dem ich Schutz finde, den großen Augustinus vor.“ Die höchste Stufe derBeglaubigung erreicht Johann jedoch so: „[…] nicht ich, sondern der Geist der Weisheit […], nicht ich,sondern der Allerhöchste sagt und macht dies alles“, womit zu Bibelstellen übergeleitet wird.473 Die
471 Weitere Beispiele sind etwa Pol. III 14, (II) 224 f.: In Grecia quis maior aut clarior Alexandro? [als Übergang zumAlexander-Exemplum, das so beschlossen wird: …] Sed ne solis Grecis mutuemur instrumenta virtutum. Scipio Africanus,cum […; es folgen römische Exempla]. Als eine Variante der chronologisch bestimmten Übergänge vom niederen zumhöheren Exemplum erscheint Pol. I 4, (I) 23, wo nach mythologischen und historischen Beispielen in der transitio auf dasSchulsystem verwiesen wird, das auch mit den figmenta als den elementa virtutis, d. h. mit der Fabel- und Dichterlektüre derUnterstufe beginne und erst dann zu anspruchvolleren Literaturformen weiterführe (vgl. dazu Anm. 550 und S. 51, 402 ff.).Nach dem Prinzip, daß jüngere und nähere Exempla rhetorisch wirkungsvollere Identifikationsmuster darstellen, können dereigene Erfahrungsbericht oder die Augenzeugenaussage in der Endposition einer Exempla-Reihe Steigerungscharakter haben:s. unten S. 234 ff.472 Pol. VI 28, (II) 82.25 f.: Et hic quidem non meus est sermo, sed quem omnium sapientum cetus concelebrat. Ebd. VII 15,(II) 155.21 f.: Si michi non credis, liber de Consolatione Philosophiae revolvatur attentius […] Ebd. III 12, (I) 213.19: Simichi non credis, vel Aquinati nostro aures accomoda.473 Pol. VI 27, (II) 81.2.24 f.: non tamen ego, sed Spiritus sapientiae […] non ego, sed Altissimus dicit et facit haec omnia.
207
besondere Vorliebe für solche entsubjektivierenden Transitio-Formen entspricht zweifellos der Abwehr vonad hominem-Argumenten, wie Johann sie gerade in Anbetracht seiner steten Betonung der Theorie-Praxis-Einheit instinktiv befürchten mußte. Darum hebt er auch im Prolog zum Policraticus den überpersönlichen,repräsentativen Charakter des Autor-Adressat-Verhältnisses zwischen ihm und Thomas Becket hervor undgibt sich selbst nicht nur als Verfasser, sondern auch als besserungsbedürftigen Empfänger der Kritik undLehren seines eigenen Buches aus!474 „Sollte jemandem etwas davon zu hart klingen, so sei ihm gesagt, daßnichts auf ihn gemünzt ist, sondern alles auf mich und meinesgleichen, auf jeden, der sich mit mir bessernwill.“ Auch im Metalogicon legitimiert er seine schriftstellerische Tätigkeit mit der Waffenhilfe seiner zuzitierenden „Freunde“ und „Lehrmeister“ und spricht ihnen als auctores (im etymlogischen Sinn) Dank aus;denn sie sind „Anstifter und Mehrer“ seiner literarischen Bildung.475 Von sich selbst als „Autor“ („Schreiber“,Zeuge und Gewährsmann) kann er nur in der Form des Sündenbekenntnisses sprechen, etwa wenn er Exemplafür concupiscentia rhetorisch
474 Zum Theorie/Praxis-Bezug vgl. §§ 45 f. – Ad hominem-Argument: vgl. ROTH 25 f.; MURPHY, Discourse (wieAnm. 446) 200 zum Einfluß der autoritativen Stelle Aug., Doctr. chr. IV 27.59–60 zu Matth. 23.3 (dicunt et non faciunt)auf die gesamte paränetische (insbesondere homiletische) Literatur des Mittelalters: Abundant enim qui malae vitae suaedefensionem ex ipsis suis praepositis et doctoribus quaerent […] dicentes: ‚quod mihi praecipis, cur ipse non facis?’ Ita fitut eum non obedienter audiunt, qui se ipse non audit, et Dei verbum […] simul cum ipso praedicatore contemnant. – Pol.Prol. (I) 15.1 ff.: Sic cum ineptias suas lector vel auditor agnoscet, illud ethicum [Hor. Sat. I 1.69–70] reducet ad animum,quia mutato nomine de se fabula narratur […] Sic dum alios doceat Seneca suum monet Lucilium. Ad Oceanum etPammachium scribit Ieronimus et aliorum plerumque castigat exessus […] Sed quid autem cuipiam asperius sonat, non inse quicquam dictum noverit, sed in meipsum et similes mei, qui mecum cupiunt emendari, aut in eos qui collapsi in fataomnem reprehensionem aequanimiter ferunt. Vgl. auch S. 336, 552 f., 578; Sap. 7.1: Sum quidem et ego mortalis homosimilis omnibus.475 Met. III, Prol. 118 f.: Et quia propriis non habundo, amicorum omnium iaculis indifferenter utor […] Et illorumhonorem desidero, qui michi contulerunt modicum illud quod scio vel opinor […] mei profectus non erubesco laudareauctores. Vgl. auch unten §§ 87 f.: Pol. Prol. (I) 16.7 ff.; S. 289, 392: „Waffenhilfe“ der auctores. Zum Motiv vgl. GodoLIEBERG, Poeta creator, Studien zu einer Figur der antiken Dichtung, Amsterdam 1982, 174 ff.: „Die Metapher vom Wortals Waffe“ (insbesondere mit Hinweisen auf Quint. 12.5.1; 10.1.29–30). MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 113, 193,198, 203–10 (Schutz- und Entlastungsfunktion der auctores für den mal. Schriftsteller). Zum Autor-Begriff vgl. auch obenS. 159 ff., Anm. 430 und unten Anm. 477.
208
in der selbstkritischen Pointe gipfeln läßt:476 „Frage mich selbst, der ich einer der elenden Sünder bin!“ Nurim negativen Exemplum der confessio spricht das Ich als authentischer Zeuge, doch auch hier nicht, um einsubjektives Ausdrucksbedürfnis zu befriedigen, sondern ebenfalls im Dienste einer „Sache“, für die dasBekenntnis als rhetorische Waffe objektiv erforderlich oder hilfreich ist.
b) Historische „Wahrheit“, Glaubwürdigkeit und Denkwürdigkeit
Das Paradox der Indifferenz und Überlieferungwürdigkeit divergierender „Historikermeinungen“ (über das historische Detail)erklärbar als rhetorisches Plausibilitätsmotiv (§ 57). Die „historische Kunst“ glaubhafter Fiktion aufgrund des (nicht nurmittelalterlichen) Begriffs einer philosophisch bedeutsamen „virtuellen Realität“ (§ 58). Fabula und historia bei Petronius,Johann von Salisbury und Petrarca (§ 59). Zwei Legitimationen für das autobiographische Exemplum: Johann „zitiert“ einpersuasives Zeugnis aus dem „Buch“ der Menschennatur; Petrarca berichtet eine (prätendiert) tatsächliche Bergbesteigung mitsubjektiv folgenreichem Lektüreerlebnis (§ 60).
57. Eine Konsequenz aus der ehrfürchtigen – von heute aus betrachtet: unselbständigen – Haltung den„glaubwürdigen Schriftzeugnissen“ gegenüber ist die eigenartig gespaltene Beziehung zu dem, was späterhistoriographische und philologische Akribie oder Quellentreue heißen sollte. So wichtig Johann die großenNamen der auctores sind, die ihm ein Exemplum als wahr und echt bezeugen, so gleichgültig geht er mit denin den historischen Quellen vorkommenden Namen um. Er schreibt etwa:477 „Ob es Heinrich oder Robertwar, tut nicht viel zur Sache […]“, oder, es sei nebensächlich, ob sich bei so ähnlich klingenden Namen eineGeschichte auf Pro tagoras oder P y thagoras beziehe.478 Anderwärts erklärt er die Verwechslung von Homermit Plato aus der Tatsache, daß große Männer mehrere Namen zu haben
476 Pol. III 4, (I) 176: meipsum interroga, qui miserorum unus sum! Gegen falsche psychologistische Deutungen rhetorischgemeinter Selbstdarstellung vgl. unten S. 233 f., 322 ff., 335 ff.477 Pol. VII 19, (II) 168.30 (über einen der Söhne Wilhelms des Eroberers): Henricus fuit an Rodbertus non multum refert.Hier wie etwa auch in II 17, (I) 99.24 entschuldigt sich Johann überdies mit einer Gedächtnislücke: Sollicitus quidam, nomenetenim a memoria excidit, etsi narrationis auctorem magnum teneam Augustinum. Vgl. oben Anm. 374 zum nomen certiauctoris. Hier wird klar, daß Johann unter auctor eines Exemplums einerseits den auctor rei gestae in der Ereignisebeneversteht, der facta und dicta hinterläßt, andererseits den auctor narrationis, der darüber berichtet.478 Pol. V 12, (I) 338.14 ff.: Nec multum refert ad propositum Pitagoras an Protagoras, sicut Quintiliano placet et Agellio,litigaverit; neque enim vis est in nomine, dum constet rem ambiguam sine temeritate diffiniri posse. Das geringe Interesseam historischen Detail hebt KORNHARDT (25) als ein Wesensmerkmal der Exempla-Praxis überhaupt hervor.
209
pflegen (polinomios extitisse).479 Johann erfindet sogar Namen, ohne dies zu verleugnen, etwa, wenn er zueinem bei Hieronymus anonym vorgefundenen Exemplum schreibt:480 „ein gewisser Publius Cineus Grecinus –oder wenn man lieber einen andern Namen wählt […]“. Von Johann dürfte auch die Taufe des bishernamenlos überlieferten Piraten aus dem berühmten Alexander-Exemplum auf den Namen Dionidesstammen.481
Da es so wenig auf das konkrete historische Detail ankommt und, wie es öfter heißt, doch allein auf denmoralischen „Nutzen“ einer wohlbezeugten Geschichte, könnte man annehmen, Johann hätte sich mit jenerin der homiletischen
479 Siehe unten Anm. 485.480 Pol. V 10, (I) 328.9 f.: Tale aliquid in veterum Romanorum scriptis invenies. Cum Publius Cineus Grecinus (aut si aliopotius dicitur nomine) argueretur ab amicis […] respondit. In Johanns Quelle, Hier. Adv. Jov. I 48, (PL 23) 292 B, fehltder Name: Legimus quemdam apud Romanos nobilem, cum eum amici arguerent […] dixisse. (Auch in der Primärquelle,Plutarch, De nuptialibus praeceptis 22 [Stobaeus serm. 72] fehlt „Grecinus“). Für MARTIN, Uses of Tradition 67 ist diesein Zeugnis für Johanns Absicht, die wenigen wirklich Gelehrten mit einem kleinen esoterischen Wink auf die ironischeSpielhaftigkeit seiner gelehrten Quellen-Manipulation hinzuweisen. Dazu vgl. oben S. 202 f.481 Pol. III 14, (I) 225.2 nach Aug. Civ. IV 4. MARTIN (Manuscripts 19) hat überzeugend nachgewiesen, daß Johann den inseiner Quelle fehlenden Namen sowie Alexanders Antwort frei erfunden und nicht, wie seit dem 19. Jh. von verschiedenenAltphilologen behauptet, einer heute verlorenen antiken Quelle (wie Ciceros De republica oder Caecilius Balbus) entnommenhat. Bereits SMALLEY (Friars 241) vermutete dies, da es im Mittelalter insgesamt nur die beiden Versionen von Augustin(Kurzfassung) und von Johann von Salisbury (erweiterte Fassung) gab. Beide wurden im MA auch gelehrt „quellenkritisch“miteinander verglichen. Bei einem dieser Vergleiche löste der Franziskaner Vital du Four das Problem so, daß er annahm, derPol. sei ein antikes Werk, das Augustin hier verkürzend zitiert habe (s. oben Anm. 335). Zur Tradition des Piraten-Exemplums vgl. CARY (wie Anm. 279) 95 ff., der generell festhält, daß dem MA Augustins für uns berühmteherrschaftsfeindliche Deutung (quid sunt regna nisi magna latrocinia) ideologisch unverständlich blieb und zu der geradevon Johann v. S. beförderten Umdeutung der Anekdote im Sinne der Herrscher-clementia Alexanders für latrones führte.Neben dem Speculum morale sacrae Scripturae des Vital du Four, das eine überaus reiche Überlieferung bis zur frühenNeuzeit hatte, sind weitere „Multiplikatoren“ der Anekdote die Weltchronik des Ranulf Higden und das CompendiloquiumJohanns von Wales. Alle hängen von der Pol.-Version ab. TAYLOR (wie Anm. 337) 46 macht wahrscheinlich, daß Chaucer(The Manciple’s Tale 226–34) diese Fassung aus dem Polychronicon Ranulfs (III 422–4) bezogen hat, die ihrerseits vonJohann von Wales abhängt. Vgl. auch L. THUASNE, Villon, Testament, 1923, II 111, III 613–623; R. GUIETTE,Alexandre et Diomedès, in: ders.: Forme et sénéfiance, Genf 1978, 135–245 zu Villons bisher verkannter Übernahme(einschließlich der positiven Alexanderwertung) aus der Foulechat-Übersetzung des Policraticus (wie oben Anm. 342).
210
Exempla-Tradition beliebten Anonymität der quidam und aliqui begnügen können;482 doch wir finden ihnganz im Gegenteil häufig damit beschäftigt, verschiedene Historikermeinungen gegeneinander abzuwägen, jaeine Art „Quellenkritik“ zu treiben. So zählt er nach beliebter Scholiastenmanier alle möglichen Varianten fürden Namen des Überläufers in der Fabricius-Geschichte auf, um dann zu schließen: non multum curo, dieHauptsache sei doch wohl, daß der römische Held den Verrat verachtet habe.483 Er zitiert zwei Versionen fürden Brand der Kapitolbibliothek, nach denen entweder Gregor der Gr. oder aber Kaiser Commodus derBrandstifter gewesen sein soll, um dann zu schließen, das eine widerspreche dem andern nicht, da dieBibliothek zu verschiedenen Zeiten zweimal gebrannt haben könnte.484 – Dieselbe Anekdote zur Todesarteines berühmten Weisen, der, als er eine einfache Frage nicht beantworten konnte, sei es aus Scham, sei esdurch einen Lachanfall ums Leben kam, findet Johann einmal auf Plato, einmal auf
482 Siehe oben S. 115 ff.483 Pol. V 7, (I) 311.26 ff.: Pace mea decertent in casu isto Valerius Maximus et Claudius Quadrigarius, contendentes denomine et officio proditoris. An Timocares fuerit iuxta Valerium pater illius qui in regis convivio pocula ministrabat, ansecundum Quadrigarium Nicias medicus, non multum curo, dummodo constet consules Romanorum eo subegisse Pirrum,quod perfidiam fuerant aspernati. Zu der komplizierten Klitterung indirekter Quellen vgl. den Apparat von WEBB undMARTIN, Manuscripts 22, Nr. 23. Denn auch für meine Belange non multum curo. – Zur Methode vgl. noch Pol. VII 1, (II)92.26 ff.: Nec moveat, si qua eorum, quae hic scribuntur, aliter inveniantur alibi, cum et historiae in diversis gestorumcasibus sibi invicem reperiantur contrariae, sed ad unum utilitatis et honestatis proficiunt fructum. Zur historiographischenIndifferenzformel unter dem Primat philosophisch-metahistorischer Sinngebung vgl. S. 216 ff., 228, 353. MINNIS(Autorship, wie Anm. 337, 36–8) wendet sich mit Recht gegen die Übertreibung, das MA habe sich überhaupt nicht umTextphilologie, sondern lediglich um die in den Texten verborgene „Wahrheit“ gekümmert, indem er auf ähnlicheFragestellungen (etwa hinsichtlich der ursprünglichen Verfasserschaft des Buches Job) und ähnliche Lösungsversuche imSinne des Ausgleichs zwischen Quellenkritik und significatio, sensus litteralis und sensus allegoricus hinweist. Wichtigerals solche Apologie für die „Wissenschaftlichkeit“ des Mittelalters, die unsere eigenen Wissenschaftsbegriffe zugrundelegt,finde ich jedoch die mentalitätsgeschichtliche Feststellung, daß gerade das, was uns wie „kritische Philologie“ erscheint,keinen Selbstzweck darstellte, sondern in einem effektvoll unterstützenden Sinn – d. h. rhetorisch – dem moralisch-geistlichen Wahrheitsziel zu dienen hatte. Vgl. dazu auch unten S. 400, Anm. 502 (J. BEER).484 Pol. VIII 19, (II) 371.1 f.: Sed haec sibi nequaquam obviunt, cum diversis temporibus potuerint accidisse. ZumNachleben dieser ursprünglich lokalrömischen Gregorlegende dank dieser Policraticus-Stelle vgl. LINDER (wie Anm. 321)328 und T. BUDDENSIEG, Gregory the Great, the Destroyer of Pagan Idoles, The History of a Medieval Legend concerningthe Decline of Ancient Art and Literature, in: JWCI. 28 (1965) 44 ff. allgemein zum Bild des Kulturzerstörers.
211
Homer bezogen. Dieses charakteristische Beispiel einer Anekdotenkonkordanz sei im Wortlaut angeführt; eszeigt gut, mit welch onomastischem Scharfsinn und welch eigenartig idealistischem Wahrheitsbegriff die sichwidersprechenden Textzeugen in Einklang gebracht werden:485 „Über den Tod Platos hatten VerschiedeneVerschiedenes geschrieben, aber wahrscheinlich ist, daß […] er sein Leben nicht mit Gelächter beendet hat.Was einige von ihm überliefern: daß er aus Scham den Geist aufgab, weil er ein von Seeleuten vorgebrachtesProblem nicht habe lösen können, beruht nachweislich auf einer falschen Lesart des Namens. Was immer dieFabeln der Griechen über ihn erzählen, das berichtet Valerius Maximus von Homer, nicht von Plato. Dennochist auch diese Geschichte über Plato verbreitet worden, weil es Leute gab, die Homer aufgrund seineraußergewöhnlichen Weisheit als Homonym für Plato bezeichneten […]. Es steht in der Tat fest, daßhervorragende Männer vielnamig waren.“ – Die Frage ist berechtigt, ob nicht die Absicht, gelehrtes Wissenum jeden Preis auszubreiten, zu dem kaum notwendigen Referieren manifest unplausibler Historikeransichtengeführt habe, wie etwa der, Themistokles habe in seinem Kampf gegen Xerxes mit Aristoteles, statt Aristideszu tun gehabt. Johann sagt dazu nicht etwa, solches sei unmöglich, sondern nur, es sei weniger plausibel, da dieratio temporis darauf hinweise, daß Themistokles und Aristoteles keine Zeitgenossen gewesen seien.486
485 Pol. VII 5, (II) 111: De morte eius diversi diversa scripserunt, sed probabilius est eum […] vitam risui non cessisse.Nam quod de eo nonnulli tradunt quia verecundia motus emisit spiritum, eo quod nautarum propositam non potuit solverequaestionem, constat nominis errore compositum. Quicquid enim de eo Grecorum loquentur fabulae, hoc de Homero, nonPlatone Valerius Maximus refert. Ex eo tamen et hoc vulgatum est, quia fuerunt qui Homerum aequivocum Platonis dicerentpropter excellentiam sapientiae. […] nam viros nobiles certum est polinomios extitisse. Dasselbe Exemplum findet sich auchin Pol. II 26, (I) 141, wo als Quelle Flavianus, De vestigiis philosophorum angegeben wird (dazu s. unten Anm. 509).Primärquelle ist nach WEBB eine pseudo-herodotische Homer-Biographie. Auch diese Anekdote wurde im Spätmittelalterüber die Exzerpt-Zwischenstationen des Compendiloquium von Johann von Wales und des Polychronicon Ranulfs (III 350 f.)berühmt; vgl. TAYLOR (wie Anm. 337) 46; vgl. oben Anm. 481. – Zu Val. Max als historischer Quelle s. S. 125 f.,A. 395, 698. – Die Gleichsetzung von Homer und Plato stammt vielleicht aus der lobenden Antonomasie: „Plato – derHomer der Philosophen“, die Cic. Tusc. I 32 dem Panaitios zuschreibt. So später auch bei Montaigne, Essais II 36 (wieAnm. 192) 732.486 Pol. VIII 14, (II) 331.14 ff.: Huius rei Temistocles testimonio est et exemplo […] Ei ergo datus est Aristides vel, ut aliisplacet, Aristotiles, etsi supputata ratio temporis indicet Temistoclem et Aristotelem coevos non fuisse. Das Argument aratione temporis gehört seit Hieronymus zur bibelexegetischen, später auch kirchenrechtlichen Interpretationstechnik (vgl.S. 423 f., A. 636, 654: circumstantiae) und ist nicht, wie A. BORST (Geschichte an mal. Universitäten, Konstanz 1969,12 f., 21 ff.) aufgrund einiger Abaelard-Stellen annimmt, allein auf ein neues Geschichtsverständnis und eine Schärfung desSinnes für Anachronistisches zurückzuführen (dazu vgl. vielmehr unten §§ 103, 108, 111 f.). Sicher aber ist dieserheuristische Gesichtspunkt ein Zeichen für das zunehmende Bedürfnis nach Beweismitteln aller Art in einer Zeit neuerjuristischer, politischer und philosophisch-theologischer Kontroversen. Vgl. GRABMANN, Schol. Meth. I 234 ff.;GRÜNDEL (wie Anm. 4) 16 ff.; LANG (wie Anm. 4) 77 f. und z. B. Rhet. eccl. (wie Anm. 8) 25 ff., bes. 30 zum statustemporis und modus conciliandi secundum statum praesentis temporis et illius temporis; ebd. 40–3 zur refutatioexemplorum ex tempore mit einem so brisanten Beispiel wie diesem: Jesus habe niemanden zum Glauben gezwungen,folglich sei gewaltsame Mission nicht rechtens: Dies sei mit dem Zeitargument zu widerlegen. Erst nach Konstantin habesich nämlich erfüllt: adorabunt eum omnes gentes (Ps. 71.11), und die Reichskirche habe daraus das heilsgeschichtlicheRecht zur Zwangsbekehrung begründet (vgl. unten Anm. 906 zum Thema).
212
Johann fühlt sich geradezu moralisch verpflichtet, alle tradierten Meinungen seinerseits weiterzugeben, auchdiejenigen, die er nicht teilt. In keineswegs nur literarisch-gelehrtem Zusammenhang schreibt er über dieübernatürlichen Zeichen beim Tode Christi (in gutem Glauben an die wirkliche Augenzeugenschaft desPseudo-Areopagiten):487 „Ich weiß, daß seither mehrere anderes gesagt haben, doch ich ziehe Dionysius vor,weil die anderen (nur) ihrer eigenen Meinung folgen.“ Er schließt die schwächeren Argumente nicht aus,sondern stellt sie weiterer Diskussion zur Verfügung. Dabei folgt er seinem Vorbild Hieronymus, dessenBibelphilologie er zu dem Maßstab aller „Textkritik“ zu machen scheint. Dies wird deutlich in seinemTyrannenexemplum vom Assyrerkönig Salmanasar, einem weiteren „vielnamigen“ Helden:488 „Niemandmöge daran Anstoß nehmen, wenn dieser mit immer wieder anderen Namen in verschiedenen Geschichtenbezeichnet wird. Denn nach hebräischer Tradition war er, wie Hieronymus bezeugt, ein pentanomius.Salmanasar hat nämlich auch die fünf Namen Sennacherib, Phul, Teglad, Phalasar und
487 Pol. II 11, (I) 84 f.: Scio plures aliter hinc locutos; sed Dionisium praefero, quia quod vidit scripsit; alii propriassequuntur opiniones. Zum Wert der Augenzeugen vgl. auch unten § 60, S. 218 ff., 222 f., 226, 237, Anm. 490.488 Pol. VIII 21, (II) 380.26 ff.: Nec moveat si alio et alio nomine censeatur in diversis historiis, quia pro traditioneHebreorum, sicut Ieronimus auctor est, idem pentanomius extitit. Dictus est Salmanasar et Sennacherib et Phul et TegladPhalasar et Sargon. Nisi enim polinomius habeatur, historicorum quadam contrarietate dissidentium quandoque vacillabitauctoritas. Betrifft IV Reg. 18 nach Hier. Comm. in Isaiam 36.1 (PL 24) 381; 20.1 (ebd.) 188. Zu polinomius vgl. Ch. A.BRUCKER, A propos de quelques hellénismes de Jean de Salisbury et de leur traduction au XIVe s., in: ALMA 39 (1974)85–94.89. – Auch GUENÉE, Hist. et culture hist. 132, betont, daß der einzige Anlaß zu „historischer Kritik“ im MA dasNicht-Übereinstimmen verschiedener auctoritates darstellte.
213
Sargon. Gälte er nicht als polynomius, so würde die Autorität der unter sich abweichenden (biblischen)Historiker durch einen gewissen Widerspruch gelegentlich ins Wanken geraten.“ Die auctoritas der Zeugnissevor Widersprüchen zu schützen, ist das zentrale Motiv für Johanns Harmonisierungen, die sich durchIndifferenz gegenüber historischen Fakten ebenso auszeichnen wie durch skrupulöse Vollständigkeit beimZitieren divergierender Berichte.489 Sein primäres, sowohl moralisch wie argumentativ-rhetorisch begründetesInteresse gilt der autoritativen Gültigkeit, der verläßlichen Schriftkundigkeit des Vorgebrachten, dem„authentique et approuvé“, wie Bernard Guenée schon in der Überschrift eines wichtigen Aufsatzes zurhistorischen Kritik im Mittelalter das ausschlaggebende Kriterium aller mittelalterlichen Historizitätnennt.490 Exempla sollen nach dieser Auffassung authentica sein, durch einen authentischen Zeugenhistorische Dignität beanspruchen können, sonst verfehlen sie als „apokryphe“ Geschichten und bloßesGerücht auch ihre persuasive Aufgabe. Historiae gehören zum offiziell anerkannten, schriftlichen Zweig derÜberlieferung, fabulae zum ungesicherten, mündlichen. „Glaubwürdigkeit der Geschichte und Berühmtheit derTradition“ – non modo
489 „Quellenkritik“ als Vergleich historiographischer Autoren und Meinungen bieten auch Pol. IV 5, (I) 249.15 über eineErzählung von Petronius: An vera sit relatio et fidelis, incertum est, et de facto Caesaris diversi diversa sentiunt (s.S. 222 ff.); Pol. VIII 21, (II) 381 ff. über Julian; zu dessen Tod (nach Cassiod. Hist. Trip. VI 47) 393.5 ff.: qui veroiustissimum tulit vulnus, hactenus ignoratur. Sed alii quendam invisibilium hoc intulisse ferunt, alii unum pastorumIsmahelitarum, alii militem fame et itinere fatigatum, sed sive homo, sive angelus fuerit, patet quia divinis iussionibusministravit. Pol. VII 5, (II) 110 unten in Anm. 891.490 B. GUENÉE, ‚Authentique et approuvé’, Recherches sur les principes de la critique historique au moyen age, in: Lalexicographie du latin médiéval …: (Colloques du CNRS 589) Paris 1978, 215–29 (neuerdings auch in: ders., Politique ethist. [wie oben Anm. 181] 253–264); vgl. auch ders., Hist. et culture historique 130 ff., 141 ff. – Diese Art „historischerKritik“ durch Sicherstellung der „würdigen“ auctoritates erhält im MA oft auch ein selbstzwecklich kompilatorischesElement (Anhäufung attestierender Quellen als Sammlung gelehrter Lesefrüchte). Vgl. S. 350 f. und RAY (wie Anm. 360)47 f.; E.M. SANFORD, The Study of Ancient History in the MA, in: Journ. of the Hist. of Ideas 5.1 (1944) 21–43, hier42 f.; MELVILLE, System 63 f.; de GANDILLAC (wie Anm. 337) 18 f.; PARTNER (wie Anm. 25) 185; MARROU, S.Augustin 132, 146 f.; ROUSSET (wie Anm. 361) 629 ff.; B. BLUMENKRANZ, La survie médiévale de s. Augustin atravers ses apocryphes, in: Augustinus Magister, Paris 1955, I 1003–18, hier 1011. Für die ideelle Hauptgrundlage dieser(tatsachenfernen) historischen Methode in der Buchreligion des Judentums s. A. MOMIGLIANO, Essays in Ancient andModern Historiography, Oxford 1977, 194 ff; WEHRLI, Lit. (wie Anm. 55) 97 ff. – Für die Exempla ist dasBeglaubigungsprinzip in beiden Traditionen – der historisch-rhetorischen und der homiletischen – grundlegend: imhomiletischen Exemplum tritt in Anbetracht mündlicher Quellen die Berufung auf Augenzeugen und ehrwürdige, sozialhochstehende Zeugen stärker hervor (vgl. S. 226, 237), im rhetorischen Exemplum diejenige auf „buchhafte“ Zitatautoritäten(magna nomina antiquitatis und certi auctoris nomen; s. S. 158 f., 239 ff., obwohl beide Zeugenarten in beidenExemplasorten vorkommen; vgl. WELTER 81; DAXELMÜLLER, Exemplum 631 ff.; KLEINSCHMIDT 79, 87;BATTAGLIA 470; SMALLEY, Friars 25 ff., 39; MEHL 237 ff.; GEBIEN 19, 56; DELCORNO (wie Anm. 108) 400 ff.;GEREMEK 168 f., 176. Die stete Betonung der fides und auctoritas historischer Exempla dürfte andererseits in einerBeziehung zu Johanns juristischem Interesse an quasi urkundlicher Dokumentation stehen, da er im Prolog zur Hist. pont.(3) in einer Aufzählung der Vorteile des Geschichtsstudiums nach der geschichtstheologischen Providenzerkenntnis (s.S. 155 ff.) und der moralischen Lehrhaftigkeit (s. S. 9 f.) als den dritten Nutzen der Geschichte für das Lebenoriginellerweise den Rechtsbeweis nennt: Valet etiam notitia cronicorum ad statuendas vel evacuandas prescriptiones etprivilegia roboranda vel infirmanda. Dazu vgl. GUENÉE Hist. et culture historique 26 f.
214
fides historiae sed celebris traditio491 – sind für Johann die beiden (häufig in einz zusammenfallenden)Garanten historischer Wahrheit.
58. Dieser Wahrheit muß, wo sie durch widersprüchliche oder zu wenig „berühmte“ Überlieferung gefährdetist, notfalls nachgeholfen werden. Was uns dabei wie Fiktion und Geschichtsklitterung erscheint, ist derAbsicht nach das Gegenteil: Fiktiven Geschichten Historizität zu verleihen, heißt, diese glaubhaft,wahrscheinlich, rhetorisch wirksam und damit „wahr“ machen. Benedetto Croces „se non è vero, è bentrovato“ erscheint wie ein ästhetisierender Nachklang dieser moralischen Überzeugung, die Johann anläßlicheiner Anekdote über Marcus Antonius so ausdrückt:492 „Dieses ist entweder
491 Pol. VI 17, (II) 45.11; vgl. auch oben Anm. 366 zur Traditionspflege nach dem Policraticus-Prolog. – LE GOFF, in:BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT 54 zitiert Caesarius von Heisterbach: […] sed miracula non sunt in exemplum trahenda.Hoc etiam scias quod huiusmodi scripturae autenticae non sunt. Unter miracula sind jedoch nicht „Wunder“, sondernMirakel, Wunderberichte im Sinne einer apokryphen Gattung zu verstehen. – GUENÉE (Hist. et culture historique (67)belegt diesen Authentizitätsbegriff noch bei frühhumanistischen Historiographen des 14. Jhs., die sich von der oralenTradition mit ihren „bäurischen Lügengeschichten“ abwenden und sich an bewährte „Bücher“ und Autoren halten wollen.Hier begegnet vielleicht erstmals die moderne Dichotomie der Exemplaforschung von volksliterarischen und gelehrten„Geschichten“, wobei die Humanisten einen so anekdotischen Schriftsteller wie Valerius Maximus als ernsteGeschichtsquelle benützten. Dazu ausführlicher unten S. 227 ff., Anm. 520.492 Pol. VIII 13, (II) 327.23: Haec quidem aut vera fuerunt aut verisimilia. Nichil enim hiis neque credibilius fingi nequevehementius exprobrari neque manifestius ostendi potuit (fingi könnte freilich auch mit „gestalten“ übersetzt werden; diesändert aber nichts am Vergleich von historischer Wahrheit und rhetorischer Wahrscheinlichkeit. Die Antonius-Anekdoteentnahm Johann Quint. IV 2.123–4, schreibt sie aber wie dieser einem Marcus Caelius zu.) Noch deutlicher ist vielleichtMet. I 7, 23: Nam ut Cicero est auctor [Parad. praef. 3], nichil est tam incredibile quod non dicendo fiat probabile. Zumciceronischen Hintergrund vgl. GAILLARD, Historia ornata (wie Anm. 508) 43 f. (doppelte Aufgabe des Historikers,bestehend aus narrare oder informieren und ornare oder mitteilend zur Geltung bringen). Zum Fiktionsbegriff Johanns s.§§ 49, 87 ff. Zum Verfahren, einer Geschichte durch Fehlzuschreibungen und erfundene Kronzeugen Autorität zu verleihenvgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 145; FUHRMANN, Mönchsgeschichten 77, 90 ff.; RAY (wie Anm. 360) 47:„The medieval veritas historiae mainly bound the chronicler to use a biblically warranted standard in making good deedslook good and bad deeds bad, with of course, little standing in the way of causing the good to seem better and the badworse.“ Man könnte dasselbe auch rhetorisch fassen als Plausibilisierung rohstofflicher gesta für ein Persuasionsziel. DieRhet. ad Her. (I 9, 16) empfiehlt ausdrücklich, die „Tatsachen“ dem Vorverständnis der Rezipienten anzupassen undwahrscheinlich zu machen: Veri similis narratio erit, si ut mos, ut opinio, ut natura postulat, dicemus […] Si vera res erit,nihilominus haec omnia narrando conservanda sunt, nam saepe veritas, nisi haec servata sint, fidem non potest facere; sinerunt ficta, eo magis erunt conservanda. Vgl. entsprechend Cic. Brut. 11.42 (cf. Part. 14.50): Concessum est rhetoribusementiri in historiis, ut aliquid dicere possint argutius; zum Mittelalter etwa Ps.-Robert Grosseteste, Summa philosophiae(ed. L. BAUR, Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MAs 9, Münster 1912) 288 f.; De historiographis (u. a. zu Val. Max.): Quodest generale paene omnibus historicis, qui pro affectu vel levi relatu casus descripserunt et quandoque parvamagnificaverunt vel e contrario magna suppresserunt et nonnumquam non gesta sola sua imaginatione vel suspicioneconcepta descripserunt veraciterque acta omiserunt. Weitere derartige Stellen zur rhetorischen Wesensbestimmung derHistoriographie bei SCHOLTZ (wie Anm. 28) 349; v. MOOS, Poeta … 118 ff.; CARTER (wie Anm. 326) 163 ff. undunten Anm. 498, 530 f.
215
wahr oder wahrscheinlich. Nichts nämlich kann glaubhafter erfunden […] und anschaulicher dargetanwerden.“ Nicht die Faktizität begründet die historische Wahrheit, sondern die Vertrauenswürdigkeitattestierende Tradition und die innere Wahrscheinlichkeit, wie sie Aristoteles in der Poetik als das„Mögliche“ begreift und wie sie das Mittelalter im allgemeinen nach der rhetorischen Erzählartenlehre alsargumentum versteht, d. h. als die „virtuelle Realität“ von Ereignissen, die sich hätten ereignen können.493
493 „Virtuelle Realität“: KLEINSCHMIDT 79 f., 84 nach Isid. Et. I 44.5: etsi facta non sunt, fieri tamen possunt. Nochparadoxer formuliert SCHÖNE, Emblematik (wie Anm. 287) 28: „potentielle Faktizität“ für jene verifizierbaren Bildbezügeaus Geschichte, Natur und Mythologie, die „jederzeit in den Gesichts- und Erfahrungskreis des Menschen treten“ und damitauch die rhetorische Funktion eines certum gegenüber einer strittigen causa übernehmen. – Zur argumentum-Theorie unddem darauf beziehbaren Gedanken des höheren philosophischen Verallgemeinerungsgrads nach Arist. Poet. 9 s. obenAnm. 147 (mit Hauptstellen der antiken Rhetorik), Anm. 288 (ficta narratio/verax significatio); vgl. S. 401 ff., 406 f. Zumhistoriographischen durch Tradition und argumentum-Plausibilität bestimmten Wirklichkeitsbegriff des MA’s vgl. G.MELVILLE, Zur ‚Flores’-Metaphorik in der mal. Geschichtsschreibung …, in: HJb 90 (1970) 65–80; ders., System 63 ff.;BOEHM (wie Anm. 25) 685 f., die in Anm. 490 genannten Beiträge und CIZEK (wie Anm. 531) passim.
216
Eine Geschichte ist dann wahrscheinlich, wenn sie so vermittelt wird, daß sie wie eine wirklich geschehenewirkt. Die Tatsächlichkeit hat darauf keinen ausschlaggebenden Einfluß: Sie kann der Persuasion vielleichtnützen (für Aristoteles ist, was geschehen ist, gelegentlich auch wahrscheinlich); sie kann im Gegenteil aberauch rhetorisch-narrativer Nachhilfe bedürfen (für den Auctor ad Herennium ist die historische Wahrheitohne die wahrscheinliche Erzählung oft unglaubwürdig).494 Am Wirklichen interessiert das Wirkende.
Die weit über das Mittelalter hinausreichende Denkform, die hinter solchem im modernen Sinneunhistorischen Umgang mit der Geschichte steht, beleuchtet Aristoteles in der ‚Politik‘, wo er historischeBelegbeispiele (also eigentliche Exempla) für Attentat und Tyrannenmord anführt und dabei (offenbaraufgrund widersprüchlicher Überlieferung einer Anekdote über Sardanapal) einschränkend erwähnen muß:495
„falls die Geschichtenerzähler
494 Arist. Poet. 9, 1451b: „Auch wenn er über wirklich Geschehenes dichtet, ist er darum nicht weniger Dichter. Dennzuweilen kann wirklich Geschehenes dem entsprechen, was wahrscheinlich und möglich gewesen wäre …“ Vgl. WASZINK(wie Anm. 125) 194 ff.; RÖSLER (wie Anm. 125) 309 f. – Rhet. Her. I 9.16 s. oben in Anm. 492. – KESSLER (Modell49 f.) betont mit Recht, daß der Moderne die (im Mittelalter noch lebendige) Einsicht in das rhetorische Grundmodell derGeschichtsdarstellung abhanden gekommen sei; danach bedeute „Wahrheit“ nicht Übereinstimmung mit der Realität, sondernGeltung als Realität. Vgl. auch oben Anm. 36, 371, unten S. 234 f. DAXELMÜLLER, Exemplum und Fallbericht 156spricht treffend von einer „unterstellten Wahrhaftigkeit“ aller Exempla. G.H. NADEL, Philosophy of History beforeHistoricism, in: History and Theory 3 (1964) 291–315, hier 299 f. (auch in: ‚Essays in hon. Karl R. POPPER’, N.Y. 1962),zu Ciceros Idee einer spezifisch rhetorischen „Wahrheitspflicht“ sogar für den Historiographen, der sich vom phantastischübertreibenden Redner ebenso unterscheidet wie vom unrhetorischen Antiquar und Geschichtsforscher der Neuzeit undGegenwart.495 Pol. V 10, 1311b 40 ff. – R. ZOEPFFEL, die dieser unscheinbaren Nebenbemerkung theoretische Bedeutsamkeitabgewonnen hat, schreibt dazu (68 f.): „… der ‚historische Sardanapal’ aber ist an sich gleichgültig. Von seinem ‚Telos’,seinem ‚Erkenntnisinteresse’ her ist Aristoteles weder im antiken noch im modernen Sinne des Wortes ein Historiker; was eran Tatsachenforschung, Historia, getrieben hat, war ihm Mittel zum Zweck einer höheren philosophischen Erkenntnis. Undalles, was man nicht um seiner selbst, sondern um der Erlangung einer anderen Sache willen tut, ist für ihn bekanntlichnotwendigerweise weniger wertvoll.“ (Zum philosophischen Erkenntnisinteresse Johanns in diesem Sinn s. unten §§ 105,109).
217
dies wahrheitsgemäß berichten; falls es für jenen Mann nicht stimmt, so dürfte es doch auf einen anderenzutreffen.“ Für die Gleichgültigkeit gegenüber aller nicht dem theoretischen Erkenntnisinteresse dienendenTatsachenforschung spricht paradigmatisch auch folgendes nach-mittelalterliche Zeugnis: Montaignegesteht,496 weder könne noch wolle er Historiker sein, da er mit der Vielfalt der „Urteile“ – m.a.W. mit denquellenkritischen Streitfragen – nicht zurechtkomme: „Plutarch (lebte er noch) würde uns gerne erklären, wieer damit fertig geworden ist; es sei (würde er sagen) das Werk der anderen, daß seine Beispiele insgesamt undfür alle ihre Zwecke der Wahrheit entsprechen; daß sie aber der Nachwelt nützen und einen Glanz erhalten,der uns zum Guten voranleuchtet, das sei sein Werk. – Möge ein anderer für mich historische Kommentareschreiben, wenn ich schlecht kommentiere. In meinen Untersuchungen über die Sitten und Verhaltensweisensind auch die legendären Zeugnisse, wenn sie nur möglich sind, so gut wie die wahren. Geschehen oder nichtgeschehen, in Paris oder in Rom, dem Hans oder dem Heinrich, immer lehrt mich die berichtete Geschichteeine Eigenheit der Menschennatur.“ Ganz abgesehen von Späterem, etwa Nietzsches bekannterHistorismuskritik, zeigen diese Stellen hervorragend, daß das historische und pseudohistorische Exemplum desMittelalters, wie es der Policraticus repräsentativ vorstellt, in der Vernachlässigung des Faktischen proptersignificationem nichts ausschließlich oder spezifisch „Mittelalterliches“ an sich hat. „Die überhistorischenMenschen“ aller Zeiten (m.a.W. die Exempla-Schriftsteller) kommen „zur vollen Einmütigkeit des Satzes:Das Vergangene und das Gegenwärtige ist ein und dasselbe, nämlich in aller Mannigfaltigkeit typisch gleichund als Allgegenwart unvergänglicher Typen ein stillstehendes Gebilde von unverändertem Werte und ewiggleicher Bedeutung“.497
496 ‚Essai’ (wie Anm. 192) I 21, 105: „Plutarch nous diroit volontiers de ce qu’il en a faict, que c’est l’ouvrage d’autruy, queses exemples soient en tout et pour tout veritables; qu’ils soient utiles à la postérité, et presentez d’un lustre qui nous esclaireà la vertu, que c’est son ouvrage.“ – Ebd. 104: „Si je ne comme bien, qu’un autre comme pour moy. Aussi en l’estude que jetraitte de nos moeurs et mouvemens, les tesmoignages fabuleux, pourveu qu’ils soient possibles, y servent comme les vrais.Advenu ou non advenu, a Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c’est tousjours un tour de l’humaine capacité, duquel je suisutilement advisé par ce récit.“ Zu Montaignes Exemplum-Begriff aufgrund dieser u. a. Stellen vgl. TOURNON 38 ff. ZuPlutarch s. auch § 47; Anm. 1004. Der „Kommentar“-Begriff entspricht dem unten Anm. 522 (auch zu Petrarca)Angemerkten. Zu „lustre“ vgl. unten Anm. 508 zur historia ornata bei Cicero.497 Siehe oben Anm. 288 (propter significationem nach Augustinus). – Zitat: Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen II:Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, (Kröner Ausg. Stuttgart 1938) 109. Zur vor-historistischenGeschichtstheorie vgl. auch unten §§ 105 ff. – Der von HONSTETTER (123 ff., 197 und passim) vertretenen Hauptthese,Augustinus habe seine Exempla aus der römischen Geschichte kritisch auf ihre Historizität überprüft und die traditionelleVorbildfunktion derselben mit der Tatsächlichkeit der berichteten Ereignisse konfrontiert, vermag ich grundsätzlich nicht zufolgen. Auch Augustinus kannte keinen historischen ‚Telos’ (s. oben Anm. 495), nur eine von „Interessen“ gelenkteSelektion aus den Geschichten, und diese Interessen waren radikal andere als die der heidnischen exempla maiorum-Benützer(vgl. oben §§ 24 ff.). Was wie historische Kritik im modernen Sinn aussieht, ist auch hier ein rhetorisch bewährtes Mittelder refutatio gegnerischer Exempla durch den Nachweis fehlender Sachgemäßheit (vgl. oben § 54, unten § 74 und Anm. 2,13, 210a, 214, 621) gerade zur Abwertung der facta gegenüber den facienda und der ratio).
218
Zwischen dem, was heute „äußere Wirklichkeit“ oder „vorliterarisches Realitätssubstrat“ heißen würde, unddem, was in den ausgewählten Zitaten das „philosophisch Allgemeine“, die „höhere Erkenntnis“, das„Nützliche“ oder den „wahren Sinn“ meint, vermittelt stets irgendwie die rhetorische oder poetische Spracheals Kunst des Wahrscheinlichen oder der Konzentration auf das Wesentliche.498 Diese „Vermittlung“ läßt sichallerdings mit modernen Informationsbegriffen nicht adäquat beschreiben, da gerade nicht Tatsachen undInformationen ihr Gegenstand sind, sondern zwei Arten von Zeugen (Informanten): entweder Augenzeugenoder Überlieferungszeugen. Ungeachtet der theoretischen Vorstellung vom höheren Wert derAugenzeugenschaft,499 bestimmt zwischen diesen beiden (geschichtswissenschaftlich nicht weiter zuhinterfragenden) Informanten nicht etwa die Nähe zu den Fakten die Rangfolge, sondern die rhetorische und„signifikative“ Qualität in einem bestimmten Beglaubigungszusammenhang. So kann von Fall zu Fall dieBerufung auf gültige literarische Tradition höhere oder geringere Überzeugungskraft haben als diejenige aufdas unmittelbare Erleben und die direkte Beteiligung; entscheidend ist einzig, daß mögliche Zweifel an derGlaubwürdigkeit der beiden Zeugnisarten im jeweiligen Kontext situationsgemäß und für das Verständnis desAdressaten angemessen beseitigt werden.
498 Vgl. ZOEPFFEL 12 ff. zum Hauptkriterium der Unterscheidung von Dichtung und Historia (bzw. poetischer undhistorischer Tätigkeit) in Aristoteles, Poetik 9: stimmige Konzentration der Ereignisse zur Tragödie versus platteshistoriographisches Nacherzählen tendenziell unendlicher Fakten. Vgl. auch § 106; KOSELLECK, Vergangene Zukunft 278zu Lessings Aristotelesrezeption. SCHOLTZ (wie Anm. 28) 349 betont nach Victorinus I 19.202; Mart. Cap. Rhet. 46, 486u. a. rhetorischen Bestimmungen zur narratio, daß die historische Wahrscheinlichkeit durch Interpolation und Auslassung,d. h. Konzentration und Konstruktion zum sinnvoll gerundeten Ganzen entstehe; vgl. auch oben Anm. 492.499 KOSELLECK (Vergangene Zukunft 183) spricht von „lebenden Augenzeugen“ und „überlebenden Ohrenzeugen“; zumRangverhältnis zwischen beiden vgl. S. 212 ff., 222 f., 231, A. 487 (Pol. II 11 (I) 84). Ein theoretischer locus classicus fürdas MA war Is. Et. I 41.1; vgl. LACROIX 50 ff. und unten Anm. 531.
219
59. Auf der einen Seite gilt es, aus wenig verläßlichen, ungenügend anerkannten Zeugen unmittelbareAugenzeugen zu machen, fiktive Erzählungen notfalls in historische zu verwandeln. Verwandt mit diesemVerfahren sind die bereits erwähnten Bemühungen Johanns, infinite Zitate der Literatur in finite Aussagenhistorischer Persönlichkeiten umzuformulieren.500 Doch auch ganze Erzählabläufe rein literarischer Artkönnen sinngemäß in den Status des Tatsachenberichts versetzt werden.501 Wie dies bereits für dieverschiedensten Gebiete der mittelalterlichen Literatur festgestellt worden ist, dient die Beschwörunghistorischer Authentizität auch bei Johann oft nicht dem historiographischen Interesse, sondernkompensatorisch der literarischen Wiedergabe gerade absonderlicher und wunderbarer Geschichten. Dies istbei Autoren, die man der „belletristischen“ Abteilung mittelalterlicher Literatur zuzuweisen pflegt (vonBenoît de Ste.-Maure zu Marie de France) vielleicht weniger erstaunlich als bei dem gelehrten undwissenschaftlich-didaktisch orientierten Verfasser des Policraticus.502 So behauptet Johann nach einem
500 Siehe oben § 48.501 Zu der antik-mittelalterlichen Gewohnheit, literarische Gestalten und Ereignisse um der höheren rhetorischenSuggestivkraft willen in einen historiographischen Kontext einzubinden und so zu historischen Phänomenen zu machen vgl.allgemein BATTAGLIA 458 ff.; KECH (wie Anm. 234) 25, 30 ff. (Hieronymus); FLINT (wie Anm. 32) 449 u. ö.(englische historiae-Kompilationen des 12. Jhs.); H. BRACKERT, Rudolf von Ems, Dichtung und Geschichte, Heidelberg1968, 237 f. (Thomasins Kombinationen fiktiver und historischer Gestalten wie Erec, Iwein, Karl d. Gr. und Alexander);DELCORNO (wie Anm. 108) 398 ff. (Giordano da Pisa); CURTIUS, ELLM 70 (die pseudo-historischen Exempla Dantes:Amyclas und Ripheus). – Die nach Isidor Et. II 11.2 belegte Vertauschbarkeit von Chria und Sentenz (oben Anm. 382)findet in der Konvertibilität von finiter historia und philosophisch-allgemeiner fabula ein Gegenstück; vgl. LAUSBERG§§ 1117 f. und oben §§ 48 f. Vgl. auch oben §§ 14 f. zum rhetorisch-argumentativen Ursprung von Fabel und Parabel inbestimmten historischen Situationen: Neben der von JÜLICHER und MEULI hervorgehobenen späteren didaktischenTrivialisierung einer ursprünglich konkret zweckhaft eingesetzten Geschichte läßt sich somit in der Entwicklung desExemplums auch das Umgekehrte feststellen: die künstliche Re-Historisierung eines narrativen Gemeinplatzes. Zu denÜbergängen in beiden Richtungen vgl. auch O. WEINREICH, Fabel, Aretalogie, Novelle. Beiträge zu Phädrus, Petron,Martial und Apuleius, (SB Heidelberger Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl. 1930/31, 7), Heidelberg 1931, 5 ff.502 Vgl. Jeannette BEER, Narrative Conventions of Truth in the Middle Ages, (Etudes de Philol. et d’Hist. 38), Genf 1981:Der Zusammenhang zwischen „truth assertion“ und Fiktionalität ist das eigentliche Thema dieser Arbeit. Vgl. auchGRUBMÜLLER, Physiologus (wie Anm. 369) 164 ff. zur „Wahrheitsklausel“ bei besonders absonderlichen undwunderbaren Naturphänomenen. – Zu der bereits antiken Gepflogenheit, gerade phantastische Geschichten als historischauthentisch in einem allgemein durchschauten, spannungsfördernden Sinn zu beschwören vgl. SALLES 12 ff. (in denconfabulationes); REITZENSTEIN (wie Anm. 147) 6 ff. u. ö. verweist auf die Tradition der im Stil des persönlichenErlebnisberichts erzählten Hades- und Jenseitswanderungen von den hellenistischen Aretalogien zu Augustinus und Gregor d.Gr. Es handelt sich hier um ein anthropologisch ubiquitäres narratives Kunstmittel.
220
Lucan-Kommentar, es stelle ein historisches Faktum dar, daß Caesar die warnende Göttin Roma am Rubiconin einer Vision erschienen sei.503 Dem Kaiser Konstantin, sagt er anderswo, sei die geschichtsträchtigeStaatsidee der nova Roma ebenfalls dank einer Erscheinung, derjenigen des Vogels Phönix, gekommen.503a
Eine ganze Reihe antiker Prodigien und Orakelberichte (auch solche aus Lucan und Statius) werden mitauffälliger Betonung wiederholt als „historisch“ charakterisiert (was im Rahmen einer Aberglaubenskritikseltsam anmutet oder vielmehr zeigt, wie wirksam der gelehrte Habitus der Geschichtswahrheits-Beschwörungwar).504
Beachtenswert ist insbesondere Johanns Umgang mit dem Satyricon des Petronius, das er zwar nichtwiederentdeckt hat, aber erstmals im Mittelalter in solcher Ausführlichkeit und mit solchemAutoritätsanspruch zitiert. Petronius, den er mehrfach arbiter noster nennt, gilt ihm gewissermaßen alsauserwählter Geheimklassiker für wenige besonders belesene Humanisten. Der Policraticus verdankt ihmeinige wichtige und für seine ersten Leser zweifellos
503 Pol. II 15, (I) 91.17 f. zu Lucan I 186: Quod si imperii nullam in veritate, quae sic appareret credidit quis fuisseimaginem, historiarum fide certiorabitur. Damit wird eine alte (endlose) Streitfrage der Lucan-Scholiasten aufgegriffen. Vgl.Arnulf von Orleans, Glosule (wie Anm. 457) zu De bello civ. I 186, 34: habitus patriae per cogitationem representatus.Quidam sompnium, quidam deliberationem fuisse dicunt sed Vacca in rei veritate sic fuisse affirmat. Vgl. B. MARTI,Vacca in Lucanum, in: Spec. 25 (1950) 198–214, hier 206; nach einer langen Liste von Urteilen pro und contra Vaccas reiveritas: „So much nonsense and so many errors repeated ad nauseam by one generation of plagiarizing scholars after another[…] make the study of glosses and commentaries at time a dreary occupation.“ Vgl. Abaelard, Sic et non (wie Anm. 561)95.147–8.503a Pol. I 13, (I) 57.25 ff.: Fenix singularis felicitatis successus pollicetur, quale est quod nova Roma viso fenice melioribusauspiciis condita est.504 Im Zusammenhang mit Sterndeutungsproblemen Pol. II 19, (I) 109.11 f.:… innuit enim poeta doctissimus (si poetadicendus est, qui vera narratione rerum ad historicos magis accedit) … Vgl. von MOOS, Poeta 100 ff. Pol. II 27 (Dearuspicibus et chiromanticis…) I 145, 20 ff.: Ad notiores transeatur historias. Apius […] Oraculum quidem auctoreLucano celebre est. Sed ne falsitatis nota in historias non oracula refundatur, canonica et cui fides incolumis adquiescitdiscutiatur historia. Pol. II 2, (I) 70.3 ff.: Sed et aves et pisces futurorum certissima produnt signa, quae Virgilius etLucanus divino comprehenderunt ingenio, et Varro in libris navalibus, dum sollicitos instruit nautas. Pol. II 4, (I) 71.5 f.:De signis quae praecesserunt excidium Ierosolimitanum novissimum: Vetus refert historia … usw.
221
besonders originelle Exempla.505 Johann scheint nun Petronius wie einen „Historiker“ von der Art desValerius Maximus als Bezugsquelle für denkwürdige historiae benützt zu haben. Dabei mußte er manches immittelalterlichen Sinn Unglaubwürdige oder auch für seine ethisch-philosophische Intention zu Derbe,Groteske oder Zynische kontextgemäß anpassen und legitimieren. Der traditionell vielschichtige semantischeGegensatz von fabula und historia war ihm hier nicht nur als derjenige zwischen fiktiver undhistoriographischer Darstellung, sondern auch (rezeptionsorientiert) als Unterschied des Bildungsniveausbewußt. Vor allem in der Tradition der hellenistischen Geschichtenerzähler selbst, z. T. auch in der späterenRhetorik galt fabula (neben apologus und fabella) als eine „volkstümliche“, d. h. für das Volk geeignete, ausdem unmittelbaren Vorstellungsbereich des „kleinen Mannes“ gegriffene, also sowohl aus der zeitgenössischenAlltagsrealität der „faits divers“ als auch aus der Phantasie stammende Erzählung mit komischschwankhaftemoder obszönem Einschlag.506 (In diesem Sinn war fabula übrigens im Mittelalter auch ein Schimpfwort fürdas, was in der Volksliteraturforschung
505 Pol. III 7, (I) 190.1: arbiter noster; vgl. ebd. III 8, 191.8. – Zu Johanns Petronius-Kenntnissen und zur Textgeschichtevgl. T.W. RICHARDSON, Problems in the Text-History of Petronius in Antiquity and the M.A., in: Americ. Journ. ofPhilol. 96 (1975) 290–305, bes. 302 zur Witwe von Ephesus; MARTIN, Uses, passim und bes. 73 zur ambivalentenBestimmung der Geschichte der Matrone von Ephesus sowohl als bloße fabula wie als wahres Ereignis; KERNER 30 f.506 Vgl. S. 51 ff., 65, 119 ff., 128; SALLES f. zu Petron. Sat. 110.6–8: Ceterum Eumolpos […] ne sileret sine fabulishilaritas, multa in muliebrem levitatem coepit iactare […] Nec se tragoedias veteres curare aut nomina saeculis nota, sedrem sua memoriae factam, quam expositurum se esse, si vellemus audire. In der Einführung zur Geschichte von der Matronevon Ephesus, von der unmittelbar darauf (111.5) berichtet wird: una igitur in tota civitate fabula erat, solum illud […]verum pudicitiae amorisque exemplum [… confitebantur]. (Zu diesem etymologischen Sinn von fabula s. oben Anm. 168,203a, 107.) Zur geringen Dignität der römischen Fabel vgl. §§ 17 f. und Apul. Met. VI 29.3: visetur et in fabulis audieturdoctorumque stilis rudis perpetuabitur historia asino vectore virgo regia fugiens captivitatem. Ebd. VIII 1.4: quae gestasunt quaeque possint merito doctiores, quibus stilos fortuna subministrat, in historiae specimen chartis involvere. Zuhistoria in diesem Sinn bei Johann s. auch S. 149. Vgl. P.G. WALSH, The Roman Novel, The ‚Satyricon’ of Petronius andthe ‚Metamorphoses’ of Apuleius, Cambridge 1970, 3,7 ff. zum gattungsmäßigen Mischcharakter (mit Komponenten ausSatire, Komödie, Roman, Historiographie u. a.) dieser Unterhaltungsliteratur, die Macrob im Kommentar zum Somn.Scip. 1.2.8 abschätzig hoc totum fabularum genus quod solas aurium delicias profitetur nennt. Zu einem ähnlichenhistoria-fabula-Gegensatz: „kleine“ Geschichte der Gegenwartsereignisse – „große“ Geschichte heroischer Vergangenheit (oderdieser gleichkommender Gegenwart) bei Boccaccio und Petrarca vgl. Anm. 317 und 521.
222
„Predigtmärlein“ heißt.)507 Historia war das gelehrte Gegenstück dazu, eine denkwürdige, ernsthafte,lehrreiche, „nützliche“, althergebrachte und allgemein anerkannte Geschichte aus ferner Vergangenheit (auchaus Mythos und Tragödie).508 Johann war nun offenbar darum bemüht, die fabulae, zu denen sich Petroniusbekennt, zu historiae oder Memorabilien im Sinne des Valerius Maximus emporzustilisieren. Dabei ist ihm dieBerufung auf Historizität nur ein Hilfsmittel. So erzählt er die im Mittelalter auch außerhalb der Petronius-Überlieferung bekannte Geschichte der Matrone von Ephesus ausdrücklich nach dem Satyricon, verweist abergleichzeitig – nicht ohne eine Spur gelehrter Ironie – auf einen gewissen „Flavianus“ als eigentlichenAugenzeugen:509 „Du magst, was Petronius mit genau diesen Worten berichtet, eine Geschichte oder, wenn dulieber willst, eine Fabel nennen; dennoch bezeugt auch Flavianius, daß der Vorfall sich in Ephesus tatsächlichso ereignet hat.“
507 Vgl. oben Anm. 107, 168, 203a, 315, 457 f.508 Die Antithese der fabula zur Tragödie und zur Geschichte ferner Vergangenheit betont Eumolpos bei Petron, Sat. 110(oben Anm. 506). Zu historia und ihrer höheren Dignität vgl. J. GAILLARD, La notion cicéronienne d’historia ornata, in:Caesarodunum XVbis, (1980) 37–45; J. MANDEL, L’historiographie hellénistique et son influence sur Cicéron, in:Euphrosyne 10 (1980) 7–24. Zweifellos besteht ein Zusammenhang zwischen dem fabula-Charakteristikum der „Neuheit“(im Gegensatz zur „alten“ historia) und der Entstehung des Begriffs Novelle (vgl. auch oben Anm. 409, unten Anm. 921).Radulf von Longchamp dürfte in seinem Anticlaudian-Kommentar so darauf hinweisen (Radulphus de Longo Campo, InAnticlaudianum Alani commentum, ed J. SULOWSKI, Polska akad. nauk zaklad historii nauki i techniki 13,Breslau/Danzig/Warschau 1972, 149): Tertia causa quare animus auditoris est infestus, contingit, quia defessus est et tuncdebet fieri insinuatio attentionis, quod fit […] auditore recreando per aliquem iocum, aut per rem novam sicut perapologum vel per fabulam, si eam permittat (vgl. auch unten S. 601 f.).509 Pol. VIII 11, (II) 301.14 ff. (als Einleitung des Exemplums): In muliebrem levitatem ab auctoribus passim multascribuntur. Fortasse falso interdum finguntur plurima; nichil tamen impedit ‚ridentem dicere verum’ [Hor. Sat. I 1.24] etfabulosis narrationibus, quas philosophia non reicit, exprimere quid obesse possit in moribus. (Dies ist eine Abwandlungder oben Anm. 506 zitierten Einleitung zur Geschichte in Petron. Sat. 110.6–8.) Nach Abschluß der Erzählung sagt Johannjedoch mit einer gewissen ironischen Unbestimmtheit (304.17 ff.): Tu historiam aut fabulam quod iis verbis refertPetronius pro libitu appellabis; ita tamen ex facto accidisse Effesi et Flavianus auctor est, mulieremque tradit impietatissuae et sceleris parricidalis et adulterii luisse penas. Zum „Augenzeugen“ Flavian, der laut Pol. VIII 11, (II) 294.17 undebd. II 26, (I) 241.9 f. einen Liber de vestigiis philosophorum bzw. De vestigiis sive de dogmate philosophorum verfaßthaben soll, vgl. Register s. l. SCHAARSCHMIDT 103 ff.: spätantiker, als Unterredner in Macrobs Saturnalien auftretenderAutor Virius Nicomachus Flavianus, der eine heute verlorene Sammlung von Philosophen-Anekdoten und Apophthegmenverfaßte, die Johann ganz oder teilweise benützt habe. Zu Flavianus Nicomachus als historische Person und Teilnehmer derSaturnalia vgl. auch Jacques FLAMANT, Macrobe et le Néo-Platonisme latin à la fin du IV siècle, Leiden 1977, 53 ff., der(ebd. 56) Johanns Angaben über Flavian als Autor der Schrift De vestigiis sive dogmate… für möglich und erwägenswerthält. Daß Name und Titel im MA auch sonst im Zusammenhang mit moralphilosophischer Florilegliteratur begegnen (vgl.S. 560), dürfte die Verfasserschaft des historischen Flavian schwerlich beweisen; die Plausibilität der Hypothese wird abervor allem durch Johanns Hinweis auf dessen Augenzeugenschaft in Ephesus eingeschränkt. Wie schon P. LEHMANN(Pseudo-antike Literatur des Mittelalters, Berlin 1927/Darmstadt 1964, 25 f.) vermutet hat, macht nun KERNER (105 ff.)glaubhaft, daß Johann ein mal. Sammelwerk unter dem Decknamen Flavianus in der (in einem weiten Sinn) auf die Antikezurückgehenden Tradition der Memorabilienliteratur benützt hat. Sollte er von der pseudoantiken Zuschreibung gewußt haben(sogar die Hypothese, daß diese von ihm selbst stammt, ist noch nicht widerlegt worden), dann läge hier ein weiteresZeugnis für sein gelehrtes „épater le lecteur“ vor (vgl. S. 202 f.). Aus der überreichen Bibliographie zum Exemplum von derMatrone als Erzählstoff vgl. etwa P. URE, The Widow of Ephesus, Reflexions on an International Comic Theme, in:Durham Univ. Journ. 18 (1956) 1–9; Atti del Convengno internaz. ‚Letterature classiche e narratologia’, Materiali econtributi per la storia della narrativa greco-latina, III, Perugia 1981 mit den Beiträgen von: M. MASSARO, La redazionefedriana della ‚Matrona di Efeso’ (217–38); L. PEPE, I predicate di base nella ‚Matrona di Efeso’ petroniana (411–26); J.BEDIER, Les Fabliaux, Paris 1925, 120, 228 ff., 462; BEYER, Schwank … (wie Anm. 409) 39 ff.; WEINREICH (wieoben Anm. 501) 5 ff., 56 f.; O. PECERE, Petronio, La novella della matrona di Efeso, Rom 1975.
223
Die Geschichte vom Erfinder des unzerbrechlichen Glases, der sich dem Kaiser empfehlen wollte und vondiesem enthauptet wurde, sollte nach Johann ein („früh-antikapitalistisches“) Fürstenspiegelexemplum gegenGeiz und Gewinnsucht abgeben, obwohl er die von Petronius gezogene, eher zynische „Moral“ nichtunterdrückt: daß ein einfacher Handwerker sich nicht einbilden solle, er „sei ein Zeus“ und daß irregeleiteter,unziemlicher Erfindergeist am Ende nur dazu führe, daß „Gold für einen Dreck“ gehalten werde.510 Dies ist dasgenaue Gegenteil der von Johann intendierten Pointe: daß nämlich materielle Werte zu verachten seien. Ererreicht sie indirekt, über eine „quellenkritische“ Glosse, die sich nicht auf Petronius, sondern auf denprimären auctor Trimalchio (den Erzähler der Rahmenhandlung) bezieht, als wäre er
510 Petron, Sat. 51 in Pol. IV 5, 248 f.; zur gesellschaftlich stabilisierenden Tendenz vgl. SALLES 10, 19 und untenAnm. 516.
224
ein historischer Zeuge:511 „Ob der Bericht wahr und glaubhaft ist, kann nicht entschieden werden. Auchmeinen verschiedene Autoren über die Tat des Kaisers Verschiedenes. Ich aber glaube, die Deutung derWeiseren nicht zu schmälern, wenn ich den Eifer des kunstfertigen Meisters für schlecht belohnt erachte undvielmehr meine, daß dem Menschengeschlecht kein guter Dienst erwiesen wird, wenn erlesene Kunst zerstörtwird, nur damit der Herd der Habsucht, die tödliche Ursache der Streitigkeiten und Kriege, das Geld und derGeldstoff in ihrem Wert erhalten bleiben.“ Wiederum hängt die historische Authentizität zusammen mit derDignität und dem moralischen Ansehen des Zeugen; aber sie gibt hier zu Bedenken Anlaß. Zur Schonung desAutors richten sich die Zweifel auf eine seiner Figuren, Trimalchio. Wahrscheinlich sieht Johann in derGeschichte eher eine fabula als eine historia, auch wenn sie ihm mittelbar geholfen hat, durch eigenegeistreiche Interpretation einen „nützlichen“ Gedanken herauszuholen. Das Exemplum verläßt erentsprechend mit der Bemerkung, daß die nachfolgenden Beispiele Lykurg, Pythagoras und Salomon alsunmittelbar nachahmenswerte Vorbilder gegen avaritia „weit nützlicher“ seien. (Von uns her betrachtet, kannes allerdings als eine Ironie des kulturgeschichtlichen Zufalls gelten, daß ausgerechnet diesem für Johannhermeneutisch in jeder historischen und moralischen Hinsicht dubiosen Bericht aller Wahrscheinlichkeit nachein tatsächlicher, auch von Plinius d. Ä. und Dion Cassius berichteter Vorfall zugrundeliegt.)512
Neben den Petronius-Exempla findet sich wohl das sinnfälligste Beispiel für die rhetorische Nobilitierungapokrypher oder fiktiver fabulae zu wahren und ehrwürdigen historiae in der Umgestaltung der berühmten,dem Menenius Agrippa zugeschriebenen Fabel vom Streit des Magens mit den Gliedern zu einerauthentischen, im Stil des Augenzeugenberichts vorgetragenen Papstanekdote.513 Johann erzählt, wie erPapst Hadrian IV. in Benevent
511 Pol. IV 5, (I) 248 f., 249.9 f., 15 ff.: Apud Petronium Trimalchio refert fabrum fuisse qui […] Quo facto se celum Iovistenere arbitratus est, eo quod familiaritatem Caesaris […] se promeruisse credebat […] An vera sit relatio et fidelisincertum est, et de facto Caesaris diversi diversa sentiunt. Ego vero sapientiorum non praeiudicans intellectui, devotionempotentis artificis male remuneratam arbitror, et inutiliter humano generi prospectum cum ars egregia deleta sit, ut fomesavaritiae, pabulum mortis, contentionum praeliorumque causa pecunia pecuniaque materia servaretur in pretio […] Zudieser Anekdote im MA vgl. WALSH (wie Anm. 506) 229.512 Plin. maior H.N. 36.195; Dion Cassius, R.H. 57. 21.7; vgl. SALLES 10.513 Pol. VI 24, (II) 67 ff.; 71.14 ff.: Risit pontifex et tantae congratulatus est libertati, praecipiens ut, quotiens sinistrumaliquid de ipso meis auribus insonaret, hoc ei sine mora nuntiarem. Et cum plurima nunc pro se, nunc contra serespondisset, apologum huiusmodi michi proposuit. Ait ergo:’ Accidit ut adversus stomachum membra […] conspirarent[…] Nach Livius II 32 bei Florus I 17 (23). Zu libertas und apologus vgl. S. 51, 149, 315 ff., A. 1051. Zur Fabel vgl.Anm. 87 ff., 118, 128 und nebst der in Anm. 89 genannten Literatur: R. DITHMAR, Die Fabel, Paderborn3 1974, 84 ff.;GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 18 ff., 379, 471 s. v. „Magen u. Glieder“ und bes. 121 (zur Situationsbindung der Fabel inder berühmtesten lateinischen Version, die zu immer neuen Einbettungen in historische Situationen motivierte); D. PEIL,Der Streit der Glieder mit dem Magen, Studien zur Überlieferungs- und Deutungsgesch. der Fabel des Menenius Agrippa vonder Antike bis ins 20. Jh., Frankfurt/Bern/New York 1985. – Zu dieser und andern Verquickungen autobiographischer mitliterarisch vorgeprägten Aussagen bei Johann vgl. HUIZINGA (wie Anm. 31) 209; MISCH 121 f.; LIEBESCHÜTZ 47. Zuweiteren Exempla aus dem eigenen Erfahrungsbereich s. § 60, S. 291 ff., 335. Mit dem Nachweis des Quellenbezugs ist dieHistoriker-Frage nach der „Lebenswirklichkeit“ natürlich weder positiv noch negativ beantwortet: Die wenig wahrscheinliche(von Geschichtsforschern in analogen Fällen meist spontan bevorzugte) Möglichkeit, Papst Hadrian habe wirklich, etwa inunbewußter Imitatio des Menenius Agrippa, diese Fabel erzählt, kann nicht a priori ausgeschlossen werden. Es gibt imMittelalter die erstaunlichsten, uns kaum mehr nachvollziehbaren Formen „zitathaften Lebens“ (s. oben S. 70, § 29 zu PetrusVenerabilis oder H. SCHAUWERKER, Otloh von St. Emmeran, München 1968, 77 ff. zum „Nachträumen“ desPrügeltraums von Hieronymus durch verschiedene Autoren). Doch passen Grenzphänomene dieser Art kaum zu dem raffiniertmit Zitaten jonglierenden Johann.
225
(1155/6) getroffen und ihm auf dessen ausdrückliche Bitte hin die im Volk verbreitete Kritik an Habsucht undBestechlichkeit der Kurie offen dargelegt habe. Der Papst habe gelacht und sich über die „Redefreiheit“ desmutigen Berichterstatters gefreut. Dann habe er einige Vorwürfe widerlegt, andere jedoch angenommen, undschließlich eine lehrreich-witzige Geschichte (apologus) zum besten gegeben. Johann läßt nur das besagteMenenius-Agrippa-Exemplum nach dem Livius-Exzerpt bei Florus wörtlich folgen. Als ein für das Mittelalteraußergewöhnlich beschlagener Quintiliankenner514 dürfte er dabei auch an jene, schon mehrfachherangezogene Stelle der Institutio oratoria gedacht haben, wo diese Geschichte als Demonstrationsbeispielfür den äsopischen Typ der niederen, durch den Reiz des Plastischen auf die naiven Gemüter der „Bauern undUngebildeten“ wirkenden Fabel (fabella, apologatio) erscheint.515 Gerade die hier angedeuteteGeringschätzung des „Volksliterarischen“ könnte Johann dazu motiviert haben, der alten politischen Parabel,die sich nach Quintilian gut für die Rede Hochgestellter zum Pöbel, insbesondere zur Besänftigung vonAufständischen eignet, einen neuen, gehobeneren
514 Vgl. oben Anm. 398 u. Anm. 397 f., unten Anm. 846.515 Quint. 5.11.19 oben Anm. 118, vgl. Anm. 128, 130, 308.
226
Rahmen zu konstruieren.516 Jedenfalls hat er so die alte Wanderanekdote aktualisiert517 und durch dasSelbstzeugnis über seine Gespräche
516 Zum Pabst als Authentizitätsverwalter vgl. S. 237. – Johanns besondere Deutung der Fabel bildet im neuen historischenKontext ein Beispiel für die organologischhierarchische und naturethische Gesellschaftstheorie und hat politologischausgesprochen „systemerhaltende“ Funktion, umsomehr als der Vergleich mit der Leib-Christi-Vorstellung zusammenhängt(vgl. KOEP 146 zu I Cor. 12.15–26; Rom. 12.4; A. WIKENHAUSER, Die Kirche als mystischer Leib Christi, 1940,130 ff.; zu Johann vgl. KERNER 181 ff.; W. STÜRNER, Natur und Gesellschaft im Denken des Hoch- undSpätmittelalters, Stuttgart 1975, 120 ff. mit dem wichtigen Hinweis, daß aus den hier beschriebenen kirchlichen Mißständenwenig früher Arnold von Brescia die systemverändernde Konsequenz gezogen hat). Die Policraticus-Fassung kann somit alseine hervorragende Bestätigung für die kritischen Bemerkungen P.L. SCHMIDTS (Polit. Argumentation 79 f.) gelten, derim Hinblick auf den ursprünglichen Sinn und die Gesamttradition dieses „Musterfalls“ der Gattung Fabel (soGRUBMÜLLER [wie Anm. 79] 18) die heute gängige Etikettierung der Fabel als „einem Kampfmittel der Unterdrücktenund Entrechteten“ (so V. RIEDEL, Lessing und die röm. Literatur, Weimar 1976, 153 f.) aufgrund zahlreicher ähnlichherrschafts-stabilisierender Deutungen nachdrücklich als ideologischen (d. h. sowohl romantischen wie klassenkämpferischen)Anachronismus verwirft und (80) betont: „Die Könige werden auf die Verantwortung verpflichtet, die das moralische Korrelatihrer Omnipotenz bedeutet; die Sozialordnung wird nicht in Frage gestellt, sondern interpretiert“. Wir können beifügen, daßsie nach Johann sogar erst recht befestigt wird. Vgl. S. 53 ff., 34, 129 ff., 180 f. zur problematischen „Volkstümlichkeit“ desExemplums, und im gleichen ideologiekritischen Geiste MEULI 18 ff. (zur ursprünglichen Hauptfunktion der Fabel:Beschwichtigung des launenhaften Volkes); SALLES 19 u. passim (sämtliche Geschichten der öffentlichen fabulatores inRom befestigen die „immuabilité de la condition sociale et le respect des hiérarchies“); Paul BARRÉ, Die ‚mores maiorum’in einer vaterlosen Gesellschaft, Ideologiekritische Aspekte literarischer Texte, Frankfurt a. M. 1973, 101 ff.517 Der Policraticus ist an der Entstehung oder Vermittlung mehrerer berühmter Wanderanekdoten beteiligt: so soll nachPol. IV 6 (I) 254 das Apophthegma: rex illiteratus est quasi asinus coronatus von einem der ersten Stauferkaiser an LudwigVII. von Frankreich gerichtet gewesen sein, nachdem Wilhelm von Malmesbury denselben Ausspruch Heinrich I. vonEngland in den Mund gelegt hatte (Gesta reg. V 390; vgl. H. GRUNDMANN, Litteratus-illiteratus, in: AKG 40 [1958]1–65; hier 50 f. = Ausgew. Aufsätze, III Stuttgart 1978, 11 ff.); verschiedene Wanderanekdoten im Rahmen derGregorlegende (S. 210; Pol. V 8 (I) 317; Gregors Gebetstränen für Traian) und der Vergilsage (z. B. Pol. II 23, Pol. I 4; vgl.SCHAARSCHMIDT 98 f.; D. COMPARETTI, Virgilio nel Medio Evo, Florenz 1937, I 156 ff.) gehen z. T. oder ganz aufJohann zurück. – Zum Phänomen der Anekdotenwanderung und der beliebigen Übertragbarkeit von Exempla auf historischePersönlichkeiten („Kristallisationsgestalten“) vgl. KLEINSCHMIDT 85 f.; WÜRZBACH (wie Anm. 171) 1106; KIRN (wieAnm. 151) 160; PABST (wie Anm. 315) 17; E. MOSER-RATH, Anekdotenwanderungen in der deutschenSchwankliteratur, in: Festschr. K. RANKE, ‚Volksüberlieferung’, Göttingen 1968, 234–47
227
mit Hadrian IV. in den Status einer historiographischen Aussage versetzt.518
Die Unterscheidung zwischen „Fabel“ und „Geschichte“ im Sinne kultureller Dignitätskategorien ist kein aufdas Mittelalter beschränktes Verfahren: Ähnlich wie Johann „zweifelhaften“ Petronius-Novellen sowohleinen historisch sichereren als auch exemplarisch eindeutigeren Charakter zu verleihen suchte, hat sich späterPetrarca darum bemüht, eine Boccaccio-Novelle, die Erzählung von der fast übermenschlich treuen Griselda,auf ein in jeder Hinsicht höheres Stilniveau zu haben. In dieser letzten Novelle des ‚Decameron‘ unterwirftbekanntlich ein Markgraf seine nicht standesgemäße Gattin härtesten Gehorsamsproben bis hin zurErmordung ihrer Kinder und der Verstoßung vom Hof, um die derart Geprüfte schließlich als absolutunterwürfige, ideale Ehefrau erst voll annehmen zu können. Die etwas zwielichtige, zwischen Heiligenlegendeund Casus schillernde Form der Geschichte, deren
518 In meiner Vorstudie: The Use of Exempla …, in: ‚The World of John …’ 225, Anm. 49 habe ich zu dieser Stelle ausPol. VI 24 Petrarcas Zitat in Fam. IX 926–28 (ed. V. ROSSI, II, Ed. naz. XI, 1934, 229) erwähnt: Sed hoc Hadriani quartidictum minus vulgatum est, quod inter philosophicas nugas legi […] Hec eisdem pene verbis ad contextum retuli, quibus abillo scripta sunt qui ex ore loquentis audierat. Dies ist ein hier richtigzustellendes Versehen: Das Petrarca-Zitat bezieht sichauf ein anderes, ebenfalls in autobiographischer Form erzähltes Papstapophthegma Johanns in Pol. VIII 23, (II) 410 f., d. h.auf die Klage Hadrians IV. über das Elend auf höchster Stufe kirchlicher Hierarchie: Romano pontifice nemo miserabilior est… Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang immerhin, daß Petrarca durch Johanns pathetische Berufung auf seineunmittelbare Zeugenschaft (unten Anm. 534 zitiert) angesteckt worden zu sein scheint. – Die aufgrund dieses Zitatsdebattierte Frage, ob Petrarca wirklich den Policraticus in den Händen hatte, ist damit allerdings noch nicht beantwortet. Dievage Bezeichnung des Lektürestoffs läßt trotz des quasi-historiographischen Hinweises auf die wörtlich zitierte Quelle an einFlorileg von der oben Anm. 509 erwähnten Art denken. LINDER (wie Anm. 321) 345 nimmt dagegen die gerade in Italienbesonders verbreitete Policraticus-Überlieferung durch Vinzenz von Beauvais als Quelle an, in der das Werk bekanntlichungenannt bleibt (s. S. 139 ff.). Weniger wahrscheinlich ist die Vermutung GEROSAS (wie Anm. 45) 205, Petrarca habeden Text selbst gelesen, da sich eine Policraticus-Hs. in der teilweise vom Humanisten übernommenen Carraresi-Bibliothekin Padua (s. G. BILLANOVICH, Petrarca letterato I, lo scrittoio del Petrarca, Rom 1947, 323 f., 239 f.) befunden hat.Gerade die von GEROSA ebd. aufgeführten Parallelen lassen eher auf ein Anekdotenflorileg oder ein historisches Handbuchschließen. (Immerhin könnte philosophicas nugas von weitem an Johanns Untertitel erinnern.) Petrarca hat diese Anekdotevon der miseria pontificum auch noch in Rerum memorandarum II 95 erwähnt. In keinem der Policraticus-Zitate oderAnklänge, die GEROSA (190 f., 204 ff.) zusammenstellt, wird Johann genannt. Zur Beliebtheit der Papstanekdote bei denitalienischen Frühhumanisten: „one of the more popular anecdotes associated with John“ s. LINDER a.a.O., 344 f.
228
Vorbildlichkeitswert im Rahmenkommentar, aber auch schon durch die Einbettung in ein mehrheitlich nichteben erbauliches Erzählwerk relativiert wird, dürfte Petrarcas Bedenken ausgelöst haben.519 Ihm erscheint dieErzählung
519 G. Boccaccio, Decameron X 10 (ed. A. ROSSI, Bologna 1977) 566–579. Der Sinn der Novelle ist bis heute in derDiskussion geblieben, die wohl Boccaccio selbst bewußt eröffnet hatte, indem er Erzählstoff und Rahmenkommentar desErzählers Dioneo auseinanderstreben ließ. Dieser Erzähler nennt das Vorgehen des Markgrafen Gualtieri (566) „non cosamagnifica ma una matta bestialità“, die keineswegs nachahmenswert sei, obwohl der 10. Tag laut Überschrift und Eröffnung(510) dem Thema der „Großmut“ – einer Fürstentugend – oder Erzählungen „di chi liberalmente o vero mangificamentealcuna cosa operasse“ gewidmet sein sollte. Auch wenn im Verlauf der Novelle Anspielungen wie die fast leitmotivischwiederkehrende Wendung „maravigliosa“ oder „maravigliandosi“ an den Stil der Heiligenlegende erinnern (vgl. E. DeNEGRI, The Legendary Stile of Boccaccio, in: Romanic Review 43 [1952] 188 f.), wird diese Assoziation vom Erzählerdoch deutlich gebrochen oder durchbrochen, wenn er in das Lob des Seelenadels auch Bedenken zur Passivität Griseldas(572) einfließen läßt – Gualtieri hätte nach ihm eine weniger duldsame Frau verdient – und überhaupt eine frühbürgerlich-pragmatischen Standpunkt gegen idealistische Übertreibungen zu vertreten scheint. – Die Ambivalenz von Heroismus undinhumaner Extremhaltung, zwischen dem „Wunderbaren“ und dem Absurden, entspricht hinsichtlich der literarischenFunktionen im Rahmen des Beispiels der Polarität von Legende/Exemplum/historia und Casus/Novelle/fabula. Auf beidenGebieten hat die Bearbeitung Petrarcas (s. nächste Anm.) die Zweideutigkeit zugunsten exemplarischer Eindeutigkeitbeseitigt, was zweifellos von großer rezeptionsgeschichtlicher Tragweite war: Der überragende Erfolg der Erzählung in deneuropäischen Literaturen der Neuzeit beruht primär und lange fast ausschließlich auf Petrarcas lateinischer Griseldis-Version,deren Beliebtheit und fast kanonische Respektabilität nachträglich auch Boccaccios italienischer Griselda-Geschichte zugutekam. Diese ebenso abgründig wie boshaft zweideutige Novelle – wohl die berühmteste im ganzen Decameron – ist dabeijedoch bis heute immer wieder auch im Geiste Petrarcas gelesen und im Sinne erbaulicher Eindeutigkeit mißverstandenworden. Was für Boccaccio eine ‚Hypothesis’ oder eine quaestio finita war (s. § 64), ist bis in die wissenschaftlicheRezeption hinein ein „Griselda-Ideal“ geworden. (Dieser Begriff findet sich bei A. SCAGLIONE, Nature and Love in theLate Middle Ages, Berkeley/Los Angeles 1963, 32). – Zu der überaus weitverzweigten und vielfältig untersuchten Geschichtedes Erzählstoffs und der Rezeption der zwei Erzählungen vgl. etwa E. FRENZEL, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1976,257 ff.; V. BRANCA, Boccaccio medievale (1956), Florenz4 1975, 342 ff.; Joachim KNAPE, ‚De oboedientia et fideuxoris’, Petrarcas humanistisch moralisches Exempel ‚Griseldis’ und seine frühe deutsche Rezeption, (Gratia, Heft 5),Göttingen 1978; F.-J. WORST-BROCK, Petrarcas ‚Griseldis’ und ihre Poetik, in: Geistliche Denkformen in der Literaturdes Mittelalters, ed. K. GRUBMÜLLER et al. (MMS 51), München 1984, 245–56. (Dieser Beitrag erschien im Juli 1985nach Abschluß dieser Interpretation. Er stimmt im Wesentlichen mit ihr überein, auch wenn er stärker aus der Perspektive derPetrarca-Forschung geschrieben ist.)
229
in der von Boccaccio gebotenen Fassung vor allem als eine den Heroismus ins Unglaubwürdige steigernde(rezeptionsästhetisch gewissermaßen den Grenzbereich „du sublime au ridicule“ streifende) fabula, die den„Vulgus“ durch „Unmöglichkeit“ verblüffen und zu Tränen rühre, ein bloß admiratives, kein imitatorischesIdentifikationsmodell anbiete. Obwohl die Tatsächlichkeit der Ereignisse weder behauptet noch negiert wird,gebührt dem offenbar als Geschichtsbeispiel zu verstehenden Thema die glaubwürdigere, höhereDarbietungsform der „wahren“ historia. Denn nur sie führt auch die moralische Identifikationsbereitschaftüber das kommune Mittelmaß hinaus:520 „Viele meinen, was gerade ihnen schwerfällt, sei allen unmöglich.
520 Petrarca hat 1373, zwanzig Jahre nach Boccaccios italienischer Urfassung der Geschichte von Griselda eine lateinischeNeubearbeitung der Novelle von Griseldis herausgebracht, die unter dem Titel De insigni obedientia et fide uxoria bekanntist (ed. A. BUFANO, Fr. Petrarca, Opere latine, II, Turin 1975, 1311–38). Der diesen Text rechtfertigende Brief anBoccaccio (Librum tuum…, ed. J. BURKE SEVERS, The Literary Relationship of Chaucer’s ‚Clerkes Tale’, N. Y. 1942,290–2) ist danach zusammen mit der Erzählung in die Briefsammlung der Senilium libri als Sen. XVII 3 eingegangen. Vondiesem als Brief an Boccaccio zu verstehenden Text, den der Empfänger nicht erhalten zu haben scheint, sandte Petrarca einJahr später eine Abschrift, die er mit dem Begleitschreiben (Inc. Ursit amor…) versah. Dieses für uns wichtigste Zeugnis desGriseldis-Dossiers berichtet dem Freund über erste Leser-Reaktionen auf Petrarcas lateinische Version, bringt also dieGeschichte ähnlich in die Diskussion wie Boccaccio dies durch den Erzähler Dioneo im Rahmen des Decameron getan hat,allerdings in diametral entgegengesetzter Intention und somit wohl als freundschaftlich-insinuatorische Kritik an Boccaccioselbst. Der Begleitbrief (Ursit amor…) wurde in der frühen Überlieferung der Erzählung übergangslos angehängt und bildetso zusammen mit dem vorangestellten Librum tuum den epistolographischen Rahmen um das Griseldis-Exemplum Deoboedientia et fide uxoris. Bisher wurde er m. W. noch nicht kritisch ediert und muß aus der Basler Edition, FrancisciPetrarcae Opera I, Basileae 1554/repr. New Yersey 1965, 606 f. zitiert werden. Nach E.H. WILKS Werkanalyse (Petrarch’sLater Years, Cambridge Mass. 1959, 256 f.) ist er korrekt als eigener Brief Sen. XVII 4 zu bezeichnen. (KNAPE benützt dievon ihm selbst als unzulänglich gerügte spätere Basler Ausgabe von 1581 nach: Originals and Analogues of Some Chaucer’sCanterbury Tales II, Chaucer Soc. 10, London 1875, 151–172. Sen. XVII 3 ist als ganzes auch in dem von BURKESEVERS a.a.O. erstellten Arbeitstext und dessen Nachdruck bei U. HESS, Heinrich Steinhöwels ‚Griseldis’, München1975, 173–238 zugänglich.) – Zu den hier zentralen Aspekten der admirativen und imitatorischen Identifikation vgl.S. 111 f., 117 f., A. 244 und zu Petrarca vor allem G. MARTELLOTTI, Momenti narrativi del Petrarca, in: StudiPetrarcheschi 4 (1951) 7–33; die Arbeit bietet zugleich eine sehr aufschlußreiche Analyse der Boccaccio-Novelle; KNAPE(wie Anm. 519) bes. 35 ff. ist von Interesse für Petrarca allein und die Tradition der historia-fabula-Unterscheidung(MARTELLOTTI wurde nicht benützt); vgl. auch ders., Historia … 249 ff. – Zu Petrarcas Texten: Schon in Librum tuum…,dem ersten Widmungsschreiben, wird die letzte Novelle des Decameron als multis precedentium longe dissimilem (BURKESEVERS 291) oder als auffällig andersartig bezeichnet, was, dem höflich huldigenden Ton des Briefes entsprechend, aus derEndstellung und Bedeutsamkeit der Geschichte erklärt wird (fine operis, ubi rethorum disciplina validiora quelibet collocariiubet). Als Adaptionsmotiv wird neben der Würde der dulcis historia die höhere internationale Kommunikabilität derlateinischen Sprache auch für nostri sermonis ignaros hervorgehoben. Im letzten Satz des Briefes geht Petrarca auf die Frageein, an historiam scripserim an fabulam und gibt sie mit einer Sallustreminiszenz an den Urheber zurück: fides penesauctorem sit. Zu Beginn des zweiten Schreibens (Ursit amor…; Opera, I [1554] 606 f.) greift er dieses Thema nochmals auf,läßt jedoch durchblicken, daß er Boccaccios ‚Griselda’ für eine fabula hält, seine eigene Bearbeitung jedoch für eineVerbesserung im Sinne der (nicht faktizitätsbezogenen, sondern rezeptionsästhetisch-rhetorisch wahren, d. h.wahrscheinlichen) historia: Ursit amor tui, ut scriberem senex, quod iuvenis vix scripsissem, nescio an res veras an fictas,quae iam non historiae sed fabellae sunt, ob hoc unum, quod res tuae et a te scriptae erant, quamvis hoc praevidens, fidemrerum penes auctorem, hoc est penes te fore sim praefatus et dicam tibi, quid de hac historia quam fabulam dixisse malim,mihi contigerit. Darauf berichtet er von zwei Freunden, von denen einer durch die Geschichte bis zu Tränen gerührt wurde,der andere aber so viel Tugend für unmöglich und folglich für „erfunden“ hielt: Ego etiam inquit flessem […] nec ego duricordis sum, nisi quod ficta omnia credidi et credo. Nam si vera essent, quae usquam mulier vel Romana vel cuiuslibetgentis hanc Griseldim aequatura sit, ubi quaeso tantus amor coniugalis, ubi par fides, ubi tam insignis patientia atqueconstantia? Petrarca hat darauf geschwiegen, um die freundschaftliche Konversation nicht zu trüben und in Disputumschlagen zu lassen, hat sich aber dabei folgendes gedacht: […] erat autem prona responsio: Esse nonnullos quiquaecumque difficilia eis sint impossibilia omnibus arbitrentur, sic mensura sua omnia metientes, ut se omnium primoslocent, cum tamen multa [multi?] fuerint, forte et sint, quibus essent facilia quae vulgo impossibilia viderentur. Quis estenim exempli gratia qui non Curtium ex nostris et Mutium et Decios, ex externis autem Codrum et Philenes fratres vel,quoniam de feminis sermo erat, quis vel Portiam vel Hypiscratheam vel Alcestim vel harum similes non fabulas fictas putet?Atqui historiae verae sunt. Vgl. MARTELLOTTI a.a.O., 32 f. zu den entsprechenden Exempla bei Val. Max, in denRubriken De pietate erga parentes… (V 4) und De amore coniugali (VI 4) sowie zu Petrarcas Absicht, im Stil der Exempla-
230
Alles messen sie an ihrem Maß, während doch vieles geschehen ist und vielleicht heute noch geschieht, waseinzelnen stets leicht ist und der Menge als unmöglich erscheint.“ Eine solche, glaubwürdig zur Nachahmungder constantia jener Frau stimulierende historia will Petrarca durch seine eigene Neufassung gestalten. Seine(für die spätere europäische Rezeption des Novellenstoffs entscheidende) Bearbeitung unter dem Titel ‚Deinsigni obedientia et fide uxoria‘ ist in der Tat ein nobles Memorabile und exemplum
Literatur, analog zu seinen De rerum memorandarum libri und De viris illustribus „historisch“ zu erzählen (vgl. auch obenAnm. 317).
231
virtutis von altrömischer und zugleich christlich-hagiographischer Art, sinngemäß nicht im „volgare“,sondern in lateinischer Sprache abgefaßt.521
60. Aus diesen Vergleichen zwischen Johann von Salisbury und Petrarca geht klar die beiden gemeinsamemethodische Grundeinstellung zur „historischen Wahrheit“ ihrer jeweiligen historiae hervor: Diese Wahrheitfinden sie nicht in außerliterarischer Realität, sondern in glaubwürdiger Aufzeichnung lehrreicher Beispiele fürdas der Menschennatur Mögliche. Sie rekurrieren zuletzt nicht auf Fakten, sondern auf Autoren. Auch diePrimärzeugen, die den Ereignissen beiwohnten, sind mehr oder weniger begabte oder glaubwürdige „Autoren“,aus denen unmittelbar oder mit Hilfe wahrscheinlichkeits-fördernder Eingriffe „zitiert“ werden kann. Fürdieses ganz rezeptionsästhetisch bestimmte Verständnis der historischen Exempla scheint das uns soselbstverständliche Denkmuster, nach dem sich historische Realität und bloße Wahrscheinlichkeit trennenlassen, weitgehend zu fehlen.522
521 Petrarcas Absicht, aus der kasuistischen Novelle ein christliches Exemplum zu gestalten, spricht auch klar aus der als‚historia docet’ abgefaßten Schlußbemerkung (ed. BUFANO 1336): Hanc historiam stilo nunc alio retexere visum fuit, nontam ideo, ut matronas nostri temporis ad imitandam huius uxoris patientiam, quae michi vix imitabilis videtur, quam adimitandam saltem femine constantiam excitarem, ut quod hec viro suo prestitit, hoc prestare Deo nostro audeant. Vgl.§ 35, S. 95, 458 ff.: exemplum impar und Imitabilitäts-Aspekt. Zur Stelle vgl. M. GUGLIELMINETTI, Petrarca fraAbelardo ed Eloisa, Bari 1969, 42: „… la quale aveva come protagonista un’ incarnazione corporea dell’anima del buoncristiano e come conclusione la felicità concessa da Dio a quest’anima dopo averla lungamente provata.“ – Zu den hier unterden Begriffen fabula und historia angesprochenen Polarität (vgl. auch oben Anm. 317) hat O. WEINREICH (wie Anm. 501)5 ff. 56 ausdrücklich auf Boccaccio verwiesen, um die Nachwirkungen der hellenistischen Aretalogie und Novelle als einständiges Hin- und Herpendeln zwischen dem grotesken und dem erhabenen Erzählmuster zu beschreiben; zur wechselseitigenVerwandlungsmöglichkeit von Novelle und (exemplarischem) Exemplum in der Neuzeit vgl. auch NIES (wie Anm. 317)passim. Vgl. auch oben Anm. 506, 508 zu Petronius und Macrob.522 Nach KLEINSCHMIDT 79 f. – Folgende Aussagen Petrarcas hätten zweifellos auch Johanns Beifall gefunden: De virisillustribus (ed. MARTELLOTTI, 1964) § 1, 6 ff.: Historiam narrare propositum est: quare scriptorum clarissimorumvestigiis insistere oportet. Ebd. § 5, 23 ff.: Ego neque pacificator neque historicorum collector omnium, sed eorum imitatorquibus vel verisimilitudo certior vel auctoritas maior est. Hierzu vgl. KESSLER, Geschichtdenken … 113 f., eine deninnovativ- „renaissancehaften“ Aspekt überbewertende Interpretation; nach GUENÉE, Hist. et culture historique 225 dauert inder frühen Renaissance die mittelalterliche Art der Autoritäten-Kritik fort und wird keineswegs generell durch Quellenkritikim modernen philologischen Sinn ersetzt (vgl. Anm. 496, 1036, S. 543 ff.).
232
Die einzige Instanz, die Historisches als nicht literarisch Vermitteltes wahrzunehmen vermöchte, wärelogischerweise das Ich des Augenzeugen. Doch selbst im Bereich der Erfahrung und des Selbstzeugnisses ist dieAblösung vom literarischen Grundmodell des „wahrscheinlichen Zitats“ zugunsten der für „Echtheit“bürgenden, eo ipso „wahren“ Augenzeugenschaft bei Johann weniger eindeutig, als man erwarten möchte. Inder Papstanekdote und in vielen ähnlichen Exempla stellt er sich selbst als Gewährsmann vor; dies steigertzugleich Unmittelbarkeit und Authentizität des Berichts.523 (In der zeitgenössischen Adaptation der Magen-Glieder-Fabel geht die beglaubigende Wirkung allerdings noch mehr als vom Ich-Erzähler vom nomen certiauctoris des Papstes aus.524) Einige Überleitungsformeln zu solchen Berufungen auf eigene Augenzeugenschaftzeigen nun deren eher kompensatorische Funktion: Da die Glaubwürdigkeit des mittelalterlichenWirklichkeitsbildes weitgehend von anerkannten Zeugen, von Büchern und anderen nicht-materiellenQuellenbelegen abhängt, muß gelegentlich selbst da, wo eigene Erlebnisse direkt wiedergegeben werden sollen,dieser grob empirische und subjektive Zugriff auf die ungeordnete rohstoffliche Masse der Tatsachen (also aufdas, was in der Neuzeit Wirklichkeit heißt) besonders gerechtfertigt werden. So klingt etwa folgende Stelle imProlog zum 7. Policraticus-Buch fast wie eine Entschuldigung für die Lückenhaftigkeit gelehrterKenntnisse:525 „Einiges allerdings, was ich in den Büchern der auctores nicht gefunden habe, habe ich aus demAlltagsleben und der Erfahrungswirklichkeit gleichsam wie aus einer Sittengeschichte herausgelesen.“ Analogzu der eingangs zitierten Briefstelle über die Hierarchie der Entscheidungshilfen von schriftlichen Autoritätenhinab zu den exempla und consilia, wird hier die persönliche Erfahrung nur subsidiär, aufgrund von Lücken inder schriftlichen Tradition als Quelle herangezogen, und zwar so, als wäre auch sie eine Art Buch oderGeschichtswerk, aus dem man „exzerpiert“.526Mangels schriftlicher Belege
523 Siehe S. 236 f.524 Vgl. S. 226, 158 f., 237.525 Pol. VII Prol. (II) 93.7 ff.: Quaedam vero, quae in libris auctorum non repperi, ex usu cotidiano et rerum experientiaquasi de quadam morum historia excerpsi. Vgl. dazu auch MUNK-OLSEN (wie Anm. 28) 53.526 Vgl. oben Anm. 1–2 zu Ep. 217; J. LECLERCQ, Aspects spirituels de la symbolique du livre au XIIe s., in: Mél. H. deLUBAC, ‚L’Homme devant Dieu’, Paris 1963, II 63–72, hier 70 f. zum liber experientiae. – Der Begriff experientia istungleich bewertet: hoch eingeschätzt als pragmatisch-empirischer Gegenpol zu abstraktem, praxisfernen Spekulieren undReden sowie als ethischer „Tatbeweis“ (vgl. § 4, S. 9 ff., 165, 234 f., 382), geringer geschätzt als ein nurOberflächenphänomene betreffendes sinnliches Erkenntnismittel gegenüber der Wesensschau ewiger und allgemeiner Ideen(vgl. §§ 49, 105, 111, S. 129 f.). Hier ist nochmals an die Exemplum-Charakterisierung Jakobs von Vitry (Prol. zu denSermones vulgares, CRANE XLI f.) zu erinnern, weil darin die doppelte Wertung auf Gesellschaftsschichten bezogen wird:Relictis enim verbis curiosis et politis convertere debemus ingenium nostrum ad edificationem rudium et agrestiumeruditionem quibus quasi corporalia et palpabilia et talia quae per experientiam norunt frequentius sunt proponenda.Magis enim moventur exterioribus exemplis quam auctoritatibus et profundis sententiis.
233
zitiert Johann einmal einen weiter nicht genannten Placentinus hospes, der ihm persönlich einen weisenSpruch mitgeteilt habe, und fügt legitimierend bei:527 „Dies sagte mir der Gastgeber aus Piacenza, und es ist,wie ich meine, glaubwürdig (dem Glauben gemäß). Solches findet man auch in den Schriften der Alten.“Offenbar waren ihm keine präzisen Stellen aus besagten „Schriften“ präsent, sonst hätte er eher diese als denanonymen Gastgeber zitiert.
Auch hier – für das Verhältnis von literarischen und existentiellen Zeugnissen – lohnt ein Blick auf dieitalienische Renaissance. Petrarca hat seine Besteigung des Mont Ventoux und seine erleuchtendeConfessiones-Lesung auf dem Berggipfel als einen tatsächlichen Vorgang seiner Jugendzeit in einemberühmten Brief geschildert, der sich wie ein bald nach dem Ereignis geschriebener spontaner Erlebnisberichtliest. Dieser Eindruck ist jedoch die Absicht eines Meisters der Rhetorik, der die Bergwanderung zum Anlaßeiner Jahrzehnte später aufgebauten, literarisch höchst anspruchsvollen, an klassischen Reminiszenzenreichen „Bekehrungsgeschichte“ genommen hat, die im wesentlichen aus der Einschmelzung großer Exemplader Vergangenheit zum autobiographischen Exemplum besteht.528 Auf der „körperlichen“ Sinnebene gleichtsie sich der von Livius berichteten Besteigung des Berges Haemus durch König Philipp V. von Makedonienan, auf der „seelischen“
527 Pol. IV 11, (I) 275.11 ff.: Haec michi Placentinus hospes; et, ut credo, fidei consentaneum est. Tale aliquid invenitur inscriptis maiorum. Eine andere anonyme Autorität aus persönlicher Bekanntschaft ist jener mit Plato verglichene Meistergeduldigen Leidens in Pol. VIII 8, (II) 278.17 ff.: Ego quidem novi hominem longe inferiorem Platoni (nisi quiaChristianus est, nec licitum arbitror Christiano praeferri vel Platonem) novi inquam hominem egrotivum […] gaudentem[…].528 Fam. IV 1 (ed. ROSSI) I 153–6; vgl. S. 548 f.; A. BUCK, Petrarcas Humanismus, in: ders. (Hrsg.), ‚Petrarca’,WdF 353, Darmstadt 1976, 1–30, hier 16 f.; ders. Der Rückgriff des Renaissance-Humanismus auf die Patristik, in:Festschr. W. von WARTBURG, Tübingen 1968, 153–175, hier 153 f.; G. BILLANOVICH, Petrarca e il Ventoso, in:IMU 9 (1966) 389–401 = Petrarca und der Ventoux, übs. in: A. BUCK, ‚Petrarca’ a.a.O. 444–63; B. MARTINELLI, DelPetrarca e il Ventoso, in: Studi in on. A. CHIARI, Brescia 1973, II 767–834; R.M. DURLING, II Petrarca, il Ventoso e lapossibilità dell’allegoria, in: REAug. 23 (1977) 304–23; COURCELLE (wie Anm. 245) 329–51; Evelyne LUCIANI, Lesconfessions de saint Augustin dans les letters de Pétrarque, Paris 1982, 65 ff.; FLASCH, Augustin (wie Anm. 562) 342 ff.(zur zentralen Bedeutung von Conf. 11.28.37). – Grundsätzlich sind bei der Interpretation solcher Fälle literarischerSelbststilisierung die beiden Klippen der nur „literalen“, faktenhistorisch-biographistischen Deutung und der formalistischenReduktion auf bloß innerliterarische Nachahmung und Fiktion gleicherweise zu meiden. Vgl. K. THIEME, PetrarcasMasken. Der Einzelne vor der Tradition, in: H. WENZEL (Hrsg.), Typus und Individualität im MA, München 1983,141–64; P. ZUMTHOR, Langue, texte, énigme, Paris 1975, 165–180 („Autobiographie au Moyen Age?“); J.-Y.TILLIETTE, Lettre inédite sur le mépris du monde et la componction du coeur adressée par Baudri de Bourgueil a Pierre deJumièges, in: REAug 28 (1982) 256–279, hier 274 ff. – Zu einer methodischen Parallele vgl. P. von MOOS,Mittelalterforschung und Ideologiekritik, Der Gelehrtenstreit um Heloise, München 1974; ders., Post festum in: PetrusAbaelardus, ed. R. THOMAS (Trierer Theol. Studien 38) Trier 1980, 75–100.
234
bildet sie Augustins Bekehrungserlebnis beim zufälligen Aufschlagen einer Bibelstelle nach (wobei derKirchenvater dieses Motiv seinerseits aus der Vita Antonii übernommen hat und sich Petrarca somit in guterspiritueller imitatio-Tradition als das Bild eines Bildes eines Bildes zeigen kann). Sei es aufgrund „zitathaftenLebens“, sei es dank nachträglicher Selbststilisierung, es ist derart ein neues, durchaus persönliches Exemplumentstanden, das uns die Einheit von Erleben und Lesen, die Suggestivkraft nachahmenswerter Gestalten derGeschichte und situationsgerechter Lektüreerlebnisse (Stichomantie gibt das rechte Wort zur rechten Zeit)vor Augen führt.529 Obwohl nun Johann von Salisbury und Petrarca von derselben (uns heute kaum mehrentwirrbaren) Verflochtenheit von Wirklichkeit und Literatur ausgehen, bekennt sich der eine zur Literatur,der andere geradezu ostentativ zur Augenzeugenschaft; d. h. der eine nimmt seine Wirklichkeit als Literatur,der andere konstruiert Wirklichkeit aus seiner Literatur. Der kleine Unterschied weist kulturgeschichtlichbedeutsam auf eine Entwicklung voraus, in der bis heute die Subjektivität als Wertmaß alles Echten undWahren das
529 Vgl. Livius XL 21.2; Aug. Conf. VIII 7.17; 12.29; X 8.15. Vgl. LUCIANI (wie Anm. 528) 65 ff., 80 f.: „Pétrarque veutagir et parler comme Augustin sans doute pour lui ressembler, pour devenir un chrétien bien meilleur qu’il n’est“. Ebd. 21 ff.zu einem vergleichbaren hagiographischen Einfluß von Conf. VIII in Fam. XXI 14 und VI 4 auf die Bekehrungsthematik undzur Rechtfertigung des Exempla-Gebrauchs in diesem Sinne nach Augustins autobiographischer Bewertung der Antoniusvita(dazu vgl. oben § 28 zur Ponticianus-Episode und S. 75, 91 ff., 100 ff., „zitathaftes Leben“, christliches Nachfolgeideal).Ohne daraus weitreichende Schlüsse ziehen zu wollen, möchte ich doch anmerken, daß diese spirituell-existentielle Seite desvornehmlich augustinischen Exemplum-Begriffs dem mittelalterlichen Humanisten Johann von Salisbury im Vergleich zuPetrarca doch auffällig fehlt.
235
öffentliche Sprachmedium der Rhetorik und rhetorischer (d. h. „nützlicher“, nicht narzißtischer) Literaturzusehends zurückgedrängt hat.530
Johanns Zitatbezug (der explizite Quellennachweis, und sei es die unmittelbare Augenzeugenschaft!) ist überdie autorisierende Funktion hinaus, oft unmerklich damit verbunden, ein Mittel zur Steigerung persuasiverEffizienz (evidentia). Im Unterschied zu dem früher erläuterten inhaltlich philosophischen Aspekt, demautoritätsabhängigen Wahrheitsgehalt, der bei zeitgenössischen oder autobiographischen Erzählungen eherproblematisch und legitimationsbedürftig
530 Vgl. auch S. 157, 216, 281 ff., 322 ff., 335 ff., 536, 548 f. zu Subjektivität und Exemplum. – Vgl. neuerdings auch diekommentierte Edition einer scheinbar autobiographischen Confessio Baldrichs von Bourgueil im Stile der augustinischenConfessiones durch TILLIETTE (wie Anm. 528) und hier besonders die treffenden Stellen pp. 277, 279: „… Baudri n’a pasrecherché, comme le feraient les lyriques modernes, à mimer la sincérité pour produire ‚un effet de réel’; il s’est conformé àl’idéal littéraire de son temps, qui, à nos yeux, est tout d’artifice, […] pour donner une valeur allégorique, c’est à direuniverselle, à un thème qui est alors d’actualité: celui de la pénitence.“ „A partir […] de l’expérience d’un ‚je’ qui, commetoujours au XIIe siècle, a une valeur emblématique, universelle, l’auteur dessine pour son correspondant l’image de lacondition humaine.“ – Ob Petrarcas Haltung mehr als spätmittelalterlicher oder frührenaissancehafter „Anfang der Neuzeit“ zudeuten sei, bleibe dahingestellt. Zu erwägen sind immerhin die von BLOOMFIELD (wie Anm. 303) 22 ff., bes. 34 f.zusammengestellten Beispiele für das Vorrücken des Dichters in die Position eines von Nebenhelden umkreisten Haupthelden(Divina Commedia und Canterbury Tales) im Spätmittelalter. – Zur Kritik am neuzeitlichen Subjektivismus und der damiteinhergehenden Zerstörung der Rhetorik vgl. die antagonistischen Positionen von M. FUHRMANN, Rhetorik undÖffentlichkeit, über die Ursachen des Verfalls der Rhetorik im ausgehenden 18. Jh. (Konstanzer Univ.-Reden 147) Konstanz1983; W. JENS. Art. Rhetorik, in: RDL III (1977) 432 ff. Zur Kritik an der Zerstörung öffentlicher Kommunikation vgl.unter mehr sozialpsychologisch-sozialgeschichtlichen Aspekten: J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit,Neuwied/Berlin 1962, 13 ff.; Richard SENNETT, The Fall of Public Man, Cambridge 1974/1976 = dt.: Verfall und Endedes öffentlichen Lebens, Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt a. M. 1983; Chr. LASCH, Das Zeitalter des Narzißmus,München 1980, 48 ff.; unter philosophie geschichtlichen Aspekten: O. MARQUARD, Der angeklagte und der entlasteteMensch in der Philosophie des 18. Jhs., in: ders., Abschied (wie Anm. 266) 39–66; ders.,Identität–Autobiographie–Verantwortung, ein Annäherungsversuch, in: Poet. u. Herm 8, ‚Identität’ München 1979, 690–99.– Es soll mit diesen Hinweisen nicht postuliert werden, das MA habe „Öffentlichkeit“ im frühneuzeitlichen oder (auch nur)antiken Sinn gekannt; die Frage, in welcher besonderer Bedeutung der Mediävist trotzdem den Öffentlichkeitsbegriff für diegesellschaftlichen Situationen mittelalterlicher Rhetorik verwenden darf, wäre eine eingehende Untersuchung wert.
236
wird, kann die rhetorisch-psychagogische Wirksamkeit bei jüngeren, aus der unmittelbaren Umwelt oder ausdem eigenen Erleben gewonnenen Exempla zunehmen. Die Berufung auf eine lange Kette gleichlautenderZeugnisse für eine „ewige Wahrheit“, als deren letztes Glied das persönliche Bekenntnis erscheint, vereint insich beide Aspekte: Rechtfertigung der eigenen (für sich genommen) schwachen Meinung sowie Steigerung derBelege hin zur Klimax der aussagekräftigsten Bestätigung durch einen direkt Betroffenen zugunsten eineszwingenden tua res agitur.531
Man kann diese Ambivalenz allein schon sprachlich an der doppeldeutigen Rolle der überleitenden Partikel„wenigstens“ (vel, seltener saltim, modo) in den exempla ex maiore ad minus ducta beobachten. Damit wirdebenso die in objektiver Hinsicht absteigende Rangfolge der Beispiele wie deren zunehmende subjektiveUnmittelbarkeit oder Identifikationspotenz für den Leser signalisiert.532 Nach der Aufzählung mehrerernegativer Helden der Antike bis zu Julian dem Abtrünnigen gelangt Johann in seiner Tyrannenschau zugewalttätigen Feudalherren der englischen Geschichte bis zur Gegenwart und
531 Vgl. S. 207 f., 232 f. (autobiographische Zeugnisse). – Evidentia: vgl. LAUSBERG §§ 810 ff. und demnächst: A.N.CIZEK, Historia – témoignage oculaire. Quelques implications et conséquences de la définition d’Isidore, Etymologiae I 41(Vortrag für den Kongreß: ‚Histoire et littérature au moyen age’, Amiens 1985), im Ersch. in: Bulletin Guillaume Budé. –Klimax: vgl. LAUSBERG § 247, 143; FRIEDRICH 30 f.; oben Anm. 474 mit Hor. Sat. I 1.69–70 in Pol. Prol. 14; §§ 56,77.532 Zum Verfahren der exempla imparia (ex maiore ad minus, ex minore ad maius) vgl. unten § 97; zu dem damitverbundenen (aber nicht identischen) Verfahren einer Steigerung innerhalb der Exemplareihe vgl. die Hauptmuster Sen., AdMarc. 13.1; Hier., Ep. 17.2.1 sowie HAGENDAHL (wie Anm. 173) 305; ANTIN (wie Anm. 464) 380; von MOOS,Consolatio I/II §§ 1126 f.; III §§ 1346 ff.; U. KINDERMANN, Laurentius von Durham, Consolatio de morte amici,Untersuchungen und krit. Text, Diss. Erlangen 1969, 179 f. Apparat zu pr. 13.16–7: Putas me alia virorum exemplaadiecturum? Mulieris adiciam […] Unde ad tuum dolorem moderandum si nichil potest documentum rationis, possitaliquid opus sapientis. Si non potest sapientis, sapientiam iactantis possit. Quodsi nec iste tibi luctum dissuadet […]persuadeat professus militiam potius quam philosophiam. Si vero robur etiam refugis animi militaris, nichil erit unde tuoluctui patrocineris, si vel virtutem non imitere sexus fragilioris. Als Policraticus-Beispiel diene etwa Pol. VI 16.41 über diemilitärische Disziplin und Abhärtung, wobei am Ende einer Exempelreihe weibliche exempla imparia so eingeführt werden(43.26 ff.): quod si nulla exhortatione virili nostri possunt milites ad virilia incitari, vel matres et uxores cedentium eosurgeant ad virtutem.
237
ruft aus:533 „Was verweile ich bei wenigen? Wo sind, um auf Heimisches zu kommen, wo sind Gaufrid, Milo,Ranulf […], wo Wilhelm von Salisbury, […] wo all die anderen öffentlichen Feinde? Ihre Schande ist berühmt,ihr Ende unselig und unserem Zeitalter unübersehbar. Wer also die alten Geschichten nicht kennt, […] nichtbedenkt den Untergang früherer Tyrannen, der achte doch wenigstens (vel) auf das, was vor seinen eigenenAugen geschieht; obwohl er es nicht sehen will, wird er sonnenklar erkennen, daß alle Tyrannen elend sind.“Auch die eigene Augenzeugenschaft Johanns für Aussprüche und Handlungen Papst Hadrians IV. (NikolausBreakspeare) hat rhetorischen Steigerungscharakter (ohne daß mit dieser Feststellung Johanns bekannte Rolleals Gesandter an der Kurie und persönlicher Freund des Papstes in Frage gestellt werden soll). Neben dembereits erwähnten Exemplum zeigt der Appell an den Leser klar die rhetorische Absicht:534 „Den HerrnHadrian […] rufe ich zum Zeugen an. […] Solange er noch unter uns weilt, frage ihn selbst und ‚glaube einemErfahrenen‘!“ Solches entspricht der generellen Feststellung, daß das Mittelalter die historische Wahrheit
533 Pol. VIII 21, (II) 395 f.: Quid moror in paucis? Ubi sunt, ut de domesticis loquar, Gaufridus, Milo, Ranulfus […]hostes publici? Ubi Wilhelmus Saresberiensis? Ubi Marmio […] Ubi alii […]? Horum utique malitia insignis est, infamiacelebris, infelix exitus et quem praesens aetas ignorare non potest. Si ergo quis antiquas nescit historias, si ignoratquomodo Cirus […] prostratus est, si casus et praecipitia praecedentium non recolit tirannorum, vel ea quae oculisingeruntur invitis attendat et luce clarius intuebitur omnes tirannos miseros esse. Andere Beispiele für die zunehmendeUnmittelbarkeit der Exempla sind etwa Pol. VII 24, (II) 216, wo die Summation aus der Literatur (comicos relege, revolvetragicos) zum eigenen Zeugnis fortschreitet: Venerabilis pater Gilebertus Herefordensis episcopus michi referre consuevitclaustralium morem quem in se ipso se fatebatur expertum […] Pol. VII 19, (II) 173 f.: Ut enim ait Tharasius patriarcha,dare est quandocumque dare et accipere, quandocumque accipere, Egregium quiddam in talibus accidit in Apuliatemporibus meis […]534 Pol. VIII 23, (II) 410 f.: Dominum Adrianum, cuius tempora felicia faciat Deus, huius rei testem invoco […] Dumsuperest, ipsum interroga et crede experto. Hoc etiam michi saepissime adiecit, quod […] Zu Petrarcas Rezeption dieserStelle vgl. oben Anm. 518. Zu Johanns Verhältnis zu Hadrian IV. vgl. KERNER 63 ff.; LIEBSCHÜTZ 19 ff.; von MOOS,Lucans tragedia 173 f.; oben S. 224 ff. Hauptzeugnisse: Pol. VI 24, (II) 67 f., 71; Met. IV 42, 216 f. Vgl. oben Anm. 490und die ebd. erwähnte Arbeit von GUENÉE, bes. 220 f.: „Les historiens du moyen âge ne critiquent pas des témoignages, ilspèsent des témoins“; und zum besonderen Gewicht päpstlicher Zeugnisse. Humbert von Romans empfiehlt, bei derVerwendung von Exempla nur quod sit competentis auctoritatis zu erzählen (wie Anm. 105, GEBIEN 175 f.): cum narraturaliquid quod dixerunt viri famosi et magni ut magister in theologia vel episcopus vel cardinalis et huiusmodi […]
238
weniger nach der Verläßlichkeit der Zeugnisse als nach dem (sozialen) Rang der Zeugen beurteilte und einempäpstlichen Zeugen grundsätzlich höhere Autorität zuschrieb als einem standesmäßig tieferen.
C) ‚Verba auctorum‘ und das neue „Denken in Alternativen“
Die Riesenkraft der magna nomina antiquitatis: über den rhetorischen Sinn des Gleichnisses von den jungen Zwergen aufden Schultern der alten Riesen (§ 61). Rhetorische und dialektische „Logik“ im Geiste humanistischer Topik (§ 62). DasProbedenken in utramque partem und die lerntechnischen Fiktionen der Schule (§ 63). Thesis und Hypothesis (§ 64).Widerspruchsbehebungsmethoden der neuen Wissenschaften (§ 65). Abaelards Sic et non-Prolog oder die Lust an derAuslegungsschwierigkeit (§ 66). Rechtskasuistik der Kanonisten und Glossatoren (§ 67). Über den wissenschaftlichen undliterarischen „Spielernst“ des Mittelalters (§ 68).
Die Probleme werden gelöst, nicht durch Beibringen neuerErfahrungen, sondern durch Zusammenstellung der längst bekannten.
L. Wittgenstein, PhilosophischeUntersuchungen § 109.
61. Wie bei anderen Zitaten geht es Johann auch beim Zitieren von Exempla primär um die „großen Namen“der Zeugen. Niemand hatte so „umwerfende“ Namen wie die auctores des heidnischen und christlichenAltertums, von denen er im Metalogicon im Zusammenhang mit der Disputationstheorie sagt:535
Den Worten der Autoren aber gebührt Ehrfurcht. Wir sollten sie nicht nur hochschätzen, sondern auch fleißigbenützen; einmal, weil sie aufgrund der großen Namen des Altertums von vornherein eine gewisse Erhabenheitausstrahlen, zum anderen, weil sich selbst schadet, wer solch überaus schlagkräftige Beweis- undWiderlegungsmittel nicht kennt. Wie ein Wirbelwind reißen sie Unwissende mit sich fort, schleudern sie durch dieLuft oder werfen sie zu Boden, so daß sie zutiefst erschrecken. Wahrhaft, Donnerschläge sind die großen Worte derPhilosophen für den, der sie zum ersten Mal hört. Wenn die neuzeitlichen und die alten Denker auch inhaltlichdasselbe meinen, so ist das Alter doch ehrwürdiger.
Vordergründig betrachtet, scheint dieser Passus die rhetorische Effizienz des Zitats (verba) höher zu stellenals die philosophische Relevanz (sensus). Im Gesamtzusammenhang der Aussagen über das Rangproblem vonauctoritas und veritas, von ehrwürdiger Herkunft und objektivem Sinngehalt eines Satzes zeigt sich jedoch,daß Johann sein zentrales Postulat der Einheit sprachlicher
535 Met. III 4.136.2 ff.: Preterea reverentia exhibenda est verbis auctorum, cum cultu et assiduitate utendi; tum quiaquandam a magnis nominibus antiquitatis preferunt maiestatem, tum quia dispendiosius ignorantur, cum ad urgendum autresistendum potentissima sint. Siquidem ignaros in modum turbinis rapiunt, et metu perculsos exagitant aut prosternunt;inaudita enim philosophorum verba tonitrua sunt. Licet itaque modernorum et veterum sit sensus idem, venerabilior estvetustas. Hinsichtlich des Zusammenhangs von Alter und Glaubwürdigkeit vgl. auch Quint. XII 4.1–2 oben in Anm. 131.Zum sensus idem modernorum et veterum vgl. unten §§ 96, 105.
239
und theoretischer Bildung, der „Vermählung des Wortes mit der Vernunft“, in keiner Weise relativiert. In derberühmteren Fortsetzung der eben angeführten Stelle übernimmt er von Abaelard den Gedanken, daß einZeitgenosse ohne weiteres fähig wäre, über eine bestimmte philosophische Disziplin ein Werk zu schreiben,das weder ad conceptionem veri noch ad elegantiam verbi einem antiken Autor unterlegen wäre; daß jedochdieses Werk im Sinne einer Autorität gesellschaftlich allgemein anerkannt werde, sei, wo nicht unmöglich, sodoch äußerst schwierig zu bewirken.536 Die autoritative Geltung hängt somit nicht nur in formaler, sondernauch in inhaltlicher Hinsicht vom „Alter“ der geistigen Produkte ab. Dieser Einschätzung ehrwürdigerantiquitas scheint die häufig einseitig als Kritik des blinden Autoritätsglaubens angeführte Prologstelle zuMetalogicon III zu widersprechen.537 Johann verspottet dort traditionalistische „Snobs“, die das einemobskuren Autor des Altertums zugeschriebene Zitat preisen, nur weil es alt ist, und dasselbe, fänden sie esunter zeitgenössischem Namen, verschmähen würden. Er verteidigt, ja entschuldigt damit das kühne Vorhaben(non erubesco laudare), aufgrund inhaltlicher Kriterien gegebenenfalls auch moderne christliche Zitate zubenutzen: „[…] die Lehrmeinungen […] unserer Philosophen sind weit glaubwürdiger und glaubensstärker(probabiliores et fideliores)“. Neben der positiven, „fortschrittlichen“ Einstellung zu den Leistungen dereigenen Zeit, die hier gern an erster Stelle genannt wird, sollte nicht übersehen werden, daß eine solcheApologie der moderni überhaupt nötig ist
536 Vgl. oben § 45 (Theorie und Praxis). – Met. III 4, 136.10 ff.: Dixisse recolo Peripateticum Palatinum quod verumarbitror, quia facile esset aliquem nostri temporis librum de hac arte componere, qui nullo antiquorum quod adconceptionem veri vel elegantiam verbi, esset inferior; sed ut auctoritatis favorem sortiretur aut impossibile autdifficillimum. Dahinter steht wohl die auch von Vinzenz von Beauvais (Prol. wie Anm. 337, 125 f.) herangezogeneAugustin-Stelle Contra Faustum XI 5 zum Vorrang kanonischer Autoritäten: In opusculis autem posteriorum, licet eademinveniatur veritas, longe tamen est impar auctoritas. Vgl. Abaelard, Sic et non (wie Anm. 561) 100 f.; Dial. (wieAnm. 896) 145 f.; JOLIVET, Arts (wie Anm. 560) 178.537 Met. III Prol. 118 f.: Quis autem nisi insulsus aut ingratus, propositum habebit autenticum, eo quo illud Coriscus,Brisso protulit aut Melissus eque omnes ignoti, nisi quatenus ab Aristotile exempli gratia nominati sunt? Et illud idemreprobabit eo quod a Gileberto, Abailardo et Adam nostro sit prolatum? Utique non sum ex eis qui bona temporis suioderunt et coetaneos suos invideant commendare posteritati […] Et he quidem accepte sunt opiniones veterum eo ipso quodveteres; et nostrorum longe probabiliores et fideliores, eo quod nostrorum sunt, reprobantur. Zu den drei imZusammenhang mit Aristoteles oder von ihm selbst (z. B. Top. I 10, 104b 23) erwähnten obskuren Autoren s. den Apparatvon WEBB 118, wobei Brisso (Bryso) nach An. Post. I 9, 75a immerhin eine gewisse anekdotische Berühmtheit erlangthaben dürfte als der Mann, der erstmals die Quadratur des Zirkels versucht haben soll. Zu Typen des literarischenObskurantentums vgl. auch oben Anm. 433. Gegen die Geringschätzung großer Zeitgenossen und die Überschätzung desKlangs großer Namen der Antike klagt ähnlich auch Walter Map in De nug. cur., Dist. IV 5, V 1 (wie Anm. 323) 311 ff.,404 ff. (u. a.: altes Kupfer gelte mehr als neues Gold). Vgl. Walter FREUND, Modernus und andere Zeitbegriffe desMittelalters, Köln/Graz 1957, 67 ff., 81 ff.; MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 11 f.; G. DUBY, The Culture of theKnightly Class, Audience and Patronage, in: Renaissance and Renewal (wie Anm. 7) 248–62, hier 251 f.; ElisabethGÖSSMANN, Antiqui und Moderni im Mittelalter, München/Paderborn/Wien 1974, 71 f.; dieselbe, Antiqui und moderniim 12. Jh., in: Miscellanea Mediaevalia, Köln 9 (‚Antiqui und Moderni …’), Berlin 1974, 40–57, hier 55; W.HARTMANN, Modernus und antiquus: Zur Verbreitung und Bedeutung dieser Bezeichnungen in der wissenschaftlichenLiteratur von 9. bis zum 12. Jh., ebd. 21–39, hier 32 ff.; unten S. 381, 448 ff., Anm. 882.
240
und daß nicht einfach alte und neue Autoren konfrontiert werden, sondern abseitige der Antike und sehrbekannte der Gegenwart (hier Coriscus, Brisso aut Melissus eque omnes ignoti, da ein Abaelard oder Gilbertvon Poitiers). Genau genommen – „mittelaltergemäß“ gesprochen – dürften wir letztere sogar nicht einmalAutoren nennen: Zeitgenössische Schriftsteller heißen nur nostri, posteriores, moderni, magistri oder schlichtscriptores und je nach der von ihnen vertretenen Literaturart etwa philosophi, poetae, historici usw. IhremLob widerspricht dies keineswegs, da Johann gerade auf den Unterschied von Qualität und Geltungaufmerksam machen will: So „heilsnützlich“ und literarisch vollkommen die moderni auch immer schreibenmögen, so fehlt ihnen doch notwendig etwas Spezifisches: die maiestas antiquitatis oder der Glanz des altenNamens.
Werden die „neuen Meister“ dennoch künstlich zu „sakrosankten“ Autoritäten aufgebaut, auf die man„schwören“ kann, so verdienen ihre Verehrer keinen geringeren Spott als jene, die sich auf antikeObskuranten wie auf auctores authentici stützen. Die Borniertheit solcher Imitatoren ist hier wie dortdieselbe: Sie „achten nicht darauf, was, sondern von wem etwas gesagt wird!“. Sie hängen allein an denWorten des Meisters, über die sie „wie um Ziegenwolle“ streiten [Horaz, Ep. I 18]. Sonst sind sie im Streitunfähig sich im freien Raum zu bewegen, und müssen den Boden des bewährten magister dixit unter den Füßenfühlen wie der Riese Antaeus, der im Kampf die Muttererde brauchte und, von Herkules in die Luft gehoben,all seine Riesenkraft verlor. (Ein wenig bekanntes Riesengleichnis Johanns, das sich dennoch auf das weitberühmtere beziehen läßt: Solche Wort- oder Scheinriesen können es nicht einmal mit den Zwergen auf denSchultern wirklicher Riesen
241
aufnehmen.) Johanns Satire auf epigonale Hochstapler trifft also gleicherweise kritiklose Nachbeter derantiqui wie der moderni.537a
Abgesehen von dieser Rezeptionskritik, d. h. unter der Voraussetzung eines „vernünftigen“ Gebrauchs derAutoritäten, wird deren objektive Geltung dennoch vom „Alter“ – allerdings in einem spezifischen Sinn –bestimmt. Nicht das in Jahren meßbare Alter – es gibt „unberühmte Alte“, veteres, nicht antiqui genannt –,sondern die Verbindung dieses Zeitbegriffs mit dem Wertbegriff „Namen“: die „Namhaftigkeit“ oderhergebrachte Anerkanntheit macht den alten Schriftsteller zum certus auctor. Nicht zufällig gehört dieseVerbindung von auctor und nomen auch zur geläufigsten Exemplum-Definition des Mittelalters (s. obenS. 158 ff.: certi auctoris nomine).
Die rezeptionsästhetische Potenz der maiestas antiquitatis – auch mit stilistischen Termini wie gravitas,energia, verba potentissima charakterisiert – ist nach Johanns theoretischer Aussage im Metalogicon nichtsbloß Aufgesetztes oder gar demagogisch Eindrückliches, wie man dies aus der Donnerwetter-Metaphorik deroben (S. 238) zitierten Stelle ableiten könnte, sondern meint gerade jene „tragende Riesenkraft“ deskulturellen Erbes, der vereinigten Ergebnisse jahrhundertealter Arbeit, die moderne „Zwerge“ „ohne eigeneKraft“, „bequem“ nutzen können, um dann, auf „Riesenschultern sitzend“, sogar noch etwas weiter zu sehenals die Alten. Denn diese Betonung der Macht und magnitudo gigantea der Tradition ist der eigentliche Kerndes vielgepriesenen (als Apophthegma Bernhards von Chrartres mitgeteilten) nani et gigantes-Gleichnisses,das sich unmittelbar auf die oben angeführte Stelle über die Geltung der alten verba auctorum bezieht.538
Intellektuelle Moral
537a Pol. VII 9 (II) 122–125 (De arrogantia multitudinis imperitae); 122.20 ff.: Pauci tamen sunt qui Achademicorumimitatores esse dignentur, cum unusquisque pro libitu potius quam ratione eligat quid sequatur. Alii namque propriis, aliidoctorum opinionibus, alii multitudinis consortio distrahuntur. Quid enim dubitat qui iuratus in verba magistri (cf. Hor.Ep. I 1.14) non quid sed a quo quid dicatur attendit? … Paratus est de lana caprina contendere (Hor. Ep. I 18.15), credensinopinabile quicquid ignotum auribus insonuit, nec rationibus adquiescit quem doctoris captivavit opinio. Quicquid enimille protulit, autenticum et sacrosanctum est. Ebd. 124.5–24, das Antaeus-Gleichnis nach Lucan IV 593 ff.538 Zum auctor-Begriff des Mittelalters vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) passim und bes. 12 f. J.W. BALDWIN,Masters at Paris from 1179 to 1215: A Social Perpspective, in: Renaiss. and Renewal 138–172, hier 161 zu magistri. – Aufdas oben Anm. 536 angeführte Zitat folgt in Met. III 4, 136.15 ff. unmittelbar: Hoc ipsum tamen asserebat [peripateticusPalatinus] maioribus ascribendum, quorum floruerunt ingenia, et inventione mirabili pollentes: laboris sui fructumposteris reliquerunt. Itaque ea in quibus multi sua tempora consumpserunt, in inventione sudantes plurimum, nunc facile etbrevi unus assequitur; fruitur tamen etas nostra beneficio recedentis, et saepe plura novit, non suo quidem precedensingenio, sed innitens viribus alienis et opulenta prudencia patrum. Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanosgigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentiacorporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea. Die Textemendation nach J.B. HALL, Towardsa Text of John of Salisbury’s Metalogicon, in: MSt 24 (1983) 791–816, hier 805 (statt opulenta patrum: opulenta prudenciapatrum und opulenta doctrina patrum in den von WEBB nicht benützten Hss., was bereits JEAUNEAU [wie Anm. 544] 95n. 131 vom Textsinn her vermutet hat). Zur Geschichte des berühmten Gleichnisses, das hier zum ersten Mal begegnet vgl.E. JEAUNEAU, Nani gigantum humeris insidentes, Essai d’interprétation de Bernard de Chartres (1967), in: ders., Lectiophil. (wie Anm. 428) 51–74, hier 53 ff. (Übersicht über die meist fortschrittsbezogenen Deutungen); 56 f. (scharfsinnigeDetailanalyse des doppelsinnigen Gleichnisses im Gesamtkontext von Met. III 4), 58 f. zur ähnlichen Konsequenz der mitdem Gleichnis verbundenen Priszian-Glosse Wilhelms von Conches über Prisc. Inst. gramm. (KEIL, Gramm. lat. I, 1.6–7):quanto iuniores tanto perspicaciores im Sinne von: plura perspicimus, non plura scimus. Vgl. auch JEAUNEAU, Nains etgéants, in: Entretiens sur la Renaissance du 12e s. (wie Anm. 28) 21–52; und speziell zur Priszian-Glosse: oben Anm. 431;H. SILVESTRE, ‚Quanto iuniores tanto perspicaciores’, Un antécédent à la Querelle des Anciens et des Modernes, in:Publications de l’Univ. Lovanium de Kinhasa, Löwen/Paris 1967, 231–55; M.J. DONOVAN, Priscian and the Obscurity ofthe Ancients, in: Spec. 36 (1961) 75–80: Der restaurative, nicht innovative Sinn der folgenreichen Priszianstelle bedeutet: jenäher ein Lehrbuchtext der Gegenwart liegt, desto „klarer“, fehlerfreier ist er, weil mehr Schreib- und Überlieferungsfehler derVorgänger bereinigt werden konnten, weil man also besser durch den Nebel der Tradition „hindurchsieht“; G. BEAUJOUAN,The Transformation of the Quadrivium, in: Renaissance and Renewal (wie Anm. 7) 463–487, 485 gegen die Deutung desGleichnisses als „a scientist’s profession of faith“; G. LADNER, Einführung zu ‚Renaissance and Renewal’ (a. O.) 8 ff. siehtdarin, dem Kontext von Met. III 4 und I 3 gemäß, vor allem eine Kritik an der Neuerungssucht der Cornificiani; so auch
242
soll es lehren, eingebildete „Selbstdenker“ soll es an uneingestandene Abhängigkeit von fundamentalerTradition und entsprechend an Demutspflicht und Dankesschuld erinnern. Später ist das Bild freilich übereinige „querelles des anciens et des modernes“ hinweg bis zu Newton und Freud hinauf meist progressivergedeutet worden. Petrarca – um bei dem sog. Renaissance-Nachfahren Johanns zu bleiben – hat eine ähnliche,aber weniger doppelsinnige, sowohl geistlichere wie fortschrittsbewußtere Metaphorik zugunsten derDiskontinuität zwischen „den Alten“ und uns verwendet: „Groß waren jene, aber sie standen in der Tiefe;klein sind wir, aber wir stehen – Gott sei’s
MISCH 1231 ff. – Bei allen Meinungsverschiedenheiten der Mediävistik über die genaue Gewichtung der modernen„Weitsicht“ und deren Traditionsbedingtheit – eine weitere endlose quaestio – herrscht weitgehend Einigkeit über dieBedeutung der kulturellen Kontinuität zwischen Antike und Gegenwart, die erst in der frühen Neuzeit einem Gefühl des„Bruchs“ weichen wird; dazu vgl. KERNER 16, MISCH 1180, 1231 f.; Brian STOCK, Myth and Science in the TwelfthCentury, A Study of Bernard Silvester, Princeton 1972, 6 f.; WETHERBEE (wie Anm. 394) 229; R. KLIBANSKY, TheSchool of Chartres, in: Twelfth-Century Europe and the Foundations of Modern Society, ed. M. CLAGETT et al.,Madison/London 1966, 3–14, hier 5 f.; ders., Standing on the Shoulders of Giants, in: Isis 26 (1936) 147–9; A. BUCK,Gab es einen Humanismus im Mittelalter? in: RF 75 (1963) 213–39, hier 234 f.; W. RÜEGG (wie Anm. 445) 312bemängelt, daß die mittelalterlichen Zwerge zwar dankbar, aber doch „herablassend“ auf ihr Fundament sehen, während erstdie Renaissance-Humanisten die Andersartigkeit der Antike als Wert entdeckt hätten (s. §§ 111 f.). Zum Gleichnis selbst vgl.S. 381 ff., 385, 395 f., 578 f., Anm. 853, 900, 1025. Ein unterhaltsam anregender Essay über die labyrinthische Geschichtedes Gleichnisses in der Neuzeit stammt vom Wissenschaftssoziologen Robert K. MERTON: On the Shoulders of Giants, AShandean Postscript, 1965 = Auf den Schultern der Riesen, Frankfurt a. M. 1980, hier zu Johann 34 ff., 170. Wichtiger istein Ergebnis der vornehmlich der Neuzeit gewidmeten Untersuchung von P. KAPITZA, Der Zwerg auf den Schultern desRiesen, in: Rhetorik 2 (1981) 49–58, bes. 52 f., weil die seit dem 16. Jh. einsetzende fortschrittsgläubige oder gegenextremen Traditionalismus gerichtete Deutung des Gleichnisses kontrastiv auf das mittelalterliche, eher konservativeVerständnis zurückverweist. Vgl. auch KOSELLECK, Vergangene Zukunft 190 f. zu der erst seit dem 18. Jh. dämmerndenIdee, daß Fakten (auch kulturelle Erscheinungen) von den Späteren besser gesehen werden als von den ersten Augenzeugenund eine gute Rekonstruktion mehr zeigt, als die im Nebel der Gegenwartsunmittelbarkeit tappenden Zeitgenossen sehenkonnten. Ein bescheidener Anfang dieser hermeneutischen Grundregel findet sich jedoch bereits bei dem GrammatikerPriszian (a.a.O.).
243
gedankt! – in erhabener Höhe.“539 Johann (bzw. Bernhard) sagt kein Wort von einer Unterlegenheit derRiesen. Die Frage, ob die Zwerge ein Recht haben, auf diese herabzusehen, stellt sich nicht; haben sie dochgenug damit zu tun, „in die Weite zu blicken“.
539 Invectiva contra eum qui maledixit Italie (ed. P.G. RICCI, 1955) 802: Magni quidem erant illi, sed imo positi; nosparvi, autem in excelso, Deo gratias, collocati sumus. Vgl. A. BUCK, Zu Begriff und Problem der Renaissance, in: Begriffund Problem der Renaissance, (WdF 204), Darmstadt 1969, 1–36, hier 8 f. zu weiteren Renaissance-Stellen für das Gefühlchristlich-moderner Überlegenheit über die heidnische Antike und unten §§ 111 f. Daß sich sämtliche Epochenmetaphern undÜbergangsvorstellungen grundsätzlich je nach Standpunkt im Sinne des Fortschritts oder der Dekadenz interpretieren lassenund darum nur mit äußerster Vorsicht Schlußfolgerungen auf das „Epochenbewußtsein“ einer bestimmten Zeit gezogenwerden dürfen, demonstriert eindrücklich A. DEMANDT, Denkbilder des europäischen Epochenbewußtseins, in: Archiv fürBegriffsgeschichte 23 (1979) 129–147. Vgl. auch unten Anm. 1000 (LÖWITH).
244
Was Johanns literarische Praxis betrifft, läßt sich dem gesamten hier erläuterten Passus aus Metalogicon III 4entnehmen, daß gnomische Verdichtung und Generalisierbarkeit (energia) die besondere Wirksamkeit dergepriesenen Autorenzitate ausmachen:540 „Im Gedächtnis zu behalten sind also die Worte der Autoren,insbesondere aber diejenigen, die volle Lehrgehalte bieten und bequem auf vieles andere übertragen werdenkönnen; denn auch diese bewahren das Wissen vollständig und enthalten eine gewaltige sowohl verborgene wieoffenkundige Macht.“ Der Handlichkeit und Übertragbarkeit der Sentenzen entspricht im Riesen-Zwerge-Gleichnis eine gewisse Passivität der kulturellen Nachfahren oder Nutznießer, die „bequem“, „ohne eigenesingenium“ und schnell „pflücken“ können, was die Vorfahren in lebenslanger Arbeit erforscht und gesammelthaben. Die verba auctorum rücken damit in die Nähe der loci communes im mittelalterlichen Sinn, jenerwiederverwendbaren, möglichst kontextunabhängig multifunktionalen, im Gedächtnis gespeicherten Zitate,dicta und facta, Apophthegmen, Chrien, Aphorismen, Anekdoten,
540 Met. III 4, 136.2 ff. wie oben Anm. 535 zur Macht der verba auctorum; in Bezug darauf folgt 137.7 ff.: Sunt ergomemoriter tenenda verba auctorum, sed ea maxime que plenas sententias explent, et que commode possunt ad multatransferri; nam et hec integritatem scientie servant, et preter hoc a seipsis tam latentis quam patentis energie habentplurimum. Johann setzt hier implizit sententia und locus communis gleich, da er sich auf Cic. Inv. II 48 stützt: haecargumenta quae transferri in multas causas possunt, locos communes nominamus. Zu plenas sententias vgl. Cic. De fin. IV14.23; zu energia s. oben Anm. 450 und Hier., Ep. 53.2: Habet nescio quid latentis energiae viva vox, et in aures discipulide auctoris ore fortius sonat. Isid. Et. II 21. 33: Energia est rerum gestarum aut quasi gestarum sub oculis inductio; derBegriff hat also bei aller Bedeutungsvielfalt den Sinn von persuasiver Unmittelbarkeit (bei Hieronymus durch akustische, beiIsidor durch visuelle Wirkung); zu sententiae que commode possunt transferri und zur gnomischen Generalisierbarkeit vgl.auch Met. I 22.51 über Seneca: nullus inter gentiles ethicus invenitur aut rarus, cuius verbis aut sententiis in omni negotiocommodius uti possis. Ad omnia enim suum aliquid confert. Zum lern- und mnemotechnischen Aspekt vgl. auch Quint. XII2.29: quae sunt tradita antiquitus dicta et facta praeclare, et nosse et animo semper agitare conveniet; unten S. 343, 363,367 f. Zur Beliebtheit von polyfunktional verwendbaren sententiae mit den darauf bezüglichen Exempla im Rahmen der locicommunes-Technik der Deklamatoren vgl. LEEMAN 232 f. und unten §§ 90 ff., 64. Zu Seneca als Sentenzen-Autor desMittelalters vgl. unten Anm. 599 und B. MUNKOLSEN, The Cistercians and Classical Culture, in: Cahiers de l’Institut duMoyen-Age grec et latin, Université de Copenhague 47 (1984) 64–102, hier 75, 79: Seneca als beliebtester auctor derZisterzienser, offenbar weil seine Pointen sich zur Aufnahme in Florilegien, zur Memorisierung und zur Meditationbesonders gut eigneten.
245
geflügelten Worte usw., die im Bedarfsfall als schlagende Beweismittel eingesetzt werden können.541
Eine andere praktische Folge der Theorie der „großen alten Namen“ ist zweifellos Johanns Neigung,mittelalterliche und zeitgenössische Autoren anonym oder – maiestatis causa – als antik anzuführen, wasbesonders im Bereich der Dichterzitate auffällt. Hildeberts bekanntes Epigramm Prima rubens unda wirdz. B. so kommentiert:542 „Mir ist es gleichgültig, wer die Verse gemacht hat; ich bemerke nur, daß er dieÄgyptischen Plagen unter dem Pharao recht konzis zusammenfaßt.“ Sehr persönlich wird dagegen eine imlateinischen Mittelalter sonst wenig bekannte Autorität wie Plutarch eingeführt, wenn auch (oder geradeweil?) das unter seinem Namen Vorgebrachte durchaus pseudepigraphischer Natur ist. Mehr als das Gewichtdes Zitats selbst wirkt immer die „Alterswürde“ des nomen certi auctoris. Die Nennung großer Namen zieltauf das, was Aristoteles in seiner Topik unter Endoxa verstand, einen unproblematischen, anerkanntenGrundbestand „meinungsmäßigen Wissens“, auf dem Argumentationen aufgebaut werden können, eine(wahrscheinlich) unanfechtbare allgemeine Ausgangsbasis für anfechtbare eigene Gedanken.543
541 Vgl. DONOVAN (wie Anm. 452) 77 f. und R.W. HUNT, Studies on Priscian in the Eleventh and Twelfth Centuries, in:Med. and Ren. Studies 1 (1941/3) 194–231, hier 211 f. zu ähnlichen Gedanken Wilhelms von Conches in seinen Priszian-Glosule über die Mühe der ersten inventio im Vergleich zu allem Traditionswissen. – Zu loci communes s. unten §§ 85 f.,S. 421 ff., 287 ff.; zu Apophthegmen und Chrien s. oben: §§ 44, 47. Zur Kombination mehrerer loci infinit sentenziöser undfinit narrativer Art in Gattungsmischformen vgl. S. 161 f., Anm. 402 und SCHON 27 ff.; 80 ff.; J. HUIZINGA, Herbst desMittelalters (übs. K. KÖSTER), Stuttgart 71953, 249 ff. zur Wechselwirkung spätmittelalterlicher Sprichwort- undExemplasammlungen, „Faictz et Dictz“, aus dem Bedürfnis, zeitlose Wahrheiten aus jedem konkreten Lebensfallherauszuholen.542 Pol. VIII 21, (II) 379.25–280.3; zitiert wird Hildeb. Cenoman., Carm.min. Nr. 34, ed. A.B. SCOTT (Leipzig 1969) 21.Dann folgt: Nec curo quis versus fecerit, hoc solum attendens, quia plagas Egipti sub Pharaone satis compendiosecomprehendit. Zu der bis ins späte 13. Jh. allgemein üblichen Methode, nur alte, keine neueren Autoren namentlich zuzitieren s. oben Anm. 337 zu Vinzenz von Beauvais, unten Anm. 973 zu Bernhard Silvestris.543 Zu pseudoantiken Zitaten vgl. A. 462, 836, 922. Zu nomen certi auctoris (Rhet. Her. IV 49.62) s. A. 374. Bei vielenpseudepigraphischen Angaben kann im allgemeinen auch ein Moment gelehrter Eitelkeit mitspielen, das GiraldusCambrensis in seinem autobiographischen Bericht über seine Lehrtätigkeit zu erkennen gibt, indem er sich seiner virtuosen„Zitatwissenschaft“ und der damit erzielten Publikumswirkung rühmt, in De rebus a se gestis, ed. BREWER (RBS 21,1861) 45; vgl. KIRN (wie Anm. 151) 177 f. Zu Zitaten als Endoxa im aristotelischen Sinn vgl. unten Anm. 547 undallgemein §§ 72, 90; VIEHWEG (wie Anm. 3) 43 f.; LUBAC (wie Anm. 430) II 2,220: „Ils ne voulaient pas reconstituer,mais construire. Ce qu’ils demandaient aux anciens, c’etait un point de départ, d’où s’élancer a leur tour.“
246
62. In dem zitierten Metalogicon-Passus über die magna nomina antiquitatis ist schließlich die dramatischeMetaphorik beachtenswert: Sie illustriert spezifisch das dialektische Streitgespräch, die ars congrediendi, dieJohann als den Höhepunkt der aristotelischen ‚Topik‘ (in deren 8. Buch) und zugleich als Quelle allerEloquenz betrachtet. Nach herkömmlicher doxographischer Schuleinteilung galt Aristoteles vornehmlich als„Logiker“, d. h. als der mit den Methoden des Redens und Denkens befaßte Philosoph. Da diese Methodenallen Wissenschaften zugrundeliegen, entstand aus dieser Einordnung im 12. Jahrhundert eine in die(scholastische) Zukunft weisende Wertvorstellung, die Johann mit Nachdruck vertreten hat: Aristoteles istihm als Theoretiker einer allgemeinen Methodenlehre „der Philosoph“ per antonomasiam. Denn er lehrtsowohl die Logik im weiteren Sinn der artes loquendi oder „Redekünste“ des Triviums (Grammatik, Rhetorik,Dialektik) als auch die eigentliche Logik oder ars disserendi, die Kunst der Wissensbildung durch dasGespräch, dessen anspruchsvollste Art das Streitgespräch darstellt. (Darum heißt er in militärischerMetaphorik campidoctor, Fecht- oder Kampfmeister des Denkens.)544 Die Überschneidung der beidenEinteilungen, derzufolge die
544 Zum weiten Begriff der „Logik“ im Sinne aller artes des Triviums (der ratio und oratio) vgl. oben § 52, unten § 72.Vgl. auch Met III 5, 140: Das beste logische Werk des Aristoteles sei die „wiederbelebte“ ‚Topik’; um der Vollkommenheits-Symbolzahl willen sei es in acht Bücher aufgeteilt (auch der Policraticus hat im übrigen acht Bücher), und da jedes Buch dasvorangehende übertreffe, sei der absolute Höhepunkt im 8. Buch der ‚Topik’ zu finden: Singula verba eius tam in regulisquam in exemplis non modo ad dialecticam, sed fere ad omnium proficiunt disciplinas. Dazu vgl. G.C. GARFAGNINI,Giovanni di S., Ottone di Frisinga e Giacomo da Venezia, in: Riv. Crit. di Storia della Filos. 27 (1972) 19–34, hier 24 f.;M. GRABMANN, Aristoteles im 12. Jh., in: MSt 12 (1950) 123–62, hier 140 ff., 155 (Johann habe die verständnisvollsteWürdigung der aristotelischen Topik im 12. Jh. zustandegebracht). – Die wichtigste (allem Folgenden zugrundegelegte)Stelle über die Einheit von Rhetorik und philosophischer Dialektik in der Disputations-Topik ist Met. III 10 (De utilitateoctavi); vgl. bes. 153.19–26, 154.1–155.5:
Familiare est omnium peritorum artificum artis sue instrumenta preparare antequam experiantur usum, ne conatus propriefacultatis inanis sit, si domesticis caruerit instrumentis. Sic in re militari previdet dux arma et impedimenta militie […]Itaque pari modo rei rationalis opifex et campidoctor eorum qui logicam profitentur in precedentibus instrumentadisputandi et quasi arma tironum suorum locavit in arena, dum semonum simplicium significationem evolueret et itemenuntiationum locorumque naturam aperiret. Consequenter autem instrumentorum exercitium docet et quodammodocongrediendi artem tironibus tradit et, quasi membra moveat colluctantium, proponendi et respondendi, convincendi etevadendi vias monstrat, et eam propter quam cetera premissa sunt facultatem preceptis informat […] Sic Topicorumoctavus constructorius est [liber] rationum, quarum elementa vel loca in precedentibus monstrata sunt. Solus itaqueversatur in preceptis, ex quibus ars compaginatur, et plus confert ad scientiam disserendi, si memoriter habeatur in cordeet iugi exercitio versetur in opere, quam omnes fere libri dialectice, quos moderni patres nostri in scolis legereconsueverant; nam sine eo non disputatur arte, sed casu […] Quia ergo exercitatio dialectice ad alterum est; pares, quosproducit et quos rationibus munivit et locis, sua docet arma tractare et sermones potius conserere quam dexteras, et tantacautela imbuit, ut totius eloquentie precepta hinc tracta principaliter, velut a primitivo fonte originis sue manareperspicuum sit. Indubitanter verum est quod fatentur Cicero et Quintilianus, quia hinc non modo rhetoricorumadiumentum, sed et principium rhetores et scriptores artium assumpserunt; postmodum tamen propriis dilatata estinstitutis. Versatur ergo tota dialectice agitatio, quoniam alter alterius iudex est, inter opponentem et respondentem. DerHinweis auf die bisherige Schulpraxis bezieht sich nach Met. III 5 auf die Zeit vor der „Wiedererweckung“ der Topik „vomTod oder vom Schlaf“ (140.10 f. oben Anm. 442). Zu Cicero und Quintilian: Cic., Orat. 32.113–4; Quint. XII 2, 12–3. Zucampidoctor nach Vegetius und zu Aristoteles logicus im Gegensatz zu Plato theologus in patristisch-frühmittelalterlicherTradition vgl. E. JEAUNEAU, Jean de Salisbury et la lecture des philosophes. in: ‚The World of John of S.’, 77–108, hier91–92. Der von Johann besonders geschätzten Bezeichnung Aristoteles philosophus per antonomasiam ist das KapitelMet. IV 7 gewidmet; s. auch ebd. IV 27, 193 f. zur Begründung aus dem Vorrang der Logik, bzw.Wissenschaftsmethodologie; Pol. VII 6, (II) 112.9 ff.: Tractavit quidem omnes philosophiae partes et praecepta dedit insingulas sed prae ceteris sic rationalem redegit in ius suum ut a possessione illius videatur omnes alios exclusisse. Itatamen in aliis viguit ut commune nomen omnium philosophorum anthonomasice, id est excellenter, sibi proprium essemeruerit. (Philosophia rationalis = Logik oder Dialektik, ratio disserendi, wie im Folgenden ausgeführt.) Vgl. C.J.NEDERMAN/J. BRUCKMANN, Aristoteleanism in John of Salisbury’s Policraticus, in: Journal of the History ofPhilosophy 21 (1983) 203–29.
247
Dialektik sowohl in die Rede- als auch in die Denklehre fällt, scheint Johann nicht gestört zu haben, weil derHauptsinn seiner etwas lockeren Wissenschaftssystematik gerade in der Verbindung von oratio und ratio, vonpropädeutischer Redelogik und vollkommener Denklogik im dialogischen Erkenntnismodell liegt.544a Dieschulmäßige Dreiteilung der artes loquendi
544a In der Klassifikation der drei Logiken: logica probabilis, demonstrativa und sophistica, wie sie Johann in Met. II 3,64 f. nach der boethianischen Tradition vornimmt (s. unten Anm. 583), wird logica probabilis (die mit der Topikzusammenfällt) als Einheit von dialectica und rhetorica definiert, da beide die persuasio „eines anderen“ (des Gegners oderRichters) erstreben. Hier fällt also die Grammatik aus dem Fächer-system heraus, während sie Johann in anderemZusammenhang zu der ebenfalls logica getauften Dreieinigkeit des Triviums rechnet; s. Met. I 10, 27.8 ff.: Est itaque logica(ut nominis significatio latissime pateat) loquendi vel disserendi ratio […] Duplicitatem vero […] a Greca […] originetrahit, quoniam ibi ‚logos’ nunc sermonem, nunc rationem significat. Ebd. I 13, 31.11 ff.: ‚Unde dicatur Grammatica’.Harum autem omnium prima est logica […] que in sermonum institutione versatur. Im gleichen Sinne bilden an zweiter unddritter Stelle Rhetorik und Dialektik die Unterbegriffe der umfassenden logica. In Johanns Sprachgebrauch erscheintdialectica selten im Sinne des aristotelischen Oberbegriffs für philosophia rationalis oder logica im weitesten Sinn, sondernmeist als Bezeichnung für die (dialektische) Teildisziplin der argumentativen (rhetorisch-dialektischen) logica probabilis oderder dreigliedrigen „arts du langage“ des Triviums. Zur Kritik an den Cornificiani verwendet er weniger logica als dialecticain abschätzigem Sinn, was der allmählichen Nobilitierung und Vorherrschaft des logica-Begriffs (gegenüber dem älterendialectica) vom 12. zum 13. Jh. entspricht; vgl. P. MICHAUD-QUANTIN, L’emploi des termes logica et dialectica aumoyen age, in: ‚Arts libéraux et philosophie au moyen âge’, Montréal-Paris 1969, 855–872, hier 858. Rhetorica andererseitswird im Met. nicht als eigenständige Disziplin behandelt, sondern je nach der elocutionellen (ornatus) oder argumentativenBlickrichtung (probatio) als Teil der Grammatik oder der „Dialektik“ (als logica probabilis im übergeordneten Sinn). Dazus. oben Anm. 446. Zur Tendenz der Dialektik seit dem späten 11. Jh., beherrschend in die beiden anderen Trivium-Fächereinzudringen, vgl. L.M. De RIJK, Logica modernorum: A Contribution to the History of Early Terminist Logic, II 1, Assen1962, 97 ff.; T. HUNT, Aristotle, Dialectic, and Courtly Literature, in: Viator 10 (1979) 95–130, 102 ff. – Zu Johannsbesonderer Gliederung im Vergleich zu den vielfältigen (ein neues Interesse an Systematik anzeigenden)Wissenschaftseinteilungen des 12. Jhs. vgl. MICHAUD-QUANTIN, L’emploi des termes logica et dialectica (wie oben)857 ff.; P. DELHAYE, L’organisation scolaire au XIIe s., in: Traditio 5 (1947) 211–68; ders., L’enseignement (wieAnm. 418) 90 ff.; JEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 544) 82 f. Danach ist besonders hervorzuheben, daß Johann die logicaim Gesamtrahmen der eigentlichen Philosophie, bestehend aus ethica, physica, logica, beläßt und nicht wie andere Denker(z. B. Wilhelm von Conches und Gottfried von S. Victor) allein dem Trivium (eloquentia-Fächer) zuweist und derart auchnicht der höheren Stufe philosophischer Fächer (praktische Philosophie = Ethik; theoretische Philosophie = Theologie undNaturwissenschaft) entgegengesetzt. Vgl. auch A. WEISHEIPL, Classifications of the Sciences in Medieval Thought, in:MSt 27 (1965) 54–90, hier 65 ff. zum 12. Jh.; G. DOTTO, ‚Artes liberales’ come ‚sapientia’ in Giovanni di Salisbury, in:Annali della Facoltà di lettere e filosofia, Perugia 16/7 (1981) 227–40. Zur späteren Verdrängung der Rhetorik aus der(Sprach-)Logik in die politische und propädeutische Ethik vgl. O. LEWRY, Rhetoric at Paris and Oxford in the Mid-Thirteenth Century, in: Rhetorica 1 (1983) 45–63; ders., Grammar, Logic, and Rhetoric, 1120–1320, in: The Early OxfordSchools, ed J.I. CATTO, Oxford 1984, 401–33; KÖHN, Schulbildung (wie Anm. 557) 265 ff.
248
bleibt sekundär gegenüber jener – auf einen Grundgedanken des Aristoteles selbst zurückgehenden –Unterscheidung und Zusammenschau der beiden Disziplinen, die es definitionsgemäß nicht allein„wissenschaftlich“ mit der Sache zu tun haben, sondern den „menschlichen Faktor“, die soziale, historischrelative Dimension mitberücksichtigen müssen: der Rhetorik und der Dialektik. Diese beiden Kunstlehrenwerden gemeinsam durch die Einbeziehung eines Gegenübers – eines Publikums oder eines Unterredners –konstituiert.
249
Die Rhetorik lehrt, wie man seinen eigenen Parteistandpunkt einem Zuhörer oder Richter gegenüberüberzeugend durchsetzt; die Dialektik, wie man einen Gesprächspartner (auch in der heuristischen Rolle desGegners) streithaft oder „sokratisch“, eristisch oder elenktisch zum Wissen führt oder mit ihm prozeßhaftwahres Wissen bildet. Der primär im Gegenstand liegende Unterschied der beiden Argumentationsarten, derrhetorischen und der dialektischen, interessiert Johann entschieden weniger als deren gemeinsame,übergeordnete Methode: die Topik, das Instrumentarium rationaler Kommunikation.545
Es ist oft ratsam, von den allzu bekannten Folgen eines Phänomens abzusehen, um diesem selbst gerechtwerden zu können. Johann kennt noch keineswegs den späteren Gegensatz zwischen einer durchformalistische Logik und Szientismus diskreditierten sog. „scholastischen“ Dialektik und einer zum Modellgesellschaftlicher Einbildungskraft und über-rationaler Verständigung
545 Grundlegend ist hier die (auffällig selten zitierte) Arbeit von Hermann THROM, Die Thesis, Ein Beitrag zu ihrerEntstehung und Geschichte, (Rhetor. Studien 17) Paderborn 1932, bes. 22 ff., 40 ff., 56 ff., 190 ff. u. ö. zu dem hinsichtlichder Form nicht wissenschaftlichen (d. h. nicht apodeiktischen) Charakter der auf Zustimmung zum „subjektivGlaubwürdigen“ angelegten und mit topischen endoxa operierenden Dialektik und Rhetorik bei Aristoteles, deren Unterschiedeinzig im Gegenstand liegt: Dialektik ist das „philosophische Verkehrsmittel“ für allgemeine, immergültige „Thesen“;Rhetorik das Überzeugungsmittel „für den Augenblick“ in konkreten Lebensfragen oder „Hypothesen“. „Wissenschaftlich“ istsomit an der Dialektik nur die zu vermittelnde „Sache“, das Beweismaterial, nicht aber sie selbst als Methode derRücksichtnahme auf das persönliche Gegenüber und der Geltungsbeschaffung durch allgemein anerkannte und qualifizierteGesichtspunkte im Gespräch. Vgl. Anal. pr. 24a 22 f. zum Unterschied apodeiktischer und dialektischer Sätze sowie S. 300zu den endoxa; Rhet. 1354a 1 dd., 14–5; 1356b 1–2; Top. 100a 25 ff. zum Gegenstand der Rhetorik und der topischenMethode sowie S. 258 ff. zur Unterscheidung von Dialektik und Rhetorik nach thesis und hypothesis. Vgl. auch J.MITTELSTRASS, Versuch über den sokratischen Dialog, in: Das Gespräch, (Poet. u. Herm. 11) München 1984, 11–28 zurplatonischen Dialektik als Methode der dialogischen Wissensbildung nur anfänglich durch Eristik (Durchsetzung eigenerMeinung), in der Hauptsache aber durch Elenktik (Übereinstimmung durch Betrugsaufdeckung und Betrugsverzicht). Aufletzteren Unterschied scheint Johann aufgrund seines boethianischen Dialektikmodells keinen besonderen Wert gelegt zuhaben, obwohl er das sokratisch-platonische Dialogideal der Wissensbildung durch ein „Denken in Alternativen“ zweifellosauch indirekt (etwa durch Ciceros Vermittlung) gekannt hat; vgl. unten S. 193, Anm. 447, 546. Nachträglich bekannt wurde:P. HADOT, La préhistoire des genres littéraires philosophiques médiévaux dans l’Antiquité, in: Les genres littéraires dansles sources théologiques et philosophiques médiévales (Publications de l’Institut d’Etudes Médiévales II 5) Louvain-la-Neuve1982, 1–10.
250
aufgewerteten „humanistischen“ Rhetorik, zwischen trockener Syllogistik und gefühls- und erfahrungsmäßigerSeelenpflege, zwischen einer Kultur des toten „Diskurses“ und einer Kultur des lebendigen Dialogs (oder welchandere Antithese aus der Denkfigurensammlung zur Selbstlegitimation der Neuzeit man wählen mag). Dergemeinsame Gegensatz zu dialektischer und rhetorischer Sprache ist ihm vielmehr die reine, absolute, nichtauf Kommunikation bezogene Wissenschaft. In seiner (von Boethius bestimmten) Terminologie ausgedrückt,unterscheiden sich logica probabilis und logica demonstrativa grundlegend: Die Methodenlehre für denUmgang mit probabilia, d. h. mit beweisfähigen und beweisbedürftigen (insofern wahrscheinlichen) Themensetzt den anderen (den Gegner oder den Richter) als Adressaten voraus; die Lehre von der apodiktischendemonstratio behandelt die auf Überzeugung und Konsens nicht angewiesenen Prinzipien sachlicherRichtigkeit oder ewiger Wahrheit (wie Geometrie und Mathematik). Vieles von dem, was die Tradition desHumanismus seit dem 14. Jahrhundert der Spätscholastik als rationalistisch und szientistisch angelastet hat,hätte Johann – man verzeihe den essayistischen Konjunktiv – wohl anstandslos unterschrieben, aber geradenicht auf die „Dialektik“ zurückgeführt, sondern auf einen Verrat am aristotelischen Telos der dialektischenTopik und am ciceronischen Ideal der Verbindung von Rhetorik und Philosophie. Diese Annahme stützt sichauf die Tatsache, daß er die ersten Anzeichen dieses Irrwegs schon im selbstherrlichen Auftreten der Schein-und Hyperdialektiker seiner Zeit bekämpft hat, die er unter der karikaturistischen Chiffre Cornificianizusammenzufassen pflegte.
Die humanistische Kritik scholastischer „Dialektik“ beruht im wesentlichen auf demselben BildungsidealCiceros, das Johann seinen – schon sprachlich keineswegs „scholastisch“ klingenden – Diatriben gegen alleswissenschaftliche Spezialistentum zugrundegelegt hat. Während Cicero durch die Einführung der dialektischenThesis die Rhetorik philosophisch, allgemeinbildend, moralisch verantwortbar machen, vor ihrer Perversionzur reinen Technik und vor sophistischem Mißbrauch und Opportunismus bewahren wollte, sah Johann seineAufgabe darin, die Gefahr einer autonom, formalistisch und damit ebenfalls „sophistisch“ werdendenDialektik durch die rhetorischphilosophische Sprachkultur einzudämmen. Diese zwei im Ansatz – in derMethode des Denkens in utramque partem und im aequitas-Ideal – gleichen Balanceakte verwerfen keine derbeiden Disziplinen, sondern lediglich die einseitige Bevorzugung der einen gegenüber der anderen. Auch vieleRenaissancehumanisten erstrebten diesen Ausgleich. Allgemein betrachtet, ist jedoch mit einem Kennerjuristischer Argumentationsmethodik im Mittelalter festzuhalten, daß das ästhetisch-philologischeScholastikverdikt in der humanistischen Tradition bis zu Mephistos Verunglimpfung des „Collegium logicum“die gesamte (grundsätzlich mehr als nur „formale“ oder „disputatorische“) Logik in der von der Spätantike biszum Spätmittelalter geltenden
251
Konzeption traf, d. h. eine allgemeine Methodenlehre, ja ein zentrales Fach humaner Allgemeinbildungdiskreditierte. Diese antirationalistische (auch nachfolgende Irrationalismen begünstigende) Tendenzentspricht im übrigen der Entwertung des argumentativen Teils der Rhetorik, die in der Barockzeit – etwaszugespitzt ausgedrückt – in mancherlei Hinsicht zu einer Technik psychagogischer Affekt-Manipulation oder(auf tieferem Niveau) zu einer stilistischen „Kolorier“-Kosmetik verkam.546
63. Die Einheit von Rhetorik und Dialektik in Johanns „Logik“ drückt sich auch in einzelnen Regeln aus: Sogehört das effektvolle Zitieren altehrwürdiger verba auctorum, das einen Gegner aus der Fassung zu bringenvermag, im erwähnten Metalogicon-Kontext ausdrücklich zu den Waffen der Dialektik,
546 Zur humanistischen Kritik an scholastischer Dialektik vgl. S. 195 ff., 307 f., 533 ff., 550 ff.; Gerhard OTTE, Dialektikund Jurisprudenz, Untersuchungen zur Methode der Glossatoren, (Ius commune 1) Frankfurt a. M. 1971, 9 f., 12 f. Vondemselben Gelehrten, der (mittelalterliche) „Geschichte als Exemplum“ und (neuzeitliches) „Exemplum als Geschichte“griffig gegenüberstellte (s. oben Anm. 44), stammen die nicht weniger prägnanten Pauschalkategorien: (mittelalterlicher)„Diskurs“, (neuzeitliches) „Gespräch“: K. STIERLE, Gespräch und Diskurs – Ein Versuch im Blick auf Montaigne,Descartes und Pascal, in: Poet. u. Herm. 11, ‚Das Gespräch’, München 1984, 297–334. – Zu Johanns Kritik an denCornificiani vgl. § 72, S. 195 ff., 289 ff., 292 f. und MUNK-OLSEN (wie Anm. 28) 59 ff. zu Johanns ciceronianischerBekämpfung aller „Spezialisten“, namentlich im Bildungswesen. Dasselbe, jedoch auf das gesamte (auch politische) DenkenJohanns ausgedehnt, sieht M. WILKS (John of Salisbury and the Tyranny of Nonsense, in: The World of John… 263–286,hier 272 ff.) in einem eigenen „Ideal der Mitte“, das allem „Absoluten“, sei es in gesetzesunabhängiger tyrannischerHerrschaft, sei es in sachfremdem „Leerlauf“ einseitig formaler Logik entgegensteht. Johanns Aristoteles-Begeisterungangesichts der Wiederentdeckung der logica nova darf darum nicht abgelöst von der (durch ihn selbst in einem mehremotionellen als philologischen Sinn) wiederbelebten Bildungsethik Ciceros und Quintilians betrachtet werden; dazu vgl.auch §§ 51 f., 71 f.. Die antiszientistische Frontstellung gegen Schuldialektik und Gelehrtendünkel zeigt UHLIG 8 f. alstraditionelles Motiv „moralistischer“ Literatur (zu deren ersten Zeugnissen er den Policraticus rechnet) durch das ganzeMittelalter bis zu Erasmus; vgl. auch §§ 71 f. Zu Ciceros Ausgleichsversuch und rhetorisch-philosophischemBildungskonzept vgl. S. 167, 295 ff., und K. BARWICK, Das rednerische Bildungsideal Ciceros (in: Forschungen u.Fortschritte 36 [1962], 245–8) = In: ‚Ciceros literarische Leistung’ hrsg. B. KYTZLER, (WdF 240) Darmstadt 1973,129–137, hier 130 ff., 136 (zur Bedeutung der Thesis); B. RIPOSATI, Zusammenfassende Betrachtung über Ciceros‚Topica’ (1947; wie Anm. 870), ebd. 421–439, hier 424 ff.; MICHEL, La théorie de la rhétorique… (wie Anm. 447) 110 ff.und Diskussionsvotum von A.D. LEEMAN ebd. 142 (zu Ciceros „ambivalence intrinsèque“ als „rhétoricien-anti-rhétoriqueur“). Vgl. auch Alain MICHELs grundlegende Monographie: Rhétorique et philosophie chez Ciçéron, Essai sur lesfondements philosophiques de l’art de persuader, Paris 1960.
252
jener Kunst, die „mit Worten statt mit Tätlichkeiten zu streiten“ erlaubt. Das Eindruckmachen mitAutoritäten erscheint uns allerdings eher als rhetorischer Trick, mit dem suggestiv auf das Gemüt gewirktwerden soll, denn als ernsthafte intellektuelle Methode philosophischer Erkenntnis. Doch Johann sieht darin(durchaus im Sinne des Aristoteles selbst) eines von vielen Mitteln, um einen Gedanken subjektiveinleuchtend und ansteckend (als endoxon) zu vermitteln und ins philosophische Gespräch zu bringen.547
Welche Bedeutung der Disput für Johann hatte, zeigt ein im gleichen Zusammenhang erteilter Rat, den sich inunseren Augen vor allem ein Redner oder Anwalt zu Herzen nehmen könnte, der sich aber klar an denangehenden Philosophen richtet:548
547 Zur Kampfmetaphorik s. Met. III 10, 153.19 ff., 154, 26 in Anm. 544 (sermones potius conserere quam dexteras). Vgl.auch HUNT (wie Anm. 544a) 105 zu Parallelen bei Abaelard. – Zu dem nicht einseitig psychagogischen, sondern auchargumentativen Begriff movere bei Johann s. oben § 53. Zu den Suggestivzitaten unter magna nomina in Met. III 4.136 s.S. 238 f. Johann kannte vielleicht den Rat des Aristoteles in Top. 105b 12 ff., „einen regelrechten Zettelkasten anzulegen“(so THROM [wie Anm. 545] 69), um berühmte Sätze im Sinne der Topik präsent zu haben, sowie die Begründung: „Manwird, was ein angesehener Mann gesagt hat, als haltbare These gelten lassen.“ Vgl. THROM a. O. 62 ff. zum „Rhetorischenin der Dialektik“ des Aristoteles, zu Suggestivschlüssen mit respektablem Wissen, anschaulichen Beispielen, Vergleichenu.a.m. Vgl. auch unten Anm. 861.548 Met. III 10.161 ff.: Proinde rationum undecumque ad statuendum vel destituendum positionem conquirenda est copia, uturgendi instandique facultas comparetur. Et, si adversarius deest, secum quisque experiatur que, quot et quanta propositequestionis articulum muniant aut impugnent; sic enim facile erit quisque idoneus ad cogendum et reluctandum et, siveagonizandum seu suadendum seu philosophandum fuerit, urgentias instantiasque habens aut superabit aut evadet cumgloria aut decenter sibi et sine ignominia superabitur. Fuit antiquitus hec in re militari disciplina Romanorum, ut quiarmis fuerant exercendi, ab ineunte etate assuescerent militie imaginarie, et ludentes in eo iugiter versarentur adolescentes,unde postmodum in necessitatibus rei publice feliciter triumpharent. Telorum quisque noverat usum et qualiter […] ferireoporteat, domi prediscebatur. Sic suorum instrumentorum necesse est logicum expeditam habere facultatem, ut […] omnesad manum habeat rationes. Zum Übungsspiel vgl. auch Met. III 10, 153 f. in Anm. 544 und unten Anm. 549. Als Quellekommt in Frage Aristot. Top. VIII 14, 163 a–b; transl. Boeth. (wie Anm. 433) 177.10 ff.: Ad omnem autem positionem, etquoniam sic et quoniam non sic, argumentum considerandum […]; sic enim simul accidet et ad interrogandum et adrespondendum exerceri. Et si ad nullum alium habemus, ad ipsos. Vgl. auch ebd. 164a, 179.8 ff.; 156b 15, 159.11 f.:Oportet autem et ipsum sibimet quandoque instantiam ferre.
253
Wir sollten überall so viele Argumente wie möglich suchen, mit denen wir ein und dieselbe These erhärten undwiderlegen können. So werden wir zu Meistern der Beweisführung. Sollte einmal ein Gegner fehlen, so mache einjeder mit sich selbst die Probe und prüfe, welche, wie viele und wie starke Argumente für oder gegen einenbestimmten Problemsatz sprechen. Auf diese Weise lernt man leicht, wie man die positive oder die negative Seiteeiner jeden These aufstellen kann.
Die Stelle bezieht sich punktuell nur auf die dialektische Lerntechnik, das Schlagfertigkeitstraining, dieDenkgymnastik für die philosophische Disputation. Der handwerklich technische Sinn ist evident: DieArgumentationskunst, deren Beherrschung im Streit Erfolg – „Sieg oder wenigstens ehrenvolle Niederlage“ –verspricht, beruht auf der Kenntnis oder geistigen Präsenz aller möglichen Gesichtspunkte für und wider einenGedanken, m.a.W. in der Ausbildung eines starken und allseitigen Problembewußtseins. Die bereitzuhaltendenrationes sind nicht in einsamer Meditation erkannte letzte Wahrheiten, sondern taugliche Kampfmittel,Argumente von einer Geltung, die auch der Gegner anerkennen muß (u. a. auch Autoritäten und Beispiele),obwohl der Rat, in Ermanglung eines Opponenten mit sich selbst einen fiktiven Disput zu führen, zweifellosauch ein Stück isolierter philosophischer Reflexion anzeigt und der Fortschritt auf dem Weg zur Wahrheit dasFernziel aller dialektischen Veranstaltungen – einsamer Selbstentzweiungen und gemeinsamerAuseinandersetzungen – bleibt.549 Gehen wir aber von dem umfassenden Sinn der Topik als universalersprachlogischer Methode von Dialektik und Rhetorik aus, so wirft Johanns Anweisung, mit sich selbst überalles und jedes zu streiten, nicht nur ein Licht auf die philosophiegeschichtlich gut erforschten Anfänge derscholastischen Methode, sondern auch auf noch weiter zu erforschende literatur-, bildungs- undmentalitätsgeschichtliche Zusammenhänge. Die zitierte Stelle eignet sich hervorragend als Motto für eineReihe noch zu schreibender mediävistischer Arbeiten über den experimentellen Dialog als Denkform undverwandte Themen (in Stichworten z. B.: das
549 Sieg oder … Niederlage: Met. III 10, 161.25 ff. in Anm. 548. Zum Spielcharakter s. ebd. die Begriffe in militiaimaginaria ludere und domi praediscere. Zur Konsensbildung durch Beispiele in endoxa-Funktion s. unten §§ 90 ff. – Zurtopischen Bestimmung der Dialektik s. Aristot. Top. VIII 1, 155b: „Alles hier Einschlägige hat Bedeutung lediglich demanderen gegenüber, während es den Philosophen, der für sich forscht, nicht kümmert.“ Zum Verhältnis von einsamerSchau/Theorie zum dialogischen (Reibung erzeugenden) Wissensbildungsprozeß der Dialektik, den Johann „nützlicher“findet, s. Met. III 10, 154.24 (oben Anm. 544): exercitium dialectice ad alterum est; ebd. 163.1–6: Sed licet nunc ad se,nunc ad alterum contingat utiliter exerceri, collatio meditatione videtur utilior. Ut enim ferrum ferro acuitur (cf.Prov. 27.17), sic ad vocem alterius contingit animum colloquentis acutius et efficacius excitari; sed maxime si cum sapienteaut modesto sermo conseritur. Letzteres entspricht Johanns eigener Kombination der ciceronischen Skepsis mit demchristlichen Demutsideal: dazu s. unten §§ 71 f. Die Bevorzugung der gewissermaßen „praktischen“ Dialektik gegenüberreiner Theorie oder Wissenschaft ist im Zusammenhang zu sehen mit Johanns Konfrontation von logica probabilis undlogica demonstrativa (vgl. unten § 52 oben § 72) und widerspricht darum keineswegs der anticornificianischen „Dialektik“-Kritik, die in Wahrheit eine Sophistik-Kritik ist (vgl. S. 250 f., 292 f.). Zur Einheit von Rhetorik und Philosophie unterdem sachoder wahrheitsbezogenen Oberbegriff der logica vgl. S. 196, 296 f. Zu Johanns Disputationstheorie vgl. die mirleider nicht erreichbaren amerikanischen Beiträge: J.J. MURPHY, Two Medieval Textbooks in Debate, in: Journal of theAmerican Forensic Association 1 (1964) 1–6; A. PELLEGRINI, Renaissance and Medieval Antecedents of Debate, in:Quarterly Journal of Speech 28 (1942) 14–9; Mary B. RYAN, John of Salisbury on the Arts of Language in the Trivium,Diss. (masch.), Washington DC 1958.
254
eristische Als ob in der Wissensbildung, das Probespiel mit extremen Antithesen, die hypothetische Ernstfall-Simulation u. a.). Diese Problemstellung führt zu der vielleicht wichtigsten Wurzel der sog. Renaissance des12. Jahrhunderts: dem neu belebten „Denken in Alternativen“. Im Sinne eines Forschungsanreizes seien hiereinige allgemeine Vorüberlegungen eingeschaltet.
Die Methode, aus Fiktionen aller Art, insbesondere aus fiktiven Konfliktsituationen denken und reden zulernen, gehörte längst vor ihrer hochmittelalterlichen Blüte und Expansion (auch längst vor derAristotelesrezeption der logica nova) zu den Grundpfeilern des mittelalterlichen Bildungswesens, das imwesentlichen dasjenige der spätantiken Rhetorenschule fortsetzte. Im Studienprogramm des Triviums, das inkontinuierlicher (die Einheit aller Teildisziplinen voraussetzender) Weise von der Grammatik zur Rhetorikund zuletzt zur Dialektik aufsteigt, finden sich erste Ansätze dieser propädeutischen Methode bereits in den(aus den Progymnasmata oder praeexercitamina weiterentwickelten) Anfängerübungen der Grammatik:Neben Autoren-Imitationen, Vers- und Prosa-Adaptationen, Nacherzählungen klassischer Werke inAufsatzform gehörten dazu auch Prosopopoeien und Ethopoeien, erfundene Reden historischer Personen indenkwürdigen Entscheidungslagen (Suasorien in nuce), Thesenverteidigungen zugunsten schwieriger, nichtohne weiteres einleuchtender Behauptungen und – am anspruchsvollsten – fiktive Disputationsinszenierungenberühmter Streit- und Gerichtsfälle.550 Eine zufällig
550 Auf diese Stufe bezieht sich Johanns berühmte Schilderung der Unterrichtsmethoden Bernhards von Chartres in Met. I 24,55 ff. Die bereits in der Grammatik verankerte rhetorische und dialektische Ausbildung zeigt gut schon die Einleitung55.11 ff.: pro capacitate discentis aut docentis industria et diligentia, constat fructus prelectionis auctorum. Sequebaturhunc morem Bernardus Carnotensis […]; figuras grammatice, colores rethoricos, cavillationes sophismatum, et qua partesui proposite lectionis articulus respiciebat ad alias disciplinas, proponebat in medio; ita tamen ut non in singulisuniversa doceret, sed pro capacitate audientium dispensaret eis in tempore doctrine mensuram. Zu der von der Spätantikebis zur frühen Neuzeit konstanten Progymnasmata-Praxis, auf früherer Stufe alles Spätere in schülerfreundlicher Weisevorwegzunehmen vgl. W. JENS, Art. Rhetorik (wie Anm. 530) 441 f. Zu Inhalten und Formen dieser „Unterstufe“ vgl. S.F.BONNER, Education in Ancient Rome, London 1977, Kap. 19–20; ders., Roman Declamation in the Late Republic andEarly Empire, Berkeley/Los Angeles/Liverpool 1949, 10 ff. u. ö.; FUHRMANN, Rhet. (wie Anm. 49) 15 ff.; LAUSBERG§ 96, 27; § 398; W. TRIMPI, The Quality of Fiction: The Rhetorical Transmission of Literary Theory, in: Traditio 30(1974) 1–118, hier 77 ff.; KOEP 144 (Fabel-Nacherzählungen); Michael WINTER-BOTTOM, Roman Declamation, Bristol1980, 1 f., 15 ff., 52 ff. (Prospopoeien); zur Rezeption der progymnasmatischen Tradition in der Neuzeit vgl. SCHON14 ff.; BARNER (wie Anm. 298) 285 ff. (als Voraussetzung des Schultheaters); D.L. CLARK, The Rise and Fall ofProgymnasmata in Sixteenth and Seventeenth Century Grammar Schools, in: Speech Monographs 19 (1952) 259–63.Mediävistische Arbeiten sind m. W. noch weitgehend ein Desiderat, zu der häufig erwähnten Fiktionalität oder Simulationvgl. oben Anm. 548 zu Met. III 10, 161 f. und etwa Quint. V 11.95–6: Nam fingere hoc loco hoc est proponere aliquid,quod si verum sit, aut solvat quaestionem aut adiuvet. Daß gerade dialektisch-logische Fragen zum Grammatikunterrichtgehörten, noch bevor die logica nova sich durchsetzte, zeigen: De RIJK, Logica modernorum (wie Anm. 544a) II 1.95 ff.; H.COING, Zum Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf die Entstehung des römischen Rechts, in: SZ Rom. 69 (1952)24–59, bes. 28 ff. Dies dürfte auch eine Ursache dafür sein, daß der allgemeinbildende Rechtsunterricht zuerst in derGrammatik stattfand, obwohl auf höherer Stufe eine stärker auf die Prozeßpraxis zugeschnittene Rechtskunde wesentlich zurRhetorik gehörte (vgl. § 67, S. 258). Nicht zufällig war der Begründer des gelehrten Rechts der Glossatoren, Irnerius,anfänglich Lehrer einer Grammatikschule. Lokale Traditionen dürften mehr als alles andere die unterschiedlicheFührungsposition der Grammatik oder der Rhetorik in der propädeutischen Ausbildung der logisch-juristischenDisputationskunst vor dem späten 11. Jh. bestimmt haben, ungeachtet der daneben stets als eigenes Fach gepflegtenDialektik, die bekanntlich seit dem Hochmittelalter die Vorherrschaft über die beiden anderen Disziplinen des Triviumserlangte; vgl. Erich GENZMER, Die Iustinianische Kodifikation und die Glossatoren, in: Atti del congresso internaz. diDiritto Romano, Bologna, Bd. I, Pavia 1934, 347–430, hier 385 ff., 398 ff., 418; Harald ZIMMERMANN, Römische undkanonische Rechtskenntnis und Rechtsschulung im früheren Mittelalter, in: La scuola nell’Occidente latino dell’AltoMedioevo, (Settimane di Studio del CISAM 19) Spoleto 1972, 767–794, bes. 780 ff.; Peter WEIMAR, Die legistischeLiteratur der Glossatorenzeit, in: Hb. d. Quellen u. Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgesch. I, ed. H. COING,München 1973, 129–260, hier 129 ff. mit ausführlicher Bibliographie.
255
überlieferte Versübung unter dem Titel Confutatio grammatice Ekkehards IV. von St. Gallen läßt sich hier alsillustratives Beispiel aus dem Zwischenbereich von Grammatik und Rhetorik anführen: KonventionelleArgumente christlicher Bildungsfeindlichkeit werden darin kaum aus inhaltlichen Gründen, sondern alsZeugnis für die rhetorische Kunst, „große Dinge klein
256
zu machen“, vorgeführt; sie demonstrieren, wie gerade das selbstverständlich hochgeschätzte Unterrichtsfach,in dem die Übung stattfindet, spielhaft herabgemindert werden kann. Typischer Übungsstoff rhetorischerExperimente waren andererseits Rechtsprobleme wie die Verfügung über Strandgut, die Strafen für Ehebruchund Muttermord, die Belohnung des Tyrannenmords u. ä., die (etwa in den erhaltenen Musterbeispielen derrhetorischen Lehrbücher Alkuins und Notkers des Deutschen) allerdings weniger juristisch als literarisch – inPlädoyers und Rededuellen über so fernliegende Fälle aus Bibel und Mythos wie Susanna, Orest oder Judith –behandelt wurden.551
Diese vielfältigen Übungen wurden alle bereits im Rahmen des (von rhetorischen und dialektischen Elementendurchsetzten) Grammatikunterrichts veranstaltet, obwohl einiges davon mit verändertem Ausbildungszielspäter unter der Ägide der beiden andern Trivium-Fächer wiederholt wurde. Auch wenn diese Zusammenhängenoch keineswegs hinreichend geklärt sind, läßt sich a limine annehmen, daß aufgrund unveränderterBildungsbedingungen und -interessen spezifische Formen der declamationes (d. h. der übungshalber aus derGerichtsrede entwickelten controversiae und der den funktionslos gewordenen Staats- und Volksredenentsprechenden suasoriae) ohne eigentliche Entwicklung bis ins 12. Jahrhundert weiterbestanden. Die direkteWirkung bestimmter deklamatorischer Texte (Seneca d. Ä., Pseudo-Quintilian) auf die mittelalterlicheLiteratur, etwa auf die eher kuriose Gattung der Kunstreden, ist kaum nennenswert. Einzelne Formelementemittelalterlicher Werke – z. B. Ethopoeien, erfundene Reden der Geschichtsschreiber, Briefeinlagen derErzähler – erinnern jedoch an den deklamatorischen Stil einiger antiker auctores und poetae, was als Hinweisauf die schulrhetorische Breitenwirkung
551 Confutatio grammatice in: Benedictiones super lectores per circulum anni I 24, ed. J. EGLI, der Liber benedictionumEkkeharts IV … (Mitteil. z. vaterländ. Gesch., Hist. Verein St. Gallen 31), St. Gallen 1909, 211–17; dazu vgl. P. STOTZ,Dichten als Schulfach – Aspekte mittelalterlicher Schuldichtung, in: MlatJb 16 (1981) 1–16, hier 2–4. Zu den Beispielen:Alcuins Lehrer-Schüler-Gespräch mit Karl d. Gr., Dialogus de rhetorica et virtutibus, ed. HALM 525–50, hier 527–9(Orestsage und biblische Exempla) sowie Notker Labeos De arte rhetorica, ed. P. PIPER, Die Schriften Notkers und seinerSchule I (1881) 623–84, hier 646 ff. (Prozeßverlaufsdarstellung zum Fall Orest aufgrund von Cic. Inv. I 13.18; 14.19) vgl.ZIMMERMANN (wie Anm. 550) 783 f. und R. GRUENTER, Über den Einfluß des Genus Iudiciale auf den höfischenRedestil, in: DVJs 26 (1952) 49–57, hier 49 f. Zu dem klassischen Deklamations- und Schulübungsthema „Tyrannenmord“mit dem ebenso topischen Fallbeispiel Judith längst vor Johanns vermeintlicher Tyrannenmordtheorie, die eine„Perfektionierung“ der Tyrannenmord-controversia darstellt, vgl. § 99, S. 365 f., A. 631 f., 642. – Zu Notker s. jetzt S.JAFFE, Antiquity and Innovation in Notker’s Nova rhetorica: The Doctrine of Invention, in: Rhetorica 2 (1985) 165–181.
257
der einstigen Deklamationspraxis verstanden werden kann.552 Wir werden immer in erster Linie fertigeErgebnisse der literarischen Praxis vergleichen müssen. Die Ausbildungs- und Lernprozesse selbst gehören zurmündlichen Kultur auf höchster Bildungsebene. Schriftliche Zeugnisse darüber sind Raritäten.552a Die Denk-und Redetechniken wurden (wie andere Techniken) in persönlichen „Meisterkursen“ durch praktisches Übenan Vorbildern erlernt. Auch hier galt der Vorrang des Beispiels vor der Regel, der Erfahrung vor derKunstlehre (usus vor ars), wie eine der wichtigsten bildungsgeschichtlichen Quellen des Mittelalters: Johannsberühmte Darstellung der Lehrtätigkeit Bernhards von Chartres, anschaulich bezeugt.553
552 Zu den controversiae und suasoriae vgl. FUHRMANN, Rhet. (wie Anm. 49) 66 ff.; BONNER, Declamation (wieAnm. 550) 149 ff. insbesondere zum deklamatorischen Einfluß auf Literatur und Geschichtsschreibung der Antike (z. B.Ovids Heroiden, Sallust); zum MA. vgl. S. 344, 353, 363. Zur direkten Wirkung deklamatorischer Texte s. S. 278 f. undz. B.U. KINDERMANN, Die fünf Reden des Laurentius von Durham, in: MlatJb 8 (1973) 108–141. Zum neuzeitlichenErbe der Deklamationspraxis im akademischen Disputationswesen und im Drama vgl. BARNER (wie Anm. 298) 393 ff.;JENS (wie Anm. 530) 441 f.; DAXELMÜLLER, Disputationes curiosae (wie Anm. 287) 41 ff.; Joel ALTMAN, The TudorPlay of Mind, Rhetorical Inquiry and the Development of Elizabethan Drama, Berkeley–Los Angeles–London 1978, 28 f.,33 ff., 45. Auch hier wären entsprechende mediävistische Arbeiten im Sinne des oben (Anm. 550 mit MURPHY) betontenForschungsdesiderats von Nutzen. Sie könnten helfen, die generelle Feststellung zu präzisieren, daß Johanns Beschreibungdes Grammatikunterrichts in Chartres ebensogut aus der karolingischen Zeit wie aus der Spätantike stammen könnte, da sichim Bildungswesen so wenig verändert habe (P. RICHÉ, Jean de Salisbury et le monde scolaire du XIIe s., in: The World ofJohn of, 39–62, hier 54 f.). Zur Invariabilität des spätantiken Lehrprogramms durch das frühere MA vgl. auch J.FONTAINE, Christentum ist auch Antike. Einige Überlegungen zur Bildung und Literatur in der lateinischen Spätantike, in:JbAC 25 (1982) 5–21, hier 17; vgl. auch das ‚Opus magnum’ von P. RICHÉ, Les écoles et l’enseignement dans l’occidentchrétien de la fin du 5e s. au milieu du 11e s., Paris 1979.552a Vgl. allgemein KÖHN, Schulbildung (wie Anm. 557) 223 ff.; im einzelnen: R.B.C. HUYGENS, Guillaume de Tyretudiant, … in: Latomus 21 (1992) 811–29; J. EHLERS, Verfassungs- und sozialgeschichtl. Studien zum BildungsgangErzbischof Adalberts II. von Mainz, in: Rhein. Vierteljahrsblätter 42 (1978) 161–84.553 Zum Verhältnis von ars und usus und zum didaktischen Vorrang der Übung vor der Theorie bei Johann s. S. 293 ff. ZumThema der Mündlichkeit vgl. STOCK, Literacy (wie Anm. 371) 3 ff., 13 ff. 595 (s. 1. „oral culture“) u. passim.Merkwürdigerweise kommt STOCK, der Bernhard von Chartres mehrfach als Autor des nani-gigantes-Gleichnisses anführtund (284) einen „modernen Sokrates“ nennt, kaum auf die (wohl nicht zufällig) fehlende Schriftlichkeit dieses Meisters zusprechen, obwohl er theoretisch sehr treffend (7) bemerkt: „Literacy is not textuality […] In fact, the assumption shared bythose who can read and write often renders the actual presence of a text superfluous.“ Das mediävistische Kernproblem einermündlichen Tradition auf höchster Stufe der Bildung und Gelehrsamkeit bleibt gestellt und sollte bei der Betriebsamkeit umden meist volksliterarischen Begriff der „oral culture“ nicht ganz vergessen gehen. (Gegen romantische Klischees auf diesemSektor vgl. aus anderer Sicht: Manfred G. SCHOLZ, Hören und Lesen, Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12.u. 13. Jh., Wiesbaden 1980). – Mit J.J. MURPHY, Discourse (wie Anm. 446) ist andererseits zu warnen vor weitreichendenExtrapolationen aus Johanns Unterrichtsdarstellung in Met. I 24, die oft mangels anderer Dokumente und Verkennung der„oral nature of most medieval discourse“ zu einem Zeugnis für 500 Jahre Schulpraxis gemacht wird. Die Warnung gilt afortiori, nachdem P.E. DUTTON (The Uncovering of the ‚Glosae super Platonem’ of Bernhard of Chartes, in: MSt 46[1984] 192–221, hier 193 f., 212 ff.) festgestellt hat, daß Johann, der Bernhard nicht persönlich kannte, nur eine ArtApophthegmensammlung umlaufender dicta des legendären Meisters zusammenstellte, die er von seinen Lehrern,insbesondere Wilhelm von Conches, gehört hatte. (Zu DUTTONS Hypothese, daß Bernhard der Verfasser der Glosae superPlatonem sei, möchte ich mich hier nicht äußern.)
258
64. In zweiter Linie – und im Bewußtsein der genannten Einschränkung – können auch theoretische Aussagenund anerkannte Kunstregeln herangezogen werden. Einige Grundprinzipien der topischenArgumentationstheorie, die schon für die Deklamationspraxis leitend waren, sind in den mittelalterlichenArtes überliefert und angewandt worden. So war jedem Schüler des Triviums (vor allem aus derAristotelesvermittlung des Boethius) die Unterscheidung zwischen thesis und hypothesis, zwischenallgemeinen infiniten und konkreten (durch „Umstände“ gebildeten) finiten Problemen bekannt. Daraufberuht letztlich die erwähnte gegenstandsbezogene Differenzierung von Dialektik und Rhetorik: Theseis(quaestiones, quaestiones indefinitae, generaliter proposita) sind univerale philosophische Grundfragen –etwa das Wesen des honestum, die Entstehung der Welt, die Unsterblichkeit der Seele –; Hypotheseis (causae,quaestiones definitae/speciales, particulariter proposita) sind ursprünglich die bestimmten Fälle, die derRedner vor dem Rat, Gericht oder Volk parteilich zu behandeln hatte, und später – nachdem die Rhetorik einFach literarischer Allgemeinbildung geworden ist – überdies auch alle durch besondere, individuelle Umstände(Peristasen, circumstantiae nach dem Merkvers: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando)eingegrenzten Probleme der Lebenswelt.554 In den spätantiken declamationes
554 Allgemein zur Unterscheidung von Thesis und Hypothesis vgl. unten §§ 90 f.; Hauptstellen: Aristot. Top. I 11,104b–105a (vgl. auch Rhet. 1326a–b; Anal. pr. 67a 27 f.); Cic., Inv. I 6.8; Top. 21.79; Or. I 31.138; De orat. II 15.65;Rhet. Her. I 2.2; I 3.4; I 10.17 u. ö.; Quint. II 4.25, 21.21; II 5.5–7, 14. Locus classicus für das Mittelalter war Boeth. Diff.Top. IV (PL 64) 1205 C–D: Dialectica facultas igitur thesim tantum considerat. Thesis vero est sine circumstantiisquaestio. Rhetorica vero de hypothesibus, id est de quaestionibus circumstantiarum multitudine inclusis tractat et disserit.Circumstantiae vero sunt: quis, quid, ubi, quando, cur, quomodo, quibus adminiculis. Rursus dialectica quidem si quandocircumstantias, veluti personam factumve aliquod ad disputationem sumit, non principaliter, sed omnem eius vim adthesim, de qua disserit, transfert. Rhetorica vero si thesim assumpserit, ad hypothesim trahit, et utraque suam quidemmateriam tractat, sed alterius assumit, ut proniore in sua materia facultate nitatur. Dazu vgl. LEFF (wie Anm. 855) 10 f.Johann hat dies in Met. II 12.83 wie folgt übernommen: Versatur exercitium dialectice in omnibus disciplinis, siquidemquestionem habet materiam; sed eam quae ypotesis dicitur, id est que circumstantiis implicatur, relinquit oratori. Suntautem circumstantiae quas Boetius in quarto Topicorum enumerat, quis, quid, ubi, quibus adminiculis, cur, quomodo,quando. Thesim vero vendicat sibi, id est questionem a predictarum circumstantiarum nexibus absolutam. – Im Sinne einerrepräsentativen mittelalterlichen Lehrbuchdarstellung vgl. auch Radulf von Longchamp, In Anticlaud. comm. (wie Anm. 508)138 f.: Materia ergo rhetoricae est hypothesis, id est causa […] Ex hoc patet, quod rhetorica nec est logica nec parslogicae, quoniam logica circa thesim id est circa generaliter proposita versatur. Rhetorica vero circa hypothesim solam idest circa proposita particulariter. Est autem hypothesis sive causa, res quae habet in se controversiam in dicendo positamde certo dicto vel facto alicuius certae personae, ut habet controversia an Orestes iure interfecit matrem suam. Non enimdico homicidium aut furtum, aut aliud huiusmodi esse materiam artis, sed rem in controversia positam, quae probabilibusargumentis vera aut falsa esse contenditur […] Vel aliter: hypothesis est quaestio implicita circumstantiis id est certisdeterminationibus personarum, factorum, causarum, temporum, modorum, facultatum, quae circumstantiae hoc versudesignantur: ‚Quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando’. (Zu logica für dialectica s. oben Anm. 544a; zu Orestesvgl. S. 256; dicto vel facto: s. A. 555). Vgl. W. TRIMPI, Quality … (wie Anm. 550) 5 ff.; ders., The Ancient Hypothesisof Fiction, An Essay on the Origins of Literary Fiction, in: Traditio 27 (1971) 1–78, hier 65 ff.; BONNER, Declamation(wie Anm. 550) 2 ff., 20 ff.; GRÜNDEL (wie Anm. 4) 20 ff.; M.L. CLARKE, The thesis in the Rhetorical Schools of theRepublic, in: Class. Quarterly 45 NS 1 (1951) 159 ff.; THROM (wie Anm. 545) 40 ff., 71 ff. u. ö. Zur Bedeutung derTheorie für die Definition von Dialektik und Rhetorik s. Anm. 545, 556. Johann bezieht sich darauf auch in Met. II 9, 75 f.;15, 88 f.; III 5, 140 f. (nach Aristot. Top. I 11, 104b–105a); vgl. auch unten Anm. 572.
259
und danach in der ganzen Unterrichts- und Schulpraxis des Mittelalters, d. h. überall da, wo Rhetorik nichtunmittelbar – in Prozessreden, Briefen, homiletischen und anderen Ansprachen – einem aktuellen Fall odernegotium dient, sondern beispielhafte Repräsentationen solcher Problemfälle behandelt, werden diecausae/hypotheseis den Exempla wesensverwandt. Abgesehen von der z. T. wortgleichen Schuldefinition fürexemplum und causa (dictum vel factum alicuius certae personae), gleichen sie sich gerade darin, daß sieeinen simulierten oder erfundenen Streitgegenstand (res quae habet
260
in se controversiam positam) vor Augen führen, an dem Argumente und Gegenargumente spielhaft geübtwerden können.555 Die Thesis steht entsprechend dem Gegenteil eines Exemplums, der Sentenz nahe; sie ist,wie das Wort sagt, eine „Setzung“ (positio), ein allgemeiner in utramque partem diskutierbarer „Satz“ zueinem Problem der praktischen oder theoretischen Philosophie. Die Grenze zwischen diesen zweiProblemsorten (genera quaestionum/causarum) ist durchlässig: Trotz der seit Boethius eingebürgertenZuordnung der Thesis zur Dialektik und der Hypothesis zur Rhetorik gehören beide in den allgemeinenAktionsraum der Topik, innerhalb dessen sie sich durch erprobte Metamorphosen gegenseitig vertauschenlassen: Nach dem klassischen Schulmuster läßt sich etwa die Thesis: „soll man heiraten?“ in Form derHypothesis: „soll Cato heiraten?“ behandeln. Umgekehrt läßt sich etwa die berühmte causa, ob Alexandernach Indien fahren soll, in die quaestio nach der Verläßlichkeit Fortunas für die Mächtigen überführen. Dadieses zweischneidige Thema wiederum selbst mit konkreten Beispielen beleuchtet werden kann (zahlloseHerrscher sind durch Hybris zu Fall gekommen), läßt sich das Verhältnis von dialektischer Thesis undrhetorischer Hypothesis als eine im Übungsbereich der Deklamation, der Schule oder der
555 Die Vergleichbarkeit von causa/Hypothesis und exemplum/Paradeigma (vgl. auch unten Anm. 573) ergibt sich bereits ausAristoteles’ Begründung der Rhetorik (Rhet. 1356b 1–6) als Überzeugungsmethode durch das Beispiel oder das Enthymem,die in der Dialektik der Induktion und dem Syllogismus entsprechen. Das Beweismittel der Rhetorik bildet also (zur Hälfte)das Paradeigma. In Rhet. 1357b 29 und Anal. pr. 58b 38 f. (s. oben Anm. 435 bei Boeth. und Johann) wird das Beispiel alsSchluß „vom Besonderen auf Besonderes“ definiert. Da aber das zu Beweisende den gleichen Geltungscharakter aufweisenmuß wie das Beweismittel (oder die Prämisse), ist auch das Objekt der Rhetorik „ein Besonderes“. Ein rhetorischer Schlußist somit der Beweis einer Hypothesis durch ein Paradeigma. Dazu vgl. THROM (wie Anm. 545) 11,29 und LEWRY (wieAnm. 544a) 55 ff. zur scholastischen Rezeption (z. B. Aegidius Romanus: instrumenta rhetorice sunt exemplum etenthimema). Das certum/dubium-Verhältnis der beiden „singulären Teile“ läßt sich (nach den oben §§ 12 f., 15 zurAmbivalenz von strukturellem und virtuellem Exemplum, Fallbeispiel und Beispielfall in Verbrauchs- undWiedergebrauchsrede entwickelten Kriterien) als situationsbedingt umkehrbar beurteilen. Überdies entsteht beim Übertritt des„Falls“ aus der Welt forensischer negotia in den Raum der Übung und Literatur eine eigene Analogie der beiden sonst strengzu trennenden exemplum-Begriffe als Bezeichnung für den mustergültigen Text und den Präzedenzfall in der für die Erlernungder Kunst vorbildlichen Problemlösung (vgl. Anm. 374). – Die in den angeführten Stellen von Radulf von Longchamp(Kontext s. oben Anm. 554) offenkundige Parallele zur exemplum-Definition der Rhetorica ad Herennium (IV 49.62 obenAnm. 374) ist darum kein Zufall. Derselbe (juristisch und literarisch interessierte) Theoretiker bezeugt repräsentativ, daß dasMittelalter Rhetorik keineswegs nur als „funktionslos“ gewordene Schul- und Deklamationsrhetorik verstand (wie CURTIUS[ELLM 78] in Verkennung gebrauchsliterarischer Mündlichkeit annahm), sondern als Methode für eine tatsächlicheRedepraxis; In Anticlaud. comm. (wie Anm. 508) 153 f.: Causa igitur, ut supra diximus, est res quae habet in secontroversiam in dicendo positam de certo dicto vel facto alicuius certae personae. Controversiam appello litem oratorumex intentione et depulsione constantem cum rationibus et confirmationibus utriusque partis, qualis […] in iudicialibusplacitum dicitur, in deliberativis consultatio, in demonstrativis contio vocatur. Tractare vero controversiam estrationabiliter intendere vel depellere. In omni vero disceptatione, in qua factum conceditur, animus auditorum sive iudicumrationem aliquam naturaliter quaerit statim audita depulsione. Haec igitur questio […] quae tacita in animis iudicumversatur, quaestio causae dicitur. Offensichtlich fingierte oder literarische Fälle juristischer Ausbildung wie OrestsMuttermord u. dgl. (s. oben Anm. 551, 554) sind vom Stoff her typische Exempla; sie bedeuten aber nicht, daß die Rhetoriknur schöngeistigen Zwecken diente, sondern vielmehr, daß sogar mythologische Themen der Antike einem praktischenÜbungszweck unterworfen wurden. Die wissenschaftliche Spezialisierung der Jurisprudenz durch die Glossatoren wird meistnur als deren Emanzipation aus bloß literarischer Trivium-Propädeutik gepriesen (s. unten §§ 91 f.), obwohl man umgekehrtmit demselben Argument auch anerkennen könnte, welche praktischen Aufgaben die frühere allgemeinbildende Rhetorikimmerhin zu übernehmen hatte.
261
Literatur umkehrbare Zweck-Mittel-Relation verstehen: Zur Lösung einer philosophisch allgemeinen Fragewird das Beweismittel aus dem Katalog berühmter causae geholt und in die Form eines Exemplum (mit derFunktion des beweisenden certum) gebracht; bei der Behandlung eines bestimmten praktischen Problems wirddas Beweismaterial durch Zuordnung zu einer (im Sinne eines locus communis vorentschiedenen) quaestiogefunden. So dient Rhetorik der Dialektik als Hilfswissenschaft und umgekehrt.556 Die Fähigkeit, zu jedemEinzelfall die übergeordnete allgemeine Frage als Topos zu erkennen, ist dem Redner ebenso nützlich wieumgekehrt dem Dialektiker die Kunst, das allgemeine Problem durch Beispiele zu konkretisieren. Dies istangesichts der Personalunion zwischen dem Schüler der Dialektik und dem der Rhetorik im mittelalterlichenTrivium allerdings eine eher akademische Unterscheidung.
556 Thesis und Sentenz: vgl. LEEMAN (wie Anm. 38) 232 f. zum deklamatorischen locus communis und S. 163 zur Gnomeim Unterschied zur exempelartigen Chrie (unpersönliche Maxime und „sagte“-Wort). Auch hier zeigt sich die gegenseitigeVerwandelbarkeit von finiter und infiniter propositio. – Nach Aristot. Top. I 11, 104b 19 f. ist „eine These eine dergewöhnlichen Ansicht widersprechende Einsicht eines angesehenen Philosophen“, d. h. eine paradoxe „Setzung“ oderMaxime, wobei das Paradoxe in der Vertretbarkeit „beider Seiten“ liegt. Dazu vgl. THROM (wie Anm. 545) 25, 31 f.Boethius übersetzt Top. I 11, 104b 35 (wie Anm. 5) 18.8 f.: Paene autem nunc omnia dialectica problemata positionesvocantur. – Der Begriff genera quaestionum stammt von Cicero, Top. 21.78 f.: Quaestionum duo genera sunt: alteruminfinitum, definitum alterum. Definitum est quod Êpøuesin Graeci, nos causam, infinitum, quod u™sin illi appellant, nospropositum possumus nominare. Der Terminus quaestio kann also sowohl als Oberbegriff aller Probleme, finiter wieinfiniter, als auch als Unterbegriff für das dialektisch-infinite Problem (Thesis) verwendet werden (vgl. auch oben Anm. 555zu quaestio causae). Zu Ciceros Absicht, die Rhetorik durch Einführung von Theseis „philosophischer zu machen“ und derdamit verbundenen Akzentuierung des Unterschieds von proposita und causae, Thesen und Hypothesen vgl. RIPOSATI (wieAnm. 546) 424 ff. Daraus entwickelt Boethius seine wissenschaftssystematische Unterscheidung der rhetorischen unddialektischen Topik (oben Anm. 554: Diff. Top. IV 1205 C–D). Zur gegenseitigen Vertauschbarkeit von Thesis undHypothesis vgl. ebd. und THROM (wie Anm. 545) 58 f. – Zum Beispiel der deliberatio Alexandri an naviget vgl.LEEMAN (wie Anm. 38) zu Seneca d. Ä., Suas. I 8–10 nach dem Schema: dixit deinde locum de varietate fortunae, et cumdescripsisset, nihil esse stabile, omnia fluitare […]; deinde exempla regum ex fastigio suo devolutorum adiecit. Vgl. auchunten §§ 91 f. Das Hauptziel der grundlegenden Arbeit von THROM besteht im Nachweis der popularphilosophischenDiatribe als ethisch-paränetischer Thesis der praktischen Philosophie (vgl. 71 ff., 77, 191). Dies ist deshalb bemerkenswert,weil in dieser für die christliche (namentlich homiletische) Literatur so modellhaften Gattung gerade die Technik der loci-exempla-Korrespondenzen besonders intensiv gepflegt wurde (vgl. §§ 44 f., 69, S. 97, 124, 362 f., Anm. 958).
262
65. Schwieriger wird das Verhältnis der Disziplinen im Zuge der allmählichen arbeitsteilig-berufsorientiertenAuflösung dieser „trivialen“ Einheit seit dem 11. Jahrhundert. In dieser bildungsgeschichtlichenInkubationszeit der Universitäten wurden bekanntlich die Dialektik zur umfassenden theologisch-philosophischen Methodenlehre der Scholastik, Rhetorik und Dialektik gemeinsam zur Fachlogik der neuenRechtswissenschaft der Glossatoren ausgebildet und formalisiert, und es entstanden auf praktischen Bedarfzugeschnittene Sonder-Rhetoriken etwa für die Predigt oder Notariatskunst. Vielfältige Spezialisierungengruben so dem herkömmlichen Trivium, insbesondere der ebenso allgemeinbildenden wie praxisbezogenenRhetorik allseits das Wasser ab, bis zuletzt oft nur noch ein eher schöngeistiges Einführungs-und Begleitfachfür Literaturkunde und Stilübung übrigblieb.557 Der Wandel
557 Zu diesem Spezialisierungsprozeß vgl. etwa Ernst MEYER, Die Quaestionen der Rhetorik und die Anfänge juristischerMethodenlehre, in SZ rom. 68 (1951) 30–73, bes. 67 f., 43 ff.; WEIMAR, Legist. Lit. (wie Anm. 550) 129 ff.; zurTrennung der mit der Rhetorik vereinten Jurisprudenz in gelehrtes Recht und Ars dictaminis seit dem 11. Jh. in Bolognavgl. ZIMMERMANN (wie Anm. 550) 788; W.D. PATT, The Early „Ars Dictaminis“ as Response to a Changing Society,in: Viator 9 (1978) 133–155, bes. 148 ff.; DELHAYE, Enseignement (wie Anm. 418) 90 f. Die neueste und beste Übersichtüber den komplizierten Umschichtungs- und Auflösungsprozeß, dem das Trivium in der Bildungsgeschichte des 12. u. 13.Jhs. ausgesetzt war, bietet jetzt die kenntnisreiche und bibliographisch ergiebige Arbeit von Rolf KÖHN: Schulbildung undTrivium im lateinischen Hochmittelalter und ihr möglicher praktischer Nutzen, in: ‚Schulen und Studium im sozialenWandel des hohen und späten Mittelalters, hg. J. FRIED (Vorträge und Forschungen 30) Sigmaringen 1986, 203–284 (nachAbschluß dieser Arbeit erschienen).
263
von der universal-propädeutischen zur „wissenschaftlichen“, fachspezifischen Konzeption der beiden logos-Künste oder „Denk- und Redelehren“ läßt sich vielleicht am einfachsten aus der Tatsache erklären, daß einbisher mehr oder weniger zweckmäßiges Akkulturationsmuster allmählich als strukturell unbefriedigendempfunden wurde: Das überkommene Bildungssystem der Antike, das mehr auf die Produktion als auf dieInterpretation von Texten angelegt war, schien den spezifischen Aufgaben einer christlichen Gesellschaftnicht mehr gewachsen; oder umgekehrt formuliert, die eminent hermeneutischen Probleme einer fastausschließlich auf Offenbarungen, Autoritäten und Schriftzeugnissen gründenden Weltsicht schienen bishereher „zufällig“ als methodisch gelöst worden zu sein, weil noch keine den antiken Beweislogikenvergleichbare systematische Auslegungslogik zur Verfügung stand. Aus solcher Erkenntnis erwachte im 11.Jahrhundert so gut wie gleichzeitig auf theologischem (insbesondere bibelexegetischem) und aufkirchenrechtlichem Gebiet ein neues Bedürfnis nach ordnender Sichtung und rationaler Benützung der bisherreflexionslos aufgehäuften und gewohnheitsmäßig applizierten auctoritates kirchlicher Tradition, nachreformgemäßer Überprüfung der consuetudo durch die ratio fidei. Allein schon in quantitativer Hinsicht wardas gesammelte Material (exegetischer Kirchenväterstellen, Konzilsbeschlüsse, päpstlicher Erlasse u. dgl.)schwer zu bewältigen, vor allem aber zeigten sich vermehrt Widersprüche, Doppelsinnigkeiten,Anachronismen, Lücken und sonstige Interpretationsschwierigkeiten beim Vergleich verschiedenernormativer Stellen. Der Schatz an verbindlichem Wissen war labyrinthisch unübersichtlich oder gefährlichambivalent geworden und machte das Ungenügen bisheriger Kompilatorik bewußt. Klarheit undMethodenstrenge wurden erstrebt, um die durch menschliche Unvollkommenheit entstellten und verwirrtenheiligen Texte wiederherzustellen, d. h. in ihrer Geltung zu stärken. Wie Stefan Kuttner (die alte Streitfragenach der zeitlichen Priorität des kirchenrechtlichen oder des theologischen Wissenschaftsaufschwungs alssinnlos verwerfend) vor kurzem betonte, entstand in demselben „intellektuellen Klima“ überall derselbeForscherdrang oder vielmehr dieselbe „leidenschaftliche Suche nach dem Verständnis der umfassendenOrdnung, die hinter den aufgehäuften, fragmentarischen, oft widersprüchlichen Autoritäten der Vergangenheitwirken soll“. Aus diesem Bedürfnis erwuchs in verschiedenen Bildungszentren eine bald mehrkirchenrechtliche, bald mehr philosophisch-theologische (etwas später auch zivilrechtliche) Wissenschaft derWiderspruchsbehebung oder (mit der berühmten, nicht nur auf die canones anwendbaren Formel) derconcordia discors. Die Lösungs- und Ausgleichsverfahren waren in diesen Bereichen des neuenwissenschaftlichen Denkens subtantiell identisch: Herkömmliche Regeln der Triviumdisziplinen wurden mithermeneutischen Techniken, die aus praktischer Nachahmung des vorbildlichen Interpretationsstils derKirchenväter gewissermaßen vorwissenschaftlich bekannt waren, in methodisch neuer Weise kombiniert;grammatikalische Bedeutungslogik und die beiden Argumentationslogiken Rhetorik
264
und Dialektik lieferten Grundlagen (wie die Prädikationslehre, status-Lehre oder Syllogistik), die nunkonsequent auf die patristische Tradition bibelexegetischer Textkritik, historischer Quellenkritik,Übersetzungskunst und philologischer Kommentierarbeit bezogen und den jeweiligen theologischen oderjuristischen Bedürfnissen angepaßt wurden. Sämtliche neuen Wissenschaften des Hochmittelalters entstandenletztlich nach diesem Muster: Alle gehen sie von hermeneutischen, nicht empirischen oderproduktionsliterarischen Prämissen aus und erstreben die vollendete Auslegung und Applikation irgendeinesschon vorgegebenen oder (enzyklopädisch und systematisch) hergestellten Haupt- und Sammelwerks. JedeWissenschaft hat nach dem Modell der Bibel ein eigenes „Buch der Bücher“: etwa Justinians Codex iuris,Gratians Decretum, das Sentenzenwerk des Lombarden, die Summa Theologica des Aquinaten, ja sogar dassalernitanische Corpus medizinischer Schriften der Antike u.a.m.558
558 Zu consuetudo/ratio vgl. §§ 24 f., 74. – Zur kanonistischen Entwicklung s. S. KUTTNER, Revival of Jurisprudence(wie Anm. 210a) 300 ff.; zitierte Stelle ebd. 310: „the old controversy on priority […] has been quietly put to rest. It was amistaken question, based on the search for ‚influences’ where the reality was that of an intellectual climate which becameapparent at the same time but in different ways north, west, and south […] We can call it a climate of desire for learning: itmanifested itself in what was more than a search, rather an impassioned quest for understanding the universal order that mustexist behind the accumulated, fragmentary, and often contradictory authorities of the past.“ Zur vorangehenden Zeit führtKUTTNER das prägnante dictum von Ch. H. HASKINS (The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge Mass. 1927,195) an: „Tradition, not reflection, determined everything.“ Die Frage nach theologischen Vorläufern der kanonistischenMethode erübrigt sich im übrigen schon deshalb, weil das Kirchenrecht ein Unterfach der „Theologie“ war, wie K.W. NÖRRbetont: Die kanonistische Literatur, in: Hb. d. Quellen u. Lit. d. Privatrechtsgesch., ed. H. COING, München 1973,365–382, hier 366. – Zum Aspekt der ins Unüberschaubare angewachsenen Stoffmasse (Burchard von Worms sprach bereitsvon einer betrüblichen confusio librorum) vgl. ZIMMERMANN (wie Anm. 550) 772 ff.; G. THEUERKAUF, Burchard vonWorms und die Rechtskunde seiner Zeit, in: FMSt 2 (1968) 144–161. – Zur Methodensynthese vgl. WEIMAR, Legist. Lit.(wie Anm. 550) 129 f.; S. KUTTNER, Interpretation of Medieval Canon Law, (Wimmer Lecture 10) Latrobe 1960; ders.,Urban II and the Doctrine of Interpretation. A Turning Point, Studia Gratiana 15 (1972) 53–85; P. FOURNIER-G. LeBRAS, Hist. des collections canoniques en Occident II, Paris 1932/Aalen 1972, 335 ff. N.M. HÄRING, Commentary andHermeneutics, in: Renaiss. and Renewal … 173–200. – Zur Konkordanz-Metapher vgl. neuerdings D. PEIL, Concordiadiscors, Anmerkungen zu einem politischen Harmoniemodell von der Antike bis in die Neuzeit, in: Geistl. Denkformen (wieAnm. 519) 401–34. Zum Wissenschaftstypus der „Leitbuch“-Auslegung vgl. CHENU 351 ff.
265
Die innovative Synthese dialektisch-rhetorischer und hermeneutischer Methoden im Hochmittelalter wirdnaturgemäß primär in den wissenschaftsgeschichtlichen Abteilungen der Theologie, Philosophie undRechtswissenschaften als Anfang der eigenen Wissenschaftlichkeit gewürdigt und erforscht. ImposanteSpezialdisziplinen sind auf diesem Feld entstanden, die den Philologen und Historikern eigene Arbeit zuersparen scheinen. In deren Kompetenzbereich dürfte dennoch eine mehr bildungs- undmentalitätsgeschichtliche Fragestellung fallen: Welche Kräfte haben auch außerhalb der Schulen das Bedürfnisnach methodischer Widerspruchsfeststellung und Widerspruchsüberwindung geweckt und die neugewonneneMethodologie „lebensweltlich“ freigesetzt, in imaginative Prozesse der Literatur transformiert? Daß der„Paradigmawechsel“ keineswegs innerwissenschaftlich blieb, belegen am besten die vom 11. zum 12.Jahrhundert zunehmenden polemischen Zeugnisse gegen frühscholastische und legistische, als dialectici undcausidici beschimpfte „Neuerer“, denen mit durchaus gleichgelagerten Argumenten sophistischeHaarspaltereien, cavillationes und anstößige Grenz- und Kompetenzüberschreitungen, „kühnes“Experimentieren und Räsonnieren außerhalb des abgezirkelten Schulraums, Debatten über „fiktiveZweifelsfälle“ (ohne Rücksicht auf die Gewißheit der Glaubenswirklichkeit) oder dialektischeBegriffsdistinktionen auf dem festen Boden kirchlich-feudaler Rechtswirklichkeit vorgeworfen wurden.559
559 Die Interdependenz von Rechts- und Bildungsentwicklung wird meist mit rechtsgeschichtlichem Interesse als Einfluß desTriviums auf die Jurisprudenz des Mittelalters dargestellt (vgl. z. B.H. COING, Einl. zum Hb … der Privatrechtsgeschichte[wie Anm. 550] 21). Die Bedeutung der juristischen Methode für die Literatur geht Philologen und Historiker an. Zu demwenigen bisher zu diesem Thema Geleisteten vgl. unten Anm. 570. Besonders spürbar ist der Mangel anargumentationstheoretisch (und damit eo ipso auch rechtsgeschichtlich) orientierten Arbeiten – im Vergleich etwa zu„bedeutungskundlichen“ oder poetologischen – auf dem Gebiet mittelalterlicher Literaturtheorie. – Zur Polemik gegen die„unerhörten Kühnheiten“ der Dialektiker und Legisten vgl. STELZER (wie Anm. 8) 13 ff. und P. CLASSEN, Gerhoch vonReichersberg, 1960, 280 f., 419 f. zu Gerhohs Liber de novitatibus huius temporis; MICHAUD-QUANTIN, L’emploi destermes … (wie Anm. 544a) 856 zu dialecticus als Schimpfwort; RICHÉ (wie Anm. 552) 53 f. und S. 250 f., zu JohannsCornificiani-Kritik im Rahmen dieser polemischen Tradition; W. HARTMANN (ed.), Manegold von Lautenbach, Libercontra Wolfelmum (MGH, Quellen z. Geistesgesch. d. MA’s, Weimar 1972), Einleitung 24 ff. zu Manegolds Stelle 106 f.:Ille vero grammaticus ad exprobrandum deo viventi de Philisteorum cetu electus, gaudens suscepit atque more scolariumrethorum, qui in suscepto themate non attendunt, quid gestum vel non gestum sit, sed in fictis causis preacuentes linguastantum eloquuntur, quantum quilibet vel inferre iniuriam vel ispe sustinere potuerit. Mit Parallelen wie Petrus Damiani,Liber qui appellatur… 2 (PL 145) 233 C.: …scholasticorum scilicet more doctorum, qui sciscitantur a pueris exquacumque propositi thematis difficultate, quid sentiunt. Vgl. auch ebd. 26 zum „Argument“ der Jungfrauengeburt gegen dieLogik des Satzes si peperit, cum viro concubuit bei Manegold und Abaelard. Die hier angeführten Stellen sind besonderswichtig für das Folgende (S. 267 ff.) über die Fiktionalität im Disputationswesen.
266
66. Welche Fragestellungen sich aus der offenbar als Bedrohung empfundenen Wende zu einem neuenDenkstil ergeben, mag das in diesem ideengeschichtlichen Zusammenhang wohl am häufigsten genannteWerk, Abaelards Sic et non exemplarisch beleuchten. Die lange als einsame Pionierleistung überschätzte,dann auch wieder allzu einseitig als konventionelle Stoffsammlung relativierte Arbeit kann heuteausgewogener beurteilt werden: als ein eher in der Mitte als am Anfang der Entwicklung stehendesKompendium divergierender Väterstellen mit einem durchaus ungewöhnlichen Prolog über den Wert desmethodischen Zweifels und mit der Systematisierung einiger (z. T. neuer) Interpretationsregeln.560 Geradedas, was wissenschaftsgeschichtlich als weniger „fortschrittlich“ galt: daß das Sic et non die konträren Zitatenur zusammenstellt, nicht aber nach Art der späteren Summen
560 Forschungsberichte bei David LUSCOMBE, Abelard and the ‚Decretum’ of Gratian, in: ders., The School of PeterAbelard, Cambridge 1969, 214 ff.; Jean JOLIVET, Arts du langage et théologie chez Abélard, Paris 1969, 238 ff.; ders.Abélard ou la philosophie dans le langage, Paris 1969, 73 ff. Für eine Relativierung des innovativen Potentials durchReduktion des Werks auf Techniken der Frühkanonistik (Bernold von Konstanz, Ivo von Chartres, Alger von Lüttich) undder theologischen Schule Anselms von Laon sprachen sich u. a. aus: GRABMANN, Gesch. d. scholast. Meth. I 234 ff.;H.E. FEINE, Der deutschsprachige Forschungsanteil zum Dekret Gratians, in: Studia Gratiana 2 (1954) 465–82, hier 478 ff.und vor allem E. BERTOLA, I precedenti storici del metodo del Sic et non di Abelardo, in: Riv. di filosofia neoscolastica53 (1961) 255–80; vgl. auch unten Anm. 561. Zum heutigen Forschungsstand und einer ausgewogenen Beurteilung vgl.nebst den genannten Arbeiten von J. JOLIVET auch dessen, Le traitement des autorités contraires selon le Sic et Nond’Abélard, in: L’Ambivalence dans la culture arabe, ed. J.-P. CHARNAY, Paris 1967, 267–80 sowie Antonio CROCCO,Abelardo, L’altro versante del Medio Evo, Napoli 1979, 76 ff.; ders., Le cinque regole ermeneutiche del Sic et Non, in: Riv.critica di storia della filosofia 24 (1979) 452–8; HUNT (wie Anm. 544a) 103 ff.; E. REISS, Conflict and its Resolution inMedieval Dialogues, in: Arts libéraux (wie Anm. 544a) 863–72, hier 870 ff.; C.H. LOHR, Peter Abälard und diescholastische Exegese, in: Freiburger Zs. f. Philos. u. Theol. 28 (1981) 95–110. – Nicht gleichgültig ist die von BERTOLA(256 ff.) mit Recht hervorgehobene Tatsache, daß der in so vielen Punkten seiner Lehre angegriffene und verketzerte Meistergerade auf keine zeitgenössische Kritik am Sic et non stieß. Selbst wenn man dies als Mißverständnis oder Unachtsamkeitder Abaelard-Kritiker deuten wollte, wäre auch so indirekt bestätigt, wie verbreitet, ja vielleicht sogar selbstverständlich dasInteresse an Problemen (schein-)widersprüchlicher Autoritäten damals bereits war.
267
harmonisiert, macht seine besondere bildungsgeschichtliche Bedeutung aus. Denn der Verzicht aufLösungsvorschläge entspricht der gewissermaßen „sportlichen“ Absicht, Auslegungsschwierigkeiten nicht als„Unfälle“ hinzunehmen oder als Peinlichkeiten wegzurationalisieren, sondern sie als Hürden und Prüfsteinebewußt aufzusuchen, ja gezielt herbeizuführen. Die im 11. Jahrhundert verbreitete und zweifellos für dieScholastik zukunftsträchtige Formel: diversi, sed non adversi schränkt Abaelard in der ersten Zeile seinesPrologs ausdrücklich ein (non solum… diversa, verum etiam … adversa): Nicht nur verschiedene, sondernauch konträre Autoritäten will er anführen, womit er subtil andeutet, daß Gegensätze und Verschiedenheitennicht dasselbe sind und daß einige Gegensätze sich nicht – wie jene Zauberformel des„Widerspruchsfreiheitspostulats“ unterstellt – ohne weiteres auf Verschiedenheiten reduzieren lassen. Ermeint dies zweifellos auch pädagogisch im Sinne intellektueller Moral: Wo sämtliche Probleme vonvornherein als Scheinprobleme deklariert werden, erschlafft der Frage- und Forschungsimpetus. Das Sic et nonsoll mit seinem Übungsmaterial aber gerade die Problemphantasie der Schüler stärken. Die Ambivalenzen undOppositionen sind weniger Ziel als Lern-Mittel der Dialektik, „der besten Methode, um zur Wahrheit zugelangen.“561 Mit seiner Verselbständigung des Lerntrainings
561 Geringe oder gar keine Wirkung des Sic et non auf die neue juristische Logik beider Rechte stellen vor allemRechtshistoriker fest, die stillschweigend voraussetzen, Abaelard habe die im 11. Jh. ansatzweise, im 13. Jh. voll entwickelteHarmonisierungsmethode unvollständig (nur in ihrem aporetischen Teil) beherrscht und noch nicht bis zur solutiovorantreiben können. GENZMER (wie Anm. 550), der zwar Abaelards Einfluß auf die Quaestionen-Technik nichtunterschätzt (382 ff.), schreibt zum Sic et non-Prolog (416): „Eigene Lösungen hütete sich Abaelard in seinem Sic et Non zugeben“, wobei gemeint ist, daß er sie nicht geben konnte. Daß er sie nicht geben wollte , soll das Folgende zeigen. DasFehlen der solutiones wird sogar häufig als Argument gegen eine tiefere methodische Wirkung auf die Quaestionen undBrocarda verwendet: vgl. OTTE (wie Anm. 281) 182 f.; WEIMAR, Legist. Literatur (wie Anm. 550) 145; NÖRR, Kanonist.Literatur (wie Anm. 558) 836 f. Zu der kaum bestrittenen Bedeutung Abaelards für die theologische Entwicklung derScholastik (Robert von Melun, Petrus Lombardus) vgl. LUSCOMBE, The School (wie Anm. 560) 196 ff., 281 ff.; zu dervon Rechtshistorikern wenig beachteten inhaltlichen Bedeutung des Sic et non für Gratians Decretum vgl. ebd. 216 ff. – Zumdiversi, non adversi-Prinzip aufgrund der Annahme nur scheinbarer Widersprüche (Enantiophanien), d. h. als Formel für das„Widerspruchsfreiheitspostulat“ vgl. GRABMANN, Schol. Methode I 234 ff.; H. de LUBAC, A propos de la formule:diversi, sed non adversi, in: Mél. J. LEBRETON II, Recherches de science religieuse 40 (1951–2) 27–40; H. SILVESTRE,Diversi, sed non adversi in: RTAM 31 (1964) 124–132; NÖRR, Kanonist. Literatur (wie Anm. 558) 835; WEIMAR,Legist. Lit. (wie Anm. 550) 142 f.; KUTTNER, Revival (wie Anm. 210a) 310 f. (mit Bibliogr.). Abaelard dagegen imProlog zum Sic et non (ed. B.B. BOYER/R. McKEON, Chicago/London 1976, 1977) 89 (1 ff.): Cum in tanta verborummultitudine nonnulla etiam sanctorum dicta non solum ab invicem diversa verum etiam invicem adversa videantur, non esttemere de eis iudicandum … Zur bewußten Spitze gegen die diversi, non adversi-Formel und zur primär aporetischenZielsetzung vgl. auch JOLIVET, Arts du langage (wie Anm. 560) 245 f.; ders. Abélard (ebd.) 76; REISS (ebd.) 870; VONDEN STEINEN, Kosmos (wie Anm. 664) 288 ff. GENZMER (wie Anm. 550) 383 sieht darin „Freude am formalen Denken,die jungen Wissenschaften eigen ist.“ Die adversitas der Autoritäten ist, im Gesamtzusammenhang des Sic et non betrachtet,allerdings eine wesentlich philologische oder semantische, in irgendeiner Weise durch die Unzulänglichkeit menschlicherSprache verursacht: meist durch Fehlüberlieferung und Verständnislosigkeit der Leser, seltener aber auch durch „Irrtümer“ derSchriftsteller (97.209 f.). Die Texte oder verba über ein und dieselbe res widersprechen sich wirklich. Durchweg verweistAbaelard jedoch auf die objektive Einheit und Widerspruchslosigkeit im res-Bereich göttlicher Wahrheit, die durch dieGnadenwirkung des Hl. Geistes nur in ungleichmäßiger, fragmentarischer, gebrochener Weise über die unterschiedlichenAutoren und Texte zu den Lesern gelangt. Insofern hält auch er in einem metaphysischen Sinn an der Scheinbarkeit allerWidersprüche fest, betont aber die tatsächliche, fragwürdige, forschungsmotivierende Gegensätzlichkeit menschlicherWahrheitsvermittlungen. Im Kern ist dies auch die erkenntnistheoretische Grundannahme Johanns von Salisbury: s. unten§§ 81, 95 f. Vgl. auch CROCCO (wie Anm. 560) 122 ff.
268
und der instrumentellen Fertigkeit erinnert das Programm noch an die alte controversia und an dasschulinterne Denkspiel mit ambivalenten quaestiones, doch richtet es sich nun – und keineswegs nur beiAbaelard – auf spezifische Gegenstände traditioneller geistlicher Hermeneutik, auf die dicta sanctorum(patrum). Durch ihre ausgesuchte Kombination geben Väterzitate sowohl die zu beweisende Thesis ab alsauch, gezielt eingesetzt, die jeweiligen Beweismittel oder loci der Verteidigung und Widerlegung. Alskasuistische Experimentierbeispiele dienen sie einem geradezu lustbetonten Scharfsinntraining, einem Spiel,das der Meister wahrscheinlich nicht durch die Beigabe eigener Lösungsvorschläge verderben wollte. Inliterarästhetischer Terminologie, im Sinne des Prinzips: variatio delectat, betont Abaelard, die Buntheit derMeinungen im überlieferten Schrifttum folge der Warnung Ciceros vor der „Gleichsinnigkeit, der Mutter desÜberdrusses“. Vielfältige, abwechslungsreiche Worte seien „umso wohlgefälliger, je mehr Mühe sie demVerständnis bereiten, je schwerer sie erobert werden.“ Dies bezeuge auch Augustin, der nicht wie einkanonischer Schriftsteller gelesen werden wollte, der nicht schrieb, „um als Autorität zu lehren, sondern umsich im Erkenntnisfortschritt zu üben“ (non praecipiendi auctoritate sed proficiendi exercitatione), dessenSelbstkorrektur in den Retractationes als „Autorität“ gegen falsche Autoritätsgläubigkeit gilt, der exegetischeProbleme, scheinbare und wirkliche Unstimmigkeiten zu jener werthaften Dunkelheit rechnete, die
269
Schutz vor Entweihung und Vulgarisierung, aber auch schwierigen Übungsstoff für die „freie Urteilsbildung“bietet, „damit der Nachwelt die so überaus nützliche Arbeit des Redens und Schreibens über schwer zubehandelnde und hin- und herzuwendende Fragen nicht ausgehe.“ Abaelard bekundet im Sinne diesesmächtigen Kronzeugen die Absicht, dissonante Väterstellen für junge Leute zu sammeln, die sich daran imZweifeln, Fragen und Ergründen üben mögen. „Eifer der Suche“ sei der „erste Weisheitsschlüssel“; vomZweifel führe der Weg zum Untersuchen und vom Untersuchen zur Wahrheit.562
562 Sic et non, Prol. (wie Anm. 561) 89 (13 ff.): Quippe quemadmodum in sensu suo ita et in verbis suis unusquisqueabundat. Et cum iuxta Tullium „In omnibus identitas mater sit satietatis“, id est fastidium generet, oportet in eademquoque re verba ipsa variare nec omnia vulgaribus et communibus denudare verbis; quae, ut ait beatus Augustinus, ob hocteguntur ne vilescant, et eo amplius sunt gratiora quo sunt maiore studio investigata et difficilius conquisita. Saepe etiam,pro diversitate eorum quibus loquimur, verba commutari oportet; […] (cf. Cic. Inv. I 41.76; Aug. En. Ps. 103 [CC 40]1490). Ebd. 101 (275 ff.): De his enim libris dici potest aliquid eos habere non consonum qui non praecipiendi auctoritatesed proficiendi exercitatione scribuntur a nobis […] Quod genus litterarum non cum credendi necessitate sed cum iudicandilibertate legendum est. Cui tamen ne intercluderetur locus et adimeretur posteris ad quaestiones difficiles tractandas atqueversandas linguae ac stili saluberrimus labor, distincta est a posteriorum libris excellentia canonicae auctoritatis veteris etnovi testamenti“ … (Aug. C. Faust XI 4–5 [CSEL 25.1] 320 f.). Ebd. 103 (330 ff.): His autem praelibatis placet, utinstituimus, diversa sanctorum patrum dicta colligere, quae nostrae occurrerint memoriae aliquam ex dissonantia quamhabere videntur quaestionem contrahentia, quae teneros lectores ad maximum inquirendae veritatis exercitium provocent etacutiores ex inquisitione reddant. Haec quippe prima sapientiae clavis definitur assidua scilicet seu frequens interrogatio;ad quam quidem toto desiderio arripiendam philosophus ille omnium perspicacissimus Aristoteles in praedicamento AdAliquid studiosos adhortatur dicens, „Fortasse autem difficile est de huiusmodi rebus confidenter declarare nisi saepepertractata sint. Dubitare autem de singulis non erit inutile.“ Dubitando quippe ad inquisitionem venimus; inquirendoveritatem percipimus (Boeth. In Categor. Aristot. 2, Aristoteles latinus, I 1–5, ed. L. MINIO-PALUELLO [1901]23.18–21). – Zur tendenziellen Verselbständigung der Methode aufgrund traditioneller Übungsformen im Trivium vgl. obenAnm. 559: In Manegolds Kritik modischer, bis hinter die Klostermauern dringender „Dialektik“ richtet sich der Angriffausdrücklich gegen das deklamatorische Disputationsmodell der fictio causae oder Hypothesis und gegen den mosscholarium rethorum (sic.). – Zu Abaelards Idee einer sowohl ästhetisch als auch erkenntnistheoretisch positiven Meinungs-und Bedeutungsvielfalt s. auch unten Anm. 729 (Theol. christ. I 117). – Zu Augustin als Vorbild eines sich selbstrevidierenden und darum nicht präzeptiven, sondern leserfreundlich offenen Denkens (vor allem nach Retract. Prol. 2;Trin. III Proem. 2; Ep. 148.4.15) s. auch Sic et non, Prol. 92 (86 ff.), 100 f. (254 ff.). Dieser Sinn für Augustinsprozeßhaftes Erkenntnismodell dürfte eine gewisse Kongenialität des abaelardschen Denkens ausdrücken, auf die J.COTTIAUX (La conception de la théologie chez Abélard, in: RHE 28 [1932] 247–95, 533–51, 788–828, hier 254) mit dertreffenden Charakterisierung hinwies:“ une pensée qui se cherche, qui se corrige et qui se précise.“ Was Kurt FLASCH,(Augustin, Stuttgart 1980, 8) von Augustin schreibt, könnte auch Abaelard gesagt haben (abgesehen davon, daß erneoscholastische Augustin-Deutungen noch nicht kannte): „Er wußte selbst, daß er sich gewandelt hatte. Er nannte einesseiner letzten Bücher Revisionen (Retractationes). Er schrieb es, um seine Leser anzuleiten, seine Bücher als Zeugnisse einerEntwicklung zu verstehen. Je länger ich mich mit Augustin beschäftige, umso klarer wurde mir, daß von diesem Winkauszugehen ist. Es ist nicht mehr möglich, Augustins Denken als synchrones System darzustellen, wie dies z. B. Gilson […]getan hat.“ – Zur intellektuellen und ästhetischen Werthaftigkeit der difficultas s. auch oben S. 185 f. Zu diesem Aspekt vgl.L.M. De RIJK, Peter Abälard, Meister und Opfer des Scharfsinns, in: Petrus Abaelardus (wie Anm. 528) 125–138, hier 130:„Die Wahrheit zu finden … war sein letztes Ziel. Leider wurde das oft verfinstert durch das Verfolgen des näheremunmittelbaren Zieles: … die Freude am Denkspiel als solchem völlig zu genießen.“ – Zu clavis sapientiae und derberühmten Maxime zur Begründung des methodischen Zweifels vgl. unten S. 474, 515 und B. SMALLEY, Prima clavissapientiae: Augustine and Abelard, in: F. SAXL Memorial Essays, London 1957, 93–100; CROCCO, Abelardo (wieAnm. 560) 76 ff. (auch zu Parallelen im Werk Abaelards und zu den direkten und indirekten Quellen bei Boethius, bzw.Aristoteles). – Das im Anschluß an die zitierte Autorität des Aristoteles (103 f., 339 ff.) angeführte Exemplum deszwölfjährigen Jesus im Tempel als Vorbild dialektischer interrogatio ist der anschaulichste Beleg für eine im Humanbereichnotwendige und nützliche Aporetik trotz oder gerade wegen der metaphysischen Folie der ewig gleichen und vollkommenenWahrheit Gottes (104.340 ff.): Quae nos etiam proprio exemplo moraliter instruens, circa duodecimum aetatis suae annumsedens et interrogans in medio doctorum inveniri voluit, primum discipuli nobis formam per interrogationem exhibensquam magistri per praedicationem, cum sit tamen ipsa Dei plena ac perfecta sapientia. Formal steht dies in derpatristischen Tradition des zweiseitigen Exemplum Christi als Aufstiegsmodell von menschlicher Schwäche zu göttlicherStärke (wie oben § 26), wobei Abaelard die zeitliche Folge („zuerst …, dann“) auch als Rangfolge sieht („primär …, erstdann“), da sein Interesse der humana dubietas gilt, nicht dem unerreichbaren certum göttlicher Weisheit. Vgl. auch unten
270
An diese berühmte Stelle erinnere ich hier nicht nur deshalb, weil Johann von Salisbury, der durch AbaelardsSchule ging, sehr Ähnliches ausdrückt, sondern auch, weil sie uns auf eine besondere „Alterität“ stößt: auf dieschwer nachvollziehbare Entgrenzung der Bereiche Spiel und Ernst, Virtuosität und Wissenschaft,Kunstfertigkeit und „letzte Fragen“; auf eine eigenartige Verbindung des „Rhetorischen“ und des„Philosophischen“. Wir sind gewohnt, ernsthafte, vor allem theoretische Forschung von formalenSchulübungen und „schöner“ Literatur zu trennen. In dieser „fröhlichen Wissenschaft“ des 12. Jahrhundertsaber wird eine Art Denkgymnastik zum exercitium maximum für die Wahrheitserkenntnis erklärt, undmethodischer Zweifel gilt nicht als freigeistige oder auch nur essayistische Irreverenz vor geheiligterTradition, sondern im Gegenteil als das würdigste Mittel zur Stärkung der Argumentationskraft derAutoritäten. Diese Paradoxie gehört neben der starken Betonung des Aporetischen und Agonalen zu jenenspezifischen Zügen der durch Abaelard mitgeprägten Frühscholastik, die für die scholastische
Anm. 593. – Zur augustinischen Grundlage der „Zetetik“ Abaelards vgl. C. VIOLA, Manières personelles et impersonellesd’aborder un problème: saint Augustin et le XIIe siècle. Contribution à l’histoire de la quaestio, in: Les genres littéraires …(wie Anm. 545) 11–31.
271
Hochblüte des ordo-Gedankens und des ruhigen Ausgleichs der Gegensätze nicht mehr typisch sind.563
67. Auch auf dem zweiten Aktionsfeld der neuen Wissenschaftslogik, der Jurisprudenz, ist das Übungsspiel mitPro- und Contra-Autoritäten von zentraler Bedeutung, umsomehr als die von Haus aus mit der rhetorischenHypothesis über konkrete Lebensfälle befaßte Disziplin dem historischen Exemplum näher steht als diephilosophische Dialektik. Die in den Policraticus-Exempla (darunter einigen eigentlich juristischen) zutagetretende Freude am Spiel mit lebenspraktischen Alternativen erinnert im übrigen nicht weniger anglossatorische Verfahren (die Johann bei seiner Amtstätigkeit und durch seinen gelehrten Freundeskreis,vielleicht durch Vacarius oder Burgundio von Pisa kennenlernen konnte) als an die im Metalogicondargestellte quaestio-Methodik Abaelards. Von der noch weitgehend ungelösten Frage, auf welchem WegJohann zu den im Policraticus ausgebreiteten Kenntnissen des Justinianischen Corpus (auch neuentdeckterTeile) gelangt ist, kann hier abgesehen werden. Ein Hinweis auf den intellektuellen Rahmen, in dem er sichbestimmte juristische Argumentationsformen aneignen konnte, muß genügen.564 Besonders im englisch-französischen Raum waren die beiden Rechte
563 Zu Johanns Abaelard-Verehrung und zum „methodischen Zweifel“ vgl. S. 239, 291 ff. 304, 367, 380 f., 448, 474 f.,A. 950. Zu Paradoxie des „Spielernsts“ s. § 70, S. 284, 290 ff., 330 f. – …maximum inquirendae veritatis exercitium: Sic etnon 103 (333 f.) oben Anm. 561. – HUIZINGA, Abaelard (wie Anm. 31) 169 zum „unruhigen“ Denken des 12. Jhs., demdas Jahrhundert der Orthodoxie und „himmlischen Harmonie“ folgte. Vgl. auch VON DEN STEINEN, Kosmos (wieAnm. 664) 295 ff.564 Zu Johanns Beschäftigung mit Rechtsfragen vgl. S. 2 f., 188 ff., 288, 312 ff., 362, 432 f., 546, A. 882, 926. Zu seinenKenntnissen der Justianischen Gesetze s. die zwei Spalten im Index der Pol.-Ausg. von WEBB, II 482 f. Zur Rezeption desCorpus iuris civilis im Mittelalter vgl. allgemein WEIMAR, Legist. Lit. (wie Anm. 550) 155 ff. Die Frage der juristischenAusbildung und der römisch-rechtlichen Kenntnisse Johanns ist auch nach dem neuesten Forschungsstand ungelöst; vgl.KERNER 84 ff., 151 ff.; ders., Römisches und kirchliches Recht im Policraticus des Johannes von Salisbury, in: TheWorld of John of S. 365–380; G. MICZKA, Zur Benutzung der Summa Codicis Trecensis bei Johannes von Salisbury,ebd. 381–401; Chr. BROOKE, John of Salisbury and his World, ebd. 1–20, hier 7: „One branch of learning was curiouslyabsent from his early schooling, and that was law. Curiously, since if John had to fill in a form between 1147 and 1176describing his profession, one perfectly good answer might have been: he was a professional lawyer.“ Die bisherigeForschung hat (bereits seit SAVIGNY) einseitig die zivilistischen, „staatsrechtlichen“ oder „politologischen“ Aspekte undQuellenkenntnisse im Policraticus untersucht (vgl. unten A. 882 und die kritische Forschungsübersicht bei KERNER 82 ff.,149 ff.), obwohl Johanns Interessen primär kanonistisch waren und sein (erst 1979 vollständig kritisch edierter) Briefwechseleine Fülle von verwaltungsrechtlichen, eherechtlichen, strafrechtlichen und anderen Kirchenproblemen behandelt. (ObigesZitat über den „Berufsjuristen“ stammt vom berufensten Kenner der Briefe: dem Herausgeber; vgl. auch die Einl. zur EditionI pp. XIX ff., II pp. XII, XLVI; KUTTNER-RATHBONE [wie Anm. 4] 288, 295 f., 298 und nächste Anm. zur Dominanzdes Kirchenrechts in England). Gerade der berühmte Vacarius, mit dem Johann in Canterbury am erzbischöflichen Hofadministrativ (und wahrscheinlich auch gelehrt) zusammenarbeitete, war nicht nur der erste Lehrer des römischen Rechts inEngland, sondern machte sich auch durch römisch-rechtliche Ergänzungen um das Kirchenrecht verdient. Die Konkordanzenzwischen Justinian und Gratian in seinem Liber pauperum sind hier zu nennen. Mit ihm hat Johann auch den souveränmoralphilosophisch-theologischen Umgang mit rechtlichem Gedankengut gemein, einen Stil, der Johann allerdings (imUnterschied zu Vacarius) den Ruf eines juristischen Dilettanten eingetragen hat. Vgl. MICZKA a. O. 399; KUTTNER-RATHBONE (wie Anm. 4) 286 f.; J. de GHELLINCK, Magister Vacarius, Un juriste-théologien peu aimable pour lescanonistes, in: RHE 44 (1949) 173–8; F. de ZULUETA (Ed.), The Liber Pauperum (Publ. of the Selden Soc. 44) London1927, XIII ff.; WEIMAR, Legist. Lit. (wie Anm. 550) 137 ff., 183, 252 f.; R.W. SOUTHERN, Master Vacarius and theBeginnings of English Academic Tradition, in: ders. Medieval Learning and Literature, FS R.W. HUNT, Oxford 1976,257–86; P. STEIN, Vacarius and the Civil Law, in: Church and Government in the MA, FS C.R. CHENEY, Cambridge1976, 119–37; KERNER, Röm. u. kirchl. Recht a. O. 375 ff. und (selten erwähnt) F.W. MAITLAND (Ed.), Vacarius,Summa de matrimonio, in: The Law Quarterly Rev. 13 (1897) 270–87. – Wichtig dürfte andererseits Johanns Freundschaftmit dem ersten englischen Kirchenrechtslehrer in Frankreich, dem führenden Kopf der Rechtsschulen von Paris und Köln,Gerhard Pucella sein, mit dem er in Paris gemeinsam Philosophie studiert hat und den er Lehrer „beider Rechte“ nennt, auchwenn von dieser (in der Geschichte des Becket-Konflikts bekannten) Beziehung nur kirchenpolitisch-diplomatischeBriefzeugnisse erhalten sind. Vgl. oben Anm. 27; KUTTNER-RATHBONE (wie Anm. 4) 296 ff.; J. SPÖRL, Rainald vonDassel in seinem Verhältnis zu Johannes von Salisbury, in: HJb 60 (1940) 250–7; BROOKE (Ed.), Letters II pp. XXX ff.Nicht besser dokumentiert ist in rechtsgeschichtlicher Hinsicht Johanns Verhältnis zu dem Übersetzer der griechischen
272
eng miteinander verknüpft und wurden im 12. Jahrhundert nach wie vor mit einer Technik gelehrt, die aufherkömmliche Problematisierungsformen des Triviums zurückgeht. Zu neuen methodisch-formalenKenntnissen aus dem römischen Rechtsleben, das seinerseits wesentlich von der Rhetorik geprägt war, führteauch die von Italien ausgehende Verbreitung des vollständigen Justinianischen Corpus iuris, die deshalb nichtallein unter materiellen Rezeptionsgesichtspunkten
Digestenstücke, Burgundio von Pisa: nur in Met. IV 7.171.25 f. wird er erwähnt, mit einem dictum zur Aristotelesdeutung.Dennoch ist auch dieser dritte mögliche Vermittler römischrechtlicher Kenntnisse hier erwähnenswert: Auch er hatte wieJohann einen weit über die spezialistischen Interessen typischer Glossatoren hinausreichenden philosophisch-theologischenHorizont. Vgl. P. CLASSEN, Burgundio von Pisa, SB Heidelberg, phil.-hist. Kl. 1974.4, hier 34, 39 ff.; JEAUNEAU,Jean de S. (wie Anm. 544) 90 f.; KERNER, Röm. u. kirchl. Recht a. O. 376 f. – Bei allen vielleicht unlösbaren Rätseln aufdiesem Gebiet ist es jedenfalls ratsam, sich die Rechtsausbildung Johanns nicht in einem eng institutionalisierten Rahmenvorzustellen. Wie auch KERNER (86) vermutet, hat er seine Rechtskenntnisse kaum bei seinen Pariser Studien, sondernspäter, in der Zeit seiner Gesandtschafts- und Verwaltungstätigkeit, autodidaktisch und durch Gespräche im Freundeskreiserlangt. Einen Wink in dieser Richtung gibt m. E. ein Brief aus dem Exil von 1168 (Ep. 256, II 516), in dem er von den„langeweilevertreibenden und zeitverkürzenden“ Freuden wissenschaftlich-schöngeistiger Geselligkeit am Hofe Theobalds vonCanterbury, zu denen auch philosophische und juristische Beschäftigungen gehörten, elegisch schreibt: … reversus sum intempora meliora quibus […] societate gratissima gaudebamus, ubi philosophiae meditatio, executio iuris, officiorum mutuacommunicatio, collatio litterarum, disceptatio utilis et iocunda taedium propulsabant et contrahebant moras temporis. –Ob Johann ein Berufsjurist war, ist umstritten; daß er aber als Rechtstheoretiker und Rechtsphilosoph einen Namen hatte,zeigt die Beliebtheit des Policraticus bei den späteren italienischen Glossatoren und an den juristischen Fakultäten desSpätmittelalters. Dazu vgl. S. 142 und die (von mir nicht gesehene) Arbeit: M. BOCZAR, Filosofia prawa w ujeciu Jana zSalisbury, in: Studia Filozoficzne 10 (1979) 53–69. – Leider ist mir bei der Arbeit der grundlegende Aufsatz von A.GIULIANI, L’elemento „giurudico“ nella logica medioevale (wie Anm. 446) entgangen. Er zeigt insbesondere den juristisch-rhetorischen Hintergrund von Johanns probabilistischer Logik.
273
so grundlegend zur „Renaissance“ der Wissenschaften im Hochmittelalter gehört.565
565 Zu den besonderen Merkmalen der englischen Rechtsgeschichte gehört der starke Praxisbezug der Ausbildung durch dieRichter (mit Hilfe von beispielhaften „cases“) und die sekundäre Rolle der akademischen Studien an den Hohen Schulen: vgl.oben Anm. 4 (CLASSEN). Für die anglonormannisch-nordfranzösische (z. T. auch für die rheinische) Tradition sindcharakteristisch die Verbindung beider Rechte unter einer gewissen kanonistischen Vorherrschaft sowie die konservativeBeziehung zum Studium der Rhetorik und Theologie, ja eine literarische (von italienischen Glossatoren als „blumiger“ mosFrancigenarum verspottete) Grundeinstellung: vgl. GENZMER (wie Anm. 550) 385 ff.; STELZER (wie Anm. 8) 44 ff.,11 f.; WEIMAR, Legist. Lit. (wie Anm. 550) 137 f.; NÖRR, Kanonist. Lit. (wie Anm. 558) 365 ff. und vor allemKUTTNER-RATHBONE (wie Anm. 4) 279 ff.; vgl. auch Anm. 8 zur Rhetorica ecclesiastica. – Zur allgemeinenVerankerung aller Rechtskunde in Grammatik und Rhetorik seit dem Frühmittelalter (einer auch von den Glossatoren nichtganz preisgegebenen Grundlage) vgl. S. 255 f. und P. RICHÉ, L’enseignement du droit en Gaule du VIe au XIe siècle, (IusRomanum Medii Aevi I 5, b, bb) Mailand 1965; Ugo GUALAZZINI, Ricerche sulle scuole preuniversitarie del medio evo…, Mailand 1943; GENZMER (wie Anm. 550) 362 ff.; MEYER (wie Anm. 557) 58 ff. – Zur Rhetorik im RömischenRecht vgl. oben Anm. 3–4 und GENZMER (wie Anm. 550) 387 f. (rhetorische Regeln im Corpus iuris). – Die doppelteVermittlung antiker Rhetorik und Dialektik durch die frühmittelalterliche Logik-Tradition (Boethius) und die JustinianischeGesetzgebung (bes. Institutiones) für die Glossatoren zeigt am Beispiel der Aristoteles-Rezeption COING (wie Anm. 550)26 ff.
274
Derart in der rhetorischen Tradition doppelt fundiert, entstanden die so auffällig an Abaelards Sic et nonerinnernden (sowohl kanonistischen als auch legistischen) Verfahren, mit denen sich widersprechende Zitateaus Gesetzestexten entweder direkt gegenübergestellt (Quare-Form) oder aufgrund vorgängiger thematischerAbstraktion und Systembildung zu gegensätzlichen Argumenten (generalia versus contraria) inBelegstellenreihen (Allegationsketten) paarweise konfrontiert werden konnten (sog. Brocarda-/Brocardica-Form). Neben diesen zwei aus den Autoritäten selbst abgeleiteten Arten der Problemsammlung entwickeltendie Glossatoren die dritte, wohl anspruchsvollste aporetische Gattung, die juristische Quaestio (der Begriffsteht für Problem überhaupt, nicht für Thesis): Hier wurden nicht Rechtsregeln verglichen, sondern schwersubsumierbare Problemfälle in autoritativ abgestützten Pro- und Contra-Erörterungen zusammengestellt.Diese und andere juristische Textarten wurden in der Schule zur Einübung in kasuistische Erwägungsspieleverwendet. Eine geistesgeschichtliche Parallele zur theologischen Entwicklung von der Früh- zurHochscholastik dürfte darin liegen, daß die frühesten Zeugnisse (etwa der Brocarda) noch keine Lösungenaufweisen, mithin wahrscheinlich primär dem Scharfsinntraining der Schüler dienten, und erst später zu denArgumenten pro und contra noch eigene solutiones hinzukamen, in denen die abgelehnten Autoritätenabschließend entkräftet und wiederverwendbare Rechtsregeln probat abgeleitet wurden.566 Vom
566 Zum Verhältnis der juristischen Quaestionen-Literatur zum Sic et non vgl. oben Anm. 561 und GENZMER (wieAnm. 550) 415, 384, 427 zu einem möglichen direkten Einfluß auf den Liber disputatorius des Pillius. – Die einzelnenFormen bespricht besonders klar und übersichtlich GENZMER a. O. 415–29; vgl. auch WEIMAR, Legist. Lit. (wieAnm. 550) 142 ff. (auch zur Disputationspraxis in fiktiven Gerichtsszenen über die gesammelten Quaestionen); OTTE (wieAnm. 281) 158 ff., 182 ff.; N. HORN, Die legistische Literatur der Kommentatoren und die Ausbreitung des gelehrtenRechts, in: H. COING, Hb. (wie Anm. 550) 261–364, hier 333 ff. – Zu den Brocarda-Sammlungen vgl. insbesondere P.WEIMAR, Argumenta brocardica, in: Collectanea S. KUTTNER IV = Studia Gratiana 14 (1967) 89–124. Die Feststellung118 läßt sich mit dem unten § 73 zu Johanns strategemmatica Gesagten vergleichen: „Brocardica […] boten dem Gegner dieMöglichkeit, dem Angreifer mit der aus den Quellen belegten Negation seines eigenen Argumentes entgegenzutreten.“Wahrscheinlich verdankt das Wort dieser strategischen Funktion auch seine Entstehung: vgl. L. SPITZER, Latin medieval<brocard(ic)a> fr. ‚brocard‘, in: MLN 70 (1955) 501–6 zu lat. broccus, „mit hervorstehenden Zähnen“ im Bologneser Jargon;also eine ähnliche Etymologie wie Johanns/Macrobs scomma unten Anm. 616. Vgl. auch unten Anm. 605 zur Beiß- undStich-Metaphorik. – Zur Entwicklung von lösungslosen Brocarda zu den solutiones vgl. GENZMER a. O. 427; WEIMAR,Argumenta brocardica a. O. 118 f. M. SCHWAIBOLD, Brocardica: Dolum per subsequentia purgari, Eine englischeSammlung von Argumenten des römischen Rechts aus dem 12. Jh., Frankfurt a. M. 1985 (konnte nicht mehr benütztwerden).
275
Denktypus her erinnern diese juristischen Gattungen an römische Praktiken wie die „fiktizischen Klagen“ zupostulatorischen Gerichtsfällen, bei denen es um künstliche Steigerung des Schwierigkeitsgrades bei derGesetzesanwendung ging und deren Sinn darin lag, daß der angehende Anwalt (weniger der Richter) ankonstruierten Aporien lernte, mit den normalerweise leichteren Fällen der Wirklichkeit besser umzugehen.Wie ein Deklamatorengleichnis sagt, „kämpfen die Gladiatoren mit schwereren Waffen im Übungsraum als inder Arena“.567Auch in der Jurisprudenz hatte das Verfahren spielerischer und notwendig fiktiver Pro- undContra-Argumentation eine quasi-ästhetische Seite – man könnte sie in heutiger Metaphorik als eineKombination von Schach- und Schauspielvergnügen umschreiben – und war doch keineswegs nur akademisch-artistisch ausgerichtet: Bedenkenswerterweise sind die wichtigsten Fortschritte des gelehrten Rechts imMittelalter – sowohl in der
567 Vgl. BONNER, Declamation (wie Anm. 550) 80 ff.: Sen. Rh. Contr. IX, Praef. 4: Gladiatores gravioribus armisdiscunt quam pugnant (Ausspruch des Votienus Montanus); vgl. auch Quint. IV 2.81; IV 2.29 zu dieser besonderenBeziehung zwischen Rhetorik und Jurisprudenz. – TRIMPI, Quality (wie Anm. 550) 7 ff.; FUHRMANN, Fiktion (wieAnm. 70) 413 ff.; E.P. PARKS, The Roman Rhetorical Schools as a Preparation for the Courts under the Early Empire (J.Hopkins Univ. Studies in Hist. and Polit. Science LXIII 2), Baltimore 1945 (war nicht zugänglich); MEYER (wieAnm. 557) 54 f.; M. KASER, Das röm. Privatrecht (Hb. d. Altertumswiss. X 3.3) München2 1971, Reg. s. v.activus/fictitius. – Ein mittelalterliches Zeugnis zur fiktiven Schwierigkeitssteigerung zitiert LANG (wie Anm. 70) 74 ausdem Perpendiculum, einem Brocardica-Werk des späten 12. Jhs. (zu den Hss. s. S. KUTTNER in: Traditio 11 [1955] 447,13 [1957] 470): Hec de presumptionibus […] scripsi ut ex his per amplius et perfectius scrutandi materiam nanciscaris; nectamen [?] vera continet hoc perpendiculum, sed et probabilia et apparentia propter exercitium disputandi, ut presentisinstructionis beneficium oratorem potius quam iudicem instruat.
276
Rechtslogik als auch in der Gesetzgebung – nicht von der Gerichtspraxis, sondern von den Schulen beiderRechte ausgegangen.567a
Dieser flüchtige Blick über den Zaun des eigenen Faches auf zentrale Gebiete der Philosophie-, Theologie- undRechtsgeschichte des Mittelalters war motiviert durch die literaturwissenschaftliche Feststellung, daß an derWurzel der ersten wissenschaftlichen Methoden, die nach der Antike entwickelt wurden und die ihrerseits zuden Grundlagen neuzeitlicher Wissenschaft gehören, „Literatur“, d. h. literarische Bildung steht – denn das inRhetorik und Dialektik gepflegte Verfahren, causae und quaestiones in einen Experimentierraum parteilicheroder konflikthafter Bearbeitung zu versetzen, ist eine Art literarischer Fiktion –, andererseits gilt es, dieHypothese zu erläutern, daß die spezifische Verwissenschaftlichung der beiden „Logiken“ in den neuenFachschulen oder Fakultäten der Theologie/Philosophie und des Rechts über die Sprach- undDenkgewohnheiten der hauptsächlich literarisch tätigen Intellektuellen, der clerici, wieder auf die Literaturzurückgewirkt haben muß.
68. Grundzüge dieser Wirkung hat einer der hervorragendsten Mittelalter-Kenner (eher ein Kulturphilosophals ein Mediävist), Johan Huizinga, in seiner Skizze der Spielformen agonaler Wissenschaft und Kunst im„prägotischen“ Mittelalter angedeutet. Das Gemeinsame der rhetorisch-deklamatorischen Übungspraxis undder neuen scholastisch-glossatorischen Wissenschaftsmethodik ist in der Tat ein im Sinne Huizingas genuin„spielhaftes“ Ziel: die Fähigkeit, Bestehendes in der Kultur, in Religion, Moral, Recht, Gesellschaft,Geschichte und Sprache nicht nur als gegebene Tatsache hinzunehmen,
567a Quasi-ästhetische Seite: gemeint ist damit die Parallele zu Abaelards Gedanken eines intellektuellen Lustgewinns durchdifficultas; vgl. S. 267 ff. M.W. ist das reizvolle Thema der (literarischen) delectatio durch genußvolle Gedankenspiele undSpitzfindigkeiten in der Jurisprudenz des Mittelalters noch kaum behandelt worden. Interessant ist GENZMERS Hinweis(wie Anm. 550, 418) auf die (rekreationshalber) am Samstag üblichen quaestiones sabbatinae oder länger andauerndenDisputations-veranstaltungen sowie auf die aus der Scholastik übernommenen Insolubilia-Probleme (sophismata logicalia),besonders harte Nüsse des Denk- und Argumentations-trainings (vgl. S. 361). Zeugnisse für den ästhetisch-literarischen (inder Rhetorik fundierten) Wert der Rechtspflege finden sich etwa bei Johann von S. (oben Anm. 564: Ep. 256), Hildebert vonLavardin (zu seiner Canones-Sammlung vgl. von MOOS [wie Anm. 211] 184 f.) oder Petrus Damiani (vgl. J. LECLERCQ,S. Pierre Damien …, Rom 1960, 207). – Zur Bedeutung der Schulen vgl. CLASSEN, Studium (wie Anm. 4) 30 f. – Leiderhabe ich erst während der Drucklegung die auch für Mediävisten höchst lehrreiche Untersuchung von A. TOURNON:Montaigne, la glose et l’essai, Lyon 1983, kennengelernt: vgl. vor allem 11 ff., 150 ff. zur juristischen Tradition der vonAnfang an (seit dem 11. Jh.) autoritätskritischen Glossatoren-Methodik, 210 ff. zu den rhetorischen declamationes undParadoxa als Hintergrund der Montaigneschen „logique de l’incertitude“.
277
sondern als ein Mögliches (ein auch anders Mögliches) der Denkphantasie zu unterwerfen. In dem halbenJahrhundert seit dem Erscheinen des Homo ludens ist eine Grundannahme dieses tiefsinnigen Essays: das Spielals Macht und Ausdruck kulturgeschichtlicher Veränderung, für das Mittelalter kaum wieder aufgegriffen undanalytisch weiterverfolgt worden. Das Thema scheint in der Mediävistik im allgemeinen übergangen wordenzu sein.568
568 Homo ludens, Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur, Amsterdam 1939, 144 ff., 171 ff., 236 ff.,248 ff. Das Werk bildet die erweiterte Fassung der Leidener Rektoratsrede von 1933: Over de grenzen van spel en ernst in decultuur, Harleem 1933. Es entstand in einer Zeit intensiver Beschäftigung mit dem 12. Jahrhundert, über das HUIZINGAeine Gesamtdarstellung vorbereitete. Die drei aus diesem dann liegengebliebenen Vorhaben entstandenen Arbeiten – siedienten einer Vortragsreihe über das 12. Jh. an der Sorbonne – berühren alle in zentraler Weise das Thema des Homo ludensunter ästhetischem (Alan), intellektuellem (Abaelard) oder ethischem Gesichtspunkt (Johann von Salisbury): Über dieVerknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de Insulis, in: Mededeelingen de K. Akad. vanWetenschappen, afd. Letterkunde, deel 74, B. 6 (1932) 89–199 = Verzamelden werken (wie Anm. 965) 3–84; Abaelard, in:Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, Jaarboek 1934/5, 66–82, und:Een praegothieke geest: Johannes van Salisbury, in: Tijdschrift voor geschiedenis 48 (1933) 225–244 = Zwei prägotischeGeister, Abaelard, Johannes von Salisbury (wie Anm. 31), hier besonders 177 ff. zum sportlichen Zug der führendenintellektuellen Bewegung des 12. Jhs. (dazu s. auch unten Anm. 571) und ebd. 186 zur erwähnten Dreiteilung derepochenparadigmatischen Biographien. Auf die Paradoxie von Spiel und Ernst geht HUIZINGA aber auch ein in seinem‚Herbst des Mittelalters’ (zuerst 1919, wie Anm. 541) 77 ff. (Liebeskonzeptionen), 251 ff. (kasuistischer Formalismus inRecht und Philosophie) und in seinem ‚Erasmus’ (von 1924, wie Anm. 38) 85 ff. (zum Moriae Encomium). Das Thema, zudem ihn wahrscheinlich in erster Linie mittelalterliches Denken angeregt hat, war ihm in einem ebenso persönlichen wiewissenschaftstheoretischen Sinn lebenswichtig. Vieles von dem, was er über diese Männer „der Nuance und des Relativen“(so a.a.O. 181 über Abaelard) schreibt, hätte er von sich selbst sagen können. Seine Grundhaltung war wie diejenige Johannsund Erasmus’ temperiert skeptisch und antiszientistisch. Ob es nun, wie er annimmt, eine spezifisch holländische (deutscherWissenschaft widersprechende) Eigenart sei, „Probleme nicht zu Ende zu denken“, „scharfe und schematischeSchlußfolgerungen“ zu meiden und „sich mit der Erkenntnis zu begnügen, die Wahrheit liege in der Mitte“, magdahingestellt bleiben. Zweifellos hat er sich damit selbst und auch seine Liebe zum „Spiel der Wissenschaft“ trefflichcharakterisiert. (Der Einfluß Deutschlands auf die niederländische Kultur, in: Wege der Kulturgeschichte, München 1930,349). Werner KAEGI begründet damit in seiner einfühlenden Würdigung (Historische Meditationen, Zürich s. a. 27 f.) dieallzu geringe wissenschaftliche Wirkung HUIZINGAS, der in den Ruf eines „Impressionisten“ kam und „zu den Historikernohne historisches Problem“ in jene „nicht zu verachtende Strafklasse“ versetzt worden sei, in der bereits Ranke undBurckhardt weilen. Zur mediävistischen Rezeption vgl. unten Anm. 571.
278
Es fehlt freilich nicht an inhaltlich orientierten Arbeiten über Aspekte wie „Scherz und Ernst“, „Schule undLiteratur“ im Mittelalter, die das Spielelement in der Kultur partiell berühren. „Das Komische“ in allenliterarischen Gattungen gehört zu den mediävistischen Lieblingsgebieten. Auch der ausgeprägte Bezug dermittellateinischen Dichtung zur Schulübungspraxis ist eine wohlbekannte Tatsache, fast eine Binsenwahrheit.Der Einfluß der oft extrem phantastischen Arrangements deklamatorischer Produkte auf die sog.Schulliteratur (namentlich auf Streitgedichte, comediae, pseudo-antike Parodien, Fabel- undExempelerzählungen in der Vorgeschichte der Novellistik) wird gern erwähnt. Gelegentlich kommen auch ausder Schulstube hinausführende Überschüsse deklamatorischer Fiktionalität zur Sprache: experimentellherbeigeführte Krisenzustände und sogar eine Art von Schicksalstragödien (wie die aus Ps.-Quintilianstammende Geschichte der Mathematicus-Dichtung Bernhards Silvestris, die über die besten Gestaltungenvolkssprachlicher Artusepik gestellt worden ist.)569 Im Vergleich zu diesen inhaltlichen, stoffund
569 Seit CURTIUS’ ‚Scherz und Ernst in mittelalterlicher Literatur’, ELLM 419–34, zweifellos die beste (auch die Theoriedes Mittelalters zur Komik und zum Lachen aufarbeitende) Untersuchung über die komische Literatur ist: J. SUCHOMSKI,Delectatio und utilitas, Bern 1875; vgl. S. 470, 598 ff.; P. STOTZ, Rez. SUCHOMSKIS in: ZfdA 1981, 13 ff. Über denneuesten Stand der theoretisch einschlägigen Forschung informieren: Wolfram-Studien 7 (1982) mit den Beiträgen desSchweinfurter Kolloquiums (darin besonders wichtig: W. HAUG, Das Komische und das Heilige, Zur Komik in derreligiösen Literatur des Mittelalters, 8–31) sowie ‚Das Komische’, ed. W. PREISENDANZ/R. WARNING, Poet. u.Herm. 7, München 1978. Vgl. jetzt vor allem M. WEIHRLI, Literatur … (wie Anm. 55) 163–181 zum Problem der„christlichen Komik“. – „Schulliteratur“ ist überwiegend das Thema der drei Bände von K. MANITIUS über dieMittellateinische Literatur, auch wenn dies nirgends gesagt wird, und vorausgesetzt, man legt den von Kuno FRANCKEexplizit gewählten Begriff zugrunde (Zur Geschichte der lat. Schulpoesie des XII. und XIII. Jhs., München 1879/Hildesheim1968). Zum Problem des Anachronismus bei der Anwendung dieses wertmäßig eher negativen Terminus auf das Mittelaltervgl. A. 570a und den ausgezeichneten Aufsatz von P. STOTZ, Dichten als Schulfach … (wie Anm. 551). Leider wird dieProsa nicht berücksichtigt (sie ist auch sonst in der Mittellateinischen Philologie eher „unterpriviligiert“). – Zu Einzelnem s.vor allem Hans WALTHER, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters (München 1920), repr. hrsg. vonP.G. SCHMIDT, Hildesheim–Zürich–New York 1984, 17 ff. zum Einfluß der Rhetorenschule; I. KASTEN, Studien zuThematik und Form des mhd. Streitgedichts, Diss. Hamburg 1973, bes. 20 ff., 40 ff. zum Einfluß der scholastischenDisputationstechnik; Joachim SUCHOMSKI (Hrsg.), Lateinische Comediae des 12. Jhs. (Texte der Forsch. 23), Darmstadt1979, Einl.; Paul LEHMANN, Pseudo-antike Lit. (wie Anm. 509) bes. 23 ff. (Valerius de non ducenda uxore aufgrund derSuasorien), 28 ff. (Gesta Romanorum); ders., Die Parodie im Mittelalter, München 1922; zu den in der Rhetorik- unddeclamationes-Forschung. gern angeführten Gesta Romanorum u. ä. Erzählungen vgl. etwa FUHRMANN, Rhet. 68;BONNER, Decl. (wie Anm. 550) 38 und die Literatur nach den Anm. 98 genannten Bibliographien. Zum ‚Mathematicus’(irrig unter den Werken Hildeberts bei Migne [PL 171] 1365–80 ediert) vgl. DRONKE (wie Anm. 729) 126–43; W. VONDEN STEINEN, Bernhard Silvestris und das Problem des Schicksals, in: Menschen im Mittelalter, Bern–München 1967,231–245, bes. 241 ff. zu Hartmann von Aue und Chrétien von Troyes; F. OHLY, Der Verfluchte und der Erwählte, VomLeben mit der Schuld, (Rhein.-Westfäl. Akad. d. Wiss., Geisteswiss. G 207), Opladen 1976, 56 ff. Den „experimentellen“Charakter der Darstellung von extremen Grenzsituationen hebt auch GRIMAL (wie Anm. 405) als eine Wirkung derDeklamationsübungen (im Zusammenhang mit Senecas Tragödien) hervor (305 f.). Zum Übergangsbereich zwischen Thesis,Dialog, Drama und Diatribe vgl. THROM (wie Anm. 545) 161 ff.
279
motivgeschichtlichen Beziehungen zwischen Literatur und rhetorischdialektischer Ausbildung fanden diemethodischen Analogien (bis vor kurzem) noch kaum Beachtung. Dabei ist die am Beispiel der frühenFormen philosophischer und juristischer quaestio-Technik (im Sic et non oder in den Brocarda-Werken)erläuterte ars disserendi durchaus vergleichbar mit einer besonderen, auf Ambiguitäten und Zwiespältigkeitenaufbauenden Literatur des Hochmittelalters, die sich heitere oder ernste Problemrepräsentation für(weiter)denkende Leser, nicht Problemlösung und Wahrheitsverkündigung für rudes et simpliciores zum Zielgesetzt hat. Kasuistische Werke dieser Art können – wie die neueste Andreas Capellanus-Forschungparadigmatisch gezeigt hat – nur umso gründlicher mißverstanden werden, je heftiger ihre implizitenPositionen inhaltlich oder weltanschaulich debattiert werden und je weiter ihr wesentliches in utramquepartem-Prinzip aus dem Blickfeld rückt.570 Solch „engagierte“ Interpretationen (etwa für und widerchristliche und „höfische“ Liebeskonzeptionen) sind jedoch oft nur das
570 Dialektik und Rhetorik als Wurzelgrund aporetischer Denkformen und Ausdrucksweisen im Mittelalter: Eine einsame(wenn auch ausdrücklich tentativ gemeinte und sehr kurze) Pionierarbeit war hier R. GRUENTERS ‚Über den Einfluß desgenus iudiciale …’ (wie Anm. 550) von 1952 zur Bedeutung der aus den controversiae stammenden, in allen Schulen desMittelalters geübten Kunst, die gleiche Sache anzuklagen und zu verteidigen. Wichtige Anregungen gab danach TRIMPI inseiner nicht mediävistischen Studie (Quality …, wie Anm. 550) 81 ff. zu Andreas Capellanus und Boccaccio. Unmittelbarvor Redaktionsschluß erschien ein wichtiger Beitrag voll programmatischer Hinweise auf die ungebrochene schulrhetorischeTradition der collatio, d. h. des philosophischen Streitgesprächs mit unentschiedenem Ausgang, unabhängig von denspäteren dialektischen disputationes der Scholastik: A. CIZEK, Zur literarischen und rhetorischen Bestimmung der SchriftCollatio Alexandri Magni regis Macedonum et Dindimi regis Bragmanorum de philosophia per litteras facta, in: Rhetorica4 (1986) 111–136. Zum Aufschwung solch bildungsgeschichtlicher Erklärungen literarischer Ambiguitäten undAmbivalenzen in der letzten Zeit vgl. vor allem T. HUNT, Aristotle, Dialectic, and Courtly Literature, in: Viator 10 (1979)95–130 besonders zu Chrétien und Andreas Capellanus; ders., The Dialectic of Yvain, in: MLG 72 (1977) 285–99. undRüdiger SCHNELL, Andreas Capellanus, Zur Rezeption des römischen und kanonischen Rechts in De amore (MMS 46),München 1982, und ders., Von der kanonistischen zur höfischen Ehekasuistik, in ZRPh 98 (1982) 257–295; verstreuteAnregungen gaben auch Beiträge des Kolloquiums: ‚Infragestellungen, neue Deutungen, neue Thesen. Diskussionsanstößezur Mediävistischen Literaturwissenschaft’ in Würzburg (4.–7. Juli) 1984 nach Abschluß dieser Arbeit erschienen unter demTitel: ‚Mittelalterbilder aus neuer Perspektive’ (Beitr. z. roman. Philol. des MA’s 14), hrsg. E. RUHE/R. BEHRENS,München 1985; darin vgl. vor allem: M. BENOIT, Le De amore: dialectique et rhétorique (13–21); A. KARNEIN, Andreas,Buoncompagno und andere: Oder das Problem, eine Textreihe zu konstituieren (31–42); R. SCHNELL, Kirche, Hof undLiebe. Zum Freiraum mal. Dichtung (75–111). Vgl. auch die wichtige neue Arbeit KARNEINs: De amore involkssprachlicher Literatur, Untersuchungen zur Andreas-Capellanus-Rezeption in Mittelalter und Neuzeit, (GRM-Beiheft 4)Heidelberg 1985 (14 f., 40–107 zum Werk selbst). Das neue Interesse entstand, wie man sieht, vornehmlich in den mit der„höfischen Liebe“ und dem höfischen Roman befaßten nicht-lateinischen Philologien (auch wenn De amore eigentlich einSpezialthema der mittellateinischen Philologie darstellt). In der weiten Forschungsliteratur zu Minne und Roman wurdennatürlich einzelne Aspekte – „doppelte Wahrheit“, Streitgedicht/partimen, Liebeskasuistik, „Minnehöfe“, Ironie, Insolubilienu. a. – schon immer mit Argumentationstechniken der Schulbildung verglichen, doch von zentraler oder dominanterBedeutung war dieser in die lateinische Kultur des Mittelalters hinüberführende Bezug m. W. in keiner Arbeit. Um hier nurdas Wichtigste zu nennen: Erich KÖHLER, Zur Entstehung des aprov. Streitgedichts, in seiner Aufsatzsammlung:Trobadorlyrik und höfischer Roman, Berlin 1962, 153 ff.; Sebastian NEUMEISTER, Das Spiel mit der höfischen Liebe,Das aprov. Partimen, München 1969 bes. 52 ff., 70 ff.; I. NOLTING-HAUFF, Die Stellung der Liebeskasuistik imhöfischen Roman, Heidelberg 1959; W. BRAND, Chrétien de Troyes: Zur Dichtungstechnik seiner Romane, München 1972;V. BERTOLUCCI, Commento retorico all’Erec e al Cligès, in: StMV 8 (1960) 9–51; E. VINAVER, A la recherche d’unepoétique médiévale, Paris 1970, 173 ff. (‚Tristan en prose’ und Abaelard) und mehrere Hinweise in dem Kongreßbericht ‚TheMeaning of Courtly Love’, ed. F.X. NEWMAN, Albany 1968, 28 ff. (J.F. BENTON zu Andreas Capellanus), 46 ff. (Ch. S.SINGLETON zu Dante) u. ö. – Auf mittellateinischem Gebiet (Andreas Capellanus ausgenommen) sind Ansätze zu einerdialektisch-aporetischen Interpretation am ehesten in Arbeiten zu den literarischen (d. h. nicht fachtheologisch-philosophischen) Werken Abaelards zu finden, in denen von vornherein die Möglichkeit eines exemplarisch-existentiellen Sicet non zu vermuten ist: vgl. Peter DRONKE, Poetic Individuality in the Middle Ages, Oxford 1970, 114 ff., 138 ff. (zu denPlanctus); ders., The Lament of Jephtha’s Daughter, in: StM 12 (1971) 819–63, bes. 851 ff.; P. von MOOS, Palatiniquaestio quasi peregrini, in: MltJb. 9 (1974) 124 ff., hier 150 ff.; ders., Die Bekehrung Heloises, ebd. 11 (1976) 95 ff., hier114 ff. (zu den Briefen). – Anregend ist auch ein Vergleich des dialektischen sic et non mit dem lyrischen odi et amo in
280
sichtbare Symptom eines grundsätzlich verfehlten Begriffs von mittelalterlicher Literatur und einesanachronistischen Mittelalterbildes. Einerseits rhetorikferne Ausdrucksästhetik und Kanonbildung aufgrundmoderner Wertunterschiede zwischen Schulliteratur, Gebrauchsliteratur und „schöner Literatur“; andererseitsdas nach-tridentinisch konfessionelle und noch postkonfessionelle Epochenvorurteil vom „geschlossenenchristlichen Zeitalter“ – dem auch das Modell einer „inoffiziellen Gegenkultur“ verhaftet bleibt –: dies sinddie wohl wichtigsten Verständnisbarrieren vor dem im besten Sinne paradoxen „Spielernst“ mittelalterlicherLiteratur, die ein fiktives, exercitium gerade mit den heiligsten Gegenständen kennt und den Eigenwert derMethode als Methode sogar sub specie aeternitatis nicht verleugnet. Es spricht viel für die Annahme, daß dieGewißheit der einen Glaubensordnung als starkes Movens der Liberalität von den vielen Verbindlichkeiten, die„aufgeklärteren“ Zeiten die Lust am Spiel verdarben, wohltätig entlastete, weil, wo einige Normen absolutfeststehen, die konstruierten Aporien der Normenanwendung sich umso freier und gefahrloser entfaltendürfen.
mlat. Liebesdichtung bei P. DRONKE, Peter of Blois and Poetry at the Court of Henry II, in: MSt 38 (1976) 185–235, hier190 ff.
281
Heilig waren die Texte, vielfältig die Auslegungen. Die Verbindlichkeit des Ganzen vertrug sich mit derbeweglichen Kombinatorik der Teile.570a
570a Es ist unmöglich, diese viel zu knappen Bemerkungen mit „Belegen zu untermauern“; sie könnten den Kern einergrößeren Arbeit über Aufgaben und Irrwege der Mittelalter-Literaturwissenschaft bilden. Einige Zufallshinweise: DieGeringschätzung alles Schulübungshaften und nur heuristisch Fiktiven (s. auch Anm. 569) tritt in der weitgehendunreflektierten (auch ungeschriebenen) Kanonbildung der mittellateinischen Literatur zutage. Klassizistische Versimitationen,wie sie im Grammatikunterricht gelernt wurden, gelten trotz oft dürftiger Hss.-Überlieferung nicht als Schulliteratur, sondernals literarische Meisterwerke und „große Dichtung“; geistreich spielerische Werke der satirisch-didaktischen Moralistik, diezum verbreiteten Lesestoff des Mittelalters gehörten, fallen als „gelehrte Prosa“ in die unteren Ränge der Gebrauchsliteratur(auf gleiche Stufe übrigens wie die nicht weniger ungerecht degradierte „geistliche Prosa“ wortgewaltiger Kirchenredner). DerWaltharius genießt ein Ansehen, als wäre er die Aeneis der mittellateinischen Literatur, der Policraticus gilt als„Fürstenspiegel“ und wird nicht von Literaturwissenschaftlern gelesen, sondern von Historikern konsultiert; und doch sindbeide Werke „Literatur“ dank derselben rhetorischen Bildung, in der man nicht nur dichten, sondern auch denken, d. h. mitAlternativen zum Bestehenden umgehen lernte. Dabei sollte die Mittellateinische Philologie besser als irgendeine andereLiteraturwissenschaft die historische Relativität des erst im 19. Jh. begründeten nationalbelletristischen Literaturbegriffskennen, der den nicht nur „alteuropäischen“, sondern auch thematisch und funktional universellen, etwa auch gelehrte Prosaeinschließenden litterae- und res literaria-Begriff ablöste. Dies war die wohl wichtigste Lektion der ELLM von E.R.CURTIUS, auf die uns heute ein Rhetorik-Forscher der frühen Neuzeit, Marc FUMAROLI (17 ff.) erneut aufmerksam macht,um das „paradoxe d’une histoire littéraire qui historicise tout, sauf le concept d’où elle tire son nom et sa légitimité“ zuüberwinden. Ein anderes „Exemplum impar“ gibt uns neuerdings aus germanistischer Sicht Max WEHRLI (Literatur im dt.Mittelalter [wie Anm. 55] 12 ff., 114 ff., 131 ff. u. ö.), da er die Gewissensfrage nach der Legitimität einer Isolierungdeutscher Literatur im europäischen Mittelalter unentwegt stellt (während früher andere gerade Mittellatein als nationaleAufgabe begriffen und als „Deutschkunde“ angepriesen hatten.) – Zum „geschlossenen Zeitalter“: Ein kleines Plädoyer (mitLiteraturangaben) für die Offenheit des Mittelalters und gegen den Ganzheitskult und „dream of order“ der Mediävisten findetsich in: von MOOS, Ideologiekritik und Mittelalterforschung (wie Anm. 528) 115 f.; vgl. S. 554. Zur Anspielung auf M.BACHTIN vgl. Anm. 313, 949; WEHRLI, Literatur… (wie Anm. 55) 171 ff. sowie die paradigmatische Kritik an deranachronistischen Gegenwelt-Vorstellung eines Bachtin-Verehrers durch F. OHLY: Rezension über R. WARNING, Funktionund Struktur. Die Ambivalenzen des geistlichen Spiels, München 1974, in: RF 91 (1979) 111–141. – Zu der im Trivium„nistenden“ Liberalität des mittelalterlichen Christentums vgl. auch oben Anm. 431 a (BLUMENBERG). Unter den „vielenVerbindlichkeiten“, unter denen sich der nachmittelalterliche Mensch seit dem 19. Jh. (nach HUIZINGA dem „Jahrhundertdes Ernstes“) quält, vgl. O. MARQUARD, Der angeklagte und der entlastete Mensch, in: Abschied (wie Anm. 266) 39–66;Identität (wie Anm. 530) 693 ff. über die „unlebbare, gnadenlose Übertribunalisierung“ und den „absolutenRechtfertigungsdruck“ des Menschen dem Menschen gegenüber (ohne den christlichen „Schutz der Gnade“). Schon dieMetapher „Tribunal“ spricht mehr von tödlichem Ernst als „Gericht“: Das Gericht als Austragungsort ernsthafter Konflikte istals Bewährungsort rhetorischer Technik auch Arena und Spielfeld. (Sogar das ‚Dies irae’ hat mit dem genus iudiciale zutun.) Wie schwer es heute fällt, das Gerichtsverfahren als Spiel zu begreifen, zeigt paradigmatisch die wissenschaftlicheRezeption des ‚Ackermann aus Böhmen’, die weitgehend einen hermeneutischen Prinzipienstreit über den Vorrang einerformal-technischen oder einer erlebnisästhetisch-einfühlsamen Interpretation darstellt, angesichts eines rhetorisch-dialektischmustergültigen Disputs zwischen dem Tod und dem durch den Verlust seiner Gattin getroffenen Autor und angesichts einesso gut wie aporetischen Ausgangs. (Die „Pointe“ liegt darin, daß Gott als Richter nicht entscheidet, sondern die causa inutramque partem offen läßt). Die an Polemik erfrischend reiche Ackermann-Forschung (an Hand des nützlichenForschungsberichts von Giorgio SICHEL, Der Ackermann aus Böhmen, Storia della critica, Florenz 1971; vgl. auch F.DELBONO, L’Ackermann aus Böhmen, storia della critica e critica della storia, in: StM 16 [1975] 379 ff.) lehrt vor allem,daß ein solches Problem ohne Verständnis für den durchaus nicht nur artistisch-stilübungshaften, sondern tiefphilosophischen Sinn des argumentativen Kriegsspiels unlösbar bleiben muß. Die in der rhetorischen Ausbildung erlernteKunst, die Methode von den Gegenständen abzulösen, bedeutet keine oberflächliche Überbewertung der Form, sondern imGegenteil eine umfassendere Betrachtung der „Sache“ von beiden Seiten her, experimentell spielhafte Distanz von dem (imgegebenen Fall tragischen) Ernst der Lage, Überwindung der einsinnig-monomanen Ereignisdeutung durch distinctiomehrerer Aspekte (also Trost; vgl. von MOOS, Consolatio I/II §§ 1157 ff.). In Anbetracht der immer wieder leiser oderlauter zu hörenden Kritik an den „unpersönlichen, scholastischen, äußerlich-strategischen, spitzfindigen, manierierten“ Zügendes Streitgesprächs frage ich mich, ob das Mittelalter nicht gerade in der Fähigkeit der objektivierenden Selbstdistanzierungund unbeirrbaren Projektion existentieller Probleme auf die rein methodische Ebene der ars nicht vielleicht eine für unsereplumpen Erlebniskriterien viel zu subtile und aufgeklärte Denk- und Lebenskunst hatte. Der unmittelbare Anlaß zu diesenNebenbemerkungen war der anregend fragwürdige Beitrag von W. HAUG, Der Ackermann und der Tod, in: Poet. u.
282
„Es ist das alte Spiel des Scharfsinns […], das schon in den ursprünglichsten Perioden, in jedem Augenblickvom Heiligen zur bloßen Belustigung abgeleitet, das einmal an die höchste Weisheit rührt, dann wieder nurspielerisches Wetteifern ist.“ Dies schrieb Huizinga von der älteren Sophistik, und mit ihr
Herm. 11, ‚Das Gespräch’, München 1984, 282–86, der knapp, aber in ungewohnter Offenheit unsereVerständnisschwierigkeiten mit dem aporetischen Argumentationsmodell analysiert und dabei eine Art Ehrenrettung der„rhetorischen Künstlichkeit“ unter der Leitvorstellung des „personalen Bezugs“ in einem „eigentlichen Gespräch“ versucht.Solche Apologie sagt im Grunde nur, wie der ‚Ackermann’ hätte aussehen können, wenn er nach heutiger Gesprächstheoriekonzipiert worden wäre.
283
verglich er die durch den „Aufklärer“ Abaelard repräsentierte geistige Bewegung des 12. Jahrhunderts: Siezeige den „Charakter eines Spiels, eines ernsten, eines gewichtigen, mitunter sogar gefährlichen, aber ebendoch eines Spiels“, insbesondere, weil darin die tiefsten Glaubensgehalte und Dogmen mit dem Denken alssolchem in rein formaler, gewissermaßen „sportlicher“ Absicht in Beziehung gesetzt werden. Der keineswegsabschätzig gemeinte Sophistik-Vergleich läßt vermuten, warum „diese sehr ernsten Spiele“ der neuen Logiker– mehr exercitia als ludi oder gar ioca – in der Mediävistik kein bevorzugtes Identifikationsobjekt darstellten:Sie lassen sich weder religiös noch ästhetisch in neuzeitliche Begriffe übersetzen, scheinen weder dem Ernsteiner absoluten Religion noch unserer idealistischen Spieldefinition von der „sinnvollen Zweckfreiheit“ zuentsprechen. Sie befremden entweder als formalistische Spielereien und Spiegelfechtereien (man kann sichhierfür auf die bereits mittelalterliche Kritik mehr mystisch ausgerichteter Theologen berufen), oder sieenttäuschen als unechte Spiele, als bloße Spielübungen, nicht Spiele der Dichter und „paradiesischenMenschen“ in der seligen Entbundenheit von allen Lebenszwecken („wie eine Mozartmelodie“). So äußertesich Hugo Rahner in einer reizvollen kleinen Studie über die christlichen Möglichkeiten des Spiels, die er alssein „patristisches Glasperlenspiel“ dem bewunderten ‚Homo ludens‘ in manchem, vor allem aber in diesemPunkt entgegensetzte: Huizinga habe wie schon Plato und „etwas enger“ Aristoteles alles Spiel nur als„Einübung auf den Ernst hin“ verstanden und
284
„darum in seinem Homo ludens fast mehr vom Ernst als vom Spiel gesprochen“.571
Auf die Gefahr hin, das Mittelalter gegen seine Liebhaber zu verteidigen, möchte ich Huizingas These von der(uns so schwer nachvollziehbaren) Untrennbarkeit von Spiel und Ernst in der rhetorisch-dialektischen Kulturdes 12. Jahrhunderts nochmals als Forschungsanreiz empfehlen, gleichviel, wie legitim daneben andere mehrpoetologische, philosophisch-ästhetische und religiöse Spieltheorien sein mögen. Es geht um die Paradoxieder Anwendbarkeit des Zwecklosen, der (aktuellen) Zweckfreiheit des (virtuell) Verzweckbaren, um denfiktiven und doch nicht irrealen Freiraum des Denk- und Machbaren in Einfällen, Proben, Versuchen,Experimenten, Fingerübungen, Würfelspielen, Planspielen und andern officiosa mendacia. In dieserparadoxen Einheit der Ernstfall-Simulation ist zwischen anscheinend reinen Bravourstücken desScharfsinnspiels und tiefernsten Abhandlungen über letzte Geheimnisse mit Hilfe listig-subtiler Hypothesen-Konstruktionen vieles möglich: Auf der einen Seite bildet die Kunst, die schwächere Sache zur stärkeren zumachen (und umgekehrt), explizit den Kern sophistischer Rhetorik – implizit wohl aller Rhetorik – undmacht auch das Rhetorische an der Dialektik aus. Diese Technik ist an sich von allen Inhalten abgelöst,richtet sich jedoch gemäß ihrer immanenten Maximalforderung praktisch auf die positiv oder negativhöchsten, d. h. schwierigsten Gegenstände. Wenn Gorgias die meistgescholtene Frau des Mythos, Helena, vonSchuld reinzuwaschen beansprucht, so liegt dies strukturell auf der gleichen Ebene wie jene selbstgewisseBehauptung Simons von Tournai, er könne die Lehre Jesu nicht nur,
571 HUIZINGA, Homo ludens (wie Anm. 568) 238; ders., Abaelard, Zwei prägotische Geister (wie Anm. 568) 177; vgl. auchebd. 179: „Das Spielelement ungestümen Wetteifers verrät […] eine Geisteshaltung, die archaischen Zeitaltern eigentümlichist. Man kann es die Haltung des Sophismus nennen. Die Fähigkeiten des folgernden Verstandes sind erstarkt, aber dieGrenzen seiner Beweiskraft werden unvollständig gesehen.“ (Vgl. S. 382 ff., 391 zum Erkenntnisoptimismus des 12. Jhs.,den man unter diesem Gesichtspunkt zweifellos besser versteht als mit Rückschlüssen vom Kartesianismus und von derSpätscholastik her.) Ebd. 182: Abaelard als „Aufklärer“. – H. RAHNER, Der spielende Mensch (erweiterte Ausg. desBeitrags im Eranos-Jb. 1948 erschienen Essay) Einsiedeln 1952, 41957, 32 f., 79. Vgl. auch R. LEVINE, Wolfram vonEschenbach: Dialectical „Homo ludens“, in: Viator 13 (1982) 177–201. – Im Text nicht mehr berücksichtigt werden konntedie anregende, ebenfalls von HUIZINGA ausgehende Darstellung des Spielelementes in der mal. Literatur von Max WEHRLI(wie Anm. 55) 166 ff., 178 f., 204 ff. – Grundsätzlich vgl. auch Joachim RITTER, Über das Lachen (1940), in: ders.,Subjektivität, Frankfurt 1974/1980, 62–94, hier 76 zum „Zusammenhang von Ernst und Unernst, vom Sittlichen und demim Sittlichen Ausgegrenzten“ und einer „den Menschen leitenden Lebensordnung des Ernstes“ als unentbehrlicherVoraussetzung jedes Spiels, insbesondere des komischen Spiels.
285
wie er es tat, verteidigen, sondern, wenn nötig, auch widerlegen. Ein im Mittelalter unübertreffliches inutramque partem! Ganz um die Sache geht es weder Gorgias noch dem als besonders subtil bekanntenDialektiker, aber ohne eine solche gewichtige „Sache“ wäre ihre Kunst undenkbar. Leere Virtuosität ohneSachbezug hätte auch kaum zu dem immerwährenden Grenzkonflikt zwischen Rhetorik und Philosophiegeführt; darüber wären Denker vom Range Platos erhaben gewesen. Dieser Streit beruht vielmehr auf derBedeutsamkeit eines Als ob, mit dem das Schwergewicht der Dinge, die Festigkeit der Meinungen ins Schwebengebracht werden können, wodurch neue Einsichten in Grundfragen des Kosmos und der Existenz,hypothetische oder utopische Wirklichkeitsentwürfe möglich werden.
Auf der (ernsteren) Gegenseite läßt sich an den Versuch Anselms von Canterbury, des ältesten Vaters derScholastik, erinnern, die Inkarnation remoto Christo zu beweisen, so, als ob es Christus und Christentum niegegeben hätte. Dieses Denkmuster steht, auch wenn es theologisch im Dienst der Glaubensstärkung eingesetztwird, in einem Zusammenhang mit der rhetorischen Kunst der Hypothesis. Im Gegensatz zur historischenDarstellung abgeschlossener Ereignisse richtet sich die declamatio auf die den Ereignissen vorangehendenEntscheidungssituationen. In deklamatorischen Schulübungen des Mittelalters wurde die Fähigkeit erlernt, sichin wichtige Gestalten der Geschichte und in Handlungsdilemmata vor den Geschehnissen hineinzuversetzen:etwa in Agamemnon vor dem Opfer Iphigenies, in Caesar am Rubicon, in Alexander vor der Indien-Expedition, in Judith vor dem Tyrannenmord, in Judas vor dem Verrat, in Pilatus vor dem Urteil. Abaelardsbekannte Ansicht, die Mörder Jesu seien aufgrund ihrer Unkenntnis der Identität des Gekreuzigten sündenfreiund schuldlos, ist zwar vornehmlich eine Konsequenz seiner extremen Intentionsethik, aber wie diese selbststellt sie auch ein Indiz dar für die Verinnerlichung einer traditionellen rhetorisch-dialektischen Methode, mitder in suasoriae und controversiae deliberative Seelenzustände historischer Personen scharfsinnigrekonstruiert und Alternativen zu den faktischen Entscheidungen in Erwägung gezogen werden mußten. DieseMethode ist die des „hypothetischen“ Denkens in einem allgemeinen, über Historisches hinausgreifendenSinn: Sie stärkt nicht nur die rationale Einbildungskraft gegenüber einer nicht tatsächlichen, d. h. einermöglichen und „ungeschehenen Geschichte“ (Demandt), sondern erweitert auch den philosophisch-theologischen Fragehorizont gegenüber dem Sinn der Geschichte und Heilsgeschichte, ja, sie erlaubt derkonjunktivischen Phantasie, was der indikativischen doctrina verwehrt ist: metaphysische Aussagen über dennicht geoffenbarten Teil der Providenzgeheimnisse.572
572 Officiosa mendacia: Pol. Prol. I 16.17 f. unten Anm. 815; Abaelard, Sic et non, Prol. (wie Anm. 561) 102 (302) = Aug.Ep. 28.3.3 (CSEL 34.1) 108. – Zum rhetorisch-sophistischen Grundprinzip vgl. FUHRMANN, Ant. Rhet. 15 ff.;HUIZINGA, Homo ludens (wie Anm. 568) 244 ff. (u. a. zu Gorgias). Der Simon von Tournai zugeschriebene Ausspruch beiMatthaeus Paris (Historia maior, ad. ann. 1201) ist vielleicht eine boshafte Übertreibung; vgl. J. WARICHEZ, Lesdisputationes de Simon de T. (Spicil. sacr. Lovaniense 12) Löwen 1932 XXI. – Sen. Rh., Suas. III: Deliberat Agamemnonan Iphigeniam immolet. Andere Beispiele s. oben Anm. 556 – Zu Anselm s. unten Anm. 966. – Eine dergeschichtstheoretisch anregendsten Arbeiten, die ich kenne, Alexander DEMANDTS eben erschienene Studie: UngescheheneGeschichte, Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn…? Göttingen 1984, bewegt sich in den Bahnen derdeklamatorischen Hypothesis-Phantasie, ohne daß der Autor dies bemerkt, vgl. bes. Kap. 5.06: „Hinweise auf möglicheAlternativentwicklungen… Was wäre geschehen, wenn Pontius Pilatus im Jahre 33 Jesus begnadigt hätte?“ (73 ff.). –Abaelard, Scito te ipsum, ed. D.E. LUSCOMBE, Peter Abelard’s Ethics, Oxford 1971, 54–56; vgl. ebd. XXXV f. – Zurliterarischen/rhetorischen Fiktion als Probespiel mit Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns und zumphilosophischen „Als ob“ vgl. auch S. 52 f., 488 f. und WÜRZBACH, Fiktion (wie Anm. 371) 1109, W. ISER, DieWirklichkeit der Fiktion, in: R. WARNING, Hrsg., Rezeptionsästhetik, München 1975, 277–321, bes. 298 ff.; F.LÖTZSCH, Art. Fiktion, in: HWbPh II 951 f.; MARQUARD, Kunst als Antifiktion… (wie Anm. 36) 38 f. – PaulFEYERABEND, Against Method (1975), übs. H. VETTER: Wider den Methodenzwang, Frankfurt a. M. 1976/1983, 35(als Plädoyer für eine Wissenschaft der Hypothesen, die das Vergebliche in der Wissenschaftsgeschichte als Möglichkeitmitdenkt und zur Aufgabe, „‚die schwächere Sache zur stärkeren zu machen’, wie es die Sophisten ausgedrückt haben, und sodas Ganze in Bewegung zu halten.“
286
d) Johanns ‚logica probabilis‘ und die „akademische“ Skepsis
Johanns Traktate als Sammlungen philosophischer quaestiones und rhetorischer causae; als argumentative „Kriegsspiele“ undengagierte Streitschriften (§ 69), als agonale Diatriben gegen den Zwiespalt von „Kunstlehre“ und „Kunst“ in der politischenund ethischen „Lebenskunst“ (§ 70). Johanns Selbstdarstellung im Dienste einer kritischen Geschichte der Philosophen biszur Gegenwart (§ 72). Der Probabilismus als spezifisch humane und zugleich christliche Wissenschaftstheorie in der„humanistischen“ Tradition zwischen Cicero und Vico (§ 72).
Num fingo, num mentior? Cupio refelli. Quid enim laboro nisi utveritas in omni quaestione explicetur.
Cicero (Tusc. 3.46)
69. Daß der „Spielernst“ eine verkannte mittelalterliche Denkform darstellt, die eine erstaunliche Freiheit inder übungsmäßigen Ablösung des Formalen vom Inhaltlichen – nicht trotz, sondern wegen der Gültigkeit der„Inhalte“ – möglich machte, dies soll vorerst als These oder auch nur als Anregung dienen, mittelalterlicheLiteratur in einer noch ungewohnten Art zu lesen und zu befragen. Begründen läßt sich die These hier alleinim Blick auf Johann von Salisbury, dessen Werk ein hervorragendes Zeugnis für die erwähnte
287
bildungsgeschichtliche Stellung zwischen der Rhetorenschule und der Artistenschule bildet, aber auch einigerhetorisch-dialektische Spieltechniken in actu vorführt, die als „essayistisch-moralistische“ Anwendung derRegel des Selbstdisputs „nach beiden Seiten“ verstanden werden dürfen. Während das Metalogicon mehr diealten und neuen Formen der Methodenlehre in einem stellenweise fachsprachlichen Stil beschreibt, spiegelnvor allem die literarischen Argumentationsstrukturen des Policraticus die traditionellen Übungen mitAmbivalenzen der quaestiones und causae wieder.
Zunächst ist an vielen der (nicht unbedingt vom Autor selbst stammenden, aber meist sinngerechten)Kapitelüberschriften des Policraticus der offenkundige Thesis-Charakter zu beachten, sowohl was diedilemmatische Form als auch was gewisse Lieblingsthemen der Deklamatoren (Kosmos, Naturrecht,Tyrannei, Recht und Macht, Schmeichelei und Wahrheit, verschiedene Pflichtenkollisionen) betrifft:572a
„Über den Nutzen und Mißbrauch des Würfelspiels“; „Daß es widernatürliche Zeichen gibt“; „Daß nichts gegendie Natur geschieht“; „Daß aus dem Möglichen das Unmögliche nicht folgt“; „Über die Komödie oderTragödie dieser Welt“; „Worin der Tyrann sich vom Fürsten unterscheidet“; „Daß auch Priester Tyrannensind“; „Daß es nach der Heiligen Schrift erlaubt und ruhmreich ist, Tyrannen umzubringen, vorausgesetzt, derMörder sei nicht durch Treuepflicht an den Tyrannen gebunden oder verletze dabei nicht aus irgendeinemandern Grund Recht und Ehre“. In einigen Fällen nennt der Titel auch noch die Argumentationsmittel:„Darüber, daß Schmeichler bestraft werden müssen wie Feinde der Götter und Menschen und daß die Wahrheitgern gehört und mit Geduld ertragen werden
572a Die (in der Antike gelegentlich als trivial und abgedroschen verspotteten) Themen der Deklamatoren sind aufgezählt beiBONNER, Declamation (wie Anm. 550) 2 ff., 6 ff., 25 ff., 28; WINTERBOTTOM (wie Anm. 550) 8 ff. Die Themendecken sich z. T. mit Johann unten Anm. 579 erwähntem dubitabilia-Katalog. – Die ausgewählten Pol.-Überschriften nachdem Inhaltsverzeichnis von WEBB I pp. III ff. I, II pp. III ff. zu I 5, 11, 12, 22; III 8, IV 1, VIII 18, 20 (Kurztitel). Ebd. zuIII 14, V 7, 17 (begründete Titel). Ebd. zu I 7, II 6, 10, VIII 7, 23 (Hypothesis-Form). – Allgemein fällt auf, daß dieStandardthemen der Deklamationsübungen im Bereich der Hypothesis aus Bereichen stammen, die auf die aristotelischeDreiteilung „Beispiel, Parabel, Fabel“ (s. § 17) zurückgeführt werden könnten: 1. Römische Geschichte undRechtsgeschichte, 2. Erfundene, aber mögliche Fälle des Alltags und der Rechtspraxis, 3. Mythologische Themen aus dergriechischen Tragödie oder Fabelstoffe. Vgl. BONNER, Decl. (wie Anm. 550) 28. Zur häufig antithetischen Form vgl. F.FOCKE, ‚Synkrisis’, in: Hermes 58 (1923) 327–368. – Zu einem Musterfall eines dilemmatischen Hypothesisthemas derDeklamatoren – „soll Cato, der Weise, sich politisch engagieren?“ – in Pol. VIII 23 vgl. von MOOS, Lucans tragedia167 ff. (zum Thema s. BONNER, a. O. 3 mit Bezug auf Cic. Top. 21.82; De orat. III 29.112; Quint. III 5.6; Sen.Ep. 14.13 u. a.)
288
muß, dargetan in Gründen und Beispielen“; „Welche Vor- und Nachteile den Untertanen aus den Sitten derFürsten erwachsen, was mit einigen hintersinnigen Beispielen erhärtet wird“; „Daß das Geld um der Weisheitwillen zu verachten ist, was durch Beispiele der alten Philosophen bewiesen wird“. Einige Titel zeigen einetypische „Hypothesis“-Form und verweisen inhaltlich auf die berühmtesten Vergleichsexempla traditionellerSynkrisis oder umgekehrt gerade durch Absonderlichkeiten auf die juristisch-kanonistische Übungspraxis derKonstruktion kurioser Streitfälle: „Über die Unähnlichkeit Augustus‘ und Neros“; „Über eine Maria, die ausHunger ihren Sohn aufaß“; „Über Vespasian, der einen Krüppel und einen Blinden geheilt haben soll“; „Überden unmäßigen Mark Anton und den mäßigen Julius Caesar“; „Darüber, daß man dem Rat des Brutus gegenschismatisch um die Papstwürde kämpfende Streithähne folgen soll“ usw. Exempla erscheinen hier – wienoch genauer zu zeigen sein wird – auf zwei Ebenen: einerseits in der rahmenbildenden Thematik derHypothesis (quaestio finita) als paradigmatische Streitfragen, andererseits als Beweismittel in der Funktionvon (mittelalterlichen) loci communes zur Bekräftigung der eigenen Ansicht und Widerlegung dergegnerischen. Die Aufforderung, „möglichst viele Argumente“ (copia rationum) für die positive odernegative Applikation im Disput bereitzuhalten, läßt sich entsprechend so verstehen, daß autoritative Beweis-Exempla zu sammeln sind, die je nach Zusammenhang „auf beiden Seiten“ einer infiniten Frage oder einerbereits zum Problembeispiel oder Beispielfall konkretisierten causa eingesetzt werden können und daß die(nur durch Übung zu erlernende) Kunst in der jeweiligen Anwendung auf das eigene Argumentationszielbesteht. Auch die Vorstellung der probeweisen Fiktion eines Gegners zu Übungszwecken läßt sich für dieInterpretation der beiden Hauptwerke Johanns heranziehen. Ohne die Kenntnis bestimmter eristischer Ritualeder (in der literarischen Praxis hauptsächlich durch die Streitschriften des Hieronymus vermittelten)controversiae würde der dominant polemischkämpferische Ton Johanns leicht mißverstanden. VieleInterpretations-schwierigkeiten stammen aus Johanns doppelter Intention, Diskussionspunkte (dubitabilia)zu beleuchten und eigene Standpunkte engagiert zu vertreten. Wann tut er das eine, wann das andere? DieKenntnis rhetorischer Techniken dürfte dem Verständnis hier eher weiterhelfen als der undifferenzierteVorwurf der „Selbstwidersprüchlichkeit“ oder die ausgeklügelte Konstruktion einer biographischen „Logik“mit Entwicklungsetappen und Entstehungsschichten des Werks.573
573 Vgl. unten §§ 80, 90 f. zum Exemplum als causa und locus. Zum Verhältnis Hypothesis-Exemplum vgl. obenAnm. 555 und TRIMPI, Hypothesis (wie Anm. 554) 65 ff. Der Begriff locus communis (s. S. 244, 344 f., 361, 425,430 ff.) im mittelalterlichen und auch im neuzeitlichen Sinn unterscheidet sich vom antiken Begriff dadurch, daß ervorwiegend das beweisende, nicht aber auch das problematische Element darstellt, während der locus communis derDeklamatoren gerade die Thesis war, für die Beispiele als Argumente herbeigeschafft werden mußten. Vgl. BONNER, Decl.(wie Anm. 550) 10, 61 f.: Für Sen. Rh. Controv. VII praef. 3 (implere locum) wird als Illustration herangezogen Controv. II4.4, wo nemo sine vitio bewiesen wird durch Catos Maßlosigkeit und Sullas Mitleidlosigkeit. Radulf von Longchamp (wieAnm. 508) 153 sieht im locus communis einen (besonders in der conclusio geeigneten) sentenziösen Beleg: est enim locuscommunis sententia sumpta a natura vel moribus, quae infertur exempli causa ad aliquid ampliandum. Also auch hier wird„aufgefüllt“, amplifiziert, aber locus ist das „Füllmittel“, nicht das Gefäß. – Zu Erwägungsspiel und copia rationum s. obenMet. III 10 in Anm. 598. – E.K. TOLAN, John of Salisbury and the Problem of Medieval Humanism, in: Etudes d’hist.littéraire et doctrinale 19 (1968) 185–99, hier 197 f. hebt aufgrund des streitbaren Tons pointiert hervor, man könnte ausPolicraticus und Metalogicon (die beide nicht als Traktate, sondern als „doctrinal debates“ über die Johann am meistenbeschäftigenden Zeitfragen in Bildungswesen und Politik zu verstehen seien) lauter quaestiones disputatae ableiten. ZumEinfluß des polemisch-satirischen und diatribischen Stils der Kirchenväter, insbesonder Hieronymus’ vgl. etwa: IlonaOPELT, Hieronymus’ Streitschriften, Heidelberg 1973 und dieselbe, Die Polemik in der christlichen lateinischen Literaturvon Tertullian bis Augustin, Heidelberg 1980 (vornehmlich Wortschatzuntersuchungen, zur rhetorischen Methodengeschichteweniger ergiebig); Hinweise auf die Tradition der controversiae bei HAGENDAHL (wie Anm. 173) 311 ff.; CARLSON100 f.; FOCKE (wie Anm. 572a) 328 ff., CAPELLE/MARROU 992 ff., 1000 f.; P.L. SCHMIDT, (wie Anm. 43) 101 ff.,183 ff.; unten S. 321 ff., 344, 350 ff.
289
70. In den Prologen beider Werke wird zuerst die streitbare Absicht kundgetan: Das freche Treiben einesCornificius zwingt den sonst friedlichen und bescheidenen Verfasser des Metalogicon, heroisch in die Arena zusteigen, wo er mit den Zitatwaffen antiker und moderner „Freunde“ fechten will; und im Policraticus zieht ermit dem Vasallengefolge der „Philosophen“ gegen eitle Höflinge ins Feld. Kampf scheint schlechthin dieForm des Denkens und der literarischen Äußerung zu sein. Darin liegt ein Problem, da die beidengattungsmäßig und thematisch heterogenen Werke keineswegs nur als Streitschriften, Invektiven oder Satirenangelegt sind. Der Sinn der agonalen Prologtopik wird klarer, wenn man die auffällige Stilfigur der Gegner-Umbenennung berücksichtigt. Die Gegenthesen zu Johanns Ansichten über das Bildungs- undVerwaltungswesen werden personifiziert und mit Phantasienamen literarischer Provenienz versehen; oder(wenn man lieber will) die Vertreter dieser Thesen erhalten Pseudonyme, Deck- und Spitznamen,Schimpfmetonymien (mit Vorliebe aus dem Onomastikon antiker Komödienpersonen und Prolog-aemuliberühmter Autoren) wie Gnathonici, Trasoniani, Lanvinii, Photiniani, Epicurei und (wohl aus Johannseigener inventio) Cornificiani. Die Namen dürften mittelalterlichen Lesern etwa so verständlich gewesen seinwie uns die analoge Wortbildung „ein Tartüff“. Diese
290
Eigentümlichkeit erweist nun die in den Prologen angekündigten „Kampfhandlungen“ als eine Art rhetorischinszenierter „Charakterkomödien“ mit diatribischen Dialogelementen (wie dem einredenden fictusinterlocutor).574 Sie lassen sich aber auch nach dem Modell jener fiktiven Probestreitgespräche mit einemimaginierten Gegner verstehen, die Johann als Denkübung empfiehlt
574 Streitbare Absicht: Met. III Prol. oben Anm. 475; Pol. Prol.: S. 401, 392 ff. Vgl. auch R.E. PEPIN, John of Salisbury’s‚Entheticus’ and the Classical Tradition of Satire, in: Florilegium 3 (1981) 215–27. – Zur eristischen Mentalität derAbaelardschule, zu der in einem weiten Sinn auch Johann gehört vgl. oben §§ 68 f. (HUIZINGA). – Zu Spitznamen undBeschimpfungsmetonymien vgl. OPELT, Hier. (wie Anm. 573) 174; Severin KOSTER, Die Invektive in der griechischenund römischen Literatur, Meisenheim a. G. 1980, 27 ff., 354, 367 u. ö. – Komödie und Decknamen: Zur Komödie alsSpiegel des privaten Lebens unter beliebiger, selbsterdachter Namengebung und Rollenformung im Gegensatz zu denverbindlichen herkömmlichen Namen der mythischen Tragödie nach Aristoteles (Poet. 9) vgl. WASZINK (wie Anm. 125)197 f.; RÖSLER (ebd.) 309 ff. Diese Theorie könnte m. E. auch hinter der späteren eigenartigen Verschränkung derGattungen Komödie und Satire sowie den Personifikationsmethoden („Maskendialogen“) in der Diatribentradition stehen;vgl. Anm. 569 zur diatribischen Thesis, § 106, S. 445 zu Johanns comedia-Begriff; U. KINDERMANN, Satyra, Die Theorieder Satire im Mittellateinischen, Nürnberg 1978, 142 ff.; ders., Mittelalterl. Beiträge zur Satire-Diskussion, in: Mittelalterl.Komponenten des europ. ‚Bewußtseins’, hrsg. J. SZÖVERFFY, Berlin 1983, 80–100; Rud. HIRZEL, Der Dialog, Leipzig1895, I 370 ff., II 370; DESCHAMPS (wie Anm. 379) 353 ff.; J.W. SMEED, The Theophrastean Character, Oxford 1985(übergeht das Mittelalter). – Ungeachtet der berechtigten historischen Frage nach den Personen und Gruppen, die sich hinterden erwähnten Decknamen verbergen, ist Johanns Vorliebe für Personifikationen und Ethopoeien vonliteraturwissenschaftlichem Interesse. Sie wird neben der Absicht kämpferischer exercitatio in der geistigen militiaimaginaria (Anm. 548) zweifellos auch durch andere Motive bestimmt, wie die in Pol. VIII 1, (II) 228; VIII 14, 33 und VII20, (II) 188 (vgl. S. 315) ausdrücklich genannte Tarnungsintention und durch den Willen, typische Zeitströmungen undintellektuelle Moden ohne unnötige persönliche Angriffe geißeln zu können (nach dem Motiv: vitia, non personae); hinzukommen die schon in karolingischer Zeit und besonders wieder bei den italienischen Humanisten der Renaissance beliebtenUmbenennungen dekorativ antikisierenden Zuschnitts, namentlich im Briefverkehr (vgl. etwa Ep. 276, II 582). Zur Suchenach dem „historischen Cornificius“ vgl. L.M. De RIJK, Some New Evidence on Twelfth-Century Logic: Alberic and theSchool of Mt. Ste-Geneviève, in: Vivarium 4 (1966) 1–57 (Cornificius = Magister Gualo); J.O. WARD, The Date of theCommentary on Cicero’s ‚De inventione’ by Thierry of Chartres and the Cornifician Attack on the Liberal Arts, in: Viator 3(1972) 219–73; E. TACCHELLA, Giovanni di Salisbury ei Cornificiani, in: Sandalion 3 (1980) 273–313. – Zu Lanviniuss. unten § 88. – Zu biblischen Decknamen im Becket-Konflikt vgl. A. SALTMAN, John of Salisbury and the World of theOld Testament, in: The World of J. 343–364, hier 346 f.
291
(S. 252 f.). Sie scheinen einem rhetorisch-dialektischen Doppelziel zu dienen: Als argumentative„Kriegsspiele“ schärfen sie das Denken in utramque partem, und durch den dramatisch gesteigertenAntagonismus der Prinzipien zwingen sie den Leser in die Rolle des Richters, der frei, aber vom Autorparteilich gelenkt, Stellung zu beziehen hat.
Diese für den modernen Betrachter eher befremdliche agonale Kombination von Spiel und Ernst,übungshafter Aleatorik und Verbindlichkeit hat neben der bisher erläuterten rhetorisch-dialektischen Seiteauch eine eigentlich philosophische: Vor allem das Metalogicon illustriert in seinen autobiographischenTeilen die Methode des inneren Disput über Pro und Contra einer Sache nach der logica probabilis. Diedoxographisch erwähnten Lehrmeister zeitgenössischer Philosophie und Theologie stehen hier analog zu densich widersprechenden opiniones der Tradition, sozusagen als lebende Problem-Exempla, die es zu vergleichenund womöglich zu versöhnen gilt. Johann berichtet über seine Studien und schildert so den durch Plato undAristoteles längst vorgebildeten Universalienstreit am Beispiel seiner Lehrer. Damit erhebt er sich „alsAugenzeuge“ selbst zum Exemplum.575
71. Ein erstes starkes Motiv zur stellenweise autobiographisch gefaßten Darlegung der Lehrmeinungen liegtzweifellos in der bereits erwähnten Theorie-Praxis-Problematik. Johann kommt immer wieder auf denHauptvorwurf gegen die Cornificiani zurück, sie würden nicht anwenden, was sie reden; ihre als Hilfsdisziplinzwar nützliche Dialektik sei für sie selbst steril, da sie „einzig
575 Zu Johanns Sicht des Universalienstreits vgl. B.P. HENDLEY, John of S. and the Problem of Universals, in: Journ. ofthe Hist. of Philos. 8 (1970) 282–309; Dal PRÀ 121 ff. und vor allem WILKS (wie Anm. 546) 264 ff. zur Behandlung desStreitfalls im Sinne der insolubilia-Fragen durch das in utramque partem oder die coincidentia oppositorum; vgl. auchAnm. 352. Während Johann im letzten Kapitel von Met, II (20) die verschiedenen Meinungen der Philosophiegeschichte zumUniversalienstreit vorführt, um die Komplexität dieses Gegenstandes zu demonstrieren und – nicht ohne ironische Spitzengegen Einseitigkeiten und Mißverständnisse – kritisch Distanz davon zu gewinnen, beteuert er im darauffolgenden Prolog zuBuch III seine eigene geringe Kompetenz solchen Fragen gegenüber und wünscht darum die (in Buch II teilweise eben nochkritisierten) ehemaligen Lehrer Abaelard, Gilbert und Adam als Helfer im Kampf gegen den Erzfeind Cornificius dankbarvorzustellen. – Zu dem auch sonst beliebten (popularphilosophisch und patristisch bestimmten) pädagogischen Verfahren derSelbstexemplifizierung vgl. CANCIK (wie Anm. 38) 71 ff. (Seneca); GEERLINGS 173 ff. (Augustinus); EHLERS, Gut undBöse (wie Anm. 181) 37 ff.; JAEGER (wie Anm. 240) 1 ff. (Abaelard); von MOOS, Cons. III §§ 1253 ff.; OHLY, Schriften359 ff. (Aelred); KINDERMANN, Satyra (wie Anm. 571) 40 f. (als captatio benevolentiae für die Satire) und § 60, 77,S. 206, 405 ff., 536.
292
in der Schule“ Verwendung finde:576 „Für jeden beliebigen Werkmeister ist nichts leichter, als über seine Kunstdaherzureden, aber Kunst zu machen – nach den Regeln der Kunst und dem Wesen der Kunst gemäß –, das istüberaus schwer.“ Diese Stelle bildet den Übergang zu dem nachfolgenden Studienbericht. Die eigenenStudienjahre, die gehörten Lehrer und Lehren werden hier gewissermaßen als Gegenbeispiel aus der Sicht deszurückblikkenden Kirchenmanns und „Praktikers“ an der curia dargestellt und mit dem Leben außerhalb derSchule in Beziehung gebracht. Durch den internen kritischen Vergleich, durch das Unterscheidendivergierender Lehrmeinungen soll gleichzeitig in actu vorgeführt werden, wie die topische Methode nachdem Ideal ex arte quod est artis facere fruchtbar gemacht werden könnte. Eine gewisse Analogie hierzu findetsich auch im Policraticus, wo die eigene Person häufig in ambivalenter Weise die Problematik desphilosophischen Lebensideals für Hofbeamte exemplifiziert, damit der Leser unmittelbarer auf dengrundlegenden Zwiespalt von philosophia und curia aufmerksam werde.577 Ein Hauptthema beider Werke, diepraktische Verwirklichung theoretischer
576 Vgl. S. 164–177 (Theorie–Praxis). – Met. II 9, 76 f.: Neque enim magnum est si […] in illis dumtaxat versetur que necmilitie, nec in foro, nec in claustro, nec in curia, nec in ecclesia, immo nusquam nisi in scola prosunt […] Est autemcuique opifici facillimum de arte sua loqui; sed ex arte quod artis est facere difficillimum est. Vgl. S. 253 ff., 361 f.,Anm. 716 (zur Antithese forum/schola Pol. V 12 (I) 338). Daß Johanns Kritik nicht die „Schule“ selbst, sondern derenAblösung vom „Leben“ trifft, zeigt ex altera parte Met. I 21,50, 14 ff.: Quintilianus eam [sc. grammaticam] commendatadeo ut dicat quia usus grammatices et amor lectionis non scolarum temporibus, sed vite spatio terminetur (cf. Quint. I8.12). Met. II 10, 77 ist überschrieben: Quorum auctoritate precedentia et sequentia constent.577 Zum Verhältnis von philosophia und curia, und zum Ideal einer von „philosophischen“ Klerikern bestimmten fürstlichenPolitik und zur Gefahr einer unkontrollierten Vermischung beider Sphären vgl. etwa HUIZINGA (wie Anm. 31) 194, 208 f.;R. KÖHN, ‚Militia curialis’, Die Kritik am geistlichen Hofdienst bei Peter von Blois und in der lat. Lit. des 9.–12. Jhs., in:Miscellanea Mediaevalia, 12.1, Berlin 1979, 227–57, hier 251 u. ö.; C.S. JAEGER, Medieval Humanism in Gottfried vonStraßburg’s Tristan und Isolde, Heidelberg 1977, 80 ff.; ders., The Origins of Courtliness – Civilizing Trends and theFormation of Courtly Ideals – 939–1210, Philadelphia 1985, 54 ff.; ders., The Courtier Bishop in ‚Vitae’ from the Tenth tothe Twelfth Century, in: Spec 58 (1983) 291–325; J. FLORI, La chevalerie selon Jean de Salisbury (nature, fonction,idéologie), in: RHE 77 (1982) 35–77; G. STOLLBERG, Die soziale Stellung der intellektuellen Oberschicht im Englanddes 12. Jhs., Lübeck 1973, 18 ff.; KERNER 158 ff.; Claus UHLIG, Hofkritik im England des Mittelalters und derRenaissance, Berlin 1973, 40 ff. Vgl. S. 185, 336, 552, 577 ff., A. 951. SEIGEL (wie A. 394) geht (183 ff.) auf JohannsVerbindung von Philosophie und Rhetorik nach dem Vorbild Ciceros ein, um sie im Vergleich mit Petrarca, Salutati u. a.Renaissancehumanisten als unklassisch (weil Martianus Capella mitwirkt) und frühscholastisch infiziert zu relativieren. Dieseeinseitige Betrachtung ist deshalb entstanden, weil SEIGEL nur die dialektisch-erkenntniskritischen Stellen des Metalogiconzum Verhältnis von Rhetorik und Philosophie herangezogen, die zentrale Problematik des Policraticus, die Versöhnung vonWeisheit und Politik, aber übersehen hat. Vgl. Anm. 599. Johanns Kritik am höfisch verdorbenen Intellektuellen, dem„Hermaphrodit“ (res monstruosa est philosophus curialis) von Pol. V 10 (I) 329, entspricht der Kritik am sophistischenLogiker und am virtuosen Bibeltheologen ohne „Werktätigkeit“, d. h. dem „Eunuchen“ von Pol. VIII 17 (II) 356. Dies sindverschiedene Erscheinungsformen derselben Entzweiung von Theorie und Praxis (vgl. auch SALTMAN [wie Anm. 574]344).
293
Grundsätze und methodischer Regeln, findet seinen vielleicht treffendsten Ausdruck gerade in einer denGegensatz von Schulübung und Lebensernst (auf propädeutischer Ebene) aufhebenden Übertragung dertechnischen, ja handwerklichen Begriffe ars und usus ins Ethische und Politische: Die in mehrerenrhetorischen Lehrbüchern wiederholte Antithese von Kunstlehre und Kunstausübung, die Johann in demobigen Zitat auf modische Pseudo-Dialektiker bezieht, verwendet er gleicherweise in einem Brief an seinenBruder Richard, um sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, er mache im Becket-Konflikt nur schöneWorte:578 „Du sagst mir vielleicht, daß es
578 Ep. 172, (II) 128 f.: Sed dices fortasse quod michi, sicut cuique, facilius est dictu facienda praescribere quam factu quaepraescripta fuerint adimplere. Nam et liber vorandus dulcescit in ore prophetae, sed ad interiora transmissus amarescit [cf.Apoc. 10.9]. Orator quoque in arte dicendi docet [cf. Civ. Inv. I 6.8] quia in artem praecepta tradere et de arte dicerefacillimum est, sed ex arte difficillimum, id est, quae praeceperis observare mandata. Nusquam vero difficilius quam in artevivendi; illa siquidem ars artium est. Zu ars artium nennt BROOKE in seiner Edition Greg. Past. I 1, was sich allerdingsauf die Kunst der Seelenleitung, nicht auf die Lebenskunst bezieht. Vgl. eher Macrob, Sat. VII 15.14 (und I 24.21) wie vonJohann auch in Pol. VIII 9, (II) 282.2 ff. zitiert: rem consensu generis humani decantatam […] philosophiam artem esseartium et disciplina disciplinarum. Ars vitae ist zudem eine Lieblingswendung Ciceros: s. z. B. Tusc. 2.12, Acad. 2.23, Defin. 3.4. Daraus läßt sich eine weitere subtile Ineinssetzung von Rhetorik und Philosophie erschließen; denn zu de arte/exarte in obiger Stelle vgl. Cic., Inv. I 6.8: verum oratori minimum est de arte loqui; quid fecit, multo maximum ex artedicere, quod eum minime potuisse omnes videmus, vgl. auch Rhet. Her. IV 3.6: Tum quis est qui possit id quod de artescripserit conprobare, nisi aliquid scribat ex arte. Vgl. auch ebd. I 2.3; als interessantes mal. Testimonium zumUnterschied von Redner und Rhetor (Rhetoriker) sowie zum Verhältnis von Rhetorik und (zur „Dialektik“ gewordener)Philosophie s. Radulf von Longchamp (wie Anm. 508) 137.11 ff.: Auctor autem, sive artifex artis rhetoricae duplex est,scilicet ex arte et de arte. De arte, qui docet artem rhetoricam, scilicet rhetor. Ex arte, qui secundum artem causas civilesnovit tractare, scilicet orator. Est autem orator vir bonus dicendi peritus… (Quint. 12.1.1, als dictum Catos).Ebd. 76.7 ff. 28 f.: Rhetorica enim est scientia utendi in publicis et privatis causis plena et perfecta eloquentia […]Dialectica quae quodammodo alias artes complectitur […] est enim ars artium, scientia scientiarum. (Dazu vgl. auch obenAnm. 544.) – Zur zeitlichen, oft auch rangmäßigen Priorität der Beispielnachfolge und Musterpflege (usus) vorLehrbuchsystematik, Methodik und Kunstlehre (ars) vgl. S. 164 ff., 376 f., Anm. 779; LAUSBERG §§ 6, 19; F.R.VARWIG, Der rhetorische Naturbegriff bei Quintilian, Heidelberg 1976, 20 ff. und die Stellen Quint. III 5.1; II 10.1;18.3–4; Rhet. Her. I 2.3; Sen., Ep. 106.12, paradigmatisch Quint. X 2.2: […] omnis vitae ratio sic constat, ut quaeprobamus in aliis, facere ipsi velimus. Sic litterarum ductus, ut scribendi fiat usus, pueri sequuntur, sic musici vocemdocentium, pictores opera priorum, rustici probatam experimento culturam in exemplum intuentur, omnis deniquedisciplinae initia ad propositum sibi praescriptum formari videmus. Johann hat mehrfach die Überlegenheit des durchimitatio exemplorum gewonnenen usus gegenüber reiner ars betont: In Pol. VI 18, (II) 57 f. stellt er einen usus ohne ars alskleineres Übel im Vergleich zu einer ars ohne usus dar: utilior sit usus expers artis quam ars que sui usum non habet.(David erschlug Goliath ohne „Kunst“); in Pol. V 9, (I) 318 f. vergleicht er den Primat der Erfahrung mit der Ableitung desWortes senatus aus senectus; in Met. II 2, 63 knüpft er an die Beobachtung, daß Plato die Logik noch nicht zu einerregelrechten Wissenschaft entwickelt habe, die Reflexion: praeerat tamen usus et exercitatio, que sicut in aliis, ita et hicpraecepta antecessit; dem pädagogischen Modell entspricht nach Met. IV 12, 178 das erkenntnistheoretische: […] quodscientia de sensu trahit originem. Nam […] multi sensus aut etiam unus memoriam unam, multe memorie experimentum,multa experimenta regulam, multe regule reddiderunt unam artem, ars vero facultatem. – Zur moralischen und politischenDeutung der usus-ars-Antithese vgl. etwa noch die Anekdote von den spinnenden Töchtern des Augustus als exemplumimpar im Sinn einer Empfehlung militärischer Disziplin durch asketisches Training oder exercitatio in Pol. VI 4 (II) 15:Utique qui [Augustus] otia non indulgebat virginibus, nequaquam permittebat milites otiari, quorum professio instituta estad laborem. In Pol. VI 18, (I) 57 f. verwahrt sich Johann gegen die Annahme, er wolle rei militaris hic artem tradere,darüber möge man Militärschriftsteller wie Vegetius konsultieren; doch all solche Kunstlehre dürfe nicht von der Übungablenken: Hoc tamen in omnium artium utilitate versatur ut nequaquam praeceptis exercitium desit. Nam sicut ait Cicero,in unamquamque rem dare praecepta facillimum est, sed eam efficaciter exequi laboriosissimum. Quod vero in praeceptiseloquentiae ad Herennium scribens de arte dicendi asseruit, eam scilicet inefficacem et inutilem esse sine usu etexercitatione dicendi, ad omnes artes arbitror transferendum quatenus non firmantur usu nec exercitio roborantur. Nebenden oben genannten Quellen vgl. auch die Eröffnung der Rhet. ad. Her. (I.1.1) gegen die theoretisierenden griechischenRhetoriker zugunsten römischer Praxis: Nam illi […] ea conquisierunt, […] ut ars difficilior cognitu putaretur: nos autemea, quae videbantur ad rationem dicendi pertinere sumpsimus […] Nunc […] de re dicere incipiemus, [sed] si te unum illudmonuerimus, artem sine adsiduitate dicendi non multum iuvare, ut intellegas hanc rationem praeceptionis ad exercitationemadcommodari oportere. – Sinngemäß wird auch umgekehrt die verderbliche Rolle schlechter Beispiele und Gewohnheiten in
294
auch mir wie jedem anderen leichter sei, über Tunliches im Reden Vorschriften zu machen als durch die TatVorschriften zu erfüllen […] Auch Cicero lehrt ja in der Redekunst, daß nichts leichter sei, als Kunstregelnweiterzugeben und über Kunst zu reden, aber nach der Kunst zu handeln und selbst aufgestellte Gebote zubeachten, das sei überaus schwer. Nirgends aber ist es schwerer als in der Kunst des Lebens, der Kunst allerKünste.“
Johanns philosophiegeschichtliches Interesse wird außerdem von seinem skeptischen Probabilismus bestimmt:Weil er keine eigenen Entscheidungen
jeder Art Pädagogik und Dialektik hervorgehoben. Das gesellschaftliche Leben ist für Johann vornehmlich deshalb eine„Komödie“ (dazu unten § 95), weil die meisten das Schlechte nur als Schauspiel nachzuäffen beginnen, später aber aus ihrerRolle nicht mehr aussteigen können (Pol. III 8, [I] 191): …comediae suae insistunt ut in se cum opus fuerit redire nonpossint. Vidi pueros tam diu balbutientium vitia imitari ut postmodum nec cum vellent recte loqui potuerint. ‚Usus enim’,ut ait quidam [cf. Hildeb. Hideb. Cenom., Ep. I 10, PL 171, 164 D], ‚aegre dediscitur’ et consuetudo alteri naturaeassistat, quam licet ‚expellas furca tamen usque recurret’ [Hor. Ep. I.10.24]. – Zu den Voraussetzungen in der antikenErziehungstheorie vgl. VARWIG a. O. 20 ff. u. ö. („zweite Natur“); H. Th. JOHANN, hrsg. ‚Erziehung und Bildung in derheidn. u. christl. Antike’ (WdF 372), Darmstadt 1976, 93 ff., 104 ff. u. ö.; GEERLINGS 151 ff.; Ch. FAVEZ, S. Jérôme,pédagoque, in: Mél. J. MAROUZEAU, Paris 1948, 173–81 (Übung an Beispielen, Exempla in der Pädagogik). Vgl. auchS. 168 ff., 257, 367 f., Anm. 578, 885.
295
treffen will oder kann, sucht er durch die Wiedergabe bisheriger Lehrmeinungen und dazu passenderAnekdoten den Weg zu weiterer Erkenntnis zu ebnen. Dabei kommt es ihm weniger auf eine „vorsichtige“,„wahrscheinliche“ Lösung an als auf die dubitabilia – „Dinge, über die ein Weiser zweifeln darf“ –, auf diezum Auffinden und Weiterdenken anregenden Streitfälle selbst.579 So sagt er über die verschiedenenphilosophischen Richtungen in der Frage des summum bonum (mit einem übrigens merkwürdig an denmodernen erkenntnistheoretischen Begriff „Fulguration“ erinnernden Bild):580 „Darüber steht es jedem freizu zweifeln und zu fragen bis im
579 Pol. VII 2, (II) 98 f.: Sunt autem dubitabilia sapienti quae nec fidei nec sensus aut rationis manifestae persuadetauctoritas et quae suis in utramque partem nituntur firmamentis. Darauf folgt eine Liste „offener Fragen“ (wie Providenz,Ursprung der Seele, Zufall–freier Wille, Definition von Raum und Zeit, Universalien u. a.) sowie „Naturrätsel“ (wieEntstehung von Flut und Ebbe, Ursprung des Nils u. dgl.) Vgl. auch oben Anm. 572a zu den deklamatorischen Thesen. –Met. I Prol. 4: Achademicus in his que sunt dubitabilia sapienti non iuro verum esse quod loquor: sed seu verum seu falsumsit, sola probabilitate contentus sum. Met. IV 31. s. unten in Anm. 595. – In Pol. VII 9, (II) 122 werden den pauciAchademicorum imitatores oder echten Selbstdenkern die zahlreichen kritiklosen Nachbeter von magistralen Lehrmeinungenentgegengesetzt (s. oben Anm. 535).580 Pol. VII 8, (II) 122, 11 ff.: De quibus dubitare et quaerere liberum est, donec ex collatione propositorum quasi exquadam rationum collisione veritas illucescat. Zu dem bereits von Platon (7. Brief, 341c, 344b) verwendeten Funken- oderReibungsvergleich für den philosophischen Dialog oder die dialogische Erkenntnis vgl. DÖRRIE, Mythos (wie Anm. 125)8; BURKERT (wie Anm. 582) 187 f. (auch zur Bedeutung für Cicero; s. De or., I 158; III 79 f.). Johann verwendet inMet. III 10, 163 (oben Anm. 549 zitiert) für dasselbe Ideal der collatio (hier im Sinne des philosophischen Gesprächs) diebiblische Metapher: ferrum ferro acuitur. Auf die zeitliche Dimension (donec) der collatio propositorum (hier also desAutoritätenvergleichs im Stil des Sic et non) verweist er ähnlich in Met. III 1, 123 f. (unten Anm. 751 zitiert): Einemöglichst große Belesenheit befähigt zur Problemlösung dadurch, daß sich die Autoren in ihren Gegensätzen gegenseitigerklären (wie die Disputanten durch den Vergleich ihrer Antagonismen allmählich zur Erkenntnis oder „Wahrheit“ vorstoßen).Vgl. auch Boeth. Cons. 3.11.24.
296
Vergleich der Sätze, gewissermaßen wie aus dem Zusammenprall der Argumente die Wahrheit aufblitzt.“Johann von Salisbury gilt der Forschung seit langem als englischer Hauptvermittler der unter dem Namen„Schule von Chartres“ zusammengefaßten neuplatonischen Strömung Nordfrankreichs. Weniger beachtetwird die kritische Distanz oder auch nur milde Ironie, mit der er deren metaphysische, kosmologische undastrologische „Gewißheitsansprüche“ beschreibt,581 und die sehr viel persönlichere Beziehung zu einer
581 Damit soll keine neue Theorie zum ominösen Thema „Johann von Salisbury und die Schule von Chartres“ aufgestelltwerden. Ich nehme nur Bezug auf eingebürgerte mediävistische Vorstellungen. So fragwürdig die Chiffre „Schule vonChartres“ geworden sein mag, kommen wir aufgrund bisheriger Konvention vorläufig noch nicht ohne dieseVerständigungshilfe aus. Zu Johanns skeptisch-moralistischer Relativierung (d. h. nicht Ablehnung) naturphilosophischerLehren, die mit Timaios-Spekulationen der „Schule von Chartres“ assoziiert zu werden pflegen (genauer betrachtet sind esLehren Wilhelms von Conches, Theodorichs von Chartres u. a., ja sogar Abaelards) vgl. LIEBESCHÜTZ 75 f.; KERNER171 f.; KLIBANSKY (wie Anm. 538) 11 f.; DUTTON (wie Anm. 553) 212 f. und oben Anm. 20, 394 ff., untenAnm. 716 f., 1049. Zu Johanns zwiespältigem Verhältnis zur „Schule von Chartres“, bzw. zur Undefinierbarkeit derselbennach Johanns Aussagen vgl. überdies A. 553, 887, 913, 1119 (Ablehnung des platonischen Realismus in derUniversalienfrage, neuplatonische integumentum-Poetik, Befürwortung moralphilosophischer Bildungsideale im GeisteBernhards von Chartres gegen extreme Dialektiker, aber eben auch gegen „kühne“ Naturalisten). Für meine mehrtheoriegeschichtlichen Belange kann die durch SOUTHERN und DRONKE aufgegriffene Streitfrage, ob die „Schule vonChartres“ mit einer Schule in Chartres identisch sei, dahingestellt bleiben. Letzte Positionen: N. HÄRING, Chartres andParis Revisited, in: Essays in hon. of A.C. PEGIS, Toronto 1974, 268–329; R.W. SOUTHERN, The Schools of Paris andthe School of Chartres, in: Renaissance and Renewal (wie Anm. 7) 113–137; ders., Platonism, Scholastic Method and theSchool of Chartres, London 1979; O. WEIJERS, The Chronology of John of Salisbury’s Studies in France, in: The Worldof John of 109–116. Die Schule von Chartres ist „gespenstisch“ geworden (BROOKE, ebd. 6: „a ghost school“), weil die inder Hitze des Gefechts verkannte Mehrdeutigkeit des Begriffs „Schule“ (lokale Institution, persönliches Schüler-Meister-Verhältnis, geistige Strömung) logische insolubilia erzeugte, wie CLASSEN, Studium (wie Anm. 4) 30 f. angedeutet undso die Frage selbst in Frage gestellt hat. Vielleicht gibt nun die behauptete Entdeckung der Timaios-Glossen Bernhards vonChartres durch DUTTON (wie Anm. 553) der Debatte eine neue Wendung. (Zu mehr Klarheit dürfte sie schon geführt haben.)– Leider habe ich den wichtigen Beitrag von J. NEWELL über den „Rationalismus“ der Schule von Chartres (wie untenAnm. 882, bes. 111 ff.) erst gegen Ende der Drucklegung gelesen: Danach würde ich, „Schule von Chartres“ hin oder her, dieim Folgenden hervorgehobene Originalität Johanns in seiner Theorie der dubitabilia und probabilia etwas einschränken, daihn offenbar auch hier sein Meister Wilhelm von Conches bestimmt hat.
297
gegenläufigen – im Grunde sokratischen – Nachwirkung Platos, zur Lehre der mittleren Akademie von dermaßvollen Skepsis, die er immer wieder nach seinem (wohl wichtigsten) Vorbild Cicero beschwört und alsderen später Anhänger er sich ausdrücklich selbst erklärt. Die Theorie des „akademischen Zweifels“ dürfteauch seine Aristoteles-Rezeption grundlegend eingefärbt haben. Sie hat ihn insbesondere dazu geführt, eherfachspezifischtechnisch gemeinten Bestimmungen der Topik und Rhetorik eine Wendung insAllgemeinverbindliche eines christlichen Sokratismus zu geben. Die zentrale Bedeutung der logica probabilisoder topischen Argumentation für seine Erkenntnistheorie und sein ethisch-lebenspraktisches Denken sowiedie ideengeschichtliche Sonderstellung dieses Probabilismus im Mittelalter lassen sich m. E. nur aus einerbestimmten „akademisch“-ciceronischen Lektüre des aristotelischen Organon verstehen.582 Da dieseZusammenhänge trotz der
582 Johann und die mittlere Akademie: vgl. neben den bereits in Am. 579–80 zitierten Stellen Pol. II 22 (I) 122: Malo cumAcademicis, si tamen alia via non pateat, de singulis dubitare quam perniciosa simulatione scientiae quod ignotum velabsonditum est temere diffinire […] Eoque libentius Academicos audio quod eorum quae novi nichil auferunt et in multisfaciunt cautiorem, […] cum ad eos etiam in senectute transierit ille, in quo Latinitas nostra solo invenit, quicquidinsolventi Graeciae eleganter opponit aut praefert, Ciceronem loquor, ‚Romani auctorem eloquii’…; (Lucan VII 62–3).Ähnlich auch Pol. Prol. (I) 17.2 ff. unten Anm. 819. – Zu Johanns akademischer Skepsis vgl. Dal PRÀ 64 ff., 94 ff.121 ff.; MISCH 1192 ff., 1264 ff., 1203, 1213 ff.; SCHAARSCHMIDT 229 f.; LIEBESCHÜTZ 75 f., 83, ders., Daszwölfte Jh. (wie Anm. 28) 265 f.; GARFAGNINI, Ratio disserendi (wie Anm. 394) 925 f.; HUIZINGA (wie Anm. 31)199 f.; HELBLING-GLOOR (wie Anm. 26) 15 f.; SEIGEL (wie Anm. 394) 183 ff.; C.B. SCHMITT, Cicero Scepticus,Den Haag 1972, 33 ff. (zu Johann); S. LERER, John of Salisbury’s Skepticism, Paper für: John of S. OctocentennialConference, Fordahm Univ. 1980; ders. (wie Anm. 423) 26 f.; ODOJ 54 ff.; McGARRY 6 f.; KERNER 15 f., 108, 183 ff.;G. DOTTO, Logica ed etica in Giovanni di Salisbury, in: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. … Perugia 18(1980/1) 7–33; BARZILLAY (wie A. 877) 17 f.; S. 168 ff., 361, 380 f., 406 ff., 467, 533. Wichtigster Lehrer Johanns warhier zweifellos Cicero (auch ein durch Augustin vermittelter Cicero): vgl. JEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 544) 93 ff.;MUNK-OLSEN (wie Anm. 28) passim. Zur ciceronianisch(-quintilianischen) Einfärbung platonisch-aristotelischenGedankenguts im Sinne einer allgemeinen rhetorisch-philosophischen Bildungsidee vgl. §§ 52, 62. Zu Ciceroslebenspraktisch-philosophischer Ausdehnung des von Aristoteles technisch begrenzten Kompetenzbereichs der Rhetorik vgl.SEIGEL 12 ff.; zu Ciceros Plato-Verständnis vgl. W. BURKERT, Cicero als Platoniker und Skeptiker, in: Gymnasium 72(1965) 175–200, insbesondere 176 f. zu Ciceros Entscheidung für die skeptische Methode auch als biographisch bedeutsameLösung des Dilemmas von res publica/studia, eloquentia/philosophia (vgl. S. 552 ff. zu Johanns analoger Positionzwischen curia und philosophia). BURKERTS aufschlußreiche Arbeit ist repräsentativ für ein gewandeltes Cicero-Verständnis, das – nach der Überwindung der Klischees vom philosophischen Eklektiker und verantwortungslosen „liberalen“Schönredner – von den antidogmatischen, aporetischen und sokratischen Zügen des Topik-Modells ausgeht. An dieserAktualität Ciceros partizipiert Johann in einer für das Mittelalter außergewöhnliche Weise: A. MICHEL (La théorie de larhétorique [wie Anm. 447] 138 f.) rechnet ihn neben Petrus Ramus und PERELMAN zu den typischen Vertretern derakademisch-skeptischen oder probabilistischen Richtung des ciceronischen Platonismus (die er der ebenfalls von Ciceroausgehenden idealistisch-platonischen Richtung Vicos und PANOFSKYS entgegenstellt). Mit diesen großenideengeschichtlichen Sprüngen ist auch Johanns schillernde Position gegenüber dem ihm indirekt bekannten platonischenGedankengut angedeutet: Johann nennt Platon sowohl zeitlich wie rangmäßig philosophorum princeps (Pol. VII 6 [II]111.23) auch als ranghöchsten Repräsentanten jener auf menschlicher Hybris aufbauenden inhaltlichen Fehlkonstruktionenheidnischer Philosophie (vgl. Anm. 580 f. und JEAUNEAU a. O. 89 f.), aber vertritt nicht als platonisch, sondern„akademisch“-ciceronisch eine Skepsis, die grundsätzlich auf Platos Lehre vom „Unsagbaren“, von der Transzendenz undUnvermittelbarkeit der Wahrheit zurückgeht. Aus der Unmöglichkeit, Wahrheit wiederzugeben, folgte bekanntlich in derAkademie bald die Unmöglichkeit, Wahrheit zu finden, und daraus die Bevorzugung ethischer Fragen sowie dieBeschränkung der Wissenschaft auf das Wahrscheinliche und Immanente. (Vgl. hierzu DÖRRIE, Mythos [wie Anm. 125]7 f.; BLUMENBERG, Prozeß [wie Anm. 402] 56–8; ders., Wirklichkeiten [wie Anm. 36] 104 ff.; MICHEL [wieAnm. 447] 125 f.; E. FRANK, Augustin und das griechische Denken [1955] in: Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart, ed.C. ANDRESEN I [WdF 5] Darmstadt 1975, 182–200). Ciceronisch ist andererseits Johanns Hochschätzung des Aristoteles,des höchsten Methodenlehrers und „Philosophen schlechthin“ (vgl. Anm. 544), weniger im Sinne der in der späterenScholastik zentralen Analytiken denn als Meister der dubitatio in der dialektischen Topik, so wie ihn schon Abaelard (mitebenfalls ciceronisch-augustinischer Akzentgebung) zum universalen Lehrer des methodischen Zweifels für alleWissenschaften erklärt hat. (Vgl. oben Anm. 546, 562 und VIEHWEG [wie Anm. 3] 31 ff.; RIPOSATI [wie Anm. 546]429 ff.; MICHEL a. O. 114 f. zu Ciceros Aristoteles-Rezeption hinsichtlich der topischen dubitatio in der praktischen
298
grundlegenden Arbeit von Mario Dal Prà außerhalb der engeren Philosophiegeschichte und sogar in derJohann von Salisbury-Forschung nicht genügend bekannt sein dürften, seien hier ein paar Belege kurzkommentiert.
Philosophie.); CROCCO, Abelardo [wie Anm. 560] 122 ff. zugleich zu Abaelards Berufung auf Platons „negativen“Gottesbegriff.)
299
72. Im Metalogicon unterscheidet Johann die drei Arten der Logik: demonstrativa, probabilis und sophistica.Die zweite definiert er so:583 „Die Logik des Wahrscheinlichen aber beschäftigt sich mit dem, was allen oderden meisten oder den Weisen richtig dünkt, und behandelt entweder alle oder viele solche Meinungen oder diebekanntesten, wahrscheinlichsten oder folgerichtigsten unter ihnen. Sie umfaßt gleicherweise Dialektik undRhetorik. Denn sowohl der Dialektiker als auch der Rhetoriker kümmern sich im Bestreben, einengegnerischen Disputanten oder Richter zu überzeugen, nicht so sehr darum, ob ihre Argumente wahr oderfalsch sind, wenn sie nur den Schein der Wahrheit für sich haben.“ Während die Sophistik ohne Rücksicht aufdie Wahrheit ausschließlich dem Erfolg oder Sieg in einer bestimmten Redesituation dient und die Apodiktikreine Wahrheit unabhängig von der Wirkung der Aussage erschließt, steht die Topik prinzipiell in der Mittezwischen absoluter Wahrheit und totaler Unwahrheit, zwischen „notwendigen“, situationsundkontextunabhängigen, zeitlos gültigen Schlüssen und rein rezeptions-orientierten Wirkungen undScheinschlüssen, befaßt sich mit dem „Wahrscheinlichen“ insofern, als sie in (vornehmlich deliberativen)Zweifelsfällen aus dem Bereich wahrscheinlicher Argumente solche hervorholt, die eine überzeugende ad hoc-Lösung bewirken.584 Wahrscheinlich sind aber vornehmlich auf Konsens beruhende, historisch bedingteMeinungen, die (entsprechend den aristotelischen Endoxa) dadurch Geltung haben, daß sie bei einer Mehrheitoder auch nur irgendeiner pars sanior Gefallen gefunden haben und
583 Met. II 3, 64 f.; 65.4 ff.: Probabilis autem versatur in his ‚que videntur omnibus aut pluribus aut sapientibus; et his velomnibus vel pluribus vel maxime notis et probabilibus’ aut consecutivis eorum. Hec quidem dialecticam et rethoricamcontinet; quoniam dialecticus et orator persuadere nitentes alter adversario, alter iudici, non multum referre arbitrantur,vera an falsa sint argumenta eorum, dummodo veri similitudinem teneant. Das Zitat stammt wörtlich (ohne den Zusatz autconsecutivis eorum) aus der Boethius-Übersetzung von Aristot. Top. I 1, 100b 21 (ed. MINIO-PALUELLO, Aristot. lat. V1, 1969) 5 f. Der Nachsatz entspricht frei Boeth. Diff. top. I (PL 64) 1180 D: id praeterea quod videtur ei cum quo sermoconseritur, vel ipsi qui iudicat, in quo nihil attinet verum falsumve sit argumentum, si tantum verisimilitudinem tenat. Vgl.auch S. 3 f., 246 ff., 302, 319, 426 f.584 Vgl. Met. II 3; 5; 10; 12 f.; III 5–10; HENDLEY, Wisdom and Eloquence (wie Anm. 394) 168 ff.; ODOJ 10 ff.;McGARRY 670 ff. M. BRASA DIEZ, Tres clases de logica en Juan de Salisbury, in: Sprache und Erkenntnis im MittelalterI, Misc. Med. 13.1 (Berlin 1981) 357–67; GERL, Spannungsfeld (wie Anm. 446) 306 ff.
300
noch finden.584a Das derart meinungsmäßig zustandegekommene Wahrscheinliche bleibt als solches notwendigzeitabhängig-historisch und gesellschaftlich diskussionswürdig. Insofern fällt das dubitabile mit dem probabilesogar zusammen; denn nur Problematisches läßt sich diskursiv „erproben“, einem Glaubwürdigkeits-„Test“unterziehen, „versuchsweise“ ins Gespräch bringen. (Diese Probe- und Probabilitäts-Vorstellungen liegen imübrigen auch an der Wurzel des von Montaigne verbreiteten „Essai“-Begriffs.585)
In einer konkreten Beweislage bedarf ein wahrscheinliches Argument, da es sein Gegenteil wenigstens virtuellstets mit sich führt, der persusiven Durchsetzung, während ein demonstratives oder axiomatisches Urteil –etwa ein mathematischer Beweis – auch richtig bleibt, wenn ihm niemand zustimmt. Als Betätigungsfeld derexakten und apodiktischen logica demonstrativa läßt Johann in der Tat nur die Mathematik gelten, die ihnaber – gewissermaßen
584a Zu Endoxon und zum Konsens vgl. S. 4, 10, 246 ff., 326 f., 421 ff.; Lothar BORNSCHEUER, Topik, Zur Struktur dergesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt a. M. 1976, 26 ff.; VIEHWEG (wie Anm. 3) 21 ff. mit der Endoxa-Definition:„angesehene, wahrscheinliche Meinungen, die auf Annahme rechnen dürfen“; B. EMRICH, Topik und Topoi, in:Deutschunterricht 18 (1966) 15–46, hier 28: die ganze Topik des Aristoteles ließe sich auf den einzelnen Topos aus demUrteil aller, der meisten oder der Weisen zurückführen. – Vgl. jedoch auch THROM (wie Anm. 545) 24 f. und OTTE (wieAnm. 552) 186 ff. zu der in der humanistischen Topiktradition gern übersehenen Differenzierung, daß die aristotelischenEndoxa nicht unwahr sein müssen und zwingende Gründe auch nicht auszuschließen brauchen. Das gegenüber der Apodeiktikentscheidende Kriterium ist vielmehr die Abhängigkeit von der Zustimmung des anderen, gleichviel ob die plausiblenArgumente aus herrschenden Ansichten, paradoxen Einsichten anerkannter Philosophen oder aus Beweistechniken bestehen,die auch außerhalb der rhetorisch-dialektischen Topik „wissenschaftlich“ gültig sind. (KOPPERSCHMIDT [wie Anm. 460]71 findet hierzu die Formel „Zustimmungsnötigung“ durch „persuasive Konvergenz“.) Johann sagt mit Boethius (obenAnm. 583) ja auch in der Tat nicht, daß probabilia falsch seien, sondern, daß es gleichgültig sei, ob sie wahr oder falschseien, wenn sie nur „überzeugen“, d. h. „subjektiv einleuchten“. Das „einleuchtende“ Moment darf aber (entgegen OTTESKritik an VIEHWEG) m. E. als „meinungsmäßig“ bezeichnet werden, wenn man unter „Meinungen“ nicht nur Ideologien,Lügen und Denkfehler versteht.585 Vgl. SCHON 21 ff. in diesem Sinn zu Montaigne, aber gepaart mit dem epochengeschichtlichen Klischee vomskeptischen Element der Renaissance als Gegensatz zum dogmatischen „Wahrheitsbesitz“ des Mittelalters. Überzeugend istdemgegenüber die mir nach Abschluß des Textes bekanntgewordene Gesamtdeutung von A. TOURNON (bes. 150 ff., 295 ff.u. ö.), die einerseits die mittelalterlichen Hintergründe dieses Probedenkens in der juristischen Glossatorenpraxis von Irneriuszu Bartolus aufweist, andererseits Montaigne als einen späten Kritiker konventionell verfestigter Renaissance-Ideale vorstellt(s. unten Anm. 1047).
301
als eine außer- und übermenschliche Wissenschaft – ziemlich gleichgültig läßt.586 Sein ganzes Interesse giltdem menschengemäßen, vom Absoluten entlastenden Denken über widerstreitende Wirklichkeiten, der logicaprobabilis, die er in Schluß- und Überzeugungskraft der syllogistischen Notwendigkeit für nahezu ebenbürtigerachtet.587
Das Christentum hatte für Johann – wie schon für einige Cicero-Liebhaber unter den Kirchenvätern – auferkenntnistheoretischem Gebiet keine dogmatisch einengende, sondern eine philosophisch ermutigende, dasProblembewußtsein stärkende Funktion:588 Gerade weil es nur eine „positive“ Philosophie, die veraphilosophia des Offenbarungswissens anerkennt; kein Allwissen beansprucht, sondern hinreichendesHeilswissen zweifelsfrei verkündet und daneben viele gottgewollt dunkle und verborgene Regionen des Geistes,
586 Met. II 12–13, bes. II 13, 83 f.: Sed demonstrativa necessarias metodos querit […] Ceterum quia vires nature aut nulluspene scrutatur aut rarus, et numerum impossibilium solus Deus novit, de necessariis plerumque non modo incertum, sed ettemerarium iudicium est […] Si enim veritatem deprehendere que (ut aiunt Academici nostri) tamquam in profundo puteilatet [cf. Cic. Acad. post. I 12.44], magnum est, quante vivacitatis est non modo veritatem sed ipsius necessitatis penetrarearchana […] Vacillet itaque in naturalibus plerumque […] ratio demonstrandi; sed in mathematicis efficacissimeconvalescit. Quicquid enim in numeris, proportionibus, figuris similibusque ab ea colligitur, indubitanter verum est etaliter esse non potest. Vgl. damit Met. III 10, 163 f. wie unten Anm. 598, besonders: … Probabilium investigatio ex quibusfere scientia est humana […] Ipsam vero, sicuti est, deprehendere veritatem, divine vel angelice perfectionis est. Vgl. DalPRÀ 103 ff. – BURKERT (wie Anm. 582) 184, 193 erläutert Ciceros ähnliche Geringschätzung der Mathematik und der„exakten“ Wissenschaft aus ethischem Leitinteresse sowie die Antithese: Wahrscheinliches ist menschengemäß – Wahresmögen die Götter wissen! (nach Or. 3.79; Ac. 2.66 ff.; Tusc. 5.18 f. u. a.). – Immerhin hat Johann in Met. IV 6–8 dieAnalytica posteriora kurz zusammengefaßt; dazu vgl. G.R. EVANS, John of Salisbury and Boethius on Arithmetic, in: TheWorld of John 161–9; E. SERENE, Demonstrative Science, in: N. KRETZMANN et al., The Cambridge History of LaterMedieval Philosophy, Cambridge 1982, 496–518, hier 497 zur Mathematik als Inbegriff der logica demonstrativa (wie inMet. IV 6.171). Zum historischen Aspekt der probabilia vgl. unten §§ 105 f.: in der Zeit veränderbare Worte undBedeutungen im Gegensatz zur substantiell immer gleichbleibenden veritas rerum.587 Met. III 6, 144 mit reverenter Kritik an Abaelards Überschätzung der logischen necessitas: Sicut enim argumentadialecticis sufficiunt probabilia, sic et probabiles consequentie. Vgl. auch unten Anm. 598.588 Vgl. Dal PRÀ 156 ff.; BLUMENBERG, Patr. (wie Anm. 36) 488 ff. zur grundlegenden Bedeutung der ciceronischenSkepsis für Laktanz (z. B. Div. Inst. III 5.1; De opif. Dei 1.15); SEIGEL (wie Anm. 394) 57 zur Beförderung deswissenschaftsskeptischen Denkens durch den Glauben nach Petrarca (etwa Sen. lb. I 6); vgl. auch §§ 94, S. 172, 383 ff.,435 ff.
302
Geheimnisse oder dubitabilia respektiert, wird alle sonstige Philosophie für Johann „negativ“, kann sie invollem Umfang wissenschaftskritisch-skeptische Aufgaben übernehmen, etwa doxographisch die Beispielebisher vertretener und möglicher Lehrmeinungen sammeln und vor der Frage nach Erkennbarkeit undBeweisbarkeit überprüfen, Thesen und Gegenthesen methodisch aufzufinden lehren, falsche Gewißheiten undDogmatismen zerstören, die Kunst des in der Schwebe gehaltenen Urteils angesichts bewußt aufgespürter undzusammengestellter Zweifelsfälle üben und doch nicht vergebliches Luxuswissen reiner curiositas ansammeln,sondern in allem die auf natürlichem Wege erreichbaren ethischen Kenntnisse der „Lebenskunst“voranstellen.589 Gegen den intellektuellen Stolz, die grenzenlose Neugier, die
589 Für die fideistische Begründung der Wissenschaftsskepsis ist der bibelexegetische, im Tenor ganz geistliche Brief 209 (II)318/20 besonders interessant, weil Johann hier die Theologie in seine Kritik einbezieht, d. h. eine nicht existentiell-heilsnützliche Kontroverstheologie, zweifellos nicht Abaelards dilemmatische Sic et non-Methode (s. Anm. 562, 593), aberwohl eine epigonale, szientistische Karikatur derselben durch einseitige dialectici aufs Korn nimmt und dabei das Feld derdialektischen Topik nicht durch die wissenschaftliche Apodeiktik, sondern durch die logik-transzendente ratio fideieingrenzt: Sed quia in hac parte fides mea discutitur, mea vel aliorum non multum interesse arbitror quid credatur; sicenim credatur an aliter, nullum salutis affert dispendium. In eo autem quod nec obest nec prodest aut in alterutro parummomenti affert acrius litigare, nonne idem est ac si de lana caprina inter amicos acerbius contendatur? [Hor. Ep. I 18.15]Proinde magis fidem arbitror impugnare, si quis id, de quo non constat, pervicacius statuat, quam si a temerariadiffinitione abstinens, id, unde patres dissentire videt et quod plene investigare non potest, relinquat incertum. Opiniotamen in alteram partem potest et debet esse proclivior, ut quod omnibus aut pluribus aut maxime notis atque praecipuisaut unicuique probato artifici secundum propriam uidetur facultatem facilius admittatur [Arist. Top. I 1; Boeth. Diff. 1180C–D wie Anm. 5], nisi ratio manifesta aut probabilior in his, quae rationi subiecta sunt, oppositum doceat esse verum.Rationi vero subiecta inserui propter illos articulos, qui omnem omnino transcendunt rationem, in quibus stulta essepraeelegit ecclesia, ut in insipientia fidei apprehenderet Christum, Dei virtutem et Dei sapientiam, quam cum philosophisgentium, qui dicentes se esse sapientes stulti facti sunt et evanuerunt in cogitationibus suis ut darentur in sensumreprobum, per superbam professionem sapientiae. Dei sapientia et uirtute destitui [cf. I Cor. 1.23 f.; Rom I 22]. – Zurnegativen Philosophie bei Johann s. unten § 114. Allgemein vgl. BLUMENBERG, Patr. (wie Anm. 36) 492 f. zu Lact. Div.Inst. II 3.23: Ita philosophi quod summum fuit humanae sapientiae assecuti sunt, ut intelligerent quid non sit; illud assequinequiverunt, ut dicerent quid sit. Vgl. auch Lact. De ira Dei 11.10 zur Aufgabenteilung zwischen christlicher positiverPhilosophie des verum intelligere und negativer Profanphilosophie des falsum intelligere. – Zu den einzelnenwissenschaftskritischen Funktionen vgl. S. 168 ff. (Doxographie); S. 353 ff., 380 ff., 474 ff. (methodischer Zweifel);S. 171, 186, 306 ff., 554, Anm. 779 (curiositas-Kritik).
303
geistige (den Alexanderzug an Arroganz überbietende) Welteroberung der Philosophen richtet sich Johannnicht nur mit dem „akademischen Zweifel“ Ciceros, sondern auch mit dem christlichen Demutsideal.590 DasBild des Turmbaus von Babel erlaubt ihm, beide Grundsätze zusammenzubringen.591 Die „aufblähende“Wissenshybris der Philosophen wurde dadurch bestraft, daß die Einheit und Einzigkeit der Wahrheitverlorenging und der Nebel der Unwissenheit sich in Gestalt von Meinungsvielfalt und philosophischerSektenbildung ausbreitete. Nach dieser Weltkatastrophe des ‚Logos‘ (mehr der Vernunft als der Sprache) istunter allen divergierenden Philosophenschulen eine dem Sinne des Wortes philosophia oder „Weisheitsliebe“am meisten gerecht geworden: die Richtung der academici, jener bescheidensten und darum hervorragendstenDenker, die wie „unser Cicero“ sich zum Nichtwissen bekennen und darin größere Sicherheit finden als „inkühnen Definitionen über Unsicheres“. Kühnheit, temeritas, ist überhaupt der moralisch-intellektuelleGegensatzbegriff zur philosophischen Haltung,592 die für Johann
590 Vgl. LIEBESCHÜTZ 75 ff., und S. 166 ff., 292 ff., 361 f., 383, 367, 554, A. 682, 709, 751 f., 886, 901.591 Pol. VII 1 (II) 94.21 ff.: […] turris elationis […] erigitur. et philosophi dum ingenii sui machinas suo quodamteomachiae genere in altum erexerunt, eis vero incommutabilis et indeficientis veritatis subtracta est unitas, et ignorantiaenebulis obvoluti eorum quae ab una et singulari veritate vera sunt, maximam notitiam perdiderunt, uti […] dispergerenturin varias sectas erroris et insanias falsas […]. Achademici vero vitantes praecipitium falsitatis in eo quidem modestioressunt quod defectum suum minime diffitentur et in rerum ignorantia positi fere de singulis dubitant. Quod quidem longetutius est quam incerta temere diffinire. Achademicorum quoque iuvat opinionem quod non modo Eraclius Ponticus etCicero noster, in summa ingeniosorum virorum laude recepti, tandem ad eos transierunt, sed et alii plures quos percurrerelongum est. Nonne ergo praeferendi sunt aliis quod et asserendi modestia et tantorum virorum commendat auctoritas? Vgl.auch S. 449 zu unitas; Anm. 391 zum „Sündenfall“ des Geistes am Baum der Erkenntnis in Pol. VIII 25; sowie Met.,Prol. 4 zu den drei Hauptfehlern: ignorantia veri, fallax aut proterva assertio falsi, et tumida professio veritatis. – NachWEBB, Anm. zu Pol. VII 1 (II) 94.17 hat Johann einen auf die Häresie und die Einheit des rechten Glaubens bezogenenPassus bei Isidor, Quaest. in Gen. IX (PL 83, 237–8) fast wörtlich auf die philosophischen Schulen und die Einheit derWahrheit übertragen. Zu Cicero in diesem Sinn vgl. auch Hier. Ep. 133.1; Aug. Civ. IV 30; De Trin. XIV 19.26; Op.imperf. c. Iul. VI 26. Diese und die nächstfolgende Stelle aus Pol. VII 2 (unten Anm. 595) finden sich auch im anonymenauctores-Florileg bei GARFAGNINI, Da Seneca a Giovanni (wie Anm. 206) 210 f.592 Zum Begriffsfeld temeritas vgl. auch Met. II 13 in Anm. 586; Ep. 209 in Anm. 589; Pol. II 22 in Anm. 581 und Pol. II24 (I) 133.13 f.: temerarium est rem sui natura incertam certo diffinire iudicio. Ebd. 133.24: …in ambiguis omnisdiffinitio periculosa. Vgl. BURKERT (wie Anm. 582) 183 zu negativen Begriffen wie affirmatio, temeritas, arrogantia imSprachgebrauch Ciceros und nächste Anm. zu temere definire bei Abaelard.
304
ebensoviel mit Bescheidenheit wie – in der zeitlichen Dimension – mit Geduld zu tun hat. DasDraufgängertum Alexanders steht der weisen Zurückhaltung des Pythagoras wie Ungeduld der Kunst desAufschubs gegenüber.593
593 Zum zeitlichen Aspekt des „akademischen Zweifels“ vgl. Met. IV 31. 199 (unten Anm. 595) und die Exempla in Pol. IV11, I 272 (Aeropag-Richter, S. 353); Pol. V 12, (I) 338 f., 335 (Pythagoras und temeritas Alexandri, unten Anm. 682); vgl.dazu GARFAGNINI, Ratio disserendi (wie Anm. 394) 925 f.; MICHEL, La théorie de la rhétorique … (wie Anm. 447)122 ff. und BURKERT (wie Anm. 582) 181 ff. zu Ciceros Theorie der ®pox¸, der Kunst der Zurückhaltung des Urteilsgerade aufgrund zielstrebiger veri investigatio (Fin. 4.1; Acad. 2.7; Off. 2.7–8 u. a.); von MOOS, Lucans tragedia 167–176zu Pol. VIII 23, einem Plädoyer gegen überstürzte politische Parteinahme des „Weisen“ (sc. Klerikers), ja gegen„Parteilichkeit“ überhaupt, verbunden mit einer Apologie des Quietismus in aporetischen Entscheidungssituationen (wie demAnaklet-Schisma von 1130) und demonstriert an den Exempla Cato und Brutus im Bürgerkrieg. In der biographischenDimension hat Johanns perfekte Diplomaten-Kunst des In-der-Schwebe-Lassens moderne Historiker des Becket-Konflikts zueinigen Zensuren veranlaßt, die nach neuestem Forschungsstand allerdings kaum mehr zu halten sind: vgl. in: The World ofJohn of S. die Beiträge von BROOKE (2 f., 13 ff.), LUSCOMBE (30 ff.) und A. DUGGAN, John of S. and Thomas Becket(427–38). Es ist vielleicht ein Zufall, jedenfalls eine Ironie, daß dem größten Ciceronianer des Mittelalters der von Cicero-Biographen debattierte Feigheits-Verdacht nicht erspart geblieben ist (vgl. oben Anm. 582). Vermittler und Liberale habensich immer (auch posthum) zwischen die Stühle gesetzt. Vgl. auch TOURNON 257 ff. zu den divergierendenMißverständnissen, denen Montaigne seit Pascal ausgesetzt war. – Als Vorbild Johanns verdient hier neben Cicero auchAbaelard Beachtung, der im übrigen selbst ein ausgezeichneter Cicero-Kenner war (vgl. G. D’ANNA, Abelardo e Cicerone,in: StM 10 [1969] 333–49). Abaelard, der eher für geistigen Eroberungswillen als für intellektuelle Demut berühmt ist, warntim Sic et non-Prolog (wie Anm. 561) 90 f. (44–54); 93 (91–6) vor überstürzten „kühnen Entscheidungen“ in Zweifelsfragen,die nach patristischem Vorbild besser weiterhin offen bleiben, und vor einem „Urteil vor der Zeit“ nach I Kor. 4.5, damit derHeilige Geist dem Interpreten die noch fehlende Gnade des Verständnisses frei schenken kann. Vgl. insbesondere Z. 53 f.,91 f.: […] spiritui per quem scripta sunt, docenda potius reservemus, quam temere definiamus. […] sub quaestione potiusreliquerunt (sancti) ea inquirentes quam certa definitione terminarent. Dies ist neben dem oben § 66 erläuterten Aspekt derspielhaften Scharfsinnübung in Aporien das zweite wichtige Motiv für die Lösungslosigkeit der Sic et non-Probleme, eindurchaus christliches und „akademisches“, wie wir es von Johann kennen. Man sollte beide Gründe viel eher als zwei Seitender einen moralisch-intellektuellen Lebenshaltung der inquisitio, interrogatio oder quaestio ansehen (s. oben Anm. 562). Zurdurchaus verwandten Einstellung Montaignes in seiner fideistisch gesicherten Philosophie der Unsicherheit und „Suche“(einer „Zetetik“) gegen die dogmatisch-sektiererische „rage de vérité“ am Ende des 16. Jhs. vgl. jetzt die hervorragende StudieTOURNONs (passim und 249 ff.).
305
Johanns Kritik der Voreiligkeit, sein Lob des Zögerns und des Heranreifenlassens von Entscheidungenentspricht im philosophisch-theoretischen wie im politisch-praktischen (und sogar im juristischen) Bereicheiner bestimmten wissensoptimistischen (wo nicht fortschrittsgläubigen) Haltung, aufgrund derer Johannimplizit mit der Möglichkeit des langsamen Erkenntniszuwachses und der allmählichen Problemlösung imLaufe der menschlichen Zeit rechnet. Aus einer witzigen Anekdote des Valerius Maximus zieht er darum dieLehre, daß unlösbare Fragen des Lebens sich, ad calendas Graecas aufgeschoben, von selbst lösen.594
Die absolute Skepsis ist ihm „ebenso fern vom Glauben wie von der Wissenschaft“ und nach beidenErkenntnisarten unphilosophisch und absurd. Auch wenn der Glaube nicht zu vollkommenem Wissen gelangtund nur die „Wahrheit des Abwesenden im Spiegel schaut“ (I Kor. 13.12), so gibt er doch Gewißheit undschließt „finstere Ambiguität“ aus.595 Der Heilsgewißheit entspricht die Vernunftsgewißheit der Naturmoralinsofern, als sie das zum richtigen Leben unentbehrliche Wissen vom Zweifel ausnimmt.596 Der radikaleSkeptiker erscheint als Zerrbild der bescheiden, maßvoll zweifelnden academici. Er führt durch die Leugnungjeder Gewißheit zuletzt den Zweifel selbst ad absurdum: Ungewiß ist ihm sogar noch, „ob er über dieselbeSache
594 Dazu vgl. unten S. 353, 380 ff. (mulier Smirnensis-Exemplum).595 Pol. VII 2 (II) 95 f.: Non tamen omnes, qui Achademicorum censentur nomine, hanc dico modestiae regulam tenuisse;cum et professio scissa sit et pro parte tam risui pateat quam errori. Quid enim ineptius quam fluctuare in singulis etnullius rei habere certitudinem et nomen philosophi profiteri? Nam qui de omnibus dubitant, eo quod nichil habent certum,tam a fide quam a scientia alieni sunt. Licet enim fides ad scientiae bravium non perveniat, dum quasi per speculumveritatem absentium [cf. I Cor. 13.12] contuetur, habet tamen certitudinem caligine ambiguitatis exclusa. Porro, si desingulis Achademicus dubitat, de nullo certus est; nisi forte et hoc ipsum incertum habeat an contrariis existentibus ineodem circa idem posset et dubius et certus esse. Sed an dubitet incertum habet, dum hoc ipsum nescit an nesciat. Vgl. auchCic. Acad. II 9.29 gegen die absolute Skepsis. In weniger polemischer Weise beschreibt Johann drei Arten von„Akademikern“ in Met. IV 31.199.22 ff.: Academicus vero fluctuat, et quid in singulis verum sit diffinire non audet. Hectamen secta triphariam divisa est; et cautela nimia demeruerunt philosophi nomen. Habet alios qui se sola necessaria etper se nota, que scilicet nesciri non possunt, confitea(n)tur nosse. Tertius gradus nostrorum est, qui sententiam nonprecipitant in his que sunt dubitabilia sapienti. Zu ähnlichen Formulierungen vgl. oben Anm. 579, 581; zu Johannsphilosophiegeschichtlichen Kenntnissen vgl. Dal PRÀ 94 ff.; zur Konfrontation von „Name“ und Sache mit Bezug aufphilosophische Schulrichtungen vgl. oben S. 168 ff. zu den Epikureern.596 Dazu vgl. die Fortsetzung der oben Anm. 595 zitierten Stelle Pol. VII 2, 96 ff. über die auf der Vernunftbegabtheit zunotwendigem ethischen Wissen beruhende Menschenwürde sowie Ep. 209 oben Anm. 589 zur ratio fidei als Grenze desZweifels.
306
zugleich zweifeln und sicher sein kann, ob er überhaupt noch zweifelt, wenn das Nichtwissen selbst zumGegenstand seines Nichtwissens wird.“597 Diese Karikatur des falschen „Akademikers“, der vor allem Züge dessophistischen Hyperdialektikers ‚Cornificius‘ aufweist, zeigt aber nur die Hochschätzung des echtenacademicus, wie ihn Cicero darstellt, und lehrt, daß alles, auch der Zweifel „zwei Seiten“ hat. Die auschristlichen, sokratischen, „akademischen“ und aristotelischen Komponenten eigenartig gemischte Theoriedes „wahrscheinlichen Wissens“ läßt sich wohl am besten mit folgendem Zitat zusammenfassen:598
597 Oben Anm. 595: Pol. VII 2, 96.11 f.598 Met. III 10, 163 f.: Unde eleganter Ambrosius: ‚Libenter fateor me nescire quod nescio, immo quod scire nichil prodest’[Amb. Hexaemer. VI 2.7]. Porro probabilium investigatio ex quibus fere scientia est humana, quodammodo maneat a fonteTopicorum, que, rerum sermonumque adiunctione deprehensa, parant copiam rationum; ut si quis in eis sufficienterinstructus fuerit, illud Pitagoricum verum esse cognoscat [Sen. Ep. 88.43, aber über Protagoras] quia de omni re potest inutramque partem probabiliter disputari. Ipsam vero sicuti est, deprehendere veritatem, divine vel angelice perfectionis est;ad quam tanto quisque familiarius accedit, quanto verum querit avidius […] Vgl. auch Met. IV 30.196.26 f.: quia ut aitPitagoras, fere de omni re potest in contrarium disputari. Vgl. oben Anm. 582, 593 zu Ciceros platonischer Theorie desinneren Zusammenhangs von Wahrheitssuche, Wahrheitstranszendenz und topischer Problemlösungstechnik in utramquepartem. – Das Ambrosius-Zitat führt über die negative Philosophie hinaus und berührt die negative (apophatische)Theologie. Johann hat nach dem neuesten Ergebnis von E. JEAUNEAU (in: The World of John of 99 ff.) einen Beitrag zurVermittlung des Ps.-Dionysius Areopagita und des Johannes Scotus Eriugena geleistet. Vgl. JEAUNEAUS Analyse vonMet. IV 40, 215 mit reichen patristischen Quellenbelegen: Deus melius nesciendo scitur […] Ignorantia Dei eius verissimasapientia est. […] Non est parva scientia de Deo scire quid non sit Deus, quia quid sit, omnino sciri non potest (DieStellen Aug. De ord. II 16 und Dion. Areop. Ep. 1 werden von Eriugena mehrfach ähnlich kombiniert). JEAUNEAUbemerkt (99): „Le scepticisme modéré dont il faisait profession était, en quelque sorte, une propédeutique à la théologieapophatique de Denys.“ Wenn dies in einen weiteren Zusammenhang gestellt werden darf, berühren sich hier also wie in deralten „Akademie“ Wahrheitstranszendenz und Skepsis (s. oben Anm. 582), nur führt der Weg in umgekehrter Richtung:Nicht vom Geheimnis zum Zweifel, sondern vom Zweifel zum (Glaubens-)Geheimnis. Zwischen Nominalismus und Mystikwerden sich im Spätmittelalter vielfältige ähnliche Wechselbeziehungen unter der allgegenwärtigen Idee der docta ignorantiabilden.
307
Schön sagt Ambrosius: ‚Ich gebe gerne zu, nicht zu wissen, was ich nicht weiß; mehr noch: was zu wissen nichtsnützt.‘ In der Tat liegt in der Suche nach dem Wahrscheinlichen schon fast die ganze menschliche Wissenschaft, unddiese strömt gleichsam wie von einer Quelle aus der ‚Topik‘ des Aristoteles, die, indem sie aufzeigt, wie die Dingeund die Worte zusammenhängen, eine Fülle von Argumenten bereitstellt. Wer in der ‚Topik‘ angemessenausgebildet worden ist, wird erkennen, wie wahr jenes Wort des Pythagoras ist, daß über jede Sache nach beidenSeiten mit wahrscheinlichen Gründen gestritten werden kann. Die Wahrheit selbst aber kann so, wie sie ist, nur diegöttliche oder engelhafte Vollkommenheit erkennen. Dieser kommt einer um so näher, je wißbegieriger er das Wahresucht.
Johann nimmt damit Hauptprinzipien der späteren („eigentlichen“) Humanisten vorweg, die diese selbst –und teilweise auch deren heutige Erforscher – als erklärten Gegensatz zum Mittelalter, insbesondere zurscholastischen Logik und Naturwissenschaft verstehen: die entschiedene Bevorzugung aller moralischen, nurden Menschen und die sprachliche Kommunikation unter Menschen betreffenden Fragen (die alshermeneutische grundsätzlich auch nie ausdiskutiert werden können) gegenüber allen bloß der curiositas-Befriedigung dienenden Sach- und Naturfragen, die nomothetisch vollständig bewältigt oder logisch für alleZeiten unwiderlegbar gelöst werden können, die Pflege der Hermeneutik als der „für Menschenlebensnotwendigen Kunst, sich verstehend in Kontingenzen zurechtzufinden“.599Bekenntnisse zum
599 Zitat: MARQUARD, Abschied vom Prinzipiellen (wie Anm. 266) 20. – Eine ‚fable convenue’ der Neuzeitforschungbesagt, die Scholastik habe das, was in der Antike Topik hieß, aufgrund einseitig logizistischer Bevorzugung von Boethius’Differentiae und der Disputationsdialektik des 8. Buchs der ‚Topik’ von Aristoteles fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt,und dann hätten die Humanisten auch auf diesem Feld das wahre Wesen antiken Geistes wiederentdeckt; vgl. etwa STUMP(wie Anm. 435) 249; BORNSCHEUER (wie Anm. 584a) 458; ZILTENER 22 usw. jeweils mit weiterführenden bibliogr.Angaben. Dabei wird die ungebrochene „akademisch“-humanistische Tradition übersehen, die dennoch einen so begeistertenCiceronianer wie Johann von Salisbury nicht daran hinderte, gleichzeitig auch an der inkriminierten scholastischenEntwicklung in deren Anfangsstadium teilzunehmen. Grundsätzlich gegen die scharfe Handbuch-Antithese von Scholastikund Humanismus wenden sich SEIGEL (wie Anm. 394) 32, 188 ff., 226 ff. u. ö.; Paul O. KRISTELLER, RenaissanceThought. The Classic, Scholastic and Humanist Strains, New York–London 1961, I 92 ff. u. ö. = Humanismus undRenaissance, ed. E. KESSLER, München s. d. (1973), I 87 ff. u. ö.; A. MICHEL (mit ausdrücklichem Hinweis auf Johann)in seinem kritischen Diskussionsvotum zum Vortrag von W. RÜEGG (wie Anm. 445) 311 f., der (bes. 279 ff., 290)nochmals kraß Mittelalter und Scholastik gleichsetzte und dieses Konstrukt zur un-ciceronischen Gegenwelt des Renaissance-Humanismus erklärte. Dasselbe überholte Scholastik-Humanismus-Klischee führt aber auf der Gegenseite auch zu derDeutung, die in Johann nur den humanistisch-ciceronischen Deichbauer gegen die dialektisch-syllogistische Methode derneuen „Aristoteliker“, nicht aber den „Wiedererwecker“ des Aristoteles logicus sieht. Diese Einseitigkeit findet sich etwa beiWilhelm KÖLMEL, Aspekte des Humanismus, Münster 1981, 18 f. (dazu s. die kritische Rezension von F.R.HAUSMANN, in: MltJb 18 [1983] 340 ff.). Vgl. unten S. 418 ff., 543. Sehr zutreffend D. LUSCOMBE, John of Salisburyin Recent Scholarship, in: The World of John 21–38, hier 26, es sei immer noch besser, das Metalogicon unter dem Aspekteiner „highly technical discussion of logical theory“ zu analysieren, als „to see it as a last-ditch defensive stand taken by asoft-headed humanist opposed to the irresistible advance of Aristotelian logic which […] was to have a ruinous effect uponculture.“ In Wirklichkeit gehe es Johann um die angemessene Einordnung der neuen Logik in die „arts of language“ destraditionellen Wissenschaftssystems. Vgl. auch §§ 62, 89, S. 195, 533. Zu Johanns keineswegs nur formallogischemTopikverständnis vgl. Dal PRÁ 46 ff., 70 ff., 159 ff.; ODOJ 11 ff. (Vergleich mit Vico), 44, 54 ff., 62 f. – Zu Johannscuriositas-Kritik vgl. S. 168, 171 f., 178, 360 ff., 467, 452, 554. In dem von GARFAGNINI, Das Seneca a Giovanni (wieAnm. 206) herausgegebenen Florileg erscheinen Seneca- und Johann von Salisbury-Zitate (209) unter der Überschrift: quodmoralis philosophia preferenda est naturali. Zur ungebrochenen Traditionslinie der Seneca-Rezeption in sowohlmonastischen wie humanistischen Kreisen des Mittelalters und von hier zur devotio moderna, den franziskanischen undhumanistischen Wissenschaftskritikern der Renaissance vgl. MEERSSEEMANN (wie Anm. 405). Vgl. auch oben Anm. 540und D. HAY, Humanists, Scholars, and Religion in the Later Middle Ages, in: Religion and Humanism, (Studies in ChurchHistory 17), Oxford 1981, 1–18, hier 8 ff.
308
einzig notwendigen cultus humanitatis finden sich bei Cicero und Seneca, bei Theodorich von Chartres undJohann von Salisbury, bei Petrarca und Lorenzo Valla und vielen anderen600 bis zu Giambattisto Vico, der1708 gegen kartesianische
600 Vgl. R. JOLY, Curiositas, in: Antiquité classique 30 (1961) 33–44; A. LABHARDT, Curiositas, in: MusHelv 17 (1960)206–224; § 98, S. 171, 178, 361 f., A. 589, 779, 1036, KLIBANSKY, Chartres (wie A. 542) 10; WETHERBEE (wieA. 394) 26; JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 38 zur Philosophiedefinition ad cultum humanitatis im Heptateuchon-Prolog Theodorichs von Chartres (MSt 16 [1954] 174) und ad cultum virtutis in Johanns Metalogicon (I 23, 53; I 12, 31).In Pol. VII 9 (II) 125.26 ff. unterscheidet Johann, Senecas Kritik an ethisch irrelevanten Forschungsinteressen (hier Ep. 46.6)abschwächend, verwerfliche und nützliche Beschäftigung mit den artes liberales nach dem Kriterium, ob sie faciunthominem meliorem, und nimmt damit implizit die spätere humanistische Begründung der studia humaniora vorweg (vgl.eine ähnliche Stelle: Met. I 22.51 unten in Anm. 877). – Zur Tradition des Ideals einer Verbindung von Rhetorik undPhilosophie, von Weltflucht und Weltzuwendung, einsamer Erforschung des Absoluten und kommunikativ-ethischer Praxisvon Cicero über Johann von Salisbury zu Petrarca u. a. vgl. vor allem die wichtige Arbeit von SEIGEL (wie Anm. 394) IX,6 f., 32, 44, 186 ff., 246 ff. u. ö. – Allein zur Renaissance vgl. LINDHARDT (wie Anm. 43) 78 ff. (Salutati); GILMORE(wie Anm. 214) 112 f.; GERL (wie ebd.) 66 ff. und L.G. JANIK, Lorenzo Valla: The Primacy of Rhetoric and the De-Moralization of History, in: Hist. and Theory 12 (1973) 389–404 (zu Valla); HARTH, Philologie und praktischePhilosophie (wie Anm. 43) 9 ff. (zu Erasmus) und allgemein RÜEGG, Cicero orator noster (wie Anm. 445) 277 ff.; Karl-Otto APEL, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico (1963), Bonn2 1975, 159 ff.
309
Rationalisten schrieb:601 „Da heute das einzige Wissensziel die Wahrheit ist, untersuchen wir die Natur derDinge, weil sie als sicher gilt; die Natur der Menschen erforschen wir nicht, weil sie ob der Freiheit des Willensvöllig ungewiß ist“, und demgegenüber empfahl, „das im Leben Tunliche“ nach den oft „ungereimtenUmständen“ flexibel zu beurteilen und nicht mit dem „starren Lineal des Verstandes“ zu messen.
e) Das Exemplum als Waffe und Reflexionsgegenstand
Die „schlauen“ strategemmata und die „freie Rede“ im Policraticus (§ 73). Auslegungsbedürftigkeit und hermeneutischeKonflikthaltigkeit aller Exempla (§ 74). Exempla der „Lasterbeschönigung“ und mittelalterliche Ideologiekritik (§ 75). DasExemplum zwischen rhetorischer und exegetischer Methode als (kontextuell bestimmte) Funktion ohne historischenEigenwert (§ 76). Hauptvorbilder Johanns: Seneca und Hieronymus (§ 77). Das Exemplum als Qualitäten-Synekdoche,„Denkbild“ und vestigium (§ 78).
Geschickte Leute […] halten sich einen geistreichen Vorrat witzigerReden und edler Taten, von welchem sie zur rechten Zeit Gebrauch zumachen verstehen […]; gangbares Wissen hat manchen mehr geholfenals alle sieben Künste, so frei sie auch sein mögen.
Gracián, Handorakel § 22,Übersetzung: A. Schopenhauer
73. Johanns erkenntnistheoretische Grundgedanken zur Relativität des dem Menschen zustehenden undmöglichen Wahrscheinlichkeitswissens, zur Methode des „akademischen Zweifels“, des Streitgesprächs undProbedenkens in utramque partem lassen sich nun auch auf die Policraticus-Exempla beziehen:
601 Zur skeptisch-demütigen „Humanismus“-Definition aufgrund von Johanns humanitas-Begriff vgl. S. 307 f. Humanistisch(und christlich) ist vom Mittelalter zur Neuzeit nicht nur die stolze Berufung auf die dignitas hominis (s. S. 172, 388),sondern auch die antiszientistische Beschränkung auf das „Menschenmaß“ und „Menschengemäße“. Dazu vgl. auch etwaMontaignes kritische Glosse auf Sen. Nat. quaest. I praef. und die Naturwissenschaft, Essais II 12 (wie Anm. 192) 588 f.:«O la vile chose, dict-il, et abjecte que l’homme, s’il ne s’esleve au dessus de l’humanité!» Voilà un bon mot et un utiledesir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing […] cela est impossible et monstrueux. Nyque l’homme se monte au dessus de soy et de l’humanité: car il ne peut voir que de ses yeux, ny saisir que de ses prises. Ils’eslevera si Dieu lui preste extraordinairement la main.“ Zu Montaignes keineswegs „freidenkerischem“, sondern diätischemBegriff eines „gezähmten“ und bis zuletzt ausgehaltenen Zweifels im Gegensatz zur späteren „Exorzisierung“ des „malin géniedu doute“ durch Descartes vgl. jetzt TOURNON 253 ff., 288 f. u. ö. Gian Battista Vico, De nostri temporis studiorumratione, München–Düsseldorf 1947/Darmstadt 1974 (mit Übs. von W.F. OTTO), VII, 58/60: Quia unus hodie studiorumfinis veritas, vestigamus naturam rerum, quia certa videtur: hominum naturam non vestigamus, quia est ab arbitrioincertissima […] Quando igitur vitae agenda ex rerum momentis et appendicibus quae circumstantiae dicuntur,aestimantur: et earum multae fortasse alienae ac ineptae, nonnullae saepe perversae, et quandoque etiam adversae suo finisunt: non ex ista recta mentis regula, quae rigida est, hominum facta aestimari possunt; sed illa Lesbiorum flexili, quaenon ad se corpora dirigit, sed se ad corpora inflectit, spectari debet. Vgl. dazu VIEHWEG (wie Anm. 3) 17; Wilh.HENNIS, Politik und praktische Philosophie, Stuttgart 1977, 49; KOPPERSCHMIDT (wie Anm. 460) 71 f. und APEL(wie Anm. 600) 337 ff. – Die im gleichen Zusammenhang gegebene Definition der wahren Philosophen als politici undPeripatetici et Academici (im Gegensatz zu den Naturphilosophen) aus Cic. De or. 3.28.109 klingt bereits bei Johann an:vgl. S. 171, 361 ff., 568. Der Unterschied zwischen Notwendigem und Freiem nach Cic., Acad. pr. II 44.136, De fin. IV27.74 findet sich auch unmittelbar vor der oben Anm. 595 angeführten Stelle Met. IV 31, 199.20 f. Vgl. andererseits Vico,De nostri temp. (a. O.) III 32/34: Academici antiqui, Socratem secuti, qui nihil se scire, praeterquam nescire affirmabat,abundantes et ornatissimi. – Ertragreich wäre auch ein Vergleich der hier nur dürftig skizzierten anti-apodiktischen, „anti-mathematischen“ oder „anti-geometrischen“ Tradition (s. oben Anm. 586) mit der Prozeßphilosophie WHITEHEADS; vgl.z. B.W. JUNG, Über Whiteheads Atomistik der Ereignisse, in: ‚Whitehead’ ed. E. WOLF-GAZO, Freiburg/München 1980,54–104, hier 55 f. Zur Aktualität der an den „Exempla“ Johann von Salisbury und Vico aufscheinendenwissenschaftstheoretischen Grundrichtung s. auch oben Anm. 572 (FEYERABEND). Als willkommene Ergänzung zu derdominant fachphilosophischen Sekundärliteratur vgl. jetzt: Michael MOONEY, Vico in the Tradition of Rhetoric, Princeton1985 (vgl. Rez. D.P. ABBOT in Rhetorica 3 [1985] 197 ff.)
310
Auch sie sind zweischneidige Waffen, die bald für, bald gegen eine propositio ins Feld geführt werden können.Eindeutigkeit und Ausschluß der Gegenthese gehören zum aktuellen rhetorisch-dialektischen Einsatz diesesKampfmittels in der Auseinandersetzung; Wiederherstellung der Ambivalenz, Zweifel an der Eindeutigkeitsind Ziele des Gegners. Die Erwägung beider Seiten obliegt dem Richter oder dem Philosophen. So verteilensich strategische und kasuistische Möglichkeiten des Exemplums.
Auf der einen Seite steht das Exemplum als eindeutig eingesetzte Waffe. Nicht zufällig benutzt Johann dieausgefallenen Termini strategemma und strategemmaticum nach dem Militärschriftsteller Frontinus häufigals Synonyma für das Exemplum und unterstreicht damit dessen instrumentellen und
311
streitbaren Charakter.602 Strategemmatica sind für ihn nicht nur (wie im 6. Buch) thematisch auf dasKriegswesen bezogen, sondern methodisch allgemein eine Art „Kriegslisten“ des dialektischen undrhetorischen Diskurses. Strategemmaticum ist jede Art Bericht von klugem, schlauem, witzigem Verhaltenund besteht häufig nur in einem Witzwort oder schlagfertigen Bonmot als Antwort auf eine Fangfrage.Ähnlich hatte schon Valerius Maximus das Wort strategemma als eine Art der „Schlaurede“ (calliditas) nebendie vafre dicta aut facta oder „gewitzten Memorabilien“ gestellt.603 Die eigenartige
602 Vgl. etwa Pol. V 7, (I) 307: Quae mala vel bona subiectis proveniant de moribus principum; quod et aliquorumstrategemmaticis roboratur exemplis. Ebd. 314: Constantia quoque cum ex pluribus strategemmatibus pateat, in virtuteRomanorum maxime claret. Eorum siquidem magnificentia et virtute, si omnium gentium historiae revolvantur, nichilclarius lucet. Zur „strategischen“ Bedeutung des Exemplums vgl. auch Rhet. Her. III 10,18, wo dem Redner empfohlenwird, seine loci so anzuordnen, wie ein Feldherr seine Soldaten in die Schlachtreihe stellt. Zur Beliebtheit militärischerBilder und Begriffe im Zusammenhang mit dem Aufschwung philosophisch-theologischer und juristischerWissenschaftslogik im 12. Jh. vgl. S. 252, 271 ff.603 Pol. VIII 14, (II) 334: Occurrent multa huiusmodi quae laudis verae poterunt praestare materiam, si quis antiquorumvafre dicta vel facta [Val. Max VII 3], strategemmata et strategemmatica quoque recenseat. Ceterum (quia saepestrategemmatum mentio facta est et res nominis non usquequaque cunctis innotuit) Valerius Maximus strategemmata sicdiffinit [VII 4] ut dicat quia eius ‚pars calliditatis egregia et ab omni reprehensione procul remota, cuius opera, quiaappellatione vix apte exprimi possunt, Graeca pronunciatione strategemmata’ appellantur. Proprie tamen strategemmatasunt quae ad rem pertinent militarem; nam ab eo dicuntur stratilates. Quae vero contra propriae appellationis notam adres alias pertinent (Iulio Frontino teste) strategemmatica appellantur; distat enim strategemmaticum a strategemmatequomodo genus a specie differt (cf. Frontinus, Strategemata I praef., ed. G. BENDZ, Frontinus ‚Kriegslisten’, lat.-dt.,Berlin–O. 1963). Zu Johanns Frontin-Rezeption vgl. KERNER 31 ff. aufgrund der ungedruckten Arbeit von MARTIN (wieAnm. 30) 191 ff.; vgl. auch MARTIN, Manuscripts 1 ff.; MARSHALL/MARTIN (wie Anm. 326) 387 f.; LIEBESCHÜTZ68 ff.; BRÜSCHWILER (wie Anm. 31) 103 f. Interessant ist, daß Salutati in Ep. VII 11 (NOVATI II, 292.8 ff.) eineähnliche Reflexion anstellt: hinc Frontinus, rei militaris scientiam non contentus preceptis et regulis tradidisse, infinitisexemplis que strategemata vocant, ante oculos posuit, veluti ratione validissima confirmavit. (Dazu vgl. KESSLER,Problem 182, STRUEVER 76.) Zu Johanns moralischer Umdeutung von Militaria – denn Frontin wollte in der HauptsacheFeldherren mit Präzedenzfällen Entscheidungshilfe bieten vgl. auch oben Anm. 347, 349 zu Vegetius sowie J.-A. WISMAN,L’epitoma rei militaris de Végèce et sa fortune au moyen âge, in: MA 85 (1979) 13–32, hier 24 ff. zu Pol. VI. – Durch dieSynchronisation der bei Val. Max. auf zwei Kapitel verteilten zwei Arten von Exempla: 1. Vafre dicta aut facta und2. Strategemata (Überschriften und Eingangsargumente von VII 3 und VII 4) zeigt Johann an, daß er die Begriffe nichtunterscheidet, wozu er sich durch VII 3, Ext. 7 berechtigt fühlen mochte: Huic vaframento consimilis illa calliditas. DerBegriff calliditas spielt auch eine Rolle in der Fabel-Theorie seit der Antike, da er primär auf den sog. „äsopischen Typ“ derGattung in Erinnerung an den durch List und Klugheit den Mächtigen überlegenen Sklaven verweist (vgl. GRUBMÜLLER[wie Anm. 79] 49 f.; einschränkend dazu jedoch auch oben Anm. 516).
312
Bezeichnung verweist auf die von Johann bevorzugten Exempla: weder rein personale Beispielfiguren nochbloß narrative Histörchen von beliebigen Personen, sondern anekdotische Geschichten von berühmtenVorbildern, die moralisch einwandfreie Schlagfertigkeit und Schläue bewiesen haben; von hervorragendenEinzelnen in schwierigen Entscheidungssituationen, die sie mit irgendeiner Art (von salomonischem,pfiffigem oder durchtriebenem) Scharfsinn gemeistert haben. Viele Exempla Johanns haben darum – vomunterhaltsamen Nebensinn guter Pointen und Geistesblitze einmal abgesehen – eine oft mehr methodische alssachbezogene Modellfunktion: Sie wollen spezifische Formen weltmännischen und philosophisch-lebensklugen Umgangs im Rahmen des urbanitas- und civilitas-Ideals lehren, insbesondere die Kunst, imrechten Augenblick das treffende Wort zu finden. „Nicht aus ihnen, sondern mit ihnen“ soll man (nacheinem Wort Herders) „denken lernen“.604Sie sind Übungsmaterial zur Erlernung einer besonderen – nebencalliditas auch mit Begriffen wie subtilitas, acumen, argutia, vafritia umschriebenen – apophthegmatischgeistreichen Redekunst, wie sie öffentlich Tätige – politici, curiales, milites, Fürstenratgeber, Diplomaten,Juristen und Beamte aller Art – immer gut gebrauchen können.605
Ein anschauliches Beispiel hierfür gibt Johann in dem unten606 angeführten Urteil der Aeropag-Richter überdie Giftmischerin aus Smyrna. Ebenfalls aus
604 Obwohl der Policraticus auch in die Vorgeschichte der späteren Klugheitslehren und Handbücher der„Hofmannserziehung“ gehört (vgl. BARNER [wie Anm. 298] 124 ff.; BRÜCKNER, Hist. 74, 109; S. 21, 124, 132, 137,470, 601), sind civilitas und urbanitas, nicht das meist pejorative curialitas die entsprechenden Wertbegriffe. – ZumKonversationsaspekt der Exempla als Bonmots und Schlagfertigkeitsbeweise vgl. RÖHRICH, Witz (wie Anm. 409) 6 ff.;ders., Art. Bonmot, in: Reallex. d. dt. Lit. s. l. 613 f.; HIRZEL (wie Anm. 571) I 4 ff.; KOEP 143; HOFSTETTER 11;OLSON (wie Anm. 280) 26, 68 f.; SCHON 8 ff., 66 ff.; GOTOFF 294 ff., 311 ff. (in den Progymnasmata); VERWEYEN11, 81 f., 56 ff., 77 f. sowie § 44, S. 244, 343 f., 355 f., 386, 402. – Zitat: Herder, Zerstreute Blätter (1792), ed. SUPHAN,Werke 16 (1887) 11, nach VERWEYEN 14 f.605 Zur Terminologie vgl. GOTOFF 313 f.; VERWEYEN 26 ff., 48 ff., 54 f., 77 f. (deutsche Äquivalente der Barockzeit:„scharfsinnige, nachsinnige Hofreden, Schlußreden, scherzende Wahrheiten, freie Scherze, Pointen, Blitze, gewitzte Repliken,Stiche, Stacheln, Haken, Bisse“).606 Unten 00.
313
juristischem Zusammenhang – dem praktischen Hauptbereich römischer Deklamations-controversiae –stammt die folgende etwas spöttische, an den Witz des Andreas Capellanus erinnernde Geschichte zumThema: „Über die Unannehmlichkeiten der Verheirateten“:607
Gelegentlich bricht die ungezügelte Begierde der Frauen hervor und legt nach Herodot mit den Kleidern auch dieScham ab; sie bricht in der Tat hervor, bis vor eine errötende Öffentlichkeit und klagt, Intimes bloßstellend,männliche Impotenz gerichtlich an; als hinreichenden und evidenten Scheidungsgrund schützt sie vor, der Gatte seiein halber Mann, eheunfähig, zum Beischlaf nicht bereit. Elegant hat mein Kollege Gottfried von Hérouville einesolch unverschämte Klägerin in die Enge getrieben. Als bestellter Verteidiger […] in einem Ehescheidungsfall dieserArt […] fragte der kluge Mann die hochgemute Frau, ob sie schon früher einmal einen anderen Ehemann gehabthabe. Als sie dies verneinte, fragte er weiter, ob sie noch Jungfrau sei; diese Information sei ihm unentbehrlich,damit er sich vor dem Richter nicht verrede. Sie behauptete züchtig, aber wenig glaubwürdig, dem sei so. Er aberwollte wissen, ob sie und ihr Mann nachts gemeinsam schlafen, sich küssen und umarmen. Als sie dies allesbejahte, sagte der Anwalt: „Woher also weißt du, wahrlich schamhafte, tugendsame, unbefleckte Jungfrau, daß derMann sich nicht als voller Mann erwies und nicht alle Ehepflichten erfüllte? Wer lehrte dich, was ein Koitus ist,damit du leugnen kannst, der Gatte habe dir unter vielen Küssen und Umarmungen beigewohnt? Es gibt gewisseLebewesen, die sich beim Küssen verbinden, und andere, die nur durch leichte Berührung schwanger werden, unddann noch solche, die bei günstiger Körperwärme von linder Luft geschwängert werden. Hier errötete sie endlich undsagte nur noch, gegen solche Fangfragen bleibe ihr das Wort im Halse stecken. Wie gut haben es doch diePhilosophen, das heißt die Kleriker: von ihnen ist niemand impotent oder keiner kann derart vor Gericht beschämtwerden.
607 Pol. VIII 11, (II) 299 f.: […] Hic illa tandem erubuit, hoc solum dicens, se quid ad huiusmodi captiones hisceret nonhabere. Sed bene cum philosophantibus, id est cum clericis, agitur, quod nemo eorum frigidus est aut in iudicio perfusushuiusmodi macula. WEBB verweist auf Abaelards Sermo XVI (COUSIN I) 476, wo Gottes Wunderkraft mit einer nichtidentifizierten Augustin-Stelle mit den vom Wind geschwängerten Stuten und vom Küssen geschwängerten Raben illustriertwird. Zu Herodot s. Hier. Adv. Jov. I 48 (PL 23) 279. Aus dieser Quelle werden im weiteren Verlauf des Kapitels mehrereandere misogyne und ehefeindliche Anekdoten des Theophrast-Fragments zitiert (vgl. DELHAYE, Le dossier [wieAnm. 385] 79 f.). Das Anknüpfungsmotiv bildet das Stichwort philosophantes, das als Wertbegriff auf Ciceros dictumhinweist: se non posse et uxori et phiosophiae operam dare (nach Hier. Adv. Jov. ebd. 291A, s. auch Abaelard, Historiacalamitatum [ed. Monfrin 1967] 76.458 ff.). Zu philosophi/philosophantes = clerici s. unten § 81 und G. POST,Philosophantes and philosophi in Roman and Canon Law, in: AHDLMA 29 (1954) 135–8 zur Beliebtheit dieserBerufsbezeichnung speziell für Juristen (!). – Zu Andreas Capellanus, der künftig aus dem romantisch gefilterten Blickfeldder „courtly-love“-Forschung gerückt werden und als ein hervorragender Zeuge für das Nachleben rhetorisch-juristischercontroversiae in der (meist oralen) Bildungstradition des Mittelalters untersucht werden sollte, vgl. die Arbeiten vonSCHNELL u. a. oben Anm. 562. – Überdies zu den bisher weitgehend verkannten Formen von subtilsten erotischen Witzenin De amore: B. BOWDEN, The Art of Courtly Copulation, in: Mediaevalia et Humanistica 9 (1979) 76–86.
314
Wie dieses Beispiel – eines der selteneren domestica exempla aus dem unmittelbaren Alltagsbereich desRechtsgelehrten – zeigt, sind es vor allem die dicta: witzige Aussprüche, schlagfertige Pointen, klugecaptiones, die Johanns Kurzerzählungen – und darüber hinaus allgemein die Exempla, Anekdoten undNovellen der Folgezeit von Salimbene bis zu Boccaccio – veranlaßt haben.608
Auf keinem anderen Gebiet als hier zeigt sich besser der rhetorisch-zweckrationale Charakter des Exemplumsim Gegensatz zu dessen vermeintlich moralisch-didaktischem, exemplarischem „Wesen“. Es geht bei denstrategemmata nicht inhaltlich um „Lehren aus der Geschichte“, sondern um scharfsinnige Einfälle, „verbaleGeschicklichkeiten“, die auf dem Experimentierfeld menschlicher Konflikte schon einmal erfolgreichdurchgespielt worden sind und aus denen sich Klugheitsregeln für das eigene Fertigwerden mit der Weltableiten lassen.609 Valerius Maximus, der berühmteste Musterautor für monumentale Vorbildexempla, aberauch für diese strategischen „Fertigkeitsexempla“, fand es nötig, auf die moralische Unbedenklichkeit derletzteren rechtfertigend hinzuweisen: Die „verschmitzten“ Beispiele seien ein Zwitter zwischen „Weisheit“und „Verschlagenheit“, „denn sie erreichen ihr Ziel mehr auf geheimen Hinterpfaden als auf offener Straße“,und die „strategischen“ gehören zu einer „sittlich erlesenen und völlig einwandfreien Schlauheit“. (Dies zitiertJohann wörtlich mit Berufung auf den auctor.610)
Zu der im Grunde universalen Kategorie des hintersinnigen Exemplums, das bereits in der griechischen ainos-Fabel vorgebildet war,611 gehören in besonderem
608 Vgl. S. 164; AUERBACH, Mimesis (wie Anm. 254) 205 f. zur Tradition der auf den witzigen Ausspruch hinkomponierten Geschichten von Salimbene zum ‚Novellino’; LHOTSKY 81: „schlagfertige Antworten“ als Hauptkomponenteanekdotischer Historiographie; ebd. 76 zur aufschlußreichen Pseudo-Etymologie von argumentum bei Isidor (VI 8.16): quodsit argute inventum ad conprobandas res (vgl. unten Anm. 834).609 Vgl. oben § 14. Den technischen Aspekt der Exempla betont die Rhet. eccl. (wie Anm. 8) zum kanonistischenProzeßrecht (2): Utilitas eius [rhetoricae] in propositis quaestionibus subtilis et acuta responsio, omnium controversiarumfacilis et rationabilis terminatio. – Allgemein zum methodischen, nicht inhaltlichen Modellcharakter von Exempla undExemplasammlungen vgl. GEBIEN 34 ff., HONSTETTER 11, SCHON 3 ff.610 Nach den sapienter dicta aut facta von VII 2 folgen in VII 3 die vafre dicta aut facta, von denen es eingangs heißt: […]genus a sapientia proximo deflexu ad vafritiae nomen progressum, quod, nisi fallacia vires adsumpsit, finem propositi noninvenit laudemque occulto magis tramite quam aperta via petit. In VII 4 folgen die strategemata mit der von Johann (obenAnm. 603) zitierten Eröffnung: Illa vero pars calliditatis egregia et ab omni reprehensione procul remota, cuius opera,quia appellatione vix apte exprimi possunt, Graeca pronunciatione strategemata dicantur. Vgl. HONSTETTER 88 f.611 Vgl. oben § 14, MEULI 13 f. (ainos als „Hofnarrenkunst“).
315
Maße Beispiele verhüllten Tadels. Für seine Hofkritik bevorzugt Johann Exempla „nicht verletzenderZurechtweisung der Mächtigen“. Das dem Kanzler des Königs, Thomas Beckett gewidmete Werk, in dem erden hohen Empfänger immer wieder direkt ermahnend anspricht, nennt er im prologartigen Entheticus (demrhetorischen Fachterminus entsprechend) ein opus insinuationis.612 Die erwähnte Umgestaltung derMenenius Agrippa-Fabel zu einer geistreichen Replik des Papstes auf die von Johann selbst vorgetrageneKurienkritik613 ist ein sprechendes Beispiel für diese Methode, gewissermaßen eine beispielhafte insinuatio fürdie Berechtigung des Insinuierens:[?]614 Denn Thomas Becket – das steht zwischen den Zeilen – soll es demnoch höher gestellten Herrn nachtun, sich ebenso geduldig wie dieser von Johann die Wahrheit sagen lassen.Im ernsten Rahmen einer ethischen officia-Lehre wird derart beiläufig eine Theorie „des freien Scherzes“ undder rhetorisch nützlichen Witzrede entwickelt. „Urbanität“ gilt dabei als Ausdruck von „Weisheit“
612 Enth. (wie Anm. 398) 182 f. 1475–1522: ‚Quod in correptionibus insinuatione utendum’; 1475–79: Ergo quos ratiodirecta nequit revocare/A vitiis, revocat insinuationis opus,/Nam sicut verbi, sic insinuatione vitae/Saepe reluctantes ad suavota trahit./Fortior est vitae, quam sit persuasio verbi […] 1485–6: Sed vereor, frustra ne cancellarius instet/ut mutetmores aula superba suos […] Insinuatio vitae dürfte sich auf Exempla beziehen; vgl. LAUSBERG §§ 280–2; Victorinus I17 (HALM) 199: … debebis dissimulare de defensione, postquam reddideris auditores, paulatim ingredi in eandemdefensionem […] Deinde occulte et de adversariis detrahere debebis. Postremo, de simili negotio aliquorum iudiciumadferri oportebit exemplum. Radulf von Longchamp (wie Anm. 508) 145: Insinuatio facit quasdam simulationes,circuitiones et digressiones, ut non videatur defendere quod tamen defendit. Vgl. auch ebd. 149 (oben Anm. 375 zitiert) zurDefinition des Exemplums als Insinuationsmittel dem Richter gegenüber, der bereitwilliger das gewünschte Urteil spricht,wenn er an ähnliche Urteile seiner Vorgänger erinnert worden ist; Anm. 1210 zur digressorischen Seite derInsinuationsexempla oder zu ablenkenden „Geschichten“. J.C. SCALIGER, Poetices III 123 (Lyon 1761/Stuttgart 1964)169a: non tam rationibus atque argumentis fides extorquenda quam exemplorum frequentia persuasio insinuanda. Vgl.§§ 56, 77, 119, 124, S. 317. Die Beziehung zwischen Hofkritik und „Hofmannserziehung“ ist in dieser Hinsichtgrundsätzlich ambivalent, da Verlogenheit und Scheinhaftigkeit die nugae curialium ausmachen, aber Verstellungskunst eineHauptregel des civilitas oder urbanitas darstellt (zu letzterem vgl. auch Stephen JAEGER, Medieval Humanism [wieAnm. 577] 87 ff.); ders. Origins (wie ebd.) 168 ff.613 Vgl. oben S. 224 f. zu Pol. VI 24, (II) 67 ff.614 Vgl. Pol. VII 25 und VIII 10 (dieselben Gedanken zum Tadel der Mächtigen und zur civilitas- oder Anstandslehre);bes. VII 25, II 224 f.: Liberum ergo fuit et semper licitum libertati parcendo personis dicere de vitiis; quoniam et ius estquo licet veras ‚exprimere voces’ [Verg. Aen. II 286] et quod etiam servis adversus dominos, dum vera loquuntur,Decembrem indulget libertatem (cf. Hor. Sat. II 7.4–5; Sat. I 1 24 auch in Pol. VIII 11 [II] 301.16 oben in Anm. 509). Zumfreien Scherz vgl. auch S. 224 f., 552 f.; zum Verhältnis von Kritiktoleranz und Mut zur kritischen Wahrheit (libertas) sowieEitelkeit und Schmeichelei vgl. § 73. SUCHOMSKI (46 ff.) analysiert diese Stellen unter seinem thematischenGesichtspunkt einer Theorie des Komischen im Mittelalter; dabei kommen die situativ-kontextuellen Aspekte derrhetorischen Intention notwendigerweise zu kurz.
316
und wird philosophisch aufgewertet: Den Vorgesetzten sucht Johann die Tugend der „Geduld“ zu empfehlenals Fähigkeit, Kritik und Spott zu ertragen, den Untergebenen hingegen die Tugend der libertas, d. h. der„freien Rede“ – heute hieße sie Zivilcourage. Dies sind die positiven Gegenpole zum Lasterpaar „Eitelkeit“und „Schmeichelei“. Die mit Exempla aus Valerius Maximus und mit längeren wörtlichen Macrob-Exzerptenangereicherten Ausführungen über die Grade und Grenzen der Kritik in bestimmten heiklen Situationengipfeln im Lob der „saturnalischen“ libertas Decembris, d. h. der Hofnarrenkunst oder Karnevalslizenz.Ähnlich wie insinuatio ist „Dezember-Freiheit“ ein Schlüsselbegriff für die kritische Werkabsicht, und Johannberuft sich Thomas Becket gegenüber ausdrücklich darauf, um seine Offenheit zu legitimieren.615 Dabei wägter mit offenkundiger Freude an gelehrten Spezialtermini die beiden schon in den Saturnalia ausgefallenenGräzismen ledoria (loidorºa) und scomma/scoma (qx©mma), gezielter offener Angriff und diplomatischgetarnte oder verhüllte Kritik, gegeneinander ab. Ein scoma ist ein „verdeckter Stich“ oder bildhaftverschleierter „Biß“, der „anders klingt, als er aufgenommen wird“, und ebenso „süß“ wie „bitter“ schmeckenkann. Im scoma zeigt sich am vortrefflichsten die Kunst der urbanitas.616 Doch ist dieses Mittel nicht überallam Platz, z. B. nicht Betrunkenen gegenüber, die vom Gelächter der Anwesenden gereizt, durch solche
615 Pol. VII 25, (II) 225.8 ff.: Utor ergo libertate Decembri et iussis tuis obtemperans, quod me et te urit beneficio iuriscommuni fidenter arguo, non necesse ratus veniam impetrare in his quae publicae serviunt utilitati et tuae sunt placitavoluntati.616 Nach Macrob, Sat. VII 3 schrieb Johann die beiden wie folgt überschriebenen Kapitel: De libertatis amore et favore, et dehis qui libere dicta patienti animo maiores tulerint et de differentia ledoriae et scomatis (Pol. VII 25, [II] 217–225; zurBegriffsunterscheidung s. 222–5); Regula convivandi sensu et fere verbis Macrobii sumpta de libro Saturnalium (Pol. VIII10 [II] 284–93). Vgl. M. SCHEDLER, Die Philosophie des Macrobius, ihr Einfluß auf die Wissenschaft des christlichenMittelalters, (Beitr. z. Gesch. der Philos. des Mittelalters, ed. Cl. BÄUMKER, XIII 1) Münster 1916, 138 f.; SUCHOMSKI46 ff., der das ausführliche Macrob-Zitat mit Recht als eigene Aussage Johanns behandelt. Vgl. auch OLSON (wieAnm. 289) zu Macrob. – Pol. VII 25, (II) 223.18 ff. = Macrob. Sat. VII 3.2–6: Est autem […] ledoria quae exprobrationemet directam contumeliam continet. Scoma quidem morsus est figuratus, quia saepe vel fraude vel urbanitate ut aliud sonetaliud intelligas; ne tamen semper ad amaritudinem pergit, sed nonnumquam in quos iacitur et dulce est. Quod genusmaxime vel sapiens vel alias urbanus exercet, praecipue inter mensas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam provocatio.
317
Raffinessen sich erst recht verletzt fühlen. Denn „Angeln mit Widerhaken sitzen fester als Messerspitzen“.Hier sei vielmehr der Frontalangriff der ledoria situationsgerecht.617
Ein Exemplum aus Valerius Maximus für das scoma ist jene Frau aus Syrakus, die täglich für das Wohlergehendes Erztyrannen Dionysius zu den Göttern betete und, „von diesem zur Rede gestellt, sagte, sie habe alsMädchen einem schlimmen Tyrannen den Tod gewünscht, dann habe nach dessen Ermordung ein nochscheußlicherer Nachfolger die Herrschaft übernommen und sie habe erneut das Ende der Tyranneiherbeigesehnt; der dritte Herrscher aber, der Angesprochene selbst, sei noch brutaler als alle seine Vorgängerausgefallen: Ich fürchte also, ein noch abscheulicherer Tyrann folge dir nach, wenn auch du hinweggenommenwirst; darum setze ich mich mit meinem Kopf für dein Wohlergehen ein. Aus Scham scheute sich selbst derschamloseste Dionysius, eine so witzige Frechheit zu bestrafen“.618Dieses Exemplum illustriert im übrigeneine formale Besonderheit des hintersinnigen Beispielgebrauchs, den Überraschungseffekt der Pointe: Dieunausgesprochene Erwartung, daß nach zwei Tyrannen, die ja selbst Beispiele im Beispiel sind, ein guterHerrscher gekommen sei, wird zuletzt erfolgreich zerstört. Dies entspricht der Anweisung in deraristotelischen ‚Topik‘, so zu tun, als wolle man Beispiele nur als Illustrationen bringen, da das Publikum eherakzeptiere, „was einer anderen Sache wegen behauptet wird und nicht sich selbst zum Zweck hat.“619
Daß ledoria nicht bloß eine Derbheit, sondern eine andere, offenere Art des kunstvollen Angriffs darstellt,zeigt das Wort Jesu an die Juden (Joh. 10.32): „Viele gute Werke habe ich euch vom Vater gezeigt. Welchesdieser Werke ist es, wofür ihr mich töten wollt?“ Diese als einen Sarkasmus verstandene Frage nennt Johanneine evangelica ledoria.620
617 Ebd. 224.1–6 (Macrob a.a.O.): … cautius in convivio abstinendum scomate quod tectam intra se habet iniuriam. Tantoenim expressius herent dicta talia quam directae ledoriae, ut hami angulosi quam directi mucrones tenacius infiguntur,maxime quia dicta huiusmodi risum praesentibus movent, quo velut assensus genere confirmatur iniuria. Ähnlich auchPol. VIII 10, (II) 290 f. nach Macrob Sat. VII 3.20–22. Vgl. auch die Wendung: scomatice aut ledorice in eos dici potest,in: Met. I 5, 18.10. Zur frühneuzeitlichen Gattungsbezeichnung „scomata“ für eine satirische Ausprägung der Fazetie vgl.BEBERMEYER (wie Anm. 381) 930 (Geiler von Kaysersberg).618 Pol. VII 25, (II) 222.24–223.8 = Val. Max. VI 2, ext. 2 (aus Heirics Collectanea, ed. R. QUADRI, Fribourg 1966, 95);ebd. 223.7–8: Tam fascetam audaciam Dionisius etsi teterrimus punire tamen erubuit.619 Arist. Top. 8.1, 156b 25–7 und 157a 14–5; vgl. McCALL 26 ff.620 Ep. 246, (II) 494: … huiusmodi evangelicam loedoriam quam in Iudeos Christus intorsit […] Vgl. auch unten S. 470 ff.zu Christus civilis.
318
74. Exempla können als strategemmata, offene und verdeckte „Spitzen“, nicht nur die Kampfmethodenlehren und zugleich selbst als Kampfmittel dienen, sondern sie sind als solche auch in utramque partemdebattierbar, sei es, daß sie vom Gegner als Argumente in Frage gestellt werden; sei es, daß sie als casus deneigentlichen Streitgegenstand darstellen. Der traditionelle geistige Rahmen, innerhalb dessen Exempla kritischüberprüft werden konnten, war auch für Johann die seit den Kirchenvätern gängige Konfrontation von„Vernunft“ und „Beispiel“, „Wahrheit“ und „Gewohnheit“.621Seitdem die Apologeten mit dem Axiom vomhöheren Rang der Wahrheit als einem spezifisch „rationalen“ Kriterium gegen das allmächtige römischeTraditionsargument des mos maiorum innovativ zu Felde gezogen waren, blieb der Gedanke derLegitimationsbedürftigkeit alles Hergebrachten und Populären stets, besonders aber in Zeiten des Umbruchsoder der Erneuerung christlicher Ideale, virulent und konnte von den verschiedensten reformfreudigenParteien gegen die verschiedensten Konservativismen eingesetzt werden. Dies zu betonen, ist nicht überflüssigangesichts des (wenigstens außerhalb der Mediävistik) noch immer weitverbreiteten Schlagworts von der„geschlossenen“, „vergangenheitsgesteuerten“, „traditionalistischen“ Gesellschaft des Mittelalters, in der lautMax Weber die „Autorität des ewigen Gestern“ geherrscht haben soll.622
621 Vgl. S. 85 ff., 326 ff. und die Testimonien in A. 210a–214; überdies von MOOS, Cons. I/II § 1127 zu Laurentius vonDurham, Consolatio de morte amici (wie Anm. 533) 14.1–3: exempla quidem si consentiant rationi imitanda sunt; si nonconveniunt sane rationi, quelibet exempla postponam. Hinc et ad sequendum iam accingerer, si quod exemplis ostenditurratione faciendum ostenderetur. Plus enim me movet quam instruit quod … (nach Aug. Civ. 1.22, oben Anm. 2). Analogdazu steht in der Kanonistik lex vor exempla und consuetudo. Meist betont Johann im Vergleich von Vorschrift und Beispielden Vorrang des letzteren (s. S. 164 ff., 177 ff., 487 f.) Eher eine Ausnahme ist Pol. IV 4, (I) 244: Sed quid ad emendicatagentium exempla decurro, […] cum rectius quisque possit ad facienda legibus quam exemplis urgeri. Vgl. oben Anm. 64zum Justinianischen Rechtsgrundsatz: non exemplis, sed legibus iudicandum est (Cod. Inst. 7. 14.13). Die Polarität vonratio und exemplum stellt also die topische Umkehrung des exemplum-praeceptum-Vergleichs dar, bei dem die Exempla denVorrang haben (s. S. 177 f.). Vgl. etwa Pol. II 28, (I) 165: Sane si ad impugnandum hunc errorem concursus rationum etcatholicae matris ecclesiae auctoritas non suppeteret, vel exempla malorum eum sufficiunt extirpare. Das Exemplum istdemnach nur hinsichtlich der rhetorischen Effizienz überlegen, ansonsten aber ratio und auctoritas nachgeordnet. Zuranalogen Rangordnung von movere und docere nach Augustin und Abaelard vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 61 f.Zur Hierarchie der Argumente in der Jurisprudenz vgl. N. HORN, Argumentum ab auctoritate in der legistischenArgumentationstheorie, in: Festschr. F. WIEACKER, Göttingen 1978, 261–72, hier 265 ff.622 Zu diesem Mittelalterbild vgl. die Stellen bei SPIEGEL (wie Anm. 181) 314 f.; zum innovativen Potential und zurWertvorstellung der „Erneuerung“ vgl. die Arbeiten von G. LADNER (wie oben Anm. 179) sowie die in Anm. 254erwähnten Beiträge. Vgl. auch unten §§ 84, 105 zum Verhältnis von „alt“ und „neu“.
319
Die schon bei den Kirchenvätern berühmte Pointierung Tertullians war von Gregor VII. als Kampfparole derReformkirche aufgegriffen worden und galt seither als eine besonders in kirchenrechtlich interessiertenKreisen beliebte auctoritas:623 „Jesus hat nicht gesagt: ‚Ich bin die Gewohnheit‘, sondern: ‚Ich bin dieWahrheit‘.“ Exempla aber sind Vertreter der Gewohnheit, des usus und der consuetudo vetusta et vulgataaufgrund ihrer topischen, meinungsmäßigen, konsensstiftenden Hauptfunktion. Darum müssen sie unterbestimmten philosophischen oder weltanschaulichen Prämissen einer höheren „rationalen“ oder geistigenInstanz – veritas, utilitas, sensus, sententia u. a. – unterworfen werden.624
Dies betrifft nicht nur die christlichen Exempla, sondern die anthropologische Struktur des Beispielsüberhaupt. Seneca beklagt als eines der großen menschlichen Übel den Herdentrieb und die Tatsache, „daß wirnach Beispielen leben, nicht von der Vernunft geleitet, sondern von der Gewohnheit irregeleitet werden“, undsagt:625 „Wir wollen nicht nachahmen, was wenige tun; haben aber viele dasselbe zu tun begonnen, dannfolgen wir, als wäre das Häufigere das Ehrenvollere.“ Auch auf die Exempla läßt sich übertragen, was in derTopik von den Endoxa gilt:626 Sie sind keine Wahrheiten oder Ur-Weisheiten, sondern mehrheitlichakzeptierte „Meinungen“ – als solche wahrscheinlich, möglicherweise einen Wahrheitskern enthaltend –,aber sie bilden nur die Ausgangspunkte, nicht die Endpunkte der Gedankenführung, sind „nach beiden Seiteneinsetzbar“ und lassen sich durch ihresgleichen in Frage stellen. Was die meisten und die Besten für wahrhalten, braucht außerhalb der Topik nicht unbedingt wahr zu sein.627 Jedenfalls haben die Topoi ebenso
623 Siehe oben Anm. 211.624 Cypr. Ep. 74.9 in Anm. 211.625 Sen. Ep. 123.6: Inter causas malorum nostrorum est quod vivimus ad exempla, nec ratione componimur, sedconsuetudine abducimur. Quod si pauci facerent, nollemus imitari, cum plures facere coeperunt, quasi honestius sit, quiafrequentius, sequimur.626 Vgl. §§ 54, 72, 90, S. 326 f.627 Vgl. KOPPERSCHMIDT (wie Anm. 460) 70 f. zu manifest ideologischen Aspekten des locus a fortuna bei Quint. V20.26 (bei Eigentumsdelikten sind Reiche weniger verdächtig). Vgl. auch S. 428 zu einem ähnlichen Beispiel beiAnaximenes. – Vgl. SCHIAN (wie Anm. 5) 175, 192 f. zum Gegenargument gegen das argumentum e consensu omnium ausder Kritik des platonischen Sokrates an der Berufung auf die herrschende Meinung des Pöbels; EMRICH (wie Anm. 584a)45 zum grundsätzlich bestreitbaren Wesen des Topos, den Cicero mit einem Acker vergleicht, der Frucht oder Unkrauthervorbringt; R. McKEON, The Methods of Rhetoric and Philosophy: Invention and Judgment, in: ‚The Classical Tradition’(Festschr.) H. CAPLAN, ed. L. WALLACH, New York 1966, 365–73, hier 371 f. zur möglichen Vorurteilshaftigkeit derTopoi im Unterschied zu paradoxen Sätzen (Arist., Top. 1.10.104a 8–37; 11.104b 18–28).
320
wie die Exempla im Bereich der Persuasionskunst streng instrumentellen und insofern wertneutralenCharakter. Wie die Topoi nicht die Argumente selbst, sondern Fundorte und Suchformeln für Argumente sind,so bilden die Exempla an sich nur historisch-literalen Stoff, den es auszulegen und richtig anzuwenden gilt: imSinne des eigenen Parteiinteresses, das sich notwendig auf die Wahrheit beruft. Der dialektisch-rhetorischeKampf mit einem Gegner wird so auch zu einem Konflikt der Exempla, bzw. der je im eigenen Sinneingesetzten Exempla-Bedeutungen.628
Johann wird nicht müde, dies mit mehreren, oft sehr ausführlichen Beispielen darzutun. So stellt er im erstenPolicraticus-Buch bewußt weithergeholte Exempla, die ein Jagdliebhaber zur Verteidigung seinesPrivatvergnügens anführen könnte, zusammen. Der Leser denkt schon, er wolle eine Abhandlung De veneticaet speciebus eius (so der Titel des 4. Kapitels) schreiben. Doch dann zeigt sich, daß die „erschöpfende“Darlegung aller nur denkbaren Argumente für die Jagdkunst nur (nach Art fiktiver Einreden) derenWiderlegung vorbereitet. Die anschließende refutatio folgt dem Prinzip der Vertrautheit und Anerkanntheitvon Exempla: Sie besteht aus einer breiten Aufzählung berühmter Männer, die aus verschiedenen Gründen dieJagd verachtet oder kein gutes Wort über sie gesagt haben. (Antike Philosophen und Kirchenväter werdenhier aufgezählt, auch solche, die sich nie weder für noch gegen die Jagd geäußert haben). Der gegnerischeVergleich mit großen „Jägern“ wie Nimrod, Esau und Judas Makkabäus soll durch die eigene Beispielmenge alsselten, ausgefallen und untauglich erwiesen werden.629 Im zweiten Buch führt Johann eine lange Exempelreihefür den scheinbaren Erfolg der Wahrsagekunst aufgrund verschiedener okkulter Zeichen nur an, um sieinsgesamt mit dem umgekehrten Argument des geringen Beweiswertes von Exempla und Üblichkeitengegenüber der ratio zu widerlegen.630
628 Siehe oben § 63.629 Pol. I 4, (I) 21–28: Voran ethnologische Beispiele für die Geringschätzung der Jagd, danach exempla berühmter Männer,die die Jagd gemieden haben, zuletzt (29 f.) weithergeholte Exempla des Gegners ad refutandum. Vgl. KERNER 166:„Johannes […] scheint auf eine Diskussion einzugehen, in der mit ähnlichen methodischen Mitteln nach einer Rechtfertigungder Jagd gesucht wird. […] eine mit Beispielen der Literatur geführte Debatte.“630 Pol. II 25, (I) 135–9: Die Exempla (zuerst biblische, dann antike) sollen den Trugschluß des Gegners hinsichtlich derverläßlichen Deutung von Vorzeichen entlarven; Einleitung (136.3 ff.): Ceterum artem esse quo quis de futuris ad omniainterrogata verum respondeat, aut omnino non esse, aut nondum innotuisse hominibus, michi multorum auctoritate etratione persuasum est. Quod si tibi persuadere non possum, obstantibus his quae michi de providentia et fato indesinenteropponis, michique repugnantibus exemplis quae de variis affers historiis, persuasi tamen michi huic non adquiescerevanitati. HELBLING-GLOOR (wie Anm. 26) 54 f. vermutet wohl zu Recht, daß die Aberglaubenskritik oft nur denVorwand zur Ausbreitung der antiken Augurallehre darstellt.
321
Exempla lassen sich nicht nur gegeneinander ins Feld führen; jedes einzelne kann auch in sichhermeneutischen Konfliktstoff bieten. Johann unterscheidet gern strittige Aspekte in ein und demselbenExemplum, etwa lobenswerte fortitudo und verwerflichen Selbstmord bei Cato oder Lucretia, beliebtenGestalten der römischen controversiae sowie der patristischen Auseinandersetzung über die Tugend derHeiden.631 Ebenso bildet der alttestamentliche „Fall“ Judith eine Gelegenheit zu Argumentationen pro undcontra
631 Pol. II 27, (I) 157 f.: Glorientur gentes in fortitudine sua, auctores earum dicant unusquisque quod sentit, dum heroumsuorum titulos praedicant, dum magnorum virorum fortitudinem praeconantur; bibat illis auctoribus Cato venenum,Vulteius dextras et mentes sociorum armet ad voluntariam mortem [cf. Lucan. IV 540 sqq.], per mamillas ad cor venenumaspidum insanabile Cleopatra traiciat, Lucretia alienam impudicitiam sanguinis sui effusione condempnet [cf. Aug. Civ. I16–19]. Ego evenire posse non arbitror ut cuiuscumque difficultatis articulo liceat propria auctoritate homini sibi morteminferre, nec etiam ubi castitas periclitatur. Licet hunc casum videatur excipere doctor ille doctorum, cui in sacrariolitterarum vix aliquem audeo comparare. Die Kritik trifft ähnlich wie diejenige Abaelards, Sic et non Nr. 155 (ed. B.B.BOYER/R. McKEON, Chicago 1977) 518 die Hieronymusstelle In Ionam I 12 [PL 25] 1129. Zum Hieronymus-Lob s.Anm. 951. Vgl. Pol. V 17, (I) 360 f. zur Grenze zwischen Martyrium und Selbstmord; Pol. III 9, I 197 zu Catoslobenswerter Verachtung der Orakel und verwerflicher Selbstgerechtigkeit. Zur antiken Tradition rhetorischer Kasuistik übersolch auslegungsbedürftige Fall-Beispiele s. § 64, 81, S. 343. DAVID, Maiorum exempla 80 f.; KORNHARDT 65 ff. (mitHinweisen auf das römische Recht); GEBIEN 68 f. (der Fall Alexander); HONSTETTER 138 ff. (Cato); zur patristisch-mittelalterlichen Fortsetzung vgl. HONSTETTER 132 ff., 138 ff. (vgl. allerdings die Einschränkung oben Anm. 497);BUISSON, Potestas 27 f. (Aug. zu Lucretia, Cato, Regulus u. a.); ders. Entstehung 109 ff. (zum „Tyrannenmord“ desBrutus); von MOOS, Lucans tragedia 183 f. (allgemein zu doppeldeutigen Helden); ders., Lucan und Abaelard, in: Festschr.A. BOUTEMY, Coll. Latomus 145, Brüssel 1976, 413–443, bes. 431 ff. (magnanimitas Catonis); BALDWIN, Masters(wie Anm. 327) I 257 zum schulmäßig disputierten Casus, ob Heinrich II. zum Mord an Thomas Becket direkt oder indirekt,bewußt oder unabsichtlich angestiftet habe; P. HERDE, Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der Renaissance, in:AKG 47 (1965) 141–220 zur Beliebtheit von pro- und contra-Spielen über Kontroversthemen wie regnumsuccessivum/electivum, Tyrannenmord und die dazugehörigen Exempla im Frühhumanismus (allerdings mit dem inadäquatenBegriff „Schulübungen“ unterbewertet). – Die verbreitete romanistische These (s. S. 20 ff.) von der Neuheit dernovellistischen Kasuistik bei Boccaccio ist aufgrund dieser ungebrochenen Tradition rhetorischer Kontroversen im Mittelaltereinzuschränken, abgesehen davon, daß auch biblische Stoffe (Jephthas Tochter, das Opfer Isaaks u. a.) zu steten theologischenund literarischen Behandlungen im Stil antiker rhetorischer Kasuistik über Problemexempla anreizten (vgl. S. 274 f., 278 ff.,342 ff., 350 ff., 356 ff., 365 f.).
322
Tyrannenmord.632 Solche Exempla entsprechen der von Jolles für den „Kasus“ gegebenen Bestimmung:633
Sie bestätigen nicht eine Regel durch den beliebig austauschbaren Einzelfall, sondern stellen die Regel durcheinen Sonderfall, d. h. oft auch einen Extremfall, in Frage. Die Norm kann sogar durch ein Beispielbuchstäblicher, starrer, kompromißloser, d. h. „maßloser“ Anwendung ad absurdum geführt werden gemäßder lapidaren römischen Formel: summum ius summa iniuria. So leitet die Diskussion über- undunmenschlicher Normerfüllungsbeispiele zurück zum Ideal der aequitas, der Sach-, Sinn- undSituationsgemäßheit und damit auch zurück zu Humanität und Toleranz. In diesem Zusammenhang sind dieExempla ein Schutz gegen die Simplifikation; sie dienen der Kunst der Nuance, weil ihre KonkretheitGeneralisierungen widerlegt.634 Vieles von dem, was Johann als persönliche Inkonsequenz und Aporetik beider Problemlösung angelastet oder aus seinem vielgepriesenen un- und antidogmatischen „Temperament“psychologisch erklärt worden ist, sollte zum mindesten auch auf dem Hintergrund einer bestimmten, aus dercontroversiae-Rhetorik stammenden Denkmethode des topischen Beispielgebrauchs zur spielhaften Einübungin juristische und moralphilosophische Differenzierungen gesehen werden. Zur Geschichte dieses Exemplumsgehört auch die moralpädagogische Variante des Verfahrens: Extremfälle heroischen bis übermenschlichenAusnahmeverhaltens – Iphigenie, Jephthas Tochter und Griseldis sind kulturell weit auseinanderliegendeBeispiele – werden vorerst anscheinend im Sinne des Ansporns zur Identifikation zitiert, damit sie hernachdistanzierter besprochen und in ihrer Gültigkeit und Imitabilität für gewöhnliche Sterbliche relativiert werdenkönnen.635
632 Pol. VIII 20 (II) 376 ff.; s. S. 365 ff., 469 ff. Die Thesis oder deliberative quaestio: „darf/soll man einen Tyrannentöten?“ gehörte von Anfang an zu den beliebtesten Debattier-loci der declamationes und controversiae. Judith konnte dasberühmte römische Exemplum Brutus biblisch ersetzen oder ergänzen; vgl. Anm. 550; BONNER, Decl. (wie ebd.) 10,25 ff., 33 f., 75 ff.; ZIMMERMANN (ebd.) 783 f.633 Vgl. oben S. 27, 30, 138, 228, 275 f.634 Vgl. Johannes STROUX, Summum ius summa iniuria, Leipzig 1926 (2. Auflage 1949 mit weiterem Titel: s. Anm. 3)12 f.; M. FUHRMANN, Philologische Bemerkungen zur Sentenz ‚Summum ius summa iniuria’, in: Studi in onore diVolterra II, Mailand 1969, 53–81; BONNER Decl. (wie Anm. 550) 46 f., 57, 124; TRIMPI (wie Anm. 550) 36;HONSTETTER 83 ff.; E. MEYER (wie Anm. 557) 57; MICHEL, Rhétorique et philosophie (wie Anm. 546) 474 ff. undS. 354, Anm. 519.635 Solche Korrekturen zur humanen Mitte hin bietet Johann in dem ausführlich zu behandelnden Beispiel derkindesmörderischen Tugend des Brutus (§ 81 oder in entheroisierten Exempla gerechtfertigter, weil naturgemäßer Schwäche(s. S. 171 f., 325, 350, 363, 433). ROUSE/ROUSE (wie Anm. 469) 245 f. zählen mehrere Themen mit „insofern“-Einschränkungen Johanns auf, bei denen Exempla eine zentrale Rolle spielen, erklären jedoch das Verfahren, „traditionelleAuffassungen zu referieren […] und abrupt, häufig in völlig überraschender Inkonsequenz“ abschließend ins Gegenteil zuwenden, biographisch oder „temperaments-psychologisch“. Vgl. auch WILKS (wie Anm. 546) 274 zu Johanns kritischemSinn für eine sich selbst ad absurdum führende extreme Logik. Generell zum Verhältnis von Extrem- und Normalfall, vonder heroischen Verkörperung des Ideals und dem pädagogisch ermutigenden Beispiel für die Möglichkeit der Nachfolge vgl.BUCK, Art. Beispiel 821 f.; BAUSINGER, Formen (wie Anm. 69) 218. Die Darstellung des Extremfalls gehört wesentlichauch zur Tragödie nach Aristot. Poet. 9, 1551a; vgl. oben Anm. 282 und WALBANK (wie Anm. 125) 216 ff.; RÖSLER(ebd.) 309 ff.; K. von FRITZ, Die Bedeutung des Aristoteles für die Geschichtsschreibung, in: Histoire et historiens dansl’Antiquité, Entretiens sur l’Antiquité classique (Fond. Hardt 4), Genf 1956, 83–146, hier 118 f. Die im Hellenismusvollzogene Annäherung der Gattungen in der sog. „tragischen Historiographie“ dürfte Stillage und pathetische Heroisierunggewisser Exempla-Darbietungen sogar im Gebrauchshandbuch des Valerius Maximus bestimmt haben (vgl. HONSTETTER70 ff.). – Schon die spätantik-heidnische Entwicklung zeigt eine gewisse, in der Patristik verstärkte Tendenz zurEntheroisierung des Exemplums: s. §§ 26–8, 37, S. 127 f., 350, insbesondere zur Ablehnung ethischer Maximalforderungenstoischer Provenienz als Inhumanität aufgrund der Inkarnationslehre und der humanitas Christi. Johann hat sich aufgrunddieser Tradition trotz seiner Sympathie für das stoische Gleichmutsideal mehrfach mit Exempla (wie den Tränen Jesu oderden erschreckten schiffbrüchigen Philosophen) gegen die konsequente Apathia gewandt: in Pol. VII 3, (II) 100 mit einemGellius-Exzerpt (XIX 1) aus Aug. Civ. IX 4; in Ep. 276 (II) 582 ff. mit demselben und Lucan II 289–90 über den notwendigfurchterregenden Weltuntergang sowie Ter. Heaut. I 77 (nihil humani alienum); in Ep. 225 an Gerard Pucella (II) 392 mitfolgender Exempelreihe zur Flucht Thomas Beckets vor Heinrich II. als Widerlegung des Feigheits-Vorwurfs: recte facit,prophetarum et apostolorum fretus exempla, cum David, Helyas, Petrus et Paulus hoc idem fecisse legantur. Est enim
323
Was die Herkunft solcher in sich problematischer oder interpretationsabhängig zweischneidiger Exemplabetrifft, verwendet Johann nicht nur die klassischen, bereits in den Rhetorenschulen der Spätantikedebattierten historiae von Tyrannenmördern, Selbstmörderinnen und andern Tragödiengestalten.Grundsätzlich ist jedes, auch noch so ehrwürdige oder heilige Exemplum Fehldeutungen ausgesetzt und damitkontrovers. Kritiklose Imitation lehnt Johann auch biblischen patres gegenüber ab. David sei nicht imEhebruch, Petrus nicht im Verrat, Paulus nicht als der Christenverfolger Saulus nachahmenswert.636 Solchessei nur aufgeschrieben und denkwürdig, damit es
temptare Deum seipsum certis et manifestis obiectare periculis, cum in Domino pateat oportunitas evadendi. Zumhistorischen Zusammenhang s. MICZKA 36 ff.636 Vgl. §§ 49, 75 zu Fehldeutungen. Pol. IV 5, (I) 248.1 ff.: Nec uxores David quidquam obiciat [II Reg. 5.13] qui forte inhoc, sicut in multis aliis, speciali privilegio gaudet; licet facile concesserim quod et ipse in hac parte deliquerit […] nec inillius excusatione laboro […] Habes itaque regem cum regibus delinquentem, et utinam cum penitente peniteant […] (vgl.Aug. En. Ps. 50.3 [CC 38] 600: Multi enim volunt cadere cum David et nolunt surgere cum David. Dazu vgl. S. 87 f. zuratio/exemplum bei Aug.) Ep. 288, (II) 642 (eine Verteidigung Thomas Beckets gegen den Vorwurf, consuetudines mißachtetzu haben): Nec in malis imitari oportet patres qui se poenitenda commisisse doluerunt, eoque sancti sunt quod eos inquibus nollent se imitatores habere successores aut coaetaneos peccasse poenituit. Non enim Moyses in diffidentia, nonDavid in proditione vel adulterio, non in proditione apostolus, non periurio Petrus, non Paulus in zelo insipientiae, non inexcommunicatorum participatione Martinus imitandus est, sicut nec in incestu nec in parricidio patriarcha, vel qui maneoriebatur archangelus in crimine apostasiae [cf. Nm. 20.7–13; II Reg. 11; Matth. 26.14–6; Mc. 14.66–72; II Cor. 11.16–8;Sulp. Sev. Chron. II 50; Dial. II 11–13; Is. 14.12]. Siquidem delicta maiorum scripta sunt ut caveantur, non utnecessitatem imitationis successoribus ingerant; nam verbum Dei forma vivendi est, non conviventium coetus. Undeapostolus [I Cor. 11.1]: ‚Estote imitatores mei sicut et ego Christi’; alioquin praeter formam Christi se nulli censuitimitandum (vgl. auch Anm. 637 zu Pol. VII 19.180). Pol. II 16, (I) 95.10 ff. (S. 185, übersetzt): Denique ad speciem factiquis Uria iustior? quis David nequior aut crudelior? quem Bersabee ad proditionem homicidium et adulterium invitavit.Quae quidem omnia contrarium faciunt intellectum, cum Urias diabolus, David Christus, Bersabee peccatorum labedeformis ecclesia figuretur. Zu diesen und anderen Stellen über die „bibelkritische“ Hermeneutik vgl. MICZKA 38 f.;SCHAARSCHMIDT 9; SALTMANN (wie Anm. 514) 351 ff.; D.W. ROBERTSON, Some Medieval Literary Terminology…, in: Studies in Philology 48 (1951), 669–692, hier 691 = in: ders., Essays in Medieval Culture, Princeton 1980, 51–72,hier 71 f. Zu wenig wird im allgemeinen gesehen, daß es sich hier um ein seit der Patristik durchaus gängigesInterpretationsverfahren handelt. Patriarchenfehler wurden entweder wegerklärt (Davids Ehebruch z. B. ausschließlich imSinne der felix culpa als Voraussetzung der Reue) oder positiv als dissuasio a peccato umgedeutet, geschichtstheologisch ausder stufenweisen Vervollkommnung des Gesetzes oder der typologischen Gegensätzlichkeit zum Neuen Testamententschuldigt oder schließlich als bloß historischer Buchstabensinn dem eigentlich spirituellen Sinn nachgestellt undverunwirklicht. Vgl. S. 184 ff., 360, 456 f. und MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 103 ff. zur späteren mal. Entwicklungder David-Interpretation, in der zusehends die moralisch problematische Wirklichkeit des sensus litteralis ernst genommenund die Urias-Geschichte zu einem doppelpoligen Exemplum wird für die dissuasio a peccato und die suasio poenitentiae.Vgl. auch Anm. 429 f. und BUISSON, Potestas 31 f.; ders. Exempla 460 ff.; DORNSEIFF 222 f.; von MOOS, Hildebert(wie Anm. 211) 191 f. Die im Kirchenrecht entwickelten Kriterien zur Fallbeurteilung galten analog für die zum Vergleichherangezogenen Beispielfälle und deren Widerlegung; vgl. etwa Rhet. eccl. (wie Anm. 8) 25 ff. ‚De concordiacontroversiarum’: Primus modus […] est diversus casus secundum situm locorum, secundum statum presentis et illiustemporis (multa antequam fiant fieri non licet, post factum tamen convalescunt), multiplicitas significationum […] etc.M.a.W. Zuständigkeit nach regional unterschiedlichen Normen, Anachronismusaspekt (Davids Ehebruch und SaulsOrakelbefragung, Konsanguinitätsehen im AT; vgl. auch A. 486), Mehrdeutigkeit der Begriffe. Vgl. auch LANG (wieAnm. 4) 73 ff., 77 f., 79 zum Unterschied von Tat und Intention in der Status-Lehre; A. 654, 858 zu den circumstantiae.Neben den Kriterien pro tempore, loco, persona etc. wird (z. B. Rhet. eccl. 15 ff.) auch die heilsgeschichtliche Stufe (lexnaturae, scripta, gratiae) für den Verbindlichkeitsgrad von Exempla (z. B. Feindeshass vs. Feindesliebe) herangezogen. Sehrwichtig ist auch die (z. B. ebd. 41 betonte) Unterscheidung von Präzedenzfällen und allegorischen Exempla (vgl. untenS. 539 zum Raub der ägyptischen spolia als Argument für den Diebstahl).
325
gemieden werde. Anderwärts wägt er in einem eigentlichen Sic et non Exempla nach Art von Autoritätengegeneinander ab:637 Plato habe zwar das Weintrinken beim Gastmahl als Mäßigkeitsprobe undTugendtraining für den Weisen empfohlen, Loth jedoch habe sich in eben diese Gefahr des Bacchus begebenund sei ihr erlegen. Also sei es klüger, das abschreckende Beispiel zu beherzigen; denn wer dürfe es wagen, sichbesser als ein solcher Patriarch zu fühlen! Das dictum steht derart als ein an sich richtiges, aberüberforderndes Ideal (auctoritas Platonis) dem aus eigener Erfahrung bestätigten factum, also einemexemplum contrarium im Sinne der Anpassung an die menschliche Schwäche gegenüber.638
75. Andererseits betont Johann die Beliebigkeit vieler Exempla. Darauf läßt sich beziehen, was er mitlogischer Schärfe zum Unterschied von literarischen und argumentativen Analogien festhält: Hieronymushabe gesagt, Gott könne alles, nur nicht eine gefallene Jungfrau wiederherstellen. Dies sei bloß ein oratoriustropus, kein notwendiger Schluß; da Gott nichts, was geschehen ist, ungeschehen machen könne, hätten sichfür diese Wahrheit auch irgendwelche anderen Beispiele anführen lassen. „Es war somit nicht notwendig, aufdie gefallene Jungfrau zurückzugreifen“.639Viele Beispiele haben ihre
637 Pol. VIII 19, (II) 292, 22 ff.: Poterit auctoritas Platonis [Gell. XV 2] movere quam plures, sed michi nimis arduus ettemerarius informioribus animis videtur cum Bacho, immo et cum quavis voluptate congressus. Si Loth vir iustus et dignus[…] femora denudavit […] quis tuto congreditur, nisi forte seipsum tantis ducat patribus praeferendum? Ut tamen Platonisnon reluctemur edicto, congredi cum voluptate sit fortius, tamen tutius sit fugere et illius declinare conflictum. Nec meminiquemquam me invenisse de provocatoribus voluptatum quem non legerim cecidisse.638 Der Vergleich des edictum Platonis mit Loths Versagen läßt sich auch auf den Gegensatz praeceptum-exemplum, Theorie-Praxis zurückführen: s. §§ 45, 49 Johanns Nachsicht gegenüber dem Alkoholgenuß geht auch aus Pol. VIII 7 (II) 270 ff. (s.unten Anm. 692) und Ep. 33 (I) 57 f. hervor: einer gelehrt-humoristischen Abhandlung über Getränkearten für Peter vonCelle: Ego tamen utriusque [sc. vini et cervisiae] bibax sum et non abhorreo quicquid inebriare potest.639 Pol. II 22, (I) 131.15 ff. zu Hier. Ep. 22.5: quo si oratorio tropo usus intellexit quae fuerunt non posse non fuisse, nonnecesse fuit ad virginem prostratam recurrere cum in praeteritis omnibus simili sententia vel errore hoc idem potueritinveniri. Hier wendet Johann also die logisch-dialektische Induktion gegen die rhetorische (vgl. S. 188 ff.). Ph. DELHAYE,Le dossier (wie Anm. 385) 79 stellt allgemein fest, daß Johann im Vergleich mit anderen Benützern des AdversusJovinianum keine Vorliebe für die sexualethisch-misogynen Übertreibungen des Hieronymus zeigt, diese vielmehr möglichstmildert.
326
Stärke in der Quantität, doch ihre Häufigkeit beweist nur die verbreitete consuetudo des Bösen, gegen die nurdas selten erreichte (darum auch nur durch wenige erlesene Beispiele zu bezeugende) Vollkommenheitsideal insFeld geführt werden kann. So nimmt Johann mehrfach die Rechtfertigung schlechter Taten durch ehrwürdigePräzedenzfälle oder „verbreitete Unsitten“ aufs Korn. Er wendet sich etwa gegen Beispiele, mit denen dieUnabhängigkeit des Fürsten vom Gesetz, das Pfründenunwesen oder der kirchliche Karrierismus gernlegitimiert werden. Klerikale Schmeichler (dealbatores potentum) reden dem Fürsten ein, er stehe über allem,und erklären ihn derart zum „exlex“:640„Dazu bringen sie irgendwo aufgestöberte Exempla von Tyrannen vor,mit denen sie beweisen wollen, daß den Mächtigen alles erlaubt sei; am meisten aber da, wo immer eineeingewurzelte Gewohnheit ihr Unwesen gegen Vernunft und Gesetz treibt […] Je ausführlicher einer aber ansolche Präzedenzfälle erinnert, je niederträchtiger er seine Bosheit durchsetzt, desto aufrichtiger erscheintseine Loyalität, desto erfolgreicher sein Eifer.“ Überhaupt stellt Johann den „verführerischen“ Mißbrauchvon Exempla und Topoi als besonderes Kennzeichen der Schmeichelei hin:641
640 Pol. VII 19, (II) 175 ff.; unten S. 329. LUMPE (1240) erinnert an die jüdische Tradition einer Kritik am Exemplum alsEntschuldigungsgrund für Sünden (Os. 4.13–4; 5.1; Macc. 2.8). Zitate: Pol. IV 7, (I) 259.7 ff.; ebd. VII 20, (II) 187.7 ff.:Ad haec conquisita tyrannorum exempla proponunt, quibus persuadeant potestatibus universa licere. Maxime tamen sicubilocorum fuerint inveterata consuetudo optineat, etiam si rationi adversetur aut legi […] Si quis autem in hiscommemorandis copiosior est et in explenda malitia nequior, sincerioris est fidei et efficacioris industriae. Zu exempla alsAntithese von ratio/lex s. § 74. Zu der etwa in Pol. IV 1; 7; VII 20; VIII 17 bekämpften, damals mit Hilfe des RömischenRechts (Ulpian, D I 3.31) neu belebten Theorie von der Rechtsunabhängigkeit des Fürsten, in der Johann den Inbegriff derTyrannei sieht, vgl. S. 494 f.; LIEBESCHÜTZ 49, 129; KERNER 144 ff.; 155 ff.; E.H. KANTOROWICZ, The King’sTwo Bodies, A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957, 92 ff.; G. POST, Medieval Legal Thought, PublicLaw and State 1100–1322, Princeton 1964, 259 ff., 499 ff.; Wh. BERGES, Die Fürstenspiegel des hohen und spätenMittelalters, MGH-Schriften 2, Stuttgart 1938/1952, 43 ff., 138 ff.; A. ROTA, L’influsso civilistico nella concezione dellostato di Giovanni Salisberiense, in: Rivista della storia del diritto italiano 26–7 (1953–4) 209–26. Zum Rechtsgrund Quod apluribus peccatur… s. unten Anm. 643.641 Pol. III 5, (I) 182.19 ff.: Porro cum omnis assentatio turpis sit, perniciosior est cum ad subornandum vitium personaevel naturae vel dignitatis accedit auctoritas. Nempe philosophi probabile dicunt quod videatur vel omnibus vel pluribus autsapientioribus aut quod in propria facultate artifici [Arist. Top. I 1. 100b.21 ff.; oben Anm. 5,583]. Si ergo sapientiamcuiusque Plato commendet aut Socrates, Aristotiles acumen ingenii, Cicero dicendi copiam, mathematicae studiumPitagoras, metrorum varietates Flaccus, Naso levitatem versificandi, quidni credat? Subeunt enim citius et fortius singulosfomenta vitiorum, ‚magnis/cum subeunt animos auctoribus’ [Iuv. Sat. XIV 32. 33]. His tamen sui compos animus nonseducitur […] Formal erinnert diese Priamel an die traditionellen panegyrischen Metaphern-Listen, die CURTIUS unter demStichwort „Überbietungsformeln“ berühmt gemacht hat (ELLM 172 f. daselbst auch zur gelegentlichen Kritik anSchmeichlern). – Vgl. noch Pol. VII 12, (II) 142: Das Wort Lucans (I 127): ‚Magno se iudice quisque tuetur’ wird aufjegliche Art von Testimonien, somit auch auf Beleg-Beispiele bezogen (dazu s. von MOOS, Lucans Tragedia 166 f.): et exverbis auctorum qui indifferenter nomina pro rebus vel res pro nominibus auctorum suam adstruit sententiam vel errorem[…] colligit quisque quo suam possit heresim confirmare. – Pol. VII 21, (II) 191 f.; eine Satire auf die heuchlerischeSelbstaufwertung monastischer Gemeinschaften durch hervorragende Ordensgründer: Se ergo Basilii, Benedicti, Augustiniaut, si hoc parum est Apostolorum et Prophetarum fatentur successores (wobei successor dem wahren imitatorentgegengesetzt wird). Zu diesem im 12. Jh. akuten Thema der ideologischen Konkurrenz verschiedener alter und neuerOrden und ihrem „esprit de corps“, die zu einer Jagd nach Exempla im Sinne von Präzedenzien, Vorläufern, Prototypen undStifterfiguren führte, vgl. die anregende Studie von B. SMALLEY, Novelty (wie Anm. 254) 104 ff. Zum Exemplum imRahmen spiritueller imitatio-Vorstellungen vgl. S. 96 f. – Daß Johanns Kritik am demonstrativen Exemplum durchtatsächlichen Mißbrauch desselben begründet war, zeigen etwa die von BEER, Truth (wie Anm. 502) 13 ff. gesammeltenBeispiele, etwa die Lobhudelei Wilhelms von Poitiers auf den mit sämtlichen Heroen der Vergangenheit verglichenenWilhelm den Eroberer, dessen Nepotismus und Gewalttätigkeit mit dem Exemplum Caesars bemäntelt werden. – Zur Kritikam klerikalen Karrierismus und an der hypocrisis mit parodistischen Zitaten und Exempla vorwiegend aus der Bibel vgl.Helga SCHÜPPERT, Kirchenkritik in der lat. Lyrik des 12. und 13. Jhs. (Medium Aevum 23) München 1972, 46 ff.,147 ff.; von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 198 ff.; zur ideologiekritischen Wertung römischer Geschichtsschreibung vonOrosius über Otto von Freising zu spätmittelalterlichen Darstellungen der Alten Geschichte vgl. LIEBERTZ-GRÜN (wieAnm. 325) 80 f.
327
„… Schändlich wird sie, wenn sie sich mit […] Autoritäten schmückt. Die Philosophen nennen dochwahrscheinlich, was allen, den meisten oder den Weiseren, oder aber dem Fachmann auf seinem Gebiet soerscheint. Wenn nun ein ganz beliebiger Mensch ob seiner Weisheit mit Plato und Sokrates, ob seinerVerstandesschärfe mit Aristoteles, wegen seiner Redegewalt mit Cicero, wegen seiner mathematischenBegabung mit Pythagoras, wegen seiner metrischen Virtuosität mit Horaz oder wegen seiner poetischenEleganz mit Ovid verglichen wird, was wird ein derart Gepriesener noch von sich halten? Stärker undschneller verderben die anstiftenden Lasterbeispiele einen jeden, ‚wenn sie mit großen Autoritäten das Herzbeschleichen.‘ Doch das seiner selbst mächtige Gemüt wird dadurch nicht verführt.“ Die moralischeTerminologie sollte nicht vergessen lassen, daß Johann mit solcher Kritik weitgehend gesellschaftlicheZustände und politische Legitimationsformen seiner
328
Zeit im Auge hatte: Das Exemplum wurde für verschiedene ideologische Auseinandersetzungen in der Folgedes Investiturstreits ein Haupt-Argumentationsmittel, mit dem sich gerade echte Neuerungen aufgrundirgendwelcher mehr oder weniger passender Präzedenzien als „Erinnerungen“, d. h. als Reformen undWiederherstellungen „des guten Alten“ ausgeben ließen. Von den Völkerabstammungssagen zu dengenealogischen Reinkarnationen (neuer David, zweiter Alexander, Traianus redivivus u.s.w.) anverschiedenen Fürstenhöfen bis zu kurialen Erneuerungsformen der antiken Roma-aeterna-Idee dienten dieverschiedensten Präzedenzfälle „dem Beweis der Kontinuitäten“. Entsprechend blieb den jeweiligen Gegnernals Kampfmittel nur die Entlarvung der Beispielbezüge als Scheinkontinuitäten. Solche Exempla-Destruktionwar – auf dem Niveau eines Johann von Salisbury – im besten Sinne des Wortes mittelalterlicheIdeologiekritik.642
Über den skrupellosen Umgang mit autoritativen Präzedenzfällen schreibt Johann eine sprühende Satire, eineweit ausholende Parodie des biblischen Exempla-Gebrauchs: Ein ambitiöser Anwärter auf den Bischofsstuhlbeweist mit unglaublichem Einfallsreichtum, wie jeder nur irgendwie mögliche Einwand gegen seineQualifikation durch den Vergleich seiner Fehler mit Eigenschaften biblischer Gestalten und Heiliger insGegenteil verkehrt werden kann. Auf drei Seiten der Edition von Webb folgen 45 Exempla, nach strengemSatzparallelismus geordnet, deren Menge auf die tendenzielle Unerschöpflichkeit billiger Ausreden hinweisensoll, aber zweifellos auch literarischer
642 Zum Exemplum zwischen Ideologie und Ideologiekritik vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 346 ff.; 347: „Laprincipale mission fut de prouver, par des précédents, des continuités“; ZIESE 7 ff.; s. S. 72, 74, 80, 474 ff. Zu den(seltsamerweise in der deutschen Mediävistik im Unterschied zu anderen historischen Disziplinen nicht selbstverständlichen)Begriffen Ideologie und Ideologiekritik vgl. die Rechtfertigungsbemühungen M. KERNERS in der Einleitung zu ‚Ideologieund Herrschaft im Mittelalter’, (WdF 530) Darmstadt 1982, 8 f.; Paul ROUSSET, Histoire d’une idéologie: La croisade,Lausanne 1983, bes. 14 ff. zur „sacralisation de la violence“. Ein entsprechendes Beispiel für die Ideologisierung desExemplum-Gebrauchs im Spätmittelalter zeigt HUIZINGA, Herbst (wie Anm. 541) 247 ff. in dem vierstündigen Plädoyerdes Jean Petit zur Rechtfertigung des burgundischen Herzogs, nachdem dieser Ludwig von Orléans umbringen ließ: Erverwendet etwa die „Urtypen“ des Verrats Luzifer, Absalon, Athalia etc. in langen Reihen; im übrigen benützt er denPolicraticus als Autorität (vgl. LINDER, wie Anm. 321, 349 und A. COVILLE, Jean Petit, La question du tyrannicide aucommencement du XVe s., Paris 1932; C.C. WILLIARD, The manuscripts of Jean Petit’s Justification. Some BurgundianPropaganda Methods …, in: Studi francesi 13 [1969] 271–80).
329
Spielfreude entspricht.643 Sie sind nach folgendem Typ gebildet: Der Kandidat ist niedrigen Standes, „aberauch Petrus war kein Patrizier“. Er ist minderjährig, aber auch Daniel war ein Knabe, als er die Greise in derAngelegenheit mit Susanna zurechtwies. Er ist Analphabet, „aber wir lesen nirgends, daß die Apostel zurSchule gegangen seien“. Er ist ein unberedter Klotz, aber auch Moses war von schwerer Zunge und Aaronsprach für ihn, u.s.w. Daß die Reihe auch um der delectatio willen so ausführlich geraten ist, beweisen groteskeÜbertreibungen wie diese: „Er ist einer Dirne nachgelaufen, aber auch Hosea umarmte auf Gottes Befehl dieHure“ (Gomer, nach Osea I 2). „Er ist töricht, aber durch die Torheit dieser Welt verhieß Gott den GläubigenErlösung“. „Er ist ein Säufer und Schlemmer, aber sogar der Herr soll ein Weintrinker und Fleischfressergewesen sein.“ Er übte bewaffneten Kriegsdient aus, aber auch Martin hat im Heer Julians gedient“. „Er ist einMörder, aber auch Moses hat einen Ägypter getötet“ und „Petrus das Schwert gegen Malchus gezückt“. Erhat die Pest, aber auch Christus, der Schmerzensmann, „hatte weder Gestalt noch Schönheit“ (Is. 53.2). Er iststumm wie Zacharias, blind wie Saulus in Damaskus, verstümmelt wie der Bekenner Paphnutius u.s.w. DerSchlußsatz lautet: „Kurzum, er ist zu allem ungeeignet, aber auch Samson hat die Philister nur mit einerEselsbacke
643 Pol. VII 19, (II) 175–8; vgl. MICZKA 39; WEBB, John (wie Anm. 28) 56 f. – Theoretisch wichtig sind folgendeStellen: die Einführung (175.8 ff.): Frustra enim, ut quemquam eorum excipias, aliquem oppones titulum, quia clamoreconductitio praevalente delebitur, concurrentibus exemplis et sanctionibus patrum. Ignobilis est, sed nec Petrus patriciusextitit … Abschluß (178.6 ff.): Ut paucis universa complectar, ad omnia ineptus est: sed Sanson in mandibula asiniPhilistiim expugnavit: potens est et nunc Deus de lapidibus suscitare filios Abrahae […] Nam ut ratione aut auctoritatereprobetur frustra expectas. Si ratione aut auctoritate niteris, consuetudinem, qua abutuntur et quam fecerunt, obicient […]Vgl. noch 180.17 ff.: Nec est quod error concurrentium sub praetextu multitudinis excusetur, quia vivendi forma aconviventium similitudine nequaquam trahitur [s. oben Anm. 636 zu Ep. 288], sed a verbo Dei […] Neque enim quod amultis peccatur peccatum non est; sed ideo gravius quia multum. Letzteres stellt eine Kritik am kanonistischen Prinzip vonC. I qu. 7, c. 14 (FRIEDBERG) 433 dar: Quociens a pluribus aut a turba peccatur, quia in omnes propter multitudinemvindicari non potest, inultum solet transire (auch in der Rhet. eccl. [wie Anm. 8] 23 f.; mit anderem Hauptsatz: … inultumtransit). Andererseits befestigt Johann mit seiner Exempla-Parodie die legistische Regel: non exemplis, sed legibusiudicandum est (s. A. 621). – Auf die um der Vollständigkeit und copia willen digressorischen Exempla-Häufungen in denfür Johann vorbildlichen Streitschriften des Hieronymus verweist OPELT, Hieronymus (wie Anm. 573) 181; vgl. dazu auchunten S. 385 ff.
330
erschlagen, und Gott kann noch heute aus Steinen Söhne Abrahams erzeugen.“644
76. Dieses Kabinettstück des typisch gelehrten Humors – es liest sich wie ein Kapitel aus ‚TristramShandy‘645– ist hier so ausführlich wiedergegeben
644 So ausgeklügelt und sarkastisch auf die Spitze getrieben die Beispiele wirken, so darf doch nicht übersehen werden, daßeine nicht ganz so sophistische, aber strukturell wesensverwandte Art, aus bibelexegetischen Subtilitäten juristischeKonsequenzen zu ziehen, durchaus zur (vornehmlich kanonistischen) Rechtspraxis gehörte. Vgl. etwa Rhet. eccl. (wieAnm. 8) 4: Zur These, ein Krimineller dürfe nicht Richter sein, wird als Beispielargument Christi Wort: „Wer ohne Schuldist, werfe den ersten Stein“ auf die Unschuld aller Urteilenden bezogen; als exempla contraria werden aufgezählt: Saul habetrotz seiner Missetaten, David trotz seines Ehebruchs, Salomo trotz seines Götzendienstes das Volk gerichtet. Dagegen seihinwiederum einzuwenden: 1. talis populus-talis propheta; Israel habe sündige Richter verdient; 2. Die Beispiele belegen,was geschehen durfte, nicht was geschehen soll, usw., usw. Einige Beispiele Johanns erinnern überdies an traditionelleArgumente zur Idoneitäts-Prüfung; vgl. ebd. 3 f.: 1. einige können, 2. andere dürfen ein Amt nicht übernehmen; ad 1: z. B.Taube, Stumme, Frauen, Knechte aller Art; ad 2: Verbrecher aller Art. Ebd. 6 f. die impedimenta: perversitas undignorantia. Ebd. 23 ff. eine vergleichbare Ausnahmeliste zur Lockerung des rigor canonicus bei Bischofswahlen (z. B.Mörder, die im Affekt getötet haben, sind aufgrund der Exempla Abraham und Petrus wählbar); Boncompagno,Boncompagnus (ed. L. ROCKINGER, Briefsteller u. Formelbücher …, Qu. u. Erört. z. bayer. u. dt. Gesch. IX 1–2,München 1863) I 169: Notula copiosa de […] potestatum electionibus mit langen pro- und contra-Reihen von Argumenten(wie: „er ist zu arm“ – „er ist zu reich“) als Inventio-Hilfe für Redner. – Vgl. auch WEIMAR, Argumenta brocardica (wieAnm. 566) 114 ff. zur juristischen Disputationsausbildung: Völlig unhistorisch behandelte, aus dem ursprünglichen Kontextgerissene Rechtssätze wurden wörtlich und überzeitlich als janusköpfige auctoritates genommen und in überaus vielfältigenund phantasiereichen Argumentationen (pro oder contra) erklärt.645 Der Vergleich ist nicht nur „impressionistisch“, da Sterne den allerdings ungenau zitierten Johann von Salisbury als„Autorität“ für die Verbindung von Scherz und Ernst anführt: Das Motto zu Buch III von ‚The Life and Opinions of TristramShandy, Gentleman’ lautet: „Multitudinis imperitae non formido judicia; meis tamen, rogo, parcant opusculis – in quibusfuit propositi semper, a jocis ad seria, a seriis vicissim ad jocos transire. – Joan. Saresberiensis, Episcopus Lugdun.“(sic.). Dies ist ein Amalgam aus Pol. VIII 25 (II) 425.1 ff.: Liber enim hic […] tibi domino stat aut cadit. Multitudinisimperitae non formido iudicia, meis tamen rogo parcant opusculis […] und Enth (minor) in Policraticum (ed. WEBB, Pol.)I 4 f., 5–9: Sic igitur nugas sparges, ne taedia gignant,/Quae rebus laetis sunt inimica nimis,/Si iubet ut nugas agites,nugare decenter:/Nam sibi per nugas serias credet agi./Utilibus nugas, sic aptes seria ludis,/Ut tibi sit gravium nullatimenda manus. Den Zusammenhang zwischen Sterne und Johann stellt inhaltlich und stilistisch auch R.K. MERTON her(s. oben Anm. 538). Zu dem hier gemeinten Bezug einer topischen Komik oder komischen Topik vgl. H. PETERS, Parodieund Kritik der Topik bei Laurence Sterne, in: D. BREUER/H. SCHANZE, Topik, Beiträge zur interdisziplinärenDiskussion, München 1981, 287–306. Leider kann hier dieses reizvolle komparatistische Thema nicht weiter verfolgt werden(vgl. auch unten Anm. 709, 949, S. 345). Immerhin sei noch erwähnt, daß Lichtenberg seine sog. „Sudelbücher“ u. a. auchin Anlehnung an obiges Tristram Shandy-Motto Jocoseria intituliert hat; vgl. H. HEISSENBÜTTEL, Als ich meineGedanken- und Phantasie-Kur gebrauchte, Zur Struktur der Sudelbücher von Georg Christoph Lichtenberg, (Akad. d. Wiss.u. d. Lit. Mainz 1985.1) 5.
331
worden, weil darin die Verzerrung deutlich macht, was bei jedem, auch Johanns eigenem Exemplagebrauchgeschieht: Das Exemplum kann wie jede bloß zitierte Autorität von sich aus keinen sensus begründen. Es istzunächst „Buchstabe“, der durch ratio und Gnade auf den „Geist“ bezogen werden muß. Deshalb ist es aberauch allem rhetorischen (demagogischen, rabulistischen) Mißbrauch ausgesetzt. Der komische Unsinn desPassus rührt größtenteils von der Ungewohntheit und Gesuchtheit der Kombinationen zwischen exemplumund causa, littera und sententia her.646 Das Exemplum ist somit einerseits dem Topos der rhetorischeninventio-Lehre verwandt, andererseits gleicht das Aktualisierungsverfahren, mit dem es auf den Vergleichsfallbezogen wird, der Allegorese. Wie der Topos begründet es vorgängig Einverständnis über Unzweifelhaftes undempfängt danach seinen eigentlichen persuasiven Sinn durch die besondere Parteinahme dem Problemgegenüber;647 wie die Allegorie birgt es als Erscheinung und „Buchstabe“ einen im rechten „Geiste“ zuerschließenden tieferen Sinn. Doch nicht Erkenntnis der unsichtbaren Wirklichkeit aus sichtbaren Zeichen istdas Hauptziel, sondern Überzeugung durch eine certa significatio aus dem Bereich solcher spirituellenKorrespondenzen.648 Das Exemplum bildet so eine Übergangsform
646 Vgl. D. MacDONALD, Proverbs, Sententiae and Exempla in Chaucer’s Comic Tales, The Function of ComicMisapplication, in: Spec. 41 (1966) 453–65 zu ähnlichen parodistischen Verdrehungen Chaucers. Der Intention nach sindjedoch andererseits die Bibelparodien der Reformationszeit mit Johanns satirischem Exemplagebrauch verwandter; vgl. K.HOFFMANN, Typologie, Exemplarik und reformatorische Bildsatire, in: ‚Spätmittelalter und frühe Neuzeit’, II, Stuttgart1977, 189–210, hier 192 ff. (195 auch die Inversion des Kinnbackenbildes auch I Reg. 10.1–10).647 Vgl. §§ 78, 90, 99. VIEHWEG 38: „Die Topoi, die helfend eingreifen, erhalten jeweils ihren Sinn vom Problem her. IhreHinordnung auf dieses bleibt ihnen immer wesentlich. Denn im Hinblick auf das jeweilige Problem erscheinen sie nacheinem durchaus nicht unveränderlichen Verständnis passend oder unpassend.“648 Vgl. unten § 101. Allegorien haben grundsätzlich mit Exempla die Kontextabhängigkeit gemein: vgl. OHLY, Schriften9 f.; H. REINITZER, Über Beispielfiguren im ‚Erec’, in: DVJs 50 (1976) 597–639, hier 599 f. – Vgl. auch LAUSBERG§ 421 zu Quint. VIII 6.52: Est in exemplis allegoria si non praedicta ratione ponantur. Das allegorische Exemplum derTropenlehre entsteht durch vorgängige Dunkelheit über die wahre, später überraschend bekanntgegebene Absicht derBezugnahme auf die causa (m.a.W. ist die Kontextualität hier verhüllter, dem Rätsel verwandt).
332
zwischen der rhetorischen und der exegetischen Methodik und irritiert den modernen Betrachter von beidenSeiten her durch die Beliebigkeit der möglichen Sinngebungen, um nicht zu sagen: Sinnverdrehungen oderManipulationen.648a
Einmal mehr zeigt sich hier, daß das Exemplum nur als literarische Funktion, nicht aber als (Erzähl-)Gattungdefiniert werden kann. Es gehört als „Sonderfall der weiteren similitudo“649zu den Sinnfiguren dersemantischen Weitung oder des amplifizierenden Vergleichs und wird, wo die Kurzform der Anspielung nichtausreicht, zum erzählerischen Exkurs (narratio als digressio).650 Nach rhetorischer Theorie muß vor allemklar zwischen dem Exemplum als reinem Sachverhalt vor der Applikation, als bloßer historischerVorgegebenheit, und dem Exemplum als aktualisiertem, intentional auf einen bestimmten Fall bezogenemVergleichsobjekt unterschieden werden. Denn es gehört zu den „von außen dem Fall zugeführten Beweisen“(quae extrinsecus adducuntur in causam),651 ist kein mit dem Fall selbst gegebener, aus dem Fall ableitbarer,rhetorische Kunst erübrigender (d. h. kein „unkünstlicher“) Beweis wie etwa das Indiz, die Urkunde oderZeugenaussage vor dem Richter. Es muß als probatio artificialis vom Redner zuerst anderswo (in derGeschichte) aufgefunden werden (inventio) und dann „mit Kunst“ herbeigeführt, der Sache einfallsreicheingefügt oder auch nur aufgesetzt werden (inductio in causam). Unter einem andern Gesichtspunkt, dem derGewichtung der historischen Analogie oder des inneren Zusammenhangs mit dem Fall, steht das Exemplumjedoch wiederum den „unkünstlichen Beweisen“ – insbesondere den praeiudicia (in ähnlichen Fällenergangenen Gerichtsurteilen) – nahe. Das vergangene Beispiel, das an sich von der gegenwärtigen causaunabhängig ist, wird durch die rhetorische Inbezugsetzung wie ein immanent zur Sache gehöriger Vor-Verweisbehandelt. Grundsätzlich versucht der Redner, dieses „Als ob“ zu tarnen und den selbst hergestellten Bezugzwischen zwei historischen Realitäten als einen objektiven, immer schon gegebenen und ernstzunehmendenzu empfehlen, während sein Gegner
648a A. MICHEL, Rhétorique et philosophie (wie Anm. 546) 366 f. sagt mit Bezug auf gewisse billige Sokratesvergleichez. B. in Ciceros Strafverteidigung Pro Milone: „Nous sommes ici au plus bas niveau de l’éloquence […] La philosophie […]n’est plus pensée, mais figure de pensée, exemplum, similitudo.“ Der große Weise als „Redeschmuck“!649 Vgl. LAUSBERG § 400 ff., bes. 410 und 422; Quint. V 11.5–6.650 Vgl. LAUSBERG § 415 und S. 61 ff., 200, 350 f., 583 ff.651 Vgl. LAUSBERG § 411 und oben S. 73 ff.
333
dieses Verhältnis aufzulösen und als willkürliche, scheinhistorische Konstruktion zu entlarven trachtet.652 Dasverfügbare rohstoffliche Faktenmaterial kann bei dieser Auseinandersetzung ganz beliebige Bedeutungenannehmen; es wird gewissermaßen zum metahistorischen Spielfeld der Einbildungskraft und zur Fundgrube für„wahrscheinliche Beweise“. Den Exempla fehlt somit die Verbindlichkeit objektiver (etwa faktenhistorischer)oder immergültiger (etwa heilsgeschichtlicher) Festlegung.653
77. Die angeführten Polcraticus-Beispiele zeigen, wie virtuos nicht nur die Exempla selbst, sondern auch diejeweiligen Deutungskriterien nach Bedarf,
652 Zum strategischen „Als ob“ vgl. auch HONSTETTER 91 f. – Hier trifft die vielleicht etwas zu generöse Typologie-Definition LAUSBERGS (Elemente § 404) durchaus etwas Wesentliches: „Wird das exemplum nicht nur als Mittel derBeweisführung oder des ornatus benützt, sondern als historisch bedeutsamer Bezug zweier historischer Realitäten ernstgenommen, so wird es zum typus.“ Vgl. S. 72 ff., 74 ff., 102 f. E. AUERBACH, Figura, in: Arch. Roman. 22 (1939)436–89, hier 468 = ders., Gesammelte Aufsätze z. Roman. Philol., Bern 1967, 55–92, hier 77: „Die Figuraldeutung stellteinen Zusammenhang zwischen zwei Geschehnissen oder Personen her, in dem eines von ihnen nicht nur sich selbst, sondernauch das andere bedeutet, das andere hingegen das eine einschließt oder erfüllt. Beide Pole der Figur sind zeitlich getrennt,liegen aber beide, als wirkliche Vorgänge oder Gestalten innerhalb der Zeit.“ Streng genommen sind demgegenüber Exemplaund Allegorien keine implizit realen Bezüge, sondern intentional hergestellte; sie tragen den Zweitsinn erst in die Geschichtehinein. F. OHLY (Typologie als Denkform [wie Anm. 234] 70) schreibt darum: „anders als übriges dichterischesAllegorisieren blieb sie [die typologische Denkform] auch davor bewahrt, zu einer Spielform des Verstandes und Witzes zudegenerieren.“ Zu der hier zutage tretenden Abwertung des Nicht-Typologischen und des literarischen Unernstes sowie zu derrhetorischen Möglichkeit, gerade und erst recht den traditionell fixierten Ernstbezug argumentativ zu verwerten und so aufeiner nächsten Bedeutungsstufe wieder als Spiel debattierbar zu machen und in Frage zu stellen, vgl. §§ 100 f.653 Dennoch gibt es Übergänge und Grenzphänomene zwischen den „künstlichen“ und „unkünstlichen“ Bezügen. In dembereits in ‚Lucans tragedia’ (wie Anm. 368) 167 ff. analysierten Pol.-Kapitel VIII 23 gegen das Schisma haben sehr ähnlichklingende Aussagen insofern verschiedenen Ernstheits-Grad. Zu Beginn steht eine Überbietung des gesamten Pharsalia-Stoffs (II 400.19 ff.): Concitata sunt iterum bella civilia, et Caesarem et Pompeium et quicquid Philippis, Leucade,Mutinae, in Egipto Hispaniave praesumtum est, quicquid impie gestum, pugna sacerdotalis absolvit. Am Ende (404 f.)lesen wir folgende apokalyptisch getönte, heils- und kirchengeschichtlich ernstzunehmende Parallele: Oret unitatis integritas[…] ne deficiat fides et expetens in cribro Sathanas non disperdat, conculcet et triticum […] Quiescant ergo stantes a longecum Petro ut videant finem (Luc. 22.31–2; Matth. 26.58) Dennoch werden unter dem rhetorischen Aspekt Beispiele wieBrutus und Petrus gleicherweise als „lebende Metaphern“ (Ricoeur) eingesetzt. Zur metaphorischen Aktualisierung vgl. auchunten Anm. 942.
334
bzw. je nach Parteiinteresse hin- und hergewendet werden können. Braucht der Gegner Exempla im Sinne der„Statistik“, um die Regelmäßigkeit oder Häufung eines Phänomens nachzuweisen, so werden sie aufgrund derMinderwertigkeit bloßer consuetudo oder Üblichkeit abgelehnt. Umgekehrt werden abgelegene oder selteneExempla als nicht repräsentativ nach dem Prinzip der Vertrautheit entwertet. Im Extremfall genügt alsWiderlegung das argumentum e silentio, der Beweis aus dem Fehlen von Exempla zu einer Position. EinExemplum wird im Literalsinn, das andere in irgendeinem übertragenen Sinn vorgebracht, bzw. widerlegt. Dieeigenen Exempla folgen also oft der dem gegnerischen Verfahren hermeneutisch entgegengesetzten Methode,so daß man sich nicht auf der gleichen Bedeutungsebene trifft.654 Denn das Exemplum wird nicht wegenirgendeines in ihm selbst liegenden, denotativ unzweideutigen Inhalts – und schon gar nicht um derhistorischen Information willen – angeführt, sondern stets funktional und situativ, als ein nur aus seinenKonnotationen verständliches Beweismittel. Es steht insofern jenseits
654 Zu den antiken Arten der Widerlegungen: durch Anführung von Gegenbeispielen, Bestreitung der Angemessenheit(Vergleichbarkeit), Hervorhebung des Ausnahmecharakters der gegnerischen Exempla usw. vgl. HONSTETTER 191 ff.;McCALL 181 aufgrund von Anaximenes (Ps.-Arist.) Rhet. 1403a, Quint. V 13.23–24 und der Redepraxis Ciceros; vgl.insbesondere Quint. V 13.24: exempla varie tractanda sunt, si nocebunt: quae si vetera erunt, fabulosa dicere licebit, siindubia, maxime quidem dissimilia. Vgl. auch Anm. 281. Eine systematische Liste von Widerlegungsmöglichkeiten denfeindlichen Exempla gegenüber gibt die Rhet. eccl. (wie Anm. 8) 25 ff. 40–50; Kriterien sind z. B. tempus, causa, voluntas,personarum diversa qualitas, prophetiae completio exemplorum, circumspecta interpretatio privilegiorum, exemplorumcontra exempla inductio; überdies modi conciliandi bei der Urteilsbildung, wie: situs locorum, status praesentis et illiustemporis, multiplicitas significationum usw. Vgl. auch S. 318 ff., A. 486, 497; WEIMAR, Argumenta brocardia (wieAnm. 566) 117 ff. zur juristischen Entscheidungsfindung, die nicht durch die Autoritäten selbst, sondern durch diezustimmungsfähige Abgrenzung ihres jeweiligen Geltungsbereichs im Einzelfall erzielt wurde. – Zu ratio vs. consuetudo s.§ 74. Zum Vertrautheitsprinzip s. S. 320. Wenigen, mühsam aus den Fingern gesaugten Exempla des Gegners werden etwain Pol. I 4, (I) 29 ganze Exemplareihen entgegengeschleudert (s. oben § 54). Zeitlich ferne werden durch jüngere z. B. inPol. IV 6, (I) 253 (oben S. 201 ff.), obskure durch berühmte Exempla z. B. in Pol. II 25, (I) 136 überboten (obenAnm. 630). – E silentio-Argumente („ich lese nirgends davon“, „nirgends finde ich Beispiele“) etwa in Pol. I 4, (I) 28 f.:nusquam sanctum legisse venatorem, oder in Pol. V 6, (I) 305.8: salvator risisse non legitur; Ep. 176, (II) 168: Omniumtemporum seriem percurramus: quem ab inicio invenimus electorum de deliciis migrasse ad delicias? quem legimus hicfloruisse et exultasse cum mundo, et nunc in ubertate fructum laetari et regnare cum Christo? (an Thomas Becket). Pol. VII19, (II) 171.5: nichil tale in illa gloriosa familia Christi legimus. Pol. VIII 13, (II) 324 s. unten in Anm. 944.
335
von Gut und Böse; einzig das Beweisziel, dem es dient, macht es bewertbar. Kaum ein Autor hat dieser Artvon Beweisführung und pädagogisch-polemischer „Abzweckung“ von Exempla größere Berühmtheit für dasMittelalter verschafft als Johanns Hauptvorbild Hieronymus. Insbesondere seine Libri adversus Iovinianumsind eine einzige virtuose Widerlegung der Exempla des ehefreundlichen Gegners durch überraschende,spitzfindige Uminterpretationen, allegorische, bzw. literale „Ehrenrettungen“ der eigenen Ehefeindlichkeit,etwa nach dem Modell: Henoch wurde nicht weil, sondern obwohl er verheiratet war, ausschließlich wegenseiner Frömmigkeit entrückt; Isaak war vermählt, aber einzig als Typus Christi und der Kirche; ebenso sinddie Frauen Jakobs ausschließlich Allegorien für Synagoge und Kirche; David und Salomon waren mehrfachverheiratet, weil sie auch sonst Sünder waren, doch zeigt sich klar der Fortschritt vom Alten zum NeuenBund: hier das Fruchtbarkeitsgebot aus Gen. 1.28, da aber das Jungfräulichkeitsgebot; Zacharias und Elisabethwaren darum verheiratet, weil sie noch nicht zum Neuen Bund gehörten, u.s.w.655
Auch darin folgt Johann seinem einfallsreichen Vorbild, daß er zeitgenössische Ereignisse, ja sogar seineeigenen Erlebnisse mehr „zitiert“ als berichtet, daß er den Erzählinhalt so gezielt dem argumentativenKontext unterordnet, daß uns die davon unabhängige Erst-Bedeutung meist nicht mehr oder nur äußerstschwer – etwa psychologisch-biographisch – rekonstruierbar ist.656 Über Seneca, das gemeinsame Modell fürHieronymus und Johann, wurde in einer das ganze Verfahren autobiographischer Argumentation treffendcharakterisierenden Weise gesagt:657 „Nichts sagt er für sich gleichsam
655 Vgl. WINTERBOTTOM (wie Anm. 550) 69 zu Hier. in der „legacy“ der Deklamatoren; OPELT, Hier. (wie Anm. 573)43 ff., 191 (auch zu den erwähnten Beispielen); GEERLINGS 163 allgemein zur „pädagogischen Abzweckung“ patristischerExempla; vgl. auch S. 474 ff., 482. Zu Johanns Verhältnis zu Hieronymus s. S. 288, 347 ff., 461 ff., 477 ff.; allerdingsauch S. 325 eine Kritik an einer allzu einfallsreichen Hier.-Stelle.656 Vgl. S. 232 ff., 206, 322 ff., 349 f.657 H. DAHLMANN, L. Annaeus Seneca, Über die Kürze des Lebens, München 1949, 11 (nach GEBIEN 170). Zu Senecavgl. auch ähnlich CANCIK (wie Anm. 38) 71 f., 76 ff., 89. – Auch das in utramque partem-Prinzip spielt hier einepädagogische Rolle, da Seneca an seinem eigenen Beispiel die Schwierigkeiten, philosophische Gewißheit zu erlangen,erläutert; s. etwa Ep. 52.1: Fluctuamur inter varia consilia. (Zur Rezeption Senecas in dieser Hinsicht vgl.MEERSSEMANN [wie Anm. 405] passim.; SCHON 34 ff., 44 ff. und S. 168 ff., 347 f.). Ähnliches hat H. RAHN fürCicero in seinem (für das Verständnis der rhetorischen Denkform) wichtigen Beitrag: Cicero und die Rhetorik (Ciceroniana 1[1959] 158–79 =) in: Ciceros literarische Leistung (wie Anm. 546) 86–110, hier 92 f. hervorgehoben: Gegen denanachronistischen Versuch, eine biographisch erklärbare Stilentwicklung aus Ciceros Reden zu rekonstruieren, spreche dasWesen rhetorischer Prosa, in der sogar die Ich-Aussage nur eines von vielen „jeweils als passend empfundenen Stilmittel“darstelle. „Entscheidend ist für die Darstellungsform nicht ein sich entwickelndes Ausdrucksbedürfnis des sprechendenSubjekts, sondern das von der Sache, vom Objekt her sachlich-objektiv Erforderliche“. Den für uns nicht mehrselbstverständlichen Zusammenhang von Parteirede und Seelenleitung stellt in diesem Zusammenhang schön das Cicero-LobQuintilians (6.1.85) her: summus tractandorum animorum artifex.
336
monologisch, auch das nicht, was er über sich sagt, sondern alles im Blick auf die Anderen, zunächst auf denAdressaten, den er mahnen, erziehen, heilen will und dem er jeweils gerade das von seinen philosophischenLehren vorträgt, was ihm dienlich ist, nicht das, worin im Augenblick bei ihm selbst der Einklang von Lebenund Lehre besteht.“ Johann selbst hat im Policraticus-Prolog diesen überpersönlichen Charakter derSeelenleitung bei Seneca und Hieronymus hervorgehoben, um sein eigenes persönliches Verhältnis zumAdressaten Thomas Beckett insinuatorisch in der paradigmatisch-didaktischen Konstellation zukaschieren:658 „So ermahnt Seneca, andere belehrend, seinen Lucilius; so schreibt Hieronymus an Oceanus undPammachius, geißelt aber meist die Unsitten anderer […]. Wenn nun hier jemandem etwas zu hart klingensollte, so soll er wissen, daß nichts für ihn gesagt wird, sondern für mich und meinesgleichen, für solche ‚diesich mit mir bessern möchten oder die im Ungeschick jede Kritik gleichmütig ertragen!“ Darum bildetJohanns (immer wieder ausschließlich biographisch ausgewerteter) Konflikt der zwei Seelen eines Hofbeamtenund eines Philosophen in einer Brust auch eine didaktisch-rhetorisch stilisierte Miteinbeziehung der eigenenPerson als Quelle von Exempla.659
658 Pol. Prol. (I) 15 bereits oben in Anm. 474 zitiert; vgl. § 88, S. 207, 402 ff., 576. – Obwohl Montaigne weder eine„interessiert“ rhetorische noch eine pädagogischlehrhafte Prosa schrieb, finde ich aufgrund von TOURNON (265 ff., 292 ff.)eine Verwandschaft zu den erwähnten Formen autobiographischer Argumentation oder Reflexion darin, daß er nichtselbstzweckliche Introspektion betreibt, sondern sich primär kommentierend den eigenen wie den fremden „Texten“ (bzw.Reminiszenzen) entlang bewegt, um den Einzeldaten philosophische Probleme abzugewinnen. „Montaigne juge et ne songepas à ‚se peindre’.“ Selbst dieser vermeintliche Vater des modernen Subjektivismus läßt sich mit einem psychologisch-biographischen Deutungsansatz kaum verstehen.659 Vgl. etwa die autobiographischen Deutungen MISCHS 1157 ff. (oder auch HUIZINGA [wie Anm. 31] 209 zu Pol. VIII24). MISCH sah das Problem durchaus, wenn er es auch anders bewertete: für ihn (1272) ist Johann kein „echter“Autobiograph, sondern ein illustrierender Anekdotenerzähler, was den oben § 88 angeführten Urteilen über denRealitätsgehalt entspricht. Die oben Anm. 564 zitierte Briefstelle aus Ep. 256 über die Idylle des geistigen Lebens amerzbischöflichen Hof von Canterbury könnte im übrigen als Widerlegung der autobiographisch unterstützten HofkritikJohanns ausgelegt werden, wäre nicht auch hier der Kontext (einer brieflichen petitio durch eine miseratio im Exil) wichtigerals die persönliche Aussage. – Die Stilisierung betont gegen biographische Überinterpretationen auch UHLIG (wieAnm. 577) 40. Vgl. auch S. 232 ff. (zur „Buchhaftigkeit“ von Selbstzeugnissen).
337
78. Die hermeneutisch ausschlaggebende Kontextabhängigkeit ist ein Hauptmerkmal allen Exempla-Gebrauchs seit der Antike. Immer und überall wurden Personen und Ereignisse künstlich aus der historischenWirklichkeit herausgelöst, ihrer individuellen Identität entkleidet. Derart zu Typen, Symbolen, Emblemen,Metaphern transformiert, vertraten sie als Ganze nur noch bestimmte ihrer Einzeleigenschaften.660 DieBeziehung zwischen dem historischen
660 Diese Wesenszüge sind in der Forschung zum Exemplum weitgehend unkontrovers (sogar die Spezialisten deshomiletischen Exemplums machen hier keine Ausnahme); umso bemühender wirkt die verbreitete Verkennung dieserEigenschaften im Rahmen monographischer Untersuchungen zu einzelnen Autoren, die Exempla verwenden (s. S. 346 ff.). –Vgl. etwa COENEN 7 ff. zum aristotelischen Beispielargument als kontextabhängiger „Verbrauchsrede“; KORNHARDT 10,20 ff. zu dem schon etymologisch (ex-emere, ex-emptum) auf „Kostprobe, Warenmuster“ bezüglichen, als pars pro toto oderunum de multis oder „Herausnehmen eines Einzelfalls“ definierten römischen Exemplum, das nicht eine ganze Persönlichkeit,sondern eine Eigenschaft repräsentativ als „Probe“ vorführt; ebd. 65 ff. zu kasuistischen Diskussionen über den jeweiligenWert der getroffenen Qualitäten-Auswahl; 86 zur Multifunktionalität von Exemplasammlungen, die „von jeher etwasMinderwertiges“ sind, da nur der Benutzer, nicht der Verfasser derselben „literarische Leistung“ erbringe; ALEWELL 95 zurbereits antiken Stereotypie mancher Qualitäten-Exempla laut Val. Max. II 10.8 (oben Anm. 169 zitiert); DORNSEIFF218 ff. zur römischen Reduktion argumentativer Möglichkeiten des Exemplums auf die „Verkörperung“ moralischerEigenschaften (s. S. 68; HONSTETTER 20 f., 82 ff., 91, 96 f. zum kasuistischen Interesse des Val. Max. für Exempla mitgegensätzlichem Deutungspotential; dazu auch GUERRINI 15, 25 ff. (s. S. 342); NORDH 225 f., 229–232 zur Identifikationvon Person und Eigenschaft als „Synekdoche“ und zur kanonischen Fixierung eines Zuordnungssystems von Namen undEigenschaften; DAVID, Maiorum exempla 74 ff., 80 ff., 85 zum antiken Exemplum als „projection métaphorique“ von einerPerson auf eine andere aufgrund des sakrosankten, konsensstiftenden mos maiorum, auf den alle Exempla, auch die in einer„juxtaposition métonymique“ (LÉVI-STRAUSS) zu Exempla-Ketten verknüpften, entindividualisiert zurückverweisen, wobeidie Angebrachtheit des Vergleichs, nicht die Autorität des Vergleichsmittels diskutierbar blieb. GEBIEN 44 f. zur konträrenVerwendungsweise gleicher Beispiele, die abgesehen von ihrer Ausrichtung auf das jeweilige Beweisziel „keinerleiEigenwert“ haben; ebd. 66 f.: zum Bildungsprogramm der Rhetorenschule, das nicht Geschichtskenntnis, sondern Exempla-Anwendung durch Geschichtsverzettelung lehren wollte; ebd. 112 ff., 160 ff. zu Senecas kontextgebundener, oft sehrunterschiedlicher Personenbeurteilung; FUHRMANN, Exemplum 451 f. zur Intentionalität und politischen Problematikantiker Exempla aufgrund deren je einseitiger Eigenschafts-Isolation, zu der jeweils ein eigenes Gegenbeispiel paßt. Ähnlichauch MICHEL, Rhétorique et philosophie (wie Anm. 546) 485 ff. zu Cic. – H. von CAMPENHAUSEN, Die Entstehungder Heilsgeschichte, Der Aufbau des christlichen Geschichtsbildes in der Theologie des 1. u. 2. Jhs., in: Saeculum 21 (1970)189–212; hier 191: Die frühchristlichen Exempla sind noch wie die römischen zu punktuellen Vergleichszwecken imGegensatz zu heilsgeschichtlichen Daten beliebig und ahistorisch verwendbar; BUISSON, Entstehung 103 ff.; Exempla458 f.: Chiffrierung vielfältiger Lebenswerte in Personen macht Exempla „außerordentlich auslegungsfähig“ und führt zuvirtuoser Hermeneutik; GRAUS (wie Anm. 176) 29 ff.: Typisierung historischer Gestalten als Verhaltens-Symbole;SULEIMAN (wie Anm. 320) 471 ff.: extreme Interpretationsbedürftigkeit mal. Predigtexempla. – DAXELMÜLLER,Exemplum 632; ders. Ex. u. Fallbericht 152 ff.: Exemplum und Gegenexemplum aufgrund derselben Materie in der frühenNeuzeit. TOURNON 50 ff., 109 ff. zu Montaignes bewußtem Spiel mit der Polysemie von Exempla und Zitaten inverschiedenen Kontexten. – Vgl. auch §§ 24, 85, 90, 96, S. 44 ff., 334, 462 f.
338
Kern einer solchen Qualitäten-Hypostasierung und dem Exemplum war dabei nicht von vornherein festgelegtund eindeutig. So ist etwa Caesar in der christlichen Überlieferung eine weitgehend entpersönlichte„Synekdoche“ für die zwei gegensätzlichen Eigenschaften der Tyrannei und der clementia.661 Gerade die amallgemeinsten verwendbaren Exempla, wie das suasiv schlechthin unbegrenzte Exemplum Christi oder auchschon summative „Inbegriffs“-Exempla wie Cato und Maria, die beide die vier Kardinaltugenden und dieTugend schlechthin verkörpern, sind im jeweiligen Traditionsverständnis unantastbare historische Modelleund zugleich hinsichtlich der Applikation debattierbare Zeichen für Überhistorisches.662 DieseAuslegungsvielfalt
661 Vgl. A. HEUSS, Art. Caesar, in: RAC II 822 f.; J.M.A. BEER, A Medieval Caesar, (Etudes de Philol. et d’Hist. 30)Genf 1976, 72 ff., 195 ff. u. ö.; von MOOS, Lucans tragedia 133 f., 143 ff. und bes. Anm. 54; hier sowie CARY (wieAnm. 179) 79 zur ähnlich doppelsinnigen Alexander-Tradition.662 Exemplum Christi: s. §§ 24 ff. – Cato: Vgl. J.M.A. BEER, A Medieval Cato – Virtus or Virtue, in: Spec 47 (1972)52–59; MARTI, Literary Criticism (wie Anm. 457) 258 f. und Glosule (wie ebd.) XLI f.; von MOOS, Lucan und Abaelard(wie Anm. 631) 434 f. und unten Anm. 870. Andere berühmte antike Symbolexempla sind Odysseus (s. oben § 49 und etwaOv. Pont. 4.10.9: exemplum est animi nimium patientis Ulixes) oder Alexander (s. Anm. 661 und S. 347 ff.; LEEMAN 255zu Curtius Rufus und Val. Max.). Maria: Vgl. CARTER (wie Anm. 326) 128 zu Wilhelms von Malmesbury Übertragungvon Cic. Inv. II 53–4 auf die Vorstellung einer totalen Tugendverkörperung in der Gottesmutter. PERELMAN (wieAnm. 10) 123–6 erläutert sein „modèle“-„antimodèle“-Begriffspaar mit den zwei „incarnations indubitables“: Gott und Satan,die alles einbegreifen und sich allem anpassen lassen, die in rhetorischer Hinsicht (aufgrund minimaler historischerKonkretheit) den Vorteil der Universalität mit dem Nachteil der Beliebigkeit verbinden (vgl. dazu auch unten §§ 99, 101,S. 462 f. zum „Spiel“ mit religiösen Exempla).
339
und Beliebigkeit der Anwendung bestimmter Exempla schmälert weder die Verbindlichkeit der damitintendierten causa noch die „historische Größe“ oder Bedeutsamkeit solcher polyvalent funktionalisierterGestalten. Die Personen der Exempla waren im Mittelalter zwar nicht mehr ausschließlich positive Heldenwie die römischen maiores, aber sie waren (innerhalb einer festgelegten, mehr oder weniger breiten Skalamöglicher Qualitäten oder Interpretationen) immer für bestimmte Tugenden oder Laster in hervorragender,unzweifelhafter Weise repräsentativ. Gerade die unanfechtbare Geltung dieser typischen Repräsentantenmenschlichen Verhaltens machte die Aktualisierung dessen, wofür sie ad hoc stehen sollten, so kontrovers.663
Mit Bezug auf die Beispiele einiger hochmittelalterlichen Humanisten schrieb Wolfram von den Steinen:664
„Das Altertum war […] die
663 Vgl. SPIEGEL 320 f. und oben Anm. 660 (zu DAVID, FUHRMANN, BUISSON, DAXELMÜLLER), von MOOS,Lucans tragedia 133 f., 168 f., 183 f.; vgl. auch §§ 21, 81 f., 99. Auf die Exempla trifft also auch zu, was oben §§ 66 f.zum theologischen und rechtswissenschaftlichen Argumentationsverfahren mit widerstreitenden Autoritäten gesagt wurde: Siewerden als Teile, Fragmente eines vorausgesetzten oder zu findenden Ganzen (und zwar bis ins Detail) ernstgenommen. WieH. COING (Hb. wie Anm. 550, 69 ff.; ähnlich auch WEIMAR, Argumenta brocardia, wie Anm. 566, 116 ff.) in einermentatilitätsgeschichtlich bedeutsamen Beobachtung festhält, ist das „Allgemeine“ nicht ein übergreifendes System, aus dem„deduziert“ werden könnte, sondern ein geheimer Zusammenhang (wie derjenige der vier Elemente, der alle Körperteile,Körper und Erscheinungen des Kosmos aufbaut), der nur topisch über sichere Einzelstellen zugänglich ist. Die meist„bedeutungskundlich“-semantisch als (allegorische) Zeichen- und Verweishaftigkeit betrachtete „Ordnung“ hat also auch einewichtige argumentative Seite: Man haftet am Einzelnen, weil es das Allgemeine zu suchen gilt. Dies ist dieexemplarisch–induktive (nicht empirisch-induktive) Mentalität des Mittelalters. Zu deren erstaunlichen Weiterentwicklungdurch Montaigne s. jetzt TOURNON 28 ff., 148 ff. (Gloses et „leçons“; Le commentaire juridique).664 W. von den STEINEN, Der Kosmos des Mittelalters, Bern/München 1959/1967, 233; ähnlich auch ders., Humanismusum 1100, in: AKG 46 (1964) 1–20 = ders., Menschen im Mittelalter, Bern 1967, 196–214, hier 202. – J. LECLERCQ, TheImage of St. Bernard in the Late Medieval Exempla Literature, in: Thought 54.214 (1979) 291–302 spricht von „Symbolen“anstelle von „historischen Personen“ als Repräsentationen des Ideals, nicht der Wirklichkeit. M.D. CHENU, La théol. auXIIe s., Paris 1957, 219: „[…] pas seulement des illustrations à l’usage des écoliers ou des simples, mais des actions types,aptes à être la règle efficace, par leur contenu concret, des actions humaines, que par ailleurs dirigent les principes généraux“;OHLY, Typologie (wie Anm. 234) 71 von der Typologie gesagt, aber auf die Exempla übertragbar: „Anschauungen von derGeschichte aus der Sinnsuche; […] gezielte und aussparende Anleuchtungen.“ Vgl. auch HUIZINGA zum Bedürfnis,Geschichtliches als Idee zu sehen, oben in Anm. 545. – Von den STEINENS Begriff „Denkbild“ müßte nach G.N.KNAUER, Die Aeneis und Homer, Göttingen 1964, 356 dem griechischen Exempeldenken entsprechen, dem „der großeMensch, das bedeutende Ereignis weniger historische Verpflichtung als ein Bild allgemein menschlicher Schicksale war“.Vgl. auch oben § 9 (B. SNELL) und FOCKE, Synkrisis (wie Anm. 560) 367: „die durchaus griechische Neigung, abstrakteBegriffe plastisch zu verkörpern, Gedanken als Gestalten zu sehen oder gegebene Gestalten zu Trägern von Gedanken zumachen“; JENNINGS 215: „…men who symbolize man’s destiny in the world.“ Was hier als griechisch bezeichnet wird,dürfte aber ungefähr dem besonderen platonisierenden Zug, der manche Exempla Johanns mit denen der integumenta-Dichterseiner Zeit verbindet, entsprechen. Dazu schreibt CURTIUS, ELLM 69: „Vertrautheit mit den wichtigsten Beispielfigurenbleibt im Mittelalter als Requisit der gebildeten Poesie bestehen. Einen festen Kanon solcher Gestalten werden wir in derplatonisierenden Dichtung des 12. Jahrhunderts finden. Sie erscheinen dort als Archetypen, welche die göttliche Weisheitvorsorglich dem Geschichtsprozeß eingegliedert hat.“ Vgl. auch Anm. 667 sowie S. 462 f., 503 ff. Den präzisesten Beleg fürdiese Art Exempla-Metaphysik gibt wohl Alan von Lille im Anticlaud. VI 434 ff. (BOSSUAT) 153: Tunc Noys ad regispreceptum singula verum/Vestigans exempla novam perquirit ydeam./Inter tot species speciem vix invenit illam/Quam petit;offertur tandem quesita petenti./In cuius speculo locat omnis gracia sedem:/Forma Ioseph, sensus Ytide, potencia iusti/Iob,zelus Finees Moysique modestia, Iacob/Simplicitas Abraheque fides pietasque Thobie./Hanc formam Noys ipsa Deopresentat, ut eius/Formet ad exemplar animam. (Zum Vorbild: Bern. Silv. Cosmographia I 3 vgl. Anm. 26.) Dieplatonische Voraussetzung dieses Exemplum-Begriffs liegt noch in eigener Weise der späteren Emblematik zugrunde; nachA. SCHÖNE (wie Anm. 287) 50 setzt sich dem Bildbetrachter die „Wirrnis des Seienden in ein Mosaik von Sinnfigurenum; ihm zeigt sich […] ein von Bedeutungszusammenhängen durchwirktes Universum, in dem das Vereinzelte bezogen, dieWirklichkeit sinnvoll, der Lauf der Welt begreifbar erscheint und die in Analogien gedeutete Welt so zum Regulativ desmenschlichen Verhaltens werden kann.“
340
Welt, wo ein Sokrates, Archimedes, Seneca die großen Vorbilder der Überlegenheit über den Tod gaben; es wardie Welt, wo ein Diogenes, ein Fabricius den Reichtum verschmähten, dem heute alles nachjagt; es war dieWelt der heldenmütigen Freundespaare wie Orest und Pylades […] Nicht große Persönlichkeiten erschienendamit dem Auge, nicht einmalige, unvertauschbare Naturen, sondern mythische Sinnbilder für etwas, was allengemeinsam vorschwebte. Es erschienen Denkbilder in Menschengestalt; jeder dieser Heroen zeigte eine vonden großen Gaben und Aufgaben des Lebens in Vollendung.“
In Johanns Metaphorik erscheinen die „großen Männer der Geschichte“ als wegweisende „Sterne“ nicht nurfür ihre eigene dunkle Zeit, sondern als Exempla für immer: „Sokrates“ lehrt zeitlos „Genügsamkeit, FabriciusLoyalität, Odysseus Geduld, Titus Milde, Abel Unschuld, Enoch Redlichkeit,
341
Abraham Gehorsam“ usw.665 Das Bild der „ewigen“ Tugendrepräsentation stellt eine andere Art Synekdochedar, die an das Fragment einer unvollständigen Überlieferung und an die heikle exegetische Sinnsuche erinnert:Die vestigia philosophorum der Titelformel sind ebenso sehr die „Fußstapfen“, in die der Nachfolgende zutreten hat, wie die „Spuren“, „Überreste“, Zeichen oder Chiffren, die es zu finden, zu lesen oderaufzuschlüsseln gilt, damit das Ganze der Botschaft rekonstruiert werden kann.666 Wir gelangen damit aufanderem Wege zum gleichen Resultat: Verbindlichkeit und Mehrdeutigkeit der Exempla schließen sich nichtaus, sondern bedingen sich.
665 Pol. III 9, (I) 197 f.: Sit ergo venerabilis imago virtutis […] (wie unten Anm. 920 zitiert, dann:) Porro praedicti etconsimiles magni quidem et laudabiles viri quasi quaedam seculorum suorum sidera splenduerunt, illustrantes temporasua, praeambuli coetaneorum suorum in id iustitiae et veritatis quod dispositione divina illuxerat eis. Sic quoque insuccessionibus fidelis populi numquam humano generi ad noctis suae tenebras cecitatisque molestias depellendas suasidera defuerunt […] quorum exemplis ad cultum iustitiae semper alii provehantur. Nonne Abel innocentiam docuit, Enochmunditiam actionis… Zu erwägen ist hier auch der neuplatonisch-christliche (möglicherweise erigenistische) Hintergrund derLicht-Finsternis-Antithese mit Bezug auf die Erleuchtung der „Propheten“; dazu vgl. MEIER Eriugena … (wie Anm. 27)Kap. III.666 Vgl. §§ 115 ff. zum Titel; vgl. auch vestigia divinitatis in Pol. III 1, (I) 172 unten Anm. 732 im Zusammenhang mit derNaturbuch-Metapher. Met. II 18.96.6: … ut verbo comici utar, fere quot homines tot sententiae [Ter. Phor. II 4.14]. Nam demagistris nullus aut rarus est qui doctoris sui velit inherere vestigiis. Ut sibi faciat nomen, quisque proprium cuditerrorem (zum Kontext s. unten S. 450).
342
f) ‚Copia exemplorum‘: der Reiz der Vielfalt und Unordnung
Exempla-Sammlungen im Dienste der inventio locorum und die Trivialisierung der Topik (§ 79). VermeintlicheWidersprüche im Policraticus aufgrund der Verkennung des topisch-funktionalen Charakters von Exempla (§ 80).Glossierend-exegetische Denkform, kasuistische Gelehrsamkeit und Ästhetik der varietas in einem Beispiel: Brutus –Kindsmörder oder Patriot? (§ 81). Literarische und philosophisch-theologische Traditionsgrundlagen des hermeneutischenVielfaltsprinzips (§ 82).
L’Histoire justificie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusementrien, car elle contient tout, et donne des exemples de tout. –… le Passéest chose toute mentale. […] Les faits, par eux-mêmes n’ont pas designification. On vous dit quelquefois: Ceci est un fait. Inclinez-vousdevant le fait. C’est dire: Croyez. Croyez, car l’homme ici n’est pasintervenu, et ce sont les choses mêmes qui parlent. C’est un fait. Oui,mais que faire d’un fait? […] En l’histoire, comme en toute matière,ce qui est positif est ambigu. Ce qui est réel se prête à une infinitéd’interprétations.
Valéry, De l’Histoire, Discours de l’Histoire,ed. J. Hytier (Pléiade) I 1957,
1130, 1132 f.; II 1960, 935.
79. Um das richtige Exemplum auf die eigene Sache überzeugend anwenden zu können, braucht der Redner(oder Schriftsteller) nicht nur die Kenntnis aller verwendbaren „Denkbilder“ und Bedeutungsträger, sondernauch das Wissen um deren nützliche Konnotationen, um zustimmungsfähige (meist tradierte) Denkinhalteund Bedeutungen. Beides wurde durch die Gattung der Exempla-Sammlungen seit Valerius Maximus gefördert.Diese Kompendien stellten Material bereit und zeigten in den zugrundegelegten Einteilungskategorien erste,rudimentäre Zuordnungsmöglichkeiten. Die Masse der Geschichten fiel unter Rubriken, die von bestimmtenTugenden, Lastern und Affektzuständen abgeleitet waren. Das gleiche Exemplum konnte dabei unterverschiedenen Einteilungsgesichtspunkten mehrfach zur Verfügung gestellt werden.667 Seit der Antike bestandeine Hauptaufgabe des rhetorischen
667 Vgl. oben Anm. 660; KORNHARDT 65 ff.; BUISSON, Entstehung 103 ff.; HONSTETTER 82 ff.; LUMPE 1254;GEERLINGS 148 ff.; CARLSON 93, und besonders LEEMAN 253 f. zur Übereinstimmung der Deklamationsthemen mitden Einteilungskategorien des Val. Max., der kein Historiker, sondern ein Stofflieferant für Redner war; vgl. auch S. 287 f.zu Johanns Pol.-Überschriften. – Zum Begriff rubrica, der in der Jurisprudenz der Glossatoren über die technischeBedeutung: „kurze Überschrift“ hinaus eine inhaltliche Bezeichnung für argumentum generale, d. h. für ein zwiespältigesBrocarda-Problem wurde, s. WEIMAR, Argumenta brocardica (wie Anm. 566) 100 f.; vgl. auch S. 274 f. Desgleichen betontMICHAUD-QUANTIN (wie Anm. 871) 35 den ursprünglichen kirchenrechtlichen Sinn von „Rubrik“: für „questiondouteuse“, „cas“.
343
Unterrichts darin, berühmte Gestalten mit bestimmten moralischen Themen in Verbindung zu bringen. Aufpropädeutischer Stufe wurde die Herstellung möglichst vielfältiger Kombinationen dieser Art geübt; darauffolgte das Anwendungstraining: Die Bezüge wurden in gegebenen Redesituationen erprobt; Adäquatheit ad hockritisch besprochen oder kasuistisch debattiert. Es galt, das Gedächtnis soweit auszubilden, daß es zu jedemBeispiel schlagfertig ein passendes Gegenbeispiel finden konnte.668 An der Kontinuität diesesAusbildungsprogramms durch das ganze Mittelalter besteht kein Zweifel, auch wenn wir nur spärliche direkteQuellen über die konkrete Unterrichtspraxis besitzen. Viel verdanken dieser Tradition die seit demInvestiturstreit neu aufblühenden Streitschriften, in denen Exempla zum Gegenstand von
668 S. 245, 254, 337 f., 347 ff. KORNHARDT 20 ff.; SANFORD (wie Anm. 490) 28 ff.; NORDH 225;CAPELLE/MARROU 1000 f.; HAGENDAHL (wie Anm. 173) 311 ff.; H.STRASBURGER, Die Wesensbestimmung derGeschichte durch die antike Geschichtsschreibung, (SB Wiss. Ges. W. Goethe-Univ., Frankfurt a. M. V 3) 1966, 47 f.; H.WALTHER, Das Streitgedicht in der lat. Lit. des Mittelalters, München 1920, 7 ff.; H. NORTH, The Use of Poetry in theTraining of the Ancient Orator, in: Traditio 8 (1952) 1–33, bes. 22. – Johanns berühmte, in vielem für die ganzemittelalterliche Trivium-Bildung repräsentative Beschreibung des in Chartres betriebenen, betont imitativ-produktivenAutorenstudiums (Met. I 24, 54–6) betrifft nicht nur den Umgang mit Textstellen, sondern auch die Applikation vonExempla: Die nachzuahmenden Autoren haben in ihren Werken den erzählerischen Rohstoff, (rudem materiam historiae autargumenti aut fabulae; s. S. 60, 364, 397, 406, 411) vollendet integriert; Bernhard von Charttres empfahl nicht nur,geeignete poemata, sondern, auch historias auszuwählen und auswendigzulernen (54.14 ff., 56.24 ff.): Auctores excutiat, etsine intuentium risu eos plumis spoliet [cf. Hor., Ep. 1.3.18–20] quas (ad modum cornicule) ex variis disciplinis, ut coloraptior sit, suis operibus indiderunt. Quantum pluribus disciplinis et habundantius quisque imbutus fuerit, tanto elegantiamauctorum plenius intuebitur planiusque docebit. Illi enim per ‚diacrisim’; quam nos illustrationem sire picturationempossumus appellare, cum rudem materiam historie aut argumenti aut fabule aliumve quamlibet suscepissent, eam tantadisciplinarum copia et tanta compositionis et condimenti gratia excolebant, ut opus consummatum omnium artiumquodammodo vidererur imago [… s. Anm. 423 …] Historias, poemata percurrenda monebat diligenter […] et ex singulisaliquid reconditum in memoria, diurnum debitum diligenti instantia exigebat. Zu dem m. W. noch ungeklärten Begriffdiacrisis (lt. McGARRY [wie Anm. 433] s. l. 66: Mart. Cap. De nupt. 5.524; Cassiod. In Ps. 30.11; 90.1; 125.4; hier aberüberall in anderen Bedeutungen) vgl. WETHERBEE (wie Anm. 394) 24 f.; zum Begriff illustratio vgl. (in andererBedeutung) Quint. VI 2.32, oben Anm. 450 zitiert, sowie BOSKOFF (wie Anm. 837) 72. Dem Sinne nach liegt auch deroben Anm. 549 belegte energia-Begriff aus derselben Quint.-Stelle nahe; vgl. auch Anm. 531, 540. Zum mnemotechnischenAspekt s. S. 363 f., 376.
344
eigentlichen Interpretationskonflikten werden.669 In vereinfachter Form lebt das rhetorische Verfahren auchin den spätmittelalterlichen Artes praedicandi fort, die im Rahmen der inventio locorum Exempla alshandliche metonymische Tugendchiffren – David für Demut, Job für Geduld – anzuwenden empfehlen.670
Die Verzettelung von Geschichte und Literatur in facta und dicta memorabilia, deren Aufteilung aufunabsehbare, in eigenen Kompendien neu systematisierbare loci communes, die mnemotechnisch-kombinatorische Einübung in die fallgerechte Anwendung derart zubereiteten Wissensbestandes, all dieseVerfahren eines universalen topischen Funktionalismus und „Utilitarismus“ erlangten jedoch ihre entschiedengrößte Blüte und Verbreitung – allerdings auch eine bald nicht mehr überbietbare Trivialisierung – in derfrühen Neuzeit bis zum 18. Jahrhundert. Zweifellos gelang es den großen Humanisten in erfundenen Briefen,Dialogen, Ethopoiien, Heroiden, Streitgesprächen, auch in neuen Gattungen wie Tragödien und Musikdramen,die Exempelgestalten
669 Vgl. oben §§ 63 ff.; ZIESE 7 ff.; I.S. ROBINSON, Authority and Resistance in the Investiture Contest, The PolemicalLiterature of the Investiture Contest, Manchester 1978; und ders., The Colores rhetorici in the Investiture Contest, in:Traditio 32 (1976) 209–38, bes. 214 f.; H. LÖWE, Von der Persönlichkeit im Mittelalter, in: Gesch. in Wiss. u. Unterr. 2(1951) 522–38, hier 532 ff.; SCHNELL, Andreas Capellanus (wie Anm. 570) 49 ff., 166; von MOOS, Lucans tragedia164 ff.; SPIEGEL 315 ff.; Wilhelm KÖLMEL, Typik und Atypik, Zum Geschichtsbild der kirchenpolitischen Publizistik(11.–14. Jh.), in: Speculum historiale, Festschr. J. SPÖRL, München 1965, 277–302; Strukturelle Analogien zwischen derpolemischen Literatur des 12. Jhs. und der Reformationszeit wären ein interessantes Forschungsthema; vgl. K. HOFFMANN(wie Anm. 646) und R. SCHENDA, Die protestantisch-katholische Legendenpolemik im 16. Jh., in: AKG 52 (1970) 28–48.– Zu der bisher noch wenig erforschten, offenbar weitgehend indirekten bildungsgeschichtlichen Nachwirkung der antikencontroversiae und suasoriae im Mittelalter (oben §§ 63, 68) finden sich Anhaltspunkte auch in der Forschung zur Novelle(vgl. etwa PABST [wie Anm. 315] 12 u. S. 228 ff., 314), zur Satire (vgl. etwa R.M. THOMSON, the Origins of LatinSatire in Twelfth Century Europe, in: Mlat. Jb. 13 [1978] 73–83, hier 79), zum Streitgedicht (WALTHER [wie Anm. 668]90 f., 224 u. ö.) und zu Kunstreden (vgl. U. KINDERMANN, Laurentius [wie Anm. 532] 26 ff. und ders., Die fünf Redendes Laurentius von Durham [wie Anm. 552] 108–41).670 Vgl. CAPLAN, Invention 291, 294. – Zu solchen Metaphern und Vossianischen Antonomasien vgl. § 19, S. 61 ff., 338sowie die ausführliche Zuordnungsliste (prudentia = Odysseus, temperantia = Nestor u. dgl.) von Tugenden/Lastern undentsprechenden homerischen und alttestamentlichen Gestalten im Prolog zur Historia Anglorum des Heinrich vonHuntingdon (ed. T. ARNOLD [RBS 74] 1879, 1 f.) oder bei Galfred von Vinsauf, De coloribus rhetoricis (FARAL, Artspoét. 326 f.) zur significatio. Vgl. auch JENNINGS 232; CURTIUS ELLM 177 f.; KNAPP, Similitudo 87, 90 f.;REINITZER 600 f.
345
der Antike lebendig vor Augen zu stellen,671 doch dominierte – wenigstens quantitativ – seit der Renaissanceeine literarisch weniger anspruchsvolle, praktische Verschmelzung von Exemplum und „Gemeinplatz“ imSinne prompter Verfügbarkeit. Ein fester Thesaurus lehrreicher Illustrationen und debattierbarer Fallbeispielestand einem ebenso festen Themenkatalog gegenüber, und auf den verschiedensten Gebieten des kulturellenLebens galt es nur noch, die beiden Schatzkammern situationsgerecht in Beziehung zu setzen.672 Seit demspäteren 18. Jahrhundert geriet die sich zusehends verbrauchende Methodik zusammen mit derherabgekommenen rhetorischen Denkweise in den Verruf des unspontanen, geistlos-mechanischenAbklapperns von proverbialen und anekdotischen Klischees in wüsten Digressionen. Herrliche Parodien wie‚Tristram Shandy‘ verspotteten und verewigten das Verfahren zugleich.673 Unsere Vorstellung vomExemplum und Topos ist im allgemeinen Bewußtsein eher durch solche Karikaturen bestimmt als durchfrühere Stadien des Verfahrens. Wie die eingangs erwähnten674 abschätzigen Urteile wohlmeinenderMediävisten über Johann von Salisbury als Exempla-Sammler gezeigt haben, bedarf es angestrengterRekonstruktionsarbeit, um hinter der späten Lächerlichkeit den einstigen guten Sinn von Topos undExemplum in der alteuropäischen Bildungstradition erkennen zu können.
80. Das Verhältnis von Exemplum und Argument, von Exempla-Anordnung und Gedankenablauf unterliegtoffenbar in ästhetischer und logischer Hinsicht durch die Jahrhunderte ganz unterschiedlichen Bewertungen,die nicht anachronistisch durcheinandergebracht werden sollten. Ein gattungsmäßiges Mischwerk wie derPolicraticus, das ebensosehr einen Traktat über diverse politische und philosophische quaestiones wie eineKompilation von nützlichen dicta und facta darstellt, läßt sich nicht wie eine moderne systematischeAbhandlung beurteilen, in der die Beispiele der substantiellen Gedankenführung zu folgen haben. Es istratsamer, die Struktur des Werks mit derjenigen einer Exempla-Sammlung zu vergleichen (auch wenn es sichnicht auf eine solche Kompilation reduzieren läßt): Die Exempla haben darin gelegentlich ein solchesGewicht, daß sie dem Gedankengang eher vor- als beigeordnet zu sein scheinen. Sie machen sichgewissermaßen selbständig.
671 Vgl. S. 529 ff, und LINDHARDT 32, 86 f.; HERDE (wie Anm. 631) 209 f.; Otto GÖRNER, Vom Memorabile zurSchicksalstragödie, Berlin 1931.672 Vgl. BOLGAR (wie Anm. 30) 270 ff., 433 ff.; GRASSI, Macht 109 ff.; BRÜCKNER, Hist. 36, 55 ff., 69.85 f.;NADEL (wie Anm. 494) 309 ff., S. 384, 528 f., 542 ff.673 Vgl. auch S. 330 f. Zu Sternes Parodie antiker Trosttopik und Trostexempla im Vergleich zu seinen direkten undindirekten Quellen (Cicero und Burtons ‚Anatomy of Melancholy’) vgl. Herm. MEYER, Das Zitat in der Erzählkunst, 1961,77 ff.; KASSEL, Konsolationslit. (wie Anm. 997) 101 ff.674 Vgl. oben § 5.
346
Dies verrät jedoch nicht nur Fabulierfreude oder intensives Geschichtsinteresse, sondern die Macht jener austraditionellen topischen Problemkreisen gebildeten Rubriken oder „geistigen Schubladen“, die, wo immer siegezogen wurden, von selbst zur dilatatio materiae oder Ausbreitung möglichst vieler historiae führten, dieMacht einer in der erwähnten schulrhetorischen Zuordnungskunst erlernten Denkform. Johanns Exemplagleichen denen der Memorabilien-Sammlungen auch darin, daß sie unter verschiedenen Gesichtspunktenmehrfach und in unterschiedlicher Weise verwendet werden. Denn sie hängen jeweils restlos vom Kontext derquaestio ab.
Werden sie ohne Rücksicht auf diesen grundlegenden rhetorischen Zusammenhang interpretiert, werden sieetwa wie historiographische Aussagen isoliert und beim Wort genommen, wie dies in der Forschung immerwieder geschehen ist, so erscheint der Policraticus leicht als ein Sammelsurium von Ungereimtheiten undWidersprüchen. Am stärksten hat sich hier vielleicht Hans Liebeschütz exponiert,675 als er dieunterschiedliche Verwendung bestimmter Exempelfiguren an verschiedenen Stellen des Policraticus einemsystematischen Vergleich unterwarf. Er unternahm dieses Experiment zu dem gewiß lobenswerten Zweck, diegängigen Vorurteile über Johanns Humanismus, über dessen vermeintlich „interesselose“ Verehrung antikerHelden zu zerstören.
Das Ergebnis ist in der Tat insofern unanfechtbar, als Johann trotz seiner überdurchschnittlichen Kenntnissedie Antike nicht um ihrer selbst willen schätzte und pflegte. Er zerstückelte, verzettelte, atomisierte,verwertete und entstellte sie nach dem im Mittelalter – und lange darüber hinaus – vorherrschenden (nur zumTeil bewußten) Anachronismus des moral-pragmatischen Geschichtsverständnisses.676 Gerade darum ist aberdie Suche nach echter
675 LIEBESCHÜTZ, Humanism 67 ff.; s. auch § 89, S. 349, KERNER stellt in seiner Monographie (nur schon mit demTitel) die Gegenthese zu der von LIEBESCHÜTZ, ROUSE u. a. vertretenen Ansicht von der Widersprüchlichkeit desPolicraticus heraus. Seine „Struktur-Logik“ besteht allerdings fast nur in dem Versuch, die vermeintlichen Widersprüche ausEntstehungsschichten und biographischen Entwicklungsstufen zu erklären. Diese harmonisierende Deutung scheint mir diekritische von Liebeschütz nicht genügend zu überwinden, da die wirkliche, dialektisch-rhetorische Logik Johanns, d. h. eingrundlegendes in utramque partem-Denken, zu wenig akzentuiert wird (vgl. oben §§ 62 f., 69 ff.).676 Ähnlich beanstandet J. SPÖRL (wie Anm. 366) 81 den Verlust des geschichtlichen Bildsinns in den Beispielen Johanns,die zu einer nurmehr allegorischen Mustersammlung verblassen. – „Intentional anachronism“: BEER, Caesar (wie Anm. 661)71; vgl. auch E.R. CURTIUS, Mißverstandene Antike, Mittelalter-Studien XVIII, in: ZRPh 63 (1943), 225–74; R.J.CORMIER, The Problem of Anachronism, Recent Scholarship on the French Medieval Romances of Antiquity, in: Philol.Quarterly 53 (1974) 145–57. und besonders KOSELLECK, Vergangene Zukunft (wie Anm. 37) 17 ff. zum „bewußtenAnachronismus“ als Ausdruck eines viel verbreiteteren „unbewußten“, der sich vom „Glauben“ an den gemeinsamengeschichtlichen Horizont von Vergangenheit und Gegenwart nährt (vgl. S. 537, 546, 540 ff.).
347
Mitempfindung im historistischen Sinn – „something of a feeling for the characters of ancient history […]behind the long series of classical illustrations“ – von vornherein zum Scheitern verurteilt. Liebeschütz677
zeigt sich enttäuscht darüber, daß z. B. keine einzige ernstzunehmende Information über die historischeBedeutung eines Scipio Aemilianus im Policraticus zu finden sei, obwohl dieser Held in zahlreichen „stories“erscheint.678 Ähnlich legt Liebeschütz den Finger auf die manifest widersprüchliche Darstellung Caesars undCatos, indem er deren Exempla liest, als sollten sie zusammengenommen ein historiographisches Gesamtbildergeben, oder gar, als habe der mittelalterliche Autor ein solches beabsichtigt.679 Das Ergebnis hinterläßt denEindruck eines etwas zurückgebliebenen Histörchensammlers, dem die Antike als „Bilderbuch“ zur Illustrationhochmittelalterlichen Lebens herhalten mußte.680
Man könnte den „Test“ bei jedem anderen Autor der Antike und des Mittelalters wiederholen und versuchen,aus den in verschiedenen Gebrauchszusammenhängen erscheinenden Exempla historische „Portraits“zusammenzusetzen; das Resultat wäre das gleiche: Wir wüßten nur, daß dieselbe Person in unterschiedlichenSituationen Unterschiedliches, ja möglicherweise diametral Entgegengesetzes bedeuten kann. Folglich istnicht sie von Interesse, sondern allein ihre kontextuelle Bedeutung. Diese Konsequenz wurde für wichtigeVorbilder Johanns: Seneca und Hieronymus, ausdrücklich gezogen,681 nicht
677 LIEBESCHÜTZ, Humanism 70 f.678 Ebd.679 Ebd. 72 f. Zu Caesar s. S. 338, 473, 510 f. Zu Cato S. 287, 321, 338, 361, 431, A. 692. Die vielen Fazetten desrömischen Helden (Freiheitsliebe, Ruhmsucht, Mut, Vorurteillosigkeit, Aberglaubenskritik und Selbstmord) blieben in dervon Augustin bestimmten Tradition ein beliebtes Kontroversthema bis ins 18. Jh.; vgl. HONSTETTER 138 f. zu Aug.; D.LEDUC-FAYETTE, Jean-Jacques Rousseau et le mythe de l’Antiquité, Paris 1974, 55.680 LIEBESCHÜTZ, Humanism 94, s. auch S. 14 ff. Ähnlich BROOKE (wie Anm. 35) Introd. XLII f. zu Johanns Caesarund Alexander: „No man bred on late Roman literature or patristic ethics could be interested in personality as a whole, it wasrather an Armageddon of warring attributes, Faustus and Hamlet in medieval dress.“ Die mosaikartig aufgelöste AntikeJohanns ohne „real understanding“ rügt auch BOLGAR (wie Anm. 30) 199 f.: „… the classical anecdotes torn form theircontext have a purely rhetorical character“ (was umgangssprachlich pejorativ gemeint ist).681 Vgl. oben § 77. Zu Seneca vgl. auch GEBIEN 160 ff., 168 ff. (Variabilität der Urteile über Gestalten wie Caesar,Alexander, Pompeius und Cato je nach der zu einem bestimmten Sinnzusammenhang passenden Version; Verzicht aufjegliche grundsätzliche Gesamtbeurteilung); O. THOMSEN, Seneca the Story-Teller, The Structure and Function, theHumour and Psychology of his Stories, in: Class. et Mediaev. 32 (1971/80) 151–77; W. TRILLITZSCH, SenecasBeweisführung, (Dte. Akad. d. Wiss., Schriften Sekt. Alterumswiss. 37) Berlin–O. 1962, 32 ff.; CANCIK (wie Anm. 38)23 ff., 71 f., 105 ff.; ALBERTINI (wie Anm. 149) 216–223; DÖRING 23 f. – Zu Hieronymus vgl. HAGENDAHL (wieAnm. 173) 311 f.; OPELT, Hieronymus (wie Anm. 569) 43 ff.; TRILLITZSCH, Hieronymus (wie Anm. 464) 43 ff.; KECH28 f. – Zu Hieronymus und Seneca als Hauptmodelle Johanns vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 64 ff.; DELHAYE, Ledossier (wie Anm. 385) 68 ff., 77 ff. – Im übrigen kann von einem nicht-historiographischen Werk nicht verlangt werden,was sogar der mittelalterlichen Historiographie abgesprochen zu werden pflegt: „individualisierendePersönlichkeitsschilderung“. Vgl. dazu etwa LÖWE (wie Anm. 669) 530; W.J. BRAND, The Shape of Medieval History,New Haven-Yale 1966, 148 u. ö.
348
aber für Johann selbst. Ihm werden Widersprüche unterschoben, die in Wirklichkeit aus dem systematischenZettelkasten scharfsinnig kombinierender Forscher stammen. Die „widersprüchlichen“ Urteile über Alexanderund Caesar – seit der Antike ohnehin besonders ambivalente Herrschergestalten – beweisen nur, daß erniemals diese Herrscher zum eigentlichen Thema erhoben hat, sondern die Tugenden oder Laster, die sie imgegebenen Fall repräsentieren.682
682 Heute ist eine Warnung vor kontextfremder Kombinatorik dieser Art auch grundsätzlich angebracht, da unkontrollierteEDV-Anwendung hier noch zu wesentlich absurderen Resultaten führen könnte. – LIEBESCHÜTZ, Humanism 55, 71 f.;vgl. S. 288, 303 f., 338, 473, 479 f., A. 481. Zu Alexander vgl. LEEMAN 255: „Inbegriffs-Exemplum“ für dieverschiedensten Eigenschaften bei Curtius Rufus und Val. Max.; Rüdiger SCHNELL, Rudolf v. Ems … (Basler Studien z.dt. Spra. u. Lit. 41) Bern 1969, 128 ff.: moralische Wertungsindifferenz gegenüber der historischen Alexander-Gestaltaufgrund der austauschbaren Funktion des Alexander-Exemplums für die Theodizee; CARY (wie Anm. 279) 101 f. u. ö.:Wenn man sämtliche aus dem Policraticus stammenden Alexander-Exempla dieser Untersuchung zusammenstellte, müßteman sich fragen, wer hier widersprüchlicher ist, CARY oder Johann von Salisbury, da der eine aus dem Mosaik des anderenein neues Mosaik anfertigt, in dem Alexander unter verschiedenen thematischen Rubriken erscheint und der ihn als Beispielanführende Johann gleicherweise unter den Kategorien „alexanderfreundlich“ und „alexanderfeindlich“ erscheint; von MOOS,Lucans tragedia 137 ff., 168 ff., 183 f. zu variablen Wertungen der Protagonisten der Pharsalia (Caesar, Brutus, Cato) beiJohann S. 321, A. 593, 653; ebd. 143 ff., 179 f., 161 ff. zu Alexander und Caesar. Wohl nirgends zeigt Johann die ganzeAmbivalenz Alexanders prägnanter als in Pol. V 12, (I) 335: Nichil vero praeclarius de Alexandro illo quem publica opiniomagnum asserit, in aliqua historia meo iudicio repperi. Michi quidem semper (ut tamen pace eorum loquar qui temeritatemvirtuti praeferunt) ditissimo Alexandro pauper Pitagoras maior erit. – Zu Caesar vgl. oben Anm. 661; HONSTETTER138 ff.; 177 ff.; BALDWIN (wie Anm. 160) 103; J.W. OPPEL, Peace vs. liberty in the Quattrocento: Poggio, Guarino, andthe Scipio-Caesar-Controversy, in: The Journ. of Med. and Renaissance Studies 4 (1974) 221–65; HERDE (wie Anm. 631)209 f. – BROOKE (Einl. zu The World of John of S. 2 f., 13) stellt auch in der Personenbeschreibung Heinrichs II., der baldals Tyrann, bald als Nationalheld erscheint, ein solches in utramque partem fest, das er eine ironische „studied ambiguity“nennt. Hier bewegt sich Johann allerdings am Rande des Exemplums (s. S. 136, 205), in einem Übergangsbereich zur causa,da die Person nicht als Beleg, Autorität oder Casus zitiert, sondern selbst „gemeint“ ist und diplomatisch geschont oderinsinuatorisch indirekt angesprochen werden soll (vgl. auch oben S. 315 ff.).
349
Wo er sich dem topischen Feld „vom bösen Ende der Tyrannen“ anschließt, wäre es lächerlich, Herrscherlobzu erwarten683, und wo er militärische Disziplin rühmt, wäre es unzeitig, eine Kritik der Welteroberungs-Hybris zu verlangen.684 Nichts wäre sinnloser, als Johanns Hochschätzung der heidnischen Antike damit inFrage stellen zu wollen, daß er auch einmal den berühmten Prügeltraum des Hieronymus, ein Kern-Exemplummittelalterlicher Bildungsfeindlichkeit, zitiert; er tut es nicht im geringsten in einer Diskussion über antikeAutoren, sondern im Zusammenhang mit den Arten der Traumdeutung.685 Johanns philosophischeReflexionen über den Vorrang der antiqui gegenüber den moderni lassen sich schließlich nur durchunangebrachte Kombinatorik als Widerspruch zu einer panegyrischen „Überbietungsformel“ deuten, dieThomas Becket über Plato stellt.686
Viele Widersprüche, die aus dem Policraticus mit unzeitigem Scharfsinn wissenschaftlich herausgearbeitetworden sind, stammen aus derselben extrem themenzentrierten kontextabhängigen Funktion von Exemplaund anderen auctoritates, d. h. sie sind erst ex post im Kopf des modernen Lesers entstanden,
683 Pol. VIII 18–19, 358 ff. Vgl. S. 202 f., 237, A. 464, 696. Zu diesem locus vgl. RONCONI, Exitus … 1258 ff.;HONSTETTER 116 ff., HANNING (wie Anm. 185) 46 f.; BRÜCKNER, Hist. 108.684 Pol. VI, bes. VI 15, 23 ff. vgl. Anm. 578.685 Pol. II 18, (I) 100.6 ff. nach Hier. Ep. 22.30. – MISCH (1172 f.) liest Johanns eigene Skrupel vor der Benützungheidnischer Autoren in die Stelle hinein. Sein Hauptinteresse an den hinter Johanns Exempla verborgenen „Persönlichkeiten“zeigt LIEBESCHÜTZ (66) so: „It is typical that John of Salisbury, while stressing the reality of St. Jerome’s punishment onaccount of his being Ciceronianus, does not mention Jerome’s later dementi, on the grounds that he could not be bound by avow in a mere dream“ (Adv. Ruf. I 31 [PL 23] 442 B). LIEBESCHÜTZ scheint derart anzunehmen, Johann habe sich wie einHieronymusbiograph verhalten wollen. Dies ist Johann gegenüber ein größerer Anachronismus als derjenige, den sich JohannHieronymus gegenüber leistet, indem er diesen zum Exemplum chiffriert. Im übrigen scheint unbekannt zu sein, daß derPrügeltraum des Hier. sogar im Kirchenrecht vorkommt; Gratian führt als eine Prämisse zu seiner ausgleichenden LösungD 37 c 8 (non prohibeantur clerici seculares litteras legere) das Hier.-Exemplum in D 37 c 7 an: B. Ieronimus ab Angeloverberatur, quia Ciceronis libros legebat.686 So bei CURTIUS, ELLM 172 aufgrund von Enth. (minor) in Policraticum I p. 2.17 ff. und Met. III 4.136.8 ff. (s. obenAnm. 535).
350
der sich an die historische oder philologische Identität solcher Personen und Zitate zu stark gewöhnt hat, umderen respektlose Funktionalisierung ohne Befremden wahrnehmen zu können. So hält man sich etwa bei deranscheinend anti-humanistischen Verurteilung der römischen Geschichte ab urbe condita auf – Aeneas fandItalien durch teuflische Eingebung; ein Brudermord begründete die Stadt; die weitere Entwicklung Roms wareine einzige Verbrechergeschichte –, doch man übersieht, daß Johann hier nicht von Rom, sondern vonfalschen Orakeln, Ehrgeiz und Habsucht spricht.687 Man kommt mit den ganz konträren Urteilen überLachen und Scherz „bei ein und demselben Autor, ja, in ein und demselben Werk“ nicht ins Reine, weilForschersystematik offenbar gerade die für Johann nicht zusammengehörigen Stellungnahmen kombiniert.688
Oder es wird festgestellt, daß Johann im Policraticus die stoische Apathia gelten läßt, sie aber in einem Briefan Thomas Becket über dessen Verfolgung mit dem Blick auf das Beispiel des weinenden Jesus kritisiert.689 Soentsteht durch Verkennung der inhaltlichen und rhetorischen Kontextualität eine biographischeÜberinterpretation. Man empfindet die satirisch-gegenwartskritische Berufung auf die virtus maiorumAltroms als einen „Denkfehler“ Johanns, da diese Vorfahren anderwärts auch Exempla für Laster abgeben,und erklärt das Ganze abschätzig als „moralistische Deklamationskunst“.690Wo das Problem auftaucht, warumJohann den an sich vorbildlichen Origenes wegen dessen Selbstentmannung kritisiert, wäre die Frage wichtiger,ob die verstreuten Origenes-Exempla überhaupt alle zusammen auf den wirklichen Origenes bezogen werdendürfen.690a
81. Dem rein argumentativ-topischen Sinn vieler Exempla scheint eine Eigenart Johanns, die wir bereitsberührt haben, allerdings zu widersprechen:691 Er liebt es, dem Leser verschiedene Versionen der gleichenGeschichte anzubieten, was einen philologisch-quellenkritischen Eindruck
687 Ein Problem machen daraus Friedr. v. BEZOLD, Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus(1922)/Aalen2 1962, 37 und HELBLING-GLOOR (wie Anm. 26) 84 aufgrund von Pol. II 15 und III 10, (I) 92 und 199 ff.688 So bei SUCHOMSKI 50 f. zu Pol. VIII 9–10 und V 6; s. unten S. 330 f., 387, 470 ff.689 B. SMALLEY, The Becket Conflict and the Schools, Oxford 1973, 106; vgl. auch MICZKA 38 und oben Anm. 635 zuEp. 276.690 UHLIG (wie Anm. 277) 49 zu Pol. III 14, (I) 223.20.690a Vgl. MICZKA 38 zu Pol. VIII 6, (II) 251.691 Vgl. S. 209 ff. Zur Neigung, alle bestehenden Versionen aufzureihen, vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 130; W.GOETZ, Wirklichkeitssinn (wie Anm. 759) 26 f. Abaelard nennt diese Sammelabsicht auf theologischem Gebietausdrücklich einen Schlüssel zur Widerspruchsauflösung im Sic et non-Prolog (wie Anm. 631) 93.97 ff.: Beato quoqueattestante Hieronymo novimus morem catholicorum doctorum hunc fuisse, ut in commentariis suis nonnulla etiamhaereticorum pessimas opiniones suis insererent sententiis, dum perfectioni studentes nulla antiquorum praeteriissegauderent. Vgl. auch oben Anm. 663 zum „Haften am Detail“ in der juristischen Argumentation aufgrund einer topischen,nicht systematischen Vorstellung vom „Allgemeinen“, die notwendig auch hinter dem Bedürfnis nach Vollständigkeit imEinzelnen steht. Der Einzelfall wird grundsätzlich nicht auf ein Prinzip reduziert, sondern dient anderen Einzelfällen alsapplizierbares, jederzeit mögliches Argument.
351
macht, so aussieht, als wolle er sich wie ein Historiker ein objektiv neutrales Urteil über den unterschiedlichbeschriebenen Fall bilden. Auch legt er gelegentlich zu einem Exemplum mehrere mögliche moralischeAuslegungen vor, die eher exkursartig vom Beweisziel weg als zu ihm hinführen. Soweit nicht einfach gelehrteZurschaustellung von Wissen vorliegt, wie sie Johann zweifellos aus Gründen der „Bildungspropaganda“betreibt, spielen hier allgemein hermeneutische Methoden der auctoritas-Kritik in Bibelexegese undKlassikerstudium eine Rolle.692
Ein Paradebeispiel in diesem Zusammenhang ist das 11. Kapitel des 4. Policraticus-Buchs mit der dem Fürstenempfohlenen Lehre, daß das Familien-interesse stets dem Gemeinwohl unterzuordnen sei. Hier wird an Brutusd. Ä. erinnert, der seine Söhne aus republikanischer Vaterlandsliebe hinrichten ließ, als deren Verschwörungzur Restauration des Königtums aufgedeckt wurde.693 Brutus habe damit beweisen wollen, daß er der Vater desVolkes
692 „Bildungspropaganda“: s. S. 202 f., 402 f. Zur Exkurstechnik vgl. auch Pol. II 27, (I) 159 f.: Johann will Cato als Feinddes Aberglaubens loben, weil dieser es verschmäht hat, das Orakel zu befragen, kann dabei aber eine Diskussion über dessenSelbstmord nicht vermeiden, was wiederum zum Zitieren aller möglichen Suizid-Exempla und immer weiter weg vomThema der vaticinia-Kritik führt. In Pol. VIII 7, (II) 267 ff. geht er in der Lasterbeschreibung weit über das Nötige – d. h.eine Kritik der Schlemmerei – hinaus und landet gewissermaßen bei einer gastronomischen Abhandlung über die seltsamstenGaumengenüsse, merkt dann offenbar selbst den Widerspruch zwischen dem positiven gelehrten Interesse und der negativenmoralischen Absicht, da er schreibt (270.20 f., 271.18 ff.): Ne tamen vitiorum longe petantur exempla, maiorum erroribussuos nostra etas adiecit […] Cenam Trimalchionis apud Petronium, si potes, ingredere, et porcum sic gravidari possemiraberis, nisi forte admirationem multiplex ignota et inaudita luxuria tollat. Et quidem multa, quae nos usu vel abusuedocti non miramur, visa sunt admiranda immo stupenda maioribus. Weitere Beispiele für die assoziativ-digressorischeDisposition s. S. 223 ff., 402 ff., 468 ff., 482 und LIEBESCHÜTZ, Humanism 116 f. – Zur auctoritas-Kritik undKommentarliteratur s. S. 210 ff., 213, 352.693 Pol. IV 11, (I) 272–4 nach Florus I 9; vgl. auch die eingehende Analyse von KERNER 200 f. sowie LIEBESCHÜTZ,Humanism 249. – Bemerkenswert ist überdies, daß Quintilian (V 11.6–7) dieses Beispiel in seiner Theorie der Exempla-Arten für das dissimile zitiert (s. A. 914) und daß Augustinus (Civ. III 16) in einer überaus kritischen Weise‚entmythologisierend’ (u. a. auch mit denselben von Johann zitierten Aeneis-Versen VI 820–3; S. 354) auf dieses Exemplumeingeht. Die verschiedenartigen Quellen (Florus, Quintilian und Augustinus) könnten sich in den darzustellendenZweideutigkeiten spiegeln.
352
sei und das Volk an Sohnesstatt angenommen habe. Doch noch während Johann das Beispiel unter demGesichtspunkt „Vaterlandsliebe“ zitiert, fällt ihm ein anderer, moralisch bedenklicher Gesichtspunkt ein, dener im Interesse der gemeinten Sache nicht unbedingt hätte erwähnen müssen:694 „Obwohl ich“, fährt er fort,„Kindesmord natürlich nur mit größtem Entsetzen ansehen kann, muß ich dennoch die Loyalität diesesKonsuls loben. Ob er richtig handelte, mögen die Weisen entscheiden!“
Diese für Johann überaus charakteristische Art, verschiedene Ansichten zu erwähnen und als offensesProblem vor den Leser zu stellen, stammt aus der Kommentar- und Scholienliteratur.695 Mit der agnostischenWendung oder „Indifferenzformel“, die ihm auch sonst häufig als Aposiopese dient, hätte er auch hier dasThema verlassen können.696 Er legt jedoch Wert auf das Wissen
694 Pol. IV 11, (I) 272.11 ff. unten Anm. 697 zitiert.695 Vgl. S. 183 ff., 208 ff. Die Ableitung „offener Fragen“ Johanns aus der Kommentarliteratur drängt sich grundsätzlich daauf, wo die gedankliche Entwicklung in einer für moderne Kompositionsbegriffe nicht unmittelbar einsichtigen Weise anAkzidenzien oder Quisquilien hängen bleibt: vgl. FONTAINE, Isidore (wie Anm. 145) 742 ff. zur „scolie retournée“, derUmkehrung des Verhältnisses von „wesentlich“ und „nebensächlich“, derzufolge der kommentierte Text zu einer ArtLemmaträger für gelehrte Disquisitionen wird; vgl. auch Peter BACHMANN, Commenta und Adnotationes, Proben antikerKommentierarbeit am Lukan, Diss. Frankf. a. M. 1974, 62 u. passim; MARTI, Glosulae (wie Anm. 457) XXXV ff. ZurÜbertragung der exegetischen Methode auf nicht genuin exegetische Bereiche vgl. RAY (wie Anm. 360) 46; zur Bewertungs. S. 210 ff., 357 ff., 361 ff., 398 f.696 Die Aposiopese signalisiert hier ebenso das Ideal der Vollständigkeit wie die Unmöglichkeit, es zu erreichen.Pauschalformeln, Unzähligkeits-Hinweise, hypothetische „Indifferenzformeln“ (Chr. MEIER, Argumentationsformenkritischer Reflexion zwischen Naturwissenschaft und Allegorese, in: FMSt 12 [1978] 116–59, 127), pathetischeKapitulationen vor dem „Meer“ der Exempla, taedium-Formeln, aber auch, was wir „weiterführende“ bibliographischeHinweise nennen, die den Leser zum Noch-mehr-Lesen anspornen, sollen gelegentlich gerade da den Eindruck erwecken, derAutor sei allwissend, das Dargebotene nur selektiv, wo Johann sichtlich Mühe hat, weiteres Illustrationsmaterialbeizubringen. Vgl. A. 462. DELHAYE, Le bien (wie Anm. 385) findet diese Haltung „un peu nouveau riche“. Beispiele sindetwa Pol. VI 15, (II) 40.21: Sed cum omnium gentium exempla revolvo, disciplina Romanorum prae ceteris lucet (Johannbietet aber ausschließlich römische Beispiele); Pol. VIII 11, (II) 306.5 ff. über die Bosheit der Frauen: In immensum paginaprotendetur, si ea perstrinxero quae in hac parte tragici, oratores, comici, satirici, poetae (ut de philosophis, ethicis ettheologis taceam) prodiderunt. Pol. VII 25, (II) 218 f. zu Exempla heroischer Freiheitsliebe: Si singula huiusmodi referrevoluero, tempus antequam exempla deficient. Pol. VIII 20 (II) 372.25 ff.: Longum est si gentilium tirannorum ad temporanostra seriem voluero trahere… (mit Hinweis auf ein Werk ‚De exitu tirannorum’, das bisher nicht nachgewiesen werdenkonnte; vgl. Anm. 462). Met. I 17, 43: Rixentur super hoc qui voluerint (non enim hanc protendo litem), sed omnium paceopinor … Pol. VIII 18, (II) 363 f.: Haec Orosius fere; cuius verbis et sensu eo libentius utor quod scio Christianum etmagni discipulum Augustini […] Haec quidem possunt et apud alios historicos inveniri diffusius qui tirannorum atrocitateset exitus miseros plenius scribunt. Quae si quis diligentius recenseri voluerit, legat ea quae Trogus Pompeius, Iosephus …(es folgt der aus Hieronymus ausgeschriebene Historikerkatalog; s. unten Anm. 853).
353
um die Meinungsverschiedenheiten selbst. So erinnert er an die controversiae der antiken Rhetorik, offenbar,weil er daran die von ihm selbst angewandte Methode demonstrieren kann:697 „Ich weiß, daß diese Streitfrageein Tummelplatz für Redner gewesen ist, und daß hier viele Redner auf beiden Seiten reichlich geschwitzthaben, um entweder den Kindsmörder mit dem Argument der patriotischen fides freizusprechen, oder um dasVerdienst der Vaterlandsliebe durch die Anklage kindsmörderischer impietas zu tilgen.“ Johann wiederholtdann, daß er seine eigene Meinung dazu nicht äußern wolle, sagt dies aber indirekt, indem er ein neuesExemplum zitiert:698 „Eine gewisse
697 Pol. IV 11, (I) 272.11 ff.: Ego quidem, etsi parricidium perhorrescam, consulis non possum non approbare fidem, quimaluit salutem liberorum suorum periclitari quam populi. Rectene fecerit, indicent sapientes. Ego enim campum istumoratoribus late patere cognovi, et in eo declamatores in ancipiti materia saepius desudasse, dum in absolutione parricidiifides laborat et parricidalis impietas meritum fidei conatur extinguere. Zu solchen und ähnlichen typischen Streitfällen fürdie declamationes vgl. BONNER, Decl. (wie Anm. 550) 6 ff.; HONSTETTER 83 ff. zur Exempla-Kasuistik im Dienste vonNormenkonflikten, und, besonders erhellend, TOURNON 109 ff., 150 ff. zu Montaignes Glossierungsmethode mit Bezugauf theoretische Arbeiten von A.J. GREIMAS und P. RICOEUR. Zur Bewertung s. §§ 63, 68.698 Pol. IV 11, (I) 272.18 ff.: Quod si me ad sententiam urges, respondeo quod in causa Smirnensi Ariopagitas GneioDolabellae invenio respondisse. Ad quem mulier Smirnensis adducta est, confitens se maritum et filium datis clam venenisoccidisse, eo quod illi filium eius ex altero matrimonio optimum […] insidiis nequiter occidissent, sibi licitum esse asserensex indulgentia legum et ius ignorare et […] tam atrocem iniuriam vendicare [cf. Dig. XXII 6, § 9]. Ius extra causa erat,cum de facto constaret et de iure quaereretur. Cum ergo Dolabella rem in consilium deduxisset, non fuit qui in causa (utputabatur) ancipiti manifestum veneficium et parricidium auderet absolvere, vel vindictam, quae in impios et parricidasprocesserat, condempnare. […] Rem itaque ad Ariopagitas Atheniensium, tamquam ad iudices graviores exercitatioresque,reiecit. At illi causa cognita actores et ream mulierem centesimo anno adesse iusserunt. Sic autem neque veneficium, quodde lege non licuit, absolutum est, neque nocens punita mulier, cui ex sententia multorum venia poterat indulgeri. Hoc itafuisse nonus liber Memorabilium dictorum vel factorum Valerii Maximi docet (sc. VIII 1; literarische Quelle ist jedochGellius XII 7). Zum Prinzip des Aufschubs als „akademische“ Position Johanns s. oben Anm. 593.595 und S. 379 ff. ZurRechtsbegrifflichkeit de iuris et facit ignorantia (Dig. 22.6; Cod. 1.18), die Johann auch in Pol. II 28, (I) 161.15 ff. undPol. IV 6 (I) 253.1 ff., vielleicht aus der Summa Trecensis übernahm, vgl. MICZKA, Summa Trecensis (wie Anm. 564)387 ff., wo allerdings vorliegende Stelle unerwähnt bleibt.
354
Frau aus Smyrna wurde vor den Statthalter Dolabella gebracht. Sie gestand, ihren Mann und ihren Sohnvergiftet zu haben, weil diese ihren eigenen geliebten Sohn aus erster Ehe meuchlings umgebracht hatten. AlsDolabella die Sache in seinem Rat besprach, war niemand bereit, in einem solch zweischneidigen Fall dasoffenkundige Tötungsdelikt zu entschuldigen oder aber die gerechte Sühne zu verurteilen. So wurde dieAngelegenheit vor den Areopag in Athen weitergezogen, wo […] erfahrenere Richter saßen. Diese jedochbefahlen, nachdem sie sich die Sache angehört hatten, sowohl den Anklägern wie besagter Frau ameinhundertsten Jahrestag der gegenwärtigen Sitzung wieder vor ihnen zu erscheinen.“ Diese für Johannsjuristisches Interesse wie für sein philosophisches Prinzip maßvoller, „akademischer“ Skepsischarakteristische Anekdote dient genau genommen nur als Kommentar zur Brutus-Geschichte. EinExemplum legt also ein anderes aus. Die Verbindung zwischen beiden stellt ein impliziter Bezug zu einemdritten Exemplum her: Sullas Rache an der Partei des Marius (nach einem Pharsalia-Vers).699 Beide, Brutusund die Frau, haben Sullas Fehler begangen: Ihr Heilmittel war stärker als die Krankheit.
Durch die digressorische Behandlung solcher moralischer Parallelkonflikte (am Rande des Topos summum iussumma iniuria) ist das eigentliche Beweisziel, der Vorrang des Gemeinwohls vor Sippschaftsinteressen, einwenig aus dem Blickfeld gerückt. Mit einem vierten Exemplum leitet Johann schließlich zu diesem Themazurück:700 Vergil habe in der Heldenschau von Aeneis VI die Haltung des Brutus tadelnd der Ruhmsuchtzugeordnet. Abschließend folgt die Bemerkung,701 daß man trotz alledem heutzutage das Brutus-Exemplumunbedenklich zitieren dürfe, da ja normalerweise ein Mann sogar die Laster seiner Söhne dem Gemeinwohlvorziehe. Ein fünftes und ein sechstes Exemplum schließen die kurvenreiche Argumentation wieder im Sinnedes Hauptthemas ab.702 Sie haben, wie es zur rhetorischen Schlußverstärkung
699 Ebd. 273.7 ff.: Ceterum et Brutum et mulierem deliquisse consentiam facile eo quod ‘excesserit medicina modum,nimiumque secuta est,/qua morbi duxere ‚manum’ [Lucan II 142–3 aus Aug. Civ. III 27, [CC 47] 93–4] et licet magnafuerint crimina, praestantius fuerat eadem sine punientis crimine vendicari.700 Ebd. 273.14 ff. durch Umdeutung von Aen. VI 820–3 wohl nach Aug. Civ. III 16 (CC 47) 81.24. Zur traditionellenKasuistik über das richtige Verhältnis von severitas und saevitia und zu gerechten, aber übertriebenen Strafen vgl.HONSTETTER 89 f., 96 f. (Val. Max.) und S. 441 ff. A. 634 f. (summum ius …), S. 322 f. (aequitas).701 Pol. IV 11, (I) 273.21 ff.: Sed ne quis amodo Brutum imitetur, populum liberis praeferens, frustra sollicitaberis, cumvel vitia liberorum saluti rei publicae praeferantur, licet certum sit, quod salutem populi liberis omnibus oporteatanteferri.702 Ebd. 273.24 ff. nach II Reg. 14 (Saul) und I Reg. 2.29, 3.13, 4.18 (Heli) unten Anm. 946 zitiert. Abgeschlossen wirddamit allerdings nur das als ganzes exkursartige exemplum Bruti in einem fortlaufenden Kapitel, das den Nutzen einergerechten, insbesondere nicht nepotistischen Herrschaft für den Fürsten selbst darstellt.
355
gehört, abschreckenden Charakter: Die Bibel rügt Saul und Heli wegen unangebrachter Milde gegen sündigeSöhne.
Dieser für viele Kapitel des Policraticus charakteristische Ablauf mag beleuchten, was Hans Liebeschütz soformuliert hat:703 „Johann interessiert sich mehr für die Histörchen aus seiner Bibliothek als für einegradlinige Darlegung seiner Gedanken“. Darauf bezieht sich mit völlig anderer Bewertung auch VincenzoCilento:704 „Die eigentliche Faszination des Policraticus liegt in der Unordnung, einer scheinbarselbstverständlichen Unordnung, der Unordnung einer Konversation, eines Dialogs, einer klassischen Diatribe,der Unordnung Petrons, Apuleius‘ oder Plutarchs.“ Johann arbeitete wie die meisten mittelalterlichenSchriftsteller vor der Hochscholastik – wegen seiner außergewöhnlichen Belesenheit allerdings ausgesprochenvirtuos – nach einem assoziativen (nicht systematisch gliedernden) quasi dialogischen Dispositionsprinzip.705
Dabei geht es, was seinen Exempla-Gebrauch betrifft, um
703 LIEBESCHÜTZ, Humanism 116 ff.: „John is more interested in the stories drawn from his library than in the straight-forward exposition of ideas […] Thus the manner in which the author allows his thinking to be guided by classical examplesmakes it impossible for him to come to the point straight away […] This peculiar structure represents a form of thoughtwhich deals with its subject matter by using parallelisms and associations rather than by analysis.“ Vgl. ähnliche Urteileauch § 5, S. 347 und SCHAARSCHMIDT 87, 191 f.; R.L. POOLE, Medieval Thought and Learning, London 1894/1920,190, 197 (der Pol. als „Miszellen-Enzyklopädie“); ATKINS (wie Anm. 366) 66 f.; ULLMAN (wie Anm. 34) 520;CURTIUS, ELLM 492; UHLIG (wie Anm. 577) 41, 61 f.; TOLAN (wie Anm. 573) 190; KNOWLES (wie Anm. 34) 137und in der kritischen Forschungsübersicht KERNERS 129, 189 f. J. Van LAARHOVEN erinnerte vor kurzem (Thou shaltnot slay a Tyrant! The so-called Theory <of Tyrannicide> of John of Salisbury, in: The World of John of S. 319–42, hier328) an das boshafte Wort von BERGES (wie 640) 139 n. 8: „Wir leisten uns das Kuriosum, J[ohann] die Klarheitabzusprechen, weil sie uns selbst fehlt.“704 V. CILENTO, Medio Evo monastico e scolastico, Mailand-Neapel 1961, 122 f.: „Il fascino del Policraticus deriva altresídal suo disordine. È un disordine apparente, beninteso. Il disordine di una conversazione, di un dialogo, di una diatribaclassica …“ Zu „conversazione“ s. S. 401 f. Diese Beurteilung steht in der Forschung ganz einsam da; sie soll hierUnterstützung erhalten.705 Vgl. KERNER 37 ff., 119, 189 ff.; MISCH 1256, 1267 zu Johann; UHLIG 6 ff., 27 ff. rechnet den Pol. insofern zurVorgeschichte des Essays, als er am Anfang der prae-humanistischen Opposition politischer „Moralisten“ gegen praxisferneSystematik und selbstzweckliche Wissenschaft stehe. Allgemein vgl. HIRZEL (wie Anm. 574) I 4 ff. zum Zusammenhangvon Konversationsmomenten in der Struktur des Kunstdialogs und vieler mit dem Dialog verwandter Gattungen. C.HENNSCHMÖLDERS, Ars conversationis, Zur Gesch. des sprachlichen Umgangs (16.–17. Jh.), in: Arcadia 10 (1975)16–33; D. MARSH, The Quattrocento Dialogue, Classical Tradition and Humanist Innovation, Harvard 1980. Den BegriffKonversation hat P.M. SCHON (14 ff.) zum Anlaß genommen, eine Linie von den Platonischen zu den CiceronischenDialogen über Montaigne zu den Moralisten des 18. Jhs. zu ziehen. Vgl. auch HIRZEL a. O. 246 zur vergleichbaren Absichtder Platonischen Dialoge und der Montaigneschen Essays: „Anzuregen, nicht zu erschöpfen bleibt ja die bescheidene Aufgabedes Essays“ (TREITSCHKE); Montaigne, ‚Essai’ II 12 (wie Anm. 192) 237: „Platon me semble avoir aimé cette forme defilosofer par dialogues à escient, pour loger plus duement en diverses bouches la diversité et variation de ses propresfantaisies. Diversement traicter les matieres est aussai bien les traicter que conformément, et mieus, à sçavoir pluscopieusement et utilement.“ (Vgl. S. 408 f.) D’Alembert, ‚Encyclopédie’, Art. ‚conversation’: „Les lois de la conversationsont en général de ne s’y appesantir sur aucun objet, mais de passer légèrement […] d’un sujet à un autre, de savoir y parlerde choses frivoles comme de choses sérieuses; de se souvenir que la conversation est un délassement […] en un mot delaisser, pour ainsi dire, aller son esprit en liberté, comme il veut et comme il peut […] de n’y point avoir le ton dogmatiqueet magistral.“ Neueres dazu: Th. W. ADORNO, Der Essay als Form, in: ders., Noten zur Literatur I, Frankfurt a. M.1958/71, 9 ff. Noch nirgends habe ich von mittelalterlichen Vorformen des Essays in dieser Hinsicht gelesen. Liegt diesmehr an der „dogmatischen und magistralen“ Schwerfälligkeit des Mittelalters oder an derjenigen der Mediävistik? Vgl.§§ 68, 82, 88, S. 344, 475 f.
356
eine mehr als nur stilistisch-literarästhetische Erscheinung. Zu den Montaigneschen ‚Essais‘ wurdefestgestellt, was sich durchaus auch auf den Policraticus übertragen läßt:706 „Das Anfügen von Beispiel anBeispiel, das die Tendenz zum Nicht-mehr-aufhören-können in sich schließt, das Gegenüberstellenverschiedener Meinungen und sich widersprechender Fakten, das Spielen mit Gegensätzen, das sind Merkmaleder Exemplasammlungen und der Essais […]“. Wichtig ist hier, wie bereits erwähnt, jener spezifischeKommentatoren-Habitus, ein Hang zum Glossieren um jeden Preis, den Johann mit vielen
706 SCHON 63 f. Jetzt wesentlich differenzierter und mit zahlreichen Kompositionsanalysen bis ins Einzelne belegt:TOURON 28 ff., 37 ff., 105 ff. u. passim. – Den Zusammenhang von Essay, Konversation und Exemplum stellt nachSCHON (75) bereits der Beginn der Noctes Atticae von Aulus Gellius her, die sich nach einem Wort BICKELS „zu einerEinheit zusammenplaudern“, ohne daß Einheit beabsichtigt ist. Vgl. auch das Vorwort von Macrobs Saturnalia und diewichtige Untersuchung von FLAMANT (wie Anm. 509) 172 ff., 219 ff. zur Gattung der „Symposien“ mit ihren quaestionesconvivales, ihrem lockeren Konversationston, ihrer Mischung von Scherz und Ernst, ihrer „faiblesse voulue des transitions“.All dies sind auch Stilmerkmale des stark von Gellius und Macrob abhängigen Policraticus: vgl. §§ 88, 99, S. 578 ff.,Anm. 370, 724, 742. – Stilistisch-dispositionelle Fragen zum Ablauf von Exempla und exempla-freien Partien können hierleider nicht behandelt werden, sosehr sie dies verdienen würden. Theoretisch bietet das Mittelalter hierzu wenig: Was dieArtes dictandi oder poeticae des Hochmittelalters etwa über den ordo artificialis, den Beginn oder Abschluß mit Exemplaoder zum amplifikatorischen Digressionsexemplum sagen, ist wohlbekannt (vgl. etwa P. KLOPSCH, Einführung in dieDichtungslehren des lat. Mittelalters, Darmstadt 1980, 130 f. mit Bibliogr.) und in dieser Hinsicht kaum der Rede wert. DieUntersuchung müßte also deskriptiv vorgehen, wobei kaum wesentlich andere Resultate als die aus Antike und Neuzeitgewonnenen zu gewärtigen sind: z. B. Ablauf von Exordium (Frage, Appell, Apostrophe u. ä.), historischem (auchautobiographischem) Exemplum (narratio, Thema) und Epimythion (Sentenz, Proverb, auctoritas, „Lehre der Geschichte“,Schlußreflexion) in einem bestimmten Hin und Her; konziser Satzduktus von Ankündigung, Erzählung und Schlußmoral ineiner einzigen Periode. Zu solchen Stilmerkmalen vgl. VERWEYEN 30 f. (Val. Max., Cic.); GUERRINI 13 ff. (Val. Max.);GOTOFF, passim (Cic.); SCHON 8 ff., 59 ff., 67 f. (Montaigne, Plutarch, Val. Max.); Will H. RACE, The ClassicalPriamel from Homer to Boethius, Leiden 1982, 17 ff. (Exempla-Reihungen). BALDWIN, Masters (wie Anm. 327) 15 f.(Assoziative Kapitelfolge im Verbum abbreviatum des Petrus Cantor mit „patch-work“-Binnenstruktur aus Zitaten, Exemplaund Kommentar).
357
Vertretern der Exempla-Literatur teilt;707 eine jegliche Wahrnehmung von Texten ebenso wie von Dingenexegetisch einfärbende Haltung, in der die Phänomene nur noch indirekt, auf dem Umweg über die dazubestehende literarische Tradition zugänglich sind und in der Abfolge der sich anbietenden Zitatekompositorisch darstellbar oder aufgrund immanenter, d. h. überlieferter Widersprüche diskutierbar werden.
Was H.-I. Marrou so eindrücklich für das spätantike Bildungssystem demonstriert hat, gilt noch weitgehendfür das Mittelalter:708 Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Methode der Neuzeit, die Problem zum Zweckeiner Lösung aufstellt, sei im alten rhetorischen Schulsystem ein selbstgenügsam
707 Vgl. Reg. s. l. Kommentar … Weil „einer Religion des Wortes jedes Wort wichtig war“ (C. SCHNEIDER [wieAnm. 271] II 36), übertraf das mal. Bildungswesen das antike noch um einiges in der Hochwertung des Kommentarmodells:Im MA gab es in einem gewissen Sinn nur Literatur über Literatur. Daß letztlich jedes Buch Kommentar sei, sagt JohannsLehrer, Wilhelm von Conches, in seiner wichtigen begrifflichen divisio (commentum = kontextfreie Gedankeninterpretation;glosa = auf Kontext und philologisches Detail eingehende Wort-für-Wort-Deutung) in seinen Glose super Platonem (ed. E.JEAUNEAU, Paris 1965) 67: commentum dicitur plurium studio vel doctrina in mente habitorum in unum collectio. Etquamvis, secundum hanc diffinitionem, commentum possit dici quislibet liber, tamen non hodie vocamus commentum nisialterius libri expositorium.708 MARROU, S. Augustin … 130, 149 ff.; 153: „S’il restait dans cette science une place à l’incertitude, c’était à cause de lamultiplicité et de la diversité des solutions proposées […] Dans ce domaine la discussion s’éternisait; à l’argument, laréfutation trouvait toujours à s’opposer.“
358
selbstzweckliches Wissen über „einen Staub von kleinen Ereignissen“, „ein Luxuswissen“ gerade über dieabseitigsten Streitfragen angestrebt worden, ohne die Absicht, zu einem Ergebnis, einer Problemlösung, janicht einmal zu enzyklopädischem Universalwissen zu gelangen. „Diese Wissenschaft erklärte alles. Wenndarin für Ungewisses Raum blieb, so lag dies an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der vorhandenenLösungsvorschläge, die in ihrer Weise gleichermaßen sachgerecht waren und nur auf dialektischer Ebenegegeneinander ins Spiel gebracht werden konnten. Eine gefährliche Methode: Auf diesem Feld verewigte sichdie Diskussion. Zu jedem Argument paßte immer irgendeine Widerlegung.“ Nach dem Mittelalter (auf diese inseinen Augen dekadente Denkform zurückblickend) sagt Montaigne ähnlich: „Mit größerer Betriebsamkeitsucht man Interpretationen zu interpretieren als Dinge zu verstehen, und es gibt mehr Bücher über Bücher alsüber irgend etwas anderes; wir glossieren uns nur noch gegenseitig. Überall wimmelt es von Kommentaren;Autoren haben Seltenheitswert.“708a Man kann dasselbe mediävistisch auch etwas anders bewerten, wenn manbedenkt, daß der vieldeutig unabgeschlossene Zitierhabitus der Scholiasten und Kommentatoren die geistigeFreiheit durch das Nebeneinander widersprüchlicher Informationen eher fördert und damit den Rechten deszum Mitdenken befähigten Lesers vielleicht besser Rechnung trägt als die zwingende Eindeutigkeit modernerWissenschaftsprosa.709 Exempla stehen nicht einseitig und fest im Dienste
708a Essais III 13 (wie Anm. 192) 1045 f.: „Il y à plus affaire a interpreter les interpretations qu’à interpreter les choses, etplus de livres sur les livres que sur autre subject: nous ne faisons que nous entregloser. Tout foumille de commentaires;d’auteurs, il en est grand cherté.“ Vgl. unten Anm. 751 (Met. III 1), Anm. 896 (Wilhelm von Conches).709 Vgl. §§ 68, 82, S. 451 f. H. DÖRRIE, Zum Problem der Ambivalenz in der antiken Literatur, in: Antike u. Abendland16 (1970), 85–92 zur beabsichtigten Vieldeutigkeit und Unabgeschlossenheit im hermeneutischen Zitierhabitus als Gegensatzzur modernen positivistischen, das endgültige Resultat suchenden Wissenschaft. Ähnlich auch ders., Spätantike Symbolik(wie Anm. 425) 3 f. zum platonischen Erbe gleichnishafter, relativer Erkenntnis als bloßer Wahrheitsannäherung und derentsprechend hochgeschätzten Meinungsvielfalt; M. de GANDILLAC, Encyclopédies pré-médiévales et médiévales, in: Lapensée encyclopédique (wie Anm. 337) 1–42, hier 22 f. zum „Liberalismus“ des Nebeneinanders widersprüchlicherInformationen (vgl. auch oben Anm. 570a, 431a); Chr. MEIER, Grundzüge der mittelalterlichen Enzyklopädik, Zu Inhalten,Formen und Funktionen einer problematischen Gattung, in: Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter u. in derReformationszeit, (Symposion Wolfenbüttel 1981) Stuttgart 1984, 467–503, hier 481 ff. und dieselbe,Argumentationsformen (wie Anm. 696) 127 ff. zum offenen Traditionsgebrauch mit „Indifferenzformeln“ zugunsten derInterpretationsfreiheit; von den BRINCKEN (wie Anm. 337) 426 zur leserfreundlichen Unabgeschlossenheit und zu offenenFragen bei Vinzenz von Beauvais (unten Anm. 720). – Grundsätzlich zum Thema „Freiheit durch Vielfalt“ vgl. O.MARQUARD, Universalgeschichte und Multiversalgeschichte, in: Saeculum 33 (1982) 106–115 und Abschied (wieAnm. 36) 91 ff., 130 ff. Was hier vortrefflich zu den vermeintlichen Neuerungen der Humanisten gesagt wird, läßt sichdurchaus bereits auf deren mittelalterliche Vorgänger und „Frühmerker“ beziehen: Die Hermeneutik ende „den Bürgerkrieg umden absoluten Text“ und erfinde die Literatur als den „nicht absoluten Text“; sie sei „Tolerantmachung“ der Texte undErrichtung einer „Gesprächsgeselligkeit“ des unendlichen Gesprächs ohne Einigungszwang. Diese heute wie stets aktuelleWeisheit, die Umberto ECO zum Hauptthema seines „Opera aperta“ und (was man zu wenig weiß) auch seinesSpätmittelalterromans, „Il nome della rosa“ gemacht hat, glaube ich, bereits bei Johann von Salisbury feststellen zu können,einem Erasmus des 12. Jahrhunderts.
359
bestimmter Beweisziele. Sie behalten vielmehr oft mitten im Argumentationszusammenhang etwas vomCharakter des Casus bei, lehren auch als formale Denkübungsbeispiele, daß und wie ihr Sinn gegebenenfalls„umgedreht“ oder entschärft werden kann.710 Es genügt also nicht, die im angeführten Brutus-Beispielevidenten Abschweifungen und dispositionellen Unausgeglichenheiten problemlos – oder auch nur zu gelehrterBelustigung – zu verzeichnen, wenn nicht gerade in den eigenartigen Übergängen jene dem „didaktischenMittelalter“ immer wieder abgesprochene Problematisierungskraft gesehen wird, die ein eigentlich illustrativgemeintes Beispiel aus seiner exemplarischen Rahmenfunktion oder „lehrhaften Verzweckung“ hinausdrängt
710 HONSTETTER (82 ff. u. ö.) zeigt diesen Doppelaspekt in den für Johann mustergültigen Memorabilien des ValeriusMaximus, sieht allerdings zu Unrecht einen Gegensatz zwischen deren zwei Funktionen, derjenigen des Stoffrepertoriumsund der des kasuistisch zu reflektierenden Lektürstoffs, da beides materiell oder formal dem Redner handbuchartig hilft, ausExempla möglichst viele Argumente und Widerlegungen herauszuholen. Gerade daß Valerius Maximus die moralischeMehrdeutigkeit und Zweischneidigkeit durch seine Auswahl und Anordnung dokumentiert, erweist ihn als rhetorischenHandbuchautor, im Gegensatz zu eigentlichen Schriftstellern, zu dem rein reflexionsbezogen literarisch-philosophischenSkeptiker Montaigne (was HONSTETTER 86 als Wertunterschied selbst vermerkt), aber auch zu vielen mittelalterlichenVerfassern von exemplarischen Traktaten, Dialogen oder Briefen, zweifellos jedenfalls auch zu Johann. Was immer man zurRehabilitierung des in der klassizistischen Altphilologie früher in der Tat verkannten Valerius Maximus sagen will, muß derklaren Absichtserklärung des Vorworts Rechnung tragen: Urbis Romae exterarumque gentium facta simul ac dicta memoratudigna quae apud alios latius diffusa sunt quam ut breviter cognosci possint ab illustribus electa auctoribus digerereconstitui, ut documenta sumere volentibus longae inquisitionis labor absit. Was SCHON (53) als Unterschied von Exempla-Kompilatoren und Montaigne hervorhebt, läßt sich auch als Unterschied von Val. Max. und Johann festhalten: Der Sammlerstellt den Stoff um seiner selbst willen zur Verfügung (gerade weil er in utramque partem gelesen werden kann), der Autormacht ihn seinen eigenen Gedanken dienstbar. Vgl. auch S. 17 f., 45. 69, 129, 137 ff., Anm. 164 sowie TOURNON 148 ff.,160 ff., 295 f.
360
und auch als ein geschichtspragmatisch ernstzunehmendes, tatsächlich widersprüchliches Ereignis kasuistischvor Augen führt.711
Mit programmatischer Klarheit sagt Johann (als scriptor, nicht als auctor) im Metalogicon-Prolog:712 „Nachder Regel aller Schriftsteller habe ich Vielfältiges so vereint, daß jeder Leser frei ist, es anzunehmen oder zuverwerfen“, wobei in der Bescheidenheitstopik die schriftstellerische Tätigkeit als bloßes Zur-Verfügung-Stellen von Variationen zu bestimmten Themen ohne eigene Stellungnahme definiert wird. Im gleichen Sinnäußern sich zwei Engländer, der eine wohl ein nahes Vorbild, der andere ein späterer Imitator Johanns.Wilhelm von Malmesbury schreibt im Polihistor:713 „Von Plinius habe ich das meiste, aber vieles darunter istunergiebig; Plinius hat selbst das meiste aus Valerius bezogen, Valerius seinerseits nahm fast alles, was er sagte,aus Cicero; dies alles habe ich, wie ich meine, hier nicht unnütz hingesetzt, damit du weißt, was ein jeder vomandern übernommen hat.“ Ranulfus Higden sagt im Prolog zu seinem Polichronicon:714 „Weder dieHistoriker noch die Kommentatoren dürfen wir verurteilen, wenn sie widersprüchliche Aussagen machen,denn die antiquitas selbst schuf den Irrtum […] und ‚alles, was geschrieben steht, ist zu unserer Lehregeschrieben.‘ [Röm. 15.4].“
Andrerseits ist die moderne Kritik an der Selbstzwecklichkeit einer solchen kompilierenden, glossierenden unddisputierenden „Wissenschaft der Zitate“ auch im Mittelalter selbst oft als eine Form der vana curiositasverurteilt worden. Für Johann von Salisbury, dessen ironisch distanzierte Bemerkung über den „Tummelplatz“„schwitzender“ Deklamatoren im Brutus-Exemplum
711 Solche Beispiele zeigen gut, wie falsch es wäre, den Policraticus als Fürstenspiegel oder politologischen Traktat zudefinieren: Die Exempla-Kenntnis und die rhetorische Logik der Exempla sind ebenso wichtige Aufgaben des Werks wie diepolitische Belehrung; das Studium des Brutus-Beispiels ist nicht weniger ernsthaft beabsichtigt als die Theorie der utilitaspublica, die POST (wie Anm. 640) 253 unter ausschließlich staatsrechtlichen Aspekten untersucht. In rechtsgeschichtlicherHinsicht wäre hier sogar bedenkenswerter, was das oben Anm. 567 nach LANG (wie Anm. 4) 73 ff. zitierte ‚Perpendiculum’zur Pflege der Exempla als Casus hervorhebt.712 Met. Prol. I, 3.19 f.: More scribentium res varias complexus sum quas quisque suo probabit aut reprobabit arbitrio.Vgl. §§ 49, 83 und CURTIUS, ELLM 491 zu Parallelen.713 Cambridge, St. John’s Coll. Ms 97, foll 111v mitgeteilt durch THOMSON, William of M. (wie Anm. 405) 390: DePlinio plura sed multa sunt et inania; plurima etiam ipse Plinius a Valerio, Valerius pene omnia que dixit sumpsit aTullio; hic tamen non incommode posita puto, ut scias quid quisque mutuatus est ex altero. (Jetzt ed. OUELLETTE [wieAnm. 1084] 61.27–30).714 Ranulfus Higden, Polychronicon (RBS 41.1), Prol. 18: Unde nec historicos nec commentarios varie loquentescondemnare debemus, quia antiquitas ipsa creavit errorem. Zu Röm. 15.4 vgl. S. 185 f., 371.
361
auffällt, war das Wort „Schule“ (nicht anders als bei den späteren Humanisten) mitunter ein Schimpfwort, jader Inbegriff für praxisferne Übungsspiele und sophistische Gedankenakrobatik. Schule war ihm der Gegensatzzum „Ernstfall“ des öffentlichen Lebens; was seiner von ethischem Pragmatismus getragenenWissenschaftsskepsis entspricht.715 Aus seiner Ablehnung mißbräuchlicher Formen der„Weltkommentierung“ ersieht man allerdings, was im Bildungsbetrieb seiner Zeit möglich war. So bekämpfter als etwas „Kindisches“ jene die These und die Gegenthese gleichzeitig implizierenden, grundsätzlichunlösbaren Fragen, die höchstens zu scharfsinniger Ausbreitung von Autoritäten führen: Was besagt derTraum des Agamemnon, in dem er träumte, man solle Träumen nicht glauben? Sagt einer die Wahrheit, dersagt: „Ich lüge“? Solches gehe in den declamationes scolasticae noch an, nicht aber „auf dem Forum“, wosich Ernst, nicht eitle Scharfsinnsdemonstration (ostentatio ingenii) zieme.716 Neben diesen aus der Logikstammenden Fragen (insolubilia als otiosae quaestiones) gab es als Themen der curiositas-Kritik auch„akademische“ Streitfälle aus Natur und Geschichte wie das geographische Problem der Lokalisierung derNilquelle, das astronomisch-metereologische der Ursache von Flut und Ebbe, das historische der Motive Catosbei der Wahl der unterlegenen Sache im Bürgerkrieg oder das mythologische der Irrtümer des klugen Odysseusnach dem Untergang Trojas. Das Eigenartigste aber ist vielleicht, daß die mittelalterliche Kritik an solchentradierten Deklamationsthemen und Schulstreitfragen selbst ein solcher locus communis gelehrterDebattierkunst war.717
715 Vgl. §§ 63, 71 f., S. 167 ff., 171 f., 292, Anm. 405, 575.716 Pol. V 12, (I) 338 f.: Fere a puero didicisti quia in quaestionibus quae habent positiones implicitas et quae latenterinvolvunt contraria, laboriosa solutio est, nisi te antiquo Nestore reputes cautiorem [cf. Macrob. Somn. Scip. I 3.15] Necredas somnio, Agamemnoni dictum est in sompnis, dum in excidio Troiae Grecia laboraret. Huiusque somniiinterpretationem Iovi censuerunt Grecorum sapientissimi reservandam. Laborantes vidi quamplurimos, dum quaeritur anqui dicit ‚Ego mentior’ verum dicat [cf. Cic. Acad. II 30.96; Sen. Ep. 45.10]. Sed neminem vidi qui Scillam vitaret etCaribdim […] At in litigiosis disputationibus et declamationibus scolasticis sine periculo ista versantur. Sed ubi ad forumventum est, in quo inanis ostentatio ingenii conquiescit et seria dumtaxat agitantur, sine periculo litigatorum aut iudicis insententiae calculo non erratur. Vgl. auch Met. II 9, 76 f. oben Anm. 576 zur Antithese scola-forum. Zu Johanns frühemZeugnis über die Insolubilia-Literatur und zur Tradition des Beispiels vom „Lügner“ vgl. L. MINIO-PALUELLO, 12thCentury Logic I: Adam Balsamiensis Parvipontanus: Ars disserendi, Rom 1956, 107; WILKS (wie Anm. 546) 267 f.; L.HICKMANN, Art. Insolubilia, in: HWbPh s. l. 396 ff. sowie oben Anm. 567a.717 Zu Johanns curiositas-Kritik vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 71 ff.; HUIZINGA (wie Anm. 31) 200 f.; von MOOS,Lucans tragedia 167 f., 175 f. und die oben Anm. 715 erwähnten Stellen. Allgemein vgl. MICHEL, Culture et sagesse (wieAnm. 402) 517 u. ö. besonders zu Sen. Ep. 88 (mit den erwähnten Beispielen). Curiositas-Rüge als Anlaß zur Ausbreitunggelehrter Kenntnisse etwa bei Laurentius von Durham, Consolatio. (wie Anm. 532) 155 ff. z. T. mit den angeführtenBeispielen (aus Sen. Ep. 88.7, Lucan 3.264: Odysseus, Cato); Alexander Neckam, De nat. rer. (ed. WRIGHT) 138 (Gezeitenals quaestio nondum soluta perfecte). Vgl. auch Johanns dubitabilia-Katalog zu weiteren quaestiones § 69, S. 295 f. Zurtraditionellen, vom Anfang an von Deklamatoren selbst vertretenen Kritik an der Lebensferne der Schule vgl.WINTERBOTTOM (wie Anm. 550) 1 ff. und S. 256, 291 f.
362
82. Die Methode der exegetischen Konfrontation diverser Lehrmeinungen läßt sich in sämtlichenBildungsdisziplinen feststellen, in denen Johann tätig war. Mit Recht wurde der juristisch-kirchenrechtlicheAspekt in den Vordergrund gestellt;718 doch auch im historiographischen Bereich knüpfte Johann an einevergleichbare Tradition an: Seit Herodot ist Neutralität gegenüber allen Versionen eines Berichts eintypisches Historikerideal. Es leistete einer gewissen historiographischen „Buntschriftstellerei“ Vorschub, inder Geschichte zu einem Mosaik paralleler, vergleichbarer Geschichten wird.719 Das Prinzip historischerWahrheitsfindung durch Sammlung und Sichtung aller verfügbaren Informationen bestimmte – namentlichseit Hieronymus – auch die Literaldeutung biblischer Geschichtsbücher mit Hilfe anderer, d. h.profangeschichtlicher Zeugnisse. Das derart geheiligte Verfahren der collatio mehrerer Texte zur Erklärungeines Textes hatte modellhafte Bedeutung für alle gelehrte und didaktische Literatur des Mittelalters. Die alsUnbeholfenheit gerügte oder als Phantasiereichtum gelobte Unordnung des Policraticus entspringt jenerlockeren Dispositionsform von kommentierter Erzählung oder erzählendem Kommentar, mit der nichtsosehr eine These entwickelt und bewiesen, als vielmehr von Zeugnis zu Zeugnis, von Auslegungsvariante zuAuslegungsvariante das zu einer These vorhandene Material als „Aspektereichtum“ aufbereitet wird.720 Inkompositorischer Hinsicht folgt Johann
718 Vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 6 f.719 Vgl. E. HOWALD, Vom Geist antiker Geschichtsschreibung, München–Berlin 1944, 16 f., 22 ff. 33, 41: Herodot oderdie Liebe zum Exkurs; historiographische Tradition unsystematischer variatio; KECH (wie Anm. 234) 30 ff., 189 undFUHRMANN, Mönchsgeschichten 67 f.: hellenistische Erzählformen und Legende; PARTNER (wie Anm. 23) 195 ff.:historiographische Parataxen; BRACKERT (wie Anm. 501) 152 ff.: Versionenangebot in der Historiographie undGeschichtsepik; KESSLER, Modell 45: Neutralitätsideal. – Zur Anekdotisierung der Geschichtsschreibung im Mittelalter s.auch § 39.720 Vgl. de LUBAC (wie Anm. 430) I 2, 467 ff., 433 zu Hraban, In I Mach. Prol. (PL 109) 1128B: ut ex multorum librorumcollatione veritas sacrae historiae pateat, et sensus narrationis eius lectori lucidior fiat; und zu mehreren analogen Stellen.Vgl. auch MEIER, Enzyklopädik (wie Anm. 709) 481 ff. u. ö. zur fortwährenden Neuordnung derselben alten Substanz, zurassoziativ-kombinatorischen Autoritätenakkumulation im Sinne der Aspektevielfalt; MARTI, Glosulae (wie Anm. 457) XLIIzu kommentierend erläuternden Exempla und Anekdoten in der Scholienliteratur. – Nicht nur für die enzyklopädischeMethode, sondern für eine ganze mittelalterliche Denkform repräsentativ ist der Speculum maius-Prolog des Vinzenz vonBeauvais (wie Anm. 337) 123; nach dem Zitat von Hier. Ep. 70.2 zur Berechtigung der Verwendung heidnischer Literatursogar in der Bibelerklärung folgt: Et ego quidem non ignoro philosophos inter se multa dixisse contraria, maximeque dererum natura […] Sed quoniam in istis […] pars utralibet contradictionis absque periculo nostre fidei potest credi veldiscredi, lectorem admoneo, si quas huiusmodi contrarietates sub diversorum actorum nominibus […] insertas inveniat,presertim cum ego iam professus sim, in hac opere me non tractatoris sed excerptoris morem gerere, ideoque non magnoopere laborasse dicta philosophorum ad concordiam redigere, sed tantum quid de unaquaque re quilibet eorum senserit autscripserit recitare, lectoris arbitrio reliquendo cuius sententiae potius deberet adherere. Ähnliche Aussagen Johanns undanderer „tractatores“ (S. 183 ff., 210 ff., 360 ff.) zeigen, daß der hier entschuldigungshalber betonte Genesatz von tractatorund excerptor keinen Wesensunterschied in der Art der Quellenbenutzung meinen kann.
363
überdies den Formen der populärphilosophischen Diatribe und der hellenistischen Novellen- undRomanliteratur, wie er sie vornehmlich aus den Briefen, Streitschriften und Legenden des Hieronymuskannte.721 Hier war die unterhaltende, Aufmerksamkeit erregende Abwechslung erstrebenswert. Als Mitteldazu diente eine eigene Exkurs- und Einschachtelungstechnik, ein parataktisches Reihen isolierterKompositionseinheiten, die je nach Thema und Topos, nicht nach einem übergreifenden Leitgedankeneingesetzt wurden.722
All diese Züge einer „Kunst der Bastelei“ sind in der allgemeinen Literaturgeschichte nicht unbekannt, werdenin der Einzelinterpretation des Policraticus jedoch – wohl wegen unserer unüberwindbarenKonsistenzerwartungen – immer wieder in den Hintergrund gedrängt.723 Johann ließ sich weder vom
721 Vgl. §§ 69, 101, S. 110 f., 124, 290 f., 461; A. OLTRAMARE, Les origines de la diatribe romaine, Lausanne 1926, 13:„La seule unité qu’on y puisse trouver est une varieté constante et forcée.“722 Vgl. KECH (wie Anm. 234) 21, 61 f., 30 ff., 189 zu Strukturprinzipien (Isolierung, parataktische Reihung, novellistischeExkurse) bei Hieronymus. Zum rekreativen Moment der ungeordneten Vielfalt vgl. S. 385 ff. und H.L.F. DRIJEPONDT,Die antike Theorie der varietas. Dynamik und Wechsel im Auf und Ab als Charakteristikum von Stil und Struktur,(Spudasmata 37) Heidelberg 1979, bes. 4 ff., 56 f., 185, 189 (zu Historiographie und Exemplum); PARTNER (wieAnm. 23) 195 ff. (parataktische Erzählformen).723 „Kunst der Bastelei“: s. U. ECO, Auf dem Weg zu einem Neuen Mittelalter (1972) in: ders., Gott und die Welt, Essaysund Glossen, übs. v. B. KROEBNER, München/Wien 1985, 8–35, hier 29 ff. – Vereinzelte Hinweise zu Johann s. beiSCHAARSCHMIDT 131 f. (patristische Assoziationsmethode); LIEBESCHÜTZ 67 ff.; KERNER 37 ff. (Traditionrhetorischer Argumentation mit Exempla); MISCH 1256 (reminiszenzbedingte Widersprüche).
364
gedanklichen noch vom erzählerischen Gesamtkontext leiten, sondern von literarischen Reminiszenzen, wiesie sich gerade einfanden. Im Prolog sagt er:724 „Was mir aus den verschiedenen Autoren an einschlägigenStellen in den Sinn kam, habe ich, wenn es nur nützlich und angenehm schien, meinen Ausführungeneinverleibt, gelegentlich ohne die Namen der Autoren zu nennen.“ Dabei wechseln die Kriterien der Aussage,bzw. des Zitats und des
724 Pol. Prol. (I) 15.20 f.: Quae vero ad rem pertinentia a diversis auctoribus se animo ingerebant, dum conferrent autiuvarent, curavi inserere … (s. auch S. 202 f., 402). Johann bezeugt mehrfach, daß er aus dem Gedächtnis zitiert; etwaPol. II 17, (I) 99.24 f.: … nomen etenim a memoria excidit, etsi narrationis auctorem magnum teneam Augustinum. Ebd. IV6, (I) 255.23: In Atticis Noctibus legisse me memini quod… Ebd. V 5, (I) 288.1: Alibi me dixisse recolo quia… (Selbstzitat)Ebd. VIII 20, (III) 378.4 f.: … quod in alio regum Iudae non memini. Ebd. VII 12, (II) 141.1 f.: Ut enim quidam ait (verbisnamque manentibus nomen excidit): … J. MARTIN, (John of S. as Classical Scholar, in: The World of John of S. 179–202,hier 196 f.) macht allerdings wahrscheinlich, daß Johann seltenere Prosa-Exempla direkt aus den Kompilations-Hss.ausschrieb und nur die üblichen Schulautoren, insbesondere die poetae, aus dem Gedächtnis anführte. Es ist also nichtauszuschließen, daß er auch hier (S. 202 ff., 413) mit seiner Belesenheit etwas kokettiert. Dies ändert aber nichts an derGlaubwürdigkeit seines Bildungsideals, das gemäß der verherrlichenden Beschreibung Bernhards von Chartres (Met. I 24) dieimitatio auctorum als Angewöhnung zum Ziele hatte; vgl. S. 239 ff., 376 f., 397, 420, Anm. 550, 668, 833. – Vgl. RAY(wie Anm. 360) 51 zur Gepflogenheit, im Grammatikunterricht geschichtliche Inhalte selektiv auswendig zu lernen und dabei– wie Sallust- und Lucan-Hss.-Randbemerkungen zeigen – gerade Exempla zu bevorzugen. – Zu den antikenVoraussetzungen vgl. die mit obiger Prologstelle verwandten Prologe Macrobs (Sat. praef. 3), Val. Max. und besondersGellius’, N.A. praef. 2: Usi autem sumus ordine rerum fortuito, quem antea in excerpendo feceramus. Nam proinde utlibrum quemque in manus ceperam […] quid memoratu dignum audieram, ita quae libitum erat […] indistincte atquepromisce annotabam eaque mihi ad subsidium memoriae quasi quoddam litterarum penus recondebam, ut quando ususvenisset aut rei aut verbi, cuius me repens forte oblivio tenuisset et libri ex quibus ea sumpseram non adessent, facile indenobis inventu atque depromptu foret. Zur Bedeutung des Exzerpierens und Memorierens von Exempla als Memorabilien inder alteuropäischen Bildungspraxis vgl. Herwig BLUM, Die antike Mnemotechnik, (Spudasmata 15), Hildesheim 1969;BRÜCKNER, Hist. 62 ff.; BARNER (wie Anm. 298) 59 ff.; Helga HAJDU, Das mnemotechnische Schrifttum desMittelalters, Wien 1936; Frances A. YATES, The Art of Memory, London 1966; FUNKE, Gewohnheit (wie Anm. 211)99 ff. Auf die Kunst der memoria gehen am Rand auch Beiträge des eben erschienenen Bandes ‚Memoria’, Der geschichtlicheZeugniswert des liturgischen Gedenkens im MA, (MMS 48) München 1984 ein (was man dem Titel nicht ansieht): s. bes.F. OHLY, Bemerkungen eines Philologen zur Memoria (9–68, hier 31, 38 ff., 44 ff., 46, 49 mit reichhaltigstenbibliographischen Angaben); O.G. OEXLE, Memoria und Memorialbild (384–440, hier 390, 394).
365
Kommentars daruber standig und oft in schillernder Weise. Eine literarische Vorlage führt häufig im erstenSchritt zu uneingeschränkter Übernahme, im zweiten Schritt zu einer Relativierung der extremen, darausmöglichen Konsequenzen und am Ende zu einem Ausgleich oder einer das Problem offen lassendenAposiopese.725 Diese drei Phasen, die der moderne Denker vielleicht zu einer einzigen simultanen,nuancenreichen Aussage synthetisieren würde, wirken bei Johann erstaunlich selbständig, wie in sichgeschlossene Kreise, die sich nur leicht am Rande überschneiden.
Man hat dieses Verfahren schon für die Widersprüche seiner „Tyrannenmordtheorie“ verantwortlichgemacht.726 Der tiefere Grund dafür liegt wohl in der spezifischen, schon patristisch fundierten Hermeneutikdes Mittelalters, die nicht die Einsinnigkeit, sondern den Sinnreichtum von biblischen und anderen
725 Vgl. § 81. Die Methode kann auch als eine monologische Umformung eines ursprünglich dialogischen Prinzipsverstanden werden: vgl. HIRZEL (wie Anm. 571) 245 f.; SCHON 16.726 Vgl. KERNERS Besprechung früherer Forschung 194 ff. und etwa LIEBESCHÜTZ. Humanism 51 mit Bezug auf dasTyrannenmord-Problem: Der Pol. sei „a symposium of various traditions lacking an opinion of its own on the problems ofJohn’s time“; ROUSE/ROUSE (oben Anm. 635); G.C. GARFAGNINI, Legittima potestas e tirannide nel Policraticus diGiovanni di Salisbury, Riflessioni sulla sensibilitá politica di un clericus per i problemi storici-politici, in: Critica storica14 (1977) 575–609 und ders. Ratio disserendi (wie Anm. 394) 39 f. Vgl. auch die bewußt provokant formulierte Leugnungjeglicher Tyrannenmordtheorie im Pol. durch J. van LAARHOVEN ‚Thou shalt not Slay a Tyrant’ (wie Anm. 703); dem istinsofern beizupflichten, als Johann dem gut illustrierten Problem gegenüber in der Tat völlig offen geblieben sein dürfte.Vgl. S. 322 ff., 468 ff. Erwähnenswert ist hier die aufgrund derselben Bildungstradition zustandegekommene AnalogieJohanns mit Salutati und anderen späteren Humanisten, die gerade solch heikle politische Themen wie Tyrannenmord oderErbnachfolge in Dialogen und Briefen pro und contra als Denkmöglichkeiten durchprobten; vgl. LINDHARDT 32, 86 f.; E.GARIN, La cultura fiorentina nella seconda metà del’300 ei ‚barbari britanni’, in: Rassegna delle lett. ital. 64 (1960) 181–95;HERDE (wie Anm. 631) 209 f.; M.A. LEVI, La controversia sulla uccisione di Giulio Cesare e le fonti latine del ‚Detyranno’ di Col. Salutati, in: Rendiconti del Istituto Lombardo 101 (1967) 717–28. Vgl. Anm. 593, 631, 697. VanLAARHOVENS geistreiche Kritik der Tyrannenmordtheorie stützt sich allerdings nicht auf diese formale Tradition derKasuistik und Thesis-Disputation, sondern rein inhaltlich auf die Tatsache, daß Johanns Thema der böse exitus der Tyrannensei, die Strafe Gottes für politische Gesetz- und Gottlosigkeit, gleichgültig durch welche Menschen oder durch welchesUnheil das Urteil vollstreckt werde. In der Grobstruktur scheint mir auch diese Deutung zutreffend, doch würde ich miteinem semper aliquid haeret differenzieren: Nach der rhetorischen Logik des Verhältnisses von dubium und certum bildethier nicht der „Untergang der Bösen“, sondern der Tyrannenmord das unzweifelhafte Beweismittel. Weil Tyrannenumgebracht werden dürfen – dies ist eine Prämisse –, darum darf man ihnen z. B. auch schmeicheln (Pol. III 15); und weil esseit Judith heroische Tyrannenmörder gibt, werden Tyrannen immer ihr verdientes Ende haben (Pol. VIII 17–23). Abgesehendavon, daß Johann tyranni nicht nur in einem eng politischen Sinn, sondern oft moralisch ganz allgemein (wie z. B. auchEpicurei und Gnathonici) als Sammelbegriff für Übeltäter aller Art gebraucht (Van LAARHOVEN a. O. 330), bleibt andieser Funktionalisierung des Tyrannenmords zum Beweis der miseria tyrannorum immerhin beachtenswert, wieselbstverständlich Johann mit der (vom Apostel Paulus keineswegs gutgeheißenen) Möglichkeit umgeht, das Problem derbösen Obrigkeit zu erledigen. Wenn der Policraticus in seiner Rezeptionsgeschichte zu einer Autorität für Tyrannenmordwurde, so ist dies zweifellos nicht immer nur grober Mißbrauch (wie im Falle des Jean Petit, s. Anm. 642, sondern keimhaftals eine offene Alternative im Werk selbst angelegt. Die unten Anm. 929 angeführte Überschrift von Pol. VIII 20 läßtinsofern an Klarheit nichts zu wünschen übrig.
366
Textstellen festzustellen suchte.727 Zwei Aussagen aus der Feder von unmittelbaren Lehrmeistern Johannsmögen dies beleuchten:728 Mehrere Deutungen einer Stelle, sagt Wilhelm von Conches zum klassischenintegumentum, seien nicht zu tadeln, da an einer Sache notwendig diverse Gesichtspunkte zu betrachten seien.„Man sorge sich nicht um die Unterschiedlichkeit der Auslegungen, man freue sich vielmehr darüber.“ DieVielfalt der Deutungen ist ein erwünschtes Zeichen für das Deutungspotential
727 Vgl. die oben Anm. 709 angeführte Literatur; überdies: BUISSON, Potestas 31 ff.; ders. Exempla 460 ff.; E.AUERBACH, Typologische Motive in der mal. Lit., Krefeld 1953/1964, 24 f.; JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428)133 ff.; LUBAC (wie Anm. 430) I 433 ff.; ROBERTSON, Terminology (wie Anm. 636) 670 f., 676 ff.; BRINKMANN,Hermeneutik (wie Anm. 145) 26 ff., 180 ff., 267 ff. u. ö.728 Wilhelm von Conches, Integumentum de Orpheo in den teilweise von E. JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 139mitgeteilten Boethius-Glossen aus Hs. Troyes 1331 f. 69r: Exposita summa integumenti singula ut in libro continenturexponamus, hoc autem premonentes quod si aliquis legens Fulgentium aliter hanc fabulam exponi videat, idcirco hancnostram non vituperet, quia de eadem re secundum diversam considerationem diverse inveniuntur expositiones. Sed non estcurandum de diversitate expositionum, immo gaudendum, sed de contrarietate si in expositione esset. Treffend schreibtJEAUNEAU ebd. dazu: „Un moderne penserait qu’en se multipliant les interprétations se détruisent les unes les autres. Pourles hommes du XIIe s. elles témoignent, par leur multiplicité même, de la richesse du texte à commenter. Ce dernier était àleurs yeux comme une pièce d’or inestimable dont on ne saurait jamais, fût-ce au prix de nombreux commentaires, finir derendre la monnaie.“ Vgl. auch A. 431 zu Marie de France und ihrer auf einem traditionellen Priszian-Mißverständnis(Anm. 538) beruhenden Vorstellung, die Alten hätten dunkle Bücher geschrieben, weil später einmal gebildetere Menschenkommen würden, die ihre Schriften kommentieren und entschlüsseln könnten.
367
eines Textes oder einer Textstelle. Ähnlich sagt Abaelard,729 die Intention des Autors sei nicht entscheidend,wenn ein Text inspiriert ist. Denn er enthalte mehrere Sinne, auch solche, die der Autor noch nicht gesehenhabe, die wir aber aufzufinden hätten. Auch daß die Deutungen sich widersprechen, sei gleichgültig, solange siedem Glauben nicht zuwiderlaufen. Aus dem einen Gold machen die einen Ketten, die anderen Ringe, diedritten Armbänder. – Beide Zeugnisse beleuchten gut einen in der Frühscholastik verbreiteten optimistischenBildungsgedanken: Das Reich der litterae, seien sie heilig oder profan, ist dem Menschen alsInterpretationsmaterial, als Rohstoff zur Verfügung gestellt, damit er durch dieses Medium die vielfältigen
729 Abaelard, Theol. christ. I 117 (= Introd. ad theol. I 20), CC med. XII (1969) 121: Si quis autem me quasi importunumac violentum expositorem causetur, eo quod nimis improba expositione ad fidem nostram verba philosophorum detorqueam,et hoc eis imponam quod nequaquam ipsi senserint, attendat illam Caiphae prophetiam [Jo. 11.50–1; 18.14: ‚Expedit unumhominem mori pro mundo’], quam Spiritus Sanctus per eum protulit, longe ad alium sensum eam accomodans quamprolator ipse senserit. Nam et sancti prophetae cum aliqua Spiritus Sanctus per eos loquitur, non omnes sententias ad quasse habent verba sua intelligunt; sed saepe unam tantum in eis habent, cum Spiritus ipse, qui per eos loquitur, multas ibiprovideat, quarum postmodum alias aliis expositoribus et alias aliis inspirat. Unde Gregorius in Registro, ad Ianuariumepiscopum Caralitanum scribens, loquitur: […; III Ep. 67, PL 77, 668 A–B; …] Sicut enim ex uno auro alii murenulas,alii anulos, alii dextralia ad ornamentum faciunt, ita ex una Scripturae sacrae sententia expositores quique per innumerosintellectus quasi varia ornamenta componunt, quae tamen omnia ad decorem caelestis sponsae proficiunt.“ Auch hier gehtes nicht primär um Bibelauslegung, die vielmehr vergleichsweise erwähnt wird, sondern um eine geistliche Macrob-Interpretation. Vgl. JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 129, 132 f.; P. DRONKE, Fabula, Explorations into the Uses ofMyth in Medieval Platonism, Leiden–Köln 1974, 63 ff.; Chr. MEIER, Überlegungen zum gegenwärtigen Stand derAllegorie-Forschung, Mit besonderer Berücksichtigung der Mischformen, in: FMSt 10 (1976) 1–69, 10 ff. zumintegumentum. Zum Bild des nutzbaren Goldes für die Wahrheit vgl. Aug. Conf. VII 9.15; Doctr. christ. II 6.7; II 40.60–1s. Anm. 396 und Chr. GNILKA, Usus iustus. Ein Grundbegriff der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur, in:Arch. f. Begriffsgesch. 24 (1980) 34–76, hier 73; vgl. auch ders. Chresis (wie Anm. 734). Zum Problem der Autor-Intentionim MA vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 36 ff., 73 ff. und S. 397 ff., Anm. 483, 912. Hervorzuheben ist, daßAbaelard im Sic et non-Prolog (wie Anm. 631) 95 die Beachtung der voluntas auctoris als eine Regel der Textkritikempfiehlt, damit man besser Zitate (oder opinio aliorum) von der Ansicht des Autors zu unterscheiden lerne. Dies gehörtaber zu den hermeneutischen Präliminarien und widerspricht keineswegs der Auffassung einer höheren, den auctor verborumübersteigenden Autorschaft Gottes (des auctor rerum), die es in letzter Instanz zu deuten gilt. Vgl. auch SALTMAN (wieAnm. 574) 357 f. zu ähnlichen Aussagen Johanns in Ep. 209 (II) 332 ff.
368
Teilaspekte der einen göttlichen Wahrheit, die als Ganzes unzugänglich bleibt, nach Menschenmaß erkennenkann.730
g) Schöpfungswelt und Literaturwelt:die Theorie der „Literaturbeherrschung“
Über Offenheit und Sinnreichtum aller Literatur als „Gottes Wort“ und die Naturunterwerfungs- und Speisemetaphorik (§ 83).Die literarische Aufgabe der auctores-Einverleibung und das philosophische Ideal des prophylaktischen „Alles-Lesens“ imHinblick auf künftigen Erkenntnisfortschritt (§ 84). Rhetorische multiplicitas und topischer Aspektereichtum (§ 85). Das„humanistische“ Paradox von Naturbeherrschung und Naturverständnis in bildungstheoretischer Metaphorik:Literaturausbeutung oder Ehrfurcht vor dem Wort? (§ 86). Die clientes-Metapher für die Verbindung von geistigerSelbständigkeit und Traditionsabhängigkeit, von interpretatio christiana und imitatio auctorum (§ 87). Apologie für das„Zitieren“ apokrypher und fiktiver Autoren mit Hilfe antiker Theorien zu fabula, argumentum und comedia (§ 88).
Wer viel weiß, der kann viel finden, wenn er die Kunst zu erfindenbesitzt.
Christian Wolff,(Vernüftige Gedanken von Gott § 861).
83. Der Gedanke der Disponibilität und Nutzbarkeit aller – wesentlich als semantisch polyvalentverstandenen – Literatur gehört zu Johanns zentralen Themen.731 Er hat ihn vor allem nach Augustin ausdem Schöpfungsbegriff entwickelt. Literatur versteht er in Analogie zu den geschaffenen Dingen der Natur,die sich der Mensch einerseits zu seinem Nutzen unterwirft und die er ausbeutet, andererseits betrachtet undwie ein Buch zu verstehen sucht, in das der „Finger Gottes“ sichtbare Zeichen für das Unsichtbare eingetragen
730 Zum frühscholastischen Bildungsoptimismus vgl. S. 377 ff., 380, 453 ff.; § 66 (zu Abaelards Sic et non) und EHLERS,Hugo (wie Anm. 17) 58 ff.731 Vgl. SCHAARSCHMIDT 83 f.; Hans H. GLUNZ, Die Literarästhetik des lateinischen Mittelalters, Frankfurt a. M.(1937) 1963, 59 f. (zu Pol. VII 9–10); HELBLING-GLOOR (wie Anm. 26), 86 f. (zu Pol. II 16); LUBAC (wie Anm. 430) I462 f.; ROBERTSON, Chaucer (wie Anm. 342) 342 f.; ders., Terminology (wie Anm. 636) 691; McGARRY 665 sowieoben Anm. 712 zu Met. Prol. 3. Vgl. auch Pol. VII 12, (II) 144.8 ff.: […] thesaurus Spiritus sancti cuius digito scripti sunt[libri divinae paginae] omnino nequeat exhauriri […] multiplicitas misteriorum intrinsecus latet et ab eadem re saepeallegoria fidem, tropologia mores variis modis edificet; anagoge quoque multipliciter sursum ducit ut litteram non modoverbis, sed rebus ipsis instituat. (Zur nachfolgenden Einschränkung hinsichtlich der profanen Literatur s. S. 456 ff., 507 f.)Wie Abaelard (oben A. 729) bekennt sich auch Johann zum Anspruch, die Autoren gegen ihr eigenes Verständnis zu lesen inMet. IV 16, 82.15 ff., wo er im Zusammenhang mit der Theorie der Weltseele Seneca (Ep. 66.12) als Zeugen für denHeiligen Geist, etsi ille aliud senserit, zitiert. Vgl. auch GREGORY, Abelárd et Platon (wie Anm. 752) 50 ff.
369
hat.732 In einem überaus wichtigen und dichten Policraticus-Kapitel (VII 10) legt Johann den Umgang mitLiteratur nach dem Modell des Schöpfungsauftrags
732 Neben den im Folgenden angeführten Stellen zum „Buch der Natur“ bei Johann s. auch Pol. VII 12 in Anm. 731 zumschreibenden Finger Gottes und Pol. III 1, (I) 172 f. über die beiden Quellen des Wissens: ratio (bzw. natura) und gratia(bzw. revelatio), insbesondere 173.13 ff. zu ersterer: Quodque magis mirere, quilibet quasi quendam librum sciendorumofficio rationis apertum, gerit in corde. In quo non modo visibilium species rerumque omnium natura depingitur, sed ipsiusopificis omnium invisibilia Dei digito conscribuntur (cf. Rom. 1.20). Hier geht es um die platonisch bestimmte Vorstellungeiner Teilhabe des geschaffenen Menschen (durch seine Vernunft) an den göttlichen Archetypen der Schöpfung als Nachweiseiner ersten oder natürlichen Offenbarung. Diese theologische Naturbuchmetapher wird in Pol. VII 10, wie zu zeigen ist, ineiner zweiten Metaphorisierung zur Basis einer Literaturtheorie. Einen ähnlichen Bedeutungswandel zeigt das zentrale Wortvestigium (s. S. 341, 393 ff.), das, wie der schreibende Finger Gottes, auf die Zeichenhaftigkeit der Schöpfungsnatur, aberebenso auf die Wahrheits-Spuren der Literatur bezogen wird; Pol. III 1, (I) 172.30 ff.: Omnia etenim virtus angelica vel ethumana divinitatis vestigium est rationali creaturae quodammodo impressum. Zu dieser Stelle und Parallelen beiBonaventura und Meister Eckhart s. Erich ROTHACKER, Das Buch der Natur (aus dem Nachlaß), Bonn 1979, 31, 43, 80 f.Der mit dem Naturbuchbild zusammenhängende Begriff liber cordis oder experientiae erscheint in Pol. VII Prol. (II) 93gleichfalls als Metapher für ein literarisches Phänomen (s. S. 232 f.). – Zum ‚Buch der Natur’ im Mittelalter kündigt F.OHLY eine größere Arbeit an; vgl. einstweilen ders., Deus geometra, Skizzen zur Geschichte einer Vorstellung von Gott, in:Tradition als historische Kraft, ed. N. KAMP/J. WOLLASCH, Berlin 1982, 1–42, bes. 1 ff.; ders., Typologische Figurenaus Natur und Mythos, in: ‚Formen und Funktionen der Allegorie’, ed. W. HAUG, Stuttgart 1979, 126–66, hier 126 f.;ders., Das Buch der Natur bei Jean Paul, in: Festschr. E. TRUNZ, Studien z. Goethezeit, Heidelberg 1981, 177–232. sowiedie (z. T. von OHLY bestimmte) vortreffliche Zusammenfassung bei WEHRLI, Literatur. (wie Anm. 55) 249 ff. – Aus derreichen Literatur zum Thema finden sich für unseren Zusammenhang die relevantesten Aspekte m. E. bei H.BLUMENBERG, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt 1981, bes. 48 ff. (Aug.), 51 ff. (Hugo v. St. Victor) u. ö.; vgl. auch D.BÖHLER, Naturverstehen und Sinnverstehen, Traditionskritische Thesen zur Entwicklung und zur konstruktivistisch-szientifischen Umdeutung des Topos vom Buch der Natur, in: ‚Naturverständnis und Naturbeherrschung’, ed. F. RAPP,München 1981, 80–95; A. DEMANDT, Metaphern für Geschichte, München 1978, 382 f.; Chr. MEIER, Das Problem derQualitätenallegorese, in: FMSt 8 (1974) 385–435, hier 434 f.; dieselbe, Enzyklopädik (wie Anm. 709) 472 ff., 483 f.;Elizabeth L. EISENSTEIN, The Printing Press as an Agent of Change, Communication and Cultural Transformation inEarly-Modern Europe, Cambridge 1979, 453 ff. („The great book of Nature and the little books of men“); CURTIUS,ELLM, 179, 323 ff.; LECLERCQ, Symbolique du livre (wie Anm. 526); BRINKMANN, Hermeneutik (wie Anm. 145) 49,74 ff. – Für den Bezug zur Exempla-Theorie vgl. ferner: VON DEN BRINCKEN (wie Anm. 337) 446 ff.; GERHARDT (wieAnm. 287) 60 f.; The Texts Called ‚Lumen Anime’, in: Arch. Fratr. Praedic. 41 (1971) 4–113, bes. 28 f.; MichaelSCHILLING. Imagines mundi, Metaphorische Darstellungen der Welt in der Emblematik, (Mikrokosmos 4), Frankf.–Bern1979, 71–81; zur frühneuzeitlichen Fortentwicklung der Idee der von Gott geschriebenen „Beispiele in Natur und Geschichte“vgl. BRÜCKNER, Hist. 36 ff., 93; ders., Loci communes 4 ff. und S. 120, 152 f. J. KOPPERSCHMIDT, Die Eloquenz derDinge: Rhetorikgeschichtliche Anmerkungen und Ergänzungen zu Hans Blumenbergs ‚Die Lesbarkeit der Welt’, in:Rhetorica 3 (1985) 105–136, bes. 109 ff. (mit weiterführender Lit.).
370
dar:733 „[…] nicht nur alles Geschriebene (scripta), sondern auch alles, was geschaffen wurde und geschehen ist(facta), ist zum Nutzen des Menschen eingerichtet, obwohl dieser es aus eigener Schuld gelegentlichmißbraucht.“ Man hört Augustins Unterscheidung der auf die Weltdinge bezogenen Begriffe uti und abutiheraus. Diesen Anklang kombiniert Johann mit Röm. 15.4: „Was immer geschrieben wurde, ist zu unsererBelehrung geschrieben“. Diese ursprünglich allein auf das Alte Testament bezügliche Paulusstelle
733 Pol. VII 10, (II) 130–134: ‚Omnes scripturas esse legendas’; 130.1–20: Omnes tamen scripturas legendas esse probabileest, nisi sint reprobatae lectionis, cum omnia non modo quae scripta sed etiam quae facta sunt ad utilitatem hominis, liceteis abutatur interdum, instituta credantur [cf. Rom. 15.4]. […] Ab initio benedixit Deus homini dicens [Gen. 1.28–9;9.1–4]: Crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et volatilibus celi etuniversis animantibus quae mouentur super terram. Et adiciens omnem herbam afferentem semen et universa ligna in ususuo (nam a carnis edulio ante diluvium creduntur abstinuisse) concessit eis in cibum […] 130.28–131.2: dominium terrae etbestiarum terror privilegium potestatis, uictualium universitas est indicium libertatis; omnia siquidem munda mundis[Tit. 1.15, cf. Rom 14.20, …] 131.29–132.13: Verum cum littera praecedens utiliter ad multa possit, referri, et ad hocposse aptari consentio ut per gratiam ex benedictione Dei collatam ad uirtutis incrementum et multiplicationem liberumexcitetur arbitrium et uirtutibus multiplicatis per gratiam adiciatur subiecto terrae quam cum in se ipso homo subiecerit,dominium sui aliorumque consequitur, ut, cunctis animantibus praelatus, timorem et tremorem incutiat omnibus quaemoventur in terra. Sunt ei ergo cuncta in cibum quia in omnibus creaturis ei verba salutis suae loquitur Dominus. Planecibatur in cunctis quibus ad vitam vel mores componendos vita hominis proficit. Constat enim quod omnis edificatiomorum a Domino est et, cum quis ad virtutem aut ab opere aut a verbo aut quocumque modo instruitur, concessis sibi aDomino utiliter cibatur. Omnis enim instructio salutis quodammodo verbum Dei est, et a quocumque veritas doctrinaeproferatur, acceptanda est eo quod veritas incorrupta semper et incorruptibilis est.
371
dehnt er in humanistischer Großzügigkeit auf alle Literatur aus.734 Überdies erinnert der Doppelsinn von facta(geschehen/geschaffen) an das andere Begriffspaar: dicta et facta, das, wie gesehen, bei ihm synonym fürExempla steht. All das zeigt, daß auch die Geschichte zum benützbaren, hermeneutisch verwertbarenSchöpfungskosmos gehört, daß sie, wie Augustin verkündet hatte, einmal geschehen, nicht mehr einemenschliche, sondern
734 Rom 15.4: Quaecumque enim scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationemscripturarum spem habeamus. Grundlegend dazu Aug. Doctr. christ. II 18.28: quisquis bonus verusque christianus est,Domini sui esse intelligat ubicumque invenerit veritatem, quam conferens et agnoscens etiam in litteris sacris superstitiosafigmenta repudiet, womit (allerdings ohne direkten Bezug auf die Römerbriefstelle) die Ausdehnung des Wahrheitskriteriumsauf den Gebrauchswert aller Literatur einschließlich des Alten Testaments, das demselben nicht notwendig und immer gerechtwird, ausgedehnt ist (vgl. S. 504 ff.). Rom. 15.4 erscheint mit gleicher Sinngebung auch in Pol. III 8, (I) 193 f.: ea quaephilosophis gentium publicae utilitatis gratia scripta sunt audire quid prohibet? ‚Quaecumque enim, inquit, scripta sunt adnostram doctrinam scripta sunt …’ (zum Kontext s. S. 496 f.). Es handelt sich dabei keineswegs um eine exegetischeKühnheit, wenn das Ausmaß der Anwendung von Rom. 15.4 auf die Profanliteratur auch ein stets debattiertes Problem war;vgl. etwa Bernhard von Utrecht, Commentum in Theodulum I 180 ff. (ed. R.B.C. HUYGENS, Spoleto 1977) 27: … adquod respondendum gentilis et sacrae scripturae signari diversitatem. […] nec gentilis scriptura remotis auctorumcavillationibus, quibus inflatur, multum valere videtur. At dices: quaecumque scripta sunt ad nostram doctrinam scriptasunt, et ego: dissuadendo quidem quaedam, quaedam vero suadendo (vgl. S. 185 f.); Ranulfus Hidgen, Polychron. Prol.(wie Anm. 714) 18 rechtfertigt mit Rom. 15.4 literarische Fiktionen: Paulus habe nicht gesagt, alles was geschrieben sei, seiwahr , sondern „zu unserer Unterweisung“. Vgl. auch CURTIUS ELLM 367; ROBERTSON, Chaucer (wie 342) 342 f.;MINNIS, Autorship (wie Anm. 337) 109 f., 119, 193, 206 f. (Rom. 15.4 „could be used to justify practically everything“).GUENÉE, Hist. et culture historique 26 f.; LACROIX 169 ff. zu Rom. 15.4 als Begründung des historia magistra vitae-Prinzips; R.M. THOMSON, The Reading of William of Malmesbury, in: RB 85 (1975) 362–402, hier 374 (analog auch zuI Thess. 5.21); GLUNZ (wie Anm. 731) 55 ff., 59 f., 181 (zu Pol. VII 10 allerdings mit der zu einfachen Vorstellung einer„Erlösung der Antike“). – Zu usus, uti bei Augustinus vgl. GNILKA (wie Anm. 729), bes. 71 ff. zur frühen christlichenFundierung in I Tim. 4.4: „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut …“; 50 ff. zu Gebrauch und Mißbrauch, Nutzen undPerversion antiker Kultur (bes. Doct. christ. II 40.60, wonach die Christen die Kostbarkeiten der spolia Aegyptiorum ausExod. ad usum meliorem zurücknehmen, da diese von den Heiden vorher zu Götzendienst mißbraucht worden sind.); ders.,Chresis, Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur I, Basel 1984 (wurde nicht mehr benützt). – ZuJohanns extensiver Auslegung von Bibelstellen im humanistischen Sinn vgl. MISCH 1271, LACROIX 170 f.; S. 156, 373,390 ff., 446.
372
eine göttliche Einrichtung darstellt und (wie die von Gott geschaffene Welt „geistigen Sinn“ offenbarend)„lesbar“ geworden ist.735 Johann erinnert
735 Zu facta s. oben §§ 42 f. Vgl. Dal PRÀ 117 f. (u. a. auch aufgrund von Pol. II 12 und II 26) zu einem neuplatonischenGrundzug der Geschichtsauffassung Johanns. Zur Geschichte als „Werk Gottes“ vgl. §§ 86, 105 f., S. 11. 155 f., 377, 383,441 ff., A. 287, 430); vgl. BOEHM (wie Anm. 25) 668; SCHULZ, Hist. Methode 68; von den BRINCKEN (wieAnm. 337) 437 ff.; MEIER, Enzyklopädik (wie Anm. 709) passim; J. LE GOFF, Au moyen âge: Temps de l’église ettemps du marchand (Annales 1960), in: ders. Pour un autre Moyen Age, Paris 1977, 46–79, bes. 51 ff. (dt. auch: Zeit derKirche und Zeit des Händlers im MA., in: ‚Schrift und Materie’, ed. C. HONEGGER, Frankfurt a. M. 1977. 393–414);DEMANDT, Metaphern (wie Anm. 732) 382 f.; LECLERCQ, Amour (387) 151; EHLERS, Hugo (wie Anm. 17) 72 f.;ROUSSET, Conception (wie Anm. 361) 624 f.; BLUMENBERG, Lesbarkeit (wie Anm. 732) 69 f.; BORST, Geschichte(wie Anm. 486) 13 f. – Zum „Buch der Geschichte“ als Teil oder Parallele der Naturbuchmetapher im Zusammenhang mitder Exemplum-Theorie vgl. etwa Robert von Basevorn und Humbert von Romans in den oben Anm. 364 zitierten Stellen. –Zur augustinischen Grundlage vgl. etwa Doctr. christ. II 28.44: Narratione autem historica cum praeterita hominuminstituta narrantur, non inter humana instituta ipsa historia numeranda est; quia iam quae transierunt nec infecta fieripossunt, in ordine temporum habenda sunt, quorum est conditor et administrator Deus; Sermo 77.7.7 (PL 38) 486: Factumquidem est et, ita ut narratur, impletum: sed tamen etiam ipsa quae a Domino facta sunt, aliquid significantia erant, quasiverba, si dici potest, visibilia et aliquod significantia (vgl. S. 90). Für den ganzen im Folgenden (bis S. 392) ausführlich zubehandelnden Gedankengang von Pol. VII 10 dürfte als Hauptquelle in einem wie immer „flächigen“ oder indirekten Sinnzuletzt Aug. Conf. XIII zur Genesis-Auslegung in Betracht kommen. Vgl. zur Polysemie und zur Vielfalt der geistigenZeugungen aufgrund des „Fruchtbarkeits“-Gebots (Gen. 1.22) Conf. XIII 24.37; Herrschaft über Kriechtiere und Vögel(Gen. 1.30) ebd. 25.38; Speisemetaphorik ebd. 26.39; zu der in allen Teilen, d. h. stofflichen und geistigen Produkten, „sehrguten Schöpfung“ und zur menschlichen Herrschaft aufgrund der Gottebenbildlichkeit ebd. 32.47. In Conf. XIII 34.49 findetsich die Kernstelle für den Übergang von der Schöpfungsordnung zur Geschichte (fieri) und Literatur (scribi): Inspeximusetiam, propter quorum figurationem ista vel tali ordine fieri vel tali ordine scribi voluisti, et vidimus quia bona suntsingula et omnia bona valde … – Zu Augustin vgl. hier STUDER 110 ff., 123; FRANK (wie Anm. 581) 386 u. ö.; ErnstA. SCHMIDT, Zeit u. Geschichte bei Augustin (SB Heidelberg. Akad. phil.-hist. Kl. 1985.3); Y. CONGAR, Le thème deDieu-Créateur et les explications de l’Hexaméron dans la tradition chrétienne, in: L’homme devant Dieu, Mél. H. de LUBACI, Paris 1963, 189–222, bes. 124; Chr. MOHRMANN, Observations sur les Confessions de S. Augustin, in: Rev. desSciences religieuses 33 (1959) 360–71; KNAPE, Historie 67 ff.; Heinz MÜLLER, Die Hand Gottes in der Geschichte …Zum Geschichtsverständnis von Augustinus bis Otto von Freising, Diss. ungedr. Hamburg 1949. Nach FONTAINE,Christentum (wie Anm. 552) 5 f. gelangte Isidor von einer anderen Seite (aufgrund von Sap. 7.17–20) zu einem ähnlichenErgebnis, indem er Naturerkenntnis mit Gotteserkenntnis gleichsetzte und das Studium der Geschichte und allermenschlichen cogitationes als Teil der Schöpfungsnatur legitimieren konnte. – Die zentrale Bedeutung der creatortemporum-Idee für die gesamte Geschichtsschreibung des Mittelalters beleuchtet grundsätzlich G. MELVILLE, Zurgeschichtstheoretischen Begründung eines fehlenden Niedergangsbewußtseins im MA, in: ‚Niedergang’, ed. R.KOSELLECK/P. WIDMER, Stuttgart 1980, 103–36, bes. 120 f. sowie HELBLING (wie Anm. 252) 115 f., zu Dantesprophetisch-praktischer Aktualisierung dieses Geschichtsverständnisses in Ep. 5 über das Kommen Heinrichs VII. (vgl.Anm. 1001). – Die Idee einer von Gott gemachten Geschichte war bis in die frühe Neuzeit ebenso selbstverständlich, wie esheute die gegenteilige Vorstellung ist, die jedoch einmal als eine radikal neue durchgesetzt worden ist: vgl. D.MENDLEWITSCH, Die Menschen machen die Geschichte. Das Verständnis des Politischen in der ‚Scienza nova’ von G.B.Vico, Köln 1983; LÖWITH 424 ff.; Ferd. FELLMANN, Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte,Freiburg/München 1971. Vgl. auch § 105, S. 517 ff.
373
an den göttlichen Befehl:736 „Seid fruchtbar, […] mehret euch und macht euch die Erde untertan undbeherrscht alles […], was sich auf Erden bewegt“, bezieht dies allegorisch auf das Toleranzgebot desTitusbriefes hinsichtlich der jüdischen Speiseriten (Tit. 1.15): „Den Reinen ist alles rein“, und postuliertschließlich das Recht zur Universalherrschaft über alle scripta.737 Vorausgesetzt bleibt allerdings die moralischbegründete Bildungskompetenz des idealen Viel- oder Alleslesers.738 Erst wenn der Mensch sich selbst
736 Pol. VII 10, (II) 130.10 ff. oben Anm. 733 (Gen. 1.28–9; 9.1–4).737 Ebd. 130 f. a.a.O., vgl. unten § 86. Dieselbe Kombination des Reinheitsgebots mit dem Schöpfungsbericht findet sichauch bei Hieronymus, Adv. Iov. II 5 (PL 23) 303 f.: Dem Menschen als Krone der Schöpfung, der nur Gott untersteht, sindalle Geschöpfe unterworfen, alle Tiere zur Speise usw. Analog auch Aug. Conf. 7.9.15 zum Kontrast derGottebenbildlichkeitsidee mit der verdorbenen Speise der Götzentiere.738 Ebd. 132.20 ff.: Fortgeschrittene dürfen mehr lesen als simplices, was allerdings moralisch eingegrenzt wird: Dummodovitia fugias, quod volueris lege. Dabei entwickelt sich die Metaphorik schillernd von den „Lastern“ (den Sündenkrankheiten)über die „Krankheit“ der Bildungsschwäche zur Verdauungsstörung und zur „Krankenkost“. Unverschlüsselt zusammengefaßtheißt dies (ebd. 133.5 ff.): Ceterum libri catholici tutius leguntur et cautius, et gentiles simplicibus periculosius patent; sedin utrisque exerceri fidelioribus ingeniis utilissimum est. Genau genommen gilt somit das Axiom omnes scripturas esselegendas nur für eine kompetente Minorität. – Zu ähnlichen Differenzierungen nach dem Bildungsstand vgl. Met. III 10.162oben Anm. 426 und Pol. IV 3, (I) 242 f. unten Anm. 960; insbesondere zu dem verwandten Unterschied tropisch verhüllter,allegorischer und offen literaler Sprache, sensus mysticus und historicus vgl. Met. I 19, 46 f.; Enth. Vs. 188 ff.; Pol. V 6, (I)300, 307; oben S. 181 ff.
374
unterworfen hat, führt Selbstbeherrschung (nach Fürstenspiegelweisheit) zur Weltherrschaft.739 So unterwirfter sich alles, was sich auf Erden bewegt und in den Büchern daliegt. Alles wird ihm Speise, weil Gott aus allerKreatur spricht (in omnibus creaturis ei verba salutis suae loquitur Dominus). Alle Tugendlehre, stamme sieaus Geschaffenem oder Geschriebenem, ist gewissermaßen Gottes Wort und darum ungeachtet der Herkunftauch zu akzeptieren. Sogar die unreine Speise der Reptilien – oder der heidnischen Literatur – ist genießbar,„weil die Wahrheit immer unverdorben und unverderblich ist.“740 In einer Pointe, die ebenso an Augustins:„Liebe und tue, was du willst“, wie an die Hieronymussentenz: „Liebe die Bücher-Wissenschaft, und du wirstkeine Fleischeslaster lieben“ erinnert, sagt Johann: „Meide die Laster und lese, was du willst.“741
739 Pol. VII 10, 131 f. wie oben Anm. 733. SCHAARSCHMIDT hat zu diesem für Johann zentralen Gedanken „richtigerHerrschaft“ angemerkt (192), der Policraticus werde von einem „hierarchischen Grundzug“ bestimmt, vom Ideal derBeherrschung heidnischer Literatur durch die christliche Lehre und des wildwüchsigen Staates durch die Ordnung der Kirche.Dies ist jedoch der traditionelle Hintergrund der augustinischen Schöpfungstheorie (s. oben Anm. 735) und, allgemeiner, dermittelalterlichen ordo-Vorstellungen. Das Eigene und Besondere liegt eher in einem ethisch-humanistischen Grundzug, in derhervorragenden Stellung, die dem sich selbst und die Welt beherrschenden „Weisen“ im Gesamtwerk Johanns eingeräumtwird. – Zu diesem Thema vgl. GLUNZ (wie Anm. 731) 56 ff.; von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 106, 320 (Nr. 124);ders., Consolatio T/II §§ 1122 ff.; CARY (wie Anm. 279) 84, 278 zum Kontrastexemplum dieses Ideals: Alexander alsWelteroberer und Knecht seiner selbst; dazu auch LIEBESCHÜTZ, Humanism 74 ff. und S. 389, 570, 577, 579 ff.740 Pol. VII 10, (II) 131 f. oben Anm. 733.741 Ebd. 132.30 oben Anm. 738. – Zum Adagium, ‚Dilige et quod vis fac’ s. Aug. In Ep. Jo. V 4, V 12, VII 8 (PL 35)2014, 1018, 2033; J. GALLAY, ‚Dilique et quod vis fac’, Notes d’exégèse augustinienne, in: Recherches de Sciencereligieuse 45 (1955) 545–555. Zur Beliebtheit des Leitsatzes im 12. Jh. vgl. J.F. BENTON, Conciousness of Self andPerception of Individuality, in: Renaiss. and Renewal 263–95, hier 292 f. – Hier Ep. 125.11 zitiert Johann in Met. I 24,37.22 und als krönenden Abschluß des vorliegenden Kapitels Pol. VII 10, 134.26 f.: Ama scientiam scripturarum et carnisvitia non amabis. Auch hier wie schon zu Rom. 15.4 (oben Anm. 734) findet eine extensive Interpretation einer ursprünglichnur auf die Bibel, nicht auf alle Literatur bezogenen auctoritas statt.
375
84. Die soweit noch ganz biblisch getönte Bildersprache geht zuletzt über in das Bienengleichnis und dieVerdauungsmetapher nach Seneca und Macrob.742 Die Legitimation der auctores-Auslegung im moralischenSinn führt auch zu Fragen der Literaturtheorie und Stilistik (insbesondere über Nachahmung, Adaptation undAssimilation fremder Texte), worauf in anderem Zusammenhang näher eingegangen werden müßte.743
Erwähnenswert ist immerhin, daß das für die Exempla so wichtige pädagogische Gewöhnungsmotiv an dieserStelle in dem Assimilations- oder Aneignungsprinzip der imitatio auctorum eine konsequente Entsprechungfindet. Johann verbindet sogar ausdrücklich beide Aspekte, wenn er mit einem Vergleich aus Horaz (Ep. I2.69–70)
742 Pol. VII 10, (II) 132.20 ff.: Verdauung leichter oder schwerer Kost je nach dem (moralisch-bildungsmäßigen)Gesundheitszustand; ebd. 133.10 ff. (unten Anm. 852): Bienengleichnis im Sinn selektiver Anverwandlung desBlütenrohstoffs nach Macrob, Sat. I praef. 5–7 (= Sen. Ep. 84.5–6): Apes quodammodo debemus imitari, quae vagantur etflores carpunt, deinde quicquid adtulere disponunt et per favos dividunt et succum varium in unum saporem mixturaquadam et proprietate spiritus sui mutant. Macrob wird zum gleichen Thema in Pol. VIII 10, (II) 284 zitiert; Johann sah inihm einen gattungsmäßig und geistig verwandten Meister der Kompilierkunst oder des Assimilierens literarischer Speisen;vgl. hier 284.15 ff.: Eum (librum Saturnaliorum) ergo in praesenti capitulo non tam vestigiis quam passibus decrevi imitariet ex opulentia promptuarii sui cellulae nostrae supplere angustias Vgl. SCHEDLER (wie Anm. 616) 135 ff. DieSpeisemetapher erinnert (abgesehen von den biblisch-patristischen Konnotationen) also auch an die durch Macrob vertreteneSymposienliteratur (s. S. 356 f., 401, 407 f.). Die erwähnte Seneca-Stelle (vgl. CANCIC [wie Anm. 38] 85) betont stärkerdie Verschmelzung diverser Quellen in unum saporem. Sie war ein Hauptzeugnis für die Theorie der imitatio auctorum seitder Renaissance; vgl. J. von STACKELBERG, Das Bienengleichnis, Ein Beitrag zur Gesch. der literarischen Imitatio, in:RF 68 (1956) 271–93, bes. 280 f. zu Johann; KESSLER, Geschichtsdenken 116 ff. zu Petrarca; BUCK, Patristik (wieAnm. 528) 155, 166 ff. zu Erasmus; ders., Petrarca (wie Anm. 528) 15 f.; H. GMELIN, Das Prinzip der Imitatio in denromanischen Literaturen der Renaissance, in: RF 46 (1932) 98 ff.; BARNER (wie Anm. 298) 61. Vgl. auch S. 420 ff.743 Pol. VII 10, (II) 133.15 ff. zur Technik der Assimilation von Lesefrüchten: …etiamsi apparuerit unde sumptum sit, aliudtamen esse quam unde sumptum noscetur appareat, quod in corpore nostro facere videmus sine omni opera nostra naturam(= Macrob., Sat. I praef. 5–7 nach Sen. Ep. 84.5). Ebd. 133.27 ff. zum Speisegebot nach Apg. 10.11 ff. über den erlaubtenGenuß von reptilia et immunda als eine Aufforderung, bedenkenlos die philosophische Literatur der Antike iugulatiserroribus gentilium zu lesen, d. h. nicht autoritätshörig, sondern kritisch: Sic ergo legantur ut auctoritas non praeiudicetrationi.
376
schreibt:744 „In dem Büchlein, in dem die Knaben ihre erste Einweihung in die Literatur erhalten [DistichaCatonis], damit Anleitung und Einübung in die Tugend den zarten Seelen nicht so leicht wieder abhandenkommt – denn ‚auch der Topf verliert den Wohlgeruch nicht leicht, womit er neu durchbalsamt worden ist‘ –sagt Cato oder irgendein anderer (der Autor ist nämlich ungewiß): ‚Wohlan, lese viel, lese gründlich und lesedann Vieles nochmal gründlich durch!“745 In diesen Zusammenhang gehört auch die bekannte Synkrisis vonBernhard von Clairvaux und Gilbert von Poitiers in der Historia pontificalis, da hier an beiden Antagonistendieselbe – Johann offensichtlich besonders wertvolle – Fähigkeit gerühmt wird, über literarische Kenntnisse,die sich allerdings inhaltlich unterscheiden, souverän zu verfügen:746 Bernhard wird gepriesen, weil er sich dieBibel so zu eigen gemacht
744 Pol. VII 9, (II) 125.5 ff.: Eo forte spectat praeceptum ethici legere libros praecipientis. In libello quoque quo parvuliinitiantur ut virtutis instructio et usus teneris ebibitus animis facile nequeat aboleri (quoniam testa diutius servat odoremeius ‚quo semel est imbuta recens’) ait vel Cato vel alius (nam auctor incertus est): ‚Multa legas facito, perlectis perlegemulta.’ (Dist. Cat. III 18). Zur Fortsetzung der Stelle s. unten Anm. 749.745 Vgl. auch Met. I 24, 54,17: quantum pluribus disciplinis et habundantius quisque imbutus fuerit, tanto elegantiamauctorum plenius intuebitur planiusque docebit. Zur literarischen Assimilations- und Mnemotechnik und zurEinübungspädagogik allgemein vgl. auch S. 244 f., 343, 364, 394 f.746 Hist. pont. XII, 26 f.: Erant tamen ambo optime litterati et admodum eloquentes sed dissimilibus studiis. Abbas enim[…] singulariter eleganti pollebat stilo, adeo divinis exercitatus in litteris ut omnem materiam propheticis et apostolicisdecentissime explicaret. Sua namque fecerat universa et vix nisi verbis autenticis nec in sermone communi nec inexhortationibus nec in epistolis conscribendis loqui noverat. Non memini me legisse auctorem qui poeticum illud tantafelicitate fuerit assecutus: ‚Dixeris egregie, notum si callida verbum/reddiderit iunctura novum’ [Hor. A. P. 47–8] Secularesvero litteras minus noverat, in quibus, ut creditur, episcopum nemo nostri temporis precedebat. […] Et licet episcopusbibliothece superficiem non sic haberet ad manum, doctorum tamen verba, Hylarii dico, Ieronimi, Augustini, et similium,sicut opinio communis est, familiarius noverat. […] Utebatur, prout res exigebat, omnium adminiculo disciplinarum, insingulis quippe sciens auxiliis mutuis universa constare. […] Utrumque in suis studiis multi conati sunt imitari, sed necunus, quod meminerim, alterutrum assecutus est. (Zu Hor. A.P. 47 f. s. S. 487, bibliotheca = Bibel; sua fecerat: s.Anm. 780: facio meum). Zur Stelle vgl. MISCH 1283 f.; KIRN (wie Anm. 151) 81; W. von den STEINEN, vom heiligenGeist des Mittelalters, Breslau 1926/Darmstadt 1968, 175 f.; Fr. SIMONE, La ‚reductio artium ad sacram scripturam’ qualeespressionale dell’umanesimo medievale fino al sec. XII, in: Convivium 6 (1949) 887–927 (= Turin 1949) 916; P.SALMON, Über den Beitrag des grammatischen Unterrichts zur Poetik des Mittelalters, in: Arch. f. d. Stud. d. neuer.Sprachen u. Literaturen 199 (1963) 65–84.
377
habe, wie Horaz die Kunst der Aneignung von Literatur überhaupt empfiehlt (Ars poet. 47–8), so daß er sichfast nur noch in biblischen Wendungen ausdrücken konnte; Gilbert wird gepriesen, die Aussprüche derKirchenväter sowie die Sprachformen und Redefiguren der Philosophen, Redner und Dichter umsomeisterhafter beherrscht zu haben.
Im Zusammenhang mit dem Gedankengang von Policraticus VII 10 ist ein erkenntnistheoretisches Themavon Interesse, das die scheinbare Inkonsistenz und Willkür im Umgang mit Exempla motiviert haben könnte.Auszugehen ist von einem prinzipiellen, theologisch fundierten Erkenntnisoptimismus, der sich in derÜberzeugung äußert, daß Gottes Wort nicht nur in der ganzen Dingwelt, der „Erstoffenbarung“ stricto sensu,sondern auch in sämtlichen Schriften und Kulturerzeugnissen ausnahmslos in irgendeiner Weise enthaltensei.747 Da die in allem mehr oder weniger spurenhaft, schattenhaft
747 Pol. VII 10, (II) 131 f. oben in Anm. 733. – Zur Erstoffenbarung besonders aufgrund von Röm. I 20 vgl. S. 155 f.; MaxLACKMANN, Vom Geheimnis der Schöpfung, Stuttgart 1952, 56–73; SCHMIDTKE (wie Anm. 287) 56 ff.; ZurÜbertragung auf Kulturgüter und menschliche Erfindungen (auch des technischen Fortschritts) in der Patristik vgl. GNILKA,Usus (wie Anm. 729) 50 ff.; H. BLUMENBERG, Nachahmung der Natur, Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischenMenschen, in: Studium Generale 10 (1957) 266–283, bes. 276 ff. Die letztere Arbeit geht im Unterschied zu den anderen reindeskriptiven (oder theologisch orientierten) Darstellungen kritisch wertend auf die kulturellen und zivilisatorischenImplikationen einer Vorstellung ein, nach der auch „alles Mögliche in der Kultur“ bereits als vom Deus creator gemacht zugelten hat, wie dies etwa Augustinus (Conf. XII 19,28) maßgeblich formuliert hat: Verum est quod non solum creatum atqueformatum, sed etiam quidquid creabile atque formabile est, tu fecisti ex quo sunt omnia. (vgl. S. 383). Johann scheintdemgegenüber die von BLUMENBERG beleuchtete paralysierende Seite solcher Theozentrik nicht gesehen zu haben; er hatvielmehr betont die humanistischen Konsequenzen der Offenheit und Verfügungsfreiheit gegenüber allem natürlich undgeschichtlich „Gegebenen“ gezogen und dürfte damit die neuzeitliche Idee des homo creator/alter deus vorbereitet haben.Vgl. S. 293 ff., 382 ff., 391 f. (zu Johanns Einschätzung von ars, Handwerk, Technik, Produktivität) und allgemein: APEL(wie Anm. 600) 321 ff. zur Neuzeit; LIEBERG (wie Anm. 475) 159 ff. zur Antike (nicht griechische, sondern jüdisch-christliche Herkunft des kulturell-poetologischen Schöpfergott-Vergleichs; Macrobs Saturnalien und ihre Metaphorik vom„Reichtum“ der göttlichen Natur für die literarische copia). Einschlägiger ist hier jedoch V. RÜFNER, Homo secundus Deus,Eine geistesgeschichtliche Studie zum menschlichen Schöpfertum, in: Philos. Jb. 63 (1955) 248–91, bes. 261 f. zu dem beiJohanns Lehrer Wilhelm von Conches (und der „Schule von Chartres“) lebendigen Gedanken der Fortsetzung göttlicherSchöpfungstätigkeit durch den Menschen als eine (im Unterschied zu Gottes opus creationis und dem evolutiven opusnaturae allerdings vergängliche) Naturnachahmung durch künstliche Umformung der Materie mit dem Ziel der Annäherungan die ewige Gleichheit, Einheit und Unveränderlichkeit Gottes (dazu s. mehr S. 504 ff., 513 ff.; vgl. M.-R. JUNG. ZurDichtungstheorie des ausgehenden Mittelalters in Frankreich, in: Vox Romanica 30 [1971] 44–64 zu dem entsprechendenUnterschied von „former“ des Dichters und göttlichem „créer“ bei Machaud). Rüfner betont von der Neuzeit her den„melancholischen“ Aspekt der Vergänglichkeit in diesem Denkmodell, der jedoch, vom Frühmittelalter her betrachtet, geradeden traditionellen unspezifischen Restbestand gegenüber der neuen „optimistischen“ Idee einer aktiven menschlichenVermittlung zwischen Geschöpflichkeit und Weltgestaltung darstellt. Wie eine Stelle der Boethius-Glossen Wilhelms vonConches zeigt, ist der Mensch (in einem eigenwillig christlichen Sinn) wieder das „Maß aller (geschaffenen) Dinge“, sowohlals Objekt wie als Subjekt des Schöpfungsprozesses (J.M. PARENT, La doctrine de la création dans l’ecole de Chartres,Paris/Ottawa 1938, 128. 29 ff.): Unde est quod homo in divinia pagina [Marc. 16.15] vocatur omnis creatura, quia videlicetres omnis vel est homo vel propter hominem creata […] cum omnis creatura propter hominem esset facta, quasi aequalitermedius id est communis medium locum, id est terram quae in medio est, occupavit. Zu diesem Grundgedanken des mal.Humanismus vgl. auch unten § 86.
378
gegebene Wahrheit jedoch nicht problemlos erkennbar ist, bedarf es gewisser Techniken der Aneignung undInterpretation. Einmal ist eine möglichst umfassende Aufbewahrung alles Geschriebenen vonnöten, d. h. einemit kompilatorischem oder gar enzyklopädischem Eifer zu fördernde Sammeltätigkeit auf allen Gebieten, umauslegbares Material – „verzehrbare Speise“ – überhaupt erst zur Verfügung zu stellen. JohannsPolyhistorismus ist bekannt:748 Als Illustration diene etwa die Fortsetzung der eben angeführten
748 Neben den bisher angeführten Stellen aus Pol. VII 9–10 vgl. die Prologe (s. § 42, S. 154 ff., 360, 386 f., 576 ff.)undetwa die Bekenntnissezum „Polyhistorismus“: Met. I 22, 52: Disciplinae liberales tante utilitatis esse tradit antiquitasut quicumque eas plene norint, libros omnes et quaecumque scripta sunt, possint intelligere etiam sine doctore. Gilbert vonPoitiers wird in Hist. Pont. XII 26 f. (s. oben Anm. 746) gepriesen: Utebatur, prout res exigebat, omnium adminiculodisciplinarum, in singulis quippe sciens auxiliis mutuis universa constare, was Johanns Theorie der „sich gegenseitigdeutenden Autoren“ (unten Anm. 751) entspricht. Hervorzuheben sind auch Stellen, in denen Johann früheren Musterautorender Enzyklopädik, Kompilation, Geschichts-Abbreviatio und Exempla-Sammlung Anerkennung zollt: Pol. I 11, (I) 50.14 ff.;VII 9, (II) 129.19 zu Varro (unten Anm. 767); Pol. VIII 18, (II) 263.28 ff. zu Orosius; Pol. VIII 21, (II) 382 zu Cassiodor;ebd. VIII 10,284 zu Macrob (oben Anm. 742); ebd. V 7, (I) 307.317 zu Frontinus. – Die enzyklopädischen InteressenJohanns wurden in der Forschung mehr getadelt als gelobt: s. S. 14 ff., 345 ff.; die Zusammenfassung früherer Urteile beiLIEBESCHÜTZ 1 f. sowie BROOKE (wie Anm. 35) Introd. XLIII–XLV: … „a memory more richly stored than any but thelargest medieval libraries.“ […] „a man who knew too much to be a philosopher, with a memory too facile for sounddigestion“ […] „The Policraticus and the Metalogicon seem to be two fragments of a vast encyclopedia of the liberal arts ofphilosophy and politics: the conception ultimately derives from Martianus Capella and St. Isidore, but its closest parallel isHugh of St. Victor’s Didascalicon.“ (Zur Inadäquatheit dieser Gattungsbestimmung s. S. 139 ff., 385. Anerkennung fand derenzyklopädische Aspekt der (an sich nicht enzyklopädischen) Werke Johanns etwa bei ATKINS (wie Anm. 366), 66 f.;MUNK-OLSEN (wie Anm. 28) 59: dieser Zug entspreche Johanns Kritik des Spezialistentums; SMALLEY, The BecketConflict (wie Anm. 689) 97 ff.: Lernfreude und Bildungsbegeisterung; KERNER 1 f. und 123 ff. zur logischen Strukturtrotz der copia; Dal PRÀ 126 (oben S. 168) zum Motiv des Sammelns aus Wissenschafts-Skepsis (vgl. dazu auch die obenAnm. 691 angeführte Abaelardstelle). Grundsätzlich müßte der Anachronismus unseres negativen Enzyklopädie- undKompilationsbegriffs in Frage gestellt werden; vgl. Chr. MEIER (Enzyklopädik … wie oben Anm. 709) undROUSE/ROUSE, Preachers (wie Anm. 323) 3 ff. zur Gattung der Florilegien. Im 12. Jh. zeigt sich auf verschiedenstenGebieten eine eigene Sammelleidenschaft, die nicht aus antiquarischem, sondern prospektivem Interesse zu den großenZusammenfassungen, Kompilationen, Kompendien, Summen führt (Gratian, Petrus Lombardus, Petrus Cantor usw.). R.SOUTHERN schreibt dazu (The Making of the Middle Ages, New Haven 1953, 205): „… the end of their undisputedusefulness in the seventeenth century marks the end of the Middle Ages more decisevely than the Renaissance orReformation.“
379
(mit den Disticha Catonis unterstützten) Ermahnung zum Viellesen:749 „So muß denn alles gelesen werden,damit hernach einiges, wenn es gelesen worden ist, wieder vernachlässigt werden kann.“ Dies kann demberühmten Dictum Hugos von St. -Victor zur Seite gestellt werden:750 „Lerne alles! Du wirst später sehen, daßnichts überflüssig war“. Abgesehen von dem kleinen Unterschied in der Gewichtung des Gelesenen, enthaltenbeide Stellen in erster Linie dasselbe Bekenntnis zur „prophylaktischen“ Wissensvermehrung durchgrenzenlose Lektüre.
749 Pol. VII 9, (II) 125.16 ff. (im Anschluß an das Zitat Anm. 744): Sic tamen omnia legenda sunt ut eorum aliqua cumlecta fuerint, negligantur.750 Didasc. VI 2 (PL 176, 799), ed. BUTTIMER (1939) 115.19: omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum. Vgl.auch MEERSSEMAN, Seneca (wie Anm. 405) 117, 131 zu der im Spätmittelalter beliebten aphoristischen Abwandlungeines Seneca-Zitats (Ep. 76.3), die den intellektuellen Aspekt durch „Lebensweisheit“ ethisch dämpft: Sic disce quasi sempervicturus; sic loquere tamquam cras moriturus; Sic vive quasi cras moriturus, sic disce quasi in eternum victurus. – DerUnterschied zwischen der anscheinend selektiven Vorstellung Johanns und der offeneren Hugos ist unerheblich, da der einemehr den mnemotechnischen, der andere mehr den hermeneutischen Aspekt hervorhebt. Deutlicher zeigt Johann dasSelektionsmotiv im pädagogisch-gedächtnisfreundlichen Sinn von Heraklit und Montaigne („mieux vaut une tête bien faitequ’une tête bien pleine“), wenn er von Bernhard von Chartres in Met. I 24, 56.28 ff. schreibt: Superflua tamen fugiendadicebat; et ea sufficere que a claris auctoribus scripta sunt. (Dies liegt auch in der Linie der curiositas-Kritik; s. obenS. 302). Umgekehrt geht die in nächster Anm. zitierte Stelle ganz im Sinne Hugos von St. Victor (oder auch Abaelards: s.oben § 66, Anm. 691) auf den hermeneutischen Nutzen einer möglichst umfassenden Belesenheit ein.
380
Für Johann ist der Belesene auch der bessere Interpret:751 „Kommt in irgendeinem Text etwas schwerVerständliches vor, so lasse sich der Leser oder Hörer nicht abschrecken. Er möge nur weiterlesen; denn dieAutoren deuten sich gegenseitig, und die einzelnen Schriften sind unter sich die Wegweiser für andereSchriften“. Die Unentschiedenheit vieler Deutungsprobleme, die Widersprüchlichkeit der vorgeschlagenenAuslegungsalternativen verweisen als ein Provisorium auf das Ziel der weiterhin zu erkundenden Wahrheit,mahnen sowohl zur Geduld wie zur Wißbegier.752 Die Zeugnisse widersprechen sich nur scheinbar, d. h.subjektiv, aus der Sicht der Beobachter. Objektiv verweisen sie alle in je eigener partieller Weise auf die eineUniversalwahrheit. Allein schon ihre Gegenüberstellung dient so – wie in Abaelards Sic et non –
751 Met. III 1, 123.12 ff.: Si quid […] in quavis scripturarum intellectu difficilius occurrit, non statim deterreat legentemaut audientem, sed procedat; quia se invicem interpretantur auctores et singule scripture vicissim sunt indices aliarum,unde legentes plurima aut nulla aut paucissima latent. JEAUNEAU, Jean (wie Anm. 544) 79 schreibt im Sinne des obenAnm. 750 angeführten Aphorismus zu dieser Stelle: „On comprend que, dans une telle perspective, la lecture ne soit pas uneoccupation réservée aux écoliers. Avec Quintilien, Jean de Salisbury estime qu’elle ne doit cesser qu’avec la vie“ (mitVerweis auf Met. I 21.50 nach Quint. I 8.12; oben Anm. 576 zitiert). Zu anderen Aspekten des Zitats aus Met. III 1 vgl.S. 447 sowie Hist. pont. XII in Anm. 748. Interessant ist auch Montaignes Spott (oben Anm. 708a): ‚Nous ne faisons quenous entregloser’.752 Vgl. Met. III 10, 163 f. oben in Anm. 598, wo besonders deutlich die Dialektik von Wissenschaftsskepsis (konzentriert inder topischen, den Disput erfordernden Erkenntnismethode) und dem gleichzeitigen religiös fundierten Ideal der allmählichen,erst in der eschatologischen Dimension vollendeten Wahrheitsannäherung zur Sprache kommt (de omni re in utramquepartem probabiliter disputari steht gegen: ipsam vero […] deprehendere veritatem divine vel angelice perfectionis est, adquem tanto quisque familiarius accedit quanto verum querit avidius…). Die Überzeugung, daß die „notwendige“Wahrheitserkenntnis nicht nur auf dem Weg des Glaubens durch Gnade, sondern auch durch wissenschaftliche Methode(natürliche Vernunft) grundsätzlich möglich ist, hat Johann nicht weniger ausdrücklich vertreten als seine skeptisch„akademische“ Position gegen hybride Wissenschaftsgläubigkeit und Unterschätzung der Erkenntnisgrenzen: vgl. Pol. III (I)173: Porro scientiae thesaurus nobis duobus modis exponitur, cum aut rationis exercitio quod sciri potest intellectusinvenit; aut quod absonditum est revelans gratia oculis ingerens patefacit. Sic utique aut per naturam aut per gratiam adveritatis agnitionem et scientiam eorum quae necessaria sunt unusquisque potest accedere. Vgl. auch McGARRY 665 zuMet. IV 37–40; WETHERBEE, Platonism (wie Anm. 394) 91 f. zu Met. IV 36; FREUND (wie Anm. 540) zu Met. III Prol.,III 4, zu der subjektiv nie restlos erkennbaren, objektiv aber ewig gleichen veritas rerum und der Frage desWissenszuwachses in der Zeit. Während Johann in der angeführten Stelle intellectus und gratia deutlich trennt, ist seinLehrer Abaelard in dieser Beziehung – sit venia verbo – weniger „rationalistisch“, da für ihn alle menschlicheVernunfterkenntnis als Gnade und göttliche Erleuchtung zu gelten hat; dazu gehört auch die Fähigkeit, logisch zu denken,eine übrigens nur „sehr wenigen“ zuteilwerdende Gnadengabe; vgl. T. GREGORY, Abélard et Platon, in: Peter Abelard(Mediaevalia Lovanensia I 2) Löwen/Den Haag 1974, 38–64, hier 47 ff.; JOLIVET, Doctrines et figures, in: PetrusAbaelardus (wie Anm. 528) 105 ff.; DeRIJK, Peter Abälard: Meister und Opfer des Scharfsinns (ebd.) 130 f.
381
dem Erkenntniszuwachs, ja, dem geistigen Fortschritt über die Jahrhunderte hin.753
Die Möglichkeit eines solchen, wie immer geringen Fortschritts bezeugt Johann ausdrücklich in demberühmten Gleichnis von den Zwergen auf den Schultern der Riesen754 oder aber, wenn er festhält, daß diemoderni der
753 Vgl. Pol. VII 8, (II) 122.5 ff. über die verschiedenen Wege der antiken Philosophen zur Erkenntnis des summum bonum:[…] licet ad unum tendant, varias sententias quasi vias beatitudinis auditoribus suis aperiunt. De quibus dubitare etquaerere liberum est, donec ex collatione propositorum quasi ex quadam rationum collisione veritas illucescat. In dieserbereits oben Anm. 580 zitierten Stelle ist nun das zeitliche Moment (donec) zu beachten. Zum in utramque partem-Prinzip s.oben Anm. 598 zu Met. III 10, 163 f., wobei der Gesamtkontext von Met. III 10 die Topik als Reservoir wahrscheinlicherArgumente ausweist, das im Gegensatz zur „einfachen Wahrheit“ (s. unten Anm. 800 zu Met. III 1.122.1 f.) durch Vielfaltder Aspekte (copia rationum; s. Anm. 548) menschlicher Erkenntnisschwäche entgegenkommt und darum auch frühereStreitpunkte ohne nachträgliche Glättung weiterer Diskussion verfügbar machen soll. Entsprechend wendet sich Johann inMet. II 17.91 ff. gegen eine falsche posthume Versöhnung Platos mit Aristoteles, die nur durch Vergewaltigung desWortlauts der Texte möglich wäre. Vgl. CHENU, Théol. (wie Anm. 664) 125: WETHERBEE (wie Anm. 394) 22 f. Ähnlichlobt Johann Abaelards streng literale Porphyrius-Deutung in Met. III 1.121 ff. und schließt folgende (mit Zeitbegriffendurchsetzte) Maximen an (122.2 ff.): Quicquid autem littere facies indicat, lector fidelis et prudens interim veneretur utsacrosanctum, donec ei alia docente aut Domino relevante veritas plenius et familiarius innotescat. Quod enim unusfideliter et utiliter docet, alter eque fideliter et utiliter dedocet … sowie die bereits oben Anm. 751 angeführte Stelle(123.12 ff.). – Zu Abaelard vgl. S. 266 ff; GRABMANN, Scholast. Meth. I 234 ff. – Zur Idee des langsamenErkenntnisfortschritts vgl. S. 451 f., A. 210a; OLSON, Ecclesia primitiva (wie Anm. 210a) 78 ff.; SMALLEY, Novelty(wie Anm. 254) 110 ff.; MELVILLE, Wozu Geschichte … (wie Anm. 368) 101 f.; CHENU, Conscience (wie Anm. 361)107 ff., 119; FUNKENSTEIN (wie Anm. 366) 52 ff. Die geistliche Legitimation findet sich etwa bei Gregor, In Ez. II 4.12(PL 76) 980 f. über ‚pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia’ (Dan. 12.4) oder Hugo v. St. Victor, De sacr. I 10.6(PL 176) 339 C: crevit […] per tempora fides; eine historiographische Anwendung von Dan. 12.4 auf die„Wissensvermehrung“ durch die zeitgenössischen magistri im Studienbericht Wilhelms von Tyrus (ed. R.B.C. HUYGENS,in: Latomus 21 [1962] 811–29, hier 823.41 ff.).754 Met. III 4, 136, s. S. 241 ff., 395 f. Dabei liegt der Hauptakzent jedoch auf der Dankbarkeitsschuld der antiquitasgegenüber.
382
aristotelischen Topik in bereichernder Weise einiges hinzugefügt haben, was dem bei Aristoteles theoretischbegründeten Prinzip der inventio locorum auch praktisch adäquat und kongenial sei.755 Die Frage ist allerdingsberechtigt, ob solches nicht im Widerspruch stehe zu Johanns Überzeugung von einer metahistorischen, ewiggleichen Wahrheit, die durch kein neues Argument entkräftet werden kann.756 Will man darin nicht ein fürihn selbst ungelöstes, in utramque partem vorgestelltes Problem sehen,757 so ließe sich annehmen, daß derhistorisierende Aspekt eines vornehmlich quantitativen Wissenschaftswachstums sich auf das immer nurbruchstückhaft erkennende Subjekt bezieht, die Zeitlosigkeit der Wahrheit aber im Sinne religiöserTranszendenz objektiv gemeint ist.758 Denn auch Johanns Erkenntnisoptimismus beruht letztlich auf der fürdas Hochmittelalter charakteristischen Hypothese, daß mehr Wissen den in der Substanz ein für allemalfeststehenden
755 Met. III 6, 143.15 ff. unten in Anm. 900 zitiert. Vgl. auch Met. III 4, 136.10 ff. oben in Anm. 536 zur höherenauctoritas der antiqui (nach einem Ausspruch Abaelards), woraus hier umgekehrt die gleiche, wo nicht höhere conceptio veriund elegantia verbi der moderni zu folgern ist. Sowohl mit einem Anklang an den inventio-Gedanken von Met. III 6 als auchim Geiste des nani-gigantes-Gleichnisses kommentiert Otto von Freising die oben (Anm. 538) besprochene Priszianglossequanto iuniores tanto perspicaciores und gelangt dabei zu einer paradoxen Gleichstellung von Fortschritt und Niedergang(Chron. V prol., ed. HOFMEISTER [MGH 55 rer. Germ.] 226). Quod non inconvenienter dictum puto, dum et priorum quiante nos sapientiae studuerunt, scriptis et institutis informamur, ac processu temporum et experientiis rerum tantomaturius in provectiori orbis aevo positi educemur, per nos quoque hiis quae ante nos sunt inventa, eodem quo et illispiritu, nova inveniri possumus. Hanc in senio mundi ex his quas dixi causis sapientiam fore multiplicandum prophetiaepraevidet qui ait: ‚Petransibunt plurimi et multiplex erit scientia’ (Dan. 12.4). Zu dieser besonders ausgewogenen Stelle imRahmen der vielfältigen Bewertungsmöglichkeiten des Verhältnisses von antiqui und moderni vgl. STOCK, Literacy (wieAnm. 371) 517 ff.; Hans-Werner GOETZ, Das Geschichtsbild Ottos von Freising, Ein Beitr. z. hist. Vorstellungswelt undzur Geschichte des 12. Jhs., Wien 1984, 88 ff., 134, 270 f. Vgl. auch S. 450 ff., 579.756 Dazu vgl. S. 238 ff., 449 aufgrund von Met. III Prol. 118 f.; III 4.136 u. a.757 Vgl. § 63, S. 267 ff., 279 ff., 295 f., 306 f.758 Vgl. § 96; A. NEMETZ, Literalness and sensus litteralis, in: Spec. 34 (1959) 76–80 zum Problem der „diversity ofunderstanding Scripture, but unity of faith“ von Isidor zu Abaelard, der die bibelexegetische Dichotomie auf dieerkenntnistheoretische Unterscheidung: Vielfalt menschlicher Meinungen – Einzigkeit der göttlichen Wahrheit ausweitet;DÖRRIE, Symbolik (wie Anm. 425) 3 f. zur platonischen Grundlage dieser Idee: alle Erkenntnis als Approximation an dasunerreichbare Eine durch die Vielfalt der Gleichnisse und deren Deutungen.
383
Glauben notwendig begründen und erläutern helfe.759 Eine Zunahme an heterogenem Wissensstoff ist demMenschen grundsätzlich nur innerhalb des geschlossenen Systems einer so und nicht anders geschaffenen Weltmöglich, die spekulativ und sub specie aeterni stets auch unter dem Blickwinkel der Vorsehung erscheint, diewesensgemäß keine intellektuellen Entdeckungen und Überaschungen kennt.760 Unter bildungspraktischemAspekt und dialektisch gesehen, heißt dies jedoch zugleich: Gerade weil die ewige Wahrheit unauslotbar ist,bleibt dem beschränkten Menschenverstand immer wieder Neues zu entdecken.761 Die dem Menschenerreichbare Erkenntnis ist die ihm je von Gott zugeteilte (also eine Gnade), weder verfügbar noch absehbar,von vornherein weder begrenzt noch grenzenlos. Wissen nicht als fertiger Besitz, sondern als stets offeneMöglichkeit der „Erleuchtung“: diese Überzeugung vereinigt Skepsis und Glauben in der Mitte zwischenIgnorantismus und Szientismus.762
759 Vgl. Colin MORRIS, The Discovery of the Individual 1050–1200, London 1972, 63; P. CLASSEN, Die Hohen Schulenund die Gesellschaft im 12. Jh., in: AKG 48 (1966) 155–180, hier 159; WETHERBEE, Platonism (wie Anm. 394) 91 f.;LIEBESCHÜTZ, Das 12. Jh. (wie Anm. 28) 258 f.; W. GOETZ, Die Entwicklung des Wirklichkeitssinnes vom 12.zum 14. Jh., in: AKG 27 (1937) 33–73, hier 39.760 Vgl. Paul ZUMTHOR, Essai de poétique médiévale, Paris 1972, 34 f.: „C’est là ce que Lotmann appelle […] une cultureparadigmatique […] en un jeu de miroirs inépuisables, mais où pourtant rien de totalement imprévisible ne peut se produire“.Daher die Vorliebe für das Zitat und die „littérature dans la littérature“. – In geschichtstheoretischer Hinsicht wurzelt hier dasderzeit aktuelle Problem, ob das Mittelalter eine – wenigstens systemimmanente – „Utopie“ gekannt, ob es Verbesserungennur als Erneuerungen oder auch als Neuerungen verstanden habe; vgl. die Zusammenfassung der Ansichten bei KERNER,Ideologie (wie Anm. 468), Einleitung 17 f. Alles hängt bei dieser leicht endlos werdenden Diskussion von der Definition derBegriffe (‚utopisch’, ‚neu’) ab. Vgl. demgegenüber U. HÜGLI/U. THEISSMANN, Art. Invention, Erfindung, Entdeckung,in: HWbPh. 4 (1976) 544–76: Verdrängung des Erfindungsbegriffs (zugunsten der inventio als Findung oder Auffindung)durch das Christentum; die alleinige Offenbarungswahrheit läßt neue Einsicht nur subjektiv für das Individuum zu;BLUMENBERG, Nachahmung der Natur: s. oben Anm. 747; ders. Lesbarkeit (wie Anm. 25) 69 f. zur Vorstellung derGeschichte als Nachschrift dessen, was Gottes Vorsehung von Anfang an im Buch der Natur verzeichnet hat. Zu den darausgezogenen historiographischen Konsequenzen: Ablehnung einer kausalen Geschichtsforschung als Versuch, vermessen dieVorsehung zu ergründen, und Vorrang eines schlichten Erzählens menschlicher Ereignisse vgl. GUENÉE, Histoire, annales,chroniques (wie Anm. 353) 1010 ff.; L. FRIEDMAN, Occulta cordis, in: Romance Philol. XI 1 (1957/8) 103–19. Vgl. auchS. 377 f., 450, 517 ff.761 Vgl. S. 450 ff. – Nachträglich bekannt wurde: A.G. MOLLAND, Medieval Ideas of Scientific Progress, in: Journal of theHist. of Ideas 39 (1978) 561–77.762 Vgl. S. 380 f., 436, 441 ff., 448, 451 f.
384
85. Sinngemäß wird die Topik als ein „Reservoir“ wahrscheinlicher Argumente verstanden, das im Gegensatzzur einfachen Wahrheit Gottes der menschlichen Erkenntnisschwäche durch Vielfalt der Aspekte (copia,diversitas) helfend entgegenkommt, indem darin auch frühere Streitpunkte ohne nachträglicheHarmonisierung oder Lösung aufbewahrt und weiterer Diskussion verfügbar gemacht werden.763 DieWissenschaft des Wahrscheinlichen oder der logica probabilis hat es mit dem Vielen, die axiomatische logicademonstrativa mit dem Einen, Wahren und Notwendigen zu tun. Nach Jahrhunderten steterAuseinandersetzung beider „Logiken“ – nach Scholastik, Humanismus, Kartesianismus – schreibt Vico fastwie Johann von Salisbury, es gebe „eine Wahrheit, viele Wahrscheinlichkeiten und unendlicheIrrtümer“.764Das Postulat der multiplicitas oder der Fülle wahrscheinlicher loci geht also auf eineerkenntnistheoretische Position sokratischer Bescheidenheit oder Selbstbeschränkung zurück und dient derKunst des iudicium, der kritischen Methode, aus einer Vielzahl von Argumenten das wahrscheinlichste zurGeltung zu bringen. Paradoxerweise führte die copia-Forderung, seit ihrer klassischen Formulierung durchCicero, häufig – in der frühen Neuzeit wohl auffälliger als im Mittelalter – zu einer selbstzwecklichen Topikder inventio, zu maßlosem Anhäufen „immer wiederkehrender Gesichtspunkte“, zu reinen Stoffsammlungenund Kompilationen von „Exempla“ im Doppelsinn der copia rerum et verborum, von mustergültigenGeschichten und Zitaten zu enzyklopädischen, polyhistorischen und „alexandrinischen“ Erscheinungen allerArt.765 Daß auch Johann einen gewissen (von seiner
763 Vgl. § 72, Anm. 753.764 De nostri temporis … (wie Anm. 601) III 32 f.: Academici in topica arte toti fuere […]: Carneades utrumqueplectebatur oppositum et uno die: iustitiam esse, altero: non esse, aequis rerum momentis et incredibili disserendi vi,disputabat. Atque haec omnia inde orta, quia verum unum, verisimilia multa, falsa infinita. Vgl. auch Anm. 765(KOPPERSCHMIDT) und Richard W. SCHMIDT, Die Geschichtsphilosophie G.B. Vicos (Epistemata 9) Würzburg 1982.765 Zu iudicium und inventio; zur dialektischen Topik des Aristoteles und der inventiven Topik Ciceros (Top. II 6, De or. I6.2 unten Anm. 768) vgl. McKEON, Invention (wie Anm. 627) 367 f. u. ö.; STUMP (wie Anm. 435) 249 ff.; APEL (wieAnm. 600) 141 ff.; COING, Hb. (wie Anm. 550) 69 ff. zum spätantiken Hauptinteresse an der inventio und Argumente-Sammlung; LANG (wie Anm. 4) 81 ff. u. a. auch zur Verflachung der aristotelischen Topik bereits durch Cicero und zuderen endgültiger Auflösung in „Lexikographie“ bei den (die wahre Topik mißverstehenden) Renaissance-Humanisten. Vgl.S. 345, 425, 430 f. Zur polyhistoristischen Materialisierung der Topik in der frühneuzeitlichen loci communes-Praxis vgl.DAXELMÜLLER, Exemplum 630 ff.; BRÜCKNER, Hist. 44 ff., 68 ff., 88 ff., 93 ff.; ders. Loci communes 34 ff.;SCHON 70 ff.; REHERMANN 27 ff.; Wh. MAURER, Melanchtons Loci communes von 1521 als wissenschaftlicheProgrammschrift … in: Luther Jb. 27 (1960) 1–50, hier 32 ff.; C. WIEDEMANN, Polyhistors Glück und Ende. Von DanielGeorg Morhof zum jungen Lessing, in: Festschr. Gottfr. WEBER (Frankfurter Beitr. z. Germ. 1), Bad Homburg 1967,215–35, bes. 218 ff.; SCHMIDT-BIGGEMANN (wie Anm. 767) 1 ff.; KOPPERSCHMIDT (wie Anm. 460) 70 f. zu VicosÜberwindung kritikloser inventio-Topik durch eine als iudicium verstandene „Kritik“, mit der die aristotelische Topik (überdie Quintilian-Rezeption) neubelebt wurde. – In der inventio-Topik werden loci häufig mit exempla gleichgesetzt, womitebenso die hier thematisierten historiae wie „Exzerpte“, Zitate gemeint sein können; vgl. Anm. 374.
385
„akademischen Skepsis“ gemilderten) Hang zur Polymathie beim Zusammenstellen seiner wie Topoibehandelten Exempla an den Tag legt, läßt sich nicht übersehen.766 Vielleicht mit ironischem Unterton,sicher aber zugleich bewundernd, zitiert er Augustins paradox hyperbolische Symploke auf denErzenzyklopädisten Varro, „der so viel gelesen hat, daß man sich wundert, wie er noch Zeit zum Schreibenfand, und so viel geschrieben hat, daß man kaum glauben kann, ein einzelner könne es noch lesen.“767
Eine rhetorische Begründung für das Ansammeln möglichst vieler Einzelgeschichten bot Quintilian mit seinerEmpfehlung:768 „In erster Linie aber müssen dem Redner Beispiele in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen,Beispiele
766 Vgl. S. 360 ff., 377 ff.767 Pol. VII 9, (II) 129.17 ff. (= Civ. VI 2.9): Iste vir tam insignis excellentisque peritiae, qui tam multa legit ut ei aliquidscribere vacasse miremur, tam multa scripsit quam multa vix quemquam legere potuisse credamus. Vergleichbare Urteileüber andere Kompilatoren und Sammler s. oben in Anm. 748. Zu einem alle Bereiche – bis zur Dichtung und Philosophie –durchdringenden Enzyklopädismus im Sinne der Verehrung „universalen Sachwissens“ im 12. Jh. vgl. CURTIUS, ELLM213 ff. In epochengeschichtlicher Hinsicht erhält dieses Resultat die richtige Proportion, wenn man es mit den obenAnm. 765 erwähnten Arbeiten zur Reformations- und Barockzeit vergleicht. Polyhistorismus vor der Erfindung desBuchdrucks blieb notwendig begrenzt. Erst die Neuzeit brachte (bis hinauf zu unserer heutigen Gelehrsamkeit) jenesphilologische Phänomen, das Umberto ECO, in Abwandlung des an Johanns Namen geknüpften Gleichnisses socharakterisiert (Il nome della rosa, Milano6 1985, 97): „La via della scienza è difficile ed è difficile distinguervi il bene dalmale. E spesso i sapienti dei tempi nuovi sono solo nani sulle spalle di nani.“ Grundlegend ist die neuerschienene, hier nichtmehr berücksichtigte Arbeit von Wilhelm SCHMIDT-BIGGEMANN, Topica universalis, Eine Modellgeschichtehumanistischer und barocker Wissenschaft (Paradeigmata 1), Hamburg 1983 (bes. 16 ff., 63 f. zum Exemplum als Topos).768 Quint. XII 4.1–2 oben in Anm. 131 zitiert; vgl. auch Anm. 373; und Cic., De or. I 6.20: Nemo poterit esse omne laudecumulatus orator nisi erit omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. Ebd. 1.158: Legendi etiam poetae,cognoscendae historiae, omnium bonarum artium doctores atque scriptores et legendi et pervolutandi et exercitationiscausa laudandi, interpretandi, corrigendi, vituperandi, refellendi; disputandumque de omni re in contrarias partis et,quicquid erit in quaque re, quod probabile videri possit, eliciendum atque dicendum. Ebd. 1.201: monumenta rerumgestarum et vetustatis exempla oratori nota esse deberi… In Brutus 39.145 lobt Cicero den Redner Crassus wegen seinerexemplorum copia. (in all diesen Stellen schwankt der Begriff exemplum zwischen historischen Beispiel und literarischemMusterzitat). Vgl. BARWICK, Cicero (wie Anm. 546) 135 ff. zu Ciceros Interesse an der Geschichte als Exempla-Schatzkammer.
386
aus alter wie auch aus neuer Zeit in solcher Menge, daß er nicht nur all das kennen muß, was in denGeschichtsschreibern steht oder was in mündlicher Unterhaltung gleichsam von Hand zu Hand gereicht wirdund was täglich geschieht, sondern sogar, was von berühmteren Dichtern erdichtet worden ist. Denn das einehat den Rang von Zeugnissen und Präzedenzentscheiden, das andere ist durch sein ehrwürdiges Alter oderdurch die Bedeutung der Dichter und der hinter dem Erdichteten stehenden Weisheitslehren allgemeinanerkannt und glaubwürdig. So soll man denn so viele Beispiele wie möglich kennen […]“. Vor dem Kriteriumrednerischer „Reichhaltigkeit“ werden alle Rangunterschiede des topischen Quellenmaterials sekundär; auchdas scheinbar Belanglose, das Anekdotische, Unterhaltsame, vor allem das Witzige kann, wenn der Rednersich rechtzeitig mit einem entsprechenden Memorabilienvorrat eingedeckt hat und sich dessen im richtigenAugenblick zu bedienen weiß, einem Argument mehr Kredit verschaffen als jeder tiefsinnige, abstrakteHinweis auf ewige Wahrheiten.769 Der Policraticus-Prolog begründet Exemplafülle und Sammeltätigkeit nichtnur produktionsästhetisch aus dem Gelehrten- und Schriftstellerfleiß (sollicitudo, triumphatrix inertiaediligentia), sondern auch rezeptionsorientiert aus der Möglichkeit, Lust und Genuß (iocunditas) zuspenden,770 wie denn auch sonst eine adäquate Mischung
769 Vgl. BATTAGLIA 460 zum historischen Exemplum im weitesten, auch alltägliche Erfahrungen und poetische Fiktioneneinschließenden Sinn (vgl. auch oben § 59, S. 54, 110 f.), worin vielleicht die wichtigste Brücke zwischen demhomiletischen und dem historisch-rhetorischen Exemplum (vgl. oben § 34) liegt, insbesondere da auch die mittelalterlichePredigtlehre Wert auf die abundantia exemplorum legt (vgl. Anm. 105 zu Humbert von Romans und Anm. 457 f. zurAmplifikationstechnik). – Treffend faßt Vico die Tradition des copia-Gebots zusammen, wenn er sich gegen puristischeEinengungen und für die levitas einsetzt (De nostri temporis … [wie Anm. 601] III, 28/30): Critica est ars verae orationis,topica autem copiosae […] facultatem habent ex tempore videndi quicquid in quaque causa insit, persuadibile […] utorator omnium animos pertigisse certum sit, omnes argumentorum locos percurrisse necesse est. Quapropter non rectenotant Ciceronem multa levia dixisse: nam et levibus illis in foro, in senatu et potissimum in concione regnavit. (Zur„Herrschaft“ der Rede vgl. unten Anm. 777).770 Pol. Prol. I 12.9 ff. oben in Anm. 366 zitiert. Vgl. auch die Fortsetzung ebd. 13.18–29: Ad haec in dolore solatium,recreatio in labore, in paupertate iocunditas, modestia in divitiis et deliciis fidelissime a litteris mutuatur. Nam a vitiisredimitur animus, et suavi et mira quadam, etiam in adversis, iocunditate reficitur, cum ad legendum vel scribendum utiliamentis intendit acumen. Nullam in rebus humanis iocundiorem aut utiliorem occupationem invenies, nisi forte divinituscompuncta devotio orando divinis insistat colloquiis […] Experto crede, quia omnia mundi dulcia his collata exercitiisamarescunt.
387
aus Scherz und Ernst als die bekömmlichste und wirksamste Darbietungsform für die philosophisch-zeitkritische Thematik des Werks bezeichnet wird.771 Exempla kommen nicht trotz, sondern wegen ihrerfleißig angehäuften
771 Vgl. Enth. in Pol. Vs. 5–9, (I) 4 f. oben Anm. 645; Pol. VIII 12, (II) 315.20 ff.: Verum si moderatio adhibeatur, hisinterdum sensuum voluptate versari sapienti non arbitror indecorum; ut saepenumero dictum est, nichil decorum est sinemodo. Nam et otiari interdum sapienti familiare est, non tamen ut virtutis exercitium evanescat, sed quo magis vigeat etquodammodo recreatur (Es folgt das Exemplum der mit Ball und Würfel spielenden Freunde Laelius und Scipio nach Val.Max. VIII 8). Pol. VIII 11, (II) 301.14 ff. oben in Anm. 509 zitiert (mit Hor. Sat. I 1.24). Pol. I 10, (I) 48.24 ff.: animussapientis […] nec apologos refugit aut narrationes aut quaecumque spectacula, dum virtutis aut honestae utilitatis habeantinstrumentum. Zum Thema delectatio und utilitas bei Johann vgl. SUCHOMSKI 46 ff. – Vielleicht erklärt sich Johannsstete Betonung des „historiographischen“ Charakters des mit historiae angereicherten Policraticus aus der hier u. ö.hervorgehobenen Kombination von iocunditas und utilitas, die Bernhard Silvestris (Comm. Aen. [wie Anm. 423] 2) als dasWesensmerkmal der historici im Gegensatz zu den einseitig auf delectatio zielenden comedi und den nur der utilitas wegenschreibenden satirici bezeichnet (Zitat in Anm. 423). Vgl. dazu auch MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 23 mitParallelen; KNAPE, Historie (wie Anm. 353) 81 f. u. unten A. 949. Ein vergleichbarer „Historien“-Begriff begleitetjedenfalls die gesamte Exempla-Tradition der frühen Neuzeit: s. A. 353, 423; vgl. BRÜCKNER Hist. 77 ff. 50 ff.; ders.,Erbauung (wie Anm. 275) 115 ff. Auch die eigenartige Verbindung von enzyklopädischem Sammelfleiß undBelustigungsabsicht ist eine aus der frühen Neuzeit besser als aus dem Mittelalter bekannte Erscheinung; vgl. diemonumentale Arbeit von E. MOSER-RATH (Lustige Gesellschaft …, wie Anm. 379) 8 ff. zur unabsehbaren Vielfalt jenerüberaus populären Kleinliteratur-Kompilationen von Erzählungen, Apophthegmen, Rätseln, Fazetien, Historien, Fabeln,Witzen, Sprichwörtern usw. usw., die sich als „Lustschriften“ zusammenfassen lassen. Die Unterhaltungsfunktion extensiverKompilatorik ist im MA ein besonderes Merkmal historiographischer Literatur. – Vgl. CLASSEN, Res gestae (wieAnm. 326) 390 ff. zu den polymathischen Zügen des Exempla sammelnden Historikers Wilhelm von Malmesbury, der inden Gesta reg. Angl. II Prol. (RBS 90, I) 103 schrieb: Multis quidem litteris impende operam, sed aliis aliam […] iam veroethicae partes medullitus rimatus, illius maiestati assurgo, quod per se studentibus pateat, et animos ad bene vivendumcomparat: historiam praecipue, quae, iocunda quadam gestorum notitia mores condiens, ad bona sequenda vel malacavenda legentes exemplis irritat. Vgl. auch B. GUENÉE; L’histoire entre l’éloquence et la science. Quelques remarques surle prologue de Guillaume de Malmesbury à ses Gesta regum Anglorum, in: Comptes-Rendus de l’Acad. des inscriptions etbelles-lettres 1982, 357–70.
388
copia auch einem in der Umwelt Johanns besonders ausgeprägten Unterhaltungsbedürfnis entgegen.772
86. Sosehr jedoch der Policraticus aufgrund der Absichtserklärung des Prologs als unterhaltsam-enzyklopädische historiae-Kompilation verstanden werden könnte – im späteren Mittelalter wurde ertatsächlich in dieser Weise verstanden und benützt – schließen andere Aussagen über die voluntas auctoris dieAnnahme aus, er sei primär als ein „neuer Valerius Maximus“ konzipiert worden. Johanns Interesse an dercopia exemplorum stammt aus seinem mehr philosophischen als philologischen Bildungsoptimismus, den erin Kapitel VII 10 mit einigem Aufwand legitimiert.773 Diesem Kapitel über die Universalität der Lesestoffe,emphatischer gesagt: über die Offenheit der Literatur, können wir eine bedenkenswerte Paradoxieentnehmen. Das Bild der Unterwerfung aller Kreatur zum Lebensunterhalt des Menschen verhält sich zumBild des göttlichen Buches der Natur (jedenfalls für modernes Empfinden – ein anderes steht nicht zurVerfügung) durch und durch widersprüchlich: Derselbe Gegenstandsbereich wird gleichermaßen als Domäneutilitaristisch ausgebeutet und verarbeitet wie als gottgegebene Wissensquelle ehrfürchtig betrachtet. Schon indem „worthaftigen“ Schöpfungsbegriff der Bibel liegt die Spannung zwischen dem herrscherlichen „Befehl“ andie Urmaterie und der gnadenhaften Erstoffenbarung Gottes für die Menschen, zwischen einer um desMenschen willen geschaffenen Welt, die ihm als dem Statthalter Gottes zur Nutzung überlassen bleibt, undeiner zeichenhaften Welt der „Werke Gottes“, in denen er die Macht des „unsichtbaren Wesens betrachten“kann, um „Ihm Ehre und Dank zu erweisen“ (Röm. I 20). Die Kosmologien der Antike unterscheiden sichgrundlegend von dieser alle christlichen Humanismen begründenden, paradoxerweise zugleich transzendentenund anthropozentrischen Wertvorstellung, die an Stelle der Dignität des Kosmos die dignitas hominis rückt,den Vorrang, ja, die Vorherrschaft des Menschen gegenüber aller anderen Kreatur (was, apokalyptischgesehen, bis heute zu der für antikes Denken ungeheuerlichen, ja, gottlosen Annahme führte, mit derAuslöschung des Menschengeschlechts sei auch der Kosmos zerstört).
Trotz dieses kosmologischen Unterschieds kennt die antike Philosophie, insbesondere die stoische, einethisches Problem beim Umgang mit der Welt, das dem christlichen Paradox einer sowohl nutz- als auchlesbaren Schöpfung strukturell entspricht und das seit der Patristik auch tatsächlich als Parallele empfundenwurde: die Frage nach dem Verhältnis von usus und
772 Zum wachsenden Unterhaltungsbedürfnis in allen Gesellschaftskreisen und zur Zunahme von Geschichtensammlungenaller Art seit dem 12. Jh. s. §§ 7, 38 f., S. 598 ff. – Zur Policraticus-Rezeption s. oben § 39 und KERNER 96 ff., 111 ff.773 Oben S. 369 ff., Anm. 733 ff.
389
admiratio mundi, von Weltbeherrschung und Weltbetrachtung, Naturunterwerfung und Naturverständnis.Diese naturethische Antithese liegt an der Wurzel des sozial- und privatethischen Gegensatzes von äußerer,eigentlicher „Welteroberung“ und innerlicher Macht durch Seelengröße (magnanimitas) über alles, „was denMenschen angeht“; von politischer Hybris und weiser Selbstgenügsamkeit; von tyrannischer Herrschaft überMenschen und von philosophischer Herrschaft („polycratia“) über das eigene Ich und über den Staat. Solcheideengeschichtlich komplexen Vorstellungen von der Welt und dem Menschen durchziehen nicht nur diepolitische Theorie des Policraticus, sondern haben auch, was kaum bekannt ist, eine semantischeTrägerfunktion für eine eigenartige Literaturtheorie. Johann überträgt sie aus dem theologischen undphilosophischen Bereich nicht nur auf die res publica, sondern auch auf die litterae oder die literarischeBildung, die er als „Welt“ verstanden wissen will.774
Zum besseren Verständnis des paradoxen Weltherrschaftsbegriffs mag eine mit ähnlicher Metaphorikarbeitende Augustin-Stelle über das Verhältnis der Geschlechter dienen: Weil der Mensch als Ebenbild Gottesnach dem Schöpfungsauftrag über die Natur herrschen soll, muß er als Mann – das Liebesgebot gehört hiernicht zum Thema – über die Frau „herrschen“, den Trieb der Vernunft unterwerfen.775 Setzen wir für unsereProblematik an Stelle der Begriffe „Natur, Frau, Trieb“ die Weltliteratur in allen Lagen und Aspekten,
774 Siehe oben Anm. 747. – Zur „imperativen“, statt demiurgischen Orientierung und zur „Worthaftigkeit“ des christlichenSchöpfungsbegriffs vgl. BLUMENBERG, Lesbarkeit (wie Anm. 732) 22 ff. Von der Dignität des Kosmos zur laudatiohominis: vgl. ders., Patristik (wie Anm. 36) 493 f., insbesondere zu Lact. Ira Dei 14.2: ei [homini] cuncta subiecta sunt utfictori atque artifici deo esset ipse subiectus. – Zu contemplatio/admiratio mundi und usus vgl. R. RIEKS, Homo,humanus, humanitas, München 1967, 112 f. (Seneca); R.A. GAUTHIER, Magnanimité, L’idéal de la grandeur de l’âmedans la philosophie païenne et dans la théologie chrétienne, Paris 1951, 169 ff., 267 ff.; GNILKA (wie Anm. 729) 44 ff.(Aristoteles’ Theorie des „angemessenen Gebrauchs“ als Ausgleich zwischen Unterwerfung der Dinge und Naturnachahmung);von MOOS, Lucan und Abaelard (wie Anm. 631) 435 ff.; BÖHLER (wie Anm. 732) 70 ff.; de GANDILLAC (wieAnm. 337) 18 ff. (zu Isidors Vermischung mit dem christlichen Doppelthema: Abwendung von der Welt (der Sünde) –Bewunderung der Welt (der Schöpfung) sowie zur Parallele: Überwindung (literaler) Autorenlektüre – (spirituelle)Autorenverehrung.775 Conf. XIII 32.47. Die etwas ausgefallene, bei Johann nicht anklingende Stelle ist mit Bedacht zum Vergleichherangezogen worden, weil sie das berühmte Bild der gefangenen, „gereinigten“ und geheirateten Heidenfrau als Metapher fürdie antike Kultur (etwa bei Hier. Ep. 70.2; s. unten Anm. 795) verständlicher macht. Johanns Herrschaftsbegriff berührt dieseit der Antike selbstverständliche ideale Verschränkung politisch-gesellschaftlicher mit kosmologisch-moralischenVorstellungen zu normativen Konstruktionen (Unterwerfung des Körpers unter den Geist; Definition der Philosophie alsKontrollinstanz der richtigen Hierarchie in allen Dingen „kosmische Liebe“ u. ä.). Vgl. auch W. WETHERBEE, SomeImplications of Nature’s Feminity in Medieval Poetry, in: L.D. ROBERT (Hg.), Approaches to Nature in the Middle Ages,New York 1982, 47–65, bes. 51 f. zu einer kosmischen Sexualmetaphorik nach Chalcidius. – Johann führt diePhilosophiedefinition: rerum omnium moderatrix nach Macrob Sat. VII 1.6 (indirekt nach Plutarch, Symp. I 1.2) in Pol. VIII10, 284.22 f. an und geht mit anderen Macrob-Exzerpten in Pol. VIII 6–7 (zu luxuria) ausführlich auf das leib-seelischeHerrschaftsmodell ein (vgl. SCHEDLER [wie Anm. 616] 6 f., 137). Angesichts der Universalität des hierarchischenNaturgemäßheitspostulats wird die Bestimmung der semantischen Funktion der Herrschaftsvorstellung (zwischenMetonymie, Metapher und Allegorie) bei einem Autor, der das Verfremdungsspiel besonders liebte, ausgesprochen schwierig(vgl. auch unten §§ 98–104). Zum epochengeschichtlichen Mentalitätenvergleich ist hier Nietzsches Kritik anWeltdeutungsprojektionen auf die Natur und an Ableitungen aus einer zuvor „sinnvoll“ gemachten Natur (wie der stoischenNaturgemäßheit, die in Wahrheit der Natur „Stoagemäßheit“ abverlange) grundsätzlich interessant (Jenseits von Gut und BöseI 9, Werk- Ed. K. SCHLECHTA II, München 1955, 573): „irgendein abgründlicher Hochmut gibt euch zuletzt noch dieTollhäusler-Hoffnung ein, daß, weil ihr euch selbst zu tyrannisieren versteht – Stoizismus ist Selbst-Tyrannei –, auch dieNatur sich tyrannisieren läßt: ist denn der Stoiker nicht ein Stück Natur? […] Aber dies ist eine alte ewige Geschichte: wassich damals mit den Stoikern begab, begibt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben.Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde, sie kann nicht anders; Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, dergeistige Wille zur Macht, zur ‚Schaffung der Welt’, zur causa prima.“ Mit dieser negativen Wertung vgl. Johanns positiveEinschätzung der Philosophie als „Herrschaft“, wie §§ 118 f., S. 441 ff., 464 ff. erläutert (u. a. im Zusammenhang mit dem„herrscherlichen“ Werktitel ‚Policraticus’)
390
dann wird der Sinn der mit kosmologischen Bildern unterstützten Aufforderung Johanns klar, alle Schriften alsad nostram doctrinam scripta zu beherrschen oder zu lesen.776 Genau genommen wird geradezu einerVergewaltigung der Literatur – aufgrund der in ihr zeichenhaft verborgenen göttlichen Wahrheit – das Wortgeredet. Wir stehen vor einer Metaphorisierung zweiten Grades: Die stoisch-moralphilosophischenHerrschafts- und Eroberungsmetaphern werden ebenso wie die jüdisch-christlichen Naturbuch- undWeltlesungsmetaphern noch einmal übertragen oder vielmehr auf den Umgang mit Literatur„zurückübertragen“, dem primären proprie-Bereich, aus dem sie stammen, wieder angenähert.777
Ausschlaggebendes Vergleichskriterium ist
776 S. 371 zu Rom. 15.4; vgl. auch oben S. 156, 361.777 Vgl. S. 32, 369 ff., 373, 466 f., 566 f. Doppelte Metaphorisierung mit halber Zurücknahme der ersten Übertragung: vgl.unten §§ 100 f. zur „Reliteralisierung“ christlicher Allegorien. – Eigenartige Parallelen zu Johanns kosmologischerLiteraturmetaphorik zeigt, ohne sie zu kennen, W. BARNER in dem bei Gryphius belegten Prinzip: „Mit Worten herrschenwir“ (über die sprachlose Kreatur) als Begründung aller Literatur (Gryphius und die Macht der Rede, in: DJVs 42 [1968]325 ff.
391
die Beherrschung und Nutzung. Die Vorstellung mag der neuen zivilisatorisch-expansiven Mentalität des 12.Jahrhunderts entsprechen, das trotz der noch gültigen religiösen Symbolhaftigkeit des Kosmos mit dertechnischen Nutzbarkeit realer Kausalitäten in der Natur Ernst zu machen und – keineswegs nur sinnbildlich –die Welt auch zu erobern begann.778 Tatsächliche Zivilisationsleistungen (Rodung, Siedlung, Städtebau u.a.m.),der zeitgeschichtliche Erfahrungshorizont und ein neuer Begriff der dignitas hominis, der Erhabenheit desvernunftbegabten Menschen über alle vernunftlosen Geschöpfe, erzeugten gemeinsam jenen spezifischnaturphilosophischen Humanismus des Mittelalters, der sich von dem „philologischen“ der Renaissancemerkwürdigerweise oft gerade durch ein ungetrübteres Verhältnis zu expansiver Naturunterwerfung undtechnischer Machbarkeit unterscheidet.779
778 Vgl. DUBY, Knightly Class (wie Anm. 541) bes. 250 ff. zum Zusammenhang des technisch-zivilisatorischen Fortschrittsmit der Rehabilitierung der Natur in der „Schule von Chartres“ sowie einem „expansiven“, nicht mehr ausschließlichrestaurativen Konzept kultureller Erneuerung: „The legacy of the past was taken up, but with the purpose of exploitation, assettlers exploited virgin lands, in order to make more from them.“ O. MARQUARD (Neuzeit vor der Neuzeit? DieFuturisierung des Antimodernismus und die mediävistischen Implikationen von Blumenbergs Neuzeitthese, in:Mittelalterliche Komponenten [wie Anm. 574] 1–6, hier 4), sieht in solchen Zügen eine „weltkonservative Weltbejahung“ imMA (aufgrund der in allem „sehr guten“ Schöpfung) als Gegensatz zur Gnosis, „der heilseschatologischen Negation dervorhandenen Welt“, und zieht daraus den aktuellen Schluß, die „Mittelalter-Neuzeit-Zäsur“ sei endlich zu „entdramatisieren“,es sei an der Zeit, das Mittelalter-Neuzeit-Verhältnis im Sinne der „Gleichförmigkeiten zwischen beiden Zeitaltern“ zuinterpretieren. Die theoretischen Widerstände gegen solch differenzierte Betrachtung des Spannungsfeldes von Kontinuitätund Diskontinuität – vor allem H.S. KUHNS einseitig aus der Naturwissenschaftsgeschichte abgezogene These von derradikalen Inkommensurabilität epochaler „Paradigmen“ oder Weltbilder – analysiert kritisch auch: Severin MÜLLER,Paradigmenwechsel und Epochenwandel. Zur Struktur wissenschaftschistorischer und geschichtlicher Mobilität bei ThomasS. Kuhn, Hans Blumenberg und Hans Freyer, in: Saeculum 32 (1981) 1–30, bes. 29 f. („Der Paradigmendarwinismus ist inRichtung einer Paradigmentoleranz zu überholen.“)779 Vgl. GREGORY, Nature (wie Anm. 26) 195, 108 ff. zur „inépuisable mentalité symbolique“ frühmittelalterlicher Denatura rerum-Traktate im Gegensatz zur Entdeckung einer „réalité substantielle“ des Kosmos, einer dank der königlichenratio des Menschen kausal erforschbaren und ökonomisch nutzbaren Natur im 12. Jh. mit besonderem Hinweis auf Johannspragmatische ars-usus-Theorie und Aufwertung mechanischer Künste (u. a. nach Pol. VI 19, [II] 57 f.; s. S. 164 ff., 257 f.,292 ff., 374 ff., A. 747); vgl. auch MUNK-OLSEN (wie A. 28) 61 und TOLAN (wie A. 573) 192 f. zu Met. I 10–11ars/Technik-Definition als „Zeitraffer“ oder compendium naturae im Gegensatz zu den langwierigen Arbeitsprozessen ohnears, die auf Zufallserfolge angewiesen sind. – Als eine Parallele zur organologischen Staatsauffassung sieht T. STRUVEdiese neue Konzeption der Natur und Naturgesetze (The Importance of the Organism in the Political Theory of John of S., in:The World of John of S. 303–18, hier 317). Dazu vgl. auch S. 466 f. Zu Kernbegriffen des hochmittelalterlichenHumanismus wie humanitas, ratio, natura vgl. auch von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 258 ff., 277 ff. Zu der damitverbundenen Aufwertung des sensus litteralis gegenüber den allegorischen Deutungen s. S. 494, 504 ff. Andererseits kannJohanns curiositas-Kritik an ethisch irrelevanter Naturwissenschaft gerade als Symptom für die Verbreitung eines neuen„Naturalismus“ verstanden werden: vgl. S. 168, 307 f. Nirgends ist wohl Johanns Haltung zu der sog. Schule von Chartresambivalenter oder (wenigstens für uns) problematischer: vgl. oben Anm. 581 und die plausible Annahme STRUVES(a.a.O. 303 ff.), die politische Naturmetaphorik wie das Bienengleichnis (s. S. 175), das Körpergleichnis (s. S. 464 ff.) oderdie Menenius Agrippa-Fabel vom Magen (S. 224 ff.) seien insgesamt durch die Makrokosmos-Mikrokosmos-Diskussionenim Kreise um Wilhelm von Conches angeregt. Vgl. dazu auch unten S. 437 ff.
392
87. Auch in Johanns „Literaturnutzungs“-Metaphorik dürfte davon etwas spürbar sein: Ohne jedephilologisch-historische Scham bekennt sich Johann offen zu einer gewissermaßen selbstherrlichenDeutungsmethode. Der letzte Teil des Policraticus-Prologs ist hauptsächlich dem Thema der„Literaturbeherrschung“ gewidmet, das im übrigen etwas mit dem Titel des Werks zu tun hat:780
Was ich am häufigsten benütze, das ist fremdes Gut, doch nur insofern, als ich alles, was irgendwo gut gesagtworden ist, zum Meinigen mache […]. Doch da ich schon daran bin, meine Werkgeheimnisse auszuplaudern, legeich meine Anmaßung noch weiter bloß. Alle, die mir in Wort und Tat als echte Philosophen begegnen, halte ich fürmeine Klienten, ja mehr noch, ich beanspruche ihren Vasallendienst und zwinge sie, durch ihreÜberlieferungszeugnisse an meiner Stelle gegen die bösen Zungen meiner Gegner zu streiten.
Diese Stelle wird gelegentlich in der Diskussion über den mittelalterlichen Humanismus und die sog.„Renaissance des 12. Jahrhunderts“ mit unterschiedlicher Wertung zitiert: entweder als Zeugnis für dieSouveränität des
780 Pol.-Prol. (I) 16.4–13: Haec quoque ipsa, quibus plerumque utor, aliena sunt, nisi quia quicquid ubique bene dictum,est, facio meum, et illud nunc meis ad compendium, nunc ad fidem et auctoritatem alienis exprimo uerbis. Et quia semelcoepi revelare mentis archana, arrogantiam meam plenius denudabo. Omnes ergo qui michi in verbo aut operephilosophantes occurrunt, meos clientes esse arbitror, et quod maius est, michi vendico in servitutem; adeo quidem ut intraditionibus suis seipsos pro me linguis obiciant detractorum. Nam et illos laudo auctores. Zum Prinzip der literarischenAssimilation (facio meum) s. S. 375. Dal PRÀ (42) bezieht diese Stelle auf den dominanten Einfluß Senecas; dazu mehrS. 394 ff. LIEBESCHÜTZ (62 f.) erwägt hinsichtlich des „Aneignungs“-Motivs einen Zusammenhang mit Johanns häufigerVerwendung des Possessivpronomens bei Klassikerzitaten (noster Cicero, noster Seneca, arbiter noster etc.). – Zum Bildder Kampfgenossenschaft und den eristischen Grundzug von Pol. und Met. vgl. S. 290 f. Zu dem auf dicta und facta (d. h.auf die Exemplum-Definition) verweisenden verbo et opere philosophantes s. S. 158, 164 ff., A. 1951. – Zurprologgerechten Verantwortungsdelegation vom eigentlichen Autor (der sich in die Kompilatorrolle hineinstilisiert) auf diezitierten auctores vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 203–10 (Boccaccio, Jean de Meun, Chaucer) und oben S. 207.
393
Mittelalters, sich die Antike lebendig anzueignen,781 oder aber als eklatanter Beweis für die völligeUnfähigkeit des Mittelalters, kulturell Fremdes als Fremdes zu verstehen oder auch nur (desinteressiert,tolerant) gelten zu lassen.782
Erklärungsbedürftig ist zunächst der clientes-Begriff. In bisherigen Übersetzungen der Stelle wurde er entwedereinfach (m. E. korrekt) aus dem Lateinischen entlehnt („clients and servants“; „Klienten“ im Sinne desrömischen Klientelverhältnisses783) oder frei umschrieben:784 „die alten Autoren wie Hörige in seinen Dienstnehmen“; „[…] habe ich zu Zubringern gemacht […], in meinen Dienst gezwungen“;785„Vasallen, die er sogarbereit sei, zu Sklaven zu machen, damit sie mit ihren Lehren ihren Herrn gegen […] Verleumderschützten“.786– Die sonstige Verwendung des Wortes bei Johann zeigt, daß er unter cliens primär „Schüler,Lernender, Anhänger, Jünger“ im Gegensatz zu „Lehrer und Meister“ versteht.787 Sämtliche Beispiele fürcliens in seinen Werken bewegen sich im Rahmen der Wissens- und Literaturvermittlung. An unserer Stellewäre eine allzu abschätzige Deutung im Sinne von: „Sklave, Knecht, Höriger“ weniger plausibel. Als nächsteslateinisches Synonym bietet sich – aufgrund ähnlich militärisch-intellektueller Doppelbedeutung – comes an(Begleiter, Teilnehmer, Gefolgsmann, aber auch Erzieher, Hauslehrer im Sklavendienst; in der Spätantikeüberdies: Beamter,
781 Vgl. etwa GLUNZ (wie Anm. 731) 52 ff. (trotz einiger Ungenauigkeiten die bisher einzige Analyse, die denZusammenhang der Prologstelle mit Prol. VII 10 im Hinblick auf die zentrale Thematik der Literatur- und Weltbeherrschungherstellt); SMALLEY, The Becket Conflict (wie Anm. 689) 91 f. sieht in der Stelle einen Beleg für den humanistischenKonkordanzgedanken (s. unten § 95).782 Vgl. etwa MISCH 1211 zu Johanns philologischer Unbekümmertheit; HARTH, Philologie … (wie Anm. 43) 16 f., 29sieht in der Stelle ein Kontrastbeispiel zu dem „echten“ historisch-philologischen Humanismus des Erasmus.783 SMALLEY, Becket Conflict (wie Anm. 689) 91; M. KERNER, Zur Entstehungsgeschichte der Institutio Traiani, in: DA32 (1976), 558–71, hier 564.784 MISCH 1211.785 GLUNZ (wie Anm. 731) 54; es folgt aufgrund der Fehldeutung von obici die allerdings phantastische Übersetzung: „daßsie nun in ihren eigenen Überlieferungen sich selber schmähen und sich widersprechen.“786 HARTH, Philologie (wie Anm. 43) 17.787 Pol. VI Prol., (II) 1.10 ff.: Dum Plutarchi vestigia in Traiani Institutione familiarius sequor, meipsum hac imaginearbitror compellari […] Me enim in praesenti clientem eius esse professus sum. Sequor ergo eum … Mit sequi wird einklassischer Begriff der literarischen Imitatio (im Unterschied zu servire ein freieres, freiwilliges Nachfolgen) auf cliensbezogen (vgl. unten S. 394 ff.). Pol. I 8, (I) 46.15 f.: Die Schauspieler (comedi und tragedi) im Dienste vonStückeschreibern (comici et tragici) heißen hier deren clientes, und sie gehören vorwiegend zum Sklavenstand (in serviliconditione pelerumque reperies). In Met. I 4, 13.16 ff., einer Aufzählung verschiedener Berufsziele der Pariser Studenten,erscheinen (wegen des Diminutivs eher abschätzig) auch clientuli medicorum (Adepten, Famuli, Arztgehilfen); in Met. IV 7,172.5 ff. wird zur Frage, warum Aristoteles „der Philosoph“ katexochen heiße, erläutert: et sicut in primis examinatoriumcudens [sc. Analecticorum librum] instruxit iudicem, sic clientem suum Aristotiles in his ad docentis provehit auctoritatem,wobei Schüler (cliens) und Lehrer konfrontiert werden. Lexikographisch war hier H. DUBLED, ‚Cliens’, in: RML 6 (1950)317–9 im Unterschied zum Mlat. Wb. und ThLL unergiebig.
394
Amtsträger; im Mittelalter auch: Vasall und Graf). In der antiken Literatursprache verweist das Wort auf einstilistisches Nachfolgeverhältnis. Um Cicero, der gern von Plato noster sprach, als einen Platoniker zucharakterisieren, sagt Plinius d. Ä.: Platonis se comitem profitetur.787a Eine ähnliche Vorstellung könnteJohann zur ironischen Umkehrung des eigentlich zu erwartenden Lehrer-Schüler-Verhältnisses motivierthaben, da sonst der die Tradition Aufnehmende der Nachfolgende und Lernende ist, hier aber zum Herrn undMeister wird. Die anschließende, explizit steigernde „Dienst“-Metapher (quod maius est … servitutem) machtihn sogar zum Befehlshaber, die clientes aber zu Mitstreitern im geläufigen (nicht unbedingt degradierenden)Sinn von „Gefolgsleuten, Begleitern, Vasallen“.
Die Stelle wird am ehesten durch Parallelen erhellt, die das Verhältnis von geistiger Selbständigkeit undAbhängigkeit von der literarischen Tradition berühren. Die antiken Termini hierzu waren Johann geläufig. Inder Sache war er – als einer der ersten Verfechter des geistigen Eigentums (gegen das Plagiat) im Mittelalter –nicht weniger bewandert.788 Stellen wie diese zitiert er zwar nicht, kennt aber deren Kontext: „Soll ich alsonicht den Vorgängern folgen? Ich tue es, aber erlaube mir auch, etwas zu entdecken, zu verändern oderwegzulassen. Ich diene ihnen nicht; ich stimme ihnen zu.“
787a Cic. Leg. 3.5; 3.32 u. a.: Plato noster; Plin., Nat. hist. praef. 2; vgl. auch Anm. 1044 zu Petrarca, Secr. III: comites alsdie tröstenden und schützenden alten auctores in schlechter Gegenwart. Diese Metaphorik zeigt allerdings die höhereRangstufe von comes gegenüber cliens trotz der identischen Schutzfunktion: Johann setzt seine Autoren-clientes alsWaffenträger gegen Verleumder ein, Petrarca fühlt sich sicher umringt von hehren Autoren-comites; Johanns clientes„dienen“, Petrarcas comites sind Vorbilder und Meister.788 Johann zum Problem der geistigen Selbständigkeit in der Traditionsgebundenheit und zur imitatio auctorum vgl. § 84,S. 364, 404 ff., 420 f. Dal PRÀ 42 zu Pol. VII 9, (II) 128; QUADLBAUER (wie Anm. 33) 23 und Joh. SCHNEIDER, DieVita Heinrici IV. und Sallust, Studien zu Stil und Imitatio in der mittellateinischen Prosa, Berlin–O. 1965, 3 zu Met. I 24.– Zu den Begriffen sequi und imitari allgemein vgl. SCHNEIDER a. O. 1 ff.; REIFF (wie Anm. 173) 58, 107 ff.;CURTIUS, ELLM 462 f.; GÖSSMANN, Antiqui … im 12. Jh., (wie Anm. 541) 17.
395
(Seneca).789 „O du leidige/Nachahmer Schar, zum Tragen und zum Folgen/geborenes Vieh! […] Ich habemeinen Weg/, […] wo kein/Lateiner mir voranging, selbst gebahnt,/nicht meinen Fuß in andrer Trittgesetzt./Wer sich’s nur zutraut, führt den ganzen Schwarm“ (Horaz).790 Auf der Ablehnung der subalternenGefolgschafts- und Imitationshaltung (sequi, vestigia) gründet eine Art literarischen „Führer“-Bewußtseins(qui sibi fidet dux) gegenüber dem epigonalen servum pecus. Bei Johann wird daraus Führerschaft gegenüberden auctores selbst. Im Banne solcher Vorstellungen von Freiheit und Gebundenheit nennt er sich einmalselbst einen cliens des großen Plutarch, dem er „folgen“ (nicht unbedingt dienen) wolle.791 Die angeführtePrologstelle wird derart gleichsam auf den Kopf gestellt, da Johann – mit oder ohne Ironie – betont, daß er indiesem Fall nicht wie sonst seine eigene Position mit Hilfe der zitierten Autoren vertrete, sondern wirklichsinngetreu der vorbildlichen Institutio Traiani folgen wolle. Da dieser Text eindeutig pseudepigraphischenCharakters, wahrscheinlich sogar von Johann selbst konstruiert ist, entsteht hier ein heiklesVerständnisproblem. Es läßt sich jedoch leicht lösen, falls Johann gerade durch diese betonte Ausnahme vonder selbst erlassenen Regel (alle Autoren als „Klienten“ zu behandeln) zu verstehen geben wollte, daß er selbstder pseudo-plutarchische Autor ist und folglich in der führenden Lehrmeisterrolle auftreten darf.792
In der vorliegenden Prologstelle bezieht sich das Klientenbild gerade nicht auf den Imitator, sondern auf die„Autorität“. Damit scheint Johann die ihm zweifellos bekannte Antithese von imitatio und aemultatio, ja,sogar den
789 Sen. Ep. 80.1: Non ergo sequar priores? facio, sed permitto mihi et invenire aliquid et mutare et relinquere. Non servioillis, sed adsentior. Vgl. RIEKS 90, 107 ff.; HADOT (wie Anm. 425) 179 ff. Vgl. auch MEERSSEMANN, Seneca (wieAnm. 405) 121 ff. zu ähnlichen Stellen aus Ep. 84 im Mittelalter.790 Hor. Ep. I 19.19–23: o imitatores, servum pecus, ut mihi saepe/bilem, saepe iocum vestri movere tumultus!/libera pervacuum posui vestigia princeps,/non aliena meo pressi pede, qui sibi fidet,/dux reget examen. (Dt. Übersetzung vonWieland). Johann zitiert Ep. I 19. 11 und 43 in Met. Prol., 3.25 und I 3, 10.14. Zur Horazstelle vgl. REIFF (wie Anm. 173)58 ff., 72, 107 ff.; McCALL 164 f. – Das Bild der Führerschaft des Autors zeigt REIFF a. O. 121 bei Hier. Ep. 58.5.2(oben Anm. 173 zitiert). Johann scheint allerdings die ausführliche Imitatio-Theorie Quintilians (X 2. 1–14) nicht zitiert zuhaben.791 Pol. VI Prol. (II) 1.10 ff. oben in Anm. 787 zitiert.792 KERNER, Institutio (wie Anm. 783) 564 sieht im Gegensatz zu dieser Deutung in der gleichen Kennzeichnung einesliterarischen Klientelverhältnisses mit vertauschten Rollen (meos clientes sind im Prol. 16.9 die Autoren, und als meclientem bezeichnet sich Johann selbst gegenüber Plutarch in Pol. VI, 1.13) einen Beweis für die Echtheit des Zitatbezugs aufdie pseudoplutarchischen Institutio Traiani. Siehe unten Anm. 922.
396
gewöhnlichen Überbietungstopos noch zu steigern. Aus dem Postulat: ‚Laß dich von den Autoren nichtversklaven; folge ihnen vielmehr, eifere ihnen nach, komme ihnen gleich, ja, übertreffe sie!‘ wird nun eineTheorie der Unterwerfung und Indienstnahme von Autoren, die ihrerseits (in völliger Umkehrung der Rollen)ihrem Herrn – dem Rezipienten und Kompilator – nicht sklavisch, sondern als dessen nützliche, hilfreiche„Zöglinge“ und Vasallen frei folgen sollen. Nicht anders tragen Traditionsriesen im nani et gigantes-Bild diejungen Zwerge und dulden solche „überlegenen“ Reiter auf ihren Schultern.793
Diese Deutung stützt sich vor allem auf den inneren Zusammenhang von Prolog und Kapitel VII 10 desPolicraticus, der im wesentlichen durch den augustinischen Leitbegriff der Herrschaft über die Weltdingegebildet wird. Das clientes-Bild erweist sich letztlich als eine besondere, humanistisch gemilderte Variante zuder bunten Metaphorik für den selektiven usus heidnischer Literatur, für die sog. interpretatio christiana.794
Am bekanntesten sind die z. T. auch von Johann (namentlich nach Hieronymus) verwendeten Vorstellungender schönen fremdstämmigen Sklavin, der die Nägel geschnitten werden (nach Deut. 21.10 ff.); der von denJuden bei ihrem Auszug aus Ägypten mitgenommenen Gefäße; der dem Herkules entrissenen Keule; des imKot des Ennius von Vergil ausgegrabenen Goldes.795 Ja sogar das Verdauungs-
793 Siehe S. 241 ff., 381, 566, 579.794 Vgl. S. 370 ff., 455 ff. Zu den Bildern der Überwindung heidnischer Literatur vgl. allgemein CURTIUS, ELLM 50 ff.,367 f. u. ö.; ders., Die Musen im Mittelalter, (Mittelalter-Studien 6), in: ZRPh 59 (1939) 179 f.; BUCK, Humanismus imMA (wie Anm. 538) 227 f.; LUBAC (wie Anm. 430) I 290 ff.; SIMONE (wie Anm. 746) passim; JEAUNEAU, Lectio (wie428) 152 f. – Sie sind keineswegs auf das Mittelalter beschränkt: zu ihrer ungebrochenen Vitalität in der (bekanntlich nichtunchristlichen) Renaissance vgl. Ch. BÉNÉ, Les Pères de l’Eglise et la reception des auteurs classiques, in: ‚Die Rezeptionder Antike’, Zum Problem der Kontinuität zwischen Mittelalter und Renaissance, (Kongreß Wolfenbüttel 1978), ed. A.BUCK (Wolfenbütteler Abh. z. Renaiss.-Forsch. 1), Hamburg 1981, 41–54, hier 43; A. BUCK, Patristik (wie Anm. 528)155 ff.; ders., Begriff d. Renaiss. (wie Anm. 539) 8; vgl. aber auch § 111, S. 534 f.795 Mulier captiva: nach Deut. 21.10 ff. bei Hier. Ep. 70.2; vgl. LUBAC (wie Anm. 430) I 290 ff.; J. de GHELLINCK, LeMouvement théol. du 12e s., Paris 1948, 94 f.; S. 389 f. Spolia Aegyptiorum: nach Exod. 3.22; 11.2; 12.35 f. (auch beiGratian D 37 c 7 [FRIEDBERG] 137); z. B. in Pol. VII 1, (II) 94.13 ff. (verbunden mit Ov. Met. IV 428: licet ab hostedoceri); vgl. LUBAC (wie Anm. 430) I 300 ff. GNILKA (wie Anm. 729) 71 ff. (bei Aug. und Petrarca); vgl. Anm. 636,734, 803, 1025, 1030. – Herkules: nach Macrob. Sat. V 3.16 in Pol. VII 13, (II) 146,5 f. – Ennius: nach Donat, VitaVergilii 18 in Pol. V Prol., (I) 281.5 f.; vgl. LUBAC a. O. 274 ff.; SMALLEY, Friars 19 f.; s. A. 729. – Vgl. auch dieGartenpflegemetaphern: gute Pflanzen aus Brennesseln, Rosen trotz Dornen pflücken, in: Enth. v. 1109–12, 172 (zu Plato);Pol. VII 10, (II) 134.10 f.
397
und das Bienengleichnis der alten Imitatio-Theorie gehörten, soweit der selektive Charakter des Bildes betontwird, in diesen Zusammenhang.796 Daneben verwendet Johann auch die gewalttätigeren Vorstellungen:„herausschlagen“ (excutere) und „Federn ausreißen“ (plumis spoliare), um den Umgang mit den auctores alsein Herauspressen, Herausschütteln, Herausklopfen zu charakterisieren, als ein Ausrupfen von Wahrheiten,die diese nicht unbedingt sagen wollten, nun aber sagen sollen.797 Auch das in der Neuzeit berühmt gewordeneBild von der „Magd der Theologie“, das letztlich auf Augustins Umdeutung von Ciceros Einschätzung derRhetorik als famula philosophiae zurückgeht, findet sich bei Johann mit Bezug auf das Verhältnis vonPhilosophie und Literatur zur Bibel:798 „Die heilige Schrift ist die Königin der anderen Schriften […] In ihrerkennt die Philosophie ihr Haupt, und alle Artes dienen ihr.“
796 Vgl. § 84, S. 420; Pol. VII 10.132 f.797 Vgl. oben Anm. 668 das Zitat aus Met. I 24, 54 f. (mit moralphilosophischem Selektionskriterium). Vgl. dazuJEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 544) 86 f., DELHAYE, Grammatica … (wie Anm. 386) 22. – Die Vorstellung eines„Kulturraubes“ ist bereits in der Vorgeschichte der integumentum-Theorie, der spätantiken Vergilerklärung angelegt, nach derdie Wahrheit der Philosophie durch Vergil aus der lügenhaften Poesie herausgeholt, „entwendet“ worden sein soll. Zu diesemThema vgl. Anm. 795, 734.798 Enth. Vs. 443–7, 150: ‚Quod divina pagina regina est aliarum’ […] Est sacra, personas et res quae consecratomnes;/Hanc caput agnoscit philosophia suum;/Huic omnes artes famulae (huic bezieht sich entgegen der Interpretation vonCOURCELLE, ‚La consolation de Philosophie … [wie Anm. 977] 51 f. nicht auf philosophia, sondern auf divina pagina,die „Königin aller Schriften“). Zu Augustins famula philosophiae nach Cicero (Doctr. christ. IV 1, IV 10) vgl. MICHEL,Culture et sagesse (wie Anm. 402) 523. – Die Liste solcher Metaphern für den christlichen usus heidnischer Literatur ließesich erweitern. Gegenstand einer eigenen bedeutungswissenschaftlichen Untersuchung sind sie m. W. bisher nicht geworden.(Modellhaft für die Methode wäre hier: Hans-Jörg SPITZ, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, [MMS 12], München1972). Bei aller bildlichen Vielfalt muß aber eine berühmte, häufig nach A. BUCK, Patristik (wie Anm. 528) 161 zitierte(von diesem selbst im WdF.-Band ‚Petrarca’ 1976 [wie Anm. 528] 12 und in: Überlegungen zum gegenwärtigen Stand derRenaissanceforschung, in: Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 43 [1981] 7–38, hier 33 wiederholt ins Zentrumgestellte), vermeintlich besonders aggressive und unhumanistische Metapher mit Sicherheit ausgeschlossen werden: LautBUCK habe Hieronymus (Ep. 57.6) die allgemeine patristische Auffassung dahin zusammengefaßt, daß man mit denheidnischen Autoren victoris iure verfahren soll. In besagter Hieronymus-Stelle ist jedoch keineswegs von antiker Literaturdie Rede; Hieronymus spricht von der Übersetzung griechischer Kirchenväter ins Lateinische und plädiert für eine freie,sinngemäße, nicht sklavisch wörtliche Übersetzung. Vorbildlich sei Hilarius: captivos sensus in suam linguam victoris iuretransposuit. So irreleitend das vielleicht in tendenziöser Absicht (s. § 110, A. 1025) von BUCK mißbrauchte Sieger-Bild fürdie patristisch-mittelalterliche Rezeption der Antike auch ist, verdient es doch Interesse weil damit noch weniger als mitJohanns clientes- und servitus-Vorstellung eine negative Wertung des Gegenstandsbereichs verbunden wird: Dieser bestehthier nämlich aus griechischen Hiob-Homilien und Psalmenerklärungen. Sie sollen vom lateinischen „Sieger“„gefangengenommen werden.“ Man muß hier auch wissen, daß Graecia capta nach einem Horazvers traditionell auf dasproblematische Verhältnis von griechischer und römischer Kultur (jenseits aller geistlichen Vorbehalte) verweist, was zweiStellen Johanns belegen können: Enth. Vs. 113–4, 140 (zum Jugendirrtum der Überschätzung reiner Dialektik): LaudatAristotelem solum, spernit Ciceronem/et quicquid Latiis ‚Graecia capta’ dedit (nach Hor. Ep. 2.1.156). Pol. VIII 7, (II)267.17 ff.: Sicut enim ‚Graecia capta ferum victorem cepit et artes/intulit agresti Latio’ [Hor. Ep. 12.1.156–7], sic omniumgentium mores boni et mali Romanum victorem persecuti sunt. – Zur victor-Vorstellung im Zusammenhang mit heidnischerLiteratur siehe hingegen Baldrich von Bourgueil, Cm. 238/200 unten Anm. 911.
398
Dem Gesagten scheint eine Policraticus-Stelle zu widersprechen, die dieselben Vorstellungen des Herrschensund Dienens im umgekehrten Sinn auf die Hermeneutik anwendet:799 „Ein Dummkopf ist, wer die Schriften,durch die er unterwiesen werden soll, zu beherrschen sucht, ihren Sinn so gefangennehmen will, daß er siezwingen kann, gegen ihren Willen seinem eigenen Verstand zu entsprechen. Sucht man in ihnen, was sie nichtenthalten, so verbaut man sich nur das eigene Verständnis und lernt nichts anderes hinzu […] Dienen mußman also den Schriften, nicht sie beherrschen; es sei denn, einer halte sich selbst für so erhaben, daß er überdie Engel herrschen zu müssen glaubt.“ In diesem Zusammenhang sind die „Schriften“ jedoch die Bibel, derenunbedingte Führerrolle sich gerade auf die „beherrschbaren“, „unterzuordnenden“ auctores beziehen läßt.Doch auch außerhalb des Umgangs mit der Heiligen Schrift scheint die am Beispiel des clientes- undVasallenbildes beleuchtete Metaphorik einer „Autorenunterwerfung“ eher kritisiert zu werden; von einerfalschen Art der Porphyrius-Lektüre redend, sagt Johann:800 „Der Literalsinn ist nämlich behutsam zuergründen, sanft herauszuklopfen,
799 Pol. VII 13, (II) 147.1 ff.: Ineptus est qui scripturis, a quibus instruendus est, appetit dominari et captivato sensu earumad intellectum suum eas nititur trahere repugnantes. Nam in eis quaerere quod non habent, proprium sensum obstruere estet non addiscere alienum […] Ebd. 148.1 ff.: Serviendum est ergo Scripturis, non dominandum, nisi forte quis se ipsumdignum credat ut angelis debeat dominari. Vgl. auch unten Anm. 912.800 Met. III 1, 121.23 ff.: Littera enim suaviter excutienda est et non more captivorum acerbe torquenda, donec restituatquod non accepit. Porro austerus nimis et durus magister est, tollens quod positum non est et metens quod non estseminatum, qui Porphirium cogit solvere quod omnes philosophi acceperunt, cui satisfactum non est, nisi libellus doceatquicquid alicubi scriptum invenitur. Plane veritas est amica simplicitati. Vgl. dazu ATKINS (wie Anm. 366) 79. Eineähnliche Kritik Petrarcas an der Überfrachtung mit Scholien bei der Interpretation vgl. S. 228 ff. – Zur „einen und einfachen“Wahrheit vgl. auch oben Anm. 764. – Zum Mißbrauch der Isagoge des Porphyrius durch gewisse Dialektiker vgl. auch untenAnm. 912 (Met. II 16–7) und Pol. VII 12, (II) 144.15 ff.: In liberalibus disciplinis, ubi non res, sed dumtaxat verbasignificant, quisquis primo sensu litterae contentus non est, aberrare videtur michi aut ab intelligentia veritatis, quodiutius teneantur, se velle suos abducere auditores. Plane Porphiriolum ineptum credo si ita scripsit ut sensus eius intelliginequeat nisi Aristotile, Platone et Plotino praelectis.
399
nicht wie ein hilfloser Gefangener auf die Folter zu spannen und gewaltsam auszupressen, bis er endlich gibt,was er nicht empfangen hat. Wahrhaftig ein allzu strenger und harter Meister ist, wer entwendet, was nichthinterlegt, und erntet, was nicht gesät worden ist; wer den Porphyrius zwingt, die Lehrmeinungen sämtlicherPhilosophen auszuschütten, und keine Ruhe gibt, bis das kleine Buch lehrt, was immer irgendwo geschriebenworden ist. Offen gesagt, die Wahrheit ist mit der Einfachheit befreundet“. Johann polemisiert so gegen denartifiziellen „Überbau“ gewisser Kommentatoren, die jeden Text und sogar noch eine schlichte Anfänger-Einführungslektüre zum Vorwand für die Ausbreitung ihrer stupenden Gelehrsamkeit nehmen, die (nach einemWort des Petrus Cantor):801 „… nicht über, sondern um den Text herum reden“. Dem Bild derAutorenbeherrschung widerstreitet dies insofern nicht, als Johann hier von dem spricht, was die Philosophen„empfangen“ haben, nicht von dem, was sie sagen wollten. Es geht ihm auch hier nicht um eine philologischeAusdeutung der voluntas auctoris, sondern um die gattungs- und kontextadäquate Erschließung der in denSchriften „deponierten“ Lehren. Nicht berührt und schon gar nicht in Frage gestellt wird die Objektivitäteines den Autor möglicherweise transzendierenden „ewigen Sinns“, den es aufzufinden gilt, wobei die Suchesich allerdings
801 Petrus Cantor, Verbum abbreviatum (PL 205) 25 D: Glossarum multitudine, lectionum superfluitate et prolixitateonerati sumus in quibus est tantum labor et afflictio spiritus [Eccl. 1.17], puta in glossis quae non intra sed circa textumloquuntur. Zum technischen Sinn der Begriffe circa und intra librum in den Accessus ad auctores (hinführende Situierungdes Texts in Tradition und Geschichte – eigentliche Deutung der intentio auctoris sowie der utilitas für den Leser) vgl.MINNIS, Authorship (Anm. 337) 31 f. Zum kritischen Sinn der Petr. Cant.-Stelle vgl. E. JEAUNEAU, Gloses etcommentaires de textes philosophiques (IXe–XIIe s.), in: ‚Les genres littéraires dans les sources théologiques etphilosophiques médiévales’, Louvain la-Neuve 1982, 120–131, hier 127. Zum Hauptanlaß solcher Kritik am „Unter-“ statt„Auslegen“: der nicht so sehr dem Textverständnis als dem „geistigen Sinn“ dienenden allegorischen Methode, vgl.JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 127 ff., 132 und unten Anm. 970.
400
(ungetrübt vom eigenen Vorwissen) auf den Text selbst zu richten hat:802 Spirituelle (oder philosophische)Sinnsuche und philologische Hermeneutik sind zwei nicht notwendig, sondern nur akzidentellzusammenfallende Geistestätigkeiten.
Das hier mit vielen kontextuell divergierenden Varianten illustrierte Thema der Nutzbarkeit oderDienlichkeit heidnischer Literatur läßt zwei Interpretationen zu: Entweder liegt der Ton auf der Ausbeutung,Beraubung, Unterwerfung des Fremden, oder die eigene Bereicherung steht im Blick.803 Zweifellosinteressierte sich Johann entschieden mehr für das letztere. Eine literaturpraktische Konsequenz bleibt aus derclientes-Stelle des Prologs noch zu ziehen: Johann betrachtet die philosophisch nützlichen Autoren undExempla, dicta und facta als wirksame Helfer, Mitstreiter im Kampf gegen die nugae curialium. Er führt siewie ein Feldherr an und setzt sie nach strategischer Beurteilung an geeigneten Stellen ein. Entsprechend kanner sie auch soweit zurechtbiegen, bis sie ihre Rolle als rhetorische Überzeugungsmittel erfüllen. DieLegitimation zu dieser wenig humanistischen Herrschaft entnimmt
802 S. 368 ff., 456 f.; MEIER, Allegorie-Forsch. (wie Anm. 425) 11 ff., 35; BRINCKMANN, Hermeneutik (wie Anm. 145)26 ff.; P. GANZ, Vom Nichtverstehen mittelhochdeutscher Literatur, in: Wolfram-Studien 5 (1979), 136–153, hier 145 ff.Das, was das MA unter voluntas auctoris verstand, ist grundsätzlich von unserem philologisch-historischen Begriff einersakrosankten, ursprünglichen Autorintention zu unterscheiden. Zentral war nicht irgendeine vom auctor gemeinte, sonderndie nützliche, wahre Botschaft, die er weitergab (s. S. 367, 472). Daraus folgt nicht, daß die Zeichenhaftigkeit allesGeschriebenen Verfasserschaftsprobleme und ähnliche quellenkritische Fragen völlig uninteressant gemacht habe (vgl.vielmehr oben § 57 und Johanns Brief 209 [II] 332 ff. über die Autorschaft biblischer Bücher); auch nicht, daß die oftwidersprüchlichen, je auf ihre Weise „nützlichen“ Meinungen der Autoritäten nicht als solche, d. h. als individuelleUnterschiede wahrgenommen würden (vgl. §§ 65 f. und Met. II 17, 94 gegen falsche posthume Harmonisierung derMeinungsdifferenzen zwischen Plato und Aristoteles); Johann ist vielmehr ein hervorragendes frühes Beispiel für jene vonMINNIS (Authorship [wie 337] 36 ff., 73 ff.) aus spätmittelalterlicher Literaturtheorie herausgearbeitete Vorstellung eineslabilen Gleichgewichts zwischen den beiden möglichen Autor-Rollen: dem auctor verborum und dem auctor rerum, demmenschlichen und dem göttlichen Urheber, dem Menschen als Texthersteller im sensus historicus und dem Menschen als„Feder“ für die schreibende Hand Gottes im sensus spiritualis. Vgl. Anm. 483.803 Vgl. JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 152 f. zu diesem Unterschied zwischen den apologetischen Kirchenvätern undden christlichen Humanisten des 12. Jahrhunderts, die nur ein Ziel kannten: „d’enrichir la pensée chrétienne des dépouilles del’antiquité“: Dieses Ziel zeigt besonders schön Theodorich von Chartres, De sex dierum operibus, Praef. in der Auslegungvon Exod. XII 35–6: expoliare Egiptios et ditare Hebreos. Vgl. auch unten S. 437 ff.
401
er ausdrücklich der „einen umwandelbaren Wahrheit“,804die hinter aller Literatur und allen überliefertenExempelgestalten als das eigentliche Lese- und Erkenntnisziel zu suchen ist. Unsere moderne Frage, welchesverbindliche Kriterium, welche Kontrollinstanz subjektive Willkür und Manipulation bei solcher Hermeneutikausschalte, findet kaum eine andere Antwort als den sehr vagen und stereotypen Hinweis auf den moralischen„Nutzen“ und die göttliche Wahrheit.805 Diese Antwort ist für uns umso irritierender, als Johann sich imgleichen Zusammenhang unumwunden zur Freiheit bekennt, Quellen nach Bedarf zu verändern, ja sogar zuerfinden, sofern dies der publica utilitas dienlich sei.
Dies ist die Quintessenz des Policraticus-Prologs. Wenn man sich die Mühe macht, dessen assoziativgewobene Struktur etwas zu entwirren, so liest er sich wie eine einzige Apologie für das philologisch ungenaueZitat, für die literarische Fiktion, für das Recht des Schriftstellers, zugunsten einer wahren Sache ein wenig zu„lügen“. Johanns Hauptvorlagen waren dabei die Vorreden zu den beiden Werken Macrobs, den Saturnaliaund dem Kommentar über Ciceros Somnium Scipionis. Der für die Gattung der „Symposien“ grundlegendeSaturnalia-Prolog verteidigt mit vielen Seneca- und Gellius-Reminiszenzen die Kompilation, Adaptation undAssimilation fremder Textstellen sowie die lockere, halb ernsthafte, halb scherzhafte Konversation übertypische quaestiones convivales. Das philosophisch anspruchsvollere Einleitungskapitel zum SomniumScipionis-Kommentar legitimiert die Form des visionären Totengesprächs und allgemeiner die literarisch-fiktive Einkleidung philosophischer Wahrheit. Es vermittelte dem Mittelalter wie kaum ein anderer Text derAntike (abgesehen von Ciceros Dialogen) das Ideal des platonischen
804 Siehe oben Anm. 733: Pol. VII 10 (II) 132.12 f. (veritas incorruptibilis), unten Anm. 893: Pol. Prol. (I) 17.15 ff.:(eadem incommutabilis veritas), Anm. 475, 780 zur strategischen Bedeutung der auctores nach Met. III Prol. und Pol. Prol.(I) 16.4 ff. – Nach GNILKA (wie Anm. 729) 43 f. und H. FLASHAR, Die klassizistische Theorie der Mimesis, in: Leclassicisme à Rome, Entretiens … Fondation Hardt 25, Genf 1979, 79–111 unterscheiden sich in der Antike imitatio undusus nach dem rhetorischen oder dem philosophischen Interesse: imitatio bedeutet literarästhetisch intensive Angleichung anein sprachliches Vorbild, usus dagegen verlangt philosophischen Abstand und Selbständigkeit im Umgang mit der Tradition.Von beiden in ihrer Eigenart gleicherweise humanistischen Forderungen hat Johann zweifellos die philosophische über dieliterarisch-rhetorische gestellt. Auch das Ideal der Einheit der Wahrheit ist im philosophischen Sinn ein humanistisches,soweit es nicht die Exklusivität, sondern die Universalität des Christentums betont (zu dieser Position Johanns s. unten§§ 94–104). Für das Verständnis des Folgenden ist somit die Unterscheidung des philosophischen und des philologischenHumanismus unentbehrlich.805 Vgl. S. 212, 216 ff., 210, 224 f., 306 ff., 311, 386 f., 403, 406.
402
Gesprächs, jener „exemplarischen Vergegenwärtigungsleistung“, die als Ersatz für den faktischen (notwendingungeschriebenen) philosophischen Wissensbildungsprozeß sokratischer Art dem Leser wenigstens einGesprächsexemplum, ein methodisches Identifikationsmodell dialogisch unabgeschlossener und jederzeitfortsetzbarer Wahrheitssuche vor Augen stellt. Durch Macrob kam Johann also mit zwei „systemfeindlichen“Denk- und Ausdrucksformen in Berührung, die dem „dogmatisch befangenen“, dem „autoritätshörigen“ oderdem „formallogisch-systematischen“ Mittelalter gemeinhin nicht von vornherein zugetraut werden.806
88. Seine Apologie für den „unphilologischen“ Umgang mit den auctores eröffnet er im Policraticus-Prologdamit, daß er die Anonymität und Unvollständigkeit der Zitate mit der Wiedergabe aus dem Gedächtnis, mitdem Primat von Relevanz oder Sachgemäßheit sowie mit bildungspädagogischen Absichten begründet:807 „Ichhabe mich bemüht, einschlägige Stellen aus verschiedenen Schriftstellern einzufügen, wie sie mir geradeeinfielen, und sofern sie hilfreich und angenehm zu lesen sind; doch habe ich die Namen der Autorengelegentlich unterdrückt, teils, weil das meiste einem Literaturkenner wie Dir onehin bestens bekannt ist, teilsauch. damit der Unkundige vermehrt zu fleißigem Lesen angespornt werde.“ Darauf folgt eine
806 Macrob, Somn. Scip. I 1.9–2.21: s. 406 f., Sat. Praef. I 1–2. Vgl. WEBBS Index locorum s. 1. und die aufschlußreicheAnalyse von FLAMANT (wie Anm. 509) 172 ff., 178 ff., 219 ff.; vgl auch oben Anm. 705 f. (Symposien) und S. 375, 470(Assimilation und Speisemetaphorik); M. BEVILACQUA, Introduzione a Macrobio, Lecce 1973 gegen das in derAltphilologie lange vorherrschende Bild des epigonalen Kompilators; BEBERMEYER (wie Anm. 381) 926 f.; J. MARTIN,Symposion. Die Geschichte einer literarischen Form, Paderborn 1931; CURTIUS, ELLM 451: Macrob als eineHauptautorität für das mittelalterliche Ansehen der Kompilation und kompilationsnaher Gattungen (vgl. auch S. 407 f. zuMacrobs Bedeutung für Johann). – FRIEDRICH, Montaigne (wie Anm. 53) 168 f. und UHLIG 5 ff. u. ö. zumKonversationston der „Moralistik“ von Seneca über die mal. „Moralphilosophie“ zu Montaigne (dazu s. auch Anm. 604);MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 203 ff. zur verantwortungsdelegierenden Kompilatorrolle (dazu vgl. auch S. 207, 392,406). – Zum platonischen und ciceronischen Dialog vgl. § 51, S. 192 ff., 252 ff., 290 f., 298 f., 266 ff., 355 ff., 406, 534 f.sowie MITTELSTRASS (wie Anm. 545) 11 f., 20 ff., 24 (Zitat).807 Pol. Prol. 15.20 ff. oben in Anm. 462 zitiert. Das Motiv, dem Leser nur Anstoß zu vermehrter Lektüre geben zu wollen,findet sich z. B. auch bei Aul. Gellius, N.A. praef. 17. – Eine andere Begründung für das „Verschweigen“ von Autor-Namengibt der Speculum maius-Prolog des Vinc. Belv. (wie Anm. 337) 117 aus der geringeren Dignität der „modernen“ Quellen,wobei das Verschweigen implizit mit dem Aneignen zusammenfällt (Text s. oben Anm. 337): quae didici […] nomine meo[…] intitulavi (heute hieße dies „Plagiat“).
403
Rechtfertigung des fiktiven, bzw. unhistorischen Charakters mancher Zitate aus dem moralphilosophischen„Nutzen“:808„Wenn darin einmal etwas von der Glaubwürdigkeit und Wahrheit stark abweicht, so bin ichsicher, daß man mir solches nachsehen muß; kann ich auch nicht versprechen, daß alles hier Aufgezeichnete(quae hic scribuntur) wahr ist, so doch, daß alles, sei es wahr oder falsch, den Lesern zum Nutzen gereichenwird.“ Die vielleicht absichtlich unklare passivische Form scribuntur läßt offen, ob Johann sich selbst alsschreibend oder nur als zitierend betrachtet. Dann rekurriert er auf die in der fabula-Theorie traditionelleFiktionsbegründung:809 „Ich bin nämlich nicht so einfältig, etwa für wahr auszugeben, daß die Schildkröteeinmal zum Federvieh gesprochen habe oder daß die Landmaus die Stadtmaus ins arme Haus aufgenommenhabe und dergleichen. Doch, daß solche Erfindungen unserer Lehre dienen, das bezweifle ich keineswegs.“ DerBegriff des Dienens
808 Pol. Prol. 15.25 ff.: In quibus si quid a fide veri longius abest, michi veniam deberi confido, qui non omnia, quae hicscribuntur, vera esse promitto, sed sive vera seu falsa sint, legentium usibus inservire.809 Ebd. 15.28 ff.: Neque enim adeo excors sum ut pro vero astruam, quia pennatis avibus quondam testudo locuta est, autquod rusticus urbanum murem mus paupere tecto acceperit, et similia [cf. Avian. Fab. 2; Hor. Sat. II 6.80]; sed quin haecfigmenta nostrae famulentur instructioni, non ambigo. Das Beispielmaterial gehört traditionell zur Fabeltheorie; dieFormulierung erinnert an die durch Isidor Et. I 40.6 berühmt gewordene Augustin-Stelle aus Contra mendacium 12.28(CSEL 41) 509 (vgl. A. 288): … unde et Aesopi tales fabulas ad eum finem relatas, nullus tam ineruditus fuit, qui putaretappellanda mendacia […] Quod utique totum fingitur, ut ad rem quae intenditur, ficta quidem narratione, non mendacitamen, sed veraci significatione veniatur. Vgl. auch De quaest. evang. II 51 bei Thomas Aqu., Summa theol. III 55.4 ad 1:non omne quod fingimus mendacium est […] cum autem fictio nostra refertur in aliquam significationem, non estmendacium sed aliqua figura veritatis. – Zu fabula als Fiktion und als Gattung in der Fabeltheorie und zum Begriffexemplarisch nützlicher Wahrheit vgl. S. 23, 32 ff., 48 ff., 120 f., 148; Pol. III 7, (I) 186: in fabulis, quoniam et mendaciapoetarum serviunt veritati; ebd. I 4, (I) 23; VI 22, (II) 63; VII 2, 94; VII 8, 120; VII 10, 130 f.; VIII 11, 301; VIII 24, 416 f.– Vgl. LAUSBERG §§ 1107–10; WALTHER, Streitgedicht (wie Anm. 668) 13 f.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 100 ff.;KOEP 150; F. WAGNER, Äsopik, in: EM s. v. 891; von MOOS, Poeta… 109 ff.; KNAPE 349 ff.; DRONKE, Fabula (wieAnm. 729) 13 ff.; BEER, Truth (wie Anm. 502) 68 f.; LIEBERTZGRÜN (wie Anm. 325) 82; W. GEBHARD, ZumMißverhältnis zwischen der Fabel und ihrer Theorie, in: DVJs 48 (1974) 122–153. In der vielschichtigen Systematik derFabelarten nach dem Grad der Wahrheit oder Dignität in mal. Literaturtheorie (vgl. OLSON [wie Anm. 280] 29 ff.) ragen die„äsopische“ oder lustvoll belehrende und die „milesische“ als verblüffend satirische heraus (vgl. WALSH [wie Anm. 506]4 ff.); Johann scheint sie kombinieren zu wollen (vgl. S. 407 f., Anm. 834, 1051, zu Hor. Sat. I 1.69–70 in Pol., Prol. [I]15).
404
(famulari) – die Fabel „dient“ der Wahrheit – bietet das Stichwort für den folgenden (bereits S. 388 ff.analysierten) metaphorischen Passus über die „Autorenbeherrschung“. Der gedankliche Ablauf enthüllt alsodie Tierfabel als pars pro toto für alle (insbesondere die heidnischen) Schriften der Tradition, die wie „Diener“(clientes) unterworfen (d. h. christlich kontrolliert) werden sollen, und erweist umgekehrt alle Literatur ineinem positiven Sinn als „fiktional“, da auf sie die gängige Vorstellung von der philosophisch-theologischwahren und historisch falschen Fabel übertragen wird.810 Johann will aber, wie das Weitere zeigt, mit seinerFiktionalitätsrechtfertigung nicht nur die Literatur selbst, sondern auch seine eigene Literaturverwertung inSchutz nehmen: Alles, was ihm „aus den Autoren einfiel“,811ist identisch mit seinem geistigen „Eigentum“.Denn im Prolog folgt unmittelbar hier812 die (S. 392 ff. besprochene) programmatische Aussage über dieassimilierend einschmelzende Technik der Autorenaneignung (quicquid ubique bene dictum est facio meum),wobei die Möglichkeiten der eigenen verkürzenden Paraphrase und des wörtlichen Zitats unterschiedenwerden.813 Das Prologthema
810 Comm. in Ecl. Theod. (wie Anm. 734) I 186–9, 27: Denique gentilia ob id leguntur, ut per ea ad celestia intelligendainformemur. Non ergo usquequaque gentilia sunt abicienda, sed ut servi dominis postponenda. Eine andere, ähnlichrepräsentative Stelle aus der Historiographie bespricht LIEBERTZ-GRÜN (wie Anm. 325) 82 f.: Erfurter Chronik (14. Jh.)(MGH SS rer. Germ. us. schol. 42) 739: Insuper fabulas ea de causa, ut plerumque ex eisdem aliquis moralis sensusextrahatur et eciam falsitas veritati famulari cogatur. Diese alles andere als originellen Stellen sind hier nicht wegen der„Poesielegitimation“ (dazu s. auch Johann in Pol. III 7 oben Anm. 809) von Interesse, sondern, weil sie die Begriffe„Herrschaft“ und „Dienst“ als literaturtheoretisch etablierte Kategorien der auctores-Verwendung beleuchten. Das Folgendezeigt eine über die poetische Fiktion hinausgreifende Begründung des philosophischen Umgangs mit geschichtlichenExempla. Die Tradition der auctores oder die „Beispielgeschichte“ dürfen den Benützer nicht versklaven; er soll vielmehr imNamen der Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit Herr über alles Geschriebene sein. Man kann dies als eine Trivialität des„geistlichen Mittelalters“ abtun; besser sähe man m. E. darin eine Spur von dem allgemeineren, durch Aristotelesgrundlegend formulierten Gedanken der Souveränität der Philosophie über alles Faktische, der den höheren Rang der(verallgemeinerungsfähigen) Dichtung gegenüber der am gegebenen Detail haftenden Geschichtsschreibung begründet (vgl.S. 53, 216 ff., 504 ff.; KOSELLECK, Vergangene Zukunft 278 zu Lessing als Aristoteliker).811 Pol. Prol. 15.20 oben Anm. 724.812 Pol. Prol. (I) 15.28 oben Anm. 809 und ebd. 16.4 ff. in Anm. 780.813 Pol. Prol. 16.3 ff. (nach der oben Anm. 809 zitierten Stelle): […] figmenta […] nostrae famulantur instructioni, nonambigo. Haec quoque ipsa, quibus plerumque utor, aliena sunt, nisi quia quicquid ubique bene dictum est, facio meum, etillud nunc meis ad compendium, nunc ad fidem et auctoritatem alienis exprimo verbis. Inhaltlich nahe liegt Macrob, Sat.praef. I 6 (nach Sen. Ep. 84.5): ut etiam si quid apparuerit unde sumptum sit, aliud tamen esse quam unde sumptumnoscatur appareat, was Johann in Pol. VII 10. 133.20 ff. wörtlich zitiert (oben Anm. 743). Andererseits entschuldigt sichMacrob im Gegensatz zu Johann gerade für die Wörtlichkeit der Zitate in praef. 4: nec mihi vitio vertas, si res quas exlectione varia mutuabor ipsis saepe verbis quibus ab ipsis auctoribus enarratae sunt explicabo, quia praesens opus noneloquentiae ostentationem, sed noscendorum congeriem pollicet, et boni consulas oportet, si notitiam vetustatis modonostris non obscure, modo ipsis antiquorum fideliter verbis recognoscas. Dazu vgl. FLAMANT (wie Anm. 509) 172 ff.
405
ist also die vom scriptor gefilterte, zurechtgemachte und dargereichte Literatur: quae hic scribuntur.
Der nächste Satz ist sinnvollerweise die (schon S. 156 f. betrachtete) Stelle über die Unentbehrlichkeitschriftstellerischer Vermittlung für die Kenntnis der nicht mehr direkt (d. h. als lebende Menschen)zugänglichen Exempla.814 Mit dem hier entfalteten Lob literarischer Tradition verweist Johann implizit auchauf deren mögliche Verfälschungen, nicht ohne sich in diesem Punkt durch ironische Selbstbeschuldigung zuentlasten:815 „Ich gebe nach, um nicht streitlustig zu erscheinen, und gestehe, daß ich dienliche Lügenverwendet habe, und, sollte mein Rivale (auch ich habe meinen Cornificius und meinen Lanvinus) mich nichtin Ruhe lassen, so bekenne ich mich sogar selbst der Lüge schuldig, kenne ich doch das Bibelwort: ‚JederMensch ist ein Lügner‘.“ Der unter der Maske des terenzischen „Lanvinus“ (Lavinius)816 verborgeneaemulus wird hierauf mit dem argumentum ad hominem zurückgeschlagen: Er begehe selbst den Fehler, dener rügt: plenam non confert nec integram servat auctoritatem, d. h. er verkürze und entstelle den vollenWortlaut der Zitate.817 Johann bekennt ein zweites Mal sein mendacium, bittet aber den Kritikus (nicht ohnehintergründige Ironie), genau nachzuweisen, was, bzw. wo er lüge; solche Lügenaufdeckung wäre ihm einwillkommener Grund zur Besserung: der Feind, der seinen Irrtum tadle, werde ihm
814 Prol. 16.7 ff. oben Anm. 780 und ebd. 16.13 ff. oben Anm. 370.815 Ebd. 16.17 ff.: Cedo tamen ne videar contentione gaudere, et me officiosis fateor usum esse mendaciis, et si aliteraemulus non quiescit, – quoniam et ego meum Cornificium habeo et Lanvinum – me mendacii reum esse consentio, quiscriptum novi, quia omnis homo mendax (Ps. 115.11). Zu officiosa mendacia s. oben Anm. 572 (Aug. Ep. 28.3.3).816 Zu Luscius Lavinius (auch Lanvinus oder Lanuvinus) vgl. Hier. Apol. adv. Rufin. 30; Aul. Gell. N.A. XV 24: einetypische Personifikation der Terenz-Prologe (s. unten S. 410 ff.).817 Pol. Prol. 16.25–28.
406
zum Freund.818 Er gibt auch zu, daß die historischen strategemmata und die philosophischen dicta oft einenunauthentischen Eindruck machen, weil die einen von den verschiedenen historici verschieden überliefert, dieanderen nach dem Muster „akademischer“ Skepsis auf ihre Wahrscheinlichkeit hin diskutiert und nichtapodiktisch „kühn“ entschieden werden können.819
Abschließend kommt Johann nochmals auf den Hauptpunkt der Anklage zurück:820 „Sollte jemand mitLanvinus die unbekannten oder erfundenen Autoren beschimpfen, so möge er wählen, ob er lieber den vonPlato ins Leben Zurückgerufenen [den Pamphylier Er]; einen Scipio Africanus, wie er Cicero im Traumerschien, und die Saturnalien feiernden Philosophen [des Macrob] anklagen oder aber diese, wie unsereeigenen Fiktionen, sofern sie dem Gemeinwohl dienen, verzeihen wolle.“ Die aprokryphen (ignotos) underdichteten (fictos) Autoren folgen dem literarischen Konzept des argumentum.821 Sie entstammenberühmtesten erfundenen Gesprächen mit historischen
818 Ebd. 16.28 ff.: Procedat tamen et publicet, arguat meum ratione vel auctoritate mendacium, et ego vel ad inimici vocemnon refugiam emendari; immo et amicum ducam, qui meum castigabit errorem.819 Ebd. 17.2 ff.: Si tamen alicubi auctorum aliter quam scripserim inveniatur, non ideo constabit me esse mentitum, cum instrategemmaticis historicos, qui frequenter ab invicem dissident, sim secutus, et in philosophicis academice disputans prorationis modulo qua occurebant probabilia sectatus sim. Nec Academicorum erubesco professionem, qui in his quae suntdubitabilia sapienti, ab eorum uestigiis non recedo. Licet enim secta haec tenebras rebus omnibus videatur inducere, nullaveritati examinandae fidelior et, auctore Cicerone qui ad eam in senectute divertit, nulla profectui familiarior est. In hisergo quae incidenter de providentia et fato et libertate arbitrii et similibus dicta sunt, me Academicum potius esse noveris,quam eorum quae dubia sunt temerarium assertorem. Zu Cicero academicus s. S. 297 f.; zu strategemmatica und historicidissidentes vgl. §§ 57, 73; zur Bedeutung der Fiktion für den „methodischen Zweifel“ vgl. oben §§ 63, 67 f.820 Pol. Prol. 17.30 ff.: Si quis ignotos auctores cum Lanvino calumniatur aut fictos, redivivum Platonis, AffricanumCiceroni sompniantem, et philosophos Saturnalia exercentes accuset, aut auctorum nostrisque figmentis indulgeat, sipublicae, serviunt utilitati. Das zweimal gebrauchte Wort auctores bezieht sich im ersten Fall auf die Fiktionsobjekte, imzweiten auf die fingierenden Subjekte. Die Beispiele entstammen Macrobs Sat.-Prolog: s. unten Anm. 822; vgl. auch Val.Max. VIII 12: Eris Pamphyli casus quem Plato scribit revixisses. Die philosophi Flavianus, Praetextatus, Evangelus u. a.erscheinen auch in Pol. VIII 6, (II) 254.7, 28 f.; 256.12; VIII 12, 307.2; 309.9. Vgl. SCHAARSCHMIDT 91 und obenS. 174 f. (Autoren-und Figurensprache).821 Vgl. S. 60 f., 213 ff., 231, 410 ff. Die genera narrationum: historia, fabula, argumentum sind erwähnt in Met. I 24,54.20 f., s. oben Anm. 668. – Außer der bereits erwähnten Literatur zum argumentum vgl. noch KLOPSCH (wie Anm. 706)58, 118; BRINKMANN, Hermeneutik (wie Anm. 145) 102 f., 163 ff.; LAUSBERG §§ 411 (Rhet. Her. 1.8.13); § 414(Bezug zur Parabel); § 398 (locus a fictione); §§ 1117 ff. (sermocinatio); E. de BRUYNE, Etudes d’esthétique médiévale,Brügge 1946, I 96 ff.; KNAPP, Similitudo 78 f. (Priszian); BATTAGLIA 458 ff. (Quint.); DAVID, Maiorum exempla (wieAnm. 149) 68 ff., 75 (Cic. zu Prosopopiie und Ethopoiie); GEBIEN 66 f. und LEEMAN 253 (beide zu historiae alsExempla mit argumentum-Charakter in Ciceros berühmter Stelle Brut. 42: Concessum est rhetoribus ementiri in historiis utaliquid dicere possint argutius; zu argutius s. S. 411 f.); O. HILTBRUNNER, Volteius Mena, in: Gymnas. 67 (1960)289–300 (Horaz erfindet im Rahmen des historisch Möglichen); STRASBURGER (wie Anm. 668) 80 ff. (Einfluß deraristotelischen Mimesistheorie auf das historiographische argumentum im Sinne romanhafter Dramatisierung);KLEINSCHMIDT 79 ff.; FRIEDRICH 25 f.; DELHAYE, Le dossier (wie Anm. 385) 79 ff. (Walter Maps Fiktionen).
407
Dialogteilnehmern: den platonischen Dialogen, dem Somnium Scipionis und den Saturnalia (in derenVorrede Macrob überdies die Argumente zugunsten solcher literarischer Einkleidungen bereitstellte).822 Damitspricht Johann diskret, aber unmißverständlich die eigene Absicht aus, ebenfalls
822 Macrob, Sat. I 1, 4–5 sieht seine disputierenden Philosophen als Imitatio der Ciceronischen Dialogfiguren: Cottae,Laelii, Scipiones […] quoad Romanae litterae erunt, in veterum libris disputabunt, und entschuldigt seine Fiktionen damit,daß auch Platos Dialoge Paramenides, Timaios und Sokrates, quo constant eodem saeculo non fuisse, wie Zeitgenossenmiteinander reden lassen, also Diachrones synchron behandeln (vgl. FLAMANT [wie Anm. 509] 159, 178 ff.). Die FiktionCiceros erläutert er ausführlich als argumentum (bzw., in seiner eigenen Terminologie, als narratio fabulosa) zu Beginnseines Kommentars zum Somnium Scipionis. Vgl. OLSON (wie 280) 29 f.; DRONKE, Fabula (wie Anm. 729) 14 ff. u.passim; BRINKMANN, Figurensprache (wie Anm. 411); Hermeneutik (wie Anm. 145) 169 ff.; vgl. S. 174. Zu anderenMacrob-Reminiszenzen im Prolog s. S. 402, 404 f. Die „quaestio“ der Relation von Wahrheit und Fabel wird in I 1.8–9mit dem in Platos Staat (614b) erwähnten Beispiel des pamphylischen Kriegers Er eröffnet, der von den Toten zurückgekehrtsein und vom Jenseits berichtet haben soll. Cicero hätte eine philosophisch wahre narratio dieser leicht als „Fabel“, d. h.Lüge für Ungebildete, mißzuverstehenden „Wiederbelebung“ vorgezogen. Entsprechend sei sein Traum Scipios eineglaubwürdige Wahrheitseinkleidung. Dennoch habe der epikureische Schwätzer Colotes mit rigoristischemWahrheitsanspruch sowohl Platos Er als auch Ciceros Scipio unterschiedslos als Fiktionen verspottet (Johanns Wortanleihenstammen vor allem aus diesem Passus; vgl. I 2.3–5): illam calumniam persequemur, quae […] manebit Ciceroni cumPlatone communis; ait a philosopho fabulam non oportuisse confingi, quoniam nullum figmenti genus veri professoribusconveniret […] haec quoniam, dum de Platonico Ere iactantur etiam quietem Africani nostri somiantis accusant – utraqueenim sub adposito argumento electa persona est quae accomoda enuntiantis haberetur […] Nec omnibus fabulisphilosophia repugnat, nec omnibus acquiescit (vgl. Pol., Prol. 17.30–18.2 oben in Anm. 820). „Lanvinus“ entspricht somitsinngemäß eher dem Colotes Macrobs als dem Lavinius des Terenz; immerhin weist die Wahl des letzteren auf die Gattungdes Pol. (s. S. 410). Denn Macrob verwirft in seiner Cicero-Apologie gerade jene Autoren der „menandrischen“Gattungsmischung zwischen Komödie, Satire und Roman (oder des „milesischen“ Fabeltyps; wie Petronius und Apuleius),die für Johanns moralische Gesellschaftskritik wichtig waren (§ 106, S. 221, S. 410), als hoc totum fabularum genus quodsolas aurium delicias profitetur (Somn. Scip. I 2.8), d. h. als bloße Unterhaltung und extremen Gegensatz derernstzunehmenden Fiktionsart philosophischer narratio fabulosa. Vgl. auch S. 403 und WALSH (wie Anm. 506) 3, 7 ff. –Zu Johanns (wohl von seinem Lehrer Wilhelm von Conches übernommenen) Macrob-Begeisterung im Rahmen einesallgemein erwachenden Interesses an den Vermittlern des platonischen Gedankenguts, dessen Bedeutung auch aus denaufwendigen geistlichen Kritiken an modischer Macrob-Rezeption (Manegold von Lautenbach, Rupert von Deutz u. a.) zuermessen ist, vgl. zusammenfassend: LUSCOMBE, in: The World of John of S. 23 und im einzelnen vor allem:JEAUNEAU, Lectio 265–308, bes. 277 ff., 299 f.; ders., Guillaume de Conches, Glosae super Platonem, Paris 1965, 10 ff.;T. GREGORY, Anima mundi: La filosofia di Guglielmo di Conches e la Scuola di Chartres, Florenz 1955; REYNOLDS(wie Anm. 299) 234; HARTMANN, Manegold (wie Anm. 559) 18 ff.; SCHEDLER (wie Anm. 616) 135 ff.; H.SILVESTRE, Note sur la survie de Macrobe au m. â., in: CM 24 (1963) 170–80; R. CRESPO, Da Macrobio al ‚Novellino’,in StM 18.1 (1977) 227–30; R. BERNABEI, The Treatment of Sources in Macrobius’ Saturnalia and the Influence of theSaturnalia During the Middle Ages, Ithaca, Cornell Univ. 1970; DUTTON (wie Anm. 578a) 110 f.; HELBLING-GLOOR(wie Anm. 26) 77 ff. (Traumdeutung); T. HUNT, Chrestien and Macrobius, in: CM 33 (1981/2) 211–27; Helen E.RODNIK, The Doctrine of the Trinity in Guillaume de Conches’ Gloses on Macrobius, … Diss. Columbia 1972 sowieunten §§ 94 f., 98, S. 375, 402, 470, 574, 579.
408
auctores zum Zweck literarischer Verdeutlichung gemeinnütziger Wahrheiten zu konstruieren. Alsvorbildliche „Autoren“ werden dabei die fingierten Gestalten, nicht aber die fingierenden Schriftstellerbezeichnet (was im übrigen für den Fiktionscharakter der Institutio Traiani des Ps-Plutarch von Bedeutungist).823 Auctor bedeutet im Zusammenhang mit der hier gleichfalls gelobten Demutshaltung der „Akademiker“soviel wie „Gewährsmann“, „Schirmherr“, ja „Verstärker“ eigener schwacher Lehre. Der Begriff steht aberauch in einem für Johann charakteristischen, moralisch unbedenklichen Sinn für Pseudonym, Maske, Rolle,Persona, Mystifikation u. dgl. Die Verwendung einer fictio auctoris oder „Autor-Ethopoeie“ ist nach einervergleichbaren, dem Robert Grosseteste zugeschriebenen Aussage ein eminentes Bescheidenheitszeugnis:824
„Plato war in seiner Lebensführung klug und
823 Vgl. LIEBESCHÜTZ 25: „He warned his readers at the end of the first prologue that something of the kind [sc. einepseudoplutarchische Fiktion] was to be expected.“ Vgl. unten Anm. 922.824 Ps-Robert Grosseteste, Summa philosophiae, I 3 ed. BAUER (wie Anm. 492) 278: De duobus famosissimis Graecorumphilosophis Platone videlicet et Aristotele eorumque conditionibus quibusdam: […] Verissimum est Platonem in agendishumanis doctissimum fuisse eloquioque comptissimum, arrogantiaeque – quemadmodum et Valerius Maximus breviter‚compositus Plato de compositione misit exemplo’ notavit – abstinentissimum, ideoque et materias, quas tractare delegitsub nomine potius alieno stilo mandasse. At contra Aristotelem contradictionis insectandique improbitas arrogantissimumvideri fecit, stilique incompositio, exquisita investigatio invidum reddidit, nec magnipendenda ingenii magnitudo, cumsapientiam priorum potius videretur invidiose reprobasse, aut tanquam sibi auctore appropriasse. Vgl. dazu M.GRABMANN, Mal. Geistesleben II, München 1936, 79 f. – Zu Plato vgl. oben Anm. 582 (princeps philosophorum),Anm. 806 (platonischer Dialog im MA), Anm. 705: Montaignes ähnliches Plato-Lob in ‚Essai’ II 12, das STIERLE,Gespräch (wie Anm. 546) 313 als besonders originelle Überwindung des „diskurshaft“-undialogischen Mittelaltersinterpretiert; GARFAGNINI … (wie Anm. 806) 236: eine Florilegstelle (Titelgebung durch Namen seiner „Lehrer“ sei einMittel, um mehr Geltung zu gewinnen); Platos stilistische Qualitäten werden in Pol. VII 5, (II) 106 nach Apuleius, Dedogm. Plat. I 2 ff. und Val. Max. VIII Ext. 3 sowie Aug. Civ. VIII 11 gerühmt. – Zu Aristoteles vgl. auch Johanns Kritikan dessen Ruhmsucht und Rechthaberei in Enth. v. 881 ff., 136; Pol. VIII 5, (II) 247 unten in Anm. 950. Vgl. auch Radulfvon Longchamp (wie Anm. 508) 128 f. zu Alans Anticlaud. III 113–4: Porphyrius habe als alter Oedipodes die Rätsel derSphinx, d. h. des dunklen Aristoteles gelöst, der siquidem superbus fuit et invidus, unde obscure locutus est. (Es gab mithinbereits vor den Humanisten, in der Zeit scholastischer Hochblüte eine Kritik an einem bestimmten, durch Aristotelesgeprägten „technischen“ Wissenschaftsjargon der Philosophie.)
409
weise, in seiner Rede gefällig und anziehend, aller Überheblichkeit durchaus abhold; daher hat er seinephilosophischen Abhandlungen lieber anderen in den Mund gelegt. Aristoteles dagegen fiel durch seine Sucht,anderen zu widersprechen und sie zu bekämpfen, als überaus anmaßender Mensch auf; seine stilistischeUngepflegtheit und sein erlesener Tiefsinn machten ihn unzugänglich und abweisend. Seine Geistesgröße solltenicht überschätzt werden, da er die Weisheit seiner Vorgänger entweder aus Neid verwarf oder sich soaneignete, daß er sie als eigene Weisheit ausgeben konnte.“ Die dieser Synkrisis zugrundeliegenden Kriterienintellektueller Moral: Vorrang der mitzuteilenden Sache vor der mitteilenden Person, Förderung des Lesersstatt eitler Selbstdarstellung des Autors, gehören im übrigen seit der Blütezeit apokrypher Apostelbriefe zuden wichtigsten Legitimationsmotiven christlicher Pseudepigraphie.824a
824a Vgl. Alfred E. HAEFNER, Eine einzigartige Quelle für die Erforschung der antiken Pseudonymität (1934), in: N. BROX(Hrsg.), Pseudepigraphie in der heidnischen und jüdisch-christlichen Antike, (WdF 484), Darmstadt 1977, 154–62; Wolfg.SPEYER, Die literarische Fälschung im heidnischen und christl. Altertum (Hb. d. Altertumswiss. I 2), München 1971, 31zu Salvian, Ep. 9 (MG AA I) 116–9, wo sich der Kirchenvater rechtfertigt, einen Pseudo-Timotheus-Brief verfaßt zu haben,damit die Geringfügigkeit seiner Person der Bedeutung der Sache nicht schade.
410
In eine andere Richtung führt die Frage, warum Johann gerade „Lanvinus“ (Lavinius), den Rivalen desTerenz, zum Pseudonym für die Kritiker der auctores-Fiktion gewählt hat.825 Terenz ist zweifellos nachHieronymus, dem Meister der Invektive, aber noch vor den römischen Satirikern, wichtigstes Gattungsmusterfür die zeit- und hofkritische Thematik des Policraticus. Johann nennt ihn Terentius noster,826 lobt seineFähigkeit, die bunte gesellschaftliche Realität mit all ihren Lastern so abzubilden, daß ein jeder getroffen unddoch niemand persönlich verletzt werde, und betont programmatisch:827 „Angenehm und passend ist derKomödiendichter; er soll bei unserem Thema der Eitelkeiten häufig ein Wort mitzureden haben“. Diequellengeschichtliche Bedeutung der Komödien des Terenz für den Policraticus ist bekannt; aus ihnenstammen vor allem viele jener Deck- und Spitznamen, unter denen Johann typische Verhaltensweisen seinerZeitgenossen verspottet (Gnatho, Thraso, Parmenio, Thais usw.).828 Im übrigen ist ihm „Komödie“grundsätzlich ein Schlüsselbegriff: formal für die mimetische Funktion des Sittengemäldes oder Sittenspiegelsund für die Absicht, durch Scherz den Ernst, durch delectatio die moralische utilitas zu fördern (wobei Johannoffenbar Komödie und Satire nicht unterscheidet);829 inhaltlich für die ganze kritische Seite des Policraticus,ein Hauptbild für die curia als lächerliches Possenspiel und letztlich für „die Welt“ als nichtiges Theater.830
Wenn er nun im Prolog die Erfindung von exemplarischen auctores im Namen der Wahrscheinlichkeit unddes öffentlichen Nutzens gegen die Kritik eines fiktiven Gegenspielers Lanvinus verteidigt, so dürfte er mitdieser aemulus-Figur mehrerer Terenzprologe – ein nörgelnder „alter Dichter“, der die Übernahme frühererKomödienstoffe als Diebstahl tadelt831 – auch einen subtilen Hinweis auf die in der rhetorischen Theorietraditionelle Beziehung von argumentum und Komödie geben. Spätestens seit der Rhetorica ad Herenniumhat sich für die drei Realismusgrade fabula, historia, argumentum die Zuweisung zu den drei Gattungen:Tragödie, Historiographie und Komödie
825 Vgl. oben Anm. 815, 820.826 Pol. I 8, (I) 46.14.827 Pol. VIII 1, (II) 228 s. unten Anm. 834 zur Satiretheorie. Pol. III 4, (I) 179, 23 f.: Iocundus est enim comicus et aptusqui se nugis nostris frequenter inmisceat. Pol. III 3, 177: Terentiano siquidem verbo libentius utor …828 Vgl. KERNER 162 ff. und den Index locorum bei WEBB s. l. – Decknamen: Vgl. oben S. 290, 305, 414 f., 509 f.829 Vgl. S. 177 ff., 330 f., 386 f., 552 f., 602. Pol. VIII 11, II 301.14 ff. zu Petron. in Anm. 509 zitiert. Zu den sowohl aufdie Komödie wie auf die Satire passenden Begriffen des Sittengemäldes vgl. SUCHOMSKI 86 ff. (Terenzrezeption) und diein Anm. 574 erwähnten Beiträge.830 Siehe unten § 106.831 Vgl. Ter. Andr. Prol. 5 ff., 18 ff.; Adelph. Prol. 10 ff.
411
eingebürgert. Die meist zitierte auctoritas zu argumentum, das ein Mittleres zwischen reiner Erdichtung undbloßem Faktenbericht darstellt,832 lautet: „Argumentum ist eine erfundene Sache, die dennoch geschehenkonnte, wie die argumenta der Komödien“. Im Verständnis des 12. Jahrhunderts erlaubte dieser argumentum-Begriff vielfältige (hier nicht näher zu untersuchende) Assoziationen zwischen den Bedeutungen:„Handlungsablauf, Intrige, Inhalt eines Stücks“, dem terminus technicus für das „Mögliche“ in deraristotelischen Unterscheidung von Poesie und Geschichte aufgrund philosophischer Generalisierbarkeit sowieder topischen Argumentationsart in der Unterscheidung von wahren und wahrscheinlichen Beweisen.833
Johann dürfte sich an anderer Stelle, wiederum einem Terenz-Lob, mittelbar auf die Mimesis-Theorie (der inseiner Zeit unbekannten aristotelischen Poetik) beziehen.834 „Im Eunuch hat der Komödiendichter dieLebensweisen beinahe
832 Vgl. oben Anm. 147 (Rhet. Her. I 8.13, Quint. II 4.2 u. a.)833 Vgl. oben Anm. 125, 492 f. – „Realismusgrad“ ist als rezeptionsästhetisch orientierter Begriff adäquater als„Realitätsgrad“. Die Kategorie der narrationum genera sind nicht historiographisch, sondern wesentlich rhetorisch gemeint.Vgl. oben Anm. 522, 492 f. Wo Johann auf eine diesen Formen zugrundeliegende materia Bezug nimmt, meint er nicht„außerliterarische Realität“, sondern allgemein: Thema, Inhalt, Gegenstand einer Komposition, und spezifisch: die wahreLehre, den moralischen Nutzen einer Darstellung. Aus der Beschreibung der Unterrichtsmethoden Bernhards von Chartres inMet. I 24, 54 f. (oben Anm. 668) geht hervor, daß die rohstoffliche Einheit aller Textsorten (oder auctores), gleichviel obhistoria, argumentum oder fabula betreffend, in kluger, sowohl rhetorisch wirksamer wie moralisch lehrreicher Weise einemSelektions- und Transformationsprozeß von der unteren Stufe der praelectio bis zur höheren imitatio (s. S. 254 f.)unterworfen werden soll. Vgl. auch oben Anm. 797 und WETHERBEE (wie Anm. 394) 24 f.834 Pol. VIII 1, (II) 228.7 ff.: Comici forte contempnis Eunuchum, sed in Eunucho fere omnium vitam expressit. Et eoquidem elegantius omnes arguit quo cautius fictitio argumento sine lesione personarum vitia denudavit. Vgl. auch dieähnlichen Stellen im Prol. (I) 15.1 ff. unten Anm. 1051 und in Pol. III 7 (I) 189 unten Anm. 986. Arguere und argumentumverweisen hier (möglicherweise unbeabsichtigt) auf jene merkwürdige Bedeutungsnuance, die Isidors „Etymologie“ vonargumentum aus dictum argutum verbreitete; s. oben Anm. 608: Et. VI 8.16; vgl. auch Et. X 6: argutus quia argumentumcito invenit loquendo (hier wird also argutus umgekehrt von argumentum abgeleitet) und Et. XVIII 15.5: argumentum […]sola investigatione invenit veritatem; unde et dictum argumentum, id est argutum inventum (wobei es sich nicht um dasgenus narrationis, sondern um eine Beweisart handelt; vgl. WEIMAR, Argumenta [wie Anm. 566] 96). Vielleicht hatte dieCicero-Stelle über das „Lügen“ der Redner in historiis, ut aliquid dicere possint argutius (oben Anm. 821) einen Einfluß aufIsidors Ableitungen. Die argumentum-argutum-arguere-Beziehung erinnert jedenfalls an den speziellen durchstrategemmaticum wiedergegebenen Exemplum-Begriff des Policraticus (siehe oben § 73). In dieser Hinsicht vgl. auchPol. III 4, (I) 181: Sic et in comediis servorum calliditate domini deluduntur (zu calliditas vgl. Anm. 603, 610). – ZurKomödie als Lebensspiegel nach Aristoteles s. WASZINK (wie Anm. 125) 197 f. und oben Anm. 571 (auch zumUnterschied von Komödie und Tragödie aufgrund der repräsentativen oder persönlichen Art der Namengebung); zurdeklamatorischen Schultradition der Terenz-Komödien als „Lebensexempla“ bis hinauf in das barocke Schülertheater s.JENS, Rhet. (wie Anm. 530) 441 f.
412
aller Menschen wiedergegeben. Umso feinsinniger hat er alle kritisch charakterisiert (arguit), als er die Lasterin erdichteter Handlung (fictitio argumento) ohne Verletzung der Personen bloßgestellt hat.“ – DerPolicraticus-Prolog läßt sich somit als eine Rechtfertigung literarisch-rhetorischer Fiktion verstehen, sowohlim Sinne der sermocinatio (Ethopoeie), mit der ein Redner einer erfundenen Person, einem Autor oder einemHelden seine eigenen Worte in den Mund legt, als auch im narrativen Sinne des argumentum, derrealitätsgerechten Erfindung einer passenden, charakteristischen Geschichte. Beide Male steht ein Name ausdem Literaturkanon stellvertretend, zeichenhaft für einen nicht im eigenem Namen aussprechbarenGedanken, sei es positiv als Autorname zur Absicherung und Verstärkung der eigenen schwachen Meinung, seies negativ als Pseudonym zur Tarnung gefährlicher Zeitkritik.
h) Unphilologischer Humanismus: Exempla zwischen Kompilatorik und Topik
Johann von Salisbury: der Spitzenhumanist des 12. Jahrhunderts? (§ 89). Die Topik als Schlüssel zu seinem Traditions-Verständnis: konsensstiftende auctores und Exempla (§ 90). Exemplum und Topos: der formale locus ab exemplo (§ 91); dermateriale Topos als Rahmen einer Exempla-„Füllung“ (§ 92) oder als Vergleichsfall und Problembeispiel (§ 93).
89. Aus der bisherigen Analyse des Prologs dürfte klargeworden sein, daß Johann sich im Geiste Macrobs zueiner literarischen Quellenbenützung bekennt, die dem modernen Philologen schon an sich „gegen den Strich“gehen muß. Deren Bedenklichkeit konstatiert denn auch die neueste Policraticus-Forschung mit immerminutiöseren und triftigeren Argumenten. Johann geht in der Tat mit seinen Autoren sehr lässig um, scheutvor Pseudepigraphien nicht zurück, zitiert weitgehend aus zweiter Hand, aus Epitomai und Florilegien (auchwenn er dabei Originaltexte nennt), ändert unbekümmert Wortlaut und Sinn vieler Zitate, ja, läßt siegelegentlich sogar das Gegenteil der Autorintention sagen (wobei zuzugestehen ist, daß raffinierte undgeistreiche Verdrehungen dieser Art ohne ein ausgezeichnetes Verständnis der Klassikertexte schwerlichgelungen wären). Da er nicht behauptet, er habe seinen denkwürdigen dicta und facta ein philologisch-historisches Interesse entgegenbringen wollen, sondern sogar ausdrücklich die entgegengesetzte Absicht
413
kundtut, hätte der Nachweis seiner philologischen Verstöße und Ungebührlichkeiten als Schulfuchserei ad actagelegt werden können. Dem ist jedoch aus wissenschaftsgeschichtlichen Gründen nicht so: Johann vonSalisbury galt seit dem 19. Jahrhundert in der gelehrten opinio communis (und gilt in Handbüchern nochheute) als eine Art Idealnorm für die überhaupt möglichen Kenntnisse des klassischen Altertums imMittelalter. Die eigentliche Spezialforschung zu Johann von Salisbury hat einer solchen Überschätzung vonAnfang an immer wieder (in letzter Zeit besonders intensiv) entgegenzuwirken versucht, ohne sich, wie esscheint, im allgemeinen Bildungsbewußtsein ganz durchgesetzt zu haben. Darum ist ein adäquates Bild derhumanistischen Einstellung Johanns für das generelle Verständnis mittelalterlicher Rezeption antiker Textekeineswegs unwichtig. Angesichts der Masse von aus zweiter Hand stammender antiker Reminiszenzen in denTexten Johanns beruft sich Schaarschmidt 1862835 auf das schon angeführte Urteil des Justus Lipsius undspricht von „Citaten, die oft in einer Weise von Johann eingestreut werden, als ob er die Werke vor sichgehabt habe, aus denen sie ursprünglich stammen […]. Sie kommen zum allergrößten Theile nachweislich ausabgeleiteter Quelle, d. h. aus andern Schriftstellern her, welche sie wieder als Anführungen enthalten.“Überdies bemängelt er, daß „[…] unser Saresberiensis sich bei seinem Citieren keineswegs immer an die ihmvorliegenden Texte gehalten hat, sondern eine seinen Zwecken dienende Umformung oft genug mit ihnenvornimmt.“ Diese und ähnliche Feststellungen gehören in den Kontext eines seltsamen Gelehrtenstreits im19. Jahrhundert, durch den Johann als Humanist überhaupt erst berühmt geworden ist. Diese Kontroversewurde von einigen eifrigen Altphilologen entfacht, die in seinen Zitaten alle möglichen Fragmente antikerAutoren aufzuspüren meinten.836
835 SCHAARSCHMIDT 86 f. (nach dem oben Anm. 33 angeführten Zitat), vgl. auch ebd. 103 ff. Dies ist allein in Bezugauf Johann von Salisbury erwähnenswert, dem dieser allgemein als typisch mittelalterlich geltende Zitierhabitusabgesprochen zu werden pflegt. Dazu vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 116 ff.836 Vgl. Kritik bei KERNER 36 f. zu Cic. De republica; dazu auch P. LEHMANN, Nachrichten und Gerüchte von derÜberlieferung der libri sex Ciceronis de re publica, in: ders., Erforschung des MAs IV, Stuttgart 1961, 96–106; EberhardHECK, Die Bezeugung von Ciceros Schrift De re publica (Spudasmata 4) Hildesheim 1966, 246 ff.; M. Tulli Ciceronis, Dedivinatione, ed. A.S. PEASE, Urbana 1920–3/Darmstadt 1963; 34 f.; R.H./M.A. ROUSE, The Medieval Circulation ofCicero’s Posterior Academics and the De Finibus Bonorum et Malorum, in: Festschr. N.R. KER, Medieval Scribes,Manuscripts and Libraries, ed. M.B. PARKES/A.Q. WATSON, London 1978, 351 f.; P. LEHMANN, Pseudoantike Lit.(wie Anm. 509) 25 ff.; MEERSSEMANN, Seneca (wie Anm. 405) 58 ff. und REYNOLDS (wie Anm. 299) 329 zum Ps.-Caecilius Balbus (einem aus Seneca und Publilius Syrus zusammengeschriebenen karolingischen Florileg); oben Anm. 509und unten Anm. 922 (zu Ps.-Flavian und Ps.-Plutarch); zusammenfassend (auch zu weiteren „Fehlanzeigen“) s. R.THOMSON, John of Salisbury and William of Malmesbury, in: The World of John of S. 117–125, hier 117.
414
Jünger ist die in den meisten Handbüchern und Gesamtdarstellungen des 12. Jahrhunderts anzutreffendeVorstellung vom seiner Zeit weit voraneilenden Humanisten, der Handschriften klassischer Originalwerke(wie einst Lupus von Ferrières und dann die Renaissance-Philologen) gesammelt, gelesen und verbreitet, derbis zu sonst im Mittelalter ganz unbekannten Autoren, den gesamten damals überhaupt erreichbaren Bestandder römischen Literatur – und zwar „zweckfrei, um seiner selbst willen“ – studiert haben soll.837
Wahrscheinlich hat sich dieses Klischee – nach einem in den Geisteswissenschaften
837 Vgl. etwa Rich. NEWALD, Nachleben des antiken Geistes, Tübingen 1960, 240; NORDEN, Kunstprosa II 715 f.;WADDELL (wie Anm. 45). XII, XXII; SMALLEY, Friars 45; E.K. RAND, Founders of the Middle Ages, NY 1928/1957,102 f.; Ch. H. HASKINS, The Renaissance of the 12th Century (Harvard 1927), Cleveland-NY 1957, 101: „To him theclassics were not a mere training for theology, they were worthy of study for their own sake and for moral profit“. K.BURDACH, Reformation, Renaissance, Humanismus, Berlin/Leipzig2 1926, 127. – Ein gutes Beispiel für dieSelbstverständlichkeit dieser Annahme nennt P.S. BOSKOFF, Quintilian in the Late Middle Ages, in: Spec. 27 (1952)71–78, hier 72 im Zusammenhang mit ihrem Nachweis, daß Johann Quintilian nur unvollständig aus Florilegien undExzerpten kannte: Ch. BALDWIN (Med. Rhetoric and Poetic, NY 1928, 171) habe dagegen das „Argument“ vertreten, „thatJohn was a ‚careful scholar’ and would naturally read the whole work“. Johann wird gelegentlich auch zum Gradmessermittelalterlicher Klassikerkenntnis erhoben: Was er nicht kannte, war demnach auch sonst unbekannt. So etwa W.CLOETTA, Beiträge zur Literaturgesch. des Mittelalters und der Ren., Halle 1890, I 14 (vgl. E. PARATORE, Tradizione estruttura in Dante, Florenz 1968, 343) zu Plautus. – Zu den Renaissance-Philologen s. S. 529 ff., S. 537 ff.: Dieherkömmliche Einschätzung Johanns als Quellenphilologe wirkt in abgeschwächter Form noch in KERNERS „Argument“zugunsten der tatsächlichen Benützung eines spätantiken Ps.-Plutarch-Textes, der Institutio Traiani, im Policraticus (s.A. 922) nach, daß Johann in seiner so gelehrten Umgebung in Canterbury andernfalls als „Fälscher“ durchschaut wordenwäre. (LUSCOMBE bemerkt in seiner Einleitung zu ‚The World of John of S’. hierzu spöttisch [33]: „Such a faith inCanterbury as a place where forgery could not flourish is touching and rarely found“.) – Trotz meiner Absicht, unnötigeGrenzen zwischen Mittelalter und Renaissance zu beseitigen, möchte ich betonen, daß Johann das eigentliche humanistischead fontes-Prinzip, wenn überhaupt, so nur in einem durchaus „zweckhaft“ auf die doctrina gerichteten Sinn gekannt hat. Vgl.auch GILMORE (wie Anm. 214) 16 ff.; MARTIN, in: The World of John of S. 182 ff. 191 zu den freien, nicht denursprünglichen Text herstellenden, sondern besserer Lesbarkeit dienenden Textemendationen Johanns. Nicht weil ihmbestimmte Autoren als solche besonders verehrungswürdig waren, sondern weil die authentische Lehre großer Denker (wieAristoteles, Dionysius Areopagita oder Nemesius von Emesa) als wiederherstellungsbedürftig erschien, interessierte er sichfür Textkritik und Übersetzungen (genauer: für zuverlässige Übersetzer; s. A. 442, 544, 564, 598). Die den späterenHumanisten wichtigen Klassikertexte liebte er zweifellos, aber weniger auf philologisch-humanistische als auf rhetorisch-utilitaristische Art, soweit sie thematisch seinen Zwecken dienten. Dies gilt auch von seinem Interesse an wenig bekanntenExempla-Exzerpten von Frontinus, Gellius, Petronius u. a., das nicht als antiquarische Sammlerleidenschaft oder Suche nachverlorenen „Quellen“ der Antike zu verstehen ist, obwohl es (etwa hinsichtlich Petronius) zu einemüberlieferungsgeschichtlich beachtenswerten Ergebnis führte (vgl. S. 220 f., 509 f., 416 ff., Anm. 846).
415
nicht unbeliebten Verfahren – dadurch herausgebildet, daß Johanns eigene Behauptungen und theoretischenStellungnahmen ungeprüft übernommen und auf seine literarische Praxis zurückprojiziert wurden: so etwaseine Verteidigung des auctores-Studiums gegen dialektische und lesefaule Cornificiani; sein nicht zuübersehendes Zurschaustellen literarischer Kenntnisse in bildungspolitischer Absicht oder gewisse Aussagen,die ihn als einen der ersten Zeugen für den Begriff des geistigen Eigentums ausweisen.838
Schon Liebeschütz ist demgegenüber bei seiner intensiven Beschäftigung mit Johanns Werk zurgrundsätzlichen Korrektur jener Übertreibung gelangt, die aus dem zweifellos ungewöhnlich belesenenHumanisten so etwas wie einen klassizistischen Spitzenrepräsentanten der „Renaissance des 12. Jahrhunderts“gemacht hat. Auch er verwies auf die lässige (indirekte und entstellende) Zitierweise Johanns.839 Mag er demim Mittelalter möglichen Geschichtsbegriff aus historistischer Befangenheit vielleicht nicht immer das nötigeVerständnis entgegengebracht haben, so bleibt doch seine Bemerkung zum Verhältnis von quantitativem undqualitativem Humanismus höchst berechtigt:840 „Ailred, dessen Kenntnis der lateinischen Klassiker unendlichbeschränkter war, hat offensichtlich intimere Beziehungen zu seinen Lesefrüchten und seinen alltäglichenErfahrungen herstellen können.“ Damit wird Johann – wertfrei ausgedrückt – Kenntnisbreite undSouveränität im Umfang mit den auctores attestiert und doch das höchste Prädikat, das ein
838 Vgl. S. 393 ff., 420 f.839 Vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 68, 70, 94; ders., John of Salisbury and Pseudo-Plutarch, in: JWCI 6 (1943), 33–39,hier 37; ders., Englische und europäische Elemente in der Erfahrungswelt des Johannes von S., in: Die Welt als Geschichte11 (1951) 38–45, hier 38.840 Vgl. oben S. 346, 349, 355, 365 f. zum Geschichtsbegriff; Zitat: Das zwölfte Jh. (wie Anm. 28) 267.
416
echter Humanist verdienen kann, abgesprochen. Ähnlich sagt Chr. Brooke,841 Heloise und Abaelard hättenbei geringerer Kenntnis tieferes Verständnis der Antike entwickelt als Johann, allein schon deshalb, weil diesereher bei Macrob und Martianus Capella zuhause war als bei Cicero und Juvenal: „Er war der gelehrtesteAltphilologe seiner Zeit, aber – im weitesten Sinne des Wortes – wohl nicht der größte Humanist.“
Inzwischen erscheint nun auch der erste Teil dieses Urteils als eine kleinere Übertreibung. Janet Martin hat ineiner groß angelegten (bisher leider nur in verstreuten Aufsätzen veröffentlichten) Monographie842 dasgesamte Reminiszenzen- und Zitatmaterial im Werke Johanns überlieferungsgeschichtlich nach derRelaisfunktion der benützten Florilegien, Kompendien, Sammelhandschriften untersucht. Sie ist zu demResultat einer mehr oder weniger oberflächlichen „second hand“-Belesenheit gekommen, die sich im übrigenvorwiegend auf zeitgenössische und jüngere englische Manuskripte kompilatorischer Art gestützt habe.Johann hat demnach Autoren bevorzugt, die bereits selbst eine Vorliebe für stoffliche oder stilistischeabbreviatio hatten, Kompilatoren und Sammlernaturen wie Valerius Maximus, Frontinus, Vegetius, AulusGellius, Macrob oder Vorbilder gnomischer Rede wie Seneca und Hieronymus.843 Seine Geschichtskenntnissebezog er nicht aus der großen römischen Historiographie, sondern aus Epitomen und Kompendien mitanekdotischem, leicht moralisierbarem Material.844 Den bereits zugunsten infiniter
841 BROOKE, Introduction (wie Anm. 33) XLIII. Ähnlich hebt THOMSON (wie Anm. 836) 119 ff. die „internalized firsthand“-Kenntnis Wilhelms von Malmesbury gegen Johanns Utilitarismus ab (s. aber unten Anm. 1028). Zu Abaelards undHeloises Klassikerverständnis vgl. auch D. KNOWLES, The Historian and Character, Cambridge 1963, 21 f.; von MOOS,Lucan und Abaelard (wie Anm. 631) passim und ders., Cornelia und Heloise; in: Latomus 34 (1975) 1024–59; D. deROBERTIS, Il senso della propria storia ritrarovata attraverso i classici nella ‚Historia calamitatum’ di Abelardo, in: Maia 16(1964) 6–54.842 J. MARTIN, John of Salisbury and the Classics, Diss. Cambridge Mass. 1968 (Ms. der Harvard University); Abstract:Harvard Studies in Classical Philology 73 (1969) 319–21. Die folgende Zusammenfassung stützt sich auf die bereitserschienenen Beiträge zu Frontinus, Gellius und Petronius (s. oben Anm. 29 sowie: John of Salisbury as Classical Scholar,in: The World of John 179–202). Vgl. auch R.M. THOMSON, William of Malmesbury, John of S. and the NoctesAtticarum, in: Festschr. A. BOUTEMY, Brüssel 1976 (Coll. Latomus CXLV) 367–89; ders., John of S. and William …(wie Anm. 836) 117 ff.; MARSHALL/MARTIN et al. (wie Anm. 326); KERNER 30 ff.843 Vgl. oben Anm. 540 zur „Handlichkeit“ Senecas nach Met. I 22, 51 und zur „bequemen Übertragbarkeit“ sentenziöserAutoren nach Met. III 4, 137.844 Vgl. oben Anm. 748.
417
Verwendbarkeit präparierten Stoff benützte er überdies höchst frei, verschmähte weder pseudepigraphischeKonstruktionen im Großen noch Wortlautumformungen und Sinnverdrehungen der Textvorlagen imEinzelnen. Vor allem aber liebte er es, große Namen – magna nomina antiquitatis – über die derartzusammengeflickten „Purpurlappen“ zu setzen, nicht unbedingt, um gelehrter zu erscheinen, als er war,sondern vornehmlich, um seine Leser mit Ironie zu erfreuen und „deren Gefühl, zu einer gebildeten Elite zugehören, zu bestärken“. Die bereits erschienen Arbeiten von J. Martin erlauben bei aller Akribie, mit dersolche „Werkstattgeheimnisse“ an den Tag gebracht werden, eine höchst vergnügliche Lektüre, vor allem,weil Johann offenbar gelehrte Kenntnisse nicht einfach vortäuscht, sondern die wirklichen Kenner und„Eingeweihten“ durch kleine schalkhafte Indizien immer wieder auf den harmlosen Betrug, auf das Dauerspielmit den auctores hinweist.845
Zur Wertungsproblematik seien vorsorglich zwei Gesichtspunkte angemerkt, die nach diesem Ergebnis leichtübersehen werden könnten: 1. So wenig Johann der philologische „Spitzenhumanist“ bleiben kann, als der ervor Liebeschütz und Martin im allgemeinen gegolten hat, so wenig sollte an seiner Fähigkeit gezweifeltwerden, mit antiken Texten und Textfragmenten (auch sehr indirekt überlieferten) produktiv umzugehen undderen Sinn kreativ umzugestalten. Selbstverständlich hat er die geläufigen Schulautoren als ganze gelesen,eingeübt und interiorisiert. (Es ist nicht auszuschließen, daß er trotzdem zusätzlich Florilegien als „aidememoire“ benutzt hat.) Nicht gegen, sondern für die Souveränität seiner Rezeptionsmethode sprechensorgsame Einzelanalysen seines Umgangs mit ausgewählten Autoren (wie Seneca, Quintilian oder Lucan), dieer alle nicht aus Unverständnis, sondern im kritischen Geiste seiner eigenen „fröhlichen Wissenschaft“gelegentlich bewußt das Gegenteil von dem sagen ließ, was sie meinten.846
845 Vgl. S. 181 f., 209, 202 f., 219, 401, 464 ff. – Zitat: World of John of S. (wie Anm. 842) 196: „reinforcement of theirsense of being a learned elite“. Dieses Verfahren gehört im Rahmen der von Cicero (De orat.) systematisierten Arten desWitzes oder der facetiae, mit denen der Redner seine Zuhörer für sich gewinnen kann, am ehesten zur urbana dissimulatio (II269).846 Trotz unvollständiger Textkenntnis (s. oben Anm. 837) hatte Johann „ein wirkliches Verhältnis zu Quintilian“, wie sichP. LEHMANN ausdrückt: Die Institutio oratoria des Quintilianus im MA (1933), in: ders., Erforschung des Mittelalters II,Stuttgart 1959, 1–29, hier 15; vgl. auch MOLLARD (wie Anm. 398) 1935, 1 ff.; SEEL, Quintilian (wie Anm. 398) 240 ff.;M. BRASA DIEZ, Quintiliano y Juan de Salisbury, in: Estudios filosóficos 24 (1975) 87–99. Vgl. auch UHLIG (wieAnm. 577) 53 zu Ovid; K.-D. NOTHDURFT, Studien zum Einfluß Senecas auf die Philosophie und Theologie des 12. Jhs.,Leiden/Köln 42 f., 114 f.; von MOOS, Lucans tragedia 167 ff.; MARTIN, John of S. and, the Classics, lt. Abstract (wieoben Anm. 842) zu Petronius; vgl. allgemein auch oben Anm. 724. Arbeitshypothetisch möchte ich die Behauptung wagen,daß Johann jeden einigermaßen wichtigen auctor des Schulkanons in einer ganz persönlichen, im Mittelalter sonstungewohnten Art zur Sprache bringt, die seine intime Vertrautheit mit der antiken Literatur, aus welchen Digests undSammelhandschriften sie immer stammen möge, bezeugt. Man mag den guten alten Brauch textphilologischerQuellenanalysen in Ehren halten, doch müßte man sich auch allmählich die Mühe machen, genuin literaturwissenschaftlichherauszufinden, was für Johann (und nicht nur für ihn) etwa ein Juvenal, ein Terenz, ein Martial wirklich „bedeutet“ haben.Dies setzt voraus, daß solche Autoren selbst (nicht nur deren Überlieferung) ernstgenommen und nach Gehalt und Form mitihren mal. Kennern verglichen werden (vgl. CURTIUS oben in Anm. 55). Die genannten Beiträge zeigen, daß dies geradenicht auf eine Neuauflage steril registrierender „Quellen“- und Textparallelen-Forschung (im Stile von M. MANITIUS)hinauslaufen muß.
418
2. Martins Resultat hat eine weit über die reine Johann von Salisbury-Forschung hinausreichende Bedeutung,da der Policraticus bereits selbst ein (wie immer persönlich und argumentativ gestaltetes) Kompendium vonExzerpten und Exzerpten von Exzerpten darstellt und zu einer Hauptquelle für viele noch beliebtereSammelwerke, insbesondere für die meistbenützte Enzyklopädie des Mittelalters, das Speculum maius desVinzenz von Beauvais, geworden ist. Im Rahmen dieser Tradition literarischer Wissensvermittlung kanneinerseits gar nicht genug betont werden, daß die bei Johann herausgestellten Charakteristika derUngenauigkeit, Mittelbarkeit, ja, der manipulativen und pseudepigraphischen Freiheit im Zitieren strukturellzu dem (gerade für die Verwendung von Exempla) seit der Antike und noch lange nach dem Mittelalter ganzüblichen Funktionalismus gehören, der schon aufgrund der definitionsgemäßen Intentionalität undinhaltlichen causa-Bezogenheit von auctoritates keinen Respekt vor Wort und Sinn der Klassiker kennt.Wer überzeugen will, sucht die zustimmungsfähige, nicht die philologisch richtige Bedeutung der Zitate (wasnicht ausschließt, daß zufällig deren ursprünglicher Sinn mitgetroffen werden kann).847
Entwicklungsgeschichtlich muß andrerseits festgehalten werden, daß Johann nicht mehr uneingeschränkt alsder hervorragende auctores-Verfechter und letzte Deichbauer gegen die um sich greifende, im 13. Jahrhundertvollendete „Digest“-Vermittlung der Antike gelten kann.848 In einem
847 Vgl. S. 139 ff., 210, 347 ff., 384 f., 543 ff.848 Mit gezielter Boshaftigkeit schreibt darum THOMSON (wie Anm. 836) 124: „John […] was himself a prisoner, as wellas a critic, of Cornificianism“. – Mit dieser sehr skizzenhaften Charakteristik des Verfalls der im engeren Sinne„humanistischen“ Errungenschaften des 12. Jhs. soll die umstrittene These P.O. KRISTELLERS von der Kontinuität derartes-auctores-Kontroverse vom MA bis zur Renaissance keineswegs in Frage gestellt werden (s. unten Anm. 1036). DerProtest gegen den Niedergang der Bildung war ohnehin immer nur Sache einer kleinen Elite, deren kritische Topik ziemlichkonstant blieb. Hier galt es nur, den unbestreitbaren Rückgang der Direktkenntnis und stilistischen Präsenz antiker Autorenim allgemeinen, breiter und arbeitsteiliger gewordenen Bildungsleben des 13. Jhs. anzudeuten, auch wenn es nicht angeht,der Scholastik – immerhin eine Aristoteles-„Renaissance“ (s. Anm. 442) – oder den Bettelmönchen, von denen viele ein„moral and antiquarian enthusiasm for antiquity“ beseelte (PANTIN [wie Anm. 337] 49 ff.), pauschal Bildungs- undAntikefeindlichkeit anzulasten. Sicher blieb die qualitative auctores-Kenntnis als Autoren-Assimilation oder imitatioauctorum hinter jener betriebsamen didaktisch verwertbaren Anhäufung „moralischer“ Geschichten und Denksprüche aus derAntike (facta und dicta im trivialen Sinn) zurück, und die Blüte der „wissenschaftlichen“ Fächer in Logik und Quadriviumging auf Kosten der „schöngeistigen“ oder literarisch-rhetorischen Bildung. Vgl. BALDWIN, Masters (wie Anm. 327) 80 f.;d’AVRAY (wie Anm. 337) 49 ff. und unten S. 543.
419
bestimmten Sinn gehört er vielmehr selbst in die Vorgeschichte jener pragmatischen „artes-Bewegung“, dieden Aufstieg von Readern, Blütenlesen und Kompendien aller Art zu Hauptmedien der antiken Literaturbefördert hat. Man kann darin ein Zeichen für die Breitenwirkung humanistischer Bildung oder ein Symptomfür deren Verdünnung sehen; man mag sich etwa im historischen Konjunktiv fragen, ob die um 1150 blühendeauctores-Pflege ohne diese Florilegien- und Handbuch-Kultur der scholastischen Epoche nicht bruchlos in dieitalienische Renaissance eingemündet wäre. Solche Fragen führen über das hier Beantwortbare hinaus. WelcheUrsachen man immer für den Fortschritt oder Verfall der Bildung anführen mag – z. B. die Entstehung derUniversitäten und der aristotelisch durchtränkten Scholastik; den Andrang breiterer Bevölkerungsschichten zuden sich nun öffnenden Zentren des Wissens und die dabei unvermeidliche Senkung des Bildungsniveaus; dieWeiterentwicklung der traditionellen Fächer des Triviums zu fachwissenschaftlichen Methodenlehren und dieAusdehnung des Wissensstoffs in den sich stärker entfaltenden naturwissenschaftlichen Disziplinen desQuadriviums sowie die Unmöglichkeit, ein derart angewachsenes Studien-programm ebenso liebevoll zuvertiefen wie das frühere, kleinere (vielleicht „humanere“ und humanistischere) Pensum – diese Entwicklungvon der lectio auctorum zum mittelalterlichen „Büchmann-Wissen“ bildet jedenfalls, von der Warte desphilologischen Humanismus betrachtet, ein „Wellental“ zwischen den „Höhen“ der beiden „Renaissancen“,der eigentlichen und der sogenannten des 12. Jahrhunderts. Johann steht am Anfang dieses Prozesses. Er hatihn theoretisch nicht zu verhindern gewußt und praktisch (in allerdings kaum merklicher Weise)mitbestimmt: So ernst seine grundsätzliche Ablehnung aller Bequemlichkeiten im Bildungswesen, seinvielgepriesenes Ideal der Direktlektüre, seine Ablehnung des Plagiats zu nehmen sind, so wenig auch sein voneigenen Leitideen strukturierter Policraticus als bloße Kompilation angesehen werden darf, müssen seineZitierpraktiken doch als
420
symptomatisch für die Tendenz zu einer „Kultur aus zweiter Hand“ beurteilt werden.849 Dies beweist, wiegesagt, am besten die Rezeptionsgeschichte seines Policraticus, der tatsächlich mehr als stoffliche Fundgrubegeplündert, denn als eigenständiges Werk gelesen wurde.850
Johanns Kritik an „cornificianischer“ Unbildung oder Schnellausbildung ohne auctores und sein eigenerphilologisch fragwürdiger Umgang mit den auctores stehen also (jedenfalls für uns) in einem gewissenWiderspruch zueinander. Abgesehen von der zentralen rhetorisch-topischen Bedeutung antiker Zitate, läßtsich hierzu vermuten, daß ihn gerade das Auseinanderklaffen seines hohen Bildungsideals, seinerpolyhistorischen Ambition und seiner wirklichen Kenntnisse dazu geführt hat, seine eigene Sekundär- undTertiärliteratur zu verschleiern und gegen geistige Hochstapler, die sich mit fremden Federn schmücken, zuFelde zu ziehen. Besonders aufschlußreich ist das Beispiel des Bienengleichnisses, jenes hervorragenden Bildesantiker Literaturtheorie für geistige Eigenständigkeit und gegen sklavische Unselbständigkeit in der imitatioauctorum:851 Johann übernimmt es direkt aus Macrob, bei dem er eine halbe Seite exzerpiert, obwohl erausdrücklich auch Seneca als Quelle angibt, was eine gewisse quellenphilologische Kenntnis verrät, da Macrobtatsächlich dem nicht namentlich zitierten Verfasser der Briefe an Lucilius folgt.852 Ausgerechnet diesePolicraticus-Stelle schreibt später Peter von Blois (ohne Johann zu nennen) unter Berufung auf die beidenantiken Autoren aus, um sich gegen den zu erwartenden Vorwurf zu verteidigen, er sei nichts weiter als einKompilator.853
849 Vgl. S. 44 ff., 138 f.850 Vgl. oben S. 138 ff.851 Vgl. oben Anm. 742 zum Bienengleichnis.852 Pol. VII 10, (II) 133.10 ff. nach Macrob Sat. praef. 5–7 (wie oben Anm. 742 f. zitiert) und Sen. Ep. 84.5–6: nos quoquehas apes debemus imitari, et quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare […] deinde adhibita ingenii nostri curaet facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere, ut etiam si apparuerit, unde sumptum sit, aliud tamen essequam unde sumptum est, appareat […] Quod in corpore nostro videmus facere sine omni opera nostra naturam. Es gibtalso neben dem organologischen Gleichnis für den Staat auch ein „Körpergleichnis“ für die literarische Bildungspflege (dazuvgl. unten § 98).853 Petr. Bles. Ep. 92 (PL 207) 289 C: Nam sicut in libro Saturnalium et in libris Senecae ad Lucilium legimus, apesimitari debemus, quae colligunt flores, quibus divisis, et in favum dispositis, varios succos in unum saporem artificimistura, in quadam sui spiritus proprietate transfundunt. Arguit aemulus et temeritate ascribit quod litteras meas passimet varie dispersas in unum colligo […] Utinam experiatur invidus meus ingenii sui vires ac de flosculis sacri eloquiicompilatis, simile componat opusculum! Vgl. damit den Wortlaut der Eröffnung in Pol. VII 10, 133.10 ff.: Ut enim in libroSaturnaliorum et in epistolis Senecae ad Lucilium legitur, apes quodammodo debemus imitari, quae vagantur et florescarpunt … Die Abhängigkeit von Johann spricht auch aus der unmittelbar folgenden Verwendung des nani-gigantes-Gleichnisses (a. O. 290 A, oben Anm. 538), das hier das Exzerpieren im Sinne einer Wiederbelebung der durch obliviogestorbenen Autoren rechtfertigen soll, da auch alle Kirchenväter voneinander abgeschrieben hätten. Peter von Blois ist auchsonst in der Geschichte des literarischen Abhängigkeitsproblems nicht unbekannt: So hat er (Ep. 101, 314 A), um sich seinerLektüreleistungen zu rühmen, eine Liste der lesenswerten antiken Historiker aus Pol. VIII 18, (II) 364.1 ff. abgeschrieben (dieJohann übrigens selbs schon aus zweiter Hand übernommen hat). Vgl. G. GLAUCHE, Schullektüre im Mittelalter, München1970, 3, 126; REYNOLDS (wie Anm. 299) 402 ff.; R.W. HUNT, The Deposit of Latin Classics in the 12th Cent.Renaissance, in: BOLGAR (wie Anm. 423) 1–5, hier 55; MARTIN, in: The World of John 194 f. Herauszuheben ist jedochweniger, daß Peter von Blois die gängigen Aneignungs- und Zitierpraktiken vielleicht besonders aktiv betrieben hat, als daßer sich zur Legitimation derselben genötigt sah, was einer zunehmenden Bewußtwerdung des Begriffs des geistigenEigentums entspricht. Zur Stellung des Petr. Bles. in dieser Hinsicht vgl. JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 64 ff.; R.W.SOUTHERN, Peter of Blois a Twelfth Century Humanist? in: ders., Medieval Humanism, Oxford 1970, 105–32, bes. 126;Ph. DELHAYE, Deux adaptations du De amicitia de Cicéron, in: RTAM 15 (1948) 304–331; Rolf KÖHN, Magister Petervon Blois, im Druck, lt. ders., Militia curialis, Die Kritik am geistlichen Hofdienst bei Peter von Blois und in der lat. Lit.des 9.–12. Jhs., in: Misc. Mediaev. Köln 12.1, Berlin 1979, 227–57, bes. 256 ff.
421
90. Nachdem nun Johann von Salisbury nicht länger als Humanist im Sinne des 19. Jahrhunderts, sondern nurnoch als „mittelalterlicher Humanist“ gelten kann, stellt sich noch die wichtige Frage nach dem Verhältnisseiner Zitierpraxis zu seinen erklärten Absichten und seinem Wahrheitsbegriff. Einerseits kommt es ihm, wiegezeigt,854 nicht so genau auf die historischen Fakten und Namen an, sondern auf die Verbürgtheit der einemBeweis dienenden Textzeugen; andrerseits ist er gleichgültig und nachlässig im Zitieren eben dieserautoritativen Textbasis; und schon fragt man sich, ob nicht doch eher die stoffliche Seite der historiaewichtiger sei als das literarische Medium. Einerseits beansprucht er, vorgegebene mehrdeutige Literatur aufihren wahren Kern hin auszulegen; andrerseits legt er in z. T. sehr subtilen, sehr spielerischen Formen der piafraus das Auslegungsmaterial so zurecht, daß es zur gewünschten Wahrheit paßt und den erforderlichenrhetorischen Effekt erzeugt.
All diesen Paradoxien kann die gängige historisch-philologische Methodik schwer gerecht werden. Sie stellendas einseitige Interesse für geschichtliche
854 Oben §§ 57, 60.
422
Faktentreue oder für das Jota überlieferter auctores in Frage. Dem Verständnis dient eher eine Optik, in derweniger das Dargestellte und die Darstellung als das rhetorische Darstellungsziel beachtet wird. „Wahr“ und„wirklich“ kann danach nur sein, was beiden, dem Redenden und dem Angesprochenen, gemeinsam alsmitteilenswert und denkwürdig erscheint: das durch Konsens begründete Wahrscheinliche der argumentativenTopik. Der Bezug auf eine „Quelle“ der Geschichte oder der literarischen Tradition erweist sich dadurch alsgültig, daß er der Redesituation angemessen ist. Die Berufung auf irgendeine Art von Objektivität derWiedergabe ist selbst ein Mittel, solche Angemessenheit zu erreichen. Diese bereits mehrfach festgestelltePlausibilisierungsfunktion des Zitats ist in spezifisch mittelalterlichem Sinn topisch.854a
Johann hat zwar für die Philosophiegeschichte das Verdienst, die logischen Schriften des Aristoteles erstmalswieder gesamthaft erörtert und das spezifisch formallogisch-dialektische Topik-Verständnis der Scholastikvorbereitet zu haben, das im wesentlichen auf die Prüfung der Argumente (iudicium) ausgerichtet war,855 dochdürfte das dafür notwendige theoretische Interesse den Stil seines Denkens und Schreibens in der Praxisweniger geprägt haben als die traditionelle, durch den Schulbetrieb habitualisierte Auffassung einerhermeneutisch inventiven Topik, die mehr auf Cicero als auf Aristoteles zurückgeht.856 Die im weitestenSinn als „allgemeine konsensfähige Argumentationsgesichtspunkte“
854a Vgl. §§ 54, 61 f., 72, S. 4, 16. Zu den erwähnten Paraxoxien vgl. auch BRACKERT (wie Anm. 501) 7 ff., der dieGeschichtskonzeption des Alexanderromans aus dem mittelalterlichen Wahrheitsbegriff erklärt: die Geschichte als schriftlichbeglaubigte Ereignishaftigkeit bildet nur eines von vielen Mitteln, den Zweck moralischspiritueller Belehrung über die einzig„wirklichen“ Idealwahrheiten zu befördern.855 Zu Johanns philosophiegeschichtlicher Stellung vgl. §§ 52, 62, 71. Zur dialektischen Topik vgl. §§ 62, 72, S. 193 ff.,246 ff., 293 ff.; O. BIRD, The Tradition of Logical Topics, Aristotle to Ockam, in: Journ. of the Hist. of Ideas 33.3 (1962)307–323; M.C. LEFF, Boethius’ De differentiis topicis Book IV, in: J.J. MURPHY (Hrsg.), Medieval Eloquence (wieAnm. 447) 1978, 3–24, bes. 16 ff.; E. STUMP (wie Anm. 435) 249 ff. und ders., Topics: Their Development andAbsorption into Consequences, in: KRETZMANN (wie Anm. 586) 273–99. Nicht mehr benützen konnte ich: Nies JorgenGREEN-PEDERSEN, The Tradition of the Topics in the Middle Ages, The Commentaries on Aristotle’s and Boethius’‚Topics’, Wien 1984. – Zum Verhältnis von inventio und iudicium vgl. oben Anm. 765 und nächste Anm.856 Vgl. S. 191 ff., 251, 297 ff., 307 f., 384 ff. Zum Unterschied zwischen Aristoteles und Cicero vgl. McCALL 114 u.BORNSCHEUER (wie Anm. 584a) 61–90; Cicero selbst verstand sich hier als Nachfolger des Aristoteles (weil er einepseudoaristotelische Schrift für die ‚Topik’ des Stagiriten hielt). Er betont in Top. II 6, er wolle wie dieser sowohl iudiciumals auch inventio pflegen, da die Stoiker letztere vernachlässigt hätten. Der inventio gilt darum sein Hauptinteresse. In dermal. Scholastik dominiert die formallogische Umdeutung des aristotelischen Toposbegriffs durch Boethius und Abaelard(iudicium-Topik), während die inventio-Topik im übrigen Bildungsleben vorherrschte und dabei stets Gefahr lief, zu einerbloßen Stoffsammlungs- und Stoffauffindungstechnik zu verkommen: vgl. STUMP (wie Anm. 435) 252 f.; LANG (wieAnm. 4) 81 ff. Der Einfluß der inventiven Topik ciceronischer Prägung zeigt sich besonders auffällig in Zusammenhängen,in denen Johann die aristotelische Topik erklärt; außer in den oben Anm. 544 besprochenen Stellen aus Met. III 10 vgl.ebd. III 9, 151 über die ersten sieben Bücher der Topik des Aristoteles: ob ubertatem locorum constare rectissime dicitursumma Topicorum, que, ut ait Isidorus [Et. II 29.16], sic dicta sunt, quoniam topos continent, id est locos, qui suntargumentorum sedes, fontes sensuum et origines dictionum. Zu sedes argumentorum vgl. Quint. 5.10.20; Cic. Top. II 8;oder neben Isidor etwa noch Cassiod. Inst. (PL 70) 1176: locus est argumenti sedes vel unde ad propositam quaestionemconveniens trahitur argumentum. Weiteres zur Diskussion s. Anm. 5 u. S. 249 ff., 299 ff., 319. Eine nützliche Übersichtüber die lateinische Entwicklung der Toposbegriffe gibt: M.C. LEFF, The Topics of Argumentative Invention in LatinRhetorical Theory from Cicero to Boethius, in: Rhetorica 1 (1983) 23–44.
423
definierbaren Topoi857 umfassen formale und materiale, metasprachliche und objektsprachliche, methodischeund stoffliche Aspekte. Auf der einen Seite können alle Regeln der Logik, Rhetorik und Grammatik einespezifisch formaltopische Funktion übernehmen: Topoi sind insofern etwa die zehn Kategorien, die vierPrädikationen, die sieben Umstände der Hypothesis (persona, factum, causa, locus, tempus, modus,facultas), die status oder Tatbestands- und Gegenstandsfragen (nach mehreren Einteilungen, vornehmlich demDreierschema: coniectura: an sit?, finitio: quid sit?, qualitas: quale sit?), aber auch die vier für dasMittelalter besonders wichtigen Normen-Interpretationsfragen seit Hermagoras (scriptum et voluntas,antinomia, ambiguitas und syllogismus), die zwei genera probationum (probatio artificialis und probatioinartificialis), die drei Ähnlichkeitsgrade
857 Vgl. Aristot. Top. I 1.1 (100a) und die interpretierende Übersetzung von L. BORNSCHEUER, Art. Topik, in: RDL IV,Berlin 1981, 455–75, hier 455: „Das Ziel dieser Abhandlung ist, ein Verfahren zu finden, mit dessen Hilfe wir gegenüberjeder Problemstellung auf der Grundlage der geltenden Meinungen zu einem schlüssigen Urteil kommen können und, wennwir selbst einer Argumentation standhalten sollen, in keine Widersprüche geraten“, sowie die Toposdefinitionen ebd. undTopik (wie Anm. 584a) 44 f.: „Gesellschaftlich allgemein bedeutsamer Argumentationsgesichtspunkt“ bzw. „allgemeinerArgumentationsgesichtspunkt“; „jeder allgemeine oder konkrete, formale oder inhaltliche Gesichtspunkt, der in einem jeweilsvorliegenden Problemzusammenhang eine neue und wichtige Perspektive eröffnet“. VIEHWEG (wie Anm. 3) 24: „Topoisind also für Aristoteles vielseitig verwendbare, überall annehmbare Gesichtspunkte, die im Für und Wider desMeinungsmäßigen gebraucht werden und zum Wahren hinführen können“. Vgl. ähnlich auch H. SCHEPERS, Art.Enthymen, in: HWPh 2 (1972) 528–38, hier 530; J. SPRUTE, Topos und Enthymen (wie Anm. 433) 90.
424
des induktiven Vergleichs (simile, dissimile, contrarium), die in der mittelalterlichen Predigtlehre beliebtenmodi dilatandi materiam (wie definiendo, describendo, interpretando, dividendo, ratiocinando) u.a.m.Solche z. T. auch wissenschaftlich objektiv gültigen Systemgesichtspunkte werden zu Topoi, sobald sie derGlaubwürdigkeitsbeschaffung dienen. Gradunterscheidung, Etymologie, Analogie, Definition, Zeitstufen einerEntwicklung, Vergleich von Teil und Ganzem, die vier Schriftsinne und unabsehbar viele ähnlicheOrdnungsprinzipien, Suchraster, quasi-steckbriefartige Frageregeln pflegen gerade aufgrund ihresklassifikatorisch-präliminaren Charakters, also dank ihrer abstrakten Inhaltslosigkeit anerkannt zu werden.858
Vollends
858 Zu den formalen „Denktopoi“ vgl. LAUSBERGS Register s. l. unter den genannten Begriffen; TRIMPI, Hypothesis (wieAnm. 554) 15 (Quint.); APEL (wie Anm. 600) 141 ff.; BORNSCHEUER, Topik (wie Anm. 584a) 35 f., 41, 43, 48(Ähnlichkeit, Gegensatz, Allgemeines und Besonderes, Abstraktion und Konkretion u. ä. bei Aristot.); MEYER,Quaestionen (wie Anm. 557) 43 f. (Hermagoras und die status interpretationis); RIPOSATI (wie Anm. 546) 421 ff.(Cicero); CROCCO, Abelardo (wie Anm. 560) 76 ff.; OTTE (wie Anm. 281) 186 ff. (Boethius und Glossatoren; hier auchzur Terminologie: „objekt-“ und „meta-sprachlich“); WEIMAR, Argumenta (wie Anm. 566) 109 ff.; ROTH 71, 37.40, 48 ff.(Predigtlehre). Vgl. auch unten Anm. 862, 874, oben Anm. 281 zu der für die Theorie des Exemplums grundlegendenEinteilung der Verhältnisse zur causa: a simili, a maiore ad minus, a minore ad maius und a contrario, die aus deraristotelischen Topik stammen; vgl. auch VIEHWEG (wie A. 3) 40; SCHEPERS (wie A. 857); OTTE (wie A. 281) 20 ff.Vgl. § 62 (Thesis/Hypothesis); § 51, S. 427 f. (locus a similitudine/ab exemplo); A. 562, 729 (Abaelards Regeln derTextkritik als Vorfragen-Topik); A. 654 (Widerlegungs- u. Ausgleichstopoi für konträre Argumente); A. 287 (modi dilatandimateriam); A. 281, 863 (genera probationum). Zum Schema der Umstände vgl. Boethius, Diff. top. (PL 64) 1212:Gleichsetzung der loci communes mit den circumstantiae/Peristasen; vgl. auch §§ 64 f.; GRÜNDEL (wie Anm. 4) 10 ff.,35 ff., u. passim; LAUSBERG § 399; LEFF (wie Anm. 855) 11 ff.; BERLIOZ, Exempla et confession (wie Anm. 313)319 ff.; KLOPSCH (wie Anm. 706) 148 f. (zur poet. Inventio-Lehre). Neben dem allgemeinen Frageschema nenntGRÜNDEL (wie Anm. 4) 20 ff., 211 f. u. ö. viele andere Umstandseinteilungen und Attribute-Verzeichnisse nach unsererSteckbriefart: Name, Verwandtschaft, Rang, Alter, Gewohnheiten, Bildungsstand etc. – Zur status-Lehre s. oben Anm. 486,554 f., 636 und die Hauptstellen bei Quint: 3.5.11–44; Cic. Inv. I 10–12; in der juristischen Topik des MA’s. überdies diecausa-bezogenen Fragen nach Tat und Intention: circa factum extrinsecus und circa factum intrinsecus. Vgl. LANG (wieAnm. 4) 74 ff.; GRÜNDEL (wie ebd.) 16 ff.; BONNER Decl. (wie Anm. 550) 12 ff.; McKEON, Invention (wie Anm. 627)369 f.; G. JAENEKE, De statuum doctrina, Leipzig–Berlin 1923, 15 ff.; MELVILLE, Wozu … (wie Anm. 368) 89 ff.,106 f. – Spezifisch mittelalterliche inventive Denkformtopoi sind der im Zusammenhang rhetorischer amplificatio geeignete„locus der vier Schriftsinne“ und der bibelexegetisch oder juristisch harmonisierende locus circa interpretationemhinsichtlich widersprüchlicher Stellen: vgl. H. CAPLAN, The Four Senses of Scriptural Interpretation and the MediaevalTheory of Preaching, in: Spec. 4 (1929) 282–90; LANG (wie Anm. 4) 79 ff.; GRABMANN, Schol. Meth. I 234 ff.;MEYER (wie Anm. 557) 43 f.; ROTH 74 f.
425
unzählig sind auf der anderen Seite die materialen Topoi oder anerkennbaren Meinungen und Urteile, diesowohl aus fertigen Formulierungen, autoritativen Zitaten, geflügelten Worten, Proverbien, Sentenzen,Maximen, Chrien als auch aus ding- oder ereignishaften Analogien, Vergleichen, Gleichnissen und Beispielenaus Erfahrung und Geschichte bestehen können.859 Ungeachtet moderner systemphilosophischerKontroversen um die Toposdefinition, läßt sich der historisch gewordene Topos des Mittelalters wedereinseitig auf eine reine „Denkform“ noch auf einen „Gemeinplatz“ oder eine rekurrente Floskelreduzieren.860 Nicht, daß die inhaltlich gefüllten Topoi notgedrungen weitgehend aus wiederholbarenKonstanten, oft auch
859 Daß bereits in der Antike eine Verengung der Topik auf „Gemeinplätze“ vorkam, zeigt deren Verurteilung durchQuintilian (II 4.27), der gegen das Auswendiglernen und wörtliche Abspulen von loci in Form berühmter Zitate polemisiert.Vgl. auch McKEON, Invention (wie Anm. 627) 368; LEEMAN 232 f. zu Sentenz und locus communis bei denDeklamatoren; LEWRY (wie Anm. 447) 113 zur Toposdefinition im Sinne der boethianischen Tradition (maximapropositio): „a self-evident general proposition introduced to validate defective argument.“; oben Anm. 540 f. zu JohannsAuffassung der (aristotelischen) loci als gnomische verba auctorum; unten S. 427 f. zum Exemplum als formalem Topos.860 Die Theoriediskussion zum Toposbegriff seit CURTIUS ist leicht zu verfolgen mit Hilfe der beiden Reader: P. JEHN(Hrsg.) Toposforschung, eine Dokumentation, Frankfurt a. M. 1972; M.L. BAEUMER (Hrsg.) Toposforschung (WdF 395)Darmstadt 1973, sowie des Kongreßberichts hrsg. von BREUER/SCHANZE (wie Anm. 645). Den neuestenForschungsstand faßt vortrefflich zusammen: L. BORNSCHEUER (wie Anm. 857), bes. 457 zum Übergang von derargumentativen Problemphantasie in der Spätantike zu einer hermeneutischen Suchphantasie: „Topischer Fundus sind dieautorisierten scripturae, nicht mehr die gesellschaftlichen endoxa“; ebd. 463 ff. zu dem unnötigen Gegensatz zwischen einemeinseitig materialen Toposbegriff (CURTIUS) und einem ebenso einseitigen rein formal-klassifikatorischen (MERTNER);ebd. 469 zu den sprachlich fixierten Topoi (Sprichwörter, Zitate) in Ciceros Topik. Vgl. auch RICHARDS (wie Anm. 55)14 f. zur verbreiteten Kritik an CURTIUS’ floskel- und klischeehaftem Toposbegriff (FRIEDRICH, AUERBACH,BEZZOLA, FARAL, BEUMANN u. a.); BORNSCHEUER, Topik (wie Anm. 485a) 13, 213 f., 239 f., 242 f. zuCURTIUS; J.A.R. KEMPER, Topik in der antiken rhetorischen Techne, in: BREUER/SCHANZE (wie Anm. 645) 17–32,bes. 28 f. zur Kritik an der verhängnisvoll erfolgreichen These MERTNERS; ähnlich beziehen zwischen den Fronten der reinmaterialen und rein formalen Toposdefinition Stellung: Wolfg. G. MÜLLER, Topik des Stilbegriffs, Darmstadt 1981, 3 ff.;VIEHWEG (wie Anm. 4) 36 ff.
426
aus abgedroschenen Bezugselementen bestehen, macht ihre Toposhaftigkeit aus, – wie seit Curtius inweitverbreitetem, selbst schon „topischem“ Irrtum angenommen wird –, sondern, daß sie als Kristallisationvon meinungsmäßig anerkannten Gesichtspunkten, herrschenden Anschauungen mit der Zuversichtherangezogen werden, daß sie in bestimmten Rede- und Argumentationszusammenhängen Zustimmungbewirken. Sowohl aufgrund der aristotelischen Endoxa und eines (von heute aus gesehen übrigens eherelitären) consensus omnium als auch im Sinne der ciceronischen loci communes, der in ihnen verdichtetenmoral- und sozialphilosophischen Idealwerte und des rhetorischen Anspruchs der copia rerum et verborumsind Topoi nicht um ihrer selbst willen dargestellte Themen oder Urweisheiten, sondern auf denProblemzusammenhang gerichtete, funktionale Orientierungspunkte, Fix-und Ausgangspunkte, Hilfsmittelzum Auffinden relativ unproblematischer, voraussichtlich unstrittiger Prämissen der Problemlösung inDiskussion und Persuasion. Dabei bedeutet es gegenüber der Antike eher eine formale Akzentverschiebung alseine substantielle Veränderung, wenn im Mittelalter die loci weniger in einem diskursiv zustandegekommenengesellschaftlichen Konsens oder sensus communis über Grundgedanken, Verhaltens- und Denkregeln gesuchtwerden als in schriftlich fixierten Autoritäten, in Normen und Gesetzen. Auch ehrwürdige Kernsätze sindTopoi, d. h. allgemeingültige Gesichtspunkte, „in beide Richtungen“ verwendbare, „interpretationsfähige undinterpretationsbedürftige, ebenso fundamentale wie polyfunktionale Grundelemente“ der Argumentation. IhreGeltung beruht gerade nicht auf einer fixen Applikationsnorm, sondern auf der Flexibilität und Vielfalt derAnwendungsmöglichkeiten.861
861 Zur Problembezogenheit und Kontextualität der Topoi vgl. S. 29 ff., 274 f., 291, 319 f., 331 ff., 346 ff., 381. –BORNSCHEUER, Topik (wie A. 485a) 43 ff.; VIEHWEG (wie A. 4) 38 ff.; HENNIS (wie A. 601) 88 ff. Endoxa undKonsens über das Anerkannte: vgl. S. 4, 196, 249, 299 ff., 319, 331 ff. SCHIAN (wie Anm. 5) 95 ff., 116 ff. mit demHinweis auf die toposbildende Kraft evidenter Tatsachen, vorphilosophischer Grundüberzeugungen, überlieferter Zeugnisseund historischer Beispiele; zu diesem Aspekt vgl. auch G. VERBEKE, Philosophie et conceptions préphilosophiques chezAristote, in: Rev. philos. de Louvain 59 (1961) 405 ff. Vor einer anachronistischen „Demokratisierung“ der Topoi warntschon Arist. Rhet. II 23 (1397a, 1398b): Auch der Expertensachverstand oder die Unmöglichkeit, dem Herrschenden zuwidersprechen, können die endoxa-bezogene Basis topischer Argumentation ausmachen. Vgl. BORNSCHEUER, Topik (wieAnm. 485a) 18 f. und oben Anm. 313 zu sozialpsychologischen Interiorisierungsproblemen im Mittelalter. Zurgrundsätzlichen, wahrheitsindifferenten, potentiell vorurteilsgebundenen Struktur des Topos vgl. S. 299 f., 319. – Zurmeinungsmäßigen Allgemeingültigkeit (mündlicher oder schriftlich fixierter) Topoi vgl. BORNSCHEUER (wie Anm. 587)455 mit den Zitaten; zum Wandel von den antiken, auf allgemeiner Anerkennung beruhenden meinungsmäßigen Topoi zuden mal. loci, regulae, Leitsätzen und Autoritäten vgl. A. LANG, Loci theologici, in LThK 6 (1961) 1110–12; A.GARDEIL, La notion de lieu théologique, in: Rev. des Sciences philosophiques et théologiques 2 (1908) 51–73, 245–76,484–505; zur Vorgeschichte dieses Wandels in der Spätantike s. oben Anm. 860; vgl. BLUMENBERG, Patristik (wieAnm. 36) 487; K. OEHLER, Der consensus omnium als Kriterium der Wahrheit in der Philosophie und in der Patristik, in:Antike u. Abendl. 10 (1961) 103–29; LANG (wie Anm. 4) 81 ff. zum Einfluß Ciceros auf die Verstofflichung der Topik;HORN, Argumentum (wie Anm. 621) 265 ff. zur dritten Argumentationsklasse: exemplum (neben 1. lex und 2. ratio), diehauptsächlich aus dem argumentum ab auctoritate besteht, im Rahmen der auf Boethius zurückgehenden juristischen Topikder modi arguendi („Konsensermittlungsregeln“) bei den Legisten des 13. Jhs.; CHENU 359 ff. zur neuenhochmittelalterlichen Konsensform der „magistralen“ Autorität (neben der eigentlichen der sancti oder authentici patres)aufgrund einer „unanimité relative“ vieler zeitgenössischer magistri in der determinatio eines bestimmten Problems. – Einevortreffliche Illustration für den fließenden Übergang zwischen Autorität und Endoxon im frühscholastischenTopikverständnis gibt Abaelard, wenn er die dialektische ratio aller auctoritas grundsätzlich überordnet (so daß sie diesersogar bestenfalls ganz entbehren kann), und doch vor besonders schweren Problemen die auctoritas als eine Art Konsens dermeisten und Besten durch die Jahrhunderte vorläufig gelten läßt; Theologia christiana III 43.49 (BUYTAERT) 212.214:Scimus omnes in his quae ratione discuti possunt, non esse necessarium auctoritatis iudicium […] Interim autem, dum ratiolatet, satisfaciat auctoritas, et ea notissima atque maxima (propositio) de vigore auctoritatis a philosophis tradita,conservetur: Quod omnibus vel pluribus videtur hominibus [Boeth. Diff. top. II, PL 64, 1190], ei contradicere nonoportere.
427
91. Die topische Bedeutung des Exemplums richtet sich zunächst nach der erwähnten Unterscheidung vonformalen und materialen Topoi: Auf der einen Seite ist der Beispieltopos ein Denkmuster oder einmethodischer Gesichtspunkt wie Analogie oder Vergleich und heißt in der Theorie entsprechend etwa „Toposaus der Induktion“, locus e similitudine oder noch enger locus ab exemplo. Denn das Verfahren, zweifelsfreieBeispiele als Beleg und Präzedenzfall für einen anfechtbaren Gedanken in Erinnerung zu bringen, um dieeigene Glaubwürdigkeit zu steigern, ist als solches eine topische Methode. Aristoteles hat unter den 28„Denktopoi“ der ‚Rhetorik‘ auch „das induktive Aufzählen von Erfahrungsbeispielen“ angeführt und inseiner ‚Topik‘ eine raffinierte Variante des Beispielarguments erwähnt, die darin besteht, daß eine Theseabsichtlich beiläufig vertreten wird, d. h. so, als sei sie gar nicht die These, sondern nur die beispielhafteIllustration für anderes (was den taktischen Vorteil des „Topos vom Beispielgebrauch“ beleuchten soll).862
862 Schon die Disposition des 2. Buches der aristotelischen ‚Rhetorik’ zeigt Beispiele und Vergleiche unter den allgemeinenTopoi; vgl. McCALL 24 ff.; BORNSCHEUER, Topik (wie Anm. 485a) 35 f., 41 ff.; PERELMAN 120 (Induktionstopos).– Zum locus a similitudine s. Cic. Top. X 44, Quint. V 11.6 und 36 ff. Zahlreiche Beispiele für den locus ab exemplofinden sich in den Rhetores latini minores (HALM 644, s. l.); vgl. McCALL 116 f., 190; DAVID, Maiorum exempla 68 ff.;GEERLINGS 149 ff.; A. CIZEK, Zur Bedeutung der ‚topoi enkomiastikoi’ in der antiken Rhetorik, in:BREUER/SCHANZE (wie Anm. 645) 33–41, hier 34 (simile unter den loci circa rem). – OTTE (wie Anm. 552) 191 ff.,204 ff. (juristische loci a toto, a minore und a maiore, a simili u.a.m.). – Zur taktischen Anwendung des Beispiel-Topos s.Aristot., Top. VIII 1, 156b.25–26.
428
Zu den formalen Topoi gehört auch eine Methode, die, inhaltlich gesehen, geradezu einen Antitopos, dasGegenteil eines Bezugs auf die herrschende Meinung, darstellen würde: die Berufung auf paradoxe,verblüffende, außergewöhnliche Beispiele, die in der antiken Rhetorik als das Verfahren p a r Å løgonbehandelt und bei Anaximenes so begründet wird:863
Du mußt Beispiele dann verwenden, wenn du etwas Unglaubliches sagst und es evident machen willst; falls etwaskraft des Wahrscheinlichen keinen Glauben gefunden hat, damit die Leute, wenn sie erfahren, daß eine andereähnliche Tat ebenso geschehen sei, wie du angibst, gehandelt zu haben, deinen Worten mehr glauben. Es gibt zweiArten von Beispielen: die einen Tatsachen sind der Erwartung gemäß, die anderen der Erwartung entgegen. Die derErwartung gemäßen bewirken, daß man überzeugt, die nicht der Erwartung gemäßen, daß man keinen Glaubenfindet. Wenn z. B. jemand sagte, die Reichen seien gerechter als die Armen, und einige Handlungen gerechterMänner beibrächte, so scheinen diese Art Beispiele der Erwartung gemäß zu sein; denn man kann sehen, daß diemeisten glauben, die Reichen seien gerechter als die Armen. Wenn aber wiederum einer zeigte, daß gewisse Reichesich in Geldsachen vergangen haben, so würde er das der Erwartung zuwiderlaufende Beispiel verwenden und so dieReichen unglauwürdig machen.
Damit wird die „Glaubwürdigkeit“ als ein von Fall zu Fall einschlägiger, publikumsorientierter Wirkungsaspektbeim Beweisen des eigenen Standpunkts und beim Widerlegen des gegnerischen, als der eigentliche Zweck derRede deutlich unterschieden von einer instrumentellen, diesem Ziele dienenden „Wahrscheinlichkeit“ (e˝køq),die durch „gewöhnliche Ansichten“ (analog zu den aristotelischen Endoxa) gebildet wird und alsPlausibilisierungsmittel gleichwertig neben deren Umkehrung, den Ausnahmeerscheinungen und originellenBetrachtungsweisen steht. Nach der zugrundegelegten Unterscheidung dürfen wir (obwohl von Topik hiernicht die Rede ist) das ganze zweigliedrige Argumentationsverfahren mit Regel und Ausnahme,Selbstverständlichem und Unerwartetem, Vorverständnis und Vorurteilskritik als formalen Topos (bzw. zweiformale Topoi) bezeichnen. Aufgrund der Thematik jedoch sind nur die erwartungsgemäßen, unumstrittenen,normalen Beispiele inhaltliche Topoi.
863 Rhet. ad Alexandrum IX, 1429a, vgl. DORNSEIFF (wie Anm. 8) 215 f.; vgl. dazu auch Anm. 281. Zu einem ähnlichenVergleich von „arm“ und „reich“ bei Quint. und zur Vorurteilshaftigkeit des locus a fortuna vgl. oben Anm. 627. – Vgl.auch GEBIEN 25 f.; VIEHWEG (wie Anm. 4) 49; MARTIN, Rhet. 122 f. (dieselbe Zweiteilung hinsichtlich der Gnomoi).
429
92. Die letzteren, die „materialtopischen“ Beispiele selbst lassen sich auf der anderen Seite nach zweimöglichen Beziehungen zwischen Topos und Exemplum wie folgt systematisieren: Entweder bildenLeitgedanken und Stichworte den topischen Rahmen für Exempla, oder diese topischen Themenverschmelzen bis zur Identität mit besonders bekannten und anerkannten Beispielen. Der Topos kann durchdas Beispiel näher bestimmt, konkretisiert werden, oder das Beispiel selbst ist der Topos, aus dem sich einArgument entwickeln läßt. Exempla dienen einerseits einem inhaltlichen Topos – wie dem von Anaximenesangeführten Satz: „Reiche gelten als gerechter“ oder dem weniger anfechtbaren: „Alle Menschen sindsterblich“ – in der Funktion von Illustrationsmaterial. Häufig malen sie ihn durch Reihen tendenziellunendlicher Belege aus. Je allgemeingültiger und evidenter der Satz, desto zahlreicher die dazu denkbarenBeispiele. Sie gehen in dem locus communis auf und bilden mit ihm zusammen jenen allgemeinenGesichtspunkt, der in einem bestimmten Kontext und Parteiinteresse konsensfördernd eingebracht werdenkann. (Der locus der allgemeinen Sterblichkeit kann etwa dem Trost bei Todesfällen, der memento mori-Predigt, der kontingenzbedingten Warnung vor revolutionären Gedanken dienen.) E.R. Curtius hat in einem„Topik der Trostrede“ überschriebenen Kapitel Beispielkataloge berühmter Todesfälle gerade für dieBinsenwahrheit, daß alle sterben müssen, nicht ohne leisen Spott angeführt, um das Zwanghafte gewisserrhetorischer Gewohnheiten und traditioneller Bildungsinhalte vorzuführen; er hielt es jedoch nicht für nötig,noch ein Wort über die jeweilige besondere Funktion und Intention solcher topischer „Katalogarien“beizufügen. So hat er gerade an dieser Nahtstelle von Topos und Exemplum das Mißverständnis gefördert,Topoi seien notwendig Klischees.864 Dies können sie sein, wenn sie mißglückt sind, oder wenn sie aufgrundhistorisch bedingter Hochschätzung traditionsgeleiteter Stereotypie eine besondere Konsensfähigkeitbesitzen. In karolingischer Zeit erzeugen sakrosankte biblische „Denkbilder“ jene argumentativ erfolgreichenuniversalen Gesichtspunkte, die in anderen Zeiten durch „herrschende Meinungen“ gebildet werden.865 AlleVerbindungen von Topos und Exemplum, die diesem Muster folgen, lassen sich gut mit demDeklamationsmeister Seneca Rhetor als „Toposauffüllungen“ (implere locum) bezeichnen
864 CURTIUS, ELLM 90 ff.; dazu vgl. von MOOS Consolatio I/II § 32. – Zu anderen „ewigen“ Themen in topischerFunktion vgl. S. 285 ff., 295, 347 ff., 365 f. Als Ordnungsprinzip und Stichwortträger fungieren vor allem die Tugend- undLasterkataloge: vgl. BRÜCKNER, Hist. 58 ff. und unten Anm. 868.865 Zu den konsensabhängigen und den hermeneutischen Topoi s. oben Anm. 860 f. – Als Kontrast vgl. HENNIS (wieAnm. 601) 97 ff. zur Problematik der „herrschenden Anschauung“ und des „gesunden Menschenverstandes“ aufgrundmoderner Massenmedien.
430
und mit dessen Beispielen illustrieren:866 Cato war unbescheiden, Cicero verräterisch, Sulla mitleidlos; dieseSätze „füllen“ den locus: „niemand ist fehlerfrei“. Solche Beispiele sind beliebig ergänzbar und austauschbar;dem oft abschließend als Epimythion formulierten Topos gegenüber sind sie akzidentell. Welche rhetorischeÜberzeugungskraft sie dennoch haben konnten, läßt der kontextuell erzeugte literarische Reiz vermuten, denetwa die angeführte867 Exemplaliste Johanns zum Topos: „Über den Zusammenhang von Unfähigkeit undAmbition bei der Bewerbung um ein öffentliches Amt“ heute noch ausübt. Daß Beispielhäufungen imMittelalter und mehr noch in der Barockzeit – der Epoche der Krise (Kulmination und Selbstzerstörung) destopischen Denkens durch eine wahre Verzettelung und Rubrifizierung der Welt – tatsächlich oft einentrivialen, dekorativen, automatisch-tiradenhaften Charakter angenommen haben, soll damit keineswegsbestritten werden. Es geht darum, solche (im übrigen eher frühneuzeitliche als mittelalterliche) Phänomeneadäquat zu bewerten: als Pseudo-Topik, nicht als Grundlage des Topischen überhaupt.868 Sosehr seit Cicero diecopia rerum et verborum zur Topik gehört, dürfen Mittel und Zweck doch nicht verwechselt werden: Topikist ihrem Wesen nach eine Kunst, eine Methode, keine Enzyklopädie. Kenntnisfülle befriedigt hier nichtselbstzwecklich aleandrinischen Sammeleifer,
866 Sen. Controv. VII praef. 3 (implere locum), II 4.4 (Topos nemo sine vitio). Vgl. BONNER, Decl. (wie Anm. 557) 61 f.;GEBIEN 68 f.; CAPLAN, Invention 287 ff. und oben Anm. 573, Anm. 556.867 Vgl. oben S. 285 ff., 329 ff. zu Johanns Themenkreisen. – Zu amplifikatorischen Beispielreihen unter einemthematischen Zuordnungstopos vgl. auch MELVILLE, System 329 f.; LUMPE 1231, 1237. Ein reizvolles Beispiel bietetBoncompagno (wie Anm. 644) I 130 im Eingangsdialog zwischen auctor und liber: eine Aufzählung von exempla invidiae,beginnend bei Abel, Josef, Homer, Sokrates usw., gipfelt im eigenen Ich, das unter Kollegenneid zu leiden hat. Vomtopischen Exemplakatalog leiten sich ganze „Textsorten“ her, wie die Frauenschimpfliteratur mit ihren unerschöpflichenListen männlicher Helden oder Opfer seit Adam. Zur immanenten Gefahr der Verstofflichung der Topik vgl. oben S. 384 ff.,425 f.868 Zur frühen Neuzeit vgl. BRÜCKNER, Hist. 55 ff., Exemplasammlung 606; BARNER (wie Anm. 298) 59 ff.;DAXELMÜLLER, Exemplum 630; SCHON 70 ff. – Eine typische nachmittelalterliche Sonderform bespricht BRÜCKNER,Hist. 61: „Exempla sind die nach loci communes aus der Geschichte gezogenen Beispiellehren“. – Vgl. auch HeinerMÜHLMANN, Ästhetische Theorie der Renaissance, L.B. Alberti, Diss. Bonn 1981, 53 ff. zum locus communis-BegriffAlbertis, der unter Topoi „autorità ed essempli“, eine Art literarischer Amplifikationsbausteine für den Wiedergebrauchversteht; P. JOACHIMSEN, Loci communes, Eine Untersuchung zur Geistesgeschichte des Humanismus und derReformation, in: Luther-Jb. 8 (1926) 27–97, bes. 36 ff. betont zu Agricola das seit der Renaissance bestehendeMißverständnis der (aristotelischen) Topik: statt Gesichtspunkten galten nun substantielle Maximen als Topoi. NADEL (wieAnm. 494) zu dem starr nach Tugend- und Laster-Exempla angeordneten „commonplace book“ des Jean Bodin;WIEDEMANN (wie Anm. 765) 219 zum grundsätzlichen Unterschied zwischen der modalen ad-hoc-Topik der rhetorischenMethode und der statisch auf Bildungsinhalte gerichteten loci communes-Exzerpte der Neuzeit. Vgl. jetzt vor allemSCHMIDT-BIGGEMANN (wie Anm. 767) passim.
431
sondern ist um der Einsatzbereitschaft in der Hand des versatilen Redners willen erstrebenswert.869
93. Neben dem implere locum als „adhäsiver“ Beziehung des Beispiels zum (materialen) Topos, kennt dieRhetorik seit der Antike eine „inhäsive“, die nach einem explicare locum verlangt. Der Topos wird hiernicht durch Beispiele bestätigt und vor Augen gebracht, sondern er ist dem Beispiel inhärent, ja,gewissermaßen mit ihm identisch und wird aus diesem heraus im Sinne des Beweisziels voll entfaltet. DasExemplum ist dabei für die opinio communis so unbestritten gültig, wie etwa (laut Seneca) die GestaltenSokrates, Cato, Regulus d. J. als Inkarnationen des vir bonus schlechthin selbstverständlich sind. Doch geradeaufgrund solcher Geltung macht das Beispiel Deutungen in utramque partem möglich und regt zum intensivenAufspüren verschiedener kasuistisch diskutierbarer Aspekte an. Wir gelangen damit unter dem besonderenBlickwinkel der topischen Methode zur Grundunterscheidung dieser Arbeit zwischen illustrativen undinduktiven Exempla, zwischen Beleg- und Fallbeispielen zurück.870
869 Die Einheit der Funktionen „Vermehrung des Sachwissens“ und „Persuasionskunst“ zeigt Johann in Met. III 9, 153 auchmit Bezug auf naturwissenschaftliche Kenntnisse: Ergo solitus rerum cursus diligenter advertendus est et quodammodoexcutiendus nature sinus ut necessariorum probabiliorumque natura clarescat: nichil enim est quod a locorum notitiammagis prosit, nichil quod veritatis notitiam amplius pariat, nichil quod ad docendum aut persuadendum magis proficiat etomnium dicendorum prestet laudabilem facultatem. Letzte Basis allen Wissens und Redens ist die „Wirklichkeit“ (dazu vgl.S. 16 f., 421, unten S. 455, 507 ff. zu res und verba). Den Anlaß zu diesem Lob der Natur-Hermeneutik (excutere istJohanns Lieblingsausdruck für die Auslegungstechnik: s. S. 343, Anm. 668) bildet im Kontext des obigen Zitats dasphysikalisch-bedeutungskundliche „lithotheologische“ Phänomen der Diamantspaltung durch Bocksblut, das Fr. OHLYdurch die Zeiten verfolgt hat: Diamant und Bocksblut, in: Wolframstudien III, Berlin 1972, 73–188. Dieses Phänomen nenntJohann also locus im philosophischen und rhetorischen Sinn, und er empfiehlt die Sammlung solcher loci zu keineswegs nurenzyklopädischem Zweck. Vgl. auch oben Anm. 287 zu mal. Vorformen der Emblematik und Anm. 663 zur induktivenLogik der „Vereinzelung“ oder zum Denken in zeichenhaften Weltfragmenten als Gegensatz zu Systemdenken undempirischem Denken.870 Vgl. oben § 78; DAXELMÜLLER, Exemplum 632 und ders., Exemplum und Fallbericht 155 ff. zu der hilfreichenUnterscheidung „adhäsiver“ (illustrativer) und „inhäsiver“ (diskutabler) Exempla. – Zur Identität von Exemplum und Toposim inhäsiven Sinn, vgl. Sen., Ep. 71.17 (Inkarnationen des vir bonus) und dazu CANCIK (wie Anm. 38) 25 f.; GEBIEN108 ff.; GEERLINGS 149 ff.; vgl. auch MARROU, S. Augustin 58 f. zur „technique des topiques“ als Ciceros Lehre vonder Verallgemeinerung des Falls; dazu auch B. RIPOSATI, Studi sui topica di Cicerone, Mailand 1947, 101 ff.; McCALL114 ff.; PRICE 106 ff.; DAVID, Maiorum exempla 68 ff.; MICHEL, Rhétorique et philosophie (wie Anm. 546) 485 ff.,585 ff. u. ö. Zu der Verwertung literarischer und historischer Helden als Exempla durch die Scholisten vgl. JENNINGS 228etwa zu den Adnotationes in Lucanum ad X 344: Caesar […] exemplum sumendi poenam de tyrannis. – Den topischenFundortcharakter zeigt auch die kleine Variante zur Exemplumdefinition nach der Rhet. ad Her. (oben Anm. 374) beiJohannes von Garlandia, Poetria (oben Anm. 375 zitiert): ibi inveniuntur dicta et facta auctoritates et proverbia. – ZurBedeutung des Beispiels als Topos in der Renaissance vgl. MÜHLMANN (wie Anm. 868) 52 ff.; STRUEVER 185 f.;SCHMIDT-BIGGEMANN (wie Anm. 767) 16 ff.
432
Im strengen Sinn macht nur der zuletzt genannte (inhäsive) Bezug die topische Funktion des Exemplums aus,weil das Beispiel darin selbst als konkrete Hypothesis die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht nureiner infiniten Thesis als Hilfsmittel dient. Es wird als Teilphänomen einer allgemein akzeptiertenVergangenheit zum Stimulans der Gegenwartsreflexion. Am bekanntesten ist diese Art der Beispieltopik ausder römischen Zivilrechtspraxis und deren mittelalterlichem Fortleben. Hier wurden neue Fälle grundsätzlichan bereits entschiedenen Fällen und die Beziehung zwischen beiden aufgrund einer eigenen „Techne desProblemdenkens“ als identisch, partiell vergleichbar oder konträr beurteilt und diskutiert. Topisch ist daranebenso die konsensfähige Erinnerung an den früheren Fall wie die Bestreitbarkeit der Anwendung auf denvorliegenden Fall.871 Solche Problembeispiele
871 Vgl. § 67. – „Techne des Problemdenkens“: vgl. VIEHWEG (wie Anm. 4) 1, 4, 38 ff., 59 f.; HENNIS (wie Anm. 601)92 ff. mit Betonung des Gegensatzes zum axiomatisch-deduktiven Systemdenken; vgl. auch BORNSCHEUER (wieAnm. 587) 470; STROUX, Rechtswissenschaft (wie Anm. 3) 25 ff.; LANG (wie Anm. 4) 77 ff. (zu den loci mal.Rechtsauslegung); §§ 1, 67 f., S. 321 f., 353 f., Anm. 711. Verwandt mit der Exempla-Topik der Rechtskasuistik ist die„Stoffauffindungslehre“ der Bußund Beichtpraxis des Mittelalters, die sich in vielem mit derjenigen der kanonistischenStrafrechtspraxis deckt: vgl. NÖRR (wie Anm. 558) 365 f. zum Beichtstuhl als forum internum; GRÜNDEL (wie Anm. 4)103 ff.; LANG (ebd.) passim; BERLIOZ, Exempla et confession (wie Anm. 313) passim und vor allem P.MICHAUDQUANTIN, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XIIe–XVIe siècles), Analectamediaevalia Namurcensia 13, Löwen-Lille-Montréal 1962, 16 ff., 39 f. u. ö.; J. DIETTERLE, Die Summae confessorum(sive de casibus conscientiae) … in mehreren Nummern der Zs. f. Kirchengesch. 1903–5; J. LONGÈRE, Quelques Summaede poenitentia à la fin du XIIe et au debut du XIIIe ss., in: Actes 99e Congr. nat. des sociétés savantes (Besançon 1974), I,Paris 1977, 45–58; L.E. BOYLE, Summae confessorum, in: Les genres littéraires dans les sources théol. et philos.médiévales, Louvain-La Neuve 1982, 227–37; Pierre J. PAYER, The Humanism of the Penitentials and the Continuity ofthe Penitential Tradition, in: MSt 46 (1984) 340–54; ders., Sex and the Penitentials, Toronto/London 1984; A. MURRAY,Confession as a Historical Source in the Thirteenth Century, in: The Writing of History in the MA, Festschr. R.W.SOUTHERN, ed. R.H.C. DAVIS et al., Oxford 1981, 275–322; GURJEWITSCH (wie Anm. 313) 373 ff.; D.W.ROBERTSON Jr., A Note on the Classical Origin of „Circumstances“ in the Medieval Confessional, in: Studies inPhilol. 43 (1946) 6–14. Das ganze Gebiet ist in der literaturwissenschaftlichen Mediävistik noch entschieden zu wenigbekannt, obwohl doch gerade die mit dem „Predigtmärlein“ befaßte Volksliteraturforschung allen Grund hätte, sich dafür zuinteressieren. Die Bettelmönche, die „dem Volk“ Geschichten erzählten, waren auch Beichtväter und sammelten kanonistisch-poenitentielle casus, d. h. wahre und konstruierte Fälle des Lebens, in eigenen „Summen“. Wahrscheinlich würde einVergleich dieses Materials mit den auf den Kanzeln vorgetragenen oder in Exempelsammlungen angehäuften Erzählungen zuähnlichen Ergebnissen führen, wie in der neueren Barockforschung, die hier eine weitgehende Konvergenz von kasuistischerGelehrsamkeit und Volkskatechese festgestellt hat: vgl. oben Anm. 10, 69, 102, 214, 313, 287 und unten 1010. Es ist keinZufall, daß der Herzog in Shakespeares ‚Maß für Maß’ in die Rolle des Mönchs und Beichtvaters steigen muß, um die Weltvon unten kennenzulernen und so ein Casus-Exemplum als Weltsymbol erfährt (das Dutzende mal. und römischer Exemplader summum ius-summa iniuria-Topik in sich birgt).
433
waren im Mittelalter kein Monopol der Jurisprudenz, sondern allgemein beliebt zur Behandlung derverschiedensten Ambivalenzen, Unklarheiten, Normenkonflikte, „Gesetzeslücken“ oder kurz (mit Johanngesprochen) aller legitimen dubitabilia. Besonders eigneten sie sich für das Gebiet zwiespältiger moralischerAdiaphora. Zu dem topischen Problemkreis, ob ein Christ über den seligen Heimgang eines geliebtenMenschen weinen dürfe, bietet die mittelalterliche Literatur unabsehbare Beispielketten pro und contra an.Ludwigs IX. Tränen beim Tod seines Bruders sind für Joinville Anlaß, entschuldigend auf Bernhard vonClairvaux hinzuweisen, der seinen Bruder Gerhard beweint und mitten in einer Hoheliedpredigt beklagt hat.Bernhard selbst hatte in dieser Totenklage seine Tränen ausführlich mit den exempla imparia David undAbsalon und dem exemplum simile des um Lazarus trauernden Jesus gerechtfertigt.872 Ähnliche Beispieltopoifinden sich für immer wiederkehrende Verhaltensfragen wie: Darf ein Weiser heiraten? Darf er sich politischengagieren? Darf ein Kleriker lieben, erotische Gedichte schreiben,
872 Zu Joinville vgl. M. ZINK, ‚Joinville ne pleure pas mais il rêve’, in: Poétique 33 (1978) 28–45, hier 33 ff.; zu BernhardsSermo 26 super Cant. Canticorum ed. LECLERCQ/TALBOT, S. Bernardi opera I (Rom 1957) 169–81, hier 179 f. vgl.von MOOS, Consolatio I/II §§ 726 ff., bes. 812 ff. und allgemein zur Tradition solch topischer Exempla für und widerTränen ebd. III §§ 96 ff., 454 ff., 1335 ff. Johann selbst verwendet sie in Bezug auf die stoische Apatheia: vgl. obenAnm. 635.
434
in den Krieg ziehen? Erträgt christliche Vollkommenheit Lachen und Scherzen, Alkoholgenuß, den Besitzvon Reichtum? usw. Solche topischen quaestiones im Zwischenbereich von Norm und Normanwendungwerden durch Beispiele repräsentiert, die ebenso das Problem selbst vor Augen führen wie durchInterpretation oder Gegeninterpretation eine Lösung ermöglichen.873 Die Exempla sind hier die produktivenKristallisationspunkte der Argumentation (nicht anders als die schulrhetorischen und rechtskasuistischen Fälleder Antike) und überdies, soweit sie durch schriftliche Tradition vorgeprägt sind, „Nester“ autoritativerStellen, Interpretationen und Kommentare, die sich für oder gegen eine Sache verwenden lassen.
Das topische Verfahren kommt im Policraticus überall hervorragend zur Geltung: Es erklärt die radikaleFunktionalität der Exempla, die als mediale Aspekte, Anhaltspunkte, Gedächtnisstützen, Denkanstöße,Aufmerksamkeitserreger dem Redenden helfen, auf irgendwelchen mehr oder weniger verschlungenen Pfadender Hermeneutik, wie es gerade kommt, durch Vergleich, Allegorese, Gegensatzbildung usw. zur gemeintenSache, zu einer Wahrscheinlichkeit oder zur „Wahrheit“ zu gelangen und die gegnerische Position als„Irrtum“ zu widerlegen.874
873 Beispiele allein aus den Werken Johanns vgl. §§ 44, 69, 74, 80 f.874 Zwischen Gedankenführung und Aufmerksamkeitserregung, bzw. zwischen dem Exemplum als Erkenntnismittel und alsPersuasionsmittel vermittelt Johanns probabilistisches Ideal approximativer Wahrheitsfindung durch disputatio vgl. S. 4 f.,168 f., 195 ff., 252 ff., 295 ff. Basis für die rhetorische Induktion ist ihm die Induktion der Erkenntnistheorie, in derexemplum als seelisch-körperliches Analogiemittel die Schaltstellung zwischen den aus Sinneswahrnehmungen stammendenBildern des Gedächtnisses und der schöpferischen Einbildungskraft einnimmt. Vgl. Met. IV 9, 174 f.: … quia […] respercipit, earundem apud se deponit imagines quarum retentione et frequenti revolutione quasi thesaurum sibi format. Dumvero rerum volvit imagines, nascitur imaginatio; que non modo perceptorum recordatur, sed ad eorum exemplaconformanda sui vivacitate progreditur. Met. IV 10, 175 f.: Imaginatio itaque a radice sensuum per memorie fomitemoritur, et non modo presentia, sed et absentia, loco quidem vel tempore, per quandam simplasim, quam nosconformationem possumus dicere intuetur. Vgl. S. 9 f., 147, Anm. 1000. Zu der nicht von Plato, sondern Aristoteles u.Boethius bestimmten Erkenntnispsychologie vgl. LIEBESCHÜTZ 76 f.; Dal PRÀ 70 ff.; ODOJ 44 ff.; McGARRY 666 ff.;M. W. BUNDY, The Theory of Imagination in Classical and Mediaeval Thought, (Univ. of Illinois Studies in Lang. andLit. 12) Urbana 1927, 184; F. A. YATES, The Art of Memory, London 1966, 56. – Ähnliche Konzepte glaubt KESSLER(Problem …) 187 bei Salutati als ganz neue, spezifisch humanistische nachzuweisen. – Zu den je nachArgumentationsinteresse wechselnden hermeneutischen Perspektiven s. S. 331 ff., 469 f.; LAUSBERG §§ 420, 230 f. (die 3Grade des Verhältnisses zwischen Beispiel und vorliegender causa: Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, Gegensatz), sowie obenAnm. 858 zur Voraussetzung in aristotelischen Denkformtopoi.
435
C) EXEMPLA IM DIENST DER „EINEN WAHRHEIT“ ODER DER KONKORDANZ VON ANTIKE UNDCHRISTENTUM
Konkurrenzloses Heilswissen und ergänzendes Bildungswissen (§ 94). Naturideal und Universalität der Wahrheit (§ 95). ZumProblem der zeitlosen Einheit wahren Wissens und des Wissensfortschritts von den antiqui zu den moderni (§ 96).Integrationsmethoden der traditionellen interpretatio christiana heidnischer Literatur, vor allem das exemplum impar (§ 97).Umgekehrte Methoden der „interpretatio naturalis“ und Traditionskombinatorik: Christliches in antikem Gewand (§ 98);Antikes in christlicher Aufmachung (§ 99). „Reliteralisierte“ Bibelallegorien und nicht geistlich ausgelegteGlaubensgeheimnisse: spielerische Formen moralphilosophisch-rhetorischer Meta-Allegorese (§ 100). Verlegenheitwissenschaftlicher Beschreibungstermini: Manierismus, Säkularisation, Blasphemie, Synkretismus u. ä. versus „préciosité“und „subtilité“ (§ 101). Ein apokryphes Paulus-Exemplum als Johanns Legitimation des Konkordanzprinzips (§ 102).Extensive Bibelauslegung und Ausklammerung zentraler Glaubensinhalte: zwei Formen hypothetisch-praeterspiritueller Ethikund Lebensweisheit (§ 103). Johanns Boethius-Lob (§ 104).
94. Eine der beliebtesten Fragen der Policraticus-Forschung betrifft Johanns Verhältnis zur Antike. Es wärefalsch, das Problem isoliert und nur für die heidnische Antike zu behandeln. Schon der Gedanke deruniversalen Verfügbarkeit und Nutzbarkeit „alles Geschriebenen“ einschließlich der historischen Exempla legteine Betrachtung nahe, die von Johanns Einstellung zu aller vergangenen Literatur ausgeht.875 DerHumanismus Johanns besteht gerade in einer gewissen Gleichschaltung herkunftsmäßig verschiedener Texteund Exempla, jedenfalls, was deren rhetorische Applikation betrifft. Er leugnet zwar grundsätzlich weder dieWerthierarchie der heidnischen, jüdischen und christlichen Zeugnisse noch den fortschreitenden Prozeß derGesamtgeschichte als Heilsgeschichte; er arbeitet gelegentlich auch mit typologischen Steigerungen (dieallerdings oft kaum vom rhetorischen exemplum a minore ad maius ductum zu unterscheiden sind).876 Erbetont überdies laufend in obligaten Zitatüberleitungen den höheren Rang der biblischen, „gläubigen“,„kanonischen“ historiae und bekennt unzweideutig, daß nur das christliche Wissen heilsnotwendig sei. ImKontext seiner Argumentationen fällt jedoch weit weniger der sozusagen minimale Kern unersetzlichen und
875 Vgl. Anm. 894 zu antiqui.876 S. 458 ff. Der „Rechtgläubigkeitsnachweis“ erübrigt sich und ist auch erwartungsgemäß schon erbracht worden, etwa nachPol. VII Prol.; VIII 8, (II) 278 f.; VII 23, (II) 204 f.; IV 3, (I) 242; Enth. 1269 ff., 1517 ff., z. B. bei MISCH 1173 ff.,BROOKE (wie Anm. 35) Introd. CLIV. Zu den eher sekundären heilsgeschichtlichen und typologischen Vorstellungen vgl.S. 203 ff., 513 ff.; Pol. VII 13, (I) 149 (figuraveritas); Pol. IV 6, (I) 251 ff.; MICZKA 41 f.
436
konkurrenzlosen Glaubensgutes ins Gewicht als der große Schatz des ergänzenden antiken Wissensgutes, daser, wo nicht für heilsnotwendig, so doch ausdrücklich für absolut bildungsnotwendig hält.877
Auch er leugnete – wie wohl jeder mittelalterliche Autor – die Autonomie antiker Kultur in dem Sinne, daß ersich eine beziehungslos neben der christlichen stehende „zweite Wertordnung“ unmöglich denken konnte.Auch er
877 Zum höheren Rang der christlichen Exempla vgl. Ep. 276, (II) 584: eorum (Stoicorum) opinio explosa est et fidelissimaratione et virtute rectius philosophantium et quod potentissimum est, sacrae scripturae praeceptis et exemplis. Pol. II 27, (I)145: oben in Anm. 470 zitiert (canonica et cui fides incolumis adquiescit discutiatur historia). Pol. IV 6, (I) 256, S. 572;vgl. Pol. VIII 8, (II) 278; VIII 20, 373; I 4, (I) 27; III 9, 197; IV 6, 253 und §§ 55, 95, S. 411 ff., A. 527, MICZKA 38,44 f.; Ph. BARZILLAY, The Entheticus de dogmate Philosophorum of John of Salisbury, in: Mediaev. et Humanistica 16(1964) 11–29, hier 16. – Zum Begriffspaar „heilsnotwendig“-„bildungsnotwendig“ vgl. Heinrich DÖRRIE, Der heroischeBrief, Berlin 1968, 343; Pol. VII 9 bringt beides ausdrücklich mit anderen Begriffen zusammen; (II) 128.25 ff.: Ego autemin illorum sententiam facillime cedo qui non credunt sine lectione auctorum posse fieri hominem litteratum … Dennochfolgt 129.28 ff. die Unterscheidung von Bildung und „Weisheit“ im Sinne der christlichen Heilslehre: Cum constet […]sapientiam sine virtute esse non posse, quis ex sola lectione, nisi adsit gratia illustratrix vivificatrixque virtutum, credatfieri hominem sapientem? In Met. I 22, 51.26 ff. wägt Johann Bildung und Ethik gegeneinander ab und kommt, einebildungsfeindliche Lesart Senecas (Anm. 600) verwerfend, zu folgendem humanistischen Ausgleich: Sentit hic [Sen.Ep. 88.1–2] quod discipline liberales virum bonum non faciunt. Ego ei consentio; et de aliis ipsum arbitror. Scientia eniminflat, sed caritas sola virum facit bonum [cf. I Cor. 8.1, …] Grammaticus, inquit, circa curam sermonis versatur; et utlongius evagetur, circa historias; ut longissime procedat, circa carmina. Hoc autem parum non est, sed plurimum prodestad informationem virtutis, que facit virum bonum. Ähnlich verknüpft Johann den christlichen Glückseligkeitsbegriff mitphilosophischen Eudaimoniavorstellungen in Pol. VIII 25, (II) 413, 421 ff., bes. 423.3 ff.: …cum et infidelium dogmatanichil utilitatis habent, nisi aliquid conferant beatitudini. Sed his omissis aut potius praemissis, dico quia haec sola suntquae sola possunt facere et servare beatum, cum ab altero iustitiae ramo, proveniat, ne cui noceatur ab altero ut sibiquisque et aliis prosit […] Visne beatus esse? Porro beatus vir qui timet Dominum [Ps. 111.1; …] Ecce habes viamverissimam et fidelissimam, assequendum statum quem desiderat Epicurus; et si eam tenueris, beatus es et bene tibi erit[Ps. 127.2]. Haec ad bene beateque vivendum potest sola sufficere … Zum Kontext s. oben S. 166; vgl. auch S. 491 f., 497zur praeteritio. Zu weiteren ähnlichen Kombinationen vgl. Pol. VIII 8, (II 878 f.; VII 9, (II) 128 f.; S. 446 ff. Zur „goldenenRegel“ als Inbegriff heidnischer und christlicher beatitudo vgl. S. 441 f. Zu den angeführten u. a. Stellen vgl. SIMONE (wieAnm. 746) 918; DELHAYE, Le bien (wie Anm. 385) 219; KERNER 27; GARFAGNINI, Ratio disserendi (wie Anm. 394)930; SMALLEY, Becket Conflict (wie Anm. 689) 91.
437
blieb also bei der reductio artium ad sacram scripturam stehen, wenn man darunter nicht dogmatischeVergewaltigung und Verkürzung, sondern rationale Arbeit der „Rückführung“ auf den verbindlichenWurzelgrund göttlicher Offenbarung in der Natur, in der menschlichen Vernunft, im „Menschenherzen“ undvorzüglich oder am klarsten in der Heiligen Schrift versteht.878 Sein Bildungsoptimismus beruht auf der inseiner Zeit neu durchdachten Grundidee von Röm. 2.14, daß die Heiden Gottes Gesetz von Natur aus erfüllen,weil es ihnen ins Herz geschrieben ist; und auf der davon bestimmten, seit der Patristik traditionellenHypothese, daß alles Gute der heidnischen Antike immer schon christlich, d. h. „wahr“ im christlichen Sinnesei. Daraus zieht Johann jedoch nicht den möglichen „reduzierenden“ Schluß, daß die Bibel allein genüge, weilsie ohnehin auch alle natürliche Wahrheit einschließe; er zieht vielmehr den „expansiven“ Schluß, daß sichdie Christen gerade um den außerbiblischen Teil der Wahrheit noch nicht genug gekümmert hätten und daßfolglich antikes Wissen mit größerem Eifer
878 Vgl. SIMONE unter diesem Titel (wie Anm. 746) 888 f.: die Instrumentalität der antiken Kultur ermöglichte derenprogressive Assimilation von der Patristik zur Renaissance; zum Fortwirken dieser Konzeption auch noch bei denRenaissance-Humanisten vgl. BÉNÉ (wie Anm. 794) 43 f. und § 110. – Hauptgrundlagen: Aug., Doctr. christ… I 4.4;22.20; IV 6.10; II 40.60–61, vgl. S. 371 ff., 396 ff., A. 729. FONTAINE, Christentum (wie Anm. 552) 5 f. wendet sichallerdings gegen die pauschale Verwendung des reductio-Begriffs im Sinne Augustins (der antikes Wissen in den Dienst desBibelstudiums gestellt wissen wollte) mit dem triftigen Hinweis auf Isidors Wissenschaftsideal aufgrund von Sap. 7.17–20,das rationale Erkenntnis der Schöpfungsnatur, einschließlich der menschlichen Geschichte (s. oben § 83) mit gläubigerErkenntnis des Schöpfers nahtlos verbindet. Meine weitere Fassung des Begriffs dürfte diesem Einwand Rechnung tragen, dasich Johann auf die in der Bibel mitenthaltenen natürlichen Normen bezieht. Präziser wäre freilich eine neu zu bildendeFormel wie (nach Sap. 7.17): reductio ad scientiam veram. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß später geradeErasmus in der rigoristischen (augustinischen) Linie wieder den „reduktionistischen“, ausschließlich auf die Bibel bezogenenSinn des Gedankens betont: Non credimus philosophis nisi cum scriptura consentiant (Ausgew. Schriften, ed. W. WELZIG,Darmstadt 1969, 450). – Zur Bedeutung von Röm. 2.14–6 und zur Idee des „ins Herz geschriebenen Gesetzes“ (z. B. nachAug., De lib. arb. 1.6.15; De div. quaest. 83.53.2) vgl. § 83, S. 575, A. 526, 732, 882 (bes. Pol. III 1, [I] 173) undallgemein WEIGAND (wie Anm. 882) 123 f. O. KUSS, Die Heiden und die Werke des Gesetzes (nach Röm. 2.14–16),Münchener Theol. Zs. 5 (1954) 77–98. Von zentraler Bedeutung für Johanns Konkordanzidee ist zweifellos auch AbaelardsIdentifikation des paulinischen „Naturgesetzes“ mit der menschlichen Vernunfterkenntnis (bei vor-mosaischen Patriarchen undheidnischen Philosophen) als einer göttlichen Erleuchtung sowie die Auffassung des Evangeliums als bloßer reformatio ebendieser natürlichen und begnadeten ratio. Vgl. dazu JOLIVET, Doctrines et figures…, passim, bes. 103 ff.; GREGORY,Abelard et Platon (wie Anm. 752).
438
gesucht und dargestellt werden müsse. Denn es gibt, wie er immer wieder hervorhebt, nur eine einzige,universale, unveränderliche Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Sie teilt sich dem Menschen in größeren oderkleineren Stücken mit, am weitesten und reichhaltigsten in der Bibel, aber ein wenig auch in den Schriften derPhilosophen. Diese dürfen keineswegs als „quantité negligeable“ angesehen werden, weil sie etwa (materiell)dasselbe sagen wie die Heilige Schrift, sondern müssen vielmehr besonders genau studiert werden, weil siedasselbe anders sagen, oft in verhüllter Weise, und somit der Auslegung bedürfen. In ihrem „wahren“ Werthermeneutisch wiederhergestellt, können sie die Bibel präzisieren, verdeutlichen, mit Beispielen undParallelen belegen, d. h. vor allem in concreto ergänzen und bereichern. (Auch hier also ein Vorrang desexemplum vor dem praeceptum, der pragmatischen utilitas vor dem Abstrakten und Absoluten!) Die seit derAreopagrede des Apostels Paulus alle christliche Mission bestimmende Grundannahme, daß das Christentumsich zur Antike nicht als Gegensatz, sondern als Erfüllung verhalte; daß es deren Lücken fülle, deren Fragenbeantworte, wird im 12. Jahrhundert gewissermaßen von der anderen Seite her interpretiert: In Vergessenheitgeratene Gemeinsamkeiten sind es nun wert, beim Namen genannt zu werden, damit die Christen nicht etwahinter die Heiden zurückfallen und ob ihrer eigensten Heilsbotschaft die erste und allgemeine Offenbarung inder erkennbaren Natur sowie die darauf gerichtete natürliche Erkenntnis, Weisheit und Philosophievernachlässigen.879 Daraus erklärt sich die Tatsache, daß
879 Zu diesem Unterschied der patristischen und hochmittelalterlichen Integrationsweise vgl. JEAUNEAU, Lectio (wieAnm. 428) 152 f. zum Mittelalter; FONTAINE, Christentum (wie Anm. 552) 14 zur Alten Kirche, deren Verhältnis zurantiken Kultur nicht in unseren Begriffen von „Koexistenz“ oder „Konflikt“ zu beschreiben ist, sondern als die Frage, wie„durch die überlieferten antiken Ausdrucksformen hindurch […] das Wesentliche des Kerygma“ bewahrt werden konnte; vgl.auch S. 303 ff., 424 f., 400, 496 ff.; grundsätzlich BLUMENBERG, Patristik (wie Anm. 36) 487 f. zu dem patristischenVersuch, das Inkommensurable des Christentums als Antwort auf alte Fragen auszugeben; C. J. STARNES, Boethius andthe Development of Christian Humanism: The Theology of the Consolatio, in: OBERTELLO, Atti … Boeziani (wieAnm. 435) 27–40, bes. 30 ff. zu Augustins Idee des „natürlichen Menschen“ (Civ. VIII 9–10; Conf. VII 9) in ihrerBedeutung für Boethius; DÖRRIE, Spätantike, Symbolik (wie Anm. 425) passim mit der bedenkenswerten Feststellung,daß die Konkordanzidee im Sinne einer „natürlichen Theologie“ der anima naturaliter christiana bis etwa 1850 (!) gegenüberaller heidnisch-christlichen Antithetik überwogen habe. Vgl. darum auch BRÜCKNER, Hist. 38 und Wh. MAURER, Derjunge Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation I, Göttingen 1967, 99 zur unangefochtenen Geltung desKonkordanzprinzips in der Reformation. – CURTIUS, Musen (wie Anm. 794) 179 f. behauptet demgegenüber ausunerfindlichen Gründen, „Baudri“ (= Baldrich) von Bourgueil habe für die christliche Verwertung aller Literatur im Sinne dernatürlichen und universalen Wahrheit „als erster“ die „systematische Begründung“ geboten (vgl. S. 456).
439
Johann wichtigste Gedanken heidnischen Zitaten anvertraut, obwohl er ebensogut christliche hätte wählenkönnen, und daß im Policraticus die antiken Exempla gegenüber den christlichen zahlenmäßig bei weitemüberwiegen.880
95. Sein vordringliches Interesse gilt dem Universal-Verbindlichen, d. h. dem Nicht-nur-Christlichen amChristentum oder, was dasselbe ist, dem Schon-Christlichen an der heidnischen Antike; in seiner eigenenBegrifflichkeit ausgedrückt: einem Naturmodell, das die historischen Ungleichheiten der „Sitten“ und„Zeitalter“ ebenso wie alle meinungsmäßigen menschlichen Antinomien
880 Allein die Konstruktion der Institutio Traiani als Gesamtrahmen für die politischen Lehren der Bücher 5 und 6(S. 464 ff.) zeigt a fortiori das Ansehen der antiken auctoritas, das sogar in Pol. V Prol. den ausdrücklichenGlaubensvorbehalt nötig macht; vgl. (I) 280.15 ff.: Nam deducta superstitione gentilium fidelis est in sententiis [… s. untenAnm. 892]. Virgilio licuit aurum sapientiae in luto Ennii quaerere, quae invidia est ea, quae ad eruditionem nostram agentilibus scripta sunt, nostris communicare? (Donat, Vita Vergil. 18, s. oben S. 396, unten A. 973 auch zu Röm. 15.4). –Ein sinnfälliges Beispiel für Johanns ständige Zuflucht zur antiken Autorität in dafür nicht gerade prädestinierten Kontextenist das Zitat von Horaz, A. P. 47 f. im Lob Bernhards von Clairvaux, dem die Bibelsprache derart in Fleisch und Blutübergegangen sei, daß er „fast nur noch in authentischen Worten“ reden konnte, in der Hist. Pont. XII 27 f. (s. Anm. 746). –KERNER (147) fällt nach einem Vergleich des Policraticus mit karolingischen Fürstenspiegeln auf, daß Johann seltenalttestamentliche Könige als Herrscherexempla verwendet. – In einem Querschnitt durch die Rezeptionsgeschichte desAdversus Jovinianum von Hieronymus hat DELHAYE (wie Anm. 385) 79 festgestellt, daß Johann den Bibelstellen derpatristischen Vorlage aus dem Wege geht und sich einseitig auf antike Philosophen-dicta und facta beschränkt: „c’est unenote caracteristique du Policraticus“. Dies bestätigt generell auch LIEBESCHÜTZ 49 f., 67 ff. DELHAYE zeigt überdies (Lebien, [wie Anm. 385] 219), daß Johann, obwohl er die christliche Wahrheit überall voraussetzt, die stoffliche Hauptquelle inder heidnischen Antike findet: „Il raisonne comme si, pour lui, un argument repris aux classiques portrait mieux qu’unrecours a l’autorité de l’Evangile“. Diese Methode stellt den genauen Gegensatz zu der von Ambrosius und Aelred vonRievaulx bei Ihren Adaptationen des ciceronischen De officiis angewandten dar: Sie suchen systematisch heidnische durchbiblische Beispiele zu ersetzen. Dazu vgl. GEERLINGS 165 ff. und OHLY, Schriften 346 ff. – Die Frequenzen der Exempla-Arten im Policraticus sind unten S. 603 (Exkurs IV) zusammengestellt. Dabei ist der Unterschied von quantitativ meßbaremund qualitativem Humanismus zu berücksichtigen (vgl. S. 415 f. sowie OHLY, Schriften 346 ff. zu Aelred; von denSTEINEN, Menschen … [wie Anm. 664] 199 zu Hildebert). Im übrigen ist, wie PÉTRÉ (122) zu Tertullian anmerkt, inRechnung zu stellen, daß das NT an sich entschieden weniger Exempla enthält als das AT und die ganze Bibel wiederumweniger als die antike Literatur. Trotzdem dürften die Resultate in Relation zu mittelalterlichen Mittelwerten (im dargelegtenSinn) verwertbar sein.
440
und Probleme ausgleicht; denn natura bedeutet ihm soviel wie der (Hierarchie stiftende) Wille Gottes, ist ineinem weiten Sinn ein Synonym für iustitia, ordo, aequitas, moderatio, rerum convenientia, moderamenrationis. Dieses Naturideal bildet nicht nur den Fluchtpunkt seiner humanistischen Perspektive, sondernverleiht auch den vielen heterogenen Gegenständen seiner beiden Hauptwerke eine geheime theoretischeKonsistenz. Die Verbindungslinien zwischen seinem gesellschafts-, bildungs- und wissenschaftstheoretischen,seinem politologischen, kosmologischen, methodologischen, erkenntnispsychologischen,rechtsphilosophischen und theologischen Gedankengut, die in der fast uferlosen, für all dies zuständigenSpezialforschung bis heute immer wieder zu neuen komparatistischen Überraschungen führen, wären ohne dasPotential dieses Naturbegriffs kaum entdeckt worden. Am bekanntesten sind Johanns naturphilosophischeund stellenweise „naturtheologische“ Gedanken zum Naturrecht, zum natürlichen Sittengesetz, zum Staat alsOrganismus, zu den Seelenkräften und der Gesellschaft als Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie.„Naturgemäßheit“ läßt sich darüber hinaus aber auch als methodisches Ordnungsprinzip literarischer undhermeneutischer Orientierung (analog zum topischen Ausgleichsverfahren) verstehen, gewissermaßen als derAriadnefaden im Labyrinth der copia rerum et verborum.880a
In zwei prägnanten Stellen über die natürliche Gotteserkenntnis und über die „goldene Regel“ der Ethikverweist Johann auf die Spannung des Naturmodells im Verhältnis zum biblisch-heilsgeschichtlichen Modellder drei
880a Diese kurzgefaßte These wird im Folgenden unter humanismusgeschichtlichen Aspekten abgestützt; zu andernGesichtspunkten und zu interdisziplinären Querverbindungen vgl. § 86, S. 175, 400 f., 448, und (sehr aufschlußreich)WILKS (wie Anm. 546) 269 ff. zum Zusammenhang des politisch-rechtlichen aequitas-Begriffs der Naturrechtslehre mitdem philosophischen Ausgleichsdenken (in utramque partem, suum cuique, „akademische Skepsis“, Ideal der Mitte,„Toleranz“, dialogische Kompromißbereitschaft u.a.m.) in umfassender Ablehnung alles „Absoluten“, Extremen undSpezialistischen. Grundlegend ist andererseits: P.E. DUTTON, Illustre civitatis et populi exemplum, Plato’s Timaeus and theTransmission from Calcidius to the End of the Twelfth Century of a Tripartite Scheme of Society, in: MSt 45 (1983)79–119, bes. 108 ff. zur überlieferungsgeschichtlich nachgewiesenen Wirkung des platonischen Harmoniemodells aus ‚Staat’und Timaios-Fragment in der Erklärung der physikalischen Welt (des Kosmos und des menschlichen Leibes) durch die(ideale) Gesellschaftsordnung (und umgekehrt) auf mehrere Denker des 12. Jhs., wobei Johann ausnehmend die politisch-moralische Normativität dieser Naturidee ins Zentrum stellt, obwohl auch er deren anthropologisch-theologischenImplikationen kennt (dazu s. auch oben S. 391 f.).
441
epochalen Entwicklungsstufen:881 Omnium temporum una est fides. „Alle Zeiten haben den einen gleichenGlauben, daß Gott gerecht und gütig zugleich ist […]. Kein Weiser hat dies je, vor, unter dem Gesetz und unterder Gnade in Zweifel gezogen […]. Es gibt bestimmte Gesetzesvorschriften, die von immerwährenderVerbindlichkeit und unbeschränkter Rechtskraft für alle Völker sind und unter keinen Umständen ungestraftaufgehoben werden können. Vor dem Gesetz, unter dem Gesetz und unter der Gnade bindet alle Menschen eineinziges Gesetz: Was du nicht willst, daß dir getan werde, das tue auch keinem anderen, und was du willst, daßdir getan werde, das tue auch dem anderen.“ Diese zwei aus dem Kirchenrecht stammenden Formulierungen(sie dienen ihm punktuell als Kritik an Aberglauben und fürstlicher Selbstherrlichkeit) bezeugen JohannsEngagement für allgemeingültige praecepta in einem nicht nur streng naturrechtlichen Sinn: Es gilt derRekonstruktion oder Anamnese eines in seinen Augen zu wenig beachteten natürlichen Sittengesetzes.882
881 Pol. II 27, (I) 154.2 ff.: Omnium temporum una est fides, Deum esse eundemque iustum et bonum et remuneratoremsperantium in se, omne plene meritis respondentem [cf. Hebr. 11.6]. Ante legem, sub lege, sub gratia, nemini rectumsapienti venit istud in dubium. Pol. IV, 7, (I) 259.3 ff.: Sunt autem praecepta quaedam perpetuam habentia necessitatem,apud omnes gentes legitima et quae omnino impune solvi non possunt. Ante legem, sub lege, sub gratia omnes lex unaconstringit: Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris; et: Quod tibi vis fieri faciendum, hoc facias alii (cf. Tob. 4.15;Matth. 7.12). – Vgl. Albrecht DIHLE, Die Goldene Regel, Eine Einführung in die Geschichte der antiken undfrühchristlichen Vulgärethik, Göttingen 1962, 109 ff. Eine andere Fassung der „goldenen Regel“ in Pol. VIII 25 s. obenAnm. 877. Zu den drei heilsgeschichtlichen Zeitstufen bei Johann und zum Kontext der Stellen vgl. MICZKA 46 ff. Vonder sozialethischen „goldenen Regel“ der Antike dürften Beziehungen zur christlichen via regia vieler Fürstenspiegel (alsaequitas-Prinzip) bestehen; EBERHARDT (wie Anm. 264) 285 f., 510 ff. bringt entsprechende Belege (u. a. obige Pol.-Stelle), ohne diesen Zusammenhang zu erwähnen.882 Diese Stellen (Anm. 881) dürften einer (für Johann typischen) extensiven Lesart theologischer und kirchenrechtlicherKonzeptionen im Sinne einer allgemeinen Naturphilosophie entsprechen: Einerseits knüpft die Formulierung una fides inPol. II 27 (implizit auch in Pol. IV 7) an die frühscholastische Diskussion der beliebten quaestio von Einheit undVeränderung des Glaubens bei antiqui und moderni an, wofür die dialektische Lösung vom „Wachstum“ (Dogmenfortschritt)bei gleichbleibender Glaubenssubstanz verbreitet war. Vgl. oben Anm. 753 (crevit fides) und unten Anm. 895 (Aug.); Greg.In Ez. II 4.7 (PL 76) 977 D: una est veterum ac novorum patrum fides; GRABMANN, Schol. Meth. II 276 ff.; LUBAC(wie Anm. 430) III 345 ff.: FUNKENSTEIN (wie Anm. 366) 52 f., 166 f. (mit weiterführender Lit.; vgl. auch obenAnm. 210a). – Andererseits überträgt Johann mehrere Naturrechtsvorstellungen auf die politische Ethik (in Pol. IV 7unmittelbar auf die Verantwortung des Fürsten dem Sittengesetz gegenüber): Lex naturalis kann gemäß derheilsgeschichtlichen Dreiteilung im Unterschied zu lex scripta und gratia die vor dem Mosaischen Gesetz bestehende Norm,also den status ante legem bezeichnen; vgl. z. B. Sententiae Anselmi (ed. F. BLIEMETZRIEDER, Anselm von Laon,Systematische Sentenzen, [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. MA’s, 18.2–3], Münster 1919, 78 ff.). Nach einer anderenTradition, die sich im ersten Satz des Decretum Gratiani niederschlug, ist gerade die lex scripta, nämlich das Alte und dasNeue Testament, als göttliches Gesetz „natürlich“: D. I 1 (C.I.C., ed. FRIEDBERG I, 1879) 2: Ius naturale est quod in legeet evangelio continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri.Unde Christus in evangelio [Matth. 7.12]: ‚Omnia quaecunqe vultis ut faciant vobis homines, et vos eadem facite illis. Haecest enim lex et prophetae’ Vgl. Rudolf WEIGAND, Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irnerius bisAccursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus (Münchener Theol. Stud. III 26) München 1967, 132 ff. An dieseDefinition klingt Pol. IV. 7 (in Anm. 881) an, erweitert die Norm jedoch „auf alle Völker“. Dies entspricht der drittenTradition des Naturrechtsbegriffs: Im Römischen Recht heißt lex naturae soviel wie ius gentium, allgemeingültiges, nicht anlokale oder ethnische „Sitten“ gebundenes Recht (WEIGAND a. O. 12 ff.). Die Kanonisten bis Gratian übernahmen dieseVorstellung aus Isidor, Et. V 4.1: vgl. Gratian I 1 c. 7 (a. O.): Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubiqueinstinctu naturae, non constitutione aliqua habetur … Die Kombination der „völkerübergreifenden“ römischen mit derheilsgeschichtlichen Naturrechtsvorstellung gelangte aufgrund der Identifikation von ius naturale mit lex divina bei Isidor,Et. V 2 in das Kirchenrecht; s. Gratian a.a.O. D. I c. 1: Hinc Ysidorus […] ait: ‚Divinae leges natura, humanae moribusconstant’ (vgl. WEIGAND 126 ff., 132). Allerdings findet sich bereits bei Iustinian, Inst. 1–2–11: Sed naturalia iura quaeapud omnes gentes peraeque servantur divina providentia constituta semper firma atque immutabilia permanent (vgl.WEIGAND 15). Besonders interessant für Johanns Begriffserweiterung ist hier auch das Dictum Gratians post 9c. 11(FRIEDBERG) 18, wo die oben Anm. 214 angeführte Augustin-Stelle Civ. I 22.2 über den Vorrang der ratio vor denexempla (bzw. die Identität beider bei glaubensgemäßen Exempla) so kommentiert wird: Cum ergo naturali iure nichil aliudprecipiatur, quam quod Deus vult fieri, nichilque vetetur, quam quod Deus prohibet fieri; denique cum in canonicascriptura nichil aliud quam in divinis legibus inveniatur, divine vero leges natura consistant: patet, quod quaecumque
442
Diese normative Ordnung bedeutet nun aber auch die gute Schöpfungsnatur des Kosmos und des Menschen, inder Physikalisch-Biologisches und Ethisch-Politisches aufeinander beziehbar werden; dieselbe „Natur“, dieandererseits als ein von Gott geschriebenes „Buch“ (wie gezeigt) auch die vielfältigsten intellektuellenBeschäftigungen begründet. Die wesentlich christliche Grundlage dieser paradoxerweise für die Rezeptionnichtchristlichen Gedankenguts
divinae voluntati seu canonicae scripturae contraria probantur, eadem et naturali iuri inveniantur adversa. Undequecumque divine voluntati, seu canonicae scripture, seu divinis legibus postponenda censentur, eisdem naturale iuspreferri oportet. Constitutiones ergo vel ecclesiasticae vel saeculares, si naturali iuri contrariae probantur, penitus suntexcludendae. Dazu (und zum Dictum Gratiani 6 c. 3) vgl. WEIGAND 135: „Das Naturrecht ist zwar ganz in der HeiligenSchrift enthalten, aber nicht alles, was in ihr enthalten ist, gehört zum Naturrecht, sondern nur die sittlichen(moraltheologischen) Vorschriften, von denen die ‚mystischen’ … zu unterscheiden sind“. Dies ist mutatis mutandis auch derSchlüssel zum Verständnis der unterschiedlichen Vorstellungen von natürlicher Moral u. Glaubensgeheimnis (S. 456 f.),sensus historicus u. mysticus (S. 491 f.), ratio (civilitatis rudimenta) u. religio (S. 471 f., 498 f.) bei Johann; m.a.W.: DieKonkordanz von heidnischer und christlicher Weisheit beschränkt sich auf das Gebiet der Ethik (– immerhin ein weitesFeld!). Gratians oben angeführter „Syllogismus“ aus Decretum 9 c. 11 zur Rechtsquellen-Hierarchie unter der „letztenInstanz“ des göttlichen Willens (d. h. des „Naturrechts“) entspricht auf dem Gebiet der Bildungstheorie und Ethik demaugustinischen Prinzip des universalen usus aller scripturae als Gottes Wort in Pol. VII 9–10 (s. oben § 83); und dieabschließende Verwerfung positiven Rechts zugunsten des Naturrechts in Konfliktfällen ist eine Konsequenz der im gleichenZusammenhang geäußerten augustinischen Antithese consuetudo/exemplum versus ratio (s. oben Anm. 3, 214). Zu diesenKonnotationen kommt bei Johann die ganze an sich schon komplexe Bedeutungsskala der Naturbuch-Metapher hinzu(Anm. 732). Insbesondere der Gedanke der Erstoffenbarung Gottes in der Schöpfungsnatur für die gesamte Menschheit allerZeiten (vor, neben, unter und nach dem „Gesetz“ der Juden) liegt nahe bei dem lex naturae-Begriff sowohl imvölkerübergreifenden wie im heilsgeschichtlichen Sinn. Vgl. dazu POST (wie Anm. 640) 513. ff. – Allgemein zurNaturrechtsvorstellung vgl. R. SPECHT, Materialien zum Naturrechtsbegriff der Scholastik, in: Arch. f. Begriffsgesch. 21(1977) 86–113 mit weiterführender Literatur; zum Verhältnis von Naturbuch und Naturgesetz vgl. OHLY, Denkform (wieAnm. 234) 75 ff.; zu discretio/prudentia in der deliberatio zwischen Dialektik und Ethik vgl. P.J. PAYER, Prudence andthe Principles of Natural Law: A Medieval Development, in: Spec. 54 (1979) 55–70. – Weitere, über die Rechtstheoriehinausgreifende Stellen zum normativen Naturbegriff Johanns sind z. B. Met. I 1, 5.5 ff.: gegen den Rhetorik- undBildungsverächter Cornificius: Adversus insigne donum nature parentis et gratie calumniam […] excitat […] Naturaclementissima parens omnium et dispositissima moderatrix […] hominem privilegio rationis extulit et usu eloquii insignivit[…] ius humanae societatis que quodammodo filiorum nature unica et singularis fraternitas est. Pol. VI 25, (II) 73.17 ff.:Rem politicam legitur Socrates instituisse et in eam dedisse praecepta quae a sinceritate sapientiae quasi quodam fontenaturae manare dicuntur. Pol. VI 21, 59 f.: Rem publicam ad naturae similitudinem ordinandam […] ut vita civilisnaturam imitetur quam optimam vivendi ducem saepissime nominavimus. Zu den platonischen Begriffen s. S. 175 ff.,571 ff., Anm. 923; DUTTON (A. 878a) 108 ff.; KERNER 152 f., 178 zum aequitas- und Naturrechts-Begriff-(bes. nachPol. IV 1–2); POST (wie Anm. 640) 502, 513 ff. zu lex naturae im moralischen und politischen Bereich; J. NEWELL,Rationalism at the School of Chartres, in: Vivarium 21 (1983) 108–26 zu einem (unabhängig von Abaelard) verbreitetenVertrauen in die natürliche ratio vor der scholastischen Aristoteles-Rezeption (Johann, Wilhelm von Conches, Theodorichvon Chartres u. a.); JOLIVET, Doctrines … 103 ff.; D.E. LUSCOMBE, Natural Morality and Natural Law, in:KRETZMANN (wie Anm. 586) 705–19.
443
eminent förderlichen Naturvorstellung dürfte ideengeschichtlich ebenso wichtig sein wie das durch denGlauben geweckte Interesse an platonischen und stoischen Texten über das Ideal der Naturnachahmung in dervita civilis und privata (Timaios-Fragment, Cicero, Seneca, Macrob u. a.). Verständlich wird das Ideal auchdurch die gegenteilige Realität, den Abfall von der Natur, die alienatio oder Entfremdung. Für Johann und fürandere „Naturalisten“
444
des 12. Jahrhunderts bis zu Alan von Lille erscheint in der „Gegennatur“ (wohl noch klarer als in positivenAussagen) der idealistisch-utopische Sinn der Naturkonzeption. Denn diese meint nicht die empirische Welt,sondern „die Schöpfung, wie Gott sie gewollt hat“, wie sie war vor dem Sündenfall und wie sie durch universalgültige Ethik immer und überall wiederherzustellen gesucht wird.883 Viele Exempla Johanns sind unter diesemAspekt satirisch
883 Zur kosmologischen und moralphilosophischen Bedeutung des naturam sequi bei Johann vgl. KERNER 170 ff., 195;POST (wie Anm. 640) 216 ff.; BERGES (wie Anm. 640) 131 f.; Ernst WERNER, Stadt- und Geistesleben imHochmittelalter, Weimar 1980, 178 ff. und vor allem LIEBESCHÜTZ 23 ff., der (23) „man’s alienation from his true self“als das zentrale Thema des ganzen Policraticus bezeichnet; zur allgemeinen Bedeutung dieses Gedankens im Mittelalter vgl.überdies: ders., Das zwölfte Jh. (wie Anm. 28) 262 ff.; MEERSSEMANN (wie Anm. 405) 122 ff.; von MOOS, Hildebert(wie Anm. 211) 281 ff.; VON DEN STEINEN, Humanismus (wie Anm. 664) 200 ff. zur Idee des „vollkommenen“,natürlichen Menschen bei Alan u. a. (204 Zitat); ders., Natur und Geist im 12. Jh., in: Die Welt als Gesch. 14 (1954) 71–90;G. LADNER, Renewal (wie Anm. 181) 10 ff.; ders., Homo viator, Medieval Ideas on Alienation and Order, in: Spec. 42(1967) 233–59, hier 254 ff.; P.G. SCHMIDT (ed.), Johannes de Hauvilla, Architrenius, München 1974, Einf. 100 ff. zurWirkung Alans. Zu dem ganzen hier nur gestreiften Bereich vgl. auch die Kongreßbeiträge in: ‚La filosofia della natura nelMedio Evo’, Mailand 1964. – Zu Met. IV 20, 187 vgl. CHENU, Théol. (wie Anm. 664) 32 ff.: Die Natur des Menschen alsTeil der guten Schöpfungsnatur (Mikrokosmos-Makrokosmos) hebt nach Nemesius von Emesa den Unterschied zwischennaturwissenschaftlich-physikalischer und ethisch-politischer Naturvorstellung auf. Hierzu vgl. auch KLIBANSKY, Chartres(wie Anm. 542) zu der parallelen Ineinssetzung der beiden Bedeutungen von ratio (causa/Vernunft) in einemnaturidealistischen Kausalitätsbegriff nach Enth. 609 ff. 155: Causarum series natura vocatur, ab illa/Sensilis hic munduscontrahit esse suum./Et si vicinis concordant plasmata causis/Tunc natura parens omne figurat opus/[…/…] plane nihilest, quod ratione caret. – Vgl. auch allgemein STÜRNER (wie Anm. 516) passim und ders., Gesellschaftsstruktur (wieAnm. 412) 163 ff.; STRUVE (wie Anm. 923) passim und ders., The Importance (wie Anm. 779) 315 ff.; CONGAR (wieAnm. 735) 206 ff.; LADNER, Erneuerung … und ders., Idea of Reform (wie Anm. 179) passim; WETHERBEE (wieAnm. 394) 158 ff., 188 ff., 242 ff.; STOCK (wie Anm. 538) 63 ff., 227. – Zum besonderen Zusammenhang solchdoppeldeutiger Naturvorstellungen mit dem Urzustand Adams vor dem Fall vgl. noch R. BULTOT, ‚Quadrivium’, ‚natura’et ‚ingenium naturale’ chez Guillaume d’Hirsau, in: Riv. di Filos. neoscolastica 70 (1978) 11–27, hier 15 ff. (zu Joh. Cass.,Coll. VIII 21) – Zum Fortleben der Vorstellung vom göttlich natürlichen „Urmenschen“ Adam in der franziskanischenSpiritualität und im Humanismus Petrarcas scheint mir ein Hinweis BURDACHS (wie Anm. 837) 163 ff. weiterverfolgenswert.
445
entlarvend gemeint; sie wollen das Leben als Un-Natur, als Schein und Komödie, als Illusionskulisseveranschaulichen.884 Sie sollen von der Naturentfremdung und Selbstvergessenheit der Höflingezurückverweisen auf die philosophische Echtheit des „naturgemäßen Lebens“ und der Selbsterkenntnis.„Natur“ ist dabei keineswegs als Gegensatz zu Kultur zu verstehen. Johann sieht darin vielmehr mit Quintilianden Inbegriff der Rhetorik im weitest möglichen Sinn: Naturhaft ist die allen Menschen gemeinsameSprachfähigkeit, die Kommunikation, die (topisch) konsensbildendes Reden und „kunstgemäßes“(methodisches) Handeln zivilisatorischer Art bis hin zum Städtebau möglich macht, sowie jene „zweite Natur“der durch Übung herangebildeten Kunstfertigkeit (facultas) auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit.885
Naturmaß und Entfremdung sind christlich begründete Vorstellungen, auch wenn sie nicht von der naturalapsa oder der regio dissimilitudinis (dem geistlichen Fremdsein in der Welt der Sünde) ausgehen, sondern vonder (vielleicht etwas semi-pelagianisch bewerteten) natura creata, und derart eine Beschäftigung mit Textenaller Art, biblischen und heidnischen, in der rein humanen Dimension ermöglichen.886 Indem Johannunablässig zu zeigen sucht, daß Heilige Schrift und antike Philosophie sich in vielen Bereichen gegenseitigunterstützen, bekennt er sich nicht etwa zu einer synkretistischen Nivellierung der Religion nach unten oderaußen, sondern zu deren Ergänzung, Bereicherung und Vertiefung auf einem der zentralen Heilsbotschaft
884 Vgl. §§ 88, 106.885 Die einschlägigen Stellen Met. I 1, 5 ff. (z. T. oben Anm. 882); I 10, 27 ff.; III 9, 153 (vgl. oben Anm. 869) u. a. sindhäufig kommentiert worden; vgl. etwa MISCH 1250 ff.; CURTIUS, ELLM 474 f. – Zu einer Voraussetzung: demrhetorischen Naturbegriff der Antike vgl. MICHEL (wie Anm. 402) 515 ff. (Cicero); SCHIAN (wie Anm. 5) 11, 92 f., 192 f.und VARWIG (wie Anm. 578) 60 ff., 153 f. zu Quintilian.886 Vgl. LADNER, Homo viator (wie Anm. 883) 237 ff.; s. auch S. 491 f., 501 f. Das Thema der Welt als Exil imGegensatz zum „Wohnen im Himmel“ kommt, so untypisch es für Pol. und Met. ist, in den späten Briefen Johannsallerdings viel deutlicher zum Ausdruck. Vgl. die beinahe „bildungsfeindliche“ Stelle in Ep. 256 (II) 518, in der Johannseine früheren gelehrten und schöngeistigen Freuden in Canterbury mit seinem geistlichen Aufschwung während seines realenExils in Frankreich vergleicht: apostolus […] docet omnem mundi supellectilem ut stercora contempnendam, ut solum inquo omnes thesauri expetibilium sunt lucrifaciam Christum [cf. Hebr. 10.1, 9, 12; Phil. 3.8]. Et quidem (ut ad tuos gentilestranseam) omnium philosophantium sectae rerum mundialium contemptum praedicant. Welche biographischen oderentwicklungs psychologischen Gründe man für den Wandel beibringen mag – das nach Abschluß der beiden Hauptwerke1159 erwachte Interesse für negative Theologie in der pseudo-dionysischen Tradition gehört vielleicht auch in diesenZusammenhang (vgl. §§ 103 f., S. 301 f., Anm. 589, 598, 1054) –, sollten doch auch die unterschiedlichen Gattungsgesetzevon persönlichem Brief und Traktat nicht unterschätzt werden. – Zu der im Humanismus des 12. Jhs. mehr oder wenigerspürbaren semi-pelagianischen Unterströmung vgl. von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 284 ff., 289 ff.; HansLIEBESCHÜTZ, Kosmologische Motive in der Bildungswelt der Frühscholastik (Vortr. d. Bibl. Warburg 3) Leipzig/Berlin1926, 85 f., u. a. zum Einfluß des Joh. Scotus Eriugena; NEWELL (wie Anm. 882) 108 ff.; J. FRIED, Über denUniversalismus der Freiheit im Mittelalter, in: HZ 240 (1985) 313–361, hier 346 ff. zu Abaelard und Johann.
446
gegenüber arbeitshypothetisch gewissermaßen „ausgezonten“ Gebiet, das ihn allerdings als sein eigentlichesSpezialgebiet besonders interessiert.887
Nicht nur Gastfreundschaft, sondern auch den legitimen Umgang mit dem Heidentum lehrt folgendesPolicraticus-Exemplum aus Eusebius:888 Gregor von Nazianz, der sich bei seinem Gewitter verirrt hatte, wurdevon einem militant antichristlichen Apollopriester als Gast in dessen Tempel aufgenommen. Er lohnte esdiesem mit situationsgemäßer „Toleranz“ dem Dämonenglauben
887 Vgl. die oben Anm. 880 zusammengefaßten Urteile DELHAYES. – Einen möglichen Einfluß der „Schule von Chartres“auf Johanns Harmonisierungstendenz aufgrund der Annahme einer „einzigen Wahrheit“ ist nach WETHERBEE (wieAnm. 394) 22 f., 28 erwägenswert; vgl. auch N.M. HÄRING, The Creation and Creator of the World according to Thierry ofChartres and Clarembald of Arras, in: AHDLMA 30 (1955) 137–216 = Die Erschaffung der Welt und ihr Schöpfer …, in:Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, ed. W. BEIERWALTES, (WdF 197), Darmstadt 1974. 21–57;JEAUNEAU, Lectio (wie Anm. 428) 152 f. u. ö. zur Lehre vom integumentum bei Wilhelm von Conches u. a. Autoren imUmkreis Johanns als „Bereicherungsversuch“; GREGORY, Abélard (wie Anm. 752) 38 ff.; LOHR (wie Anm. 560) 100 ff.zu Abaelards apologetischer Befestigung der Trinitätslehre mit jüdischen und heidnischen Parallelen als occasio convertendifür Ungläubige. Solche Quellenbezüge betreffen zusammen mit den oben Anm. 882 erwähnten kanonistischen Grundlagenmehr die theoretische Basis der Konkordanzidee. Für die Praxis wichtiger war die schulmäßig verbreitete, im 12. Jh.wissenschaftlich vervollkommnete Methode des hermeneutisch-dialektischen Autoritätenvergleichs. Vgl. oben § 65 zuraristotelischen Philosophie und Theologie, § 67 zur Jurisprudenz; MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 113 ff. zurSchulübungstechnik des Hin- und Herbeziehens heidnischer und biblischer Autoren (dazu s. auch S. 490).888 Pol. VIII 13, (II) 325 f. nach Euseb. Hist. eccl. VII 25; 325.11 ff.: Hanc quoque gratiam (humanitatis) nec adversaereligionis nec praecedentis inimicitiae titulus perimit. Mehr zu dieser Anekdote und ihrem Kontext s. unten S. 461 f.; zumToleranzbegriff s. S. 454.
447
gegenüber, und diese Menschlichkeit bewirkte ihrerseits, daß der heidnische Priester sich zum Christentumbekehrte. Die Anekdote zeigt besonders schön, wo die Schwelle zwischen der Ebene des „kulturellenAustausches“ und der höheren Ebene der Inkommensurabilität von Religion und Götzendienst liegt: Johanninterpretiert nur die erstgenannte Ethik der humanitas als sein eigentliches Thema der Geschichte, nicht aberdie geistliche Pointe: den Missionserfolg.
Die Suche nach einer allgemeinen, natürlichen, humanen Ethik bestimmt einige literarischeEigentümlichkeiten Johanns. Er liebt besonders Vergleiche und doppelte Belege aus heidnischen undchristlichen, aus vergangenen und zeitgenössischen Quellen, weil se invicem interpretantur auctores.889 Solchesich gegenseitig erhellenden Autoritäten sind etwa Plato und Jeremias, Sokrates und Salomo, Seneca undPaulus sowie Plato und der Evangelist Johannes.890 Letztere Parallele wird allerdings mit gelehrter Vorsicht,aber nicht ohne Entdeckerfreude festgestellt.891 „Der große Kirchenvater Augustinus bezeugt – sofern, wasich unter seinem Namen lese, verläßlich ist –, daß in den platonischen Büchern zu finden ist, was der heiligeEvangelist Johannes vom Himmel her anstimmte: ‚Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott […]‘bis: ‚Und das Licht scheint in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht angenommen.‘ Hätte ich diesnicht in den Schriften der Väter gelesen, nie hätte ich geglaubt, daß es irgendeinem Ungläubigen gestattet war,seinen Mund zu öffnen und solch ein Licht, das kein irdisches Auge sehen darf, zu weissagen.“ Die Stelle stehtkeineswegs in theologischem Kontext, sondern in einer doxographischen Würdigung Platons.
96. Parallelisierungen dieser Art verweisen gelegentlich behutsam auf die durch Abaelard wesentlichprovokativer formulierter Theorie von der göttlichen Erleuchtung einzelner – aus der Finsternis ihresZeitalters herausragender
889 Met. III 1, 123 oben S. 380.890 Plato-Jeremias: Pol. VII 5, (II) 108; Plato-Johannes: ebd. 110; Sokrates-Salomo: Pol. IV 6, (I) 256 (s. S. 572, A. 414);Seneca-Paulus-Hieronymus: Pol. VIII 13, (II) 318 f., bes. 319.1 ff.: Qui Apostoli familiaritatem meruisse constat et adoctissimo Ieronimo in sanctorum catalogo positum (vgl. ähnlich auch Enth. 1267 f. nach Hier. De vir. ill. 12 [PL 23] 662;vgl. NOTHDURFT, [wie Anm. 846] 42 f., 111 f.)891 Pol. VII 5, (II) 110.10 ff.: Magnus pater Augustinus auctor est (si tamen quae sub nomine eius concepta legi recolofideliter) quod in libris Platonicorum inventum sit quod beatus evangelista Iohannes altius celo intonuit et quam humanamens percipere queat, licet auris utcumque possit audire; inventum est inquam, quod ait ab initio Evangelii: ‚In principioerat Verbum’ et cetera usque ad locum quo ait: ‚Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt.’ Egoquidem, nisi in patrum scriptis legeretur, nequaquam alicui infidelium concessum crederem ut os in tantae lucis oraculumaperiret quam oculus mundanus non sufficit intueri. … (cf. Conf. I 9.13).
448
– Heiden und von deren Anteil an der Offenbarung; eine Theorie, die sich in nuce auf patristische Autoritätstützen konnte, wie etwa auf Augustins Überzeugung, daß alle Wahrheit, von wem immer sie gesagt wird, vomHeiligen Geist stamme.892 Johann spricht in diesem Zusammenhang
892 Die eben angeführte Stelle aus Pol. VII 5 und insbesondere auch die kurz davor (108.15 ff.) entwickelte Theorie, daßPlaton im Timaios von der Trinität gesprochen habe, könnte nach JEAUNEAU (wie Anm. 428) 289 von AbaelardsInspirationslehre beeinflußt sein. Vgl. auch CHENU, Conscience de l’hist. (wie Anm. 361) 113 f, GREGORY, Abélard (wieAnm. 752) 44 ff. und neuerdings MEIER, Eriugena … (wie Anm. 27) zu analogen Vorstellungen in der ps.-dionysisch-erigenistischen Tradition. Die Vorstellung der Inspiration der Heiden kommt vornehmlich in der oben Anm. 665 und untenAnm. 920 zitierten Stelle: Pol. III 9, (I) 197 f., im Bild der göttlichen „Erleuchtung“ hervorragender, ihrem Zeitalter „wieSterne“ vor-leuchtender Gestalten zur Sprache. Dazu vgl. unten §§ 106 f.; FREUND (wie Anm. 537) 69 f. Vgl. auch Pol. VProl., (I) 280 f. zur partiellen Glaubensgemäßheit Plutarchs: … deducta superstitione gentilium fidelis est in sententiis […]Si quid autem apud eum a fide dissentit aut moribus, tempori potius quam viro adscribatur. Auch hier wird dashervorragende Individuum als Wahrheitsträger seinem irrenden Zeitalter entgegengesetzt, eine Vorstellung, die m. E. ganz aufdiese Funktion der Rechtfertigung heidnischer Kultur beschränkt bleibt und darum nicht anachronistisch im Sinne unsererGenie- oder gar Avantgarde-Begriffe verstanden werden kann. Auch die integumentum-Theorie (vgl. S. 179 ff., 366 f.,Anm. 664) erlaubt Johann, das Thema der Inspiriertheit Vergils vorsichtig anzudeuten, indem er einen Unterschied zwischenMenschen und Texten derart einführt, daß der „Geist“ durch die „einwohnende Gnade“ zwar nur den Auserwählten zuteilwird, die göttliche Weisheit aber Autoren wie Vergil zum Sinn verhelfen kann (Pol. VIII 24, [II] 415.10 ff.): Si verbisgentilium uti licet Christiano – qui solis electis divinum et Deo placens per inhabitantem gratiam esse credit ingenium (etsinec verba nec sensus credam gentilium fugiendos dummodo vitentur errores) hoc ipsum divina prudentia in Eneide sua subinvolucro fictitii commenti innuisse visus est Maro. Vgl. Anm. 423 – Augustin: vgl. Doctr. christ. II 18.28 oben inAnm. 734. Zur Grundlage in der früheren Lehre vom Logos-Christus, der, mit der Wahrheit identisch, Teile der Wahrheit inalle Menschen „eingesät“ hat, vgl. J.H. WASZINK, Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos spermatikos, in: ‚Mullus’,Festschr. Theod. KLAUSER (JbAC Erg.-Bd. 1) Münster 1964, 380–90; J. HOLTE, Logos Spermatikos, Christianity andAncient Philosophy according to St. Justin’s Apologia, in: Stud. Theol. 12 (1958) 109–68. – Zum Einfluß der vornehmlichaugustinischen Formulierungen des Konzepts vgl. SIMONE (wie Anm. 746) 893 ff. Petrarca hat Doctr. christ. II 18.28(Anm. 734), ohne Augustin zu nennen, übernommen, und man sah darin ein spezifisch renaissancehaftes, patristisch-mittelalterlichen Rigorismus aufbrechendes Manifest: s. BUCK, Patristik (wie Anm. 528) 159, 166 zu Fam. XXI 10 (IV76); ähnlich auch B.L. ULLMAN, The Humanism of Coluccio Salutati, Padua 1963, 61 zu Salutati; demgegenüber betonenLUCIANI (wie Anm. 528) 9 und BÉNÉ (wie Anm. 794) die Konstanz des universalen christlichen Wahrheitsbegriffs derPatristik in der Renaissance. Vgl. auch S. 528 f.
449
statt vom Heiligen Geist lieber von der ewig gleichen, unveränderlichen Wahrheit Gottes, die, wie erwiederholt betont,893 „dieselben Aussagen bei antiqui und moderni erzeugt“. Dabei versteht er unter „denAlten“ ebenso antike Philosophen wie christliche Kirchenväter, d. h. überhaupt alle geistige Tradition (dicta)und exemplarische Geschichte (facta).894 Die These der Einheit alles wahren Wissens führt ihn zuPointierungen wie dieser:895 Ein irgendeinmal in der Vergangenheit richtig erfaßter Aspekt der Wahrheitveralte nicht durch eine attestatio novi auctoris. „Was einmal wahr ist, bleibt immer wahr.“ Die in solchenFormulierungen verborgene Spitze gegen alle Traditionsverächter an Schulen und Höfen, gegen dialektischeCornificiani und oberflächlich-modische curiales tritt in offenem Spott über aufgeblasene
893 Vgl. S. 303, 383, 450, 504 ff. Pol. Prol. 17.17 ff.: Scripturarum quoque testimoniis… quandoque usus sum; ita tamenut nichil fidei aut bonis moribus inveniatur adversum, ac si sententias tam modernas quam veteres eadem incommutabilisveritas genuisset (vgl. Aug., Doctr. christ. I 8.8–9). Es folgt das unten Anm. 904 angeführte Ovidzitat. In diesem Kontextbedeutet scripturae wohl: scriptores moderni im Gegensatz zu den auctores (nicht etwa die Bibel). Vgl. auch Met. III 4, 136in Anm. 539 (licet modernorum et vetrum sit sensus idem).894 In Pol. VIII 23, (II) 400.3 ff. bedeutet antiqui z. B. die frühen Christen: Antiqui quondam trahebantur […] admartirium. Nach der Grundtendenz des Werks spielt diese begriffsgeschichtliche Unterscheidung (vgl. auch FREUND, [wieAnm. 540] 69 ff.) jedoch praktisch nur eine geringe Rolle: Zu den antiqui/veteres gehören mehrheitlich die antiken Denkerund Exempla-Helden als Vorboten der christlichen Wahrheit oder, was dasselbe ist, als Zeugen der einzigen Wahrheit.895 Pol. VII 1, (II) 94 f. zu incommutabilis et indeficientis veritatis unitas s. das Zitat oben Anm. 591. – Met. IIIProl. 118.23 ff.: Rerum enim veritas permanet incorrupta, nec umquam, quod in se verum est, attestatio novi auctorisevanescit. (novus ist oft das negative Pendant zu modernus: vgl. Anm. 902). Met. IV 32,200: nicht nur die notwendigenabsoluten principia wie die der Mathematik (vgl. oben Anm. 586) seien „unsterblich“ und „überzeitlich“, sondern auch dievon der göttlichen Vernunft angeschaute Wahrheit, so unterschiedlich und historisch wandelbar (in der Zeit fortschreitend)deren menschliche Erkenntnis auch sei: Ex hoc autem veritatis rationisque consortio quibusdam philosophantibus visum estsemper esse verum quod semel est verum; quibus videtur suffragari ratio quam Augustinus inducit, ut doceat nostram etprecedentium patrum eandem esse fidem; etsi nos parte gaudeamus impletum quod illi prestolabantur implendum. Ait enim[cf. Tract. in Iohann. XLV 10.9; Enarr. Ps. I 17]: ‚Non est mutata fides, etsi variata sint tempora. Et nos et illi eandemamplectimur veritatem, sed aliis et aliis sermonibus predicamus. Dazu vgl. CHENU, Théol. (wie Anm. 604) 99, 114 f.;§ 84, A. 882. Allgemein zum antiqui-und moderni-Problem vgl. auch GÖSSMANN und HARTMANN (wie Anm. 537)und die dort verzeichnete Literatur.
450
Autodidakten in der Entdeckerpose hervor:896 „Weisheitsschwadroneure brüsten sich, aufs Neue gefunden zuhaben, was schon die Alten wußten und seither längst bekannt ist, was dank der Zeugenschaft der Bücher überviele Jahrhunderte bis in unsere Zeit geleitet worden ist.“ Die Vorstellung erinnert an die Redensart vom„nochmals entdeckten Amerika“; doch vor der kopernikanischen Wende gilt eine umgekehrte Wertung:Nicht, daß einer unselbständig, zu wenig empirisch vorgeht und kein wirkliches „Neuland“ (auch dies eineheute positive Wissenschaftsmetapher) findet, sondern, daß er das längst gegebene Alte aus selbstverschuldeter Traditionslosigkeit, als „Esel auf eigene Faust“ (Goethe) eigenmächtig für das Neue hält, wirdals lächerlich empfunden. Nichts ist demnach unwissenschaftlicher als der Versuch, Neues unter der Sonne zuerforschen, bevor man das Alte gründlich kennt.
Das Prinzip einer einzigen, sich immer gleich bleibenden Wahrheit steht nun allerdings in einem paradoxen,gelegentlich widersprüchlichen Verhältnis zu dem ebenso wichtigen Gedanken, daß der Mensch diese Wahrheitauf Erden nie restlos erkennen kann, sich jedoch dauernd darum bemühen soll: vom Alten her und in derdemütigen Hoffnung, vielleicht doch noch etwas Weniges über das Alte hinaus zu erkennen.897 Johann geht eshier wesentlich
896 Pol. VII 12, (II) 137.4.9 ff.: […] iactatores sapientiae […] iactant se invenisse de novo quod tritum est ab antiquis ettestimonio librorum per etates multas ad tempora nostra perductum. Zum mal. und neuzeitl. Begriff der inventio vgl. U.HÜGLI/U. THEISMANN, Invention, Erfindung, Entdeckung, in: HWbPh, IV, 544–74, bes. 572. Vgl. auch Met. II18.96.6 ff. (oben Anm. 666 zitiert) zur falschen Sucht eines jeden Nachkommenden, die Ansichten seiner Vorgänger umjeden Preis zu ändern, anstatt doctoris sui inherere vestigiis; wozu Ter. Phorm II 4.14: fere quot homines tot sententiae diesatirische Maxime abgibt. Interessanterweise findet sich diese anscheinend konservative Auffassung sogar bei Abaelard,dessen Bevorzugung kommentierender gegenüber „inventiver“ Arbeit Johann in Met. III 4 (s. oben in Anm. 536)ausdrücklich lobt und der in seiner Dialectica (II Prol., ed. L.M. De RIJK, Assen 1956, 146.8 f.) schreibt: Neque enimminorem aut fructum aut laborem esse censeo in iusta expositione verborum quam <in> inventione sententiarum. Vgl. auchEnth. v. 43 ff., 139 über die „autodidaktische“ Jugendrevolte der Cornificiani: […] si quid forte probare velis,/Undiqueclamabunt: ‚vetus hic quo tendit asellus?/Cur veterum nobis dicta vel acta refert?/A nobis sapimus, docuit se nostraiuventus,/Non recipit veterum dogmata nostra cohors‘ … Dazu vgl. auch CURTIUS ELLM 62 f.: JEAUNEAU, Lectio (wieAnm. 428) 59, 302 zur Priszian-Glosse Wilhelms von Conches: sumus relatores et expositores veterum, non inventoresnovorum, die noch von Erasmus zitiert wurde (vgl. auch Montaigne in Anm. 708a). Letztlich liegt ein vergleichbarerWahrheitsbegriff auch hinter dem späteren ad fontes-Prinzip der Renaissance-Humanisten: vgl. BRÜCKNER. Hist. 38 undunten Anm. 1032.897 Vgl. S. 381 ff.
451
darum, die nicht vom Menschen gemachte Welt „der Dinge“, die göttliche veritas rerum, die vom Menschenauch nicht verändert werden kann, zu unterscheiden von deren partieller „Lesbarkeit“ in einer Welt dermenschlichen Zeichen, die – insbesondere an der Oberfläche der verba, weniger in der Tiefe der sensus – demWandel alles Zeitlichen unterworfen ist.898 Solche Veränderung ist kein Ideal, sondern eine Notwendigkeit,die wertfrei hingenommen werden muß. Denn sie bedeutet, negativ betrachtet, Traditionsverlust,babylonischen Zerfall des natürlichen Einheitswissens in chaotisch historischen Meinungswirrwarr,899 aberebenso, nun in positivem Sinn, die fruchtbare, offen-endlose hermeneutische Diskussion über die Vielfalt derMeinungen, die erneuernde Wiederherstellung unklar gewordener Worte, vergessener Bedeutungen und inglücklichen – d. h. hier: gnadenhaften – Augenblicken den Gewinn neuer Einblicke in die objektiv ewig gleicheWahrheit. Diese inventio des Neuen unterscheidet sich von der modernen Vorstellung eines autonomenErkenntnisfortschritts einmal durch die implizite methodische Bindung an die Tradition: Die neue Einsichtfolgt dem gleichen „Geist“, in dem schon die „Alten“ ihre „Erfindungen“ gemacht haben.900 Sodann ist auchder Erkenntniszuwachs eine Gnade und keineswegs ein selbstverständlich aus menschlicher Forschungerwachsendes Resultat. Derselbe Geist Gottes, der alles Wahre der bisherigen Kultur inspiriert hat, bewirkt afortiori im letzten christlichen Stadium eines Geschichtsprozesses stufenweiser Vervollkommnung, daß vieles,was früheren Generationen noch verborgen war, allmählich ans Tageslicht kommt.901
898 Vgl. Met. III 4, 128 f.: […] veritatem rerum, quoniam eam homo non statuit, nec voluntas humana convellit. Itque, sifieri potest, artium verba teneantur et sensus. Sin autem minus, dum sensus maneat, excidant verba; quoniam artes scirenon est scriptorum verba revolvere, sed nosse vim earum atque sententias. Zu einer philologischen Konsequenz vgl. untenS. 496 f. Zu veritas rerum im Verhältnis zu sensus/sententiae S. 507 f., 455. Zu den zwei auctor-Begriffen: Gott als auctorrerum, der Mensch als auctor verborum vgl. oben Anm. 802 und MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 36 ff., 73 ff.899 Vgl. oben S. 303 zu Pol. VII 1, 94 f.900 Vgl. Met. III 4, 135 f. oben Anm. 538, 755 f.; bes. 136.15 ff. und 25 f.: maioribus […] quorum floruerunt ingenia etinventione mirabili pollentes: laboris sui fructum posteris reliquerunt […]. Im nani-gigantes-Gleichnis können die„Zwerge“ non utique proprii visus acumine weiter sehen. Met. III 6.143.15 ff. zur Topik des Aristoteles: Non tantum huicoperi tribuo, ut inanem reputem operam modernorum, qui equidem nascentes et convalescentes ab Aristotile, inventis eiusmulta adiciunt rationes et regulas prioribus eque firmas. Ceterum hoc Aristotili debetur. Vgl. auch oben Anm. 755 zu einerParallele bei Otto von Freising.901 Zur Bedeutung der Gnade in der Bildungs- und Erkenntnistheorie Johanns vgl. z. B. Met. IV 36, 208.13 ff.: Homo veroquantuscunque, affectat quidem certiorari; eo quod amor veritatis cognatus et innatus est rationi […] Hec utique aliundenon provenit, quam si aliqua stilla divine sapientie per gratie eliquationem seipsam infundat et mentem se querentis etamantis illustret. Vgl. Anm. 877 zu gratia illustratrix, Anm. 878a zu amor veritatis innatus (z. B. nach Aug. En.Ps. 25.4–5). Pol. VIII 25 (II) 421.18 ff.: Non tamen eatenus Maronis aut gentium insisto vestigiis ut credam quempiam adscientiam aut virtutem propriis arbitrii sui viribus pervenire. Fateor gratiam in electis operari et velle et perficere(Phillipp. 2.13). Vgl. auch WETHERBEE (Anm. 394) 91 f. sowie Anm. 752, 882 (Met. I 1.5), 892, S. 519; Anm. 589(Ep. 209, 318 f.) zur scharfen Trennung von ratio probabilior im Sinne der dialektischen Topik und einer nur im Glaubenerlangbaren sapientia Dei, deren articuli: omnem omnino transcendunt rationem und die Weise zu Toren macht. – Zumchristlichen „Fortschrittsproblem“ bei Johann vgl. oben § 84. Allgemein zum heilsgeschichtlichen Aspekt einerVervollkommnung der Kirche auch nach der Zeitenmitte und in dialektischem Verhältnis zum senescens saeculum „dieserWelt“ vgl. BUISSON, Potestas 49 f.; ders., Exempla 460 ff. sowie oben Anm. 755, 760, unten § 105.
452
So vortrefflich manches schon von den antiqui gedeutet und gesagt worden ist, sind doch nicht sieunübertrefflich, sondern die Sache selbst ist menschlicher Schwäche nie ganz ausdeutbar. Dem Lob der antiquimuß darum das Lob der moderni – wie etwa in folgender Stelle – keineswegs widersprechen:902 „Ich habe esnicht verschmäht, die Lehren der Modernen,
902 Met. Prol. 3 f.: nec dedignatus sum modernorum proferre sententias quos antiquis in plerisque preferre non dubito;ebd. III Prol. 119: Et he quidem accepte sunt opiniones veterum eo ipso quod veteres; et nostrorum longe probabiliores etfideliores, eo quod nostrorum sunt, reprobantur. Zum Argument der (glaubensmäßigen) Überlegenheit der Christen bis zurGegenwart (fideliores), das Johann hier eher beiläufig und auch sonst kaum je ohne ein bildungsmäßiges distinguo verwendetvgl. auch oben Anm. 527 (Plato und ein anonymer, beliebiger Christ) und allgemein unten § 105. SEIGEL (90 f.) zeigt, daßdieser Gedanke in der Renaissance stärkeres Gewicht hatte; insbesondere Salutati leitet die Überlegenheit der moderni ohneAbstriche daraus ab (Ep. IV 135): Plato und Aristoteles, lebten sie heute, würden ihr Wissen für geringer schätzen als dasirgendeines ungebildeten Christen. Demgegenüber vgl. zu Johanns weniger fideistisch als wissenschaftlich und humanistischbegründetem Lob der moderni: S. 239 f., 381. – Die im obigen Zitat gemeinte Spitze gegen die Cornificianer (Met.Prol. 3 f.; III Prol. 118 f.; zum Kontext s. oben Anm. 537) steht nur scheinbar im Widerspruch zu der ebenfalls gegen dieCornificiani gerichteten Kritik an der traditionslosen inventio novorum: Beide Haltungen, die der traditionalistischenÜberbewertung der alten Autoritäten und diejenige der Selbstüberschätzung der entdeckungsfreudigen Traditionsverächter(oben Anm. 896 zu Pol. VII 12) haben die gleiche moralische Wurzel in der intellektuellen Hybris, die dem Geist einergemeinsamen allmählichen Annäherung aller Wissenschaftsgenerationen an die eine Wahrheit am meisten zuwiderläuft (vgl.§ 84). – Entgegen der Ansicht von J. SPÖRL (Das Alte und das Neue, in: Hist. Jb. 50 [1930] 295–517, hier 315) ist beiJohann also von einer Unübertrefflichkeit der Alten nicht die Rede, aber ebensowenig von der Möglichkeit selbstherrlicherinventio außerhalb einer Bindung an die Tradition.
453
die ich den Alten in sehr vielen Fällen zweifellos vorziehe, hier vorzutragen.“ Die Lückenhaftigkeit undUnabgeschlossenheit menschlichen Wissens motiviert gerade die Zuversicht in einen wie immer langsamenErkenntnisfortschritt mit offenem Ende über die Jahrhunderte hin. Dieser Optimismus setzt im 12.Jahrhundert jenen in die Neuzeit weisenden Bildungseifer vom Humanisten in Gang, die a priori alles fürwissenswert halten, prophylaktisch auch scheinbar Überflüssiges und gegenwärtig Nutzloses für zukünftigeWissenschaft aufheben nach dem Motto: omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum.903
Für dieses Prinzip zeugt auch das gelehrte, überaus kenntnisreiche Werk Johanns, das sich hauptsächlicheinem Zusammenstellen, Vergleichen, Abwägen, Ausgleichen, Harmonisieren der verschiedenartigen dicta etfacta verdankt, die zu der einen Wahrheit hinführen können und sollen. Wie der Policraticus-Prolog miteinem Ovid-Vers andeutet, präsentiert sich die Wahrheit wie die Gesichter zweier Schwestern: historischverschieden, aber substantiell gleich.904 Johann bietet seinen ganzen Scharfsinn auf, um oft sehr schwieriges,heterogenes Material auf einer Ebene zusammenzufassen und zu versöhnen, damit alles gemeinsam dem zurDebatte stehenden Beweisziel dienstbar werde.905
903 Vgl. S. 378 f., A. 750 zu Pol. VII 9, (II) 125; Met. I 24, 54 und Hugo von St. Victor, Didasc. VI 2.904 Pol. Prol. 17.20 (unmittelbar nach der oben Anm. 893 zitierten Stelle): Siquidem ‚facies non omnibus una,/non diversatamen, qualem decet esse sororum’ (Ov. Metam. II 13.14). Das Bild der physiognomischen Ähnlichkeit gehört zurliterarischen imitatio-Metaphorik wie dasjenige von Vater und Sohn bei Seneca (Ep. 84.8) und danach etwa bei PetrarcaFam. 23.19 (ROSSI IV 206). Zur Bedeutung für die Identifikation mit Exempla s. oben Anm. 92 (Conde Lucanor). Hierbezieht sich das Bild (s. auch oben Anm. 893) nicht auf die formale Seite der Angleichung von Zitaten und Reminiszenzen(scripturarum testimoniis) sondern auf die inhaltliche Einsinnigkeit (ita … ac si sententias … veritas genuisset) und bildetdamit – in vielleicht bewußter Umkehrung – auch einen Anklang an die relativistische veritas filia temporis-Maxime(Gellius, N.A. XX 12.11.7): Die Verwandtschaftsbeziehung aller sententiae ist trotz historischer Unterschiede ihregemeinsame Abstammung von veritas, nicht von tempus. Zu veritas filia temporis vgl. CHENU, Conscience 107; ders.,Théologie 62; DUTTON, Bernard of Chartres (wie Anm. 553) 193 f.; BORST, Gesch. (wie Anm. 486) 34, 39 (mit Hinweisauf eine Tagebuchstelle Leonardos da Vinci). – Vgl. andererseits die von CHENU (Théologie 51 f.) kommentierte Alan-Stelle (Planct. [PL 200] 446) über das Verhältnis von rationaler und glaubensmäßiger Erkenntnis, „profaner und heiliger“Weisheit, wo die personifizierte Natura über die Theologie sagt: Non adversa, sed diversa sentimus.905 Vgl. oben § 81, S. 210 ff., 379 ff., 404 ff.
454
97. Diese kompilatorische Konkordanzmethode darf allerdings nicht anachronistisch als Zeichen irdgeneinesPluralismus oder Liberalismus gewertet werden. Selbst unser Toleranzbegriff wäre darauf kaum anzuwenden.Tragend ist vielmehr die Glaubensgewißheit, daß die Wahrheit, wie Gott sie kennt, nur stückhaft und vielfältiggebrochen zugänglich werde auf dem Weg einer Erkundungsarbeit oder Spurensuche und eines kritischenVergleichens im Bereich aller bisherigen Erkenntnisse, Halbwahrheiten, Halblügen und Widersprüche derTradition. Was uns wie Horizonterweiterung durch weltanschaulich Fremdes erscheinen mag, ist intendiert alsinventio, als ein Finden und Wiederfinden im Glauben an die göttliche Einheit alles Wissens. Was wieLiberalität aussieht, ist eher ein Nebenprodukt, ein nicht primär beabsichtigtes Ergebnis dieses intellektuellenProzesses der ratio fidei (der freilich nirgends ein sacrificium intellectus verlangt). Wie wenig für Johannpluralistische Toleranz etwa im politischen Sinne denkbar war, zeigt schön seine Verurteilung Julians desAbtrünnigen, dessen Hauptverbrechen darin bestehe, daß er jedem erlaubt habe, seine eigene Religion frei zuwählen. Das oben zitierte Beispiel einer Begegnung der Religionen im Zeichen der Gastfreundschaft oder derMitmenschlichkeit belegt nicht Toleranz, sondern volle Identität der Naturmoral bei Heiden und Christen.906
906 Vgl. S. 446 zu Pol. VIII 13. – Pol. VIII 21, (II) 384, 27 ff.; Ut vero favorem multitudinis sibi conciliaret, ius sibipreferendae religionis omnibus indulgebat. Studebat ob hoc omnibus omnia fieri [cf. I Cor. 9.22]. Hinc vanae gloriae causalargus […] hinc a civilitate fictitia comis, hinc gravis a mole imperii et, quod maxime erat, ne crudelis habereturmansuetudinem mentiebatur. Die Toleranz Julians wird so aufgrund der parodistischen Verwendung der auf Paulusbezüglichen Bibelreminiszenz zu einer teuflisch-antichristlichen Nachäffung der Nächstenliebe und gleichzeitig zu einerPerversion des antiken philosophischen Ideals der Herrschermilde. Zu Julians wirklichen Intentionen: hellenistischeOffenheit, „fruchtbare Unbestimmtheit des Bildungsideals“, Ablehnung der als „Barbarei“ betrachteten, kultur-verengendenEinheits- und Monopolidee des Christentums vgl. z. B. MARROU, Gesch. d. Erziehung 328 ff. – Zum generellenNichtverstehen solcher Vorstellungen (auch nicht einmal auf der historischen Beschreibungsebene) im Mittelalter ist keinWort zu verlieren, sosehr es seit den Kreuzzügen Religionsgespräche und Kulturbegegnungen aller Art gegeben hat. Vgl. J.LAMART, Julien dans les textes du MA, in: L’Empereur Julien de l’histoire à la légende, ed. R. BRAUN, et al., Paris1978, 269–94 und auch oben Anm. 486 zur kirchenrechtlichen Begründung der Zwangsbekehrung aus der typologischenErfüllung alttestamentlicher Prophezeiung in Kaiser Konstantin. Vgl. auch OLSON, Ecclesia primitiva (wie Anm. 210a) 82zur insgesamt positiven Sicht der „Konstantinischen Wende“ im Kirchenrecht. – Der legendäre Ruhm Johanns als eines„Erasmus des 12. Jahrhunderts“ und eines außergewöhnlich liberalen und toleranten Kirchenmanns bleibt in den hierangedeuteten Grenzen und in Relation zu seiner eigenen Zeit freilich unberührt: vgl. z. B. ROUSE/ROUSE, Tyrannenmord(wie Anm. 468) 245 f. und oben S. 322, 357 f., unten Anm. 973.
455
Für die Rekonstruktion solcher Identität, bzw. für die Versöhnung auseinanderstrebender Zeugnisse, wendetJohann eine Technik an, die zweifellos unseren Maßstäben philologischer Exaktheit wenig entspricht. Seineprogrammatische Apologie geistig fruchtbarer Fiktionen läßt von vornherein annehmen, daß er dieEinsinnigkeit der Autoren (wo sie nicht aus den Zitaten selbst sprach) mit rhetorischer Kunst ans Licht holte,bzw. erst herstellte; und daß die kombinatorische Einbildungskraft dabei wichtiger war als genaueTextwiedergabe. Das Erkenntnisziel ist die unverbrüchliche veritas rerum, die nicht vom Menschen gemachtist. Darum sind einzig die sententiae und sensus oder geistigen Inhalte, nicht aber die zufälligen, den Wirrender Überlieferung ausgesetzten verba scriptorum relevant und der Wiedergabe wert, was eine gewisse Freiheitim Umgang mit der literarischen Tradition selbstverständlich macht.907
Gewiß pflegt auch Johann die üblichen, bereits von den Kirchenvätern praktizierten Adaptionen nach demKomplementärprinzip und der a fortiori-Analogie, d. h. er schließt Lücken der Bibel, indem er aus derheidnischen Literatur ergänzt, „was dem Glauben nicht widerspricht“908oder er führt moralische Helden derAntike zur Beschämung sündiger Christen in dem überaus beliebten exemplum impar vor.909 Das dritte,vielleicht wichtigste Integrationsmittel der interpretatio christiana, die Allegorese antiker Zeugnisse, trittdiesen beiden Methoden gegenüber auffällig zurück.910 Während
907 Vgl. oben Anm. 898 zu Met. III 4 (veritas rerum/verba); § 88 zur Fiktionsabsicht im Prolog, § 48, S. 202 f., 402 ff:Beziehung von Fiktion und Konkordanzidee; MELVILLE, System 60 ff., 335 ff. zum Verhältnis von Einheitsidee undphilologisch-historischer Arbeit am „Vielfältigen“.908 Zu diesem Ergänzungsprinzip, das formal einer bereits römisch-rechtlichen Methode bei der Behandlung vonGesetzeslücken entspricht, und zu patristischen, kanonistischen und legistischen Analogien vgl. oben Anm. 3–4, 564 (mitweiterführender Lit.); zur theologischen Analogie aufgrund der keineswegs nur juristischen Naturrechtsidee vgl. obenAnm. 882 und besonders WILKS (wie Anm. 546) 70 f.; DELHAYE, Le bien (wie Anm. 385) 219 ff.: „Jean de Salisbury vadonc chercher chez les païens ces applications pratiques qu’il ne trouvait pas chez les auteurs chrétiens“. Vgl. auch MICZKA36; E.R. CURTIUS, Jorge Manrique und der Kaisergedanke, in: Ges. Aufsätze z. Roman. Philol., Bern 1960, 353–72, hier370 f. (Anm.) zum Rückgriff auf die heidnische Antike mangels christlicher auctoritates als Gattungsmerkmal derFürstenspiegelliteratur, was CURTIUS durch die pseudoplutarchische Kompilation institutio Traini im Pol. bezeugt. Vgl.auch S. 464 ff., 488 f.909 Vgl. unten S. 458 ff.910 Vgl. S. 391 f., 399, 472, 494, 504 ff. Der Sinn aller Allegorien und Allegoresen innerhalb und außerhalb desChristentums liegt wohl immer in irgendeiner rezeptionsgeschichtlichen „Akkulturation“. Vgl. den anregenden Bericht vonP. MICHEL über ‚Formen und Funktionen der Allegorie’ (wie Anm. 427) in: Freiburger Zs. f. Philos. u. Theol. 29 (1982)527–38, bes. 533: „Allegorese ist das Mittel, mit dem altehrwürdigen Texten, die in einer sie tradierendenKulturgemeinschaft keinen Sinn mehr hergeben, ein neuer Sinn abgewonnen werden kann (von dem freilich behauptet wird,er habe immer schon im Text gelegen)“. Ich erwähne diese Selbstverständlichkeit, weil die in Klammer erwähnteUnterstellung sogar noch uns von einer gewissen Mediävistik – und sei es nur in einer euphemistisch-betulichen Wortwahl –zugemutet wird, als wäre der sensus spiritualis eine noch heute gangbare Hermeneutik. Johanns Plädoyer für den sensushistoricus mag hier als Gegengift dienen (vgl. S. 494, 504 ff.).
456
etwa Baldrich von Bourgueil in einem berühmten Gedicht die Verwendung mythologischer Gestalten undGötter als exempla malorum oder bonorum, Mahn- oder Warnbeispiele mit den auch hier zentralen Motivender Bibelstelle Röm. 15.4 und mit dem Bild der Knechtschaft heidnischer Autoren legitimiert und folgert:omnia mystica (alles hat nur spirituellen Sinn),911 distanziert sich Johann ausdrücklich von der allegorischenAuslegung profaner Texte der artes:912 Nur in der Bibel haben sowohl res wie verba neben der literalenSinnebene noch die drei geistigen Deutungsstufen der Allegorie, Tropologie und Anagogie, jedoch „in denfreien Künsten, wo nicht die Sachen, sondern nur die Worte zeichenhaft sind, scheint mir jeder, der sich mitdem ersten Sinn des Buchstabens nicht zufriedengibt, in die Irre zu gehen.“
911 Baldric. Burg. Cm. 200 (ed. K. HILBERT, Heidelberg 1979), 269 (= ed. ABRAHAMS Nr. 238, 337) Vs. 105–110,125–134: Ut sunt in veterum libris exempla malorum,/Sic bona, que facias, sunt in eis posita./Laudatur propria provirginitate Diana/Portenti victor Perseus exprimitur/Alcidis virtus per multos panditur actus/omnia, si nosti, talia misticasunt […] Captivas ideo gentiles adveho nugas/Letor captivis victor ego spoliis./Dives captivos habeat Pregnaria servos […]Hostili preda ditetur lingua Latina,/Grecus et Hebreus serviat edomitus./In nullis nobis desit doctrina legendi/Lectio sitnobis et liber omne, quod est. Vgl. dazu CURTIUS, ELLM 367 f.; ders., Musen (wie Anm. 794) 179 f. und dieEinschränkung oben in Anm. 798. Zur Metaphorik (Gefangenschaft, Sieg, Knechtschaft) vgl. S. 396 ff. Zu Rom. 15.4 vgl.oben S. 371; zu Exempla im suasiv-dissuasiven Doppelsinn vgl. §§ 49, 74, S. 338.912 Pol. VII 12, (II) 144.5 ff.: Divinae paginae libros […] tanta gravitate legendos forte concesserim, eo quod thesaurusSpiritus sancti, cuius digito scripti sunt, omnino nequeat exhauriri. Licet enim ad unum tantummodo sensum accommodatasit superficies litterae, multiplicitas misteriorum intrinsecus latet et ab eadem re saepe allegoria fidem, tropologia moresvariis modis edificet; anagoge quoque multipliciter sursum ducit, ut litteram non modo verbis sed rebus ipsis instituat. Atin liberalibus disciplinis, ubi non res, sed dumtaxat verba significant, quisquis primo sensu litterae contentus non est,aberrare videtur michi (zur Fortsetzung s. oben Anm. 799). Zur Buchmetaphorik s. Anm. 731. Die Formulierung des letztenSatzes erinnert an die (jedoch allein auf die Bibelexegese bezügliche) auctoritas Augustin, Doctr. chr. I 36–7, 41 (der auchinhaltlich die oben Anm. 799–800 angeführten Pol.-Stellen entsprechen): Sed quisquis in scripturis aliud sentit quam ille,qui scripsit, illis non mentientibus fallitur […], ita fallitur, ac si quisquam errore deserens viam eo tamen per agrumpergat, quo etiam via illa perducit. Corrigendus est tamen et, quam sit utilius viam non deserere, demonstrandum est, neconsuetudine deviandi etiam in transversum et perversum ire cogatur. Adserendo enim temere quod ille non sensit, quemlegit, plerumque incurrit in alia. In der angeführten Stelle aus Pol. VII 12, deren direkter Anlaß die maßlose Aufblähung derPorphyrius-Interpretation durch gewisse Scholiasten und Magistri seiner Zeit bildet (s. oben Anm. 800 auch zu Met. III 1,121), ist nicht ganz klar, ob Johann mit in liberalibus artibus nur die Artes-Lehrbücher oder auch deren Gegenstand, dieauctores im Auge hat. Jedenfalls hätte er sich im zweiten Fall selbst keineswegs konsequent an diese seine Regel gehalten,da er echt tropologische Mythendeutung nach dem Prinzip der suasiven oder dissuasiven Exempla-Lesart (s. S. 176 ff.,184 ff.) treibt (vgl. auch Anm. 430 zu den drei Schriftsinnen im Anticlaudianus laut Wilhelm von Auvergne). Andererseitssteht auch seine betonte Zurückhaltung gegenüber bibelexegetischer Allegorese (S. 494), die er mit Abaelard und Hugo vonSt. Victor teilt, in einem gewissen Widerspruch zu seinem spielerisch-experimentellen Umgang mit dem „eindeutigen“Literalsinn der Heiligen Schrift. Er hätte wohl selbst nicht behauptet, daß die aus der Emmaus-Episode abgeleiteteAnstandslehre (S. 430 ff.) der unus sensus historicus sei, obwohl er in diesem Zusammenhang von der literalen superficiesdes Ereignisses spricht. Für uns läuft diese Art, die Bibel zu lesen, letztlich doch auf eine von vielen möglichen moralisch-tropologischen Deutungen hinaus. Man kann jedoch auch ganz auf die schriftsinn- und allegorietheoretische Terminologieverzichten und von figurate dicta (im Gegensatz zu proprie dicta) innerhalb des sensus litteralis ausgehen (vgl. MINNIS,Authorship [wie Anm. 337] 74 f. zu einer Diskussion des Thomas von Aquin), obwohl Johann diese poetologischeUnterscheidung nicht gekannt zu haben scheint (vgl. auch unten Anm. 935).
457
(Aus dieser Kritik läßt sich im übrigen eher die Verbreitung des Verpönten im Mittelalters als dessen Fehlenfolgern).913
Eine gewisse Distanz gegenüber allegorisch-typologischen Deutungen legt Johann auch in der Methode desexemplum impar an den Tag. Seit der Patristik hat sich wohl kein Verfahren aus den reichen rhetorischenAnwendungsmöglichkeiten
913 Nicht grundlos hat später Erasmus die Allegorisierung von Predigtexempla aus dem Gesta Romanorum und aus demSpeculum historiale des Vinzenz von Beauvais (das nach dem S. 139 ff. Festgestellten auch Policraticus-Exempla enthält)verspottet. Vgl. WESSELSKI (wie Anm. 315) XXXIX zu Encomium moriae: stultam fabulam … adferunt et eandeminterpretantur allegorice, tropologice et anagogice. – Zur angeführten Pol.-Stelle vgl. LUBAC I (wie Anm. 430) 496 f.;CAPLAN, Four Senses (wie Anm. 828) 286. Zur Beliebtheit der christlichen Mythenallegorese bei den „Integumentalisten“der sog. Schule von Chartres vgl. JEAUNEAU, Lectio 152 ff.; DRONKE, Fabula (wie Anm. 429) 55 ff.; STOCK (wieAnm. 538) 273 ff.; WETHERBEE (wie Anm. 394) passim. Zur Ovid-Allegorese im besonderen vgl. S. VIARRE, La survied’Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe ss., Poitiers 1966, 55 ff., HORSTMANN (wie Anm. 203a) 11 f. undS. 540 f. – Einige Germanisten (vgl. vor allem W. SCHRÖDER, Zum Typologie-Begriff und Typologieverständnis in dermediävist. Literaturwiss., in: The Epic in Mediev. Society, ed. H. SCHOLLER, Tübingen 1977, 64–85; JENTZMIK, wieoben Anm. 183) haben mit wissenschaftlich zweifellos ertragreichem Aufwand die von F. OHLY vertretene These von derspirituellen (allegorischen und typologischen) Deutung profaner oder auch nur nicht-biblischer Texte und Ereignisse zuwiderlegen gesucht. Dieser Versuch dürfte das Ziel darin verfehlt haben, daß er eher absoluten theologischen Kategorien alsder historischen Wirklichkeit des Mittelalters gerecht wird, in der es offenbar mehrere gegensätzliche Standpunkte und auchviele Zweifelsfälle und Inkonsequenzen gab. Demgegenüber vgl. nach wie vor OHLY, Schriften 336 ff.; ders., TypologischeFiguren aus Natur und Mythos (wie Anm. 732); ders., Typologie als Denkform (wie Anm. 234); Heinz MEYER, MosRomanorum, Zum typologischen Grund der Triumphmetapher im Speculum ecclesiae des Honorius Augustodunensis, in:Verbum et signum, Festschr. F. OHLY I, München 1975, 45–58, hier 50, 54 ff. zu eindeutigen Stellen (sogar liturgischen),aus denen Römisches als Präfiguration des Christlichen hervorgeht. Zum Verhältnis von Typologie und Exemplum vgl.außerdem die in Anm. 156 vereinigten Querverweise, S. 486 zu König Kodros, § 107, S. 333, 339 f., 461, 481 f. zuGrenzen und Übergängen zwischen der hermeneutischen und der rhetorisch-dialektischen Methode. Besonders überzeugend istauch GREGORYS Analyse der typologischen Platondeutung Abaelards aufgrund der heilsgeschichtlichen Stellung dergriechischen Philosophie im Offenbarungsprozeß (Abelard et Platon [wie Anm. 752] 40 ff.; 43: Verhüllung, involucrum alsPräfiguration und typus der sich in der Zukunft enthüllenden Wahrheit). Da Johann gerade diese Integumentum- Theorieselbst übernommen hat (s. oben S. 447 Platon als Lehrer des Trinitätsgeheimnisses), kann sich eine Kritik nur auf eine vielobhrflächlichere Anwendung der Schriftsinn auf ungeeignete, „nicht inspirierte“ Texte der Artes beziehen.
458
des antiken Exemplums stärker durchgesetzt als dieser a fortiori-Schluß in der spezifisch pädagogisch-paränetischen Überbietungsform eines Ansporns lauer Christen durch besonders beschämende heidnischeTugendbeispiele. Das zugrundeliegende antike rhetorische Schema besteht dabei in einem vornehmlichdiatribisch verwertbaren Vergleich zwischen dem seinen Voraussetzungen nach (von Natur, seiner Stellung,seinen Kräften oder anderer circumstantiae nach) virtuell überlegenen Adressaten mit der in der gleichenAngelegenheit ebenfalls virtuell unterlegenen Beispielfigur (etwa einer Frau, einem Kind, einem Sklaven), dietrotz konstitutioneller Benachteiligung aktuell mehr leistet als der angesprochene exhortandus und diesemfolglich als ein umso wirksameres Vorbill empfohlen werden kann.914 Für die Beliebtheit diesesVergleichsmusters in der christlichen Literatur war eine geschichtstheoretische Vorstellung
914 Zu den exempla imparia (ex maioribus ad minora/ex minoribus ad maiora ducta; verkürzt auch maius minoris und minusmaioris, d. h. „Größeres für Kleineres“ und „Kleineres für Größeres“) vgl. Quint. V 11.9–10; LAUSBERG §§ 419 ff.;MARTIN, Ant. Rhet. 121; GEBIEN 64 f., 76; LUMPE 1245 f. und S. 106, 117 f., 236. Das exemplum impar ist derwichtigste Teil der rhetorischen Lehre von den Ähnlichkeits- bzw. Unähnlichkeitsgraden zwischen Exemplum und causa,Vergleichsmittel und Vergleichsziel oder Beispielargument und vorliegendem Fall (ex/ab exemplo ad causam), bestehend aus1. exemplum simile, 2. dissimile, 3. contrarium (Quint. V.11.5); und bildet darin eine durch die „Ungleichrangigkeit“definierte Sonderart des exemplum simile. Diese Ungleichrangigkeit bezieht sich nicht etwa auf soziale, konstitutionelle oderandere Voraussetzungen, Zugehörigkeiten, „Umstände“ (wie genus, modus, tempus, locus, die Quint. in V 11.13ausdrücklich als Kriterien des exemplum dissimile erwähnt), sondern auf das zentrale Beweisthema selbst, und derKomparativ hat auch nichts zu tun mit einem internen Vergleich zwischen Exempla (etwa in einer Exempelreihe), sondernnur mit der Reaktion des Exemplums (oder auch mehrere Exempla) mit der Sache, für die es einsteht. Sonst bliebeunerfindlich, warum nach der Präambel: admirabilior in femina quam in viro virtus (Quint. V 11.10) Beispiele wie Lucretia,die als Modell für heroischen Freitod wirksamer sei als Cato, exempla ex maioribus ad minora heißen: si ad fortiterfaciendum accendatur aliquis […] et ad moriendum non tam Cato et Scipio quam Lucretia: quod ipsum est ex maioribus adminora. (Das „Kleinere“ ist also aliquis, nicht etwa Lucretia, das „Größere“ sind nicht etwa Cato und Scipio, sondern alledrei Exempla, von denen Lucretia das geeignetste darstellt.) Die „der Erwartung gemäß“, in der Regel, aufgrund ihrer Anlageusw. zum Heroismus weniger begabte und dennoch heroische Frau ist ein „größeres“ Vorbild für den insofern „kleineren“exhortandus männlichen Geschlechts. Diese Differenzierung ist deshalb so wichtig, weil Johanns heidnische Exempla immoralischen Sinne oft trotz oder gerade wegen der Überlegenheit des Christentums – einer ihnen fehlenden günstigenVoraussetzung – genau genommen exempla a maioribus ad minora heißen müßten; denn das Vergleichsziel ist einbestimmtes Verhalten natürlicher Moral. Als exempla a minoribus ad maiora, wie alle heidnischen Beispiele in christlicherFunktion genannt zu werden pflegen, dürfen sie streng genommen nur dann gelten, wenn der Rangunterschied den Glaubenoder Glaubensgehalte auf der causa-Seite direkt betrifft; so ist das apologetische Exemplum von König Kodros für dieKreuzigung Jesu aus frühchristlichen Apokryphen (unten § 102) klar a minore ad maius ductum. Bei Quint. V 11.9 steht alsBeispiel „vom Kleineren zum Größeren“ (bzw. „Kleineres für Größeres“) der Vergleich von Holzbläsern mit Magistraten imExil nach Liv. 9.30: tibicines cum ab urbe discessissent, publice revocati sunt, quanto magis principes civitatis viri et benede re publica meriti […] reducendi. Nach diesem Muster werden Heiden mit Christen auch in der in nächster Anm.folgenden Augustin-Stellen verglichen. Grundsätzlich können die gleichen exemplum-causa-Relationen sowohl ad maiorawie ad minora laufen, da alles von der jeweiligen Redesituation und Persuasionsabsicht abhängt. Daß die imparia-Lehre keinausgefallenes Steckenpferd spätantiker Schulrhetorik, sondern ein Grundprinzip „allgemeiner Rhetorik“ darstellt, zeigt gutPERELMAN (wie Anm. 10) 120 f. mit der Illustration für das „exemple hiérarchisé“ aus Aristot. Rhet. II 23, 1398b überden Topos von der Induktion: „Alkidamas beweist, daß alle die Weisen ehren […] So haben die Mytilineer die Sappho,obwohl sie eine Frau war, geehrt; die Lakedämonier beriefen den Cheilon in den Rat der Alten, obwohl sie doch keineswegsBildungsfreunde sind …“ usw. Alle Beispiele sind in dieser Weise ungleichrangig, d. h. a minore ad maius.
459
wichtig, wie sie Augustinus formulierte:915 „[…] Das römische Reich ist deshalb so ruhmvoll ausgebreitet,damit die Bürger jenes ewigen Staates während
915 Aug. Civ. V 16 (CC 47) 149: (Übersetzung: W. THIMME, Vom Gottesstaat I, Zürich 1955, 296): Romanum imperiumad humanam gloriam dilatatum est […], ut […] cives aeternae illius civitatis, quamdiu hic peregrinantur, diligenter etsobrie illa intueantur exempla et videant, quanta dilectio debeatur supernae patriae propter vitam aeternam, si tantum asuis civibus terrena dilecta est propter hominum gloriam. Ähnlich ebd. V 18, 154: Proinde per illud imperium tam latumtamque diuturnum virorumque tantorum virtutibus praeclarum atque gloriosum et illorum intentioni merces quamquaerebant est reddita, et nobis proposita necessariae commonitionis exempla, ut, si virtutes quarum istae utcumque suntsimiles, quas isti pro civitatis terrenae gloria tenuerunt, pro Dei gloriosissima civitate tenuerimus, superbia nonextollamus. Zu Augustin vgl. GEBIEN 76 f., HONSTETTER 179 ff.; GEERLINGS 182 ff. – Zur christlichen Traditionsolcher exempla imparia (meist a minore ad maius nach dem einfachen Muster: „Wenn schon Heiden, wieviel mehrChristen“) vgl. zur Patristik: PÉTRÉ 16, 29 f., 67 ff., 82 f.; CARLSON 96 ff., 100 ff.; HERZOG, Gattungskontinuität (wieAnm. 275) 418 f.; ders., Metapher–Exegese–Mythos (wie Anm. 275) 178 ff.; CAMPENHAUSEN (wie Anm. 660) 191;zum Mittelalter vgl. BUISSON, Potestas 26 ff.; ders., Entstehung 38 ff.; ders., Exempla 460 ff.; OHLY, Schriften 381 ff.,393; ders., Das Buch der Natur bei Jean Paul (wie Anm. 732) 290 ff.; CAPLAN, Invention (wie Anm. 277) 292;KLEINSCHMIDT 37 ff.; FRIEDRICH, Rechtsmetaphysik 35 f.; von MOOS, Consolatio I/II § 1126 u. ö.; SMALLEY,Friars 52 f.; MEHL 241; zur Neuzeit vgl. H.-J. SCHINGS, Die patrist. u. stoische Tradition bei Andreas Gryphius,Köln/Graz 1966, 171 ff.; BRÜCKNER, Hist. 70 ff., auch zu einer Kuriosität (m. E. einer konfessionell-rigoristischenVerfallserscheinung im Verfahren) bei Justus Chr. Udenius, Excerpendi ratio nova (Nordhausen 1681, col. 189a): „Ausdiesen heidnischen Exempeln kann man Compar. Imparium machen, e. g. hat der Satan solche Wunder gethan, wie vielmehrGott durch den Christl. Glauben bey rechtgläubigen“ (Abkürzungen sic).
460
ihrer irdischen Pilgerschaft aufmerksam und ernsthaft auf dieses Beispiel schauen und begreifen, welch eineLiebe sie um des ewigen Lebens willen dem Vaterland droben schulden, wenn um menschlichen Ruhmes willendas irdische Vaterland von seinen Bürgern dermaßen geliebt wurde.“ Dennoch beruhen nicht alle Vergleichedieser Art auf bewußten heilsgeschichtlichen Bezügen. Was von Tertullians Gebrauch der exempla impariagesagt worden ist, läßt sich auf viele mittelalterliche Parallelen übertragen:916 Sie sind primär rhetorisch,dienen in deliberativen Situationen beliebiger „pädagogischer Abzweckung“ und unterscheiden sich insofernwesentlich von jener objektiven Verbindlichkeit demonstrativer und indikativisch feststellender Typologien,in denen Geschichte nicht bloß zu positiven oder
916 GEERLINGS 163 f.; vgl. auch FRIEDRICH, Rechtsmetaphysik 35 f. zu einer von der Heilsgeschichte abgelösten Sichtder heidnischen Exempla im Mittelalter ad confundendam impudentiam nostram nach Gregor d. Gr., Moral. Praef. II 4. EinGrenzfall ist die von besagten Augustinstellen (Anm. 915) abhängige Darstellung Ottos von Freising, Chron. II 34, die inder moralisch exhortativen wie spirituell demonstrativen conclusio gipfelt: Restat igitur ut nos, qui in ecclesia essecernimur, exemplo gentium, secundum quod propheta ait: ‚Erubesce Sydon, ait mare’ [Is. 23.4], de malis operibuserubescamus ac de amore presentium ad aeternorum desiderium conversi rapiamur.
461
negativen ad hoc-Vergleichen herhalten muß, sondern in denen daran erinnert wird, daß Vergangenes durchGegenwärtiges – im Zeichen des neuen Äon Christi – überwunden ist und sich darin zugleich erfüllt undsteigert.917 Johann gehört deutlich zu den Liebhabern des untypologischen, rhetorischpädagogischenVergleichs. Die Geschichte benutzt er weitgehend als Bilderbuch und Spielfeld für virtuose Exempla-Bezügeauf der Ebene imaginärer Simultaneität. An der prinzipiell ungleichen Herkunft jüdischer, heidnischer undchristlicher historiae zeigt er wenig Interesse. Selbst echte typologische Bezüge verwendet er nicht um ihresspirituellen Sinnes willen, sondern als rhetorisch steigernde Mittel zum gerade intendierten lehrhaften Zweck(vorwiegend der politischen Ethik).918
Er kennt allerdings ein anderes (für den „praktischen Philosophen“ charakteristisches) a fortiori: denVergleich von hohen, aber nicht verwirklichten Idealvorstellungen unter Christen mit einer zwar nurhumanen, aber dafür in die Tat umgesetzten heidnischen Natur-Ethik. Im Anschluß an die angeführteAnekdote vom gastfreundlichen Apollopriester führt Johann eine harte Polemik gegen hyperasketischeZisterzienser, die durch unmenschlichen Rigorismus elementarste Gesetze der Gastfreundschaft verletzen, undsagt mit Bezug auf ein Juvenal-Zitat prägnant:919 „Der Heide pflegt auch in dieser Sache
917 §§ 29 ff. S. 333, 457 f., 474 ff., 504 ff. CAMPENHAUSEN (wie A. 660) 191 ff. SCHRÖDER (wie Anm. 913) 72, 82;JENTZNIK (wie Anm. 183) 23 f.; KLEINSCHMIDT 37 ff.; J.R. BASKIN, Job as Moral Exemplar in Ambrose, in: VigiliaeChristianae 35 (1981) 222–31, hier 222 zum Wesensunterschied von Exempla und typologischen Bezügen. – Demgegenüberdürfte OHLY, Das Buch der Natur (wie Anm. 732) 287 ff. den Typologiebegriff überziehen, wenn er auch die beschämendenexempla imparia (s. oben Anm. 914) dazu rechnet (vgl. Anm. 952). In diesem Sinn verwendet auch GEERLINGS 159 ff.den Begriff m. E. zu extensiv. Vollends untypologisch sind die von HERZOG, Gattungskontinuität (wie Anm. 275) 402 als„Erfüllung“ alttestamentlicher Figuren bezeichneten Exempla demonstrativer Rhetorik in einer Seesturm-Ekphrasis Paulinsvon Nola. Hier wäre (wie auch sonst so oft) besser von einer christlichen aemulatio antiker Formen die Rede (so auchzutreffender HERZOG selbst a.a.O. 415).918 S. 475 ff., 513 f. – Mit Recht sagt DELHAYE, Le dossier (wie Anm. 385) 78 f.: „… sagesse païenne et christianisme,philosophie et cléricature sont intimement mêlées. On ne passe pas de l’une à l’autre par un a fortiori comme chez saintJérôme; l’opposition plus ou moins consciente de l’Historia calamitatum abélardienne est ignorée. Salisbury avoue ne pasvoir de distinction entre l’état de clerc et du philosophe“. Zu letzterem s. unter anderem Gesichtspunkt unten Anm. 951(Johann und Hieronymus als „Intellektuelle“).919 Zur Natur-Ethik s. S. 441 ff. Zur praktischen Philosophie im Gegensatz zu schein-christlichen Formen der inhumanitasvgl. auch S. 164 ff. Zur Anekdote des Apollopriesters aus Eusebius in Pol. VIII 13, (II) 325 f. s. auch S. 446; vgl.ebd. 326.14: Ethnicus quoque in eo fidelius et familiarius videtur insistere virtuti, quod statuit ut ea quae intus sunthospitibus hilari modestia apponantur ‚quod domus non est et habet vicinus, ematur’ [Iuv., Sat. VI 152]. JAEGER, Origins(wie Anm. 577) 143 f. behandelt diese Geschichte als Musterbeispiel für das höfische urbanitas-Ideal im MA. Vgl. auch dasTugendlob der Heiden in Pol. V 11, (I) 333.24: Unde et apud antiquos, etiam salutiferae veritatis ignaros, omne quod exdebito officii gratuitum esse oportet, si fiat ad pretium, in sordibus computatur. (Ähnliche Kritik an hyperasketischenMönchen übt im Namen der Humanität und Naturmoral Hildebert von Lavardin in Ep. I 11 [PL 171] 169 ff.; vgl. vonMOOS, Hildeb. [wie Anm. 211] 138 ff.) In Pol. V 16 (I) 349 f. führt Johann eine längere Stelle aus den Digesten und ausdem Codex gegen Korruption der Richter (etiam in clero) an, was nicht nur ein Licht auf die Bedeutung des römischenRechts für das Kirchenrecht (s. KERNER 154) wirft, sondern auch auf die hier fast als unerreichbar erscheinendeVorbildlichkeit der Römer: Utinam haec vel audiantur a nostris! nam ut serventur, optare vix audeo. Quos quotiensdiligentius intueor, concussores mihi potius videor videre quam iudices.
462
(wie so oft) die Tugend mit mehr Herz und Verlaß.“ Wohl in Erinnerung an Augustins rhetorische Zuspitzung,daß alle heidnischen Tugenden nur „glänzende Laster“ (splendida vitia) seien, leistet er sich eine eigenekonträre Pointe: Tugenden ohne Christenglauben seien zwar bloß „schattenhafte“ imagines; aber für dieGegenwart sei es wichtiger als alles andere, wenigstens eben diese imago, diesen „Schein der Tugend“ oder„Tugendabglanz“ tatkräftig zu verwirklichen.920
920 Pol. III 9, (I) 197 f. (z. T. schon oben Anm. 665 und 892), 197.20 ff.: Sit ergo venerabilis imago virtutis, dum sine fideet dilectione substantia virtutis esse non possit. Et utinam inveniatur in nobis qui vel virtutis imaginem teneat! ‚Quis enimvirtutem amplectitur ipsam?’ [Iuv. Sat. X 141] Quis etiam umbras virtutum induit, quibus videmus floruisse gentiles, liceteis subtracto Christo verae beatitudinis non apprehenderint fructum? Quis Temistoclis diligentiam, Frontonis gravitatem,continentiam Socratis, Fabricii fidem, innocentiam Numae, pudicitiam Scipionis, longanimitatem Ulixis, Catonisparcitatem, Titi pietatem imitatur? Quis non cum admiratione veneratur? probitas siquidem laudatur et alget [cf. Iuv.Sat. I 74; Matth. 24.12: refrigescet caritas]. Zu ähnlichen Ketten symbolhafter Inbegriffsexempla vgl. Anm. 664 (Alan),Anm. 1178 f. (Dante). Zum Begriffspaar imago/substantia virtutis vgl. MINNIS, Chaucer (wie Anm. 342) 31 ff., dasKapitel unter der Überschrift „The Shadowy Perfection of the Pagans“, eine kleine Rezeptionsgeschichte der zitierten Stelle(Pol. III 9) von Johann von Wales zu Chaucer. Vgl. noch Pol. VIII 11, (II) 296.4 ff.: Concinit in hunc modum totus rectephilosophantium chorus, ut, si Christianae religionis, abhorrent rigorem, discant vel ab ethnicis castitatem. Ebd. VIII 8,(II) 274 f. über Epikur, den vermeintlichen Schlemmer, der asketisch vorbildlicher als viele Christen gelebt hat: Sed fortenimis austerus videtur esse Ieronimus […] Esto, liceat contempni Ieronimum, Stoicorum vilescat auctoritas, excludanturPeripatetici, dum vel voluptatis assertor audiatur: Testantur enim, ut de nostris taceam, Seneca et multi alii clari interphilosophos quod ille… (es folgt eine Anekdote über dessen frugalitas nach Hier. Adv. Jov. II 11). Zur pädagogischenBedeutung der Identifikationserleichterung beim Vergleich des versagenden Christen mit moralisch überlegenen Heiden inentsprechend absteigenden Exempla-Reihen (auch zur typischen vel-/saltim-Formel) vgl. S. 236 f. – Zum positivenEpikurbild Johanns (trotz der negativen Bedeutung des „Epikureismus“ der Epicurei) vgl. oben S. 166.
463
98. Noch interessanter als die besprochenen mehr oder weniger traditionellen Methoden der Integrationheidnischen Gedankenguts ist deren erstaunlich eigenwillige Umkehrung: Johann bedient sich nicht nur derinterpretatio christiana antiker Literatur zur Einkleidung christlicher Thematik, sondern auch des christlichenTraditionsguts – sozusagen in einer interpretatio naturalis –, um nicht- (oder jedenfalls nicht spezifisch)christliche Themen zu veranschaulichen. Im Policraticus läßt sich insofern eine fast systematischeVerfremdung des üblichen Belegverfahrens feststellen. Johann scheint in einem zweifellos nur für gebildeteLeser bestimmten Variationsspiel jeweils den erwarteten biblischen Beleg durch einen heidnischen, denerwarteten heidnischen aber durch einen biblischen zu ersetzen. Philipp Delhaye sprach in diesemZusammenhang von einer „Literatenkoketterie“.920aDas oft witzige Spiel im Namen der Konkonrdanzideedürfte in der Tat auch der intendierten iocunditas rekreativer Neuheit entsprochen haben.921
920a Literatenkoketterie: DELHAYE, Le dossier (wie Anm. 385) 79: „On peut être chrétien de pensée en citant les païens etpaïen d’esprit en invoquant des textes chrétiens: ce qui compte essentiellement, c’est une mentalité générale, une sagesse dansle sens de laquelle on plie les arguments d’autorité. L’attitude de Salisbury s’expliquera plutôt comme une coquetterie delettré. Il lui plaît de retrouver dans la tradition philosophique un enseignement moral, de trouver chez les anciens, qu’il aimede toute son âme, des exemples et préceptes dont il puisse s’inspirer dans sa conduite et dans ses écrits“. Vgl. auch ähnlichin Le bien (wie Anm. 385) 218 zur Vermischung christlicher, heidnischer, historischer und gegenwärtiger Perspektiven: „Jeande Salisbury fait étalage d’érudition au point que certaines pages de son ouvrage ne sont plus qu’une savante marqueterie.Cela fait un peu nouveau riche“; sowie zu den „mots qui mêlent si curieusement une réponse chrétienne à une problématiquepaïenne“ wie Pol. VIII 25, (II) 423: Visne beatus esse? Porro beatus vir qui timet Dominum (s. oben Anm. 877). – BeiJohann findet sich zwar nicht jene fast zwanghafte Bannung christlicher Stellen zugunsten antiker, die DELHAYE imMoralium dogma philosophorum festgestellt hat (Une adaptation du De officiis au XIIe s.: Le Moralium dogmaphilosophorum, in: RTAM 16 [1949] 227–258; 17, 1950, 5–28, hier [1949] 234; vgl. S. 475 ff., 497 ff.), seinVertauschungsverfahren läuft vielmehr in beide Richtungen, wirkt aber oft nicht weniger gesucht. ZUMTHOR (wieAnm. 760) 94 f. beschreibt solches theoretisch in Übertragung von PANOFSKYS kunstgeschichtlichem„Disjunktionsprinzip“ (vgl. Anm. 1027) als „diachronen Typenwandel“, bei dem eine spielerische Projektion vomSystematischen („référence traditionelle“) auf das Syntagmatische („sens contextuel“) entstehe.921 Vgl. S. 202 f., 386 f. Grundsätzlich geht es hier um das rhetorische Gegenprinzip zum „Vertrautheits“-Postulat (§ 54):um Aufmerksamkeitserregung durch Überraschung. Vgl. Guibert von Nogent, Lb. quo ord. (wie Anm. 364) 25: Geschichtenaus dem AT seien oft förderlicher als solche aus dem NT, denn, dum […] auditui novum insonat, animos quasi quadamvoluptuosa sonoritate innovat; Robert von Basevorn, Forma praed. (wie Anm. 364) 316: …sciendum quod ita potestadduci historia alia sicut historia Bibliae, ut puta aliqua narratio Augustini vel Gregorii, vel alicuius auctoris, velHelinandi vel Valerii vel Senecae vel Macrobii […] et hoc modo magis acceptatur narratio Augustini, dummodo sit nova etinusitata quam Bibliae; et magis Helinandi vel alicuius alterius qui raro habetur, quam Augustini vel Ambrosii. Cuiusratio non est alia nisi vana curiositas hominum. Zum erzählerischen novitas (Anekdote, Novelle) vgl. A. 409, 508. ZuHelinand als Pol.-Vermittler für die Prediger s. S. 139 ff. Ähnliches auch im Speculum exemplorum bei CRANE XX zitiert.Zur Tradition vgl. KORNHARDT 69 (nova exempla und Überalterung von Exempla im Römischen Recht); ALEWELL 88 f.(Abwechslungsbedürfnis und varietas-Forderung wichtig für die Entstehung der Sammlung des Val. Max.); PÉTRÉ 122(Vorzug der nova exempla des Christentums gegenüber abgedroschenen exempla maiorum); MARROU, S. Augustin 154 f.(Augustins Vorliebe für das „Merkwürdige“ und das mirabile als Protest gegen Denkträgheit); BACHMANN (wieAnm. 695) 77 f. (Unterhaltungsbedürfnis und Hang zum Anekdotischen im Schulbetrieb seit der Spätantike); SMALLEY,Friars 42 (Tendenz zur Zurückdrängung bekannter biblischer Beispiele zugunsten neuer, anekdotischer bei den predigendenBettelmönchen).
464
Auf der einen Seite der Traditionskombinatorik finden sich antikisierende Travestien christlicher undaktueller Problematik. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Institutio Traiani, eine meisterhafte literarischeFiktion mit scheinbarer interpretatio christiana, in der Johann den vermeintlichen Kronzeugen Plutarch nurauftreten läßt, um kirchenpolitisch so brisante Themen zu beleuchten wie die göttliche Herkunft der respublica und den Vorrang der Priesterkirche vor aller irdischen Macht.922 Er hätte Dutzende von besser
922 Das Quellenproblem der Institutio Traiani (Pol. V VI) ist vielleicht noch nicht restlos, aber für meine Policraticus-Interpretation hinreichend geklärt: Man mag weiterhin über die noch unbewiesene und wenig wahrscheinliche, freilich nichtauszuschließende Hypothese debattieren, daß Johann aus irgendeinem (möglicherweise sogar pseudo-plutarchischen) Exzerpt-und Florilegmaterial (das nach den bisherigen Vorschlägen in dem weiten Zeitraum vom 4. zum 9. Jh. irgendeinmalenstanden sein soll) irgendwelche Stellen ausgeschrieben habe. Davon bleibt die am Text nachweisbare Tatsache unberührt,daß er vor allem seinen eigenen Ansichten mit „den großen Namen“ Plutarch und Trajan aufhelfen, d. h. einen autoritativen,würdigen Rahmen geben wollte. „Uns liegt hier im wahrsten Sinne des Wortes Johanns eigene Staatsdarstellung vor“(ROUSE/ROUSE, Tyrannenmord [wie Anm. 468] 249), aber in einer eigenartig „archaisierenden Inszenierung“ und„kulturellen Verkleidung“ (G. DUBY, Die drei Ordnungen, Das Weltbild des Feudalismus, übs. G. OSTERWALD,Frankfurt a. M. 1981, 384). Man kann wie in so vielen anderen Passagen dieses Meisters der Kunst der „Autoren-Verdauung“(s. oben §§ 84–89), dem vor allem bestehende Kompilationsliteratur heterogenster Herkunft hilfreich war (S. 416), natürlichauch hier ein Stück literarisch-gelehrter Einlegearbeit vermuten und deren Komponenten weiterhin zu rekonstruierenversuchen. Dies ist aber etwas völlig anderes als die Behauptung, Johann habe wirklich mit einer ‚Institutio Traiani’betitelten und Plutarch zugeschriebenen Vorlage wie mit einem vermeintlichen Klassikertext gearbeitet. Gegen die fundiertenund bis 1977 auch ziemlich unangefochtenen Argumente LIEBESCHÜTZ’ zugunsten der Fiktion im genannten Sinn hat M.KERNER mit viel Scharfsinn und Einfallsreichtum eine Reihe von Gegenargumenten vorgebracht und den Gelehrtenstreitneu in Gang gebracht (KERNER 180 f.; ders., Institutio [wie Anm. 783] mit erschöpfendem Forschungsbericht). Nachsorgfältiger Überprüfung aller Gründe pro und contra habe ich den hierzu vorbereiteten Exkurs wieder ad acta gelegt, da ichden neuesten, philologisch überzeugenden Analysen von J. MARTIN, die den Fiktionscharakter der Institutio erneut miteiner erdrückenden Zahl von Argumenten plausibel machen, nichts Wesentliches beizufügen habe. Zu einer Einzelheit:Johanns Aufforderung an den Leser, die Institutio selbst zu lesen, s. oben Anm. 462; MARTINS Arbeiten, sind obenAnm. 29 und 462 erwähnt; vgl. vor allem den letzten Beitrag im Kongreßbericht: The World of John of S. von 1984 (wieAnm. 842). KERNER hat sich ebenda 203–6 nochmals mit „Randbemerkungen“ zu Wort gemeldet, in denen ich allerdingskeine neuen Argumente zu entdecken vermag. Der wiederholte Hinweis auf die Arbeit von Saverio DESIDERI, La ‚InstitutioTraiani’, Genua 1958, ist ein unglückliches argumentum ab auctoritate, da diese Arbeit als ein Musterbeispiel fehlgeleiteteraltphilologischer Quellenmonomanie auf mediävistischem Gebiet gelten kann. (DESIDERI gibt unter der petitio principiieiner echten ‚Institutio Traiani’ eine Fragmente-Sammlung kritisch heraus, ohne sich gebührlich für die Intention desmittelalterlichen Autors zu interessieren.) Die von MARTIN neubefestigte These LIEBESCHÜTZ’ scheint sich im übrigenauch weitgehend durchgesetzt zu haben (vgl. allein in ‚The World of John of S.’ den Forschungsbericht von D. LUSCOMBE28, 32 f., sowie THOMSON 118, SALTMAN 358). Den wichtigsten Punkt an der Argumentation KERNERS hebtallerdings (ebd. 305) STRUVE nochmals hervor: Die in einer frühmittelalterlichen Justinian-Einleitung vorkommendenseltenen officia-Bezeichnungen für Beamte des spätrömischen Reiches, die Johann in seinem (bzw. „Pseudo-Plutarchs“)Vergleich mit den Körpergliedern verwendet. Auf denselben Punkt weist vorsichtig auch DUTTON, Civitatis exemplum (wieAnm. 878a) 87, 109 f. hin, um zu betonen, daß Johann seine ungewöhnlich vielgliedrige Ausgestaltung des organologischenGleichnisses, das in der Substanz aus dem Timaios-Kommentar des Chalcidius, bzw. aus dessen Tradition stammt, nochzusätzlich einer anderen unbekannnten Quelle verdanken müsse. In dieser unbestimmten Form (wobei ich statt Quelle eherQuellen sagen würde) bleibt die auf rechts- und verwaltungsgeschichtliches Gebiet führende (erstmals von DESIDERIvorgebrachte) Hypothese in der Tat weiterhin erwägenswert. Doch an Stelle der Suche nach einer bestimmten Institutio, diesich als ein ähnliches Phantom herausstellen könnte wie die „Gerüchte“ um Caecilius Balbus, Flavian oder Ciceros De republica (S. 413 f.), wären Bemühungen auf der „langue“-Ebene angezeigter d. h. zunächst einmal Wortschatzuntersuchungenim Umfeld der frühmittelalterlichen und zeitgenössischen gelehrten Literatur zur Justinianischen Gesetzgebung, insbesonderebei den Glossatoren, was überdies die noch weitgehend ungeklärte Frage nach Johanns Beziehungen zu den italienischenLegisten erhellen könnte (s. Anm. 564). Anregend ist auch der Vorschlag, den geistigen und literarischen Hintergrund eineretwaigen Vorlage Johanns im Umkreis der Investiturstreitschriften zu suchen; vgl. M.L. PALLADINI, Rez. von DESIDERI,in: Latomus 19 (1960) 156–9; EBERHARDT (wie Anm. 264) 310 f. – Max KERNER hat im übrigen für den Kongreß derMGH: „Fälschungen im Mittelalter“, München, September 1986, den wohl neue Resultate zeitigenden Vortrag: „DieInstitutio Traiani“ angekündigt. – Es gehört zu den Ironien der Überlieferungsgeschichte, daß der „einzige im 14. Jh.bekannte Plutarch“ der durch den Policraticus „popularisierte Pseudo-Plutarch“ war (so LINDER [wie Anm. 321] 33), daßwahrscheinlich Petrarca (obwohl dies mit m. E. dürftigen Argumenten bestritten wurde) und sicher Salutati glaubten, eine
465
bekannten und zudem christlichen Zeugnissen für dieselben Reformideen anführen können. An Stelle derberühmten antikisierenden Rahmenmetapher vom Staatskörper hätte er auch das übliche ekklesiologischeBild vom corpus Christi mysticum ausgestalten können. Daß er solches nicht tut, beweist sprechend, wiewichtig ihm der Nachweis ist, daß selbst ein so zeitnaher und anscheinend klerikaler Standpunkt dernachgregorianischen Kirchenreformpolitik des 12. Jahrhunderts schon immer und überall, also zum Beispielin der Welt Plutarchs und des guten Kaisers Traian, richtig war; daß es sich dabei um eine zeitlose Wahrheithandelt.
Denn „Wahrheit“ ist für Johann in einem idealen Sinn „naturhaft“ und darum zeitlos. Sie ist so unabänderlichund immergültig wie die aristotelischen Gesetze des Denkens oder die platonische Harmonie des Kosmos. Dielogischen und kosmologischen Prinzipien sind nicht nur philosophische
gute lateinische Plutarch-Übersetzung zu benützen und sich in Wahrheit auf Johanns Institutio Traiani stützten. Dazu vgl.R.B. DONOVAN, Salutati’s Opinion of Non-Italian Latin Writers of the Middle Ages, in: Studies in the Renaiss. 14 (1967)185–201, hier 194. Vgl. auch unten Anm. 1014. (Nachtrag: In den erwähnten Kongreßakten der MGH habe ich michmeinerseits nochmals zur Institutio-Frage geäußert: Fictio auctoris, Eine theoriegeschichtliche Miniatur am Rande derInstitutio Traiani).
466
Theoreme der Antike, sondern objektive Axiome der von Gott gewollten guten Schöpfungsordnung. Darumhaben sie auch eine eigene christliche Verbindlichkeit für den Menschen und die Gesellschaft. Natur ist nichtnur ein nachzuahmendes, sondern ein wiederherzustellendes Maß. Nachdem der „babylonisch“ verwirrteMensch in ideologische Zersplitterung und Wandelbarkeit gefallen ist, gilt es, diese „Natur“ als ein verlorenesLeitbild, als die Norm des „Einen“, der aequitas, der Herrschaft alles Oberen über alles Untere, immer wiederneu zu suchen und zu verwirklichen.923
923 Zum Körpergleichnis vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 43 ff., 129; ders., Das zwölfte Jh. 265; KANTOROWICZ (wieAnm. 640) 94, 198 f., 207 f.; PEIL (wie Anm. 412) 307 ff.; DUBY (wie Anm. 922) 384 f.; Tilman STRUVE, DieEntwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter (Monogr. z. Gesch. d. MA’s 16) Stuttgart 1978, 21 ff.;ders., Vita civilis naturam imitetur. Der Gedanke der Nachahmung der Natur als Grundlage der organologischenStaatskonzeption Johannes von Salisbury, in: HJb. 101 (1981) 341–61; ders., Pedes rei publicae. Die dienenden Stände imVerständnis des Mittelalters, in: HZ 236 (1983) 1–48; ders., The Importance of the Organism in the Political Theory of Johnof Salisbury, in: The World of John of S. 303–18, bes. 312 ff. zur Beziehung des aequitas-Ideals der kanonistischenNaturrechtslehre mit platonischem Gedankengut im Umkreis Wilhelms von Conches; STÜRNER (wie Anm. 516) 119 ff.;ders., Gesellschaftsstruktur (wie Anm. 412) 162 ff.; vor allem aber DUTTON, Civitatis exemplum (wie Anm. 878a)bes. 108 ff.: Johanns organologische Metapher ist wesentlich bestimmt durch das neue Interesse am Timaios-Fragment unddessen Kommentar von Chalcidius (neben andern platonischen Informationen bei Macrob und Apuleius) sowie durch diedarauf bezügliche Diskussion über die richtige hierarchische Ordnung (oder „Herrschaft“) in menschlicher Psyche, Kosmosund Gesellschaft, wobei die verbreitete Dreistufenordnung im Pol. aufgrund primär ethisch-politischer Fragestellung einemvielgliedrigen (der Vielfalt arbeitsteiliger Gesellschaft angemessenerem) Modell weicht. Vgl. A. 965: Hierarchie der officia;§ 48, S. 441 ff., 574 f.: platonischer Hintergrund; Anm. 882: aequitas und Naturideal; S. 175, 420 f.: Bienengleichnis alspolitische, aber auch bildungstheoretische Analogie zum Körpergleichnis; Anm. 852: Körpergleichnis für die Bildungspflege.Auch die Menenius Agrippa-Fabel vom Magen (S. 224 f.) gehört zu dieser Naturspekulation, obwohl Johann dabei dasVerfahren und das antike Exemplum in ein kirchengeschichtliches Gewand kleidet. Zur Zeitlosigkeit der Wahrheit und zurbabylonischen Wissenschaftszersplitterung vgl. S. 303, 582. Zum Herrschaftsbegriff als Grundlage des Policraticus-Titelsvgl. §§ 118 f. – Die konkrete, keineswegs „harmonische“ Zeitsituation am Vorabend des Becket-Konflikts mußzusammengesehen werden mit der ganz spekulativen Idee der Natur-Hierarchie im Pol., damit die Spannung vonBestehendem und Wünschenswertem romantischnostalgische Verzerrungen dieses Natur- und ordo-Denkens zum mal.„Weltbild“ verhindere (vgl. in diesem kritischen Sinn auch STOLLBERG (wie Anm. 577) 160 und unten S. 554 f.).
467
Ein anderes zentrales Thema seiner beiden Werke, die Wissenschaftskritik, hätte Johann mühelos aufbiblische Stellen wie das paulinische Wort vom „aufblähenden Wissen“ (I Kor. 8.1) oder die evangelischeVerurteilung des Schriftgelehrtendünkels stützen können, umso mehr, als ihm der religiöse und metaphysischeSinn der Demut und Ehrfurcht vor den Geheimnissen göttlicher Wahrheit durchaus am Herzen liegt. Doch erbekennt sich, wie gezeigt, vornehmlich mit Cicero zur Schulrichtung der skeptischen mittleren Akademieoder mit Seneca zum Vorrang der praktischen Philosophie gegenüber aller selbstzwecklichen und müßigencuriositas:924 kaum nur aus literarästhetischen Gründen – etwa weil die passenden Bibelstellen zuabgedroschen klangen, das antike Gewand eleganter, die ungewohnte Form rhetorisch wirksamer schien –,sondern vornehmlich aufgrund der ihn faszinierenden Entdeckung substantieller Analogien zwischenheidnischer und christlicher Weisheit.
924 Vgl. oben S. 171, 178, 186, 251, 301 ff., 307 f., 360 ff., 391 f., 452…
468
99. Gerade diese Überzeugung erklärt auch den zweiten Verfremdungsmodus beim wechselseitigen Vertauschender Sprachcodes: Johann liebt neben der antiken Form für christliche oder kirchenpolitisch aktuelle Themenebenso, wenn nicht noch stärker, die christliche Einkleidung antiker und nicht spezifisch christlicher Gehalte.Das bekannteste Beispiel bildet hier die gedanklich aus Cicero stammende, aber vorwiegend durch biblischeund christliche Exempla und Zitate untermauerte Tyrannenmordtheorie. Die Methode wird ausdrücklichbegründet:925 „Doch, damit die Geltung der römischen – meistens von Ungläubigen über Ungläubigegeschriebenen – Geschichte nicht entwertet werde, soll dasselbe (Argument) durch Beispiele der göttlichenGeschichte der Gläubigen bestätigt werden“. Auch diese Formulierung zeigt, daß Johann weniger an derherkunftsmäßigen Abgrenzung als an der Austauschbarkeit der Beweismittel liegt, damit sein eigenesBeweisziel größere Überzeugungskraft erlange. Im gegebenen Fall ist dieses Beweisziel inhaltlich gewiß nichtpagan, um dies nur anzumerken: Die in ihren Konsequenzen modern scheinenden Erwägungen zumTyrannenmord erklären sich wesentlich aus Johanns kirchenpolitischer Stoßrichtung. Den Versuchen, mit neubelebten römisch-rechtlichen Ideen die Gesetzesunabhängigkeit des Königs zu legitimieren, sollte ein mitanderen römischen Beweisgründen gebildetes Gegengewicht entgegengestellt werden. Zu postulieren war dieUnterwerfung des Fürsten unter das „göttliche Gesetz“ und damit indirekt unter die Ansprüche dernachgregorianischen Reformkirche.926
925 Vgl. Reg. s. l. Tyrann. Pol. VII 17, (II) 160 ff.; VIII 17, VIII 20, 372 ff.; Pol. III 15, 232 f. DELHAYE, Le bien (wieAnm. 385) 220: „Ici Jean de Salisbury dépasse très largement les thèses chrétiennes pour adopter un doctrine païenne. Et parparadoxe, il en appelle plus explicitement ici a l’autorité des Ecritures ou des auteurs chrétiens“. Ähnlich auchLIEBESCHÜTZ, Humanism 109 f.; KERNER 188. – Zitat in Pol. VIII 20, (II) 373.5 ff.: Sed, ne Romanae historiaevilescat auctoritas, quae plerumque ab infidelibus et de infidelibus scipta est, hoc divinae et fidelis historiae comprobeturexemplis.926 Zur historischen Situierung der Tyrannenmord-controversia vgl. R. FOREVILLE, Naissance d’une conscience politiquedans l’Angleterre du XIIe s., in: Entretiens sur la Renaissance du XIIe siècle, (wie Anm. 28) 179–208, hier 194 ff.;GARFAGNINI, Legittima potestas (wie Anm. 726) passim; van LAARHOVEN (wie Anm. 726) passim; ROUSE/ROUSE,Tyrannenmord (wie Anm. 468) 253 ff. – Zur Kontroverse um die legistische Interpretation der These princeps legum nexibussolutus (einer Frühform absolutistischer Ideologie) und die kanonistischen Gegenpositionen, die ebenso römisches Rechtinvolvierten, vgl. S. 326 f., 571, A. 882, 971, 993; KERNER 150; CLASSEN, Studium (wie Anm. 4) 27 ff.; BERGES(wie Anm. 640) 49 ff., 134 f.; KANTOROWICZ (wie Anm. 640) 94 ff.; D.E. LUSCOMBE, The State of Nature and theOrigin of the State, in: KRETZMANN (wie Anm. 586) 757–70, bes. 767 f.
469
Zum literarischen Verfremdungsverfahren ist die Feststellung wichtig, daß Johann das Thema des legitimenTyrannenmords allein aus der römischen Antike, nicht aus dem neuen Testament bezieht, daß er es übrigensnur vorsichtig in utramque partem wendet,927 als eines unter anderen Argumenten dem erwähntenpolitischen Ziel dienstbar macht; aber gerade weil diese Vorstellung ideologisch heikel, mit christlichenBelegen nur schwer zu untermauern ist, holt er paradoxerweise alles, was an biblischen, vor allemalttestamentlichen Stellen und Exempla aufzutreiben ist, heran und steckt so in der Tat Heidnisches in einchristliches Gewand.
Als einziges Beispiel aus diesem Zusammenhang sei die Geschichte von Judith und Holofernes erwähnt.Johann verschweigt das moralisch Bedenkliche der Tatumstände nicht, beschwört vielmehr die geradezukriminelle Verstellungskunst der mulier fortis in rhetorischen Fragen:928 „Was läßt sich Hinterhältigeresaushecken? Was läßt sich Betrügerischeres sagen?“. Dennoch bezieht er das Exemplum, ohne auf dietraditionellen heilsgeschichtlichen und typologischen Deutungen auch nur anzuspielen, unmittelbar auf diebewußte, eher brisante politische Moral, die er unter der Kapitelüberschrift zur Diskussion gestellt hat:929
„Daß es aufgrund biblischer Autorität erlaubt und ruhmvoll ist, öffentliche Tyrannen umzubringen.“
Weniger bekannt als das Tyrannenmordkapitel, aber nicht weniger aufschlußreich ist die ausführlicheDarstellung einer höfisch-humanistischen Anstandslehre
927 Vgl. Anm. 726.928 Pol. VIII 20, (II) 377.18 f.: Quid quaeso insidiosius excogitari, quid captiosius dici potest hac misitici dispensationeconsilii?929 Ebd. Überschrift 372: „Quod auctoritate divinae paginae licitum et gloriosum est publicos tirannos occidere“. DieKombination dieses Zitats mit der in Anm. 928 zitierten Stelle zeigt die Ambivalenz der Tyrannenmordidee (vgl. Anm. 726)noch von einer anderen Seite: Judiths Tat ist als dispensatio mystici consilii, d. h. durch den sensus spiritualis „absolviert“(dispensatio = relaxatio iuris; vgl. unten Anm. 1030), und dieser „Sinn“ liegt dem Kontext gemäß in der gerechtenVorsehung Gottes, die auf vielfältige Weise Tyrannen bestraft, sowie in Judiths Gottvertrauen und Mut, die ihr erlaubten,mystice in die Rolle der Fleischeslust zu schlüpfen (usa est luxuria aliena). Ihre Tat erscheint jedoch als diskutabler Grenzfall(analog zum Kindermord des Brutus, S. 351 f.), da sie als negativer Pol mit dem Vorbildexemplum David, der in ähnlicherLage den Tyrannen Saul gerade nicht umgebracht hat, konfrontiert wird (378.10 ff.). – Zu dem merkwürdigen historischenEreignisbegriff des MAs, nach dem Handlungen nicht in der rein historischen Dimension vorstellbar waren, sondern immerauch als „für uns“, „zu unserem Nutzen“, für die „kommenden Leser“ geschehen, ja (mystisch oder moralisch) sogar„intendiert“ gelten sollen vgl. S. 538. Zu Johanns Gebrauch der Antithese sensus litteralis/ mysticus vgl. auch S. 456, 471,475 f.
470
mit biblischen Mitteln.930 Es gibt wohl kein Gebiet, über das das Neue Testament weniger Aufschluß gibt alsüber civilitas, vornehme Tischsitten, geziemendes Scherzen und gefälliges Auftreten. Johann von Salisburygelingt es jedoch im 8. Buch des Policraticus aus Bibelstellen eine Art Cortegiano herauszudestillieren.Christus erhält hier Prädikate, die uns eher auf einen leutseligen und geistreichen Fürsten zu passenscheinen:931 Er ist quovis philosopho
930 Pol. VIII 8–10, bes. VIII 9 (II) 279 mit der Überschrift: Quod etiam in sacra Scriptura sunt optimae civilitatis regulae.Abgesehen von dem Aperçu HUIZINGAS (wie Anm. 31) 194, 210 f. („für ein urbanes Christentum“) wurde dieser Teil desPolicraticus eingehender gewürdigt nur von SUCHOMSKI 46 ff. – LIEBESCHÜTZ (Humanism 93) sieht in derzugrundeliegenden Gleichsetzung von urbanitas mit civilitas einen Beweis dafür, daß „John … failed completely to recoverthe original meaning of the words civilis and civitas which referred to a man’s political activities“. Dies ist ein schwaches esilentio-Argument; abgesehen von der bereits antiken Zweitbedeutung civilis = urbanus, trifft es sachlich nicht zu: vgl. obenAnm. 412 (vita civilis), 882 (vita civilis naturam imitetur). Auf der Gegenseite ist eine Deutung wie diejenige ODOJS (117)genauso übertrieben, die Pol. VIII 9 als ein Zeugnis für eine frühe Form des „civic spirit“ im Sinne Hans BARONS inAnspruch nimmt. In einem ganz anderen Sinn ist das hier vorgestellte Ideal der humanitas, urbanitas, civilitas, iocunditas,hilaritas, gravitas und verecundia durchaus humanistisch, obwohl nicht all diese Begriffe altrömisch klingen: vgl. RIEKS(wie Anm. 774) 119 ff.; KLINGNER, Humanität und humanitas, in: Röm. Geisteswelt (wie Anm. 160) 704–46, hier720 ff.; von MOOS, Hildebert 149 ff., 264 ff. (zu einer im Ansatz ähnlichen Anstandslehre). Vgl. S. 312, 315, 577 ff., zumIdeal „tugendhafter“ Verstellungskunst (insinuatio, calliditas) des Intellektuellen am Hof S. 356 f., 402, 407 f. zur„Symposienliteratur“. Interessant ist die Kombination des politischen und des moralisch-urbanen (kultivierenden) Charaktersvon civilitas in der auf Cicero zurückgehenden Rhetorikdefinition Radulfs von Longchamp (wie Anm. 508) 137, 139: Genusartis rhetoricae est qualitas ipsius artificis secundum eius effectum, videlicet quod artificium ipsum est pars civilis scientiaemaior. Est enim civilis ratio quidquid rationabiliter tota civitas dicit vel agit […] Ad multam utilitatem […] inchoata estrhetorica sicut insinuat Tullius in primo Rhetoricae [Inv. I 2]: Dicit enim quod in principio mundi homines bestiales erantet rudes, in quo tempore ‚vir quidam magnus et sapiens’ cepit uti eloquentia, ruditatem depulit et homines ad rectevivendum aggregavit <et> […] congregatis iura recte vivendi monstravit. Vgl. Anm. 1125 zu Ähnlichem in Met. I 1.931 Pol. VIII 9, (II) 279.22; ebd. 281.25 f. – Zur Begründung eines dezenten christlichen Humors trotz der verbreitetenAnsicht vom nicht lachenden Jesus vgl. CURTIUS, ELLM 422; SUCHOMSKI 44 ff. (bes. zu Pol. V 6, 305 f.); vonMOOS, Hildebert 150 ff.; JAEGER, Origins (wie Anm. 577) 136 ff., 161 ff.; WEHRLI (wie Anm. 55) 177 ff. – Ähnlichhebt Johannes von Garlandia in dem De curialitatibus in mensa conservandis überschriebenen Kapitel seines Moralescolarium (ed. L.J. PAETOW, Berkeley 1927) p. 205, c. IX v. 191–2 den vorbildlichen Witz Christi hervor: Est deus advota pius ipse facetia tota/Hunc imitare…
471
civilior und liberalissimus et civilissimus aut facetissimus paterfamilias. Die Methode, die Johann erlaubt,Anstandsregeln aus dem Evangelium abzuleiten, besteht hauptsächlich darin, parabolisch gemeinte oderüblicherweise allegorisch verstandene Stellen in origineller Weise wörtlich zu nehmen, was er auchausdrücklich verteidigt:932 „Obwohl sie einen spirituellen Sinn (mysticum sensum) haben, zeigen sie auf ihrerOberfläche dennoch die Grundprinzipien des Anstands.“
100. So werden Allegorien und Gleichnisse gewissermaßen durch „Re-Literarisierung“ zu Exempla: Dietörichten und klugen Jungfrauen lehren, daß man beim Gastmahl nur guten Umgang pflegen soll; der Mannohne Hochzeitskleid, der vom König hinausgeworfen wird, lehrt etwas über anständige Kleidersitten; das Festbei der Rückkehr des verlorenen Sohnes etwas über Tafelmusik. Die Vorschrift aus Lukas 14.8, man solle sichnicht an den obersten Platz setzen, um hinterher nicht zum untersten herabkomplimentiert zu werden,bezieht sich nun auf die korrekte Sitzordnung. Christus selbst hat gelehrt, daß man den Dank gleich zu Beginndes Gastmahls aussprechen soll, da er das Brot, bevor er es brach, segnete.933 Man sieht, wie durch dasWörtlichnehmen traditionell übertragener Bedeutungen eine Verfremdung, d. h. neue Uneigentlichkeitentsteht, für die sich weder in der Rhetorik noch in der Schriftsinntheorie ein Fachterminus anbieten dürfte.
Schaarschmidt, der in manchem noch heute unübertroffene Kenner Johanns, hatte auf diese Kuriositäthingewiesen, wobei seine Bewertung der „allegorisierenden“ Verfahren auf den heutigen Mediävisten je nachStandpunkt erfrischend oder unangenehm wirken mag:934 „[…] in dem Maß, als dem Mittelalter dereigentliche historische Sinn abhanden gekommen ist, nimmt überhaupt das willkürliche, maßloseAllegorisieren zu, mit dem man seine politischen und philosophischen Anschauungen subjektiver Art in dieheilige Schrift hinein zu interpretieren im Stande ist. Auch Johannes bedient sich dieser Freiheit […], aberthut noch einen weiteren Schritt vorwärts. Nicht allein, daß er die Bibel in seinem Sinne allegorisch umdeutet,er wendet auch die umgedeutete Bibel auf seine Zeit und deren Verhältnisse direct an.“ Solch „direkte“Anwendung nennt Johann selbst „oberflächenhaft“, d. h. literal, im Gegensatz zu „mystisch“. Sensus litteralisist also nicht nur eine
932 Pol. VIII 9, (II) 280.4 ff., 23 ff.: Et licet religionis potius quam civilitatis videatur edictum, ego religionis formam acivilitate non divido, cum nichil civilius sit quam cultui virtutis insistere […] Haec autem, licet misticum habeantintellectum, nichilominus in ipsa superficie civilitatis praeferunt rudimenta. Nam et illud quidem fideliter sonat ad litteramquod Apostolus praecipit… (I Cor. 5.11 gegen Grobheiten und Beschimpfungen).933 Pol. VIII 9, (II) 279.19–280.23, 281.23–282.1.934 SCHAARSCHMIDT 127 f.
472
unzweideutige, „buchstäbliche“ Erstbedeutung, die auf den höheren Schriftsinnebenen tropologisch,allegorisch, anagogisch erst noch vervielfacht werden müßte; für Johann bildet er umgekehrt gewissermaßenauch das Residuum dessen, was nach Abzug des Überbaus verästelter, spiritueller Sinnbezüge übrigbleibt: dennicht-geistlichen, den „amystischen“ Sinn. Dieser Sinn ist seinerseits das Ergebnis einer Interpretation underscheint uns insofern (in allgemein-rhetorischen Begriffen gesprochen) als eine höchst „übertragene“Redeweise, ja, als ein eigentlich allegorisches alieniloquium, gleichviel, ob er nach mittelalterlicherbibelexegetischer Begrifflichkeit „literal“ heißt. (Erst im Spätmittelalter dürfte dafür der präzisere Terminussensus litteralis figuratus geprägt worden sein.) Was Johann einfach Literaldeutung nennt, und was uns alsmanifestes, eher subjektives (wenn man will: „poetisches“) Hineinlesen höfischer Regeln des „savoir vivre“in die Gleichnisse Jesu (nach dem Modell „moralischer“ Ovidallegorese) erscheint, darf als symptomatischesZeichen für eine Grundtendenz des 12. Jahrhunderts verstanden werden: In einem der traditionellen(integrativ anpassenden und sinnreduzierenden) Allegorese heidnischer Literatur gegenläufigenAdaptationsverfahren wird nun die Bibel so sinnerweiternd gelesen, daß sie antiker und allgemein humanerWeisheit entspricht.935 Der Absicht nach galt diese Methode zweifellos
935 Zum sensus litteralis s. oben Anm. 932. Es handelt sich hier nicht einfach um das, was der biblische Autor sagen wollte(so etwa, nach Hugo von St. Victor, SMALLEY, Study of the Bible [wie Anm. 321] 93 ff.; s. aber auch oben Anm. 802),sondern um das, was die Bibelstelle als Teil eines auf allen Ebenen inspirierten Buchs „vorallegorisch“, im Erstsinn „meint“.Die im späteren MA geläufige Unterscheidung von proprie und figurate dicta innerhalb des sensus litteralis (s. obenAnm. 912; MINNIS, Authorship 73, insbesondere zu einer Warnung Wilhelms von Ockham vor naiver Verwechslung desallegorischen Sinns mit einem bloß übertragenen Literalsinn) erwähnt Johann nirgends und dürfte sie auch nicht gekannthaben; jedenfalls zeigt seine Praxis eher die beanstandete unreflektierte Verwechslung von proprie und figurate. – Zumsinnerweiternden Verfahren vgl. JEAUNEAU, Lectio 179: in einem „choc en retour“ wird die Gewohnheit, Profantexte nurnoch allegorisch zu verstehen, auf die Bibel zurückübertragen. E.R. DODDS (Pagan and Christian in an Age of Anxiety,Cambridge 1965, 130) sieht Ähnliches bereits in der platonisierenden Umdeutung des Neuen Testaments in der christlichenSpätantike aufgrund jener allegorischen „art of twisting texts“, mit der immer schon Homer gelesen wurde. Der subjektiveCharakter der sog. Literaldeutung Johanns bestätigt auf der anderen Seite, daß gerade ein allegorischer Sinn als dereigentliche, objektive, offenbarungsmäßige Sinn einer Bibelstelle gelten konnte (vgl. §§ 87, 101, S. 177 ff., 323 ff., 396 ff.,455 ff., 539). Man pflegt mal. Allegorie von barocker Emblematik gerade dadurch zu unterscheiden, daß in ersterer diespirituelle Dingbedeutung als verbindlich vorgegeben, nicht als kombinatorisch beliebig herstellbar gilt (vgl. MICHEL [wieAnm. 910] 536 f.). Umso weiter ist dafür das mal. Spielfeld der literalen Ebene, auf der sich Bedeutungen konstruierenlassen, die mehr mit emblematischer Subtilität als mit historisch-philologischer „Jota-Bibelexegese“ zu tun haben.
473
als eine bisher vernachlässigte Zurückführung biblischer Aussagen auf ihren universalen Kern und eigentlichenPrimärsinn; für uns besteht trotzdem kein Zweifel, daß damit eine zuvor über die Bibel gestülpte littera ineinem keineswegs notwendig biblischen Sinn „allegorisch“ ausgelegt wird.
Auch die oben eingehend besprochene humanistische Abwandlung der Natur-Buch-Vorstellung ist einederartige Reliteralisierung oder doppelte Allegorese: Auf einer ersten Umsetzungsstufe wird derSchöpfungskosmos zum Buch; in der zweiten wird dieses bereits allegorische oder metaphorische Buch derNatur auf die Bücher der Kultur zurückübertragen. Dieses Hin und Her zwischen erster und zweiterBedeutungsebene ist hier besonders aufschlußreich, weil damit zugleich argumentativ die multiplicitas der„Lektüren“ und Lesarten so verteidigt wird, daß auch der mehrfache Schriftsinn als in den Dienst einerSteigerung rhetorischer copia gestellt erscheint.936 Einige weitere Beispiele mögen die ungewohnteRückbindung üblicher spiritueller, allegorisch-typologischer Konnotationen an einen politisch, ethisch oderbildungstheoretisch auslegbaren „Literalsinn“ beleuchten.
Das Exemplum des Herodes, der den Vorläufer Jesu, Johannes d. T., der „Tänzerin“ zuliebe enthaupten ließ –auferendo praeambulum gratiae veritatis occidendo praeconem – lehrt hier ex negativo, daß unsittlicheVersprechen nicht gehalten werden müssen.937 Die geistliche Wortwahl ändert nichts an dem reinmoralischen historia docet, das dem einfachen Literalsinn, einem Nebensinn der traditionellen Exegeseentnommen wird. Der Anklang an die spirituelle typologische Bedeutung dient dabei eher der rhetorischfeierlichen Hebung des Arguments. – Über Intrige und Schmeichelei redend, bringt Johann Beispiele für dieTatsache, daß Verführer und Verführte, Betrüger und Betrogene zueinander passen, so etwa Labienus undCaesar, Kleopatra und ihre Liebesopfer Caesar und Antonius usw. Daß aber e contrario die effizientesteVersuchung an der ihr entgegengesetzten Tugend der Unbestechlichkeit scheitert, zeigen Augustus derselbenKleopatra gegenüber, Odysseus vor den Sirenen und Christus vor den Pharisäern (nach Matth. 22.16 ff.).938
Im Zusammenhang mit der Bildungs- und Erkenntnistheorie, bzw. den ethischen Voraussetzungen für dieWahrheitserkenntnis empfiehlt Johann eine emotionslos offene Frage- und Diskussionsbereitschaft undverteidigt dabei sein zentrales Ideal „akademischer“ Skepsis gegen die Laster des Zorns und der Rechthabereimit Cicero, den Disticha Catonis, aber auch mit neutestamentlichen Beispielen jüdischer Halsstarrigkeit. DerWehruf Jesu – veritas ipsa incarnata – gegen die unbußfertigen Städte Chorozaim und Bethsaida
936 Vgl. § 107, S. 424 f.937 Pol. III 11, (I) 208.1 ff. nach Matth. 14.3 ff.938 Pol. III 10, (I) 204.22 ff.
474
(Apg. 7.51), sowie der allegorische Bezug auf den Vorhang oder Schleier (velum), der den Juden die Wahrheitnoch immer verdeckt, für die Christen aber beim Kreuzestod Jesu im Tempel „von oben bis unten zerrissenist“ (Matth. 27.51) und der seither den Blick auf die Wahrheit freigibt, dienen hier einzig der moralischgemeinten Warnung vor Verbohrtheit bei der wissenschaftlichen inquisitio veritatis.939 – In dem berühmtenKapitel über die sechs claves discendi nach Bernhard von Chartres: –
„Sinn voll Demut, Eifer der Suche, ruhiges Leben,Schweigende Forschung, fremd im Land und ohne Besitz sein“
– wird der „Lernschlüssel“: terra aliena oder „Exil“ mit den alttestamentlichen Beispielen Abrahams, Jakobsund des ungleichen Paars Rachel und Lea in mehr oder weniger verschlungener Weise auf das Thema desAuszugs in die Fremde bezogen und tropologisch illustriert.940 Ähnlich wird der zweite Schlüssel, quaerendistudium (Bildungsbeflissenheit, Wissensdurst, Forschungsdrang) mit bibelallegorischen Bezügen wie derJakobsleiter ausgemalt.941
In einer Satire auf die Ehrsucht (ambitio) und deren in unmittelbarer Gegenwart sichtbare Folgen:Gewalttätigkeit, Korruption, Kirchenraub und Simonie, zählt Johann eine Reihe biblischer Exempla inallusiver, die Bekanntheit voraussetzender Weise so auf, daß die Zeitlosigkeit und Wiederholbarkeit derEreignisse rhetorisch zur Geltung kommt. Die historischen Gestalten werden wie gegenwärtige dargestellt:942
„Der eine vertraut auf die vielen Reichtümer
939 Pol. VII 7, (II) 117.15 ff. mit Cic. Tusc II 2.5; Dist. Catonis II 4 gegen ira und pertinacia. Zur Verhüllungsmetapher fürden geistigen Schriftsinn vgl. SPITZ (wie Anm. 797) 37 ff. – Zur „akademischen“ Skepsis vgl. § 72, S. 167 f., 303 ff.940 Pol. VII 13, (II) 145.12–14 (übers. W. von den STEINEN, Kosmos [wie Anm. 664] 278): Mens humilis, studiumquaerendi, vita quieta,/scrutinium tacitum, paupertas, terra aliena,/haec reserare solent multis obscura legendo“. Dazu s.auch Hugo von St. Victor, Didasc. III 13–20; vgl. MICHEL, Culture et sagesse (wie Anm. 402) 527 f. und oben Anm. 562zu Abaelard. – Pol. VII 13, (II) 151 f. mit Gen. 12.1 ff.; 32.24 ff.; 29.6 f.941 Ebd. 148 f. unten in Anm. 995 f. zitiert.942 Pol. VII 17, (II) 160 ff.: De ambitione et quod cupiditas stultitiam comitatur; et quis sit ortus tirannidis;ebd. 163.12 ff.: Alius sperans in multitudine divitiarum, Simone ducente ingreditur, non inveniens ibi qui eum et pecuniamsuam ire iubeat in perditionem. Alius in muneribus ad Petrum reformidat accedere; clanculo tamen per impluvium auri acsi per tegulas Iupiter illabatur in gremium Danes, sic in sinum Ecclesiae procus descendit incestus. (vgl. Apg. 8.18 ff.;Terenz, Eun. III 5.41 ff.; oben Anm. 424) – Zum Aspekt der Zeitlosigkeit und Wiederholbarkeit von Exempla s. unten§ 108, 000. Zur metaphorischen Aktualisierung historischer Exempla als gegenwärtige Gestalten vgl. auch Anm. 653, 949sowie GURJEWITSCH (wie Anm. 313) 127 und CURTIUS, ELLM 104 ff. zu satirischen Adynata der „Zeitklage“ (wieCato als Schlemmer, Lucretia als Dirne, Kirchenväter als Säufer): eine spezifisch mittelalterliche Form des intentionalenAnachronismus.
475
und tritt, von Simon geführt, ins Haus, aber findet dort keinen, der ihn und sein Geld ins Verderben fahrenließe [Apg. 8.18]; ein anderer wagt es nicht, mit Geschenken offen vor Petrus hinzutreten, heimlich abergelingt es ihm mit Gold: Als würde Jupiter, in Goldregen verwandelt, vom Dach herab in den Schoß Danaesfallen, so steigt er als unzüchtiger Freier in den Schoß der Kirche hinab“. Auch ohne das eigentümlichemixtum compositum der profanen und geistlichen Quellen (Apostelgeschichte und Terenz) fällt auf, wie sehrdie biblischen Exempla in funktionaler Hinsicht den antiken gleichen. Ihnen fehlt alles Spezifische undUnterscheidende: etwa das steigernde Motiv der Typologie oder auch nur schon der unverwechselbareinmalige Charakter des historischen Ereignisses.943 Auch sie sind ad hoc einsetzbare rhetorischeVeranschaulichungsmittel, Projektions- und Identifikationsfiguren. – Ein Vergleich zwischen Abraham undden Emmaus-Jüngern ist eine Pseudotypologie ohne echte Steigerung, da beide Beispiele gleichgewichtigneben einer Reihe anderer antiker und biblischer Exempla großzügige, aber nicht „üppige“ Gastfreundschaft(im Gegensatz zur Schlemmerei oder zum Geiz unter dem heuchlerischen Gewand monastischer Askese)empfehlen sollen. Dieser moralische Kern verbirgt sich jedoch hinter durchaus spirituellem (demchristologischen Thema gemäßem) Wortlaut.944
101. Die angeführten Beispiele – nur eine kleine Auswahl aus dem Policraticus – beruhen alle auf einemliterarisch innovativen, aufmerksamkeitssteigernden Spiel mit den Bedeutungsebenen, das eine geradezuintime Vertrautheit mit der Bibel ebenso voraussetzt wie eine gewohnheitsmäßige Verfestigung undVerselbständigung gewisser Interpretationsweisen.945 Es scheint
943 Vgl. S. 457 f., 461, 333, 435 ff.944 Pol. VIII 13, (II) 323 f. (zum Kontext vgl. S. 446, 461 f.) mit Macrob. Sat. III 17.15; III 13.13 (Antonius triumvir),Gen. 18.2 (Abraham), Gen. 19.1 (Loth), Tob. II 1.2 ff. (Tobias), Luc. 22.29 (Jünger von Emmaus); 324.15 ff.: Discipuliquoque persuasionibus usi sunt, ut Dominum volentem ire longius hospitio detinerent, et nobis hospitalitatis formampraescribentes exemplo coegerunt eum, visique sunt ei locum cessisse primum quem postmodum agnoverunt Dominum infractione panis. Alias namque delicias, nisi qua forte necessitas exigebat, ei non legimus esse appositas.945 In diesen Zusammenhang gehören auch einige nach der Schriftsinntheorie als „tropologisch“ zu bezeichnende biblischeExempla, bzw. deren Auslegungen, die vorwiegend im Sinne politischer oder natürlicher Ethik ausfallen. Vgl. S. 468 undPol. IV 3, (I) 239 ff. zum kirchenpolitischen Thema der Unterordnung des Fürsten unter die Priester-Vorherrschaft: Nach denBeispielen Konstantin, Theodosius und Saul folgt Melchisedech als Vorbild uneigennütziger, nicht den sippschaftlich-dynastischen Interessen dienender Amtsausübung; abschließend wird die übliche typologische Dimension dieser Gestaltzugunsten der tropologischen ausdrücklich ausgeschlossen (241.18 ff.): Unde et Melchisedech quem primum Scriptura regemintroducit et sacerdotem – ut ad praesens mysterium taceatur, quo praefigurat Christum… (vgl. auch §§ 102 f. zurreticentia). Darauf folgen unmittelbar die antiken Exempla Kodros und Lykurg (vgl. S. 486). – Zum Ausschluß der„spirituellen“ Deutungsebene s. unten § 103. – In Pol. IV 6, (I) 251 f. wird dem Fürsten die Gesetzestreue aufgrund derErfüllung des Levitischen Gesetzes durch Jesus und der darauf gründenden Achtung des Kirchenrechts durch Justinianempfohlen (vgl. dazu auch S. 494 ff., 514). In Pol. V 6 bildet die Geschichte Jobs den Kapitelrahmen für einen reinenFürstenspiegel (I 300–307). – Zur Zweigleisigkeit des Exemplums im sensus mysticus und im moralisch aktualisiertenproprie-Bereich vgl. auch DORNSEIFF 207 ff., 221 f.; KNAPP, Similitudo 182 f. Zum Variations-Spiel aufgrundverfestigter spiritueller Sinngebung vgl. den grundsätzlich anregenden Beitrag von Reinhold GRIMM: Von der explikativenzur poetischen Allegorese, in: Poetik u. Herm. IX, ‚Text und Applikation’, München 1981, 567–76, bes. 568 ff. zurWeiterentwicklung des allegorischen Zweitsinns zu einem neuen Primärsinn, der seinerseits wieder allegorisch ausgelegtwerden kann (im Zusammenhang mit mal. Paradieses-Auslegungen).
476
nicht, daß Johann oder seine Leser darin etwas Leichtsinniges oder gar Blasphemisches gesehen hätten.Schwieriger wird es für uns, das im Mittelalter unproblematische Spiel da noch nachzuvollziehen, woHeilswahrheiten in jedem, auch im historisch-literalen Sinn (wie der Kreuzestod Christi) in nicht-geistlicherWeise ausgelegt werden. Neben dem bereits zitierten Beispiel des Brutus, der seine Söhne um der res publicawillen nicht vor der Hinrichtung „verschonte“, und den Gegenbeispielen von Saul und Heli, die ihrelasterhaften Söhne aus privater Rücksicht vor Strafe „verschonten“, bringt Johann über das tertiumcomparationis jener allem dynastischen Eigennutz vorzuziehenden salus publica zuletzt noch Gott Vater, der„seinen eigenen Sohn nicht verschonte“.946Da die Passion unmittelbar keine politische Lektion darstellt,entsteht hier wiederum eine umgekehrte Allegorese: Nicht eine res oder historia wird auf ihre Heilswahrheithin interpretiert, sondern die Heilswahrheit wird zum bloßen Exemplum reduziert. Zum Verständnis mußallerdings nachgetragen werden, daß sich Johann mit Vehemenz gegen eine Inanspruchnahme der DavidischenVerheißungen im Sinne „herrschaftstheologischer“ Legitimation des Geschlechteradels oder der„Geblütsheiligkeit“ wendet. Ideologischen Versuchen, die monarchische Erbfolge durch die Herkunft Christiaus dem „Samen Davids“ pseudoexegetisch zu begründen, setzt er mit Nachdruck den Literalsinn alsmoralische und eigentlich geistigimmaterielle
946 Pol. IV 11, (I) 274 f.; im Anschluß an die S. 351 ff. erörterte Exemplakette folgt 273.24 ff. nach II Reg. 14 (Saul) und IReg. 2.29, 3.13, 4.18 (Heli): In libro Regnorum arguitur Saul quod […] paterno motus affectu contra religionis votumpepercit filio, […] Heli quoque […] quia filiorum pepercit vitiis aversa sella fractis cervicibus corruens expiravit. Ut deceteris taceam, quantum quaeso publicam hominum dilexit et quaesivit salutem qui proprio Filio non pepercit, sed pronobis tradidit illum […]
477
Deutung zugunsten des Geistesadels entgegen.947 In diesem Kontext bedeutet Gott Vater als Exemplumparallel zu dem kindsmörderischen Brutus und konträr zu den nachgiebigen, allzu milden Vätern Saul und Helieine präzise Antwort an die Adresse jener sophistischen Weißwäscher (dealbatores potentum), die mit deredlen Abkunft Jesu dynastische Ansprüche verteidigen möchten. Als Argumente für oder gegen dieErbmonarchie stehen die exempla divina natürlich dem sensus spiritualis gleicherweise fern. Obwohl Johannintentional die christliche Lehre von ideologischen Materialisierungen zweifellos rein zu halten sucht, dientsein „spiritueller“ Vergleich (Gott Vaters mit irdischen Vätern und Stammhaltern) – wie auch diekulminierende Endstellung in der Exempelreihe zeigt – wiederum vornehmlich der rhetorischen Steigerungeiner überall gleicherweise gültigen Moral (hier derjenigen, daß nur „gute“ Söhne die Erbfolge verdienen).
Dies dürfte den bei allen Erscheinungen eines christlichen Manierismus schnell geäußertenSäkularisationsverdacht in Frage stellen. Hieronymus ist wohl der in der Forschung am meisten diskutierteVertreter dieser manieristischen Stilrichtung. In Arbeiten über den Kirchenvater fehlt es nicht ananachronistischen Fehl- und Überinterpretationen. Sie sind für den Mediävisten ebenso lehrreiche Paradigmenwie deren Widerlegung. Nach der neuesten Forschung kann dank konsequenter Berücksichtigung der jeweiligenspätantiken Gattungs- und Formtradition, die das Geistesspiel im gegebenen Fall begründet, vonSäkularisationstendenzen bei Hieronymus kaum mehr die
947 Johann bestreitet (in Pol. IV 11, [I] 269 ff.) nicht die successio… in carne et sanguine oder Erbfolge als legitime, auchgeistlich begründete Nachfolge, bindet sie jedoch – und dies ist hier sein Hauptanliegen – an die Bewährung „der Söhne“.Nach dem Zitat der Psalmverse 131.11–12, 88.30–32 (Si iustitias meas profanaverint et mandata mea non custodierint,visitabo in virga iniquitates eorum) folgt 270.5 ff. so, als gehöre dies auch noch zur Bibelstelle und zu der von Gott selbstverkündeten Drohung: ut translato regno de gente in gentem et deletis his heredibus qui secundum carnem videntur esse insemine, transferatur successio ad illos qui fidei et iustitiae inveniuntur heredes. In eoque promissionis subsistit veritas etrata permanent quae ex ore Altissimi processerunt, quod iustis regibus successione fidelium semen permanet in eternum.Hoc autem (ut ad praesens de Christo qui factus ex semine David secundum carnem rex regum est et dominus dominantium,nulla sit mentio) etiam secundum litteram perpetuo arbitror obtinere, ut succedant parentibus filii, si eos in mandatisDomini fideliter fuerint imitati. Zur bekämpften dynastischen Ideologie vgl. GUENÉE, Politique et histoire (wie Anm. 181)341 ff. und K. HAUCK, Geblütsheiligkeit, in ‚Liber floridus’, Festschr. P. LEHMANN, St. Ottilien 1950, 187–240. ZumBegriff „Ideologie“ s. oben Anm. 642. – Zu dealbatores s. S. 326.
478
Rede sein,948 und wir dürfen dieses Resultat – und zwar a maiore – auch auf dessen Bewunderer Johann vonSalisbury übertragen: Die Bibel wird dadurch noch nicht ohne weiteres zum Text neben Texten entwertet, daßsie zu den ausgefallensten Bedeutungs- und Formspielen verwertet wird; ihr kann damit gerade Reverenzerwiesen werden, daß sie bis an die Grenze des Absurden als das unübertreffliche „All-Buch“ demonstriert wird,das sogar Ersatz bietet für die gesamte heidnische Literaturtradition. „Ersatz“ kann entweder den Ausschlußder antiken Kultur bedeuten oder aber – und dies ist Johanns Position – Austauschbarkeit in bestimmtenBereichen. So paradox dies wirken mag, ist die ursprünglich intendierte Alleinherrschaft der Bibel alsozugleich der dialektische Anlaß zur Kulturosmose und zur Rehabilitierung „polymythischer“ Offenheit.949
948 Zu Hieronymus vgl. S. 480 f. Zum Säkularisationsverdacht vgl. S. 501 f. HERZOG hat ihn 1971 (Metapher…, [wieAnm. 275] 175 ff.) erhoben; vgl. dagegen die Einwände M. FUHRMANNS in der Diskussion (ebd. 605 f.); 1977 äußertsich HERZOG (Gattungskontinuität… [wie Anm. 275] 376 ff.) grundsätzlich kritisch gegen die (implizit protestantische)Säkularisations- und Dekadenzvorstellung für die christliche Spätantike. Zur Begriffsgeschichte vgl. insgesamt:‚Säkularisierung’, hrsg. von H. H. SCHREY, WdF 424, Darmstadt 1981 und A. SCHÖNE, Säkularisation alssprachbildende Kraft…, Göttingen 1958. Legt man SCHÖNES (22) weitherzige Definition zugrunde, nach der alleÜbertragung aus religiösem Bereich in einen intentional nicht religiösen Kontext Säkularisation darstellt, dann müßte„Säkularisationsforschung“ ein Hauptzweig der Mediävistik sein. Gegen eine solche Absurdität genügt die aphoristischeBemerkung ZUMTHORS (wie Anm. 760, 104): „La tradition médiévale est assez puissante pour intégrer sa proprecontestation“.949 Zum Bibelsynkretismus vgl. HERZOG, Metapher (wie Anm. 275) 183 ff. – Zur Bibel als All-Buch vgl. S. 366 ff.;CURTIUS, ELLM 323 ff.; MEIER, Enzyklopädie (wie Anm. 709) 472 ff.; BRINKMANN, Hermeneutik (wie Anm. 145)74 ff. Zum Begriff „polymythisch“ s. oben Anm. 266. – Damit ist von einer anderen Seite her die §§ 66, 68, S. 187 f.erläuterte difficultas-Herstellung durch Entgrenzung von Spiel und Ernst berührt. Am Methodischen entzündete sich invielfältiger Weise literarischer Ehrgeiz: die Kunst, die Bibel zu verfremden und kulturell zu öffnen, war primär eine ArtVirtuosität ad maiorem Dei gloriam, eine partielle Autonomie und Zweckfreiheit der Literatur innerhalb, ja aufgrund derreligiösen Zweckbindung. Vgl. HUIZINGA, Homo ludens (wie Anm. 568) 225 ff. zur Allegorie als Spiel mit heiligerWirklichkeit (dies gilt auch für deren scheinbares Gegenteil, die Auflösung von Allegorie zugunsten eines verblüffendenLiteralsinns). Die gebräuchlichen Begriffe für solche Erscheinungen, wie „Parodie“ oder „Karnevalskultur“ (BACHTIN) sindzu rudimentär und (je nach Standpunkt) auch zu negativ oder zu „emanzipatorisch“. Vgl. oben § 68 und WEHRLI (wieAnm. 55) 56 ff., 171 ff. Was es als Spiel im Sinne HUIZINGAS zu sehen gilt, ist die gegenseitige Unterstützung desVerbindlichen und des Scherzhaften, des Sakrosankten und der bravourösen Kompliziertheit. Ein gutes Beispiel ist die CenaCypriani, die BACHTIN (M. BAKHTINE, L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au m. â., et sous laRenaissance, Paris 1979, 84 ff., 92 ff.) als „la plus ancienne parodie grotesque“ im Sinne seiner populistischenLiteraturkonzeption (s. oben Anm. 313) feiert. Auch in diesem seit dem 9. Jh. mehrfach umgearbeiteten, ja gelehrtkommentierten (dem Kirchenvater Cyprian zugeschriebenen) Text spätantiker Herkunft (vgl. LEHMANN, Parodie [wieAnm. 569] 25 ff.; MGH Poet. IV 2, ed. STRECKER [1923] 872–98; PL 4, 95 ff.; vgl. E. DEKKERS, Clavis patrum lat.,Nr. 1430) dient biblisches „Personal“ einer erheiternden Gastmahlbeschreibung, in der alle historischen Unterschiedezugunsten einer (den Exempla Johanns in Pol. 19 oben § 75 vergleichbaren) Simultaneität und Totalisierung aufgehobensind: Von Adam und Kain über Ruth, Susanna, Absalon bis zu Judas und Pilatus usw. und sogar Jesus selbst (der Sekttrinkt, weil Wein an die passio erinnert) sind alle Helden der Bibel gemeinsam Gäste des Königs Johel, geben sich diversenTafelfreuden hin, werden andern Tags des Diebstahls angeklagt und gepeinigt, bis Agar als Sühneopfer für alle stirbt undfeierlich beerdigt wird. Noch vor allen komischen Einzelheiten bietet das Arrangement selbst, die gleichzeitige Versammlungungleichzeitiger Personen in einem ungewohnt alltäglichen Kontext einen parodistischen Reiz, der aus moderner Literatur(etwa Dürrenmatts ‚Achterloo’) bekannt ist, und es ist kaum anzunehmen, daß im MA darüber aus wesentlich anderenGründen gelacht wurde, sofern wir Parodie nicht mit Spott, sondern mit Verfremdungswitz gleichsetzen. Wenn es zutrifft,daß der ursprüngliche Anlaß dieses unpolemisch belustigenden Textes eine Predigt Zenos von Verona gegen ausgelasseneOsterbräuche war (LEHMANN a. O. 27 f.), so zeigt die Rezeptionsgeschichte, daß der mutmaßliche satirische Kern vergessenwurde und die reine Unterhaltung (gepaart allerdings mit der obligaten utilitas) als Autorintention angesehen wurde. EinePrologstrophe des rhythmischen Gedichts aus dem 9. Jh. (MHG Poet. IV 857) preist den „wahren Sophisten“ im Bereich dergöttlichen Wunder, ein Oxymoron, das sich auch gut auf den „Spielernst“ mancher Policraticus-Stelle beziehen ließe (vgl.auch S. 330 f.); Ad cenam venite cuncti Cypriani martiris,/rhetoris et papae clari Libicae Carthaginis,/quam sophista veraxlusit divinis miraculis,/non satiricis commentis, non comoedi fabulis. (Zur Dreiteilung vgl. A. 771: historia, satira, fabula;wobei sophista verax hier für die delectatio-utilitas-Verbindung der historia steht).
479
Das historische Verständnis wird allerdings nicht durch Zudecken, sondern durch kontrastives Herausstellendes Fremden und Befremdlichen gefördert. So sei denn noch auf die für modernes Empfinden völlig disparatenBedeutungen in dem Vergleich hingewiesen, in dem Johann die Hypostasierung von Alexander, Aristoteles,Plato und Augustus zu Göttersöhnen aus menschlicher Ruhmsucht erklärt und vermerkt,950 der wahreMenschensohn habe
950 Pol. VIII 5, (II) 247.6 ff.: Multorum quoque fuit opinio, et eorum qui in veteri philosophia prae ceteris floruerunt,Alexandrum <et> Aristotilem a numinibus esse progenitos, eo quod in omnibus propriam quaerebant gloriam [cf.Jo. 7.18]. Platonem quoque propter divinam quodammodo qua eminuit sapientiam et Augustum propter potentiamfortunamque tranquillam a diis traxisse originem tradiderunt. Et quidem in contrarium rectius collegissent eos aut divininon esse generis aut deorum filios esse degeneres, nisi quia dii gentium demonia sunt […] Nam et verus Dei Filius, Deushomo, propriam non quaerit gloriam in omnibus quae gloriose fiunt ab eo, sed Patris [cf. Jo. 8.50], eoque illustraturgloria ampliori quod ad eum, ex quo sunt omnia [i Cor. 8.6], bonorum operum gloriam refert. Sic et vere sapiens omnis,vere potens, et vere bonus, ad unicum omnium bonorum fontem sua omnia laudabiblia refert, summan scilicet creatricem etindividuam Trinitatem. Zu gloria s. oben Anm. 915. Zu Alexander und Aristoteles, die Val. Max. VIII 14, ext. 2, 3 zuExempla der Ruhmbegierde zusammenfaßt, vgl. Iustin, Epit. XI 11; Solin IX 18 hinsichtlich der göttlichen Abkunft. Daßdieses Paar demjenigen von Plato und Augustus in sinnvoller Symmetrie gegenübersteht (Eroberung, Befriedung) zeigt dasS. 304, 348 f., 408 f. Festgehaltene. Zu Plato vgl. Apul. De dogm. Plat. I 1. Zur Trinität vgl. Abaelard, Theol. christianaIV 159 ff. (CC med. XII) 345 f. und die dort angeführten Quellen. – Ähnliche Vergleiche zwischen Göttersöhnen und demGottessohn gibt es bereits in der Patristik (z. B. Justin, Apol. 1.21, Tert., Apol. 21.14). BLUMENBERG (Patristik [wieAnm. 36] 487, 492) spricht hier von „purer Mimikry“ des Christentums „im Milieu der alten Religionen“, die der „Preis fürdas weltgültige Eingehen in die hellenistische Geisteswelt“ darstelle.
480
nicht seinen Ruhm gesucht, und dann einen quasi-typologischen Vergleich dieser vergöttlichtenBerühmtheiten der Antike mit der Trinität zieht. In diesem Zusammenhang scheint uns der Aufwand etwasgroß, wenn Johann aus dem Scheitern des Welteroberers Alexander und dem damit verglichenen Erfolg desWeltenschöpfers bloß eine moralische Empfehlung der Demut und eine Warnung vor Ruhmsucht ableitet.Solche Stellen zeigen Johanns starke Abhängigkeit von Hieronymus,951 der es u. a. fertigbrachte, nebenChristus Buddha, Minerva, Plato, Romulus und Remus auf gleicher Ebene anzuführen und dem PhilippDelhaye insofern „eine Geringschätzung elementarster
951 Johanns Verhältnis zu Hieronymus könnte das Thema einer eigenen lohnenden Untersuchung sein; vgl. im Register 1unter Hieronymus. – DELHAYE, Dossier (wie anm. 385) 77 ff.; SCHAARSCHMIDT 132 f. mit einer Sammlung vonLobworten Johanns über den Kirchenvater (auch zum Adversus Jovinianum-Traktat, einer „unerschöpflichen Fundgrube vonNotizen und Geschichten“ nach Art des Val. Max.). Vgl. insbesondere Pol. II 27, (I) 158.5 ff.: doctor ille doctorum cui insacrario litterarum vix aliquem audeo comparare (doctor doctorum auch in Pol. VII 10, [II] 134.26) oder die persönlicheBerufung auf den Patron der „Intellektuellen“ (clerici, politici, philosophi, philosophantes; vgl. S. 461 ff., 568, 574) gegeneifernde Mönche in Pol. VII 23, (II) 208.21 ff.: Auctor mihi Ieronimus est, licet eum nonnullis monachorum minus benigneaudiant eo quod clericos quod ad aliquid visus est praetulisse. Auctor est, inquam, quod vestis nequaquam religionisdifferentiam faciat, sed in omni habitu qui timet Dominum et operatur iustitiam acceptus est illi (mit Bezug auf die danachzitierte Stelle aus Hier. Ep. 52.9; vgl. LIEBESCHÜTZ, Humanism 82 S. 168, 461 f., 475, 569 ff.). Hier klingt der tiefsteGrund für Johanns besondere Affinität zu Hieronymus an: Der Kirchenvater ist ihm der wichtigste Kronzeuge für seinpersönliches Lebensideal der philosophia, das er im Namen seines Standes, des intellektuell und administrativ tätigenWeltklerus gegen scheinheilige Mönche, eingebildete Schuldialektiker und eitle curiales gleicherweise zu verteidigen sucht.Zum Rangstreit zwischen Kleriker und Mönchen vgl. von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 142 ff.; zur Bedeutung desHieronymus darin vgl. Ch. FAVEZ, La satire dans les lettres de S. Jérôme, in: REL 24/5 (1946/7) 209 ff., 216 ff. ZurÜbernahme der Stadtkritik des Hieronymus in Johanns Hofkritik vgl. UHLIG (wie Anm. 577) 47 ff.; ANTIN (wieAnm. 464) 380 ff. Besonderes Gewicht hat darum das philosophus-Prädikat in Pol. VIII 2, (II) 294.1 f.: De molestiis etoneribus coniugiorum secundum Ieronimum et alios philosophos; 300.23 f.: cum philosophantibus id est cum clericis. Diesist nicht eng als Gruppenkategorie zu verstehen – auch Mönche heißen oft philosophi (aus der Schule der vera philosophiaChristi; vgl. Ep. 194, [II] 268) –, sondern als ein Wertbegriff, mit dem beliebige Personenkreise, vornehmlich aber diezwischen actio und contemplatio stehenden Kleriker an das Ideal praktischer Philosophie erinnert werden können. Ausdemselben Grund nannten sich vorzüglich auch Juristen philosophantes (vgl. G. POST, Philosophantes and philosophi, in:AHDLMA 29 [1954] 135–8); G. SCHRIMPF, ‚Philosophi’-„philosophantes“. Zum Selbstverständnis der vor- undfrühscholastischen Denker, in: StM 23 [1982] 697–727; F. TRONCARELLI, Philosophia: vitam monasticam agere.L’interpretazione cristiana della ‚Consolatio philosophiae’ di Boezio dal VI als XII sec., in: Quaderni Medievali 15 [1983]6–25).
481
Unterschiede“ angekreidet hat, „die wir bei einem modernen Autor als Blasphemie empfinden würden.“952
Die derart angedeutete Gefahr eines anachronistischen Mißverständnisses kann gar nicht genug betontwerden. Johann ist zunächst ein Meister jener allgemeinen mittelalterlichen, sozusagen unschuldigenTraditionskombinatorik, die nicht auf die nachtridentinische Goldwaage für christliche, heidnische undsynkretistische Spurenelemente gelegt werden sollte. Das verfremdende Spiel mit der Vermischung derHerkunftsbereiche ist eine ehrwürdige literarische Methode, die nicht nur von eigenwilligen Humanisten,sondern auch von ernsthaft engagierten Kirchenmännern von Augustinus bis zu Bernhard von Clairvauxgepflegt wurde. Sie zeugt so von der Macht spätantik-hellenistischer
952 DELHAYE, Dossier (wie Anm. 385) 69 aufgrund von Adv. Iov. I 42 (PL 23) 270 f., 273; vgl. auch ANTIN, Touchesclassiques et chrétiennes juxtaposées chez s. Jérôme, in: Recueil (wie Anm. 464) 47–57; BAUER (wie Anm. 271) 130 ff.;HAGENDAHL (wie Anm. 173) 303 ff.: „… no preference is given […] to one or the other kind of literature [d. h. derheidnischen und der christlichen]. This unprejudiced attitude is preculiar to Jerome as distinguished from other Christianwriters“; HERZOG, Gattungskontinuität (wie Anm. 275) 394 ff. zur nicht-typologischen, sondern dekorativen, „denmodernen Leser bisweilen blasphemisch anmutenden“ biblischen Metaphorisierung diverser antiker Topoi (s. oben Anm. 917zu dem hier passenden aemulatio-Begriff); vor allem aber FUHRMANN, Mönchsgeschichten 42 (Hieronymus „fiebert vorliterarischem Ehrgeiz“), 53, 82 ff. zur formalen Experimentierfreude im christlichen Umprägen antiker Formen. – OHLY,Typolog. Figuren aus Natur und Mythos (wie Anm. 732) 136 ff., 150 sucht synkretistisch wirkende Erscheinungen dieserArt typologisch zu erklären, was jedoch für Hieronymus nur beschränkt gelingt, da die Entsprechungen bei ihm nicht mehrdie „Werbefunktion“ ausüben, die sie in der Predigt für Gebildete etwa bei Clemens von Alexandrien hatten, sondernliterarische Virtuosität in der spielerischen Kombinatorik an den Tag legen sollen. Gerade diese Tatsache ist für dieHieronymus-Renaissance des 12. Jhs. nicht zu unterschätzen. – Untersuchungen zur zentralen Bedeutung des Kirchenvatersfür die hochmittelalterliche Literatur (insbesondere als Stilmuster für alle Arten der Kritik, Satire, Polemik, Invektive) sindm. W. noch ein Desiderat, das auch THOMSON, Latin Satire (wie Anm. 669) 79 hervorhebt.
482
Stilgewohnheiten und braucht im Einzelfall nicht gleich religionsgeschichtliches Aufsehen zu erregen.953
Die Mediävistik steht aufgrund eines untergründig konfessionellen Bildes vom „frommen Mittelalter“ oftratlos vor solcher Spielhaftigkeit. Im Deutschen fehlen hierzu – abgesehen von dem schillerndenVerlegenheitsbegriff „Manierismus“ – sogar weitgehend Fachtermini eines Beschreibungsrepertoires.954 DerVergleich mit der französischen Forschungssituation ist darum anregend: Seit H.I. Marrou und A. Loyen(1938, 1943) hat sich in Arbeiten über Spätantike und Mittelalter das aus der Welt des 17. und 18.Jahrhunderts entliehene, schwer übersetzbare Schlüsselwort „préciosité“ eingebürgert, das, den geläufigen,namentlich deutschen Vorstellungen vom Mittelalter
953 Zum Anachronismus vieler mediävistischer Diskussionen über weltanschauliche Einflüsse vgl. auch MORRIS, Discovery(wie Anm. 758) 55 f. und SEEL (wie Anm. 170) 105: „… jener naive mittelalterliche Synkretismus, der mit fröhlicherDuldsamkeit zwischen Elysium und Paradies einen großzügigen Transitverkehr gelten ließ und keine Bedenken trug,plutarchische Helden und stoische Weise gewissermaßen mit einem zwar kleinen, aber doch immerhin respektablen paganenHeiligenschein zu dekorieren“. In der Tat ist schon im Mittelalter vieles von der Art des bekannten Geistesblitzes vonErasmus (Convivium religiosum, Opera, Lugd. Batav, 1703/6, repr. 1943, 681 f.): Sancte Socrate, ora pro nobis! SolcheEinfälle liegen in einem heute immer schwerer zugänglichen Zwischenbereich von Ernst und Scherz und werden durchaufwendiges Herbeizitieren theologischer Autoritäten (etwa zum ‚logos spermatikós’) nicht verständlicher. – Zum formalenVermischungsspiel seit der Patristik vgl. etwa MARROU, S. Augustin 498 ff., 502; André LOYEN, Sidoine Apollinaire etl’esprit précieux en Gaule aux derniers jours de l’Empire, Paris 1943, bes. 11, 37, 156; von MOOS, Hildebert (wieAnm. 211) 264 ff. und jetzt auch WEHRLI (wie Anm. 55) 204 ff. (Spiel und Ernst); 271 ff. (Parodie und Kontrafaktur).954 Vgl. BARNER (wie Anm. 298) 33 ff. zur „Manierismuswelle“ und ihren Mißverständnissen seit CURTIUS undHOCKE. – Die meisten Fachbegriffe auf diesem Gebiet stammen aus der Barockzeit oder der Barockforschung. Danebenerscheinen gelegentlich Verlegenheitsbegriffe theologischer Provenienz (zu Säkularisation s. oben Anm. 948). Besondersbeklagenswert ist hier das Fehlen antiker Beschreibungstermini, was HERZOG, Gattungskontinuität (wie Anm. 275) 399feststellt. Auch die Altphilologie benützt Stilkategorien der Barockzeit: vgl. Erich BURCK, Vom römischen Manierismus,Darmstadt 1971, bes. 26 ff.
483
widerstreitend, auf das Relative, Problematische, Paradoxe im Objektbereich oder das Geistreiche,Aufklärerische, Raffinierte im Darstellungsbereich verweisen kann.955 Daß „préciosité“ nicht nur aufmondäne Gesellschaftsspiele zu beziehen ist, geht aus Marrous tiefsinnigem Kurzkommentar zu einerstoischen Pointe Augustins (in geistlichem Kontext) paradigmatisch hervor:956
„[…] wir haben mittlerweile insbesondere von Giraudoux gelernt, den preziösen Stil in der Literatur nicht mehr inBausch und Bogen zu verwerfen. Gewiß ist er manchmal lächerlich und verrät eine ‚Geschmackskrankheit‘. Aber erkann gerade unter der Feder strengster Denker auch ein bevorzugtes Ausdrucksmittel werden, das die menschlicheSprache befähigt, es in der Freiheit des Ausdrucks (subtilité) mit der Wirklichkeit des Lebens und der Weltaufzunehmen, mit jener unendlich differenzierten Wirklichkeit (ce réel si subtil) zu wetteifern, die mit ihrem ganzenHort an Geheimnissen, Zweideutigkeiten und Paradoxien wiederzugeben ist“.
Subtilitas wäre in der Tat ein lateinisches Äquivalent für „préciosité“. Aber weder das eine noch das andereläßt sich unmittelbar als Fremdwort ins Deutsche übernehmen, was augenfällig die Unmöglichkeit zeigt,Marrous Wortspiel mit der lebensmäßigen und objektiv-kosmischen Bedeutung von „subtilité“ wiederzugeben.Denn „subtil“ sind sowohl der Scharfsinn und die
955 MARROU und LOYEN (wie oben Anm. 953). – Zum Begriff vgl. u. a. René BRAY, La préciosité et les précieux deThibaut de Champagne à Jean Giraudoux, Paris 1948. Auch hier handelt es sich darum (wie bei locus communis: s. S. 345),hinter eine im allgemeinen Bewußtsein fixierte Verfallsstufe des Begriffs zurückzugelangen. BRAY schreibt entsprechend(15): „La préciosité littéraire n’est baptisée de ce nom que vers 1650 […] Lorsque la critique prononce sur elle un diagnostic,au temps de Molière et de Boileau, elle est à la veille de sa disparition“. – Ich habe den Begriff „Preziosität“ undifferenziertmetaphorisch neben „geistlicher Schöngeistigkeit“ in meiner Hildebert-Monographie von 1965 (wie Anm. 211) 151 ff.,264 ff., 404 u. ö. (s. Reg.) für genau dieselben Phänomene verwendet, die auch bei Johann begegnen. CURTIUS benützt dasWort nur im üblichen abschätzigen Sinn von „gesuchter Metaphorik“ für Dante (ELLM 142) und versucht (ebd. 523) eineAbleitung des Wortes aus der metaphorischen Verwendung von pretiosus in rhetorischem Zusammenhang bei SidoniusApollinaris und Marbod von Rennes. In der Sache handelt jedoch ein wichtiger Teil seines Werks von mittelalterlicher undbarocker „préciosité“.956 H.I. MARROU, L’ambivalence du temps de l’histoire chez saint Augustin, (Conférence Albert le Grd.), Montréal–Paris1950, 52. Die Übersetzung in: Zum Augustingespräch … (wie Anm. 581) 366 wurde zum Vergleich herangezogen; wederdiese noch die hier gebotene befriedigen restlos. Unübersetzbarkeit ist manchmal das Kennzeichen hervorragenderWissenschaftsprosa: „Mais nous avons appris, et précisément à propos de Giraudoux lui-même, à ne plus condamner sansexamen la préciosité littéraire: sans doute, elle est quelquefois ridicule et dénote une ‚maladie de goût’, mais elle peut aussidevenir, et cela sous la plume des penseurs les plus sérieux, un instrument d’expression privilégié qui permet au langagehumain de rivaliser de subtilité avec la réalité même de l’être et du monde, ce réel si subtil en effet qu’il s’agit de traduireavec tout ce qu’il renferme de mystère, d’ambiguité, de paradoxe“. – Eine überraschende Bestätigung für das hier Gemeintegibt neuerdings – mirabile dictu im deutschen Wissenschaftsbereich – Heinrich LAUSBERG: Der Johannes-Prolog,Rhetorische Befunde zu Form und Sinn des Textes, in: Nachrichten der Akad. der Wiss. in Göttingen I (phil.-hist. Kl.)1984.5, 276, § 69.12 über die „Preziosität“ der „exordialen Dunkelheit“: „im Sinne eines sublimen l’Art pour l’Art, das dem‚Unausdrückbaren’ in dem so konstituierten ‚Frei-Raum’ ‚Sprache’ gibt, nicht in plump-erbaulicher Direktheit, sondern infreier ‚poetischer’ Atmosphäre… Diese literarische ‚finesse’ ist eine – kommunikative – Variante der ‚Sprachengabe’(Act. 19.6; 1 Cor. 12–14) … Die Preziosität – die ein ‚läppisches’ Spiel sein könnte – ist ein Instrument der ‚Freiheit’ immystischen Bereich, in dem es auf ‚pubertäre Spontaneität’ ankommt.“ (Es folgt ein Hinweis auf Johannes vom Kreuz). InLAUSBERGS Hdb. (s. § 1246) wird der Begriff „précieux“ übrigens primär auf das stilistische vitium des hyperbolischenVerstoßes gegen das aptum bezogen.
484
Ausdrucksfeinheit (argutia) als auch die hinter dem Schleier der Phänomene verborgene harmonischeOrdnung der Dinge. Wir sind auf umständliche begriffsgeschichtliche Erläuterungen angewiesen, wo derfranzösischen Sprache einfache Beschreibungstermini zur Verfügung stehen, um die spezifischenZusammenhänge zwischen dem kombinatorischen Stil anscheinend synkretistischer Quellenmischung undeinem auf der platonischen Dichotomie von äußerem Schein und unsichtbarer Wahrheit beruhendenWirklichkeitsverständnis darzutun. Diese der Barockforschung (etwa hinsichtlich Concettismus undTheatermetaphorik) wohlbekannten Beziehungen sind überdies auch thematisch der Mediävistik eher fremd,obwohl sie im Mittelalter durchaus nicht fehlten, wie Johanns Beispiel im Folgenden noch deutlicher zeigenwird. Thesenartig sei hier nur vorweggenommen, daß das befremdliche Überspringen weltanschaulicherUnterschiede, die Vorliebe für geistreiche Ambiguitäten im Nebeneinanderstellen unvereinbarer Symbole ausverschiedenen Religionen weder einseitig ästhetisch als Formenspielerei noch einseitig ideengeschichtlich alsSäkularisation und Verweltlichung angesehen werden sollte, sondern auf den (freilich nicht widerspruchsfreien)Versuch zurückzuführen sind, einen „höheren Standpunkt“ oder „Schauplatz“ zu gewinnen, von dem aus derbabylonische Wirrwarr der Menschen überschaubarer wird, die munda comedia vel tragedia der Gesellschaftkritischer durchschaut werden kann, und von dem aus ein weiterer Ausschnitt der rätselhaften „Natur derDinge“, der verschlüsselten ewigen Wahrheit Gottes, für den philosophischen Blick frei wird.957
957 Zur Barockforschung über die Theorie der argutia des Geistes in Bezug auf die subtilitas der Dinge vgl. VERWEYEN52 ff. (s. oben Anm. 410); FUNKE, Gewohnheit (wie Anm. 211) 244 (Graciáns Traktat „Über den Scharfsinn“); BARNER(wie Anm. 298) 86 ff.; BRÜCKNER, Hist. 102 ff.; CURTIUS, ELLM 148 ff. (Schauspiel-metaphorik); Helmut ABELER,Erhabenheit und Scharfsinn. Zum ‚argutia’-Ideal im aufgeklärten Klassizismus, Göttingen 1983. – Zu Johann s. unten § 106(Pol. III 7–8). Zum subtilitas-Begriff vgl. auch S. 312, 601, Anm. 410, 609, 973.
485
102. Daß Johann christliche Glaubensinhalte mit heroischen Beispielen der Antike und umgekehrtForderungen der rein natürlichen, insbesondere politischen Ethik mit heilsgeschichtlichen Ereignissen undPersonen zu begründen und zu illustrieren suchte und insofern sogar Christus auf eine Stufe mit heidnischenHelden zu stellen sich berechtigt fühlte, hat er einmal ausdrücklich mit dem Vorbild des Apostels erklärt.Nach apokrypher Tradition hat Paulus in Athen den Kreuzestod Christi mit heidnischen Parallelenungerechter Todesstrafe oder der heroischer Selbstopfer als etwas „Normales“ verständlich zu machen, bzw.vom Odium zu befreien gesucht, das der Vorstellung anhaftete, ein Religionsstifter habe die für Sklavenvorgesehene Todesstrafe erlitten.958 Dieses missionarisch-apologetische Motiv war vielleicht überhaupt diefrüheste Einlaßstelle für heidnische Exempla in der Alten Kirche: Für die Verkündigung desInkarnationsparadoxons eignete sich der Rekurs auf den mos maiorum hervorragend, weil er einen Aufstiegzum novum exemplum der Heilstat des Erlösers ermöglicht.959 Im Mittelalter
958 Pol. IV 3, (I) 242 f. (s. unten Anm. 961); vgl. M.R. JAMES, Apocrypha Anecdota, Cambridge 1893, 56 f.; AA SS Oct.9, vol. IV, 707; Richard von St. Victor (PL 196) 1007. Diese drei Stellen nennt WEBB im Apparat. Vgl. jedoch vor allemauch Arnobius, Adv. nationes 1, 40, wo Pythagoras, Sokrates, Regulus u. a. die Kreuzigung in diesem Sinn begreiflichmachen sollen. Vgl. GEBIEN 75; I. OPELT, Das Bild des Sokrates in der christlichen lateinischen Literatur, in: Festschr.H. DÖRRIE, ‚Platonismus und Christentum’ (JbAC, Erg.-Bd. 10), Münster-W. 1983, 197–207, hier 197 f.; CARLSON 98.Der Kern dieser Tradition liegt bereits in der Areopagrede, Apg. 17.28 f. („wie auch einige von euern Dichtern gesagt haben“)sowie in der Tendenz der Apostelgeschichte, Paulus als hervorragenden Volksredner zu zeigen. Zur Bedeutung derAreopagrede für die antik-christliche Kulturosmose vgl. CAPELLE/MARROU, Diatribe 998 f.; BLUMENBERG, Patristik(wie Anm. 36) 487; SÖDER (wie Anm. 271) 112 ff.; FONTAINE, Christentum (wie Anm. 552) 12. Insbesondere wurdenaufgrund von Hier. Ep. 70.2 damit heidnische Dichterzitate im Mittelalter legitimiert (vgl. Vinc. Belv., Prol. [wieAnm. 337] 123; BÉNÉ [wie Anm. 794] 44 zu Boccaccio). Vgl. auch § 94 zu Röm. 2.14. Im übrigen galten die Paulusbriefeals Zeugnis kirchlicher Persuasionskunst, als das Muster eines movere mit exempla und consilia, während die Evangelien fürdas (erzählende) „Lehren“ vorbildlich waren. So deutet z. B. Abaelard im Comm. in Rom., Prol. (CCmed. XI) 41 auch diepädagogisch mustergültige Abfolge von Evangelien und Episteln als Aufstieg von der Theorie zur Praxis, vom evangelischenpraeceptum zum brieflich-homiletischen exemplum, von der doctrina christiana zur adhortatio der Christen (vgl. obenAnm. 420, 541).959 Einlaß-Stelle: Vgl. LUMPE 1248 (Athenagoras, Origenes, Justin, Minucius Felix, Laktanz u. a.); OPELT, Sokrates (wieAnm. 958) 197; CARLSON 94. – Pädagogischer Aufstieg zum novum exemplum: vgl. § 26, S. 104 ff.; LUMPE 1242 f.;von MOOS, Consolatio III § 488; GEERLINGS 179 ff., 190, 211 f.; BLUMENBERG, Patristik (wie Anm. 36) 490 ff.;LÖWITH (wie Anm. 129) 441: die historische Situation zwang „nicht nur, zu anderen zu reden und sich gegen sie zuverteidigen, sondern auch in ihrer Sprache zu sprechen, um ihnen verständlich zu sein“; FONTAINE, Christentum (wieAnm. 552) 14 oben Anm. 879.
486
überlebte vor allem der homiletisch-pädagogische Aspekt. Die Apologie der „Kreuzesschmach“ jedoch hattenach dem Ende heidnischer Opposition ihre Aktualität eingebüßt. Johann scheint nun beide Gesichtspunktenochmals zusammenzubringen. Nachdem er die zwei strategemmata von König Kodros und dem GesetzgeberLykurg erzählt hat – beide gingen in listiger Weise freiwillig in den Tod, um dem Volk den Frieden bzw. dieUnverbrüchlichkeit der Gesetze zu sichern –, sagt er:960
Diese Beispiele verwende ich umso lieber, als ich lese, daß auch der Apostel Paulus genau dieselben verwendethabe, als er den Athenern predigte. Dieser große Prediger suchte Jesus Christus als einen Gekreuzigten denGemütern dadurch nahezubringen, daß er, auf das Beispiel der Heiden verweisend, lehrte, durch die Schande desKreuzes seien schon viele befreit worden. Doch er überzeugte die Athener auch davon, daß solche Befreiung nurdurch das Blut der Gerechten und der Vorsteher des Volkes zu geschehen pflegte, daß aber zur Befreiung aller ,nämlich der Juden und der Heiden, niemand gefunden werden könne, außer […] der Sohn des allmächtigen Gottes.
Daraus folgt eine pädagogische Erläuterung zum Gebrauch von Exempla überhaupt:961 Paulus zeige die Kunstder Anpassung an den Kenntnisstand der Zuhörer, da er Schritt für Schritt vom Vertrauten zu dem für dieAthener noch neuen Wort Gottes von der Torheit des Kreuzes aufgestiegen sei.
Man kann diese apokryphe Anekdote wie ein Urzeugnis für die homiletische Exemplatradition lesen. Nichtzufällig weist auch Alan von Lille in seiner
960 Pol. IV 3, (I) 242 f. nach Justins Epitoma II 6.16–21 und III 3.7–9; ebd. 242.32 ff.: His quidem exemplis eo libentiusutor, quod apostolum Paulum eisdem usum, dum Atheniensibus praedicaret, invenio. Studuit praedicator egregius IesumChristum et hunc crucifixum sic mentibus eorum ingerere, ut per ignominiam crucis liberationem multorum exemplogentilium provenisse doceret. Sed et ista persuasit fieri non solere nisi in sanguine iustorum et eorum qui populi gererentmagistratum. Zu König Kodros als einem der bekanntesten Exempla für den Opfertod und als Typus Christi in Patristik undMittelalter vgl. SEEL (wie Anm. 170) 125 (Cic. Tusc. I 116; Iust. II 6.19); CARLSON 10 (Hier. In Eph. I 7); OLSSON(wie Anm. 299) 190 f. (Val. Max. VI 8 Ext. 1 u. John Gower); OHLY, Denkform (wie Anm. 234) 76 (Speculum humanaesalvationis u. a.) Zu Johanns politischer Deutung des Exemplums vgl. KERNER 153 f.961 Pol. IV 3, (I) 243.13 ff.: Dum ergo sic crucis ignominiam praedicaret, ut gentium paulatim evacuaretur stultitia, sensimad Dei verbum Deique sapientiam et ipsum etiam divinae maiestatis solium, verbum fidei et linguam praedicationis evexitet, ne virtus Evangelii sub carnis infirmitate vilesceret a scandalo Iudeorum gentiumque stultitia, opera Crucifixi […]exposuit. Zum rhetorischen, auch homiletischen Prinzip der convenientia, accomodatio u. ä. oder dem locus a qualitateaudientium vgl. Anm. 426 (Met. III 10, 162) Anm. 738 (Enth. 188 ff.); vgl. auch GEBIEN 83; WELTER 75 ff., 120;SUCHOMSKI 218; von MOOS, Consolatio I/II § 160.
487
Predigtlehre auf den Prediger Paulus hin, um dicta gentilium in der Predigt zu rechtfertigen; dabei zitiert erden für alle kombinatorische Literaturästhetik grundlegenden Horazvers (A. P. 48–49) von der callidaiunctura, der geistreichen Verbindung, die das altbekannte Wort als Neuheit wirken läßt.962 Johannübernimmt das im homiletischen Kontext bekannte Exemplum der paulinischen Heidenmission, erwähnt, wiees sich gehört, auch dessen primäre geistliche Bedeutung – es illustriert die „Trittbrett-Funktion“ heidnischerExempla –, doch in seinem Zusammenhang der politischen Morallehre dient es ihm allein dazu, dasFürstenideal nachdrücklicher zu empfehlen, das bis zur Selbstaufopferung altruistische, der salus publicadienende Verantwortungsbewußtsein mit der höheren christlichen auctoritas des Paulus zusätzlich zu stärken.Denselben Apostel preist er anderwärts als vermeintlichen Korrespondenten Senecas und als einen für dieantike Kultur besonders offenen Kirchenlehrer.963 Wie sehr ihm die traditionellen geistlichen Argumente dereinstigen Apologetik zu rein persuasiven Steigerungsmitteln geworden sind, zeigt schon die Anlage desKapitels: Das Paulusexemplum nimmt sich in der hier gebotenen antiken Exemplareihe wie ein Exkurs aus.Johann hebt zwar in apologetischer Tradition hervor:964 „Die Spitzfindigkeiten des Aristoteles, die Kniffe desChrysipp, die Fallstricke sämtlicher Philosophen widerlegte der von den Toten Auferstandene“. Doch setzter danach die Kette seiner antiken Exempla für uneigennützige Herrschaftsausübung übergangslos mit denDeciern und mit Caesar fort, als diente ihm der christologische Bezug nur als überleitende Steigerung, um vonden philosophischen dicta zu den politischen facta zu gelangen.
103. Sosehr nun das beschriebene Verbinden und Mischen sakraler und profaner, biblischer und antikerSemantik für uns etwas Spielerisches, ja Aleatorisches haben mag, darf doch das wichtigste Motiv desVerfahrens nicht übersehen werden: Es geht Johann um die mit allen Mitteln zu erstellende Gleichungzwischen christlichem und nicht-christlichem Denken mit Hilfe
962 Alanus ab Insulis, Summa de arte praedicandi (PL 210) 114: Poterit etiam ex occasione interserere dicta gentilium, sicutet Paulus apostolus aliquando in Epistolis suis philosophorum auctoritates inserit, quia elegantem habebit locum, sicallida verbum iunctura reddiderit novum. – Zu Hor. A. P. 47–8 im Mittelalter vgl. D. KELLY, The Source and Meaningof Conjointure…, in: Viator 1 (1970) 179 ff. und oben Anm. 746, 880 zu Johanns Hist. pont. 12, 26 f.963 Johann lobt Paulus zusammen mit Seneca in Pol. VIII 13, (II) 318 und Enth. 1470 ff.; vgl. LIEBESCHÜTZ 20;NOTHDURFT (wie Anm. 846) 113.964 Pol. IV 3, (I) 243.24 ff. (nach Hier. Ep. 57.12): Astutias Aristotelis, Crisippi acumina, omniumque philosophorumtendicula resurgens mortuus confutabat. Zur Tradition des Übergangs von den „alten“ (bloß literarischen oder „fabulösen“)Exempla zu den „wahren“ und realen nova exempla des Christentums vgl. §§ 24, 26. Zur Verbindung mit der praktischenPhilosophie vgl. § 45, S. 82 ff., 90 ff., 461.
488
der beiden Bereichen gemeinsamen Topik. Vordergründig betrachtet, geht diese harmonisierendeKombinationskunst zweifellos aus der besonderen pragmatischen Thematik des Policraticus hervor, die schontreffend als „Verwaltungsethik“ charakterisiert wurde.964a Johann bezeichnet sich indirekt selbst als officiorumscriptor, d. h. als einen didaktischen Autor, der für jedes einzelne Amt, vom höchsten zum niedrigstensozialen Rang specialia praecepta, Vorschriften eines Fürsten- und eines „Gesellschaftsspiegels“ zu gebenhat.965 Die erste Quelle allen mittelalterlichen Wissens, das Neue Testament,
964a Vgl. C. MORRIS, Zur Verwaltungsethik: Die Intelligenz des 12. Jahrhunderts im politischen Leben, in: Saeculum 24(1973) 241–50, bes. 241 f.; ders., Discovery (wie Anm. 758) 47, 125; in dessen Gefolge auch KERNER 203 f. – ZurStellung der „scholars in administration“ und deren z. T. von Cicero übernommenen Ämterethik vgl. auch SOUTHERN, ThePlace of England (wie Anm. 28) 205 f.; LIEBESCHÜTZ 45, 72, 79, 81; ders., Englische und europäische Elemente (wieAnm. 839) 43; DELHAYE, Le bien (wie Anm. 385) 219 f.; STOLLBERG (wie Anm. 577) 18 ff. u. ö.; K. GUTH,Johannes von Salisbury, St. Ottilien 1978, 28 f.; C. WARREN HOLLISTER/J.W. BALDWIN, The Rise of AdministrativeKingship: Henry I and Philip Augustus, in: American Historical Review 83 (1978) 867–905; J.W. BALDWIN, Masters atParis …, in: Renaiss. and Renewal 138 ff., bes. 157 f. zum fast hundertjährigen administrativen Vorsprung Englandsgegenüber Frankreich. – Zu den besonderen institutionellen Verpflichtungen der clerici und magistri im Rahmen deranglonormannischen Verwaltungszentralisation (vor allem in der Gerichtsbarkeit) vgl. KUTTNER/RATHBONE (wieAnm. 4) 279 ff. und allgemein Christopher R. CHENEY, English Bishop’s Chanceries 1100–1250, Manchester 1950 sowieoben Anm. 564.965 Vgl. oben Anm. 564 zu Ep. 256, (II) 518 (officiorum mutua communicatio) – Pol. VI 20, (I) 59.7 ff.: Dabei bricht er, aufder untersten Stufe angelangt, seine Soziallehre in Anbetracht der Vielfalt und Breite der officia an der Basis der Pyramidemit einer Unsagbarkeitsformel ab (‚Qui sint pedes rei publicae’): Haec autem prae multitudine numerari non possunt, cumtamen infinita sint per naturam, sed quia tam variae figurae sunt ut nullus umquam officiorum scriptor in singulas specieseorum specialia praecepta dederit. Daraus läßt sich schließen, daß, was Johann in den vorangehenden Seiten zu den höherenStufen schreibt, specialia praecepta eines officiorum scriptor sind. Zu Johanns origineller Ausweitung der ursprünglichdreigliedrigen organologischen Staatsmetapher platonischer Herkunft auf ein vielgliedriges Modell vgl. DUTTON, Civitatisexemplum (wie Anm. 80a) 108 ff. und Anm. 923. Bei allen Fortschritten der Quellenforschung zu den gelehrten antikenEinflüssen in Johanns Institutio Traiani, deren Rückgrat dieses Körpergleichnis bildet, sollte man m. E. doch vor lauterBäumen den Wald noch sehen, d. h. die christliche Sozialidee, die Y. CONGAR (Les laïcs et l’ecclésiologie des ‚ordines’[wie Anm. 424] 101 zu Pol. V 2 und VI 20 und ebd. 114 f.) so zusammenfaßt: „toute cette idéologie des ordines estdominée par la doctrine paulinienne du Corps mystique abordée par son aspect solidariste et moral, passé d’ailleurs à traversle grand enseignement de St. Augustin: nul ne doit vivre pour soi seul“. In der für den Policraticus zentralen vielschichtigenofficia-Pyramide innerhalb des Organismusvergleichs liegt auch ein Hauptargument gegen die eingebürgerte Bestimmung desWerks als „Fürstenspiegel“: Dies ist er auch, aber nur, was das oberste officium dieses „Gesellschaftsspiegels“ betrifft. Vgl.auch S. 560, 570 f. und KERNER 132; UHLIG (wie Anm. 577) 41; SMALLEY, Becket (wie Anm. 689) 90: „a swollenversion of the Speculum genre: a Mirror for Princes combined with a Mirror for Society“. Die von den Modellen Ciceros undAmbrosius’ abgeleitete Gattung De officiis findet im Mittelalter vornehmlich die Bezeichnung speculum im Sinne einerStandesethik für bestimmte Ämter: vgl. P. LEHMANN, Mittelalterliche Büchertitel (SB Bayer. Ak. d. Wiss. 1948.4;1953.3) München 1949/53, hier 1953, 30 ff.; M. BERNARDS, Speculum virginum, Köln/Graz 1955, 1 ff. (mit reichenListen von Titeln). Da speculum jedoch noch einen weiteren, insbesondere enzyklopädischen Sinn hat (wie bei Vinzenz vonBeauvais), wird die spezifisch politisch-ethische Ämterlehre, wie sie etwa Hildebert, Peter von Blois, Stephan Langton,Gerald von Wales, Jakob von Cessoles, Johann von Wales u. a. vertreten, präziser als officia-Literatur bezeichnet. Dabeihandelt es sich um eine eigentliche, sowohl inhaltlich wie formal bestimmte Gattung, die nähere Untersuchung verdient.Viele ihrer Charakteristika begegnen erstmals im Policraticus, z. B. in der Kompositionstechnik der stete Wechsel vonExempla und Reflexion, metaphorischer Rahmenbildung mit divisio, wie die Einteilungen nach der Körpermetapher, denWeisheitsschlüsseln, den Schachfiguren u. dgl. – In diesem Beitrag zum Exemplum, das selbst keine Gattung, sondern einefür mehrere Gattungen wichtige Funktion darstellt (S. 44f.). konnte ich nur sporadisch auf gattungsgeschichtliche Aspekteeingehen. Es wäre jedoch ein lohnendes Ziel, die drei aristotelischen Arten des Beispiels: (historisches) Exemplum,Gleichnis und Fabel in ihrer unterschiedlichen Bedeutung für verschiedene Gattungen zu untersuchen (s. S. 51 ff.). DasExemplum kann von der gattungskonstituierenden Hauptfunktion bis zu der hier erwähnten instrumentellen Organisations-oder Dispositionsfunktion (bei der es unübersichtlichen Kompilationsstoff gliedern hilft) viele Gattungsrollen übernehmen.Verstreut finden sich Hinweise auf Gattungsprobleme an folgenden Stellen: S. 21, 129 f., 161, 172 f., 355 ff., (moralisch-essayistische Gattungsmischung); S. 170, 177 (anekdotische Biographie); § 73; S. 162, 601 (Fazetie, Chrie, Scherzund
489
konnte für diese „Spezialregeln“ nur wenige Belege beisteuern und auch kaum konkrete Lösungen der eigenen,zum Teil ganz neuen Probleme einer (erzbischöflichen und königlichen) Hofverwaltung im England HeinrichsII. anbieten. Als politischer „Moralist“ stand Johann gewissermaßen vor jenen Gesetzeslücken und Aporien,auf die er sich in der als erstes Zitat dieser Arbeit angeführten Briefstelle bezieht. Zu deren Lösung empfiehlter dort, Pro und Contra mit bestem Gewissen abzuwägen und mangels passender Glaubenslehren „Exempla“ zuHilfe zu nehmen. Durchweg läßt sich seine Rezeption antiker Moral in der Tat als ein solches die normativenFixpunkte (christliche Gesetze und Autoritäten) ergänzendes – nicht ersetzendes –
Klugheitsrede); S. 17 f., 110 f., 124, 132, 137, 177, 359, 521 (Historiographie und Anekdotensammlung); S. 342, 359,375, 378 f., 385 f., 402, 521 (Kompilatorik und Enzyklopädik); § 92, S. 356 f. (topische Kompositionsweise).
490
Herbeizitieren von exempla im weitesten Sinne des Wortes verstehen. Da sich in seiner Sicht eigenständigesProblemdenken unbedingt durch verbindliche Tradition legitimieren, sich sogar innerhalb derselben vollziehenmuß, sind heidnische facta und dicta auctorum eine Art Lückenbüßer im Beweisnotstand bei unvollständigerkanonischer Zeugenreihe.966
Betrachten wir aber nun, wie Johann christliche Belege und Bibelzitate umdeutet und zurechtbiegt, um siemöglichst fugenlos in sein Testimonien-Mosaik einlegen zu können, so erscheint die Frage nach der Zweck-Mittel-Relation antiker und christlicher Stellen doch eher zweitrangig gegenüber dem gemeinsamen Zielbeider Zeugnisarten: einer christlichen, aber nicht spezifisch christlichen Naturphilosophie. Man kann diesvielleicht besser von der Gegenposition her verdeutlichen, deren Vertreter eine integrative Umdeutung oder –wie es in erbaulicherer Mediävistensprache heißt – „Läuterung“, „Erlösung“ heidnischer Theorien im Dienstefrommer Spekulation, anstreben und etwa Ciceros Freundschaftslehre auf die reine Gottesliebe, Senecasschulkritische Lebensmoral auf die mystische docta ignorantia beziehen. Die hinter solcher Hermeneutikwirkende Grundhaltung läßt sich als „spirituell“ bezeichnen. (Der ursprünglich französische Begriff„Spiritualität“ ist nicht zuletzt dank der Autorität des ‚Dictionnaire de la spiritualité‘ zum internationalenfrömmigkeitsgeschichtlichen Fachterminus geworden und hat insbesondere der deutschen Mediävistikgeholfen, die unglückliche Wahl zwischen den von „Geist“ abgeleiteten Adjektiven, dem klerikalen„geistlich“ und dem idealistisch vorbelasteten „geistig“, zu meiden.) Hans Urs von Balthasar definiert denchristozentrischen Innerlichkeitsbegriff bündig als „die subjektive Seite der Dogmatik“ und Jean LeclercqO.S.B. (allerdings
966 Vgl. oben Anm. 1 zu den urduae dubietates bei mangelnden Autoritäten; § 43, Anm. 374 zum weiteren Begriffexemplum für Ereignisse und Zitate. – MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 113 ff. zeigt eine interessantespätmittelalterliche Entwicklung auf, deren Anfänge allerdings schon bei Johann liegen dürften: Die antiken Autoren werdenzusehends weniger als verstärkende oder gar nur dekorative Parallelzeugen für christliche Autoritäten „ausgebeutet“, sondernals eine Art „Experten“ auf Gebieten, auf denen die heiligen Quellen des Christentums versiegen (Naturwissenschaft, Politik,Ethik), um Information angegangen. Gleichzeitig werden (was für das Folgende wichtig ist) biblische Autoren, namentlichdiejenigen der „Weisheitsbücher“, so gelesen, als wären auch sie in gleicher Weise Spezialisten für gelehrte Sachfragen, waseine gegenseitige Unterstützung heidnischer und christlicher Autoritäten außerhalb der Glaubenslehre, auf dem Sektor dernatürlichen Vernunft erleichtert. Johann verwendet hier eine intellektuelle Analogie zur moralphilosophischen Methode derbeschämenden exempla imparia: Antikes Wissen wird nach bewußter Ausklammerung des Glaubenswissens durchauskonkurrenzfähig mit der Bibel, ja enthält gerade wegen der geringeren Gnadenerleuchtung der Heiden (s. Anm. 665) eineumso höhere wissenschaftliche Autorität.
491
die monastische Ausprägung betonend) als „die Form des religiösen Lebens, die keinen Nebenzweck kennt“,die außer kontemplativer „Gottsuche“ keine „Zwecke“ kirchlicher, seelsorgerlicher, karitativer, politischer,sozialer, ethischer, wissenschaftlicher (usw.) Art kennt und von allen „Umständen“ zugunsten des „Wesens“der Religion absieht.967
Man kann die beiden Hauptwerke Johanns insofern als „unspirituelle“ Literatur bezeichnen, weil er darin ehervom „Wesen“ des Christentums zugunsten der „Umstände“ des Christentums absieht, was immer er sonstgedacht und geglaubt haben mag. Unverfänglicher finde ich jedoch den in kontrastiver Anlehnung an dieSpiritualitätsforschung entstandenen Begriff „praeterspirituell“, der insbesondere auf verschiedene Artenhypothetischer – aber keineswegs kritischer oder negativer – Ausklammerung der zentralen christlichenDogmen angewandt worden ist. So grundverschiedene Autoren wie Boethius, Martin von Braga, Anselm vonCanterbury, Abaelard, Bernhard Silvestris, Alan von Lille oder der Verfasser des ‚Moralium dogmaphilosophorum‘ (Wilhelm von Conches?) sind unter diesem Aspekt als Hauptvertreter „praeterspiritueller“Tradition verglichen worden.968 Hinter allen Unterschieden
967 Jean LECLERCQ, Aux sources de la spiritualité occidentale, 3 Bde. Paris 1964, I, 306. – Hans Urs von BALTHASAR,Spiritualität, in: ders., Verbum caro, Einsiedeln 1960, 226–44, hier 227. Zur spirituellen Integration der Antike vgl. A. 734(„Erlösung“); A. 405, 599 (Seneca); Etienne GILSON, La théologie mystique de S. Bernard, Paris 1947, 183 ff.; R.GELSOMINO, San Bernardo di Chiaravelle e il ‚De amicitia’ di Cicerone, in: Anal. monast. 5 (Studia Anselmiana 43),Rom 1958, 180 ff.; DELHAYE, Deux adaptations du ‚De amicitia’ (wie Anm. 853) 304 ff.; A. SQUIRE, Aelred ofRievaulx, London 1969, 98 ff. u.a.m.968 Diese für das Mittelalter überaus wichtige Tradition verdient im einzelnen noch intensive Erforschung, die bishervielleicht aus Furcht vor voraussehbaren Mißverständnissen und Anachronismen (Säkularisation, Rationalismus,Ästhetizismus u. dgl.) unterblieben ist. Zum Grundsätzlichen hat W. von den STEINEN alles Nötige prägnant formuliert:vgl. Humanismus (wie Anm. 664) 199 f.; Natur und Geist (wie Anm. 883) 83, 86 ff.; Der Kosmos (wie Anm. 664) 234 f.,264 ff., 278 f., 385. Mit praeterspirituellem Humanismus habe ich mich schon befaßt in Hildebert (wie Anm. 211) 280 ff.,293 f. und Consolatio I/II §§ 1061–1136, bes. 1134 ff.; nebst der dort verzeichneten Literatur s. vor allem JohanHUIZINGA, Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de Insulis, in: Verzamelde Werken IV2, Haarlem 1949, 3–84, bes. 40, 67; JEAUNEAU, Lectio 152 f. (vgl. oben §§ 94 f.). GÖSSMANN, Antiqui und moderniim Mittelalter (wie Anm. 541) 68 ff. (zu Johann); SMALLEY, Friars 52 f. (zu John of Wales): „he […] wanted to showwhat pagans could achieve by the light of natural reason and virtue without those aids of revelation and grace which shouldenable Christians to do better“; THOMSON, William of Malmesbury as Historian (wie Anm. 405) 403 f. zu Wilhelmsprimär stoischer Moral im ‚Polyhistor’: „It goes without saying that none of this moral advice has any specific Christiancontent […] It is not that the values implicit in William’s examples are anti-Christian, but that they are not necessarily thosewhich are given high priority within the Christian scheme of things“; HANNING (wie Anm. 185) 121 ff. zur Historia regumBritanniae Galfreds von Monmouth als historiographischem Versuch, „a purely human causation“ jenseits der Vorstellungenvon Providenz und Heilsgeschichte darzustellen; LÖWE, Persönlichkeit (wie Anm. 669) 534 ff. zur Lockerung frühererreligiöser Bindungen und zu spielerischen Formen des hypothetischen Denkens in der Frühscholastik als Nachwirkung desInvestiturstreits und zu Simons von Tournai erstaunlicher Behauptung (536), er sei fähig, die Lehre Jesu ebenso gut zubekräftigen wie zu widerlegen. Zur methodischen (an die Sophistik erinnernden) Grundlage solcher „Kraftakte“ vgl. § 66,S. 266 ff. – Vgl. auch GREGORY (wie Anm. 26) 195 ff. zu einem Hauptmerkmal der „Renaissance des 12. Jahrhunderts“:dem in den De natura rerum bezeugten Interesse an „natürlichen Ursachen“ gegenüber traditionellen symbolischallegorischenNaturerklärungen, das nur dank eines arbeits-hypothetischen Ausklammerns der göttlichen „Erstursache“ zugunstenphilosophisch relevanter causae secundae möglich ist. Vgl. auch A. 779, sowie Anm. 886, 979 zu der text- undgattungsbezogenen Charakterisierung der Hauptwerke Johanns als „praeterspirituell“ im Unterschied zum spirituellen Zeugnisder späten Briefe. Im übrigen hat CHENU in seinem noch immer grundlegenden Kapitel (Théologie 142–56) über die AetasBoethiana des 12. Jhs. aus ähnlichen Gründen die Consolatio philosophiae ein „paratheologisches“ Werk genannt (142).
492
der Intention und Thematik ist diesen Denkern der Versuch gemeinsam, (probehalber) voraussetzungslos zuargumentieren: remoto Christo, unter Suspension des Christentums, ohne Bezug auf die Offenbarung;subtracto Christo, mit der nach Abzug des Christentums übrigbleibenden Vernunft, jener gottgegebenenVernunft Adams, die auch nach dem Sündenfall (wie die Leistungen der Heiden beweisen) nicht ganz erloschenist und die der Mensch auch nach der Erlösung weiterhin von sich aus gebrauchen darf. Von den vielfältigenMotiven, derart vom Glauben zeitweilig abzusehen, seien nur die wichtigsten summarisch aufgezählt: bessereVerständlichkeit in der Verkündigung und Verteidigung des Glaubens durch induktive Anknüpfung anBekanntes; Kommunikationserstellung im Religionsgespräch mit Hilfe des kleinsten gemeinsamen Nenners;Anpassung an das human- und sozialethisch Mögliche in der Laienkatechese durch Verzicht auf christlicheMaximalforderungen (wie die sog. Vollkommenheitsräte). Dies sind pädagogische und taktische Gründe proforo. Daneben gibt es spiel- und übungshafte Gründe pro schola – wie die Scharfsinnserprobung am Problemder Vernunft- und Naturgemäßheit des Glaubens – sowie allgemein literarästhetische – wie das propriecommunia dicere (Horaz, A.P. 128), die „schwierige“ Kunst, alt und selbstverständlich gewordeneGlaubenssätze in neuem, nicht-christlichem Gewand wirksamer auszudrücken. Den tiefsten Grund bildet jedochseit der Patristik das Leitmotiv aller „natürlichen Theologie“: das Christentum auch ohne die Bibel alsrational verstehbar, in die Sprache
493
der Philosophen übersetzbar zu erweisen; im Vertrauen auf die Identität des deus incarnatus mit demKosmokrator, im Kosmos die christliche Lehre naturaliter, „naturrein“, wiederzufinden.969
Daß diese Motive, gerade auch das zuletzt genannte (hervorragend von Augustin vertretene) an mehrerenStellen den Policraticus und den Metalogicon bestimmt haben, braucht nicht nochmals ausgeführt zu werden.Johanns Besonderheit in der „praeterspirituellen“ Tradition dürfte darin liegen, daß
969 Zur Formel Anselms von Canterbury: remoto Christo vgl. VON DEN STEINEN, Kosmos (wie Anm. 664) 265; CurDeus homo Praef. (ed. F.S. SCHMITT, Darmstadt 1960) 2: Ac tandem remoto Christo, quasi nunquam aliquid fuerit deillo, probat rationibus necessariis esse impossibile ullum hominem salvari sine illo. Ebd. I 10, 38: Ponamus ergo deiincarnationem, et quae de illo dicimus homine numquam fuisse. – Zu Johanns Ausdruck substracto Christo in Pol. III 9 s.oben Anm. 920 und S. 497. Den für die Laienethik traditionellen, auch bei Johann maßgeblichen Grundgedanken formuliertbereits Bischof Martin von Braga im Widmungsbrief zu seiner Formula honestae vitae an den westgotischen König Miro(ed. C.W. BARLOW, Martini episc. Bracarensis Opera omnia, New Haven 1950, 237 oder F. HAASE, Senecae operaquae supersunt III, 1872, 468): Titulus autem libelli est formula vitae honestae […] quia non illa ardua et perfecta, quaepaucis egregiis deicolis patrantur, instituit, sed ea magis commonet quae, sine divinarum scripturarum praeceptis, naturalitantum humanae intelligentiae lege etiam a laicis recte honesteque viventibus valeant adimpleri. Vgl. dazu von MOOS,Hildebert (wie Anm. 211) 280 ff. – Zu Boethius s. unten § 104. Zum Moralium dogma philosophorum s. S. 498. – ZuAugustins Begründung natürlicher Theologie aus der Betrachtung des Kosmos (Civ. XI 2.4) vgl. FLASCH (wie Anm. 562)401 ff. – Zum pädagogischen „Absehen“ vom Glauben s. S. 485 f, zum übungshaften s. §§ 66, 68; zum literarisch-dekorativen, vgl. S. 277 ff. und unten S. 496 f. – Die mittelalterliche Tradition bildet die noch weitgehend theologischfundierte Vorstufe zu christlichen und allmählich weniger christlichen Formen einer „Philosophie des Als ob“ in der Neuzeit,die von Balthasar Graciáns jesuitischer „Meisterregel“ der lebenspraktischen Trennung des göttlichen und menschlichenBereichs (Oraculo manual [wie Anm. 427] Nr. 251) zur folgenreichen Weltformel et si Deus non daretur bei Leibniz, zuKants „heuristischer Fiktion“ und Schelers „postulatorischem Atheismus“ reicht und den Menschen „als Maß aller Dinge“ aufvielen Umwegen zu installieren sucht. BLUMENBERG, Neugierde (wie Anm. 402) 148 ff. weist auf eine bedeutendeIntensivierung dieser Tendenz im spätmittelalterlichen Nominalismus, besonders bei Wilhelm von Ockham, hin: DurchTranszendentalisierung des Gottesbegriffs entfernt sich Theologie aus autonom werdender Wissenschaft und Moral mit derHypothese: „als ob es Gott nicht gäbe“. Vgl. dazu auch BARNER (wie Anm. 298) 125 ff.; MARQUARD, Kunst (wieAnm. 36) 38 ff.; F. LÖTZSCH, ‚Als ob’, in: HWbPh I 198 f. – Vgl. aber auch ganz unabhängig von der philosophisch-theologischen Fragestellung die geschichtstheoretische Betrachtung des Konjunktivs: „Was wäre ohne Jesus geschehen?“oben Anm. 572 zu A. DEMANDT.
494
er deren „Als ob“ mit dem (gleicherweise auf dem Wertbegriff der natürlichen Vernunft beruhenden)Konkordanzverfahren verbindet. Beides hängt insofern zusammen, als er den Boden, auf dem der Austauschzwischen Antike und Christentum stattfinden soll, vorgängig glättet, durch den Ausschluß alles reinSpirituellen aus der Bibeldeutung, durch Reduktion des Textes auf den „Buchstaben“ der natürlich-moralphilosophischen Lesart. Seine als Beweis intellektueller Gradlinigkeit oder gar des gesundenMenschenverstandes gelobte Kritik an ausufernder, ausgeklügelter Hyperallegorese und an einem an denHaaren herbeigezogenen sensus spiritualis dient letztlich einer nicht weniger raffinierten Literaldeutung, dieihm erlaubte, die Bibel so weit wie möglich auf die Moralphilosophie und die politische Theorie hin zuöffnen.970
Eine subtile Art dieser extensiven Bibelauslegung besteht im ausdrücklichen Zugeständnis einerGrenzüberschreitung auf den spirituellen Bereich hinüber, in einer rhetorischen Selbstkorrektur, die demSuspensionsverfahren die Form einer praeteritio verleiht. So weist Johann in der Fürstenethik des 4.Policraticus-Buchs mit ironischem Unterton gewissermaßen auf die politisch juristische Unzuständigkeitchristlicher Spiritualität für den gegebenen Fall hin.971 Es geht hier um die Widerlegung jenes besondersgefährlichen
970 Zu mühsamen Versuchen Johanns, aus der Bibel soviel politische Ethik wie möglich herauszuholen, vgl. § 100, S. 175,473. Zu Johanns differenzierter Einstellung hinsichtlich des richtigen Maßes der Allegorese s. oben § 97, S. 390 ff., 398 ff.,470 ff., 504 ff. Grundsätzlich ist unser Eindruck einer virtuosen loci-Kombinatorik mit z. T. auch allegorischem Einschlag inseiner literarischen Praxis (§§ 49, 76, 100, S. 368) zu kontrastieren mit seiner hermeneutisch strengen Absicht, wildesAllegorisieren zugunsten des Literalsinnes bei jeder Auslegungsart einzudämmen; vgl. S. 328 ff., 391 f., 404, 455 ff.,504 ff.; Pol. VII 12, (II) 137 f.; Met. I 19, 46 f.; ebd. II 17, 91 f.; ebd. III 1, 121; Pol. VII 10, (II) 131.24 ff.: Cum veroprimum sit excutiendus sensus historicus, quicumque vel ad fidem vel ad opera fidei, quae sunt boni mores, magis informat,laudabilior et plane utilior est. Vgl. auch LUBAC (wie Anm. 430) I 473; EHLERS, Hugo von St. Victor (wie Anm. 17)89; M.-D. CHENU, Histoire et allégorie au XIIe siècle, in: Festschr. J. LORTZ, ‚Glaube und Geschichte’, II, Baden-Baden1958, 59–72, hier 69 ff.; ders., La décadence de l’allégorisation (wie Anm. 368) 129 ff. zur Verteidigung des Literalsinnesim 12. Jahrhundert gegen modische Hyperallegorese; JENTZMIK (wie Anm. 183) 67 zu Hugo von St. Victor; SMALLEY,Study of the Bible (wie Anm. 321) 94 f., 108 ff.; LOHR (wie Anm. 560) 100 ff. zu Abaelard; G.M. EVANS, Hugh ofSt. Victor on History and the Meaning of Things, in: Studia Monastica 25 (1983) 223–34.971 Pol. IV 6, (I) 252 (zum Gesamtkontext s. KANTOROWICZ [wie Anm. 640] 105 und unten Anm. 993), 252.6 ff.:Attende quanta debeat esse diligentia principis in lege Domini custodienda, qui eam semper habere legere praecipitur etrevolvere [cf. Deut. XVII 19], sicut Rex regum, factus ex muliere, factus sub lege [cf. Gal. 4.4], omnem implevit iustitiamlegis, ei non necessitate, sed voluntate subiectus, quia in lege voluntas eius, et in lege Domini meditatus est die ac nocte.Quod si ille in hac parte non creditur imitandus, qui non regum gloriam, sed fidelium amplexus est paupertatem etinductus forma servili reclinatorium capiti non quaesivit in terris et interrogatus a iudice regnum suum de hoc mundo nonesse confessus est [Philipp. 2.7; Matth. 8.20; Io. 18.33.36], proficiant vel exempla regum illustrium quorum memoria inbenedictione est [cf. Eccli. 46.14] Procedant ergo de castris Israel David, Ezechias et Iosias et ceteri qui in eo sibi regnigloriam constare credebant, si Dei quaerentes gloriam se et subditos divinae legis nexibus innodarent. Et ne illorumremota videantur exempla […] ne quasi aliena aut prophana contempnantur exempla. Fast dasselbe, von Johann angedeuteteund wieder zurückgenommene exemplum impar (vgl. S. 454 ff.) illustriert PERELMAN 126 für das besondersallgemeingültige, aber darum auch umso leichter manipulierbare „modèle parfait“ mit einem Bossuet-Zitat (Sermons II, Ed.Garnier 50): „pour donner à tous les monarques, qui relèvent de sa puissance, l’exemple de modération et de justice, il avoulu lui-même s’assujettir aux règlements qu’il a faits, et aux lois qu’il a établies“. Zu Johanns Bekämpfung derlegistischen Theorie vom princeps legibus solutus/absolutus mit der Gegenthese der publica utilitas und dem aequitas-Idealvgl. S. 441 ff., 468, 514; KERNER 149 ff.; MICZKA, Summa Codicis (wie Anm. 564) 381 ff.; J. DICKINSON, TheMedieval Conceptions of Kingship and Some of Its Limitations as Developed in the Policraticus of John of Salisbury, in:Spec. 1 (1926) 308–37.
495
römisch-rechtlichen Prinzips, nach dem der Fürst, über dem Gesetze stehend, auch „vom Gesetz gelöst“ sei.Johann zieht dabei zunächst als argumentatives und zugleich vorbildliches Exemplum das Christkönigsbeispielheran: Der „König der Könige“ habe sich durch die Inkarnation freiwillig dem „Gesetz“ unterworfen. DerVergleich dürfte ihn jedoch bei näherer Betrachtung – sei es aus theologischen Bedenken, sei es auspersuasions-strategischen Überlegungen – nicht ganz befriedigt haben. (Die Menschwerdung alsverfassungsrechtlicher Beweis stellt im Grunde eine eher ungebührliche Verengung eines zentralenGlaubensgeheimnisses dar.) Jedenfalls verwirft er die Analogie bereits im nächsten Gedanken wieder und steigtin geschickter transitio, als wolle er der Ungereimtheit noch einen rhetorischen Vorteil abgewinnen, von derbiblischen Argumentationsebene so auf das Suspensions- oder Ausschlußverfahren über: Da Christi Reich nichtvon dieser Welt sei, könne auch dessen Gesetzesgehorsam bis in Armut, Erniedrigung und Tod kein sonderlichgeeignetes Beispiel für den glorreichen König abgeben. (Es ist in der Tat ein allgemeines, für alle Gläubigengültiges Exemplum, kein spezielles, auf das Herrscheramt zugeschnittenes). „Wenn Er also in dieser Hinsichtnicht für nachahmenswert gehalten wird, der ‚Knechtsgestalt angenommen‘, ‚keine Ruhestatt für sein Haupt‘gesucht hat und auf die Frage des Richters bekannte, sein Reich sei nicht von dieser Welt, dann mögen dochwenigstens Beispiele angesehener Könige gesegneten Andenkens zum Nutzen gereichen …“ Johann hätte imZusammenhang mit dem Exemplum Christi neben der Mahnung
496
zur gesetzlichen Selbstbeschränkung der Macht allerdings auch auf die im früheren Mittelalter – besonders imottonischen Zeitalter – so wichtige „herrschaftstheologische“ Idee der Christusnachfolge in der humiliatioChristi hinweisen können. Er übergeht sie, wiewohl er insgeheim daran gedacht haben könnte (was demVerschweigen einen sarkastischen Beiklang gäbe). Unterdrückt oder nicht offen ausgesprochen werdenjedenfalls alle auf spezifisch christliche Normen bezüglichen Folgerungen der Passionstheologie; nicht weil sieungültig wären, sondern weil der exhortandus ihnen nicht gewachsen wäre (was gewissermaßen einunterdrücktes exemplum impar darstellt). Nach dem derart ausgeklügelt herangezogenen und als unpassendwieder verworfenen Christkönigsbeispiel folgen unmittelbar die „näherliegenden“ Exemplaalttestamentarischer Könige und christlicher Kaiser des spätrömischen Reichs.972
Die Stelle zeigt gut die erwähnte Besonderheit in Johanns Anwendung der praeterspirituellen Methode: SeinAusschluß biblischer Bezüge bleibt auf bestimmte Punkte beschränkt und wird explizit in rhetorischenÜbergangsformeln kenntlich gemacht. Damit unterscheidet es sich von den im 12. Jahrhundert beliebtwerdenden Boethius-Imitationen, die sich mit einem durchgängigen, stillschweigenden oder nur formalenMeiden christlicher Konnotationen begnügen. Antikisierende Verse Bernhards Silvestris führt Johann beinaheentschuldigend an:973 Sie seien zwar „von einem hervorragenden Autor
972 Vgl. auch Anm. 979.973 Zu Boethius-Imitationen vgl. S. 281 ff., 498 f., A. 879; Verf., Consolatio I/II §§ 1 100 ff., 113 ff.; KINDERMANN(wie Anm. 533) 51 ff.; G. RAYNAUD DE LAGE, Alain de Lille, Paris 1951, 103 ff. Auf Boethius ist zweifellos dasauffällige Zusammentreffen der prosimetrischen oder dialogischen Form mit der praeterspirituellen Thematik bei Hildebert,Laurentius von Durham, Bernhard Silvestris und Alan von Lille zurückzuführen. – Pol. III 8, (I) 194.21 ff. Die leise Kritikbetrifft die klassischen Termini sors caeca und dei (Götter) in einer Umschreibung für das Auf und Ab irdischer Kontingenz,[…] quod et quidam temporis nostri scriptor egregius infidelium tamen verbis eleganter expressit: ‚Ridiculos hominumversat sors caeca labores;/secula nostra iocus ludibriumque deis’. (Die mutmaßliche Verfasserschaft Bernhards Silvestrisberuht auf einer Marginalglosse zu dieser Pol.-Stelle, ist aber im bekannten Werk des Dichters bisher nicht nachgewiesenworden.) Johann zitiert dies inhaltlich zustimmend. Auch der „heidnische“ Sprachgebrauch dürfte ihm eher als eine„allzumenschliche“ Unschicklichkeit erschienen sein, da er kurz vor dem Zitat für eine gewisse Toleranz (patientia) bei derVerwendung des Fortunabegriffs eintritt (193.25 ff.): Quod ergo aliquid fortunae videmur ascribere, ei [sc. Deo] nequaquampraeiudicat. Sed quia nobis ad homines sermo est, hominum verbis utimur. Pingui […] Minerva [Cic. Lael. 5.19] agentesde singulis, de nullo subtilem reddentes rationem. Quod si hoc ipsum patienter admittitur, ea quae a philosophis gentiumpublicae utilitatis gratia scripta sunt audire quid prohibet? Quaecumque enim, inquit, scripta sunt ad nostram doctrinamscripta sunt … (Rom. 15.4; vgl. S. 370 f., 456, A. 734) Zur üblichen anonymen Anführung zeitgenössischer Autoren(scriptores, nicht auctores) vgl. oben Anm. 337, 542.
497
(scriptor) unseres Jahrhunderts, aber in heidnischen Worten.“ Das rein verbale, generelle Antikisieren dürfteihm eher als modisch dekorativer Anachronismus erschienen sein. Ihm ging es um eine bewußte, sachlich undrhetorisch adäquate Ausklammerung des Christlichen, und er hob sie auch ausdrücklich als ein selektiveinzusetzendes Argumentationsmittel hervor mit Überleitungen der rhetorischen praeteritio, reticentia undAposiopese wie: „Doch lassen wir dies beiseite…; lassen wir Christus unerwähnt…; um an dieser Stelle Christusnicht zu nennen…; um von Christus jetzt einmal zu schweigen…“.974
Man hat ein Hauptwerk praeterspiritueller Tradition, das Moralium dogma philosophorum, als eine reineLaienethik der geistlich fundierten Moral dem Policraticus entgegenzusetzen gesucht.975 Auf den ersten Blicktrifft dieser Unterschied zu. Der (m. E. anonyme) Autor des Moralium dogma zitiert die Bibel nicht; Johannbenützt sie eifrig. Seine praeterspirituelle Grundtendenz zeigt sich jedoch nicht äußerlich (philologischquantifizierbar) im Nichtverwenden der Bibel als literarischer Quelle, sondern im subtilen Absehen von dereninkommensurablem Autoritätscharakter gegenüber außerbiblischen auctores, in der Vorliebe für deren nichtspezifisch geistliche Gehalte, ja sogar im gelegentlichen Übergehen der wesentlichen Heilslehre unter jeweilsklar benannten Gesichtspunkten. Auch zeigt sie sich nicht durchgängig, sondern nur in bestimmten wichtigenPartien des Policraticus. Auf das Ganze des Werks gesehen, können wir heute allerdings dem Eindruck einergewissen Widersprüchlichkeit nicht entgehen. Er entsteht aus dem gleichzeitigen Versuch
974 Pol. VIII 25, (II) 423.5 f. (s. oben Anm. 878): Sed his omissis aut potius praemissis …; Pol. III 9, (I) 197.22: subtractoChristo; Pol. IV 6, (I) 252.12 f.: Rex regum […] si in hac parte non creditur imitandus … (s. oben Anm. 971); Pol. IV 11,(I) 270.11 ff.: Hoc autem (ut ad praesens de Christo qui factus ex semine David […] nulla sit mentio (s. oben Anm. 947);ebd. IV 3, 241.19 f.: ut ad praesens misterium taceatur quo Melchisedech praefigurat Christum (s. oben Anm. 945). Demselektiven Einsatz dieser praeterspirituellen Suspensionsmethode entspricht im Sinne der Konkordanzidee die ebensopunktuelle „Ausklammerung“ des spezifisch Heidnischen , also ein „praeterpaganes“ Als ob. Vgl. etwa in Pol. V Prol. (I)280 f. (oben in Anm. 892) die paradoxe Formulierung: deducta superstitione gentilium fidelis est (mit Bezug auf Plutarch).Von beiden Seiten her wird also angepaßt, „abgesehen“, „abgezogen“ (subtracto Christo, deducta superstitione erinnern aneinen arithmetischen Subtraktionsvorgang), d. h. alles wird ausgeschlossen oder verschwiegen, was sich gegen dieEinheitsidee des „Natürlich-Christlichen“ sperren könnte.975 SUCHOMSKI 38 ff., 49.
498
Johanns, die christliche Doktrin nach erschöpfender Befragung „rein christlicher“ auctoritates mit(„natürlich-christlichem“) Fremdgut nur zu vervollständigen, und der humanistischen Absicht, die höchsteAutorität der Bibel hypothetisch-experimentell beiseite zu schieben. Johann selbst dürfte hier keinenWiderspruch gesehen haben, weil ihn der Offenbarungsglaube und das Vertrauen auf die gottgegebeneMenschenvernunft zur gleichen Wahrheit führen mußten. Konkordanzidee und praeterspirituelles Denkenerlaubten ihm (als optimistische Methoden), dem natürlichen Menschen eine Weisheit zuzutrauen, die nachspirituell extremer sola gratia-Auffassung allein der Christ erlangen kann.976
104. Am schönsten zeigt sich sein Verständnis des Konkordanzgedankens und des zeitweiligen Ausschlussesder rein christlichen Dimension in dem bekannten Lob auf Boethius, den er einen „hervorragendenGläubigen“ nennt, der seinen Glauben in der Consolatio Philosophiae absichtlich nicht bekannt habe, unddennoch bei allen rational Denkenden hohes Ansehen genieße. Seine Consolatio könne kein vernunftbegabterMensch verschmähen:977
976 Zum Moralium dogma philosophorum vgl. oben Anm. 920a und die dort genannte Arbeit von DELHAYE. Vgl. auchdessen: Gauthier de Châtillon est-il l’auteur du Moralium dogma? (Annal. Mediaev. Namurc. 3), Namur Lille 1953;NOTHDURFT (wie Anm. 846) 94 f.; von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 148; T. GREGORY, Anima mundi (wieAnm. 822), 19 ff. und KERNER 21 zu der auch heute noch ungeklärten Verfasserschaft trotz der verbreiteten Zuschreibungan Wilhelm von Conches. – Zu Johanns Kombination der beiden Prinzipien im Namen einer christlichen Naturmoral odereines natürlichen Christentums vgl. §§ 95, 97, 108, S. 436 f., 488 ff. Zu einer ähnlichen Ambivalenz bei Theoderich vonChartres vgl. auch HÄRING, Die Erschaffung der Welt (wie Anm. 887) 162: Theoderich äußert die Absicht, „die meistenAnsichten der Philosophen mit der christlichen Wahrheit zu versöhnen, so daß das Wort der Schrift durch seine Gegner sogarnoch gestärkt werde.“977 Pol. VII 15, (II) 155 f. (nach einer Kritik der epikureischen Güterlehre und als Überleitung zu einer allgemeinen Theoriedes summum bonum) 155.21–156.3: Si michi non credis, liber de Consolatione Philosophiae revolvatur attentius et planumerit haec in contrarium cedere. Et licet liber ille Verbum non exprimat incarnatum, tamen apud eos qui ratione nitunter nonmediocris auctoritatis est, cum ad reprimendum quamlibet exulceratae mentis dolorem congrua cuique medicamentaconficiat. Nec Iudeus quidem nec Grecus sub praetextu religionis medicinae declinet usus, cum sapientibus in fide et inperfidia desipientibus sic vividae rationis confectio artificiosa proficiat et nulla religio quod miscet abhominari audeat,nisi qui rationis expers est. Sine difficultate profundus est in sententiis, in verbis sine levitate conspicuus, orator vehemens,efficax demonstrator; ad id quod sequendum est nunc probabiliter suadens, nunc quasi stimulo necessitatis impellens. ZuGrecus vgl. S. 167 f., A. 463, 485, 798; der Begriff steht hier für heidnische Weisheit überhaupt, während Johann latinitasnostra (Pol. II 22, 122.13, s. oben Anm. 582) als kulturelle, das Christentum einbegreifende Einheit davon absetzt. – Zuprobabiliter suadens – stimulo necessitatis impellens vgl. oben §§ 50, 72. Denselben humanistischen Gesichtspunkt der„rationalen“ Verständigung jenseits der Kulturen und Religionen hebt auch der Boethius-Accessus Konrads von Hirsau imDialogus super auctores (ed. R.B.C. HUYGENS, Coll. Latomus 17 [1955] 46.1163) hervor. – In Johanns Met. II 1,61.18 ff. illustriert der Christ Boethius, mit Vergil konfrontiert, nicht Johanns praeterspirituelles Prinzip, sondern denKonkordanzgedanken: Unde nostrorum doctissimus poetarum, vite beate monstrans originem, ait: ‚Felix qui potuit rerumcognoscere causas/atque metus omnes et inexorabile fatum/subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari’ [Georg. II490–2]. Et alius fide et notitia veritatis prestantior: ‚Felix qui potuit boni/fontem visere lucidum;/felix qui potuitgravis/terre solvere vincula [Cons. phil. III 12 m. 1–4]. – Im übrigen galt Boethius im ganzen Mittelalter als Christ, jagewissermaßen als ein vom „Christenverfolger“ Theoderich umgebrachter Märtyrer der christlichen Philosophie oderwenigstens als ein vorbildliches Exemplum stoisch-christlicher „Weltverachtung“: vgl. F. SASSEN, Boethius leermeesterder Middeleeuwen, in: Studia Catholica 14 (1938) 97–122, 216–30 = Boethius – Lehrmeister des MA’s, in: Boethius, hrsg.M. FUHRMANN/F. GRUBER, WdF 483, Darmstadt 1984, 82–124, bes. 85 ff.; C.J. de VOGEL, The Problem ofPhilosophy and Christian Faith in Boethius’ Consolatio, in: Romanitas et Christianitas, Festschr. J.H. WASZINK,Amsterdam/London 1973, 357–370 = in: Boethius… WdF. 483 a.a.O., 286–301; STARNES (wie Anm. 879) 27 ff.; P.COURCELLE, La consolation de philosophie dans la tradition littéraire, Paris 1967, 239 ff. (343 zu Johann); ders., Le tyranet le philosophe d’après la Consolation de Boèce; in: Convegno internaz. ‚Passaggio dal mondo antico al medio evo daTeodosio a S. Gregorio Magno’, (Atti di Convegni Lincei 45), Rom 1980, 195–224; von MOOS, Lucans tragedia 134 ff.und vor allem Henry CHADWICK, Boethius, The Consolation of Music, Logic, Theology and Philosophy, Oxford 1981,248 f. mit einer Boethius-Deutung, die derjenigen Johanns nähersteht als dem verbreiteten modernen Zweifel amChristentum des Philosophen: „If the Consolation contains nothing distinctively christian it is also relevant that it contains
499
Wenn du mir nicht glaubst, so lese aufmerksam das Buch über den Trost der Philosophie! […] Obwohl dieses Werkdas Fleischgewordene Wort nicht ausdrückt, genießt
nothing specifically pagan either;“ man glaubt überall den Augustinus der platonisierenden Frühdialoge zu sehen, „standingbehind the author’s shoulder“.
500
es doch bei denen, die sich auf die Vernunft stützen, kein geringes Ansehen, da es zur Heilung aller akuter seelischerLeiden einem jeden die passende Medizin verabreicht. Weder ein Jude noch ein Grieche mag unter dem Vorwand derReligion hier ärztliche Behandlung ablehnen, da eine so meisterhafte Zubereitung der lebendigen Vernunft sowohlden Weisen im Glauben wie den im Unglauben Törichten förderlich ist und keiner diese Arzneimischung aufgrundder Religion zu verschmähen wagt, es sei denn, er entbehre jeglicher Vernunft. Das Buch ist in der Sache tiefsinnigohne Unverständlichkeit, in den Worten anschaulich ohne Oberflächlichkeit. Geschrieben hat es ein mitreißenderRedner und überzeugungsmächtiger Lehrer, der die Unterweisung, bald mit glaubhaften Gründen anratend, bald mitlogischer Notwendigkeit aufzwingend, vorträgt.
501
Sowohl inhaltlich als Lehrer der Scheingüter und des summum bonum wie formal als wirksamer, für allegültiger Redner und geschickter Pädagoge ist Boethius, wie Liebeschütz mit Recht herausgestellt hat,978 einHauptvorbild Johanns im Policraticus gewesen. Beide Aspekte führen aber zurück zu dem grundlegendenVertrauen in eine allen Menschen gemeinsame, alle religiösen
978 LIEBESCHÜTZ, Humanism 28–33; ders., Englische und europ. Elemente (wie Anm. 839) 45; ders., Das zwölfte Jh.(wie Anm. 28) 264 f.; ders., Chartres und Bologna (wie ebd.) 9–12 zu der von Boethius inspirierten Leitidee desPolicraticus, der nicht primär als politischer Traktat zu verstehen sei, sondern (von den sinngebenden Büchern VII und VIIIher) als eine stoisch-popularphilosophische Lehre über das Thema: Philosophia rettet aus den Verstrickungen des Politischen(curia). Dieses Resultat hat KERNER in seiner grundlegenden und ausgewogenen Arbeit wo nicht bestritten, so dochrelativiert (130 f., 185 ff.). Er gründet sein Hauptargument, die zu geringe philologisch „direkte Wirkung“ der Consolatiophilosophiae, allerdings auf den, wie man seit den akribischen Untersuchungen von J. MARTIN (vgl. S. 416 ff.) weiß, invielem fragwürdigen und unvollständigen Index locorum der Ausgabe WEBBS und überschätzt grundsätzlich die Bedeutungder bloßen Wortlaut-Imitatio gegenüber Aspekten geistiger Rezeption. Zur tieferen Boethius-Wirkung vgl. vielmehr die aufJohanns zentrales Konkordanzstreben im Gefolge Abaelards verweisenden Deutungen von MISCH 1175 f., 1259;DELHAYE, Le bien (wie Anm. 385) 203 f., 218 ff.; D.E. LUSCOMBE, The Ethics of Abelard …, in: ‚Peter Abelard’(Mediaevalia Lovanensia I 2), Löwen/Den Haag 1974, 66–73, hier 69 f. – Johanns hervorragendes (noch dem modernenBoethius-Kenner aufschlußreiches) Boethius-Verständnis lobt COURCELLE (a.a.O.) 343 f., der im übrigen auf zwei auchweiter verbreitete Kennzeichen dieser Rezeption verweist: den Aspekt pädagogischer Propädeutik und das Interesse an dersog. Güterlehre (bzw. an dem topischen Thema des summum bonum und den falschen Glücksgütern). Zum letzteren vgl. auchR. BULTOT, Cosmologie et ‚contemptus mundi’, in: Mél. H. BASCOUR, ‚Sapientiae doctrina’, Löwen 1980, 1–23,bes. 10 f. zu Enth. 1131 ff. und ders., La ‚chartula’ et l’enseignement du mépris du monde dans les écoles et les universités[…] médiévales, in: StM VIII 2 (1967) 787–834, bes. 812 ff.; von MOOS, Lucans tragedia 134 ff. (Anm. 16, 23); ders.,Consolatio I/II §§ 473 ff., 1076 ff., 1095 ff.; ders., Hildebert (wie Anm. 211) 118 ff., 274. Zwei neuplatonische Grundideen,die zur zentralen Thematik Johanns gehören, stammen vornehmlich aus deren Adaptation durch Boethius: dieUnveränderlichkeit und Einfachheit Gottes im Vergleich zur historischen Vielfalt und Vergänglichkeit der Menschen (s.§§ 92, 105) und die Utopie von der Philosophenherrschaft im Staat (s. § 118, S. 464 ff.). Den hervorragenden Beitrag desBoethius zum platonisch-augustinischen Synkretismus des 12. Jhs. hebt CHENU, Théol. 142 ff. (z. T. auch mit demZeugnis Johanns) unter folgenden Gesichtspunkten hervor: 1. Harmonisierung von Plato und Aristoteles in derUniversalienfrage (vgl. Met. II 17.94); 2. „concordisme“; 3. Primat des Einen gegenüber der konkreten Vielfalt derWirklichkeit (Met. II 20, 115: s. unten § 105); 4. religiöses Vertrauen in die Vernunft jenseits der Unterscheidung„christlicher“ und „profaner“ Werte. Andererseits betonen (z. T. ebenfalls mit Berufung auf Johann) GRABMANN, Schol.Meth. I 176 ff.; COURCELLE (a.a.O.) 339 ff.; L. OBERTELLO, Severio Boezio, Genua 1974 (Conclusio); STARNES(wie Anm. 879) 28 ff.; OTTE (wie Anm. 552) 18 ff. die Bedeutung des Boethius für die scholastische Versöhnung des„natürlichen“ mit dem „geoffenbarten Wissen“. Denselben Aspekt zeigt andererseits anregend NEWELLS (wie Anm. 882)122 ff. in der Boethius-Rezeption des sog. Chartrenser Neuplatonismus, genauer, in der kritischen Frontstellung Wilhelmsvon Conches gegen jenen monastischen Fideismus und „Ignorantismus“, unter dem Abaelard und Gilbert zu leiden hatten;vielleicht enthält Johanns Lob auf den „gläubigen Rationalisten“ insofern eine bestimmte aktuelle Apologie.
502
und ideologischen Schranken überwindende Wahrheit, die das Absehen von Christus, das Ausklammern derHeilswahrheit legitimiert. Darauf beruht, wie gesagt, auch das zeitweilige hypothetische Aufweichen undAuflösen jener strengen semantischen Differenzen, die der Absolutheitsanspruch der Religion mit sich bringenkann. Es ist nicht anzunehmen, daß sich Johann die Frage bewußt machte, ob er damit einer Relativierung derGlaubensexklusivität, einer Schwächung christozentrischer Unbedingtheit Vorschub leistete. Sie mag hier auchfür uns dahingestellt bleiben.979 Zu weiterem Nachdenken
979 Vgl. § 95, S. 463, 491 f. Besonders auffällig ist in der oben A. 971 erwähnten Stelle Pol. IV 6, 252 der Ausschlußzentraler Bibelstellen, die im früheren Mittelalter zur Begründung einer „christomimetischen“ Reichs- undHerrschaftstheologie gehörten: vgl. L. BORNSCHEUER, Miseriae regum, Berlin 1968, 208 ff. u. ö. Die Form derAposiopese in hac parte non imitandus zeigt überdies, daß aus dem Exemplum Christi nicht Amtsheiligung imcharismatischen Sinn abgeleitet, sondern einzig ein Moralvorbild gewonnen werden soll. Grundsätzlich zu einem nichtchristozentrischen, humanistischen Christentum vgl. von den STEINEN, Humanismus (wie Anm. 664); von MOOS,Hildebert (wie Anm. 211) 250 ff.; LADNER, Renewal (wie Anm. 181) 8 ff.; JEAUNEAU, Lectio 152 ff. und §§ 87, 95.Die Bewertung hängt natürlich von den eigenen Standpunkten der Forscher ab, die aber, soweit sie wissenschaftliche Folgenzeitigen, m. E. nicht indiskutabel sind. So darf man sich fragen, warum den Renaissanceforschern unentwegt das Pagane,Säkularisierte, Synkretistische an derselben Konkordanzmethode auffällt, die in der Mediävistik ebenso traditionell als einedurchaus rechtgläubige, patristisch fundierte verteidigt zu werden pflegt. Objektive Unterschiede seien damit nicht geleugnet.So konnte die im Mittelalter unbewußt-problemlose Symphronistik seit dem 16. Jh. nur noch mit eindeutigemweltanschaulichem Bekenntnis zu einer „liberalen“ Position wie derjenigen, die Erasmus gegen Luther vertrat, angewandtwerden (vgl. BUCK, Petrarca [wie Anm. 528] 170 ff.). Dennoch wird noch allzu oft dasselbe humanistische Phänomen mitzweierlei Maß beurteilt; je nach spezialistisch (oder ideologisch) bedingten Forschervorlieben paßt es zum „frommenMittelalter“ oder zu einer beinahe „neuheidnischen“ Renaissance. Vgl. auch § 110. Gegen diese epochengeschichtlichenKlischees habe ich die humanistisch-praeterspirituellen Züge im Werk Johanns vielleicht etwas zugespitzt betont. Gegen einmögliches biographisches Mißverständnis „von der anderen Seite“ sei nochmals (wie schon A. 886) hervorgehoben, daß hierkeine generelle Antwort auf die Frage nach Johanns Christentum angestrebt wird. Es ist zweifellos auch bedenkenswert, daßJohann als Freund Peters von Celle und Verehrer Bernhards von Clairvaux spirituellen Strömungen seiner Zeit keineswegsfernstand. Wie vor allem die nach Abschluß der beiden Hauptwerke entstandenen Briefe zeigen, pries er die vera philosophiaChristi als das Privileg des idealen Mönchtums und leistete durch sein Interesse am pseudo-dionysischen Schrifttum einenBeitrag zur Tradition der mystisch-apophatischen Theologie. E. JEAUNEAU, der dies (in: The World of John of S. 84 ff.,98 ff.) anregend herausarbeitete, fand sogar einen von WEBB übersehenen Anklang an Bernhards Lehre von der reinenGottesliebe, die Idee des modus sine modo diligendi in Pol. VII 11 (II) 135; vgl. auch SALTMAN (ebd. wie Anm. 574)342 ff. zur überwiegend biblisch geprägten Sprache Johanns in den Briefen über den Becket-Konflikt. Die Frage, ob diehumanistische Phase Johanns vor 1159 durch eine spirituelle Spätphase abgelöst worden sei, ist so interessant wie schwer zubeantworten, da wir nicht wissen, wie ein Werk vom humanistisch-moralistischen Gattungscharakter des Policraticusausgesehen hätte, wenn es später geschrieben worden wäre. Abgesehen davon sind biographisch-entwicklungsgeschichtlicheFolgerungen auch aus dem bestehenden Werk heikel, da der Policraticus, der keinen spirituellen Gesamteindruck hinterläßt,weder als Johanns „einzige Lehre“ noch als dessen „Lebensbeichte“ gelesen werden darf (vgl. §§ 56, 71, S. 232, 335 f.).Vielleicht ist er nicht trotz, sondern wegen des vorhandenen, aber verschwiegenen Teils der religiösen Überzeugungen seinesVerfassers als praeterspiritueller Text im Geiste des Boethius beachtenswert.
503
soll eine Beobachtung Hans Blumenbergs Gelegenheit geben:979a „Die christliche Rezeption der Antike und diesog. neuzeitliche Säkularisation des Christentums sind strukturell und funktionell weitgehend analogePhänomene: das patristische Christentum tritt in der Rolle der antiken Philosophie auf, die neuzeitlichePhilosophie vertritt weiterhin die Funktion der Theologie“. In welcher Übergangszeit stehen abermittelalterliche Humanisten wie Johann von Salisbury zwischen dem Als ob der „natürlich-christlichen“auctores und dem Als ob des kommenden „theologischen Atheismus“? Die Heiden sind bereits soweitintegriert, daß sie das Trinitätsdogma zu erläutern helfen, und noch besteht keine „nachkopernikanische“Notwendigkeit, das Christentum wie die ägyptischen spolia als Gebrauchswert ad usum meliorem in eine neueWelt hinüberzuretten.
979a Hans BLUMENBERG, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt a. M. 1966, 43; vgl. auch O. MARQUARD, Neuzeit vorder Neuzeit (wie Anm. 778) 1 ff.; LÖWITH (wie Anm. 129) 458 (Besprechung der Arbeit von BLUMENBERG). – Zumtheologischen Atheismus s. oben Anm. 969.
504
… par consequent se trompent et mentent les sens de nature, prenansce qui apparoit pour ce qui est, à faute de bien sçavoir que c’est quiest. Mais qu’est-ce donc qui est véritablement? Ce qui est éternel […]Pourquoy il faut conclure que Dieu seul est.
Montaigne (Essais II 12).
Wir denken […] an die Geschichte des Denkens, ohne an das Gedachtedie Wahrheitsfrage zu stellen, d. h. wir denken gedankenlos.
K. Löwith (wie Anm. 129, 357).
IV. DAS EXEMPLUM ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND GESCHICHTS-INTERESSE IMMITTELALTER UND IN DER RENAISSANCE
Das „Intelligible“, die ewige veritas rerum und die Unvollkommenheit sinnlicher Erkenntnis (§ 105). Die Theatermetapherfür die Scheinhaftigkeit der Geschichte (§ 106). Die Simultaneität aller historiae vor dem philosophischen Auge (§ 107).„Gleichförmigkeiten in der Geschichte“ als anthropologische Basis des Exemplums (§ 108). VermeintlicheEpochenunterschiede mit Bezug auf das Exemplum: „zyklische und lineare Geschichtsauffassung“ (§ 109); „didaktischesMittelalter und induktive Renaissance“ (§ 110). Humanistische Autopsie-Versuche in der Forschungsdiskussion um die„Neuheit“ der Renaissance (§ 111). Die anachronistisch integrierte Antike des Mittelalters und die Entdeckung historischer„Alterität“ in der Renaissance: eine Regel mit Ausnahmen (§ 112). Johanns Exempla als Kampfmittel der Gegenwartskritik,Petrarcas Exempla als Trostmittel der Gegenwartsflucht (§ 113). Das Exemplum und Johanns philosophische Leistung(§ 114).
105. Johann beschäftigt sich im Policraticus zu einem großen Teil mit geschichtlichem, historiographischüberliefertem Material: mit kleinen Geschichten, die durch ihren anekdotischen Grundzug einenanschaulichen, gelegentlich sogar „realistischen“ Eindruck machen. Hinzu kommt, daß er im Metalogiconeine autobiographisch gefärbte Bildungsgeschichte und in der Historia Pontificalis eine aus eigener Erfahrungstammende Kirchengeschichte zu schreiben imstande war. An seiner historiographischen Begabung bestehtkein Zweifel.980 – Dennoch gilt Johanns‘ primäres Interesse nicht der Geschichte.
980 Zu Johann als Historiker vgl. M. CHIBNALL, John of Salisbury as Historian, in: The World of John of S. 169–78 unddieselbe, (ed.) Hist. pont., Einleitung XXXI ff.; Alan Drummond McLAY, A Comparative Study of the Life of St. Thomasof Canterbury by John of Salisbury and Other Contemporary Latin Lives, Ph.-Diss. Univ. of Wisconsin 1969 (Diss.Abstracts 30.3, 1969, 1143A); Bohdan LAPID, Jana z. Salisbury rozumienic zadan historiografii, in: Studia Zrodloznawcze,Commentationes 15, (Warschau 1971) 85–107 mit frz. Résumé. Lobende Urteile finden sich etwa noch bei SPÖRL,Grundformen (wie Anm. 366) 82; P. BREZZI, Il superamento dello schema Agostiniano nella storiografia medievale, in:‚Forma futuri’, Festschr. M. PELLEGRINO, Turin 1975, 952–600, hier 958 (wichtiger synchroner Vergleich zurNuancierung des im Folgenden festzustellenden trotzdem übrigbleibenden Augustinismus); FREUND (wie Anm. 540) 68;MICZKA 42 f.; BROOKE, Renaissance (wie Anm. 462) 71; MISCH 1282; KIRN 80 ff. (zur Synkrisis Bernhard–Gilbert);GUTH (wie Anm. 967) 83 ff., 103 ff.; CHENU, Conscience (wie Anm. 361) 116; von den STEINEN, Kosmos (wieAnm. 664) 98 f.; FUNKENSTEIN (wie Anm. 366) 75 f. usw.
505
Sie ist ihm vielmehr Mittel zu dem eigentlich philosophischen Ziel seiner Arbeit, die allgemeinen, innerenGesetze der Erfahrungswelt aufzudecken.981 Das historisch Partikuläre wird ihm nicht zum unwiederholbarEinmaligen, sondern höchstens zu einem charakteristischen Detail, das durch konkrete Anschaulichkeiteinleuchtend auf eine immergültige Wahrheit verweist, sei diese nun bereits gefunden oder erst noch durchAuslegung zu entdecken. Durch exemplarische Geltung und Subsumierbarkeit verliert sich das eigentlicheGeschichtliche eines Faktums. Johann leugnet den Wandel der Lehrmeinungen in der Ideengeschichte zwarnicht; er beschreibt ihn gewissenhaft, aber als ein Oberflächenphänomen, hinter dem es vor allem dasGleichbleibende aufzuspüren gilt. In seinem Bestreben, das Zeitlose oder Überzeitliche an verschiedenenZeugnissen verschiedener Zeiten herauszuarbeiten, geht er induktiv vor, vom Einzelnen zum Allgemeinen,bleibt aber aufgrund der letztlich neuplatonischen Voraussetzung, des augustinischen „éternisme“, wie M.-D.Chenu geistreich sagte,982 „demzufolge allein das Nicht-Zeitliche wirklich ist“, jeglichem echt empirischenVergangenheitsinteresse fern.
981 CHENU, Théol. 86: [Jean de S.…] est plus „philosophe qu’historien“ (aus den unten Anm. 982 angeführten Gründen);vgl. auch ebd. 62 ff. und ders., Conscience (wie Anm. 361) 116 f. zur Dialektik der „sensibilité à l’histoire“ und der„strukturalistischen“ Interessen bei Johann, dessen Anspruch, aus den „innersten Gesetzen“ der Geschichte Gottes Willen zuerkennen und aus Vergangenem pragmatisch zu lernen, gleicherweise das kausale Denken des Historikers wie die ahistorisch-nomothetische Wirklichkeitssicht des Philosophen gefördert hat. Dieses philosophische Geschichtsinteresse ist wesentlich„wirklichkeitsnäher“ (im modernen Sinn) als allegorische, symbolische und noch emblematische Deutungen historischer undnaturwissenschaftlicher „Realien“, die um ihres „höheren Sinnes“ oder ihrer „Bedeutsamkeit“ willen bis auf ein Minimum andesignativer Anknüpfung entsubstantialisiert werden müssen. – Philosophisch ist im übrigen Johanns Ausrichtung auch aufanderen lebensweltlichen Gebieten: Er war weder ein Historiker noch ein Jurist im üblichen Sinne, sondern einGeschichtsdenker und ein Rechtsphilosoph in praktischer Absicht vgl. S. 271 ff., 441 ff.982 CHENU, Théol. 99 (vgl. S. 455 ff., 449, 451, 507 f.) zum Unterschied von konstanten res und wandelbaren verba undinsbesondere zum Einfluß des aristotelischen Satzes: „verbum consignificat tempus“ (Peri Hermeneias 16 b 6) in Met. IV32, 200 f. (mit der Stelle: semper esse verum quod semel est verum, wie Anm. 895) und Met. I 14, 34: „… cet espèced’éternisme, selon lequel l’intemporel serait seul vrai“; ebd. 114 f. zu Met. IV 35 (s. unten Anm. 983) im Zusammenhangmit dem delikaten kosmologischen Problem einer creatio ab aeterno in der „Schule von Chartres“ (vgl. auch obenAnm. 664, Alan) im Gegensatz zur biblischen creatio a nihilo: „C’est à contre fil de cette historicité que Jean de S. donneun chaleureux consentement […] au thème platonicien (et augustinien) que seules sont vraies les réalités éternelles, VEREsunt …“ Dies ist umso bedeutsamer, als CHENU gerade bei Johann und Otto von Freising einen Wandel zu kausalenErklärungen in der praktischen historischen Reflexion feststellt, die bei einer radikalen Entwirklichung der Zeitvorstellungkaum denkbar wären. Es gehört zu den besonderen Verdiensten des großen Theologiehistorikers, daß er immer wiederunmißverständlich kritisch (gegen jedes problemlose oder gar naive Nachvollziehen des mittelalterlichenWirklichkeitsverständnisses) auf den Wesensunterschied zwischen echter Historizität und jener im Mittelalter so verbreitetenscheinhistorischen – symbolischen bis metaphorischen – Funktionalisierung und Ausbeutung der Geschichte zuIllustrationszwecken für zeitlose Ideale hingewiesen hat. Vgl. neben Théol. 62 ff. auch: L’homme et la nature, Perspectivessur la Renaissance du XIIe s., in: AHDLM 19 (1952) 39–66; Histoire et allégorie (wie Anm. 970) 59 ff., bes. 69: „Dantetiendra l’allégorie pour l’une des formes les plus naturelles et satisfaisantes de la rhétorique […] Mais lire ainsi Virgile, c’estévidemment en évacuer la matière historique, et, avec elle l’immédiate substance poétique. Tout comme pour la Bible“. (!)Am deutlichsten in dieser Hinsicht ist der Beitrag: La décadence de l’allégorisation… (wie Anm. 368) bes. 133 ff. zurVerwertung von Geschichtsdaten als Exempla (= Allegorien) ewiger Wahrheit: „… on voit quel idéalisme menace etl’intelligence et la réalité de l’histoire. Rupert de Deutz ne pouvait prétendre sauvegarder la réalité sous ces similitudes, qu’enprofessant explicitement, dans son idéalisme augustinien, l’irréalite foncière en face de l’éternel“. Grundsätzlich wichtig istzum Zeitbegriff des Mittelalters auch die stark von CHENU beeinflußte Arbeit von LE GOFF, Temps de l’Eglise et tempsdu marchand (wie Anm. 735) bes. 51 ff. Vgl. auch SCHLETTE (wie Anm. 368) 101 f.; R. BULTOT, Anthropologie etspiritualité, in: Rev. des sciences philos. et theol. 51 (1967) 3–22, bes. 13 f.; LADNER, Renewal (wie Anm. 181) 10 f.sowie § 111, S. 339 f., 448 f., 456 f. Zu Augustins Geschichtsbegriff s. die oben in Anm. 735 erwähnten Arbeiten sowieMARROU, L’ambivalence (wie Anm. 956) 42 ff.; in ‚Augustinus magister’, Paris 1955 (2 Bde.) die Beiträge: J. CHAIX-RUY, La Cité de Dieu et la structure du temps, I 923–31; R. GILLET, Temps et exemplarisme chez. s. Augustin, I 933–41;H.I. MARROU, La théologie de l’historie, III 192–212; J. GUITTON, Le temps et l’éternité chez Plotin et s. Augustin,Paris (1933)3 1959; J. CHAIX-RUY, S. Augustin, le temps et l’histoire, Paris 1956; ders., Antihistoricisme et théologie del’histoire, in: Rech. Augustiniennes I (1958) 287 ff. A. BUCHER, Der Ursprung der Zeit aus dem Nichts, Zum ZeitbegriffAugustins, ebd. 11 (1976) 35–51; FLASCH (wie Anm. 562) 269 ff., 277 ff. (insbesondere zu Augustins Verwechslung von
506
Im Metalogicon kombiniert er die jüdisch-christliche vanitas mundi-Vorstellung mit der platonischenIdeenlehre eigenartig zu einem Realitätsbegriff, der, wo nicht die Entwertung, so doch die hierarchischeUnterordnung alles Geschichtlichen, d. h. alles Zeitlichen und „Sinnlichen“ unter das „Intelligible“
„Zeit“ und „Zeitlichkeit“). Selbst bei einem Otto von Freising bleibt wie bei den meisten mal. Geschichtsschreibern der„historiographische Augustinismus“ in dem das Schreiben motivierenden Wunsch erhalten, aus der Geschichte zu lernen, daßund wie man sich von der Geschichte abkehren und dem Ewigen zuwenden soll: vgl. oben Anm. 368. Auch ihm istGeschichte, was LÖWITH 469 zu Augustins Idee des Gottesstaats schreibt: eine successio fidei „quer hindurch durch alleswechselvolle irdische Geschehen, das in seiner Weltlichkeit nur ein sinnloses Auftreten und Abtreten von Siegern undBesiegten ist“. Mit dem auch in diesem Gedankenkreis wichtigen historiographischen Leitsatz: per visibilia ad invisibilia(vgl. oben Anm. 367: Hist. Pont. 3 nach Röm. 1.20) ist die Confessiones-Stelle VII 17 als autobiographische Variante zuvergleichen: … inveneram incommutabilem et veram veritatis aeternitatem supra mentem meam commutabilem. Das Motivsetzt eine ambivalente Realitätsbestimmung voraus, innerhalb derer entweder mehr das Medium oder Erkenntnismittel, diehistorische Erfahrung oder mehr das metaphysische Erkenntnisziel der zeitlosen Wahrheit betont werden kann (vgl. auch obenAnm. 368 und 429). Bei Augustin läßt sich neben der (den meisten philosophischen Richtungen der Antike gemeinsamen)Betonung des Ewigen und Gleichbleibenden in der Geschichte auch eine Art „Entdeckung“ des Geschichtlichen finden, da ereinen spezifisch christlichen Begriff der Neuheit und Einmaligkeit dessen, was in der Zeit entsteht und kein zeitliches Endehat, dem kosmologischen jüdischen (und antiken) „Nichts Neues unter der Sonne“ entgegensetzt. Vgl. FLASCH (wieAnm. 562) 395 f. zu Civ. XII 13; KOSELLECK 138 ff. (unten Anm. 1005). Diese Ambivalenz einer durch Nicht-Wiederholbarkeit aufgewerteten, durch eschatologische Bedeutsamkeit in ihrer Substanz wieder abgewerteten „historischenRealität“ findet sich auch bei Johann und anderen Geschichtsdenkern des 12. Jhs.; sie führt in der Mediävistik zudivergierenden, aber gleicherweise berechtigten Akzentsetzungen: Entweder wird a) das historisch-induktive Moment betont(vgl. MICZKA 42d. und die oben Anm. 980 genannten Arbeiten) oder b) die ahistorischen Aspekte werden unterstrichen;vgl. PARTNER (wie Anm. 25) 188; EHLERS, Hugo (wie Anm. 17) 82 f.; LACROIX 169 ff.; von MOOS, Lucanstragedia 147 ff., 173 f.; FRIEDRICH 43; BRAND (wie Anm. 681) 148, 166; HELBLING (wie Anm. 252) 43 ff., 112 undvor allem (auch mit entsprechender Forschungskritik) A. SEIFERT, Historia im Mittelalter, in: Arch. f. Begriffsgesch. 21(1977) 226–84, hier 227. Unter dem besonderen Gesichtspunkt der Exempla lehnt BATTAGLIA 468 ff., 478 ff. anregendAUERBACHS „Realismus“-Begriff als anachronistisch ab mit dem Hinweis auf den grundlegenden platonischen„Realismus“, die höchst unrealistische Wirklichkeitsidee, die immergleichen allgemeinen Prinzipien, die sich in konkretenFällen des flüchtigen Lebens nur spiegeln. JENTZMIK (wie Anm. 183) verweist auf dieselbe ahistorische Exemplarik, „denVergleich zeitloser Wirklichkeit in verschiedenen geschichtlichen Ausprägungen“ als Gegensatz zur wesentlich historischenTypologie (S. 461). Johanns platonische Bewertung der Geschichte steht jedoch auch im Einklang mit der aristotelisch-frühscholastischen Idee vom Vorrang des Allgemeinen vor dem Besonderen, nach der die Geschichte zur „Wissenschaft vomnichtwissenswerten Detail“ verkommt; vgl. § 109, S. 9 ff., 54 f. und BORST (wie Anm. 486) 14 ff.; ZOEPFFEL 33 ff.,67; OTTE (wie Anm. 552) 43 f. – Nicht mehr benützen konnte ich: Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Age(Colloque intern. du C.N.R.S. 604) Paris 1984.
508
bezeugt:983 „… Weil alles Nichtige den Geist betrügt und nach dem Betrug wieder erlöscht wie ein Traumbild[…], ruft der Kohelet aus: ‚Alles unter der Sonne ist eitel‘. Mit solcher Wortgewalt und Überzeugungskraftruft diese Stimme, daß sie zu allen Völkern und Sprachen hingelangt, daß sie allen Menschen, die Ohren habenzu hören, ins Innerste dringt. So sagt auch Plato in seiner Lehre vom Unterschied zwischen dem wahrhaftSeienden und dem Nichtigen oder scheinbar Seienden, daß einzig die Idee (intelligibilia) das wahrhaft in sichSeiende ist; denn vor äußerer Gewalt und innerer Leidenschaft sicher, trotzt sie dem Auf und Ab der Zeit undbleibt sich immer umwandelbar wesensgleich.“ Den philologisch-historischen Idealen der Neuzeit völligentgegengesetzt ist sodann auch die erklärte Absicht Johanns, hinter dem historisch sich wandelnden ususverborum aller Autoren und aller menschlichen Kommunikation die ewig gleiche, weil göttliche veritas rerumzu suchen:984 „Die Wahrheit der Dinge kann durch menschlichen Willen
983 Met. IV 35, 204.15 ff.: Omnia vero vana […] velut fantasmata evanescunt. Unde ob hanc rerum evanescentiumdisparentiam omnia que sub sole sunt vana esse in concione universorum qui versantur in mundo proclamat Ecclesiastes [I14; …] Plato quoque eorum que vere sunt et eorum que non sunt sed esse videntur, differentiam docens, intelligibilia vereesse asseruit, que nec incursionem passionumve molestiam metuunt, non potestatis iniuriam, non dispendium temporis, sedsemper vigore conditionis sue eadem perseverant [cf. Apul. De Plat. et dogm. I 6.193; Boeth. Inst. Arithm. I 1]. Vgl. dazuauch CHENUS Kommentar in Anm. 982. – Hier, in Hist. pont. 13.32 (oben Anm. 981) und in Met. II 17, 93 f. führtJohann den platonischen Grundgedanken der Werthaftigkeit des Seins gegenüber der Scheinhaftigkeit des Werdens stets mitBoeth. Inst. Arithmet. I 1 (PL 64) 1086 und im Zusammenhang mit der Universalienfrage an, in der dritten Stelle jedoch miteiner aristotelisch inspirierten Kritik an der künstlichen Trennung von „Ding“ und „Idee“, singulare und universale, die inder menschlichen Wirklichkeit nur gemeinsam (als Materie und Form) gegeben seien. Der folgende Ausschnitt läßt sichdarum auch auf Johanns ambivalentes Verhältnis zum „Ewigen im Geschichtlichen“ beziehen (Met. II 17, 94 ff.): Que quidemcorporibus adiuncta mutari videntur, sed in natura sui immutabilia permanent. Sic et rerum species transeuntibusindividuis permanent eedem, quemadmodum preter fluentibus undis notus amnis manet in flumine (notus für motus: emend.J.B. HALL). Der Unterschied zwischen Plato und Aristoteles spielt also für die hier interessierende Bewertung von Dauerund Veränderung (der „Flußhaftigkeit“ am Fluß und des herunterfließenden Wassers, der allgemeinen Natur der Dinge undden scheinhaften Dingen selbst, wie sie in vorübergehenden Individuen erscheinen) eine geringe oder nur graduelle Rolle(vgl. auch S. 521 ff., 525).984 Met. III 4, 138 bereits oben Anm. 898 zitiert. Entsprechend ist auch Johanns Ablehnung, einer nicht philosophischfundierten Rhetorik in Met. I 6.21 zu verstehen: Res enim philosophia (aut funis eius, que est sapientia) querit, non verba.Vgl. §§ 71, 96 S. 167 ff., 400, 548 f.; JEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 549) 85 ff., mit stärkerer Betonung desGegensatzes von Philosophie und Rhetorik aufgrund der res-verba-Antithese. Jedenfalls liegt in diesem metaphysischenWirklichkeitsverständnis die tiefste Wurzel der bekannten Kritik Johanns am bloßen Wortemachen und Theoretisieren, an der„reinen“ Dialektik und aller nicht religiös fundierten Bildungspflege. Zum augustinischen Hintergrund der Unterscheidungunveränderlich ewiger res und veränderlicher zeitabhängiger signa vgl. Doctr. christ. II 1 ff., FLASCH (wie Anm. 562)124 ff.; S. 368, 449, 504 ff. zur Mehrdeutigkeit der von Gott geschaffenen res gegenüber bedeutungsarmen Zeichen(verba/voces) der Menschen in Pol. VII 12, (II) 144; vgl. dazu auch Pol. II 16, (I) 94 94.55 ff.
509
nicht verändert werden, da der Mensch sie auch nicht festgelegt hat. Darum müssen wir, wo möglich, sowohldie Worte der Artes wie deren Sinn aufbewahren. Sollten wir aber beides zugleich nicht behalten können, dannmögen die Worte entfallen, wenn nur der Sinn erhalten bleibt! Denn die Kenntnis der Artes besteht nicht imHin-und-Her-Wenden der Schriftstellerworte, sondern im Wissen um deren Bedeutung und gedanklichesGewicht.“
106. Auch die oben (S. 369 ff.) behandelte Metaphorik des „Naturbuchs“ macht die Geschichte zurSchatzkammer für Vorbilder und Argumente und damit letztlich zu einem ahistorischen, weil aufGleichzeitigkeit beruhenden Bilderbuch für Philosophen. Wie ernst auch immer die darin erkannten ewigenWahrheiten (res) genommen werden, bleibt doch das sprachliche Medium (verba), in dem sie sich darbieten,für sich genommen nur eine mehr oder weniger belanglose Hülse. Der Bilderbuchvorstellung entspricht aufdem Gebiet der Gesellschaftsanalyse die aus satirischer Tradition stammende Theatermetapher im 3.Policraticus-Buch, die auch Demandt in seinem wichtigen Beitrag über „Metaphern für Geschichte“behandelt.985
Die Gestaltung dieser Metapher gehört zu den einflußreichsten Stücken des Policraticus bis in die Barockzeitund gibt in dichtester Form auch wesentlichen Aufschluß über Johanns Exemplum-Konzeption. Die originelle,sich zusehends vertiefende, zuletzt ins Metaphysische vorstoßende Reflexion setzt bei dem einfachenpoetisch-satirisch Gemeinplatz von der Illusion treuer – d. h. nicht durch Fortuna und Eigennutz bestimmter– Freundschaft
985 DEMANDT, Metaphern für Geschichte (wie Anm. 732) 347; vgl. auch ebd. 379 ff. allgemein zur Verwandtschaft desTheaterbildes mit der Naturbuch-Metaphorik im Hinblick auf die Entwertung der Geschichte. Eine Linie von Johann zuMontaigne zieht auch anregend J. STAROBINSKI, Montaigne et la dénonciation du mensonge, in: Poet. u. Her., 8,Identität, München 1979, 463–80, hier 463. – Siehe Pol. II 8 (I) 190 ff.; III 9, 196 ff unter den Überschriften: De mundanacomedia vel tragedia, […] eadem fides est nostri temporis et praecedentium patrum et virtutis cultores sunt inspectorestheatri huius. Zu Pol. III 7–9 S. 340 f., 410 ff., 484, A. 920; CURTIUS, ELLM 149 ff. (auch zu antiken und patristischenQuellen); CILENTO (wie Anm. 704) 121 f., 284; WALSH (wie Anm. 506) 24, 229 (zur Petronius-Rezeption von Johannbis zu Shakespeares: „All the world’s a stage“).
510
ein. Auf die Komödie der „Freundschaft“ oder Liebe in allen Arten menschlichen Zusammenlebens beziehensich die eingangs zitierten Spottverse des Petronius:986
Fahrendes Volk gibt ein lustiges Spiel: der eine ist Vater,Sohn der zweite, als reich gibt sich ein anderer aus.Kaum aber sind mit dem Stück die komischen Rollen zu Ende,fällt die Maske, es kehrt wieder das wahre Gesicht.
986 Pol. III 7–8, (I) 189.26–190.19: Quod ex eo constat, quod, si cessat utilitas, rarus aut nullus est qui propter se virtutemamicitiae colat […] Hoc ipsum Arbiter noster [Sat. 80] ingemiscit, etsi alterius videatur induisse personam; ait enim:‚Nomen amicitiae si quatenus expedit heret,/calculus in tabula mobile ducit opus./Cum fortuna manet, vultum servatisamici;/cum cecidit, turpi vertitis ora fuge. Grex agit in scena mimum, pater ille vocatur,/filius hic, nomen divitis illetenet;/mox ubi ridendas inclusit pagina partes,/vera redit facies, dissimulata perit.’ […] Et quidem eleganti utitursimilitudine, quia fere quicquid in turba prophanae multitudinis agitur comediae quam rei gestae similius est. ‚Militia,inquit, est vita hominis super terram’ [Iob. 7.1]. At si nostra tempora propheticus spiritus concepisset, diceretur egregiequia comedia est vita hominis super terram, ubi quisque sui oblitus personam exprimit alienam. (Die deutsche Übersetzungaus: Petronius, Satyrica, ed./übs. K. MÜLLER/W. EHLERS, München/Zürich/Darmstadt 1983, 164). ZumKomödienbegriff vgl. S. 180, 290 f., 410 ff., 440 ff., 552 f. Zur satirisch-epigrammatischen Kontrastierung von Schein(Name) und Sache vgl. NORDH 231 ff.; S. 179 f., 290, 305.326 f., 411 f. Zur Metaphorik der Hofkritik s. S. 179 f. ZurBedeutung Petrons für Johann s. § 59. – Zur negativen Exemplarität der Geschichte (ad dissuadendum) als Narrenspiel fürdie Weisen (Montaigne, Essai III 8 [wie Anm. 192] 899 f.) vgl. oben § 49. – Das bei Petronius erwähnte Brettspiel weist gutauf den inneren Zusammenhang der beiden für das weltliche Rollen- und Figurenspiel geschichtlicher Existenz zentralenmittelalterlichen Metaphern: Schachspiel und Theater; vgl. A. VIDMANOVÁ, Die mittelalterliche Gesellschaft im Lichte desSchachspiels, in: Misc. Med. Köln 12.1, Berlin 1979, 323 ff.; H.J. KLIEWER, Die mal. Schachallegorie und die deutscheNachfolge des Jacobus de Cessolis, Heidelberg 1966. – Das „Theater“ gehört andererseits wie der menschliche Organismus,die Lebensalter, der Bienenstaat, das Schachspiel u.a.m. zu jenen S. 464 ff. erwähnten dispositionellen Großmetaphern oderGleichnissen, mit denen Johann seine Kapitel zu gliedern liebt. Er nennt sie selbst exempla oder similitudines (s. obenAnm. 348: Job. 7.1. als elegans exemplum; Anm. 923: exemplum civitatis; Anm. 412: naturae similitudo). Auch dasTheatergleichnis ist wie viele andere dieser „exempla“ platonischen Ursprungs (vgl. Nomoi 644d), obwohl dies Johannwahrscheinlich nicht bewußt war. – Zur Wirkungsgeschichte von Pol. III 7–9 vgl. CURTIUS, ELLM 150; BARNER (wieAnm. 298) 86 ff. bes. 91 ff.; BRÜCKNER, Hist. 102 ff.; LINDHARDT 41 ff. (Salutati); CLAYTON (wie Anm. 343)bes. 399 ff. (Ben Johnson); P. RUSTERHOLZ, Theatrum vitae humanae, Funktion und Bedeutungswandel eines poetischenBildes (Philol. Stud. u. Quellen 51) Berlin 1970; wobei zweifellos noch eine große rezeptionsgeschichtliche „Dunkelziffer“aufzudecken bleibt. Die im Folgenden kurz zusammengefaßten Bedeutungskomponenten der Metapher bleiben in derBarockzeit erhalten; was neu hinzukommt, ist m. E. die Vorstellung, daß Gott das Schauspiel leitet, und der Mensch trotzaller Scheinhaftigkeit des Theaters auf der Weltbühne seine Rolle verantwortungsvoll zu spielen hat. Vgl. BARNER,a.a.O. 124 ff. zu Gracián, (wie Anm. 427) 13, 10, der wie Johann (s. auch Pol. II 28 [I] 160 oben Anm. 348), aber mitweltimmanenter Konsequenz Job. 7.1 auf die Schauspielmetapher bezieht. Bei Johann ist das Spiel durch Fortuna undmenschliche Torheit inszeniert, und der Weise hat sich daraus zu Gott hin zu entfernen: eine wesentlich platonisch-stoischeVorstellung. Der dem moralischen vanitas-Gedanken gerade entgegengesetze Aspekt der intellektuellen Welterkenntnis durchPerspektivegewinn von der Höhe eines „erhabenen Orts“ herab ist ebenfalls bereits bei Johann angelegt (vgl. Anm. 988).Nach BARNER kam diese Vorstellung erst im neuzeitlichen Polyhistorismus voll zur Entfaltung. Man kann JohannsErkenntnisoptimismus jedoch auch mit resignativeren Aussagen der Reformationszeit vergleichen. K. LÖWITH sagt ineinem Aufsatz zur Relativierung der Geschichte von Augustinus zu Luther (Schriften 433–51) vom letzteren (439): [er]„vergleicht die Weltgeschichte einem Turnier, in dem bald dieser und bald jener oben auf sitzt oder am Boden liegt. DieMenschen sind nur Gottes ‚Larven und Mummereien’ in diesem Auf und Ab der menschlichen Ohnmacht. Es ist nicht Sachedes Glaubens, hinter die Bühne schauen zu wollen, um herauszubekommen was diesen zeitweiligen Aufgang und Niedergangaller Reiche veranlaßt“. Genau diesen „entlarvenden“ Durch-und Überblick sucht Johann zu gewinnen.
511
Johann gelingt es nun, mehrere Hauptthemen des Policraticus in diesem Bild des Rollenspiels brennpunktartigzu vereinen: die moralische Forderung nach Wahrhaftigkeit als Übereinstimmung von Denken, Reden undHandeln; die entsprechende Kritik an der Selbstvergessenheit (alienatio), an verlogener, heuchlerischer,schmeichlerischer, feiger Anpassung an gesellschaftliche Konventionen aus opportunistischem Vertrauen inFortunas Gunst, die definitionsgemäß auch in Ungunst umschlagen kann und die Komödie zur Tragödie werdenläßt, u.a.m. Ihre zentrale philosophische Dimension erreicht die Theatermetapher jedoch mit demunmerklichen Übergang von der moralisch-satirischen auf die geschichtstheoretische Ebene: Das Ziel eineswahren philosophischen Lebens ist die einsame platonische contemplatio fern vom Jahrmarkt derEitelkeiten, die den Aufstieg zum Ewigen – zu Gott und zur Ideenwelt – möglich macht und dem Weisengestattet, von diesem „höheren Standpunkt“ aus wieder herabzusehen auf das Scheinleben der anderen, auf dieabsurde, lächerliche und tragische Maskerade der Gesellschaft, auf das sinnlose Treiben der „törichten“multitudo profana aller Zeiten. Wer Distanz von den Dingen gewinnt, kann Umwelt und Geschichteperspektivisch sehen, als Illusionskulisse durchschauen. Wer den philosophischen Fluchtpunkt des Einenfindet, beherrscht das Viele in den Erscheinungen – als ein polycraticus.987
987 Zur Einheit von Reden und Handeln vgl. §§ 45, 70, S. 361 ff. Fortuna: s. Anm. 988 Elite und multitudo profana:Pol. III 8, 190.14. – Zur alienatio oder Selbstvergessenheit (sui oblitus in Pol. III 9, 190.18 oben A. 986) vgl. S. 445 f.;STAROBINSKI (wie Anm. 985) 468 f. zu Montaignes Theaterbild gegen das „vivre hors de soi“ und für das stoische Idealdes „retour à soi“, ohne allerdings die in dieser Hinsicht frappante Policraticus-Parallele zu erwähnen. – Zur „Tragikomödie“s. Pol. III 8, 192.8 ff.: In eoque vita hominum tragediae quam comoediae videtur esse similior, quod omnium fere tristis estexitus, dum omnia mundi dulcia […] amarescunt. Trotz dieser Doppelbedeutung liegt der Hauptakzent eindeutig auf demsatirischkomischen, nicht auf dem „tragischen“ Aspekt (vgl. BARNER [wie Anm. 298] 109). Umgekehrt betont unter dergleichen geschichtstheoretischen Voraussetzung Otto von Freising mit vielen anderen Historikern die „Tragödie“ oder das„durchgängige Elend“ aller Geschichte: vgl. CLASSEN, Res gestae (wie Anm. 326) 400 ff.; von MOOS, Lucans tragedia147 ff.; J. KOCH, Die Grundlagen der Geschichtsphilosophie Ottos von Freising, in: Münchener Theol. Zeitschr. 4 (1953)79–94; auch in: Geschichtsdenken u. Geschichtsbildung im MA., ed. W. LAMMERS, (WdF 21), Darmstadt 1965, 321–49.– Zu polycraticus s. Exkurs I unten §§ 115 ff.
512
Das gesellschaftliche Leben besteht aus einem Netz verschiedenster Rollen, die so automatischaufeinanderwirken und ineinandergreifen wie die traditionellen Intrigen der Terenzkomödien. Die moralischeAufgabe wird demgegenüber negativ als Rollenverweigerung definiert: Der Nichtspieler bleibt nicht nur selbstvom Bösen unberührt, sondern wird auch den anderen zum Spielverderber. Fehlt der lächerliche Alte, so ist esum die Liebesintrige der Jungen geschehen; wird nur eine Figur vom Brett genommen, ist das Spiel aus.Historisches Beweisexemplum: Kleopatra – Inbegriff bewährter weiblicher Verführungskunst – war erfolgreichbei Caesar und Antonius, weil diese rollengemäß mitspielten; prallte ab an Augustus, der sich standhaft derRolle verweigerte und so zum herrscherlichen „Sieger“ über weibliche Schönheit und Fleischeslust wurde. DerTheaterspuk war gebrochen; „die Hure war wert, unterzugehen“; ihr Selbstmord war „für sie selbst wohl eintragischer Abgang, der Welt aber ein komisches Finale.“ Diese hier nur kurz zusammengefaßte Passage987a
dient der Lehre stoisch-asketischer Abwehr des „Welttheaters“, führt nicht zu der – in der Barockzeit sobeliebten – Mahnung, in die Geschichte gestaltend einzugreifen, mitten in den Verflechtungen vonlasterhaften und tugendhaften „Umwelteinflüssen“ etwa durch das eigene Vorbild-Exemplum eine„verantwortliche Rolle“ zu spielen. Für Johann wird die Welt durch Nichtbeachtung gebessert, das heißt:Wenn jeder seinem inneren (unveränderlich) besseren Selbst treu bleibt, keine „Persona“ annimmt, geschiehtauf der Bühne wenig, und der Idealzustand der Theaterlosigkeit – im Sinne des „Aeternismus“ – rückt näher.Die wenigen Hervorragenden, denen dieser Aufschwung gelingt – seien sie Heiden, Juden oder
987a Pol. III 10 (I) 199 f.; vgl. auch S. 473.
513
Christen – bilden die auserwählte Schar jener,988 „die vom hohen Gipfel der Tugend wie von einem Elysiumherabsehen auf das Welttheater und Fortunens Spiel verachten. Zuschauer der weltlichen Komödie sind siezusammen mit Ihm, der alle Taten und Vorhaben der Menschen unablässig vor sich sieht. Da jedermannschauspielert, muß es auch Zuschauer geben. Keiner möge sich beklagen, seine Bewegungen würden vonniemandem beachtet, agiert er doch vor dem Angesicht Gottes, der Engel und einiger weniger Weiser, demwahren Publikum solcher Schaustellungen.“ Die gesamte Geschichte (der Ereignisse und des Geistes) unterliegtdem durch solchen Schauspielvergleich verdeutlichten Wirklichkeitsverständnis. Sie ist zwar durchaus einbetrachtenswertes, lehrreiches Stück, ja gelegentlich sogar ein bunter und unterhaltsamer „Zirkus“ (ludorumistorum circensium), aber nur für den, der ihre letzte Substanzlosigkeit durchschaut, der Erfahrungstatsachenphilosophisch zu lesen, der aus konkretem Schein etwas über die wahre Realität immergültiger und abstrakterIdeen-Wahrheit zu lernen versteht.989
107. In einem gewissen Sinn berührt diese Feststellung natürlich die gesamte mittelalterliche Epistemologie.Aaron J. Gurjewitsch schreibt treffend: „Die Welt wurde im Mittelalter nicht in der Veränderung aufgefaßt. Siewar stabil und unbeweglich in ihren Grundlagen. Wandlungen berührten nur die Oberfläche des von Gotterrichteten Systems. Die vom Christentum hervorgebrachte
988 Pol. III 9, (I) 199.5 ff.: Hi sunt forte qui de alto virtutum culmine theatrum mundi despiciunt ludumque fortunaecontempnentes nullis illecebris impelluntur ad vanitates et insanias falsas. Hi iam in suis gaudent Elisiis, ad utilitatemsuam vident plurima et ad eam omnia visa retorquent. […] Speculantur isti comediam mundanam cum eo qui desuper astatut homines actusque eorum et voluntates indesinenter prospiciat. Cum enim omnes exerceant histrionem, aliquem essenecesse est spectatorem. Nec queratur aliquis motus suos ab aliquo non videri, cum in conspectu Dei agat angelorumqueeius paucorumque sapientum, qui et ipsi ludorum istorum circensium spectatores sunt. Zum Begriff despicere mundum undder darin mitschwingenden platonisierenden Jenseitsvorstellung und Weltverachtungsidee – „herabsehen auf“ ist durchauswörtlich und kosmologisch zu verstehen – vgl. BULTOT, Cosmologie (wie Anm. 978) 7 f.; von MOOS, Consolatio III§§ 832, 858 (in der consolatio mortis). Zu den spectatores gehören nach dem Kontext von Pol. III. 9. 197 ff., die HeldenCato, Themistokles, Fabricius, Abel, Moses, Job, Johannes d. T., die Kirchenväter und Märtyrer (A. 892, 920). Diewichtigste Inspiration zur Vorstellung des Zuschauerraums gab wohl I Cor. 4.9: spectaculum facti sumus mundo et angelis ethominibus. Dazu vgl. auch H.R. JAUSS, Soziologischer und ästhetischer Rollenbegriff, in: Identität (wie Anm. 985) 599 ff.mit dem Hinweis, daß bei Johann die Zuschauerrolle von der Umwelt auf Gott übergehe.989 Pol. III 8, 199.18 (Zitat wie in Anm. 988). Zum Theaterbild in diesem metaphysischen Sinn vgl. Aug., En. Ps. 127.15und dazu DODDS (wie Anm. 935) 8; MARROU, Ambivalence (wie Anm. 956) 48.
514
Idee der historischen Zeit vermochte diese Grundeinstellung nicht zu überwinden. Im Ergebnis blieb sogar dasGeschichtsbewußtsein, soweit man in bezug auf das Mittelalter davon sprechen kann, im Grunde genommenantihistorisch.“989a Im Rahmen der vielfältigen Möglichkeiten platonisierend-idealistischenGeschichtsdenkens im Mittelalter – etwa gegenüber theologisch systematisierenden, allegorisierenden,typologisierenden sog. „symbolischen“ Formen – zeichnet sich Johann jedoch durch seine unbestreitbareliterarische Freude am historischen (oder auch nur anekdotischen) Einzelphänomen aus wie auch durch seinekonsequente Anwendung des sämtlichen historiae zugrundeliegenden Prinzips der Einheit und Gleichheit allesGewesenen vor dem philosophischen Auge.990
Sogar das heilsgeschichtliche Entwicklungsdenken, von dem Johann einige Beispiele eher beiläufig zuEinteilungszwecken übernimmt, verblaßt vor seiner geschichtsmetaphysischen Einheitsidee.991 Gerade in denseltenen Fällen, in denen er Weltalterschemata übernimmt, unterscheiden sich diese von echtheilsgeschichtlichen Kategorien dadurch, daß sie meist nur der steigernden Reihung vom Ferneren zumNäheren, von jüdischen über heidnische zu christlichen Exempla dienen, wie die Überleitungen zurnächsthöheren Stufe zeigen, die stets den Gedanken an die höhere Geltung oder auctoritas für die intendierteLehre aus dem Bereich der Naturmoral ins Spiel bringen.992 Sogar ein offener Rekurs auf Typologisches, wieer sich beim unmittelbaren Übergang
989a GURJEWITSCH (wie Anm. 313) 157.990 In dieser Hinsicht wird sogar die auf falscher Textüberlieferung beruhende Verwechslung des TitelsPolicraticus/Policraticon (in der Tradition der „Vielbuch“-Titel) mit Polichronicon ein wenig verständlich. Dazu (und zurTiteldeutung aus poly- in klassischer Schreibweise) s. unten Exkurs I §§ 115 ff.991 Zur Steigerung durch die kompositorische Abfolge von jüdischen, heidnischen und christlichen Exempelreihen aufgrundder Überleitungsformeln (transitiones) s. § 55 S. 460 ff. Ähnliches stellt HANNING (wie Anm. 185) 135 ff. für die nachargumentativen, nicht heilsgeschichtlichen Gesichtspunkten angeordneten Exempla bei Galfred von Monmouth fest; vgl.auch LIEBERTZ-GRÜN (wie Anm. 325) 85 f. zu Jans Enikel.992 Zum grundsätzlichen Unterschied zwischen heilsgeschichtlich-typologischem Geschichtsinteresse und bloß exemplarischparänetischer Verwendung der Geschichte (bereits in der frühsten Kirche bestanden beide Formen nebeneinander) vgl.CAMPENHAUSEN (wie Anm. 660) 191 ff. und § 94, Anm. 915. Sogar bei Otto von Freising, dessen heilsgeschichtlichesInteresse außer Zweifel steht, begegnet gleichzeitig der „statische“ Einheitsgedanke als eine Ausprägung des contemptusmundi: s. oben Anm. 987. – Das rhetorisch funktionalisierte Anordnungs-Schema von den exempla aliena und profana zuden exempla christiana bei Johann entspricht weitgehend dem antiken Rezept, den griechischen exempla externa römischeexempla domestica folgen zu lassen: vgl. Anm. 464.
515
von alttestamentlichen Exempla zu solchen der christlichen Geschichte von selbst anbietet, unterstützt einzigdie auf rhetorische Effizienz hin angelegte Abfolge: Von den fernerliegenden Exempla David, Ezechias undJosias leitet Johann zu den (für die causa einer Fürstenermahnung) zeitlich näheren, konkreteren,eindringlicheren Kaiservorbildern Konstantin, Theodosius, Justinian und Leo so über:993
Damit die angeführten Beispiele nicht als zu abgelegen und deshalb als weniger befolgenswert erscheinen, da wirvon deren Gesetz, Sitten und Religionsausübung […] ein wenig abweichen dürften. (Obwohl wir und sie dengleichen Glauben haben, so ist es doch so, daß sie als zukünftig noch erwartet haben, was für uns zu unserer Freudeund Verehrung bereits zu einem guten Teil erfüllt ist, nachdem nur die Schattenbilder, in denen die Wahrheit ‚ausder Erde gesproßt ist‘, beseitigt sind, diese selbst allen Völkern sichtbar offenbart ist.) Damit also, sage ich, jeneExempla nicht wie etwas Fremdes und Profanes verachtet werden, mögen nun unsere Konstantin, Theodosius,Justinian, Leo und andere allerchristlichste Fürsten den christlichen Fürsten belehren […] Ihre Taten nämlich sindAnsporn für die Tugend; alle ihre erhaltenen Aussprüche wie Sittenerlasse.
Zweifellos lassen sich hier auch der heilsgeschichtliche Grundgedanke und ein typologischer Bezugnachweisen. Doch mehr Beachtung verdient der Kontext, der solches in eine Parenthese zwingt und darinnochmals abschwächt (durch licet nobis et illis eadem fides sit). Johann referiert einen selbstverständlichvorauszusetzenden Glaubensgehalt und klammert ihn
993 Pol. IV 6.252 f.: Et ne illorum remota videantur exempla et ex eo sequenda minus, quod a lege eorum […] et fideiprofessione aliquantisper videmur abscedere (licet nobis et illis eadem fides sit, ita tamen ut, quod illi futurum expectabant,nos ex parte magna gaudeamus et veneremur impletum, abiectis tantum umbris figurarum ex quo veritas de terra orta est[Ps. 84.12] et in conspectu gentium revelata); ne, inquam, illorum quasi aliena aut prophana contempnantur exempla,Constantinus noster, Theodosius, Iustinianus et Leo et alii Christianissimi principes principem possunt instruereChristianum […] Illorum itaque gesta virtutum incitamenta sunt, verba quot sunt tot institutiones morum. Zu dieser Stelles. S. 494 ff., A. 346, 945. MICZKA 41, 45 f. sieht darin heilsgeschichtliches Denken auch bei Johann, was in einemrelativen Sinn zutrifft, jedoch durchaus im normalen Rahmen mittelalterlicher „langue“ bleibt. Abgesehen von der Isoliertheitder Aussage über das typologische „Erfüllungs“-Modell ist vor allem zu beachten, daß sie in einer (von WEBB mit Rechteditorisch herausgehobenen) Parenthese steht, die einen selbstverständlichen Glaubensgehalt als bekannte Voraussetzungreferiert, um ihn gerade als kontextfremd auszuschließen. Für den auctor sind die alttestamentlichen und die christlichenHerrscher in Bezug au f das Thema (die Gesetzestreue des Fürsten) gleichwertige Exempla, aber für den auditor/lector wirkendie letzteren glaubwürdiger: Dies ist ein rhetorischer, kein geschichtstheoretischer Gesichtspunkt. Abgesehen davon dürfte derrechtsphilosophische Aspekt der immutabilitas des Naturrechts (Justinian, Inst. 1.2.11, oben Anm. 882) gerade in diesemKontext wichtig sein zur Begründung der moralisch und religiös fundierten Gesetzesgebundenheit des Fürsten gegen dielegibus solutus-Theorie (vgl. KERNER 149 ff. und oben S. 326 ff., 441 ff., 468, 494 f.)
516
gleichzeitig dadurch aus, daß er mit den christlichen Exempla vor allem erreichen will, daß diealttestamentlichen befestigt, als inhaltlich gleichwertig bestätigt, persuasiv durch höhere auctoritas verstärktwerden. Aus dem Zusammenhang ergibt sich auch, daß die christlichen Exempla als direkt einsichtige, inChristus „entschleierte“, den alttestamentlichen deshalb vorzuziehen sind, weil sie sub gratia auch deneffizienteren Ansporn zur Tugendnachahmung darstellen. Die alle Allegorese erübrigende Evidenz undUnmittelbarkeit einer moralischen Wahrheit gilt also als didaktischer Vorzug.994
Als paradigmatischer Fall für die literarische Freiheit, mit der Johann das für die typologische Methodezentrale Heilsgeschehen benützt, um auch diesem (wie anderen geistlichen Motiven) ausschließlich moralischeExemplarität im Verbund mit beliebigen antiken Exempla zu verleihen, mag nochmals die bereits kurzerwähnte Darstellung des Bildungsprogramms nach Bernhard von Chartres dienen. Anläßlich der zweiten Stufein den sog. „Lernschlüsseln“, dem studium quaerendi (Forschungsbetrieb, Wißbegierde, Problemorientiertheitim Lichte des etymologischen Sinns von philo-sophia) wählt er als ein eigentliches Exemplum dietypologische figura des mit dem Engel kämpfenden und die Himmelsleiter schauenden Jakob und bemerkt:995
„Dies aber widerfuhr ihm im Geist und als Beispiel (figura), uns aber dient das Beispielhafte (figuralia) alsLehre“ (I Kor. 10.11). Die übliche spirituelle Deutung wird auch hier keineswegs unterdrückt: „Dahin führtnämlich dieser Kampf nach dem Zeugnis des siegenden Mannes, daß Gott selbst, die höchste Wahrheit, vonAngesichts zu Angesichts geschaut werden kann. Alles Gute also, was im Glauben oder in den Werkenerscheint, ist wie ein Bild der Schau Gottes.“ Doch nach dieser von Gregor d. Gr. übernommenen Lesart, diesich auf das Postulat der Identität von Glauben und Wissen stützt, geht Johann unmittelbar zu weiterenmoralischen Exempla für vorbildlichen Wissensdurst über:996 „In der Tat, zum Eifer der Forschung werden wirnicht nur durch heimische, sondern auch durch fremde Exempla ermuntert. Denn Solon, der stets von größterLiebe zur Weisheit entflammt war […].“ (Es folgen noch historiae von Karneades und Cato, beide nachValerius Maximus.)
994 Vgl. S. 462 f., 470 ff.995 Vgl. S. 474. – Pol. VII 13, 148.15 ff., 23 ff.: Haec ei in spiritu aut figura contigerunt, sed nobis Apostolo testantefiguralia servunt [I Cor. 10.11; …] Eo enim lucta ista perducit ut triumphantis hominis testimonio Deus ipse, qui summaveritas est, facie ad faciem videatur. Quicquid enim boni in fide aut operibus apparet, imago quaedam divinae visionis est.Vgl. Greg., Hom. in Ezech. II 2.13 (PL 76) 955, Zum Thema der Identität von Glauben und Wissen vgl. auch oben §§ 94 f.996 Pol. VII 13, 149.3 ff.: Porro ad studium quaerendi non modo domesticis, sed etiam extraneis animamur exemplis. NamSolon, qui summo sapientiae fervore semper flagraverat […, das Folgende nach Va. Max. VIII 7] vgl. oben S. 474 ff. Zuexempla extranea/domestica (hier in Umkehrung) vgl. S. 203 f.
517
108. Das Vertrauen in anthropologische Konstanten und der Sinn für Gleichförmigkeiten in der Geschichtesind von der Antike bis zur Neuzeit immer wieder bestimmten gelehrten Strömungen, philosophischenSchulen oder religiösen Bekenntnissen zugewiesen worden. Nach solcher Kategorisierung ließe sich derExempla-Gebrauch Johanns etwa als „spät-neuplatonisch“, „synkretistisch“, „vor-strukturalistisch“chiffrieren. Vielleicht wäre es aber besser, vor der Wahl irgendeiner wissenschaftsgeschichtlichen Etikettegrundsätzlich den vor-wissenschaftlichen Charakter des Exemplums zu berücksichtigen.Bemerkenswerterweise bezeichnet Franz Dornseiff in dem wohl immer noch tiefsinnigsten Beitrag zumExemplum (1924) gerade diesen Sinn für „Gleichförmigkeiten in der Geschichte“ als das grundlegendemenschliche Bedürfnis, aus dem überall und zu allen Zeiten literarische und nichtliterarische Exemplaentstehen.997 In diesem Sinn hat auch Thomas Mann in seiner
997 DORNSEIFF 206 f.: „Ebenso wie durch Aussprechen einer allgemeinen Regel wendet sich durch ein Beispiel derSprecher an den Sinn des Menschen für Gleichförmigkeiten in der Welt, deren innezuwerden uns Menschen ein starkesBedürfnis ist…“ Der in den Vorträgen der Bibliothek Warburg erschienene Beitrag war eine Vorarbeit zu DORNSEIFFSWerk: Die archaische Mythenerzählung, Berlin/Leipzig 1933. Ähnlich sagt auch Hans LIPPS 45 f. zum „Exempel“ im SinneKants (vgl. oben § 11): „Das Allgemeingültige des Exempels liegt darin, wie sich in einem Geschehen die ‚ewige Natur derDinge’ bzw. die konstante Art von etwas durchsetzt und sich das andere unterordnet. Insofern lernt man daraus, wie es‚immer’ ist und geschieht“. Den Aspekt der Zeitlosigkeit, Wiederholbarkeit und anthropologischen Konstanz in derExemplum-Definition heben auch heraus: GEBIEN 95; SCHENDA 75; KORNHARDT 86; MEHL 233; BATTAGLIA 468;LANDFESTER 111 f.; A. MOMIGLIANO, Time in Ancient Historiography, in: Essays (wie Anm. 490) 184; HERZOG,Orosius (wie Anm. 197) 80 f.; HOWALD (wie Anm. 719) 14 f. (Herodot); FINLEY (wie Anm. 47) 31 ff. (Thukydides undTolstoi); DEMANDT, Geschichte als Argument (wie Anm. 11) 59 ff.; KOSELLECK 43 ff. (zum vor-historistischenGeschichtsinteresse überhaupt, das sich stets mehr auf das Wiederkehrende als auf das Einmalige gerichtet hat); von MOOS,Consolatio I/II §§ 29 ff., III §§ 512 ff., 526 ff. und R. KASSEL, Untersuchungen z. griech. u. röm. Konsolationslit.(Zetemata 18) München 1958, 71 f. zum Trostargument des Immergleichen anhand von Beispielen im locus de communihominum condicione (vgl. dazu auch §§ 9, 92). Zeitlosigkeit und Repetition hebt HERZOG, Gattungskontinuität (wieAnm. 272) 405 f. auch als Beruhigungs- und Trostmotiv im Exempla-Gebrauch Paulins von Nola gegenüberKatastrophenängsten angesichts der Barbareneinfälle und der Bedrohung des Römischen Reichs hervor. Allgemein zu diesemMotiv vgl. A. DEMANDT, Geschichte in der spätantiken Gesellschaft, in: Gymnasium 89 (1982) 255–72, hier 265. Denanthropologischen Kern betont auch DAVID, Présentation … zu ‚Rhétorique et histoire’ 19 ff., wenn er auf die„Wiederinszenierung“ des Vergangenen in afrikanischen Ritualen hinweist. Grundsätzlich zu bedenken ist die Bemerkung vonG. LADNER (Medieval and Modern Understanding of Symbolism: A Comparison, in: Spec. 54 [1979] 223–256, hier230 f.), daß das Mittelalter neben dem symbolisch-heilsgeschichtlichen Denken auch das zeitlose System des „Mythos“ imSinne von Cl. LÉVI-STRAUSS gekannt habe. Hierzu vgl. auch GURJEWITSCH (wie Anm. 313) 31 ff. über den„archaischen“ Begriff historischer Gleichzeitigkeit; Mircea ELIADE, Kosmos und Geschichte, Der Mythos der ewigenWiederkehr, Frankfurt a. M. 1984, bes. 41 ff., 48 ff. über die unhistorische, ereignislose Wirklichkeitserfahrung archaischerKulturen, in der es nur beispielhafte „Präfigurationen, Vorbilder, Mythen, Archetypen, Paradigmen“ gibt: Geschichte undExemplum werden hier gewissermaßen zu absoluten metaphysischen Gegensätzen.
518
Festrede zum achtzigsten Geburtstag Freuds (1936), von den psychologischen Grundlagen der Biographiesprechend, den Geschichtsbegriff des Exemplums eindrücklich zusammengefaßt:998 „Denn dem Menschen istam Wiedererkennen gelegen; er möchte das Alte im Neuen wiederfinden und das Typische im Individuellen.Darauf beruht alle Traulichkeit des Lebens, welches als vollkommen neu, einmalig und individuell sichdarstellend, ohne daß es die Möglichkeit böte, Altvertrautes darin wiederzufinden, nur erschrecken undverwirren könnte.“ Von einer ähnlichen Vorstellung dürfte Aristoteles in seiner Rhetorik ausgegangen sein,wo er den fast sprichwörtlich allgemeinen, jedoch vorzugsweise in der Historiographie heimischen Gedanken,daß die Zukunft meistens der Vergangenheit gleiche, heranzieht, um die konsensbildende Schlußkraft desBeispielbeweises zu begründen.999 Man mag in der latenten Annahme von der immergleichen Menschennaturetwa auch Platonisches, in der Gleichförmigkeitsidee etwa auch die jüdisch-christliche Welt-und Neuheits-Verachtung im Geiste des Kohelet heraushören. Solche geistesgeschichtlichen Zuordnungen sind jedochdurchaus sekundär gegenüber dem erkenntnispsychologisch gewissermaßen archaischen Prinzip derÜberlegenheit alles historisch Vergleichbaren über das Unvergleichbare und Vereinzelte. Einem Thukydides„genügt es“, Ähnlichkeiten des Vergangenen und Künftigen „aufgrund des menschlichen Charakters“ zuzeigen (was heute unter Historikern zweifellos als Anthropologismus oder Soziologismus gälte). Für ihn liegtdarin ein vitales Interesse und „der Nutzen der Geschichte für das Leben“; das gegen den Vergleich sichsperrende Detail aber ist gleichgültig oder bestenfalls kurios.1000
998 Th. Mann, Freud und die Zukunft (wie Anm. 170) 492.999 Arist., Rhet. II 20, 1394a 7–9; I 35, 1368a 38; vgl. S. 10 f., 51 ff., 216 f. und ZOEPFFEL 40 ff. gegen die verbreiteteInanspruchnahme dieses „statischen“ Konzepts für die Konstruktion einer „zyklischen Geschichtsauffassung der Antike“ (s.S. 525 ff.). – Zur Begründung der Argumentation mit dem consensus omnium aus der unproblematischen Vorstellung derimmergleichen Menschennatur in der Antike vgl. SCHIAN (wie Anm. 5) 192 f.1000 Vgl. §§ 4, 42, S. 102 ff., 216 ff., 184 ff., 337 f., 504 ff. Zu einer als Wort Platos zitierten Chalcidius-Stelle überErkenntnispsychologie in Met. IV 10 s. Anm. 18 ff. (vgl. auch Anm. 874). MELVILLE (Wozu Geschichte [wie Anm. 368]100) bemüht ähnliche Stellen zur Analogie von Vergangenheit und Zukunft aufgrund der Beziehung zwischen memoria undimaginatio aus Augustin und Thomas von Aquin, um damit mal. Geschichtstheorie zu begründen. BLUMENBERG,Lesbarkeit (wie Anm. 25) 54 sieht trotz des scholastischen Aristotelismus einen verkappten Platonismus in dermetahistorischen, das radikal Neue ausschließenden Kanonisierung der bestehenden Natur als der einzig möglichen Natur.Nicht nur als Beleg für die Ubiquität dieses alteuropäischen Gedankens, sondern als Zeugnis für das, was noch in derBarockzeit „historische Wirklichkeit“ war, ist die von V. MEID, Barocknovellen? Zu Harsdörffers moralischen Geschichten,in: Euphorion 62 (1968) 72–6, hier 73 angeführte Stelle Harsdörffers interessant, der das Postulat aufstellt, Exempla müssenhistorisch tatsächlich und nicht erfunden sein; denn: „Was vergangen ist,/geschieht wider/[…] Daher die Hebreer sagen:/Wasden Vättern begegnet/soll den Kindern Warnung sein“. – Zum geschichtstheoretischen Topos bei und nach Thukydides (Hist.Prol. I 22) vgl. ROMILLY (wie Anm. 15), 41; LANDFESTER 152 ff.; GEBIEN 30 f.; FINLEY (wie Anm. 47) 9 ff.,14 ff.; K. ADSHEAD, Thucydides and Agathias, in: History and Historians in Late Antiquity ed. B. CROKE/A.M.EMMETT, Sydney 1983, 82–7, hier 85 f.; BLUMENBERG, Wirklichkeitsbegriff (wie Anm. 266) 38 zum Zusammenhangdieser Geschichtsauffassung mit dem philosophischen Wirklichkeitsmodell eines „ruhenden Sehens des ruhendenGegebenen“, dem die Wahrnehmung des Bewegten als „Wechsel je für sich konstanter Formen an einem identischenSubstrat“ entspricht. Ähnlich auch DÖRRIE, Mythos (wie Anm. 125) 13 zu Plato und FLASCH (wie Anm. 562) 395 f. zuAugustin; KOSELLECK, Vergangene Zukunft 137 f.: „In dieser Erfahrung war enthalten die Wiederholbarkeit derGeschichten […] woraus ihre Lernbarkeit abgeleitet werden konnte. Dieser gesamte Komplex hält sich bekanntlich bis ins 18.Jh. hinein. Ihn als Einheit zu untersuchen, wäre auch heute noch ein Vorgebot unserer Wissenschaft, wenn auch dietheoretischen Vorleistungen, um Vergleichbarkeit zu erzielen, dank dem Primat chronologischer Epochengliederung inunserer Zunft verkümmert sind […] Denn die naturhaften Bedingungen, die in alle Geschichten hineinragen, […] lassen sichihrerseits nicht restlos historisieren“. Die geschichtstheoretische Position, die KOSELLECK als Historiker derart vorsichtig(darum umständlich) gegen den von seiner „Zunft“ zu gewärtigenden Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit in Schutz zunehmen sucht, hat sich K. LÖWITH als philosophische (u. a. von Nietzsche und Burckhardt bestimmte) Grundthese seinesDenkens engagiert zu eigen gemacht und immer wieder in provozierenden Formulierungen vertreten. Vgl. unten Anm. 1005und z. B. Schriften 356: „Der trivialste Ausdruck für das zeitgeschichtliche Bewußtsein des heutigen Menschen ist die Redevom ‚Übergang’ zu einer neuen Epoche und die ihr entsprechende Rede von einem bisherigen und künftigen Menschen, alsob die Geschichte den Menschen jemals gelehrt hätte, ein anderer zu werden und sich zu verändern. Zwar offenbart sich in derGeschichte, wie in einem vergrößernden und vergröbernden Spiegel der Mensch, aber nicht als ein jeweils anderer, sondern
519
Viele theoretisch anspruchsvolle Gedankengebäude seit der Antike beruhen auf dieser elementarenÜberzeugung die vielleicht als zu trivial erscheint, um bei ideengeschichtlichen Untersuchungen ernstgenommen zu werden. Auch Johanns lebendiges Geschichtsinteresse entstammt dem anthropologischallgemeinen Bedürfnis nach pragmatischem Orientierungswissen durch das „Wiedererkennen“ in „vertrauter“Vergangenheit. Man scheut sich fast, eine solche Selbstverständlichkeit festzustellen, wenn man dentiefsinnigen, windungsreichen metaphysischen Begründungen gefolgt ist, die seine spekulative philosophisch-theologische Geschichtstheorie dafür gibt. Danach muß alle Erkenntnis möglichst nahe an die unerreichbareeine göttliche Wahrheit heranführen, die sich – nach dem berühmten Vers des Boethius über den„unbeweglichen Allbeweger“ – besonders durch zeitliche simplicitas, durch ewige Simultaneität desGegenwärtigen, Vergangenen und Zukünftigen auszeichnet.1001
als immer derselbe. Der Mensch hat schon vielerlei Übergänge bestanden und überstanden, ohne daß er je aufgehört hätte zusein, was er immer schon war“. (Zur Ideologie der „Übergänge“ vgl. auch DEMANDT, Epochenbewußtsein [wie Anm. 539]129 ff.). LÖWITH, Schriften 435 f.: „Es fehlt den vormodernen Autoren unser Wort ‚Geschichte’ (als singulares Substantiv),weil ihnen die damit gemeinte Sache fremd ist. Weder die griechische Philosophie noch die christliche Theologie hat dieGeschichte so überschätzt wie wir, die wir alle noch in irgendeinem Ausmaß Hegelianer sind“.1001 Pol. II 21–22, (I) 115 ff. zur Providenz, bes. II 21, 116.25 ff.: Licet enim quae scientia Dei complectitur, mutabilitatisubiaceat, ipsa tamen alternationis vices ignorat, et uno singulari aspectu et individuo, omnium quae dici aut quocumquesensu excogitari possunt, universitatem claudit et continet; […] temporalia sine mutabilitate et motu sic uniformitercomprehendit, ut ei nec praeterita transeant nec futura succedant […] Cum vero divinae simplicitatis aspectusinnumerabilia claudat, una tantum est et individua substantia praescientis. Ebd. II 22, 123.23 ff.: Porro divinaesimplicitatis status longe alia conditio est. Ea siquidem uno simplici et individuo aspectu […] quae sunt, quae fuerunt, etquae futura sunt, omnia contemplatur, nulloque rerum mutabilium lapsu movetur, sed in seipsa semel et simul contuensuniversa subsistit invariabilis, ‚stabilisque manens dat cuncta moveri’ (Boeth. Cons. Phil. III m. 9.3). Der ganzeGedankengang folgt genau Abaelards Introductio ad theologiam (COUSIN II 134 ff., 145 f.); vgl. auch Theol. christ. I 78,115 (CC med. 12) 104, 120 zur Boethius-Stelle und allgemein zu deren Wirkung: COURCELLE (wie Anm. 977) 181; T.GREGORY, Platonismo medievale, Rom 1958, 53 f.; STARNES (wie Anm. 879) 30 ff.; SMALLEY, Novelty (wieAnm. 254) 113 ff.; CHENU, Théol. 167 f. – Zur Bedeutung der göttlichen Simultaneität für das exemplarisch-paradigmatische Geschichtsverständnis des Mittelalters vgl. AUERBACH, Typolog. Motive (wie Anm. 727) 19 f.:ZUMTHOR (wie Anm. 760) 34; CHENU, Théol. 114 f.; HELBLING (wie Anm. 252) 112 ff. zu DANTE, Parad. 17.16–8und Thomas Aq., Summa Th. 2.2. 172.1 und ebd. 115 f. zu Dantes Ep. 5 als Versuch, konkrete Zeitgeschichte unter demGesichtspunkt der göttlichen Vorsehung, der alles gegenwärtig ist, zu interpretieren und so Oktavian und Heinrich VII. zuparallelisieren (ed. Soc. Dant. Ital., Florenz 1921, 421): Nempe si’ a creatura mundi invisibilia Dei, per ea quae facta sunt,intellecta conspiciuntur’ [Röm. 1.20] et si ex notioribus nobis innotiora, si simpliciter interest humane apprehensioni utper motum celi Motorem intelligamus et eius velle; facile predestinatio hec etiam leviter intuentibus innotescet. Vgl. auchMELVILLE, Niedergang (wie Anm. 735) 120 ff.; ROUSSET (wie Anm. 361) 624 f., 629 f. spricht von einermittelalterlichen „volonté d’ignorer le temps“, weil in Gott alle Zeit aufgehoben ist; FONTAINE, Isidore (wie Anm. 145)811. 871 f. sieht in dieser geschichtstheologischen Voraussetzung am Anfang des Mittelalters, bei Isidor, ein Motiv für dieTendenz, alle Autoren und Geschichtskenntnisse auf einer einzigen synchronen Ebene zusammenzufassen, und zitiert dazu dastreffende Wort von M. de Unamuno (Essayos I, Madrid 1942, 57): „Pour lui, il y a deux mondes: un kaléidoscope de faits etun système de concepts; et au-dessus d’eux un Moteur immobile“.
520
Geschichtserkenntnis erklärt Johann entsprechend als partielle – demütig auf Gnadenhilfe angewiesene –Aufdeckung der dem Menschen in der Hauptsache verschlossenen Providenzgeheimnisse mittels einesVergleichs rekurrenter oder analoger Erscheinungen der historischen Zeit. Dies ist seine meta-historischeLegitimation für eine dennoch (im vor-historistischen und pragmatischen Sinne) durchaus historischeGeistesbeschäftigung, für die zeitgeschichtliche Neugierde, für das Interesse an Prognosen (oder„Zukunftsforschung“ mit allem, was bis zur Astrologie dazugehört) und nicht
521
weniger für den antiquarischen Sammeleifer bei der Suche nach bunten Vergangenheits-Beispielen für diepolitische Klugheitslehre.1002
109. Was nun die eingangs gestellte Frage nach der „Epochenzugehörigkeit“ Johanns aufgrund seinesExempla-Gebrauchs betrifft, muß zunächst der eben erwähnte anthropologische Aspekt – oder wenigstens dieBedeutung der „longue durée“ im mentalitätsgeschichtlichen Sinn – nochmals betont werden. Dietheoretische Grundlage des Exemplums, der Glaube an die Wiederholbarkeit der Geschichte, m.a.W.: „derGlaube an den Präzedenzfall und seine Beweiskraft sitzt sehr fest im menschlichen Bewußtsein“.1003DieserGlaube selbst ist nur zu einem geringen Teil historischen Wandlungen unterworfen. In der frühen Neuzeitschafft er sich ein methodisch neues Kleid, sucht sich durch systematische Ermittlung genereller, notwendigerStrukturgesetze (zum Zweck fehlerfreier Prognose) als Wissenschaft (ja „Naturwissenschaft“) zu etablieren;doch die Stoßrichtung des allgemeinen Geschichtsinteresses ist noch die des Policraticus, gerichtet auf dieSammlung exemplarisch nützlicher „Historien“ oder loci communes historici (vornehmlich aus der römischenHeldengeschichte), auf den die Zeiten überbrückenden lehrreichen
1002 Zur prognostischen Bedeutung der Exempla vgl. § 4; Dal PRÀ 117 f. (Exempla als Zeichen der göttlichen Erstursachen);das Gemeinte ließe sich auch mit J. RÜSEN (Geschichte und Norm – Wahrheitskriterien der historischen Erkenntnis, in:‚Normen und Geschichte’, ed. W. OELMÜLLER, UTB 896, Paderborn 1979, 110–39, hier 117) auf die griffige Formelbringen: „Geschichten sind […] die Probe der Vergangenheit aufs Exempel der Zukunft“.1003 DORNSEIFF 206 f.
522
Vergleich und die rhetorisch-„prudentistische“ Bildung.1004 Erst mit dem Historismus des 19. Jahrhundertsverliert diese Spielart des historia magistra vitae-Prinzips die wissenschaftliche Dignität, was sie keineswegsdaran hindert – sozusagen als „gesunkenes Wissenschaftsgut“ – lebensweltlich weiterzublühen. Seit derEntdeckung des historisch Einmaligen in der unwiederholbaren Fortentwicklung, d. h. des schlechthin„Beispiel-losen“, gelten Beispiele aus der Geschichte gelehrtem Verständnis als ahistorisch, alsKalendergeschichten und Lehrstücke auf dem Schulbuchniveau der (ihrerseits didaktisch trivialisierten)Tierfabeln.1005
1004 Vgl. GILMORE (wie 214) 27 f., 34 zu strukturgeschichtlichen Versuchen Macchiavellis und Bodins. – ZumMonumentalismus der frühen Neuzeit, der gegenüber dem Mittelalter (in dem es noch keine Artes historicae undAnleitungen zum Exzerpieren, Katalogisieren und probaten Applizieren moralischer Exempla gab) noch erheblich gesteigertwurde, vgl. NADEL (wie Anm. 494) 306 ff.; SCHOLTZ (wie Anm. 28) 358; v. BEZOLD, Methodik (wie Anm. 42)375 ff.; DAXELMÜLLER, Exemplum 631 f.; R. de MATTEI, Il culto della storia in Italia tra il Cinque e il Seicento; in:Festschrift E. PARATORE, (wie Anm. 316) III 1981, 1413–24; MAURER, Melanchthons loci communes (wie Anm. 765)32 ff.; BRÜCKNER, Hist. 41, 51; C. VASOLI, Topica, retorica e argumentazione nella ‚prima filosofia’ del Vico, in:Revue intern. de philos. 33 (1979) 188 ff. zu Vicos Suche nach idealen Ähnlichkeiten in entferntesten und diversestenEreignissen als „Topik“ im Gegensatz zum Gesetzeswissen (dazu vgl. § 72, Anm. 765–7). – Zu der gegenüber demMittelalter nach der Renaissance gesteigerten, oft ausschließlichen Geschichtswürdigkeit der antiken Exempla (namentlichaufgrund der überragenden Bedeutung des im Mittelalter so gut wie unbekannten authentischen Plutarch) vgl. GILMORE(wie Anm. 214) 14 (Petrarcas De viris illustribus); NADEL (wie Anm. 494) 291 ff., 311, 314; LEDUC (wie Anm. 679)11 f., 17 ff., 140 ff. (zu Rousseau). V. PÖSCHL weist dasselbe Muster noch im Georgekreis nach: Gundolfs Caesar, in:Euphorion 75 (1981) 204–16.1005 Vgl. §§ 3 f., 8, 12 f., S. 314, 540; LANDFESTER und FUHRMANN, Exemplum (passim); und vor allemKOSELLECK (Historia Magistra Vitae) 38 ff. – In der gelegentlich polemisch geführten Diskussion über die Frage, ob dasMittelalter „unhistorisch gedacht“ habe, gibt es vielfältige Antworten: pathetische Verwerfung der Frage selbst etwa durch J.SPÖRL, Das mittelalterliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe in: Hist. Jb. 53 (1953) 281 ff. = Geschichtsdenken(wie Anm. 987) 1 ff.; geringe Neigung, darauf einzugehen, bei BOEHM (wie Anm. 25) 663 ff.; BORST (wie Anm. 486)21 ff.; vorsichtige Bejahung bei LIEBERTZ-GRÜN (wie Anm. 325) 78; H. GRUNDMANN, in: Geschichtsdenken (wieAnm. 987) 426; MELVILLE, Wozu Geschichte (wie Anm. 368) 125 ff.; ders., Niedergang (wie Anm. 735) 120 ff.;HUIZINGA, Herbst (wie Anm. 545) 246 ff. und dezidierte bis engagierte Bejahung durch BRAND, Shape (wie Anm. 681)160 ff.; SEIFERT (wie Anm. 982) 227 f. sowie bei fast allen Renaissanceforschern. Solange nicht klar gesagt wird, ob derneuzeitlich historistische oder der anthropologisch allgemeine Geschichtsbegriff gilt, kann es sich hier nur um Scheingefechtehandeln. Zur Begriffsklärung war mir der apologetisch gemeinte Beitrag von E. FRANK, Die Bedeutung der Geschichte fürdas christliche Denken (1955), in: Zum Augustingespräch (wie Anm. 581) I 381–389, dialektisch hilfreich, weil hier (382)Augustin als der „erste Philosoph“ gerühmt wird, „der verstand, was Geschichte wirklich besagt: eine einmalige,unwiederholbare Fortentwicklung zu einem Ziel, ein teleologischer Prozeß, in dem jedes Ereignis neu und ohne Beispiel ist“(Hervorhebung von mir). Die Konfusion des modernen historistischen mit dem heilstheologischen Geschichtsbegriff könntenicht deutlicher zu Tage treten (vgl. oben Anm. 982). – Der Begriff „Historismus“ wird hier ausschließlich in demeindrücklich von E. AUERBACH (Literatursprache [wie Anm. 232] 9 ff.; Ges. Aufsätze [wie Anm. 652] 233) erläuterten,neutral charakterisierenden Sinn der Heuristik Vicos, allenfalls in dem positiven (pluralistisch-liberalistischen) SinnROTHACKERS und CROCES gebraucht: Im Kern steht die individualisierende und relativierende Betrachtung deshistorisch Konkreten und Besonderen im Gegensatz zu universalistischen, uniformierenden, dogmatischen,„naturgesetzlichen“, strukturalen, soziologischen etc. Verfahrensweisen. Daß es daneben leider eine Vielfalt anderer, z. T.sogar gegensätzlicher Historismusbegriffe gibt, die aufgrund der einseitig entwicklungsgeschichtlich-genetisch orientiertenDefinition vieler Geschichtswissenschaftler und vornehmlich durch die ungeheuerliche terminologische Verschmelzung mitPOPPERS „Historizismus“ (außerhalb der deutschen Sprache) ein chaotisches Gesamtbild ergeben, ist mir schmerzlichbewußt. Klärend dazu ist G. SCHOLTZ, Art. Historismus, Historizismus in: HWbPh III 1141–7; paradigmatisch für denbeklagten Zustand hingegen A. NABRINGS, Historismus als Paralyse der Geschichte, in: AKG 65 (1983) 157–212. – DenKern des Historismus-Begriffs trifft die unten Anm. 1031 zitierte Schelling-Stelle vortrefflich. Vgl. in diesem Sinn auchKOSELLECK, Vergangene Zukunft 176: „Was das arg strapazierte Schlagwort vom Historismus auch sonst alles meint,sicher zielt es auf diesen mit dem Ablauf der Geschichte allen Beteiligten abgenötigten Standortwechsel“. – Zum Überlebender vor-historistischen, pragmatischen Geschichtsauffassung in der Gegenwart vgl. GEREMEK 172 zu populären Exemplaals Erinnerungsbildern in den Massenmedien; KORNHARDT 86 zur volkstümlichen Geschichtsauffassung in den durchReduktion auf sog. „historische Augenblicke“ und große Männer gewonnenen Exempla; H. BAUSINGER, Denkwürdig, in:
523
Bekannt ist aus Alltagserfahrung (und Zeitungslektüre) das Bedürfnis nach „analogen Beispielen“ und„historischen Parallelen“ in kritischer Lage. Die neuesten „Fälle“ und Zumutungen der Zeit führen jeweilsleichter oder schwerer zu Exempla: Den Tod Hitlers konnten die Intellektuellen 1945 nach bewährtemDenkmodell und vertrautem Schema als Despotenende registrieren (Policraticus VIII 21: omniumtirannorum finem esse miseriam, hätte zitiert werden können); drei Monate später, bei der erstenAtombombe, fehlten die realen und literarischen Prototypen. Doch selbst wo es keine Beispiele gibt, kannund muß – der romantischen Utopie von der Direktmitteilung einmaliger Wirklichkeitserfahrung zum Trotz– das Orientierungsbedürfnis Beispiele erfinden oder vielmehr per analogiam hermeneutisch „finden“. Als im13. Jahrhundert Augenzeugenberichte von den Mongolen im Westen eintrafen, wurde diese neue Erfahrungsogleich dem tradierten Geschichtswissen – dem Mythos von Gog und Magog – zugeordnet und sogarsprachlich angepaßt (aus Tataren wurden, der tradierten tartarus-Etymologie zu Liebe, „Tartaren“).1005aDieEvidenz wurde durch den Autoritätswert historischer Exempla gemildert, wo nicht entkräftet. Trotz derspezifisch mittelalterlichen Form dieser Sinnbildleistung darf das zugrundeliegende Perzeptionsmodell: dieAbschirmung des Neuen durch das Vorverständnis, allein schon in erkenntnispsychologischer Hinsicht getrostals anthropologisch universell bezeichnet werden.
Darum sind Versuche, aus der Geschichte des Exemplums Epochenunterschiede abzuleiten, nur mit größterVorsicht zu unternehmen. Skepsis verdienen insbesondere Pauschalurteile wie die vom „zyklisch-repetitiven“Geschichtsbegriff der Antike im Verhältnis zu einem „linear-teleologischen“ des
Festschr. J. DÜNNINGER, Berlin 1970, 27–33 und ders., Natur und Geschichte bei Wilhelm Grimm, in: Zs. f. Volkskunde60 (1964) 54–69 zur mythisierenden Geschichte, die das jeweilige Detail um jeden Preis zugunsten des Dauernden undZeitlosen abzustreifen sucht, und zu deren ideologischen Hintergründen heute. – Man kann mit HENNIS (wie Anm. 601) 19andererseits beklagen, daß der Historismus in trivialwissenschaftlicher Form sich bereits derart durchgesetzt hat, daß dermetahistorische Sinn des historia docet von der Antike bis zum 18. Jh. schwer verständlich geworden ist; daß, was einAristoteles oder Cicero „zeitlos lehren wollten“, nicht mehr interessiert, sondern nur noch, was sie als historische Gestaltengerade für ihre eigene Zeit bedeutet haben. Vgl. auch oben Anm. 1000 und LÖWITH, Schriften 357 f.: „… wer könntebestreiten, daß die natürliche Welt selbst, zur Zeit von Platon und Kant, dieselbe war, obwohl sie verschieden verstandenwurde, und daß die verschiedenen geschichtlichen Welten von Homer, Dante und Shakespeare antiquarische Kuriositätenwären, wenn wir uns in ihren Taten und Leiden […] nicht selbst wiedererkennen würden? […] Eine Betrachtungsweise desMenschen und der Geschichte unter dem Gesichtspunkt des Immerwährenden und sich in der Zeit Bewährenden ist heuteunzeitgemäß, weil unser vom historischen Bewußtsein besessenes Denken das Immerseiende und Immerwährende nichtwahrhaben will und es entbehren zu können meint“. Diese Polemik gegen das Historische im modernen Sinn halte ich fürebenso wichtig wie CHENUS Kritik am Ahistorisch-Allegorischen im mittelalterlichen Sinn (oben Anm. 982), ob sich beideUrteile widersprechen oder dialektisch ergänzen, bleibe als Frage jetzt offen. Es genügt hier, die vorhistoristische und diehistoristische Denkform auf gelehrter und trivialer Ebene, in wissenschaftlicher und ideologischer Beurteilung durch solcheBelege zu konfrontieren.1005a Ich beziehe mich hier dankbar auf einen eindrucksvollen Vortrag von Johannes FRIED: Auf der Suche nach derWirklichkeit: Die Mongolen und die europäische Erfahrungswissenschaft im 13. Jh., gehalten am 14.11.1985 in Münster(ersch. in HZ) – Zu den Ereignissen von 1945 vgl. Peter von MATT, Die erste Atombombe im Tagebuch, in: Literatur undKunst, Beilage der Neuen Zürcher Zeitung vom 11./12.5.1985, Nr. 108, 67 zu Tagebuchnotizen von C. Mauriac, D. deRougemont, E. Jünger, B. Brecht und H. von Doderer.
524
Mittelalters, da sie nur in Verkennung der in beiden Zeitaltern (wie stets) lebendigen historischen Beispielezustandekommen können.1006 Das Periodisierungskriterium der „Geschichtsanschauung“ löst sich hierüberdies weitgehend in ein über die Epochen hinweg geltendes Gattungs- oder Funktionsmerkmal auf, daszuvor durch den behaupteten epochalen Weltbild-Alleinvertretungsanspruch der einen oder andern Textartkünstlich zugedeckt worden ist. Auch hier gilt Friedrich Ohlys beherzigenswerte Warnung vor Periodisierungs-Übereifer:1007 „Der Stilsprung von Gattung zu Gattung in der Synchronie ist […] ausgeprägter als derStilwandel in der Diachronie, an dem die Gattungen im Gang der Epochen gleichartig partizipieren.“ DieAufgabe des Exemplums ist der pragmatisch-rhetorische ad hoc-Vergleich über die Zeiten hinweg; für denVerlauf der Zeiten selbst sind andere Reflexions- und Darstellungsformen (wie Chronik undgeschichtsphilosophische Abhandlung) zuständig. Exemplarische Vergangenheitsnutzung gab es immer: Siewar in der Antike lange die einzige, später die vorherrschende Art historischer Beschäftigung, ganzunabhängig von jeglicher Deutung der Gesamtgeschichte, die beim einen zyklisch, beim anderen prozeßhaftausfallen konnte, im allgemeinen
1006 Vgl. § 108, S. 10 ff., 54, 216 ff.; ähnlichkritisch auch FUHRMANN, Exemplum 449 ff.; G. TROMPF, The Idea ofHistorical Recurrence in Western Thought, Berkeley 1979, 179 ff.; MOMIGLIANO Essay (wie Anm. 490) 179 ff., 191;ZOEPFFEL 40 ff. und LÖWITH 432, 468 (statischer Geschichtsbegriff bei Aristoteles, der nicht Kreislauf, sondern Zufall und menschliche Ohnmacht vor der Geschichte meint; vom Zufälligen und Wechselnden gibt es nur Bericht, nicht„Wissenschaft“); HANNING (wie Anm. 185) 13; M.L. LAISTNER, The Greater Roman Historians, Berkeley/Los Angeles2
1963, 13 (gegen die Verwechslung der zyklischen Geschichtsidee mit rhetorisch exemplarischer Vergangenheitspragmatik). –Die Reduktion des mittelalterlichen Geschichtsdenkens auf das heilsgeschichtlich teleologische Modell – etwa beiKESSLER, Modell 59 ff. (repräsentativ für unzählige nicht-mediävistische Feststellungen dieser Handbuchweisheit über dasMittelalter) – verkennt vor allem die ungeheure Macht und Verbreitung historischer Exempla in Ethik und Gesellschaftslehre.Entschuldigend ist dazu allerdings zu bemerken, daß auch die Spezialliteratur zum mittelalterlichen Geschichtsdenken diesenAspekt wenig betont; eher Beiläufiges dazu vgl. etwa bei BOEHM (wie Anm. 25) 679 f.; GUENÉE, Hist. et culturehistorique 27 ff.; LACROIX 167 ff.1007 OHLY, Schriften 363; ebd. 361 ff. (Halbbiblische und außerbiblische Typologie) auch ausdrücklich auf „Globalkonzeptewie die von einer zyklischen Zeitvorstellung der Antike und einer dimensionalen oder linearen Zeitvorstellung imChristentum“ bezogen. Vgl. auch HANNING (wie Anm. 185) 1 ff. mit der Ergänzung, daß die gleichen Schriftsteller inWerken und Kontexten verschiedener Gattungen oder rhetorischer Systeme völlig unterschiedliche Geschichtskonzeptionen anden Tag legen. Zum Epochenproblem unter diesem Aspekt vgl. auch HEINZLE 51 f.; GILMORE (wie Anm. 214) 108.
525
aber aus mangelndem Interesse unterblieb.1008 Das Christentum brachte mit dem neuen heilsgeschichtlichenüberhaupt erst universalgeschichtliches Denken in die antike Welt, was allerdings keineswegs heißt, das zuvorund daneben weitergepflegte „beispielsphilosophische“ Denkmuster sei unhistorisch. Ebensowenig begnügtesich das Mittelalter durchweg mit einer linear auf das Eschaton gerichteten Entwicklungsidee. Zyklisch bliebaufgrund des Wissens um die vanitas und mutabilitas mundi insbesondere jene moralpädagogisch nützliche,überaus verbreitete Schicksalsvorstellung vom Auf und Ab irdischer Reiche, vom wiederkehrenden Ablauf vonHöhe und Fall alles Großen und aller Großen.1009
110. Eine andere epochengeschichtliche Simplifizierung liegt in der These, das Exemplum des Mittelalters seiillustrativ und didaktisch, dasjenige der Renaissance problemorientiert und induktiv. Auch hier wird ein„Gattungsunterschied“ – derjenige zwischen Beleg- und Fallbeispiel – mit einem Epochenunterschiedverwechselt. Schon die rhetorische inventio-Theorie unterscheidet diese zwei Spielarten allenBeispielgebrauchs. Der Redner hat sich immer für das eine oder das andere zu entscheiden: entweder für das„Auffüllen“
1008 In dem System der vier von RÜSEN (wie Anm. 37) als Typen des historischen Erzählens vorgestellten Modelle –„traditionales, kritisches, genetisches, exemplarisches“ Erzählen – wird letzteres bezeichnenderweise mit dem mittelalterlichenExemplum, mit Macchiavelli und mit Ranke (!) illustriert. – FINLEY (wie Anm. 47) 9 ff. betont das fehlende Interesse derantiken Philosophen an der Geschichte als eigenständigem Studienobjekt, abgesehen von der stets lebendigenAufmerksamkeit für „Beispiele der Vergangenheit“. Zur Gleichgültigkeit der Spätantike gegenüber eigentlich historischenFragen des Entwicklungsprozesses aufgrund neuplatonischer Prämissen vgl. DÖRRIE, Symbolik (wie Anm. 425) 7 f.LÖWITH 383 (ähnlich auch 468): „Die griechische Historie war nicht von der Zukunft her motiviert, und sofern siegelegentlich auch diese betrachtete, tat sie es nicht in der Meinung, daß alles bisher Gewesene seinen Zweck erst in derZukunft erfülle, sondern in der ganz andern Überzeugung, daß auch die künftigen Geschehnisse denselben Gesetzenunterstehen werden wie alle bisherigen, weil die Natur des Menschen sich nicht wesentlich ändert und es ‚die Natur allerDinge ist, hervorzugehen und zu vergehen’ (Thukydides)“.1009 Vgl. §§ 105 f., Anm. 992. HANNING (wie Anm. 185) 17; F.P. PICKERING, Augustinus oder Boethius?, Berlin 1967,passim (zur Chiffre „Bœthius“); von MOOS, Lucans tragedia 147 ff.; MOMIGLIANO, Essays (wie Anm. 490) 184 zuAugustins Kohelet-Interpretation und deren „zyklischem“ Zeitbegriff; LADNER, Erneuerung (wie Anm. 179) 243 zur Ideeeiner wiederholten Erlösung bei Origenes; HERZOG, Orosius (wie Anm. 197) 98; HELBLING (wie Anm. 252) 75 ff.,135 ff. zum spätmittelalterlichen Wiederholungsgedanken. – D. KARTSCHOKE, ‚Nihil sub sole novum’? ZurAuslegungsgeschichte von Eccl. 1.10, in: Geschichtsbewußtsein… hrsg. von Chr. GERHARDT (wie Anm. 420) 175–188,bes. 180 ff. zur Deutung im Sinne des contempus mundi.
526
eines locus mit unproblematischen (häufig didaktischen) Beispielen oder für das Entwickeln eines locus auseinem Problembeispiel oder Casus.1010 Wer die Ubiquität dieser topischen Möglichkeiten des Exemplumsdiesseits und jenseits der umstrittenen Epochenschwelle betont, zieht leicht den allzu oft gegen E.R. Curtiuserhobenen Vorwurf auf sich, er wolle alle historischen Unterschiede einebnen und so die epochale Bedeutungder italienischen Renaissance schmälern. Gelegentlich wird sogar unterstellt, die Betonung mittelalterlich-neuzeitlicher Kontinuitäten diene einer aus zünftischer Geltungssucht inszenierten „Revolte derMediävisten“.1011Das Echo bleibt nicht aus: Die derart Angegriffenen rechnen den Renaissanceforschern adhominem
1010 Vgl. S. 19 ff., 429 f. Am deutlichsten zeigt sich dieses Schema in dem insofern NEUSCHÄFERS Novellentheoriefolgenden Beitrag von STIERLE (vgl. Anm. 44, 283, 286; NEUSCHÄFER, wie Anm. 315), der einen Epochenwandel aufdie vermeintliche Ablösung des einsinnigen, „einpoligen“, problemlos-didaktischen mittelalterlichen Predigtexemplumsdurch den novellistischen, diskutierbaren, „doppelpoligen“ Casus im Decameron abstützt. DAXELMÜLLER (Exemplum628, 634 u. ö.) betont dagegen mit Recht die weitgehende Konstanz des rhetorischen Exemplum-Begriffs von der Antike bisins 18. Jh. gerade hinsichtlich der doppelten Funktion als Illustrations- oder als Fallbeispiel.1011 Vgl. HEINZLE, Boccacio 61 kritisch zu A. BUCK, Zu Begriff und Problem der Renaissance (wie Anm. 543) 17 ff.HEINZLE, ebd. 42 ff. eine Apologie für CURTIUS gegen das erwähnte Klischee (mit einem Seitenhieb auf H.R. JAUSS’,„Alteritäts“-Begriff). HEINZLES Beitrag findet im übrigen Lob bei RICHARDS (wie Anm. 55) 15 f., 155 f. zur CURTIUS-Rezeption. – Zum krampfhaften „intellektuellen Besitzstandsdenken“, das viele Renaissance-Spezialisten daran hindert, aufder Hand liegende Kontinuitäten zu sehen, vgl. auch A. SAPORI, Moyen Age et Renaissance vus d’Italie, in: AnnalesE.S.C. 11 (1956) 433–57, hier 434 f. HEITMANNS Versicherung von 1977, daß „heute“ fast alle Renaissanceforscher dieKontinuität zwischen MA und Renaissance „angemessen“ würdigen (K. HEITMANN, Die heutige literarhistorischeDefinition der französischen Renaissance, in: Bibliothèque d’Humanisme et de Renaissance 39 [1977] 329–61, hier 341),läßt sich zum mindesten auf dem Gebiet der Exempla-Forschung auch 1985 noch nicht ohne weiteres bestätigen. Vgl. nunauch die (während der Drucklegung dieser Arbeit bekanntgewordenen) kritischen Beiträge zu Neuerscheinungen, die dasberuhigende Urteil HEITMANNS widerlegen dürften: F.-R. HAUSMANN, Novellenerzählen? – Eine neue Theorie zurGenese und Struktur der französ. Renaissance-novelle, in: ZRPh 98 (1982) 394–406 sowie M. ZIMMERMANN, Bespr. in:Vox Romanica 42 (1983) 270–75 (beide über: W. WEHLE, Novellenerzählen, Französische Renaissancenovellistik alsDiskurs, München 1981); R. SCHNELL, Kirche, Hof und Liebe, Zum Freiraum mal. Dichtung, in: Mittelalterbilder ausneuer Perspektive (wie Anm. 570) 75–111 (über: H.U. GUMBRECHT, Literarische Gegenwelten, Karnevalskultur und dieEpochenschwelle vom Spätmittelalter zur Renaissance, in: GRLMA, Begleitreihe I: Literatur in der Gesellschaft desSpätmittelalters, hrsg. von H.-U. GUMBRECHT, 1980, 95–144).
527
kanonische „Zementierung“ der Epochengrenze unter dem ideologischen „Denkzwang“ des Neuheits-Klischees vor, d. h. „Wahrnehmungsblindheit“ für Kontinuitäten und Analogien um der Legitimation deseigenen wissenschaftlichen Daseins willen. Besonders heftig ist dieser Gelehrtenstreit in der BeurteilungBoccaccios geführt worden, und der strittigste Punkt dabei war stets die Frage, ob das Dekameron diemittelalterliche Exempla-Tradition nur weiterführe, modifiziere oder ganz aufbreche und überwinde. Soweitdie Beziehung der sich herausbildenden neuzeitlichen Novelle zum spätmittelalterlichen „Predigtmärlein“ zurDebatte steht, ist diese Frage von hohem gattungsgeschichtlichen (narratologischen) Interesse. Zumepochengeschichtlichen Verständnis des rhetorischen Geschichtsbeispiels jedoch kann sie nichts beitragen.1012
111. Trotz all dieser Bedenken seien einige vorsichtig programmatische Überlegungen zu Johanns Positioninnerhalb einer noch zu schreibenden Entwicklungsgeschichte des rhetorischen Exemplums vom Mittelalterzur Neuzeit angestellt. Viele Policraticus-Exempla sind zweifellos als Problematisierungsund Erkenntnismittelgemeint und eingesetzt worden, nicht nur als Illustrationen vorgegebener Gewißheiten und Dogmen. Darinunterscheiden sie sich kaum von denen Petrarcas und Salutatis.1013 Auch der autoritative Quellenbereich, derin erster Linie die gesamtantike – nicht nur die klassische oder die heidnische – Exemplaliteratur umfaßt, istim Kern derselbe geblieben. Hinzugekommen sind in der frühen Renaissance allerdings nicht nur dieberühmten altphilologischen Neuentdeckungen, sondern auch ein weniger berühmter Bestand anmittelalterlicher Literatur (zu dem auch der Policraticus
1012 Ausführlicher hierzu HEINZLES polemische, in der Hauptsache zutreffende NEUSCHÄFER-Kritik (42 ff.), die am Randauch die Boccaccio-Forschung V. BRANCAS und TODOROVS impliziert. Vgl. auch S. 19, 132, 228 ff., 279 ff., 321 (zuBoccaccio); §§ 63, 66, 74, S. 314 f., 279 ff., 322 ff., 359 f. – Die Position V. BRANCAS (vgl. die zusammenfassendeDarstellung in dem oben Anm. 317 genannten Beitrag, bes. 1283 ff.) bietet eine „realismusbezogene“ Variante des vonHEINZLE gerügten „Neuheits“-Syndroms: Boccaccio habe sich von den heroischen Exemplafiguren einer „absoluten“Vergangenheit und deren moralischen Abstraktionen wie von der „epopea“ zur „comedia“ hin entwickelt. Nach demDecameron-Vorwort wollte Boccaccio „casi … e avvenimenti … ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi“ bringen;dies bedeute bewußt realistische Hinwendung zur Zeitgeschichte. Merkwürdig ist m. E. dabei eher der Abstand, derBoccaccio trennt von Petrarcas Hypostasierung der Antike und der hohen historia (als Gegensatz zur fabula). EineÜberwindung mittelalterlicher „Geschichtslosigkeit“ vermag ich darin nicht zu sehen; vgl. S. 132 f., 228 f., Anm. 631.1013 Vgl. oben S. 4, 170, 183, 252 ff., 293 ff., 319 ff., 325 ff., 350 ff.
528
selbst gehört).1014 Die Auswahl aus diesem traditionellen Beispielschatz erfolgte in der gleichenpragmatischen Intention, nach der gleichen Konkordanzmethode und im gleichen Glauben an die eineunteilbare Wahrheit Gottes, wo immer sie sich finde.1015 Ein wichtiger Unterschied dürfte jedoch in
1014 Vgl. S. 142, 233 ff., 307 f., 217 f., A. 878, 892, 922. Zu der sehr beachtlichen Benützung patristisch-mittelalterlicherLiteratur durch die Renaissance-Humanisten erscheinen immer mehr Beiträge, die einen Großteil der älteren Renaissance-Forschung in Frage stellen: Vgl. grundsätzlich DONOVAN (wie Anm. 922) 185 mit einer Liste stereotyperForschungsurteile über die Nicht-Existenz einer solchen Tradition, sowie die Arbeiten von GEROSA (wie Anm. 45) und(gründlicher) LUCIANI (wie Anm. 528) zu Petrarca und Augustin (LUCIANI 9: „Pétrarque m’apparaît le plus ‚moyenâgeux’par rapport aux hommes de la Renaissance“; ebd. 211 ff. zu Petrarcas patristisch-hagiographischer Motivation zum Exempla-Gebrauch); BÉNÉ (wie Anm. 794) zu dem auf die christliche Antike angewandten ad fontes-Prinzip und zur ungebrochenengeistigen Unterordnung alles heidnischen Gedankenguts unter den Glauben in der Renaissance (S. 540 f., A. 896); SEIGEL33 zu Petrarcas (von Hieronymus beeinflußter) Furcht, er könnte Cicero zu exzessiv lieben (Fam. XXI 10; vgl. demgegenüberoben A. 685: Johann aktualisiert den „Prügeltraum“ niemals in dieser skrupulösen Weise); vor allem aber DONOVAN a.a.O.zu mittelalterlichen Autoren bei Salutati, Petrarca und Nicolas de Clamanges u. a., wobei besonders die Anwendung der„Renaissance“/renasci-Metapher auf Humanisten des 12. Jahrhunderts (190, 198) auffällt, denen damit offensichtlich die Ehrephilologischer „Wiedererweckung“ aus dem Schlummer spätscholastischer Nichtbeachtung zuteil wird (bes. zu SalutatiEp. III, 76.147 über Abaelard). Nicht weniger erstaunlich ist die Zeitklage über den kulturellen Verfall der eigenen Zeit (des14. Jhs.) gegenüber der einstmals so hochstehenden christlichen Bildung eines Bernhard von Clairvaux und eines Peter vonBlois (p. 197 zu Ep. III 43, unten Anm. 1042). Zu Salutatis Verehrung für Johann vgl. ebd. 193 f und oben S. 557, A. 340,603, 922. Wie wenig den Humanisten die Periode von Boethius zu Petrarca als nur „finster“ erschien, zeigt auch SalutatisEp. IV 126–145 (ebd. 196) an Poggio Bracciolini mit dem Hinweis auf Beda, Anselm, Bernhard und viele andere summitheologi, deren Eloquenz derjenigen antiker Autoren überlegen sei, da bei ihnen noch ein gelehrtes Christentumhinzukomme. (Ein so „patristisches“ Argument wird man übrigens bei Johann vergeblich suchen: Er mußte nicht geistlicheSchriftsteller gegen den modischen Vorwurf der Barbarei in Schutz nehmen, sondern antike auctores gegen denjenigen derUnchristlichkeit). Vgl. auch G. CONSTABLE, Petrarch and Monasticism, in: Franc. Petrarca Citizen of the World (Studisul Petrarca 8) New York 1980, 53–99. Noch nicht sehen konnte ich A.M. VOCI, Petrarca e la vita religiosa: il mitoumanista della vita eremitica, 1983. – Zur Bedeutung Johanns für die Humanisten vgl. auch G. BILLANOVICH, I primiumanisti e le tradizioni dei classici latine, Fribourg 1953, 59 (zu Petrarca, Valla und Handschriften Johanns), sowie S. 142,227 ff., 242 f., Anm. 603, 726, 742, 922.1015 Zur Konkordanzidee in der Renaissance vgl. BUCK, Patristik (wie Anm. 528) 153 f., 161, 166, 169 ff. Unerwähntbleibt hier jedoch, daß die damit verbundene Umdeutung der eklektischen Einstellung der Kirchenväter zur heidnischenLiteratur in einem humanistisch liberalen Sinn durchaus schon ein mittelalterliches Phänomen darstellt (vgl. oben §§ 94 ff.).Überhaupt bemüht sich BUCK in diesem Aufsatz von 1968, neuere Resultate zur christlichen Tradition in der Renaissancemit älteren, etwas peinlich gewordenen Vorstellungen vom humanistischen Paganismus ohne Gesichtsverlust für dieRenaissance-Forschung zu harmonisieren (s. oben in Anm. 798 ein symptomatisches Beispiel).
529
der Einschätzung des historischen Eigenwerts und der historiographischen Relevanz der Exempla liegen.Während Johann und die Humanisten des 14. Jahrhunderts sich der Exempla gleicherweise bedienen, um einemoralische Eigenschaft oder einen Beweis glaubwürdiger vorzuführen, wird nur bei den letzteren ein Bestrebenerkennbar, den Exempla als wirklichen Persönlichkeiten gegenüberzutreten, sie empirisch zu sehen, vonihnen richtiges Verhalten und Denken zu lernen, als wären sie Meister und Freunde, mit denen manzusammenlebt und geistig verkehrt.1016 Solches strebt Petrarca vornehmlich antiken (auch antik-christlichen)Exempla gegenüber an; Johann unternimmt es nicht einmal bei biblisch-heilsgeschichtlichen oderhagiographischen. Der Unterschied zwischen dem mittelalterlichen Exemplum und dem der Renaissance –wenn der paradigmatische Vergleich der beiden in der Forschung so oft nebeneinander gestellten Humanistenderart verallgemeinert werden darf – liegt also nicht in der moralischen Exemplarität und der rhetorischenFunktionalität der Beispiele, sondern in einer graduellen Verschiebung der Betrachtungs- undDarstellungsweise: Ein eher statisches, stilisiertes, schematisch ikonenhaftes, chiffrenhaft sinnbildlichesExemplum, das zeichenhaft-repräsentative „Denkbild in Menschengestalt“, wandelt sich zu einemdynamischeren, konkreteren, anschaulicheren, individuelleren Exemplum, einer bei aller Vorbildlichkeit dochunvertauschbaren Einzelpersönlichkeit. Deren Vergegenwärtigung oder imaginäre „Autopsie“ mit Hilfemöglichst präziser historisch-philologischer Detailkenntnis soll zur eigenen praktischen Lebenshilfe inentsprechenden Vergleichs-Situationen beitragen. Jede exemplarische Vergangenheit, in erster Linie dieheidnische und christliche Antike, sollte „ihr eigenes Gesicht zeigen, damit es zu einem echten Gesprächkommen konnte.“1017 Eher die Perspektive bestimmte den Wandel
1016 Vgl. LANDFESTER 10 u. ö.; KESSLER, Petrarca 105 ff.; LINDHARDT 40 (zu KESSLER); GILMORE (wieAnm. 214) 1 ff.; E. GARIN, Medioevo e Rinascimento, Bari 1954, 194 ff.; BUCK, Humanismus (wie Anm. 542) 236;ders., Die Rezeption der Antike in den roman. Literaturen der Renaissance, Berlin 1976, 14 ff.; s. S. 533 ff.; MINNIS,Authorship (wie Anm. 337) 211 ff. (vgl. A. 103); STIERLE, Gespräch (wie Anm. 546) 306 ff.; KÖLMEL (wie Anm. 599)237 ff.1017 „Denkbild…“: s. S. 339 f. – … „ihr eigenes Gesicht …“: LINDHARDT 27 in der Zusammenfassung der Positionen vonE. GARIN (wie Anm. 1016) 10, 101 und dessen, L’educazione in Europa, Bari 1957, 84 (GARIN verfaßte im übrigen auchden Policraticus-Artikel in Kindlers Literaturlexikon s. 1.). – Zum historiographischen Begriff der Augenzeugenschaft s.S. 212, 218 f. (zu Pol. II 1 1 [I] 84): Diese Berufung auf die schriftliche auctoritas desjenigen, der „dabei war“, hat nichts zutun mit dem Ideal eigener persönlicher Annäherung an eine exemplarische Gestalt der Geschichte.
530
als der Objektbereich und die philosophische Intention. Bedenkt man parallele kulturgeschichtlicheEntwicklungen – die Ausprägung des Wirklichkeitssinns in der Porträtmalerei oder in derPassionsikonographie; die theoretische Aufwertung der Sinne und Affekte gemäß einer Pathos-Ästhetik, ja„Gefühlskultur“ in allen Zweigen rhetorischer Repräsentation, insbesondere auf der Bühne, u.a.m. –, so dürftedie hier nur angedeutete Stoßrichtung des Wandels weder erstaunlich noch bestreitbar sein (so vieleAusnahme- und Grenzfälle man im einzelnen auf beiden Seiten des Übergangs auch aufzählen mag).1018
Anschaulichkeit oder die Macht der demonstratio ad oculos – die formale Hauptqualität in der Kunstlehre desExemplums – war nach mittelalterlicher Wertung ein Mittel zur Denknachhilfe für intellektuell Bedürftige,ein geistiger Köder für „schaulustige“ Sinnenmenschen oder bestenfalls eine poetische Einkleidung fürbelesene Auslegungskünstler, diente so oder so der Erklärung und Deutung abstrakter, universaler, „ewiger“invisibilia. Am Ende des Renaissance-Humanismus (wobei die Anfänge dieser Umwertung schon imspätmittelalterlichen Nominalismus liegen) gilt das „Sehen“ in jeder Bedeutung, d. h. die sinnlicheWahrnehmung überhaupt, die Erfahrung
1018 Mehr Perspektive als Objektbereich: so definiert auch BUCK, Rezeption (wie Anm. 1016) 10 den Wandel; vgl. auchders., Humanismus (wie Anm. 542) 229 ff.; RÜEGG, Cicero (wie Anm. 445) 295 ff.; STRUEVER 38; S. 180 f., 187 f.,199. Zu den Ausnahmen vgl. S. 542 ff. Allgemein zur Entwicklung vgl. z. B. GOETZ, Wirklichkeitssinn (wie Anm. 759)36 ff.; A. MIRGELER, Erfahrung in der Geschichte und Geschichtswissenschaft, in: Experiment und Erfahrung inWissensch. u. Kunst, hrsg. W. STROLZ, Freiburg/München 1963, 227–265, hier 250; A. v. MARTIN, Salutati (wieAnm. 43) 266 ff.; zu kunstgeschichtlichen Parallelen vgl. z. B.H. MÜHLMANN, Über den humanistischen Sinn einigerKerngedanken der Kunsttheorie seit Alberti, in: Zs. f. Kunstgesch. 33 (1970) 127–142, hier 139 f.; SAPORI (wieAnm. 1011) 439 von Giottos Symbol-Landschaft und Masaccios Perspektive; unten Anm. 1020 (GOMBRICH). –Willkommene Bestätigung von mediävistischer Seite gibt die theoretisch durchdachte Synthese GURJEWITSCHS (wieAnm. 313) über das „Weltmodell“ oder den Wirklichkeitsbegriff des Mittelalters: Was der russische Historiker etwa (341 ff.)zu der kaum vorhandenen Kategorie der „Individualität“ im Verhältnis zu den reich entwickelten Formen der Personifikationschreibt, läßt sich a fortiori auf das mittelalterliche Exemplum übertragen: Wenn schon die Persönlichkeitserfassung vonmal. Zeitgenossen – rhetorisch gesehen auf der causa-Seite – den Menschen auf seine Attribute und Eigenschaften reduziert,als „Gefäß“ von Tugenden und Lastern, als Kampfplatz äußerer allgemeiner „Kräfte“ begreift, wie viel leichter konnten dannAnalogien und Beziehungen zu dem definitionsgemäß als Persönlichkeits-Synekdoche und Eigenschaftsverkörperungfunktionalisierbaren Exemplum hergestellt werden!
531
des Partikularen als eine unersetzliche Erkenntnis sui generis.1019 Dies ist eine mehr mentalitäts- alsideengeschichtliche Feststellung: Die theoretische Legitimation blieb hinter dem praktisch folgenreichenInteressen- und Perspektivewandel in mancher Hinsicht noch lange zurück; die aristotelisch oder platonischfaßbare Überzeugung von der Überzeitlichkeit und Universalität der Wahrheit stand weiterhin in einem (aufdie Dauer problematischen) Verhältnis zu dem neu erwachten historischen Interesse und Realitätssinn.1020
Kontrovers ist nicht der Charakter, sondern der je nach Standpunkt heruntergespielte oder ausgedehnteGeltungsbereich der Veränderung, da sich daran ein wesentlicher Aspekt der Frage nach Kontinuität oderDiskontinuität der Epochen und damit nach dem Selbstverständnis der Renaissance und derRenaissanceforschung demonstrieren läßt. Vor allem Ernesto Grassi und seine Schüler haben dem Renaissance-Exemplum paradigmatische
1019 Zur didaktisch-paränetischen Bestimmung der Affektstimulation und Anschaulichkeit im MA vgl. S. 192, 195 ff.,232 f., 542; zur Aufwertung sinnlicher Erkenntnis und der Leidenschaftsästhetik in der Neuzeit S. 197, 199, 234 f.;STRUEVER 37 ff. u. ö. Auch hier ist freilich die funktionale Konstanz des Exemplums über die Epochen hinweg zubeachten: Gerade der homiletische Beispielgebrauch legitimiert sich stets als untergeordnetes Mittel der sinnlichenAufmerksamkeitssteigerung gegen Ermüdung; s. S. 197 f., 601 f., A. 164, 874, 921; BRÜCKNER, Hist. 38 ff.; ders.,Exemplasammlungen 604 ff. und Erbauung (wie Anm. 275) 140; sowie SCHENDA, Legendenpolemik (wie Anm. 669)28 ff. zur reformatorischen und gegenreformatorischen Propaganda mittels Exempla; ebenso gilt sinnlich imaginativeErkenntnis als Köder der Kindererziehung und der damit befaßten Literatur; vgl. HARTH, Chr. Wolfs Begründung desExempel- und Fabelgebrauchs (wie Anm. 95) 44 f.1020 Vgl. GILMORE (wie Anm. 214) 98 ff., 140 zu diesem Dualismus u. a. bei Erasmus, und allgemein LINDHARDT 39 f.(Besprechung von STRUEVER); Ernst H. GOMBRICH, Art and Illusion: A Study in the Psychology of PicturalRepresentation, Princeton 1960 = Kunst und Illusion, Zur Psychologie der bildlichen Darstellung, Köln 1967, 179 ff. zumWandel der Kunstanschauung bei gleichbleibender „Universalien-Theorie“ vom Mittelalter zur Neuzeit als einMethodenwechsel vom beispielhaften Illustrieren des Allgemeinen zum Nachweis des tieferen Wesens der Dinge durchBeobachtung (mal. Kunst zeige „ den Hund“, Renaissancekunst „Hunde“). HEITMANN, Dichtung u. Geschichtsschreibung(wie Anm. 43) 270 ff. zeigt die nach wie vor auch in der Neuzeit auf eine „philosophische“ Universalwahrheit gerichtete undexemplarische Geschichtsauffassung von Valla bis zu Leibniz: Das konkrete Detail wird theoretisch als Vehikel zumAllgemeinen (vor allem der Ethik) legitimiert; und doch gewinnt es methodisch einen expressiven Eigenwert. STRUEVER37 ff. sieht eine grundlegende Antinomie zwischen „Philosophie“ („truth beyond events“) und „Rhetorik“ („truth of events“)seit der Renaissance; vgl. auch JANIK (wie Anm. 600) 390 ff. in diesem Sinn zu Valla (philosophische Einsinnigkeit gegenrhetorische Vielsinnigkeit). Auf dem Hintergrund der stets problematischen Verbindung von Thesis und Hypothesis beiCicero und in deren humanistischen Tradition im Mittelalter läßt sich diese zur modernen „Zwei-Kulturen“-Diskussionführende Dichotomie auch als historisch sinnvolle Auflösung der bisher unproblematischen und erträglichen Ambivalenzeiner „anti-rhetorischen Rhetorik“ oder „rhetorischen Philosophie“ verstehen (§ 62, S. 191 f., 196, 246 ff., 384). Der vonGünther BUCK, Beispiel 819 ff. als neuzeitlich definierte Beispielbegriff seit Comenius, der sich vom mittelalterlichendurch den Vorrang sinnlicher Erkenntnis vor deduktiven Verfahren unterscheide, bildet eher eine mentalitäts- als einephilosophiegeschichtliche Kategorie. Dasselbe gilt von LANDFESTERS (59, 134) Geschichts- und Erfahrungsbegriff.
532
Bedeutung für eine spezifische Weltsicht zugeschrieben.1021 Diese wird in der Hauptsache bestimmt vomVorrang der „Geschichtlichkeit der Sprache“, des „bildnerischen Denkens“, der topischen Imagination undKommunikation gegenüber dem von der Scholastik bis zu Descartes (und damit bis heute) vorherrschendenszientifischen Rationalismus, den zu bekämpfen sich diese Schule zur weltanschaulichen Aufgabe gemacht zuhaben scheint. Da Grassi seine Thesen programmatisch für weitere Forschung verkündet, sind Übertreibungenverständlich. Wenn der (theoretisch interessierte) Mediävist den humanistischen Affekt gegen moderneWissenschaftsgläubigkeit sogar sympathisch finden mag, so kann er sich doch keinesfalls mit Grassi die Optikder Renaissancehumanisten zu eigen machen und muß offenkundige, tendenziöse Verzeichnungen desMittelalters zurechtrücken. So zieht Grassi aus Einzelstellen der dialektischen Philosophie Abaelards überzeitlos richtige axiomatische Sätze der Logik die unfair generalisierende Schlußfolgerung, das Mittelalter habedie „wissenschaftliche Bedeutsamkeit der rhetorischen Sprache abgelehnt“. Die oberflächlichste Kenntnis der„anticornificianischen“
1021 Vgl. E. GRASSI, Die Macht der Phantasie (wie Anm. 11) bes. 97 ff.; ders., Macht des Bildes: Ohnmacht der rationalenSprache, Zur Rettung des Rhetorischen, Köln 1970, 138 ff., 200 ff.; ders., Humanismus und Marxismus, Zur Kritik derVerselbständigung von Wissenschaft, Reinbek 1973; weitere Beiträge in den folgenden Anmerkungen. Eine grundsätzlicheKritik an GRASSIS allzu scharfer Entgegensetzung einer topischen und einer rationalistischen Philosophie im Abendland(Vico versus Descartes) bei O. PÖGGELER, Topik und Philosophie, in: BREUER/SCHANZE, Topik (wie Anm. 645)95–123, hier 110 f.; vgl. auch APEL (wie Anm. 600) 197–200: „Zum Humanismusverständnis E. Grassis“, bes. 198: „DieseInterpretation denkt […] die italienischen Denker [Guiciardini, Macchiavelli, G. Bruno, Vico] mit Hilfe einerphilosophischen Konzeption zu Ende, die weit über deren eigene Ansätze hinausgeht […], erst recht aber würde sie diegeistige Haltung und Reichweite der großen Masse der spezifisch humanistischen Texte verfehlen“. Der übertriebeneDualismus und Antikartesianismus führt Grassi auf der Gegenseite zu einer Projektion seiner Abneigung gegen den „esprit dela méthode“ auf alle mittelalterliche (mit scholastischer gleichgesetzte) Logik. Zur Kritik an diesem Antirationalismus-Syndrom vgl. S. 195, 251, 422.
533
und topischen Wissenschaftstheorie Johanns von Salisbury, der immerhin auch ein eminenter Abaelardschülerwar, hätte solche irreführenden Urteile aufgrund eines unstatthaft simplen Mittelalterbildes verhindert.1022
Das von Grassi entworfene Programm wurde in mehreren Arbeiten der von ihm herausgegebenen„Humanistischen Bibliothek“ ergänzt und präzisiert. Eigens mit dem Policraticus als Kontrastbeispiel zum„echten“ Humanismus beschäftigte sich Dietrich Harth in seiner Erasmus-Monographie. Ähnlich, wie GrassiAbaelards Denken auf Formallogik reduziert hat, nur noch einseitiger, sieht Harth in dem, was Johann unter„Eloquenz“ verstand, „ein Produkt der Logik, […] von der antiken Auffassung weit entfernt“, ein Mittelbloßer Disputationskunst zur Enthüllung universeller, immergültiger Wahrheit.1023 Eine zentrale Stellungnimmt das Exemplum in den Arbeiten von Eckhard Keßler über die italienische Renaissance ein, in deneneine insgesamt gerechtere und differenziertere Beurteilung des Mittelalters angenehm auffällt. Zunächst läßtKeßler keinen Zweifel an der ungebrochenen Tradition des pädagogischen historia magistra vitae-Axioms, dasbis zur Renaissance dem Exemplum seine wichtigste theoretische Legitimation und Funktion gab. Trotzeiniger in der Linie Grassis liegender Übertreibungen zur deduktiven und illustrierenden Anwendung diesesPrinzips im Mittelalter im Verhältnis zu den „echt induktiven“ Methoden der Renaissance scheint mir dasHauptergebnis überzeugend – es bot für die hier maßgeblichen Fragen eine Hauptanregung –, daß Humanistendes 14. Jahrhunderts unter dem erkenntnistheoretischen Primat der Induktion den antiken Exempelgestaltenein empirisch-praktisches Interesse entgegenbrachten, das so – aufgrund genereller Überbewertungapriorischer Reflexion gegenüber der Erfahrung des Zufällig-Partikulären – im Mittelalter nicht möglichwar.1024
1022 GRASSI, Macht der Phantasie (wie Anm. 11) 103 f. Als Urteil über Abaelard und als Generalisierung (Abaelard vertrittdas Mittelalter) ist dies gleicherweise unhaltbar (s. S. 266 ff., Anm. 442, 486). Zu Johanns topischer Wissenschaftslehre vgl.S. 252 f., 285 ff., 308 ff.; ODOJ 11 ff., 56 ff. (Joh. als Vorläufer Vicos), 29 f. (Vernachlässigung Johanns in derRenaissanceforschung aufgrund der einseitigen Gleichsetzung von Mittelalter und Scholastik); Dal PRÀ 74 ff. zu JohannsKritik an einseitiger Dialektik; ebd. 156 ff.: Johann in der Tradition abendländischer Skepsis von Karneades über Ockham zuHume.1023 HARTH (wie Anm. 43) bes. 16 ff., 29 zu Met. III 4 und dem Pol.-Prolog (clientes-Bild); vgl. oben §§ 61, 87, S. 417 ff.1024 KESSLER, Problem … bei Salutati, bes. 184 ff.; ders., Petrarca 112, 116 ff., 134, 247; ders., Geschichtsdenken 112 f.,129. – Zur exemplarischen Geschichtsauffassung s. Petrarca 134 (zu Ep. VIII 6); Problem 35 ff., 204 ff.; zustimmendLANDFESTER 20 und pointiert R.G. WITT in der Rezension des Petrarca-Buchs für Spec. 55 (1980) 804: „The authorconcludes that Petrarch – and with him all historians down to the eighteenth century – could be considered medieval“. Imgleichen Sinn vgl. auch LINDHARDT 40 und S. 26 ff. Übertreibungen: KESSLER Geschichtsdenken 132, der obligateVergleich Dante (Mittelalter)–Petrarca (Renaissance) wie zwischen zwei Epochensymbolen, wobei der eine die Wahrheitbestätige, der andere neue Wahrheit suche. Daß Dante nicht unbedingt für das deduktivapriorische Denken „des“ Mittelaltersrepräsentativ ist, hat schon H. FRIEDRICH gezeigt (s. oben § 10). KESSLER, Geschichtsdenken 112: Petrarcas Umgangmit den historischen Quellen wird mit Recht als nicht kritisch (im modernen Sinn), sondern als auf Wahrscheinlichkeit undimitatio gerichtet erklärt; dies ist aber bei Johann und vielen Autoren des Mittelalters keineswegs anders: vgl. S. 219 ff.,228 f.; weitere kritische Randbemerkungen zu KESSLER s. oben Anm. 424, 874.
534
Besonders charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die Beliebtheit des freilich schon alten Topos vom„hohen Geistergespräch“, vom Freundschaftsdialog mit den auctores, dem ein wesentlich persönlicherer,konkreterer Sinn verliehen wurde. Petrarca ging es offenbar um mehr als um eine Metapher, wenn er einpersönliches Gespräch mit den Alten für möglich hielt und es dem oberflächlichen Alltagsverkehr mit seinenZeitgenossen vorzog. Einen größeren Gegensatz zu dieser Vorstellung als diese utilitaristische clientes-Metapher Johanns (oben S. 392 ff.) kann man sich schwerlich denken.1025
1025 Zur Bedeutung des Gesprächs mit den Toten der Antike vgl. neben KESSLER, Petrarca 111 ff. auch E. GARIN, Lastoria del pensiero del rinascimento, in: ders., Medioevo e Rinascimento (wie Anm. 1016) 194 ff., bes. 204; GILMORE(wie Anm. 214) 5 ff., 17; BUCK, Rezeption (wie Anm. 1016) 16 f. – Eine Stelle wie Petrarca, Fam. 24.9 (ROSSI IV 229)an Cicero: Ex libris animum tuum novi, quem noscere mihi non aliter quam si tecum vixissem videor, ist mit Pol. Prol. I 16(s. oben Anm. 370, 780) zu vergleichen: Wo Petrarca Freude über die persönliche Begegnung ausdrückt, betont Johann dasBehelfsmäßige der nur noch über die schriftliche Tradition möglichen Kenntnis antiker Gestalten. Von uns her läßt sichletzteres (aufgrund der oben Anm. 36 erwähnten Prämissen) sogar als die „realistischere“ und „aufgeklärtere“ Ansichtverstehen; jedenfalls drückt sich darin nicht „moderne“ Geringschätzung der antiqui aus (wie RÜEGG zum nani-gigantes-Gleichnis behauptet; oben Anm. 538), sondern ein Sinn für menschliche Kontingenz (vgl. auch Anm. 1047). Zur Traditiondes Bildes vom Geistergespräch vgl. vor allem Sen. Ep. 104.21–22 (im Mittelalter allerdings ausüberlieferungsgeschichtlichen Gründen kaum bekannt); Ep. 98.12 (Geisterbeschwörung, convictus, conversatio) und dazuRIEKS (wie Anm. 774) 97; DÖRING 18 f., sowie die grundlegende Arbeit von Klaus THRAEDE, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik, (Zetemata 48), München 1970, die überwiegend dem Brieftopos der Präsenzgewinnung durch dasSchreiben gewidmet ist (bes. 39 ff., 65 ff., 146 ff.). – Zum Aspekt der Gegenwartsflucht zurück zu den großen Ahnen vgl.KESSLER, Petrarca 115 f.; ders., Geschichtsdenken 112 vor allem zu Fam. IV 4 und unten § 113. – Den Vergleich mitJohanns clientes-Metapher (s. oben § 87) stellt HARTH (wie Anm. 43) 16 f., 29 auch ausdrücklich an, allerdings nicht zuPetrarca, sondern zu Erasmus (was a fortiori berechtigt ist). Die kontextuellen Unterschiede sind dabei jedoch nicht zuübersehen. Ähnliche Bildvorstellungen der Überlegenheit oder zum mindesten der Verfügungsmacht der moderni über dieAntike gab es auch noch in der Renaissance. Vgl. BUCK, Begriff und Problem der Ren. (wie Anm. 543) 8 zu Luis Vives:„Die Alten sind zwar unsere Wegbereiter, aber nicht unsere Herren“. (Opera, Valentine 1785, VI 6 f., Praef. In libro dedisciplinis). Sogar Petrarca selbst benützte an anderer Stelle, in De sui ipsius et multorum ignorantia, nach Aug.Conf. 7.9.15 das Bild der ägyptischen spolia (s. S. 396) und betonte die Überlegenheit der christlichen Moderne über alles(selbst das antike) Heidentum; vgl. GNILKA (wie Anm. 729) 71 f. (88); BUCK, Petrarca (wie Anm. 528) 11 und obenAnm. 539. Der Unterschied zwischen der mittelalterlichen und der humanistischneuzeitlichen usus- oder Verwertungs-Metaphorik (hier clientes, dort „Freunde“) liegt also nicht in der weltanschaulich festgelegten Ranghöhe der heidnischenAntike, sondern einzig in der Rezeptionsart, die utilitaristisch-distanzlos oder reverent-historisierend sein konnte.
535
Neuen Glanz im Sinne plastischer Vergegenwärtigung erhielt auch die Spiegelmetapher, die traditionell dieSelbsterkenntnis durch Vergleich mit großen Mustern empfehlen sollte und nun auf analytische biographisch-autobiographische Persönlichkeits-Kontrastierungen bezogen wurde. Dabei befreit zwar das subjektiv-introspektive Reflexionsideal das Exemplum von didaktischer Subsumierbarkeit unter Regeln und Normen,schwächt aber auf der Gegenseite dessen gesellschaftliche Vergleichbarkeit. Da das Exemplum grundsätzlichauf die Verbindung von Allgemeinem und Besonderem angewiesen ist, verliert es seinen spezifischenErkenntniswert nicht nur in der trivialen Aufzählung beliebig vertauschbarer „Muster“ für unproblematischeWahrheiten – „Warenmuster“ ist der erste etymologische Sinn von exemplum –, sondern auch in derKonstruktion eines nicht weiter generalisierungsbedürftigen oder generalisierungsfähigen Vergleichs zwischenreinen Individuen. Im Unterschied zum echten, d. h. repräsentativen platonischen Gesprächs-Exemplumtendiert die nur innersubjektive „Begegnung“ von der Exemplum-Funktion weg ins Private. Auch dieAutobiographie kann zwar durchaus verallgemeinerungswürdiger Selbstvergleich auf verschiedenenEntwicklungsstufen sein, wird aber als „Nabelschau“ zum extremen Gegensatz des Exemplums. Ein reinindividuelles Exemplum ist nicht nur ein ineffabile, sondern eine contradictio in adiecto. Die problematischeSpannung zwischen dem Repräsentativen und dem Persönlichen im Exemplum, die Petrarca bei seinem Eifer,antike Helden subjektiv zu verlebendigen, kaum zur Sprache bringt, hat zweihundert Jahre nach ihmMontaigne scharfsinnig analysiert, etwa, indem er das humanistische „Autopsie“-Postulat probehalber mitdieser Zuspitzung ad absurdum führte: „Das Leben Cäsars hat keinen größeren Beispielwert für uns als unsereigenes Leben“. Was sollen Exempla der Antike, wenn der allerkonkreteste und moralisch lehrreichsteReflexionsgegenstand aus der Geschichte, das eigene Ich, zur Verfügung steht? Die Autobiographie enthält inder Tat gute und böse Präzedenzfälle für alle Lebenslagen,
536
nicht weniger nützliche als die Weltgeschichte. Doch diese subtile Vertiefung der historischen Grundidee desExemplums – das generelle tertium comparationis ist hier die Identität des Individuums durch die Jahre –bleibt insofern dem frühhumanistischen Ideal einer unmittelbaren menschlich-zwischenmenschlichenWirklichkeitserfahrung verwandt, als Montaigne im 16. Jahrhundert keineswegs mehr die mittelalterlichen,sondern die inzwischen „trivialhumanistisch“ gewordenen Exempla aus der Bilderbuchwelt der Antike, diesubsumierbar-regelhaften Tugend- und Lasterembleme für Selbstverständliches und Offizielles, dieliterarischen Heldenklischees verwirft, um nun an Stelle der „echten“ Begegnung mit den großen antiqui auchdie eigene Selbsterfahrung und Selbstfindung zu pflegen: „Ich möchte mich lieber in mir selbst auskennen alsim Cicero.“1026
112. Die Voraussetzung für den unbestreitbaren Hang der Renaissance-Humanisten nach individuellerBegegnung mit den „wiederbelebten“ alten Meistern, für die liebevolle Aufmerksamkeit für jedes, auch daskleine menschliche Detail an diesen übergroßen Vorbildern, war die Entdeckung, daß diese maiores wirklichfern und gestorben sind. Bis dahin standen sie in quasi zeitloser, gleichzeitiger Exemplarität zur Verfügung.Die empirischpraktische Konzeption oder die Historisierung des Exemplums entstand in der Renaissanceparadoxerweise gerade aus einem Distanz- und Verlusterlebnis
1026 Zum „Spiegel“ in der Selbsterkenntnis-Tradition vgl. S. 98 f., 166, 171 f., 552 f. COURCELLE, Connais-toi (wieAnm. 247) 22, 49 u. ö.; KESSLER, Geschichtsdenken 129. – ‚Essais’ III 13 (wie Anm. 192) 1051; „J’aymerois mieuxm’entendre bien en moy qu’en Ciceron […] La vie de Caesar n’a poinct plus d’exemple que la nostre pour nous“. Vgl. dazuSTIERLE 372: die Geschichte werde von der „Lehrmeisterin“ zum Gegenstand einer Reflexion über den reinen Einzelfall, derin letzter Konsequenz mit keiner Regel oder Parallele, sondern nur noch mit sich selbst übereinstimme. Gegen eine allzuweitreichende Interpretation solch geistreichkritischer Zuspitzungen Montaignes vgl. jedoch SCHON 70 ff.: Gerade seineLieblingsgedanken pflegt der große Skeptiker ironisch zu brechen, so auch seine Verehrung römischer und plutarchischerExempla und seine eigene Exempla-Exzerpt-Technik. Er wirft sich den oft gerügten Fehler selbst vor, im Glashaus zu sitzenund Bücher auszuschreiben, anstatt die Wirklichkeit, die eigene Vergangenheit, zu studieren. (Zu einer Parallele bei RobertGaguin vgl. GILMORE [wie Anm. 214] 89 f.: Apologie zeitgenössischer Beispiele gegen den Kult antiker Exempla). Vorallem aber steht seine Betonung der Vielfalt des historisch Individuellen in einem dialektischen Verhältnis zu seiner Suchenach bestimmten Gleichförmigkeiten in „exemplarischen Existenzen“; vgl. dazu STAROBINSKI (wie Anm. 985) 471;TOURNON 292 ff. Das Thema heißt hier jedoch nicht Montaigne, sondern das von ihm in utramque partem gewendetePrinzip, daß das Exemplum immer auch eine „Regel“ oder „Struktur“ voraussetzt, ein Minimum an Generalisierbarkeiteinschließt und darum das Gegenteil des „Einzigartigen“ darstellt (dazu vgl. PERELMAN, wie Anm. 10) 119; vgl. auchoben Anm. 58.
537
gegenüber dem, wenn man will, naiven kulturellen Kontinuitätsbewußtsein des Mittelalters.1027 Dasselbe läßtsich mit anderer (mehr historistischer) Wertung so formulieren: Erst die italienischen Humanisten des 14. und15. Jahrhunderts haben den unverbesserlichen Anachronismus, in dem das Mittelalter einer brauch- undmißbrauchbaren Antike gegenüber lebte, kritisch durchbrochen dank der neugewonnenen Fähigkeit, die„Alterität“ von Vergangenem zu sehen und durch historisch kontrastierenden Vergleich für die Gegenwartfruchtbar zu machen.1028
1027 Zu diesem m. E. einzigen wirklich beachtenswerten Epochenunterschied gibt es in der Forschung zahlreicheBestätigungen seit der folgenreichen Formulierung durch Erwin PANOFSKY, Renaissance and Renascences in Western Art,Stockholm 1960 Kap. 1–2 (z. T. bereits in Kenyon Review 6 [1944] 201–36; vgl. ‚Renaissance and Renewal’ [wie Anm. 7]Introd. XXIV f. zur heutigen mediävistischen Diskussion der These); vgl. etwa noch BUCK, Begriff (wie Anm. 539) 20,ders., Rezeption (wie Anm. 1016) 10 ff.; ders., Humanismus (wie Anm. 538) 225, 237; LINDHARDT 27 f., 29 ff.;GARIN, Educazione (wie Anm. 1017) 84, 100 ff.; G.M. SCIACCA, Il valore della storia di Col. Salutati, in: Annali Fac.Lett. e filos., Univ. di studi di Palermo 1950, 352–66; GILMORE (wie Anm. 214) 5 ff., 108 ff. Peter BURKE, TheRenaissance Sense of the Past, London 1969, Kap. I.1028 LADNER, Renewal (wie Anm. 181) betont, daß erst das Distanzerlebnis der Renaissance den „Wiedergeburtsbegriff“möglich machte. Im Klassizismus und Humanismus des 12. Jahrhunderts waren nämlich die antiqui „noch am Leben“. Derin der Einleitung der Herausgeber R.L. BENSON und G. CONSTABLE zu ‚Renaissance and Renewal’ (wie Anm. 7) XXVzusammengefaßte Einwand, das 12. Jh. habe das Bewußtsein der „eigenen Modernität“ erlangt, bestätigt im Gegenteil diedistanzlos „ausbeuterische“ Einstellung einer „nützlichen“ Antike gegenüber (§ 87, S. 534 f.); vgl. MISCH 1169, 1185;BATTAGLIA 468; von MOOS, Lucans tragedia 130 (mit weiteren Literaturangaben). – Für irreführend halte ich auch denVersuch, einzelnen, namentlich monastischen Humanisten des MAs eine „selfdelighting fascination“ an einer„verinnerlichten“ Antike zuzuschreiben, eine Klassikerverehrung, die „utilitaristischen“ Humanisten wie Johann fremd sei (soTHOMSON [wie Anm. 835] 119 ff., s. auch oben Anm. 840): Trotz des zweifellos wichtigen Unterschieds zwischen dermehr meditativen auctores-Lektüre im Kloster und der direkten rhetorisch-strategischen Verzweckung antiker Lesefrüchte imPolicraticus, sind beide Beschäftigungen weit entfernt von neuzeitlicher Bewußtwerdung historischer Distanz, prägen diese„Distanzlosigkeit“ vielmehr nur auf eigene Weise, mehr spirituell oder mehr moralphilosophisch aus. Den generellen„unbewußten Anachronismus“, in dem das MA mit der Antike lebte (vgl. auch Anm. 676) sollte die Mediävistik nichtleichtfertig leugnen, – sei es nur, um der Renaissanceforschung keinen Anlaß zum Vorwurf zünftlerischer Borniertheit zugeben. Die einfachste Formulierung für das Gemeinte ist vielleicht HUIZINGAS Parodie eines Bibelwortes (Abaelard [wieAnm. 541] 167): „Das Altertum hatten sie alle Zeit bei sich“. Wie alle andere Vergangenheit lieferte es immer neue,wiederholbare Motive für die Gegenwart und hätte einen guten Teil solch lebendiger topischer Wiederholbarkeit eingebüßt,wenn man es im modernen Sinn historisch etwas genauer gekannt hätte (vgl. HELBLING (wie Anm. 252) 92 f.).
538
Es ist eine Ironie der Wissenschafts- und Bildungsgeschichte, daß wir uns bereits derart an das mit dem Endedes Mittelalters entstandene „Objektivieren“ oder Gegenübersetzen gewöhnt haben, daß wir dieAndersartigkeit eines Zeitalters, dem die historische Alteritäts-Vorstellung abging, nur noch mit Müheverstehen; daß wir jene fundamentale Subjekt-Objekt-Einheit bei mittelalterlicher Rezeption literarischer undhistorischer Gegenstände sowie die darauf beruhende Unschärfe in der Unterscheidung schriftlich überlieferterGeschichtszeugnisse und äußerer „realer“ Geschichtsfakten nur mit einem besonderen Akt hermeneutischerSelbstverleugnung rekonstruieren können. Doch es gilt, die von den Humanisten erstmals konzipierteAufgabe, Vergangenes als eigene Welt zu erfassen, auch an ihrem methodischen Gegenteil: dermittelalterlichen Hermeneutik, zu erfüllen. Einzelne Beobachtungen dürften die dabei entstehendenSchwierigkeiten besser zeigen als ein ausführlicher Forschungsbericht zum Realitätsbegriff in Mittelalter undRenaissance.
Den Lucan-Vers I 44: „viel verdankt Rom dem Bürgerkrieg“ erläutert ein spätmittelalterlicher Kommentatorlakonisch:1029 „Denn dieses Ereignis ist zu deinem Nutzen geschehen.“ Wohlverstanden: „geschehen“, nicht:„gedichtet“, „aufgeschrieben“, „überliefert worden“. Die Geschichtswirklichkeit selbst ist identisch mit der alshistorische Quelle gelesenen Pharsalia. Sie wird nicht einmal vorgängig als eigene Dimension dem, was Lucanin seinem bitteren Sarkasmus sagen wollte, gegenübergesetzt; der Bürgerkrieg ist „für dich“ als Lehre undWarnung vor dem Übel des Krieges geschehen. Das historische Faktum als solches gibt es nicht; es fand –aufgrund einer interiorisierten Providenzvorstellung – bereits im Ereigniszeitpunkt als Lehre und Zeichenstatt. Ähnliches läßt sich an einem biblischen Beispiel zeigen: Der Raub der ägyptischen Gold- undSilbersachen beim Auszug der Juden aus dem Exil hat im modernen Verständnis eine historische oder literaleBedeutung, die (schon im Religionsunterricht für Kinder) nach Erklärungen ruft: Tatmotiv und milderndeUmstände dieses Diebstahls sind ein schwer zu umgehendes Thema. Im Mittelalter galt solcheBetrachtungsweise höchstens als irregeleiteter Umgang mit dem sensus litteralis, den man etwa demspitzfindigen Anwalt eines Räubers vor Gericht zutraute. Das „Vergehen“ der Juden konnte keinenunmoralischen Sinn haben, da es von seiner Bedeutung für die Nachwelt gar nicht abgelöst gedacht werdenkonnte (oder sollte). Es ist nur
1029 M.A. Lucani Pharsalia vol. III: Scholiastae, ed. C.F. WEBER, Leipzig 1831, 13: ‚Multum debet civilibus armis’: Etquamvis multa mala evenerunt per civile bellum […] Nam ad utilitatem tuam est res haec acta. (Aus den Scholien der HS.einstmals Berlin, Kgl. Bibl. lat. fol. 34, s. XIII/XIV, vgl. ebd. XXVI). Zur stereotypen dissuasiven utilitas-Bestimmung derPharsalia im Mittelalter (dehortatio a civili bello) vgl. von MOOS, Poeta und historicus 124 f.
539
deshalb geschehen, damit die Christen dereinst – nach offizieller und sakrosankter Allegorese – heidnischeLiteraturwerke für geistliche Zwecke „ausbeuten“ dürfen.1030 In beiden Fällen ereignet sich also Geschichtenicht „für sich“, sondern als Text „für uns“, im Hinblick auf eine besondere, in ihr bereits angelegteInterpretation und Nutzanwendung.
Dem zutiefst anachronistischen, zeitenthobenen Interesse am eigenen kulturellen Erbe, das aus solchenZeugnissen spricht, kann der „historische Sinn“ der Renaissance: die sich vom 14. zum 16. Jahrhundertallmählich entwikkelnde Fähigkeit des hermeneutischen „Standortwechsels“, entgegengestellt werden. Welcheunerwartete Konsequenzen dieser Epochenwandel für die Rezeption antiker Literatur haben konnte, zeigteine Beobachtung Heinrich Dörries zu den Heroiden Ovids im 16. Jahrhundert:1031 Antike auctores undpoetae lebten und schrieben nach mittelalterlichem Verständnis grundsätzlich
1030 Rhet. eccl. (wie Anm. 8) 41: … respondere possumus ex causa, quod quaedam in antiquo populo significationis causafuere permissa, quae in ecclesia dei hodie sunt recidenda […] Item si contendat adversarius uxorem et alienigenis ducendamexemplo Samsonis, significationis causa et hoc permissum est […] Item si probetur rapinam licere exercere exemploIsraelitarum, qui a vicinis Aegyptiis accommodatis sibi preciosis eorum abierunt [Exod. 3.22, 11.2, 12.35–6]. Hoc enim adhoc illis fuit permissum, ut aliud in ecclesia significaret agendum, paginas videlicet philosophorum quasi quasdam domosAegyptiorum spoliandas exemplis et sententiis quaesitis et quodam ornatu verborum illius paginae quasi spoliis quibusdamdeo construendum tabernaculum, ut ipse apostolus et Augustinus et Hieronymus fecerunt. Vgl. auch oben Anm. 929 zuJohanns „mystischer“ Rechtfertigung Judiths. Zur Theorie der juristischen Exempla-Auslegung, die hier den Kontext bildets. oben Anm. 643 f., 654, 486. Zur traditionellen Allegorese der spolia Aegyptiorum vgl. oben Anm. 734, 795, 803 undGNILKA (wie Anm. 729) 71 ff.1031 DÖRRIE, Der heroische Brief (wie Anm. 877) 363 f. Zur mal. Ovid-Allegorese s. oben Anm. 913 und O. SCHWENKE,Zur Ovid-Rezeption im Mittelalter, Metamorphosen-Exempel in biblisch-exegetischen Volksschriften, in: ZfdPh 89 (1970)336–46. Zur mal. Integration der erotischen Rolle Ovids (neben der Allegorie vor allem durch das Exemplum dissuasivum indem oben § 49 ausgeführten Sinn) vgl. MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 56. – Ein ähnliches Beispiel bietet die Cicero-Rezeption: Im Mittelalter waren moralische Schwächen des größten römischen Redners nicht unbekannt (s. oben Anm. 398zu Johann), aber sie interessierten nicht biographisch, sondern höchstens als negatives ethisches Beispiel und beeinträchtigtenin keiner Weise den literarischen Rang der Werke Ciceros. Erst Petrarca „entdeckt“ gleichzeitig mit den Briefen an Atticus,Quintus und Brutus (in seinem Bestreben, Cicero als „Freund“ zu begegnen) auch dessen „Fehler“ in einem konkretexistentiellen und von der Literatur nicht mehr problemlos abzulösenden Sinn. Vgl. dazu die überaus aufschlußreichen Seitenvon MINNIS a.a.O., 211 ff. – Treffend bringt ROUSSET (wie Anm. 361) 629 f. die mittelalterliche Paradoxie desKulturgebrauchs auf den Nenner, daß der „goût du passé“ ebenso intensiv sei wie die eingewurzelte „volonté d’ignorer letemps“. Vgl. S. 454, 517 ff.; SPIEGEL (wie Anm. 181) 322 f.: „To the very degree that men in the Middle Ages sensed thereality of the past, they were incapable of perceiving with equal acuteness its distance“. Sehr erhellend für den Gegensatzzwischen anachronistischer und historischer Einstellung ist die schon von BORST (wie Anm. 486, 31, allerdings mit andererKonsequenz) angeführte Schelling-Stelle (Die Weltalter,… ed. M. SCHRÖTER, München 1946, 11): „Wie wenige kenneneigentliche Vergangenheit! Ohne kräftige, durch Scheidung von sich selbst entstandene Gegenwart gibt es keine. Der Mensch,der sich seiner Vergangenheit nicht entgegenzusetzen fähig ist, hat keine, oder vielmehr kommt er nie aus ihr heraus, lebtbeständig in ihr“.
540
ad nostram doctrinam, mochte ihr Lebenswandel noch so zweifelhaft, ihre Produkte noch so frivol,blashemisch, obszön oder zynisch sein. So galten die Heroiden als moralische Exempelgedichte, die nebenehrwürdigsten christlichen Autoritäten bis hin zur Bibel zitiert werden konnten (weil ihr „geistiger Sinn“ einfür allemal feststand). Die Renaissance wollte den trügerischen Schein der Allegorie beseitigen, denursprünglichen Sinn der Dichtung (oder was man dafür hielt) wiederentdecken. Doch die gleichzeitigeReformation suchte zensurierend zu verhindern, daß der nun in voller unchristlicher Echtheitwiedererstandene erotische Dichter jugendgefährdend werden konnte. Zum Ovidius moralisatus führte keindirekter Weg zurück. Ovid ließ sich als „Dichter der Schlüpfrigkeit“ konfessionell bannen; später konnte er inanderer Art wieder allegorisch „gerettet“ werden. In der frühen Neuzeit überlebte er vornehmlich dankethischer Umkehrung in den Heroides sacrae. So stehen wir vor einem „ironischen“ Ergebnis: Ein imMittelalter vielgelesenes Werk der „goldenen Klassik“ büßte im Laufe der Renaissance und zum Teil geradeaufgrund humanistischer Prinzipien seine privilegierte Stellung im Lektürekanon obligater Bildung ein. DieHauptursache für diese Kuriosität liegt in dem auf beiden Seiten der „Erneuerung“ – der humanistischen undder evangelischen – lebendigen Bestreben, ad fontes zu gelangen. Mit Hilfe philologisch sauberer Texte solltevergangene Wirklichkeit – die römische Kultur und die Welt Jesu – als solche, d. h. so wie sie sich für damalsLebende darstellte, nicht so wie spätere Sinngebung sie gebrauchsfertig zugerichtet hatte, möglichstnaturgetreu rekonstruiert werden, und doch sollte diese echte Rekonstruktion des Ursprünglichenselbstverständlich nicht weniger idealisierungsfähig und exemplarisch sein als die überwundenen allegorischenund sonstigen utilitaristischen Projektionen des Mittelalters.1032 Das Bedürfnis nach historisch reinen undmoralisch vorbildlichen „Quellen“
1032 Zur Begründung des philologischen Humanismus aus dem Wunsch, den erst neu festgestellten historischen Abgrund, dieerschreckende Zeitendistanz durch fleißige Rekonstruktionsarbeit wieder zu überbrücken vgl. SEIGEL (wie Anm. 394) 261;GILMORE (wie Anm. 214) 5, 17 ff.; G. BILLANOVICH, Petrarch and the Textual Tradition of Livy, in: JWCI 14 (1951)137–208 sowie ders., in: BOLGAR, Classical Infl. (wie Anm. 423) 57–66 mit einer Zusammenfassung seiner zahlreichenForschungsergebnisse zur Textkritik Petrarcas. Auch hier muß vor Generalisierungen gewarnt werden: Nicht alle Humanistenwaren stets um den reinen Originaltext bemüht; oft genug ging es auch ihnen allein um das rhetorisch effizienteWeiterreichen approbierter (d. h. „wahrscheinlicher“) Überlieferung; S. 217, 228, 533 f. Montaigne, Essai I 21 (wieAnm. 192) 104 f. in Anm. 496, beruft sich auf Plutarch für den höheren Wert des moralischen Nutzens gegenüber derhistorischen Wahrheit, die er nur als eine „vérité emprunté“ versteht. – Zum Verhältnis von humanistischen undkonfessionellen ad fontes-Prinzip vgl. S. 414 f., 450; BUCK Patristik (wie A. 528) 170 f.; BENE (wie A. 794) passim;MAURER, Melanchthon (wie A. 879) passim und BRÜCKNER, Hist. 38 f. zum Zusammentreffen humanistisch-philologischer Gelehrsamkeit, Idealisierung der „Ursprünge“, Verdächtigung aller Tradition als Eintrübung des reinenUrquells bei Melanchthon. Vgl. die ganz gegensätzliche Hochwertung aller kulturellen Vermittlung bei Johann S. 154. – Zubeachten ist neben der der ad fontes-Parole auch der zunehmende Rigorismus, die reformatorische und gegenreformatorischeDomestizierung aller Lebensgebiete im nachmittelalterlichen Christentum, einem „christianisme systématique et capillaire“,das jenes liberale und „wilde“ Christentum des Mittelalters zu überwinden suchte: vgl. Jean DELUMEAU, Le catholicimeentre Luther et Voltaire, Paris 1971 passim, bes. 5 f. und BOGLIONI (wie Anm. 313) 31 ff. zur „unausrottbaren Legendevom christlichen Mittelalter“ sowie TOURNON 163 ff., 256 ff., 295 f. u. ö. zu Montaignes Einsatz für die freie Reflexionauf dem finsteren Hintergrund neuer sektiererischer und dogmatischer Herausforderungen am Ende des 16. Jhs.
541
machte blind für authentische und (im Sinne der frühen Neuzeit) amoralische Literatur der Klassik. SolchesStörpotential wurde verdrängt oder wenigstens mit dem Argument der stilistischen Mustergültigkeitunsterblicher Dichtung rationalisiert. Ovid machte als ein erster manifester Problemfall den Widerspruch derethisch-ästhetischen Klassiker-Geltung bewußt. Den meisten anderen auctores konnte die neue historischePerspektive kaum schaden. Sie wurden entlassen aus dem Sicherheitsnetz und Verweissystem mittelalterlichersignificationes, in dem sie, was immer sie meinten, nur etwas moralisch oder geistlich Nützliches bedeuteten,und doch bildeten sie insgesamt noch keine Gefahr für Glaube und Sitte, ja gewannen sogar oft mit demhistorischen Profil einiges an Modellhaftigkeit hinzu. Der Liebesdichter aber zeigt vorerst als Ausnahme, wasspäter allgemein ruchbar wurde: die Dialektik von Historisierung und Relativierung der Vergangenheit, diezuletzt, im 19. und 20. Jahrhundert, auch dem klassischen Altertum als ganzem nicht erspart blieb.Erstaunlich ist im Grunde eher, wie lange die im Renaissance-Humanismus noch fraglose Kongruenz vonhistorischer und exemplarischer Wahrheit, von Faktenkenntnis und Monumentalität erhalten blieb. Erst imeigentlichen Historismus seit dem späten 18. Jahrhundert wird diese Harmonie grundsätzlich in Fragegestellt.1033
1033 Vgl. KOSELLECK 39 ff.; HAHN 402. – JANIK (wie Anm. 600) 394 ff. zeigt am Beispiel der Kontroverse zwischenValla und B. Facio über den Vorrang der dignitas (im Sinne moralischer Stoff-Selektion) oder der unzensurierbaren memoriain der Historiographie eine erste Problematisierung der Einheit von historischer und didaktischer Haltung gegenüber derGeschichte. BEZOLD, Methodik (wie Anm. 42) 363 ff. stellt sogar (ähnlich wie DÖRRIE in der Ovid-Rezeption) einen imMittelalter noch nicht bekannten Puritanismus in der Geschichtsexemplarik der frühen Neuzeit fest: Erst jetzt wird es nötig,so ärgerniserregende und ruhmlose Taten wie diejenigen Catilinas, die im Mittelalter als negative Beispiele durchaus„nützlich“ waren, als der verehrten Antike unwürdig aus der historischen Darstellung zu bannen. Zur freieren mal. Haltungvgl. S. 175 f., 180 f.
542
Wenn cum grano salis der historische Objektivismus als eigene neue Tendenz der Renaissance, der ethischeMonumentalismus hingegen als dauerhaftes alteuropäisches Allgemeingut bezeichnet werden darf, so werdendifferenzierterer Betrachtung doch folgende Abweichungen und Ausnahmen nicht entgehen: Der induktiveErkenntnisweg kann keineswegs als eine theoretische Entdeckung der Renaissance gelten. Schon lange vorSalutati hat Johann von Salisbury mit impliziter anti-platonischer Deduktions-Kritik das aristotelische Modelleines Aufstiegs von der Wahrnehmung über die Erinnerung zur Erfahrung ins Zentrum seiner Erkenntnis- undErziehungstheorie gestellt.1034 Der Unterschied der Zeiten liegt nicht im Induktions- oder Deduktionsbegriff,sondern in der literarischen Praxis der Exempla-Verwendung, und hierzu muß wiederholt werden, daß Johannnicht von der „Autopsie“ des historischen Details ausgeht, sondern von der rhetorisch-argumentativenVerfügbarkeit anerkannter historiae und heroischer Denkbilder der Literatur.1035
Petrarcas Wunsch nach persönlicher Vergegenwärtigung der dem subjektiven Empfinden in historische Ferneentschwundenen Schriftsteller und Helden der Antike mit Hilfe authentischer Zeugnisse aus erster Hand darfnicht pauschal zu einem Epochensignum erklärt werden, ebenso wenig, wie das scholastisch-dialektischeDesinteresse an der Realität der zu Stichwortträgern
1034 Zur angeblichen Entdeckung der Induktion in der Renaissance vgl. etwa GRASSI, Macht des Bildes (wie Anm. 1021)138 ff.; KESSLER, Problem … bei Salutati 187; KELLEY, Foundations (wie Anm. 43) 20, 27 f. – Zum aristotelischenInduktionsmodell (Metaph. 980a27–29; Anal. post. 81b2–9; De memoria 480a30) bei Johann (z. B. Met. II 10, IV 8–9.12,19, III 10) vgl. ODOJ 44, 54 f.; Dal PRÀ 70 ff.; McGARRY 666 f., 672; HELBLING-GLOOR (wie Anm. 26) 16 f.; s.§§ 46, 49 f., 147, A. 447, 544, 573, 578, 874. Vgl. BERLIOZ, Le récit efficace … 127 ff. zur scholastischen memoria-Theorie als Aufwertung sinnlicher Erkenntnis aufgrund der Inkarnationslehre (gegen popularphilosophisch-neuplatonischeRelikte).1035 Vgl. § 86, S. 212, 218, 382 ff., 420, 434, 531 f. Allerdings trifft die Feststellung eines Auseinanderklaffens desBeispielbegriffs in der Erkenntnistheorie und in der praktischen Exempla-Anwendung auch neuzeitliche Autoren: Vgl.NADEL (wie Anm. 494) 309 ff. zu Jean Bodin und Macchiavelli.
543
für Sentenzen degradierten auctores als epochales Abgrenzungskriterium des 13. Jahrhunderts gegen dasvorangehende und das nachfolgende Jahrhundert tauglich ist. Neben dem eigentlichen Autoren-Studium gab eswährend dieser drei Jahrhunderte und darüber hinaus stets auch eine „Digest“-Kultur mit Florilegien, Spruch-und Memorabilien-Sammlungen. Der artes-auctores-Streit bestand durchweg über diesen Zeitraum hinweg. Dieanti-scholastische Polemik der Renaissance-Humanisten stellt in vielem nur eine Verlängerung der im 12. und13. Jahrhundert lebendigen anti-dialektischen Opposition dar, als deren Hauptvertreter Johann von Salisburygenannt zu werden pflegt.1036 Johann ist jedoch auch in diesem Konflikt weit stärker theoretisch als praktischengagiert. Sein im Metalogicon emphatisch verkündeter Respekt vor den auctores verträgt sich offenbardurchaus mit der wilden Ausbeutung mittelalterlicher Sammelhandschriften und ihrer oft sehr selektivenauctores-Exzerpte im Policraticus. Doch gerade seine kombinatorische Freiheit im Umgang mit den in ihredisiecta membra (meist in „geflügelte Worte“) aufgelösten scriptores und denkwürdigen Exempla ist allesandere als eine ausschließlich mittelalterliche Unart. Viele Renaissance-Humanisten setzten das Verfahrensowohl sammelnd wie applizierend fort; denn die stets verbindliche
1036 Johanns Bekenntnis zur auctores-Pflege: §§ 42, 61, S. 364, 376, 417 ff. Zur Kontinuität des artes-auctores-Streits vom12.–14. Jh. vgl. vor allem Paul Oskar KRISTELLER in mehreren Arbeiten seit: Humanism and Scholasticism in the ItalianRenaissance (1944), in: ders., Renaissance Thought, I, New York 1961, 92–119 = Humanismus und Scholastik in der ital.Renaissance, ed. E. KESSLER (UTB 914/5), München 1973/5, I 87–111; vgl. auch die zusammenfassende Darlegung inDiskussionsvoten zu ‚Arts libéraux et philosophie au Moyen Age’, Montréal/Paris 1969, 151–6, sowie ders., Il Petrarca,l’umanesimo e la scolastica, in: Lettere Italiane 7 (1955) 367–88 = Petrarca, der Humanismus und die Scholastik, in:Petrarca (wie Anm. 528) 261–81, bes. 264, 268, 276 ff. Vgl. auch W. KÖLMEL, Scolasticus literator [sic], Die Humanistenund ihr Verhältnis zur Scholastik, in: Hjb 93 (1973) 301–35, bes. 334 ff. gegen KESSLERS erzwungene Isolierung Petrarcasgegenüber mal. auctores-Tradition. – Gerade das Bekenntnis zu den allein nützlichen Kenntnissen im Humanbereichgegenüber eitler curiositas auf naturwissenschaftlichem Gebiet vereint hier Johann und Petrarca als Humanisten (im bestenSinne des Wortes) über die Jahrhunderte hinweg: §§ 46, 72, S. 178 f., 251 ff. Die zeitweilige Überlegenheit der artes-Richtung über die auctores-Richtung im späteren MA wird mit KRISTELLERS Kontinuitätsthese keineswegsausgeschlossen (s. S. 418 ff. u. Anm. 1037): Dazu lassen sich grundsätzlich verschiedene Urteile abgeben, je nach derBedeutung, die man Spezialisierungen wie der theologischen oder juristischen Wissenschaft in Paris und Bologna für diegesamte Bildungsgeschichte einzuräumen beliebt, oder je nach dem Vorrang des qualitativen oder des quantitativen Aspektsbei dem Vergleich elitärer Minoritäten mit dem Bildungsdurchschnitt in bestimmten Regionen, Gruppierungen, Schulenusw. und der Gelehrtenstreit kann dank unklarer Fragen unendlich weitergehen.
544
antike Rhetorik hatte es theoretisch sanktioniert. Mnemonische Gesichtspunkte der inventio locorumbestimmten weiterhin, seit der Renaissance sogar vermehrt, die Verzettelung und handliche Bereitstellung derWelt- und Geschichtskenntnisse.1037
1037 Zu Johanns praktischem Umgang mit den auctores vgl. § 56, S. 402 ff., 416 ff. MURPHY, Rhetoric and Dialctic (wieAnm. 446) 203 verweist mit Recht auf die Paradoxie, daß Johann, der als Quintilian-Verehrer und Verteidiger des Gesamt-Triviums gegen die Monopolstellung der Dialektik gilt, dennoch aufgrund seiner gleichzeitigen extremen Hochschätzung deraristotelischen Logik-Schriften die dialektische Methode der Scholastik und den Zusammenbruch des „Quintilian approach tolanguage“ gefördert habe. – Für die allgemeine Tendenz zur Vulgarisation und „Digest-Kultur“ seit dem späten 12. Jh. vgl.BOLGAR (wie Anm. 30) 219 ff.; J. de GHELLINCK, L’essor de la littérature latine au XIIe s., Paris 1954, 5 ff.; E.K.RAND, The Classics in the Thirteenth Century, Spec. 4 (1929) 249–69 (dessen Nachweis der auctores-Pflege während derScholastik gerade das indirekt proportionale Verhältnis von quantitativem und qualitativem Humanismus bestätigt); J.R.O’DONNELL, The Liberal Arts in the Twelfth Century …, in: Arts liberaux (wie Anm. 1036) 127–36, bes. 127 zur „gradualerosion“ des älteren Ideals der Direktlektüre der auctores durch die Florilegien-Flut, aber auch durch Grammatiken,Rhetoriken und Poetiken (die m.E. im allgemeinen viel zu wenig als Zeichen des Niedergangs verstanden werden). Eineparallele Entwicklung zeigt sich in der Jurisprudenz, wo die allgemeinbildende Funktion des Triviums mit seinerhistorischen Übungspraxis und imitatio auctorum seit dem 11. Jh. erlöscht und durch berufspragmatische Spezialisierungenund „Technisierungen“ wie der ars dictaminis (im engeren italienischen Sinn einer Notariatskunst) und der streng auf dasCorpus iuris beschränkten Wissenschaft der Glossatoren als schöngeistiges Relikt überholt wird (s. S. 262). Mit demMetalogicon als Werk des Übergangs in der Philosophiegeschichte sind in der Rechtsgeschichte Übergangswerke wie dieRhetorica ecclesiastica (s. Anm. 8 und 565) zu vergleichen, in denen noch versucht wird, alte Methoden des Triviums zuaktualisieren und zugleich die neue (frühscholastische oder glossatorische) Logik zu integrieren. Vielleicht konnte Johannseine merkwürdige Doppelrolle als Vermittler der neuen aristotelischen Logik und als Verteidiger des ciceronianischen,rhetorisch-literarästhetischen Bildungsideals nur einigermaßen widerspruchslos durchhalten, weil er die Topik der inventiound des iudicium (der Mnemonik probater loci und der „Logik“ des Wahrscheinlichkeitswissens) als untrennbare Einheitverstand (§§ 61 f., 69 f., 90, S. 434). Fortsetzung der Kompilations- und Vulgarisierungshaltung in der frühen Neuzeit vgl.BOLGAR (wie Anm. 30) 270 ff.; die als „mittelalterlich“ bezeichnete Methode charakterisiert er 433 f. so: „Each propoundsa different system, but all start from the same presupposition that the body of human knowledge consists of separatedisconnected facts the significance of which is fully understood in isolation. Consequently they never try to assemble factsaccording to their natural affinities into connected systems explicatory of some aspect of the universe; instead they force theirmaterial into artificial groups which fit in with their particular system of mnemonics“. Vgl. auch A. BUCK, Die Methodeder Humanisten, Tübingen 1952 passim zur parzellierenden Tätigkeit der Adagien- und Exemplasammler; HUIZINGA,Erasmus (wie Anm. 38) 48 ff.; SCHON 72 ff.; GILMORE (wie Anm. 214) 48 ff., 102 zum dekorativenEpigonalhumanismus: „instead of revivifying the past they turned latin from a living to a dead language“; G. HIGHET, TheClassical Tradition, (1949), N.Y. 1057, 190 f. (zur abstrusen Sammelwut eines Burton im Vergleich zu Montaignesreflektierter Selektion innerhalb derselben Epoche). Vgl. S. 417 ff., 550 f. E. KESSLER, Petrarcas Philologie, in: ‚Petrarca’,ed. SCHALK (wie A. 287) 97–112, 101 f., sieht als eine Hauptursache für diese Irrwege des Humanismus dieInstitutionalisierung der ursprünglich allgemeinbildenden studia humanitatis zwischen dem 14. und dem 16. Jh. inSpezialfächern der Universität, deren lächerlich pedantischen Auswüchse Descartes in seiner Rückbesinnung auf rationaleMethodenstrenge leicht aufs Korn nehmen konnte.
545
Wenn nun das Exemplum bei Petrarca und anderen Pionieren des Renaissance-Humanismus alsrepräsentatives Epochensymbol für das intensive Verlangen nach persönlicher Begegnung und Identifizierungmit geschichtlichen Vorbildern den instrumentalisierten anekdotischen Bilderbuchexempla des Mittelalters(von den homiletischen Schwankexempla ganz zu schweigen) entgegengesetzt wird, dann entsteht leicht einVergleich des Unvergleichbaren und eine unfaire Verallgemeinerung, die das Mittelalter trivialisiert, dieRenaissance heroisiert. Die Kritik soll jedoch nicht den gerügten Fehler mit umgekehrtem Vorzeichenwiederholen.1038 Innerhalb des gleichen Registers, der gleichen Textsorte, des gleichen Verfahrens ist durchausein Vergleich möglich, der einen entwicklungsgeschichtlich paradigmatischen Unterschied in der Artfestzustellen erlaubt, wie Johann seine auctores und historiae als argumentative Kampfmittel einsetzt, und wiePetrarca mit seinen antiken Freunden Umgang pflegen möchte; wie der eine immer nur einzelne Aspekte undEigenschaften historischer Gestalten funktional zum argumentativen Vergleich heranzieht, der andere die „inihrer Totalität bejahte Persönlichkeit“ zum Reflexionsgegenstand und Modell erhebt.1039 BeiBerücksichtigung
1038 Apologetische Versuche, wie diejenigen von WADDELL (wie Anm. 45) XIII, Johann und Petrarca in ihrer auctores-Liebe gleichzustellen, da ja auch Johann von noster arbiter „affectionately every few pages“ spreche, sind aufgrund derseither diskutierten Gesichtspunkte nicht mehr ernst zu nehmen. Innerhalb desselben „Registers“ ist dagegen der von OWST(wie Anm. 106) 166 f. angestellte Vergleich mittelalterlicher Predigtmärlein mit Poggios Facetien, der keinen nennenswertenUnterschied ergibt, durchaus sinnvoll. Vgl. auch oben Anm. 1028.1039 Vgl. BUCK, Rezeption (wie Anm. 1016) 9 ff.: die hier zur Unterscheidung der Epochen gebotenen Gesichtspunktetreffen z. T. auf die Gegenüberstellung der beiden „Spitzenhumanisten“ zu, z. T. werden damit Gattungsunterschiedezwischen dem Exemplum und der Historiographie angesprochen; insbesondere zur Definition des Exemplums paßt der Satz:„[die Autoren] hörten auf, Personen zu sein, und standen nur noch stellvertretend für bestimmte aus ihnen abstrahierteGedanken“. Dies hat aber mit Epochenunterschieden nichts zu tun. Siehe oben § 78.
546
aller Gattungsunterschiede – auch Johann zeichnet in der Historia pontificalis jene eindrückliche SynkrisisBernhards von Clairvaux und Gilberts von Poitiers, ein Meisterwerk ganzheitlicher biographischerPersönlichkeitscharakterisierung; auch Petrarca betreibt in De remediis utriusque fortunaeGeschichtsverzettelung nach Art der Exempla-Sammlungen und Florilegien – und in Erwägung allerUnterschiede der sog. „Umstände“ (Amt, gesellschaftliche Stellung, persönliches Temperament usw.), scheintmir doch (im Sinne der opinio communis der Renaissanceforschung, aber durchaus wertfrei) die Fähigkeit desspäteren der beiden Humanisten, die Vergangenheit, namentlich die entfernte, antike als eine eigene, vomBetrachter abgelöste Welt sowohl als Verlust wie als Sehnsuchtsobjekt zu empfinden, eineentwicklungsgeschichtlich repräsentative Neuerung darzustellen.1040
113. Um auf den funktionalen, un-empirischen und unpersönlichen ja metahistorischen ExemplagebrauchJohanns zurückzukommen, möchte ich zuletzt noch zu bedenken geben, daß der Verfasser des Policraticusvielleicht zu stark in Probleme und Konflikte seiner eigenen Gegenwart verstrickt war, um sich den Luxusreiner Vergangenheitsbetrachtung leisten zu können. Dies widerlegt die eingangs festgestellte merkwürdigeForschungsmeinung, er habe sich aus antiquarischem Interesse an Histörchen von den eigenen Zeitfragenabgewandt. Seine Exempla sind topisch-instrumental und in der Tat oft rhetorisch virtuos angewandt, weil esihm nicht um eine historiographische Beschreibung
1040 Zu Johanns Synkrisis s. S. 376 ff.; zu Petrarcas De rem. fort., vgl. C.N.D. MANN, Petrarch and the Transmission ofClassical Elements, in: Classical Influences (wie Anm. 423) 217–224. Zur beruflichen und sozialen Stellung Johanns vgl.STOLLBERG (wie Anm. 557) 18 ff. und § 66, A. 564; zu derjenigen Petrarcas vgl. SEIGEL (wie Anm. 394) 200 ff.;GILMORE (wie Anm. 214) 61 ff. (auch zur avantgardistischen Stellung italienischer Juristen seit Irnerius). Insgesamt sinddie Unterschiede eher kulturgeographisch als epochenspezifisch: der stadtstaatlich-bürgerlichen Berufspraxis italienischerHumanisten als Juristen, Notare und dictatores steht die Lehrtätigkeit französischer Intellektueller an philosophisch-theologischen Schulen oder die Beamtentätigkeit in höfisch-feudalem Dienst gegenüber. Weder Petrarca noch Johann ordnensich in dieses Schema ganz ein. Petrarca war trotz seiner Rechtsstudien und Beziehungen zum Juristenmilieu Privatgelehrterund Dichter, gewissermaßen „freischwebende Intelligenz“; Johann stand nach seiner philosophischen Ausbildung in Parisdurch die Vielfalt seiner Funktionen vom erzbischöflichen Sekretär und Berater des königlichen Kanzlers zum Gesandten ander Kurie und Bischof von Chartres jenseits jeglicher einseitigen Festlegung (etwa als „Hofbeamter“) und wirkte vornehmlichals „freier“ Hof- und Verwaltungskritiker. Mehr als der beruflich-gesellschaftliche Unterschied fällt darum die Ähnlichkeit derbeiden Humanisten in der Gespaltenheit und Problematik des Intellektuellen zwischen Engagement und Ungebundenheit,actio und contemplatio, Philosophie und Hof bzw. Stadt auf. Vgl. §§ 71, 119, S. 292 f., 336, 568 f., Anm. 446 f., 564,951, 978, nach Register s. l. Petrarca, curia/philosophia.
547
vergangener Wirklichkeit, sondern um eine moralische Veränderung seiner eigenen Zeitsituation geht, einesverwirrlichen „Jahrmarkts der Eitelkeiten“ voll Oberflächlichkeit, Unsinn, Hochstapelei und Heuchelei.Beispiele schärfen die Beobachtung des Satirikers und helfen dem Kritiker, sich besser zurechtzufinden.1041
Auch Renaissance-Forscher geben im allgemeinen (oft allerdings zurückhaltend) zu, daß der mittelalterlicheUmgang mit der Antike bei allem Mißbrauch doch ein lebendiger und gegenwartsbezogener gewesen sei.Demgegenüber können sie ihren Humanisten einen gewissen Eskapismus nicht ganz absprechen: Dieengagierte Hinwendung zum Geisterdialog mit den Alten erscheint gelegentlich unübersehbar als Flucht ausböser Gegenwart in idealisierte Vergangenheit. (Zudem sind diese exemplarischen „Alten“ nicht nur diegroßen Klassiker, sondern auch Kirchenväter.) Petrarca sagt in aller Klarheit:1042 „Indem ich schreibe,verweile ich auf die einzige mir mögliche
1041 Zu Johanns Einsatz satirischer Mittel im Dienste des moralphilosophischen Hauptziels einer Gesellschaftsreform durch„Rhetorik“ vgl. LIEBESCHÜTZ 2, 108; GARIN, Johann von S. in: Kindlers Lex. d. Lit. 7630; UHLIG (wie Anm. 577)46, und in ‚Classical Influences’ (wie Anm. 423) die Beiträge von B. BISCHOFF, Living with the Satirists, 83–94, hier92 f.; B. SMALLEY, Sallust in the Middle Ages, 165–176, hier 172 f.1042 Fr. Petrarca Fam. VI 4.5–8 (ROSSI II 78.29 ff.): Inter scribendum cupide cum maioribus nostris versor uno quo possummodo; atque hos, cum quibus iniquo sidere datum erat ut viverem, libentissime obliviscor; inque hoc animi vires cunctasexerceo, ut hos fugiam, illos sequar […] ita cum mortuis esse potius quam viventibus delectarer. (Vgl. A. BLASCHKA,Der Topos ‚scribendo solari’, in: Wiss. Zs. d. M. Luther-Univ. Halle/Wittemberg, ges.-sprachw. Reihe 5 [1955/6] 637 ff.;von MOOS, Consolatio III §§ 35 ff.). – Zu solchen Stellen in der Renaissance forschung (s. auch unten Anm. 1044) vgl.KESSLER, Geschichtsdenken 112 f.; ders., Problem … bei Salutati 179; ders., Petrarca 246 f., 33; BUCK, Rezeption (wieAnm. 1016) 15; ders., Petrarca (wie Anm. 528) 3 f. – LUCIANI (wie Anm. 528) 9 erlaubt sich hierzu die Pointe: Petrarcabreche viel mehr mit seinen eigenen Zeitgenossen als mit der gesamten, auch mittelalterlichen Tradition; vgl. auchebd. 211 ff. zu den angeführten Stellen Petrarcas und zu dessen Exemplum-Definition im Sinn des Gegenwarts-Ersatzes undder hagiographischen Vorbildlichkeit. – Zu Salutati vgl. A. 1014 und DONOVAN (wie Anm. 922) 197 über dessen Brief III43 an Zambeccari: Fuit hec eruditio quondam temporibus priscis et, quantum conicere possum, usque ad beati BernardiClaravallensis abbatis et contemporanei sui Petri Blesensis etatem continua successione perducta, que nedum inmulieribus, sed ferme in viris nostris temporibus evanuit … Vgl. auch Ep. III 76–91 an Kardinal Oliari zurDekadenzgeschichte der lateinischen Kultur seit Tacitus, in der Ivo, Bernhard von Clairvaux, Hildebert und Johann vonSalisbury als rühmenswerte Ausnahmen erscheinen, und wo betont wird, selbst Petrarca und Boccaccio würden „dieseVorgänger“ keineswegs mehr erreichen. (Der Ruhm Peters von Blois in diesem Zusammenhang dürfte zum Teil auch aufdessen u. a. aus dem Policraticus gestohlenen „fremden Federn“ beruhen: vgl. S. 419 f.) K. ARNOLD (Das „finstere“Mittelalter. Zur Genese und Phänomenologie eines Fehlurteils, in: Saeculum 32 [1981] 287–300, hier 294 f.) bringt dieseund ähnliche berühmte Stellen früher Renaissancehumanisten als Belege für die Entstehung des negativen medium aevum-Begriffs aus der (pikanterweise bereits im Mittelalter beliebten) Zeitenmetaphorik zur Kritik der Gegenwart oderunmittelbaren Vergangenheit, einer Zwischenzeit-Vorstellung mit Bezug auf alles, was die wenigen übrigbleibendenErneuerer unter den herabgekommenen Zeitgenossen von einer idealen, wiederherzustellenden Urzeit trennt. (Daraus wurde m.E. allerdings erst im 17. Jh. und keineswegs direkt unser Epocheneinteilungskriterium.)
548
Weise mit Lust und Liebe bei unseren Vorfahren und vergesse nur allzu gern die Leute, mit denen zu leben, einböses Geschick mir auferlegt hat. Darin übe ich alle Kräfte meines Geistes, daß ich diese fliehe, jenen aberfolge […] So macht es mir mehr Freude, mit Toten zu verkehren als mit Lebendigen.“ Bezeugte die Stellenicht so viel verbindlichen (durchaus mittelalterlichen) Respekt vor der memoria großer Toter, so könntehier von einer Art Nekrophilie gesprochen werden, der gegenüber die pia sollicitudo scriptorum ettriumphatrix inertiae diligentia literarischer Tradition, der sich Johann von Salisbury im Kampf gegenMißstände am Hof Heinrichs II. und in der englischen Kirche anschließt, doch geradezu erfrischend wirkt.1043
Dasselbe Verhältnis Petrarcas zu den maiores erscheint als eine fast solipsistische Trosthaltung:1044 „Es istnämlich ein großer Trost, von so berühmten Begleitern
1043 Pol. Prol. I 12.11 f.; oben Anm. 366 u. 770. Vgl. auch allgemein OHLY, Denkform (wie Anm. 732) 92 f. zummittelalterlichen Hochgefühl gegenüber der Gegenwart, die als wahre Höhe der Zeit im Heilsplan Gottes (und derdazugehörenden kulturellen Tradition) gilt im Unterschied zur wesentlich als ungenügend empfundenen Gegenwart in derRenaissance. (Dies ist m. E. epochengeschichtlich wichtiger als alle Hinweise auf mittelalterliche „Zeitklagen“ und senescenssaeculum-Vorstellungen: vgl. auch S. 241 ff., 381 ff., 448, 537 f., 551 f.)1044 Petrarca, Secretum III (Prose, ed. E. CARRARA, 1955) 178: Est enim […] grande solatium tam claris septum essecomitibus; itaque fateor talium exemplorum, velut quotidiane supellectilis, usum non reicio. Iuvat enim non modo in his[…] habere aliquid in promptu quo me soler. (Die Übersetzung „Zitate“ für exempla ist hier angebracht aus den A. 374erwähnten Gründen. Zu comites vgl. auch oben Anm. 787a). Fam. VI 4.2 (ROSSI II 77 f.): Sed in tot mundi malis inter tammulta dedecora tacere difficile est; satis patientie prestitisse videor […] cum diu ante hec monstra scriptum videam:‚difficile est satyram non scribere’ [Iuv. Sat. I 30]. Multa passim loquor, multa etiam scribo, non tam ut seculo meoprosim, cuius iam desperata miseria est, quam ut me ipsum conceptis exhonerem et animum scriptis soler. (Zu scribendosolari s. Anm. 1042). Zu diesen und ähnlichen Stellen vgl. KESSLER, Petrarca 109 ff., 246 f.; ders., Problem … beiSalutati 179. Sie bilden nach SEIGEL (wie Anm. 394) 44 ff., 52 u. ö. allerdings nur den einen Pol einer Dichotomie undungelösten Problematik, in der Petrarca zwischen „Philosophie und Rhetorik“, Einsamkeitsbedürfnis und politischemEngagement hin- und hergerissen wurde, und die in anderer Weise auch Johann in der Spannung von philosophia und curiathematisiert hatte (s. oben Anm. 1040). Bei dem hier interessierenden Vergleich der beiden Humanisten geht es nicht umGegensätze, sondern um Akzente und Gewichtungen. Zu ergänzen wäre hinsichtlich SEIGELS Thesen vor allem die imMont-Ventoux-Besteigungsbericht (s. Anm. 528) eruierbare dialektische Ursache für Petrarcas Rückzug in eine sowohlreligiöse wie humanistische Innerlichkeit: Die von den Confessiones inspirierte Antithese der zu Füßen liegenden äußerenWelt und der wahren christlichen Glückseligkeit in der inneren Welt der Seele (Anm. 528) ist zwar aufgrund patristisch-mittelalterlicher Tradition eine spirituelle, allerdings stark subjektivistisch eingefärbte Rückbesinnung auf das einzige demMenschen Notwendige, das innere Seelenheil, kann aber auch als Reaktion, als ein Zurückschrecken vor den neuenMöglichkeiten einer weltund naturerobernden Expansion in die äußere Unendlichkeit verstanden werden, insofern also auchals Ausdruck einer Spannung zweier Weltsichten an einem Epochenübergang. In einer durchaus ähnlichenÜbergangssituation, im 12. Jahrhundert, verhält sich Johann aktiver, weltzugewandter. Zu diesen Stichworten, aus denen sichleicht ein weiteres Buch machen ließe, vgl. z. B. S. 171 ff., 232 ff., 391, 449 ff., BUCK, Petrarca (wie A. 528) 16 f.; ders.Patristik (wie ebd.) 153 f.; LUCIANI (wie ebd.) 65 ff.; BILLANOVICH, Petrarca und der Ventoux (wie ebd.) 444 ff.;GAUTHIER (wie Anm. 774) 480 ff. (franziskanische magnanimitas in stoischer Tradition der Welteroberungskritik beiPetrarca); THIEME (wie Anm. 528) 142 ff., 154 (Petrarcas subjektivistische „Rolle“ in der Mt.-Ventoux-Episode alsReaktion auf den Zerfall des mal. Weltbildes). Interessant ist die persönliche Rezeption der kulturkritischen Aspekte Petrarcasdurch dessen Bewunderer J.G. Herder am Anfang der Romantik, der sich mit dem Frühhumanisten in „der dunklen Unruhe,die eine andere Welt sucht und sie noch nicht fand“, identifiziert. Vgl. dazu die Zeugnisse bei F. WAGNER, J.G. Herder ePetrarca, in: Quaderni Petrarcheschi 1 (1983) 141–69, hier 150 und 156, besonders signifikant (SUPHAN XVIII 362): „Dieswar sehr natürlich für den, der auch an Cicero, Varro und Livius Briefe schrieb, als ob diese noch lebten, der mitAbwesenden wie mit Gegenwärtigen umging, ja der überhaupt mehr in der Entfernung als in der Gegenwart, mehr in derEinbildung als im Genuß des Daseyns lebte“.
549
umgeben und beschützt zu sein. Daher bekenne ich, daß ich es mir nicht versage, solche Zitate wie täglichesHausgerät zu verwenden. Es ist nämlich […] nicht nur in diesem Fall […] von Nutzen, das Trostmittelgriffbereit zu haben.“ – „Bei so vielen Übeln dieser Welt fällt es schwer zu schweigen […]. Viel spreche ichbeizeiten, viel schreibe ich auch, aber nicht so sehr, um meinem Jahrhundert zu nützen, dessen Elend schonzum Verzweifeln ist, als um mich selbst durch Besinnung zu entlasten und durch Schreiben das Gemüt zubeschwichtigen.“ Ein Humanist, der Zuflucht bei seinen auctores sucht, dürfte diese um ihrer selbst willenstudieren. Gegen die Umwelt sind sie ein „Zaun“ oder „Schutzwall“ der Intimität, nicht strategisch einsetzbare„Kampfgefährten“ und Argumenteträger wie bei Johann.
550
In der älteren Humanismusforschung entstand gerade an diesem neuralgischen Punkt der Epochenbewertungeine mehr oder weniger rationalisierbare Begriffsverwirrung:1045 Man mußte die Renaissance „voll vonGegenwartswillen und Zukunftsverlangen“ im Gegensatz zu antiquarischer Mentalität zeigen und konnte dochnicht übersehen, daß das Mittelalter gerade im Bewußtsein ungebrochener Kulturkontinuität bis hin zum„fruchtbaren Mißverständnis“ freier mit der Antike umgehen konnte, daß den mittelalterlichen Humanistenalso gerade das konservative Element abging: „Sie wollten nicht wiederherstellen, sondern selbst bauen. Beiden Alten suchten sie nur einen Ausgangspunkt, von dem sie sich ihrerseits emporschwingen konnten.“1046
So half man sich mit allerlei Konstruktionen wie der, daß eine weltanschauliche Hingebung an die diesseitigeWelt der Antike von selbst wieder in die Gegenwart zurückführe, während dem Mittelalter mangelndeVitalität, lediglich formale auctores-Nachahmung, Traditionsgebundenheit und respektloser Tagebau imSteinbruch des „Kulturstoffs“, also widersprüchlicherweise eine sowohl antiquarische als auch barbarisch-utilitaristische Einstellung bescheinigt wurde.1047 Die Inkonsequenz solcher Urteile macht niemand besserbewußt als Johann von Salisbury: In einer für das
1045 Vgl. zur älteren Forschung die Zusammenfassung bei MISCH 1166 (NORDEN, VOIGT, BURDACH); CURTIUS, Ges.Aufsätze (wie Anm. 908) 463 ff. mit Polemik gegen jene Humanismusforscher (gemeint sind E. GARIN und W. RÜEGG),die mittelalterliche Rhetoriktradition verkennend, „in Gefahr geraten, Amerika immer wieder neu zu entdecken“ (467);HEINZLE (wie Anm. 315) 42 ff., 56 ff. sehr anregend zum „Denkzwang“ der Modernität der Renaissance.1046 LUBAC (wie Anm. 430) II 2, 220.1047 Zur Verbindung des „Antiquarischen“ mit dem „Fortschrittlichen“ vgl. etwa SCHON 53: Montaigne habe in derExempla-Tradition nicht mehr bloß kompiliert und „totes Material zusammengetragen“, sondern „frei und überlegengestaltet“. Der Stoff stehe „nicht mehr um seiner selbst willen, sondern ist den Gedanken Montaignes dienstbar gemacht“.Eine auf den Humanisten des 16. Jahrhunderts durchaus zutreffende Formulierung! Doch gerade die hier gerühmte Freiheitwird von anderen Renaissance-Forschern dem Mittelalter vorgeworfen, ebenso die Unfähigkeit, Antikes „um seiner selbstwillen“ zu lieben. Richtiger wäre der Vergleich Montaignes und anderer „überlegener Gestalter“ der Renaissancezeit mit denvielen humanistisch-antiquarischen „Kleingeistern“ der gleichen Zeit ausgefallen. STRUEVER, Language of History 39meint, das Verdienst der Renaissance bestehe in der Bekämpfung der religiösen und philosophischen Wirklichkeitsflucht undin einem „saving of the phenomena“, „a saving of history“. Dies läßt sich in dem S. 537 betonten epistemologischen Sinndurchaus vertreten, nicht aber in dem bei STRUEVER mitschwingenden moralisch-lebenspragmatischen Nebensinnprogressiv-antiasketischer Weltzugewandtheit. Ein beliebter Universalschlüssel zur Lösung der Epochenprobleme istPANOFSKYS (in dem von ihm primär gemeinten kunstgeschichtlichen Sinn unbestrittenen) „Disjunktionsprinzip“(Renaissance [wie Anm. 1027] 87), d. h. die Feststellung, daß im Mittelalter entweder die Form oder der Gehalt einerDarstellung antik sein können, beide Arten der Imitatio aber nie gleichzeitig im gleichen Werk zusammenkommen. Wirddaraus ein Erklärungsmodell für alle kulturellen Erscheinungen abgeleitet (s. etwa SEIGEL [wie Anm. 394] 174 ff., 186 f.),so liegt die tautologische Schlußfolgerung oft bedenklich nahe, das Mittelalter habe, seinem eigenen Weltbild verhaftet, nichtüber seinen Schatten springen können und die Antike nicht mit antiken Augen gesehen. Dieses Wunder konnten offenbar dieRenaissancehumanisten vollbringen. Daß sie dies wünschten , macht die Naivität einer Selbstüberschätzung aus, die sichdurchaus neben der vielgerügten anachronistischen Naivität des Mittelalters sehen lassen kann (s. Anm. 1025, 1028). – Ineiner fast sophistischen Argumentationskette sucht Th. E. MOMMSEN Petrarca optimistische Zukunftsorientiertheit zuunterschieben (Petrarch’s Conception of the Dark Ages, in: Spec. 17 (1942) 226–42, hier 239 ff.): Zuerst wird dessenKulturpessimismus eingestanden: Er kenne nur zwei Zeitalter, das „goldene“ römische und die nachfolgende Dekadenz,gipfelnd in seiner eigenen Zeit. Das „dritte Zeitalter“ liege jedoch in der Zukunft. Im 15. Jh. sei auch tatsächlich einoptimistisches Zeitalter angebrochen, das im Gefühl lebte, „einer neuen Zeit“ anzugehören. Diese neue Zeit habe aber mitPetrarca begonnen… „It would be asking too much to expect Petrarch to proclaim himself explicitly the inaugurator of a newera …“ So wird für die ganze Renaissance, auch für Petrarca selbst, das Hauptkriterium, die „notion of belonging to a newtime“, das Hochgefühl der Jugend gerettet. – Eine andere Variante der erwähnten Widersprüchlichkeit bietet W. RÜEGG (wieAnm. 445) 279, 290, 309 mit seiner Kritik an KRISTELLERS Kontinuitätsthese: Die Humanisten hätten das Mittelalternicht aus Klassizismus, nicht wegen dessen Unkenntnis der Antike abgelehnt, sondern im Namen „lebendiger Religion“, ausWiderwillen gegen die „scholastische Gelehrsamkeit“, die (mit Hilfe des dazu passenden neo-scholastischen Mittelalterbildesvon E. GILSON) als das eigentlich Mittelalterliche am Mittelalter ausgegeben wird. Syllogistik und kalte Formallogik sinddie Schreckgespenster, mit denen die humanistische Topik aufgeräumt haben soll; und dies wiederum dient als Argumentgegen den naheliegenden Einwand, die Humanisten hätten doch in ihren loci communes-Sammlungen auch oft nur spröde
551
Mittelalter außergewöhnlichen Weise bezieht er sich emphatisch auf die Gegenwart seiner „eigenen Zeit“(meum tempus), und zugleich gilt er aller altphilologischen „Nachleben-Forschung“ als einer derberühmtesten und gelehrtesten Antike-Kenner des Mittelalters.1048 Beide Aspekte bringt er selbst
Gemeinplätze konserviert. Vgl. oben Anm. 1037 und jetzt TOURNON 259 f. zu Montaignes Kritik am „Thesaurus“ oder„receptacle de lettres mortes“, den die Kompilationswut der vorangehenden Renaissance gedankenlos angehäuft hat.)1048 Zu meum tempus in Pol. VII 19, (II) 173.19 vgl. FREUND (wie Anm. 537) 68 f.; KERNER 191 f.; BREZZI (wieAnm. 980) 958 f. Johanns Zeitgefühl ist allerdings, wie folgende Stellen (Anm. 1049 f.) zeigen (vgl. auch Pol. VI 16, [II]41; Pol. III 14, [I] 223), keineswegs nur positiv: seine dominante gesellschaftliche Dekadenzvorstellung wird jedoch voneinem heroisch-elitären Begriff der zeitüberlegenen Einzelpersönlichkeit als Träger einer Art „Fortschritt“ durchbrochen; vgl.Anm. 1050.
552
sogar sinnvoll zusammen, wenn er mit Seneca die bloß antiquarisch-genüßlichen Studien zugunsten aktiverGesellschaftskritik (allerdings nicht ohne den uns von Petrarca her bekannten elegischen Unterton) deutlichverschmäht:1049 „Angenehm wäre es gewesen, um mit Seneca zu sprechen, zu den alten Zeitenzurückzukehren und auf bessere Jahre zurückzublicken, doch mein Herz ist schwer und erbittert.“ AuchJohann leidet unter Mißständen der Gegenwart, insbesondere unter dem Kulturverfall, aber eine radikale Zeit-Abkehr widerspräche seiner Überzeugung, daß kein Zeitalter, sei es noch so dekadent oder vergreist, nichtdoch seine „vorherleuchtenden Sterne“ oder hervorragenden Einzelnen hätte, daß z. B. den heidnischenPhilosophen und altjüdischen Propheten heute die „heiligen Mönche und Regularkanoniker“ dermonastischen Reformbewegung an die Seite zu stellen sind.1050 Vor allem aber glaubt er nicht an„kulturkritischen Eskapismus“, sondern an die Wirksamkeit kulturverändernder Kritik. Mehrfach betont erden rhetorisch-instrumentellen Charakter seiner Zitate und Exempla als eine Art insinuatio für dieGegenwartssatire, für die notwendige Kritik an einer herabgekommenen Zeit, die durch erhabene Muster unddurch ihr eigenes lächerliches Spiegelbild gleicherweise beschämt werden kann:1051 „Wenn also der Leser oderHörer seine eigenen Torheiten erkennt, möge er jenes sittenrichterliche Wort beherzigen: mutato nomine dete/fabula narratur, ‚Die Fabel
1049 Met. IV Prol. 165: Iocundum enim fuerat, ut Senece verbis utar [cf. Sen. m. Controv. I praef. 1], in antiqua rediretempora et ad annos respicere meliores, nisi amaritudo […] animum pregravaret. Vgl. dazu SPÖRL (wie Anm. 366) 82;sowie oben Anm. 564 zu Ep. 256 (II) 516 (reversus sum in tempora meliora). Die ethisch-politischen HauptinteressenJohanns betont WETHERBEE (wie Anm. 394) 28 als ein Wesensmerkmal, das ihn von der reinen auctores- und Bildungs-Pflege der „Schule von Chartres“ unterscheide.1050 Zu den sidera saeculorum suorum in Pol. III 9, (I) 198.7 s. S. 341, 448. Vgl. FREUND (wie Anm. 537) 69 f. zuweiteren Stellen. – Pol. VII 23, (II) 204.17 ff.; 207.6 ff.: Magni proculdubio viri et inter praecipuos numerandi, cum nonmodo professiones sed iam senescente mundo in tanta multitudine labentium seculorum pauci processerint homines quisatietatis sibi aliquos praescripserint terminos. – […] sancti monachi et canonici regulares, et in his, sicut stella a stelladiffert in claritate, sunt alii aliis sanctiores. Vgl. MICZKA 45; FREUND a. O. 71; S. 475. 568 f., A. 641, 951 zu der mitdiesem Ideal übereinstimmenden Kritik an realen Mißständen im zeitgenössischen Mönchtum. Ähnlich positiv äußert sichOtto von Freising zur historischen Spitzenrolle des Reformmönchtums inmitten des allgemeinen Verfalls (Chron. VII 35).1051 Pol. Prol. (I) 15.1 ff.: Sic enim cum ineptias suas lector vel auditor agnoscet, illud ethicum reducet ad animum, quiamutato nomine de se fabula narratur [cf. Hor. Sat. I 1.69–70; …] Novi enim quia nulli gravis percussus Achilles [Iuv.Sat. I 163]: et praesens aetas corrigitur dum praeterita suis meritis obiurgatur. Sic dum corrigatur, Oratius etiam servis,ut Decembri libertate utantur, indulget [cf. Hor. Sat. II 7.4–5]: ‚Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico/tangit, etadmissus circum praecordia ludit’. [= Pers. Sat. I 116–7]. Hervorzuheben ist die Verwendung historischer Exempla –Achilles wie alle Toten als ferne Vergangenheit – im Sinne insinuatorischer Milderung der Gegenwartskritik. Sie erfüllensomit die sonst den Charaktermasken mit Phantasienamen (Menedemus, Gnatho u. dgl.) in der Komödie vorbehalteneFunktion. Pol. VIII 1, (II) 228.7 ff. zu Terenz bereits oben Anm. 834 zitiert. Zu den berühmten satirischen loci vgl.SCHMIDT (wie Anm. 74) 85 f.; KOSTER (wie Anm. 571) 24 ff.; zur Bedeutung derselben im Mittelalter vgl.SUCHOMSKI 249 (auch zu Johann); zum Verhältnis von Satire und Komödie im Mittelalter s. oben § 70; nachKINDERMANN, Satire (wie Anm. 574) 41 ist die Identifikation beider Gattungen mit der ethischen Unterweisung unddamit deren Gleichschaltung ein bei Persius und Juvenal beginnender, bei Johann von Salisbury abgeschlossener Prozeß.
553
ist unter anderem Namen deine eigene Geschichte‘.“ – „Du wirst vielleicht den ‚Eunuch‘ des Terenzgeringschätzen, doch im ‚Eunuch‘ vergegenwärtigt der Komödiendichter das Leben fast aller Menschen undübt umso feiner seine Kritik an allen, als er die Laster vorsichtig unter fiktiver Handlung ohne Angriff aufbestimmte Personen bloßstellt.“ Damit greift Johann auf eine seit Horaz traditionelle Definition der Satire(und der später zusehends mit der Satire identifizierten Komödie) durch das Exemplum zurück: ImUnterschied zur Invektive will satirische Komik nicht eine bestimmte Person „bestrafen“, sondern einenoffenen Personenkreis, tendenziell die ganze Menschheit, durch paradigmatisch repräsentative Lächerlichkeit(meist unter pseudonymer Adressatenbenennung) erzieherisch „bessern“.1052
114. Ein letztes Wort zum Inhalt der für den Gebrauch von Exempla so maßgeblichen Zeit-Satire: Derkomplexe historische Hintergrund läßt sich kurz so skizzieren, daß die sog. Renaissance des 12. Jahrhundertsihren Glanz einer Krise verdankt, dem Ansturm neuer konflikthaltiger Informationen, der Überforderungälterer einfacherer Erklärungsschemata, dem Zusammenprall bisher unversöhnlich nebeneinanderliegenderLegitimationsmuster, dem Bewußtsein bisher nur latenter Widersprüche und nicht zuletzt dem Entstehen
1052 Vgl. Pol. VIII 3, (II) 236.22 ff. (nach einem Zitat aus dem Eunuch): Talemne vidisti alicubi? Immo nec quempiamillorum qui felices esse videntur sine huiusmodi mancipio agnovisti, adeoque scitum hominem ubique reperies qui hominesex stultis, ut ait Parmeno, prorsus insanos faciet (cf. Ter. Eun. II 2.23). Zur insinuatorischen Kritik vgl. auchEnth. 1475 ff., 182; Pol. VII 25, (II) 224 f. oben Anm. 614 f. und Pol. VIII 13, (II) 317.25 ff.: Simpliciter constatfrugalitatem in bonis numerandam utpote illam quae Saturno regnante regna aurea temperavit et eorundem omniadispensavit officia. Haec est quae Astream et Pudicitiam in terris diutius tenuit, donec eas, invalescente luxu, regnante Iove,ad superos contingit evolasse [Iuv. Sat. VI 14–20]. Nos haec fabula respicit [cf. Hor. Sat. I 1, 69], ut sciamus sinefrugalitate non posse iustitiam aut pudicitiam conservari. Vgl. auch §§ 49, 73, S. 290, 403, 410 ff., 445, 509 f.
554
neuer Sonderaufgaben in einer arbeitsteiliger werdenden Gesellschaft (was mit dem Stichwort„Verwaltungsethik“ angedeutet wurde).1053 Darauf lassen sich wesentliche Intentionen Johanns beziehen: seinKonkordanzdenken, seine Offenheit für heidnisches Gedankengut, sein fideistisch temperierter Skeptizismus,seine Bevorzugung topischer, auf Konsens und „common sense“ beruhender Methoden der Problemlösung,seine Abneigung gegen apodiktische und dogmatische Behauptungen, gegen szientistisch-dialektische Hybris –kurz all das, was nach Mario dal Prà sein philosophiegeschichtliches Hauptverdienst, ja seine Einzigartigkeitim Mittelalter ausmacht: seine Philosophie der Negativität und Wissenskritik.1054 Weder literarischerExhibitionismus
1053 § 95, S. 262 ff., 391 f., 466 f., 488, A. 663, 965. Zum Konfliktpotential des Investiturstreits und der folgendenAuseinandersetzungen zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt im Rahmen der „Renaissance des 12. Jahrhunderts“ vgl.S. 86, 326 ff., 344, A. 922 f., 964a; BENSON/CONSTABLE, ‚Renaissance and Renewal’ (A. 7), Introd. XXVIII; LÖWE,Persönlichk. (wie Anm. 669) 524, 534 ff.; John O. WARD, Artificiosa Eloquentia’ in the Middle Ages, Diss. Toronto1972, I 235 ff.; von MOOS, Lucans tragedia 165 f., 174 ff.; ROBINSON, Authority (wie Anm. 669) jeweils mitweiterführender Literatur; Wh. KÖLMEL, Imago mundi: das Weltverständnis in Schriften des Investiturstreites, StudiGregoriani 9 (1972) 167–98. – Der Policraticus erschien übrigens den MGH-Herausgebern der sog. Libelli de lite alsgregorianische Streitschrift (vgl. LIEBESCHÜTZ 4). – Zum Loyalitätskonflikt als Folge des Investiturstreits bei Johann vgl.LIEBESCHÜTZ 40 f.; BROOKE, Letters (wie Anm. 1) II, Introd. XII. STOLLBERG (Anm. 577) 160 macht auf das gegendie Realität abstechende besondere Gesellschaftsideal geordneter (organischer) Harmonie bei ihm u. a. englischenIntellektuellen aufmerksam (s. oben Anm. 923); MISCH (1243, 1247) sieht bei ihm einen Übergang „von dem reichbewegten Anfang des Hochmittelalters“ zu der „harmonisch geordneten Vollendung“, aber auch Verengung der Scholastik(vgl. oben §§ 65 ff.).1054 Vgl. Dal PRÀ 126, 145 ff., 156–9 u. ö. (S. 170, 297 ff., 372 f.) Die philosophiegeschichtliche Stellung Johanns wurdebisher nirgends prägnanter und überzeugender umrissen. Weitere Detailforschung auf diesem Gebiet wünscht mit RechtKERNER, 183. – Wenn Johann die besondere Stärke des Aristoteles in der Kritik und Widerlegung, nicht in der Affirmationsieht, so könnte diese Charakterisierung auf ihn selbst zurückbezogen werden (Met. III 8, 147): validior hic expugnator extititquam assertor (vgl. auch Anm. 823). Johann vergleicht dabei neutral zwei gewissermaßen arbeitsteilig notwendige Arten desPhilosophierens (die einen sind besser im „Ja“, die andern im „Nein“). Der Vergleich zwischen negativem und positivemDenken entstammt einer patristischen Steigerung von der Philosophie zum Glauben, wie sie repräsentativ z. B. Lactanz, Div.Inst. II 3.24 vornimmt: Ita philosophi quod summum fuit humanae sapientae assecuti sunt, ut intelligerent, quid non sit;illud assequi nequiverunt, ut dicerent quid sit. Dazu vgl. BLUMENBERG Patristik (wie Anm. 36) 492. Johann wertet dieNegativität höher. Sie steht als besonderes Philosophen-Merkmal jener „akademischen“ Skepsis nahe, zu der er sich bekennt(vgl. §§ 45 f., 72). Vgl. auch JEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 544) 100 ff. zu einem Ansatz negativer Theologie beiJohann (vgl. auch oben Anm. 598).
555
noch Freigeistigkeit, sondern eher ein Sicherheitsbedürfnis, Angst vor dem Ungewissen bestimmen seinInteresse an den diskutierbaren dubitabilia und an der Sammlung von Exempla als Waffen der Disputationund Auseinandersetzung. Die hier gleich zu Beginn an einer Briefstelle illustrierte Methode, in omni arduadubietate mangels anderer Gewißheiten auch Exempla zu studieren, betrifft nicht nur aktuelle praktischeFragen des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik, sondern auch alle philosophisch existentiellen undmoralischen Fragen, die im Policraticus behandelt werden. Exempla sind zeitlos, frei von der Not und Engedes geschichtlich Einmaligen. Darum eignen sie sich als Orientierungshilfen bei der Suche nach einemphilosophischen certum in der historischen Welt der Ungewißheiten.1055
1055 Vgl. oben Anm. 1 zur Antithese dubietas–certum in Ep. 217, (II) 364 f. Zum Aspekt der Orientierungshilfe vgl. auchMet. Prol. 4: De moribus vero nonnulla scienter inserui; ratus omnia que leguntur aut scribuntur inutilia esse, nisiquatenus afferunt aliquod adminiculum vite. Est enim quelibet professio philosophandi inutilis et falsa que se ipsam incultu virtutis et vitae exhibitione non aperit. Met. IV 36, 208.13 f.: Homo vero quantuscumque affectat quidem certiorari eoquod amor veritatis cognatus et innatus est rationi (vgl. oben Anm. 901).
556
EXKURSE
Ohne Furcht vor dem Odium der Peinlichkeit, neigen wir vielmehr derAnsicht zu, daß nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei.
Thomas Mann, Vorwort zum ‚Zauberberg‘.
I. DER TITEL DES POLICRATICUS
Forschungsbericht (§ 115). Zur mittelalterlichen Tradition der „Vielbuch“-Titel und zur Kompilationstheorie (§ 116). DieRadix poli- im Sprachgebrauch Johanns (§ 117). Der zentrale Herrschaftsbegriff im Policraticus und in der Policraticus-Rezeption (§ 118). Policraticus-Prolog und Epilog im Hinblick auf die moralische Weltherrschaft der litterae und derphilosophia (§ 110). Die „polycratia“ der Philosophie (§ 120).
115. In der Policraticus-Forschung ist das Problem des Werktitels immer wieder zur Sprache gekommen. Dereine oder der andere Lösungsvorschlag fand zeitweilig jene breite Zustimmung, die eigene Beschäftigung mitder Frage erübrigt. Wenn der Untertitel De nugis curialium et vestigiis philosophorum auch zu keinengrößeren Verständnisschwierigkeiten geführt hat, so ist der Sinn des Wortes policraticus m. E. doch nochnicht überzeugend und allgemein akzeptabel ermittelt worden. Es lohnt sich, dieses Detail noch einmal insGespräch zu bringen, weil der Titel in einer bestimmten Lesart auf eine zentrale Idee des Werks verweist, dieauch Gegenstand des vorstehenden Beitrags ist.
Die bisherigen Deutungen seien vorweg rekapituliert: Explizite Zeugnisse aus dem Mittelalter sind selten. EinKopist (wohl des 13. Jahrhunderts) schrieb in seiner Exzerpt-Sammlung:1056 Liber primus policratici magistriJohannes et dicitur policraticus id est de pluralitate iudiciorum et dicitur liber de nugis curialibus et vestigiisphilosophorum. Der früheste Übersetzer des Werks, Denys Foulechat, glossierte 1372 den Titel so:1057 ‚carpolis segnefie multitude de pluseurs personnes…‘. Dies erklärt sich aus der im Mittelalter auch sonst belegtenScheinetymologie von pøliq (Stadt) aus pol¥q (viel) und bezieht sich offenbar inhaltlich auf die Vielheit derdargestellten oder zitierten Menschen, seien es Höflinge, Philosophen oder Autoren.1058
1056 München, Clm. 631 s. XII/XIV (nach WEBB, Pol. prolegomena I p. XVI: manu saeculi XIII, ni fallor, exarata)fol. 34ra, zit. nach WEBB ebd. p. XLVIII und KERNER 2.1057 Vgl. L. DELISLE, Cabinet des Manuscrits…, I, Paris 1868, 39 f.; BRUCKER (wie Anm. 488) 89 und oben Anm. 342,481.1058 Vgl. unten S. 564.
557
Erstmals hatte ein berühmter Leser der Frührenaissance, Coluccio Salutati, Mühe mit dem Titel, da erschrieb:1059 apud magistrum Johannem de Saberiis [sic] anglicum tractatu De nugis curialium et vestigiisphilosophorum quem librum nescio qua ratione Policratum [sic] vocant. Ebenso enthält sich der erstekritische Gesamtherausgeber J.A. Giles 1848 vorsichtig einer eigenen Meinung:1060 Cur Polycraticum opussuum Johannes inscripserit nobis incompertum. Vocis enim etymon de operis natura et argumento nihil nosedocet. Auffällig ist immerhin, daß Giles – wie viele Handschriften und wie die meisten Editionen oderAnführungen der Neuzeit vor Webb1061 – Polycraticus (mit y) schreibt und damit stillschweigend für dieAbleitung a pluralitate Partei ergreift, einen Bezug zu polis sich mithin nicht vorstellen kann.
Man darf allerdings nicht übersehen, daß beide Orthographien (mit i und mit y) im Mittelalter unterschiedslos,d. h. ohne strikt etymologischen Bezug möglich waren, wie es der Freiheit oder Willkür unreglementierterSchreibgewohnheiten entsprach. Erst die Herausgeber der Neuzeit, Griechischkenner und klassizistischgebildete Philologen, die den Kopistenunsitten des Mittelalters mit klassischer Einheitsorthographie zu Leibezu rücken trachteten, sahen sich in der gegebenen Situation vor einem interpretatorischenEntscheidungsproblem, mußten sich mit ihrer Lesart zu der Etymologie bekennen, die ihrer Ansicht nachJohann vorgeschwebt haben mochte. In der modernen kritischen Edition, die das genaue Schriftbild der bestenTradition – also gegebenenfalls orthographischen „Wildwuchs“ – in absolut mittelaltergemäßer Texttreuequasi photographisch abzubilden hat, entfällt dann wieder ein solcher, oft unbequemer hermeneutischerEntscheid (wie hier für y oder i oder in ähnlichen Fällen für ae oder e, t oder c, v oder u).1062
1059 Ep. 2.482 (NOVATI); vgl. ULLMANN (wie Anm. 34) 529; KERNER, Institutio (wie Anm. 783) 179 f. DieFehlüberlieferung: Policratus findet sich auch anderswo, etwa bei Walter Burley oder Philippe de Mézières nach LINDER(wie Anm. 321) 341, 348.1060 J.A. GILES, ed. Joannis Saresberiensis… opera omnia, Oxford–London 1848, V, 1; vgl. WEBB p. XX: „Policraticumsive, ut mavult Giles, Polycraticum“.1061 Vgl. A. 1070. Zu älteren Ausgaben vgl. SCHAARSCHMIDT 10, WEBB XVI, zu Hss. WEBB p. XIII (S):Polycraticon; zu Frühdrucken unter dem Titel Polycraticus (s. 1. 1475, Paris 1513, Lyon 1595) s. G. FASOLI, Medio Evoe Storiografia del Cinquecento, in: ‚Storiografia e Storia’, Festschr. E. DUPRÈ THESEIDER, Rom 1974, I 311 ff., hier315.1062 Zum methodischen Problem der Editions-Orthographie, insbesondere zu der nur theoretisch möglichen„Mittelaltergemäßheit“ und der Fiktion eines „mittelalterlichen Normalschriftbildes“ vgl. CONSTABLE (wie Anm. 248) II84 ff.; von MOOS, Consolatio I 12.
558
Nach der bisher offenbar vorherrschenden Ableitung des Titels von polys ging erstmals und mitEntschiedenheit Schaarschmidt 1862 von polis aus:1063 „Was nun den Namen Policraticus anbetrifft, so wirdsich wohl Niemand mit dem neuesten Herausgeber von Johann’s Schriften, Giles, darin einverstandenerklären, daß das Wort keine genügende Beziehung zum Inhalt des Werkes habe. Eine solche ist ohne Zweifelvorhanden, und man muß nur den Versuch machen, sie zu finden.“ Johann sei, des Griechischen unkundig,aber als Hellenismen-Liebhaber vom „bekannten griechischen Namen Polycrates“1064ausgegangen, habejedoch irrtümlich unter „Poly“ Stadt verstanden. Die „einzig richtige Übersetzung“ sei: „Stadt- d. h. Hof-Bezwinger“, was sich auf de nugis curialium im Untertitel beziehe. Da „Polis“ Stadt, Hof und die Weltüberhaupt bedeute, sei der Policraticus schließlich „eine Schrift, darin die Welt in ihre Schranken gewiesen, dieHerrschaft des Geistes über sie und das Recht seiner Vertreter, der Geistlichkeit […] nachgewiesen wird.“Letzteres beziehe sich auf den zweiten Teil des Untertitels: de vestigiis philosophorum. – Die Quintessenzdieser Deutung machte sich auch der kritische Herausgeber Clemens Webb (1909) mit nicht geringererÜberzeugung zu eigen:1065 de titulo Policratici nec dubitandum est quin de libro in usum civitatis regentiumintellegi debeat.
Diese Ansicht wurde in der Folgezeit lange nicht mehr in Frage gestellt. Nachdem John Dickinson seineenglische Teilübersetzung von 1925 mit „The Statesman’s Book“, als sei dies die wörtliche Wiedergabe deslateinischen Titels, überschrieben hat1066, herrscht im allgemeinen Verständnis, wie es in Handbüchern undLexika zutage tritt, die Annahme vor, der Policraticus sei – wie schon aus der Überschrift ersichtlich – einFürstenspiegel, eine
1063 SCHAARSCHMIDT 144 f.1064 Ebd. – Der Eigenname konnte aus Val. Max. VI 9.5 bekannt sein, und vielleicht aufgrund der Stelle: tyranniabundatissimis bonis conspicuus wäre eine Pseudoetymologisierung denkbar. Johann selbst zitiert aber die berühmteGeschichte vom Ring nirgends, so daß dieser Bezug unwahrscheinlich ist. – BLAISE, Lex. latinitatis med. aev. (Turnholt1975) belegt das Adjektiv polycrates (s. v.) mit Genitiv im Sinne von „fort en“, „maître en“. Der Beleg von FORCELLINIs. v.… darf erst recht außer Acht bleiben: polyxqatºa: Arati, Achaeorum ducis uxor (Liv. 27.31).1065 WEBB p. XLVIII; auch p. XXII: Librum in usum civitatibus imperantium.1066 John DICKINSON (transl.), The Stesman’s Book of John of Salisbury, Being the Fourth, Fifth and Sixth Books, andSelections from the Seventh and Eighth Books of the Policraticus, New York 1925, 1927, repr. 1963. In der Einleitungp. XVII heißt das ganze Werk, nicht etwa nur die spezifisch in diesem Sinn getroffene Auswahl „the earliest elaboratemediaeval treatise on politics“. Vgl. auch F. MARKLAND (ed.), John of Salisbury, Policraticus – The Statesman’s Book,New York 1979 (nicht eingesehen).
559
„Staatsschrift“ oder ein politisches Lehrbuch.1067 Noch die 1984 erschienene italienische Übersetzung trägtden Titel: ‚Policraticus, l’uomo di governo nel pensiero medievale‘.1068Die implizite petitio principii bliebunbemerkt. Zwei Beispiele aus der engeren Johann von Salisbury-Forschung: Der verdiente Erforscherpolitischer Theorien des Mittelalters, Walter Ullmann, schreibt:1069 „The title itself is obviously a neologismcoined by the author to express the main concern of the book: government of the polis.“ André Pézardleitet seinen Beitrag ‚Du Policraticus à la Divine Comédie‘ so ein:1070
1067 Vgl. etwa ZANOLETTI (wie Anm. 343) 15 f.; GARIN, Art. Policraticus in Kindlers Lex. d. Lit. s. 1; Tusculum-Lexikon, ed. W. BUCHWALD et al. München–Zürich/Darmstadt3 1982, 410: „Sein […] Hauptwerk Policraticus […]behandelt von hoher ethischer Warte die Prinzipien der Staatslenkung“. Gerechterweise ist einzuschränken, daß die zweiwichtigsten Handbücher der Mittellateinischen Philologie den Pol. nicht auf einen Fürstenspiegel reduzieren: GustavGRÖBER behandelt den „Policraticus (Hofbeherrscher)“ in seiner erstmals 1902 erschienenen Übersicht über die lat. Lit. vonder Mitte des 6. Jhs. bis zur Mitte des 14. Jhs. (München2 (1963) 214 im Kapitel „Morallehre, Erziehungsschriften,Staatsschriften“ und schreibt, der Pol. sei „seinem Grundgedanken nach wenigstens ein Werk der Moral, sofern es denZerstreuungen des Hoflebens […] die Aufgaben eines dem Ernst hingegebenen Lebens entgegenhält …“ (Es folgt einKondensat des Inhaltsverzeichnisses) … „… wobei im bequemen Rahmen einer planlosen Darstellung auch die altenPhilosophen gemustert, vom Zweifel und seinen Grenzen […] häufig sprunghaft, aber gedanken- und geistreich gehandeltwird“. Auch Max MANITIUS nennt in seiner Geschichte der lat. Lit. im MA III (1931) 256–8, hier 258 (nachSCHAARSCHMIDT) den Pol. abschließend „einen Weltspiegel, der das Leben der höheren Stände und der gelehrten Kreisemit großer Schärfe reflektiert“. Bemerkenswert ist hier auch, daß W. BERGES in seiner Monographie über die Fürstenspiegel(wie Anm. 640) 131 ff. den Pol. nur in einem sehr weiten Sinn zur Gattung rechnet und ausdrücklich vor einer Isolierung derpolitischen Theorie aus dem großen philosophischen Zusammenhang oder vor der Unterschlagung nicht zum politischenInteresse passender Kapitel warnt. Vgl. auch EBERHARDT (wie Anm. 264) zur wesentlich weiteren Thematik des Pol. imVergleich mit karolingischen Fürstenspiegeln.1068 Übs. von Luca BIANCHI und Paola FELTRIN, (Jaca Book 137) Mailand 1984. Erst das Kleingedruckte auf derCopywright-Seite zeigt den selektiven Charakter: „prima traduzione italiana dei libri III–VIII“. Allein durch diese Auswahlwird auch hier der Eindruck erweckt, der Pol. sei ein politischer Traktat, obwohl L. BIANCHI in seiner konzisen, denneuesten Forschungsstand berücksichtigenden ‚Introduzione’ die thematische Vielfalt und philosophische Bedeutung desWerks ausgezeichnet zusammenfaßt.1069 ULLMANN (wie Anm. 34) 519.1070 PÉZARD (wie Anm. 343) 1 f. – Nach der unten besprochenen Arbeit KERNERS, aber noch von der DeutungSCHAARSCHMIDTS und WEBBS inspiriert, hat M. WILKS (wie Anm. 546) 279 f. eine interessante, aber m.E. zuimpressionistische Interpretationsvariante vorgeschlagen: Der ideale „Fürst“, den man sich wohl als ein christlichesGegenstück zu Macchiavellis Titelhelden vorzustellen hätte, sei als Antipode des „Tyrannen“ der Policraticus in einem ganzwörtlichen, der organologischen Staatsmetapher entsprechenden Sinn: „If the polis has a persona corporis, […] then thisideal ‚man of state’ has to be given actually in the person of the ruler: he literally is the man of the State, the ‚State’s-man’, aphysical expression of the body of right“. Dies berührt zweifellos eine über das Politische hinausführende Grundidee desWerks, die sich jedoch auch auf andere Weise – ohne die Ableitung von polis – auf die Titelformel beziehen läßt, etwa überdie Vorstellung der Herrschaft des „Einen“ über das „Viele“ (vgl. S. 407 f., 466 f., 488 f., 510, 513, 574 ff.). Vermutlich hatCHENU aus diesem Grunde Polycraticus geschrieben (vgl. z. B. Théologie 21, 37 und oben § 105).
560
„Ces préoccupations politiques sont si apparentes […] que ses derniers illustrateurs ou éditeurs, Schaarschmidtet Cl. Webb y voient l’explication d’un titre que rendait incompréhensible la graphie Polycraticus adoptéepar les éditeurs du XIXe siècle. Il faut donc revenir à Policraticus, et y reconnaître un radical polis, ‚Etat‘,très correctement employé à former un terme policratia comparable à poliarchia et à thalassocratia: Jean deSalisbury s’est proposé un traité De regimine civitatis“.
Die Selbstverständlichkeit dieser Deutung hat nun Max Kerner in seiner hervorragenden Monographie zumPolicraticus (1977) nach sorgfältiger Überprüfung aller bisherigen Argumente wieder in Frage gestellt, da erden Titel nur aus einem adäquaten Werkverständnis heraus erklären wollte und der keineswegs auf diepolitische Thematik reduzierbare, sondern viel komplexere, im wesentlichen philosophische Gehalt diebisherige bequeme Lösung suspekt machte.1071 Überzeugend erläutert Kerner zunächst den (allerdings ohnehinweniger kontroversen) Untertitel; er leitet ihn aus einer seit der antiken Rhetorik für Memorabilienliteratur,Exemplasammlungen und Moralhandbücher vorgegebenen Titelformel (De vestigiis philosophorum) ab, derkein zwingender Hinweis auf eine Staatstheorie oder politische Streitschrift zu entnehmen ist.1072 Was denzur Debatte stehenden Haupttitel betrifft, übergehe ich Kerners völlig berechtigte Kritik an den bisherigeneinseitig politisch-politologischen Deutungen und fasse den neuen und bisher
1071 KERNER 203 ff., 101 ff. (zum Titel).1072 KERNER 104–107 zur Nachbildung des Titels der nicht identifizierten Schrift eines Flavian ‚De vestigiisphilosophorum’, die (gleichviel ob echt oder pseudepigraphisch) zur Memorabilienliteratur gehört. Zu Flavian und Macrobvgl. oben Anm. 485, 509, 836. Auf die Memorabilien-Gattung weist Johann in Pol. VIII 6, (II) 260.27 ff. selbst hin: ab hisqui res memorabiles scribunt, womit er sich auf factorum et dictorum memorabilia des Val. Max. und andere Werke dieserArt bezieht. – Eine weitere heranzuziehende Gattungsbezeichnung läßt sich aus officiorum scriptores ableiten: s. obenAnm. 965.
561
letzten Erklärungsversuch kurz zusammen: Kerner stellt einmal fest, daß der Titel nicht erst von einemAbschreiber, sondern von Johann selbst stammt, der seine Schrift mehrfach so zitiert.1073 (Allerdings hat erPolicraticus wahrscheinlich erst für eine zweite, erweiterte Fassung des zuvor allein mit dem jetzigenUntertitel überschriebenen Werks gewählt.)1074 Kerner versucht dann, den Haupttitel „auch inhaltlich stärkermit dem […] Untertitel zu verknüpfen“, d. h. von diesem her zu deuten.1075 Er will im Policraticus „eineübergreifende inhaltliche Einheit […] sehen, die den Gegensatz Höfling/Philosoph aufnimmt und vielleicht ineiner bestimmten Weise verarbeitet.“1076 Da er den Begriff nachdrücklich auf eine Person bezieht, fordert ereine stärker „moralische Ausdeutung des Herrschaftsbegriffs“ (von polykrateo, potens sum) und gelangt zudem vorsichtigen Schluß, policraticus „würde danach weniger einen Polis-Herrscher bezeichnen, sondern ehereinen Christen, der ein humanistisch-christliches Lebensideal zu verwirklichen sucht.“1077 „Für Johannes wäredann derjenige, der dieses christliche Lebensideal verwirklicht, ein wahrhafter Christ, wenn man so will, ein‚policraticus‘.“1078Kerner gibt selbst das Hypothetische dieses Vorschlags zwischen den Zeilen zu und regtdamit zu weiterer Untersuchung an.
116. Vorweg ist grundsätzlich anzunehmen, daß Johann, der die lateinische Tradition griechischer Buchtitelmit ausgeprägtem Philhellenismus pflegte (er erfand auch Entheticus und Metalogicon),1079 trotz seiner kaumnennenswerten Griechischkenntnisse ungefähr wußte, was die Wortbestandteile von Policraticus
1073 KERNER 102 ff. Johann erwähnt Policraticus noster in Met. I 4, 15.9 f. mit Verweis auf die nugae curialium; Met. I10, 28.5 f.: Sed de his latius dictum est in Policratico mit Bezug auf abergläubische Praktiken, que […] ab officiis alienesunt. (Auch hier ein Hinweis auf den Charakter eines officia-Traktats: vgl. Anm. 968).1074 KERNER 206.1075 Ebd. 103.1076 Ebd. 104.1077 Ebd. 206.1078 KERNER, Institutio (wie Anm. 783) 190. – Wenig erhellend ist die unabhängig von allen bisherigen Interpretationengebotene Anspielung von G. DUBY, Die drei Ordnungen (wie Anm. 922) 387: das Werk sei „ein Spiegel des Hofes als Orteiner – polykratischen – Umsetzung der Macht“.1079 Vgl. Macrob, Sat. V 17.20: denique omnia carmina sua Graece maluit inscribere Bucolica, Georgica, Aeneis cuiusnominis figuratio a regula Latinitatis aliena est. Johann erklärt selbst nur den Titel Metalogicon in Met. Prol 3.16 f.: quialogicae suscepi patrocinium (also „mit der/für die Logik“). Vielleicht kannte er auch die Liste modisch-prunkvoller Titel,von denen sich Aulus Gellius, N. A. praef. 5–9 in topischer Bescheidenheit distanziert (s. unten Anm. 44). Griechische Titelwurden im Hochmittelalter allgemein beliebt (KERNER 101 erinnert an Monologion, Proslogion, Dragmaticon,Megacosmus/Microcosmus). Offenbar galten sie nicht nur als eine Spezialität Vergils, sondern als ein allgemeinesKennzeichen literarischer Dignität in der Antike. Vgl. in diesem Sinn etwa Richard von Bury, Philobiblon, ed. A.ALTAMURA, Neapel 1954, 73: … quia vero de amore librorum principaliter disserit, placuit nobis more veterumLatinorum ipsum greco vocabulo Philobiblon amabiliter nuncupare.
562
bedeuten.1080 – Die erste Hauptfrage dürfte verhältnismäßig leicht zu klären sein: ob der Gräzismus mit polisoder mit polys/poly gebildet ist. Paul Lehmann hat in seinem stoffreichen Aufsatz über ‚MittelalterlicheBüchertitel‘ einige Beispiele erwähnt, in denen „die Vielheit des Dargebotenen eine Rolle spielt“:1081
Milleloquium, multiloquium, polychronicon, polypticon (sc. polypticus, politicus, poleticon). Eine Kuriositätstellt insbesondere letztere Abschleifung von pol¥ptixon dar, die gerade in Titeln für moralische Florilegienverbreitet ist und zur Verwechslung der Ableitungen von polis und polys beigetragen hat. In einemEinzelfall1082 erwägt Lehmann die Hypothese, daß ein ursprünglich auf Politisches weisender Titel politicumerst in der handschriftlichen Überlieferung und Umarbeitung zu polipticum, „das
1080 Zu Johanns zwar kaum nennenswerten Griechischkenntnissen, aber großer Verehrung alles Griechischen und seinerBekanntschaft mit Übersetzern vornehmlich in Süditalien vgl. KERNER 80 f., 104; BRUCKER (wie Anm. 48) passim;CILENTO (wie Anm. 704) 118; M.-Th. d’ALVERNY, Translations and Translators, in: Renaiss. and Renewal (wie Anm. 7)421–462, hier 427, 433; N.M. HÄRING, Commentary and Hermeneutics, ebd. 173–200, hier 197 f. betont aber zu Rechtdie paradoxe Vorliebe für ausgefallene griechische Titel aufgrund fehlender Griechischkenntnis. Zu Johanns Rolle bei derWiederentdeckung und Vermittlung verlorener oder wenig bekannter Werke des Aristoteles und des Ps.-Dionysius AeropagitaS. 193 f., 246 f., 306. – Seltsam wirkt das Faktum, daß in einer gerade den Griechischkenntnissen im lateinischenMittelalter gewidmeten Untersuchung (W. BERSCHIN, Griechisch-lateinisches Mittelalter, Bern/München 1980, 276) imAbstand von zwei Zeilen der Titel unseres Werks einmal Policraticus, dann Polycraticus geschrieben wird.1081 LEHMANN (wie Anm. 965) = in: ders., Erforschung des Mittelalters, 5, Stuttgart 1962, 1–93, hier 47 f. Dies ist m. E.die einzige umfassende Arbeit zu diesem interessanten und damit noch keineswegs erschöpften Thema der mittellateinischenPhilologie. (Einzelne Titel wie speculum wurden gelegentlich für besondere Gattungen untersucht; vgl. oben S. 488 f.). Eineallgemeine Geschichte der Buchtitel ist überdies, wie BRÜCKNER, Hist. 103 betont, ein wichtiges komparatistischesDesiderat. Für den nicht-lateinischen und den späteren Bereich vgl. etwa Klaus DÜWEL, Werkbezeichnungen dermittelhochdeutschen Erzähllit., Diss. (masch.) Göttingen 1965; Herb. VOLKMANN, Der deutsche Romantitel (1470–1770),Eine buch- und literaturgeschichtl. Untersuch., in: Arch. f. Gesch. d. Buchwesens 8 (1967) 1145–1324 (Diss. Berlin 1954).1082 LEHMANN, Büchertitel (wie Anm. 1081) 48 zu Ps.-Atto von Vercelli; vgl. auch Du CANGE s. v. polyptichum.
563
Vielbuch“, verdorben wurde. Er fügt bei, daß dann der mutmaßlich ursprüngliche Titel trefflich mitdemjenigen „der Staatslehre des John of Salisbury in Parallele zu setzen wäre.“ Damit übernimmt Lehmannungeprüft die gängige Forschungsmeinung zur Deutung von policraticus, gegen die er aufgrund seiner eigenenKenntnis der ungeheuren Verbreitung von „Vielbuch“-Titeln leicht hätte angehen können. Ist es Zufall, daßer außer dem vermeintlichen des Policraticus keinen anderen polis-Titel kennt, den er mitpolipticum/politicum hätte vergleichen können?
Zur Tradition der „Vielbuch“-Titel muß ergänzend die von Johann häufig zitierte naturkundliche SammlungCollectanea rerum memorabilium seu Polyhistor des Solinus genannt werden.1083 Poliistor/Polyhistor hatauch der nach neuesten Ergebnissen ungewöhnlich belesene Humanist Wilhelm von Malmesbury(c. 1095–c. 1143) – landläufig nur als Historiker bekannt – seine Exzerptsammlung von literarischem,historiographischem, anekdotischem und naturkundlichem Material aus der Antike überschrieben.1084 MancheAnalogien, insbesondere in der Verwertung derselben ausgefallenen auctores-Stellen, haben zu der (allerdingsnoch kontroversen) Annahme geführt, Johann hänge in manchem von diesem Werk ab.1085 Nichtauszuschließen ist jedenfalls, daß er Solins oder Wilhelms Polyhistor-Titel für nachahmenswert hielt und sichdavon zu der Abwandlung Policraticus inspirieren ließ. Erwähnenswert ist auch die ‚Polistoria de virtutibus etdotibus Romanorum‘ des Valerius Maximus-Liebhabers und Anekdotensammlers Johann Cavallini aus demfrühen 14. Jh., der nicht anders als Wilhelm mit der „Vielheit“ mehr die denkwürdigen historiae als die„Erkundung“ der Natur assoziiert haben dürfte.1086
1083 Von Johann (nach WEBBS Index locorum II 499 f. s. l.) häufig benützt. Vgl. Ps.-Robert Grosseteste, Summa philos.(wie Anm. 492) 289.8: polyhistor, idest multarum historiarum relator (s. oben Anm. 299); Du CANGE s. v. polyhistor: exmultis historiis et compilationibus […] quasi pluralitas historiarum (Joh. de Janua).1084 Zu Wilhelm s. die oben Anm. 405, 842, 734 angeführten Arbeiten von R.M. THOMSON, sowie die in Anm. 326genannten Beiträge von CARTER (163 ff.), MARSHALL et al. (369 f.), CLASSEN (390 ff.). – Kritische Edition des‚Polyhistor’ (Poliistor deflorationum Willelmi) durch Helen Testroet OUELLETTE, Medieval & Renaissance Texts &Studies 10, Binghamton, New York 1982.1085 Diese Abhängigkeit hat R.M. THOMSON, William of M. (wie Anm. 842) 382 ff. nachzuweisen gesucht. Einwändedagegen erhob J. MARTIN, Uses of Tradition (wie Anm. 29) 17 hauptsächlich aufgrund der Möglichkeit, daß die beiden umeine Generation zeitlich getrennten Autoren mit dem gleichen Hss.- und Florileg-Material gearbeitet haben können.1086 Vgl. H. DIENER, Johannes Cavallini (wie Anm. 299) bes. 152, 171 zur vor-humanistischen philologischen Arbeit desHss.-Vergleichs am Val. Max.-Text.
564
Ein für die Wirkungsgeschichte des Policraticus wichtiger Text des 14. Jahrhunderts ist hier besondersinteressant, die umfangreiche Universalgeschichte Polychronicon/historia polychronica des Ranulfus Higdenvon Chester:1087 Einmal werden hier im Vorwort Kronzeugen aufgezählt, die pro clypeo contrasugillantes1088 – also ähnlich wie die clientes-Vasallen bei Johann – eingesetzt werden sollen; unter diesenAutoritäten findet sich auch Johannes Salisburiensis in suo Polycraticon (sic) quem intitulavit de NugisCurialium et Philosophorum (sic). Nach anderer Lesart steht hier statt Polycraticon: Polychronicon. DasWerk wird dann als „polychrone“ Geschichte eingeführt:1089 Et quia praesens chronica multorum temporumcontinet gesta, idcirco eam Historiam Polychronicam, a pluralitate temporum quam continet, censuinuncupandam. Die beiden Titel Polychronicon und Polycraticon/Polycraticus sind in der Überlieferung oftmerkwürdig verwechselt worden. So führt ein Katalog Ranulfs Werk als Polycratica temporum seuPolychronica an;1090 Handschriften nennen es Historia policratica, Polycraticon, das Werk Johanns aber imGegenzug Polychronicon. Schließlich findet sich für Ranulfs Universalgeschichte die explizite Gleichung:1091
vulgo vocatur Polichronicon sive Policraticon. Solch krause Irrtümer zeigen zum mindesten, daß JohannsPolicraticus-Titel – vor und nach der Veröffentlichung – einer Publikumseinstellung entgegenkam und daß(angesichts der Beliebtheit ähnlicher Titel) die Leser eher geneigt waren, Poli- mit „viel“ als mit „politisch“zu identifizieren. Dies ist, wie die oben angeführte Glosse des französischen Policraticus-ÜbersetzersFoulechat annehmen läßt, umso wahrscheinlicher, als selbst in Kenntnis der Bedeutung von polis: civitas velurbs (so etwa bei Papias) die Etymologie unentwegt in dem berühmteren polys gesucht wurde, d. h. in derVielheit der in einer polis lebenden Personen.1092
1087 Ranulfus Higden, Polychronicon, ed. C. BABINGTON (RBS 41.1–9) 1865–85, Bd. I, vgl. J. TAYLOR (wieAnm. 337) passim und MINNIS, Authorship (wie Anm. 337) 113, 193 ff., 203 ff. zur Kompilationstheorie. – ZurPolicraticus-Rezeption Ranulfs vgl. LINDER (wie Anm. 321) 344 f.; vgl. auch oben Anm. 366, 714, 734.1088 Ranulf I 24.1089 Ebd. I 26. – Vgl. Vinc. Belv., Spec. doctr. III 127: Historia multorum annorum vel temporum est; GUENEÉ, Histoire,annales, chroniques (wie Anm. 353) 997; LACROIX 38. Der Titel ‚Polychronicon’ für Historia polychronica ist eine spätereGlättung aus Abschreiberhand seit dem 15. Jh., entspricht aber durchaus sinngemäß der erwähnten voluntas auctoris.1090 Ranulf, ed. BABINGTON (wie Anm. 1087) Introd. XV.1091 Ebd. XVIII.1092 Vgl. auch LEHMANN, Büchertitel (wie Anm. 1081) 48 zu weiteren Übergängen zwischen polis = urbs/civitas und polis= plurale/pluralitas. – Zu Foulechat s. oben Anm. 1057. – Die verwendbaren Wörterbücher (Papias, FORCELLINI, duCANGE, BLAISE, ARNALDI) zeigen entschieden häufiger Zusammensetzungen auf der Basis poly- als solche mit polis-,polit- im spätlat. und mlat. Wortschatz (etwa poliformis, poliarchus, policrates, polychronia, polygenus, polyloquus,polypticum, polysemia, polyxenus, polygonius, polynymos, polypodios, polystriae, polymita, polygamia usw. usw.).
565
Was die Rezeptionsgeschichte des Policraticus betrifft, herrschte von Anfang an und bis ins 19. Jahrhunderteine auch die Titeldeutung einfärbende Vorstellung von „bunter Fülle“ (copia und varietas), wie sie erstmalsim Lob des jüngeren Freundes Peter von Blois in einem Brief von 1170 zum Ausdruck kommt:1093 librumvestrum de Nugis curialibus legi er mirabiliter me refecit. Nam et ibi optima forma eruditionis est et propterartificiosam sententiarum varietatem inaestimabilis materia voluptatis. Ähnlich formuliert nochFabricius:1094 Opus varium jucundumque lectu et in quo centone multos pannos purpurae et fragmentamelioris aevi agnovit Lipsius. Im übrigen führt Fabricius eine französische Übersetzung mit dem Titel‚Polycraticus des traces des philosophes et des truffes et vanitez de ceux qui suivent les cours des princes‘ an,was an die Idee eines Kompendiums oder Florilegs zu den im Untertitel genannten Themen erinnert.1095 Eineähnliche Vorstellung steht hinter der manifest falschen Bezeichnung Policaticon et Polipomenon, mit derPhilippe de Mézières in seinem ‚Le songe du vieil pelerin‘ dem französischen König Karl VI. den Policraticusals Fürstenlektüre empfiehlt.1096 Überhaupt dürfte der Fehler in der Titelüberlieferung, der aus der Person einNeutrum macht und schon unmittelbar nach dem Tode Johanns zu belegen ist,1097 auf der Annahme beruhen,es handle sich hier um eine Art Gattungsbezeichnung für kompilatorische Literatur. Nur so ist diemerkwürdige Stelle bei Ranulfus Higden1098 zu verstehen: In suo Polycraticon quem intitulavit de Nugis…
Allgemein ist auch zu bedenken, wie stark ein enzyklopädischer Grundzug die literarische Tätigkeit imMittelalter bestimmt. In vielen Prologstellen wird der Grundsatz bekräftigt, das jeweils vorliegende Buch habedurch seinen großen Wissensschatz das Verdienst, als ein einzelnes eine ganze Bibliothek
1093 Petr. Bles., Ep. 22 (PL 207) 82.1094 Wie oben Anm. 33. – Lipsius hat im übrigen selbst zwei seiner Werke ähnlich überschrieben: die antiquarische SchriftPoliorceticon (1596) und Politicorum libri (1589). Zu letzterem „politologischem“ Werk vgl. Montaigne I 26 (wieAnm. 192) 146 f.: „… des centons qui se publient pour centons; et j’en ay veu de très-ingenieux […] Ce sont des esprits quise font voir et par ailleurs et par là, comme Lipsius en ce docte et laborieux tissu de ses Politiques“. Montaigne lobt m.a.W.an Lipsius, was Lipsius an Johann von Salisbury lobt.1095 Notitia litteraria in der Pol.-Ausgabe bei MIGNE (PL 199) XIV abgedruckt.1096 Vgl. LINDER (wie Anm. 321) 348.1097 Siehe unten S. 573.1098 Polychron. I 24 wie oben S. 564.
566
zu ersetzen, weil es eine multitudo librorum in sich schließe.1099 Eine ganze Blüte von poetisch-metaphorischen Titeln entsproß diesem kompilatorischen Anspruch; neben den erwähnten poly-Titelnwimmelt es bekanntlich in mittelalterlichen Bibliotheksverzeichnissen von Bildungen wie thesaurus, varia,panopticum, milleloquium, communiloquium, panormia, pantheon, florilegium, pratum usw., die alle nichtso sehr die trockene Verkürzung des „Digest“ (wie compendium, breviarium, summa) als die bunte Vielfaltund Mischung des Materials empfehlen wollen. (Die Tradition der erwähnten poly-Titel in diesem Sinnerreichte übrigens ihre volle Blüte im frühneuzeitlichen Polyhistorismus.1100)
Die Annehmlichkeiten eines „Bibliotheksersatzes“ und Weltbuchs legt etwa Gottfried von Viterbo seinemfürstlichen Leser Kaiser Heinrich VI. zur Erklärung des Titels Pantheon ans Herz:1101 Ceterum quia tante estlibrorum multiplicitas […] ego libellum istum non superfluum ex omnibus ystoriis compilavi. EinFlorilegverfasser will dem „schlaffen Gedächtnis“ durch Selektion aufhelfen, da die multitudo librorum nurzerstreue und niemand sich an alles erinnern könne.1102 Bartholomeus Anglicus kommt mit seinerEnzyklopädie
1099 Zum Grundgedanken der Enzyklopädik vgl. MEIER (wie Anm. 709) 488 ff.; A. BORST, Das Bild der Geschichte in derEnzyklopädie Isidors von Sevilla, in: DA 22 (1966) 1–62, bes. 54 f.; CURTIUS, ELLM 451; §§ 84, 94, S. 385, 402,430 f., A. 337. Multitudo librorum […] in unum corpus zu vereinigen, nennt Vinzenz von Beauvais seine Absicht imSpeculum maius-Prolog (wie Anm. 337) 115. Das mühelose und sofortige Auffinden betont Petrus Lombardus als Dienst amLeser in seiner Sentenzen-Kompilation (PL 192) 522: … ut non sit necesse quaerenti librorum numerositatem evolvere, cuibrevitas quod quaeritur offert sine labore. Weiteres hierzu vgl. bei R.H./M.A. ROUSE, Statim invenire, Schools, Preachersand New Attitudes to the Page, in: Renaissance and Renewal (wie Anm. 7) 201–225, hier 206 ff.; M.B. PARKES, TheInfluence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio on the Development of the Book, in: ‚Medieval Learning andLiterature’, Festschr. R.W. HUNT, Oxford 1976, 115–41.1100 Eine Sammlung mittelalterlicher Titel s. bei GUENÉE, Hist. et culture historique 211 f. – Von Interesse ist hier auch dieListe verspotteter Fülle- und Reichtumstitel – in sich eine kleine Titel-Kompilation – bei Aulus Gellius, Praef. zu N.A. 5–9: Musen, Wälder, Gewand, Füllhorn, Waben, Wiesen, Früchte, Blüten, Fackeln, Fruchtkorb, Gemischtwaren usw. DieKritik richtet sich dabei weniger auf die Titel selbst als auf die bloße Stoffanhäufung (praef. 11–12) nach HeraklitsWahrspruch „Vielwisserei lehrt nicht Vernunft“. – Zu poly-Titeln der Neuzeit vgl. BRÜCKNER, Hist. 732 ff., 83;VERWEYEN 75.1101 Pantheon, ed. MGH SS XXII 103; vgl. MELVILLE, System 59 f.1102 Florilegium Bruxellense nach DELHAYE, Grammatica (wie Anm. 386) 35 (aus Hs. Douai 285 f. lv): volui […] madidememoria consulere. Distrahit enim librorum multitudo et omnium habere memoriam nemo potest.
567
‚De proprietatibus rerum‘ den Ungebildeten, zu denen er sich demütig selbst rechnet, mit schlichterExtraktkost zu Hilfe, damit simplices et parvuli von der librorum infinitas nicht abgestoßen werden.1103
Richard von Bury, ein guter Policraticus-Kenner, im übrigen auch ein Liebhaber griechischer Titel, spricht inseinem Philobiblon den thesaurus sapientiae et scientiae, d. h. Gott, in hymnischen Worten an:1104 O valorsapientiae […] O munus celeste! ‚Per te reges regnant‘ (Prov. 8.15) und fragt in unmerklichem Übergangzum Gedanken an die ideale Universalbibliothek: Quo lates potissime, preelecte thesaure, et ubi te reperientanime sitibunde? Antwort: In libris proculdubio posuisti tabernaculum tuum, ubi te fundavit Altissimus,lumen luminum, liber vite. Es folgt eine vom Policraticus-Prolog beeinflußte Apotheose des „unendlichenBücherschatzes“, ohne den weder Alexander noch Cäsar, weder Fabricius noch Cato heute bekannt wären.(Auch für ihr Fortleben gilt: per te regnant.)1105 Das vorliegende Büchlein empfiehlt sich schließlich selbst als„Buch über die Liebe zu den Büchern“, als eine Art „Bücherbuch“.
Dies sei hier nur angeführt als Illustration des geistigen Klimas, der allgemeinen Erwartungshaltung in Bezugauf die zahlreichen Buchtitel, die etwas mit dem Begriff der Vielheit zu tun haben. Daneben fallen – trotz derbekannten Bezeichnung politia für Platons ‚Politeia‘1106– die wenigen mit polis oder polit- gebildeten Titelim Mittelalter nicht ins Gewicht. Gewiß wird damit noch nicht bewiesen, daß Johann von Salisbury sich beiseinem Einfall von Policraticus unbedingt an das Übliche halten wollte. Er hätte sich auch bewußt kryptischoder originell geben können. Doch wahrscheinlicher ist von vornherein eine Bedeutung des Titels, diezeitgenössischen Lesern – dem Charakter des Werks gemäß kann es sich ohnehin nur um die Minoritäthumanistisch gebildeter Leser handeln – unmittelbar und kommentarlos als Anspielung auf bestehendeTradition verständlich gewesen sein kann, gerade weil Johann im Gegensatz zur präzis aufgeschlüsseltenTitelgebung von Metalogicon
1103 De propr. rer., Frankfurt 1601/repr. 1964, 1261.1104 Richard von Bury, Philobiblon I (wie oben Anm. 1080) 77. – Richard war als Bischof von Durham († 1345) Besitzereiner Policraticus-Hs.; vgl. WEBB pp. XI f, (A); zur Benutzung s. unten S. 574 ff. Vgl. auch MARSHALL/MARTIN (wieAnm. 326) 383 ff.1105 Vgl. oben § 42 zum Pol. Prol.; S. 175, 572, 575 zu Prov. 8.15; S. 437 zu Sap. 7.17 ff. als religiöser Grundlage eineschristlichen Polyhistorismus.1106 Johann selbst zitiert in Met. IV 10 oben Anm. 18 Platos ‚Politia’. – Christine de Pisan zitierte laut LINDER (wieAnm. 321) 914 die Foulechat-Übersetzung des Policraticus in ihrem ‚Le livre du corps de Policie’, was vielleicht alsrezeptionsgeschichtliches Indiz gewertet werden kann’, aber zu keinem Rückschluß auf die Autorintention zwingt. Vgl. auchULLMANN (wie Anm. 34) 541 (82).
568
(pro logica)1107 es durchaus nicht für nötig erachtet, zu Policraticus irgendeine explizite Erläuterungabzugeben.
117. Versuchen wir jetzt (weiterhin ausschließlich zum Wortglied poly- oder poli-) Indizien im Policraticusselbst zu finden: Unbestreitbar ist zunächst, daß Johann den Begriff politicus (wie civilis) im Sinne von ad rempublicam pertinens,1108 öffentlich, verwaltungs- oder staatsbezogen, insbesondere mit der Nuance desAktiven, Praktischen im Gegensatz zum Kontemplativen, bloß Theoretischen häufig verwendet, z. B.:1109
Plato scripsit libros plurimos et politici hominis merita contemplatio non repressit et contemplationisacumen actionis necessitas non extinxit; oder:1110 philosophus (sc. Plutarchus) virum politicum mittit adapes, ut ab illis suum discat officium. Noch konkreter sind Stellen, in denen Johann unter einem politicusoffensichtlich
1107 Vgl. oben Anm. 1080, und KERNER 101.1108 Vgl. etwa Pol. VII 9, (II) 125.16 ff.: Sic tamen omnia legenda sunt […] sed prae omnibus maiori diligentia insistendumest quae aut politicam vitam sive in iure civili sive in aliis ethicae praeceptis instituunt aut procurant corporis aut animaesanitatem. Ebd. I 3, (I) 20.11 ff.: Philosophi gentium, iustitiam, quae politica dicitur, praeceptis et moribus informantes,cuius merito respublica hominum subsistit et viget, unumquemque suis rebus et studiis voluerunt esse contentum urbanis etsuburbanis, colonis quoque vel rusticis sua singulis loca et studia praescribentes. Ebd. V 2, (I) 282.5 ff.: Sequuntureiusdem [Plutarchi] politicae consitutionis, capitula in libello qui inscribitur Institutio Traiani. Vgl. auch S. 470 zu vitacivilis. I 5 (II) 110.26 f.1109 Pol. VII 5, (II) 110.26 f.1110 Ebd. VI 24, (II) 66.6 f. Dem Sinne nach erinnern solche Stellen an Ciceros Darstellung der Peripatetiker und Akademikerals politici philosophi in De orat. III 28.109 (einem von Johann laut WEBB II 482 häufig angeführten Werk; s. auchREYNOLDS [wie Anm. 299] 107 zu Johanns De orat.-Hs. in Chartres): Dicunt igitur nunc quidem illi qui ex particulaparva urbis ac loci nomen habent et Peripatetici philosophi aut Academici nominantur, olim autem propter eximiam rerummaximarum scientiam a Graecis politici philosophi appellati universarum rerum publicarum nomine vocabantur. (ZurBedeutung dieser Stelle für das Ideal der Verbindung von Theorie und Praxis bei Vico s. oben Anm. 601). Politicus darf aufjeden Fall nicht in einem zu engen modernen Sinn allein auf „Politisches“ bezogen werden. Nach den oben Anm. 1108erwähnten Stellen bezieht sich das Wort am ehesten auf Sozialethik oder „praktische Philosophie“ (zu Johanns Wissenschafts-Einteilung s. oben Anm. 930). In Pol. I 3 (I) 20 (Anm. 1108) bezeichnet Johann das Prinzip des suum cuique oder deraequitas im Naturrecht und in der natürlichen Moral als iustitia politica. In Pol. VII 9 (II) 125 (ebd.) nennt er ius civile und„andere“ Regeln der Ethik (d. h. klar: das Recht ist ein Teil der Ethik) als Ordnungsprinzipien der vita politica. Wäre derBegriff politici philosophi (oder gar politici als Kurzform für politici philosophi) quellenkritisch sicher aus obiger Cicero-Stelle ableitbar, so könnte man eine Deutung des Titels aus dem platonischen Ideal der Philosophenherrschaft im Staatversuchen (s. unten Anm. 1120).
569
einen klerikalen oder weltlichen Amtsträger oder auch nur eine öffentliche Person im Gegensatz zummachtlosen Volk oder den weltentrückten Mönchen versteht. So beruft er sich einmal auf denMönchskritiker und Klerikerfreund Hieronymus, um im Sinne des Sprichworts „l’habit ne fait pas le moine“wahre, werktätige religio von scheinheiliger zu unterscheiden:1111 Neben und über den Mönchsregeln gebe esnoch die regula veritatis, und diese befehle, „Witwen und Waisen zu besuchen und sich moralisch makellosaufzuführen.“ Diese Regel aber sei politicorum omnium, d. h. sie soll insbesondere die in der Welt öffentlichTätigen leiten, die mehr als andere dazu verpflichtet sind, ein gutes Beispiel zu geben. In einem anderenFall1112 spricht Johann über die ambitio von Karrieristen, die sich zu „Tyrannen“ machen, weil sie nurdadurch aufsteigen können, daß sie andere erniedrigen und unterdrücken: … non modo in populo sed inquantavis paucitate potest quisque suam tirannidem exercere. Nam etsi non populo, tamen quatenusquisque potest dominatur. Hier sei nicht die Rede von den Unterworfenen und Demütigen, sondern vitapotius politicorum excutienda est, es gehe um Ämterkritik, denn: Quem michi dabis inter illos qui non velitvel unum potentia anteire? Es folgt eine eher altrömisch als mittelalterlich klingende Aufzählung der indieser Hinsicht anfälligsten politici bzw. Angehörigen des „öffentlichen Lebens“ und Inhabern eines officiumvom höchsten zum niedrigsten: dux, iudex, centurio, decanus, praeco und caupo, aber zweifellos meintJohann vor allem die curiales und Amtsträger jeder Art, geistliche wie weltliche.1113
Sind die politici nun jene Hofbeamten, denen Johann dem Hauptsinn seines Werks gemäß „die Philosophiebeibringen“ will, so könnte man versucht sein, den Policraticus-Titel in der Bedeutung von„Höflingsbeherrscher“ oder „Politikerunterweiser“ zu lesen. Solcher Versuchung ist jedoch schon mit demeinfachen Argument zu widerstehen, daß Johann in diesem Fall die Radix polit- verwendet und etwapoliticraticus geschrieben hätte, umso mehr als er nirgends im Policraticus einen einschlägigen von polisgebildeten Gräzismus ins Spiel bringt.1114
1111 Pol. VII 23, (II) 208 f.; vgl. dazu auch oben Anm. 951.1112 Pol. VII 17, (II) 162.1113 Ebd. 162.17 ff. Zum weiteren Kontext einer Simonie-Kritik s. oben Anm. 942. – Zu Standesbezeichnungen für das, washeute als „Intellektuelle“ bezeichnet wird, vgl. auch S. 309 ff., 480, 546.1114 Die bei Du CANGE unter polisis gegebene Briefstelle Johanns („Ep. 268“) war mit den reichhaltigenEditionskonkordanzen der Edition MILLOR/BROOKE, The Letters of John of S. (II) LXXX ff. nicht eruierbar: in polisimundana, re scilicet publica degentium, in hoc seculo seditiones esse patitur.
570
Für die Titelerklärung relevanter dürfte Johanns Vorliebe für seltene, teils von ihm selbst erfundeneWortschöpfungen auf der Basis von polys, wie polynomius oder polyxenus sein, die C.A. Brucker in einerUntersuchung über Johanns Hellenismen quellenkritisch eingehend besprochen hat.1115 Die bisherigenErwägungen sprechen eher zugunsten einer Übersetzung des Titels mit „Vielbeherrscher“ und gegen die vonDickinson propagierte von „The Statesman’s Book“. „Vielbeherrscher“ bleibt jedoch ein vager Begriff,solange der beherrschte Gegenstand und die Eigenart des Herrschens nicht bestimmt sind. Wie kommt Johannzu kråtein oder kråtoq?
118. Diese Frage hängt stärker mit einem Gesamturteil über den Sinn des Werks zusammen; die Antwort wirdalso subjektiver, hermeneutisch diskutabler ausfallen. Darum sollen vor einer Entscheidung möglichst alle(vernünftigen) Deutungsmöglichkeiten verglichen werden. Es wurde vorgeschlagen,1116 das stoische Motiv derWeltbeherrschung durch Selbstbeherrschung, wie es etwa in folgenden Versen des Entheticus in Policraticumzum Ausdruck kommt, auf das Wort policraticus zu beziehen:1117
Vir patiens forti melior; minor esse triumphusUrbis quam mentis dicitur, estque minor.
Dies würde in Relation mit dem kurz davor entwickelten satirischen Gedanken der Herrschaft der Eitelkeiten– nugae regnant1118 – und im kämpferischen Gesamtkontext einer Streitschrift gegen nugae curialium mitder Waffenhilfe aller versammelter Philosophen und philosophantes etwa der erwähnten Erklärung Kernersentsprechen, die den Titel als eine Art personhafter Konzentration der christlich gewordenen officia-Ethikder Antike ausweist.1119 Der Gedanke, daß „Selbstherrschaft“ (Selbstbeschränkung, Machtverzicht),
1115 BRUCKER (wie Anm. 488) bes. 89 zu polinomius in Pol. VII 6, (II) 111.11; VII 21, (II) 381.3; polixenus in Pol. II 16,I 94.10 (nach Serv. Aen. I 1) vgl. auch WEBBS Index verborum zu poli-.1116 Vgl. SCHAARSCHMIDT 145; PÉZARD (wie Anm. 343) 1 f.1117 Enth. min. (WEBB) I 9.19 f. – Analog zur Herrschaft über Fortuna in Pol. V 17, (II) 17.366.16 ff. (oben Anm. 404);Weltherrschaft durch Erhebung über das „Welttheater“ in Pol. III 9 I 199 (oben §§ 106 f.); Vergleich des militärischen undmoralischen Eroberungsbildes in Pol. VI 19, (II) 54; Weltherrschaft als Herrschaft über die nugae auch im Pol. Prol. I14.17 f.: nec deliciarum sectaris mollia sed ipsi, quae mundo imperat, imperas vanitati. Pol. VII 10, (II) 132.1 ff.(Selbstbeherrschung = Weltherrschaft) oben Anm. 733 zitiert.1118 Enth. min. I 5.19.1119 KERNER 103 f., 106 (s. S. 561); vgl. ebd. 21 ff., ein m. E. untauglicher Versuch, das (als Werk Wilhelms vonConches angesehene) Moralium dogma (vgl. oben Anm. 976) als „Chartrensischen“ Einfluß gerade aufgrund der Formel(HOLMBERG 53.15–6): Si vis omnia sibi subicere te subice rationi. Multos enim regis, si ratio te rexerit zu erweisen. Zudiesem ganz unspezifischen und überaus verbreiteten Gedanken s. S. 510 ff.; GARFAGNINI, Da Seneca a Giovanni di S.(wie Anm. 206) 208; von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 107 f., 181, 320 (Nr. 124); ders., Consolatio II § 1093 (6),246; BARNER (wie Anm. 298) 130 ff.
571
nicht „Weltherrschaft“ (Welteroberung, Machtausübung über andere) wahre „Größe“ zeige, galt imMittelalter zusammen mit der daraus ableitbaren Utopie der Philosophenherrschaft im Staat als das Kernstückeiner ethischen Gesellschaftstheorie, die den „politischen Philosophen“ Sokrates und Plato zugeschriebenwurde. Johann hat diese loci communes verbunden mit Augustins christlicher, weit über das Politischehinausgreifender Kritik an der „Herrschaft“ als Form falschen menschlichen Zusammenlebens im Geiste desStolzes, der Selbstsucht und Despotie: als „private“ Gesetzesüberschreitung im Gegensatz zum Dienst am„Allgemeinen“ unter dem ewigen Gesetz.1120 Auf diesem doppelten (antiken und patristischen)Gedankenkreis beruht im Policraticus die berühmte Unterscheidung zwischen „Fürst“ und „Tyrann“: DerFürst beschränkt sich selbst, unterwirft sich freiwillig dem Gesetz Gottes und wird dadurch dem „König derKönige“, den er auf Erden vertritt, „ähnlich“; der Tyrann sucht umgekehrt nicht sich selbst, sondern dieanderen zu beherrschen, will in luziferischer Weise seine Person „absolut“ setzen und bricht derart aus derGesellschaftsordnung, ja aus aller menschlichen Gemeinschaft in die Vereinzelung des Bösen aus.
Wer diese (hauptsächlich auf das 8. Buch konzentrierte) Lehre als die Quintessenz des Werks ansieht, wirdgeneigt sein, den Titel aus dem princeps platonisch-augustinischer Prägung zu erklären, aus dem idealenFürsten, der sich selbst unterwirft und der res publica oder civitas oder sogar „polis“ (d. h. der aus einer„Vielheit“ von Einzelnen gebildeten Allgemeinheit), jedenfalls einem hierarchisch gegliederten„Staatskörper“ als gesetzesgehorsamer Statthalter Gottes vorsteht und dient.1121 1122 Nur um eine Nuanceverschieden wäre demgegenüber folgende Deutung: Polycraticus, der „Vielbeherrscher“ zwingt die beidenunglücklich auseinanderstrebenden Welten der
1120 Zu den sokratisch-platonischen dicta vgl. S. 572 ff.; Ps.-Caecilius Balbus in den Collectanea Heirics von Auxerne (ed.R. QUADRI, Fribourg 1966, 136 Nr. 35): Socrates (…): Stultum est, ut velit quis imperare cum sibi ipsi imperare nonpossit. DUTTON, Civitatis exemplum (wie Anm. 578a) 81, 91 f., 95, 98 zur Tradition der ersten rei publicae scriptores:Sokrates und Plato (aufgrund von Chalcidius). Vgl. FLASCH (wie Anm. 562) 275 f. zu Augustin vor allem nach De lib.arb. I 6.15; II 16.41; vgl. dazu auch oben S. 374, 389 f.1121 Vgl. Pol. VIII 17 ff. (II) 345 ff.; VIII 23, 408 und WILKS (wie Anm. 546) 277 ff. und oben Anm. 1070; VanLAARHOVEN (wie Anm. 703) 329 nennt den Pol. „a guide work for people in the polis, especially for those who ex officiohave to dominate themselves rather than others“. Zu Pol. VIII 17 ff. und VIII 23 s. auch oben S. 299, 321 f., 349, 474.1122 ??
572
Politik und der Weisheit, der Praxis und der Theorie, der curiales und der philosophi wieder zusammen unterdem berühmten platonischen Motto von den Weisen auf dem Thron, das Johann nach Boethius so zitiert:1123
„Glücklich wären die Staaten, wenn Philosophen sie beherrschten, oder wenigstens, wenn es den Fürstengelänge, Weisheit zu lernen. Doch wenn du diese, des Sokrates Autorität verschmähen zu können glaubst, sohöre doch das Wort Gottes: ‚Durch mich‘, sagt die Weisheit, ‚regieren die Regierenden‘ und erlassen dieGesetzgeber gerechte Gesetze.“ In solchen Deutungen geht es ausschließlich um inhaltlich-thematischeVorstellungen von Herrschaft, die sich irgendwie an die bereits von Schaarschmidt 1862 festgelegtePolicraticus-Interpretation anschließen, daß nämlich der „Grundzug“ des Werks ein „hierarchischer“ sei, dagefordert werde, daß die christliche Lehre die heidnische Literatur und Weisheit, daß die Kirche den weltlichenStaat (Stadt und Hof) dominiere und „unterjoche“.1124
Diese Aspekte sind (etwas anders formuliert und ergänzt) zweifellos Leitgedanken des Werks: Die richtige –gottgewollte oder „natürliche“ – Ordnung der Gesellschaft lehrt eine „Philosophie“, die, als rerum omniummoderatrix, dux salutis, divinitatis amor u. ä. definiert, gleicherweise die „höchste Weisheit“ der delphischenSelbsterkenntnisregel und das christliche Liebesgebot in sich schließt; d. h. die „praktische Philosophie“, dieals Ethik (insbesondere Sozialethik) die beiden anderen philosophischen Teildisziplinen „Physik“ und„Logik“ beherrscht und die, mit der Rhetorik verbunden, den exemplarischen vir magnus et sapiens derVorzeit befähigt hat, die zerstreuten Einzelmenschen aus der Wildnis zur schönen kulturellen Einheit einesgesitteten Staatslebens zusammenzuführen. Solche philosophiebezogenen Hegemonievorstellungen lassen sichin der Tat aus keiner Erklärung
1123 Pol. IV 6, 256.17 ff.: Socrates […] tunc demum respublicas fore beatas asseruit, si eas philosophi regerent aut rectoresearum studere sapientiae contigisset. Et (si tibi Socratis videtur contempnenda auctoritas): Per me, inquit Sapientia, regesregnant et conditores legum iusta decernunt. Vgl. Boeth. Cons. I 4.15 (nach Plat. Rep. V 473d): Atqui tu hanc sententiamPlatonis ore sanxisti beatas fore res publicas si eas vel studiosi sapientiae regerent vel earum rectores studere sapientiaecontigisset. Zur Tradition vgl. COURCELLE, La Consolation (wie Anm. 977) 61 ff., 65 (zur obigen Pol.-Stelle);EBERHARDT (wie Anm. 264) 440 f. („das Hauptanliegen“ aller Fürstenspiegel überhaupt). Daneben s. auch Val. Max. VII2 Ext. 4: Iam Platonis verbis adstricta, sed sensu praevalens sententia, qui tum demum beatum terrarum orbem futurumpraedicavit, cum aut sapientes regnare aut reges sapere coepissent. Zur Kombination des platonischen Dictums mitProv. 8.15–21 vgl. unten S. 575 (Richard von Bury).1124 SCHAARSCHMIDT 192 f.; vgl. oben Anm. 739.
573
des Policraticus wegdenken.1125 Die Frage ist nur, ob sie auch ausreichen; ob auf anderer Grundlage nicht nochphilologisch präzisere Deutungen möglich sind, die auch der weiten nicht-sozialphilosophischen Thematik desWerks, insbesondere den keineswegs nebensächlichen literatur-, bildungs- und erkenntnistheoretischenAspekten gerecht werden und überdies die mächtige Tradition der „Vielbuch“-Titel mitberücksichtigen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß Policraticus sprachlich ein Mensch und keineSache ist. (Das in der handschriftlichen Überlieferung und in Zitaten gelegentlich auftauchende Policraticonberuht auf einem Mißverständnis und ist apokryph.1126) Diese „literale“, vordergründige Bedeutungsdimensionsollte vor allen tiefsinnigen thematischen Bezügen ernst genommen werden. (Gerade die Personhaftigkeit desTitels führte übrigens im Spätmittelalter zu kuriosen Verwechslungen von Titel und Autor bis zu jenerAnführung eines unter dem Namen Policraticus bekannten Kirchenvaters.1127) Die Personifikation giltprimär dem Buch, nicht einer darin enthaltenen Idee. In dem Widmungsgedicht ‚Entheticus inPolicraticum‘1128schickt Johann sein Buch, den Policraticus, auf eine gefährliche Wanderschaft (wie einstOvid und Horaz ihre Dichtungen zum kaiserlichen Gönner
1125 Zu Johanns Philosophie-Verständnis vgl. JEAUNEAU, Jean de S. (wie Anm. 544) 82 ff. und A. 775 (rerummoderatrix): A. 882, 922 f. (Naturordnung), S. 510 ff. (Herrschaft des Einen); S. 195, 251, 293 ff. (Ciceros Bildungsideal);A. 930 (Cic. Inv. I 2: vir magnus et sapiens; Dreiteilung der Philosophie); S. 294 f. (Vorrang der Ethik, ars vitae, arsartium). Vgl. Enth. 279 f. 145: Philosophia quid est nisi fons, via duxque salutis,/lux animae, vitae regula, grata quies.Ebd. 307 ff. 146: (quod philosophia et caritas sunt idem); ebd. 327 ff. (quod philosophia ordinem et modum in cunctisexigit.); Pol. VII 8 (II) 120.6 ff. (divinitatis amor); Met. IV 40.214.2 ff (zum delphischen Spruch); Met. I 1, 7.14 ff. (nachCic. Off. I 16.50): hec autem est illa dulcis et fructuosa coniugatio rationis et verbi, que tot egregias genuit urbes, totconciliavit et federavit regna, tot univit populos et caritate devinxit […] omnes simul urbes et politicam vitam totamaggreditur Cornificius noster studiorum eloquentie imperitus …1126 Siehe oben S. 557 und WEBB I p. XV (M) und XVIII (Frühdruck von 1513). Immerhin findet sich Polycraticon bereitsim Necrologium Carnotense (Gallia Christ. VIII col. 1148; Recueil des Hist. ed. BOUQUET XIV 487). Vgl. LINDER (wieAnm. 321) 321. Auch Richard von Bury zitiert das Werk (Philobiblon 118.39–40) so: istud eleganter IoannesSaresberiensis pertractat in suo Policraticon, libro IV. – Daß die maskuline Form mit Bedacht gewählt wurde, zeigt dieNeutrumbildung von Metalogicon (vgl. oben Anm. 1080).1127 Siehe oben Anm. 335.1128 Enth. min. (WEBB) I 1 ff.; vgl. LIEBESCHÜTZ 19, UHLIG 34 ff. zur insinuatorischen Bedeutung.
574
und Schützer aussandten)1129 mit einer Anrede voller kluger Warnungen vor bösen Feinden, Neidern undkorrupten curiales, die Öffentliches eigennützig mißbrauchen, sowie mit Ratschlägen über den richtigen Wegzum guten Adressaten Thomas Becket, der publica privatis praefert commoda semper.1130 Die angeführteStelle: Vir patiens forti melior […] steht in diesem Zusammenhang.1131 Sie bezieht sich auf einen Kampf umdie „Weltherrschaft“ nach stoischem Muster; denn zuvor1132 wird beklagt, daß die nugae sämtliche Stände,jedes Geschlecht und die ganze Welt beherrschen. Der unter häßlicher Verkleidung wie ein Kämpfer unter derTarnkappe ausgesandte Policraticus1133 ist dennoch keine moralische Persönlichkeit, kein „wahrhafterChrist“ (Kerner), sondern immer noch ein Buch in einer fictio personae oder Prosopopoeie.
Wie läßt sich die inhaltliche moralphilosophische Dimension mit der metaphorisch „buchhaften“ vermitteln?Aufschluß könnte ein Vergleich mit einer späteren Policraticus-Imitatio bieten: In dem bereits erwähntenPhilobiblon des Richard von Bury findet sich unter der Überschrift Qui deberent esse librorum potissimidilectores ein Kapitel über die Lesepflicht aller rei publicae directores1134 wie principes, prelati und doctores,die wegen ihrer öffentlichen Position der Weisheit besonders bedürfen. Es sind dieselben von Johann politicigenannten Personen, an die sowohl Philobiblon wie Policraticus als zwei wie immer unterschiedlicheBeispiele der weitverzweigten Gattung der „Ämterlehren“, Offizien-Traktate, Beamtenspiegel u. ä. gerichtetsind.1135 Nach einem auch von Johann in Bildungsfragen mehrfach angewandten totum-pro-parte-Verfahren1136 setzt Richard von Bury emphatisch die Weisheit oder die Philosophie stellvertretend fürBücher und Autoren. Hier arrangiert er originell viele der bisher erwähnten Themen und führt dabei Johannvon Salisbury namentlich als Autorität an: Weisheit wird zunächst verstanden als Regierung seiner selbst undder andern.1137 Danach erscheint
1129 Ov. Trist. I 1; Hor. Ep. I 1.20. Die Stellen sind in Prologen auch sonst beliebt (Nigellus Wireker, Arnulf von Lisieuxu. a.). – ROUSE/ROUSE, Tyrannenmord (wie Anm. 468) 253 f. sehen in der Allegorie eine vorsichtige Anspielung auf dieAbsicht, indirekt auf den eigenen „Augustus“, Heinrich II., zu wirken.1130 Enth. min. I 2.11.1131 Ebd. I 9,19 f., s. oben S. 570.1132 Ebd. I 6.15 ff.1133 Ebd. I 1.11 ff.1134 Richard von Bury, Philobiblon, cap. XIV 117 f. (Überschrift).1135 Vgl. oben § 73, S. 21, 488 f.1136 Vgl. z. B. S. 206 f., Anm. 414.1137 Philobiblon XIV 117.5 f.: Est autem sapientis officium bene ordinare et alios et seipsum (cf. Macrob. Somn. I 6.64.).
575
die Gestalt der Philosophia des Boethius mit dem Szepter in der Linken, den Büchern in der Rechten, damitgezeigt werde, „daß keine res publica ohne Bücher regiert werden könne.“ Es folgt das bereits von Johannzitierte platonische Wort in der Fassung des Boethius:1138 ‚Tu‘, inquit Boetius, loquens Philosophie, ‚hancsententiam Platonis ore sanxisti, beatas fore respublicas, si eas vel studiosi sapientiae regerent vel earumrectores studere sapientie contigisset.‘ Nach einigen historiae zur Belesenheit (Alexander) und Unbelesenheit(Phaethon) von Herrschenden und deren positiven, bzw. negativen Folgen,1139 kommt Richard mit dem 4.Policraticus-Buch auf den Bildungsauftrag der Fürsten zu sprechen und erinnert an die Vorschrift aus demDeutoronomium (XVII 18–19),1140 daß der König das „göttliche Gesetz“ so, wie es ihm die LevitischenPriester überreichen, abschreiben und täglich lesen solle, um damit völlig vertraut zu werden. Während Johannaus dieser Stelle auch juristisch-politische Konsequenzen für die Gesetzestreue eines Fürsten sowie für dieBedeutung des Kanonischen Rechts zieht,1141 ruft Richard aus, wie tröstlich für das schwacheMenschengeschlecht doch die Einrichtung des Buches sei. Denn Gott, der „täglich einzelne Menschenherzenerschafft“, kannte die labilitas des menschlichen Gedächtnisses und die instabilitas des moralischen Willens;daher habe er das Buch als omnium malorum antidotum und cotidianum saluberrimum spiritusalimentum1142 vorgesehen, damit der menschliche Geist nicht weiter „schlaff und zweifelnd erzittere“, wenner wissen wolle, was tunlich sei.1143 Istud eleganter Ioannes Saresberiensis pertractat in suo Policraticon,libro IVº. In der Hauptsache liegt die hier angerufene Analogie in der wortähnlich empfohlenen Bedeutung derperitia litterarum für alle Regierenden.1144
119. Der Vergleich mit dem Philobiblon zeigt noch eine andere Seite der Buchpersonifikation: die (soweit aufdie Bibel bezogen) religiöse und darüber hinaus quasi-religiöse Hypotasierung des Buches zu einer Figur weiserWeltregierung oder idealer Herrschaft über Herrschende und Hochgestellte aller Art. In diesem Sinn wäre esletztlich gleichgültig, ob das policraticus genannte Buch als geistiger Herrscher über die politici der polis oderüber irgendeine „Vielheit“ von Menschen oder Weltdingen vorzustellen ist, und
1138 Ebd. 117.11 ff. nach Boeth. Cons. I 4.15 s. oben S. 572.1139 Ebd. 117.21 ff. – Das Exemplum Alexanders (Philipp dankte den Göttern, daß sein Sohn zur Zeit des PädagogenAristoteles geboren wurde) aus Gellius N. A. IX 3 findet sich auch in Pol. IV 6, (I) 255 f. neben den anderen Autoritäten (s.A. 1123 und die nächste Anm.), was das Policraticus-Kapitel insgesamt als Vorlage von Philobiblon XIV ausweist.1140 Philobiblon 118.29 ff. nach Pol. IV 6, (I) 250.30 ff.1141 Vgl. KERNER 136 ff.1142 Philobiblon 118.35 ff.1143 Ebd. 118.38 ff.1144 Ebd. 117.28, wie Pol. IV 6, 254.16 f.
576
wir könnten es mit Schaarschmidts Formel vom „Welt- und Hofbezwinger“ bewenden lassen. Dagegensprechen zwei Bedenken: Einmal wird nicht klar, in welcher Weise das Buch neben den nugae curialium auchauf die vestigia philosophorum beherrschenden Einfluß nehmen könnte. Sodann läßt sich fragen, ob dieerhabene Vorstellung einer Weltherrschaft nicht besser zu einem fremden (insbesondere einem „heiligen“)Buch paßt als zum eigenen Werk.
Erwägenswert sind auch die zuletzt von Richard von Bury genannten Vorstellungen vom Buch als Trost undSpeise für die menschliche Schwachheit. Sie erinnern an ein ganzes Feld bildungs- und literaturtheoretischerLeitideen des Policraticus, die in der vorstehenden Untersuchung beleuchtet worden sind1145 und von denenaus eine bisher noch nie vorgeschlagene Titeldeutung plausibel gemacht werden kann. Die These lautet:Policraticus ist auf der ersten Sinnebene das über viele auctores herrschende Buch; auf der zweiten aberverlangen der Verfasser, der Erstempfänger und wer immer es lesend in sich aufnimmt, dank der Fülle (polys)der im Buch vereinigten vestigia philosophorum oder Weisheitslehren der Tradition die Fähigkeit oder Macht(kratein), sich selbst und die Welt, vor allem aber die nugae curialium zu besiegen und zu beherrschen. Mitschlichteren Worten gesagt, meint der Titel nur, das Buch sei ein praktisch zu beherzigendes Kompendiumder Moralphilosophie für Hofbeamte.
Zur Begründung seien Überlegungen aus der vorangehenden Exemplum-Studie unter dem spezifischen Aspektder vorgeschlagenen Titeldeutung nochmals aufgegriffen und ergänzt: Im Unterschied zu dem inhaltlichintentional gemeinten Untertitel verweist der Haupttitel auch auf die literarische Methode oderQuellenbehandlung, die einen zentralen Gegenstand des Prologs ausmacht. Dieser beginnt nicht wenigerhymnisch als das stark davon abhängige Philobiblon mit einer superlativischen Lobrede auf alle litterae undscriptores, wobei der Gegensatz zwischen dem Wenigen, was der vergeßliche Mensch in seiner kurzenLebenszeit lernen kann – paucula – und dem „Vielen“, was wir dank literarischer Tradition wissen können,herausgehoben zu werden verdient.1146 Im Hinblick auf das Wort policraticus ist auch das unentwegteInsistieren auf militärischen Begriffen wie Triumph, Ruhm, Herrschaft auffällig.1147 Im unmittelbarenKontext entsteht die Vorstellung eines siegreichen Kampfes der Wissenschaft gegen ihren Erzfeind Oblivio,das personifizierte Vergessen, die Stiefmutter der Memoria. Die Bilderreihe führt weiter: Die Triumphbögen,sagt Johannes, helfen den einstigen Triumphatoren, den Alexandri und Caesares nur, weil eine InscriptioGenaueres über
1145 Vgl. oben §§ 42, 83.1146 Pol. Prol. 12 in Anm. 366; vgl. auch S. 379 ff.1147 Vgl. § 73, S. 289 ff.
577
deren Heldentaten erzählt.1148 „Niemand hat nämlich jemals in dauerhaftem Ruhme geglänzt außer durchseine eigene oder anderer Schrift.“ – „Gleich ist der Ruhm eines Esels und irgendeines Imperators schon nachkurzer Zeit, sofern die Erinnerung an den einen oder an den anderen nicht durch Schriftstellergunst verlängertworden ist.“ Die Apotheose der Literatur, der eine gewisse Lächerlichkeit reiner Tathelden gegenübersteht,geht dann in eine mildere oder zivilere Tonart über:1149 in dolore solatium, recreatio in labore, in paupertateiocunditas, modestia in divitiis et deliciis seien weitere Wohltaten der litterae, gleichviel ob einerproduzierend oder rezipierend mit ihnen zu tun habe (ad legendum vel scribendum utilia). AbschließenderHöhepunkt ist das persönliche Bekenntnis.1150 Experto crede! ruft Johann aus: Er wisse aus Erfahrung, daßalle Freuden der Welt vor den Buchfreuden bitter werden, und er habe folglich keine Lust mehr, noch eineSprosse seiner Hofkarriere ambitiös zu erklimmen, da vor der literarischen Bildung und der Philosophie dasganze Treiben der curiales ohnehin zum Inbegriff irdischer Nichtigkeit werde.
Diese allgemein gehaltene Apologie der litterae triumphales geht dann über in eine panegyrisch-insinuatorischen Anrede des Widmungsempfängers Thomas Becket,1151 der die Versuchungen der curia weitbesser als der Autor selbst
1148 Pol. Prol., (I) 13.1 ff. Arcus triumphales tunc proficiunt illustribus viris ad gloriam, cum ex quibus causis et quorumsint, impressa docet inscriptio […] Nullus enim umquam constanti gloria claruit, nisi ex suo vel scripto alieno. Eadem estasini et cuiusvis imperatoris post modicum tempus gloria, nisi quatenus memoria alterutrius scriptorum beneficioprorogatur. Vgl. auch Heinz MEYER (wie Anm. 913) 45 ff. zur Triumphmetapher; BALDWIN (wie Anm. 160) 102 f.,105 ff. zur antiken Tradition der biographischen imago-Metapher im Zusammenhang mit exempla maiorum sowie untenS. 589. – Das im gesamten Prolog mehrfach berührte Thema der Schriftstellermacht aufgrund der Nachruhmverleihungs-Fähigkeit – ein Selbstlegitimationstopos des politisch machtlosen Intellektuellen gegenüber realer Macht – kommt indirektauch in Pol. VIII 14, (II) 328 f. zur Geltung, wo Johann kritisch auf den „Machtmißbrauch“ des Schriftstellers (der dieFalschen rühmt) eingeht. Dazu vgl. M. LIDA DE MALKIEL, L’idée de la gloire dans la tradition occidentale, Paris 1968,145 ff.; ATKINS (wie Anm. 366) 77; CARY (wie Anm. 279) 105 ff.; CURTIUSELLM 471.1149 Pol. Prol. 13.18 ff.1150 Ebd. 13.28 ff.: Experto crede, quia omnia mundi dulcia his collata exercitiis amarescunt. Zu Alexander und Caesarebd. 12.17 ff., oben § 42.1151 Pol. Prol. 14.14 ff.: Et te quidem sentio in eadem conditione versari, nisi quia rectior et prudentior, si facis quodexpedit, stas semper immotus in solidae virtutis fundamento, nec agitaris arundinea levitate, nec deliciarum sectaris mollia,sed ipsi quae mundo imperat, imperas vanitati. Unde cum tibi diversae provinciae […] quasi arcum erigant triumphalem,ego vir plebeius stridente fistula inculti eloquii librum hunc ad honorem tuum, velut lapillum in acervo praeconiorumtuorum conieci […] Nugas pro parte continet curiales […] Pro parte versatur in vestigiis philosophorum; quid in singulisfugiendum sit aut sequendum relinquens arbitrio sapientis.
578
meistere (d. h. meistern möge); er beherrsche nämlich (bzw. er sollte beherrschen), was die Welt beherrscht:quae mundo imperat, imperas vanitati. Darum verdiene er statt eines Triumphbogens das vorliegende,stilistisch wie immer unvollkommene Buch. Hier liegt ein erster Schlüssel zum Policraticus-Titel, der dieÜberlegenheit der Schreibenden und der Schriften gegenüber den großen Tätern und erst recht gegenüber deneitlen Scheintätern, den nugatores und curiales, anzeigt. Das derart dedizierte Buch ist wesentlich eineStreitschrift gegen eitle Hofleute und eine Mahnschrift an ernsthafte politici; es enthält Satire undphilosophische Lehre. Der Angeredete werde selbst zu entscheiden wissen, was zu meiden, was zu befolgensei.1152 Der gepriesene Empfänger wird so zum belehrbaren Leser. In der weiteren Insinuatio ist er diesallerdings nur stellvertretend für alle anderen, die der Lehre und des Tadels bedürfen, angefangen beim Autordes Buches selbst.1153
Der Schreibende gelangt nun aufgrund dieses selbstkritischen Arguments der captatio benevolentiae zumHauptstück des Prologs, das (in Anlehnung an Macrobs Saturnalia-Vorrede)1154 die Bedeutung und Methodeeines rhetorisch-moralphilosophischen Sammelwerks verteidigt. Insbesondere wird hier das Verhältnis vonliterarischer Unselbständigkeit und eigenständiger Assimilationsleistung des Sammlers durch die Vielzahl derphilosophisch nützlichen Zeugnisse legitimiert.1155 Das zuvor allgemein über die Macht der Schriftsteller undSchriften Gesagte wird eingeengt und auf den Verfasser und sein Kompendium angewandt. Die dabei gewähltemilitärisch-imperatorische Metaphorik wird im Sinne leiser Selbstironie durch den Ton eines Geständnissesgemildert. Die Kernstelle ist für die Titelgebung so wichtig, daß sie hier noch einmal zitiert zu werdenverdient:1156 Arrogantiam meam plenius denudabo. Omnes ergo qui michi in verbo aut operephilosophantes occurrunt, meos clientes esse arbitror et quod maius est, michi vendico in servitutem; adeoquidem ut in traditionibus suis seipsos pro me linguis obiciant detractorum. Nam et illos laudo auctores.Johann gibt sich als der Führer oder Feldherr dieser „Autoren“, die dadurch definiert sind, daß sie in Wort undTat, durch dicta und facta „philosophieren“. Nach dem Gesagten sind es Exempla aller Art. Wasentschuldigend als „Anmaßung“ bezeichnet wird,
1152 Vgl. auch oben S. 186 ff.1153 Pol. Prol. 15.1 ff. wie oben Anm. 474, 1051 zitiert.1154 Vgl. oben § 88, bes. Anm. 813, 820, 822 zu Pol. Prol. 15–17.1155 Vgl. oben § 84.1156 Pol. Prol. 16.9 ff.
579
erinnert an das Gleichnis von den Zwergen auf den Schultern der Riesen:1157 es ist die Kühnheit, so berühmteGestalten1158 wie Alexander, Cäsar, Sokrates, Zeno, Plato und Aristoteles – nie gesehene, nur überlieferte –derart in Dienst zu nehmen. Da sie allein durch die Gnade der Schriftsteller weiterleben, hängt ihr posthumesSchicksal auch ein wenig davon ab, ob Johann ihre Tradition um eine kleine Stufe verlängert. GültigeTradition versteht er aber als Selektion und moralische Ausrichtung ad utilitatem legentium. So darf seinBuch als Beherrscher und Einiger vieler diverser Memorabilien gelten, etwa in dem Sinn, in dem Macrob seineSaturnalien einführt:1159 Tale hoc praesens opus volo: multae in illo artes, multa praecepta sint, multorumaetatium exempla, sed in unum conspirata.
Beachtung verdient auch das bereits1160 ausführlich erläuterte Kapitel VII 10 (Omnes scripturas esselegendas) über die Analogie von Naturunterwerfung und Literaturpflege. Weil der Mensch Herr über alleKreatur ist und ihm alles Geschaffene als Gottes Wort zur „Speise“ dient, wird durch „Herrschaft über sichselbst und andere“ …„die Tugend vergrößert und vervielfältigt“:1161Verum cum littera praecedens utiliter admulta possit referri […] et ad hoc posse aptari consentio ut per gratiam ex benedictione Dei collatam advirtutis incrementum et multiplicationem liberum excitetur arbitrium et virtutis multiplicatis per gratiamadiciatur subiectio terrae quam cum in se ipso homo subiecerit, dominium sui aliorumque consequitur utcunctis animantibus praelatus, timorem et tremorem incutiat omnibus quae moventur in terra. Sunt ei ergocuncta in cibum quia omnibus creaturis ei verba salutis suae loquitur Dominus. Nach der eingehendenAnalyse dieses Kapitels darf angenommen werden, daß Johann mit dem Titel Policraticus den moralischenHerrschaftsanspruch eines vielbelesenen Humanisten sowohl über die von ihm nutzbringend (christlich)eingesetzte (heidnische) Literatur wie über die „Welt“ in jedem Sinn, über die kulturelle wie über die natürlicheOrdnung der Dinge zum Ausdruck bringen will. Das Buch selbst – Medium und Vermittler diesesHerrschaftsanspruchs – trägt metonymisch den Namen, der dem Autor, dem Erstempfänger oder dem„idealen Leser“ zukäme, wenn diese seine Lehren praktisch befolgten. Dies deutet der aus Vorrede undSchlußkapitel gebildete Rahmen einer Widmungs- und Auftragstopik an. Johann erklärt hier Thomas Becketin konventionellen, aber insinuatorisch eigenwillig eingesetzten Bildern zum „Herrn“ des Policraticus:1162
Liber enim
1157 Vgl. S. 241 ff.1158 Pol. Prol. 16.13 ff. wie oben Anm. 370.1159 Sat. praef. I 10. Vgl. auch S. 402 ff., 407 ff., Anm. 724, 742, 852 f.1160 Vgl. oben § 83.1161 Pol. VII 10, (II) 131.30 ff.; vgl. auch § 83.1162 Pol. VIII 25, (II) 425.1 f.
580
hic […] tibi domino stat aut cadit. Wenn der Policraticus seinen Namen aus der Fülle der nützlich vereintenund beherrschten Autoren bezieht, dann wird der Empfänger und Eigner, der sich dieses „Vielbuch“ wie Speiseaneignet, sich mit ihm identifiziert, selbst zu einem Herrscher über alles moralisch zu Unterwerfende. Er sollals Mensch in der Praxis das sein, was der Policraticus als Buch in der Theorie ist. So wird es auch jedem Leserunter den politici wie Thomas Becket ergehen: als Herr des Buches wird er vieles beherrschen.
Darum geziemt sich für den scriptor eines solch „mächtigen Buches“ die Bescheidenheit undUnselbständigkeit des bloßen Sammlers. Johann betont, daß er nur der publica utilitas zuliebe und auf Befehldes Auftraggebers geschrieben habe; denn in ihm selbst sei nichts, was Leser interessieren könnte:1163 homoundique immunitus et imminutus, cui nec vita ad conscientiam nec ad doctrinam scientia nec operasuppetunt ad exemplum; ein Mensch sei er, dem man vor allem das Schweigen empfehlen könne. Doch aufihn käme es hier nicht an, sondern auf das, was er mitteile:1164 Non ergo quis, sed quid quave de causascribam dilegens lector attendat. Mit einer Ausschließlichkeit, die bei einem der frühesten humanistischenVerfechter des „geistigen Eigentums“ überrascht, bekennt er sich danach (der hier gebotenen rhetorischenSituation gemäß) zu völliger „Unorginalität“:1165Nichil equidem praesenti operi ex proposito inseretur quodnon sit ratione vel praecedentium scriptorum auctoritate subnixum. Dem freien Leser wird überlassen quidsequendum sit, und der Autor entzieht sich der Verantwortung: procul a nomine meo – faciam vitium […]mentiendi.1166 Im letzten Satz des Policraticus wird auch der letzte kleine Hinweis auf den Sinn des Titelsgegeben: Was nämlich vom Autor selbst stammt, das sei Sünde, Sünde der Lüge (wie eben zitiert), aber auchSünde der Polylogia oder, wie man heute sagen würde, der philologischen Sammelwut:1167 Scio enim quia in
1163 Pol. VIII prol., (II) 226.16 ff.1164 Ebd. 227.3 f.1165 Ebd. 227.14 ff.1166 Ebd. 227.18.1167 Pol. VIII 25, (II) 425.19. Vgl. Prov. X 19: In multiloquio non deerit peccatum, qui autem moderatur labia suaprudentissimus est. Als Epilogtopos klingt auch das Ende des Kohelet (Eccles. 12.12) an: His amplius, fili mi, ne requiras.Faciendi plures libros nullus est finis, frequens meditatio carnis adflictio est. Die Ironie liegt darin, daß Johann sagen will,sein Buch enthalte (wenigstens der Absicht nach) keine von ihm selbst stammenden Überflüssigkeiten oder nicht „derWeisheit“ dienenden Aussagen, wie dies auch die Parallele in Met. II 8, 75.8 ff. zeigt: Non est maior gloria dixisse quodnoveris quam siluisse quod nescias [Sid. Ap. Ep. VII 9.5]. Sed et Cicero verba redarguit que sine utilitate aut voluptatetam dicentis quam audientis inutiliter proferuntur [cf. Rhet. Her. IV 3.4]. Opinet enim illud poeticum [Hor. Ep. I 18.15]:Aut prodesse volunt, aut delectare poete,/aut simul et iocunda et idonea dicere vite./Omne tulit punctum qui miscuit utiledulci’. Et multiloquium peccata comitantur. Linguae autem volubilitas tunc demum prodest, si ad sapientiam disponatur.RUBERG, Beredtes Schweigen (wie Anm. 264) geht weder auf die Stelle noch auf die dahinter stehende Prologtopik ein, diegerade aus dem Schweige-Ideal eine Legitimation zum Vielreden dialektisch ableitet.
581
multiloquio peccatum non deest. Diese nicht ganz unironische Selbstverkleinerung mündet ein in dieSchlußbitte an den Leser, um die Gnade göttlicher Offenbarung oder weiterer Aufklärung über den Weg, zumHöchsten Gut zu beten.1168
120. Nach dem Versuch, die verschiedenen Bedeutungsnuancen von Policraticus aus dem Werkverständnisheraus auf einen sinngebenden Nenner zu bringen, bleibt die heikle Frage der Übersetzbarkeit des bedeutsamenund auch einprägsamen Titels. „The Statesman’s Book“ war eine elegante, aber falsche Lösung. Ob dieAspekte der Literaturbeherrschung, des „Vielbuches“ und der moralphilosophischen Weltbeherrschung ineinem Begriff zu vereinen sind – „Vielbeherrscher“, „Herr vieler Diener“, „der Vielvermögende“, „Meistervieler Denkwürdigkeiten“? –, halte ich für zweifelhaft. Bis dieses Kunststück jemandem gelingt, können wirin allen modernen Sprachen bei Policraticus bleiben und begehen mit Polycraticus auch keinen sinnstörenden,höchstens einen kleinen textkritisch-orthographischen Fehler. – Hier kam es vor allem darauf an, den Titelvon der etablierten und unreflektierten Bindung an „Politisches“ zu befreien: Policraticus ist keine gelehrt-metaphorische Periphrase für „Fürstenspiegel.“ Diese einseitige Auslegung, die der vorherrschendenwillkürlichen Spezialisierung auf die „Staatstheorie“ im Werk entspricht, sollte durch Vermehrung derDeutungsmöglichkeiten, durch „Aspektereichtum“ oder pluralitas iudiciorum (S. 556) in Frage gestelltwerden. Naturgemäß ist dabei die bisher am wenigsten bekannte Interpretation aus Hegemonievorstellungenim Bereich der litterae am ausführlichsten dargestellt worden. Damit soll nun allerdings nicht etwa an Stelleder „politologischen“ eine „philologische“ Einseitigkeit empfohlen werden. Der von Johann zweifellosbewußt so allgemein und polyvalent gehaltene Titel erlaubt – wie das ganze Werk selbst – letztlich nur eineumfassende Erklärung: Die Philosophie soll den „Hof“ beherrschen, nicht umgekehrt. Johann selbst gibt sichvom Prolog an unentwegt als ein leidendes und strebendes Exemplum für dieses Ideal aus, für den Wunsch, aushöfischer „Knechtschaft“ zur „Herrschaft der Weisen“ zu gelangen. Hof und
1168 Pol. VIII 25, (II) 425.19 ff.: Sed invito et in caritate Dei exhortor lectorem quod memor in orationibus suis impetret utFilius Dei vivi et Virginis intemeratae Deus homo manifestet seipsum et palam faciat viam qua nobis incedendum est inbeneplacito suo et dirigat in eo gressus nostros. EXPLICIT POLICRATICUS IOHANNIS DE SARESBERIE.
582
Philosophie sind aber nur Metonymien für die christliche Grundantinomie: Die vera sapientia – d. h. die veraphilosophia Christi – soll über die Welt (in der Seele, in der Gesellschaft, in Erkenntnis und Bildung)„herrschen“.1168Sie ist der ruhende Pol, auf den sich gesellschaftliches Treiben und historische Bewegunghinordnen sollen; die Einheit, zu der das in Meinungsvielfalt zersplitterte Wissen zurückstreben soll; der„Weg“, auf dem jeder einzelne und alle gemeinsam beständiges Glück suchen sollen und finden können.„Polykratisch“ ist das Buch, das diese philosophische Zentralperspektive lehren und (wie der Untertitelpräzisiert) mit bösen und guten Beispielen, satirisch und humanistisch-„moralistisch“ vor Augen führen will:Zu „meiden“ sind die falschen Wege, die Ab- und Holzwege der höfischen Zerstreuung. (Pascal wird stattnugae mit metaphysischer Sinngebung „divertissement“ sagen.) Zu „folgen“ ist den Spuren und Fährten, diezu dem einen „Königsweg“ der Philosophie hinführen, den dürftig überlieferten oder gar durch Irrtümerentstellten Zeugnissen vorbildlicher Denker und Täter, den dicta et facta philosophantium, die der officiorumscriptor in dieser Schrift vereinigt (und sich dabei ein wenig so verhält wie Max Schelers Wegweiser, der denWeg, den er weist, nicht selbst geht.)1168a
1168 Pol. Prol. (I) 14.9–18: funem […] qui in curialibus nugis tamdiu tenuit et tenet adhuc obnoxium servituti […] quasisacratioris philosophiae lactatum uberibus ablactatumque decuerat ad philosophantium transisse cetum quam ad collegianugatorum. Et te quidem sentio in eadem conditione versari, nisi quia […] ipsi quae mundo imperat, imperas vanitati. Vgl.oben Anm. 1125 zu Enth. 279 f., 307 ff., 145 f. zum philosophia-Begriff (philosophia = caritas).1168a Pol., Prol. 14.10–18; vgl. oben Anm. 1125 (Enth. 279, 307 ff., p. 145 f.); EBERHARDT (wie Anm. 264) 510 ff. zurvia regia.
583
II. ‚IMAGO‘: EIN PHANTOM DER EXEMPLAFORSCHUNG
Der Unterschied von exemplum und imago als „Beispielerzählung und Beispielfigur“ bei E.R. Curtius (§ 121).Vorgeschichte: Dornseiff und Alewell (§ 122). Folgen: Konstruktion des Wesensunterschieds zwischen dem antiken,„bildnishaften“ und dem mittelalterlichen, narrativ-homiletischen Exemplum (§ 123).
121. In der neueren Forschungsliteratur wird häufig eine angeblich antike Unterscheidung zwischen exemplumund imago (eikon) nach E.R. Curtius angeführt, die der „dynamischen“, ausführlich darstellendenBeispielerzählung (exemplum) die „statische“, lediglich anspielende Beispielfigur als Erwähnung oderNennung (imago) entgegengesetzt habe1169
Die Feststellung ist nicht zu bestreiten, daß Exempla entweder erzählt werden müssen, weil sie vielleicht zuwenig bekannt sind, oder als „Ereignisvermerke“, die ihre bekannte Geschichte „in sich tragen“, bloß erwähntzu werden brauchen. Für diesen evidenten Unterschied fehlt es nicht an Belegen aus der rhetorischen Theorieder Antike und des Mittelalters.1170 Fraglich ist jedoch einmal die Bezeichnung imago im Sinne einer (inantiker und mittelalterlicher Literaturtheorie verankerten) Gegensatzkategorie zu exemplum; fraglich istsodann der Abstand zwischen beiden Begriffen. Sind nur Arten, Aspekte, Nuancen des Oberbegriffs „Beispiel“(exemplum/paradeigma) gemeint, oder haben Beispielerzählung und Beispielfigur als zweiwesensverschiedene, klar zu trennende Verfahren zu gelten? Curtius hat letzteres aufgrund des, wie er annahm,etablierten terminus technicus ‚imago‘ entschieden bejaht. Seine Ansicht ist in der Folge opinio communisder Wissenschaft geworden.
Die sachlichen Argumente, die gegen eine radikale Aufspaltung des erzählten und des „standbildhaften“,chiffrierten oder symbolischen Beispiels sprechen, sind in dieser Arbeit bereits genügend zur Sprachegekommen.1171 Nachzutragen bleibt eine Überprüfung des imago-Begriffs im behaupteten Sinn. Daß es sichdabei nicht um eine philologische Quisquilie handelt, zeigen die Folgerungen, die aus einer nicht zumExemplum (als Erzählung) gehörigen Form imago (als vergleichender Nennung historischer oder mythischerPersonen) gezogen worden sind. Mit Hilfe dieser kategorialen Abgrenzung konnte eine bestimmteVolksliteraturforschung ihre einschränkende narratologische Definition des Predigtmärlein-Exemplums vorstörenden Einflüssen aus anderen Disziplinen, insbesondere vor antiken Begriffen des aristotelischen Beweis-Paradeigma und des monumentalen römischen exemplum virtutis bewahren und
1169 CURTIUS, ELLM 69; s. unten S. 595 zur Nachwirkung.1170 Vgl. oben § 19.1171 Vgl. oben §§ 10, 16, 19, 40, S. 161, 124 ff.
584
sich auch gegen den normativ-pragmatischen Beispielbegriff der Historiker und Rechtshistoriker erfolgreichschützen.1172 Was ursprünglich nur ein polemisches Detail aus einer Rezension war, das Curtius (dankBerufung auf philologische Exaktheit) immerhin als Argument rhetorisch überzeugend vorzubringenverstand,1173 ist weithin zu einer selbstverständlichen, ja normativen Begriffsunterscheidung von exemplumund imago geworden; und dieses Theorem hat für lange Zeit Exempla-Forschung auf allgemein rhetorischerund literaturanthropologischer Grundlage behindert. Die eher anspruchslose Alternative zwischen anekdotischillustrierenden Geschichtchen und klischeehaft verkürzten, stereotypen Tugend(vor)bildern ließ wenig Raumfür so wichtige Fragen wie die nach dem Erkenntniswert des historischen Beispiels oder nach derOrientierungsfunktion konsensstiftender Symbolgestalten.1174 Soviel nur, um den Sinn der folgenden, etwasumständlichen Curtius-Kritik zu zeigen. Man gelänge in der Tat einfacher zur Sache, lägen nichtwissenschaftsgeschichtliche „Umstände“ im Weg. Eine geringfügige Ungenauigkeit, besser: eine polemischeÜbertreibung eines großen Gelehrten, ist nach dem Gesetz der wachsenden Geltung von Autoritätsargumentenzur offiziellen Doktrin geworden. Eine Entwicklung, die so leicht in Gang gekommen ist, kann nur mühsamwieder rückgängig gemacht werden.1175
Curtius‘ bekannteste Äußerung zum Thema findet sich in ‚Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter‘(S. 69): „Wie die Sentenzen dienen dem Mittelalter Musterbeispiele menschlicher Vorzüge und Schwächen(exempla), die es in den antiken Autoren fand, zur Erbauung. Exemplum (paradeigma) ist ein Kunstausdruckder antiken Rhetorik seit Aristoteles und bedeutet ‚eingelegte Geschichte als Beleg‘. Dazu tritt später (seitetwa 100 v. Chr.) eine neue Form des rhetorischen Exemplums, die für die Folgezeit wichtig wurde: die‚Beispielfigur‘ (eikon, imago), das heißt ‚die Verkörperung einer Eigenschaft in einer Gestalt‘: Cato illevirtutum viva imago.“ Für imago wird einzig auf F. Dornseiff verwiesen.1176
Die Stelle ist fast wörtlich übernommen aus der im Tenor destruktiven Rezension, die Curtius 1942 der imgleichen Jahr erschienenen Arbeit seines romanistischen Kollegen Hugo Friedrich: ‚Die Rechtsmetaphysik dergöttlichen Komödie. Francesca da Rimini‘ angedeihen ließ.1177 Die Kritik gipfelt
1172 Vgl. §§ 41, 50, 64.1173 Vgl. oben §§ 10, 16, 34.1174 Vgl. § 11.1175 Methodisches Vorbild waren die ebenso feuilletonistischen wie akribischen Miszellen, die F. CHÂTILLON in der seitJahren größtenteils von ihm allein bestrittenen ‚Revue du Moyen Age Latin’ periodisch erscheinen läßt.1176 DORNSEIFF 218. Die Hinweise auf KORNHARDT 14 und Joh. von Garlandia haben mit imago nichts zu tun: s. obenS. 159 f.1177 Zur Danteforschung, bes. 11 ff.; dazu vgl. oben § 10.
585
in dem Vorwurf, Friedrich habe „den prinzipiellen Unterschied zwischen altrömischen Tugendvorbildern undmittelalterlichen Predigtmärlein“ übersehen (S. 12). Um dies zu beweisen, entnimmt Curtius zunächst demSprachgebrauch Dantes, daß exemplum nur in der Bedeutung „Vorbild einer Tugend“ zum Thema gehöre.1178
Nach der oben (aus ‚Europäische Literatur …‘) zitierten Stelle folgt: „Endlich aber muß man wohl beachten,daß das antike exemplum, d. h. die Erzählung eines historischen Beispiels, wie die Compilation des ValeriusMaximus solche bietet, im Mittelalter überwuchert wurde von einer ganz anderen neuen Gattung, die nun auchexemplum heißt: Klapper sagt treffend: ‚Im Mittelalter heißt jede Erzählung exemplum, die zurVeranschaulichung einer theologischen Lehre dient‘.“1179Die Schlußfolgerung
1178 Ebd. 11. Interessant ist vor allem die u. a. als Beispiel für ein „echtes“ Vorbild-exemplum angeführte Stelle ausMonarchia II 5 (ed. G. VINAY, Florenz 1950, 136 f.; vgl. dazu bereits oben Anm. 345 und 920): De personis autemsingularibus compendiose progrediar […] Nonne Cincinnatus ille sanctum nobis reliquit exemplum libere deponendidignitatem in termine suo, cum assumptus ab aratro, dictator factus est, ut Livius refert, et post victoriam […] sudaturuspost boves ad stivam libere reversus est? […] Nonne Fabricius altum nobis dedit exemplum avaritie resistendi, cum, pauperexistens, pro fide qua rei publice tenebatur auri grande pondus oblatum derisit, ac derisum, verba sibi convenientiafundens, despexit et refutavit? Es folgen in gleicher Weise, der Hauptproposition jeweils auch syntaktisch nachgestellt, dieExempla Camillus, Brutus, Mucius, die Decier und Cato. Nach CURTIUS müßten diese rudimentär charakterisiertenGestalten nicht anders als die Helden des 5. Höllenkreises imagines heißen, obwohl er von exempla spricht. Vgl. auchVITALE-BROVARONE (wie Anm. 99) 101 zur „narrazione compendiata o implicata“: „… che il cittadino debba porsi difronte allo Stato ed al potere personale ‚come fece Cincinnato’, è indubbiamente una proposizione di exemplum narrativoimplicito“. Vgl. auch S. 61, Anm. 345, 374 und H. PFLAUM, Il ‚modus tractandi’ della Divina Commedia, in: Il GiornaleDantesco 39 n.s. 9 (1938) 153–78, hier 177 zum modus exemplorum positivus.1179 Zur Danteforschung, 11, mit Bezug auf den Art. in MERKER-STAMMLERS ‚Reallexikon d. dt. Literaturgesch.’ I 332.– Zur Verwendung metaphorischer und anspielender Exempla bei Dante vgl. neben FRIEDRICH 55 ff. auch H.RHEINFELDER, Dante und die Geschichte, in: ‚Speculum historiale’, Festschr. J. SPÖRL, Freiburg–München 1965,303–315, bes. 304 f. und H. DÖRRIE, Der heroische Brief (wie Anm. 577) 350 ff. zur Rezeption von Heroiden-Exempla inGottfrieds von Straßburg ‚Tristan’ (17186–203) verglichen mit ‚Paradiso’ IX 97 ff.: In besagter ‚Liebesgrottenszene’ beiGottfried entsprechen die traurigen „maeren“ von unglücklichen, an der Liebe gestorbenen Frauen, was die Form einer bloßanklingenden Erinnerung betrifft, durchaus dem 5. Gesang des ‚Inferno’ mit der berühmten von Aen. VI 442 ff. angeregtenAufzählung unglücklich Liebender. In all diesen Fällen handelt es sich ganz und gar um eigentliche Exempla (überdies vonliterarisch hohem Rang). H. GMELIN (Kommentar zur Göttl. Komödie I, Stuttg. 1954/1966, 106) schreibt zu Inf. V 52–72,Dante habe hier auch eine „Huldigung für die antike und mittelalterliche Liebesdichtung“ geschrieben und sei abschließendmit einem zeitgenössischen Exemplum – Paolo und Francesca – mit ihr „in Wettstreit getreten“. So hat es auch FRIEDRICHgesehen (s. oben § 10). Der schicksalshaften Kontinuität von Semiramis, Dido, Kleopatra zu Francesca entspricht dieliterarische Identität des Erinnerungsmittels „Exemplum“ von den Evokationen ferner Vergangenheit zurGegenwartserzählung.
586
gegen Friedrich lautet (S. 13): Kurze Erwähnungen von Namen wie Dido, Kleopatra, Helena u. a. im ‚Inferno‘V seien „nichts anderes als ‚Beispielfiguren‘ (imagines) in dem oben bezeichneten Sinn. Derartiges kommt inder lateinischen wie in den volkssprachlichen Literaturen viele tausend Male vor und hat nichts Auffallendes.Es ist rhetorischer Schmuck der geläufigsten Art. Aber es sind imagines, nicht exempla: es sind keineErzählungen, sondern Namen, deren bloße Nennung, eventuell unter Beifügung weniger kennzeichnenderWorte genügt, um die Erinnerung an bestimmte Tugenden oder Laster wachzurufen.“ Nachdem einigeBeispielreihen aus Reliefdarstellungen des ‚Purgatorio‘ angeführt worden sind (S. 15 f.), „ergibt [es] sich also,daß Dante das abgenutzte Schema der Beispielfigur kunstvoll erneuert und reich variiert hat. Zugleich aberstellen wir fest, daß dieses danteske Exemplum [sic!] mit der populären Erzählungsform des mittelalterlichenPredigtexemplums nichts zu tun hat. Dante gibt keine ‚Geschichten‘, sondern er nennt Beispielfiguren, die sobekannt sind […], daß ihre Geschichte nicht erst erzählt zu werden braucht.“ (Curtius bezeichnet hier das vonihm imago genannte Beispiel inkonsequenterweise auch als Exemplum.) Schließlich folgt die entschiedeneAbweisung des Friedrichschen Versuchs, die Francesca-Szene als Exemplum in Form einer „Begegnung“ zuverstehen:1180 „… zum Begriff des – heidnischen oder christlichen – Exemplums gehört, daß es eine‚Geschichte‘ ist, etwas Erzähltes, eine belehrende, erhebende, erbauliche oder auch schlechtweg unterhaltende‚Anekdote‘, eine moralisierende Kurzform volkstümlicher Prosa.“ Curtius ist also an dieser Stelle, was dasVerhältnis von altrömischen und homiletisch-mittelalterlichen Exempla betrifft, offenbar zu einer beidegemeinsam umfassenden narratologischen Definition bereit. Was er ablehnt, ist einerseits die Verwechslungvon Erzählung und Beispielfigur, und andererseits die Identifizierung zweier insgesamt so gewöhnlicher Arten– der grundsätzlich „volkstümlichen“ Erzählexempla und der manierierten, „abgenutzten“ imagines – mit„großen Begegnungen der Dichtung.“
In seinem früheren Aufsatz von 1939: ‚Die Musen im Mittelalter‘ liegt seine Geringschätzung derrhetorischen Ausdrucksform Exemplum schon offen zu Tage.1181 Er geht in einer ausdrücklich als„Abschweifung“ bezeichneten
1180 Vgl. oben § 10.1181 Mittelalter-Studien VI, in: ZRPh 59 (1939) 129–188, hier 177 f.
587
Stelle über Gedichte Baldrichs von Bourgueil (S. 177 f.) auf Synkrisis und „feste Clichés“ der „Überbietung“ein, wie sie panegyrisch gemeinte Vergleiche von Dichtern mit Orpheus, Artistoteles, Vergil, Homer usw.oder von Fürsten mit Hektor, Octavian, Achill, Cäsar usw. zeigen, und stellt fest (S. 178): „Das Verfahrenwird deutlich geworden sein; zugleich die Hohlheit der Manier. Es ist aber sehr lehrreich für die Geschichte desmittelalterlichen Stiles, denn es ist nur die Übertreibung der Theorie, wonach Geschichte eine Sammlung vonexempla darstellt.“ Die angeführten Verse Baldrichs1182 zeigen deutlich, daß das, was Curtius mit demmittelalterlichen Dichter exempla nennt, im Sinne seiner Friedrich-Rezension hätte imagines heißen müssen.Im Aufsatz ‚Die Musen im Mittelalter‘ hat er also, nach seiner Wortwahl zu urteilen, den später Friedrich mitpolemischer Schärfe vorgehaltenen Begriffsunterschied noch nicht gekannt oder für gleichgültig gehalten.Merkwürdigerweise zieht er auch eine (später als wissenschaftliche Hauptautorität gegen Friedrichmobilisierte) Stelle aus dem Beitrag von Franz Dornseiff bereits heran, hier jedoch ausdrücklich als Beleg fürdie Gleichsetzung beider Begriffe. „Das exemplum entspricht dem aristotelischen e˝k√n (imago) =‚Verkörperung einer Eigenschaft in einer Person‘.“ Aus Dornseiffs Arbeit zitiert er die Feststellung, daß dashistorische Beispiel in der römischen Entwicklung immer mehr ‚Bild‘, ‚Vorbild‘ geworden sei.1183 Es kommtihm hier auf die unauflösbare Beziehung zwischen Geschichte und Exemplarität an, wie sie sich sprachlich inder Synonymie von historia und exemplum ausdrückt.1184 Für die literarische Kontinuität, ja Ubiquität diesesTyps von Exemplum nennt er neben der lateinischen Dichtung des 11. und 12. Jahrhunderts noch Lope deVega und Calderon (deren Dramen von Exempla „wimmeln“) und empfiehlt abschließend – als sähe er keinenUnterschied zwischen Beispielfigur, Beispielerzählung, Predigtmärlein – das wissenschaftliche Standardwerkzum Thema Exemplum überhaupt: J. Th. Welters (bekanntlich allein dem homiletischen Exemplumgewidmete) Monographie.
Schon in diesen drei grundlegenden Passagen, in denen auch der imago-Begriff explizit erscheint, hinterläßtdie praktische Verwendung des Exemplum-Begriffs durch Curtius einen zwiespältigen Eindruck. Man könnteeinen allmählichen Sinneswandel annehmen. (Jedem Forscher sind Meinungsänderungen im Laufe der Jahrestatthaft und oft von Nutzen.) Doch in der uns interessierenden Frage fehlt jegliche Veränderung oderSelbstkorrektur (zwischen
1182 Baldr. Cm. 200 (HILBERT) 105 ff. oben in Anm. 911 zitiert. Gravierend ist überdies, daß CURTIUS hier denHauptsinn von exempla: Musterstelle aus antiken Autoren (über mythologische Themen) mit mythologischen Beispielenverwechselt hat. Vgl. Anm. 374, 911.1183 CURTIUS, Musen … 178 (Anm.) zu DORNSEIFF 218 f.1184 Zu diesem wichtigen Aspekt vgl. auch oben § 41, S. 50 ff., 57 ff.
588
1939 und 1948). Die ‚Europäische Literatur …‘, eine Art revidierter Summe der wichtigsten (als„Vorarbeiten“ bezeichneten) Aufsätze, bietet (S. 367) eine Wiederholung der oben angeführten Seite überBaldrich aus dem „Musen“-Aufsatz von 1939. Nicht genug: Obwohl im Text auf die hier zuerst erwähnteSeite 69 der ‚Europäischen Literatur …‘ (mit der Lehre vom Unterschied von exemplum undimago/Beispielfigur) zurückverwiesen wird, schreibt Curtius unbekümmert den neuen einleitenden Satz: „DieBedeutung der Beispielfiguren (exempla) haben wir kennengelernt.“ Abgesehen davon verwendet er an keinerStelle seines Hauptwerks, außer S. 69 – dem Extrakt aus der Friedrich-Rezension – den Ausdruck imagines imSinne von Beispielfiguren. (Die Ketten von „Beispielen berühmter Langlebigkeit“ auf S. 91 f. hätten nachihm denselben durchaus verdient.) Curtius spricht vielmehr (S. 67–70, 123, 432 usw.) unbeirrt vonExemplum, wo nach seiner eigenen Definition imago angebracht gewesen wäre (etwa S. 123 in einerAufzählung aller der Liebe verfallenen Herrscher seit Alexander, S. 432 zu einer Anspielung auf Nebukadnezarals Koch u.a.m.). Im übrigen erwähnt er seiner humanistischen Ausrichtung gemäß Predigtmärlein in‚Europäische Literatur …‘ überhaupt nie als Exempla und, wenn ich das richtig sehe, auch kaum je in seinemGesamtoeuvre – außer in besagter Besprechung von Friedrichs Dante-Buch.
Drängt sich schon hier der Verdacht auf, Curtius könnte ein abgelegenes oder apokryphesUnterscheidungskriterium, um das er sich sonst selbst nicht kümmerte, punktuell (will sagen: tendenziös gegenFriedrich gerichtet) ins Rampenlicht gezogen haben, so zeigt eine Erkundung des Weges, auf dem er zu demangeblich antiken imago-Begriff gelangt ist, schon fast pseudepigraphisch zu nennende Indizien. Jedenfallsergeben sie insgesamt das Bild eines Holzweges.
Die erste Station findet sich in dem ungemein vielseitigen und anregenden Aufsatz von Franz Dornseiff, aufden – bzw. auf einen Satz desselben – Curtius sich an allen fraglichen Stellen beruft. Dornseiff hat (nachAristoteles, Rhet. II 20) die Theorie der Induktion und die Arten des Beispiels referiert und erläutert: darauffolgt folgende, von Curtius durchweg ungenau zitierte Stelle (S. 218, Nicht-Beachtetes von mirhervorgehoben): „Aristoteles und mit ihm andere unterscheiden […] drei Arten: 1. parådeigma , exemplum =ist die eingelegte Geschichte als Beleg, historisches Beispiel, 2. parabol¸ , similitudo … 3. m†uoq, løgoq,fabula […] Dazu tritt für uns seit der etwa 80 v. Chr. verfaßten Rhetorik an Herennius und Cicero 4. e˝k√n ,imago = die eigentliche Verkörperung einer Eigenschaft in einer Gestalt, z. B. Cato ille virtutum viva imago.Die 4. Unterart scheint damals neu zu sein […] sie ist die wichtigste und entscheidende für die Folgezeitgeworden.“ (Notabene: Von „Beispielfigur“ ist nicht die Rede; das aristotelische Paradeigma ist nichtAnführung einer „Geschichte“ im Sinne von beliebiger Erzählung, sondern eines Geschichtsereignisses als„historisches Beispiel“).
589
122. Zweite Station: Wie kommt Dornseiff zu der nach-aristotelischen Kategorie imago (beim frühen Curtiusvon 1939 ist sie zur aristotelischen geworden)?1185 Mit Nachdruck muß vorweg der Leitgedanke (unabhängigvon der terminologischen Problematik) in Schutz genommen werden: Die Entwicklung von der griechischenzur römischen Rhetorik brachte in der Tat eine Verlagerung von einem mehr argumentativen zu einem mehr„exemplarischen“ Beispiel mit sich.1186 Zutreffend ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf denwichtigen römischen Wertbegriff imago virtutis für eine vorbildliche Ahnengestalt.1187 Mit drei Substantivenfaßt Dornseiff prägnant zusammen, was vom griechischen zum römischen Exemplum führt: „Das Beispielwird Bild, Vorbild“ (219). Frei ins Lateinische übersetzt, hieße das etwa: de (probationis) exemplo fit imago(virtutis). Um Übertreibungen vorzubeugen, ist allerdings zu wiederholen, daß diese Entwicklung eher eineAkzentverschiebung als eine Wesensveränderung bedeutet.1188 Jedes Beispiel, auch das griechische, kanngewissermaßen „Verköperung einer Eigenschaft in einer Gestalt“ sein, da in der Geschichte des Exemplumsniemals eine Gestalt als solche dargestellt wird – das wäre Biographie –, sondern stets ein sachdienlicherAspekt eines Lebens auf eine causa funktional, d. h. einseitig verkürzt (als Synekdoche) hingeordnet wird.Andererseits können die durch ein Wertsystem auf bestimmte „Eigenschaften“ oder Normen fixiertenexempla maiorum oder exempla sanctorum der römischen und christlichen Tradition durchaus auch alsArgumente im Sinne der aristotelischen Lehre vom „Beweis durch das Beispiel“ verwendet werden. In denHauptzügen trifft Dornseiffs Darstellung eines Wandels vom Beweis- zum Vorbildbeispiel jedoch zu; ebensoplausibel und aufschlußreich ist in kulturgeschichtlicher Hinsicht der imago-Begriff als Metapher aus demBereich der bildenden Künste. Unbewiesen bleibt nur die Annahme, daß imago von der Herennius-Rhetorikund von Cicero als rhetorischer Fachterminus und als vierte Kategorie der Beispielarten neben paradeigma,parabole, mythos eingeführt worden sei. Dornseiff gibt dafür keinen antiken Beleg, sondern verweist auf dieDissertation von Karl Alewell (1913).
Dritte Station: Alewell behandelt in einer wahldokumentierten, sauberen Analyse die Vergleichsarten derBeweistheorie in der nach-aristotelischen Rhetorik bis Quintilian (S. 19 ff.), wobei er primär an derGeschichte der Systeme und Gliederungen interessiert ist (Aristoteles: Zweiteilung in historische undselbstgebildete Beispiele unter dem Oberbegriff paradeigma; später
1185 Musen … 178 (Anm. 2) s. oben S. 584.1186 Vgl. oben S. 68 f.1187 Vgl. oben § 21, S. 341, 462 f. unten Anm. S. 590 f. und in ‚Römische Wertbegriffe’, ed. H. OPPERMANN, (WdF 34),Darmstadt 1967, besonders 274 ff. (ROLOFF); 376 ff. (BÜCHNER); 420 ff. (KNOCHE).1188 Vgl. oben S. 66.
590
neue Drei- und Vierteilungen unter Oberbegriffen wie similitudo, homoeosis, comparabile u.a.m.).1189 ImAnschluß an ein Cicero-Zitat (Part. or. 40) über die drei noch aristotelisch wirkenden Arten exemplum, reisimilitudo und fabula sowie über deren in dieser Reihenfolge abnehmende Beweiskraft schreibt er (S. 20–22):„diese dreiteilung wird dann teils erweitert, teils variiert; beides auf kosten der fabel, die ja schon Cicero miteiner gewissen bedenklichkeit zu betrachten scheint. vor allem tritt Ô e˝k√n (imago) als neue species auf.durch ihr hinzutreten gibt es eine vierteilung, bei der die fabel den letzten platz bekommt […] meist tritt diee˝k√n (imago) an stelle der fabel, so daß wir eine dreiteilung in parådeigma (exemplum, historischesBeispiel), parabol¸ (similitudo, bei Cicero collatio genannt) und e˝k√n (imago) haben.“ Eine Anmerkung(2) faßt die zitierten imago-Definitionen zusammen (s. gleich unten) und erwähnt der Vollständigkeit halberlexikographisch, daß „in der praxis“ und „in besonderen fällen“ – d. h. eindeutig außerhalb der rhetorischenTheorie – der Terminus imago auch an Stelle von exemplum im Sinne von „Inbegriff“ oder „Abbild“gebraucht werde. Alewells Zitate sind schöne Zeugnisse für die metaphorische Bedeutung des Bildnisses imrömischen Helden- und Ahnenkult (z. B. Seneca ‚De tranq. an.‘ 16.2: Cato ille virtutum viva imago). Erkommentiert: „imago ist stärker. Cato ist nicht nur ein beispiel, sondern ein bild der tugend.“ Die hierhervorgehobene Standbild- und Gemäldemetapher ist im übrigen, vom antiken Ruhmes- undUnsterblichkeitsgedanken geprägt, in epideiktischen Gattungen wie Totenrede, Biographie oder Grabinschriftdurchaus geläufig und selbstverständlich. (Sie hat, mit Curtius zu reden, „nichts Auffallendes“.)1190
1189 Vgl. S. 51 ff., 58 f.; s. auch PÖSCHL, Literatur (wie Anm. 170) 70, 126 zur besonderen Stellung des römischenExemplums zwischen der starren kollektiven Autorität primitiver Gesellschaftsordnung und dem Ideal derIndividualitätsausbildung.1190 ALEWELL führt außerdem noch zwei Seneca-Stellen an: Cons. ad Helv. 12.7: paupertatem, cuius tam clarae imaginessunt, und Ep. 120.8 über die facta des Fabricius und Horatius Pulvillus, die imaginem nobis ostendere virtutis. – Zusätzlichvgl. etwa noch Quint. 2.20.6; 10.2.15. Zur rein metaphorischen, keineswegs literaturtechnischen Bedeutung solcher imago-Verwendungen vgl. McCALL IX f., 164 f. – Zu einer anderen Bedeutung von imago (Abklatsch, Abglanz, Kopie, Schatten,Schein) und einer imago virtutis als Gegensatz zur substantia virtutis aufgrund patristischer Polemik gegen das altrömischeTugendideal s. S. 462 f. Daß ALEWELLS Assoziation der rhetorischen imago und der monumentalen moralischen imagoGefahr läuft, mißverstanden zu werden, beweist auch J.-M. DAVID (Maiorum exempla 73), da er direkt von dieser Stelle her(ohne DORNSEIFF und CURTIUS zu erwähnen) die Definition der Herenniusrhetorik: ante oculos ponit (IV 49.62) mit dengenannten Seneca-Zitaten verbindet, um zu der an sich treffenden mentalitätsgeschichtlichen Feststellung zu gelangen: „Or lamémoire du passé était, pour le peuple romain, largement faite d’images visuelles: imagines des morts, statues et autresreprésentations plastiques, processions triomphales, inscriptions, rituels des événements politiques etc. […] L’évocation quel’exemplum développe est donc pour l’essentiel composée de ces scènes qui, vécues ou transmises, constituent en fait, unebonne partie des matériaux de l’imaginaire collectif“. Zur Bedeutung der römischen imagines für den Exempla-Gebrauch vgl.auch BALDWIN (wie Anm. 160) 102 f., 105, 112; GEBIEN 63, der zu Seneca mit Recht schreibt: „Die in den Exempelngeschilderten historischen Personen werden […] als imagines virtutis verstanden“. Vgl. auch GUERRINI 61 ff. zurfließenden Grenze zwischen literarischer und ikonographischer Tradition in der Rezeptionsgeschichte des Val. Max., der dieimago-Metapher selber mehrfach braucht; vgl. Val. Max. 4.6 praef.: legitimi amoris quasi quasdam imagines […] lectorisoculis subiciam (wobei quasi auf das Metaphorische verweist); ebd. 6.6 praef.: cuius imagine ante oculo posito; 9.11 praef.:exemplorum imaginibus. (Synonyma sind etwa effigies oder repraesentatio.) Nach TRIMPI, Quality (wie Anm. 55) 36 kanndie Ausmalung eines Exemplums zum „Porträt“ bei der Hypothesis-Bildung der Deklamationen ebenfalls in einemmetaphorischen Sinn imago heißen. Insgesamt kann mit McCALL IX f. gar nicht genug vor der leichtfertigen Gleichsetzungdes metaphorischen Eikon-Begriffs mit einem literaturtechnischen Terminus gewarnt werden. – Die Arbeit von R. DAUT,‚Imago’, Untersuchungen zum Bildbegriff der Römer, (Bibl. d. kl. Alertumswiss. NF 2, R.LVI) Heidelberg 1975 enthältnichts über den eigentlichen Wortgebrauch hinaus, behandelt Bildarten (Kunstbild, Götterbild u. dgl.), keine Bild-Metaphern.
591
Am Ende bleibt also eine Untersuchung der verzweigten rhetorischen Vergleichsartenlehre und eine Fußnotezur gelegentlichen (übertragenen und verstärkenden) Anwendung von imago im Sinne von „Beispiel“ imliterarischen Sprachgebrauch übrig.
Was imago in der Rhetorik bedeutet, zeigt die auch von Alewell herangezogene Definition aus der Rhetoricaad Herennium (4.49.62): formae cum forma cum quadam similitudine conlatio. Sie bezieht sich auf einebestimmte Vergleichsart innerhalb der „Gedankenfiguren“ sententiarum exornationes der Tropenlehre. Wasgemeint ist, ersieht man besser aus dem Anwendungsbeispiel: Inibat in proelium corpore tauri validissimi,impetu leonis acerrimi similis. Letzteres Bild erscheint auch in der von der Paradeigma- Theorie völliggetrennten Lehre des Aristoteles von „Bildvergleich“ (e˝k√n) und Metapher (Rhet. III, 1406 b 21): „Wie einLöwe stürzt er auf ihn; so der Bildvergleich. Sagt man aber: Ein Löwe stürzte auf ihn, so ist es eineMetapher.“ Diese imago wird in der Rhetorica ad Herennium nun neben dem (als historisches Beispielverstandenen) exemplum unter dem Oberbegriff similitudo zusammengefaßt. Cicero (Inv. I 30.47.49) teilt das(an Stelle von similitudo verwendete) comparabile seinerseits ein in exemplum, imago, collatio und definiertimago als oratio demonstrans corporum aut naturarum similitudinem.1191
1191 Zur stilistischen Bedeutung der schmückenden Metapher und deren Unterart eikon bei Aristoteles vgl. McCALL 29 ff.Zum Wesensunterschied dieses poetisch-literarischen Vergleichsmittels zu den rhetorisch-argumentativen Vergleichsartenunter dem Oberbegriff paradeigma s. auch oben § 18. Zur imago als Unterart der similitudo in der Rhet. ad Her. IV 49. 62vgl. McCALL 65 ff., 79 ff.; bei Cicero ebd. 89 f.; bei Quint. ebd. 201 f. Zu eikon als Porträtmetapher bei Platon (fürVergleich und Gleichnis) vgl. WILMS (wie Anm. 125) 1 ff.; allgemein als stilistische „Gedankenfigur“ vgl. LEEMAN 40 f.;die wichtigsten Stellen der rhetor. Theorie sind in ThLL s. l. imago 410.20 ff. aufgeführt.
592
Neben similitudo und comparabile sind homoiosis und simile die geläufigsten Oberbegriffe der im Mittelaltersowohl in der grammatikalischen Tropenlehre als auch in der rhetorischen Figurenlehre und Topikbeheimateten Einteilung. Trotz der langen, reich verästelten und ziemlich verwirrlichen Überlieferung diesesVergleichsarten- Theorems bleibt der Sinn der Unterscheidung von exemplum und imago, paradigma undicon/ycon wenigstens in einem Punkt durchweg über jeden Zweifel erhaben: exemplum vergleicht„Geschehenes“, handelnde Personen oder Ereignisse (vorwiegend aus der Geschichte); imago vergleicht(beseelte oder unbeseelte) Naturphänomene und bestenfalls natürliche, bzw. körperliche Attribute vonPersonen (hauptsächlich in der Personenschilderung).1192 Niemals aber ist in der homoiosis-Lehre
1192 Das S. 56 zur similitudo Gesagte trifft also auch auf den Unterbegriff imago als Gegensatz von exemplum zu. Vgl.LAUSBERG § 422, 233: Wenn man von der Gesamt-Homoiosis den „Bereich der Geschichte und der poetischen Fiktion“abzieht, so bleiben „für die engere similitudo die Bereiche der Natur und des allgemeinen (nicht historisch fixierten)Menschenlebens übrig“. Die similitudo „verlangt keinen besonderen Bildungsstand (wie etwa das exemplum, das historischeKenntnisse voraussetzt)“. Vgl. auch § 40, S. 63. Zur similitudo/homoiosis-Lehre und ihrer Entwicklung in Rhetorik u.Grammatik s. S. 58 ff.; KREWITT 29 f., 43, 79, 84, 155 f.; FONTAINE, Isidore (wie Anm. 145, 151 ff.; GEBIEN 56 ff.;LAUSBERG §§ 422 ff.; ZILTENER 51 ff., 60 ff.; VITALE-BROVARONE 97 ff.; ROLLINSON 154 ff. und KNAPP,Similitudo 66 ff., 176 f. – Über den schwankenden Sinn der imago-Definitionen läßt sich streiten. (Was bedeuten forma,persona, natura? Wie lassen sich similitudo, conlatio, figura in nicht tautologischer Weise verbinden? usw.) Wenigerkontrovers sind die Anwendungsbeispiele. Eine Gruppe von Definitionen des Vergleichs stellt „Personen“ und „Akzidentienvon Personen“ nebeneinander: Marius Plotius Sacerdos (Gramm. lat. IV, 465.23): icon: personarum similium compararatio(im Sinn der descriptio); Diomed. (ebd. I 663.13 ff.): icon est descriptio figurae alicuius expressa vel personarum inter seeorumve quae personis accidunt comparatio; Julius Rufinianus (Rhet. lat. min. 44 f.): Icon fit, cum perfectae formae similesconferuntur […] Cicero de populo Romano [p. Cluent. 138]: ut mare, quod sua natura tranquillum sit, ventorum vi agitariet conturbari solet: sic populus Romanus… Donat, Gr. 3.6. (Gramm. lat. IV 402): icon est personarum inter se vel eorumquae personis accidunt comparatio. Charisius, Gramm. 4.2 (ebd. I 277.8 f.): identisch mit Donat. Eine andere Gruppe hebtden Vergleich innerhalb derselben „Gattung“, insbesondere von Körpermerkmalen in der Personenbeschreibung, hervor; vgl.etwa Victorinus in Cic. inv. 1.49 (Rhet. lat. min. 228.9): per imaginem simile fit, cum ex simili specie vultus vultibuscomparamus, ut ‚os umerosque deo similis’ (Aen. I 589). Zu vultus als Synonym von imago = „Standbild“ vgl. von MOOS,Par tibi Roma nihil… in: Mlat. Jb. 14 (1979) 119 ff. – Isid. Et. I 37.32: Icon est imago, cum figuram rei ex simili genereconamur exprimere, ut: ‚Omnia Mercurio similis, vocemque coloremque/et crinis flavos et membra decora iuventae’.Congrua enim est similitudo de specie, cuius persona inducitur. Als zweiten Begriff für icon verwendet Isidor Et. II 21.40(nach Diomedes, Gramm. lat. I 3, 463.13): characterismus, descriptio figurae alicuius expressa und gibt dasselbeAnwendungsbeispiel, Verg. Aen. IV 558. Am klarsten ist hier wohl Macrob, Sat. 4.5, wo die drei Arten der loci circa remad pathos movendum a simili (Sat. 4.5.1 ff. s. oben Anm. 145): exemplum, parabola, imago heißen und von letzterer(Sat. 4.5.9–12) zwei Unterarten genannt werden: a) cum aut forma corporis absentis decribitur, b) aut omnino quae nulla[forma] est fingitur; m.a.W. a) Beschreibung der äußeren Erscheinung eines Abwesenden (wie Ethopoeia), b) Ausmalungeines nicht existierenden Wesens (wie Personifikation und Prosopopoeia). Beispiel für a) ist Aen. III 488: ‚O mihi sola meisuper Astyanactis imago:/Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat’; Beispiel für b) u. a. Aen. VIII 702: ‚Est scissagaudens vadit Discordia palla,/Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagello’. (Letztere imago wurde im MA fürmythologische und allegorische Personen bedeutsam: s. unten Anm. 1195). Die Anwendungsbeispiele für imago/-icon zeigeninsgesamt wie schon in der rhetorischen Tradition bei Aristoteles und dem Auctor ad Herennium Bildvergleiche beiPersonenschilderungen. Entgegen der Definition werden also nicht die Personen selbst verglichen, sondernBeschreibungsmerkmale derselben. Die parallel dazu vorgebrachten Definitionen von exemplum/-paradigma enthalten isoliertoder kombiniert vor allem die zwei festen Bestandteile rei praeteritae relatio (z. B. Marius Plot. Sacerd., Gramm. lat. VI465.19 f.; Charis., ebd. I 277.16 f.; Diomed., ebd. I 464.17 ff. hier mit dem aus Donat übernommenen Zusatz: enarratioexempli) und ad hortationem vel dehortationem (vgl. A. 145, 418). Die Anwendungsbeispiele für exemplum/paradigma sindausnahmslos historische oder mythologische Gestalten, selbst in abweichenden, besonders heterogenen Zeugnissen wie Isid.Et. I 37.34: Paradigma vero est exemplum dicti vel facti alicuius aut ex simili aut ex dissimili genere conveniens eius, quamproponimus rei, ita: ‚Tam fortiter periit apud Hipponem Scipio quam Uticae Cato’; oder Gervasius von Melkley (Ars poet.,ed. H.-J. GRÄBENER, Münster 1965) 150 f.: paradigma est positio exempli dum deterreat vel hortetur. Deterreat, ut sidehortans aliquem ne dominum suum relinquat, dicas: ‚Iudas dominum suum tradidit’ […] Hortatur, ut si mones aliquemad conversionem, dicas: ‚Petrus flevit et dimissum est ei peccatum’. Per coadunationem autem decoratur paradigma(gemeint ist die elocutionell amplifikatorische Exemplareihe; es folgt eine Beispielkette mit Alexander, Socrates, Atlas. Vgl.oben S. 200).
593
oder in der übrigen rhetorischen Theorie eine Unterscheidung zweier Beispielarten im Sinne von „Erzählung“und „Anspielung“ – die authentischen rhetorischen Termini heißen narratio und commemoratio – mit denBegriffen
594
exemplum und imago vorgenommen worden. Wo sich eine solche Lehre in der modernen Forschungsliteraturfindet, läßt sie sich also aller Wahrscheinlichkeit nach auf die von Curtius apodiktisch verbreitete pseudo-antike Erfindung Dornseiffs zurückführen.1193
123. Fassen wir zusammen: Alewell referiert zwei berühmte Dreiteilungen, die aristotelische (paradeigma =historisches Beispiel, Parabel, Fabel) und die nacharistotelisch-ciceronische (similitudo/homoiosis/comparabile = exemplum/paradigma, collatio/parabola, imago/icon), versucht, eine quellengeschichtlicheEntwicklungslinie vom einen zum anderen zu ziehen, und bemerkt dabei, daß die Fabel des Aristoteles in dersimilitudo-Lehre fehlt. Daraus schließt er, daß sie durch eikon/imago ersetzt worden sei, was der Feststellungentspräche, daß in der römischen Praxis des Exemplums die Fabel in der Tat eine sehr geringe Rolle spielt.Dornseiff geht ein Stück weiter: Er reiht die drei aristotelischen Arten des Paradeigma hintereinander auf undfügt als vierte nacharistotelische und offenbar allgemeinantike die
1193 Den hier besprochenen Irrtum hat bereits KNAPP (Similitudo 177, 330) festgestellt, ohne allerdings die weitreichendenforschungsgeschichtlichen Folgen zu berühren: „Viele Beispiele waren so allgemein bekannt, daß sie typisch gebrauchtwerden konnten […] Der Name für die Beispielfigur blieb dabei stets exemplum. Sofern jedoch damit der Inbegriff, dasAbbild einer Tugend gemeint ist, kann in der Praxis dafür auch imago stehen […], was jedoch keine Gleichsetzung mit demrhetorischen Begriff imago meint. F. DORNSEIFF […] hat also ALEWELL in diesem Punkt völlig mißverstanden, undE.R. CURTIUS ist DORNSEIFF darin gefolgt“. Ich würde diese „Schuldzuweisung“ etwas anders akzentuieren:DORNSEIFF hat aus ALEWELL (S. 21) immerhin den Sonderfall von Minukian (3. Jh. n. Chr., I 341, SPENGEL)wiedergegeben, dessen eigenwillige „Vierteilung“ ALEWELL mit guten Gründen als Kombination der aristotelischenDreiteilung (paradeigma, parabole, logos) mit der „neuen species“ eikon erschien. Der Fehler hat sich jedoch durchstillschweigende „Enthypothetisierung“ der ohnehin fragwürdigen Vermutung ALEWELLS eingeschlichen, aufgrund diesesvereinzelten späten griechischen Zeugnisses könne die Entstehung des schon seit der Herennius-Rhetorik ganz normalen, jakanonischen Dreierschemas paradigma, parabole, icon generell aus der Substitution der aristotelischen Fabel/logos-Kategorie durch eikon/-imago erklärt werden. DORNSEIFFS immanent rhetorikgeschichtliches Mißverständnis wird jedocheinigermaßen aufgewogen durch die Einbettung in eine insgesamt unanfechtbare und wichtige kulturgeschichtliche Tendenzbeschreibung, umso mehr als der theoretische Ansatz interdisziplinär weit über das bloße Rhetorisch-Technischehinausgreift (vgl. § 108). Erst durch die Inszenierung des erwähnten rhetorikgeschichtlichen „Lapsus“ durch einen soangesehenen Spezialisten der Rhetorikforschung wie CURTIUS kam aber das Gerücht in Umlauf, heroische exemplamaiorum als „Denkbilder“ (s. S. 339 f.) seien keine exempla, sondern imagines; exempla dagegen seien ausschließlich„Histörchen“ aller Art von Valerius Maximus zu den Predigtmärlein.
595
imago hinzu, die er von sich aus als „Verkörperung einer Eigenschaft“ auslegt und auf den maiores-Kult derRömer bezieht. Schließlich entnimmt Curtius dieser Darlegung die „rhetorische Theorie“ von derAnspielungs- und Nennungsform der imago und spricht davon, als handle es sich um eine alte, allbekannte(von H. Friedrich sträflich übersehene) Regel.
Ein Ausblick auf die Folgen mag die Mystifikationsgeschichte abrunden: L. Arbusow übernimmt in seinem(vor Lausbergs ‚Handbuch‘ in der Mediävistik vielbenutzten) Abriß der Rhetorik1194 so gut wie alle der hierangeführten Curtius-Passagen fast wörtlich, fügt aber überall verstärkend Eigenes hinzu: „Beispielfigur, Eikon,Imago, die typische Idealfigur, die eigentliche feststehende Verkörperung einer Eigenschaft: Cato viva imagovirtutum […]. Eine Sammlung von antiken Exempla war des Valerius Maximus Buch […] Bei Dante, wie inder mittelalterlichen Literatur überhaupt, sind Namen wie Dido, Helena, Paris, Tristan bloße Beispielfiguren[…] lediglich ‚Träger fester, ein für allemal gegebener Typen‘1195[…] rhetorische Schmuckrequisite.“ – DerBegriff „Beispielfigur“ hat sich inzwischen wissenschaftsterminologisch eingebürgert. Er dient (namentlich ingermanistischen Arbeiten) dazu, das, was in der rhetorischen Theorie und Praxis der Antike und desMittelalters exemplum heißt, künstlich von dem berühmteren neuphilologischen Homonym mit derBedeutung „Predigtmärlein“ zu unterscheiden.1196 Quid mirum? In dem unentbehrlichen und unschätzbaren
1194 Leonid ARBUSOW, Colores rhetorici, Eine Auswahl rhetorischer Figuren und Gemeinplätze als Hilfsmittel fürakademische Übungen an mittelalterlichen Texten, Göttingen 1948, 67.1195 Aus H. BRINKMANN, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung, Halle/1928, 60 f. übernommen, obwohl dortnicht von Exempla die Rede ist, sondern von poetischen Anwendungsbeispielen der descriptio personae bei Matth. v.Vendôme! Damit wird die schon in der DORNSEIFF/CURTIUS-Rezeption liegende Verwechslung einerpersonenbeschreibenden imago mit dem historischen Exemplum noch verstärkt.1196 Vgl. etwa Ulrike COVA, Antike Beispielfiguren in deutschsprachl. didakt. Lit. und darstellender Kunst des 13. Jhs.,Diss. (masch.) Wien 1973; REINITZER (wie Anm. 648), Titel, obwohl sich der Verf. in der Sache von CURTIUS absetzt(598) und betont, daß nicht nur reine Erzählungen, sondern auch in einem Namen verdichtete Erzählungen Exempla sind.KLEINSCHMIDT 77 f. unterscheidet ein argumentatives „Exemplum“ von der eine Eigenschaft (Tugend) verkörpernden„Beispielfigur“ (imago, icon). HONSTETTER 177 bezeichnet die nach Sallusts Caesar-Cato-Synkrisis gestalteten ExemplaAugustins in Civ. V 18 als „eher klischeehafte imagines“ denn „als Exempla im eigentlichen Sinn“ und stelltzusammenfassend fest (91), die kaiserzeitlichen Exempla seien fest mit bestimmten Eigenschaften verknüpft und „zuimagines erstarrt“. Auch DAXELMÜLLER, Exemplum 634 f. nennt die Identifikation von virtutis exempla mit Menschenimago/eikon. SCHÜPPERT (wie Anm. 641) 165 f. bezieht sich gleichzeitig auf CURTIUS und ARBUSOW (zumExemplum) und auf OHLY (zur Typologie) und konstruiert aus den hier als synonym zu verstehenden Begriffen: „biblischeTypen“ und „exempla oder imagines“ die „Beispielfiguren“. Diese an die Figuraldeutung erinnernde „Beispielfigur“ wirdzugleich als „Verkörperung einer einzigen Eigenschaft“ definiert (Natürlich ist neben typus, exemplum, figura, umbra auchimago ein geläufiger bibelexegetischer Terminus für eine Präfiguration [s. Thll. s. l. imago 412.47 ff.], was jedoch nicht zueiner solchen Gleichsetzung mit dem rhetorischen Exemplum berechtigt; vgl. die Verweise in Anm. 156).
596
Standardwerk der literarischen Rhetorik von Heinrich Lausberg fehlt zwar gänzlich der imago-Begriff imSinne von Curtius, und auch „Beispielfigur“ kommt m. W. nicht vor, doch im Register stoßen wir (S. 699) auffolgende Merkwürdigkeit: „Die Vossianische Antonomasie ist für das exemplum das gleiche, was die Metapherfür die similitudo ist: die Unterschreitung des minimalen Umfangs durch Ineinssetzung des Vergleichenden mitdem Verglichenen. Das exemplum wird in der Antonomasie auf die ‚Beispielfigur‘ (s. Curtius p. 69) reduziert,die mit dem Verglichenen ineinsgesetzt wird.“1197 Das neueste Zeugnis der konfusionsstiftenden Curtius-Wirkung bietet J. Le Goff:1198 „C’est aussi à l’Antiquité que Curtius attribue ‚une nouvelle forme d’exemplum(vers 100 av. J.-C.) qui devait jouer plus tard un grand rôle: ‚le personnage exemplaire (eikon-imago)‘. Mais[…] il assimile exemplum à imago alors que Cicéron tout en les rapprochant, distinque imago, collatio,exemplum (De Iventione I 49).“ Daß Curtius gerade den Unterschied von exemplum und imago betonenwollte, ist unbekannt. Le Goff ruft Cicero als Kronzeugen an, um den modernen Popanz „imago“ – eineimago, die mit der elocutionellen Vergleichsart kaum mehr als den Namen gemeint hat –, die „Beispielfigur“oder „le personnage exemplaire“, d. h. das personenhafte Exemplum aus seiner künstlich auf den didaktisch-homiletischen „récit bref“ eingeschränkten, narratologischen Exemplum-Definition auszuschließen.
So quält sich die Wissenschaft vom Mißverständnis zum Mißverständnis des Mißverständnisses fort. Nachsoviel Kritik zuletzt ein selbstkritisches Zeugnis: In ‚Consolatio‘ (IV S. 15) habe ich 1972, im Banne desvermeintlichen imago-exemplum-Unterschiedes, geglaubt, Exempla der allgemeinen Sterblichkeit, derheroischen Gefaßtheit (wie Anaxagoras und Job) oder exempla iusti doloris (wie Orpheus, David, Cäsar) soeinführen zu müssen: Exemplum sei „hier im antiken und mittelalterlichen Sinn der imago (Beispielfigur,Idealtyp) und der damit als ‚Beleg‘ für ein praeceptum verbundenen narratio, nicht aber im ausschließlichmittelalterlichen Sinn der (Predigt-)Kurzgeschichte (Anekdote, Novelle, Fabel u. ä.)“ zu verstehen. DiesePeinlichkeit
1197 Vgl. oben S. 64.1198 In: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT (1982) 33.
597
führe ich gerne im Geiste Johanns von Salisbury an, der im (Policraticus-Prolog 15.10) schrieb: Si quidautem cuipiam asperius sonat, non in se quicquam dictum noverit, sed in meipsum et similes mei, quimecum cupiunt emendari.
598
III. GESCHICHTEN-ERZÄHLEN IM 12. JAHRHUNDERT UND DIE UNTERHALTUNGVERSCHIEDENER SOZIALER GRUPPEN
124. In anderem Zusammenhang müßte die Frage nach Johanns Bewertung unterhaltender, zum Lachenanstiftender Aktivitäten nochmals zur Sprache gebracht werden. Joachim Suchomski behauptet in seinergrundlegenden Untersuchung über die komische Literatur des Mittelalters,1199 Johann habe dabei eineambivalente, ja widersprüchliche Haltung eingenommen und mühsam, im letzten erfolglos einen Ausgleichzwischen Kritik und Rechtfertigung der komischen recreatio mit Hilfe des Kriteriums ästhetisch-moralischerDezenz oder moderatio gesucht. Das Zweideutige könnte als eine doppelte klerikale Antwort auf diebesondere und neue Herausforderung des im 12. Jahrhundert aufblühenden Unterhaltungsgewerbes verstandenwerden: Eine mögliche Reaktion war schroffe Ablehnung jeglicher eigenständigen Laienkultur, die andere einvom Konkurrenzneid getragener Kompensationsversuch durch „seriösere“ lateinische Formen derUnterhaltung, zu denen an erster Stelle das Geschichten-Erzählen anhand des antiken Exempla-Materialsgehörte. Johann vertritt theoretisch offen den ersten Standpunkt1200 und dürfte, auch wenn er dies nirgendszugibt, praktisch im Sinne der zweiten Möglichkeit gewirkt haben.1201
Das gesteigerte hochmittelalterliche Interesse an Geschichten und deren „Häufung“ ist auf beiden Seiten derGrenze zwischen nichtklerikaler und klerikaler Kultur deutlich spürbar.1202 Daß dazwischen eigenartigeBrücken
1199 Delectatio und utilitas (1975) 46 ff. Zu Ambivalenzen vgl. auch S. 350, 387, 470 ff; CURTIUS, ELLM 419 ff. (HatJesus gelacht?); von MOOS, Hildebert (wie Anm. 211) 150 ff. (zu einem ähnlichen Harmonisierungsversuch über dasmoderatio-Ideal).1200 Vgl. etwa Pol. I 8; VIII 2, (II) 233; VIII 6, 259; VIII 12, 312 f. (= Macrob. Sat. III 14.11); MISCH 1219 ff.;SUCHOMSKI 46 ff.; F.H. BÄUML, Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy, in: Spec. 55 (1980)237–65, hier 255 ff.1201 Zu dieser Hypothese vgl. SUCHOMSKI 53; HUIZINGA, Zwei prägot. Geister (wie Anm. 31) 210 f.; MISCH 1183,1219 ff. („Der Jongleur als Rivale des Philosophen“). KARNEIN, Rez. R. SCHNELL, Andreas Capellanus (wie Anm. 570)in ZfdA 113 (1984) 68 ff., bes. 74 zur Irritation eines Klerikers durch erotische Literatur.1202 Vgl. oben S. 135 ff., 385 ff., 463 f. zum „cult of story-telling“. Zur zunehmenden Verwendung unterhaltenderGeschichte und Geschichten bei der (monastischen) Tischlektüre vgl. R.D. RAY (wie Anm. 360) 41; ders., Ordericus Vitalisand His Readers, in: Studia monastica 14 (1972) 17–33; SMALLEY, Friars 26 ff., 29 ff., 42.; LECLERCQ, L’amour deslettres (wie Anm. 387) 135 ff. – Zum signifikanten Zuwachs der Kurzgeschichten-Sammlungen in fürstlichen Bibliothekenseit dem frühen 12. Jh. vgl. GUENÉE, Hist. et culture historique 315 ff. – Zu Gegensatz, Konkurrenz und Interdependenzklerikaler und höfischer Kultur auf dem Gebiet der Erzählgattungen vgl. allgemein auch VITALE-BROVARONE 109 f.;KÖHN, Militia curialis (wie Anm. 853) 251 f.; UHLIG (wie Anm. 577) 43 f.; KNAPP, Similitudo 23 f.; PARTNER,Serious Entertainments (wie Anm. 25) 62 f.; FLINT (wie Anm. 32) 447 f.; A. KARNEIN, Auf der Suche nach einem Autor,Andreas, Verfasser von ‚De amore’, in: GRM 59 (1978) 1–21, hier 14; AUERBACH, Literatursprache (wie Anm. 232)216 ff. G. DUBY, The Culture of the Knightly Class, Audience and Patronage, in: Renaissance & Renewal (wie Anm. 7)248–62, bes. 259 f.
599
bestanden, mag als besonders illustratives Beispiel eine Anekdote über das Erzählen von „Memorabilien“ und„Facetien“ zeigen. Das Lütticher Chronicon S. Huberti Andaginensis aus dem frühen 12. Jahrhundert (auchCantatorium genannt) berichtet1203 von einem klösterlichen Grundstückshandel, der deshalb im Interesse derMönche geglückt sei, weil bei den Verhandlungen als captatio benevolentiae eine Unzahl von antiken, an denHöfen kursierenden Scherz-Exempla (sales palatini) erzählt worden seien. Dies gibt dem Chronisten die guteGelegenheit, seine Geschichtsschreibung zu unterbrechen und ausführlich Geschichten zu erzählen. Die hiervereinigten historiae füllen in der Foliantausgabe von Pertz mehr als zwei Kleindruckseiten.Bemerkenswerterweise finden sich einige von ihnen auch im Policraticus; alle aber stammen aus denselbenantiken Hauptquellen, aus denen Johann fast ein halbes Jahrhundert später seine strategemata schöpfenwird.1204
1203 Nach 1118 von einem Mönch (Lambert d. J.?) des Ardennenklosters St. Hubert bei Lüttich verfaßt. In der ältestenAbschrift des 13. Jhs. als liber qui cantatorium dicitur bezeichnet; MGH SS VIII (1848) 568 ff. ed. BETHMANN undWATTENBACH, hier Sp. 598–600, Nr. 59–63; vgl. MANITIUS III 555 ff.; WATTENBACH-HOLTZMANN II 741 f.; K.HANQUET, Etude critique sur la chronique de Saint Hubert dite Cantatorium, Brüssel 1900.1204 Quellen (vgl. WEBB, Index loc.): Aul. Gell. I 6.19–25; Macr. Sat. I 6 (Papirius); Cic., Off. III 9 (Gyges, Damon u.Phintias); Cic., Nat. deor. III 34; Cic. Tusc. V 21 (Damocles; vgl. Pol. VIII 23, 408.15); Val. Max. 3 Ext. 1 (Alexander);ebd. IV 3 Ext. 1; Macrob. Sat. I 11 ff.; II 2 ff. 7 (Hannibal, Caesar; vgl. Pol. VIII 14, 335.4).
600
Eine Delegation des Lütticher Hubertus-Klosters suchte also einen verkaufsunwilligen Abt zum Verkauf einesGrundstücks umzustimmen. Durch copia exemplorum erreichte sie ihr Ziel:1205 „So sehr haben sie es demMann mit ihren witzigen Geschichten angetan, daß er all seine Themen vergaß und sich mit besonderemGenuß ihren Reden hingab. Lambertus aber, der von Jugend an das Hofleben gewöhnt war, erfreute den Abtmit höfischen Pointen und fügte – als dem Jüngeren stand ihm nur kurzes Reden zu – noch Kurzgeschichtenaus alten Annalen bei. Der Abt aber verlangte mehrfach, er möge ihm zum Vergnügen doch nochmalserzählen, wie der junge Papirius Praetextatus, um den Senat nicht zu verraten, seine Mutter hereingelegt habe[…]. Nachdem Lambertus solches zum Wohlgefallen des Abtes vorausgeschickt hatte, erzählte er folgendeGeschichten, wie es sich gerade fügte, um den Hörer bei Laune zu halten […].“ Nach der an dieser Stelleeingeschobenen kleinen Exemplasammlung folgt anschließend:1206 „Durch diese und ähnlicheScherzgeschichten wurde der Abt geneigter zum Wohlwollen und fragte verhalten, mit welchem Anliegendenn eigentlich die Gäste gekommen
1205 Chron. S. Hubert. Andag. Nr. 60, Sp. 598.22 ff.: Excepti honorabiliter a venerabili abbate […] adeo virum suisaffectabant facetiis, ut quibusque suorum postpositis, illorum specialiter frueretur colloquiis. Et Lambertus quidem maior,utpote qui ab adulescentia sua curiis fuerat assecutus, cum delectaret confabulantem sibi abbatem palatinis salibus, iuniorvero prout erat illi dicendi locus breviter defloratos veterum annalium subinferret eventus, illud vel saepius exigebat abbasreferendum sibi quasi ad gratiam iocunditatis, quomodo Papirius Praetextatus puer, ne senatus consultum proderet,matrem suam eluserit […] Hiis illatis ad placitum abbatis prosequebatur Lambertus quae subsequuntur, proutinterveniebat ei opportunitas ad gratiam audientis…1206 Ebd. Nr. 63, Sp. 600.42 f.: Hiis et huiusmodi salibus abbas iam pronior ad gratiam factus, requisivit secretius, quaefuerit causa eorum ad se adventus. Dieser abschließende Satz läßt sich auf die Theorie der genera narrationum (s.Anm. 147; Cic. Inv. I 19.27; Rhet. Her. I 7.12–11.19) beziehen, die alle Erzählungen nach der argumentativen Nähe zur„Sache“ (causa) einteilt in 1. die eigentliche und direkte, 2. die abschweifende oder dekorativ amplifizierende Darlegung desSachverhalts und 3. das vergnügliche Erzählen als Exkurs und gezieltes Vermeiden der Sache (genus a civilibus causisremotum, seinerseits aus den oben §§ 58 f. u. ö. berührten literarisch-epideiktischen Unterarten fabula, historia, argumentumbestehend). Für dieses letztere causa-freie Erzählen bietet also unsere Stelle ein unterhaltsames Beispiel. Es gehörtargumentationstechnisch zu den Mitteln der aversio a materia (LAUSBERG §§ 411 ff., 848 ff.), mit denen der Rednerscheinbar von etwas anderem redet als von seinem Vorhaben, um zuletzt auf dieses umso effizienter zurückzukommen. In derreichen Forschungsliteratur zur „Rhetorik“ des Predigtmärleins scheint diese elementare Theorie weitgehend unbekannt zusein, obwohl die homiletische, oft rekreative Erzähleinlage argumentationsrhetorisch doch primär dem genus narrationis a(civilibus) causis remotum zuzuweisen wäre.
601
seien.“ Diese Anekdote über die Beliebtheit des Geschichtenerzählens bestätigt anschaulich, wie fließend dieGrenze zwischen dem homiletisch-volks-literarischen und dem antik-rhetorischen Exemplum im Mittelalterwar, da die Erzählungen einerseits auch zum Stoffkreis unterhaltsamer Predigteinlagen gehören, andererseitsaber die konkrete strategische Funktion rhetorischer Situationsänderung übernehmen; vor allem aber wird hierdeutlich, daß verschiedene Stände und Kulturschichten die gleichen Exempla verwenden konnten, derliterarische Geschmack des „Volkes“, des Klerus und des Adels offenbar den gegenseitigen Austausch desGeschichtenmaterials zuließ.1207
Der Erzähler hat seine Kunst „an den Höfen“ gelernt, wo sie nicht nur als Zeitvertreib,1208 sondern als Teilder Hofmannserziehung zu Umgänglichkeit, geschliffener Konversation und – dies zeigt der utilitaristischeZweck des Beispiels – zu diplomatischer Insinuation gepflegt wurde.1209 Letzteres stellt auch nach der antikenRhetorik (im Rahmen der captatio benevolentiae) eine Hauptaufgabe allen Erzählens dar: Geschichtenlockern eine allzu angespannte rhetorische Situation, tarnen die Absicht hinter bloßer Unterhaltung, führenaber in Wirklichkeit durch eine solche List des Umwegs leichter zum Persuasionsziel.1210 Die delectatio anunterhaltsamen historiae steht also
1207 Vgl. oben §§ 16,36–38, 32, 66, s. Register 4 s. l. Volk.1208 Zum rekreativen und im tiefsten therapeutischen Aspekt der confabulatio (Konversation und Geschichten-Erzählen) vgl.OLSON (wie Anm. 280) 9 ff., 26.76 f., 57 ff. u. ö.; KOEP 143; BRÜCKNER, Hist. 50 ff.; GUENÉE, Hist. et culturehistorique 25 ff. (recreatio als ein Hauptmotiv mal. Geschichtsschreibung).1209 VITALE-BROVARONE 109 f.: Exempla in der ritterlichen Erziehung (als Argument gegen die einseitig homiletischeexemplum-Definition der Predigtmärlein-Folkloristen). Zur Kunst der subtilitas und argutia als Ausweis höfischer Bildung(vgl. oben § 73,00,00; VERWEYEN 48 ff., 56 ff.; F. BRUNI, Semantica della sottigliezza, in: StM 19 (1978) 1–36.1210 Zur funktionalen Bedeutung des Erzählens als Insuationsmittel vgl. § 14, S. 314 ff., 402 ff., 552. JÜLICHER I 99 ff.;SALLES, passim; MEULI 18 ff. u. ö.; GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 50; BRÜCKNER, Hist. 74. – TheoretischeAussagen der Antike z. B. bei Macrob Sat. VII 2.11: narratio zur Rettung heikler Situationen; ebd. 14–6: die Kunst, andere(vor allem erzählfreudige Greise) zum Erzählen zu bringen. Rhet. Her. I 6.10 (zur insinuatio ab rebus ipsis im Rahmen derArten der captatio benevolentiae): Si defessi erint audiendo, ab aliqua re, quae risum movere possit, ab apologo, fabula,verisimili […] similitudinis novitate, historia […] Victorinus I 17 (HALM 199) unter den Mitteln de insinuatione dieErregung des Lachens durch apologi. Vgl. A. 450, 508, 874, 921 zur Weckfunktion, sowie die repräsentativen Stellen beiRadulf von Longchamp, In Anticlaud. (wie Anm. 508) 136.7 f.: Quandoque autem orator debet inserere ludicra ut sicauditores torpentes reddat attentos. Sallustius […] movit omnes ad risum et sic reddit eos attentos; ebd. 145. 3 ff.:Insinuatio facit quasdam simulationes, circuitiones et digressiones, ut non videatur defendere, quod tamen defendit.Insinuatio enim est oratio […] obscure subiens animum auditoris. Ebd. 149.14 ff. zum Exemplum als Mittel der insinuatiobenevolentiae vor dem Richter s. oben Anm. 375; 149.30 ff. zur insinuatio attentionis: Quod fit duobus modis: autpromittendo brevitatem maiorum quam proposueramus, aut auditores recreando per aliquem iocum, aut per rem novam,sicut per apologum, vel per fabulum, si eam permittat.
602
nicht im Gegensatz zur utilitas pragmatischer Wirkung, sondern macht sie möglich. Die Kenntnis undprompte Verfügbarkeit einer möglichst großen „Fülle“ witziger Geschichten ist Voraussetzung dieser Kunstder „Klugheitsrede“. Wie im Policraticus verfolgt auch hier die kompilatorische Anhäufung der Exempla ausdem Schatzhaus antiker Sammelwerke neben der aktuellen Demonstration erfolgreicher rhetorischerGeschicklichkeit in einer bestimmten Situation auch das didaktische Ziel, Memorabilien, Fazetien undAnekdoten stofflich bekannt zu machen. Belesenheit auf diesem Gebiet bringt „Verschlagenheit“.1211
1211 Vgl. SCHON 63 ff.; BRÜCKNER, Hist. 73 ff. 109; VERWEYEN 75 ff.; W. GOEZ, Die Anfänge der historischenMethodenreflexion in der ital. Renaissance und ihre Aufnahme i. d. Geschichtsschreibung des dt. Humanismus, in: AKG 56(1974) 25–48, hier 27 ff. (Macchiavelli). Die hier mit Beispielen aus der frühen Neuzeit illustrierte Kunst der„Verschlagenheit durch Belesenheit“ läßt sich also schon im Mittelalter feststellen; vgl. auch §§ 44, 47, 73.GRUBMÜLLER (wie Anm. 79) 256 ff., 261 ff.
603
IV. ZUR VERTEILUNG DER EXEMPLA IM POLICRATICUS
(s. S. 439)
a) Herkunftsbereiche
Pol.- heidnisch-antik biblisch christlich
Buch mytholog. historisch AT NT christl.-antik
mittel-alterlich
Gegenwart(jüngste
Vergangenheit)
AnzahlExempla
I 10 8 6 – 3 – 2 29
II 5 21 24 6 5 – 3 64
III 17 34 6 5 1 – – 63
IV 2 23 14 3 7 – 2 51
V 11 50 12 4 2 – 5 84
VI 8 70 4 3 1 3 11 100
VII 6 52 32 33 12 – 6 141
VIII 35 155 35 11 9 2 11 258
94 413 133 65 40 5 40 790
507 198 85 Ø
64 % 25 % 11 % 100 %
b) Exempladichte; Verhältnis von praecepta und exempla (Relation von traktathaften zu exemplahaltigenTeilen in Seitenzahlen und Prozenten)
Pol.-Buch Text insgesamt (in Seiten) Text mit Exempla (inSeiten)
Anteil Exempla (in %)
I ca. 52 ca. 26 ca. 50
II 104 56 54
III 63 30 48
IV 34 28 82
V 88 52 59
VI 89 50 56
VII 134 35 26
VIII 199 135 68
763 412 54 %
(100 %)
604
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
WERKE JOHANNS VON SALISBURY
Enth. The ‚Entheticus‘ of John of Salisbury, a Critical Text, ed R.E. PEPIN, in: Trad. 31 (1975)127–93 (mit den Emendationen von J.B. HALL ebd. 39 [1983] 444–7).
Enth. in Pol. Entheticus in Policraticum, in: Pol. (unten s. l.) I 1–11.
Ep./Epp. The Letters of John of Salisbury, Bd. I: The Early Letters (1153–1161) ed. C.N.L. BROOKE,London 1955; Bd. II: The Later Letters (1163–1180) ed. W.J. MILLOR/C.N.L. BROOKE,Oxford 1979.
Hist. pont. Historia Pontificalis, Memoirs of the Papal Court, ed. M. CHIBNALL, London 1956.
Met. Ioannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis Metalogicon lb. IIII, ed. C.C.I. WEBB, Oxford1929 (mit den Emendationen von J.B. HALL, in: StM 24 [1983] 791–816).
Pol. (Policraticus), Ioannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis Policratici sive de nugis curialiumet vestigiis philosophorum lb. VIII, ed. C.C.I. WEBB, Bd. I–II, Oxford 1909.
SAMMELPUBLIKATIONEN
AASS Acta Sanctorum (Bollandiana)
AHDLMA Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age
AKG Archiv für Kulturgeschichte
ALMA Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange)
Arch Archiv
BECh Bibliothèque de l’Ecole des chartes
BHL Bibliotheca hagiographica latina (Brüssel 1898–1901/1949)
CC/CC med. Corpus Christianorum, Series latina/Continuatio mediaevalis
CM Classica et Mediaevalia
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
DA Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters
DSp Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique
DVJs Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte
EM Enzyklopädie des Märchens
FMSt Frühmittelalterliche Studien
GRM Germanisch-Romanische Monatsschrift
HALM s. Rhet. lat. min.
HbAW Handbuch der Altertumswissenschaft
HJb Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft
HZ Historische Zeitschrift
HWbPh Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von J. RITTER/K. GRÜNDER
IMU Italia medioevale e umanistica
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JL JAFFÉ/LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, Leipzig 1885/8
JWCI Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
605
MA Moyen-âge, Revue d’histoire et de philologie
MedAev Medium Aevum
MGH SS/SS rer. Germ. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores/Scriptores rerumGermanicarum in usum scholarum
MH Museum Helveticum
MIÖG Mitteilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung
MiscMed Miscellanea Mediaevalia
MLN Modern Language Notes
MltJb Mittellateinisches Jahrbuch
MltWb Mittellateinisches Wörterbuch
MMS Münstersche Mittelalter-Schriften
MSt Medieval Studies
PL J.B. MIGNE, Patrologia Latina
Poet. u. Herm. Poetik und Hermeneutik
RAC Reallexikon für Antike und Christentum
RB Revue Bénédictine
RBS Rerum Brittanicarum Medii Aevi Scriptores
RDL Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte (MERKERSTAMMLER), 2. Aufl.
RE PAULY’S Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,Neue Bearb. hrsg. von G. WISSOWA u. a.
REAug Revue des Etudes Augustiniennes
Rech Recherches
REL Revue des Etudes latines
Renaiss. and Renewal Renaissance and Renewal in the Twelfth Century,ed. R.L. BENSON/G. CONSTABLE, Oxford 1982
RF Romanische Forschungen
RHE Revue d’histoire ecclésiastique
Rhet. et Hist. Rhétorique et Histoire, L’exemplum et le modèle de comportementdans le discours antique et médiéval, s. unten Bibliogr. s. l. BERLIOZ/DAVID
Rhet. lat. min. Rhetores latini Minores, ed. C. HALM, Leipzig 1863
RML Revue du moyen-âge latin
RTAM Recherches de theologie ancienne et médiévale
SB Sitzungsberichte
CS Sources chrétiennes
Spec Speculum
StM Studi Medievali
StMV Studi Mediolatini e Volgari, Pisa
SZ Kan/Rom Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische/RomanistischeAbteilung
ThLL Thesaurus Linguae Latinae
Trad Traditio
606
TRHS Transactions of the Royal Historical Society
WdF Wege der Forschung, Darmstadt
World of John of S. The World of John of Salisbury, ed. M. WILKS(Studies in Church History, Subsidia 3), Oxford 1984
ZfdA Zeitschrift für deutsches Altertum
ZfdPh Zeitschrift für deutsche Philologie
ZRPh Zeitschrift für romanische Philologie
Zs Zeitschrift
Die Abkürzungen: §, S. und Anm. (außerhalb von Literaturangaben) beziehen sich auf Querverweise innerhalbder vorliegenden Arbeit.
607
AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE
Abgesehen von vereinzelten Standardwerken enthält dieses Verzeichnis abgekürzt angeführter Literatur nurArbeiten zum Exemplum (im allgemeinen und bei Johann von Salisbury). Andere, z. T. wichtige Titel sindüber Verweise auf die erste Nennung in Anmerkungen und Register zu finden. – Im übrigen vgl. dieausführlichen neuesten Bibliographien zu Johann von Salisbury von D. LUSCOMBE in ‚The World of Johnof Salisbury‘ (Studies in Church History, Subsidia 3) Oxford 1984, 445–58 und zum Exemplum vonSCHENDA, BERLIOZ/DAVID und BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT (s. unten s. l.). – Die Sekundärliteraturwird mit Autornamen abgekürzt. Mehrere Arbeiten ein und desselben Autors werden mit Titelstichwort oderAsteriskus (* für den nur mit Autornamen zitierten Beitrag) unterschieden.
ALEWELL, Karl: Das rhetorische Paradeigma. Theorie, Beispielsammlungen, Verwendung in der römischenLit. der Kaiserzeit, Diss. Kiel, Leipzig 1913.
ALSHEIMER, Rainer: Das Magnum Speculum Exemplorum als Ausgangspunkt populärer Erzähltraditionen(Europ. Hochschulschriften 193) Bern 1971.
D’AVRAY, David: Another Friar and Antiquity, in: Religion and Humanism, (Studies in Church History 17)ed. K. ROBINS, Oxford 1981, 49–58.
BALDWIN, John W.: Masters, Princes, and Merchants, The Social Views of Peter the Chanter and hisCircle, 2 Bde., Princeton U.P., New Jersey 1970.
BASKIN, J.R.: Job as Moral Exemplar in Ambrose, in: Vigiliae Christianae 35 (1981) 222–31.
BATTAGLIA, Salvatore: L’esempio medievale, in: ders., La coscienza letteraria del medioevo, Neapel 1965,447–486; Dall’esempio alla novella, ebd. 487–548.
BAUSINGER, Hermann: Exemplum und Beispiel, in: Hessische Blätter f. Volkskunde 59 (1968) 31–43.
– Zum Beispiel, in: Festschr. Kurt RANKE, ‚Volksüberlieferung‘, Göttingen 1968, 9–18.
– Beispiel und Anekdote, in: ders., Formen der ‚Volkspoesie‘ (Grundl. d. Germ. 6), Berlin 1968, 210–225.
BECK, Wolfgang: Protestantischer Exempelgebrauch am Beispiel der Erbauungsbücher Joh. Jac. Othos, in: Jb.f. Volkskunde NF 3 (1980) 75–88.
BENOIT, William L.: Aristotle’s Example: The Rhetorical Induction, ungedr. Diss. Detroit 1978; z. T .erschienen in: Quarterly Journal of Speech 66 (1980) 182–192 (nur dieser Aufsatz wird zitiert).
BERLIOZ, Jacques: Le récit efficace: L’exemplum au service de la prédication (XIIIe–XVe siècle), in:BERLIOZ/DAVID, Rhétorique et histoire, 113–146)
– Virgile dans la littérature des exempla (XIIIe–XVe siècles), in: Lectures médiévales de Virgile, Actes duColloque de Rome 1982, (Collection de l’Ecole française de Rome 80) Rom 1985, 65–120.
BERLIOZ (J.)/DAVID (J.M.): Rhétorique et histoire, L’exemplum et le modèle de comportement dans lediscours antique et médiéval, (Mél. de l’Ecole française de Rome 92.1) Rom 1980 (Table ronde, 18. Mai1979).
BLOMENKAMP, P.: Art. ‚Erziehung‘, in: RAC 6 (1966) 509–59.
BLUMENTHAL, A. von: Typos und Paradeigma, in: Hermes 63 (1928) 391–414.
BONNER, S.F.: Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire, Berkeley–LosAngeles–Liverpool 1949.
DE BOOR, Helmut: Über Fabel und Beispiel, SB Bayer. Akad. München 1966 (1).
BREITKREUZ, H.: Literarische Zitatanalyse und Exemplaforschung, in: Fabula 12 (1971) 1–7.
BRÉMOND, Cl.: Structure de l’exemplum chez Jacques de Vitry, in: Atti del convegno internazionale„Letterature classiche e narratologia“, Perugia 1981, 27–50.
608
BRÉMOND (Cl.)/LE GOFF (J.)/SCHMITT (J.-Cl.): L’exemplum (Typologie des sources du moyen âgeoccidental, ed. L. GÉNICOT, 40), Turnhout 1982.
BRÜCKNER, Wolfgang: Historien und Historie, Erzählliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts alsForschungsaufgabe, in: ‚Volkserzählung und Reformation‘, Ein Handbuch zur Tradierung und Funktionvon Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus, Berlin 1974, 13–123.
– Art. ‚Exempelsammlungen‘, in: EM s. v. (1983) 604–26.
– Loci communes als Denkform, Literarische Bildung und Volkstradition zwischen Humanismus undHistorismus, in: Daphnis 4 (1975) 1–12.
– Erzählende Kurzprosa des geistlichen Barock, in: Österr. Zs. f. Volkskunde 86 (1983) 101–147.
BUCK, Günther: Hermeneutik und Bildung, München 1981.
– Art. ‚Beispiel‘, in: HWbPh I (1971) 818–23.
– Über die Identifizierung von Beispielen, Bemerkungen zur Theorie der Praxis, in: Poetik u. Hermeneutik 8:‚Identität‘, München 1979, 61–81.
BUISSON, Ludwig: * Potestas und Caritas, die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter, (Forsch. z. kirchl.Rechtsgesch. u. z. Kirchenrecht 2) Köln–Graz 1958. (2. durchgesehene Aufl. mit bibliogr. Nachtrag,Köln/Wien 1982 konnte nicht benützt werden).
– Die Entstehung des Kirchenrechts, in: SZ, kan. 52 (1966) 1–175.
– Exempla und Tradition bei Innocenz III., in: ‚Adel und Kirche‘, Festschr. G. TELLENBACH,Freiburg–Basel–Wien 1968, 458–476.
– Exemplum und Geschichte im Mittelalter, ungedr. Vortr. am Konstanzer Arbeitskreis f. mal. Gesch.,Reichenau 1960, nach: RHE 55 (1960) 1057.
CAPELLE, (A.W.)/MARROU (H.I.): Art. ‚Diatribe‘, in: RAC III (1957) 990–1009.
CAPLAN, Harry: Rhetorical Invention in Some Medieval Tractates of Preaching, in: Spec. 2 (1927)284–295.
CARLSON, Mary Louise: Pagan Examples of Fortitude in the Latin Christian Apologists, in: Class. Philology43 (1948) 93–104.
CHENU, Marie-Dominique: Conscience de l’Histoire er théologie au XIIe s., in: AHDLMA 21 (1954)107–133.
– *La théologie au XIIe siècle, Paris 1957.
CHESNUTT, M.: Art. ‚Exemplasammlungen‘ (im Mittelalter), in: EM s. v. (1983) 592–604.
COENEN, H.G.: Argumentieren mit Fabeln, in: Grazer Linguistische Studien 10 (1979) 7–18.
COVA, Ulrike: Antike Beispielfiguren in deutschsprachiger didaktischer Literatur und darstellender Kunst des13. Jhs., Diss. Wien (ungedr.) 1973.
CRANE, Thomas F.: (ed.) The ‚Exempla‘ or Illustrative Stories from the ‚Sermones vulgares‘ of Jacques deVitry, London 1890/repr. 1967.
CRISCIANI, Chiara: ‚Exemplum Christi‘ e sapere, Sull’epistemologia di Arnaldo da Villanova, in: Archivesintern. d’Hist. des Sciences 28 (1978) 245–302.
CURTIUS, Ernst Robert: Zur Danteforschung, in: RF 56 (1942) 3–22.
– Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern 1948/1953 etc. (= ELLM).
DAL PRÀ, Mario: Giovanni di Salisbury, Mailand 1951.
609
DARDANO, Maurizio: L’exemplum mediolatino, in: ders., Lingua e tecnica narrativa nel Duecento, Rom1969, 17–37.
DAVID, Jean-Michel: Présentation; Maiorum exempla sequi: L’exemplum historique dans les discoursjudiciaires de Cicéron, in: BERLIOZ/DAVID, Rhét. et Hist. 9–14; 67–86.
DAXELMÜLLER, Christoph: *Art. ‚Exemplum‘, in: EM s. v. (1983) 627–659.
– Exemplum und Fallbericht, Zur Gewichtung von Erzählstruktur und Kontext religiöser Beispielgeschichtenund wissenschaftlicher Diskursmaterien, in: Jb. f. Volkskunde NF 5 (1982) 149–159.
DELHAYE, Philippe: Le dossier anti-matrimonial de l’Adversus Jovinianum et son influence sur quelquesécrits latins du XIIe s., in: MSt 13 (1951) 65–86.
DEMANDT, Alexander: Geschichte als Argument, (Konstanzer Univ. Reden 46) Konstanz 1972.
DÖRING, Klaus: Exemplum Socratis, Studien zur Socratesnachwirkung in der kynischstoischenPopularphilosophie der frühen Kaiserzeit und im frühen Christentum, Wiesbaden 1979.
DÖRRIE, Heinrich: Der heroische Brief, Berlin 1968.
DOGLIO, Maria L.: L’exemplum nella novella latina del ‘400, Turin 1975.
DORNSEIFF, Franz: Literarische Verwendungen des Beispiels, in: Vorträge der Bibliothek Warburg 4(1924/5) 206–228.
EHLERS, Joachim: Gut und Böse in der hochmittelalterlichen Historiographie, in: Misc. Mediaev. 11: ‚DieMächte des Guten und des Bösen‘, Berlin 1977, 27–71.
– *Hugo von St. Victor, Studien zum Geschichtsdenken und zur Geschichtsschreibung des 12. Jhs.,(Frankfurter hist. Abh. 7), Wiesbaden 1973.
FINLEY, Moses I.: The Use and Abuse of History, London 1975.
FLECK, M.: Untersuchungen zu den exempla des Valerius Maximus, Diss. Marburg 1974.
FRENKEN, Goswin: Die Exempla des Jacob von Vitry, (Quellen u. Untersuch. z. lat. Philol. d. MA’s 1)München 1914.
FRIEDRICH, Hugo: Die Rechtsmetaphysik der Göttlichen Komödie, Francesca da Rimini, Frankfurt a. M.1942.
FUHRMANN, Manfred: Die Mönchsgeschichten des Hieronymus, Formexperimente in erzählender Literatur,in: ‚Christianisme et formes littéraires de l’Antiquité tardive en Occident‘, (Fondation Hardt 23), Genf1977, 41–100.
– Das Exemplum in der antiken Rhetorik, in: Poetik u. Hermeneutik 5: ‚Geschichte – Ereignis undErzählung‘, München 1973, 449–452.
– Die antike Rhetorik, Eine Einführung, München–Zürich 1984.
FUMAROLI, Marc: L’âge de l’éloquence. Rhétorique et res literaria de la Renaissance au seuil de l’époqueclassique, Genf/Paris 1980.
GAILLARD, J.: Regulus selon Cicéron, Autopsie d’un mythe, in: REL 50 (1972) 46–9.
– Auctoritas exempli: Pratique rhétorique et idéologie au Ier siècle avant J.-Chr., in: REL 56 (1978) 30–34.
GEBIEN, Kurth: Die Geschichte in Senecas philosophischen Schriften, Diss. Konstanz 1969.
GEERLINGS, Wilhelm: Christus Exemplum, Studien zur Christologie und Christusverkündigung Augustins,(Tübinger theol. Stud. 13), Diss. Tübingen 1977.
GEREMEK, Bronislaw: L’exemplum et la circulation de la culture au moyen âge, in: BERLIOZ/DAVID,Rhét. et hist. 153–179.
610
GILMORE, Myron: The Renaissance Conception of the Lessons of History, in: ders.: Humanists and Jurists,Cambridge Mass. 1963, 14 ff.
GOTOFF, H.C.: Cicero’s Style for Relating Memorable Sayings, in: Illinois Class. Studies VI (1981) 294–316.
GRABMANN, Martin: Die Geschichte der scholastischen Methode, 2 Bde., (1911), Darmstadt 1961.
GRASSI, Ernesto: Die Macht der Phantasie, Zur Geschichte des abendländ. Denkens, Königstein 1979.
GRAUS, Frantisek: Lebendige Vergangenheit, Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vomMittelalter, Köln–Wien 1975.
GROSS, Karl: Auctoritas – Maiorum exempla, Das Traditionsprinzip der hl. Regel, in: Stud. u. Mitteilungen z.Gesch. des Benediktinerordens … 58 (1940) 59–67.
GROTHE, Heinz: Anekdote, (Realienbücher f. Germanisten M 101), Stuttgart (1971) 1984.
GRUBMÜLLER, Klaus: Meister Esopus. Untersuchungen zu Geschichte und Funktion der Fabel imMittelalter, (Münchener Texte u. Unters. z. dt. Lit. d. MA’s 56) Zürich–München 1977.
GUENÉE, Bernard: * Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980.
– Histoire, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques au moyen âge, in: Annales S.E.C. 1973,997–1016.
GUERRINI, Roberto: * Studi su Valerio Massimo, Con un capitolo sulla Fortuna nell’iconografia umanistica,(Biblioteca di studi antichi 28) Pisa 1981.
– Tipologia di fatti e detti memorabili. Dalla storia all’exemplum, in: Materiali e discussioni per l’analisi deitesti classici (Pisa) 4 (1980) 77–96 (nach Année philol. 51 [1980] Nr. 4399; nicht gesehen.).
HABERSETZER, Karl-Heinz: Politische Typologie und dramatisches Exemplum. Studien zum historisch-ästhetischen Horizont des barocken Trauerspiels am Beispiel von Andreas Gryphius‘ Carolus Stuardus undPapinianus, (Germanist. Abhandlungen 55) Stuttgart 1985.
HAHN, M.: Art. ‚Geschichte, pragmatische‘, in: HWbPh III (1974) 401 f.
HAMBLENNE, P.: Exempla Sallustiana, in: Latomus 40 (1981) 67–71.
HANNING, Robert W.: The Vision of History in Early Britain, From Gildas to Geoffrey of Monmouth, NewYork–London (1966)2 1969.
HARTH, Dietrich: * Philologie und praktische Philosophie, Untersuchungen zum SprachundTraditionsverständnis des Erasmus von Rotterdam, (Humanist. Bibl. I 11), München 1970.
– Christian Wolffs Begründung des Exempel- und Fabelgebrauchs im Rahmen der praktischen Philosophie, in:DVJs 52 (1978) 43–62.
HAVERKAMP, Anselm: Typik und Politik im Annolied, Zum Konflikt der Interpretationen im Annolied,Stuttgart 1979.
HAZELTON, Haight, E.: The Roman Use of Anecdotes, New York 1940 (war unzugänglich).
HEITMANN, Klaus: Das Verhältnis von Dichtung und Geschichtsschreibung in älterer Theorie, in: AKG 52(1970) 244–79.
HEINZLE, Joachim: Boccaccio und die Tradition der Novelle, Zur Strukturanalyse und Gattungsbestimmungkleinepischer Formen zwischen Mittelalter und Neuzeit, in: Wolfram-Studien 5 (1979) 41–62.
HERDE, Peter: Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der Renaissance, in: AKG 47 (1965) 141–220.
HERZOG, Reinhardt: Metapher-Exegese-Mythos, in: Poet. u. Herm. IV: ‚Terror und Spiel‘, München 1971,157–185.
611
HEUSS, Alfred: Alexander der Große und die politische Ideologie des Altertums, in: Antike und Abendland 4(1957) 65–104.
HONSTETTER, Robert: Exemplum zwischen Rhetorik und Literatur. Zur gattungs-geschichtlichenSonderstellung von Valerius Maximus und Augustinus, Diss. Konstanz 1977.
HORSTMANN, Axel: Der Mythosbegriff vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, in: Arch. f.Begriffsgesch. 23 (1979) 7–54.
HOWIE, Margaret D.: Studies in the Use of Exempla, Diss. London 1923.
IVANKA, E. von: Römische Ideologie in der ‚Civitas Dei‘, in: Augustinus Magister, III, Paris 1955,411–417.
JANIK, L.G.: Lorenzo Valla: The Primacy of Rhetoric and the De-Moralization of History, in: History andTheory 12 (1973) 389–404.
JAUSS, Hans-Robert: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur, München 1977.
– Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt a. M. 1982.
– Negativität und Identifikation, Versuch zur Theorie der ästhetischen Erfahrung, in: Poet. u. Herm. VI:‚Positionen der Negativität‘, München 1975, 262–339.
– Zur historischen Genese der Scheidung in Fiktion und Realität, in: Poet. u. Herm. X: ‚Funktionen desFiktiven‘, München 1983, 423–431.
JEAUNEAU, Edouard: * Lectio philosophorum, Recherches sur l’école de Chartres, Amsterdam 1973.
– John of Salisbury and the Lectio philosophorum, In: ‚The World of John of S.‘, 77–108.
JENNINGS, M.: Lucan’s Medieval Popularity: The Exemplum Tradition, in: Riv. di cultura class. e medioev.16 (1974) 215–233.
JOLIVET, J.: Doctrines et figures de philosophes chez Abélard, in: Petrus Abaelardus, Person, Werk undWirkung, hrsg. von R. THOMAS (Trierer Theol. Studien 38) Trier 1980, 103–120.
JOLLES, André: Einfache Formen, (Tübingen 1930), Darmstadt 1969.
JOST, Karl: Das Beispiel und Vorbild der Vorfahren bei den attischen Rednern und Geschichtsschreibern bisDemosthenes (Rhet. Stud. 19), Paderborn 1936.
JÜLICHER, Adolf: Die Gleichnisreden Jesu, 2 Bde. (Freiburg i. Br. 1888), Tübingen3 1910.
KÄSTNER, Hannes: Mittelalterliche Lehrgespräche, (Philol. Stud. u. Qu. 94) Berlin 1978.
KECH, Herbert: Hagiographie als christliche Unterhaltungsliteratur, Studien zum Phänomen des Erbaulichenanhand der Mönchsviten des hl. Hieronymus, (Göpp. Arb. z. Germanistik 225), Göppingen 1977.
KELLEY, Donald R.: Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law and History in theFrench Renaissance, New York–London 1970.
KEMMLER, Fritz: ‚Exempla‘ in Context, A Historical Study of Robert Mannyng and Brunne’s HandlyngSynne, Tübingen (1986 angekündigt).
KERNER, Max: Johannes von Salisbury und die logische Struktur seines ‚Policraticus‘, Wiesbaden 1977.
KESSLER, Eckhardt: Das Problem des frühen Humanismus, Seine philosophische Bedeutung bei ColuccioSalutati, (Humanist. Bibl. I 1) München 1968.
– Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung bei Petrarca, in: AKG 51 (1969) 109–136.
– Petrarca und die Geschichte, (Humanist. Bibl. I 25), München 1978.
– Das rhetorische Modell der Historiographie, in: Formen der Geschichtsschreibung, (Theorie der Geschichte4, dtv 4389), München 1982, 37–85.
612
KEUCK, Karl: ‚Historia‘, Geschichte des Wortes und seiner Bedeutungen in der Antike und in denromanischen Sprachen, Diss. Münster–W. 1934.
KIRN, Paul: Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke, Göttingen 1955.
KIRSCH, W.: Kaiser Friedrich II. – ein neuer Alexander, in: AKG 56 (1974) 217–220.
KLAPPER, J.: Art. ‚Exempel‘, in: RDL III (1977) 413–18.
KLEINSCHMIDT, Erich: Herrscherdarstellung. Zur Disposition mittelalterl. Aussageverhaltens, untersuchtan Texten über Rudolf I. von Habsburg, Bern–München 1974.
KLINGER, P.: ‚Paradeigma‘, Eine semasiologisch-bedeutungsgeschichtliche Untersuchung, Diss. Innsbruck1960 (nicht eingesehen).
KLINGNER, Friedrich: Römische Geisteswelt, München5 1965/Stuttgart 1979.
KLOOS, H.M.: Alexander der Gr. und Friedrich II., in: AKG 50 (1968) 181–99.
KNAPE, Joachim: * ‚Historie‘ in Mittelalter und früher Neuzeit, Begriffs- und gattungsgeschichtlicheUntersuchungen im interdisziplinären Kontext, (Saecula spiritualia 10), Baden-Baden 1984 (Diss.Göttingen 1982).
– De oboedientia et fide uxoris. Petrarcas humanistisch-moralisches Exempel ‚Griseldis‘ und seine frühedeutsche Rezeption, (Gratia 5), Göttingen 1978.
– Zur Typik historischer Personen-Erinnerung in der mhd. Weltchronistik des 12. und 13. Jhs., in:Geschichtsbewußtsein in der deutschen Literatur des MAs, hrsg. v. Chr. GERHARDT u. a., Tübingen1985, 17–36.
KNAPP, Fritz Peter: * Similitudo, Stil- und Erzählfunktion von Vergleich und Exempel in der lateinischen,französischen und deutschen Großepik des Hochmittelalters, Bd. I (Bd. 2 nicht erschienen),Wien–Stuttgart 1975.
– Historische Wahrheit und poetische Lüge, Die Gattungen weltlicher Epik und ihre theoretischeRechtfertigung im Hochmittelalter, in: DVJs 54 (1980) 581–635.
KÖLMEL, Wilhelm: Typik und Atypik. Zum Geschichtsbild der kirchenpolitischen Publizistik (11.–14. Jh.)in: ‚Speculum historiale‘, Festschr. J. SPÖRL, München 1965, 277–302.
KOEP, L.: Art. ‚Fabel‘, in: RAC VII (1969) 129–154.
KORNHARDT, Hildegard: Exemplum, Diss. Göttingen 1936.
KOSELLECK, Reinhardt: Historia magistra vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlichbewegter Geschichte, in: ‚Natur u. Geschichte‘, Festschr. K. LÖWITH, Stuttgart–Berlin–Mainz 1967,196–219 (auch im nächsten Titel 38 ff. übernommen).
– * Vergangene Zukunft, Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1979.
KREWITT, Ulrich: Metapher und tropische Rede in der Auffassung des Mittelalters, (Beih. z. MlatJb 7),Ratingen-Kastellaun–Wuppertal 1970.
LACROIX, Benoît: L’historien au moyen âge, Montreal–Paris 1966.
LANDFESTER, Rüdiger: Historia magistra vitae, Untersuchungen zur humanistischen Geschichtstheorie des14. bis 16. Jahrhunderts (Travaux d’Humanisme et Renaissance 123) Genf 1972.
LANDSBERG, Fritz: Das Bild der alten Geschichte in mittelalterlichen Weltchroniken, Diss. Basel 1934.
LANG, Albert: Rhetorische Einflüsse auf die Behandlung des Prozesses in der Kanonistik des 12.Jahrhunderts, in: Festschr. Ed. EICHMANN, Paderborn 1940, 1–97.
613
LAUSBERG, Heinrich: * Handbuch der literarischen Rhetorik, München 1960. Elemente der literarischenRhetorik, München (1963) 1967.
LEEMAN, Anton Daniel: Orationis Ratio. Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators, Historians,and Philosophers, Amsterdam 1963.
LE GOFF, Jacques: L’exemplum, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT (oben s. l.) Teil I, 17–57, 69–84.
– ‚Vita‘ et ‚pré-exemplum‘ dans le 2e livre des ‚Dialogues de Grégorire le Grand‘, in: ‚Hagiographie‘, Cultureset sociétés, IVe–XIIe s. (Colloques du C.N.R.S., Paris X, 1979), Paris 1981, 105–120.
– Pour un autre Moyen Age, Paris 1977.
– Le Juif dans les ‚exempla‘ médiévaux: le cas de l’Alphabetum narrationum, in: Pour L. POLIAKOV, Leracisme …, ed. M. OLENDER, Brüssel 1981, 209–20.
– Réalités sociales et codes idéologiques au début du XIIIe s.: un exemplum de Jacques de Vitry sur les tournois,in: Europ. Sachkultur des Mittelalters, (SB Österr. Akad. Wiss., phil.-hist. Kl. 374) Wien 1980, 101–12.
– Philippe Auguste dans les „Exempla“, in: La France de Philippe Auguste … (C.N.R.S. Colloques 602) Paris1982, 145–155.
– L’exemplum et la rhétorique de la prédication aux XIIIe–XIVe siècles, in: ‚Retorica e poetica tra XII e XIVsecolo, Convegno internaz …, Associazione per il Medioevo e l’Umanesimo Latini (A.M.U.L.), Trento1985, Spoleto i. Ersch.
LEVI, M.A.: Gli esempi storici dell’ad Herennium, in: ‚The Classical Tradition‘, Festschr. H. CAPLAN, NewYork 1966, 360–364.
LHOTSKY, Alphons: Über das Anekdotische in spätmittelalterlichen Geschichtswerken Österreichs, in:Arch. f. österr. Gesch. 125 (1966) 76–95.
LIEBERTZ-GRÜN, Ursula: * Gesellschaftsdarstellung und Geschichtsbild in Jans Enikels ‚Weltchronik‘. MitNotizen zu Geschichtserkenntnis und Geschichtsbild im Mittelalter, in: Euphorion 75 (1981) 71–99.
– Das andere Mittelalter. Erzählte Geschichte und Geschichtserkenntnis um 1300, Studien zu Ottokar vonSteiermark, Jans Enikel, Seifried Helbling, München 1984.
LIEBESCHÜTZ, Hans: Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury, (Studies of theWarburg Institute 17), London 1950/repr. Nendeln 1968.
LINDHARDT, Jan: Rhetor, Poeta, Historicus, Studien über rhetorische Erkenntnis und Lebensanschauung imitalienischen Renaissancehumanismus, (Acta theol. Danica 13), Leiden 1979.
LIPPS, Hans: Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalles zum Gesetz (1934), in: ders., DieVerbindlichkeit der Sprache, Arbeiten zur Sprachphilosophie und Logik, (1944), Frankfurt a. M.3 1958,39–65.
LITCHFIELD, H.W.: National Esempla Virtutis in Roman Literature, in: Harvard Studies in Class. Philol. 25,1914 (war nicht auffindbar).
LÖWITH, Karl: Sämtliche Schriften 2: ‚Weltgeschichte und Heilsgeschehen‘, Stuttgart 1983.
LO NIGRO, Sebatiano: L’exemplum e la narrativa popolare de secolo XIII, in: ‚La letteratura popolare‘, AttiIIIo Conv. di Studi sul folklore Padano, Florenz 1972, 319–28.
– Le brache di San Griffone, Novellistica e predicazione tra ‘400 e ‘500, 1983 (war nicht zugänglich).
LÜBBE, Heinrich: Art. Geschichten, in: HWPh III (1974) 403 f.
– Was sind Geschichten und wozu werden sie erzählt? Rekonstruktion der Antwort des Historismus, in:Erzählforschung, Ein Symposium, hrsg. v. E. LÄMMERT, Stuttgart 1982, 620–9.
LUMPE, A.: Art. Exemplum, in: RAC VI (1966) 1229–1257.
614
MacDONALD, D.: Proverbs, Sententiae and Exempla in Chaucer’s Comic Tales: The Function of ComicMisapplication, in: Spec. 41 (1966) 453–465.
MARROU, Henri-Irénée: Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris (1928, 1949), 1958 (=Augustinus und das Ende der antiken Bildung, übs. L. WIRTH-POELCHAU, hrsg. J. GÖTTE, Paderborn1981).
– Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Paris3 1955 (= Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum,übs. Ch. BEUMANN, hrsg. R. HARDER, Freiburg–München 1957).
MARTELLOTTI, Guido: Momenti narrativi del Petrarca, in: Studi Petrarcheschi 4 (1951) 7–33.
MARTIN, Janet: John of Salisbury and the Classics, Diss. (ungedr.) Cambridge Mass. 1968 (Ms.: HarvardUniv.; war nicht zugänglich). Abstract in: Harvard Studies in Classical Philology 73 (1969) 319–21.
– John of Salisbury’s Manuscripts of Frontinus and of Gellius, in: JWCI 40 (1977) 1–26.
– Uses of Tradition: Gellius, Petronius and John of Salisbury, in: Viator 10 (1979) 58–76.
– John of Salisbury as Classical Scholar, in: The World of John of Salisbury, (Studies in Church History,Subsidia 3) Oxford 1984, 179–202.
MARTIN, Josef: Antike Rhetorik, HGAW, II 3) München 1974.
McCALL, Marsh: Howard Ancient Rhetorical Theory of Simile and Comparison, Cambridge Mass. 1970.
McGARRY, Daniel D.: Educational Theory in the Metalogicon of John of Salisbury, Spec. 23 (1948)659–675.
McGUIRE, B.P.: The Cistercians and the Rise of the ‚Exemplum‘ in Early Thirteenth Century France…, in:CM 34 (1983) 211–67.
McKEON, Richard: Rhetoric in the Middle Ages, Spec. 17 (1942) 1–32.
MEHL, J.M.: L’exemplum chez Jacques de Cessoles, in: Le Moyen Age 84 (1978) 227–246.
MEID, V.: Barocknovellen? Zu Harsdörffers moralischen Geschichten, in: Euphorion 62 (1968) 72–76.
MELVILLE, Gert: System und Diachronie, Untersuchungen zur theoretischen Grundlegunggeschichtsschreiberischer Praxis im Mittelalter, in: HJb 95 (1975) 33–67, 308–341.
MEULI, Karl: Herkunft und Wesen der Fabel, Basel 1954 (auch in: Schweiz. Arch. f. Volkskunde 50, 1954,65 ff. und in: ders., Gesammelte Schriften II, Basel 1975, 731 ff.).
MICZKA, Georg: Das Bild der Kirche bei Johannes von Salisbury (Bonner hist. Forsch. 34), Bonn 1970.
MIKOLETZKY, H.L.: Geschichtsschreiber und Geschichtenschreiber, in: ‚Storiografia e storia‘, Festschr. E.DUPRÉ THESEIDER I, Rom 1974, 401–424.
MILBORN, R.L.P.: Early Christian Interpretation of History, London 1954.
MINNIS, Medieval Theory of Authorship, Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages, London1984.
– Chaucer and Pagan Antiquity, (Chaucer Studies 8), Cambridge 1982.
MIRGELER, Albert: Erfahrung in der Geschichte und Geschichtswissenschaft, in: Experiment und Erfahrung‘,hrsg. W. STROLZ, Freiburg–München 1963, 227–265.
MISCH, Georg: Geschichte der Autobiographie III 2, Frankfurt a. M. 1962, 1157–1295 (Johannes von S. unddas Problem des mal. Humanismus).
MIX, E.R.: Marcus Atilius Regulus: Exemplum historicum, Den Haag 1970.
MOOS, Peter von: Consolatio, Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problemder christlichen Trauer, (MMS III) 4 Bde., München 1971/72.
615
– Lucans tragedia im Hochmittelalter. Pessimismus, contemptus mundi und Gegenwartserfahrung, in: MlatJb14 (1979) 127–186.
– Poeta und historicus im Mittelalter. Zum Mimesis-Problem am Beispiel einiger Urteile über Lucan, in: PBB(= Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache und Lit.) 98 (1976) 93–130.
– The Use of Exempla in the Policraticus of John of Salisbury, in: The World of John of S., 207–261.
– Sulla retorica dell’exemplum nel Medioevo, in: ‚Retorica e poetica tra XII e XIV secolo‘, Convegnointernaz. di studi…, Associazione per il Medioevo e l’Umanesimo latini (A.M.U.L.) Trento 1985,Spoleto i. Ersch.
MOSER-RATH, Elfriede: Art. ‚Anekdote‘, in: I (1977) 528–541.
– Predigtmärlein der Barockzeit. Exempel, Sage, Schwank und Fabel in geistlichen Quellen des oberdeutschenRaumes, Berlin 1964.
– Lustige Gesellschaft. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichemKontext, Stuttgart 1984 (erst nach Abschluß der Arbeit bekannt geworden).
– Anekdotenwanderung in der deutschen Schwankliteratur, in: Volksüberlieferung, Festschr. K. RANKE,Göttingen 1968, 233–247.
– Erzähler auf der Kanzel. Zu Form und Funktion des barocken Predigtmärleins, in: Fabula 2 (1959) 1–26.
MURPHY, James J.: Rhetoric in the Middle Ages, A History of Rhetorical Theory from St. Augustine to theRenaissance, Berkeley–Los Angeles–London 1974.
NADEL, George H.: Philosophy of History before Historicism, in: Essays in hon. Karl R. POPPER; Historyand Theory 3 (1964) 291–315.
NEUSCHÄFER, Hans-Jörg: Boccaccio und der Beginn der Novelle, München 1969.
NORDH, Arvast: Historical Exempla in Martial, in: Eranos 52 (1954) 224–38.
NOWICKI, Jürgen: Argumenta emblematica bei Petrarca. Einige Bemerkungen zu einemArgumentationsschema humanistischer Literatur, in: ‚Petrarca‘, Beiträge zu Werk und Wirkung, hrsg.von F. SCHALK, Frankfurt a. M. 1975, 209–20.
ODOJ, Ursula: Wissenschaft und Politik bei Johannes von Salisbury, Diss. München 1974.
OEHLER, Robert: Mythologische Exempla in der älteren griechischen Dichtung, Diss. Basel, Aarau 1925.
OHLY, Friedrich: Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungskunde, Darmstadt 1977.
OLSSON, Kurt O.: Rhetoric, John Gower, and the Late Medieval Exemplum, Mediaevalia et Humanistica 8(1977) 185–200.
OPPEL, Hans D.: Exempel und Mirakel, in: AKG 58 (1976) 96–114. Zur neueren Exempla-Forschung, in:DA 28 (1972) 240–3.
OTT, N.H.: Kompilation und Zitat in Weltchronik und Kathedralikonographie. Zum Wahrheitsanspruch(pseudo-)historischer Gattungen, in: Geschichtsbewußtsein in der dt. Lit. des MAs, hrsg. von Chr.GERHARDT et al., Tübingen 1985, 119–135.
OWST, G.R.: Preaching in Medieval England, Cambridge 1926.
– * Literature and Pulpit in Medieval England, A Neglected Chapter in the History of English Letters and ofthe English People, (Cambridge 1933) Oxford2 1961.
PANTIN, W.A.: John of Wales and Medieval Humanism, in: Medieval Studies presented to A. GWYNN, ed.J.A. WATT et al., Dublin 1961, 297–319.
616
PARTNER, Nancy F.: Serious Entertainments, The Writing of History in the Twelfth Century England,Chicago–London 1977.
PERELMAN, Chaim: L’empire rhétorique, Rhétorique et argumentation, Paris 1977.
PERLMAN, S.: The Historical Example, its Use and Importance as Political Propaganda in the AtticOrators, in: Scripta Hierosolymitana 7 (1961) 150–166.
PÉTRÉ, Hélène: * L’exemplum chez Tertullien, Thèse Paris, Dijon 1940.
– Art. ‚Exemple‘, in DSp IV (1961) 1878–1892.
PÖSCHL, Viktor: * Literatur und geschichtliche Wirklichkeit, Kleine Schriften II (Biblioth. d. klass.Altertumswiss. NF. II 74), Heidelberg 1983.
– Augustinus und die römische Geschichtsauffassung, in: Augustinus Magister I, Paris 1955, 957–63.
PRICE, B.J.: Paradeigma and exemplum in Ancient Rhetorical Theory, Diss. Berkeley 1975 (war nichtzugänglich).
RAMBAUD, Michel: Cicéron et l’histoire, Paris 1953.
REHERMANN, Ernst Heinrich: Das Predigtexempel bei protestantischen Theologen des 16. und 17.Jahrhunderts, (Schriften z. niederdt. Volkskunde 8), Göttingen 1977.
REINITZER, Heino: Über Beispielfiguren im ‚Erec‘, in: DVJs 50 (1976) 597–639.
REITZENSTEIN, Richard: Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906.
RENZ, Hans: Mythologische Beispiele in Ovids erotischer Elegie, Tübingen 1935.
RHEINFELDER, Hans: Dante und die Geschichte, in: ‚Speculum historiale‘, Festschr. J. SPÖRL,Freiburg–München 1965, 303–315.
RICOEUR, Paul: La métaphore vive, Paris 1975.
ROLLINSON, Philip: Classical Theories of Allegory and Christian Culture, London 1981.
RONCONI, A.: Art. ‚Exitus illustrium virorum‘, in: RAC VI (1966) 1258–1268.
ROTH, Dorothea: Die mittelalterliche Predigttheorie und das Manuale Curatorum des Johann Ulrich Surgant,Diss. Basel, (Baseler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 58) Basel–Stuttgart 1956.
ROUSE, R.H./ROUSE, M.A.: Preachers, Florilegias and Sermons, Studies on the Manipulus Florum ofThomas of Ireland, Leiden 1979.
ROUSSET, Paul: La conception de l’histoire a l’époque féodale, in: Mél. d’histoire du m. â., Festschr. L.HALPHEN, Paris 1951, 623–633.
RÜSEN, Jörn: Die vier Typen des historischen Erzählens, in: Formen der Geschichtsschreibung, hrsg. R.KOSELLECK u. a. (Theorie der Geschichte 4; dtv 4389), München 1982, 514–606.
SALLES, Catherine: Assem para et accipe auream fabulam. Quelques remarques sur la littérature populaire etle répertoire des conteurs publics dans le monde romain, in: Latomus 40 (1981) 3–20.
SCHAARSCHMIDT, C.: Johannes Saresberiensis nach Leben und Studien, Schriften und Philosophie, Leipzig1862.
SCHENDA, Rudolf: Stand und Aufgaben der Exemplaforschung, in: Fabula 10 (1969) 69–85.
SCHMIDT, Peter L.: Politische Argumentation und moralischer Appell: Zur Historizität der antiken Fabel imfrühkaiserzeitlichen Rom, in: Deutschunterricht 31/6 (1979) 74–89.
SCHMITT, Jean-Claude: L’exemplum, in: BRÉMOND/LE GOFF/SCHMITT (s. oben s. l.) 57–68, 85–112,147–164.
617
– Recueils franciscains d’exempla et perfectionnement des techniques intellectuelles du XIIIe au XVe siècle,in: BECh 135 (1977) 5–21.
– La parole addomesticata. San Domenica, il gatto e le donne di Fanjeux, in: Quaderni Storici 41 (1979)416–39.
– „Religion populaire“ et culture folklorique, in: Annales S.E.C. 31 (1976) 941–53.
SCHNEIDERHAN, Alfons: Die Exempla bei Hieronymus, Diss. (ungedr.) München 1916 (nicht eingesehen;als Publikation mit Jg. 1922 nicht auffindbar).
SCHÖNBERGER, Hans: Beispiele aus der Geschichte, ein rhetorisches Kunstmittel in Ciceros Reden, (Diss.Erlangen 1908), Augsburg 1910 (war unzugänglich).
SCHOLTZ, G.: Art. ‚Geschichte‘, in: HWbPh III (1974) 345–398.
SCHON, Peter M.: Vorformen des Essays in Antike und Humanismus. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichteder ‚Essais‘ von Montaigne, (Mainzer Romanist. Arb. 1), Wiesbaden 1954.
SCHWENCKE, Olaf: Zur Ovid-Rezeption im Mittelalter. Metamorphosen-Exempel in biblisch-exegetischenVolksschriften, in: ZfdPh 89 (1970) 336–346.
SCIACCA, Guiseppe M.: Il valore della storia di Coluccio Salutati, in: Annali della Fac. di lett. e filos., Univ.di studi di Palermo 1950, 352–366.
SEEL, Otto: Römertum und Latinität, Stuttgart 1984.
SEIFERT, Arno: Historia im Mittelalter, in: Arch. f. Begriffsgesch. 21/2 (1977) 226–284.
SEIGEL, Jerold Edward: Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism, Princeton 1968.
SETAIOLI, A.: Dalla narrazione all’exemplum. Episodi erodotei nell’opera Senecana, in: Materiali econtributi per la storia della narrativa Greco-Latina (Perugia) 3 (1981) 379–396 (war nicht zugänglich).
SILK, M.R.: Scientia rerum: The Place of Example in Later Medieval Thought, (nicht gesehen: s. Diss.Abstracts, Ann Arbor 43 [1982] 1639).
SIMON, Gertrud: Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber biszum Ende des 12. Jhs., in: Arch. f. Diplomatik 4 (1958) 52–119 (I); ebd. 5/6 (1959/60) 73–153 (II).
SMALLEY, Beryl: English Friars and Antiquity in the Early Fourteenth Century, Oxford 1960.
– The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1952.
– Moralists and Philosophers in the 13th and 14th Century, in: Misc. Med. (Köln) II: ‚Die Metaphysik imMittelalter‘, Berlin 1963, 60–67.
– Oxford University Sermons 1290–93, in: ‚Medieval Learning and Literature‘, Festschr. R.W. HUNT,Oxford 1976, 306–327.
– ‚Exempla‘ in the Commentaries of Stephen Langton, in: Bull. of the John Ryland’s Library 17 (1933)121–129.
SNELL, Bruno: Gleichnis, Vergleich, Metapher, Analogie. Der Weg vom mythischen zum logischen Denken,in: Die Entdeckung des Geistes, Göttingen4 1975, 175–204.
SOUTHERN, Richard W.: Aspects of the European Tradition of Historical Writing, in: Transactions of theRoyal Historical Society, 5th ser. 20 (1970) 173–196; 21 (1971) 159–179; 22 (1972) 159–180; 23(1973) 243–263.
SPIEGEL, Gabrielle M.: Political Utility in Medieval Historiography: a Sketch, in: History and Theory 14(1975) 314–25.
SPÖRL, Johannes: Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung (1935), Darmstadt 1968.
618
STIERLE, Karlheinz: Geschichte als Exemplum – Exemplum als Geschichte, in: Poet. u. Herm. V:‚Geschichte – Ereignis und Erzählung‘, München 1973, 347–373 (= L’histoire comme exemple,l’exemple comme histoire, in: Poétique 10, 1972, 176–198).
STRASBURGER, Hermann: Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike Geschichtsschreibung,(SB Univ. Frankfurt a. M. 5) 1966 (3).
STRUEVER, Nancy S.: The Language of History in the Renaissance. Rhetorical and Historical Consciousnessin Florentine Humanism, Princeton 1970.
STUDER, Basile: ‚Sacramentum et exemplum‘ chez saint Augustin, in: Rech. Augustiniennes 10 (1975)87–141.
SUCHOMSKI, Joachim: Delectatio und utilitas. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalterlicher komischerLiteratur, Bern–München 1975.
SULEIMAN, Susan: Le récit exemplaire. Parable, fable, roman a thèse, in: Poétique 32 (1977) 468–489.
TAYLOR, Archer: The Anecdote. A Neglected Genre, in: Medieval Lit. and Folklore Studies, Festschr. F.L.UTLEY, New Brunswick 1970, 223–228 (nicht eingesehen).
– ‚What Bird Would You Choose to Be?‘ – a Medieval Tale, in: Fabula 7 (1965) 97–114.
THIEME, Klaus: Petrarcas Masken. Der Einzelne vor der Tradition, in: ‚Typus und Individualität imMittelalter‘, hrsg. H. WENZEL, München 1983, 140–163.
THOMSEN, Ole: Seneca the Story-Teller. The Structure and Function, the Humour and Psychology of hisStories, in: Classica et Mediaevalia 32 (1971–1980) 151–197.
THOMSON, Rodney M.: William of Malmesbury, John of Salisbury and the Noctes Atticarum, in: Festschr.A. BOUTEMY, (Collection Latomus 145), Brüssel 1976, 367–389.
– William of Malmesbury as Historian and Man of Letters in: Journal of Eccles. History 29 (1978) 387–413.
– The Reading of William of Malmesbury, in: 85 (1975) 362–402.
– John of Salisbury and William of Malmesbury, in: ‚The World of John‘ of S. 117–126.
TOURNON, André: Montaigne, La glose e l’essai, Lyon 1983 (wurde erst während der Drucklegung benützt).
TRIMPI, W.: The Ancient Hypothesis of Fiction: An Essay on the Origin of Literary Theory, in: Trad. 27(1971) 1–78.
– The Quality of Fiction: The Rhetorical Transmission of Literary Theory, ebd. 30 (1974) 1–118.
TROMPF, G.W.: The Idea of Historical Recurrence in Western Thought, Berkeley 1979.
TUBACH, Frederic C.: Index Exemplorum, (FF Communications 204) Helsinki 1969.
– Strukturanalytische Probleme: Das mittelalterliche Exemplum, in: Hess. Blätter f. Volksk. 59 (1968)25–29.
619
UHLIG, Claus: Hofkritik im England des Mittelalters und der Renaissance, Berlin 1973.
VERWEYEN, Theodor: * Apophthegma und Scherzrede. Die Geschichte einer einfachen Gattungsform undihrer Entfaltung im 17. Jahrhundert, (Linguistica et Litteraria 5) Bad Homburg–Berlin–Zürich 1970.
– Art. ‚Apophthegma‘, in: EM I (1977) 674.678.
VIEHWEG, Theodor: Topik und Jurisprudenz, München (1953)3 1965.
VITALE-BROVARONE, Alessandro: Persuasione e narrazione: L’exemplum tra due retoriche, VI–XII sec.,in: BERLIOZ/DAVID (oben s. l.) 87–112.
VON DEN STEINEN, Wolfram: Kitsch und Wahrheit in der Geschichte, in: ders. Geschichte alsLebenselement, Bern 1969, 102–29.
VOSS, Bernd Reiner: Berührungen von Hagiographie und Historiographie in der Spätantike, in: FMSt 4 1970,53–69.
WAGNER, Fritz: Studien zu Caesarius von Heisterbach, in: Anal. Cisterc. 29 (1973) 79–95.
– Caesarius von Heisterbach, in: EM II (1978) 1163–43.
– Äsopika, ebd. I (1976) 889–903.
– Bromyard, John, ebd. II (1978) 797–802.
WASZINK, J.W.: Il concetto del ‚mythos‘ nella teoria poetica da Aristotele a Orazio, in: Letteraturecompararate, Festschr. E. PARATORE, I, Bologna 1981, 193–204.
WEINREICH, Otto: Fabel, Aretalogie, Novelle. Beiträge zu Phädrus, Petron, Martial und Apuleius, SBHeidelberg 1930/31, 7, Heidelberg 1931.
WELTER, J.-Th.: L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen âge, Paris–Toulouse1927, repr. Genf 1973.
WILKS, Michael: John of Salisbury and the Tyranny of Nonsense, in: The World of John of S. 263–286.
WOLF, Herbert: Das Predigtexempel im frühen Protestantismus, in: Hess. Blätter f. Volkskunde 51/2 (1960)349–69.
WOLPERS, Theodor: Die englische Heiligenlegende des Mittelalters, Tübingen 1964.
YOUNG, Gregg, J.: The Exempla of ‚Jacob’s Well‘, A Study in the Transmission of Medieval SermonStories, in: Trad. 33 (1977) 359–380.
ZIESE, Jürgen: Historische Beweisführung in den Streitschriften des Investiturstreits, (Münchener Beitr. z.Mediävistik u. Renaissanceforschung 8), München 1972.
ZILTENER, Werner: Studien zur bildungsgeschichtlichen Eigenart der höfischen Dichtung, Antike undChristentum in okzitanischen und altfranzösischen Vergleichen aus der unbelebten Natur, (RomanicaHelvetica 83), Bern 1972.
ZOEPFFEL, Renate: Historia und Geschichte bei Aristoteles, (Abh. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., phil.-hist.Kl.), Heidelberg 1975, 2.
ZORZETTI, Nevio: L‘„esemplarità“ come problema di „psicologia storica“: un bilancio provvisorio, in:BERLIOZ/DAVID, Rhét. et hist. (s. oben s. l.) 147–152.
620
NACHTRAG
(Die folgenden, im Sommer 1987 vor dem Umbruch beigefügten Titel beziehen sich auf Aspekte der ganzenArbeit, nicht allein auf das Exemplum.)
BALMER, Hans Peter: Philosophie der menschlichen Dinge. Die europäische Moralistik, Bern/München1981.
CAHN, Michael: Kunst der Überlistung, Studien zur Wissenschaftsgeschichte der Rhetorik, (Theorie u.Geschichte der Literatur…2), München 1986.
CAMPBELL, J.A.: A Rhetorical Interpretation of History, in: Rhetorica 2 (1984) 267–80.
ECO, Umberto: Huizinga e il gioco, in: ders., Sugli specchi e altri saggi, Mailand 1985, 283–300.
EDEN, Kathy: Poetic and Legal Fiction in the Aristotelian Tradition, Princeton 1986.
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, M.: Le bugie di Isotta, Immagini della mente medievale, Bari 1987(Teil I, „Morale e politica“ über Johann v. S.).
KARADAGLI, T.: Fabel und Ainos. Studien zur griechischen Fabel, Königstein 1981.
LAARHOVEN, Jan van: John of Salisbury’s Entheticus maior and minor edited, 3 Bde. (Studien u. Texte z.Geistesgesch. d. MAs 17) Leiden/Köln 1987 (mit einer Monographie und der neuesten vollständigenBibliographie zu Johann).
MARTEL, J.-P.: Rhétorique et philosophie dans le Metalogicon de Jean de Salisbury, in: Actas del VCongreso internacional de filosofia medieval II, Madrid 1979, 961–68.
MOOS, Peter von: Das argumentative Exemplum und die „wächserne Nase“ der Autorität im Mittelalter, in:Exemplum et similitudo, hrsg. v. M.J. AERTS et al., Groningen (1988 i. Ersch.; erweiterte deutscheFassung des ital. Beitrags: Sulla retorica dell’exemplum…).
NEDERMAN, C.J.: Aristotelian Ethics and John of Salisbury’s Letters, in: Viator 18 (1987) 161–174.
RHEBERGEN, Phil: Over de verleiding van de macht. Politieke opvattingen van Johannes van Salisbury inde boeken IV, V en VI van de Policraticus, Diss. Amsterdam 1985.
TRIMPI, Wesley: Muses of One Mind, The Literary Analysis of Experience and Its Continuity, Princeton1983 (erweiterte Fassung der oben s. l. angeführten Beiträge).
WESTRA, Haijo: The commentary on Martianus Capella’s De nuptiis Philologiae et Mercurii attributed t oBernardus Silvestris, (Studies and Texts 80), Toronto 1986.
WHITE, Hayden: Auch Klio dichtet, oder: Die Fiktion des Faktischen, Studien zur Tropologie deshistorischen Diskurses; Einführung v. R. KOSELLEK (= Tropics of Discourse), Stuttgart 1986.
WILSON, Bradford: Guillaume de Conches, Glosae in Iuvenalem, edited with introd. and notes, (Textesphilos. du moyenäge 18), Paris 1980.
WILSON, K.M.: Antonomasia as a Means of Character-Recognition in the Works of Hrotsvit ofGandersheim, in: Rhetorica 2 (1984) 45–54.
rr l::: i beziehen sich auf
b ::: rparsche Moralistik,
t ' :ges:hichte der Rheto-tr Rietorica 2 (1984)
dr:: ' .rggi. Mailand 1985,
lücr. Princeton 1986.b. l:.:ragini della mentet Y S t
Sc Konigstein 1981.fr.: qinor edited, 3 Bde.I . : i - (mi t e iner Mono-l n '
t ie Jean de Salisbury, in:l e i : i 1979 ,961 -68 .l-e \ase" der AutoritätAERTS et al.. Groningen
ls S-rila retorica dell'ex-
f 's Letren, in: Viator 18
b. :::rngen van Johannesb { : rs terdam 1985.lEr:erience and lts Con-
!F;::ten Beiträge).ft::is Philologiae et Mer-
I T : : on to 1986 .lFa<::schen, Studien zurpSrlUx (= Tropics of
l. e:::ed with introd. and
l;r.:::.n in the Worla of
REGISTERKursive Ziffem beziehen sich auf die Anmerkungen. - Die bei einer Seitenzahlangabemitgemeinte Anmerkung kann auf einer der nachfolgenden Seiten zu finden sein, da imText Anmerkungsziffer und entscheidendes Stichwort durch den Seitenumbruch oftauseinandergerückt sind.
l. Nrmen und rnonyme WerkeDie Namen des Texts sind vollständig, die derAnmerkungen selektiv erfaßt. Im allgemeinenwerden nur Anmerkungen berücksichtigt, deren Seitenzahlen nicht bereits zu Beginneines jeden Artikels aufgefiihrt sind. Das Register veneichnet fast keine unkommentiertenBelege aus der Fonchungsliteratul sondem beurteilende Stellen sowie sämtliche in derBibliographie aus Raumgründen ausgesparten Literaturangaben (Erstnennungen) in denAnmerkungen.
A Altmann, J. 512Alvemy, M.rTh. d' ,1080
Abaelard 239f1., 2ffi-72, 274-85, 366f., Ambrosius 82f., 306f., 105, 258, 265, 880'380f., 416, 448, 491f., 533, 211, 2r5, 310, 968402,425,45j,,486, 503, 582, 587,621,691, Amyclas 501856, 861, 878, 886, 896, 9 16, 950, 970, 978, Anaxasoras 596|NI , I0t4
Abel XVIII.340f.Abeler, H. 957Abraham 474f.,340f.Absalon 433Achilles XYll,l05lAdalbert II. von Mainz 552aAdam 883Adam von Petit Pont 442. 575Adorno (T Wiesengrund) 705Adshead, K. l0UAelred von Rievaulx 415,880,967Aeneas 166,350Aesop 32, 128,603,809Agamemnon 361Aischylos 50,116Alan von Lille 486f ., 4 30, 5 68, 664, 824, 904,
973Alberti, L.B. 868Albertini, E. 150Alcuin 256Alembert" J. d' 705Alewell, K. 589f., 594, 121Alexander d. Gr. XVII, 78ff.,156, 172,209,
260, 285, 303f., 347 ff .,37 4,479, 567, 575ff.,588, 175, 186, l9Ia f., 357, 47 1, 570, 631,66rf., 680f.,739, 854
Alexander II., Papst 5Alexander Neckam 136, 7 17Alger von Lüttich 560Alkidamas 9/4Alsheimer. R. 278. 337
Anaximenes 427f .,8, 281,436, 654Andreas Capellanus 279f'f ., 3l2ff .Anselm von Canterbury X11,285, 493, 966,
IOI4Anselm von Laon 560, 882Antin, P 464,951Antonius, M., Triumvir 214, 288, 473, 5ll,
936. %4,987aAntonius d. Gr., Eremit 97 ff ., I 05, 2 37, 24 3,
245f., 269, 3or, 364, 529Apel, K. O. 6mAppius Claudius Pulcher 205f.,504Apuleius 506, 823, 950, 983Arbusow, L. 595, I194Archimedes 664Aristides 2llf.Aristophanes 82Aristoteles IX, xul, xLV 9f.,38,48-54,
64f.,71, 83, l l0, l l7f., 156, 168f., 188ff.,201 ff., 205, 2l I f .,239f .,246ff .,296f., 381 f.,408f., 4l l, 4r9,422ff.,479,487,504, 517,587, 594, 562, 572, 641, 767, 787, 798, 823,874, 900, 978, IN6, 1034, 1037, 1139,s. auch Platon
- Poet.215ff..219, 125, 129,282, 571, 574- Rhet.4,6, l l0,188ff.,82 89, II3, I2l,123,
I26fL, r 32, 178, 383, 635, 914, 999f.- Top. 307, 3t.7, 319, 327Amobius d. A. 958Amold von Brescia 5/6Amold, K. IM2Amulf von Orl6ans 16
621
ilF" fF illEff,
Aspasia 439Aspines 281Athanasius 100Atkins. J. W H. 366,748Auerbach, E. XXIX, 232, 254, 378, 608,
652, 727,982, 1005Augustinus 86-93, 138, 206, 234ff., 268ff..
367. 370ff.. 374i.. 185. 388f., 396ff.,437f.,462f., 48 1, 483f., 493. 504t.. 2, 7 I, 497, 5 36,562. 59t, 636, 679, 809, 895, 989, IN5,tn9, 1014, 1025, I120
- Civ.87.107f., 169f., 459f., t05, 48/,, 631,635, 693, 69ef., 823, I 196
- Conf. 96ff., l2lf., 447, 747, 1U4- Doctr. christ. 448. 45 l, 9 1 2Augustus 137,288, 47 3, 479,511, 57 3f ., 2 64,
332, 57 IAvianus 809Avray, D. d' 337, 848
B
Bachmann, P. 695,921Bachtin, M. 277ft.,280f., 478, 313, 570a,
949Bacon. Francis 21.331Bacon, Roger ,164Bäumf, F. H. 1200Bagni,P. 420Balbus. Caecilius 202f.. 836Baldrich (Baudri) von Bourgueil 438,456,
587, 530, 798, 879, 9l IBaldwin, B. 160Baldwin. J.W. 538, 837Baldwin, W. 964aBalmer, H. P 620Balthasaq H. U. von 490Barchiesi, M. 343Bariö, P 5/6'Barlaam und Josaphat' ,105Bamer, W. 298,777Baron, H. 9-?0Barthes, R. 371Bartholomaeus Anglicus 567Barwick, K. 147Barzil lay.P.877Baskin, l.R. 203Basthseba/Bethsabee 6-16Battaglia, S. 11, 374,982Batail lon. L.-1. 337Baudri s. BaldrichBauer, J. B. 271BausingeE H. 69, ll0, 1005
622
Bavel, T. J.van 229Beaujouan, G. 5-?8Bebermeyeq R. -tlt J8lBeck, W 110Beda Venerabilis 58, 105, 145, I0l4Bödier, J. J09Beer, S. 502,661f.Bönä C, 794Benedikt von Nursia (u. Regel) 95f., 107, Z
2r8.254,307Benoil M. 9.570Benoit de Ste-Maure 219Benson, R. L. ZBenton, J.F. 570,741Berger, P.L./T. Luckmann -16Berges, W. 640Berlioz. J. XXIIIff.. 313, 338,429Bemards. M.965Bemhard von Chartres XXXIV 169, 241f.,
257,47 4, 2 541., 4 t I, 5 t 5, 542, 5 5 3, 558, 66E,724.797, %0
Bemhard von Clairvaux 95f., 376ff., 433,481, 546, 664, 880, 10t4, lM2
Bemhard silvestris 278f., 496f., 620, 423,664, 77 I
Bernhard von Utrecht 404,734Bernhold von Konstanz 560Berschin, W. 1080Bertau. K. XXU. XXXryBertini. F 42-?Bertola, E. 560Beumann. H. 283Bevilacqua, M. 806Beyer, J. 3/5Bezold, F.von 42Bezzola. R. R. -t28Bianchi. L. 559Bichsel, P XXXIIIBillanovich, G. 1014, 1032Bird, O. 855BischolT, B. lUlBlaschka, A. 1042Bloomfield, M. Vl JOJBlumenberg, H. XLf., XLII, 16, 502, 25,
100, 266, 406, 423. 732,747,778,950,965Blumenkranz, B. 490Boccaccio XXIII, 19f., 29, 132, 227 ft.,314,
2t8f .. 32r. 526f.. 3 r 7, 562Boczar, M. 564Bodinus, J. 53, 868, 10U, 1035Böhler. D. 732Böhm. L. 25. 1005Boesch-Gajano, J. 294Boethius 4, 206, 250, 258ff., 28l ff., 490ff.,
496,498ff., 518, 567. 5565, 855ff., 858f., 86r, 8
Boglioni, P XLI, J1JBolgar, R. R. 544f., J0Bollack, J. 402Bonaventura 7-J2Boncompagno da Sig,na tBonner, S. F J50Boor, H. de 286Borges, J. L. XVII[.. XXBornscheuer, L. 584a. E:Borst A. 176, I9la, 4E6,
t099Bosch, C. 152Boskoff, P S. 8-tzBossuet 9ZlBowden, B. 607Boyle, L. E. 871Brackert, H. 501Branca, V. 317,519Brand, W J70Brand, W J. 681, INsBrasa Diez, M. 584Bray, R. 955Br6mond, C. XXllI.44,Brennus 2M[.Brezzi,P. 980Brincken, A. D. von denBrinkmann, H. 145, 4l LBrisso 240Brooke,C. XII, 15, 415f..
748, t053Brucker. C. A. 570, Y2,'Brückner.W XXIV2. J1,Brüschweiler, W J,lBruni,F. 1209Brutus/Bruti 76Brutus d. A. :so-0t. aroBrutus d. J. 174f., 288.11Bruyne, E. de 821Bucher, A. 982Buck, A. 528, 538f., 798.
1039Buck, G. XXll,43, 57Buisson, L. 4,636Bultmann, R. 296Bultot, R. 369, 882,978. IBundy, M. W. 874Burchard von Worms -5jBurck, E. 954Burckhardt, J. XVn, XXBurdach, K. 837Burgundio von Pisa 27lfBurke,P. 1027
I
).I)h-)c
-. . _?8/
. : ! 14-i , 145, 1014
I
N-- ; " u Regel) 95f . ,107,2,Fl < -t -hU. - - : l l 9t -
tt ---. - r: l0l�. 734r l r . . - , - : ,2 - j60I . ;r \ . \ \ \ IV)a
L . -
| .4-'
t,(\t . . . r . 1 0 3 2
1.i -2;t _?' r.Li.
XLII, 16, 502. 25,: : :
- 32, 747, 778, 950, 965
r71I: . ei.. 29. 132.227 ft^3t4.: 117 .562
v"; 1ffi, IQJJ
, :94:50. 258ff.. 28lff.. 490ff..
496, 498ff., 518, 567, 572,575,433, 554,565, 8551J., 8s8f., 86r, 879,9s1, 983, 1M9
Boglioni, P XLI, -t1-lBolgar, R. R. 544f., -t0Bollack, J. 402Bonaventura 7-?2Boncompagno da Signa 644,867Bonner, S. F J-tOBoor, H. de 286Borges, J. L. XVIIf., XXXVBornscheuer, L. 584a, 857, 8ffi,979Borsf A. 176, 191a,486, 1A05, 1022, i'031,
1099Bosch, C. /57Boskoff, P S. 8-tzBossuet 97lBowden, B. ffi7Boyle, L. E. 871Brackert, H. 501Branca, V. 317, 519Brand, W J70Brand, W I. 681, 1005Brasa Diez, M. 584Bray, R. 955Brömond. C. XXII.44,58Brennus 204f.Brezzi.P. 980Brincken, A. D. von den 337Brinkmann, H. 145, 4l l, 1/95Brisso 240Brooke,C. XII, 15,415f.,126,462, 564, 680,
748, 1053Brucker. C. A. 570, 342,488Brückner,V{ XXIVZ 3 1, 109, 164, 275, 316Brüschweiler, W 31Bruni,F. 1209Brutus/Bruti 76Brutus d. A. :so-6t. 476.635Brutus d. J. 174f.,288,4ll, 631f,653Bruyne, E. de 821Bucher, A. 982Buck, A. 528, 538f.,798, 892, 1016, 1037,
r039Buck, G. XXll,43, 57Buisson, L. 4,636Bultmann, R. 296Bultot,R. 369, 882, 978, 982Bundy, M. W. 874Burchard von Worms 5J8Burck, E. 9J4Burckhardt, J. XVff., XXX,39, 95, 568Burdach, K. 837Burgundio von Pisa 271f.Burke,P. 1027
Burke-Severs, J. 120Burkert, W. 528Burton, R. 673, 1037Bush, D. 4J
cCaesar 156. 220, 285, 288, 338, 347 f ., 473,
510f., 535f., 567, 579.596, 192, 641, 653,661.726, tqu
Caesarius von Heisterbach ll3f ..491Cahn. M. 620Calderon 587Cambronne, P J. E. 66Camert n. A. 201.271Camillus //78Campbell, J. A. 620Campenhausen,H. von 6ffiCancik, H. 38'Cantatorium' 599fLCapelle, A.W. 265Caplan, H. 277, 858Car lson, M.L. 464,915Carte\P 326Cary G. 279,682Casella, M.T. 299Cassiodor 374, 435, 489, 748, 856Cassius, Dio 224Catilina 1033Cato (Uticensis) 174f., 260,287,321, 338f.,
347f., 36r,430ff., 567, 584f., 587, 590,572a, 593, 692, 717,914,920,988
Cato (incertus auctor) 175,376f.- 'Disticha Caronis' 9, 155,376, 379,473f.,
369. 744Cavallini. Johannes 563. 299Cazier,P. 294'Cena Cypriani'
s. Ps.-CyprianChadwick, H. 977Chaix-Ruy, J. 982Chalcidius 10, 923, 1000Chapeaurouge,D. de l9lCharisius //92Charland, T.M. 364Chätillon, F. I175Chaucer, G. 142, 481, 646Cheney, R. 964aChenu, M.-D. 504ff., 361, 368, 428, 664,
970,978, 982, 986Chesnutt, M. 297Chibnall, M. 980Chlodwig /9/a
623
- 5 - - : . '
f - - - . . l r n n J 6j
f,l: " _,,',r 338,429
1 9 'fC-.:::s XXXIY 169,241f.,U . : t : ,542,553,558,668,pI C . -.aux 95f., 376ff., 433,| ' ; . . , t4 . 1M2hs:- , :-8i. 496f ., 620, 423,I
vlI' '"f ' "FIf . rl BFIEr:7F " :D, l 'b . ,th
F
Choerillus (Choirilos) 189Chrötien de Troyes 131,569f.Christine de Pisan 1106'Chronicon S. Huberti Andaginensis' 59ff.,
1203Chrysipp 487Cicero 21, 38, 50ff., 56ff., 70f., 167ff., 175,
189, 191 ff., 250, 268, 294, 296ff ., 303, 305,308f., 360, 384, 386, 394,397,401, 406ff.,422, 426, 430, 467 f ., 47 4 f ., 4mf., 5 36, 539f.,588ff., 594, 596,258, 406,481,492, 540,544, 546, 5 56, 58 1, 64 1, 648a, 657, 685, 7 1 6,765, 768f'798,836, 853, 880, 870,922,9ffi,967f.,973, 1014, t206
- Acad. pr 595,601,716- Brutus 492.768.821- Inv. 6, I13, I15, 126, 130, I4l, 147,433,
439, 55t, s62, 578, 858, 1 198, 1206- Lael. 415. 853.973- olI. I6s,406,880, e67f.- Or 14l , 149a,305,395,398,544- De orat. 17, 42, 130, 140, 165, 361, 395,
ffit, 768, 845, I I I0- Part.on 14l.450.457- Top. 6, 126, I4l, 433, 436, 440, 556, 856,
862- Republ. 481,836,922-Tusc. 939,gffiCilento, V 355Cincinnatus 1178Cizek, A. 531, 570,862Clark, D. L. 550Clark, M. L. 554Classen, P. 4, 326, 559, 758Claudian 175Clayton, M. 343Clemens von Alexandrien 952Coenen, H.G. l2lCoing, H. 550, 559Colonna, Johannes XXV -i-f8Colotes 822Commodus (Ks.) 210Comparetti, D. 517Congar, Y. 424,735Constable, G. I014Coppens, J .C.L. 207Coriscus 240Cormier, R. J. 676Comificius 289f1.,292f .,305, 405, 538, 546Corpus iuris canonici s. GratianCorpus iuris civilis 264,27lft.,3f., 564, 643,
698, 882, 926, s. auch JustinianCottiaux, J. J62Courcelle. P. 245, 247, 348,976-8
624
Cova,U. l196Coville, A. 642Crane, T. F 100Cranz, F E. 299Qrespo, R. 822Crisciani, C. 219Crocco, A. 560Croce, B. 214Croesus 206Crusius, O. 80Curtius,E. R. IX,XXII,XXXVIIff ,XLIY
xLuI, 24-6, 63f ,,278, 425ff .,438, 456,526. 583-97. 38, 54, 147, 555, 569, 570a,664, 676, 686, 794, 862,908,954f., IA5
Cyprian 86ff.Ps. Cyprian (Cena Cypriani) XlX, %9
D
Dahlmann, H. 335f.Dalitzsch, M. 409f.Dal Prä, M. 170, 554,20, 402, 735Danae 180f., 474, 424, 942f.Daniel 329Dante 24-6,29,142, 584ff., 264, 315, 343,
345,982, 1001, 1024Dardano, M. 320Dareios 7Daut, R. //90David 174f., 184f., 203, 323, 335, 344, 433,
514, 596, 264, 310,413,636, 674,947David, J. M. XXilL44, 97, 99, I 50, 283, 997,
I I90Daxelmüller, C. XXIV 30, 10,69, 103, 150,
2r4, 287.870, 1010Decii/ P Decius Mus 80. ,l//8Delaruelle, E. 274Delbono, F. 570aDelclos. J.-G. 431Delcomo, C. 108Delhaye, Ph. 463, 468, 480, 385f., 4 /,8, 853,
880,908, 9t8,978Delumeau. J. 3ll. 1032Demandt,A. XXVI,7,285f.,508f., I I, 169,
539, 572, 732,997De Negri, E. 519Descartes, R. 309, 532,601Deschamps, L. 379Desideri, S. 922Dickinson, J. 558, 570, 971Diderot, D. VII, 345Dido 25, 346,423, ll79Diener H. 299
Dietterle, J. 871Dihle, A. 409. 881Diogenes 340Diogenes Laertios 140f..Diomedes /192Dionides 209Dionysios von Syrakus JPs. Dionysius Areopagra'Disticha
Catonis' s. CatcDi Stefano, G. 299Dithmar, R. J/_?Ditsche, M. 254Dockhorn, K. 449Dodds, R. R. 9-?JDöllinger, I. von J8Döring, K. 384Dörrie, H. 539, 425, 7N.Doglio, M.L. 3tSDominicus .l4JDonat 58f., 795, I192Donovan, M. J. 5JSDonovan, R.B. 922. l0t4Dom, E. 2JlDomseiff, E 516f.. 520. _il
8Dotto. G. 544a. 592Dowdell, V.L. 447Drexler, H. 170Drijepont, H.L.F. 722Dronke. P 570a.729Duby, G. 778,922. 1078Dünenmat! F XIXDüwel. K. I08lDutton, PE. 553, 880aDyck, J. ,158
E
Eberhard, O. 264, g8t. tAEckhart, Meister 732Eco,U. XIX,XXXUII . I I
709, 723, 767Eden, K. 620,353Ehlers, H. 17, 18],,353Ehlen, l. 552aEinhard 310Eisenstein, E.L. 732Ekkehard IV von St. GalterEliade,M. 997Elias 6JJElias, N. XXXIXEmrich, B. 584aEnnius 396
mF"
6,:towt:2 : -OtI
üI\. \XII. XXXVIIff.,XLIV
6. r-1i.. 278.425ft,438, 456,l. -i! -i/ 147, 555, 569. 570a,b - 't 862, 908,954f., IA5
Ce-: Crpriani) XlX, g4g
[ - ' : i i. f i i .
l-,. i51. 20, 402, 735,1- !. 1)4, 942f.
.r2. 584ff., 264, 3',5,343,i ' , )4
nt8:: . 103. 323, 335, 344,433,61 : . ,. 11 3, 636, 674,947x\r rr..,4. 97, 99, I 50, 283, 997,
,c \\ l!: 30, 10,69, 103, 150,7t, . l r tslrj) \{.ls 80. 1178|
^ ' J
f - i . :
i- .i,..'
, . !1r,-i 168. 480, 385f., 4 l,8, 853,
l r f ; - iL i . ; 1032. \ \ \ r .7 .285i . ,508f . , I I ,169,t 3 : JQ-
L : ) 8 . 5 7 0 . 9 7 1I'll -i1_iL r :3 I 179w
Dietterle, J. 871Dihle, A. 409,881Diogenes 340Diogenes Laertios 140f., 164, 169f., -t-i5Diomedes 1192Dionides 209Dionysios von Syrakus 317Ps. Dionysius Areopagita 212,446, 886'Disticha Catonis' s. CatoDi Stefano, G. 299Dithmaq R. J/-?Ditsche, M. 254Dockhom, K. 449Dodds, R. R. 9-tJDöllinger, I. von J8Döring, K. 384Dönie, H. 539, 425,709,877,879, l l79Doejio, M. L. -t1JDominicus -l4JDonat 58f., 795, II92Donovan, M. J. J-?8Donovan. R.B. 922, l0I4Dom,E .251Domseiff, F 516f., 520, 584f., 587ff., 594f.,
8Dono, G. 544a, 582Dowdell, V.L. 447Drexler, H. 170Drijepont, H.L.F. 722Dronke, P. 570a,729Duby, G. 778,922, 1078Dünenmatt F XIXDüwel, K. l08lDutton, PE. 553,880aDyck, J. ,158
E
Eberhard, O. 264,881, 1067, lI23Eckhart, Meister 732Eco, U. XXIIX, XXXUII, ll3, 345, 620, 27 5,
709.723.767Eded. K. 620.353Ehlers, H. 17, 181, 353Ehlers, J. 552aEinhard -il0Eisenstein, E. L. 732Ekkehard IV von St. Gallen 255f.Eliade,M. 997Elias 6JJElias, N. XXXIXEmrich, B. 584aEnnius 396
Enoch 340f.Epikur 166, 462f.,726Er 406Erasmus 132, 553, 38, 317, 398,425, 546,
568, 6N, 878, 896, 906, 9t 3, 95t,953, 979,1020. 1025. 1037
Euphorbus ,l9,faEusebius 446f..461f.Evagrius 100,237, 243Evans. G. R. 586.970Ezechias 203,514
F
Fabricius, C. Luscinus 210, 340, 567,920,988
Fabricius, J. A. 565, ,?-?'Li Faits des Romains' 137, 297Fasoli, G. ,106lFavez. C. 464, 578.951Febvre, L. XLIFeine, H. E. 560Fellmann, F 7JJFeltrin, P 559Festugiöre A.J. 271Feyerabend, P. 572,601Fichtenau, H. 180Finley,M. 21,78, 1008Flamant, J. 509Flasch. K. 562Flashar, H. 8MFlavianus (. N./ auctor incertus) 222, 462,
485,836. 1072Fleck, M. -i8Flint. V l. J. 32Flon,J. 577Florus, P Annius 225,358, 693Focke,F. 572aFontaine, J. II0, 145,218,252, 276, 552,
I00IForeville, R. 926Forti,F.423Foulechat, Denys 142, 556,564,481Four, Vital du -l3jFowler-Magerl, L. 8Francesca da Rimini 24ff.. 29. 584ff.Francke, K. 569Frank, E. 581, 1005Frauenholz, E. von 264Frenken, G. I0l,313Frenzel, E. 519Freud, S. 242,517Freund, W. 537
2,,.u .
? '
, ,r a. 532. 601L : -e9::
625
Freyer,H. 778Fried, J. 886, 1005aFriedrich, H. 24ff., 584ff., 531Friedrich I. Barbarossa 5. l9laFriedrich II. (Ks.) 19laFritz, K. von 379,635Frontinus 292f.,3l0f ., 416, fr3, 748Fronto 920Fueter. E. 38Fuhrmann, M. XXXIX, lllf., 10,44,49,
70, 102, 201, 271f.,402,425, 530Fulgentius (Mythogr.) 42-?Fumagalli, M. 520Fumaroli, M. 570aFunke, G. 2lIFunkenstein, A. 366
G
GadameE H. G. XXUI, XXXIGaillard, J. 167, 171,508Galbraight, V.H. 328Galfred von Monmouth 136, 327f.' 965'
991Galfred von Vinsauf |ffi, 376, 670Gallay, J. 741Gandillac, M. de 337Ganymed 420Garu,P. 803Gardeil, A. 861Garfagnini, G. C. 206, 394, 544, 726Garin, E. 389,726, I0l6f.Gauthier, R. A. 774Gebhard, W 809Gebien, K. 43f .,4. 102Geerlings, W. 2l)aGeiler von Kaysersberg 6,17Gellius (Aulus G.) 401,416, 366,410,462'
635. 698, 706, 724, 1080, I IN, I 139, 1204Gelsomino, R. 967Gemoll, W. 410Genzmer, E. 550George, S. Im'lGeremek, B. 100,274Gerhardt, C. 287,420Gerhoh von Reichersberg 559Gerl, H. B. 43,446Gerosa, P.P. 45Gervasius von Melkley //92Garvasius von Tilbury 322, 340'Gesta Romanorum' 321, 569Ghellinck, J. de 564, 795, 1037Gieon,O. 271
626
Gilbert von Poitiers 240,2Uf .,.376ff., 546Gilchrist, l. 2l0aGiles, J. A. 557Gillet, R. 982Gilmore,P. 214Gilson, E. 562, IU7Giordano da Pisa /08Giotto /0/8Giraldus Cambrensis 406, 543, 548' 968Girardus Pucella 13, 56{Giraudoux, J. 483f.Glauche, G. 8J-?Glunz, H. H. 731, 734,781, 785Gmelin, H. 742, I|79Gnatho 410,343Gnilka, C. 276,729,734Görner, O. 68Gössmann, E. 537Goethe 23f..250f ..247Goetz, H.-W 149a,755Goetz, \{ 1018Gombel, H. 89Gombrich, E.H. 1020Gomer 329Gompf, L. 425Goppelt, L. 258Gorgias 284Gottfried von Straßburg XL, I179Gottfried von Viterbo 137. 566Gower, John 297f., 430, 9ffiGrabmann, M. 28i,, 544, 561,823Graciän, B. 21, 173, 309, 4 10, 42 3, 427' 957,
965f.,986Graecinus P 209Grant, M. A. 315Grassi, E. 53lff., i IGratian 264,3,21üJ., 560f., 564,685' 882Graus. E 72.303Green-Pedersen, N. J. 85JGregor d. Gr. 47,92ff., 106f., ll3f., l22ff.,
124f.. 2r0. 226f., 515, 7 l, 105, I 08, 2 39f.,252, 266, 269, 280, 405, 578, 729, 7 53, 9I 6,921
Gregor VII. 5, 319,211Gregor von Nazianz 4y',6f .,46lf .Gregory T. 391f., 26,752,822,965, l09lGreimas, A.J. 697,706Greverus, T,-M. 68Grimal, P. 405, 569Grimm, R. R. 94JGriselda/Griseldis 29, 226ft, 322Gröber, G. 1067Groß,K. 2l0aGrothe, H. 409
Grubmüller, K. 79, 369Gründel. J. 4. 858Gruenter, R. 551,570Grundmann, H. 518, I{Gruppe, O. 427Gryphius, A. 777,915Gualazzini, U. J6JGuen6e, B. 213t.,25, ttGuerrini, R. -18Guglielminetti,M. 521Guibert von Nogent 76.Guido da Pisa -i1-lGuiette, R. 481Guitton, J. 982Gumbrecht, H. I0l IGundolf, F. 1004Gurjewitsch,A. J. XXX
3t3Guth,K. 964aGuy ,LC .294
H
Habermas, J. XIVHadot,I. 425Hadot, P 54JHadrian IV (Papst) 224flHaefner, E. 824aHäring, N. M. J58, J81, iHagendahl, H. 173.283Hahn, M. ,11Hajdu,H. 724Hamblenne, P .174Hanning, R.W. 185, ImHamack, A.von 234Harnisch, W 77HarsdörfTer. G. Ph. 3 I 7.Harth, D. 533ft..43, 95Hartmann von Aue 569Hartmann, W. 537, 559Haskins. C.H. 558.837Hauck, K. 947Haug, W 283,569,570aHausmann, E R. 1011Hay.D. 599Hazelton Haight, E. 409Heck, E. 8-?6Hegel, G. W F X, XVI. )Heinrich I. Beauclerc J/lHeinrich II. Plantagen€t
328,468, 63r,682, rr29Heinrich IV (Kaiser) 5Heinrich VI. (Kaiser) 137
[e:. ].10. 244t.,. 3'7 6f1., 546AaI
1
ba ."t8
trensrs 406, 543' 548' 968b
' .3 .564
48_1iLf_?73 ;
' 34 ,781 ,785
l : ; t '9j1:6 . ' : 9 734I
t i i . : l Zl !91 755l8j9H 1020
556
St::3burg XL, I179\ ' : ierbo 137,5662ct-' 130, 960L : i l . 544,561,823ll. .
--1. -109, 4 10, 423, 427, 957,
21,*
lf i t I3. : : irT , 56t)f., 564, 685, 8823t-:
:c. \ J. 8JJ; r-.92ff.. 106f., l l3f., 122ff.,22b: . j15. 71, 105, 108' 239f. '9. ): ' , 405, 578,729,753' 9i,6'
{ : . 1 r / /
faz.:nz 446f.,461f.9',a . :6. 752, 822,965, I09lJ . : ; - '06
M i,i
r -'öE
rc.:;. 19. 226f1.,322lu 'tkJt-*
Grubmüller, K. 79. 369Gründel, J. 4,858Gruenter. R. 551. 570Grundmann, H. 518, 1005Gruppe, O. 427Gryphius, A. 777,9/5Gualazzini, U. 565Guenöe, B. 213f.,25, I8l, 353, Z7lGuerrini, R. -?8Guglielminetti,M. 521Guibert von Nogent 76,258, 364,921Guido da Pisa -?1-?Guiette, R. 481Guitton, J. 982Gumbrecht" H. l0l IGundolf, F. lU4Gu{ewitsch, A. J. XXXII, XLil|St|I IB,
3t3Guth,K. 964aGuy ,J .C .294
H
Habermas, J. XIVHadot,L 425Hadot, P J4JHadrian IV (Papst) 224ff., 237f., 3tsHaefner, E. 824aHäring, N. M. 5,t8, 581,887, I0B0Hagendahl, H. 173,283Hahn, M. ,l/Hajdu,H. 724Hamblenne, P -?24Hanning, R.W. 185, IM7Hamack, A.von 234Harnisch, W /7Harsdörffer. G. Ph. 317. lXnHarth, D. 533ft.,43, 95Hartmann von Aue J69Hartmann. W. 537,559Haskins. C.H. 558.837Hauck, K. %7Haug, W 283,569,570aHausmann, F R. 1011Hay,D. 599Hazelton Haight, E. 4UHeck, E. 8J6Hegel, G. W F X, XVJ,XLX, rcA|Heinrich I. Beauclerc J18Heinrich II. Pfantagen€t 136,205,489. 7,
328,468, 631,662. r129Heinrich IV (Kaiser) 5Heinrich VL (Kaiser) 137
Heinrich (le lib6ral), Gralvon Champagne137
Heinrich von Huntingdon 136, 423, 670Heinrich von Mügeln 299Heinzle, J. 315, l0llf.Heissenbüttel,H. 645Heitmann, K. 43, 264, 423, l0l I. 1020Hektor 94Helbing, H. 252Helbing-Gloor,B. 26Helena 25,284Heli 354f..476f..%6Helinand von Froidmont 139ff.. l42. 92lHeloise 416Hempel, W. 264Hendley,B.P 3%, 575Henn-Schmölders, C. 205Hennis, W. ffiL, 1005Henoch 335Heraklit 750,j,n?Herde. P 6-71Herder, J. G. 32ff, 312, 1044Herkules 396Hermagoras 423Hermaphrodit 420Herodes 473Herodot 362,366, 383, ffi6Herzog, R. 197, 246, 275, 9i,7, 948, 952. 997Hesdin, Simon -142Hess, U. 120Heuss. A. 80. 175Hickmann, L. 716Hieronymus 168, 212, 288f., 313f.. 321.
325f., 333ff., 347ff., 363, 373ff , 396ff.. 4 10.416, 461ff., 477ff., 568ff, 578, 298, 374,385, 474, 5 1 3, 63 I, 643, 655, 685, 8n, 95 If.,9ffi.10t4
- Epp. 173, 218, 283, 374, 532f' 540, 591,639, 685, 720, 74 t, 790, 798, 95 1, 958, 964
- Adv. Jov. 353, 3E5,464,480, 606, 654, 237,880, 920.gst
- Adv. Ruf. 685,816Highet, G. 1037Hildebert von Lavardin XXXII, 245,2il,
406, 542, 546, 567a, 578, E80,9 19,930,923,1002
Hildegard von Bingen 13Hiltbrunner, O. 821Hirzel.R. 574'Historia Augusta' i,69'Historia Lausiaca' ll3Hitler 523Hocke, G. R. 9J4Holte, J. 892
627
Holtz.L. 145Homer X'{I,l, 22, 34, 169, 17 7 ff ., I 89f., 208,
210f..935Honstetter. R. 137f.. 38, 497, 710, I 196Horatius Pulvillus 127Horaz 178, 240, 326f., 375f., 395, 487, 492,
552f.,573f., 170- A. P 375f.. 487. 423, 433, 880, 962- Epp. 422, 537, 540, 578, 744, 798, 1129,
I 167- Sat. 400, 474, 509, 531, 614, 771, 809,
10srf.Hom, N. 566,621,881Horstmann, A. 203a,427Howald, E. 719Hrabanus Maurus 720Huber,C. 428Hublocher, H. 337Hübner, K. XVHüeli, U. 896Hugo von St. Victor 367f.,378f.,453, 16,
214, 36r, 368,748, n3,940,970Huizinga,J. XXXII,l4f.,276ff., 31, 38, 541,
568,571,664, 1005Humbertvon Romans /0J, 246, 287f., 364,
458, s34, 536, 735Hume, D. 366, 1022Hunt R. W. 541f.,853Hunt. T. 544a,822Huygens, R. B. C. 552a,753
vJ
Jaeger, C. S. 240, 577,612Jaffö, S. 5J1Jakob 335.474.515Jakob von Cessoles 265, 337,986Jakob von Yenedig 442Jakob von Vitry ll3f., 313, 345, 526Janik. L. G. 600Jaspers, K. 55Jauß,H.-R. XLI,30,52, 117, I I, 37, 58, 103,
r24, 163, 282f., 988, 101 IJean de Meun 430Jean de Montreuil 341Jeanne d'Arc 72f.Jeauneau, E. 428, 544, 707, 728, 802, 809Jennings, M. 165Jens, W J-10Jentzmik. P 183, 91 3, 982Jepht^ 322,631, 635
628
Jeremias 447'lnstitutio Tiaiani' s. Ps. PlutarchJoachimsen, P 868Job 344. 596.265, 390, %5Johann, H.T. 578Johannes, Ev. 447Johannes d. T 473Johannes Balbi von Genua (Januanensis)
435Johannes Cassianus 96f.. 244, 883Johannes Chrysostomus J35Johannes von Garlandia 158f., 375,457,
931Johannes von San Gimignano 345Johannes Sarracenus 4y'?Johannes Scotus Eriugena XXXVIII, 6EdJohannes vonTepl 570aJohann(es) von Wales XXYl40f .,338,965Johannes von Winterthur -115Joinville, Jean de 433,872Jolivet,l. 402Jolles, A. 27f'f..322,68, 103Joly, R. 600Jonson, Benjamin 343Jordan, M.D. 219Josias 203,514Iphigenie 285,322Imerius JJOIsaak 335lser, tN. 572Isidorvon Sevilla 57ff., lslf., J91, 735, 87E,
lNl- Diff. t43, 3s3- Et. I. 128, 143, 145, 149a,288,353f.,362,
364,493,499, 531, 809, 1192- II 3. 382,5U,540,856, 1192- v 8 8 2- vt 834. ffi8Isokrates 22Ivo von Chartres 560Juan Manuel, Infant Don 92,297, WJuanRuiz 297Judas II92Judith 256, 322, 385, 469, 55 I, 632Jülicher, A. 18, 32ff., 39, 751J., 158Julianus Apostata 236, 19la,489Julius Rufinianus 59f., 381, II92Julius Victor 9, 145, 399, %2Jung, M. R. 747Justinus(Epitomator) 960Justinus Martyr 892, 950Justinian 203,2&,271ff.,514, 3, %5, 993,
s. auch Corpus luris CivilisJuvenal 206, 461, 620, 641, 920, 1044, l05I
K
Kaegi, W 191a,58Kaise:r'G. 147Kantorowicz, E. t9to" 6Kapitza, P 538Kant, I. 26ff.. %5Karadagli, I. 620Karl d. Gr. /86Karl d. Kühne I9ta,26aKarl V von Frankreich IKarl VI. von FrankreichKarnein, A. 570, 1202Kartschoke, D. 1009Ytaser,M. 4, 567Kassel, R. 997Kasten, I. 569Kech,H. 234Kelley, D. R. 43Kelly D. 962Kemer, M. XXII. l3t. t
783,922,978, 1ilgKeßler, K. 533ff., 43, 325,Keuck, K. 359Kindermann, U. 552, 571Kirn, P 63Kirsch, W. lglaKlapper, J. 585Kleinschmid! E. t49. ISIKleopatra XVI, 25, 473.
I 179Klibansky, R. lJ8Kliewer, H. J. 956Klingner, E ,160Kloos, H. M. IglaKlopsch, P 706Kluxen, \ry XLKnape, l. 353, 364, 5t9I.Ihapp, F. P 99, 288, 420. ,Knowles, D. -i4Knuth d. Gr. 204f.Koch. J. 982Kodros 540, 913f., %j 96Köhn, R. 557,577,853Kölmel, W. 599, t036, I0SKoep,L. 74Konrad von Hirsau 9ZZKonstantin 203, 220, 514.
906,945,993Koppenchmid|J. 4fl,73.Komhardf H. 100, IU, yKoselleck, R. XXVI, -?Z tKosteq S. 524Kretzmann. N. J66
rr . Ps. PlutarchE't
16_: 3E{J, 945J - i+t'4 - l
i von Genua (Januanensis)
ienus 96f., 244,883rostomus J.35Garlandia 158f, 375' 457,
San Gimignano 345rc,etus 442!s Enugena XXXVIII,886TepI 570ap \t'aies XXV 140f., 3J8, 96J$'rnterthur 315de 133.872
L )22 .68 , 103
mrn J4J: : E
Ii -11:
illa 5"ff., 151f.,591, 735, 878'
L?ß :1: 149a,288, 353f., 362,9 : 31 .809 , l l 92u :rr.1.856, l l92
I
les -i60,Ir:.tant Don 92, 297' 904n
D. - r85. 469,55/ , ,632It. ::tT. 39, 7511., 158slla- 136. 191a,489nu . 59 i . 381 ,11929 ,J:. 399, %2
71-bnarort 960v 92. es0[ :$. 211ff., 514, 3, 945, 993,
4tu- ltns Civil is4r:. 620. 64 1, 920, IU4, 1051
K
Kaegi, \{ 19Ia, 568KaiseqG. 147Kantorowicz, E. I9l a, 640Itupitza, P 538Kant, I. 26ff., %5Karadrgli, I. 620Karl d. Gr. 186Karl d. Kühne 191a,264Karl V von Frankreich 142Ifurl VI. von Frankreich 565Karnein, A. 570, 1202Kartschoke, D. 1009KasegM. 4,567Kassel, R. 997Kasten. I. J69Kech,H. 234Kelley, D. R. r'3KellyD.962Kemeq M. XXI 138, 560ff., 4, 564,675,
783,922,978, tI19Keßler, K. 533ff., 43,325,874, IN6, 1037,Keuck, K. 359Kindermann, U. 552, 574Kirn, P 63Kirsch. W. 19laKlapper, J. 585Kleinschmidt E. 149, l,50, 356, il96Kleopatra XVI, 25, 473, 510f., t86, 631,
I 179Klibansky, R. JJ8Kliewer, H. J. 986Klingneg F 160Kloos, H. M. I9laKlopsch, P 706Kluxen. \Y XLKnape, J. 353, 364, 519f.Knapp, F. P 9, 288, 420, I/93Knowles, D. -?4Knuth d. Gr. 204f.Koch ,J .987Ko'dros 540, 913f., %5, 9ffiKöhn, R. 557, 577,853Kölmel, W. 599, 1036, 1053Koep,L. 74Konrad von Hirsau 977Konstantin 203,220, 514, I9la, 264, 4t6,
906,945,993KoppenchmidLJ. 4ffi,732Komhard! H. |00, IU,345Koselleck, R. XXVI, 37,53, nnKoster, S. 574Kretzmann. N. J66
Krewitt, U. 144f.KnqL 409Kristelleq P O. 543f., 599, 848, t036Kuhn, H. S. 778Kuss, O. 878Kuttner, S. 263, 4,210a,375
L
Laarhoven, J. van 620, 703,226Labhardt A. ffiOLabienus, T 473Lackmannn, M. 747Lacrq4B. 17Lactantius 83, 202, 206, 221, 588f., 1054LadneqG. 179, l6I, 254, 622, 883,997, I02ELaelius 175Laistneq M.L. /,006Lama4l. 906Landfester, R. 22Landsberg, E 332Lang, A. 4, 861Lange, W D. 450Lanvinus (Lavinius/Lanuvinus) 405.
409ft., 8t 5Lapid,B. 980Laurentius von Durham 36lf ., 532f., 552,
621, 669.973Lausberg, H. XXII, XLIII, 18,483f., 596, Z
40Lazarus 433Leclercq, J. 4n 387,526,567a,664Leduc-Fayette,D. 679Leeman, A. D. -18Leff, M. C. 855f.Le GofI, J. 41ff., 48f., 596, 58, 96, 100, t n,
2 t7fJ., 239, 280, 296, 299, 375, 7 35Lehmann, P 562, 509, 569, 836, 846, 968Leibniz 965Leo VI. (byz. Kaiser) 514Leo d. Gr. 230Lere( S. 423,581Lessing, G. E. XXXY 32ff.,53L6vi-Strauss, C. 571, 660,997Levine,P 571Lewry, O. 447, 544aLhotsky, A. 2Lichtenberg, G. C. VII, 65r'Lida de Malkiel, M. 1148Lieberg, G. 475Liebertz-Grün,U. 325, InsLiebeschütz, H. 14, 346f., 355, 415ff., 500f.,
20, 28,6f.5, 726, 839, 930
629
Linder, A. 321, 335Lindhardt, J. 4-?Linnö, C. von XLIVLipps, H. 27ft., 10, 102,997Lipsius, J. 15,413, 565,33Livius 35, 225.233f., 87, 128, 513, 529,Lötzsch, F. 572,965Löwe, H. 669,968Löwith, K. X, 503, 517ff., 129, lXnLohr, C. H. 560,887Longöre, J. 871Lo Nigro, S. ,l/0Lope de Vega, E 587Lorenz, K. XXXLoth325. 944Loyen, A. 482f.Lubac. H. de 430, 561Lucan XXII, 169, 174, 178, 180f., 189,
205f .,220,354,417 ,538,433, 54, 593,653,682, 846
- Phars. I 219f,641, 1029- II 354,191a,635,699- It/ 631- Y 2 0 5Lucas, R. H. 299Luciani, E. 528, 1042Lucretia 321, 631,942Ludwig VII. (le jeune) 518Ludwig IX. (d. hl.) 433Lübbe. H. XIV 37Lullos, Raimundus XXXVIIILumpe, A. 164Lupus von Ferriöres 414,310Luscombe, D. E. -t89, 572, 882,922,978Lusignan, S. 332Luther, M. 2l I, 418, 979, 986Lykurg 224, 486, 945, 960
M
Maass, F 18-lMacchiavelli. N. 1004, 1008, 1035, 1070Macrob 174f., 316ff., 375ff., 401f., 404f.,
406ff ., 412, 416, 420f ., 443, 47 0, 562, 578ff.,4r r, 462, 509, 706,742, 748,820, 822,921
- Sat. 145, 370, 578, 616f.,724,742,795, 806,913,822,852, 882,944, rr59, r2U
- Somn. Scip. 506,716, I137, 124ff., I2l0f.Maier, F G. 170Maitland, F.W.ä 564Mandel, J. 508Mangegold von Lautenbach 559, 562Manitius, K. 846, 1067
630
Mann, Th. XIX, 75, 517, 556, 170, 186Manthey, J. r'55Marguerite de Navane .?1JMaria 338f.Marie von Champagne 137Marie de France 219, 327f.,431,728Marius, s. SullaMarius Plotinus Sacerdos 1192Marouzeau,J.42IMarquard, O. X, Xry XX\XL1,307f.,36,
266, 530, 570a,709,778Manou, H. I. 169f., 357ff., 482ff., 38, 170,
400, 708.956Marsh, D. 705Marshall. P.K. 326Martel. J.-P 620Marrellotti, G. 520Martha, C. 302Marti, B. 457, 503, 695Martial 152Martianus Capella 416, 620, 427Martin von Braga 491,969Martin von Tours 94, 100ff., 329, 416,
249f1., 276, 636Martin, A. von 43Martin, C. 371Martin, Janet XXII, 4l6fl,29f., 326, 724,
842ff.,922,978, t085Martin, Jos. 8,457,4ffiMatt, P von 1005aMatthaeus Pais 572Maurer, K. 125Maurer, W. 765, 879McCall, M. H. l l l , 120f., 126,136McGarry, D. D. 1t 433,731,752McKeon, R. 627Mclay, A.D. 980Meerssemann, G. G. 405, 425Mehl, J. M. 337Meid,Y. I}NMeier, C. 27, 425, 431, 696, 709, 729, 73|f.Mejer,J.400Melanchthon 38, 765, 879, IN4Melchisedech 94JMelissus 240,537Melville, G. 25, 368,493, 735, 1000, 1005Mendelewitsch,D. 735Menenius Agrippa 35, 53,224ff .315, 8ryL,
rr8, 128,5t3fJ., e23Merlin 27Mertner, E. 860Merton, R. K. J38Meuli, K. 32tr.,74, 78Meyeq E. J-17
Meyer, Heinz 91JMeyer, Herm. 6ZJMichaud-Quantin, p iMichel, A. 338,402. tlMichel, P 910Miczka, G. l, 186. 564Mikoletzky, H.L. 162Minio Paluello,L. U2.Minnis, A. 337, 342,1]lMinukian 1/9JMirgeler, A. 1018Misch, G. 659,978Mittelstraß, J. XXI, )O(Mohammed 192Mohrmann, C. XI. l35Moliöre, J.B. 955f.Molland, A.G. Z6lMollard. A. 398Momigliano, A. 27t,1CMommsen, T.E. IU7Montaigne,M.de XXV
53f.,79, 153,217f., 3fr53, 192,365,496,567a6ffi, 697, 705f., 70Ea,987, 1026, 1032. 1037.
Mooney, M. frIMoos, P von XVIIL )C
21r, 264, 36f', 399, 526'Moralium dogma pfulc
497f .,920a,976. 1il9Morhof, D.G. 765Morris, C. 758,964aMoser-Rath, E. 379,4AMoses 107, 6J6Mosher, J. A. 135, /01,Mühlmann, H. 8df., I0lMüller, H. 735Müller. S. 778Munk Olsen, B. 25, yqMurphy, J.l. 15,446, yMunay, A. 871
N
Nadel. G. H. 4%Napoleon 63,186, IgIaNebukadnezar 588Nederman, C. J. 6n. SlNemesius von Emesa 8{Nemetz. A. 757Nero 80,288,346,567
x\. --i. 517, 556, 170, 186t_i-.I \..er ane -l1J
nmpagne 137me 119, 327f . ,431,728[iaus Sacerdos 1192
\. xlY xxl, xLI, 307f .,36,l0a '09,778
169t. 357ff.,482ff., 38, 170,JöD,ia 2 1 Ä
62;;i : : 0n:l. ii,3 695
pella 416,620,427Yaza 191,969Tours 94, l00ff., 329, 416,
,6_?6tn J-?v1I \xll. 4l6ft., 29f., 326, 724,, 9 - i t 0 8 56 1)', 46t)In' ' :a
lns -('2l-'-'76: t '9[ ] t i . 120 f . , 126 ,136D t5 .433 ,731 ,752ö : -
). ' !1,
Meyeq Heinz 913Meyer, Herm. 673Michaud-Quantin, P 544 a, 87 IMichel, A. 338,402,447, 546, 648aMichel, P 910Miczka, G. I, 186, 564Mikoletzky, H.L. 162Minio Paluello,L. U2, 7 16Minnis, A. 337, 342,430Minukian 1,19.?Mirgeler, A. 10/8Misch, G. 659,978Mitrelstraß, J. xxl xxxvll, J4JMohammed 192Mohrmann, C. XI,735Moliöre, J.B. 955f.Molland. A.G. 761Mollard, A. 398Momigliano, A. 271, 490, 997Mommsen, T.E. IU7Montaigne,M. de XXVI,XXXI, l, 19,21,
53f., 78, 153,217f.,300, 359ff., 503, 535f.,53, 192, 365,496, 567a,585,593, ff iL,658,6ffi, 697, 705f., 708a, 710, 806, 896,985,987, 1026, t032, 1037, 1M7, 1094
Mooney, M. ffiIMoos, P von XVIII, XXIV 569f., 620, St,
2I I, 264, 368, 399, 528, 631, 955, I 192'Moralium dogma philosophorum' 491ff.,497f.,920a,976, l119
Morhof. D. G. 765Morris, C. 758,964aMoser-Rath, E. 379,409, 5j,8Moses 107, 636Mosher, J. A. 135, 105, 322Mühlmann, H. 868, 1018Müller. H. 735Mülleq S. 778Munk Olsen, B. 28,540f.Murphy, J. J. 15,446, 549, 553. 1037Murray, A. 871
N
Nadel. G. H. 494Napoleon 63,186, IgIaNebukadnezar 588Nederman, C. J. 620,544Nemesius von Emesa 883Nemetz, A. 757Nero 80, 288,346, 567
Nestle, W 89Nettersheim, Agrippa von 147Neumeisteq S. 570Neureutheq H.P 409Neuschäfer, H. 67, 3/'5, I0l0f.Newald, R. 837Newell, J. 581,882,978Newton 242Nicolas de Gonesse 299Nies. F 312Nietzsche, F. 217, 51, 497, 775, 1000Nimrod 320Nön, K. W 558Nsjg;aard, M. j,35Nolting-HaufT,I. 570Nordh. A. 152North, H. 668Nothdurf! K.-D. a6Notker d. Deutsche (Labeo) 256,55l,Nowicki, J. 287Numa Pompilius 920
o
Obertello, L. 978Odoj, U. 15,930O'Donnel, J.R. 1037Odysseus XVII, 34, 177ft., 187,340, 361f.,
421,662,920Oehle4 K. 861Oehleq R. 12JOexle, O. G. 724Ohly, F 524,203, 234, 254, 256, 258, 569,
570a, 652, 724, 732,913,917,952, In7,IU3
Olivier de laMarche 264Olsen, G. 210aOlson, G. 280Olsson. K.O. 29Oltramare. A. 721Opelt, L 573,958Oppel, H. D. 103,2%Orest 50, 256,261,340,551, 554f.Origenes 168,350Orosius 7y'8Orpheus 596,145Otloh von St Emmeram J/3otr E. 8Otto, G. 250f.,552Otto von Freising 368, 755,916,982,987,
992, 1050Ouellette, H.T. I0A
EG G 405,4253-:-nI, t:: tlt, 696,709,729,73|f.DI t \ '65,879, IN4
b *t-'
1. "'-r-l : : :q.493,735, Iou, lmsl r o 7 i5brra 35. 53, 224ft.,315. EUf,y:": e23
leoI ,- ' !F-
-1 =8
t-
631
Ovid 166, 17 5,327, 453,539f .,573, 4 I 5, 4 39,641, 795, 846, 904, 9t 3, I I29
Owst, G. R. 106
P
Pabst, W -il5Padoan, G. 264Palacz, R. J-tjPalladini, M.L. 922Palladius 182, 426Panofsky, E. 920a, 1027, 1M7Pantin, W A. -?-t8Papias 152,564Papirius Praetextatus 600Paratore, E. 837Parkes, M. B. 1099Parks, E. P 562Parmenio (bei Terenz) 410Partner, N. E 21, 423, 1202Pascal, B. 582Pateq W A. de 433Paterson, L.M. 313Paulinus von Nola 245,997Paulmier-Foucarl, M. 337Paulus (Apostel) 323, 438, 485ff, 958, 962Paulus Diaconus 251, 513Payer, P J. 871,882Pease, A. S. 8J6Pecere, O. 509Peil, D. 412, 558Pellegrini, A. 549Pepe,L. 509Pepin, R. 574Perelman, C. 10, 58'Perpendiculum' 567Persius 105,1Peter s. PetrusPeters, H. 645Petit, Jean 340, 642, 726Petrarca, n XXIII, 19, 20f., 53f., 2l9ff.,
226ff ., 233tt., 243, 308, 529f., 534f., 545f.,547ft.,45, 158, 246, 3r7, 338, 341, 518ff,528, 539, 588, 6U, 795, 883, 892,922, 1A04.1014, 1016, 1024f., 1036, r038fL, Iu4
Pötri,,H. 2,207Petronius 219ff .,228,5091., I 07, I 3 l, 505f.,
5 I01J., 692, 829, 846, 986Petrus, Apostel 323f .,329,474f .,635f.,653,
822,942, It92Petrus von Blois 420f.,547 f.,565,570a,853,
1014, lM2, 1093Petrus Cantor 399,325, 801Petrus Comestor (Manducator) 158, 361
632
Petrus Damiani 559, 567aPetrus Lombardus 262, 1099Petrus Venerabilis 101ff.P6zard, A. 559f., 343, II16Pflaum, H. 345, II78Phaeton 575Philipp (II.) August 137, 1059Philipp von Makedonien 233f.Philippe de M6ziöres 565, 1059, 1096Plagnieux, J. 369Plaia, G. -?-i8Platon IX, 9, 83, 91, 160, 175, 205,208,211,
285, 297, 325, 327,349,394,440, ,|43ff.,447f.,480,488, 504ff., 513ff., 516f., 520,531ff , 535, 567f., 571f,, 57sff., Igf., 125,2t4, 383, 527, 544, 564, 580f1.,664,705,757, 874,923,950
- P vs. Aistoteles 9f.,147 ,156, 168f., 283f.,291, 381, 408f., 507, 542, 352, 7 52f., 822f.,978, txn
Plautus 8-i7Plinius d. A. t:0, 224,3fi,394,7i13Plotin 146, -?48Plutarch 21, 132f., 172,217f, 408, 496,
In4, 1032,408Ps. Plutarch ( I n s t i tut io Traiani) I 68 f., I 74f.,
202f.,245,395, 408, 414, 416ff., 439, 455,464ff., 488f., 568f ., 347, 7 83, 7 87, 837, 892,922, 1004
Pöggeler, O. I02IPöschl, V. 4, 150, 170, 1004Poggio Bracciolini, G. F. 682, 1038Polemon 169Polykrates 558Pompeius 80, I9l a, 653, 681f.Pontano. G. 132f.317Ponticianus 97ff.Poole, R. 703Popper, K. 58, 1005Porphyrius 398f ., 7 5 3, 9 I 2Portunianus (bei Macrob) 174,462Post, G. 607, 640Pratt"R. 342Präaux,J. 445Price, B. J. 616Priszian 147, 380f.,431, 538, 541,728,755,
896Proserpina 166Protagoras 208f., 478, 59EPublilius Syrus 836Pylades 340Pynhus 206,483Srthagoras 146, 208f., 224, 304, 307, 327,
353, 19 1 a, 348, 478, 593, 598, 64 1, 682, 958
aQuadlbauer, E 3JQuintilian 35, 38. 4tf
t92ft.,225.256.218.I I I, 837. 1037
- Inst. I 6, 380f.,4fl. .- I I 147,832,859- rrr 21f.,858- IY 374.492- v 2, a,88, 161, tU.
18, r28, 130, t36. 15(457, 5t5, 550, 557f.. (
- YI 450.66E- YII I49a- YIrr 137, 382,$fi,6-xtI I3t, 373, 395.12.
R
Race, W H. 7MRachel/Lea 474Radulfus Ardens dJORadulf(us) von Longr
578, 6t2, 824, 930Rahn, H. 202,657Rahner, H. 283ff.Rall. H. 2J4Rand, E. K. 837Ranke. L. 1n8Ranulfus Higden von (
337, 339, 36,481,4E.Rapp,F. 732Ray, R. D. l4I, 3&Raynaud de Lage, G. 9Regulus d.J. 431,956Rehermann, E.H. 98Reiff, A. /73Reinitzer, H. 648Reiss, E. J60Reitzenstein, R. 147Rembrandt 23Reuter, T. ZReynolds, L.D. 299Rhebergen, P 620Rheinfelder. H. 1179'R haoica ecl esiastica'
636,643f., 1030, t1y'Rhetoica ad Herenniun
158f., 163,200f., 216.59tff .,277
- Lb. I 147,450,4%, 5'- rI 140, 149
n : : 9 : 6 7 aldu. 162.1@9bi}s lt i1ff.9 f . 311. 1 i l6t i . ' ;
- !
ug-:s: 1,1'. 10i9[eoonren 233f.iz:e::s 565. 1059. 109636,
B . ; r . : d r . 175 .205 .208 .211 .6. ::-. i19. 39a. 4'10. 443ff..tst. i- ' j tT. 513ff.. 516f.. 520.56-a . i -1 i . 515f1. . 19f . . / ,25.F :t! 56t. :801f., 61. 705.t t ;_'-de -'. lr-. 156.168f..2t3f..lf . j.
-. ){2. J-ir, i52f..421..
l-t ::r. ,160. l9t. zl-lßll:: :-:. : l '1. 40€- 196.
ü!fin-: :-: : T.aunt) l6tf-. l;4f -
E " . i r i l . 116 f f . . 439 .155 .
i. -<ti: -;r - -6-?. -6-.
6-?-. E9:
I,0-'
aQuadlbauer, F 33Quintilian 35, 38, 48ff., 53ff., 149, 167f.,
t92ff ., 225, 256, 27 8, 35 l, 385 f., 417, 445,111,837, 1037
- Inst. I 6, 380f., 4fl, 576, 751- I I t47.832,859- rrr 2rf.,858- rY 374.492- v 2, a, 88, 164, t88, 654, 856 (Y il: I t2-
t8, 128, 130, t36, 150, 3U, 308, 433,441,457, 515, 550, 557f., 693, 862,914)
- YI 450,668- YII I49a- Yrrr 137, 382,4&, 648-xtI I3t, 373, 395,422, 540, 544,768
R
Race, Wl H. 706Rachel/Lea 474Radulfus Ardens 430Radu(us) von Longchamp 375, 554f.,
578, 612, 824,930Rahn, H. 202,657Rahner, H. 283ff.RaU. H. 2J4Rand, E. K. 837Ranke, L. 1008Ranulfus Higden von Chester 360, 564f.,
337, 339, 366,481,485, 714, 734, I08Uf.Rapp,F. 732Ray, R. D. I4I, 3ilRaynaud de Lage, G. 973Regulus d. J. 431, 9J8Rehermann, E.H. 98Reiff, A. 123Reinitzer. H. 648Reiss, E. J60Reitzenstein, R. 147Rembrandt 23Reüte4 T. 7Reynolds, L.D. 299Rhebergen, P 620Rheinfelder, H. I179'Rhetoica qclesiastica' 8, 382, 565, fi9,
636,643f.,1030, 1034'Rhetorica ad Herennium' 8, 48, 50ff., 57ff ,
158f., 163, 200t., 216, 410f., 460f., 588ff.,591f1.,277
- Lb. I r47,450,4%, 578, 832, 1206, I2I0_ II T4O, 149
- rrr 142,602- rv t2, II0, r13, r40ff., r64, r98,218,345,
374, 383, 450, 457, 460, 548, 555, 578, I 167,I r90f.
Richard von Bury 567,574t.,/080, 1126Richards, E. J. 5JRichardson, T. W JOJRich€, P 552, 562Ricoeur, P 77, 653, 697, 706Rieks, R. 774Rieß. P XXVI. XXXUIRijk, M. L. de 371,544a,562,574,752Riposati, B. 546,870Ritter. J. XLil.57lRobert von Basevorn 364,735,921Ps. Robert Grossesteste (Summa philo-
phiae) 408f., 299, 824, 492Robertson, D. W Jr. 342, 636, 871Robinson, l.S. 669Rockinger, L. 644Rodnik, E.H. 822Röhrich, L. 409, ffi4Rösler, W. 125Rötzel H.G. 203Roger, Bacon s. BaconRollinson, P ,lJ6Romein, J. 409Romilly, J. de /-iRomulus/Remus 350Ronconi, A. 262Rose, V 335Rota. A. 640Roth, D. 219,287Rothacker, E. 732Rouse, R. H./M. A. Rouse 323, 468, 635,
836,732,922, 1099Rousseau, J. J. 679, 1004Rousset P. 361,642, l03lRuberg, U. 264Rudolf von Ems 682Rüegg,W 445Rüfneq V. 747Rüsen, J. 37, 1ffi2, 1008Rupert vonDeutz 9E2Ryan, M. B. 549
sSabellicus (M. Coccio) 38Sachs, H. 23Sale.A. dela 142.342Salimbene 314, ffi8Salles. C. /-?1
l-qrt:
- . -r"r1
:- F 4t-'. /t-rE
r , - ' - - : 6 ' ! / - :. . -
- ' -11 -vi - ! -
Ii :
l_i: ,
r:I1 .lI
e
t,-$
IFl f
r -*.o. -1j-. f,-":a- t .i f'r t5t
hr
E;ilI
633
Salmanasar 212Salmon, P 746Salome 473Salomon 17 5, 224, 335, 447, 473, 644Saltman, A. 574Salutati,C. 19,311,528,542,548f.,557,214,
340f., 6m, 603, 726, 874, 892,922,985,IU4, IA2
Salvian von Marseille [email protected] 329f.Sandys, E. 45Sanford, E.M. 490Sapori, A. /0,1/Sappho 9/4Sardanapal 216f.,495Sassen E 9ZZSaul 206, 354f .,476f.,644, 702, %5f.Savigny, E K. von 564,(272)Scaglione, A. 519Scaliger, J.C. 612Schaarschmid\ C. 4l3f ., 47 l, 558, 550, 572,
739.934Schauwerker, H. 51-?Schedler, M. 616Scheleq M. 582Schelling, F.W. J. In5, I03ISchenda, R. XXIII, 48f.,96, I10, 669Schepers, H. 857Schian, R. 5Schilling, M. 732Schings, H. J. 915Schirmer, rü F -?28Schleiermacher, F IXSchleue, H. R. -168Schmidt, E. A. 735Schmidt P G. 883Schmidt P.L. 43,74, 128, 516Schmidl R.W. 764Schmidt, W. l2ISchmidt-Bigge mann,'V.L 7 67Schmidtke, D. 287Schmitt, C. B. J81Schmitt, J.-C. XXm, |U,274,280, 313Schmitz-Kailmann, G. 49Schneider, A. 447Scheider. C. 271,707Schneider, J. 788Schnell, R. 570, 682, 871, IU ISchöne, A. 287, %8Scholtz. G. 28, InsScholz, M. G. 5J-lSchon, P M. 705Schopenhauer, A. XXVIIIf., XXXry
XXXVIII
634
Schrey, H.H. 948Schrimpf, G. 951Schröder, W. 913Schüppert, H. 641, 1196Schulz, F 4Schulz, M. 418Schunck, P 170Schwaibold, M. 566Schwenke, O. I03lSciacca. G.M. 1027Scipio AemilianusAfricanus 347,406, 47 I,
682, 820,920Seel, O. 170, 398,953Seife4 A. 982 (506\, 1005Seigel, J. E. 394 , ffiO,677, 1047Semele 420Semiramis //79Seneca d. A. 256, 429f, 556, 567f., 572,
IU9Senecad. J. 124, 168, 171,205ff.,308f.,375,
395, 401 f., 4l6f.,420f.,443,447 ,487 ,552,57 8,snf ., 464, 47 4, 540, 599, 657, 6ffi, ß 1,780, E36, 843, 846, 696,92t
- Epp. 22, 168, 353, 380,405,421f.,474,598,62sf, 7 r 6f., 73 r, 742, 7s0, 789, 8s2f., 870,877, m4, 1025, II90
- Dial. 16,214,421, 532, 540, II90Servius 147Shakespeare, W. 871, 985Sibylle 166f.Sichel, G. J70aSidonius Apollinaris 953, I 167Silvestre, H. J-18, 561, 822Simon Magus 474Simon von Tournai 284f..491f .Simon. G. /7Simone, F 246Smalley,B. 135,254, 299, 32 l, 338,423, 562,
689.968Smeed, J.W. 574Snell, B. 22.50, 125Söder, R. 27lSokrates 52f., 88,94, 156, 168f., 175, 189,
t92f'f .,205,296ft.,3t9f .,327,340, 402, 43 I,u7, 57 rf ., 2 62, 4 3 31f., 54 5, 60 r, 648a, 882,920,953,958, rl20ff.
Solignac, A. 4NSolinus 653,950Solon 35,515Southern, R. W I I, 135, 24, 26, 28, 325, 564Specht, R. 882 (443)Speyer, W. 824aSpiegel, G. M. /8/, 190, I9Ia, I03ISpitz, H. J. 798
Spitzer', L. 566Spörl, J. 27, 36, 5U,Sprute, J. 433, E57Squire, A. 967Stackelberg, J.von 7lStanford, W.B. 423Starobinski, J. 98JStatius 220Stefan von BesangonSteger,H. 264Stein, P 564Stelzer, W 8Steme, L. 330f., 345. ;Stierle, K. XXII,2O. 4
IU0Stock, B. 371, 553, 5JaStollberg, G. 577Stotz, P 551, 569Strasburger, H. ffiStroux, l. 3,634StrueveE N. S. /0r7Struve, T. 779, 923Studeri B. 203. 232Stürner, W. 412, 5l,6Stump, E. 435Suchomski. J. 350. 59
6t6.688Sueton 332,853Suleiman, S. 320Sulla (u. Marius) 350.3Sulpicius Severus 94, l(
636'Summa philosophiaei sseteste
'Summa Trecensis' 561, tSusanna 256Syrnmachus 127,302
T
Tacchella. E. 574Iälbert, C.H. 271Taylor, A. 337, I0E7Tell, Wilhelm 72f.Terenz 180f., 405,410ff
343,424, s53,635,8%.'Gnatho, Lanvinus. IThraso
Tertullian 86f., 319f.,,f6(Thais 410Thamin, R. 265Theiler, W. 191
9r! t9_i.u:61 ., | 196
6mL .'M1,,' i .'
, l - _ -
nus {incanus Y1 .4M.47 l.)196 9-i-rl l : ; :1-^ ' . lmj,1 tti 6". 1U7
wZ.t. 13f . 556. 56i1.. 57:.
l l . _ :!. 1 -1.
205ff.. 308f..3'15.16f ::."'f . {{3. J.1'. {t?. ,i52.l. 1' r :1r.t. 599. 657, ffi. I I.l \ r . t96.921J_i-: -ri'1 105.121f..171. 5%..13,
't: -50.'E9.852f.. t70.
f tL {_'. -._?_' :10. I I9tL
l ; - . t t - r
bJae:. )i3 l16'F ::. i- '- '
tL--,...! --it -t-'., -r_l&4;'J _i4,'
frtl . - ' '
tf -: i: lrrf . 1-i- lü9"IF I :-. :_'- :"&] rf.xr 4-ll-l L ! ; . , - : 1 : t : . 6a4c t rl - _ -
j
rF
I " -': -'r -'1 -'!. l:-{ -i0.Nr..,bI t i J : . : - " . - : . '
I
Spitzer, L. 566Spörl, J. 27, 366, 564,676,902, 1005Sprute, J. 433,857Squire, A. 967Stackelberg, J.von 742Stanford, W.B. 423Starobinski, J. 98JStatius 220Stefan von Besangon 246Steger,H. 264Stein, P J6CStelzer, W 8Steme, L. 330f., 345,709Stierle, K. XXII,20, 44,283,286, 546,824,
1010Stock, B. 371, 553, 538Stollberg, G. 577stotz. P 551, 569Strasburgeq H. 668Stroux, J. 3,634Struever, N. S. /047Struve, T. 779,923Studeq B. 203,232Stürner, W. 412, 516Stump, E. 435Suchomski, J. 350, 598ft., 147, 569, 614,
6t6. 688Sueton 332,853Suleiman, S. -?20Sulla (u. Marius) 350,354, 430,6E9Sulpicius Severus %, l00ff., 237,249,276,
636'Summa philosophiaei s. Ps. Robert Gros-
seteste'Summa Tieensis' 564, 698Susanna 256Symmachus 127, 302
T
Täcchella, E. 574Tblbe( C.H. 271Taylor, A. 337, 1087Tell, Wilhelm 72f.Terenz 180f., 405, 410ff., 475, 510, 553ff.,
343, 424, s53, 63s, 896, %2, r05If,,s.auchGnatho, Lanvinus, Parmenio, Thais.Thraso
Tertullian 86f., 319f., 460,2l I, 265, 950Thais 410Thamin, R. 265Theiler. W 19/,
Themistokles 211f., 347, 920, 988Theobald von Canterbury 564Theodeich 977Theodorich (Theodoricus, Thierry) von
Chartres 307 fl., 574, 58 l, 599f., 803, E82,976
Theodosius 175, 203f., 513f.,346, 357, %5Theophilus l0lTheophrast 574Theuerkauf, G. JJ8Thieme. K. 528, IU4Thierry, s. TheodorichThomas von Aquin y'50Thomas Becket von Canterbury 63, 165,
207,293f .,315f .,322f .,336,349f., 574, 580,631, 63sf., 6s4
Thomas von Irland -12-lThomasin von ZerkJaere 428Thomsen, O. 681Thomson, R. M. 401, 669, 734, 835, 842,
96s, 1028, 1085Thraede, K. 1025Thraso 410Throm, H. 249ff.,545Thuasne, L. 481Thukydides XXX, 517f., 366, 418, 997,
r008Tiberius 170Tillietre. J.-Y. 528, 530Titus 340,920Tobias 944Todoroq l. I0l2Tolan, E. K. 573Toumon, A. 567a, 585, 593, 657, 697, 706,
1032Traian 174, 518,922, s. auch Ps. PlutarchTrillitzsch, W. 68/Trimpi, W 620, 550, 554, 562Trompl G. 1006Troncarelli, E 9J1Tübach, F. 144,3/'5
U
Udenius, J.C. 915Uhlig, C. 31, 34,46, 577Ullmann, B.L. 892Ullmann, W 559, 34, 340Unamuno, M. de Ia0IUrban II. 211Ure,P 509Urias 184f., 6Jd
t 4 - . :l E ! : t 1 : . ! 9 l f
635
vVacarius 2'll, 564Vacca (Lucan-Scholiast) J02Valerius Maximus 69,124f., 132f., l35ff.,
153, 157ff., 2n,22tf .,229f., 305, 3l lff.,314f., 317, 342. 359f.,416, 515, 563, 585,38, t64, 279, 339, 342, 347, 395,400,4t0,483, 635, 6ffi, 698, 7m, 724, 77 I, 820, 823,921,960, t064
Valöry P 342Valla, L. 19, 308ff., 423, ffiO, 1014, 1020,
1033Van der Nat"G. 424Varro, T. 168f.,385, 398,400, 5U, 748Varwig, F R. 528Vegetius l46f .,169, ffi3Vergil XXI 166f., 169, 174f., 179f., 189,
227ft'354,396, 562, 338, 392, 5U, 518,6t4, 797, 892, 977, I 179, I 192
Verweyen, T. 46, 299Vespasian 288Viane, S. 9,1-iVico, G. B. XVIIf., 308f., 384,386, ffi I, 7 3 5,
769, t005, t02lVictorinus 146, 611, 1192Vidmanova, A. 986Viehweg, T. 3, 601Villon, F 48lVinaver, E. 570Vinzenz von Beauvais XXV XXX[.
139ff.,418, 264, 337, 364, 5t7, 536, 542,720, 807, 91 3, 1089, 1099
Yiola,C. 562Vitale-Brovarone, A. 99, I10, 294Vittinghofl, E 20lVives, J. L. 1025Voci, A. M. I0I4Vogel, C. de 977YoggJ. 170Vogüö, A. de 240, 307Volkmann, H. I08Ivon den Steinen, rrV 339f., J5, I 62, 252, 569,
664,746, 883, e65, 979Voss, B. R. 236Vossius, G. J. 214tfulteius 63,1
wWaddell, H. 45, 1038Wagner, F. lA4Wagner, R. XXXX
636
Walbank, F.W. 125Walter Burley XXV 140, 1059Walter Map 136, 322f., 537, 540'Waltharius' 570aWafther, H. 668Ward, J. O. 547, 1053Waichez, J. 572Waming, R. 570aWanen Hollister, C. 964aWaszink, J.W. 125Webb, C. 558,560, 28,978, 10ffiWeber, Max 318WedetH. 77Wehle,W. 101 IWehrli, M. 55, 570a, 571, 732Weigand, R. 882Weimar, P 550, 566Weinreich, O. 50,,Weinrich, H, 85, IffiWeischedel, W. 172Weisheipl, A. 544aWelles. C.B. 22Welter, J. T XXII, 134f., 587, 99, l0IWemer, E. 883Wesselski, A. 315Westra, H. 620Wetherbee, W. 3%,775White, H. 620Whitehead, A. N. IX, XLV ffiIWiedemann. C. 765Wilhelm von Auvergne 287,430,912Wilhelm Bnto I9IaWilhelm von Conches 36ff., 392, 541,
553, 58t, 707, 747, 822, 887, 896,976,978Wilhelm der Eroberer 6y'1Wilhelm von Malmesbury 136, 360, 563ff.,
191 a, 243, 327, 4 1 8, 51 8, 7 1 3, 77 1, 965Wilhelm von Ockham XLV935,965, 1022Wilhelm von Poitiers 641Wilhelm Rufus 2M, 191aWilhefm von Tyrus 552a,753Wilks, E. H. 520Wilks, M. 546,878aWilliard, C.C. 642Willms, H. 125Wilson, B. 620Wilson, K. M. 620Winterbottom, M. J50Wisman,l.-A, ffi3witt, R. G. 1024Wittgenstein, L. 238Wolff, C. 368Wolfram. H. 264Wolfram von Eschenbach XXXIY 571
Wolpers, T. 2J2Worstbrock, F. l. 519Würzbach, N. J71, -r
x t Y
Xenokrates 169Xenophon 439Xerxes 7, 2l IYates, F A. 724, 874
Job 7.1 146,986Job 39.34 166Prov.8. l5 175,567.5 'Sap. 7. 17ff. 437,56't.Eccles. l. l0 1009Eccles. 1. 14 983Dan.12.4 381,753Rom. 1.20 155f., 372.
t00t
3 . S
Policraticus
Prol. I
45-6810l ll 3
154, 198.38(563,567.5 ' l418,43t ,45780, 807, 8l105r, I t08I t083ffi,47r, 62J4t6354, 826, 78'77t748503a26,5A?t7 sM487395358, 502, 68'430, 636.9&380,422, 7)4
i l 2I I 4I I I II I 13I I 15I I 16I I 17
r t - ' i
x\\. 110. 10J916. 3::i.. 537,5407f-'at617 ' t i-?V:/ I , JJ
ctC 964a/_. r
,56:,. -'8, 978, 10ffil 8
II: ' ; , . < 7 t 7 2 )
B-'t.:t_4'5t.l
l: i4rI r - lJ44auxi l . r31f. ,587,99, t01I3l :D
39t "5
Wolpers, T 232Worstbrock, F. J. 519Würzbach, N. 371, 572
x t Y
Xenokrates 169Xenophon 439Xerxes 7, 2l IYates, F A. 724, 874
Job 7.1 146,986Job 39.34 166Prov. 8.15 175, 567, 572, 57 5Sap. 7. 17ff 437,567, 735, 878Eccles. 1. l0 lN9Eccles. 1.14 983Dan.12.4 381,753Rom. 1.20 155f.,372,377, 388, 367f., 983,
t00r
Policraticus
Prol. I 154, 198,386f.,392ff.,402ff,548,563,567,575ff., 586f., 366, 370,418, 43t, 45t, 462, 474, 658, 724,780, 807, 809, 940, 1025, 1043,
zZacharias/Elisabeth 335Zanoletti, G. 343Zeno von Elea 156.205Zeno von Yerona 949Ziltener,W. 106Zimmermann, H. JJOZimmermann,M. 315, IUIZink,M. 872Zinn, G. A. 369Zoepffel, R. 38, 94, 129,495,498, 1006Zorzetti,N. 277Zulueta, F. de. 564Zumthoq P XLIY 528, 760,948
2. Bibelstellen
Rom. 2.14-6 435ff., 437f., 485, 878aRom. 15.4 185f., 360, 37lf.,456,540,430,
880.973lCor.8. l 877I Cor. l0 . l l 515I Cor. 13.12 305Jac.1.22 165ffT i t . l .15 373
287,430,9t2
XXXn. JZi
105r, il08I 108360, 47t, 629, 654416354, 826, 787771748503a26, 504353, 504487395358, 502, 687430, 636, 984380, 422, 724
3. Stellen aus den Werken Johanns von Salisbury
631
t)tc:l H ' ( .
tC:91> * -
I
7! : . - : . . : :
J]t
5-68 ' �l0l ll 3
i l 2I I 4I I 1 1I I 13I I 15I I 16I I I7
I I l8 351,68sII 19 5Mrr2t I00tll22 5, 395, 58t, 639, 100trr25 357. 630.654il26 485,509ll27 354, 470, 5A, ß1, 692, 877, 88t,
951I I 28 346,348,62t ,698III I 666.732.752III 3 827III 4 476,827,834I I I 5 Jilr7 508fi.,4/t 420, 5r3, 809, 9s7III 8 508ff., -r28, 734, 973rrr 9 508fT.,667, 892,920,974I I I l0 687,938I I I 1 l f . 472I I I14 346,413,471,481,690
IV3 347,426,738,958,945,960f.,964,974
rv 4 347,4t6,420,621ry 5 346, 58e, 5t0f.,636IV 6 575, 346, 4t4, 464, 654, 698, 724,
890, 945, 97 t, 974, 979, 993rv 7 881IV 8 347rv ll 35tft., 357, 527, 593, 697, %6f.,
vlr 13 347, 799, 940f., 995vrr 14 397f.uI 15 472.977vtl 17 942, il12f.vII 19 347,477, 533, 640, 643,654, tA8vII 20 347,640VII2I I9l avII 23 398,1050, IIrIvil24 533vII 25 3t5ff.,6l4fL, 696Prol. VIII580uil I 827,834VI I I2 951vflt 3 ]052ut l5 950VIII 6 398,411,690a, 1072vlll 7 346, 394f,462,638,692,798vlrr 8 527,920,930vrrr 9 470ff .,400, 930f1.U\4II l0 315ff.,614, 617, 742UVIII ll 509, ffi6,696,771,829,920VIII 12 771VIII 13 469,492, 888, 890,9t9,944VIII 14 347,486, ffil II48vrrr 18 357,683,696,748vrrl l9 346, 35s, 358,459,484,637VIII 20 358, 3ffi, 632, 696,724,928vtII 2l 355,465,489, 533, 542,641,748vIIr 23 399,406, 534,653, 593, 894,95rvrrr 24 3erff., 423, 8e2vtlr 25 573f., 579fr., 389f., 397,645,877,
920a, 974, I 162, I 167f.
Metalogicon
hot. 394, 579, 591, 631, 7 12, 902, 1055,1085
r l 8 8 2t4 354,107316 984I l0 544a,1073r 14 982I 19 738rzt 751| 22 397, 422, 540, 748, 843, 877124 399, 423, 550, 668, 724, 797, 833,
903t73 696II I 977Ir2 398.564II 3 J8-'II 8 1167II 9 554, s76II l0 576
I I 12 554,859rr 13 586rI 15 s54tI t7 352, 753I[20 198,352, 575Prol.l l l 475,537,756.I [ I I I 748,751,753.rII 4 s35f., 538, t
898,9AIII 5 442,544,5yr I I6 587,755, Wi .III 9 869,885III l0 426,433,415.
738, 752f., 851tv 7 544, 564, 7E7M 351,874ry l0 9f., 18,874, t,IV 16 731IY 20 883IV 30 598IV 31 593,595IV 32 895,982IV 35 982f.M6 ntIV 40 397rv 42 534
Entheticus maior
IV 12Prol.YV Iv 2v 4V 5V 6v 7V 8V 9v l 0v l lv t 2v 1 6v 1 7Prol.Ylu lV I 4V I 6VI 15VI 16vt 17VI 18VI 19VI20v I 2 lv t22w24w25w27VI28Prol.Yllu t lv]t2VI I3u r 5VI I6V I I8V I I9
974358, 462880892I I083477246s4,738,93i ,483, ffi2,748354394, 564420,480, 5779 t9682, 7 r69 t9353, 397, 4U, I I 17787792578357353, 6963473s7f., 4661J., 49r7, 349, 357, 399,42t, 578347,45t ,779968412, 882346,4235r3ff.,534, rr10882473423, 472s2sf., 732359,483, 59rs78f, 5e0lI., seslI.635398,485,890ff., rrqe395, 544,939580177f'f.,575,579, 346, 398, 420ff.,45 r, 537, 579, 744, 74Ef., 767, 877,
43ff. 896ll3f. 798l88ff. 427,738u3ff. 798609ff 883
882, rr08ul l0 368 - 392, I9ta., 73[f., 742f.,
8 r 3, 852f., 882, 9s t, 970vII l2 3%, 64t,724, 73tf., 896,912,984
638
Ex: Exemplum, Exr
A
abbraiatio 62ff., s. aucUmfang
Aberglaube XLl, 12, Z631, 692
Abstraktion IX, XLV. s. rBesonderes, Subsump
academicus 296f.. 305f..I I 10, s. auch Skepsis
actio/contemplatio 56acutus 562,609Adäquatheit, Sachdienir
l99ff., 218, 320. s. aucl
rg9 ".t,',; 995
t7'l l i : 'li- ._r_r u0. 643. 654, 1048,lt.
t0: : i l1
A ; 1,a' 696
L]J
11. t7 }a 107219t ' 162.638.692,798,2! i_tt l'
1 , t , Q l f t l f
- 6 r l 617 ,742ah 196. 171, 829,920
t9: \88. 8m, 919, %4JE6 tt3, ll48,83 tE6.748t-i-i,?-i8. 459, 484, 637,a. ,3). 696, 724,928t6: 189. 533, 542, 641,748){r :31 653. 593,894,951r J ' ? q q . r
, 5-arT. 389f., 397, 645, 877.,9-1 t162, 1167f .
,7t :e1. 63 t, 7 12, 902, l,055,
fu-_t
I , - i
1'.,. '48, 843, 877: i,,t 668. 724, 797, 833,
x*
rr 12 554, 859rr 13 586II 15 554II l7 352,753II 20 t88,352, 575Prol.Ill 475, 537, 756, 895, 902II I I 748,75t,7ß,8n,912rrr 4 s3sf., s38, 540, 686, 7ssf., a3,
898,984III 5 442, 544, 554III 6 587, 755,9m, 1022III 9 869,885[III l0 426,433,445, 544,547f.,586,598,
738, 752f., 856lv 7 544,564,787IV 9 351,874ry l0 9f. , 18,874,/106IV 16 731IV 20 883IV 30 598Ml 593,595tv 32 895,982rv 35 e82f.IV36 Wrv 40 397rY 42 534
Entheticus maior
43ff. 896113f. 798l88ff. 427,738443ff. 798609ff. 883
831ff 398881ff 823t267f. 8901475ff. 6t2
Entheticus minor
573ff. 645, 689,771
Epistolae
r44 405152 388r72 578176 654185 27,387187 360209 5,329217 r, 1055225 635242 4f.246 620256 564,886276 232,635,877288 233,636
Historia Pontihcalis
503, 2 3, 25, 367, 4 t 8, 746, 748, 880
Vita Anselmi
A
abbraiatio 62ff., s. auch commemoratio,Urnfang
Aberglaube XLl, 12,206, 220,320, 5U,63t.692
Abstraktion IX, XLY s. auch Allgmeines/Besonderes, Subsumption
academicus 296f., 305f., 395, 579ff., 819,I I 10, s. auch Skepsis
actio/contemplatio 568acutus 562,609Adäquatheit, Sachdienlichkeit der Exx
199ff., 218. 320. s. auch convenientia
396
Adel, Adelskritik 74, 132f, 137, 219ff.,476f.
Adelsliteratur 124. 137. 600ff.admiratio 389, s. auch imitatioaedificatio 345, 364, 4 18aemulatio s. imitatioaemul tFormel 405ff., 4l0ff.aequ itas 250, 322f ., 354, 441ff ., 87 8aAffektstimulierung 196ff., 251, s. auch
Pathos, PsychagogikAhnen, Ahnenexempla 61ff., 66, 70ft.,79,
8lff., 84, 93, 100ff., 107,328,589tr,262s. auch mos maiorum
ainos (Fabel) 32ff., 51,314
4. Sachen, Begrifie, TerminiEx - Exemplum, Exx: Exempla. Bildsprachliche Lemmata in Anfiihrungszeichen.
t-
639
alienatio 444ff.. 510f.alieniloquium 158Allegorie, Allegorese 73, 183ff., 331i., 335,
390ff., 455i., 470ff., 475ff., 494, 538t,540t, 1J8, 287, 345, 424f., 429f., 664, 731,7 38, 777, 779, 80 1, 9 1 2, 945, 949, 970, 982,s. auch Schriftsinne
Allgemeines/Besonderes, Regel/Fall IX,17ff.,26ff.,38f., 190, 503n, 5l6ft
Als-Ob s. F ik t ionAlterität 79,276,393, 537ff., 540ff., 1011Ambiguität 281ff.,305ambitio 414,569,942Ambivalenz (der Exx) 184ff., 267ff.,
318ff., 322ff , 338ff., 342ff., 357f.- in utramque partem 250, 253ff., 260,
27 rft.,279ff.,284f., 307i., 325, 342fr., 353,362ft., 426,43 1, 433i., 469 . 5 56, 562, 5 7 0a,579, 657, 764, s. auch suasio/dissuasio,Polyvalenz / Widerspruch
amp I ificat io, di I aratio 200f ,329f1.,332,346,287, 858, 867f, s. digressio, Umfang
Anachronismus 2l I f., 346,393,537i., 540,546,486, 636, 822, 942, 953, e65, 1031,1U7
ancilla theologiae 297 f .Anekdote 35, 66ff., 164ff, 169ff., l72ff.,
3t7, 384f.,40ef.- Wanderanekdoten 36, 226f ., 484, 5 1 8Anonymität XXVI, 80, 100, 109ff, 115f.,
122, 158i., 163,210ft 402ff., vgl. Namhaf-tigkeit
Anschaulichkeit 89f., 91ff., 128i., 155,l80t , l96ff., 232ft.,373f .,434.530ff., 542,431a,449f.,455, s. auch evidentia
Anspielung s. Leserkompeteflz, commemo-ratio
Anstandslehre 312, 4701., 601, s. auchKlugheit
Antike: A. und Christentum XL. 81ff..303ff., 388ff., 435ff., 454ff., 496ff., 547ff.
- A.-Rezeption XIf., 14i., 346, 393, 413-21, 435fr., 502, 533ff., 537 46,549ft, 603,s. auch imitatio, usus. Herrschaft
antiqui/ modernl 54, 238ff., 243,349,381f.,43s,449,4s2r.,537 ,547 ff.,882, 894f., e02,.1028 s. auch Neuheit, Kontinuilät, Zwer-ge / Riesen
Antonomasie,Vossianische A . 64,344,596Apathia 171,322f.,350, 433, 635, 872Apokatastasis 74Apokryph, rgzotus auctor 213f .,406ft.,820,
vgl. Authentizitätapologus, apologatio 34f., 51, 148f., 221,
640
225,60r f . ,513Apomnemoneuma l6lf.Apophthegma 35, 1 10, 128, 132, 140, 161,
1't2fl., 312. 37 3f., 385, 4 I 0Aporetik s. dubietasAposiopese 352, 365, 494f. 497., 696, s.
auch C h ri s t o remo to, praeterspirituellargumentum: Erzäh-lart 60f., 148f., 214ff.,
231ff., 314,406f1.410 (comedia), 125, 147,608, 82 1, 833, I 206, s. auch genera narra-tionis
- Argument 621, 861, (vgl. auctoritas)- a.ad hominem77,207- a.e sil entio 334f ., 944- Argumentative Exx s. Beweis, Vergleichargutia, argutius, argurere 312ff., 406f.,
41 1f., 483f., 608, 834f., e57ars 391,445,347, 5l l, 747, 779- 294f . (a.artium, a.vivendi)- d.vs cd.rus 544, 779- a.vs. ll.rr./s 169,257,290ff.,376f., 553, 575,
578. 779. s. Theorie/ Praxisartes: a.liberales 456f., 544a- a.sermocinales 195, 246, s. Trivium- a.vs.auctores 415ff., 4l8ft, 542tr.,848- a.dictandi 557, historicae 1004, poeticae
706, 1037, praedicandi 344f ., 277Askese 374,475, 637Astrologie 5l9f .,504Ataraxie 17lAtheismus 502aucto4 auctores l57ff., 189, 206f ., 210, 223,
23rff., 238ff., 358, 360, 400, 402ff., 408,41 5, 4 1 8i., 42 1 ff., 477 ff .,534, 540f., 547ff.,374, 377f., 430, 472ff., 477, 538, 64 t, 729,823,896,898,966, s. auch artes, Autorin-tention, Anonymität, Namhaftigkeit,Apokryph, scriptor
auctoritas, Autorität xx, xxu, 72, 83f.,104, 122, l58ft , 20 l ff., 2 13, 238ff., 263ff.,268ff., 318ff., 323f ., 327 f ., 331, 375, 405,426, 515,553i., 580, s. auch Argument,Zitat
- a. / ratio(veritas)239f., 2 I0a, 743- a.exempli54,65f., 68ff., l45ff., 3f., 643Auferstehungsbeweis 82, 91f.Aufmerksamkeitsenegung vs. Ermüdung
197ff., 475ff, 60tf.450, 508, 874, 92t,12l0,s.auch varietas
Auge(n) s. Anschaulichkeit, Augenzeuge,Autopsie, Erkenntnis, evidentia
Augenzeuge, Augenzeugenschaft 96f.,99, 1 1 0, 206, 2 1 2f ., 2r8f ., 222t., 234ft. 29 t,487,490, t017
Authentizität" authen2t3ff ., 224, 232ff .. 3 7 :keit
Autobiographisches I335ff., 535f., s. aucexemplum
Autopsie 23f.,96f., 23Augeweuge, aidcat
Autorintention 367f.. 3423,472,912
B
Babylon, babylonisch :Barock, Barockforschu
954Bedeutungsviefalt s. F-Begegnung"/Ex 24ff.Beichte s. Buße, corfasBeispiel 26ff., - B.{rnr
40ff., 70ff.. 122. 5S3-trgeben 71 Lff', 293frgemeinschaft 70ff.. 93
Beispiellosigkeit D(f., )521,555,567, J6. s. aucWiederholbarkeit
Bekehrung 98ff., 109. ZBeweis vs. Vorbild (argr
lische Exx) 67ff.. 71. gs. auch p ro b at io, yertJ,
Bibel l5l, 184,263.351ft456ff.,478f., s. auch Oltb Schriftsinne
,,Bienen' 175, 375f.. 3n.Bildhaftigkeit s. Ansctu
Denkbld, pictura,,Bildnis', "Standbild" X
590f.Bildungsgeschichte 256f
357Bildungsideal, BilduncsDr
202f ., 250f ., 350f., i6i436ff., 453ff., 485f., 752
Biog;raphie, Biographisctl l0, 16l, 172ff., 517. 5t1
Blasphemie 476ff., 4gt. gBonmot 16l.3llff.Brief 129, t42, 256f.. 2621brocarda, brocardico 274fr,Buch" 232f' 369, 561fr..
Erfahrung 232f.- B. der Geschichre I I f.. i
16, 369ff., 3g9ff.. 442f..3r3, 361, 364, 666, U2, e
_i, .'
ne :n : l 6 l f .m - r i . 110. 128, 132, 140, 161,
2 - 2 , l R \ 4 l n
du: .e tas-1::. 165. 494f., 491., 696, s.vc . e4o t o. praeterspirituell: Ezahlan 60t, 148f., 214ff. ,,+.,tt-f . 1l0/co media), 125, 147,13: . :' tö. s. auch genera narra-
|ö:. i6L (vgl. auctori tas)u*
-11.20' l
r l - :-1: . 94-1Ir ; : Exx s. Beweis, VergleichrI:t. arglrere 3l2fi.. 406f.,' : t
t \ 3 4 f . . 9 5 7; _2.t- i I l .
'47, 779at *. ; r 'nendi)sJJ
--9
l6n : i - . :90 f f . .376f . . 553, 575,, T - : - : : e / P r a x i sdt : ioi . i44a!r: .n5. l-16. s. Triviumm : i :T. 118ff . 542f1.. 848::- . . : :Dncae l0U, poeticae
P ' : , : . :nd t 311f . .277l - i ^ : -
i ln: . ' JIt{:l e . : - 1 . . 8 9 . : 0 6 f . 1 1 0 . 2 2 3 .F :r: . - : tJ, ' . . !-r i . {r l tT.. 408.a:. " :--f i - lJ j !- ' f . i {7ff . .1 : : - : : ' r - - . : 3 t 6 1 1 . ' ) 9 .ts - - ' . i - - : . - ; ' re . i . \u tonn-f , :
- . - - * \ :nnat i rgke i lI
f : ' " - - . - ' . 'hr : - - : \ \ \ \ \1 .
-1. 83i . .
F-- : - :. -: :-:3:T. :63ff..
F , : , ' . ' : - : : - : - . l - 5 . 105 ,L<-- ' r : : . - - : \ :gument ,I
r r : - . . : j . - ' , j - J - ?
| : : ' : . i := . { : : . 3 i . . 643! . i : - : ' ! 1 . : , :l : - . , . - . t - : j : : Ermüdungf r ' :-'-' -;,.; 874, 921,ü - - . ' : '
F - . - : - { 3 ' - . \ ugenzeuge ,E ; l , - - ' - : r , i ? n l t a
: - . : - - - i - r i t schaf t 96 t ,- : : ' : : : i . 2 3 4 f f . , 2 9 1 ,
Auth-ertizität authentica persona 159f,213ff.,224,232ff., -?Zl, s. auih NamhaftilJkeit
Aulobiographisches 100, 129,233f1., 2glf .,335ff., 535f., s. auch confessio, Selbstlexemplum
Autopsie 23f., 96f., 231ff ., 527ff., 542f.. s.Augenzeuge, aidentia
Autorintentio n 367 f ., 3gg, 397ff., 412, 417,423.472. 9r2
B
Babylon, babylonisch 303, 451, 467, 503f.Barock, BarocKonchunC XLi q84, Sli,
954Bedeutungsvielfalt s. polyvalenz-Begegnung"/Ex 241f, SlS, SAOBeichte s. Buße. confesstoBeispiel 26f,f ., - B.-irgur/ B.+nählung 25,
40.ff., 701_f., 122, 583:ff., 595ff. :ü;ie;:geben 71 168, 293ff., 5ll, 569 _'B._gemeinschalt 70ff.. 93ff.
BeiTie_ll-ojiekeit_ IXf., XIXf., XXVI, 5 I 7,5_2_1,555,567, J8, s. auch Individuum, vgl.Wiederholbarkeit
Bekehrung 98ff., 109, 233ft.. 4/r6f.Beweis vs. Vorbild (argumentative/ mora_
lische.Exx) 67ft.,7l, g4f.,91, lggf., 164,s. auch probatio, Vergleich
Bibel l5l, 184,263, 35Ih. 36ff..397.437t..456ff., 478f., s. auch Offenb rrung,' äur)tt4 Schriftsinne
di-..n.ll r7 5. 37 sf ., 397, 420f ., 568Bil_dhaftigkeit s. Anschaulic l*eit" imago,
Der*bild,, pictura,"Bildnis', "Standbild" XI, 66ff., 70, 577,
590f.Bil-dungsgeschichte 256f.., 262ff., 26gff.,
357Bildungsideal, Bildungspropaganda l9gf.,
?g?f:2!gf_3fg{., 56i, teI. qozr., Äö"436ff., 453ff., 48sf., 7s2, 984
BiggfqT-e._niosraphisches 66, 71, 103,_. 1 10, 16l, l72fL, 517, 5gg, 1026Blasphemie 47 6f,t., 4gl. 95 2Bonmot 16l.3llff.Brief 129, t42,256f.,262f.. I02Sbycqrda, brocardica 27 4ff ., 56 1, 566"B!.ll 232f.,369,561ff., s73ff. _ B. der
tsrtahrung 232f.- B. der Geschichte I I f., ZJJ - Naturbuch
16,-369ff., 389ff., U2f.,473, 508ff., 287,3r3, 361, 364, 666, 882. s85
Buchtitel s. TitelgebungBuße, Bußpraxis 821
ccalliditas 3l1ff., 411f., 4g7captatio benanlentiae s. insinuatiocaszs, Kasus, FaX 2ff.,26ff., 139.229.27Sf.^
:)8fr.;3]2,360ff., 431, s26, 6s,. .u.r,Kasutstrk, ars / casus, Zufall
causa/E_x 258ff., 286ff., 331,554f.,1206, s.auch Hypothesis
causae secandae 391,966, 1002causidicas 265cautela 367,418,420ce2yyrldu-bryn 2, 4f ., 31, 62, l0g, l g9, 201,2:^2ff., 3\0, 331f., sss, zn, isqf.,' sai,
frof' r05scharacteismus II92Chartres, Schule von Ch. 296f.,3%, SS3,- 581,747,887,913,978, rMg, i rD 'Chie,-chia, y1tls 35, t6tff., 244f., 425,
379fr, 540, 556Clnsto remoto 285, 493, 9('f., 97 4Chistus uemplum 78f., g3ff., ggff.. 99ff.-
1lZ,.3l?t, 32ef., 338f., 3350, 433,470f.;lry!:, !94f.,sOr, re2, 2 tna, 2 i7, soz, osi,e46l, e7e
circTtmstantiae s. Umständeciv iJ js, c yi I itqs t7 4 f ., 3 t2ff ., 470f., 568, 57 l,
573, ffi4, 882.906clavß discendi/sapientiae XXXry 269,
474,515, 562clementia, mansuetudo ßg. n6clenci 951, s. philosophi, politici, Intellek-
tuelledierya, ,,Klienten" 392-401, 404, 533f.,
s64,579Code-Wechsel 333ff., 46g, 475ff., s. auchyenremdungcot!gy!o_(c9nlgy,o) 58ff, 29Sf., Smf., t14,
570, 720. 753collisio 580 753comedia, comedi, comici 2X), 445, 4g4,
tgtft2 423' s6e, s74, 77r, 787, b85,- s'.Komtidie
comes 393,787acoyyn1morgtio XI, 50, 59, 61ff., 162 (fiir
Chrie).593fcommunio sanctorum 93ff., l0l. 103comparabile 591f.. Il4comparatio 58ff.,95clnOendlun 566, 8/j (für paraphrase)uoncettismus 484
t :] ' -
641
concordia discors 263f, 558confessio 129,208,530confirmatio 67f.conformatio, simplasis 874coniectura 423consensus omnium s. Konsensconsilium lf.consuetudo s. Gewohnheitcontemplatio 510,774, s. auch cctio'contemptus mundi 4/,sf., 978, 985f.' 992,
s. auch vanitascontroversia 30f., 256, 2fi,268,285, 288f.,
313, 321ff.,344ff., 353, 55Lfr., 554f., ffi6,669, 726, s. auch Disputation" drclamatio
convenientia 189, 192, 19f., 440, 433, s.Adäquatheit
copia (uemplorum, rationun) 31f., 329,342ff., 384ff., 4 26, 430ff ., 47 2f ., 564f ., fi2,r 3 t. 598, 64 3, 705, 7 5 3, 7 68f., 869, s. auchiwentio, ToPik, Vonat
Corni,ficiani 195, 250f., 415, 559, 574f', s'auch Comiftcius (Reg. l)
corpus Chisti trrystiilm 74,93, l0lf'' 46f,965
caia vs. philosophia 157,292ff., 3 12, 336f.,392, 552{T., 559 ,561,569,5'12,577f., 581f.,372, 577f., s. auch Hofkritik
curialis. carialitas ffi4, 93 1cuiositas l7l, 360ff., 379, 422, s. auchWis-
senschaftskritik
D
Dqembi libertas s. libertasDecknamen s. Namendelamatio 30.244.256f .,275, 278ff-, 285ff.,
321 f., 361, 1 68, 669, 69T,s. auch co ntrover'sia. suasoia
dehortatio s. suasio / dissuasioDekadenz s. Niedergangdel qtatio s. imitatio, utilitas, Unterhaltungdemonstratio 91,529f.Denkbild 199, 337ff., 664, 920Denkwürdigkeit 132, 153, 155ff., 199,
2081T., 219ff., 157, 366, /033, s. auchmemorabile, vgl. Faktizität" HistorizitätWahrheit
dacriptio 146,592f ., 354despicere mundum 988dantio moderna 405, 599diacisis 668Dialektik 246t1.,265tr.,306, 543 * D./Rhe-
torik Xf., 189ff., 195ff.' 248ff., 260ff., 299'544a. 859
642
Dialog XXXff , 174, 192f1.,246ff.,253ff .,281ff, 290ff, 335f., 355f.,401, 406ff., 535,545, s60, 580, 7UL, 706, 725, 820fr,973s. auch Konversation, Disput Fiktion(fictus intul oantor), sermocinatio
- D. mit Toten 529, 534f. - Selbsqespräch253,291f.,552
,piamanf E69biatribe 79, 109, 123f., 128,1631T., 26lf',
288ff.,353, 958dicta s. facta / dictaDienst s. Hemchaftdffical tas / obscuntas (Ventändnisschwie-
rigkeit als Wert) l85lf., 268ff., 2'15f.,4'18f., 430, 567, v$. Ambivalenz, Polyva'lenz, Widenpruch
digressio, Exkurs 2A0, 317, 332, 350f .' I 50,457,706, II92
dilatatio s. amplificatio, modi dilatandidilucidatio (rheL) 448, 450-Disjunktionsprinzip" 463, 537dßpositio (rhet), Komposition 15ff., 138,
288f., 342ff., 355f., 362f., 560ff.- Dispositionsmeapheq Rahmengleichnis
464ff.,488f., 509,986Disput(ation), Streitgespräch 194ff.,
246ff ., 252ff ., 533, 370, 566, 567 a, 57 3f'dissimulatio 6IIdissuasio s. suasio/d.diversi, non adversi 261 , 561, m4diversitas s. Polyvalenz, Widenpruchdocumentum({ür Ex) I't4f.domesticalsterna mc 189f., 203f., 2M,
347,464,92Doxographie l63lf., 170f., 291Drama 550, 552, 569,834dubietas, dubitatio, dubitabile, Aporetik
xIXf., l, 92,288,295f., 432f.,490, 555,562, 570, 706, 7 I 7,s. auch certum, Skepsis,Widerspruch
dynastische Exx 74, 124,477f1, vgl' Adel'Ahnen
E
üisies ll90Ehe 313f.,335Eigenschaftsverkörperung s. Synekdocheeikon 55f.,583,587, 590f., s. avch imagoEinheit (das Eine) vs. Vielheit Vielfalt
xIIIf., 5lo, 513, 5l8l; s&ff,573,757- E. des Glaubens 441. 54lm 895- E. der
Wissenschaft 303. 435ff., 451, 467, 582,923
Einmaligkeit (hisL) s.Emblematik 117ff.. 3
732. E69Endoxa 4,196,245f.:
426, s. Topik, Konxenergia/ enaryeia l97l
didentiaEntdeckung s. InvenüEntfremdung s. alienoEnthymem 51,1t8ff.Enrwicklung (hisr) X
s. auch Fortschrin Ischichte, vgl. Wiede
Enzyklopädik 244.26418,430, 56f..337.Kompilatorik. Polytr
qicarei s. Epikur (RegEpimythion s. LehrhalEpitaph 70Epochen (Schwellea
schiede) XIIf., X!xlrf., 19II., 133. 521s. auch Gattung
Erbauung ll l f.,5t6. sErbfolge 476f.. %7Ereignisvermerk 149,
tio, abbraiatio,UnfiErfahrung, qpeientt4
79,t65,232,257,5041359,755, s. auch Aur
Erhndung s. InventionEristik 249ff., 279ft.. ZErkenntnis (theoret. p
147, lggff., 195ff., :451,498, 503ff., 530f874, s. auch imginartrung
Enählung ss. KurzgeGeschichtenerzählen
, f , ,se l 227,518,1148'essample'(afr.) 46f.Essay 21, 161,287,300Ethik 443,488ff.572f..Ethopoeie 254.256f .. 41
Prosopopoeie, Fiktiordentia
Etymologie als Topos Iaidentia 83, 89,98, l97l
(inductio sub octtlis)accerptor 362f.accutere auctores 39 fr .,uemplar l4/�f.,147,ffiacemplum, Exemplum
57 f ., 126tr., 144ff., l5t,870
, lr1. 192ff., 246ff.,253ff.,135f.. 355f., 401, 4061T., 535,7r/.f., 706, 725, 820f.,973ErsauorL Disput FiktionJor), sermocinatiot29. 534i. - SelbstgesPrächI
,. l:3f.. 128, l63ff., 261f.,üdctüafi
nra r (Versländnisschwie-Ienr 185ff, 268ff., 2'15f.,7, vgj. Ambivalenz, PolYva-ruchr 200. 317, 332,350f., 150,tfficatto, modi dilatandiL) uE.450fuzrp' 463,537l. Komposition 15ff., 138,lssf. 362f., 560ff.leupher RahmengleichnisW . 9 E 6
Sreitgespräch 194ff,5J-:. -?'0, 566, 567a, 573f.nw drn: 16-. 5il, m1)raier"z. Widerspruchh Er l*tf.bc grr 189f.. 203f.. 204,
i -0 f . .291tv
Cubnabile Aporetitta5f. 132f.. 490. 555.iuchcertum Skepsis,
-1 ,:{. 4r?ff.. vgl Adcl,
Einmaligkeir (hist.) s. BeispiellosigkeitEmblematik fiiff, 33i, 339f., 369f., 4s3,
732. 869Endoxa 4, 196, 24Sf , 252, 2g9ft., 3lgf ., 327,
426, s. Topik, Konsens, vgl. paradoxenetgialenargeia 197f., 241f., 244, 66g, s.
aidentiaEntdeckung s. InventionEntfremdung s. al ienatioEnthymem 51, 188ff., SS5, gS7Ennricklung (hist.) XVf.,203, 516ff., 525,
s luch Fortschritt, Niedergang, Heilsge-schichte, vgl. Wiederholbarkeit
Enzyklopädik 244, 264, 362f .,375ff., 378ff .418,430, sff,f.,337, 748, z6Z.869, s. auchKompilatorik, Polyhistorismus
epicarei s. Epikur (Reg. l)Epimythion s. LehrhaftiskeitEpitaph 70Epochen (Schwellen, Grenzen. Unter-
schiede) XIIf., XVI, XXII, XXVIf..xLIf., 19ff., 133, 520ff., 53tf.,543, 778,s. auch Gattung
Erbauung 111f.,586, s. aedificatioErbfolge 476f., %7Ereignisvermerk 149, 583, s. commemora-
tio, a b b railat io, UmfangErfahrung, upeientia, acperimentum 38,
7 9, t65, 232, 257, sc/�f ., 530, 533, 542, 3 I 3,359, 755, s. auch Autopsie, Buch der E.
Erlindung s. InventionEristik 249ff., 279ff.. 288ff.Erkenntnis (theoret., psychol.) 9f., l2gf..
147, 198ff., t95ff., 246f'f.,292tr., 377ff..451, 498, 503ff., 530f., 542f., 526, 570a.,874, s. auch imginatio, memoria, Erfah-rung
Enählung ss. Kurzgeschichte. nanatio.Geschichtenezählen
,Esel' 227,518, II48'essample'(afr.) 46f.Essay 21, 16l, 287,300, 356f.Ethik 443, 488ff., 572f., 5,14a,882,969Etttopoeie 254,256f ., 408, E2 I, 834f. s. auch
Prosopopoeie, Fiktion, sermocinatio, a,i-dentia
Etymologie als Topos 424f.qidentia 83, 89,98, 197f., 2i,8, 225, 53i1, 544
(inductio sub oculis)accerptor 362f.scatere auctores 397 ff .. 869acemplar 144f., 147, 664uemplum, Exemplum XXI! 45ff, 49ff..
57f.,126ft.,144ff , 158, 106, 352, 555, 6ffi,E70
- ex als Zitat, Exzerpt lSBt., JZ4, 555, Z65,1U4,1t82
- als Gerücht J06- als Gleichnis 986- ex vs. ratio / lex / praeceptum, als fabula,
Typus, Topos s. l.- enc sanctorum s. HagiographieExemplaarten (ex<ausa-Relationen) 433.
3U,858,874, et4- ac impar 104ff., I I7ff., 236ff.,424f ..434f..
454ff.,458ff.,495f.. s. auch vel- s simile 55,433, 914- ex contrarium 325,428Exemplareihen 70ff., 203f., 236, 351ff.
429f ., 435ft..4ffift.,487,513ff.. 586. 588.593, 262, 294, 6ffi, 6U, 867, I192. s. auchKlimax. domestica exx
Exemplasammlungen 14, 17 f ., Jj, 45, l2S,129, t37ft.,342ff., 345ff., 384, 388, 430f..542f'563,ff iO,fi2
exercitium, exercitatio 268, 270, 280f., 283.388, 548, 562, 567, 578
achortatio s. suasio / dissuasioacitus illustrium virorum 177. 262Exkurs s. digrasioocp erientia s. ErfahrungExtremfall-Relativierung 322ff., 519, s.
auch summum ius...
F
Fabel, fabula XXIV XLV 23, 29, 32ff.48ff., 50f., 53ff., 55, 58ff., 64tt, 82, ll0:128, 133, l4gf., 16lff., 225,403ff.,521.552f, 588f., 590 ,594,89, I 68, 288, 353, 506.516, 550, &3, 634, 822, 964, s. auch Fik-tion, Mythos, Tierfabel
- E/Exemplum 55, 1J-1, I4S, tS8, 286.288, 1052f.
- äsopische/milesische F 51,407f.- E/Parabel 36, ll9- E ftir Gerücht, Geschwätz 47, 201, 222
I 68, 203a, 3 I 5,964 -fabelta 5t,221f.,225,114
-fabulosa narratio s. intqumentum-fabula vs. histoia s. nanationum genera,
histoiaFabliaux 13l,16lfacta (Taten, Ereignisse, Geschaffenes)
155f. 176ff..370ff.
643
- f. et dicta('faictsetdits') l3l,l57{T., 164ff.,202, 268,311f .,372ft., U9, 487, 514, I 49a,2ee,38tlJ.
- f. vs. facienda 8ff., 87f., 3l8ff ., lf., I 3, s.auch Tünlichkeit
- factibile / suadibile 96facultas 445, 564, 869Faktizität XVIf., XXVI, 213ff,216, 231ff.,
238, s. auch Wahrheit, WirklichkeitFall s. casus, Allgemeines / BesonderesFamilienexx s. Ahnen, dynastische ExxFazetie, facetia, facetus 13l, 148f., 162,
4't0t.,409f.Fertigkeit s. SchlagfertigkeitJigra 147 (aemplum), 515, II92 s. auch
Typologie- figuratel proprie s. sensus litteralisFiktion, Fiktionalität 3 l, 53 ff., 59 ff ., 7 3, 7 6,
82f ., r2r, r7 6f ., 202f ., 2W, 2r4ff ., 2r9f'�f .,253, 265f ., 267 fl., 27 5f ., 278, 284f ., 288,290ff., 401 ff., 4l3lT., 4541f., s. auch Fabel,intqumentum, Lüge, SPiel, Wirklich'keitsbegriff
- Denkfiktion, Hypothese, Als0b 52ff.,252ff.,277f1.,285f., 333, 4881T., 493, 495,502
- ficti auctora 405ff., s. Pseudepigraphie- fictus interlocutor 290- lictio personae s. Prosopopoeie- fiktizische Klage (ur.) 31,274f.,559' 567finitio, fiatte I infinite Exx I 7f., 3 I ff., 162f.,
219,258ff ., 423, s. auch Thesis / Hypothe-sis
Florileg 138, 142, 164ft.,223, 5fi ,922, 1037forma (imago) 591forma vivendi 176, 643Fortschritt XIV 104, 239f., 305f., 335,
379ff., 450f., 7 ffif., 778, 882, 1 048,s. auchNiedergang, Zwerge / Riesen
Fortuna, fortuna 170f., 508f., 510f., 512,19I a, 556, 973, 978, 986, 988, I 1 17
forum s. schola 292,361Fragmente, antike (bei Johann) 13ff.,413,
466Frau 101ff., 132, 313, 388f., 469, 473, 867Freiheit ( der Rede) s. libertasFreundschaft 508f., 534, 986Führer/Hen vs. Knecht s. clientes, Hen-
schaftFürstenspiegel 124, 138, l4lf., 175, 360,
374, 455, 488f., 494f., 558ff., 581,880, %5,1123, s,auch ofricia
Fulguration 295
644
G
Galerie, Museum 186Gasfreundschaft 446f., 46lf., 470f., 475,
s. auch SymposienGattung 0ir) XLIY 137f., l44fT., l47lT.,
161ff., 524, 381, 419, 965- G. vs. Funktion 42ff.,161,332- G. und Epoche 524f.,545- Gattungen mit Exx XXry 21, 131ff.,
407.489. 822,965Gattungsmischung ll0, ll2f., 138, 162'
402, 506, 822,965Geduld 303.316,336,geflügeltes Wort' 66, s. ChrieGegenwartsbewußtsein, Zeitgefühl 205'
241ff., 341, 38lfT., 448f., 537f., 547ff.,55 I ff.
Gegenwartsdarstellung, Zeitgeschichte 9,14f.,291, 503f., 1012
Geld 224,288,5IIgenealogische Exx 70ff., s. Ahnerl dyna-
stische Exxgenera dicendi, Stilhöhe 133, s. auch serrno
humilisgeneru nanationum s. nanationum 8,.genera probationum s. probationum g.genera quaestionum/ causarum 2ffiGeometrie 250Gerichtsrede, Gerichtspraxis 31, 254ff.,
27 lft.,354, 8, 570a. E5 5, v$. lurisprudenzGeschichtenerzählen 128. 135ff., 385ff.'
597ft., r3l,921Geschichtsauffassung Xf., XIVff., 9ff', 54,
97, 155ff., 208ff., 214ff, 346ff, 503ff.,508ff., 5l2ff., 516ff., 519ff., 525,587 -
Geschichte als Werk Gottes ll, 372ff.,377f.,383, 503ff., s. auch Allgemeines/Besonderes, Heilsgeschichte, historia,Beispiellosigkeit
Geschichtsschreibung s. Historiographie,Historismus
Gesetz vs. Beispiel/Fall s. /4, Allgemei-nes/ Besonderes
Gesetz im Herzen 437f., s. NaturGesetz und Fürst (Gesetz Gottes vs' /qgt'Öas
s o I utu s -Prirlzip) 362ff., 44 I ff., 468, 4%ff.,57t. 926, 97 I, 993
Gesetzeslücke 2, 29, 86, 275f., 433, 455,489f.
Gewöhnung 375f., s. auch mirafi'o UbungGewohnheit (consuetudo vs. ratio / veritas)
84ff., 104, 168, 263, 3 18ff.,326tr.,334, 517,2f.,578, s. auch ratio/q
Glaubwürdigkeit (his514f.
Gleichfürmigkeit der (derholbarkeit
Gleichnis s. Parabel- G. Jesu 32ff.,36, 53.
126, 145, 158,425Gleichzeitigkeit des
XVf., 102f., 3,t0f.. 50(Glossatoren 27 lft., 3SjGnade (und Ex) 91f..9- G.derErkenntnisG:z
451f.,519, 752,877, &Gnathonici 2n.726Götter 456, 479f..950. tGrammatik 58f., 147.
550f., s. auch Täviumgrovitas 241f.,930griechische vs. lateinisct
71,94,167,205,3nf ..463, 485, 582, 79E, ekenntnisse, ÜUenetz544, 598. 798
Gründungsmodell, Gnsprung
Güterlehrte (philos.) s. s
H
Hagiographie, Heilige, h41ff., 83ff., 93f..95tr.t22ff ., 512, 589, I 64, 2lnio ss.
Hausväterliteratur 132Heidenmission 128.446Heilsgeschichte 92, l0
513ff., 525, 538,636, 6Helden, Heldenexx X
7 gfl., 92, 94, 96, gg, I l3229ff.,32tf.,339,512
- Heldensage 74- Entheroisierung 96ff.,
350Herdentrieb 319ff., s. GrHermeneutik XX, )OC
26,ff'26f,ff..307ff.. 3l362ff., 398ff.. 523. 53Buch, dfficalras, Codrkompetenz, Polyvalenkeit
Henschafl H. und DienModell 368f.,388f.,39466f., 510f., 556ff., 567.92-? s. auch nsus
ß ' t tön s6t. 451f., 470f., 475,D$enfrn. rri. 144ff., 147ff.,l t !19 %5bc r l f f . 16 l . 332be 511f.. 545m Exx XXIV 21, 131ff.,l % :[ne ]10. l l2 f . . 138, 162,I Cr,( i
t 6 . 1 1 6ln- b6. s Chrielu8sern Zeitgefrihl 205,3ilfi. +{tf.. 537f., 547ff.,
lne.,::ng- Zeitgeschichte 9,f.. lr ' l- 't - "
Lrr -Off. s Ahnen dYna-
Sn:hore 133. s. auch scznro
fu- : nanAttonum g.rr-. i pobationum g-
3< :nsarum 2f f iIt G:::hrspraxrs 31. 254fT.,l_r- i i-r_{ vgl.JurisprudenzLii-:: 1lt. 135ff.. 3t5ff.,DIlss ::-; \f . Xlvff.. 9fT., Y,n: ::lff. ]16ff.. 503ff.,l : : f . 519f f . 525. 587 -
* \r:: i Gones 11. 372ff.,BI : auch Allgemeines/, H: .=gesclrrchtE. historio,l e :F:-:j s HisoriograPhie'I
!: F| s /a. Allgemei-tr5[E- l j- i. s Narurls -':.ez Gones vs. /4iäus4 i:if . 441ff . 168.494ff.,I i - :r I -': it. :'5f.. 433, 455,
F:' ; :;:h rnllano,Übungbn
----:: s. mtio / vaitas)l ' : - : : : iR . 126f f . .334,517,b - : - : a
Glaubwürdigkeit (hist.) 20$ff ., 424,429,514f.
Gleichfürmigkeit der Geschichte s. Wie-derholbarkeit
Gleichnis s. Parabel-
Q Jesu 32ff.,36,53,58ff.,65, 129, 180f.,126, 145, 158,425
Gle,ichzeitigkeit des Ungleichzeitigen_xvf., 102f., 340f., 5Mff., 50g, 5t3ff ., %2Glossatoren 27lff., 357, 550Gnade (und Ex) 91f.,95ff., 109.49g- G. der Erkenn tnts (grat ia i I I ustratix\ 393.
451f., 519, 752, 877, 882, 892Gnathonici 2n,726Götter 456, 419f .,950, s. auch MvthosGrammatik 58f., 147, 255f., 5i2, 544a,
550f, s. auch Triviumgravitas 241f..930griechische vs. lateinische Kultur/Exx 6g.
7 t, 94, t67, 205, 397 f .,5g7, 5gg, 395, 4 3 3,463, 485, 582, 798,92l, - Griechisch-kenntnisse, Übersetzungen 561f.. 442,544, 598, 798
Gründungsmodell, Gründerexx s. Ur-sprung
Güterlehrte (philos.) s. summun bonum
H
Hagiographie, Heilige, hagiograph. Exx lf..4lfr., 83ff., 93f., 95ff., 100ff., 108, I10ff.,122ff,512,589, 164,298, s. auch commu-nio ss.
Hausväterliteratur 132Heidenmission 128, 446f., 485Heilsgeschichte 92, 105, 37lff., 435ff..
513ff., 525, 538,636, 660, 8Stf.Hglden, Heldenexx XXIVf., 40, 61ff.,
79ff.,92,94,96,98, 113ff., 117, 132f., 156,229ft., 32rf..339. 5 l2
- Heldensage 74- Entheroisierung 96ff, 109, 127f.,322f.,
350Herdentrieb 319ff., s. GewohnheitHermeneutik XX, XXX, XL[, lglff..
?g?\:, 2ffiff ., 307ff., 3 I 8ff., 33 I ff., 342ff.,362ff., 398ff., 523, 538f., 541. s. auchBuch, dfficuhas, Code-Wechsel. Leser-kompetenz, Polyvalenz, Zeichenhaftig-keit
Henschaf! H. und Dienst" hierarchischesVg9"tt 368f., 388f., 393ff., 396ff.,,104ff.,466f., 5 I 0f., 556ff., 567, 569 ff ., 57 6i,ff ., q I,92J s. auch usus
- H. über Literarur 36gff., 3ggff.. 404- Naturbehemchung 388ff., 393ff., 774,
778- Selbstbehenschung / Welthenschaft
374ff .,570f.,574ff.,579, 739, I t I9- H. der Philosophie 157, 389f., 441ff..
4&ff.,570.-,,Henschaftstheologie" 476, 496, 501.
979Herrscherexx l57ff., 495f.. 514historia, historiae 23, 58, 60f., l3 I f., l4gff..
I 52, 16 l, 165,204f ., 229, 353, 597,3 3 7, 34 5,365, 369,412,418,420,483, 502, 533, ffi2,668, 77 l, 833, 877,921,925, s. auch sezsuslitteralis, Satire
- h. v s. fa bu I a 82ff ., 147, t49, 2t9ff ., Z2lft.,224.228tt.,231tf.,203a, 3 I7, 353,423,77 r.949, 1012, s. auch nanationum genera
- hi!tuna magistra vitae Xyf.,7ff., 19, 39,155f., 521f., 533. 541f.
- historia ornata 496, 508histoici 423, 696,771Historik s. GeschichtsauffassungHistorigraphie XVII,9,53, I10, 125, 135ff..
l4lf., 150f., 154ff., 177ff., 179ff., 208ff..2t9ft., 342ff., 362f ., 386,406, 4l l, 416f..503f., 505f., 599, 208, 299,492. 635, 735,760.771
Historismus XVf., XXVI, XXXIX, XLIIf..2t7f .,347 ,393,519ff.,521,537 ff .,54t,276,497
Historizitiit von Exx 48ff.,55ff., 57,6,99,l l0, l l9, 337, 342ft.,451, 475, 504ff..537ff., vgj. Notorierät, Faktizität Denk-würdigkeit, Wahrheit
histno 354. 988Hof, Höfisches s. cuia, Anstandslehre.
AdelsliL, offcraHo_f_krilik l79f .,336f ., 410, 445,509ff., 548,
570ff ., 577, 95],. s. curiaHomoeosis, homoiosis 58ff., 2ll, 590.
592f ., 145, 164, 38/, I192, s. auch simili-tudo
Humanismus (philos., moral.) 172, 194t.,306ft., 322f., 388, 391ff, 415f., 440ff.:532ff, 543, 394, 745, 747,8A, 880, 882,930,979
- dignitas / utilitas hominis 172, 3gg, 391f..406, 774
- H. (philol.) s. Antike-Rezeptionhumanitas / inhumanitas 164ff., 301, 307f.,
u7f .,46tf., 774f., 582, 887, 930, 973- cttltus humanitatis 172,307t.,406, ffiOhumanitas Christi 9lff.. 635
645
Hypothese s. Fiktion (Als0b)Hypothesis (reth.) s. Thesis, ccusc
UJ
Jagdkritik 320icon s. eikon, imagoldee, idea, idos 503ff., 508ff., 312Identifikation s. imitatio, Vorbild (...)Ideologie, I.-kritik XX, 71f., 79f., 319,
325tr,627, 863, %7, lA05ignorantia iuis 698illustratives vs. induktives Ex s. Induktion
imaginato, imago (psych.) 10, 351, E74,r0ü
imago (retL) 25f., 58f., 64,67,583-597f.,I14
- i., icon (eikon) 55f.,58f.,588, snff,145,s. auch Homoeosis
- t. (metaph.), Abbild, Bildnis 25,6,70,160, imago virtutis 341,462f., 584, 588ff.,665
imitatio (auctorum), lit. Nachahmung239f1., 257, 343, 375ft, 392-411, 4r7ff .,420f1., 487, 492, 550f ., 57 8, 7 24, 7 42, 7 88,9U.1037
- i., aemulatio (Freiheitsgrade der Anei-gnung) 37 5f1., 392, 395ff., 402, 374, 9 I 7,1179, s. auch sequi,Plagiat"Zitat
imitatio (acemplorum) 8, 26f., 70ff., 80,92ff., lll, 230f., 234ff., 312ff., 319{T.,323ff., s. auch Nachfolge Christi
-Imitabilität imitabile 92ff., 95ff., l17,t27 f ., t32f ., 2t7, 229f1., 322, 492, 5 1, 3M,520, s. auchfacta (factibile) - i. vs. admi-ratio / delectatio I I lf., ll7 f ., 228ff ., 244
imperativische Exx s. indikativischeimplere loatm 525f.,573, 866Inbegriffsexempla 120, 338f., 431f., 462,
585incitamentum virtutis 198Indifferenzformel 183ff., 186, 208, 210f.,
21 6, 222f ., 245, 352, s. auch Versionsange-bot Leserkompetenz
indikativische /imperativische Exx 105Individuum, Individualitiit IXf., XVIIIf.,
xxvll, 8, 27ff., 1001ff., 127, 340, 504, 529,535f.,92, 681, 904, 1001, vsl. Allgemei-nes/Besonderes, Subsumption, Bei-spiellosigkeit Subjektivität
Indizienbeweis 75f.Induktion, inductio 8ff., 19, 38f., 49ff.,
I 17f., 182f., 188-208, 235ff ., 333f ., 427 ff .,
646
485,492,504,542,277, 639, 874, 914 s.auch aüdentia
- induktives vs. illustratives Ex 19ff.. 26ff.,37ff., I 17ff., t23, l32ff ., 136, 525ff., 533ff
Information XXIX. 8. 218ingenium 244,361Inkamation 90ff.. 285. 323. 498f.. s. auch
humanitas Chistiinquisitio veritatis 269, 473f,562 s. auch
studiumInquisition XLIinsinuatio (reth.) 197, 207f., 224, 3l4ff,
336, 402f.,468, 470, 552, 578ff., 599ff.,601insolubilia 276. 361. 567aInspiration der Heiden 448f ., 729, 7 3 l, 892,
953intqumentum (involucrum) 183ff., 366f.,
203 a, 420, 42 3, 42 5, 428, 509, 664, 7 29, 797,892,913
Intellektuelle (im Hofdienst) 267, 271f.,452, 473ft.,480f., 488f., 546, 569f1, 951s. auch curia, philosophi, politici
intelligibilia 503-8Intention (vs. Tat) 324, 636,858, s. auch
Autorintentionintelpretatio christiana 184, 187f., 370f.,
392- 40t.454ff., 463ff., 487f., 490f.-,interpretatio naturalis" 463fLIntertextualität 380. u7, 7 5 1intra/ oetra taetum39Invektive l88ff., 335, 410, 553, 952inventio (reth.) 31, 332f., 342ff.,368, 382,
450f.,454, 375,- i./iudicium 384f. 422f., 5U, 765, 856,
1037, s. auch TopikInvention (philos.), Entdeckung, Erfrndung
XX, 223f., 450, 54 5, 7 5 5, 760, s. auch Neu-heit
Investiturstreit 86f., 326ff., 344ff., 922f.,965, 1053
invisibilia s. Sichtbaresinvolucrum s. integumentumiocunditas 386f ., 930, s. utilitas, Unterhal-
tungIronie 202f., 209,405ft.,417,494ff., s. auch
insinuatio, Komikiudicium (ratio) 384, s. ratio vs. Ex, inventioiunctura 487,962Jurisprudenz 1ff., 85, 188, 191f.,271ff.,288,
3t2ft.,362f., 432f.,546, s58ff., 698, 871,862, s. auch Kirchenrecht Gesetz(..),Gericht(..), Glossatoren, Naturrecht - J.und Trivium, Rechtsunterricht 254f .,258,262ft., 27 rff ., 3f., 8, 5 50, s6s
K
Kaiserkult 8lKaisenage 19laKalendergeschichte 132,,IGmpl", Kriegsmetapl
27 4f ., 286ff .. 290. 309flstlk, mi I itia, strat cgemt
,,Kamevalskultuf 277frKasuistik t32, 274f., 27
350ff., 359f., 365. 43 I f.Kausalität s. causae srcuKirchenkritik 224ff.Kirchenrecht 84ff., 101
3l8ff., 362,468Kirchenreform, gre!
463f.,468K.lassizismus 4%f., 541Klimax (in der Eren
236ff.,513ff., s. auch aKlugheit, Klugheitslehre
54ft., 124f., 132, t37 .3192, 297, ffi4
Körpergleichnis, org;anokfassung 36, 391,440f..965, 986, /051 s. auch r
Komik, das Komische ,350, 397f., 434, 470f.. 59614 s. auch Fazetie, FiScherz/Emst, UnterhIronie
Kommentar als Denlfom2t7 f ., 350-62, 378ff., 39{
Komödie XIX, 81. 147.4l0ff., 440ff.. 445. 508f.834, 986.,1051, s. auch ,
Kompilator 21, 13443,',37 8ff ., 402, 4t6ff.. 453. t578f.,742,806, s. auch I
Komplementarität (hei<l455, 4X), 908,s. auch Anltum, Konkordanz, Gese
Komposition, Aulbau s. dKonformismus 319ff.. 33
GewohnheitKonkordanz (antik<hris
,146ff., 485ff., 494,52tf ..Konsens, consensus omniut
3t9ft, 421-7, 627, EAEndoxa
Konstanz (anthropologiscl2t7, 23tff ., 3 19f., 438, 5 Iheit(..), 6lglshzsirigksiWiederholbarkeir
D4. 512. 277, 639, 874,914 s.VN
rs. rllustratives Ex 19ff., 26ff.,- l:3. 132ff., 136, 525ff., 533ffKX IX . 8 ,2 I8L ,161mff . 285. 323, 498f., s. auchChnstilatrs 269.473f' 562 s. auch
rlInh.r 197, 207f., 224, 314ff.,t6t. 170. 552, 578{T., 599ff., 60116. )61. 567ax Heiden 4r',gf., 729, 73 l, 892,
t /:m'olucrum) l83ff., 366f.,t: _? 1 : 5. 42 8, 509, 664, 729, 797,
I rrm Hofdienst) 267, 271f.,, .180f . 488f., 546, 569ft, 95l,b. p hil osop hi, po I itici5{,1-8I Tatl 324, 636, 858, s. auchnoachnstrana 184, 187f., 370f.,fi it . 163ff., 487 f ., 490f .frc naturalis" 463f1.ir -r80. 447,751Aun39Jff. -j35.4r0.553,952lr ,r1. 332f., 342ff, 368, 382,J
--{
r -1r-1i. 122t.. 544. 765, 856,lh ToprkIloi r. Entdeckung, Erfindungf5{,. -i4-5, 7 5 5. 7fr ,s. auch Neu-
it r6f . 326ft., 344ft., 922f.,
417.494ff.. s. auch
E). lE8. 191 f . , 27l f t , 288,..::. 516. 5s8lf., 698, 871,K::chenrecht, Gesete(..),: ssaroren. Nafurrecht - J.
i rsunterric ht 254f.. 258.t : 5 0 . 5 6 5
K
Kaiserkult 8lKaisenage 191cKalendergeschichte 132,,Ifumpf", Kriegsmetaphoik 246f.. 252.
27 4f ., 286ff., 290, 309ff.,,101. s. auch Eri-stik, mi I i t ia, s t rat qem ma
,,Karnevalskultuf 27i ft., 3 16ff.. 4ZgKasuistik 132, 274f., 279ff, 322ff., 344f.,
350ff., 359f., 365. 431f., 63 I, 667Kausalität s. causae secundaeKirchenkritik 224ff.Kirchenrecht 84ff., 104, 262ff.. 27tff..
318f f . ,362,468Kirchenreform, gregorianische 262f..
463f.,469Klassizismus 496f..541Klimax (in der Exemplareihe) 203ff..
236ff.,513ff., s. auch ecemplum impa4 velKlugheit Klugheirstehre XVIf., 34ff., 3gf..
54ff., t24f, t32, t37 ,3t4, 470,519f., 602,92.297, ffi4
Körpergleichnis, organologische Staatsauf-fassung 36, 391, 440f .,46f.,571ft, g52,965, 986, 1053, s. auch corpus Christi
Komik, das Komische l3l, 172f., 330f..350, 387f., 434, 470f., 598ff., 3 r 5, 450, 569,614 s. auch Fazetie, Fabliau. Schwank.Scherz/Emsq Unterhaltung, Lachen.lronie
Kommentar als Denkform XXXII, 210ff..217f.,35042,378ff., 398f., 522, 720, 895
Komödie XIX, 81, 147, 180, 2nf. 402,4l0ff., 440ff., 445, 508f., 552f., 574, s78,834,986., 1051, s. auch comedia, Satire
Kompilator 21, t3443, 263, 342ft. 345.378ff ., 402, 4t6ff., 453, 542f., 545f., 56l ff..578f .. 742, 804 s. auch Enzyklopädik
Komplementarität (heidnischer Werte)455.4%,90E,s. auch Antike u. Chhrisren-tum, Konkordanz, Gesetzeslücken
Komposition, Aufbau s. dispositioKonformismus 319ff., 334, 510. s. auch
GewohnheitKonkordanz (antik*hristliche) 435ff..
446ff , 485ff., 494, 528t., 554Konsens, consensus omniun 16,253,29f.flf ..
319ff., 421-7, 627, 864, 999, s. auchEndoxa
Konstanz (anthropologische) XVf., 7, ll,217,231ff.,319f., 438, 516ff.. s. auch Ein-heit(..), Gleichzeitigkeit, KontinuitäLWiederholbarkeit
Kontextualität der Exx XXVf., 44f., 331ff..337ff., 347f., 363ff.
Kontinuität (hist.) 526f., 53746Konversation 312, 355f., 402, 601, s. auch
Essay, SymposienKosmologie 287 f ., 296ff ., 388ff.. 440f.Kuriosität curiosa 79, ll0, l16, ll8. l34ff..
202,287,921, s. auch mirabile, WunderKurzgeschichte ll0f., 125, 133ff., 144ff..
598ff., s. auch Geschichtenerzählen. nar-rationum genera
L
Lachen 210f., 350, 598ff., 57 1, 9J 1, g4gLaien 492,497, 598ff., 966, s. auch Adel.
VolkLatein/Volkssprachen XXXVIIIf.. 122-
229ff.,520Lebensalter 42-ilectio 877, 9l Iledoria, loidoria 316ff.Legende ll0, 128, 228,244,251 s. auch
HagiographieLehrbuch 138, 142, l46f.,345.s.auchTrak-
tatLehrhaftigkeit, ,,Moral" von Exx 19ff..23.
29, 32ff..35f.. 53, 66, I 18f., 153. 314ff..359f . .430.521, 540
Leserkompetenz 51, 53, 6lff., &, 122ff..127t., r32f.,140, 149, 176f., 181ff., 373f..4t7, 463, 530, 566ff., 580, 3/1, 337, 425f.,433,450. 526
lex vs. acemplum (consuetudo) 1,29,145f,3,64,621,640,861, s. auch rarrb, auctori-tas
/iöenas, freie R ede 224f .,3Cff�fL, 3 I 6ff., 374.886. I05r
List, Überlistung 34f., 3 1 1ff., 486, 601f.Literaturbegriff XLY 13ff., 154ff., 157f..
2t9, 23tff., 2ffiff, 276, 280f., 368412.570a
littera s. sensus litteralisLiturgie (und Ex) 90ff., 105locus 547, 856, 859,86{ s. auch implere
locum- l. a qualitate audientium 961- l. circa interpretationem 858- l. circa rem 145- l. a simititudine/ab *emplo 192ff..423f..
427f.locus communrs 132, 139, 244,288t.,345,
361 f., 394f., 42 4f1.,429ff .,520f ., 544f ., 2g7,556,868, s. auch Thesis, Topik
647
Lo$k, logica 193ff., 2,16ff., 276,308,532f.,572,246f1.
- l. dialectica 544a, 554f.- ratio loquendildisserendi 544f.- drei Logiken (demonstrativa, probabilis,
sophistica) 196, 246ff., 286ft., 297ff.,384ff.,4D, 544a, 549
- l. vetus/nova 251f., 546/ogos (Fabef) 52 - l. (ratio/oratio) 195,303,
446logos spermatikos s. InspirationLohn / Strafe (Vorbild / Abschreckung)
155f., 175, 186f.,393Lüge (eth.) 361,580f.- L. (rhet/poet) 314, niff., 420, 808f.,
815,821, s. auch Fiktion,mendacium ofri-ciosum, Wahrheit
M
Mäeutik l92lTMär, maere 46, 1179Mäzenat 136ff.Magen-/Glieder-Fabel s. Menenius
Agnppamagister 240,538, 861magistratus 960magnanimitas 388I., 570f., IU4Manierismus 478fT., 482f., 586f.Manipulatior\ Demagogie mit Exx 34f.,
325f1.materia, materies publica (rhet) XY 231,
367,6ßMathematik IX, 250, 300f., 895, 983maxima propositio 859medietas, tertium comparationis lnf ., 4 3 3,
435Medlc,in 264- -I{." (metaph.) 499f.memorabile, Memorabilien X, 14ff., 26, 30,
I10f., 13lf., 16l, 172ff.,560,ß, I49a,283,s. auch Denkwürdigkeit
memoria 10, 155, 2,14f., 3&, 402, 57 5f., 35 I,366,723f.,874, Im, 1034, 1037, s. auchimaginatio, oblivio, Mnemonik, comme-moratrc
mendacium fficiosum 284f .,405, 572, 8/,5Mendikaten, Bettelmönche l22ff, l34ff .,
337,Maalogicon' 568, 1080Metapher, Metaphorik 49, 56, 64, 146,
390f.. 591. 596
648
- metaphorisches Ex 63f., 66, 68, 327f.,337f., s. auch Namen
- M. vs. Ex 38f. - M. für Ex/Geschichte90f., 96, 389ff., 508 - Dispositionsmeta-pher s. dispositio
Methodenlehre s. Logik, ars, artesMetonymie 64Jvlilch" (fiir Exx) 152,313, 337,738militia (: vita) 146,985f. - m. imaginaria
548. 574Mimesis:Theorie 4llf.Miwrc 570amirabile 79,912Mirakel, miraculum ll0, 128,491, s. auch
WunderMittelalter(Begriff,Bild) XIIf.,XXXVIIff.,
280f..3l8ff.. 570a,923, 1032, IU2Mnemonik 343f., 363f., 376,417 ,5U, 477,
54Q s. auch memoria, imitatiomoderatio 389f., ,140, 572t., 598, s. Herr-
schaftmodernus s. antiquivs. moderni, Neuheitmodi dilatandi 120f.,424modi tractandi 345. ll78Mönchtum, Mönchtumskritik 99, 104,
46tf., 475, 552, 569, 641, 95 I, t0r4, 1050Mongolerl Tätaren 523monimentum 144f., 370, 391Monomythie s. PolymythieMoralistik 21,287,356f., 488f., 546, 806mos maiorum 84f.,94,318, s. auch Ahnenmovere vs. docere 192, l96ff ., 433, 457, 62 IMündlichkeit XXXIX, 156f., 2l3f ., 257 f .,
s. auch Schriftlichkeitmultiloquium 562, 580f.multiplicitas, multiplicatio 579 (virtutum),
384,753, 755 (scientiae), 912 (scipturae)multitudo (impeita/profana) 180f., 510,
643, 645,906- m. librorum56fI.Mythos, mythologische Exx XY XXVI;
22f., 50, 52, 55, 72ff.,93f., lg7, 456ff.,474ft., 587 , 590ff., 203a, 420, 423f., 431a,9 I 3, 997,s. auch Allegoie, intqumentum
N
Nachfolge s. imitatio- N. Christi 91ff., 94, 96, 98ff., 103f., 108,
495f.,501f.Nachruf 70, 100ff., 429f.. 5nName (hist.) XVIII, 208ff., 238ff.
- N. als Metapher (srau I79, 583, 586, 149f.,s. aumemoratio, Umfang
- N./Schein vs. Sache ll411f.,509f., 595,641
- Deck- u. Spitzname.305,408,410ff., 509f.,
Namhaftigkeil PersonluxxvL 66f., 100, t5208f., 210ff., 239, 24auch AuthentizitäLAnonymität
nonatio: n. fiir Ex 149, .- n. vs. Ex (tota n. v s. con
583-97, s. auch Name- n vs. probaab 8f., s a-fabulosa narratio n3,
tumnanationum genera (hü
mentum), Realismuq4n.125, 147,821, E33.
Narratologie, NarrativisciNatur, natura.'Schöpfuq
438ft., 774ff, E82, n(Naturbuch)
- N./Geschichte 56. l5i- anima naturaliter chrü
492t.- n. creata/lapsa 445- n. rentm, Naturwissens
779, 882f., s. auch caus- Naturbehemchung 3t
auch Hemchaft-Naturphilosophie, Na
437f1.,4t10,463,4n, $- N. des Menschen 517.- N.-ideal, -ethik 388fl
uTff ., 454,461f ., 4{f., t- naturam sequi Wf.,72- N.-recht 287f..44frfr^
993- N. (rhet), ,zweite N."
86e,882Naturvergleich, J,{aur
152f., s. Allegorie, sizrNegativität (philos., tha
554f.,996nqotium 56, JJJNeuheit (hist), das Nt
xlxf., 95ff., 93, 103fr., :382f ., 449 ff ., 492, 501 tr .Reform, antiqui
- N. 0ir) 463f., 475f..Novelle. imitatio. Av1regung, novum d
bches Ex 63f., 66, 68,327f.,rch \amen
-18f - M. für Ex/Geschichtel9fT. 508 - Dispositionsrneta-wsittohre s. Logik, ars, arteseErxt 152, 313,337,738bt 1t6.985f. - n. imaginaia
pne 4 l l f .19t :zcalum ll0, 128, 49I,s. auch
lcenff. Bild) XIIf.,XXXYIIff.,t.. : 'rta,923, 1032, IA2'3r-1i . 363f., 37 6, 417, 544, 477,h memoria, imitatiot9f . 140, 572f., 598, s. Hen-
antrqui vs. moderni, Neuheitü t20f . .424ü 345. I I78
Vönchrumskritik 99, 104,,55:. 569, 641, 951, 1014, 1050huren 523I 11.{ f . . 370,391r s Polyrnythien. 28'. 356f., 488f.,546,806r 8rf. 94. 318, s. auch Ahnenrce.e 192.l96ff .,433, 457, 621I XXXIX. 156f, 213f., 257f.,hnJ'Jrchkeitr io2.5E0f .; multrplicatio 579 (virtutum),15i i scientiae),912 (scipturae)tlnpenta/profana) 180f., 510,I)6r ic'6tT.llboioersche Exx XY XXV;XL :i. 72ff., 83f., 187, 456ff.,L 5C,rff. 203a, 420,423f.,431a,i au. ir {llegone, intqumentum
| . - : i : : o
19.:T. }{ . %.98ff . , 103f. , 108,tI la'.: 129f.. 590) \\ti l. 208ft.238ff.
- N. als Metapher (statt Erzählung) 63f., 67,79, 583, 586, /491, s. auch Metapher,com-memorutio, umfang
- N./Schein vs. Sache 180,290, 305, 326f.,4llf.,509f., 595,641
- Deck- u. Spitzname, Pseudonym 290f.,305, ,108, 410ff., 509f., 553, 574, 828, 834
Namhaftigkeit Penonhaftigkeit (der Exx)xxvl, 66f., 100, lsgf., t6tft, 202f.,208f., 210ff., 239, 241, 402ff., 596, s.auch Authentizität Notorietät, vgl.Anonymität
nanatio: n. fiir Ex 149,240,921- n.vs.Ex (tota n.vs. commemoratio)6147,
583-97. s. auch Name- n. vs. probatio Sf.,s.auchpropositio-fabulosa narratio 403,408, s. intqumen-
ntmnanationum genera (histoia/fabulalaW-
mentum), Realismusgrade XI,,106ff.,4n, 125, 147, 821, 833, 1206
Narratologie, Nanativistik 39fI., 47, 67Natur, natura: Schöpfung ll, 16, 106, 120,
438f1., 774fr., 882, 1000, s. auch Buch(Naturbuch)
- N./Geschichte 56, 152f.,345- anima naturaliter christiana 106, 438ff.,
492f.- n. creatallapsa 445- n. rerum, Naturwissenschaft 308f ., ffif.,
779, 882f., s. auch causae secundae- Naturbehemchung 368ff., 388ff., s.
auch Herrschaft-Naturphilosophie, Naturtheologie 106,
437 ff ., m, 463, 490, 492t., 979- N. des Menschen 517,999, s. Konstanz- N.-ideal, -ethik 388ff., 437f., ,|40ff.,
u7 fI., 454, 46tf ., 46f', 47 6f ., 4t2- naturam sequi U4f .,725, 747, 883- N.-recht 287f.,44f�ff.,455, 880a., 881f.,
993- N. (rhet), gweite N." ,|45f., 564, 578,
669,882Naturvergleich, J.{aturexemplum" 120,
152f., s. Allegorie, similitudoNegativität (philos., theol.) 297ff., 301f.,
554f.886nqotium 56,5JJNeuheit (hist), das Neue, Emeuerung
xxf., 95ff.,93, 103ff.,239ff, 319ff., 329,382f., 449ff., 492, 504ff., 5 17, 527f., s. auchReform, antiqui
- N. (it.) 463f., 475f., 487ff., s. auchNovelle, imitatio, Aufmerksamkeitser-regung, novum 8(
Neugierde s. curiositasNeuplatonismus s. PlatonNeuzeit 501f.,507, 549Niedergang, Verfall, senescens saralum
fiz, 36t, 45tf ., 547 f ., %8, I A48, I 050, vet.Fortschritt
Nominalismus 530notarevs. docere 177Notorietät, Vertrautheit von Exx XIXf.,
61ff., 66, 109f., llsf., l99ff., 240, 320,334f., 460ff., 517, 523f., vgl. HistorizitätAnonymität, Neuheit
Novelle 19ff ., 69, 7 9, I 25, I 3 I f., 13 4ft., l42f .,16l f., 228ff., 314, 526f ., 669
- res nova 409. 508novum ü,emplum, novitas 82, 93, 463f.,
485f.,262, 895,964, s. auch Neuheitnugae 574,827, s. curia
oobllivio 154f., 576f., memoiaobscuritas s. dfficultasOffentlichkeit (rhet) 31, 235, 55, s. auch
publicus/privatusOffenbarung (erste/zweite) ll, 156, 377 f .,
388ff.,437f., 232, s. auch Buch derNatuqBibel
Offenheit literarische 360, 369ff., 388,417ff., s. Polyvalenz
ofi c i a, Ämterlehre, Verwaltungsethik I 38,142, 488f., 5,16, 568.,572, 57 4, 564, 92 3, 965(ofriciorum sciptor), I 07 2f.
Onomastik s. Name, PolynomieOrakel 206,220,350orator/iudoc 567ordo 271,440,4ffif.,572- o. artilicialis 706, s. dispositio- o. iudiciorum 8- drei ordinu (rustici, nobiles, clerici) 424,
923,965, s. auch KörpergleichnisOrientierungswissen XX, lf., 555Orthographie (rnlt) 557
P
Pädagogik 8ff., 23f., 26, 72, 81ff., 89ff.,9llf., 107, I17ff., 163ff., 168ff., 192ff., 197,269f ., 293fr., 322, 33 5, 342ff ., 37 6f ., 495 f .,493, 499f., 515, 542, s. auch Anschaulich-tpit, Gewöhnung; Jvlilch", Schule,Ubung
Pädien 132
649
Panegyrik 7 ltr., I26f ., 587, 64 IParabel, parabola XLV 32ff., 36, 48ff.,
slff., 55f., 58ff., 64ff., 110, l19, 192f.,588ff., ,t,t-il, 126, 130, 137, 145, t58, s.auch Gleichnis Jesu, Homoeosis
paradeigma, paradigma 6ff., 49f., 58f.,l58ff., 587ff.,590,592f., r4sf., r64, 176,J8l, s. auch Homoeosis
- p. kata/para logon 117,427f.,281, 863,,Paradies" 166ff.Paradigmengebet 74,,Paradigmenwechsel" (H. S. Kuhn) 265,
778Paradox(ie) 255f., 280f., 427 f., 482ft., vgl.
EndoxaParänese, paränetische Exx s. Predigtex,
Lehrhaftigkeit, Induktion,,Paratheologisches" 491ff., 968Parodie 78f., 278f.,329ff, 345, 478f, 646,
949, 953PassionChristi 92f., 107,476,485f.Pathos 197ff.,234f.,530f., 140, 145, 1019,s.
auch moverepatientia fr)r Toleranz 97 3pentanomius 272Peristasen s. Umständepersona 56, 5ll, 381f., 986Personendarstelltng, descriptio personae
103, 376ff., 545f., 592f.Personhaftigkeit s. Authentizität, Nam-
haftigkeit, Chrie (personale dictum)Philosophie, philosophia XVI, 175, 303ff.,
389f., 44lft., 480f., 503ff., 515, 567f.,57 l ff., 58 l f., 387, 394, 4Uf., 42 2, 544, 97 8,1055
- P vs. Poesie 178f.- P vs. curia s. curia- P vs. Rhetorik. s. Rhetorikphilosophi, philosophantes 14l, 157, l6l,
313f., 350ff., 430,423, 431, E77, 886, 8e5,9t8.920.951
Philosophenanekdote 20f., 7lf ., I10f.,138ff., 157ff., 16lf., 164ff., t69fl., t77,292tr, 295f, 3ttf ., 206, 27 I, 384f., 402 .
Phönix 220pictura 43laPlagiat 139, 393f.,409f., 4l9fl,807, 853Platonismen s. Platon (Reg. l)pluralitas iudiciorum 556, 564, vgl. Polyva-
lenzPoesie, poetische Exx XVIII, 53f., ll0f.,
l2t, 149, t77 ff ., 2t9f1.,386, 4l l, 346, 3ffi,809 s. auch Fiktion
Point€ 311,314ff.
650
Polemik s. Invektive, StreitschriftPolycraticus, polycraticus 389f., 392, 510,
513,556f f . . 9E7,9npolis 556,564,571politicus, -i 312, 562ff .,567ff , 574, 601, 95IPolitik, staatslehre 440ff, 558ff., 581, s.
Fürstenspiegel, fficia, KörpergleichnisPolychronicon 513, 564, 9npolyhistor polyhistoria 563f ., 299Polyhistorismus 132, 366ff., 377ff., 385,
420, 453f1., 544f ., 56f, 765, 986, s. auchEnzyklopädik
,,Polymythie/Monomythie" 109, 478, 266polynomius, polynomia 208f., 2l lf., 570polypticon 562Polyvalenz/Polysemie (Vielfalt von Aspek-
ten, Meinungen, Deutungen) XX, 72,t76ff, 2r2, 217, 303ff., 320ff., 337ff.,347ff., 366ff., 380ff., 384if., 45 r,454f .,47 3,581,429, 709, 720, 757
polyxenus 570ponere, afene exempla 374positio 2ffi,556Postille 132Postmodeme XII, XIVPotential(ität), semant. 367, s. Polyvalenzpraeambulus 665praecepta/exempla VJl., lßff ., 177f., 438,
243, 345, 395, 451, 621, 638, 877 s. auchTheorie/Praxis
Präexistenz 72,76praeiudicium 29, 332f ., 387 f ., 2, 1 7 8, 37 5praelectio 550,833praemeditatio malorum l78f .,421,traeterspirituelles" 488ff., 491 ff.Präzedenzfall X, I ft., 29,7 2f ., 77 ff., 9 l, 3 I 8,
326f1., 432, 520f., 535 f.,,pröciositö" (Präziosität) 482ft., 95 5Predigt 486f., s. anes praedicandi-,,P" (als Metapher) 96Predigtexemplum XXIIIff., 25, 39ff.,
l l2ff., 129ff., 134, 139ff., 143, 152, t73f.,t97 , 222ft.,234ff.,262f.,386, 424, 485ff.,527, 583f., 586, 595ff., 601
Priamel 126f.Probabilismus 170, 250, s. Skepsis, /ogico
probabilisprobatio s. Beweis, Vergleich- pro bat ionum genera (p. ani/icial isl inanifi -
cialis) 72-9,332f ., 423f ., 2Problematisierung, hoblemphantasie
266ff.359, s. Skepsis, Topikhognostik 4f.,9ff., l l f.,9l, 178, 184,320,
517f . .520
Progymnasmata s. SclProlog(motive) 9. l55tpromptuarium 742propositio vs. nanatiopropietas, propie s. s
pnusProsimetrum 97JProsopopoeielcriopcr
82l, s. auch Ethopoeproverbium -17J, s. SentFrovidenz 11ff,518ff..
zeitigkeitProzessrecht s. ordo ir
derlzPrudentismus 21.124.
auch KlugheislehrePseudepigraphie 407ff
824a,836, s. auch Fil- PseudoantikeLit2TlPseudonym s. NamePsychagogik l92.lnflpublicuslprivatus 571.
publicapurpureus pannzs, -Pu4
565
aQuadratur des Zirkelsquaestio 2581t., 274, 271
859, s. auch Thesis- q. causae 555- quaestionum genera !- q. convivalis 402- q. sabbatina 567aqualitas (rhet. Status) 4,,Quellenkritik" im MA
350f.,413ff., J19
R
Rätsel und Ex 648ratr'o, Vemunft, Ratior
437f., 492, 498tr.2E1,882f., 977f., s. au(GewohnheiL Natur ä
- r. fidei 454- r vs. uemplrm lf., tl
326f.,2, 643, 645, E6r.l*
ratioci nat io (vs. inductio ),,Rationalismus" 250. 3{
532,58t, 752f.
#
we krive. Streitschriftplrcraticus 389f., 392, 510,98- 990
1 . 5 - ll:. 562ff., 567 fl., 57 4,601, 95 Irlehre 440ff., 558ff., 581, s.4el. oflic ia. Körpergleichnist : 1 3 . 5 6 4 , 9 X )|yhistoria 563f.,299rrs 132. 365ff., 377ff., 385,, rlrf. 566, 765' 986, s. auchüikMonomythie" 109, 478, 266oly nomia 208f., 2llf., 570ubll semie (Vielfalt von Aspek-mgen. Deutungen) XX, 72,t. : i-. 303ff., 320ff., 337ff.,I_. r80ff..384ff. ,451,454f .,473,w.
-20.757
0e e:templa 374J_i6
r \ l l . X IVI semant. 367, s. Polyvalenz6:
mpia %)f ., l44fl., 177f., 438,9: 1:1, 621, 638,877 s. auchla\rs72.
-6
a.332f . ,387t . ,2 , 178, 3753 i_?,?) malorum l78f .,421lrelles" 488ff.,491ff.I X. lf i ., 29,72f.,77ff.,91,318,,510f . . 535f .ftazrosität) 482tr.,955, -< anes praedicandiFapher) 96plum XXIIIff, 25, 39ff.,tr. r_{n. t39ff., 143, t52,173f.,, 2_i-rff. 262f .,396,424,495fI,5t6. 595ff.,601tr 1'0. 250, s. Skepsis, /ogico
le*ers. !'ergleichs gen e ra ( p. a rt ilic ial is / i nart ifi-I -132t. 423f.,2rung. Problemphantasie, s Skepsis, Topikf,-. .rff.. l lf., 91, 178, 184, 320,
Progymnasmata s. SchulübungenProlog(motive) 9, 155f., 176f.promptuarium 742propositiovs. narratio 374proprietas, propie s. sensüJ litteralis pro-
pnusProsimetrum 9ZJProsopopoeie,lictio personae 254, 574,SS0,
821, s. auch Ethopoeieproverbium JZl, s. SentenzProvidenz I1ff.,518ff.,538, s. auch Gleich-
zeitigkeitProzessrecht s. ordo iudiciorum, Jurispru-
denzPrudentismus 21, 124, 132, 137, 521, ffi,4,s.
auch KlugheitslehrePseudepigraphie 407ff., 417, 462, 543fr'
824a, 836, s. auch Fiktion- Pseudoantike Lit. 278f.,463ff.Pseudonym s. NamePsychagogik 192, 197 ft., 251publicus/privatus 571, 574 s. auch salus
publicapurpureus panruJ, ,,Purpurlappen" 15, 556,
565
aQuadratur des Zirkels 537quaestio 258ft., 274, 278ff., 556, 561f., 566,
859, s. auch Thesis- q. causae 555- quawtionum genera 556- q. convivalis 402- q. sabbatina 567aqualitas (rhet. Status) 423,,Quellenkritik" im MA 2l0ft, 217 fl., 264,
350f.,413ff., J19
R
Rätsel und Ex 648rarrb, Vernunfl Rationalität XLf., 319,
437f., 492,498ff.28r, 774ff., 878, 8E0a,8E2f., 977f., s. auch causa, logos,Gewohnheit NaEn, iudicium
- rfidei 454- r vs. uemplum lf.,8l, 84ff., 145, 3l8ff.,
326f., 2, 643, 645. 86/, s. auch auctoitas,lac
ratiocinatio (vs. inductio) 192f., 44 I,,Rationalismus" 250, 308f., 318f., 498ff..
532,581, 752f.
,Realismus' 13ff., 504ff., 529ff., 982, s.Wirklichkeit
Realismusgrad s. narrationum generaRealpräsenz,,,Realisierung', Reinkarna-
tion, Repristination 69ff., 72ff., 76f1.,93ft., 147, 328, vgl. Wiederholbarkeit
Recht s. Jurisprudenz, Kirchenrecht,Kasuistik, Glossatoren,,,Renaissance"des 12. Jhs.
recreatio s. UnterhaltungRede, Kunstrede im MA 256f., s. auch de-
clamatioRedegattungen (udicial, deliberativ,
demonstrativ) 76f., 105, l9l, s. auchInduktion, Beweis, Vergleich
reductio ad sacram scipturam 437ff., s.auch interp retat io chistiana
- "reductio (sacrae scipturae) adethicam" 461, 488ff., 494, 515, s. auch" i n t erp ret a t i o na ru ra I is "
Reform s. Neuheit (Emeuerung), Kirchen-reform, r{ormatio rationis 878
- reformatio in melius 103f.Reformation 540f1., 879, l0I9rdutat io acemp I o rum l99f .,218, 3 I 8, 320ff.,
332ff.,486, 497, 641f., 652, 654Regel/Fall s. Allgemeines/Besonderes,,Regel, goldene" #i0ft., 881f.rqio dissimilitudinis 445regula veitatis vs. Mönchsregel 569Reichtum/Armut 319f., 428Reinkamation s. Realpräsenzreligionis praamus 977Religionsvergleich, Religionsgespräch
446.454.492remedium (sacramentum a ecemplum) 9l-R enaissance' XXXI, 442-,R.' des 12. Jhs. XIIf., XLf., 136,245,
262ff.,273,391ff., 415, 419, 439ff., 553f.-,R.' des röm. Rechts (,zivilistische
R.") :3, 271tr.,432,468, s. auch GesetzRenaissance, R.-Humanismus/MA
xxllf., 19ff., 133, 142, t95, 217 f., 228ff..233ff ., 243, 251, 307f., 345, 394ff., 3glf.,414f., 4l gff., 425, 430f ., 437, 520ff., 525ff.,53tff ., 547 ff ., 424, 7%, 896, 92 2, 979, I 0 I 4
renovatio 104, s. Neuhei\ novumrepraesentatio 197f., I InRepräsentation s. Realpräsenzres (sensus)lverba 83,95, 165ff., 179,238ff.,
400, 449ff., 451, 455, 507ff , 512, 387, 3%,869, 898, 912, 982, s. auch Name. Theo-rie/Praxis, Wirklichkeit, Rhetorik/philo-sophie, pratepta
651
res publica 571rarylvere uempla/histoias 347, 354, 357,
3flRezeption flil) 721t, 134ff, 143, A6,
Leserkompetenz, Antike-R.Rhetorik XLVI, 24ff., 38ff., 99f., 128,342,
u5,486,572f ., 586f ., 202, 545f., 555, 572,57E,930. s. auch Schule
-,R." als Metapher 91,93ff., 219,450- R. im Wissenschaftssystem 418,544a,s.
Tävium, Dialektik, Jurisprudenz- R../Philosophre 22f., 167ff., lglf., 196,
246f1., 250, 252f ., 27 0, 284f ., 292f1., 397,549, ffio,874,877,9U, 1020, 1U4
idicalum(Gattung) 38/Rom (Idee, Kritik, Geschichte) 220,326f.,
350, .t8, 1004, s. auch Zuordnungskrite-rien
Roman llOf.,362f.Rubrik (in Exx-Sammlung) 342f., s. auch
ZuordnungskriterienRuhm 71f., 76,80,96, 479, 576f., snf., 370,
9/ ,5,950,97trusticitas 128.s. sermo humilis
ssacramentum/ac 91, 203, 232Säkularisation 112, 478, 5m, 948, 954, 98saailtia/sarcitas 700scles (Fazetien) 599salus publica 351, 354ff.,476f.,487, s. auch
publicusSatire 81, 138, 180, 278,336,410,474,508,
547ff., 552ff , 578, 574f., 69, 952, 996- S./Komö'die 290f., 410, 552f .,423, 574f.,
771, 834, %9- s.lhistoria 423.771Satumalien 316,406ff."Schach" (als Rahmenmetapher) 986Scharfsinn 268, 31 1ff., 484,s. auch argutia,
subtilitas, vafritiaScheinhaftigkeit s. Theateq vanüas, NameSchen/Ernst l32f .,197 .,278ff., 328f., 350,
386f., 410,417f., 470ff., 553, s. auch Spiel,Komik. libenas
Schlagfertigkeit 35,312ff.,343, s. auch ListSchmeichelei 287 f ., 316, 326ff .Schöpfung 3681L, 372ff., 388tr.,735, 747,
774, 887,982, s. auchfacta, Kosmologie,Natur
Scholastik, Scholastikkritik 195f., 249ff.,274, 307f., 419, 422f., 444, 532f., 543,
652
550ft.,546, sffif., 577, 599, A8,978, 1022,INo,1036f.
Schriftlichkeit 153ff., 401. 538. s. Mitund-lichkeit, memoia
Schrillsinne I 84ff., 33 I f., 424, 455f., 470ff.,494. 424, 4 30, 636, 94 5,s. auch sensus (. .),tropologia
Schule 31, 128, 254f1., 376, 47 I- Schulkitik 292, 361f, 405, 575, 75 I- "Schulliteratuf 25, 132, 278ff ., 569- Schulrhetorik 252tr., 21 tfr., 27 6, 278ft,
323.357ft.- Schulübung 31, 163, 203,254ff.,264ff.,
2'l 8ff .,285f .,343f ., 4ll, 492, 5 50, 5 58, 63 I,s. auch Ubung
Schwank ll2, l3lSchweigen 580f.Schwierigkeit als Wert s. dfficultasscolastico more philosophari 405scom(m)a 309ff..3l6f[scribendo solan IM2, fi44scipta 370, 398f., s. auch facta/ dictasciptor, scribens 195, 240,36f., 497, 337,
542, vgl. auctorSeelenwanderung 7 4, I9I aSehen s. Anschaulichkeit Augen, Sichtba-
res- S. vs. Lesen (Auslegen) 180f., 187, 199,
373f.,530f.Selbsrerkenntnis 22ff., 98f., 166f., 170,
207 f ., 232f ., 535ff , s. auch,Spiegel"Selbstexemplum, Selbstzeugnis 4, 96, 168,
206, 208, 232ft., 291, 3351T., 405f., 536f.,577, 581f., s. auch Autobiographisches
Selbstgespräch s. DialogSef bstmord 87 f ., 146, 321, 5ll, 348, 692, 9 I 4Selbst- und Weltbeherrschung s. Hen-
schaftsenescens seaculum s. Niedergangsensus, sententia s. res/verba, Schrillsinnes ensus I it tera I is( his to icas) 334, 39 I f., 398f.,
455f.,494f., 538, 935- s. l. propiusls. l. figuratus 456fL,
4'nft.,912, 935sensus mysticus(spiitualis) 399f., 455ff.,
469ft.,475t.Sentenz 159ff., 163f., 24ff., 2ffi, 425, 283,
540, 5 56, 859, vgl. Chriesequi 393ff . (s. imitatio), 4 30, 7 87f., (s. sua-
sio/dissuasio)sermo humilis(rusacusl I 18f., 127 f., 298sermocinatio 412, E2I, s. auch EthopoeieSexualethik 313,639Sichtbares/Unsichtbares 95, 155ff., 331f.,
368ff., 530, 982 s.Wirklichkeit
significatio 64, l2l. 2l',signum lEE,9Msimile 592similitudo 491T.. 55tr.
590ff.,596, 106, 136/.364, s. auch lorlHomoeosis
Simonie 474f.s i mp I as i s ( co nfo rmatio )simplicitas Dei IA0l, s,
tigkeitSinntälligkeit, sinnlicl
Exx s. Anschaulicblstimulation, aidentia
Skepsis("akademische-292f., 301ff., 353f.. j467 f ., 47 3 f ., sy.f ., 102,752,939, 1022. s. aucl
Sokratismus s. SotrareSophistik, Sophisma 25
3ffif.,549, 567a, 57|f.Soziafethik s. officiaSpeisemetaphorik 373f
742f.Spezialistentum XXXf
s. Cornificiani, vg)" EuSphinx 82r',Spiegel", sprulum 9tl
537f.,552f., 247, 337,"Spiel" (Gesellschaftsspi
s. auch Schac[ ThearSpiel/Emsfall 30f., 7tf
267, 276ff., 2t/. zg}t47 Off ., 47 8, 482ff.,,1t7 f771,988, s. auch Üburbung
Spiritualität 481- Suspension der S. 26spolia Aqtpti(orun) 39
m3,1025,1030Staatslehre s. ofiicia,
geichnisStadtkfiik 9J1. s. HolkrStand, St
Bildungsstand s. Les{cia
Standbild s. Bildnisstarus(rhel) 27 3ff ., 4231
636, 858- s. interpretationis X)(
Umstände, Anachrorention
,6{,f.. 577, 599, AE,978, 1022,
; 15iff.. 401. 538, s. Münd-rcna1t4ft . 33 1 f., 424, 455f., 4701T.,| 6-16. % 5,s. auch sensus (. .),
I 254ff., 376,471n2.36rf .,405, 575, 751hr 25,132,278ft.,569ir 252ff., 27 tff ., 27 6, 278ff .,
I 31. 163, 203, 254f1., 264fr.,, 343 i. 4 l 1, 492 , 550, 558, 63 I,ng; l - 11Df.ds Wert s. dfficultasc philosophai 405)ff..316ff.n 1rX2,lM4Itl. s. auch/actaldictaru 195, 2n,3fi,491, 337,llorwV 74, l9 laüaulic hkeit Augen, Sichtba-
r (.{uslegen) 180f., 187, 199,
ns 22ff., 98f., 166f., 170,535ff, s. auch "Spiegel"mr. Selbstzeugnis 4,96, 168,ptr. 291, 335ff., 405f., 536f.,r auch Autobiographischesh s Dialogtf.. 116. 321, 5l t, 348, 692, 9r4Teltbehemchung s. Hen-
tlum s.Niederganglb s. res/verba, SchriftsinneA hrrc icus) 334, 391 f., 398f.,53t. 9JJts;s. /. /iguratus 456ff.,935ry( spiirualis) 399f., 455ff.,
t. 163i., 2uff .,2fi,425,2E3,P, vgl. Chrielinitatio), 430, 78T., ß. sua-,)lrul rcrs) llSf ., 127 f ., 298al2. E2l, s. auch Ethopoeie) t3.639tsrchtbares 95, 155ff., 331f.,
368ff., 530, 982, s. auch intelligibilia,Wirklichkeit
signilicatio 64, l2l, 217 ff ., I 50signun 18E,984simile 592similitudo 49ff., 55ff., 146, 192f.,332, 42'1,
590ff.,596, 106, r36f., i,39, r41,287,345,364, s. auch locas a similitudine,Homoeosis
Simonie 474f.simpl asis(conformatio) 874simplicitas Dei lAil, s. Einheit Gleichzei-
tigkeitSinnliilligkeil sinnliche Qualität von
Exx s. Anschaulichkeig movere, Affekt-stimulation, aüdentia
Skepsis("akademischeJ 168ff., 196, 253f.,292f., 301ff., 353f., 361, 393, 395, 406,467 f .,473f., 554f., 402, 5E I, 586, 595f., ffi I,752, 939, 1022, s. auch academicus
Sokratismus s. Sokrates (Reg. l)Sophistik, Sophisma 250, 282ff .,29,305f .,
3ffif., 549, 567a, 57 |f,, 96ESozialethik s. ofriciaSpeisemetaphorik 373ff., 575, 579, 733,
742f.Spezialistentum XXIXf., XXXI\ 546, 5 57,
s. Comificiani, vgl. EinheitSphinx 824"Spiegel', sputlum 98f., l7lf., 410, 535,
537f., s52f., 247, 337, e2r, 965, 1026"Spiel" (Gesellschafsspiel) 450f ., 5ll, 986,
s. auch Schach, TheaterSpiel/Emsfall 30f., 78f., 254ff., 259ff . 265,
267, 276ff., 28/', 2nff ., 330f., 361, 463,47 Off ., 47 8, 482ff .,.49t f ., 2 7 6, 5 ß, 5 7 1, 6 5 2,771,988, s. auch Ubung, Scherz, Schulü-bung
Spiritualität 481- Suspension der S. 269ff, 277ff.,488ff.spolia Aegtpti(orum) 396,539ff., 636, 734,
803, 1025, 1030Staatslehre s. ofricia, Politik, Körper-
geichnisStadtkitik 95l, s. HofkritikStand. Standesunterschied.
Bildungsstand s. Leserkompetenz, o;ffi-cia
Standbild s. Bildnisslarus(rhet) 273ff ., 423fI., 437, 486, 5 54I.,
636,858- s. interpretationis XXXI, 8J8, s. auch
Umstände, Anachronismus, Zeit, Int-ention
Sterbe-Exempla 339f., 170, s. auch ,4itat-haftes Leben"
Stereotypie(derExx) 61ff., 68, 79, 102, 108,127,337ff .,921, s. auch Trivialisierung
,Steme', sidera saealorum (fiirExx) 339ff., 552,665
,Steuermann" (Parabel) 52ff., 192, 125f.,145
Stifterfigur 611, s. UrsprungStilhöhen 133. s. auch sennmo humilisStoa, Stoakritik 5l l, 6Jl, 877, s. auch Apa-
thiastratqemma, stratqemmaticarn 35, 148ff.,
309ft. 486, 354, 610, EIg, 834, s. auchFrontinus (Reg. l)
Streitgedicht 278f ., 569, 669Streitschrift 286ff.,335,3,14ff., 363, s. auch
Invektive SatireStrukturalismus 516f.studium 551f.- s. quaerendi, inquirendi 474,515,s. auch
inquisitio, Zetetiksuas io/ d issuasio ( oeho rtatio / dehortatio,
mahnendes/abschreckendes Ex, Fol-gen/Meiden) 67 f.,91, 105, 176ff., 184ff.,3l8ff., 323f., 337ff .,37t,538,578, 145f.,164, 367, 369, 373, 4IE, 420, 423, 429f.,734, 912, 1192, s. auch factalfacienda,Ambivalenz, Homoeosis, Lohn/Strafe,zsus, Versionenangebol Widerspruch
suasoia 30, 254, 256f ., 285, 344Subjektivität (Subjektivismus vs. Entsub-
jektivierung) XLVI, 206ff., 2 l6ff., 231 ff.,322ff., 335fT., 382, 523, 536, 549f ., 5 2 gff.,570a, 741, IO44 s. auch IndividuumAutobiographisches, Augenzeuge, Er-fahrung Selbstex.
Subsumierbarkeit 26ff., 504, 535, s. Allge-meines/Besonderes
subtilitas, "subtilitö" 319, 483f., 6f�1, 410,ffig,956f.,973, 1209
Sünde, Sünder-Ex 96f., l0l, 184ff.,207f.,322fL,3ffi,456f., s. auch confessio
Sündenfall 16f., 444f., 39l, vgl. Natursumere acempla 374summum bonurz (Güterlehre) 165f., 295f.,
snf.,582,978summum ius summa iniuna 322ff.. 354.
634f., 700, s. auch Extremfallrelativie-rung
supey'icies(sensus) litteralis 9 I 2, 932Suspension religiöser Aussagen s. remoto
Christo, Praelenpirituelles, Fiktion (Als-ob)
653
suum cuique 880a, s. aequitasSyllogismus 182f., l88ff., 301, 160, 426,
433, 448, s. auch EnthymemSymbol 337 ff ., 39lf ., 664Symposien (Gattung 3 17, 356, 401f., 407f.,
706. 742.806 s. auch KonversationSynekdoche, Eigenschaftsverkörperung
67 f ., t73,326ff., 337ff., 34l, 584, 587, 589,162, 287,4t0, 6ffi, 665
,,Synkretismus 81, 107ff., 166ff., 445f.,47 5ff .. 394, 948, 950, 952f.
Synkrisis 103, 203, 287f., 376ff., 546, 587,572a,980
Szientismus s. Wissenschafßkritik
T
Tädel s. Invektive, insinuatio, libertasTechnik s. Naturbehenschung, arst emeri t as, t emera riu s 302ff ., 5 68, 5 9 1 f., 6 3 7,
682.9t2tertium comparationis s. medietastestimonium 144f., 374, 457"Iheatef (Metapher) 180, 345, 410, 445f.,
483f.,508ff., 957,985f., s. auch Komödie,Tragödie, vgl. Drama
theatram (Buchtitel) 419thema 559, vgl. ThesisTheokratie 571ff.. s. HenschaftTheorie/Praxis 83ff., 90, 95, 1,|4ff., 157ff.,
l64ff., 206f., 257, 292f., 325, 361, 461f.,487, 510f., 568, 575, 578, 669, 962 s. auchars
thesaurus (Buchtitel) 566f.Thesis/Hypothesis (quaestiolcausa) 163,
228, 250, 258ff.,27t, 284-9, 423f., 43tf,545f., 554, 556, 573, 726, 858f., s. auchUmstände, causa, quaestio, Sentenz,Chrie
Tierfabel,,,Tierexempel" 53, 56, 403, 287,s. Fabel
Tischsitten 470f.- Tischlektüre 129,315Titelgebung (Buchtitel) 177, 286f., 488f.,
513, 556ff., 561ff., 566, 965, 968, I08ITod, Tote 100ff., 429, 596f., s. auch
Sterbeexx.Totenklage 433Toleranz 322, 357 ff ., 373, 446f ., 454, 709,
880a, 888, m6,973 s. patientia, summumius..
Topik XY XVIII, XXIV XLIIIf., 4,195t.,20tf., 245, 246-5t, zffift., 297f1., 307,
654
319f., 331f., 342tr., 345, 384ff., 421-34,526,532f,5,14, 554, 287, 433, 445f., 544f.,549, 583, 598, 753, 764f., 856f., 861, 1004,1021, 1037, s. auch Argument Ambi-valenz, copia, Endoxa, Dialektik, En-thymem, Gewohnheit Induktion, inven-tio, implere locum, iudicium, Kontextuali-tät, locus, /ogrco Notorietät Polyvalenz,Rhetorik/Philosophie, Thesis, Konsens
- T und Ex 192f., 319f., 331f., 421, 425,427tr..526.5,547,870
tractatio, tractator 363. 34 5, 7 20, I I 78 (noditractandi)
traditio 214Tiadition 71f., 93, 154ff., 213, 238ff., 435,
450f.,576,578f., I032, s. auch Schriftlich-keit, memoia
- .Iraditionalismus" 318f.Thänen 350, 432f., 872, vgl. ApathiaTiagödie, tragedia 131, 145, 569, 574,635,
787,986f.- T./Komödie, Tiagikomödie 484, 510ff.,
834, s. Theater,comedia, KomödieTiaktat 138, 286ff., 345, 360translatio studii 203Tiauer 433,596f.Thaumdeutung 185f., 349, 361Tänität 479f.,822, 887,,Triumphbogen" 576f.Tävialisierung, Trivialität von Exx 79,
I I lf., s. Stereotypie, NotorietätTrivium 195, 246ff., 262ff.,272,419, 544a,
550,557, J99, s. auch Grammatik, Rheto-rik, Dialektik, Jurisprudenz
Tropen(gramm./rhet.) 56ff., 58f., 197f.,325 (oratoius topus),390,591fT., s. auchrepraesentatto
tropologia(exeeet) 16, 2 14, 912, %5Trost, Trostexx XXIL 22f ., 126, 429 ff ., 516,
548f., 577, 596f.,570a, 673,997Tünlichkeit 6, 201 ff., s. factalfaciendaTypisierung s. Denkbild? Wiederholbar-
keit Stereotypie, ThivialisierungTypologie, typus, Jigura 64, 74ff., 84, 94,
100, 104ff., t47, 203, 323ff., 330ff, 335,435, 457ff., 4&ft.,473,475ff., 481f., 486,506, 513ff.. 252-8, 486, 636, 652, 664, 91 3,9 1 7, 958, 992, 9%, vgl. Realpräsenz, Alle-gorie, Exx-Arten (exemplum impar)
Tyrann, Tyrannenkritik 34, 177, 202ff.,2t2f ., 236f ., 287 f ., 3t2, 326, 338, 349, 389,523, 569,57r, 462, 683, 696, 726, %2, 977
Tyrannenmord 142, 216, 3 17, 365f., 468ff.,335, 55t, 63rf., 642
U
Überbietung (rhel) &653
Überlistung s. ListUbung 8,252tr.?57.
Gewöhnung. Schuliusus
Umfang des Exemplurformen) 61ff.. 79. Iauch commemomtio.
Umstände,(circamstantiae) 163636,914, s. auch Tktus
Universalien, U.-streir507, 575, 97E, 9E3, s,Besonderes
Univenität(im MA) iUnterhaltung Untcrtu
69,79f., 110ff.. l24l197ff., 268, 275. 3Z598.fCI2,276, 772. A.
urbanitas 312ff.. 316.humanitas
Urkirche 85, 103Ursprung, Ursprungs(
414f., 450,539tr. 8J'Ahnen, Tradition-Rezeption
rrur, rti,Welt- u. Liten293ff., 371ff. (vs. fra396ff., 537ff., 540.4A84,808,8/8, s. auchHenschafl imitatio
- u. in anderen BedeChrie, Gewohnheit I
utilitas 224. 319. 370ff.Lehrhaftigkeit srgzfi
- u. vs. delectatio 410.770f.
- l. vs. veritas (histoiar
vvafitia, vafre dicta 35. :v anitas 505ff .. 525, 96 3, I
contemptus mundivaietas, variatio 26f.14
492,564f .. 705, 722, E5.lio, Neuheit Aufmrung
-Vasall' 393ff.
:- _u2rT.. 345, 384ff., 421-34,trr. 551. 287, 433, 445f., 544f.,ß.
-:3, 7Uf'856f., E6I, 1004,I s auch Argument Ambi-xa. Endoxa. Dialektik, En-ies ohnheit, Induktion, lnven-t I xa m, iu d icium, Kontextuali-bSrrca, Notorietät Polyvalenz,lhrlosophie, Thesis, Konsensl9tf. 319f., 331f, 421, 425,
,5 . : 4 ' , 870wo r 363. 34 5, 720, I I 78 (nodi
t.. 93. r54ff., 213, 238ff.,435,In9i . 1032, s. auch Schriftlich-?b[smus" 318f.132f ..872, vgl. Apathiagedn l3I, 145, 569, 574,635,
b. Tragikomödie 484, 510ff.,tter. comedia, Komödie2t6fT.. 345, 360Ju 203t%fre 185f . ,349,361- 8)2, 887pn- 576f.3 Trivialität von Exx 79,Feotypie, Notorietät, 2.16ff., 262ff ., 272, 419, 544a,19, s. auch Grammatik, Rheto-[k. Jurisprudenzhh /rhet.) 56ff., 58f., 197f.,ir's tropus),390,591ff, s. auchYtoEAeLt 16,214,912, %5q XXII, 22f., 126, 429ft,516,5%f .. 570a, 673,997t 20Iff., s. factalfaciendas. Denkbild? Wiederholbar-lqpie. Trivialisierungpus. ftgura 64, 74ft., 84,94,, 1.17. 203, 323ff., 330ff., 335,, 460ff., 473, 47 str., 481f., 486,, 2 5 2-8, 486, 636, 652, 664, 9 1 3,12. 9%,vgl. Realpräsenz, Alle-Aflen (exemplum impar)rnnenkritik 34, l7'1, 202ff.,, 281f., 3 12, 326, 338, 349, 389,1r.462, 683, 696,726, %z977td 142, 216, 317, 365f., 468ff.,itLf..642
U
Überbietung (rhet.) 84, 334, 396, 587, 641,653
Überlistung s. ListUbung 8,252ff.,257,288, 5481f., s. auch
Gewöhnung, Schulübung, imitatio, ars/usus
Umfang des Exemplums (Kurz- und Lang-formen) 61ff., 79, 149, 583-97, 195f., s.auclt commemorat io, narratio
Umstände, Peristasen(circumstantiae) 163, 258ft., 423f ., 4, 5 54,636,914, s. auch Thesis/Hypothesis, sta-tus
Universalien, U.-streit XIIIf., 147, 291f.,507, 575, 978, 9E3, s. auch Allgemeines/Besonderes
Univenität (im MA) 262,276,419Unterhaltung, Unterhaltungskritik XI, 5 l,
69,79f.,110ff., 124f., l2gf., 13lf., 137,l97fl., 268,275, 329,386f., 463f., 586,59842,276, 772, 822, 930
urbanitas 3l2ft. 316, s. auch civilitas,humanitas
Urkirche 85, 103Ursprung, Ursprungsideal, ad fontes 74,
414f., 450, 539ff.,837, 896, 1032, s. auchAhnen, Tradition, Urkirche, Antike-Rezeption
usus, uti,|Velt- u. Literaturgebrauch" 285,293ft.,371ff. (vs. frui, vs. abuti), 388ff.,396ff., 537ff., 540, 4U, 57 8, 729, 7 34, 774,8U, 808,878, s. auch Antike-Rezeption,Herrschaft, imitatio
- u. in anderen Bedeutungen s. ars./u.,Chrie, Gewohnheit, Übung
utilitas 224,319, 370ff., 401f.,483, s. auchLehrhaftigkeit, s igni/icatio
- r. vs. delectatio 410, ffi\ 323, 420, 423,770f.
- r. vs. veitas (histoiae) 216ft.,402
vvafitia, vafre dicta 35, 31 1 ff., 314, 603, 610vanitas 505ff.,525,983,985f., s. auch nugae,
contemptus mundivaietas, vaiatio 268,342-50,350-61, 362-8,
492,564f ., 705, 7 22, 85 2, 92 I,s. auch imita-tb, Neuheit, Aufmerksamkeitssteige-rung
-Vasall' 393ff.
vel, sa I t i m (in der Klimaxbildu nü 236, 5 3 2,62t ,920,926,97t
Veränderung vs. Unabänderlichkeit 450f.,503ff., 512f., vgl. Einheit
Verbrauchs-/Wiedergebrauchsexx 18,22ft.,32ff .,37f ., 2s7
,ferdauung" 375ft, 397ff.Verfremdung (lir),,,öcart" 463, 468ff., 471,
475ff , s. auch Code-We chsel, vaietasVergleich (hist. / rhet.) 22, 55ff., 98f., I 92ff.,
424. 427 ff .. 5 I 7ff.. 589ff.- Vergleichsarten: stilistischer vs. argu-
mentativer V Xf., 48ff., 55f., 72ff.,196,199, 251, 325f., 589ff., s. auch Beweis
veritas rerum s. res/verba, WahrheitVersionenangebot 19ff., 213f., 350f., s.
auch Indifferenzformel, Leserkompe-tenz
Vertrautheit von Exx. s. NotorietätVenvaltungsethik s. o/fi c iavestigium 166, 337ff., 341 , 395, sffif.,732,
742,787via rqia 582,264, 881vitia splendida 462f.Volk, Volkstümlichkeit, Volkskultur
xxxvll lf., 33, 51, 63ff.,k l12, l l4f.,124f., 128ff., t80f .,221ft.,226, 3 19f.. 373f.,569,597f.
-,Volksliteratuf' (nanative) 51, ll4, 128,22r,225f.. 583f., 601, l3t, t49, 22tff., s.auch Latein, Fabel, Leserkompetenz
- Volkspredigt Volksseelsorge, 34, 79f.,109f., 123f., 128f.,199ff.,225,492, s. auchPredigtexemplum
,f,olksfrömmigkeit" ll2, 27 5Volkssprachen s. LateinVollkommenheit, Vervollkommnung 92,
96f.. 104.326Vorbild{Warn-)Exemplum 8f., 39ff., 67ff.,
70ff.,92ff., l00ff., 128, 144ff., l54fL,340f.,514f., 536ff., 541, 585, 587,589, s. auchBeweis
,lorläufef 341,448, 508ff., 552Vonat an Exx 30. 138. 386. s. auch Exx-
Sammlung, copra
wWahrheit (philos., theol.): Einheit u. Una-
bänderlichkeit der W 306f.. 368. 374.382,398,401f.,450, 503ff., 591, 753, 800,8U, 882, 895, 978,982 s. auch Einheit.Zeit
655
- veitasfilia temporis 453, W- Wahrheitssuche s. inquisitio, ZetetikWahrheit (hist.) 208ff., 2llf., 214,219tr.,
232{T., 403ff., 54t, 46t, 470, 492494, 502,854
s. auch h isto ia, Faktizität Denkwürdiekeit,utilitas, vgl. Fiktiorq Lüge
Wahrscheinlichkeit 6, 2l4fl., 250, 299fI.,307 ,384,422,428f., s. auch Glaubwürdig-keit logica probabilis, naftationumgen era, a rgu mentum, Endoxa
,Weg" 166, s. via regia, vestigium, sequiWelt 774 (Schöpfung/Sünde) - W-hen-
schaft s. Hemchaft - W-theater s. Thea-ter - jW-deutung,/til+rsatz" lll
Weltalter 513, vgl. EpochenWidenpruc[ Widenprüchlichkeit 213ff.,
322ft.,347f1.,360, 365ff., 380, 385, 388f.,406,454,553f., 598, s. auch Ambivalenz,dub ietas, dffictl tas, Versionenangebot -Widerspruchsbehebung 210ff., 213,262f1.,267,3r8ff., 339, 380ff., 858, s. auchEinhei! Dialektik, diversi non adversi,concordia discors
Wiederholbarkeit (hist), jWiederkehf X,xv xx, 7, tt,t't ff .,217 ,340f., 504ff., 508,513ff., 516ff., 520fT., 525, 535,22, 132,s. auch Konstanz, Gleichzeitigkeit vgl.Beispiellosigkeit
Wirklichkeit (Begriff, Vorstellung, Kon-struktion) XLIII, 15ff, 70ff., 81f., 89,96f .,157,208ff., 214f., 2t8,232ff.,332f .,391f., 421f., 483f., 504ff., 523, 529ft.,536ff., 545f., 36, 964,982, s. auch Wahr-heif Offenbarung, Faktizitä\ res/verba,vgl. Fiktion, Zeichenhaftigkeit
Wissenschaftstheorie XLf., 10, 246ff.,262ff .,27 6,305, 382f., s. auch Erkenntnis,Logik - Wissenschafbkritik l68ff., 178,186f., 250f., 291, 296ff., 301, 307f., 361,373f., 392f., 435ff., 454, 466f., 531ff, 554,405, 549, 589, 750, 779, 877, 902, 921. s.auch Einheit Negtivität Skepsis, Spe-zialistentum, carios itos, temeritas
Witz 16l, 3llff., 386,410, s. ScherzWunder 12, 79, 82f .,91, 93ff., 96ff., 100ff.,
l@ff., l14, l16, l18, 164, 276, 280, 921,s.auch mirabile, Mirakel, imitatio/ admira-tio
Wunderbares s. Kuriosität
zZaubenpruch 76Zeichenhaftigkeil,tesbarkeit" der Welt
xv 331f., 388ff., 451, 504, 507f., 541, s.auch Allegorie, Hermeneutik, Offenba-rung, "Buch, signi,Jicatio, signum
Zeit (philos., theol.): Z. und Wahrheit155ff., 238ff., 340f., 382f., ,149ff., 456f.,474, 504ff., 5&,735, 892,942, 978,982f.,997, s. auch Einheit Gleichzeitigkei!Wahrheit
- Z. als Umstand (rheL), ratio tempois2llf.,323f.,334, 486, 6J6, s. auch Ana-chronismus
Zeitgefiihl, Zeitkritik s. Gegenwart (...)Zerstreuung (vs. Sammtung) 582Zetenk 263, 474,515, 562, 593, s. auch
studium quaerendi, inquisitio veitatisZit:rt 4, 157ff., 163, 17 4ff .,202f ., 206ff., 235,
238, 245, 26f1., 27 rff., 360fT., 364, 402ff ,408, 4l2lT., 4t6ff ., 42t, 425ff., 490, 497,I9la, 337, 546, 713, E07, s. auch auctor,auctoitas, Chie, facta/dicla, Fiktion(ficti auctores), acemplum (als Z.) Plagiat
- Zitiertechnik, Z./Parapfuase 138, 404f.,454,813,835, s. auch imitatio
- "zitathaftes Leben" 70,7 5,234, 5 I 3, 998,s. auch Realpräsenz
Zufall: in der Geschichte 533. 1006- Z. vs. Methode s. ars.Zuordnungskriterien (der Exx) 342ff.,
384f., s. inventiolwergelRiesen' XX, 238ff., 241ff., 381,
395f., 579, 538, 553, 767, 853, 900, 1025
ERRATA
S. XXIX, 2.23: Soll<S. XXXVII, 2.35: v<S.206, Al. (Nr. 56): IS .291, Z . l0 : des innS.619, s. l . VERttvE'S. 631, nach OTT ein5 .632, s . l . PLAIAI :S. 645, s. l.: HistoriolA n m . 3 3 8 , Z . 1 l f . : qAnm. 369, Z. 5: Dist.Anm. 538 und S. 604Anm.578 (5 .295\ .2
656
! - 6fierl Jesbarkeit" der Weltlt8tT. 151, 504, 507f., 541, s.pne. Hermeneutik. Offenba-b- sßnrficatio, signum, theol.): Z. und Wahrheittr. 340f., 382f., 449ff., 456f.,#. 7 3s, 892, 942, 978, 982f.,ch Einheit, Gleichzeitigkeit
nand (rhet.), ratio tempois, -7Y. 486,6J6, s. auch Ana-I
Bitkdtik s. Gegenwart (...)lvs Sammlung) 5824-1. 515, 562, 593, s. auchurendi, inquisitio veritatis: I 63. I 74ff., 202f ., 2mff .,235,5ff.. 27I ff., 360ft, 364,,102ff.,416ff., 421, 425f1., 4n, 497,
516. 7 I 3, 807. s. auch auctorChne, factaldicta, Fiktion
at exemplum (als Z.) Plagiatit. Z./Paraphrase 138, ,()4f.,lJ. s. auch imitatiorLeben" 70,75,234, 5 I 3, 998,lprasenz'Geschichte 5ß,1n6bde s. crs.ntenen (der Exx) 342ff.,avllorcn' XX, 238ff., 241ff., 381,138. s53, 767, 8s3, 900, I02s
ERRATA
S. XXIX,2.23: Sol len wir , um .. .S. XXXVII, Z. 35: vorwerfen lassen, er vergesse ..,S. 206, Al. (Nr. 56): Da Johann Geschichte ..S. 291, Z. l0: des inneren Disputs über ..S. 619, s. l. VERWEYEN: - Art. 'Apophthegma': ...674 - 678.S. 631, nach OTT einfügen: OTTE, G. 546.S. 632, s. L PLAIAI: PrArA..S. 645, s. l.: Historiographie ..Anm. 338, Z. ll f .: quellenphilologischer Arbeit ..Anm. 369, Z. 5: Dist. Cat. III l3: oben 9, Anm. 16.Anm. 538 und S. 604, s.l. Met.: HALL ..., StM 24 (1983) ...Anm. 578 (S. 295), Z. 15: cf . Hildeb. Cenom.