Entwicklung und Stellung der Intellektlehre im System des Albertus Magnus
-
Upload
albertus-magnus-institut -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Entwicklung und Stellung der Intellektlehre im System des Albertus Magnus
ENTWICKLUNG UND STELLUNG DER INTELLEKTTHEORIE IMSYSTEM DES ALBERTUS MAGNUS Henryk Anzulewicz Vrin | Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 2003/1 - Tome 70pages 165 à 218
ISSN 0373-5478
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age-2003-1-page-165.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anzulewicz Henryk, « Entwicklung und stellung der intellekttheorie im system des Albertus Magnus »,
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 2003/1 Tome 70, p. 165-218.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Vrin.
© Vrin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
AHDLMA 70 (2003) 165-218
ENTWICKLUNG UND STELLUNGDER INTELLEKTTHEORIE IM SYSTEM DES ALBERTUS MAGNUS
par Henryk ANZULEWICZ
Albertus-Magnus-Institut,Adenauerallee 17-19, D-53111 Bonn
RésuméL’œuvre d’Albert le Grand représente un système théologico-philosophique
ambitieux, dont l’anthropologie avec sa doctrine de l’intellect forme le noyau. Larecherche sur la théorie albertinienne de l’intellect, conduite dans une perspectivediachronique, montre qu’elle reçoit un développement systématique par intégration etreformulation d’éléments doctrinaux augustiniens et dionysiens, (néo)platoniciens etaristotéliciens-péripatéticiens. Elle explicite la montée de l’homme vers l’accom-plissement suprême de son intellect.
AbstractAlbert the Great’s work offers an ambitious theological-philosophical system, the
core of which is the anthropology with its theory of the intellect. This research of Albert’stheory of the intellect, which is carried out in a diachronic point of view, shows how itreceives a systematic development through integration and new formulation ofAugustinian and Dionysian, (neo-)Platonic and Aristotelian-Peripatetic doctrinalcomponents. It explains the rise of man towards his intellect’s highest perfection.
ZusammenfassungDas Werk des Albertus Magnus stellt ein anspruchsvolles, theologisch-
philosophisches System dar, dessen Herzstück die Anthropologie mit der Intellektlehreist. Die in diachronischer Perspektive durchgeführte Untersuchung der AlbertschenIntellekttheorie zeigt, daß sie einer systematischen Entwicklung unterliegt, welche aus derIntegration und Reformulierung augustinisch-dionysischer, (neu-)platonischer undaristotelisch-peripatetischer Lehrstücke resultiert. Sie expliziert den Aufstieg desMenschen zu seiner höchsten intellektiven Vollendung.
[Mots-clés : Albert le Grand, théorie de l’intellect (Albert le Grand)]
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
166 HENRYK ANZULEWICZ
EINFÜHRUNG *
as Herzstück des albertinischen Œuvre, welches aus unserer Sicht nichtnur eine imposante Anreihung von Schriften des Doctor universalis zu fast
allen Wissensbereichen seiner Zeit darstellt, sondern ein in sich geeintes Systemeiner ganzheitlichen, dem biblisch-christlichen Offenbarungsglauben und demWissenschaftlichkeitsanspruch der Zweiten Analytiken gerecht werdenden Expli-kation der gesamten denkerisch faßbaren Wirklichkeit ist, bildet die Anthropo-logie. Wir haben sie als eine in doppelter Hinsicht ganzheitliche Lehre vomMenschen charakterisiert : einerseits von der Auffassung ihres Gegenstands her,andererseits von der Zugangsweise zu diesem 1. In den beiden Merkmalenmanifestiert sich gewisse Originalität und Attraktivität des Ansatzes Alberts.Betrachten wir seine Anthropologie chronologisch in ihrer Entwicklung, stellenwir fest, daß sich in ihr allmählich zwei Brennpunkte herauskristallisieren, unddaß sie nicht bloß ein abstraktes Theoriestück ist, sondern daß sie gleichsam einenTheorie und Praxis miteinander verbindenden, bewundernswerten Lebens-vollzug ihres Autors darstellt. Werden die Inhalte anthropologischer Schriftenund anthropologisch relevanter Texte aus dem Gesamtwerk des Doctor univer-salis eingehender untersucht, fällt zweierlei auf : Es zeigt sich zum einen, daßseiner Lehre vom Menschen so wie seinem Denken insgesamt eine konstanteStruktur zugrundeliegt, die wir als ein theologisch grundgelegtes und demneuplatonischen Denkmuster entsprechendes Denkmodell bezeichnen 2. Zumandern wird aber deutlich, daß das Hauptthema und das Hauptanliegen derAlbertschen Anthropologie die Verwirklichung des Menschen als Mensch unterden Bedingungen der Kontingenz (in Raum, Zeit und Materie) in der Ausrichtungauf die höchstmögliche Vollendung hin, die perfectio, ist.
Albert benennt und erläutert zwei Wege der Verwirklichung des Menschenals Mensch. Es ist einerseits die intellektive Verwirklichung, welche dieVollendung gemäß dem Intellekt (perfectio animae secundum intellectum)darstellt. Andererseits handelt es sich um die sittliche Vollendung, welche dieVerwirklichung gemäß den sittlichen Tugenden (perfectio secundum virtutem et
(*) Für die sprachliche Revision des Textes sei Frau Dr. Alice Reininger, Wien, ganz herzlichgedankt.
(1) H. ANZULEWICZ, « Der Anthropologieentwurf des Albertus Magnus und die Frage nach demBegriff und wissenschaftssystematischen Ort einer mittelalterlichen Anthropologie », Was istPhilosophie im Mittelalter ?, hg. v. J. A. AERTSEN u. A. SPEER, Berlin-New York 1998 (MiscellaneaMediaevalia, 26), p. 756-766, hier p. 757, 765sq.
(2) ID., « Die Denkstruktur des Albertus Magnus. Ihre Dekodierung und ihre Relevanz für dieBegrifflichkeit und Terminologie », in L’élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge,ed. J. HAMESSE et C. STEEL, Turnhout 2000 (Rencontres de Philosophie Médiévale, 8), p. 369-396 ; ID.,« Pseudo-Dionysius Areopagita und das Strukturprinzip des Denkens von Albert dem Großen », inDie Dionysius-Rezeption im Mittelalter, hg. v. T. BOIADJIEV, G. KAPRIEV u. A. SPEER, Turnhout 2000(Rencontres de Philosophie Médiévale, 9), p. 251-295 ; ID., « Die Rekonstruktion der Denkstrukturdes Albertus Magnus. Skizze und Thesen eines Forschungsprojektes », Theologie und Glaube, 90(2000), p. 602-612.
D
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 167
virtutis felicitatem) meint 3. Beide Wege der Verwirklichung entsprechen derNatur des Menschen – seiner Vernunftbegabung 4 und seiner Sittlichkeit 5 – undführen ihn zur absoluten Vollendung (perfectio) 6 und höchsten Glückseligkeit(summum felicitatis) 7. Diese besteht unter den viatorischen Bedingungen auf dereinen Seite in einer «Tätigkeit gemäß der vollkommenen sittlichen Tugend » und«im höchsten Guten », welches diese ungehinderte Tätigkeit darstellt – Albertbezeichnet sie als die felicitas moralis secundum suum esse et secundum suummaximum posse. Auf der anderen Seite besteht die höchste Glückseligkeit« vornehmlich in der Betrachtung der einfachen Substanzen und der ErstenSubstanz », in einer Betrachtung, die weder von innen noch von außen herbehindert wird 8, oder anders ausgesagt : « im Verbleiben im göttlichen Sein und
(3) ALBERTUS MAGNUS, De intell. et int. l. 2 c. 12 : ed. A. Borgnet, Paris 1890 (Alberti MagniOpera omnia, Ed. Paris. IX), p. 521b ; Metaph. l. 5 tr. 4 c. 1 : ed. B. GEYER, Münster 1960 (AlbertiMagni Opera omnia, Ed. Colon. XVI), p. 272.14-27 ; cf. De nat. et orig. an. tr. 2 c. 14 : ed. B. GEYER,Münster 1955 (Alberti Magni Opera omnia, Ed. Colon. XII), p. 39.75sq. H. ANZULEWICZ – C. RIGO,« Reductio ad esse divinum. Zur Vollendung des Menschen nach Albertus Magnus », in Ende undVollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, hg. v. J. A. AERTSEN u. M. PICKAVÉ, Berlin2002 (Miscellanea Mediaevalia, 29), p. 388-416, hier bes. p. 391.
(4) Die prägnanteste Formulierung hierfür, die bei Albert oft wiederkehrt, lautet : « homo solusintellectus est » (= « homo enim in eo quod homo, tantum est naturae rationalis ») : cf. ALBERTUS
MAGNUS, De IV coaeq. tr. 4 q. 69 a. 3 part. 3 : Paris, BnF lat. 18127 f. 95va, ed. A. Borgnet, Paris 1895(Ed. Paris. XXXIV), p. 703a ; Super Dion. De cael. hier. c. 1 : ed. P. SIMON et W. KüBEL, Münster 1993(Ed. Colon. XXXVI/1), p. 12.56 ; De nat. et orig. an. tr. 2 c. 6 : ed. cit., p. 29.36 ; für weitereBelegstellen cf. H. ANZULEWICZ – C. RIGO, « Reductio ad esse divinum », p. 397 mit Anm. 48. Inseinem zweiten Ethikkommentar hebt Albert die Vorzüglichkeit der intellektiven Vollendung undder kontemplativen Glückseligkeit des Menschen gegenüber der sittlichen Vollkommenheit und demdaraus resultierenden, auf bloß menschlichen Tätigkeiten beruhenden und somit kontingenten Glückhervor : cf. Ethica l. 10 tr. 2 c. 3 : ed. A. Borgnet, Paris 1891 (Ed. Paris. VII), p. 627b-630a.
(5) Cf. De IV coaeq. tr. 4 q. 61 a. 4 : Paris, BnF lat. 18127 f. 83vb-84ra, ed. cit., p. 655b sq. ; q. 69a. 3 part. 3 : f. 96vb, p. 707a ; De bono tr. 5 q. 1 a. 1 : ed. W. KüBEL et F. HEYER, Münster 1951 (Ed.Colon. XXVIII), p. 267.34-41 : « hoc proprium est homini, ut consideret honestum et inhonestum,laudabile et vituperabile in vita, et ab instinctu talis naturae est ius naturale et ideo instigat ad difficileet bonum et non instigat ad id quod est sub necessitate materiae, sed potius ad id quod est sub voluntatesecundum naturam ordinatam ad bonum, quae tamen potest deflecti ad oppositum » ; De animal. l. 22tr. 1 c. 5 : ed. H. STADLER, Münster 1920 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters,XVI), p. 1354.17-20 : « discernere inter honestum et turpe soli convenit homini inter animalia. Ex quoconsequitur solius hominis esse honestum prosequi, cum omnia bruta non nisi utilia et delectabiliaprosequantur ». Durch die sittliche Vollendung erlangt der Mensch das menschliche Glück (« felicitashumana »), das gegenüber der kontemplativen Glückseligkeit, welche aus der intellektivenVollendung hervorgeht, nachrangig ist ; cf. vorherige Anm.
(6) Cf. III Sent. d. 34 a. 2 : ed. A. Borgnet, Paris 1894 (Ed. Paris. XXVIII), p. 620b, 622a.(7) Cf. Metaph. l. 5 tr. 4 c. 1 : ed. cit., p. 272.24-25. Mit Blick auf Albert hebt Kurt Flasch
treffend hervor, daß die Theorie des Intellektes zugleich die Theorie der Glückseligkeit ist :K. FLASCH, « Converti ut imago – Rückkehr als Bild. Eine Studie zur Theorie des Intellekts beiDietrich von Freiberg und Meister Eckhart », in Albert le Grand et sa réception au Moyen Âge.Hommage à Zénon Kaluza, éd. par F. CHENEVAL, R. IMBACH et Th. RICKLIN, Fribourg 1998, p. 132.
(8) IV Sent. d. 49 a. 6 : ed. A. Borgnet, Paris 1894 (Ed. Paris. XXX), p. 674b-675b ; Metaph. l. 11tr. 2 c. 35 : ed. cit., p. 527.46-59. Cf. Summa theologiae sive de mirabili scientia dei I tr. 2 q. 9 : ed.D. SIEDLER, W. KüBEL et H.-G. VOGELS, Münster 1978 (Ed. Colon. XXXIV/1), p. 31.74-31.1.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
168 HENRYK ANZULEWICZ
in der vollendeten Tätigkeit » 9, – diese Art der Glückseligkeit wird als die felicitascontemplativa secundum esse et secundum suum maximum posse bezeichnet. Diepostmortale Glückseligkeit (beatitudo secundum statum perfectionis patriae)hingegen besteht « im Innewohnen in Gott und im Besitz in ihm all dessen, waserstrebt wird » 10.
Die sittliche Vollendung des Menschen und das Sittlich-Gute, das im « Gutenalles Guten », d. h. in Gott, gründet, behandelt Albertus Magnus bereits in seinemErstlingswerk De natura boni. Er widmet diesem Problem in seinem Gesamtwerkeinen breiten Raum. Es liegen hierzu mehrere Schriften vor, von denen diewichtigsten De bono, Super Ethica und Ethica sind. Genannt seien auch dieAbhandlungen über die verschiedenen Aspekte des Guten, die im Sentenzen-kommentar, im Corpus Dionysiacum, in De natura et origine animae, in denKommentaren zur Hl. Schrift und in der Summa theologiae sive de mirabiliscientia dei enthalten sind 11.
In dieser Untersuchung wird die theoretische Grundlage albertinischer Lehrevon der intellektiven Vollendung des Menschen in den Blick genommen und inden wichtigsten Phasen ihrer systematischen Entwicklung vorgestellt werden.Gemeint ist die Intellekttheorie, in der sich drei Entwicklungsphasen ermittelnlassen, wenn man das ihr jeweils zugrundeliegende Einteilungsmodell des Intel-lektes rekonstruiert und zum Unterscheidungskriterium der Lehrentwicklungmacht. Es sei unterstrichen, daß diese entwicklungsgeschichtliche Perspektive inder bisherigen Forschung wenig beachtet 12 und folglich, wie Burkhard Mojsischtreffend bemerkte, nicht in angemessener Weise gewürdigt wurde 13.
Die Frühwerke des Albertus Magnus, deren Reihe der Sentenzenkommentarschließt, markieren die erste Entwicklungsphase der Intellekttheorie. IhrenHöhepunkt erreicht sie in dieser Periode in De homine (um 1242), wo der
(9) Cf. De intell. et int. l. 2 c. 12 : Neapel, BN VIII C 37 f. 87va, ed. cit., p. 520b : « anima sicreducta de cetero sensibilibus et materia corporis non indiget, eo quod materialia et instrumentaliaorgana non accepit secundum naturam nisi ad hoc quod in esse divinum reduceretur ; stat igitursubstantiata et formata in esse divino et operatione perfecta ».
(10) IV Sent. d. 49 a. 6 : ed. cit., p. 675a-b : « Beatitudo autem secundum statum patriae estinhaerere deo, et in ipso habere omnia quae appetuntur : et sic diffinitur a Boethio beatitudo ».Cf. unten p. 175 mit Anm. 47.
(11) Cf. H. ANZULEWICZ, « « Bonum » als Schlüsselbegriff bei Albertus Magnus », in AlbertusMagnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren : Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven, hg. v.W. SENNER [u. a.], Berlin 2001 (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens, N.F. 10), p. 113-140.
(12) Grundlegend hierfür ist die unveröffentlichte, in polnischer Sprache verfaßte und in derForschung kaum rezipierte Dissertation von A. SKWARA (†2000), Alberta Wielkiego teoria intelektu.Problem ewolucji pogladów (Die Intellekttheorie Alberts des Großen. Das Problem der Entwicklungseiner Anschauungen), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1984.
(13) B. MOJSISCH, « Zum Disput über die Unsterblichkeit der Seele in Mittelalter und Renais-sance », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 29 (1982), p. 345. Die wichtigsteLiteratur zur albertinischen Intellektlehre verzeichnet H. ANZULEWICZ, « Die platonische Traditionbei Albertus Magnus. Eine Hinführung », in The Platonic Tradition in the Middle Ages and EarlyModern Period. A Doxographical Approach, ed. by S. GERSH and M. J. F. M. HOENEN, Berlin 2002,p. 260 mit Anm. 184.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 169
systematische Grundstock gelegt und der begriffliche Apparat nahezu komplettentwickelt oder vielmehr aufgenommen wird. In seinem Anthropologieentwurfentfaltet der Doctor universalis eine durchaus originelle und in sich abge-schlossene Theorie des Intellektes, in der u. a. die augustinische, und, man mußhinzufügen, auch die pseudo-dionysische Illuminationslehre mit der peripate-tischen Lehre vom intellectus agens, mit der fluxus- und irradiatio-Theorie vonAvicenna, al-Ghaz�l�, dem Liber de causis und anderen arabischen und jüdischenQuellen verbunden und reformuliert wird 14. Die Interpretation der Illuminations-lehre auf der Grundlage der Psychologie des Aristoteles und der Unterscheidungzwischen dem intellectus agens und dem intellectus possibilis begegnet uns schonin De IV coaeq. (um 1241) 15. Albert knüpft an diese Frage auch im Sentenzen-kommentar an, wo er die Erleuchtung des menschlichen Intellektes nach Ps.-Dionysius als eine durch die Engel vermittelte « Rückführung » des Menschen zurgöttlichen Seinsweise (reductio nostrae hierarchiae per hierarchiam angelorum)bezeichnet. Ihre philosophische Entsprechung fand er bei den Philosophen, wie ervermerkt, unter der Namen continuatio intellectuum und in der Annahme, daß dermenschliche Intellekt nur im Licht des Ersten « sehen » kann 16. Diese ursprün-glich augustinische, um die pseudo-dionysischen und aristotelisch-peripate-tischen Elemente erweiterte und reformulierte Illuminationstheorie begegnet uns
(14) Z. B. ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 55 a. 3 : Ann Arbor Univ. Libr., Alfred TaubmanMedical Libr. 201 (im folgenden zit. als « Ann Arbor 201») f. 71vb, 72rb, 72va, ed. A. Borgnet, Paris1896 (Ed. Paris. XXXV), p. 464b, 467a-b, 468b-469a. Zur Auffassung der irradiatio, die als einSynonym zu illuminatio aufgefaßt wird, cf. u. a. ALBERTUS MAGNUS, Metaph. l. 11 tr. 2 c. 20 : ed.B. GEYER, Münster 1964 (Ed. Colon. XVI), p. 507.81-509.19. Die Illuminationslehre des AlbertusMagnus fand in der bisherigen Forschung wenig Beachtung. Die Literatur hierzu erschöpft sichnahezu vollständig in folgenden Beiträgen : M. L. FÜHRER, « Albertus Magnus’ Theory of DivineIllumination », in Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren cit., p. 141-155 ; ID., « TheContemplative Function of the Agent Intellect in the Psychology of Albert the Great », in Historiaphilosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, hg. v. B. MOJSISCH
u. O. PLUTA, Amsterdam – Philadelphia 1991, p. 311-313 ; ID., « The Theory of Intellect in Albert theGreat and its Influence on Nicholas of Cusa », in Nicholas of Cusa in Search of God and Wisdom, ed.by G. CHRISTIANSON and T. IZBICKI, Leiden 1991, p. 52-54. L. A. KENNEDY, « St. Albert the Great’sDoctrine of Divine Illumination », The Modern Schoolman, 40 (1962), p. 23-37. G. DE MATTOS,« L’intellect agent personnel dans les premiers écrits d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin »,Revue néoscolastique de philosophie, 43 (1940), p. 145-161, bes. p. 150-152. M. BROWE, « Circaintellectum et eius illuminationem apud S. Albertum », Angelicum, 9 (1932), p. 187-202, hier p. 196-202. Cf. auch die Bemerkung von P. WILPERT, « Die Ausgestaltung der aristotelischen Lehre vomIntellectus agens bei den griechischen Kommentatoren und in der Scholastik des 13. Jahrhunderts »,in Aus der Geisteswelt des Mittelalters, hg. v. A. LANG [u. a.], Münster 1935 (Beiträge zur Geschichteder Philosophie und Theologie des Mittelalters, Suppl. III/1), p. 458 : « Albert versucht bereits einenEinbau des Augustinismus in die christliche Form der aristotelischen Philosophie, wie wir es dann beiThomas sehen ».
(15) Cf. ALBERTUS MAGNUS, De IV coaeq. tr. 4 q. 31 a. 1-2 : Paris, BnF lat. 18127 f. 51ra-va, ed.cit., p. 522a-525a.
(16) Cf. ALBERTUS MAGNUS, I Sent. d. 2 a. 5 : ed. A. Borgnet, Paris 1893 (Ed. Paris. XXV), p. 59-60 ; II Sent. d. 1 a. 7 : ed. A. Borgnet, Paris 1894 (Ed. Paris. XXVII), p. 21a-b ; a. 12 : p. 34a-35b ; untenp. 174-175 mit Anm. 47.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
170 HENRYK ANZULEWICZ
öfter im albertinischen Werk. Ihre Vollendung findet sie in De intell. et int. II 17.Für weitere Textbelege hierfür sei vor allem auf die Quaest. de proph. 18 (vor1250), die Kommentare zum Corpus Dionysiacum (um 1248-1250) 19, den erstenEthikkommentar 20 sowie auf die Kommentare zum Matthäusevangelium (um1257-1264) 21 und zum Liber de causis hingewiesen 22.
Die zweite Entwicklungsphase der Albertschen Intellekttheorie setzt imKommentar zu De div. nom. des Ps.-Dionysius Areopagita (um 1250 in Köln) ein.Sie findet ihren vorläufigen Abschluß und ihre vollendete Gestalt im Kommentarzu De anima (um 1254-1257, wahrscheinlich in Köln).
Die dritte und letzte Phase der Entwicklung, die sich in zwei Etappenvollzieht, markieren zum einen das erste Buch von De intell. et int. (verfaßt um1259 in Köln) und zum anderen das zweite Buch des gleichen Werkes sowie dieSchriften De nat. et orig. an. (um oder nach 1259), Metaph. (um 1264) und Decausis et proc. univ. a prima causa (um 1264-1267).
Unterschiedliche Aspekte der Intellektlehre, die sich entwicklungsgeschicht-lich in alle drei Phasen fügen, werden zumeist digressionsartig auch in anderenaußer den genannten Schriften Alberts erörtert, im besonderen in Super Ethica(um 1250-1252) 23, De unitate intell. (1. Fassung : 1256/57 24, 2. Fassung : nach1274 25), Ethica (um 1262) 26, De XV probl. (vor 10. 12. 1270) 27 und Probl.determ. (1270) 28, sowie in Super Iob (um 1274) 29. Selbst in den Schriften zurLogik, die der Doctor universalis in den Dienst der intellektiven Vollendung desMenschen stellt, und in denen er « das Gute und die Glückseligkeit des Menschengemäß dem vollkommensten Akt des vornehmsten Teils der menschlichen Seele,d. h. gemäß dem betrachtenden (theoretischen) Intellekt », das bonum contem-plationis also und die Glückseligkeit des Menschen in der Schau der Wahrheit als
(17) Parallel zu der Deutung der Illumination als die Rückführung des Menschen durch die Engelzur göttlichen Seinsweise (I Sent. d. 2 a. 5) ist Alberts Auffassung von « der Rückführung » dergesamten Wirklichkeit zur göttlichen Seinsweise durch den menschlichen Intellekt zu sehen, eineLehre, die in De intell. et int. l. 2 c. 12 (ed. cit., p. 520b) dargelegt ist.
(18) ALBERTUS MAGNUS, Quaest. de proph. a. 1 § 1 : ed. A. FRIES, W. KÜBEL et H. ANZULEWICZ,Münster 1993 (Ed. Colon. XXV/2), p. 50.57-51.11.
(19) Z. B. Super Dion. De cael. hier. c. 4 : ed. P. SIMON et W. KÜBEL, Münster 1993 (Ed. Colon.XXXVI/1), p. 67.1-68.37, p. 69.14-70.47 ; Super Dion. De div. nom. c. 4 : ed. P. SIMON, Münster 1972(Ed. Colon. XXXVII/1), p. 121.20sq.
(20) Super Ethica l. 6 lect. 8 : ed. W. KÜBEL, Münster 1987 (Ed. Colon. XIV), p. 449.77-450.60.(21) Super Matth. 5.34 : ed. B. SCHMIDT, Münster 1987 (Ed. Colon. XXI), p. 152.3-44 ; cf. auch
Super Is. 11.2 : ed. F. SIEPMANN, Münster 1952 (Ed. Colon. XIX), p. 170.6-55.(22) Cf. z. B. De causis et proc. univ. l. 1 tr. 2 c. 1 : ed. W. FAUSER, Münster 1993 (Ed. Colon.
XVII/2), p. 26.70-78.(23) Cf. Super Ethica l. 6 lect. 8 : ed. cit., p. 445.42-455.32.(24) De unitate intell. pars 3 § 1 : ed. A. HUFNAGEL, Münster 1975 (Ed. Colon. XVII/1), passim,
bes. p. 21.61sq.(25) Summa theologiae II tr. 13 m. 3 : ed. A. Borgnet, Paris 1895 (Ed. Paris. XXXIII), p. 75a-
100b.(26) Z. B. Ethica l. 1 tr. 6 c. 6 : ed. cit., p. 92b sq. ; l. 9 tr. 2 c. 1 : p. 570a.(27) De XV probl. I : ed. B. GEYER, Münster 1975 (Ed. Colon. XVII/1), p. 31.39sq.(28) Probl. determ. q. 34 : ed. I. WEISHEIPL, Münster 1975 (Ed. Colon. XVII/1), p. 60.11-61.59.(29) Super Iob 28.12-13 : ed. A. WEISS, Freiburg 1904, Sp. 316-18.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 171
deren Letztziel bestimmt 30, finden sich wiederholt Anknüpfungen an dieIntellektlehre 31.
Diese drei Entwicklungsphasen albertinischer Intellekttheorie werden wir imfolgenden anhand der für ihre Rekonstruktion wichtigsten, oben verzeichnetenWerke kurz vorstellen. Wir werden uns dabei auf die Anfänge und den systema-tischen sowie quellengeschichtlichen Kontext dieser Entwicklung konzentrieren,um den Weg zur Entfaltung einer geschlossenen Intellekttheorie Albertsaufzuzeigen. Die eingangs kurz umschriebene Stellung der Intellektlehre desAlbertus Magnus in seinem System soll zum Schluß hervorgehoben werden.
1. DIE ERSTE PHASE : DIE FRÜHWERKE
Die älteste uns bekannte Schrift des Doctor universalis – De natura boni –,welche aus Alberts anfänglicher Lehrtätigkeit an den deutschen Konventsstudienvor 1240 hervorging, ist, wie schon festgehalten, dem Sittlich-Guten und derVerwirklichung des Menschen als Mensch unter dem sittlichen Aspektgewidmet. Das Sittlich-Gute, das nach Albert im transzendenten Guten gründet,führt den Menschen auf sein Letztziel hin, das « an sich und wesenhaft das Guteist, und das selbst seine Gutheit ist » 32. In dieser Schrift finden wir noch keine Ele-mente einer Intellekttheorie. Das Werk ist allerdings unvollständig bzw.unvollendet überliefert.
1.1. De bono
In seiner um 1243 in Paris verfaßten Summe De bono greift Albert erneut dieFrage nach dem Guten auf und entfaltet seinen ganzheitlichen Begriff desGuten 33. Er wendet sich dann dem moralphilosophischen Aspekt des Guten zuund damit ergänzt und vollendet er das mit De natura boni begonnene Projekt. Fürdie Entwicklung der Intellekttheorie ist diese Schrift insofern interessant, als sieeinige Anknüpfungen an die Intellektlehre enthält. Es werden hier im Anschluß
(30) De V univ. l. 1 tr. 1 c. 3 : ed. J. BLARER, Teoresi, 9 (1954), p. 207.16-24 : « Est autem nontantum necessaria, sed etiam utilis haec scientia. Sicut enim bonum et felicitas hominis est secundumoptimae partis animae hominis perfectissimum actum, hoc est secundum intellectum contempla-tivum, nec contemplari poterit intellectus nisi noverit contemplationis principia et sciat invenire quodquaerit comtemplari et diiudicare id ipsum quod iam contemplatur inventum, patet quod praeomnibus utilis est ad felicitatem haec scientia, sine qua non attingitur felicitatis actus et per quam ipsefelix actum non impeditae recipit operationis ». Cf. H. ANZULEWICZ, « « Bonum » als Schlüsselbegriffbei Albertus Magnus », in Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren, p. 134 mit Anm. 52.
(31) Z. B. ALBERTUS MAGNUS, De V univ. l. 1 tr. 1 c. 5 : ed. BLARER, p. 217.30-36 ; ibid. tr. 2 c. 3 :ed. A. Borgnet, Paris 1890 (Ed. Paris. I), p. 24a-b ; c. 4 : ed. cit., p. 28a-b ; Anal. post. l. 1 tr. 1 c. 5 : ed.A. Borgnet, Paris 1890 (Ed. Paris. II), p. 16b.
(32) De natura boni, prol. et tr. 1 pars 1 : ed. E. FILTHAUT, Münster 1974 (Ed. Colon. XXV/1),p. 1.5-7 u. 57-59 ; cf. De incarnatione tr. 5 q. 2 a. 2 : ed. I. BACKES, Münster 1958 (Ed. Colon. XXVI),p. 215.3-5.
(33) Vgl. H. ANZULEWICZ, « « Bonum » als Schlüsselbegriff », p. 113-140.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
172 HENRYK ANZULEWICZ
an Ps.-Dionysius Areopagita zum einen der « gottförmige Intellekt » (intellectusdeiformis) und zum anderen der « nachforschende Intellekt » (intellectus inqui-sitivus), der wie im Spiegel und in Rätseln erkennt, sowie der « zusammen-tragende menschliche Intellekt » (intellectus conferens humanus) erwähnt,dessen Erkenntnis durch « Zusammentragen » (per collationem) zustandekommt 34. Ferner nennt Albert den « theoretischen Intellekt » (intellectus specula-tivus) mit der Feststellung, daß sein Ziel das allgemein Wahre bzw. die allgemeineWahrheit (verum universale) ist 35. Der Intellekt wird als die bewegende Kraft(virtus motiva) des Menschen aufgefaßt, die in Verbindung mit dem Willen(voluntas) und der Strebekraft (appetitus) den Motor menschlicher Handlungendarstellt 36. Eine Intellekttheorie wird hier nicht entwickelt.
1.2. De sacramentis
Die ersten Ansätze zu einer Intellektlehre begegnen bei Albertus Magnusallerdings schon vor De bono, nämlich in De sacramentis, seiner ersten in Parisum 1241 verfaßten Schrift. Im theologischen Kontext – es handelt sich um dieEucharistielehre – legt Albert den Satz aus 1 Kön. 14, 27 : Illuminati fuerunt oculiIonathae allegorisch aus, indem er die Erleuchtung der Augen als die « Vollkom-menheit des Verstandes » (perfectio mentis) « gemäß seiner Doppelaspektivität »deutet, als die Vollkommenheit hinsichtlich des « theoretischen » und des« praktischen Intellektes » (intellectus contemplativus et practicus) 37. Zuvor warim gleichen Werk die Rede von der « Eingießung der Tugenden und der Erleuch-tung des Verstandes » (infusio virtutum et illuminatio mentis) in der Taufe 38.
1.3. De incarnatione
In der chronologisch nächsten Schrift – De incarnatione – finden sich imKontext der Christologie, wo das menschliche Wissen Christi erörtert wird,einige neue Bausteine zur Intellektlehre. Hier hält Albert fest, daß der « tätigeIntellekt » (intellectus agens) und der « mögliche Intellekt » (intellectus possibi-lis) sowie das Einbildungsvermögen (phantasia) zu den Konstitutionsprinzipiender menschlichen Natur gehören. Das Wissen gewinnt der Mensch, so Albert mitdem Hinweis auf Aristoteles (De an. III 3 : 431b2-6), dadurch, daß das sinnen-hafte Vorstellungsbild (phantasma) den « möglichen Intellekt » bewegt und der« mögliche Intellekt » durch das Licht des « tätigen Intellektes » hinsichtlich jenes
(34) ALBERTUS MAGNUS, De bono tr. 1 q. 1 a. 2 : ed. H. KÜHLE, Münster 1951 (Ed. Colon.XXVIII), p. 8.11-13 : « intellectus deiformis », « i. inquisitivus » ; tr. 5 q. 1 a. 1 : ed. W. KÜBEL etF. HEYER, p. 263.4-8 : « conferens i. » et « deiformis i. », p. 267.92-96 : « i. deiformis ».
(35) De bono tr. 4 q. 1 a. 1 : ed. B. GEYER, Münster 1951 (Ed. Colon. XXVIII), p. 220.5-6.(36) De bono tr. 4 q. 1 a. 2 : ed. cit., p. 227.56-61, 228.28-30.(37) De sacramentis tr. 5 pars 1 q. 1 a. 2 : ed. A. OHLMEYER, Münster 1958 (Ed. Colon. XXVI),
p. 51.55-56.(38) De sacramentis tr. 3 q. 1 a. 2 : ed. cit., p. 28.51-52, 27.73-74.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 173
Vorstellungsbildes aktuiert wird 39. Hier wird zum ersten Mal der Begriff des« gottförmigen Intellektes » (intellectus deiformis) eingeführt. Albert entlehnt ihnvon Ps.-Dionysius (De div. nom.) und deutet ihn auch aus der Perspektive desLiber de causis. Der « gottförmige Intellekt » erkennt mittels der ihm in derErschaffung eingeprägten Formen. Er ist wie jede Intelligenz von intelligiblenFormen erfüllt. Diese Formen ähneln den Ideen im göttlichen Verstand. Der« gottförmige Intellekt » und seine Erkenntnisweise sind den Engeln und denSeelen der Verherrlichten eigentümlich 40.
Im gleichen Kontext spricht Albert in Anknüpfung an Aristoteles (De an. III10 : 433a17sq.) vom « zusammengesetzten Intellekt » (intellectus compositus),welcher die Vernunft (ratio) heißt. Diesem ist eigen, daß er seinen komplexenGegenstand strukturiert aufnimmt. Der « zusammengesetzte Intellekt » erfaßtseinen Gegenstand wie eine Vielzahl von aufeinander bezogenen Termini, diegleichsam einen Satz oder Sätze ergeben, und er ordnet diese Sätze derart an, daßsie die logische Struktur eines Syllogismus erhalten 41. Etwas später wird unterBezugnahme auf De an. III 4 (429b22-26) festgehalten, daß der Gegenstand(intelligibile) und der Akt des Intellektes hinsichtlich des Erkennens und derAffektion dasselbe sind, während sie hinsichtlich ihrer Substanz und Naturjeweils verschieden bleiben 42.
Zu Beginn von De incarnatione geht Albert auf die Illuminationstheorie ein.Er vertritt den Standpunkt, daß die menschliche Natur bzw. der Intellekt desMenschen unter den Bedingungen der Kontingenz (secundum statum viae adbeatitudinem) fähig ist, Erleuchtungen (illuminationes) zu empfangen, die durchEngel, philosophisch ausgedrückt : durch getrennte Geistwesen (intelligentiaeseparatae), vermittelt werden, und die von Gott, philosophisch ausgesagt : vom« Ersten », herrühren. Die explizit genannten Quellen dieses Illuminations-gedankens sind Augustinus (De Gen. ad litt.), Ps.-Dionysius Areopagita (De cael.
(39) De incarnatione tr. 4 q. 1 a. 1 : ed. cit., p. 204.37-45 : « de veritate nostrae naturae est habereintellectum agentem et possibilem et phantasiam (…). Dicit autem Philosophus, quod phantasma,obiectum possibili intellectui, movet ipsum, et luce intellectus agentis possibilis perficitur exphantasmate, et talis modus est in profectum scientiae ».
(40) De incarnatione tr. 4 q. 1 a. 2 : ed. cit., p. 205.66-76 : « Item est alia (sc. notitia angelorum)qua cognoscunt res in seipsis, idest per formas, quas habent apud se a creatione. Sicut enim dicitur inLibro de causis, « omnis intelligentia est plena formis. » Et hanc cognitionem appellat (sc.Augustinus) vespertinam. Tunc autem cognoscunt, sicut dicit Dionysius in VII cap. De divinisnominibus, intellectu deiformi, idest formis datis sibi a creatione, quae sunt similes ideis in mentedivina. Talem etiam cognitionem habet anima beata. Quod patet ; aliter enim nihil cognosceret nonexistens in corpore ». Cf. II Sent. d. 3 a. 15 : ed. cit., p. 91b-93b.
(41) De incarnatione tr. 4 q. 2 a. 2 : ed. cit., p. 208.51-54 : « Dicit autem Philosophus, quodintellectus compositus, qui dicitur ratio, simul apprehendit plura, non ut plures terminos, sed ut unumordinatum ad alterum, ut videmus, quod in propositione praedicatum ordinatur ad subiectum, inargumento vero ordinantur praemissae ad conclusionem et uniuntur in habitudine medii ». Eineumfassendere und wesentlich differenziertere Interpretation des Begriffspaares « intellectuscompositus » wird später in Super Ethica l. 6 lect. 8 : ed. cit., p. 448.34-449.76, geboten.
(42) De incarnatione tr. 6 q. 1 a. 2 : ed. cit., p. 221.80-83 : « Licet enim intelligibile sit actusintellectus, non tamen est actus eius secundum substantiam et naturam, sed secundum cognitionem etaffectionem tantum ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
174 HENRYK ANZULEWICZ
hier.) und Alfred von Sareshel (De motu cordis). Die drittletzte Quelle wird als« das Buch über die Intelligenzen eines gewissen Philosophen » angeführt. DieErleuchtungen werden im theologischen Sinne als Offenbarungen (revelationes)aufgefaßt ; sie werden in keiner Weise erläutert 43. Im Zusammenhang mit demaristotelischen Begriff des Lebens (De an. II 2 : 413a23) bemerkt Albert, daß dermenschliche Intellekt seinen Sitz im Kopf hat 44.
1.4. De resurrectione
In der frühesten Fassung albertinischer Eschatologie – in der Schrift Deresurrectione – begegnet die schon in De sacramentis erwähnte, nunmehrterminologisch und sachlich geringfügig abgewandelte Unterscheidung desIntellektes in den « theoretischen » und den « praktischen » (intellectus specula-tivus et practicus). Der « theoretische Intellekt » wird als das Vermögen auf-gefaßt, das das Prinzip der theoretischen Erkenntnis ist. Er erschließt eine Sachebzw. einen Sachverhalt nur in theoretischer Hinsicht. Der « praktische Intellekt »hingegen ist das Vermögen, das seinen Gegenstand unter dem Aspekt der Nütz-lichkeit und der Schädlichkeit zu erkennen vermag. Nimmt er das Schädliche alsbesonders bedrohlich wahr, kann er dem Erkennenden durch die Intensität derWahrnehmung gleichsam die Strafe zutragen 45. Dieser intellekttheoretischeAspekt findet somit eine interessante explikative Funktion in der Eschatologie.
Bei der Erörterung der Akte des ewigen Lebens gemäß der intelligiblen Seelehält Albert fest, daß der geschaffene Intellekt in seiner ontischen Struktur einezweigeteilte Einheit bildet : er ist auf der einen Seite ein tätiger (intellectus agens)und auf der anderen Seite ein möglicher (possibilis) 46. Die Funktion des « tätigenIntellektes » ist die Abstraktion, die des « möglichen » die Aufnahme und dasErleiden. Der « mögliche Intellekt » bedarf des Lichtes des « tätigen » für seineAktuierung, d. h. für seine Überführung aus der Potentialität in den Akt. Imewigen Leben vereinigen sich die beiden Intellekte, so Albert, unmittelbar mitGott, genauerhin : Gott vereinigt sich unmittelbar mit dem tätigen Intellekt wiedas Erleuchtende (ut illuminans) und mit dem möglichen Intellekt wie dasErkannte. Der Unterscheidung zwischen dem « tätigen » und dem « möglichenIntellekt » liegt im ewigen Leben nicht die eigentümliche Tätigkeit des jeweilsanderen zugrunde – der « tätige Intellekt » empfängt ja nichts –, sondern sie beruhtauf der dem jeweiligen Intellekt eigentümlichen Art der Vereinigung mit Gott.Gott ist für den Intellekt das Intelligible an sich (intelligibile per se), dieGeschöpfe das Intelligible durch ein anderes (intelligibile per aliud). Deshalb
(43) De incarnatione tr. 2 q. 1 a. 2 : ed. cit., p. 173.52-67.(44) De incarnatione tr. 5 q. 2 a. 8 : ed. cit., p. 218.12 : « sedes intellectus est in capite ».(45) De resurrectione tr. 2 q. 10 a. 5 : ed. W. KÜBEL, Münster 1958 (Ed. Colon. XXVI),
p. 295.15-21 : « duplex est intellectus, scilicet speculativus, qui apprehendit rem, secundum quod estprincipium scientiae tantum, et iste non conducit poenam ; et est intellectus practicus, qui apprehenditrem in ratione convenientis et nocivi, et iste potest conducere poenam, si apprehendat nocivum utimminens ».
(46) De resurrectione tr. 4 q. 2 a. 5 : ed. cit., p. 344.56-57.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 175
zielt die Erleuchtung des « tätigen Intellektes » nicht auf das Intelligible an sich, d.h. auf Gott ab, sondern auf den « möglichen Intellekt », der dieser Erleuchtungbedarf. Gemeint ist hier der Intellekt nach dem Tode des Menschen und dieGlückseligkeit (beatitudo) der verherrlichten Seele, eine Vereinigung desmenschlichen Intellektes mit dem Licht der Gottheit, welches Gott selbst ist, einZustand, der philosophisch als die continuatio animae post mortem cum motoreprimo umschrieben wird 47. Später hält Albert in De nat. et orig. an. fest, daß dieSeele eines Menschen, der seine intellektuelle Vervollkommnung vernachlässigthat, nach dem Tode in ewiger Dunkelheit bleibt, weil der « mögliche Intellekt »dann nicht fähig sein wird, das intelligible Licht aufzunehmen 48.
Wie zuvor in De incarnatione nimmt Albert auch in De resurrectione an, daßder « mögliche Intellekt » Formen der geschaffenen Dinge besitzt. Diese Formensind die « Ähnlichkeiten der göttlichen Ideen », welche nicht von den Dingenabstrahiert sind, sondern dem Intellekt des Menschen bei seiner Erschaffung vomSchöpfer eingeprägt wurden. Sie sind weder allgemein noch partikulär, sondernFormen für die Dinge (formae ideales ad rem) und ähneln jenen idealen Formen,aus denen die Dinge im Schöpfungsakt entstanden sind. Dieselbe Art von« idealen Formen für die Dinge » ist, wie wir schon aus De incarnatione wissen 49,dem Intellekt der Engel eigentümlich. Mittels solcher Formen gelangt der« mögliche Intellekt » auf dem Wege der natürlichen Erkenntnis zu den Dingen 50.Die Erkenntnis des Menschen in der Verherrlichung (in patria) vollzieht sichdeshalb jenseits von Irrtum. Sie nimmt ihren Lauf nicht bei der Sinnes-wahrnehmung, sondern im Intellekt. Folglich beruht sie auf der sicheren Einsichtin den Erkenntnisgegenstand, da die sinnenhaften Formen, die der Intellekt denGegenständen zuweist (formae ad res), dem sicher Erkannten zugeordnetwerden 51. Die Erkenntnis der vom Körper getrennten Seele vollzieht sich also aufgenau umgekehrtem Wege als die Erkenntnis unter den Bedingungen der Kontin-genz. Nicht der Sinnesgegenstand wird das Prinzip der intellektiven Erkenntnissein, sondern die intellektive Erkenntnis wird zum Prinzip der Sinneserkenntnis 52.Die inneren Vermögen der Seele – die Einbildungskraft (phantasia) und das
(47) Cf. IV Sent. d. 49 a. 5 : ed. cit., p. 670b : « ibi (sc. in patria) incircumscriptum lumen deitatisquod est deus ipse, unitur intellectui agenti, et sic effunditur substantialiter super totam animam etimplet eam ; et hoc modo anima plena erit ipso deo qui est sua beatitudo. Et hoc est quod obscuredixerunt philosophi, quod si anima post mortem primo motori continuaretur, hoc esset ratione suaeprosperitatis ».
(48) De nat. et orig. an. tr. 2 c. 13 : ed. cit., p. 39.24-46.(49) Cf. oben Anm. 40.(50) ALBERTUS MAGNUS, De resurrectione tr. 4 q. 2 a. 5 : ed. cit., p. 344.60sq., 345.7-33.(51) De resurrectione tr. 4 q. 2 a. 4 : ed. cit., p. 344.3sq.(52) Ibid., p. 344.11-23 : « in futuro ab intellectu certo ipsius rei incipit cognitio, et ideo formae
sensibiles, quae ponuntur circa illud, ponuntur circa certum. Et ideo in tali compositione non acciditerror. Unde patet, quod necessarium est, quod incipiat ab interiori. Et hoc credo esse intellectumAugustini in libro De spiritu et anima, ubi dicit, quod « sensus vertetur in rationem, ratio inintellectum, intellectus in intelligentiam » ; verti enim sensum in rationem nihil aliud est nisi vertisensum ad rationem, ut sicut modo sensus est principium cognitionis rationalis, ita tunc cognitiorationalis efficiatur principium sensus ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
176 HENRYK ANZULEWICZ
Einschätzungsvermögen (aestimativa) werden vom Intellekt aktuiert werden.Die Erkenntnisweise, die dem Menschen unter den Bedingungen der Kontingenzeigentümlich ist, wird damit hinfällig. Das erworbene Wissen geht aber nicht mitdem Tod zugrunde, weil das Gedächtnis gleichsam eine Schatzkammer dersinnenhaften Formen sein kann, mit denen die idealen Formen umkleidet werdenkönnen 53.
Diese ausgeprägt platonischen Aspekte der theologischen Intellekt- undErkenntnislehre werden in den chronologisch unmittelbar auf De resurrectionefolgenden und teilweise parallel zu diesem Werk verfaßten Schriften De IVcoaeq. 54 und De homine 55, sowie in den Abhandlungen De raptu, De visione deiin patria, De sensibus corp. gloriosi und De intell. animae 56 wiederaufgenom-men. Sie werden u. a. in De somno et vig., De nat. et orig. an. und in De intell. etint. thematisiert. Die Entwicklung dieser Theorie kann hier jedoch nicht imeinzelnen verfolgt werden. Wir werden sie im folgenden nur noch anhand von DeIV coaeq. und von De homine erörtern.
1.5. De IV coaequaevis
In den sich an De resurrectione anschließenden Entwürfen einer Schöpfungs-theologie und Anthropologie – De IV coaeq. und De homine – macht Albert imVergleich zu den bisherigen Ansätzen einen Meilenschritt in der Entfaltung seinerIntellektlehre. Den Anfang macht er im Kontext der Schöpfungslehre mit einemExkurs über den « tätigen Intellekt » 57. Im kosmologischen Teil, der über denHimmel (caelum), die kosmischen Intelligenzen bzw. die Beweger der Himmels-sphären und die Beseelung des Himmels handelt, gibt es einige interessante und– ungeachtet der teilweise sehr komplizierten und noch zu klärenden, späterenredaktionellen Überarbeitung der Schrift De IV coaeq. 58 – systematisch undquellenkritisch aufschlußreiche, intellekttheoretische Aussagen 59. Im Rahmen
(53) Ibid., p. 344.43-48 : « omnis ille modus sciendi et accipiendi cessabit qui hic est. UndeAugustinus Super Apostolum ad Cor. dicit, quod scientia destruetur quantum ad modum. Sednihilominus memoria potest esse thesaurus sensibilium specierum, quae circumponuntur intelligi-bilibus divinis ».
(54) Hier besonders die Abhandlung über die Schöpfung : De IV coaeq. tr. 1 q. 1 a. 6 : Paris, BnFlat. 18127, f. 6vb, ed. cit., p. 316b, und über die Engel : ibid., tr. 4 q. 24 : f. 40va-44ra, ed. cit.,p. 473-486b.
(55) Cf. De homine tr. 1 q. 56 a. 4-5 : Ann Arbor 201, f. 74vb-75rb, ed. cit., p. 483b-486b.(56) All die genannten Abhandlungen liegen in der krit. Ausgabe vor : ALBERTUS MAGNUS,
Quaestiones : ed. A. FRIES, W. KÜBEL et H. ANZULEWICZ, Münster 1993 (Ed. Colon. XXV/2).(57) De IV coaeq. tr. 1 q. 1 a. 6 : Paris, BnF lat. 18127, f. 6vb, ed. cit., p. 316b.(58) Hierzu vgl. C. RIGO, « Zur Rezeption des Moses Maimonides im Werk des Albertus
Magnus », in Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren, p. 32 mit Anm. 18. In diesemZusammenhang sei angemerkt, daß es auch für De homine zwei Redaktionsstufen des Textes gibt,wobei die zweite Redaktionsstufe im wesentlichen durch eine Erweiterung des optischen Teil desWerkes ins Gewicht fällt, eine Ergänzung, welche in den unkritischen Ausgaben von P. Jammy undA. Borgnet als « Appendix ad quaestionem 22 » (bei Jammy irrtümlich 21) überschrieben wird. EineUntersuchung zur Redaktionsfrage von De homine wird von mir derzeit vorbereitet.
(59) Z. B. ALBERTUS MAGNUS, De IV coaeq. tr. 3 q. 16 a. 2-3 : Paris, BnF lat. 18127, f. 33ra-35ra,ed. cit., p. 439b-446b.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 177
der Lehre von den Engeln wird dann der Intellekt der Engel, der seiner Natur nacheine « geistige Substanz » (substantia intellectualis) ist, zum Gegenstandeingehender Erörterung 60. In De homine legt Albert seine anthropologischeIntellekttheorie im Lehrstück « Über den Intellekt » (De intellectu) systematischdar 61. Wir stellen den Exkurs über den « tätigen Intellekt » und die wichtigstenAspekte der auch anthropologisch relevanten Lehre über den Intellekt der Engelanhand von De IV coaeq. kurz vor. Den kosmologischen Teil werden wirübergehen, um uns auf die anthropologische Intellekttheorie zu konzentrieren,die im Lehrstück « Über den Intellekt » in De homine vorliegt.
In einem Exkurs über den « tätigen Intellekt » (intellectus agens) hält Albert inseiner Schöpfungslehre fest, daß dieser der Wesensart und Gattung nach vom« theoretischen Intellekt » (intellectus speculativus) verschieden ist. Er bestimmtden « theoretischen Intellekt » als den Akt des « möglichen Intellektes » 62. Der« tätige Intellekt » hingegen ist das Aktuierungsprinzip des « möglichen Intel-lektes », das diesen in den « Akt des theoretischen Intellektes » überführt 63. DieFunktion des « tätigen Intellektes » im Erkenntnisvorgang besteht also darin, den« möglichen Intellekt » aus seiner Potentialität in den Akt zu überführen. Ist dieseAktuierung vollzogen, wird der « mögliche Intellekt » zum « theoretischen Intel-lekt ». Eine art- oder gattungsmäßige Angleichung des « theoretischen Intel-lektes » an den « tätigen Intellekt » ist nach Albert ausgeschlossen. Diese Ansichtwird später in De anima bekräftigt 64. Die Differenz zwischen dem « tätigen »,dem « möglichen » und dem « theoretischen Intellekt » wird am Beispiel vonLicht, Oberfläche eines Körpers und seiner Farbe erklärt. Der « tätige Intellekt »ist gleichsam das Licht ; der « mögliche Intellekt » hingegen ist wie die Oberflächeeines Körpers, deren Beschaffenheit sich entsprechend den Veränderungen derErstqualitäten dieses Körpers verändert. Die Erstqualitäten und ihre Verände-rungen entsprechen den Vorstellungsbildern, die den « möglichen Intellekt »bewegen. Der « mögliche Intellekt » ist also wie die Oberfläche eines Körpers, dievom Licht bestrahlt und von den Erstqualitäten in ihrer Beschaffenheit verändertwird. Der « theoretische Intellekt » ist hingegen wie die bestimmte, durch dasLicht des « tätigen Intellekts » aktuierte Farbe dieses Körpers 65. Bei seiner Inter-pretation des « tätigen Intellektes » als das innere Aktuierungsprinzip der Seele,welches gleichsam Licht ist, das die Farben aus der Potentialität in den Akt über-
(60) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 1 : Paris, BnF lat. 18127, f. 40va sq., ed. cit., p. 473a sq.(61) De homine tr. 1 q. 54-57 : Ann Arbor 201, f. 69ra-77rb, ed. cit., p. 448-498b.(62) De IV coaeq. tr. 1 q. 1 a. 6 : Paris, BnF lat. 18127, f. 6vb, ed. cit., p. 316b : « intellectus agens
non est similis in specie vel genere cum intellectu speculativo qui est actus intellectus possibilis ».(63) Ibid. : « agens enim educit possibilem in actum speculativi intellectus ».(64) De anima l. 3 tr. 2 c. 19 : ed. C. STROICK, Münster 1968 (Ed. Colon. VII/1), p. 206.71-78 :
« intelligere intellectus possibilis post mortem est aequivocum ad intelligere in vita, quando utitursensibus (…). Sic igitur patet, quod intellectus agens est forma possibilis, et sunt isti duo unum sicutcompositum, sed operationibus sunt diversi ».
(65) De IV coaeq. tr. 1 q. 1 a. 6 : Paris, BnF lat. 18127, f. 6vb, ed. cit., p. 316b : « sicut est lux ista,ita est intellectus agens, sicut et sunt qualitates (primae add. ed.) complexionales variantes superfi-ciem, ita sunt phantasmata moventia intellectum possibilem. Et sicut est superficies mota ab utroque,ita est intellectus possibilis. Et sicut est species coloris constituta, ita est intellectus speculativus ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
178 HENRYK ANZULEWICZ
führt, d. h. diese sichtbar macht, stützt sich Albert explizit auf De anima (III, 5 :430a10sq.). Weitere Quellen, die in diesem Zusammenhang direkt oder vermitteltmiteinbezogen werden, sind Platon, Aristoteles (Metaph.), Averroes (InMetaph.), sowie « Avicenna, Theodosius 66 und deren Gefolgsleute ».
Mit seinem Exkurs über den « tätigen Intellekt » in der Schöpfungslehre willAlbert beweisen, daß der Schöpfungsakt von einem tätigen Prinzip vollzogenwird, welches hinsichtlich seines Wirkens zwar mit einem in der Naturwirkenden, natürlichen Prinzip übereinstimmt, das aber der von ihm hervor-gebrachten Schöpfung weder der Gattung noch der Wesensart nach gleichkommt.Die Differenz zwischen dem, was das Aktuierungsprinzip ist, und dem, was diePotentialität darstellt, ist unaufhebbar. Die ontologische Differenz, welche hierzwischen dem « tätigen Intellekt » auf der einen Seite und dem « möglichen »sowie dem « theoretischen Intellekt » auf der anderen Seite unterstrichen wird,soll die Transzendenz jenes Wirkprinzips verdeutlichen, welches der Urheber derNatur ist und über die getrennten Intelligenzen und die Bewegung der Himmels-sphären in die Natur hinein wirkt.
In der Abhandlung über die Intelligenz der Engel wird die Frage diskutiert, obden Engeln der « tätige » und der « mögliche Intellekt » eigen ist. Der Ausgangs-punkt ist wie im Exkurs über den « tätigen Intellekt » im Kontext der Schöpfungs-lehre die anthropologische Intellektlehre des Aristoteles (De an. III 5 : 430a10sq.) 67. Albert vertritt die Ansicht, daß den Engeln der « mögliche Intellekt derSubstanz und dem Zugrundeliegenden nach » (secundum substantiam etsubiectum) eignet. Ps.-Dionysius (De div. nom.) folgend unterstreicht er, daß derIntellekt der Engel « gottförmig » ist, weil er niemals ermangelt (numquam est subprivatione) und sich niemals irrt. Aus diesem Grund würde er von den Philo-sophen für vollkommen (perfectus) gehalten. Mit dem Hinweis auf die Philo-sophen wird explizit der Liber de causis (prop. IX), aber auch Alfred von Sareshelmit dem Werk De motu cordis gemeint 68. Die intelligiblen Formen sind dem« möglichen Intellekt » der Engel mit der Erschaffung eingeprägt. Sie werden ausder Potentialität in den Akt durch den « tätigen Intellekt » überführt. Der« mögliche Intellekt » des Menschen hingegen ist gleichsam eine « unbe-
(66) Vgl. ANZULEWICZ, « Die platonische … », p. 236, Anm. 105.(67) ALBERTUS MAGNUS, De IV coaeq. tr. 4 q. 24 : Paris, BnF lat. 18127, f. 40va sq., ed. cit.,
p. 473a sq.(68) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 41vb-42ra, ed. cit., p. 478b-479a :
« intellectus angelorum a philosophis ponitur perfectus ut tabula cum pictura, humanus autem poniturperfectibilis (ut – perfectibilis] et non ed. Paris.) ut tabula rasa. Cuius probatio est per aliamauctoritatem quam inducere intendimus, et est IX propositio in Libro de causis, ubi sic dicitur :« Omnis intelligentia plena est formis » ; verum ex intelligentiis sunt quae continent formas minusuniversales, et ex eis sunt quae continent formas plus universales. Quod sic intelligitur : Intelligentiaangelica dicitur plena formis propter duo, quorum unum est quod non habet formas cognoscibilium(naturalium add. ed. Paris.) naturaliter in parte sicut intellectus humanus, qui non habet formascognoscibilium nisi per studium, sed non habet formas eorum quae effugiunt studium suum, sicutdicitur in libro De motu cordis (…). Aliud est, quia formae angeli plenum et perfectum efficiuntcognoscere, cum sunt (sit ed. Paris.) per exemplaria causarum. In hominibus autem de quibusdamnon est nisi opinio vel phantasia ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 179
schriebene Tafel » (tabula rasa) und kann erst durch die Aufnahme vonintelligiblen Formen, die der « tätige Intellekt » von den Vorstellungsbildernabstrahiert bzw. diese in einfache und allgemeine Formen umwandelt, und durchdie Erleuchtung (Aktuierung) seitens des « tätigen Intellektes » auf dem Weg derdiskursiven Erkenntnis zu den wahren Ursachen gelangen. Bei diesem diskur-siven Erkenntnisvorgang kann ein Irrtum unterlaufen. Die Existenz des « tätigenIntellektes » der Engel steht nicht zur Diskussion 69. Aus der Abhandlung über dieErkenntnisweise der Engel, lassen sich noch einige weitere Aufschlüsse über dieEntwicklung einzelner Segmente der anthropologischen Intellekttheorie desAlbertus Magnus gewinnen. Wir greifen einige Aspekte auf, die für unsereFragestellung von größerer Bedeutung sind.
Die Gottförmigkeit des Intellektes der Engel erklärt Albert in Anlehnung anDe div. nom. (VII) des Ps.-Dionysius Areopagita, den Liber de causis (prop. IX)und De motu cordis des Alfred von Sareshel. Er macht sie zum einen an derErkenntnis durch die dem Intellekt in der Erschaffung eingeprägten species, zumanderen am Erkenntnisakt als solchem fest 70. Die species im Intellekt der Engel,die an sich auch dem Menschen, wie es später in De homine heißt, bei derErschaffung eingeprägt wurden, sind die « Urbilder der die Materie auf natürlicheWeise verändernden und bewegenden Ursachen » 71. Sie sind « Formen für dieDinge » (formae ad res, f. compositionis), die sich von jenen, die von denSinnesgegenständen abstrahiert sind (formae a rebus, f. abstracte a sensibilibus),gänzlich unterscheiden. Die Funktion des « tätigen Intellektes » der Engel bestehtalso nicht in der Abstraktion der intelligiblen Formen, sondern nur in derErleuchtung der ihnen schon immer eignenden formae ad res. Diese Formen, diefür die Seinsrealität der Erkenntnisgegenstände konstitutiv sind, liegen derErkenntnis, die den Engeln eigen ist, zugrunde.
Im Anschluß an De anima III 5 vergleicht Albert den « tätigen Intellekt » mitdem Licht der Sonne. Er sei wie das Licht der Sonne, das nicht nur die Farbenabstrahiert, d. h. diese sichtbar macht, sondern auch durch die Erleuchtung den
(69) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 1 : Paris, BnF lat. 18127, f. 40vb, ed. cit., p. 475a : « dicimus nosquod in angelis est intellectus possibilis secundum subiectum et substantiam, ut probant primaeobiectiones, sed intellectus possibilis in eis numquam est sub privatione » ; f. 42ra-va, ed. cit.,p. 479a-481a.
(70) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 41va, ed. cit., p. 477a : « Et haec virtusdicitur deiformis propter duo, quorum unum est in specie per quam intelligit angelus, et alterum inactu » ; ibid., f. 41vb, ed. cit., p. 478b : « Dicitur ergo intellectus eorum deiformis propter duo… » ;f. 89ra-b, p. 674b, 675b-676a.
(71) De homine tr. 1 q. 56 a. 5 : Ann Arbor 201, f. 75rb, ed. cit., p. 486a-b : « anima post mortemintelligit per formas ordinis universi sicut et intelligentia separata. Quae autem sint formae tales,sufficienter explanatum est in quaestione de angelis. Et concedimus quod illae formae concreatae suntanimae rationali. (…) Quod autem anima modo non agat per formas illas, hoc est, quia fortiores motusin comparatione ad corpus excludunt alios qui sunt debiliores ; omnes enim motus exteriores, uthabetur in libro De somno et vigilia, fortiores sunt interioribus » ; cf. auch ibid. tr. 1 q. 4 a. 3 : f. 7vb,p. 44b : « Intellectus autem activus in nobis in quattuor distinguitur ab intellectu speculativo. Quorumprimum est quod activus habet formam quae principium est operationis, quod possibile est fieri pervoluntatem (…). Secundum est quod forma quae est in intellectu activo, est operativa rei, et propterhoc magis dicitur forma compositionis quam abstractionis… » ; II Sent. d. 3 a. 16 : ed. cit., p. 94b-95a.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
180 HENRYK ANZULEWICZ
Gesichtssinn fähig macht, die Sache in ihrer Gestalt zu sehen 72. Die Gottförmig-keit des Intellektes der Engel wird primär auf den Erkenntnisakt bezogen ; siebesteht im unmittelbaren Anschauen von Wesenheiten und Wahrheit der Dingejenseits von diskursivem Nachforschen, jenseits der Vorstellungsbilder und derAbstraktion, und folglich jenseits von jedem Irrtum 73.
Bezüglich der Quellen der Intellektlehre, die Albert in De IV coaeq.verarbeitet, wurde bereits deutlich, daß die Unterscheidung zwischen dem« tätigen » und dem « möglichen Intellekt » auf De anima des Aristoteles zurück-geht. Diese aristotelische Grundlage wird jedoch in systematischer Hinsichtdurch theologische, platonische und neuplatonische Quellen und Interpretamentewesentlich ergänzt. Wie bedeutsam diese Erweiterungen sind, zeigte sich in derBestimmung und Deutung der Gottförmigkeit des Intellektes der Engel. Die theo-logischen und platonisch-neuplatonischen Traditionen sind hierbei von Anfangan wirksam und maßgeblich. Zu diesem Befund führt u. a. ein Blick in die Ab-handlung über die Theophanie der Engel und über die erleuchtende Einwirkungder Engel auf die menschliche Seele bzw. auf den Intellekt 74. Die Engel können– so Albert in De IV coaeq. – durch die Illumination des menschlichen Intellektes,ihn zum « göttlichen Intellekt » (intellectus divinus) machen. Wie der « tätigeIntellekt », der die intelligiblen Formen von den sinnenhaften Vorstellungs-bildern abstrahiert und sie mit dem « möglichen Intellekt » vereint – sei es in derHinordnung auf theoretisches Wissen, sei es praktisches Handeln –, könnenEngel die intelligiblen Formen durch das ihnen eignende Licht von densinnenhaften Vorstellungsbildern abstrahieren und sie mit dem Intellekt desMenschen verbinden. Auf diese Weise erklären sich Offenbarungen, welche dieEngel im menschlichen Intellekt erwirken 75.
Den mit der Angelologie verknüpften Lehrstücken albertinischer Intellekt-theorie liegen in erster Linie die augustinisch-dionysische Illuminationslehre unddie platonisch-neuplatonische Tradition zugrunde. Die explizit angeführtenQuellen sind – abgesehen von der Hl. Schrift und der sie erklärenden Glossaordinaria Bibliae – die Werke von Augustinus (De diversis quaest. 83, De Gen.ad litt. und De trin.) und Ps.-Dionysius (De div. nom., De cael. hier., Epist.) mit
(72) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 42ra-b, ed. cit., p. 479b : « (intellectusagens) illuminat ad contemplandum res in formis ; sicut enim lux solis non tantum abstrahit speciemcoloris, sed etiam illuminat visum ad videndum rem in specie, ita enim est de intellectu agente, quisecundum Philosophum in tertio De anima est sicut lux » ; cf. ibid., q. 60 a. 2 : f. 79ra, p. 636b ; Dehomine tr. 1 q. 55 a. 1 : Ann Arbor 201, f. 70rb, ed. cit., p. 455b ; De anima l. 3 tr. 2 c. 18 : ed. cit.,p. 204.19-63.
(73) De IV coaeq. tr. 4 q. 24 a. 2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 41vb sq., ed. cit., p. 478b sq.(74) De IV coaeq. tr. 4 q. 32 a. 1-2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 47(bis)rb-49ra, ed. cit., p. 507a-514b ;
ibid., q. 34 a. 1-3 : f. 51ra-va, p. 522a-526b.(75) De IV coaeq. tr. 4 q. 34 a. 2 : Paris, BnF lat. 18127, f. 51va, ed. cit., p. 524b-525a : « triplex est
modus, quibus angeli illuminant animas, scilicet ad sensum et ad imaginationem (ymaginem cod.) etintellectum (…). Unde sicut intellectus agens abstrahit species a phantasmatibus et unit eas intellectuipossibili secundum ordinem ad scientiam et opus, sic intelligentia angelica lumine suo abstrahitspecies a phantasmatibus et componit cum intellectu animae secundum ordinem ad revelationemoccultorum ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 181
gelegentlicher Begleitung seiner Ausleger (« Commentator », « Iohannes quidamexpositor », Hugo von St. Viktor). Einen unmittelbaren und tiefgreifenden Ein-fluß üben Boethius (De consol. philos.), der Liber de causis und Alfred vonSareshel (De motu cordis) aus. Im kosmologischen Teil des Werkes, der in diesemÜberblick nicht berücksichtigt wird, benutzt Albert noch viele andere philoso-phische und theologische Quellen. Zu nennen sind hier auf der einen Seite Platon,Isaac Israeli (De diff.), Avicenna (VI De nat., De caelo et mundo), MosesMaimonides (Liber de uno deo benedicto) und Averroes (In De caelo et mundo,De substantia orbis), und auf der anderen Seite Johannes von Damaskus (De fideorth.).
In der anfänglichen Phase der Entfaltung seiner Intellektlehre in De IV coaeq.,in der der Intellekt in seiner ontologischen Struktur aristotelisch, in seinenWesenseigenschaften und seiner Wirkungsweise hingegen theologisch undplatonisch sowie neuplatonisch aufgefaßt wird, hatte Albert, wie teilweiseaufgezeigt, viele philosophische Quellen zur Verfügung gehabt und ausgewertet.Die Schriften De anima und Metaphysica des Aristoteles sowie die Kommentaredes Averroes hierzu auf der einen Seite, Augustinus, Ps.-Dionysius Areopagitaund der Liber de causis auf der anderen Seite spielten dabei eine außerordentlichwichtige Rolle. Eine explizite Benutzung der Schriften des Avicenna, nicht abersein Einfluß, blieb in diesem Kontext vorerst noch verhältnismäßig begrenzt. Esgibt noch keine Belege für die Assimilation anderer außer den genannten Quellenperipatetischer Intellektlehre griechisch-arabischer Provenienz, welche Albert inden nachfolgenden Werken benutzen wird. Aber man kann dennoch nicht mitSicherheit ausschließen, daß die Abhandlungen über den Intellekt von Alexandervon Aphrodisias und al-Kind�, die zu Beginn des Lehrstücks über den Intellekt inDe homine zum Vorschein kommen und danach – besonders die Intellektlehre desAlexanders – stets präsent sind, Albert schon bekannt waren. Mit dem Werk Deintellectu et intellecto des al-F�r�b� wurde er erst nach der Abfassung von Dehomine und wohl auch nach der Fertigstellung seines Kommentars zu De animavertraut. In De IV coaeq. ging es primär um eine spezielle, auf die Engel und aufdie getrennten Wesen bezogene Intellekttheorie. Auch wenn die Gleichsetzungder Engel mit den getrennten Wesen für Albert zunächst durchaus plausibel zusein schien – diese Auffassung vertritt er noch in De homine und gibt sie imSentenzenkommentar (II Sent.) und in der revidierten Fassung von De IV coaeq.auf 76, – war hier sein Anliegen ein primär theologisches. Die Intellektlehre wurdeinnerhalb der Angelologie in einer umfassenden Perspektive entwickelt, in derdie Ebenen der Transzendenz und der Kontingenz aufeinander bezogen sind, undin der auch der menschliche Intellekt seinen Platz hat. Dieser Umstand erklärt,warum Albert sich nicht auf theologische Quellen beschränkte, sondern sich auchder philosophischen bediente, ohne sich einer bestimmten philosophischenRichtung zu verpflichten. Eine derartige philosophiesystematische Standort-bestimmung hätte eine Einengung der ganzheitlichen Perspektivierung zur Folge.
(76) Cf. oben Anm. 58.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
182 HENRYK ANZULEWICZ
1.6. De homine
Alle intellekttheoretischen Ansätze in den Frühwerken des Albertus Magnusfinden ihre Vollendung in De homine und sind als eine Hinführung zu derVollgestalt der anthropologischen Intellektlehre des Doctor universalis in derersten Phase ihrer Entwicklung zu verstehen. Das kompakte Lehrstück über denIntellekt in De homine ist Bestandteil der Untersuchung über die menschlicheVernunftseele, genauerhin über deren Erkenntniskräfte 77, und handelt über dreithematische Komplexe : (1) über die unterschiedlichen Intellekte oder vielmehrüber die ontologische Grundstruktur und die verschiedenen Vollendungsstufendes menschlichen Intellektes, (2) über das Intelligible als den Gegenstand desIntellektes, und (3) über das wechselseitige Verhältnis des Intellektes und desSinnesvermögens 78. Der Schwerpunkt liegt im ersten der drei genanntenBereiche, was sowohl aus der Ausführlichkeit und der Tiefe der Erörterungen, alsauch aus der Eigenständigkeit bei der Harmonisierung unterschiedlicher Lösun-gen ersichtlich ist. An dieser Stelle kann weder der Inhalt der einzelnenAbhandlungen 79 noch das Wesentliche einer komplexen Intellekttheorie
(77) ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 53 prol. : Ann Arbor 201, f. 68vb, ed. cit., p. 445sq. :« Post haec quaerendum est de anima rationali. Et circa quam quaeruntur duo, scilicet de viribus eiusapprehensivis, et de ipsa secundum se. De viribus autem apprehensivis animae rationalis quaerunturtria, scilicet de opinione, et de intellectu et de ratione ».
(78) De homine tr. 1 q. 54 prol. : f. 69ra, ed. cit., p. 448 : « Deinde quaerendum est de intellectu. Etquaeruntur tria, scilicet de differentia intellectuum (Et – intellectuum] om. cod.), et de differentiaintelligibilis, et de comparatione intellectus ad sensibilem animam ».
(79) Bezüglich des Inhaltes sei festgehalten, daß dem « tätigen Intellekt » in De homine einebesondere Aufmerksamkeit gilt. Als das Wirkungsprinzip der intellektiven Erkenntnis wird derintellectus agens an erster Stelle in sechs Einzelabhandlungen erörtert. Auf die einleitende Frage nachder Existenz dieses Intellektes (1. An sit intellectus agens) folgen Untersuchungen zu den Fragen, obder « tätige Intellekt » zur Gattung des Habitus gehört (2. Utrum sit in genere habitus), ob er einegetrennte Substanz ist (3. Utrum intellectus agens sit substantia separata vel non), ferner ob er seinerWesenheit nach identisch mit dem « möglichen Intellekt » ist bzw. an diesem teilhat (4. Utrumintellectus agens sit idem cum possibili vel compars eius in eadem natura animae existens). Dievorletzte Frage gilt der Bestimmung des « tätigen Intellektes » hinsichtlich seiner Substanz undDefinition (5. Quid sit intellectus agens secundum substantiam et diffinitionem). Zum Schluß wird derModus der Erkenntnis und der Aktivität des « tätigen Intellektes » behandelt (6. Qualiter intelligat etde modo actionis eius). Die Untersuchung über den « möglichen Intellekt » umfaßt fünf Ab-handlungen zu folgenden Themen : Wesen des « möglichen Intellektes » (1. Quid sit), seine onto-logische Struktur (2. Utrum sit simplex vel compositus), Stufen seiner Potentialität (3. De gradibuspotentiae intellectus possibilis), seine Vergänglichkeit bzw. Ewigkeit (4. Utrum intellectus possibilissit corruptibilis vel non) und Modus seiner Erkenntnis nach dem Tode des Menschen (5. Qualiterintellectus possibilis intelligit post mortem). Dem « theoretischen Intellekt » werden ebenfalls fünfAbhandlungen gewidmet, die folgende Fragen erörtern : Was ist der « theoretische Intellekt » ?(1. Quid sit intellectus speculativus) ; Ist der « theoretische Intellekt » im Akt die erkannte Sache ?(2. Utrum intellectus speculativus in actu sit res scita) ; Ist ein und numerisch derselbe « theoretischeIntellekt » allen Vernunftseelen gemeinsam ? (3. Utrum unus et idem numero intellectus speculativussit omnibus animabus rationabilibus) ; Sind die intelligiblen species im Intellekt wie im Ort oder wiein der Materie ? (4. Utrum species intelligibiles sint in intellectu ut in loco vel ut in materia) ; Verbleibtder Habitus des « theoretischen Intellektes » nach der Betrachtung in ihm selbst, oder in einemGedächtnis, das ein Teil der Vernunftseele ist, oder besteht dieser gar nicht in der Vernunftseele ?(5. Utrum habitus intellectus speculativi post considerationem manet in ipso vel in memoria aliquaquae sit pars animae rationalis, vel omnino non manet in anima rationali).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 183
wiedergegeben werden. Wir beschränken uns nur auf den ersten Teil desLehrstücks, das die Grundstruktur und die verschiedenen Vollendungsstufen desIntellektes zum Gegenstand hat, damit wir die Entwicklung albertinischerIntellektheorie in diesem Punkt mit ihrem quellenhistorischen Hintergrund in denBlick bekommen.
Seine Untersuchung über den menschlichen Intellekt gliedert Albert in vierAbschnitte. Zu Beginn werden anhand einschlägiger Quellen verschiedeneEinteilungen des Intellektes, oder vielmehr die Struktur und die Vollendungs-stufen des einen menschlichen Intellektes vorgestellt, die sowohl in bezug auf diejeweils angenommene Anzahl der Gliederungselemente als auch deren begrif-fliche und inhaltliche Bestimmung meist derart voneinander abweichen, daß siegar widersprüchlich zu sein scheinen 80. Die präsentierten Einteilungsmodellestammen von Aristoteles (De anima), Alexander von Aphrodisias (De intellectuet intellecto), al-Kind� (De intellectu et intellecto), Avicenna (VI De naturalibus),al-Ghaz�l� (Metaphysica) und Averroes (Comm. in De anima). Es fällt auf, daßlateinische Quellen zur Intellektlehre in diesem Zusammenhang nur sehr spärlicherwähnt werden. Sie beschränken sich zunächst auf die Schriften von Augustinus(De magistro), Boethius (De consol. philos.) und Dominicus Gundissalinus (Dean.). Der Grund hierfür liegt darin, daß Albert sich nur in sehr begrenztem Maßeauf Lehrmeinungen stützen konnte, die zu seiner Zeit in Paris vertreten wurden 81.Besonders hinsichtlich des intellectus agens fand er unter den referiertenPositionen keine Lehrauffassung, wie er feststellt, die er selbst teilen könnte. Ersieht sich deshalb veranlaßt, im Anschluß an Aristoteles und Averroes eigeneIntellekttheorie zu entwickeln. Mit seiner Kritik, welche er an jener Lehransichtübt, die die Existenz des intellectus agens verneint, distanziert er sich u. a. vonWilhelm von Auvergne 82. Seine Kritik an der Intellektlehre der moderniLatinorum wird in De anima-Kommentar deutlicher und detaillierter. Er wirftihnen vor, daß sie sich eng an platonische Positionen halten und in den Prinzipienmit der Auffassung der Peripatetiker nicht übereinstimmen 83.
(80) De homine tr. 1 q. 54 : Ann Arbor 201, f. 69ra, ed. cit., p. 449a sq. : De divisione intellectus.(81) Grundlegende Orientierung fand Albert vor allem in der Summa fratris Alexandri und bei
Philipp dem Kanzler ; cf. ALEXANDER HALENSIS, Summa theologica II : Ed. Quaracchi 1928, p. 446sq.,bes. p. 453-455. PHILIPPUS CANC., Summa de bono : ed. N. WICKI, Bern 1985, p. 270.197sq. Zu RobertGrosseteste cf. H. A. DAVIDSON, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect, New York – Oxford1992, p. 215 mit Anm. 456.
(82) ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 55 a. 1 : Ann Arbor 201, f. 70ra, ed. cit., p. 454a ; ibid.,a. 3 : f. 72ra, p. 466a. Cf. beispielsweise GUILL. ALVERNUS, De anima : Paris 1674 (Opera omnia, II/2),p. 205b sq., 210a sq. Schon A. Schneider hat festgestellt, daß Alberts Kritik an der Intellektlehre derLateiner sich in erster Linie gegen die des Wilhelm von Auvergne richtete ; cf. A. SCHNEIDER, DiePsychologie Alberts des Großen, I. Teil, Münster 1903 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie desMittelalters, IV/5), p. 185-186. G. JÜSSEN, « Wilhelm von Auvergne und die Transformation derscholastischen Philosophie im 13. Jahrhundert », in Philosophie im Mittelalter, hg. v. J. P. BECKMANN
[u. a.], Hamburg 1996 2, p. 163. H. A. DAVIDSON, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect,p. 215.
(83) ALBERTUS MAGNUS, De anima l. 3 tr. 3 c. 10 : ed. cit., p. 220.28-221.5 ; tr. 2 c. 11 :p. 191.55sq.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
184 HENRYK ANZULEWICZ
Auf diesen ersten allgemeinen Teil der Intellektlehre folgen drei spezielleUntersuchungsblöcke über den « tätigen », den « möglichen » und den « theore-tischen Intellekt » 84. Diese Dreiteilung des Lehrstücks gibt die Makrostruktur derAlbertschen Intellekttheorie wider, die in De homine vorliegt. Sie orientiert sichweitgehend an der Auslegung der aristotelischen Seelenlehre durch Averroes undberuht auf einem dreiteiligen Modell, in dem folgende drei unterschiedlicheArten oder vielmehr Stufen des menschlichen Intellektes festgehalten werden :
1. intellectus agens2. intellectus possibilis3. intellectus speculativus
Man darf jedoch nicht übersehen, daß neben der Adaption und punktuellerUmformung der Intellektlehre des Averroes 85 auch andere peripatetische Quellendie Gestalt der Intellekttheorie des Albertus Magnus, die er in De homine ent-wickelt, mitbestimmen. Denn in der dreiteiligen Makrostruktur des Lehrstückssind alle wesentlichen Elemente der Intellekttheorien von Alexander vonAphrodisias, al-Kind�, Avicenna und al-Ghaz�l� präsent. Sie werden auch inspäteren Schriften in demselben Kontext wirksam und adaptiert. Durch unter-schiedliche Ansätze der « späteren Peripatetiker » inspiriert, insbesondere durchdie des Averroes, erweitert Albert in De homine die bei Aristoteles vorgefundenedychotome Bestimmung der ontologischen Struktur des Intellektes zu einerDreierstruktur und nimmt bei dem dritten Glied, dem « theoretischen » bzw. dem« formalen Intellekt », mehrere Vollendungsstufen an. Diese Erweiterung deraristotelischen Grundstruktur wird auch in den nächsten Entwicklungsphasen derIntellekttheorie Alberts beibehalten ; es kommt sogar zu einer weiterenAusdifferenzierung, die sich am deutlichsten in der Schlußphase der Entwicklungin De intell. et int. zeigt 86.
Ausschlaggebend für die Entfaltung des Lehrstücks über den Intellekt warendie Schriften griechischer und arabischer Autoren, in denen die aristotelischenAnsätze aus der Schrift De anima reflektiert und weiterentwickelt wurden. Alberthat mehrere von den neu in lateinischen Übersetzungen bekanntgewordenen
(84) De homine tr. 1 q. 55 : Ann Arbor 201, f. 69vb, p. 452sq. : (2) De intellectu agente ; q. 56 :f. 73vb, p. 477sq. : (3) De intellectu possibili ; q. 57 : f. 75rb, p. 486sq. : (4) De intellectu speculativo.
(85) Cf. E.-H. WÉBER, « Les emprunts majeurs à Averroès chez Albert le Grand et dans sonécole », in Averroismus im Mittelalter und in der Renaissance, hg. v. F. NIEWÖHNER u. L. STURLESE,Zürich 1994, p. 149-179, bes. 149 u. 155-160. K. BORMANN, « Wahrheitsbegriff und QRÀM-Lehre beiAristoteles und einigen seiner Kommentatoren », in Studien zur mittelalterlichen Geistesgeschichteund ihren Quellen, hg. v. A. ZIMMERMANN u. G. VUILLEMIN-DIEM, Berlin – New York 1982(Miscellanea Mediaevalia, 15), p. 23. B. MOJSISCH, « Zum Disput über die Unsterblichkeit der Seele »,p. 344-345. E. P. MAHONEY, « Sense, Intellect, and Imagination in Albert, Thomas, and Siger », in TheCambridge History of Later Medieval Philosophy, hg. v. N. KRETZMANN [u. a.], Cambridge 1982(Reprint 1996), p. 602-605. J. BONNÉ, Die Erkenntnislehre Alberts des Großen mit besondererBerücksichtigung des arabischen Neuplatonismus, Bonn 1935, p. 30sq.
(86) Hierzu vgl. D. N. HASSE, « Das Lehrstück von den vier Intellekten : von den arabischenQuellen bis zu Albertus Magnus », Recherches de théologie et philosophie médiévales, 66 (1999),p. 68-75.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 185
Quellen assimilieren können, die sich auf die aristotelische Grundlage aus dem 3.Buch von De anima stützend, eine eigene Theorie des Intellektes entwickelten.Vor allem bei den griechischen und arabischen Aristoteles-Kommentatorensowie bei jenen Autoren, die sich um ein vertieftes Verständnis der aristotelischenAnsätze in der Intellektlehre bemühten und die Albert als posteriores Peripateticibezeichnet 87, kommt es bekanntlich zu einer Ausdifferenzierung der Interpreta-tionsmodelle und der Begrifflichkeit. Albert stellt die wichtigsten Positionen vorund zeigt, wie sie sich zum einen in bezug auf die Anzahl der Intellekte bzw. derIntellektstufen, zum andern in deren Benennung und Verständnis unterscheiden.Er stellt fest, daß, während Aristoteles nur zwei Arten des Intellektes (duaespecies intellectus) in der menschlichen Seele anzunehmen scheint, nämlich den« tätigen » und den « möglichen » Intellekt, die späteren Autoren sich auf dieseUnterscheidung beziehend unterschiedliche Modelle entwickeln.
Alexander von Aphrodisias nimmt eine Dreiteilung des Intellektes an, indemer (a) einen « möglichen oder materiellen Intellekt » (i. possibilis sive materialis),(b) einen « habituellen oder formalen Intellekt » (i. in habitu sive formalis) und(c) eine von den beiden verschiedene, « tätige Intelligenz » (intelligentia agens)unterscheidet.
Auch bei Averroes findet Albert eine Dreiteilung vor, die jedoch im einzelnenvon der des Alexanders abweicht. Nach seinem Verständnis nimmt der Kom-mentator in der menschlichen Seele (a) einen « tätigen Intellekt », (b) einen« möglichen Intellekt » und (c) einen « theoretischen Intellekt » an.
Diesen beiden dreistufigen, jeweils verschiedenen Modellen stellt er einevierstufige Einteilung gegenüber, die er bei al-Kind�, Avicenna und al-Ghaz�l�ermittelt. Die vier Arten des Intellektes (species intellectus) sind nach al-Kind� :(a) ein « Intellekt, der immer in der Verwirklichung ist » (intellectus qui semperest in actu), (b) ein « Intellekt, der in Möglichkeit in der Seele ist » (i. qui inpotentia est in anima), (c) ein « Intellekt, der aus der Möglichkeit zur Verwirklich-ung in der Seele übergeht » (i. cum exit in anima de potentia ad effectum) und(d) ein « Intellekt, den man als den beweisenden nennt » (i. quem vocamus demon-strantem). Nach Alberts Urteil unterscheiden sich Avicenna und al-Ghaz�l� inihrer Einteilung teilweise von al-Kind� und nehmen an, daß es (a) einen « tätigenIntellekt » (intellectus agens), (b) einen « möglichen Intellekt » (i. possibilis),(c) einen « habituellen Intellekt » (i. in habitu) und (d) einen « erworbenenIntellekt » (i. adeptus) gibt. Um diese unterschiedlichen Einteilungen miteinandervergleichen und beurteilen zu können, wird nach einem objektiven und für alldiese Modelle gemeinsamen Kriterium gesucht. Ein solches macht Albert in derDefinition des Intellektes aus, die der Ausgangspunkt für alle Einteilungen ist.Hierbei zeigt sich, daß die avicennische Definition des Intellektes 88 sachlich undformal dem Begriff des « tätigen Intellektes » nicht gerecht wird. Deshalb wird
(87) Cf. ALBERTUS MAGNUS, De anima l. 3 tr. 2 c. 2 : ed. cit., p. 179.77-80.(88) ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 54 : Ann Arbor 201, f. 69rb, ed. cit., p. 449b : « virtus
contemplativa intellectus est virtus quae solet informari a forma universali nuda a materia ».Cf. AVICENNA, VI De nat. pars 1 c. 5 : ed. S. VAN RIET, Louvain – Leiden 1972, p. 94.15-16.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
186 HENRYK ANZULEWICZ
nach einem anderen Weg gesucht, um die Widersprüchlichkeiten der zum Teilstark voneinander abweichenden philosophischen Auffassungen sowohl in bezugauf die angenommene Anzahl der Intellekte als auch deren Benennungen undBestimmungen auszuräumen. Die Lösung findet Albert in der Bestimmung derArt der unterschiedlichen Einteilungen : sie sind analog, oder – nach seinenWorten – auf das Analogon bezogen, das die Mitte zwischen dem Äquivoken unddem Univoken hält 89. Die einzelnen Glieder aller Intellekteinteilungen sind aufden « theoretischen Intellekt » bezogen : der « tätige Intellekt » als das Wirkungs-prinzip, der « mögliche Intellekt » hingegen als das rezeptive Prinzip. Der vonAvicenna genannte « habituelle Intellekt » (intellectus in habitu) und der von al-Kind� bezeichnete « beweisende Intellekt » (intellectus demonstrans) sind auf den« theoretischen Intellekt » wie « das Vorbereitende » bzw. « das Folgende »hingeordnet. Wichtig ist, daß Albert für die jeweilige Einteilung das ihr jeweilszugrundeliegende Kriterium ermittelt und somit ihre Unterschiedlichkeitgegenüber anderen Einteilungen widerspruchsfrei erklären kann. Er bekräftigteinerseits die grundlegende Bedeutung der aristotelischen Einteilung in den« tätigen » und « möglichen Intellekt », deren Begründung er im tätigen undpotentiellen Teil der Seele sieht. Er gibt andererseits aber zu, daß dieseZweiteilung eine gewisse Einengung mit sich bringt, weil sie sowohl den« habituellen », als auch den « erworbenen » und den « beweisenden Intellekt »außer acht läßt. Die drei genannten Vollendungsstufen des Intellektes gehen aufdie « Ähnlichkeiten der Dinge » zurück, welche keine wesenhaften Teile derSeele sind, die Aristoteles im Blick hatte, sondern ihr zufallen.
Hinsichtlich des « tätigen Intellektes » hat Albert seinen eigenen Standpunktbereits im Rahmen der allgemeinen Intellektlehre deutlich gemacht, den er u. a.beim Nachgehen der Frage, ob der « tätige Intellekt » unter die Gattung desHabitus gehört, wiederholt und erläutert. Der « tätige Intellekt » ist ein formalerTeil der intellektiven Seele und die substantiale Form. Er fällt weder mit dem« habituellen » noch mit dem « erworbenen » noch mit dem « formalen Intellekt »zusammen, da die drei genannten Intellekte auf die Form, die von den Dingenabstrahiert und von der Materie entkleidet ist, zurückgehen. Der « tätigeIntellekt » hingegen ist für die intellektive Seele nicht äußerlich, sondernkonstitutiv 90. Mit dieser Position distanziert sich Albert ausdrücklich von der
(89) ALBERTUS MAGNUS, De homine, l. c. : f. 69va, p. 451a. Zum Verständnis der « divisionesanalogi » cf. ALBERTUS MAGNUS, De V univ. l. 1 tr. 1 c. 5 : ed. cit., p. 220.25-222.45 ; De divisione tr. 2c. 1 : ed. P. M. DE LOE, Bonn 1913, p. 25.1-8.
(90) ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 55 a. 2 : Ann Arbor 201, f. 71ra, ed. cit., p. 460a :« intellectus vero agens non est extrinsecus animae intellectivae, sed est de constitutione ipsius ».Cf. Super Dion. De div. nom. c. 4 : ed. cit., p. 134.79-135.2 (siehe unten Anm. 100). J. VENNEBUSCH,« Die Interpretation von De anima III, 5 bei Albertus Magnus und anderen lateinischen Kommen-tatoren », in Proceedings of the World Congress on Aristotle, Thessaloniki, August 7-14, 1978, vol. 2,Athens 1981, p. 154-158. In diesem Punkt sehe ich – anders als B. Mojsisch – keinen Unterschiedzwischen der Auffassung von Albert und der von Dietrich von Freiberg ; cf. B. MOJSISCH, Die Theoriedes Intellektes bei Dietrich von Freiberg, Hamburg 1977 (Beihefte zu Dietrich von Freiberg Operaomnia, 1), p. 53.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 187
Auffassung des Themistius, des Alexander von Aphrodisias und derenGefolgschaft, sowie von jenen nicht namentlich genannten Denkern, die den« tätigen Intellekt » für den Habitus und Wesensart der Erstursache halten. Der« tätige Intellekt » des Menschen ist, so Albert unter dem Hinweis auf den Kom-mentar des Averroes zu De anima des Aristoteles, mit der menschlichen Seeleverbunden ; er ist einfach und besitzt keine intelligiblen Formen, sondern machtdiese im « möglichen Intellekt » aus den Vorstellungsbildern 91. Die Position desAverroes, aber auch die von Avicenna, wird hier als konform mit seiner eigenenAuffassung des « tätigen Intellektes » ausgegeben. Daß es sich um eineMißdeutung handelt, zeigt sich spätestens in Alberts Kommentar zu De anima,wo er feststellt, daß Averroes « mit fast allen Philosophen darin übereinstimmt,daß der tätige Intellekt getrennt und mit der Seele nicht verbunden ist » 92.
In der unmittelbar nach De homine verfaßten Schrift De bono gibt es, wiebereits gesehen, nur wenige, sporadische Anknüpfungen an die Intellektlehre.Sie bieten keinen lehrinhaltlichen Zuwachs an dem zuvor erreichten Niveauund können somit, wie auch die intellekttheoretisch relevanten Aussagen imSentenzenkommentar, noch der ersten Phase der Entwicklung zugerechnetwerden. Im Sentenzenkommentar, der chronologisch auf De bono folgt, wird dieIntellektlehre in verschiedenen Zusammenhängen zwar thematisiert. Aber wirhaben dort bisher keinen Beleg für eine wirkliche Lehrentwicklung in diesemPunkt finden können. Nach dem gegenwärtigen, flüchtigen Einblick in denangelologischen und anthropologischen Werkteil einschließlich der Christologieund Eschatologie gehen wir zunächst davon aus, daß Albert hier an seiner inDe homine entfalteten Konzeption ohne Abstriche festhält. Es bleibt alsounverändert bei dem Drei-Stufen-Modell des Intellektes, dessen Glieder, wieoben festgehalten, sind : (1) intellectus agens, (2) intellectus possibilis und (3)intellectus speculativus.
Mit diesem Einblick in die formale Struktur, systematische Konzeption undQuellen des Lehrstücks über den Intellekt, das in De homine vorliegt, und mit derentwicklungsgeschichtlichen Einordnung der intellekttheoretischen Ansätze inDe bono sowie im Sentenzenkommentar beenden wir die Skizze der erstenEntwicklungsphase der Intellekttheorie des Doctor universalis. Im folgendenstellen wir die zwei nächsten Entwicklungsphasen seiner Intellekttheorie kurzvor.
(91) ALBERTUS MAGNUS, De homine tr. 1 q. 55 a. 1 : Ann Arbor 201, f. 70ra, ed. cit., p. 454b :« Item, Averroes ibidem dicit quod in anima est intellectus agens, quo est omnia facere secundumAristotelem, et intellectus possibilis, quo est omnia fieri. Idem (I.] Ibidem cod.) dicunt Alfarabius(=Averr.), Alkindius, Alexander, Avicenna et omnes philosophi » ; ibid. a. 3 : f. 72ra, p. 466b :« sequentes enim Aristotelem et Averroem dicimus caelum non habere animam praeter intelligen-tiam, ut supra in quaestione de caelo determinatum est. Et similiter dicimus intellectum agentemhumanum esse coniunctum animae humanae, et esse simplicem et non habere intelligibilia, sed agereipsa in intellectu possibili ex phantasmatibus, sicut expresse dicit Averroes in commento libri Deanima ».
(92) De anima l. 3 tr. 3 c. 11 : ed. cit., p. 221.9sq. ; cf. Super Ethica l. 6 lect. 8 : p. 451.29sq.H. ANZULEWICZ – C. RIGO, « Reductio ad esse divinum », p. 397 mit Anm. 50.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
188 HENRYK ANZULEWICZ
2. DIE ZWEITE PHASE : SUPER DION. DE DIV. NOM. UND DE ANIMA
Bei der zweiten und bei der dritten Entwicklungsphase der Intellekttheorie desAlbertus Magnus beschränken wir uns nur auf eine kurze Präsentation desjeweiligen Einteilungsmodells des Intellektes, das wir als das Kriterium für dieFeststellung einer Lehrentwicklung angenommen haben. Wir werden dieUnterschiede und Neuerungen, die im Vergleich der ermittelten Modelle sichtbarwerden, herausstellen. Auf Erläuterungen zu den einzelnen Stufen des jeweiligenModells und quellenkritische Untersuchungen wird an dieser Stelle verzichtet.
2.1. Super Dion. De div. nom.
Während im Sentenzenkommentar noch keine Anzeichen dafür gefundenwerden, daß Albert die in De homine dargelegte Theorie in ihrer Grundstrukturoder in irgendeinem Punkt modifiziert oder ergänzt, ist im Kommentar zu De div.nom. des Pseudo-Dionysius eine gewisse Entwicklung wahrzunehmen. Bei derErörterung der Frage nach den äußeren Hervorgängen göttlicher Gutheiten undihrem Fließen in die menschliche Seele – es handelt sich um eine von Ps.-Dionysius theologisch adaptierte, neuplatonischen Emanationslehre – wird dasvertraute Drei-Intellekte-Modell um eine weitere, vierte Stufe ergänzt. Es seibemerkt, daß Albert sich auf dieses erweiterte Modell im dezidiert theologischenKontext beziehend, es ausdrücklich als ein von Philosophen aufgestelltesbezeichnet. In diesem Modell werden in der angegebeben Reihenfolge vierIntellektstufen genannt 93 :
1. intellectus agens2. intellectus possibilis3. intellectus formalis4. intellectus adeptus
Die sich hier abzeichnende Entwicklung setzt beim dritten Glied aus demvorgängigen Modell ein. An die Stelle des intellectus speculativus tritt nun derBegriff des intellectus formalis. Durch diesen Austausch kommt es zwar zurkeiner inhaltlichen Verschiebung in der Auffassung der dritten Stufe der unsschon vertrauten Struktur, da die beiden Bezeichnungen in diesem Zusammen-hang explizit als synonym aufgefaßt werden 94. Dieser terminologische Wechselweist aber zum einen auf eine fortschreitende Assimilation peripatetischer Intel-lektlehre hin. Er zeigt zum andern, daß Albert sein ursprüngliches Drei-Stufen-Modell auf eine differenziertere Interpretation hin öffnet. Später, vor allem in Deintell. et int. (I 3 3), wird deutlich, daß der hier eingeführte Begriff des intellectusformalis die Grundlage für eine noch stärkere Ausdifferenzierung derVollendungsstufen des Intellektes darstellt. Diese sich allmählich vollziehendeEntwicklung ist eine positive Entfaltung der Lehre, die nicht als eine Diskonti-
(93) ALBERTUS MAGNUS, Super Dion. De div. nom. c. 4 : ed. cit., p. 133.71-73.(94) Ibid., p. 134.74-79.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 189
nuität der in De homine dargelegten Theorie gedeutet werden kann. Im Kommen-tar zu De div. nom. wird dieser Umstand von Albert selbst, wie erwähnt, dadurchunterstrichen, daß er die Bezeichnung intellectus formalis als die Äquivalenz zuder bisher verwendeten Bestimmung intellectus speculativus begreift. Von denbeiden Bezeichnungen wird nun die erstere deshalb bevorzugt, weil sie inangemessener Weise den Begriffsgehalt und die Schlüsselstellung dieser Intel-lektstufe für den weiteren Aufstieg des Intellektes zum Ausdruck bringt. Derintellectus formalis bzw. der intellectus speculativus ist nach Albert zusammen-gesetzt aus dem intellectus possibilis und der vom intellectus agens « infor-mierten » species. Daraus wird erkennbar, welche Bedeutung diese termino-logische Veränderung für die systematische Erweiterung des Modells darstellt,und warum die vierte Stufe der intellektiven Vollendung – der intellectus adeptus– eingeführt wurde. Ohne das « Informieren » der species des intellectus possibilisdurch den intellectus agens kann nicht der Habitus intellektiver Vollendung,näherhin der intellectus adeptus, erlangt werden 95. Mit der Modifikation in derTerminologie und ihrer inhaltlichen Ausfüllung öffnete Albert sein Stufenmodellin systematischer Hinsicht auf eine weitere Differenzierung an dem dritten Glieddes Modells, eine Ausdifferenzierung, die später vor allem in De intell. etint. vorgenommen wird. Er öffnete damit aber sein bisher auf die Grundstrukturreduziertes Modell nicht nur für eine weitergehendere Ausdifferenzierung,sondern auch für eine philosophisch stimmigere und ausgereifte Darstellungseiner eigenen, schon in De IV coaeq. und in De homine formulierten Auffassungvon den Stufen der Vollendung des menschlichen Intellektes. Diese Vollendunghat er philosophisch im Anschluß an Averroes, aber auch mit Bezugnahme aufPlaton, mit der sogenannten continuatio intellectus beschrieben, die häufig, aberdoch nicht immer, als postmortal aufgefaßt wird 96. Daß diese continuatio bzw.coniunctio intellectus in hac vita formaler Art (coniunctio formalis) ist, und daßsie den menschlichen Intellekt mit den getrennten Substanzen bzw. mit dem
(95) Ibid.(96) Z. B. De IV coaeq. tr. 1 q. 1 a. 3 : Paris, BnF lat. 18127, f. 6ra, ed. cit., p. 312b-313a : « Unde
etiam positio philosophica est quod finis prosperitatis animae post mortem est quod continuetur(continetur cod.) primo motori per contemplationem. Et hoc est quod dicit Plato in secundaauctoritate » ; tr. 3 q. 16 a. 1 : f. 32va, ed. cit., p. 436b ; De homine tr. 1 q. 56 a. 4 : Ann Arbor 201,f. 74vb-75ra, ed. cit., p. 484a : « Dicunt enim philosophi quod anima post mortem convertitur admotorem primum, et hoc est finis prosperitatis eius » ; ibid., q. 61 a. 2 : f. 81va, ed. cit., p. 523a : « Item,Averroes (Avicenna ed. Paris.) Super XI metaphysicae dicit quod anima rationalis manet postmortem, et finis prosperitatis eius erit, si coniungetur primo motori. Et appellat primum motoremuniversitatis principium quod est deus » ; IV Sent. d. 49 a. 5 : ed. cit., p. 670b : « ibi enim (sc. in patria)incircumscriptum lumen deitatis quod est deus ipse, unitur intellectui agenti, et sic effunditursubstantialiter super totam animam et implet eam, et hoc modo anima plena erit ipso deo qui est suabeatitudo. Et hoc est quod obscure dixerunt philosophi quod si anima post mortem primo motoricontinuaretur, hoc esset ratione suae prosperitatis » ; De anima l. 3 tr. 3 c. 13 : ed. cit., p. 226.53-58 ;Super Ethica l. 6 lect. 8 : ed. cit., p. 452.69sq. ; Ethica l. 1 tr. 7 c. 17 : ed. cit., p. 133b. Cf. E.-H. WÉBER,« Les emprunts majeurs à Averroès chez Albert le Grand », p. 166-169. A. DE LIBERA, Albert le Grandet la philosophie, Paris 1990, p. 242-251, 265-266, 274-275. Für die platonischen Elemente in derIntellektlehre des Albertus Magnus, cf. H. ANZULEWICZ, « Die platonische Tradition bei AlbertusMagnus », p. 259-263.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
190 HENRYK ANZULEWICZ
intellectus universaliter agens verbindet, der nicht ein Teil der menschlichenSeele ist, wird anhand des viergliedrigen Stufenmodells besser verständlich.Deutlich wird dies erst später im Kommentar zu De anima 97, wie wir noch sehenwerden, sowie auch in den Kommentaren zu De somno et vig. 98 und zum Liber decausis 99. Hier im Kommentar zu De div. nom. endet der Exkurs mit derHervorhebung der konstitutiven Funktion des intellectus agens für dieErkenntnisfähigkeit des Menschen 100.
2.2. De anima
Die in Super Dion. De div. nom. vorgenommene Erweiterung der dreiteiligenGrundstruktur, die dem Lehrstück über den Intellekt in De homine zugrundeliegt,um eine weitere Stufe wird im Kommentar zu De anima beibehalten. DieIntellektlehre wird hier wie auch in der kommentierten Vorlage hauptsächlich imdritten Buch behandelt. Die Darstellung der vier Stufen des menschlichen Intel-lektes unterscheidet sich ein wenig hinsichtlich ihrer Reihenfolge und Benennungvon der Aufstellung im Dionysius-Kommentar. Damit wird allerdings kaum eineAbänderung in der bisherigen Interpretation intendiert. Das Modell aus demKommentar zu De anima, welches – wie man unterstreichen muß – nicht aus deraristotelischen Vorlage oder einem anderen Werk des Aristoteles, und auch nichtvon den « späteren Peripatetikern » einfach übernommen wird, sondern Albertseigene, sich an die genannten Quellen anlehnende Schöpfung darstellt, umfaßtfolgende vier Stufen 101 :
1. intellectus possibilis2. intellectus universaliter agens3. intellectus speculativus4. intellectus adeptus
(97) Cf. ALBERTUS MAGNUS, De anima l. 3 tr. 3 c. 12 : ed. cit., p. 224.84-90 : « nobis videtur, quodin hac vita continuatur cum agente formaliter, et tunc per agentem intelligit separata, quia aliterfelicitas contemplativa non attingeretur ab homine in hac vita ; et hoc est contra omnes peripateticos,qui dicunt, quod fiducia contemplantium est ut formam attingere intellectum agentem ». In diesemSinne erklärt Albert die Gottesschau bzw. Gottes Gegenwart in der Seele in via als die « assimilatioformalis speciei » ; cf. IV Sent. d. 49 a. 5 : ed. cit., p. 670b.
(98) De somno et vig. l. 3 tr. 1 c. 4 : ed. A. Borgnet, Paris 1890 (Ed. Paris. IX), p. 182a-183a ; c. 9-11 : p. 190a-194b (u. ö.). Cf. De homine tr. 1 q. 56 a. 5 : Ann Arbor 201, f. 75rb, ed. cit., p. 486b.
(99) Z. B. De causis et proc. univ. l. 1 tr. 2 c. 1 : ed. cit., p. 26.45sq.(100) Super Dion. De div. nom. c. 4 : ed. cit., p. 134.79-135.2 : « et sic patet quod remoto agente
removentur omnes alii intellectus, et ideo dicimus, quod anima non habet esse intellectualis nisi perintellectum agentem ». Cf oben Anm. 90.
(101) De anima l. 3 tr. 3 c. 12 : ed. cit., p. 225.6-9 ; cf. ibid. tr. 2 c. 5 : p. 184.8-15. [E.-] H. WÉBER,« Les apports positifs de la noétique d’Ibn Rushd à celle de Thomas d’Aquin », in Multiple Averroès.Actes du Colloque international organisé à l’occasion du 850 e anniversaire de la naissanced’Averroès, Paris 20-23 septembre 1976, Paris 1978, p. 222 mit Anm. 3.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 191
Der tätige Intellekt wird jetzt an zweiter Stelle nach dem möglichen genannt,wodurch der natürlichen Ordnung der intellektiven Verwirklichung des Men-schen und seiner sich stufenweise vollziehenden Vollendung Rechnung getragenwird 102. Es fällt auf, daß bei der dritten Vollendungsstufe in diesem Modell Albertzu der Bezeichnung intellectus speculativus zurückkehrt und nicht die zuletzt inSuper Dion. De div. nom. gebrauchte, synonyme Bestimmung intellectus formalisbeibehält. Dieser Umstand bringt inhaltlich keine wesentliche Differenz mit sich,weil es sich um eine begriffliche Äquivalenz handelt. Die Wahl bestimmterTerminologie, wie in diesem Fall, ist nicht zufällig. Sie ist zum einen durch einegrößere Nähe zum kommentierten Text des Aristoteles diktiert. Zum andernbringt sie das Bemühen zum Ausdruck, sich begrifflich gefälliger, präziser undaussagekräftiger in den systematischen Kontext zu fügen. In einem durch diearistotelische Theorie und Begrifflichkeit durchwegs geprägten Bezugsrahmeneiner Paraphrase wird die Bezeichnung intellectus speculativus, die aus De animades Aristoteles stammt, ausdrucksvoller als der Begriff intellectus formalis, deraus einem anderen Kontext herrührt 103, mit der Frage nach der felicitas contem-plativa verknüpft. Mit dem Begriff intellectus speculativus kann die höchsteVollendungsstufe des menschlichen Intellektes genauer erklärt werden. Denndieser Prozeß vollzieht sich nach Albert auf der Stufe des intellectus speculativusund besteht in dessen Vereinigung mit dem intellectus agens. Alberts Theorieberücksichtigt nicht nur den Entwicklungsstatus, welcher im Kommentar zu Dediv. nom. erreicht wurde, sondern sie präzisiert und entfaltet das, was zuvor nur imAnsatz und ohne nähere Erklärung zum Ausdruck kam.
Im Kommentar zu De anima hält Albert fest, daß seiner Ansicht nach dermenschliche Intellekt – gemeint ist hier der intellectus speculativus – in diesemLeben (in hac vita) sich mit dem intellectus agens « formal vereinigt » (conti-nuatur cum agente formaliter) und folglich auch getrennte Substanzen (separata)erkennt. Doch bevor es zu dieser formalen Vereinigung mit dem intellectus agenskommen kann, vereinigt sich der intellectus agens mit dem intellectus possibiliswie das wirkungsursächliche Prinzip (ut efficiens), das die kontemplativeAnschauung in uns bewirkt, die nicht nur in der Natur des Menschen gründet,
(102) Cf. ALBERTUS MAGNUS, De anima l. 3 tr. 2 c. 19 : ed. cit., p. 205.88-206.3 : « quandocomparamus istos intellectus ad se invicem, tunc intellectus, qui est secundum potentiam dictus,tempore prior est in individuo quolibet, quoniam prius intelligimus in potentia tantum, et non operaturintellectus agens adhuc in nobis aliquas intelligentias speculativas. Postea autem crescentibusexperimento et tempore incipit in nobis manifestari operatio intellectus agentis per separationemintelligibilium. Sed universaliter secundum substantiam comparando possibilem intellectum adagentem, tunc non praecedit tempore, quoniam si comparantur isti intellectus, non prout manife-stantur in nobis, sed secundum suas substantias, tunc agens prior est acto et informans prior est infor-mato » ; ibid., tr. 3 c. 11 : p. 222.15-37, bes. 29-37 : « In hoc autem modo prior est potentia intellectusquam actu intellectus ; et hoc fuit, quod saepe superius diximus, quod possibilis prior est tempore inunoquoque individuo, quod habet utrumque intellectum, sed actu dictus intellectus est simpliciterprior. Ex hoc iterum patet, quod agens intellectus, prout est adeptus ut forma, « ingreditur in hominemab extrinseco », ut dicit Aristoteles in XVI Libro animalium ».
(103) Cf. die entsprechenden Quellenangaben zur Herkunft der Termini intellectus speculativusund intellectus formalis bzw. intellectus in habitu sive formalis im Anhang II.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
192 HENRYK ANZULEWICZ
sondern auch – was man unterstreichen muß – von seiner willentlichenEntscheidung abhängig ist. Wenn der intellectus possibilis andauernd das Lichtdes intellectus agens empfängt, wird er mehr und mehr ihm ähnlich, weil er wiedieser mehr und mehr « getrennt und geistig » wird. Diesen intellektivenVollendungsprozeß auf seiten des Menschen nennen die Philosophen, so Albert,« Angetrieben-Sein zur Vereinigung mit dem intellectus agens » (moveri adcontinuitatem cum agente intellectu). Es ist damit ein Prozeß intellektiver Vollen-dung gemeint, der im Empfang durch den möglichen Intellekt der gesamtenIntelligibilia gleichsam der Form, die diese Vereinigung konstituiert, gipfelt. Mitanderen Worten : Wenn der intellectus agens dem möglichen Intellekt wie dieForm der Materie innewohnt, ist die continuatio intellectus erlangt. Was diesecontinuatio intellectus, deren terminologische Äquivalenz contemplatio heißt,genauer bedeutet und was ihr Letztziel (finis prosperitatis) ist, wird von Albertspäter in De intell. et int. II 104 und in De nat. et orig. an. verdeutlicht 105. Durchdiese Vereinigung der beiden Intellekte erlangt der Mensch nach Albert, der indieser Auffassung den Peripatetikern folgt, die höchste Vollendungstufe desIntellektes. Diese Vollendungsstufe wird begrifflich mit der Bezeichnungintellectus adeptus et divinus ausgedrückt. Der Mensch, der den intellectusadeptus et divinus erlangt hat, ist vollkommen hinsichtlich seiner spezifischmenschlichen Tätigkeit, d. h. hinsichtlich der Kontemplation und der Erkenntnisaus sich selbst immaterieller Wirklichkeit (separata). Durch den intellectusadeptus wird er auf gewisse Weise gottähnlich, da er sowohl göttliche Tätigkeitausüben und sich selbst und anderen göttliche Einsicht freigiebig schenken, alsauch alles Erkannte (omnia intellecta) auf gewisse Weise empfangen kann 106. Ertranszendiert die Kontingenz und ist, wie gesagt, vollkommen hinsichtlich seinerspezifisch menschlichen Tätigkeit. Darin besteht nach Albert die höchstekontemplative Glückseligkeit des Menschen, die in diesem Leben erreichtwerden kann 107. Die Ursache oder die Grundlage für diesen Vollendungsstatusdes menschlichen Intellektes, d. h. für die Erlangung des intellectus adeptus,welcher aus der Vereinigung des intellectus agens ut forma mit dem intellectuspossibilis resultiert, ist nach Albert der intellectus speculativus 108. Daraus istersichtlich, warum für die dritte Intellekt-Stufe der Begriff des intellectus
(104) Cf. De intell. et int. l. 2 c. 8 : ed. cit., p. 515b ; c. 9 : p. 516a-517b ; c. 12 : p. 520b.(105) Cf. De nat. et orig. an. tr. 2 c. 13 : ed. cit., p. 37.80sq., 38.42sq. mit Anm. 73 und 74.(106) De anima l. 3 tr. 3 c. 11 : ed. cit., p. 222.80-87.24-28.(107) De anima l. 3 tr. 3 c. 6 : ed. cit., p. 215.4sq. ; c. 11 : p. 221.32sq. ; c. 12 : p. 224.78-90.(108) De anima l. 3 tr. 3 c. 11 : p. 222.15-28 : « intellectus agens tribus modis coniungitur nobis,
licet in se et secundum essentiam suam sit separatus. A natura enim coniungitur ut potentia et virtusquaedam animae, sed faciendo intellecta speculativa coniungitur ut efficiens, et ex his duabusconiunctionibus non est homo perfectus, ut operetur opus divinum. Coniungitur tandem ut forma, etcausa coniunctionis illius est intellectus speculativus ; et ideo oportet esse speculativum ante adeptum.Et tunc homo perfectus et divinus effectus est ad suum opus, inquantum homo et non animal est,perficiendum ; et sunt gradus in intellectu speculativo, quibus quasi ascenditur ad intellectumadeptum, sicut per se patet cuilibet ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 193
formalis aus dem zuvor in Super Dion. De div. nom. aufgestellten Vier-Stufen-Modell durch den Begriff des intellectus speculativus ersetzt wird.
Bevor wir diese kurze Präsentation des Vier-Intellekte-Modells aus demalbertinischen Kommentar zu De anima beschließen, bleibt uns noch daraufhinzuweisen, daß Albert die einzelnen Vollendungsstufen des menschlichenIntellektes in seinem Werk sehr ausführlich und detailliert erklärt. Er stützt sichdabei zwar auf die aristotelische Vorlage, aber nur insofern sie hierfür ausreicht.Wir haben bereits deutlich gemacht, daß diese nur das Fundament, d. h. die zwei-bzw. dreiteilige Grundstruktur bereitstellt. Die Erweiterung aber und dieAusdifferenzierung des Modells ist die Eigenleistung des Doctor universalis, dievon ihm auch formal von der eigentlichen Kommentierung der Aristotelesschriftklar abgegrenzt wird. Sie wird in Form von zahlreichen Digressionen dargeboten,die den paraphrasierenden Duktus des Kommentars formal und inhaltlichsprengen. Als wichtige Inspirationsquelle galt hierbei die Intellektlehre derposteriores Peripatetici. Diese konnte jedoch wegen ihrer großen Vielfältigkeitund Uneinheitlichkeit, sowie mancher Unvereinbarkeit mit theologischenVorgaben weder als Maßgabe dienen noch ohne notwendige Umformungen undKorrekturen in die eigene Intellekttheorie integriert werden 109.
3. DIE DRITTE PHASE : DE INTELL. ET INT. I UND II
An das in De anima entfaltete, hier in einigen Strichen umrissene Vier-Intellekte-Modell knüpft Albert in De intell. et int. und in De nat. et orig. an.,sowie im Metaphysikkommentar und in De causis et proc. univ. a prima causa an.Den Übergang von dem in De anima festgehaltenen Status zu dieser drittenEntwicklungsphase scheinen die erste Redaktion von De unitate intell. 110 und dieWerke De mot. animal. sowie De princ. motus proc. zu dokumentieren, währenddie zweite Redaktion von De unitate intell. und die Gelegenheitsschriften De XVprobl. und Probl. determ. chronologisch in die letzte Entwicklungsphase zurechnen sind. Im folgenden beschränken wir uns darauf, diese Entwicklungsstufeanhand von De intell. et int. I und II vorzustellen. Es muß an dieser Stelle genügen,
(109) Cf. B. MOJSISCH – F.-B. STAMMKÖTTER, « Conclusiones de intellectu et intelligibili – EinKompendium der Intellekttheorie Alberts des Großen », Mediaevalia Philosophica Polonorum, 31(1992), p. 44-46. K. BORMANN, « Wahrheitsbegriff und QRÀM-Lehre », p. 22-23. B. MOJSISCH, « ZumDisput über die Unsterblichkeit », p. 344-345. E. P. MAHONEY, « Sense, Intellect, and Imagination inAlbert, Thomas, and Siger », p. 602, 604-605. Alberts Theorie der continuatio intellectuum, die er imAnschluß an Averroes entwickelt (cf. B. MOJSISCH, « La psychologie philosophique d’Albert leGrand et la théorie de l’intellect de Dietrich de Freiberg. Essai de comparaison », Archives dephilosophie, 43 [1980], p. 684), weist meines Erachtens bereits in der Ausgangsposition wesentlicheUnterschiede zu der Auffassung des Averroes auf ; sie ist durch die augustinische und pseudo-dionysische Illuminationslehre sowie die fluxus-Theorie des Liber de causis und des Avicenna inentscheidender Weise geprägt.
(110) Cf. A. HUFNAGEL, « Zur Geistphilosophie Alberts des Großen », in Einsicht und Glaube. FSG. Söhngen, hg. v. J. RATZINGER und H. FRIES, Freiburg-Basel-Wien 1962, p. 221-223.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
194 HENRYK ANZULEWICZ
daß wir uns nur auf zwei Textpassagen aus De intell. et int. konzentrieren,nämlich auf Buch I Tr. 3 Kap. 3 und Buch II Kap. 9.
3.1. De intell. et int. I
Eine weitergehendere Ausdifferenzierung des Vierermodells erfolgt in Deintell. et int. I 3 3. Der Ausgangspunkt hierfür ist die aristotelische Dreierstruktur« möglicher – tätiger – formaler Intellekt » (i. possibilis, i. agens, i. formalis). Diebeiden ersten Glieder – der mögliche und der tätige Intellekt – werden Aristotelesfolgend und in Anknüpfung an die einige Jahre zurückliegenden eigenenAusführungen im De anima-Kommentar gemäß den entsprechenden Teilen derSeele angenommen. Das dritte Strukturglied – der formale Intellekt – bestimmtAlbert als die durch das Licht des tätigen Intellektes aktuierte Form des möglichenIntellektes, die entweder auf das Wissen oder auf das Handeln hingeordnet ist. DieReihenfolge der einzelnen drei Stufen entspricht der im De anima-Kommentarangenommenen natürlichen Ordnung der Verwirklichung des intellektivenVermögens. Die in De homine und in Super Dion. de div. nom. gewählte Perspek-tive der Betrachtung des Intellektes an sich (simpliciter) ist zwar hier wirksam,wie aus der Kapitelüberschrift und auch aus dem Kapitelschluß hervorgeht. Dieaus dieser Zugangsweise im De anima-Kommentar hergeleitete Rangordnung,welche dem aktuellen tätigen Intellekt eine Priorität gegenüber dem möglicheneinräumt, wird hier jedoch nicht beibehalten. Das Neue an diesem Modell ist, daßauf die dritte Stufe, den formalen Intellekt, nicht wie bisher angenommen, direkteine vierte Stufe – der « erworbene Intellekt » (intellectus adeptus) – folgt,sondern an dieser dritten intellektiven Verwirklichungsebene weitere Differen-zierungen vorgenommen werden. Im « formalen Intellekt », dessen Gehalt (formasciti) einerseits als eine theoretische, andererseits als eine praktische Formbestimmt wird, unterscheidet Albert einen « einfachen » und einen « zusammen-gesetzten Intellekt » (intellectus simplex und i. compositus). Den « zusammenge-setzten Intellekt » unterscheidet er ferner in einen dem Menschen in gewisserWeise eingeborenen Intellekt (secundum quidam innatus nobis), welcher der« Intellekt der Prinzipien » (intellectus principiorum) ist, und in einen Intellekt,den der Mensch von außerhalb seiner selbst erwirbt (ex aliis acquisitus), welcherder « erworbene Intellekt » (intellectus adeptus) heißt 111. Dieses modifizierte undstärker als bisher differenzierte Modell wird aus der Analyse sowohl desIntellektes als solchen als auch und im besonderen in seinem Bezug auf dieSeelenteile sowie auf seinen Gegenstand hergeleitet. Der Aufbau des Modellskann schematisch folgenderweise dargestellt werden :
(111) De intell. et int. l. 1 tr. 3 c. 3 : ed. cit., p. 501a. Cf. A. SCHNEIDER, Die Psychologie Alberts desGroßen. Nach den Quellen dargestellt, II. Teil, Münster 1906 (Beiträge zur Geschichte derPhilosophie des Mittelalters, IV/6), p. 334sq.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 195
1. intellectus possibilis2. intellectus agens3. intellectus formalis :
intellectus practicusintellectus speculativus
3.1. intellectus simplex3.2. intellectus compositus3.2. 1. intellectus principiorum3.2. 2. intellectus adeptus
Im gleichen Abschnitt von De intell. et int. (I 3 3) und unmittelbar imAnschluß an das erste Modell der verschiedenen Intellektstufen führt Albert nochein anderes Modell ein, dem weder der Intellekt an sich noch in seinem Bezug aufdie Seelenteile noch das Intelligible als sein Gegenstand zugrunde gelegt wird,wie es in dem ersten Modell der Fall war, sondern die unterschiedliche intel-lektive Fähigkeit der menschlichen Natur. Hinsichtlich seiner Quellen bemerktAlbert, daß dieses alternative Modell bei manchen Philosophen Erwähnungfindet, insbesondere bei Aristoteles und Avicenna und ihrer Gefolgschaft. Dieseszweite Modell umfaßt insgesamt vier Glieder, denen Albert bis auf eine Aus-nahme keine prägnanten Bezeichnungen gibt, sondern sie jeweils umschreibt. DieAusnahme betrifft die vollkommene Art und die höchste Vollendungsstufe desmenschlichen Intellektes, für die der Begriff des intellectus sanctus sive mundusbzw. intellectus divinus gebraucht wird. Die erste Bezeichnung stammt vonAvicenna, die letztere ist deren Äquivalenz bei Aristoteles. Betrachtet man diesesModell genauer hinsichtlich der Anordung der einzelnen Glieder, stellt man fest,daß das erste und das zweite Glied jeweils den Beginn und die oberste Grenze derintellektiven Vollendung umrahmen. An dritter Stelle wird ein Intellekt genannt,der seinem Vollendungsstatus nach sich zwischen der Verhaftung in derKontingenz und dem Aufstieg zur höchsten Vollendung befindet. In demvierstufigen Modell kommt ihm eine Mittelstellung zu : er rangiert zwischen deman erster Stelle genannten, noch mit der Kontingenz zusammenhängendenIntellekt und der an zweiter Stelle verzeichneten Vollendungsgestalt desmenschlichen Intellektes. An vierter und letzter Stelle wird ein Intellekt von derniedrigsten Stufe intellektiver Fähigkeit genannt, der weder « getrennt » ist nochvon der Sinneserkenntnis gestüzt werden kann. Er wird der Rangordnung nachunterhalb des medius intellectus plaziert und in der absteigenden Reihenfolge alsder dritte (tertius) und der letzte bezeichnet. Es ergibt sich daraus eineRangordnung, in der der intellectus sanctus die oberste Stufe der Vollendungeinnimmt. Die Anordnung und Beschreibung der einzelner Intellekte stellt sichbei Albert wie folgt dar :
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
196 HENRYK ANZULEWICZ
1. intellectus immixtuscontinuo et tempori
Intellekt, der vorwiegend mit Raum und Zeit, d. h. mitVorstellungsbildern und Sinneswahrnehmung ‘vermischt’ ist.
2. intellectus separatus Intellekt, der getrennt ist, den Avicenna als den ‘intellectussanctus’ und Aristoteles als den ‘intellectus divinus’bezeichnen.
3. intellectus medius Intellekt, der die Mittelstellung zwischen dem erst- undletztgenannten wahrt ; durch die Lehre gestützt, steigt er leichtzur Prophetie und zur Erkenntnis des Göttlichen auf.
4. intellectus tertius Intellekt, der entweder aufgrund psychophysiologischerAnlage oder Lebensgewohnheit des Menschen keinVermögen besitzt, etwas aus der Vorstellung und derSinneswahrnehmung zu empfangen noch durch diese gestütztzu werden (moriones, idiotae).
Zwei Bemerkungen seien zu den zwei ersten Gliedern des Modellshinzugefügt. Der intellectus immixtus ist nach Albert mit Raum und Zeit« vermischt » ; er ist dadurch verdunkelt (obscurus) und nimmt die Intelligibilianur mit Mühe auf. Menschen von derartiger intellektiven Verfaßtheit sind beimWissenserwerb auf sinnenhafte Beispiele angewiesen. Sie können entweder garnicht oder nur mit großer Anstrengung zur Einsicht des An-sich-Offenbaren unddes Göttlichen gelangen, d. h. dessen, was den Gegenstand der Ersten Philosophieausmacht. Man bezeichnet sie geläufig als schlecht begabt.
Menschen hingegen, deren Intellekt « mehr getrennt » (intellectus plusseparatus) ist, vermögen aus den Ansätzen einer Lehre alles zu erschließen, weilsie den tätigen Intellekt nicht bloß wie das Vermögen (tamquam potentiamanimae), und auch nicht wie das Wirkungsprinzip (quasi efficientem) besitzen, dasdurch die Abstraktion den intellektiven Erkenntnisgehalt aktuiert, sondern siebesitzen ihn gleichsam wie die Form (habent eum quasi pro forma), durch welchedie intellektive Seele insgesamt sich betätigt (cuncta operatur). Diese Tätigkeitder intellektiven Seele, die vom intellectus agens gleichsam als die Form ausgeübtwird, nannte Albert im Kommentar zu De anima, wie er in De intell. et int. ver-gegenwärtigt und worauf wir zuvor hingewiesen haben, die Glückseligkeit (felici-tas). Sie ist die Kontemplation, die im De anima-Kommentar und schon in denFrühschriften auch als die continuatio intellectus bezeichnet wird, welche diehöchste Vollendungsstufe des menschlichen Intellektes und das von jedem Philo-sophen erstrebte Ziel darstellt, wie es hier und im Kommentar zu De animaheißt 112. In De intell. et int. wird sie nach Avicenna intellectus sanctus und nachAristoteles intellectus divinus genannt. Im De anima-Kommentar bezeichneteAlbert sie auf nahezu identische Weise, nämlich als der intellectus adeptus etdivinus.
Nicht gänzlich neu im Vergleich mit dem bis zu De anima-Kommentarentfalteten systematischen Gehalt albertinischer Intellekttheorie, aber dennoch
(112) ALBERTUS MAGNUS, De intell. et int. l. 1 tr. 3 c. 3 : ed. cit., p. 501b ; De anima l. 3 tr. 3 c. 11 :ed. cit., p. 221.47sq. ; c. 12 : p. 224.88-90.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 197
stärker betont und weiter gefaßt ist der Zusammenhang der höchsten intellektivenVollendung des Menschen mit seiner Befähigung zur Prophetie 113 und zurwahren Auslegung der Träume. Die anthropologische Voraussetzung für die Pro-phetie und für die wahre Traumdeutung wird im Studium und in der auf diesemWege gewonnenen Illumination des im höchsten Grade vollendeten Intellektesangenommen. Wenig später wird in De intell. et int. II 9 die Illumination undProphetie auf der Grundlage der neuplatonischen Emanations- und Intellektlehrephilosophisch und letztlich theologisch expliziert. Albert stützt sich hierbei aufseine Theorie der Vollendung und des sich stufenweise vollziehenden Aufstiegsdes menschlichen Intellektes zum Intellekt der getrennten Substanzen undschließlich zum göttlichen Intellekt, der « das Licht und die Ursache von allem »,oder, wie es an anderer Stelle heißt, « das Erste, das Notwendig-Seiende und dieUrsache von allem » ist 114.
3.2. De intell. et int. II
Zum Schluß dieses ersten Versuchs, die Entwicklung der Intellekttheorie imWerk des Doctor universalis anhand des ihr jeweils zugrundeliegenden Intel-lektmodells zu verdeutlichen, soll noch das in De intell. et int. II 9 enthalteneModell vorgestellt werden. Das gesamte, zwölf Kapiteln umfassende Buch II vonDe intell. et int. handelt über den intellektiven Aufstieg des Menschen und überdie einzelnen Vollendungsstufen des Intellektes. Gegen Ende des Buches(Kap. 9) faßt Albert seine Theorie des intellektiven Aufstiegs zu einem sechs-stufigen Intellektmodell zusammen. Es sind im einzelnen folgende Stufen 115 :
1. intellectus possibilis2. intellectus agens3. intellectus principiorum (i. formalis)4. intellectus in effectu5. intellectus adeptus6. intellectus assimilativus
Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses Modells erheblich von dem ausdem vorigen Buch und noch stärker von dem Vier-Intellekte-Modell aus Deanima und aus dem Kommentar zu De div. nom. Diese Unterschiede, im beson-deren zu dem vorgängigen Modell (De intell. et int. I 3 3) sind jedoch keineswegsgroß, wie man durch vergleichende Analyse der verwendeten Benennungen fest-stellen und aus den Ausführungen zu den einzelnen Stufen des Modells ent-
(113) Der Zusammenhang der intellektiven Vollendung mit der Prophetie wird in De anima-Kommentar im Anschluß an Avicenna erörtert ; die « wahre Auslegung » prophetischer Träume wirdin diesem Kontext nicht thematisiert : cf. ALBERTUS MAGNUS, De anima l. 3 tr. 3 c. 11 : ed. cit.,p. 223.30-34.
(114) De intell. et int. l. 2 c. 9 : ed. cit., p. 516a : « … surgit ad intellectum divinum, qui est lumen etcausa omnium » ; c. 12 : p. 521b : « reducitur ad primum, quod est necesse esse et omnium causa ».
(115) De intell. et int. l. 2 c. 9 : ed. cit., p. 517a-b.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
198 HENRYK ANZULEWICZ
nehmen kann. Wir können hier diese sachliche Übereinstimmung und termino-logische Äquivalenz nicht Stufe für Stufe aufzeigen. Es sei nur als Beispiel daraufhingewiesen, daß der intellectus principiorum und der intellectus in effectu sichunter dem Begriff des intellectus formalis bzw. des intellectus speculativus zu nureinem, zweigeteilten Strukturglied in diesem Modell subsumieren lassen.Wichtig ist und es muß herausgestellt werden, was an diesem Modell neuerscheint. Neu ist hier der an letzter Stelle genannte intellectus assimilativus bzw.intellectus assimilans, dessen Name nach Albert von den ältesten Philosophenherrührt. In diesem intellectus assimilativus besteht – so wird ausdrücklich erklärt– die Vollkommenheit der Seele 116. Er ist gleichsam die Krönung allerintellektiven Vollendungsstufen und ihre Überformung, da er aus allen früherenIntellektstufen resultiert (oritur ex omnibus intellectibus). Im Anschluß an al-F�r�b� schränkt Albert nunmehr seine bisherige Auffassung des intellectusadeptus als die höchste intellektive Vollendungsgestalt nur auf den vonMenschen erworbenen, eigenen Intellekt, näherhin auf die intellektive Selbst-findung und Selbsterkenntnis. Diesem intellektiven Vollendungsstatus in derGestalt des intellectus adeptus fügt er unter dem Namen des intellectus assimi-lativus eine neue Stufe intellektiver Vollkommenheit hinzu, die den Aufstieg« zum göttlichen Intellekt, der das Licht und die Ursache von allem ist », bedeutet.Wie im einzelnen dieser Aufstiegsprozeß zu verstehen ist und was er an sichbedeutet, wird sowohl in De intell. et int. II, als auch in De nat. et orig. an., sowiein der Metaph. 117 erklärt. Erwähnt sei abschließend, daß Albert vom Begriff desintellectus assimilativus und der Art und Weise des Aufstiegs zu ihm ausgehendvon fünf Intellekten als « Gestreu » des intellectus assimilativus spricht. Er meintdamit jene Intellekt-Stufen, die unmittelbar zuvor in dem Modell des Aufstiegszum intellectus assimilativus genannt wurden 118.
EXKURS ÜBER DEN INTELLECTUS AGENS 119
Die Bezeichnung intellectus agens bzw. intellectus universaliter agens wirdvon Albert spätestens in De causis et proc. univ. im äquivoken Sinne sowohl fürden « tätigen Intellekt » in der menschlichen Seele als auch für die getrennteIntelligenz (intelligentia agens) und auch für den Intellekt der ersten Ursache(intellectus primae causae) verwendet. Die Äquivozität der Termini hebt er schonin De homine mit dem Hinweis auf Averroes (In Metaph. XI) hervor 120. Aber er
(116) Ibid., p. 516a. Cf. L. HÖDL, « Die « Entdivinisierung » des menschlichen Intellekts in dermittelalterlichen Philosophie und Theologie », in Zusammenhänge, Einflüsse, Wirkungen, hg. v. J.O. FICHTE [u. a.], Berlin-New York 1986, p. 60.
(117) Cf. z. B. ALBERTUS MAGNUS, Metaph. l. 1 tr. 5 c. 15 : ed. cit., p. 89.27-64 mit Anm. 61-62.(118) De intell. et int. l. 2 c. 9 : ed. cit., p. 517b.(119) Zur Ergänzung cf. K. FLASCH, « Converti ut imago – Rückkehr als Bild », p. 132-133.(120) De homine tr. 1 q. 55 a. 3 : Ann Arbor 201, f. 71vb, ed. cit., p. 464b : « Averroes super XI
Metaphysicae dicit quod intellectus primae causae cum nostro intellectu aequivocus est, eo quod
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 199
hält vorerst noch an der begrifflichen Unterscheidung fest, indem er den intel-lectus agens universaliter der Ersten Ursache nicht anders als den intellectusprimae causae bezeichnet und für den menschlichen « tätigen Intellekt » dieBenennung intellectus agens bzw. intellectus agens universaliter verwendet. DerUnterschied zwischen dem Intellekt der Ersten Ursache und dem intellectusuniversaliter agens des Menschen besteht nach seiner Auffassung darin, daß dererstere die ontologische Seinsursache alles Seienden ist und keine Ursache seinerselbst in einem Seienden hat, während der letztere vom Seienden verursachtwird 121. Diese Frage behandelt er ausführlicher in De causis et proc. univ., wo erdie Bezeichnung intellectus universaliter agens äquivok für den Intellekt desErsten Prinzips und die von ihm verursachten Intellekte benutzt, d. h. für denIntellekt der substantiae separatae und den « tätigen Intellekt » des Menschen 122.Er macht jedoch deutlich, daß der tätige Intellekt des Ersten Prinzips nicht univokmit dem tätigen Intellekt des Menschen und der getrennten Wesen ist, weil dergeschaffene tätige Intellekt nicht aus sich selbst, sondern nur aufgrund derEmanation des tätigen Intellektes einer höheren Rangordnung wirkt 123. WennAlbert in De homine feststellt, daß der « tätige Intellekt » nicht die Erste Ursacheist, verwendet er also die Bezeichnung intellectus agens nur für den menschlichenund den verursachten Intellekt ; er vermeidet im Frühwerk den äquivokenGebrauch ein und derselben Bezeichnung für den Intellekt der Ersten Ursacheund einen geschaffenen Intellekt 124.
intellectus primae causae est causa entis, intellectus autem noster causatur ab ente ». Cf. AVERR., InMetaph. l. 11 comm. 51 : Venetiis 1560 f. 352vF. ALBERTUS MAGNUS, Metaph. l. 11 tr. 2 c. 33 : ed. cit.,p. 525.34-38.
(121) De homine tr. 1 q. 55 a. 3 : Ann Arbor 201, f. 71vb, ed. cit., p. 464b (siehe vorige Anm.) ;f. 72va, p. 468b : « intellectus agens non est a seipso nec intelligit a seipso hoc modo quod non sitcausatus ab alio, immo est causatus a causa prima, et quod intelligit, habet a causa prima ; sed hocmodo non intelligit ab alio intelligibili quod in ipso faciat suam similitudinem et speciem. Unde patetquod non sequitur quod intellectus agens sit causa prima. Ad aliud dicendum quod in anima humananihil divinius est et nobilius intellectu agente, et propter hoc non habet aliquid perficiens se, sedintelligit per suam substantiam. Intellectus tamen eius requirit aliquid extra se ad quod terminetursicut ad materiam, et per hoc differt ab intellectu primae causae. Ad aliud dicendum quod intellectusprimae causae est causa entis in esse, quia ab ipso fluit ens, sed sic agens intellectus non est causa, sedin eo quod abstrahendo agit simplicitatem in universalibus, causat nostram scientiam quae est inintellectu possibili ».
(122) De causis et proc. univ. l. 1 tr. 2 c. 1 : ed. cit., p. 25.15-26.78. Cf. L. SWEENEY, « Are Plotinusand Albertus Magnus Neoplatonists ? », in Graceful Reason : Essays in Ancient and MedievalPhilosophy presented to Joseph Owens, CSsR, ed. by L. P. GERSON, Toronto 1983 (Papers in Mediae-val Studies, 4), p. 195-197. H. A. DAVIDSON, Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect, p. 215.
(123) ALBERTUS MAGNUS, De causis et proc. univ. l. 1 tr. 2 c. 1 : ed. cit., p. 26.67-78.(124) Die Auffassung von E. P. Mahoney (« Sense, Intellect, and Imagination in Albert, Thomas
and Siger », p. 604), Albert verneine, daß der tätige Intellekt ein transzendentes (getrenntes) Wesenist, kann in dieser Verallgemeinerung und ohne eine Differenzierung nur für das Frühwerk gelten.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
200 HENRYK ANZULEWICZ
BILANZ
Die Intellekttheorie des Albertus Magnus ist in einer weiten Zeitspanneentstanden, die nahezu 30 Jahre umfaßt. Die ersten Anfänge liegen am Beginnseines Pariser Studienaufenthaltes und seiner Lehrtätigkeit an der Pariser Univer-sität. Ihre volle Entfaltung und ihren Höhepunkt erreicht sie unzweifelhaft in Deintell. et int. Aber sie beschäftigte Albert auch danach bis ins Spätwerk. Ihre Ent-faltung ist naturgemäß dem Gesetz eines langjährigen und durch viele Faktorenbedingten geistigen Entwicklungsprozesses unterworfen. Wir haben versucht,den Entwicklungsgang am Intellektmodell aufzuzeigen. Es dürfte im Ansatzdeutlich geworden sein, daß Albert die Frage nach dem die Natur transzen-dierenden Status des menschlichen Intellektes und seiner darin angelegtenVollendungsmöglichkeit affirmativ aufgreifend, sich andauernd bemühte, denintellektiven Aufstieg des Menschen zur höchsten Vollendung mit philoso-phischen Mitteln in eingehender Weise und umfassend darzustellen. Sein stetigesBemühen manifestiert sich in den verschiedenen Intellekt-Modellen, in denen wireine steigende Differenzierung an den intellektiven Vollendungsstufen wahr-nehmen. Wir konnten zeigen daß, während das erste Modell (De homine) nur dieGrundstruktur mit drei Intellektstufen umfaßte, im letzten Modell (De intell. etint.) insgesamt sechs Vollendungsstufen des Intellektes erscheinen.
Die Entwicklung der Intellekttheorie nimmt bei Albertus Magnus ihren Laufim theologischen Kontext und setzt sich in der Anthropologie, Psychologie undMetaphysik fort. Ihren Höhepunkt erreicht sie zwar in De intell. et int., aber sie istzeitgleich in anderen albertinischen Werken (vor allem in De nat. et orig. an.) undauch noch später – im Metaphysikkommentar und in De causis et proc. univ., inDe unitate intell., De XV probl. und Probl. determ. x ein außerordentlichwichtiger Gegenstand. Ihr Ausgangspunkt ist die aristotelische Grundlage unddie Unterscheidung zwischen dem « tätigen » und dem « möglichen Intellekt » aufder einen Seite, sowie zwischen dem « theoretischen » und dem « praktischenIntellekt » auf der anderen Seite. Es ist anhand der verwendeten Begrifflichkeitund Terminologie erkennbar, daß Albert sich bei der Entfaltung seiner Intellekt-theorie im wesentlichen auf die griechisch-lateinischen und arabisch-lateinischenÜbersetzungen von De anima des Aristoteles, auf die Intellektlehre desAlexander von Aphrodisias, al-Kind�, al-F�r�b�, Avicenna, Isaac Israeli, al-Ghaz�l� und Averroes stützt. Aus unserem ersten Durchgang durch das alberti-nische Frühwerk konnten die ersten Ansätze zu einer Intellektlehre und ihreverschränkte Entwicklungsgeschichte mit ihrer Terminologie und ihren Quellenerfaßt werden. Die prägende Wirksamkeit der theologischen Perspektive, die inder anfänglichen Entwicklungsphase den kontextuellen Rahmen ausleuchtete,verlor auch im weiteren Verlauf nicht ihre maßgebliche Geltung. Sie wurde aberauf der explikativen Ebene durch die philosophische Interpretation überlagert,nachdem Albert schon zu Beginn vom theologischen Standpunkt her dieKonvergenz der theologischen und der philosophischen Theorie der intellektivenVerwirklichung des Menschen und seiner Vollendung feststellen konnte. Die
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 201
fundamentale, ganzheitliche Struktur dieser Intellekttheorie, die aus der theolo-gischen Perspektive erarbeitet wurde und eine theologische ist, wird philo-sophisch – nach Alberts Bekenntnis vorwiegend in Anlehnung an die späterenPeripatetiker – expliziert.
Zum entwicklungsgeschichtlichen und systematischen Ertrag dieser Unter-suchung gehört die Feststellung, daß der Doctor universalis die Grundlagen einervon Aristoteles nur ansatzweise erarbeiteten Intellektlehre mit der theologischenund philosophischen Illuminationslehre verbindet und reformuliert. Will mandiese letztgenannten Elemente seiner Intellekttheorie systematisch einordnen,gehören sie der theologischen und platonisch-neuplatonischen Tradition, derenQuellen in erster Linie Augustinus, Ps.-Dionysius Areopagita, der Liber decausis, Avicenna, Alfred von Sareshel und Isaac Israeli sind. Die vollendeteGestalt albertinischer Intellekttheorie, wie sie in De intell. et int. vorliegt, bleibtder peripatetischen Tradition verpflichtet. Sie assimiliert und harmonisiert denintellekttheoretischen Ertrag griechischer, arabischer und jüdischer Autoren, vondenen die wichtigsten Alexander von Aphrodisias, al-Kind�, al-F�r�b�, IsaacIsraeli, Avicenna, al-Ghaz�l� und Averroes sind. Die Bedeutung der Intellektlehrevon Avicenna und al-F�r�b� für die spätere, dritte Entwicklungsphase alberti-nischer Intellekttheorie ist dabei besonders hervorzuheben 125.
Bezüglich der Stellung der Intellekttheorie im System des Albertus Magnussei unterstrichen, daß sie im Zusammenhang mit seiner Auffassung des Menschengesehen werden muß. Wie eingangs festgehalten, bildet die ganzheitliche, theo-logisch grundgelegte Anthropologie das Herzstück des albertinischen Systems.Der Mensch, genauer : seine Vollendung, rückt mehr und mehr in den Mittelpunktseines Interesses. Deutlich wird das insbesondere an der Entfaltung der Intellekt-theorie, in der Albert einen der zwei Wege der vollendenden Verwirklichung desMenschen als Mensch, d. h. den Weg der intellektiver Vollendung, erklärt und aufdiese Weise, wie auch mit seinem Gesamtwerk, beschreitet. In unserer Würdi-gung der Intellekttheorie des Doctor universalis soll deshalb herausgestelltwerden, daß sie im Ganzen betrachtet von einem akademischen Lehrstück imeigentlichen Sinne mehr und mehr zum Vollzug selbst einer in der Vernunftgründenden, die intellektive Vollendung stufenweise in der Ausrichtung auf dasLetztziel des Menschen als Mensch realisierenden Selbstverwirklichung wird.
(125) Es sei hinzugefügt, daß während Avicenna’s Schriften Albert schon in seinem Frühwerkrezipierte, fand er einen direkten Zugang zu al-F�r�b�’s Schrift De intell. et int. wohl erst nach derAbfassung des Kommentars zu De anima. In De homine zitiert er zwar den Namen al-F�r�b� oft, dochhandelt es sich dabei stets um Averroes als den Autor des Kommentars zu den Parva naturalia. Manmuß also wissen, daß unter dem Namen des al-F�r�b� sich in Alberts Frühwerken bis auf zweiAusnahmen Averroes verbirgt. Die genannten zwei Ausnahmen sind der Kommentar des Averroes zuDe memoria, der mit korrekter Autorenangabe zitiert wird, und die Erläuterungen zu denPropositionen des Liber de causis, die al-F�r�b� zugeschrieben werden. Cf. ALBERTUS MAGNUS, Dehomine tr. 1 q. 40 a. 1 : Ann Arbor 201, f. 52ra, ed. cit., p. 340b : « Prima probatur ex dicto Averrois insuo libro De memoria et reminiscentia… » ; ibid. q. 55 a. 3 : f. 71va, p. 463a : « in commento supertertiam propositionem Libri causarum dicit Alfarabius… ».
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
202 HENRYK ANZULEWICZ
Das Letztziel des intellektiven Aufstiegs des Menschen aber, welcher begrifflichu. a. mit coniunctio intellectus, status animae optimus, felicitas und finisprosperitatis animae zum Ausdruck kommt, ist nach Albert – und darauf seiausdrücklich hingewiesen – die postmortale Vollkommenheit der animarationalis. Dieses Ziel wird erst dann erreicht, wie es in De nat. et orig. an. undauch in De intell. et int. heißt, wenn die Vernunftseele zum « Ersten Erkennbarengelangt, das die Ursache von allem anderen ist, und in dem sie wie im Gipfel ihrerWeisheit und höchsten Kontemplation zu stehen kommt » 126. Der unter denBedingungen der Kontingenz erreichte Zustand der intellektiven Verwirklichungdurch den Erwerb der intelligibilia ist die Voraussetzung der absolutenVollendung des Menschen gemäß dem Intellekt nach dem Tode. Denn die in Zeitund Raum vom menschlichen Intellekt gewonnene Erkenntnis ist nach Albert dasLicht, genauer : die Lichter, die der Intellekt, der nach der Trennung vom Körpernur auf sich selbst und nicht mehr auf die Sinneswahrnehmung bezogen ist, in sichbehält und von denen erleuchtet wird. Durch diese Erleuchtung wird seineErkenntnisfähigkeit über das dem Intellekt aus sich selbst eignende Vermögenausgeweitet und gestärkt, so daß er fähig sein wird, das an sich Intelligibile(intelligibile per se) zu erkennen. Wie er allmählich von der Erkenntnis dessen,was den Bedingungen der Zeit unterworfen ist (Gegenstand der Physik), zurErkenntnis des nur noch mit dem Raum Verbundenen (Gegenstand der Mathe-matik), und von hier aus zur Erkenntnis des an sich Erkennbaren aufsteigt, dashinsichtlich des Seins noch innerhalb der Kontingenz bleibt (Gegenstand derMetaphysik), so steigt der Intellekt von dieser Erkenntnisstufe zur Erkenntnis dergetrennten Substanz auf, und – durch ihr Licht gestärkt – zur Erkenntnis derErsten Ursache auf (Gegenstand der Metaphysik und Theologie), in der erverharrt, weil sie das Letzterkannte und das Licht von allem Erkannten ist 127.
In dieser Interpretation des intellektiven Aufstiegs des Menschen kam einweiterer, bisher unerwähnter, öfters wiederkehrender Aspekt albertinischer Intel-lekttheorie zum Ausdruck, ein wissenschaftssystematisch und wissenschafts-geschichtlich relevantes Moment. Wir beenden diesen Überblick mit derFeststellung, daß Albert seiner Intellekttheorie eine wissenschaftstheoretischeRelevanz beimißt. Die Wissenschaften, die der menschliche Intellekt besitzt odererwirbt, näherhin die Physik, die Mathematik und die Metaphysik, haben ihreunmittelbare Ursache im Rückbezug des menschlichen Geistes auf den intellectusagens und auf die innere Sinneswahrnehmung. Das Licht des tätigen Intellektesist für die menschliche Seele, so Albert in De unitate intell., die Quelle der
(126) De nat. et orig. an. tr. 2 c. 13 : ed. cit., p. 38.44-50 : « per intelligibilia, quae sunt cumtempore et continuo, venire habet (sc. anima rationalis) ad intelligibile, quod secundum esse etessentiam per se est intelligibile, et si est ordo in illis per se intelligibilis, habet devenire ad primumintelligibile, quod est causa omnium aliorum, et in illo stat sicut in vertice suae sapientiae etcontemplationis finalis » ; De intell. et int. l. 2 c. 9 : ed. cit., p. 517a-b ; c. 12 : p. 521a-b.
(127) Ibid. tr. 2 c. 13 : ed. cit., p. 38.82-39.4 ; cf. ibid., p. 37.74-78.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 203
Theorie, welche die Erste Philosophie ist, während die Vorstellung die Grundlagefür die Mathematik und der Gemeinsinn für die Naturphilosophie darstellen 128.
Für die Veranschaulichung der hier vorgestellten Entwicklung albertinischerIntellektlehre in ihrem systematischen und quellengeschichtlichen Kontextanhand der Terminologie und ihrer Quellen, werden in einem ersten Anhang diewichtigsten Intellektbenennungen in chronologischer Ordnung ihres Auftretensin Alberts Werk – soweit wir sie in einer ersten Sichtung der Texte erfassenkonnten – aufgelistet. Dieses wie auch das nachfolgende Verzeichnis erhebennicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen vielmehr ein repräsentativesBild vermitteln, welches Rückschlüsse auf die Intellekttheorie des Doctor uni-versalis in ihrer Entwicklung erlaubt. Die meisten der im Anhang I aufgelistetenIntellektnamen, wurden in den obigen Ausführungen erwähnt und erläutert. Ineinem zweiten Anhang wird versucht, die unterschiedlichen Intellektbenen-nungen systematisch zu ordnen und mit Angaben über Fundstellen im Werksowie über Quellen, insofern diese aufgrund einer ersten Durchsicht der Texteermittelt wurden, zu präsentieren. Mit diesen beiden Verzeichnissen, die ingewisser Weise an die Untersuchungen von D. N. Hasse zur quellengeschicht-lichen und systematischen Entwicklung der Intellekttheorie bei den Scholastikernanknüpfen, soll ein erster Überblick über die albertinische Intellekttheorie in ihrerEntwicklung geboten werden 129. Die drei Entwicklungsphasen mit demjeweiligen Intellektmodell und seiner Ortung im Werk des Doctor universalisstellt auf einen Blick der Anhang III vor 130.
(128) De unitate intell. pars 3 § 1 : ed. cit., p. 22.21-26 : « Et ideo etiam habet (sc. anima rationalis)tres theorias, quoniam theoria sua secundum lucem agentis est philosophia prima, secundum autemconversionem ad imaginationem habet theoriam mathematicam et secundum conversionem adsensum communem habet theoriam physicam ».
(129) Grundlegend hierzu ist der Beitrag von D. N. HASSE, « Das Lehrstück von den vierIntellekten », p. 21-77.
(130) Stellenangaben, die im Anhang auf Seiten- und Zeilen- bzw. Spaltenangaben reduziertsind, richten sich nach der Editio Coloniensis und einigen weiteren Einzelausgaben, insofern dieTexte in den kritischen Editionen vorliegen, andernfalls nach der Gesamtausgabe von A. Borgnet.Den übrigen Quellenangaben liegen die derzeit gängigen Standardausgaben zugrunde.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
204 HENRYK ANZULEWICZ
ANHANG I
DIE WICHTIGSTEN INTELLEKTNAMEN BEI ALBERTUS MAGNUS IM
CHRONOLOGISCHEN ÜBERBLICK
Frühesterwähnungen im Werk
INTELLEKTBEZEICHNUNG FUNDORT ZEIT QUELLENANGABE DES AUTORS
1. intellectus contemplativus De sacram.,
p. 51.55-56
um 1241
2. intellectus practicus
illuminatio mentis (per gratiam)
‘illuminatio oculorum’ (1 Kön 14, 27)
= perfectio mentis secundum
intellectum contemplativum et
practicum
De sacram.,
p. 51.56
ibid., p. 27.73-
74, 28.51-52
ibid., p. 51.53-56
3.
illuminationes (revelationes)
a primo
intellectus agens
De incarn.,
p. 173.52-67
De incarn.,
p. 204.41
um 1241 Aug., De Gen. ad litt. XII 12.
13.22.26 (etc.)
Ps.-Dion., De cael. hier. IV
Alfr. de Sareshel, De motu
cordis, prol.
Arist., De an. III 7
4. intellectus possibilis De incarn.,
p. 204.40-41
Arist., De an. III 7
5. intellectus deiformis De incarn.,
p. 205.72
Ps.-Dion, De div. nom. VII
6. intellectus compositus De incarn.,
p. 208.52
Arist., De an. III 6
7. intellectus speculativus De resurr.,
p. 295.16
um 1241
8. intellectus divinus
intelligentia divina
intelligentia angelica
cf. intellectus angelicus, unten n. 10
De IV coaeq.,
f. 51ra, p. 522
ibid., f. 33rb,
p. 443b
De homine,
f. 14ra, p. 82b
um 1241
um 1242
abgeleitet von Ps.-Dion.,
De cael. hier. IX
Liber de causis § 22
9. intellectus caeli De IV coaeq.,
f. 33va. p. 441a
10. intellectus angelicus De homine,
f. 3va, p. 19a
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 205
11. intellectus theoricus
cf. i. contemplativus, oben n. 1 ;
i. in habitu, unten n. 18 ;
i. formalis, unten n. 28
De homine, f.6rb,
p. 36a-b
12. intellectus activus De homine,
f. 7rb, p. 41b
Avic., Philos. prima IX 2
13. intellectus materialis De homine,
f. 7va, p. 44a
Avic., VI De nat. I 1
14. intellectus qui in potentia est in anima De homine,
f. 69ra, p. 449a
al-Kind�, De intell. et int., p. 1
15. intellectus in effectu
i. in effectu cum exit in anima de
potentia ad effectum
i. in effectu sive speculativus
De homine,
f. 7va, p. 44a
ibid., f. 69ra,
p. 449a
ibid., f. 75rb,
p. 487a
Avic., VI De nat. I 1
al-Kind�, De intell. et int., p. 1
Avic., VI De nat. I 5
16. intellectus qui semper est in actu De homine,
f. 69ra, p. 449a
al-Kind�, De intell. et int., p. 1
17. intellectus demonstrans De homine,
f. 69ra, p. 449a
al-Kind�, De intell. et int., p. 1
18. intellectus in habitu (sive formalis)
cf. i. formalis, unten n. 28
De homine,
f. 69ra, p. 449a
Avic., VI De nat. I 5
Algazel, Metaph. II 4 5
19. intellectus adeptus
= i. acquisitus
= i. accommodatus
= i. possessus (i. habitus), unten n. 40
De homine,
f. 69ra, p. 449a
ibid., f. 69va,
p. 451b
Avic., VI De nat. I 5
Algazel, Metaph. II 4 5
(i. acquisitus)
20. intellectus simplex De homine,
f. 69rb, p. 450a
21. intellectus ut fides De homine,
f. 69rb, p. 450b
Averr., In De an. III 6
22. intellectus ut informatio De homine,
f. 69rb, p. 450b
Averr., In De an. III 6
23. intellectus universaliter agens humanus
(coniunctus)
cf. i. universaliter agens separatus,
unten n. 33
De homine,
f. 70ra, p. 454b
24. intellectus primae causae
cf. i. increatus, unten n. 32 ;
i. primus/primi, unten n. 34
De homine,
f. 71vb, p. 464b
Arist., Metaph. XII 9
Averr., In Metaph. XII 9
25. intellectus hylealis
cf. i. possibilis, oben n. 4 ;
i. materialis, oben n. 13
De homine,
f. 17ra, p. 102a
Alex. de Aphr., De intell. et int.
p. 81 (p. 74)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
206 HENRYK ANZULEWICZ
26. intellectus passivus
cf. i. possibilis, oben n. 4
De homine,
f. 71va, p. 463b
Arist., De an. III 5
27. intellectus principiorum De homine,
f. 72rb, p. 468a
abgeleitet von Boeth., De
consol. philos. V 3 (metr.)
28. intellectus formalis
i. formalis sive speculativus
cf. i. speculativus, oben n. 7 ;
i. theoricus, oben n. 11 ;
i. contemplativus, oben n. 1
De homine,
f. 84vb, p. 541b
Super Dion.
De div. nom.,
p. 133.72
um 1250
29. intellectus sanctus De homine,
f. 80va, p. 518a
Avic., VI De nat. V 6
30. intellectus conferens De bono,
p. 263.6-7
um 1243 Ps.-Dion., De div. nom. VII
31. intellectus inquisitivus De bono, p. 8.12
32. intellectus increatus I Sent. (d. 2),
p. 60a
um 1243-
1244
33. intellectus universaliter agens separatus
cf. i. universaliter agens humanus
(coniunctus), oben n. 23 ; i. primae
causae, oben n. 24
II Sent., p. 497b 1246
34. intellectus primus/primi
cf. i. primae causae, oben n. 24
Super Ethica,
p. 767.47
1250-
1252
35. intellectus purus et immixtus Super Ethica,
p. 779. 58-66
36. intellectus operativus
cf. i. practicus, oben n. 2 ;
i. activus, oben n. 12
Phys., p. 142.26.
29.30-31
um 1251-
1252
37. intellectus passibilis De an., p. 206.65 um 1254-
1257
Arist., De an. III 5
38. intellectus cogitativus De an.,
p. 224.73.76.77
39. intellectus assimilativus De intell. et int.,
p. 516
um 1259
40. intellectus possessus
cf. i. adeptus, oben n. 19
Ethica, p. 433a-b um 1262
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 207
ANHANG II
DIE INTE LLEKTBENENNUNGEN IM WERK DES ALBERTUS MAGNUS
UND IHRE HERKUNFT 1
Versuch einer Systematisierung
INTELLEKTNAME FUNDORT IM WERK QUELLE
1. intellectus agens(i. a. humanus)
cf. i. agensuniversaliter
De incarn., p. 204.37-38De resurr., p. 344.56sq.De IV coaeq., f. 6vb, p. 316b ;
f. 40va, p. 473b sq., f. 51va,p. 524b
De homine, f. 17vb, p. 107a ; f. 69ra,p. 448sq. ; f. 69va, p. 451a ;f. 69vb, p. 452sq. ; f. 70va,p. 457a (Themist.) ; f. 71rb,p. 460b (‘Algazel expresse dicitquod intellectus agens non est incorpore’) ; f. 71va, p. 463b(‘Plato enim dixit omniauniversalia esse penesintellectum semper ... Boethiusautem in «Consolationephilosophiae» dicit quodintellectus agens universaliaretinet et singula perdit’) ;f. 71vb, p. 464b (Aug.) ; f. 72va,p. 468b sq. (Aug.), und passim
Quaest. de proph., p. 50.41-51.11(Aug. et Boeth.)
Quaest. de raptu, p. 87.25.40-41(Aug. et Boeth.)
I Sent. d. 2 a. 5, p. 59bII Sent. d. 3 a. 15, p. 90bIII Sent. d. 13 a. 4, p. 240a ; ibid. a.
10, p. 249aSuper Dion. De cael. hier., p. 12.47
(Arist.), p. 12.51.66-67, 21.31,22.4.6.12-13.16.19-20.23.32.36.41.43.49.52.76.78
Super Dion. De div. nom.,p. 121.35.39.40.43-44, 122.3.77,133.72, 134.71, 189.85
Super Ethica, p. 80.56, 449.43-44.48, 450.80sq. ; cf. Index,p. 839
Phys., p. 534.16, 578.75-76De an., p. 203.79sq., 205.8 ;
cf. Index, p. 268De unitate intell., p. 12.64sq. ;
cf. Index, p. 85De nat. et orig. an., p. 15.17.87sq.,
abgeleitet von Arist., De an. III 5 (430a14-15 :‘quo omnia est facere’)
Alex. de Aphr., De intell. et int., p. 77. 80Themist., De an. VI : vermittelt durch Averr.,
Comm. in De an. (z. B. III comm. 5, p. 406.566 sq. ; comm. 20, p. 444. 35 sq.)
abgeleitet von Algazel, Metaph., p. 183.17-20.abgeleitet von Aug., De magistro XI, 38 u. XII,
40.abgeleitet von Boeth., De consol. philos. V
metr. 3 20-24Averr., Comm. in De an., passim (cf. Index,
p. 583)
(1) Zur Ergänzung hinsichtlich der Herkunft der nachfolgend aufgelisteten Intellektnamen,cf. D. N. HASSE, « Das Lehrstück … », im bes. p. 23-26.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
208 HENRYK ANZULEWICZ
16.4,43.53-54.68.69-70.73.75De intell. et int., p. 501a, 506b sq.
(passim)De somno et vig., p. 184b-185b
(Avic., Philos. prima, Algazel,Metaph.)
Super Matth., p. 152.18, 184.24Metaph., p. 383.60.67, 472.69 ;
cf. Index, p. 625Politica, p. 735b (‘Greg. Nyss.’)De causis et proc. univ., p. 26.68-78,
127.25.30.31-32.38 und passim ;cf. Index, p. 272
1.1. intellectus agensuniversaliter(coniunctusanimae humanae,i. universaliteragens in genere)
De homine, f. 70ra, p. 454b ; f. 70rb,p. 455b, p. 456a ; f. 70va,p. 457b ; f. 70vb, p. 458b
De an., p. 25.8cf. Phys., p. 562.24.30, 563.18-19,
566.12, 569.37De nat. et orig. an., p. 16.2.34De causis et proc. univ.,
p. 26.42.68.70 ; cf. p. 25.29-30.72-73 (‘quo est omnia facereet nihil pati vel recipere’),p. 30.54-55 und passim ;cf. Index, p. 274
1.2. intellectusuniversaliteragens
(i. primae causae,primum,i. universalitersimpliciter,i. universaliteragensprimus/primi)
II Sent. d. 30 a. 1, p. 497b(‘Philosophus dicit de intellectuuniversaliter agente etAugustinus de deo’)
De caelo et mundo, p. 79.6, 83.40(‘Anaxagoras’)
Phys., p. 171.61, 172.56(‘Anaxagoras’)
Metaph., p. 526.36, 557.40De causis et proc. univ., p. 25.14.29-
30.72-73 (‘quo est omnia facereet nihil pati vel recipere’), 26.17-18.44sq.67-70, 30.54-55 undpassim (cf. Index, p. 275)
cf. De homine, f. 71vb, p. 464b (i.primae causae) ; f. 72va, p. 468b
Averr., Comm. in Metaph. XI comm. 51
2. intellectuspossibilis
De incarn., p. 204.38De resurr., p. 344.57sq.De IV coaeq., f. 6vb, p. 316b ;
f. 40va, p. 473b sq.De homine, f. 69ra, p. 448sq. ;
f. 70va, p. 457a (Themist.) undpassim
Quaest. de intell. an., p. 269.53.54,270.1.6.10
I Sent. d. 2 a. 5, p. 59bII Sent. d. 3 a. 3, p. 65bIII Sent. d. 13 a. 4, p. 240a ; a. 10,
p. 249aSuper Dion. De cael. hier., p. 12.46-
47 (Arist.).69,22.17.18.23.67.79
abgeleitet von Arist., De an. III 4 (429a22) ; III5 (430a14-15), transl. vetus : ‘intellectusquo omnia fiunt’
abgeleitet von Alex. de Aphr., De intell. et int.,p. 79 (und passim) : ‘i. quod possibile estfieri’, ‘i. qui possibile est ut intelligat’,‘intellectus in potentia’
abgeleitet von Themist., vermittelt durchAverr., Comm. in De an. (z. B. III comm.20, p. 444.35 sq.)
Averr., Comm. in De an., passim : ‘intellectusin potentia’
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 209
Super Dion. De div. nom.,p. 121.36-37, 122.2, 133.72,134.72
Super Ethica, p. 80.53-54.56-57,449.46-47
De caelo et mundo, p. 63.49-50De V univ., p. 28a-bDe an., p. 42.30sq., 43.21sq.,
177.4sq., 204.67sq., 205.64sq.,225.6 und passim, cf. Index,p. 268
De unitate intell., p. 12.15sq. undpassim, cf. Index, p. 85-86
De nat. et orig. an., p. 16.4sq.,43.54.56.64
De intell. et int., p. 501a, 508b sq.und passim
Super Matth., p. 152.22Metaph., p. 383.60.67, 472.71.78De causis et proc. univ., p. 25.30.61-
62 (‘quo est omnia fieri et nihilfacere’), 30.58, 127.17sq. ;cf. Index, p. 273
2.1. intellectusmaterialis(i. possibilis sivematerialis, i.possibilis)
De homine, f. 7va, p. 44a ; f. 69ra,p. 449a
Summa theol. I, p. 23.75-76
Alex. de Aphr., De intellectu et intellecto, p. 74sq. (passim)
Avic., VI De nat. I 5, p. 96.41, 99. 83 ; V 1,p. 81.78.86 ; V 6, p. 137 .71-72, 138.86,151.84 ; V 7, p. 151.84
cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,p. 128.24-25, 134.15-135.1
Dominic. Gundiss., De an. X, p. 87. 17, 95.26.Algazel, Metaph., p. 175.5Averr., Comm. in De an., passim
2.2. intellectushylealis
De homine, f. 17ra, p. 101b-102a ;f. 74ra, p. 478b ; f. 74rb, p. 480b,481b ; f. 76va, p. 494b ;cf. f. 76va, p. 450b
Alex. de Aphr., De intellectu et intellecto, p. 81(‘intellectus yliaris’)
2.3. intellectus inpotentia(i. qui in potentiaest in anima)
De homine, f. 69ra, p. 449a Alex. de Aphr., De intell. et int., p. 79, 81al-Kind�, De intell. et int., p. 1.15Avic., VI De nat. I 5, p. 98.63, 99.70.72 ; V 6,
p. 151.85cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,
p. 129.5-11Dominic. Gundiss., De an. X, p. 87. 37, 88.9Algazel, Metaph., p. 175.5-6Averr., Comm. in De an., passim
2.4. intellectus patiensuniversaliter(i. possibilis)
De homine, f. 69ra, p. 448 abgeleitet von Arist., De an. III 5 (430a 14-15),transl. vet. : ‘intellectus quo omnia fiunt’
2.5. intellectuspotentialis
Quaest. de proph., p. 61.42.55-56Phys., p. 534.19.26-27, 534.12-
13.19.26-27.67, 534.11-12.19De V univ., p. 148b
2.6. intellectuspassibilis
De homine, f. 78ra, p. 503bDe an., p. 206.31
Arist., De an. III 5 (430a24-25), transl. vetus(alia lectio)
Averr., Comm. in De an. III comm. 20,p. 454.306.313
2.7. intellectuspassivus
De homine, f. 71va, p. 463bDe an., p. 206.68-69
Arist., De an. III 5 (430a24-25), transl. vetus
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
210 HENRYK ANZULEWICZ
(idest possibilis) cf. Super Dion. De div. nom.,p. 134.72-73
2.8. intellectus cumexit in anima depotentia adeffectum
De homine, f. 69ra, p. 449a al-Kind�, De intell. et int., p. 1.16-18
3. intellectusspeculativus
cf. i. formalis, i. inhabitu,i. contemplativus
De resurr., p. 295.15De IV coaeq., f. 6vb, p. 316b ;
f. 33va, p. 441aDe homine, f. 7vb, p. 44b sq. ;
f. 51vb, p. 339a (‘intellectusspeculativus extendendo se fitpracticus’) ; f. 57rb, p. 374a ;f. 69ra, p. 448, f. 70va, p. 457a(Themist.) ; f. 71ra, p. 460b(intellectus in actu qui estperfectio potentiae possibilis) ;f. 72ra, p. 466a ; f. 73rb, p. 473b(‘intellectus speculativus estseparatus a materia etappendiciis materiae [...], qui estprincipium scientiae, et ille esthabitus principiorum [...], et illetantum est circa verum’) ; f. 75rb,p. 486sq. ; f. 85rb, p. 543b (undpassim)
De bono, p. 220.5-6, 221.19,222.25.29-30, 230.43-44,252.21, 263.41-42, 265.62-63
Super Dion. De div. nom.,p. 120.60-61, 134.75
Super Ethica, p. 747.56.63-64.67-68, 754.69, 755.2-3.16-17,756.3-4, 758.46.55-56, 768.24
Phys., p. 142.30.32, 533.55sq.,573.34
De V univ., p. 34a, 148bDe an., p. 205.64.81sq., 217.16-18
(‘... qui etiam vocatur intellectusin habitu’), 225.8-9, 230.85,232.66sq. ; cf. Index, p. 268
De intell. et int., p. 501aDe unitate intell., p. 3.19.20,
15.40.46, 23.33Super Matth., p. 256.71-74
(‘i. speculativus apud se habetcommunes animi conceptiones,quas non discit a magistro, sedmediantibus illis accipitscientiam per doctrinam’)
Ethica, p. 624a, 625a, 626a, 627a,630a
De causis et proc. univ., p. 30.58-59,127.20.25 (cf. Index, p. 274)
Arist., De an. III 10 (413a14) ; III 9(432b27.29), transl. vetus
Themist., De an. : vermittelt durch Averr.,Comm. in De an. (z. B. III comm. 5,p. 406.566sq. ; comm. 20, p. 444.35sq.,448.127-128)
Averr., Comm. in De an. passim (cf. Index,p. 583)
3.1. intellectusformalis(sivespeculativus)
De homine, f. 84vb, p. 451bSuper Dion. De div. nom.,
p. 133.72, p. 134.74-76(‘i. formalis sive speculativus,qui est compositus ex possibili et
cf. die Quellenangabe zu ‘intellectus in habitu’cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,
p. 128.25
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 211
cf. i. speculati-vus ;i. in habitu (siveformalis)
specie informata per actionemintellectus agentis’)
De intell. et int., p. 501a, 510b sq.Metaph., p. 472.83-85 (‘Intellectus
autem formalis est, qui inhaeretpossibili et intelligibilibus, deactione agentis proveniens’)
De causis et proc. univ., p. 25.66-67
3.2. intellectus quisemper est in actu
cf. i. speculativus
De homine, f. 69ra, p. 449a, f. 71ra,p. 460a (Themist.) : ‘intellectusin actu’ ; f. 71ra, p. 460b (‘i. inactu, qui est perfectio potentiaepossibilis et vocatur intellectusspeculativus’)
al-Kind�, De intell. et int., p. 1.13-14Avic., VI De nat. I 5, p. 99.71cf. Avic., VI De nat. V 6, p. 151.85cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,
p. 135.8Dominic. Gundiss., De an. X, p. 88.9-10cf. Averr., Comm. in De an. III comm. 20,
p. 445.64-446.68, 448.127sq. (Themist.)
3.4 intellectus ineffectucf. i. principiorum
De homine, f. 70va, p. 457aDe intell. et int., p. 512a sq., 513b,
520b
Alex. de Aphr., De intell. et int., p. 76al-Kind�, De intell. et int., p. 9.4-5.8-9Avic., VI De nat. I 5, p. 97.53, 98. 61, 99.82 ; V
1, p. 81.82 ; V 3, p. 112.32 ; V 6,p. 150.61.66
id., Philos. prima VIII 7, p. 425.28cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,
p. 129.6sq.Algazel, Metaph., p. 175.17Dominic. Gundiss., De an. X, p. 87.26.29.36,
p. 88.5, 95.11
3.5. intellectusdemonstrans
De homine, f. 69ra, p. 449a ; f. 69va,p. 450a, 451a ; f. 69vb, p. 452b
al-Kind�, De intell. et int., p. 1.19
3.6. intellectus inhabitu(sive formalis)
cf. i. speculativus, i. formalis
De homine, f. 69ra, p. 449a (‘i. inhabitu sive formalis’) ; f. 69va,p. 450a, 451a ; f. 69vb, p. 452b
De an., p. 217.18.35Metaph., p. 520.44sq.
Alex. de Aphr., De intell. et int., p. 77Avic., VI De Nat. I 5, p. 97.52, 99.82.84 ; V 6,
p. 151.85Algazel, Metaph. II 4 5, p. 175.13Dominic. Gundiss., De an. X, p. 87.25-26,
95.27Averr., In De an. III comm. 20, p. 448.129 und
passim
3.7. intellectuspracticus(sive operativus,sive activus)
cf. i. activus, i.operativus
De sacram., p. 51.56De resurr., p. 295.18-19De IV coaeq., f. 33va, p. 441aDe homine, f. 15vb, p. 94a (‘i.
practicus sive actualis’) ; f. 57rb,p. 374a ; f. 70rb, p. 456b ; f. 83va-b, p. 534a-b ; f. 84rb sq.,p. 538sq. ; f. 98rb, p. 619b
De bono, p. 229.22-25.27-28(Arist.), p. 230.14-15.44, 263.50,265.62 ; cf. p. 227.52 : ‘ratiopractica’, 228.76-77 :‘intelligentia practica’
Quaest. de intell. an.,p. 269.39.53.56, 270.1.9
Super Dion. De div. nom., p. 120.60Super Ethica, p. 90.88, 449.49,
491.50, 492.18, 767.37.46,768.27
Phys., p. 59.36.45, 78.73,121.11.12, 142.36, 568.20,
Arist., De an. III 10 (433a14-15), transl. vetus
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
212 HENRYK ANZULEWICZ
573.35, 606.45-46De caelo et mundo, p. 64.30De V univ., p. 34aDe an., p. 232.68sq., 234.4sq.
(passim, cf. Index, p. 268)De intell. et int., p. 501aSuper Matth., p. 362.10De causis et proc. univ., p. 74.63.65
(cf. Index, p. 273)Probl. determ., p. 60.55.59.64
3.8. intellectus activus(sive practicus)
cf. : i. practicus, i.operativus
De homine, f. 7rb, p. 41b ; f. 7vb,p. 44b sq. ; f. 85ra, p. 541b
Phys., p. 59.36, 123.9-10, 552.31 (i.activus practicus etimpermixtus)
De caelo et mundo, p. 64.30, 115.13(i. universaliter activus etoperativus)
De an., p. 177.9De nat. et orig. an., p. 16.91Super Matth., p. 256.75 (i. activus
apud se habet universaliamorum, quae sunt communesanimi conceptiones, quasquisque probat auditas, per quasaccipit scientiam et electionemmoralium et prudentiam ...)
Metaph., p. 508.10.22.55De causis et proc. univ., p. 30.46,
109.58, 136.48-49, 163.6Probl. determ., p. 60.58.64, 61.9
Avic., VI De nat. V 1, p. 80.71, 81.75.78.27Dominic. Gundiss., De an. X, p. 84.23, 85.6,
86.34.15, 87.21
3.9. intellectusintellectusoperativus (sivepracticus)
cf. : i. activus, i.practicus
Phys., p. 142.26.29.30-31, 171.68,563.48, 573.33.39, 580.41-42,607.27
De caelo et mundo, p. 115.13 (‘i.universaliter activus etoperativus’), 174.66
De an., p. 232.68-70 (‘i. qui semperratiocinatur propter aliquid quodest extra ipsum, est et vocaturpracticus, quod idem sonat quodoperativus’).81
De causis et proc. univ., p. 25.29.44,74.63-64 (i. qui dicitur practicussive operativus), 135.39
Probl. determ., p. 60.65
Arist., De an. III 10 (433a14-15), transl. arab.-lat.
Averr., In De an. III comm. 20, p. 454.318-319(und passim)
3.10. intellectussimplex(i. qui estintelligibilisincomplexi)
De homine, f. 69rb, p. 450a (‘parspotentiae speculativae animaeintellectualis’) ; f. 69vb, p. 452b(‘accipitur penes diversitatemintelligibilis et non intellectus’) ;f. 78ra, p. 503b
Super Dion. De div. nom.,p. 205.69-70
De intell. et int., p. 501aDe causis, p. 26.21
Avic., VI De Nat. V 6, p. 149.43.49
3.10.1 intellectus utinformatio(i. qui accipit
De homine, f. 69rb, p. 450a ; f. 69vb,p. 452b (‘accipitur penesdiversitatem intelligibilis et non
Averr., In De an. III comm. 21, p. 455.10sq.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 213
formamintelligibilisincomplexi)
intellectus’)cf. Super Dion. De cael. hier.,
p. 21.49-53De an., p. 207.27-28
3.11. intellectuscompositus(i. qui estintelligibiliscomplexi)
cf. i. formalis sivespeculativus
De incarn., p. 208.52De homine, f. 69rb, p. 450a (‘pars
potentiae speculativae animaeintellectualis’) ; f. 69vb, p. 452b(‘accipitur penes diversitatemintelligibilis et non intellectus’) ;f. 73ra, p. 473a
De intell. et int., p. 501aDe causis et proc. univ., p. 150.75
abgeleitet von Arist., De an. III 6 (430a27-28),transl. vetus : ‘compositio quaedamintellectuum est’
3.11.1.
intellectus utfides(i. qui accipitformamintelligibiliscomplexi)
De homine, f. 69rb, p. 450a ;f.. 69vb, p. 452b (‘accipiturpenes diversitatem intelligibiliset non intellectus’)
cf. Super Dion. De cael. hier.,p. 21.53-55
De an., p. 207.31-33
Averr., In De an. III comm. 21, p. 455.10sq.
3.12. intellectusconferens
De bono, p. 263.6-7Super Dion. De div. nom.,
p. 296.74-78.
abgeleitet von Ps.-Dion., De div. nom. VII(cf. unten ‘i. deiformis’)
3.13. intellectusinquisitivus
De bono, p. 8.12
3.14. intellectuscogitativus
De an., p. 224.73.76.77
3.15. intellectuscontemplativus(i. speculativus)
De sacram., p. 51.55-56De an., p. 233.16-17.23.48.55.58-
59.65.71-72.76Analytica post., p. 3aEthica, p. 630aMetaph., p. 526.32.34
Arist., Eth. Nic. X 7 (1177a12qq.)
3.16. intellectusprincipiorum
(i. in effectu)
De homine, f. 71rb, p. 468aDe an., p. 177.12-13De intell. et int., p. 501a, 513b sq.
(‘in omni intellectu qui in effectuest, primo accipitur i.principiorum’)
abgeleitet von Boeth., De consol. philos. Vmetr. 3
‘quidam de Arabum philosophis’
3.17. intellectusdeiformis(‘i. boniformis’)
De incarn., p. 205.72De IV coaeq., f. 41vb, p. 478bDe homine, f. 80va, p. 518aDe bono, p. 8.11, 263.4 ; 267.92Super Dion. De cael. hier.,
p. 206.29.32, 207.4Super Dion. De div. nom.,
p. 269.13.14, 296.74.
Ps.-Dion., De div. nom. IV u. VII
3.18. intellectusdivinus
De IV coaeq., f. 51ra, p. 522 ;f. 51rb, p. 524a
De homine, f. 5rb, p. 29a ; f. 13va,p. 80a (Arist. De an. II 4 :‘intellectus est divinum aliquodet impassibile’) ; f. 15rb, p. 91b(Arist., De animal. XVI :‘intellectus tantum intrat abextrinseco et quod ipse solus estdivinus, quoniam operatio eiusnon habet communicationemcum operatione corporali aliquo
Ps.-Dion., De cael. hier., IX ; in späterenWerken (Super Ethica, De intell. et int.)auch Arist., Eth. Nic. X 7 (1177b30) unddiesbezügliche Kommentare vonEustratius und Michael Ephesius
Averr., In Metaph. XI comm. 51abgeleitet von Arist., De an. II 4 (408b29),
transl. vetus : ‘Intellectus autem fortassisdivinum est et aliquid impassibile’ ; De gen.an. II 3 (736b28), transl. Mich. Scoti
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
214 HENRYK ANZULEWICZ
modo’) ; f. 81rb, p. 522a-bI Sent. d. 2 a. 5, p. 60aSuper Dion. De cael. hier., p. 174.39
(Ps.-Dion.)Super Dion. De div. nom.,
p. 189.15, 190.5.6Super Ethica, p. 708.18 (Averr.)Phys., p. 171.72-73, 178.72,
179.13-14.45.51, 573.87De an., p. 222.5.83 ; cf. p. 43.49-54De intell. et int., p. 501b, 520bDe animal., p. 1096.38De nat. et orig. an., p. 6.17-18,
29.34.38-39Super Matth., p. 550.23 (‘lumen i.
divini, quod est verbum patris,lumen de luce, dominus IesusChristus’)
Ethica, p. 627bMetaph., p. 7.88, 8.2-3 (Averr.),
93.62-63, 311.85-86 (cf. Index,p. 625)
Summa theol. I, p. 2.27.34(Averr.).40 (Ps.-Dion.),p. 31.2.42 (Arist, Eth. X)
3.19. intellectussanctus(sive mundus)
De homine, f. 80va, p. 518aDe bono, p. 250.11-12 (‘qui omnia
intelligit per seipsum’)Super Ethica, p. 19.49, 91.48,
p. 93.45, 779.52De an., p. 223.24De intell. et int., p. 501b
Avic., VI De nat. V 6, p. 151.84.87Dominic. Gundiss., De an. X, p. 95.26-27.29
3.20. intellectusadeptus
(=i. acquisitus, i.accomodatus, i.possessus)
De homine, f. 69rb, p. 450a ; f. 69va,p. 451a-b ; f. 69vb, p. 452b ;f. 84vb, p. 541b
Super Dion. De div. nom.,p. 133.73, 134.78-79
De an., p. 199.31-32, 206.61,216.10, 222.5 (i. adeptus etdivinus).81, 225.9, 233.19-20(und passim, cf. Index, p. 268)
De unitate intell., p. 7.21sq.,20.69sq., 23.39, 25, 89
Anal. post., p. 16b (Plato, Socrates,Aug., Boeth., Nemesius Emesen.[‘Greg. Nyss.’])
De intell. et int., p. 501a, 514b sq.(‘qui acquiritur per studium...,quando per studium aliquisverum et proprium suumadipiscitur intellectum, quasitotius laboris utilitatem etfructum’), 520b
Ethica, p. 6a, 92b, 133b, 570a, 630b,631a, 632a
Metaph., p. 326.42-43, 473.40-41.44-45.58-59.65, 527.48-49
Politica, p. 735b (NemesiusEmesen. [‘Greg. Nyss.’])
Alex. de Aphr., De intell. et int., p. 77-80al-Kind�, De intell. et int., p. 5.10al-F�r�b�, De intell. et int., p. 121-122Avic., VI De nat. V 6, p. 150.65cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,
p. 135.23Dominic. Gundiss., De an. X, p. 88.2-3, 95.10.Averr., Comm. in De an., passim (cf. Index,
p. 583)id., Comm. in Metaph. XII comm. 17
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 215
De causis et proc. univ., p. 25.31.32-33, 127.20.26 und passim(cf. Index, p. 272)
Super Iob, col. 316 (‘adeptus sivepossessus intellectus’), 317
Summa theol. I, p. 2.3-4, 69.81(‘i. adeptus sive possessus’),193.58
Summa theol. II (q. 73), p. 55b,(q. 77) p. 78a
3.21. intellectusaccommodatus(i. adeptus)
De homine, f. 69va, p. 451b Avic., VI De nat. I 5, p. 98.69, 99.74.76.81
3.22. intellectusacquisitus(i. adeptus)
De homine : f. 69va, p. 451bDe intell. et int., p. 501aEthica, p. 433b
Avic., VI De nat. V 6, p. 139.6Algazel, Metaph. II 4 5, p. 175.20Dominic. Gundiss., De an. X, p. 91.33, 94.31cf. al-Kind�, De intell. et int., p. 9.4
3.23. intellectuspossessus(i. adeptus, i.acquisitus, i.habitus)
Ethica, p. 433a-bDe causis et proc. univ., p. 115.1Super Iob, col. 316Summa theol. I, p. 69.81
Eustratius, In Eth. Nic. VI 5
3.24 intellectusassimilativus siveassimilans
De intell. et int., p. 516a-517b(‘in quo homo quantum possibilesive fas est proportionabilitersurgit ad intellectum divinum,qui est lumen et causa omnium’),p. 520b
abgeleitet von : ‘antiquissimi Philosophorum’,al-F�r�b�, Ps.-Ptolem., Hermes Trism.
4. intellectusangelicus
De homine, f. 3va, p. 19a ; f. 72rb,p. 467a
I Sent. d. 2 a. 5, p. 60aSuper Dion. De div. nom.,
p. 134.26-27.29-30, 344.13Super Dion. Epist., p. 481.2-87
(passim)Summa theol. I, p. 3.69
Ps.-Dion., De div. nom. VIIcf. Algazel, Metaph., p. 121.7-8, 184.2sq.
4.1. intelligentiaagens(intelligentia)
De IV coaeq., s. unten s. v.‘intelligentia divina’
De homine, f. 69ra, p. 449a (Alex.de Aphr.) ; f. 71rb, p. 461b(Algazel), 462a (Avic. und IsaacIsr.) ; f. 71va, p. 462b sq. (Liberde causis, ‘philosophi’,Dominic. Gundiss.)
De bono, p. 2.37-39 (‘opus naturaeest opus intelligentiae’ ;‘intelligentia in operatione suapraefigit finem’)
Quaest. de proph., p. 61.30Quaest. de intell. an., p. 269.57Phys., p. 534.66De V univ., p. 37a-b, 148aDe somno et vig., p. 184b-186a
(Avic., Algazel)De unitate intell., p. 1.32-33cf. De causis et proc. univ., p. 26.47-
48 (‘intelligentia illustrans superanimas nostras, quae non agituniversaliter simpliciter’),
Alex. Aphr., De intell. et int., p. 76, 78-79Liber de causis § 2, 3, 12 (passim)Isaac Isr., De diff., p. 313.25-26, 309.25-28 ;
cf. p. 311.7 (‘intelligentia quae semper estactu’)
Avic., VI De nat. V 5, p. 126.27sq. (passim) ;ibid. V 6, p. 142.51, 148.41, 150.59.72
id., Philos. prima IX 3, p. 475.11, 476.30-35(u. ö.)
cf. Ps.-Avic., De causis primis et secundis X,p. 130.11-12.14, 134.10
Algazel, Metaph., p. 175.22, 183.2-3.23-24,184.3.5.18 (passim)
Dominic. Gundiss., De an. X, p. 89.3, 94.1-2.27 (‘principium agens’, ‘intelligentiaagens’), 92.31-32 : ‘intelligentiae agentes’,93.5-6, 94.27, 95.2.5.15 : ‘intelligentiaagens’
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
216 HENRYK ANZULEWICZ
26.50-51 (‘intelligentia primi velsecundi vel deinceps [lege :decimi] ordinis’)
4.2. intelligentiadivina(anima mundi,anima caeli,intellectus caeli)
De IV coaeq., f. 34rb, p. 443b(‘dicitur in II De anima etXXII[II] propositione De causis :« Omnis intelligentia divina scitres per hoc quod est intelligentia,et regit eas per hoc quod estdivina ». Et dicitur « divinaintelligentia » ibi participansbonitates divinas a primo motorequi est deus’), f. 34va-b,p. 445a-b
Liber de causis, passim, insb. § 22weitere Quellen : Arist., De caelo, Metaph. XIIoh. Dam., De fide orth.Avic., IV De nat., De caelo et mundoAverr., In De caelo et mundo, In Metaph., De
subst. orbis$O-%LWU�M� (Alpetragius), De motibus caelorumMoses Maimonides, Liber de uno deo
benedictoPs.-Gilb. Porr., De sex princ.
4.3 intelligentia De incarn. 173, 65De IV coaeq., f. 38ra, p. 462b
5. intellectus caeli /intellectuscaelestis
De IV coaeq., f. 33va, p. 441aDe nat. et orig. an., p. 10.11-12,
28.46-47, 29.34-35
5.1. intellectusprimus/i. primi(i. primi principii,i. primae causae)
Super Ethica, p. 767.47Phys., p. 171.72, 573.30-33De caelo et mundo, p. 64.23-
24.26.34-35De an., p. 233.68-69De nat. et orig. an., p. 2.24, 6.37-
38.87, 9.77, 12.68, 13.11.17.18,14. 64-65, 33.19, 39.2
De unitate intell., p. 13.8.16-17 sq.De animal., p. 1092.15.40, 1094.32,
1308.17Metaph., p. 157.37-38De causis et proc. univ., p. 42.25-26,
55.90, 56.20 (cf. Index,p. 273sq.)
5.2. intellectusincreatus
I Sent. d. 2 a. 5, p. 60a
5.3. intellectus purus(i. purus etimmixtus,i. purusuniversaliteragens qui exseipso constituitet producit et facitomne quod est)
Super Ethica, p. 779.58-66Phys., p.604.52-53De V univ., p. 28aDe animal., p. 1094.33De nat. et orig. an., p. 6.18.76.84.94,
7.18-19, 12.72, 13.7, 14.27Metaph., p. 8.9-10, 490.13De causis et proc. univ., p. 26.17.21-
22, 100.59
cf. Avic., VI De nat. V 6, p. 139.5
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
INTELLEKTTHEORIE DES ALBERTUS MAGNUS 217
ANHANG III
INTELLEKTMODELLE BEI ALBERTUS MAGNUS
IN IHRER ENTWICKLUNG
I. Die erste EntwicklungsphaseDie erste Entwicklungsphase : bis ungefähr 1242, Paris bis ungefähr 1242, Parisdas Frühwerk, mit dem Höhepunkt in De homine
De homine (um 1242) ::
1. intellectus agens2. intellectus possibilis3. intellectus speculativus
II. Die zweite EntwicklungsphaseDie zweite Entwicklungsphase : um 1250-1257, Köln um 1250-1257, KölnSuper Dion. De div. nom. und De anima
Super Dion. De div. nom. (um 1250) :
1. intellectus agens2. intellectus possibilis3. intellectus formalis4. intellectus adeptus
De anima (um 1254-1257) :
1. intellectus possibilis2. intellectus universaliter agens3. intellectus speculativus4. intellectus adeptus
III. DDie dritte Entwicklungsphase : ab ca. 1258, Köln (und andere Aufenthaltsorte inDeutschland) ab De intell. et int. I-II, mit dem Höhepunkt in De intell. et int. II 9
De intell. et int. I 3 3 :
A.1. intellectus possibilis2. intellectus agens3. intellectus formalis :
intellectus practicusintellectus speculativus
3.1. intellectus simplex3.2. intellectus compositus3.2. 1. intellectus principiorum3.2. 2. intellectus adeptus
B.1. intellectus immixtus (sc. continuo et tempori)2. intellectus separatus = iintellectus sanctus sive mundus/ i.
divinus3. intellectus medius4. intellectus tertius
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin
218 HENRYK ANZULEWICZ
De intell. et int. II 9 :
1. intellectus possibilis2. intellectus agens3. intellectus principiorum (i. formalis)4. intellectus in effectu5. intellectus adeptus6. intellectus assimilativus
Henryk ANZULEWICZ, né en 1955, docteur en théologie, est collaborateurscientifique à l’Albertus-Magnus-Institut de Bonn. Il a publié entre autres :
avec A. FRIES et W. KÜBEL (edd.) : Alberti Magni Ordinis Fratrum Praedica-torum Quaestiones, Münster, Aschendorff 1993 (Alberti Magni Opera omnia,Ed. Colon. XXV/2) ;
« De forma resultante in speculo ». Die theologische Relevanz des Bildbegriffsund des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus. Einetextkritische und begriffsgeschichtliche Untersuchung, 2 Bde., Münster,Aschendorff 1999 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie desMittelalters, N. F., 53/I-II) ;
« Die Denkstruktur des Albertus Magnus. Ihre Dekodierung und ihre Relevanzfür die Begrifflichkeit und Terminologie », dans L’élaboration du vocabulairephilosophique au Moyen Âge, ed. J. HAMESSE et C. STEEL, Turnhout, Brepols2000 (Rencontres de Philosophie Médiévale, 8), p. 369-396 .
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 87
.79.
68.5
3 -
06/0
6/20
12 2
1h09
. © V
rin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 87.79.68.53 - 06/06/2012 21h09. ©
Vrin































































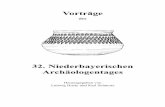




![Kouřil P., Gryc J. 2011: Der Burgwall in Chotěbuz – Podobora und seine Stellung in der Siedlungsstruktur des oberen Odergebietes vom 8. bis zum 9. / 10.Jahrhundert, [in:] J. Macháček,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63156d693ed465f0570b8f58/kouril-p-gryc-j-2011-der-burgwall-in-chotebuz-podobora-und-seine-stellung.jpg)







