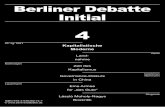Die kybernetischen Hände, oder: Wie man mit einem Computer regieren kann
Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden
Transcript of Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden
Helmut Buske Verlag GmbH is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Studien zur AltägyptischenKultur.
http://www.jstor.org
Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden Author(s): Ursula Verhoeven and Orell Witthuhn Source: Studien zur Altägyptischen Kultur, Bd. 31 (2003), pp. 307-315Published by: Helmut Buske Verlag GmbHStable URL: http://www.jstor.org/stable/25152899Accessed: 21-05-2015 07:32 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden
Ursula Verhoeven und Orell Witthuhn
(Tafel 22-24)
Abstract
Eine spatagyptische Totenstele aus Kalkstein wird auf ihre Datierung und Herkunft hin naher untersucht.
Neben den Namen der Besitzerin Ta-aa(t) und ihrer Eltem Pa-di-mehit und Ta-scherit-mehit innerhalb der
Opferformel enthalt der Text einen kurzen Anruf an die Lebenden. Besonderheiten zeigen sich im Giebel
feld, im Titel ?Hathor" (statt ?Osiris") der Verstorbenen, sowie in der Nennung des ?Wustentales" am
Ende des Stelentextes. Im Bildfeld treten die Gutter Atum und Re-Harachte auf.
Dem Fachgebiet Agyptologie der Philipps-Universitat Marburg wurde in der 1990er
Jahren freundlicherweise eine Stele aus Privatbesitz zur Bearbeitung iiberlassen (Inv.Nr.
001/95, Taf. 22)1.
Beschreibung Die Stele bildet ein oben abgerundetes Rechteck im Hochformat. Inschriften und
Darstellungen sind in versenktem Relief angebracht. Reste einer Bemalung sind nicht
erhalten, doch lassen kristallisierte Riickstande in den vertieften Hieroglyphen darauf
schlieBen, daB sie mit einer eingelegten Paste farbig gestaltet worden waren.
Der auf der Vorderseite geglattete Stein ist stark bestoBen und teilweise verwittert, im
unteren Sockelfeld haben sich einige horizontale Schleifspuren erhalten. Auf der Stand flache sind im Abstand von 6,3 cm zur linken und 7,4 cm zur rechten Stelenecke modern
zwei einzementierte Kupferstifte zur Aufstellung in einem Sockel angebracht worden.
Mafie Die maximale Hohe betragt 57 cm, die Breite oberhalb des Bildfeldes 40,3 cm, die Breite an der Unterkante 37,7 cm. Die linke Seitenkante ist 6,8 cm bis 5 cm tief, die rechte
Seitenkante 6,7 cm bis 5,8 cm tief. Die Stele wird nach unten hin schmaler, die maximale
Tiefe betragt 8,3 cm, wobei sich die Riickseite zur Mitte hin vorwolbt und mit einem Flacheisen nur partiell geglattet wurde. Weitere DetailmaBe finden sich im Abschnitt
?Textfeld".
1 Im Rahmen eines Seminars an der Philipps-Universitat Marburg im Jahre 1996 entstand die Idee der
gemeinsamen VerOffentlichung. Wahrend diese nun im Oktober 2002 endlich einen AbschluB gefrinden hat, k6nnen sich zur gleichen Zeit erstmals wieder Nebenfachstudenten fur das Fach Agyptologie an
jener Universitat einschreiben. Der Aufsatz sei daher der Zukunft der Marburger Agyptologie gewidmet und versteht sich in diesem Sinne ebenfalls als ein ?Anruf an die Lebenden".
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
308 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
Material
Die Stele besteht aus kreidigem Kalkstein von weiBgrauer Farbe und poroser Konsistenz.
Die Oberflache ist von zahlreichen aufgeschlagenen Hohlraumen bedeckt, die mit der Zeit
beige-gelb nachgedunkelt sind. Teile des Steins sind von einer diinnen Schicht porzellan artigen, gelblichen Kalkes iiberzogen2.
Bildszenen und Beischriften
Die bildlich und schriftlich dekorierte Stelenflache wird von einer diinnen Linie, die der Stelenform folgt, nach auBen hin begrenzt. Die Dekoration gliedert sich in drei Felder: das
gerundete Giebelfeld, das rechteckige Bildfeld und das Textfeld mit waagerechten Zeilen.
1 Das Giebelfeld (Taf. 23) Im Halbrund des Giebelfeldes schwebt eine gefliigelte Sonnenscheibe, deren Schwingen ein dreistufiges Federkleid zeigen und am Ende in kleine Einzelfedern auslaufen. Aus ihrer Mitte hangen zwei Urausschlangen herab, die rechte tragt die Rote Krone, die linke
die WeiBe Krone. An der tiefsten Stelle des Schlangenkorpers ist je ein Anch-Zeichen
angebracht. Zwischen den Uraen verlauft eine vertikale Inschriftzeile. Der von rechts nach
links zu lesende Text benennt das Fliigelwesen als l A "^37 g^ Bhd.tj nb p.t ?Behedeti,
der Herr des Himmels". Das Giebelfeld wird rechts und links durch zwei antithetisch-sym metrisch angebrachte Inschriften nach unten hin abgeschlossen, die jeweils von auBen
nach innen als [ j ^^ dj^f cnh wis ?Er moge Leben und Gliick geben" oder als Er
weiterung des Namensvermerks insgesamt als ?(Das ist) Behedeti, der Herr des Himmels,
indem er Leben und Gliick gibt"3 zu lesen sind. Dieser Zusatz ist auf den Privatstelen der
Spatzeit auBerst seiten4.
2 Das Bildfeld (Taf. 23) Dieses rechteckige Feld wird von dem dariiber liegenden Giebelfeld durch eine die voile Breite der Bildflache einnehmende Himmelshieroglyphe
^=^ abgetrennt. Unter diesem
?Himmel" sind antithetisch-symmetrisch zwei Opferszenen dargestellt. Die rechte Bildhalfte zeigt eine stehende, nach links gewandte menschliche Figur, die
beide Hande im Anbetungsgestus erhoben hat. Sie ist barfuB und tragt ein knochellanges Gewand, dessen gravierte Innenzeichnung von links oben nach rechts unten verlaufend
geschwungene Falten wiedergibt und einen Schulterbehang aufweist5. Die Kopfpartie ist im hinteren Bereich derart zerstort, daB man den Eindruck gewinnt, es konne sich um eine
mannliche Person mit kurzer Haartracht handeln. Aufgrund des Gewandes und der
2 Vgl. R. Klemm/ D.D. Klemm, Steine und Steinbriiche im Alten Agypten, 1993,166f., Farbtf. 5.2, die
einen solchen Kalkstein aus der Gegend um El Hammamiya beschreiben. 3
Nach K. Jansen-Winkeln, Text und Sprache in der 3. Zwischenzeit, AAT 26, 1996, 23. 4
Siehe z.B. Boston MFA 22.402, CAA Boston, Lf. 3, 137 (spates 4. Jh.v.Chr.). 5 Vgl. zum Gewandtyp die Zeichnung in CG 22001-22208 (A.B. Kamal, Steles ptolemaiques et
romaines II, 1905), Tf. 87, Nr. 136.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2003 Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden 309
Beischrift ist aber davon auszugehen, daB hier wie auf der parallelen linken Opferszene eine Frau (mit zerstorter langer Periicke) dargestellt ist. Der vor ihr stehende Opferaufbau besteht aus zwei schlanken Altaren, die mit LotusstrauBen, Spitzbroten und kleineren
GefaBen bestiickt sind. An der AuBenseite der Stander steht auf dem Boden jeweils ein
Weinkrug mit spitz zulaufendem VerschluB, dazwischen ist ein Gebinde aus Papyrus dolden aufgestellt. Links des Opfertisches ruht eine nach rechts gewandte Gotterfigur auf dem flachen, nach vorne schrag abfallenden Sockel in Form der ro^-Hieroglyphe ([=^). Ihr falkengestaltiger Kopf mit Periicke ist von einer groBen Sonnenscheibe mit Uraus
schlange bekront, der anthropomorphe Korper ist mumienformig, die vorgestreckten Arme
halten ein Was-Szepter. Die aufgrund der Ikonographie mogliche Identifikation dieser
Figur als eine Erscheinungsform des falkenkopfigen Sonnengottes wird durch die
Nennung des Re-Harachte in der Beischrift und dem Opfertext gesichert. Fiinf vertikale Linien von jeweils 2,5 cm Lange begrenzen vier Inschriftzeilen, die zwischen den Kopfen der beiden Figuren angebracht sind. Die Hieroglyphen sind zum groBen Teil beschadigt: ?Re-Harachte" ist gerade noch in der Zeile vor dem Falkenkopf zu erkennen. In den drei
Zeilen vor dem Kopf der betenden Person diirfte zu lesen sein: ldd mdw Hw.t-Hr 2[T1-Cl(.t)] mlc-hrw 3fsl.tJ Pl-dj-Mhj.t
?Worte zu sprechen (von) Hathor [Ta-aa(t)]6, gerechtfertigt, [Tochter] des Pa-di-mehit".
Die linke Bildhalfte zeigt auBen eine nach rechts gewandte Frau, die ebenfalls stehend beide Hande im Anbetungsgestus erhoben halt. Sie tragt eine lange Periicke, von der einzelne Haarstrahnen als Erhebung aus dem Stein herausgearbeitet worden sind. Be
kleidet ist sie mit dem gleichen knochellangen Gewand wie die Figur rechts. Vor ihr sind zwei Opferaltare aufgebaut, die nur in Details von denen der rechten Szene abweichen: der
BlumenstrauB hat eine andere Form, die GefaBe und Brote sind etwas groBer, die Wein
kriige auf dem Boden stehen jeweils rechts von den Standern (der ganz rechts stehende
laBt iibrigens die Grenze des Verschlusses erkennen), ein StabstrauB fehlt hier unter den
Altaren. Als Empfanger der Gaben ist eine nach links gewandte mannliche Gottheit
dargestellt. Auch ihr Korper ist mumienformig gestaltet, die Arme greifen ein Was
Szepter, und die Gestalt steht ebenfalls auf einem flachen m^-gestaltigen Sockel. Die
Unterscheidung zum Gott der rechten Szene beschrankt sich auf den Oberkorper: hier ist
der Kopf menschlich mit Gotterbart ausgefuhrt und tragt die Doppelkrone, um die Schultern liegt ein breiter Halskragen. Diese Ikonographie spricht fiir eine Identifikation als Atum, was der Opfertext bestatigt. Zwischen der Beterin und dem Gott sind zwar
wieder ftinf vertikale Linien von 2,8 cm Lange eingraviert, die vier senkrechte Zeilen fur
eine Beischrift bilden, die Hieroglyphen sind hier aber nicht ausgefuhrt worden. Zwischen beiden Bildhalften verlauft im Riicken der Gotterfiguren eine vertikale Zeile,
die deutlich erkennbar mit den Worten hl^fmj Rc ?um ihn wie Re" endet. Die voran
gehenden Zeichen sind stark beschadigt, die erhaltenen Hieroglyphenteile bilden aber
geniigend Anhaltspunkte fiir die Lesung:
6 Zum erganzten Personennamen siehe unten.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
310 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
g?g si [cnh wis nb] hi*fmj Rc
Wm ?AUer Schutz, alles Gliick und Leben sind um ihn wie Re".
f
Diese Beischrift gehort normalerweise hinter einen Konig, ftir Stelen sei auf Ver
gleichsbeispiele aus dem Neuen Reich7, Stelen aus Nuri8 oder die Mendesstele Ptole maios6 II.9 verwiesen, in Ritualszenen auf Tempel wanden findet sich dieser Zusatz regel
maBig. Im Riicken antithetisch angeordneter Gotter stehen auf den Privatstelen der Zeit andere Texte (Gotterbeinamen, dd-mdw-Vermerke, ein Gebet iiber den Sonnenaufgang oder der Name des Verstorbenen). Ist diese Ubernahme der koniglichen Beischrift nun ein Fehler in der Konzeption der Stele oder ein versteckter Hinweis auf den Konig als Mittler zwischen den Gottern und der Verstorbenen?
iDasTextfeld Etwas mehr als die Halfte der gesamten Stele wird von den sechs horizontalen Zeilen der
linkslaufigen Inschrift eingenommen, die sich unterhalb der Opferszenen findet. An der rechten Seite miBt das Textfeld insgesamt 22,1 cm H6he, an der linken 22,6 cm. Die
Zeilenbreite schwankt zwischen 36,8 cm in der ersten Zeile und 36 cm in der letzten. Die Zeilenhohe variiert ebenfalls, sie liegt zwischen 3,2 und 3,6 cm, die unterste Zeile ist mit
4,1 cm deutlich hoher. In der vorletzten und der letzten Zeile sind die Hieroglyphen offen sichtlich mit Absicht gestreckt, um den vorhandenen Raum zu fiillen. Ein leeres Sockel feld von 6 cm Hohe und maximal 38,5 cm Breite fullt den Raum zwischen der letzten Zeile und der unteren StelenabschluBkante.
Hieroglyphische Abschrift
ftrjtf jffii5?o_artMPfcr? P]
mmnmz^mm [4] 7
Zwischen Amenophis I. und Ahmes-Nefertari: Bierbrier, HTBM 12, 1993, Tf. 38-39, Inv.Nr. 1347; Gebel-Barkal-Stele Thutmosis' HI., CAA Boston, Lf. 3, 140, E und J.
8 Boston MFA 17-2-1920, siehe CAA Boston, Lf. 3,116 und Boston MFA 21.347, siehe CAA Boston, L?3,121.
9 Urk. II, 29,10 (CG 22181; CG 22001-22208 [Kamal, Steles], Tf. 54).
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2003 Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden 311
Transkription
[1] htp nsw Rc-Hr-lh.tj ntrcl nbp.t Tm nb Jwnw dj^s<n> pr.t-hrw^ t hnq. t kl. w Ipd. wjrp
[2]jrt.t sntr mrh(.t/h) mnh.t htp.w dfl h.t nb(.t) nfr(.t) wcb(.t)
[3] cnh(.t) ntrjm^s n klHw.t-Hr Tl-Cl(.t) (?) mlc-hrw sl(.t) Pl-dj-Mhj.t
[4] mlc-hrw ms (n) nb(.t)-pr T(l)-srj.t-Mhj.t mlc-hrw j cnh.w tp.jw tl{.wj}
[5] swl.tj^sn nb hrjspn njs^tn n^j rn^j
[6] pw dbh. w t hnq. t kl. w Ipd. w sntr d. t (n)hh jn. v*'
Kommentar zu einzelnen Hieroglyphen
(a) Das Arw-Zeichen sieht eher wie ein mdw-Stab bzw. ein groBes Brot wie in Z. 6 aus.
(b) Das SalbengefaB lauft nach unten sehr schlank zu und hat einen dreieckigen FuB.
(c) Das Berg-Determinativ hat drei sehr spitze Hiigel.
Ubersetzung
[1] Ein Konigsopfer (fur) Re-Harachte, den groBen Gott, Herrn des Himmels, und Atum, Herrn von Heliopolis, damit sie ein Totenopfer aus Brot und Bier, Rind, Gefliigel, Wein,
[2] Milch, Weihrauch, 01/ Fett, Alabaster, Opfergaben, Nahrung und alien guten und
reinen Dingen, [3] von denen ein Gott lebt(a), gewahren fur den Ka der Hathor^ Ta-aa(t)(c),
gerechtfertigt(d), der Tochter des Pa-di-mehit(e), [4] gerechtfertigt(d), geboren von der Haus
herrin Ta-scherit-mehit(f), gerechtfertigt(c). Oh ihr Lebenden auf Erden, [5] die alle an diesem Grab voriibergehen werden: Ihr
moget fiir mich(8) diesen meinen Namen ausrufen. [6] Opfert(l) Brot, Bier, Rind, Gefliigel und Weihrauch ewiglich und unendlich (im) WiistentaP.
Kommentar zur Transkription und Ubersetzung
(a) Die Konigsformel entspricht W. Barta, Aufbau und Bedeutung der altagyptischen
Opferformel, AF 24,1968,209, die erbetenen Gaben gleichen im ersten Teil der Bitte 2a
(ebd., 212), erganzt durch htp.w dfl. (b) Hw.t-Hr ist der ab der Ptolemaerzeit mitunter fur weibliche Verstorbene benutzte
Titel ?Hathor NN" anstelle von ?Osiris NN"10.
10 Belege dazu siehe Wb III, 5,13; F. Daumas, in: LA II, 1029, mit Anm. 50-51, s.v. Hathor. AuBerdem
M. Valloggia, Le Papyrus Lausanne N? 3391, in: Hommages S. Sauneron I, BdE 81, 1979, 290, mit
weiterer Literatur in Anm. 5; D. Kurth, Der Sarg der Teiiris, AT 6, 1990, 11, Anm. 98 (Hinweis von
H. Felber); eine mogliche Deutung gibt S. Morenz, Das Problem des Werdens zu Osiris in der
griechisch-romischen Zeit Agyptens, in: Religions en Egypte, Coll. Strasbourg, 1969, 81f.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
312 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
(c) Die Lesung des Namens der Stelenbesitzerin ist problematisch, da die Inschrift an
dieser Stelle besonders zerstort ist (vgl. Taf. 24). Man erkennt jedoch ein schmales
liegendes Zeichen in der Form des Landzeichens tl, darunter eine liegende Zeltstange (cl), sowie Endungen (Strich und t bzw. ?Ei)". Bei Ranke, PN I, 376-7 finden sich einige
Beispiele fur Namen, die mit dem Landzeichen beginnen wie Tl-srj, Tl-jw, Tl-wl, Tl-nfr, so daB eine Bildung Tl-Cl durchaus denkbar ist. Eine Parallele kann jedoch nicht genannt
werden. Gleichlautende Namen mit Tl als femininem Artikel sind bei Ranke, PN 1,354,13
[Tl-Cl(.t)] u. 19 [Tl-Cl.w] sowie PN II, 324,2 seit dem Neuen Reich und ftir die Spatzeit aufgeftihrt11.
(d) Im Beiwort mlc-hrw ist in diesem Text dreimal ein Schilfblatt statt der Feder
geschrieben. Beide Zeichen gleichen sich zwar prinzipiell im unteren Bereich, allerdings miiBte der Federkiel bei dieser Schriftrichtung am rechten Rand des Zeichens herunter
reichen, wahrend der Schilfblattstengel - wie hier - am linken Rand hinabftihrt. Umfang
reiches Material zu epigraphischer Austauschbarkeit bietet M.-Th. Derchain-Urtel12, fiir
den Wechsel von Schilfblatt und Feder hat sie uns ein sicheres Beispiel aus der Zeit des Hadrian genannt13.
(e) Der Name des Vaters ist gut belegt14. Die Schreibung ist korrupt, da unter dem Zeichen Mhj.t einp anstelle eines t geschrieben steht. Zu dieser Verwechslung in der
Ptolemaerzeit siehe D. Kurth, in: ders. (Hg.) Edfu: Bericht iiber drei Surveys; Materialien und Studien, ITE/B 5, 1999, 92 (ea).
(f) Der Name der Mutter stellt ebenfalls keine Belegprobleme dar15.
(g) Das feminine Suffix der 1. P. Sg. im Dativobjekt n*j ist hier mit einem t und der sitzenden Frau geschrieben, vgl. K. Jansen-Winkeln, Spatmittelagyptische Grammatik der
Texte der 3. Zwischenzeit, AAT 34, 1996, 131 mit zahlreichen Belegen. (h) Die Anordnung der Zeichen beim Imperativ dbh.w ist auffallend: die Pluralstriche
stehen zwischen der Gruppe ? jj[ und der Gruppe 0 .
(i) Der SchluB des Textes ist sehr ungewohnlich, denn in Analogie zu den Stelen CG
22023,22032 oder 22034 ware ein nhh d.tsp 2 bzw. zu CG 22095, 22139 oder 22152 ein nhh d.tza erwarten. Das isoliert stehende Wort ?Wiistental" kann allgemein eine ?Nekro
pole" bezeichnen oder speziell auf die thebanische Nekropole verweisen.16 In Mescheich/
Lepidotonpolis begegnet der Ausdruck jn.t sstl ntj rsj Bhd.t ?geheimes Tal, das siidlich von Behedet (=Mescheich) ist"17.
11 Vgl. auch H. De Meulenaere, ?Notes d'onomastique tardive (2*me serie)", in: RdE 12, 1960, 67.
12 M.-Th. Derchain-Urtel, Epigraphische Untersuchungen zur griechisch-romischen Zeit in Agypten, AAT
43,1999,294ff. Vgl. auch D. Kurth, in: Ders. (Hg.), Edfu: Bericht uber drei Surveys; Materialien und
Studien, ITE/B 5, 1999, 88 (bx) (Hinweis von D. Budde). 13 Chr. Zivie, Le Temple de Deir Chelouit III, 1986, 94, Nr. 127, Z. 19f. im Namen von Atum. 14
Ranke, PN I, 123, 20; 124, 1; 272, 11; DemNb 1/1,315 (Pl-tj-mhj); P. Munro, Die spatagyptischen Totenstelen I, AF 25,1973,260.292 bis; Th. G. Allen, Egyptian Book of the Dead Documents, OIP 82,
1960, 60, Tf. 51 A (ptol. Totenbuch pChicago OIM 17242). 15
Ranke, PN I, 369, 4; 368, 5, 1. Beleg; DemNb 1/3,1114 (Tl-sr.t-mhj). 16
B.G. Ockinga/ Y. al-Masri, Two Ramesside Tombs at el Mashayikh 1,1988, 76, Anm. 307. 17
Ockinga/ al-Masri, Two Ramesside Tombs I, 73.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2003 Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden 313
Parallelen
Es ist erstaunlich, daB sich bei den uns moglichen Recherchen keine exakte Parallele im
Stelenaufbau finden liefi. Die antithetischen Szenen im Giebelfeld werden hSufig durch
ein zweitgeteiltes Textfeld nach unten hin fortgefuhrt18, wahrend die sechs Textzeilen hier
waagerecht durchlaufen, wie es sich an verschiedenen oberagyptischen Orten findet19.
Die gefliigelte Sonnenscheibe mit herabhangenden Uraen und der Beischrift ,JBehedeti, Herr des Himmels" findet sich nach brieflicher Mitteilung von M. Derchain-Urtel bei alien
Assuan-Stelen, allerdings gibt es auch Belege aus Theben, iibrigens mit ahnlicher Frisur
und Gewandung der Frau, sowie den Gottern Atum und Re-Harachte20. Die Fortfuhrung der Beischrift der Flugelsonne mit dj^fcnh wis hat hingegen keine Parallele21.
Die Kombination von Sonnenscheibe mit langen Uraen, Gewandtyp der Frau und
Bezeichnung ?Hathor" vor dem Namen taucht auch bei CG 22014 auf22, einer Stele, deren Herkunft unbekannt ist; die dargestellten Gottheiten sind hier allerdings Osiris, Isis,
Nephthys, Horus.
Das Gotterpaar Re-Harachte und Atum mit vergleichbarer, mumiengestaltiger Ikono
graphie findet sich auf einigen Stelen der Phase Theben III23 und in Verbindung mit weite ren Gottern auf Kalksteinstelen aus Koptos24 und Abydos III25. Eine Ubereinstimmung aller Bildelemente, wenn auch in etwas anderem Stil, begegnet auf der Kalksteinstele CG
22071 (Theben III)26. Mit Schurz und ausschreitenden Beinen werden Re und Atum in
Assuan27, Edfu28, Theben29 und Abydos30 dargestellt, thronend auf CG 22004, wieder aus
Edfu.
18 Vgl. die Beispiele Munro, Totenstelen II, Tf. 4-5, Abb. 16-19.23 (Theben); Tf. 22, Abb. 78.79 (Edfu). 19 Vgl. die Beispiele Munro, Totenstelen II, Tf. 4, Abb. 13; Tf. 5, Abb. 20; Tf. 6, Abb. 21-22. 24; Tf. 7, Abb. 25; Tf. 13, Abb. 47. 49 (alle Theben); Tf. 24, Abb. 87-88 (Assuan); Tf. 36, Abb. 131 (Abydos); Tf.52,Abb. 175(Achmim).
20 Munro, Totenstelen II, Tf. 13, Abb. 47. 49
21 Munro, Totenstelen II, Tf. 2, Abb. 7, Tf. 3, Abb. 11 und Tf. 5, Abb. 18 (Cnh-Zeichen, alle Theben); Ebd., Tf. 4, Abb. 14, Tf. 63 (beide Memphis) und Tf. 9, Abb. 33 (Theben) sowie CG 22077 (Achmim) haben dj cnh; Munro, Totenstelen I, Tf. 52, Abb. 177 enthalt cnh wis als Schmuckelemente (Achmim). 22 CG 22011-22208 (Kamal, Steles), 14f., Tf. 6. Vgl. fur den Hathor-Titel auch CG 22011 aus Abydos und CG 22124 aus Achmim.
23 Munro, Totenstelen II, Tf. 16, Abb. 56. 57 (dazu Totenstelen 1,231ff.), antithetisch Tf. 13, Abb. 49.
24 Munro, Totenstelen II, Tf. 25, Abb. 93.
25 Munro, Totenstelen II, Tf. 44, Abb. 157.
26 CG 22011-22208 (Kamal, Steles), Tf. 23, vgl. Munro, Totenstelen 1,229: A.-S. Stele, Theben III, 350 300 v.Chr.
27 Munro, Totenstelen II, Tf. 24, Abb. 87-88.
28 CG 22024.
29 CG 22010. Vgl. auch Bologna KS 1954, E. Bresciani, Le stele egiziani del Museo Civico Archeologico di Bologna, 1985, 90f, Nr. 34.
30 Munro, Totenstelen II, Abb. 131.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
314 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
Zwei Opferstander nebeneinander sind im Material von Munro in den Phasen
Theben II31, Theben III32, Abydos I33, Achmim II34 zu finden. Neben mehreren Einzelbeispielen fur die Namen der beiden Elternteile unserer Stele
aus Achmim35 begegnet einmal auch ein Elternpaar mit diesen Namen, und zwar auf der
Achmimer Stele CG 22129: der Vater tragt dort allerdings den Titel sml, die Mutter ist
Sangerin des Min. Aus Abydos stammt die friihptolemaische Stele Kairo T. 30/5/24/1, auf der ein Pa-di-mehit und dessen GroBmutter Ta-scherit-(en)-mehit innerhalb einer langeren
genealogischen Aufzahlung erwahnt werden; beide sind Mitglieder einer thinitischen
Priesterfamilie, die Kulte fiir verschiedene Gottheiten versahen36. Auf den ptolemaischen Stelen Kairo CG 22129 aus Achmim und Kairo T. 4/7/24/7 aus Abydos sind ebenfalls ein Pa-di-mehit und eine Ta-scherit-(en)-mehit als Ehepaar aufgefuhrt. Der Name der Mutter
ist auch noch auf zwei ptolemaischen Totenbuchern belegt37 und als Besitzerin einer Stele
(vielleicht aus Abydos)38.
Herkunft Die Gotterverbindung zwischen Re-Harachte und Atum ist urspriinglich aus Heliopolis
gut belegt39, andererseits tauchen in Abydos Atum mit dem Epitheton nbjdb.wj Jwnw und Re-Harachte als ntr cl nb p. t bereits in der Re-Harachte-Kapelle des Sethos I.-Tempels als
sich gegenseitig ersetzende Gotter auf40. Auf den Totenstelen tritt dieses Gotterpaar, wie
gezeigt wurde, mit Ausnahme von Achmim in den wichtigen Zentren von Abydos bis Assuan auf.
Die in den theophoren Namensbildungen beider Elternteile der Stelenbesitzerin ent
haltenen Verweise auf die Gottin Mehit legen eine Herkunft der Familie aus dem 8. ober
agyptischen Gau in der Gegend um Thinis/ Abydos bzw. Mescheich41 oder auch aus Achmim42 nahe43. Allerdings besteht auch eine Beziehung zu Edfu, wo spatestens in der
31 Munro, Totenstelen II, Abb. 34.
32 Munro, Totenstelen II, Abb. 51, Papyrus. 33 Munro, Totenstelen II, Abb. 111.134.
34 Munro, Totenstelen II, Abb. 191, Papyrus. 35 Stelen Chicago 31277 und 31667 (Munro, Totenstelen I, 321), Hildesheim 1874 (ebd., 316). 36 H. De Meulenaere, Une famille de pretres thinites, in: CdE 29, 1954, 221-236.
37 U. Kaplony-Heckel, Agyptische Handschriften III, Verz. Or. Handschriften in Deutschland XEX/3,
1986, Nr. 47 (P. Berlin P. 3064 A-B) und Nr. 111 (P. Berlin P. 10478 A-N). 38 Egypte et Province, Musee Calvet, 1985,48, ? 80, Abb. auf S. 41 (Inv. A23). 39 Zuletzt P. J. Brand, The Monuments of Seti I. Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, PA
16,2000,140-142. 40
Calverley/ Gardiner, Abydos I, Tff. 13. 14. 18. 19. 41
Siehe Belege im Index bei Munro, Totenstelen I, 365 u. 367. 42
Siehe Belege im Index bei Munro, Totenstelen I, 368 u. 370. 43 M. Malinine, Un pret de cereales a l'epoque de Darius I (Pap. dem. Strasbourg No. 4), in: Kemi 11,
1950, bes. 23, Anm. h; J.-Cl. Goyon, Les cuites d'Abydos a la basse epoque d'apres une stele du Musee de Lyon, in: Kemi 18, 1968, bes. 37, Anm. 9 u. 38, Anm. 22.; H. De Meulenaere, in: CdE 29, 1954, bes. 223 u. 227f.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2003 Eine Marburger Totenstele mit Anruf an die Lebenden 315
Ptolemaerzeit ein Kult der Mehit bezeugt ist44. Eine topographische Festlegung der Stele
ist somit schwierig, da es Indizien fur mehrere oberagyptische Stadte von Achmim bis Assuan gibt.
Datierung Die Namensbildung Pa-di-mehit ist bereits ab dem 8. Jh. v. Chr. (Stele Louvre C 110)
bezeugt und laBt sich bis in die ptolemaische Epoche durch Denksteine verfolgen (CG 22129). Der Frauenname Ta-scherit-(en)-mehit ist erstmals am Ende der 26. Dyn. belegt45,
haufiger tritt er aber erst ab dem 4. Jh. v.Chr. (z.B. Paris, Guimet C 43, Hildesheim 1874,
Leiden VII,9) und bis in die spatptolemaische Epoche hinein (Kairo CG 22129, 22139, London BM 1141) auf. Der Frauentitel ?Hathor" wird offenbar erst ab der Ptolemaerzeit
benutzt. Die Schreibung des Namens Atum verweist dagegen nach Derchain-Urtel, Epi
graphische Untersuchungen, 73 auf die vorptolemaische Zeit.
Im abydenischen Umfeld kann der hier besprochene Denkstein am ehesten an Kairo T.
28/10/24/246 aus der Phase Abydos III angeschlossen werden, der ebenfalls eine mumien
formige Gestalt sowohl von Re-Harachte als auch von Atum aufweist (nach Munro eine
Anregung aus dem thebanischen Raum), auBerdem einen relativ hohen Duktus des
Schriftstils. Munro datiert diese Stele ?etwa 300-250 v.Chr."47. In Theben stammen die
engsten Parallelen ebenfalls aus Phase III, die das 4. Jh. v.Chr. umfaBt.
Ein Datierungsansatz der Marburger Stele in das 4. Jh. oder den Beginn des 3. Jh. v.
Chr. scheint uns daher aus den genannten Indizien am ehesten vertretbar.
44 Siehe das reichhaltige Material bei S. Cauville, L'hymne a Mehyt d'Edfou, in: BIFAO 82,1982,105 125 sowie dies., Essai sur la theologie du temple d'Horus a Edfou, BdE 102, 1987, 69ff.
45 Collection egyptienne, Musee Granet, Aix-en-Provence, 1995, 64-67, Stele No. 12 (Inv. 832-1-7).
46 Munro, Totenstelen I, 304, II, Abb. 157.
47 Munro, Totenstelen I, 304.
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Tafel 22 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
ii?MM^^^^BBI!ll^^^^^^^^l^^B^^^^^B^ I'^ISlH" OK
vjjll?llll^B^^Birell^l^^ * hii$$:?\." ~ w> Xc ^
^MliiflB|BB - >,- IBI
^t1I1bB^^^^^H^BPB^B^^^^^BB^^^MMH? y *^hPt ,^^|pjMl^^BpWlM|pM||JJBBBMB 4gl
f^MlBBBIB^
^(|p9^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^H^^^^H^^^^^^^P^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ?^^BHI^IH^^^^^^^^^^^^^^^Ii^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^III^^^^^^^^B %lJ^Hfl^HHHBBfl^^B^^^^^^^BBs^HSH^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^H
Stele Marburg 001/95, Gesamtansicht
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
-Myflj?|H v. '<&?
* ̂̂ ^^ ' V
tetim ^B^S^ L> ^ffBBgJi&*< ^
Iw ?BP?BpSwB^Bre - ^ pww|#^ * >jftp^|?gi|||?|f|B "^~~
^?li^BfjH|BPlMlfffHB^ C.
Stele Marburg 001/95, Giebel und Bildfeld w
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Tafel 24 U. Verhoeven / O. Witthuhn SAK 31
lsBwBlBMfflBliM
Stele Marburg 001/95, Name der Besitzerin in Zeile 3
This content downloaded from 134.93.10.23 on Thu, 21 May 2015 07:32:50 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions