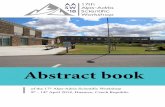Die Alpen-Adria-Region. Bindungen und Grenzen
Transcript of Die Alpen-Adria-Region. Bindungen und Grenzen
Proof
Die Reihe „KLAGENFURTER INTERDISZIPLINÄRES KOLLEG“wird herausgegeben von:
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wilhelm Berger
Mag. Dr. Horst Peter Groß
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Martin Hitz
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Erich Schwarz
Univ.-Prof. Mag. Dr. Reinhard A. Stauber
Proof
Heike Egner / Horst Peter Groß (Hrsg.)
DIE ALPEN-ADRIA-REGIONBINDUNGEN UND GRENZEN
BILDUNGSwISSENScHAFTEN / GEOGRAPHIE / GEScHIcHTE SOZOLOGIE / wIRTScHAFTSwISSENScHAFTEN
Proof
Die interdisziplinäre Lehrveranstaktungsreihe an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, aus der die vorliegende Publikationsreihe hervorgeht, wird seit 2009 von der Privatstiftung Kärntner Sparkasse gefördert.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbib-liografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.ddb. de abrufbar.
© 2013 Profil Verlag GmbH München – Wien
Umschlaggestaltung: Patrick Kagelmann, 10takel design Druck und Bindung: Druck Team GmbH & Co. KGPrinted in Germany
ISBN 978-3-89019-691-6
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-mungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Proof
Inhalt
1.0 Anstelle einer Einleitung 7
1.1 Die Alpen-Adria-Region. Grenzen und Bindungen – Interdisziplinäres „Sparkassenseminar“ 2012 9
Heike Egner & Horst Peter Groß
1.2 Die Alpen-Adria-Region: Brillenscha(r)f 15
Katrin Baumgärtner & Heike Egner
1.3 Grenzen überwinden. FriedensBildung in der Alpen-Adria-Region 25
Bettina Gruber
2.0 Standortbestimmung I – Perspektiven aus der Geographie 35
2.1 Die Hoffnung liegt auf der Region. Zu Recht? 37
Heike Egner
2.2 Pluralität von Regionen. 43
Marika Balode, Rosemarie Mitterbacher, Roswitha Ruidisch & Birgit Wertschnig
2.3 Die Alpen-Adria-Region 2.0. 73
Oskar Januschke & Manfred Rader
3.0 Standortbestimmung II – Historische Wurzeln 109
3.1 „Innerösterreich“ als Teil der Alpen-Adria-Region 111
Werner Drobesch
3.2 Aspekte wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in „Innerösterreich“ im 19. Jahrhundert 117
Ingrid Groß, Anita Lackner, Susanne Ruhdorfer
4.0 Standortbestimmung III – Diversitätsbewußte Perspektiven 165
4.1 Zur sozialen Grammatik der Raumpraxis in der globalisierten Welt 167
Erol Yildiz
4.2 Einblicke in die Alpen-Adria-Raumpraxis 173
Katrin Baumgärtner, Marc Hill, Dragana Jakovljevic , Heidrun Puff, Vera Ratheiser, Elvisa Imširovic
Die Autorinnen und Autoren 197
Proof
9
1.1 Die Alpen-Adria-Region. Grenzen und Bindungen – Interdisziplinäres „Sparkassenseminar“ 2012 Heike Egner & Horst Peter Groß
„Der Begriff „Region Alpen-Adria“ bezeichnet ein Gebiet, das sich einigermaßen
schwer fassen lässt. In der „Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria“, die sich seit 1978
darum bemüht, die inneren Grenzen der Region zu überwinden, haben sich die
österreichischen Bundesländer Burgenland, Kärnten und Steiermark, die ungari-
schen Komitate Baranya und Vas, die italienischen Regionen Lombardei und Vene-
tien sowie die Staaten Kroatien und Slowenien zusammengeschlossen. Gleichzeitig
zeigt die „gelebte Praxis“ (auch an unserer „Alpen-Adria“-Universität), dass der
Umgang mit territorialen Grenzen trotz der Nähe zu den unmittelbaren Nachbarn
in Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien eine ständige Herausforderung darstellt.
Die gemeinsame Lage der Gebiete an Alpen und Adria dient als „Klammer“ für die
Idee einer gemeinsamen Region Alpen-Adria. Nach den Erkenntnissen des Regio-
nal- und Standortmarketings wird eine Region dann erfolgreich sein (was immer
„Erfolg“ heißen mag), wenn die dort lebenden Akteure eine „regionale Identität“
empfinden und aus diesem Impuls heraus ihre Region über Aktivitäten erst hervor-
bringen. Eine gemeinsame „Identität“ lässt sich in der Alpen-Adria-Region bislang
erst in Ansätzen finden. Die Frage nach den Möglichkeiten der Überwindung der
Differenzen beispielsweise in historischer, politischer, wirtschaftlicher, kultureller
oder auch technischer Hinsicht ist nach wie vor offen.
Das interdisziplinäre Seminar wird der Frage nachgehen, welche Grenzen die
Region (nach innen und außen) definiert (wer definiert unter welchen Bedingungen
und mit welchen Auswirkungen?) und welche Bindungen sich finden lassen, die es
erlauben, so unterschiedliche Gebiete (im Hinblick auf Sprache, Kultur, Wirtschaft,
Politik...) zu einer „Region“ zusammenzufassen.“
So lautete der Text der Ausschreibung zum „Interdisziplinären Kolleg 2012“
unter der Leitung von Univ-Prof. Dr. Heike Egner (Institut für Geographie und
Regionalforschung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften), Dr. Horst Peter
Groß (IFWF, Institut zur Förderung von Wissenschaft und Forschung der
Kärntner Sparkasse AG), Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz (Institut für Erziehungs-
wissenschaft und Bildungsforschung) und Ao.-Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner
Drobesch (Abteilung für Neuere und Österreichische Geschichte, beide von
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät) im Sommersemester 2012, das sich
an Doktoratsstudierende sowie Masterstudierende aller vier Fakultäten der
Alpen-Adria-Universität richtete. Es handelte sich dabei um das inzwischen
Proof
10
bereits vierte Seminar dieser Reihe nach „FREIZEIT“ (2009), „Das HAUS“ (2010)
und „VISUELLE KULTUR“ (2011) – jeweils in interdisziplinärer Betrachtung.
Ziel ist es, ein Thema von unterschiedlichen Disziplinen her zu bearbeiten und
dabei von den unterschiedlichen inhaltlichen und methodischen Zugängen
her zu bearbeiten. Es geht darum, die unterschiedlichen Zugänge nicht nur
kennen zu lernen, sondern auch (wissenschaftlich) kompetent zu hinterfragen
und voneinander zu lernen. Gleichzeitig ist dieses Seminar, das vom Arbeits-
aufwand her für alle Beteiligten ziemlich aufwändig ist, eine Übung in Selb-
storganisation, was die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen Gruppen
betrifft; dies gilt auch hinsichtlich der Verfassung des gemeinsamen Textes,
der in der vorgesehenen Publikation einen bestimmten Zugang zum gestellten
Generalthema – Alpen-Adria-Region: Bindungen und Grenzen – abdecken soll.
Die TeilnehmerInnen dieser Lehrveranstaltung müssen also zumindest im
Masterstudium sein (um über hinreichendes disziplinäres und methodisches
Wissen zu verfügen, auf dessen Basis sich erst ein interdisziplinärer Austausch
entwickeln kann) und werden über ein persönliches Gespräch mit den Lehr-
veranstaltungsleiterInnen nominiert.
Das Design des Seminars ist relativ einfach erklärt: Nach einer Auftaktveran-
staltung, in der die LehrveranstaltungsleiterInnen die Besonderheit des Semi-
nars und die damit verbundenen Anforderungen noch einmal explizit darstel-
len, werden gemeinsam mit den Studierenden (die nach einem ersten Briefing
im Zuge ihrer Nominierung mit Ihren unterschiedlichen Vorstellungen in
diese Lehrveranstaltung gekommen sind) die möglichen Forschungszugänge
und -fragen diskutiert, um sich in den jeweiligen disziplinären Gruppen auf
einen bestimmten Fokus zu einigen. Die zweite Phase ist die selbst-organisierte
Recherche der jeweiligen Gruppen, in denen diese sich einen ersten Überblick
über das Thema verschaffen. In einem etwa dreistündigen gemeinsamen Zwi-
schentermin mit allen Gruppen werden die Zwischenergebnisse der Recherchen
gegenseitig präsentiert und mit den LerhrveranstaltungsleiterInnen diskutiert.
Dabei werden der jeweilige inhaltliche Fokus und die weiteren Arbeitsschritte
zur Vorbereitung auf das dreitägige Abschluss-Seminar abgestimmt und fest-
gelegt. Bei diesem Zwischentermin waren auch die für die ARGE Alpen-Adria
zuständigen Beamten der Kärntner Landesregierung (Mag. Wolfgang Platzer
und Mag. Thomas Pseiner) eingeladen, um ihre Arbeit zu präsentieren und den
aktuellen Stand der ARGE sowie auch die speziellen Herausforderungen und
Projekte zu diskutieren. In der darauf folgenden dritten Phase werden die jewei-
ligen Themen in einzelnen Gruppen für das Abschluss-Seminar ausgearbeitet
und in präsentationsgerechte Form gebracht – wobei die jeweiligen Lehrver-
anstaltungsleiterInnen für Rückfragen und als FeedbackgeberInnen zur Verfü-
Proof
11
gung stehen. Das Abschluss-Seminar – in diesem Falle in Bled/Slowenien, also
im Hinblick auf das Thema des Seminars bewusst im „senza confini“ – Grenz-
gebiet von Slowenien, Italien und Österreich – bildet die jeweilige praktische
„Feuertaufe“ für die einzelnen disziplinären Teams, die sich nicht nur gegen-
seitig ihre Forschungsergebnisse und Positionen (verständlich) erklären, son-
dern auch versuchen müssen, die Zugänge der anderen Gruppen zu verstehen
und „wissenschaftlich“ zu hinterfragen. – Keine einfache Aufgabe, zumal der
interdisziplinäre Dialog in der wissenschaftlichen Community, die sich über-
wiegend fachspezifisch und sehr spezialisiert profilieren muss, vielfach selbst
noch in den Anfängen steckt.
Doch damit nicht genug: Um es für die Studierenden noch etwas „anspruchs-
voller“ und praxisorientierter zu gestalten, sind in einem weiteren Schritt am
zweiten Tag des Abschluss-Seminars auch Praxispartner eingeladen, denen
die jeweiligen Ergebnisse der einzelnen Gruppen „in aller Kürze“ darzustellen
sind (d. h. analog einer „Vorstandssitzung,“ wo es darum geht, die wichtigsten
Ergebnisse, welche einen kompetenten Überblick über die jeweilige „Sache“
ergeben, zu präsentieren). Dies ist wiederum eine völlig andere Herausfor-
derung, wie auch die anschließende Diskussion mit den Praxispartnern1, die
ganz andere Fragen stellen als zuvor die Studierenden untereinander.
Die letzte Phase nach dem Seminar besteht für die Studierenden in der gemein-
samen Ausformulierung der jeweiligen disziplinären Beiträge für die Publika-
tion, wobei nach Möglichkeit die jeweiligen Erkenntnisse aus dem inter- und
transdisziplinären Dialog des Seminars mit einfließen sollen. Insgesamt ist
das „Interdisziplinäre Seminar“ eine sehr anspruchsvolle arbeits- und zeitauf-
wändige Veranstaltung; und dennoch sind die Rückmeldungen der Studieren-
den, wie schon in den vergangenen drei Seminaren, erfreulich positiv.
Erwähnt werden muss vielleicht noch, dass – quasi als Belohnung für den
überdurchschnittlichen Aufwand – das Abschluss-Seminar traditionell nicht
an der Universität, sondern in einem schönen Seminarhotel stattfindet. Dabei
ist immer auch ein Freizeitprogramm eingeplant, das in diesem Falle aus
einer mehrstündigen Wanderung vom Loiblpass (ein „geschichtsträchtiger“
Grenzübergang in den Karawanken zwischen Kärnten und Slowenien) nach
Begunje in Slowenien bestanden hat. Wir sind „Slowenien entgegen“ gegan-
1 Josef Laussegger, CEO der Banka Sparkasse d.d./ Slowenien; Mag. Friedrich Veider, Organisationsentwickler und Regionalmananger aus Lienz/Osttirol; Christian Smerietschnig, bigbang – Kanzlei für Kommunikation, Klagenfurt; Prof. Dr. Dietrich Kripfberger, Privatstiftung Kärntner Sparkasse
Proof
12
gen und dabei einem Wanderpfad aus dem gleichnamigen Buch2 des Univer-
sitätskulturzentrums UNIKUM gefolgt – eine grenzüberschreitende und zum
Teil herausfordernde, aber ausnehmend schöne Wanderung von den Karawan-
ken hinunter Richtung Bled mit kultur- und geschichtswissenschaftlicher
Betrachtung.
Im vorliegenden Seminar erhielten wir folgende Feedbacks, wobei als „augen-
zwinkerndes“ Motto im Hinblick auf die heftige Diskussion um die „korrekte“
Verwendung der Begriffe „Raum“ und „Region“ der Satz: „Wir sitzen gemeinsam in
einem (Such-)RAUM und wissen nicht, in welcher REGION wir uns eigentlich befin-
den …“ vorangestellt werden kann.
„Blitzlicht“ am Ende des ersten Tages:
• Spannend
• Erstaunlich, wie intensiv man sich mit Begriffen beschäftigen kann
• Interessant sind diese verschiedenen Perspektiven, Frosch|Vogel
• Die Diskussion gefällt mir gut, die Grenzen …
• Nach der Früh, wo ich (mir) sicher war, bin ich nun irritiert
• Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt; ich kann nun bei meinem schriftlichen
Beitrag auch auf die anderen eingehen
• Vielfalt und Durcheinander! Ich habe das Bedürfnis, dass dies absitzt und ich
eine Adlerperspektive bekomme
• Ich bin dankbar für das Feedback; aber es ist Chaos eingetreten, in das ich wieder
Ordnung hineinbringen muss – vielleicht morgen?
• Die vermeintlichen Klarheiten sind bescheiden
• Der Sinn des Seminars? – Nachdenken über die Region. Über die nationalen
Grenzen hinauszugehen und Menschen zu verbinden; es ist wichtig, darüber zu
diskutieren
• Interessant, verschiedene Perspektiven! Wir müssen aufräumen, um Struktur
hereinzubringen
• Intensiv! – Ich bin sprachlos
2 Gerhard Pilgram/Wilhelm Berger/Gerhard Maurer: Slowenien entgegen – Zu Fuß von Klagenfurt nach Ljubljana; Drava Verlag/UNIKUM, Klagenfurt 2004
Proof
13
• Das Problem könnte sein, dass wir disziplinär denken. Analog dazu könnte es das
Problem mit dem Transnationalen sein, dass es so schwierig ist, weil wir national
denken. Vielleicht hilft folgendes: Egal was du denkst, denk‘ das Gegenteil!
• Erweiterung des Erkenntnisstandes, des Bewusstseinshorizonts; Wissen-
schaft ist der Veränderung unterworfen, eine letzte, endgültige Antwort der
Wissenschaft kann es nicht geben – auch nicht der Naturwissenschaft. Was
heute richtige Antwort ist, kann morgen schon anders sein.
• Es hat mir gezeigt, welchen Mut es braucht, die eigenen Begrifflichkeiten in
Frage zu stellen; daher auch diese Erschöpfung.
Das Abschluss-Feedback der Studierenden:
• Sehr positiv war die Wertschätzung, die geherrscht hat, bei den LeiterInnen, aber
auch den Gruppenmitgliedern.
• Das angenehme Arbeitsklima.
• Die anderen und unterschiedlichen Sichtweisen.
• Die Intensität des Seminars! Sie erforderte hohe Konzentration; das war nicht
lauwarm, sondern heiß.
• Ich habe auch einige Irritationen mitgenommen.
• Egal was du denkst, denke das Gegenteil.
• Ich wurde zum Nachdenken angeregt, wir haben in der Gruppe abends noch
lange diskutiert.
• Wir haben Zeit gehabt, mehr als in anderen Seminaren, um sich mit einem Thema
zu beschäftigen
• Positiv war die Wanderung vorweg! Dabei konnten wir uns gleich besser kennen-
lernen. Minuspunkt dazu: Wir hätten vorher genauer wissen sollen, WAS das für
eine Wanderung ist.
• Ein Pluspunkt waren die Praxispartner, ihre sehr persönlichen Stellungnahmen.
Da wurden die Bedeutung der Sprache (Kenntnis der anderen Sprachen) und der
Wert der persönlichen Beziehungen deutlich. Daran müssen wir mehr arbeiten,
um den Nationalismus zu überwinden!
Proof
14
• Das Seminar hat uns gezeigt, wo wir in unseren interdisziplinären Bestrebungen
stehen; da ist noch viel zu lernen, weil man sich interdisziplinär nur dann öff-
nen kann, wenn man eine disziplinäre Verankerung hat (einen Standort, einen
Standpunkt)
• Positiv war der Standortwechsel nach Bled.
• Idee: Den Zwischentermin länger und intensiver gestalten.
• Idee bzw. Anregung für die „interdisziplinäre Diskussion“ am Ende des ersten
Tages: Dafür sollten sich die Gruppen vorbereiten, indem sie (schon vor dem
Abschlusstermin) ein Handout für die anderen erarbeiten, in dem die diszipli-
näre Sicht auf das Thema zusammengefasst ist: Was sagt meine Disziplin dazu!?
• Mein Symbol für dieses Seminar ist: Wachsen! Dadurch, dass wir umgepflanzt
worden sind, einerseits im Sinne der Interdisziplinarität, andererseits in der
Gruppe. Das Bild dazu: Aus einem festen Boden kommt etwas Gutes heraus.
Doch auch das Feedback bzw. die Stellungnahmen der LV-LeiterInnen fallen
erfahrungsgemäß sehr positiv aus. Im vorliegenden Fall konnte folgendes
registriert werden:
• Wo war die Kritik? – Ich bin überwältigt!
• Auch für mich bin ich auf einige Aspekte gekommen, über die ich nachdenken muss.
• Ich habe das Seminar als sehr angenehm empfunden.
• Es war eine Herausforderung, es waren viele Spannungsmomente dabei.
• Man hat am Anfang keine Ahnung, wie es weitergehen wird, aber man kommt an
ein Ziel; der zweite Teil ist nun die Publikation.
• Ich habe für mich mitgenommen, dass man doch den Schritt aus der Enge seines
Faches wagen sollte; vielleicht sollte man so ein interdisziplinäres Seminar auch
aus der Universität selbst heraus veranstalten?
• Das Seminar war ereignisreich, es gab Überraschungen (auch bei der Wande-
rung); positiv war auch die Steigerung innerhalb des Seminars von der ersten zur
zweiten Präsentation, und dass man das so gut schafft!
Diese „Befunde“ geben Anlass zur Hoffnung, dass dieses interdisziplinäre Kol-
leg weitergeführt wird.
Proof
15
1.2 Die Alpen-Adria-Region: Brillenscha(r)fKatrin Baumgärtner & Heike Egner
1.2.1 Was hat das Kärntner Brillenschaf mit der Alpen-Adria-Region zu tun?
Mit „Alpen-Adria“ wird eine Region bezeichnet, von der eigentlich niemand so
richtig weiß, welche Gebiete darunter zu fassen sind und was diese Region im
Inneren ausmacht und zusammenhält. An Deutungsversuchen und Konkreti-
sierungen der Selbstbeschreibung fehlt es nicht (vgl. beispielsweise Moritsch
2001, Valentin 2006, Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria 2001 oder auch die Bei-
träge aus geographischer Perspektive in diesem Band). Fragt man aber konkret
nach, was diese Region zusammenhält und wer oder was genau dazugehört,
dann beginnt in der Regel eine lange Diskussion, an deren Ende nur eines
bleibt: Unklarheit. Die Frage nach der Alpen-Adria-Region berührt auf diese
Weise ganz grundsätzliche Fragen der Identität und der Zugehörigkeit von
Menschen und Dingen. Dabei geht es auch immer um den Wunsch nach Ein-
deutigkeit in der Zuordnung, nach Klarheit, Homogenität, Reinheit und Ord-
nung (vgl. Räthzel 1999). Dieser Wunsch hat zur Folge, dass Differenzen kons-
truiert werden, um so anhand unterschiedlichster Kategorien ein Wir von den
Anderen abgrenzen zu können. All diese Aspekte finden sich vom Großen bis
zum Kleinem wieder: beispielweise bei Nationen, Regionen oder Gruppen: wer
wird warum als zugehörig oder fremd angesehen, was sind die Ein- und Aus-
schlussmechanismen und durch welche Alltagspraktiken und Diskurse wird
dies im Konkreten hergestellt?
Und damit sind wir beim Brillenschaf, das aufgrund seiner Geschichte fast als
ein Paradebeispiel für das Hin und Her in der Frage der Zugehörigkeit sowie für
die Uneindeutigkeit bei der Suche nach Eindeutigkeit, Reinheit, Homogenität
und Ordnung verstanden werden kann. Das Brillenschaf dient uns in diesem
Beitrag als „lupenreines“ Beispiel, anhand dessen wir einige historische Ent-
wicklungen sowie Diskurslinien in der Debatte um die Region versuchen kön-
nen zu verstehen.
Proof
16
1.2.2 Die Geschichte des Kärntner Brillenschafes – Eine Geschichte von Bindungen und Grenzziehungen3
a) Bindungen durch Rassenkreuzungen
Die Wurzeln des Brillenschafes reichen bis in das 18. Jahrhundert zurück, als
sich in den Alpenländern die Wolle zum wichtigsten Produkt der Schafzucht
entwickelt hatte und daher nach Schafen mit sehr feiner Wolle gesucht wurde
(vgl. Schafe- und Ziegenzuchtverband o.J., S. 2 f.). Zwar erfüllten verschiedene
Rassen aus England, Spanien und Schweden dieses Kriterium, aber sowohl
aufgrund von Ausfuhrhindernissen und -verboten als auch aufgrund der
Entfernung wurde stattdessen im unmittelbaren Umfeld nach „edlen Scha-
fen mit einer sehr feinen, zu allen Manufakturen tauglichen Wolle“ (ebenda,
S. 2) gesucht. Das war die Geburtsstunde des Brillenschafes als „Drei-Länder-
Schaf“, das durch die Kreuzung der drei Rassen des alten Kärntner Landschafes
mit dem oberitalienischen Bergamasker Schaf und vor allem mit dem Paduaner
Seidenschaf gezüchtet worden ist (vgl. Schwend 2001, S. 3 ff.). Sein ursprüngli-
cher Name Seeländerschaf verweist auf das ursprüngliche Hauptverbreitungs-
gebiet: Seeland, die heutige slowenische Gemeinde Jezersko. Rasch verbreitete
sich das Brillenschaf von dort aus in ganz Kärnten, Krain4, in der Steiermark
sowie in weiten Teilen der Habsburgermonarchie einschließlich Südtirol und
im bayerischen Voralpenland, da es bestens an die klimatischen und topogra-
phischen Anforderungen dieser gebirgigen und niederschlagreichen Gebiete
angepasst war. Das Brillenschaf zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr genüg-
sam und robust, dabei leichtfüßig und leichtfüttrig ist, eine hohe Fleischaus-
beute hat und auf dessen sehr feinen Wolle der Niederschlag gut abperlt (vgl.
Schwend 2001, S. 4).
Trotz all dieser Vorteile blieb die Schafzucht ein eher vernachlässigtes Segment
der Viehwirtschaft mit einer eher geringen Marktleistung. Aufgrund der feh-
lenden Feinheit des Vlieses erlangten die Kärntner Schafe, unter diesen auch
das Brillenschaf, für die Wollerzeugung keine wirkliche Bedeutung. Allerdings
wurde das Brillenschaf aufgrund seiner Fleischqualität bis ins ausgehende 19.
Jahrhundert zu einem begehrten Artikel im europäischen Ausland: Jährlich
wurden etwa 50.000 Brillenschafe als Schlachttiere in die Schweiz, nach Frank-
3 Wir danken Herrn Friedhelm Jasbinschek, Vorsitzender des Vereins der Kärntner Brillenschafzüchter Alpen-Adria, für das Interview und die Informationen über das Brillenschaf, welche nachfolgend in den Text einfließen.
4 Bis 1918 waren große Teile des heutigen Slowenien als Kronland Krain eine eigenständige Verwaltungseinheit.
Proof
17
reich und Deutschland exportiert – aufgrund seiner Robustheit konnte es von
den Alpweiden direkt auf die dortigen Märkte getrieben werden (vgl. Schafe- und
Ziegenzuchtverein o. J., S. 4). Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts brach die Schaf-
zucht ein, da die Zölle für lebende Schafe erhöht wurden und darüber hinaus die
Konkurrenz aus Übersee billigere Wolle anbot. Wurden 1880 noch 167.809 Schafe
gezählt, waren es 1900 nur mehr 118.563 (vgl. Erker 2003, S. 372). Und die Talfahrt
ging weiter: 1910 wurden in Kärnten nur mehr 71.316 Schafe gezählt. Selbst die
kostenlose Überlassung von Zuchtwiddern führte zu keiner Wende (vgl. ebenda,
S. 406). Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Schafzucht wieder rentabel,
da der erhöhte Fleischbedarf der Bevölkerung im Zuge des ersten Weltkrieges zu
einer Preissteigerung der Schafe führte. 1923 waren die Erlöse aus der Schafzucht
schließlich um 90 % größer als vor dem Ersten Weltkrieg.
b) Grenzziehungen durch Rassentrennung
Die nationalsozialistischen Reinheitsvorstellungen des Dritten Reiches führ-
ten auch in der Tierzucht zu einer Zentralisierung mit einer Vielzahl von staat-
lichen Regulierungen (vgl. IÖW et al. 2004, S. 26 ff.). Am 17. März 1936 wurde das
„Reichsgesetz zur Förderung der Tierzucht“ als eine Art Rahmengesetz verab-
schiedet, das die Vereinheitlichung der Tierzucht im gesamten Reich zum Ziel
hatte und Grundlage für eine große Anzahl von Erlassen und Verfügungen war.
Sie dienten der Rassenbereinigung, also zur „Beseitigung der Rassenvielfalt
und zur Herstellung der Rassenreinheit“ (Kunze 1984, S. 168). Die große Zahl an
verschiedenen Bergschafen wurde als „hemmend für den züchterischen Fort-
schritt gesehen“ (Schwend 2001, S. 5), daher wurden 1939 alle Bergschafrassen
zum „Deutschen Bergschaf“ zusammengefasst. Als Rasseziel galt das Berga-
masker Schaf, weil es „stets reinweiß“ war (vgl. ebenda). Auch in Österreich
galten ab März 1938 nach dem so genannten Anschluss die deutschen Gesetze.
In den folgenden Jahren kam es vor diesem Hintergrund zu einer Verdrän-
gungszucht des Kärntner Brillenschafes mit reinweißen Bergamaskerwiddern,
so dass die großen Populationen verschwanden. Einige Kärntner Bauern aller-
dings, die verstreut Kleinherden über ganz Kärnten hatten, widersetzten sich
dem und verkörperten so den Widerstand gegen das Dritte Reich, denn für sie
gehörte das Brillenschaf zum regionalen Kulturgut (vgl. Arrieta 2007, o. s. ).
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt das Brillenschaf als beinahe ausgestorben
(vgl. Schwend 2001, S. 5). Gleichzeitig ließ das Interesse an der Schafzucht ins-
gesamt nach, da in der Nachkriegszeit weder Wolle noch Schafsfleisch gefragt
waren. Die insgesamt wachsende Nachfrage nach Fleisch wurde durch eine
verstärkte Rinderzucht befriedigt.
Proof
18
Bis Mitte der 1950er Jahre wurden noch einige wenige Brillenschafe von einzel-
nen Züchtern zwischen Slowenien und Kärnten ausgetauscht. Aber auch das
kam durch den „Eisernen Vorhang“ fast völlig zum Erliegen – nur noch verein-
zelt wurden Schafe illegal über die grüne Grenze geschmuggelt.
c) Bindungen durch Rassenerhaltungsbestrebungen in grenzüberschreitender Zusammenarbeit
Im Zuge des Diskurses um Artenvielfalt („Vielfalt statt Einfalt“) und der Rück-
besinnung auf alte, vom Aussterben bedrohte Arten wurden auf Privatinitia-
tive hin Ende der 1980er Jahre tierische „Restressourcen“ des Brillenschafes für
eine Erhaltungszucht gesucht, um einer Inzucht der kleinen Kärntner Popula-
tion entgegenzuwirken – damals noch inoffiziell in Slowenien, wohin trotz des
Eisernen Vorhangs noch lose Kontakte bestanden. Nach Ende des Kalten Krie-
ges wurde dann auch in Slowenien offiziell und über die Medien gesucht und
zwölf phänotypische Tiere importiert. 1995 wurde der Verein der Kärntner Bril-
lenschafzüchter Alpen-Adria gegründet und im gleichen Jahr lief auf Initiative
des Vereins das Kärntner-slowenische Interreg-Projekt „Schafzucht ohne
Grenzen“ an.
Für ein Interreg-Projekt, das damals binational angelegt war, war ein Spiegelpro-
jekt im Nachbarland notwendig, weswegen 1997 mit Unterstützung des Vereins
der Kärntner Brillenschafzüchter Alpen-Adria ein slowenischer Schafzuchtver-
band gegründet wurde. Ziele des Projekts waren ein Zuchtprogramm zur Erhö-
hung und Stabilisierung der Population, die Zusammenarbeit von Kärntner
und slowenischen Schafzüchtern sowie ein Informationsaustausch auch mit
deutschen und südtiroler Züchtern. Diese Projektziele wurden erreicht und die
Zusammenarbeit von den Kärntner und slowenischen Züchtern war gut – auch
sprachlich gab es keinerlei Probleme, denn insbesondere in der Grenzregion kön-
nen viele Züchter, trotz des Kalten Krieges, sowohl Deutsch als auch Slowenisch –
zudem Englisch. Darüber hinaus wurde mit den Universitäten Wien und Ljubljana
ein Zuchtprogramm für die Rückzucht und die Rasseerhaltung entwickelt.
d) Das Brillenschaf heute – erneute Grenzziehungen sowie Bindung durch Marketing
Heute ist die Population des Brillenschafes stabilisiert. Die Schwerpunkte der
Züchtung liegen in Österreich in Südkärnten, um St. Pölten und im Salzbur-
ger Raum. Im österreichischen Zuchtprogramm sind heute etwa 5.000 weibli-
che und 250 männliche Tiere verzeichnet, das heißt, sie sind im Herdenbuch
Proof
19
mit Abstammungsnachweis aufgenommen. Darüber hinaus findet sich eine
Schwarzpopulation von etwa 1.000 Tieren, die nicht im Zuchtprogramm ver-
zeichnet sind, aber dennoch zu den Kärntner Brillenschafen zählen. Außer-
halb von Österreich finden sich Brillenschaf-Populationen in Slowenien, Süd-
tirol, Südostbayern, Norddeutschland und sowie vereinzelt auch in der Eifel.
Im österreichischen Zuchtprogramm wird heute ein weibliches Tier jährlich
mit 55 Euro und ein männliches mit 130 Euro gefördert; in Slowenien hingegen
erhalten Züchter für ein Tier in der Reinzucht nur 18 Euro pro Jahr. Auf dem
Markt kann man für einen Widder etwa 1.000 bis 2.000 Euro erzielen.
Mittlerweile sind die im Rahmen des Zuchtprogramms angelegten Herdenbü-
cher in Österreich und Slowenien geschlossen, mit der Folge, dass eine erneute
Grenzziehung erfolgt: Die so genannte Fremdblutzufuhr wurde beendet – das
heißt, für die Kärntner Zucht werden nur Kärntner Brillenschafe, für die slowe-
nische Zucht nur slowenische Brillenschafe benutzt. Zwar gehören beide einer
Rasse an, aber es sind unterschiedliche Schläge, die mit der Zucht verfolgt wer-
den. Sie unterscheiden sich vor allem in der Stärke der Pigmentierung ihrer
Brillen. Die Grenzziehungen finden jedoch alleine in den Züchtungslinien
ihren Niederschlag. Die Züchter in Österreich, Slowenien, Deutschland, Italien
und der Schweiz sind gut untereinander vernetzt und es findet ein lebhafter
und regelmäßiger Wissensaustausch statt.
Das Kärntner Brillenschaf dient mittlerweile als ein regionales Produkt mit
dem in Wort und Bild rechtlich geschützten und eingetragenen Markenna-
men „Kärntner Brillenschaf“ (Abb. 1.1). Die Verkaufsstrategie basiert zum
einem auf Selbstvermarktung auf den Höfen der Züchter, zum anderen auf
Lebendverkauf der Schafe auf Märkten. Das Brillenschaf wird außerdem
zunehmend auch als Therapieschaf in psychosozialen Projekten aufgrund
seines ruhigen Wesens eingesetzt.
Zu einer guten Marke gehört auch ein entsprechendes Sponsoring – dem Kärnt-
ner Brillenschaf ist dies, ganz im Gegensatz zu der Alpen-Adria-Region selbst,
ausgezeichnet gelungen. 1998 hat der Verein der Kärntner Brillenschafzüchter
Alpen-Adria mit dem Augenoptikunternehmen Fielmann AG aus Hamburg einen
prominenten Sponsor gefunden, der die Arbeit und Ziele des Vereins unterstützt
und damit maßgeblich zu der Etablierung des Kärntner Brillenschafs beiträgt. Der
Unternehmer Günther Fielmann betätigt sich selbst als Biobauer, besitzt heute
ebenfalls etwa 300 Kärntner Brillenschafe und fördert viele naturwissenschaftli-
che Projekte, da er an der Erhaltung vom Aussterben bedrohter Arten interessiert
ist (vgl. Fielmann AG o.J.). Der Vorsitzende des Vereines der Kärntner Brillenschaf-
Proof
20
züchter Alpen-Adria, Friedhelm Jasbinschek, warb Günther Fielmann als Sponsor
und der Verein konnte – neben der finanziellen Unterstützung – auch auf dessen
Marketingwissen zurückgreifen. Die Fördergelder von Fielmann wurden für die
Erstellung eines Herdenbuchs, für wissenschaftliche Arbeiten (z. B. die Disser-
tation von Katharina Schwend 2001), die Einführung und Pflege von EDV sowie
Marketing genutzt. Als Gegenleistung nutzt Fielmann das Brillenschaf für sein
eigenes Marketing. Die Verbindung zwischen dem Verein und seinem Sponsor
ist eng: Der Vereinsgründer und Obmann Friedhelm Jasbinschek besucht den
Sponsor Günther Fielmann etwa zweimal jährlich und betreut ihn persönlich als
Züchter. Zu Beginn des Jahres 2013 löste sich der Verein aufgrund der steigenden
Züchterzahlen und der Erweiterung der Aufgaben auf und übergab seine Arbeit
an die Landwirtschaftskammer Kärnten und den Schaf- und Ziegenzuchtverband
Kärnten. Die Arbeit am Brillenschaf ist damit auch amtlich institutionalisiert.
Abb. 1.1 Schild eines Kärntner Zuchtbetriebes (Bild: Katrin Baumgärtner).
Proof
21
1.2.3 Fazit: Das Kärntner Brillenschaf als Symbol für die Hybridität von Kulturen
Die Geschichte des Brillenschafes zeigt ein beständiges Hin und Her basierend
auf der Frage nach der Zugehörigkeit, die sich auch in der Zugehörigkeit zu einer
Region ausdrückt. Das Brillenschaf hat seine Wurzeln in unterschiedlichen
Schafrassen aus Oberitalien, Slowenien und Kärnten – es ist als Kreuzung ein
biologisches Hybrid und gleichzeitig ein sozial-erzeugtes hybrides Produkt
einer Region, das durch seine unterschiedlichen Wurzeln mit je unterschied-
lichen Vorzügen optimal an die Region angepasst ist und so bis zum Dritten
Reich eine Erfolgsgeschichte war. Die Homogenitäts- und Reinheitsvorstellung
der Nationalsozialisten setzten dem ein Ende. Es wurde eine Rasse aufgrund der
Eigenschaft „reinweiß“ aufgewertet und die andere als minderwertig abgewer-
tet, obwohl sie bestens aufgrund einer Vielzahl von Eigenschaften an die Region
angepasst war. Verstärkt durch den Kalten Krieg, dessen „Eiserner Vorhang“ quer
durch das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Brillenschafes führte, starb das
Brillenschaf fast aus. Die Grenze, die durch eine Region gezogen wurde und nati-
onalstaatliche Homogenitäten durch beinahe hermetische Abriegelung wahrte,
bedeutete folglich fast das Ende eines transnationalen Schafes. Erst nach dem
Ende des Kalten Krieges, dem Öffnen der Grenzen und (finanziell) durch die
europäische Integration gefördert war es möglich, das Schaf wiederzubeleben.
Bemerkenswert ist, dass es ein Prozess von Unten war, der auf grenzübergrei-
fender Initiative der Schafszüchter beruhte. Sie waren auf Zusammenarbeit und
Vernetzung angewiesen, um das Brillenschaf zu retten. Die informellen Struktu-
ren und Netzwerke, die durch die regionale Zusammenarbeit entstanden, wurde
durch den Prozess der europäischen Integration und dem Bereitstellen finanzi-
eller Mittel formalisiert und gefestigt – so dass ein bottom-up- mit einem top-
down-Prozess korrespondierte. Heute differenziert sich das Brillenschaf wieder
weiter aus. Der Stamm mit seinen unterschiedlichen Wurzeln ist der Gleiche,
aber es gibt (wieder) verschiedene Schläge wie das Kärntner Brillenschaf (in
Kärnten), das Jezersko-Solcavska-Schaf in Slowenien oder das Villnößer Schaf in
Südtirol. Sie unterscheiden sich anhand von Äußerlichkeiten wie beispielsweise
in der Stärke der Pigmentierung ihrer Brillen, werden aber getrennt vermarktet
und es wird wert darauf gelegt, diese in der „Reinzucht“ nicht zu vermischen.
Es werden also einerseits wieder Grenzen gezogen, andererseits sind Bindungen
entstanden und die Brillenschafzüchter arbeiten grenzüberschreitend zusam-
men, sind sehr gut vernetzt und es findet ein laufender Wissensaustausch statt:
„Das Projekt ist lebendig und wird gelebt“ (Friedhelm Jasbinschek). Darüber hin-
aus hat das Schaf auch wieder – wie schon vor etwa 150 Jahren – seinen Sprung
über seine Ursprungsregion geschafft. Züchter nicht nur aus Italien, Slowenien
Proof
22
und Kärnten, sondern auch aus ganz Österreich, der Schweiz und Deutschland
arbeiten zusammen und vergrößern stetig die Population eines fast ausgestor-
benen Tieres und wecken auch in anderen Ländern Interesse – wie neuerlich in
Kroatien. So entwickelt sich die einstige Erfolgsgeschichte – nach einem jahr-
zehntelangen Stillstand – wieder weiter.
Für uns ist die Geschichte des Kärntner Brillenschafes fast eine Parabel5 für die
Geschichte der Alpen-Adria-Region, die ihren Charme eben nicht durch Rein-
heit, Ordnung und Homogenität, sondern vielmehr durch ihre Vielfalt an Spra-
chen, Traditionen, kulturellen und sozialen Praktiken und politisch-ökono-
mischen Perspektiven gewinnt. Die Alpen-Adria-Region ist in dieser Hinsicht
auf dem Weg zu einer hybriden Kultur, die Grenzen durchlässiger werden lässt
und bei der das eine in dem anderen enthalten ist (vgl. Tschernokoshewa 2005,
S. 15 f.). Zwar könnte das Beispiel des Kärntner Brillenschafs eine eher biolo-
gistische Deutung des Begriffs Hybrid nahelegen, dies ist jedoch ausdrücklich
nicht gemeint. Hybridität als Konzept beschreibt das Zusammenführen zweier
oder mehrerer getrennter unterschiedlicher Phänomene und veranschaulicht
die Durchlässigkeit, die Überschneidung und das Überschreiten von Grenzen.
So stehen soziale Praktiken, historische Prozesse, eigenen Lebenserfahrungen
und Aushandlung unterschiedlicher Machtinteressen im Mittelpunkt (vgl.
Tschernokoshewa 2005, 2011). In dieser Perspektive sind letztlich auch Zucht-
entscheidungen ein Ausdruck sozialer Praxis und Manifestation gesellschaft-
licher Diskurse. An ihnen wird deutlich, welche Präferenzen gesellschaftlich
getroffen werden (können) und in welcher Weise sich Gesellschaft („Kultur“)
zu Lebewesen und Dingen („Natur“) in Beziehung setzt.
Am Beispiel des Brillenschafes lässt sich zeigen, welchen Weg die Alpen-Adria-
Region gehen und in welche Richtung sie sich entwickeln könnte. Verantwort-
lich für die Wiedergeburt und die -etablierung des Brillenschafes waren die
Rückbesinnung auf die gemeinsamen, grenzüberschreitenden, alpen-adri-
atischen Wurzeln, auf das Verbindende, das gemeinsame Engagement, die
Zusammenarbeit, der Zusammenhalt der Akteurinnen und Akteure und ein
gemeinsames Ziel – und das nach der Abschottung durch territoriale und ideo-
logische Grenzziehungen, dem Verbot und dem Zusammenbruch von Kommu-
nikation und Interaktionen über ein knappes halbes Jahrhundert. Das Enga-
gement um das Brillenschaf zeigt, dass dieses Trauma überwunden werden
kann.
5 Im Sinne einer lehrhaften und kurzen Erzählung, die Fragen über die Moral und ethischen Grundsätze aufwirft und dessen im Vordergrund stehendes Geschehen eine symbolische Bedeutung für die Lesenden hat (vgl. Elm 1991).
Proof
23
Die Alpen-Adria-Region hingegen scheint dieses Trauma noch nicht auf- und
verarbeitet zu haben. Gleichzeitig scheinen in den verschiedenen beteiligten
Regionen (nationale) Homogenitätsvorstellungen und Reinheitsvorstellungen
noch so dominant zu sein, dass die einstigen Grenzen in den Köpfen nicht ver-
schwinden können. So steht oftmals das Trennende und nicht das Verbindende
im Vordergrund. Es müsste ein bottom-up-Prozess entstehen, der danach fragt,
auf welche gemeinsame Wurzeln eine Alpen-Adria-Region zurück blicken
kann, was sie zusammenhält, wofür sie steht und wohin sie sich in gemein-
samer Zusammenarbeit entwickeln soll. Dabei stellt sich die Frage, wer die-
sen Prozess tragen könnte? Bisher scheint „Alpen-Adria-Region“ zwar bereits
ein geflügeltes Wort zu sein, jedoch ist nicht klar, was damit gemeint ist: Es
gibt eine Verpackung, aber kaum Inhalt. So müsste die Alpen-Adria-Region vor
allem von der Bevölkerung als den aktiven Akteurinnen und Akteuren als eine
Region gelebt und erlebt werden. Erst dann kann sich eine hybride Kultur auch
so manifestieren, dass sie sich räumlich verorten lässt.
Literatur
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (2001): Minderheiten und Grenzüberschreitende Zusammenar-beit im Alpen-Adria-Raum. Trient.
Arrieta, Teresa (2007): Friedhelm Jasbinschek. Hausverstand und bäuerliches Auge (online unter http://oe1.orf.at/artikel/211506, zuletzt besucht am 02.03.2013)
Elm, Theo (1991): Die moderne Parabel. Stuttgart.
Erker, Konrad (2003): Von Maria Theresia zur EU. Geschichte und Wirken der landwirtschaftlichen Berufskörperschaft Kärntens im Spiegel der eigenen Presse. Klagenfurt.
Fielmann AG (o. J.): Hof Ritzerau (online unter www.fielmann.de/gesellschaftliches-engagement/hof-ritzerau, zuletzt besucht am 24.02.2013).
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Öko-Institut e.V, Schweisfurth-Stiftung, Freie Uni-versität Berlin & Landesanstalt für Großschutzgebiete (2004): Agobiodiversität entwickeln! Handlungsstrategien für eine nachhaltige Tier- und Pflanzenzucht. Endbericht – Kapitel 4: Rechts- und Insitutionenentwicklung (online unter http://www.agrobiodiversitaet.net/download/4Rechtinstitution.pdf, zuletzt besucht am 21.02.2013).
Kunze, Eberhard (1984): Gesetzgebung und allgemeine staatliche Förderung. In: Gustav Comberg (1984): Die deutsche Tierzucht im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart, S. 141–181.
Moritsch, Andreas, Hg. (2001): Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Cevolec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj.
Räthzel, Nora (1999): Hybridität ist die Antwort, aber was war noch mal die Frage? In: Brigitte Kossek (Hg.): Gegen-Rassimen: Konstruktionen – Interaktionen – Interventionen. Hamburg,: 204–219.
Schafe- und Ziegenzuchtverband Kärnten (o. J.): Das Kärntner Brillenschaf, Klagenfurt (online unter www.brillenschafe.at/geschichte/, zuletzt besucht am 15.12.2012).
Schwend, Katharina (2001): Untersuchung zur genetischen Variabilität der Kärntner Brillenschafe in Österreich, Dissertation, Wien.
Proof
24
Tschernokoshewa, Elka (2011): Die hybridologische Sicht. Von der Theorie zur Methode. In: Elka Tschernokoshewa & Ines Keller (Hg.): Dialogische Begegnungen. Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht. Münster, New York, München, Berlin, S. 11–30.
Tschernokoshewa, Elka (2005): Geschichten vom hybriden Leben: Begriffe und Erfahrungswege. In: Elka Tschernokoshewa & Marija Juric Pahor (Hg.): Auf der Suche nach hybriden Lebens-geschichten. Theorie – Feldforschung – Praxis. Münster, New York, München, Berlin, S. 9–41.
Valentin, Hellwig (2006): Strategien und Perspektiven der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria. Rede manuskript (online unter www.alpeadria.org/deutsch/index.php?page=595301927&f=1&i=595301927, zuletzt besucht am 18.02.2012).
Verein der Kärntner Brillenschafzüchter Alpen-Adria (o.J.): Das Kärntner Brillenschaf, Klagenfurt.
Proof
25
1.3 Grenzen überwinden. FriedensBildung in der Alpen-Adria-RegionBettina Gruber
„Die Grenze ist etwas Zwiefaches und Doppeldeutiges: bisweilen ist sie eine Brücke,
um dem anderen entgegen zu gehen, bisweilen eine Schranke, um ihn zurückzu-
stoßen: Oft entspringt sie dem Wahn, jemanden oder etwas auf die andere Seite
verweisen zu wollen...“ (Magris 2002, S. 61).
„…Die Grenze ist eine Notwendigkeit, denn ohne sie, oder besser ohne begrenzende
Unterscheidung gibt es keine Identität, keine Form, keine Individualität, ja nicht
einmal eine reale Existenz, denn sie würde vom Gestalt- und Unterschiedslosen
verschlungen. Die Grenze bedeutet Wirklichkeit, verleiht Umrisse und Gestalt,
bestimmt die Besonderheit der Einzelperson wie des Kollektivs, der Existenz wie
der Kultur“ (Magris 2002, S. 71).
Die Auszüge zweier Zitate von Claudio Magris in seinen ‚Grenzbetrachtungen’
werden hier herangezogen, da Magris als Schriftsteller und Wissenschafter
Zeit seines Lebens wie kaum ein anderer in der Alpen-Adria-Region so tref-
fend die Grenzen wie auch Grenzüberschreitungen und ihre widersprüchliche
Bedeutung im Rahmen von Sicherheit und Unsicherheit, von Fremdheit und
Zugehörigkeit, von Freiheit und Unfreiheit thematisierte und immer noch ins
Zentrum seiner Betrachtungen rückt.
Geht man davon aus, dass es nach den friedlichen Revolutionen des Jahres 1989
zu einer de facto Europäischen Integration durch den Fall der Mauer und den
anschließenden Zusammenschluss der europäischen Staaten gekommen ist,
so bleiben innerhalb und an der Peripherie Europas kulturelle und politische
Grenzsituationen weiter als reale wie auch imaginäre Grenzen in den Köpfen
der Menschen, in verschiedensten Kollektiven wie auch im System der ein-
zelnen Nationalstaaten bestehen. Die dominanten Ordnungsstrukturen sind
nach wie vor Nationalstaaten mit ihren lang eingeübten Formen der Exklusion
und Grenzziehungsmechanismen – seien sie es in Richtung Nachbarnationen
oder in Richtung Minderheiten, seien sie es im Kontext von Zuwanderung. Aus
nationaler Perspektive liegen Grenzregionen am Rand, auch wenn sich durch
die Entwicklung der Europäischen Union seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, dem Schengener Abkommen und der EU-Osterweiterung die Bedeutung
der Grenzen im Zuge von Globalisierung und Europäischer Integration grund-
sätzlich gewandelt haben.
Proof
26
Der Begriff „Grenzregion“ bezeichnet in diesem Kontext einen identifizierbaren
Handlungsraum (Region), der sich durch eine oder mehrere nationalstaatliche
Grenzen und damit durch nationalstaatliche Teilräume auszeichnet und gleich-
zeitig durch grenzüberschreitende Institutionen auf subnationaler repräsentiert
wird. Grenzregionen sind Subsysteme, die sich durch die horizontale Vernet-
zung von funktionalen Teilbereichen der jeweils in Frage stehenden nationalen
Referenz-Systeme konstituieren (vgl. Schmitt-Egner 2005, S. 57 ff.). Im Gegensatz
zu Grenzregionen betont die Verwendung des Begriffs „Grenzraum“ lediglich
dessen Grenzlage, ohne dass damit ein identifizierbarer Kooperationsraum oder
seine spezifische Verfasstheit gemeint ist (vgl. Harz et al. 2010, S. 500).
Mehr als 30 % der Bevölkerung der erweiterten EU leben in Grenzräumen, die
mehr als 40 % des EU-Territoriums einnehmen. Hier wirken sich gesamteuro-
päische Entscheidungen oftmals direkt auf das Alltagsleben der Menschen aus;
Grenzregionen werden gerne als das „Europa im Kleinen“ bezeichnet. Natio-
nalstaatliche Grenzen wirken dennoch bis heute als Barrieren und als Schnitt-
stellen. Die besonderen Bedeutung der äußeren Grenzen eines Staates ist erst
durch die Bildung moderner Nationalstaaten entstanden und hat sich in den
letzen zwei Jahrhunderten verfestigt: Grenze diente sowohl im funktionalen wie
symbolischen Sinn als ein konstitutives Mittel zur deutlichen Einfassung des
eigenen Staatsgebietes und zur klar definierten Abgrenzung von anderen Staa-
ten und Staatsgebilden. Sie kann damit als ein ‚Schmelztiegel’ von Handlungen,
Erfahrungen und Diskursen, die Raum, Identität, Alterität und Transfer ständig
konstruieren wahrgenommen werden (vgl. Duhamelle et al. 2007, S. 11).
1.3.1 Historische Voraussetzungen im Alpen-Adria-Raum
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Grenzen zu keiner Zeit je stabil waren
und sich jederzeit ständig geändert haben. Insbesondere die Geschehnisse im
20. Jahrhundert hatten eine große Bedeutung für heutige Konstellationen in
Grenzregionen. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der Gründe,
die zur Initiierung der grenzüberschreitenden Kooperationen beigetragen
haben. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die grenzüberschreiten-
den Kooperationen als eine Chance zur Aussöhnung zwischen den ehemals
verfeindeten Nationen gesehen; so erhoffte man sich durch Kommunikation
und kontinuierlichen Austausch das verlorene Vertrauen langsam wieder auf-
bauen zu können. Grenzregionen sind damit ‚Laboratorien’ für die Europäische
Integration. So erfüllt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im europä-
ischen Kontext zum einen eine spezifische horizontale Integrationsfunktion
– und zwar nicht nur in den politischen Diskursen der handelnden Akteure vor
Proof
27
Ort, sondern auch und gerade in den Zielsetzungen der europäischen Politiken
und Institutionen: das Zusammenwachsen Europas an den Grenzen der Mit-
gliedstaaten, das Europa der Bürger, die territoriale Kohäsion oder die Europä-
ische Nachbarschaftspolitik sind Konzepte, die sich unmittelbar auf die euro-
päische Dimension der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beziehen
(vgl. Euro-Institut 2010, S. 19 f.).
Die Länder der Grenzregion Alpen-Adria heute, zum Teil nun in der Europäi-
schern Union und zum Teil noch außerhalb, die wiederum auch einzeln an die
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien grenzen, teilen sich die Erinne-
rung an eine gemeinsame leidvolle Geschichte von Kriegen, Konflikten und
Grenzziehungsprozessen im vorliegenden Raum und seinen Nachbarstaaten.
Der Einschätzung von Andreas Moritsch folgend basierte der Kampf zwischen
homogenem Nationalstaatswunsch und dem Imperativ des nationalstaatli-
chen Prinzips versus vielfältiger Volksgruppen und Minderheiten im 19. und
20. Jhdt. hauptsächlich aufgrund dauernder unterschiedlicher Grenzziehun-
gen im Rahmen vielfältiger Kriege und Konflikte (vgl. Moritsch 2001, S. 7).
Der Wunsch nach Übereinstimmung von Nationalität und Territorium stand
immer wieder im Zentrum, sowie eine dauernde Sehnsucht nach Homogeni-
sierung; nach Moritsch haben sich die Minderheiten im Alpen-Adria-Raum bis
heute drastisch reduziert, doch gelang es nicht, sie ganz vom Erdboden ver-
schwinden zu lassen (vgl. Moritsch 2001, S. 8). Die Konflikte vor und während
der beiden Weltkriege, die für einen Großteil unzufriedenstellenden Friedens-
verträge im Anschluss, die lange Periode des Kalten Krieges und seinen Aus-
wirkungen, der Fall der Berliner Mauer und der anschließend folgende Jugos-
lawienkrieg in den 1990er Jahren brachten auf allen Seiten enormes Leid und
Umbrüche in die Region und beeinträchtigten das spätere Zusammenleben der
Menschen in diesem Alpen-Adria-Raum; die Folgen dieser kriegerischen Aus-
einandersetzungen und Konflikte bestimmen bis heute die Region.
Entscheidende politische Veränderungen entstanden durch die EU-Osterwei-
terung. Durch den Abbau der Grenzen wurden wirtschaftliche Beziehungen,
Reiseverkehr, transnationale Kooperationen einfacher und die Kommuni-
kation im Alpen-Adria-Dreieck wesentlich ausgebaut. Trotz dieser sehr posi-
tiven Entwicklungen sind die gemeinsame leidvolle und traumatisierende
Geschichte in diesem Raum immer noch spürbar und wirksam – sei es durch
fortdauernde gegenseitige Vorbehalte, sei es durch Stereotype, Vorurteile und
Feindbilder, die weiter aufrecht erhalten werden.
Proof
28
Seit 1945 bis in die jüngste Gegenwart gibt es jedoch auch grenzüberschrei-
tende friedenspolitische Bemühungen, die langfristig zur Befriedung des
gesamten südosteuropäischen Raumes initiiert wurden; hier sind bi- und
trilaterale Vereinbarungen auf zwischenstaatlicher Ebene, die Installierung
der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria im Jahr 1978 und die friedenspolitische
Arbeit verschiedener NGO`s in der Region zu nennen; Auseinandersetzungen
um Grenzziehungen, wie zum Beispiel jene zwischen Slowenien und Kroatien
in jüngster Zeit sind jedoch bis heute Ausdruck unbewältigter gemeinsamer
Vergangenheit und Aussöhnung.
Was bedeutet nun die Überwindung solcher Traumata der Vergangenheit für
Staaten, Kollektive und einzelne Individuen, welche Voraussetzungen sind
hierfür notwendig und um welche Herausforderungen geht es hier? Gesamt-
politisch bedeutet dies ein notwendiges aktives und kontinuierliches Engage-
ment im Auf- und Ausbau von Kooperationen der Staaten, in der gemeinsamen
ernsthaften Auseinandersetzung mit ungelösten Minderheitenfragen, der
Beschäftigung mit Herausforderungen im Kontext der Migration bzw. der Her-
stellung von kontinuierlichen Dialogen über die Grenzen auf politischer wie
kultureller Ebene.
1.3.2 Komplexe Grenzregionen in Europa und Kooperationsstrukturen
Das Europäische Zentrum für Föderalismus-Forschung (EZFF) an der Univer-
sität Tübingen erstellte 2008 im Auftrag der Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens ein Gutachten zu komplexen Grenz-Regionen. Auf der
Grundlage von 14 Merkmalen untersuchte es 19 Grenzregionen und definierte
die Komplexitätsstufe in qualitativer Hinsicht. Hierbei wurden komplexe Regio-
nen herausgefiltert, zu denen zum Beispiel auch die Alpen-Adria-Region gezählt
wird; die folgenden Regionen etwa werden im Kontext komplexer Regionen
genannt: Euregio Maas-Rhein,Großregion SaarLorLux Oberrheinkonferenz,
Bodenseekonferenz, Euregio Neiße, Euregio Weinviertel, Adria-Alpen-Pan-
nonia. Sie werden auch als Euroregionen bezeichnet; der Begriff steht für ein
geographisches Gebiet wie für eine transnationale Region. Sie sind freiwillige
Zusammenschlüsse über nationalen Grenzen hinweg. Sie sehen sich nicht als
neue Verwaltungsebene, sondern als Bottom up-Initiative, basierend auf der
Zusammenarbeit regionaler und lokaler Akteure (vgl. Heukemes 2008, S. 5). Über
EU-Programme wie das Programm‚ INTERREG’ etwa werden die Zusammenar-
beit im Kontext von Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Regionalentwicklung
entsprechend gefördert.
Proof
29
1.3.3 Friedensbildung für den Raum
Langfristig werden und können Kooperationen über die Grenzen in den oben
beschriebenen Bereichen einen wesentlichen Beitrag leisten, Räume und
Regionen längerfristig zu befrieden bzw. ihre Prosperität zu steigern, wenn
sie von einer zukunftsweisenden Staaten- und Europapolitik begleitet wer-
den; parallel dazu sind nachhaltige pädagogische Konzepte, Kooperationen
und Programme zu initiieren und zu fördern; die Bearbeitung gemeinsamer
kriegerischer Vergangenheit, die Auseinandersetzung mit Fragen von Identi-
tät, Ethnizität, die gemeinsame Beschäftigung mit gegenseitigen Stereotypen
und Vorurteilen, die Reflexion bestehender nationaler Narrative und der Auf-
bau gewaltfreier Formen von Kommunikation sind nur einige Beispiele frie-
denspädagogischer Intentionen.
Für die Friedensbildung stellt sich die Herausforderung, Programme, Koope-
rationen und Projekte zu entwickeln, die langfristig den Bereichen Erinne-
rungskultur, Gedächtnispolitiken, interkulturelle und transkulturelle Kom-
munikation, Konfliktbearbeitung und Entwicklung gemeinsamer überregi-
onaler Friedensperspektiven Rechnung tragen; dies bedeutet die Notwen-
digkeit einer Zusammenarbeit in der Friedensbildung im schulischen und
außerschulischem Bereich und im Rahmen von grenzüberschreitender Schul-
entwicklung; im Weiteren ist vor allem die Entwicklung eines konzertierten
längerfristigen Gesamtkonzepts für die Region von hoher Relevanz, wie es die
Vorbilder Deutsch-Französisches und auch das Deutsch-Polnische Jugendwerk
ursprünglich gemeinsam andachten und bis in die Gegenwart umsetzen.
1.3.4 Kooperationen im Kontext der Friedensbildung – einige Beispiele
Es gibt bereits viele grenzüberschreitende Initiativen seitens verschiedener
Institute, Universitäten, Bildungsinstitutionen und NGO`s im vorliegenden
Raum. Seitens der Universitäten wurden in den letzten Jahrzehnten gemein-
same Forschungsvorhaben umgesetzt – hier ist beispielhaft die Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt zu nennen, die seitens ihrer verschiedenen Institute
über die Grenzen forscht und arbeitet; im schulischen Bereich gibt es seit Jahr-
zehnten Schüleraustausch, Lehreraustausch und viele nachhaltige Projekte in
diesem Bereich; im Folgenden sollen nur einzelne kurz skizziert werden.
Proof
30
a) Sommerfriedensuniversitäten im Alpen-Adria-Raum als Lernarrangements in peripheren Grenzregionen
Hier ist zum Beispiel die Sommerfriedensuniversität, wie sie 2009 von den
Universitäten Klagenfurt, Koper und Udine in Tarcento umgesetzt wurde, zu
nennen, an der Studierende aus der gesamten Alpen-Adria-Region teilnah-
men und die von ExpertInnen zu Fragen der Friedenskultur im weitesten Sinn
unterrichtet wurden; solche Modelle erfüllen in einem besonderen Maß den
Anspruch, in einer multiethnischen Randregion Europas über die Grenzen an
friedensrelevanten Fragestellungen zu arbeiten und Zukunftsperspektiven
zu entwickeln. Es zeigt, dass es ganz wesentlich und zielführend ist, solche
Projekte vielfältig in ganz Europa und über die Grenzen Europas hinaus auf
einer internationalen Ebene aufzusetzen, zu unterstützen und zu finanzie-
ren. Flüchtlingsströme, Vertreibungen, die Öffnung Süd- und Südosteuropas
ebenso wie Arbeitsmigration und die Globalisierung vieler Bereiche haben das
Alltagsleben auch jener Regionen Europas erreicht, die noch vor einigen Jah-
ren weit weniger plural und divers zusammengesetzt waren. Europas verstärk-
tes Interesse, als Ganzes, als multinationale Einheit intendiert, müsste über
vielfältigste Programme die Überwindung des Nationalen im Focus haben.
Lernen an verschiedenen Orten Europas auf verschiedensten Bildungsebe-
nen zu Fragen des Friedens, der Ökologie und der Menschenrechte sind eine
wesentliche Zukunftsoption, um das gewaltfreiere Zusammenleben in Europa
zu unterstützen. Die aktive Nutzung von speziellem Wissen, das von den
Studierenden mitgebracht wird – einerseits über die Kompetenz verschiede-
ner Sprachen, Dolmetschqualitäten, Wissen über den geographischen Raum
und auf künstlerisch-kreativer Ebene bedeutet einen Zugang zu neuen Lern-
formen und Methoden; Eine tragende Säule des didaktischen Rahmens sind
neben den inhaltlichen Themen die Förderung und Stärkung der Sprachen
des Alpen-Adria Raums und das Mitdenken der Vielsprachigkeit während des
Unterrichts, aber natürlich auch außerhalb. Die Globalisierung und ihre Aus-
wirkungen setzen vorliegende Lernarrangements voraus; in derartigen Model-
len auf schulischer wie universitärer Ebene liegen nachhaltige Chancen für die
Unterstützung von Friedensentwicklungen in Europa aber auch international.
b) Sommerkolleg Bovec für Studiernde im Alpen-Adria-Raum
Seit Jahrzehnten wird nun das Sommerkolleg in Bovec durchgeführt. Die Pro-
jektleiterInnen wollen die Bereitschaft und Fähigkeit zur transnationalen
Kooperation im multinationalen Alpen-Adria-Raum fördern. Am Vormittag
werden Sprachkurse für Deutsch, Italienisch, Slowenisch, Kroatisch (jeweils
Proof
31
Anfänger/innen und Fortgeschrittene) abgehalten. Nachmittags folgen Referate,
Workshops und Exkursionen zum jeweiligen Generalthema. Die Rahmenthe-
men der letzten Jahre lauteten „Gemeinsam leben nach den Kriegen. Ereignisse
und Erinnerungen“, „Jugend und Krise“ oder etwa „Gesellschaftliche Vielfalt in
Regionen: kulturelle, sprachliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte“.
c) Bildungskooperationen auf schulischer Ebene im Alpen-Adria-Raum
Im sogenannten Dreiländereck, der Grenzregion zwischen Österreich, Slo-
wenien und Italien finden bereits eine Reihe von Aktivitäten statt, die darauf
abzielen, die Regionen füreinander zu öffnen und den dort lebenden Kindern
und Jugendlichen interkulturelle, transkulturelle und drei- bzw. mehrspra-
chige Bildungschancen zu bieten.
d) ‚Drei Hände – Tri roke – tre mani’ – der Alpen-Adria- Bildungsverbund von Nötsch/Gailtal, Kranjska Gora und Tarvisio
Die Marktgemeinde Nötsch im Gailtal betreibt einen Kindergarten, in dem seit
2006 erfolgreich ein Sprachenprojekt umgesetzt wird. In Kooperation mit den
Kindergärten von Kranjska Gora und Tarvisio erfolgt ein wöchentlicher Aus-
tausch der KindergärtnerInnen, um den Kindern die zwei Nachbarsprachen
näher zu bringen. Auch in der Volksschule Nötsch wird der Weg der dreisprachi-
gen Erziehung in Kooperation mit den Nachbarschulen aus Italien und Slowe-
nien seit einem Jahr im Rahmen eines Schulversuches erfolgreich fortgesetzt:
Die 1. und die 2. Klasse lernen Italienisch und Slowenisch von den LehrerInnen
der Nachbarländer. Die gemeinsame Vision aller Beteiligten: „Dreisprachig vom
Kindergarten bis zur Matura“. An einer Fortsetzung des Projektes in der Sekun-
darstufe wird gemeinsam mit dem BG/BRG Villach St. Martin und entsprechen-
den Partnern aus den Nachbarländern bereits gearbeitet. Seit dem Frühjahr 2009
ist das Projekt mit dem Interreg IV-Projekt ESCO – Educare Senza Confini/Bildung
ohne Grenzen vernetzt, welches die Entwicklung eines grenzüberschreitenden
dreisprachigen Bildungsangebots für die Sekundarstufe I und II anstrebt. 2011
haben die Bildungsverantwortlichen von Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-
Venetien einen „Letter of Intent“ zur Gründung eines trilateralen Bildungsnetz-
werkes mit dem Namen dreitretri unterzeichnet, in dem es unter anderem heißt:
„Hauptziel ist die nachhaltige Etablierung grenzüberschreitender, mehrsprachi-
ger Bildungskooperationen im Sinne trilateraler Unterrichts- und Schulentwick-
lung, die Vernetzung länderübergreifender Projekte und der Informationsaus-
tausch auf allen relevanten Netzwerkebenen“.
Proof
32
Seit 2009 findet jährlich ein Symposium über Mehrsprachigkeit in Nötsch
statt, das vierte Symposium 2012 wurde im Herbst 2012 in Udine durchgeführt.
Inhaltlich beschäftigten sich die Symposien mit aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, zwei- und mehrsprachigen Modellen (z.B. Zweisprachigkeit in
Kärnten, Mehrsprachigkeit bei den Ladinern) bzw. Erfahrungsaustausch zwi-
schen den PädagogInnen (vgl. Gombos & Pasquariello 2010, S. 312 ff.).
1.3.5 Installierung von Jugendwerken als konzertierte nachhaltige grenzübergreifende Netzwerke für Aussöhnung und Verständigung – zwei Beispiele
Die folgenden beiden Jugendwerke wurden nach dem 2. Weltkrieg bzw. nach
der Ostöffnung 1989 installiert, um längerfristig auf Jugendschiene friedens-
politisch Akzente zu setzen.
a) Deutsch-Französisches Jugendwerk
Das Deutsch-Französische Jugendwerk ist eine internationale Organisation im
Dienst der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Seine Aufgabe ist es, die
Bande zwischen der deutschen und französischen Jugend enger zu gestalten
und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Die Gründung des Jugendwer-
kes geht auf den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den „Elysee-
Vertrag“, von 1963 zurück. Das Jugendwerk fördert den Jugendaustausch und
Jugendprojekte zwischen Deutschland und Frankreich. Dazu gehören Schüler-
und Studentenaustausch, Praktika und Austausch im Berufsbereich, Fachse-
minare, Sportbegegnungen, Sprachkurse, Forschungsarbeiten, Partnerschaf-
ten von Städten und Regionen. Es arbeitet nach dem Subsidiaritätsprinzip mit
zahlreichen Partnern zusammen. Ziel ist es, die deutsch-französischen Bezie-
hungen zu vertiefen, Schlüsselkompetenzen für Europa zu vermitteln bzw.
interkulturelles Lernen zu fördern, Erfahrungen des deutsch-französischen
Jugendaustauschs und der Aussöhnung an Drittländer weiterzugeben. Seit 1963
hat es mehr als 8 Millionen jungen Franzosen und Deutschen die Teilnahme
an rund 300.000 Austauschprogrammen ermöglicht. Es fördert jedes Jahr
mehr als 11.000 Begegnungen (mehr als 6.500 Gruppenaustauschprogramme
und rund 4.300 Individualaustauschprogramme), an denen rund 200.000
Jugendliche teilnehmen.6
6 Für weitere Informationen siehe unter www.dfjw.org (zuletzt besucht am 15.08.2012).
Proof
33
b) Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Das Ziel des Deutsch-Polnischen Jugendwerks ist es, auf der Grundlage der För-
derrichtlinien bestehende Jugendprojekte auszubauen und zu vertiefen und
neue deutsch-polnische Initiativen zu ermöglichen. Dies soll zu einem besse-
ren gegenseitigen Verständnis beitragen, Vorurteile überwinden helfen sowie
die gemeinsame Verantwortung von jungen Menschen aus Deutschland und
Polen für die zukünftige Gestaltung eines freien Europa fördern. Die Gründung
einer deutsch-polnischen Organisation nach dem Vorbild des Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerks geht auf Tadeusz Mazowiecki (damaliger Premierminis-
ter der Republik Polen) und Helmut Kohl (damaliger Kanzler der BRD) zurück.
Als am 17. Juni 1991 der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftli-
che Zusammenarbeit, abgeschlossen wurde, unterzeichneten die Regierungen
beider Länder zugleich das Abkommen über das Deutsch-Polnische Jugend-
werk, auf dessen Grundlage das Jugendwerk 1993 seine Tätigkeit aufnahm.
Seit dem Beginn seiner Tätigkeit unterstützte es mehr als 50.000 Projekte, an
denen über zwei Millionen Jugendliche teilgenommen haben; es fördert Pro-
gramme in beiden Ländern – vor allem Begegnungen, Praktika, Fortbildungen
und Gedenkstättenfahrten. Gefördert werden Jugendliche im Alter von 12 bis
26 Jahren, deren Betreuer und Sprachmittler; für PraktikerInnen und Organi-
satorInnen von Jugendbegegnungen bietet es Sprachkurse, Konferenzen und
Seminare zur Information und Weiterbildung auf dem Gebiet der deutsch-pol-
nischen Zusammenarbeit. 7
1.3.6 Resümee
Bereits heute gibt es im Alpen-Adria-Raum sehr viele Kooperationen und sehr
gute Programme und Projekte im Kontext der Friedensbildung, die zur Ver-
ständigung in dieser ‚komplexen Region’ wesentlich beitragen. Die vorliegen-
den Jugendwerke sind und können Vorbilder für die mögliche Initiierung einer
‚Alpen-Adria Youth Association’ sein – hier wären die Bündelung von bereits
bestehenden Bemühungen, Initiativen und Programmen notwendig: vorberei-
tende Konferenzen zu Fragen der Friedensbildung, vertiefende Workshops zu
gemeinsamen relevanten Themenbereichen wie etwa die Beschäftigung mit
Erinnerungskultur im Alpen-Adria-Raum, regelmäßige Jour fixe zum Aufbau
von Bildungskooperationen und einer gemeinsamen Schulentwicklung in der
Region wären von besonderer Relevanz; es müssen längerfristige kontinuierli-
che Strukturen geschaffen werden, damit die bereits eingeleiteten wesentlichen
Vorhaben das Engagement einzelner engagierter Menschen überdauern können.
7 Für weitere Informationen siehe unter www.dpjw.org (zuletzt besucht am 15.08.2012).
Proof
34
Literatur
Duhamelle, Christophe, Andreas Kossert, & Bernhard Struck ( 2007): Einleitung. Perspektiven für eine vergleichende Grenzforschung Europas. In: Dies. (Hrsg.): Grenzregionen. Ein europäischer Vergleich vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main.
Europäisches Institut (2010): Kooperations- und Governancestrukturen in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen – Analyse der bestehenden grenzüberschreitenden Strukturen der Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen und räumlichen Zuschnitten. Schlussbericht der Expertise, bearbeitet von Joachim Beck in Kooperation mit Eddie Pradier, Martin Unfried, Claude Gengler & Rolf Wittenbrock; zit. nach Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-entwicklung (Hrsg., 2011): Metropolitane Grenzregionen. Abschlussbericht des Modelvor-habens der Raumordnung (MORO). Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreiten-den Verflechtungsräumen. Berlin (online unter www.metropolitane-grenzregion.eu, zuletzt besucht am 15.08.2012).
Gombos, Georg & Antonio Pasquariello (2010): Dreisprachig Grenzen überschreiten – der Alpen-Adria-Bildungsverbund. In: Werner Wintersteiner, Georg Gombos & Daniela Gronold (Hrsg.): Grenzverkehrungen. Ména – mejà. Confini – confronti. Border dis – solutions. Mehrsprachig-keit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum. Vecjezicnost, transkulturnost in izob-razba. Plurilinguismo, transculturalità e istruzione. Multilingualism, Transculturality and Educa-tion. Articles in five languages, English versions of all texts on CD, Klagenfurt/Celovec.
Harz, Andrea, Gerd-Rainer Damm & Stefan Köhler (2010): Großräumige grenzüberschreitende Ver-flechtungsräume – ein Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) des BundeS. In: Raumfor-schung und Raumordnung 6/2010: 499 ff.; zit. nach Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg., 2011): Metropolitane Grenzregionen. Abschlussbericht des Model-vorhabens der Raumordnung (MORO). Überregionale Partnerschaften in grenzüberschreiten-den Verflechtungsräumen. Berlin (online unter www.metropolitane-grenzregion.eu, zuletzt besucht am 15.08.2012).
Heukemes, Norbert (2008): INTERREG III Programm der EUREGIO MAAS-Rhein. Netzwerk Komple-xer Grenzregionen. Ergebnisse der Fachtagung, 21. -23. April 2008 in Eupen (online unter www.dglive.be, zuletzt besucht am 15.08.2012).
Magris, Claudio (2002): Auf der anderen Seite. Grenzbetrachtungen. In: Claudio Magris, Renate Lun-zer, Madeleine von Pásztory & Petra Brauns (Hrsg.): Utopie und Entzauberung. Geschichten, Hoffnungen und Illusionen der Moderne. München, S. 60–80.
Moritsch, Andreas (2001) Einleitung. In: Ders. (Hrsg.) Alpen-Adria. Zu Geschichte einer Region. Klagenfurt.
Schmitt-Egner, Peter (2005): Handbuch zur Europäischen Regionalismusforschung – theoretisch-methodische Grundlagen, empirische Erscheinungsformen und strategische Optionen des Transnationalen Regionalismus im 21. Jhdt. Wiesbaden.
Proof
37
2.1 Die Hoffnung liegt auf der Region. Zu Recht?Heike Egner
Der Begriff „Region“ scheint auf den ersten Blick sehr eingängig und verständ-
lich, ist er doch im alltäglichen Sprachgebrauch in so vielfältigem Einsatz: da
geht es um re gionale Produkte (die einen „nachhaltigen“ Lebensstil ermöglichen
und die heimische Wirtschaft stärken sollen), um Regionalentwicklung (wenn
eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung eines konkreten Gebietes gemeint
ist), um Heimat und Region (wenn eigentlich politische Ziele verfolgt werden
sollen), um konkrete Gebietskörperschaften im Rahmen einer territorialen Ver-
waltung (z. B. in Frankreich) und so weiter. Gemeint ist mit „Region“ immer ein
Bereich, dem eine gewisse Zusammengehörigkeit der dort agierenden Menschen
unterstellt wird und der räumlich begrenzt ist (oder werden kann).8
Der Begriff der Region hat in den letzten etwa zwanzig Jahren eine erstaunliche
Karriere erfahren, vor allem als Gegenbegriff zum Globalen und den Prozessen
der ökonomischen Globalisierung. Der Druck auf die Ausweitung von Freihan-
del sowie der zunehmenden Freizügigkeit in der Arbeitsplatzwahl führte nach
und nach zu dem Wegfall nationalstaatlicher Beschränkungen. Dadurch kön-
nen Unternehmen ebenso wie ArbeitnehmerInnen aus einem weitaus größeren
Angebot ihren Unternehmens- und Wohnstandort wählen. Vor diesem Hinter-
grund sind spätestens seit Beginn der 1990er-Jahre auch Städte und Gemeinden
in einen internationalen Wettbewerb geraten, bei dem sie um Unternehmens-
ansiedlung, den Zuzug von möglichst vielen SteuerzahlerInnen, TouristInnen
usw. untereinander konkurrieren. Ein „Kirchturmdenken“ (jede/r kämpft für
sich) hat in einer solchen Situation wenig Chance. Die Hoffnung auf eine grö-
ßere Sichtbarkeit, Erhöhung der Attraktivität für die Ansiedlung von Unterneh-
men und damit eines guten Arbeitsplatzangebotes, das wiederum Arbeitneh-
merInnen anzieht usw. zwingt zum Zusammenschluss zu größeren Einheiten:
der Region. Städte wie Wien und Bratislava bilden dann „Metropolregionen“,
Europa fördert regionale Zusammenschlüsse in dem Programm „Europa der
Regionen“, Regionalmarketing und Regionalmanagement sind neue Berufsbil-
der, die es vor zwanzig, dreißig Jahren noch gar nicht gab. Die Hoffnung liegt
also in der Region, vielleicht umso stärker, wenn es sich um peripher gelegene
Gebiete handelt, wie es in unserem Fall der Alpen-Adria-Region der Fall ist.
Kärnten beispielsweise liegt in der Peripherie seines Nationalstaates, wobei
8 Interessanterweise wird der Begriff „Region“ nicht durchgängig für den mit Alpen-Adria bezeichneten Bereich genutzt. Vielmehr wird vielfach auf den sehr viel weicheren, aber aus geographischer Sicht nicht minder unkonkreten und schwierigen Begriff „Raum“ ausgewichen (siehe beispielsweise Valentin 1998 oder Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria 2001).
Proof
38
Österreich selbst ebenfalls keiner der großen „Player“ auf dem europäischen
Parkett ist. Den anderen beteiligten Gebiete in der Alpen-Adria-Region geht es
nicht besser. Umso mehr liegt die Hoffnung auf einem regionalen Zusammen-
schluss, der Sichtbarkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Attraktivität
im internationalen Wettbewerb garantieren soll.
Fragt man jedoch nach dem, was die Zusammengehörigkeiten einer Region
konkret begründet oder nach den räumlichen Grenzen der Region, schaut man
in der Regel in fragende Gesichter (wenn man nicht gerade mit dem Regional-
manager einer Region spricht, dessen tägliches Geschäft es ist, seine „Region“
zu vermarkten und dazu recht mühevoll damit beschäftigt ist, die „Akteure“
dazu zusammenzubringen). Der auf den ersten Blick so klare und eindeutige
Begriff „Region“ wird auf den zweiten Blick zu etwas Unklarem, Verschwom-
menen, dessen inhaltliche Füllung ganz offensichtlich variieren kann und
alles andere als eindeutig ist.
Abb. 2.1 Die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria im Jahr 1999, mit 18 Mitgliedsregionen die Zeit ihrer größten räumlichen Ausdehnung (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria).
Proof
39
Abb. 2.2 Die aktuellen Mitgliedsregionen der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria im Jahr 2013 mit nur mehr acht Mitgliedern (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria).
Dieses unklare Bild zeigt sich auch bei der „Alpen-Adria-Region“, die wir mit
unserer interdisziplinären Lehrveranstaltung „Die Alpen-Adria-Region. Bindun-
gen und Grenzen“ genauer in den Blick genommen haben. Es zeigte sich schnell,
dass alle Beteiligten spontan sehr wenig sowohl zu den „Bindungen“ (was hält
die Region zusammen?) als auch zu den äußeren „Grenzen“ (wer und was gehört
zu der Alpen-Adria-Region?) sagen konnten, obwohl die meisten seit langem
in dieser Region beheimatet sind. Interessanterweise fielen dagegen einige der
inneren „Grenzen“ (Differenzen in Sprachen, territoriale Grenzen, unterschied-
liche politische und ökonomische Praktiken, kulturelle Unterschiede usw.) sehr
schnell ein. Ein Blick auf die institutionalisierte Form der Alpen-Adria-Region
– die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (ARGE) – hat uns bei dieser Frage auch
nur wenig weitergeholfen. Denn in der Hochzeit, also der größten räumlichen
Ausdehnung der Arbeitsgemeinschaft im Jahr 1999, gehörten 18 Mitgliedsregio-
nen der ARGE an (Abb. 2.1), darunter beispielsweise auch Bayern, das allenfalls
mit den Alpen in Verbindung gebracht werden könnte, aber mit der Adria? Jen-
Proof
40
seits dieser Kritik, lag der große Charme der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria
seit ihrer Gründung bis zum Fall des Eisernen Vorhangs darin, dass unter einem
gemeinsamen „Dach“ kommunistisch orientierte Staaten, NATO-Länder und
neutrale Staaten miteinander verbunden waren und versuchten, über Staats-
und Ideologiegrenzen hinweg zu kooperieren. Derzeit gehören der Arbeitsge-
meinschaft nur noch acht Mitglieder an (Burgenland, Friaul-Julisch Venetien,
Kärnten, Kroatien, Slowenien, Steiermark, Vas, Veneto). In dieser Zusammenset-
zung umfasst die Alpen-Adria-Region eine Fläche von 136.245 km² und ist Hei-
mat von etwa 14,8 Millionen Menschen (Abb. 2.2).
Für eine Annäherung an die Bindungen und Grenzen der Alpen-Adria-Region
trägt dieser territoriale Blick auf Zugehörigkeit und damit die räumlichen
Grenzen also wenig bei. Versuchen wir es mit einem Zugang über die „Region“
allgemein. Jede Wissenschaft hält für ihre Grundbegriffe Definitionen vor, die
ihre grundlegenden „Gegenstände“ beschreiben sollen. So auch die wissen-
schaftliche Geographie. In einem ihrer Wörterbücher bietet sie sieben unter-
schiedliche Zugänge für den Begriff „Region“ an:
1 „ein konkreter dreidimensionaler Ausschnitt der Erdoberfläche, unabhän-
gig von dessen Größe,
2 größere geographische Raumeinheit, die mehrere Landschaften umfasst,
ohne das hinsichtlich Größe und Inhalt der Region besondere Forderungen
gestellt werden,
3 in der Landeskunde ein meist historisch und/oder administrativ bedingtes Terri-
torium, manchmal mehr oder weniger identisch mit Naturräumen oder Teilen
von diesen,
4 ein Großraum der regionischen Dimension der Dimensionen landschaftli-
cher Ökosysteme,
5 im weitesten Sinne eine geographisch-räumliche Einheit (Raumeinheit, geo-
graphischer Raum) mittlerer Größe, die sich funktional oder auch strukturell
nach außen abgrenzen lässt (sozio-ökonomischer Verflechtungsraum bzw.
homogener Raum),
6 in der Raumplanung ist die Region die Planungseinheit für die Regionalpla-
nung. Dementsprechend sind die Planungsregionen der deutschen Bundes-
länder auf der Grundlage der vorgegebenen Verwaltungsgrenzen gegliedert.
In der Regel wird eine Region aus mehreren Landkreisen und evtl. kreis-
freien Städten gebildet“
Proof
41
7 in populärwissenschaftlichen Publikationen und in der Tagespresse wird
der Begriff Region zunehmen fälschlich anstelle von Stadtumland oder sub-
urbanem Raum gebraucht (z. B. „Er zieht aus der Stadt in die Region um“)
(Leser 2011, S. 756).
Leider tragen auch die Definitionen für unsere Beschäftigung mit der „Alpen-
Adria-Region“ nur wenig bei. Allenfalls Definition Nr. 5 könnte als ein erster Aus-
gangspunkt für unsere Überlegungen herangezogen werden. Definitionen Nr. 1,
2 und 4 sind in unserem Kontext so aussagelos, dass sie uns bei der Frage nach
der genaueren Bestimmung der „Alpen-Adria-Region“ nicht weiterhelfen. Einen
historischen oder administrativen Vorläufer (Nr. 3), der als Referenzrahmen für
die Betrachtung von Bindungen und Grenzen der Alpen-Adria-Regionen dienen
könnte, gibt es nicht. Nr. 6 entfällt ebenfalls, da es sich bei der Alpen-Adria-
Region um eine Region handelt, die durch mehrere territoriale Grenzen durch-
schnitten wird und damit keine Planungsregion im Rahmen der Regionalpla-
nung darstellt. Ganz im Gegenteil: Jegliche Koordination über eine grenzüber-
schreitende Planung z. B. für infrastrukturelle Vorhaben sind ein langwieriges
und mühevolles Vorhaben, da mehrere Nationalstaaten mit ihren unterschiedli-
chen gesetzlichen Verfassungsrahmen und planerischen Praktiken daran betei-
ligt sind. Definition Nr. 5 betont die funktionalen Beziehungen, die sich vielleicht
auch strukturell nach außen abgrenzen lassen, mit dem Verweis in der Klammer
auf einen „sozio-ökonomischen Verflechtungsraum bzw. homogenen Raum“.
Welche Dimension von „homogen“ auch gemeint sein mag (ökonomisch, poli-
tisch, sozial, sprachlich, kulturell, landschaftlich-räumlich...) – dieser Aspekt
trifft als „Bindungsmittel“ für die Alpen-Adria-Region keineswegs zu. Bleibt also
die sozio-ökonomische Verflechtung als Ausgangspunkt. Um die Region über
diese Verflechtungen nach außen abgrenzbar zu machen, müssten innerhalb
der Alpen-Adria-Region verstärkte Aktivitäten feststellbar sein, in jedem Fall
intensiver als mit Regionen oder Bereichen außerhalb der Alpen-Adria-Region.
Es lässt sich unschwer feststellen, dass dies nicht der Fall ist.
Wir haben bei der Alpen-Adria-Region also offensichtlich mit einer Konst-
ruktion zu tun, das zweifach schwierig ist: Einerseits vor dem Hintergrund
eines grundlegenden Verständnisses einer „Region“ und andererseits mit
dem „Alpen-Adria-Element“, das die Region zu einer eindeutig identifizier-
baren Region werden ließe. Ob es also sinnvoll ist, dass sich die Hoffnung
für Wachstum, Sichtbarkeit, Eingebundensein und Anschluss an Europa und
den Rest der Welt auf die Region Alpen-Adria richtet, ist eine offene Frage.
Proof
42
Die beiden folgenden Beiträge aus der Perspektive der Geographie beschäftigen
sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Marika Balode, Roswitha Mitter-
bacher, Roswitha Ruidisch und Birgit Wertschnig fragen nach dem Regions-
verständnis, dass der Konstruktion einer Alpen-Adria-Region zugrunde liegen
kann und stellen dabei eine eher territoriale Perspektive (die in der Arbeits-
gemeinschaft Alpen-Adria ihren Ausdruck findet) einem eher relationalen
Verständnis gegenüber, bei dem eine Region vor allem durch soziale, ökono-
mische, kulturelle und politische Beziehungen hergestellt wird. In dieser Sicht-
weise entsteht eine Region durch die Praktiken und täglichen Handlungen der
Bewohnerinnen und Bewohner der Region, und das immer wieder aufs Neue.
Vor diesem Verständnis muss die Alpen-Adria-Region durch vielfältige Ver-
flechtungen gelebt werden, um zu existieren. Bislang tut sie das nicht.
In dem zweiten Beitrag blicken Oskar Januschke und Manfred Rader aus der
Sicht von Akteuren auf die Region und versuchen, den Regionsbegriff neu zu
beleben, indem sie die „Region 2.0“ konzeptionalisieren. Sie verstehen dar-
unter eine Region, die bottom up mit den Bürgerinnen und Bürgern als aktive
Akteure in einem kontinuierlichen Prozess die Alpen-Adria-Region zu einer
zukunfts- und wettbewerbsfähigen europäischen Standortgemeinschaft
gestaltet wird, die dadurch selbstbewusst gelebt und erlebt werden kann und
sich auf dem „europäischen Markt der Regionen“ auch wirtschaftlich etablie-
ren kann.
Literatur
Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria (2002): All together, Klagenfurt.
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (2001): Minderheiten und Grenzüberschreitende Zusammenar-beit im Alpen-Adria-Raum. Trient.
Leser, Hartmut (Hrsg., 201115), Heike Egner, Stefan Meier, Thomas Mosimann, Simon Neumair, Rein-hard Paesler & Dieter Schlesinger (Bearb.): Diercke Wörterbuch Geographie, Braunschweig.
Valentin, Hellwig (1998): Kärntens Rolle im Raum Alpen-Adria. Gelebte und erlebte Nachbarschaft im Herzen Europas (1965–1995). Klagenfurt.
Proof
43
2.2 Pluralität von Regionen. Von der ambitionierten Kopfgeburt zur Totgeburt einer Alpen-Adria-Region?Marika Balode, Rosemarie Mitterbacher, Roswitha Ruidisch & Birgit Wertschnig
2.2.1 Alpen-Adria-Region: Eine Annäherung und methodisches Vorgehen
Eine erste Suche nach der Alpen-Adria-Region hat ergeben: „Alpen-Adria-
Region“ scheint „überall und nirgends“ zu sein: die Universität in Klagenfurt
wird „Alpen-Adria-Universität“ genannt, eine mittlerweile wohlbekannte
Bank bezeichnet sich als „Hypo Alpe Adria“, Feste werden unter dem Label
gefeiert (z. B. „Alpen-Adria-Hafenfest“ oder „Alpe-Adria-Biofest“), alles über
die „Alpen-Adria-Region“ liest man im „Alpe-Adria-Magazin“. Auf den ersten
Blick scheint ein Beleg dafür gefunden, dass diese „Region“ Alpen-Adria „über-
all und nirgends“ ist. Aber was heißt dieser Befund?
Der Begriff „Region“ wurde vor über dreißig Jahren hauptsächlich als Fachbe-
griff in der Raumplanung eingeführt. Aktuell wird „Region“ auch in weiteren
Kontexten, etwa in Politik, Wirtschaft, Soziologie oder Ökologie verwendet,
da „Region“ mittlerweile auch als ein Gegenentwurf zum Globalen gilt (vgl.
Sinz 2005, S. 920), das im Zuge der ökonomischen Globalisierung so domi-
nant geworden zu sein scheint. Jedoch findet jede Entwicklung „im Globalen“
auch irgendwo statt: in der Region eben. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird
„Region“ üblicherweise „für Gegebenheiten oder Vorgänge“ verwendet, die
„mehr als den örtlichen Zusammenhang betreffen, aber unterhalb der staatli-
chen Ebene angesiedelt“ (Sinz 2005, S. 919) sind. „Region“ ist zu einer entschei-
denden Einheit geworden, wenn es etwa um Fördermittel der Europäischen
Union geht oder um eine Platzierung im internationalen Standortwettbewerb.
Entsprechend dem neueren Verständnis in der wissenschaftlichen Geogra-
phie sind Regionen kein a priori, kein einfach Gegebenes, das unhinterfragt
angenommen werden kann, sondern sie sind gesellschaftliche Konstrukte,
die durch Interaktionen und soziale Praktiken „gemacht“ werden und dies
immer wieder aufs Neue. Dementsprechend ist die Semantik des Begriffs
nicht eindeutig, sondern hat sich im Laufe der Zeit stetig verändert. So kann
Region etwa eine raumbezogene Einheit, ein homogenes, abgrenzbares Gebiet
bezeichnen oder schlicht ein Ausdruck von Einigungen über (sich jedoch stän-
dig verändernde) Begriffsinhalte sein. Was Region semantisch umfasst, ist
daher nicht eindeutig, sondern äußerst vielfältig. Ein erster Hinweis darauf,
das eine bestimmte Region durchaus plural gedacht werden kann.
Proof
44
Jeder Einsatz des Begriffs „Region“ deutet darauf hin, dass es in einem gewis-
sen Gebiet vielfältige Bindungen gibt, die einen Zusammenhalt und Vertrauen
demonstrieren. Diese „vielfältigen Bindungen“ können etwa soziale Bezie-
hungen sein (auf privater, kommunaler oder ökonomischer Ebene) oder aber
gemeinsame historische Wurzeln, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Koopera-
tionen von Vereinen oder ähnliches. Soziale Beziehungen sind eine besondere
Form von sozialen Interaktionen, die als zeitlich begrenzte Kontakte verstan-
den werden können (vgl. Wössner 1971, S. 45). Daher sind Bindungen nicht sta-
tisch, sondern dynamisch – sie befinden sich im Fluss der Interaktionen. Wo
es soziale Bindungen gibt, werden territoriale Grenzen überwunden. Dement-
sprechend lassen sich Regionen, die auf sozialen Bindungen basieren, kaum
territorial eingrenzen.
Eine andere Möglichkeit auf Regionen zu blicken, ist, sie durch territorial
gedachte Grenzen zu formieren. Dieses Verständnis ist eher ein administrati-
ves oder planerisches Verständnis einer Region. Dabei ist jede „Grenzsetzung
Willkür“ (Simmel [1908] 1992, S. 21), da sie auch Verschiebungen, Erweiterun-
gen, Einziehungen und Verschmelzungen erlaubt. Solche Grenzziehungen
haben dadurch eine „soziologische Funktion“ (ebenda, S. 23), dass sie ein Aus-
schluss und Anschluss garantieren: Über die Ausschlussfunktion separiert
sich eine Region von ihrer Umwelt (von anderen Regionen z. B. oder: dem Rest
der Welt); über die Anschlussfunktion schaffen Grenzziehungen Inklusion,
Dazugehörigkeit und bestenfalls Homogenität nach Innen.
Eine Region, die von vielfältigen sozialen Interaktionen geformt wird und
weniger in einem territorialen Verständnis ihren Ausdruck findet, ist überall
dort, wo diese als solche gemacht, gedacht und kommuniziert wird. Da der
Begriff „Region“ sehr stark von einer subjektiven Wahrnehmung abhängt, lässt
sich eine Pluralität dessen vermuten, was in unserem Beispiel Alpen-Adria
unter einer „Alpen-Adria-Region“ verstanden wird. Ob das Verständnis der
Alpen-Adria-Universität dasselbe Regionsverständnis ist wie das eines Alpen-
Adria-Hafenfests, ist anzuzweifeln. Region in diesem Sinne ist vielmehr
eine imaginäre Einheit, die allgegenwärtig (vgl. Langendijk 2007, S. 1194) und
zugleich nicht wirklich zu fassen ist. Diese Annahme ähnelt der von Marija
Juric-Pahor (2011), die den Begriff „Alpen-Adria-Raum“ ebenfalls als einen
„imaginären Akt“, also einen Akt „des Vorstellens und Kreierens, für dessen
Wirkungsmacht der Glaube und die Selbstbindung der Individuen an ‚ihn’ aus-
schlaggebend waren bzw. sein sollten“ (vgl. Juric-Pahor 2011, S. 319) beschreibt.
So werden „Räume“ oder „Regionen“ erfunden, um sie – als eine Art Chimäre
für ökonomische oder politische Zwecke zu kommuniziert und zu nutzen.
Proof
45
Regionen lassen sich jedoch auch ganz konkret, d. h. über einen formalen
Akt der Gründung (z. B. durch Mitglieder) herstellen. Ein Beispiel für eine
administrative und damit territorial abgegrenzte Region in unserem Unter-
suchungsgebiet ist die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (ARGE Alpen-Adria).
Diese Institutionalisierung einer regionalen Kooperation wurde bereits in den
1970er-Jahren gegründet. Damals war es ein ambitioniertes und überaus inno-
vatives Unterfangen, denn im nachkriegserschütterten Europa gab es bisher
keine grenzüberschreitenden Kooperationen dieser Art, vor allem keine, die
zugleich versuchte Ideologiegrenzen zu überwinden. Da diese Institution vor
allem von der politischen Elite der Länder zwischen den Alpen und der Adria
gegründet wurde, war sie weitgehend eine in mühevoller Kleinarbeit geborene
Idee. Doch die institutionalisierte „Kopfgeburt“ schien zunächst durchaus
lebensfähig, denn statt eines „Gegeneinanders“ (etwa am Eisernen Vorhang
zwischen Österreich und Slowenien) setzte man vielmehr auf ein „Miteinan-
der“. Anfangs verständigten sich die Beteiligten vor allem über gemeinsame
Projekte der Raumplanung, was zu einem durchaus erfolgreichen Beginn
führt. Die historischen Umbrüche zu Beginn der 1990er-Jahre, wie der Fall
des Eisernen Vorhangs und eine stärker werdende Europäische Union, stell-
ten unerwartet widrige Rahmenbedingungen für die institutionaliserte Form
der Alpen-Adria-Region dar. Man könnte sie auch als Komplikationen bei der
„Kopfgeburt“ bezeichnen, denn sie stellten das Überleben der „Kopfgeburt“ auf
eine harte Probe. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs verloren die gemeinsa-
men Ziele der Raumplanung an Bedeutung und die Region Alpen-Adria hatte
innerhalb kürzester Zeit keine eindeutigen Aufgaben mehr. Ein- und Austritte
von Mitgliedern stellten die Grenzen der Institution in Frage. Die „Kopfgeburt“,
die durchaus einmal lebte, hat damit an Lebensmotivation verloren. Im Jahr
2012 titelt eine Schlagzeile schließlich vom „langsamen Tod der Pioniere“.
Vor diesem Hintergrund könnte man den Sinn einer „territorial verordneten
Region“ auch in Frage stellen: Ist die Alpen-Adria-Region gar eine „Totgeburt“?
Was bedeutet die Pluralität des Regionsbegriffs für „die“ „Alpen-Adria-Region“?
Welche „Kopfgeburten“ „der“ „Alpen-Adria-Region“ haben Überlebenschan-
cen, welche sind „Totgeburten“? Auf diese Fragen gehen wir im folgenden Text
näher ein und suchen nach Antworten. Mit unserer Arbeit wollen wir zu einem
bewussten Umgang mit dem Begriff der „Region“, vor allem mit dem Begriff „der“
„Alpen-Adria-Region“ beitragen. Wie anfangs aufgezeigt, wird die „Alpen-Adria-
Region“ inflationär verwendet, ein reflektierter, bedachter Einsatz des Begriffs
lässt sich daher nicht annehmen. Damit verliert der Begriff an Wirkungsmacht
einerseits, aber auch an Sinnhaftigkeit und Glaubwürdigkeit andererseits.
Besonders die Verwendung des bestimmten Artikels („die“) erzeugt aber eine
Proof
46
genau gegenteilige Aussage: Jeder spricht von der Alpen-Adria-Region, aber kei-
ner weiß eigentlich, wofür diese Bezeichnung steht. Für uns ergibt sich damit ein
Widerspruch: ein Begriff soll fixiert werden, der keinen Inhalt zu haben scheint.
Um die „Alpen-Adria-Region“ zu verstehen, haben wir uns zunächst mit dem
Begriff „Region“ auseinandergesetzt (Kapitel 2.2.2). Es zeigt sich, dass auf einer
theoretischen Ebene der Begriff der „Region“ bereits vielfach gedeutet werden
kann und aktuell ein Trend hin zu Relativismus und Relationalität der Region
zu verzeichnen ist. Wir stellen dort zwei Positionen der Deutung von Region
gegenüber, die wir bereits in der Einleitung pointiert hervorgehoben haben:
ein territoriales Verständnis einerseits und ein relations Regionsverständnis
andererseits. In Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 folgen dann empirische Beispiele für
die beiden Perspektiven. Für einen territorial verstandenen Regionsbegriff
dient uns die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (ARGE Alpen-Adria) in Kapitel
2.2.3. Der Sammelband des Historikers Andreas Moritsch über die Geschichte
der Alpen-Adria-Region (2001) und das Buch des Historikers Hellwig Valentin
(1998) zum 20jährigen Jubiläum der ARGE Alpen-Adria gaben uns Einblick in die
Vergangenheit der ARGE. Aktuelle Berichte in der Tagespresse über Austritte
von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft sowie ein Interview mit Wolfgang
Platzer, dem Leiter der Geschäftsstelle Kärnten, ermöglichten uns Einblicke in
die aktuellen Aufgaben, Ziele, Chancen und Herausforderungen einer begrenz-
ten Alpen-Adria-Region. Ein eher relationales Verständnis einer „Alpen-Adria-
Region“ folgt in Kapitel 2.2.4, das eine Region basierend auf Bindungen und
sozialen Interaktionen in den Mittelpunkt stellt. Dazu haben wir Menschen
interviewt, die entweder mit der „Alpen-Adria-Region“ auf Grund Ihrer berufli-
chen Tätigkeit sehr viel zu tun haben oder die berufliche und private Netzwerke
in einem Gebiet haben, welches historisch oft als alpen-adriatischer Kernraum
bezeichnet wird. Dieser Kern umfasst das Bundesland Kärnten, die Region
Friaul-Julisch-Venetien, das Land Slowenien und die Gespannschaft Istrien in
Kroatien (vgl. Moritsch 2001, S. 14). Unsere Interviewpartnerinnen waren Emil
Kristof vom Universitätskulturzentrum UNIKUM der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt, Stefan Merkac vom Büro für ÖKO-Projektmanagement ecocontact,
Johannes Tomic vom Biohof Tomic und Irena Benedicic vom Industriemuseum
Jesenice/Slowenien. Allen, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben,
schulden wir großen Dank. Die in den Beitrag eingeflossenen Zitate unserer
Interviewpartner bleiben bewusst anonym.
Zu unserem methodischen Vorgehen: Alle Interviews wurden problemzent-
riert und von einem Leitfaden unterstützt durchgeführt. Der Leitfaden hatte
einerseits die Aufgabe, den Interviewpartnern Platz für eigene Erzählungen
Proof
47
zu lassen, andererseits ermöglichte er bei stockendem oder problematischem
Verlauf ein Einschreiten der Interviewerin (vgl. Flick 2005, S. 134 ff.). Der Leitfa-
den umfasste vier thematische Einheiten: der erste Teil widmete sich den Auf-
gaben und regionaler Arbeit der Institution bzw. Person, der zweite Teil zielte
auf die ARGE Alpen-Adria als begrenzte Region ab, der dritte Teil auf Inter-
aktionen im Sinne von Zusammenhalt und Zusammenarbeit in einer Alpen-
Adria-Region und der vierte Teil fragte nach einem subjektiven Verständnis
zum Begriff „Region“. Da Bindungen in einer Region vielfältig motiviert sein
können, erfolgte die Auswahl der Interviewten entsprechend breit. Wir wähl-
ten Personen, denen wir auf Grund ihrer beruflichen oder privaten Interessen
eine Expertise zur Alpen-Adria-Region zuschrieben: Beamte, Künstler, Muse-
umsleiter, Freiberufler oder Landwirte. Fünf Interviews wurden von Mai bis
Juli 2012 in Österreich und Slowenien geführt. Die Interviews dauerten 60 bis
90 Minuten und wurden auf Tonband aufgenommen. Das Material wurde aus-
gewertet, so dass sich aus Schlüsselaussagen Kategorien ergaben, die einen
Hinweis auf ein relationales Regionsverständnis liefern.
In den Interviews hat sich gezeigt, dass es sehr unterschiedliche Gründe
und Motivlagen gibt, Interaktionen innerhalb einer Region aufzunehmen.
Ein einheitliches Bild einer Alpen-Adria-Region ergibt sich dadurch nicht,
aber eine große Pluralität an Vorstellungen und Zielen. Wir sprechen daher
bewusst im Plural, wenn wir „Alpen-Adria-Regionen“ sagen. Unser abschlie-
ßendes Kapitel resümiert schließlich zur Frage, ob eine Alpen-Adria-Region
(über-)leben kann (oder wird).
2.2.2 „Region“ – ein schwieriger Begriff!? Territoriale versus relationale Perspektiven auf Region
Was ist eine „Region“?
Ursprünglich leitet sich das Wort Region vom lateinischen „regio“, einer Rich-
tung, einer Gegend oder einem Gebiet (vgl. Sinz 2005, S. 919) und dem lateini-
schen „regere“, lenken, leiten, Grenzen abstecken (vgl. Grom 1995, S. 7) ab. In der
deutschsprachigen Verwaltung gibt es keine als Region bezeichnete Ebene. Als
eigene administrative Ebene ist Region etwa in Großbritannien, Frankreich und
Italien etabliert, wo diese vor allem als Manifestation der Dezentralisierung ein-
geführt wurde (vgl. Sinz 2005, S. 919). Im Sinne einer Gegend oder eines Gebietes
ist Region etwas, das auf einen „Raum“ verweist. „Region“ ist damit ein raum-
bezogener Begriff – dies war zumindest das Verständnis in den 1980er-Jahren,
als „Region“ etwa als eine nach bestimmten Kriterien als homogen abgrenzbare
Proof
48
räumliche Einheit verstanden wurde (vgl. Roemheld et al. 1987, S. 72 ff.). In der wis-
senschaftlichen Geographie wurde „Region“ in dieser Zeit als „ein geographisch
bestimmter Raum mittlerer Größenordnung“ definiert, der als zusammengehö-
rig angesehen wird, so der Geograph Heinrich Blotevogel (1996). In diesem Sinn
ist Raum etwas Materielles jenseits des eigenen Körpers, in dem verschiedene
Handlungen durchgeführt werden. Dieser „Lebensraum“ ist das Ergebnis einer
„komplexen Dialektik zwischen natürlichen Gegebenheiten einerseits und von
Menschen geplanten und durchgeführten Prozessen der verändernden, entwi-
ckelnden Gestaltung dieser Gegebenheiten andererseits“ (Roemheld et al 1987,
S. 73). Diese Annahmen sind aus heutiger Sicht problematisch, denn die damit
verbundene Raumauffassung ist zum einen trivial, zum anderen geht dieser
Regionsbegriff davon aus, dass „Region“ immer auch erdräumlich fixierbar ist.
Eine eindeutige Unterscheidung wird damit nicht gemacht, nämlich zwischen
dem Begriff und dem bezeichneten Gegenstand oder der bezeichneten Gegeben-
heit. Denn die Bedeutungen von Begriffen sind nicht Eigenschaften der Objekte,
„sondern Ausdruck von Konventionen, von Einigungen über den Bedeutungs-
gehalt eines Begriffs mittels Definitionen“ (Werlen 2004, S. 214). Daraus folgt
in einer neueren Perspektive der wissenschaftlichen Geographie, dass es keine
„Räume“ oder „Regionen“ gibt, die von ihrem Wesen her vorgegeben sind.
„Räume“ und „Regionen“ sind sozial konstruierte Entitäten, die sich je nach Fra-
gestellung und Interesse auf unterschiedliche Tatsachen beziehen und somit
auch unterschiedliche Ausprägungen annehmen können.
Diese Konstruktionsleistung zeigt der Historiker Joachim Kuropka (1994, S. 19)
an Hand des Begriffs der „landsmannschaftlichen Verbundenheit“ auf. Er argu-
mentiert vor allem mit einer zeitlichen und historischen Einprägung von Regi-
onen und damit verbundenen Identitäten. Es scheint, als müsse den Menschen
nur lange genug erzählt werden, welcher „Region“ sie angehören und welche
Eigenschaften damit verbunden sind. Daraus entwickelt sich dann schließlich
nach einigen Generationen ein Gefühl der Zugehörigkeit oder noch intensiver:
Patriotismus (vgl. Kuropka 1994, S. 22). Was Joachim Kuropka hier meint, kann
ohne weiteres als eine Art von Regionalisierungsprozess verstanden werden.
Sowohl konkrete Regionen als auch ihre Deutungen und Zuschreibungen sind
veränderlich. In Europa wurde die Region insbesondere nach 1989 aufgewertet,
was der Kulturwissenschaftler Walter Schmitz (2010, S. 28) als „Wiederkehr des
Regionalen“ bezeichnet. Es entwickelte sich eine Denkrichtung, die als „new
regional geography“ bezeichnet wird. Basierend auf der Strukturationstheorie
von Anthony Giddens (1984) wird Region als etwas verstanden, wo sich sozio-
ökonomische Beziehungen konzentrieren. Das kann auf unterschiedlichen
Proof
49
Ebenen und in einem bestimmten physisch-materiellen Kontext erfolgen.
Diese Diskussion regte ein Nachdenken darüber an, wie Regionen „gemacht“
werden und weshalb sich Regionen beispielsweise ungleich entwickeln. Die
Denkrichtung des „new regionalism“ geht in die gleiche Richtung. Die Region
wird hier als eine eigenständige handlungsfähige Einheit gesehen, die wirt-
schaftliche Entwicklung und Wohlstand erzeugen kann. In politischer Hin-
sicht gelten Regionen sogar als wettbewerbsfähigere und effizientere Einhei-
ten als Nationalstaaten (vgl. Jonas 2012, S. 266). „Muster-Regionen“ wie Baden-
Württemberg, Emilia Romagna und Silicon Valley und deren wirtschaftliche
Erfolge schienen die Annahmen zu bestätigen. Die Versuche, das Erfolgsge-
heimnis dieser Regionen zu kopieren, scheiterten jedoch bislang. Darüber hin-
aus lässt das Konzept des „new regionalism“ außer Acht, wie Regionen regio-
nalisiert werden. Die Regionalisierungsprozesse erscheinen hier als „blinder
Fleck“ des Ansatzes.
Daher kritisierten etwa die Geographen John Lovering (1999) oder Gordon Mac-
Leod und Martin Jones (1999) Ende der 1990er-Jahre den „new regionalism“. Sie
richteten ihren Blick auf regionale Eliten und hinterfragen deren Einfluss auf
die Konzeption von Regionen, welche Ideen sie antrieben und deren Hand-
lungen. Die wissenschaftliche Bewegung, die den „new regionalism“ in Frage
stellt, nennt sich „post-new regionalism“. Lovering bringt die neuen Erkennt-
nisse, zu dem was Region ist, auf den Punkt: „[the ideas of what constitutes the
‚region‘] are not self-evident economic facts, they are social constructions, dis-
cursive inventions and as such influenced by all manner of political, cultural
and other less than ’rational’ factors“ (Lovering 2003, S. 44, 45). Anders als der
„new regionalism“, der davon ausgeht, dass regionale Akteure etwas am besten
so oder anders tun sollen, fragt der „post-new regionalism“ etwa danach, wer
überhaupt regionale Entwicklungsstrategien entwirft, für wen er das macht
und welche Auswirkungen das hat.
Die Geographin Judith Miggelbrink (2002, S. 94) bringt das Problem einer
„Region“ wie folgt auf den Punkt: einerseits wird „Region“ häufig aus dem Dis-
kurs über „Raum“ abgeleitet, andererseits ist „Region“ aber mit einer Reihe von
mehr oder weniger konkreten gesellschaftlichen Begriffsinhalten versehen.
Damit befindet sich die „Region“ in einem Spagat zwischen einer bestimm-
ten Räumlichkeit, wo es durchaus um materielle Aspekte der Ordnung von
Gesellschaft geht, aber eben auch um kommunikativ hergestellte Ordnungen,
mit denen Akteure Strategien verfolgen und so vermeintlichen Sinn und letzt-
lich Durchsetzungsfähigkeit schaffen können (vgl. Miggelbrink 2002, S. 94).
Dadurch erhält „Region“ eine irritierende Fülle an unterschiedlichen Bedeu-
Proof
50
tungen. Es entsteht eine Pluralität von Regionen, denn Region kann offensicht-
lich vieles sein: ein Ort, an dem etwas stattfindet, ein konkreter, politisch-
administrativer Raum, eine von Aktivitätslinien durchzogene Fläche, ein
Element sozialer Kommunikation oder ein Steuerungsinstrument (vgl. Mig-
gelbrink 2002, S. 95).
Region als territorial gebunden und mit Grenzen versehen
Die Region erlebt derzeit eine Renaissance, so titelt etwa der Geograph Hans
Heinrich Blotevogel schon 1996 und zehn Jahre später auch der Geograph Uwe
Kröcher (2007). Eine Ursache für die Neubewertung des Regionalen sieht Blote-
vogel (1996) in dem tiefgreifenden Strukturwandel spätmoderner Gesellschaf-
ten. Regionalsierung, als der Prozess, der etwas zu einer Region macht, ist ein
Strukturmerkmal des „Post-Fordismus“9 geworden. Im „Post-Fordismus“ wird
die Region im wirtschaftlichen Kontext als neuer Produktionszusammenhang
verstanden, aus dem Cluster und Netzwerke hervorgehen, die aus der Deregu-
lierung hierarchisch-zentralistischer Großbetriebe entstanden sind. Auch in
politisch-administrativen Zusammenhängen gewinnen regionale Einheiten
an Bedeutung, wie etwa „die Region“ im Leitbild eines „Europa der Regionen“.
Als Grund für die Aktualität von Regionen und den Prozessen der Regionalisie-
rung wird angenommen, dass ein zunehmender Wunsch nach Überschaubar-
keit und Gemeinsinn in den als unübersichtlich und unkontrollierbar wahrge-
nommenen Prozessen der ökonomischen Globalisierung entsteht.
Bilden sich Regionen, dann bedeutet das, dass etwas von etwas anderem in
einer räumlichen Dimension getrennt wird (vgl. Gebhardt et al. 2011, S. 14).
Regionalisierung schafft dadurch eine Region, indem sie Grenzen zieht. Abge-
grenzte Einheiten (Regionen) kommen auf unserer Erde natürlicherweise nicht
vor, sie werden vielmehr durch gesellschaftliche Prozesse erst erzeugt. Damit
sind Regionen ein Ergebnis sozialer Konstruktionen und weder eindeutig noch
objektiv gegeben (vgl. Gebhardt et al. 2011, S. 16). Prozesse der Regionalisierung
stellen somit Aus- und Neuverhandlungsprozesse dar, mit deren Hilfe Ord-
nung und Überschaubarkeit geschaffen soll. Der Geograph Arnoud Langendijk
(2007, S. 1194) führt als Gründe für Regionalisierungsprozesse vor allem zwei
Ansätze an: (a) äußerliche Strukturen als Auslöser von Regionalisierungen –
der Trend zur Region ist hier ein logisches Ergebnis eines größeren Wandels
9 Fordismus basiert auf der Produktionsweise von Henry Ford und bezeichnet die Umstrukturierung der Arbeit auf Fließbandarbeit und Arbeitsteilung zur Erzeugung von Massenproduktion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Der zeitlich seit etwa den 1970er-Jahren darauf folgende Post-Fordismus unterscheidet sich davon besonders durch flexible Produktion und Individualität der (Massen-)Produkte (vgl. Haas & Neumair 2007, S. 85 ff.; Bathelt & Glückler 2002, S. 55, 259)
Proof
51
oder externer Zwänge (zit. n. Benz et al. 1999, S. 133) wie Globalisierung, Fle-
xibilisierung der Produktion, Wandel des Wohlfahrtsstaates oder Urbanisie-
rung; (b) Regionalisierung als Ergebnis von Vermittlungen – Regionen werden
aus dieser Sicht als diskursive und materielle Konstrukte betrachtet, die aus
einer Vielzahl an Prozessen entstehen und ihre eigenen Logiken, Routinen und
Praktiken aufweisen. Regionen sind aus dieser Perspektive zeitweise stabile
Ergebnisse. Das Konzept der Regionalisierung weist damit also eine gewisse
Variabilität auf, das für spezifische Interessen funktionalisiert werden kann
(vgl. Benz et al. 1999, S. 140).
In jedem Fall scheint Regionalisierung ein Prozess mit einer hohen Eigendyna-
mik und einem in der Regel offenen Ausgang zu sein. Die Politikwissenschaft-
ler Arthur Benz und Dieter Rehfeld, der Raumplaner Dietrich Fürst und die
Stadtplanerin Heiderose Kilper (1999, S. 141 f.) scheinen sogar gewisse „Regel-
mäßigkeiten“ bei Regionalisierungsprozessen feststellen zu können:
• Regionalisierung als Institutionalisierung: Hier ist Regionalisierung eine
Stufe im Prozess der Institutionalisierung einer spezifischen Region. Der
Prozess findet dort statt, wo neue regional zu bearbeitende Aufgaben insti-
tutionalisiert werden sollen.
• Regionalisierung als temporärer Vermittlungsprozess: Regionalisierung
bringt Akteure zusammen, die auf Grund von institutionellen Hindernissen
zu hohe Transaktionskosten hätten, damit sie Zusammenarbeiten könnten.
Regionalisierung dieser Art ermöglicht für die beteiligten Akteure neue
Handlungsmöglichkeiten.
• Regionalisierung als dauerhaftes Verhandlungssystem: Regionalisierung
setzt sich etwa mit gesellschaftlichen Verteilungsfragen auseinander.
• Regionalisierung als Ritual: Regionalisierung findet dann statt, wenn es
Anreize wie Fördermittel oder eine Möglichkeit zur Imageverbesserung gibt.
„Regionen“ sind, und das zeigt auch die Analyse von Regionalisierungsprozes-
sen und deren Ausgängen, konstruierte Gegebenheiten, die sich je nach Frage-
stellung und Interesse auf unterschiedliche Gegebenheiten beziehen und damit
auch unterschiedliche Ausprägungen annehmen können: „Räume bzw. Regi-
onen bestehen nicht an sich, sondern werden in der Domäne von Beobachtern
erzeugt und sozial bzw. kulturell eingeschrieben. In diesem Sinne kann das
Regionale als ein Modus der Grenzziehung konzipiert werden“ (Block 1997, S. 211).
Proof
52
Region als ein Produkt von Interaktionen und sozialen Konstruktionen: Die relationale Region
„Traditionelle“ regionale Geographie untersucht empirische Entitäten, Abhän-
gigkeiten oder „horizontale“ Verbindungen zwischen Menschen und ihrer
Umwelt in einer bestimmten Region. Territoriales Verständnis bedeutet aus
dieser Sicht institutionalisierte Territorialstrukturen und Grenzziehungen,
sowie funktionales, planerisches und administratives Handeln (vgl. Wardenga
2002, S. 8 ff). Im Gegensatz dazu ist der relationale, kognitive Raum, durch die
Art und Weise der Menschen in Bezug auf ihre Werte, Gefühle, Überzeugungen
und Wahrnehmungen über ihren Lebensraum (z.B. Region) definiert. Damit
sind die Beziehungen mit anderen Menschen und mit der physischen und psy-
chischen Umwelt gemeint. So wird relationaler Raum bewusst oder unbewusst
in unseren Absichten und Handlungen eingebettet (vgl. Holt-Jensen 2009,
S. 226 f.). Die Zusammenhänge zwischen der physisch-materiellen Struktur
des Raumes und der dabei gegebenen Relationalität der Dinge zueinander mit
sozialen Gegebenheiten sind auf mehreren Dimensionen erkennbar. Eine erste
leicht einsichtige Dimension ist die Funktionalität. Die räumliche Anordnung
physisch-materieller Dinge und ihre relationalen räumlichen Beziehungen
zueinander sind eine wichtige funktionale Voraussetzung für das Ablaufen
sozialer und ökonomischer Prozesse (vgl. Weichhart 2008, S. 62).
Die Geografen Andrew E.G. Jonas und Gordon MacLeod haben in ihren kon-
zeptionellen Innovationen der wissenschaftlichen Geographie versucht, den
Begriff der „relationalen Region“ zu etablieren. In seinem Artikel „Region and
place. Regionalism in question“ (2012) stellt Andrew E.G. Jonas „Relationale
Regionen“ im Sinne von Beziehungen, ‚flows‘ (also: Strömen) und Netzwerken
dar. Region ist damit ein Knotenpunkt, wo sowohl nahe gelegene als auch ent-
fernte soziale, politische und wirtschaftliche Beziehungen zusammen laufen.
Dieser Knoten stimmt nicht notwendigerweise mit politisch-administrativen
Einheiten überein. Relationale Konzeptionen fragen danach, warum und wie
Regionalisierungsprozesse ausgehandelt, konstruiert und umkämpft werden,
wie Regionen zeitweilig festgelegt und wieder aufgelöst werden. Regionen
können damit auch als räumlich absolut losgelöst gedacht werden. Gegen den
„space of places“ entsteht – so die dahinterliegende These für relationale Regi-
onen – der „space of flows“, der vor allem die territorial gestützten Organisatio-
nen, aber auch den gesamten historischen und institutionellen Rahmen eines
spezifischen Ortes in Frage stellt. Space of flows ist die räumliche Manifestation
von Macht und Funktion in einer globalisierten Gesellschft. Diese bildet sich
nach funktionalen – nicht territorialen – Mustern aus: Flows von Kapital, Infor-
Proof
53
mationen, Technologie, Symbolen etc. sind dem Territorialprinzip entwach-
sen (vgl. Castells 1994 und 2001, S. 410 f.).
Zusammenfassend stellen wir also fest, dass sich die Pluralität von „Regionen“
auf zwei Betrachtungspole reduzieren lässt:
• relationale Vorstellung: ihre Grenzen sind unklar und durch nichthierarchische,
netzwerkfähige Beziehungen/Bindungen definiert; unter anderem gehören
dazu auch lokale Eigenheiten, Interaktivität, Atmosphäre und Vertrautheit;
• territoriale Vorstellung: ergibt sich durch institutionelle bzw. politische
Ansprüche, die häufig durch Wirtschaftsbeziehungen geprägt sind; begreift
Region als eine räumliche Einheit, die durch eine Grenze markiert wird;
damit ist sie fixiert, statisch und ahistorisch.
Das territoriale Konzept begreift Region als eine räumliche Einheit, die durch
eine Grenze markiert wird und ist damit fixiert, statisch und ahistorisch, das
heißt sie lässt geschichtliche Aspekte außer Acht (beispielsweise National-
staaten). Territoriale Konzepte fragen nach Land, Ressourcen, Wirtschafts-
entwicklung und Bürgern. Regionalpolitische Arbeit basiert häufig auf diesem
Konzept. Relationales Denken dagegen deutet die Region als kritische Katego-
rie, als visionäres Vorhaben, als versteckte Realität und damit als Forschungs-
vorhaben. Die Zusammenhänge zwischen dem „Territorialen“ und dem „Sozia-
len“ können aus einer relationalen Perspektive beobachtet werden und stellen
sich aus unserer Sicht als Gegensatz dar (Abb. 2.3). Bei der „traditionellen“ regi-
onalen Geographie stehen planerisches und administratives Handeln im Vor-
dergrund. Die daraus entstehenden Territorialstrukturen und Grenzziehungen
hinterlassen deutliche „Spuren“. Der betrachtete Container Raum „Region“,
symbolisiert durch den Schirm, umfasst die Abhängigkeiten oder „horizon-
talen“ Verbindungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Gegenüber dem
„relationalen Denken“ beschränkt der Schirm die Sicht und beschränkt die
Möglichkeiten der Wahrnehmung anderer Perspektiven.
Die beiden folgenden Kapitel versuchen, für diese konzeptionellen und theo-
retischen Gegensätze zwischen territorialer und relationaler Perspektive auf
„Region“ empirische Evidenz zu finden.
Proof
54
Abb. 2.3 Ein territoriales Regionsverständnis wirkt hermetisch und oftmals so selbstverständlich „evident“, dass andere Möglichkeiten (z.B. Relationalität) nicht gesehen werden können (Zeichnung: Marika Balode).
2.2.3 Alpen-Adria-Region im territorialen Verständnis – Das Beispiel der ARGE Alpen-Adria
Administrativ und planerisch – eine Form der Selbstausgrenzung?
Territorialität bedeutet Grenzziehung und das Ziehen von Grenzen wiederum
geht mit dem Ausschließen dessen, was außerhalb dieser Grenze liegt, einher.
Als Gegenteil dazu kann die Globalisierung gesehen werden, deren Ziel es ist,
wirtschaftliche, politische, kulturelle, kommunikative Grenzen aufzuweichen
und zu einem globalen Ganzen zu verschmelzen. In diesem Sinn können Regi-
onen auch als Gegenpol zur Globalisierung gesehen werden. Doch was bedeu-
tet das nun für das Bestehen einer Region im Zeitalter der Globalisierung? Die
territoriale Bildung von Regionen kann mit einer Insel verglichen werden:
Alles für die Region Bedeutsame passiert auf dieser Insel und sie grenzt sich
somit selbst von allem ab, was außerhalb dieser Insel liegt. Daher stellt sich
die Frage: Ist das territoriale Verständnis von dem, was Region ist, fördernd für
eine Bildung und das Bestehen von einer Region oder gilt das Gegenteil: kata-
pultiert dieses Verständnis die Region ins Aus?
Proof
55
Was unter der „Alpen-Adria-Region“ verstanden werden kann (und werden
soll), wurde in den letzten Jahrzehnten maßgeblich von der ARGE Alpen-Adria
geprägt. Sie wurde am 20. November 1978 von der politischen Elite der Länder
und Regionen konzipiert, die sich im weitesten Sinne von der Adria bis zum
Alpenvorland erstreckt. Der ARGE Alpen-Adria kam von Anfang an eine welt-
politisch einzigartige Bedeutung zu. Noch in Zeiten der Ost-West-Konfronta-
tion wurde eine sub-staatliche, aber von offiziellen Stellen (Bundesländern,
Gemeinden, später auch Komitaten) getragene Kooperation über die Block-
grenzen hinweg in die Wege geleitet, sozusagen eine „regionale Außenpolitik“
(Juric-Pahor 2011, S. 318). Auch wenn die Beschlüsse der ARGE als Absichtser-
klärungen der Regionalregierungen nicht rechtskräftig sind, war dieser inter-
regionale Zusammenschluss doch mehr als ein symbolischer Akt: „Er war die
punktuelle Überwindung der Trennung zwischen NATO-Italien, dem neutra-
len Österreich und dem blockfreien Jugoslawien; eine Kooperation, die sich
über die Systemgrenzen von Kapitalismus und Sozialismus hinwegsetzte und
eine Brücke zwischen dem romanischen, germanischen und slawischen „Kul-
turkreis“ schlug – ein Signal zur Überwindung des Ost-West-Konflikts also“
(Wintersteiner 2004, S. 20).
Grundlegende Idee war es damals, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb
dessen man gemeinsame Herausforderungen der Raumordnung diskutieren
konnte, wie den Ausbau der Verkehrsverbindungen zwischen Österreich und
Italien (vgl. Valentin 1998, S. 44, 46).
Das Territoriale bzw. Erdgebundene dominierte demnach auch in den Anfän-
gen der ARGE Alpen-Adria und der Regionsbegriff wurde im Sinne einer Pla-
nungsregion verwendet. Dem Selbstverständnis der ARGE zufolge ist die
Alpen-Adria-Region auch heute noch eine administrative Einheit: „Eine Region
ist eine Verwaltungseinheit, wie etwa ein Bundesland. Demnach sind alle Mit-
glieder der ARGE Alpen-Adria Regionen, egal ob Bundesland, Nationalstaat
oder Komitat“, so Wolfgang Platzer, Generalsekretär der ARGE Alpen-Adria.
Hiermit wird deutlich, dass für die ARGE das planerische, administrative
Verständnis im Vordergrund steht. Gleichzeitig entsteht allerdings auch der
Eindruck, dass das territoriale Verständnis einer Alpen-Adria-Region von der
ARGE derart fixiert ist, dass kaum mehr eine andere Sichtweise einer Alpen-
Adria-Region möglich erscheint. Derzeit gehören der ARGE Alpen-Adria 8 Mit-
glieder an: Burgenland, Friaul-Julisch-Venetien, Kärnten, Kroatien, Slowenien,
Steiermark, Veneto. Allerdings hat sich die Mitgliederzahl in den letzten Jahren
dramatisch verändert: 1999 hatte die ARGE mit insgesamt 18 Mitgliedsregionen
Proof
56
einen Höchststand, seither ist die Zahl der Mitglieder beständig rückläufig.
Eine der Ursachen für die Austritte von Regionen aus der ARGE mag an deren
geringer finanzieller Ausstattung liegen – andere Fördermittelgeber, etwa die
EU, haben höhere Förderquoten als die ARGE. Diese verfügt lediglich über ein
Budget, das aus den Beiträgen der jeweiligen Mitglieder finanziert wird, wobei
sich der Mitgliedsbeitrag aus der Einwohnerzahl des Mitgliedslandes errech-
net. Eine zwangsläufige Folge der sinkenden Mitgliedszahlen der ARGE ist die
Schrumpfung des Budgets: Im Jahr 2012 etwa standen gerade einmal € 65.000
zur Verfügung, wie der Generalsekretär der ARGE, Wolfgang Platzer berichtet.
Nicht gerade eine Summe, um Meilensteine in der Regionalförderung zu set-
zen. Etwas resigniert schildert Platzer, dass die finanzierten Projekte kaum
noch öffentliche Aufmerksamkeit erfahren: „Wir informieren die Presse über
alle unsere Projekte, diese schreibt aber nicht darüber, da z.B. höher finan-
zierte EU-Projekte als interessanter eingestuft werden.“
Aber nicht nur das geringe Budget wurde zum Ausstiegsgrund für einige Mit-
gliedsländer. Es fehlt die Gewissheit darüber, „was“ man eigentlich ist und wo
die Arbeit hinführen soll. Das Geld wird knapp und somit ist auch die Zeit der
größeren Projekte vorbei, wie etwa der Ausbau der Verkehrsverbindung Öster-
reich-Italien. Vom raumplanerischen Geist ist bei der aktuellen Projektarbeit
wenig geblieben, so Platzer: „In 35 Jahren gab es über 800 Projekte in der ARGE.
Am wichtigsten waren die Raumplanungsprojekte. Heute haben wir die Alpen-
Adria Jugendsportspiele und Literaturtreffen.“
Doch welchen Sinn machen Projekte ohne größeren Charakter, in einer
Region, von der man gar nicht weiß, ob sie überhaupt existiert? Kroatien hat in
den Jahren 2011 und 2012 den Vorsitz in der ARGE und setzt in dieser Zeit ganz
auf die „Stärkung der regionalen Identität“ (Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria
o.J.). Dieses Vorhaben scheint, realistisch gesehen, etwas utopisch, denn wie
kann man von einer gemeinsamen Identität in einer Alpen-Adria-Region spre-
chen, von der das Verständnis, was eine Region überhaupt sei, nicht geklärt
ist. Es macht den Eindruck als würde hier nur hinausgezögert werden, was
ohnehin schon dem Tode geweiht ist. Die Kärntner Kronen Zeitung titelte mit
„dem langsamen Tod der Pioniere“ (Kimeswenger 2012, S. 14). Kärnten dachte
auch verstärkt über einen Austritt nach, übernahm aber den Vorsitz für das
Jahr 2013. Eigentlich ein Absurdum, wenn man sich die Entwicklung der letz-
ten Jahre ansieht. So pionierhaft die ARGE in den Anfängen in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit war, so negativ belastet sind die Ereignisse der
letzten Jahre. 2012 kann ganz klar von einer Krise gesprochen werden. Oder
lässt sogar die Auflösung nicht mehr lange auf sich warten?
Proof
57
Brüche im Dasein der ARGE Alpen-Adria
Für das im vorherigen Kapitel skizzierte Auf und Ab in der Geschichte der ARGE
Alpen-Adria lassen sich einige Gründe identifizieren, die für die Entstehung
einer Krise in der ARGE verantwortlich sind. Wir identifizieren vor allem drei
markante Brüche.
a) Politische Meilensteine – Stolpersteine für die ARGE Alpen-Adria
Das Verständnis darüber, was die „Region der ARGE Alpen-Adria“ eigentlich
ist, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Hierzu sind einige politische Ereig-
nisse von Bedeutung, (hier eine Auswahl) die in der horizontalen Ebene (Jah-
reszahlen) Brüche verursacht haben (Abb. 2.4):
• Bei der Gründung 1978 erfolgte die Unterzeichnung der „gemeinsamen Erklä-
rung“. Ziele waren „(...) die gemeinsame informative fachliche Behandlung
und Koordinierung von Fragen, die im Interesse der Mitgliedsländer liegen“.
Die damals so innovative Eröffnung einer Zusammenarbeit zwischen NATO-
Italien, dem neutralen Österreich und blockfreiem Jugoslawien begann sehr
hoffnungsvoll, mit einem Fokus auf Fragen der planerischen Zusammenarbeit.
• Im Meraner Manifest wurde 1984 festgelegt „(...) dass kein Land durch ein ande-
res Schaden erfährt, dass es den Bewohnern dieser Länder ohne Ansehung der
Weltanschauung, der Nationalität oder einer unterschiedlichen Gesellschafts-
ordnung leicht gemacht wird, sich zu verstehen, um den Weg der Zusammenar-
beit, den Erhalt des Friedens in Europa als gute Freunde gemeinsam zu gehen“.
• 1988 stellten die Regierungen von Deutschland, Italien, Jugoslawien, Öster-
reich und Ungarn mit der Erklärung von Millstatt fest, dass „die Tätigkeit
und Programme der ARGE Alpe-Adria im Einklang mit (...) der KSZE (Kon-
ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) stehen und somit
im europäischen Interesse liegen“ (Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, o.J.).
Obwohl die Erkenntnis, dass die ARGE im europäischen Interesse liegt, als
durchaus positiv angesehen wurde, ergab diese Erklärung einen Bruch, denn
plötzlich stand man in Konkurrenz zu einem Europa der Regionen.
• Fall des Eisernen Vorhanges (1989): Durch den Fall des Eisernen Vorhangs
hätte man annehmen können, dass dies eine Erleichterung für die Zusam-
menarbeit der Mitglieder bedeuten würde. Der Bruch liegt allerdings darin,
dass man die Notwendigkeit einer solchen Institution nach dem Fall des
Eisernen Vorhanges eher in Frage gestellt werden konnte.
• EU-Beitritt Österreich (1995)
• EU-Beitritt Slowenien, Ungarn (2004)
Proof
58
Abb. 2.4 Brüche horizontal (Entwurf: Birgit Wertschnig).
Mit der schrittweisen Öffnung der Grenzen, sowohl physisch als auch
psychisch, war sozusagen ein Punkt überwunden, sodass die vorher so
innovative Zusammenarbeit, die ja wirklich noch „grenzüberschreitend“
war, nun eine eher unbedeutende Rolle einnahm. Wozu braucht man eine
Arbeitsgemeinschaft für Grenzen überschreitende Zusammenarbeit in
einem Europa, wo die Grenzen ohnehin schon gefallen sind? Einen Aus-
nahmefall bot hier über längere Zeit noch die Zusammenarbeit mit Kroa-
tien wobei auch hier, mit dem EU-Beitritt am 1. Juli 2013, die letzte Grenze
fallen wird. Hier muss noch einmal verstärkt über die Sinnhaftigkeit von
Regionsbildung im territorialen Verständnis der ARGE nachgedacht wer-
den, denn wozu neue Grenzen ziehen, wo sich andere schon geöffnet haben
bzw. gerade geöffnet werden?
b) Die Europäische Union: Ein Konkurrenzunternehmen?
Ein weiterer Bruch in der ARGE Alpen-Adria sind die Projekte der EU. Gerade
in den letzten etwa 15 Jahren hat sich eines der Förderprogramm der EU, das
„Europa der Regionen“,als sehr starkes Konkurrenzunternehmen zur ARGE
herauskristallisiert. Dabei handelt es sich um geförderte Projekte, die in
ihrem Ausmaß, finanziell und vom Bekanntheitsgrad her, der ARGE weit
überlegen sind.
Proof
59
Nach der Erweiterung der EU 2004 reagierten die Vertreter der ARGE Alpen-
Adria und die Kärntner Politik, indem sie im Jahrbuch 2006 ein Kapitel mit dem
Titel: „Die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria fungiert als ‚Klein-EU’ für Kärn-
ten“ aufnahmen. Damit wird Anleihe an der seit knapp 30 Jahren bestehenden
ARGE Alpen-Adria genommen, die einst über ideologische und Systemgrenzen
hinweg die Zusammenarbeit für Kärnten über seine engeren Grenzen hinweg
aufgebaut hat und erfolgreich grenzüberschreitend und friedensstiftend agiert.
Ihr positives Image wird allgemein für die Völkerverständigung und gleichzeitig
bereits für ein „Gefühl der Zugehörigkeit“ zu einer Region in Europa zwischen
– beides in Halbtagesentfernung mittlerweile gegenseitig erreich- und erlebbar
– empfunden. Für den Einzelnen ist ein „kleineres Europa“ auch leichter fassbar
und wahrscheinlich auch überschaubarer. Die Menschen in Kärnten merken,
einige bewusst, viele noch unbewusst, dass das Land in seinen eigenen Gren-
zen zu klein ist, um sich allein als „Freistaat“ behaupten zu können oder ande-
ren gegenüber beweisen zu müssen. Die Europäische Union mit ihrer rasanten
geographischen Ausdehnung in den letzten Jahren ist vielen noch nicht ans
Herz gewachsen. Als Antwort und eine Art Standortbestimmung innerhalb der
„neuen, mehrere Ebenen umfassenden Identität“ und wegen der ebenfalls nicht
konkretisierbaren Globalisierung ist es erklärbar, dass eine Art größere Heimat
in einer grenzenlosen „Klein-EU“, der Alpen-Adria-Region, gesucht wird (vgl.
Anderwald 2006).
Als spezifisches EU-Konkurrenzprojekt konnte das INTERREG-Projekt mit der
Bezeichnung: „Matriosca-Adria-Alpe-Pannonia“ gesehen werden. Speziell die
ungarischen Alpen-Adria-Mitglieder tendierten zu diesem neuen Projekt, das
von 2005 bis 2007 über 30 Monate lief. Es galt insbesondere als Konkurrenz zur
ARGE, da es ziemlich genau dasselbe geographische Gebiet umfasste. Zu der
Abgrenzung „Adria-Alpe-Pannonia“ zählten Teilbereiche von Österreich, Ita-
lien, Ungarn und Kroatien. Matrioscas, die ineinanderschachtelbaren, russi-
schen Puppen, standen dabei symbolisch für Makro- und Mikroregionen. Die
einzelnen Mitglieder galten demnach als Mikroregionen, die versuchten ihre
Stärken zu bündeln und somit als Makroregion zu fungieren und ihre Posi-
tion gegenüber anderen Makroregionen Europas zu festigen. Die Projektkosten
beliefen sich hier auf € 854.000,00, also eine Dimension, die mit dem Budget
der ARGE nicht vergleichbar ist (vgl. Land Steiermark 2007).
Ein aktuelles Konkurrenzprojekt zur ARGE Alpen-Adria ist die Euregio „senza
confini“. Dabei geht es um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit von
Kärnten, Veneto und Friaul-Julisch-Venetien, die seit kurzem ins Leben geru-
fen wurde. Es wird in diesem Kontext vom „kleinen Europa an der oberen
Proof
60
Adria“ gesprochen (Kleine Zeitung online vom 19.12.2011). Die regelmäßigen
trilateralen Regierungssitzungen dienen zur Weiterentwicklung von Projek-
ten in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Sprachen, Bildung, Forschung,
Entwicklung und Umwelt. Von besonderem Interesse ist auch die Bewerbung
als Drei-Länder-Skiweltmeisterschaft 2017 sowie der Ausbau der baltisch-adri-
atischen Achse, also dem Verkehrskorridor zwischen Danzig und Rimini bzw.
der Ostsee und der Adria. Die Kooperation zwischen den drei senza confini-
Ländern, die 2007 startete, wurde auch schon verlängert, und eine Einbindung
von Slowenien und Teilen Kroatiens ist im Gespräch (Amt der Kärntner Lan-
desregierung o. J.). Gleichzeitig bedeutet der Einstieg in diese Euregio für viele
aber auch den Ausstieg aus der ARGE Alpen-Adria. Dies zeigt wiederum deut-
lich, dass die ARGE Alpen-Adria in der Krise steckt und der großen Konkurrenz
nicht standhalten kann.
c) Das Regionsverständnis – der größte Bruch
Politische Brüche und Konkurrenzprojekte der EU haben die ARGE Alpen-Adria
also verändert und teils auch negativ beeinflusst. Diese Brüche sind allerdings
nicht ausschlaggebend für das Regionsverständnis, sondern vielmehr führt das
Regionsverständnis selbst zu Brüchen (vertikale Ebene) (Abb. 2.5). Die Pluralität
des Begriffs „Region“ zeigt sich deutlich anhand der unten stehenden Grafik. Zu
jedem denkbaren Zeitpunkt der ARGE hat es mehrere Verständnisse von dem
gegeben, was diese Region ist. Wie schon im konzeptionellen Teil unseres Bei-
trages gezeigt, gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen darüber, was eine
Region ist bzw. darüber, ob Regionen überhaupt existieren (können). Die „Kopf-
geburt“ der Alpen-Adria-Region als Planungseinheit war schon zum Zeitpunkt
der Gründung durch unterschiedliche Regionsverständnisse belastet, denn wo
die Einen von einem territorialen Verständnis ausgingen gab es im Gegensatz
dazu auch eine relationale Auffassung dessen, was eine Alpen-Adria-Region
sei, wobei sich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Verständnis noch
weitere Unterschiede ergaben. Um sich das Ganze besser vorstellen zu können,
kann man davon ausgehen, dass in einem Jahr x im Leben der ARGE y unter-
schiedliche Auffassungen dessen, was die ARGE Alpen-Adria überhaupt sei, zu
Problemen führte. Denn diese unterschiedlichen Regionsverständnisse, die in
Abb. 2.5 vertikal abgetragen werden zeigen, dass sich die Institution ARGE von
Anbeginn auf wackeligem Terrain bezüglich ihres Daseins befand. Dies führt
letztlich auch zu der Begründung, dass die Pluralität des Begriffes „Region“, die
Bezeichnung der ARGE als „Totgeburt“ gerechtfertigt ist.
Proof
61
Abb. 2.5 Brüche vertikal (Zeichnung: Birgit Wertschnig).
Das unterschiedliche Verständnis dessen, was Region ist, sowie das territori-
ale Verständnis, das sich selbst auszugrenzen scheint, sind aus unserer Sicht
nicht lebenserhaltend für eine Alpen-Adria-Region. Hier setzt das relationale
Verständnis an, das mit seinen „Flüssen und Strömen“ versucht, die Alpen-
Adria-Region zu neuem Leben zu erwecken. Folgt man der Sentenz „Das Leben
kann als ein Traum angesehen werden und der Tod als Erwachen“, die Arthur
Schopenhauer zugeschrieben wird, dann lässt sich hoffen, dass aus dem Nie-
dergang der institutionalisierten Alpen-Adria-Region neues Leben für eine
Alpen-Adria-Region erwacht.
2.2.4 Die Region und die Alpen-Adria-Region in einem relationalen Verständnis
Für uns stellte sich die Frage, inwieweit Beziehungen, Interaktionen und
Netzwerke auf verschiedenen Ebenen sowie Verflechtungen kultureller, öko-
nomischer und finanzieller Art für eine Alpen-Adria-Region von Bedeutung
sind? Wie wichtig sind Interaktionen, also dieses wechselseitige Agieren und
Reagieren unter AkteurInnen, innerhalb einer Region?
Territoriales lässt sich sichtbar machen, indem Grenzen gezogen oder Pla-
nungen am Reißbrett durchgeführt werden. Relationales dagegen ist etwas,
das wahrgenommen, konstruiert und kommuniziert wird. Damit entsteht es
Proof
62
vor allem im Kopf. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry schreibt
etwa, „[...] dass es ein Irrtum sei zu glauben, etwas existiere nicht, weil sich
nichts darüber aussagen lässt. Denn Aussagen ist gleichbedeutend mit Wahr-
nehmen. Und der Teil im Menschen, der bislang gelernt hat, wahrzunehmen,
ist nur schwach entwickelt. Was ich eines Tages wahrnehme, hat auch schon
am Tag zuvor existiert, und ich irre mich, wenn ich mir einbilde, das, was ich
vom Menschen nicht ausdrücken kann, verdiene deswegen auch keine Beach-
tung...“ (Saint-Exupéry, zit. n. Perfahl 2007, S. 71).
Dieses Zitat hat auch für die Alpen-Adria-Region in der Weise Gültigkeit, dass
ein relationales Verständnis dem Großteil der Bevölkerung nicht bewusst ist.
Nach Expertengesprächen mit Vertretern von verschiedensten Organisationen
und Institutionen haben wir versucht, Menschen, die in irgendeiner Weise mit
der Alpen-Adria-Region verbunden sind, grob in vier Gruppen einzuteilen, mit
denen wir die verschiedenen im Interview zutage getretenen Einstellungen
zusammenzufassen: Menschen, die sozusagen „die Region arbeiten“, diejeni-
gen, „die Region leben“, diejenigen, „die Region frustriert“ und diejenigen, „die
Region optimistisch und innovativ betrachten“. Diese Gruppierung diente der
Analyse unserer Befunde.
Ohne Interaktion kein Regionsverständnis
Menschen, welche „die Region arbeiten“, versuchen sich auf administrati-
ver Ebene zu etablieren. Wichtig scheint hier die Verknüpfung verschiedener
Dimensionen von Führung miteinander zu sein. Strategische und finanzielle
Planung sowie Organisation und Personalplanung liegen in einer Hand. Als
Beispiel gilt die ARGE Alpen-Adria: Die knappe Finanzierung erfolgt über die
Mitgliedsbeiträge, wobei einer der größten Nettozahler, die Lombardei, aus der
Alpen-Adria-Region ausgestiegen ist. Es bleiben Mitglieder mit geringeren Bei-
tragsleistungen, mit denen die einst festgeschriebenen Ziele der kulturellen
Vielfalt, der Völkerverständigung und des Hebens des Lebensstandards kaum
mehr erreichbar sind. Stattdessen versucht man mit „Literaturtreffen“ und
„Jugend-Sport-Spielen“ das Auslangen zu finden. Man könnte meinen, dass
durch das starre System der gewählten Organisationsform, beginnend von der
Vollversammlung über das Präsidium hin zu den leitenden Beamten, bis „end-
lich“ die Projektgruppe erreicht wird, das Geld versiegt und die beste Idee im
Keim erstickt ist. Ihren Höhepunkt an Bedeutung erreichte die ARGE Alpen-
Adria zweifelsohne zwischen 1984 bis 1997. Danach verlor sie rasch an Größe,
Geltung und Reputation.
Proof
63
Im Gegensatz zu denen, die „die Region“ arbeiten gibt es jene, die „die Region
leben“. Sie fühlen sich „frei“ von politischen Zwängen und nicht „eingeklemmt“
zwischen Ebenen, die in gewisser Weise Hemmnisse für die gesteckten Ziele
sein können. Menschen, die „die Region leben“, erleben sich selbst gestärkt im
Zusammenhalt durch gemeinsame Vorhaben und gemeinsame Projekte. Die
Region wird als das räumliche Gebilde gesehen, in dem man sich miteinander
verständigen und wo man sich im täglichen Leben leicht austauschen kann.
Ähnliche Probleme und ähnliche Ziele schaffen Zusammenhalt. Interaktio-
nen zwischen Akteuren bestimmen die Entstehung von Regionen, nicht nur
in deren Köpfen. Die Vorstellung über Region verändert sich im Laufe der Zeit.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs waren es noch starke Vorurteile gegen-
über den Menschen in den Nachbarländern, insbesondere zwischen Kärnten
und Slowenien, jedoch haben sich nach vermehrten regelmäßigen Kontakten
untereinander „die Grenzen zumindest in den Köpfen“ abgebaut und aufgelöst.
Die Region ist in ihrer Ausdehnung von den Interaktionen und Netzwerken der
Menschen untereinander bestimmt.
Als eine besondere Institution zeichnet sich das Universitätskulturzentrum
(UNIKUM) in Kärnten aus. Das UNIKUM versucht als „Vermittler“ zwischen
universitärer und nicht-universitärer Gesellschaftsebene zu fungieren und
konzentriert sich ausschließlich auf den Bereich von Kunst und Wissenschaft.
Es fühlt sich ausschließlich den Grundsätzen „kultureller Vielfalt, geistiger
Offenheit und Toleranz“ verpflichtet. Das UNIKUM ist eine freie Kulturinitia-
tive (gemeinnütziger Verein), organisiert über einen wissenschaftlich-künst-
lerischen Programmbeirat, bestehend aus Experten der Alpen-Adria Univer-
sität Klagenfurt sowie bildenden KünstlerInnen und MusikerInnen und zwei
hauptberuflichen Mitarbeitern, die sich gemeinschaftlich als „die Themen-
schmiede“ bezeichnen. Hier werden sämtliche Projekte für das jeweilige Jahr
besprochen und im Ablauf fixiert. Es gibt unterschiedlichste Aktionsradien,
die von den Alpen bis hin zur Adria reichen. Kunstaktionen werden zum gro-
ßen Teil über länderübergreifende Projekte (EU-Finanzierung) und über Spon-
soring finanziert. Ziele u.a. sind gemeinsame Kunst- und Kulturprojekte nicht
nur regional und überregional zu fördern, sondern es wird zusehends eine
internationale Vernetzung angestrebt.
Kultur und Kunst sowie Musik spielen eine überaus wichtige Rolle für diejeni-
gen die „die Region leben“. Durch Interaktionen fördert man wechselseitiges
Agieren und Reagieren und findet über gemeinsame Ideen und Ziele verbin-
dende Werte für die Region, die an Größe und Vielfalt dadurch immer mehr
Proof
64
gewinnt. Die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen werden nicht als Barri-
eren, sondern als Bereicherung gesehen.
Darüber hinaus gibt es sowohl Menschen die „die Region frustriert“, als auch
Menschen die „die Region innovativ und optimistisch als Chance“ sehen. „Der
Wille ist da, aber es fehlt einfach das Geld. Dadurch ist leider nur wenig geblie-
ben“. Diese und andere Aussagen hört man von AkteurInnen aus dieser Region.
In den Jahren zuvor konzentrierte man sich auf geförderte bilaterale Projekte
zwischen Slowenien, Italien und Österreich, jedoch ist diese EU-Förderung-
möglichkeit seit 2007 nicht mehr gegeben. Geblieben sind heute nur noch
wenige, nicht unbedingt repräsentative Alpen-Adria-Feste. „Ziel war außer-
dem eine Plattform zu haben, die auch in Brüssel die Interessen dieser Gruppe
vertritt, aber man hatte zu wenig Lobbyismus betrieben bzw. man konnte kei-
nen Lobbyismus betreiben und es fehlte an wichtigen Unterstützern unter den
Entscheidungsträgern“, ist die Aussage eines Gesprächspartners.
Weitere Gründe für die vielen Austritte aus der Alpen-Adria-Region liegen in der
Organisation. Die Verwaltung durch beamtete Personen erzeugt wenig Dynamik
und Innovation, so ein Gesprächspartner. Wichtige Entscheidungen werden
demnach auf politischer Ebene getroffenden es fehlen unabhängige Entschei-
dungsträger, wie NGO’s.
Im Grunde könnte man die Alpen-Adria-Region mit einer „Amöbe“ verglei-
chen, wie es einer unserer Gesprächspartner aus der Gruppe derjenigen, „die
Region leben“ gesagt hat. Eine Amöbe ist plastisch, verändert sich ständig und
ist stets im Fluss. So wie eine Vergrößerung des Amöbenbestandes bzw. deren
Fortpflanzung nur durch Teilung möglich ist, so ist es vergleichsweise auch
bei der Alpen-Adria-Region. Eine Vergrößerung der Region ist nicht möglich,
dazu gibt es zu unterschiedliche Auffassungen, die eher zur Spaltung bzw. in
weiterer Folge zum Aussteigen führen. Vorher werden neue, ähnliche Projekte
und/oder neue Regionsideen geboren: Das bereits genannte Beispiel der senza
confini, „das kleine Europa an der oberen Adria“, könnte man auch als Zelltei-
lung im Sinne der Amöbe verstehen.
„Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist“,
lautet ein Zitat vom französischen Schriftsteller Victor Hugo (zit. n. Wermke
2002, S. 759). Der Alpen-Adria-Region scheint jedoch die Idee verloren gegan-
gen zu sein, obwohl die notwendigen Kontakte und Vernetzungen für eine
lebendige Region vorhanden sind.
Proof
65
Bestandteile einer relational gedachten Alpen-Adria-Region
Aus unserer Recherche hat sich ein Bild der Alpen-Adria-Regionen ergeben,
das wie eine Art Puzzle erscheint, das viele Teile hat und das trotz – und viel-
leicht gerade aufgrund – der vielen Teile nie vollständig zu sehen ist. Die fol-
genden sechs Bestandteile konnten wir im Rahmen unserer Arbeit als zentrale
Puzzleteile herausfiltern.
Die Region als eine Frage des Handelns
Durch die Interaktion wirtschaftlich, sozial und kulturell motivierter Akteu-
rInnen entstehen Netzwerke, die für die Entstehung einer Region – zumindest
in den Köpfen der Menschen – ausschlaggebend sind. Die Alpen-Adria-Region
zeichnet sich viel mehr durch ihre Handlungen als durch ihre Grenzen aus,
denn beim relationalen Verständnis stehen administrative Grenzen eher im
Hintergrund. Wie wichtig Interaktion in Regionen ist und welchen Zusam-
menhalt sie für die Zukunft von Regionen bringen kann, spricht ein Akteur der
Alpen-Adria-Region an: „Jetzt haben wir regelmäßig Kontakt zu den Bauern in
Slowenien, wir machen gemeinsame Exkursionen und schicken Leute hin und
her“. Region im relationalen Verständnis könnte man auch als „die Summe
sozialer Prozesse“ beschreiben.
Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Region sind jedoch nicht
zu jeder Zeit möglich. Ausschlaggebend für die Region scheint ein window of
opportunity zu sein – den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, um die Weichen-
stellung für die Zukunft der Region vornehmen zu können. Bislang scheinen
die Zeitpunkte eher verpasst worden zu sein, wie einer unserer Gesprächspart-
ner, der eher frustriert auf die Alpen-Adria-Region blickt, offenbart: „Alpen-
Adria könnte Region WERDEN, aber dahin ist es noch ein langer Weg.“
Die Region als eine Frage der Zeit
AkteurInnen und deren Interessen, Motivationen sowie Aktivitäten und
Umsetzungen für die Region ändern sich im Laufe der Zeit, führen zu veränder-
ten Praktiken, die auch Auswirkungen z.B. auf die räumliche Ausdehnungen
einer Region haben können. Daraus folgt, dass sich eine Region im Laufe der
Zeit immer wieder verändert und somit auch immer wieder neu formen muss.
Sie kann – wie oben getan – mit einer Amöbe verglichen, aber auch als dyna-
mischer Prozess verstanden werden. Das Phasenhafte der Alpen-Adria-Region
verdeutlichte auch einer unserer Gesprächspartner: „Jetzt läuft halt nicht mehr
soviel. Es gibt halt einfach Phasen, die auch von Fördermitteln abhängen.“
Proof
66
Die Region als eine Frage der Distanz
Der Begriff der Region verweist auch immer auf räumliche Nähe und eher
geringe Distanzen, die zu überwinden sind. Dennoch bedarf es einer gewissen
räumlichen, aber auch geistigen Mobilität, damit Interaktion, Austausch und
Zusammenarbeiter „über Grenzen hinweg“ stattfinden kann: „Früher amol
waren die da hinter der Grenz.“ Die Alpen-Adria-Region ist daher in ihrer Aus-
dehnung bestimmt von den Beziehungen der Menschen untereinander, dies
zeigt sich auch aus diversen Aussagen von Menschen, die dort leben: „Im Alltag
ist es den Menschen wichtig, sich auf eine leichte und bequeme Art austau-
schen zu können. Wenn die Region einmal definiert ist, dann kann man den
Mittelpunkt begründen, aber kein Zentrum!“
Unter Mobilität kann aber auch in gewisser Weise die Arbeitsmigration, Migra-
tion und residentielle Multilokalität der Menschen verstanden werden. Diese
räumlichen Mobilitäten spannen heute den Bogen von der interregionalen bis
hin zur intra regionalen Mobilität und können eine Region zu Gunsten einer
anderen „entleeren“ und umgekehrt. Auch in Zeiten der sehr einfachen Mobili-
tätsmöglichkeiten, ist die eigene Mobilität des Einzelnen sehr unterschiedlich
ausgeprägt: „Es ist egal, ob ich mit dem eigenen Auto nach Wien oder an die
Adria fahre“ sagte einer unserer Gesprächspartner. Ein anderer dagegen: „Ein
missing link ist die Mobilität!“
Die Region als eine Frage des Zufalls
Die Leitidee der Alpen-Adria-Region war es ursprünglich, Menschen trotz
deren möglicher Berührungsängste (verschiedene Sprachen, Kulturen)
zusammenzuführen. Die ARGE hat dies über sportliche, kulturelle und wirt-
schaftliche Aktivitäten versucht und so den Begriff der Alpen-Adria-Region
mit spezifischen Inhalten gefüllt. Heute wird der Begriff Alpen-Adria-Region
für beliebige Aktivitäten und Projekte eingesetzt. Auf konkrete Nachfrage bei
einem Akteur zeigt sich, dass die begriffliche Übernahme weitgehend ohne
Überlegung erfolgt: „Also, das ist nicht unsere Wortkreation. Ich glaube das
hat ein Herr von der Landesregierung erfunden, weil dieser recht beseelt war.“
Nichtsdestotrotz soll der Begriff Alpen-Adria offensichtlich eine „verbindende“
Beziehung zwischen Menschen diesseits und jenseits der Grenzen vermitteln
und eine „gelebte Nachbarschaftspolitik“ unterstreichen, wie die Namensge-
bung verschiedenster Institutionen zeigt: Alpen-Adria Bildungsverbund, Alpe-
Adria Radweg, Alpe-Adria Kindergartenverbund.
Proof
67
Die Region als eine Frage der Geschichte
Die Alpen-Adria-Region ist historisch und symbolisch stark aufgeladen (vgl.
Valentin 1998, S. 8 ff.). Zwar bildet die Alpen-Adria-Region seit Jahrhunder-
ten die „geschichtliche Heimat“ vom Romanischen, Germanischen und Sla-
wischen Kulturkreis, dennoch gab es für sie in keiner Zeit eine gemeinsame
Benennung. Selbst nicht in der als intensiv erlebten Kaiserzeit. Zwischen Kon-
frontation und Kooperation hat diese Region im Laufe der Historie eine wech-
selvolle Vergangenheit erlebt. Physisch errichtete Barrieren wie beispielsweise
der Eiserne Vorhang lassen sich oft leichter abbauen, als die damit verbunde-
nen mentalen Barrieren. An historischen Beziehungen vor dem Eisernen Vor-
hang anzuknüpfen, wird offenbar eher als mühsam und problematisch erlebt.
Die „Grenzen im Kopf“ scheinen so etwas wie „Regionalbewusstsein“ in der
Alpen-Adria-Region zu behindern. Damit wirken die Ereignisse aus der jünge-
ren Vergangenheit offensichtlich deutlich prägender als die Verbindungen aus
der längeren Vergangenheit. Wir trafen häufiger auf die Meinung „solange die
Region nicht im Sinne des relationalen Verständnisses lebt, kann man nur eine
Hülse drüberstülpen“.
Unbelastet von historisch gewachsenen Grenzen im Kopf scheint allein die
Wirtschaft, denn sie agierte grenzüberschreitend in der Region schon längst
bevor die Alpen-Adria-Region institutionell begründet wurde. Ein Unterneh-
mer betonte im Gespräch, dass die „Wirtschaft schneller als der Mensch ist und
die Kultur erst nachgezogen wird“.
Die Region als eine Frage des Sichtbarmachens
Die Alpen-Adria-Region ist kaum sichtbar. Einer der Gründe für die Unsicht-
barkeit mag in dem Fehlen einer aussagekräftigen Symbolik liegen. In der Zeit
der Monarchie hatte man in der heute als Alpen-Adria bezeichneten Region
keine gemeinsame einheitliche Präsentation wie zum Beispiel ein Wappen.
Trotz der Konstruktion der Alpen-Adria-Region besteht auch heute noch kein
anderes gemeinsames, sichtbares Symbol – in Zeiten des Regionalmarketings
in der Regel ein gemeinsames „Logo“. Man sucht zwar bewusst „Ähnliches“,
wie Kultur, Bräuche, Sprachen etc., um dieses eventuelle „Gemeinsame“ mit-
und untereinander zu leben, zu schützen und bewusst nach Außen zu tragen.
Es fehlt jedoch trotzdem an Stereotypen und sichtlich an Authentizität im
Gebiet der Alpen-Adria-Region. Auch die Arbeitsgemeinschaft – als instittuti-
onalisierte Form der Region – ist hier kein Ersatz. Ein Repräsentant der ARGE
äußerte die Meinung: „wenn die ARGE wegbricht, wird die Alpen-Adria-Region
nicht sterben oder leben!“
Proof
68
Unsere Beobachtung am Anfang, dass Alpen-Adria als eine Art Marke für
unterschiedliche Aspekte benutzt wird, lässt die Frage zu, ob die Alpen-Adria-
Region nur eine Illusion, eine Imagination ist. Sie scheint auch von politischen
Entscheidungsträgern als ein Werbegag auf Zeit instrumentalisiert zu wer-
den, zumindest überwiegt bei einem Befragten der Eindruck, dass „die Alpen-
Adria-Region in der Politik nur für heißes Gerede hergenommen wird – nur
Blabla und heißer Dampf, das nervt“. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass
das „Sichtbarmachen“ von Regionen die einfachste und effektivste Form von
Regionalität sein könnte. Sie entsteht aber nicht allein über ein Logo oder eine
andere Symbolik, sondern über soziale, ökonomische und politische Interak-
tionen und Netzwerkstrukturen mit unterschiedlichen Dichten von Beziehun-
gen zwischen Verwaltung, Wirtschaft, Forschung, Bildung und Kultur. Damit
wächst eine Region die territoriale Verwaltungsgrenzen hinaus.
2.2.5 Ein Schlussversuch: (Über-) Lebt die Alpen-Adria-Region?
Wir konnten zeigen, dass weder das Konzept, noch der Begriff noch die kon-
krete Füllung von „Region“ alles andere als eindeutig ist. „Regionen“ sind über-
all dort, wo sie über soziale Interaktionen erschaffen und über Zuschreibungen
sozial konstruiert werden. Die Semantik von „Region“ ist daher so vielfältig
und plural wie die gesellschaftliche Zuschreibungen aus denen die „Region“
gemacht wird. Wenn wir heute von „Region“ sprechen, dann ist dies eine Ein-
heit die weitgehend relational ist und damit durch „relations“ (engl. für Bezie-
hungen) geformt wird. Regionen entstehen und bestehen daraus, dass Perso-
nen (Akteure) miteinander kommunizieren, sich austauschen und gemein-
same Ziele verfolgen. Dadurch entstehen Bindungen, die immer in Bewegung
und im Fluss sind. Durch Bindungen kommt es zum Zusammenhalt und es
entsteht eine Gemeinsamkeit, bezeichnen wir es als „Region“. Wo es Bindun-
gen gibt, werden Grenzen überwunden und verlieren ihre Bedeutung.
„Regionen“ wurden lange Zeit als etwas gedacht, das einen Bezug zu einem
„Raum“ hat. Auch diese Frage hat uns beschäftigt, denn territoriale Regionen
sind in „terra“, dem Boden, der Erde eingeschrieben. Wie mit einem Zaun oder
Mauern werden territoriale Regionen begrenzt und schaffen Dazugehörigkeit
oder Ausschluss. Die Europäische Union ist ein Beispiel für eine territoriale
Regionsvorstellung. Sie baut ihre Mauern an den Außengrenzen ihrer Mitglie-
der auf und konstruiert damit die „Festung Europa“. Wer dazugehört, ist poli-
tisch und administrativ festgelegt. Gehört man dazu, hat man alle Vorteile des
Dabeiseins, etwa freien Handel, freie Bewegung von Menschen und Gütern,
Fördermittel und einen Platz unter dem Rettungsschirm in der Krise. Territo-
Proof
69
riale Regionen sind deshalb im europäischen Denken tief verankert und von
Bedeutung, da sie in Verbindung gebracht werden mit Fördermitteln oder der
Vermarktung von Standorten. Kleiner Einheiten (wie einzelne Gemeinden,
Jesenice in Slowenien beispielsweise) sind im europäischen und im globalen
Wettbewerb nicht sichtbar und können in der Konkurrenz um Infrastruktur,
Unternehmen oder Touristen nicht bestehen. Territoriale Regionen grenzen
und schränken aber auch ein. Sie sind Einschnitte, die Beziehungen ermögli-
chen oder verunmöglichen und grenzüberschreitende Bindungen behindern.
Eine Alpen-Adria-Region ist so plural wie die Regionsverständnisse, die
dahinterliegen. Was für den Einen eine Region ist, bedeutet noch lange nicht,
dass es für den Anderen auch eine Region oder gar dieselbe Region ist. Anhand
unserer empirischen Arbeit wurde deutlich, welche Herausforderungen durch
territoriale Grenzen entstehen können und welche Chancen Relationen der
Alpen-Adria-Region bieten. Die ARGE Alpen-Adria vertritt etwa eine territorial
begrenzte Region. Ihr „terra“ liegt irgendwo zwischen Adriaküste, Alpen und
Alpenvorland. Sie entstand 1978 als Kopfgeburt der politischen Eliten und war
zu ihrer Gründungszeit eine Innovation und ein sehr ambitioniertes Unterfan-
gen. Als eine Art „kleine EU“ hat sie bereits im Kalten Krieg nationalstaatliche
und mentale Grenzen überwunden, wo an anderen Orten noch Mauern auf-
gebaut wurden. Nationalstaatliche Grenzen wurden etwa zwischen Österreich
und Slowenien trotz des Eisernen Vorhangs überwunden und Kooperatio-
nen wurden eingegangen. Doch die selbst geschaffenen, institutionellen und
administrativen Grenzen haben auch eingegrenzt. Auch hier ging es zunächst
um Infrastrukturprojekte, gemeinsame Gelder und darum, als größere Einheit
gesehen zu werden. Die von der ARGE gemachten Grenzen wurden im Laufe
der Zeit zu nahezu unüberwindbaren Barrieren, die eine Flexibilität in der
Ausdehnung des Regionsgebietes, Dynamiken an Fördermitteln und Bewe-
gung im Denken erstarren ließen. Neue, erstarkende territoriale Einheiten, wie
die Europäische Union wurden für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zu
einer attraktiven Alternative, nachdem der Kalte Krieg vorbei war, die Mitglie-
derzahlen schrumpften und die Fördermittel der ARGE geringer wurden. Eine
territorial begrenzte Alpen-Adria-Region hat angesichts der widrigen Rahmen-
bedingungen kaum mehr Lebensgeist, denn nun kündigen weitere Mitglieder
ihre Zugehörigkeit. Das Überleben der Institution steht zunehmend in Frage,
denn das, was die Alpen-Adria-Region ausmacht ist auch in der Arbeitsge-
meinschaft nicht mehr eindeutig. Die Pluralität der Region sprengt die Gren-
zen der Institution, die nicht weiß, woran sie leidet, denn: Es ist schwierig eine
Krankheit zu behandeln, die man nicht diagnostizieren kann.
Proof
70
Abb. 2.6 Region unter freiem Himmel: relationales Regionsverständnis befruchtet territoriale Regionsvorstellungen (Zeichnung: Marika Balode).
Unsere Vorstellung ist es, eine neue, eine andere Alpen-Adria-Region entste-
hen zu lassen. Sie wird von Menschen geprägt, die Kontakte, Beziehungen und
Bindungen aufbauen, wo eine territoriale Alpen-Adria-Region nicht weiter-
hilft. Die symbolisierte Abgrenzung „Schirm“ (Abb. 2.6) wird bedeutungslos
und sprachliche, kulturelle und politische Unterschiede stellen keine Grenze
mehr dar. Der Raum ist nicht mehr „eingeengt“, sondern die entstehenden
Beziehungen und „Kreisläufe“ sind nach allen Seiten offen. Wie der Regen sich
unbegrenzt über die Landschaft verteilt, so sollte sich der Vorgang der Sozi-
alisation als ein „Hineinwachsen“ der TeilnehmerInnen in verschiedene For-
men von aktiven „Wir- Beziehungen“ entwickeln und damit eine Verstärkung
der Erlebnistiefe, Erlebnisnähe und Erlebnisintensität gewährleisten. Brü-
cken werden gebaut durch Sport, Musik, Handel und Kunst. Es entsteht neue
Dynamik durch Bindungen jenseits administrativer Grenzen. Neues Leben ist
spürbar in der Art und Weise wie über Beziehungen einer Alpen-Adria-Region
berichtet wird. Eine Region erfährt durch Beziehungen, durch Relationen, rela-
tional also ein neues Leben. Und: Wo? Wo, lässt sich nicht festlegen. In den
Köpfen irgendwo zwischen Ljubljana und Triest und Villach und Graz und Kla-
genfurt. Irgendwo zwischen Adriaküste, Alpen und Alpenvorland. Doch ganz
geklärt ist es noch nicht, denn: Wie ist es zu denken, das neue Leben auf dem
Territorium? (Wo) Gibt es (Ver-)Bindungen zwischen Mensch und Materie?
Proof
71
Literatur
Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1. (o. J.): Referatsbereiche und Projektumsetzung. Internationale Beziehungen. Euregio „Senza Confini“ (online unter www.ktn.gv.at/194727p_DE-Internationale_Beziehungen-Euregio_quot_senza_confiniquot_, zuletzt besucht am 13.08.2012).
Anderwald, Karl (Hrsg., 2006): Kärntner Jahrbuch für Politik 2006. Klagenfurt.
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (o. J.)a: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria kroatischer Vorsitz − 2011 und 2012 (online unter www.alpeadria.org/deutsch/print.php?page=857751208&f=1, zuletzt besucht am 13.08.2012).
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (o.J.)b: Chronologischer Überblick (online unter www.alpeadria.org/deutsch/index.php?page=733044516&f=1&i=733044516, zuletzt besucht am 13.08.2012).
Bathelt, Harald & Johannes Glückler (2002): Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive. Stuttgart.
Benz, Arthur, Dietrich Fürst, Heiderose Kilper & Dieter Rehfeld (1999): Regionalisierung. Theorie – Praxis – Perspektiven. Opladen.
Block, Friedrich (1997): Innen und Außen in der Literatur. Die Frage nach dem Regionalen im Umgang mit architektonischen Texträumen. In: Anselm Maler (Hrsg.): Literatur und Regionalität. Frankfurt am Main, New York, S. 211–228.
Blotevogel, Hans-Heinrich (1996): Dimensionen des Regionsbegriffs am Beispiel des Ruhrgebiets. In: Schulbuchinformationsdienst Ruhrgebiet (26), S. 2–4.
Castells, Manuel (1994): Space of Flows – Raum der Ströme. Eine Theorie des Raumes in der Infor-mationsgesellschaft. In: Peter Noller & Walter Prigge (Hrsg.): Stadt-Welt. Über die Globalisierung städtischer Milieus. Frankfurt am Main, New York, S. 120–134.
Castells, Manuel (2001): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Opladen.
Flick, Uwe (2005): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg.
Gebhardt, Hans, Rüdiger Glaser, Ulrich Radtke & Paul Reuber (Hrsg., 2011): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. Heidelberg.
Giddens, Anthony (1984): Interpretative Soziologie. Eine Kritische Einführung. Frankfurt.
Grom, Ingrid (1995): Regional grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Beitrag zur Förderung der europäischen Integration. 3 Bände. Berlin.
Haas, Hans-Dieter & Simon-Martin Neumair (2007): Wirtschaftsgeographie. Darmstadt.
Holt-Jensen, Arild (2009): Geography. History and concepts; a student‘s guide. Los Angeles, Californien.
Jonas, Andrew E. G. (2012): Region and place: Regionalism in question. In: Progress in Human Geogra-phy 36 (2), S. 263–272.
Juric-Pahor, Marija (2011): Grenzen, Schwellen, Übergänge: Überlegungen zum Alpen-Adria-Raum. In: Elka Tschernokoshewa & Ines Keller (Hrsg.): Dialogische Begegnungen. Minderheiten – Mehrhei-ten aus hybridologischer Sicht. New York, München, Berlin, S. 318–337
Kimeswenger, Fritz (2012): Der langsame Tod der Pioniere. In: Kärntner Kronen Zeitung vom 29.03.2012, S. 14.
Kleine Zeitung online (19.12.2011): Kooperationsvertrag „Senza Confini“ in Kärnten verlängert (online unter www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/klagenfurt/2902939/vertrag-montag-verlaen-gert.story, zuletzt besucht am 13.08.2012).
Kröcher, Uwe (2007): Die Renaissance des Regionalen. Zur Kritik der Regionalisierungseuphorie in Ökonomie und Gesellschaft. Münster.
Kuropka, Joachim (1994): Thesen zur regionalen Identität. In: Volker Schulz (Hrsg.): Region und Regi-onalismus. Cloppenburg, S. 11–34.
Lagendijk, Arnoud (2007): The Accident of the Region: A Strategic Relational Perspective on the Con-struction of the Region‘s Significance. In: Regional Studies 41 (9), S. 1193–1208.
Proof
72
Land Steiermark, Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2007): EU-Projekt „Matriosca-AAP“ (online unter www.europa.steiermark.at/cms/beitrag/11694748/2950520/, zuletzt besucht am 13.08.2012).
Lovering, John (1999): Theory Led by Policy: The Inadequacies of the „New Regionalism“. In: Internati-onal Journal of Urban & Regional Research 23 (2), S. 379–395.
Lovering, John (2003): MNCs and Wannabes – Inward Investment, Discourses of Regional Develop-ment, and the Regional Service Class. In: Nicholas A. Phelps & Philip Raines (Hrsg.): The New Competition for Inward Investment. Cheltenham, Northampton (Mass. ), S. 39–60.
MacLeod, Gordon & Martin Jones (1999): Reregulating a Regional Rustbelt. Institutional Fixes, Entre-preneurial Discourse and the „Politics of Representation“. In: Environmental Planning D 17 (5), S. 575–605.
Miggelbrink, Judith (2002): Der gezähmte Blick. Zum Wandel des Diskurses über „Raum“ und „Region“ in humangeographischen Forschungsansätzen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Leipzig.
Moritsch, Andreas (Hrsg., 2001): Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt, Ljubljana, Wien.
Roemheld, Lutz, Regine Roemheld & Gerd Rojahn (1987): Der Begriff „Region“ im Spannungsfeld zwi-schen Regionalwissenschaft und Regionalpolitik. Versuch der Problematisierung eines ambiva-lenten Begriffs. In: Kurt Duwe (Hrsg.): Regionalismus in Europa. Frankfurt am Main, S. 72–86.
Perfahl, Jost (2007): Lichtgrüße vor der unendlichen Nacht. München.
Schmitz, Walter (2010): „Gedachte Ordnung“ – „erlebte Ordnung“. Regionen als Sinnraum. Thesen und mitteleuropäische Beispiele. In: Gertrude Cepl-Kaufmann (Hrsg.): Konstruktionsprozesse der Region in europäischer Perspektive. Essen, S. 23–44.
Simmel, Georg (1992): Gesamtausgabe. Frankfurt am Main.
Sinz, Manfred (2005): Region. In: Ernst-Hasso Ritter (Hrsg.): Handwörterbuch der Raumordnung. Han-nover, S. 919–923.
Valentin, Hellwig (1998): Kärntens Rolle im Raum Alpen-Adria. Gelebte und erlebte Nachbarschaft im Herzen Europas (1965–1995). Klagenfurt.
Wardenga, Ute (2002): Alte und neue Raumkonzepte für den Geographieunterricht. In: Eberhard Kroß (Hrsg.): Geographie heute. Seelze, S. 8–11.
Weichhart, Peter (2008): Entwicklungslinien der Sozialgeographie. Von Hans Bobek bis Benno Werlen. Stuttgart.
Werlen, Benno (2004): Sozialgeographie. Eine Einführung. Bern.
Wermke, Matthias, & Maria Grazia Chiaro (Hrsg., 2002): Zitate und Aussprüche. Mannheim: Dudenverlag.
White, Harrison C. (1992): Identity and control. A Structural Theory of Social Action. New York, London.
Wintersteiner, Werner (2004): Interkulturelles Lernen im Alpen-Adria-Raum. Der Alpen-Adria-Raum – ein „Kreuzungspunkt der Geschichte“. In: Ausblicke (20), S. 20–22 (online unter www.his. se/PageFiles/9222/Ausblicke20.pdf, zuletzt besucht am 26.09.2012).
Wössner, Jakobus (1971): Soziologie. Einführung und Grundlegung. Köln.
Proof
73
2.3 Die Alpen-Adria-Region 2.0. Von gut nachbarschaft-lichen Beziehungen zur trag- und wettbewerbs-fähigen europäischen StandortagglomerationOskar Januschke & Manfred Rader
2.3.1 Die Alpen-Adria-Region neu gedacht
Die bisherige Zusammenarbeit der Gemeinschaft der Alpen-Adria-Region
erfolgte vor allem aufgrund institutioneller Vereinbarungen mit dem Schwer-
punkt der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (ARGE) auf gegenseitiger Kon-
sultation und der Leitzielsetzung des Aufbaues und der Vertiefung gut nach-
barschaftlicher Beziehungen im Alpen-Adria-Raum. Kritische Stimmen und
redaktionelle Berichterstattung sprechen nun seit längerem von Ermüdungs-
erscheinungen und dem Bedarf einer Neuausrichtung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit der beteiligten Regionen in der Alpen-Adria-Region. Der
Beitrag versucht, das von der 1978 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Alpen-
Adria entwickelte Modell einer interregionalen Zusammenarbeit in der Alpen-
Adria-Region alternativ aus aktueller standortpolitischer Perspektive, unter
Einsatz von Strategien und Instrumenten des „Standortmanagements“, sowie
standort- und regionalpolitischer Entwicklungsmethoden, zu diskutieren.
Wir konzentrieren uns in unserem Beitrag auf Überlegungen für eine „Alpen-
Adria-Region 2.0“ mit einem Schwerpunkt auf die Standort-, Marken- und
Arbeitsmarktpolitik. Neben einer umfassenden Literaturarbeit stützten wir
uns auf Interviews mit Wolfgang Platzer, Generalsekretär der Arbeitsgemein-
schaft Alpen-Adria (23. Mai 2012), Thomas Pseiner, Amt der Kärntner Landes-
regierung, Abteilung 1, Alpen-Adria-Geschäftstelle Kärnten (24. Oktober 2012),
Doerte Gensow, Bodensee Standort Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit Regionalmarke Vierländerregion Bodensee (26. Oktober 2012).
2.3.2 Charme und Chancen als internationale Standortagglomeration (Oskar Januschke)
In der wirtschaftswissenschaftlichen Geographie wird ein Standort als geo-
graphischer, funktionaler Raum mit einer bestimmten Kombination und
Dichte an Menschen, Institutionen und Infrastruktur beschrieben, der je nach
Betrachtungsperspektive und Rahmen Städte, Regionen, ganze Länder oder
auch interregionale und internationale Agglomerationen umfassen kann (vgl.
Pechlaner et al. 2009, S. 11). Die Hierarchie funktionaler Räume beginnt auf
der untersten Ordnungsebene bei Grundstücken und Immobilien als Mikros-
Proof
74
tandorte für unternehmerische oder gemeingesellschaftliche Tätigkeiten und
baut sich über Quartiere, Orts- und Stadtteile, Gemeinden, Regionen, überre-
gionale Wirtschafts- und Lebensräume, Nationen bis hin zu Agglomeratio-
nen aus Regionen und Teilräumen verschiedener Nationen zur Standortebene
erster Ordnung oder Makrostandorte auf (vgl. Gubler & Möller 2006, S. 42 ff).
Unternimmt man davon ausgehend den Versuch, die Alpen-Adria-Region in
dieses Muster raumbezogener Kooperationen einzuordnen, zeigt sich, dass
die bisher bestehende, schwerpunktmäßig eher konsultative Zusammenarbeit
der acht Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (Burgenland, Friaul
Julisch Venetien, Kroatien, Kärnten, Slowenien, Steiermark, Vas, Veneto) mit
einem 136.000 km² umfassenden Raum und einer Einwohnerzahl von 14 Mil-
lionen jedenfalls einer sozioökonomischen Kooperationsebene oberster Stufe,
verbunden mit hoher entwicklungspotentieller Bedeutung, zuzuordnen wäre
(vgl. Arbeitsgemeinschaft Alpen Adria 2011, S. 4).
Für den Begriff „Standort“ gibt es derzeit verschiedene Definitionsansätze.
Mathis beispielsweise definiert den Terminus „Standort“ als ökosozialen
Lebens- und Wirtschaftsraum, an denen Gruppen von Menschen, Gesellschaf-
ten leben und arbeiten und fasst Gemeinden und Regionen zur Standortmenge
einer „Mesoebene“ zusammen (vgl. Mathis 2005, S. 58). Für die operative Gestal-
tungs- und Organisationsdimension dieser ökosozialen Lebensräume prägt
Mathis den Begriff der „Standortwirtschaft“ (vgl. Mathis 2007, S. 274). Er versteht
darunter die umfassende und nachhaltige Bewirtschaftung von ökosozialen
Lebensräumen mit der Zielsetzung der Sicherung und dem Ausbau der ökonomi-
schen, sozialen, kulturellen Attraktivität und Qualität sowie die damit für den
Standort verbundene allgemeine Lebensqualität (vgl. ebenda, S. 275).
Gubler & Möller (vgl. 2006, S. 33) beschreiben Standorte als territoriale, aber
auch soziale, dynamisch veränderliche Gebilde, die einerseits durch ihre
räumliche Abgrenzung (territoriale Beschreibung) in einer weiteren Perspek-
tive auch durch gemeinsame Merkmale und laufende soziale, funktionale Ver-
flechtung (relationale Beschreibung) ausgebildet werden. Auch wenn Standorte
üblicherweise durch ihre Grenzen bzw. durch ihre politisch/administrativen
Strukturen (Gemeinden, Länder, Kantone, Verwaltungsregionen, etc.) deter-
miniert werden, ermöglicht der Ansatz der kooperativen und sozialen Stand-
ortbildung Standortentwicklungsprozess dynamische, veränderliche und von
territorialen und administrativen (hoheitlichen) Grenzziehungen gelöste Bin-
dungen und Ausbildungen von vitalen, dynamischen und wettbewerbsfähigen
Lebens- und Wirtschaftsstandorten (vgl. ebenda, S. 41 ff.). Standorte werden
dabei als Systeme verstanden, welche ansässige BewohnerInnen, Unterneh-
Proof
75
men, Verbände, sonstige Organisationen, kulturelle Einrichtungen sowie
politische Institutionen ebenso umfassen wie die intersozialen Beziehungen
dieser Akteure untereinander (vgl. ebenda, S. 249). Aus diesen Ansätzen einer
ersten begrifflichen Festlegung wird erkennbar, dass Standorte hoch komplexe
Systeme darstellen, die sich aus materiellen bzw. physischen Elementen, den
zur Verfügung stehenden Ressourcen, geografischen und klimatischen Gege-
benheiten, die den Rahmen der Entwicklungsmöglichkeiten und die Attrakti-
vität des Standortes darstellen sowie den verschiedenen sozial interagieren-
den Elementen, den BewohnerInnen, ansässigen Unternehmungen und Orga-
nisationen sowie Institutionen zusammensetzen (vgl. ebenda, S. 41). Die Kom-
plexität von Standorten begründet sich in der Pluralität und Diversität ihrer
sozialen Elemente, die als autonome Akteure einzelne Interessen verfolgen,
unterschiedliche Ansprüche an den Standort formulieren, dynamische, netz-
werkartige Beziehungen eingehen und gleichzeitig als soziale Gruppe nach
außen als Einheit auftreten (vgl. ebenda, S. 41). Aber auch wirtschaftliche Ver-
netzungen, räumliche Strukturen, soziale Bindungen oder spezifische Mobi-
litätsmuster machen Standorte als solche erkennbar (vgl. ebenda, S. 41). Das
Ausmaß an Komplexität und damit der Abstimmungs-, Koordinations- und
Steuerungsbedarf verstärkt sich insbesondere bei internationalen, mehrere
Länder übergreifenden Standortkooperationen wie es die Alpen-Adria-Region
verkörpert. Eine besondere Herausforderung stellen dabei Sprachbarrieren,
nationalstaatlich definierte Rechtsordnungen und von Territorialität geprägte
Verwaltungskulturen dar.
Aus der Perspektive der Geographie beschreibt Leser einen Standort als „vom
Menschen für bestimmte Nutzungen gewählte Raumstelle bzw. der Platz, an dem
verschiedene soziale, wirtschaftliche und/oder politische Gruppen im Raum inter-
agieren“ (Leser 2010, S. 886). Standorte, ihre Merkmale und Attribute werden
dabei von einer Vielzahl von mehr oder weniger untereinander unabhängigen
Anspruchsgruppen und Entscheidungsträgern mitgestaltet und beeinflusst,
welche den verschiedenen Anforderungen ihrer Akteure gerecht werden
sollen (vgl. Gubler & Möller 2006, S. 11). Ein Umstand, der sich insbesondere
aufgrund der pluralen Strukturen, der unterschiedlichen Organisations- und
Steuerungsebenen in den Teilregionen des Alpen-Adria-Raumes als große
Herausforderung für eine gewünschte künftige gemeinsame Standortpolitik
darstellt. Eine erfolgreiche Positionierung als Standort muss sich auf eine von
möglichst vielen Entscheidungsträgern und Anspruchsgruppen gemeinsam
getragene Standortpolitik abstützen können (vgl. ebenda, S. 11). Voraussetzung
dafür ist, dass sich die Akteure verständigen, die ihnen in den räumlichen Teil-
bereichen und Sektoren zur Verfügung stehenden Mittel und Kompetenzen für
Proof
76
ein gemeinsames „Standortverständnis“ kooperativ abzustimmen und wir-
kungsvoll einzusetzen (vgl. ebenda, S. 11). Um drohenden Attraktivitäts- und
Wettbewerbsverlust von Regionen mit einer umfassenden Standortentwick-
lung entgegen wirken zu können, ist es neben konzentrierten Maßnahmen
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik notwendig, die lokalen Akteure vor Ort
zu binden „halten“ und deren Engagement, Talente und Ressourcen für den
Standort einzusetzen (vgl. Hohn 2008, S. 1). Wesentliche Handlungsebenen
einer Standortkooperation sind der Aufbau und die Bildung öffentlich-priva-
ter Netzwerke sowie die Unterstützung relational motivierter Initiativen, um
endogenes Know-how und offenen Informationsaustausch zur Erzielung von
Wettbewerbsvorteilen einzusetzen (vgl. ebenda, S. 1). Bereits an dieser Stelle ist
erkennbar, dass Charme, Chancen oder auch Misserfolg einer länderübergrei-
fenden Kooperation im Modus einer internationalen Standortgemeinschaft
(Standortagglomeration) im Alpen-Adria-Raum wesentlich vom Beteiligungs-
grad, dem Involvement und der aktiven Interaktion breiter sozialer Gruppen an
einem offenen Entwicklungs- und Gestaltungsprozess abhängig sind. In Bezug
auf die Einbindung der Bevölkerung in die Aktivitäten der länderübergreifende
Zusammenarbeit weist die Kärntner Tageszeitung bereits im Jahr 1989 in einem
Artikel kritisch darauf hin, dass nach rund elf Jahren Zusammenarbeit in der
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria der Grundgedanke an der großen Masse der
Bevölkerung relativ spurlos vorübergegangen ist (vgl. Bericht in der Kärnt-
ner Tageszeitung vom 11.06.1989, zitiert nach Valentin 1998, S. 85). Verstärkt
wird der Eindruck einer vor allem auf die politisch/administrativen Eliten
beschränkten Zusammenarbeit mit dem Kommentar in der Kärntner Tageszei-
tung vom 22. September 1993, dass die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria eher
das Steckenpferd von Politikern als regionales Bedürfnis sei (vgl. Bericht in der
Kärntner Tageszeitung vom 22.09.1993, zitiert nach Valentin 1998, S. 85).
Die Alpen-Adria-Region als Standort – hart am Wind oder schlaffe Segel im Wettbewerb?
Die Internationalisierung und Globalisierung und die damit verbundenen
Flexibilisierungs- und Mobilisierungsprozesse fordern von Standorten neue,
umfassende Entwicklungskonzeptionen, spezifische Standortprofile und eine
nachhaltige Umsetzungen dieser (vgl. Balderjahn 2000, S. 5). Größere Ballungs-
räume, interregionale Standortverbunde und Standortagglomerationen können
die Chancen einzelner Teilräume auf eine prosperierende Entwicklung durch
Kooperation und Zusammenarbeit zu wettbewerbsfähigen Standortformaten
(wie zum Beispiel Metropol- und Makroregionen) erhöhen. Mit der Ausbildung
von Standortpartnerschaften und Allianzen von Teilregionen wird aktuell vie-
Proof
77
lerorts der Versuch unternommen, neue standortpolitische Strategien und Poli-
tiken umzusetzen und durch Kooperation und breiter Zusammenarbeit positive
Effekte im Hinblick auf die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Standorten
zu erzielen. Standortwettbewerb ist Wettbewerb von ortsgebundenen Faktoren
(Standortfaktoren) um mobile Ressourcen wie Kapitel, Wissen, gut ausgebildete
Personen, Fachkräfte, BürgerInnen, Leistungsträgern, etc. (vgl. Guber & Möller
2006, S. 20). Die Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit von Standorten wird
wesentlich durch den Aufbau, die kontinuierliche Gestaltung und Pflege einer
gemeinsamen, unverwechselbaren Identität und von Kernkompetenzen im
räumlichen Wirkungsbereich der Standortkooperation im Vergleich zu anderen
Wirtschaftsräumen gestärkt und getragen (vgl. ebenda, S. 22 ff). Damit geben
die Autoren einen ersten Hinweis auf die mögliche Bedeutung einer gemeinsa-
men Marken- und Identitätspolitik, einer Profilbildung durch Zusammenarbeit
nach dem Standortmodell. Standortstrategische Handlungsfelder und Instru-
mente, welchen bisher in der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Part-
nerregionen der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria kaum Bedeutung zuerkannt
wurden, respektive wenig essenzielle Umsetzungen erzielt werden konnten.
In einem kooperativen Standortentwicklungsprozess könnte, basierend auf
einem konsensual definierten Rahmenzielsystem und den daraus für die Teil-
räume der Alpen-Adria-Region abzuleitenden Entwicklungsschwerpunkte, ein
besonderes Standortprofil, respektive ein attraktives Bündel von Standortin-
dikatoren entstehen. Die aus der Zusammenführung der Profile entstehende
Einzigartigkeit, auch als „ULP“ (Unique Local Proposition) bezeichnet, könnte
die ökonomischen, sozialen, kulturellen Besonderheiten sowie die Lebens- und
Umweltbedingungen in der Alpen-Adria-Region gleichermaßen vereinen und
abbilden (vgl. ebenda, S. 23). Eine gemeinsame Standortpolitik mit einer tragfä-
higen Standortmarke „Alpen-Adria-Region“ als Dach und Klammer der gemein-
samen Entwicklungstätigkeit könnte Wind in die Segel der länderübergreifen-
den Kooperation treiben und Region, Organisation und Partner kraftvoll neuen
Kurs aufnehmen lassen.
Die Realität der Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum zeigt leider ein anderes
Bild. Entgegen den politischen Erklärungen hinsichtlich der Bedeutung einer
intensiven länderübergreifenden Zusammenarbeit und den Zielsetzungen
europäischer Rahmendokumente und Protokolle, sieht sich das Generalsekre-
tariat als zentrale Koordinationsstelle der Zusammenarbeit der Alpen-Adria-
Region im 34. Bestandsjahr der Arbeitsgemeinschaft mit einer schwindenden
budgetären Ausstattung und dem Austritt von Mitgliedsregionen konfron-
tiert. In Zahlen dargestellt beträgt das aus Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung
stehende operative Jahresbudget 2012 lediglich € 63.790,00 (Thomas Pseiner,
Proof
78
Interview 24.10.2012). Der Stand an Mitgliedsregionen hat sich von ehemals 14
auf 8 verringert (Wolfgang Platzer, Interview 23.05.2012). Daraus folgt: Wenig
Wind und schwindende Fahrt bei aufkommender rauerer See, sprich härter
werdendem Wettbewerb der Regionen und Standorte.
Standortpolitik – Motivator und Promotor der Kooperation
Unter „Standortpolitik“ werden im politisch-ökonomischen Sinne staatli-
che oder von anderen Gebietskörperschaften und öffentlichen Institutionen
initiierte Programme, Maßnahmen und Aktivitäten verstanden, die geeignet
erscheinen, die Ansiedlung neuer Unternehmen zu fördern bzw. allgemein
die Attraktivität, Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit eines als räumlich
funktional definierten Bereiches „Standortes“ im internationalen Wettbewerb
zu gestalten, zu verbessern, respektive zu erhalten (vgl. Schubert 2010, S. 1034).
In der Praxis der politisch-sozialen Dimension von Standortpolitik wird in
guten Anwendungen (good practice) von einer umfassenden Wirkungsebene
ausgegangen. Unter dem Terminus „Standortpolitik“ werden in diesen Fällen
umfassende politisch-gesellschaftlichen Programme, Maßnahmen und Akti-
vitäten verstanden, die geeignet sind, die Entwicklung, Gestaltung und Steue-
rung von Lebens- und Wirtschaftsräumen zu fördern bzw. Aktivitäten dazu zu
motivieren (vgl. ebenda). Die zunehmende Bedeutung politischer Maßnahmen
zur Verbesserung von Standortqualitäten reflektiert einerseits die enorm hohe
internationale, regionale und kommunale Wettbewerbssituation um Unter-
nehmer, Investoren, gut ausgebildete Personen, sogenannte Leistungsträger,
Steuerzahler, Wohnbevölkerung sowie zentrale Infrastrukturen (vgl. ebenda).
Angesichts der wettbewerblichen Situation der Standorte und des Mangels an
volkswirtschaftlichen Modellen und Leitbildern wird deutlich, dass Innovati-
onsdynamik, permanenter Strukturwandel sowie eine stringente Standortpo-
litik zunehmend als zentrale politisch-ökonomische Aufgaben angesehen wer-
den, die in vielen Fällen als Bottom-up-Prozesse angesetzt werden (vgl. ebenda).
Die Entwicklungsmöglichkeit eines Standortes wird im Besonderen durch die
gemeinsame und abgestimmte Standortpolitik definiert und vorgegeben (vgl.
Gubler & Möller 2006, S. 27 ff.). Die Standortpolitik hat zum Ziel, die richtigen
Strategien zur Entwicklung eine Standortes festzulegen und die entsprechen-
den Programme und Maßnahmen durchzuführen, bzw. in die Wege zu leiten
(vgl. ebenda, S. 28). Zentrale strategische Mittel und Instrumente der Stand-
ortpolitik sind die Raumplanung, Bildungspolitik, Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik, Investitions- und Förderpolitik, Umwelt- und Infrastrukturpolitik,
eine möglichst harmonisierte Steuer- und Gebührengestaltung, ein gemei-
Proof
79
nes Standortmanagement als operative Organisationseinheit und eine in der
Innen- als auch der Außenperspektive abgestimmte Standortmarkenpolitik
bzw. Markenführung (vgl. ebenda, S. 28). An dieser Stelle wird ersichtlich, dass
internationale, länderübergreifend agierende Standortkooperationen wie sie
die Alpen-Adria-Region beschriebt, bzw. darstellen könnte, sehr hohe Anfor-
derungen an die Abstimmungs- und Steuerprozesse, somit an ein gemeinsa-
mes Standortmanagement stellt. Umfassende Standortpolitik hat demnach
die nachhaltige Planung, Förderung und Entwicklung der verschiedenen Fak-
toren (Standortfaktoren) zur Stärkung von Lebens- und Umweltqualität, sozi-
aler Gerechtigkeit sowie Prosperität, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des
Regionsraumes zum Ziel (vgl. ebenda, S. 30 ff.). Nach Gubler & Möller (2006,
S. 37) setzt ein Standortentwicklungs- und -managementprozess eine gemein-
same politisch/gesellschaftliche Willensbildung von Behörden, Parlamenten,
der Wirtschaft und nicht zuletzt die Akzeptanz einer breiten Bevölkerung vor-
aus. Beim Versuch der Übertragung dieses Ansatzes auf die Zusammenarbeit
der Mitglieder der Alpen-Adria-Region zeigt sich, dass abgesehen von dem in
der Vollversammlung der Regierungschefs am 19. November 2002 in Venedig
beschlossenen Leitbilds „ARGE-Alpen-Adria im Europa des dritten Jahrtau-
sends“ wenig konkret ausformulierte und operationalisierte Zielvereinbarun-
gen zur umfassenden Zusammenarbeit und Entwicklung im länderübergrei-
fenden Regionsraum vereinbart wurden, noch dass rechtsgültige und verbind-
liche Regierungs- oder Parlamentsbeschlüsse die Entwicklung fundieren oder
gar langfristig absichern.
Gemeinsames Standortmanagement – Impresario der länderübergreifenden Zusammenarbeit
Standortmanagement stellt die Planung, Organisation, Durchführung und
Kontrolle von Strategien und Abläufen zur Entwicklung und Vermarktung
regionaler Standorte sicher (vgl. Balderjahn 2000, S. 57). Nach Mathis (2007,
S. 280 ff.) bedarf die Organisationsleistung zur Förderung und Bewirtschaftung
der kontinuierlichen und planmäßigen Entwicklung sowie die Anpassung von
Standorten an sich dynamisch ändernde gesellschaftliche, soziale, politische,
wirtschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen einer operativen Orga-
nisationseinheit, einem initiierenden und koordinierenden Standortmanage-
ment, einer regions- und territorienübergreifend agierenden Organisations-
einheit. Hauptaufgaben der Standortorganisation sind die Umsetzung der in
den gemeinsamen Leitzieldokumenten und Standortentwicklungskonzepti-
onen definierten Programme und Projekte, die Organisation und Bereitstel-
lung der Ressourcen sowie das begleitende Controlling und die Veranlassung
Proof
80
der notwendigen Adaption und Neuausrichtung der Zielsysteme (vgl. ebenda,
S. 290). Einen zentralen und kritischen Erfolgsbereich stellt die Impuls- und
Moderationskompetenz des Standortmanagements dar, Menschen, Netzwerke
und Organisationen für die gemeinsame Standortentwicklung zu motivie-
ren und langfristig in kooperative Entwicklungsprozesse einzubinden (vgl.
ebenda, S. 291). Eine immanente Herausforderung an die Kooperationspartner
stellt die Ausstattung der Organisationseinheit mit ausreichenden Kompe-
tenzen und Ressourcen – insbesondere in länderübergreifenden Anwendun-
gen wie im Fall der Alpen-Adria-Region – dar (vgl. ebenda). In der Praxis zeigt
sich, das vielfach Entwicklungsgesellschaften und -organisationen bei hohen
Erwartungshaltungen der Partner mit zu geringen Kompetenzen ausgestattet
und in hohem Ausmaß politisch/administrativen Interessenkonflikten ausge-
setzt werden (vgl. ebenda). Ein Standortmanagement ist nur dann erfolgreich
und nachhaltig wirksam, wenn es professionell, ernsthaft und auf Langfristig-
keit hin ausgerichtet ist und über eine leistungsfähige Aufbau- und Ablaufor-
ganisation verfügt (vgl. ebenda, S. 292).
Für ein länderübergreifend wirkendes Standortmarketing, wie jenes für die
„Alpen-Adria-Region“, ergibt sich die Notwendigkeit im direkten Kontakt mit
den politischen Entscheidungsträgern wirken zu können und auf ein geeig-
netes Struktur- und Organisationskonzept aufbauen zu können (vgl. Mathis
2007, S. 292). Nach Wolf Huber (2011, S. 44) verlagert sich das Schwergewicht
der Kooperationsbemühungen von Standortorganisationen aktuell vom „Plan
als fertigem Ergebnis zur Planung“ als nie abgeschlossenen, permanenten und
kommunikativen Prozess. Die Bereitstellung sozialer Kommunikation ist für
das Verhalten und die Entwicklung sozialräumlicher Systeme von eminenter
Bedeutung und damit Aufgabenschwerpunkt der Standortorganisation (vgl.
ebenda, S. 42). Dem Standortmanagement wächst in offenen Planungsprozes-
sen die Aufgabe zu, als Moderator Kommunikationsprozesse erfolgreich zu
gestalten, eine neutrale Haltung einzunehmen und eigene Sichtweisen nicht
zum alleinigen Maßstab der Entwicklung zu machen. Nach Wolf Huber (2011,
S. 47) könnte eine bewusste Mitgestaltung des räumlichen Kontextes für gesell-
schaftliche Entwicklung unter Verzicht auf starre Zielsysteme so etwas wie eine
neue Leitvorstellung für raumbezogene Tätigkeiten sein. In diesem Zusam-
menhang weist Huber auf die Bedeutung von Information und Kommunikation
als Instrumente der Standort- und Raumentwicklung hin und verweist dabei
auf Bereiche wie Medien, Kunst, aber auch symbolische Aspekte (vgl. ebenda,
S. 58). Somit wird auch bei dieser methodischen Vorgehensweise auf die Mög-
lichkeiten und Chancen einer gemeinsamen Markenpolitik als visuelles Dach
und Klammer der intersozialen Kooperation hingewiesen. Der Ansatz einer
Proof
81
möglichen Standortentwicklung für den Alpen-Adria-Raum, welcher von starr
vorgeplanten Zielsystemen und -vorstellungen abgeht, bedarf für die nachhal-
tige Umsetzung ebenso einer gemeinsamen Organisationseinheit, die Prozesse
anstößt, moderiert, kommuniziert und unterstützt. Mangels einer endgültigen
und umfassenden terminologischen Beschreibung der länderübergreifend wir-
kenden Organisationseinheit unternehmen wir hier an diese Stelle den Ver-
such, diese Funktion für die Alpen-Adria-Region als „Impresario oder Kümme-
rer“ einer offenen, kooperativen Zusammenarbeit zu skizzieren.
EU-Makroregionen – Relaunch und Impulse als Standortkooperation „Alpen-Adria-Region 2.0.“
Mit der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes und der zunehmenden
Globalisierung hat sich in den letzten Jahren die wettbewerbliche Situation
für Regionen und Standorte und mit ihnen die Standortpolitiken und -strate-
gien deutlich verändert (vgl. Balderjahn 2000, S. 3). Der Abbau der Handelsbe-
schränkungen, die Niederlassungsfreiheit und die uneingeschränkte Mobili-
tät der Produktionsfaktoren haben Regionen und Standorte zur Neuausrich-
tung und Adaption ihrer Standortstrategien veranlasst. Im Wettbewerb um
komparative Standort- und Wettbewerbsvorteile bemühen sich Regionen um
spezifische Standortprofile und kooperieren mit der Zielsetzung der Potenti-
alagglomeration in verschiedenen Modellen und Formaten interregional und
international zu Makro-, Standort-, Lebens- und Wirtschaftsregionen mit
abgestimmten standortpolitischen Programmen (vgl. ebenda, S. 5). In der aktu-
ellen Diskussion um mögliche Entwicklungspfade für die Alpen-Adria-Region
stellt sich im Kontext gleichzeitig stattfindender ambitionierter europäischer
Bemühungen internationale Standortkooperationen auszubilden die Frage,
ob nicht gerade jetzt das richtige Zeitfenster aufgegangen ist, die bisher eher
auf Elitenkontakte sowie Kennenlern- und Austauschprogrammen aufgebaute
Kooperationskultur der ARGE Alpen-Adria in einer konsequenten Neuausrich-
tung im Sinne einer umfassenden, integrierten und von breiten Bevölkerungs-
kreisen getragenen Standortkooperation, einer europäischen Makroregion
„Alpen-Adria“, anzugehen.
Der in der Europäischen Union entwickelte neue Raumbegriff „Makroregion“
ist transnational. Makroregionen definieren sich nicht vorrangig über Verwal-
tungsgrenzen sondern über Themenzusammenhänge. Die Europäische Kom-
mission definiert Makroregion als ein „Gebiet, das mehrere Verwaltungsregionen
umfasst, aber genügend gemeinsame Themen aufweist, um ein einheitliches stra-
tegisches Konzept zu rechtfertigen“ (Leitermann 2011, S. 3). Mit dieser Feststel-
Proof
82
lung gibt Leitermann Hinweise darauf, dass die Formulierung und Bildung
von Standortkooperationen nicht ausschließlich auf territorial/politischen
Top-down-Entscheidungen basieren muss, sondern aus thematischen Zusam-
menhängen, Bündeln von Standortfaktoren, dynamischen sozialen und wirt-
schaftlichen Interaktionen als Bottom-up-Prozesse lokal motiviert und initiiert
werden kann. Damit sind Standortbildung und -kooperation nicht auf Denk-
und Zielprozesse der politischen und administrativen Eliten beschränkt, son-
dern können von verschiedenen Initiativen, Nicht-Regierungs-Organisationen
(NGOs), BürgerInnen- und Interessengruppen etc. initiiert und getragen wer-
den. Für die Europäische Gemeinschaft hat sich der EU-Ausschuss der Regionen
(AdR) zur Plattform etabliert, von der aus in den letzten Jahren mehrere Inter-
regionale Gruppen (IG) nach dem Prinzip der Makroregion themenorientiert in
Regionen übergreifenden Zusammenhängen agieren (vgl. ebenda, S. 3 ff). Im
Rahmen der „Stockholm-Konferenz 2009“ (EU-Ministerkonferenz) wurde der
Begriff einer makroregionalen Strategie dazu näher definiert. Eine Konzeption,
die mehr als einen Politikbereich abdeckt, einen integrierten strategischen
Ansatz verfolgt und die nachhaltige ökologische, ökonomische und soziale
und damit integrierte Entwicklung des betroffenen makroregionalen Raumes
zum Ziel hat (vgl. Sweet 2011, S. 4 f.). Makroregionale Strategien sind ein neuer
Weg in der Europäischen Union, eine Chance der transnationalen Zusammen-
arbeit, wenngleich zentrale Fragen der Koordination der Zusammenarbeit und
Festlegung von Handlungs- und Aktionsbereichen zum Zeitpunkt noch nicht
abschließend diskutiert und festgelegt sind (vgl. ebenda, S. 4). Mit der Einfüh-
rung dieses neuen, uneingeschränkten, auf Konsens setzenden Standortkoope-
rationsansatzes wird insbesondere die Rolle des „grenzüberschreitend agie-
renden“ Koordinators, Promotors und Moderators von hoher Erfolgsbedeutung
(siehe dazu auch Seite 79). Das Beispiel der Arbeitsgemeinschaft der Alpen-Adria-
Region kann dazu eine gute Ausgangslage vorweisen. Die Mitgliedergemein-
schaft könnte als Träger („Impresario“) einer Agglomeration „Alpen-Adria“ ihre
jahrzehntelange Erfahrung aus der interregionalen Zusammenarbeit sowie ein
umfassendes Netzwerk und Vertrauen aus der Umsetzung vielfältiger operatio-
neller Projekte erfolgswirksam einbringen.
Angesichts der Gefahr schwindender Wettbewerbsfähigkeit und getrieben
durch die Notwendigkeit, trotz oder gerade wegen rückläufiger öffentlicher
Budgets und Haushaltsrestriktionen zukunftsträchtige und wettbewerbsfä-
hige Entwicklungsperspektiven durch Standortkooperationsprozesse zu moti-
vieren, entwickelte sich im Jahr 2012 quasi ein „run“ um Gemeinschaftspro-
jekte und Positionierungen als international gut vernetzte und prosperie-
rende Wirtschaftsräume. Letztlich spielt sicherlich auch die Hoffnung mit,
Proof
83
als kooperierende Gemeinschaft von Standortakteuren leichter Zugang zu den
Finanz- und Fördermitteln der EU-Regional- und Strukturfonds zu finden.
Als Beleg oder aktuelles Beispiel dazu kann die am 29. Juni 2012 vom Tiroler
Landeshauptmann Günther Platter vor versammelter Mitgliederkonferenz der
Arbeitsgemeinschaft Alpenländer „ARGE Alp“ unter dem Titel „Kooperation
in den Bergen“ bekannt gegebene Absichtserklärung der Weiterentwicklung
und strategischen Neuausrichtung der 1972 gegründeten Arbeitsgemeinschaft
nach dem Modell der EU-Makroregionen angeführt werden (vgl. Naschberger
2012, S. 14 ff). Im vierzigsten Jahr des Bestehens der ARGE Alp soll die Neukon-
stituierung und Ausrichtung als EU-Makroregion „Alpenraum“ die territoriale
Zusammenarbeit des 50 Millionen Einwohner umfassenden Wirtschafts- und
Lebensraumes als innovationsgetriebene und wettbewerbsfähige Standort-
kooperation der Alpenländer gefestigt und neue Impulse gesetzt werden (vgl.
ebenda, S. 15). Damit „verordnet“ Landeshauptmann Günther Platter der eben-
falls in die Jahre gekommenen Plattform der Alpenländer „ARGE Alp“ eine
Entwicklungsdimension. Zugleich eröffnet er aber auch den Wettbewerb im
Alpenraum um kreative und tragfähige Standort- und Kooperationskonzepte,
attraktive Kooperationspartner und finanzielle Ressourcen.
In der ARGE Alpen-Adria sind Belege für eine latent rückläufige Entwicklung
und Austritte wesentlicher Partner aus der Arbeitsgemeinschaft in den letzten
Jahren feststellbar. Schon 1993 wurde vom damaligen Kärntner Landeshaupt-
mann Dr. Christof Zernatto und seinem friulanischen Amtskollegen Vinicio
Turello eine Neuausrichtung und Neustrukturierung der ARGE Alpen-Adria als
notwendig aufgezeigt (vgl. Valentin 1998, S. 85). 2012, rund zwanzig Jahre spä-
ter, verstärkt sich der Reformbedarf, auch weil sich zeitgleich mehrere Orga-
nisationen mit vergleichbarer Zielausrichtung einer grenzüberschreitenden
Regions- und Standortbildung, wie etwa die ARGE Alp, die 1952 aus der Taufe
gehobene nicht staatliche Dachorganisation CIPRA (Commission Internationale
pour La Protection des Alpes) oder die 1997 gegründete Allianz in den Alpen,
ein Zusammenschluss von Gemeinden und Regionen aus sieben Staaten des
Alpenraumes (vgl. Naschberger 2012, S. 15.) etc. aktiv um vitale Standortkoope-
rationen von Gemeinden, Ländern und Regionen im erweiterten Alpenraum
bemühen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im restlichen Regions- und Mitglieder-
raum der ARGE Alpen-Adria, auch hier kommt es vermehrt zur Neubildung von
Kooperationen und Standortverbindungen wie etwa die 2007 unter dem Titel
„Euregio Senza Confini“ ins Leben gerufene, am 16. März 2012 verlängerte und
inhaltlich gestärkte trilaterale Zusammenarbeit der norditalienischen Regio-
nen Veneto und Friaul-Julisch-Venetien mit Kärnten (vgl. Kärntner Landesre-
gierung, Landespressedienst vom 16.03.2012).
Proof
84
Was bleibt in diesem aufgewühlten Umfeld – einer Art Aufbruch- und Neu-
gründerstimmung in der Standort- und Regionalentwicklung – von der ehe-
maligen Leitinitiative und dem Fackelträger länder- und regionsübergreifen-
der Zusammenarbeit der ARGE Alpen-Adria an Bestand, welche Entwicklungs-
modelle und Methoden sind tragfähig? Fragestellungen, die aus heutiger Sicht
nicht umfassend und endgültig beantwortet werden können. Stärkung und
Aktualität erfährt das Modell länderübergreifender Standortverbünde aus Bei-
spielen wie jenes der 2009 von der Europäischen Kommission genehmigten
Ostsee-Strategie „Makroregionsstrategie Ostsee“ (vgl. Sweet 2011, S. 4) oder der
2010 vom Rat bestätigten EU-Strategie für den Donauraum, wo in „Bottom-up-
Prozessen“ mit Konferenzen, Workshops und offenen Planungsplattformen in
allen Städten entlang der Donau kooperative Entwicklungsstrategien für einen
künftigen 115 Millionen Menschen umfassen Raum initiiert wurden (vgl. Gön-
ner 2011, S. 6).
Markenpolitik und Branding – ein gemeinsames Dach für die „Alpen-Adria-Region 2.0.“?
Im folgenden Kapitel wird überblicksmäßig den Intentionen nachgegangen,
mit Hilfe von Techniken, Strategien und Anwendungen der Markenpolitik von
geographischen Räumen Überlegungen für die Implementierung einer Dach-
marke als gemeinsames emotionales Bindeglied, roter Faden und Identitätsan-
ker für eine „Alpen-Adria-Region Version 2.0“ anzubieten.
Zielbildung, Strategien und Instrumente der Markenpolitik von Standorten
Die Markierung von geographischen Räumen für eine Vermarktung ist vom
Prinzip her keine Erfindung des 21. Jahrhunderts oder gar ein neuartiges Phä-
nomen (vgl. Kühne 2008, S. 16). Mehrfach wird in der Fachliteratur für die Mar-
kenführung von Räumen als historischer Beleg und Beispiel für ein integriertes
Branding Frankreich nach der Revolution von 1789 herangezogen. Bereits damals
wurde mittels unterschiedlicher Instrumente wie einem Logo (Tricolore), einem
Slogan (Libertè, Eglité, Fraternité) oder einer Melodie (Marseillaise) die neue
Identität Frankreichs für die breite Masse der BürgerInnen erfahrbar gemacht
(vgl. Olins 2004, S. 18, zit. nach Kühne 2008, S. 16). Aktuelle Anwendungen und
Beispiele der Markenpolitik geographischer Räume gehen von der reinen Kom-
munikationsfunktion und Vermittlung räumlicher Identität durch Marken ab
und bauen auf die Markenfunktion als Impulsträger und emotionaler Anker für
Prozesse einer kooperativen Regions- und Standortentwicklung auf.
Proof
85
Eine der bekanntesten Praxisanwendungen von markenpolitischen Instrumen-
ten für geographische Räume stellt das „Destination Branding“ dar (vgl. Kühne
2008, S. 52). Im Wettbewerb der Tourismusstandorte um Image, Bekanntheit und
letztlich Nächtigungen setzen Talschaften, Tourismusregionen und Koopera-
tionen von regions- und länderübergreifende Tourismusdestinationen auf die
emotionale Wirkung einer gemeinsam Marke (vgl. ebenda, S. 52 ff.). Eine weitere
Markenanwendung im räumlichen Kontext stellt das „Place of Origin Branding“
dar, bei dem Produkte und Leistungen durch Co-Branding mit der Verwendung
der Assoziationen des Ursprungsortes (Südtiroler Äpfel, Prosciutto San Daniele,
Salzburger Mozartkugeln, etc.) vermarktet werden und damit gleichzeitig Merk-
male und Attribute der Region vermitteln (vgl. ebenda, S. 53). Durch die zuneh-
mende Bedeutung von Kultur, Freizeit, Unterhaltung und herausragender Archi-
tektur als Standortfaktoren werden verstärkt Anstrengungen unternommen,
diese Attribute in die Markenpolitik von Regionen zu integrieren (vgl. ebenda).
Die Schaffung einer unverwechselbaren Identität und die Nutzung dieser Iden-
tität zur Bildung eines starken Images stehen vielfach im Zentrum der Marken-
politik geographischer Räume (vgl. ebenda, S. 55). Sowohl in der wissenschaftli-
chen Diskussion als auch in der praktischen Anwendung wird der Markierung
von Nationen unter dem Ansatz „National Identity, National Branding“ besondere
Beachtung gegeben. Vor dem Hintergrund der rasanten Internationalisierung
und Globalisierung der Weltwirtschaft verlieren jedoch nationale Grenzen kon-
tinuierlich an Bedeutung (vgl. Kirchgeorg 2005, S. 590). Gleichzeitig verlagert sich
der Wettbewerb um mobile Standortfaktoren und damit die räumliche Marken-
dimension von der Ebene der Nationalstaaten auf die Interregions- und Standor-
tebene (vgl. ebenda, S. 591, siehe auch den Exkurs zur Dachmarke „Vierländerre-
gion Bodensee“, Seite 90). Bei der Profilierung von Regionen und Standorten kön-
nen Local oder Place Brands eine wichtige Identifikations- und Orientierungsrolle
sowohl nach innen zur eigenen Bevölkerung als auch in der Außendimension als
visueller Kristallisationskern des Leistungsspektrums eines Standortes darstel-
len (vgl. ebenda, S. 590). Eine Regions- oder Standortmarke kann sich im Zeitab-
lauf der Standortentwicklung, Zug um Zug durch Vernetzung und Kooperation
der Akteure zu einer internationalen Marke entwickeln (vgl. ebenda, S. 592). Im
Rahmen des Standort- oder Regionalmarketings stehen Local Brands für das
gesamte Leistungsbündel (Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur- und Bildungsange-
bot, soziale Einrichtungen, Netzwerke, Einwohner und andere) einer Region (vgl.
ebenda). Überwiegend werden Regions- und Standortmarken nach der Dachmar-
kenstrategie entwickelt, unter deren „Schirmwirkung“ die Leistungsbündel und
Attribute der Teilregionen und Partner zu einer Markenidentität zusammenge-
fasst (vgl. ebenda, S. 596). Eine solche gemeinsame Dachmarkenpolitik für einen
Standort oder eine Gesamtregion wird auch als „Branded Region“ bezeichnet
Proof
86
(vgl. ebenda, S. 597). Probleme beim Aufbau einer zentralen Markenidentität von
Dachmarken ergeben sich aus inhomogenen Leistungsangeboten der Teilregio-
nen und Partner, was die gezielte Gestaltung eines Gesamtleistungsspektrums
und die klare Profilbildung eher erschwert (vgl. ebenda). Eine erfolgreiche insti-
tutionelle Verankerung einer Standortmarke erfordert jedenfalls die Einbindung
der verschiedenen Leistungserbringer in den Markenentwicklungsprozess, weil
alle Akteure durch ihre Aktivitäten nach innen und außen die Leistungen und
das Erscheinungsbild sowie den Charakter und schlussendlich die Markenper-
sönlichkeit der Dachmarke mitprägen (vgl. ebenda).
Konzeptionen und Strategien der Markenbildung für Standorte und Regionen
zielen im Wesentlichen auf vier Wirkungsebenen ab:
• Profilierung bei den Hauptzielgruppen in der Außenebene,
• Differenzierung gegenüber mitbewerbenden Standorten,
• Koordinations- und Motivationswirkung für die verschiedenen Akteurs-
gruppen und Beteiligten in der Innenperspektive sowie
• Kooperations- und Kopplungswirkung zu anderen Standorten, Angeboten
und Leistungen (vgl. Kühne 2008, S. 18).
In der Markenführung von Standort- und Regionsmarken werden insbeson-
dere die Identitäts- und Identifikationsfunktion (emotionale Verbundenheit,
Bekanntheit), Orientierungsfunktion, Kompetenzfunktion, Vertrauensfunk-
tion und die Imagefunktion (Reputation) angesprochen, respektive die mar-
kenpolitischen Zielsetzungen darauf abgestellt (vgl. Kirchgeorg 2005, S. 594).
Eine Marke kann als ein in der Psyche der potentiellen Zielgruppen, Akteure,
Gäste, etc. verankertes unverwechselbares Vorstellungsbild verstanden wer-
den (vgl. Hohn 2008, S. 134). Gut platzierte und profilierte Standortmarken
erzeugen eine Art „Vorzugsstellung“ in den Köpfen breiter Zielgruppen (vgl.
Kirchgeorg 2005, S. 601). Standortmarken sind darauf abgestellt, Qualität zu
signalisieren, sie wirken vertrauensbildend und komplexitätsreduzierend (vgl.
Hohn 2008, S. 135). Damit stellen räumliche Marken eine extreme Verdichtung
von Informationen für wesentlichen mit der Standortmarke verknüpften Asso-
ziationen dar (vgl. ebenda, S. 135 ff). Die Ausbildung und Verdichtung vielfälti-
ger Merkmale zu einer gemeinsamen spezifischen Markenidentität stellt bei
raumbezogenen Markenbildungsprozessen, insbesondere bei länderübergrei-
fenden Standortkooperationen meist eine besondere Herausforderung dar
(vgl. Kühne 2008, S. 90 f.).
Proof
87
In einer starken Standortmarke bündeln sich rationale (ökonomische, harte)
und emotionale (weiche) Bausteine der Teilregionen zu einem prägnanten
Markenkern (vgl. Hohn 2008, S. 135 ff). Die Bindungs- und Gravitationskraft
einer Marke ist abhängig von der höchstmöglichen Übereinstimmung des
Selbstbildes der angesprochen Person, sozialen Gruppe, Netzwerke, etc. zur
wahrgenommenen Persönlichkeit der Standortmarke (vgl. ebenda, S. 136).
Zentrale Bedeutung für den Erfolg von Standortmarken ist dabei das Geschick
glaubhaft ein bestehendes oder auch künftiges Lebensgefühl (Trend) einer
möglichst breiten Bevölkerungsgruppe zu verkörpern (vgl. ebenda, S. 136). Die
Wahrnehmung eines Standortes kann über die Beschreibung mit Hilfe von
Merkmalen ermittelt werden (vgl. Kirchgeorg 2005, S. 603). Im Hinblick auf
unterschiedliche Identitätsträger (Innen- und Außenperspektive, respektive
Selbst- und Fremdeinschätzung) wird zwischen der Identifikation und damit
Identifikationswirkung auf die Bewohner am Standort und andererseits der
Identifizierung oder Wiedererkennung durch Personen von außerhalb, unter-
scheiden (vgl. ebenda, S. 603). Bei dieser Unterscheidung kommen in der Stand-
ortbildung und -entwicklung unterschiedliche Handlungsalternativen für den
Standort zum Tagen. So kann beispielsweise die Zielsetzung einer identitäts-
orientierten Markenführung von Regionen einerseits die Verringerung der
Abwanderung von Bevölkerung durch Bindung oder auch die Motivation für
Zuzug gut ausgebildeten Leistungsträgern, Arbeitskräften oder Schlüsselper-
sonen durch Marken- und Standortattraktivität sein (vgl. ebenda).
Für den Kernbereich der Alpen-Adria-Region bietet die Bindungsfunktion
einer attraktiven Standortmarke Chancen, einer prognostizierten negativen
Bevölkerungsentwicklung durch Wegzug und Überalterung entgegenzuwir-
ken. In der Innenperspektive kann eine vitale Standortmarke darüber hinaus
regionale Akteure (Unternehmen, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Bür-
gerInnen) zur Zusammenarbeit und Vernetzung anregen, zu Initiativen und
Projekten motivieren und allgemein die Leistungsfähigkeit des Standortes
positiv beeinflussen (vgl. ebenda, S. 594 f.). Die konstituierende Wirkung von
offenen Standortmarkenprozessen, Menschen, Organisationen, Initiativen,
Netzwerken, Unternehmen, sozialen Einrichtungen von einer Vision heraus
zu einer gemeinsamen Entwicklung zu motivieren und damit bestehende
Grenzen aus endogenen Kräften heraus überschreiten zu lassen, bietet für
die Teilregionen und Akteure im Alpen-Adria-Raum die Chance, die Region
als Standort neu in einem umfassenden Bottom-up-Prozess neu Schritt für
Schritt zu formieren, zu festigen und unter dem gemeinsamen Markendach als
lebenswerter und wettbewerbsfähiger Europäischer Standort zu profilieren.
Diese zusammenführende, standortkonstituierende Wirkung wird auch von
Proof
88
Kirchgeorg (2005, S. 595) mit der Feststellung angeführt, dass sich Regionen
und Standorte immer häufiger dadurch auszeichnen, dass sie sich durch dyna-
mische Vernetzung der Akteure und die daraus entstehenden Initiativen und
Projekte neu formieren und mit markenpolitischen Instrumenten und Strate-
gien neue Identitäten aufbauen.
Vom Emblem zur Marke – bisherige Markenpolitik für die Alpen-Adria-Region
Die Formulierung „Alpen-Adria“ als Überbegriff und Klammer für die Zusam-
menarbeit Kärntens, Sloweniens und Friaul-Julisch-Venetiens bildete sich 1967
heraus und wurde anfänglich von den politischen Eliten als eine Art Chiffre für
geplante Kooperationen im engeren Grenzraum Kärntens zu Italien und Jugos-
lawien eingesetzt (vgl. Valentin 1998, S. 12). Die konkrete materielle Anwendung
des Begriffes und damit verbunden vermutlich der erste Hinweis auf eine mar-
kenähnliche Verwendung wurde 1962 mit der erstmaligen Organisation einer
„Internationalen Messe Alpen-Adria“ in Laibach gesetzt (vgl. ebenda, S. 12). In
den Folgejahren kam der ursprünglich als Kurzbezeichnung für die politisch/
administrative Anwendung der grenzüberschreitender Besuchsdiplomatie
geprägte Begriff „Alpen-Adria“ oder auch verkürzt zu „Alpe-Adria“ immer mehr
auch für wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Belange, insbeson-
dere für Veranstaltungen zur Anwendung (vgl. ebenda, S. 13 ff). In den Siebzi-
gerjahren des letzten Jahrhunderts wurde der Begriff dann aus verschiedenen
Motivationen heraus sehr inflationär eingesetzt. Von Alpen-Adria-Ärztetref-
fen, verschiedensten Sportveranstaltungen, Alpe-Adria Malersymposien, Kul-
turwochen, Jugendspielen, Filmwochen, über den Bildungsbereich, wie die
1979 erstmals abgehaltene alpen-adriatische Rektorenkonferenz, reicht die
Anwendung bis zur Benennung der Autobahnverbindung Villach-Udine im Juli
1986 als „Alpen-Adria-Autobahn“ und die Umbenennung der Kärntner Landes-
bank im Jahr 1995 in die „Hypo Alpe Adria Bank“ (vgl. ebenda, S. 36. ff.).
Auf der Suche nach weiteren Anwendungen des seinerzeit für die Bezeichnung
der transnationalen Zusammenarbeit entstandenen Kurztitels zeigt sich bei
einer Onlinerecherche, dass in der Praxis der Zusatz „Alpen-Adria“ teilweise
auch ohne konkreten Kontext zu den inhaltlich/räumlichen Bezugspunkten
der Bezeichnung steht, wie vermutlich im Fall des Alpen-Adria-Hundesport-
zentrums, dem Alpe-Adria-Naturstromanbieter, einer großen Anzahl gastro-
nomischer Betriebe und Campingplätzen, Musikgruppen, die Alpen-Adria-
Fischprämierung, das Krone Alpen-Adria-Hafenfest in Klagenfurt und ein
Alpen-Adria-Saunabetrieb sowie viele andere Anwendungen mehr (Onlinere-
cherche im Internet 12.09.2012). Analog der Feststellungen im Beitrag zur The-
matik der Regionsbildung, dass „die Alpen-Adria-Region überall ist“, eröffnet
Proof
89
die Recherche Hinweise und Evidenzen, dass unter dem Titel, dem Emblem,
dem Logo oder der Marke „Alpen-Adria“ verschiedenste Produkte und Leistun-
gen angeboten und die Alpen-Adria-Region de facto nicht nur „überall“ ist, son-
dern unter ihrer Bezeichnung auch fast „alles“ verstanden, respektive angebo-
ten und „vermarktet“ wird.
Die Auswahl und Festlegung zur Führung eines gemeinsamen offiziellen Emb-
lems geht auf den Beschluss der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft
vom 23. September 1980 zurück (vgl. Arbeitsgemeinschaft-Alpen-Adria 2006,
o. s. ). Unter siebzig Einsendungen wurde im Rahmen eines Wettbewerbes das
Emblem ausgewählt und beschlossen (vgl. ebenda). Mit Beschluss der Vollver-
sammlung der Regierungschefs vom 23. November 2006 wurden allgemeine
Organisations- und Verfahrensregeln für die Arbeitsgemeinschaft Alpen-
Adria mit Feststellungen betreffend die „Darstellung des Emblems der Arbeits-
gemeinschaft“ verabschiedet (vgl. ebenda). Zentraler Inhalt der Regelungen ist,
dass die Führung des Alpen-Adria-Emblems den Gremien der Arbeitsgemein-
schaft, ihren Mitgliedern, den Geschäftsstellen und dem Generalsekretariat
vorbehalten ist und darüber hinaus die Verwendung des Emblems in Zeitschrif-
ten und Publikationen, welche für den Zweck der Verbreitung und Förderung
der Alpen-Adria-Idee dienlich sind, gestattet ist (vgl. ebenda). Nähere, kon-
kretisierende Festlegungen auf die Emblem- oder Logo-Führung, Zielsetzung,
Qualitätssicherung, Umgang mit Drittverwendungen, Lizenz- und Nutzungs-
vereinbarungen, Co-Verwendungen, etc. werden in diesem Dokument nicht
getroffen. Aus der Wahl der Bezeichnung „Emblem“ und den Anwendungshin-
weisen im Basisdokument kann abgeleitet werden, dass sich die ARGE für die
gemeinschaftlichen Aktivitäten eine Art Wahr- und Erkennungszeichen, ein
Abzeichen der Gemeinschaft mit der Funktion eines Organisationslogos oder
auch gemeinsamen Verwaltungs- und Hoheitszeichens festgelegt, respektive
ihre Außendarstellung darauf vereinheitlicht hat.
Die Führung einer gemeinsamen Dachmarke und der Einsatz markenpoliti-
scher Instrumente wurden zwar mehrfach in verschiedenen Gremien disku-
tiert, aber schließlich nicht weiter verfolgt (Pseiner 2012, Interview 24.10.2012).
Damit wurde der Aufbau und die Chancen zur Verständigung auf ein gemein-
sames, länderübergreifendes Markenprofil, die Antwort auf die Frage, „Wie
und mit welchen Bildern soll sich die Alpen-Adria-Region in den Köpfen der
einzelnen Anspruchsgruppen künftig darstellen und verfestigen“, welche
gemeinsamen Identitätsmerkmale, welche Assoziationen sollen entstehen,
nicht wahrgenommen. Die Praxis zeigt eine plurale, wenig profilprägende
Vielfalt von Anwendungen des Wortlautes, verschiedenste Wort-Bildmarken-
Proof
90
Kombinationen, wenig Gemeinsames. Der Entwicklungspfad vom Emblem zur
Marke, zu Dach und Schirm gemeinsamer Standortentwicklung steht offen.
Damit verbunden auch die Chance für die Arbeitsgemeinschaft und ihre Mit-
glieder neue Kraft auf zu nehmen und die Kernbotschaft der länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit via gemeinsamer Regions- und Dachmarke in die
Köpfe und Herzen der BürgerInnen zu bringen.
Exkurs: Standort- und Markenpolitik der „Vierländerregion Bodensee“
Aufbauend auf eine Machbarkeitsstudie „Themenwelt Bodesee“, Zukunftskon-
ferenzen, Ideenforen, einer Leitbildfestlegung sowie mehreren Studien zur
Identitäts- und Markenbildung, wurde im Projekt Internationaler Wirtschafts-
raum Bodensee (IWB) am 30. Juni 2011 nach einem eineinhalbjährigen parti-
zipativen Markenbildungsprozess die Einführung und Positionierung einer
gemeinsamen Standort- und Regionenmarke beschlossen (vgl. BSM 2012a, S. 1).
Die Vierländerregion Bodensee umfasst als internationaler Verflechtungsraum
vier Staatsgebiete (Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein), meh-
rere Kantone, Landkreise und Bundesländer mit 2,2 Millionen Einwohnern, 1,15
Millionen Erwerbstätigen, renommierten Hochschulen und einer beachtlichen
Anzahl international agierender Unternehmen mit Standort und Headquarter
in der Region (vgl. ebenda). Die internationale Standortkooperation steht unter
dem Motto „Ein starker internationaler Wirtschaftsstandort: Ein See, eine Region –
vier Länder, tausend Möglichkeiten“ (ebenda). Von den 15 Projektpartnern und 14
Projektbeteiligten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung,
Kultur und Tourismus wurde ein offener Prozess initiiert, der als interdiszip-
linärer und partizipativer Entwicklungsprozess konzipiert, die Standortvor-
teile und Ressourcen der Teilregionen verbindet und laufend neue Interessierte
und Partner in die gemeinsame Entwicklung einbindet, respektive unter dem
Schirm der Regionenmarke zusammenführt (vgl. ebenda, S. 2 ff).
Die Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) mit Sitz in Konstanz (Deutsch-
land) ist als supranationale Organisation und operative Einheit für die gemein-
same Standortentwicklung und Markenführung in der Vierländerregion
Bodensee konstituiert und den dort lebenden Menschen, den Unternehmen
und öffentlichen Institutionen mit der Zielsetzung der Stärkung der Zukunfts-
fähigkeit der Region, verpflichtet (Doerte Gensow, Interview 26.10.2012). Die
BSM ist als international agierende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
derzeit 40 Gesellschaftern formiert und wird durch Sponsoren wie die Credit
Suisse, die Sparkasse Bodensee, Siemens AG u. a. finanziell unterstützt (vgl.
BSM 2012b).
Proof
91
Die von der BSM operativ geführte Regionenmarke „Vierländerregion Boden-
see“ soll sich langfristig als markantes Erkennungszeichen für die Bodense-
eregion profilieren, übergreifend Bereiche wie Wirtschaft, Tourismus, Wis-
senschaft, Bildung, Kunst, Kultur, Politik, Sport und Naturschutz unter einem
regionenübergreifenden „Markendach“ verbinden, nach außen eine Einheit
vermitteln sowie nach innen zur eigenen Bevölkerung kraftvoller Identitäts-
und Identifikationsanker sein (Doerte Gensow, Interview 26.10.2012). Der Ent-
wicklung und Positionierung der Regionenmarke „Vierländerregion Boden-
see“ ist ein umfassender Beteiligungsprozess vorangegangen (vgl. BSM 2012a,
S. 2). Zielsetzung der Standortkooperation ist es gemeinsame Entwicklungs-,
Marketing- und Kommunikationseffekte für die Vierländerregion Bodensee
zu erzielen und nach innen wie außen ein gemeinsames Dach, einer Regio-
nenmarke, zu bilden, unter dem die Anrainerregionen, Institutionen, Kom-
munen, Unternehmen sowie BürgerInnen und zahlreiche weitere Akteure mit
ihren pluralen Zielsetzungen, unterschiedlichen Kulturen und verschiedenen
Themen, freiwillig zum Zweck der gemeinsamen Erfüllung einer länderüber-
greifenden Standortentwicklung unter Beibehaltung ihrer Selbstständigkeit
und Identität zusammenarbeiten (Doerte Gensow, Interview 26.10.2012). Die
besonderen Alleinstellungs- und Differenzierungsmerkmale zu anderen Regi-
onenmarken generiert die Standortmarke aus den im Markenkern definier-
ten Spannungsfeldern „See&Landschaft – Natur&Kultur – Ruhe&Dynamik
– Tradition&Innovation – Regional&International“ (vgl. BSM 2012a, S. 1). Mit
einer offenen Markenarchitektur und der Vergabe von Nutzungslizenzen an
Partner, Initiativen, Institutionen Unternehmen und Netzwerken im Koope-
rationsraum (differenziert in Markenträger, Vollanwender, Teilanwender,
Additivanwender und Fakultativanwendern) entstehen kontinuierlich neue
strategische Kooperationen mit der Standortgemeinschaft (Doerte Gensow,
Interview 26.10.2012). Diese Kooperationen stärken die Regionenmarke „Vier-
länderregion Bodensee“ mit weiteren Kompetenzfeldern und zusätzlichen,
die Attraktivität und Profilbildung schärfenden Attributen, Produkten und
Leistungen (vgl. BSM 2012b). Die Markenführung der Standort- und Regionen-
marke durch die BSM und Ihrer Partner, regelt und steuert dabei das sensible
Ausbalancieren von Gemeinsamkeit und Autonomie der verschiedenen Betei-
ligten und stellt die Zielerreichung und Konformität der Markenpolitik sicher
(vgl. BSM 2012a, S. 3 ff.). Die Markenpartner profitieren von der Kraft und
Bekanntheit der Verbund- und Regionenmarke, ohne auf ihren eigenen Mar-
kenauftritt und ihre eigene Visuelle Identität verzichten zu müssen (Doerte
Gensow, Interview 26.10.2012). Damit besteht die Chance durch Kooperation
und Zusammenarbeit verschiedener Akteure (Netzwerke, Milieus, Interes-
sengruppen, etc.) Schritt für Schritt organisch ein gemeinsames, breit getra-
Proof
92
genes Standortverständnis aus eigener Aktivität heraus Bottom-up dynamisch
auszubilden, zu festigen und als neue gemeinsame Identität „Vierländerre-
gion Bodensee“ abzusichern (Doerte Gensow, Interview 26.10.2012).
„Von der Region zur Marke“ betitelt die BSM im Markenmanual, dem Grund-
satzdokument zu Markeninhalten, Werten und Zielen die umfangreichen
Initiativen zur Entwicklung und Bündelung der Standortaktivitäten im lände-
rübergreifenden Raum (BSM 2012a, S. 2). Die BSM und Ihre Partner verstehen
sich dabei als Motivatoren, Moderatoren und „Kümmerer“ für die Kontinuität
und qualitätsvolle Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit von Institutionen, Personen und Netzwerken in der Vierländerregion
Bodensee und engagieren sich im Sinne einer vitalen internationalen Stand-
ortkooperation unter Verwendung einer Markenführung für eine moderne,
international wettbewerbsfähige Bodenseeregion (Doerte Gensow, Interview
26.10.2012). Bereits wenige Monate nach der Markeneinführung konnten über
150 Lizenzpartner für die Beteiligung und Nutzung der Regionenmarke gewon-
nen und eine hohe Bekanntheit und gute Akzeptanz bei der Bevölkerung für
das Standortmodell, erzielt werden (Doerte Gensow, Interview 26.10.2012).
Der Ansatz des Standortmarketings und Markenpolitik der Vierländerregion
Bodensee ermöglicht und motiviert die Ausbildung einer offenen, sich auf-
grund kooperierender Zielsetzungen, Strukturen, Funktionen und Werte
dynamisch ausbildenden und veränderlichen Standortgemeinschaft. Im Ver-
gleich dazu stellt die von der ARGE Alpen-Adria gewählte gemeinsame Dar-
stellungsform mit Hilfe eines Emblems ein eher territorial bestimmendes und
Grenzen ziehendes Wahr- oder Hoheitszeichen, oder ein auf die Kennzeich-
nung der Organisation abgestelltes Logo, dar.
2.3.3 Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik als Standortfaktor in der Alpen-Adria-Region (Manfred Rader)
Das folgende Kapitel fokussiert nun exemplarisch auf eine der zentralen stand-
ortpolitischen Funktionen und Kooperationsbereiche einer Region: die Ver-
einheitlichung und Mobilisierung zu einem gemeinsamen, länderübergrei-
fenden Arbeitsmarkt. An diesem spezifischen fachpolitischen Bereich einer
umfassenden Standortzusammenarbeit sollen die Bedeutung, Chancen und
der Status quo der Aktivitäten und Bemühungen aufgezeigt und im Blickwin-
kel einer möglichen Zusammenarbeit als Europäische Standortagglomeration
Alpen-Adria-Region 2.0. diskutiert werden.
Proof
93
Bedeutung und Chancen eines gemeinsamen Arbeitsmarktes und einer gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik in der Alpen-Adria-Region
Seit der Abspaltung Sloweniens von Jugoslawien am 25. Juni 1991 und insbe-
sondere später mit dem Beitritt zur EU am 1. Mai 2004 waren Slowenien und
der Kernbereich der Alpen-Adria-Region einem großen Umwandlungsprozess
unterworfen. Kärnten und Oberitalien trugen diese Veränderungen mit. Aus
ehemaligen Grenzbereichen mit peripherer Anbindung wurden verkehrstech-
nisch gut gelegene Gebiete, die ihr Potenzial erkennen und nutzen lernen
mussten und müssen. Mit dem freien Zugang zum Arbeitsmarkt, den Slowe-
nien und auch die anderen neuen EU-Beitrittsländer (außer Bulgarien und
Rumänien) mit 1. Mai 2011 erhielten, ergibt sich nun ein potenziell gemeinsa-
mer Arbeitsmarkt. Gerade letzteres braucht aber noch Zeit, um in den Köpfen
der politischen Entscheidungsträger und der Bevölkerung anzukommen und
vor allem um gelebt zu werden. An dieser Stelle sei nun nochmals die Chance
einer Markenentwicklung im Sinne eines Wir-Gefühles erwähnt.
Betrachten wir die wirtschaftliche Ausgangssituation Sloweniens, so sprechen
wir hier von einer traditionell stark auf einige Großbetriebe konzentrierten Volks-
wirtschaft, die eher geringe Qualifikationen nachfragt, deren Produktivität Auf-
holbedarf aufweist, ein geringes Lohnniveau besitzt und sehr oft einer Außen-
steuerung unterliegt (vgl. Moro 2000, S. 17). Dies gilt vielmehr noch für die Grenz-
regionen der Slowenischen Republik, die auch vom Landesschnitt noch deutlich
abfallen. Das durchschnittliche slowenische Einkommen pro Beschäftigte/n lag
noch vor zehn Jahren an die 10 % höher als beispielsweise in den Grenzbezirken
Kososka, Podravska und Pomurska. Werden die Reallöhne der Staaten Slowenien
und Österreich verglichen, ergibt sich nochmals ein relativ großes Gefälle. Ende
der 1990er-Jahre betrugen diese Unterschiede um die 40 % (vgl. ebenda, S. 76 ff.).
Betrachten wir die wirtschaftlichen Verflechtungen der letzteren Staaten, so lässt
sich nachweisen, dass die Investitionsvolumina Österreichs beträchtlich sind. In
Slowenien nimmt Österreich als Investor mit 27,9 % Anteil an den Gesamtbestän-
den 2007 den ersten Rang ein: „Der Großteil der österreichischen Direktinvestiti-
onen in Ost-Mitteleuropa fließt dabei – wie schon über die gesamten neunziger
Jahre – in den Dienstleistungssektor. Herausragende Internationalisierungs-
branche der österreichischen Wirtschaft ist das Kredit- und Versicherungswesen
[…]“(Huber et al. 2007, S. 113 ff.). Es kann davon ausgegangen werden, dass 70 %
in den neuen EU-Ländern bereits in ausländischer Hand sind (vgl. Breuss et al.
2004, S. 10 ff.). Gerade letzteres hat aber auch in den vergangenen Jahren am Ban-
kensektor in Österreich zu größeren Turbulenzen geführt, so dass einige Institute
vorsichtig ihre Investitionen reduzieren oder sogar aussteigen.
Proof
94
Österreich hat laut einer Publikation des Wirtschaftsforschungsinstituts
(WIFO) 2006 von allen Integrationsschritten wirtschaftlich profitiert. So wird
vorgerechnet, dass seit 1989 das reale BIP um rund 3,5 Prozentpunkte gestei-
gert werden konnte (das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen
zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,5 %). Die Studie spricht von einem
Arbeitsplatzgewinn um 77.000 (vgl. Breuss 2006, S. 9). Knapp vor der Öffnung
des Europäischen Arbeitsmarktes für die Neuen EU-Beitrittsstaaten führte die
Wirtschaftskammer Österreich im Jänner 2011 eine Befragung unter den Mit-
gliedsbetrieben durch, die auf das Problem des Fachkräftemangels in Öster-
reich hinweist. Es „[…] zeigt sich eine leicht steigende Tendenz zur Anstellung
ausländischer Fachkräfte: So planen 21 % der befragten Unternehmen die Ein-
stellung von ausländischen Fachkräften zu forcieren […]“ (Huber & Steigenber-
ger 2011). Dies weist auf jeden Fall auf eine Bewusstseinsänderung der Betriebe
hin, die Arbeitsmärkte größer und globaler zu sehen und dem Gedanken der
Alpen-Adria-Region eine Chance zu geben. Eine Umsetzung auf organisatori-
scher Ebene erfolgte bis dato aber nicht. Das Konstrukt der Alpen-Adria-Region
ist zu groß, mit zu vielen Einzelinteressen durchsetzt und zu träge. Ein echter
Entwicklungsplan, der von allen Mitgliedsverwaltungen getragen wird, konnte
nie beschlossen werden. Der Geist einer zusammenarbeitenden Alpen-Adria-
Region flackerte nur fallweise auf und wird bis heute nicht im Sinne einer
„Marke“ gelebt. Gemeinsame Sportveranstaltungen sind einfach zu wenig.
In den statistischen Recherchen zu den Anrainergebieten hat sich zudem
noch der Unsinn unterschiedlicher statistischer Erfassungsmethoden
gezeigt, die ein gegenseitiges Verständnis umso schwieriger machen. Die
Arbeitslosenstatistik wird in Österreich, Italien, Slowenien auf ganz unter-
schiedliche Weise bearbeitet. Als kleinster gemeinsamer Nenner können die
EUROSTAT-Definitionen dienen. Auch der zwischenstaatliche Austausch von
Arbeitskräften birgt nicht nur sprachliche, sondern auch versicherungstech-
nische Probleme. Die Zusammenarbeit unter den Versicherungsträgern von
Slowenien, Italien und Österreich funktioniert nur schleppend. Eine Mit-
nahme eines Arbeitslosengeldbezuges aus Italien oder Slowenien kann sich
im Einzelfall sehr schwierig gestalten.
Ein weiterer Ansatzpunkt die regionale Markenidentität zu forcieren, ist der ver-
kehrstechnische Ausbau über die Staatsgrenzen hinweg. So titelt die Kronenzei-
tung am 29. September 2011: „Karawankentunnel-Ausbau: Slowenien und Kärn-
ten einig“. Gerhard Dörfler, Landeshauptmann Kärntens, gibt in einer Aussen-
dung der Kärntner Landesregierung im Mai 2012 bekannt: „Ich freue mich sehr
über die heutige Bekanntgabe von Frau Bundesministerin Doris Bures und des
Proof
95
Asfinag-Vorstandes, eine zweite Vollröhre […] zu bauen. Damit hat sich die Achse
Kärnten – Slowenien durchgesetzt und dies ist […] ein Zeichen des neuen guten
Klimas zwischen Kärnten und Slowenien. […] Es rückt aber auch der Alpen-Adria
Raum im Sinne der Idee „Senza Confini“ näher zusammen.“ Das sind erfreuliche
Schritte, die nun aber auch ins Feld gestellt werden müssen. Wir stehen also
am Anfang einer neuen Entwicklung der Zusammenarbeit und eines einander
Näherkommens der Staaten der Alpen-Adria-Region. In welcher Form sich die
Anrainerstaaten organisieren werden, wird die Zukunft noch erweisen.
Diversität als Ansatz in der Arbeitsmarktpolitik der Alpen-Adria-Region
Diversitätsmanagement stellt eine Strategie zur Förderung der Vielfalt (Diver-
sität) in Organisationen und Institutionen dar. „Der Grundgedanke von
Diversity Management ist […], dass Menschen unterschiedlicher sozialer und
kultureller Orientierung konstruktiv miteinander umgehen, wenn sie ihre
Verschiedenheit zur Geltung bringen können“ (Kuhn-Fleuchaus & Bambach
2007, S. 24). Es ist eine Art der Organisationsführung, bei der der Fokus auf
die Heterogenität gelegt wird. Die Unterschiedlichkeit soll nicht trennen, son-
dern im Gegenteil zu Vorteilen führen. Ein solcher Ansatz kann natürlich auch
im Zusammenhang mit Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Standortpolitik zur
Anwendung kommen. Ziel dabei ist die optimale Nutzung und Vernetzung
von Ressourcen und Potenzialen. In einer Publikation der Friedrich Ebert Stif-
tung (Deutschland) artikuliert Gertrude Krell dies folgendermaßen: „Ich […]
sehe aber in dem Diversitätsansatz einen wichtigen Pluspunkt: Er ist geeignet,
all den Politiken und Instrumenten […] einen Rahmen zu geben, er kann also
potentiell alle Anti-Diskriminierungsinstrumente unter einem Dach vereinen.
Ein anderer Vorteil: Diversitätspolitik ist demokratisch legitimiert, da sie dis-
kursiv entsteht. Das bedeutet, jede Organisation hat die Möglichkeit, ihren
eigenen Diskussions- und Definitionsprozess zu führen, in dessen Verlauf der
für die eigenen Bedürfnisse richtige Ansatz und die richtigen Maßnahmen
gewählt werden können“ (Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg 2011, S. 2).
Daraus folgt die Notwendigkeit für eine Bewusstseinsentwicklung bezüglich
der eigenen Werte, der regional-wirtschaftlichen Vorzüge und der eigenen
Möglichkeiten des Beitrages zum gemeinsamen Wirtschaftssystem (Standort-
wirtschaft). Vielfalt und Flexibilität am Arbeitsmarkt helfen Krisen zu meis-
tern, neue Sichtweisen können entstehen und helfen, alternative Lösungsan-
sätze zu entwickeln. In einer Publikation der Wirtschaftskammer Wien wer-
den Vorteile von Diversität für die heimische Wirtschaft aufgezählt:
Proof
96
• höhere Beschäftigung durch den Zugriff auf bislang unentdeckte Talente,
• weiteres Wirtschaftswachstum durch das Ausschöpfen aller zur Verfügung
stehenden Ressourcen,
• mehr Internationalisierung durch erweiterten Handlungsspielraum (z. B. im
Sinne von Mehrsprachigkeit),
• gesteigerte Verteilungsgerechtigkeit durch die Einbeziehung von Personen und
Gruppen, die bislang nicht oder nur eingeschränkt wahrgenommen wurden,
• größerer sozialer Zusammenhalt durch proaktive Begegnungen und Aus-
tausch mit diversifizierten Anspruchsgruppen“ (WKO 2012, S. 3).
Die Umsetzung erfolgt zwar direkt in den Betrieben, es sind aber organisato-
risch-politische Klammern notwendig, die Überzeugung dafür zu entwickeln,
diese im größeren Kontext zu koordinieren. Ausgehend von einer Potentialana-
lyse der Mitgliedsgebiete der Alpen-Adria-Region bis in die einzelnen Unterneh-
men sollte dieser Ansatz als Standortentwicklungsprozess geführt werden und
im Sinne einer gemeinsamen Markenpolitik zu einer bewusst gelebten Marke
„Alpen-Adria-Region“ führen – natürlich nur dann, wenn dies überhaupt von
den Mitgliedern angestrebt wird. Dabei wäre von folgenden Fragen auszugehen:
Welche Diversitäten sind im Alpen-Adria-Region festzumachen, wie können sie
genutzt oder sogar in Wert gesetzt werden?
Im IAW-Forschungsbericht Nr. 67 aus dem Jahre 2007 werden solche Untersu-
chungsmethoden in Bezug auf die Entwicklung von Industriebetrieben aufge-
zeigt. Die Untersuchung geht aber grundsätzlich von vier Bereichen aus:
1 Input-bezogene Standortfaktoren, wie Flächenbedarf, Arbeit, mit Lohnni-
veau, Arbeitslosigkeit, Qualifikationsniveaus, Forschungs- und Entwick-
lungs- sowie Infrastrukturausstattung,
2 Output-bezogene Standortfaktoren, wie absatzmarktbezogene und gewinn-
steuerbezogene Standortfaktoren,
3 Siedlungsstrukturelle Beschäftigungsdeterminanten, wie Urbanisierungs-
effekt und Verdichtungsgrad sowie Nachbarschaftseffekte und schließlich
4 Wirtschaftsstrukturelle Beschäftigungsdeterminanten, die in Lokalisa-
tionseffekten und Branchenkonzentration sowie betriebsstrukturellen
Determinanten festgemacht werden (vgl. Krumm et al. 2007, S. 51 ff.).
Proof
97
Dieser Ansatz mag zugegebenermaßen ein sehr technokratischer sein, stellt
jedoch eine gute Möglichkeit dar, den Status quo nachvollziehbar zu erheben
und eine mögliche Entwicklungslinie zu skizzieren. Ziel ist eine multikultu-
relle Organisation: „[…] mit anderen Worten herrscht in der multikulturellen
Organisation Chancengleichheit und es wird sowohl das Prinzip der anerkann-
ten Gleichwertigkeit als auch das Prinzip der anerkannten Verschiedenartig-
keit berücksichtigt“ (Kaszinski 2000, zitiert nach Sandner 2006, S. 79).
Regionen stehen auch in Arbeitsmarktbelangen in Konkurrenz – Konsequenzen für die Alpen-Adria-Region
Die bereits erwähnte Konkurrenzsituation von Kommunen und Regionen
betrifft auch den Arbeitsmarkt: „Der Standortwettbewerb von Nationen und
Regionen ist schärfer geworden. […] in der wirtschaftlichen Einflussnahme auf
die Standortqualität wird ein essentielles wirtschaftspolitisches Handlungs-
feld gesehen. Dies geschieht zum einen durch die Schaffung investitions-
freundlicher gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen […] zum anderen
spielen auch staatliche Fördermaßnahmen eine große Rolle […]“ (Dietrich et
al. 1998, S. 11). Betrachten wir die Förderpraxis der EU im Bereich des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF), Mittel also, die in erster Linie zur Arbeitsmarktförde-
rung verwendet werden, so fällt auf, dass zwei Ziele klar definiert sind: (1) Es
sollen durch die ESF-Mittel die regionale Wettbewerbsfähigkeit und die Siche-
rung der Beschäftigung sowie der Standorte erreicht werden. (2) Außerdem
wird das Ziel der Konvergenz verfolgt, was zur Stärkung weniger entwickelten
Regionen führen soll. Dafür werden auf jeden Fall mehr als 80 % der ESF-Mittel
aufgewendet. Im Zusammenhang mit der Alpen-Adria-Region kann gemut-
maßt werden, dass die Konkurrenzsituation selbst zum regionalen Zusam-
menschluss beigetragen hat. Für Kärnten spricht der Geograph Martin Seger
(2007, S. 97 f.) davon, dass die organisatorische Klammer, ARGE Alpen-Adria,
vor allem deshalb beibehalten werde, weil Kärnten als treibende Kraft sich im
Kontext der Mitgliedsregionen zentral in verkehrtechnischer und kulturmitt-
lerischer Hinsicht erlebt und so selbstbewusst agieren kann. Und weiter stellt
er fest, dass viele Regionen sich nur deshalb konstituieren, um finanzielle Mit-
tel aus Brüssel zu erhalten – dies treffe auch für die Alpen-Adria-Region zu.
Aus diesen allgemeinen und individuellen Zielsetzungen ist ein Bekenntnis
zur Region und erst in zweiter Linie zu staatlicher Abgrenzung abzulesen.
Im Projekthandbuch für Nordwesteuropa-Projekte (Interreg) kommt dies
noch klarer zum Ausdruck: „Bei der transnationalen Zusammenarbeit geht es
darum, sich von lokalen Themen und nationalen oder regionalen Grenzen zu
Proof
98
lösen, Menschen kennenzulernen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen,
eine neue Kultur zu entwickeln und gemeinsam bessere Lösungen zu entwi-
ckeln, als es allein möglich gewesen wäre“ (INTERREG IVB North-West Europe
2011, S. 3). Die Verwaltungseinheiten werden also aufgebrochen und neue
„Regionen / Standortkooperationen“ geschaffen, die gefördert werden sollen.
Der monetäre Druck kreiert neue Strukturen.
Regionen haben es aber in der Realität schwer, neue Investitionen und
Wachstumszentren anzuziehen. „Die Wirtschaftsförderung kann höchs-
tens dazu beitragen, durch Informations- und Imagekampagnen die Vorteile
eines neu entstehenden Wachstumszentrums herauszustellen“ (Dietrich
et al. 1998, S. 12). Außerdem veränderten sich die industriellen Organisati-
onsformen in räumlicher und hierarchischer Hinsicht. Das bedeutet, dass
Unternehmen durch die Entwicklung neuer und flexibler Produktionstech-
nologien sowie durch neue Formen der inner- und zwischenbetrieblichen
Organisation neue Handlungsdispositionen hinsichtlich Entscheidungen
über Investitionen und Umstrukturierungen entwickeln konnten. Für die
Praxis der Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung ergibt sich aus
diesem Zusammenhang der Bedarf, Standortpflege zu betreiben und weniger
die Akquisition neuer Unternehmen zu forcieren. Allerdings gilt, dass „viele
Rahmenbedingungen, die ein Land als Standort für Industrieunternehmen
[oder Unternehmen allgemein (eigene Ergänzung)] attraktiv machen [...] nur
auf der nationalen Ebene verändert und gestaltet werden […]“ kann. Dies liegt
an der kameralistischen Organisation von Fördervergaben. Der Einfluss der
Wirtschaftsförderung auf regionaler und kommunaler Ebene ist erfahrungs-
gemäß eher untergeordnet“ (Dietrich et al. 1998, S. 12 ff.). Dazu kommt, dass
Entscheidungen der Marktteilnehmenden letztlich nur zu einem geringeren
Teil auf „harten Standortfaktoren“ basieren, auch wenn zur Rechtfertigung
der getroffenen Entscheidungen oft herangezogen werden. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass besonders weiche Standortfaktoren von immer größerer
Bedeutung sind. Entwicklungsstrategien werden vorweg aus individuel-
len Vorstellungswelten heraus entwickelt. Untersuchungen von Städten in
Europa haben gezeigt, dass jede Stadt aus Marketinggründen ihre eigenen
Bilder (Images) von sich entwirft. Wien beispielsweise ist in den Köpfen der
Menschen (und damit auch Entscheidungsträgern) als Kulturstadt bekannt.
Als Finanzplatz, Forschungs- und Entwicklungsstandort besitzt Wien jedoch
kaum ein entsprechendes Image (vgl. Grabow et al. 1995, S. 362 ff.).
Proof
99
Für die Entwicklung einer Region, eines Standortes als Marke bedeutet dies
die Notwendigkeit nationale Individualität für einen neuen wirtschaftli-
chen (regionalen) Zusammenhang aufzugeben. Eine Untersuchung der IAB
in Deutschland kommt zum Schluss, dass funktionierende regionale Arbeits-
marktpolitik nur dann zu bewerkstelligen ist, wenn die Arbeitsmarktverwal-
tung im gesamten Bereich leistungsfähig agiert. Dazu sind gemeinsame Qua-
litätsnormen, gemeinsame Zielgrößen, einheitliche Messinstrumentarien und
Definitionen sowie eine ‚Kundenorientierung’ anzustreben. Effektivitätsnor-
men und barrierefreier Austausch von Informationen und Arbeitskräften sind
Grundvoraussetzungen (vgl. Vollkommer 2004, S. 171 ff.). Grundlegend kann
festgestellt werden:
„Durch die zunehmende Dezentralisierung in der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik werden den lokalen Akteuren mehr Entscheidungsspielräume
übertragen. […] Die Entwicklung einer Region hängt von zahlreichen regiona-
len, nationalen als auch internationalen Faktoren ab. Somit ist für die Entwick-
lung regionaler Ökonomie nicht nur die Lage der nationalen Volkswirtschaft
und der Weltwirtschaft ausschlaggebend; vielmehr wird deren wirtschaftliche
Dynamik auch von regionsspezifischen Besonderheiten […] bestimmt“ (Möller
& Walwei 2009, S. 64).
Für die regionalpolitische Praxis ist es daher von vornherein notwendig, klare
und konkrete Ziele und Teilziele zu definieren. Der Erfolg jeder regionalpoliti-
schen Maßnahme wird es sein, die Steigerung von Einkommen und Beschäf-
tigung zu erreichen. Und in diesem Streben stehen alle Regionen in Konkur-
renz zueinander (vgl. Dietrich et al. 1998, S. 15 ff.). Für eine gemeinsam gelebte
Standortkooperation einer Marke Alpen-Adria-Region bedeutet das:
1 sich als Interessensgemeinschaft und Gruppe zu verstehen und die Einzel-
maßnahmen miteinander zu koordinieren,
2 notwendige Schritte und Ziele gemeinsam festzulegen und die Überprü-
fung des Erfolges gemeinsam vorzunehmen,
3 Austausch von Innovationen, Kultur, Weiterentwicklungen zu pflegen und,
was mir am wichtigsten erscheint und
4 ständig Kommunikation sowohl zwischen den Entscheidungsträgern als
auch der Bevölkerung zu begünstigen.
Proof
100
Zusammenwachsen der Arbeitsmärkte in der Alpen-Adria-Region am Beispiel Österreichs nach der Öffnung am 1. Mai 2011
Das zuständige Bundesministerium stellte ein Jahr nach der Öffnung des
Arbeitsmarktes stolz in einer Pressekonferenz fest, dass die Prognosen, die
vor der Liberalisierung erstellt wurden, sich im Wesentlichen bestätigten. Die
Verdrängungsprozesse, vor denen einige gewarnt hatten, waren in diesem
Jahr nur marginal. So wurde von Huber & Böhs (2012a, S. 21) eine Steigerung
der Arbeitslosenquote von 0,08 % errechnet. Die Öffnung des Arbeitsmarktes
ist jedoch nur ein vorläufiger Endpunkt der Entwicklung in Österreich: „Der
Großteil der Zuwanderung [eigene Ergänzung: bereits vor dem 1.5.2011] nach
Österreich resultiert aus der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit innerhalb der
EU sowie aus der Familienzusammenführung. Nur ein geringer Anteil der
ZuwandererInnen aus Drittstaaten reist auf Basis von Schlüsselqualifikationen
[…]“ ein (Biffl 2011, S. 62). In der WIFO-Konjunkturprognose 2011 wurde zwar
eingeräumt, dass eine leichte Steigerung der Arbeitslosigkeit 2013 durch die
„Ostöffnung“ auf 7,3 % (nationale Berechnung) erfolgen werde, die Erholung
soll aber die Jahre danach rasch geschehen. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte
auch die Österreichische Nationalbank im Juni 2012. (Tab. 2.1)
2011 2012 2013 2014
ArbeitnehmerInnenentgelt/AN -0,4 -0,1 +0,5 +1,0
Unselbständig Beschäftigte 1,7 1,6 1 1,3
Arbeitlosenquote (EUROSTAT) 4,2 4,3 4,3 4,2
Tab. 2.1 Auswirkungen der Öffnung des Arbeitsmarktes mit dem 01.05.2011 (Quelle: Österreichische Nationalbank, Prognose Juni 2012).
Die Östereichischen Nationalbank geht davon aus, dass der Einfluss der Freizü-
gigkeit der neuen europäischen Oststaaten gering bleibt. Änderungen ergeben
sich eventuell bei der Anzahl der Beschäftigten. Eine Sockelarbeitslosigkeit
wird sich laut Prognose um 4,2 % einpendeln. Auch der Inflationsdruck wurde
in den Prognosen für 2012 bis 2016 als gering eingeschätzt. IHS-Berechnungen
sprechen von ungefähr 1,9 %. Ähnliche Werte werden für Österreich durch die
Europäische Kommission und die OECD prognostiziert (vgl. Österreichische
Nationalbank 2012, S. 12 ff.).
Betrachten wir nun die realen Zahlen(vgl. BMASK 2012, S. 3 ff). Das Ministe-
rium veröffentlichte für die Zeit von 1. Mai bis 31. Dezember 2011 ein Beschäf-
tigungsplus von 21.736 Personen – bis Mai 2012 berechnete das AMS Österreich
Proof
101
insgesamt den Liberalisierungseffekt mit 26.806 Personen. Davon verlagerten
39 % ihren Wohnort nicht nach Österreich, sondern gelten als Grenzpendler.
Diese sind vor allem in den Bereichen Burgenland und Südkärnten anzutref-
fen. Die betroffenen Branchen sind besonders im Tourismus, in der Landwirt-
schaft und nur zu geringerem Teil in Produktion zu finden. Der Gastgewerbe-
bereich konnte regional Steigerungsraten von 6 % (Tirol und Salzburg) bis 8 %
(Burgenland) verzeichnen. Der Land- und Forstwirtschaftliche Sektor wurde
zum großen Teil durch Ungarn (im Burgenland +5,2 % Liberalisierungseffekt),
nämlich zu 43 %, abgedeckt. Für Kärnten ergab sich im Detail ein ähnliches
Bild. Auch die Flexibilisierung in Form der Leiharbeit wird mit 34 % bestätigt.
Werden noch die Beschäftigungen im Tourismus, Bau, Land- und Forstwirt-
schaft sowie Gebäudebetreuung, die ebenfalls als saisonal befristet gelten
können, addiert, so ergibt sich ein fast 80 %-Anteil an befristeten Arbeitsstel-
len. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wird außerdem durch Analysen
des AMS Österreich bestätigt, die ergaben, dass nur mehr 2 von 5 Personen aus
den neuen EU-Staaten, die die Arbeit aufgenommen haben, noch im gleichen
Dienstverhältnis sich befinden (vgl. Huber & Böhs 2012b, S. 91 ff.).
Branche Liberalisierungseffekt
Bau 35
Tourismus 322
Leasing 318
Handel 66
Gebäudebetreuung, Garten 62
Herstellung von Waren 121
Land- und Forst 5
gesamt 929
Tab. 2.2 Beschäftigte aus Liberalisierungseffekt (01.05.12) nach Branchen in Kärnten; absolute Zahlen (Quelle: WIFO 2012).
Tabelle 2.2 zeigt in diesem Zusammenhang, dass der Liberalisierungseffekt
sich besonders in den äußerst flexiblen Branchen Tourismus und Leasing in
Kärnten durchschlug. Andere Bereiche blieben eher unberührt von der Ent-
wicklung. Für den Bereich Slowenien existieren keine aussagekräftigen Unter-
suchungen. Die Arbeitspendler aus Österreich nach Slowenien spielen dabei
eine eher untergeordnete Rolle.
Proof
102
Als wirtschaftlicher Effekt der Liberalisierung ist ein konjunkturstützender
Einfluss festzustellen. Die Kaufkraft wurde erhöht und allein durch die zusätz-
lichen Arbeitskräfte wurden ungefähr 340 Mio. € an zusätzlichen Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen vom Österreichischen Staat eingehoben, rechnet
das zuständige Bundesministerium vor. Hinzu kommt der Umstand der anstei-
genden Entsendemeldungen um 20 % im Jahr 2011. Sowohl auf Betriebsebene
als auch bezogen auf die Anzahl der Personen (die Zahl wurde sogar verdoppelt)
waren diese wirtschaftlichen Sogwirkungen zu erkennen. Besonders Betriebe
im Grenzbereich zu Österreich profitierten von dem Liberalisierungseffekt und
konnten ihre Dienstleistungen jenseits der Grenze verkaufen. Ein Sozialdum-
ping ist aus diesem Umstand aber nicht abzulesen, da die gesetzlichen Bestim-
mungen bei Entsendungen den regionalen Kollektivlohn garantieren sollten.
Die Bundesregierung hat vorsorglich gesetzliche Vorkehrungen getroffen, die
durch vermehrte Kontrollen der Finanzbehörden und durch kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden (vgl. Huber & Böhs 2012b, S. 41 ff.).
Die Qualifikationen der freizügigkeitsberechtigten Personen sind laut Anga-
ben der Versicherungsanstalten im unteren bis mittleren Bereich anzusiedeln.
Der Ruf der Unternehmen in Österreich nach Fachkräften findet kaum Ent-
sprechung in der Aufnahmepolitik seit Mai 2011. Es herrschen Anstellungen
im Saisongeschäft und im Hilfsbereich vor. Über die Nachhaltigkeit der Mig-
rationsbewegungen kann vorerst noch keine schlüssige Aussage getätigt wer-
den, dazu ist noch zu wenig Zeit vergangen. Das mag mit den aus Studien zur
Migration bekannten Phasen der Migration zusammenhängen. Die Modelle
gehen aber von einem mehr oder minder konfliktgeladen Prozess aus, der
Zeit benötigt. Sowohl soziale Komponenten als auch wirtschaftliche spielen
dabei eine große Rolle (vgl. Bade 2000, S. 85 ff.). Wie die Arbeitslosenstatistik
in Österreich zeigt, sind Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund von Vornhe-
rein unverhältnismäßig mehr gefährdet, arbeitslos zu werden als inländische
ArbeitnehmerInnen (vgl. Statistik Austria 2012). Zusätzlich ist es in bestimm-
ten Branchen oft schwierig aus befristeten Dienstverhältnissen auszusteigen
(Saisonbeschäftigung). Dazu tragen auch die mangelhaften Qualifikations-
strukturen der ArbeitsmigrantInnen bei. Seitens der Entscheidungsträger
muss aber daraus die Gefahr einer sozialen Schieflage gesehen werden, die
langfristig den sozialen Frieden stören könnte (vgl. Giesecke 2006, S. 256 ff.).
Um Arbeitsmärkte im grenzübergreifenden Raum im Sinne einer vitalen Stand-
ortkooperation zusammenwachsen zu lassen benötigt es in erster Linie Zeit.
Veränderungsprozesse werden durch Zugangserleichterungen (Freizügigkeit)
angestoßen, müssen aber, sofern ein Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen gege-
Proof
103
ben ist, sowohl im Hinblick auf eine breit in der Bevölkerung gestreute Infor-
mation als auch im gemeinsamen Tun ihre Entsprechung finden. Dabei darf es
keine Gewinner oder Verlierer geben, sondern als Ziel sollte die gewinnbrin-
gende Nutzung der Ressourcen für alle stehen. Die Systeme sind jedoch komplex
und manchmal unübersichtlich, subjektiv oder sogar irrational: „Folglich ist das
empirisch zu beobachtende Arbeitsmarkgeschehen Ergebnis der Handlungen
von in Rahmenbedingungen eingebetteten Akteuren, die gleichzeitig mit dem
Handeln anderer Akteure verbunden sind“ (Erlinghagen 2004, S. 44).
Initiativen zur Koordination arbeitsmarktpolitischer Bemühungen sind gefragt
Die Kooperationen zwischen Arbeitsmarktverwaltungen und Unternehmen
sollen intensiviert werden. So wurden kürzlich in einer Konferenz der Österrei-
chisch-Slowenischen (EXP:AK AT.SI) ExpertInnenakademie am 20. September
2012 in Klagenfurt MitarbeiterInnen des AMS und ZRSZ ein Einblick in europä-
ische Projekte ermöglicht. Good practice-Projekte wurden präsentiert, um neue
Ideen zu initiieren. TeilnehmerInnen der Konferenz waren VertreterInnen aus
den zuständigen Ministerien in Slowenien und Österreich und leitende Ver-
treterInnen der Arbeitsmarktverwaltungen. Referenten kamen aus Norwegen,
Schweden und Irland, die Projekte aus ihren Ländern präsentierten. Durch sol-
che Konferenzen soll im Rahmen der EXP:AK Technologietransfer erfolgen und
ein Bewusstsein für die Europäische Dimension von Regionalprojekten entwi-
ckelt werden. Bei der Konferenz wurden Managementtools, Jugendprojekte bis
hin zum Internetportal der dänischen Arbeitsmarktverwaltung diskutiert.
Zurzeit arbeiten vier ExpertInnenakademien (EXPAK AT.HU, EXPAK AT.SI,
EXPAK AT.SK, EXPAK AT.CZ) an Themen des Arbeitsmarktes in Informations-
seminaren, Kooperationsmeetings, Arbeitsmarktkonferenzen, in Pilotprojek-
ten, Entwicklungsworkshops, im Rahmen von Studien und anlassbezogenen
Hilfestellungen sowie Webauftritten. Zielsetzungen der Kooperationen zwi-
schen den Arbeitsmarktverwaltungen sind die Schaffung einer gemeinsamen
Wissensbasis über neue Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten in den Grenz-
regionen, die Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses, Konzeption,
Diskussion und Umsetzung neuer Programme und Maßnahmen, Verbesse-
rung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den administrati-
ven, wirtschaftlichen, sozialpartnerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen
AkteurInnen sowie der Aufbau einer gleichberechtigten Kooperationsbasis.
Ähnliche Ziele werden auch vom Alpe-Adria Zentrum für grenzüberschrei-
tende Kooperation (AACC) verfolgt. Im Mittelpunkt stehen die Intensivierung
Proof
104
der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit, die wirtschaftliche Kooperation
innerhalb der EU, vertrauensbildende Maßnahmen und Sicherung des sozi-
alen Friedens. Methoden hierfür sind meist ähnliche wie bei EXP:AK, näm-
lich Kooperationsplattformen, Unterstützung von Kommunikationsforen und
Know-how-Transfer-Möglichkeiten sowie gemeinsame Projekte. Das AACC
versucht laut eigenen Angaben einen Beitrag zur Überwindung bestehender
geistiger und materieller Barrieren gegen eine Zusammenarbeit in Mittel- und
Südosteuropa zu leisten (AACC o. J.: § 2 und § 3/1–4). Eine Bündelung der Kräfte
über Parteigrenzen hinweg scheint hier angeraten, um den Bestrebungen mehr
Nachdruck zu verleihen und Doppelgleisigkeiten zu verhindern und auch eine
wirkliche Marke (mit Inhalt und Qualitätsanspruch) entstehen zu lassen.
Der Slowenische Minister für Europafragen, Milan Cvikl, referierte bereits
2004 auf Einladung der AACC vor Kärntner Wirtschaftstreibenden und betonte
dabei: „Europa wird als die konkurrenzvollste und dynamischste Wirtschaft
der Welt einen wirksameren und flexibleren Arbeitsmarkt benötigen, mit viel
mehr Mobilität. […] Die europäischen Arbeitsmärkte sind wegen der kulturel-
len, sozialen und sprachlichen Hindernisse an sich schon relativ uneffizient.
Deshalb sollten wir uns bemühen, wenigstens die administrativen Hinder-
nisse für einen freien Austausch der Arbeitskräfte zu beseitigen und die Staats-
bürger zu einer größeren Mobilität zu bewegen“ (Cvikl 2004). Und gerade das
scheint der Knackpunkt zu sein, das Regionsverständnis in Form eines WIR-
Verständnisses nachhaltig entstehen zu lassen. Auch Klaus F. Zimmermann,
der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, betont: „Nicht
mehr die Knappheit an Kapital, sondern an personellen Ressourcen bestimmt
mehr und mehr die Wachstumsperspektiven der Unternehmen“ (Verhounig
2012, S. 5). Daraus folgt die Notwendigkeit einer überregionalen Sichtweise mit
einem hohen Maß an regionaler Flexibilität der Arbeitskräfte. Die Potenziale
müssen daher gemeinsam nach den jeweiligen Bedürfnissen genutzt werden.
Ebenfalls im Jahre 2004 wurde im Rahmen der Präsentation von Workshop
Ergebnissen „Alte Nachbarn – Neue Partner“. Neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit in der EU-Zukunftsregion im Lichte der erweiterten EU am 25. Juni
in Graz festgestellt: „Die zunehmende Technologie- und Innovationsorientie-
rung und die Intensivierung der Forschungsaktivitäten rücken den „Faktor
Mensch“ in den Mittelpunkt. Neben der generellen Sicherung der Verfügbarkeit
hoch qualifizierter Wissenschafter und exzellent ausgebildeter Hochschulab-
solventen innerhalb EU-Zukunftsregion gilt es, deren Austausch in der Region
weiter zu forcieren: […] dem Thema „Infrastruktur“ in Zusammenhang mit der
Etablierung der EU-Zukunftsregion […]“ (Land Steiermark 2004, S. 8) komme
Proof
105
eine entscheidende Rolle zu: „Eine funktionierende Infrastruktur ist eine der
wesentlichen Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum und die Wettbe-
werbsfähigkeit einer Region und ist dementsprechend entscheidend für den
Wohlstand der Menschen, die in dieser Region leben. Internationale Verkehrs-
verbindungen sind jedoch nicht nur für die Region an sich, sondern für die
gesamte Europäische Union von Bedeutung. Durch die EU-Osterweiterung
hat sich eine neue Situation ergeben, so dass es unerlässlich ist, sich weitere
Gedanken über das europäische Infrastrukturnetz zu machen und insbeson-
dere eine neue, den zukünftigen Anforderungen entsprechende Priorisierung
der Hauptverkehrsrouten vorzunehmen“ (Land Steiermark 2004, S. 9).
Damit ist wie erwähnt nicht nur der Verkehr gemeint. Eine Neuorientierung
muss bei allen Standortfaktoren und speziell am Arbeitsmarktsektor erfolgen.
2.3.4 Die Alpen-Adria-Region 2.0. Europäische Standortagglomeration & Marke – Vision oder Wirklichkeit
Länderübergreifender europäischer Standort und Marke sein zu wollen und
damit Impulse für die Zusammenarbeit zu einer wettbewerbsfähigen europäi-
schen Region „Alpen-Adria-Region 2.0.“ generieren zu können, ist eine komplexe
und ehrgeizige Zielsetzung. Der isolierte Wunsch „Marke sein zu wollen“ ließe
sich möglicherweise rasch durch die „Bestellung und Beauftragung“ eines Mar-
kenbildes erzielen. Sollte die Entwicklung jedoch zu einer breit getragenen und
auf Langfristigkeit angesetzten Zusammenarbeit in Form einer europäischen
Standortagglomeration für eine „Alpen-Adria Region 2.0“. führen, muss die
internationale Kooperation durch deutlich mehr als die Sehnsucht nach einem
gemeinsamen Markenbild getrieben sein. Um kraftvoll neuen Kurs aufnehmen
und straff die Segel im Wettbewerb der Regionen und Agglomerationsräume
setzen zu können, bedarf es einer gemeinsamen Standortpolitik und eines von
breiten Kreisen der Bevölkerung getragenen Standortentwicklungsprozesses.
Dieser Prozess muss auf einer grundlegenden Willensbildung der Parlamente
und Verwaltungen der teilnehmenden Regionen zur Zusammenarbeit als Stand-
ortgemeinschaft aufbauen, die BürgerInnen in den Mittelpunkt der Gestaltungs-
und Entwicklungszusammenarbeit stellen und Ihnen durch die Förderung viel-
fältiger Netzwerke und Initiativen eine zentrale Gestalterrolle einräumen.
Auf der Suche nach zukunftsträchtigen Entwicklungspfaden für die in die
Jahre gekommene Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria bietet sich die beson-
dere Chance aus aufbauend auf bestehende Netzwerke, Erfahrungen und
Ressourcen der Organisation in einem partizipativen Standortentwicklungs-
Proof
106
prozess die Funktion eines „Impresarios“ oder „Kümmerers“, eines Prozess-
begleiters und Moderators zu übernehmen, der sensibel aber kurssicher
zwischen Gemeinsamkeit und Autonomie der internationalen Kooperati-
onsteilnehmer vermittelt. Ein solcherart begleiteter Entwicklungsprozess
motiviert vielfältige Initiativen, er „erordnet keinen Wandel von Regionen
zu einem Standort durch die politisch/administrativen Eliten, sondern steht
für ein Verständnis, relationale, von bestehenden Verwaltungs- und Steue-
rungsebenen unabhängige Initiativen zu fördern. Geduld, Mut und ein neues
Politikverständnis sind gefragt, um eine Alpen-Adria-Region 2.0. entstehen
zu lassen, die dynamisch von innen heraus wachsen darf und sich Schritt
für Schritt organisch zu einer attraktiven, lebens- und wettbewerbsfähigen
Europäischen Standortkooperation (Agglomeration) koordiniert. In einem
weiteren Schritt können dann die Programme und Maßnahmen durch eine
gemeinsame Markenführung, eine länderübergreifende Dachmarkenpolitik
nach außen kommuniziert und im Innenverhältnis gravitativ, standortkon-
stituierend und identitätsbildend wirken. Anhand der Ausführungen betref-
fend den Entwicklungsstand des länderübergreifenden Arbeitsmarktes als
eines der bedeutungsvollsten und zugleich komplexesten Politikfelder einer
abgestimmten Standortpolitik wurde schlüssig aufgezeigt, dass die Bildung
und Mobilisierung zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt im grenzübergrei-
fenden Raum einen offenen Umgang mit Informationen, Freude zur grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit der Behörden und Akteure, Mehrspra-
chigkeit aber in erster Linie Zeit und Vertrauen sowie eine konsequente,
Koordination und Steuerung benötigt um nicht im Konjunktiv zu verbleiben.
Um aus der aufgezeigten Vision auch zur Umsetzung zu finden, wird folgen-
der, stark fokussierter Ausblick formuliert: Mit einem ambitioniert gesetzten
Relaunch könnte von der bisherigen Leitzielsetzung gut nachbarschaftlicher
Beziehungen ausgehend gemeinsam mit den BürgerInnen der Teilregionen
im Alpen-Adria-Raum Bottom up ein konsequenter Entwicklungsschritt zu
einem kontinuierlichen Gestaltungsprozess für eine zukunfts- und wettbe-
werbsfähige Europäische Standortgemeinschaft „Alpen-Adria-Region 2.0.“
gesetzt werden. Der Zeitpunkt dafür scheint in Beobachtung der Ausbil-
dung mehrerer attraktiver Standortverbünde im räumlichen Umfeld als gut
geeignet. Hingegen sind die Vorzeichen für eine einfache Fortführung der
bestehenden auf Konsultation der politisch/administrativen Eliten konzen-
trierten Zusammenarbeit der Gemeinschaft der Alpen-Adria Mitgliedsregio-
nen aufgezeigt und ermutigen erst Recht zu einer Neuausrichtung im Modus
eines partizipativen Standortentwicklungsprozesses.
Proof
107
Literatur
Alpe-Adria Zentrum für grenzüberschreitende Kooperation (AACC, o. J.): Vereinsstatuten (online unter: www.aacc.or.at/deu/deu_pra.htm, zuletzt besucht am 25.10.12).
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (2000): Leitbild der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, im Europa des drit-ten Jahrtausends, Sárvár, Ungarn, 24. November 2000. Klagenfurt.
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (2006): Organisations- und Verfahrensregeln der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, 23. November 2006. Klagenfurt.
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria (2011): All together. Klagenfurt.Bade, Klaus J. (2000): Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
München.Balderjahn, Ingo (2000): Standortmarketing. Stuttgart.Biffl, Gudrun (2011): Deckung des Arbeitskräftebedarfs durch Migration in Österreich. Studie des Nationalen
Kontaktpunkts Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk. Wien.Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK, 2012): Arbeitsmarkt im Jahr 2011.
Wien.Bodensee Standort Marketing GmbH (2012a): Infosheet Regionenmarke Vierländerregion Bodensee (Infor-
mationsfolder). Konstanz. Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM, 2012b): Regionenmarke Vierländerregion Bodensee (online
unter www.vierlaenderregion.com/, zuletzt besucht am 23.10.2012).Breuss, Fritz, Gerhard Fink & Peter Haiss (2004): How Well Prepared Are the New Member States for the
European Monetary Union? In: Journal of Policy Modeling 26(7), S. 769–791.Breuss, Fritz (2006): Ostöffnung, EU-Mitgliedschaft. Euro-Teilnahme und EU-Erweiterung. Wirtschaftliche
Auswirkungen auf Österreich. In: WIFO Working Papers, Nr. 270. Wien.Cvikl, Milan M. (2004): Rede am Mittwoch, dem 7. Juli 2004. Das Hauptthema: Slowenien – Ein neues EU-
Mitglied. Prioritäten des Jahres 2004 (online unter www.aacc.or.at/deu/rede_cvikl.htm, zuletzt besucht am 27.02.2013).
Dietrich, Vera, Peter Franz, Ingrid Haschke & Gerhard Heimpold (1998): Ansiedlungsförderung als Stra-tegie der Regionalpolitik. Theoretische Grundlagen, instrumentelle Möglichkeiten und Grenzen. Baden-Baden.
Erlinghagen, Marcel (2004): Die Restrukturierung des Arbeitsmarktes. Arbeitsmarktmobilität und Beschäfti-gungsstabilität im Zeitverlauf. Wiesbaden.
Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg, Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg., 2011): Diversitätsma-nagement – Ein Konzept auch für die Kommune?! Stuttgart.
Giesecke, Johannes (2006): Arbeitsmarktflexibilisierung und Soziale Ungleichheit. Wiesbaden.Gönner, Ivo (2011): EU-Strategie für den Donauraum. In: Europa Kommunal. Europäische Zeitschrift für Rat,
Verwaltung und Wirtschaft, Heft 2, S. 6–8. Grabow, Busso, Dietrich Henkel & Beate Hollbach-Grömig (1995): Weiche Standortfaktoren. Köln.Gubler, Robert E. & Christian Möller (2006): Standortmarketing, Konzeption, Organisation und Umsetzung.
Bern, Stuttgart, Wien. Hohn, Stefanie (20082): Public Marketing. Marketing-Management für den öffentlichen Sektor. Wiesbaden.Huber, Claudia & Karin Steigenberger (2011): Wirtschaftsbarometer Austria (WBA 2011/I). Fokus: Fachkräfte,
Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Wirtschaftspolitik, Wien.Huber, Peter, Peter Mayerhofer, Klaus Nowotny & Gerhard Palme (2007): Labour Market Monitoring II – Ver-
änderungen, auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung. Handlungsorientierter Bericht. Wien. Huber, Peter & Georg Böhs (2012a): Auswirkungen der Liberalisierung des österreichischen Arbeitsmarktes
für die StaatsbürgerInnen der EU 8 auf die Regionen Österreichs. Endbericht. Wien.Huber, Peter & Georg Böhs (2012b): Monitoring der Arbeitsmarktauswirkungen der Zuwanderung aus
den neuen Mitgliedstaaten im Regime der Freizügigkeit – Begleitende Beratung und Analyse Arbeitsmarktöffnung – Ein Jahr danach. WIFO (online unter www.arbeitsmarktoeffnung.at/servlet/ContentServer?pagename=S04/Page/Index&n=S04_80.3.d, zuletzt besucht am 14.10.2012).
Huber, Wolf (2011): Politik und Raum in Theorie und Praxis, Systemisches Verständnis von staatlichem Han-deln, Möglichkeiten der Politikkoordination und Grenzen der politischen Steuerungskapazität (Österrei-chische Raumordnungskonferenz 3). Wien.
INTERREG IVB North-West Europe (2009) : Projekthandbuch, Leitfäden (online unter www.nweurope.eu/nwefiles/file/DE_GN_Call_10bis. pdf, zuletzt besucht am 27.02.2013).
Kärntner Landesregierung, Landespressedienst (2012): Euregio „Senza Confini“. Gemeinsam die Zukunft gestalten, Aussendung vom 16. März 2012.
Proof
108
Kaszinski, Susanne & Regine Steinhauer (2000): Managing Diversity. Ansätze zur Schaffung transkultureller Organisationen, Berlin.
Krumm, Raimund, Martin Rosemann & Harald Strotmann (2007): Regionale Standortfaktoren und ihr Bedeu-tung für die Arbeitsplatzdynamik und die Entwicklung von Industriebetrieben in Baden-Württemberg.In: IAW Forschungsberichte Nr. 67.
Kuhn-Fleuchaus, Christine & Marco Bambach (2007): Diversity Management – Unsichtbare Potenziale för-dern. Stuttgart, Berlin.
Kühne, Martina (2008): Die Stadt als Marke, Eine qualitativ-empirische Untersuchung zur identitätsorientier-ten Markenpolitik von Städten, Aachen.
Land Steiermark, Fachabteilung „Europa und Außenbeziehungen“ (2004): Alte Nachbarn – Neue Partner. Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der EU-Zukunftsregion im Lichte der erweiterten EU (online unter www.europa.steiermark.at/cms/dokumente/10257079_2951057/34aabae0/EU-Zukunftsregion_Workshopergebnisse_DE.pdf, zuletzt besucht am 24.01.2013.
Leitermann, Walter (2011): Makroregionen in der EU. Neues Modell für die regionale Zusammenarbeit. In: Europa Kommunal. Europäische Zeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft, Heft 2: S. 3.
Leser, Hartmut (Hrsg., 201014): Diercke Wörterbuch Allgemeine Geographie. München. Mathis, Gerald (2007): Nachhaltige Standort- und Wirtschaftsentwicklung. In: Dietmar Brodel & Fran-
ziska Cecon (Hrsg.): European perspectives for public management (PuMa-Schriftenreihe 2). Villach, S. 269–299.
Mathis, Gerald (2005): Standortsoziologie. Der Einfluss von individuellen und kollektiven Werte- und Denk-haltungen auf die Wirtschaftskraft und die Innovationsfähigkeit von Standorten. Dornbirn.
Kirchgeorg, Manfred (20052): Identitätsorientierter Aufbau und Gestaltung von Regionenmarken. In: Heri-bert Meffert, Christoph Burmann & Martin Koers (Hrsg.): Markenmanagement. Identitätsorientierte Markenführung und praktische Anwendungen. Wiesbaden, S. 590–617.
Möller, Joachim & Ulrich Walwei (Hrsg., 2009): Handbuch Arbeitsmarkt 2009. Nürnberg.Moro, Karin (2000): Der Arbeitsmarkt im steirisch-slowenischen Grenzraum. Eine kommentierte Daten-
sammlung. Graz.Naschberger, Daniel (2012): Kooperation in den Bergen. In: Saison. Tourismusmagazin, Heft 4, S. 14–15.Österreichische Nationalbank (OeNB, 2012): Gesamtwirtschaftliche Prognose der OeNB für Österreich 2012
bis 2014GESAMTWIRTSCHAFTLICHE PROGNOSE der OeNB für Österreich 2012 bis 2014: Österreichs Wirtschaft behauptet sich in schwachem internationalen Umfeld. Wien (online unter www.oenb.at/de/img/prognose_gewi_2_12_tcm14-247945.pdf, zuletzt besucht am 15.10.2012).
Österreichisch-Slowenische ExpertInnenakademie (EXP:AK AT.SI, 2012): Konferenzbericht der Österrei-chisch-Slowenischen ExpertInnenakademie: Kooperation zwischen Arbeitsmarktverwaltungen und Unternehmen (online unter expak.at/expak/img/uploads/expak3313.pdf, zuletzt besucht am 15.10.12).
Olins, Wally (20042): Branding the Nation. Creating the Unique Destination Proposition. Amsterdam. Pechlaner, Harald, Elisabeth Fischer & Eva-Maria Hammann (2009): Innovationen in Standorten – Perspek-
tiven für den Tourismus. In: Harald Pechlaner & Elisabeth Fischer (Hrsg.): Strategische Produktentwick-lung im Standortmanagement. Wettbewerbsvorteile für den Tourismus. Berlin, S. 10–29.
Sandner, Dominik (2006): Diversity Management. Vielfalt als Ressource. Betriebswirtschaftliche Begründun-gen. Saarbrücken.
Schubert, Klaus (20104): Standortpolitik. In: Dieter Nohlen & Rainer-Olaf Schultze (Hrsg): Lexikon der Poli-tikwissenschaft. München, S. 1034.
Seger, Martin (2007): Geographical Dimensions of the Alps-Adriatic Region. In: Josef Langer (Hrsg.): Euro-regions – The Alps-Adriatic Context. Frankfurt am Main, S. 97–111.
Statistik Austria (Hrsg., 2012): Arbeitsmarktstatistik. 3. Quartal 2012. Mikrozensus – Arbeitskräfteerhebung, Wien.
Sweet, David (2011): Zukunft des makroregionalen Strategieansatzes in der EU. In: Europa Kommunal. Euro-päische Zeitschrift für Rat, Verwaltung und Wirtschaft, Heft 2, S. 4–5.
Valentin, Hellwig (1998): Kärntens Rolle im Raum Alpen-Adria. Gelebte und erlebte Nachbarschaft im Herzen Europas (1965–1995). Klagenfurt.
Verhounig, Ewald (2012): Arbeitsmarktliberalisierung 2011. Volkswirtschaftliche Effekte für den steirischen Arbeitsmarkt (Steirische Regionalpolitische Studien Nr. 04). Graz.
Vollkommer, Dieter (2004): Regionalisierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik. IAB, Beitrag 287, Nürnberg.WIFO, Arbeitsmarktservice Österreich (Hrsg., 2012): Auswirkungen der Liberalisierung des österreichischen
Arbeitsmarktes für die StaatsbürgerInnen der EU8 (Endbericht). Wien.Wirtschaftskammer Wien (WKO), Diversity Referat (Hrsg., 2011): Diversity Management. Ein Leitfaden für
die Praxis. Wien.
Proof
111
3.1 „Innerösterreich“ als Teil der Alpen-Adria-Region Werner Drobesch
Regionen haben Geschichte, und sie bestimmen Geschehen, wie umgekehrt
die in ihnen lebende Bevölkerung das Geschehen und die Landschaft gestal-
tet. Das ist spätestens seit der Schule der „Annales“, seit Fernand Braudels
Universalgeschichte des Mittelmeeres eine mögliche Geschichtsbetrach-
tung. Als eine solche Region ist auch das Territorium zwischen der Adria,
den Alpen und ihren Ausläufern anzusehen, gekennzeichnet durch eine
landschaftliche wie klimatische Pluralität. Die Vielgestaltigkeit des Natur-
raumes – vom Hochgebirge bis zur Ebene, vom alpinen bis zum mediterranen
Klima – hat über die Jahrtausende hinweg zur Ausformung unterschiedlicher
Lebensformen und Gemeinschaften beigetragen. Bedeutende Verkehrswege
führten und führen durch die Region, die im Schnittpunkt der West-Ost- und
Nord-Süd-Transversale Europas gelegen ist, miteinander verbunden durch
ökonomische Interessen, aber auch durch sprachliche Durchlässigkeit (vgl.
Moritsch 2001, S. 18 ff.). Sie wurde zu einem Begegnungspunkt von Sprachen-
gemeinschaften: der deutschen, der slowenischen, der italienischen und
friulanischen, die bis zum „nationalen Erwachen der Völker“ neben- und
miteinander existierten. Es entstand eine „Einheit in der Vielfalt“ und eine
„Vielfalt in der Einheit“.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatten die historischen Kernlän-
der der Region (Triest (Trieste, Trst), Istrien, Görz, Kärnten, Krain und Steier-
mark) – subsumiert unter der Bezeichnung „Innerösterreich“ – untereinan-
der engere Beziehungen in den Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft und
Lebenskultur entwickelt. In seiner Gesamtheit war das Territorium durch
die Geschichte mehrmals teilweise und im habsburgischen Länderkonglo-
merat bis 1918 – abgesehen von kurzen Unterbrechungen – sogar in seiner
Gesamtheit vereinigt. Es waren die Habsburger, die aus politischen Überle-
gungen die Kernländer der Region seit dem Hochmittelalter zu einem größe-
ren, zusammenhängenden Länderkomplex zusammenführten. Im Zuge der
Hausmachtpolitik und im Vorfeld der venezianischen Expansion suchte man
einen territorialen Rückhalt für den Ausbau des Länderbesitzes im Süden in
Richtung Adria (vgl. Rumpler 2001, S. 518). Nachdem die Steiermark schon seit
1282 habsburgisch war, folgten 1335 Kärnten und Krain sowie 1374 die Görzer
Besitzungen in der Windischen Mark und Möttling. 1366 hatten sich die Her-
ren von Duino mit dem Westteil Istriens und dem Gebiet nördlich von Triest
(Trieste, Trst) den Habsburgern unterworfen. 1382 huldigte diesen auch die
Proof
112
Stadt Triest (Trieste, Trst). Spätestens 1500, als Maximilian I. die Besitzungen
der Görzer Grafen im nördlichen Isonzotal (Tolmein, Tolmin) und in Friaul in
habsburgischen Besitz überführte, waren die Grenzen der innerösterreichi-
schen Länder klarer beschrieben (Neunteufl 1967, S. 513 ff.).
Mit der habsburgischen Länderteilung von 1564 war eine seit dem Neuberger
Vertrag (1379) und der Teilung des Jahres 1411, als Herzog Ernst das Gebiet der
„inneren Lande“ erhalten hatte, vorgezeichnete Entwicklung zu einem vor-
läufigen Abschluss gekommen. Innerösterreich (Steiermark, Kärnten, Krain,
habsburgisch Istrien mit Rijeka, Fiume, St. Veit am Flaum, Triest (Trieste,
Trst), Görz (Gorizia, Gorica), Gradiska, Teile des Friaul) wurde neben Nieder-
und Oberösterreich, dem Königreich Böhmen, dem Königreich Ungarn und
Tirol-Vorlande zu einem der großen Territorialverbände der habsburgischen
Länderunion. Flächenmäßig umfasste es im Jahre 1564 47.776 km2 und cirka 1,5
Millionen Einwohner (vgl. Neunteufl 1967, S. 522). Für mehr als ein halbes Jahr-
hundert – bis 1619/1628 – bildete dieser innerösterreichische Länderkomplex
mit dem Zentrum Graz sogar einen nahezu selbstständigen Staatsverband mit
einem eigenen Landesherrn (Erzherzog Karl II.; Erzherzog Ferdinand II.), einer
eigenen Verwaltung und Gerichtsbarkeit, einer eigenen Militärgewalt sowie
einer eigenen, in Graz befindlichen Nuntiatur (Spreitzhofer 1988, S. 19 f.). Sogar
nach der Übersiedlung Ferdinands II. 1619 nach Wien blieb die Eigenständig-
keit erhalten. Als politisch-administrative Einheit bildete die innerösterrei-
chische Ländergruppe den räumlichen Kern für die weitere Geschichte der
Alpen-Adria-Region. Wirtschaftspolitisch bedeutete das, dass die Länder als
Montanregion und als Verkehrsbrücke nach Triest (Trieste, Trst), das seit 1719
auf Betreiben Kaiser Karls VI. zu einem Seehandelszentrum ausgebaut wurde,
zusammenwuchsen. Sieht man von geringfügigen territorialen Korrekturen
ab, veränderten sich bis in die Zeit der napoleonischen Kriege die Grenzen der
innerösterreichischen Länder nicht.
Was die innerösterreichischen Provinzen verband, war nicht nur der gemein-
same habsburgische Herrscher, sondern auch ein zwischen der staatlichen
und der Landesverwaltung eingefügter Behördenapparat. Im vielschichti-
gen Geflecht der Verwaltung sicherten die gemeinsamen Behörden bis zu
den theresianisch-josephinischen Reformen die Zusammengehörigkeit des
Länderverbandes, der zusätzlich in den die Ländergrenzen überschreiten-
den Bistumssprengeln eine Ergänzung fand. Ein weiteres verbindendes Ele-
ment war die Verdichtung der ökonomischen Beziehungen und kulturellen
Verflechtungen. Zum einen war es seit dem frühen 17. Jahrhundert die jesu-
itische Geistes- und Kulturwelt mit ihrer barocken Orientierung, die einen
Proof
113
geistig-kulturellen Überbau bildete, zum anderen hielt im späten 18. Jahr-
hundert das Gedankengut der Aufklärung als ein neue, länderübergreifende
Geistesströmung Einzug.
Mit dem Reformwerk des aufgeklärten Absolutismus entstand einerseits eine
noch engere Verbindung zwischen einem Teil der innerösterreichischen Län-
der, andererseits zeichnete sich eine Aufspaltung Innerösterreichs ab. Das
zwischen 1782/ 1783 und 1791 geschaffene „Innerösterreichische Gubernium“
umfasste nur mehr die Steiermark, Kärnten und Krain. Dem neuen „Triest-
Görzer Gubernium“ wurden die Stadt Triest (Trieste, Trst) samt Gebiet, Görz
und Gradisca sowie Istrien zugeteilt. Einem Intermezzo des Rückgriffs auf die
theresianische Behördenorganisation folgte 1803 erneut das Gubernialsystem
mit einem steiermärkisch-kärntnerischen Gubernium (Sitz: Graz), einer Krai-
ner und Görzer Landeshauptmannschaft (Sitz: Laibach (Ljubljana) und einem
Triest-Istrianer Gubernium (Sitz: Triest (Trieste, Trst). Von diesen blieb wäh-
rend der Franzosenkriege nur das Grazer Gubernium (Steiermark, Klagenfurter
Kreis) übrig. Die von Frankreich besetzten Gebiete wurden 1809 – 1813 in den
Illyrischen Provinzen (Krain, Görz, Villacher Kreis, Osttirol, Österreichisch
Istrien, Venezianisch Istrien, Zivilkroatien und kroatische Militärgrenze, Dal-
matien) mit dem Zentrum Laibach (Ljubljana) zusammengefasst (Žontar 1988,
S. 34 ff.). Was durch die im Verlaufe der napoleonischen Kriege geschlossenen
Verträge getrennt worden war, führte der Wiener Kongress (1814/1815) zusam-
men. Die alte Guberniumseinteilung mit den Zentren Graz, Laibach (Ljubljana)
und Triest (Trieste, Trst) wurde wieder hergestellt. 1816 wurde im Anschluss
an die französischen Illyrischen Provinzen das Königreich Illyrien, das mehr
eine politische Vision als eine politische Realität war, errichtet. 1822 schieden
Rijeka (Fiume), Zivilkroatien und die kroatische Militärgrenze aus. 1825 wurde
das Kronland Kärnten, das bis zu diesem Zeitpunkt auf die Steiermark (Kla-
genfurter Kreis) und Krain (Villacher Kreis) aufgeteilt war, wieder hergestellt.
Drei Gubernien wurden errichtet: Graz (Steiermark), Laibach (Krain, Kärnten)
– diese drei Provinzen bildeten während des Vormärz den bereits recht losen
Länderverband „Innerösterreich“ – und Triest (Stadt Triest (Trieste, Trst) mit
dem Umland, Görz-Gradisca, Istrien) (Žontar 1988, S. 34 ff.). Die Organisierung
des Raumes zu einer provinzübergreifenden Region kam kaum voran. Nicht
die länderübergreifenden Institutionen, sondern die Provinzbehörden wur-
den zur eigentlichen Verwaltungsstelle (vgl. Drobesch 2003, S. 41). Die poli-
tisch-administrative Einheit des Territoriums Innerösterreich, das mit einer
Gesamtfläche von 42.819,2 km2 16,9 Prozent der späteren cisleithanischen
Länder der Gesamtmonarchie umfasste (Tafeln zur Statistik 1847), erodierte
immer mehr in Einzelteile.
Proof
114
Mit der Reorganisation des österreichischen Kaiserstaates im Gefolge der
Revolution von 1848/ 1849 zerfielen die letzten noch existenten administra-
tiven Bindungen zwischen den innerösterreichischen Ländern. Die bereits
in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches einsetzende Entwicklung fand
ein Ende. Die Länder, welche eigene Identitäten, die sich auf geographische,
historische und seit dem 19. Jahrhundert verstärkt auf ethnisch-nationale Kri-
terien stützten, herausgebildet hatten, erreichten im Sinne förderalistischer
Lösungsansätze in Teilbereichen der Verwaltung eine Selbstständigkeit. Dabei
blieb es bis 1918.
Der Zerfall Österreich-Ungarns in den frühen Novembertagen des Jahres 1918
bewirkte das Auseinanderbrechen Innerösterreichs und der Alpen-Adria-
Region. Die Pariser Friedensordnung von 1919/ 1920, mit der sich die nationa-
len Sonderinteressen durchsetzten, schrieb neue Grenzen fest. Krain kam zum
SHS-Staat, Kärnten und die Steiermark – beide verloren allerdings Teile an Ita-
lien bzw. den SHS-Staat – zu Österreich. Die vielfältigen Fäden eines nahezu
sechshundertjährigen, im Grunde für alle Seiten gewinnbringenden Neben-
und Miteinanders wurden mit einem Schlag zertrennt. Die in der Region bzw.
in Innerösterreich vereinigten Länder befanden sich plötzlich in einer Rand-
lage. Ökonomisch war ihnen das Hinterland abhanden gekommen. Daran
änderte die Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg vorerst wenig.
Im Gegenteil: Die Trennlinie wurde noch dadurch verstärkt, dass die Län-
der unterschiedlichen politischen wie wirtschaftlichen Blöcken angehörten:
zum einen im Falle der zu Italien gehörigen Gebiete wirtschaftlich der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, militärisch (seit 1949) der NATO, im Falle
Österreichs ökonomisch seit 1960 der EFTA, militärisch-politisch seit 1955 neu-
tral, und im Falle Sloweniens als Teil Jugoslawiens (seit 1961) zur „Bewegung
der blockfreien Staaten“. Erst die europäische Integration und der einsetzende
Zerfall des jugoslawischen Staatsverbandes durch den Austritt Sloweniens und
Kroatiens (1991) führten die einstigen innerösterreichischen Länder – wenn
vorerst noch sehr lose – wieder mehr zueinander. Die 1990er Jahren brachten
eine Beschleunigung dieses Zueinanders. Der Beitritt Österreichs zur „Europä-
ischen Union“ (1995) bildete einen ersten Schritt, und der Beitritt Sloweniens
(2004) setzte den vorläufigen Schlusspunkt in Richtung einer Zusammenfüh-
rung der Länder in ein Europa der Regionen unter Beibehaltung der politi-
schen Grenzen, die mit dem Beitritt Österreichs, Italiens und Sloweniens zum
Schengen-Abkommen durchlässiger wurden. Damit knüpfte man zumindest
teilweise an das an, was vor 1918 bestanden hatte und der Region sowie Inne-
rösterreich die Eigentümlichkeit verlieh, nämlich eine Region „ohne Grenzen“/
„brez meja“/ „senza confini“ mit einer „Vielfalt in der Einheit“ zu sein.
Proof
115
Literatur
Drobesch, Werner (2003): Grundherrschaft und Bauer auf dem Weg zur Grundentlastung. Die „Agrarrevolution“ in den innerösterreichischen Ländern (Aus Forschung und Kunst 35). Klagenfurt.
Moritsch, Andreas (2001): Geographische Voraussetzungen der Geschichte der Alpen-Adria-Region. In: Andreas Moritsch: Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec et al., S. 11–36.
Neunteufl, Walter (1967): Die Entwicklung der innerösterreichischen Länder. In: Innerösterreich 1564 – 1619 (Joannea 3). Graz, S. 513–524.
Rumpler, Helmut (2001): Verlorene Geschichte. Der Kampf um die politische Gestaltung des Alpen-Adria-Raumes. In: Andreas Moritsch: Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec et al., S. 517–569.
Spreitzhofer, Karl (1988): Die innerösterreichischen Zentralbehörden und die Verwaltung der inne-rösterreichischen Länder bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. In: Jože Žontar (Red.): Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918. Ein historisch-bibliographischer Führer. Prirocniki in karte o ogranizacijski strukturi v deželah Koroških, Primorju in Štajerski do leta 1918 Zgodovinsko-bibliografski vod-nik. Manuali e carte sulle strutture amminstrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918 Guida storico-bibliografica (Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 15). Graz et al., s. 18–30.
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie (1847). Wien.
Žontar, Jože (1988): Die Verwaltung der Steiermark, Kärntens, Krains und der Küstenländer 1747/48 bis 1848. In: Ders. (Red.): Handbücher und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918. Ein historisch-bibliographischer Führer. Prirocniki in karte o ogranizacijski strukturi v deželah Koroških, Primorju in Štajerski do leta 1918 Zgodovinsko-bibliografski vodnik. Manuali e carte sulle strutture amminstrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918 Guida storico-bibliografica (Mittei-lungen des Steiermärkischen Landesarchivs 15). Graz et al., S. 31–49.
Proof
117
3.2 Aspekte wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in „Innerösterreich“ im 19. JahrhundertIngrid Groß, Anita Lackner, Susanne Ruhdorfer
3.2.1 Einleitung
Tempora muta(ba)ntur. Die Zeiten änder(te)n sich. Das gilt auch für die innerös-
terreichischen Länder während des „langen 19. Jahrhunderts“. Wie andere Pro-
vinzen des österreichischen Vielvölkerstaates wurden auch diese während des
Vormärz von einem tiefgreifenden Paradigmenwechsel erfasst. Das bedeutete
zum einen die Abkehr von der Feudalwirtschaft und -gesellschaft sowie das Ein-
dringen (wirtschafts)liberaler Postulate, zum anderen das „nationale Erwachen
der Völker“, das à la longue die Ausformung nationaler Bewegungen nach sich
zog – im Falle der inner österreichischen Länder sowohl der deutsch- als auch der
slowenisch- und italienischsprachigen Bevölkerung – und ab den 1870er Jahren
in den Kampf der Völker um die nationale Vorherrschaft im Staat mündete.
Nach Überwindung der durch die napoleonischen Kriege bedingten Kri-
senzeit setzte sich im ökonomischen Bereich ab etwa 1825/1830 der seit der
theresianisch-josephinischen Epoche in Gang befindliche Modernisierungs-
prozess zunächst fort. Begünstigt durch die geo- und verkehrspolitische Lage
als Schnittstelle zwischen dem nördlichen und südlichen Europa profitierte
man vorerst noch vom Aufbruch ins Industriezeitalter. Nochmals erlebte die
innerösterreichische Wirtschaft, insbesondere jene Kärntens und Krains,
eine bemerkenswerte Blütezeit. Dafür verantwortlich zeichnete in erster Linie
die Montanindustrie. Sie war der eigentliche Motor der Prosperität. Getragen
wurde diese von Vertretern der „zweiten Gesellschaft“, die aus dem wirtschaft-
streibenden Bürgertum des 18. Jahrhunderts hervorgegangen war. Aus seinen
Reihen rekrutierte sich im 18. Jahrhundert ein neuer Unternehmertypus, der
als Konsequenz seines erfolgreichen ökonomischen Agierens über die Nobi-
litierung einen gesellschaftlichen Aufstieg erreichte. In seiner Geisteshaltung
und seinem Lebensstil entsprach er dem Schumpeterschen Ideal des „Entre-
preneurs“. Neben dem Fachwissen und technologischen Innovationsdrang
verfügte dieser über ein ausgeprägtes schöpferisches Potential, das – gepaart
mit chrematistischem Streben – durch die Einführung moderner Produkti-
onsverfahren die Profitmöglichkeiten steigerte. Im ausgehenden Vormärz ver-
schmälerte sich diese Gruppe. Das Auftreten neuer Unternehmertalente wurde
zu einer Rarität. Verschwunden war jene unternehmerische Gesinnung, wel-
che die führenden Proponenten im innerösterreichischen Unternehmertum
Proof
118
nahezu ein Jahrhundert ausgezeichnet hatte. Die Repräsentanten der (inzwi-
schen) alteingesessenen Unternehmerfamilien waren ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts immer weniger bereit, unter schwieriger gewordenen Rahmenbe-
dingungen als Industrieunternehmer zu agieren, wie es die Altvorderen getan
hatten. Für sie war es kein Lebensinhalt mehr, Unternehmer zu sein. Das Leben
eines kunstsinnigen „Landlords“ zu führen, erschien ihnen lebenserfüllender.
So mancher von ihnen verkaufte die Unternehmensreste und zog sich wie etwa
Graf Ferdinand Franz von Egger Anfang der 1870er Jahre auf seine Landbesit-
zungen, die ihm eine ausreichende Lebensbasis boten, zurück, um dort „schön
zu leben“ und den Musen zu frönen (Drobesch & Stermitz 2008, S. 37).
Zu diesem Zeitpunkt war die zentrale Institution des Feudalsystems, die Grund-
herrschaft, nicht mehr existent. Mit dem Grundentlastungsgesetz (7. September
1848) war diese zerschlagen geworden. Damit war für den Habsburgerstaat das
Ende des Feudalzeitalters besiegelt und de jure der Startschuss zum Aufbruch
in die ökonomische Moderne gegeben. Denn die alte feudale Agrarverfassung
hatte einen entscheidenden Schwachpunkt für die ökonomische Modernisie-
rung gebildet. In besonderer Weise davon betroffen waren die innerösterreichi-
schen Länder, wo es im Gegensatz zum böhmischen Raum vor 1848 zu keiner
Agrarrevolution im Sinne eines rasanten Modernisierungsprozesses, sondern
nur zu einer Teilmodernisierung kam (Drobesch 2003, S. 181 ff.). Dafür zeichne-
ten zu einem wesentlichen Teil die grundherrschaftlich-bäuerlichen Verhält-
nisse verantwortlich, weil die bis 1848 bestehende Feudalverfassung jenen Teil
der Bauern und Grundherren, der auf eine Modernisierung drängte, hemmte.
Um die Jahrhundertmitte war daher die Produktion nur zu einem geringen
Maße nach den Prinzipien der „rationellen Landwirtschaft“, d. h. gewinn-
orientiert organisiert. Nur singulär waren die Grundherrschaften und die
bäuerlichen Wirtschaften zu einem ökonomisch ertragreichen Unternehmen
gemacht worden. Der agrarische Sektor, in dem klein(st)betriebliche Struktu-
ren und traditionelle Produktionsformen dominierten, produzierte mehr für
die Eigenversorgung und kaum für den Markt. Das traf auch für die Herrschaft
Bleiburg, die im Besitz der Thurn-Valsassina war, zu. Die innerösterreichi-
schen Grundherrschaften, die – anders als in Böhmen – von einem territorial
geschlossenen Wirtschaftskörper weit entfernt und kleinstrukturiert waren,
wurden zu einem Abbild dieser Gegebenheiten (Drobesch 2007b, S. 65), in die
sich die im Besitz der Thurn-Valsassina befindliche Herrschaft Bleiburg nahtlos
einfügte. Weil insgesamt der Impetus zur Modernisierung in den innerösterrei-
chischen Ländern gering blieb, blieben sie über 1848 hinaus eine auf sich selbst
bezogene Agrarregion, in der es nur die eine oder andere industrielle Oase gab.
Eo ipso handelte es sich um eine Agrargesellschaft.
Proof
119
Diese geriet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Sog des Nationa-
litätenkampfes. Maßgeblich zeichneten kulturelle, gesellige, soziale, sportli-
che wie ökonomische Vereinigungen sowie die Publizistik dafür verantwort-
lich, dass sich ein nationales Bewusstsein bildete, das rasch in nationales Han-
deln mündete. Zunehmend wurde ab etwa 1880 in der Steiermark, in Kärnten
und Krain der Lebensalltag „nationalisiert“. In diesem Zusammenhang kam
den nationalen Stereotypen eine erhebliche Bedeutung zu. Einerseits verfes-
tigte sich über sie im Rahmen der politischen Agitation das Bild vom national
Andersgesinnten, andererseits leisteten sie im Volkstumskampf einen Beitrag
zur nationalen Identitätsstiftung. Initiativen, die wie etwa das „Kronprinzen-
werk“ dazu gedacht waren, die nationalen Antagonismen zu überwinden und
die „Vielheit in der Einheit“ zu propagieren, erzielten nicht die intendierte Wir-
kung. In den Novembertagen des Jahres 1918 zerbrach der habsburgische Viel-
völkerstaat in Nationalstaaten.
3.2.2 Herrschaftszugehörigkeit, Besitzverteilung und Besitzstruktur im Vormärz: das Beispiel des Steuerbezirkes und der Grundherrschaft Bleiburg (Anita Lackner)
Die Grundherrschaft: eine Definition
Die Grundherrschaft (Dominium) war jener institutionelle Rahmen, der
vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert die Agrarwirtschaft und länd-
liche Gesellschaft der Alpen-Adria-Region prägte. Sie war eine Form „des
landwirtschaftl[ichen] Großgrundbesitzes, bei der das Land (Herrschaftsland)
vollständig o[der] zum größten Teil nicht vom Besitzer […] selbst bewirtschaf-
tet, sondern als grundbares Land an Bauern ausgegeben“ wurde, „von denen
er i[m] wesentl[ichen] nur Zahlungen“ empfing (Haberkern & Wallach 2001,
S. 261). Aber nicht nur die ländliche Ökonomie, sondern auch die Gesellschaft,
Verwaltung und der Lebensalltag wurden von ihr bestimmt (vgl. Ploetz o.J.,
S. 176). Im Verlaufe der Urbarmachung des Landes zur Gewinnung agrarischer
Nutzflächen konnte sie sich als Herrschaftsform und Wirtschaftsinstitution
etablieren. Sie bestimmte die gesellschaftliche und ökonomische Stellung sei-
nes Besitzers (vgl. Melville 1981, S. 301). Das gilt für den Habsburgerstaat und als
einem Teil von diesem für die Provinzen der Alpen-Adria-Region.
Bis zum Grundentlastungsgesetz (7. September 1848) war die Untertänigkeit das
zentrale Machtmittel, welches das Verhältnis des Bauern als zinspflichtigen
Untertanen zum Grundherrn als rechtlichen Eigentümer von Grund und Boden
bestimmte. Hinsichtlich der Rechtsform gestaltete sich dieses Abhängigkeits-
Proof
120
verhältnis in den einzelnen Provinzen der Habsburgermonarchie unterschied-
lich. Es war das Besitzrecht (Freistiftrecht, verliehenes Kaufrecht), das den Grad
der Abhängigkeit des Bauern und die zu leistenden Abgaben (an den Grund-
herrn) regelte. Letztere bestanden zunächst in Naturalleistungen, die seit der
theresianisch-josephinischen Epoche vermehrt durch Geldzahlungen ersetzt
wurden, ohne gänzlich zu verschwinden. Sie stellten die größten auf den bäu-
erlichen Untertanen lastenden Verpflichtungen dar (vgl. Smole 2008, S. 24). Bis
in die Mitte des 18. Jahrhunderts ließen die rechtlichen Verhältnisse der bäuer-
lichen Wirtschaften einen Kauf bzw. ein Vererben der Liegenschaft kaum zu.
Eine Änderung brachte erst das 1772 eingeführte Kaufrecht. Mit diesem war die
Weitergabe der Liegenschaft an die Nachkommen möglich, und zwar „durch die
Leistung entsprechender Abgaben“ (Smole 2008, S. 25). Schwierig gestaltete sich
die Herrschaftsausübung und Verwaltung, weil es sich im Falle der Dominien
um keine geschlossenen administrativen Einheiten mit räumlich klar definier-
ten Grenzen handelte. Bisweilen waren einzelne Untertanen sogar mehreren
unterschiedlichen Grundherren zins- und arbeitspflichtig (vgl. Smole 2008, S. 25).
Somit standen die Untertanen mit der eigentlichen landesfürstlichen Herrschaft
nur in einem Mediatenverhältnis (vgl. Reinhard 2002, S. 212). Das bedeutet, dass
die staatliche Zentralmacht auf lokaler Ebene nur schwach und diskontinuier-
lich präsent war. Wohl ging man seit Joseph II. daran, erste geschlossene staat-
liche Verwaltungseinheiten zu schaffen. Die Schaffung von Katastralgemeinden
stellte einen ersten Schritt in diese Richtung dar. Aber auch in ihnen hatten meh-
rere lokale und/ oder auswärtige Grundherren Besitz und Untertanen. Bis in die
josephinische Zeit war das in der Regel ein Adeliger oder die katholische Kirche.
Im Vormärz traten zu diesen vermehrt Bürgerliche (vgl. Reinhard 2002, S. 183 ff.),
die die ökonomische Modernisierung der Grundherrschaft in ihrer letzten
Bestandsphase vorantrieben und bestrebt waren, aus ihr ein gewinnorientiertes
Unternehmen zu machen (Drobesch 2007b, S. 71). Die Revolution von 1848/1849
brachte die Abschaffung des mittelalterlichen Feudalsystems. Nun erfolgte
eine grundlegende Neuordnung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
administrativen Rahmenbedingungen nach den Prinzipien des Wirtschaftsli-
beralismus und der modernen Staatsverwaltung. Davon tangiert waren auch die
innerösterreichischen Länder, wo nun an die Stelle der Grundherrschaften die
Gemeinden als neue staatliche Verwaltungseinheiten traten.
Grundherrschaft und Steuerbezirk Bleiburg: Landschaftsstruktur und Klima – Konstanten der Beeinflussung agrarischer Produktion
Auch im südöstlichen Alpenraum bildeten im frühen 19. Jahrhundert die Domi-
nien nach wie vor das Herzstück der lokalen Herrschaftsausübung und der
Proof
121
Wirtschaft (vgl. Drobesch 2003, S. 148). Zwar unterstanden die Grundherren als
Herrschaftsinhaber der Aufsicht staatlicher Behörden, doch in ihrer Funktion
als „verlängerter Arm des Staates“ bestimmten sie das Leben der bäuerlichen
Untertanen (vgl. Drobesch 2003, S. 57, 148). Vom Ideal einer territorialen und
wirtschaftlichen Geschlossenheit blieb man in Innerösterreich – im Gegen-
satz zu Böhmen – aber weit entfernt. Die herrschaftlichen Besitzungen und die
Kulturflächen der zinspflichtigen Bauernwirtschaften lagen in der Regel über
mehrere Katastralgemeinden verstreut. Das galt für größere wie kleinere Herr-
schaften gleichermaßen. In diesem Kontext bildete die Herrschaft Bleiburg, die
sich seit 1601 im Besitz der Familie Thurn-Valsassina befand, eine Ausnahme.
Diese zeichnete sich durch eine relative Geschlossenheit aus. Die Untertanen
verteilten sich auf einen territorial klar eingegrenzten Steuerbezirk.
Der Steuerbezirk Bleiburg lag im Südosten des Kronlandes Kärnten, größtenteils
eingebettet in das Jaun- und Mießtal. Es handelte sich dabei um ein von Gebir-
gen durchzogenes Territorium, das im Südwesten und Süden von der Petzen,
einem Ausläufer der Karawanken – jener Gebirgskette, die das heutige österrei-
chische Staatsgebiet vom slowenischen trennt – und den dieser Gebirgsgruppe
vorgelagerten Erhöhungen landschaftlich charakterisiert wurde. Das sich im
Südwesten und Süden hinziehende Petzengebirge hatte den Angaben des Fran-
ziszeischen Katasters zufolge eine Seehöhe von 2.054 m. Die ihr vorgelager-
ten Berge (Steinkogel, 1.264 m; Fettengupf, 1.106 m; Kömel, 1.062 m; Seloutz,
Lamberg und Volliniachberg, 885 m; Ursulaberg, 1.738 m) wiesen eine geringere
Seehöhe auf. Im Südwesten und Süden (bedingt durch die Petzen) sowie im
Südosten und Osten (bedingt durch den Ursulaberg) befanden sich die Hoch-
gebirgsregionen, während der Norden eine von mittelhohen Bergen unterbro-
chene Flachgegend umfasste. Die hohe, gebirgige Lage der Katastralgemeinden
im Süden erschwerte die agrarische Produktion, wovon die arbeitstechnische
Seite aber nicht unmittelbar betroffen war. Denn im frühen 19. Jahrhundert
waren aufgrund des geringen technischen Fortschritts bei den landwirtschaft-
lichen Arbeitsgeräten die Steilflächen leichter zu bearbeiten als die Ebenen.
Vielmehr wirkte sich die Seehöhe des südlichen Teiles durch die verkürzte
Vegetationsperiode auf das Pflanzenwachstum und die Ertragsmenge negativ
aus. Einen schädigenden Einfluss auf das umliegende Agrarland übte auch die
Drau aus. Sie beeinträchtigte die landwirtschaftliche Produktion maßgeblich,
und zwar aufgrund der starken Früh- und Spätfröste und des Rostes, der ins-
besondere die Getreideproduktion hemmte. Die Körner verkamen oder reiften
aufgrund der kalten Temperaturen erst gar nicht. Im Norden wiederum, wo die
landwirtschaftliche Produktion keinen nachteiligen Klimaeinflüssen ausge-
setzt war, belasteten Pflanzenkrankheiten den Ackerbau.
Proof
122
Die klimatischen Verhältnisse im Steuerbezirk waren höchst unterschied-
lich. Der Südwesten und Süden war durch ein überwiegend raues und kaltes
Klima gekennzeichnet, was sich infolge der verkürzten Vegetationsperiode
und der Verwinterung auf den agrarischen Ertrag negativ auswirkte. Der
hügelige Norden war nicht nur aus topographischer, sondern auch aus klima-
tischer Sicht für die Agrarwirtschaft geeigneter. Hier waren die Temperatu-
ren doch um einiges milder. Der übrige Teil des Steuerbezirkes war aufgrund
seines gebirgigen Charakters und der lang anhaltender Kälteperioden für die
Agrarproduktion weniger ertragreich.
Agrarstrukturen und gesellschaftliche Gegebenheiten
Zur Zeit der Erhebungen zum Franziszeischen Kataster umfasste der Steuerbe-
zirk Bleiburg eine Fläche von 44.323,52 ha. Diese zusammenhängende staatli-
che Verwaltungseinheit gliederte sich in 64 Katastralgemeinden. Das Gros der
Untertanen unterstand der grenzübergreifenden Grundherrschaft Bleiburg,
die sich seit 1601 im Besitz der Familie Thurn-Valsassina befand. Diese übte die
grundherrliche Gewalt aus. Ihr unterstanden die Bauern in Angelegenheiten
der Zivilgerichtsbarkeit und Ortspolizei ebenso wie in ökonomischer Hinsicht
(vgl. Wadl 1995, S. 67). Für die Überlassung von Grund und Boden waren diese
dem Grundherrn zu verschiedenen Leistungen verpflichtet. Dazu gehörte u. a.
die Robot. Dabei handelte es sich meist um eine Hand- oder Zugrobot. Hinzu
kam noch, vor allem im Falle von kirchlichen Gülten, der Zehent. In Summe
ergab das für die Bauern große finanzielle Belastungen.
Im Steuerbezirk Bleiburg spiegelt sich die Situation der innerösterreichischen
Grundherrschaftsstruktur wider. Die Herrschaften waren an keine räumlich
klar umrissenen Gebietskomplexe gebunden. „Eine verwirrende Vielfalt ein-
ander überschneidender Herrschaftsrechte“ kennzeichnete auch das Bleibur-
ger Gebiet (vgl. Wadl 1995, S. 68). Aufschlüsse über den herrschaftlichen Besitz
liefern die Grundparzellenprotokolle des Franziszeischen Katasters. Diese
geben nicht nur Auskunft über die Herrschaftsinhaber der einzelnen Grund-
stücke, sondern auch über jene Person, welche die Nutzungsrechte innehatte
bzw. Nutzungseigentümer war. Das bedeutet, dass auch die gesetzliche Eigen-
schaft der Parzellen, nämlich ob es sich um Dominikal- oder Rustikalland10
handelt, vermerkt wurde. Die Verteilung der Dominikal- und Rustikalgrund-
stücke ergab ein deutliches Übergewicht der letzteren(Tab. 3.1).
10 Beim Dominikalland handelt es sich um unmittelbaren Herrschaftsbesitz, der vom Grundherrn selbst bewirtschaftet wurde. Hingegen handelte es sich im Falle des Rustikallandes eine untertänige Liegenschaft, die vom Grundherrn immer wieder neu vergeben wurde.
Proof
123
KulturgattungParzellen
ha fl. kr.dominikal rustikal
Acker 140 195,859 2.279 12
10.750 6.892,70 57.826 49
Summe 10.890 7.088,56 60.106 1
Aue 33 21,611 16 55
Summe 33 21,611 16 55
Aue & Weide 1 0,135 6
29 17,307 14 5
Summe 30 17,442 14 11
Egarten 41 17,964 60 51
579 368,203 1.403 9
Summe 620 386,167 1.464 0
Große Gärten 8 4,175 56 49
112 28,585 437 20
Summe 120 32,760 494 9
Hochwald 157 3.269,99 1.026 52
6.537 17.527,37 7.461 12
Summe 6.694 20.797 8.488 4
Kleine Gärten 55 3,009 96 37
1.362 191,25 722 42
Summe 1.417 194,259 819 19
Niederwald 22 14,813 6 52
Summe 22 14,813 6 52
Obstgarten 1 0,144 2 14
Summe 1 0,144 2 14
Weide 331 622,014 411 29
10.645 10.124,79 7.719 35
Summe 10.976 10.746,81 8.131 4
Weide & Obst 16 10,345 20 23
1.128 209,125 1.299 4
Summe 1.144 219,47 1.319 27
Wiese 306 228,825 1.441 17
9.706 4.055,74 22.712 30
Summe 10.012 4.284,57 24.153 47
Tab. 3.1 Verteilung der Dominikal- und Rustikalparzellen (Quelle: KLA Klagenfurt, Grundparzellenprotokolle der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg).
Proof
124
Die Rustikalgüter überwogen nicht nur hinsichtlich der Parzellenanzahl, son-
dern auch in Bezug auf die Flächengröße und den Ernteertrag. Von den insge-
samt 41.959 Parzellen entfielen 97,5 Prozent auf die Rustikalparzellen, und nur 2,5
Prozent waren Dominikalparzellen. Ähnlich stellte sich die Situation hinsicht-
lich der Flächen- und Ertragsverteilung dar. Bezug nehmend auf die vier wich-
tigsten, weil einträglichsten Kulturgattungen (Äcker, Hochwälder, Hutweiden,
Wiesen) lässt sich festhalten, dass sich die Verteilung des prozentuellen Anteiles
von Dominikal- und Rustikalflächen ähnlich verhielt wie jene der Gesamtpar-
zellenanzahl. Der flächenmäßige Anteil der Dominikal- und Rustikalparzellen –
gemessen am Gesamtflächeninhalt der jeweiligen Kulturgattungen – belief sich
bei den Ackerflächen auf 2,7 Prozent bzw. 97,3 Prozent, bei den Waldungen auf
12,7 Prozent bzw. 87,3 Prozent, bei den Hutweiden auf 5,8 Prozent bzw. 94,2 Pro-
zent, sowie bei den Wiesen auf 5,4 Prozent bzw. 94,6 Prozent. Ähnlich stellt sich
das Verhältnis bei den Erträgen dar. Der Anteil der dominikalen Ackererträge
(nach dem Wert) belief sich auf 3,8 Prozent, jener der rustikalen Ackererträge auf
96,2 Prozent. Bei den Hochwäldern entfielen 12,1 Prozent auf die dominikalen
und 87,9 Prozent auf die rustikalen Wälder, bei den Hutweiden 5,1 Prozent und
94,9 Prozent sowie bei den Wiesen 5,9 Prozent und 94,1 Prozent, jeweils gemes-
sen am Gesamtertrag der Nutzfläche der jeweiligen Kulturgattung.
In seiner Struktur war der Bleiburger Steuerbezirk ein Abbild der inneröster-
reichischen Gegebenheiten. Die Grundparzellenprotokolle verzeichnen für
diesen 177 Grundherrschaften – davon 84 weltliche und 93 geistliche – mit
Grundbesitz und Eigentumsrechten. Diese große Herrschaftszahl lässt erken-
nen, dass es sich um ein inhomogenes Gebilde handelte. Für die untertäni-
gen Bauern stellte die Zersplitterung des grundherrschaftlichen Besitzes ein
schwerwiegendes Problem dar. Sie waren dem Grundherrn nicht nur arbeits-
und zinspflichtig, sondern sie waren von der Herrschaft auch als Verwal-
tungsinstanz abhängig. Entschied sich ein Dominium für die administrative
Zentralisierung, lag der Weg des Bauern von seiner Liegenschaft bis zu der für
ihn zuständigen Behörde bzw. dem zuständigen Gericht, dem er unterstand,
in einer so weiten Entfernung, dass der Rechtsweg meist gar nicht bestritten
werden konnte. Andererseits erhöhten sich aufgrund der permanent steigen-
den Rechts- und Verwaltungstätigkeit die Kosten bei mehreren Verwaltungs-
zentren drastisch, sodass sich die Herrschaften mehrere kleinere Verwal-
tungssitze („Ämter“) kaum leisten konnten bzw. nicht selten die Belastungen
auf die Untertanen abwälzten (vgl. Drobesch 2003, S. 155). Die Zerstreuung des
grundherrschaftlichen Besitzes ergab „ein buntes herrschaftliches Durchei-
nander“ (Drobesch 2003, S. 156), nicht nur auf der Ebene der Steuerbezirke,
sondern auch in den Katastralgemeinden. In einigen Katastralgemeinden des
Proof
125
Steuerbezirkes Bleiburg übten zwischen 21 und 32 unterschiedliche weltliche
und geistliche Dominien Besitz- und Eigentumsrechte aus. Betrachtet man die
Herrschaftsanzahl je Katastralgemeinde im Verhältnis zur Flächengröße, ergibt
sich ein erstaunliches Bild. In der Katastralgemeinde Bleiburg lebten auf einer
Fläche von 266,72 ha Untertanen von 23 Grundherrschaften. In der Katastral-
gemeinde Feistritz, die sich über ein Gebiet von 1.230,6 ha erstreckte, hatten 32
Herrschaften bäuerliche Untertanen. Ähnlich stellte sich die Situation in ande-
ren Katastralgemeinden (Moos: 1.133,72 ha, 26 Grundherrschaften; Rinkenberg:
973,39 ha, 21 Grundherrschaften; St. Michael: 621,34 ha, 21 Grundherrschaften)
dar. Demnach umfasste eine einzelne Grundherrschaft in Bleiburg durch-
schnittlich eine Fläche von 11,6 ha, in Feistritz von 38,5 ha, in Moos von 43,6 ha,
in Rinkenberg von 46,4 ha und in St. Michael von 29,6 ha. Es finden sich aber
im Steuerbezirk auch Katastralgemeinden, welche zur Gänze im Besitz einer
einzigen Herrschaft waren. Dazu gehörten Jaswina (752,19 ha), Mißberg jenseits
(247,44 ha), Platt (655,12 ha), St. Margarethen (343,09 ha), Topla (1.323,61 ha), Wei-
ßenstein (541,90 ha) und Wistra (2.627,78 ha). In diesen Katastralgemeinden war
ausschließlich die Herrschaft Bleiburg begütert.
Der aus der Sicht der Herrschaftsstruktur am stärksten geschlossene Gebiets-
komplex des Bleiburger Steuerbezirkes lag im Süden bzw. Südwesten. Er
umfasste die Katastralgemeinden Topla, Schwarzenbach, Wistra, Luderberg,
Jaworia, Jaswina, Platt, Mißdorf, Mißberg diesseits sowie Mißberg jenseits. In
diesem Gebiet mit einer Fläche von 5.187,28 ha verfügten nur fünf Herrschaften
(Herrschaft Bleiburg, Pfarrhof Schwarzenbach, Stadtpfarrhof Bleiburg, Pfarrkir-
che St. Michael und Kirche Unterdrauburg) über Grundbesitz. Ein zweites relativ
geschlossenes, aber kleineres Territorium fand sich im Norden. Dieses umfasste
eine Fläche von 1.487,36 ha, erstreckte sich über die Katastralgemeinden St. Mar-
garethen, Weißenstein und Jamnitzen und wies lediglich drei verschiedene
Grundherrschaften (Herrschaft Bleiburg, Landschaft, Kirche St. Daniel) auf. Eine
solche Strukturierung war in Innerösterreich die Ausnahme und nicht die Regel.
Den größten Flächenanteil im Steuerbezirk hatte die Grundherrschaft Blei-
burg mit einer Fläche von 24.878,25 ha, gefolgt von der Herrschaft Sonnegg
(2.893,27 ha), und der Herrschaft Eberndorf (989,34 ha). Unter den geistlichen
Herrschaften ragte der Pfarrhof Maria am See als flächenmäßig größtes Domi-
nium heraus. Dieses umfasste 604,73 ha. Die anderen geistlichen Gülten waren
kleiner und die Unterschiede innerhalb dieser erheblich. So betrug der steu-
erbare Besitz der Kirche Ursulaberg 299,84 ha, jener der Pfarrkirche Bleiburg
264,49 ha, hingegen im Falle der Kirche St. Andrä zu Unterdrauburg lediglich
0,63 ha. Die großen flächenmäßigen Differenzen zwischen den einzelnen
Proof
126
Grundherrschaften spiegeln sich in den jährlichen Reinerträgen aus der agra-
rischen Produktion wider. Diese variierten zwischen 36.188 fl. 33 kr. (Herrschaft
Bleiburg) und 1 fl. 38 kr. (Kirche St. Andrä zu Unterdrauburg) (KLA Klagenfurt,
Grundparzellenprotokolle der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Blei-
burg). Auffallend groß war die Anzahl der geistlichen Herrschaften – nicht nur
im Steuerbezirk Bleiburg, sondern in Innerösterreich. Das lässt sich u. a. damit
erklären, dass das Leben in einer geistlichen Herrschaft von den Untertanen
als angenehmer empfunden wurde als in den weltlichen Domänen. So fiel in
einem geistlichen Dominium die Robotbelastung meist geringer aus als einem
weltlichen, weil die Seelsorger die von den Untertanen zwangsweise zu verrich-
tenden Arbeitsverpflichtungen als nachteilig empfanden und auf diese nicht so
bedacht waren. Ein weiteres Element war die Umwandlung der Robotleistungen
in Naturalabgaben unter Kaiser Joseph II. Diese befreite die Untertanen der Kir-
chen- und Pfarrgülten von ihren Robotverpflichtungen (vgl. Wadl 1995, S. 67 ff.).
Wie im Falle der Grundherrschaften im Steuerbezirk Bleiburg war auch im übri-
gen Kärnten, in Krain und in der Steiermark der Großteil der Herrschaften und
Gülten dem Kleinstbesitz zuzuordnen. Meist betrug die nutzbare Fläche weniger
als 100 ha. Von den im Steuerbezirk Bleiburg begüterten Dominien überschritt
der Grundbesitz von nur 38 Herrschaften die 100 ha-Marke. Einen Besitz von 100
bis 500 ha erreichten 29 Grundherrschaften, 500 bis 1.000 ha Fläche besaßen
neun Herrschaften, davon acht weltliche und eine geistliche. Größere Grund-
herrschaften wie jene von Sonnegg und Bleiburg waren in Innerösterreich sel-
ten. Ein Blick auf die Kulturflächenverteilung der großen Dominien zeigt, dass
in ihnen mit Abstand die Waldflächen überwogen. Die Herrschaft Bleiburg ver-
fügte im Steuerbezirk über 11.967,2 ha Waldbesitz, gefolgt von den Hutweideflä-
chen mit 7.469,9 ha, den Äckern mit 2.340,4 ha und den Wiesen mit 2.064,1 ha.
Die Herrschaft Sonnegg besaß 1.294,5 ha Wald, 763,8 ha Ackerflächen, 431,7 ha
Hutweiden und 327,5 ha Wiesen. Gemessen an der Gesamtfläche der beiden Herr-
schaften machten die Waldflächen fast die Hälfte des Besitzes aus (Herrschaft
Bleiburg 48,2 Prozent; Herrschaft Sonnegg 44,7 Prozent). Beachtlich groß war
gleichfalls der Flächenanteil der Hutweiden. Im Falle der Herrschaft Bleiburg lag
dieser bei 30 Prozent der Gesamtfläche. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass
die Herrschaften einen entsprechenden Gewinn aus ihrer Größe erzielen konn-
ten. Denn sowohl bei den Hochwäldern als auch bei den Hutweiden handelte es
sich um Kulturgattungen, deren finanzieller Ertrag im Vergleich zu den Acker-
erträgen niedrig ausfiel. Aber zur Versorgung der Montanindustrie bildeten die
Wälder eine unentbehrliche Ressource, die letztlich angesichts der Nachfrage
nach Holz eine solide Einnahmequelle bildete – auch weil aufgrund des Holz-
mangels im späten Vormärz die Preise zu steigen begannen.
Proof
127
3.2.3 Die agrarwirtschaftliche Situation im Steuerbezirk Bleiburg: paradigmatisch für Innerösterreich?
a) Verteilung und Reinerträge des agrarischen Nutzlandes
Die Agrar- und Forstwirtschaft stellte im frühen 19. Jahrhundert den wirt-
schaftlichen Hauptzweig der Alpen-Adria-Region dar. Im Steuerbezirk Bleiburg
umfasste die landwirtschaftliche Nutzfläche 22.819,45 ha, während sich die
Waldflächen (Hoch- und Niederwald) auf 20.603,47 ha beliefen. Zum landwirt-
schaftlichen Nutzland gehörten neben den Äckern, Wiesen und Hutweiden auch
Gärten, Weingärten, Egärten, Auen sowie Weiden mit Obstbäumen(Tab. 3.2).
KulturgattungFläche Jährlicher Reinertrag
ha fl. kr.
Äcker 7.093,3 60.106 2
Wiesen 4.292,8 24.235 9
Hutweiden 10.709,2 8055 27
Kleine Gärten 53,6 802 33
Große Gärten 31,4 468 46
Hochwälder 20.588,6 8.275 52
Auen 39,1 31 7
Weiden und Obst 213,6 1259 29
Egärten 386,4 1.464 1
Niederwälder 14,8 6 52
Summe 43.422,8 104.705 18
Tab. 3.2 Verteilung der Kulturflächen und jährlicher Reinertrag, um 1830 (Quelle: KLA Klagenfurt, Grundparzellenprotokolle der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg).
Das flächenmäßig umfangreichste Gebiet unter dem landwirtschaftlichen
Nutzland nahmen die Hutweiden ein (10.709,2 ha), gefolgt von den Äckern
(7.093,3 ha) und Wiesen (4.292,8 ha). Die übrigen Kulturgattungen (Auen,
Egärten, Gärten, Weingärten, Weiden mit Obstbäumen) waren dagegen klein
(724,2 ha) und wirtschaftlich unbedeutend. Wenig rentabel waren, ungeachtet
ihrer Größe, die forstwirtschaftlichen Flächen.
Gemessen an der gesamten land- und forstwirtschaftlichen Fläche im Steuerbe-
zirk Bleiburg nahmen die Äcker 16 Prozent, die Wiesen 9,9 Prozent, die Hutweiden
24,7 Prozent, die Egärten 0,9 Prozent und die übrigen Kulturgattungen (Gärten,
Proof
128
Weingärten, Auen, Hutweiden mit Obstbäumen) nur 0,8 Prozent ein. Der pro-
zentuelle Anteil der Hoch- und Niederwälder lag bei 47,5 Prozent. Der Rest war
Ödland. Mangels entsprechender forstwirtschaftlicher Kenntnisse, aber auch
aufgrund des Mangels an entsprechendem Gerät wurde das Waldland wenig
gepflegt. Entsprechend gering fiel der Reinertrag aus. Dieser wurde mit 8.282 fl.
44 kr. bewertet. Das waren nur 7,9 Prozent des gesamten agrarischen Reinertra-
ges. Den höchsten Reinertrag erbrachten die Äcker. 57 Prozent des Gesamtrein-
ertrages entfielen auf das Ackerland, gefolgt von den Wiesen (23,2 Prozent), den
Hutweiden (7,7 Prozent) sowie den Gärten, Auen, Hutweiden mit Obstbäumen
und Egärten (3,9 Prozent). Dem zu Folge lieferte pro Jahr 1 ha Ackerfläche einen
Reinertrag von 8 fl. 28 kr., während jener im Falle der Wiesen bei 5 fl. 39 kr. und
der Hutweiden bei 45 kr. lag und beim Wald nur 24 kr. betrug. Als Vergleichswert
zum Reinertrag der Nutzfläche sei der Verdienst eines Handwerkers bzw. Taglöh-
ners angeführt. Dieser verdiente täglich ohne Kost und Logis zwischen 12 kr. (KG
Heiligenstadt) und 30 kr. (KG St. Margarethen). In der KG Moos wurde außerdem
der Verdienst weiblicher Aushilfsarbeiterinnen (Schnitterinnen) angegeben.
Ohne Kost kamen diese pro Tag auf 15 kr. Mit der Verpflegung sank der Verdienst
der Arbeiter. Dieser lag dann zwischen 7 kr. (KG Graditschach) und 10 kr. (KG Hei-
ligenstadt, Lavamünd). Aufgrund der gebietsweise zu geringen Zahl an Arbeits-
kräften kam es vor, dass Arbeitskräfte aus den benachbarten Katastralgemeinden
bzw. aus dem benachbarten Krain herbeigeholt werden mussten. Nur in wenigen
Katastralgemeinden (KG Feistritz, Kömel, Moos, Rinkenberg) waren genügend
Arbeitskräfte (Taglöhner) vorhanden (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuere-
laborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg). Der Gesamtar-
beitsaufwand für die Agrarprodukte – vom Anbau über die Kultivierung bis zur
Ernte – betrug 2.501,29 Tage „gemeine Handarbeit“ à 10–12 kr. und 430,48 Tage à
15–18 kr. „besondere Handarbeit“. Davon entfielen 718,68 Tage „gemeine Hand-
arbeit“ und 337,9 Tage „besondere Handarbeit“ auf die Wiesen. Aufwändiger
war die Kultivierung der Äcker. Diese umfasste neben 1.782,61 Tagen „gemeine“
und 92,58 Tagen „besondere Handarbeit“ zusätzlich noch 8,69 Tage Zugarbeit
mit einem Ochsen, 408,31 Tage Zugarbeit mit zwei Ochsen sowie 139,64 Tage
Zugarbeit mit drei Ochsen (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der
Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, Tabelle: „Zusammenstellung
des gesammten Cultur Aufwandes beim Acker-, Wiesen- und Weidelande“).
b) Grundherrschaftliche Kulturflächenverteilung
Die Relationen zwischen der Gesamtflächen- und der Kulturflächenvertei-
lung, bezogen auf die Herrschaften, waren nahezu ident. An Flächenmaß und
Ernteertrag lag die Herrschaft Bleiburg an vorderster Stelle, gefolgt von der
Proof
129
Herrschaft Sonnegg. Bei einer land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche von
43.422,8 ha entfielen 56 Prozent auf die Herrschaft Bleiburg, während Sonn-
egg als die flächenmäßig zweitgrößte Grundherrschaft des Steuerbezirkes nur
sechs Prozent des Nutzlandes umfasste. Ähnlich verhielt es sich hinsichtlich
des Ernteertrages. An jährlichen Reinertrag erwirtschafteten die Bauern des
Steuerbezirkes summa summarum 104.705 fl. 18 kr. Nicht weniger als 35 Pro-
zent dieses Betrages – das waren 37.093 fl. 54 kr. – wurde auf den Besitzungen
der Herrschaft Bleiburg erwirtschaftet. Der Sonnegger Besitz erbrachte nur
acht Prozent oder 9.254 fl. 33 kr.
c) Die Agrarproduktion: gemächliche Modernisierung
Die Landwirtschaft des Steuerbezirkes Bleiburg stützte sich vorwiegend auf den
Ackerbau. Dieser erbrachte die größten Gewinne. Zu den Hauptanbaufrüchten
zählten Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Heiden. Nicht unbedeutend war – das
ist ein Indiz für einen fortschrittlichen Ackerbau – die Verbreitung des Mais-,
Kartoffel- und Kleeanbaus. In einigen Katastralgemeinden (Aichdorf, Bleiburg,
Dobraua, Gamsenegg, Gutenstein, Lavamünd, Mißdorf, Moos, Nauerschnig-
gupf, Neuhaus, Oberloibach, Penk, Pfarrdorf, Pollain, Pudlach, Rinkenberg, St.
Michael, Schwabegg, Schwarzenbach, Seloutz, Traundorf, Tscherberg, Unterort)
zählten diese Pflanzen sogar zu jenen Früchten, deren Anbau „in größerer Aus-
dehnung“ betrieben wurde (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der
Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 9: Grunderzeugnisse). Weni-
ger rentabel waren dagegen die Hutweiden, die sich auf den Steilhängen der
Petzen befanden. Andererseits gab es Gegenden, die sich aufgrund ihrer Höhen-
lage und Bodenbeschaffenheit auf eine Intensivierung des Grünlandes stützen
mussten. Dieses lieferte Heu bzw. Grummet, oder man pflanzte Klee an, um den
Nährstoffgehalt im Boden zu verbessern. Das war für den Ackerbau bahnbre-
chend. Dadurch konnte eine zweijährige Nutzung erfolgen, und es lassen sich
Hinweise dafür finden, dass die traditionelle Dreifelderwirtschaft verschwand
(vgl. Drobesch 2003, S. 99). Ebenso stellte die Kleefütterung die Grundlage für die
ganzjährige Stallfütterung des Viehs dar. Der positive Effekt war, dass nun aus-
reichend Dünger vorhanden war. Damit konnte das Wachstum und die Menge
der Ackerfrüchte gesteigert werden (vgl. Drobesch 2003, S. 100). Förderlich war
gleichfalls der Anbau des Mais. Einerseits wurde damit das Fruchtfolgesystem
verbessert, andererseits diente der Mais zur Viehfütterung. Aufgrund der reich-
lichen Nährstoffe und seines hohen Sättigungsgrades wurde er für die Tier-
mastung immer wichtiger. Ähnlich verhielt es sich mit der Kartoffel mit ihrem
hohen Kohlenhydratgehalt. Sie war allerdings für Krankheiten (Kartoffelfäule)
empfänglich. Nichts desto trotz eignete sie sich für das sich im Wandel befind-
Proof
130
liche Anbausystem von der Dreifelder- zur Fruchtwechselwirtschaft hervor-
ragend. Ihre Kultur erforderte kein teures Gerät, kein Zugvieh, sie konnte von
Frauen und Kindern bearbeitet werden und erbrachte hohe Erträge (vgl. Sand-
gruber 1982, S. 149). Verfüttert wurde sie insbesondere an Schweine. Die Kartoffel
war nicht nur wegen ihrer hohen Flächenproduktivität geschätzt, sondern auch
wegen des geringen Aufwands in der Weiterverarbeitung. So drang sie vermehrt
als Lebensmittel in die bäuerlichen, aber auch bürgerlichen Haushalte ein. Ver-
breitet war auch der Anbau von „Mischling“ (bestehend aus Wicken und Hafer)
und Pfennich. In geringerer Ausdehnung baute man Hirse, Lein (Flachs), Linsen,
Kraut und Rüben an. Eine Rarität war der Anbau von Weberkarden und Krapp.
Das eine dient dem Aufrauen von Wollgeweben, das andere zum Einfärben von
Textilien. Weinbau wurde nur in der Katastralgemeinde Aich betrieben. Die aus
den Trauben gewonnene Menge Wein war unbedeutend, auch war die Qualität
des Weines aufgrund der ungünstigen klimatischen Bedingungen nicht gut (vgl.
KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbe-
zirkes Bleiburg, § 9: Grunderzeugnisse).
Für die Bearbeitung waren die Böden sehr unvorteilhaft, auch weil man in der
agrartechnologischen Entwicklung dem neuesten Stand hinterher hinkte. Außer
der hölzernen Arl wurden keine anderen Ackergeräte eingesetzt. Der moderne
Pflug wurde – wie allgemein in Innerösterreich – selten verwendet (Abb. 3.1).
Abb. 3.1 Der „Anhäufe“-Pflug (Quelle: Blätter für Landwirthschaft und Industrie 1833/2).
Proof
131
Im Steuerbezirk Bleiburg kam er „vorzüglich“ in der Katastralgemeinde Lava-
münd zum Einsatz und in einigen Katastralgemeinden selten (vgl. KLA Kla-
genfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes
Bleiburg, § 10: Cultur des Bodens). Sowohl die Arl als auch der Pflug wurden mit
Ochsen- und selten mit Pferdegespann gezogen. Des Weiteren verwendete man
Sicheln zum Getreideschneiden, Walzen, Dreschflegel und eine Windmühle
zum Trennen der Getreidehülsen von den Körnern, Krummhauen, hölzerne
Rechen, Sensen sowie Heu- und Düngegabeln (vgl. Drobesch 2003, S. 110 f.). Diese
Arbeitsgeräte waren mehrheitlich noch immer aus Holz gefertigt. Eiserne Geräte
waren nur selten anzutreffen. Zum Transport verwendete man traditionell den
Buckelkorb, zum Fahren gab es ein- und zweirädrige Karren, sowie die vierräd-
rigen Ochsen- und Pferdewagen. Letztere waren für die Bauern wichtig, sicherte
doch den meisten bäuerlichen Wirtschaften das Fuhrwerk als Nebengewerbe
einen (über)lebenswichtigen Zusatzverdienst (vgl. Dinklage et al. 1966, S. 147 ff.).
Neben dem Geräteeinsatz war für die agrarische Produktion das Anbausystem
entscheidend. Der Übergang von der Dreifelderwirtschaft hin zu einer effek-
tiveren Fruchtwechselwirtschaft wurde von den Bauern und Grundherren
nur zögerlich vollzogen. Insbesondere für Kärnten war ein Grund dafür der
Umstand, dass es im Gegensatz zur Steiermark an Dünger mangelte, was auf die
geringe Weidehaltung der Tiere zurück zu führen war (vgl. KLA Klagenfurt, Kata-
stralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 4:
Viehstand). Gedüngt wurden nur die Flächen in guter Lage und mit fruchtbaren
Böden. Dabei handelte es sich vorwiegend um Äcker in den Katastralgemeinden
Bleiburg, Gamsenegg, Gutenstein, Jaswina, Kömel, Lavamünd, Luderberg, Miß-
berg diesseits, Mißdorf, Schwarzenbach, Tscherberg, Werdiniach und Wistra.
Die Düngermenge variierte. Verteilt auf einen Hektar Ackerland waren es in der
Katastralgemeinde Gutenstein 38.960,70 kg, in der Katastralgemeinde Schwar-
zenbach dagegen nur 4.870,09 kg (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate
der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, Vortrags-Protokolle des
Franziszeischen Katasters: Düngung des Ackerlandes, Äcker I. Klasse).
Die Einführung von agrarischen Innovationen war – wie in Innerösterreich
allgemein – ein mühsamer Prozess. Es waren meist die Verhältnisse, wel-
che die Landwirte zwangen, sich die Innovationen zu Nutze zu machen (vgl.
Dinklage et al. 1966, S. 175). Nur wenn der Vorteil für die Bauernschaft evident
war, übernahmen die Bauern neue Anbausysteme oder Agrartechnologien. In
diese Richtung wirkten wie auch in Krain und der Steiermark die Initiativen
der „Kärntner Ackerbaugesellschaft“ (Bäck 2005, S. 74 ff.). Mit dem Kartoffel-,
Mais- und Kleeanbau sowie dem System der Fruchtwechselwirtschaft setzten
Proof
132
sich im Bleiburger Steuerbezirk und in Innerösterreich im ausgehenden Vor-
märz gemächlich Neuerungen durch. Zu einer „rationellen Intensivierung“ der
Agrarproduktion kam es aber nicht, weil zum einen das notwendige Kapital
für Investitionen fehlte und zum anderen die Modernisierungsskepsis über-
wog. Das galt auch für die Waldwirtschaft.
d) Forstwirtschaft: Wildnis im Wald
Bei Innerösterreich handelte es sich ebenso wie beim Steuerbezirk Bleiburg um
ein waldreiches Gebiet. Allerdings war die Forstwirtschaft ein Sektor, der im
Vergleich zur Ackerwirtschaft nur eine marginale Rolle spielte. Die Kultivie-
rung der Wälder wurde vernachlässigt. Im Steuerbezirk Bleiburg umfasste die
Forstwirtschaft eine Fläche von 20.603,47 ha (vgl. KLA Klagenfurt, Katastral-
steuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, Grund-
parzellenprotokolle). Das waren 47,5 Prozent der Gesamtfläche des Steuerbezir-
kes und entsprach den innerösterreichischen Verhältnissen. In der Steiermark
lag der Waldanteil gleichfalls bei nahezu 50 Prozent, in Krain und Kärnten
war er etwas geringer (vgl. Drobesch 2003, S. 87). Überall wurden die Wälder
kaum gepflegt. Eine geregelte Waldwirtschaft bzw. geplante Aufforstung fand
nicht statt. Oft dienten die Waldflächen als Weiden für die Schafe und Ziegen.
Entsprechend groß war die Schädigung der Wälder aufgrund des Verbisses
und des Auftretens des Waldbodens. Daher blieb der jährliche Holzzuwachs
sehr gering. So lag er bei den Hochwäldern (Fichten, Kiefern Weißkiefern, teil-
weise Buchen, Lärchen, Tannen und Birken) der I. Schätzungsklasse zwischen
3,22 m3 (KG Gamsenegg, KG Gutenstein) und 6,92 m3 (KG Mißberg diesseits) pro
Hektar (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemein-
den des Steuerbezirkes Bleiburg, Waldschätzungselaborat, § 1: Hochwälder I.
Klasse). Unbedeutend war mit einer Fläche von 14,82 ha der Bestand an Nieder-
wäldern (Hainbuchen, Erlen). Ihr Holz diente der Herstellung von Wirtschafts-
geräten und als Brennholz (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der
Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, Waldschätzungselaborat,
§ 2: Niederwälder). Ursprünglich bestand der Steuerbezirk vorwiegend aus
Eichenwäldern, worauf die Ortsnamen und Landschaftsbezeichnungen Aich,
Aichdorf und Dobraua verweisen. Diese Eichenwälder gab es zu Beginn des 19.
Jahrhunderts nicht mehr. Der Grund war die Schweinehaltung. Die Eichenwäl-
der dienten als Weidestätten für die Schweine. Die Schäden waren teils enorm.
Das Weiden der Schweine verhinderte ein Nachwachsen der Eichen, weil der
Bestand geschädigt wurde. In Verbindung mit dem zunehmenden Rückgang
des Nährstoffgehaltes des Bodens verschwanden die Eichen, und die weniger
anspruchsvollen Kiefern begannen sich zu verbreiten. An die Stelle der Laub-
Proof
133
wälder traten Nadelwälder (vgl. Smole 2008, S. 15). Von einer systematischen
Bewirtschaftung konnte aber nach wie vor keine Rede sein. Vielfach handelte
es sich um Plenterwälder. Eine geregelte, planvolle Schlagwirtschaft gab es
kaum. Nur zu oft wurden wie im Falle der Katastralgemeinden Bleiburg und
Neuhaus die Stämme willkürlich, je nach Bedarf aus den Wäldern herausge-
fällt. Oft wurden ganze Flächen kahl geschlagen (KG Bleiburg, Platt, Ursula-
berg, Wistra). Aufgrund der Plenterwirtschaft waren die Waldbestände gelich-
tet und wiesen altersmäßig große Unterschiede auf. In einigen Katastralge-
meinden (KG Bleiburg, Mißberg diesseits, Moos, Weißenstein, Wistra) waren
in allen Altersklassen schüttere Bestände vorzufinden. Gut geschlossene,
junge Waldbestände waren selten (KG Platt, Prevali, Schwabegg) (vgl. KLA Kla-
genfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes
Bleiburg, Waldschätzungselaborat, § 1: Hochwälder I. Klasse). Das stellte für die
Zukunft der Forstwirtschaft ein erhebliches Manko dar.
Ein Holzverkauf fand aufgrund der Beschwerlichkeiten bei der Bringung und
des geringen Zuwachses kaum statt. Soferne ein Holzüberschuss zustande kam,
verkaufte man diesen, teils bereits als Holzkohle, an die holzarmen Katastralge-
meinden in der Umgebung und an die Gewerkschaften in der Mieß, Schwarzen-
bach, Streiteben, Lippitzbach oder an das Hauser’sche Sensenwerk in der Steier-
mark. Ein anderer Teil wurde über die Drau nach Marburg zum Verkauf verflößt.
Einige wenige Katastralgemeinden (KG Jaswina) verkauften ihre geradwüchsi-
gen Lärchenstämme an Holzhändler aus Triest (Trieste, Trst), wo sie für den
Schiffsbau benötigt wurden (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der
Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 1: Hochwälder, I. Klasse).
e) Viehwirtschaft: beginnende Vermehrung
Es lässt sich festhalten: „In der innerösterreichischen Landwirtschaft vollzog
sich der Übergang zu einer planmäßigen Tierzucht und zu einer Veredelungs-
wirtschaft nur langsam. Es gestaltete sich […] die Zucht von Pferden, die zur
leistungssteigernden Ausstattung eines landwirtschaftlichen Betriebes gehör-
ten, nur mühsam. Auch die Rinderzucht kam nur langsam in Schwung. Erst
gegen Ende der 1820er Jahre lässt sich ein Trend in Richtung Vermehrung der
Zahl der gehaltenen Tiere“ (Drobesch 2003, S. 100) feststellen. Das trifft auch
– wenngleich mit Einschränkungen – für den Steuerbezirk Bleiburg zu, wo es
von 1830 bis 1832 zu einem markanten Anstieg allerdings nur bei den Schafen
von 4.647 auf 6.896 Stück kam (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate
der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 4: Viehstand). Die Zahl
der Pferde, Ochsen und Kühe verringerte sich sogar geringfügig (Tab. 3.3).
Proof
134
Viehbestand
Tierart 1830 1832
Pferde 433 406
Fohlen 34 16
Ochsen 2.187 2.055
Stiere k.A. 59
Kühe 2.935 2.793
Jungvieh k.A. 1.715
Schafe 4.647 6.896
Ziegen & Böcke k.A. 545
Schweine k.A. 3.725
SUMME 10.236 18.210
Tab. 3.3 Anzahl der Nutz- und Zuchttiere (Quelle: KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 4: Viehstand).
Da die Erfassung der Viehbestände für die Zeit des Vormärz nur für Stichjahre
möglich ist und diese meist auf Schätzungen basiert (vgl. Drobesch 2003, S. 100),
können die Zahlen für den Steuerbezirk Bleiburg nur als näherungsweise Anga-
ben angesehen werden. Dennoch geht aus den Zahlen hervor, dass Pferde als ein
„Luxusgut“ betrachtet wurden. In den Katastralschätzungselaboraten gibt es
Hinweise auf „leichte“ Fuhrpferde. Vor allem für den Warentransport, Gewerbe-,
Fracht- und „Industrial“fuhren wurden diese benötigt. Die Pferde wurden nicht
im Steuerbezirk gezüchtet, sondern aus den Nachbargegenden zugekauft. Die
große Anzahl an Ochsen verweist darauf, dass man für die Feldarbeit nach wie
vor auf diese setzte. Dem Einsatz des Pferdes stand man skeptisch gegenüber.
Arbeits- und Kostennutzen wurden bezweifelt. Man erblickte keine Vorteile im
Einsatz des (teuren) Pferdes gegenüber dem (billigen) Ochsen. Was die Pferde
durch ihre Kraft und ihren schnelleren Gang mehr leisteten – so die Argumenta-
tion -, wurde durch den erhöhten Verbrauch an Geschirr und dessen Abnützung
aufgewogen. Daher zog man die Ochsen noch immer zur Feldarbeit heran. Erst
ab den 1840er Jahren griffen die Bauern vermehrt auf Pferde zur Bearbeitung der
Felder zurück. Die Folge war eine Steigerung der Arbeitsleistung und eine Erhö-
hung der Produktivität. Durchschnittlich konnten zwei Pferde im flachen Acker-
land an einem Tag ein Joch (= 0,575 ha) umpflügen, ein vierspänniges Ochsenge-
spann dagegen nur ein halbes Joch. Die Pferdehaltung hatte Auswirkungen auf
die Rinderzucht. Denn die Pferdefütterung, insbesondere mit Klee und Hafer,
ging zu Lasten der Rinder. Auch konnten mit dem Futter für ein Pferd eineinhalb
Kühe versorgt werden (vgl. Drobesch 2003, S. 101 ff.).
Proof
135
Auffallend ist die große Anzahl an Schweinen (3.725 Stück), von denen 3.265
Stück als Zuchtschweine ausgewiesen wurden. Ob es sich hierbei tatsächlich
ausschließlich um Zuchtschweine handelte, ist zu bezweifeln. Nur „hin und
wieder“ – so die Katastralschätzungsbeamten – wurden sie auf den Wochen-
märkten in Klagenfurt und Völkermarkt verkauft. Gewöhnlich dienten sie zur
Deckung des eigenen Fleisch- und Fettbedarfes. Groß war die Zahl an Schafen
(6.896 Stück), was im Zusammenhang mit den topographischen Gegebenhei-
ten zu sehen ist und mit der klein(st)betrieblichen Struktur der Bauernwirt-
schaften zusammenhängt. Denn es waren die Schafe, welche die kargen Steil-
flächen abweideten, und es waren vor allem jene Katastralgemeinden in den
Hochgebirgsgegenden im Süden, die eine große Schafzahl aufwiesen, wie etwa
die Katastralgemeinde Unterort mit 1.800 „feinen“ Schafen und 333 „gemei-
nen“ Schafen. Die Tiere wurden teils zur Deckung des eigenen Fleischbedarfs
gehalten, teils auf dem Bleiburger Herbstmarkt an Fleischer „aus der Ferne“,
an Wirte oder an die Moro’sche Tuchfabrik in Viktring verkauft, wo ihre Wolle
zu Loden und Strümpfen verarbeitet wurde. Ziegen („Keuschlerkühe“) wurden
ausschließlich von Keuschlern und „Inleuten“ zur Milch- und Fleischnutzung
gehalten und dienten im Wesentlichen der Befriedigung subsistenzwirtschaft-
licher Bedürfnisse.
Über das Hornvieh wurde berichtet, dass es von leichtem Landschlag bzw.
„stärkerer Bergrasse“ sei, „ziemlich hochbeinig, schmal in Kreuz und Brust,
theils weißer, theils röthlicher Farbe“ (KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelabo-
rat der KG Rinkenberg, § 4: Viehstand). Hierbei handelte es sich um eine aus
dem Raum Mittelkärnten stammende Rasse, die Ende des 18. Jahrhunderts
auf dem Gut Mayerhofen im Metnitztal gezüchtet wurde. Im Unterkärntner
Raum war allerdings eine Rasse verbreitet, die mit denselben Merkmalen und
Eigenschaften beschrieben wurde, aber unter der Bezeichnung „Lavanttaler“
bekannt war (vgl. Wilckens 1876). Bei den Rindern mit rötlicher Fellfarbe han-
delte es sich wohl um die robusten, widerstands- und leistungsfähigen Pinz-
gauer, die sowohl der Fleisch- als auch Milchproduktion dienten. Während der
Sommermonate und des Herbstes war der Weidegang des Hornviehs üblich,
das auf den Weiden- und Waldflächen gehalten und nur teilweise während der
Nacht in die Stallungen gebracht wurde (Abb. 3.2).
Proof
136
Abb. 3.2 Viehweide vor der Stadt Wolfsberg (aus: Wagner 1844, S. 42).
Von den größeren Besitzungen im Steuerbezirk wurden im Durchschnitt ein
bis drei Pferde, zwei bis sechs Ochsen, zwei bis acht Kühe, zwei bis sechs
Stück Jungvieh, sechs bis 100 Schafe sowie zwei bis 15 Schweine gehalten
(vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der KG Topla und KG Podkrai,
§ 4: Viehstand). Die größeren Landwirtschaften hielten zwischen 15 und 138
Tiere. Im Hinblick auf die herrschenden Arbeitsbedingungen war das nicht
wenig. Aber es gab auch viele Kleinbauernwirtschaften. Diese hielten um
die Hälfte weniger Vieh als die größeren Bauernhöfe, und der Viehbestand
der Keuschler beschränkte sich auf eine Kuh und ein Mastschwein bzw. ein
paar Schafe und/ oder Ziegen (vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate
der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 4: Viehstand). Damit
hatte eine Bauernfamilie ihr Auskommen.
3.2.4 Die gesellschaftliche Situation: bäuerliche Welten mit bürgerlichen Oasen
Die Bevölkerungszählung des Jahres 1830 ergab, dass im Steuerbezirk Bleiburg
auf einer Fläche von 443,26 km2 vgl. (KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelabo-
rate der Katastralgemeinden des Steuerbezirkes Bleiburg, § 1: Topographie)
13.291 Einwohner – davon 6.561 männliche und 6.730 weibliche – lebten (vgl.
KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des Steu-
erbezirkes Bleiburg, § 3: Bevölkerung). Das ergab eine Bevölkerungsdichte
Proof
137
von 30 Personen je Quadratkilometer. Am dichtesten besiedelt waren die
Katastralgemeinden Gutenstein (527 Einwohner/km2), Mißdorf (352 Einwoh-
ner/km2), Bleiburg (266 Einwohner/km2), Schwarzenbach (116 Einwohner/
km2) und Lavamünd (113 Einwohner/km2). Bei diesen Katastralgemeinden
handelte es sich einerseits um die mit dem Stadt- bzw. Marktrecht ausgestat-
teten Orte (Markt Gutenstein, Stadt Bleiburg, Markt Lavamünd), andererseits
um Orte, in denen sich „Industrial“-Unternehmen mit einem entsprechen-
den Arbeitskräftebedarf befanden. Der übrige Steuerbezirk – und das war der
größte Teil – war mit 4 bis 86 Einwohnern je Quadratkilometer dünn besie-
delt. Bei den Katastralgemeinden Topla (4 Einwohner/km2), Wistra, Unterort
(8 Einwohner/km2), Luderberg (9 Einwohner/km2), Ursulaberg (10 Einwohner/
km2) handelte es sich um Hochgebirgsgegenden im Süden, die aufgrund ihrer
topographischen und klimatischen Gegebenheiten nur wenigen Menschen
einen Lebensraum boten.
Die 13.291 Einwohner des Steuerbezirkes Bleiburg bildeten 2.453 Familien-
verbände, von welchen 1.791 (73 Prozent) ausschließlich im primären Sektor
beschäftigt waren. In den meisten Katastralgemeinden (Heiligenstadt, Jam-
nitzen, Luderberg, Mißberg jenseits, Podkrai, Schöllenberg, Weißenstein,
Werdiniach, Wistra, Woroujach) lebten die Familien ausschließlich von
der Landwirtschaft – und das nach subsistenzwirtschaftlichen Prinzipien:
einfach und bescheiden. Kleinst- und Kleinbetriebe dominierten. Die 1.543
„Bestiftungen“ des Steuerbezirkes verteilten sich auf 583 Ganzhuben, 138 Drei-
viertel-, 273 Halb- und 217 Viertelhuben sowie 332 Keuschen. Die Besitzgröße
dieser „Bestiftungen“ variierte je nach Katastralgemeinde. Bei den Ganzhüb-
lern lag sie zwischen 1,2 ha und 460 ha, bei den Dreiviertelhüblern zwischen
3,5 ha und 104,7 ha, bei den Halbhüblern zwischen 0,6 ha und 117,3 ha, bei
den Viertelhüblern zwischen 0,4 ha und 117,3 ha und bei den Keuschlern
zwischen 0,06 ha und 32,2 ha. In manchen Katastralgemeinden übertrafen
die kleineren „Bestiftungen“ die nächst größere „Bestiftung“ im Flächenum-
fang. Diese Tatsache war ein Ausdruck der Bonität. Je besser die Bodengüte,
desto höher der Ertrag und desto höher die Klassifizierung des Grundstückes
(vgl. KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborate der Katastralgemeinden des
Steuerbezirkes Bleiburg, § 12: Gattung des Grundeigenthumes, Anzahl der
Bestiftungen). Die Agrarwirtschaft überragte den sekundären und tertiären
Sektor. Der Anteil des Gewerbes und der Industrie sowie des Dienstleistungs-
sektors war gering. Um 1830 engagierten sich nur 378 Familien sowohl in der
Landwirtschaft als auch im Gewerbe, und lediglich 221 waren ausschließ-
lich Gewerbe- bzw. „Industrial“treibende. 39 Personen waren als Geistliche,
Honoratioren, Beamte oder Lehrer Teil des in Ausformung begriffenen Bür-
Proof
138
gertums, Sieht man von den Geistlichen ab, lebten diese in der Stadt Bleiburg,
in den Märkten oder größeren Orten. Sie waren ein Indiz für die am fernen
Horizont sich ankündigende gesellschaftliche Modernisierung.
Mit der bescheidenen Lebens- und Wohnsituation gingen die Ernährungsge-
wohnheiten der ländlichen Bevölkerung einher. Für das Jahr 1832 wurde im Steue-
relaborat der Katastralgemeinde Bleiburg festgehalten: „Die Nahrung der hiesigen
Bewohner ist so wie ihre Beschäftigung verschieden, bestehet jedoch bey jenen
Leuten, welche sich mit der Landwirthschaft vorzüglich beschäftigen, aus Mehl-
speisen von Haidenmehl vorzüglich, Hirse- und Pfennichbreie, sonstigen Greisel-
werk, Kartoffeln und übrigen Gemüse, dann Milchspeisen. Fleischspeisen werden
von den mit der Landwirthschaft beschäftigten Familien außer den Fest- und Fey-
ertragen selten, von den übrigen jedoch häufiger genossen“ (KLA Klagenfurt, Kata-
stralsteuerelaborat der KG Bleiburg, § 3: Bevölkerung). Dementsprechend kärglich
waren die Grundzutaten der Hauptmahlzeiten und der wöchentliche Speiseplan,
wie etwa in der Katastralgemeinde Heiligenstadt (Tab. 3.4 und Tab. 3.5).
Speise Zutaten
Gefüllte Nudeln30 dag Weizenmehl, 30 dag Hirse, 1,5 l Milch, 0,25 l Rahm, 18 dag Speck oder Butterschmalz
Geschnittene Nudeln 60 dag Weizenmehl, 5 dag Speck oder Butterschmalz
Abgeschmalzene Nudeln 70 dag Mehl, 0,8 l Milch, 20 dag Speck
Gerstensuppe 15 dag Rollgerste, 5 dag Speck
Brotsuppe 0,5 kg Brot, 5 dag Speck
Milchbrei 30 dag Hirse, 2 l Milch, 3 dag Butterschmalz
Milchsuppe 0,5 l Milch, 15 dag Weizenmehl
Farferln 30 dag Weizenmehl, 2 l Milch, 5 dag Speck oder Butterschmalz
Milchkoch 60 dag Weizenmehl, 2 l Milch, 2 Eier, 3 dag Speck oder Butterschmalz
Heidensterz 60 dag Heidenmehl, 15 dag Speck
BrotMischbrot aus ½ Roggen- und ½ ‚Mischlingmehl’ (hauptsächlich Gerste)
Tab. 3.4 Grundzutaten ausgewählter Speisen (umgerechnet auf 4 Personen) (Quelle: KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborat der KG Heiligenstadt, § 3: Bevölkerung).
Proof
139
Morgen Mittag Jause Abend
MontagBrotsuppe ,Milch-brein und Brot
Heidensterz und Sauerkraut, Brot
Brot und Most Geschnittene Nudeln und Brotsuppe
DienstagBrotsuppe, Milch-brein und Brot
Abgeschmalzene Nudeln und Sau-erkraut, Brot
Brot und Most Gerstensuppe und Kartoffeln
MittwochBrotsuppe, Milch-brein und Brot
Heidensterz und Sauerkraut
Brot und MostMilchbrein und Farfeln
DonnerstagBrotsuppe, Milch-brein und Brot
Gefüllte Nudeln mit Sauerkraut
Brot und MostGerstensuppe und Milchbrein
Freitag Milchsuppe und Milchbrein
Milchkoch und Einbrennsuppe
Brot und Most Milchfarfeln, Kraut
Samstag Milchsuppe Geschnittene Nudeln und Milchsuppe
Brot und Most Gerstensuppe und Milchbrein
SonntagBrotsuppe, gefüllte Nudeln oder Rindfleisch
Geschnittene Nudeln und Sau-erkraut, Brot
Keine AngabenMilchbrein, Kartof-feln oder Farfeln
Tab. 3.5 Wochenspeiseplan der Katastralgemeinde Heiligenstadt 1833 (Quelle: KLA Klagenfurt, Katastralsteuerelaborat der KG Heiligenstadt, § 3: Bevölkerung).
Die Mahlzeiten der ländlichen Bevölkerung waren eintönig, aber unter dem
Strich doch sättigend. Verzehrt wurden vor allem Suppen, Sterz und Breie, die
auf den unterschiedlichen und vor Ort angebauten Getreidesorten basierten.
Ein Grund für diese Ernährungsgewohnheiten war neben wirtschaftlichen
Aspekten wohl der schlechte Zustand der Zähne. Nicht selten war es der Fall,
dass die Menschen bereits vor dem Erreichen des 30. Lebensjahres zahnlos
waren. Getreide als Stärkelieferant wurde täglich verzehrt, außerdem das
Vitamin-C-reiche Sauerkraut und Milch (vgl. Smole 2008, S. 136). Ebenso verar-
beitete man die Kartoffel zu unterschiedlichsten Speisen. Das Brot bestand aus
Roggen-, Gersten- und Hafermehl und wurde meist in Kombination mit Flüs-
sigkeiten in Form von Suppen oder Most eingenommen. Fleischspeisen kamen
selten auf den Tisch – außer an Feiertagen und zu besonderen festlichen Anläs-
sen. Ebenso sparte die Küche bei der Verwendung von Fett. Der Jahreskonsum
an Nahrungsmitteln einer Person stellte sich 1833 in der Katastralgemeinde
Heiligenstadt folgendermaßen dar: „12 kg Fleisch, 25 kg Fett, 26 Stück Eier, 4,5 l
Rahm, 245 l Milch, 150 l Most, 100 kg Sauerkraut, 45 kg Kartoffel, 120 kg Brot,
75 kg Weizenmehl, 32 kg Hirse, 15 kg Heidenmehl und 12 kg Rollgerste“ (Smole
2008, S. 137). Das war nicht viel, aber es reichte zum (Über-)Leben.
Proof
140
3.2.5 Ländlicher Alltag in subsistenzwirtschaftlichen Kategorien
Die Ökonomie Innerösterreichs und des Bleiburger Steuerbezirkes basierte
während des Vormärz nahezu ausschließlich auf der Landwirtschaft. Diese war
noch nicht auf eine marktwirtschaftliche, sondern subsistenzwirtschaftliche
Produktion ausgerichtet. Solange die Eigenversorgung gesichert war, hatten die
bäuerlichen Wirtschaften nur ein geringes Interesse daran, die traditionellen
Wirtschaftsweisen aufzugeben und zu modernisieren. Erst im Gefolge der Ver-
sorgungsengpässe nach 1815 war man bereit, die von der „Kärntner Ackerbau-
gesellschaft“ propagierten Neuerungen umzusetzen. Das ging nicht von heute
auf morgen. Nur langsam begann sich die Agrarwirtschaft des Bleiburger Steuer-
bezirkes sowie der innerösterreichischen Länder zu modernisieren. Mittels der
Einführung neuer Agrartechnologien und Anbausysteme konnte die Produktion
in kleinen Schritten gesteigert und die Produktivität erhöht werden. In Summe
handelte es sich um eine moderate Produktions- und Produktivitätssteigerung.
Ziel war und blieb die Befriedigung der regionalen Bedürfnisse. Für die Konkur-
renzwirtschaft eines größeren Marktes reichte das aber noch nicht. Dazu war
man zu kleinstrukturiert und produzierte zu wenig nach den modernen markt-
wirtschaftlichen Vorstellungen, auch weil Albrecht Thaers Prinzipien einer
„rationalen Landwirtschaft“ von der bäuerlichen Masse nicht rezipiert wurden.
Damit fügten sich die Grundherrschaft Bleiburg und der gleichnamige Steuerbe-
zirk in den Kontext der innerösterreichischen Länder und des Alpen-Adria-Rau-
mes ein. Auch hier lief man der ökonomischen Moderne, wie sie in Westeuropa
(England) und in den Ländern der Wenzelskrone bereits stattfand, hinterher.
Die Welt der Wirtschaft: industrielle Entwicklung und Unternehmertum im Gubernium Laibach im Vormärz (Ingrid Groß)
Die im Rahmen des Wiener Kongress (1814/ 1815) erfolgte Neuordnung Europas
tangierte auch die Industriewirtschaft der Alpen-Adria-Region und als Träger
dieser das Unternehmertum. Als dessen Repräsentant im Übergang von der
Proto-Industrie zur Industrie gilt im Sinne Joseph A. Schumpeters der „Entre-
preneur“, der für die ökonomische Modernisierung im Sinne kapitalistischer
Prinzipien verantwortlich zeichnet(e). Er rückte im Zuge der Industrialisierung
bzw. Industriellen Revolution in den Brennpunkt der ökonomischen Entwick-
lung. An ihm lässt sich zum einen das verbindende und trennende Element
innerhalb ökonomischer Prozesse darstellen, zum anderen der Frage nachge-
hen, ob er auch in der Alpen-Adria-Region, insbesondere im Gubernium Lai-
bach (Kärnten, Krain) als einem Teil von diesem, vorhanden war – und wenn
ja, wie stark dieser Unternehmertypus hier verbreitet war.
Proof
141
Der „Entrepreneur“ im Gubernium Laibach: ein unerschlossenes Forschungsfeld
Im Gegensatz zur Unternehmensgeschichtsforschung für den habsburgischen
Gesamtstaat, die im Zusammenhang mit der Bürgertumsforschung seit den
1970er-Jahren dem Unternehmertum als einem Segment des Wirtschaftsbür-
gertums eine größere Aufmerksamkeit schenkte, blieben Forschungsarbeiten
zur ökonomischen Entwicklung und zur Geschichte des Unternehmertums für
die Länder des Laibacher Guberniums ein vernachlässigtes Forschungsfeld.
Dennoch wird aus der einschlägigen Literatur über die ökonomische Entwick-
lung im Vormärz ersichtlich, dass Kärnten und Krain im frühen 19. Jahrhun-
dert eine andere Entwicklung nahmen als etwa die Länder der Wenzelskrone
oder Teile von Österreich ob und unter der Enns. Es erstaunt, dass angesichts
ihrer Bedeutung für die gesamtstaatliche Wirtschaft von der theresianisch-
josephinischen Epoche bis in den späten Vormärz eine sich auf beide Provinzen
erstreckende wissenschaftliche Untersuchung zur industriellen Entwicklung
fehlt. Aber auch einschlägige Studien auf Länderebene sind im Gegensatz zum
angrenzenden Küstenland mit dem Hafen Triest (Trieste, Trst) und zur Steier-
mark nur in geringer Zahl vorhanden. Dem entspricht auch der Stellenwert in
den Ländergeschichten und Gesamtdarstellungen, in denen die Wirtschaftsent-
wicklung des Guberniums nur peripher erwähnt wird. Lediglich die Montan-
industrie findet die ihr zustehende Beachtung. Andere industrielle Segmente
bleiben ebenso wie markante Unternehmerpersönlichkeiten bzw. -familien
nahezu unbeachtet. Dabei existierte seit der theresianisch-josephinischen Epo-
che eine Vielzahl engagierter Unternehmer sowohl im Sinne der Schumpeter-
schen „Unternehmer“-Definition, wonach „Unternehmer“ nur derjenige war, der
„im Rahmen seiner Verfügung über die Produktionsmittel neue Kombinationen
(neue Produkte, Produktionsmethoden, Absatzmärkte usw.) durchsetzte“, als
auch nach der Auffassung Josef Mentschls, nach dessen Verständnis die Auswahl
des Kreises der Unternehmer an „das alleinige oder anteilige Eigentum an den
Produktionsmitteln im Sinne [Lujo] Brentanos“ zu binden wäre (Mentschl 1969,
S. 289). Ebenso inexistent ist für das Laibacher Gubernium eine Unternehmer-
Typologie im Sinne von „Biographien der Innovatoren und wagemutigen Unter-
nehmer“ (Matis 1969, S. 286). Die vorhandenen Unternehmerbiographien haben
meist einen anekdotischen bzw. hagiographischen Charakter. Wenn es so etwas
wie eine Unternehmensgeschichtsforschung für die Alpen-Adria-Region gibt, ist
diese bestenfalls zum Status eines „hoffnungsvollen Ansatzes“ vorgedrungen.
Ein kollektivbiographisch ausgerichteter Überblick (in einem zeitlichen Längs-
schnitt) zur Zusammensetzung des Unternehmertums der beiden Länder bis
Proof
142
1848 bzw. 1918 liegt nicht vor. Gleichfalls gibt es – wohl das Ergebnis einer unter
nationaler Perspektive geschriebenen Geschichte – keine Zusammenschau der
industriell-gewerblichen Entwicklung der beiden Länder.
In Anlehnung an die These eines wirtschaftlichen Versagens der Habsburgermo-
narchie vertrat man bis in die 1960er Jahre die Ansicht, dass deren wirtschaftli-
che Rückständigkeit auf das Nichtvorhandensein eines innovativen Unterneh-
mertums zurückzuführen und sie daher ein Staat ohne Unternehmertradition
gewesen wäre. Aussagen wie „Unternehmer von rechtem Schrot und Korn habe
es in Österreich nie gegeben; zumindest seien sie auch in der Vergangenheit so
seltene Ausnahmeerscheinungen gewesen, dass es nicht wundernehmen dürfe,
wenn Österreich auch heute an einem akuten Unternehmermangel leide“ oder
„unternehmerischer Geist hätte aus dem Ausland nach Österreich importiert
werden“ müssen, wurden ab den 1970er Jahren zunehmend in Frage gestellt.
Es ist Franz Mathis (vgl. 1987, 1990) zuzuschreiben, bezüglich einer sozialen
Typologisierung und Kategorisierung des österreichischen Unternehmertums
eine systematische methodische Herangehensweise entwickelt zu haben. Als
Ausgangspunkt dafür dienten ihm die von Alfred D. Chandler herangezogenen
Indikatoren des Wachstums und der Eigentumsstrukturen von Unternehmen.
Denn die vertikale Integration neuer Vertriebsorganisationen und die horizon-
tale Diversifikation in zusätzliche Produktionsbereiche veränderte nach Chand-
ler nicht nur die Strategie, wie Wachstum herbeigeführt werden konnte, sondern
bewirkte zugleich eine nachhaltige Veränderung der Eigentumsstruktur. Auf die
Fragen, welche Faktoren zum Wachstum industrieller Unternehmen beitrugen
und inwiefern sich diese auf einen Wandel der Eigentumsstruktur vom Typ des
Eigentumsunternehmers zu einem Managerunternehmer auswirkte, wurde
nicht nur nach dem Geburtsort des Unternehmers, dem Industriezweig, dem
Gründungsjahr und -ort, der sozialen Herkunft wie auch nach dem öffentlichen
Wirken des Unternehmers gefragt, sondern auch nach der Betriebsgröße. Damit
ließen sich binnenstaatliche Vergleiche durchführen.
Obwohl sich die Unternehmensgeschichtsforschung seit den 1990er Jahren
neuen theoretischen Konzepten wie der Neuen Institutionsökonomik, Indust-
rieökonomik und der Evolutorischen Ökonomik zuwandte, hat Mathis´ Studie
aufgrund ihrer theoretischen Substanz bis heute nichts an Bedeutung einge-
büßt. Sie gilt – und dies gerade im Hinblick auf eine systematische Erschlie-
ßung von Kollektivbiographien für das Unternehmertum im Gubernium Lai-
bach im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts – noch immer als der vielverspre-
chendste Ansatz, um unternehmerisches Agieren festzumachen, auch weil die
anderen Ansätze Schwächen aufweisen (vgl. Haupt & Kocka 1996, S. 11, 14 f.).
Proof
143
In Anbetracht der Tatsache, dass es aufgrund der vorherrschenden feudalen
Agrarstrukturen während des Vormärz im Gubernium Laibach zu keiner voll-
ständigen Ausbildung eines Kapitalmarktes gekommen war, ergibt sich bei
der Neuen Institutionsökonomie das Problem, dass die angefallenen Transak-
tionskosten nicht oder nur teilweise zu messen sind und damit die Möglich-
keit einer Quantifizierung kaum gegeben ist (vgl. Spoerer 2002, S. 184). Auch
die Netzwerkökonomik, die in den letzten Jahren aus dem ältesten und am
stärksten der neoklassischen Statik verhafteten Konzept der Industrieökono-
mie entstanden ist, weist zwar ein großes Potenzial in Verbindung mit histo-
risch wichtigen Produktinnovationen auf, doch besteht in ihrem Fall das Prob-
lem der Messbarkeit und Quantifizierbarkeit (vgl. Spoerer 2002, S. 187). Diesen
Konzepten jüngeren Datums ist gemeinsam, dass das Forschungsinteresse am
Unternehmer als gestaltendes Element innerhalb des Unternehmens zuguns-
ten von marktwirtschaftlichen und sozialen Analysen an Bedeutung verlor.
Seit geraumer Zeit rückt der Unternehmer wieder verstärkt in den Fokus der
Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsgeschichte. Man erkennt wieder
seine herausragende Bedeutung als treibende Kraft im Rahmen der kapitalis-
tischen Wirtschaft (vgl. Matis 2002, S. 11 ff.). Diese Einschätzung steht in der
Tradition Joseph A. Schumpeters, der den „Entrepreneur“ als einen selbststän-
dig tätigen und schöpferisch wirkenden Innovator innerhalb des Wirtschafts-
prozesses charakterisiert und ihm die Funktion eines Motors bezüglich des
Wirtschaftswachstums zuweist. In diesem ist der Unternehmer allein durch
seine funktionale Stellung gekennzeichnet: „The entrepreneur and his func-
tion are not difficult to conceptualize: the defining characteristic is simply the
doing of new things or the doing of things that are already being done in a new
way (innovation)“ (Schumpeter 1947, S. 151). Aus diesem Ansatz heraus rückt bei
Schumpeter der Unternehmer „als Träger des Veränderungsmechanismus“ in
den Mittelpunkt.
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die „New Economy“ auf kleine und
mittlere Unternehmen, die in einer zunehmend komplexer werdenden Öko-
nomie im Gegensatz zu Großunternehmen flexibler auf Marktveränderungen
reagieren und somit mittelfristig für ökonomisches Wachstum und höhere
Beschäftigungszahlen sorgen können (vgl. Mugler 2004, S. 256). Man hat erkannt,
dass „vor allem drastische Innovationen […] zu ihrer Durchsetzung die Ener-
gie von Entrepreneuren [benötigen], die den Willen haben, den Status quo am
Markt zu verändern“ (Franke & Lüthje 2004, S. 36). Was somit der Wirtschafts-
geschichte in den letzten Jahrzehnten selten gelungen ist, nämlich die institu-
tionelle Verankerung eines Unternehmensgeschichte-Lehrstuhles, gelang den
Wirtschaftswissenschaften innerhalb von nur wenigen Jahren (vgl. Mosser
Proof
144
1999, S. 57). Charakteristisch für die noch relativ junge Teildisziplin „Entrepre-
neurship“ ist die explizite Verbindung zwischen wissenschaftlicher Forschung,
unternehmerischer Praxis und interdisziplinären Ausrichtung (vgl. Fallgatter
2004, S. 11 ff.). Diese sieht in der Gründung und Leitung eines gelingenden Unter-
nehmens nicht nur den Ausdruck unternehmerischer Kreativität, sondern auch
die Position des Unternehmers als eines bestimmenden und gestaltenden Fak-
tors der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung (vgl. ebenda).
Im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Agens wird der Unterneh-
mer als „idealer Repräsentant des technischen und organisatorischen Fort-
schritts“ dargestellt. An diesem Punkt kann, befruchtend wie auch kritisch
reflexiv die moderne Unternehmensgeschichtsforschung ansetzen, um
Antworten auf die Fragen „nach dem Unternehmer in seiner funktionalen
und sozialen Rolle innerhalb und außerhalb von Unternehmen sowie nach
der Veränderung der Unternehmerfunktion im Zeitverlauf, wie sie ausgeübt
wurden und wer sie ausgeübt hat“, zu erhalten (vgl. Schmidt 2011).
Eine weitere Gemeinsamkeit mit der „New Economy“ ist die Auswahl der
Unternehmen anhand der Unternehmensgröße. Die Betriebswirtschaft sah
vordergründig in der Optimierung, Rationalisierung und Effektivitätssteige-
rung bestehender Großunternehmen jene wichtigen Faktoren, die zu einem
sicheren und schnellen Wirtschaftswachstum führ(t)en. Forschungen, die
sich mit dem Unternehmertum und den Innovationen auseinandersetzten,
führten hingegen lange Zeit eine Randexistenz. Sie passten nicht in das vor-
herrschende Paradigma von Optimierung und Rationalisierung (vgl. Franke
& Lüthje 2004, S. 33 f). Schließlich galt auch für Mathis die Beschäftigtenzahl
als das wichtigste Kriterium bei der Auswahl seiner Unternehmen. Seine Ent-
scheidung, Großunternehmen mit einer Mindestanzahl von 1.000 Beschäf-
tigten für seine Untersuchung auszuwählen, beruhte darauf, dass er primär
in ihnen ein für die moderne Wirtschaft und Gesellschaft typisches Phäno-
men erblickte (vgl. Mathis 1990, S. 17).
Dieses quantitative Kriterium zu übernehmen, bedeutet im Falle des Guber-
niums Laibach für den zu untersuchenden Zeitraum eine äußerst geringe
Ausbeute. Von den insgesamt 189 bei Mathis erfassten Betrieben waren – und
zwar ausschließlich – vier im Klagenfurter Kreis ansässig. Von diesen entfiel
lediglich ein Betrieb in den besagten Untersuchungszeitraum. Kritisch zu ver-
merken ist, dass jener Betrieb (Firma Neuner) bei seiner Gründung 1793 noch
keine 1.000 Beschäftigten aufwies. Erst 1972 erreichte er diese Beschäftigten-
zahl. 1840 zählte die Firma Neuner lediglich 40 Mitarbeiter (vgl. Mathis 1987,
Proof
145
S. 200 f). Unter diesem Aspekt erscheint die von Mathis angewandte Metho-
dik der Unternehmensauswahl schwer nachvollziehbar zu sein. Zwar wer-
den explizit Gründe genannt, die zu einer Aufnahme der Unternehmen in die
Untersuchungen führten. Allerdings ist unklar, nach welcher Systematik diese
im Detail erfolgten. Neben der von ihm erwähnten Sozialtypologie wurden
Betriebe in Industrie und Bergbau in die Analyse miteinbezogen, die im Ver-
laufe ihres Bestehens mindestens einmal mehr als 1.000 Mitarbeiter zählten.
Zugleich wurden aber Manufakturen des späten 18. und frühen 19. Jahrhun-
derts nicht berücksichtigt, da sie aufgrund ihrer Produktionsmethoden noch
der Manufakturepoche zuzuordnen sind und per se noch keine modernen
Industrieunternehmen waren (vgl. Mathis 1990, S. 18 f.). Die Firma Neuner war
aber in der Anfangsphase ihres Bestandes ein Manufakturbetrieb. 1793 in Kla-
genfurt von Christof Neuner gegründet, übernahm 1828 sein gleichnamiger
Sohn das Unternehmen und rationalisierte fabrikmäßig die Herstellung von
Pferdegeschirren. Diese waren ein gefragtes Produkt. Innerhalb nur weniger
Jahrzehnte expandierte der Betrieb. In der Folge wurde die Produktpalette um
die Herstellung von Treibriemen, technischen Lederwaren, Koffern, Reisearti-
keln und Geschirrscheiden erweitert (vgl. Mathis 1987, S. 200 f.). Auch ein ande-
res Kärntner Unternehmen verfügte über eine erhebliche Zahl von Beschäftig-
ten. Die St. Vinzenzer Spiegelfabrik auf der Koralpe zählte in den 1840er-Jahren
cirka 400 Beschäftigte (vgl. Drobesch 2004, S. 265). Warum dieses Unterneh-
men mit zehnmal mehr Beschäftigten zur selben Zeit als die Firma Neuner
keine Aufnahme in die Studie gefunden hat, bleibt unklar.
Ein erster Baustein: Das Erhebungsverfahren und seine methodischen Herausforderungen
Wie groß die Lücken zur Unternehmensgeschichtsschreibung für das Guber-
nium Laibach sind, zeigen die Studien zum österreichischen Unternehmertum
(vgl. Naderer 1976). Die repräsentativste Studie zur Erstellung kollektivbiogra-
phischer österreichischer Unternehmer ist die Dissertation Wolfgang Meix-
ners (2001) über „Aspekte des Sozialprofils österreichischer Unternehmer im
19. Jahrhundert“. Dieser untersuchte ca. 20.000 Betriebe im Zeitraum von 1800
bis 1914. Daraus ergab sich ein Sample von 2.592 cisleithanischen Unterneh-
merpersönlichkeiten. Von diesen waren 77 Unternehmerpersönlichkeiten (= 3
Prozent) den Ländern Kärnten und Krain zuzuordnen. Eine Tabelle verzeich-
net die Namen, Firmensitze und Geburtsdaten der angeführten Unternehmer.
Bezieht man das Sterbe- und Geburtsdatum der genannten Unternehmer mit
ein, reduziert sich die Anzahl der „Wirtschaftstreibenden“ für das Gubernium
Laibach für den Zeitraum von 1815 bis 1848 von 77 Unternehmern auf 28.
Proof
146
Im folgenden Arbeitsschritt wurde Johann Slokars Standardwerk zur „Geschichte
der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I.“ her-
angezogen und hinsichtlich der angegebenen Industriesparten und Unterneh-
mer ausgewertet. Verglichen und ergänzt wurden die erhobenen Fakten mit
den Angaben zu Unternehmen bzw. Unternehmern im „Schematismus des
Guberniums Laibach“ der Jahre 1836 bis 1848 inklusive der Angaben zur ersten
in „Klagenfurt im Jahre 1838 eröffnete[n] Industrie-Ausstellung des Vereins zur
Beförderung und Unterstützung der Industrie und der Gewerbe in Inneröster-
reich“ (Bericht über sämtliche Erzeugnisse, 1839). Für das Jahr 1842 wurden 47
Industriesparten und 332 Industriebetriebe, in denen aktiv 226 Unternehmer
tätig waren (Abb. 3.3), verzeichnet, wobei sich nahezu 54 Prozent im Klagenfurter
Kreis befanden. Dagegen waren der Adelsberger und Neustadtler Kreis indust-
riell wenig entwickelt. Jedoch geben die Zahlen über die „Qualität“ der Unter-
nehmen, d. h. die Beschäftigtenzahlen und die Produktionsmengen, keine Aus-
kunft. Die Erhebung dieser ist aus dem amtlichen Material nur punktuell mög-
lich. Die Spannungsbreite bei den Beschäftigtenzahlen war erheblich. Sie reichte
von 15 Arbeitern in der Bleiweißfabrik des Johann Matthias Koller in St. Veit an
der Glan (in den 1840er Jahren) bis zu ca. 200 Arbeitern im Falle der Lippitzba-
cher Gewerkschaft (im Jahr 1844) (vgl. Slokar 1914, S. 568, 472).
Abb. 3.3 Anzahl der Unternehmen und Unternehmer in den einzelnen Kreisen 1842 (Quelle: Slokar 1914; Schematismus Gubernium Laibach 1836–1848; Klagenfurt im Jahre 1838).
In beiden Kronländern wies der montanindustrielle Bereich gegenüber den
anderen Industriesegmenten ein deutliches Übergewicht auf. Mit über 200
Betrieben war die Metallproduktion und -verarbeitung in Kärnten dominant;
Proof
147
die anderen Sparten führten ein Mauerblümchendasein Ähnlich stellte sich die
Situation in Krain, wo es im Vergleich zu Kärnten deutlich weniger Industrieun-
ternehmen (Fürst Auersperg, Viktor Ruard) von überregionaler Bedeutung gab,
dar. Nur im Laibacher Kreis entwickelte sich in Ansätzen eine Industriezone mit
dem Schwerpunkt einer Eisenverarbeitung. Hinzu kamen noch fragmentarisch
Papier-, Textil-, Glas-, Nahrungsmittel- oder die chemischen Fabriken (Abb. 3.4).
Abb. 3.4 Prozentuale Anteile der einzelnen Industriesparten im Adelsberger, Klagenfurter, Laibacher, Neustadtler und Villacher Kreises 1836 bis 1846 (Quelle: Slokar 1914; Schematismus Gubernium Laibach 1836–1848; Klagenfurt im Jahre 1838).
Zur historischen Verortung des Unternehmertums im Gubernium Laibach und wirtschaftliche Entwicklung
Die moderne Historiographie sieht die wirtschaftliche Entwicklung des
Guberniums Laibach während des Vormärz nüchtern. So konstatiert Joa-
chim Hösler, dass das „Herzogtum Krain […] über alle Zäsuren hinweg eines
der ausgeprägtesten Agrargebiete der Habsburgermonarchie“ war und blieb
(Hösler 2006, S. 77). Wohl setzte während des Vormärz ein Wirtschaftsauf-
schwung – in Kärnten stärker, in Krain etwas schwächer – ein, doch war die-
ser auf die günstigen Startbedingungen aus der Zeit der maria-theresianisch-
josephinischen Epoche zurückzuführen (vgl. Rumpler 1992, S. I/215).
In Gang gesetzt wurde dieser Boom einerseits durch die staatliche Förderung,
andererseits durch die „entrepreneurs“. Erst dadurch konnte ein industriel-
ler Wachstumsschub initiiert werden, der „Kärnten und Krain für mehr als
ein halbes Jahrhundert in ein `Goldenes Zeitalter´“ führte (Drobesch 2007a,
Proof
148
S. 169). Innerhalb von ca. zwanzig Jahren verzeichnete das Gubernium Laibach
einen Zuwachs von 45,9 Prozent an Industriebetrieben (vgl. Drobesch 2007a,
S. 168). Das Herzstück der Wirtschaft, insbesondere in Kärnten, bildete die
traditionelle Montanindustrie. Sie konnte im Vormärz ihre Position auf dem
Markt des österreichischen Kaiserstaates und gegen die europäische Konkur-
renz behaupten. Anfang der 1830er Jahre übertrafen die Verhüttungsbetriebe
der Montanindustriellen mit ihren Produktionsmengen noch jene der böh-
mischen Konkurrenz (vgl. Drobesch 2004, S. 260). Bleiberg im Villacher Kreis
war eines der bedeutendsten Zentren der österreichischen Bleiproduktion. Der
gesamte Kärntner Bleibergbau beschäftigte 1845 in Bleiberg, Raibl, Windisch-
Bleiberg, Eisenkappel, Petzen und Schwarzenbach ca. 2.000 Arbeiter. Von
dem auf 721.910 Gulden veranschlagten Produktionswert erzeugten die Pri-
vatgewerken in Bleiberg 50 Prozent, das Ärar in Raibl 30 Prozent, die Gewerk-
schaften des Villacher Kreises außerhalb Bleibergs 4 Prozent und jene des
Klagenfurter Kreises 16 Prozent (vgl. Dinklage 1953, S. 233). Neben den alteinge-
sessenen Adelsfamilien (Henckel von Donnersmarck, Christallnigg, Lodron),
die sich im montanindustriellen Sektor engagierten, zählten die der „zweiten
Gesellschaft“ zugehörigen (Gustav Graf von Egger in Treibach, Eugen Ritter
von Dickmann, der „genialste Kopf und großzügigste Eisenindustrielle“, in
Lölling und Urtl die Gebrüder von Rosthorn in St. Gertraud) sowie die bürger-
lichen Unternehmerfamilien wie etwa die Gebrüder Rauscher in Mosinz und
Heft zu den bedeutendsten Kärntner Gewerken. Bartholomäus Wodley, Ange-
höriger einer krainischen Eisengewerkenfamilie, gründete bereits 1801 nach
dem Vorbild Lippitzbachs das zweite Blechwalzwerk Österreichs in Gössering
im Gitschtal. Der Absatz dieses Werkes orientierte sich wie jener der anderen
Montanbetriebe vornehmlich in den Süden nach Italien. Dorthin konnte man
aufgrund der geringen Distanz kostengünstig liefern. Das Gubernium erlebte
eine Gründerzeit. 1826 erwarb die Firma Rosthorn die Kameralherrschaft
Wolfsberg mit den Montanwerken in St. Gertraud, Frantschach, Kollnitz sowie
die Herrschaft St. Leonhard mit sämtlichen Eisenbergbauen und Hammerwer-
ken. Sie waren in ihrem unternehmerischen Wirken so erfolgreich, dass das
Unternehmen sechs Jahre später in die „Wolfsberger Eisenwerksgesellschaft
Aktiengesellschaft“ umgewandelt wurde. Aus dieser Umwandlung entstand
die erste Aktiengesellschaft Kärntens (vgl. Drobesch 2006, S. 76). Mit 13 Pud-
del- und Schweißöfen und fast 500 Arbeitern erreichte das Unternehmen 1834
den Zenit seines wirtschaftlichen Erfolges (vgl. Drobesch 2007a, S. 176). 1830
errichteten die Gebrüder Rosthorn in Frantschach ein weiteres, drittes Walz-
werk. Mitte 1837 zogen sie sich aus dem Wolfsberger Industrieengagement
zurück und begannen in Prävali (Prevalje) mit dem Aufbau eines modernen
Hüttenwerkes (Abb. 3.5).
Proof
149
Abb. 3.5 Das Eisenwerk Prävali (aus: Wagner 1844, S. 99).
Ebenfalls zu den „Eisenbaronen“ zählte Hugo Graf Henckel von Donners-
marck, schlesischer Aristokrat, Großgrundbesitzer und Industrieller. Früher
als die heimischen Gewerken bemerkte er das herannahende Ende der Kärnt-
ner Montanindustrie. Dessen ungeachtet erwarb er 1846 die „Wolfsberger
Eisenwerksgesellschaft“ sowie die Herrschaften Wolfsberg und St. Gertraud.
Zur selben Zeit errichtete er ein Stahl- und Walzwerk. Da sich das Werk in der
Nähe der steirischen Ortschaft Zeltweg befand, verlor Frantschach als Stand-
ort an Bedeutung. In Krain zählten Viktor Ruard, Bartholomäus Wodley und
die Freiherren von Zois zu den erfolgreichen Industriellen. Viktor Ruard besaß
mehrere Bergwerke und Hochöfen. Seine Unternehmen beschäftigten um 1840
etwa 500 Arbeiter. Die Ruardsche Gewerkschaft in Save (Sava) mit einer Pro-
duktionsmenge von über 30.000 Zentnern und jene der Freiherren von Zois zu
Jauerburg (Javornik) und Feistritz (Bistrica) gehörten zu den größten der Pro-
vinz (Slokar 1914, S. 468). Ruard verkaufte seinen Besitz in Sagor (Zagorje) und
in Littai (Litija) 1840 an seinen Schwiegervater Joseph Atzl, der die „Gewerk-
schaft am Savestrom zu Sagor“ gründete (Vilfan 1992, S. 249 f.).
In den frühen 1840er Jahren zeigten sich erstmals die Grenzen der Entwick-
lungsmöglichkeiten der Bergbauindustrie. Erste Krisenanzeichen machten
sich bemerkbar. Die Betriebe produzierten mehr, als am Markt abgesetzt wer-
Proof
150
den konnte. Die Produktionspalette begann antiquiert zu werden. Noch immer
konzentrierte man sich auf die Roheisenproduktion. Der Anteil des Gussei-
sens, das sich für die Herstellung von Massenwaren wie Töpfen, Pfannen, Roh-
ren oder Herdrückenplatten eignete und am Markt immer stärker nachgefragt
wurde, blieb gering. Nur langsam stieg man in die Herstellung von Halb- bzw.
Ganzfertigwaren ein. Die Anstrengungen der Gewerken, die Verhüttung tech-
nologisch auf den neuesten Stand zu bringen, reichten nicht mehr aus, um
ihre Betriebe wettbewerbsfähiger zu machen. Die am Markt erzielten Preise
deckten nicht mehr die Gestehungs- und Transportkosten. Erschwerend kam
hinzu, dass das knapper werdende Holz die Preise in die Höhe trieb. Und Holz
war für die Holzkohle unverzichtbar. Immer stärker bekam man die binnen-
staatliche und die internationale Konkurrenz zu spüren.
Schwerwiegend für die weitere ökonomische Entwicklung der beiden Pro-
vinzen des Laibacher Guberniums war, dass es nicht gelang, neue zukunfts-
trächtige Produktionszweige aufzubauen. Außer der Montanindustrie gab es
kaum andere Industriezweige – am ehesten noch die Textilindustrie – von
überregionaler Bedeutung. Das textilindustrielle Zentrum befand sich im Lai-
bacher Kreis. Verglichen mit den anderen Kreisen war Laibach (Ljubljana) mit
einem 25-prozentigen Anteil an Betrieben im Textilbereich führend, gefolgt
vom Villacher Kreis mit 7 Prozent und dem Klagenfurter Kreis mit 3 Prozent.
1837 wurde die k.k. private Baumwollspinnerei mit einer Dampfmaschine
von W. und D. Moline errichtet. Moline, der aus England kam und seit 1820 in
Krain lebte, war auch an einer der beiden Laibacher Zuckerraffinerien betei-
ligt. Seine Baumwollspinnerei zählte 1841 164 Beschäftigte, fünf Jahre später
bereits 311. Rationalisierungsmaßnahmen, insbesondere die Mechanisierung,
steigerten die Garn- und Zwirnproduktion um 85,3 Prozent. Zugleich wurde
die Belegschaft um etwa ein Drittel auf 200 Beschäftigte reduziert (vgl. Hös-
ler 2006, S. 82). Als Kleingewerbe verbreitet war in Krain die Tuchmacherei.
Doch ähnlich der Montanindustrie konnte die Krainer Tuchmacherei mit den
Modernisierungsmaßnahmen der böhmischen und mährischen Konkurrenz
nicht Schritt halten. Bis in die 1840er Jahre konnten sich noch einige größere
Betriebe behaupten. Johann Nepomuk Rößmann (auch: Reßmann), Tuchma-
cher in Sgosch bei Vigaun (Zgoša) im Bezirk Radmannsdorf stand mit 80 Arbei-
tern unter den Tucherzeugern Oberkrains an erster Stelle. Ebenfalls von guter
Qualität wurde Loden in Krainburg (Kranj) erzeugt (vgl. Slokar 1914, S. 356 f.).
Eine größere Anzahl von Lederern wies außerdem die Umgebung von Laibach
(Ljubljana), Bischoflack (Škofja Loka) und Münkendorf (Mekinje) auf. 1841 wur-
den in Krain 19 Lederfabriken gezählt, darunter zwölf im Adelsberger, fünf
im Neustädter und zwei im Laibacher Kreis. Der aus Krainburg (Kranj) stam-
Proof
151
mende Kaufmannssohn Fidelis Terpinc war einer der bedeutendsten Indust-
riellen in Krain, „der zwischen 1830 und 1868 so viele Industrieunternehmen
ganz verschiedener Branchen in Ljubljana und Umgebung gründete, wie nie-
mand vor und nach ihm“ (Hösler 2006, S. 83). Er errichtete nicht nur eine Leder-
und Deckenfabrik, sondern auch sein eigenes Landesproduktengeschäft. 1842
errichtete er die erste mechanisierte Papierfabrik in Krain. Dieser wurde auf
seine Initiative hin eine Öl- und eine Farbholzfabrik angegliedert, deren Pro-
dukte in Bukarest (Bucuresti), Brünn (Brno), Graz, Marburg (Maribor), Pest
(Pest) und Wien abgesetzt wurden (vgl. ebenda). Im Gegensatz zu Kärnten, wo
die Papierfabrikation keine Bedeutung hatte, bestanden in Krain fünf Papier-
mühlen und zwei Fabriken (vgl. Slokar 1914, S. 439).
Doch auch die erfolgreichen Kärntner Unternehmer, darunter die Tuchfabri-
kanten Moro in Viktring, deren Fabrik in den 1830er Jahren zwischen 200 und
400 Arbeiter beschäftigte und die 4.000 Stück Feintuch und 200 Stück Kasi-
mire im Gesamtwert von 450.000 Gulden erzeugte, die Gebrüder Rauscher, die
Bleiweißfabrik der Familie Herbert in Klagenfurt – diese war einst eine Pio-
niergründung gewesen – und die 1816 von Philippo Ferarri della Torre gegrün-
dete Bleiweißfabrik in St. Johann bei Villach – 1831 verkaufte er diese an Ernst
Dietz – konnten den Niedergang der Industrie im Laibacher Gubernium nicht
aufhalten. Um 1850 handelte es sich bereits mehr um eine Entfaltung und nicht
„um die Weiterentwicklung einer traditionellen Wirtschaftsstruktur“ (Rump-
ler 1992, S. 215). Die Textilindustrie und mit ihr die chemische Industrie waren
zu wenig verbreitet. Das erwies sich als umso tragischer, galten die beiden
Branchen doch als eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung der Inno-
vationen der Industriellen Revolution. Es ist zu hinterfragen, ob die Ursachen
für diesen Niedergang – wie in der historiographischen Literatur nachzule-
sen – in einer für die beiden Länder des Guberniums ungünstigen politischen
Entwicklung und/ oder in den subjektiv so empfundenen Benachteiligungen
– etwa in Form einer fehlenden Eisenbahnanbindung – durch die staatliche
Wirtschaftspolitik lagen. Während der 1840er Jahre machten sich erste Anzei-
chen für das Ende des „Goldenen Zeitalters“ bemerkbar. Der „great spurt“ blieb
aus. Der Sprung ins Industriezeitalter fand nicht statt. Es kam nur zu einem
eingeschränkten Wandel. Kärnten und Krain wurden zu einem Modellfall
einer „partiellen Modernisierung“, d. h. einer „Modernisierung ohne Indus-
trialisierung“ (Drobesch 2004, S. 275). Die Leistungen der Ökonomie, insbe-
sondere der Industrie, basierten auf wenig unkoordinierten und im Endeffekt
unproduktiven Leistungen einzelner Unternehmerfamilien und Betriebe
(vgl. Rumpler 1992, S. I/216). Nur mehr scheinbar nahmen Kärnten und Krain
am Gründungsfieber des Vormärz teil. Der Typus des „Entrepreneurs“, der im
Proof
152
Gubernium Laibach in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in die Vorstufe
zur Industrialisierung geführt hatte, verschwand (vgl. Drobesch 2007a, S. 178).
Was folgte, war ein sukzessiver Niedergang, der sich nach der „Großen Depres-
sion“ von 1873 beschleunigte.
3.2.6 Identitätsfindung und Versuche zu deren Überwindung (Susanne Ruhdorfer)
Unter dem Vorzeichen des aufkommenden Nationalismus: vom Neben- und Miteinander zum Gegeneinander
Der Kernraum der Alpen-Adria-Region, d. i. die einstige administrativ-politi-
sche Einheit Innerösterreich, war in seiner Geschichte weder sprachlich noch
ethnisch eine geschlossene, homogene Zone. Auf engem Raum lebten bis ins
frühe 19. Jahrhundert mehrere Völker unterschiedlicher Sprache mit- und
nebeneinander. Friulaner, Steirer, Görzer, Kärntner, Krainer und Triestiner
wurden unter dem schwarz-goldenen Banner der Habsburger vereint. Ein die
Region verbindendes, gemeinsames Symbol gab es nicht. Sieht man vom vor-
märzlichen Intermezzo des Königreiches Illyrien ab, gab es keinen die gesamte
Alpen-Adria-Region bzw. Teile von dieser umfassenden Herrschaftstitel. Und
dennoch bestanden zwischen den Ländern enge wirtschaftliche, kulturelle
Verflechtungen. Im politisch-administrativen Bereich war man durch die Per-
son des Landesfürsten miteinander verknüpft.
Im Prozess des „Erwachens der Völker“ wandelte sich nach 1815 das friedvolle
Neben- und Miteinander mehr und mehr zu einem Gegeneinander. Die Vision
der Nation hinterließ im Denken und Agieren der Bevölkerung erste Spuren.
Wie komplex sich die nationale Situation um die Mitte des 19. Jahrhunderts
darstellte, veranschaulicht Carl von Czoernigs „Ethnographie der Oesterrei-
chischen Monarchie“ (1857). Der Ethnograph, Polyhistor, Sprachforscher, Kul-
turpublizist, Statistiker und Kartograph war einer der führenden Propagandis-
ten im Rahmen der neoabsolutistischen „Reformpolitik von oben“ (Rumpler
2010, S. 834), deren Ziel eine Unifizierung des Habsburgerstaates war. In die-
sem Zusammenhang war die Feststellung der sprachlichen Verhältnisse nicht
unwichtig. So wurde für Czoernig „die ethnographische Beschreibung der
Monarchie […] zu einem politischen Gegenprogramm gegen das schranken-
lose Nationalitätsprinzip“ (Petschar 1992, S. 193). In seiner „Ethnographie“ zählt
er für den habsburgischen Gesamtstaatsverband 137 ethnische Gruppen und
Volksstämme sowie 22 Sprachgruppen auf (vgl. Nikocevic 2006, S. 42). Beson-
dere Erwähnung findet ein Teil der heutigen Alpen-Adria Region: Istrien, für
Proof
153
das Czoernig (1857, S. 8) „dreizehn ethnographische Nuancen“ feststellt. Er teilt
diese in „Italiener, Romanen, Albanesen, Slovenen, Kroaten und Tschitschen“
ein. Für ihn war es erstaunlich, wie nahe sich in Istrien die „Volksstämme“
standen: „In keinem Gebietstheile der Monarchie haben sich im Verhältnisse
zu dem Umfange so viele Reste verschiedener Nationalitäten und Abstufungen
derselben noch mehr als in der Sprache, in der Kleidung und Sitte erkennbar
erhalten, als in der kleinen Halbinsel von Istrien, dem Lande, wo sich die frü-
heste Cultur unseres Weltbildes […] mit den auf unsere Zeit gekommenen nied-
rigsten Stande der Civilisation innerhalb des Reiches die Hand bietet“ (Czoer-
nig 1857, S. 8). Was sich in Istrien zeigte, stellte sich in anderen Provinzen der
Alpen-Adria-Region – wenngleich in einem kleineren Rahmen – auch so dar.
Im Verlaufe der ausufernden Nationalitätenkämpfe bedingte diese nationale
Vielfalt als Mittel der nationalen Überhöhung bzw. Verunglimpfung die Aus-
bildung von Stereotypen.
Nationale Stereotypen: „Hier bin ich der Barbar, weil ich von niemandem verstanden werde“ (Ovid)
Ein vereinfachtes, von Stereotypen bestimmtes Geschichtsbild prägt(e) oft
Generationen (vgl. Plaschka 1995, S. 21). Die Stereotypisierungen wurden über
Opern, Gemälde, Museen, Belletristik, Reden, Publizistik sowie „in Karikatu-
ren und in der politischen Publizistik“ (Bruckmüller 1995, S 39) den Massen
vermittelt. Sie bezeugen, mit welchen Metaphern gearbeitet wurde, um Fremd-
artiges zu suggerieren. Zur Schaffung von Feindbildern wurde die gegnerische
Seite – in der Regel verkörperte sie das „Böse“, während man selbst die Inkar-
nation des „Guten“ war – negativ stereotypisiert (vgl. Moritsch 1995, S. 79). Dazu
wurde die Welt der Anderen bewusst verfälscht und mit dem Topos des Nega-
tiven versehen.
An diesem Muster orientierten sich in den ab den 1870er Jahren heftiger wer-
denden nationalen Auseinandersetzungen auch die Bewohner der Alpen-
Adria-Region, unabhängig davon ob sie deutscher, slowenischer oder italie-
nischer Zunge waren. Die nationale Stereotypisierung, sowohl die eigene als
auch jene des Anderen, gewann für den politischen Alltag an Bedeutung. Die
sich neu definierenden „Nationen“ mussten die Anderen stereotypisieren,
einerseits um sich selbst Identifikationsmerkmale zu geben, andererseits um
die Minderwertigkeit des Gegenüber zu unterstreichen. Das Ergebnis waren
zwei Formen nationaler Stereotypen. Zum einen handelte es sich um posi-
tive Stereotypen, die sich die „Nationen“ selbst („Autostereotype“) gaben,
um eine eigene Identitätsstiftung, ein „Wir-Gefühl“, zu geben. Wer sich der
Proof
154
„nationalen Sache“ nicht eifrig genug anschloss und „kein ausgeprägter Nati-
onalist war, der wurde alsbald als nationaler Laumann abgestempelt“ (Cvirn
1995, S. 65). Zum anderen bildete man in Abgrenzung und Gegnerschaft zu
den Anderen negativ konnotierte Stereotypen („Heterostereotype“) aus, um
die eigene „Nation“ zu erhöhen und ein nationales Feindbild zu kreieren. Ent-
scheidend war, das entworfene Bild der eigenen „Nation“ bzw. des nationalen
Rivalen der Öffentlichkeit propagandistisch und polarisierend zu vermitteln.
Mit einer Schwarz-Weiß-Malerei wurde die „gegenseitige Abstoßung mittels
selbstauf- und fremdabwertender Urteile“ (Moritsch 2002, S. 13) eingeleitet.
Je ähnlicher und geographisch näher sich zwei Volksgruppen standen, desto
stärker war das Bedürfnis vorhanden, die Unterschiede zu betonen. Der unmit-
telbare Nachbar eignete sich besonders für „ausgeprägte Klischeevorstellun-
gen, besonders klare Stereotypen“ (Bruckmüller 1995, S. 31). Das gilt auch für
die Bevölkerungsgruppen der Region, insbesondere für die deutsch-sloweni-
schen, aber auch für die italienisch-slowenischen und deutsch-italienischen
nationalen Gegensätzlichkeiten.
„Ungebildete, erzkatholische slowenische Kleinbauern“ und „zivili-sierte Deutsche“ – Stereotypisierte Identitätsfindung am Beispiel Krain
Im Habsburgerreich fiel der deutschen Sprache eine zentrale Rolle zu, obwohl
nach den Sprachenerhebungen im Rahmen der Volkszählungen ab 1880 (bis
1910) die slawischen Sprachen – von Tschechisch über Polnisch bis zu Slowe-
nisch – dominierten. Davon unabhängig postulierten das Deutschtum und in
einer radikaleren Weise die Deutschnationalen, dass „Fortschritt, Zivilisation
und Kultur“ untrennbar mit dem Deutschtum verbunden wären (Moritsch
1995, S. 83). Davon betroffen waren sämtliche Provinzen der Alpen-Adria-
Region – ausgenommen Triest (Trieste, Trst), wo der Konflikt primär zwischen
italienisch- und slowenischsprachiger Bevölkerung um 1900 eskalierte. In den
anderen Kronländern mit Slowenisch- und Deutschsprechenden war es für die
deutschsprechende bürgerliche Oberschicht evident, dass die Slowenen ihnen
die „Zivilisation“ zu verdanken hätten. Aus dieser Perspektive definierte sich
das Deutschtum als Kulturvermittler unter dem slawischen „Proletariervolk“
(Cvirn 1995, S. 68), weil – so ihre Sichtweise – die nichtdeutschsprachigen Völ-
ker, insbesondere die Slowenen, dem Deutschtum nicht ebenbürtig und „rück-
ständige Bauern und Viehzüchter“ (Moritsch 1995, S. 83) wären. Das bildete den
Nährboden für die Ausbildung von Stereotypen vom „Slowenen“ bzw. „Slawen“.
Ein frühes Beispiel, quasi eine Vorstufe zur Stereotypenbildung des 19. Jahr-
hunderts, ist Belsazar de la Motte Hacquets „Oryctographie Carniologica, oder
Proof
155
Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil
der benachbarten Länder“. Dieser schreibt vom unterschiedlichen Körperbau
der Slawen. Illyrier, „Karbaten“ und Kroaten beschreibt er als „schlank“ und
„muskulös“. Sie stünden im Gegensatz zu den Böhmen und Russen, die „kurz“
und „untersetzt“ wären (vgl. Petschar 1992, S. 186). Zu den Einflüssen des Mili-
eus auf den Charakter der Slawen kämen als sozialisierendes Element Erzie-
hung, Lebensart, Religion, politische Verfassung und die Unterdrückung der
Freiheit hinzu (vgl. Petschar 1992, S. 187).
Daran knüpfte man im 19. Jahrhundert an. Ab den 1860er Jahren wurden die Slo-
wenen als „klerikal, föderalistisch, rückschrittlich“ sowie als „struppige Kary-
atidenhäupter“ bezeichnet (vgl. Bruckmüller 1995, S. 39). Die damit intendierten
Assoziationen waren evident: „Die Slowenen sind bestenfalls, ein ethnographi-
scher Begriff, sie haben keine Kultur und keine Schriftsprache, sie sind ständige
Verbündete der `Römlinge ; dazu kommen die Begriffe `Bauer´ und `besoffen´
– also Bauernnationen (wenn überhaupt) und höchst unzivilisiert“ (Bruck-
müller 1995, S. 41). Die gängigen deutschen, aber auch italienischen nationa-
len Heterostereotypen von den Slowenen waren „Undankbarkeit, Falschheit,
Hinterhältigkeit, Unfähigkeit zu kulturellem Schaffen und gesellschaftlicher
Ordnung“ (Moritsch 2002, S. 24). In diesem Sinne verfasste der deutschnatio-
nale Journalist Walter Rogge eine „antiklerikale, antiföderalistische und anti-
slawische Propagandaschrift“, wenn er meinte: „Slowenisch zu lernen, ist eine
hundertmal schlimmere Vergewaltigung, als wenn er in Riga russisch lernen“
müsste (Bruckmüller 1995, S. 39 f.). Rogge ging noch weiter. Er bezeichnete die
slowenische Sprache als eine „künstliche Angelegenheit“ (Rogge 1873, S. 401, zit.
n. Bruckmüller 1995, S. 40). Ihm schlossen sich andere an. 1863 hielt Graf Anton
Auersperg (= Anastasius Grün) im Krainer Landtag eine antislowenische Rede,
in der er betonte, dass die Bildung der Slowenen unter dem Einfluss des „deut-
schen Geistes“ erfolgt sei: „So war und ist es, und will es Gott, so soll es auch
bleiben“ (Castle 1909, S. 195, zit. n. Cvirn 1995, S. 68). Alles, was „Krain an Wohl-
fahrt, an geistigen Gütern, an Rechts-Institutionen und anderen Vorzügen“
besäße (Castle 1909, S. 195, zit. n. Cvirn 1995, S. 68), wäre von den Deutschen ins
Land gebracht worden.
Solche Äußerungen blieben nicht ohne Folgen. Der Assimilationsdruck stieg.
Mancher Slowene vollzog den Wechsel seines Volkstumsbekenntnisses. So
entstammte der „bekannteste Renegat“ und Führer der deutschen Verfas-
sungspartei in Krain, Karl Deschmann, einer slowenischen Familie (vgl. Cvirn
1995, S. 69). In seinem politischen Agieren übernahm er die Stereotypen der
deutschnationalen Propaganda und radikalisierte diese, indem er die Slowe-
Proof
156
nen als „faul“, „unterwürfig“, „mit einer Vorliebe für Lederhosen, krainische
Wirtshäuser und den dazu gehörigen Gelagen“, als „pfäffisch hinterhältig“,
„prahlend“, „rauf- und fleischeslustig“ sowie „grob“ bezeichnete (Prijatelj 1956,
S. 72, zit. n. Cvirn 1995, S. 69). Die Zukunft für seine Kinder erblickte er in der
deutschen Sprache und deutschen Kultur, wenn diese „auch deutsch sprechen
lernten, da Handel und Gewerbe ihn mit den deutschen Nachbarsprovinzen
in Verbindung brächten, und mehr in Verbindung brächten, als mit den noch
gering zivilisierten Ländern des slawischen Südens, wo man noch Blutrache
habe und mit der Flinte über der Schulter das Feld ackere“ (Cvirn 1995, S. 69 f.),
hatten sie eine Zukunft. Kurzum: Die Slowenen wurden zu ungebildeten Klein-
bauern ohne höhere Kultur und Angehörigen der Unterschicht stilisiert, deren
Nationsgedanke zudem eng mit dem „pfäffischen“ Katholizismus verbunden
war. Für die antiklerikalen, liberal-freisinnigen Deutschnationalen waren
Katholizismus und Slowenentum kongruent (vgl. Moritsch 2002, S. 23 f.). Des-
halb war ihr Kampf gegen die „fanatischen slowenischen Politiker“ auch ein
Kampf gegen die slowenischen Geistlichen, die als ideologischer Wegbereiter
des aufkeimenden slowenischen Nationalismus angesehen wurden. Diese
Stereotype – „und das gilt ganz besonders für die nationalen Auto- und Hete-
rostereotype“ – wurden in dem Augenblick problematisch, als „sie bewusst
der Realität weiter entfremdet und zum Zwecke der Konkurrenz zwischen
gesellschaftlichen Gruppierungen […] als solche instrumentalisiert“ wurden
(Moritsch 2002, S. 18).
Versuch der Überwindung nationaler Stereotypen: die Alpen-Adria-Region im „Kronprinzenwerk“
In Zeiten des eskalierenden Nationalitätenstreites suchte der Staat nach Wegen
und Möglichkeiten, das nationale Gegeneinander zu relativieren. Dazu diente
u. a. eine Reihe staatlicherseits geförderter populärwissenschaftlicher sowie
publizistischer Werke, etwa Adolph von Fickers „Die Völkerstämme der Oes-
terreichisch-Ungarischen Monarchie, ihre Gebiete, Gränzen und Inseln“ (1869),
Friedrich von Umlaufts „Die österreichisch-ungarische Monarchie: Geogra-
phisch-statistisches Handbuch mit besonderer Rücksicht auf politische und
Cultur-Geschichte für Leser aller Stände“ (1876), das fünfzehnbändige Opus „Die
Länder Oesterreich-Ungarns in Wort und Bild“ (ab 1880) sowie Carl Prochaskas
„Die Völker Österreich-Ungarns. Ethnographische und culturhistorische Schil-
derungen“ (1881–1883). Sie kennzeichnen einen Paradigmenwechsel, der an die
Stelle „einer Naturgeschichte der Nationen“ eine „Kulturgeschichte der Nationa-
litäten“ setzte (Petschar 1992, S. 194). In weiterer Folge bildeten sie die Grundlage
für das monumentale Werk „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort
Proof
157
und Bild“ („Kronprinzenwerk“), einer enzyklopädisch angelegten Buchreihe
in 24 Bänden, die auf Betreiben des Thronfolgers, Erzherzog Rudolf, zustande
kam. Neben diesem waren Karl Menger – in den Jahren 1876 bis 1878 einer sei-
ner Lehrer – der Herausgeber des „Neuen Wiener Tagesblattes“ Moritz Szeps und
der Musikkritiker Eduard Hanslick die führenden Köpfe der Redaktionsarbeit.
Am Anfang des Projektes stand als spiritus rector gemeinsam mit dem Kronprin-
zen Alfred von Arneth. Arneth war „Historiker und Präsident der Akademie der
Wissenschaften“ und „seit 1870 für den Lehrplan von Rudolfs Geschichtsunter-
richt verantwortlich“ (Petschar 2011, S. 157). Zudem war er richtungsweisend in
der Erstellung eines neuen inhaltlichen Konzeptes. Seine Stimme hatte großes
Gewicht. Die Zielsetzung war klar: „Die Darstellung der Länder sollten nach ihrer
Beschaffenheit, Geschichte, Kunst, Kultur und Volkswirtschaft und der Schilde-
rung der darin wohnenden Völkerstämme erfolgen, diese wiederum hinsicht-
lich ihrer physischen Beschaffenheit und ihrer Kultur, Sitten, Brauchtum und
Literatur beschrieben werden“ (Petschar 2011, S. 157).
Vom supranational konzipierten Opus erhoffte man sich, das Problem der
nationalen Antagonismen zumindest lösen zu können und zu zeigen, dass
alle Völker ein Teil des „großen Hauses“ Österreich seien (Shedel 2002, S. 70).
Die Völker sollten nicht mehr das Fremde, sondern das Gemeinsame und sie
Verbindende entdecken, und an die Stelle gegenseitigen Hasses und Neides
sollten die gegenseitige Achtung und Wertschätzung treten: „‘Wissen ist Ver-
söhnung‘“, lautete das Motto, das Moritz Szeps in einem zur Subskription des
Werkes aufrufenden Leitartikel schrieb (vgl. Stagl 2002, S. 173). „Österreich-
Ungarn in Wort und Bild“ war als „zweiter Elternteil“ gedacht, und zwar zur
Verinnerlichung des Vaterland-Gefühls (vgl. Shedel 2002, S. 78). Die Menschen
sollten sich mit dem multinationalen, multikonfessionellen und multikultu-
rellen Kaiserstaat identifizieren und in diesem ihre Wurzeln sehen (können),
ungeachtet des Umstandes, dass in diesem elf verschiedene Völker lebten.
Das Gesamtwerk beinhaltet „587 Artikel von 432 Autoren auf 12.596 Textsei-
ten sowie 4.529 Illustrationen nach Originalvorlagen von 264 Künstlern“ (Pet-
schar 2011, S. 152). Bekannte Namen unter den Autoren waren Karl Freiherr von
Czoernig senior und junior, Thomas Koschat, Peter Rosegger, Ferdinand von
Andrian-Werburg, Eduard Hanslick, Josef Alexander von Helfert, Maurus (Mór)
Jókai, Carl Menger oder Emil Zuckerkandl (vgl. Petschar 2011, S. 160). Im Hin-
blick auf den Inhalt betonte Kronprinz Rudolf immer wieder, dass alle Völker
der Monarchie in gleicher Weise vertreten sein sollen, seien sie doch auch ein
gleichwertiger Teil des Ganzen. Der Wahlspruch „Viribus unitis“ des Kaisers
klang überall durch (vgl. Barth-Scalmani & Scharr 2011, S. 96), obwohl Vater
und Sohn den Wahlspruch inhaltlich unterschiedlich interpretierten (vgl. She-
Proof
158
del 2002, S. 72). Der Thronfolger wollte seinen Untertanen eine Zukunftsvision
anbieten, um alle Nationen, gleichgültig welcher Sprache und Kultur, im Vater-
land Österreich-Ungarn zu vereinigen (vgl. Shedel 2002, S. 71).
Da es der Masse der Bevölkerung nicht möglich war, ihr eigenes Kronland zu
bereisen, sollte das Studium des „Kronprinzenwerkes“ als imaginärer Streif-
zug einen entsprechenden Ersatz bieten (vgl. Stagl 1998, S. 24). Daraus ergab
sich dessen formal-sprachliche Gestaltung, die sich am Typus des Reisebe-
richtes und des politischen Diskurses orientierte (vgl. Nikocevic 2006, S. 45).
Summa summarum war es eine „Reise auf dem Papier“ (Schmid 1995, S. 100),
die auch nach Innerösterreich führte. Beredtes Zeugnis sind die Bände über
die Steiermark, Kärnten und Krain, das Küstenland mit Görz, Gradiska, Triest
(Trieste, Trst) und Istrien, Dalmatien sowie Croatien und Slavonien. Berichte
über die Slowenen finden sich in vier Bänden, was durchaus der Fragestellung
des „Kronprinzenwerkes“ entsprach, das „der geographischen und kulturel-
len Vielfalt der Slowenen“ nachgehen wollte (Ložar-Podlogar 2008, S. 217). Die
Beiträge sind in den Bänden Steiermark, Kärnten und Krain, Küstenland und
im vierten Ungarn-Band zu finden. Autoren für die Beiträge über die „Slove-
nen“ waren „Lehrer, Pfarrer oder Beamte“ (Ložar-Podlogar 2008, S. 218). Ihre
Erkenntnisse beruhten allerdings mehr auf Erfahrungen und Gesprächen mit
Einheimischen als auf historischen Quellen.
Exemplarisch werden im Band „Steiermark“ die Slowenen von Franz Hubad mit
dem Beitrag „Volksleben, Sitten und Sagen der Slowenen“ vorgestellt (Die öster-
reichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 7: Steiermark (1890). Als
Vorlage diente ihm Joseph Šumans „Sprache der Slovenen“. Die Slowenen wer-
den als gute Handwerker sowie Liebhaber von – zumeist wehmütiger – Musik
und Volksdichtung beschrieben. Sie seien „gastfreundlich, religiös, mäßig,
dankbar, ehrlich […] gegenüber den Fremden hilfsbereit und vertrauensvoll“
(Ložar-Podlogar 2008, S. 119). Ausführlich beschreibt Hubad das Brauchtum
im Jahresverlauf. Erstaunt zeigt er sich darüber, dass die Festtagskleidung
der Frauen inklusive der Frisur einen Hinweis auf deren Familienstand gibt.
Ebenso werden im „Küstenland“-Band die Triestiner Slowenen als „gefühlvoll
und freundlich beschrieben, wobei deren Volksleben und Volkskultur von
Frömmigkeit und tiefem [katholischen] Glauben geprägt“ seien (vgl. Ložar-
Podlogar 2008, S. 232). Allen Autoren scheinen das Familienleben und die
Hochzeitsbräuche der Slowenen besonders ins Auge gestochen zu sein. Denn
im Beitrag von Valentin Bellosics im vierten „Ungarn“-Band berichtet dieser
auf mehr als zehn Seiten über die oft Tage dauernden Hochzeitsfeierlichkeiten
(vgl. Ložar-Podlogar 2008, S. 236 f.). Im achten Band über „Kärnten und Krain“
Proof
159
stellt für die beiden Verfasser, Rudolf Waizer und Franz Franzisci, das Neben-
einander von Deutsch- und Slowenischsprachigen eine Selbstverständlichkeit
im Lande dar. Der Seelsorger und Begründer der Kärntner Volkskunde Franz
Franzisci (Franziszi) sowie der Schriftsteller und Heimatforscher Rudolf Franz
Waizer beschreiben „mit einer erstaunlichen Ausgewogenheit“ den „Volks-
charakter, [die] Trachten, Sitten und Gebräuche der beiden Nationalitäten, der
Deutschen und der Slowenen“ (Petschar 2011, S. 161). Ähnlich lautet der Tenor
über das Zusammenleben der Nationalitäten in den Beiträgen über die „Steier-
mark, Krain, das Küstenland und Dalmatien“ (ebenda). Im „Küstenland-Band“
wird neben Görz, Gradiska und Istrien die Stadt Triest (Trieste, Trst) beschrie-
ben. Franz Swida widmet sich auf den Seiten 51 bis 92 der Beschreibung der
„landschaftlichen Lage, [des] Volkslebens, [der] geschichtlichen und culturel-
len Entwicklung Triests“. Triest (Trieste, Trst) wird als „aktive Stadt“ beschrie-
ben mit einem regen gesellschaftlichen Leben. Die Triestiner seien „schöne
Menschen“, die wissen, das Leben zu genießen und zudem auf ihr äußeres
Erscheinungsbild großen Wert legen. Viele Triestiner gehen ohne Hut und
dass „ihr Kopf [..] nur von den sorgfältig frisi[e]rten Haaren, in der kühleren
Jahreszeit von einem Schleier bedeckt ist, vermindert sicher nicht den Reiz der
Erscheinung dieses frohen raschlebigen Völkchens, in dessen Adern südliches
Blut rollt.“ (Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 10:
Das Küstenland (Görz, Gradiska, Triest und Istrien), S. 70). Die Bewohner Triests
lieben die Kaffeehauskultur, und die Triestinerinnen schätzen schönes Schuh-
werk. Die Freude an der Musik existiere zwar, jedoch sei diese nur von kurzer
Dauer. Gänzlich fehlen ihm bei den Triestinern die Volkspoesie und Volks-
lieder. Obwohl Triest (Trieste, Trst) schlechthin eine Handelsstadt ist, sei das
Interesse der Bewohner an der Ökonomie wenig ausgeprägt. Die Abhandlung
„Zur Volkskunde Kärnten, Volkscharakter, Trachten, Sitten und Bräuche“ gibt
einen umfassenden Eindruck in das Volksleben des Landes der Seen und der
Karawanken. Der Deutschkärntner wird als „grundehrlich, bieder, gemüthlich
und sinnlich“ (Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd.
8: Kärnten und Krain, S. 97) beschrieben. Allerdings unterscheiden die Autoren
zwischen Tal- und Bergbewohnern. „Während der Möll-, Lieser- und Drautha-
ler berechnend, klug, nüchtern und wißbegierig ist, ist der Glanthaler und der
Bewohner der Gurkthales mit Ausnahme des obersten Theiles wie der Krapfel-
der mehr leichtlebig, sangeslustig, übermüthig und mitunter auch rauflustig.
Während der Bewohner der `Gegend´ und des Feldkirchner Bezirkes sich mehr
oder weniger durch eine gewisse Urbanität und Freundlichkeit vorteilhaft aus-
zeichnet, hat der geistig geringer begabte Lavantthaler gerne Rechtshändel und
zeigt eine starke Neigung zur Sinneslust“ (Österreich-Ungarn in Wort und Bild,
Bd. 8: Kärnten und Krain, S. 97). Ungeachtet der Stereotypisierung hinsichtlich
Proof
160
menschlicher Charaktereigenschaften mit örtlichen Bezügen, vermeiden die
Autoren nationale Heterostereotypisierungen, die nationale Antagonismen
schaffen. Unübersehbar ist die Tendenz, die unterschiedlichen kulturellen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wurzeln Innerösterreichs in ein
gemeinsames Totum, nämlich den habsburgischen Vielvölkerstaat, münden
zu lassen. Am Ende bleibt aber die nicht oder nur kaum zu beantwortende
Frage im Raum stehen: Als „wer“ fühlten sich die Menschen? Fühlten sie sich
als „österreichische Triestiner“ oder als „österreichische Kärntner“? Nimmt
man den poltischen Alltag als Grundlage der Bewertung dann fühlten sie sich
nicht als solche, sondern als „italienische Triestiner“, „deutsche Kärntner“
oder „slowenische Kärntner“.
Das „Kronprinzenwerk“ hatte mehr als einen bloß repräsentativen Charakter,
auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, dass es die Leser weniger zum
Lesen, sondern ob der „rund viereinhalbtausend Illustrationen“ zum Durch-
blättern und Ansehen animieren sollte (vgl. Zintzen 1999, S. 9). Für die passen-
den Motive wurden „Künstler, Fotografen und lokale Autoren“ ausgesandt, um
den Lesern ein möglichst authentisches Bildmaterial über jedes Kronland und
die Völker des Habsburgerreiches bieten zu können (vgl. Petschar 2011, S. 163).
Das Spektrum der Sujets ist reichhaltig. Es finden sich Familien in Feiertags-
kleidung sowie in Arbeitskleidung, Pfeifen rauchende Männer, Bauern beim
Tagwerk, Hirten auf Weiden mit ihren Schafen und Ziegen, Landschaftsillus-
trationen und die Verbildlichung wichtiger Feiertagen und Bräuche aus dem
kirchlichen Festkalender wie etwa Ostern, Fronleichnam, Kirchweihfeste,
Erntedank, dem Nikolausfest oder Weihnachten. Nach 1918 war es dann ein
Blick in die „Welt von gestern“, weil die emotionale Kraft der politischen Vision
der eigenen „Nation“ stärker auf Seele und Verstand wirkte als das Faszino-
sum des multiethnischen Staates. Daran konnte auch das „Kronprinzenwerk“
nichts ändern.
Proof
161
Quellen
Archivalische Quellen
a) Kärntner Landesarchiv Klagenfurt (KLA Klagenfurt)
Franziszeischer Kataster: Steuergemeinde Aich: Nr. 76001, K 003; Steuergemeinde Berg ob Leifling: Nr. 76002, K 021; Steuergemeinde Bleiburg: Nr. 76003, K 26; Steuergemeinde Feistritz: Nr. 76004, K 056; Steuergemeinde Grablach: Nr. 76005, K 99; Steuergemeinde Graditschach: Nr. 76006, K 104; Steuergemeinde Gutenstein: K 128; Steuergemeinde Heiligenstadt: Nr. 76007, K 140; Steuer-gemeinde Kömel: Nr. 76014, K 195; Steuergemeinde Lavamünd: Nr. 77117, K 225; Steuergemeinde Leifling: Nr. 76009, K 230; Steuergemeinde Moos: Nr. 76010, K290; Steuergemeinde Neuhaus: Nr. 76011, K 297; Steuergemeinde Oberloibach: Nr. 76012, K 308; Steuergemeinde Penk: Nr. 76013, K 319; Steuergemeinde Pudlach: Nr. 76014, K 354; Steuergemeinde Rinkenberg: Nr. 76015, K 376; Steuergemeinde St. Margarethen: Nr. 76016, K 257; Steuergemeinde St. Michael: Nr. 76017, K 273; Steuergemeinde Schattenberg: Nr. 76018, K 391; Steuergemeinde Schwabegg: Nr. 76019, K 402; Steuergemeinde Traundorf: Nr. 76020, K 450; Steuergemeinde Unterort: Nr. 76022, K 467; Steuer-gemeinde Weißenstein: Nr. 76023, K 497; Steuergemeinde Woroujach: Nr. 76024, K 518.
b) Arhiv Republike Slovenije Ljubljana/ Laibach (ARS Ljubljana)
Franziszeischer Kataster: Steuergemeinde Aichdorf: K 005; Steuergemeinde Berg ob Tscherberg: K 022; Steuergemeinde Dobraua: K 039; Steuergemeinde Dürngupf: K 042; Steuergemeinde Fet-tengupf: K 061; Steuergemeinde Gamsenegg: K 074; Steuergemeinde Jamnitzen: K 159; Steuerge-meinde Jaswina: K 160; Steuergemeinde Jaworia: K 162; Steuergemeinde Köttulach: K 197; Steu-ergemeinde Lamberg: K 215; Steuergemeinde Langstegg: K 221; Steuergemeinde Liescha: K 238; Steuergemeinde Lokowitzen: K 247; Steuergemeinde Luderberg: K 252; Steuergemeinde Mißberg diesseits: K 281; Steuergemeinde Mißberg jenseits: K 282; Steuergemeinde Mißdorf: K 283; Steu-ergemeinde Nauerschniggupf: K 294; Steuergemeinde Pfarrdorf: K 329; Steuergemeinde Platt: K 333; Steuergemeinde Podgorach: K 335; Steuergemeinde Podkrai: K 336; Steuergemeinde Pollain: K 339; Steuergemeinde Prescheggupf: K 345; Steuergemeinde Prevali: K 346; Steuergemeinde Sagradi: K 388; Steuergemeinde St. Daniel: K 031; Steuergemeinde Schöllenberg: K 397; Steuerge-meinde Schwarzenbach: K 403; Steuergemeinde Selloutz: K 407; Steuergemeinde Straschischa: K 427; Steuergemeinde Stroina: K 430; Steuergemeinde Topla: K 448; Steuergemeinde Tscherberg: K 456; Steuergemeinde Ursulaberg: K 473; Steuergemeinde Werdiniach: K 504; Steuergemeinde Wistra: K 507; Steuergemeinde Wriesenza: K 520.
Gedruckte Quellen
Bericht über sämtliche Erzeugnisse, welche für die erste, zu Klagenfurt im Jahre 1838 veranstaltete […] Industrieausstellung […] eingeschickt worden sind (1839). Graz.
Blätter für Landwirthschaft und Industrie 1833/ 2.
Castle, Eduard (Hrsg.) (1909): Anastasius Grüns Werke in sechs Teilen, Tl. 5. Berlin.
Czoernig, Karl von (1857): Ethnographie der oesterreichischen Monarchie, Bd. 1. Wien.
Czoernig, Karl von (1855): Ethnographie der oesterreichischen Monarchie. Bd. 3. Wien.
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild Bd. 22: Bosnien und Hercegovina (1901). Wien
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 7: Steiermark (1890). Wien.
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 11: Dalmatien (1892). Wien.
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 8: Kärnten und Krain (1891). Wien.
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 10: Das Küstenland (Görz, Gradiska, Triest und Istrien) (1891). Wien
Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 24: Croatien und Slavonien (1902). Wien
Schematismus des Laibacher Gouvernements-Gebiethes im Königreich Illyrien. 1836–1848. Laibach.
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, Bd. 15 (1842). Wien.
Proof
162
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, Bd. 20/ 21 (1847). Wien.
Wagner, Joseph (1844): Ansichten aus Kärnten. Klagenfurt.
Wurzbach, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. 60 Bde., 1856 – 1891. Wien.
Literatur
Bäck, Roland (2005): Die Kärntner „Ackerbaugesellschaft“ von ihrer Gründung 1764 bis zur Grun-dentlastung 1848: eine frühbürgerliche Vereinigung als ökonomisches Modernisierungsinstru-ment. Diplomarbeit. Klagenfurt.
Barth-Scalmani, Gunda & Scharr, Kurt (2011): „Mit vereinten Kräften!“. Raumkonstruktion und politische Kommunikation im Kronprinzenwerk. In: Österreich in Geschichte und Literatur 55, S. 92–108.
Bruckmüller, Ernst (1995): Entfernte Verwandte. Stereotypen, Klischees und Vorurteile in der Beur-teilung der Slowenen seitens der (Ost-) Österreicher. In: Franc Rozman (Red.): Sosed v ogledalu soseda od 1848 do danes. Pprvo zasedanje Slovensko-Avstrijske Zgodovinske Komisije, Bled 9. – 12.11.1993. Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn von 1848 bis heute. Ljubljana, S. 31–53.
Cvirn, Janez (1995): Die Slowenen mit deutschen Augen gesehen (1848–1914). In: Franc Rozman (Red.): Sosed v ogledalu soseda od 1848 do danes. Pprvo zasedanje Slovensko-Avstrijske Zgo-dovinske Komisije, Bled 9. – 12.11.1993. Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn von 1848 bis heute. Ljubljana, S. 65–78.
Dinklage, Karl, Konrad Erker & Franz Koschier (1966): Geschichte der Kärntner Landwirtschaft und bäuerlichen Volkskunde. Klagenfurt.
Dinklage, Karl (1953): Kärntens gewerbliche Wirtschaft von der Vorzeit bis zur Gegenwart, hrsg. Von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Kärnten. Klagenfurt.
Drobesch, Werner (2003): Grundherrschaft und Bauer auf dem Weg zur Grundentlastung. Die „Agrarrevolution“ in den innerösterreichischen Ländern (Aus Forschung und Kunst 35). Klagenfurt.
Drobesch, Werner (2004): Kärnten-Böhmen. Annotationen zum Strukturwandel von Gesellschaft und Wirtschaft während des Vormärz. In: Claudia Fräss-Ehrfeld (Hrsg.): Kärnten und Böhmen, Mähren, Schlesien (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 89). Klagenfurt, S. 257–275.
Drobesch, Werner (2006): Die Rosthorns – Aufstieg und Fall einer (inner)österreichischen Unter-nehmerdynastie im 19. Jahrhundert. In: Helmut Alexander, Elisabeth Dietrich-Daum, Wolfgang Meixner (Hrsg.): Menschen – Regionen – Unternehmen. Festschrift für Franz Mathis zum 60. Geburtstag. Innsbruck, S. 71–90.
Drobesch, Werner (2007a): Das Ende des „Entrepreneurs“ – Industriewirtschaft und Unterneh-mertum in Innerösterreich während des Vormärz. In: Michael Pammer, Herta Neiß, Herta & Michael John (Hrsg.): Erfahrung der Moderne. Festschrift für Roman Sandgruber zum 60. Geburtstag. Stuttgart, S. 167–178.
Drobesch, Werner (2007b): Das „Unternehmen“ Grundherrschaft in den innerösterreichischen Län-dern am Vorabend der Grundentlastung – Hemmnis einer ökonomischen Modernisierung?. In: Werner Drobesch & Claudia Fräss-Ehrfeld (Hrsg.): Die Bauern werden frei. Innerösterreichs Landwirtschaft zwischen Beharren und Modernisierung im frühen 19. Jahrhundert (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 93). Klagenfurt, S. 55–76.
Drobesch, Werner & Martin Stermitz (2008): Eine Kärntner Unternehmerdynastie: Die Egger. Han-delsherren – Eisentycoons – bourgeoise Bonvivants. In: Geschichtsverein für Kärnten. Bulletin. Zweites Halbjahr 2008, S. 33–38.
Fallgatter, Michael J. (2004): Das Handeln von Unternehmern: Einige Überlegungen zum Kern des Entrepreneurship. In: Ann-Kristin Achleitner et al. (Hrsg): Jahrbuch Entrepreneurship. Grün-dungsforschung und Gründungsmanagement 2003/04. Berlin et al., S. 11–32.
Franke, Nikolaus & Christian Lüthje (2004): Entrepreneurship und Innovation. In: Ann-Kristin Ach-leitner et al. (Hrsg): Jahrbuch Entrepreneurship. Gründungsforschung und Gründungsmanage-ment 2003/04. Berlin et al. 2004, S. 33–46.
Proof
163
Haberkern, Eugen & Joseph Friedrich Wallach (2001): Hilfswörterbuch für Historiker: Mittelalter und Neuzeit. Erster Teil: A-K. Tübingen, Basel.
Haupt, Heinz-Gerhard & Jürgen Kocka (1996): Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Prob-leme. Eine Einleitung. In: Heinz-Gerhard Haupt & Jürgen Kocka (Hrsg.): Geschichte und Ver-gleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main et al., S. 9–45.
Hösler, Joachim (2006): Von Krain zu Slowenien. Die Anfänge der nationalen Differenzierungspro-zesse in Krain und der Untersteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution, 1768 bis 1848. München.
Ložar-Podlogar, Helena (2008): Die slowenische Volkskultur im „Kronprinzenwerk“ (mit besonderer Berücksichtigung der Sitten und Bräuche). In: Jurij Fikfak (Hrsg.): Ethnographie in Serie: zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien, S. 217–241.
Mathis, Franz (1987): Big Business in Österreich. Wachstum und Eigentumsstruktur der österreichi-schen Großunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 1: Österreichische Großunternehmen in Kurzdarstellungen. Wien und München.
Mathis Franz (1990): Big Business in Österreich. Wachstum und Eigentumsstruktur der österreichi-schen Großunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 2: Analyse und Interpretation. Wien und München.
Matis, Herbert (1969): Der österreichische Unternehmer. Erscheinungsbild und Repräsentanten. In: Karl-Heinz Manegold (Hrsg.): Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Studien zur Geschichte. Wilhelm Treue zum 60. Geburtstag. München, S. 286–298.
Matis, Herbert (2002): Der „Entrepreneur“ als dynamisches Element im Wirtschaftsprozess: Schum-peters Beitrag zur Theorie unternehmerischen Verhaltens. Wien.
Melville, Ralph (1981): Grundherrschaft, rationale Landwirtschaft und Frühindustrialisierung. Kapi-talistische Modernisierung und spätfeudale Sozialordnung in Österreich von den theresianisch-josephinischen Reformen bis 1848. In: Herbert Matis (Hrsg.): Von der Glückseligkeit des Staa-tes. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Österreich im Zeitalter des aufgeklärten Absolutis-mus. Berlin, S. 295–313.
Mentschl, Josef (1969): Österreichisches Industrie-Unternehmertum im 19. Jahrhundert. In: Öster-reich in Geschichte und Literatur 13, S. 289–294.
Meixner, Wolfgang (2001): Aspekte des Sozialprofils österreichischer Unternehmer im 19. Jahrhun-dert: regionale und soziale Mobilität. Dissertation, Innsbruck.
Moritsch, Andreas (1995): Das deutsch-österreichische Bild vom „Slovenen“ 1848 – 1914. In: Franc Rozman (Red.): Sosed v ogledalu soseda od 1848 do danes. Pprvo zasedanje Slovensko-Avstrijske Zgodovinske Komisije, Bled 9. – 12.11.1993. Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn von 1848 bis heute. Ljubljana, S. 79–90.
Moritsch, Andreas (2002): Ursache und Wirkungsweisen nationaler Stereotype. In: Andreas Moritsch & Alois Mosser (Hrsg.): Den Anderen im Blick. Stereotype im ehemaligen Jugoslawien. Frankfurt am Main et al., S. 15–26.
Mosser, Alois (1999): Business History in Österreich. In: Alice Teichova, Herbert Matis & Andreas Resch (Hrsg.): Business History. Wissenschaftliche Entwicklungstrends und Studien aus Zent-raleuropa (Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Unternehmensgeschichte 21). Wien, S. 53–66.
Mugler, Josef (2004): Klein- und Mittelunternehmen in europäischer Perspektive. In: Ann-Kristin Achleitner et al. (Hrsg): Jahrbuch Entrepreneurship. Gründungsforschung und Gründungsma-nagement 2003/04. Berlin et al. 2004, S. 249–270.
Naderer, Edith (1976): Versuch einer historischen Unternehmertypologie für Österreich (1848–1914). Wien.
Nikocevic, Lidija (2006): State Culture and the Laboratory of Peoples: Istrian Ethnography during the Austro-Hungarian Monarchy. In: Folks Art – Croatian Journal Of Ethnology and Folklore Research, S. 41–57 (online unter hrcak.srce.hr/file/36543, zuletzt besucht am 01.08.2012).
Petschar, Hans (1992): Ansichten des Volkes. Über die Transformation von Kollektivvorstellun-gen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. In: Karl Kaser & Karl Stocker (Hrsg): Clios Rache. Neue Aspekte strukturgeschichtlicher und theoriegeleiteter Geschichtsforschung in Österreich. Wien, S. 173–202.
Petschar, Hans (2011): Altösterreich: Menschen, Länder und Völker in der Habsburgermonarchie. Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien.
Proof
164
Plaschka, Richard (1995): Zur Einleitung. Geschichtsbild als Emotionsherd. In: Franc Rozman (Red.): Sosed v ogledalu soseda od 1848 do danes. Pprvo zasedanje Slovensko-Avstrijske Zgodovinske Komisije, Bled 9. – 12.11.1993. Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn von 1848 bis heute. Ljubljana, S. 17–22.
Ploetz (o. J.): Lexikon der Weltgeschichte. Personen und Begriffe von A bis Z. Freiburg im Breisgau.
Reinhard, Wolfgang (2002): Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsge-schichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München.
Rumpler, Helmut (1992): Kärntens Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Das Ende des Montanzeitalters und die Krise der Modernisierung. In: Verlag Gesellschaft für Wirtschaftsdokumentationen (Hrsg.): Kärnten Landwirtschaftschronik. Klagenfurt, S. I/215–265.
Rumpler, Helmut (2010): Carl Josef Czoernig Frh. von Czernhausen als „Vater“ der österreichischen Verwaltungsstatistik. In: Christian Brünner & Werner Hauser (Hrsg.): Mensch-Gruppe-Gesell-schaft. Von bunten Wiesen und deren Gärtnerinnen bzw. Gärtnern. Festschrift für Manfred Prischnig zum 60. Geburtstag. Wien, S. 833–847.
Sandgruber, Roman (1982): Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Konsumgüterverbrauch, Lebens-standard und Alltagskultur in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert (Sozial- und wirtschaftshis-torische Studien 15). Wien.
Prijatelj, Ivan (1956): Slovenska kulturnopoliticna in slovstvena zgodovina [Slowenische Kultur- und Literaturgeschichte), Bd. 2. Ljubljana.
Shedel, James (2002): The Elusive Fatherland: Dynasty, State, Identity and the Kronprinzenwerk. In: Moritz Csáky (Hrsg.): Inszenierungen des kollektiven Gedächtnisses (Paradigma: Zentraleuropa 4). Innsbruck et al., S. 70–82.
Schmid, Georg (1995): Die Reise auf dem Papier. In: Britta Rupp-Eisenreich & Justin Stagl (Hrsg.): Kulturwissenschaften im Vielvölkerstaat. Zur Geschichte der Ethnologie und verwandter Gebiete in Österreich, ca. 1780 bis 1918 (Ethnologica Austriaca 1), Wien, S. 100–113.
Schmidt, Dorothea (2011): Unternehmensgeschichte trifft Entrepreneurship (online unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=18013, zuletzt besucht am 15.12.2011).
Schumpeter, Joseph Alois (1947): The Creative Response in Economic History. In: The Journal of Economic History 7/2: S. 149–159.
Slokar, Johann (1914): Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I. Mit besonderer Berücksichtigung der Großindustrie und unter Benützung archivali-scher Quellen verfasst. Wien.
Smole, Cäcilia (2008): Neuhaus: Geschichte und Gegenwart. Ein Gemeindebuch für alle. Klagenfurt.
Spoerer, Mark (2002): Mikroökonomik in der Unternehmensgeschichte? Eine Mikroökonomik der Unternehmensgeschichte. In: Jan-Otmar Hesse, Christian Kleinschmidt & Karl Lauschke (Hrsg): Kulturalismus, Neue Institutionsökonomik oder Theorienvielfalt. Eine Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte (Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 9). Essen 2002, S. 175–195.
Stagl, Justin (1998): The Kronprinzenwerk – Representing the Multi-National State. In: Bálint Balla & Anton Sterbling (Hrsg.): Ethnicity, nation, culture. Hamburg, S. 17–30.
Stagl, Justin (2002): Das „Kronprinzenwerk“ – eine Darstellung des Vielvölkerreiches, in: Akos Moravánsky (Hrsg.): Das entfernte Dorf. Moderne Kunst und ethnischer Artefakt (Ethnologica Austriaca 3). Wien et al., S. 169–182.
Vilfan, Sergij (1992): Unternehmer und Gutsbesitzer. Ländliches Bürgertum in Slowenien im 19. Jahrhundert. In: Hannes Stekl et al. (Hrsg.): Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit (Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2). Köln und Weimar, S. 244–254.
Wadl, Wilhelm (1995): Magdalensberg. Natur, Geschichte, Gegenwart. Gemeindechronik. Klagenfurt.
Wilckens, Martin (1876): Die Rinderrassen Mitteleuropas. Grundzüge einer Naturgeschichte des Hausrindes. Wien.
Zintzen, Christiane (1999): Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Aus dem „Kronprinzenwerk“ des Erzherzog Rudolf (Literaturgeschichte in Studien und Quellen 3). Wien.
Proof
167
4.1 Zur sozialen Grammatik der Raumpraxis in der globalisierten Welt
Erol Yildiz
„Theoretisch innovativ und politisch entscheidend ist die Notwendigkeit, über
Geschichten von Subjektivitäten mit einem Ursprung oder Anfang hinaus zu den-
ken.“ (Homi Bhabha 1997, S. 124)
Eine Art mobiler Sesshaftigkeit oder sesshafter Mobilität scheint das Charak-
teristikum gegenwärtiger Gesellschaften zu sein, setzt Denkbewegungen in
Gang und beeinflusst unsere Lebensentwürfe, Wirklichkeitsauffassungen und
räumlichen Bezüge. Weltweite Öffnungsprozesse und erweiterte Mobilität
stellen konventionelle Raumkonstruktionen in Frage, bieten neue und alter-
native Möglichkeiten zur Raumpraxis. Es entstehen neue Verortungspraxen,
Lebenskonstruktionen, neue Bindungen und Vernetzungen, die Menschen
und Orte miteinander verknüpfen, aber auch die gegenläufigen Tendenz neuer
Grenzziehung. Regionen, Kulturen, Lebensstile und Lebensformen, die oft
geographisch wie zeitlich weit voneinander entfernt sind, kommen in unter-
schiedlichen Kontexten auf lokaler Ebene zusammen und erfordern neue
Raumvorstellungen. Dabei entstehen, wie Martin Albrow (1997) sagt, diverse
„Soziosphären“, die unterschiedlich gelagerte, weltweit gespannte gesell-
schaftliche wie lebensweltliche Phänomene und Verknüpfungen präsentieren.
Diese neue globale Dynamik erfordert das Überdenken unserer Vorstellungen
von Raum, Zeit und Welt.
Die Gleichzeitigkeit von Grenzöffnungen und lokaler Diversifizierungsprozesse
lässt ethnisch-nationale Metaerzählungen fragwürdig werden und geht mit der
Auflösung tradierter Lebensformen einher. Lebensläufe, Differenzen und Zuge-
hörigkeiten sind in Bewegung geraten, haben ihre Eindeutigkeit und räumliche
Fixierung verloren. Immer weniger Menschen verbringen ihr Leben an ein und
demselben Ort, viele haben ihren Wohnsitz mehrmals gewechselt, Ländergren-
zen passiert. Geographische und kognitive Bewegung gehen Hand in Hand. Dies
alles gehört zum Alltag. Vieles, was wir heute als national oder homogen wahr-
nehmen, ist ein Ergebnis von Vermischung, ein Teil verflochtener Geschichten.
Durchlässig gewordene Grenzen in der Alpen-Adria-Region haben in den letzten
zwanzig Jahren zu neuen Prozessen geführt. Ein positiver Blick auf diese Region
macht Potentiale sichtbar, die sie im Schnittpunkt sprachlicher und kultureller
Einflüsse und durch die wechselvollen Biographien ihrer Menschen zu bieten
hat und die oft genug übersehen oder von politischer Seite argwöhnisch betrach-
Proof
168
tet werden. Politische Nationalismen und Homogenisierungstendenzen haben
in der Alpen-Adria-Region zu leidvollen Erfahrungen und zählebigen Feindbil-
dern geführt. Doch jenseits der politischen Instrumentalisierung ethnisch-nati-
onaler Differenzlinien gibt es eine andere Seite und das ist die, die hier in den
Blick genommen wird: Gelebte Vielfalt und unterschiedliche Raumpraktiken.
Im künstlerischen Schaffen, kulinarischer Vielfalt oder geführten Wande-
rungen im Dreiländereck, bei Musik-, Literatur- und Kulturveranstaltungen,
in zivilgesellschaftlichen Initiativen und alltäglicher Heterogenität und
Mehrsprachigkeit finden sich viele Aspekte historisch gewachsener Erfah-
rungen, Bindungen und Verbindungen – eine Art Kosmopolitisierung von
unten. Ähnlich argumentieren Ulrich Beck u. a. (2001, S. 16): „Die Debatte um
einen neuen Kosmopolitismus verweist vielmehr auf komplexe Erfahrungs-
räume und Erwartungshorizonte, in denen die verschiedenen Ordnungen
und Ordnungsvorstellungen des menschlichen Zusammenlebens wider-
spruchsvoll aufeinander treffen und zur Artikulation gedrängt werden. Es ist
also die Differenz und nicht die Einheit, welche den neuen ‚transnationalen‘
Erfahrungsraum kennzeichnet.“
In der vorliegenden Studie werfen die Autorinnen und Autoren einen Blick auf
die Gegenwart der Alpen-Adria-Region, vor allem auf Raumkonstruktionen bzw.
-praktiken jenseits nationaler Narrative. Sie zeigen, unter welchen Bedingun-
gen, in welchen Kontexten und mit welchen Absichten die Alpen-Adria-Region
tagtäglich als Raum konstruiert wird und welche Bindungen und Grenzen durch
diese Praxis sichtbar werden. Der Blick auf die bisher unbeachteten Lebenser-
fahrungen und Wirklichkeitskonstruktionen und deren besondere Relevanz
für individuelle Verortungspraktiken macht anschaulich, dass es jenseits oder
unterhalb national-homogener Vorstellungen eine spezifische Vielschichtigkeit,
hybride und widersprüchliche Alltagspraktiken, kulturelle Überschneidungen,
Überlappungen und Verflechtungen gibt, die überwiegend als ein Ergebnis geo-
graphischer und mentaler Bewegungen zu betrachten sind.
Ein relationales Raumverständnis bildet den theoretischen Hintergrund der
Beobachtungen: Wenn Orte und Räume aus unterschiedlichen Perspektiven,
als Prozess bzw. in Bewegung beschrieben und analysiert werden, wie es in
der vorliegenden Studie der Fall war, dann sieht man sich mit unterschiedli-
chen Entwicklungen, historischen Erzählungen und Spuren konfrontiert, die
das Leben in der Alpen-Adria-Region in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Im folgenden Zitat kommt die Spezifik der Alpen-Adria-Region besonders prä-
gnant zum Ausdruck: „Obwohl mein Vater zeit seines Lebens im gleichen Dorf
Proof
169
lebte, wechselte seine Staatsbürgerschaft sechsmal: Österreich-Ungarn, Ita-
lien, Deutschland, Jugoslawien, Freies Territorium Triest mit seinen verschie-
denen Zonen, dann wieder Italien. Wenn man die EU mitzählt, sind es sieben.
Man könnte es ‚Die glorreichen Sieben‘ nennen. Sie kamen und sie gingen. Das
ist das Schicksal solcher Orte“ (Klabjan 2010, S. 208).
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie demonstrieren, wie Räume im medi-
alen, wissenschaftlichen, politischen, ökonomischen und biographischen
Kontext konstruiert werden. Sie werden durch eine endogene, in dieser Region
immer vorhandene und eine exogene, translokale und globale Vielfalt charak-
terisiert. Als exogene Diversität wird die Summe jener von außen hinzukom-
menden Impulse bezeichnet, die in der Region wirksam wurden bzw. werden
und zu einer spezifischen Entwicklung ökonomischer, politischer und kultu-
reller Konfigurationen bzw. zu einer spezifischen Raumpraxis geführt haben. Es
zeigt sich auch, dass diese endogenen und exogenen Prozesse nach dem Ende
des Eisernen Vorhangs und durch die Osterweiterung eine Intensivierung
erfahren haben bzw. mit neuen Konfigurationen und Verknüpfungen einher-
gehen. Diese Studie belegt, dass Räume nicht im „luftleeren Raum“, sondern
in unterschiedlichen Kontexten konstruiert werden und je nach Perspektive,
Bindungen erzeugen, mit Grenzziehungen einhergehen, Barrieren errichten
oder Machtverhältnisse reproduzieren. Raumkonstruktionen können ökono-
mischen Zwecken dienen, politisch instrumentalisiert, medial inszeniert oder
auch individuell genutzt werden.
Im Alpen-Adria-Raum werden Querverbindungen, vielschichtige Interakti-
onen und Verflechtungen erkennbar, die neue individuelle Verortungsprak-
tiken ermöglichen. Darüber hinaus wird erkennbar, dass solche Alltagsprak-
tiken in der Regel keine Rücksicht auf homogenisierende nationale Diskurse
nehmen und im Prinzip unterhalb bzw. jenseits von nationalen Erzählungen
verlaufen. Sie weisen transkulturelle und translokale Verschränkungen auf,
auch wenn einzelne Elemente für nationale Erzählungen instrumentalisiert
wurden und werden.
Die in der Studie vorgestellten Biographien aus der Region zeigen dagegen, wie
divers und vielschichtig die Lebensentwürfe sind und dass Biographien topo-
graphische Konstruktionen darstellen. Die Beispiele aus der Region machen auf
je eigene Weise die jeweils genutzten Kontexte und Orte sichtbar und zeigen
andererseits die individuellen mentalen Landkarten. Mobilität geographischer
und mentaler Art spielt bei beiden Lebensgeschichten eine zentrale Rolle. Es
zeigt sich weiter, wie sich Grenzöffnungsprozesse, kulturelle Heterogenität und
Proof
170
Mehrsprachigkeit auf die Lebensentwürfe auswirken, wie sie biographisch bear-
beitet werden und sich zu Strukturen und Kommunikationsformen verdichten.
So werden unterschiedliche Elemente grenzüberschreitender Herkunft vor Ort
biographisch genutzt und in die Alltagspraxis übersetzt. Auf diese Weise entste-
hen lokale Räume, die ich als „Transtopien“ bezeichne (Yildiz 2013).
Lebensentwürfe werden zu topographischen Konstruktionen, in denen unter-
schiedliche Orte, Menschen, Erfahrungen und Ereignisse miteinander verbun-
den werden (vgl. Apitzsch 2003). So gewinnen Biografien durch jeweilige Stra-
tegien und Verknüpfungen ihre spezifischen Ausprägungen und räumlichen
Bezüge. Solche bewegten Lebensentwürfe werden auch in Zukunft das Leben
in der Alpen-Adria-Region prägen. Es ist höchste Zeit, diese Öffnungsprozesse
und die damit einhergehende Diversifizierung als Potentiale wahrzunehmen
und als Ressource für die Gestaltung der Region zu nutzen. Der Alpen-Adria-
Raum entsteht durch die Menschen, die hier leben, unabhängig davon, woher
sie kommen, welche Verortungspraktiken und Zukunftsvisionen sie haben.
Lange Jahre wurde in der offiziellen Kärntner Politik die historisch gewach-
sene und alltäglich gelebte Diversität und Transkulturalität ignoriert, proble-
matisiert oder für politische Zwecke benutzt. Solche Diskurse verfestigen eine
kulturelle Hegemonie, schaffen künstliche Differenzlinien und Grenzen und
versuchen, die vielschichtigen Alltagspraktiken auf ethnisch-nationale Narra-
tionen und deren Ausschlusskriterien zu reduzieren. Diesen Ordnungszwang
führt Ursus Wehrli (2011), ein Schweizer Künstler, mit der ironischen Frage
ad absurdum: Was würde passieren, wenn man in der Kunst oder im Alltag
anfinge, aufzuräumen? Alle Elemente eines Bildes oder einer vielschichtigen
Alltagssituation werden fein säuberlich voneinander getrennt, nach Größe,
Form und Farbe nebeneinander aufgereiht und werden auf diese Weise bis zur
Unkenntlichkeit entstellt. Die Lebenswirklichkeit heute und unsere Alltagssi-
tuationen entziehen sich jedoch zu gängigen Orientierungsmustern.
Biographien sind in Bewegung geraten, verlangen neue Orientierungen und
Raumpraktiken und führen dazu, dass Vertrautes neu interpretiert werden
muss. Dieser Wandel erfordert ein Überdenken unserer Wahrnehmungspers-
pektiven, unserer Raum- und Zeitbegriffe, er ermöglicht ein neues, weltoffenes
Alltagsverständnis.
Proof
171
Literatur
Albrow, Martin (1997): Auf Reisen jenseits der Heimat. Soziale Landschaften in einer globalen Stadt. In: Ulrich Beck (Hrsg.): Kinder der Freiheit. Frankfurt am Main, S. 288–314.
Apitzsch, Ursula (2003): Migrationsbiographien als Orte transnationaler Räume. In: Ursula Apitzsch & Mechthild M. Jansen (Hrsg.): Migration, Biographie und Geschlechterverhältnisse. Münster, S. 65–80.
Beck, Ulrich, Wolfgang Bonß & Christoph Lau (2001): Theorie reflexiver Modernisierung – Frage-stellungen, Hypothesen, Forschungsprogramme. In: Ulrich Beck & Wolfgang Bonß, (Hrsg.): Die Modernisierung der Moderne. Frankfurt am Main, S. 11–59.
Bhabha, Homi K. (1997): Verortungen der Kultur. In: Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius & Therese Steffen (Hrsg.): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusde-batte. Tübingen, S. 123–148.
Klabjan, Borut (2010): Ein Spaziergang durch die vielschichtige Vergangenheit vin Triest/Trst. In: Tanja von Fransecky, Andrea Rudorff, Allegra Schneider & Stephan Stracke (Hrsg.): Umkämpfte Erinnerungen: Kärnten, Slowenien, Triest. Ein Reisebuch. Berlin, S. 203–208.
Wehrli, Ursus 2011: Die Kunst, Aufzuräumen. Zürich/Berlin.
Yildiz, Erol (2013): Die weltoffene Stadt. Wie Migration Globalisierung zum urbanen Alltag macht. Bielefeld.
Proof
173
4.2 Einblicke in die Alpen-Adria-RaumpraxisKatrin Baumgärtner, Marc Hill, Dragana Jakovljevic , Heidrun Puff, Vera Ratheiser, Elvisa Imširovic
4.2.1 Einführung
Historisch entstand der Begriff „Alpen-Adria-Raum“ Ende der 1970er Jahre,
noch zu Zeiten des Kalten Krieges. 1978 wurde eine Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Alpen Adria mit dem Ziel ins Leben gerufen, die vorhandenen infor-
mellen Beziehungen in den Grenzgebieten zu formalisieren bzw. voranzu-
treiben. Es ging um die Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses durch
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in unterschiedlichen Bereichen. His-
torisch bedingte ethnische Konflikte sollten auf diese Weise überwunden und
die räumlichen, kulturellen und sprachlichen Potentiale in der Region gewür-
digt und genutzt werden (vgl. Pahor 2011, S. 319 ff.).
Seit der Gründung der ARGE scheint sich der Gebrauch des Begriffs „Alpen-
Adria“ insbesondere in Kärnten veralltäglicht und normalisiert zu haben. In
der Gegenwart kommt er in unterschiedlichen Kontexten vor. Die Klagenfurter
Universität trägt diesen Namen. In der lokalen Medienlandschaft wird per-
manent Bezug darauf genommen. Mit dem Titel „Alpen-Adria“ erscheint eine
monatliche Zeitschrift. Auch die Wissenschaft befasst sich zunehmend mit
der Idee des Alpen-Adria-Raumes. Zu diesem Themenfeld wurden und werden
Diskussionen, Tagungen und Konferenzen veranstaltet, Stadtführungen orga-
nisiert und Aufsätze und Bücher publiziert. Im Spektrum dieser Aktivitäten
sind unterschiedliche Perspektiven bzw. Definitionen zu finden, und je nach
Perspektive stehen historische, geographische, politische, ökonomische oder
mediale Aspekte im Mittelpunkt.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung begegnet man eher positiven
Entwicklungen und Chancen, die der Alpen-Adria-Raum bietet, wie die fol-
genden Beispiele demonstrieren. So wird in dem von Andreas Moritsch her-
ausgegeben Sammelband der Versuch unternommen, aus unterschiedlichen
Blickwinkeln die Geschichte der Alpen-Adria-Region neu zu erzählen. Aus-
gehend von der sprachlichen, kulturellen und historischen Vielfalt wird der
modellhafte und experimentelle Charakter der Region für eine transnationale
Geschichtsschreibung hervorgehoben (vgl. Moritsch 2001, S. 10): „Nicht gegen-
seitige Abgrenzung und Homogenisierung territorialer und gesellschaftlicher
Einheiten, sondern die geographische Vielgestaltigkeit des Gebiets mit einer
Proof
174
überaus bewegten Geschichte und in hohem Grade multikultureller Bevölke-
rung sollte zur übergeordneten Identität einer Alpen-Adria-Region in einem
integrierten Europa werden“ (Moritsch 2001, S. 36). Mit dem Titel „Europa erle-
sen. Alpen-Adria“ wurde 2008 ein weiteres Buch herausgegeben, in dem die
literarische Vielfalt im Alpen-Adria-Raum gewürdigt und die Literatur als ein
wesentliches Bindeglied interpretiert wird (vgl. Platzer & Wieser 2008). Auch
ein im Jahr 2010 publizierter Tagungsband macht den Alpen-Adria-Raum
zum Gegenstand und fokussiert auf Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und
Bildung in dieser Region. Die Herausgeber definieren den Alpen-Adria-Raum
bewusst als Handlungs- und Lebensfeld und als Erfahrungshorizont und
sehen ihn als „ein multikulturelles und mehrsprachiges Laboratorium der
Geschichte“, die „alle Voraussetzungen für positiv gelebte Mehrsprachigkeit“
biete (vgl. Wintersteiner, Gombos & Gronold 2010). In einem 2012 publizierten
Reader mit dem Titel „Kärnten liegt am Meer“ finden wir ähnliche Perspekti-
ven. Die Autoren setzen sich mit der Alpen-Adria-Idee auseinander und versu-
chen aus historischer wie gegenwärtiger Perspektive sowohl die vorhandenen
Konfliktlinien als auch Chancen und neue Visionen zu formulieren (vgl. Pet-
ritsch, Graf & Kramer 2012). Dazu notiert Wolfgang Petritsch einleitend: „Der
Titel unseres Buches ‚Kärnten liegt am Meer’ – inspiriert von Ingeborg Bach-
manns Gedicht Böhmen liegt am Meer – ist eine gleichsam poetische Vision für
die Zukunft des Landes. Natürlich liegt Kärnten nicht am Meer. Was jedoch
der Titel zum Ausdruck bringen möchte, ist die reale Möglichkeit der Überwin-
dung von alten Vorurteilen und neuen Ressentiments, die uns alle beschrän-
ken. Die Karawanken nicht mehr als ‚Grenzwall’ zu begreifen, sondern als
attraktive Verbindung zum Meer vor unserer Haustür“ (Petritsch 2012, S. 31).
Werner Wintersteiner spricht in diesem Kontext von der „Vision einer Frie-
densregion Alpen-Adria“: „Die Idee einer grenzüberschreitenden Kooperation
bis hin zu einer ‚Friedensregion’ Alpen-Adria hat überlebt, und sie hat seit-
her neue Formen angenommen. Sie tritt heute weniger programmatisch und
stärker pragmatisch in Erscheinung“ (Wintersteiner 2012, S. 537). Und weiter:
„Kärnten liegt am Meer – das hat aber nicht nur eine reale, sondern auch eine
symbolische Bedeutung. Es ist Ausdruck einer unendlichen Sehnsucht, die
uns antreibt, über uns hinauszuwachsen, und die uns überhaupt erst erlaubt
Visionen zu entwickeln“ (ebenda, S. 544).
Bereits 1990 spielte der Alpen-Adria-Gedanke eine wesentliche Rolle, als sich
Kärnten gemeinsam mit den Nachbarländern Slowenien und Italien Ende
der 1990er Jahre für die Austragung der Olympischen Spiele 2006 unter dem
Motto „Senza Confini“ (ohne Grenzen) bewarb. Die Bewerbung war erfolglos,
aber der Gedanke blieb.
Proof
175
Die oben ausgeführten Beispiele können einerseits als Versuch gelesen wer-
den, eine Alpen-Adria-Vision zu formulieren, in der die alten Konfliktlinien
in den Hintergrund treten und die positiven Aspekte wie Transkulturalität,
Mehrsprachigkeit oder Literatur hervorgehoben werden, um die Region sym-
bolisch aufzuwerten. Andererseits herrschen weiterhin national orientierte
Raumordnungen, die in Kärnten politisch instrumentalisiert werden.
Darüber hinaus zeigt die Perspektivenvielfalt in Bezug auf Raumkonstrukti-
onen, dass es den Raum an sich nicht gibt. Räume werden aus unterschied-
lichen Perspektiven, in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten und mit
bestimmten Intentionen hergestellt. Räume tauchen als Vision auf, sie werden
als Experiment betrachtet, sie können als Prozess interpretiert werden, sie
werden ethnisch-national eingefärbt oder es handelt sich um eine gelebte All-
tagspraxis. Dies erfordert bei Raumanalysen die Pluralität, Mehrdimensionali-
tät und Vielschichtigkeit räumlicher Bezüge in den Blick zu nehmen, unabhän-
gig davon, ob es sich dabei um Individuen, ökonomische, politische, nationale
oder supranationale Strukturen handelt.
Die unterschiedlichen Vorstellungen belegen, dass Räume keine ontologischen
Gegebenheiten sind, sondern einen prozesshaften und experimentellen Cha-
rakter aufweisen, sich in Bewegung befinden und sich permanent wandeln.
Räume werden also gesellschaftlich hergestellt und erlangen auf diese Weise
soziale Bedeutungen. Wenn man verstehen und analysieren will, wie Räume
entstehen und welche sozialen Bedeutungen sie im Laufe der Zeit bekommen,
dann scheint es sinnvoll, den Blick erst auf die gesellschaftlichen Bedingun-
gen zu richten, unter denen sie konstituiert werden. Dafür eignen sich konst-
ruktivistisch orientierte Raumkonzepte. Daher wird hier mit dem relationalen
Raumansatz gearbeitet, der in den letzten Jahren einen starken Einfluss auf
sozialwissenschaftliche Raumkonzepte ausgeübt hat (vgl. exemplarisch Löw
2000, Schroer 2006).
Zunächst werden wir diskutieren, was ein relationales Raumkonzept bedeu-
tet, welche Aspekte in den Mittelpunkt gerückt werden und welche in den
Hintergrund treten. Anschließend wird begründet, warum das relationale
Raumverständnis für die Analyse der Alpen-Adria-Region geeignet ist.
Danach wird die Methodik der Studie vorgestellt und zum Schluss werden
anhand einiger Fallbeispiele unterschiedliche Raumkonstruktionsprozesse
im Alpen-Adria-Raum beschrieben, theoretisch reflektiert und Schlussfolge-
rungen daraus gezogen.
Proof
176
4.2.2 Vom Container- zum relationalen Raumverständnis
Nach der konstruktivistisch orientierten Raumperspektive wird die Herstel-
lung von gesellschaftlichen Räumen auf soziale Operationen zurückführt.
Aus diesem relationalen Raumverständnis werden Orte, Plätze, Regionen
oder Territorien nicht als ontologische Gegebenheit betrachtet, sondern als
relationale Anordnungen sozialer Güter und Individuen (vgl. Löw 2000).
Räume erscheinen als dynamische und permanent herzustellende Gebilde.
Auf diese Weise wird der Schwerpunkt auf die Prozesse der Produktion von
Räumen gelegt. Daher sind Raumkonstruktionen nicht beliebig und passie-
ren nicht in einem luftleeren Raum, sondern hängen von diversen gesell-
schaftlichen Faktoren ab. Dabei können symbolische wie materielle Struktu-
ren, habituelle und körperliche Möglichkeiten der handelnden Personen wie
auch gesellschaftliche Positionen und Machtverhältnisse eine wesentliche
Rolle spielen. Raumkonstruktionen können auch zum Gegenstand politi-
scher Auseinandersetzungen werden.
Auch Michel de Certeau definiert den Raum als ein Geflecht von beweglichen
Elementen, ein Ergebnis von Handlungen, „die ihm eine Richtung geben, ihn
verzeitlichen und ihn dahin bringen, als eine mehrdeutige Einheit von Kon-
fliktprogrammen und vertraglichen Übereinkünften zu funktionieren“ (de
Certeau 1988, S. 218). So kann davon ausgegangen werden, dass Räume erst
durch Wahrnehmung eine gewisse soziale Relevanz bekommen und durch
Handlungen und soziale Bezüge bestimmt werden. Räume können nicht außer
gesellschaftlicher Wahrnehmung existieren, sondern unsere Wahrnehmun-
gen werden durch soziale Bezüge gerahmt. „Damit wird Raum zu einer soziolo-
gischen Kategorie“, so Hamm (1982, S. 24).
In diesem Zusammenhang kritisiert Läpple (1991) die immer noch dominan-
ten konventionellen Containerraumkonzepte und spricht von einer „bana-
len Raumauffassung“. Nach diesem banalen Raumverständnis werden die
gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen, unter denen Räume hergestellt
werden, kaum erfasst. Er plädiert für ein erweitertes Raumkonzept, das die
Raumkonstruktionen aus ihren gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse heraus
erklärt. Diesen auf dem relationalen Raumverständnis basierenden Raumbe-
griff nennt Läpple (1991, S. 195) einen „Matrix-Raum“ und meint damit einen
gesellschaftlichen Raum, der erst aus dem gesellschaftlichen Herstellungs-,
Verwendungs- und Aneignungszusammenhang plausibel erscheint und in
dem unterschiedliche gesellschaftlich relevante Elemente miteinander in
Beziehung treten. Er formuliert weiter: „Als Resultat der materiellen Aneig-
Proof
177
nung der Natur ist ein gesellschaftlicher Raum zunächst ein gesellschaftlich
produzierter Raum. Seinen gesellschaftlichen Charakter entfaltet er erst im
Kontext der gesellschaftlichen Praxis der Menschen, die in ihm leben, ihn
nutzen und ihn reproduzieren. Durch diese unmittelbare gesellschaftliche
Dimension erklärt sich auch sein Charakter als ‚Matrix-Raum’, d. h. ein sich
selbst gestaltender und strukturierender Raum“ (Läpple 1991, S. 197). Nach dem
relationalen Verständnis können Raumkonstruktionen als vielschichtiger,
mehrdimensionaler und mehrdeutiger Prozess interpretiert werden. Durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse wie Globalisierung, Mobilität oder neue
Kommunikationstechnologien werden Menschen dazu genötigt, die vorhan-
denen Raumauffassungen in Frage zu stellen, zu revidieren, neu zu interpre-
tieren und weiterzuentwickeln (vgl. Läpple 1991, S. 203).
Räume, Macht und Grenzen
Auch wenn relationale Raumauffassungen eine breite Aufmerksamkeit für die
Erklärung bestimmter Entwicklungen wie weltweite Öffnungsprozesse oder
neue Kommunikationsformen erlangt haben, sind nationale „Behälter-Raum-
konzepte“ jedoch immer noch dominant und bestimmen weiterhin gesell-
schaftliche Raumordnungen, weil sie den Einzelnen und Gruppen in der glo-
balisierten Welt eine gewisse Orientierung bieten (können). Gerade die Natio-
nalisierung der Welt durch Bildung von Nationalstaaten schaffte eine Einheit,
marginalisierte die vorhandene Vielfalt, förderte Homogenität und errichtete
neue Grenzen, mit denen wir noch heute zu tun haben.
Oft werden durch die relationale Perspektive Möglichkeiten und Chancen bei
der Herstellung und Gestaltung von Räumen hervorgehoben, dabei aber außer
Acht gelassen, dass Räume Macht ausüben und die Handlungen und Kommu-
nikationsstrukturen prägen (können) (vgl. Schroer 2006, S. 176). Wenn man
verstehen will, wie Räume gesellschaftlich hergestellt werden und soziale
Bedeutungen erlangen, dann sollte man zunächst die Konstitutionsbedingun-
gen beschreiben, die solche Raumkonstruktionen erst möglich machen.
Die Etablierung neuer Raumkonstruktionen in der Gegenwart bedeutet
zunächst, dass die konventionellen und bekannten Raumordnungen in eine
Krise geraten sind. Wir beobachten eine Gleichzeitigkeit diverser und wider-
sprüchlicher Raumordnungen, also Syntopien. Wir erleben einerseits die Ent-
stehung neuer Räume, die das konventionelle nationale Modell in Frage stellen
und neue Raumvorstellungen hervorbringen, andererseits sehen wir uns mit
Renationalisierungstendenzen konfrontiert, die mit der Neuerfindung und
Proof
178
Wiederbelebung des geschlossenen Modells einhergehen und neue Grenzen
zu etablieren versuchen. Raumkonstruktionen können mit neuen Grenzen
einhergehen, neue Grenzziehungen möglich machen, neue Grenzregime und
damit neue Zugangsregelungen etablieren und auf diese Weise neue Zuge-
hörigkeiten definieren. Dazu schreibt Markus Schroer (2006, S. 179) treffend:
„Gerade vor dem Hintergrund sich auflösender Grenzen scheint das Container-
Modell erneut an Attraktivität zu gewinnen. Selbst wenn sich diese Schlie-
ßungsszenarien und Abschottungsstrategien als Illusion erweisen, so sind sie
doch überaus gebräuchliche und wirkungsmächtige Illusionen“.
Diese Entwicklung zeigt, dass Grenzen nicht an Bedeutung verlieren und gänz-
lich verschwinden, sondern sie verschieben sich, werden neu definiert und
neu errichtet. Sie verschwinden an einem Ort und tauchen an einem anderen
wieder auf. Sie sind nicht mehr klar definierbar und eindeutig, sondern blei-
ben zum Teil unsichtbar. In der globalisierten Welt sind die Raumkonzepte
und Grenzen in Bewegung geraten. Sie sind prozesshaft und werden perma-
nent ausgehandelt. Das heißt aber nicht, dass Räume und Grenzen ihre Bedeu-
tung verlieren. Was wir beobachten, ist die ständige Veränderung räumlicher
Bezüge, die dazu führt, dass unterschiedliche Raumkonstruktionen nebenei-
nander existieren, also nicht alternativlos sind, sondern in der globalisierten
Welt zu einer optionalen Angelegenheit werden. Das bedeutet aber nicht, dass
jetzt alle Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten hätten, mobil
zu sein, ihre räumlichen Bezüge freiwillig zu wählen. Vielmehr erleben wir
gegenwärtig eine Art „Hierarchie der Mobilität“ und damit eine Abhängigkeit
von Räumen. Bei dem einen wird Mobilität gefördert und bei dem anderen kon-
trolliert. Damit haben nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten, Mobili-
tät als Ressource zu nutzen und Grenzen zu passieren.
Biographie als topographische Konstruktion
Die neuen Raumkonstruktionen gehen mit unserer Lebenspraxis einher, die
sich sozial und kulturell durch neue räumliche Gegebenheiten wie Globalisie-
rung, erweiterte Mobilität, neue Kommunikationstechnologien, neue Lebens-
formen, virtuelle Räume etc. stark verändert hat. Damit haben sich auch die
gesellschaftlichen Bedingungen gewandelt, unter denen die Einzelnen leben,
sich individuell und räumlich verorten und ihre Biographien entwerfen. Sol-
che strukturellen Veränderungen gehen also mit sozialen Veränderungen
einher, die sich in neuen Raumkonstruktionen niederschlagen. In einer Welt,
die immer globaler und virtueller wird und in der Mobilität räumlicher und
mentaler Art zur Normalität gehört, werden Menschen dazu genötigt, sich neu
Proof
179
zu orientieren und sich neu zu verorten. Unter den individualisierten Lebens-
bedingungen werden völlig andere räumliche Zusammenhänge sichtbar, die
über die konventionellen Lebensentwürfe hinausgehen.
Im Zuge der radikalen Individualisierung und der Auflösung tradierter Lebens-
formen sind ein Großteil der Lebensläufe in Bewegung geraten, haben ihre
Geradlinigkeit verloren, sind riskanter geworden. Der Lebenslauf zerfällt immer
mehr in einzelne Phasen und Abschnitte (vgl. Beck-Gernsheim 1997, S. 65 ff.),
reicht über herkömmliche Bezugspunkte wie Geburtsort oder erlernter Beruf
hinaus. Die durch radikale Individualisierung in Gang gesetzte reflexive Wende,
die den Einzelnen immer wieder zum Nachdenken über die eigene Biogra-
phie nötigt, hat den gesamten Lebenslauf zu einem Lernfeld werden lassen. So
wird die Wahlbiographie zur Wahlgeographie. In diesem Kontext stellt sich die
berechtigte Frage, über welche Möglichkeiten und Ressourcen die einzelnen
Personen verfügen, Räume zu konstruieren und sich anzueignen: „Raumerle-
ben differenziert sich unter den individuellen Bedingungen jedes Lebenslaufes,
und wer solche Lebensräume beschreiben will, muss auch die mit ihnen verbun-
denen Räume beschreiben. Biographie ist insofern immer auch Topographie“
(Becker, Bilstein & Liebau o.J., S. 10, zitiert nach Schroer 2006, S. 112).
Transnationale Räume
In der zunehmend globalisierten Welt sind wir im alltäglichen Leben perma-
nent mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Elementen konfrontiert,
die in einem weltweiten Kommunikationszusammenhang stehen. Die Nor-
malisierung von Begriffen wie „Transnationale Räume“, „Kosmopolitisierung
des Alltags“ oder „Transnationalisierung der Lebensführung“ in der Fachlite-
ratur bringt diesen Wandel zum Ausdruck. Aus dieser Perspektive erscheint
Globalisierung als etwas Gewöhnliches. Unsere Erfahrungs- und Vorstellungs-
räume sind inzwischen – vor allem durch technologische und elektronische
Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten – von weltweiter Reichweite.
Diese Entwicklung beeinflusst unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit und die
Gestaltung unserer Lebensräume.
Gerade Mobilität in Form von Migration ist ein Beleg dafür, wie es zu biographi-
schen Neuorientierungen, räumlichen Neuverortungen und damit zu transnati-
onalen Räumen kommt. Migranten bewegen sich in unterschiedlichen lokalen
Kontexten, in denen unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Elemente
aus allen Teilen der Welt zusammenkommen. Gerade diese Bewegung nötigt die
betroffenen Menschen zur permanenten Biographisierung und eröffnet neue
Proof
180
Zugänge zu sich selbst und den eigenen Lebensräumen. Die so genannte Gast-
arbeitergeneration, deren Lebenssituation in Österreich von Anfang an medial
dramatisiert wurde, zeigt, wie sich diese Generation vor Ort orientierte und
neue, weltweite Bezüge herstellte. Aus dieser Sicht müsste auch die Geschichte
der so genannten Gastarbeiterinnen und -arbeiter neu erzählt werden: denn
die Migranten der ersten Generation brachen ihre Verbindungen zu ihren Her-
kunftsorten keineswegs ab. Vielmehr entwickelten sich auch hier vielfältige
Formen der Mobilität und etablierten sich neue soziale Bindungen und Netze.
Dabei handelte es sich um „Welt-Räume“, in denen weltweite Querverbindungen
zusammenlaufen und sich zu Alltagskontexten verdichten. Dadurch haben sich
Zwischenräume herausgebildet, die sowohl aus den Herkunftsräumen als auch
Ankunftsräumen zusammengesetzt sind und die für die Lebensentwürfe der
betroffenen Individuen konstitutiv sind. So entstehen hybride Lebensformen.
Diese neuen Verortungspraktiken erscheinen aus nationaler Sicht als Defizite
und werden folglich marginalisiert. Doch diese Praxis, die mit banalen Raum-
ordnungen bricht, entfaltet eine innovative Kraft, die für die biographische und
räumliche Orientierung von Menschen sehr bedeutsam ist.
Solche individuellen Lebensentwürfe und Raumkonstruktionen finden wir auch
in der Alpen-Adria-Region, auf die wir später eingehen werden. Der Alpen-Adria-
Raum erscheint aus dieser Perspektive als ein hybrider Lebensraum, beeinflusst
von Unterschieden, Widersprüchlichkeiten und territorialen Verstrickungen. In
einer wechselvollen Geschichte treffen unterschiedliche kulturhistorische Strö-
mungen wie germanische, slawische, romanische, aber auch orientalische auf-
einander. Mitten durch diesen Raum verlief der „Eiserne Vorhang“, der im Kalten
Krieg politische Blöcke und Systeme trennte. Heute liegt der Alpen-Adria-Raum
im Zentrum Europas und wird aufgrund seiner Geschichte und Vielfalt zu Recht
als Gradmesser der europäischen Integration betrachtet. Hier stellt sich die Frage,
wie die Grenzöffnungen nach 1990 von Menschen in der Region wahrgenommen
und praktiziert werden, welche neuen Lebensentwürfe, räumliche Bezüge und
Bindungen entstanden sind und welche neuen Grenzen errichtet werden.
Methodischer Zugang
Wir nahmen eine Perspektivenumkehr vor und stellten die alltäglichen Prak-
tiken in den Mittelpunkt. Insofern betrachten wir die methodische Frage als
eine theoretische Frage (vgl. Kaufmann 1999). Um Raumkonstruktionen sicht-
bar zu machen, kamen verschiedene qualitativ ausgerichtete Methoden in
Anwendung: Ethnographische Feldbeobachtungen, Medien- und Dokumen-
tanalyse und biographische Interviews. So untersuchten wir zunächst, wie
Proof
181
der Begriff „Alpen-Adria-Raum“ im Internet kommuniziert wird und welche
Raumvorstellungen sichtbar werden. Anschließend ging es darum, herauszu-
arbeiten, in welchen Kontexten der Begriff in der Stadt Klagenfurt auftaucht
und welche Anliegen damit verbunden werden. Was die medialen Raumkons-
truktionen betrifft, wurden zwei Beispiele zur Analyse herangezogen: „Radio
Agora“ und die TV-Serie „Servus Srecno Ciao“, die beide mit der Alpen-Adria-
Idee arbeiten, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Was das Thema
Bildung betrifft, haben wir die Universität Klagenfurt herangezogen, die sich
selbst Alpen-Adria-Universität nennt und wo in unterschiedlichen Zusam-
menhängen der Alpen-Adria-Gedanke thematisiert wird. Gezielt haben wir
eine Ausgabe der Universitätszeitschrift UNIsono ausgewählt, in der eine Aus-
einandersetzung mit der Idee des Alpen-Adria-Raums stattfand. Abschließend
wurden zwei Personen interviewt, um einerseits zu zeigen, welche räumlichen
Bezüge in den beiden Lebensentwürfen hergestellt werden und andererseits
zu demonstrieren, dass biographische Konstruktionen immer auch topogra-
phische Konstruktionen sind und räumliche Bezüge mit den individuellen
Lebensbedingungen im Zusammenhang stehen.
Zur Erforschung unterschiedlicher Raumkonstruktionen in verschiedenen
Kontexten hat es sich als sinnvoll erwiesen, methodisch gezielt, differenziert
und offen vorzugehen. Diese methodische Offenheit (vgl. Kaschuba 1999) hat
sich im Laufe unserer Feldforschung bewährt. Es ist kaum zu vermeiden, dass
mit der Entscheidung für eine konkrete Fragestellung jeweils auch eine Reduk-
tion der Vielfalt und damit Strukturierung des untersuchten Feldes verbunden
ist: Bestimmte Aspekte wurden, je nach Kontext und Situation, in den Vorder-
grund gerückt, andere mussten (zumindest vorerst) als weniger wesentlich in
den Hintergrund treten.
Alpen-Adria-Raum aus unterschiedlichen Perspektiven
Mit ethnographischen Streifzügen durch das Internet, durch mediale und bil-
dungspolitische Landschaften in Kärnten sowie durch die Stadt Klagenfurt
wurde ein erster Zugang zum Alpen-Adria-Raum gewählt. In diesem Abschnitt
werden Fallbeispiele vorgestellt und diskutiert.
Fallbeispiel: Internetpräsenz
Die folgenden Bezeichnungen, die sich auf den Alpen-Adria-Raum beziehen,
wurden im Internet gefunden: Verein der Kärntner Brillenschafzüchter Alpen-
Adria, Alpe-Adria-Tierfriedhof, Alpe Adria Rockfest, Alpen Adria Hafenfest,
Seefahrtschule Alpe Adria, Alpen Adria Biofestival, Alpe Adria Kulturreisen,
Proof
182
Alpe-Adria-Magazin, Hypo Alpe-Adria, Alpe-Adria-Weindepot, Alpe-Adria-Cup
der Floristen, Alpe-Adria-Magazin, Alpe-Adria Eventing Trophy, Alpen-Adria
Abenteuerreisen, Alpe Adria Air Luftschiff- und Ballonfahrt, Alpen-Adria Media-
thek, Alpen-Adria Galerie, Alpe-Adria Immobilien, Alpen-Adria Wirtschafsprü-
fung, Alpen-Adria Aquanauten, Alpe-Adria Segelflugcup, Alpen-Adria Stadtho-
tel, Alpen-Adria Energie, Alpe Adria Golfclub, Alpe-Adria-Magazin, Alpe-Adria-
Magazin-TV, Alpe-Adria-Radweg, Alpe Adria Rally-Cup, Alpen-Adria-Landwirt-
schaftsmesse, Alpen-Adria Gymnasium, Alpe-Adria Wirtschaftsmagazin.
Die vorangestellten Begrifflichkeiten sind eine kleine Auswahl dessen, was man
findet, wenn man nach „Alpen-Adria“ oder auch „Alpe-Adria“ als erste Annähe-
rung im Internet recherchiert. Hotels, Messen, Events und selbst ein Tierfriedhof
tragen diesen Beinamen. Aber was steckt dahinter? Was haben sie gemeinsam,
was verbindet all das mit dem „Alpen-Adria-Raum“? Was wird unter „Alpen-
Adria“ verstanden und welchen Bezug und Engagement gibt es zu diesem Raum?
Und welche Raumvorstellungen werden unter „Alpen-Adria“ sichtbar?
Der Großteil der untersuchten Alpen-Adria-Internetseiten hat ihren Stand-
ort in Kärnten mit Schwerpunkt Klagenfurt und Villach. Einige wenige in der
Steiermark, aber auch außerhalb Österreichs in Deutschland und Slowenien.
Primär lassen sich die Seiten vor allem den Branchen Freizeit, Sport, Touris-
mus und Gastronomie zuordnen. Der zweite, aber weniger stark ausgeprägte
Anspruch ist im Bereich (Weiter-)Bildung auszumachen, gefolgt vom Bereich
Landwirtschaft im weiteren Sinne und diversen sonstigen Seiten – beispiels-
weise Bank- oder Immobilienwesen.
Interessant ist nun, welches Verständnis von „Alpen-Adria“ vorhanden ist.
Zum einem wird darunter ein regionaler Zusammenschluss von Kärnten,
Oberitalien und Slowenien verstanden, zum anderen sämtliche Alpen- und
Adria-Anrainerstaaten, was in der Nord-Südausdehnung einen Raum von
Süddeutschland bis nach Mazedonien und in der West-Ostausdehnung einen
Raum von Frankreich bis nach Tschechien und Ungarn ausmacht.
Entsprechend der jeweiligen Definition von „Alpen-Adria“ ist das Engagement
und der Bezug zum „Alpen-Adria-Raum“ unterschiedlich. Es wird im Bereich
Tourismus Werbung für die jeweilige Definition des „Alpen-Adria-Raumes“
gemacht, wobei hier wieder unterschiedliche Territorien dieses Raums bewor-
ben werden, ohne eine, wie auch immer geartete, Verbindung zum „Alpen-Adria-
Raum“ herauszustellen: Das Einzige, was die einzelnen Territorien gemeinsam
zu haben scheinen, ist ihre geographische Lage an der Adria oder in den Alpen.
Proof
183
Es wird nicht eine Geschichte des Raumes erzählt, eine Verbindung herge-
stellt, auf gegebenenfalls gemeinsame historische Verknüpfungen eingegangen
oder diese inszeniert. Auch ist festzustellen, dass im Bereich des Tourismus
mit „Alpen-Adria“ zwar geworben wird, aber teilweise keinerlei Alpen-Adria-
Bezug besteht, sondern nur ein Alpen- oder nur ein Adria-Bezug zu sehen ist.
Beispielsweise ist bei diversen Festivals zu beobachten, dass diese als Alpen-
Adria-Festivals beworben werden, aber kaum bis keinerlei Alpen-Adria-Bezug
besteht: Man könnte bei diesem Label erwarten, dass beispielsweise verschie-
dene Bands, Künstler oder zumindest das Publikum aus dem wie auch immer
definierten „Alpen-Adria-Raum“ kommen, aber nichts dergleichen. Bestenfalls
werden „Schmankerl“ aus den angrenzenden Staaten angeboten. Bei Sportveran-
staltungen ist hingegen meist ein Alpen-Adria-Bezug zu erkennen: entweder ist
die Zielgruppe aus Slowenien, Oberitalien und Kärnten oder die Veranstaltung
findet in einem oder allen Ländern statt – etwa bei Wettbewerben.
Die Analyse der Internetpräsenzen von Alpen-Adria-Seiten zeigt, dass es kein
einheitliches Verständnis dieses Raumes gibt und unter diesem Label viele
verschiedene, sehr heterogene Inhalte gefasst werden, die wenige Gemeinsam-
keiten aufweisen. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass der Schwer-
punkt der Seiten in Kärnten zu verorten ist und sich der Großteil der Seiten in
den Bereichen Tourismus, Event und Gastronomie befinden, scheint „Alpen-
Adria“ ein reines Label zu sein, das zur Vermarktung und Verkaufsförderung
gedacht ist, um die Tourismusregion zu stärken – das alpine Territorium Kärn-
ten durch das Hereinholen der Adria attraktiver zu machen. Allerdings fehlt
diesem Label die Einheitlichkeit, man weiß nicht, was sich darunter verbirgt:
Verpackung und Inhalt passen demnach nicht zusammen.
In der Alpen-Adria-Vermarktung gibt es keine einheitlichen Alpen-Adria-
Bezüge oder Verbindungen. Es gibt aber auch scheinbar keine Grenzen in der
Auslegung des „Alpen-Adria-Raumes“. Eine verlässliche Definition darüber,
was unter „Alpen-Adria“ genau zu verstehen ist, scheint es im Alltagsverständ-
nis nicht zu geben. Es ist für die Industrie möglich, Alpen-Adria-Bezüge her-
zustellen und einen genauen Kontext auszuklammern. Im inflationären und
gleichzeitig undefinierten Gebrauch scheint die Bedeutung von „Alpen-Adria“
zu verwässern und bedarf einer umfassenden Aufarbeitung, möchte sie nicht
die Grenze des Bedeutungsverlustes überschreiten.
Fallbeispiel: Stadtbild Klagenfurt
Bei einem photographischen Rundgang durch Klagenfurt zeigte sich, dass im
Stadtbild Italien im Bereich des Konsums präsent ist. Es gibt eine immens
Proof
184
hohe Anzahl an Cafés, Eisdielen, Pizzerien und Boutiquen – teilweise machte
sich der Eindruck breit, mehr italienische als kärntnerische und österreichi-
sche. Auch Slowenien ist im Stadtbild präsent, aber eher im Bezug auf den
nationalen Minderheitendiskurs. Man muss sich – sozusagen – auf die Suche
abseits der Einkaufsmeilen danach machen. So gibt es in Klagenfurt bei-
spielsweise eine Bank, eine Schule, einen Kindergarten oder auch eine Buch-
handlung. Weiterhin gibt es auch milieuspezifische Szenekneipen, die das
Thema Slowenien aufgreifen, jedoch entspricht dies nicht dem Mainstream.
In einem Punkt sind jedoch Slowenien und Italien gleich stark vertreten: In
der Bewerbung slowenischer und italienischer Kundschaft. Sowohl Einzel-
handel als auch in der Gastronomie findet man beispielsweise Werbeschil-
der, Plakate und Produktinformationen nicht nur auf Deutsch, sondern auch
auf Italienisch und Slowenisch.
Als Ergebnis dieser Annäherung an Alpen-Adria kann man festhalten, dass
auf den ersten Blick Slowenien eher spezieller und von (Bildungs-)Institu-
tionen thematisiert wird, Italien hingegen für Konsumenten sehr präsent
ist und anscheinend ein bestimmtes, italienisches Lebensgefühl vermittelt
werden soll. Diese Annahmen beruhen auf dem ersten Gesamteindruck, den
man bei einem Ausflug durch die Stadt gewinnt.
Fallbeispiel: Radio Agora (Arbeitsgemeinschaft Offenes Radio)
„Radio Agora“ versteht sich als ein Radioformat, das die sprachliche und
kulturelle Vielfalt in Kärnten auch über die politischen Grenzen hinweg
aufzeigen und erzählen will. Diese Sender ist daher ein Beispiel für den
Alpen-Adria-Raum.
„Radio Agora“ wurde 1998 als nicht-kommerzielles Community-Radio gegrün-
det. Seit 2003 kooperiert „Radio Agora“ mit dem slowenisch-sprachigen For-
mat des „ORF Kärnten“, der täglich acht Stunden von „Radio Agora“ ausstrahlt.
Zielgruppe ist vor allem die Minderheit der Kärntner Slowenen, aber auch
andere (Sprach-)Minderheiten. So bietet „Radio Agora“ nicht nur Sendungen
auf Deutsch, Slowenisch und Italienisch an, sondern beispielsweise auch auf
Persisch oder Kroatisch. Der sprachliche Schwerpunkt liegt jedoch mit etwa 90
Prozent auf Slowenisch, Interviews werden jedoch meist mit zweisprachigen
Personen geführt, um die Vielfalt in Kärnten zu veranschaulichen. Die inhalt-
lichen Schwerpunkte, die von unterschiedlichen Mitarbeitern bedient werden,
liegen auf Politik, Geschichte, Kultur und Musik – Themen, die die Identitäts-
konstruktion von Menschen mit ausmachen.
Proof
185
Insbesondere sind auch der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus ein
wichtiges Thema: Besonders für die slowenische Minderheit in Kärnten war
und ist diese Zeit prägend für ihr Selbstverständnis, da viele von ihnen im
Nationalsozialismus in Arbeitslager zwangsdeportiert worden sind. Im Jahr
2012 jährten sich die leidvollen Erfahrungen der Deportationen zum 70. Mal.
Daher wurden in diesem Gedenkjahr vor allem Politiker sowie Zeitzeugen zu
diesem Thema interviewt.
Weiterhin ist „Radio Agora“ durch seinen musikalischen Jazz-Schwerpunkt,
der für „Nicht-Mainstream“ und Diversität steht, bekannt und einzigartig in
Österreich. Ferner legt „Radio Agora“ viel Wert auf Live-Übertragungen und
strahlt beispielsweise mehrsprachig Sportereignisse aus.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass „Radio Agora“ ein Format
darstellt, das primär versucht, die Vielfalt in Kärnten in sichtbar zu machen,
tabuisierte Themen ausspricht und somit ins öffentliche Bewusstsein trägt.
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt daher auch auf der slowenischen Sprache
und Kultur, aber gleichzeitig verwirklicht „Radio Agora“ auch seinen diversi-
tätsbewussten Selbstanspruch und berichtet auch, aber in einem geringeren
Ausmaß, über andere Minderheiten in Kärnten. Gleichzeitig versucht „Radio
Agora“, das Ideal eines „Alpen-Adria-Raums“ aufzuzeigen, indem es Inhalte
über alle drei Kernregionen sendet.
Fallbeispiel: TV-Format „Servus Srecno Ciao“
„Servus Srecno Ciao“ ist eine TV-Sendung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den
Austausch zwischen Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien zu för-
dern und wurde im Rahmen der ethnographischen Studie analysiert, um den
Anspruch der Sendung mit der konkreten Umsetzung zu vergleichen. Der ORF-
Landesdirektor für Kärnten, Willy Haslitzer, erarbeitete gemeinsam mit dem
slowenischen Redaktionsleiter des ORF Kärnten, Marijan Velik, das Konzept der
Sendung „Servus Srecno Ciao“. Die erste Sendung lief am 3. April 2000 und wurde
von Haslitzer moderiert. Insbesondere gab es in der Anfangsphase der Sendung
eine enge Zusammenarbeit mit der damals am slowenischen Gymnasium einge-
richteten „Kugy-Klasse“. In dieser Klasse wurden Schülerinnen und Schüler aus
Kärnten, Italien und Slowenien auf Deutsch, Slowenisch und Italienisch sowie
zusätzlich auf Englisch unterrichtet. Im Jahre 2001 folgte ein Radio-Sprachkurs
mit dem Namen „100 Worte in 100 Tagen“, der als ein täglicher Sprachkurs für
jedermann in allen drei Sprachen dienen sollte. Ein Jahr darauf folgten Ausflug-
stipps für Kärnten, Friaul und Slowenien mit dem Ziel, diese Regionen stärker im
öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Aufgrund des EU-Beitritts Sloweniens
Proof
186
wird die Sendung seit dem Jahr 2004 auch dort ausgestrahlt, um so grenzüber-
schreitende Aktivitäten, einen Austausch in den Bereichen Kultur, Wirtschaft
und Bildung zu fördern und um die Jugend auf vielfältige Chancen in einem
grenzübergreifenden Raum aufmerksam zu machen.
Die Ergebnisse der Beobachtungen unterstreichen, dass sich „Servus Srecno
Ciao“ dem Austausch zwischen Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Vene-
tien widmet: Aus jedem Land werden aktuelle Themen wie Jugendveranstal-
tungen, kulturelle Ereignisse, Musikerbiographien, alte Berufe wie Schuster
oder Goldschmiede oder traditionelle Spezialitäten vorgestellt.
Fallbeispiel: Alpen-Adria-Universität
Als Beispiel für eine Einrichtung des Bildungssektors, die sich die Bezeich-
nung „Alpen-Adria“ gegeben hat, wurde die „Alpen-Adria-Universität“
anhand ihrer Uni-Zeitschrift untersucht. Die Märzausgabe 2012 des „Uni-
sono“ hatte den „Alpen-Adria-Gedanken“ zum Thema. Sie stellte die Frage,
was sich durch den 2004 selbst verliehenen Beinamen „Alpen-Adria“ an der
Universität getan hat. Ziel der erweiterten Namensgebung war es, sich als
Drehschreibe der Universitäten im „Alpen-Adria-Raum“ unverwechselbar zu
positionieren. Im Rahmen der Auswertung wurden das Vorwort sowie vier
zum „Alpen-Adria-Gedanken“ geführte Zeitungsinterviews näher beleuch-
tet. Es ergaben sich die Kategorien Leitbild und Programm, Umsetzung und
Kritik, die nachfolgend beschrieben werden.
Die Universität will das Besondere des „Alpen-Adria-Raumes“ leben, worunter
zu verstehen ist, dass an der österreichisch/kärntnerischen, italienischen und
slowenischen Grenze drei Sprach- und Kulturräume aufeinander treffen und
hier Zwei- und Mehrsprachigkeit, gegenseitiges Verständnis, Voneinander-
Lernen sowie ein interkultureller Austausch mit den Nachbarländern gelebt
werden soll. Der Beiname „Alpen-Adria“ ist als Angebot und Aufforderung zu
verstehen, sich grenzüberschreitenden Themen zu widmen, sich auf die nach-
barschaftlichen Beziehungen zu Oberitalien und Slowenien zu konzentrieren
und den Raum für gemeinsames Lernen, Lehren und Forschen wahrzuneh-
men, wobei sich die „Alpen-Adria-Universität“ selbst als Drehschreibe der Uni-
versitäten im „Alpen-Adria-Raum“ versteht.
In der Praxis ist die Universität Mitglied der „Alpen-Adria-Rektorenkonferenz“
– wie gleichzeitig auch der „Donaurektorenkonferenz“ -, um dort Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit voranzutreiben. Es bestehen Partnerschaftsverträge
mit den Universitäten im „Alpen-Adria-Raum“ und mit den Partneruniversi-
Proof
187
täten werden gemeinsame Programme entwickelt – wie beispielsweise mit
der „Universität Udine“ ein Double-Degree-Programm, ein Sommerkolleg im
slowenischen Bovec, alpen-adriatische Gastprofessuren an der kulturwissen-
schaftlichen Fakultät sowie die Vergabe von Stipendien für Forschungsauf-
enthalte, Sprachkurse und Sommerschulen. Ebenfalls wird in diesem Zusam-
menhang auf CeSEE-PhD-Net (Central and Southeast European PhD Network)
verwiesen, einen Verband für das wirtschaftswissenschaftliche Doktorrats-
studium mit Partneruniversitäten in Slowenien, Bosnien, Kroatien, Ungarn
und Österreich. Am Rande wird erwähnt, dass der „Alpen-Adria-Gedanke“ der
Universität von engagierten Lehrenden getragen wird – sofern sie der jeweili-
gen Landessprache mächtig sind.
Kritisiert wird in der Zeitschrift, dass der alpen-adriatische Gedanke der Uni-
versität meist bloß eine (leere) Überschrift ist, da es an nachhaltigen Projekten
mangelt: Die grenzüberschreitenden Aktivitäten werden demnach von personell
und finanziell gering ausgestatteten Organisationseinheiten der Universitäten
umgesetzt. Darüber hinaus würde, so die weitere Kritik, die Zwei- und Mehrspra-
chigkeit am Eingang enden. Weiterhin wird von den kritischen Stimmen darauf
hingewiesen, dass die Studierenden englisch- und spanisch-sprachige Länder
für ihr Auslandsstudium präferieren und weniger den benachbarten Ländern
wie Italien und Slowenien den Vorzug geben würden. Auch wird die Frage auf-
geworfen, warum im täglichen Sprachgebrauch die slowenischen Städtenamen
wie Ljublijana für Laibach oder Maribor für Marburg unterpräsentiert wären.
Die ethnographischen Beobachtungen zeigen, dass es nicht den Alpen-Adria-
Raum gibt, sondern viele, die nebeneinander gleichzeitig existieren: Diese
Räume werden unterschiedlich konstruiert, indem unterschiedliche (Selbst)
Verständnisse von „Alpen-Adria“ vorliegen, verschiedene Grenzziehungen
unternommen, differierende Schwerpunkte gesetzt werden, Ereignisse, Bezie-
hungen, Inhalte und Verbindungen je nach Kontext ein- oder ausgeblendet
werden. Somit zeigt sich eine immense Heterogenität und Diversität in der
Anwendung und inhaltlichen Ausrichtung des Begriffs.
Aus unserer ethnographischen Perspektive ist „Alpen-Adria“ ein Label, das
in erster Linie vermarktet wird: Allerdings bleibt es streckenweise bei diesem
Label. Zwar wird versucht, dieses mit alpen-adriatischen Inhalten zu füllen,
diese Inhalte sind aber meist mehr „alpin“, also, auf Kärnten bezogen, und das
„Adriatische“, also Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien wird entweder ver-
schwiegen oder auf ein kulinarisches und mediterranes Lebensgefühl – mit
dem Schwerpunkt auf Italien und weniger auf Slowenien – verkürzt.
Proof
188
Insbesondere Slowenien scheint der blinde Fleck Kärntens zu sein und domi-
niert im öffentlichen Diskurs entweder durch Absenz oder in Hinblick auf die
nationale Minderheit der Kärntner Slowenen. In Kärnten wird ein Alpen-Adria-
Bild erzeugt, das auf den ersten Blick vor allem auf ein (italienisches) Lebens-
bzw. Wohlgefühl verweist.
Auf diese Reduzierungen hin wird ein weiteres Bild von einem Alpen-Adria-
Raum aufgezeigt und zwar seitens bildungspolitischer und kultureller Ein-
richtungen: Ziel ist es, in Kärnten die Minderheiten sichtbarer zu machen, sie
ins öffentliche Bewusstsein zu holen und ihnen einen Platz in der Gesellschaft
zu geben. Dieses Bild distanziert sich von einer nationalstaatlichen Perspek-
tive und bezieht sich auf den Alpen-Adria-Raum als einen gemeinsamen und
sozialen Raum, in dem alle gleichberechtigt und gleichrangig sind. Allerdings
dominiert hier – verständlicherweise – die slowenische Perspektive, denn
diese ist bestrebt, aus der Marginalisierung herauszutreten.
Letztendlich fehlt ein Gesamtbild, in dem alle drei alpen-adriatischen Regio-
nen als Partner auf einer Augenhöhe gemeinsam ein Bild eines Alpen-Adria-
Raums entwerfen, das bei der Bevölkerung verankert ist und von ihr auch
gelebt wird.
Lebensentwürfe und räumliche Bezüge
In diesem Abschnitt werden zwei Biographien vorgestellt, die sich im Alpen-
Adria-Raum verorten. In den biographischen Erzählungen werden räumliche
Bezüge hergestellt, auf Verbindungen und Grenzen hingewiesen, die sich auf
diese Region beziehen. Es wird deutlich, wie durch geographische und men-
tale Mobilität neue Lebensweisen entstehen, neue Räume hergestellt werden
und wie auf diese Weise Biographie zu einer Topographie wird.
Francesco
Francesco wurde 1964 in Slowenien, damals noch Teilrepublik von Jugos-
lawien, geboren und wuchs in Ljubljana auf. Seine Mutter ist Tschechin und
sein Vater Italiener. Die Großeltern mütterlicherseits sind aus Tschechien nach
Ljubljana ausgewandert und haben dort mit böhmischen Kristall gehandelt.
Aufgrund der frühen Trennung seiner Eltern lebte Francesco ausschließlich bei
seiner Mutter. Zu seinem Vater hat er keinen Kontakt mehr. Nach dem Besuch
des Gymnasiums in Ljubljana ging er auf eine Militärschule in Sarajewo. Kurz vor
dem Kriegsausbruch verliebte er sich in eine Krankenschwester aus Ljubljana,
die bald darauf aus beruflichen Gründen nach Österreich auswanderte. Nun
Proof
189
stand Francesco vor der großen Entscheidung, in Slowenien zu bleiben oder ihr
nach Österreich zu folgen. Er entschied sich im Jahre 1993, kurz vor Kriegsaus-
bruch, nach Österreich auszuwandern, heiratete und wurde dann bald Vater von
einer Tochter. Francesco startete seine berufliche Karriere in Österreich als Tel-
lerwäscher in Klagenfurt. Danach folgten Hilfsjobs als Kellner und kurzfristig
pachtete er ein eigenes Lokal. Nach ein paar Jahren scheiterte seine Ehe, da sich
seine Frau für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft entschieden habe.
Heute lebt Francesco mit einer Frau aus Tschechien zusammen, die er in Kärn-
ten kennen gelernt hat. Seit drei Jahren arbeitet er in einem alternativen Café in
der Innenstadt von Klagenfurt. Das Café ist dafür bekannt, kultureller Vielfalt
einen Raum zu geben. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat er einen
zweiten Job als Kellner in einer Pizzeria, die von einem Araber geführt wird.
Den Gästen gegenüber versucht er unnötigen Fragen über seine Herkunft aus-
zuweichen, indem er sich als Italiener, mit dem Vornamen seines italienischen
Vaters Francesco, ausgibt. Nach Francescos Erfahrungen reagieren viele Gäste
sehr empfindlich auf die Herkunft des Besitzers: „Das ist ja kein Italiener, das
ist nur der Araber.“
Für Francesco ist der „Alpen-Adria-Raum“ vergleichbar mit dem italienischen
Nudelgericht „Pasta monti e mare“ (Pasta mit Pilzen und Garnelen). Monti, die
Berge, und Mare, das Meer. Beides gibt es im „Alpen-Adria-Raum“ in unmittel-
barer Reichweite und stellt für ihn eine abwechslungsreiche Kombination dar.
Es ist ein „vollendeter Genuss“. Dieses Bild vom „Alpen-Adria-Raum“ deckt sich
mit seinen Hobbies: Wandern und Schifahren in den Bergen und im Sommer
Baden in der Adria und den Kärntner Seen. Für Francesco ist Heimat losgelöst
von einer nationalen Verortung: „Für mich ist Heimat überall. Dort wo ich gerade
bin, unabhängig von Land, Stadt oder Sprache.“
Jozo
Jozo wurde im Jahre 1979 in der jugoslawischen Teilrepublik Slowenien gebo-
ren, wo er zwischen mehreren Grenzen und Sprachen seine frühe Kindheit
verbrachte. In der Stadt Radenci besuchte er die Hauptschule, danach in Mur-
ska Subota das Gymnasium, eine Ortschaft die sich nur wenige Kilometer von
seiner Heimatstadt befindet. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre und
Philosophie absolvierte Jozo in Ljubljana, wo er über ein Jahrzehnt lebte. Die
deutsche Sprache hat er als erste Fremdsprache in der Schule gelernt und durch
deutschsprachiges Fernsehen, das in Jugoslawien empfangen wurde, vertieft. In
der Heimatregion, dem Nordosten Sloweniens, der zum länderübergreifenden
Gebiet Pannonien zählt, hat er nie Erfahrungen mit physischen Grenzen, wie
Proof
190
den Gebirgszug der Karawanken, gemacht. Er ist oft zwischen mehreren Staats-
grenzen gewandert, konnte sogar in der Zeit des „Kalten Krieges“ bis nach Teme-
schwar in Rumänien mit dem Fahrrad fahren, ohne einen Hügel zu überqueren.
Nach seinem Studium in Ljubljana kehrte Jozo nach Murska Subota zurück, wo
er sich im kulturellen Leben engagierte. Er schrieb unter anderem eine Rezen-
sion mit dem Titel „Hören wir den Roma zu“ für den Lokalsender „Radio Romec“.
Nach einiger Zeit ging Jozo wieder nach Ljubljana und arbeitete bei kommer-
ziellen Sendern als Online-Journalist mit. Insbesondere beschäftigte er sich
mit der kulturellen Vielfalt dieser Stadt. Nachdem seine langjährige Beziehung
auseinander ging, war er ohne Wohnung und verlor darüber hinaus noch seine
Arbeitsstelle, was er zusammen als schicksalhaftes Ereignis beschreibt. Gleich-
zeitig, im Jahr 2011, wurde in Ljubljana eine Firma mit fast sechzig Mitarbeitern
geschlossen, womit seine Chancen auf eine neue Arbeitsstelle weiter sanken.
In der Folge seiner schwierigen Lebenslage bekam er Depressionen und wurde
dadurch gezwungen, sein Leben fundamental zu verändern, wenn er sich wie-
der von den Schicksalsschlägen erholen wollte. Jozo überlegte sich, nach Zürich
auszuwandern und als Taxifahrer seine Existenz zu sichern. Über seine sozia-
len Netzwerke erfuhr er schließlich, dass eine Stelle bei „Radio Agora“ in Kla-
genfurt frei wurde. Er bewarb sich, wurde eingestellt und begann im November
2011 bei „Radio Agora“ zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt reiste er das erste Mal
nach Kärnten. Mit Kärnten verbindet ihn ein Teil seiner Verwandtschaft. Sein
Urgroßvater lebte dort bis 1920 und wanderte dann nach Jugoslawien aus. Ein
Teil der Familie des Urgroßvaters verblieb in Kärnten, aber es kam nur einmal
zu einem Familientreffen, als er fünf Jahre alt war. Später ist er kaum in Kontakt
mit seinen Angehörigen in Kärnten gekommen, weil er zuerst mit dem Studium
beschäftigt und anschließend wegen unterschiedlicher Arbeitsaufträge in Slo-
wenien unterwegs war. Erst durch das neue Arbeitsverhältnis mit „Radio Agora“
kam er wieder in Verbindung mit seiner Verwandtschaft im Rosenthal, die ihn
dabei unterstützt hat, sich schnell in Kärnten zurechtzufinden.
Jozos neue Arbeitsstelle hat ihn persönlich wieder aufgebaut. Er arbeitet selb-
ständig, wählt seine Beiträge selbst aus, interessiert sich insbesondere für
soziale Themen wie Menschen mit Behinderungen, alternatives Theater, aber
auch für Landwirtschaft und aufgrund seines eigenen bewegten Lebens für
das Thema Migration.
Er betrachtet Klagenfurt als eine Stadt, die nur wenig alternatives Kulturpro-
gramm anbietet. Es gibt keine diversen Musik- und Veranstaltungseinrichtun-
Proof
191
gen bzw. Treffpunkte, wo sich junge Leute, auch nach Mitternacht treffen könn-
ten. Für ihn ist Klagenfurt als Stadt nur für ältere Generationen attraktiv. Durch
seine Offenheit hat er jedoch viele neue Netzwerke mit Menschen aus Kärnten
aufgebaut, die aber, wie er betont, keine Boulevardpresse wie die „Kronen Zei-
tung“ lesen. Trachtenanzüge empfindet er als bedrohlich und verbindet diese
mit dem Nationalsozialismus. Die Menschen in Kärnten findet er einerseits als
offen und freundlich, anderseits aber, wenn es sich um „die Anderen“, „die Frem-
den“ handelt, als weltverschlossen und dogmatisch.
Heute arbeitet Jozo als Journalist für „Radio Agora“, lebt mit seiner neuen
Freundin, die eine gebürtige Kärntnerin und überzeugte Kommunistin ist,
in einer Wohnung in Klagenfurt. Außerdem ist er schon nach relativ kurzer
Zeit stolzer Pächter einer von den „Einheimischen“ begehrten Mietkabinen am
„Strandbad Wörthersee“ geworden. Er hat sich in Kärnten gut integriert und
kann es kaum glauben, dass es für ihn in Kärnten in sämtlichen Lebensbe-
reiche aufwärts geht. Er wünscht sich in der Zukunft, mehr für deutschspra-
chigen Medien arbeiten zu können und, dass die Kärntner mehr Interesse für
östliche Fremdsprachen, wie Slowenisch, entwickeln.
Die beiden biographischen Porträts zeigen, wie sich durch Handlungen Räume
herausbilden, in denen Grenzbiographien im Alpen-Adria-Raum entworfen
werden, die mit herkömmlichen Kategorien nicht zu fassen sind und daher im
öffentlichen Diskurs oft als „Problemfall“ oder als „Identitätsdefekt“ behan-
delt werden. Wie an den Beispielen deutlich wird, stellen aber gerade solche
Grenzbiographien transnationale Räume dar, in denen unterschiedlichen Per-
spektiven, Differenzen, Ambivalenzen und Widersprüche biographisch reflek-
tiert und bearbeitet werden, woraus lokale Verortungspraxen hervorgehen.
Gerade diese „Grenzbiographien“, sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass die
Lebensentwürfe und Raumkonstruktionen nicht mehr im nationalstaatlichen
Rahmen gedacht werden können. Diese „Grenzbiographien“, die unter dem
Vorzeichen transnationaler Räume oder transnationaler Identitäten diskutiert
werden, fügen sich nicht mehr den als stabil wahrgenommenen ethnischen
oder nationalen Kulturen ein.
Die beiden Lebensentwürfe demonstrieren, wie sich die räumlichen Bezüge
mit Mobilität und biographischer Neuorientierung verändert haben und in
Bewegung geraten sind. Die unterschiedlichen familiären Bindungen, Berufs-
beziehungen und Freundschaften im Alpen-Adria-Raum sowie Phänomene
wie Mehrsprachigkeit, Transkulturalität und Translokalität lassen die Ver-
bindungen der Menschen untereinander plastisch werden. „Mare e Monti“,
Proof
192
eigentlich ein Gericht, wird als Metapher für den Alpen-Adria-Raum genannt.
Kärnten hat die Berge, jedoch erscheint das Meer durch die Grenzlage und die
Nähe zur Alpen-Adria-Küste immer in Reichweite. Beide Interviewpartner nut-
zen die Tourismus-, Bildungs- und Kulturlandschaft des Alpen-Adria-Raumes.
Die Beschreibungen des Alpen-Adria-Raumes in den biographischen Erzäh-
lungen zeigen die Existenz einer imaginären Alpen-Adria-Landschaft. Für den
einen war diese Landschaft, die er noch aus seiner Kindheit kennt, völlig ohne
Berge, empfunden als eine grenzenlose, flache Ebene. Der andere erlebte den
Alpen-Adria-Raum fast täglich aus einer Pasta monti e mare-Perspektive.
In den Gesprächen wird der Alpen-Adria-Raum immer wieder aufs Neue
erfunden. Es sind Erzählungen und interaktive Handlungen, die den Alpen-
Adria-Raum erst als eine relationale Kategorie entstehen lassen. Als mentale
Grenze wurden im Gespräch Trachten und Uniformen genannt. Durch diese
Form der Tradierung von nationalen Grenzvorstellungen entsteht aus einer
biographisch gelebten kosmopolitischen Perspektive heraus ein plötzliches
Unbehagen. Die Uniformierung verweist für Jozo auf die bewusste Trennung
zwischen „Wir“ und den „Anderen“. Sein Unbehagen entsteht jedoch scheinbar
nur, wenn mit nationalen Traditionen Machtverhältnisse reproduziert wer-
den. Solange damit ein Brückenschlag und eine Diversifizierung des Raumes
in einem „glokalen“ Sinne assoziiert werden kann, ist auch das Tragen einer
Tracht, die Pflege einer Muttersprache, sogar eine Nationalhymne ein Kenn-
zeichen von Vielfalt, welche von beiden Interviewpartnern befürwortet wird.
Die biographischen Erzählungen machen eine Normalität im Alpen-Adria-
Raum sichtbar, zu der die Anerkennung des Anderen, die beruflichen Möglich-
keiten, die bewegten Orte und Verbindungen selbstverständlich gehören. Die
Lebensentwürfe bringen diesen Aspekt auf den Punkt, da sie alles miteinan-
der vereinen und die widersprüchlichen Re/De/Nationalisierungstendenzen
sichtbar machen. Die Widersprüche zeigen sich nicht nur in den Biographien,
sondern finden auch ganz konkret im Alltag ihren Ausdruck und ihre Struktur.
Momentan scheint es ein Verständnis zu geben, dass Italien mit Genuss und
einem mediterranen Lebensgefühl in Verbindung gebracht wird und Slowe-
nien mit dem nationalen Minderheitendiskurs. Dieses Verständnis hat auch
etwas mit den Bildern in den Köpfen der Menschen zu tun, die durch perma-
nente Reproduktion im politischen und medialen Diskurs sich verfestigen.
Gerade weil Grenzen in der globalisierten Welt zunehmend flüchtig werden,
wird die Wahrnehmungsmauer im Kopf neu zementiert (vgl. Beck 2002, S. 66).
Proof
193
Im Sinne der Vielfalt und eines relationalen Raumverständnisses sind es
Menschen und Institutionen, die den Raum immer wieder aufs neue re/de/
konstruieren können. Im Erfinden, Entdecken und Kritisieren liegt die refle-
xive Dimension des „Alpen-Adria-Raumes“, die ihren ganz individuellen
Ausdruck in biographischen Erzählungen findet.
4.2.3 Fazit
Die oben ausgeführten Beispiele zeigen, dass sich Raumkonzepte in der glo-
balisierten Welt gewandelt haben und unterschiedliche Raumvorstellungen
nebeneinander existieren (können). Eine Art Syntopie scheint das Charakte-
ristikum der globalisierten Welt zu sein. Es gibt nicht den Alpen-Adria-Raum,
sondern unterschiedliche Vorstellungen, die nach Kontext und Fragestellung
variieren. Sie zeigen, wie Räume unter welchen gesellschaftlichen Bedingun-
gen hergestellt werden, was damit bezweckt wird, welche sozialen Bedeutun-
gen sie erlangen und welche Bindungen oder Grenzen dadurch sichtbar wer-
den. Der Alpen-Adria-Raum wird zu einer gelebten Alltagspraxis und wirkt wie
eine real gewordene Utopie, wie eine reale, aber doch imaginäre Landschaft,
die sich je nach Kontext verändert.
In der Bevölkerung ist der Alpen-Adria-Raum verankert durch Sprachenviel-
falt, Herkunft und Mobilität der Menschen. Ob kulinarisch, kulturell oder bio-
graphisch – es lassen sich zahlreiche Belege finden. Die wechselseitigen Bezie-
hungen der Menschen in einem geographisch vielseitigen Raum mit einer
langen Geschichte, die geprägt ist von Kriegen, gemeinsamen Erfahrungen,
Migrationsbewegungen und unterschiedlichen politischen Systemen, zeigen,
dass eine Rückbesinnung auf Bindungen und Grenzen ein dynamischer Pro-
zess bleibt. Bei diesem Prozess werden auch in Zukunft immer wieder neue
Differenzlinien entstehen, neue Auseinandersetzungen stattfinden und neue
Gemeinsamkeiten entdeckt. Wichtig erscheint uns in diesem Kontext, dass
Lokalität durch Handlungen neu interpretiert wird, auf diese Weise eine Art
„Translokalität“ entsteht, die ein Ergebnis von Enträumlichung und Verräumli-
chung darstellt. Auch wenn durch Globalisierung das Lokale an Bedeutung ver-
liert, bleibt es doch, wie die oben vorgestellten Biographien veranschaulichen,
immer noch primärer Bezugspunkt bei der Organisation des Alltagslebens. Die
räumlichen Bezüge werden aktiv hergestellt, sind in Bewegung geraten und
erlangen, je nach Kontext und Perspektive neue Bedeutungen. Durch Globali-
sierungsprozesse geraten unsere gängigen Konstruktionen gesellschaftlicher
Wirklichkeit ins Wanken und öffnen sich zur Welt (vgl. Yildiz 2004).
Proof
194
Literatur
Beck, Ulrich (2002): Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue Weltpolitische Ökonomie. Frankfurt am Main.
Beck-Gernsheim, Elisabeth (1997): Stabilität der Familie oder Stabilität des Wandels? Zur Dynamik der Familienentwicklung. In: Ulrich Beck & Peter Sopp (Hrsg.): Individualisierung und Integra-tion. Neue Konfliktlinien und neuer Integrationsmodus? Opladen, S. 65–81.
Becker, Gerold, Johannes Bilstein & Eckart Liebau (o.J.): Räume bilden. Studien zur pädagogischen Topologie und Topographie. Seelze-Velber, S. 9–16.
Certeau, Michel de (1988): Praktiken im Raum. In: Ders. : Kunst des Handelns. Berlin, S. 177–238.
Hamm, Bernd (1982): Einführung in die Siedlungssoziologie. München.
Kaschuba, Wolfgang (1999): Einführung in die Europäische Ethnologie. München.
Kaufmann, Jean-Claude (1999): Das verstehende Interview. Theorie und Praxis. Konstanz.
Läpple, Dieter (1992): Essay über den Raum. In: Hartmut Häußermann, Detlef Ipsen, Thomas Krä-mer-Badoni, Dieter Läpple, Marianne Rodenstein & Walter Siebel (Hrsg.): Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler, S. 157–208.
Löw, Martina (2000): Raumsoziologie. Frankfurt am Main.
Moritsch, Andreas (Hrsg., 2001): Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt, Ljubljana, Wien.
Pahor, Marija Juric (2011): Grenzen, Schwellen, Übergänge: Überlegungen zum Alpen-Adria Raum. In: Elka Tschernokoshewa & Ines Keller (Hrsg.): Dialogische Begegnungen. Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht (=Hybride Welten 5). Münster, S. 318–338.
Petritsch, Wolfgang (2012): Zu viele Mythen, zu wenig Wirklichkeit. Kärnten neu verstehen. In: Petritsch, Wolfgang, Wilfried Graf & Gudrun Kramer (Hrsg.) (2012): Kärnten liegt am Meer. Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Klagenfurt, S. 15–32.
Petritsch, Wolfgang, Wilfried Graf & Gudrun Kramer (Hrsg.) (2012): Kärnten liegt am Meer. Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Klagenfurt.
Platzer, Wolfgang & Lojze Wieser (Hrsg., 2008): Europa erlesen. Alpen Adria. Klagenfurt.
Schroer, Markus (2006): Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frank-furt am Main.
UNIsono, März 2012, Klagenfurt.
Wintersteiner, Werner (2012): „Kärnten liegt am Meer“. Vision einer Friedensregion. In: Wolfgang Petritsch, Wilfried Graf & Gudrun Kramer (Hrsg.): Kärnten liegt am Meer. Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Klagenfurt, S. 524–545.
Wintersteiner, Werner, Georg Gombos & Daniela Gronold (Hrsg., 2010): Grenzverkehrungen. Mehr-sprachigkeit, Transkulturalität und Bildung im Alpen-Adria-Raum. Klagenfurt.
Yildiz, Erol (2004): Leben in der kosmopolitanen Moderne. Die Öffnung der Orte zur Welt. Unveröf-fentlichte Habilitationsschrift, Köln.
Proof
Proof
197
Die Autorinnen und AutorenAlle Autorinnen und Autoren sind mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
verbunden, indem sie dort arbeiten, studieren oder aufgrund eines anderen
Verhältnisses assoziiert sind.
Marika Balode B.DAB.ZIN. studiert im Bachelorprogramm „Slawistik“ sowie im Masterprogramm „Geographie und Regionalforschung“. Sie arbeitet zum Thema „Raumbezogene Identität“.Kontakt: [email protected]
Katrin Baumgärtner M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie und Doktorandin der Soziologie. Sie arbeitet zum Thema „Berufli-che Selbstständigkeit von Migranten“.Kontakt: [email protected]
A.o.-Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Drobesch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Neuere und Österreichische Geschichte. Seine Forschungs-schwerpunkte sind Österreichische Geschichte (Reformation und Gegenrefor-mation, Jesuiten, Vormärz), Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Alpen-Adria-Region und Kärntens. Kontakt: [email protected]
Univ.-Prof. Dr. Heike Egner ist Professorin und Institutsvorständin am Ins-titut für Geographie und Regionalforschung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind geographische Risikoforschung, selbstorganisierende soziale und natür-liche Systeme, Theorie der Geographie und Fragen der Nachhaltigkeit.Kontakt: [email protected]
Mag. Dr. Horst Peter Groß ist Leiter des Instituts zur Förderung von Wissen-schaft und Forschung der Kärntner Sparkasse und Präsident des Universitäts. club|Wissenschaftsverein Kärnten.Kontakt: [email protected]
Mag. Ingrid Gross ist Doktorandin der Geschichte und arbeitet zum Thema „Das Ende des Montanzeitalters im Gubernium Laibach (Krain, Kärnten) im Vormärz – Misslingen der Industrialisierung und Reagrarisierung“. Kontakt: [email protected]
Dr. Bettina Gruber ist stellvertretende wissenschaftliche Leiterin des Zent-rums für Friedensforschung und Friedenspädagogik.Kontakt: [email protected]
Proof
198
Dipl.-Päd. Marc Hill ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erzie-hungswissenschaft und Bildungsforschung und ist Doktorand der Pädagogik. Er arbeitet zum Thema „Migration, Marginalisierung und Stadträume“.Kontakt: [email protected]
Mag. Elvisa Imširovic ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung und ist Doktorandin der Pädagogik. Sie arbeitet zum Thema „Migrationsfamilien“. Kontakt: [email protected]
Dragana Jakovljevic B.A. studiert in den Masterprogrammen „Schulpäda-gogik“ und „Sozial- und Integrationspädagogik“. Sie arbeitet zu dem Thema „Bedeutung der Mehrsprachigkeit auf Identitätsentwicklung und Bildungsas-piration der Kinder mit Migrationshintergrund in Österreich“.Kontakt: [email protected]
Mag. (FH) Oskar Januschke ist Leiter des Stadtmarketings der Stadt Lienz und studiert im Masterprogramm „Geographie und Regionalforschung“. Er arbeitet zu dem Thema „BürgerInnenbeteiligung in der Stadtentwicklung“.Kontakt: [email protected]
Mag. Anita Lackner ist Doktorandin der Geschichte und arbeitet zum Thema „Die ökonomischen Probleme der Grundherrschaft vom Zeitalter der Gegen-reformation bis zur Grundentlastung am Beispiel der grenzüberschreitenden Herrschaft Thurn in Kärnten“.Kontakt: [email protected]
Ing. Rosemarie Mitterbacher Bakk. rer. nat. leitet die Forstaufsichtsstation Wolfsberg-Ost der Bezirksforstinspektion Wolfsberg und studiert im Mas-terprogramm „Geographie und Regionalforschung“. Sie arbeitet zum Thema „Forstwirtschaft im Klimawandel“.Kontakt: [email protected]
Mag. Heidrun Puff ist EU-Koordinatorin im Landesjugendreferat Kärnten und Doktorandin der Pädagogik. Sie arbeitet zum Thema „ Lernen in anderen Kul-turen – Auslandsaufenthalte als Chance des informellen Bildungserwerbs bei Jugendlichen“.Kontakt: [email protected]
Mag. Manfred Rader ist Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice Klagenfurt und ist Doktorand am Institut für Geographie und Regionalforschung. Er arbeitet zum Thema „Flexicurity. Förderungen des AMS Kärnten und ihre Auswirkungen“.Kontakt: [email protected]
Proof
199
Mag. Mag. Dr. Vera Ratheiser hat Anfang 2013 ihre Dissertation abgeschlos-sen. Sie arbeitet zum Thema „Diversity Management aus Sicht der Transkul-turalität. Erfahrungen internationaler Fachkräfte in Kärnten. Eine qualitative Studie“.Kontakt: [email protected]
Bakk. Bakk. Susanne Ruhdorfer studiert im Masterprogramm „Angewandte Kulturwissenschaft“ und „Geschichte“ und arbeitet zum Thema „Der St. Veiter Kreis um Justinus Mulle, Gerhard Glawischnig und Günther Mittergradnegger“ bzw. „J. K. Rowlings `Harry Potter´ und der Zauber des magischen Mittelalters“.Kontakt: [email protected]
Dipl.-Geogr. Roswitha Mathilda Ruidisch war bis September 2012 wissen-schaftliche Mitarbeiterin und ist Doktorandin am Institut für Geographie und Regionalforschung. Sie arbeitet zum Thema „Territoriale Kohäsion in der euro-päischen Regionalpolitik“.Kontakt: [email protected]
Birgit Wertschnig BSc studiert im Masterprogramm „Geographie und Regi-onalforschung“ und arbeitet zum Thema „Migrationsverhalten in den Town-ships Südafrikas“.Kontakt: [email protected]
Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz ist Professor am Institut für Erziehungswissen-schaft und Bildungsforschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrati-onsforschung, Stadtforschung, Diversität und Interkulturelle Bildung.Kontakt: [email protected]
Proof
KLAGENFURTER INTERDISZIPLINÄRES KOLLEG
Das „Interdisziplinäre Kolleg“ ist eine Einrichtung an der Alpen-Adria-Univer-sität mit dem Ziel, die Studierenden an interdisziplinäre Arbeitsweisen heran-zuführen und sie dadurch für die komplexen Problemstellungen in der Praxis zu sensibilisieren. Dieser innovative Lehrveranstaltungstyp geht bewusst über den einzelwissenschaftlichen Zugang zu Themen und Phänomenen hinaus und will die Studierenden dazu befähigen, unterschiedliche Wissenschaftskulturen kennen zu lernen und nutzbar zu machen. Dabei geht es nicht nur darum, die Forschungsfragen und methodischen Zugänge verschiedener Fakultäten bzw. Wissenschaftsdisziplinen sichtbar zu machen, sondern auch den Umgang mit den unterschiedlichen Forschungsrichtungen und -ergebnissen zu erlernen. Bisher sind erschienen:
Band 1 – Das Haus als Gegenstand interdisziplinärer Forschung
Martin Hitz / Gerhard Leitner / Horst Peter Groß (Hrsg.)
Unter anderem werden betriebswirtschaftliche, informationstechnologische,
psychologische, architektonische und philosophische Aspekte interdiszipli-
när behandelt.
ISBN 978-3-89019-620-6, 260 S.
Band 2 – Visuelle Kultur als Gegenstand interdisziplinärer Forschung
Jörg Helbig / Horst Peter Groß (Hrsg.)
Unter anderem werden im vorliegenden Band literaturwissenschaftliche,
betriebswirtschaftliche, informationstechnologische und medienwissen-
schaftliche Aspekte behandelt.
ISBN 978-3-89019-690-9, 192 S.
Band 3 – Die Alpen-Adria-Region / Bindungen und Grenzen
Heike Egner / Horst Peter Groß (Hrsg.)
In den vorliegenden Band fließen unter anderem bildungswissenschaftliche,
geographische, geschichtliche, soziologische und wirtschaftswissenschaftli-
che Aspekte ein.
ISBN 978-3-89019-691-6, 180 S.








































































































































































































!["Η αυστριακή πολιτική και η ελληνική ναυσιπλοΐα (1750-1800)” [The Austrian policy and the Greek shipping in the Adria, 1750-1800], Parousia](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325610b7fd2bfd0cb036eb1/i-ustriki-politiki-ki-i-elliniki-nusiplo.jpg)