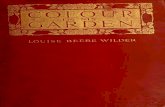Der islamische Garden
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Der islamische Garden
D er islamische Garten Architektur . N atur . Landschaft
Herausgegeben von Attilio Petruccioli
Aus dem Italienischen iibertragen von Ulrike Stopfel
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart
Die in diesem Buch verwendeten Koranzitate wurden auger in den Fallen, in denen eine genaue Dbersetzung aus dem Italienischen im Sinne des vorausgehenden oder nachfolgenden Textes unvermeidlich war, der im Verlag Wilhelm Goldmann, Miinchen, erschienenen Dbertragung des Korans von Ludwig Ullmann in der Bearbeitung durch Leo Winter entnommen.
Bildnachweis Wir bedanken uns bei den Autoren, die freundlicherweise das ikonographische Material zur Verfiigung gestellt haben:
Archivio Fotografico dei Musei Vaticani, Vatikanstadt Arthur M. Sackler Gallery, Washington Bibliotheque N ationale, Paris The British Library, London Ermanno Cacciatore Giancarlo Costa, Mailand The cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio DaluJones, Rom Harvard University· Art Museum, Cambridge K e B News, Florenz Roberto Lanza Publifoto di Brai, Palermo
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Der islamische Garten: Architektur - Natur - Landschaft / herausgegeben von Attilio Petruccioli. -Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1995
Einheitssacht.: II giardino islamico <dt.> ISBN 3-421-03089-8
NE: Petruccioli, Attilio [Hrsg.]; EST
© 1994 Elemond SpA, Milano © 1995 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart (fiir die deutsche Ausgabe) Lektorat: Renate J ostmann Umschlagentwurf: Brigitte und Hans Peter Willberg, Eppstein Satz: Typomedia Satztechnik GmbH, Ostfildern Druck: Fantonigrafica, Milano Printed in Italy ISBN 3-421-03089-8
Reg. f\!o
Clas s~ -- .- --- - .. _-
i 7- i l.031i-6"+i I. IS
Die koniglichen Garten von Aschraf und Farahabad Mahvash Alemi
Die Gewohnheit der persischen Herrscher, yaylaq und qishlaq1 zu machen, eine Art Sommer- und Winterfrische, hat zur Entstehung eines dichten Netzes koniglicher Garten am jeweiligen Reiseweg geftihrt. Dabei begaben sie sich mitsamt ihrem Gefolge jagend von einem Ort zum anderen. Das gilt auch ftir die Provinz Masanderan, das bevorzugte Jagdrevier von Schah Abbas.2 Wie der Chronist Iskandar Bayg notiert, verbrachte der Konig »den groJSten Teil des qishlaq in dieser Gegend und ihrenJagdgebieten«. 1m Jahre 1031 nach der Hedschra wurde Mirza Taqi Khan, der Wesir der Provinz Tabaristan, beauftragt, die StraiSe von Savadkuh, die wichtigste des Masanderan, auf der der Konig mit seinem Gefolge reiste, zu verbreitern und zu befestigen.3 Die von Kleiss nachgezeichnete Karte4 der SafawidenstraiSe von Isfahan nach Farahabad zeigt die einzelnen Haltepunkte, die nach Iskandar Bayg in einer Entfernung von jeweils vier farsakh aufeinander folgten und aus Herbergen, Versorgungseinrichtungen, Garten und Badern bestanden.5 Solche Anlagen, von Kleiss als »Unterkunftsund Jagdschlosser« bezeichnet6, wurden vom Konig und seinem Gefolge nur zu kurzen Aufenthalten an ihrem Reiseweg genutzt; im Masanderan nahmen sie allerdings den Charakter regelrechter koniglicher Residenzen an7
, wie auf der von Herbert gelieferten Karte des persischen Imperiums zu erkennen ist.8 Die am haufigsten aufgesuchten Orte waren Farahabad und Aschraf; dort hatte der Konig Garten und Palaste errichten lassen, von denen heute nur noch geringe Reste vorhanden sind. 1m folgenden solI versucht werden, das Bild der Residenzen von Farahabad und Aschraf zu rekonstruieren, und dies nicht nur in bezug auf ihre Anlage und ihre architektonischen Merkmale, sondern auch in ihrem Zusammenhang mit der ringsum emporwachsenden Stadt. Dazu dienen Plane und Luftbilder, welche die heutige urbane Situation veranschaulichen; die noch vorhandenen Dberreste vervollstandigen zusammen mit den Informationen, die wir den literarischen Quellen und sonstigen Dokumenten entnehmen konnen, ein andernfalls vages und ltickenhaftes Bild.
Farahabad Iskandar Bayg nennt Farahabad einen dar ul-suru~, ein LustschloiS, und ftigt hinzu, daiS der Konig hier Wohnung nahm, urn zu jagen und den Winter zu verbringen. Er berichtet vom Aufenthalt von Schah Abbas »an diesem paradiesischen Ort an der Ktiste ... , der friiher unter dem Namen Tahan bekannt war ... Da die Gegend, die vom FluiS Tijne durchflossen wird, es verdiente, eine Stadt zu werden, beschloiS er, dem am FluiS gelegenen dawlatkhane prachtvolle imarat hinzuzurugen ... Dieser Ort der Ltiste wurde Farahabad genannt, und er ftigte ihmjedes Jahr neue imarat, Garten, Basare, Bader, Moscheen und Karawansereien hinzu ... Von dieser Stadt bis nach Sari, was einer Entfernung von vier farsakh entspricht, legte er einen khiyaban an, der, weil es hier, wie tiberall am Meer, so haufig regnet und der Boden schlammig ist, einen steinernen Belag erhielt, urn Unglticksfalle zu vermeiden«.l0
201
Eine Karte vom Stidufer des Kaspischen Meeres, von den Teilnehmern der Morganschen Persienexpedition 11 erarbeitet, bezeichnet deutlich den Standort der koniglichen Anlage von Farahabad, die tiber Sari ftihrende StraiSe, die sie mit Aschraf verb and, und eine zweite VerbindungsstraiSe zwischen den beiden Residenzen, die an der Ktiste verlief. Von dieser zweiten StraiSe spricht auch Pietro della Valle, der sich 1618 in Aschraf aufhielt: »Der Konig verlieiS Escref und begab sich nach Farahabad, nicht auf der direkten StraiSe, sondern am Meer entlang undjagend, so wie er sonst immer mit den Frauen reist.«12 Die UferstraiSe tiberquerte den Tijne auf einer Brticke13, deren Reste auf dem Luftbild erkennbar sind. Der FluiS14, so berichtet Pietro della Valle, hatte »innerhalb von Ferrahabad eine einzige gut gebaute Brticke«.15
Der Konigspalast und die Garten wurden im Jahr 1020 nach der Hedschra (nach unserer Zeitrechnung 1611) im Norden der Stadt errichtet. Pietro della Valle notiert: »Wo die Provinz Masanderan ins nordlich anschlieiSende Kaspische Meer iibergeht, in einer weiten Ebene, hat der Konig Abbas vor wenigenJahren begonnen, diese Stadt Ferrahabad zu errichten ... Die StraiSen von Ferrah-abad sind alle sehr lang, wie ich schon gesagt habe, gerader und breiter als die Via Giulia in Rom ... Die Hauser sind ... alle einstOckig, sie haben groiSe Dacher aus Schilfrohr, die das Wasser sehr gut abhalten. Aus Ziegelsteinen gut gebaut ist allein das Haus des Konigs, das groiS, aber noch nicht Fertig ist und von dem ich, da ich es innen nicht gesehen habe, nichts weiter sagen kann als das, was man von auiSen sieht, daiS es nicht anders ist als die anderen Hauser des Konigs. Ebenfalls aus Ziegelsteinen und noch nicht fertiggestellt ist auch eine Karawanserei oder offentliche Unterkunft, die schon von Karawanen genutzt wird ... Es gibt auch ein offentliches Bad, aber es ist nicht groiSartig.« 16
Der Palast befand sich am westlichen Ufer des Flusses, »ohne daiS hier noch platz ftir eine StraiSe bleibt; er reicht bis an das Wasser heran«P Auf der von Jules Laurens gezeichneten Ansicht des FluiSufers 18 sind der Palast tiber einer fluiSseitigen Sttitzmauer sowie ein achteckiger Turm zu sehen. Sir William Ouseley zeigt dieses Gebaude, den J ahan Nama 19, auf quadratischem GrundriiS mit drei J ochen auf jeder Seite und mit abgeschragten Ecken.20 Die Zeichnung von Jules Laurens und die - spatere - Skizze von Holmes21 geben eine andere Version wieder: Der GrundriiS ist nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig; die Langsseite hat ftinf Joche, die Schmalseite vier. Diese Version wird durch eine Fotografie von Rabino bestatigt.22 Man kann also davon ausgehen, daiS der Jahan Nama zur Zeit von Schah Abbas einen quadratischen GrundriiS hatte wie derjenige von Schiraz23, bei dem vier ayvan ein Kreuz bilden; man kann des weiteren annehmen, daiS das Gebaude spater, unter der Dynastie der Kadscharen, verandert wurde.
Hommaire ist der Ansicht, der Jahan Nama sei von seinen Dimensionen her eher ein groiSer Pavillon als ein Palast gewesen24, ~nd ftigt
Die Strafie von Isfahan zum Masanderan, auch Rah-i Sangfarsh genannt, mit den verschiedenen Haltepunkten (nach W Kleiss, Die Schlosser des Shah Abbas" ,),
I RAH SAN' FAIHH" AS8ASASAD 51AHKUH I I' f'FLAHffl. srRASS~
GaM C {(!~;5:;:,::::: ,,"",,' c " ~ ,<\8,£ GERM
K: ~~,AN """J'~~~" "" ···" .• , •••• ,~ATANZ C· I ",
"1'''', '·'.; .. ~,.~~aAT JAN"'" '" " ' .
• CHAH~"'AaAD
DO,.,:>:_""'" """"" C NAIN I I., , .
o ISFMMN "'" . "
a 50 100 150 200 K 11 1i'K.8S
Die Bucht von Astarabad mit den Arealen von Aschraf und Farahabad; Detail der Karte »Rives meridionafes de fa mer Caspienne« (nachJ. de Morgan, Mission scientifique en Perse).
202
/ /
. ;;r-'-' ~ ----.. " t;t_ .
/"~ ,/ n.f~ ;;/ _.
h .. <t,.,.i.I..il.i. J _ ... / .. '
"
. '!\
, .. -
Ansicht des Tijne-Flusses mit dem Jahan Nama (nachJ. Laurens, Voyage en Turquie et en Perse).
203 --.
'---- ------
Zwei Ansichten des Jahan Nama (nach Sir W Ouseley, Travels in Various Countries of the East, More Particularly Persia, und WR. Holmes, Sketches on the Shores of the Caspian).
hinzu, daiS man von den »BalkollS« des zweiten Geschosses die Stadt Farahabad uberblicken und den Garten mit seinen Wasserbecken, den von hohen Mauern mit Tiirmen umgebenen andarun (privaten Bereich) und das Meer bewundern konnte.
Die von Hommaire ins Spiel gebrachte Frage nach den Dimensionen dieser Gebaude wirft zugleich Licht auf eine architektonische Besonderheit der koniglichen Residenzen: Sie bestanden in der Regel aus einer Reihe von Pavillons in mehreren Garten und aus Hafen, die die buyutat (Wirtschaftsgebaude) aufnahrnen; sie prasentierten sich also
204
eher als em Gebaudeensemble und nicht als em einzelner groiSer Palast.
1m Falle Farahabads war dieses Ensemble nicht sehr ausgedehnt.25 Es bestand aus zwei groiSen Bereichen. Der erste, der von einer Mauer und verschiedenen Versorgungseinrichtungen26 umgebene andarun, lag im Norden. Hier stand, auf halbem Weg entlang der Mauer, die das Westufer des Flusses begleitete, derJahan Nama. Auf den anderen drei Seiten war er von einem Garten umgeben, dessen Seitenlangen 120 Schritt betrugen.27 Das vom andarun eingenommene Areal entsprach dem auf dem Luftbild noch heute erkennbaren Quadrat. Siidlich davon lag ein ebenso groiSer Bereich, den man von einem Verbindungswe~8 aus erreichte, der in sudlicher Richtung zum Haupteingang fiihrte. Ein Teil dieses Areals muiS vom divankhane (dem Saal der affentlichen Audienzen) und von dem klein en Hof eingenommen worden sein, in dem sich die Stalle und ein hammam (Badehaus) befanden.
Der hohe Eingangsbau war wie ublich auf einen groiSen platz ausgerichtet. Hier befanden sich der Basar, die Moschee (deren Reste auf dem Luftbild gut zu erkennen sind) und die Karawanserei,z9 Der Komplex der affentlichen Gebaude spricht fur die Bedeutung dieses koniglichen Aufenthaltsorts. Ouseley nennt auiSer der Karawanserei und der Moschee noch die medrese (ReligiollSschule) und den daral-Shafa oder tabib khane (Hospital); er prazisiert auch, daiS der Konigspalast an einen Basar anschloiS, der einen schonen maydan (Platz) ahnlich demjenigen von Isfahan bildete.30
Der Hinweis auf die Vorbildstellung des maydan von Isfahan ist durchaus gerechtfertigt. Tatsachlich war die Situation hier die gleiche wie in der Hauptstadt: Der Konigspalast grenzte mittels eines schonen Eingangsbaus - »dargah-i dawlatkhane-yi Farahabad«31 - direkt an den Platz, und Schah Abbas konnte von diesem Gebaude aus die auf dem maydan stattfindenden offentlichen Lustbarkeiten verfolgen.32
Der maydan war, wie in Isfahan, von den Saulengangen des Basars umgeben, von denen Hommaire ein Joch, mit genauen Mafhahlen versehen, abgebildet hat.33 Die Saulengange34 umschlossen ein Rechteck von 274 mal 132 Schritt. Fraser bestatigt, daiS dieser Basar dem von Isfahan glich, und fugt hinzu, daiS sich gegenuber dem Portalbau des Palastes35 der Eingangsayvan der Moschee befand, der seinerseits an ein Hospital und eine Karawanserei anschloiS. Der maydan lag also vermutlich nordlich des heutigen Eingangs zur Moschee und nahrn das auf dem Luftbild hervorgehobene Rechteck ein. An seiner Sudseite lagen die Moschee und die angrenzenden affentlichen Gebaude, die einen weiteren langgestreckten Hof einschlossen. Dieser Hof ist, anders als der maydan, nach Mekka orientiert. Wie in Isfahan ist auch hier das Problem des Anschlusses zwischen den beiden Richtungen durch das Mittel des Eingangsbaus gelost, und beide Areale, der sahn ebenso wie der maydan, sind vollig regelmaiSige Anlagen. An der Siidwestseite des Hofes befand sich der shabistan der Moschee, der mit seinen Reihen spitzer Bogen auf Pilastern »66 Schritte in der Lange und 25 Schritte
t
1
1
1
S
11
-n
:S
n
-If 11
11
Is IS
IS
Ie
~s
11
te
Ltiftbild von Farahabad; man sieht die dem maydan zugewandte Moschee, die Reste der Br':icke iiber den Tijne-Flufl und einenTeil der kiilliglichen Giirten.
205
Die Reste der Briicke von Farahabad.
206
gegeniiberliegende Seite: Farahabad, Reste der Stiitzmauern der koniglichen Garten am Tijne-Flufl und die safawidische Moschee, die sich mit einem heute zerstorten groflen Portalbau dem maydan zuwandte.
Plan der heutigen Stadt Aschraf Die Markierung des von Morgan atifgenommenen Areals zeigt die Obereinstimmung der Terrassierung der Garten mit den Hohenlinien sowie einer Strafle der modernen Stadt mit dem Boulevard Bagh-i Sahib-i Zaman.
Der Bagh-i Shah und der Divankhane in Aschraf mit dem »a05erhalb gelegenen Platz, dem gedeckten VorhoJ. .. und den schneebedeckten Bergen drauflen« (Pietro della Valle, BAV, Cod. Ottob. Lat. 3382, fol.276).
in der Tiefe« ma£36 und von einer hohen Kuppel tiberwolbt war.37 1m Osten und im Westen schlossen zwei kleinere Gebaude an die Moschee an, die ihrerseits rechteckige Hofe umschlossen - die Religionsschule und das HospitaP8
Mit dem so rekonstruierten Bild der kcmiglichen Residenz von Farahabad rticken morphologische und urbanistische Aspekte ins Licht, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: enger Zusammenhang von Konigspalast und Platz; der letztere ein Ort der Konzentration der offentlichen Gebaude und zugleich Vestibtil der Palastanlage; diese ist als ein Ensemble von Elementen angelegt, das in diesem Fall nicht sehr
gro£ ist.
Ashraf Die Garten von Ashraf gehorten zu den schonsten Schopfungen von Schah Abbas und beherbergten »den prachtigen imarat ftir den Aufenthalt des Konigs, der mit Badem, Wirtschaftsgebauden und talar versehen war«. Das Datum ihrer Errichtung ist uns in einem Preisgedicht aus dem J ahr 1021 nach der Hedschra (nach unserer Zeitrechnung 1612) tiberliefert. Nach Iskandar Bayg »lie£ der Konig hier mit der Zeit Obsthaine anlegen, die imarat und hawzkhane . .. enthielten und in denen liebliche Wasser von hoch oben in Becken herabfielen und die paradiesischen Garten schmtickten. Aus der Mitte jedes der Becken stieg ein Wasserstrahl wie eine Flamme zum Himmel empor ... «.39
Pietro della Valle schreibt vom gleichen Ort: »Endlich kamen wir in Escref an, das etwa zwei Meilen ... vom Meer entfemt liegt, am Ende einer herrlichen Ebene und zu Fti£en von Htigeln, die den Ort nach Stiden hin begrenzen. Bisher steht hier noch nichts anderes als die Residenz des Konigs, die noch nicht fertig gebaut ist, mit Garten, einer Basarstra£e und vielen Hausem, die sich ohne Ordnung hier und da zwischen den Baumen tiber ein sehr gro£es Gebiet verteilen ... Lebendiges und flie£endes Wasser40 gibt es hier in gro£er Ftille und von guter Qualitat. Es gibt auch gro£e und schone Baume im Dberflu£, zwischen denen die Hauser so vereinzelt und so beschattet stehen, da£ man sie kaum sieht und da£ ich es in meinem Diarium offengelassen habe, ob Escref eine in einen Wald gesate Stadt oder aber ein bewohnter Wald ist, der sich als Stadt gibt.«41
Auf einem heutigen Lageplan von Aschraf kann man die Zone der koniglichen Garten und Spuren einiger ihrer Komponenten erkennen. Der Komplex der Garten lag im Stidwesten der Stadt an den Hangen des Sut Klum. Morgan42 hat eine Aufnahme angefertigt, welche die Situation der Ruinen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zeigt: Man erkennt den von einem Platz aus zuganglichen Bagh-i Schah, ostlich davon den von Mauern mit Ttirmen umgebenen Bagh-i Tappe und den nach Stidosten orientierten Bagh-i Tschischme; im Westen liegen drei zusammenhangende Garten, von Norden nach Stiden identifiziert als Bagh-i Sahib-i Zaman, Bagh-i Schumal und der Hof mit den Stallungen und den Wohnungen der Bediensteten.
208
--c
--
,. I to I.. I
I,
- I ~ I J .. i& I
~ I
1 I
~ '\ -' J e ,
I, ~
'" I ..(
~
f i !
M
~
~ i r !
! i
I ! I
I i I J I 1 I.
i I
I
1
I I
I , 1
1 j
j
!
vorhergehende Seite: Rekonstruktion der koniglichen Giirten von Farahabad, des maydan, der Moschee und der Briicke iiber den TijneFlufl (Zeichnung Mahvash Alemlj.
Ansicht der Giirten von AschraJ im Vordergrund das grofle Becken und der von Nadir Schah errichtete Tschihil Sutun; im Hintergrund der Imarat-i Sahib-i Zaman (nachJ. Laurens, Voyage en Turquie et en Perse).
Der heutige StadtgrundriB ist insofern ein wichtiges Kontrollinstrument fiir die Rekonstruktion des Erscheinungsbildes der koniglichen Residenz, als sich eine Reihe von Elementen erhalten hat. In den Niveauunterschieden zeigen sich in der Tat noch die Terrassen der inzwischen verschwundenen Garten, und eine der heutigen StraBen verlauft in der Linie der zentralen Allee des Bagh-i Sahib-i Zahman, wie sie auf Morgans Aufnahme erscheint. Der heutige Stadtplan gibt im iibrigen die Namen der historischen Quartiere an und klart damit den Zusammenhang der koniglichen Residenz mit der safawidischen Stadt43 : 1m Westen des Komplexes liegt Farrash Mahalle, das Quartier der Bediensteten des Konigspalastes; im Norden Bazar Mahalle, das Basarviertel; im Nordosten Naqqash Mahalle, das Quartier der Maler, die am Hof tatig waren; und im Osten schlieBlich Gurji Mahalle, das Quartier der von Schah Abbas hierhergebrachten georgischen Bevolkerung.
Der Zusammenhang der koniglichen Garten mit der Stadt wird auch bei Pietro della Valle deutlich, der von seiner ersten Audienz bei Schah Abbas am 4. Marz 1618 im Saal der offentlichen Audienzen von Aschraf berichtet: »Der Haupteingang des Palastes liegt gegeniiber einer langen und schonen StraBe. Dort angekommen, stiegen wir ab, gingen aber nicht auf die groBe Wiese44, die hier als Vorhof dient, sondern hielten uns nach rechts, bis wir an einen groBen, dem Palast gegeniiberliegenden Platz kamen, von dem aus man zum Gartentor kommt ... Am Ende des platzes und nahe am Palast steht ein schoner groBer Baum, und hier stehen wiederum Wachsoldaten.«45 Della Valles Skizze des Audienzgebaudes46 ist ein sehr interessantes Dokument, denn sie zeigt auch den »auBerhalb gelegenen Platz«, vom dem aus man durch den »gedeckten vorhof« in den Garten gelangte. Damit bestatigt sich auch in Aschraf die Regel, nach der sich immer ein maydan als Vestibiil zwischen dem dawlatkhane und der Stadt befinden muBte. Der Platz war ein unerlaBliches Element der Komposition des dawlatkhane; hier wie in Farahabad, Sari, Astarabad, Kaschan, Qazwin, Tabriz und anderswo fiihrte man ein Modell aus, dessen vollkommenster Vertreter sich in Isfahan erhalten hat, wo der Maydan-i Schah als Vestibiil der koniglichen Garten fungierte, die man durch den Eingangsbau Ali Kapu erreichte.
Zur Zeit des Besuchs von Pietro della Valle war der Platz noch nicht, wie in Farahabad, von den Saulengangen des Basars umgeben: »Wir traten durch den machtigen Torbau am Ende der geraden und breiten StraBe ein, die bisher noch ausschlieBlich von Hecken und Garten gesaumt ist. Der Wesir hat mir aber gesagt, daB sie ganz bebaut und zum Basar gemacht werden soIl, und er hat mir auch die Stellen gezeigt, an denen Bader, Karawansereien, Maydan oder Platze geplant sind, und dazu gesagt, daB das Ganze bald eine groBe und schone Stadt sein wird«47; »Hinter der ersten Tiir entdeckte ich einen kleinen Hof, der, wie mir scheint, als Kiiche oder Speisekammer dient, denn ich sah hier viele mit Speisen gefiillte GefaBe und Platten. Von diesem kleinen
211
Der Tschihil Sutun und der Imarat-i Tschischme in Aschraf (l1ach Sir W. Ouseley,Travels ill Various Countries of the East, More Particularly Persia).
Aschraf, der Imarat-i Tschischme ttl1d der Hattptkanal im Bagh-i Schah.
212
Hofchen aus gingen wir durch einen zweiten Eingang48 in einen gedeckten Vorhof, und dann folgt nochmals ein bewachter Eingang, hinter dem sogleich der Garten beginnt.«49 Hanway, der den Palast im Jahre 1743 besuchte, erwahnt mehrere Raume zwischen den beiden Eingangen50, die von der koniglichen Wache genutzt wurden.
Nach Pietro della Valle war der Garten des divankhane »nicht sehr gro~ ... Genau in der Mitte steht der Divan Chane, eine etwas erhohte Loggia oder Saulenhalle, zu der zwei Stufen hinauffiihren, an der Vorderseite ganz geof£net, auf den anderen Seiten von Mauern mit vielen Fenstern umgeben. Gegeniiber dem Eingang befindet sich eine Tiir. Die von Wasser begleitete Hauptachse verlauft vom Eingang [des Gartens] zum Divan chane, durch die erwahnte Tiir auf der anderen Seite wieder hinaus und bis zum Ende des Gartens«.51
Der durch einen Brand zerstorte divankhane von Schah Abbas wurde im Hedschra-J ahr 1144 (nach unserer Zeitrechnung 1731) von Nadir Schah rekonstruiert. Das neue Gebaude, bekannt als Tschihil Sutun, ist sowohl bei Ouselel2 als auch bei Jules Laurens53 abgebildet. Beide zeigen einen von zwei Reihen holzerner Saulen getragenen talar mit zweigeschossigen Seitenfliigeln (gushvar). Nadirs Tschihil Sutun war auf beiden Seiten offen, wahrend man der Beschreibung, die Pietro della Valle von der Safawidenloggia gibt, entnehmen mug, dag sie nur nach Norden geoffnet war wie ein ayvan: »Divan chane, das ist eine Loggia, dreimal so lang wie breit und an der Vorderseite ganz geoff net, an der Riickseite und den Schmalseiten dagegen von Mauern eingefagt, diese aber mit vielen Fenstern.«54
Hanway55 beschreibt den Tschihil Sutun als prunkvollen, mit den Bildern eines niederlandischen MaIers geschmiickten ayvan. Wenn es sich urn Malereien John Duchmans56 handelt, des - nach Herbert -Hofmalers von Schah Abbas, dann konnen wir annehmen, dag das Gebaude bei dem erwahnten Brand nicht vollig zerstort wurde und da~ Nadir Schah Teile des aus der Safawidenperiode stammenden Bauwerks iibernahm. Hanway erwahnt im iibrigen ein Wasserbecken und einen steinernen Kanal mit 6ffnungen, in die man Kerzen setzen konnte.57 Ein solcher Kanal ist im Bagh-i Tschihil Sutun noch heute vorhanden, wahrend man das Becken zugedeckt hat.58
Vermutlich stand der Raum, in dem Schah Abbas seine offentlichen Audienzen abhielt, an der Stelle, an der auf Morgans Plan der Tschihil Sutun steht - im Zentrum des Bagh-i Schah.59 Hier la~t sich auch sagen, wo der rnaydan lag, den Pietro della Valle als »augerhalb gelegenen Platz« bezeichnet und nordlich vom divankhane abbildet; Morgan markiert ein eingefriedetes Areal, heute befindet sich an dieser Stelle ein Teich. Das Vorhandensein eines Sabz-i Maydan nordlich des Gebaudes wird auch durch den Text des Mirza Ibrahim bestatigt.60 Das kleine Hofchen, in dem die Teller mit den Speisen standen, konnte also mit dem Areal identisch sein, auf dem Morgan den abanbar (Zisterne) ansiedelt, dessen Eingang auf einer Fotografie von Sarre erscheint.61
Pietro della Valle besuchte auger dem Divankhane noch andere Teile
der koniglichen Residenz in Aschraf, die ebenfalls aus mehreren imarat, offentlichen und privaten Garten und einer Reihe von Wirtschaftsgebauden bestand. Er nennt einige davon und fugt dann hinzu, daG der Konig mit dem Bau weiterer Hauser und Loggien begonnen habe.62 In der Tat beschreiben die Reisenden einer spateren Zeit eine ausgedehntere Anlage.
Das Ensemble der Garten sudostlich des maydan wird von Pietro della Valle wie folgt beschrieben: »Hinter der Tur, durch die wir eintraten . .. , befand sich eine schone groGe Wiese, die als Vorhof des koniglichen Hauses dient und auf der sich die Leute versammeln, die den Konig sehen oder sprechen wollen ... Neben dem Badehaus erhebt sich ein Hugel63, der zum Teil kunstlich aufgeschuttet ist mit Erde, die man hergebracht hat, und auf diesem Hugel, den man auf einer Treppe ersteigt64, befindet sich ein Garten voller Orangen- und Limonenbaume, voller Blumen und Fruchte aller Art und voller duftender Krauter ... Inmitten dieses Gartens, der nicht sehr groB ist, hat man ein achteckiges Gebaude errichtet, ebenfalls klein, aber hoch und voller Zimmer, die samtlich bemalt und vergoldet sind, aber winzig klein, wie es bei ihnen der Brauch ist ... Dieser Ort ist nur fur die Frauen.«65 An anderer Stelle heiGt es, daG dieser Garten »von starken Mauern mit Turmen umgeben« war.66
Ein ahnlicher Garten, der Bagh-i Tappe (Hugelgarten), ist von Morgan osthch des Bagh-i Tschihil Sutun aufgenommen worden. Zwischen diesen beiden Garten nennt Morgan einen balakhane, wo die Treppe zum Bagh-i Tappe hinauffuhrte.67 Auf dieser Seite der Anlage befanden sich auch der Bagh-i Tschischme und der Bagh-i Zaytun68; die Ruinen des Imarat-i Tschischme sind noch he ute vorhanden.69 Der von Hommaire angefertigte GrundriG zeigt einen typischen Pavillon mit vier ayvan. 1m mittleren Raum, der von einer Kuppel uberwolbt wird70, befindet sich ein Brunnen, dessen Wasser den ganzen Garten versorgte und die Becken des Hauptkanals speiste. Vom System der Hofe und Garten westlich des maydan heiGt es bei Pietro della Valle: »Nachdem wir ebenjene Treppe heruntergegangen waren, erblickten wir das Haus des Konigs rechts von der besagten Wiese ... mit einem kleinen Garten71 und einem Torbau72
, der gegen das Gebirge und den Divan chane geht; ein Brunnen wirft sein Wasser sehr hoch, und in diesem Haus lassen sie es durch aIle Raume bis zum Dach laufen, und wenn sie Brunnen machen konnten nach unserem Gebrauch, ware es sehr gefallig; auch dieses Haus ist klein, und die Zimmer sind winzig und zahllos .. . , alle bemalt und vergoldet mit kostbaren Miniaturen wie diejenigen, die ich mit Bezug auf das Haus von Sphahan beschrieben habe. Es hat viele Balkone nach allen Seiten, hat einen Raum, der auf allen seinen vier Seiten Turen oder Fenster hat und zwei riesige Spiegel, die selbst wie Fenster sind und einen schonen Anblick vortauschen, indem sie auf allen Seiten so viele andere Zimmer ahnlich diesem erscheinen lassen ... U nd einige andere geheime Raume, die sie chelvet chane (khalvatkhane) nennen, das heiBt Hauser der Ein-
214
samkeit . . . Ich traf dort viele Leute, die arbeiteten, vor allem Maler, denn es ist noch nicht fertiggestellt«?3
Wiederum nach Pietro della Valle befand sich der khalvatkhane in einem kleinen Garten, der auch einen balakhane uber einem nach Suden gehenden Torbau enthielt. Die verschiedenen Reisenden auBern sich unterschiedlich bezuglich der Frage, wo genau sich dieser Garten befand; aIle siedeln ihn allerdings westlich des Bagh-i Tschihil Sutun an74, das heiGt im andarun, dem privaten Teil des dawlatkhane. Della Valle bestatigt, daB sich hier der haram75 und das Haus des Konigs befanden. Der »kleine Garten« war vermutlich der nordlich des Bagh-i Sahib-i Zaman gelegene Garten.76
Die Reste des Imarat-i Sahib-i Zaman wurden sowohl von Jules Laurens77 als auch von Ouseley78 gesehen; beide zeichnen ein Gebaude auf rechteckigem GrundriG,der denjenigen des Pavillons mit den vier ayvan dreimal wiederholt.79 Dieser imarat zeigt ein typisches Kennzeichen der persischen Architektur, die Verwendung kodifizierter Elemente. Westlich des dawlatkhane, angebunden durch eine StraGe, die den Hugel hinauffuhrt, findet sich ein weiterer Pavillon, der Imarat-i Safiabad. Dieses Gebaude, das auf einer Zeichnung von Ouseley erscheint, besaG nach Meinung einiger Autoren einen rasadkhane (Observatorium).80 Es war von Schah Abbas auf einer kunstlichen Plattform erbaut worden8!, und zwar mit vier ayvan.82 Der Pavillon ist mehrfach restauriert worden und existiert noch heute; der Grundrill der heutigen Stadt zeigt die Substruktionen und einige Reste, die Holmes auf seiner Reise sehen und beschreiben konnte.83
Von der Terrasse genieGt man eine wundervolle Aussicht in die Ebene, auf die von Waldern bedeckten Berge und auf das in der Ferne liegende Kaspische Meer. Diese Landschaft, charakterisiert durch eine parallel zum Meer verlaufende Bergkette und die davorliegende, von Flussen durchzogene Ebene, rechtfertigt das Vorhandensein weiterer Pavillons, Garten und Palastanlagen im Masanderan.84
Unsere Rekonstruktion hat gezeigt, daG Aschraf sich mit seiner Anlage, mit der Ausrichtung der Achsen seiner Garten an der Linie des starksten Gefalles und mit der Position seiner Pavillons nach landschaftlichen Gesichtspunkten eng an die morphologischen Gegebenheiten des Ortes halt. Der Freiheit dieses Entwurfs kommt zugute, daG es mehrere Komponenten sind - Pavillons, Garten und Hofe -, die miteinander den bestgeeigneten Rahmen fur die vielfaltigen Funktionen des hofischen Lebens bilden.
Dieses Moment des Vielfaltigen in den Raumen und Gebauden laGt Gliederung und Flexibilitat zu und gewahrt die Moglichkeit, Formen und Dimensionen zu verandern und je nach Bedarf und historischer Situation ein Element zu eliminieren oder weitere Elemente hinzuzufugen.
I Yaylaq sind kiihle, qishlaq sind klimatisch gemaBigte Orte. 2 Pietro della Valle, Cod. Ottob. Lat. 3382: Dieser in der Biblioteca Apostolica Vaticana aufbewahrte Kodex enthalt - bis fol. 261 -das persische Reisetagebuch des Pietro delIa Valle und im AnschluB daran seine Briefe. Auf fol. 268 spricht der Verfasser iiber die Griinde der Errichtung der Stadt Farahabad im Masanderan: »Es sind zwei Griinde, die den Konig bewogen haben, diese Stadt zu bauen. Der erste ist der ihm angeborene immerwahrende Wunsch, sein Reich zu vergroBern und zu verschonern ... , der zweite ist seine besondere Liebe zur Provinz Masanderan, einmal weil seine Mutter aus dieser Gegend stammt und folglich auch er dieses Blut in sich tragt, zum anderen weil er in keiner seiner Provinzen sicherer ist als hier im Masanderan, umgeben von einem wenig befahrenen und wegen der engen und schwierigen StraBen auch wenig befahrbaren Meer, in einer Gegend also, die ohne Zweifel sehr leicht zu verteidigen und iiberdies wohl auch am weitesten entfernt ist von allen Feinden, die der Konig urn sich hat, vor allem von den Tiirken.« 3 Iskandar Bayg Torkaman, Tarikh-i Alalllyi Abbassi, Teheran 1335, Band II, S. 850-851 und Band III, S.990: »Die StraBe von Savadkuh erreicht den Masanderan iiber Khwar, Hilrud und Firuzkuh; der Zug des Konigs benutzt diese Stralle; bis nach Farahabad sind es acht-neun IIIarhale (Tagesreisen) vonjeweils etwa fiinfjarsakh (drei Meilen) oder wenig mehr.« 4 W. Kleiss, »Die Schlosser des Shah Abbas am Konigsweg von Isfahan an die Kiiste des Kaspischen Meeres«, in Architectllra, XVI, 1986, S. 42-49. 5 Iskandar Bayg, op.cit., »IIIIarat mit kIla/lehayi lIishilllall, bllllltat und baghceha, von denen die meisten ein halllllla/ll besitzen.« 6 W. Kleiss, op.cit. Diese Unterkunfts- und J agdschlosser ahneln den Karawansereien. Manchmal besitzen sie einen doppelten Hof wie in Dumbi und Sifidab. 7 Iskandar Bayg, op.cit., S.1111. AuBer Farahabad und Aschraf nennt der Autor die Residenzen von Amu1, Sari, Barfurush Dih und Astarabad. 8 T. Herbert, SOl/le Years Tra llels ill to ... describillg ... the two Fa/llolls E/Ilpires, the Persiall alld Great Mogll11, London 1638. 9 Iskandar Bayg, op.cit. Farahabad wird immer in dieser Weise apostrophiert, mit Ausnahme einer Stelle auf Seite 945, wo der Ausdruck dar II/-saltane erscheint, eine Bezeichnung, wie sie sonst den Hauptstadten Tabriz, Qazwin und Isfahan vorbehalten ist.
10 Ibide/ll, S. 850. 11 J.J. M. de Morgan, Missioll scielltifiqlle ell
Perse, par J. de Morgall, Cartes des rives /IIeridiolIales de la /IIer Caspie/lI/e ... , Paris 1895. 12 P. della Valle, op.cit., f. 98v. 13 M. Sutudeh, Frolll Astara to Estarabad, Teheran 1366, Band IV, Teil I, S.588, Abb. 310; die Pfeiler der Briicke messen 3 x 6 m und sind abgerundet; drei von ihnen sind eingestiirzt, vier weitere existieren noch. 14 H. L. Rabino (»A Journey in Mazandaran«, in Geographical JOllmal, XLII, 5, 1913) beschreibt den FluB Tijne, der, aus dem Bergland zwischen Pulwar lllld Fulad Mahalleh kommend, die Gewasser der Ebene von Hizar J arib aufnimmt, bevor er bei Farahabad, siebzehn Meilen nordlich von Sari, ins Kaspische Meer miindet. I S P. della Valle, op.cit., f. 269. 16 ibide/ll, f.268. 17 ibidem, f.273v. 18 X. Hommaire de Hell, Voyage e ll 1l,rqllie et ell Perse; acco/llpaglle d'Wl albll/ll de 100 plallches dessillees d'apres lIatllre par Jllies LallrellS, Paris 1860, vol. III. Diese Ansicht (Tafel LXXIX) tragt den Titel Riviere de TichellrolV (rijne Rud) Palais a Tarabad (Farahabad). 19 W. Ouseley, Travels ill Voriolls COlllltries of the East, More Partielliarly Persia, London 1819-23, Taf. LXXI. 20 J. B. Fraser, Travels aHd Advflltllres ill Provillces 011 the SOli them Banks of Caspia" Sea, London 1826, S. 72: »Das einzige noch aufrechtstehende Haus ist ein nahezu quadratisches Gebaude, zweistockig, mit einem ebenfalls quadratischen Turm. Es steht nahe am FluB und wird als Jehan Numah bezeichnet .. . Es hat groBe Ahnlichkeit mit einigen Bauten in Ashruff: 1m ErdgeschoB befindet sich ein groBer zentraler Raum mit Nebenraumen an den Ecken und noch kleineren Raumen zwischen diesen; im oberen GeschoB folgen kleine Zellen, zum Teil ell sllite, aufeinander ... Westlich dieses (Gebaudes) kann man die Reste einer Mauer und eines Portals erkennen, die wahrscheinlich einmal zum Garten gehort haben.« 21 W. R. Holmes, Sketches 011 the Shores of the Caspiall, Descriptive alld Pictorial, London 1845, S.225. 22 M. Sutudeh, op.cit., Foto Nr. 31l. 23 A. Aryanpour, A SlIrvey of Persiall GardeliS ... , Teheran 1986, S.238: Grundrill des Pavillons Jahan N ama in Schiraz. 24 X. Hommaire de Hell, op.cit., S.263. 25 J.B . Fraser, op.cit., S. 72: »Bei den Ruinen von Farahabad gibt es zwei Gruppen, zum einen die typischen Gebaude einer koniglichen Residenz, zum anderen die offentlichen Gebaude, wie sie in einer respekta-
215
bien Stadt im allgemeinen vorhanden sind. Fiir die ersten ist ein groBer Bereich abgeteilt worden, mit Bastionen an den Ecken; dieser Raum ist wiederum in zwei Teile geteilt: im Norden die Privatappartements, im Siiden die offentlichen Raume.« 26 J. c. Haentzsche, »Palaste Schah Abbas I von Persien in Masanderan«, in Zeitschrift der Delltscltell Morgwlii"dischell Gesellschaft, Leipzig 1864, Band 18, S. 669-679 (S.671). An der Siidwestecke der Mauer befand sich ein kleiner Turm; auf der Nord-und der Siidseite waren die Mauern mit Spitzbogen versehen, hinter denen die Kiichenraume und die Behausungen der Bediensteten lagen, wahrend sich in der Nordost- und der N ordwestecke niedrige oktogonale Raumlichkeiten in der Art von Badern befanden. Vgl. auch Hommaire de Hell, op.cit.: »Die Behausung der Eunuchen . .. befindet sich rechts, wenn man in den Garten eintritt. Die Bader und Kiichen lagen dagegen auBerhalb der Mauern, am Ende eines kleinen Hofes.« 27 J. c. H aentzsche, op.cit., S. 67l. 28 X. Hommaire de Hell, op.cit., S.263: » Vom Garten des a/ldanlll gelangt man zu demjenigen, in dem sich die Residenz des Schah befand, von der sich nicht ein einziger Stein erhalten hat; danach passierte man ein schones Portal, das noch gut erhalten ist und den Zugang zum graBen Platz von Farahabad gewahrt«; vgl. auch J.B. Fraser, op.cit., S.73: »Der Zugang von diesem zum nachsten Sektor erfolgt durch einen von starken Mauern umgebenen langen und engen Gang, wie man ihn in den haralll findet ... [SchlieBlich 1 erreichten wir einen weiteren Eingangsbau, der sich auf einen groBen rechteckigen Platz offnete.« 29 Mirza Ibrahim, Safamame-yi Astarabad va Gila/I, hg. von Mas'ud Guizar, Teheran 1976, S. 108: Die Gebaude des Schah Abbas in Farahabad sind aufgelistet als Jahan Nama, raste-yi bazar, Karawanserei, Moschee, Badehaus, divallkha/le, askarklzalle und sartavile. 30 W Ollseley, op.cit., S.282. 31 Iskandar Bayg, op.cit., Band III, S. 946. 32 X. Hommaire de Hell, op.cit.: »Der Torbau umschlieBt zur Rechten und zur Linken kleine Raume, in denen Schah Abbas sich niederlassen konnte, urn den Festlichkeiten und Spielen beizuwohnen, fiir die der Platz haufig als Biihne diente.« 33 X. Hommaire de Hell, op.cit., Zeichnung Nr.5 der Tafel XXIII und S. 404: »Plan eines Ladenlokals des zerstOrten Basars: A, Ladenlokal, drei bffnungen. Scheitelhohe der Spitzbogen C 4 m; Hohe der Kuppel D 5,20m.« 34 J.B. Fraser, op.cit., S.73: »Das Platzareal
miBt 250 x 134 Schritte und ist von einem 15 FuB hohen Portikus umgeben ... Es handelte sich wahrscheinlich urn einen graBen Basar wie im Fall des Maidan-Shah von Isfahan«; X. Hommaire de Hell, op.cit., S.263: »Dieser Platz ist 274 Schritte lang und 132 breit; die Ecken sind mit kleinen Kuppeln verziert.« 35 J. C. Haentzsche, op.cit., berichtet, daB der Portalbau dem gegeniiberliegenden glich. 36 J.B. Fraser, op.cit., S. 73. 37 X. Hommaire de Hell, op.cit., S.264, berichtet, daB er den Raum von Strauchern, Granatapfel- und Feigenbaumen ganz zugewachsen vorfand. 38 M. Sutudeh, op.cit., Band IV, S. 578, Fotos Nrn. 305-308; vgl. auch B. Atabay, Fihrist albll/llha-yi saltallati: daftar II. 130, das Aufnahmen von Gebauden des Schah Abbas in Farahabad enthalt. 39 Iskandar Bayg, op.cit., S. 855-856. 40 H. L. Rabino, op.cit., S.64: »Aschraf und das Umland werden bewassert vom FluB Barzu, vom FluB Saru, der vom Abbasabad herunterkommt, und von den Bachen Khalil Mahallah und Rubat, die von den Bergen des Yakhkash herunterstromen.« 4 1 P. della Valle, op.cit., f. 275. 42 J.J. M. de Morgan, »Les rives meridionales de la mer Caspienne«, in Etudes geographiqlles, vol. I, S. 18l. 43 Mirza Ibrahim, op.cit., S. 80. 44 Der Platz vor einem koniglichen Palast wurde haufig als sahz-i /IIaydall bezeichnet, was soviel heiBt wie Wiesenplatz, wahrscheinlich weil diese Platze nicht gepflastere waren. Es handelte sich urn eine Rasenflache, auf der man reiten konnte. In dies em Zusammenhang vgl. P. della Valle, op.cit., f. 284: »Eine schone groBe Wiese dient dazu, die Leute zu versammeln, die dem Konig schmeicheln wollen oder die darauf warten, ihn zu sehen und zu sprechen. Der Konig gibt seine Audienzen niemals in den Salen oder Raumen seines Hauses, sondern immer stehend in den Hofen oder zu pferd auf den iiffentlichen Plat-zen.« 45 Ibidem,ff. 275v und 95. 46 Ibidem, f. 276. In den Erlauterungen zu seiner Skizze nennt Pietro della Valle unter anderem eine »weiterfiihrende StraBe«, einen Fischteich, eine groBe StraBe, den Eingangsbau zum Garten, einen »gedeckten Vorhof«, den Hof, in dem die Speisen gerichtet wurden. 47 Ibide/ll, f. 99. 48 F. Sarre, DeIlk/lliiler Persischer Ballk'lllst. Gesclliclltliche Ulltersllcllllllg WId AlifilOlwle Mllha/ll/lleda/ziscller Backsteillballtell ill Vorderasiell WId Persiell, Berlin 1910. Fiir den
Bagh-i Schah nennt der Autor die Ma[\e 450 x200m. 4 9 P. della Valle, op.cit., f. 276. 50 ]. Hanway, British Trade over the CaSpiall Sea, London 1754: "Uber dem Torbau, der als Eingang fungiert, sieht man das Wappen Persiens . . . Jenseits des Eingangs beginnt ein langer Weg, auf beiden Seiten von 30 Hauschen der koniglichen Wache flankiert; der nachste Torbau offnet sich auf einen Garten.« 5 1 P. della Valle, op.cit., f. 95. 52 W. Ouseley, op.cit., Taf. LXXI. 53 · X. Hommaire de Hell, op.cit., Taf. LXXX. 54 P. della Valle, op.cit., f. 276. 55 ]. Hanway, op.cit.: » .. . ein Garten mit einem steinernen Kanal, etwa drei Fu[\ breit und einen Full tief; in diesem Kanal fliellt Wasser, das im Abstand von etwa 30 yards vier etwa ein ell hohe Kaskaden bildet,jede mit einem kleinen Becken und einem Brunnen. Diese Kaskaden mussen eine schone Wirkung machen, denn entlang der Wasserstrecke hat man in regelma[\igen Abstanden Vertiefungen geschaffen - es sind ungefahr tausend - , urn Kerzen aufstellen zu konnen. Am Ende [des Kanals] befindet sich ein grolles steinernes Becken von etwa sechs Full Tiefe. In dem dann folgenden Gebaude befindet sich ein prachtvoller aYVall, der mit goldenen Blumen auf blauem Grund ausgemalt ist ... Auch gibt es hier zahlreiche Bildnisse, die anscheinend von einem Hollander gemalt wurden, aber nicht mit der Hand eines Meisters. In den Seitenflugeln befinden sich viele kleine Raume, und hinter dem Gebaude fallen drei weitere Kaskaden von einem steilen baumbewachsenen Hang herab.« 56 ]. Carswell, »East and West: a Study in Aesthetic Contrasts (Part I) , Sir Thomas Herbert and His Travel Writings«, in Art alld Arc/zaology Research Papers, Dezember 1972. 57 G. V. Melgunow, Safamal1le-yi Me/gllll(g be sawahil-i darya-yi Khazar (1858-1860), hg. von Masud Gulzari, Teheran 1985, S.88: » Vor dem Tschihil Sutun befindet sich ein Becken ... , das als hawz-i ciraghall (Becken der Lichter) bekannt ist; ein steinerner Kanal .. . bis zum Eingang, an den Seiten mit Lochern fur die Kerzen versehen.« 58 Nadir Schahs Gebaude wurde unter Schah Reza Pahlevi erneut instandgesetzt und ist heute Sitz der lokalen Verwaltung. 59 Diese These wird von allen Reisenden des 19. Jahrhunderts und von den Forschern vertreten, die sich mit diesen Garten beschaftigt haben. Vgl. Ali Baba Askari, Billshahr: Ashraf al-balad, Teheran 1350;
siehe auch D. Newton, Persiall Gardells alld Gardell Palli/iolls, Washington DC 1979. 60 Mirza Ibrahim, op.cit., S. 85. Nach diesem Text befanden sich westlich des Tschihil Sutun die Garten des alldanlll, die, am Hang angefangen, aus dem Bagh-i Sahib-i Zaman, dem Bagh-i Haram und dem Bagh-i Schumal bestanden; westlich dieser drei Garten standen in gleicher Anordnung drei Gebaude, der Bagh-i Khalvat, der Divankhane und der Sabz-i Maydan. 61 F. Sarre, op.cit., Taf. 137; diese Zisterne wird bei Mirza Ibrahim, op.cit., S. 82, als von Schah Abbas angelegt erwahnt. 62 P. della Valle, op.cit., f. 276. 63 ibidelll, f. 284: »Linkerhand erhebt sich ein schaner Hugel, teils natiirlich und teils kunstlich aus Erde gemacht, die man hergeschafft hat; zu seinen Fullen befindet sich ein Badehaus ... « 64 Mirza Ibrahim, op.cit., S. 83: »Ostlich des Tschihil Sutun befindet sich .. . ein darlllaze, durch den man iiber eine Treppe den Baghi Tappe erreicht, dessen vier Ecken mit Turmen verse hen sind. Hier stehen Orangenbaume und sechs Zypressen, ferner ist hier ein halll/llalll und ein illlarat.« 65 P. della Valle, op.cit., f. 99. 66 ibidelll, f. 284. 67 F. Sarre, op.cit.: Dieser kleine Garten millt 150 auf 60 Meter; W.R. Holmes, op.cit., S.236: ,)Einer dieser Tiirme ist sehr hoch und besitzt ein rundes Ziegeldach ... In der Mitte sieht man die Ruinen eines kleinen Pavilions, und gegen den Bagh-i Shah hin ... liegen Bader und andere Raume.« 68 Der in den Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert erwahnte Bagh-i Zaytun fungierte als Verbindungsglied zwischen dem Bagh-i Tappe und dem Bagh-i Tschischme; er nahm den Raum ein, der durch den Richtungswechsel zwischen den beiden letztgenannten entstanden war. 69 F. Sarre, op.cit. Der Bagh-i Tschischme ist 450 m lang und 130 m breit; nach Thomas Herbert, der ihn imJahre 1627 sah, stammten die Malereien von »John a Dutchman«; Sarres Tafeln 141, 142, 143 und 145 reproduzieren die Uberreste dieser Malereien; ein Foto, das ich von diesem Pavilion gemacht habe, zeigt die Situation des Jahres 1992. 70]. Hanway, op.cit. 7 1 P. della Valle, op.cit., f. 284: »Im ersten Torbau befindet sich ein ganz kleiner Garten, und an dem Weg, der von diesem zum grollen Garten mit dem Divan chane fuhrt, in dem ich empfangen wurde, fo lgt ein groIler Eingangsbau .. und ein Brunnen, der das Wasser sehr hoch wirft.« 72 Iskandar Bayg, op.cit., S.l1l1, gibt eine ahnliche Beschreibung.
216
73 Pietro della Valle, op.cit., f. 99 74 Diese unterschiedlichen Interpretationen erklaren sich damit, dall der private Teil des koniglichen Palastes mit verschiedenen Namen belegt werden konnte: haralll, alldanm und khalvat; Melgunow plaziert den Bagh-i Khalvat nordlich des Sahib-i Zaman; ein kleiner Hof trennte ihn vom Bagh-i Shumal; Holmes sieht den Bagh-i Khalvat dagegen sudlich des Sahib-i Zaman, von dem er allerdings zugibt, da[\ nichts von ihm ubriggeblieben sei, und er nennt den nord lichen Garten alldanlll; fur Wilber lag nordlich des Sahib-i Zaman der Bagh-i Haram, gefolgt vom Bagh-i Khalvat und vom Bagh-i Shumal; man kann also sagen, da[\ diese Rekonstruktionen im wesentlichen gleich lauteten und sich auf ein noch »Iesbares« rechteckiges Areal auf dem Territorium der Stadt bezogen. Eine andere Gruppe von Reisenden distanziert sich alle rdings von dieser Interpretation; fur diese Autoren lagen westlich dieses Areals noch weitere Elemente. Fraser liefert eine Version, die derjenigen von Mirza Ibrahim gleicht, wenn er sagt, dall nordlich des Sahib-i Zaman der haralll und westlich von dies em der khalvat lagen, vor dem er die Reste des Pflasters eines Audienzpavillons von Schah Abbas gesehen hatte. Sarre, der die Aufnahme von Morgan heranzieht, berichtet, dall der Hof ~ordlich des Sahib-i Zaman der haralll war, gefolgt vom BagJi-i Shumal; im Westen des izaralll fiigt er den Bagh-i Khalvat hinzu. Diese letztgenannten Versionen finden keine Bestatigung - weder in eventuellen Uberresten auf dem Plan der Stadt noch in der Aufnahme Morgans, auf der der Bereich des Bagh-i Khalvat sich jenseits der Umfassungsmauer des privaten Bereichs befinden mullte ; und schlielllich auch nicht in der Beschreibung des Pietro della Valle. 75 P. della Valle, op.cit., f. 95. 76 ]. Hanway, op.cit.: »Von hier fuhrte man uns in einen anderen Garten von mehr oder weniger dem gleichen Stil, in dem sich der Harem befand: hier trafen wir niemanden; im ubrigen war das das Appartement der Frauen .. . Davor lag ein gralles Wasserbekken und ein quadratischer Platz mit Marmorbanken an jeder Ecke; eine Sykomore von erstaunlicher Gro[\e, die sich in seiner Mitte erhob, beschattete ihn mit ihren weit ausladenden Asten. Auch Kaskaden waren da, ahnlich denjenigen in dem anderen Garten, von dem schon die Rede war. Von hier aus brachte man uns zum Pavilion der Bankette (der einem Neffen Allahs geweiht war) .« 77 X. Hommaire de Hell, op.cit. Ein Teil der Ruinen ist auf Tafel LXXX zu erkennen.
78 W. Ouseley, op.cit., Taf. LXXI. 79 F. Sarre, op.cit., Abb.147-150. 80 ]. Hanway, op.cil. 81 Andere Autoren sind der Meinung, dall es nicht mehr unter Schah Abbas, sondern erst unter seinem Nachfolger Safi vollendet wurde. 82 W. Ouseley, op.cil., Taf. LXXI und S. 274: »Von den vielen Gebauden, die dies en Hugel kronten, blieben nur ein Teil des Badehauses und ein Ende des Aquaduktes, uber den das Wasser einer beruhmten Quelle von den nahen Bergen kunstvoll in gro[\er Hohe gefiihrt wurde. Dieser Aquadukt geharte dem im Persischen als shllter gil III bezeichneten Typ an, was soviel heillt wie Kehle des Kamels; seine Reste erscheinen auf Tafel LXXII.« 83 W. R. Holmes, op.cit.: »Auf halber Hohe ... find en sich die Reste eines Bogenportals und einer Mauer, die sich uber eine Strecke von etwa zweihundert yards am Hugel hinzieht. Wir stiegen den Serpentinenpfad hinauf und erreichten nach Passieren zweier weiterer Zugange - der eine in einem in Ruinen liegenden Turm und der andere in einer etwa funfzehn Full hohen Mauer - eine quadratische Terrasse ... , 75 x 55 yards grail ... Der Pavillon steht in der Mitte; er millt 75 mal 51 Fu[\ und ist etwa 80 Full hoch ... Der Hauptraum im ErdgeschoE hat Kreuzform; mit den vier kleinen Raumen an den Ecken des Gebaudes ergibt sich ein Quadrat. Auf der Terrasse stehen hohe Zypressen und Orangenbaume ... Die Anlage wurde von Schah Abbas als Lusthaus genutzt.« 84 9 km siidostlich von Aschraf befinden sich die Reste eines kunstlichen Sees, des Istakhr-i Abbas abad, in dessen Mitte sich ein Pavilion erhebt. Andere Gebaude, darunter einige Turme und ein Badehaus, vervollstandigten einst den Komplex, der von Schah Abbas bewohnt wurde, wenn er in dieser Gegendjagte. Der See verdankte seine Entstehung clem Graben, den der Konig hatte anlegen lassen, urn grolle Anbauflachen bewassern zu konnen.
Der osmanische Garten im Spiegel der Landschaft des Bosporus Maurice Cerasi
Vom originalen osmanischen Garten wissen wir wenig oder nichts, es sei denn auf dem Weg tiber Reiseberichte und literarische Texte. Garten aus der Zeit vor dem 19. J ahrhundert haben sich nicht erhalten. Ein glaubwtirdiges Bild von Garten und HCifen, die wir noch als osmanisch bezeichnen konnen, liefern allein die detaillierteren Zeichnungen, wie sie seit dem Ende des 18. und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, sowie die eine oder andere alte Fotografie.
Gewill suggerieren die Miniaturen und Texte das Bild ummauerter Garten mit sich kreuzenden Wegen und einem Brunnen in der Mitte, eine Architektur also, die derjenigen der persischen Garten sehr ahnlich ist. Aber nichts gestattet uns zu glauben, daB es sich dabei nicht urn konventionelle Bilder handelt, so wie im allgemeinen ja auch die mongolisierenden Portraits und die gleichzeitigen Darstellungen von Moscheen und Hausern, die den osmanischen Bauten nur vage ahneln, konventionell und eben nicht realistisch sind.
Es ist sehr wahrscheinlich, daB der osmanische Garten del' Zeit vor dem 18. Jahrhundert den Garten der von den ttirkischen Stammen besiedelten oder durchquerten Regionen - den Garten Persiens, Zentralasiens sowie des armenischen und des byzantinischen Anatolien -verwandt war, aber wenn wir ehrlich sein wollen, mtissen wir zugeben, daB wir nicht in der Lage sind, Struktur und Erscheinungsbild des tiirkisch-osmanischen Gartens zu rekonstruieren, so wie wir nicht in der Lage sind, die byzantinischen Garten zuverlassig zu beschreiben.
Nach den wenig en verbliebenen HCifen und hangenden Garten zu urteilen, besteht der Reiz des osmanischen Gartens letzten Endes in der Spannung zwischen wenigen geometrischen Elementen und dem herausgestellten nattirlichen Material - den Baumen und dem stromenden Wasser, dessen Vorhandensein haufig ein unerlaBlicher Faktor ist, wenn es darum geht, einen art als potentiellen Garten oder als Statte der Rekreation zu identifizieren. In manchen Fallen sind wenige, aber signifikante Zutaten des persischen Gartens erhalten geblieben: eine regelmaBige Umfassung, wenige Pfade und Wege, die eine relative geometrische Spannung einftihren. Dagegen fehlen das komplexe System der Kaskaden und Wasserflachen, die Axialitat und der ausgesprochen geometrische Charakter des Mogul- wie des persischen Gartens. Der osmanische Garten hat nichts vom MaBstab, von der GroBartigkeit und geometrischen Konsequenz der anderen Garten im Bereich der gewachsenen islamischen Kultur. Seine Faszination und seine Botschaft liegen anderswo.
In den Fallen, tiber die wir einigermaBen gut unterrichtet sind, scheint der osmanische Garten, verstanden als ein aus def N atur oder dem Stadtgebiet sozusagen herausgeschnittener und von Pflanzen und Baumen gebildeter art, kein starkes architektonisches Eigenleben zu besitzen. In vieler Hinsicht ist dieser Garten in einem riesigen Gebiet, das von Venedig tiber Mazedonien und die griechischen Inseln bis zum Taurusgebirge reicht, durch eine gewisse Lust am Informellen oder, wenn man so will, einen gewissen Funktionalismus gekennzeichnet.
217
Wie in vielen abendlandischen und orientalischen Klostern prasentiert er sich quasi als ein hortu5, in dem Krauter, Blumen und fruchttragende Pflanzen in Beeten beisammenstehen, entsprechend del' Logik des Gartners, der eher an die Sonneneinstrahlung und die Bearbeitung der Beete denkt, als daB er sich von einem asthetischen Landschafts- oder Architekturverstandnis leiten lieBe. Der Garten ist das Produkt einer Art »funktionaler Nattirlichkeit«.
1m tibrigen zeichnen sich die offenen stadtischen Bereiche in dem hier interessierenden Gebiet selten durch prazise architektonische Formen aus. Eine Ausnahme bilden die groBen HCife der monumentalen religiosen Zentren, die eine geometrische, formale und typologische Folgerichtigkeit zur Schau stellen, wie sie im offenen Raum der osmanischen Stadt vollig fehlt, und eine Ausnahme bilden ferner die namzagah, eine Art gepflasterter Plattformen auf quadratischem oder rechteckigem GrundriB ftir das Gebet unter freiem Himmel, zu denen einige Stufen hinauffuhren - dies ist allerdings ein Typ, der nicht sehr verbreitet ist. Auch in den hangenden Garten des Topkapi-Palastes sind die offenen Bereiche in der Regel gepflastert: Es handelt sich also nicht urn Garten im eigentlichen Sinne. 1m halboffenen Hof des prachtigen Kiosks Osmans III. ist es die Architektur selbst, die den Raum definiert, unterstiitzt von der schlichten Marmorpflasterung. Die beiden sauber aus dem Marmor herausgeschnittenen Blumenparterres und ein Brunnen sind die einzigen Gestaltungselemente.
Die Grundelemente, die in anderen Kulturen das formale Gertist des Gartens bilden - Pflanzen und Wege - prasentieren sich im osmanischen Bereich mit einer bemerkenswerten formalen Uneindeutigkeit, mit einer unabhangigen und haufig nicht orthogonalen Geometrie und oft auf »malerische« oder »pittoreske« Weise, urn einen Ausdruck zu benutzen, der in der osmanischen Asthetik nichts verloren hat, aber haufig von westlichen Beobachtern verwendet wurde, die die Kompositionsprinzipien solcher Raume schlecht verstanden.
1m Binnenbereich der monumentalen Komplexe ist der offene Raum zwar geometrisch konfiguriert, aber wiederum nicht rigoros geschlossen; zahlreich sind die bffnungen nach auBen, und zahlreich sind auch die subtilen Modifikationen des geometrischen Schemas (z.B. leichte Verschiebungen gegentiber der Symmetrieachse) in der Absicht, sich dem natiirlichen Raum zu Ciffnen. Selbst die HCife der groBen im 15. Jahrhundert von Sinan errichteten Moscheen sowie des Topkapi-Palastes, die von einer Vielzahl von Gebauden rigoros, aber asymmetrisch umschlossen sind, werden von diagonalen Wegen durchquert. Dahinter steckt offensichtlich eher eine funktionale Logik (der Gedanke der Verbindung zwischen wichtigen Punkten) als irgendwelche formal en oder zeremoniellen Erwagungen. Wenn man allerdings die Paare von Zypressen oder die monumentalen platanen betrachtet, die hier wie zufallig stehen, dann wird man sich eben doch einer bemerkenswerten kontrapunktischen Wirkung gegentiber der gebauten Architektur bewuBt.
Osmanische Kopie nach Amir Khusraw Dilhavi, die in der Wiedergabe der LandschaJt byzantinische Einfliisse zeigt.
218
Wiirdentriiger in einem Garten (aus der Siileymaniye).
Belustigung und Tanz am Bosporus (aus dem Hiinernameh).
Wiirdentriiger in einem Garten (aus der Siileymaniye).
219
Ga·rten auf einer Karte der Aquiidukte von Ista/tbul, A1yang 18. Jahrhundert.
Wandbild des 18. Jahrhunderts in den Appartements der Sultanill Mihrisah im Topkapi-Palast, das einen imagilla·ren Garten mit der charakteristischen Anordllung der Beete zeigt.
Baumbestandener platz a'!J der agaischen Insel Kos (aus Comte de Choiseul-Gouffie1; Voyage pittoresque de la Grece, Band I, Paris 1782 und Band II, Paris 1809).
Die offenen Raume sind also nur im Binnenbereich der groiSen Komplexe formalisiert; ansonsten bewirken sie die freie Aufeinanderfolge monumentaler Elemente. Miissen wir daraus auf die Nichtformalitat des osmanischen Gartens schlieiSen? Oder sollten wir nicht vielmehr von einem architektonischen Spiel der Spannungen zwischen Bauten (Monumenten, dem durchgehenden stadtischen Ensemble, dem einen oder anderen Ausstattungsstiick) und natiirlichen Elementen sprechen?
Die Liebe zum flieiSenden Wasser ist zweifellos etwas, was der osmanische Garten mit den Garten aller iibrigen islamischen Kulturen teilt - sie wurzelt aber auch hier erkennbar in autochthonen Traditionen. Wir brauchen insoweit nur an die lokalen Gegebenheiten zu denken: Der Bosporus kann als ein groiSer FluiS betrachtet werden; seine Wasser sind standig in Bewegung, wobei es zwei Stromungen sind, die zwischen den beiden Meeren flieiSen; im Bereich der Deiche stehen Hauser und Kioske immer dort, wo Wasser flieiSt, selten in der
220
Nahe von stehendem Wasser. Was es hier aber nicht gibt, das ist eine Vision des Gartens als Wiedererschaffung der Natur, des Gartens als Oase, als paradiesischer Mikrokosmos, den doch anscheinend jeder islamische Garten suggerieren will. Wenn man diese ausgepragte Eigenart des osmanischen Raums nicht erfaiSt, kann man ihn nicht verstehen und nicht in die dichte und dabei so eigentiimliche Welt der osmanischen Kultur eindringen.
Wie erklaren sich diese Eigenarten? Sie haben einerseits geographische Griinde; sie wurzeln namlich in der spezifisch menschlichen (und mithin historischen) Geographie der zentralen Region, in der sich diese Kultur iiber lange Zeit entwickelt hat. Andererseits sind es Griinde der Mentalitat und einer Zivilisation, die von den zentralasiatischen Kulturen ebenso beeinfluiSt ist wie von der slawischen und der griechischen (sowohl hellenistischen als auch christlichen) Kultur. Die spezifische Auffassung von der Natur und ihrem Dialog mit der Architektur, die Formen der Ansiedlung, das langsame Wachsen der
Darstellung der Gi:irten des TopkapiPalastes von J.B. Hi/air. Festliche Prozession. Zeichnung von A.I. Melling.
Das Auiflugsgebiet Kagithane (nach Mouradja d'Ohsson, Tableau de l'Empire Othoman, Paris, 18. Jahrhunderlj.
Traditionen und Gewerbe einer Stadt, die Herz, Him und Vorbild des ganzen Reiches ist - wir werden diese Dinge genau betrachten mussen, urn den naturlichen Raum, das »Grun« oder die Garten (die Begriffe sind nicht wichtig und ohnehin irrefuhrend) dieser Stadtkultur zu verstehen.
Die Betrachtung der Natur Auch wenn der osmanische Garten der Fruhzeit und der klassischen Periode (des 15. und 16. Jahrhunderts) in keinem einzigen Beispiel uberlebt hat, so ist doch das, was sich vom osmanischen Verstandnis von Raum und Umgebung, von der Vision der Natur und vom Verhaltnis zwischen Stadt und Natur erhalten hat, hachst interessant und eindrucksvoll.
Nach dem 17. Jahrhundert fand das kulturelle Bedurfnis, das mit dem Formmittel des Gartens befriedigt wird, bei den Osmanen eine vom Gartenverstandnis anderer Kulturen abweichende Lasung. Zugespitzt kannten wir sagen, dag es den osmanischen Garten uberhaupt nicht gibt. Auch wenn wir uns zu diesem Paradoxon nicht versteigen wollen, ist es doch legitim zu denken, dag der Osmane kaum jemals einen Garten erfindet oder erschafft. Viel haufiger tut er etwas anderes - er entnimmt sozusagen der Natur und seiner Umgebungjene Elemente (Sichtachsen, Pflanzen, Ansichten, Raumeinheiten), die den gleichen asthetischen und funktionalen Bedurfnissen entsprechen, die auch die eher »formalen« Garten offensichtlich befriedigen wollen.
Ein Garten ist ein transformiertes Stuck Natur oder ein transformierter offener Raum, der es gestattet, sich in die Elemente der N atur _ Pflanzen, Licht, Himmel, Sonne - zu versenken. Dieses Geniegen und Kontemplieren erfolgt in aller Regel eingebunden in kunstliche Formen und Sichtbahnen. Nicht so - oder nur selten so - bei den Osmanen, deren Naturbetrachtung die Form des Hineingehens, des Sicheinfugens in diese Elemente annimmt.
Die »Bestandteile« der Natur, die Pflanzen, das fliegende Wasser, das Spiel von Licht und Schatten werden jedes fur sich und in seiner Art wahrgenommen, innerhalb eines Raums, der sie enthalt, nicht aber in eine einheitliche und organische geometrische Ordnung bringt. Die Natur wird erfahren und genossen, ohne dag ihre Teile beherrscht und transformiert wurden: Jeder Eingriff - sei es zu Zwecken der Urbanisierung oder der Gestaltung eines offenen Raums - bedeutet das fraglose Akzeptieren der praexistenten Formen. Die architektonische Magnahme gerat fast immer zum Kommentar uber diese Formen, zu einer Art von Unterstreichen. Die Transformation des natiirlichen Ortes geschieht leise, das Ergebnis bleibt bescheiden. Eben deshalb ist es oft schwierig, den »Garten« vom einstigen Rasen oder bestellten Feld zu unterscheiden. In vielen Fallen wird eine Wiese, vor allem, wenn sie affentlich genutzt werden soll, allein dadurch transformiert, dag ein Pavillon an der richtigen Stelle errichtet und der Wasserlauf gefagt wird, der sie vonjeher durchquert hat.
221
Die physische und die kulturelle Geographie Vielleicht lag es an der Uppigkeit der anatolisch-balkanischen Landschaft, vielleicht auch daran, daE das animistische Denken weder bei den Eroberern noch bei der alteingesessenen Bevolkerung (nach d'Ohsson wurden die Garten von Istanbul vorwiegend von Inselgriechen betreut) vollig verschwunden war, daE Baum, FluE und Quelle nicht »Kreaturen« waren, die sich leicht dem gottlichen Willen oder dem ahnlich machtvollen architektonischen Willen hatten unterwerfen lassen. Vielmehr waren es Faktoren, die untereinander und mit der »Schopfung« des Menschen in Dialog traten. Wir sind hier weit entfernt von der Bedeutung, die von den Fachleuten haufig dem Garten des arabisch-persischen Kulturkreises beigelegt wird: Der Garten als Wiedererschaffung der Natur, der von seiner Umgebung (der Wiiste) isolierte griine Bereich als Rekonstruktion von Eden.
Mit dem Riickgriff auf die Geometrie, mit den Kompositionen, die sich iiber groEe Raume und groEe Entfernungen erstrecken, geht haufig so etwas wie eine Aposiopesis, ein Abbrechen der Rede, ein erschrockenes Verstummen einher: Irgendein Element unterbricht die groEe geometrische Affirmation und lenkt die Gedanken auf ein kom-
222
plexes ideologisch-asthetisches Moment, das vielleicht mit dem Kult der N atur und dem heiligen Erschrecken vor ihrer Profanierung zu tun hat - mit Gefiihlen, die im balkanisch-anatolischen Raum tiefverwurzelt sind. Ich habe an anderer Stelle ausfiihrlich auf die besondere Bedeutung hingewiesen, die das Bauen und die Stadt in den Riten und der Mentalitat dieser Weltgegend angenommen haben, die die hellenistischen Naturkulte (denken wir an die Nymphaen, an die heiligen Baume in den temenoi), den schamanischen Animismus und den Buddhismus der vorislamischen Turkstamme, die Glaubenswahrheiten der siidslawischen Bevolkerungsgruppen und die neoromanischen Kulte in Folge erlebt hat. Hier will ich mich auf die Hypothese einer Naturauffassung beschranken, die von deJjenigen der mediterranen und arianischen Volker (der Perser und Inder) abweicht.
Die Osmanen (Muslime wie Christen) konnten, verglichen mit den Byzantinern und den Seldschuken, auf ein groEes Wissen zuriickgreifen, wenn es darum ging, sich ein natiirliches Terrain ohne Anwendung orthogonaler und geometrischer Schemata zunutze zu machen, urn einen zwar nicht axialen, aber psychologisch raffinierten perspektivischen Raum zu erschaffen, wie er in Anatolien seit den Tagen der
Der namazgah, eine Statte des Gebets (Stich des 19. Jahrhunderts von V. Raineri nach dem Original von Mouradja d'Ohsson, Tableau de l'Empire Othoman, Paris, 18.Jahrhundert).
Hethiter und der vorgriechischen (vor allem der lydischen und phrygischen) Kulturen prasent war und sich mit der hellenistischen Urbanistik traf, wo diese sich, wie in Pergamon und Assos, vom hippodamaischen System befreite.
Auch ist, einerseits in N ordanatolien und im georgischen Kaukasus, andererseits in Albanien und Mazedonien, eine offene Anordnung der landlichen Siedlungen zu beobachten, die dann von den Stadten tibernommen wird (parzellierte Flachen fur Haus-Garten-Einheiten; im Abstand voneinander verlaufende isometrische Reihen von Parzellen entlang den gleichen Hohenlinien) . Das kulturelle und politische Barizentrum des Osmanenreiches mit Konstantinopel, Bursa, Saloniki, Adrianopel und dem Berg Athos war weit entfernt von den Gebieten des mediterranen und armenischen Klassizismus und von den tiirkisch-seldschukischen und persischen Regionen und nahm Anleihen bei labileren Gruppen und Siedlungsformen auf, die an den gr08en Stadtkulturen des Mittelmeerraumes und Asiens kaum einen Anteil hatten. Der kleine osmanische Staat, als letzter nach den Seldschukenreichen entstanden, entwickelte sich im uppigen anatolischen Nordwesten, in einem die gesamte osmanische Kultur pragenden geographischen und landschaftlichen Kontext, der nicht mit den Steppen, Wtisten und Hochebenen der anderen islamischen Gesellschaften zu vergleichen war und sich auch von der Landschaft und Geographie Andalusiens unterschied. Vom Berg Athos bis zum slawischen Mazedonien, von Istanbul bis Bursa waren es die gleichen Elemente einer »kulturellen Geographie « - die gleichen ehrwurdigen Platanen, die gleichen Altane und Portiken, die gleiche Introvertiertheit und, wenn man so will, die gleiche teils islamisch, teils von alteren Kulturen und Traditionen gepragte Spiritualitat - eine Spiritualitat ubrigens, die sich merkwtirdigerweise an eher hedonistischen Elementen und Orten au8erte -, die das Verhaltnis zur Umgebung und das Verstandnis der Umgebung pragten.
Was an der Architektur dieser Gegend am starks ten ins Auge falIt, ist ihre Verbundenheit mit Erde-Luft-Meer. Vom westlichen Schwarzen Meer bis Istanbul, am Marmarameer und in Bursa, an der mazedonischen Ktiste, am Berg Athos, in Saloniki und im Tal von Vardar -uberall herrscht das gleiche Licht, tiberall erstreckt sich eine ahnliche grtine Hugellandschaft, und tiberall spurt man, da8 das Meer nicht sehr fern ist. Diese Atmosphare hat eine am Panorama, am Wasser und an der Orographie orientierte offene urbane Form hervorgebracht, eher eine deutliche Streuung der Gebaude als etwa eine formale Integration mit geometrischen Perspektiven und Profilen.
Unabhangig davon, ob es sich bei den Gebauden urn Hauser oder urn religiose Monumente handdt, ergibt sich im Verhaltnis zum natiirlichen Raum, also in der Bezogenheit auf au8erarchitektonische Elemente, sowohl Regelma8igkeit als auch Unregelma8igkeit - Regelma8igkeit insofern, als die Architektur Bezug auf das Panorama nimmt oder eine orographische Form betont; Unregelma8igkeit insofern, als
223
das Ensemble durch die betont episodischen Kompositionen eine bffnung erfahrt. In diesem Zusammenhang sei an die Wandbilder mit den imaginaren Landschaften oder den imaginaren Ansichten von Istanbul erinnert, die viele H auser und Palaste des 18. Jahrhunderts schmuckten: J enseits der Imitation der westlichen Landschaftsmalerei und der hier und da erkennbaren hellenistischen und pompejanischen Reminiszenzen scheint die Ikonographie selbst wichtig - das Insistieren einerseits auf halburbanen Raumen - auf Moscheen, Hausern und Villen, die durchaus stadtisch, aber in eine deutlich artikulierte natiirliche Landschaft gesetzt sind (das Meer wird immer zu einer Assemblage aus Bosporussen und Goldenen Hornern) - und auf Stadte, die als Montagen urbaner Elemente erscheinen, in die ganze Abschnitte der natiirlichen Landschaft einbezogen sind. Fur den Einwohner der osmanischen Stadt scheint es kein Gltick zu geben ohne die Betrachtung eines Stiicks Natur, das kein kunstlicher Garten ersetzen kann. Die osmanische Stadt ist also nicht zufallig und nicht allein aufgrund des Zeitgeschmacks eine offene Stadt ohne feste Grenze zum landlichen Umfeld. Sie ist es auch aufgrund von Faktoren, die letztlich historischer und geographischer Art sind: Hier kommt vielen Elementen (wie den Friedhofen und den Gruppen von Grabmalern, regelrechten Totenstadten, sowie den gr08en offenen Flachen der Wiesen und Garten), die in den ummauerten Stadten des Orients und des Okzidents fehlen oder keine gro8e Rolle spiden, ein erhebliches Gewicht zu, weil sie einerseits die Fortsetzung eines nattirlichen Erscheinungsbildes sind und andererseits die einzigen offenen Raume von einer gewissen Bedeutung darstellen. Dberdies erlebt diese Stadt, die ja keine ummauerte Stadt ist (die noch existierenden Mauern sind byzantinischen oder seldschukischen Ursprungs und haben in der Regel ihre Funktion eingebti8t), eine spontane, zentrifugale und von landlichen Flachen unterbrochene Suburbanisierung, eine Entwicklung, die sicherlich von gro8erer Relevanz ist als das im persischen Raum beobachtete sporadische Auf tau chen au8erstadtischer Garten. Auf diese Weise, aber nicht nur auf diese Weise, wird die Struktur des Stadtganzen urn nattirliche Abschnitte bereichert. Der offene Raum, soweit es sich nicht urn den Hof irgendeines monumentalen Komplexes handelt, hat keine Form, weil er Natur ist und weil eben die Stadt in ihrer Gesamtheit als offener Raum aufgefa8t wird, dessen struktureller Sinn in seiner Plazierung in der Natur liegt.
Die osmanische Stadt vermittelt den Eindruck der »offenen« Form, wenn sie in ihrer Kontinuitat mit dem Ort und mit der Natur gesehen wird. Sie scheint nur dann keine Form zu haben, wenn man eine in sich vollstandige und sich selbst genugende Konzeption von Form auf sie anwendet. So gesehen zeichnet die osmanische Kultur sich eher durch asiatische als durch mittelorientalische Elemente aus und ist von der Raumvorstellung des mediterranen Europa weiter entfernt als die arabische und die persische Architektur.
Osmanisches Begriibnis (aus Mouradja d'Ohsson, Tableau de I'Empire Othoman, Paris, 18. Jahrhundert).
Die Gesellschcift und ihr hedonistisches Verhiiltnis zur Umgebung Ohne eine strukturierte Aristokratie und ein solides Handelsbiirgertum spiegelt die Gesellschaft der osmanischen Stadt, auch wenn sie nicht die klassenlose Gesellschaft ist, von der eine gewisse mythisierende Literatur spricht, die Instabilitat der Akkumulation, die Unsicherheit der Individuen und Familien angesichts einer absoluten staatlichen Macht. Die zahlenmaEig recht starken gehobenen oder reichen Schichten begegnen dieser Instabilitat in der Weise, da~ sie ihr Engagement reduzieren und sich verstarkt dem Genu~ des Lebens hingeben. Sie bauen sich Hauser, die es an Gro~e und Qualitat zwar nicht mit den aristokratischen Wohnsitzen des Abendlandes aufnehmen konnen, aber doch unvergleichlich viel raffinierter - und zugleich verganglicher - sind als diejenigen anderer islamischer Gesellschaften und der einheimischen biirokratischen und militarischen Fiihrungsschicht der Zeit vor dem 17. J ahrhundert.
Die auf ewig von der Krise affizierten unteren und mittleren Schich-
224
ten (die Ladenbesitzer und Handwerker, die niedrigen und mittleren Range der Janitscharen, die einfachen Mitglieder des Klerus etc.) reagieren ihrerseits mit einem religios hinterfutterten Obskurantismus. Die Unruhen der Str~e sorgen immer wieder dafiir, da~ die herrschenden Schichten ihre abendlandischen Lebensformen und ihren Reichtum verbergen miissen, und zwingen die Biirokratie, in ihren Reformbestrebungen zuriickzustecken. Allerdings - das Verhaltnis zur Umgebung ist sowohl bei den herrschenden Schichten als auch im Volk ein hedonistisches, und das wird sich niemals verlieren.
Diese Widerspriiche fiihren einerseits zur Schaffung gro~er offener Raume, die jedermann zuganglich sind und eine erstaunliche Vermischung del' verschiedenen Schichten del' Bevolkerung erleben, andererseits zur anhaltenden Tendenz, die reicheren Hauser den Blicken der Menge zu entziehen und weniger augenfallig zu machen. Die einzigen relativ gro~en Wohnhauser, die im 18. und 19. Jahrhundert in Istanbul gebaut werden, die sogenannten yali, liegen weit entfernt von den zentralen Platzen, vielleicht weil ihre Bewohner dem unmittelbaren Kontakt mit der Plebs und deren standigen Unruhen aus dem Weg gehen wollen. Gro~e den Wohnhausern angeschlossene formale Parks waren VOl' dem 19. Jahrhundert nicht nur undenkbar, sondern, wie wir noch sehen werden, auch praktisch nicht moglich. Abel' - und hier haben wir wiederum einen Widerspruch im Widerspruch - die herrschaftlichen Wohnhauser waren zu keiner Zeit vollstandig hinter hohen Mauern verborgen. Sie waren sehr wohl sichtbar und machten den Bosporus zu jener kiinstlich-natiirlichen Landschaft, die uns so fasziniert. Das offentliche Leben unterlag in del' Zeit yom 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gro~en Schwankungen; die praktizierte Lebensfreude wechselte ab mit religioser Strenge. Manchmal berichten die Chronisten, da~ die Orte der offentlichen Belustigung kaum besucht werden, da~ nur die Manner sich auf dem Markt treffen und die Stra~en abends wie ausgestorben seien, dann wieder schildern sie das offentliche Leben unter freiem Himmel als uberschaumend und vielfaltig.
Del' Gebrauch, den die Osmanen von ihren offenen Raumen machten, war im wesentlichen statisch und kontemplativ (man wahlte sich einen Ort - eine Sitzbank, ein Stiick Wiese) und zugleich sehr variiert (hier sa~, sang, a~ man, und hier erholte man sich). Die Familie oder Gruppe, eine ideale und uniiberschreitbare Runde, bildete eine fixe und anonyme Prasenz im Raum (wobei die Fixitat sich in der Kutsche oder im Boot in Bewegung ubersetzte) und unterhielt keine Beziehungen zu anderen Grupp en. Die Langsamkeit der Bewegungen, die »Se~haftigkeit« des Gemeinschaftslebens, die Gemessenheit, die Ruhe, die Freude an der Stille - all das beeinflu~te wiederum das Raumerie ben nachhaltig. Del' Spaziergang nahm den Charakter eines Landausflugs an; ganze Familien und Freundesgruppen nahmen einen bestimmten Ort stunden-, manchmal auch tagelang in Beschlag und errichteten hier ihre Zelte. Aus diesem Grunde wuchs die Zahl der
Mausoleum und sebil aus der klassischen Periode in der Unifassungsmauer des Komplexes der Hagia Sofia in Istanbul.
Stadtische Strafle mit FriedhoJsgarten in Eyup, Istanbul.
225
Monumel1tale Grabbauten und der FriedhoJshugel von Eyup.
Blick V01l1 asiatischen Ufer des Bosporus atif die Stadt Istanbul und die TopkapiSpitze (aus Comte de Choiseul-Go tiffier, Voyage pittoresque de la Grece, Balld 1, Paris 1782 und Band II, Paris 1809).
Spazierwege und offentlichen Rasen£lachen stark an. Fast immer handelte es sich dabei urn nattirliche Wiesen an den Ufern des Goldenen Horns und des Bosporus und auf den umliegenden Hiigeln. Bereits im 16.Jahrhundert schiittete man den Hafen von Dolmabahc;:e zu, urn hier einen grogen Garten anzulegen, und Pietro della Valle sah im Jahre 1614 zahlreiche Garten und Kioske am Bosporus. Evliya Celebi, ein osmanischer Reisender und Chronist des 17. J ahrhunderts, berichtet von Dutzenden von Spazierwegen augerhalb der Mauern von Istanbul, die von allen sozialen Schichten frequentiert wurden. Diese Wiesen und Spazierwege, mesire genannt, entstanden dadurch, dag man sich die N atur, den Ort mit seinen Wiesen, seinen Wassern, seinem Panorama sozusagen zu eigen machte. Nur selten wurde der Ort kiinstlich erschaffen, mit kostspieligen Umgestaltungen, wie im Fall des Dolmabahc;:e, was soviel bedeutet wie »aufgefiillter Garten«. Auch in der Nutzung traten Anderungen ein: Der Adel machte sich einen Ort zu eigen und iiberlieE ihn dann dem einfachen Volk. Die wichtigsten Parks und mesire, die dem Sultan und anderen Mitgliedern des Hofs gehorten, waren an bestimmten Wochentagen fiir das Publikum geoff net.
Die Funktionen und die Beziehungen zum Umfeld, wie sie anderswo den Garten definieren, sind hier auf die vielfaltigen Strukturen der Stadt verteilt. Die stadtische Strage »nimmt sich« Baume und Garten, urn sie als Leitlinien zu den Monumenten miteinander zu verknupfen, aber wiederum ohne formalen Zwang oder geometrische Eindeutigkeit. Der Weg »erzahlt« die Folge der Gebaude und der Raume wie bei einem Rosenkranz, ohne sie irgend zu konditionieren und ohne von ihnen konditioniert zu werden. Die Baume, manchmal riesige Exemplare, fiigen sich in die Stragen und in die kleinen und grogen Friedhofe ein. Die formalen Garten sind eklektisch und haben im Genug der Natur und des offenen Raums eine zweitrangige Rolle
226
Paliiste am Bosporus (aus Mouradja d'Ohssol'l, Tableau de l'Empire Othoman, Paris, 18. Jahrhulldert) .
inne. Ein gepflastertes Hofchen kann die gleiche Empfindung gegeniiber dem nattirlichen Raum zum Ausdruck bringen wie ein mit Rosen und Zypressen bestellter Garten, denn die bffnung auf die Landschaft ist in beiden die gleiche. Fast jeder imaret (Komplex von Gemeinschaftsgebauden innerhalb der religiosen Stiftungen) besitzt Hofe und kleine Friedhofe, die wie Garten gehalten werden.
Im Grunde ist der Bosporus mit seinen Waldchen und seiner Uferbebauung eine einheitliche Landschaft: mehr als eine Garten-Stadt, ein Park, ein riesiger Garten, der den eindeutigen Stempel einer Kultur tragt. Dag Garten und stadtischer Raum nicht voneinander zu unterscheiden sind, ist eine zugleich psychologische, funktionalistische und stilistische Folge dieser Mentalitat.
Wer hier herkommt, urn einen »osmanischen Garten« zu sehen, mug seine Optik andern. Er mug bereit sein, innerhalb jener besonderen Konstruktion, die einst die osmanische Stadt war, eher so etwas wie »Garten-Momente« zu sehen, und zwar die Spazierwege oder mesire, den Bosporus in seiner Gesamtheit sowie die kleinen baumbestandenen Bereiche im urbanen Kontinuum und dazu, sozusagen diesen drei Elementen beigegeben, den einen oder anderen Hof, den wir mit einem traditionellen Ausdruck auch als Garten bezeichnen konnen.
Die EntUJicklung der Stadt und der Bosporus Die Wasserversorgung spielte eine groge Rolle bei der Entwicklung der Stadt und ihrer Garten. Im 18. Jahrhundert wurden der Bosporus und das Goldene Horn in die organische Struktur der Stadt integriert: Istanbul dehnte sich mit einer neuen Infrastruktur in Richtung des Bosporus aus. Dag der Grogwesir Ibrahim Pasa mit dem von ihm befohlenen Bau eines Aquadukts die Absicht verb and, die Zone von
Uskudar zu erschlieiSen, ist wohl eindeutig. Ahnlichen Zwecken dienten auch die neuen Aquadukte auf der europaischen Seite mit ihren Abzweigungen zum Bosporus. Ein Funftel der im 18. Jahrhundert angelegten Brunnen befindet sich am Bosporus.
Bis zum 18. Jahrhundert waren die wenn auch schon zahlreichen Ansiedlungen auiSerhalb der Mauern sozusagen nur Fortsatze und als soIehe noch nicht in das stadtische Leben integriert. 1m 18.Jahrhundert war diese Bebauung zwar noch immer nicht dicht, und die Entfernungen von Haus zu Haus oder von Siedlung zu Siedlung waren noch immer betrachtlich, aber jetzt nahm die enge Nachbarschaft mit der Natur eine Form an, aus der sich schlieiSlich das Siedlungsbild entwickelte, das man auch als die »Kultur des Bosporus« bezeichnet hat. Die noch ganz aristokratischen Vororte hatten sich mit den an den Ufern errichteten und durch Walder voneinander getrennten yali bereits eine eigene Raumsprache und ubrigens auch ein eigenes Transportsystem mit Tausenden von Booten geschaffen, die die einzelnen Siedlungskerne miteinander verbanden. (Am Ende des 17. Jahrhunderts zahlte man rund 1500 Boote, am Ende des 18. Jahrhunderts waren es 4000; die Tatigkeit der Bootsfuhrer und die Preise, die sie verlangten, wurden von der Obrigkeit kontrolliert.)
Eine Ahnung von den besonderen Zusammenhangen zwischen den offentlichen Spazierwegen, der Vorstellung von der Natur und der Konzeption der Stadt gewinnen wir auch, wenn wir uns mit der paramilitarischen Einrichtung der bostanci (wortlich soviel wie »Gartner«) befassen. Die bostanci waren ursprunglich fur die kaiserlichen Garten und fur die Instandhaltung der mesire verantwortlich und hatten die offentliche Ordnung an diesen Orten aufrechtzuerhalten. 1m Laufe der Zeit dehnten sie diese Verantwortung auf alle offentlichen Orte aus und ubernahmen auch die Bauaufsicht am Bosporus, insgesamt also ein Aufgabengebiet, das besonders interessant ist, weil es darauf hinweist, daiS dem offenen Raum der Stadt als einer kontinuierlichen Erscheinung innerhalb wie auiSerhalb der Stadtgrenzen eine eigene Stellung und besondere Bedeutung zukam. Dahinter steht eine neue Sicht der stadtischen Ansiedlung, die in die Landschaft des Meeres und der Hugel eindringt und ihrerseits von dieser Landschaft durchdrungen wird.
Schon im 17. J ahrhundert entstand im Waldgebiet von Belgrad, zwanzig Kilometer nordlich von Istanbul, ein aristokratisches Erholungsgebiet mit Spazierwegen, Landhausern, Kiosken und Zelten in jeder Bucht, und die beruhmte »Kagithane«, das Gebiet der »SuiSen Wasser Europas« mit seinen Hunderten von Bottegen, Stallungen und Kiosken des Sultans und der hofischen Gesellschaft zog Zehntausende von Spaziergangern an. 1m Sommer errichteten die reichen Leute hier Zelte, und das einfache Volk kam in Scharen und erfreute sich an Spektakel und Feuerwerk. 1m Jahre 1721 lieiS der Sultan eine Moschee, einen Kiosk mit marmornen Saulen und einen zwei Kilometer langen Zierkanal bauen. Die wohlhabende Bevolkerung wurde aufge-
Der Bosporus atif einer Karte vain Anfang des 20.Jahrhunderts.
fordert, PavilIons zu errichten, und in der Umgebung entstanden sechzig Kioske fiir die Mitglieder des Hofs. Dieses ephemere und naturalistische Versailles mit dem N amen Saadabad (Ort der Gliickseligkeit) war der Allgemeinheit zuganglich. N eun Jahre spater allerdings endete eine durch den Zorn des Volkes angesichts der reformerischen und »okzidentalisierenden« Politik des Sultans und der aufwendigen Lebensfiihrung des kaiserlichen Hofs ausgeloste Welle der religiosen Strenge in einer Erhebung, in deren VerlaufSaadabad zerstort wurde.
1m spateren 18. Jahrhundert entstand ein zweites Saadabad. Der inzwischen sehr starke westliche Ein£lu£ war an dieser neuen Landschaft nur als eine unter vielen Komponenten beteiligt. Zusammen mit dem persischen Garten der Safawidenzeit schiirte er zweifellos die Freude am Gegensatz zwischen gro£en Wasserspiegeln und Rasen£lachen und gab die Anregung zu dem sehr leichten Baudekor und in gewissem Umfang auch zu des sen Formen sowie zum Arabeskenrelief der marmornen Bassins und Wassertreppen. Dagegen verraten die stark vorkragenden Holzdacher, die zierlichen Briicken, die maandernden Wasserlaufe, gewisse Details der Pavillons und die gegeniiber den persischen und franzosischen Garten verhaltenere Axialitat den chinesischen Ein£lu£, der in der Kunst der Osmanen keine neue Erscheinung war. Auch in dieser Version von Saadabad war die Bep£lanzung noch nicht durchweg formalisiert: Das Band der Wege und die in Reihen stehenden Orangenbaume waren nur Beigaben zur gro£en Masse des weiterhin frei wachsenden Baumbestandes. Dieser gro£e offene Raum bewies eine Pragnanz und eine Qualitat, wie sie in der osmanischen Stadt sonst nicht anzutreffen waren. Eine wunderbare Leichtigkeit kennzeichnete das Verhaltnis zwischen den gebauten Elementen und der teils transformierten, teils belassenen Natur. Insgesamt handelte es sich urn eine nur am Rande architektonisch definierte, kaum aus dem natiirlichen Umfeld herausgehobene und eher suggerierte als tatsachlich gestaltete Raumlichkeit.
228
Von den franzosischen Parks war hier allein die Tendenz zur organischen Anlage des Ganzen und zur Einheitlichkeit der gro£en Flachen iibernommen worden, wahrend das Monumentale und Reprasentative, die Perspektive als Vermittlerin zwischen den raumlichen und den baulichen Elementen und die Rotation der Sichtachse urn den Drehpunkt etwa eines Obelisken oder einer Statue vollig fehlten. Nicht nur offneten sich die Kioske und ksar nach au£en; der Au£enraum selbst erwarb eben durch die Leichtigkeit und Offenheit der gebauten Elemente eine prazise Qualitat.
Der schon erwahnte asiatisch-chinesisierende Ein£lu£, wie er sich in den weit vorkragenden Dachern, den scheinbar zufallig plazierten Briickchen, den gewundenen Wasserlaufen und vor allem in den allzu komplizierten oder unsorgfaltigen axialen Kompositionen zeigte, wurde als pittoresk bezeichnet, war aber etwas sehr anderes: Hier tauchten, parallel zum Verklingen des Klassizismus und dem damit einhergehenden Desinteresse gegeniiber den rigoroseren und rationaleren Aspekten sowohl der persischen Tradition als auch der neuen franzosischen Ein£liisse, die zentralasiatischen Wurzeln der tiirkischen Kultur wieder auf.
Die QuelIe des fremden Ein£lusses war haufig eine imaginare, was nicht bedeutet, da£ sie nicht real war. Sie war aber vor allem instrumental: Sie diente sozusagen als wohlklingende Referenz oder auch als Anreiz fiir etwas Neues, wenn dabei auch den typologischen Hintergriinden oder der historischen Wahrheit kaum Aufmerksamkeit zuteil wurde. Ungeachtet alIer Anleihen blieb der osmanische Blickwinkel gewahrt. J a, vielleicht klarten und verstarkten diese von den eigenen Urspriingen abgelosten und auf das rein formensprachliche Material reduzierten Entlehnungen sogar noch den ideologischen Hintergrund der osmanischen Sichtweise.
So erfuhren Axialitat und Symmetrie, die doch, von Persien, dem Abendland und dem Mogulreich suggeriert, durchaus existierten, eine
1
:1 1
l.
r
1
1
1
r
t
1
1
r
1
t
1
1
Der Palast der Sultanin Ratice am Bosporus in cler Wieclergabe clurch A. I. Melling.
subtile Schwachung und Deformation (weiter unten spreche ich von der »verschobenen« Axialitat). Der lichte und leichte Charakter der Formen war mehr als suggeriert, er war »autorisiert« vom abendlandis chen Rokoko, wobei dessen monumentale Schemata allerdings ignoriert wurden. Vielmehr ging die neue Formensprache eine Verb indung mit den Prinzipien der Serialitat durch Aneinanderreihung und des nichtgeometrischen »Naturalismus« ein. Das Ergebnis war jene auEergewohnliche und im europaischen Rokoko undenkbare Kombination aus grazioser Architektur, nur andeutungsweise regulierten offenen Bereichen und einer quasi jungfraulichen N atur.
In der Gartenkunst, die vor all em unter anbautechnischen Vorzeichen betrachtet wurde (die Osmanen waren bis zum 17. J ahrhundert geschickte Gartner gewesen; die alten Frauen kannten sich in der Kunst des Propfens und Veredelns - und iibrigens auch in der des Impfens - aus; es gab verschiedene Traktate iiber das Gartnern, in denen es urn Fragen von Zucht und Anbau, niemals aber urn Entwurf und Form ging), wandte sich das Interesse am Ende des 18. Jahrhunderts den neuen abendlandischen Techniken zu. Man holte sich europaische Gartner, die nicht nur neue Praktiken und neue Pflanzen, sondern auch ihren jeweils eigenen Stil mitbrachten. 1m Jahre 1835 waren die kaiserlichen Garten von Beylerbeyi in der Obhut franzosischer, italienischer, deutscher und sogar russischer und spanischer Gartner, und j eder von diesen legte einen Garten nach der Mode seines Heimatlandes an.
Eine gewisse in der Tulpenara zu beobachtende planimetrische Axialitat der Anlage, ein - allerdings sehr relatives - Interesse an perspektivischen Sequenzen, eine gewisse Entsprechung zwischen den Konturen des Gartens und der Gliederung der Binnenareale sprechen dafiir, daE die Architekten sich eher an den Schilderungen der Reisenden von den Villen und Parks des Abendlandes orientierten als daE sie die Vorbilder etwa selbst in Augenschein genommen hatten. Ein Vergleich der mesire des 18. Jahrhunderts mit dem axialen Schema der franzosischen Parks, an denen die ersteren sich nach Aussage ihrer Schopfer und Auftraggeber orientierten, macht deutlich, was die Osmanen vom Ausland iibernahmen, was davon authentisch war und was sie andererseits auEer acht lieEen oder der eigenen Sicht der Dinge so gut anverwandelten, daE es seine urspriingliche Bedeutung restlos einbiiEte.
Deryali
1m my this chen und nostalgischen Gedankengut der osmanischen Gesellschaft gab es eine Stadt, die aIle anderen Stadte in sich schloE und zur Verkorperung der Idee der Urbanitat wurde: Istanbul. Sie ist die Stadt der materiellen Gliickseligkeit: Sa'd-iabad. Wahrend die alten islamischen Stadte Anatoliens - und in einem gewissen Umfang auch die kleinen Zentren auf dem Balkan - sich in ihrer strengen spirituellen Welt verkapselten, trafen hier muslimische und christliche Kiinst-
229
Der yali des Riiseyll Pasa Ilordlich vall Alladolu Risari, 1699.
1 1 1 1
: ! : i~ ____ ____________________________ _
_- I
i 1 t I 1
Typologie des kosk in seiner klassischen Form als Jreistehender Pavillon.
!,l 1-1 ii ii I !! 'i i iI
f- -I-+!-'---r----++-d . II
!I \.\ ,-I i J,-I I
!.'::=~·-""·1-:·:::=~:· y. .. ··T If . i
IiIP~·····'-<~ i! l /e I "' .. ! I
/' I '\1 : i I ''I' ~- -.--:---- t-TI
\ ,; ~ \ .: ,
" ... I " -.. -._. -_.-" ... , . __ J
__ ~ ______ J , !-----------
-e· . a
h 9
ler und Baumeister aus dem ganzen Reich zusammen und beeinfluf!,ten sich gegenseitig, urn zur Gluckseligkeit des Alltags und zur Schonheit des urbanen Lebens in einer prachtigen, aber nicht uber
schaumenden Natur beizutragen. Istanbul ist das verwirklichte Modell der osmanischen Stadt. Die Vor
stellung von der osmanischen Stadt ist immer die - idealisierte oder wahrheitsgetreue - Vorstellung von Istanbul. J edes wohlhabende Haus in der Provinz besitzt Bilder oder zumindest ein Bild von Istanbul. Ganze Teile der Stadt des 18. Jahrhunderts kunden von einem kultu-
~.::;:: ... ~.: •. , <> ':. 0 :· .:.:. ~; ,
~ . ~ ... - ..... . ~ -.. ~ .
. .. -.~~ . -
" i
rellen Vermachtnis, das eine Vorstellung oder potentielle Form von Stadt hat entstehen lassen, der ein platz im universalen Museum der Stadtbaukunst gebuhrt. Zu ihnen zahlt die Ansiedlung am Bosporus.
Welches sind die konstituierenden Elemente dieser Garten-Stadt?
230
Mit Sicherheit die N atur und die Idee der Einfugung - der Moglichkeit der Einfugung - in diese Natur, noch mehr allerdings die Art der Einfugung, wie sie im Typ des Hauses und in der Form des Gartens impliziert ist. Diese Elemente sind nicht voneinander zu trennen und
erklaren sich wechselseitig.
Der yali ist ein mittelgro£es bis gro£es Haus in Uferlage. Vom Stadthaus unterscheidet ihn nur seine markante Horizontalitat und seine ausgesprochene Orientierung auf das Wasser. Der kosk (Kiosk oder Pavillon) ist ein Lusthauschen, das in einem Garten oder in der freien Landschaft steht und nur hin und wieder bewohnt wird. Er kann sich als ein einziger Raum nach au£en offnen oder mehrere Raume enthalten. In der Regel zeichnet er sich durch Einfachheit und Symmetrie aus. Die einzelnen Anwesen bestehen aus einem yali oder einem kosk, manchmal auch aus der Kombination beider Typen. 1m
ubrigen nimmt der allgemeine Sprachgebrauch hier keine sehr prazise Unterscheidung vor.
Dank der Technik des holzernen Rahmens konnte das osmanische Stadthaus seine charakteristischen Merkmale frei entwickeln. Sein Grundri£ ist kompakt; Loggien und Galerien sind selten. Die Befensterung ist gro£flachig und regelma£ig. Die Architektur ist wie die der ganzen Stadt von der raumlichen, geometrischen und formensprachlichen Autonomie jeder seiner Komponenten (Zimmer) bestimmt. Es gilt ein analytisches Kompositionsschema, und zwar die Montage von wiederkehrenden Einzelelementen, ein Schema, das im Mittelmeerraum, wo man plastisch vorgeht, ganz unbekannt ist. Der die Zimmer verbindende Raum (soja oder hayat) liegt an zentraler Stelle, haufig nach zwei Seiten orientiert und in seiner strengen Symmetrie den entsprechenden Raumen des venezianischen Hauses und der VenetoVilla sehr ahnlich; auch er ist ein reprasentativer und dem allgemeinen Gebrauch dienender Raum. Das Haus als Ganzes erweist sich als geschickte Verschachtelung geometrischer Formen.
Das modulare Schema, bei den Fassaden so gut wie immer, bei den Grundrissen der Holzbauten haufig angewandt, erfullte eine regulierende Rolle, was die Proportionen, die Komposition und die Konstruktion anging, wobei die Technik des Holzbaus dem noch entgegenkam. Die immer gro£eren Fensterflachen lie£en den inneren Rhythmus der vertikalen Elemente der holzernen Struktur deutlicher hervortreten. Dieser Aspekt des strukturellen Rhythmus und der Organisation des Raums wie der Bauvolumina (das Pavillonsystem spiegelt sich auch in der Dachausbildung) ist wichtiger fur die Wirkung des Baumaterials in der Landschaft als dessen Oberflachengestalt.
Die Idee und das Zentralschema des Binnenraums gehoren zu den Angelpunkten der osmanischen Raumauffassung auch auf dem profanen Sektor (hier nicht mit Kuppeln, sondern mit Grundri£- und Deckenformen, die das Zentralschema andeuten). In den kleinen formalen Garten, die aus dem umgebenden grunen Raum »herausgeschnitten« sind und in unmittelbarer Verbindung mit dem Hauptinnenraum stehen, treffen wir haufig auf die gleiche zentralschematische Symmetrie.
Es fallt schwer, den starken Kontrast nicht zur Kenntnis zu nehmen, der in der osmanischen Stadt zwischen der prazisen Geometrie der in Stein errichteten Bauten - der Moscheen und monumentalen Kom-
231
Zwei yali am asiatischen Ufer des Bosporus.
Der Palast des Said Pasa am Bosporus. Blick vom Goldenen Horn auf den Topkapi-Palast und seine Giirten.
plexe - und der ephemeren und heiteren Architektur aller ubrigen Gebaude einschlieBlich der kaiserlichen Palaste besteht. J ahrhundertelang treffen wir auf eine architektonische Form, die, darin dem griechischen Tempel und der gotischen Kathedrale vergleichbar, an anderen Stellen und von anderen Bauten der Stadt nicht ubernommen wird. Daraus ergibt sich eine Isolation des typologischen und formensprachlichen Kodex des Kultbaues, fast so als gabe es ein stillschweigendes Verbot seiner Verbreitung auf andere Momente der Stadt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei eher urn ein politisches als urn ein religioses Verbot: Der Sultan wacht eifersuchtig uber seine Oberherrschaft auf allen Gebieten.
Bei den yali treffen wir niemals auf eine Kuppel oder auf irgendwelche aufgemauerten Teile. Der Sultan war vielleicht zu nahe (selbst der Reformer Selim III. pflegte den Bosporus zu inspizieren, urn sich
232
ein Bild yom Reichtum der dortigen Grundsruckseigentumer zu machen und dann die Hohe der Steuern festzusetzen, die sie zu zahlen hatten) und hatte sich beleidigt fiihlen konnen, wenn ein anderer mehr Prunk entfaltete als die Herrscher selbst (die sich in dieser Hinsicht bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinein recht zuruckhaltend verhielten).
Der ephemere Charakter der Gebaude ist vielleicht auch psychologisch zu erklaren: Eine Gesellschaft, in der die Prasenz der Nomaden und der nomadischen Lebensweise uberall zu spuren ist und die folglich eine gewisse Unsicherheit und Wurzellosigkeit empfindet, betrachtet die Wohnung als etwas Provisorisches, von dem man sich auch trennen kann. Andererseits spielen zweifellos auch verbreitete Praferenzen und die Mentalitat ganz allgemein eine Rolle: eine soziale Schicht, die stan dig groBer wird, ubernimmt auch die Freude am Hellen und Leichten, den Symbolen der Lebensfreude, in ihre materielle Kultur.
Helligkeit und Leichtigkeit: Jedes dieser Zimmer ist gleichsam ein leichter Rahmen, in den sich das Licht und die durch die groBen Fenster sichtbare Landschaft, die gemalten Ansichten und das Intarsienwerk der eingebauten Schranke einfiigen. Den Widerspruch zwischen dem Alltaglich-Ephemeren, den weltlichen Werten und Freuden einerseits - auf deren Eitelkeit und Nichtigkeit die Religion immer wieder mit dusterem Ernst verweist - und den Werten der Arbeit, des Ansammelns und produktiven Investierens andererseits, von Tatigkeiten also, deren Erfolg unter den herrschenden politischen Gegebenheiten unsicher ist -, diesen Widerspruch muB man nicht im Koran suchen; er findet sich auch in der Fluchtigkeit des urbanen Lebens. Der prekare und provisorische Charakter der praktischen Losungen wird zum raffinierten MaBstab des Ephemeren.
Das Bewufltsein Jiir die architektonische Komposition Merkwurdig und spezifisch osmanisch - wir sagten es bereits - sind die Geometrie als fundamentale Komponente des Planungsverfahrens, das ausgepragte Gespur fur die geometrische Einfachheit, das die kompliziertesten raumlichen Gliederungen auf simple Figuren reduziert -Gegenfiguren zur augenscheinlichen Nichtformalitat der groBen Kompositionen - sowie die Bejahung der (kaum transformierten) Natur. Aller komponierenden Tatigkeit gemeinsam sind allerdings die Prinzipien der Aneinanderreihung, der Wiederholung, des Kontrapunktes und der Zusammenballung, Prinzipien, die starker sind als diejenigen der Harmonie und der Einheitlichkeit per Analogie und Homogenitat, der Plastizitat und Vereinheitlichung der Elemente durch reziproke Mimese. Die Stadt und ihre einzelnen baulichen Komplexe sind zusammengesetzt aus analytisch bestimmten und wiederholbaren Elementen: Zimmer, Kuppel, Fassaden-Modul, Baum, Stein, Wiese ... Diese primaren Elemente sind ad infinitum aggregierbar und kombinierbar. Erst mit dem Eindringen der Formensprache
des Rokoko werden die Kompositionen flieBender, und dies weniger, weil man auf die iterative Methode verzichtet hatte, als vielmehr wegen der Einheitlichkeit und Plastizitat der verbindenden Accessoires - der Ornamente, Mauern, Brunnen.
Rufen wir uns die »Accessoires« des yali vor Augen: die seitlichen Ufergarten, die yom Meer durch befensterte Mauern getrennt sind, die offenen oder in das UntergeschoB des yali integrierten kleinen Hafenbecken, die formalen Gartchen, die in Verbindung mit den Hauptraumen stehen, die auf der einen Seite des Hauses (als selamlik) fur die Manner, auf der anderen Seite (als harem) fur die Frauen gedacht sind, schlieBlich die ungeometrischen Walder aus Platanen, Pinien, Zypressen, Linden, Judasbaumen und vielen exotischen Importen sowie die Umfassungsmauern, bei denen der Baumeister seiner Phantasie freien Lauf laBt, die aber immer flieBende Formen und unauffallige Anschlusse haben, um die Natiirlichkeit des Ortes nicht zu st6ren (erst viel spater, im 19. J ahrhundert, werden die Walder in man chen Fallen umgestaltet: mit absteigenden Terrassen, die den Zusammenhang mit dem yali und dem baumbestandenen Hugel dahinter beeintrachtigen. Damit - das heiBt durch einen ProzeB, wie er ahnlich schon in den dichtbesiedelten Teilen der Stadt abgelaufen war und die dortige urbane Form hervorgebracht hatte - entsteht eine Landschaft aus einzelnen Elementen oder Gruppen von Elementen, die nebeneinander treten, ohne sich wechselseitig zu gestalten).
234
Wiederholung und Serialitat kennzeichnen aIle Stufen der Formierung der Stadt. Der in der spaten Architektur der osmanischen Stadt sehr lebhafte Eindruck der Bewegung ist das Ergebnis der langen iterativen Sequenz, die mit Variationen der Profile und der volumetrischen Kennzeichen einhergeht und eine Konstante der »Formensprache« der osmanischen Stadt ist: der Schatten der ausladenden Dacher, die reichen oder einfachen Fassaden, die kunstvollen Brunnen, die achtlos neb en ein schmuckloses Gebaude gesetzt sind, Mauern, die von gekehlten Fenstern durchbrochen sind, Architekturteile einer Komposition ohne Ordnung, wie feierliche und strenge Figuren in reichen Kleidern, die sich uber einen groBen Saal verteilen; dazu der Kontrapunkt der riesigen und prachtvollen Baume und des Spiegelbilds der Gebaude im Wasser. Alles bewegt sich und steht im Dialog, um eine Sprache zu finden, die keiner anderen Sprache ahnelt, die wir kennen.
1m 18. Jahrhundert nehmen wir in den Portalbauten und den Saulengangen, die die Hofe der neuen Moscheen rahmen, einen schuchternen Perspektivismus von der Stadt und auf die Stadt hin wahr. Die neuen Formen - leicht, durchbrochen und mit ausgedehnten, schattigen horizontalen Flachen - bilden Folgen aus Elementen, die homogen sind in ihrer raumlichen Wirkung und in ihrem Spiel mit dem Licht. Architektonische Verbindungselemente - durchbrochelle Umfassungsmauern, Einschube wie Brunnen und Portale, Kioske und auf den langen Stiitzmauern der yali im Abstand wiederkehrende be-
f
gegeniiberliegende Seite: Pavilions und Wasserspiegel in Kagithane.
Der A tifSenhof der Sultan-AhmetMoschee in Istanbul.
235
fensterte Baukorper - betonen die neue Flussigkeit und Kontinuitat des stadtisehen Raums des 18. J ahrhunderts.
Die Hofe werden in vielen Fallen zu Garten oder zu Raumen, die sich mit der Landschaft durchdringen. Die Bauten des stattlichen Stiftungskomplexes Hekimoglu drangen sich an den Randern zusammen, urn einen gro~en Garten zu ermoglichen, in dessen Zentrum die Mosehee steht. 1m prachtvoll am Bosporus gelegenen BeylerbeyiPalast von 1778 ist die Umfassungsmauer ein trilithischer Rahmen fur vielfach wiederholte Eisengitter, vollig durchsichtig gegen das Meer.
Die kurvige Fuhrung sowohl der Baukorper als auch des Dekors betont das Moment der Bewegung noch weiter: dies mit Zwecken und Wirkungen, die sich von denen des abendlandischen Klassizismus (und zum Teil auch von denen der safawidischen und der Mogularehitektur) unterscheiden, bei dem die Bewegung einen »kurzen« Dialog zwischen den Elementen (zum Beispiel zwischen zwei niedrigen Seitenflugeln und einem hoheren Mittelbau) eroffnet, urn ihn gleich anschlie~end im inneren Gleichgewicht der Komposition wieder zu beenden, die damit straff und autozentriert bleibt. In der osmanischen Architektur verbreitert sich die Bewegung (sie findet kein ausschlie~lich inneres Gleichgewicht) bis zur Einbeziehung der Umgebung, des Panoramas, die damit zwangslaufig zu Bezugspunkten werden.
Die >>unvollkommene Axialitat« ist das Au~erste, was die osmanische Auffassung von der urbanen Form dem Gedanken der Perspektive zugesteht. Es handelt sich sozusagen urn eine »verschobene« Axialitat, die durch eine gegenuber den Achsen der Gebaude und Hauptraume . tangential gefuhrte oder seitlich versetzte Achse zustande kommt. Die Achsen der wenigen gro~en Kompositionen sind ideale Achsen, wahrnehmbar nur in der Planimetrie; sie entwickeln sich niemals zu Achsen, die sich abschreiten lie~en. Die frontale Ansicht ist niemals privilegiert und kommt nur in dem Augenblick ins Spiel, in dem man tatsachlich vor dem Gebaude ankommt; ein geradliniger und axialer Weg wird niemals erkennbar. Es ist zwar richtig, da~ die mesire haufig eine Hauptachse besitzt, aber dieser Achse fehlt es nicht nur an »grandeur« und Monumentalitat (Qualitaten, die die osmanische Asthetik au~erhalb der gro~en religiosen Komplexe nicht sucht, nicht versteht und nicht will, wobei diese Komplexe merkwurdigerweise im 18. J ahrhundert wenn schon nicht im Aufri~, dann mit Sicherheit im Grundri~ yom »informellen« Geschmack ergriffen werden). Es fehlt ihr daruber hinaus auch der in Frankreieh libliche Rekurs auf die Perspektive, urn den Raum und die Ansichten einheitlich zu gestalten; es gibt keine Skulpturen oder sonstigen Elemente, auf die man die perspektivischen Achsen festlegen oder in denen man sie zusammenlaufen lassen konnte; die vorhandenen Gebaude sind sozusagen von der Ideologie her antimonumental; die sehr seltenen Alleen werden
236
von den maturalistisch« gehaltenen Anpflanzungen uberstimmt; alle Gebaude oder Gebaudekomplexe schein en, anstatt ihrerseits zum Zentrum oder zum Endpunkt eines Teils der Komposition zu werden, von einem eigenen Lebensraum umgeben, dem keine besondere Beachtung zuteil wi rd. Sie fugen sich also als autonome Konstellationen in ein Universum narurlicher Raume ein, in dem es keine prazisen Grenzen und keine definitiven Schwellen zwischen dem »komponierten« Raum und der N atur gibt.
Viele abendlandische Beobachter sahen und sehen in diesen Besonderheitennur ein kompositorisches Unvermogenoder schlicht und einfach die Barbarisierung der europaischen und orientalischen »Stile«; andere waren und sind davon fasziniert.
Die lange Agonie Warum sind von den originalen Garten und del' »Kultur des Bosporus« nur so geringe Reste erhalten geblieben? Die -Antwort liegt gerade in der Vitali tat der in diesel' Gesellschaft so verbreiteten und so tief verinnerlichten Typen: Dies~ Garten und Hauser wurden bis zum letzten genutzt und deshalb transformiert. Die Transformation war eine allmahliche und erfa~te breite soziale Schichten und ihr Umfeld. Die Zahl der monumentalen Anlagen war sehr gering; die Garten steckten im Ensemble, nicht au~erhalb; mit der Modifikation dieses Ensembles modifizierten sich auch die Garten und modifizierte sich der Bosporus. Ais del' Markt von europaischen Waren und Moden uberschwemmt wurde und der osmanische Staat seine Durchsetzungskraft und Glaubwurdigkeit verloren hatte, fanden das osmanische Haus und die osmanische Kultur des Ambiente die Kraft zum Dberleben und zur Verbreitung in weiten Bereichen des Balkans und Anatoliens. Deshalb verschwanden das typisch osmanische Haus und seine Umgebung nur allmahlich. Del' eigentliche Dbergang erfolgte in den letzten vier Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als auch am Bosporus mehrgeschossige »Burger«-Hauser mit zahlreichen Wohnungen errichtet wurden. Mit del' planimetrischen Veranderung ging das Anliegen der Reprasentativitat einher, wobei man auf die Formensprache des europaischen Eklektizismus zuriickgriff, del' die Fassaden gliederte und dadurch schwerfallig machte. Das Holz als Baumaterial regte zu merkwurdigen Kombinationen del' traditionellen Technik mit dem neogotischen Stil und samtlichen damals in del' westlichen Architektur herrschenden Revival-Bewegungen an. Dennoch war die Landschaft am Bosporus ungeachtet aller Transformationen fast bis an die Schwelle des Zweiten Weltkriegs noch stark osmanisch gepragt, obwohl es keinen Garten und keinen zusammenhangenden Abschnitt del' Stadt mehr gab, del' nicht von den standigen Eingriffen in seinem Charakter verandert worden ware.
1
1
«
:l
f 1
r
1
1
r
t
t
Die Garten von Samarkand und Herat Michele Bernardini
Die Untersuchungen, die in unseremJahrhundert tiber die Garten der islamischen Welt und besonders tiber die persischen Garten vorgelegt wurden, haben ein Schwergewicht auf die Bedeutung des timuridischen bagh (Garten) gelegt und deutlich gemacht, da~ das zu Zeiten Timurs und seiner Nachfolger entwickelte Modell in spaterer Zeit gro~en Erfolg hatte. Es stie~ nicht nur auf Anklang in den nachtimuridischen Garten Zentralasiens und des Chorassan, sondern hatte betrachtliche N achwirkungen vor all em im safawidischen Iran und im Indien der Moguln.1
Leider sind die Timuridengarten heute zerstort, ja sie scheinen schon hundert Jahre nach ihrer Errichtung verlassen und in Ruinen gelegen zu haben. Ftir Samarkand, das vom Ende des 14. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts (1370-1405) Hauptstadt des von Timur beherrschten Weltreichs war, haben die urn die Mitte unseres J ahrhunderts durchgeftihrten archaologischen Untersuchungen ein wenn auch ltickenhaftes Bild der Gartenanlagen aufgezeigt?
Dartiber hinaus haben auch die ausgezeichneten Arbeiten von E. Wilber tiber die persischen Garten3 und von R. Pinder-Wilson zum gleichen Thema4 eine aufmerksame Prtifung der historisch-literarischen Quellen vorgenommen und insgesamt durchaus gtiltige hypothetische Rekonstruktionen erbracht.5 Beztiglich Herat kommt vor all em T. Allen6 das Verdienst zu, in systematischer Arbeit zahlreiche Garten lokalisiert und - was noch wichtiger ist - in die historischkulturelle Gesamtsituation der Epoche eingeordnet zu haben. Allgemeinere Veroffentlichungen, die vor allem die Architektur der Timuriden betreffen, haben durchweg die Bedeutung des bagh als eines im Grunde architektonischen Elements hervorgehoben, das sich nicht losgelost vom Rest des umfangreichen Bauprogramms der Epoche Timurs und seiner N achfolger betrachten la~t?
Samarkand und Herat wurden beide in timuridischer Zeit neu gegrtindet, doch liegen diesen Neugrtindungen unterschiedliche Konzeptionen zugrunde. In Dbereinstimmung mit dem einleuchtenden Ansatz von Golombek und Wilber8 kann man in Samarkand, del' Kaiserstadt, den monumentalen Ausdruck der militarischen Erfolge Timurs sehen, wahrend Herat einer eher »metropolitanen« Konzeption folgt, die unter anderem auf eine Erweiterung der architektonischen Aktivitaten zielte. Samarkand spiegelt im Grunde den politischmilitarischen Hohepunkt des Reiches Timurs, wahrend die Entwicklung in Herat in der Epoche der Nachfolger dem politisch-militarischen Niedergang der Dynastie parallellauft.
J enseits solcher theoretischen Verallgemeinerungen la~t sich beztiglich der Anlage von Garten an der Peripherie der Stadte dennoch eine substantielle Kontinuitat zwischen del' ersten und der zweiten Periode feststellen: Die Modelle scheinen sich zu perpetuieren, und auch die kleineren Garten, wie sie vor all em in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts in Herat entstehen, sind gleichsam ein Echo auf die in Timurs Hauptstadt bereits existierenden Prototypen.
Den zu Garten und Nutzflachen bestimmten oder in dieser Weise genutzten vorstadtischen Arealen in Samarkand und Herat kam in timuridischer Zeit also eine ganz erhebliche Bedeutung zu. In Samarkand spiegelt sich in dieser Entwicklung der ganze Proze~ der Urbanisierung oder, genauer gesagt, diese Entwicklung konnte die Folge der Urbanisierung sein. Wir wissen vom Durchbruch durch das Stadtzentrum, der es notig machte, die Einwohner in andere Quartiere umzusiedeln9, und wahrscheinlich gab es in der Nahe der gro~en kaiserlichen Gtiter landliche Siedlungen, die von einer Bevolkerung bewohnt wurden, die zuvor in del' Stadt gelebt hatte. Auf jeden Fall erftillten die Peripherien eine habitative und eine agrikulturelle Funktion. Das gilt sowohl ftir Samarkand, wo die einstige Landwirtschaft im 15. Jahrhundert wieder auflebt, als auch ftir Shahr-i Sabz (Kish), die Privatstadt Timurs, und schliemich ftir Herat. In del' letztgenannten Stadt war die Peripherie tibersat mit unter landwirtschaftlichen Gesichtspunkten hochst wertvollen bagh in der N achbarschaft aristokratischer Residenzen und religioser Zentren.10
Die Beschaftigung mit den Quellen erlaubt, zumindest auf der hypothetischen Ebene, eine typologische Rekonstruktion des timuridischen bagh, die, auch wenn sie nur Annaherungswert besitzt, durch die Ergebnisse der archaologischen Grabungen in gewissem Urn fang bestatigt wird. Es handelte sich gewohnlich urn rechteckige Anlagen an Orten, die sich bewassern lie~en. Das ganze Areal war von einer Mauer umgeben, die in man chen Fallen aus ungebrannten Ziegeln bestand und Eckttirme besa~, die auch als Taubenturm dienten. ll Den Zugang zum Garten gewahrten in del' Regel mehrere Portalbauten, von denen einer gro~er als die anderen und als monumentaler ayval1 ausgebildet sein konnte. 1m Garten selbst und hier zumeist in zentraler Position befand sich ein Pavillon (koshPZ), der je nach seiner Nutzung auch als Palast (qasr oder imarat) beziehungsweise als Residenz (kakh) bezeichnet wurde. Von diesem Gebaude hei~t es oft, es sei viergeteilt oder auf kreuzformigem Grundri~ errichtet; in manchen Fallen stand es auf einer Art Sockel (pishgah), von dem aus man den ganzen Garten betrachten konnte. Haufig war dieses Gebaude mit Malereien geschmtickt13 oder mit glasierten Fliesen verkleidet. Davor lag ein Wasserbecken. 1m tibrigen war der ganze Garten von der Wasserfuhrung beherrscht, welche die Anordnung der Beete seitlich einer zentralen Achse bedingte. Die Beete (rawze, Plural riyaz) folgten einer geometrischen Ordnung und bildeten Dreiecke, Vierecke und Sechsecke. Die hydraulische Anlage versorgte auch die Becken (hawz), die sich mit den Beeten abwechselten und deren Form imitierten. In den Becken standen Obstbaume, und an ihren Seiten zogen sich Reihen von Pappeln oder anderen hohen Baumen hin, die den Spaziergangern Schatten spendeten. Die Anordnung dieser vielen verschiedenen Baume folgte ebenfalls einer strengen Ordnung, die nicht nur die Farbe, sondern auch den Duft der Bltiten berticksichtigte. Die Garten waren mitunter durch lange Stra~en (khiyabal1) mit der Stadt verbunden, die
plan der Peripherie von Samarkand mit den Giirten in timuridischer Zeit (nach Golombek-Wilbe~.
OBagh-1 Behisht
o 801'llh-1 ShIma!
plan der Peripherie von Herat mit den Garten in timuridischer Zeit (nach AI/en).
OChah.'lrb.lgh
~~?~;;D }<F~~D8agh-r Dilgush ...
Samflrqand in the Timurid Period
City, Gardens, Meadows
(Sketch after Babur)
Observiltory ~f Ulugh Beg
2 Shah-i Zindeh
Masjid-I Jami of Timur
4 Registiln
5 Cltildel
6 Gur-i Amlr
o Gardens
sich an den grofSen Stadttoren vereinigten; auch diese StrafSen waren von Reihen von Baumen gesaumt und gelegentlich von gekachelten Mauern begleitet.
Dber eine Gruppe von Garten in Samarkand ist wenig bekannt: Gemeint sind jene nach den wichtigsten Stadten der damaligen islamischen welt benannten Garten, die rund urn Samarkand angelegt worden waren. Aus den Quellen wissen wir, dafS sie nach Kairo (Misr), Damaskus, Baghdad, Sultaniye und Schiraz benannt waren.
Von anderen Garten haben wir etwas eingehendere Notizen, und in manchen Fallen kennen wir auch das Datum ihrer Errichtung. Der am ausfuhrlichsten beschriebene Garten ist der Bagh-i Dilguscha (der Herzerfreuende Garten), der im Osten der Stadt lag und imJahre 1396 aus AnlafS der Heirat Timurs mit Tubl Khanum angelegt wurde.14
Noch we iter ostlich lag der Bagh-i Dulday (der Vollkommene Garten). Westlich der Stadt befanden sich der Bagh-i Schimal (der Nordliche Garten) von 1397, der Bagh-i Naw (der Neue Garten) von 1404 und der Bagh-i Bihischt (Garten des Paradieses), einer der ersten uberhaupt (1378). 1m Suden lag en der Bagh-i Tschinar (Platanengarten) und der Bagh-iJahannuma (der Garten des Eroberers der Welt). 1m Norden, an den Hangen des Kuhak-Berges (Cupan Ata) , lag der Bagh-i Naqsh-i Jahan (»Abbild der Welt«) und weiter westlich der Bagh-i Maydan (der Platz-Garten). Die Quellen erwahnen auch den Bagh-i Buland (den Langen Garten) und den Gulbagh (den Blumengarten), den Wilber im GrundrifS rekonstruiert hat. iS
Dank der sowjetischen Grabungen lafSt sich das Aussehen des Bagh-i Dawlatabad (des Gartens des Reiches) rekonstruieren. Diese Anlage geht auf das Jahr 1399 zuruck und bestand aus zwei nebeneinanderliegenden Einfriedungen. 1m Zentrum der einen erhob sich ein Palast auf kreuzformigem GrundrifS, dem ein Portikus vorgelagert war. Der Garten war ummauert, mit Becken geschmuckt und durch eine StrafSe mit der Stadt verbunden.16 Den sowjetischen Grabungen verdanken wir des weiteren den Fund des sogenannten Baghce (des kleinen Gartens) des Ulugh Beg, des Nachfolgers Timurs als Regent der Stadt Samarkand.
Auf einer ziegelgepflasterten Terrasse im Westen des Areals erhob sich eine zwolfeckige Plattform, in deren Mitte sich ein rundes Becken und eine quadratische, mit Onyxplatten bedeckte Flache befanden. Dieser Ort durfte der takhtgah (wortlich: Thronsaal) gewesen sein; er war aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Baldachin uberdeckt. 1m Osten hat man eine ebenfalls gepflasterte Plattform mit einem Aufbau (s~iffe) gefunden, der ein oktogonales Becken trug. Unweit des Baghce stand der Tschinf Khane, ein ebenfalls von Ulugh Beg errichteter Pavillon, den sechseckige Fliesen aus weifSem und blauem Ming-Porzellan und solche einheimischer Produktion aus Terrakotta schmucktenY Ulugh Beg war auch der Schopfer des Bagh-i Nawruzi (des
1 N eujahrsgartens). L ____ ~ _____ ~:::::::",=--_____ ~~~~~~~km~ In Herat anderte sich nach der Eroberung der Stadt durch Timur
238
Schemata der timuridischen bagh: 1, Bagh-i Di/guscha; 2, Bagh-i Schimal; 3, Gulbagh; 4, Bagh-i Naw; 5, Bagh-i Maydan, Bagh-i Tschinar, Bagh-i Safid, Baghce; 6, Bagh-i Dawlatabad.
Pavillon
Torbau
Eckturm
Y ... Eckpavillon
Mauer
Kanal
II
··································11··········· o () D 0 o 0
HIIH
1
5
.... .. .. ... ··· ·· ····· ·.11 : 2
II 4
II II 6
Baysunghur ibn Shahrukh in einem Garten, aus einem Kalile va Dimne des Nizam ad-Din Abu'l-Ma'ali Nasr Allah, Herat 1429 (Istanbul, Bibliothek des Topkapi-Palastes, ms.R. 1022,1 1 r).
Humay und Humayun in einem Garten, aus einer Anthologie, Herat ca. 1430 (Paris, Musee des Arts Decoratifs, Inv. 3727, loses Blat~.
240
z
s b '\ 1:
t s
I
J r
(
t
c I
]
zunachst nichts an der Gartensituation: Der Bagh-i Shahr (Stadt-Garten) war bereits zur Zeit der Kartiden (ca. 1300-1380) intra muros, im Schutz der Zitadelle, angelegt worden. Der siegreiche Timur ordnete hier die Errichtung eines qasr an, und Schah Ruch nahm im Bagh-i Shar Wohnung, als er nach Timurs Tod (1405) die Hauptstadt von Samarkand nach Herat verlegte. Spater wahlte er allerdings den auBerhalb der Stadt gelegenen und ebenfalls aus der Zeit der Kartiden stammenden Bagh-i Zaghan (Rabengarten) zu seinem Wohnsitz. Der Bagh-i Safid (der WeiBe Garten) ging in seinen Anfangen zwar auf das Jahr 1319 zuruck, wurde aber von den Timuriden in groBem Umfang restauriert.
Es war Husayn Bayqara (1469-1506), auf den die bedeutenderen Gartengrundungen im timuridischen H erat zuruckgingen. Der wichtigste dieser Garten war sicherlich der Bagh-iJahan Ara'i (der Garten, der die Welt schmuckt), 1469 begonnen und mit Dutzenden von Pavillons sowie Wohn- und Verwaltungsbauten versehen. Von ihm hat sich nur eine riesige Zisterne, umgeben von den Resten von vier Pavillons, lokalisieren lassen. Kleinere Garten, wie der Baghce-yi Ali Schir Nava'i (der Kleine Garten des Ali Schir Nava'i) aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, entstanden in groBer Zahl an der Peripherie der Stadt. Der Baghce des Ali Schir stand in einem Zusammenhang mit dem Heiligtum von Gazugah, andere baghce begleiteten Kanale - zum Beispiel denJuy-i Sultani (den Koniglichen Kanal); manche wurden als takht (Thron) bezeichnet, ein Hinweis auf ihre gunstige Lage als Belvedere.18
Nach diesem Versuch, die Gartenanlagen in den beiden Stadten dingfest zu machen, solI im folgenden nach der Ideologie gefragt werden, die hinter der Errichtung des Timuridengartens stand. Diese Suche muB ihren Ausgangspunkt bei einem sehr wichtigen anthropologischen Faktum nehmen: Die Einverleibung von Samarkand und Herat in Timurs Herrschaftsbereich bedeutete eine weitere Episode im Rahmen der tausendjahrigen Begegnung zwischen iranischer SeBhaftigkeit und tiirkischer Nomadenkultur. Den Timuriden wurden damit einerseits alte Gegensatze - wie detjenige zwischen Iran und Turan - erneut ins BewuBtsein gebracht, die in groBem Stil schon von Firdausi in seinem Shahnameh (Konigsbuch) beschworen worden waren. Andererseits hatte das Zusammentreffen der beiden Kulturen zumindest fur Samarkand und Herat nicht mehr die dramatische Konnotation der mongolischen Invasion, auch wenn die Timuriden sich eindeutig auf die Mongolen bezogen, und zwar sowohl in den grausamen Formen der Machtergreifung wie anschlieBend in ihrer Handhabung von Recht und Verwaltung. 19
M. Gronke hat darauf au&nerksam gemacht, daB Timur sich der Grundung einer Hauptstadt in Balkh durch Amir Husayn, seinen Rivalen urn die Herrschaft uber die Caghatay, widersetzte, weil dies den Regeln der nomadischen Tradition (»Immer wandern, niemals bleiben«) widersprach. Urn 1370 allerdings verriet er mit der Grun-
241
Khusraw und Schirin in einem Garten, aus einer Khamse des Nizami, Herat 1445-46 (Istanbul, Bibliothek des Topkapi-Palastes, ms. H. 781,1 48v).
gegeniiberliegende Seite: Disputierende Theologen in einem Garten. Aus dem Sadd-i Iskandar des Ali Shir Nawa'i, urn 1485. Oxford, Bodleian Library, Elliot 339,1 95v}.
Zeit lager in einem Garten mit saraparde, Herat, 15. Jahrhundert.
Miniatur aus einer Khamse des Nizami, Schiraz, 1398 (Istanbul, Turk ve Islam Eserleri Muzesi, ms. 1950,f128v).
Lackierter Bucheinband, persisch, aus der Mitte des 16. Jahrhunderts (Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Or 104).
dung seiner eigenen Hauptstadt dieses fundamentale Prinzip des turko-mongolischen Nomadentums selbst.2°
Immerhin verzichtete Timur darauf, sich in Samarkand fest zu etablieren. Der Kok Saray (der Blaue Palast) innerhalb der Zitadelle blieb wahrend der Jahre seiner Regierung und auch unter seinen Nachfolgem in erster Linie Gefangnis und Aufbewahrungsort des Schatzes.21
Timur zog es vor, sich extra muros aufzuhalten und die kalte J ahreszeit in den qishlaq oder Winterlagem, die warme in den yaylaq oder Sommerlagem zu verbringen.22 Nach Clavijo wechselte er den Aufenthalt sogar von Woche zu Woche.
Allerdings waren die timuridischen qishlaq und yaylaq im allgemeinen schon eine Vorstufe permanenter agrarischer Ansiedlungen; das erklart auch den Eingang der beiden Begriffe in die regionale Toponomastik und die - spatere - Einbiirgerung des begriffes mawz i (Plural mawazi, im modemen Usbekisch mauza) zur Bezeichnung von Orten, die urspriinglich zu Sommer- oder Winterlagem bestimmt waren und dann zu Ackersiedlungen wurden.23
Timur schloB also einen KompromiB zwischen seiner eigenen und der seBhaften iranischen Kultur: Er akzeptierte die Idee der Hauptstadt, des festen Regierungssitzes in Samarkand (unter seinen Nachfolgem in Herat), aber er ))llomadisierte« die Peripherie, und auch die von ihrer Anlage her ganz iranischen Garten wurden zu Lagerplatzen und nahmen mit der wachsenden Zahl von Zelten schlieBlich ein Aussehen
244
an, das sie vom Typ des tradition ellen iranischen Gartens unterschied. Timurs ZeIt glich in der Tat einem mobilen Palast. Wilber, der es anhand der Beschreibungen von Clavijo und Ibn Arabshah rekonstruiert haf4, spricht von einem mehr als zehn Meter hohen iiberkuppelten Aufbau, der von zwolf Masten und 500 Seilen gehalten wurde. Daneben muB man sich die anderen Zelte vorstellen, aus denen das »typische« timuridische Lager bestand; aus den erhaltenen Miniaturen und schriftlichen Quellen kann man schlieBen, daB es sich im allgemeinen urn yurte handelte, die mongolischen Kuppelzelte. Sie waren, wie das Zelt Timurs auch, mit kostbaren Stoffen verkleidet, auf die spater noch eingegangen wird. Die »Zeltstadte« der Timuriden zeichneten sich als einzige dadurch aus, daB in ihnen regelrechte Wege verliefen - markiert durch lange Stoffbahnen, die zugleich als Abgrenzungen einzelner Bereiche des Lagers fungierten (saraparde).
Aber das nomadische Element verschmolz mit der iranischen SeBhaftigkeit. Der Timuridengarten ist in erster Linie eine agrikulturelle Anlage. Timur wandte sein besonderes Interesse den Problemen der Bewasserung zu, wie die Quellen im Zusammenhang mit der Anlage der befestigten Stadt Baylaqan beweisen.25 1m iibrigen miissen sich die mit der Betreuung der Garten beauftragten Personen einer besonderen Stellung am Hof erfreut haben, wie der Fall des Schihab al-Din Ahmad Zardakhschi zeigt, von dem in den Quellen die Rede ist.26
Bei der Anlage von Garten waren ebenso wie bei der Errichtung von
l.
1
1
1
f
e r
e e !l
:l
!l
i
Gebauden komplizierte Regeln zu beachten; so war es zum Beispiel unerlafSlich, daG ein Horoskop den gliicklichen Ausgang des Unternehmens prophezeite. Man brauchte dazu quali£lzierte Arbeitskrafte, die zum Teil aus den eroberten Landern - aus Indien und Aserbeidschan -, zum Teil von anderswoher geholt wurden, so zum Beispiel aus China (woher ja auch die Ming-Fliesen stammten, die den Tschini Khane des Ulugh Beg schmiickten).
Was das eigentlich iranische Element in der Gartenkultur betrifft, so gibt ein Landwirtschaftstraktat aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts Auskunft, der Irshad a l-zira 'a, der in Herat von Fazil Haravi verfaGt wurde und immer wieder Gegenstand der Forschung gewesen istP Dieser Traktat hat zu einer Vielzahl von Gartenrekonstruktionen AnlaG gegeben, so durch G. Pugacenkova28
, durch R. Pinder-Wilson29
und schliefSlich durch M. Alem?o. Die letztere hat darauf aufmerksam gemacht, daG die Wasserachse, die den von Haravi konzipierten »Ur«Garten durchquert, sich nicht mit einer anderen Achse kreuzt, wie der Name caharbagh (Viergeteilter Garten) immer wieder vermuten lieG, sondern als Fiihrung fiir das Wasser fungiert, das die zu beiden Seiten liegenden Beete bewassert, so wie es in vielen Timuridengarten und spater in den Safawidengarten der Fall war, von denen sich einige Zeugnisse erhalten haben.
Was den von einer Wasserachse zweigeteilten Garten betrifft, so erscheint die Idealdarstellung eines solchen in einer Gruppe von Miniaturen aus Schiraz, die im Tiirk ve Islam Eserleri Miizesi in Istanbul aufbewahrt werden und das Werk eines nicht weiter bekannten Bahbahani aus dem Ende des 14. Jahrhunderts sind. Beim aufmerksamen Vergleich des Gartengrundrisses mit den Miniaturen in diesem Kodex31 erkennt man den zentralen Kanal, dessen Wasser sich in ein Becken ergieGt. Einmal abgesehen von der komplizierten und nicht eigentlich veri£lzierbaren These, die H. Corbin in diesem Zusammenhang vortrag22 , handelt es sich bei der Malerei des Bahbahani mit Sicherheit urn eine Idealdarstellung, die sich durch eine Gemeinsamkeit mit dem Werk des Haravi auszeichnet: Sie hebt ebenfalls auf die botanische Varietat und Vielfalt ab, die den Garten kennzeichnen sollte und der der Autor des Irshad al-zira'a zwei Kapitel seines Buches widmet: 1m ersten behandelt er die zu »gewohnlichen« Zwecken verwendeten Pflanzen, im zweiten die Zierpflanzen.
Die Varietat war mit Sicherheit ein Kennzeichen des Timuridengartens. Einen ganz deutlichen Beweis dafiir £lnden wir bei Scharaf aI-Din Ali Yazdi, der in einem Kapitel seines ZaJarnameh von den vielen Friichten berichtet, die irn Bagh-i Dilguscha wuchsen. J edes Beet trug eine andere Sorte, und der Autor verliert sich in der Beschreibung der verschiedenen Apfel-, Birnen-, Aprikosen-, p£lrsich-, pflaumen- und Granatapfelsorten, der Trauben, Pistazien und Mandeln.33
Die Gartenlandschaft des Bahbahani steht auch im Gegensatz zu einer Vorstellung des Chaos, wie sie auf vielen Bucheinbanden des 15. und 16. Jahrhunderts erscheint: Ich meine die Wildnisdarstellungen,
245
Rekonstruktion des Zeltes von Timur (nach Wilber).
die vor allem die schwarzgrundigen Lackeinbande schmiicken. Hier wird die Natur als grausam und gefahrlich geschildert, bewohnt von wilden und phantastischen Tieren wie Drachen und simurgh in aggressiver Pose. Wahrend die Miniaturen des Bahbahani, helle Tagesbilder, durch das FlieGen des Wassers gekennzeichnet sind, reprasentieren diese wilden Szenen - N achtbilder, die an Alptraume erinnern -die in der persischen Literatur hau£lg beschriebenen Taler der Holle.
Es lassen sich mit Sicherheit zwei verschiedene Vorstellungen der Natur ausmachen: Die erste, die ide ale Vorstellung, ist irn hortus conclusus verkorpert und beschreibt ein Bild des Paradieses; die zweite, feindliche, fiihrt die Unterwelt vor. Beide Ikonographien tauchen in der Epoche der Timuriden auf: Wie wir sahen, gab es in Samarkand einen Bagh-i Bihischt (einen Garten des Paradieses), und ein interessanter Text iiber die Stadt Herat, ein Werk des Zamci, tragt den bezeichnenden Titel Rawzat al-Jannat fi awsaJ madinat Herat, was soviel bedeutet wie »Die Beete des Paradieses, eine Beschreibung der Stadt Herat«.34 Man darf in diesem Titel nicht einfach ein poetisches Epi-
Gnmdr!fi des Tschinili Kiisk und des Dawlatabad.
246
theton sehen: Er schlieBt das Konzept des paradiesischen Beetes ein, wie es sich auch in der Literatur, zum Beispiel im Baharistan (»Fruhlingsgarten «) des J ami £lndet, der auch in rawza eingeteilt ist, die gleichen rawz a, denen wir im Irshad al-zira'a begegnen.
L. Golombek hat darauf aufinerksam gemacht, daB der Ausdruck rawza in der muslimischen Hagiographie auch mit dem Paradies einhergehen kann.35 Sie zitiert eine Stelle bei N asir-i Khusraw, in der es heiBt, daB die rawza einer der Garten des Paradieses (Bustanha-yi Bihischt) sei, wie der Prophet sagt: »Zwischen meinem Grab und meinem minbar be£lndet sich einer der Garten (rawza) des Paradieses (riyaz al-J annat) .«
Die Anspielung auf die Garten des Paradieses £lndet sich hau£lg auch in der Form des Tropus, etwa wenn von den »Garten von Iram« gesprochen wird, die so vollkommen sind wie diese imaginare Stadt. Diese Gartenvorstellung legte ein Schwergewicht auf das kontemplative Element, und der Kontemplation mussen viele Garten gewidmet gewesen sein, was schon aus den N amen hervorgeht: Denken wir zum Beispiel an den Bagh-i Nazargah (den Belvedere-Garten), der unter Husayn Bayqara in Herat angelegt wurde. Dieser Aspekt wird unterstrichen durch Bezeichnungen wie takht oder suffe, die auf einen erhoht liegenden Standort verweisen, von dem aus man die Landschaft betrachten kann, und er £lndet eine weitere Bestatigung in der Architektur selbst, und zwar in der erhohten Anordnung des Pavillons an zentraler Stelle. Der Pavillon, der immer wieder als viergeteilt beschrieben wird, scheint von Anfang an fur die Kontemplation der umgebenden Landschaft konzipiert.
In diesem Zusammenhang emp£lehlt sich auch ein Blick auf die Literatur, die einiges zur Ikonographie des PavilIons beizusteuern hat. Immer wieder wird hier zum Beispiel die Geschichte des Bahram Gur behandelt, der sieben Nachte in ebenso vielen PavilIons verbringt, urn den Erzahlungen von sieben Frauen - in anderer Version: sieben Weisen - zuzuhoren.Jedem Pavillon wird dabei eine bestimmte Farbe zugeordnet, und er ist mit Pflanzen in dieser Farbe ausgestattet; ferner bestehen Assoziationen zum Beispiel mit einem bestimmten Edelstein, einem Klima, einer geographischen Gegend, die der Pavillon verkorpert.
Die Geschichte des Bahram Gur erfreute sich vor allem in der Epoche der Timuriden groBer Beliebtheit. Sie wurde sowohl von Nizami und von Amir Khusraw erzahlt, den »Klassikern« dieses Genres, als auch in neuer Version in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts von Hati£l und Ali Shir N ava'i. Die Version des Hati£l tragt den Titel Haft Manzar (Sieben Szenarien, oder Sieben Belvederes), wahrend Bertel's36 den Begriff manzar mit dem russischen pavil'on ubersetzt, urn auf die architektonisch-landschaftliche Bivalenz des literarischen Gebaudes aufinerksam zu machen.
Der Pavillon als Ort der Landschaftsbetrachtung ist keine neue Erscheinung im iranischen Garten. Wir £lnden ihn schon im 9. Jahr-
1
1
1
r
:l 1
t
1
r
r
1
1
r
r
1
t
"
hundert im abbasidischen Samarra, und zwar sowohl im Jawsaq alKhaqani (836 n.Chr.) als auch im Balkuwara-Palast (859 n.Chr.), und wahrscheinlich ahmten diese Pavillons ihrerseits noch altere Prototypen nach wie den sasanidischen Imarat-i Khusraw a Qasr-i Shirin oder den Khawsh Kuri, die beide wahrend der Regierungszeit von Khusraw Parviz (591-638) auf hohen Sockeln errichtet wurden, von denen aus man die umliegenden Garten betrachten konnte.37
D. Fairchild Ruggles, der diese Garten in Kenntnis der Arbeit von Pinder-Wilson untersucht ha28, bringt sie in einen Zusammenhang auch mit den Garten von Madinat al-Zahra, der spanischen Stadt, die sich sehr stark am Vorbild Samarras orientierte. Auch hier vollzog der Pavillon die Rolle der viewing platform oder, urn den eher angebrachten spanischen Ausdruck zu verwenden, der mit dem italienischen »belvedere« zusammenfallt, des mirador.
Die Analogie zwischen den Pavillons von Samarra und de~enigen der Timuriden gewinnt an Stringenz, wenn man die Grundrisse miteinander vergleicht: Beide sind kreuzformig und mithin viergeteilt. Ein Vertreter dieses Typs laBt sich mit Sicherheit in einem Gebaude ausmachen, das zwar nicht auf timuridischem Gebiet errichtet wurde, sich aber in direkter Linie von der timuridischen Architektur herleitete: im Tschinili Kosk (= Keramikpavillon; man beachte die Analogie mit dem Tschini Khane des Ulugh Beg) in Istanbul.
Dieses Gebaude, zur Zeit Muhammads II. errichte29 , ist mit Sicherheit ein typischer Vertreter des timuridischen Pavillons. Es ist zweistOckig und besitzt einen kreuzformigen GrundriB, dem in beiden Geschossen vier Eckraume zugeordnet sind. Eine Analogie besteht zweifellos mit dem Tschihil Sutun, dem Tarab Khane und dem Gartenpavillon des Bagh-i Dawlatabad, zu dem G. Pugacenkova Rekonstruktionszeichnungen vorgelegt hat.40 Aber auch die Grundrisse des J awsaq al-Khaqani und des Balkuwara-Palastes sind kreuzformig und scheinen in einem Zusammenhang mit alteren Prototypen zu stehen.
Goodwin hat darauf hingewiesen, daB die Vierteilung des Tschinili Kosk sich in Fatehpur Sikri wiederfindet, »wo der Thron ins Zentrum der vier Kardinalpunkte geriickt war«, weshalb man sich fiir diesen Standort des Pavillons entschied.41
Es laBt sich also eine plausiblere Erklarung des Begriffs caharbagh (viergeteilter Garten) vortragen: Zum einen waren diese Garten haufig dem das Zentrum dominierenden Pavillon »gewidmet«; zum anderen hatte der Pavillon, takhtgah (wortlich: Thronsaal), in dem Augenblick, in dem der Konig sich hier niederlieB, die Aufgabe, den Mittelpunkt des Gartens und mithin der ganzen welt zu reprasentieren. 1m iibrigen ist der Garten in der iranischen Welt von altersher ein speculum mundi. Eine Bestatigung dafiir lieferten in der Epoche der Timuriden der Naqsch-i Jahan (»Abbild der Welt«), der J ahannuma, (»Eroberer der Welt«) und der Jahan Ara'i (»Schmiicker der Welt«).
Auch die im verhaltnis zu den kaiserlichen bagh periphere Lage der »Stadt-Garten« urn Samarkand - die Hauptstadt des Reiches - sym-
247
bolisiert diese Zusammenhange, jetzt allerdings nicht mehr auf der architektonischen, sondern auf der hoheren urbanistischen Ebene.
Beziiglich der Gartentypologie, wie sie auf den Teppichen erscheint, wird allerdings haufig vom caharbagh gesprochen. Die Teppiche, sehr oft viergeteilt durch die Kreuzung zweier Wasser»achsen« im Zentrum, reprasentieren ein Idealbild des Vierergartens, das seinerseits mit dem Schematismus des Teppichs eine »Weltkarte« darstellt, bevor noch das Portrait eines bagh realiter existiert.
Dabei ist diese Art der Darstellung der Welt als Garten auf dem »Landschaftsteppich« nicht neu: Eines der ersten Beispiele diirfte der Teppich sein, den die Araber am Tag nach ihrem Einfall in Ktesiphon fanden. Wie es heiBt, war die ganze Erde im Friihling darauf abgebildet, und alle Grenzen waren durch aufgenahte Edelsteine markiert.42
Aber die Korrespondenz von Teppich und Garten laBt noch weitere Dberlegungen zu. Wie E. Cohn-Wiener ausfiihrt, gehen die am AqSaraq-Mausoleum in Samarkand verwendeten Schmuckformen auf die persischen Teppiche zuriick, die urn die Mitte des 15.Jahrhunderts den geometrischen Stil zugunsten eines floralen aufgaben.43 Das gleiche sagt auch A. Briggs, der im Aufkommen von Teppichen mit Arabesken einen Ersatz der geometrischen Motive sieht, welche die erste Halfte des Jahrhunderts beherrscht hatten.44 Dieser Geschmackswandel konnte die Folge einer neuen N aturauffassung und mithin einer neuen Sicht auch des Gartens gewesen sein, einer Sicht, die sich sozusagen an der Natur festrnacht und sie ideologisch ordnet.
Zu dieser naturalistischen Ikonographie traten gewisse chinesische Einfliisse, vor allem auf dem Weg iiber die Stoffe: Diese bedeckten die Zelte und bildeten die saraparde, markierten also, wie schon gesagt, die Wege in der Zeltstadt. Sie fanden auch in den Stadten selbst Verwendung: Sie fungierten als Dekoration bei wichtigen Zeremonien und nobilitierten, am Boden ausgelegt, den Zug des Souverans durch die groBen StraBen.45
Es war also die Darstellung der Natur - zum Beispiel in Gestalt der Teppichmuster -, welche die Stadt in dem Augenblick in einen Garten verwandelte, in dem sie durch den Besuch des Henschers zum Mittelpunkt der Welt wurde.
1 Dieses Problem ist bisher nur ansatzweise aufgenommen worden und bedarf in Zukunft einer systematischen Betrachtung. Vgl. D . Wilber, Persia II Cardells alld Cardell Paviliolls, Tokio 1962, S. 58; T Allen, Tilllllrid Herat, Wiesbaden 1983, S. 55. 2 LA. Sucharev, Dvorecsad tilllllra DOII/atabad, in »Trudy Uzbekistanskogo Gosudarstvennogo Unive rsiteta«, 14,2,1940, S. 1-18; G. Pugacenkova, Sadovo-Parkovoe iskllsstvo SredlIej Azii v epocl/ll Tilllllra i tilllllridov, ivi, 23,
1951 ; Micoulina-Tochtahojaeva, Problellls oj Cardell Archaology ill the USSR, in Les Jardills de I'islalll / Islalllic Cardells - 2. Colioqlle illterlIatiollal sllr la protectioll et la restauratioll des jardills historiqlles OIgallise par I'ICOMOS et l'IFLA, Crellade, Espaglle, dll 29 oct. all 4 1I0V.
1973,0.0.,0']., S. 83-102; G. Pugacenkova, Zodcestvo Celltral'lIoj Azii XV-XVI vv., Taschkent 1976. 3 D. Wilber, op.cit., 1962. 4 R. Pinder-Wilson, The Persiall Cardell:
Bagh and Char Bagh, in The Islamic Garden, hg. von E. MacDougall und R. Ettinghausen, Washington 1976, S. 71-85. 5 Andere allgemeine Veroffentlichungen uber den islamischen Garten haben diese Studien ziemlich genau ubernommen, auch soweit es den Timuridengarten betrifft. Das gilt fur zwei Bucher, deren Titel nahezu identisch lauten: J Brookes, Gardells of Paradise, New York 1987, S. 70-77; E.B. Moynihan, Paradise as a Gardel/, London 1979, S.70-78. 6 T. Allen, op.cit. 7 Hierhin geh6ren die folgenden Arbeiten: G. Pugacenkova, op.cit., 1976, S. 95-99; B. O'Kane, Timurid Architecture ill Khurasan, Costa Mesa 1987, S.l1-13; 1. Golombek, D. Wilber, The Timurid Architecture of Iran and Turall, Princeton NJ 1988, S. 174-183. 8 L.Golombek, D. Wilber, op.cit. 9 Vgl. M. Bernardini, »The Ceremonial Function of the Artisans in Timurid Town«, in journal of the Islamic Elivirolllllelltal Desigll Research Centre, 1, 1991. 10 Vgl. O .D. Cekovic, Samarkalldskije Dokumentij XV-XVI vv., Moskau 1974; M. Rogers, »Waqfiyyas and Waaf Registers: New Primary Sources for Islamic Architecture«, in K'Hlst des o riell ts, 11, 1976-77, S.182-196; M.E. Masson, G. Pugacenkova, »Shakhri Syabz pri Timure i Ulug Beke«, in Irall, 16, 1978, S. 103-126; M. Bernardini, »L'agricoltura timuride tra bag e qislaq«, in Islam, storia e civilta, 21,1987, S.253-261. 11 Vgl. W.M. Thackstons Obersetzung der Veroffentlichung von Yazdi (uber den Bagh-i Dilguscha) in A Cmtury of Prillces, SOl/rces all Timl/rid History alld Art, Cambridge Mass. 1989, S.85, Nr.26, in der es
im Zusammenhang der Ecktiirme des Gartens urn die Variante burj-i kablltar geht. 12 Interessant und amusant zugleich ist die jungste Auseinandersetzung tiber den Begriff des kiisk in S. Tekin, »K6sk Kelimesi Farsca degil, Ttirkcedir!«, in Tarih ve Top/um, 66, Haziran 1989, S.332-335. 13 Sie stellten zum Beispiel die Siege Timurs dar. 14 Die bedeutendsten persischen Quellen in bezug auf die Garten von Samarkand und Herat sind Scharaf aI-din Ali Yazdi, Zafamame, hg. von M. Abbasi, Teheran 1336 [1958]; Gazi Zahiruddin Muhammed Babur, Vekayi Bebur'llI1 Hatirati, turkische Obers. von R. Rahmeti Arat, Ankara 1987; Ibn Arabschah, Zalldagr shigliftavar-i Timl/r, pers. Obers. von M.A. Nijati, Teheran 1370 [1992]; sowie die in W.M. Thackston, op. cit., zitierten; R. Gonzalez de Clavijo, Vida y Hazalias del Grall Tamorlall COil la descripcioll de las tierras de su imperio y sellorio, Madrid 1782. 15 Vgl. D. Wilber, Persiall Garde/lsoo., cit., Abb.23. 16 Der GrundriB ist abgebildet in Micoulina-Tochtahojaeva, op.cit., S. 85, Abb. 11. 17 Vgl. G. Pugacenkova, Zodcestvo ... , cit., S.97; 1. Golombek, D. Wilber, op.cit., S. 177. 18 Vgl. T. Allen, op.cit. 19 Vgl. B.-E Manz, The Rise alld Rule of Tamerlalle, Cambridge 1989. 20 Vgl. M. Gronke, »The Persian Court between Palace and Tent: from Timur to Abbas 1«, in Timurid Art and Culture - Iran alld Cmtral Asia in the Fifteellth Cmtllry, hg. von 1. Golombek und M. Subtenly, Leiden 1992, S. 18-22.
21 Vgl. ibidem, S. 19; zur Zitadelle von Samarkand vgl. I.E Borodina, "Gradostroitelnaj a struktura Srednevekovogo Samarkanda (poplany 1874 goda) «,inProbleIllY IstoriiArchitektury - Sbomik Nallwik TrHdov, hg. von O.C.Chalpakhcijan,Moskau 1974,S. 55-67. 22 Vgl. M. Bernardini, L'agricoitllra til1luride ... , cit. 23 Vgl. ibidelll; interessant ist die Verb reitung des Ortsnamens in der gesamten iranischen Region. 24 Vgl. D. Wilber, »The Timurid Court: Life in Gardens and Tents«, in Iran, 17, 1979, S. 127-133. 25 Vgl. J. Augin, »Comment Tamerlan prenait les villes«, in Stl/dia Islalllica, 19, 1963, S.92-93. 26 D. Wilber, Persia II Garde/lSoo., cit., S.67. 27 Vgl. Fazil Haravi, Irshad al-Ziraa, hg. von A. Najm al-Dawla, Teheran 1904-05; I. Afshar, »Fihristname-yi ahamm-i mutun-i Kishavarzi dar zahan-i farsi«, in AYallde, VIl!, 10-11, 1983-84, S.686-694 und 810-814; J. J akobi, Agriw/ture between Literary Tradition alld Firsthand Experimce, in Tililt/rid Art ... , cit., S.201-208. 28 G. Pugacenkova, Zodcestvo ... , cit., S. 98. 29 R. Pinder-Wilson, op.cit., Abb. 8. 30 M. Alemi, »Chahar Bagh«, in journal of the Islamic Elwironlllflital Design Research Cmtre, 1, 1986, S. 44. 31 Das Manuskript tragt die Signatur M. 1950; vgl. M. Aga Oglu, »The Landscape Miniatures of an Anthology Manuscript of the Year 1398«, in Ars Islalllica, 1936, S.77-78; B. Gray, La peintl/re persalle, Genf 1961, Ab. S. 68. 32 H. Corbin, Corpo spirituale e terra celeste, Mailand 1986, S.274 Anm. 71.
248
33 Vgl. Scharaf ai-din Ali Yazdi, op.cit., Band II, S.14-15. 34 Vgl. M. Barbier de Meynard, »Extraits de 10 Chronique persane d'Herat traduits et annotes par M. Barbier de Meynard«, in jOl/mal Asiatiql/e, XVI, 1860, S.461-520; XVII, 1861, S.438-522; XX, 1862, S. 268-319. 35 Vgl. 1. Golombek, The Tilllllrid Shrille at Gazur Gah, Toronto 1969, S.104-105. 36 M.E. Bertel's, Navoi, Moskau-Leningrad
1948. 37 Vgl. R. Pinder-Wilson, op.cit.; vgl. auch A. U. Pope, Ph. Ackerman, »Gardens«, in A SUrlley of Per sial 1 Art, Oxford 1939. 38 D. Fairchild Ruggles, »The Mirador in Abbasid and Hispano-Umayyad Garden Typology«, in Muqamas, 7,1990, S. 73-82. 39 Vgl. G. Necipoglu, Architectl/re, Cerelllonial, OIld Power - The Topkapi Palace ill the FifteCllth and Sixteetlih Cet1turies, CambridgeLondon 1991, S.212-217. 40 Vgl. G. Pugacenkova, Zadcestvo ... , cit., S.42. 41 Vgl. G. Goodwin, A History of Ollomall Architecture, London 1971, S. 136-137. 42 Vgl. Abu Ali Muhammad Bal'ami, Tarikh-i Tabari, Tarjullla, hg. von M.J. Mashkur, Teheran 1958, S. 305. 43 E. Cohn-Wiener, »An Unknown Timurid Building«, in Burlillgto/i Magazille, CCCLXXXVII, 1935, S.272-277. 44 Vgl. A. Briggs, »Timurid Carpets - II Arabesque and Flower Carpets«, in Ars Islamica, 11-12, 1946, S. 146. 45 M. Bernardini, »L'esposizione di tessuti durante importanti cerimonie nel periodo timuride«, in Quademi di Storia, 29,1989, S. 105-109.
I }
II
, I 1 f ,
Die Garten cler Moguln in Kaschmir Attilio Petruccioli
»Kaschmir ist ein Garten des ewigen Fruhlings, ein Schatzhaus fur den Palast des Konigs. Ein uppiger Blumenteppich, ein Vermachtnis, das den Glaubigen das Herz aufgehen lafk Die Schonheit seiner Wiesen, der Zauber seiner Kaskaden entziehen sichjeder Beschreibung. Zahllos sind die Quellen und Sturzbache. Wohin man den Blick wendet, sieht man Wasserlaufe in einer grunen Landschaft. Die rote Rose, das Veilchen und die Narzisse wachsen wild; im Feld stehen aIle Arten von Blumen und duftenden Krautern. Ein Fruhling, der das Gemut erhebt, bringt Hugel und Niederungen zum Bluhen. An Mauern, Toren, Hofen und Dachern leuchten die Tulpen gleich Fackeln, die ein Bankett verschonern. Was konnten wir noch weiter sagen von diesen Dingen, von diesen endlosen Wiesen und vom wohlriechenden Klee?«l Mit diesen Worten ruhmt Jahangir in seinen Erinnerungen den prachtigen Anblick des Tals von Srinaga~, dem seine lebenslangliche Liebe galt und in dem er deutliche Zeichen seiner Begabung als Schopfer von Gartenanlagen hinterlassen hat.
Das Tal von Kaschmir ist mit den umgebenden Bergen etwa 170 Kilometer lang und his zu 60 Kilometer breit; es hat die Form eines Ovals und entspricht der Niederung des Flusses Vitasta, des heutigen Jhelum. Seine politische und sprachliche Einheit verdankt es der isolierten Lage und besonderen Geographie: Eine fruchtbare Aufschuttungsebene, umgeben von hohen Gebirgsketten und beherrscht von den Mahadeo-Bergen, in der sich ein Reich entwickeln und eine Kultur entfalten konnte. Die Hohe von 1500 m uber dem Meeresspiegel und die geschutzte Lage halten die qualende Hitze Indiens ebenso wie die grimmige Kalte der Himalajaregionen fern. Die Abgeschiedenheit hat es einer konservativen Gesellschaft ermoglicht, sich ihre archetypischen Merkmale ungeachtet der politis chen Wechselfalle und der Konversion zum Islam zu bewahren.3
Die Hauptstadt Srinagar, im Zentrum des Tals am FluiS Jhelum gelegen, ist Schauplatz eines regen Austauschs von Waren, die per Schiff transportiert werden, und verfugt mit den Seengebieten des Dal und des Anchar uber ein weites und fruchtbares Hinterland.
Ein Plan des 18.Jahrhunderts, den das MaharajaJai Singh II Museum in Jaipur bewahrt4
, zeigt die von zahlreichen Kanalen durchzogene Stadt. Von einem schmalen Festlandstreifen abgesehen, auf dem sich der Berg Haraparbat erhebt5, ist sie auf drei Seiten ·von Wasser gesichert: vom FluiS, vom Sumpfgebiet des Anchar-Sees im Westen und vom Dal-See im Osten. Unten erkennt man das Knie des Tsunth Kul oder Mar, des von einem durchgehenden Schutzdamm (setu) begleiteten Kanals, der den FluiS mit dem See verbindet. J enseits des Kanals liegen hintereinander die Quartiere Bardimar, Balandimar und Khandabavan, wo sich der antike vihara (ein hinduistisches oder buddhistisches Kloster) von skandabavana befand und heute der ziyarat (das islamische Heiligtum) Pir Muhammad Basur steht. Reste des Klosters wurden noch im vergangenen Jahrhundert als tirtha (heilige Quelle) verehrt. Auch der Ort des Zusammentreffens von Kanal und FluiS auf
249
der Hohe des Schergarhi-Palastes, Marisamgana genannt, gilt vonjeher als ein tirtha und dient heute als Statte von Funeralzeremonien. Am linken Ufer zweigt ein Kanal in Richtung des Khatul-Quartiers ab, der hinter der letzten Brucke den FluiS erreicht und den Booten als Abkurzungsweg dient. Weiter westlich wird die Stadt durch den DudhgangafluiS gesichert, der von den Hohen des Pir Pantsal herabkommt; der Ort, an dem er mit dem Jhelum zusammenflieiSt, gilt den Hindus als heilig. Am rechten Ufer erkennt man das Rechteck desJami Masjid, der Freitagsmoschee, die in ihrem Innern zahlreiche Dberreste alterer Bauten - hinduistischer Tempel - birgt. Diese kurze Beschreibung6
macht deutlich, dafS Srinagar fur die Hindus ein ksetra ist, ein »Feld« heiliger Statten, die durch Ritualwege (jatra) hierarchisch miteinander verbunden sind?
Ganz Indien ist von den vier Ecken des Subkontinents und bis hinunter zu den einzelnen Stadten in dieser Weise - durch heilige Orte und heilige Wege - strukturiert, wobei die Praxis der rituellen Begehung in jeder der Zonen eine Hierarchie der Pilgerwege und Pilgerorte begrundet hat.
Diese hierarchischen Systeme stellen sich urn so deutlicher dar, je kleiner das Areal ist, das sie einnehmen, und je mehr Gewicht ihren nichtraumlichen, also sozialen und ideologischen Aspekten zukommt. Man kann sich das vielleicht an der Vorstellung einer Folge konzentrischer Ringe klarmachen. Der kleinste Ring, die Stadt - und Srinagar macht insoweit keine Ausnahme - ist so lokalisiert, dafS die umliegenden topographischen Punkte die Sakralitat des Ortes verkunden und verstarken. 1m folgenden solI versucht werden, den heiligen BezirP rund urn Srinagar oder, besser gesagt, die signifikanten Punkte abzuwandern, die seinen limes ausmachen.
Die bedeutendste Erhebung im Suden ist der Takht-i Sulayman, der an eine Pyramide erinnernde Salomonsberg, auf dessen Gipfel sich Reste eines Hindutempels befinden, in dem wahrscheinlich der Kult des Schiwa-Jyestheshvara zelebriert wurde. Heute wird am FuiS des Berges, bei der knapp zwei Kilometer ostlich liegenden Quelle von Yether, ein gleichnamiger linga (phallisches Kultbild, Symbol des Schiwa) verehrt.9 Weiter ostlich liegt zwischen Garten und Rebfeldern die Ortschaft Thid, das im Radschatarangini erwahnte Theda. Abul Fazl beschreibt den zauberhaften Ort, »an dem sich sieben Quellen vereinigen; rundherum steinerne Gebaude, Erinnerung an vergangene Zeiten«.l0 Die dann folgende kleine Ansiedlung Bran ist wohl als das antike Bhimadevi zu identifizieren. Der tirtha ist nicht mehr vorhanden, man kann ihn sich aber bei der Dampor-Quelle denken, an der spater ein muslimisches Heiligtum entstand.
Sehr beruhmt und bedeutend ist der Ort Ishabar in der Nahe des Mogulgartens Nischat; an den zum See abfallenden Steilhangen dieser Ansiedlung, die der Durga, der Frau des Schiwa, geweiht ist, finden sich zahlreiche Pilgerziele. 11 J enseits des Schalimar-Gartens erreicht man die Sind-Ebene mit der Ortschaft Ranyil und der gleichnamigen
Srinagar und seine Seen auf einer Karte vom Anfang des 20. und auf einem Leinwandplan des 18.Jahrhunderts aaipur, MaharajaJai Singh II Museum). Die auflermaflstabliche Darstellung zeigt den Kranz der Garten rand um den See; im Zentrum die Pestung Haraparbat mit dem Palast der Moguln.
Quelle. In den Verzweigungen des Flusses nordlich vom Dal-See liegt Zukur, dessen Heiligttimer und Grabmaler wahrscheinlich aus den Dberresten eines ehemaligen vihara erbaut wurden. Der ziarat Farrukhzad Sahib im Ort Amburher ist wahrscheinlich tiber einem alteren Schiwa-Tempel errichtet. Drei Kilometer weiter, in Richtung Srinagar, liegt inmitten von NuEp£lanzungen der groEe Ort Vicar Nar, im Monat Caitra (Marz/ April) wegen des hier aufbewahrten Kultbildes einer heiligen Schlange (naga) ein beliebtes Pilgerziel. Westlich von Vicar Nar tauchen die Dberreste dreier Hindutempel auf, die heute als ziyarat und Grabbauten dienen.12 In einem tiefen Fjord des Dal-Sees stOEt man auf den Ort Sudarabal, in dem einst die Sodara-Quelle sprudelte. Neben der Moschee des Ortes befinden sich zwei Wasserbecken, die von perennierenden Quellen gespeist werden. Wenige hundert Meter weiter westlich erhebt sich das bekannteste muslimische Heiligtum von ganz Kaschmir, Hazrat Bal, in dem, wie es heiEt, ein Haar vom Bart des Propheten aufbewahrt wird. Hazrat Bal steht an der Stelle eines ehemaligen Gartens, der, wie Stuart-Villiers erkannt hat, vermutlich ebenfalls aus muslimischer Zeit stammt.
13
Alle diese Punkte ergeben zusammengenommen eine gebrochene Linie, den limes dieses heiligen Bezirks, der sich erstaunlicherweise nicht tiber den Gebirgskamm hinaus erstreckt, sondern, am FuE der Berge verlaufend, die Grenze des bestellten Territoriums markiert und so die ktinstliche Welt der Nutz£lachen, Rebfelder, Kanale und schwimmenden Garten von den Stimpfen und Waldern trennt. Nicht zufallig erscheint der ksetra in der brahmanischen Vorstellungswelt immer in der Gestalt eines eingefriedeten Gartens.
Diese Linie begrenzt einen im wesentlichen aquatischen Bereich: »Die Gotter begeben sich an die Orte, die Wasser und Garten besitzen«, heiEt es im Bhavisya Purana (I.CXXX, 10). DaE es in der Nahe von Quellen schon in vorislamischer Zeit regelrechte »gebaute« Garten und nicht nur offene parkartige Landschaften gab, ist nicht sicher, aber doch vorstellbar, denn der gleiche heilige Text verktindet wenig spater (I.CXXX, 15): »Die Gotter wohnen in der Nahe von Waldern, Bergen, Fltissen und Bachen sowie in den Stadten, die voller Garten sind.« In der Kadambari von Banabhatt aus dem 7. Jahrhundert ist im Zusammenhang der Beschreibung eines Gartens von den Vorrichtungen zur Hebung und zum Transport von Wasser sowie von Kanalen und Badebecken die Rede. 1m Radschatarangini erwahnt Kalhana einen Garten, den der Konig Jaysingh im Jahre 1150 in Kaschmir anlegte
(VII,3360). Die Vorstellung ist also durchaus zuiassig, daE sich am Ufer Garten
aneinanderreihten, die in ihrer Anlage sehr verschieden waren und zuweilen in das Gewebe der auf dem See schwimmenden Nutzflachen tibergingen 14: eine totale Synthese aus Wasser und Feldbau - eine durchaus einleuchtende Losung, wenn man bedenkt, daE diese Gesellschaft - anders als die muslimische - ja kein dialektisches oder kontrares Verhaltnis zur Natur unterhielt, sondern sich ihr zugehorig ftihlte.
t
1
1
1
1
s
1
t
~
~
r
:1 :1 t
t
l:
e
r, g l,
tl
tl
tl
tl
e
tl
d tl
e
-
Zwei Ansichten des Dal-Sees var dem Haraparbat; Hiiuser und hi:ingende Gi:irten an einem der Kaniile, die die Stadt Srinagar durchziehen.
~ _ ... ... • n..; •
• • Q..' ~ I'~' .., •• • •
i';.
Rekol1struktiol1 des ksetra VOI1 Sril1agar; eingezeichl1et sil1d die ziyarat, die muslimischen Heiligtumer (0), und die thirta (0), heilige Quellen der Hindus (Zeichnul1g Attilio PetrucciolO·
Rekonstruktion des Gartens VOIl Vemag. s j
I
Rekonstruktion des Nischat- und des Schalimar-Gartens (Zeiclmungen Augusto Cusmai und Attilio Petruccioli).
Rekonstruktion des ksetra VOIl Sril1agar; eil1gezeichl1et sil1d die ziyarat, die muslimischen Heiligtiimer (o}) ul1d die thirta (o}) heilige Quellen der Hindus (Zeichl1ul1g Attilio Petruccioli).
Rekonstruktiol1 des Gartens von Vemag.
Rekonstruktion des Nischat- und des Schalimar-Gartel1s (Zeichn ul1gen Augusto Cusmai und Attdio Petntccioli).
253
Die Festung Haraparbat mit dem Palast im 18. Jahrhundert, Detail eines Leinwandplans (Jaipur, Maharaja Jai Singh II Museum).
Unsere Rekonstruktion hat aber noch ein weiteres interessantes Faktum ans Licht gebracht: die topographische Koinzidenz des Heiligen. Das heiBt die heiligen Orte der Hindus wurden nach der islamischen Besetzung zu heiligen Orten der Muslims. Wir konnen die Hypothese aufstellen, daB die islamischen Dynastien bei der Aneignung eines neuen Territoriums die schon immer am jeweiligen Ort verehrten Quellen »ubernommen« und rekonsakriert haben. Diese Kontinuitat wird im ubrigen durch die N omenklatur der Ortsnamen bestatigt, die weiterhin eindeutig sanskritischen Ursprungs sindY
Akbar, der GroBmogul, kam, nachdem Kaschmir dem Kronbesitz zugeschlagen worden war, nur dreimal in diese Gegend; er begann mit der Errichtung seines Palastes in der Festung Haraparbat - Mauerreste und zwei Turen existieren noch heute - und mit der Anlage eines kleinen Gartens, von dem sich nichts erhalten hat. Ein weiterer, am Dal-See gelegener Garten, der mit Akbar in Verbindung gebracht wird, der Nasim Bagh, ist heute ein Platanenwaldchen. Die regelmaBigen Reihen von platanen wurden bereits von Akbars N effen Shah J ahan angepflanzt. Von der ursprunglichen Anlage sind noch Reste der Uferterrassen vorhanden; von den fur einen Mogulgarten unerlaBlichen hydraulischen Vorrichtungen haben sich dagegen keinerlei Spuren erhalten. Der eigentliche N eugestalter des Tals war allerdings Akbars SohnJahangir, ein groBer Kenner und Liebhaber der Natur. Er legte zunachst Hand an den Garten seines Vaters: »Im Palast gab es einen
254
kleinen Garten mit einem PavilIon, in dem mein verehrter Vater haufig gesessen hatte. Er erschien mir unordentlich und zerstort ... Ich befahl ... einem treuen Diener, der mein N aturell kennt, alles zu tun, urn den Garten in Ordnung zu bringen und den Pavillon wiederherzustellen. Dank der Emsigkeit meines Dieners gewann die Anlage binnen kurzem eine neue Schonheit: Er legte im Garten eine in drei Zonen unterteilte quadratische Terrasse an, deren Seiten 32 gaz (etwa 25 m) maBen. Nachdem er das Gebaude repariert hatte, schmuckte er es mit Malereien. Ich nenne diesen Garten Nur-Afza.«16 Auf dem in Jaipur aufbewahrten Plan ist der Palast mit seinen Garten, so wie er sich vor der Zerstorung durch die afghanis chen Herrscher prasentierte, im einzelnen dargestellt.
Am Eingang des Tals, nicht weit vom Banihal-PaB, liegt der von Pinienwaldern umgebene Ort Vernag, in dem der FluB Bihat entspringt. Seine aus der Tiefe aufsteigende Quelle ist seit undenklichen Zeiten einer naga geweiht. Das Projekt des Konigs beschrankte sich darauf, dem Naturphanomen eine geometrische Fassung zu geben: Ein blaues Becken von oktogonaler Form 17, umgeben von einem durchgehenden Portikus, der nur den Blick auf die Berge und den Himmel zulaBt, umgibt den Quelltopf, in dem Schwarme von Karpfen schwimmen. Aus dem Becken flieBt das Wasser zunachst in einem Kanal durch den ebenen Garten, urn dann in einen reiBenden Bach voller Forellen zu sturzen. GroBe Planer entscheiden sich fur das Essentielle:
g
n
1-
:n
:n
1) it Ir
)r
m
t-
;n :h m
he1 n
lal
er le:
Schalimar, der talar des divan-i am; Detail der Kaskade des talar mit den tschini khane; Blick aus dem talar des divan-i am auf die Achse des Gartms; A11Sicht der Parterres.
255
l
Schalimar, Ansicht der Achse des dem kaiserlichen HoJ vorbehaltenen Teils des Gartens; die Fontiinen auJ dem Kanal; zwei Details des plans aus dem Museum von Jaipur: links die heute verschwundenen Giirten in der Niihe des Hazrat Bal, rechts Schalimar Bagh und Nischat Bagh.
e
e
2
einer so ostentativ vorhandenen und damit von vornherein tiberlegenen N atur setzte J ahangir die abstrakte Komposition eines Nodus, einer Linie, einer Flache entgegen.
In Achabal stellte sich als neues Problem, dem von oben herabschieBenden Wasser einer perennierenden Quelle eine Ordnung aufzuzwingen - wer einen Sturzbach in Kaschmir zur Zeit der Schneeschmelze gesehen hat, weiB, was das bedeutet. Die Generationen vorausgegangener Mogulgarten hatten sich immer am kanonischen Modell des theoretisch endlos teilbaren caharbagh orientiert, sei es in der Version des Gartengrabes (Mausoleum des Humayun in Delhi und Mausoleum des Akbar in Sikandra) oder in der des Lustgartens (die Garten Akbars in Fatehpur Sikri). Sie richteten sich also nach einem Gartentyp, in dessen Kanalchen, die haufig schmaler waren als ein Schuh, nur kleinste Wassermengen liefen, ja beinahe standen. Hier wurde die Erinnerung an die Fltisse und Berge Afghanistans ktinstlich beschworen, indem man die Bewegung des Wassers auf der privilegierten Symmetrieachse mit Hilfe zunehmend hoherer Terrassen beschleunigte, dies allerdings unter unverhaltnismaBigen Anstrengungen. Wir wissen, daB Babur in seinem Garten in Dholpur zu diesem Zweck erst einen ktinstlichen Htigel anlegen lassen muBte.
Was J ahangir sich in Achabal einfallen lieB, ist nicht grandios; Monumentalitat wird nicht auf dem Weg tiber die heroische Dimension erreicht, sondern durch Bandigung des narurlichen Elements: Die Wassermassen flieBen gezahmt in ihrem steinernen Bett, bevor sie tiber die cadar - Wasserrampen, deren reliefierte Oberflache das Spritzen und Sprtihen des Wassers zu imitieren scheint - zur nachsten Gelandestufe hinuntersrurzen. Auf seinem Weg abwarts verengt sich der Kanal, so daB der Wasserdruck ansteigt, und schlieBlich vereinigt sich das Wasser mit dem unten flieBenden Sturzbach. Alles andere vollzieht sich sozusagen unauffallig: Die Seitenarme des caharbagh, die gegentiber der Hauptsymmetrieachse keine Existenzberechtigung mehr haben, verschwinden aus der Komposition.
In erster Linie war es allerdings die Gegend urn Srinagar, in der J ahangir und sein Sohn Shah J ahan, von den GroBen des Reiches imitiert, darangingen, das Territorium nach ihren eigenen Vorstellungen umzugestalten.18 Hinsichtlich der Gebaudekomplexe beschrankten sie ihre MaBnahmen auf das, was von den ))GroBen Beschtitzern des Islam« erwartet wurde; den Garten dagegen wandten sie ihre ganze Aufmerksamkeit zu. Dieser Eifer ftihrte nach Aussage der Quellen dazu, daB im Tal nicht weniger als siebenhundert Garten entstanden. Der )heilige Bezirk« von Srinagar erfuhr eine systematische Umgestaltung, und nur die oberflachliche Betrachtung kann darin einen Versuch der Laisierung sehen (Garten und Park gelten nur im Abendland und hier erst seit der Aufklarung als profane und sozusagen )dienende« Bereiche). Hier wurde im Gegenteil der gezielte Versuch unternommen, eine dritte Ebene des Heiligen zu erschaffen, deren Protagonist die Figur des Konigs sein sollte.
Rekonstruktion eines saraparde oder kaiserlichen ZeIt lagers. Von unten nach oben der naqare khane (Vestibul), der divan-i khas oder Audienzraum des HoJs und am Ende der haram (Zeichnung Attilio PetrucciolQ.
257
Axonometrische R k schalimar B h ~ onstntktion des
(z . h ag nut sein B ,(f etc Hung Au usto er ~PJ,anzung
Petruccioli). :g Cusmat und Attilio
258
Axonometrische Rekonstruktion des Nischat Bagh mit seiner BepJlanzung (Zeichnung Augusto Cusmai und Attilio Petrucciol0.
259
/",";l~ t.('1-;\.,..J ..... .... fiJ' ... ~,~.,.,. j
';
.':'
-'"V .r.V ..
" !-,/-"' ,
,I:':'!..-;, / - ?- ,. -~~ ", ·. ~\_3> : ;
--"" "'':s.' .. \~..J r,J.\ J-;;:'.z
Nischat Bagh, Blick von der Stelle des zerstorten Pavillons auf den See und auf den Berg.
260
In einem vielbeachteten Aufsatz uber das Tadsch Mahal hat Begley19 dargelegt, daB die Embleme der Macht die Moguln unablassig beschaftigten und daB hinter allen ihren Bauvorhaben letztlich das Anliegen stand, durch die Gleichsetzung architektonischer Formen mit uberweltlichen Prototypen das gottliche Bild des Konigs zu verherrlichen. Was der orthodoxe Muslim, der Stellvertreter Allahs, nicht deutlich aussprechen konnte, wurde der Metapher des Steins anvertraut. Immer in einem mehrdeutigen Spiel mit dem Begriff des gottlichen und des koniglichen Throns begriffen, verwandelte eine hemmungslose Eitelkeit, unterstiitzt von der Schmeichelei der Hofpoeten, GrabmaIer und Monumente in Symbole von Ruhm und Ehre und erschuf Garten - als Replik des koranischen Paradieses - zu dem Zweck, die Figur des (gottlichen) Weltbaumeisters zu erhohen. »Der Garten ist der Ort der Illusionen«, schreibt Pierre Grimal, »an dem man dem Konig schmeichelt und an dem sich die (ganz und gar imaginaren) Beweise seiner Allmacht haufen«,z°
Ein anderer Aspekt war die groBe Mobilitat des ganzen Hofes, die mit Sicherheit in der langen nomadischen Tradition der TschagataiTurken wurzelte, daneben aber auch von der Notwendigkeit diktiert war, die Prasenz des Herrschers im gesamten Herrschaftsgebiet zu vermitteln, urn auf diese Weise eine ideologische Kontrolle auszuiiben und die Rebellen in Schranken zu halten. Wahrend der Sommeraufenthalte des Hofs in Kaschmir manifestierte sich diese Tradition in einem regen Hin und Her der landesublichen Gondeln (schikara) , in denen der Konig sich vom Palast in die Garten begab, urn die N atur zu studieren (»In jenen zwei oder drei Tagen bestieg ich haufig die Gondel und genoB es, umherzufahren und die Blumen im Phak oder im Schalimar zu bewundern<P) oder langere Expeditionen in die Nebenarme des Jhelum unternahm: eine »analoge« Form des thirtaJatra. In den Garten waren die Quellen gezahmt, und das Wasser floB unter dem Thron des Herrschers (chabutra) hindurch, der ))Destillat der Emanation des Gottlichen Wesens« war, ))Strahl der Sonne, der das Universum erleuchtet; Gegenstand des Buches der Vollkommenheit; Urgrund aller Tugenden«22: Der thirta hatte eine Umwidmung erfahreno Schalimar Bagh liegt am Ostufer des Dal-Sees; dahinter erheben sich schroffe Hugel. Es ist nicht viel platz zwischen den Bergen und der Lagune, welche die Verbindung zum See herstellt. Ein Kanal von anderthalb Kilometer Lange, in diese Lagune eingeschnitten, diente der koniglichen Flotte als Verbindungsweg. Das Terrain fallt nur sehr allmahlich ab, die Terrassen scheinen in der Landschaft aufzugehen. Schalimar ist ein Garten, den man nur Stiick urn Stiick entdecken kann, einen Bezirk nach dem anderen. Ais koniglicher Garten (padsha bagh) orientiert er sich an dem bekannten Schema, bei dem auf die offentlichen Bereiche (divan-i am) zunachst der dem Konig und seinen Vertrauten vorbehaltene halboffentliche Bezirk (divan-i khas) und schlieBlich die privaten Raume (haram) folgen. Dieses Schema findet sich in allen Palasten, aber sein Ursprung liegt eindeutig im timuridi-
r
r
[l
r
n e .r
1.
1,
/) l-
r-
,-n
1-
Nischat Bagh: Blick auf den Berg; ein chabutra mit dem danmter herabstiirzenden Wasser; der Rain des zinane.
261
Nischat Bagh, Blick von der Stelle des zerstorterI Pavillons auf derI See und auf den Berg.
f , .,,·k ~
i' ... ~ ,( " / . 1 .
. 0 -..
• t . • :~.::-: .
In einem vielbeachteten Aufsatz uber das Tadsch Mahal hat Begley19 dargelegt, daB die Embleme der Macht die Moguln unablassig beschaftigten und daB hinter allen ihren Bauvorhaben letztlich das Anliegen stand, durch die Gleichsetzung architektonischer Formen mit uberweltlichen Prototypen das gottliche Bild des Konigs zu verherrlichen. Was der orthodoxe Muslim, der Stellvertreter Allahs, nicht deutlich aussprechen konnte, wurde der Metapher des Steins anvertraut. Immer in einem mehrdeutigen Spiel mit dem Begriff des gottlichen und des koniglichen ThrollS begriffen, verwandelte eine hemmungslose Eitelkeit, unterstutzt von der Schmeichelei der Hofpoeten, GrabmaIer und Monumente in Symbole von Ruhrn und Ehre und erschuf Garten - als Replik des koranischen Paradieses - zu dem Zweck, die Figur des (gottlichen) Weltbaumeisters zu erhohen. »Der Garten ist der Ort der Illusionen«, schreibt Pierre Grim aI, »an dem man dem Konig schrneichelt und an dem sich die (ganz und gar imaginaren) Beweise seiner Allmacht haufen«.20
Ein anderer Aspekt war die groBe Mobilitat des ganzen Hofes, die mit Sicherheit in der langen nomadischen Tradition der TschagataiTurken wurzelte, daneben aber auch von der Notwendigkeit diktiert war, die Prasenz des Herrschers im gesamten Herrschaftsgebiet zu vermitteln, urn auf diese Weise eine ideologische Kontrolle auszuuben und die Rebellen in Schranken zu halten. Wahrend der Sommeraufenthalte des Hofs in Kaschmir manifestierte sich diese Tradition in einem regen Hin und Her der landesublichen Gondeln (schikara), in denen der Konig sich yom Palast in die Garten begab, urn die Natur zu studieren (»In jenen zwei oder drei Tagen bestieg ich haufig die Gondel und genoB es, umherzufahren und die Blumen im Phak oder im Schalimar zu bewundern«21) oder langere Expeditionen in die Nebenarme des Jhelum unternahm: eine )analoge« Form des thirtajatra. In den Garten waren die Quellen gezahmt, und das Wasser floB unter dem Thron des Herrschers (chabutra) hindurch, der )Destillat der Emanation des Gottlichen Wesens« war, )Strahl der Sonne, der das Universum erleuchtet; Gegenstand des Buches der Vollkommenheit; Urgrund aller Tugenden«22: Der thirta hatte eine Umwidmung erfahren. Schalimar Bagh liegt am Ostufer des Dal-Sees; dahinter erheben sich schroffe Hugel. Es ist nicht viel platz zwischen den Bergen und der Lagune, welche die Verbindung zum See hersteUt. Ein Kanal von anderthalb Kilometer Lange, in diese Lagune eingeschnitten, diente der koniglichen Flotte als Verbindungsweg. Das Terrain faUt nur sehr allmahlich ab, die Terrassen scheinen in der Landschaft aufzugehen. Schalimar ist ein Garten, den man nur StUck urn StUck entdecken kann, einen Bezirk nach dem anderen. Als koniglicher Garten (padsha bagh) orientiert er sich an dem bekannten Schema, bei dem auf die offentlichen Bereiche (divan-i am) zunachst der dem Konig und seinen Vertrauten vorbehaltene halboffentliche Bezirk (divan-i khas) und schlieBlich die privaten Raume (haram) folgen. Dieses Schema findet sich in allen Palasten, aber sein Ursprung liegt eindeutig im timuridi-
260
Nischat Bagh: Blick auf den Berg; ein chabutra mit dem darunter herabstiirzenden Wasser; der Hain des zinane.
261
262
Nischat Bagh; Ansicht der Fassade des zinane mit einem der Aussichtstiirme.
Tschischme Schahi; das herabstiirzende Wasser, vom unteren Parterre aus gesehen) und Ansicht der Parterres.
schen Zeltlager, und das bezieht sich nicht nur auf die Anordnung der einzelnen Bereiche, sondern auch auf die Gebaude und ihre Bezeichnung. Der Mogulpalast wurde auch als »steinernes Zeltlager« bezeichner23
, und haufig trat die Realitat an die Stelle der Metapher: In den langen Sommermonaten nahmen die geschorenen Rasenflachen des Gartens die mit roten Ttichern und Vorhangen (saraparde) - Symbol der Krone - geschmtickten koniglichen Zelte auf
Auch im Schalimar war der im Jahre 1619 unter J ahangir angelegte offentliche Bereich mit dem dominierenden talar tiber dem Thron der Schauplatz des darbar, der offentlichen Audienz und Zurschaustellung der gottlichen Abkunft des Konigs. Mit feinem Gesptir ftir die theatralische Wirkung war hier allen Beteiligten ihre genau festgelegte Rolle zugewiesen. »Wenn der Konig auf dem Thron Platz nimmt, werfen sich aile Anwesenden auf die Knie ... Dann bleiben sie an dem ihnen durch ihren Rang zugewiesenen Platz stehen, die Arme verschrankt, teilhaftig des Lichts der Gottlichen Physiognomie ... Der erstgeborene Prinz steht ein bis vier gaz vom Thron entfernt ... Der zweitgebo-rene ... sitzt in einer Entfernung von drei bis 12 gaz.«24 Eine besondere Dekoration und Beleuchtung des dival1-i am erfolgte anlaBlich der Sonnen- und Mondgeburtstage des Konigs, bei religiosen Festen und aus Anla£ militarischer Siege; bei solchen Gelegenheiten wurde auch der ganze See in das Geschehen einbezogen.
Die zweite und die dritte Ebene des Gartens nahmen zwei klassische caharbagh ein, die nach 1630 unter Schah J ahan fertiggestellt wurden. Der erste war dem Herrscher vorbehalten, des sen Thron sich auch hier im Zentrum eines quadratischen Wasserbeckens befand, das von vier riesigen Platanen umstanden war - ein in Kaschmir sehr haufiges Arrangement. Der andere war der caharbagh des zil1al1e, des Frauentraktes, mit dem prachtvollen Schwarzen Pavillon. Der in den Garten geleitete Sturzbach flo£, beschattet von Platanen, in einem sechs Meter breiten Kanal majestatisch dahin. All das beeindruckte im Jahre 1665 auch Franr;:ois Bernier: »Hier nimmt ein gro£artiger Kanal seinen Anfang, der tiber flache Stufen den Garten bis zum Ende durchlauft. Dieser Kanal ist in Stein gefa£t, und in der Mitte steigt eine lange Reihe von Wasserstrahlen auf, aile ftinfzehn Fu£ einer.«25 Die beabsichtigte Wirkung war die eines durchgehenden Bandes aus Wasser, das zerreillt, wenn es von einer Stufe zur anderen springt, um anschlie£end in flache Becken zu fallen. Ober diesen erheben sich abwechselnd in der Mitte oder zu beiden Seiten Pavillons wie Pfahlbauten. Die drei Bezirke des Schalimar bildeten den adaquaten au£eren Rahmen ftir das tagliche Leben des Hofes, das zwar einem sehr starren Ritual gehorchte, in der Nutzung des Raums aber au£erordentlich flexibel war. Die einzelnen Quadranten des Gartens waren zur Zeit Jahangirs mit Obstbaumen in ausgesprochen geometrischer Anordnung bepflanzt; heute zieht man - wie in der Kolonialzeit - eine freiere Anordnung vor.
Jahangir und seine Gartner waren bestrebt, Ordnung in die Natur zu
263
bringen, was bedeutete, da£ sie sich bei der Bepflanzung eines Gartens nach formalen Gesichtspunkten richteten, dies allerdings ohne den Pflanzen in ihren Moglichkeiten Gewalt anzutun. Die Kunst des Baumschnitts hat, wie man wei£, in der Welt des Islam nie eine Rolle gespielt. Pavillons, Mauern, Fu£boden, Kanale, Becken und Wasserspiele - das Wasser war die Primadonna in den Mogulgarten - wahrten ihren Charakter als ktinstliche Ausstattungsstiicke, abgesetzt vom nattirlichen Element der Anpflanzungen und der bltihenden Parterres. Die Lust an der Uneindeutigkeit, an dem, was sich zwischen »vegetabilischer Architektur« und der konstruierten natiirlichen Form (z.B. der Grotte) bewegt und im italienischen Garten des Cinquecento vom Prinzip der »Kunst als Imitation der Natur« diktiert war, konnte im Mogulgarten nicht aufkommen und ware an einem Ort, an dem Geometrie, Symmetrie und Proportion das Gleichgewicht zwischen dem Menschen und der gottlichen Ordnung garantierten, ganz unsinnig gewesen.
Der Nischat Bagh liegt unmittelbar am Dal-See. Man erreicht ihn von einer Seeschleife her, in der das Wasser besonders klar ist. Die Situation ist heute allerdings durch den Bau der modernen Stra£e verandert und die Oberraschung bei der Landung nicht mehr so gro£ wie einst, als die Flucht der Treppen, die jahrhundertealten Platanen und die Silhouette der Berge in diesem Ensemble sich im Wasser des davorliegenden Sees spiegelten. Die sehr akzentuierten und durch die cadar, chabutra, Treppen und Dekorationselemente noch besonders markierten Gelandesprtinge sowie die majestatischen Platanen wollen eine Monumentalitat bewirken, wie sie in den anderen Garten nicht gesucht wurde. Was dieser Planung zugrunde liegt, ist der Gedanke der endlos sich hinziehenden Trasse, ein barockes Prinzip; die Terrassen -zwolf wie die Zeichen des Tierkreises - scheinen sich zu einer einzigen gro£en Treppe zu vereinigen. Die ganze Komposition ist eindeutig von der Zentralperspektive beherrscht, die in Indien seit dem Ende des 16. J ahrhunderts durch die Heiligenbildchen der Missionare bekannt war, hier als Metapher jenes in Etappen erfolgenden Pilgerzugs, den die Herrscher und ihr Gefolge alljahrlich unternahmen, tim der trockenen Hitze von Lahore zu entgehen. Einer weisen Choreographie folgend, die allerdings im gleichzeitigen Tadsch Mahal von Agra ebenfalls befolgt wird, endet der Weg abrupt an der sechs Meter hohen, mit Nischen und zwei Ecktiirmen auf oktogonalem Grundri£ geschmtickten Fassade des z il1al1e. Sichtachse und Laufachse treten auseinander: die letztere, urn 90 Grad gedreht, wird deklassiert. Die wenigen Baume auf den von einem harten Licht getroffenen unteren Terrassen stehen ftir die Landschaft der Ebene; weiter oben wird die Bepflanzung allmahlich immer dichter, um auf der Hohe des zil1al1e gleichsam ein geschlossenes Bataillon zu bilden, einen Hain, frisch wie das Paradies, in dem das Licht nur noch mit Mtihe seinen Weg durch das Laubwerk findet.
Der Tschischme Schahi Bagh oder Garten der koniglichen Quelle,
von Schah J ahan im Jahre 1632 angelegt, ist nach tiefgreifenden U mgestaltungen zum Teil in seinem Charakter verandert. Der Garten hat die Form eines Rechtecks und besteht aus drei Terrassen. Ober der Quelle erhob sich schiitzend ein ayvan, dessen bffuung auf den See gerichtet war. Das Wasser speiste, von Terrasse zu Terrasse fallend, mehrere Becken und passierte einen Pavillon im Kaschmirstil. Ein von Mi£verstandnissen getragenes Restaurierungskonzept hat vor wenigenJahren zum Abbruch aller spateren Bauten gefiihrt: So ist zusammen mit dem Pavillon des Tschischme Schahi auch der baradari am Eingang zum Nischat Bagh verschwunden.
Ein wiederkehrendes Thema in der Mogularchitektur ist das der Wasserfront des Gartens. Es ist im Laufe der Zeit unterschiedlich geli::ist worden. Die ummauerten caharbagh, die den kiinstlichen See in Fathepur Sikri begleiten, scheinen einen Zusammenhang mit dem Wasser von sich weisen zu wollen. In der Nahe des Ajmer-Tors steht allerdings ein merkwiirdiges Gebaude, das den Namen Kush Khane tragf6, ein auf einem Sockel stehender oktogonaler Pavillon mit umlaufender Galerie, und ein Fresko im Khawbagh von Fathepur Sikri zeigt Hi::iflinge in einem Boot, das mit vollen Segeln fahrt. Aus dem Fenster des erwahnten Gebaudes blickt man auf den endlos sich hinziehenden Grund des einstigen Sees, der heute als Kulturland geniitzt wird. Der Reisende unserer Tage fragt sich, wie es mi::iglich war, in dieser Gegend zu segeln. Aber wenn er seine Phantasie anstrengt, kann er das Wasser, dessen Stand von der Schleuse von Tehra Mori reguliert
wird, bis zum einstigen Pegel steigen sehen, kann erkennen, wie es den Kush Khane - eine Art steinerner Insel - umgibt, und sich die Boote
. des Ki::inigs vorstellen, die hier anlegen.
264
In Agra, am linken Ufer der Jumna, liegt eine Reihe von Garten zwischen dem Flu£ und der freien Landschaft, beginnend im Norden mit Baburs Ram Bagh.27 Diese Gegend wurde Kabul genannt, und die Brisen, die vom Flu£ her wehten, bescherten den Bewohnern die Illusion der Berge und der kiihlen Luft Afghanistans. Die Uferseite der Garten lag urn einige Meter erhi::iht; irnmerhin aber konnten Boote hier festmachen.
In Ajmer, am See Sagar, lie£ Schah J ahan das Terrain absenken und das Ufer mit prachtvollen marmornen Pavillons schmiicken. In Amber dehnt der auf Substruktionen angelegte Garten das Terrain kiinstlich auf das Gebiet des Sees aus: Ohne Umfassungsmauern wirkt er wie ein auf dem Wasser schwirnmendes bliihendes Parterre.
Der Dal-See ist reguliert, so da£ keine Oberschwemmungsgefahr besteht. Hier ist das Thema der Wasserfront im Sinne der Kontinuitat geli::ist: Die Terrassen erstrecken sich fast bis an den Saum des Wassers, und die gro£en Torbi::igen (pischtaq) markieren einerseits den Obergang vom See auf das feste Land und sind andererseits »das Tor zum Was-ser«.
In den letzten zweihundert J ahren wurden viele Garten zu N utzgarten umfunktioniert oder, noch schlimmer, einer allzu vitalen N atur iiberlassen. Heute breiten sich Schilf und Gestriipp zu Seiten einer
:n
te
:n
:n
le
le
er te
ld ~r
:h Lll
lr
at :s,
zlr
er
gegenuberliegende Seite: Der hiingende Garten im Ambersee, Rajasthan.
Landschqft in Analogie zum Dal-See auf einer Miniatur der Schule von Oudh (18. Jahrhundert).
modernen Stra8e aus, wo wir uns, wenn wir den in Jaipur aufbewahrten Plan mit der dichten Folge der Garten am Flu8ufer betrachten, eine geschlossene Front von Terrassen, Eingangsbauten und Kiosken vorstellen konnen.
Auf einer Miniatur des 18. Jahrhunderts, die am Provinzhof von Oudh entstanden ist und in den Berliner Staatlichen Museen aufbewahrt wird28, erscheint eine stark perspektivisch wiedergegebene Gartenlandschaft, ein orientalisches Versailles. 1m Vordergrund bezeichnen zwei Pavillons und zwei alte Platanen die Wasserfront eines Gartens; im Hintergrund schlie8t ein gebirgiges Panorama eine regel-
265
ma8ige Folge von caharbagh abo Den gro8ten Teil des Bildes nimmt ein von Gondeln (schikara) belebter See ein. Rechts erkennt man schwimmende Garten. Auf einer kleinen Insel in der Mitte des Sees schutzen vier Platanen einen Pavillon - das traditionelle Schema des caharcinar. Die Darstellung ist stark idealisiert; ich halte sie aber dennoch fur das Souvenir einer Reise in das Tal von Srinagar, ein Dokument, das urn so wertvoller ist, als es von einer Welt und einem Lebensstil zeugt, die nicht mehr existieren.
Die religiose Topographie der Hindu ist ein Forschungsgebiet, das voller Hinweise und Andeutungen steckt und das zu studieren uner-
lamich ist, wenn man die Einstellung der Moguln zur Natur und zur Landschaft Indiens verstehen will. Von den vielen Stichworten, die ich hier nicht berucksichtigt habe, will ich nur eines noch nennen. In der geschlossenen Welt der hinduistischen ksetra spielt das Denken in Analogien eine ganz groJSe Rolle: Die Form des Raums und die Anordnung der signifikanten Objekte im Raum oder auch die Bewegung von einem Objekt zum anderen rufen »per Analogie« einen ksetra groJSeren Zuschnitts und/oder eine kosmologische Konstruktion ins BewuJStsein, die es in der Realitat nicht gibt.
Tatsachlich kommt in der Vorstellungswelt der Moguln etwas ganz Ahnliches vor: Babur erinnert sich in seinem Lebensbericht voll Sehnsucht an die Grassteppen von Samarkand, die in den Garten von Agra und Dholpur niemals sublimiert wurden; und Akbar mag bei seiner Bautatigkeit in Fatehpur Sikri von dem Traum geleitet worden sem, ein Band zur nie gekannten Heimat zu knupfen.
Fur die Moguln bedeutete Kaschmir mit den Gesichtern seiner Landschaft, mit seinem Klima und mit seinen wilden, aber der Bandigung zuganglichen Wassern das Ende des Pilgerweges, die Ruckkehr ins Haus der Vorfahren, das wiedergefundene Paradies.
1 Nur ad-Din MuhammadJahangir, Tlizuki jahallgiri, libers. von A. Rogers, hg. von A. Beveridge, New Delhi 1968, S.143-144. 2 In der Mogulliteratur bedeuten Kaschmir und Srinagar das gleiche, was flir erhebliche Verwirrung gesorgt hat. Srinagar entspricht dem alten S'rinagari, das Kalhana im Radschatarangilli, einem wichtigen Werk der indischen Geschichtsschreibung, als die vom gro~en Aschoka gegrlindete Hauptstadt erwahnt. Sie lag slidlich der heutigen Stadt und wird gewohnlich mit dem Ort Pandrethan gleichgesetzt. Die neue Hauptstadt wurde nach den Chroniken vom Konig Pravarasena II gegrlindet, der sie Srinagar oder Pravarapura nannte. N ach der muslimischen Eroberung imJahre 1320 hie~ die Stadt Kaschmir. Mit dem Beginn der Herrschaft der Sikh im 19.Jahrhundert nahm sie erneut den ursprlinglich sanskritischen Namen an. Kaschmir kommt vom sanskritischen Kaschmira, das im Prakrit zu Kaschwir wurde und von Ptoleomaus, dem Gesandten Alexanders des Gro~en, zu Kaspira transkribiert wurde. 3 Zur Geographie siehe EDrew, The jummoo and Kashmir Territories. A Geographical Account, Graz 1976, Kap. VII-X, und W. Hamilton, A Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan and Adjacent Coulltries, Neudruck Delhi 1971, S. 504ff. 4 Nr.120 des Museumskatalogs. Der Leinwandplan mi~t 280 x 223 cm und zeigt in der Mitte den Dal-See, oben die Stadt mit der Festung und ferner zahllose Garten ausder Epoche der Mogulkaiser, allerdings oh-
ne ihre Namen zu nennen. Der Zeichner hat seine Aufmerksamkeit vor all em dem Wasser zugewandt und eine Art aquatischen Mikrokosmos dargestellt. s Nach der Legende zeigten Damonen dem Konig Pravaresvara von dieser Stelle aus den Ort, an dem er seine neue Stadt grlinden sollte. Der Felsbrocken am Fu~ des Hligels wird seit alter Zeit als physische Manifestation des Ganescha, eines Sohnes des Schiwa, verehrt. Nicht weit davon entfernt erheben sich der ziarat des Bahau-d din Sahib, der aus dem Material eines antiken Tempels errichtet wurde, und der J ami Masjid. 6 M.A. Stein hat eine - allerdings nur partielle - wissenschaftliche Rekonstruktion der tirtha von Srinagar und Umgebung versucht. Siehe M.A. Stein, »Memoir on Maps Illustrating the Ancient Geography of Kasmir«, in journal of the Asiatic Society of Bellgal, 2,1899, S.147ff. Abul Fazl Allami, der Biograph des Mogulkaisers Akbar, zahlt in der gesamten Region 45 Mahadewa-, 64 Wischnu-, drei Brahma- und 22 DurgaHeiligtlimer, ferner 700 Orte, an denen Schlangen - Objekt der Verehrung - im Bild dargestellt waren. Siehe Abul Fazl AIlami, The Ain-i Akbari, libers. von H. S. Jarrett, Neudruck Delhi 1978, Band II, S.352. Im Museum von Srinagar werden 250 Plane von tirtha aufbewahrt. Sie stammen aus einem Manuskript des Pandit Sahibram, der 1872 starb. 7 Der Sanskrit-Ausdruck tirtha-jatra steht flir den Besuch der heiligen Statten nach
266
einem vorgegebenen Plan. Eine interessante Parallele ergibt sich im Tal von Kathmandu, dessen Bevolkerung zum gro~ten Teil aus Hindus und Buddhisten besteht. N ach Gutschow, der sich mit den religiosen Festen in Kathmandu und Bhaktapur beschaftigt hat, verleihen die Prozessionsriten den von der Prozession berlihrten Orten eine bestimmte Bedeutung. Es dlirfte sich urn eine Art wechselseitiger Sinnzusicherung zwischen dem Ritus und dem jeweiligen Ort handeln. Zugleich leistet der Deambulationsritus eine "Zusammengruppierung« ansonsten unverbundener Orte zu einer Einheit. Siehe N. Gutschow, FtlnC
tions of Squares in Bhaktapur, Ritual Spaces in bldia: Studies in Architectural Alltlzropology, hg. von]. Pieper, London 1980; ders., Kathmalldu. Symbolik der Stadt ill Raum lind Zeit, in Stadt lind Ritual, hg. von N. Gutschow und Th.Sieverts, Darmstadt 1978. Die »Zusammengruppierung« flihrt gelegentlich noch weiter, namlich zur Abgrenzung eines hei" ligen Bezirks, ahnlich den in den Tafeln' von Gubbio beschriebenen IllstratiOlles. Siehe R. Herdick, Stadt lind Ritllal. Am Beispiel der Newarstadt Kirtipur, Mlinchen 1988. 8 Entsprechend etwa dem Haram rund urn Mekka oder - in Europa - zum Beispiel dem Sacri Monti von Varese. 9 Die Entfernung zwischen tirtha und Tempel ist nicht gro~er als diejenige zwischen dem Lalitaditya-Tempel in Martand und der heiligen Quelle, der er geweiht ist. Man kann also schlie~en, da~ die zwei Orte am Salomonsberg dem gleichen Kult dienen. 10 Abul Fazl, op.cit., II, S.361. 11 Der tirtlza von Isabar wird in allen im Kaschmir entstandenen Texten als ganz besonders heilig beschrieben; er wird von den Frommen aufgesucht, die ihr Ende nahe glauben. Die gro~te Attraktion des Ortes ist eine Quelle mit N amen Guptaganga, die ein antikes Wasserbecken im Zentrum des Ortes speist. 12 Zu diesen Ruinen siehe H.H. Cole, Illustrations of Ancient Bllildings ill Kashmir, 1869, S.31. 13 C. M. Stuart-Villiers, Gardens of the Great Moguls, Neudruck Delhi 0.]., S. 160-161.
14 Bei den sogenannten floating gardetts auf dem Dal-See handelt es sich urn klinstliche Garten. Sie bestehen aus Erde und Humus, die auf gro~e Seerosenblatter gehauft werden. Das Ganze wird von unten mit einem dlirren Zweig wie von einer Hutnadel zusammengehalten. Da sie transportabel sind wie Frachtkahne, werden diese »Garten« zuweilen gestohlen. IS Viele Ortsnamen enden auf -pur, -mar, -khot; Namen von Seen und Sumpfgebieten auf -sar, -Ilambal, -nag; N amen von Fllissen und Bachen auf -kul und -khall. 16 Jahangir, op.cit., II, S. 150. 17 Das Oktogon erfreute sich in Indien seit der Herrschaft der Lodi (1450-1526) einer anhaltenden Beliebtheit; Grabbauten, Kioske und andere einzeln stehende Gebaude waren haufig als Oktogone ausgebildet. 18 Lo specclzio del principe. Mecenatismi paralleli: Medici e mogul, hg. von D.Jones, Rom 1991; ferner, a.a.O., mein Aufsatz »La citta come teatro: Note in margine all'urbanistica delle grandi capitali moghul dei secoli XVI e XVII«, S. 63-75. 19 W. Begley, »The Myth of the Taj Mahal and a New Theory of Its Symbolic Meaning«, in Art Bulletin, Marz 1979, S. 7-37. 20 P. Grimal, »Jardin des hommes, Jardin des rois«, in Traverses, 5/6, 1976, S. 71-72. 21 Jahangir, op.cit., II, S.150. 22 Abul Fazl, Akbarnama, 3 Bd., Calcutta 1877-86, Band I, S. 18. 23 A. Petruccioli, Fa thpur Sikri, Citta del sole e delle acque, Rom 1988, S.20-21. 24 Abul Fazl, op.cit. 2S E Bernier, Travels ill the Moghul Empire: A.D. 1656-1672, Neudruck New Delhi 1972. 26 Eine von mir angefertigte Aufnahme des Kush Khane ist publiziert in A. Petruccioli, Fathpur Sikri, op.cit. 27 E. Koch, »The Zahara Bagh (Bagh-i J ahanara) at Agra«, in Elwirollmelltal Desigl', 1986, S.30-37. 28 Die Miniatur tragt einen sehr allgemeinen Titel (»Seen und Garten«), ist 1770-87 datiert und gehort in ein Album, das in den Staatlichen Museen in Berlin aufbewahrt wird (Kat. MIK 50053).
Glossar
a: arabisch k: kaschmiri p: persisch s: urspriinglich SanskritAusdruck, ins Urdu oder Hindi emgegangen t: rurkisch
Agdal (a) groBes mit Nutzbaumen besetztes Areal auBerhalb der Stadt.
Andaruni (P) privater Bereich einer Residenz.
Anguristan oder Anguri bagh (P) Rebgarten.
Aramgah (p) »Ort des Ausruhens«; Schlafraum oder RuhepavilIon des Mogulkaisers. Auch als khwabgah bezeichnet.
Arsa (a) Lustgarten. In Marrakech: kleiner Obst- oder Gemiisegarten oder Garten innerhalb der Kasba. In Fez: alle Garten innerhalb der Mauern.
Ayn (a) Brunnen, Quelle.
Ayvan oder Iwan (p) Ausdruck mit mehreren Bedeutungen. Bezeichnet u. a. einen gewolbten, auf drei Seiten ganz geschlossenen, auf der vierten Seite ganz geaffneten Raum; auch: Eingangsbau zum Garten; auch: zur Halle erweiterter Monumentalbogen.
Bagh (P) Garten; siehe auch caharbagh; baghce.
Baghban (P) Gartner.
Baghce (P) Beet; kleiner Garten.
Balakhane (P) Loggia iiber dem Eingang zum Garten; Torpalast.
Ba'oli (s) unterirdischer Brunnen.
Bahr (a) See.
Baradari (P) »mit zwolfEingangen«; Pavillon auf rechteckigem oder quadratischem GrundriB mit dreifacher Arkade oder Kolonnade aufjeder Seite; allgemeiner: Sommerhaus.
Bihischt (P) Paradies.
Birka (a) Speicher, Zisterne.
Buhayra (a) Schwimmbecken, Wasserbecken; bewasserter (Nutz)garten.
But] (P) Turm, gewohnlich Bestandteil einer befestigten Anlage.
Bustan (P) Garten (allgemeiner Ausdruck), bestellter Garten, groBer Obstgarten, Anpflanzung.
Buyutat (P) Wirtschaftsgebaude einer herrscherlichen Residenz.
Cadar (P) Wasserrutsche.
Caharbagh (P) viergeteilter Garten (wortlich »vier Garten«).
Caharcil1ar (P) typische Anordnung aus vier platanen an den Eckpunkten eines Quadrats, durch die das Zentrum standig beschattet wird. Haung in Kaschmir anzutreffen.
Cahartaq (P) architektonisches Element auf quadratischem GrundriB mit zentraler Kuppel.
Caman (P) Feld.
Car su (p) offe~er platz mit vier Bogen (oder Emgangen) am Kreuzungspunkt zweier BasarstraBen oder im Verlauf einer BasarstraBe.
Cawgal1 bazi (P) Polo spiel.
Chabutra (s) erhohte Plattform.
Chattri (s) kleiner iiberkuppelter Kiosk; auch Baldachin.
DaJtarkhal1e (P) Archiv oder Verwaltungsgebaude einer herrscherlichen Residenz.
Dar (a) Haus, Wohnung.
Darbar (P) offentliche Audienz des Mogulherrschers.
Dargah (P) in Indien Statte der Verehrung eines heiligen Muslims (sun), bei den Moguln bezeichnete der Ausdruck den kaiserlichen Hof.
Dar-ul shaJa (P) Hospital.
Darvaze (P) Eingang, Tiir.
Daryace (P) kleiner Teich.
Dawlab (a), na'ura (a) Rad zum Heben des Wassers, auch »persisches Rad« genannt.
Dawlatkhal1e (P) Komplex der koniglichen Residenz.
Dival1-i am (P) Raum der affentlichen Audienzen.
Dival1-i khas (P) Raum der Privataudienzen.
Dival1khal1e (P) Audienzsaal.
Driba (a) enge Stelle, Winkel, im Winkel gefiihrter Hauseingang.
Farsakh (P) persisches EntfernungsmaB, entspricht 6 km.
Favvare (P) Wasserstrahl.
Firdaws (P) Paradies.
Fiskiyya (a) Zisterne, groBes Bekken.
268
Foggara (a, Berberausdruck) unterirdischer Bewasserungsbnal, in Persien als qanat bezeichnet.
Funduk (a) Herberge.
Gaz (P) LangenmaB der Moguln. Auch als zar' bezeichnet. In der Architektur wurde vor allem mit dem unter Akbar eingefiihrten gaz-i ilahi gerechnet, der 81-82 cm betragt.
Ghadir (a) Teich, Kanal, Bach.
Guldaste (P) »BlumenstrauB«, Fiale, die in der Regel in einem floralen Motiv endet.
Gulistal1 (P) Rosengarten.
Gushvar (P) Seitliche Teile der Loggia.
Hadika (a) Von Gebauden oder von Beeten umgebener Garten, Palmenhain.
Hammam (a) Bad, Badehaus; besteht gewohnlich aus mehreren Raumen fiir die verschiedenen Phasen der Badeprozedur. Der hammam hat im Gegensatz zum romischen Bad in der Regel
kein Jrigidarium. Die drei Hauptraume des hammam bei den Moguln sind der rakht kan (Ausund Ankleideraum), der sard khal1e (Kaltbad) und der garm khal1e (Warmbad).
Haram (a) privater Bereich einer Wohnstatte.
Hascht Bihischt (P) »acht Paradiese«, PavilIon mit Flachdach, des sen Grundflache in neun Gevierte eingeteilt ist.
Hawz (a) Becken, Zisterne, Bassin, kiinstlicher See.
Hawzkhal1e (P) Raum mit einem Becken.
Haveli (s) Komplex von Wohnbauten mit einem oder mehreren offenen Hafen, haung auf mehreren Ebenen. Der Ausdruck bezeichnet nichtherrscherliche Residenzen.
Hayr (a) Gartenpavillon. In Spanien PavilIon aus der Epoche der Omayyaden im Binnenbereich eines Palastes oder Kiosk in einem Privatgarten.
Idgah (a) Statte fiir das Gebet im Freien anlaBlich des islamischen Id-Festes.
Imam (a) »Fiihrer«, »Vorbild«, Vorbeter in der Moschee.
Imarat (a) Gebaude, Palast, Wohnbau, Gartenpalast; Synonyme: koshk, kakh, qasr, saray.
Imarat-i sardar (P) Vestibiil.
Iram (P) Paradies.
Iwan siehe ayva11.
Jami (a) Moschee.
Jami masjid (a) Versammlungsmoschee, Freitagsmoschee.
Janal1 al-Jirdaws (P) Garten-Paradies (in Persien); Garten des Paradieses; fruchtbares Tal.
Jal1nat (a) Garten, Paradies.
Jharoka (s) Architektonische Struktur fiir die offentlichen Auftritte des Mogulkaisers.
Jnan (a, Dialektausdruck) groGer Martaba (a) Ebene, Terrasse. Pishgah (P) Sockel. (a, klassisch) erhohte Terrasse Garten; eingefriedeter Oliven- Masjid (a) Moschee. Pishtaq (P) hohes Eingangsportal. oder Rundweg. garten.
Mayazib (a) Bewasserungskanale, Qabaq andazi (P) BogenschieGen. Suq (a, souq) Markt, Marktgasse. Juy (P) Wasserkanal. Rinnsale.
Qal'e (a) Zitadelle. Suratkhane (P) Bildergalerie. Kantara (a) Brucke. Maydan (P) Platz, Feld.
Qasaba (a, kashbah) befestigte Takht oder Takhtgah (P) Platt-Khanaqah (P) Wohnstatte from- Mechouar (a, vom klassischen Stadt, Festung. form, Podium, Thron, Terrasse,
r mer Muslime, Kloster. Ausdruck mashwar) groGer Eh- Esplanade. Kharga (P) Konigszelt. renhof vor einem Palast. Qasr (a) Palast, Pavillon.
Takhtnishin (P) Thronsaal. Kharkar (P) Arbeitsmann, Hand- Mellah (a) furJuden reserviertes Qibla (a) Gebetsrichtung der
Talar (P) Begriff mit mehreren langer. Quartier. Moslems nach Mekka.
Bedeutun~en, u. a. L0tagia mit Khwabgah (P) »Haus der Trau- Mihrab (a~ nach Mekka orien- Qishlaq (t) Winteraufenthalt an Saulenstel ung. 1m sa awidischen me«, Pavillon, der dem Mogul- tierte Ge etsnische einer Mo- klimatisch gemaGigtem Ort. Persien Saulensaal. kaiser als Schlafstatte diente. schee. Qubba (a) Pavillon, Kiosk, haufig Taqche (P) Nische. Khiyaban (P) Allee. Mimar (a) Architekt. von einer Kuppel uberdeckt.
Tarh (P) Projekt. [l
Kos (P) bei den Moguln ubliches Mimar bashi (a) Chefarchitekt. Rasadkhane (P) Observatorium. Thirta (s) heilige Quelle. LangenmaG, entspricht etwa Minar (a) siehe manar. Rawze (P) Mausoleum.
zwei englischen Meilen. Munya (a) Sommerresidenz am Rawdah (a) Nutzgarten.
Thirtayatra (s) Prozession zu den
Ksar (a, Dialektausdruck), qasr Rand der Stadt. heiligen Quellen.
(a, klassisch) Kastell, befestigter Muqarnas (a) Stalaktiten, islami-
Rawze (a) Beet; auch Garten. Tschihil Sutun (P) »Saal der vier-Palast.
sches Architekturornament. Raz (P) Rebgarten. zig Saulen«, wobei »vierzig« fur
Ksetra (s) geheiligtes Areal. Ribat (a) befestigtes Kloster. »viele« steht. Siehe auch dawlat-Mutissadi-yi baghat (P) Obergart- khane und divankhane.
Kul (k) Kanal. nero Riyad (a) Bewasserter Binnen-Tschini khane (P) »Keramikzim-
Kiilliye (a, t) die Gesamtheit der Naga (s) Bild der gottlichen garten mit bepflanzten Parterres. mer«; der Begriffbezeichnet
zu einer Moschee und Stiftung Schlange. Sahn (a), saha (a) Hof einer Mo- kleine Wandnischen, in die man gehorigen schulischen und kari-
Nahr (P) Kanal; der Hauptkanal schee, manchmal mit Baumen. Flaschen, Vasen u. a. stellte. tativen Einrichtungen.
1 Ma (a, p) Wasser.
des Gartens (seine Verzweigun- Sakya (a) Rinnsal, Bachlein, Tschini (P) Keramik, aus Kera-n gen ~onnen a~s {adval oder juy Kanal unter freiem Himmel. mik bestehend.
Madi (P) von einem FluG ab- ezelchnet sem . Salsabil (P) Kaskade. Vihara (s) Kloster. zweigender Kanal. Nakhla (a) Palmenhain. Saniya (a) in Marokko Nutz- Wast ai-dar (a) Mittelpunkt des Ma'il (a) Zisterne. Nakhlistan (P) Palmenhain. garten, Garten. Hauses, Patio.
Madrasa (a) Hochschule fur Namazgah (P) Gebetsstatte. Saraparde (P) Vorhang, von Stoff- Yali (s) durchbrochenes Stein-Theologie und andere Diszipli-Naqare khane, nawbat khane ~) bahnen umschlossener Raum. gitter. nen. »Haus des Trommlers«, Ge au-
Mahal (P) Palast, PavilIon, de des Hoforchesters, Vestibul Saray (P) Palast, Pavillon. Yatra (s) Prozessionsweg.
Appartement, Saal. des Palastes. Setu (s) Damm, Deich, Erdwall. Yaylaq (t) Sommeraufenthalt an Makhzahn (a) Regierungssitz. N arinjistan (P) Orangenhain. Shah juy (P) Hauptkanal. kuhlem Ort.
Manar (a) Leuchtturm, hoher Nawbatkhane (P) Vestibul. Shikara (k) Landestypisches Boot Zawiyya (a) Grab eines mysti-Turm, Turm eines Kastells. f'.!azargah (al)' Belvedere, Aus-
auf dem Dal-See. schen Fuhrers, Konvent, Kloster.
Mandai (a) Pavillon, Haus. slchtsgebau e. Shish mahal (P) mit Mosaiken Zinane (P) Wohntrakt der Frauen.
Manzar (a) Belvedere, erhoht Pairidaeza (P) Einfriedung, dekorierter Raum. Ziyarat (P) siehe zawiyya und stehender Pavillon. Garten-Paradies. Skala (a, Dialektausdruck) sikala dargah.
269