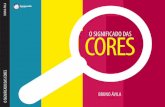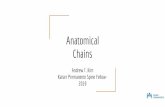Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
Transcript of Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
173
Ritterliche Turniere des Spätmittelalters und der Renaissance waren prachtvoll inszenierte sportliche Spektakel. Die ritu-alisierten Kämpfe, die bei diesen Festen abgehalten wurden, boten den Teilnehmern den Rahmen, um Tugenden wie Tap-ferkeit, Lehnstreue und Minnedienst unter Beweis zu stellen. Nur Mitglieder geadelter Familien besaßen traditionell die Tur-nierfähigkeit, also das Recht, an den Wettkämpfen teilzuneh-men. Der Dokumentation der Bewerbe kam aufgrund dieser strengen Restriktionen große gesellschaftliche Bedeutung zu; die Namen der Mitwirkenden sowie der Verlauf der einzelnen Kämpfe wurden festgehalten. Waren dies im Mittelalter zu-meist rein schriftliche Aufzeichnungen, so entstanden in der Spätgotik und in der frühen Neuzeit reich illustrierte Bücher, in denen der Ablauf bestimmter Turniere nachgezeichnet wurde. Turnierbücher waren für den Adel, aber auch für das aufstrebende Bürgertum der reichen Handelsstädte1 ein we-sentlicher Bestandteil ihrer Erinnerungskultur. René d’Anjou (1409 –1480),2 die sächsischen Kurfürsten des frühen 16. Jahr-hunderts3 und nicht zuletzt die Habsburger4 gaben aufwendig gestaltete Turnierbücher in Auftrag.
Das Kunsthistorische Museum in Wien verwahrt eine der prachtvollsten Turnierhandschriften der frühen Neuzeit, den ca. 1512 bis 1515 entstandenen Freydal Kaiser Maximilians I. Der Freydal zeigt 64 ritterliche Turniere, die jeweils aus einem Ren-nen, einem Stechen und einem Fußkampf bestehen.5 Am Ende jedes Turniers ist eine Mummerei zu sehen, ein Maskenball, der
traditionell abends nach den Bewerben veranstaltet wurde. Eine der Zeichnungen des Freydal, das Stechen, das nach fol. 173 stand, ist verloren, sodass der Codex heute statt 256 insgesamt 255 Miniaturen umfasst. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-derts wurde die Handschrift in einen ornamentierten Einband aus rotem Kalbsleder über Holzkern gebunden.
Der Freydal ist Teil jener Reihe von Büchern und Druckwer-ken, die Kaiser Maximilian I. zur Verherrlichung seines eigenen Lebens vorgesehen hatte. Zu diesem einmaligen autobiogra-phischen Projekt zählen auch die illustrierten Romane Theuer-dank und Weiskunig sowie propagandistische Arbeiten wie der Triumphzug und die Ehrenpforte. In den drei Büchern Freydal, Theuerdank und Weisskunig wird das Leben des Kaisers in Form aufwendig illustrierter Heldenepen geschildert. Der Hauptak-teur ist in allen drei Fällen das literarische Alter Ego des Kai-sers, die Namen der Helden fungieren als Titel der Bücher. Im Theuerdank wird von der gefahrenvollen Hochzeitsfahrt des Helden berichtet; der Weisskunig erzählt von der Kindheit und der Erziehung sowie von den Schlachten des weißen Königs (Maximilian). Die Bilderreihe des Freydal steht inhaltlich am Beginn dieses Zyklus. Sie widmet sich der Minnefahrt des jun-gen Herrschers; von drei königlichen Jungfrauen ausgeschickt, nimmt er an unterschiedlichen Orten siegreich an Turnieren teil und vergnügt sich bei den abendlichen Kostümfesten. Am Ende der Reise erhört die burgundische Prinzessin Maria – Ma-ria von Burgund (1457–1482) – sein Werben, woran die Erzäh-lung des Theuerdanks anknüpft.
Die Bilder des Freydal gehen auf tatsächliche Turniere und Kostümfeste des Kaisers zurück. Die Handschrift bietet aber nur in einem Fall nähere Angaben zur Örtlichkeit: Das Schweifrennen auf fol. 204 trägt die Beischrift: »sol das perlen Rennen / sein zu Augspurg«. Maximilian tritt in jedem einzel-nen Wettkampf des Buches persönlich auf. In den Mummereien ließ er sich durchwegs als Fackelträger darstellen, nie jedoch als Teilnehmer an den Tänzen. Die Namen von Freydals Geg-nern und von manchen Gästen der Mummereien sind bei den Zeichnungen notiert sowie in Listen gesammelt, die dem Co-dex vorgebunden sind. Eines dieser Verzeichnisse nennt jene »schonsten kunigin / fürstin grefin freÿin vnd Edler junck=/fra-wen vnd frawen namen in ger=/manien vor denen freÿdal ge-rendt / gestochen gekempfft vnd gemumbt / hat«.6 Unter diesen Damen finden sich etwa Sophia von Brandenburg (1464–1512),
Stefan Krause
»die ritterspiel als ritter Freydalb hat gethon aus ritterlichem gmute« – Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
II.50FreydalSüddeutsch, ca. 1512–1515Papierklebeband, 273 Blätter, H. 38,2 cm, B. 26,8 cm, davon 255 mit aufgeklebten MiniaturenTempera- und Aquarellmalerei über Federzeichnung, Gold- und SilberhöhungWien, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, Inv.-Nr. 5073Literatur: Leitner 1880 –1882; Best.-Kat. Wien 1976, S. 170 –171; AK Innsbruck 1992, S. 310 –313, Kat.-Nr. 126; AK Magdeburg/Berlin 2006, S. 126 –127, Kat.-Nr. III.6 –III.9; AK Bern/Brügge/Wien 2008 –2010, S. 356, Kat.-Nr. 170; AK Wien 2012–2013, S. 282–284, Kat.-Nr. 72.
174 Stefan Krause
hat in ain buch mallen lassen.«).13 In einem ca. 1505 bis 1508 verfassten Gedenkbuch wird der Freydal in Verbindung mit dem Theuerdank erwähnt (»Freithart Comedi vnd anfanng mit den alten greysen Erwalter Theuerdank Tragedi«.14 Ein kurz ge-fasstes Inhaltsverzeichnis des geplanten Buches von der Hand des kaiserlichen Sekretärs Marx Treytzsaurwein aus dem Jahr 1512 legte die Anzahl der darzustellenden Turniere fest (»Item Es sollen Sechs vnnd Zwainzig teutscher gestech sein.«, etc.); der Entwurf basiert, wie Treytzsaurwein schreibt, auf einem mündlichen Diktat des Kaisers (»müntlichen angeben«).15 Zu jener Zeit umfasste der Freydal insgesamt 128 Zweikämpfe zu Pferd; dies entspricht der Anzahl der betreffenden Miniaturen im Wiener Sammelband. Spätestens im Oktober 1512 waren auch die Fußkämpfe und Mummereien Teil der Planung, da Maximilian damals von »drithalb hunderten«, d. h. ca. 250 Mi-niaturen spricht.16 Im Jahr 1516 sind die ersten konkreten Vor-bereitungen für die drucktechnische Umsetzung des Buches dokumentiert, die jedoch nie über das Anfangsstadium hinaus gekommen ist. Lediglich fünf Holzschnitte zum Freydal sind bekannt; diese aber lassen sich Albrecht Dürer zuschreiben17. Zu einem dieser Holzschnitte hat sich in Berlin der originale Holzstock erhalten.18
Eine einzelne der 255 Miniaturen des Wiener Freydal – die Mummerei auf fol. 116 – ist signiert. Auf dem Türbogen links im Bild ist die Jahreszahl »1515« sowie das Monogramm »NP« zu sehen, das traditionell mit dem Innsbrucker Maler Nikolaus Pfaundler in Verbindung gebracht wird.19 Lässt sich diese Zu-schreibung wissenschaftlich auch nicht belegen, so wirft das Monogramm doch die Frage nach den am Freydal beteiligten Künstlern auf. Die Miniaturen dieses Turnierbuches sind sti-listisch und künstlerisch überaus heterogen. Detailreich aus-geführte Malereien mit reicher Gold- und Silberhöhung sind mit simplen kolorierten Federzeichnungen kombiniert; räum-lich gestaltete Szenerien finden sich neben Motiven, die auf die Darstellung der Umgebung fast vollständig verzichten. Quirin von Leitner zählte innerhalb dieses Konvoluts nicht weniger als 26 verschiedene Hände; manche davon mit einzelnen Blät-tern, andere mit mehreren Dutzend.
Eine große Zahl der Blätter des Freydal lässt sich süddeut-schen Künstlern zuschreiben. Die energische Strichführung in den Zeichnungen, die Leitner unter der Meisterhand 10 zusam-menfasste, verrät die Nähe dieses anonymen Meisters zur sog.
die Tochter König Kasimirs IV. von Polen (1427–1492) und Sa-bina von Bayern (1492–1564), die Tochter Herzog Albrechts IV. von Bayern und Nichte Maximilians I.
In weiteren Listen sind die Turnierkontrahenten Freydals nach Art des Kampfes aufgereiht, so etwa jene Personen, »mit welhen freydal teutsch / gestochen hat« oder »mit welhen freÿdal gerendt / hat vnnder dem Pundt«.7 Bei den Gegnern Freydals handelt es sich um Adelige höheren, aber auch nie-deren Ranges aus allen Teilen des habsburgischen Einfluss-gebietes, so etwa aus Burgund, Bayern, Brandenburg und Österreich. Die geographische und soziale Vielfalt, die sich in dieser Auswahl spiegelt, war keinesfalls Zufall, vielmehr stand dahinter das politische Kalkül des Kaisers. Auf diese Art schuf Maximilian persönliche Abhängigkeiten, die im Umgang mit den Landesfürsten des Reiches von großer Bedeutung waren. Viele der im Freydal genannten Personen waren hochrangige Mitglieder des habsburgischen Hofstaates, die in vielen Fällen dem Kaiser seit dessen Kindheit eng verbunden waren. Das Rennen auf fol. 29 zeigt Sigmund von Welsperg, der Maximi-lian I. als Kämmerer, Rat und Oberstfeldhauptmann von Tirol diente. Welsperg hatte ebenso das Amt des Obersthofmeisters von Bianca Maria Sforza (1472–1510), der zweiten Ehefrau Ma-ximilians I., inne.8 In insgesamt elf Kämpfen tritt Freydal gegen Wolfgang von Polheim (1458 –1512) an, einmal im Fußkampf mit dem Aalspieß, dreimal im Stechen und siebenmal im Rennen (vgl. fol. 62, Kat. Nr. II.50.3).9 Polheim war von Kaiser Friedrich III. zum Rat und Kämmerer des jungen Erzherzogs Maximilian ernannt worden und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1512 in dessen Diensten. Er war Obersthofmeister, Hof-marschall sowie Renn- und Gestechmeister des Kaisers, 1477 hatte er Maximilian auf der Hochzeitsfahrt zu Maria von Bur-gund begleitet. 1501 wurde Polheim in den ehrenvollen Kreis der Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies aufgenommen.10 Ein Küriß-Fragment aus seinem Besitz in Wien zeigt promi-nent die Embleme des Vlies-Ordens.11
Im Gegensatz zu den Büchern Theuerdank und Weisskunig, die zu Maximilians Tod 1519 vollendet beziehungsweise nahe-zu druckfertig vorlagen,12 blieb der Freydal ein Fragment. Die Planungen zu diesem Turnierbuch dürften kurz nach 1500 begonnen haben. Im Jahr 1502 verfügte Maximilian, dass alle seine Kostüme in einem Buch zusammengestellt werden soll-ten (»Maister Martin sol all mumerey do k. Mt ye gebraucht
175Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
Die ausgestellten Seiten des Freydal
Rennen
Donauschule.20 Freydals Rennen gegen Wolfgang von Polhaim (fol. 212) findet vor einem effektvoll in Abendrot getauchten Himmelsgewölbe statt und dürfte von einem talentierten Künstler aus dem Umfeld Albrecht Altdorfers stammen.21 Von besonderer Bedeutung im Kontext der stilistischen Untersu-chung der Miniaturen des Freydal ist ein Schreiben Maximili-ans I. von 1512. Darin heißt es: »Der Freydal ist auch wohl halb außgemacht vnnd den maisten tail an solchem allen haben wier zu Cöln gemacht«.22 Die Kölner Kunst des Spätmittelal-ters stand unter dem starken Einfluss der benachbarten Nie-derlande; ein wesentlicher Teil der Miniaturen des Freydal ver-rät tatsächlich eine Abhängigkeit von der flämischen Malerei. Die minutiöse Ausführung mit teilweise reicher Vergoldung (etwa auf fol. 94, 109 und 149), aber auch Interieurs wie jenes auf fol. 168, lassen auf Künstler schließen, die in der nieder-ländischen Tradition geschult worden waren. Für die dunkle, schimmernde Farbigkeit, die die Turnierszenen auf fol. 29, 113 und 176 charakterisiert, dürften die Vorbilder ebenso in der niederländischen und Kölner Kunst des frühen 16. Jahrhun-derts zu suchen sein.23
Neben dem Wiener Sammelband ist eine Reihe weiterer Werke erhalten, die der Arbeit am Freydal zuzurechnen sind. In London hat sich zu der Szene auf fol. 85 eine zweite, eng verwandte Version erhalten, die möglicherweise von demsel-ben Meister ausgeführt wurde.24 Eine Studie für das Turnier auf fol. 150 wurde im Jahr 1923 mit der Zuschreibung an einen flä-mischen Meister in London versteigert.25 Im Codex Vaticanus Latinus 8570, fol. 103v – 114r sind etwa zwanzig Entwürfe zu Miniaturen des Freydal zu finden, die schriftliche Anmerkun-gen zur Kolorierung beinhalten.26 Federzeichnungen, die mit den wenigen in Holzschnitt ausgeführten Freydal-Miniaturen von Dürer in Verbindung stehen, sind in einer Handschrift der Stadt- und Staatsbibliothek in Augsburg miteingebun-den.27 Die National Gallery of Art in Washington verwahrt ein Konvolut von insgesamt 203 simplen, kolorierten Skizzen in brauner Feder, die als vorbereitende Stufe oder als Nachzeich-nungen derselben zu identifizieren sind.28 Einige dieser Blätter sind mit handschriftlichen Korrekturangaben zur Position der Figuren bzw. der Lanzen versehen, die im Wiener Freydal bild-lich umgesetzt zu sehen sind. In welchem Verhältnis all diese Werke zueinander und insbesondere zu dem Wiener Codex stehen, ist bisher noch nicht eingehend untersucht worden.
II.50.1Fol. 17 zeigt Freydal im Antzogen-Rennen mit »Graf Wolf von Furstenberg« – Wolf-gang I. Graf von Fürstenberg (1465–1509). Fürstenberg nahm im Jahr 1490 unter Maximilian an der Vertreibung der Ungarn aus Wien teil. Als Hofmarschall war er 1503 auf diplomatischer Mission bei Herzog Wilhelm von Jülich und Berg, 1505 wurde er in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen.
II.50.2Fol. 29 zeigt Freydal im Geschifttartschen-Rennen mit »Her[n] Sigmundt von Welsperg« – Sigmund von Welsperg (gest. um 1503). Welsperg diente Maximilian als Kämmerer, Rat, Oberst-feldhauptmann von Tirol und Obersthofmeister von Bianca Maria Sforza (1472–1510), der zweiten Ehefrau Maximilians.
II.50.3Fol. 62 zeigt Freydal im Bund-Rennen mit »Herr[n] Wolf-gang von Polhaim«. Wolfgang von Polheim (1458 –1512) war Obersthofmeister, Hofmarschall sowie Renn- und Gestechmeis-ter des Kaisers. 1501 wurde er in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen.
II.50.4Fol. 93 zeigt Freydal im Bund-Rennen mit »Philip von Rech-perg« (Philipp von Rechberg). Im Status »Römischer kn. mt. Hofgesinde« wird Philipp von Rechberg unter den Grafen und Herren mit fünf Pferden Bestal-lung erwähnt.
II.50.5Fol. 97 zeigt Freydal im Anzogen-Rennen mit »Her[n] Niclas von Firmian«. In den maximilianischen Quellen wird Firmian (gest. 1509) Hauptmann an der Etsch und Burggraf von Tirol genannt. Er hatte das Amt des Obersthofmeisters der Bianca Maria Sforza inne; 1497 wurde er in den Freiherrenstand erhoben.
II.50.6Fol. 125 zeigt Freydal im Schweif-Rennen mit »Graf Hanns von Montfort« – Johann Graf von Montfort zu Tettnang (gest. 1529) erscheint 1490 im Hofstaat Maximilians bestallt mit acht Pferden. Kaiser Fried-rich III. belehnte 1492 die Brüder Haug und Johann zu Montfort mit der Grafschaft Rotenfels im Allgäu.
II.50.7Fol. 129 zeigt Freydal im Schweifrennen mit »Her[n] Anthoni von Lefon« – Antonio de Caldonazo Freiherr von
177Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
Yfan (gest. kurz nach 1509). Anton von Yfan wurde 1490 als königlicher Rat und Truchsess erwähnt. Er nahm 1494 bei der Hochzeitsfeier von Wolfgang von Polheim und Johanna von Borselle in Mecheln im Beisein von Maximilian und dessen Sohn Philipp an einem Turnier teil (vgl. dazu auch Adam von Frundsberg auf fol. 186).
II.50.8Fol. 133 zeigt Freydal im Geschifttartschen-Rennen mit »Her[n] Veit von Wolkenstain« – Veit von Wolkenstein (gest. 1498). Veit, erster Freiherr von Wolkenstein, war Maximilians Rat, Kämmerer und oberster Feldhauptmann, in späteren Jahren Statthalter in den vorde-rösterreichischen Landen (vgl. auch fol. 49).
Stechen
II.50.9Fol. 38 zeigt Freydal im Wel-schen Gestech mit Franziskus de Montibus. Im Jahr 1490 wird ein Franciscus de Montibus, Abgesandter König Ferdinands von Sizilien (Ferdinand II. von Aragon (1452–1516), am Hof Friedrichs III. urkundlich erwähnt.
II.50.10Fol. 49 zeigt Freydal im deut-schen Gestech mit »Her[n] Veit von Wolkenstain« – vgl. dazu auch das Rennen auf fol. 133.
II.50.11Fol. 57 zeigt Freydal im deut-schen gestech mit »Graf Fridrich von Ötting« – Graf Friedrich von Öttingen. Friedrich (um 1459 –1490), der Sohn des Wil-helm von Öttingen (gest. 1467) und der Beatrix della Scala, war 1485/86 zum Bischof von Passau ernannt worden. Im Verzeichnis der Erbbegräbnisse der Familie Öttingen in Kloster Kirchheim findet sich hingegen ein 1514 verstorbener Graf desselben Na-mens, der ein Sohn des Joachim von Öttingen und der Dorothea von Anhalt war.
II.50.12Fol. 74 zeigt Freydal im deut-schen Gestech mit »Philipp von Rechberg«; zu Philipp von Rechberg vgl. das Bund-Rennen auf fol. 93.
II.50.13Fol. 90 zeigt Freydal im deut-schen Gestech mit »Her[n] Thoman von Frundtsperg«. Thomas von Frundsberg (gest. 1497) war der zweite Sohn von Ulrich X. von Frundsberg und der Barbara von Rechberg. Am Hof Erzherzog Sigmunds von Tirol wird er als Rat und Kämmerer erwähnt. 1485 ist er als Hauptmann im Inntal doku-mentiert. Vgl. auch Adam von Frundsberg, den fünften Sohn des Ulrich X. von Frundsberg auf fol. 90, sowie Georg II. von Frundsberg (1473–1528), Ulrichs vierten Sohn, auf fol. 163.
II.50.4
II.50.7
179Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
II.50.14Fol. 118 zeigt Freydal im wel-schen Gestech mit »Scharl von Wiauin« (Tscharl von Wiewin).
II.50.15Fol. 134 zeigt Freydal im wel-schen Gestech mit »Lancelote Breuille«. Die de Bréville sind ein Adelsgeschlecht der Normandie (Caen).
II.50.16Fol. 177 zeigt Freydal im wel-schen Gestech, sein Kontrahent ist »Der von Ramulj«. Ramillus, ein burgundischer Hauptmann zu Fuß, war ein treuer Anhän-ger König Maximilians. 1488 fiel er bei der Verteidigung des Schlosses Borselle in die Hände der aufständigen Brüsseler, die ihn hinrichteten.
Fußkampf
II.50.17Fol. 63 zeigt Freydal im Fuß-kampf mit Eisenkolben und kleiner Tartsche; sein Kon-trahent ist »Her Melhior von Massmunster«. Melchior von Massmünster dürfte aus dem El-sass stammen. Er ist 1467 unter jenen Kindern nachzuweisen, die gemeinsam mit dem jungen Maximilian lernten und spiel-ten. 1496 wird er als Truchsess und Jägermeister Maximilians in Flandern erwähnt. 1504 ist Massmünster als kaiserlicher Rat, Kämmerer, Truchsess und Stadthauptmann zu Wiener Neustadt dokumentiert.
II.50.18Fol. 83 zeigt Freydal im Fußkampf mit Drischel; sein Kontrahent ist »Her Wilhalm Awer«. Wilhelm Auer von Herrenkirchen zu Neudorf in Niederösterreich erscheint 1490 und 1492 als Oberststallmeister von Erzherzog Sigmund von Tirol und 1493 als Pfleger von Hertenberg. Unter Maximilian I. ist er als Rat, Hauptmann von Neustadt und 1512 als landes-fürstlicher Pfleger zu Kranich-berg dokumentiert.
II.50.19Fol. 91 zeigt Freydal im Fuß-kampf mit Drischel; sein Kon-trahent ist »Jörg Harder«. Die Harder waren ein in der Stei-ermark ansässiges Geschlecht. Georg Harder ist 1489 und 1500 urkundlich belegt. 1497 wird er als Fürbitter erwähnt; 1513 vermitteln Balthasar Gleinizer, Sigmund Welzer, u. a. einen Vergleich zwischen Bernhard Stadler zu Stadl und Jörg von Hard.
II.50.20Fol. 95 zeigt Freydal im Fuß-kampf mit dem Turnierschwert; sein Kontrahent ist »Her Asm Lueger«. Erasmus (Erasam) Lueger war Burgraf von Lienz und Lueg. Kaiser Friedrich III. verlieh ihm 1478 die von seinem Vetter Haug Burggraf von Lienz verkauften Güter. 1480 soll er am Hof Friedrichs III. gelebt und während dieser Zeit einen Marschall von Pappenheim um-gebracht haben. Nach dieser Tat
II.50.10
II.50.13
181Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
Georg II. von Frundsberg (1473–1528), auf fol. 163). Adam nahm an jenem Turnier teil, das anlässlich der Hochzeit des Wolfgang von Polheim und der Johanna von Borselle 1494 in Mecheln veranstaltet wurde; die Feierlichkeit fand unter Beisein von Maximilian I. und dessen Sohn Philipp statt (vgl. dazu auch Anton von Yfan auf fol. 129).
II.50.24Fol. 230 zeigt Freydal im Fußkampf mit Eisenkolben und Pavese; sein Kontrahent ist »Leonhart Gödl«.
Mummereien
II.50.25Fol. 44 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei, an der auch »Der Jung von Gett«, »Anthoni vom Ross«, »Franziskus Prager« und »Reyhenburger« teilnah-men. Anthoni von Ross war unter Erzherzog Sigmund zum obersten Amtsmann der Haller Münzstätte ernannt worden. Als einer der ersten Darlehns-geber des Erzherzogs hatte er in den 1470er Jahren den Schwazer Silberhandel unter seine Kon-trolle gebracht. 1491 endeten seine Spekulationen im Anlei-henwesen und im Metallhandel jedoch im Konkurs. Franziskus Prager war der Sohn von Hanns Prager, des Marschalls von Kärnten; er besaß in Kärnten die Güter Obertrüxen, Prasberg und Schöneck.
soll er auf sein Schloss in Lueg geflohen sein und während der Belagerung durch kaiserliche Truppen erschossen worden sein.
II.50.21Fol. 115 zeigt Freydal im Fußkampf mit Turnierschwert und Buckler; sein Kontrahent ist »Her Jacob Silber Camrer«. 1490 wird am Hof Maximilians ein Herr Jacob Silbercamerer als Truchsess mit fünf Pferden bestallt erwähnt.
II.50.22Fol. 159 zeigt Freydal im Fuß-kampf mit dem Dolch; sein Kontrahent ist »Jorig Weysp-riacher«. Jörg von Weispriach war der zweite Sohn des Ulrich d. Ä. Weispriach, Freiherr von Kobelsdorf und Braunau. 1490 wird er am Hof Maximilians unter den Grafen und Herren mit fünf Pferden Bestallung aufgeführt. 1500 wird in einem der Gedenkbücher Maximilians ein Stechzeug des Jörg von Wei-spriach erwähnt, das von einem Fuhrmann von Augsburg nach München und wieder zurück gebracht wurde.
II.50.23Fol. 186 zeigt Freydal im Fußkampf mit Dolch; sein Kontrahent ist »Her Adam von Frundtsperg«. Adam von Frundsberg war der fünfte Sohn von Ulrich X. von Frundsberg (vgl. dessen zweiten Sohn, Thomas, auf fol. 90 des Freydal, sowie dessen vierten Sohn,
II.50.16
II.50.19
183Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
II.50.26Fol. 56 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei, unter deren Gästen sich auch »Peter Alten-hauser, Jörg Goldaker [und] Schefftenberg« befanden. Peter Altenhauser gehörte einem stei-ermärkischen Adelsgeschlecht an; Peter wird im Jahr 1500 als »kgl. Maj. stallmaister« erwähnt. Das geschlecht der Goldaker stammte aus Kärnten, doch sind Familien desselben Namens auch in Bayern, Sachsen und Thüringen nachweisbar. 1507 bezahlt Maximilian den Augs-burger Plattner Lorenz Helm-schmid für einen Harnisch, den er »unserm marschalh Jorgn Golldacher« machen ließ. Das uralte Geschlecht der Scherffen-berg war in Krain beheimatet, waren jedoch auch in Öster-reich ansässig geworden. Zur Zeit Kaiser Friedrichs III. und Maximilians I. sind mehrere Mitglieder der Familie doku-mentiert, so etwa Ulrich, dessen Sohn Bernhard, sowie Johann, Wolfgang, etc.
II.50.27Fol. 96 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei, zu deren Gästen auch »Hermanstainer, Gloiacher, Mindorffer«. Die Glo-yach sind ein steiermärkisches Rittergeschlecht; Georg Gloiach war seit 1497 Verwalter der Burg zu Marburg; im selben Jahr wird er als Truchsess der Bianca Ma-ria Sforza, der zweiten Ehefrau Maximilians I., erwähnt. Weite-re Mitglieder der Familie, die im Umfeld Maximilians Erwäh-
nung finden, sind Christoph, sowie die Brüder Benedict und Adrian. Mit »Minndorfer« könn-te Christoph II. von Minndorf beziehungsweise einer seiner sechs Söhne (Christoph, Erhart, Franz, Sigmund, Hanns und Ihan) gemeint sein. Christoph II. erscheint 1490 als Truchsess von Maximilian I., 1501 wird er zum obersten Feldzeugmeister in Niederösterreich ernannt. 1515 hat er an einem von Maxi-milian in Wien veranstalteten Turnier teilgenommen.
II.50.28Fol. 104 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei, an der auch »Newhauser, Rauber, Thurn, Freyberger [und] Jaketl« teilnah-men. Ein Newhauser wird 1490 unter den Edelknaben des maxi-milianischen Hofes erwähnt. Fa-milien mit diesem Namen sind zur Zeit Maximilians in Öster-reich in Tirol, in Kärnten und in der Steiermark, sowie in Krain, Bayern, Österreich und Böhmen nachweisbar. Die Rauber waren ein altes Adelsgeschlecht aus Krain, das im 14. Jahrhundert in Niederösterreich ansässig geworden war. Zahlreiche Mitglieder der verschiedenen Geschlechter zu Thurn standen in Diensten Maximilians I., so etwa Georg von Thurn (gest. 1503). Die Freyberg stammten ursprünglich aus Graubünden und waren unter Maximilian in Schwaben, Bayern, Tirol und Kärnten beheimatet.
II.50.22
II.50.25
185Das Turnierbuch Freydal Kaiser Maximilians I.
II.50.29Fol. 152 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei. Der Miniatur fehlt die Beischrift, daher ist keiner der weiteren Gäste zu identifizieren.
II.50.30Fol. 195 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei. Der Miniatur fehlt die Beischrift, daher ist keiner der weiteren Gäste zu identifizieren.
II.50.31Fol. 203 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei. Der Miniatur fehlt die Beischrift, daher ist keiner der weiteren Gäste zu identifizieren.
II.50.32Fol. 207 zeigt Freydal als Gast einer Mummerei. Der Miniatur fehlt die Beischrift, daher ist keiner der weiteren Gäste zu identifizieren.
II.50.28 II.50.29
II.50.32
186 Stefan Krause
Handschriften und alten Drucken, Cod. Ser. n. 2645. Zit. nach: Leitner, 1880 –1882, S. VII; vgl. Menhardt 1960 –1961, Bd. 3, S. 1468; Unterkir-cher 1963, S. 248. In einem Gedenk-buch von 1509 bis 1513 findet sich auf fol. 2 der Verweis: »Vermerkt die puecher so die Ro. Kay. Mt. dannen richten will«, genannt werden darunter die Ehrenpforte, der Weisskunig, der Theuerdank, die Triumphwagen sowie der »Freytal«, Wien, Österreichische Nationalbi-bliothek, Cod. 2900; vgl. Leitner 1880 –1882, S. VII.
15 Zit. nach Leitner 1880 –1882, S. VIIf. (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ms. 2835, fol. 38). Ein Textentwurf zum Freydal findet sich auch in Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2831. Der Text wurde ediert von Quirin von Leitner; vgl. Leitner 1880 –1882, S. XV–XXXVI.
16 Alte Abschrift eines Briefes Maximilians I. an Siegmund von Dietrichstein in: Wien, Österreichi-sche Nationalbibliothek, Cod. Ms. 7425; Leitner 1880 –1882, S. IXf., Anm. 1.
17 Vgl. Schoch [u. a.] 2001–2004, Bd. 3, S. 152–164.
18 Vgl. Schoch [u. a.] 2001–2004, Bd. 3, S. 162, Abb. 1.
19 Vgl. Leitner 1880 –1882, S. VI, Anm. 5.
20 Vgl. etwa fol. 2, 14, 18, 22, etc. Zur vollständigen Liste vgl. Leitner 1880 –1882, S. Vf., Anm. 5.
21 Vgl. auch fol. 41, 220, 248.
22 Zit. nach Leitner 1880 –1882, S. X, Anm. (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ms. 7425).
23 Zur Kölner Buchmalerei des frühen 16. Jahrhunderts vgl. Hem-fort 2001, S. 18 –32, 89 – 96.
24 London, British Museum, Inv.-Nr. 1926,0713.9.
25 Vgl. Aukt.-Kat. London 4. Juli 1923, Nr. 59, ill.
26 Vgl. Rudolf 1980, S. 171.
27 Vgl. Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, Sig. 2° Cod. 563, fol. 1r-3r, 4r; vgl. Gehrt 1993, S. 150 f.; AK Augsburg 1994, S. 204 f.
28 Vgl. Dodgson 1926; Dodgson 1928.
Anmerkungen
1 Vgl. etwa das Turnierbuch, Nürnberg, Mitte 17. Jahrhundert, New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 22.229; vgl. Nickel/Breiding 2010.
2 Turnierbuch des René d’Anjou, 1446, St. Petersburg, Russische Nationalbibliothek, Sig. Ms. F. XIV N 4; vgl. Turnierbuch René d’Anjou [1998].
3 Zu den Turnierbüchern der Kur-fürsten Johann (1468 –1532), Johann Friedrich (1503 –1554) und August (1526 –1586); vgl. Haenel 1910.
4 Turnierbuch des Erzherzogs Ferdinands II. von Tirol, Österreich, nach 1557, Wien, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, Inv.-Nr. 5134; vgl. AK Ambras 2005, S. 67 – 68, Kat.-Nr. 3.1 (Matthias Pfaffenbichler und Veronika Sand-bichler).
5 Zu den Arten des Turniers vgl. weiter unten.
6 Zit. nach Wien, Kunsthistori-sches Museum, Hofjagd- und Rüst-kammer, Inv.-Nr. KK 5073, fol. Ar.
7 Zit. nach Wien, Kunsthisto-risches Museum, Hofjagd- und
Rüstkammer, Inv.-Nr. KK 5073, fol. Er und fol. Hv.
8 Im Freydal ist Sigmund von Welsperg weiters auch in den Ren-nen auf fol. 9, 50, 70, 121 zu sehen sowie im Stechen auf fol. 217; vgl. Leitner 1880 –1882, S. XCIVf.
9 Vgl. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkam-mer, Inv.-Nr. KK 5073, fol. 23, 34, 62, 66, 86, 89, 126, 137, 161, 212 und 221.
10 Zu Wolfgang von Polheim vgl. Allgemeine Deutsche Biogra-phie 1888, S. 821– 823 (Hans von Zwiedineck-Südenhorst).
11 Küriß-Fragment Wolfgang von Polheims, Innsbruck, um 1510, Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 107; vgl. Best.-Kat. Wien 1976, S. 214.
12 Vgl. Kat. Nr. II.50.3.
13 Zit nach Leitner 1880 –1882, S. VII sowie S. V, Anm. 1 und 2 (Wien, Österreichisches Staatsar-chiv, Haus- Hof und Staatsarchiv, Cod. Ms. 13, fol. 147).
14 Wien, Österreichische Natio-nalbibliothek, Sammlung von