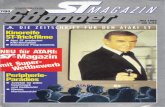Die Deutsche Glaubensbewegung als ideologisches Zentrum der völkischreligiösen Bewegung [2012]
Cumulative Arrangements. Time, Space, and Local Identity in Seville (in German). In: Zentrum für...
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Cumulative Arrangements. Time, Space, and Local Identity in Seville (in German). In: Zentrum für...
30.11 – 01.12.2012
Konrad Zuse-Straße 16
44801 Bochum
www.zms.rub.de
Ordnung und Chaos im Mittelmeerraum
3. Bochumer Nachwuchsworkshop für MediterranistInnen
Impressum
Redaktion und Layout:
Urs Brachthäuser
Marcus Nolden
Stefan Riedel
Christine Isabel Schröder
Titelbild:
Constance von Rüden
Graffito in Kairo
Bochum 2012
Seite | 1
Inhalt Christine Isabel Schröder: Ordnung und Chaos im Mittelmeerraum. Einleitende Überlegungen ...... 2
Christine Isabel Schröder: Un- und Um-Ordnung von Gesellschaft .................................................... 9
David Wallenhorst: Montecassino zwischen Normannenexpansion und Investiturstreit - Die
normannische Eroberung Unteritaliens und die Leiden der Bevölkerung im Spiegel der
Privaturkunden Montecassinos ......................................................................................................... 10
Martina Clemen: Von Ordnungskonzepten und Problemlösestrategien: „generation-building“ in
Spanien (1914-1948) ......................................................................................................................... 15
Katharina Schembs: Der italienische Korporativstaat und seine Ausstrahlung auf Lateinamerika:
Der Arbeiter in der Bildpropaganda des faschistischen Italiens und des peronistischen Argentiniens
(1922-1955) ....................................................................................................................................... 22
Marcus Nolden: Identität & Alterität ................................................................................................ 30
Carolin Philipp: Spaces of Resistances – perceptions and practices in the cracks of 'capitalism in
crisis' .................................................................................................................................................. 31
Abdellatif Bousseta: Die Identitätsfrage im modernen arabischen Diskurs - Zwischen der
vermeintlichen Einheit und der realen Vielfalt ................................................................................. 39
Kristine Wolf: Grenzregime und gegenhegemoniale Mobilitätsprozesse im euro-mediterranen
Raum – Wirkmächtigkeiten selbstorganisierter Migrant/innen in Rabat ......................................... 51
Urs Brachthäuser: Erinnerung – Ordnung der Vergangenheit, ordnende Vergangenheit? .............. 58
Merryl Rebello: Ordnung schaffen mit Romulus: Cicero räumt auf.................................................. 60
Christiane Schwab: Kumulative Ordnungen: Zeit, Raum und Identitätskonstruktionen in Sevilla ... 64
Andrea Spans: Das perserzeitliche Jerusalem zwischen Wunsch und Wirklichkeit. - „Raum“ im
Medium „Text“ .................................................................................................................................. 68
Stefan Riedel: Wissen und Wissenskonzeption als ordnende Prinzipien .......................................... 74
Arne Franke: Ordnung durch Architektur: Entstehung und Rezeption gotischer Bauten auf Zypern
........................................................................................................................................................... 76
Ma ias oernes: eine arbaren me r ast s on Römer. Kulturelle Formierungsprozesse und
zivilisatorische Ordnung in Strabons Geographika ........................................................................... 80
Julia Linke: Der König als Hüter der Ordnung und Bezwinger des Chaos - Mythologische
Hintergründe des altorientalischen Konzeptes von Königtum und deren Auswirkungen im
archäologischen und philologischen Befund ..................................................................................... 85
TeilnehmerInnen des Workshops ..................................................................................................... 91
Seite | 2
Christine Isabel Schröder: Ord-
nung und Chaos im Mittelmeer-
raum. Einleitende Überlegungen1
Chaos und Ordnung – Meer und Land –
Leviathan und Behemoth
Beginnen möchte ich mit einigen, zunächst
vielleicht ungeordnet erscheinenden
Überlegungen zu den Verknüpfungen von
Mittelmeer, Chaos und Ordnung – und ich
möchte beginnen mit Fernand Braudel,
dem großen Mediterranisten des 20. Jahr-
hunderts.
»Jedermann sagt, jedermann weiß, daß
die ›An änge der Zivilisation‹ im östli en
Mittelmeerraum, im Vorderen Orient lie-
gen. Aber nicht gleich von Beginn an war
das Meer dafür verantwortlich – jahrtau-
sendelang blieb es leer, öder als selbst die
Wüste, Hindernis und nicht Verbindung
zwis en den Mens en […].«2
Mit diesen Worten eröffnet Braudel sei-
nen Essay Dämmerung in der Sammlung
Die Welt des Mittelmeers. »Die Anfänge«
– »von Beginn an«– »leer« – »öde« –
»Wüste« – »das Meer«. Auch wenn mir
nicht der französische Urtext vorliegt, so
stechen die Anleihen doch deutlich her-
vor: Braudel zitiert hier einen sehr be-
rühmten und sehr alten Text, der in der
weiteren Mittelmeerwelt entstanden ist
und in ihr und über sie hinaus zirkulierte:
der Schöpfungsbericht der hebräischen
Bibel in Genesis 1.
1 Ich danke Medardus Brehl, Jürgen Ebach und
Steffen Leibold für die hilfreichen Hinweise und Anmerkungen. 2 Braudel 1987, 63.
Die Bibel beginnt:
bere’schit bara’ ’älohim ’et haschamajim
we’et ha’aräz
In der Übersetzung nach Martin Luther
(1984):
»Am Anfang3 schuf Gott Himmel und Er-
de.«
weha’aräz hajetah tohu wavohu
»Und die Erde war wüst und leer,«4
wechoschäch ʽal-pene tehom
weruach ’älohim merachäfät ʽal-pene
hamajim
»und es war finster auf der Tiefe; und der
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.«
Vor Gottes (ordnendem) Schöpfungshan-
deln und vor Beginn der menschlichen
»Zivilisation« war also Meer und Tohuwa-
bohu, eine lebensunfreundliche Unord-
nung, das Chaos.
Meer und Chaos, Mittelmeerwelt und Al-
ter Orient – das lässt an die Chaostiere der
altorientalischen Mythologie denken, in
der Bibel Leviathan und Behemoth ge-
nannt.5
Leviathan ist das Ungeheuer des Meers –
in Gestalt einer Schlange oder eines Dra-
chen, in ägyptischer Variante in der Ge-
stalt eines Krokodils; der Nilpferd-artige
Behemoth wird, obwohl auch ein dem
3 Es ließe sich z.B. auch »beim Beginn« lesen, um
noch weiter an das Braudel-Zitat anzuknüpfen. 4 Tohu wavohu wird von Martin Buber und Franz
Rosenzweig in ihrer Verdeutschung der Schrift übrigens mit »Irrsal und Wirrsal« wiedergegeben. 5 vgl. hierzu Ebach 1984.
Seite | 3
Wasser verbundenes Un/Wesen, mit der
Herrschaft des Chaos zu Land assoziiert.6
Auch in anderen antiken Texten wird der
sog. Chaoskampf mit dem Meer oder der
Flut als Inbegriff und Erfahrungswelt von
Chaos beschrieben.
Herrschen Behemoth und Leviathan, so ist
die Welt für den Menschen unwirtlich und
lebensbedrohlich, die göttliche Schöp-
fungsordnung ist in Gefahr, d.h.: Die alt-
orientalischen Metaphern von Chaos ste-
hen für die Gefährdung der Weltordnung.7
Die Bibel lässt im Hiobbuch Gott dazu Stel-
lung beziehen, der erklärt, dass es die
göttliche Macht sei, nicht etwa die
menschliche, die Leviathan und Behemoth,
die Chaosmächte, im Zaum halte.8
Im Traktat Avodah Sarah des Babyloni-
schen Talmud heißt es:
»Rabbi Jehuda sagte im Namen des Raw:
Der Tag besteht aus 12 Stunden; in den
ersten drei Stunden beschäftigt sich der
Heilige, gesegnet sei Er, mit der Torah; in
den zweiten drei Stunden sitzt er und hält
Gericht über die ganze Welt; während des
dritten Viertels ernährt er die ganze Welt
[…]; wä rend des vierten Viertels spielt er
mit dem Leviathan.«9
6 In der arabischen Tradition dagegen ist Bahamut
ein großer Fisch, der im Urmeer schwimmt und von Gott geschaffen wurde, um die Welt auf seinem Rücken zu tragen. 7 vgl. Bauks 2001; Ebach 1984.
8 vgl. Ebach 1984, 32; Ebach 2009, 140–154, insbe-
sondere 146 ff. 9 na Ps 104 26: „… der Leviat an den du gebildet
ast damit zu spielen.“
Und was – so möchte ich mit Jürgen Ebach
fragen –spielen die beiden wohl im Meer?
– Vermutlich Schiffe versenken.10
Die Erzählung von einem Gott, Herrscher
der Welt und Behüter der Weltordnung,
der mit der Chaosmacht spielt, wirft eine
Frage auf: Wessen Ordnung bedeutet
wessen Chaos?
Als 1651 T omas obbes’ Staatst eorie
Leviathan erschien, ist dessen Meeresun-
geheuer kein Chaosdrache mehr, sondern
positiv gewendet die Verkörperung des
allmächtigen, absolutistischen oder auch
»totalen« Staates, der für die richtige
Ordnung der Gesellschaft sorgt. Eine völlig
andere Perspektive, nicht ohne Sitz im
Leben: Hobbes schrieb das Werk während
des englischen Bürgerkriegs. 1668 ent-
stand der Gegenpart obbes’ Behemoth,
der den »Unstaat« als chaotischen »Na-
turzustand« beschreibt, der überwunden
werden müsse.
Fast 300 Jahre später veröffentlichte Franz
Neumann in Anlehnung an Hobbes 1942
im US-amerikanischen Exil sein Werk
Behemoth – Struktur und Praxis des Natio-
nalsozialismus. Darin erklärt er:
»Da wir glauben, daß der Nationalsozia-
lismus ein Unstaat ist oder sich dazu ent-
wickelt, ein Chaos, eine Herrschaft der
Gesetzlosigkeit und Anarchie, welche die
Re te wie die Würde des Mens en ›ver-
s lungen‹ at und dabei ist die Welt
durch die Obergewalt über riesige Land-
massen in ein Chaos zu verwandeln,
scheint uns dies der richtige Name für das
10
vgl. Ebach 2011, 36–38.
Seite | 4
nationalsozialistische System: Der
Behemoth.«11
Chaos, Ordnung und das mare nostrum
Wo hat nun also das Motto unseres Work-
shops seinen Sitz im Leben? – Tatsächlich
entstammt es dem Blick auf den Schreib-
tisch eines Doktoranden. Doch kommt
diese Assoziation: Ordnung – Chaos – Mit-
telmeer, nicht aus dem Nichts und sie
kommt nicht von ungefähr:
Chaos und Ordnung sind ‚mediterrane’
Begriffe, wenn man so will: Ordnung von
lateinisch ordo, Chaos von griechisch χάος.
»(unendlich) leerer Raum«, bzw. χάσμα
für »Kluft, Spalt«.
Das Mittelmeer – das Chaos = die Kluft
zwischen Europa und Nordafrika und Asi-
en?
‚Ordnung’ und ‚C aos’ sind Deutungsmus-
ter, das haben wir in der Ausschreibung
bereits benannt, die gerade in aktueller
Perspektive immer wieder auf den Mit-
telmeerraum angewendet werden, sei es
z.B. im Blick auf die gesellschaftlichen
Umwälzungen in Maghreb und Maschrek,
in der EU-Flüchtlingspolitik oder im Hin-
blick auf Naturereignisse und Umweltfra-
gen. Wir können täglich neue Meldungen
verfolgen, die den Mittelmeerraum und
das Meer selbst als Ort von Ausnahmezu-
ständen, Rebellion, Aufständen, Terroran-
schlägen, Kriegsdrohungen, Flucht und
Vertreibung, Hilflosigkeit und Umwälzung
präsentieren.
11
Neumann 1984, [Vorwort].
Gleichzeitig hören und lesen wir von dem
Bemühen um Wiederherstellung, Stabili-
tät, Einigung, aber auch von neuen Ord-
nungsentwürfen und deren Konsequen-
zen, wie die im Dienst der EU agierende
Grenzschutzagentur Frontex und die Pläne
zur Überwachung der europäischen Au-
ßengrenzen mithilfe von Drohnen.
Eine »Krise«, ein »Krisengebiet« wird
sichtbar, wenn der Blick aus dem Norden
auf die aus der Reihe tanzenden Mittel-
meerstaaten der EU gerichtet wird; »Cha-
os« beschreibt die Erfahrungswelt der
Flüchtlinge, die als so genannte »Illegale«
jenseits – oder auch aus unserer Perspek-
tive: diesseits – des Mittelmeeres Rettung
vor Armut und Krieg suchen und die oft-
mals (um es einmal in eine konventionelle
Kollektivmetapher zu fassen) vom Regen
in die Traufe geraten. Denn für Tausende
pro Jahr ist das Mittelmeer nicht nur eine
Gefahr, sondern die tödliche Chaosmacht:
das Meer als Ungeheuer, das die Men-
schen verschlingt: Fast 70.000 Menschen
haben 2011 die Flucht von Nordafrika
nach Europa über das Mittelmeer ver-
sucht. Mindestens 18.500 Flüchtlinge sol-
len laut Menschenrechtsorganisationen
seit 1988 an Europas Außengrenzen um-
gekommen sein; die meisten ertranken im
Mittelmeer.12 Nur zynisch ließe sich hier
das Bild des deus ludens, des mit seinem
Leviathan spielenden Gottes anbringen,
oder tatsächlich nur als Theodizee begrei-
fen. So schließen sich Fragen nach Macht-
verhältnissen, nach Recht und Gerechtig-
12
FR online, 24.09.2012 http://www.fr-online.de/politik/afrika-fluechtlinge-europa-macht-die-schotten-dicht,1472596,17895098.html (zu-letzt aufgerufen am 05.02.2013).
Seite | 5
keit, nach der Hierarchie von politischer
Ordnungsmacht und ethischen Grundre-
geln an.
Dass chaotische Zustände v. a. in größerer
historischer Perspektive als Auslöser und
Übergang zu einem Neuen, einer Neu-
schöpfung, einer Neuordnung erscheinen,
sehen wir zum Teil anhand der Umbrüche
in der arabischen Welt, aber immer noch
und gerade mit Blick auf Syrien oder Ägyp-
ten stellt sich die Frage, wie eine neue
Ordnung möglicherweise aussehen und
welche Konsequenzen sie für unterschied-
liche Akteure und Gruppen haben wird.
Wir wollen uns im Rahmen dieses Work-
shops sowohl mit diesen Bildern von Cha-
os und Ordnung in Geschichte und Ge-
genwart einer – wie auch immer konzi-
pierten – mediterranen Welt beschäftigen,
als auch der Frage nachgehen, wie diese
Blickwinkel, wie diese Ordnungsschemata
konfiguriert werden und in welche sozia-
len, kulturellen und historischen Kontexte
sie jeweils zu stellen sind.
So haben wir in der Ausschreibung für den
Workshop bereits darauf hingewiesen,
dass die Setzung der ategorie ‚Raum’
allein schon ein ordnungsmächtiger Akt
ist: der Raum hat ein Innen und ein Außen,
ein Dazugehören und ein Außenvorsein
und dazwischen eine signifikante Grenze,
die diskursiv gesetzt und militärisch ver-
teidigt wird.
Die Konstruktion dieses Raumes erfolgt
entlang normativer Setzungen kollektiver
Rede. Der Raum steht nicht für sich a prio-
ri oder als »Naturzustand«. Die Frage da-
nach, was der Raum eigentlich ist und wo,
wird entlang der Ordnungen eines Diskur-
ses immer wieder neu gestellt und ver-
handelt. Nicht nur das Mittelmeer selbst
ist (erdgeschichtlich) historisch, sondern v.
a. seine Wahrnehmung, Erfassung, die
Perspektive auf ihn, so wie die Begriffe
Mittelmeer und Raum selbst historisch,
sozial, kulturell d. h. nicht zuletzt wissens-
geschichtlich zu verorten sind. Wir möch-
ten nach den unterschiedlichen Perspekti-
ven auf den mediterranen Raum fragen,
nach ihren Rahmungen und Bedingungen
und nach den Auswirkungen dieses ord-
nenden Blicks auf eine spezifische Region.
Die Dialektik der Ordnung
Die Geschichte der Erforschung des Mit-
telmeerraums mäandert zwischen der
Suche nach der Einheit des Raums und der
Postulierung seiner unüberwindbaren Zer-
splitterung, zwischen der Suche nach dem
mediterranen Leitmotiv, der
Mediterranität, und der Bewahrung der
Vielfalt; zwischen aneignenden Diskursen
und Diskurspraktiken entlang kolonial-
exotisierender Hegemonien und postkolo-
nialen Selbstermächtigungen als einem
neuen »Mediterranismus«13. Es liegt nicht
fern, die jeweiligen Forschungsparadig-
men an and der ategorien ‚C aos’ und
‚Ordnung’ au zus lüsseln wurden do
lange Zeit, und werden auch immer wie-
der, Bilder von Ordnung, von Stabilität,
Begriffe wie »höhere Kultur« und »Zivilisa-
tion« eben als mit einer westlichen bzw.
(nord-/west-)europäischen Kultur-Leistung
assoziiert, während man Bilder von Chaos,
13
vgl. Giaccaria – Minca 2010.
Seite | 6
Unordnung, Unübersichtlichkeit, Planlo-
sigkeit, Wildheit, aber auch Exotik dem
Süden und spezifisch dem Mittelmeer-
raum zuordnete und weiterhin zuordnet.
Dies lässt sich nicht zuletzt immer noch im
gültigen populären Wissen nachweisen
(etwa im konventionellen Stereotyp vom
»hitzigen Südländer«).
Ordnungsentwürfe, Ordnung schaffen,
Ordnung suchen und sehen kann als
Selbstvergewisserung, als Identitätsent-
wurf gelesen werden; Zuschreibungen des
Chaotischen als Abgrenzung und othering
im Aushandeln von Identitäten. Zygmunt
Bauman hat diesen Zusammenhang, diese
wechselseitige Bedingtheit von Ordnung
und Chaos in dem Begriff der »Dialektik
der Ordnung« zu fassen gesucht: Das Cha-
os erscheine nicht zuletzt auch als ein Re-
flex, als eine Kreatur, vielleicht als die ne-
gative Projektion einer gesetzten Vorstel-
lung von Ordnung. Unordnung entsteht
also erst dann, wenn man einen Begriff
von Ordnung formuliert, weil dann alles,
was nicht Teil dieser Ordnung ist, als Un-
ordnung erscheint, als das andere, das
geordnet d.h. überwunden und eliminiert
werden muss.14 So schreibt Bauman über
die gesellschaftlichen Visionen von Ord-
nung:
»Sie spalten die menschliche Welt in eine
Gruppe, für die die ideale Ordnung errich-
tet werden soll, und eine andere, die in
dem Bild und der Strategie nur als ein zu
überwindender Widerstand vorkommt –
als das Unpassende, das Unkontrollierba-
re, das Widersinnige und das Ambivalente.
Dieses Andere, das aus der ‚S a ung von
14
Baumann 1992a.
Ordnung und armonie’ ervorgegangen
ist, das Überbleibsel des
klassifikatorischen Bestrebens, wird aus
jenem Universum der Verpflichtung
herausgeworfen, das die Mitglieder der
Gruppe bindet und ihr Recht anerkennt,
als Träger moralischer Rechte behandelt
zu werden.«15
Bedeutsam ist also die grundsätzliche Vor-
stellung einer diskreten Unterscheidung
zwischen Ordnung und Un-Ordnung, dem
was dazugehört und dem was nicht dazu
gehört, kurz: zwischen Identität und Alteri-
tät.
Es erscheint uns wichtig, nicht an der
Oberfläche stehen zu bleiben und sich das
vorzuspiegeln, was wir ohnehin schon zu
wissen glauben, sondern genauer hinzu-
sehen und zu fragen, in welchen Kontex-
ten welches Wissen, welche Bilder und
Narrative jeweils mit Chaos und Ordnung
konnotiert sind: Modernität und Rück-
ständigkeit, Aufbruch und
Festgefahrenheit, Vernunft und Gefühl,
männlich und weiblich, Nord und Süd, Ost
und West, und so weiter...
Den eigenen (wissenschaftlichen, for-
schenden) Blick zu schärfen, bedeutet so-
mit den eigenen Blick zu perspektivieren.
Perspektivität, oder: thinking outside the
box, bedeutet manchmal eine Herausfor-
derung liebgewonnener Ein-Sichten. Das
trifft vor allem dann zu, wenn wir die Ge-
genpole Ordnung und Chaos aufeinander
treffen lassen: Der spielende Gott tollt mit
dem Leviathan im Meer herum und das
klingt possierlich; doch die beiden spielen,
15
Bauman 1992b, 55.
Seite | 7
wie schon gesagt, Schiffe versenken und
dabei gehen Menschen zugrunde. Aber
auch: Der Neu-Ordnung einer Welt, einer
Gesellschaft, geht doch immer eine Um-
Ordnung und damit verbundene Un-
Ordnung der alten einher. Die Ordnung
der einen bedeutet das Chaos der ande-
ren, der Aufstieg, der Glanz, die Macht der
einen bedeutet den Niedergang, den Ver-
fall, die Ohnmacht der anderen. Die Stabi-
lität des Euro gegen den Klassenkampf in
Griechenland. Die Möglichkeiten der Glo-
balisierung gegen den Verlust Jahrhunder-
te alter Traditionen. Die Ordnung der
(modernen) Welt gegen die Weisungen
Gottes. Die Sicherheitsordnungen des mo-
dernen Nationalstaates gegen die Un-
Kalkulierbarkeit nomadischer Lebenswel-
ten usw.
Ordnung und Chaos sind somit Säulen ei-
nes antagonistischen Weltbildes und
Denksystems, das historisch weit zurück-
reicht, so weit wie die Geschichtsschrei-
bung selbst, und das tief in unserem
Sprachgebrauch verankert zu sein scheint.
Nun ist es die Frage, ob wir in Antagonis-
men (weiter-)denken müssen oder ob es
Alternativen gibt – in unserem Blick auf
unseren Forschungsgegenstand, in unse-
rem Sprachgebrauch. Das ist vielleicht
auch eine der Fragen, die zu diskutieren
wir morgen in der Abschlussdiskussion
Gelegenheit haben werden.
Bei Braudel klingt bspw. auch eine andere
Perspektive auf den Mittelmeerraum an,
die den Chaoskämpfen entgegensteht: das
Mittelmeer und seine Welt ist ihm eine
Welt der Verbindungen und Verbunden-
heit, der »Konnektivität« – bei allen Diffe-
renzen und Konflikten: eine Einheit in der
Vielfalt, nicht des »Clash of Civilizations«.
Abschließend noch einmal zurück zu den
Ausgangsfragen dieses Workshops, die uns
in den Diskussionen begleiten sollen:
Wie sind Konjunkturen von ordnenden
und »chaotisierenden« (Leit-)Bildern in
Bezug auf das Mittelmeer und seine Um-
welt in historischen und aktuellen Kontex-
ten zu verorten?
Inwiefern spiegeln die wissenschaftlichen
und politischen Diskurse über den Mittel-
meerraum das Bestreben wider, den Mit-
telmeerraum zu ordnen und zu systemati-
sieren? Sehen sich die Wissenschaften z.B.
einer chaotischen Natur gegenüber, die
mithilfe menschlicher Ordnungssysteme
und Modernisierungen bezwungen wer-
den muss? Oder sind es Menschen, die
eine »natürliche Ordnung« gefährden?
Welche Bilder und Erzählungen von Chaos
und Ordnung, von Meer und Land,
Mensch und Natur werden in den ver-
schiedenen Gruppen und Gesellschaften
tradiert, die den Mittelmeerraum prägten
und immer noch prägen? Welche Erinne-
rungsnarrative erzählen von Erfahrungen
von Ordnung und Chaos?
Sind ‚Ordnung’ und ‚C aos’ Topoi die ei-
ner kollektiven Erinnerung Struktur ge-
ben?
Was geschieht mit der Erinnerung an das
Chaos, wenn Ordnung herrscht, und um-
gekehrt? Was wird überliefert und wie?
Wo treffen wir vielleicht auf Leerstellen?
Seite | 8
Gibt es ein »mediterranes« Gedächtnis?
Gibt es spezifische »mediterrane« Erinne-
rungsorte? Und wie sind Erinnerungsorte
in den Prozess eingebunden, Stabilität zu
stiften?
Welche Erfahrungen von Migration, Ent-
wurzelung und Vertreibung, von Wider-
stand gegen und Unterwerfung unter
Mehrheitsordnungen werden in Überliefe-
rungen sinnstiftend eingebunden oder
fließen in materielle Kultur, Literatur,
Kunst und Musik ein?
Wie wird sich mit konkreten Ordnungen
wie etwa Geschlechterverhältnissen oder
Sesshaftigkeit auseinandergesetzt und wie
werden diese Entwürfe in Handlungen
übersetzt?
Welche Übergänge, Zwischenräume und
Alternativen zwischen Ordnung und Chaos
lassen sich erkennen?
Und vielleicht auch: Welche Zukunft lässt
sich denken, in oder jenseits von Chaos
und Ordnung?
Literatur
M. auks ‚C aos’ als Metap er ür die
Gefährdung der Weltordnung, in: B. Ja-
nowski – B. Ego (Hrsg.), Das biblische
Weltbild und seine altorientalischen Kon-
texte (Tübingen 2001) 431–464.
Z. Bauman, Dialektik der Ordnung. Die
Moderne und der Holocaust (Hamburg
1992a).
Z. Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das
Ende der Eindeutigkeit (Hamburg 1992b).
F. Braudel (Hrsg.), Die Welt des Mittel-
meeres (Frankfurt am Main 1987) [frz.: La
Méditerranée. L’espa e et l’ istoire les
ommes et l’ éritage Paris 1985–86].
J. Ebach, Leviathan und Behemoth. Eine
biblische Erinnerung wider die Kolonisie-
rung der Lebenswelt durch das Prinzip der
Zweckrationalität (Paderborn 1984).
J. Ebach, Streiten mit Gott. Hiob, 2 Bde.
³(Neukirchen-Vluyn 2007–2009).
J. Ebach, Schrift-Stücke. Biblische
Miniaturen (Gütersloh 2011).
P. Giaccaria – C. Minca, The Mediterra-
nean Alternative, Progress in Human Ge-
ography 35, 3, 2010, 345–365.
F. Neumann, Behemoth. Struktur und Pra-
xis des Nationalsozialismus 1933–1944
(Frankfurt am Main 1984) [dt. zuerst 1977;
engl. zuerst 1942 als: Behemoth. The
Structure and Practice of National
Socialism].
Seite | 9
Christine Isabel Schröder: Un- und
Um-Ordnung von Gesellschaft
Der diesjährige Workshop beginnt mit
einem Panel, das mit Un- und Um-
Ordnung von Gesellschaft betitelt worden
ist. Es wird also zunächst um das Chaos
gehen und Versuche seiner Bewältigung,
um politische und soziale Umwälzungen,
um Niedergang alter und Strukturen neuer
Ordnungen. Braudels oben genanntes Zi-
tat der »Zivilisation« – gleichwohl von ihm
in Anführungszeichen gesetzt, denn Brau-
del schreibt nicht ohne kritischen Kom-
mentar die Geschichte derselben – ist
wiederum selbst Teil einer Ordnung stif-
tenden Erzählung vom Mittelmeer, dem
ihm umgebenden Gebiet und seinen Be-
wohnern. Diese Erzählung, die so hartnä-
ckig, gerade im populären Diskurs, für das
sogenannte »europäisch-westliche«
Selbstverständnis steht, wird kontrastiert
mit den historischen und aktuellen Bildern
und Erfahrungen von Umwälzungen, Krieg,
Gewalt und Vertreibung – und dabei sind
es hauptsächlich »europäisch-westliche«
Ereignisse, Entwicklungen und Bewegun-
gen, die besonders in diesem ersten Panel
im Hinblick auf Un- und Umordnung von
Gesellschaften in den Fokus gerückt wer-
den: die Raubzüge der Normannen aus
dem Norden ins Mittelmeergebiet im Mit-
telalter, der italienische Faschismus und
der spanische Franquismus und ihre Ge-
waltverstrickungen im 20. Jahrhundert.
Zunächst richtet David Wallenhorst (Kiel)
einen sozialgeschichtlichen Blick auf das
Gebiet des italienischen Klosters
Montecassino im 11. und 12. Jahrhundert
zwischen der Expansion der Normannen
und dem Investiturstreit. Anschließend
werden wir in die Neuzeit springen und
zwei europäis e viellei t ‚mediterrane’
Diktaturen des 20. Jahrhunderts fokussie-
ren. Martina Clemen (Göttingen) wird die
Sinn- und damit Ordnungs-stiftenden Nar-
rative drei verschiedener spanischer Ge-
nerationen vom Niedergang alter Ordnun-
gen, dem Aufbruch in die Moderne bis hin
zur Ära Francos analysieren. Katharina
Schembs (Berlin) setzt sich schließlich mit
der italienisch-faschistischen Bildpropa-
ganda auseinander, die das Bild des Arbei-
ters in eine neue ästhetische Ordnung zu
übertragen suchte, und sie untersucht die
Wirkungsmacht dieser Neuordnung in
transmediterraner Perspektive, nämlich im
Vergleich mit dem peronistischen Argenti-
nien.
Seite | 10
David Wallenhorst: Montecassino
zwischen Normannenexpansion
und Investiturstreit - Die norman-
nische Eroberung Unteritaliens
und die Leiden der Bevölkerung
im Spiegel der Privaturkunden
Montecassinos
Die äußere Geschichte des Klosters
Montecassino bestimmten in der zweiten
Hälfte des 11. Jahrhunderts nicht nur die
Auseinandersetzungen um Investiturstreit
und Kirchenreform, sondern auch, in sei-
ner direkten Nachbarschaft, die militäri-
sche Expansion der Normannen. Zu Beginn
des Jahrhunderts waren die Krieger aus
der Normandie als Söldner ins Land geru-
fen worden. Am Ende des 11. Jahrhun-
derts kontrollierten sie als Vasallen des
Papstes den Großteil Süditaliens, nachdem
sie den Einfluss der Langobardenfürsten
und -grafen sowie der Byzantiner zurück-
gedrängt hatten; später sollten sie auch
die Araber verdrängen. Die Äbte
Montecassinos verstanden es, ihr Kloster
aus den verschiedenen Konflikten weitge-
hend herauszuhalten. Im Streit zwischen
geistlicher und weltlicher Macht vollbrach-
te etwa Abt Desiderius das Kunststück,
gleichzeitig dem Papst und dem Kaiser die
Treue zu halten – er meldete Gregor VII.
die nahende Befreiung und zugleich Hein-
rich IV. die nahende Gefahr, als 1084 die
Normannen auf Rom marschierten, um
ihrem Lehensherrn Gregor VII. zu Hilfe zu
kommen. Schon früh bemühten sich die
Äbte Montecassinos darum, mit diploma-
tischem Geschick Konflikte mit den nor-
mannischen Eroberern zu vermeiden, sie
mit der liturgischen und legitimitätsstif-
tenden Funktion des Klosters für sich zu
gewinnen und letztlich von den Norman-
nen und ihren zunehmenden Schenkungen
zu profitieren.
Leben und Besitz der Menschen im Um-
kreis des Klosters wurden jedoch von den
Normannenzügen durchaus in Mitleiden-
schaft gezogen, und die reiche chronikali-
sche und urkundliche Überlieferung
Montecassinos erlaubt es, Dinge in den
Blick zu nehmen, die von den mittelalterli-
chen Geschichtsschreibern nur selten be-
rücksichtigt werden: nämlich die Hand-
lungsmöglichkeiten und das Schicksal der-
jenigen, die nicht Politik machen, sondern
die der Politik und den Eroberungszügen
ausgeliefert sind.
Über die Geschichte des Klosters und sei-
ner Umgebung berichten zahlreiche erzäh-
lende Quellen, allen voran die Chronik von
Montecassino des Leo Marsicanus und
seiner Fortsetzer. Daneben verfügen wir
über Privaturkunden, die in recht ver-
streuten und zum Teil sehr alten Drucken
publiziert und nicht vollständig in moder-
nen Regestenwerken erfasst sind. Diese
Rechtsdokumente sind stark formalisiert
und oft nicht mehr als ein knapper Beleg
für einen rechtlichen Vorgang, der bereits
bei der Zuordnung von Orten und Perso-
nen Schwierigkeiten bereitet. Ihre große
Zahl erlaubt allerdings, sie vergleichend in
den Blick zu nehmen.
Trotz der hier nötigen Einschränkung auf
Urkunden, die einer geistlichen Einrich-
tung (Montecassino oder einer seiner De-
pendancen) den Erwerb durch Kauf oder
Schenkung beglaubigen, bietet das Urkun-
dencorpus wertvolle Ergänzungen zu dem,
Seite | 11
was sich den anderen Quellengattungen
entnehmen lässt. Welche Unruhe der
Vormarsch der Normannen in Süditalien
hervorrief, kann man den erzählenden
Quellen ebenso entnehmen wie zum Bei-
spiel den überlieferten Briefen, die aber
nur von wenigen Personen, etwa Papst
Gregor VII., erhalten sind. Dagegen ist das
Schicksal der von der politischen und mili-
tärischen Entwicklung betroffenen Bevöl-
kerung, die in der sonstigen Überlieferung
keine Erwähnung findet, in den Urkunden
ihrer Rechtsakte zu erahnen.
Die Not der Menschen lässt sich bereits an
der bloßen Vielzahl der Verkäufe und Stei-
gerung der Schenkungstätigkeit in den
späten 1060er Jahren ablesen, als die Ter-
ra Sancti Benedicti und das Fürstentum
Capua von den Normannen verwüstet
wurden: „Gerade in dem Ja rze nt in
dem die härtesten Kämpfe und Aufstände
in der Umgebung Montecassinos ausge-
tragen wurden, war die Schenkungsdichte
am größten!“1 Darüber hinaus enthalten
einige Urkunden deutliche und innerhalb
eines durchweg formelhaften und spröden
Rechtstextes umso bemerkenswertere
Aussagen über die Motive der betreffen-
den Rechtshandlung. 1068 wurde etwa
der Verkauf eines ausgesprochen kleinen
Grundstücks an das Kloster Montecassino
damit begründet, die minderjährigen Ver-
käufer seien in derart tiefe Not gestürzt,
dass sie nichts mehr zum Leben hätten;
mehrfach wiederholt der Urkundentext
die Wendung, der Verkauf solle Not und
Hungertod verhindern.2 Offenbart die Ur-
kunde auch in scheinbar drastischen Wor-
1 Dormeier 1979, 65 f.
2 Gattola 1733, 74.
ten den Grund ihrer Entstehung, so kann
sie in formaler Hinsicht als Beispiel dafür
gelten, wie die Menschen selbst in derart
unruhigen Zeiten Besitzveränderungen in
den üblichen Formen festzuhalten such-
ten: Vom Vorgehen der Verkäufer bis zur
Wortwahl des Richters, welcher die Ur-
kunde aufsetzt, entspricht das Formular
völlig dem im 11. Jahrhundert üblichen
Verfahren, das auf die Langobardenrechte
des 8. Jahrhunderts zurückgeht.3 Als Atta,
die Tochter des Paldus von Venafro und
Gattin des Johannes von Venafro, 1072
wort- und wiederholungsreich darlegt, wie
sorgfältig sie ihren Mann um die Erlaubnis
gebeten habe, dem Kloster Santa Maria in
Cingla etwas von ihrem Besitz schenken zu
dürfen, dann betont sie gleichfalls ganz
dem geltenden Re t entspre end: „dass
ich mich rechtlich von meinem Muntherrn
völlig ab ängig weiß.“4
Besonderer Wert kommt denjenigen
Rechtstexten zu, die der Form nicht ent-
sprechen oder über das Übliche hinausge-
hen. 1075 übertrug der Langobardengraf
Johannes Squintus von Pontecorvo einen
großen Teil seines Besitzes dem Kloster
Montecassino – „gemäß dem Gesetz“ und
„o ne irgendeinen Vorbe alt“ wie es dem
üblichen Formular entsprach.5 Dann
macht er aber doch einen Vorbehalt, der
so ungewöhnlich wie aufschlussreich ist:
„I be alte meinen re tmäßigen Erben
vor, dass, wenn bessere Zeiten kommen,
sie dann das Recht haben sollen, diesen
meinen esitz zurü kzukau en.“6 Zwar
wird nicht klar gesagt, warum die Zeiten
3 vgl. Fabiani 1968, I, 246.
4 Gattola 1733, 45 f.
5 Gattola 1734, 169.
6 Gattola 1734, 169 f.
Seite | 12
schlecht seien. Der Schenkgeber legt aber
fest: Falls sie noch schlechter werden,
dann soll derjenige all sein restliches Ver-
mögen er alten wel er „uns il e leisten
oder uns ein Ort sein soll, an den wir flie-
hen können oder wo wir uns aufhalten
können: das besagte und obengenannte
heilige Kloster; und wir behalten uns vor,
wenn solche Dinge irgendwann gegen un-
seren Willen geschehen sollten, dann [im
Kloster] das Leben der Seele wie des Kör-
pers zu aben.“ Die Sorge um das Seelen-
heil ist in vielen Urkunden als Grund der
Stiftung angeführt, und auch einen Eintritt
in den Konvent erstrebten viele Menschen
im Interesse von Seelenheil und Totenge-
dächtnis.7 Den Wunsch, ins Kloster eintre-
ten oder sich dort zumindest aufhalten zu
dürfen, mit dem Ziel der körperlichen Un-
versehrtheit zu verbinden, ist hingegen
ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass
der Langobardengraf sein Leben außer-
halb der Klostermauern in Gefahr sah.
Die Normannen erwähnt der
Langobardengraf zwar nicht, aber dass nur
sie die Ursache seiner Ängste sein können,
ergibt sich aus der Parallelüberlieferung
der erzählenden Quellen, die von fort-
schreitendem Landgewinn der Norman-
nen berichten. Die Chronik von
Montecassino hebt zugleich den Besitzzu-
wachs des Klosters durch die Schenkung
des Grafen hervor, ohne freilich auf Ver-
sorgungsanspruch und Rückkaufvorbehalt
einzugehen.8
Im selben Kapitel zählt Leo Marsicanus
zudem auf, was Paldus von Venafro dem
7 vgl. Dormeier 1979.
8 Chronik III, 17
Kloster als Großteil seines Besitzes über-
tragen hat. Der Stifter, der nicht das Klos-
ter Montecassino, sondern den heiligen
Benedikt als den eigentlichen Empfänger
anspricht, fügt zwischen Pertinenz- und
Pönformel den Wunsch ein, das erhaltene
Gut möge Benedikts Vertretern weder
Streit bringen noch Gewalt.9 Davon hatte
er selbst genug erfahren, und indem er
weite Teile seines Besitzes dem Kloster
übertrug, gab er seinen Widerstand gegen
die normannischen Eroberer auf. Wie aus-
sichtslos dieser war, musste auch sein
Verwandter, Landulf von Venafro, erleben,
der vergeblich Widerstand leistete und
letztlich alles verlor. Die Datierung der
1064 ausgestellten Urkunde nach den Re-
gierungsjahren Richards von Capua unter-
streicht die alleinige Herrschaft des Nor-
mannenfürsten, und Richard selbst bestä-
tigt den politischen Wechsel in dieser Re-
gion in der Narratio einer Urkunde von
1065. Dort heißt es, die langobardischen
Grafen von Venafro hätten sich gegen ihn
verschworen und Feinde in sein Land „ein-
geladen und ereinge ü rt“; da er sei
ihnen all ihr Gut entzogen worden – ge-
mäß dem langobardischen Recht.10 Nun
aber wolle er Teile dieses Gutes dem Klos-
ter Montecassino übertragen: Er habe
eingesehen, dass, wer Gottes Besitz ein-
nehme, von Gott zerstört werde (Ps
83,14). Der biblische Ausdruck könnte auf
Abt Desiderius zurückgehen, über den die
Chronik von Montecassino berichtet, er
allein habe mit Geschenken und Bitten
erreicht, dass Richard der Übertragung u.
a. einer urg „überaus reudig zu-
9 Gattola 1734, 168.
10 Gattola 1734, 164 f.
Seite | 13
stimmt“.11 Laut Richards Urkunde hatte
den Anstoß allerdings ein Fürbitter gege-
ben der mit den Worten „einstmals Graf
von Teano“ benannt wird.
Nachdem die Normannen die angestamm-
ten Langobardengrafen verdrängt hatten,
übernahmen sie nicht nur hergebrachtes
Recht, sie förderten auch die Kirche, wie
es ihre Vorgänger getan hatten. Schließlich
wurden sie gar zu Verfechtern der Kir-
enre orm wie jener Gilbert „aus dem
Volk der Normannen“ der 1070 eine klei-
ne Kirche an Santa Maria in Cingla gab. Er
selbst hatte sie zuvor „entspre end unse-
ren räu en“ von Ri ard von Caiazzo
erhalten, als er dessen Schwester geheira-
tet hatte. Da sie nun ohne Leitung und
ohne Regel darniederliege, so heißt es in
der Urkunde, hoffe er, dass von Santa Ma-
ria in Cingla aus der Konvent wieder auf-
gerichtet werden könne.12 1094 fürchtete
Robert von Caiazzo um sein Seelenheil,
weil im vorher so vorbildlichen Kloster
Santa Maria in Cingla der Gottesdienst
nachlässig abgehalten und das zugehörige
Kloster schlecht und weltlich geführt wer-
de. Da es früher zu Montecassino gehört
habe, gebe er es nunmehr zurück.13 Als
„zurü kgegeben“ bezei net es au der
Cassineser Chronist, und er erwähnt 1105
ausdrücklich, die Intervention Roberts von
Caiazzo habe Fürst Richard (II.) von Capua
dazu gebracht, auch den Großteil von
Pontecorvo an Montecassino zu übertra-
gen.14
11
Chronik III, 16 12
Gattola 1733, 42. 13
Gattola 1734, 713 f. 14
Chronik IV, 16/25.
Es zeigt sich also nicht nur, wie rasch die
Normannen die Herrschaft übernommen
haben, sondern auch, wie gut sie sich in
die bestehende rechtliche und soziale
Ordnung eingefügt und ihre verdrängten
Vorgänger regelrecht ersetzt haben. Dass
die ansässigen Menschen auf ihre Not re-
agierten, indem sie ihre Güter dem schüt-
zenden Kloster übergaben – mitunter auch
sich selbst –, hatte einen nicht zu unter-
schätzenden Anteil an dem Aufschwung,
welchen Montecassino nahm. Es erhielt
Zuwendungen der ansässigen Menschen,
die von den Normannen heimgesucht
wurden, und es erhielt Zuwendungen der
Normannen, die, einmal angekommen,
Legitimität und Seelenheil suchten.
Die Privaturkunden Montecassinos und
seiner Dependancen bilden ein Corpus,
das nicht nur aufgrund seines Umfangs
weitere Ergebnisse verspricht, sondern
auch inhaltlich besonders aufschlussreich
ist, weil der Kreis der Verkäufer und
Schenker ausgesprochen groß ist und bei
unterschiedlicher sozialer Stellung Einhei-
mische wie Invasoren umfasst.
Quellen und Literatur
H. Bloch, Monte Cassino in the Middle
Ages, 3 Bde. (Cambridge/MA 1986).
M. Dell’Omo Monte assino. Un’abbazia
nella storia (Cinisello Balsamo 1999).
M. Dell’Omo Il Registrum di Pietro Di-
acono (Montecassino, Archivio
dell’Abbazia Reg. 3). Commentario odi-
cologico, paleografico, diplomatico (Mon-
tecassino 2000).
Seite | 14
H. Dormeier, Montecassino und die Laien
(Stuttgart 1979).
L. Fabiani, La Terra di S. Benedetto. Studio
storico-giuridi o sull’Abbazia di Monte-
assino dall’VIII al XIII se olo 2 de (Mon-
tecassino 1968).
E. Gattola istoria abbatiae Cassinensis …
distributa (Venedig 1733).
E. Gattola, Ad Historiam abbatiae
Cassinensis Accessiones (Venedig 1734).
H. Hoffmann (Hrsg.), Die Chronik von
Montecassino, MGH SS 34 (Hannover
1980).
G. A. Loud, Conquerors and Churchmen in
Norman Italy (Aldershot 1999).
Seite | 15
Martina Clemen: Von Ordnungs-
konzepten und Problemlösestra-
tegien: „generation-building“ in
Spanien (1914-1948)
Einleitung
Der Vortrag analysiert spanische Genera-
tionenkonstruktionen der ersten Hälfte
des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Unter-
suchung der generationell argumentie-
renden Akteure als politische bzw. kultu-
relle Eliten, ihre diskursive Stilisierung zu
einer Generation sowie die Analyse ihrer
sinnstiftenden Ordnungsentwürfe liefern
neue Erkenntnisse für die spanische Gene-
rationenforschung: Es wird gezeigt, in wel-
chem konstitutiven Verhältnis die Para-
digmen Generation und Nation, im Sinne
einer „imagined ommunity“1 stehen.
Zunächst zur ordnenden Funktion des Ge-
nerationenbegriffs: Seine Verwendung
kann insbesondere in politisch instabilen
Zeiten sowie Zeiten der Beschleunigung
strukturstiftend wirken; sozusagen als
identitärer „Rettungsanker in risenzei-
ten“.
Zudem erlauben es generationelle Zu-
schreibungen, historischen Wandel kollek-
tiv wahrnehmbar und erfahrbar zu ma-
chen.2
Wer waren die Akteure, die auf dieses
Interpretationskonstrukt rekurrierten? In
Spanien waren es primär Personen geho-
bener sozialer Schichten, die vorwiegend
dem Bildungsbürgertum zuzurechnen wa-
ren. Man könnte sie als „Intellektuelle“ 1 s. Anderson 1993.
2 s. Jureit, 3.
bezeichnen, die sich zu den verschiedens-
ten Themen des öffentlichen Lebens ihrer
Zeit äußerten und daneben oftmals Ämter
in erzieherischen sowie politischen Institu-
tionen bekleideten.
Dabei standen sie mit Gleichgesinnten
ihrer Zeit in engem Kontakt: die Zeugnisse
regelmäßiger Treffen, Briefkorresponden-
zen sowie publizistischer Initiativen be-
kräftigen dies; symptomatisch ist auch das
hohe Maß an Selbstreferenz sowie patrio-
tischem Veränderungsbewusstsein.3
Die Bestandsaufnahme eines diagnosti-
zierten „Spanienproblems“ ging dem
Wunsch nach Um-Ordnung und Struktu-
rierung voraus. Ziel war die Lösung dieses
Problems und die Formierung einer jeweils
neu erdachten spanischen Nationsprojek-
tion.
Im Folgenden möchte ich in Anlehnung an
Ulrich Herbert4 und Ulrike Jureit5 vom
onstrukt der „politis en Generationen“
sprechen: Die in Spanien durch den Gene-
rationenbegriff evozierte Imagination ei-
nes „Wir-Ge ü ls“ ist nämli dadur
politisch konnotiert, dass sie primär auf
Staatlichkeit ausgerichtet war. Obwohl in
Spanien insi tli der „politis en Ge-
nerationen ormationen“ immer wieder
Re erenzen au „Vorgängergenerationen“
Konjunktur hatten, ist doch zu beobach-
ten, dass diese Handlungsgemeinschaften
3 Insbesondere charakteristisch für die politische
Generation der „1936er“ in Spanien ist die Au as-
sung der eigenen Generation als „Trägergruppe mit
besonderen Au gaben“: ierzu (S. 152) und zur
ategorie der Generation als „Selbstermä ti-
gungs“-Kategorie, s. Dabag 2006. 4 s. Herbert 2003.
5 s. Jureit 2006.
Seite | 16
zukunftsorientiert agierten; die Reklama-
tion eines Generationenwechsels wird
dabei insbesondere zu Krisenzeiten gesell-
schaftsfähig.6
Das prägende Jahr 1898, in dem Spanien
im Krieg mit den USA seine letzten über-
seeischen Kolonien verlor, ging als „natio-
nale Demütigung“ in die spanis e Ge-
schichtsschreibung ein. Das
„Sonderwegsnarrativ“ Spanien unter-
scheide sich in seinen Grundfesten von
anderen europäischen Nationen und die
damit einhergehende Annahme, dass Spa-
nien spätestens seit dem 18. Jahrhundert
im Verfall begriffen sei, führte zu vehe-
menten Klagen insbesondere auf Seiten
der kulturellen Elite. Eine Lösung für das
„Problem“ wurde einge ordert mit ande-
ren Worten: die Errettung des Landes aus
einem emp undenen „C aos“.
Ausweg aus der Krise 1:
Spanien braucht ein (-europäisches-)
Rückgrat!
Waren die An änger der „1898er-
Generation“ als erste „politis e Genera-
tion“ der klassis en Moderne no als
„introspektiv-pessimistis “ zu bes rei-
ben, so änderte sich dies grundlegend mit
der generationellen Konzeption des groß-
bürgerlichen Philosophen José Ortega y
Gasset (1883-1955), der die kulturpoliti-
sche Elite in seiner Konferenz Vieja y
nueva política (Teatro de la Comedia von
Madrid, März 1914) zu mehr Initiative auf-
forderte.7 Genauer: Die „privilegierten
6 Jureit 2006, 39.
7 Ortega y Gasset 1966.
Männer der ungere ten Gesells a t“8
seiner Zeit sollten Spanien als neue Gene-
ration ein Rückgrat verleihen, indem sie
gezielt und verantwortungsvoll die politi-
sche Neuordnung der Nation herbeiführ-
ten.
Warum aber dieser energische Appell zur
gesellschaftlichen Um-Ordnung – was war
die Antriebskraft für diesen politischen
Mobilmachungsakt?
Ohne Zweifel sind die Gründe im spani-
schen fin de siècle zu sehen: die geschei-
terte Revolution von 1868 und die Etablie-
rung der nicht von Erfolg gekrönten Ersten
Republik von 1874/75, die schließlich die
Restauration der Bourbonendynastie zu
Folge hatte mit einem politisch äußerst
instabilen System der Oligarchie und des
Kazikentums.9 Die sogenannten „nationa-
len risen aktoren“ kulminierten (s.o.) im
Jahr 1898.
Ortega y Gasset s rieb 1914: „Quisiera
gritar lo menos posible“ – „I mö te so
wenig wie mögli s reien“ denn Ge-
schrei, so der Essayist in Anlehnung an da
Vin is „dove si grida non è vera s ienza“
zeugte von Unwissenheit. Seine Generati-
on sollte nach außen orientiert sein; Län-
der wie England, Frankreich oder Deutsch-
land sollten Spanien als Vorbilder dienen.
Ortega forderte die Integration europäi-
scher Wissenschaft und Kulturen, um sys-
tematis eine dynamis e „vitale“ Nati-
8 „[M]e dirijo a los nuevos ombres privilegiados
de la injusta sociedad – a médicos e ingenieros, profesores y comerciantes, industriales y técnicos –; me dirijo a ellos y les pido su olabora ión.” Or-tega y Gasset 1966, 286. 9 s. Bernecker – Pietschmann 2005, 278–283.
Seite | 17
on zu konstruieren und das Land somit aus
der beklagten Stagnation zu erretten. Dem
Politikverständnis des Philosophen liegen
deutlich kulturelle Prämissen zugrunde:
nur durch pädagogische Intervention und
kulturelle Integration sei die Neuordnung
des Landes und im Zuge dessen die For-
mierung einer „organisierten“10 Nation
überhaupt möglich.
Der Aufruf Ortegas von 1914 war folgen-
reich: Obgleich das von ihm verfolgte Pro-
jekt einer „Liga der Politis en Erzie ung“
(„Liga de la Edu a ión Políti a“) nur von
kurzer Dauer war, können sowohl er als
Sprecher als auch seine Anhänger als fun-
damentale Akteure im Prozess der refor-
merischen Neuordnungen im Zuge der
Zweiten Spanischen Republik (1931-
1936/39) gesehen werden.
Ausweg aus der Krise 2:
Politische Ordnung durch Besinnung auf
europäische Hochkulturen und Katholi-
zismus
Ganz anders sah Jahre später der Lösungs-
vors lag des „Spanienproblems“ ür die
siegreich aus dem spanischen Bürgerkrieg
hervorgehenden Franquisten bzw. Falan-
gisten aus: die Lösung für die national-
10
Wenn Ortega von „Nationalisierung“ spri t
geht es ihm semantisch hauptsächlich um Organi-
sation und Strukturierung des Landes: „Señores la
obra más característica que quisiéramos realizar
[…] onsiste en poner junto a aquella a irma ión
genéri a de liberalismo […] el prin ipio de la orga-
niza ión de España” s. Ortega y Gasset 1966 292.
katholis e „Generationsein eit“11 der
„Generation von 1936“ lag so einer i rer
wohl profiliertesten Sprecher, dem Histo-
riker Pedro Laín Entralgo (1908-2001),
allein in der Verbreitung des Katholischen
Glaubens sowie der Able nung „blinder
Wissenschaftsgläubigkeit“ der „1914er“.
Das Werk „Spanien als Problem“ von
194912 war Laín Entralgos Versuch, die
erange ensweise „seiner“ Generation
retrospektiv zu rechtfertigen.
Laín bezei nete seine „Generationsein-
eit“ als „ ra ión atóli a y na ional“ der
mit Ende des Kriegs die Aufgabe der Lö-
sung des „Spanienproblems“ au getragen
wurde.13
In Abgrenzung zur Generation um Ortega
wird taktisch auf den Ersten Weltkrieg
verwiesen, der den Menschen gezeigt ha-
ben sollte, dass Wissenschaft, nun unmo-
ralisch und ketzerisch, das Anathema von
Sicherheit und Glückseligkeit darstelle. Die
Lösung sah Laín schließlich im christlichen
Glauben, wobei er diesen auf den katholi-
schen reduzierte. Dieser wäre Schlüssel für
die Konstruktion eines vorbildhaften und
reinen Spaniens; die Konzentration auf
europäische Hochkulturen Garant für die
11
Zum analytischen Konzept der Generationen
“Generationslagerung” “Generationszusammen-
ang” und “Generationsein eit” s. Mann eim
1970, hier 547 ff. 12
s. Laín Entralgo 2006. 13
Laín Entalgo 2006 386: „Sólo un amino vimos
muchos abierto: intervenir con alma limpiamente
católica y anchamente nacional en la ya iniciada
tragedia de España; intentar resolver – con ánimo
más generoso y resuelto que nunca, pensamos – el
problema de España que al despertar a la vida
histórica encontramos tan acerba, tan cruelmente
planteado.”
Seite | 18
politische Einheit des Landes. Die Zielset-
zungen der neuen „Generationsein eit“
wurden besonders im Bereich der Schul-
bildung instrumentalisiert, um eine staats-
konsolidierende Elite „ eranzuzü ten“.
Der spanischen Jugend wurde eine Missi-
on angetragen: sie sollte dem Vaterland
Ruhm und Ehre verschaffen, wie einst die
onquistadoren und Gebildeten des „Gol-
denen Zeitalters“.14
Insbesondere in den Kriegs- und Nach-
kriegsjahren beherrschte dieser Diskurs
das öffentliche Leben. Doch mit der deut-
schen Kapitulation 1945 begannen sich
einige Vertreter der regimekonsolidieren-
den „1936er Generation“ von i rem in den
Gründungsjahren überschwänglichen fa-
s istis en „Ei er“ zu distanzieren. In
manchen Fällen schlossen sie sich sogar
der im Exil aktiven Opposition an. So am
Beispiel Pedro Laíns, Dionisio Ridruejos
oder auch Antonio Tovars zu beobachten,
die allesamt der kulturtragenden Elite des
Landes angehörten.
Pedro Laín Entralgo diagnostizierte dem-
zufolge am Ende der 1940er Jahre: Das
„aktuelle“ Spanienproblem beste e darin
dass Politik und Gesells a t der „Zwei
Spanien“ der zwei gegenüberste enden
Lager, es nicht vermögen, sich anzunähern
und zu versöhnen.
Dem kollektiven Au ru zu diesem „kultu-
rellen rü kenbau“15, einer Integration der
14
s. hierzu bspw. die Oberstufenreform Ley de 20 de septiembre de 1938 (B.O.E. 23-IX) des Nationa-len Bildungsministeriums (Ministerio de Educación Nacional). 15
So betont der Philosoph und Essayist José Luis López-Aranguren au der legendären “Generatio-nenkon erenz” der University o Syra use NY im
Antinomien, sollte ihn, wie auch anderen
Intellektuellen mit diesem „Sinneswan-
del“ zu eginn der 1950er Ja re den Le r-
stuhl kosten.
Nach 1945 kann also in Spanien die Ten-
denz einer politisch-kulturellen Unsicher-
heit einiger Vertreter der im Land geblie-
benen Intelligentsia ausgemacht werden.
So verwundert es nicht weiter, dass in
diesen Jahren einer beginnenden politi-
schen Instabilität erneut Legitimations-
maßnahmen ergriffen wurden, die wieder
„Ordnung“ in ein wenn auch nicht offen-
si tli es so do internes „C aos“ brin-
gen sollten.
Ausweg aus der Krise 3: Ein „katholisches
Rückgrat“ für den „chaotischen Konti-
nent“!
Der dritte generationelle Ordnungsent-
wurf als Gegenstand des Vortrags ist der-
jenige der „Generation von 1948“.16
Protagonist und Sprecher dieser Formati-
on war Rafael Calvo Serer (1916-1988),
seines Zeichens katholischer Schriftsteller
und Opus-Dei-Mitglied. Seine Botschaft:
Spanien hätte kein, wie die Gruppe um
Laín Entralgo Ende der 40er Jahre diagnos-
tizierte „Integrationsproblem“ der „zwei
Spanien“. Vielme r war „Spanien o ne
Problem“ – so der vielsagende Titel seines
Buches.17 Dieses neue Deutungsangebot
Ja r 1967: „[ ]emos servido de puente simbóli-camente; pero toda la generación ha sido un puen-te entre los unos y los otros, entre los que nos pre edieron y los que nos siguen.” zit. na Schmidt 1972, 316. 16
vgl. zu dieser Generationenformation die Studien von Prades Plaza 2007 und Díaz Hernández 2008. 17
s. Calvo Serer 1949.
Seite | 19
als Appell nationaler Einheit präsentierte
Calvo Serer zudem in dem Au satz „Eine
neue spanische Generation“ in der von
i m begründeten Zeits ri t „Arbor“ des
„Obersten Rates für wissenschaftliche For-
schung“ (CSIC).18
Calvo Serer grenzte sich hier mit Gleichge-
sinnten wie Florentino Pérez Embid und
Ángel López-Amo deutlich von der
„1936er-Generationsein eit“ um Ridruejo
Tovar und Laín ab – ihre kulturellen Ord-
nungsentwür e galten als „ges eitert“.
Ziel „seiner Generation“ sollte vielme r
sein, eine solide Grundlage für eine kultu-
relle Vormachtstellung zu konstruieren,
um die genuin spanis e „nationale Struk-
tur“ wiederzuerlangen.19
Konkret hieß dies: Abwendung von einem
Kastilien-zentrierten Spanienbild und An-
erkennung der regionalen Diversität des
Landes. Den Zentralismus verortete Serer
als klares Erbe der Französischen Revolu-
tion, die zutiefst häretisch und daher von
„seiner Generation“ abgele nt wurde. Es
galt, so der verklärte Ton des Manifests, zu
einer paradiesis anmutenden „mittelal-
terli en Tradition“ zurü kzuke ren. Zum
generationellen Vorbild und Lehrer wurde
der Kulturwissenschaftler Marcelino Me-
néndez y Pelayo (1856-1912) stilisiert,
Verfasser der mehrbändigen Anklage-
s ri t „Ges i te der spanis en ete-
rodoxen“.20 Die „ eterodoxie“ der ver-
gangenen Jahrhunderte wurde von der
18
s. Calvo Serer 1947. 19
s. Calvo Serer Ra ael: “Los intentos de una es-tru tura na ional ” A C 4. August 1953; zitiert in Juliá 2005, 359. 20
Menéndez Pelayo 1978.
„neuen Generation“ als das zentrale Ele-
ment eines empfundenen „Ver alls“ der
spanischen Nation angesehen. Der katho-
lische Glaube wurde zum glorreichen All-
heilmittel stilisiert und sämtliche liberale
Tendenzen zurückgewiesen.
Interessant: Calvo Serer drehte den Aufruf
Ortega y Gassets von 1914 in sein Gegen-
teil um, wobei er das gleiche Verb
„vertebrar“ zu Deuts „stabilisieren“
„ein Rü kgrat geben“ verwendete: wäh-
rend die „Generation von 1914“ pro-
grammatisch den Blick nach Europa richte-
te, das Spanien mit seiner wissenschaftli-
chen Fortschrittlichkeit strukturieren und
stärken sollte, war es nun die katholische
Struktur des Landes, welche dem Konti-
nent als Vorbild diente.21
Fazit: „Unsere Generation“ schafft Ord-
nung! Ein rekursives Deutungsmuster als
Leitmotiv der Intellektuellen im Spanien
des 20. Jahrhunderts
21
„De aquí la gran misión en la ora angustiosa de
la Europa moderna, ya que ésta, aunque más des-
viada y dañada por sus pecados, necesita de la
misma uente de vida.” s. Calvo Serer 1947 345.
Seite | 20
Das Generationen-Konzept erfreute sich in
der spanischen Kulturgeschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts großer Beliebt-
heit. Ortegas Konferenz von 1914 hat auf
die folgenden Vergemeinschaft-ungen,
wenngleich deren Deutungsangebote
stark divergieren, Einfluss ausgeübt; dies
ist an strukturellen und formellen Elemen-
ten nachzuzeichnen. Allen kommentierten
Generationenformationen ist die Kompo-
nente einer aktiven, politischen Herbei-
führung neuer gesellschaftlicher und kul-
tureller Ordnungssysteme gemein. Deren
Akteure wandten sich als Repräsentanten
der kulturellen Elite des Landes stellver-
tretend ür „i re“ Generation in ange-
nommenen Krisenzeiten an die Öffentlich-
keit und betonten die Rolle der Bildung zur
Durchsetzung ihrer Programmatik. In ei-
nem Vergleich wird selbstverständlich ihre
ideologische Disparität offenbar: jeweils
neue Ideale lehnen das bis dato Gültige als
„überkommen“ ab um die neu ange-
nommene „generationelle“ Identität zu
legitimieren.
Literatur
B. Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur
Karriere eines erfolgreichen Konzepts 2(Frankfurt am Main 1993).
W. L. Bernecker – H. Pietschmann, Ge-
schichte Spaniens 4(Stuttgart 2005).
R. Calvo Serer, Una Nueva Generación
Española, Arbor 8, 24, 1947, 333-348.
R. Calvo Serer, España, sin problema, (Ma-
drid 1949).
M. Dabag, Gestaltung durch Vernichtung.
Politische Visionen und generationale
Selbstermächtigung in den Bewegungen
der Nationalsozialisten und der Jungtür-
ken, in: M. Dabag – K. Platt (Hrsg.), Die
Machbarkeit der Welt. Wie der Mensch
sich selbst als Subjekt der Geschichte ent-
deckt (München 2006), 142–171.
O. Díaz Hernández, Rafael Calvo Serer y el
Grupo Arbor (Valencia 2008).
U. Herbert, Drei politische Generationen
im 20. Jahrhundert, in: J. Reulecke (Hrsg.),
Generationalität und Lebensgeschichte im
20. Jahrhundert (München 2003), 95–114.
S. Juliá, Historias de las Dos Españas (Ma-
drid 2005).
Seite | 21
U. Jureit, Generationenforschung (Göt-
tingen 2006).
P. Laín Entralgo, España como problema
(II) – Desde la Generación del 98 hasta
1936 (Barcelona [1949] 2006).
K. Mannheim, Das Problem der Generati-
onen, in: K. Mannheim (Hrsg.), Wissensso-
ziologie: Auswahl aus dem Werk 2(Berlin
1970), 509–565.
M. Menéndez Pelayo, Historia de los hete-
rodoxos españoles, 2 Bde. (Madrid 1978).
J. Ortega y Gasset, Vieja y nueva política,
in: J. Ortega y Gasset (Hrsg.), Obras com-
pletas Bd. 1 (1902-
1916) (Madrid 71966), 267-299.
S. Prades Plaza, Escribir la Historia para
definir la nación. La historia de España en
Arbor: 1944-1956, Ayer 66, 2007, 177–
200.
P. Schmidt, Dionisio Ridruejo – Ein Mit-
glied der spanis en “Generation von 36”
(Diss. Bonn 1972).
Seite | 22
Katharina Schembs: Der italieni-
sche Korporativstaat und seine
Ausstrahlung auf Lateinamerika:
Der Arbeiter in der Bildpropagan-
da des faschistischen Italiens und
des peronistischen Argentiniens
(1922-1955)
In der Zwischenkriegszeit wurde in einigen
südeuropäischen Staaten mit der Adopti-
on des Korporativismus eine Reformierung
der Wirtschafts- und Arbeitsordnung vor-
genommen, wobei das faschistische Italien
ab 1922 eine Pionierrolle einnahm. Nicht
nur wirtschaftliches Reformprogramm,
sondern auch hoch ideologisiert, sollten
durch das korporativistische Modell über-
kommene Klassenkonflikte harmonisiert
und im internationalen System ein „Dritter
Weg“ beansprucht werden.1 In der erst-
maligen Nutzung der modernen Massen-
medien diente die Propaganda um den
Korporativismus als aktiv erzieherisches
Mittel, die neuartige korporative Arbeits-
und Gesellschaftsordnung zu verbreiten
und Konsens in der Bevölkerung zu erzie-
len. In Anlehnung an Massentheorien des
ausgehenden 19. Jahrhunderts sahen die
Faschisten Bilder im Allgemeinen als be-
sonders geeignet an, die größtenteils
illiterate Masse zu beeindrucken. Die Bild-
propaganda sollte als Träger einer innova-
tiven, dem Faschismus eigenen Ästhetik
mit identitätsstiftender Wirkung fungie-
ren.2 Zentral waren das Thema der Arbeit
und die Figur des Arbeiters, der zum
exemplarischen Bürger stilisiert und zur
1 Santomassino 2006, 9.
2 Falasca-Zamponi 1997, 20.
Konstruktion eines Neuen Italiens aufgeru-
fen wurde.3
Der Korporativismus war jedoch nicht nur
für das italienische Inland relevant, son-
dern Gegenstand aktiver Auslandspropa-
ganda und als sol er „wi tigste[r] ideo-
logis e[r] Exportartikel“ des italienischen
Faschismus, dessen Ausstrahlungskraft gar
die Existenz des Regimes überdauerte.4 So
orientierte sich Juan Domingo Perón, von
1946 bis 1955 Präsident des sich zu gro-
ßen Teilen aus italienischen Einwanderern
konstituierenden Argentiniens, vor allem
unter dem Eindruck seines Italienaufent-
haltes 1939-41 am italienischen Korpora-
tivstaat und dessen Propagandaapparat.5
Auch im peronistischen Projekt nationaler
Erneuerung wurde der Arbeiter zum nati-
onalen Helden erklärt, von dem die Zu-
kunft der Nation abhinge, und im Rahmen
des alten rieges eine „Dritte Position“
postuliert.6 Die Ausstrahlung des italieni-
schen Korporativismus auf Argentinien ist
insofern repräsentativ für die Inspirations-
kraft südeuropäischer Korporativstaaten
auf Lateinamerika, als sich beispielsweise
auch der brasilianische Präsident Getúlio
Vargas (1930-1945) in seinem Bestreben,
einen korporativistis en ‚Estado Novo‘ zu
errichten, am salazaristischen Portugal
orientierte.7
Die bisher in der historischen Forschung
unterbelichtete faschistische und peronis-
tische Bildpropaganda mit ihrem Fokus auf
dem Thema der Arbeit wird in diesem Bei-
3 Gagliard 2010, 5.
4 Nützenadel 2005, 345.
5 Galasso 2005, 122 f.
6 vgl. Perón 1974.
7 Marques Santos 2006, 1.
Seite | 23
trag nicht nur als Visualisierung der neuen
korporativen Ordnung konzipiert, sondern
ihrerseits als Aktivposten, die wesentlich
deren Errichtung begünstigte. Nach der
Erläuterung der kulturpolitischen Rah-
menbedingungen und personellen Verbin-
dungen zwischen beiden Ländern liegt der
Fokus auf dem vorrangig inhaltlichen Ver-
gleich von propagandistischen Bildsujets.
Ziel ist es, sowohl nationale Spezifika als
auch transnationale Verflechtungen in der
propagandistischen Inszenierung des
korporatistischen Ordnungsmodells als
einem wesentlichen Stabilisator der bei-
den Regime zu verdeutlichen.
Kulturpolitik und Propaganda im faschis-
tischen Italien und im peronistischen Ar-
gentinien
Im Hinblick auf die mit der korporativen
Umgestaltung einhergehende Kulturpolitik
im faschistischen Italien sollten ministeria-
le Neugründungen oder Erweiterungen
wie der Presseabteilung 1922 (Ufficio
Stampa del Capo del Governo) oder des
Ministeriums für Populärkultur 1937
(Ministero della Cultura Populare) eine
zentralisierte Koordination und Kontrolle
von Propaganda und Kulturpolitik garan-
tieren.8 Im Zentrum der Propaganda um
den neuen Korporativstaat stand die Figur
des Arbeiters in verschiedenen Varianten:
zum einen als Nutznießer der faschisti-
schen Reformen im Arbeitsbereich, zum
anderen als zukunftsorientierter aktiver
Erbauer des neuen Vaterlandes.
8 Tranfaglia 2005, 18.
Auch der gesamte Kulturbereich wurde
nach korporativen Leitlinien reorganisiert,
was eine intensivierte staatliche Interven-
tion ermöglichte. Die Mitgliedschaft bil-
dender Künstler in den 18 provinziell or-
ganisierten Gewerkschaften war Voraus-
setzung für die Teilnahme an öffentlichen
Ausstellungen und im großen Stil vom Re-
gime lancierten Wettbewerben um staatli-
che Aufträge und Stipendien. Mussolini
forderte, dass auch die künstlerische Pro-
duktion zur wieder beanspruchten Größe
Italiens beizutragen habe. Zu diesem
Zweck sollte eine neue, vermeintlich origi-
när faschistische Kunst geschaffen wer-
den. Aufgrund des Ausbleibens konkreter
ästhetischer Direktiven herrschte in stilis-
tischer Hinsicht jedoch weitgehender Plu-
ralismus und so unterschiedliche künstle-
rische Gruppierungen wie Novecento, Fu-
turismus und Strapaese kollaborierten eng
mit dem Regime.9 Somit wurde das fa-
schistische Regime zu einer der ersten
Nationalregierungen weltweit, die Avant-
garde-Kunstrichtungen in Dienst nahm
und massiv finanziell förderte. Die politi-
sche Mobilisierung dieser als neu dekla-
rierten Ästhetik wurde als faschistische
Innovation ausgewiesen und als Mecha-
nismus der Abgrenzung von der Kulturpo-
litik der liberalen Ära genutzt.10 Während
in den 1920er Jahren der Fokus auf der
korporativen Organisation des kulturellen
Bereichs lag und wenige thematische und
inhaltliche Vorgaben von Seiten des Re-
gimes gemacht wurden, gab es in der Fol-
gedekade durchaus konkretere Anweisun-
gen, die um Themenkomplexe wie Arbeit,
Produktion und Konstruktion kreisten.
9 Sedita 2010, 181.
10 Stone 1993, 228.
Seite | 24
Traditionell bestanden enge personelle
Verbindungen zwischen Italien und Argen-
tinien als einem der außereuropäischen
Länder mit der größten Konzentration an
italienischen Immigranten, die zusammen
mit ihren Nachkommen bis zu 50% der
argentinischen Bevölkerung stellten.11 In
italiani all’estero, also Italiener im Aus-
land, umdefiniert und als solche weiterhin
Gegenstand faschistischer Politik waren
die italienischen Immigrantengemeinden
in Argentinien Zielscheibe intensiver Aus-
landspropaganda.12 Ziel war es, die fa-
schistische Ideologie auch unter ihnen zu
verbreiten, sie letztendlich zu repatriieren
oder doch zumindest im Kriegsfall aus der
„patria di riserva“ dem Reservevaterland,
einzuziehen.13 So meldeten sich im Äthio-
pienkrieg 1935 tatsächlich einige hundert
Italo-Argentinier als Freiwillige.14 Im Zuge
der Auslandspropaganda spielten neben
der faschistischen Auslandsorganisation
Fasci italiani all’estero ebenso die zahlrei-
chen italienischen Kulturinstitute und As-
soziationen italienischer Migranten in Ar-
gentinien eine wichtige Rolle.15 Diese be-
stellten auch aktiv Propagandamaterial
aus Italien vorrangig über die „großen
Leistungen“ des Fas ismus wie den or-
porativstaat. Hierbei wurde Bildmaterial
besonders geschätzt, um den visuellen
Kontakt zwischen Italienern im Ausland
und dem Mutterland aufrechtzuerhalten,
wie es in einer Anfrage des italienischen
11
Newton 1994, 41. 12
Guerrini / Pluviano 1994, 381 f. 13
vgl. Bertagna 2006. 14
Grillo 2006, 249. 15
Devoto 2006, 344.
Kulturinstituts Dante Alighieri in der ar-
gentinischen Stadt Rosario heißt.16
Was den kulturellen Bereich angeht, reis-
ten Exponenten der vom Faschismus pro-
tegierten Kunstbewegungen wie Futuris-
mus und Novecento nach Südamerika, so
Filippo Tommaso Marinetti und Margheri-
ta Sarfatti in den 1920er und -30er Jah-
ren.17 Auf argentinischer Seite stellte in
Künstlerkreisen im Rahmen der nahezu
obligatorischen Bildungsreise nach Europa
Italien ein begehrtes Ziel dar, wo zur Zeit
des Faschismus die staatlich geförderten
Kunstrichtungen rezipiert wurden.18
Nicht zuletzt hatte Perón selbst während
seines zweijährigen Europaaufenthaltes ab
1939 als Emissär des argentinischen Mili-
tärs Italien als Basis gewählt, dort u. a. an
Kursen über Syndikalismus teilgenommen
und sich insgesamt von Mussolinis Ar-
beitsreformen und Propagandamaschine-
rie äußerst beeindruckt gezeigt. Nach sei-
ner Rückkehr nach Argentinien und Wahl
zum Präsidenten 1946 stellte der italieni-
sche Korporativstaat für die Umgestaltung
der argentinischen Wirtschaft sowie die
Organisation der staatlichen Propaganda
ein wirkmächtiges Modell dar.19 Während
Peróns Regierungszeit bis 1955 wurde
Argentinien zu einem der ersten Wohl-
fahrtsstaaten Lateinamerikas ausgebaut,
eine umfangreiche Sozial- und Arbeitsge-
setzgebung verabschiedet und die Rechte
des Arbeiters in der neuen Verfassung
16
uste „Propaganda as ista in Argentina” Ar i-vio Centrale dello Stato, Rom. 17
Schnapp – de Castro 1996, 106; Tadeu 2003, 27. 18
vgl. López Anaya 1997. 19
Galasso 2005, 122 f.
Seite | 25
1949 verankert.20 Begleitet wurden diese
Reformen von einem enormen propagan-
distischen Aufwand, der von der neu ge-
gründeten Subsecretaría de Informaciones
y Prensa (1943) koordiniert wurde. Im
Gegensatz zur Vergabe staatlicher Aufträ-
ge über öffentliche Ausschreibungen und
Wettbewerbe im faschistischen Italien,
beschäftigte die peronistische Propagan-
dadirektion ein festes Team von Graphi-
kern.21 Innerhalb der peronistischen Kul-
turpolitik blieben Bestrebungen von Re-
gierungsseite, Intellektuelle und Künstler
nach korporativem Muster zu organisieren
oder über Assoziationen Einfluss zu neh-
men, jedoch weitgehend erfolglos. In sti-
listischer Hinsicht herrschte ein ähnlicher
Pluralismus wie im faschistischen Italien,
wenn auch tendenziell realistische Darstel-
lungsweisen bevorzugt wurden.22
Zentrales neues Element innerhalb des
propagandistischen Diskurses war auch im
peronistischen Argentinien die Figur des
Arbeiters, die erstmals in die Selbstreprä-
sentation des Staates integriert wurde und
in diesem Zuge eine enorme semantische
Aufwertung erfuhr.23 Auch im argentini-
schen Kontext sind verschiedene Rollen
auszumachen, in denen der Arbeiter in der
Propaganda auftaucht: Neben der Darstel-
lung als Hauptadressat bereits von statten
gegangener Sozial- und Arbeitsreformen
wurde ebenso die zukunftsträchtige Rolle
an ihn herangetragen, aktiv ein Neues Ar-
gentinien zu schaffen.
20
James 1988, 11 f. 21
Gené 2004, 329. 332. 334. 22
Giunta 1999, 59 f. 23
James 1988, 14.
Class, gender und race in der Bildpropa-
ganda des faschistischen Italiens und des
peronistischen Argentiniens
Außer den zeitlichen Wandel der Bildpro-
paganda zu erfassen, sind Leitfragen, die
an einen Vergleich des konkreten Bildma-
terials herangetragen werden können,
welcher Typus Arbeiter vom jeweiligen
Regime im Verhältnis zur verfolgten Wirt-
schafspolitik propagiert wurde. Die spärli-
che bestehende Forschung befindet, dass
im peronistischen Argentinien der Fokus
eindeutig auf dem städtischen Industrie-
arbeiter gelegen habe, während im fa-
schistischen Italien in etwas anachronisti-
scher Weise der Landarbeiter in Überein-
stimmung mit der vom Regime vertrete-
nen Ruralismus-Ideologie verherrlicht
worden sei.24 Diesen Befund gilt es zu
überprüfen, da sich Gegenbeispiele in bei-
den Fällen finden. So stellte auch der In-
dustriearbeiter einen Gegenstand der
Bildpropaganda im faschistischen Italien
dar, beispielsweise markiert durch rau-
chende Fabrikschlote im Hintergrund
(Abb.1). Umgekehrt war der Landarbeiter
in der peronistischen visuellen Propagan-
da vor dem Hintergrund der entschiede-
nen Aufwertung manueller Arbeit im All-
gemeinen keineswegs absent. Vielfach
wird gerade auf die Harmonisierung und
Vereinheitlichung von Arbeitern verschie-
dener Klassenzugehörigkeit abgehoben
oder Industrie und Landwirtschaft als na-
hezu gleichwertig integrale Bestandteile
der argentinischen Wirtschaft dargestellt.
So findet auf einem Propagandaplakat
anlässlich des Zweiten Fünfjahresplanes
neben der prominenten industriellen Pro-
24
Gené 2005, 95 f.
Seite | 26
duktionsstätte im Hintergrund auch noch
der landwirtschaftliche Betrieb Platz (Abb.
2).
Abb. 1: „Die faschistische Regierung Abb. 2: „Man muss den zweiten Fün -
hat mir meine Würde als Arbeiter und Ja resplan in ewegung setzen“
als Italiener zurü kgegeben“ Italien 1925(?) Argentinien ca. 1952.
Gender ist eine weitere Kategorie, die für
den Vergleich sehr fruchtbar zu machen
ist. Vor dem Hintergrund der offenkundi-
gen Dominanz von männlichen Arbeiterfi-
guren in der visuellen Propaganda beider
Länder, stellt sich die Frage nach den
Frauen zugeschriebenen gesellschaftlichen
Rollen. In der graphischen Propaganda des
faschistischen Italiens tauchen Frauen,
abgesehen von großangelegten Kampag-
nen wie den Getreide- oder Geburten-
schlachten oder der Kriegswirtschaft im
Allgemeinen, zumeist in traditionellen
Rollen als Hausfrauen und Mütter auf
(Abb. 3). Ein ähnlich reaktionäres Bild
wird in der peronistischen Propaganda
vermittelt. Zwar wurden die politischen
Rechte der Frau in Form des Wahlrechts
entscheidend erweitert und diese Errun-
genschaft war auch Gegenstand von Pro-
pagandakampagnen. Was jedoch typische
Tätigkeitsprofile angeht, blieben sie ideal-
erweise auf ihre Mutterrolle sowie sanitä-
re und pädagogische Berufe beschränkt
(Abb. 4).1
1 Gené 2005, 130 f. 134.
Seite | 27
Abb. 3: „Nationaler Wettbewerb. Der Sieg Abb. 4: „ rankens westers ule“
des Getreides“ Italien 1922-43. Argentinien 1950.
Im Hinblick auf race gilt es zu fragen, wel-
che Konzeption von nationaler Identität,
von italianità bzw. argentinidad, über die
Identifikation mit der Figur des Arbeiters
konstruiert wird und wie diese formal
oder inhaltlich kodiert wird. Dies kann
entweder über Abgrenzung zu anderen,
der Schaffung von Feindbildern oder offe-
nen Rassismus passieren, wie in Italien
spätestens seit den Rassegesetzen 1938
üblich,1 oder aber über die Nationalfarben
wie im argentinischen Fall, das Inkarnat
der Figuren oder landestypische Kleidung
(Abb. 6).
Einhergehend mit der Phasenverschiebung
des Vergleichsarrangements liegt ein gro-
ßer Unterschied zwischen beiden Regimen
in der fehlenden militärisch-expansiven
Note im peronistischen Argentinien. Im
Gegensatz hierzu stehen die umfassenden
Mobilisierungskampagnen im Umfeld des
1 vgl. Guiman – Parodo 2011.
Äthiopienkriegs und des Zweiten Welt-
kriegs im faschistischen Italien. Interessant
ist, wie im propagandistischen Diskurs die
Arbeitsthematik mit dem Kriegsaufwand
verknüpft wird (Abb. 5). Das peronistische
Regime hingegen unternahm lediglich ei-
nige Anstrengungen in Richtung wirt-
schaftlicher Integration mit den Nachbar-
ländern und förderte den kulturellen Aus-
tausch mit ihnen.2 Die in der peronisti-
s en Doktrin verkörperte „Dritte Positi-
on“ sollte ledigli als Art moralis er
Leu tturm „zur Er ellung der Welt“ die-
nen, wurde jedoch nicht aggressiv zu ver-
breiten versucht.3
2 Rapoport – Spiguel 2005, 37.
3 Subsecretaría de Informaciones: La Nación Argen-
tina, Justa, Libre y Soberana, Buenos Aires 1950, 476.
Seite | 28
Abb. 5: „Arbeiten und kämp en ür das Abb. 6: „Die argentinis e Arbeit im
Dienst Vaterland ür den Sieg“ Italien der Amerikas“ Argentinien 1946-1955.
1922-1943.
Literatur
F. Bertagna, La patria di reserva.
L’emigrazione as ista in Argentina (Rom
2006).
T. Chiarelli (Hrsg.), Novecento sudameri-
cano: relazioni artistiche tra Italia e Argen-
tina, Brasile, Uruguay (Mailand 2003).
F. J. Devoto, Historia de los italianos en la
Argentina (Buenos Aires 2006).
S. Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle. The
Aest eti s o Power in Mussolini’s Italy
(Berkeley 1997).
A. Gagliard, Il corporativismo fascista
(Rom 2010).
N. Galasso, Perón. Formación, Ascenso y
Caída (1893-1955) (Buenos Aires 2005).
M. Gené, Políticas de la imagen. Sobre la
propaganda visual del peronismo, in: P.
Berrotarán – A. Jáuregui (Hrsg.), Sueños de
bienestar en la Nueva Argentina. Estado y
políticas públcas durante el Peronismo
(1946-1955) (Buenos Aires 2004) 327–346.
A. Giunta, Las batallas de la vanguardia
entre el peronismo y el desarrollismo, in:
J. E. Burucúa (Hrsg.), Nueva historia argen-
tina. Arte, sociedad y política (Buenos Ai-
res 1999) 57–118.
M. V. Grillo, Creer en Mussolini. La
proyección exterior del fascismo italiano
(Argentina, 1930-1939), Ayer 62, 2006,
231–256.
Seite | 29
I. Guerrini – M. Pluviano L’organizzazione
del tempo libero nelle comunità italiane in
America Latina: l’Opera Nazionale
Dopolavoro, in: V. Blengino – E. Franzina
(Hrsg.), La Riscoperta delle Americhe.
Lavoratori e sinda ato nell’emigrazione
italiana in America Latina 1870-1970
(Mailand 1994) 378–389.
M. Guiman – C. Parodo, Nigra subucula
induti. Immagine, classicità e questione
della razza nella propaganda dell’Italia
fascista (Padua 2011).
D. James, Resistance and Integration. Pe-
ronism and the Argentine Working Class,
1946-1976 (New York 1988).
J. López Anaya, Historia del arte argentino
(Buenos Aires 1997).
P. Marques Santos, Relations between
Portugal and Brazil (1930-1945). The rela-
tionship between the two national experi-
ences of the Estado Novo, e-JPH 4, 2006,
1–15.
R. C. Newton, Ducini, Prominenti, Antifas-
cisti: Italian Fascism and the Italo-
Argentine Collectivity, 1922-1945, The
Americas 51, 1, 1994. 41–66.
A. Nützenadel, Korporativismus und
Landwirtschaft im faschistischen Italien,
in: A. Mazzacane – A. Somma (Hrsg.),
Korporativismus in den südeuropäischen
Diktaturen (Frankfurt am Main 2005) 345–
364.
J. D. Perón, La tercera posición argentina
(Buenos Aires 1974).
G. Santomassino, La terza via fascista. Il
mito del corporativismo (Rom 2006).
J. T. Schnapp – J. C. de Castro Rocha, Bra-
zilian Velo ities: On Marinetti’s 1926 Trip
to South America, South Central Review
13, 2/3, 1996, 105–156.
G. Sedita, Gli intelletuali di Mussolini. La
cultura finanziata dal fascismo (Florenz
2010).
M. Stone, Staging Fascism. The Exhibition
of the Fascist Revolution, Journal of Con-
temporary History 28, 1993, 215–243.
N. Tranfaglia, La stampa del regime 1932-
1943. Le veline del Minculpop per orienta-
re l’in ormazione (Mailand 2005).
30 | S e i t e
Marcus Nolden: Identität & Alteri-
tät
Identität ist ein zentraler kulturtheoreti-
scher Begriff, der Anknüpfungsmöglichkei-
ten in vielerlei Richtungen eröffnet und
der gemeinsam mit dem Begriff der Alteri-
tät, ein philosophiegeschichtlich bedeut-
samer Begriff, auf die spannende Dicho-
tomie von Alterität und Identität als ei-
nander bedingende Momente verweist.
Identitäten werden demnach durch Ab-
grenzung und Ausgrenzung konstruiert
und auch stabilisiert. Das 'konstitutive
Außen' ist dabei nicht nur die Bedingung
der Möglichkeit von Identität, sondern
zugleich immer auch Teil derselben. Das
Zentrum und der Rand sind somit intrin-
sisch miteinander verwoben. Soll daher
Andersheit gedacht werden, bedeutet der
Begriff nicht, dem Selbstidentischen des-
sen komplementäres Gegenteil entgegen-
zusetzen, sondern das angeblich Mit-sich-
selbst-Identische in seiner Angewiesenheit
auf und Kontaminierung durch sein ver-
meintlich Anderes zu lesen. So wird z.B. in
Edward Saids Studie Orientalism der Be-
griff des Anderen als Beschreibungskate-
gorie des Orientalischen genutzt, das als
das irrationale Andere dem rationalen
Selbst europäischer Identität gegenüber-
gestellt wird. Durch diese Prozesse des
othering, durch die dem Anderen vor der
Folie des "weißen, männlichen, heterose-
xuellen" Subjekts jede Identität abgespro-
chen werden, wird, so Saids Analyse und
Kritik, die europäische Identität erst er-
zeugt und bestätigt.
Auch im mittelmeerischen Diskurs wird
das „Andere“ o t der aotis en Sp äre
und das „Eigene“ dem erei der Ord-
nung zugewiesen. Aus dieser Dichotomie
von Chaos und Ordnung entwickeln sich
Fragen wie das „Andere“ kontrolliert
werden soll und wie diese Praxis der Kon-
trolle sich z.B. auf Migrationsbewegungen
im Mittelmeerraum auswirkt. Weiterhin
entspannen sich Fragen, die sich den aus
dieser Dichotomie entwickelnden – evtl.
auch neuem – Praktiken widmen.
Im folgenden Kapitel wird zuerst der Bei-
trag von Kristine Wolf vorgestellt. Ihr Pro-
motionsprojekt widmet sich den Vorstel-
lungen, dem Wissen und den Interaktio-
nen von MigrantInnen und Einheimischen
in euro-mediterranen Grenzräumen. Ihr
Beitrag wird sich hier nun den Fragen der
„Grenzregime und gegen egemonialen
Mobilitätsprozessen im euro-
mediterranen Raum“ widmen. Der zweite
Beitrag in diesem Kapitel stammt von Ca-
rolin Phillip. Sie konzentriert sich im Rah-
men ihres Promotionsvorhabens auf das
Verhältnis von Theorie und Praxis aus der
Sicht politisch aktiver Menschen im ge-
genwärtigen Athen im Kontext der Krise.
Ihr Beitrag beschäftigt sich daher folge-
richtig mit den Fragen wie Menschen in
wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Krisensituationen Möglichkeitsräume für
alternative Denk- und Handlungsweisen
schaffen können. Der letzte Beitrag
stammt von Abdellatif Bousseta der sich in
seinem Promotionsvorhaben mit Interkul-
turellen Lebensläufen u.a. am Beispiel von
Taha Hussein und Elias Canetti auseinan-
dersetzt. Sein in dieser Publikation vorlie-
gender Beitrag beschäftigt sich mit der
kulturellen Identität im modernen arabi-
schen Diskurs.
31 | S e i t e
Carolin Philipp: Spaces of Re-
sistances – perceptions and prac-
tices in the cracks of 'capitalism in
crisis'
Einleitung
Da die 'Brüche des Kapitalismus'1 in Kri-
senzeiten besonders sichtbar werden, ha-
be ich den Fokus meiner Forschung
'Spaces of Resistances – perceptions and
practises in the cracks of 'capitalism in
crisis'' auf Athen gerichtet, dem geogra-
phischen Symbol der sogenannten Euro-
Krise2. Hier untersuche ich das Verhältnis
von Diskursen und Praxen aus der Per-
spektive der Menschen, die in den 'Brü-
chen' aktiv sind. Im Folgenden möchte ich
versuchen, erste Eindrücke aus den sieben
bereits geführten problemzentrieren eth-
nographischen Interviews zu verarbeiten,
die ich mit politisch aktiven 'Subjektivitä-
ten' im alternativen Athener Spektrum
geführt habe: im linken, migrantischen,
anti-nationalistischen und anti-
rassistischen Raum.
Hintergrund
Im dominanten Diskurs werden meist en-
dogene Ursachen für die Krise in Griechen-
land verantwortlich gemacht: Steuerhin-
terziehung, die verkrustete politische Ord-
nung, Korruption, Vetternwirtschaft und
Familiendynastien in Politik und Wirt-
schaft.
1 Holloway 2010.
2 Žižek 2012.
EU-Institutionen sind angetreten um das
Chaos zu beenden und Griechenland
durch europäische Ordnungsmechanis-
men wieder 'auf Kurs' bringen. Diese ba-
sieren auf den lange in Ländern des Globa-
len Südens angewendeten Strukturanpas-
sungsmaßnahmen des Internationalen
Währungsfonds, die nun durch die Troika
aus EU-Kommission, Europäischer Zentral-
bank und IWF nach Griechenland gebracht
werden3. Dass der starke Druck, der Wirt-
schaftsreformen hauptsächlich an die Un-
ter- und Mittelschichten weitergeleitet
wird, kritisiert der Historiker Antonis Lia-
kos als 'Social Engineering'4: „Die rise ist
ein Instrument zur Veränderung der Ge-
sellscha ten“ zur Etablierung neuer Ord-
nungen im „ risenlabor Grie enland“5.
Maßnahmen wie Privatisierungen, Kür-
zungen von Renten, Abbau von Gesund-
heits- und Sozialsystemen, Entlassungen
im öffentlichen Dienst und die Senkung
der gesetzlichen Mindestlöhne versetzten
Teile der evölkerung in eine Art „S o k-
starre“6.
Die Krisenpolitiken des griechischen Staa-
tes sowie der EU werden aber auch auf
vielfältige Weise ideologisch sowie prak-
tisch herausgefordert. Eine Krise kann
auch Möglichkeitsräume eröffnen, nicht
nur, um neoliberale Experimente im Inte-
resse der „ errs enden Eliten“ dur zu-
führen7. Die Räume werden auch von
rechten und linken sozialen Bewegungen
genutzt, um alte Ordnungen in Frage zu
stellen, Machtpositionen durch Anti-
3 Caffentzis 2012.
4 Liakos 2011.
5 Hartmann – Malamatinas 2011.
6 Klein 2007.
7 Hartmann – Malamatinas 2011.
32 | S e i t e
Logiken herauszufordern und durch ge-
genhegemoniale Projekte aufzubrechen8.
Gerade durch die radikale und gewaltvolle
Performanz von griechischer Bewegung
und Staatsmacht sind diese zum Sinnbild
der Auseinandersetzungen in Südeuropa
geworden. Die massivsten Zusammenstö-
ße von Staat und Protestbewegungen so-
wie die gewalttätigsten Konflikte inner-
halb verschiedener Bewegungen – etwa
zwischen Neo-Nazis versus Linken, Anti-
Autoritären und Migrant_innen – finden in
Athen und seinen Außenbezirken statt.
In den letzten vier Jahren finden konstant
Aushandlungsprozesse statt, die von den
Vertreter_innen der alternativen sozialen
Bewegung in den Interviews auf verschie-
dene Höhe- und Wendepunkte konzent-
riert werden9. Die vier Ereignisse haben
jeweils räumliche, diskursive und prakti-
sche Facetten, die At en als „divided ity“
(geteilte Stadt) manifestieren.
1# Dezember Revolte 2008
2# Platzbesetzung der Indignad@s in Syn-
tagma Mai – Juli 2011
3# Ausschreitungen um zweites Memo-
randum im Februar 2012
4# Einzug der Neo-Nazi-Partei Xrysh Augh
(„Goldene Morgenröte“) ins Parlament im
Mai & Juni 2012
8 Holloway 2010.
9Aufgrund der angespannten und gewalttätigen
Situation in Athen, kann ich mich meine Interview-
daten nur in der alternativen Athener Szene sam-
meln.
1#
Abbildung 1
Soziale Bewegungen haben in Griechen-
land traditionell eine stark linke, marxisti-
sche Prägung. In den letzten 10 – 15 Jah-
ren entwickelte sich eine stärker anarchis-
tisch, anti-autoritär ausgerichtete Jugend-
bewegung. Das Zentrum, der Dreh-, An-
gelpunkt und Rückzugspunkt dieser Bewe-
gung liegt im zentralen Athener Stadtteil
Exarchia.
„Exarchia if we look back in the years,
since ever(!), it has always been the Left-
ists, the Anarchists, the Gay, the every-
thing Other.“ (Int. 1)
Der tödliche Schuss auf Alexis Grigoropou-
los am 6. Dezember 2008, der die Dezem-
ber Revolte auslöste, fiel in einer Fußgän-
gerzone in ebendiesem Viertel. Noch am
selben Abend begannen Proteste gegen
Polizeigewalt, die bis Januar 2009 andau-
erten. Obwohl es Demonstrationen und
Solidaritätsaktionen in ganz Griechenland
und im Ausland gab, blieb das Zentrum
der Ereignisse konzentriert auf Exarchia.
33 | S e i t e
Abbildung 2
Der Massenprotest, den Costas Douzinas
in Referenz zur Pariser '68er Revolte als
„grie is en Mai“ bezei net war getra-
gen von Schüler_innen und Student_innen
und geprägt von der totalen Opposition
gegen dem Staat10. Thematisch ging der
Protest weit über Widerstand gegen Poli-
zeigewalt hinaus. Die Folge war eine all-
gemeine Politisierung der jungen Genera-
tion und ein Erstarken der anarchistischen
Jugend der „ inder des Dezember.“ (Int.
3)
“... It's like one of the things that haunts
you for your whole life. ...(10:00) ... you
know I had like that point when you com-
pare everything with that. That was De-
cember 2008 for me. (11:00) After that you
had like this thing in Syntagma and I can
totally see the huge differences between
this two things and yeah, I'm still for De-
cember 2008. … That it was something
with no demands. It was something that it
couldn't be manipulated ... And you can
see the kind of people that participated in
that thing (12:00) you had like immigrants,
students, minors, hooligans. ... It was
something ... like it said a dilemma: either
you are with us or you are not. And if you
are not with us then you support like …
Greece in a way. Like it was something
10
Douzinas 2010.
caused, no caused: it was performed by
outcasts in many ways. (13:00) And it
aimed the order of Greek society. But in a
very deep level. You know, not something
superficial, like we close the street because
we demand that. No. It was something
chaotic, something ... something very
nice.” (Int. 2)
2#
Mit der gewaltlosen Besetzung des zentra-
lem Syntagma-Platzes von Mai bis Juli
2011 erreichten die Proteste gegen das
Krisenmanagement einen Höhepunkt.
Menschen aus vielen Schichten und mit
unterschiedlichen politischen
Abbildung 3
Hintergründen versammelten sich täglich
vor dem griechischen Parlament. In den
meisten Analysen zur griechischen in-
dignad@-Bewegung wird der Platz in eine
obere und untere Hälfte eingeteilt11. Die
obere Hälfte der Protestierenden wendete
sich dem Parlament: oft patriotisch mit
griechischen Flaggen, empört vom politi-
schen Establishment. In den Versammlun-
gen und Massendiskussionen der eher
links-liberal bis radikal geprägten unteren
11
vgl. Papadpopoulos – Tsianos – Tsomou 2012.
34 | S e i t e
Hälfte ging es eher darum, Alternativen zu
finden.
Im Herbst 2011 fand eine Diffusion der
„oberen re ten“ sowie „unteren linken“
Versammlung in die Stadtteile statt. Nach-
barschaftskomittees und lokale Initiativen
wurden gegründet, die versuchen, die
Auswirkungen der Krise u.a. durch die
Gründung von Gesundheits- und Sozial-
zentren aufzufangen.
“… for example my suburb this is very im-
pressive, because it's a middle-class sub-
urb (…) So seeing that over the past two
years, especially last one year, they started
some local assemblies where that were
open, not only to the people only that had
this left background, anarchist background
but they could co-exist with people coming
from a different background, political
backgrounds... because of same needs and
the same problems, facing the same reali-
ty.” (Int. 1)
Abbildung 4
Obwohl die Bewegung eher von Empörung
(indignad@s, αγανακτισμένοι) geprägt
war und kein klares Ziel hatte12 konnte
man thematisch eine Eingrenzung gegen-
über Dezember 2008 beobachten. Sie
konzentrierte sich auf die Krise, das Kri-
12
Papadpopoulos – Tsianos – Tsomou 2012.
senmanagement und seine Alternativen13.
Im Gegensatz zur Dezember-Revolte war
Syntagma trotz genereller Ablehnung der
repräsentativen Demokratie14 mit Forde-
rungen verbunden, die eine Reform des
staatlichen Rahmens anvisierten: direkte
Demokratie15, eine neue Verfassung, här-
tere Besteuerung von Reichen.16 Vom
Staat wurde verlangt, seine Funktion als
Ordnungsmacht auszufüllen, wenn auch
auf eine sozial verträglichere Weise.
Die Zusammenarbeit unterschiedlicher
sozialer Schichten und politischer Richtun-
gen, die sich mit denselben Problemen
konfrontiert sahen, verband Griechinnen
und Griechen in ihrer Prekarität gegen die
griechische Elite und die EU-
Ordnungskräfte. Viele sahen im Austritt
aus der Europäischen Union und in einer
nationalen Unabhängigkeit einen Ausweg
aus der Krise17. Besonders in der griechi-
schen Indignad@-Bewegung waren patrio-
tische Tendenzen zu beobachten, Mit dem
Slogan „We are all Greeks“ wurden soziale
und politische Barrieren überwunden.
Allerdings war die Kehrseite des Ein-
schlussprozesses unter dem Banner der
nationalen Einheit der Ausschluss der
migrantischen Bevölkerung. Im Gegensatz
zum Dezember 2008 bemängeln migranti-
sche Gruppen fehlende Solidarität, nicht
erst nach wiederholten gewalttätigen Aus-
schreitungen gegen Migrant_innen in Syn-
tagma.
13
Cossar-Gilbert 2012. 14
Tzanetti 2011. 15
http://real-democracy.gr, http://amesi-
dimokratia.org/,
http://www.amesidimokratia.com. 16
Versammlung in Syntagma am 27.05.2011. 17
Gerbaudo 2011.
35 | S e i t e
3#
Als am 12. Februar 2012 das zweite Spar-
paket im Parlament verabschiedet werden
sollte, wurde eine Teilnahme von Vielen
als so selbstverständlich angesehen, dass
organisierte Massenmobilisierung kaum
nötig war. Es kam zur letzten Großde-
monstration (Stand 2/2013) mit 80.000–
500.000 Teilnehmern und massiven Kra-
wallen. Räumlich konzentrierte sich der
Protest um das debattierende Parlament
am Syntagma Platz. Im Gegensatz zur
Platzbesetzung von 2011 zerstreuten sich
die Aktionen allerdings in die umliegenden
Gassen, da die Ordnungskräfte die aufge-
brachte Menge nicht auf den Platz vorrü-
cken ließ. Aus Protest wurden Dutzende
Gebäude, hauptsächlich Banken und in-
ternationale Ketten in Brand gesetzt. Die
Demonstration war eine Manifestation der
Zerstörung der „absoluten Verweige-
rung“18 gegen das Sparpaket ohne sich in
die Position der Fordernden zu begeben,
eine Zurückweisung jeglicher Politiken von
Markt und Staat.
Abbildung 5
Nachdem während der Indignad@-
Proteste erstmals konservative, patrioti-
sche und nationalistische Gruppen auf
18
Hatzopoulos – Marmaras – Parsanoglou 2012.
dem gleichen Platz mit links-liberalen, -
radikalen und anti-autoritären protestier-
ten, beobachtete ein Interviewpartner am
12. Februar 2012 erstmals, wie neben
Anarchisten, die sich Auseinandersetzun-
gen mit der Polizei lieferten auch schwarz
vermummte Faschisten Jagd auf
Migrant_innen machten (Int. 3).
4#Ereignis
Bei den Parlamentswahlen kommt es ne-
ben dem Erstarken der linksradikalen Syri-
za als zweitstärkste Partei hinter der kon-
servativen Nea Dimokratia zum Einzug der
faschistischen Xrysh Augh. Die Popularität
von Xrysh Augh kann unter anderem dar-
auf zurückgeführt werden, dass sie sich als
tatkrä tige „mikro- as istis e“ Na bar-
schafts-Ordnungsmacht19 mit guten Ver-
bindungen zur lokalen Polizei etabliert
haben20. Ausgehend von Agios Pantelei-
monas, einem ehemals bürgerlichen
Stadtteil mit heute sehr großem Anteil
armer migrantischer Bevölkerung, weite-
ten sie ihre Aktivitäten auf andere Bezirke
aus.
19
Parsanoglou 2012. 20
Lampropoulos 2012.
36 | S e i t e
Abbildung 6
Abbildung 7
Sie besetzten öffentliche Plätze, verriegel-
ten einen Kinderspielplatz, den hauptsäch-
lich Kinder mit Migrationshintergrund be-
suchten, und hissten die griechische Flag-
ge. Auf dem Wochenmarkt patrouillieren
Neo-Nazis und schikanieren die migranti-
schen Verkäufer. Diese und andere Aktio-
nen trugen dazu bei, Stadtteile in Ghettos
zu verwandeln in denen man sich in stän-
diger Angst vor Übergriffen bewegen
muss:
„Even our way home everyday is a form of
resistance for us migrants nowadays. We
have to be constantly aware of the danger
of verbal or physical attack.“ (Int. 4)
Die gesellschaftlichen Folgen der zuge-
spitzten Krise erweisen sich als Nährboden
ür ein a e „Lösungen“ von re tsextre-
men Nachbarschaftsinitiativen, Xrysh
Augh und anderen gewalttätigen gewalt-
tätige Neo-Nazi-Gruppen. Ein Interview-
partner erzählt, dass nach Dezember 2008
die anarchistische Jugendkultur tonange-
bend war eute dagegen sei es „in“
rechtsradikal zu sein „Let's say it's trendy,
it's „pop“ nowadays to beat up migrants“
(Int. 3). Somit eröffnet sich für die extreme
Rechte ein Möglichkeitsraum, um ihre
Werte und Diskurse als neue gesellschaft-
liche Ordnung und Normalität zu etablie-
ren.
Denn der Rechtsruck spiegelt sich im ge-
nerellen Diskurs wieder: in der zentralen
Wahlkampfrede von Präsident Samaras
„I werde die illegalen Migranten aus
unserem Land schmeißen. Sie sind zu Ty-
rannen unserer Gesellschaft gewor-
den!“21, in der Gesetzgebung (Zurücknah-
me des Einbürgerungsgesetzes
3838/2010) und bei den Exekutivorganen
(massive Misshandlungen von Migranten
durch die Polizei22 und Räumung von al-
ternativen Sozialzentren seit Ende 201223).
Fazit
Die diskursive Wende hat wiederum Ein-
fluss auf die Diskurs- und Aktionsräume
alternativer sozialer Bewegungen:
“... So we used to do demonstrations in
order to say, well what is happening in the
center and they arrest people because
they are black ... And we would, you know,
try to put these in light because they were
in a sense down in the shadows... But now,
they [the government, C.P.] are advertising
this things. So, you know, they leave you
no room to scandalize it. We have to find
other ways to interact, to make our ac-
tion.” (Int. 5)
Von thematischer Vielfalt und Kooperatio-
nen über linke, migrantische und anti-
autoritäre Gruppengrenzen hinweg (2008)
21
Antonis Samaras auf dem Syntagma Platz am
15.06.2012. 22
Amnesty International 2012. 23
Aldermann 2013.
37 | S e i t e
konzentrierten sich die Bewegungen mit
der verstärkten Krise sehr auf ökonomi-
sche Thematiken und direkt-
demokratische Prozesse (2011). Die abso-
lute Zurückweisung alles Staatlichen wäh-
rend der Februar-Ausschreitungen 2012
hatte eine weitere Radikalisierung der
Gesellschaft im rechten und linken Spekt-
rum zur Folge. Durch das Erstarken des
gewaltbereiten rechten Spektrums ver-
breitet sich in der von mir untersuchten
alternativen Bewegungen der Eindruck,
dass ihre Aktionen reduziert ist auf Reak-
tionen.
“... what is the main goal and what are the
short term goals, you understand? It is
very important to look also at other prob-
lems of the society, but someone has to
fight the fascism in the neighborhoods and
this has to happen now!” (Int. 3)
Von Exarchia über Syntagma hat sich das
räumliche Zentrum von alternativer Aktion
nach Agios Panteleimonas und die umlie-
genden Bezirke verlagert. Hier fanden En-
de 2012 viele antifaschistische Aktionen
statt (z.B. wiederholt auf der Platia Ameri-
kis), sowie die Konflikte gegen die Räu-
mung von drei besetzten Häusern Anfang
2013 (Villa Amalias, Lela Karagiannis, Ska-
ramaga).
Abbildung 8
Mit den Auseinandersetzungen um kon-
kreten (Frei-)Raum in der 'devided city'
bekommen abstrakte Krisendiskurse wie-
der eine Kontur. Durch die empfundene
Dringlichkeit konzentrieren sich linken,
anti-autoritären, migrantischen sozialen
Bewegung auf die Bekämpfung faschisti-
scher Gruppen sowie auf die Rückerobe-
rung von Raum. Sie bewegen sich aus ih-
rem angestammten Bezirk heraus in
Nachbarschaften, die geprägt sind von den
Ordnungsversuchen der rechten sozialen
Bewegungen und der Raumnahme durch
den als repressiv empfundenen Staat.
Dies schafft, trotz aller problematischen
Aspekte, die die Konzentration auf ein
Thema mit sich bringt, auch Möglichkeits-
räume für neue Allianzen und die Über-
brückung ideologischer Differenzen.
Literatur
L. Aldermann, Bomb Attacks in Greece
Raise Fear of Radicalism. In: New York
Times 20.01.2013,
<https://www.nytimes.com/2013/01/21/
world/europe/bomb-attacks-in-greece-
raise-fear-of-revived-
radicalism.html?pagewanted=all&_r=0>
(28.02.2013).
Amnesty International, Police Violence in
Greece. Not just 'isolated incidents'
(2012),
<https://www.amnesty.org/en/library/inf
o/EUR25/005/2012/en> (28.02.2013).
G. Caffentzis, Summer 2012, a report from
Greece (2012),
38 | S e i t e
<http://www.uninomade.org/report-
from-greece/> (28.02.2013).
S. Cossar-Gilbert, Reflections on 2011:
From indignados to occupywhere, a year
of protest in Europe (2012),
<http://takethesquare.net/2012/01/03/fr
om-indignados-to-occupywhere-
reflections-on-year-of-struggle-in-
europe/> (28.02.2013).
C. Douzinas, The Greek Tragedy. In: Critical
Legal Thinking (2010),
<http://criticallegalthinking.com/2010/11/
17/the-greek-tragedy/> (28.02.2013).
P. Gerbaudo, Los indignados: the emerg-
ing politics of outrage (2011),
<http://www.redpepper.org.uk/los-
indignados/> (28.02.2013).
D. Hartmann – J. Malamatinas, Krisenlabor
Griechenland. Finanzmärkte, Kämpfe und
die Neuordnung Europas (Berlin 2011).
P. Hatzopoulos – I. Marmaras – D.
Parsanoglou, An absolute refusal? Notes
on the 12 February demonstration in Ath-
ens (2012),
<https://nomadicuniversality.wordpress.c
om/2012/02/13/an-absolute-refusal-
notes-on-the-12-february-demonstration-
in-athens/> (28.02.2013).
J. Holloway, Crack Capitalism (London
2010).
N. Klein, The Shock Doctrine. The Rise of
Disaster Capitalism (New York 2007).
V. Lampropoulos, 'Οι αστυνομικοί
ψήφισαν και πάλι μαζικά «Χρυσή Αυγή»'
('Polizisten wählten erneut massiv «Xrysh
Augh»'). In: To Bima 19.06.2012,
<http://www.tovima.gr/society/article/?ai
d=463063]> (28.02.2013).
A. Liakos, Griechenland und Europa. Im
Knäuel der Krisenreaktionskräfte – Vorur-
teile und Richtigstellungen, Lettre Interna-
tional 95, 2011.
D. Papadpopoulos – V. Tsianos – M. Tso-
mou, Athen: Metropolitane Blockade, di-
rekte Demokratie. In: Diss-Journal 22
(2012), <http://www.diss-
duisburg.de/2011/11/athen-
metropolitane-blockade-direkte-
demokratie/#footnote_0_1022>
(28.02.2013).
D. Parsanoglou, Feindbild MigrantInnen,
der rechte rand 137, 2012.
T. Tzanetti, The Surprise of Syntagma and
Its Indignados. (2011),
<http://www.thenewsignificance.com/201
1/06/06/thalia-tzanetti-the-surprises-of-
syntagma-and-its-
%E2%80%9Cindignados%E2%80%9D/>
(28.02.2013).
S. Žižek The heart of the people of Europe
beats in Gree e.” Dis ussion in Ath-
ens/Greece 03.June 2012 (2012),
<http://takethesquare.net/2012/06/04/th
e-heart-of-the-people-of-europe-beats-in-
greece-with-slavoj-zizek/> (28.02.2013).
39 | S e i t e
Abdellatif Bousseta: Die Identitäts-
frage im modernen arabischen
Diskurs - Zwischen der vermeintli-
chen Einheit und der realen Viel-
falt
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die
französische Spedition nach Ägypten
(1798–1801) unter der Führung von Napo-
leon Bonaparte einen entscheidenden
Punkt in der Geschichte der modernen
arabischen Welt bildete und lange ihre
Wahrnehmung des Selbst und des Ande-
ren prägte. Die rasch erfolgte Eroberung
(vom 1. bis zum 20. Juli) Alexandrias und
Kairos sowie die enorme zivilisatorische
Kluft zwischen Ägypten und dem europäi-
schen Eroberer waren ein großer Schock
und vor allem eine große Herausforderung
für die ägyptische Nation, die sich ge-
zwungen sah, aus ihrem Begriffssystem
über das Selbst, die Geschichte und die
Zivilisation auszutreten. Und in eine neue
geistige Dynamik einzusteigen, deren Mit-
telpunkt der andere, politisch militärisch
und zivilisatorisch fortgeschrittene Westen
ist.
Was waren die politischen und geistigen
Fragestellungen, die dieses geschichtliche
Ereignis aufgeworfen hat? Wie und unter
welchen Voraussetzungen wurde die Fra-
ge der Identität in verschiedenen Zeitab-
schnitten gestellt und von verschiedenen
Eliten beantwortet? Inwieweit stellt die
Identitätsfrage ein Hindernis vor dem
Fortschritt und der Öffnung einer perma-
nent veränderbaren Welt gegenüber dar?
Diese wären die wichtigsten Fragen, die
wir in diesem Artikel zu beantworten ver-
suchen werden.
Bevor wir uns der Beantwortung dieser
Fragen widmen, möchten wir betonen,
dass die Frage der Identität in einem Konf-
rontationskontext (Imperialismus dann
Kolonialismus) auf drängender Weise ent-
standen ist. Außerdem erfolgte die Diskus-
sion um die eigene kulturelle Identität und
um den Anderen durch Begriffe wie: Tradi-
tion, Moderne, Authentizität usw. und in
verschieden Wissensbereichen wie: der
Geschichte, der Kulturwissenschaft, der
Politikwissenschaft, Soziologie Literatur
usw., was jedem Forscher erschwert, eine
deutliche umfassende Konzeption des
Selbst und des Anderen herauszubilden.
Wir versuchen daher die Komplexität des
Themas abzubauen, indem wir die Frage
der Identität im Hinblick auf die Diskussion
über die Tradition und Moderne erörtern.
Eine Diskussion, deren Schatten in allen
Lebensbereichen vorzufinden sind. Die
Frage der Identität ist in dieser Hinsicht
ein Versuch einer neuen Positionierung
des Selbst und des Anderen im eigenen
Vorstellung- und Wertsystem.
I. Die Selbstwahrnehmung:
Im Hinblick auf die Diskussion über die
Tradition und Moderne, die Renaissance
und Dekadenz lassen sich im modernen
arabischen Diskurs drei wichtige Strömun-
gen oder Abdullah Laaroui folgend drei
Wahrnehmungsmodelle unterscheiden:
Der salafistische, der liberale und der
technokratische Diskurs.
40 | S e i t e
a. Der salafistische Diskurs:
Es ist hier notwendig, den salafistischen
Diskurs von der religiös-politischen Bewe-
gung des Salafismus, die als Teil des
salafistischen Denkens gelten kann, zu
unterscheiden.
Mit dem salafistischen Diskurs meinen wir
die geistige Richtung des Salafismus, wie
sie sich nach der Begegnung mit dem Wes-
ten in den Schriften des Reformators Mo-
hammad Abdoh (1849–1905) und seiner
Schülerschaft kristallisiert hat und die sich
vor allem dadurch auszeichnet, dass sie
zwischen dem Islam und den errungenen
Leistungen der Moderne vor allem in der
Politik und der Technologie (moderne
Wissenschaften) zu vermitteln versucht
hat.
Ein Versuch, der schon durch Rifaa Rafi At-
tahatawi (1801–1873) angebahnt wurde.
Er s rieb: „Wenn Europa von der islami-
schen Zivilisation gelernt hat. Was verbie-
tet denn, dass wir uns wieder in Verbin-
dung setzen mit unseren Vorfahren durch
den Westen?“
Als Motto salafistischen Denkens gilt der
auf den Imam Malik (starb 795 n. Chr.)
zurü kge ü rte Satz: „Die Situation der
Nation kann sich bessern, nur durch die
geistige Rückbesinnung auf die Altvorde-
ren (arab. Sala ‚Vor a ren‘).“
Trotz der Aufforderung, sich auf die Alt-
vorderen zurückzubesinnen, unternahmen
die Vertreter dieser Strömung gewaltige
Bemühungen, zwischen dem Islam und
dem Westen zu vermitteln. Ihre Haltung
impliziert, dass die Zivilisation eins ist, und
dass die Wendung zu Europa eine Wen-
dung zur eigenen Kultur und Zivilisation
ist, wie es uns das folgende Zitat vom
Cheikh Mohammad Abdoh verrät:
„Ein Funke vom Islam at den Westen
beleuchtet .Wie man sagen könnte: Das
gewaltige Licht und die große Sonne sind
im Orient aber die Orientalen leben blind
in der Finsternis.“1
Der westliche Fortschritt könnte demnach
auf den Islam zurückgeführt werden. Die-
selbe Idee finden wir beim marokkani-
schen Denker und Schriftsteller Allal Al
Fassi:
„Die universalen Ideen der Frei eit an die
wir heute glauben, haben ihre Wurzeln in
der ersten Revolution des Islams; Aber der
Aberglaube und die Abweichungen haben
sie bede kt.“2
Die Gründe der Dekadenz liegen daher,
dem salafististischen Diskurs nach, in der
Unfähigkeit der Muslime den wahren Is-
lam zu verstehen und in der politischen
Zerrissenheit der Nation, welche dem
westlichen Einmarsch Gelegenheit gibt.
So schreibt Jamal Ed-Dine al Afghani
(Ǧamāl ad-Dīn al-A ġānī 1838–1897 ):
„... Und der Orient i setzte mein Ge irn
dafür ein, seine Krankheiten zu diagnosti-
zieren und Heilmittel zu suchen. Ich fand
die Krankheiten in der Zerrissenheit seiner
Einwohner und in der Zersplitterung ihrer
Meinungen… i tat sie um ein Wort zu
sammeln und sie auf die westliche Gefahr
au merksam zu ma en.“3
1 Abdoh 1976, 156.
2 Zitiert nach Laaroui 1970, 75.
3 Ad-dine Al Afghani – Abdoh 1970, 13.
41 | S e i t e
Al Afghani sieht die Erlösung in der Rück-
kehr zu den ersten wahren Grundsätzen
des Islams und in der politischen Einheit.
So fährt er fort:
„I re Arznei (die erkrankte Nation) ist die
Rückkehr in die Gebote der Religion und
ihrer Folge leisten, wie sie (die religiösen
Gebote)am Anfang waren. Darüber hinaus
die Anleitung der Pöbel durch ihre wichti-
gen Lehren, die Verbesserung der Manie-
ren, das Anfachen der Vaterlandsliebe und
die Aufopferung der Seelen zum Wohler-
ge en der Nation.“4
Seinerseits fordert Mohammad Abdoh:
Erstens den Einsatz der Vernun t zur „Er-
neuerung der Religion, sowie die Wieder-
belebung der philosophischen Studien und
die Durchführung einer geistigen Revolu-
tion, wodurch unser kulturelles Erbe über-
prü t und aussortiert wird“.
Und zweitens die politische Befreiung
„vom olonialismus der si in die Region
vordringt, ihm zivilisatorisch entgegenwir-
ken und widerstehen durch die Verkörpe-
rung der Prinzipien des islamischen Den-
kens in konstitutionellen und modernen
parlamentarischen Institutionen und
durch die Eingrenzung der Regierungs-
macht durch die Verfassungen und die
Gesetze“.5
Wichtig ist es aber der Frage nachzugehen,
was Mohammad Abdoh unter der Ver-
nunft versteht? Er nennt seine reformisti-
s e Au gabe olgendermaßen: „Die e-
freiung des Denkens von den Fesseln der
Imitation (Tradition), das Verständnis der
4 Ad-dine Al Afghani – Abdoh 1970, 61.
5 Amara 1972, 37.
Religion nach der Art und Weise der Vor-
deren, bevor es zum Zwiespalt kam. Und
das Erwerben ihrer Erkenntnisse (die Reli-
gion) durch das Zurückgreifen auf die ers-
ten Quellen. Außerdem sollte die Religion
zu den Maßen der menschlichen Vernunft
gehören, die Gott erschaffen hat, um sie
(die Vernunft) zu zähmen, und ihre Irrtü-
mer zu verringern.“6
In dem vorausgegangenen Zitat betont
Mohammad Abdoh, dass die Offenbarung
der Vernunft weit überliegt , und dass die-
se letzte au dieser Weise „wissens a ts-
freundlich wird, anregend dazu, die Welt-
geheimnisse zu erforschen, veranlassend
zum Respekt fester Wahrheiten und sie
beachtend zur Verbesserung der Seele
und Veredelung der Taten“7.
urzum verste t er darunter „die Vernun t
der Vergangenheit, doch die sunnitische
Vernunft, welche die Vernunft der
Mu’atazila (eine rationalistis ausgeri h-
tete Schule innerhalb der islamischen
Theologie. Dieser Vernunft verdankt die
islamische Zivilisation ihre größten Philo-
sophen und Wissenschaftler) gebannt und
unterdrü kt at“8.
Neben der Einheit der Zivilisation und der
Vernunft oder der Wahrheit (vertreten im
wahren Glauben und in der wahren Scha-
ria), ruft der salafistische Denker zu einer
Einheit des Staates seinen falls des Kali-
fats. In diesem Zusammenhang schreibt Al
Afghani:
6 Zitiert nach Amine o. A., 327.
7 Amine o. A., 327.
8 Abid Al Jabri 1982.
42 | S e i t e
„Der Orient wird nie lebendig werden
wenn er nicht einen starken gerechten
Mann kennt, der ihn beherrscht in Ab-
stimmung mit seinen Einwohnern und
o ne despotis e Mittel.“9
Seinerseits duldet Mohammad Abdoh so-
gar die despotischen Mittel, wenn diese
die Einheit unter den Muslimen hervor-
bringen, und aus ihnen wieder eine starke
Nation machen können. Er schreibt:
„Der Orient kann nur durch einen gerech-
ten Alleinherrscher wieder aufsteigen, der
die nicht Befriedeten dazu zwingt, sich
gegenseitig kennen zu lernen… be errs t
die Menschen zu ihrem Vorteil nach seiner
Meinung mit Willkür, wenn sie sich nicht
frei entschließen können, zu dem, was
i nen Glü k bringt.“10
Die erwünschte Einheit zwischen der Au-
torität und der Wahrheit prägte lange das
arabisch islamische Denken und bildete
den Rahmen aller Identitätsüberlegungen.
In diesem Sinne schlussfolgert ein nach
den theoretischen Grundsätzen im Den-
ken von Mohamed Abdoh und Al Afghani
su ender Fors er: „Aus dem Vor erge-
sagten, können wir resultieren, dass sich
die Struktur des arabisch- islamischen
Denkens um die Idee der Einheit dreht:
Die Einheit der Sprache, der Scharia, der
Wahrheit und der Macht bzw. das Fortbe-
ste en des Staates…. Die Ein eit verkör-
pert sich natürlich im Staatsystem wo sich
die Wahrheit und die Macht treffen: Die
9 Zitiert nach Laaroui 1970, 61.
10 Zitiert nach Al Jundi o. A., 52.
Macht schützt die Wahrheit, und die
Wa r eit ist die asis der Ma t.“11
b. Der Verwestlichungsdiskurs:
Die reformistischen Gedanken des Imams
ebneten den Weg für die nächsten Gene-
rationen, die liberalistische Tendenzen
gezeigt haben. Der renommierteste Ver-
treter dieser Strömung war Ahmed Lutfi El
Sayed(1872–1963). Er erfasste in der eu-
ropäischen Zivilisation ihre nationale Art.
Und formulierte deshalb seine politische
P ilosop ie unter dem Leitspru : „Ägyp-
ten ür die Ägypter“. Ein Satz der gegen
die vom Sultan Abdulhamid aufgerufene
Solidarität unter den Muslimen (gegen das
Kalifat) und gegen die englische Okkupati-
on wirken sollte. Er war der Meinung, dass
Ägypten schon lange vor dem Islam eine
unabhängige Nation bildete und positio-
nierte daher den Islam in der Identitätsbil-
dung nicht im Vorrang. Er sagte in einer
Rede:
„Die ö entli e Meinung kann eine starke
Wirkkraft haben, nur wenn sie auf Solida-
rität zwischen allen Bürgern und auf den
völligen Bedarf nach dieser Solidarität ba-
siert. Getrieben vom Gefühl der Nationali-
tät und dem gemeinschaftlichen Nutzen
und nicht von anderen Faktoren wie die
der Religion oder der Rasse.“12
Andernorts: „I zwei le ni t daran dass
der religiöse Glaube ein Grund für das Zu-
gehörigkeitsgefühl und die Solidarität zwi-
schen den Individuen ist. Aber ich lehne
entscheidend ab, dass er als Basis für poli-
11
Morched o. A., 57. 12
Lutfi El Sayed 1908.
43 | S e i t e
tische Aktionen gelten darf. Da diese auf
die Nutzen basieren und nicht auf den
religiösen Glauben. Denn ansonsten wä-
ren die Engländer und die Deutschen eine
Nation gewesen.“13
Seine Forderungen nach den europäischen
Grundsätzen der Zivilisation: Nach der
Freiheit, der Gleichheit, der Verfassung
oder dem Gesellschaftsvertrag und der
objektiven positivistischen Weltanschau-
ung stellten eine Abkehr von den vermit-
telnden Bemühungen seines Lehrers Mo-
hammad Abdoh dar und waren eine muti-
ge Hinwendung zu Europa und der Mo-
derne.
In diesem Kontext der Suche nach der kul-
turellen Identität Ägyptens lassen sich die
Ideen des Pharaonismus (Taoufiq Al Ha-
kim), und des Mediterranismus (Taha Hus-
sein) einordnen. Der Mediterranismus von
Taha Hussein z. B. war ein Versuch, sich
von der fesselnden Wirkung der sunniti-
schen Vernunft (As-Salafija) zu befreien
(zugunsten des griechischen Rationalis-
mus) und zugleich gegen die Termini wie
Orient, Okzident gerichtet.
In diesem Zusammenhang schreibt er in
seiner Charta über die kulturelle Identität
Ägyptens: „Sollte der ägyptische Logos von
etwas geprägt worden sein, dann vom
Mittelmeer. Sollte er Güteraustausch ver-
schiedener Art geführt haben, dann mit
den Völkern am Mittelmeer.“14
Der Wunsch vom Khediv Ismail (1830–
1895) aus Ägypten ein Stück Europa zu
13
Lutfi El Sayed 1908. 14
Hussein 1938.
machen, wird von den Liberalen aufgefan-
gen und im politischen Programm verkör-
pert. Das europäische Modell sollte als
Beispiel in der Politik, Erziehung und der
Kultur dienen. So schreibt Taha Hussein:
„Wir müssen den Europäern na ei ern
um ihnen ebenbürtige Partner in der Zivili-
sation werden zu können.“15
c. Der technokratische Diskurs:
Die liberalistischen Forderungen dieser
Generation krönten sich mit der Revoluti-
on von 1919 und ihren wichtigen Errun-
genschaften (die Abschaffung des briti-
schen Protektorats; Die erste Verfassung
Ägyptens 1923). Doch die Verbundenheit
reaktionärer Kräfte, vertreten im König-
tum und Feudalherrscher, mit dem Kolo-
nialismus hinderten die politischen Be-
strebungen der Liberalen und führten in
die politische Szene einen neuen Diskurs
ein: Der technokratische Diskurs.
Seinerseits sieht der Technokrat die Kluft
zwischen Europa und der arabischen Welt
nur in der Technologie. So wendet sich
Salama Moussa Im Jahre 1930 in der gro-
ßen Aula der Universität Kairo an die Stu-
denten mit der Frage:
„Der Orient und der Okzident. Ist das eine
geographische Wahrheit? Nein, eine
ethnologische auch nicht. Und ich glaube
nicht dass mir einer sagen würde, dass der
Unterschied in der Religion liegt. Seit über
25 Jahren ist mir nur eine einzige Wahr-
heit in den Sinn gekommen. Diese ist, dass
der Unterschied zwischen uns und den
15
Hussein 1938, 45.
44 | S e i t e
zivilisierten Europäern die Industrie ist. die
Industrie und nichts Anderes als die In-
dustrie.“16
„Die Zivilisation ist nun die Industrie Und
die Kultur dieser Zivilisation ist die Wis-
senschaft. Während die Kultur der Agrar-
gesellschaft, die Literatur, die Religion und
die P ilosop ie seien.“ Mit diesem Zitat
wird deutlich, dass der Technologie- Uto-
pist völlig die eigene Kultur und Geschich-
te als Kultur der vorindustriellen Gesell-
schaft ablegt und sich der Aneignung der
neuen Technologien zuwendet. Und
zwingt somit dem modernen Araber eine
ihm Völlig fremde kulturelle Identität an.
So formuliert Salama Moussa sein Ziel:
„Die erausbildung eines modernen Ara-
bers, dessen Geschichte nicht tiefer als
500 Jahre in die Geschichte zurückreicht.
Jene Zeit, zu der die Europäer anfingen,
wissenschaftliches Wissen statt vererbtes
Glauben zu bea ten.“17
Ein Modell, das seine Verkörperung im
arabischen Nationalstaat (nach der Unab-
hängigkeit: Nassers Ägypten, Ben Bellas
Algerien, Bourgibas Tunesien usw.) findet.
Und in dem die Kultur dem politischen
Programm der Modernisierung sich unter-
ordnen musste. Entweder in Form einer
transnationalen arabischen Kultur (Pana-
rabismus) oder eines laizistischen Moder-
nismus.
II. Wahrnehmung des Anderen:
16
Zitiert. nach Laaroui 1970, 55. 17
Zitiert nach Abid Al Jabri 1982, 41.
Die Identitätserfahrung wie wir im vorigen
Kapitel sehen konnten war immer von
einem angestrebten Modell vorbestimmt.
Das Modell könnte in der frühen Vergan-
genheit des Islams, in der Philosophie der
Aufklärung oder im technischen Fort-
schritt liegen. Die Alteritätserfahrung war
auch nach diesem Modell determiniert. So
verkörperte alles, was nicht dem er-
wünschten Modell entspricht den Frem-
den/Anderen. So war der Andere für den
salafistischen Diskurs manchmal das eige-
ne Kulturerbe des mu‘atazilis en Den-
kens, ein anderes Mal der europäische
Westen besonders sein Materialismus. Für
den Verwestlichungsdikurs bildete
manchmal das eigene Kulturerbe den
Fremden, den man bekämpfen sollte.
Manchmal der europäische Imperialismus
selbst und immer das osmanische Reich.
Wie Mohammed Abid Al Jabri bemerkt
verschweigen die beiden Diskurse des
Salafismus und des Modernismus eine
wichtige Tatsache: Diese ist, dass das Ver-
schwinden bzw. Vernichten des Anderen,
eine Voraussetzung für den eigenen Ge-
deih ist18.
„Es ist erstaunli wie si der arabis e
Intellektuelle jedes Mal und dauernd fragt:
„Was ne men wir vom eigenen ulturer-
be? Was vom Westen?“ Aber er ragt si
nie: „Wer und was bin i jetzt?“. Wir ra-
gen uns, was wir vom eigenen Kulturerbe
nehmen, als hätten wir bisher nichts ge-
nommen, und was wir vom Westen neh-
men, als wären wir ihm nicht verbunden
und in seiner Zivilisation integriert?.“19
18
Abid Al Jabri 1982, 60. 19
Abid Al Jabri 1982, 61.
45 | S e i t e
Da der moderne arabische Diskurs über
die Identität sich in der Konfrontation mit
dem Kolonialismus befand, wetteiferte er
sich zuerst darin die ihm aufgezwungen
Eigenschaften, sogenannten historischen
Bestimmungen zu widerlegen. So finden
wir zum Beispiel im Vermittlungsdiskurs
des Salafismus, dass die Vorteile des Wes-
tens: Die Arbeit und die Freiheiten nicht
dem Christentum entspringen, der immer
ein Synonym für die Unterdrückung war.
Oder, dass die Dekadenz, Passivität oder
die Demut nicht vom Islam kommen, son-
dern als ihm fremde Elemente zu bezeich-
nen sind. In diesem Bezug schreibt Allal Al
Fassi: „Die universalen Ideen der Freiheit,
an die wir heute glauben, haben ihre Wur-
zeln in der ersten Revolution des Islams;
Der Aberglaube und die Abweichungen
aben sie bede kt.“
So wäre jeder Fortschritt, jede Entwick-
lung ein Fortschreiten in die Richtung zum
wahren Islam. Der Islam würde uns nie an
dem Forts ritt indern“. Der Vermittler
bedient sich bei seiner Auseinanderset-
zung mit dem Westen eines religiösen
Bewusstseins, wenn er seine eigene Ge-
sellschaft kritisiert, aber eines liberalen
Bewusstseins/Diskurses bei der Analyse
und Kritik der westlichen Zivilisation. (So
verurteilt z.B. der Cheikh die Ausbeutung
der Frau im Westen ausgehend von west-
lichen Berichten über Frauenarbeit, wäh-
rend er völlig über den Missbrauch der
Frauenrechte in seiner Gesellschaft
schweigt).
„Dieses Grei en au die zweierlei Maßstä-
be bei der Bewertung des Anderen defi-
niert immer noch die Bewusstseinszustän-
de in jeder Interaktions- und wechselseiti-
gen Durchdringungsphase zwischen dem
Westen und dem Osten.“20
Auch der Westen wendet diese Strategie
an: „Der westli e ürger weiß genau
dass keine Gesellschaft ausschließlich nach
ihrem religiösen Bewusstsein definiert
werden kann. Aber er beschränkt sich
trotzdem in seiner Wahrnehmung des
Arabers ausschließlich auf den Glauben
und die islamischen Rituale.“21
Versagen der einheitlichen Identität:
Aus dem vorhergesagten können wir be-
merken, dass die verschiedenen Denkrich-
tungen vor allem darum bemüht waren
(zumindest auf Diskursebne) eine kollekti-
ve Identität auf religiöser oder nationaler
Basis herzustellen, während die Realität
zunehmende Gruppierungen und Spaltun-
gen kannte. So sind aus der Schule des
Imams Mohammad Abdoh viele Strömun-
gen entstanden, die sich wiederum in an-
dere politische und philosophische Grup-
pierungen spalteten.
Die Diskurse der Vereinheitlichung kultu-
reller Identität scheiterten daran, vor al-
lem vor politischen und wirtschaftlichen
Herausforderungen, denen die arabisch-
islamische Welt nach der Unabhängigkeit
ausgesetzt war, die in der Gesellschaft
innewohnenden wirkenden Differenzen zu
minimieren oder zu neutralisieren. Im Ge-
gensatz dazu blieb die Frage der kulturel-
len Identität eine Streitfrage der politi-
schen Wahlkampagnen und nicht der poli-
tischen Ausübung.
20
Laaroui 1970, 73. 21
Laaroui 1970, 76.
46 | S e i t e
Tatsache, die uns erklärt, warum in der
arabischen kulturellen Identität, anstelle
der Dialektik, ein (dialogisch) totes stati-
sches, adynamisches Aufeinandertreffen
zwischen dem Islam und dem Westen, der
Authentizität und der Moderne fortlebt
und andauert.
Eine Doppelhaftigkeit, die bedeutet die
Errungenschaften der Moderne, abgese-
hen von ihren philosophischen Inhalten,
zu konsumieren22.
III. Abdelkebir Khatibi: Die Alteri-
tät denken:
atibi ängt sein Werk „Double Critique“
mit der Bemerkung an, dass die arabische
Welt als Zivilisation große Umwälzungen
erkannt hat und dass sie eine große Viel-
falt kennt, die sich in allen Formen der
Akkulturation und Assimilierung manifes-
tiert.
„Die arabis e Welt ist also eine Viel alt.
Sie bildet – auf keinen Fall – eine Einheit
oder eine feste harmonische Ganzheit, die
wir in ein einziges System einordnen kön-
nen.“23
Er geht von der realen Vielfalt der arabi-
schen Gesellschaften aus, um der Ideolo-
gie der Einheit, religiösen Ursprungs24, zu
widerlegen. Er schreibt:
„Ne men wir das eispiel vom Araber
und noch genauer bestimmt vom Marok-
kaner, so merken wir, dass er in seinem
Innern seine ganze anteislamische, islami-
22
Choukri 1978, 279. 23
Khatibi 2000, 11. 24
Khatibi 2000, 16
sche, berberische, arabische und westliche
Vergangenheit trägt. Das Wichtigste ist,
dass wir diese vielfältige Identität, welche
diesen Menschen formt, nicht vernachläs-
sigen. Andererseits sollten wir an eine
mögliche Einheit all dieser Elemente den-
ken. Sie sollte aber keine theologische,
metaphysische Einheit sein, damit es je-
dem Element sein Recht auf Andersheit
und dem Ganzen die Bewegungsfreiheit
gewä rt wird.“25
Khatibi unterzieht sowohl die westliche als
auch die arabisch- islamische Zivilisation
einer Kritik, die sich als Ziel setzt, die Ideo-
logie der Einheit und der Totalität zu de-
konstruieren:
„I ru e zu einer doppelten ritik au zu
einer Kritik, die sowohl uns als auch den
Westen zum Objekt hat. Und die zwischen
ihm und uns urteilt. Sie setzt sich als Ziel,
den Begriff der Einheit und der Totalität,
der als Bürde auf unseren Schultern liegt,
zu dekonstruieren. Sie zielt darauf, die
Metaphysik und die zur absoluten Einheit
rufenden Ideologie zu zerstören.“26
Als geschlossene Metaphysik bezeichnet
Khatibi die arabisch- islamische Zivilisati-
on, da sie seiner Ansicht nach unfähig ist,
si als „ein eitli es Denken“ zu erneu-
ern oder zu regenerieren. Ausgenommen
mithilfe eines inneren Aufstandes des auf
Alterität beruhenden Denkens: Ein Den-
ken, das im permanenten Dialog mit den
sich weltweit abspielenden Veränderun-
gen steht.
25
Khatibi 2000, 50. 26
Khatibi 2000, 11.
47 | S e i t e
Darüber hinaus sieht er dass, die westliche
(griechischen Ursprungs und Essenz) und
die islamische Metaphysik unterschiedli-
che Ausdrucksformen derselben Weltan-
schauung sind, die auf drei Prinzipien be-
ruht: Die Prinzipien des Einen, Ganzen und
des Identischen. Er ist der Meinung, dass
die Metap ysik die von der „Erri tung
des Göttlichen in den Herzen von Men-
schen und i ren Geistern“ spri t eine
gewaltige Macht auf uns ausübt. Daher
sind ihre Kritik und ihre Befragung ein Auf-
stand gegen diesen metaphysischen Tod,
der uns unaufhörlich vernichtet und ein-
zäunt.
„Wir können unserem Leben und Tod ge-
wachsen sein, nur indem wir die um die
Metaphysik trauern. Diese Trauer würde
uns dazu motivieren, die Frage der unter-
drückten Gewohnheiten anders zu stel-
len.“27
Die Trauer um die Metaphysik ist die
Trauer um die Idee der Vergangenheit:
Das Kulturerbe unserer Vorfahren als
Quelle für die Erneuerung und Wiederge-
burt:
„Das ulturerbe (das Gedä tnis die Erde
die Sprache) beleuchtet den Menschen
nur in dem Maße, dass dieser seinen Tod
unter den Verstorbenen verdient.“28
Zur Überholung der Vergangenheit fordert
Khatibi eine neue Interpretation des Kul-
turerbes. Sowie die Dekonstruktion seiner
totalitären Einheit und die Aufdeckung
und Betonung seiner unterdrückten Rän-
der und Außenseiter. Er bezeichnet als
27
Khatibi 2000. 28
Khatibi 2000, 13.
„gewaltsame Di erenz“ jenes Identitäts-
verständnis, das den Anderen in eine ab-
solute Externe schleudert. Dieses Ver-
ständnis vergisst, dass der Andere –
vertreten im Westen – in uns wohnt und
für uns eine Herausforderung darstellt, die
wir verantwortungsbewusst (ohne Ableh-
nung oder Abhängigkeit) wahrnehmen
müssen.
Die islamische Metaphysik behauptet, so
Khatibi, sie sei immer pur gewesen, aber
sie hat seiner Meinung nach in sich immer
i re „Ränder“ oder i re „Außenseiter“
enthalten, die ihre vermeintliche Einheit
und Ihre pure Identität belästigten. Die
Kopten, die Kurden, die Berber waren die
Außenseite und der Rand aller Ränder war
au „die Frau“. Darüber inaus er u r die
arabische islamische Nation die Auflösung
in Völker, Sekten, und Sozialklassen usw.
Kahtibi sieht keinen Ausweg aus dem Ge-
fängnis der Vergangenheit und des kultu-
rellen Erbe nur in dem Zuhören, Aushor-
chen auf die Stimmen, welche diese ver-
meintliche Einheit belästigen und stören.
Und au im Er inden des „Unwa ren
(Verwandelten) Fremden und Entstellten“
und das kann nur die Kunst und das Alteri-
tätsdenken. Nur so wird die Alterität der
Araber ihr Dasein und nicht ihre vermeint-
liche Identität.
Er schenkt deswegen in seinem literari-
schen und philosophischen Werk der Idee
der Differenz eine besondere prioritäre
Aufmerksamkeit: Die Differenz, die ständig
präsent und vor allem resistent war, in
drei Fachbereichen der arabisch islami-
schen Kultur: Im Sufismus, im Körper (Tä-
48 | S e i t e
towierungen, Kalligraphie usw.) und im
mündlichen Kulturerbe.
„Das Zu ören au die unbewussten stellen
die Ausdrücke des Imaginären und die
Erzeugnisse der Volkskultur und auf die
spontanen Ausdrucksformen, die sich der
Strenge der Vernunft nicht anpassen und
ständig am Rande des herrschenden kultu-
rellen Diskurses waren.“29
Die Moderne ist bei Khatibi keine Konfron-
tation zwischen Orient und Okzident. Sie
ist vielmehr eine Konfrontation zwischen
Gesellschaften, die folgende Mängel auf-
weisen:
- Eine schwache Zivilgesellschaft
- Diktatorische politische Systeme
- Unzureichende Kenntnis im Be-
reich der modernen Wissenschaf-
ten und neuen Technologien
- Die ungeheure Macht der Meta-
physik, die jede Unterscheidung
zwischen dem Staat und der Religi-
on verhindert
- Das beeinträchtigte Bild, das die
arabische Welt von sich hat
All das in Konfrontation nicht mit der Mo-
derne, sondern mit dieser drolligen Mi-
schung zwischen der Metaphysik und der
Wissenschaft, die der Westen uns vermit-
telt hat. Diese Mischung nennt Khatibi
„die neue Tradition“.
Diese neue Tradition besteht, seiner Mei-
nung nach, aus: Entdeckungen, Erfindun-
gen und Werten (bildeten sicher die Basis
29
Afaya 1988, 10.
einer starken technologischen Zivilisation),
die uns unaufhörlich erobern und unsere
Beziehung zur eigenen Kultur und unseren
Gewohnheiten ständig umbauen, indem
sie unsere Sitten aussortieren und sie in
Vergessenheit drängen30.
Aus dem Vorhergesagten schließen wir
dass es eine Konfrontation innerhalb der
Metap ysik gibt zwis en einer „alten
Tradition“ (das ultuerbe) und einer „neu-
en“ die si als (Moderne) bezei net.
Denn die echte Moderne liegt in der Zu-
kunft und nicht in der Vergangenheit.
In dieser insi t betri t die „Double
Critique“ sowo l die Traditionalisten als
auch die Modernisten. Und ist eine Über-
holung des manichäischen Zwiespalts zwi-
schen der Tradition und der Moderne, weil
diese Trennung nicht die Komplexität un-
seres Daseins berücksichtigt.
„Modernisten und islamistische Tenden-
zen ernähren und unterstützen sich ge-
genseitig: Die Eine hält die Andere zu-
glei ür eindli und verbündet“.
Es ist daher realistisch die Hybridität zwi-
schen der alten und der neuen Tradition
zu bemerken um endlich mit den Einbil-
dungen des „Ursprungs“ (Sala ismus) und
der „endgültige ru mit der Vergangen-
eit“ (Modernismus) de initiv zu bre-
chen31.
IV. Schlussfolgerung:
30
Khatibi 2002, 106. 31
Al Chaikh o. A., 72.
49 | S e i t e
Das philosophische Projekt von Abdelkebir
Khatibi erlangt in den aktuellen Entwick-
lungen in den arabischen Ländern seine
Bedeutung, da es der realen ständig zu-
nehmenden Vielfalt der arabisch islami-
schen Welt entgegenkommt, und somit
der Alterität und der hybriden Identität
Platz im modernen arabischen poltischen
Diskurs einräumt. Denn so Moncef Al
Marzouki:
„Die Gesells a ten bestehen seit lange
aus Schichten, Sozialklassen und unter-
schiedlichen Interessen und Meinungen.
Aber da dieses Phänomen der Pluralität
wegen Der Bildung und der gesellschaftli-
chen Entwicklungen ständig zunimmt,
kann offenbar keine religiöse oder ideolo-
gische Partei, einheitlicher Natur, solche
Gesellschaften führen, außer durch Ver-
nachlässigung dieser Pluralität, ihre Un-
terdrückung durch Gewalt und ihre ver-
eerenden Folgen.“32
Außerdem überwindet Khatibis philoso-
phisches Projekt vor allem diesen ideologi-
schen Zwiespalt zwischen der Tradition
und der Moderne. Und somit auch die
Gegensätzlichkeit zwischen Europa und
der arabischen Welt. Dagegen plädiert er
2001 für einen Euromediterranen Raum
und einen polyzentrischen Universalismus:
„Géopolitiquement dans le voisinage ara-
bo- européen, naitra peut être de la nou-
velle méditerranée cet espace, ou, en uto-
pie, chaque partenaire apporterait sa part
d’ umanité et de ivilisation. En ore au-
dra-t- il le bâtir sur des lois d’ ospitalité
qui devront au de là de l’utilitarisme se
32
Al Mazouki.
frayer un chemin vers un universalisme
polycentrique. »33
Als „pro essioneller Fremder“ d. jemand
der aus den Fragen der übergangsorte und
der Resistenz zwischen den Zivilisationen
eine Aufgabe der alltäglichen Arbeit in
seiner Heimat und in der Fremde macht,
ragt si atibi: „Pourquoi nous ne
devrions pas être omme n’importe quel
umain les ôtes du utur?“34.
Literatur
M. Abdoh, Rissalat At-tawhid (Beirut
1976).
M. Abid Al Jabri, Der zeitgenössische ara-
bische Diskurs (Beirut 1982).
J. Ad-dine Al Afghani – M. Abdoh, Al Oroua
al Outhqa (Beirut 1970).
M. N. Afaya, Identität und Alterität (Casa
1988).
M. Al Chaikh: Die Marokkaner und die
Moderne (o. A.).
A. Al Jundi, Ach-chrak fi fajr al jakada (o.
A.).
M. Al Mazouki, <http://moncef-
marzouki.net/spip.php?article285>.
M. Amara, Vorwort zum Gesamtwerk von
Mohammad Abdoh, Arabische Institution 33
Abdelkebir atibi: l’universalisme et l’invention du futur (considérations sur le monde arabe) In : les ivilisations dans le regard de l’autre. A tes du colloque international Paris 2001. UNESCO 2002 S.180 34
Ebenda S .181
50 | S e i t e
für Studien und Veröffentlichungen 1 (Bei-
rut 1972).
A. Amine: Die Reformationsführer in der
zeitgenössischen Zeit (Beirut o. A.).
G. Choukri, Renaissance et Déclin de la
Pensée Arabe Moderne – Étude Critique
de Régime de Mohamed Ali et Celui de
Nasser (Beirut 1978).
T. Hussein, Mostakbal al-thakafa fi Misr =
L'Avenir de la Culture en Égypte (Kairo
1938).
A. Khatibi, An-Nakd al mozdauij = Double
critique (Rabat 2000).
A. Khatibi, Chemin de Traverse (Rabat
2002).
A. Laaroui, Die zeitgenössische arabische
Ideologie (Beirut 1970).
A. Lutfi El Sayed, in: Al Jareeda, 22. August
1908 (zitiert in: Ri ’at As-Sai’id Al A ram
19.September 2009).
M. Morched: Auf der Suche nach den the-
oretischen Grundsätzen des Denkens von
Abdoh und Al Afghani (o. A.).
51 | S e i t e
Kristine Wolf: Grenzregime und ge-
genhegemoniale Mobilitätsprozesse
im euro-mediterranen Raum –
Wirkmächtigkeiten selbstorganisier-
ter Migrant/innen in Rabat
Einleitende Überlegungen aus der Perspek-
tive einer reflexiven postkolonialen Migrati-
onsforschung
Eine kritische Beschäftigung mit facheigenen
Paradigmen, entlarvt die in vielen Untersu-
chungen noch häufig zugrunde gelegte Kon-
struktion des mediterranen Raums als (neo-
)koloniales und hegemoniales Verhältnis. Es
ist das Bild einer einheitlichen, das vermeint-
li e „Zentrum“ von der „Perip erie“ klar
voneinander trennenden Pufferzone und
zeugt von einer dominanten eurozentrischen
(Macht-)Vorstellung wel e die „ remden
Anderen“ systematisiert ordnet und kontrol-
liert.
Auch das EU-Grenzregime im euro-
mediterranen Raum – polemisch gar als
„neues System der Apart eid“ de iniert1 –
kann als (vor-)herrschendes Ordnungssystem
identifiziert werden; als ein System, das mit
seinem ambivalenten Interesse, Migrations-
bewegungen zu kontrollieren, zu steuern, zu
erzwingen oder zu verhindern sucht, einen
neokolonialen Konsens herstellt und damit
europäisch-imperiale Muster kolonialer Herr-
schaft fortsetzt.
Mobilitäten stehen hier für ein hegemoniales
Feld, in dem unterschiedliche Mobilitätsord-
nungen und Grenzregime herrschen und in-
einander verwoben sind. „Migration“ wird
darin ein politisch-rechtlicher Sonderstatus
1 Balibar 2006.
zugeschrieben, der seit der Entstehung west-
licher Nationalstaaten sowie ihrer Einbettung
in die Mechanismen europäischer Koloniali-
sierung kontinuierlich Grenzen und Aus-
schlüsse produziert, insbesondere im Sinne
einer naturalisierten Unterscheidung von
Subjekt im Verhältnis zu Staat und Gesell-
schaft. Im Gegensatz dazu werden andere
Formen der beruflichen, touristischen, öko-
nomischen oder medialen Mobilität als Privi-
leg und zunehmend auch als Pflicht der vor-
gebli sess a ten „Ein eimis en“ des Nati-
onalstaats propagiert. Migration demaskiert
hier die scheinbare Grenzenlosigkeit von
„Mobilität“ als (neoliberale) errs a tsideo-
logie2.
Die These des Gegenhegemonialen, mit der
ich mich auf das Gramsci'sche Hegemonie-
Konzept und seine spätere Erweiterung und
Aktualisierung durch Laclau/Mouffe3 beziehe,
scheint mir ein geeignetes Analyseinstru-
ment, um Bündnisse, Praktiken und Imagina-
tionen herauszustellen, die sich den etablier-
ten Machtverhältnissen widersetzen.
In der aktuellen Phase meiner Forschung fo-
kussiere ich die Selbstorganisation von Mig-
2 ojadžijev – Römhild 2011.
3 Laclau und Mouffe zeichnen in ihrem Werk die Ge-
nealogie des Begriffs der Hegemonie nach: von frühen Anfängen in der russischen Sozialdemokratie bis Gramsci und reformulierten dessen Ansatz diskurs-theorietisch. Die Frage der Demokratie stellt sich für sie insofern neu, da jene gegenhegemoniale Anstren-gung, die aus der Artikulation und damit Verknüpfung unterschiedlicher emanzipatorischer Subjektpositio-nen zumindest potentiell erwachsen konnte, einen radikal demokratischen Charakter besitzen sollte (Marchart 2007, 104). Angesichts einer zunehmenden autoritären und radikal neoliberalen Entdemokratisierung ging und geht es dabei um den Aufbau einer demokratischen Gegenhegemonie, das heißt, einer gegenhegemonialen Strategie der Demo-kratisierung der Demokratie.
52 | S e i t e
rant/innen als Teil der Auseinandersetzung
um Anerkennung ihrer fundamentalen Rech-
te auf dem umkämpften Feld politischer
Macht. Ich versuche hegemoniale Dynamiken
und gegenhegemoniale Bewegungen, Prakti-
ken, Bündnisse und Imaginationen aufzuzei-
gen, ihr Verhältnis zu analysieren und eine
Kartographie der verschiedenen am
Auseinandersetzungsprozess teilhabenden
Akteur/innen zu erstellen. Es geht dabei um
die Reaktionen, die in der Zivilgesellschaft
sowie auf institutioneller und staatlicher
Ebene durch selbstorganisierte Praxen ausge-
löst werden: situativ geknüpfte Bündnisse,
Kollaborationen und Aufbau von Solidaritäts-
netzwerken.
Es ist zu untersuchen wie wirksam die in ei-
nem transnationalisierten und transkulturel-
len Kommunikations- und Aktionsraum ent-
wickelten Praktiken und Diskurse dazu bei-
tragen, die Hegemonie jenes neoliberalen
repressiven Migrationsdiskurses in Frage zu
stellen, zu demontieren oder zu unterwan-
dern, wie er von den marokkanischen Behör-
den rigoros insbesondere gegen vermeintlich
irreguläre Migrant/innen aus dem globalen
Süden und Osten und deren selbstorganisier-
te Akteur/innen durchgesetzt wird - legiti-
miert durch einen politischen Diskurs der
Stigmatisierung und getragen von rassisti-
schen Diffamierungskampagnen der Tages-
presse.
Migrations- und Grenzregime im euromedi-
terranen „borderland“4
4 Gloria E.Anzaldúa und Stefanie Kron konzeptualisie-
ren „borderland“ als Zone des Transits des permanen-ten Übergangs und der kulturellen Übersetzung.
Seit 2003 wurde das von den EU-Staaten de-
finierte Migrations- und Grenzkontrollsystem
mittels EU-europäischer Partner- und Nach-
barschaftspolitik bis über die südliche
Schengengrenze in den Maghreb vorverla-
gert. Diese Strategie der Externalisierung ging
einher mit der schrittweisen Delegation sub-
stantieller Teile EU-europäischer Migrations-
politik an das bis heute autokratisch regierte
Königreich Marokko. Die im Gegenzug aufge-
setzten politisch-ökonomischen Programme
banden das Land fest in den neu etablierten
hegemonialen Herrschaftsraum des EU-
Grenzregimes ein. Marokko ist heute einer
der kooperativsten Partner im EU-
Grenzmanagement und dem „ amp gegen
illegale Migration“.
Dieser in den Grenzregionen EU-Europas ab-
laufende Herstellungsprozess von Räumen
hierarchisch differenzierter Rechte und
Souveränitäten blieb nicht unberührt von
den Dynamiken des „arabis en Frü lings“
den seit Beginn 2011 anhaltenden sozialen
und politischen Protesten und Umbrüchen im
Maghreb und Mashrek sowie von den damit
einhergehenden migrantischen Mobilitäten
und Flüchtlingsströmen in der Mittelmeerre-
gion. Durch intensive Mediatisierung der
grenzüberschreitenden Bewegungen in Rich-
tung Europa rückten diese erneut ins öffent-
lich-politische Zentrum der EU-europäischen
Aufmerksamkeit. Der Umgang mit Europas
inneren und äußeren Grenzen wird seitdem
auf der EU-politischen Agenda generell hin-
terfragt und politisch kontrovers verhandelt.
Die Umsetzung neuer, auf sicherheitspoliti-
sche Kooperation mit den nordafrikanischen
Eliten setzende Konzepte, wie EUROSUR und
das „Smart oders“-Modell, sind in Vorberei-
tung.
53 | S e i t e
Insbesondere seit den tragischen Ereignissen
an den Grenzzäunen der spanischen Exklaven
Ceuta und Melilla im Jahr 2005 begreifen die
marokkanischen Autoritäten globale Mobili-
tätsbewegungen auf eigenem Territoium als
sicherheitspolitisches Problem. Sie ignorieren
die sozial- und rechtspolitische migrantische
Realität und ergreifen, trotz starker Kritik
vonseiten marokkanischer und internationa-
ler NGOs o ensive Maßna men gegen „un-
liebsame“ Einwander/innen: willkürli e Raz-
zien „ra ial pro iling“ massive Festna men
und Abschiebungen an die algerische und
mauretanische Grenze sind alltäglich.
Ohne Konzepte für eine bewusste Asyl-, und
Integrationspolitik zu erarbeiten, betrachtet
der marokkanische Staat jegliche Zuwande-
rung als zeitlich begrenzt5. Mediale Öffent-
lichkeit und politischer Diskurs kolportieren
zudem das ild des „Transmigranten“ der
auf seinem Weg nach Europa lediglich tem-
porär in Marokko weilt bzw. von Mig-
rant/innen, die das Territorium betreten, um
sich irregulär niederzulassen. Damit wird die
eigentliche Dynamik ausgeblendet: seit Mitte
der 1990er Jahre entwickelte sich Marokko
vom typischen Auswanderungs- zum Transit-
land und seit den 2000er Jahren zunehmend
auch zum Zielland für migrantische
Mobilitäten aus dem globalen Süden und
Osten6.
Akteur/innen der organisierten Einwande-
rungsgesellschaft in Rabat
Zahlreiche Akteur/innen in Rabat sind Teil
der Implementierung des EU-gesponserten
Migrationsmanagement-Programms: inter- 5 De Haas 2009.
6 Peraldi u. a. 2011.
und transnational tätige als auch kleinere
national NGOs und Vereine nutzen die von
der EU für migrationsspezifische (sozio-
kulturelle, Recherche-)Projekte bereitgestell-
ten Fördergelder.
Die einschlägigen großen internationalen
Organisationen, wie das Hohe Flüchtlings-
kommissariat der Vereinten Nationen
(UNHCR) oder die Internationale Organisati-
on für Migration (IOM) präsentieren sich als
Dienstleister ihrer Mitgliedsstaaten und Koo-
perationsforen im Migrationsbereich.
Insbesondere die IOM beteiligt sich unter
den Etiketten „Multilateralismus“ und „Nord-
Süd- ooperation“ maßgebli an der Aus-
formung von Standardkonzeptionen der EU-
Migrationspolitik7. Im ambivalenten Pro-
gramm der „ reiwilligen Rü kke r“ wird dem
Wunsch der Migrant/innen auf Rückkehr ins
Heimatland nachgekommen, ohne die aktuel-
le soziale und Situation von Migrant/innen in
Marokko als Grund für diesen Schritt zu hin-
terfragen oder die spezifische Lage im Rück-
kehr-Land ausreichend zu prüfen. Insbeson-
dere jene Personen die si tägli „dur h-
s lagen“ müssen und wegen e lender i-
nanzieller Ressourcen längerfristig keine
stabile Lebensperspektive in Marokko auf-
bauen können und/oder daher auch die
Hoffnung auf eine Überfahrt nach Europa
zunächst aufgeben, lassen sich auf die lange
Liste der „ reiwilligen Rü kke rer“ setzen. Die
Nachfrage in Marokko steigt und kann mo-
mentan aufgrund des ungenügenden Bud-
gets nicht befriedigt werden. Wie der Par-
cours einiger meiner Protagonist/innen zeigt,
stellt das Programm der IOM, das neben dem
Flugticket auch eine finanzielle Anschubhilfe
7 Caillault 2012.
54 | S e i t e
für die Neuorientierung im Heimatland von
rund 500€ vorsie t einen gern genutzten
Service für die Realisierung ihrer weiteren
Pläne dar, inklusive einer u.U. neuerlichen
Rückkehr nach Marokko. Damit werden in
dieser taktischen Kollaboration die eigentli-
chen Ziele der IOM und der Geldgebenden
Staaten, nämlich die Fernhaltung und Entfer-
nung missliebiger Migrant/innen vom Terrain
der auftraggebenden Mitgliedsstaaten, un-
terwandert und in ihrem Sinne sinnstiftend
umgedeutet.
Na der dramatis en „Erstürmung“ der
Grenzzäune von Ceuta und Melilla im Jahr
2005 begannen die in Marokko, speziell in
Rabat lebenden frankophonen Migrant/innen
aus den Ländern West- und Zentralafrikas
sich zu organisieren – und zwar erstmals in
einer Form, die die bis dahin existierenden
und nach nationalen Zugehörigkeiten geord-
neten Gemeinschaften übergreift. Das signa-
lisierte die Absicht, offene und unabhängig
von vermeintlichen Trennungslinien nach
Herkunft, Sprache oder Gemeinschaft funkti-
onierende Organisationen zu bilden, die alle
Migrant/innengruppen, insbesondere auch
anglophone Subsahara-Afrikaner sowie jene
in Rabat lebenden Migrant/innen aus dem
globalen Osten (Bangladesch, Pakistan, Indi-
en, Philippinen, Syrien, Libanon u.a.) anspre-
chen und einbeziehen wollen.8
Parallel dazu etablierte sich seit 2006 im ad-
ministrativen und politischen Zentrum Ma-
rokkos ein engmaschiges Unterstützungsmili-
eu bestehend Organisationen, Vereinen, Kol-
8 Nichtsdestotrotz scheint es trotz dieser Bemühungen
nicht nur schwierig zu bleiben, anglophone und fran-kophone Migrant/innengruppen zusammenzubringen, sondern auch insbesondere bei der Eskalation inter Konflikte den Rekurs auf eben jene Differenzierungen zu vermeiden.
lektiven und Initiativen, das bis heute stark
angewachsen und vergleichsweise vielfältig,
gut vernetzt ist, insbesondere im Gesund-
heitsbereich eine gut funktionierende Platt-
form bildet, die organisierte Migrant/innen
als Partner/innen einbezieht. Die selbstorga-
nisierten Strukturen von Migrant/innen er-
reichen derzeit einen relativ hohen Institu-
tionalisierungsgrad. Sie kooperieren und ver-
netzen sich rege mit jenen lokalen überregi-
onal, trans- und international tätigen Organi-
sationen bzw. integrieren sich in die Struktu-
ren offiziell legitimierter Akteure:
Die älteste der selbstorganisierten
migrantis en Strukturen der „Conseil des
Migrants Subsa ariens au Maro “ (CMSM
seit eginn 2012: „Conseil des Migrants au
Maro “ Rat der Migrant/innen) gründete
sich 2005. Weitere Zusammenschlüsse von
inzwischen nicht mehr aktiven oder aus Ab-
spaltungen vom CMSM hervorgegangene
Gruppen wie das „Colle ti des
Communautés Subsahariennes au Maro “
(CCSM) folgten. Im Juni 2012 gründete sich
die im von starker Armut geprägten Arbei-
ter/innen- und Migrant/innenviertel
Takadoum („Forts ritt“) se r aktive
„Asso iation Lumière sur l'Emigration
Clandestine au Maro “ (ALECMA) sowie –
unter großer medialer Aufmerksamkeit – die
„Organisation démo ratique des travailleurs
immigrés – Maro “ (ODT-I), die erste Ge-
werkschaft für Arbeitsmigrant/innen als Sek-
tion der regierungskritischen Gewerkschaft
ODT, einer von mehreren kleineren Rich-
tungs-Gewerkschaftsdachverbänden in Ma-
rokko. Die Konstituierung dieses bisher in
einem arabischen Land bzw. in Afrika einzig-
artigen Zusammens luss‘ ür sogenannte
Arbeitsmigrant/innen war keine völlig unab-
hängige Aktion, sondern Initiative der ODT-
55 | S e i t e
Zentrale in Aushandlung mit dem CMSM. Ist
sie auch Teil einer Strategie der Mitglieder-
anwerbung vonseiten der ODT9, so kann die-
ses taktis e ündnis zwis en „Ein eimi-
s en“ und den vermeintli migrantis en
„Anderen“ als situative gegen egemoniale
Praxis und wegweisender Indikator für eine
sich aktiv formierende marokkanische Ein-
wanderungsgesellschaft gelesen werden.
Migrantische Selbstorganisation zwischen
emanzipatorischer Bewegung und profes-
sionalisiertem Aktivismus als (Überlebens-
)Strategie
Sowohl die Aktivitäten der Mig-
rant/innenorganisationen als auch der ODT-I
- welche damit den üblichen gewerkschaftli-
chen Aktionsradios weit überschreitet – zie-
len generell auf die Themen Legalisie-
rung/Bleiberecht, Integration und alltägliches
Zusammenleben, Diskriminierung und Mar-
ginalisierung. Sie denunzieren rassistische
Übergriffe und die Straflosigkeit von Tätern,
fordern den Respekt von Menschenrechten
und in der marokkanischen Gesetzgebung
und ratifizierten internationalen Konventio-
nen verbrieften Rechten für sog. Auslän-
der/innen inklusive Beschulung und Zugang
zum staatlichen Gesundheitssystem. ODT-I
reklamiert dabei grundsätzlich die Umset-
zung der von der UNO 1990 verabschiedeten
„Internationalen onvention zum S utz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen“.10
9 Die Sektion besteht mittlerweile marokkoweit aus ca.
350 Mitgliedern, neben mehrheitlich West- und Zent-ralafrikaner/innen auch einige Philippiner/innen, Syrer und Türken. 10
Sie wurde bereits 1993 von Marokko ratifiziert, trat 2003 in Kraft und lenkt die internationale Aufmerk-
Diese konkreten politischen Forderungen
werden punktuell durch aktive Teilnahme an
soziopolitischen Foren (Maghrebinisches So-
zialforum, Weltsozialforen) und in öffentli-
chen Protestaktionen wie Sitzblockaden vor
Polizeistationen, Gerichtsgebäuden und Bot-
schaften, Straßendemonstrationen zusam-
men mit dem Unterstützermilieu und ODT-
Gewerkschaftsmitgliedern an den Staat ge-
richtet. Außerdem gibt es Kooperationen für
Rechercheprojekte und gemeinsame Publika-
tionen zur Situation von Migrant/innen.
Daneben beschränkt sich das zentrale Tätig-
keitsfeld der selbstorganisierten Gruppen
momentan hauptsächlich auf die Konzeption
und Planung konkreter „integrativer“ sozialer
und kultureller Projekte. Da sie über kein
eigenes Budget verfügen, können diese aus-
schließlich in Zusammenarbeit und über Fi-
nanzierung durch die einschlägigen NGOs
und damit EU-Fördergeldern durchgeführt
werden. Da zahlreiche NGOs ihre Subventio-
nen für Projekte im Bereich Migration in Ma-
rokko momentan deutlich reduzieren, konn-
ten 2012 nur wenige der ursprünglich geplan-
ten Projekte tatsächlich realisiert werden.
Der derzeitig rigide Fokus der Mig-
rant/innengruppen auf diese Art der
kollaborativen und subventionierten Projekt-
arbeit schränkt aufgrund der Abhängigkeit
von Hilfsgeldern deren Wirkungsgrad und
Aktionsradius stark ein. Über die kollektive
Herausforderung hinaus nutzen einige
migrantische Aktivist/innen die verantwortli-
chen Tätigkeitsbereiche der Selbstorganisati-
on als individuelle Taktik der „Vollzeit-Selbst-
es ä tigung“ zur Stabilisierung der eigenen
samkeit auf die Verletzlichkeit und Kriminalisierung, der Migrant/innen aufgrund ihres prekären juridischen Status ausgesetzt sind.
56 | S e i t e
Situation. Ihr Einkommen besteht in der
Schaffung sozialen und symbolischen Kapitals
über soziale Anerkennung, Prestige, exklusive
Kontakte und Informationen und somit ein
(Praxis-)Wissen der Vernetzung.
Darüber hinaus ist die Versuchung groß, die
ursprünglichen Ziele migrantischen Aktivis-
mus' zu pervertieren, da der privilegierte
Zugriff auf finanzielle Ressourcen miss-
braucht werden kann als lukrative Nebenein-
kün te und ür „Ges ä te“ die das eigene
Überleben und Vorankommen sichern und
Zukunftspläne voranzutreiben helfen.
Konklusionen
Insgesamt ergeben die hier nur knapp ange-
rissenen Dynamiken wertvolle Hinweise auf
ein ambivalentes Bild der sich formierenden
Einwanderungsgesellschaft in Marokko. Es
zeugt von der zunehmend wahrgenommenen
Präsenz organisierter migrantischer Kämpfe,
ihren situativen Bündnissen, individuellen
Manövern und kollektiven Taktiken als ge-
genhegemoniale Dynamik zum etablierten
Migrationsregime.
Werden die Migrant/innenorganisationen
vom marokkanischen Staat bisher – mit Aus-
nahme der ODT-I – nicht als rechtsgültige
Strukturen anerkannt, so ist ihre Visibilität
und Präsenz als soziale und kollektive Ak-
teur/innen im öffentlichen Raum unleugbar
und ihre Rolle als Sprachrohr migrantischer
Bürger/innen in den Massen- und neuen so-
zialen Medien ein soziales Faktum. Es bleibt
abzuwarten, inwieweit sich die aktuelle Kons-
tellation ür eine um assende „ ewegung“
und bewussten kollektiven Protest (Bayat
2012: 128 f.) erweitert z.B. über solidarische
Kooperationen mit den Akteur/innen anderer
empanzipatorischer sozialen Bewegungen,
wie dem “20 Février“. Wie e izient sie si in
weiteren Aushandlungen mit hegemonialen
Machtverhältnissen auf den Feldern der me-
dialen Repräsentation, der Bür-
ger/innenrechte und der politischen Macht
behaupten kann, wird sich in der Zukunft
zeigen.
Literatur
G. Anzaldúa, The Border/La Frontera. The
New Mestiza (San Francisco 1987).
E. Balibar, Der Schauplatz der Anderen
(Hamburg 2006).
A. Bayat, Leben als Politik. Wie ganz normale
Leute den Nahen Osten verändern (Berlin
2012).
M. ojadžijev – R. Römhild, persönliche Noti-
zen zum Vortrag „ ritik der Migrantologie“
vom 28.11.2011, im Rahmen der Ringvorle-
sung „Wer MAC T Demo_kratie“ am Institut
für Sozialwissenschaften der HU Berlin, orga-
nisiert von Allmende e.V und Netzwerk MiRA
(Berlin 2011).
C. Caillault, The Implementation of Coherent
Migration Management Through IOM Pro-
grams in Morocco, In: M. Geiger – A. Pécoud
(Hrsg.), The New Politics of International Mo-
bility. Migration Management and its Discon-
tents. IMIS-Beiträge 40, 2012, 133–156.
H. De Haas, Länderprofil Marokko. In:
BpB/Netzwerk Migration in Europa/ HWWI,
Fokus Migration 16, 2009, 1–13,
57 | S e i t e
<http://focus-
migration.hwwi.de/Marokko.5987.0.html>.
S. Kron, Intersektionalität oder borderland als
Methode? Zur Analyse politischer
Subjektivitäten in Grenzräumen, in: S. Hess –
N. Langreiter – E. Timm (Hrsg.),
Intersektionalität Revisited, (Bielefeld 2011)
197–220.
E. Laclau – C. Mouffe, Hegemonie und radika-
le Demokratie. Zur Dekonstruktion des Mar-
xismus. (Wien 1991).
O. Marchart, Eine demokratische Gegenhe-
gemonie. Zur neo-gramscianischen Demokra-
tietheorie bei Laclau und Mouffe, in: A. Fi-
scher-Lescano – S. Buckel (Hrsg.), Hegemonie
gepanzert mit Zwang. Zivilgesellschaft und
Politik im Staatsverständnis von Antonio
Gramsci (Baden-Baden 2007) 104–119.
M. Peraldi u. a., D'une Afrique à l'autre (Ra-
bat 2011).
58 | S e i t e
Urs Brachthäuser: Erinnerung – Ord-
nung der Vergangenheit, ordnende
Vergangenheit?
Erinnerung ist ein selektiver Prozess, in dem
eine Masse vergangenen Geschehens und
vergangener Erfahrung gefiltert, Wissen ge-
ordnet wird. Erinnerung an Vergangenes be-
deutet dessen Vergegenwärtigung durch die
oder den Erinnernden. Sie gibt Orientierung
in der Gegenwart, aber auch für die Gestal-
tung der Zukunft.
Die Erinnerung an die Vergangenheit ist da-
bei den jeweiligen gegenwärtigen Bedürfnis-
sen unterworfen. Das Bild, das zu jeder Zeit
von der Vergangenheit entworfen wird, ist
eine Form der Ordnung. Durch die Vermitt-
lung der jeweiligen Gegenwart entfaltet Ver-
gangenheit Wirkung in der Zukunft, sei es zur
Legitimierung bestimmten Handelns oder
Denkens, der Festlegung normativen Verhal-
tens oder der Prägung des Erwartungshori-
zonts der Zeitgenossen. In der Erinnerung
verbinden sich so Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.
Wie lässt sich Erinnerung als Konzept auf das
Mittelmeer als Forschungsgegenstand an-
wenden? In der Einleitung seines weniger
bekannten Buchs über die Frühgeschichte
und antike Geschichte des Mittelmeers, das
den Titel „Les Mémoires de la Méditerranée“
trägt, erhebt Braudel das Mittelmeer selbst
zum Zeugen seiner Vergangenheit: „Es [Anm.:
das Mittelmeer] gibt den Erfahrungen der
Vergangenheit kontinuierlich ihren Platz,
kontextualisiert sie, haucht ihnen wieder Le-
ben ein und stellt sie unter einen Himmel, in
eine Landschaft, die wir mit eigenen Augen
sehen können, genauso wie die Menschen
von einst.“1 Das Mittelmeer erscheint hier als
eine historische und gleichzeitig zeitlose
Landschaft, die das Handeln der Menschen
durch die Jahrhunderte über sich ergehen
lässt, zugleich als Beobachterin der longue
durée und als Konstante im Wandel mensch-
licher Erfahrungen auftritt. Braudel ist als
Historiker der Chronist dieser Erinnerungen
des Meeres, Verfasser seiner Memoiren, er-
scheint so dort als neutrales Medium der
Erinnerungen seines Betrachtungsgegen-
standes wo er eigentlich Produzent von Erin-
nerung, Akteur des Gedächtnisses ist.
Auch in jüngerer Zeit wurde sich dem Mit-
telmeer aus der Perspektive der Erinnerung
angenä ert. 2010 versu te das ‚Centre or
Mediterranean Studies‘ der Universität
Zag reb so mit dem „Mediterranean Memo-
ry Proje t“ eine rü ke zwis en Vergangen-
heit und Zukunft zu schlagen. Durch die Erin-
nerung an die einstige Vernetztheit, Verbun-
denheit und Verflochtenheit der Menschen
am Mittelmeer sollte mediterrane Gemein-
schaft, Gemeinsamkeit und Identität neu
belebt werden. Ausgangspunkt hierfür war
die Geschichte Dubrovniks und die seiner
frühneuzeitlichen Konsulate im gesamten
Mittelmeerraum. Diese Verflechtung war
bzw. ist für die Initiatoren Ausdruck mediter-
raner Gemeinschaft und Einheit sowie Basis
einer gemeinsamen Identität. Die wissen-
schaftliche Beleuchtung dieser Verflechtun-
gen ging mit Treffen der Bürgermeister der
verschiedenen Städte einher, die sich über
die Möglichkeiten von Netzwerkbildung und
neuen Kooperationen austauschten.
1 „[…] elle resitue patiemment les expérien es du
passé, leur redonne les prémices de la vie, les place sous un ciel, dans un paysage que nous pouvons voir de nos propres yeux analogues à eux de jadis.“ – Braudel 1998, 21
59 | S e i t e
Dem Aspekt der Erinnerung in Großregionen
widmete sich 2006 auch eine Konferenz des
Nordeuropa-Instituts der Humboldt-
Universität und des Leipziger GWZO (Geis-
teswissenschaftliches Zentrum Geschichte
und Kultur Ostmitteleuropas). Im Mittelpunkt
des Interesses standen hier transnationale
Erinnerungsorte und Erinnerungslandschaf-
ten als Ergebnis postnationaler Erinnerungs-
kulturen.
Die Beiträge des Panels näherten sich dem
Gegenstand aus ganz unterschiedlichen Per-
spektiven. Andrea Spans untersuchte in ih-
rem Vortrag mit Jerusalem einen religions-
übergreifenden Erinnerungsort. Sie ging da-
bei anhand eines alttestamentlichen Textes
der Frage nach, inwiefern nach einer Phase
des Chaos der Rekurs auf alttestamentliche
Traditionen und die Erinnerung an vergange-
ne Ordnungen für die Restauration bzw. den
Neuentwurf von Ordnungsstrukturen heran-
gezogen wurde. Der Beitrag von Christiane
Schwab widmete sich der kollektiven Erinne-
rung und Identität des spanischen Sevilla.
Hier stand die Frage nach städtischer Erinne-
rungsgemeinschaft, Identität und Orientie-
rung sowie die Selektion von Erinnerung im
Fokus. Merryl Rebello nahm schließlich den
römischen Stadtgründungsmythos, seine In-
strumentalisierung zur Traditions- und Identi-
tätsbildung und seine zeitspezifische Umfor-
mung in den Blick.
Literatur
Fernand Braudel, Les Mémoires de la Médi-
terranée (Paris 1998).
60 | S e i t e
Merryl Rebello: Ordnung schaffen
mit Romulus: Cicero räumt auf.
Romulus ist eine der wenigen großen Helden
der Römer, der kein Kulturimport aus dem
reichen Angebot griechischer Götter und He-
roen ist, sondern dessen Geschichte un-
trennbar mit den Anfängen Roms verbunden
ist. Die Gründungssage als ein Meilenstein
des römischen quest for identity ermöglicht
den Römern eine kulturelle Abgrenzung von
den griechischen Übervätern, aber auch von
den italischen Nachbarvölkern.
Neben der kanonisch gewordenen Form des
Mythos, die wie z.B. beim Geschichtsschrei-
ber Livius (ca. 59 v. – 17 n.Chr.) greifen kön-
nen, gibt es innerhalb der
lateinischsprachigen Literatur aber auch eine
Vielzahl von abweichenden Versionen. Wich-
tige Referenzpunkte dieser über 700 Jahre
umfassenden motivgeschichtlichen Entwick-
lung liegen bei den Autoren Naevius, Ennius,
Varro, Cicero, Livius, Vergil, Properz, Ovid
und schließlich beim Kirchenvater Augusti-
nus. Angesichts dieser Vielzahl von Stimmen
zu Romulus aus den unterschiedlichsten Epo-
chen ist es kaum verwunderlich, dass mit-
nichten immer wieder dieselbe Konfiguration
des Mythos nacherzählt wird, sondern jeder
Autor seine jeweils eigenen Schwerpunkte
setzt.
Mit fortschreitender Zeit aber scheinen sich
die Kernbestandteile der Erzählung zu ver-
mehren – ein Befund, der sich nicht allein
durch eine bessere Überlieferung erklären
lässt. Poucet nennt dies das Phänomen der
Romulisation: Es handele sich hierbei um
eine Tendenz, dem Stadtgründer sukzessive
immer mehr kulturelle und
zivilisatorische Pionierleistugen zuzuschrei-
ben, von denen ursprünglich noch nicht die
Rede war.1 Pausch konstatiert Ähnliches und
spri t von Romulus als einem „Aitien-
Magnet“2. Beides setzt voraus, dass Romulus
im Rahmen einer retrospektiven Um- und
Neuordnung von Ereignissen eine tragende
Rolle zukommt.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung des
Romulus-Mythos halten wir bei einer Mo-
mentaufnahme Mitte des 1. Jh. v. Chr. inne
und zeichnen am Beispiel von Ciceros Schrift
De re publica seine Ordnung der Ereignisse
um Romulus nach. Dabei soll einerseits klarer
hervortreten, welche Aspekte Cicero beson-
ders betont und welche er demgegenüber zu
kaschieren sucht, andererseits soll auch auf
mögliche Gründe für dieses Vorgehen ver-
wiesen werden.
Laut eigener Aussage vollzieht Cicero in die-
sem literarischen Dialog bei der Schilderung
der mythistorischen Frühzeit Roms eine Be-
wegung a fabulis ad facta3. Im Zuge einer
rationalisierenden Umarbeitung der traditio-
nellen Version versucht er, Unglaubwürdiges
von Plausiblem zu trennen. Für die Betreiber
dieser Mythenrationalisierung4 ist es durch-
1Poucet 1985.
2Paus 2008. Aition (gr. αἴτιον) bedeutet „Ursprung;
Ursa e“; Aitiologie ist olgli der Versu P äno-
mene der Gegenwart (Gegenstände, Rituale etc.) aus
der Vergangenheit heraus zu erklären, häufig unter
Zuhilfename von Etymologien. Beispiel: Warum führen
die Römer noch zu Ciceros Zeiten vor wichtigen politi-
schen Entscheidungen eine Vogelschau durch? – Weil
einst dem Romulus durch ein Vogelzeichen kundgetan
wurde, dass er die Stadt Rom gründen solle. 3„Von Ges i ten zu Tatsa en“ s. Ci . rep. 2.4.
4Dieses Vorgehen ist eine Art Mode unter den republi-
kanischen Historikern. Der genaue Verlauf dieser Ent-
wicklung kann jedoch aufgrund der nur fragmentarisch
überlieferten Texte nicht nachgezeichnet werden.
61 | S e i t e
aus gängige Praxis, die göttliche Abstammung
solcher Heroenfiguren wie Romulus zu leug-
nen und auch ihre Vergöttlichung nach dem
Tod als Erfindung (und nicht als Tatsache) zu
präsentieren. Wie kommt es aber, dass Cice-
ro Romulus nicht einfach gänzlich verwirft,
sondern ihn unter teils erheblichem Anpas-
sungsaufwand für seine Argumentation nutz-
bar macht?
Ein Ziel der Schrift de re publica ist laut Cice-
ros eigener Aussage, jungen Männern den
Weg in die Politik zu weisen und den Staat so
mit fähigen Nachwuchskräften zu stärken.5
Der Dialog selbst spielt im Jahre 129 v.Chr.
und liegt damit aus der Perspektive Ciceros
über 70 Jahre in der Vergangenheit.6 Die auf-
tretenden Personen formieren sich als ge-
lehrte Gruppe um den Staatsmann Scipio
Africanus. Anders als beim Referenztext je-
doch, der Politeia Platons, ist der beste Staat
in ihren Diskussionen kein utopisches Kon-
zept, sondern war in der römischen Königs-
zeit, die mit Romulus beginnt, bereits einmal
verwirklicht.
Wie wichtig dabei der Rückbezug auf und die
Erinnerung an die Vergangenheit für ein rö-
misches Lesepublikum sind, erkennen wir an
der komplex ausgestalteten Erzählsituation.
Es finden sich insgesamt vier Erählinstanzen,
die sukzessive weiter in die Vergangenheit
zurückgreifen, wobei die Grenze zwischen
Autor und Werk in der Person Ciceros über-
sprungen wird, der einerseits Verfasser von,
dann aber auch Sprecher in seinem eigenen
Werk ist. Das gesamte Gespräch will er in
Frühe Vertreter einer Historiographie mit mythenkriti-
schen Tendenzen sind z.B. Gnaeus Gellius und Licinius
Macer. 5Cic. rep. 1.2 u. 1.8.
6De re publica ist zwischen 54 u. 51. v.Chr. entstanden.
seiner Jugend von einem Freund namens
Rutilius Rufus erzählt bekommen haben.7
Rufus erinnert sich an das zurück, was der
alte Scipio an diesem Tag erzählte, dieser
wiederum verwies damals auf den zeitlich
noch weiter zurückliegenden Cato. Feldherr
bringt die Situation folgendermaßen auf den
Punkt "Cicero remembers Rutilius Rufus,
remembering Scipio, remembering Cato,
remembering Romulus".8 Damit steht Romu-
lus am Ende einer rückwärts gewandten
Erinnerungsreihe, wobei das Dazwischen-
schalten so vieler Instanzen den Wert des
Erzählten durchaus zu steigern vermag.9
Eine ähnliche Rückwärtsbewegung ist auch in
Cic. rep. 1.25 zu beobachten. Scipio nimmt
eine angeblich in Rom gesichtete Doppelson-
ne zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass
eine Rückberechnung aller Sonnenfinsternis-
se bis zu derjenigen bei Romulus' Tod mög-
lich sei. Man kann also, so wird suggeriert,
mit wissenschaftlichen Methoden – denn als
eine solche wurde die Rückberechnung in der
Antike gewertet – bis in die Zeit des Romulus
zurückdringen. Er erscheint somit als Figur
greifbarer; insgesamt wird der Abstand der
Jetztzeit zur Frühzeit als überwindbar präsen-
tiert.10
7Cic. rep. 1.17.
8Feldherr 2003, 206.
9Voraussetzung dafür ist, dass wie hier wichtige Auto-
ritäten namentlich genannt werden. Möchte Cicero
ausdrücken, dass (nach dem Prinzip Stille Post) die
ursprüngliche Botschaft durch wiederholtes Weiterer-
zählen verloren gegangen sein könnte, greift er auf
unpersönliche Formulierungen wie dicitur, putatur,
perhibetur o.ä. („Man sagt dass...“) zurü k. 10
Cicero/Scipio ist viel daran gelegen, Romulus vom
Staub der Jahrhunderte zu befreien und ihn als Bei-
spiel von aktueller Relevanz in neuem Glanz erstrahlen
zu lassen vgl. dazu die kritis e Re lexion im „Met o-
denkapitel“: Ci . rep. 1.58.
62 | S e i t e
An anderer Stelle (rep. 2.4f) erzählt Cicero die
Romulus-Geschichte in einer eigenen, an die
Werkintention angepassten Version. Dabei
beseitigt er Volksmärchenhaftes, betont hin-
gegen politisch relevante Aspekte ganz be-
sonders. Gegenüber der kanonischen Version
fallen gravierende Abweichungen auf: Cicero
lässt den Streit der Zwillinge um die Mauer
und den daraus resultierenden Brudermord
völlig unerwähnt und die Wölfin, eigentlich
ein zentraler Bestandteil der Erzählung mit
emblematischem Charakter, wird in einem
Akt der Verfremdung zu einem "wilden Wald-
tier" (silvestris belua) reduziert. Kaum heran-
gewachsen, befehligt Romulus Truppen und
erwirbt im Kampf um die Stadt Alba Longa
Kriegsruhm.11 Der später von christlichen
Autoren so verurteilte Raub der Sabinerinnen
findet zwar noch Erwähnung, wird aber kei-
neswegs als Akt der Gewalt dargestellt, son-
dern als probates Mittel, um das noch junge
Gemeinwesen mit Bürgern zu bevölkern.12
Die Göttlichkeit des Romulus ist für Cicero als
Rationalisten problematisch, deshalb wird die
Apotheose als eine Erfindung der Vorfahren
präsentiert – eine Erfindung allerdings, die
insofern ihre Berechtigung hat, als sie dem
Wunsch der Menschen entsprang, die großen
Staatsmänner für ihre herausragenden Leis-
tungen wie Götter zu verehren. Im weiteren
Verlauf der Geschichte betont Cicero, dass
Romulus der Urheber zentraler römischer
Institutionen wie des Klientelwesens, eines
auf Besitz basierenden Strafrechts (rep. 2.15)
sowie des Senats und der Auspizien war (rep.
11
An dieser Stelle weicht die bisher einfache Sprache
der Erzählung einem stärker militärisch konnotierten
Vokabular. 12
Der Zweck (ad firmandam novam civitatem bzw. ad
muniendas opes regni ac populi sui, Cic. rep. 2.12)
heiligt hier die Mittel.
2.17). Diese kulturell-zivilisatorischen Errun-
genschaften werden dazu benutzt, um den
Glauben an seine Göttlichkeit zu erklären. Ein
ursprünglich religiöses Konzept, die Vergöttli-
chung, wird also entsprechend der Werkin-
tention durch eine leistungsbasierte Apothe-
ose ersetzt.
Was bleibt mit Blick auf diese kleine Auswahl
an Romulus-Bildern festzuhalten? In De re
publica zelebriert Cicero den Romulus als
zentrale Figur der römischen Erinnerungskul-
tur, befreit ihn dabei aber von seiner mythi-
schen Aura und unterfüttert die allseits be-
kannte Geschichte stattdessen mit Details
von politischer Relevanz. Problematisches
(Romulus' Status als Halbgott) wird rationali-
sierend umgearbeitet; lediglich der Argumen-
tation Entgegenstehendes (z.B. der Bruder-
mord) fällt ganz weg.13
Warum aber wählt Cicero den Romulus, um
die Vergangenheit zu ordnen? Zum einen
liegt mit ihm, wie eingangs bereits erwähnt,
eine genuin römische Identifikationsfigur vor.
Aeneas, dem der augusteische Dichter Vergil
eine Generation später in der Aeneis ein un-
vergessliches Denkmal setzen wird, stellt auf
den ersten Blick eine gewisse Konkurrenz zu
Romulus dar.14 Für Cicero jedoch hat Aeneas'
Name einen bitterem Beigeschmack, da die-
ser bereits von der Familie der Julier als
Stammvater beansprucht wurde, u.a. also
von Caesar, in Ciceros Augen also einem der
größten Feinde der Republik, dessen politi-
sches Agieren bereits früh auf eine Allein-
herrschaft abzielte. Vor diesem Hintergrund
13
In Werken mit anderem Grundtenor (z.B. der Spät-
schrift De officiis) nimmt Cicero in Sachen Fratrizid
durchaus kein Blatt vor den Mund (off. 3.41). 14
Beide fallen in die Kategorie der culture heroes.
63 | S e i t e
ist es Cicero kaum möglich, in Aeneas ein
Vorbild zu sehen.
Zweitens eignet sich Romulus auch deshalb
besser für eine sinnstiftende Vergangenheits-
rekonstruktion, wie Cicero sie hier vornimmt,
weil er (im Gegensatz zum aus Troja zuge-
wanderten Aeneas) gewissermaßen römi-
sches Urgestein ist. Eine Rückbesinnung auf
die eigenen Wurzeln muss also, wenn man in
Rom verharren möchte, notwendigerweise
bei Romulus enden. Wann immer Cicero die
römische Frühzeit behandelt, beginnt sie
immer bei Romulus, nie aber bei Aeneas.
Drittens, und damit sei dem hier besproche-
nen Beispiel sein Platz innerhalb des Panels
„Erinnerung – Ordnung der Vergangenheit,
ordnende Vergangen eit“ zugewiesen ist
Romulus nicht zuletzt auch das erste Glied in
der Reihe der sieben mythistorischen Könige
Roms, und Königsreihen eignen sich nun
einmal besonders gut, um die Vergangenheit
ordnend zu überblicken. Dadurch aber, dass
es sich bei der frührömischen Monarchie um
ein leistungsbasiertes Wahlkönigtum handelt,
bei dem Blutsverwandtschaft keine Rolle
spielt, sind Romulus und Co. mit republikani-
schen Grundsätzen, wie Cicero sie verkör-
pert, bestens zu vereinbaren.
Literatur
K. Büchner, Marcus Tullius Cicero. Der Staat
(München 1993).
S. Cole, Cicero, Ennius and the Concept of
Apotheosis in Rome, Arethusa 39, 2006, 531–
548.
T. J. Cornell, Cicero on the Origins of Rome,
in: J. G. F. Powell (Hrsg.), Cicero's Republic
(London 2001) 41–56.
A. Feldherr, Cicero and the Invention of
'Literary' History, in: U. Eigler u.a. (Hrsg.),
Formen römischer Geschichtsschreibung von
den Anfängen bis Livius. Gattungen – Auto-
ren – Kontexte (Darmstadt 2003) 196–212.
D. Pausch, Der aitiologische Romulus. Histori-
sches Interesse und literarische Form in Li-
vius' Darstellung der Königszeit, Hermes 136,
2008, 38–60.
J. Poucet, Les Origines de Rome. Tradition et
Histoire (Brüssel 1985).
J. G. F. Powell, Marci Tulli Ciceronis De re
publica, De legibus, Cato maior de senectute,
Laelius de amicitia (Oxford 2006).
E. Rawson, Cicero the Historian and Cicero
the Antiquarian, The Journal of Roman Stud-
ies 62, 1972, 33–45.
J. von Ungern-Sternberg, Romulus-Bilder: Die
Begründung der Republik im Mythos, in: F.
Graf (Hrsg.), Mythos in mythenloser Gesell-
schaft. Das Paradima Roms (Stuttgart 1993)
88–108.
S. Walt, Der Historiker Licinius Macer. Einlei-
tung, Fragmente, Kommentar (Stuttgart
1997).
J. E. G. Zetzel, Cicero, De re publica:
Selections (Cambridge 1995).
64 | S e i t e
Christiane Schwab: Kumulative Ord-
nungen: Zeit, Raum und Identitäts-
konstruktionen in Sevilla
Städte sind zeitlich sedimentierte Kulturräu-
me. Hier treffen Dimensionen des Individuel-
len und des Kollektiven, des Lokalen und des
Translokalen sowie des Historischen und des
Zukünftigen zusammen und bilden einen
spezifischen Rahmen menschlicher Wirklich-
keitserfahrung. In Anlehnung an neuere Dis-
kussionen in Stadtanthropologie, Humangeo-
graphie und Stadtsoziologie1 habe ich in mei-
ner Dissertation Sevilla als ein Sinngefüge
untersucht, das die Ebenen der physisch-
materialen Umwelt, der Symbolisierungs-
und Thematisierungsformen des Alltags, der
körperlich-räumlichen Routinen sowie die
der zeichenhaften Verdichtungen über die
Stadt selbst umfasst. Alle diese Elemente
ergeben eine distinkte kulturelle Textur mit
ineinander verwobenen Elementen, die sich
unter spezifischen historischen Bedingungen
gerade hier abgelagert hat und ihre Wirkung
zeigt.
Um diese „kumulative Textur der Stadt“2 in
ihrer longue-durée zu sondieren und zu in-
terpretieren, habe ich mittels unterschied-
lichster Methoden einen Quellenkorpus er-
stellt, der historische und zeitgenössische
Dokumente beinhaltet und der im Sinne der
flexiblen Herangehensweise der Grounded
Theory und mittels diskurstheoretischer An-
sätze, welche die Mechanismen der Produk-
tion von Bedeutung erschließen, analysiert
und interpretiert wurde. Beobachtungspro-
tokolle, Filme, Interviewtranskripte, Ge-
1 vgl. zum Forschungsstand etwa Lee 1997; Lindner
1993; Löw 2008; Suttles 1984; Taylor u. a. 1996. 2 vgl. Suttles 1984.
schichtsbücher, autobiographische Quellen,
Literatur, Plakate oder die Namen von Res-
taurants und Kindergärten und viele weitere
Quellen verweisen als Aussagefragmente auf
generative kulturräumliche Muster, welche
sich weitaus langsamer wandeln, als ökono-
mische oder soziokulturelle Transformati-
onsprozesse glauben machen wollen.
Die künstlichen Trennlinien, die ich in die
Texturen Sevillas geschlagen habe, beleuch-
ten die Stadt aus verschiedenen Perspekti-
ven. Als eine erste Orientierungslinie kam die
zeitliche Dimension zum Tragen. Analog zur
Textur einer Stadt ist auch ihr Gedächtnis ein
heterogenes, aber verknüpftes Gewebe, das
von bestimmten Diskursgemeinschaften und
thematischen Strängen dominiert wird. Die
kollektiven Erinnerungen dienen in erster
Linie gegenwärtigen Bedürfnissen nach Ori-
entierung und Selbstinszenierung und geben
in dieser Eigenschaft weniger Auskunft über
vergangene Ereignisse als über lokale Selbst-
bilder und Traumata sowie über Verortungs-
weisen der Stadt in ihrem translokalen Be-
zugssystem. Für Sevilla ist seine „myt is e“
Zeit das 16. und das 17. Jahrhundert, als es
den alleinigen Ausgangspunkt der Kolonisie-
rung des amerikanischen Kontinents bildete.
Insbesondere von den wirtschaftlichen und
politis en Eliten wird das „amerikanis e“
und „unterne meris e“ Sevilla beständig
und in verschiedenen medialen Kontexten
repräsentiert, um die Stadt als dynamisch
und kosmopolitisch zu positionieren. Über
eine weitaus höhere alltagsweltliche Rele-
vanz als das imperiale Sevilla der Renaissance
verfügen allerdings die Kunst und die Ästhe-
tik des Barock, was sich insbesondere der
künstlerischen Blüte verdankt, die Sevilla im
17. Jahrhundert im Zusammenspiel mit der
Gegenreformation erlebte. Einige der belieb-
65 | S e i t e
testen Christus- und Marienfiguren der Stadt,
die bis heute zentrale Objekte der lokalen
Identifikation darstellen, entstanden in dieser
Zeit, und als die Semana Santa (Karwoche) im
19. Jahrhundert unter touristischen und iden-
titätspolitischen Vorzeichen neu auflebte,
wurde der Neobarock zur stilprägenden Aus-
drucksform für die Marien- und Christusfigu-
ren sowie für den Schmuck und die prächti-
gen Gewänder der Büßerinnen und Büßer.
Ein weiterer Aspekt der zeitlichen Orientie-
rungen Sevillas ist seine Funktion als „Gene-
rationenort“ (Aleida Assmann). Die soziale
Verankerung der Bruderschaften in der Be-
völkerung, die starken lokalen Identifikatio-
nen und eine relativ hohe räumliche Stabilität
der erweiterten Familie tragen dazu bei, dass
sich die Geschichte der Familie und die eige-
ne Biographie mit den Charakteristika der
Stadt, ihren materialen Strukturen und ihren
Zuschreibungen verbinden. In dieser Eigen-
schaft wird Sevilla überwiegend als ein sedi-
mentierter Kulturraum wahrgenommen, des-
sen historischer Sinn festgelegt ist und der
sich jenen Zukunftsvisionen verweigert, wel-
che die heimatlichen Strukturen zu verän-
dern bedrohen. Diese Implikationen histori-
scher Sinnbildung widersprechen hegemonia-
len An orderungen von „Mobilität“ und „Fle-
xibilität“ in einem immer kompetitiveren na-
tionalen und internationalen Raum der Städ-
te.
Auch in einer zweiten Perspektive, die Sevilla
als ein sozialräumliches Gefüge betrachtet,
werden seine Charakteristika als ein Genera-
tionenort relevant. Der maurisch-
mittelalterliche Kern, der noch in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts nahezu den ge-
samten Stadtraum umfasste, zeichnet sich
aufgrund seiner stofflichen Verfasstheit
durch eine hohe Kontaktdichte sowie durch
regenerative Formen der Aneignung aus. Dies
führt dazu, dass die Stadt als ein soziales und
mit Sinn aufgeladenes Feld erlebt wird. Die
spezifischen Verdichtungsformen werden
durch die Institutionen der Bars und der Bru-
derschaften, deren Institutionalisierung auf
dem territorial gebundenen Zunftsystem be-
ruht, auch in jene Stadtviertel getragen, die
im 20. Jahrhundert im Rahmen der periphe-
ren Expansion Sevillas entstanden waren.
Bedingt durch die sozialräumlichen Nut-
zungsweisen, die häufigen persönlichen Kon-
takte im öffentlichen Raum und eine geringe
interurbane Mobilität zeichnet sich die Stadt
durch eine dichte lokale Symbolik aus, die für
einen Großteil der Bevölkerung einen we-
sentlichen Bestandteil des lebensweltlichen
Bezugsrahmens bildet. Die symbolische Aus-
drucksstärke der lokalen Bezüge, ihre
identitäre Wirkkraft und ihre kohäsiven Funk-
tionen werden in erster Linie am Beispiel des
Wissens- und Symbolkomplexes der Bruder-
schaften und der Semana Santa dargestellt.
Die hohe emotionale Ortsbezogenheit, die
durch den symbolischen Reichtum der Stadt
sowie die biographische Stabilität räumlicher
und familialer Bindungen begünstigt wird,
tritt angesichts spätmoderner Überschnei-
dungen verstärkt hervor. In diesem Kontext
wird Sevilla im Gegensatz zu den „Ni tor-
ten“ Nordspaniens Europas oder Nordame-
rikas als eine „ umane“ und „warme“ Stadt
begriffen.
Eine dritte Linie der Interpretation bezieht
sich auf soziale und mental-evaluative Ord-
nungen. Die Feria de Abril (ein sevillanisches
Volksfest, das sich aus einer Landwirt-
schaftsmesse des 19. Jahrhunderts entwi-
ckelte) verweist dabei als eine Verdichtung
66 | S e i t e
zentraler Repräsentationen der Stadt auf
lokale Strukturen und Befindlichkeiten, die
ihre Wurzeln in einer agrarischen Wirt-
schafts- und Sozialordnung haben. Die Funk-
tionen eines agrarischen Handelszentrums
und eines Wohnortes für die Familien des
Großgrundbesitzes, welche Sevilla bis ins 20.
Jahrhundert kennzeichneten, haben zu einer
Ausprägung von spezifischen Distinktions-
formen, Statussymbolen und Räumen der
Repräsentation geführt, wie auch bestimmte
Interpretationen der Stadt von den hegemo-
nialen Diskursgemeinschaften etabliert wur-
den. Insbesondere die Institutionen des alten
Adels und der Bruderschaften, die Überliefe-
rungen der Feria, der Pilgerfahrt nach Rocío
und der Semana Santa sowie das Fehlen al-
ternativer Leitbilder tragen dazu bei, dass
diese Ordnungen bis heute in der Stadt tra-
diert und popularisiert werden. Die konserva-
tive Tönung dieser Muster sowie der soziale
und wirtschaftliche Eigenweg der Stadt gene-
rieren im Rahmen interstädtischer und inter-
nationaler wirtschaftlicher Kontexte nicht
selten ein Gefühl der Unterlegenheit, das mit
essentialistischen Konturierungen eines posi-
tiven Selbstbildes kompensiert wird.
Der letzte Teil der Arbeit widmet sich den
sevillanis en „Myt en“ und i ren soziokul-
turellen Bedingungen der Entstehung und
der Überlieferung. Nahezu alle gegenwärti-
gen lokalen Bilder und Narrative wurden in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mo-
delliert, als sich mit der Entstehung einer
agrarischen Bourgeoisie, die nach neuen kul-
turellen Leitbildern suchte, sowie durch den
Kontakt mit den romantisch inspirierten Rei-
senden aus Mittel- und Nordeuropa ein spe-
zifischer Kontext städtischer Selbstbeobach-
tung ergab. In diesem Zusammenhang wur-
den die romantis en Myt en der „volkstüm-
li en“ „ländli en“ „kat olis en“ und
„ursprüngli en“ Stadt entwor en die si im
Rahmen diverser Kontexte beständig verdich-
teten. Dies gilt auch für die Zeit der franquis-
tis en Diktatur als die ilder des „volkstüm-
li en“ und „kat olis en“ Sevillas zum nati-
onalen Mythos gesteigert wurden. Die Kul-
turalisierung der Stadt verstärkte sich wei-
terhin angesichts ihrer Transformation in
eine Dienstleistungsgesellschaft, in welcher
die wirtschaftliche Dominanz des Tourismus
eine kaum zu überschätzende Rolle spielt,
und durch die Ernennung Sevillas zur Haupt-
stadt der autonomen Region Andalusien, was
zu einer Festigung der ideologischen Funkti-
on der Stadt führte.
Betrachten wir Sevilla als einen kodierten
Raum, in welchem historische Konstellatio-
nen ihre Wirkung entfalten, zeigen sich die
andauernde Dominanz agrarischer Funktio-
nen und die überwiegend regionale Ausrich-
tung Sevillas als Handelszentrum für sein Um-
land und als Wohnsitz des Großgrundbesitzes
als besonders wirkungsreiche Faktoren. Auf-
grund seiner Eigenschaften als identitär auf-
geladener Generationenort und angesichts
seiner überwiegend bewahrenden
Arenafärbung werden hier die Reibungen
zwis en „lokalen“ und „translokalen“ Struk-
turen, wie sie seit der Öffnung des Landes
1975 in ganz Spanien bemerkbar sind, auf
eine weitaus spannungsreichere Weise spür-
bar als an anderen Orten, etwa in traditionell
offeneren Hafenstädten oder im kulturellen
Zentrum Madrid, das immer auch einen Brü-
ckenkopf nach Europa bildete. Zwar wurden
seit dem Beitritt in die Europäische Union die
gewaltigen sozioökonomischen Unterschiede
innerhalb der sevillanischen und der andalu-
sischen Bevölkerung wesentlich nivelliert; der
wirtschaftliche Wandel und der Einfluss in-
67 | S e i t e
ternationaler Bilderwelten bewirkten aber
keinen Verlust lokaler Deutungsweisen.
Vielmehr bilden spätmoderne
Gleichzeitigkeiten einen besonders wirkungs-
vollen Kontext der gegenwärtigen Selbstkul-
turalisierung. Auch neue Formen des Wett-
bewerbs zwischen Städten fördern die Insze-
nierung lokaler Eigenarten als wirkmächtige
Narrative, die immer auch den Raum der
Stadt symbolisch aufladen und seine Nutzung
bestimmen. Auch wenn derlei Inszenierun-
gen nicht vereinfachend mit dem Leben, wie
es sich in der Stadt vollzieht, in eins zu setzen
sind, zeigt sich deutlich dass sie auch die lo-
kalen Identifikationen der Bevölkerung be-
stimmen, wenngleich diese weitaus differen-
zierter und intimer verlaufen, als die simplifi-
zierten Bilder glauben machen möchten. So
zeigen sich die historisch sedimentierten Tex-
turen Sevillas nach wie vor als formative Kräf-
te lokaler Strukturierungen und territorialer
Identitäten, und sie werden auch in der Zu-
kunft bestimmen, wie die Stadt und ihre Be-
völkerung sich im Rahmen nationalstaatli-
cher, europäischer und globaler Herausforde-
rungen verorten werden.
Literatur
M. Lee, Relocating Location: Cultural Geog-
raphy, the Specificity of Place and the City
Habitus, in: J. McGuigan (Hrsg.), Cultural
Methodologies (London1997) 126–141.
R. Lindner, Das Ethos der Region, Zeitschrift
für Volkskunde 89, 1993, 169–190.
M. Löw, Soziologie der Städte (Frankfurt am
Main 2008).
G. D. Suttles, The Cumulative Texture of Local
Urban Culture, American Journal of Sociology
90,2, 1984, 283–304.
I. Taylor u. a., A Tale of Two Cities: Global
Change, Local Feeling and Everyday Life in
the North of England. A Study in Manchester
and Sheffield (London 1996).
68 | S e i t e
Andrea Spans: Das perserzeitliche
Jerusalem zwischen Wunsch und
Wirklichkeit. - „Raum“ im Medium
„Text“
Einleitung
Die nachfolgenden Ausführungen verstehen
sich als Diskussionsbeitrag zur Frage nach der
ordnungsstiftenden Funktion der Erinnerung.
Sie stellen mit Jes 60,1–16 ein alttestamentli-
ches Textbeispiel in den Mittelpunkt, das
Jerusalem als Zentrum einer friedlichen Uni-
versalordnung in Szene setzt und demnach
ein Ordnungsbild zeichnet, dem Zentralität
als Ordnungsprinzip zugrunde liegt.
Zu Beginn des 5. Jh.s entstanden, enthalten
Jes 60,1–16 eine Ordnung der Vergangenheit,
die in ihrer Zeit eine Veranlassung kennt,
gleichwohl von der Neuordnung wiederum
zeitlich vorausliegender Inhalte lebt. In Auf-
nahme bekannter Vorstellungsgehalte und
früherer Traditionen richten die Literaten die
für sie autoritativen Erinnerungen neu an
ihrer Gegenwart aus und begründen auf die-
se Weise eine Zukunftshoffnung.
Es wird zu zeigen sein, dass dieses Zukunfts-
bild in krassem Gegensatz zu den archäologi-
schen Evidenzen für das perserzeitliche Jeru-
salem steht; das Textbeispiel Jes 60,1–16
leistet also keine wirklichkeitsgetreue Abbil-
dung der Welt hinter dem Text, sondern er-
öffnet gleichsam eine eigene, neue Welt, die
dem Wunschdenken der Verfasser ent-
stammt. Demnach ist nachfolgend ebenso
das Verhältnis zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit zu formulieren.
Vor diesem Hintergrund macht sich die vor-
liegende Untersuchung die raumsoziologi-
sche Grundeinsicht zu eigen, dass der Raum
eine kulturelle Größe sui generis darstellt,
d.h. sich in und durch soziale Prozesse konsti-
tuiert.1 Das hier operationalisierte Raummo-
dell ist nicht mehr das klassische Behälter-
modell, das Raum und Rauminhalt dissoziiert;
der Raum ist nicht mehr die Bühne der in ihm
handelnden Menschen, sondern der Raum
wird dadurch erst geschaffen, dass Menschen
sich bewegen, handeln, symbolische Werte
zuschreiben und durch Bebauung materielle
Werte schaffen.2 Insofern setzt die raumsozi-
ologische Untersuchung beim empirisch Ge-
gebenen ein. Dazu gehört die Beobachtung
beispielsweise des Stadtbildes, der materiel-
len Strukturen (Häuser, Straßen, Freiflächen)
und ihrer Lagen zueinander, aber auch und
gerade die Beobachtung des Menschen bzw.
einzelner Gruppen, die sich in einen sozialen
Zusammenhang einfügen, indem sie sich z.B.
innerhalb räumlich markierter Grenzen be-
wegen, oder aber soziale Strukturen dadurch
aufbrechen, dass sie ebendiese Grenzen
überschreiten und damit nicht selten mit
gesellschaftlichen Konventionen brechen.
Dieser Frageperspektive wird im Folgenden
dahingehend Rechnung getragen, dass mit
den materiellen Hinterlassenschaften zu-
nächst der empirisch erhebbare Befund zum
Jerusalem des 5. Jh.s dargestellt wird. Jes
60,1–16 transportieren demgegenüber da-
durch eine Raumidee, dass in Aufnahme be-
kannter Traditionen Bewegungsabläufe so-
wie Handlungsvollzüge in und um Jerusalem
dem Leser vor Augen geführt und zu einem
Stadtbild mit ganz eigener ideologischer Prä-
1 vgl. Gehlen 1998, 377.
2 vgl. Läpple 1991; Löw 2009.
69 | S e i t e
gung zusammengeführt werden. Folglich sind
nicht die sich empirisch-materialiter darstel-
lende Gestalt Jerusalems und ihre sozialen
Implikationen Gegenstand der Ausführungen;
vielmehr steht mit Jes 60,1–16 ein literarisch
verdichteter Ordnungsversuch im Fokus. Die
Differenz zwischen empirisch zu beschrei-
bender Raumgestalt und theologisch einzu-
holender Raumidee gibt – so die hier vertre-
tene These – einen Diskurs um die Stellung
Jerusalems in persischer Zeit zu erkennen:
Nachdem mit der Zerstörung von Stadt und
Tempel 586 v. Chr. das geschichtliche Chaos
Überhand nahm, stellt sich im 5. Jh. die Frage
nach Übernahme und/oder Neuentwurf be-
stehender Ordnungsmuster.
Stadtbild und Weltbild
Aus den archäologischen Evidenzen ist fol-
gendes Stadtbild zu erschließen3: Obgleich
sich einem Bewohner des perserzeitlichen
Jerusalems die Stadt als bedeutendste Sied-
lung der Provinz Jehud (Juda) – als Zentrum
gegenüber der Peripherie des landwirtschaft-
lich geprägten Hinterlandes – darstellt, ist
von den wenigen materiellen Hinterlassen-
schaften auf ein von Bescheidenheit gekenn-
zeichnetes Stadtbild zu schließen. Mit einem
Zehntel der Siedlungsfläche (5–6 ha), einer
Einwohnerzahl von vielleicht 15004, einem
kaum zu fortifikatorischen Zwecken errichte-
ten „Stadtmäuer en“5 und einem karg aus-
3 Zur nachfolgenden Rekonstruktion vgl. Keel 2007,
953. 4 Dies ist eine vergleichsweise maximalistische Zahl,
anders demgegenüberFinkeklstein 2008 514: „a ew undred people“. 5 Strittig ist in der Forschung, ob sich die durch die
Mauer eingefasste Stadtsiedlung auf den Südosthügel beschränkte oder ob sie sich ebenso auf den Südwest-hügel erstreckte, vgl. Ussishkin 2006, 147.
gestatteten Zweiten Tempel steht das per-
serzeitliche Jerusalem weit hinter Größe und
Rang der Stadt im 8./7. Jh. zurück. So wenig
diese Befunde zum Bild der Stadt einerseits
über die sozialen Prozesse innerhalb und au-
ßer alb des „Stadtmäuer ens“ Auskun t
geben, so aussagekräftig ist dieser Mangel
andererseits: Jerusalem ist offenkundig keine
Stadt von Weltrang!
Ganz anders beurteilen demgegenüber die
Literaten in Jes 60,1–16 die Bedeutung ihrer
Stadt, wenn sie ein Raumkonzept entwerfen,
das gleichsam Weltbildkompetenz bean-
sprucht: Jerusalem ist nicht eine vergleichs-
weise unbedeutende Stadt, sondern der Na-
bel der Welt!
Dieses in universale Dimensionen ausgezo-
gene Stadtbild hat zwei Eckpunkte, Jes 60,1–
3 und Jes 60,13–14. Die Stadt Jerusalem
bleibt im Aussagegang zwar zunächst eine
Unbekannte, denn erst mit der Namensge-
bung in V 14 „Stadt J w s“ und „Zion des
eiligen Israels“ wird i re Identi ikation
nachgeholt.6 Nichtsdestoweniger setzt die
Darstellung in V 1–3 Traditionen und Motive
voraus, die Jerusalem als Gestalt indirekt
erschließen lassen: Das Alte Testament kennt
die personifizierende Redeweise von der
Stadt, der aufgrund ihres grammatischen
Geschlechts weibliche Rollen und Attribute
beigelegt werden können. Vor diesem Hin-
tergrund lassen erstens die femininen Impe-
rativformen aufmerken, die eine Frau als Ad-
ressatin zu erkennen geben; zweitens hat
genau diese Anredeform – also eine Mehr-
zahl femininer Imperative und die Eröffnung
mit „ste au “ – ihre Vorläufer im Jesajabuch,
und zwar in Jes 51,17; 52,2, wo die Adressa-
6 vgl. Polan 2001 66: „delayed identi i ation“.
70 | S e i t e
tin explizit benannt wird: „Ste au Jerusa-
lem!“ und „ste au setz di in Jerusa-
lem!“ Der ges ulte Leser kann ni t anders
denn die neuerli e Au orderung „ste au !“
zu ihren Vorgängern im Buch in Beziehung zu
setzen und auch hier die Gestalt Jerusalem
als Adressatin zu erkennen.7
Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass die
Gestalt ihren ganz eigenen Beitrag zu einem
Raumkonzept leistet, das in V 1–3 begründet
und nachfolgend, ab V 4, entfaltet wird.
Der zentrale Bezugspunkt im Raum ist gemäß
Jes 60,1–3 die personifizierte Stadt, die als
am Boden kauernde Frau vorgestellt wird
und sich zu erheben aufgefordert ist.8 Folg-
lich ist der hier entworfene Raum erstens
durch den Gegensatz oben/unten und damit
in der Vertikalen strukturiert, wobei die kör-
perliche Erfahrung der Gestalt als Referenz
herangezogen wird. Ferner verbindet sich
auch mit der Rede vom Kommen deines Lich-
tes in V 1 eine räumliche Vorstellung, denn
die parallele Wendung „und die errli keit
J w s ist über dir au gegangen“ indiziert ei-
nen Bewegungsablauf in der Vertikalen –
gleichermaßen also wie das Aufstehen der
Gestalt. Schließlich ist dieser vertikalen Aus-
richtung mit dem Motiv eines Völkerzuges
„zu dir“ in V 3 eine orizontale Orientierung
an die Seite gestellt. Durch Bewegung wird
hier eine Distanz im Raum überwunden, die
sich zuvor, in V 2, bereits als Kontrast zwi-
schen dem Licht Zions einerseits und dem
Dunkel der Völkerwelt andererseits vermit-
telte. So wie der Gegensatz oben/unten
strukturiert auch die horizontale Differenzie-
rung zwischen Nähe und Distanz den in Jes
60,1–3 entworfenen Raum. Auf diese Weise
7 vgl. Lau 1994, 26.
8 vgl. Steck 1991 82, Anm. 4; Lau 1994, 25.
werden die unterschiedlichen Bewegungsab-
läufe in ein Koordinatensystem eingepasst,
dessen Nullpunkt mit der Stadt als Gestalt
und ihrer körperlichen Erfahrung gegeben ist.
Dieses Koordinatensystem gewinnt an Tie-
fenschärfe, wenn seine Verstehens-
voraussetzungen in den alttestamentlichen
Traditionen näher untersucht werden. So ist
erstens der motivliche Zusammenhang aus
Licht und Völkerwelt keine Neuheit innerhalb
des Jesajabuches, denn bereits in Jes 42,6;
49,6 bestimmen diese Motive die Funktion
einer Gestalt.9 Dort ist es in der Situation des
Exils der Gottesknecht, dem die Aufgabe zu-
kommt „Li t ür die Völker“ zu sein. Er be-
zeugt das alleinige Gottsein Jhwhs vor aller
Welt, und die Licht werdende Gestalt Jerusa-
lem ist das Ziel einer Bewegung aus der Völ-
kerwelt heraus. Im Jesajabuch wandelt sich
somit die Hinwendung zu den Völkern als
Licht im Exil zur Hinwendung der Völker zum
Licht nach dem Exil.10
Zweitens wird die Vorstellung einer göttli-
chen Präsenz über der Stadt in bekannte
Denkmuster eingekleidet, diese werden in Jes
60,1–3 jedoch zugleich modifiziert. Im Hin-
tergrund stehen Theophanie-darstellungen,
wie sie u.a. in die Tora Eingang gefunden ha-
ben.11 Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wol-
len, gewinnen die Eigentümlichkeiten der
Konzeption in Jes 60,1–3 in diesen Denkbah-
nen folgendermaßen an Kontur: Bei aller
Verwiesenheit auf die Theophanietradition
bricht hinsichtlich des räumlichen Bezugssys-
tems die erste Differenz auf. Keiner der Refe-
renztexte verlegt wie Jes 60,1–3 göttliches
9 vgl. paradigmatisch Steck 1991.
10 vgl. Steck 1991, 91.
11 Zu Dtn 33,2 vgl. Langer 1989, 42 f. Zu Lev 9,6.23;
Num 14,10; 20,6 vgl. Langer 1989, 77–79.
71 | S e i t e
Erscheinen auf die vertikale Raumachse, die
in Jes 60,1–2 darstellungsbestimmend ist
(vgl. „über dir“). Das zweite Unters ei-
dungsmoment ist die ästhetisierte Form gött-
lichen Erscheinens – keine Spur von Feuer,
Blitz, Donner oder Beben in Jes 60,1–2! Viel-
mehr lässt das Bild des aufgehenden Lichtes
an einen Sonnenaufgang denken, der den
Tagesanbruch und damit den Beginn einer
grundsätzlich heilvollen Zeit verheißt.12 In Jes
60,1–3 wird dieser positive Erfahrungsbezug
für die Völker an Zion konkret: In ihrem Licht
erkennen sie das Licht Gottes, das auch für
sie den Beginn der Heilszeit markiert. Die
Gottesknecht- und die Theophanietradition
werden damit neu zu der Vorstellung geord-
net, dass Zion als Sehnsuchtsort für die ganze
Welt Gestalt annimmt: Die Gestalt steht als
Heilsmittlerin im Zentrum einer Universal-
ordnung!
Drittens und letztens gründet diese Zent-
rumsideologie im Weltbild der so genannten
Jerusalemer Kulttradition13: Dort berühren
sich Himmel (vertikale Orientierung) und Er-
de (horizontale Orientierung) im Tempel auf
dem Zion. Der Gottkönig Jhwh beherrscht
von seinem himmlischen Thron, dessen
Schemel im Tempel auf dem Zion steht, das
Chaos und garantiert solchermaßen die
Weltordnung. Das in Jes 60,1–3 entworfene
Raumkonzept atmet den Geist dieses Ord-
nungsmusters, ohne jedoch dass von einem
Tempel in Zion als Ort der Vermittlung die
Rede wäre. In diese Funktion rückt vielmehr
die personifizierte Stadt selbst ein, für die das
Zentrum beansprucht wird, wohingegen Völ-
ker und Könige zunächst die dunkle Periphe-
rie besetzen und sie anschließend verlassen.
12
Weippert 1998, 13 mit Verweis auf Ps 19,6; 104,23. 13
vgl. Steck 1991, 89.
Diese Zentralitätskonzeption setzt die Ge-
genüberstellung von Zentrum und Peripherie
als räumliche Ordnungsstrukturen einerseits
voraus; andererseits wird diese Unterschei-
dung dadurch gewissermaßen nivelliert, dass
sich die dunkle Völkerwelt zur Gottesstadt
auf den Weg macht. Die Lichtfunktion be-
gründet demnach eine Öffnung, die nun auch
räumlich übersetzt wird: Das Heilsgelände im
Zentrum öffnet sich den Völkern und Köni-
gen!
Das ommen „zu dir“ zur Gottesstadt bildet
folglich den cantus firmus der V 4–9 und
nimmt die horizontale Initialbewegung aus V
3 auf. Zugleich wird die in V 1–3 festge-
schriebene Zentrumsideologie in die Vorstel-
lung eines Kultbetriebes ohne Restriktionen
und ohne Amtspriester überführt, wenn die
Tiere nicht nur Jhwh loben, sondern selbsttä-
tig zum Opfer den Altar besteigen14. Rückt
Zion also innerhalb der Universalordnung in
Jes 60,1–3 in die Funktion des Tempels für
Völker und Könige ein (vgl. auch V 9!), ist es
nur konsequent, den Kultbetrieb offen zu
gestalten.
Den Befund, dass sich die Stadt als offenes
Heilsgelände, ja Heiligtum textweltlich kon-
stituiert, bestätigen folgende vier Beobach-
tungen zu Jes 60,10–14:
(1) Durch den Mauerbau (vgl. V 10) wird
das Zentrum Jerusalem mit einer
räumlichen Grenze versehen, die die
Peripherie als außerhalb des Stadtin-
neren gelegenen Bereich ausgrenzt.
Das Motiv eines Mauerbaus durch
Fremde führt jedoch die durch die
räumliche Grenze einer Mauer
eingestiftete soziale Opposition zwi-
14
So oole 2001 233: „sel -sa ri i e“.
72 | S e i t e
schen der Stadtbevölkerung innerhalb
und den Fremden außerhalb der
Mauer ad absurdum. Gleichermaßen
wird die ab- und ausgrenzende Funk-
tion der Mauer in V 11 dadurch auf-
gehoben, dass ihre Tore beständig
und ohne Gefährdung für die Stadt of-
fen stehen, um den Zustrom der
Menschen und Reichtümer einzulas-
sen15.
(2) Ab Jes 60,10 bestimmt nicht mehr die
ewegung „zu dir“ das topograp i-
sche Bild, sondern es steht der Eintritt
in die sich herausgeschälte, offene
Stadt im Fokus.16
(3) Nach Abschluss der Bewegung zur
Stadt und in die Stadt hinein wird die-
se in V 13 erstmals explizit als „Ort“
bestimmt. Die parallelen Bezeichnun-
gen „Ort des eiligtums“ und „Ort
meiner Füße“ ru en abermals die
Raumordnung der Jerusalemer Kult-
tradition auf: Während dieser Sprach-
gebrauch in anderen prophetischen
Büchern mit der Rede vom Gottes-
thron im Tempel zusammenfällt, ist in
Jes 60,13 nicht der Thron, sondern die
Stadt insgesamt Realsymbol göttlicher
Gegenwart;17 der „Ort meiner Füße“
ist nämlich nicht der Thron, sondern
der (gesamte) „Ort meines eilig-
tums“.
(4) In diesem Sinne ist auch die abschlie-
ßende Namensgebung zu verstehen:
„Stadt J w s“ und „Zion des eiligen
Israels“.
15
vgl. Blenkinsopp 2003, 215. 16
vgl. Koole 2001, 240. 17
vgl. Lau 1994, 55.
Dieses Weltbild mit Jerusalem im Zentrum
schließt so, wie es in den Eingangsversen
eröffnet wurde: mit einem Handlungsvollzug
der personifizierten Stadt, der zugleich eine
Bewertung des universalen Völkerzuges
durchscheinen lässt: Die sich an der Völker-
milch und an der Brust von Königen labende
Gestalt soll in der Hinwendung von ebendie-
sen Völkern und Königen die Zuwendung
ihres Gottes erkennen.18 Versammelt sich die
Welt in der Gottesstadt, hat jene an der
glücklichen Zeit teil, die somit auch für diese
konkret wird!
Jerusalem als offenes, universales Heilsge-
lände. Fazit
Der sich im Medium des Textes ausspannen-
de Raum ist kein völliger Neuentwurf, son-
dern knüpft an das aus der Jerusalemer Kult-
tradition bekannte Ordnungsbild an. Die Lite-
raten suchen demnach Anschluss an eine
„Ordnung der Vergangen eit“ die sie jedo
in einem Zukunftsbild der Stadt so neu konfi-
gurieren, dass für die Gottesstadt insgesamt
das Zentrum der Welt beansprucht wird, ja
mehr noch: Als Zentrum wird sie sich unter
Beteiligung der Völker, Außenstehender,
Fremder erst herausbilden. Die Erinnerung an
das altbekannte Weltbild hat für die Verfas-
ser dieses Textes insofern eine ordnungsstif-
tende Funktion, als ebenjenes Zentrum resti-
tuiert wird – in Anerkenntnis des sich in der
Situation des Exil Bahn brechenden Universa-
lismus ist allerdings der Einschluss der Völ-
kerwelt für die Verfasser nicht nur denkmög-
lich, sondern denknotwendig geworden. Der
Wunsch, Jerusalem als offenes, universales
Heilsgelände zu gestalten, lässt sich mit den
18
vgl. Berges 1998, 442.
73 | S e i t e
materiellen Hinterlassenschaften zwar nicht
zur Deckung bringen; er steht jedoch nicht
fernab der Lebenswirklichkeit der Literaten,
hat er doch in der hebräischen Bibel eine
solide Traditionsbasis, die Stadt- und Welt-
bild verschmelzen lässt.
Literatur
U. Berges, Das Buch Jesaja. Komposition und
Endgestalt, HBS 16 (Freiburg 1998).
J. Blenkinsopp, Isaiah 56–66. A New Transla-
tion with Introduction and Commentary,
AncB 19B (New York 2003).
I. Finkelstein, Jerusalem in the Persian (and
Early Hellenistic) Period and the Wall of Ne-
hemiah, JSOT 32, 2008, 501–520.
HRWG (1998) 377–398 s. v. Raum (R. Geh-
len).
O. Keel, Die Geschichte Jerusalems und die
Entstehung des Monotheismus (2 Bde.), Orte
und Landschaften der Bibel IV,1 (Göttingen
2007).
J. L. Koole, Isaiah. Part III, Volume 3: Isaiah
Chapters 56–66, HCOT (Leuven 2001).
B. Langer, Gott als "Licht" in Israel und Me-
sopotamien. Eine Studie zu Jes 60,1–3.19f.,
ÖBS 7 (Klosterneuburg 1989).
D. Läpple, Essay über den Raum. Für ein ge-
sellschaftswissenschaftliches Raumkonzept,
in: H. Häußermann u.a. (Hrsg.), Stadt und
Raum. Soziologische Analysen (Pfaffenweiler
1991) 157–207.
W. Lau, Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56–
66. Eine Untersuchung zu den literarischen
Bezügen in den letzten elf Kapiteln des
Jesajabuches, BZAW 225 (Berlin/New York
1994).
M. Löw, Raumsoziologie, Suhrkamp-
Taschenbuch Wissenschaft 1506 (Frankfurt
2009).
G. J. Polan, Zion, the Glory of the Holy One of
Israel: A Literary Analysis of Isaiah 60, in: L.
Boadt – M. Smith (Hrsg.), Imagery and Imagi-
nation in Biblical Literature, CBQ.MS 32
(Washington D.C. 2001) 50–71.
O. H. Steck, Lumen Gentium. Exegetische
Bemerkungen zum Grundsinn von Jesaja
60,1–3, in: O. H. Steck, Studien zu Tritojesaja,
BZAW 203 (Berlin 1991) 80–96.
D. Ussishkin, The Borders and De Facto Size
of Jerusalem in the Persian Period, in: O.
Lipschtis – M. Oeming (Hrsg.), Judah and the
Judeans in the Persian Period (Winona Lake
2006) 147–166.
H. Weippert, Altisraelitische Welterfahrung.
Die Erfahrung von Raum und Zeit nach dem
Alten Testament, in: H.-P. Mathys (Hrsg.),
Ebenbild Gottes – Herrscher über die Welt.
Studien zu Würde und Auftrag des Men-
schen, BThS 33 (Neukirchen-Vluyn 1998) 9–
34.
74 | S e i t e
Stefan Riedel: Wissen und Wissens-
konzeption als ordnende Prinzipien
Die unter den Begriffen Wissen und Wissens-
konzeption subsummierten methodischen
Konzepte und Herangehensweisen beeinflus-
sen, ob bewusst oder unbewusst, sämtliche
Vorstellungen der Dichotomie von Ordnung
und Chaos. Allein die Beschäftigung mit ei-
nem spezifischen Thema versucht die ge-
wählte Problematik und das verfügbare Ma-
terial nicht nur zu erfassen, sondern das ver-
meintliche Chaos der Daten in eine als sinn-
voll und nachvollziehbar erachtete Ordnung
zu bringen. Den Wissensbeständen unter-
schiedlicher Gesellschaften in verschiedenen
zeitlichen und räumlichen Kontexten kommt
dabei besondere Bedeutung zu, wurde und
wird doch gerade Wissen und dessen Kon-
zeption dazu genutzt Ordnung und somit
auch Chaos zu beschreiben und definieren.
Wissen strukturiert die Um- und Erfahrungs-
welt von Individuen und Gruppen, grenzt
diese nach außen und auch innen ab und
postuliert so als gut bzw. schlecht empfun-
dene Zustände, die wiederum mit Ordnung
und Chaos identifiziert werden können. So-
mit erscheint Wissen als eine Kategorie, die
zum einen notwendig zur Definition von For-
schungsgegenständen aber auch der eigenen
Erfahrungswelt ist, die andererseits durch
diese oft dogmatisch wirkenden Definitionen
aber auch Gefahren birgt. So stellt sich häufig
die Frage, wessen Wissen bzw. Wissenskon-
zeptionen bestimmten Ordnungen zugrunde
liegen und ob diesen andere Wissensbestän-
de gegenüberstehen können, die abweichen-
de Bilder zeichnen.
Im Mittelmeerraum lassen sich dabei durch
die Zeiten hinweg Phänomene beobachten,
in denen Wissen und Wissenskonzeptionen
als ordnende Prinzipien eingesetzt werden
und wurden. Dabei manifestiert sich das Wis-
sen auf unterschiedliche Art und Weise in
Wort und Bild. Aus unterschiedlichen Quellen
lässt sich daher häufig direkt oder indirekt ein
gewisser Drang oder Wunsch ablesen, eine
Gesellschaft, einige ihrer Segmente oder gar
die gesamte bekannte Welt zu erfassen, zu
strukturieren und zu ordnen. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich auch die Frage, in-
wieweit der Mittelmeerraum bzw. dessen
Wahrnehmung derartige strukturelle Prozes-
se begünstigt oder beeinflusst.
In den Beiträgen dieses Panels werden derar-
tige Prozesse sowie die Rolle und Bedeutung
von Wissen und Wissenskonzeptionen für die
Schaffung und Wahrnehmung von Ordnun-
gen unter verschiedenen Aspekten und in
unterschiedlichen historischen Epochen be-
trachtet. So beleuchtet Julia Linke die altori-
entalische Vorstellung von Ordnung und
Chaos im Hinblick auf die zentrale Rolle des
Herrschers innerhalb dieses Konzeptes und
untersucht, wie sich dies im philologischen
sowie archäologischen Befund niederschlägt
bzw. fassen lässt. Matthias Hoernes geht in
seinem Beitrag anhand einer Analyse von
Strabons Geographika der Frage nach, in-
wieweit die Barbaren in römischer Zeit in die
von dem antiken Geographen entworfene
gesellschaftlich-zivilisatorische Ordnung ein-
fügen bzw. einfügen lassen. Abschließend
ordnet Arne Franke die gotische Architektur
Zyperns in den Kontext ihrer Entstehungszeit
sowie in die Zeit ihrer Rezeption ein und be-
trachtet diese hinsichtlich eines postulierten
ordnungsstiftenden Sinnes im Hinblick auf
76 | S e i t e
Arne Franke: Ordnung durch Archi-
tektur: Entstehung und Rezeption
gotischer Bauten auf Zypern
Einleitung
Nach der Eroberung Zyperns im Jahr 1191
und der Verstetigung der Kreuzfahrerherr-
schaft wurde die neue Ordnung nicht allein
politisch und militärisch etabliert, sondern
auch kulturell1. Zu den Zeugnissen dieser
Entwicklung gehört heute vor allem die goti-
sche Architektur. Im Folgenden soll Augen-
merk auf drei Zeitabschnitte gelegt werden.
Erstens werden die Entstehungsumstände
gotischer Architektur in der Kreuzfahrerherr-
schaft vor allem in der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts beleuchtet; zweitens die Rezep-
tion dieser Gebäude im ausgehenden 19.
Jahrhundert, als Zypern wieder verstärkt von
europäischen Forschen besucht wurde; und
drittens ist eine heutige Perspektive auf bei-
de Phänomene notwendig, die sie einordnet
und zusammenführt.
Mit Blick auf die Schwerpunkte des Work-
shops und des Panels besteht eine doppelte
Relevanz dieser Fragestellung: Es zeigt sich,
wie durch Architektur beim Bau im Mittelal-
ter und durch die Rezeption in der Neuzeit
Ordnung symbolisiert wurde. Zudem wird
deutlich, wie und aus welchen Quellen Wis-
sen über Architektur weitergegeben und spä-
ter interpretiert wurde.
Befund
1 zur historischen Einordnung: Edbury 1991 sowie
Coureas 1997.
Wir wissen von mehreren hundert zumeist
religiösen oder militärischen Gebäuden, die
wegen des Baustils und durch Technik Objek-
te eines mittelalterlichen Kulturtransfers wa-
ren. Zu den bekanntesten Beispielen gehören
etwa die Nikolauskathedrale in Famagusta,
die Sophienkathedrale in Nikosia und das
Kloster Bellapais. Alle Gebäude setzen einen
klaren Kontrapunkt zu einerseits der traditio-
nellen lokalen und andererseits zur islami-
schen Architektur.
Dieser Stiltransfer nach Zypern fand nicht
voraussetzungslos statt. Er war eine direkte
Folge von Wünschen der politischen und
geistlichen Eliten der Franken. Bei der Suche
nach der Motivation dieser Gruppen wird
bereits die Interpretationsebene beschritten.
Warum wurde nicht auf lokale Architektur
zurückgegriffen? Schließlich war die Mehr-
heit der Bevölkerung und damit potentieller
Bauleute lokaler Herkunft. Schriftliche Quel-
len, die sich mit Baustilentscheidungen aus-
einandersetzen und diese Frage beantworten
könnte, existieren nicht.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert dominierte
daher folgende Interpretation: Während der
Kreuzfahrerherrschaft auf Zypern sei Kunst
des lateinischen Westens gleichsam impor-
tiert worden2. Damit wandten die Forscher
auf der späteren Kronkolonie Zypern auch für
die mittelalterliche Architektur koloniale Er-
klärungsmuster an: Die Bauten des 13. und
14. Jahrhunderts seien Übertragungen euro-
päischer Architektur und damit stilistische
Kopien vor allem aus dem heutigen Frank-
reich oder dem Rheinland, die durch europäi-
sche Bauherren und Architekten immun ge-
genüber Einflüssen lokaler Bauten errichtet
2 vor allem: Enlart 1899
77 | S e i t e
wurden. Diese stilgeschichtliche Analyse ist
bis heute weitgehend unverändert For-
schungsstand geblieben3. Die Interpretation
entstand aber – so meine These – interes-
sensgeleitet: Die Vereinnahmung der fränki-
schen Kunstgeschichte verlief parallel zur
politischen Aneignung des Territoriums der
Insel Zypern im 19. Jahrhundert. Nach jahr-
hundertelanger Herrschaft des osmanischen
Reiches über Zypern war dieser Ansatz auch
mit historischer Legitimation der Verände-
rungen auf Zypern verbunden.
Neuinterpretation
Durch eine Neubewertung der Befunde
kommt man zu anderen Schlussfolgerungen
betreffs der stilistischen Ursprünge und der
politischen Ikonografie. Um dies zu errei-
chen, sind die Mittel der vergleichenden Stil-
analyse mit denen der Quellenkunde zu
kombinieren, um sowohl tatsächliche Ur-
sprünge der Architektur als auch die Motiva-
tion von Bauherren zu identifizieren. Kerner-
gebnisse der zyprischen Gotikforschung stel-
len sich in der Folge als Mythen heraus. Als
Beispiel soll hier die Nikolauskathedrale in
Famagusta herausgegriffen werden4. Diese
im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts errich-
tete Kirche gilt in der Forschung bis heute als
provinzielle Kopie der Kathedrale im französi-
schen Reims, die als Krönungskathedrale der
französischen Könige diente. Die über Zypern
regierenden Lusignans – ein Haus mit Wur-
zeln in Frankreich – habe Anleihen beim fran-
zösischen style rayonnant und der Architek-
turikonografie genommen, um ihre Krö-
nungskathedrale als Könige von Jerusalem
3 etwa: de Vaivre – Plagnieux 2006.
4 Darstellung folgt: Franke 2012
entsprechend zu gestalten. Diese Ergebnisse
können meiner Meinung nach nicht verifiziert
werden. Bei kritischer Lektüre der Quellen
stellt sich heraus, dass das Königshaus als
Auftraggeber mit der Kathedrale in
Famagusta nicht in Verbindung stand. Neben
Bischof und Kapitel der Kathedrale war es vor
allem die Bevölkerung der Stadt, für die ge-
baut wurde. Der Grund lag allein im zu klei-
nen und engen Vorgängerbau. Schließlich
kamen mit dem Fall von Akkon im Jahr 1291
viele Flüchtlinge in die Stadt, wo sie ökono-
misch für einen Aufschwung sorgten. Eine
stilkundliche Analyse stützt die Ablehnung
des Forschungsstandes. Die Kathedrale ge-
hört zwar gewissermaßen zur Sprachfamilie
des style rayonnant, spricht aber mitnichten
einen Reimser oder ikonografisch königlichen
Dialekt. Das typische Register für eine Krö-
nungskathedrale mit Chorumgang und Radi-
alkapellen sowie Querschiff wird nicht gezo-
gen. Auch die Zweiturmfassade, die den For-
schern als speziell Reimserisch gilt, hat als
Vorläufer lediglich den Fassadentypus, nicht
einen speziellen Bau. Tatsächlich wäre die
Nikolauskirche als Krönungskathedrale in
Europa nicht vorstellbar. Ihre Form ist Aus-
schlusskriterium und nicht Argument für ei-
nen Transfer dieses Bautypus nach Zypern.
Der tatsächliche Befund wurde somit vor
mehr als einem Jahrhundert überformt durch
eine akademische Projektion: Eine Krönungs-
kathedrale des Königreiches Jerusalem im
Kreuzfahrerstaat Zypern müsse ein Implantat
europäischer Architektur aus dem kulturellen
Milieu des Kreuzfahrers Ludwig IX. sein.
78 | S e i t e
Revision
Der Grundriss der Nikolauskathedrale hat
seinen Ursprung in den frühen Kathedralkir-
chen des Heiligen Landes. Dort wurde eine
Vielzahl von Bauten mit drei Schiffen und
Polygonalschlüssen errichtet. Möglicherweise
wurde auch die Grundrissform des örtlichen
Vorgängerbaus wieder aufgenommen. Der
Innenraum ist dem entgegengesetzt karg und
stark durch die Mendikatenarchitektur ge-
prägt. Damit kontrastiert er mit dem pracht-
vollen Außenbau, der mit äußerst progressi-
ven Elementen versehen wurde. Unter ihnen
sticht insbesondere das Maßwerk heraus,
dessen Formen möglicherweise durch Bau-
zeichnungen den Weg nach Zypern fanden
und nicht durch reisende Architekten ver-
antwortet worden sein müssen. Bei vielen
Einzelformen des Maßwerkes können Bezüge
etwa zum vor 1300 entstandenen Riss F der
Kölner Dombauhütte gezogen werden. Zu-
sammengefasst weist die Nikolauskathedrale
genauso wenig auf eine Einzelquelle hin wie
sie die Funktion einer Krönungskathedrale
hatte. Stattdessen waren die stilistischen
Ursprünge vielschichtig und setzten sich ad-
ditiv zusammen. Der Neubau selbst wurde in
erster Linie wegen der zahlreich gewordenen
Stadtgesellschaft notwendig.
Was für die Nikolauskathedrale gilt, ist auf
die zyprische Gotik übertragbar. Im Laufe der
Kreuzfahrerherrschaft kam es zu einer Amal-
gamierung von Motiven zentraleuropäischen
Ursprungs mit den erwachsenden fränki-
schen Architekturtraditionen. Die Stilformen
können nicht mit einem statischen Denken
und Abhängigkeitsverhältnissen von Zentrum
und Peripherie erklärt werden. Es gab viel-
mehr eine prozesshafte, hybride Wechsel-
wirkung zwischen Zypern und anderen Regi-
onen. Wenn man sich darüber hinaus nicht
auf herausragende Baufunktionen be-
schränkt, sondern zyprische Architektur in
ihrer Breite betrachtet, werden noch mehr
Differenzierungen offenbar. Während in der
Handelsstadt Famagusta die Kathedrale und
verwandte Bauten entstanden, werden or-
thodoxe Kirchen auf Zypern selbstverständ-
lich wie altbekannt errichtet. Diese hybride
Kultur verstärkt sich zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts weiter: Ein halbes Jahrhundert nach
dem Bau der Nikolauskathedrale werden
sogar bei der Errichtung der orthodoxen Ka-
thedrale von Famagusta architektonische
Elemente des lateinischen Westens rezipiert.
Das Ordnende von Architektur – respektive
das Ansinnen, Herrscher und Beherrschte
auch architektonisch zu trennen – löst sich
somit auf.
Ordnung und Chaos
Bezogen auf das Leitthema der Konferenz
bedeutet dies: Es gab in der Kreuzfahrerherr-
schaft Zypern den Willen, Ordnung durch
Architektur zu symbolisieren. Die herrschaft-
liche Aneignung von Raum hatte sowohl Ein-
fluss auf den Bau als auch auf die spätere
Interpretation gotischer Architektur. Sie dient
als Machtzeichen, ordnendes Element und
als Legitimation von Herrschaft. Die Thesen
der frühen Forschung gingen aber zu weit: Es
gab ni t die Alternative zwis en C aos’
durch eine lokale Bauweise und der Verkör-
perung neuer Ordnung’ dur europäis e
Architektur. Es kann der Schluss gezogen
werden, dass künstlerisch kein absolutes Ab-
hängigkeitsverhältnis in Richtung des lateini-
schen Westens bestand. Vielmehr hatte sich
spätestens zu Beginn des 14. Jahrhunderts
79 | S e i t e
eine selbstbewusste Kreuzfahrergesellschaft
etabliert, die sich nicht kolonial an das fran-
zösische Königtum, das Reich, oberitalieni-
sche Handelsstädte oder das Papsttum ge-
bunden fühlte. Sie hatte bereits ihre eigenen
Traditionen. Die eigene Identität und die In-
tegration von unterschiedlichen Gruppen in
die Kreuzfahrerherrschaften – und damit
soziale, ökonomische und kulturelle Vielfalt –
spiegelt sich auch in der Architektur wider.
Literatur
N. Coureas, The Latin Church in Cyprus.
1195–1312 (Aldershot 1997).
P. W. Edbury, The Kingdom of Cyprus and the
Crusades. 1191–1374 (Cambridge 1991).
C. Enlart L’art got ique et la renaissance en
Chypre 1–2 (Paris 1899).
A. Franke, St Nicholas in Famagusta: A new
Approach to the Dating, Chronology and
Sources of Architectural Language, in: N.
Coureas – P. Edbury – M. Walsh (Hrsg.), Me-
dieval and Renaissance Famagusta (Aldershot
2012) 75–91.
J.-B. de Vaivre – P. Plagnieux ( rsg.) L’ art
gothique en Chypre (Paris 2006).
80 | S e i t e
Matt ia oerne : eine arbaren
me r a t on R mer. Kulturelle
Formierungsprozesse und zivilisato-
rische Ordnung in Strabons
Geographika
‚Ordnung‘ und ‚C aos‘ sind Denkkategorien
die einer Deutungshoheit bedürfen. Infolge-
dessen ist ihre Bestimmung und bedeutungs-
volle Aufladung stark an den Kontext jener
Akteure und Kollektive gebunden, in deren
Weltbild sie als mehr oder weniger stark aus-
geprägte Argumentationsfiguren und diskur-
sive Parameter fungieren, die Realitäten
strukturieren und an and derer ‚Weltord-
nungen‘ als sol e erst ausver andelt und
positiv wie negativ bestimmt werden können.
In diesem Sinn implizieren ‚Ordnung‘ und
‚C aos‘ normative Ma t und legitimieren
umgekehrt Machtstellungen, wo Ordnung im
Sinn der je spezifischen Weltanschauung ge-
schaffen und Chaos vertrieben wird. Damit
stellen sie für die Geschichte des europäi-
schen Kolonialismus keine bloßen Analyseka-
tegorien der modernen Forschung, sondern
wesentliche Argumentationsmuster der Eli-
ten des späten 18. und 19. Jahrhunderts dar.
Sie verdi ten si in der ‚mission
ivilisatri e‘ oder ‚ ivilizing mission‘ wie sie
etwa das British Empire oder die Dritte Fran-
zösische Republik basierend auf einem euro-
päischen Überlegenheitsanspruch gegenüber
den ‚no ni t Zivilisierten‘ und einem es-
ten Glauben an historischen Fortschritt pro-
pagierten. Zivilisierungsmissionen – in voller
Ausformung jene des viktorianischen Groß-
britannien – konstruieren eine „Stu enleiter
kultureller Wertigkeiten“ ein graduell abge-
stuftes Zivilisationsspektrum, innerhalb des-
sen ‚Völker‘ Nationen und ollektive in un-
terschiedlichem Ausmaß an einem globalhis-
torisch gedachten Fortschritt Anteil haben.
Aus seiner Position als ‚ ö erste endem‘
leitet der Zivilisator die moralische oder his-
torische Pflicht ab, diese Kollektive, jedenfalls
aber deren Eliten, an eine höhere Stufe zivili-
satorischer Ordnung heranzuführen und auf
diese zu ‚er eben‘.
Im Kontext ihrer Zeit und durchaus mit expli-
zitem Bezug auf den hier umrissenen geistes-
geschichtlichen Hintergrund meinte die Alter-
tumswissenschaft des fortgeschrittenen 19.
Jahrhunderts mit dem Konzept der Romani-
sierung ein zwar nicht deckungsgleiches, al-
lerdings doch dem kulturmissionarischen
Eifer Europas verwandtes Phänomen in der
römischen Antike gefunden zu haben. An-
hand dieses Modells wollten Theodor
Mommsen, Francis Haverfield und ihre Zeit-
genossen die Durchdringung der Provinzen
mit römischen Gebrauchsgütern und Kera-
mik, Architektur und Städtebau, der lateini-
schen Sprache, Mustern soziopolitischer Or-
ganisation sowie Gesetzen, Normen und
Werten neu erklären. Die römische Kultur
erschien dabei als monolithische Einheit, de-
ren Träger sie von Rom und Italien ausge-
hend in das Reich zu den passiv rezipieren-
den provinzialen Populationen trugen und
diese dadurch zivilisierten. Die moderne Al-
tertumswissenschaft hat – insbesondere im
Zuge der postcolonial studies – die Brauch-
barkeit dieser Analysekategorien und der
zugrunde liegenden Modelle ab den 1960er
Jahren kritisch hinterfragt. Deutlich hat sie
gesehen, wie stark es von der jeweiligen Ge-
genwart und zeitgenössischen Geisteswelt
überformt ist und an das zivilisatorischen
Überlegenheitsgefühl der europäischen Ko-
lonialmächte des 19. Jahrhunderts anknüpft,
mit dem diese Kultur, Bildung, Ordnung und
81 | S e i t e
materielle Errungenschaften in die koloniale
Welt zu tragen meinten und dies als ihre
welthistorische Aufgabe proklamierten. Hat-
ten Mommsen und Haverfield den Zivilisie-
rungsbegriff noch gebraucht, um auf einer
analytisch-etischen Ebene die Verwirklichung
einer historischen Aufgabe und einen als re-
alhistorisch verstandenen Prozess zu be-
zeichnen, verwendet die moderne Alter-
tumswissenschaft diesen in der Folge zur
emischen Charakterisierung eines römischen
Selbstverständnisses.
Obwohl das Romanisierungsmodell des 19.
Jahrhunderts, in dem die Vorstellung des
‚zivilisierenden Römers‘ wissens a ts isto-
risch situiert ist, längst dekonstruiert und
diskreditiert ist, hat sich die Auffassung, kul-
turmissionarische Unterfütterungen hätten
der Rechtfertigung der römischen Herrschaft
im Speziellen, aber auch jener imperialer
Herrschaftsgebilde im Allgemeinen gedient,
zu einem selten reflektierten Gemeinplatz
verfestigt. Eine fruchtbare Forschungsdiskus-
sion über die Frage, ob sich aus den wenigen
einschlägigen Zeugnissen tatsächlich ein fast
zeitlosen Prinzip römischer Herrschaft destil-
lieren lässt, hat sich jedoch ausschließlich in
der britischen Altertumswissenschaft ent-
facht. So kontrovers diese Debatte auch ge-
führt wird, so eint sie doch ein ausgeprägtes
methodisches Bewusstsein und das Bemü-
hen, sich von älteren Romanisierungsvorstel-
lungen sowie insbesondere von imperialisti-
schen Überlagerungen der Neuzeit zu lösen.
Das hier vorgestellte Vorhaben nimmt es sich
zum Ziel, diese abseits der britischen For-
schung wenig beachtete Debatte samt ihrer
methodisch-theoretischen Problematik neu
aufzurollen. Ausgehend von strukturellen
Merkmalen neuzeitlicher Zivilisierungsmissi-
onen möchte ich die zur Verfügung stehen-
den Quellen daraufhin analysieren, inwieweit
ausgewählte lateinische und griechische Au-
toren der Kaiserzeit bis Spätantike Konzepte
von Zivilisation und Zivilisierung entwickeln
und diese als Triebfeder, aber auch als Legi-
timation für den Aufstieg des imperium
Romanum zu einem Weltreich verstehen.
Breiter gefasst gilt es zu beleuchten, wie vor-
ne mli literaris e Quellen kulturelle
Trans orma onsprozesse in den
provinzialisierten Gebieten unter römis er
Herrschaft wahrnehmen und diese im Span-
nungsfeld von topischer Beschreibung und
faktischem Anspruch bewerten.
In seltener Deutlichkeit und mehrfacher Hin-
sicht finden sich die – hier primär kulturell
verstandenen – Deutungsmuster ‚Ordnung‘
und ‚C aos‘ im kulturgeograp is en Werk
Strabons. Anhand von Fallbeispielen aus dem
westlichen Mittelmeerraum lotet der griechi-
sche Geograph und Historiker augusteischer
Zeit wiederholt aus, welche kulturellen Trans-
formationsprozesse sich in den neu erober-
ten Regionen unter römischer Herrschaft
vollzogen haben und – auf einer Metaebene
– was zivilisatorische Ordnung als solche
ausmacht. So versteht Strabon etwa das Gal-
lien seiner Zeit primär aus römischen Einflüs-
sen heraus, denen es die Entfaltung seines
Potenzials in Gestalt geordneter Gemeinwe-
sen, moralischer Standards und wirtschaftli-
cher Blüte verdanke. Die römische Herrschaft
habe in Gallien barbarischen Sitten ein Ende
gesetzt die den Normen „bei uns“ zuwider-
laufen, darunter der Gepflogenheit, Gegnern
im Kampf den Kopf abzuschneiden und die-
sen an den Türpfosten des eigenen Hauses zu
nageln, die Schädel bekannter Persönlichkei-
ten einzubalsamieren oder Menschenopfer
82 | S e i t e
darzubringen1. Infolgedessen hätten die krie-
gerischen Gallier ihre Waffen niedergelegt,
lokale Konflikte zwischen einzelnen Stämmen
beendet und sich fortan der Landwirtschaft
gewidmet2.
Aber auch manche der Bevölkerungsgruppen
auf der Iberischen Halbinsel, allen voran die
Turdetaner am aetis seien „ganz zu dem
Lebensstil der Römer übergegangen und be-
wahren nicht einmal mehr eine Erinnerung
an die eigene Sprache: Ferner sind die meis-
ten Latiner geworden und haben römische
Siedler bekommen, sodass nur noch wenig
daran fehlt, dass sie sämtlich Römer sind;
auch die neuerdings zusammengesiedelten
Städte, Pax Augusta bei den Keltikern, Augus-
ta Emerita bei den Turdulern und
Caesaraugusta im Gebiet der Keltiberer und
einige andere Siedlungen, illustrieren den
Umschwung besagter Gemeinwesen; so wer-
den denn auch alle Iberer, die zu dieser Kate-
gorie gehören, togati genannt (darunter sind
auch die Keltiberer, die ehedem als die wil-
desten von allen galten)“3. Eine ‚Romanisie-
rung‘ wie im Fall der Turdetaner s reibt
Strabon den gallis en Cavaren zu denn „der
Name ‚Cavaren‘ ist der errs ende und
man nennt jetzt allmählich alle dortigen Bar-
baren so, die auch gar keine Barbaren mehr
sind, sondern zum größten Teil den Stil der
Römer sowohl in der Sprache als auch in der
Lebensweise, manche auch in der Ordnung
der Gemeinwesen übernommen aben“4.
Dagegen kennzeichnen das vorrömische Gal-
lien interne und externe Konflikte, ein ausge-
prägtes Kriegertum sowie Jagd und Viehhal-
tung als Subsistenzform, eine mangelnde
1 Strab. 4,4,5 p. 197f. C.
2 Strab. 4,1,2 p. 178 C; 4,3,2 p. 192 C.
3 Strab. 3,2,15 p. 151 C; Übersetzung nach Stefan Radt.
4 Strab. 4,1,12 p. 186 C.
Ausformung soziopolitischer Organisation,
zerstreutes Siedeln sowie Isolation und feh-
lender ontakt sowo l inner alb eines ‚Vol-
kes‘ als au zu anderen ‚Völkern‘.
Diese vorrömis e und ‚präzivilisatoris e‘
Zeit kontrastiert Strabon – einem kaum vari-
ierten narrativen Muster folgend – mit dem
Wandel in der Folge der römischen Erobe-
rung. Wo die naturräumlichen Gegebenhei-
ten die Errungenschaften der Zivilisation bis-
her verhindert hatten, verhalfen nach
Strabons Geschichtsnarrativ die Römer ei-
nem stabilen Frieden, friedlichem Ackerbau,
der vernünftigen Nutzung natürlicher Res-
sourcen und wirtschaftlicher Prosperität zum
Durchbruch und etablierten ausdifferenzierte
soziopolitische Gemeinwesen sowie urbane,
in das vernetzte Reichsganze eingebundene
Zentren. Ein solcher Gegensatz zwischen Zivi-
lisierten und Unzivilisierten dient Strabon
neben dem traditionellen Barbarendiskurs
und der ethnischen Zuweisung auf der
Grundlage sprachlicher Zugehörigkeit als ein
drittes Raster zur ordnenden Beschreibung
der bewohnten Welt. Dieser Kontrast mani-
festiert sich in distinkten Merkmalen zivili-
sierter bzw. unzivilisierter Lebensform. An-
hand derer entwirft Strabon für den westli-
chen Mittelmeerraum eine kulturelle Matrix
zwischen den Polen von Unordnung und Sta-
bilität, Barbarei und Zivilisation. In das Ext-
reme gewandt grenzen sich so die bewohnte
Welt, deren Ränder mit jenen des imperium
Romanum zusammenfallen, und die unbe-
wohnten oder von Nomadismus und Piraterie
beherrschten Gebiete jenseits ihrer Grenzen
voneinander ab. Der Gradient zwischen zivili-
satorischer Ordnung und chaotischer Wild-
heit bestimmt zugleich die narrative Raumor-
ganisation und die Disposition des Stoffes in
den Geographika. In seiner wegweisenden
83 | S e i t e
Studie hat bereits Patrick Thollard eingehend
gezeigt, dass Strabon die Behandlung eines
Großraums bei jenen Regionen aufnimmt, die
ihm wie etwa die urbanen Zentren an den
Küsten als zivilisiert erscheinen, und zu Ge-
genden geringeren Zivilisationsgrades fort-
schreitet, mithin den geographischen Raum
abhängig von der Kulturgeographie und be-
dingt durch sein Zivilisationsverständnis be-
schreibt.
Ausgehend von jenen Fallbeispielen, in denen
wie unter einem Vergrößerungsglas der kul-
turelle Wandel in der Westhälfte des römisch
dominierten Mittelmeerraums exemplifiziert
wird, lässt sich Strabons Einschätzung des
zivilisatorischen Einflusses der römischen
Herrschaft herausarbeiten und in den Rah-
men seines Zivilisationskonzepts stellen. Da-
bei lassen sich in den Geographika unter-
schiedliche Schichten des Zivilisationsver-
ständnisses trennen, die teils kulturell, teils
ethnisch fundiert sind und letztlich nicht mit-
einander harmonisiert werden können. In
diesem Spannungsfeld nicht kohärenter Zivi-
lisationsauffassungen konzeptualisiert
Strabon P änomene von ‚barbaris em‘
C aos und ‚zivilisatoris er‘ Ordnung als Pole
eines kulturellen Kontinuums, an dem der
westliche Mittelmeerraum – diachron und
synchron – in unterschiedlichem Maß Anteil
hat. Die unterschiedlichen Ebenen des Zivili-
sationsverständnisses Strabons sind damit
allenfalls angedeutet. Exemplarisch zeigen sie
jedo au wie das Gegensatzpaar ‚Ordnung‘
und ‚C aos‘ als analytis es Instrument ge-
winnbringend angewendet, aber auch histo-
rischen und kulturwissenschaftlichen Fallana-
lysen unterzogen werden kann, um Diskurse
zu beleuchten, die Realität und Geschichts-
narrative erzeugen und strukturieren.
Literatur
E. Almagor, Who is a Barbarian? The Barbari-
ans in the Ethnological and Cultural Taxono-
mies of Strabo, in: D. Dueck – H. Lindsay – S.
Pot e ary ( rsg.) Strabo’s Cultural Geogra-
phy. The Making of a Kolossourgia (Cam-
bridge 2005) 42–55.
D. Dueck, Strabo of Amasia. A Greek Man of
Letters in Augustan Rome (London 2000).
M. Gehler - R. Rollinger (Hrsg.), Imperien und
Reiche in der Weltgeschichte.
Epochenübergreifende und globalhistorische
Vergleiche (Wiesbaden 2013; im Druck)
R. Hingley, Globalizing Roman Culture. Unity,
Diversity and Empire (London 2005).
D. J. Mattingly, Imperialism, Power, and Iden-
tity. Experiencing the Roman Empire (Prince-
ton 2011).
J. Oster ammel „T e Great Work o Upli ting
Mankind“. Zivilisierungsmission und Moder-
ne, in: B. Barth – J. Osterhammel (Hrsg.), Zivi-
lisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesse-
rung seit dem 18. Jahrhundert, Historische
Kulturwissenschaft 6 (Konstanz 2005) 363–
425.
P. Thollard, Barbarie et civilisation chez
Strabon. Étude critique des livres III et IV de
la Géographie, Centre de Recherches
d’ istoire An ienne 77 = Annales littéraires
de l’Université de esançon 365 (Paris 1987).
E. C. L. van der Vliet, The Romans and Us.
Strabo’s Geograp y and t e Constru tion o
Ethnicity, Mnemosyne 56, 2003, 257–272.
84 | S e i t e
E. C. L. van der Vliet L’et nograp ie de
Strabon: idéologie ou tradition?, in: F.
Prontera (Hrsg.), Strabone. Contributi allo
studio della personalità e dell’opera 1 (Peru-
gia 1984) 27–86.
G. Woolf, Becoming Roman. The Origins of
Provincial Civilization in Gaul (Cambridge
1998).
85 | S e i t e
Julia Linke: Der König als Hüter der
Ordnung und Bezwinger des Chaos -
Mythologische Hintergründe des alt-
orientalischen Konzeptes von König-
tum und deren Auswirkungen im ar-
chäologischen und philologischen
Befund
In folgendem Beitrag geht es um die mytho-
logis en Aspekte des Ideenspektrums „Ord-
nung und C aos“ wel e Rolle es ür die ö-
nigsideologie des Alten Orients spielt und wie
dieses spezielle Konzept von Königtum im
archäologischen und philologischen Befund
des neuassyrischen Reiches in der ersten
Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. wiederzu-
finden ist. Dabei entfernen wir uns lokal zu-
nächst vom Mittelmeer bzw. vom mesopo-
tamis en Standpunkt aus dem „Oberen
Meer“ (tamtu elitu).
Konkret zu fassen ist der Gegensatz zwischen
Ordnung und Chaos v.a. im mesopotami-
schen Weltbild. Um dieses zu erläutern be-
ziehe ich mich auf die Mythen des Alten Ori-
ent. Obwohl zu verschiedenen Zeitpunkten
verschriftlicht, handelt es sich bei den für
diesen Beitrag herangezogenen Mythen um
lange tradierte – wir sprechen z.T. von über
tausend Jahren. Dabei beschränke ich mich in
diesem Rahmen auf diejenigen Inhalte der
Mythen, die im Zusammenhang zu den Be-
gri en „Ordnung“ und „C aos“ sowie zu der
Konzeption von Königtum stehen
Die Schöpfung
Zunächst möchte ich aber ganz von vorne
beginnen, mit der Schöpfung. Nach dem so
genannten „großen mesopotamis en
S öp ungsmyt os“1 enūma eliš existierte
vor der Schöpfung der Welt nur der männli-
che Apsu, die große Wassermasse, und die
weibliche Gottheit Tiamat, das Meer. Durch
das Vermischen ihrer Wasser entstanden
weitere Gottheiten, die selbst wiederum Göt-
ter zeugten. Der Lärm dieser jungen Götter
störte nun aber Apsu und er beschloss, die
jungen Götter zu vernichten. Im darauffol-
genden Kampf wurde Apsu getötet, und
Tiamat erschuf eine Schar von Ungeheuern
und unterstellte sie Kingu, ihrem neuen Ge-
fährten. Niemand konnte etwas gegen Kingu
und seine Ungeheuer ausrichten bis einer der
jüngsten Götter auf, namens Marduk, auf-
tauchte und anbot, gegen Kingu und Tiamat
zu kämpfen. Sollte er Erfolg haben, verlangte
er aber von den Göttern, dass sie ihn zu ih-
rem König machen, worauf die Götter sich
schließlich einließen. Daraufhin statteten sie
den jungen Gott aus: „Sie ügten i m die eu-
le, den Thron und den Stab zu, sie gaben ihm
die unwiderstehliche Waffe, die den Feind
überwältigt.“2 So ausgerüstet zog Marduk
gegen Tiamat und ihre Ungeheuer, tötete sie
mit P eil und ogen und „seiner großen Waf-
e“ der Sturm lut. Na diesem Sieg er oben
die Götter Marduk wie versprochen zu ihrem
önig. Als önig der Götter sollte er nun „die
Menschen, seine Geschöpfe, als Hirte leiten...
und auf Erden das Gleiche tun, was er im
immel getan at.“3 Darauffolgend formte
1 Schöpfungsmythos ist insofern ein falscher Ausdruck,
als dass der Mythos eigentlich den Aufstieg Marduks zum höchsten Gott des Pantheons erklärt, und die Schöpfung eher am Rande vorkommt. 2 Taf. IV Z. 29 f., Übersetzung nach Lambert 1994.
3 Taf. VI Z. 112, Übersetzung nach Lambert 1994.
86 | S e i t e
Marduk die Welt und schuf den Menschen.
Damit ist im enūma eliš die Schöpfung abge-
schlossen, aber andere mesopotamische My-
then schließen daran an bzw. erläutern Teile
dieser Schöpfung ausführlicher.
Wenn wir nun von der göttlichen Ebene weg
und hin zu den Menschen gehen, so ist der
entscheidende Schritt in deren Geschichte,
der auch ihr Verhältnis zu den Göttern maß-
geblich bestimmt, die Schaffung der eigenen
menschlichen Kultur und Ordnung, in Ab-
grenzung zu der vor-zivilisatorischen Welt
und dem dort herrschenden Chaos. Dabei ist
die Stadt quasi Grundvoraussetzung des me-
sopotamischen Lebens, und wird demzufolge
schon in der Urzeit von den Göttern selbst
erschaffen. An Hand eines sumerischen
S öp ungstextes der sogenannten „Genesis
von Eridu“ wird die S öp ung der Städte
nachvollziehbar: Die Göttin Nintu macht dem
Nomadenleben der Menschen durch die
Gründung von Städten ein Ende. Der Exis-
tenzgrund der Städte ist die Besorgung des
Kultes der Götter; die Durchführung ihres
Willens, also die Schaffung einer Ordnung,
die die überirdische Ordnung der Götter auf
Erden wiederspiegelt
Was bei der Schöpfung aber noch fehlt, ist
die Ordnung-schaffende Instanz, als Vermitt-
ler zwischen Göttern und Menschen: das
Königtum. Der König vermittelt die Aufgaben
der Menschen in der göttlichen Weltord-
nung, er leitet den Kult an und organisiert
den Dienst an den Göttern. Wie der König
bestimmt wird, ist z.B. in der altbabyloni-
schen Version des Etana-Mythos überliefert:
„Den önig atten sie (no ) ni t eingesetzt
unter allen zahlreichen Menschen; daher war
keine Tiara, keine Kopfbinde (= Krone) gekno-
tet, und kein Szepter war mit Lapis besetzt.
Die Heiligtümer waren sämtlich noch nicht
erbaut, (und) die siebenfachen Tore waren
gegen die Mächtigen verriegelt. Szepter,
Kopfbinde, Tiara und Hirtenstab waren vor
Anu im Himmel niedergelegt. Da es keinen
Besonnenen ihres Volkes gab, stieg ┌die Her-
rin (?)┐ vom immel erab [… …] su te ┌Ištar (?)┐ ┌einen König (?).┐“4
Die Etablierung des irdischen Königtums bil-
det den Abschluss der Welt-, Menschheits-
und Kulturschöpfung der Götter in Mesopo-
tamien.
Der Ursprung des altorientalischen König-
tums
In der mesopotamischen Vorstellung ist das
Königtum eines der ME; es wird vom Gott Ea
in seiner Wohnstatt aufbewahrt. Die ME sind
nach Brigitte Groneberg5 die „Summe der
Zivilisation“ Gaben und egabungen die die
Götter den Menschen geben. Nach dem Text
der so genannten Sumerischen Königsliste
kommt das Königtum von den Göttern auf
die Erde, und zwar einmal vor, und dann ein
zweites Mal nach der Flut. Dabei wird in der
Sumerischen Königsliste eine realpolitische
Dynamik rekonstruiert, in der das Königtum
jeweils von einer Stadt zur nä sten „getra-
gen“ wird bzw. mit Wa engewalt errungen
wird. Hier ist wichtig zu beachten, dass die
Sumerische Königsliste ein ideologischer Text
ist, der Mesopotamien als ein von Anfang an
unter nur einem König stehendes Reich ver-
standen haben will, wo nur ein einziges Kö- 4 Z. 6 ff., Übersetzung nach Haul 2000.
5 Groneberg 2004, 140.
87 | S e i t e
nigtum existiert – das widerspricht der histo-
rischen Realität. Trotzdem ist der Text inso-
fern aufschlussreich für das Verständnis des
Konzeptes des mesopotamischen Königtums,
als dass deutlich wird, dass die einzelnen
Herrscher eine zeitliche Inkarnation in einer
ewigen Funktion sind, d.h. dass das Herr-
schen dem Ausüben einer Rolle entspricht.
Ein akkadischer Mythos6 berichtet darüber
hinaus von der Schaffung des Königs als Per-
son.
Nach der Schöpfung der Menschen spricht
der Gott Ea zur Muttergott eit ēlet-ilī:
„bilde nun den önig den überlegend-
entscheidenden Menschen. Mit Gutem um-
hülle seine ganze Gestalt, gestalte seine Züge
armonis ma e s ön seinen Leib!“7
Daraufhin geben einige Götter dem König
ihre Attribute:
„Anu gab i m seine rone Enlil ga[b i m sei-
nen Thron], Nergal gab ihm seine Waffen,
Ninurta g[ab ihm seinen Schreckensglanz],
elēt-ilī gab i m [i r!? s önes Ausse en].“8
Dieser Übergabe-Ritus erinnert an die oben
zitierte Übergabe von Waffen etc. an Marduk
im enūma eliš, der damit die böse Gottheit
Tiamat, die das Chaos der Welt vor der
Schöpfung symbolisiert, bekämpfen soll. Hier
wird das Motiv des Gottes, der das Chaos
6 Vorderasiatisches Museum Berlin. Vorderasiatische
Abteilung. Tontafeln (VAT) 17019. 7 VAT 17019, Z. 33` ff., Übersetzung nach Mayer 1987.
8 VAT 17019, Z. 37´ ff.
bekämpft9 und deswegen von den anderen
Göttern zu ihrem König erhoben wird, über-
tragen auf den menschlichen König.
Der König als Bewahrer der Ordnung: Der
Hirte
Der König ist nach dieser Konzeption von
Königtum, wie wir sie in altorientalischen
Mythen fassen können, also von den Göttern
als Ordnung-schaffende Instanz eingesetzt, er
soll – auch mit Waffengewalt – gegen die
chaotischen Mächte kämpfen und Sorge tra-
gen für die Menschen und den Kult. Letzteres
beinhaltet die Aufrechterhaltung der irdi-
schen und kosmischen Ordnung. Dies er-
reicht der Herrscher durch zivile Maßnahmen
wie Rechtsprechung, durch die Bereitstellung
einer Infrastruktur, durch Bautätigkeit sowie
durch seine Rolle als Spitze des Verwaltungs-
apparates, kurz: durch seine Politik. Eine Rol-
le spielt bei der Idee der Fürsorge für seine
Untertanen die Konzeption des Königs als
„ irte“ seines Volkes wie sie u.a. im enūma
eliš für Marduk sowie im Etana-Epos explizit
formuliert wird.
Wie der Hirte seine Herde soll der König sei-
ne Untertanen führen, beschützen, ernähren
usw.
So sind Epitheta und Beinamen mit den Be-
griffen SIPAD bzw. rē’u also „ irte“ für alt-
orientalische Herrscher gebräuchlich. Die
durch den Hirtenbegriff veranschaulichte
9 Das Motiv des Gottes, der das Chaos bekämpft und
deswegen von den anderen Göttern zu ihrem König
erhoben wird, ist ursprünglich aus der Ninurta-
Theologie entlehnt.
88 | S e i t e
pastorale Macht impliziert gute bzw. wohltä-
tige Absichten, sie schützt und beschützt die
Bevölkerung - wenn auch nicht unbedingt
uneigennützig. Dieser Hirtenaspekt des Kö-
nigs zeichnet nach Michel Foucault10 prinzipi-
ell eine Herrschaft aus, die auf Menschen
ausgelegt ist, entsprechend dem Verhältnis
der Menschen zu Gott, das ebenso als Herde-
Hirten-Beziehung zu verstehen ist. Auch hier
liegt also die Idee zu Grunde, dass die irdi-
sche Welt die Welt der Götter und deren
Ordnung wiederspiegeln soll.
Der König als Bezwinger des Chaos in der
neuassyrischen Kriegspropaganda
Im komplementären Zusammenhang mit der
Schaffung von Ordnung steht die Abwehr des
Chaos durch den König. Um die Ordnung im
Inneren zu bewahren, muss der König sein
Land vor dem Außen, in dem Chaos herrscht,
schützen. Dieses Konzept von Königtum und
dem König als Hüter der Ordnung und Be-
zwinger des Chaos wird deutlich in der neu-
assyrischen Königsideologie. Deren Grundla-
ge bildet ein zweigeteiltes Verständnis der
Welt:
10
„Dass der önig der Gott das Ober aupt im Ver-hältnis zu den Menschen ein Hirte [berger] ist, wäh-rend die Menschen gleichsam seine Herde sind, ist ein Thema, das sich sehr häufig im gesamten mediterra-nen Orient findet. [...] Das Pastorat ist ein grundlegen-der Verhältnistypus zwischen Gott und den Menschen, und der König hat gewissermaßen teil an dieser pasto-ralen Struktur des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen. [...] Es ist eine Macht religiösen Typs, die ihren Ursprung, ihre Grundlage, ihre Vollendung in der Macht hat, die Gott auf sein Volk ausübt. [...] Die Macht des Hirten ist eine Macht, die nicht auf ein Territorium ausgeübt wird, sondern eine Macht, die per de initionem au eine erde ausgeübt wird […].” Vorlesung 5, Sitzung vom 8. Februar 1978, in: Sennelart 2004, 185 ff.
Es gibt auf der einen Seite Assyrien und die
von ihm abhängigen bzw. ihm unterworfenen
Länder, auf der anderen Seite „die Anderen“
die Nicht-Assyrer. Alles nicht-Assyrische wird
als Chaos verstanden, das es zu bekämpfen
gilt, um auch die Ordnung in Assyrien selbst
zu erhalten. Die Stadt und später das Reich
Assur sind formal eine Theokratie, in der der
Gott Assur als König herrscht und einen irdi-
schen Obmann als Stellvertreter und Reprä-
sentanten bestimmt: den König. Der assyri-
sche König herrscht nicht nur im Auftrag
Assurs, sondern er ist auch Garant der Welt-
ordnung und wehrt das Chaos durch adäqua-
tes Verhalten den Göttern und Menschen
gegenüber ab. Ideologisch wird das Chaos in
dem Moment zur Ordnung, wo das feindliche
Land Assyrien einverleibt wird.11
Da der König diese Ordnung schaffen soll,
begründet dieses Konzept die stark expansive
Auslegung des assyrischen Reiches. So sind
die militärischen Aktionen des Königs ein
Ausdruck seiner ideologischen Verantwor-
tung, das Chaos der Fremdländer in die Ord-
nung des Reiches zu überführen.
Diese Konzeption von Königtum zeigt sich z.B.
an der Schilderung Asarhaddons von seinem
Feldzug nach Ägypten:
„I wurde wütend wie ein Löwe zog den
Panzer an, setzte den Helm, das was zu einer
Kampfausrüstung gehört, auf mein Haupt
und fasste mit meiner Hand den mächtigen
Bogen und den starken Pfeil, die Assur, der
König der Götter, mir verliehen hatte. Wie
ein wütender Adler, mit ausgebreiteten
Schwingen, ging ich wie eine Sintflut an der
Spitze meines Heeres einher. Der schonungs-
11
vgl. Liverani 1979.
89 | S e i t e
lose Pfeil des Assur sauste zornig und wütend
ort... ŠÁR-UR4 (die gesamte Potenz: Nieder-
ma en) und ŠÁR-GAZ (die gesamte Potenz:
Töten) gingen vor mir er.“12
Das Motiv des önigs als „Sint lut“ nimmt
dabei wiederum Bezug auf den bereits er-
wähnten Schöpfungsepos enūma eliš, wo der
Gott Marduk mit Hilfe der Flut die böse Ur-
Gottheit Tiamat besiegt.
Es lässt sich festhalten, dass durch die von
den Göttern übertragene Aufgabe des Si-
cherns und Wiederherstellens der göttlichen
Ordnung auf Erden militärische Aktionen ide-
ologisch gerechtfertigt und begründet sind.
Na der Eroberung des „ remden Landes“
erfolgt dessen Überführung in die Ordnung
des neuassyrischen Reiches. Das geschieht
durch Prozesse der Vereinigung und Assimi-
lierung der Bevölkerung, wozu auch die von
den Assyrern betriebenen Deportationen zu
zählen sind. So werden in den neuen Provin-
zen die sprachliche und die gesetzliche Ver-
einheitlichung nach der Eroberung eingelei-
tet und das assyrische Verwaltungsmuster
verbreitet sich.
Der König als Erhalter der Ordnung – Bautä-
tigkeit
Auch die Kultivierung der neuen Provinzen,
der Bau von Bewässerungsanlagen und all-
gemeine Bauprogramme in den neuen Ge-
bieten spielen in diesem Zusammenhang eine
Rolle. Königliche Bauprojekte können im Zu-
sammenhang mit dem Ordnen der Welt ge-
sehen werden, denn der Bautätigkeit des
12
Borger 1956, Nin. E, Kol. II, 6–13.
Königs liegt sein göttlicher Auftrag zum
Schaffen, Verwalten und Sichern der irdi-
schen Ordnung zu Grunde.
Vollendete Bauprojekte zeigen die Fähigkeit
des Königs, seiner ihm von den Göttern ge-
gebenen Aufgabe nachzukommen, die Welt
zu ordnen; sie sind ein sichtbarer Marker
seiner Tüchtigkeit und Pflichterfüllung. Be-
wässerungsprojekte schaffen dabei die Vo-
raussetzung für die Versorgung der Bevölke-
rung. Durch sie kommt der König seinem
göttlichen Auftrag nach, sich um die Men-
schen zu kümmern. Kanäle dienen nicht al-
lein der Bewässerung, sondern können darü-
ber hinaus für die Schifffahrt genutzt werden,
d.h. sie sind ebenso wie Straßen, deren Anle-
gen in den Inschriften in der Regel allerdings
nicht auftaucht, Teil der Infrastruktur, die
den Handel erleichtert und die Versorgung
mit Rohstoffen und Gütern aller Art verbes-
sert bzw. erst ermöglicht. Die Infrastruktur
erscheint zentral im Hinblick auf den Ord-
nungs-schaffenden Auftrag des Herrschers.
Im „ aotis en“ „wilden“ Land werden
Wegenetze und Kanäle angelegt, Tempel,
Paläste und auch ganze Städte errichtet.
Konkret ist auch in den neuassyrischen In-
schriften die Erschließung von Land in den
Provinzen ein Thema. Der König tritt z.B. in
einer Zylinder-Inschrift von Sargon II. als Ur-
barma er „öden“ Landes au :
„Der er a rene önig der beständig Pläne
erwägt, die Gutes (bewirken), der sein Au-
genmerk auf die Besiedelung brachliegender
Steppengebiete, auf die Kultivierung des Öd-
landes und auf das Anpflanzen von Obstgär-
ten richtete, erwog in seinem Innern, (selbst)
steile Felsgebirge (Ernte)ertrag bringen zu
90 | S e i t e
lassen, denen nie zuvor Grünes entsproß,
sein Herz trug sich damit, wüstem Brachland,
das unter den vorangegangenen Königen den
Pflug nicht kannte, Saatfurchen entstehen
und den alāla-Ruf erschallen zu lassen, eine
Quelle (in) einer Umgebung ohne Brunnen
als ein karattu zu öffnen und wie mit der
Masse des Hochwassers (eines Flusses im
Frühjahr mit) Wasser im Überfluß von oben
bis unten (alles) bewässern zu lassen.“13
Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
an Hand der mesopotamischen Mythen
nachzuvollziehen ist, dass die Götter den Kö-
nig erschaffen und seine Aufgaben festlegen.
Ein zentraler Punkt dabei ist die Spiegelung
der himmlischen Ordnung auch auf Erden,
wofür der König verantwortlich ist. Die Ord-
nung auf Erden reflektiert so die göttliche
Ordnung, und jedes Individuum muss seine
Pflichten gemäß seinem Platz in dieser Ord-
nung erfüllen. Das Königtum und damit der
König ist dabei Garant dieser Ordnung. In
diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden
zwischen defensiven Maßnahmen, die die
Ordnung im eigenen Reich erhalten, und of-
fensiven Aktionen, die die eigene Ordnung
verbreiten, wobei beide gleichermaßen durch
den göttlichen Auftrag legitimiert werden.
13
Z. 34-37, Übersetzung nach Fuchs 1994.
Literatur
R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Kö-
nigs von Assyrien, Archiv für Orientforschung
Beiheft 9 (Graz 1956).
B. Groneberg, Die Götter des Zweistromlan-
des (Düsseldorf 2004).
M. Haul, Das Etana-Epos. Ein Mythos von der
immel a rt des önigs von iš (Göttingen
2000).
W. G. Lambert, Enuma Elisch, in: Texte aus
der Umwelt des Alten Testaments III/4 (Gü-
tersloh1994) 565–602.
J. Linke, Das Charisma der Könige. Zur Kon-
zeption des altorientalischen Königtums in
Hinblick auf Urartu (unpublizierte Dissertati-
on).
M. Liverani, The Ideology of the Assyrian Em-
pire, in: M. T. Larsen (Hrsg.), Power and
Propaganda (Kopenhagen 1979) 297–317.
S. Maul, Der assyrische König. Hüter der
Weltordnung, in: J. Assmann – B. Janowski –
M. Welker (Hrsg.), Gerechtigkeit. Richten und
Retten in der abendländischen Tradition und
ihren altorientalischen Ursprüngen (Mün-
chen 1998) 65–77.
W. R. Mayer, Ein Mythos von der Erschaffung
des Menschen und des Königs, in: Orientalia,
Nova Series 56, 1987, 55–68.
F. Oakley, Kingship. The Politics of Enchant-
ment (Oxford 2006).
P. Panitschek, LUGAL – šarru – βασιλεύς
(Frankfurt 2008).
91 | S e i t e
M. Sennelart (Hrsg.), Michel Foucault: Ge-
schichte der Gouvernementalität I. Sicher-
heit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am
Collège de France 1977-1978 (Frankfurt
2004).
TeilnehmerInnen des Workshops
Abdellatif Bousseta (Tanger/ Karlsruhe)
Urs Brachthäuser (Bochum)
Martina Clemen (Göttingen)
Arne Franke (Berlin)
Matthias Hoernes (Innsbruck)
Julia Linke (Freiburg)
Marcus Nolden (Bochum)
Carolin Philipp (Athen)
Merryl Rebello (Göttingen)
Stefan Riedel (Bochum)
Katharina Schembs (Berlin)
Christiane Schwab (München)
Christine Isabel Schröder (Bochum)
Andrea Spans (Bonn)
David Wallenhorst (Kiel)
Kristine Wolf (Berlin)





























































































![Die Deutsche Glaubensbewegung als ideologisches Zentrum der völkischreligiösen Bewegung [2012]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6340808b5a150e6dd70b25aa/die-deutsche-glaubensbewegung-als-ideologisches-zentrum-der-voelkischreligioesen.jpg)