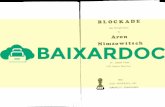Buzogány, Aron und Kropp, Sabine. 2013: Koalitionen von Parteien, in: Niedermayer, Oskar (Hrsg.):...
Transcript of Buzogány, Aron und Kropp, Sabine. 2013: Koalitionen von Parteien, in: Niedermayer, Oskar (Hrsg.):...
Koalitionen von Parteien
Aron Buzogány und Sabine Kropp
1 Koalitionen als Gegenstand politikwissenschaftlicher Forschung
Koalitionen sind in die Europa am häufi gsten vertretene Regierungsform: Einer verglei-chenden Studie über 17 europäischen Demokratien zufolge wurden zwischen 1949 und 1999 rund 63 Prozent aller Regierungen aus mehreren Parteien gebildet (Saalfeld 2007: 180). Selbst im Stammland der Einparteiregierung, in Großbritannien, wurde 2010 ein bis dahin ungewöhnliches Bündnis aus Tories und Liberaldemokraten geschmiedet, da die relative Mehrheitswahl keine Mehrheit für eine Partei erbrachte. Koalitionen gehen mit einer Machtteilung zwischen den Parteien in der Regierung einher, weshalb sie konsens-demokratischen Merkmalen zugeordnet werden (Lijphart 1999). Auch die Vetospielerthe-orie betrachtet Koalitionen wegen der ihnen innewohnenden Verhandlungs- und Kom-promisszwänge als eine wesentliche Ursache dafür, dass Politikwechsel in den Ländern, die regelmäßig Regierungsbündnisse bilden, langsamer verlaufen und weniger umfassend ausfallen (Tsebelis 2002). Aus welchen Gründen Parteien nach Wahlen ein Bündnis ein-gehen, wie stabil Kabinette sind, warum sie beendet werden, aber auch, wie miteinander im Wettbewerb stehende Parteien gemeinsam regieren, sind seit nunmehr einem halben Jahrhundert Kernfragen der Koalitionsforschung. Es gibt wohl kaum einen anderen Zweig der Politikwissenschaft , der ähnlich viel kumulative Forschung hervorgebracht hat und in den so unterschiedliche theoretische Ansätze und methodische Vorgehensweisen einge-fl ossen sind. Dabei wurde der Th eoriebildung von Beginn an ein vergleichsweise großer Stellenwert beigemessen, während die empirische Forschung erst mit einer gewissen Zeit-verzögerung nachfolgte (Müller 2004: 267). Die Koalitionsforschung entwickelte sich im Großen und Ganzen nach dem Prinzip der abnehmenden Abstraktion (Lindenberg 1992: 4): Von anfänglich einfachen spieltheoretischen Modellen ausgehend, wurden die Annah-men und Befunde im Laufe der Zeit zunehmend ausdiff erenziert.
O. Niedermayer (Hrsg.), Handbuch Parteienforschung,DOI 10.1007/978-3-531-18932-1_9, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
262 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Die Koalitionsanalyse wurde frühzeitig von zwei unterschiedlichen Forschungsli-nien geprägt, die sich zunehmend überscheiden und wechselseitig befruchten: Die ers-ten Studien nahmen ihren Ursprung in spieltheoretischen Modellen, die anhand eines möglichst großen N getestet und seit Beginn der Sechzigerjahre fortlaufend verfeinert wurden. Eine andere Vorgehensweise fi rmierte unter dem Etikett der „European poli-tics tradition“, mit dem Untersuchungen bezeichnet wurden, die stärker kontextbezogen und induktiv angelegt waren und zumeist einen oder wenige Fälle umfassen. Inzwischen setzen auch theoriegeleitete Fallstudien oder Vergleiche, die auf einer kleinen Fallzahl aufb auen, die bereits getesteten spieltheoretischen Th eoreme als Heuristiken ein, und umgekehrt machen sich die deduktiv angelegten, modellorientierten Studien ihrerseits Hypothesen generierende Studien zunutze, die auf kleinen Fallzahlen beruhen. Insofern haben sich beide Forschungsrichtungen aufeinander zubewegt (vgl. hierzu Bäck/Dumont 2007; Druckman 2008).
Es lassen sich grob drei unterschiedliche, aber miteinander verfl ochtene Stränge der Koalitionsforschung unterscheiden: Analysen zu Koalitionsbildungen, zur Koalitionssta-bilität und zur Regierungspraxis von Koalitionen. Studien zur Koalitionsbildung waren in der Anfangszeit weniger an Ex-post-Untersuchungen, sondern vor allem an Prognosen interessiert, welches Regierungsbündnis voraussichtlich nach Wahlen zustande kommt. Diese als „Hollywood-Eff ekt“ (vgl. Müller/Strøm 1997) bezeichnete Schwerpunktsetzung, die eher an dem „Wer mit wem?“, weniger jedoch an den Mühen der Regierungspraxis von Koalitionen interessiert ist, wurde schon bald von Forschungen über die Stabilität und die Ursachen für die Beendigung von Regierungsbündnissen ergänzt. Hinzu kamen zahlreiche „thick descriptions“, die sich auf der Grundlage unterschiedlicher theoreti-scher Ansätze vor allem der Regierungspraxis von Parteienbündnissen in einem oder mehreren Ländern oder dem Vergleich von subnationalen Regierungen widmeten.
Diese drei Forschungsrichtungen und ihre wesentlichen Befunde werden im nachfol-genden, zweiten Abschnitt in komprimierter Form dargestellt und in einem dritten Ka-pitel auf die deutsche „Koalitionslandschaft “ bezogen. Die für den deutschen Fall heraus-gearbeiteten empirischen Ergebnisse werden schließlich in einem abschließenden Kapitel in den Forschungsstand zu Koalitionen in Europa vergleichend eingeordnet.
2 Koalitionstheorien
2.1 Koalitionsbildungen
Die frühen, zu Beginn der Sechzigerjahre entwickelten spieltheoretischen Modelle kon-zipierten Koalitionsbildungen als Nullsummenspiel. Als Spieleinsatz galten die nach Wahlen von den Parteien errungenen Mandate, als feststehende Gewinnsumme wurde eine Zahl an Ministerien bestimmt. Parteien galten als „offi ce-seeker“, die an der Über-nahme möglichst vieler Ministersessel interessiert sind. Diese frühen Modelle setzten sich zum Ziel, die Zusammensetzung von Regierungen nach Wahlen zu prognostizieren
263Koalitionen von Parteien
(Riker 1962; Gamson 1961). Dem sog. „Größentheorem“ zufolge entstehen axiomatisch „minimal-winning“-Koalitionen, bei denen der Austritt einer Partei aus dem Bündnis den Verlust der parlamentarischen Mehrheit nach sich zieht. Jedoch gibt es nach Wahlen häufi g mehrere solcher Bündnisse, weshalb das Kriterium des „minimal winning“ nur bedingt für Prognosen taugt. Den theoretischen Überlegungen zufolge streben rational kalkulierende Parteien den größtmöglichen Gewinn an. Sie erzielen ein solches optima-les Ergebnis, wenn die parlamentarische Mehrheit möglichst knapp über 50 Prozent liegt („minimum winning coalitions“) und die kleinste Gewinnkoalition gebildet wird. Die Transaktionskosten lassen sich in solchen Spielen zudem verringern, wenn die Koalition möglichst wenige Parteien umfasst (Leiserson 1968).
Der inzwischen vielfach getesteten „Gamson-Regel“ zufolge werden die Gewinne, d.h. die Regierungsämter, im Großen und Ganzen tatsächlich proportional zum einge-brachten Spieleinsatz, den erzielten Mandaten, ausgezahlt. Dabei gewinnen die kleineren Koalitionsparteien leicht überproportional (vgl. für viele Debus 2008: 517). In Deutsch-land hat sich zudem eine informelle Norm etabliert, die dafür sorgt, dass Parteien mit einer günstigen Verhandlungsposition diese nicht umfassend ausnutzen (Linhart/Pappi/Schmitt 2008). Es ist im Einzelfall allerdings schwierig zu bestimmen, wie der Gewinn einer Partei berechnet werden soll: Weder besitzt ein und dasselbe Ressort für verschie-dene Parteien das jeweils gleiche Gewicht, noch kann ein Ministerium als feste Größe begriff en werden, da der Ressortzuschnitt selbst Gegenstand von Koalitionsverhandlun-gen ist. Auch haben einzelne Ministerien per se eine größeres Bedeutung als andere, da sie, wie der Bereich Finanzen, entweder Querschnittsfunktionen abdecken und damit den Wirkungsbereich anderer Ressorts mit abstecken, oder weil sie, wie das Amt des Regierungschefs oder des Außenministers, gegenüber anderen Ressortchefs ein Mehr an Kompetenzen und Ressourcen begründen.
Die Erklärungskraft von „Offi ce-seeking-Th eorien“ erwies sich auch aus anderen Gründen als begrenzt. Sie vermochten weder das Zustandekommen von Minderheits-regierungen zu erklären, bei denen die Parteien, welche die Regierung tolerieren, auf die Übernahme von Ministerien verzichten. Auch „surplus coalitions“, die mehr Parteien in das Bündnis aufnehmen als für die Mehrheitsbildung unbedingt nötig, konnten mit dem angenommenen, auf Ämtermaximierung gerichteten rationalen Kalkül der Parteien nicht erfasst werden. Parteien gehen ein Bündnis mit anderen Partnern vielmehr auch ein, um politische Inhalte zu gestalten („policy-seeking“). Die Koalitionsforschung be-gann somit frühzeitig, die Charakteristika von Parteiensystemen, ihre Polarisierung und Fragmentierung, sowie Cleavage-Strukturen in den Mittelpunkt der Koalitionsforschung zu stellen (vgl. Dodd 1976). So gingen „Policy-distance“-Th eoreme davon aus, dass Koali-tionen weniger Verhandlungskosten aufwenden müssen, wenn die ideologischen Distan-zen zwischen den Parteien gering sind („minimal range“, vgl. Leiserson 1968; De Swaan 1976). Weist ein Parteiensystem eine Blockstruktur auf, so werden Koalitionen meistens innerhalb dieser Blöcke gebildet. Dabei wurden ideologische Distanzen zunächst auf ei-ner eindimensionalen Achse gemessen, später jedoch, je nach Art des Parteiensystems, auch in einem mehrdimensionalen „policy space“ bestimmt. Kombiniert man das Grö-
264 Aron Buzogány und Sabine Kropp
ßentheorem wiederum mit dem Th eorem eines „minimal range“, lässt sich schließen, dass am wahrscheinlichsten „minimal winning“-Bündnisse entstehen, die sich zusätzlich durch eine ideologische Kompaktheit auszeichnen (Axelrod 1978).
Beinahe alle nachfolgenden Untersuchungen waren bestrebt, beide Rationalitätsan-nahmen konzeptionell miteinander zu verknüpfen. Laver und Shepsle (1996) gingen etwa davon aus, dass Minister jeweils über klar abgrenzbare Geschäft sbereiche zur Gestaltung von politischen Inhalten verfügten, so dass „offi ce-seeking“- und „policy-seeking“-Mo-tive ineinander übergingen und sich wechselseitig bedingten. Dieses Konzept, das von einer weitreichenden Ministerautonomie ausging, die sich wiederum in der ministeri-ellen Agendakontrolle und in dem Recht zur Implementation von beschlossenen Ma-terien innerhalb des eigenen Geschäft sbereichs manifestiere, erweist sich jedoch als zu holzschnittartig (vgl. kritisch Müller 2004: 287 f.). Einzelstudien zu Deutschland weisen z.B. auf die Möglichkeit hin, dass sachverwandte Politikfelder, etwa im Bereich der So-zialpolitik, so auf die einzelnen Koalitionspartner verteilt werden, dass sich daraus ein „institutionalisierter Überwachungs- und Koordinationsmechanismus“ ergibt (Saalfeld 2010: 195). In einigen Ländern ist es zudem gängige Praxis, dem Minister im Zuge eines „Kreuzstichverfahrens“ einen Staatssekretär bzw. „junior minister“ der anderen Koali-tionspartei als Kontrollinstanz zur Seite zu stellen (Carroll/Cox 2012). Ähnliche Über-wachungs- und Koordinationsfunktionen können, je nach institutioneller Ausgestaltung und je nach Machtverteilung in einem politischen System, auch von Parlamentsausschüs-sen ausgehen, wenn den Vorsitz ein Vertreter einer Oppositionspartei wahrnimmt. Diese Beispiele zeigen, dass sich die institutionellen Besonderheiten der einzelnen politischen Systeme, die eine Machtauft eilung zwischen den Koalitionspartnern bedingen, nur mit Abstrichen in schlichte Modelle integrieren lassen, die auf alle potenziellen Koalitions-bildungen angewendet werden.
Andere Modelle wiederum verwiesen darauf, dass die Verhandlungsmacht während der Koalitionsbildung unterschiedlich zwischen den Parteien verteilt ist. Sie untersuch-ten z.B. die Bedeutung der stärksten Partei, die als Formateur die Agenda für die Ko-alitionsbildung setzt (Austen-Smith/Banks 1988). So betont das dem „offi ce-seeking“ zuzurechnende Th eorem des „dominant player“ (Peleg 1981), dass dieser als der Spieler, der in die meisten möglichen Gewinnkoalitionen eingeschlossen ist, über eine erhebliche Verhandlungsmacht verfügt. Der „median legislator“, also die Partei, die den Abgeord-neten in ihrer Mitte hat, der auf einer eindimensionalen Links-Rechts-Skala gleich viele Abgeordnete neben sich hat, könne aus einer in sich stabilen Regierung schwerlich aus-geschlossen werden (Laver/Schofi eld 1990). Der „central player“ in einem Koalitionsspiel wiederum enthalte den „median legislator“, der defi niert, welche ideologisch verbundene Koalition gebildet werden kann (vgl. van Deemen 1989; van Roozendaal 1992).
Parteien streben aber nicht nur danach, Ämter zu erhalten und politische Inhalte mit-zugestalten. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass „offi ce-seeking“- und „policy-seeking“-Präferenzen in die Wirklichkeit umgesetzt werden, ist ihr Erfolg bei Wahlen: Parteien sind nicht zuletzt Organisationen, die Wählerstimmen maximieren wollen. Ko-alitionstheorien zufolge bewegen sich Parteien in einem Koordinatensystem, das durch
265Koalitionen von Parteien
„offi ce“-, „policy“- und „vote-seeking“-Motive zusammengehalten wird. Bezieht man „vote-seeking“-Überlegungen in die Untersuchung von Koalitionsbildungen ein, lässt sich auch das Zustandekommen von Minderheitsregierungen konzeptionell erfassen, die in Westeuropa immerhin rund ein Viertel aller Regierungen zählen (Saalfeld 2007: 180): Da Regierungsparteien im Laufe einer Legislaturperiode in der Regel wegen umstrittener Entscheidungen an Wählerzustimmung verlieren, sparen sich die Parteien, die eine Min-derheitsregierung tolerieren, die Kosten des Regierens. Gleichzeitig können sie außerhalb der Ministerien auf die Gestaltung von Politik Einfl uss nehmen (vgl. Strøm 1990), da sie über ein nicht unbeträchtliches Erpressungspotenzial verfügen. Institutionelle Rahmen-bedingungen, die den Tolerierungsparteien Möglichkeiten zur Gestaltung von Policies eröff nen, sind, wie die skandinavischen Länder belegen, beispielsweise eine starke Stel-lung von Parlamentsausschüssen im Gesetzgebungsprozess oder korporatistische Struk-turen. Daneben lassen sich auch „surplus coalitions“ mithilfe dieser Trias punktgenauer erklären: Die Kosten des Regierens können in übergroßen Koalitionen, wie in Finnland, auf mehrere Schultern verteilt werden, und potenzielle Oppositionsparteien können aus unpopulären Entscheidungen bei Wahlen keinen oder weniger Profi t schlagen, wenn sie in die Regierung eingebunden sind.
Werden neben „offi ce-seeking“- auch „policy“- und „vote-seeking“-Präferenzen der Parteien in die Analyse von Koalitionsbildungen integriert, eröff nen sich zudem For-schungsperspektiven, die präelektorale und parlamentarische Parteienbündnisse in den Blick nehmen. Parlamentarische Bündnisse zwischen Parteien können im Falle von Minderheitsregierungen mehr Parteien umfassen als die Regierung und sogar Züge einer Quasi-Koalition annehmen, wenn sie z.B. durch Tolerierungsabkommen zwischen den Parteien gestützt werden. Präelektorale Koalitionen setzen sich zudem in der Regel in Regierungskoalitionen um. Sie beruhen auf Absprachen zwischen Parteien, die durch das Wahlsystem erzwungen werden: So unterstützen Parteien in Mehrheitswahlsystemen z.B. wechselseitig ihre Kandidaten in den Wahlkreisen, um später eine mehrheitsfähige Regierung bilden zu können.
Inzwischen hat sich die Forschung über „Koalitionssignale“ zu einem weiteren Feld der Koalitionsanalyse entwickelt (vgl. für viele: Golder 2005; Pappi/Herzog/Schmitt 2006; Debus 2007; Linhart 2007). Sie unterscheidet positive Koalitionsaussagen, mit denen die Parteien ihren Wählern vor dem Urnengang signalisieren, mit wem sie zu regieren ge-denken, von negativen Signalen, mit denen eine Partei eine andere von vornherein als Partner ausschließt. Diese Signale müssen nicht symmetrisch ausfallen und auch nicht in jeweils gleicher Intensität vom Gegenüber erwidert werden (Decker 2009: 435). Sie schließen aber einen Teil rechnerisch möglicher Regierungsbündnisse von vornherein aus dem Spiel der Koalitionsbildung aus. Je nach Wahlsystem, können solche Signale den Wählern strategisches Wählen erleichtern, da diese Informationen darüber erhalten, wie die Koalitionsregierung, der sie mit ihrer Stimme ins Amt verhelfen wollen, voraussicht-
266 Aron Buzogány und Sabine Kropp
lich zusammengesetzt sein wird. Da eindeutige Signale es den Wählern erleichtern, mit ihrer Stimme über eine Regierung zu befi nden, werden sie aus demokratietheoretischer Perspektive positiv bewertet. Koalitionssignale können jedoch auch dazu beitragen, dass Regierungen nur unter erschwerten Bedingungen und mit erheblichen Verhandlungs-kosten gebildet werden oder erst gar nicht zustande kommen, wenn die Parteien bei unerwartetem Wahlausgang und im Falle explizit formulierter Wahlaussagen bei den Wählern im Wort stehen und ein Abrücken von eindeutigen Signalen als Wortbruch und Glaubwürdigkeitsverlust gewertet würde.
2.2 Koalitionsstabilität und Beendigung von Regierungsbündnissen
Die Stabilität von Kabinetten, ihre Anfälligkeit für interne Krisen und extern ausgelöste Schocks, ist für die Funktionsfähigkeit des gesamten politischen Systems von zentraler Bedeutung. Die Suche nach Ursachen, die für die Überlebensfähigkeit von Koalitionen verantwortlich zeichnen, begründet somit einen weiteren Zweig der Koalitionsforschung. In einigen Studien wurden z.B. Verfassungsnormen mit Überlegungen zu Merkmalen des Parteiensystems und exogenen Schocks (Krisen, Katastrophen, Skandale) im Rah-men von Ereignisanalysen verknüpft (vgl. Browne/Frendreis/Gleiber 1984; King et al. 1990). Bisherige Untersuchungen zu Westeuropa zeigen ein eindeutiges Muster, die mit den Annahmen zur Koalitionsbildung korrespondieren: „Minimum winning coalitions“ erwiesen sich bisher als stabiler als Minderheitsregierungen oder „surplus coalitions“.1 Frühere Studien waren noch davon ausgegangen, dass stabile Koalitionen den Median-abgeordneten einschließen müssen (vgl. oben). Allerdings ließ sich diese Annahme em-pirisch nicht belegen.
Zu den wesentlichen Bestimmungsfaktoren der Koalitionsstabilität zählen struktu-relle Merkmale der politischen Systeme: Die Anfälligkeit von Regierungen, die durch eine formale parlamentarische Bestätigung des Regierungschefs ins Amt kommen, ist zu Beginn der Legislaturperiode signifi kant höher. Haben Regierungen aber diese Hürde genommen, erweisen sie sich anschließend als beständiger als die Regierungen, die einer solchen Investitur nicht bedürfen (vgl. Saalfeld 2006, 2007). Die Haltbarkeit von Koali-tionen wird durch hohe Hürden für Misstrauensvoten nicht positiv beeinfl usst (anders: Harfst 2001: 11 f.), und auch umfassende Rechte des Regierungschefs zur Parlaments-aufl ösung wirken off enbar nicht disziplinierend auf die Parlamentsfraktionen. Stabilisie-rend wirkt hingegen das Regierungsprivileg des letzten Änderungsantrags (Saalfeld 2007: 204), wohingegen die mit dem Kreuzstichverfahren eingebauten Kontrollmöglichkeiten regierungsinterne Konfl ikte tendenziell sogar institutionalisieren. Die Haltbarkeit von Koalitionen folgt zudem gewissen zeitlichen Rhythmen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Koalitionen aufgelöst werden, steigt mit zunehmender Amtsdauer und näher rückendem
1 Studien zu mittelost- und südosteuropäischen Koalitionen ergaben jedoch ein anderes Bild, vgl. Nikolényi 2004; Kropp 2008, Grotz 2007.
267Koalitionen von Parteien
Wahltermin an, da anstehende Wahlen die Konkurrenz stärker in das Bündnis verlagern (vgl. Kropp 2001: 80 ff .). Koalitionen, die ihre Zusammenarbeit über eine Wahlperiode hinweg fortgesetzt haben und weiter fortführen wollen, sind dabei weniger anfällig für interne Konfl ikte als diejenigen, die zum ersten Mal miteinander kooperieren (vgl. Saal-feld 2007: 203).
In jüngerer Zeit wurden Überlegungen zur Stabilität von Koalitionen mit Befunden zur Governance von Regierungsbündnissen analytisch miteinander verbunden. Deren Robustheit hängt nicht unwesentlich davon ab, inwieweit es auf ein tragfähiges Koaliti-onsmanagement, das auf institutionalisierten Regeln beruht (vgl. Kropp 2001), zurück-greifen kann. Inzwischen gilt es als gesicherte Erkenntnis, dass Koalitionen, die ihre Zu-sammenarbeit auf die Grundlage eines schrift lichen Abkommens stellen, stabiler sind als solche Bündnisse, die sich dieser Mühe nicht unterziehen (Saalfeld 2007: 196 f.). Auch wenn es keine externe Sanktionsinstanz für Verstöße gibt, hegen Koalitionsverträge (vgl. Kropp/Sturm 1998) doch die für Regierungsbündnisse typischen doppelten Agenturpro-bleme ein: Koalitionsparteien delegieren als Prinzipale Macht nicht nur an die Minister der eigenen Partei, sondern auch an die des Bündnispartners; sie gehen damit ein Kon-trollrisiko ein, das durch Abkommen eingegrenzt werden kann. Koalitionsabkommen reduzieren die durch den Wettbewerb zwischen den Partnern induzierte Unsicherheit, sie vermindern Transaktionskosten, indem sie beträchtliche Segmente des Regierungs-handelns schon zu Beginn des gemeinsamen Regierens dem späteren Ringen um Kom-promisse entziehen. Jedoch handelt es sich bei Koalitionsverträgen insofern um eine „endogene“ Variable (vgl. Saalfeld 2007), als nur die Parteien die Kosten für Vertrags-verhandlungen auf sich nehmen, die ohnedies eine längere Zusammenarbeit anstreben. Auch die gemischten Gremien der Konfl iktschlichtung, die zur Stabilität eines Bündnis-ses beitragen und außer den Fraktionsführungen und Regierungsmitgliedern z.B. Partei-führungen oder Fachpolitiker integrieren, werden insbesondere dann gebildet, wenn ein echtes Interesse an einer erfolgreichen Kooperation besteht.
In vielen koalitionstheoretischen und empirischen Studien werden Parteien der Ein-fachheit halber als unitarische kollektive Akteure konzipiert. Jedoch wirken sich innerpar-teiliche Konfl ikte und, allgemein, der Grad der innerorganisatorischen Zentralisierung bzw. Dezentralisierung, auf das Regieren und die Stabilität von Koalitionen unmittel-bar aus. Selbst Einparteiregierungen treten mitunter als eine „Koalition eigener Art“ auf (Bull 1999). Ob stärker zentralisierte Parteien mehr oder weniger Stabilität erzeugen, ist indessen umstritten. Moshe Maor (Maor 1998) nahm an, dass dezentralisierte Parteien in Koalitionen einfacher zu handhaben seien, weil Mitglieder, die mit der Regierungspolitik nicht einverstanden seien, es leichter hätten, innerhalb der Organisation ihre Position („voice“) zu vertreten. In zentralisierten Parteien hingegen bleibe unzufriedenen Mitglie-dern nur der Austritt („exit“). Dem widersprechen auf anderen theoretischen Annahmen basierende Studien, indem sie darauf hinweisen, dass die Fliehkräft e in Koalitionen, die aus dezentralisierten Parteien bestehen, beträchtlich sind (vgl. Druckman 1996; Peder-sen 2010). Parteien, bei denen die Parteiorganisation im Vergleich zur Fraktion stark ist, tendieren off enkundig dazu, weniger Kompromisse einzugehen (für linke Parteien vgl.
268 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Dunphy/Bale 2011). Angesichts des fortgeschrittenen Forschungsstandes kann man so-mit davon ausgehen, dass fragmentierte, dezentralisierte Parteistrukturen die Stabilität von Regierungen eher beeinträchtigen denn fördern.
2.3 Regierungspraxis von Koalitionen
Analysen zur Regierungspraxis von Koalitionen beruhen in der Regel auf Einzelfallstu-dien oder auf Vergleichen mit kleiner Fallzahl. Vergleiche der Regierungspraxis subna-tionaler Regierungsbündnisse sind insofern einfacher durchführbar, als in ihnen viele institutionelle Variablen konstant gehalten werden können. Insbesondere die Darstel-lungen, welche die Entscheidungspraxis zum Gegenstand haben, untersuchen politische Prozesse und schließen daher viele erklärende Variablen ein. Koalitionen in einzelnen Ländern folgen häufi g pfadabhängigen Entwicklungen, sodass kulturellen und histori-schen Erklärungsmustern eine große Bedeutung beigemessen wird. Etliche international vergleichende Studien beschränken sich auf die institutionalisierten und daher einfacher erfassbaren Aspekte des Koalitionsmanagements, etwa auf Inhalte und Regelungskraft von Koalitionsvereinbarungen oder auf Koalitionsausschüsse (vgl. Müller/Strøm 2003), die einem komparativen Design leichter zugänglich sind als die vielfältigen informel-len Interaktionen, die den Alltag von Regierungsbündnissen wesentlich strukturieren. Entscheidungsprozesse von Regierungsbündnissen verspannen zudem unterschiedliche Handlungsebenen, was die Analyse des Regierens in Koalitionen zu einer komplexen An-gelegenheit werden lässt. George Tsebelis (1990) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Regierungspraxis von Koalitionen sich über mehrere Arenen (z.B. Wähler, Parteiorganisation, Fraktion usw.) erstrecke, wobei das Nutzenkalkül der Parteien kei-neswegs immer in erster Linie der Funktionsfähigkeit und dem Bestand der Koalition gelte. Vielmehr kann die „primäre“ Handlungsebene je nach Entscheidungssituation wechseln (vgl. Kropp 2001), und der Wechsel solcher Präferenzen erfolgt bei den Koaliti-onspartnern keineswegs immer auf symmetrische Weise.
Insgesamt stellt sich die Koalitionsanalyse heute als stark ausdiff erenzierter, häufi g mit hochgradiger inhaltlicher und methodischer Spezialisierung verbundener Forschungs-zweig dar. Die Transformation der mittelost- und südosteuropäischen Staaten bietet dabei die Gelegenheit, bisher im westeuropäischen Kontext erprobte Modelle innerhalb eines anderen institutionellen Kontexts mit tendenziell instabileren Parteiensystemen und Wähler-Partei-Allianzen weiter zu testen und zu verfeinern. Auch die lokale Ebene eröff net ein weiteres Laboratorium für die empirische Bearbeitung sehr unterschiedli-cher Fragestellungen und für den Test von Th eoremen auf der Grundlage einer größeren Fallzahl.
269Koalitionen von Parteien
3 Koalitionen in Bund und Ländern
3.1 Koalitionsbildungen in Bund und Ländern
Die häufi gste Regierungsform sind in Deutschland die sog. „minimal winning coali-tions“, die aber nicht notwendig dem Kriterium der kleinsten siegreichen Gewinnkoa-lition entsprechen. Im Bund haben die Parteien mit Ausnahme der Regierungsbildung von 1957, als Kanzler Adenauer trotz absoluter Mehrheit der CDU/CSU mit der DP eine „surplus coalition“ bildete, bisher ausnahmslos dieses Format bevorzugt; die einzige Ein-parteiregierung entstand vorübergehend, als 1960 der Ministerfl ügel der DP, der mit der CDU eine Wahlabsprache eingegangen war, im Laufe der Legislaturperiode der CDU beitrat und die DP damit von der CDU faktisch absorbiert wurde (vgl. Tabelle 7 im Da-tenanhang, Kapitel 32).2 Obwohl das Parteiensystem bei den ersten Wahlen zum Deut-schen Bundestag noch von einer starken Fragmentierung und Polarisierung geprägt war und in etlichen Merkmalen dem Weimarer Parteienwettbewerbs entsprach, konnten von 1949 an bereits ideologisch verbundene Mehrheitskoalitionen gebildet werden, die sich weitgehend innerhalb der sich allmählich verfestigenden Blockstrukturen bewegten.
Bis zum Einzug der Grünen in den Bundestag im Jahre 1983 durchlief das Parteien-system einen Prozess der beständigen Konzentration. Die FDP fungierte im „Zweiein-halbparteiensystem“ seit den Sechzigerjahren als Zünglein an der Waage bzw. als „domi-nant player“, der Bündnisse sowohl mit der SPD als auch mit der CDU/CSU herzustellen vermochte. Mit der Deutschen Einheit verstärkte sich jedoch der Trend hin zum „fl u-iden Fünfparteiensystem“ (Niedermayer 2001), in dem Fragmentierung und Polarisie-rung ebenso wie die Segmentierung zunahmen. Blockübergreifende Bündnisse und/oder Dreiparteienbündnisse können angesichts dieser Entwicklung in Zukunft wohl auch auf Bundesebene nicht mehr ausgeschlossen werden. Große Koalitionen aus CDU/CSU und SPD, die zwar dem Kriterium des „minimal winning“ entsprechen, aber blockübergrei-fend gebildet werden, gab es im Bund bisher nur in sieben von insgesamt 63 Regierungs-jahren. Da diese „oversized coalitions“ große Teile der Wählerschaft repräsentieren, gel-ten sie als konsensdemokratisches Merkmal: Bezeichnenderweise wurden während der Regierungszeit großer Koalitionen umfassende Verfassungsreformen mit Zweidrittel-mehrheit in Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Jedoch entsprach die 2009 gebil-dete große Koalition kaum mehr der Vorstellung von einer „Elefantenhochzeit“, da sie sich, anders als ihr Pendant in den Sechzigerjahren, das über 86,9 Prozent der Stimmen und über 90 Prozent der Mandate im Bundestag verfügte, nur noch auf 56,8 Prozent der Stimmen und 62 Prozent der Mandate stützen konnte. Minderheitsregierungen sind im Bund wiederum bislang nicht gezielt gebildet worden. Sie werden noch immer mit den instabilen Minderheitskabinetten der Weimarer Republik assoziiert, nicht jedoch mit den vergleichsweise stabilen, koalitionsähnlichen Tolerierungsmodellen, wie sie z.B. in Schweden üblich sind.
2 Für Recherchen zu diesem Beitrag danken wir Matthias Leowardi.
270 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Die koalitionspolitische Farbenlehre in den Ländern fällt gegenüber der des Bundes bunter aus. Wurden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst häufi g Allpar-teienkoalitionen gebildet, deren Ziel es war, die Kriegsschäden zu beseitigen und den Wiederaufb au voranzutreiben, so vollzog sich seit den Fünfzigerjahren auch auf subna-tionaler Ebene ein leicht zeitversetzter, aber kontinuierlicher Prozess der Konzentrati-on des Parteiensystems, der seinen Niederschlag in der allmählichen Angleichung der Koalitionsmuster von Bund und Ländern fand. Dieser koalitionspolitische Gleichklang prägte insbesondere die späten Sechziger-, die Siebziger- und auch noch die Achtziger-jahre. Gleichwohl blieben stets Unterschiede zwischen den staatlichen Ebenen bestehen, die dadurch begründet waren, dass in den Ländern nicht nur kleine Parteien, die aus dem Bundestag ausgeschieden waren, etwas länger überlebten, sondern neuen Parteien oder kurzlebigen „fl ash parties“, wie der Schill- oder der Stattpartei in Hamburg, der Einzug in die Landesparlamente gelang. Jüngere Wahlerfolge der Freien Wähler in Bayern oder der Piraten in Nordrhein-Westfalen weisen darauf hin, dass aufgrund der Volatilität des Wählerverhaltens neue Parteien heute selbst in Flächenländern die Fünfprozenthürde vergleichsweise einfach überspringen können. Die Länder bieten ein Experimentierfeld, auf dem auch neue Parteienbündnisse auf ihre Regierungsfähigkeit hin getestet werden können. Die Kombinationsmöglichkeiten sind durch die Segmentierung des Parteiensys-tems im Mitte-Rechts-Spektrum aber begrenzt, da die NPD, die Republikaner oder die DVU auch von der CDU und CSU als nicht koalitionsfähig betrachtet werden. Demge-genüber wird die Linke (früher PDS) insbesondere in den neuen Ländern, nicht jedoch im Bund, von der SPD inzwischen als potenzieller Bündnispartner durchaus akzeptiert.
Gleichzeitig sind die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD ideologisch beweg-licher und gegenüber neuen Regierungsbündnissen off ener geworden (vgl. Niedermayer 2010: 9 ff .). Koalitionen, welche die Blockgrenzen überwinden, sind angesichts der Wäh-lervolatilität teilweise eine notwendige Bedingung, um überhaupt eine Regierung bilden zu können. Die Parteien können heute weniger denn je damit rechnen, hergebrachte Bündnisse fortsetzen zu können. Angesichts der beschriebenen Dynamiken in der Koa-litionslandschaft lässt sich die Th ese, dass sich das gesamtdeutsche Parteiensystem auf-grund der Dominanz von „Kartellparteien“ in die Richtung eines bipolaren Zweipartei-en- oder Zweiblöckesystems entwickele (vgl. Mair 2006), somit nicht bestätigen.
Auch wenn Koalitionsbildungen in Bund und Ländern eng aufeinander bezogen sind, so orientieren sich Regierungsbündnisse in den Ländern nicht automatisch am Muster der Bundespolitik. Zwar fanden Studien heraus, dass die Zusammensetzung der Regie-rungsmehrheit im Bund sowie der Opposition den größten Einfl uss auf die Koalitions-bildungen in den Ländern ausübt (Pappi/Becker/Herzog 2005; Däubler/Debus 2009: 81). Gleichwohl entsprachen zwischen 1990 und 2009 nur 36 von 74 gebildeten Kabinetten dem auf der Bundesebene dominierenden bipolaren Muster (vgl. Kropp 2010). Gleichzei-tig nahm die Zahl der Einparteiregierungen in diesem Zeitraum weiter ab; ihr Anteil lag zwischen 1949 und 2005 bei insgesamt 36,7 Prozent (Freitag/Vatter 2005: 125). Seit 1990 wurden insgesamt 20 große Koalitionen in den Ländern gebildet, da die abnehmende Zweiparteiendominanz und die wachsende Fragmentierung die Bildung von Mehrheits-
271Koalitionen von Parteien
regierungen nach vertrautem Muster, bestehend aus einer großen und einer kleinen Par-tei, verhinderten. Allerdings entwickeln sich (ähnlich bereits im Bund 2005) auch „gro-ße“ Koalitionen mehr und mehr in Richtung einer kleinformatigen „minimal winning coalition: besonders einprägsam in Sachsen, wo die Koalition aus CDU und SPD 2005 nur 51 Prozent der Stimmen und 55 Prozent der Mandate erringen konnte.
Die von der Bundesebene abweichenden Regierungsformate in den Ländern deuten darauf hin, dass die bipolare Struktur des Koalitionssystems insgesamt poröser wird. In den vergangenen Jahren experimentierten die Parteien mit unterschiedlichen blocküber-greifenden Bündnissen. So gingen die CDU und die Grünen in Hamburg 2008 die erste schwarz-grüne Koalition ein. Mit der FDP wurde dieses Bündnis im Saarland 2009 zur ersten sog. „Jamaika-Koalition“ erweitert. Dort konnten die Grünen während der Koali-tionsbildung als „central player“ agieren, der allerdings nicht den Medianabgeordneten umfasste – eine Konstellation, die in der Koalitionsforschung als tendenziell instabil be-wertet wird (Nikolényi 2004). Beide Experimente wurden noch vor Ablauf der Legisla-turperiode abgebrochen. Ebenso zeigen die wenigen Erfahrungen mit „Ampelkoalitio-nen“, dass die zentrifugalen Kräft e aufgrund der teilweise unvereinbaren Positionen der Grünen (bzw. in Brandenburg von Bündnis 90) und der FDP beträchtlich waren und die SPD vor eine Zerreißprobe stellten (vgl. Putz 2008). Studien belegen, dass die gro-ßen Parteien aus solchen „komplexen“ Koalitionen tendenziell gestärkt hervorgehen und die kleinen Parteien in nachfolgenden Wahlen verlieren (Klecha 2011: 346). Auf Bun-desebene würde ein Funktionieren solcher blockübergreifender Koalitionen zusätzlich dadurch erschwert, dass ein Bündnis aus drei Parteien, das die Fraktionsgemeinschaft der CDU/CSU umfasst (vgl. Hirscher 1999), faktisch aus vier Parteien bestünde und die regierungsinterne Fragmentierung und Polarisierung sowie die damit einhergehenden Konfl iktpotenziale und Verhandlungskosten zunehmen würden.
Die beschriebene Ausdiff erenzierung des Parteien- und Koalitionssystems hat dazu beigetragen, dass sich eindeutige Koalitionssignale für die Parteien zu einer risikoreichen Angelegenheit entwickeln können. Angesichts der Volatilität des Wählerverhaltens im „fl uiden Fünfparteiensystem“ (Niedermayer 2001) können positive wie negative Signale dazu führen, dass nach Wahlen keine Mehrheitsregierung zustande kommt. Allerdings ist es für die kleinen Parteien, z.B. für die Grünen und die FDP, ebenfalls riskant, auf eindeutige Signale zu verzichten, da sie unter den Bedingungen des Zweistimmenwahl-systems dann ggf. die Unterstützung ihrer Wähler und Leihstimmen verlieren. Vor den Wahlen zum Bundestag 2009 sprach sich z.B. die FDP eindeutig für eine Koalition mit der CDU/CSU aus – eine, wie sich angesichts des historischen Wahlerfolgs mit beinahe 15 Prozent der Wählerstimmen herausstellen sollte, zwar durchaus erfolgreiche Strategie. Geht dieses Kalkül jedoch nicht auf, läuft eine Partei Gefahr, an Glaubwürdigkeit einzu-büßen, wenn sie trotz anderslautender Aussagen mit einem anderen Partner ein Bündnis eingeht. Sendet eine Partei vor Wahlen inkompatible Signale aus, kann im schlechtesten Fall keine Regierung gebildet werden. Die Wahlen zum Hessischen Landtag 2009 zeigen, dass dieses Szenario keine nur hypothetische Möglichkeit darstellt. In Hessen mussten
272 Aron Buzogány und Sabine Kropp
schließlich Neuwahlen anberaumt werden (vgl. Schmitt-Beck/Faas 2009; Decker 2009: 446).
Koalitionsbildungen in Bund und Ländern entsprechen dem Muster des sog. „free-style-bargaining“. Es gibt keine in der Verfassung oder in Gesetzen festgelegte Regelung, die einen Formateur oder genaue Abläufe für die Verhandlungen nach Wahlen bestim-men würde. Vorwirkungen ergeben sich lediglich durch die Bestimmungen im Grundge-setz (Art. 63 GG) und in den Landesverfassungen, welche die Wahl des Regierungschefs festlegen. Da der Bundeskanzler im ersten Wahlgang mit der Mehrheit der Stimmen des Bundestages gewählt wird, einigen sich die Parteien zuvor auf eine tragfähige Mehrheit. Wenn, wie in Sachsen-Anhalt 1994 und 1998 oder in Nordrhein-Westfalen 2010, Minder-heitsregierungen gebildet werden, müssen sie auf die bereits verhandelte Bereitschaft zu-sätzlicher Abgeordneter oder einer tolerierenden Fraktion setzen können, der Regierung durch eine formale Investitur ins Amt zu verhelfen. Eine von einzelnen Parteien mitunter reklamierte Regel, dass die stärkste Partei auch den Regierungschef stellen müsse, gibt es nicht. Jedoch haben sich in den vergangenen Jahrzehnten informelle Regeln herausgebil-det, die, mit gewissen Variationen, von beinahe allen Parteien befolgt werden und damit die Freiräume der Regierungsbildung mit informalen Institutionen füllen (vgl. Kropp/Sturm 1998).
Der Wahl des Regierungschefs gehen in der Regel zunächst Sondierungsgespräche mit potenziellen Koalitionspartnern voraus. Kann eine Partei mehrere Koalitionsvarianten eingehen, befi ndet sie sich in der Position eines dominanten Spielers. Die Koalitionsver-handlungen sind in der Regel so organisiert, dass die spezifi schen Policy-Vorhaben in Arbeitsgruppen, bestehend aus den Fachpolitikern der künft igen Koalitionsfraktionen und den designierten Ministern, für den Koalitionsvertrag ausgearbeitet werden. Im Bund werden auch regierungserfahrene Minister der Landesregierungen herangezogen. Hat eine Partei bereits in der Wahlperiode zuvor ein Ministerium geführt, werden Sach-komplexe auch dort für die Verhandlungen ausgearbeitet (Kropp 2001: 130). Strittige und policy-übergreifende Fragen, die in den Arbeitsgruppen nicht gelöst werden können, werden zumeist in einer zentralen Steuerungsgruppe behandelt, an der neben den Partei-führungen auch der designierte Regierungschef und sein Stellvertreter beteiligt sind (für die Koalitionsverhandlungen 2009 im Bund vgl. Saalfeld 2010: 188).
Die Verhandlungen fi nden nicht-öff entlich statt. Tauschgeschäft e lassen sich unter den Augen der Öff entlichkeit kaum vornehmen, weil die Beteiligten dann einen stärker posi-tionsbezogenen Verhandlungsstil verfolgen. Allerdings hat es sich inzwischen durchge-setzt, dass die Öff entlichkeit regelmäßig über den Stand der Verhandlungen informiert wird. Der erarbeitete Koalitionsvertrag wird schließlich auf Parteitagen abgesegnet, um die Parteibasis an die Vereinbarungen zu binden. Dabei handelt es sich um einen poli-tischen, nicht aber um einen rechtswirksamen Vertrag. Wie hoch die Zustimmung der Parteibasis ausfällt, gilt gemeinhin als Gradmesser dafür, inwieweit in der nachfolgenden Legislaturperiode Konfl ikte mit der eigenen Partei, die durch die Unzufriedenheit mit Koalitionskompromissen ausgelöst werden, zu erwarten sind. Erst nach diesen Voten er-folgt die formale Wahl des Regierungschefs im Parlament.
273Koalitionen von Parteien
Personalia werden zuletzt verhandelt und sind normalerweise nicht expliziter Gegen-stand des Vertrages, da dieser ansonsten der verfassungsrechtlich verankerten Personal-kompetenz des Regierungschefs (Art. 64 GG) vorgreifen würde (auch wenn bestimmte Personen als „gesetzt“ gelten und die Verteilung der Geschäft sbereiche sich teilweise auch an persönlichen Präferenzen orientiert). Diese ist freilich durch das informelle Recht der Koalitionspartei auf Nominierung eigener Kandidaten faktisch eingeengt. Der Koaliti-onsvertrag wird als Arbeitsprogramm der Regierung inzwischen regelmäßig der Öff ent-lichkeit zugänglich gemacht, schon, um die intransparenten Verhandlungen zu legitimie-ren und die beteiligten Akteure auf die vereinbarten Inhalte zu verpfl ichten. Tatsächlich scheinen veröff entlichte Verträge eine Koalition zu stabilisieren (vgl. Saalfeld 2007: 197). Die beschriebenen informellen Verfahren haben in den vergangenen Jahrzehnten insge-samt einen Prozess der Institutionalisierung durchlaufen und sind im kollektiven Ge-dächtnis der Parteien gespeichert. Sie werden von nachfolgenden Koalitionen übernom-men und den jeweiligen Bedingungen fortlaufend angepasst.
3.2 Stabilität von Koalitionen
Koalitionen zeichnen sich in Deutschland durch eine im internationalen Vergleich große Stabilität aus (vgl. Tabelle 1). Hierzu tragen sowohl die institutionellen Rahmenbedin-gungen als auch das Koalitionsmanagement bei (vgl. oben): Regierungschefs kommen sowohl im Bund als auch in den Ländern durch eine formale Investitur ins Amt, so dass designierte Kabinette gleich zu Beginn eine hohe Hürde nehmen müssen, anschließend aber tendenziell stabiler bleiben. Im Bund konnten aufgrund erfolgreicher Vorverhand-lungen der Parteien bislang alle Kanzler gleich im ersten Wahlgang bestellt werden. Das Kreuzstichverfahren, dem zufolge die Minister einen Staatssekretär der anderen Partei zu Überwachung an die Seite gestellt bekommen und das als tendenziell destabilisierend gilt, wird in der Mehrzahl der Regierungsbündnisse nicht oder nur in Einzelfällen an-gewandt (vgl. mit Beispielen Saalfeld 2010: 196). Üblich sind seit den Sechzigerjahren zudem schrift liche Koalitionsabkommen, mit denen sich die Parteien auf die Eckpunkte ihrer Zusammenarbeit einigen. Die Koalitionsausschüsse sind als Steuerungs- und Kon-fl iktschlichtungsgremien zudem so ausgestaltet, dass sie mehrere Handlungsebenen ver-spannen und zur eff ektiven Konsensbildung zwischen den Partnern beitragen.
Betrachtet man die Lebensdauer von Koalitionen in Bund und Ländern,3 so fällt auf, dass die Legislaturperioden im Bund zumeist ausgeschöpft wurden. Veränderte sich die Zusammensetzung der Bundesregierung, wie dies in den Sechzigerjahren mehrfach der Fall war (vgl. Tabelle 7 im Datenanhang, Kapitel 32), so war dies nicht immer auf eine Regierungskrise zurückzuführen. Nur einige Male zerbrachen Regierungen an unver-
3 Ein Kabinett gilt als beendet, wenn sich (1) die parteipolitische Zusammensetzung des Ka-binetts ändert, (2) die Person des Regierungschefs wechselt oder (3) eine Neuwahl des Parla-ments stattfindet.
274 Aron Buzogány und Sabine Kropp
einbaren Positionen der Partner: so etwa 1966, als die CDU/CSU/FDP-Koalition wegen wirtschaft licher Probleme und Auseinandersetzungen über den Bundeshaushalt schei-terte und anschließend eine große Koalition gebildet wurde. 1982 stand die seit 1969 amtierende SPD/FDP-Regierung wegen unüberbrückbarer Diff erenzen in haushalts- und wirtschaft spolitischen Fragen vor dem Aus; die FDP hatte zuvor bereits wirtschaft spo-litische Positionen der CDU/CSU übernommen und ging nach dem Sturz von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) eine Regierung mit ihr ein. 2005 leitete Kanzler Gerhard Schröder (SPD) über eine unechte Vertrauensfrage (wie 1972 bereits Willy Brandt) vorzeitig Neu-wahlen ein, nachdem die rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen nach einer Rei-he von für die SPD verlorenen Landtagswahlen ebenfalls abgewählt worden war. In den Ländern ist demgegenüber nicht nur die Koalitionslandschaft bunter, sondern es werden auch Kabinette häufi ger vorzeitig beendet, wenngleich auch dort die Regierungsstabilität – insbesondere in Ländern mit langjähriger Dominanz einer Partei (z.B. Bayern, Baden-Württemberg, längere Zeit auch Nordrhein-Westfalen) – beträchtlich ist.
Minderheitsregierungen wurden im Bund bislang nicht gebildet, sie bestanden nur vorübergehend, wenn im Zuge einer Regierungskrise ein Koalitionspartner das Kabinett verlassen hatte (vgl. Tabelle 1). Auch in den Ländern wurden nur selten gezielt Minder-heitskabinette ins Leben gerufen. Ausnahmen waren z.B. die von der PDS tolerierte rot-grüne Regierung (1994-1998) und die SPD-Minderheitsregierung (1998-2002) in Sach-sen-Anhalt, die stabil blieben, weil ihnen keine kompakte Opposition gegenüber stand und sie so das Kriterium der „government viability“ erfüllten (Strøm 1990). Vor allem das SPD-Minderheitskabinett Höppner glich einer recht stabilen parlamentarischen Koaliti-on, da SPD und die tolerierende PDS gemeinsame Vorhaben schrift lich fi xiert hatten. Die 2010 von SPD und Grünen gebildete Minderheitsregierung scheiterte 2012 an der Auf-stellung des Haushalts. Auff allend ist ferner die hohe Stabilität von Einparteiregierungen, die ihre Legislaturperiode in den Ländern in der Regel voll auszuschöpfen vermochten. Nach einem noch häufi gen Auft reten von „surplus coalitions“ in den Ländern in den Aufb aujahren der Bundesrepublik verlor dieses Format in den Sechzigerjahren an Be-deutung. Die Parteien bildeten nun häufi g die stabileren „minimal winning“-Bündnisse, die zudem in der Regel ideologisch verbunden waren. Für Bund und Länder lassen sich die Aussagen über die Stabilität unterschiedlicher Regierungsformate unseren Berech-nungen zufolge mit kleinen Abweichungen bestätigen: „Minimum winning coalitions“ erwiesen sich durchschnittlich sogar als etwas stabiler als „minimal winning“-Bündnisse und Einparteiregierungen, diese weisen wiederum eine höhere Lebensdauer auf als „sur-plus coalitions“ und Minderheitsregierungen. Diese Befunde sprechen dafür, dass sich die oben beschriebenen Merkmale der Koalitionspolitik in Deutschland stabilisierend auswirken.
275Koalitionen von Parteien
Tabelle 1 Prozentuale Verteilung von Regierungsformaten Einpartei-
regierungEinpartei- MinReg
MinK MWC Surplus
Österreich 16,00 4,00 0 72,00 8,00
Belgien 7,69 5,13 5,13 41,03 41,03
Bulgarien 11,11 33,33 0 33,33 22,22
Zypern 0 14,29 28,57 28,57 28,57
TschechischeRepublik
0 22,22 22,22 55,56 0
Deutschland 3,45 10,34 0 68,97 17,24
Dänemark 0 40,00 48,57 11,43 0
Estland 0 16,67 16,67 66,67 0
Spanien 27,27 72,73 0 0 0
Frankreich 10,34 17,24 10,34 24,14 37,93
Finnland 0 9,30 13,95 16,28 60,47
Griechen-land
78,57 7,14 0 7,14 7,14
Ungarn 0 20,00 0 30,00 50,00
Irland 24,00 24,00 20,00 24,00 8,00
Island 0 12,50 6,25 68,75 12,50
Italien 0 25,45 16,36 9,09 49,09
Lettland 8,33 2,78 25,00 33,33 30,56
Luxemburg 0 0 0 94,74 5,26
Malta 50 0 0 50,00 0
Niederlande 0 0 21,43 42,86 35,71
Norwegen 20 43,33 20,00 16,67 0
Poland 0 31,25 18,75 50,00 0
Portugal 18,75 31,25 0 31,25 18,75
Rumänien 0 23,53 41,18 5,88 29,41
Slowakei 0 9,09 18,18 54,55 18,18
Slowenien 0 0 25,00 41,67 33,33
Schweden 6,90 62,07 10,34 20,69 0
VereinigtesKönigreich
91,67 4,17 0 4,17 0
Quelle: ERD-Datensatz (Andersson/Ersson 2012); MinK = Minderheitskoalition; MWC = minimal winning coalition
276 Aron Buzogány und Sabine Kropp
3.3 Regieren von Koalitionen
Die Regierungspraxis von Koalitionen umfasst eine Vielfalt von Aspekten, weshalb im Folgenden einige prägnante informale Regeln des „coalition governance“ vorgestellt werden, die in Koalitionsabkommen in Bund und Ländern festgeschrieben sind. In den Koalitionsverträgen werden Kooperationsregeln, Politikinhalte und – dies allerdings in Deutschland eher selten – die Vergabe von Ämtern niedergelegt.
Kooperationsregeln zwischen den Parteien schaff en einen Rahmen, der dazu beitra-gen kann, Konsensbildungsprozesse während des gemeinsamen Regierens zu strukturie-ren und Konfl ikte zu vermeiden. So hat sich in Deutschland zum einen die Regel durch-gesetzt, dass Koalitionen in G-Ländern, die aus Parteien bestehen, die sich im Bundestag in der Regierung und in der Opposition befi nden, ihr Stimmverhalten für den Bundesrat festlegen. Einigen sich die Partner nicht, enthalten sie sich normalerweise der Stimme; „konforme“ Regierungen sprechen sich mitunter auch für die Unterstützung der Regie-rungsmehrheit im Bund bzw. für eine kritische Haltung gegenüber der Bundesregierung aus (vgl. Kropp/Sturm 1998). Bei als wichtig eingestuft en Materien wird das Entschei-dungsverhalten teilweise auch vorab vertraglich fi xiert. Zum anderen tragen die im Ab-kommen niedergeschriebenen Regeln dazu bei, die Koalitionsdisziplin sicherzustellen. Ein abgestimmtes Verhalten ist vor allem für das Überleben von „minimum winning coalitions“ essentiell, da solche Regierungsbündnisse über eine knappe parlamentarische Mehrheit verfügen. Die Koalitionsdisziplin soll gewährleistet werden, indem wechselnde Mehrheiten bei Abstimmungen im Parlamentsplenum und in den Ausschüssen ausge-schlossen werden, ebenso mithilfe eines Gebots, das die Abstimmung parlamentarischer Initiativen zwischen den Koalitionsfraktionen zur Pfl ichtaufgabe macht. Grundsätzlich gilt auch, dass ein Partner im Kabinett nicht von dem oder den anderen überstimmt werden darf.
Koalitionsverträge tragen dazu bei, den in Regierungsbündnissen internalisierten Wettbewerb zwischen den Parteien in ein kooperatives Verhältnis zu überführen und Unsicherheiten zu reduzieren. Nach Wahlen befi nden sich Parteien in der Situation ei-nes Gefangenendilemmas (Kropp/Sturm 1998: 97): Zwar ziehen sie eine Kooperation der Einzelstrategie vor, da jene mit einer Auszahlung von Ämtern und der Möglichkeit zur Gestaltung von Policies einhergeht. Gleichzeitig jedoch stehen sie in einem Konkurrenz-verhältnis zueinander, so dass die Anreize, Gewinne auf Kosten des Partners zu maxi-mieren, während des gemeinsamen Regierens weiterhin gegeben sind. Je präziser deshalb die einzelnen Sachkomplexe in den Koalitionsverhandlungen abgearbeitet und festgelegt werden, desto leichter lassen sich in der Regierungszeit Konfl ikte vermeiden. Dies mag ein Grund dafür sein, dass Koalitionsabkommen heute vergleichsweise detailliert ausge-staltet sind. Die Abkommen ermöglichen es zudem, Koppelgeschäft e über verschiedene Politikfelder hinweg abzuschließen. Gleichwohl gelingt es nicht, alle potenziellen Proble-me zu antizipieren und jedweden Konfl ikt zu vermeiden. Bei Koalitionsvereinbarungen handelt es sich nur um unvollständige Verträge, was den Agendasetzern, v.a. den Minis-tern, während des Regierens Freiräume verschafft (Saalfeld 2010: 203). In den Abkommen
277Koalitionen von Parteien
fi nden sich zudem regelmäßig Konfl iktvertagungen, Formelkompromisse und teilweise sogar explizite Konfl iktmarkierungen, die der Wählerschaft oder der Parteibasis signali-sieren sollen, dass die Verhandlungsführungen gegenüber dem Partner standhaft geblie-ben sind. Konfl ikte, die verschoben werden, brechen jedoch mit einer hohen Wahrschein-lichkeit im Laufe des Regierens wieder auf (vgl. Kropp/Sturm 1998). Im Allgemeinen lässt die Wirksamkeit von Abkommen im Laufe des Regierens nach, insbesondere dann, wenn im Vorfeld anstehender Wahlen Wettbewerbsorientierungen die Kooperationswilligkeit von Akteuren überlagern.
Koalitionen in Bund und Ländern bilden regelmäßig einen Koalitionsausschuss, der entweder als permanentes Steuerungsorgan oder als Gremium fungiert, mit dem Kon-fl ikte geschlichtet werden. Aus staatsrechtlicher Sicht wurden diese Ausschüsse kriti-siert, weil sie die verfassungsmäßigen Organe, insbesondere das Parlament, abwerteten und politische Verfahren intransparent gestalteten (Schreckenberger 1994). Sie sind als Gremium für ein eff ektives Konfl iktmanagement jedoch unentbehrlich. Dies zeigen die letztlich erfolglosen Versuche der 1998 gebildeten rot-grünen Bundesregierung, ohne ein solches Gremium auszukommen (vgl. Kropp 2003). In der Regel setzen sich Koalitions-ausschüsse in Deutschland aus den Parteiführungen, den Fraktionsvorsitzenden (und ggf. Parlamentarischen Geschäft sführern), dem Regierungschef und seinem Stellvertreter zusammen. Mitunter werden auch Fachpolitiker herangezogen. Die Koalitionsgremien, welche die unterschiedlichen Handlungsebenen von Regierungsbündnissen verknüpfen, d.h. Kabinett, Partei und Parlamentsmehrheit, vermögen Konfl ikte eff ektiver zu lösen. Sie erzeugen eine höhere Stabilität als die Gremien, die z.B. nur Regierungsmitglieder umfassen (Saalfeld 2007: 199), da sie den Ort der Steuerung, je nach Konfl iktniveau, va-riieren können.
Im föderalen System besitzt die Koalitionspolitik eine bundesstaatliche Dimension (vgl. Downs 1998), da beide Ebenen miteinander verschränkt sind. Diese Aussage trifft vor allem auf den deutschen Föderalismus zu, da dieser kein Trennsystem abbildet, in dem die Kompetenzen von Bund und Ländern eindeutig getrennt sind. Er ist vielmehr maßgeblich von Kooperation, Politikverfl echtung und zentripetalen Dynamiken geprägt. Diese Charakteristika werden durch den Parteienwettbewerb wesentlich abgestützt und verstärkt. Anders als in der Schweiz, in Belgien oder in Kanada, entsprechen sich die Parteiensysteme in Bund und Ländern trotz einiger regionaler Abweichungen im Großen und Ganzen, so dass auch die Parteien in sich föderale Systeme darstellen und Tendenzen der Politikverfl echtung verstärken.
Aus welchen Parteien Landesregierungen zusammengesetzt sind, ist für die Mehr-heiten im Bundesrat und für den Handlungsspielraum der Bundesregierung von ent-scheidender Bedeutung. Dominieren in den Ländern Koalitionen, die mit der Bundes-tagsmehrheit nicht konform sind, ist die Bundesregierung in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschnürt, da die Länderkammer bei zustimmungspfl ichtigen Gesetzen – immerhin etwa 35 bis 45 Prozent, vor der Föderalismusreform von 2006 sogar etwa 60 Prozent al-ler Gesetze – über ein absolutes Veto verfügt. Insofern haben die Bundesparteien ein genuines Interesse daran, Koalitionsbildungen auf der Landesebene und das Entschei-
278 Aron Buzogány und Sabine Kropp
dungsverhalten von Landesregierungen in ihrem Sinne zu beeinfl ussen. Auch die Poli-cy-Positionen der Landesparteien werden durch die Bundesparteien erkennbar geformt: Landesregierungen gleichen sich in wirtschaft spolitischen Fragen der Bundesregierung an, während sie in sozialpolitischen Fragen eher von ihr abrücken (vgl. Däubler/Debus 2009: 91).
Seit 1949 sind die Phasen, in denen die parteipolitische Zusammensetzung der Bun-desratsmehrheit der Regierungsmehrheit entsprach, überschaubar gewesen: Nur in 21 von 60 Jahren verfügten die konformen Länderkoalitionen über eine Mehrheit im Bun-desrat. Dies weist darauf hin, dass die Handlungsfähigkeit deutscher Bundesregierungen auf gewisse Hemmnisse stößt, die ihren Ursprung in der föderalen Koalitionspolitik ha-ben. Allerdings hätte auch die Opposition nur in 13 der verbliebenen 39 Jahre über den Bundesrat eine explizit gegen die Bundesregierung gerichtete Politik betreiben können, da der Anteil der „gemischten“ Regierungsbündnisse, die aus Parteien bestehen, die sich im Bundestag sowohl in der Opposition als auch in der Regierung befi nden, eindeutige Mehrheiten verhinderte. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich der Anteil dieser sog. „G-Länder“ aufgrund der Ausdiff erenzierung der Koalitionslandschaft erkennbar erhöht (vgl. Kropp 2010).
Abbildung 1 Stimmverteilung im Bundesrat 1949-2008 (Quelle: eigene Berechnungen.)
G-Länder („mixed coalitions“) enthalten sich im Bundesrat der Stimme, wenn sich die Koalitionsparteien nicht auf ein Stimmverhalten einigen können. Diese Enthaltungen gehen aber in defür die Mehrheitsbildung verloren. Zwar sind die Parteiverbände in den
279Koalitionen von Parteien
Ländern ihrer Bundesorganisation keineswegs hierarchisch unterstellt, so dass den Lan-desparteien, die auch die Koalitionsräson in der Landesregierung im Auge behalten müs-sen, kein Stimmverhalten oktroyiert werden kann. Landesregierungen verhalten sich, z.B. bei Finanzfragen, im Bundesrat keineswegs nur entlang der Parteilinie. Vor allem wenn die Mehrheiten im Bundesrat knapp ausfallen, sind die dortigen Mehrheitsverhält-nisse aber stets ein Th ema des Koalitionsverhaltens von Landesregierungen. Die häufi g beschriebene informelle große Koalition aus CDU/CSU und SPD (Schmidt 1996), der zufolge die großen Parteien bei einer abweichenden Bundesratsmehrheit in eine infor-melle Kooperation gezwungen werden, weicht unter den Bedingungen einer zunehmend bunter werdenden Koalitionslandschaft in den Ländern heute teilweise einer Verhand-lungssituation, in der die Bundesregierung mit vier oder gar fünf an Landesregierungen beteiligten Landesverbänden unterschiedlicher Parteien Verhandlungen führen muss. Die enge Verschränkung der Koalitionspolitik in Bund und Ländern führt somit in Ver-bindung mit einer abnehmenden Prägekraft des bipolaren Parteienwettbewerbs letztlich dazu, dass konsensdemokratische Ausprägungen des politischen Systems heute tenden-ziell stärker zu Tage treten (vgl. Kropp 2010; anders Mair 2006: 70).
4 Koalitionen im europäischen Vergleich
4.1 Koalitionsbildungen in Europa
In Europa werden nach Wahlen überwiegend Koalitionsregierungen gebildet. Der Anteil von Einpartei-Mehrheitsregierungen ist mit etwa 13 Prozent recht überschaubar (An-dersson/Ersson 2012).4 Sie treten verstärkt im Vereinigten Königreich, in Griechenland und in Malta auf. Als das klassische europäische Land der Einparteiregierung gilt das Vereinigte Königreich. Der Hauptgrund ist die relative Mehrheitswahl, die bisher fast im-mer klare Mehrheiten hervorgebracht hat. Etwas häufi ger als Einpartei-Mehrheitsregie-rungen kommen in Europa Minderheitsregierungen einer Partei vor (knapp 20 Prozent). Solche Regierungen wurden vor allem in Spanien und Schweden gebildet; aber auch in den anderen nordeuropäischen Staaten sowie in Bulgarien, Polen und Portugal lassen sich mehr als ein Drittel der Regierungen dieser Kategorie zurechnen. Vor allem in den nordischen Staaten, die geradezu als die Wiege der Minderheitsregierungen gelten (in Dänemark allerdings vor allem in Form von Minderheitskoalitionen), fördern spezifi -sche institutionelle Merkmale das Zustandekommen solcher „undersized governments“. Hierzu zählen der „negative Parlamentarismus“, d.h. die Regel, dass eine Regierung auch nach Wahlen weiter amtiert, bis sich eine Mehrheit gegen sie formiert, die schwierige
4 Grundlage der nachfolgenden Berechnungen ist ein kürzlich von einer skandinavischen Forschergruppe um Torbjörn Bergman veröffentlichter Datensatz European Representative Democracy (ERD), der alle Koalitionen in 29 europäischen Demokratien bis ins Jahr 2010 umfasst.
280 Aron Buzogány und Sabine Kropp
oder das Fehlen einer vorzeitigen Parlamentsaufl ösung in Schweden und Norwegen oder korporatistische Strukturen, die Oppositionsparteien eine gewissen Einfl uss auf nationa-le Politiken verschaff en. Minderheitsregierungen gelten in skandinavischen Staaten nicht als Krisenerscheinung, sondern sind eher Ausdruck eines konsensualen Regierens zu ver-stehen. Sie sind auch eine Antwort auf die Volatilität der Wähler und die Fragmentierung des Parteiensystems. Sozialdemokratische Parteien gaben in skandinavischen Ländern Minderheitenregierungen auch deshalb den Vorzug, weil sie mit ihnen kontroverse Ent-scheidungen einfacher durchsetzen konnten als in einer Koalition. Allerdings ist seit den 2000er Jahren in mehreren nordischen Staaten ein Trend hin zu Mehrheitsregierungen festzustellen, der zumindest teilweise auf die Notwendigkeit zurückgeführt wird, mit starken Mehrheiten in den Verhandlungen auf der EU-Ebene aufzutreten (Strøm/Berg-man 2011: 363).
Ein anderer Typus von Einpartei-Minderheitsregierung fi ndet sich in Spanien, in dem das Parteiensystem sowohl auf der nationalen als auch auf der regionalen Ebene von ei-ner starken Bipolarisierung gekennzeichnet ist. Im Vergleich zum deutschen föderalen System fallen vor allem die Inkongruenz zwischen den Parteiensystemen auf der sub-nationalen und der nationalen Ebene sowie die zunehmenden zentrifugalen Fliehkräft e auf. Während auf der regionalen Ebene Koalitionen regelmäßig von dominanten regio-nalistischen Parteien gebildet wurden, haben sich auf der nationalen Ebene seit Anfang der Achtzigerjahre die sozialistische PSOE und die konservative PP in der Regierung ab-gewechselt. Lange Zeit schien von dieser Arbeitsteilung zwischen der regionalen und der föderalen Ebene eine stabilisierende Wirkung auszugehen, die sich auch in einer langen Amtsdauer der jeweiligen Regierung niederschlug. Allerdings ist das Monopol der Regio-nalparteien durch die Verschärfung des regionalen Parteiwettbewerbs in Katalonien, Ga-lizien und im Baskenland geschwächt worden. Diese Entwicklungen schlagen sich in in-nerparteilichen Konfl ikten der Regionalorganisationen nationaler Großparteien nieder und wirken zunehmend auf die nationale Ebene zurück (Wilson 2012; Stefuriuc 2009).
Ähnlich wie in Deutschland, sind minimale Gewinnkoalitionen europaweit mit 36 Prozent aller Koalitionen die am stärksten verbreitete Regierungsform. Neben Luxem-burg, Österreich und Deutschland fallen auch in Estland, der Tschechischen Republik, in der Slowakei und in Polen mehr als Hälft e aller gebildeten Koalitionen in diese Kategorie. Gleichzeitig zeichnet sich in mehreren Staaten, darunter Belgien, die Niederlande, Irland oder Portugal, eine Entwicklung hin zu minimalen Gewinnkoalitionen (aber auch zu Minderheitsregierungen) ab. Dieser Trend wird zum Teil auf die sinkende Bedeutung etablierter Parteien zurückgeführt, deren Stimmanteil in Westeuropa in den letzten zwei Jahrzehnten im Schnitt um 6.5 Prozent gesunken ist (Keman 2011: 20).
Demgegenüber werden „surplus coalitions“ mit nur 18 Prozent aller Regierungen deutlich seltener gebildet. Besonders oft kamen solche Koalitionen in Finnland vor (60 Prozent), aber auch in Ungarn, wo sich immerhin die Hälft e aller Regierungen auf eine übergroße Mehrheit stützen konnte. Auch in den Ländern mit stark konkordanzdemo-kratischen Elementen, wie den Niederlanden und Belgien, waren „surplus coalitions“ stark verbreitet, auch wenn die Entwicklung in den letzten Jahren auch dort eher in die
281Koalitionen von Parteien
Richtung von minimalen Gewinnkoalitionen oder Minderheitsregierungen zu gehen scheint (Keman 2011: 21). Die Gründe, die für eine Bildung von „surplus coalitions“ spre-chen, sind vielfältiger Natur: Sie können auf das Bestreben der Parteien zurückgeführt werden, die Lasten des Regierens, bestehend in einer rückläufi gen Wählerzustimmung während der Legislaturperiode, auf mehrere Partner zu verteilen, auf die notwendige Absicherung politischer Mehrheiten angesichts häufi ger Fraktionswechsel, aber auch auf hohe Mehrheitserfordernisse im Gesetzgebungsprozess, z.B. bei Zweidrittelhürden. In Finnland wurden z.B. blockübergreifend kleinere Parteien links und rechts der Mitte in die „Regenbogenkoalition“ integriert, um diese ideologisch besser ausbalancieren zu können (vgl. Jungar 2002). Als in Ungarn 1994 die an die Macht gewählte post-sozialis-tische Nachfolgepartei MSZP als erste eine blockübergreifende Koalition einging, nahm sie den aus der antikommunistischen Opposition hervorgegangenen SZDSZ mit in die Regierungsverantwortung, obwohl dessen Beteiligung rechnerisch für die Mehrheitsbil-dung nicht erforderlich gewesen wäre. Jedoch hofft e die MSZP von einer Beteiligung der ehemaligen Regimeopposition, die demokratische Glaubwürdigkeit der Regierung auf diese Weise insgesamt stärken und die hohen Hürden für eine Änderung der Verfassung überwinden zu können.
Aus der in Tabelle 1 dargestellten prozentualen Verteilung von Koalitionstypen geht hervor, dass in vielen Ländern keine eindeutigen Koalitionsmuster dominieren; zudem wird es im Zeitverlauf zunehmend schwerer, solche Muster einzelnen Staaten eindeutig zuzuschreiben. Insbesondere in den neuen Demokratien Osteuropas haben sich oft keine typischen Koalitionsmuster etabliert. Gleichwohl öff nete sich dort ein neues Forschungs-feld, in dem unter neuen Bedingungen klassische Th eorien der Koalitionsforschung überprüft werden können. Zu den auff älligen Unterschieden im Koalitionsverhalten ge-hören die im Vergleich zu Westeuropa niedrigeren Werte für Einpartei-Mehrheits- und Minderheitsregierungen, während minimale Gewinnkoalitionen häufi ger gebildet wur-den. Versucht man, Erklärungen für diese Unterschiede zu fi nden, müssen vor allem die Fragmentierung und Instabilität der Parteiensysteme als wichtige Faktoren berücksich-tigt werden. Die Erfolge neugegründeter Parteien und die zahlreichen Fraktionswechsel erschwerten Regierungsbildungen erheblich (Grotz/Weber 2011:199). Th eorien, welche die Rolle von Parteiideologien in den Mittelpunkt stellen, haben für Osteuropa hingegen eine deutlich niedrigere Erklärungskraft . Sie scheitern mitunter bereits an der schwieri-gen ideologischen Einordnung der ost- und mitteleuropäischen Parteien entlang einer Links-Rechts-Achse (Tavits/Letki 2009). Von größerer Bedeutung ist demgegenüber der historisch gewachsene „regime divide“ zwischen den Anhängern des alten kommu-nistischen Regimes und der Regimeopposition; dieses Cleavage, dessen Prägekraft sich allmählich abschwächt, kann sich jedoch auch mit der Links-Rechts-Achse überlappen (Grzymala-Busse 2001; Savage 2012).
282 Aron Buzogány und Sabine Kropp
4.2 Koalitionsstabilität
In der vergleichenden Regierungslehre gilt die Stabilität von Koalitionen als ein wesent-licher Indikator für die Legitimität und Performanz parlamentarischer Systeme (Saalfeld 2009: 499). Die vergleichende Koalitionsforschung hat, mit einem eindeutigen empiri-schen Fokus auf Westeuropa, eine Vielzahl von institutionellen und strukturellen Fak-toren herausgearbeitet, welche die Stabilität von Regierungen erklären. Dazu gehören Merkmale des politischen Systems (wie die Struktur des Parteiensystems oder Verfas-sungsnormen zur Bestimmung des Regierungschefs), spezifi sche Charakteristika der Koalition (wie der Koalitionstypus oder die ideologische Distanz zwischen den Koaliti-onspartnern), aber auch exogene Eff ekte, wie politische oder wirtschaft liche Krisen, die zur vorzeitigen Beendigung von Koalitionsregierungen führen können. Üblicherweise werden zwei Maßzahlen benutzt, um die Stabilität von Koalitionen zu ermitteln: die ab-solute (durchschnittliche) Dauer von Koalitionen und die relative (durchschnittliche) „Überlebensdauer“, die den Anteil angibt, den Koalitionen von ihrer regulären Amtszeit ausgeschöpft haben.5 Vor allem Kabinette in Luxemburg, Spanien und Schweden amtie-ren durchschnittlich bis zum Ende ihrer möglichen Amtszeit, während sie in Italien im Durchschnitt nur ein Drittel ihrer Amtszeit ausschöpfen können.6
Vergleicht man die Lebensdauer von Koalitionen in West- und Osteuropa, fällt auf, dass westeuropäische Koalitionen eine insgesamt höhere Lebensdauer aufweisen: Wäh-rend westeuropäische Koalitionsregierungen im Schnitt 710 Tage Bestand haben, lag die Lebensdauer in den ost- und mitteleuropäischen Staaten etwa ein Viertel unter diesem Wert (539 Tage). Vergleicht man die Beständigkeit verschiedener Koalitionsformate, be-stätigt sich auch für die osteuropäischen Staaten die Th ese, dass minimale Gewinnkoali-tionen stabiler sind als Minderheitenregierungen oder übergroße Koalitionen. Dagegen erweisen sich Minderheitsregierungen in Westeuropa als haltbarer (488 bzw. 355 Tage), während übergroße Koalitionen in den Ländern Ost- und Mitteleuropas im Schnitt bes-sere Überlebenschancen haben (503 bzw. 383). Bei Minderheitsregierungen kann dieser Unterschied teilweise auf unterschiedliche normative Bewertungen solcher Koalitionen zurückgeführt werden. Während die Minderheitsregierung vor allem in den nordischen Staaten ein durchaus erwünschtes Regierungsformat ist, das durch institutionelle Regeln wie den „negativen Parlamentarismus“, die fehlende formelle Investiturabstimmung oder die vorgeschriebene Wahlfrequenz stabilisiert wird, werden solche Regierungen in Osteuropa eher als Notlösungen interpretiert.
5 Alternativ dazu verwenden Grotz/Weber 2011 den Anteil aller Koalitionen, welche die volle Amtszeit ausgeschöpft haben.
6 Allerdings sind diese dem ERD-Datensatz entnommenen Daten mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil hier auch sog. „caretaker governments“ eingerechnet sind. Dies erklärt auch, warum Deutschland lediglich im Mittelfeld platziert wird (siehe aber die Ausführungen im Kapitel 3).
283Koalitionen von Parteien
Die erstaunliche Stabilität von „surplus coalitions“ in den mittel- und südosteuropäi-schen Staaten geht auf das Bestreben der Parteien zurück, sich für die während der letz-ten zwei Jahrzehnte untergenommenen, einschneidenden sozioökonomischen Reformen und die EU-Integration eine breite Legitimationsbasis zu verschaff en. Ende der Neunzi-gerjahre sind solche „surplus coalitions“ oft als ideologisch heterogene, aber gemeinsame Front „demokratisch“ gesinnter Parteien gegen übermächtige Gegner gegründet worden. Beispiele hierfür sind die Bündnisse gegen das nationalistische Mečiar-Regime in der Slowakei oder gegen die postkommunistische PDSR in Rumänien.
Sieht man von dieser im Vergleich zu Westeuropa erstaunlichen Stabilität übergroßer Koalitionen in den neuen EU-Staaten ab, liegt eine weitere Besonderheit im positiven Zusammenhang zwischen ideologischer Heterogenität von Koalitionen und deren Dauer und Stabilität (vgl. Grotz/Weber 2011). In eine ähnliche Richtung weisen neuere Studien, die eine hohe Stabilität solcher Koalitionen belegen, die den „regime divide“ überwunden haben (Tzelgov 2011). Wird die ideologische Nähe durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu Parteienfamilien gemessen, zeigt sich, dass solche „inkohärenten“ Koalitionen sogar um einiges stabiler sind als solche, die sich aus der gleichen Parteifamilie rekrutieren (Grotz/Weber 2011). Diese Befunde sind keineswegs ein osteuropäisches Spezifi kum: Auch für westeuropäische Staaten fanden sich Belege, dass sich ausgerechnet ideologisch verbundene Koalitionen im Vergleich mit nicht-verbundenen Koalitionen als weniger stabil erwiesen (Saalfeld 2006: 500). Sucht man nach möglichen Erklärungen für dieses Ergebnis, so liegt auch die Annahme nahe, dass Bündnispartner, die ihre jeweiligen Ein-fl ussbereiche voneinander trennen und ggf. unterschiedliche Wählersegmente bedienen, Konfl ikte eher zu vermeiden vermögen als solche, die sich einer ähnlichen Klientel ver-pfl ichtet fühlen und ähnliche inhaltliche Schwerpunkte setzen. In den neuen Mitglieds-staaten spielt möglicherweise auch die mangelnde programmatische Verfestigung der Parteien eine Rolle, die es erschwert, die Zugehörigkeit zu europäischen Parteienfamilien abzubilden.
284 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Tabelle 2 Durchschnittliche Lebensdauer verschiedener Regierungstypen (Mittelwerte)
Mittelwert Minimum Maximum MinK MWC Surplus
Belgien 536 7 1479 56 821 396Bulgarien 740 61 1466 490 1190 846Dänemark 670 40 1329 656 783Deutschland 759 14 1431 24 954 484Estland 529 84 1003 456 566Finnland 451 35 1418 258 451 615Frankreich 638 30 1774 379 907 673Griechenland 810 23 1453 1259 95 135Irland 945 228 1788 842 1229 649Island 743 48 1455 146 907 740Italien 385 9 1605 267 389 490Lettland 416 49 1292 267 423 572Luxemburg 1233 151 1910 1275 467Niederlande 770 80 1616 191 949 903Norwegen 789 23 1415 675 1033Österreich 907 157 1411 529 850 685Polen 423 30 1403 265 581Portugal 621 16 1635 780 449 259Rumänien 445 12 891 468 279 428Schweden 825 166 1442 872 816Slowakei 678 117 1418 185 801 1049Slowenien 597 128 1368 203 879 522Spanien 1096 603 1402 1025TschechischeRepublik
616 37 1409 582 696
Ungarn 770 158 1389 357 683 988Vereinigtes Königreich
992 30 1804 196 769
Quelle: ERD-Datensatz, Andersson/Ersson 2012. MC = minority coalition; MWC = mini mal winning coalition.
Neben Erklärungen, die auf die Binnenstruktur von Koalitionen fokussieren, gelten Merk-male des politischen Systems als wesentliche Bestimmungsfaktoren der Koalitionsstabi-lität. Institutionelle Variablen, wie die formale parlamentarische Investitur des Regie-rungschefs, führen zwar zu Beginn der Legislaturperiode zu einer erhöhten Sterblichkeit
285Koalitionen von Parteien
von Regierungen, jedoch verbessern sie anschließend ihre Überlebenswahrscheinlichkeit (Saalfeld 2007: 22). Eine Studie konnte kürzlich Belege dafür liefern, dass den in der For-schung vernachlässigten Verfassungsnormen zur Bestimmung des Regierungschefs eine große Erklärungskraft zukommt (Schleiter/Morgan-Jones 2009). Insbesondere Spannun-gen zwischen Staatspräsident und Regierungschef können in diesem Zusammenhang Konfl ikte auslösen; dass diese in semi-präsidentiellen Systemen virulenter sind, liegt auf der Hand. Weitere Deutungsversuche heben Strukturmerkmale des Parteiensystems, wie dessen Fragmentierung oder Polarisierung, hervor. Die im Vergleich zu Westeuropa niedrige Koalitionsstabilität in den neuen EU-Mitgliedsstaaten wurde oft mit der star-ken Fragmentierung der Parteienlandschaft erklärt. Eine diachrone Betrachtung zeigt indessen, dass die Koalitionsstabilität in mittel- und südosteuropäischen Ländern trotz einer gewissen Konsolidierung der Parteiensysteme nicht zugenommen hat (Grotz/We-ber 2011). Insgesamt betrachtet liegt jedoch die Vermutung nahe, dass trotz der im Ver-gleich zu Westeuropa anders verlaufenden historischen Entwicklungslinien in den neuen EU-Mitgliedsstaaten nicht nur die Koalitionsformate, sondern auch deren Beständigkeit auf vergleichbare Faktoren zurückzuführen sind (Grotz 2007; Grotz/Weber 2011; Somer-Topcu/Williams 2008).
4.3 Regieren von Koalitionen
Die Regierungspraxis von Koalitionen ist im Vergleich zu den anderen Zweigen der Ko-alitionsforschung ein noch wenig bestelltes Feld. Wie wechselseitige Kontrollmechanis-men ausgestaltet sind und wie Koordination und Konfl iktmanagement innerhalb von Koalitionen erfolgen, spielt allerdings sowohl für die Stabilität von Koalitionen als auch für deren eventuelle Fortsetzung nach einer Wahl eine wichtige Rolle. Dieser Erkenntnis tragen eine wachsende Zahl von Studien Rechnung, die Koalitionsbildung, Regierungs-praxis, und Regierungsstabilität als unterschiedliche, miteinander verknüpft e Abschnitte desselben Lebenszyklus einer Regierung ansehen.
Grundsätzlich lassen sich drei miteinander verbundene Arenen der „coalition gover-nance“ unterscheiden (Strøm et al. 2010: 522). Innerhalb der Regierung fi ndet zunächst durch die Zuteilung von Ministerialposten („portfolio allocation“) eine wechselseitige Ex ante-Kontrolle der Koalitionspartner statt. Die gegenseitige Überwachung der Koaliti-onspartner kann durch das bereits erwähnte „Kreuzstichverfahren“ institutionalisiert werden. In der zweiten, parlamentarischen Arena fi ndet nach einer in manchen Ländern vorgesehenen Investiturabstimmung die tägliche Kontrolle häufi g innerhalb der Fach-ausschüsse statt, welche die ministeriellen Zuständigkeiten zumeist spiegeln. Eine dritte, wesentliche Arena des Koalitionsmanagements wird von den Parteien geformt. Auf die-ser Handlungsebene werden Koalitionsverträge ausgehandelt und Kontrolle und Koordi-nation innerhalb von Koalitionsausschüssen institutionalisiert.
Tabelle 3 fasst Ergebnisse einer Studie zu verschiedenen Ausprägungen der Regie-rungspraxis in mehreren westeuropäischen Staaten zusammen (Strøm et al. 2010). Nur
286 Aron Buzogány und Sabine Kropp
sechs der untersuchten 15 Staaten verwenden nicht das Kreuzstichverfahren, allerdings wurde dieses Verfahren auch in den Ländern, die es anwenden, unterschiedlich intensiv genutzt. Meistens wird das Instrument ohnehin nur in Politikbereichen verwendet, in denen die Koalitionspartner unterschiedliche Präferenzen haben (Falcó-Gimeno 2012). In Deutschland machten weniger als die Hälft e der Bundesregierungen von diesem Inst-rument Gebrauch; zusammen mit Norwegen und Schweden zählt das Land damit zu den europäischen Schlusslichtern.
Die zentralen Steuerungsinstrumente von Regierungsbündnissen sind Koalitionsver-träge. Sie regeln neben der Verteilung von Zuständigkeiten auch Grundsätze der Zusam-menarbeit, wie z.B. das Verbot, den Koalitionspartner im Kabinett zu überstimmen, oder sie legen eine Koordinationspfl icht für den Gesetzgebungsprozess fest. Mittlerweile haben sich schrift lich fi xierte Koalitionsverträge in fast allen Ländern als Standard durchgesetzt (vgl. Tabelle 3). In Schweden, Norwegen, Finnland, Luxemburg und Portugal schlossen alle untersuchten Koalitionen einen solchen Vertrag. Oft werden diese politischen Ver-träge auch veröff entlicht (vgl. Kropp 2008: 543 f.), womit diese eigentlich informellen Abkommen eine höhere Bindekraft entfalten können. Die Parteieliten können, indem sie sich „an den Mast binden“ (Strøm et al. 2008: 165), den „Sirenengesängen“ aus der eigenen Partei widerstehen. Obwohl es keinen eindeutigen statistischen Zusammenhang zwischen der Koalitionsdauer und den prozeduralen Regeln von Koalitionsverträgen gibt (Saalfeld 2007: 197), scheinen sie sich insgesamt zu bewähren. In einer empirischen Studie wurde nachgewiesen, dass immerhin mehr als zwei Drittel aller in Koalitions-verträgen vereinbarten Vorhaben in Regierungsentscheidungen umgesetzt wurden und Vereinbarungen somit tatsächlich eine gewisse Verlässlichkeit bieten (Moury 2011: 400).
287Koalitionen von Parteien
Tabelle 3 Regieren von Koalitionen7
Zahl der Regie-rungen
Kreuzstich-verfahren
FormaleInvesti-tur
Änderungs-recht der Ausschüsse
Schrift li-cher Koali-tionsvertrag
Koalitions-ausschuss
Österreich 17 88 Nein Ja 82 47Belgien 28 79 Ja Ja 71 68Dänemark 17 – Nein Nein 47 –Finnland 33 – Nein Ja 100 42Frankreich 17 88 Nein Nein 47 18Deutschland 22 45 Ja Ja 45 100Griechenland 2 – Ja Nein 50 100Island 22 – Nein Ja 82 –Irland 10 90 Ja Nein 80 100Italien 34 100 Ja Ja 3 100Luxemburg 16 – Ja Nein 100 50Niederlande 23 91 Nein Nein 48 100Norwegen 8 38 Nein Ja 100 14Portugal 6 – Ja Nein 100 100Schweden 7 43 Ja Ja 100 –
Quelle: Strøm/Müller/Markham Smith (2010), S. 525.
Für das Management von Koalitionsstreitigkeiten haben die meisten Staaten Koalitions-ausschüsse eingerichtet (vgl. Tabelle 3). Ähnlich wie in Deutschland, bildeten bisher alle Regierungen in den Niederlanden, Irland, Italien, Griechenland und Portugal ein solches Gremium. Besonders erfolgreich scheinen solche Koalitionsausschüsse zu sein, welche die Akteure auf mehreren Ebenen (wie Partei und Kabinett) zusammenbringen (Saalfeld 2007: 199). Dagegen werden in Ländern, die von Minderheitsregierungen geprägt sind, wie Schweden und Dänemark, solche Gremien kaum (oder allenfalls als Prototyp eines solchen Ausschusses) gebildet, da parlamentarische Mehrheiten häufi g ad hoc ausgehan-delt werden müssen. Die in Koalitionsausschüssen praktizierten Kooperationsnormen können zur Stabilisierung des gegenseitigen Vertrauens und somit dazu beitragen, dass die Partner die Koalition in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen wollen. Wie wich-tig solche eingespielte Normen der Zusammenarbeit sind, zeigte sich nach der Grün-dung der konservativ-liberaldemokratischen Koalition im Vereinigten Königreich, das seit mehr als einer Politikergeneration keine Regierungsbündnisse mehr erlebt hat. Vor diesem Hintergrund bleibt es nur wenig verwunderlich, dass die Regierung von wieder-holten Krisen heimgesucht wurde, die auf das mangelnde Bewusstsein der Regierungs-
7 Die Zahlen sind Prozentangaben aller Koalitionsregierungen
288 Aron Buzogány und Sabine Kropp
mitglieder und Abgeordneten zurückzuführen waren, dass ein gemeinsames Regieren koalitionsinterner Abstimmungen bedarf (Matthews 2011; McLean 2012).
5 Perspektiven der Koalitionsforschung
Die Koalitionsforschung stützt sich heute auf eine Vielzahl von ausdiff erenzierten theo-retischen und empirischen Zugängen. Außer spieltheoretisch orientierten Arbeiten ha-ben auf „dichte Beschreibungen“ setzende Untersuchungen ebenso ihren Platz gefunden wie Vergleichsstudien, die sich auf ein „Small N“ stützen.
Abschließend lassen sich drei als besonders gewinnbringend erscheinende Pfade kar-tieren, welche der vergleichenden Koalitionsforschung einen weiteren Schub verleihen könnten. Erstens erscheint der methodologische Wechselschritt zwischen kontextualisie-renden Analysen und Large N-Studien als ein Gebot der Stunde. Wie in diesem Beitrag immer wieder betont, können von einer regionalen Ausdehnung der Koalitionsforschung auf mittelost- und südosteuropäischen Staaten sowie auf die regionale oder lokale Ebene wichtige neue Impulse erwartet werden, da auf diese Weise institutionelle und struktu-relle Faktoren variiert werden können. Auch die gesonderte Betrachtung von „deviant cases“, von Fällen also, die zunächst keiner gängigen Erklärung entsprechen, kann dabei eine sinnvolle Ergänzung sein (Andeweg et al. 2012).
Zweitens wirkt sich die Europäisierung der Regierungstätigkeit auch auf das Binnenle-ben von Koalitionen aus. Wurden in frühen Europäisierungsstudien Koalitionsregierun-gen lediglich als potentielle Vetospieler betrachtet, gibt es mittlerweile eine wachsende Zahl von Studien, welche den Zusammenhang zwischen transnationaler Integration und Kabinettspolitik, z.B. bei der „portfolio allocation“ (Bäck et al. 2009, 2012), genauer unter die Lupe nehmen. Eine neuere Studie über dänische Minderheitsregierungen zeigt, dass Regierungen in europäisierten Fachpolitiken breitere und stabilere Ad-hoc-Bündnisse etablieren, als das der Fall bei nur auf nationaler Ebene verlaufenden Gesetzgebungspro-zessen der Fall ist (Christiansen/Brun Petersen 2012).
Drittens sollte von der in der Koalitionsforschung noch immer – oft nur aus for-schungspragmatischen Gründen – dominierenden Sicht Abschied genommen werden, dass Parteien einheitliche Akteure sind. Parteiinterne Konfl ikte wirken sich auf alle Di-mensionen der Koalitionspolitik aus. Neben der in diesem Beitrag angesprochenen Frak-tionsdisziplin können parteiinterne Fragmentierungen oder auch Koalitionen innerhalb von Parteien mit in die Forschungsagenda der Koalitionsforschung aufgenommen wer-den (Giannetti/Benoit 2008). Selbstredend erfordert diese Erkenntnis, dass theoretisches und empirisches Neuland beschritten wird. Die Koalitionsforschung scheint mit ihrer Methoden- und Th eorienvielfalt dafür aber gut gerüstet.
289Koalitionen von Parteien
LiteraturAndersson, Staff an/Ersson, Svante (2012): Th e European Representative Democracy Data Archive.
http://www.erdda.se/.Andeweg, Rudy. B./De Winter, Leon/Dumont, Patrick (2012): Puzzles of government formation.
Abingdon: Routledge.Austen-Smith, David/Banks, Jeff rey (1988): Elections, coalitions, and legislative outcomes, in:
American Political Science Review, 84, S. 405-422.Axelrod, Robert (1978): A Coalition Th eory Based on Confl ict of Interest, in: Evan, William. M.
(Hrsg.): Interorganizational Relations. Selected Writings. Harmondsworth: Penguin, S. 44-54.Bäck, Hanna/Dumont, Patrick (2007): Combining Large-n and Small-n Strategies: Th e Way For-
ward in Coalition Research, in: West European Politics, 30, S. 467–50.Bäck, Hanna et al. (2012): European Integration and Prime Ministerial Power. A Diff erential Im-
pact on Cabinet Reshuffl es in Germany and Sweden, in: German Politics, 21, S. 184-208.Bäck, Hanna et al. (2009): Does European Integration Lead to a Presidentialization of Executive
Politics? Ministerial Selection in Swedish Post-War Cabinets, in: European Union Politics, 10, S. 226–252.
Browne, Eric C./Frendreis, John/Gleiber, Dennis (1984): An Events Approach to the Problem of Cabinet Stability, in: Comparative Political Studies, 17, S. 167-197.
Bull, Hans Peter (1999): Die Ein-Partei-Regierung – eine Koalition eigener Art. Beobachtungen eines Teilnehmers, in: Sturm, Roland/Kropp, Sabine (Hrsg.): Hinter den Kulissen von Regie-rungsbündnissen. Koalitionspolitik in Bund, Ländern und Gemeinden. Baden-Baden: Nomos, S. 169-179.
Carrol, Royce/Cox, Gary W. (2012): Shadowing Ministers: Monitoring Partners in Coalition Governments, in: Comparative Political Studies, 45, S. 220-236.
Christiansen, Flemming J./Brun Pedersen, Rasmus (2012): Th e Impact of the European Union on Coalition Formation in a Minority System: Th e Case of Denmark, in: Scandinavian Political Studies, 35, S. 179–197.
Däubler, Th omas/Debus, Marc (2009): Government Formation and Policy Formulation in the Ger-man States, in: Regional & Federal Studies, 19, S. 73-95.
De Swaan, Abram (1973): Coalition Th eories and Coalition Formations. Amsterdam: Elsevier Sci-entifi c Publishers.
Debus, Marc (2007): Pre-Electoral Alliances, Coalition Rejections, and Multiparty Governments. Baden-Baden: Nomos.
Debus, Marc (2008): Offi ce and policy payoff s in coalition governments, in: Party Politics, 14, S. 515-538.
Decker, Frank (2009): Koalitionsaussagen der Parteien vor Wahlen. Eine Forschungsskizze im Kontext des deutschen Regierungssystems, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 40, S. 431-453.
Diermeier, Daniel (2006): Coalition Government, in: Weingast, Barry R./Wittman, Donald A. (Hrsg.): Political Economy. Th e Oxford Handbooks of Political Science. New York: Cambridge University Press, S. 162-179.
Dodd, Lawrence C. (1976): Coalitions in Parliamentary Government. Princeton: Princeton Uni-versity Press.
Downs, William M. (1998): Coalition Government, Subnational Style. Multiparty Politics in Europe’s Regional Parliaments. Columbus: Ohio State University Press.
Druckman, James N. (2008): Dynamic Approaches to Studying Parliamentary Coalitions, in: Po-litical Research Quarterly, 61, S. 479-483.
Druckman, James N. (1996): Party Factionalism and Cabinet Durability, in: Party Politics, 2, S. 397-407.
290 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Druckman, James N./Roberts, Andrew (2005): Context and Coalition-Bargaining – Comparing Portfolio Allocation in Eastern and Western Europe, in: Party Politics, 11, S. 535-556.
Dunphy, Richard/Bale, Tim (2011): Th e radical left in coalition government, in: Party Politics, 17, S. 488-504.
Falcó-Gimeno, Albert (2012): Th e use of control mechanisms in coalition governments: Th e role of preference tangentiality and repeated interactions; in: Party Politics, veröff entlicht am 15. März 2012 unter http://ppq.sagepub.com/.
Freitag, Markus/Vatter, Adrian (2008): Die Demokratien der deutschen Bundesländer. Politische Institutionen im Vergleich. Opladen und Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich – UTB.
Gamson, William (1961): A Th eory of Coalition Formation, in: American Sociological Review, 26, S. 373-382.
Giannetti, Daniela/Benoit, Ken (2008): Intra-party politics and coalition governments. Abingdon- Routledge: Taylor & Francis.
Golder, Sona N. (2005): Pre-electoral Coalitions in Comparative Perspective: A Test of Existing Hypotheses, in: Electoral Studies, 24, S. 543-663.
Grofman, Bernard/Roozendaal, Peter van (1997): Review Article: Modelling Cabinet Durability and Termination, in: British Journal of Political Science, 3, S. 419-451.
Grotz, Florian (2007): Stabile Regierungsbündnisse? Determinanten der Koalitionspolitik in Ost-mitteleuropa, in: Osteuropa, 57, S. 109-122.
Grotz, Florian/Weber, Tim (2011): Regierungskoalitionen: Bildung und Dauerhaft igkeit; in: Grotz, Florian (Hrsg.): Regierungssysteme in Mittel-und Osteuropa, Wiesbaden: VS Verlag, S. 194-216.
Grzymala-Busse, Anna (2001): Coalition Formation and the Regime Divide in New Democracies: East Central Europe, in: Comparative Politics, 1, S. 85-104.
Harfst, Philipp (2001): Regierungsstabilität in Osteuropa. Der Einfl uss von Parlamenten und Par-teien. Discussion Paper FS III 01-204. Berlin: Wissenschaft szentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
Hirscher, Gerhard (1999): Die CSU als Koalitionspartner, in: Sturm, Roland/Kropp, Sabine (Hrsg.): Hinter den Kulissen von Regierungsbündnissen. Koalitionspolitik in Bund, Ländern und Ge-meinden, Baden-Baden: Nomos, S. 96-119.
Jungar, Ann-Cathrine (2002): A Case of Surplus Majority Government: Th e Finnish Rainbow Co-alition, in: Scandinavian Political Studies, 25, S. 57-83.
Keman, Hans (2011): Patterns of multi-party government: Viability and compatibility of coali-tions; in: Political Science, 63, S. 10-28.
King, Gary et al. (1990): A Unifi ed Model of Cabinet Dissolution in Parliamentary Democracies, in: American Journal of Political Science, 34, S. 846-871.
Kopecký, Petr/Mudde, Cas (2002): Th e Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integration in East Central Europe, in: European Union Politics, 3, S. 297-326.
Kropp, Sabine (2001): Regieren in Koalitionen. Handlungsmuster und Entscheidungsbildung in deutschen Länderregierungen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Kropp, Sabine (2003): Regieren als informaler Prozess. Das Koalitionsmanagement der rot-grünen Bundesregierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43, S. 23-31.
Kropp, Sabine (2008): Koalitionsregierungen, in: Gabriel, Oscar W./Kropp, Sabine (Hrsg.): Die EU-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozi-alwissenschaft en (3., aktual. u. erw. Aufl .), S. 514-549.
Kropp, Sabine (2010): Th e Ubiquity and Strategic Complexity of Grand Coalition in the German Federal System, in: German Politics, 19 (Special Issue: Kenneth Dyson and Th omas Saalfeld (Hrsg.): Grand Coalition as Systemic Transformation? Th e German Experience), S. 286-311.
Kropp, Sabine/Sturm, Roland (1998): Koalitionen und Koalitionsvereinbarungen. Th eorie, Analy-se und Dokumentation. Opladen: Leske und Budrich.
291Koalitionen von Parteien
Laver, Michael J./Schofi eld, Norman (1990): Multiparty Government. Oxford: Oxford University Press.
Laver, Michael J./Shepsle, Kenneth A. (1996):Making and Breaking Governments. Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
Leiserson, Michael A. (1966): Coalition in Politics: A Th eoretical Empirical Study. New Haven: Yale University.
Leiserson, Michael A. (1968): Factions and Coalitions in One-Party Japan: An Interpretation Bases on the Th eory of Games, in: American Political Science Review, 62, S. 70-87.
Lijphart, Arend (1999): Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Th irty-Six Countries.New Haven, London: Yale University Press.
Lindenberg, Siegwart (1992): Th e Method of Decreasing Abstraction, in: Coleman, James S./Fara-ro, Th omas J. (Hrsg.): Rational Choice Th eory – Advocacy and Critique. Newbury Part/London/New Dehli: Sage, S. 3-20.
Linhart, Eric (2007): Rationales Wählen als Reaktion auf Koalitionssignale am Beispiel der Bun-destagswahl 2005, in: Politische Vierteljahrsschrift , 48, S. 461-484.
Linhart, Eric/Pappi, Franz Urban/Schmitt, Ralf (2008): Die proportionale Ministerienauft eilung in deutschen Koalitionsregierungen: Akzeptierte Norm oder das Ausnutzen strategischer Vor-teile?, in: Politische Vierteljahresschrift , 49, S. 46-68.
Mair, Peter (2006): Party System Change, in: Katz, Richard S./Crotty, W. (Hrsg.): Handbook of Party Politics. London: Th ousand Oaks, New Dehli: Sage, S. 63-73
Maor, Moshe (1998): Parties, Confl icts and Coalitions in Western Europe. Organisational Deter-minants of Coalition Bargaining. London/New York: Routledge.
Matthews, Felicity (2011): Constitutional stretching: coalition governance and the Westminster model, in: Commonwealth & Comparative Politics, 39, S. 486-509.
McLean, Ian (2012): ”England Does Not Love Coalitions”: Th e Most Misused Political Quotation in the Book; in: Government and Opposition, 47, S. 3-20.
Moury, Catherine (2011): Coalition agreement and party mandate, in: Party Politics, 17, S. 385-404.
Müller, Wolfgang C. (2004): Koalitionstheorien, in: Helms, Ludger/Jun, Uwe (Hrsg.): Politische Th eorie und Vergleichende Regierungslehre. Frankfurt a.M./New York: Campus, S. 267-301.
Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare (1997): Koalitionsregierung in Westeuropa – eine Einleitung, in: dies. (Hrsg.): Koalitionsregierung in Westeuropa. Bildung, Arbeitsweise und Beendigung, Wien: Sigma, S. 9-46.
Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare (1999): Political Parties and Hard Choices, in: dies. (Hrsg.): Po-licy, Offi ce, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Choices. Cambridge: Cambridge University Press, S. 1-35.
Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare (2000): Die Schlüssel zum Zusammensein: Koalitionsabkom-men in parlamentarischen Demokratien, in: van Deth, Jan W./König Th omas (Hrsg.): Europäi-sche Politikwissenschaft : Ein Blick in die Werkstatt. Frankfurt/New York: Campus, S. 136-170.
Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare (Hrsg.) (2003): Coalition Governments in Western Europe. New York: Oxford University Press.
Niedermayer, Oskar (2001): Nach der Vereinigung: Der Trend zum fl uiden Fünfparteiensystem, in: Gabriel, Oscar W./Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutsch-land. (2. Aufl age), Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 107-127.
Niedermayer, Oskar (2010): Von der Zweiparteiendominanz zum Pluralismus: Die Entwicklung des deutschen Parteiensystems im westeuropäischen Vergleich, in: Politische Vierteljahres-schrift , 51, S. 1-13.
Nikolényi, Csaba (2004): Cabinet Stability in Post-Communist Central Europe, in: Party Politics, 2, S. 123-150.
292 Aron Buzogány und Sabine Kropp
Pappi, Franz Urban/Herzog, Alexander/Schmitt, Ralf (2006): Koalitionssignale und die Kombi-nation von Erst- und Zweitstimme bei den Bundestagswahlen 1953 bis 2005, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 37, S. 493-513.
Pedersen, Helene Helboe (2010): How intra-party power aff ect the coalition behaviour of political parties, in: Party Politics, 16, S. 737-754.
Peleg, Bezalel (1981): Coalition Formation in Simple Games with Dominant Players, in: Internati-onal Journal of Game Th eory, 1, S. 11-33.
Pridham, Geoff rey (2002): Coalition Behaviour in New Democracies of Central and Eastern Euro-pe: Th e Case of Slovakia, in: Journal of Communist Studies and Transition Politics, 2, S. 75-102.
Putz, Sebastian (2008): Macht und Ohnmacht kleiner Koalitionspartner. Rolle und Einfl uss der FDP als kleine Regierungspartei in vier ostdeutschen Landesregierungen (1990-1994). Baden-Baden: Nomos.
Riker, William H. (1962): Th e Th eory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press.Saalfeld, Th omas (2006): Parteiensystem und Kabinettsstabilität in Westeuropa 1945-1999, in:
Niedermayer, Oskar/Stöss, Richard/Haas, Melanie (Hrsg.): Die Parteiensysteme Westeuropas. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 477-506.
Saalfeld, Th omas (2010): Regierungsbildung 2009: Merkel II und ein höchst unvollständiger Koa-litionsvertrag, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 41, S. 181-206.
Saalfeld, Th omas (2007): Koalitionsstabilität in 15 europäischen Demokratien von 1945 bis 1999: Transaktionskosten und Koalitionsmanagement, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 38, S. 180-206.
Saalfeld, Th omas (2009): Die Stabilität von Koalitionsregierungen im europäischen Vergleich: Empirische Befunde und institutionelle Erklärungsansätze, in: Schrenk Klemens H./Soldner, Markus (Hrsg.): Analyse demokratischer Regierungssysteme. Festschrift für Wolfgang Ismayr, Wiesbaden: VS Verlag, S. 499-523.
Savage, Lee M. (2012): Who gets in? Ideology and government membership in Central and Eastern Europe; in: Party Politics, 18, S. 21-40.
Schmidt, Manfred G. (1996): Th e Grand Coalition State’, in: Colomer, Joseph M. (Hrsg.): Political Institutions in Europe. London, New York: Routledge, S. 62-98.
Schmitt-Beck, Rüdiger/Faas, Th orsten (2009): Die hessische Landtagswahl vom 27. Januar 2008: Wiederkehr der „hessischen Verhältnisse“, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 40, S. 16-34.
Schreckenberger, Waldemar (1994): Informelle Verfahren der Entscheidungsvorbereitung zwi-schen der Bundesregierung und Mehrheitsfraktionen: Koalitionsgespräche und Koalitionsrun-den, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 25, S. 329-346.
Schleiter, Petra/Morgan-Jones, Edward 2009. Constitutional Power and Competing Risks: Mon-archs, Presidents, Prime Ministers, and the Termination of East and West European Cabinets, in: American Political Science Review, 103, S. 496-512.
Shabad, Goldie/Slomczynski, Kazimierz M. (2004): Inter-party mobility among parliamentary candidates in post-communist East Central Europe, in: Party Politics, 10, S. 151-176.
Somer-Topcu, Zeynep/Williams, Laron K. (2008): Survival of the Fittest? Cabinet Duration in Postcommunist Europe, in: Comparative Politics, 40, S. 313-329.
Stefuriuc, Irina (2009): Explaining Government Formation in Multi-level Settings. Coalition Th e-ory Revisited: Evidence from the Spanish Case, in: Regional & Federal Studies, 19, S. 97-116.
Strøm, Kaare (1990): Minority Government and Majority Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
Strøm, Kaare/Müller, Wolfgang C./Bergman, Torbjörn (Hrsg.) (2008). Cabinets and Coalition Bar-gaining: Th e Democratic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.
Strøm, Kaare/Bergman Torbjörn (2011): Th e Madisonian Turn: Political Parties and Parliamenta-ry Democracy in Nordic Europe. Minnesota: University of Michigan Press.
293Koalitionen von Parteien
Strøm, Kaare/Müller, Wolfgang C./Markham Smith, Daniel (2010): Parliamentary Control of Co-alition Governments, in: Annual Review of Political Science, 13, S. 517-535.
Tavits, Margit/Letki, Natalya (2009): When left is right: party ideology and policy in post-commu-nist Europe; in: American Political Science Review, 103, S. 555-569.
Timmermans, Arco (2006): Standing apart and sitting together: Enforcing coalition agreements in multiparty systems, in: European Journal of Political Research, 45, S. 263-283.
Tsebelis, George (1990): Nested Games, Rational Choice in Comparative Politics. Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press.
Tsebelis, George (2002): Veto Players: How Political Institutions Work. New York: Russell Sage Foundation and Princeton NJ: Princeton University Press.
Tzelgov, Eitan (2011): Communist successor parties and government survival in Central Eastern Europe; in: European Journal of Political Research, 50, S. 530-558.
Van Deemen, A.M.A. (1989): Dominant players and minimum size coalitions, in: European Jour-nal of Political Research, 17, S. 313-332.
Van Roozendaal, Peter (1992): Th e eff ect of dominant and central parties on cabinet composition and durability, in: Legislative Studies Quarterly, 17, S. 5-36.
Wilson, Alex (2012): Multi-level Party Systems in Spain; in: Regional & Federal Studies, 22, S. 123-139.













































![Dukhan, a Turkic variety of Northern Mongolia: Description and Analysis. Wiesbaden: Harrassowitz. [Turcologica 76.] 2011](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63356336253259241700843c/dukhan-a-turkic-variety-of-northern-mongolia-description-and-analysis-wiesbaden.jpg)