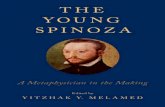Boehler, Arno: Deleuze in Spinoza – Spinoza in Deleuze., in: Violetta L. Waibel (Ed.):...
Transcript of Boehler, Arno: Deleuze in Spinoza – Spinoza in Deleuze., in: Violetta L. Waibel (Ed.):...
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
1
Deleuze in Spinoza – Spinoza in Deleuze.
Wissen wir was das Medium „Körper“ kann?
Arno Böhler
I. Spinoza: der Denker absoluter Immanenz.
Für Deleuze ist Spinoza der Prinz der Philosophie, weil es ihm als Erstem gelungen ist, die
Substanz gänzlich von der Idee der Immanenz her zu denken. „Wer sich ganz und gar dessen
bewusst war, dass die Immanenz nur sich selber immanent und damit eine Ebene ist, die von den
Bewegungen des Unendlichen durchlaufen wird, angefüllt mit den intensiven Ordinaten – ist
Spinoza. Darum ist er auch der Erste unter den Philosophen.“1 Wenn Spinoza im ersten Teil
seiner Ethik Substanz als etwas definiert, „was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen
wird, d. h. das, dessen Begriff nicht des Begriffs eines anderen Dinges bedarf, von dem her er
gebildet werden müsste“ (E 5, d. 3), dann ist es offenkundig die Idee dieses In-sich-selbst-seins,
von der her Spinoza das auslegt, was er unter Substanz versteht. Nicht die Rückführung aller
Modi und Attribute auf eine einzige Substanz macht das charakteristische Moment aus, das ihn,
Spinoza, für Deleuze zum Fleisch gewordenen „Christus der Philosophen“2 macht, sondern die
Bestimmung der Substanz vom quod in se est her, von der Idee reiner Immanenz, die sich in ihrer
Inständigkeit in sich selbst gänzlich selbst genügt.
„Nicht die Immanenz ist es, die sich auf die Substanz und die Modi bei Spinoza bezieht, im
Gegenteil, die spinozistischen Begriffe von Substanz und Modi sind es, die sich auf die
Immanenzebene als ihre Voraussetzung beziehen. Diese Ebene präsentiert uns ihre beiden Seiten,
1 Gilles Deleuze, Was ist Philosophie? Frankfurt a. M. 2000, 57. Im Folgenden zitiert als „Deleuze, Was ist Philosophie“. 2 „Man möchte sagen, DIE Immanenzebene sei zugleich das, was gedacht werden muss, und das, was nicht gedacht werden kann. […] Was nicht gedacht werden kann und doch gedacht werden muss, wurde ein einziges Mal gedacht, wie Christus ein einziges Mal Fleisch geworden ist, um für dieses Mal die Möglichkeit des Unmöglichen aufzuzeigen. Daher ist Spinoza auch der Christus der Philosophen, und die größten Philosophen sind Apostel, die diesem Mysterium näher oder ferne stehen. Spinoza, das unendliche Philosophen-Werden.“ Deleuze, Was ist Philosophie, 68-69.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
2
die Ausdehnung und das Denken, oder, genauer, ihre beiden Potenzen, Seinspotenz und
Denkpotenz. Spinoza – das ist der Taumel der Immanenz […].“3
Die Idee von Immanenz ist für ihn also kein konstitutives Wesensprädikat von Substanz, sondern
gerade umgekehrt. „Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur;“ (E 5, d. 3).
Einzig und allein das, was in sich selbst die Kraft besitzt, sich durch sich selbst zu konzipieren
und folglich gänzlich aus sich selbst heraus auszudrücken (exprimit4), eignet sich dafür, Substanz
genannt zu werden.5
Ganz im Sinne der antiken Philosophie entspricht der οὐσία („Substanz“) folglich derjenige
Bewegungsmodus, den die Griechen φύσις (Physis) nannten: Die Bewegung eines aus sich selbst
heraus rollenden Rades, die Ereignis wird, wenn etwa eine Blume aus ihrem eigenen Sperma und
Licht (φῶς) heraus aufgeht, indem sie am eigenen Leib die Natur ihres Blumensamens figurativ
zum Ausdruck bringt und damit an etwas, nämlich an der Blume selbst, dinghaft zur Schau stellt,
ihre immanentes Wesen also ek-phantisch6 demonstriert. Seit Aristoteles wurde diese
Bewegungsform bekanntlich vom technischen Hervorbringen und pathischen Erleiden von
Dingen begrifflich unterschieden, da in diesen beiden Bewegungsmodi etwas gerade nicht aus
sich selbst heraus konstruiert, sondern von etwas anderem (technisch) ins Sein hervorgebracht
wird – ein Bettgestell wird nicht von einem anderen Bettgestell sondern von einem Menschen
hergestellt –, bzw. etwas von etwas anderem im eigenen Dasein (pathisch) affiziert wird. Und so
kann auch Spinoza ganz klassisch Substanz weiter definieren als dasjenige, dessen
selbstimmanente Konzeption nicht der Konzeption eines anderen äußeren Dings bedarf, um in
sich selbst ek-sistent, d. h. aus-drücklich zu sein. „Per substantiam intelligo id, […] cujus
conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari debeat.“ (E 4, d. 3). Substanz ist per
3 Deleuze, Was ist Philosophie, 57. 4 „Zuerst und vor allem drückt sich die Substanz in ihren Attributen aus, und jedes Attribut drückt ein Wesen aus. Sodann aber drücken sich die Attribute ihrerseits aus: sie drücken sich in den von ihnen abhängigen Modi aus, und jeder Modus drückt eine Modifikation aus. Wir werden sehen, dass die erste Ebene als die einer eigentlichen Konstitution, fast einer Genealogie des Wesens der Substanz verstanden werden muss.“ Gilles Deleuze, Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. München 1993, 18. Im Folgenden zitiert als „Deleuze, Spinoza Ausdruck“. Vgl. dazu vor allem die folgenden Stellen in Spinozas Ethik: „aeternam et infinitam essentiam exprimit“ (E 7) sowie „aeternam et infinitam certam essentiam exprimit“, „aeternitatem, et infinitatem exprimunt“, „realitatem sive esse substantiae exprimit“ (E 21). 5 Vgl. Deleuze, Spinoza Ausdruck, 17–25. 6 Zur ek-phantischen Präsenz vgl. Dieter Mersch: „Negative Präsenz“, in: Arno Böhler; Susanne Granzer (Hg.): Ereignis Denken. Wien 2009, 107-114.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
3
Definition das, was von nichts anderem äußerlich abhängt und folglich ist sie als eine Entität zu
bestimmen, die den Grund ihrer Existenz gänzlich in sich selbst und gerade nicht in einer anderen
besitzt, wie es bei endlichen Modi der Fall ist.7 Als ein solches, sich selbst immanentes Leben,8
ist sie, wie Spinoza gleich in der ersten Definition seiner Ethik expliziert, notwendigerweise auch
causa sui. Denn: „Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Essenz Existenz
einschließt, anders formuliert das, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann.“ (E 5).
Insofern Spinoza das, was ihm Substanz heißt, in einem mehrfältigen Sinne von der Idee reiner
Immanenz her bestimmt, insofern, und nur insofern, gebührt ihm für Deleuze das Prädikat, der
Erste und Künftigste unter den Philosophen gewesen zu sein. „Er hat die ‚beste’, das heißt reinste
Immanenzebene gezeigt, errichtet, gedacht, diejenige, die sich nicht dem Transzendenten
preisgibt und nichts vom Transzendenten zurückgibt, diejenige, die am wenigsten Illusionen,
schlechte Gefühle und irrige Wahrnehmungen erregt.“9
1. Spinoza: der Lebensphilosoph.
Deleuze hat die philosophische Bedeutung dieses Gedankens zwei Monate vor seinem Tod in
seinem letzten literarischen Vermächtnis Die Immanenz: Ein Leben...10 noch einmal emphatisch
hervorgehoben. Schon die auffällige Interpunktion des Titels – Die Immanenz wird durch zwei
Doppelpunkte (quasi definitorisch) mit einem Leben in Beziehung gesetzt, das seinerseits mit
drei Auslassungspunkten in einer indefiniten, unendlich ergänzbaren Reihe endet –, weist
eindringlich darauf hin, dass die spinozistische Idee einer reinen, absoluten Immanenzebene für
7 „Dasjenige Ding heißt in seiner Gattung endlich, das von einem anderen derselben Natur begrenzt werden kann.“ (E 5, d. 2). 8 „’Man möchte sagen, die reine Immanenz sei Ein Leben und nichts anderes. Sie ist nicht Immanenz im Leben, vielmehr ist sie als Immanentes, das in nichts ist, selbst ein Leben. Ein Leben ist die Immanenz der Immanenz, die absolute Immanenz. Es ist vollkommenes Vermögen, vollkommene Glückseligkeit.’ […] Ein Leben manifestiert sich in den Ereignissen, die einem Individuum zustoßen und es – vielleicht nur unmerklich – vom Weg abkommen lassen oder es sogar aus der Bahn werfen.“ Friedrich Balke, Gilles Deleuze. Frankfurt a. M./New York 1998, 108. 9 Deleuze, Was ist Philosophie, 69. 10 Gilles Deleuze, „Die Immenanz: ein Leben…“, in: Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie. München 1996, 29-33.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
4
Deleuze nur dann in ihrer wesenhaften Bedeutung erschlossen wird, wenn sie definitiv als
dasjenige verstanden wird, was im Zuge eines Lebens jedes Mal wieder von Neuem
ereignet/Ereignis geworden sein wird – Ein Leben. Und zwar insofern es selbst als Er-eignis
einer Immanenzebene Ereignis/ereignet wird. Weil Immanenz nur im Zuge des Lebens eines
Lebens stattfindet, sie also nur im Er-eignis eines Lebens selbst aus-drücklich wird, daher lässt
sie sich für Deleuze niemals vor dem Leben eines konkreten Lebens in ihrer Eigenheit und
Eignung bestimmen. Definiert sie sich doch einzig und allein in, durch und aus der Art und
Weise heraus, wie ein Leben tatsächlich gelebt, erlebt, ereignet, eräugt,11 sprich Ereignis worden
sein wird.
Spinoza, der Denker der Immanenz. Dieser Ehrentitel ist für Deleuze folglich alles andere als ein
Titel für das Denken eines Denkers, der bloß die leblose Geometrisierung und schematisierende
Mathematisierung eines univoken Seins gelehrt hätte.12 Für Deleuze ist er vielmehr ein, mit
Bergson und Nietzsche in einer Reihe und Linie stehender Philosoph des Lebens! Wobei der
Terminus Leben in diesem philosophischen Kontext nichts anderes bedeutet als das Moment des
Ereignis-Werdens der Immanenzebene selbst: Indem sie sich selbst als immanente Ursache ihrer
selbst in sich selbst äußert, wird die Immanenzebene in diesem, ihrem Er-eignis, sich selbst
dynamisch allererst zu eigen, d. h. lebendig zugeeignet.
René Schérer hat den ereignishaften Zusammenhang von Immanenz & Leben, in dem das eine
Moment, Die Immanenz, das andere, ein Leben definiert und umgekehrt, treffend auf den Punkt
gebracht, wenn er in einer Ouvertüre zu Deleuze schreibt: „Spinoza benutzt gewöhnlich das
lateinische Wort quatenus für den Ausdruck der Substanz (oder der Natur) durch die Modi. Jene
sind die Substanz selbst, insofern sie ausgedrückt ist, das Sein, insofern es Ereignis, Modus oder
11 Zum Verhältnis von Ereignis und Eräugnis bei Martin Heidegger vgl. Michael Wetzel, „Das Ereignis zwischen Eräugnis und Bewägung“, in: Arno Böhler; Susanne Granzer (Hg.): Ereignis Denken. Wien 2009, 259-267. 12 Wenn Hegel Spinoza vorwarf, dass die geometrische Methode ungeeignet sei, die organische Selbstentfaltung des absoluten Begriffs zu demonstrieren, dann darum, weil Hegel die geometrische Methode von der Mathematik, und nicht, wie Spinoza selbst, von den Gemeinbegriffen her verstanden hat, die für Deleuze primär einen biologisch-(chemischen) und keinen mathematischen Sinn haben. Sie beschreiben keine abstrakten idealen Figuren, sondern den regelmäßigen Ordnungszusammenhang der gesetzmäßigen Zusammensetzung verschiedener Teile unter einem Gemeinbegriff (notiones communes). „In diesem Sinne sind die Gemeinbegriffe mehr biologisch als mathematisch und bilden eine natürliche Geometrie, die uns die Einheit der Zusammensetzung der gesamten Natur und die Variationsmodi dieser Einheit verstehen lässt.“ Gilles Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, Berlin 1988, 98. Im Folgenden zitiert als „Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie“.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
5
Singularität ist. Der homo tantum ist ein Leben, insofern es ausgedrückt ist […]: ereignishafter
Ausdruck der Natur, insofern sie Mensch ist.“13
Je mehr ein Leben im Sinne dieses spinozistischen quatenus gelassen wird, die selbstimmanente
Logik seiner Natur im eigenen Leben zum Ausdruck zu bringen, umso mehr folgt und gehorcht
es tatsächlich der Explikation seiner ihm inhärenten Wesensnatur. Man lebt dann ein Leben, das
sich gleichsam als schlichte geometrische Folge der eigenen immanenten Essenz realisiert. Prä-
individuell singulär, als wäre man selbst ein partikulares Medium des Lebens selbst, das in uns
selbst nach einen modalen Ausdruck seiner selbst verlangt.
Schon Giorgio Agamben hat in seiner Hommage an Gilles Deleuze mit dem Titel „Die Absolute
Immanenz“ auf die bemerkenswerte Fügung aufmerksam gemacht, dass der Begriff des Lebens
sowohl im Zentrum des letzten Textes von Michel Foucault als auch von Gilles Deleuze
gestanden hatte.
„Der Sinn dieser testamentarischen Fügung (in der Tat handelt es sich in beiden Fällen um eine
Art Testament) erschöpft sich nicht in den geheimen Banden, die zwischen Freunden bestehen
können. Er schließt die Formulierung eines Vermächtnisses ein, das sich unmissverständlich an
die kommende Philosophie wendet. Wenn sie dieses Vermächtnis annehmen will, wird sie von
jenem Begriff des Lebens ausgehen müssen, auf den die letzte Geste der Philosophen wies –
zumindest ist das die Annahme, von der unsere Untersuchung ausgeht.“14
Ein Leben als dynamisches Er-eignis einer reinen Immanenzebene denken lernen, die sich in sich
selbst, aus sich selbst heraus und durch sich selbst immanent zum Ausdruck bringt, dieser
Gedanke ist es, den uns Spinoza als Denker hinterlassen hat, um ihn als künftige Aufgabe der
Philosophie zu bedenken. Ihn nachzudenken heißt für Agamben, heißt für Deleuze, im
eigentlichsten Sinne Spinozist zu sein. Die Teilung dieser substantiellen Aufgabe eines künftigen
Denkens der Immanenz stiftet erst jenes spinozistische Wir, mit dem Deleuze nicht umsonst sein
kleines Spinozabüchlein Spinoza Praktische Philosophie enden ließ, um den Text mit dem
Hinweise auf ein Kommendes zu beschließen.
13 René Schérer, „Homo tantum, Das Unpersönliche: eine Politik“, in: Jean-Luc Nancy; René Schérer: Overtüren Texte zu Gilles Deleuze. Zürich-Berlin 2008, 12-13. 14 Giorgio Agamben, Bartleby oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz. Berlin 1998, 79.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
6
2. Spinoza und Wir.
„’Spinoza und wir’: diese Formel kann vieles meinen, unter anderem auch ‚wir inmitten
Spinozas’. Den Versuch, Spinoza von der Mitte her wahrzunehmen und zu verstehen. Im
Allgemeinen fängt man an mit dem ersten Prinzip eines Philosophen. Doch zählen das dritte,
vierte oder das fünfte Prinzip genauso. Alle Welt kennt das erste Prinzip Spinozas: eine einzige
Substanz für alle Attribute. Doch ebenso kennt man das dritte, vierte oder fünfte Prinzip: eine
einzige Natur für alle Körper, eine einzige Natur für alle Individuen, eine Natur, die selbst ein auf
unendlich viele Weisen variierendes Individuum ist. Das ist nicht mehr die Affirmation einer
einzigen Substanz, das ist die Aufdeckung eines gemeinsamen Plans der Immanenz.“15
Spinoza von der Mitte her denken – wir in Spinoza, Spinoza in uns – mit dieser Aufgabe ist für
Deleuze nichts anderes als die Einkehr des Denkens in die denkerische Aufdeckung eines von
allen Körpern, Seelen und Individuen gemeinsam geteilten Immanenzplans gemeint. Er wird von
allen Dingen expliziert, und zwar mehr oder weniger, je nach ihrem Vermögensgrad, vom
Ganzen der Welt affiziert zu werden und die Mannigfaltigkeit dieser Affektionen ihrer
immanenten Wesensnatur gemäß tätig zusammensetzen, woraus die Quantität, Qualität und der
Intensitätsgrad der Lust- und Unlustgefühle des jeweiligen Lebewesens folgt. „Dieser Immanenz-
oder Konsistenzplan ist kein Plan im Sinn eines Entwurfs im Geist, kein Projekt, Programm,
sondern ein Plan im geometrischen Sinn, Schnitt, Überschneidung, Diagramm. Inmitten von
Spinoza zu sein, heißt dann, an diesem modalen Plan zu arbeiten, beziehungsweise, sich auf
diesem Plan anzusiedeln, was eine Lebensweise, eine Art zu leben, impliziert.“16
Wieder betont Deleuze an dieser Stelle, dass das Er-eignis der Immanenz kein abstrakter Plan
eines bloß mathematisch-geometrischen Kalküls, sondern der Vollzug einer konkreten
Lebensweise ist, deren Performance im Modus der eigenen Existenz zum Ausdruck gebracht
werden muss. Als ein allen Modi immanenter Plan ist er zwar jedem Modi selbst-inhärent.
Insofern er jedoch modalisierbar ist, ist der Immanenzplan eine allen Entitäten immanente Ebene, 15 Gilles Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 159. 16 Gilles Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 159.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
7
auf der sich ein Modi mehr oder weniger explizit ansiedeln kann, um den Modus des eigenen
Lebens ausdrücklich von da her, und nicht von woanders her, zu vollziehen, zu stratifizieren,
auszudrücken.
Für Deleuze beginnt man, immer mehr auf diese konkrete Art und Weise inmitten der Natur da
zu sein, je mehr man bereit ist, all jene Modifikationen des Lebens im Da-sein zu entmachten, die
das immanente Tätigkeitsvermögen (agendi potentia) eines Lebewesens reduzieren, indem sie es
hemmen, seiner Wesensnatur ek-sistentiell Ausdruck zu verleihen. Im Gegenzug dazu muss man
bereit sein, all jene Ausdrucksformen der Natur inmitten der Natur aktiv zu fördern, die dem
selbstimmanenten Ausdruck des Immanenzplans der Natur in der Natur folgen und auf ihre Art
und Weise dadurch selbsttätig zum Ausdruck verhelfen. „So findet sich die eigentliche ethische
Frage mit der Frage der Methode verbunden: Wie erreichen wir es, aktiv zu sein?“17
Aktiv und frei ist für Spinoza ein Lebewesen paradoxerweise aber nur dann, wenn und solange es
im Stande ist, als lebendige geometrische Folge seines eigenen immanenten Wesens ek-sistent zu
werden. Nur unter dieser Bedingung lebt es in der Tat ein freies, sprich ungehemmtes Leben, das
mit seiner Natur in Übereinstimmung steht und daher notwendigerweise ein freudiges Leben sein
wird. Hingegen verliert ein endlicher Modus immer mehr die Eigenschaft, Er-eignis seiner
immanenten Natur zu sein, je mehr er im Zuge seines Anwesens inmitten der Natur von äußeren
Umständen daran gehindert wird, seiner immanenten Essenz existentiell Ausdruck zu verleihen.
Ein solches, pathisch gehemmtes Lebewesen wird mit absoluter Notwendigkeit eine Vielzahl
trübseliger Leidenschaften empfinden müssen. Es wird eine große Zahl passiver Affektionen
erleiden, während ein endlicher Modus, der seiner immanenten Wesensnatur folgen und diese im
eigenen Leben quasi automatisch zum Ausdruck bringen kann, mit absoluter Notwendigkeit eine
große Zahl freudiger, aktiver Affektionen erleiden wird, die ihm wie von selbst das Gefühl der
Freiheit und Stimmigkeit (Adäquatheit) des eigenen Lebens vermitteln werden. „Die große Frage,
die sich in Bezug auf den endlichen existierenden Modus stellt, ist also die, ob er zu aktiven
Affektionen gelangen wird, und wie. Diese Frage ist die im eigentlichen Sinn ‚ethische’ Frage.“18
Während ein schlechter Lebensmodus unsere Kraft, in uns, durch uns und aus uns selbst heraus
inmitten der Natur tätig zu sein vergiftet, fördert und stimuliert ein guter Lebensmodus die 17 Deleuze, Spinoza Ausdruck, 194-195. 18 Deleuze, Spinoza Ausdruck, 193.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
8
immanente Ausdruckskraft eines Lebewesens. Befähigt sie einen endlichen Modus doch immer
mehr, seine immanente Natur (natura naturans) inmitten der Natur (natura naturata) zur Ek-
sistenz zu bringen. Ein falsches, inadäquates Leben modifiziert den Immanenzplan der Natur
inmitten der Natur hingegen so, dass das Tätigkeitsvermögen der Lebewesen verringert,
durchkreuzt, geschnitten, beschnitten, kurz gesagt verringert wird – wodurch es für Spinoza eben
zu einer Vergiftung ihres Immanenzplans kommt. Diese inadäquaten Modifikationen der Natur
inmitten der Natur außer Kraft zu setzen, indem sie im Zuge der Ausbildung der ersten und
zweiten Erkenntnisart zunächst einmal rational verstanden und in der dritten Erkenntnisart
schließlich in Hinblick auf existierende Einzeldinge intuitiv eingesehen und in Richtung auf eine
Vermehrung von Freude und Verminderung von Trübsal vernünftig ausgerichtet, organisiert und
letztlich adäquat modifiziert werden, ist die eigentlich (soteriologische) Intention von Spinozas
Ethik. Unzweifelhaft trägt sie stark rationalistische Züge, insofern es die vernünftige Organisation
unserer Affekte ist, die uns methodisch gesehen eine Rückkehr zum Immanenzplan der Natur
verspricht. Dennoch dürfen wir dabei nicht vergessen, dass diese, Spinozas Rationalität von
Anfang an so konzipiert ist, dass die vernünftige Organisation unseres Da-seins für ihn eine
soteriologische Funktion erfüllt, insofern sie nichts anderem dient, als dem Immanenzplan der
Natur inmitten der Natur existentiell zum Durchbruch zu verhelfen, indem die natura naturans
von uns Menschen eben vernünftig eingesehen und die natura naturata allmählich zu einem
adäquaten Ausdruck derselben modifiziert wird. (Vgl. E 63-67). Die spinozistische Vernunft ist
daher bekanntlich weder etwas Widernatürliches, noch sind die Affekte im spinozistischen Sinne
irrational. Sie ist vielmehr durch und durch als soteriologische Vernunft konzipiert – als
menschliches Stratifikationsprinzip, das wir, wir Menschen, brauchen, um inadäquate
Modifikationen der Natur inmitten der Natur als inadäquat erkennen und in Richtung auf eine
adäquate Organisation unserer Affekte modalisieren zu lernen. Nicht „die Vernunft“, sondern die
Natur der Vernunft, insofern sie uns als brauchbares Mittel zur Verfügung steht, uns mit dem
Immanenzplan der Natur wieder zu versöhnen, ist das, was Spinoza an ihr schätzt.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
9
II. Spinoza: Der Denker einer praktischen Philosophie.
Die Idee reiner Immanenz hat für Deleuze damit aber auch einen klar verortbaren Gegner
bekommen, dem sich Spinozas Ethik ganz praktisch entgegensetzt, um ihm, seinem mächtigen
Widersacher, ein für alle Mal seine Herrschaft zu entziehen: Die Idee eines transzendenten
Lebens, das unser immanentes Leben notwendigerweise zu einer großen Illusion erklären und
über dasselbe damit zwangsläufig Trübsal verbreiten und irrige Wahrnehmungen predigen muss,
insofern es naturgemäß gezwungen ist, die Immanenz unseres Lebens einem kommenden, einem
inadäquaten, einem schlechten, weil durch und durch falschen Leben zu opfern, anstatt die
Ewigkeit der Immanenz des Lebens im Zuge der Ausbildung der dritten Erkenntnisart intuitiv zu
erkennen (vgl. E 183) und inmitten der Zeitlichkeit selbst freudvoll bejahen zu lernen (vgl. E 565-
595)!19
Von daher gesehen ist es nur schlüssig, wenn Deleuze in seinem kleinen Spinozabüchlein
Spinoza Praktische Philosophie angesichts einer moralinsüchtig gewordenen
Menschheitsgeschichte die, im ersten Anschein rein resignativ anmutende Feststellung tätigt:
„Das Leben ist durch die Kategorien von Gut und Böse, Verstoß und Verdienst, Sünde und
Erlösung vergiftet.“20 Spinoza ist für Deleuze jedoch kein, wie Nietzsche womöglich sagen
würde, passiver (Kultur-)Nihilist. Haben wir doch schon gehört, dass er für Deleuze auch eine
konkrete Lebensphilosophie konzipiert hat, die exakt darin besteht, „alles aufzuzeigen, was uns
vom Leben trennt; alle die gegen das Leben gerichteten transzendenten Werte, die an die
Bedingungen und Illusionen unseres Bewusstseins gebunden sind.“21 Diese schlechten
Modifikationen des Lebens systematisch durchzudeklinieren und aufzudecken, um sie als solche,
als schlechte Modifikationen des Lebens zu entlarven und schließlich zu dekonstruieren, das ist
es, was Spinoza für Deleuze in seiner Ethik in der Tat gemacht hat. Er hat sein masterpiece nicht
nur Ethik genannt. Seine Ethik ist in der Tat praktische Philosophie! – Und daher von seinen
Leser/innen auch als solche zu behandeln: Philosophie einer praktischen Lebensform, die es
19 Zum Akt der Re-Signation als die ein Leben bejahende Gegen-Zeichnung eines Lebens vgl. Arno Böhler, „Politiken der Re-Signation: Derrida – Adorno“, in: Eva L-Waniek; Erik M. Vogt (Hg.): Derrida & Adorno - Zur Aktualität von Dekonstruktion und Frankfurter Schule. Wien 2008, 167-188. 20 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 38. 21 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 37-38.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
10
handelnd zu ergreifen gilt, indem man sich tatsächlich gegen die Trias eines falschen Lebens zu
wenden und aktiv aufzulehnen beginnt. Gegen den Modus eines Lebens, das sich im Namen einer
Philosophie „des ‚Gewissens/Bewusstsein’, der ‚Werte’ und der ‚trübsinnigen Leidenschaften“22,
d. h. im Namen einer dreifachen nihilistischen Anklage gegen das Leben inmitten der Natur seit
langem schon kulturell zum Ausdruck gebracht hat; ja inzwischen sogar zum herrschenden
Dispositiv über alle anderen Lebensformen aufgebläht und weltweit zur Herrschaft gebracht hat.
Die Notwendigkeit der Bejahung einer immanenten Lebensweise, die sich in der dritten
Erkenntnisart über die amor dei intellectualis (vgl. E 576) mit dem Immanenzplan der Natur
verbündet, um eine Nobilitierung aktiver, freudvoller Affekte auf den Weg zu bringen, impliziert
für Deleuze zugleich die historische Notwendigkeit einer Kulturrevolution, die sich an der
weltweiten Entmachtung eines falsch eingewöhnten, destruktiven Lebensmodus abarbeitet.
Hier, in diesem gemeinsamen Kampf gegen einen selbstzerstörerischen Modus des Lebens, der
im Namen eines transzendenten Lebens die Verneinung des Lebens predigt, liegen für Deleuze
„die drei großen Ähnlichkeiten Spinozas mit Nietzsche.“23
– Beide haben sich gegen das Modell des Bewusstseins gewendet, um an seine Stelle das Modell
der Körper zu setzen. In diesem Zusammenhang spricht Deleuze von der „Entwertung des
Bewusstseins (zugunsten des Denkens): Spinoza als Materialist.“24
– Beide haben sich gegen das Modell der Moralität gewendet, um an seine Stelle eine Ethik
jenseits von Gut und Böse zu setzen. In diesem Zusammenhang spricht Deleuze von der
„Entwertung aller Werte, vor allem von Gut und Böse zugunsten von ‚gut’ und ‚schlecht’):
Spinoza, der Immoralist.“25
– Beide haben sich schließlich gegen das Modell einer Theologie trübsinniger Affekte gewendet,
um an ihre Stelle den Gott reiner Immanenz, den Gott der Musen, der nichts als reine Freude ist,
zu denken. In diesem Zusammenhang spricht Deleuze von der „Entwertung aller ‚trübseliger
Leidenschaften’ (zugunsten der Lust): Spinoza der Atheist.“26 Damit ist jener dreifache,
kulturrevolutionäre Schlag gegen die Trias eines falschen Lebens vollzogen, dessen „hit“ von den
22 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27. 23 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27. 24 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27. Vgl. ebd., 27-32. 25 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 32. Vgl. ebd., 32-36. 26 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 36. Vgl. ebd., 36-41.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
11
meisten Menschen notwendigerweise noch lange als tragisch wird empfunden werden müssen,
weil gerade das, wogegen sich diese Kulturrevolution wendet, bisher als die höchsten Werte der
Menschheit überhaupt gedacht und empfunden worden sind: Unser Bewusstsein von Freiheit,
Moral und Gott. „Schon zu seinen Lebzeiten bezichtigte man Spinoza deswegen des
Materialismus, der Immoralität und des Atheismus.“27
Was Spinozas Ethik von Anfang an zum Skandal gemacht hat und noch heute im besten Sinn des
Wortes das Prädikat des Unzeitgemäßen verleiht, sind für Deleuze einzig und allein die
praktischen Konsequenzen seiner Ethik. Und nur sie! – Nicht als akademisches
Gedankenexperiment genommen vermochte und vermag seine Ethik alle Moralisten dieser Welt
nachhaltig zu empören, sondern erst, und nur in dem alles entscheidenden Moment, in dem das,
wovon sie handelt, als Maxime des eigenen Handelns, Denkens und Fühlens praktisch zu
fungieren beginnt.28 So wie der Jurastudent Raskolnikow in Verbrechen und Strafe bei
Dostojewskij nicht schon dadurch zum Verbrecher wurde, dass er seine Theorie über das
Verbrechen in einem akademischen Journal veröffentlichte, sondern erst dadurch, dass er den
Drang verspürte, mit seiner Theorie ernst zu machen, indem er sie in der Tat zum Stratifikanten
seiner eigenen Lebensform machte und sich ihren Maximen gemäß handelnd zu verhalten
begann,29 so nehmen wir nach Deleuze Spinozas Ethik erst dort von ihrer Mitte her wahr, wo wir
uns handelnd in das hineinbegeben, wovon sie handelt: Die Kultivierung aktiver Affekte im Zuge
der Dekonstruktion lebensfeindlicher Instinkte, die sich in uns selbst eingewöhnt haben, aber
27 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27. Nietzsche selbst beschreibt sein Verhältnis zu Spinoza in einer
berühmt gewordenen Postkarte an seinen Freund Overbeck vom 30. Juli 1881 wie folgt: „Ich bin ganz erstaunt, ganz entzückt! Ich habe einen Vorgänger und was für einen! Ich kannte Spinoza fast nicht: dass mich jetzt nach ihm verlangte, war eine ‚Instinkthandlung.’ Nicht nur, dass seine Gesamttendenz gleich der meinen ist – die Erkenntnis zum mächtigsten Affekt zu machen – in fünf Hauptpunkten seiner Lehre finde ich mich wieder […]: er leugnet die Willensfreiheit –; die Zwecke –; die sittliche Weltordnung –; das Unegoistische –; das Böse –;“ Friedrich Nietzsche, Sämtliche Briefe, Kritische Studienausgabe Band 6, München–Berlin–New York 1967–1977, 111. 28 Es genügt nicht, „den großen theoretischen Leitsatz des Spinozismus in Erinnerung zu rufen: dass es nur eine einzige Substanz gibt, […]. Es genügt nicht, aufzuzeigen, wie sich Pantheismus und Atheismus, indem sie die Existenz eines moralischen, schöpferischen und transzendenten Gottes verneinen, in dieser These kombinieren. Man muss vielmehr von den praktischen Thesen ausgehen, die den Spinozismus zum Skandal gemacht haben.“ Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27. 29 Vgl. dazu Arno Böhler: „Spielerische Versuchsanordnungen“, in: Maske und Kothurn, Internationale Beiträge zur Theater-, Film- und Medienwissenschaft, 54 Jahrgang (2008) Heft 4, 81-90.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
12
auch im Sinne des Sturzes der auf sie gebauten und bauenden Institutionen eines
selbstdestruktiven Todeskults, der ihnen Bestand und Macht gewährt.
III. Spinoza. Der Denker eines Theaters der Immanenz.
Wenn Michel Foucault in Le Nouvel Observateur über Differenz und Wiederholung gesagt hat,
dass man dieses Buch von Deleuze so aufschlagen sollte, „wie man die Türen eines Theaters
aufstößt, wenn das Rampenlicht aufleuchtet und der Vorhang sich hebt,“30 dann gilt diese
Lektüreanweisung eben so sehr für jene, parallel zu Differenz und Wiederholung erschienene
Schrift von Deleuze Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie und nicht
minder für seine zweite Spinozalektüre Spinoza Praktische Philosophie. Spinozas Ethik ist für
Deleuze eben auch als ein revolutionäres Drama zu lesen. Als eine subversive Bühne, auf der
rhetorische Fragen verhandelt werden wie die, was ein Körper kann? Auf der er seine
Opponenten imaginär sagen lässt: „Wenn jetzt jemand fragt […]“ (E 21), „Was mich angeht“ (E
33), „Nun werden sie sagen: […]“ (E 231). Szenische Formulierungen, die wir in den Scholien
zuhauf finden und die aufgrund ihrer dramatischen Konzeption für Deleuze eindringlich darauf
hinweisen, dass Spinozas Ethik eben auch theatral gelesen werden muss. Umfasst sie doch
„zugleich das kontinuierliche Ganze der Propositionen, Demonstrationen und Corollarien, wie
auch die großartige Bewegung der Begriffe und die diskontinuierliche Verkettung der Scholien,
als ein Schleudern von Affekten und Implosionen, als eine Stoßserie. Buch V ist die extrem
extensive Einheit, aber nur weil sie der am engsten zusammengezogene intensive Punkt ist: es
gibt keinen Unterschied mehr zwischen Begriff und Leben.“31
Die intime Mechanik unserer Affektivität wird von Spinoza in seiner Ethik demnach nicht nur in
abstrakten Allgemeinbegriffen philosophisch reflektiert, sondern in den Scholien auch auf
singuläre Art und Weise emotional selbst vollzogen, aufgeführt, dramatisch exponiert, affektiv
ausgestellt, zur Schau gestellt, theatral demonstriert, in actu fleischlich zur Darstellung gebracht.
30 Michel Foucault: „Der Ariadnefaden ist gerissen“, in: Gilles Deleuze Michel Foucault: Der Faden ist gerissen. Übersetzt von Walter Seitter und Ulrich Raulf, Berlin 1977, 8. 31 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 168-169.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
13
1. Spinoza: der Materialist.
Das alles entscheidende Beispiel für einen solchen eruptiven Gefühlsausbruch finden wir in der
umfangreichen Anmerkung zum Lehrsatz 2 im III. Teil seiner Ethik. Ein Abschnitt, der
bezeichnenderweise von dem Ursprung und der Natur der Affekte handelt und Spinozas
Körpermodell gegenüber dem klassischen Bewusstseinsmodell verteidigt, um nicht zu sagen,
affektiv in Szene setzt (vgl. E 227-237). Denn: „Wenn Spinoza sagt, wir wissen nicht einmal, was
ein Körper kann, dann ist diese Formulierung fast ein Schlachtruf.“32
Sie, die anderen, gegen die Spinoza anschreibt, sie, die Bewusstseins- und Reflexionsphilosophen
seiner Zeit, sie sprechen zwar ständig von Bewusstsein und vom Geist, und selbstverständlich
auch von der angeblichen Macht der Seele, den Körper zu beherrschen. Sie tun dies aber ohne
sich auch nur einen Moment ernsthaft gefragt zu haben, was er, der Körper kann? Hierin liegt der
Grund, „warum Spinoza in wahre Schreie ausbricht: ihr wisst nicht, wozu ihr im Guten wie im
Schlechten fähig seid, ihr wisst nicht im Voraus, was ein Körper oder eine Seele in solcher
Begegnung, jener Anordnung, jener Kombination vermag.“33
Ihr. Ihr anderen. Die ihr das Modell des Bewusstsein dem Modell der Körper vorzieht...
Ihr. Ihr anderen. Die ihr in der Tat die wahren Antispinozisten seid, insofern ihr dem Gegenideal
vollkommener Bewusstheit huldigt – – –, ihnen sagt Spinoza auf den Kopf zu: „Allerdings, was
der Körper kann, hat bislang noch niemand bestimmt; d. h., die Erfahrung hat bislang niemanden
darüber belehrt, was der Körper bloß nach den Gesetzen der Natur, insofern diese allein als
körperlich angesehen wird, verrichten kann und was allein dadurch, dass er von dem Geist
bestimmt wird.“ (E 229).
Sie, die Bewusstseinsphilosophen und Reflexionsphilosophen seiner Zeit, ich darf ergänzen, auch
die unserer Zeit, sie wissen es nicht was ein Körper kann. So lautet zumindest Spinozas Befund.
Denn sie wissen im Vorhinein nicht, wie ein Körper gehandelt haben wird, wenn er in diese oder
jene Situation gekommen sein wird. Für Deleuze bietet Spinoza den Bewusstseinsphilosophen 32 Deleuze, Spinoza Ausdruck, 225. 33 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 162.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
14
damit ein neues Modell an: „den Körper. Er bietet ihnen an, den Körper als Modell einzusetzen:
‚Man weiß nicht, was der Körper alles vermag...’ Diese Unwissenheitserklärung ist eine
Provokation: wir sprechen vom Bewusstsein und seinen Beschlüssen, vom Willen und seinen
Wirkungen, von tausend Mitteln, den Körper zu bewegen, den Körper und die Leidenschaften zu
beherrschen – aber wir wissen nicht einmal, was der Körper alles vermag.“34
In dieser Anmerkung hat Spinoza seine philosophischen Gegner unmittelbar im Visier, um ihnen,
wie es Celan in seiner Büchnerrede im Meridian ausdrückt, sein alles entscheidendes Gegenwort
auf den Kopf zu zu sagen. Denn ihnen scheint im Vorhinein gewiss, „dass der Körper bloß auf
Geheiß des Geistes bald sich bewegt, bald ruht und dass er sehr vieles verrichtet, was allein von
dem Willen des Geistes und dessen Erfindungskunst abhängt. Allerdings, was der Körper kann,
hat bislang noch niemand bestimmt;“ (E 229).
Es ist die Thematisierung dieser opaken Wissenslücke des Geistes, die sich auftut, sobald der
Geist mit dem Eigensinn der Körper konfrontiert wird, die Spinoza aus der Fassung zu bringen
und in Rage zu versetzen scheint. Ihn, wie es Deleuze eben formuliert hatte, in wahre Schreie
ausbrechen und selbst affektiv giftig werden lässt. Fast so, als wäre die sprachliche
Bewusstwerdung dieses wunden Punkts für ihn nicht nur ein philosophisches Argument, sondern
selbst das alles entscheidende Gift, das er seinen Opponenten in dieser Scholie buchstäblich
entgegenschleudert, um es ihnen gegen den lang und weit herkommenden Irrtum ihrer Lehren
von der kontrollierten Herrschaft des Bewusstseins, des freien Willens und eines trübsinnig
richtenden Weltenlenkers als Pharmakon zu verabreichen. In der Hoffnung, ihrem moralischen
Schwindel damit ein für alle Mal ethisch Einhalt zu gebieten.
Hier, in dieser Anmerkung, in der es darum geht, unsere Körper unabhängig vom Geist sein zu
lassen, ist Spinozas Ethik für Deleuze in der Tat zum konkreten Ort einer revolutionär
philosophischen Bühne geworden, in der er am eigenen Leib selbst um jene affektive Katharsis
ringt, die ihn, mit seinesgleichen, vom Gift jenes falschen Lebens zu befreien trachtet, das seine
Gegner seit alters her versprüht haben, indem sie die Herrschaft des Geists über den Körper
verkündet hatten.
34 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
15
Diese Stelle ist für Deleuze ein beredtes Zeugnis für die dramatische Rhetorik, der sich Spinoza
in seiner Ethik bedient, um mit ihrer Hilfe das abzuschaffen, wovon er spricht:35 Die Abwehr
passiver Leidenschaften, mit dem Ziel, den Anteil an aktiven Affekten im Gemüt zu vermehren.
Unter anderem eben auch im eigenen Gemüt, das sich hier entlädt.36
Kein geringes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass dieses Anliegen für Spinoza einer radikalen
Umwertung der bisherigen Wertschätzungen des Lebens insgesamt gleichkommt, insofern sich
Ethik, insoweit sie bislang meistens mit Moral verwechselt wurde, sich bestens auf das
Umgekehrte, die Förderung trübsinniger Eigenschaften verstanden hatte.
2. Spinoza: der Alchemist.
Spinozas Ethik als praktische Philosophie behandeln lernen heißt für Deleuze folglich, in der Tat
mit der Entgiftung jenes kulturellen Erbes zu beginnen, das uns allen, einem mehr, dem anderen
weniger, in den Schlund gekrochen ist und uns daher nicht mehr nur von außen, sondern auch
von innen her zersetzt und vergiftet. Trennt uns die Lehre von der Herrschaft des Geistes über
den Körper in der Tat doch von dem, was unsere Körper von sich aus zu tun vermöchten, wenn
sie rein nur gelassen würden, ihrer eigenen immanenten Ordnung dynamisch zu folgen, um sie
aktiv zum Ausdruck zu bringen.
Wie das Gemüt von giftigen Leidenschaften reinigen, wenn sie uns inzwischen von außen und
innen gleichzeitig affizieren? Wie eine anders geartete kulturelle Praxis initiieren, die uns der
gängigen selbstdestruktiven Praxis der moralischen Trias des Lebens gegenüber immunisiert, so
35 Vgl. dazu: Jacques Derrida; Friedrich Kittler, Nietzsche – Politik des Eigennamens. Wie man abschafft, wovon man spricht. Berlin 2000. 36 Da für Spinoza bekanntlich nichts in der Natur geschieht, „was ihr selbst als Fehler angerechnet werden könnte, denn die Natur ist immer dieselbe, und was sie auszeichnet, ihre Wirkungsmacht, ist überall ein und dasselbe;“ (E 221), darum folgt jedes einzelne Gefühl, auch dieser eruptive Zornesausbruch in Spinozas Körper selbst, für ihn mit absoluter geometrischer Notwendigkeit aus der ewigen Gesetzmäßigkeit seiner Natur, insofern er sich in einem endlichen Modus zum Ausdruck bringt, der sich in diesem Fall ganz konkret von der Rachsucht Gottes zu befreien trachtet. Gerade weil das Gemüt kein Ort irrationaler Gefühle, sondern selbst Ausdruck einer immanenten Logik und Mechanik des Fühlens ist, die vernünftig organisiert werden kann – weh spricht vergeh, doch alles Lust will Ewigkeit –, kann Spinoza von der Natur und den Kräften der Affekte eben nach derselben geometrisch rationalen Methode handeln, wie er in anderen Teilen der Ethik von Gott und der Seele gehandelt hatte. (Vgl. E 221).
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
16
dass wir schließlich, durch die Verabreichung eines geeigneten Gegengifts, von ihr nicht, oder
kaum mehr affiziert werden können?
Das, und nur das sind für Deleuze die zentralen ethischen Fragen der spinozistischen Ethik aus
der Sichtweise endlicher Modi. Und das, was Spinoza nach Deleuze als Gegenwort an die Stelle
jener Trias eines falschen Lebens zu setzen trachtete, ist nichts anderes als das schlichte, ja naiv
anmutende Leben eines Körpers, der schalfwandelnd in sich selber ruht und nichts anderem folgt
und damit zum Ausdruck bringt, als eben die Physio-Logie seiner eigenen immanenten Physis.
„Allein“ schreibt Spinoza, „ich habe schon darauf hingewiesen, dass sie gar nicht wissen, was der
Körper kann, oder was sich aus der Betrachtung allein seiner Natur herleiten lässt, ja dass sie
selbst erfahren, dass allein nach den Gesetzen der Natur vieles geschieht, von dem sie niemals
geglaubt hätten, es könne ohne Anleitung des Geistes geschehen, z. B. was Nachtwandler im
Schlafe tun, worüber sie sich dann im wachen Zustand wundern. Es sei noch hinzugefügt, dass
gerade der Bau des menschlichen Körpers in seiner Kunstfertigkeit alles weit übertrifft, was
menschliche Kunst je gebaut hat, ganz davon zu schweigen, dass ich oben erwiesen habe, dass
aus der Natur, unter welchem Attribut auch immer betrachtet, unendliches vieles folgt.“ (E 231).
Der schlafwandlerisch (hellwach) fungierende Körper operiert offenkundig auf einer prä-
individuellen Ebene, die ihn koordiniert durch den Raum bewegt, ohne dass er selbst ein
ausdrückliches Wissen davon hätte, was, und wie er das tut, was er in der Tat zu tun faktisch im
Stande ist, während er „sich selbst“ blindlings, und doch zielsicher, durch den Raum bewegt. –
Gleich den Puppen in Kleists Marionettentheater, oder neuerdings den Satelliten gesteuerten
Autos, die den Koordinaten ihres Navigationssystems blindlings, und gerade darum in der Regel
zielsicher folgen, ohne dass die so bewegten Individuen selbst Kenntnis davon hätten, was mit
ihnen geschieht und wie ihnen geschieht, während sie ihr Ziel erreichen. – Alles Beispiele
subjektloser Tätigkeiten, in denen ein Körper in der Tat von der ihm immanenten Struktur eines
Verweisungsgefüges medial bewegt wird, ohne dass er, der bewegte Körper, selbst von jenem
bewegenden Prinzip Kenntnis besitzen würde, dem er in der Tat selbstimmanent folgt.
Es handelt sich bei diesen Beispielen für Deleuze offenkundig um den Nachweis, „dass der
Körper die Erkenntnis übersteigt, die man von ihm hat, und dass ebenso das Denken das
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
17
Bewusstseins übersteigt, das man von ihm hat.“37 Die Tatsache des Bewusstseins ist zwar
erstaunlich, aber der Leib ist, wie Nietzsche in spinozistischer Manier formuliert hat, ein noch
weit erstaunlicherer Gedanke!38 Denn noch weit verwunderlicher als die bewusst gesteuerte
Bewegung eines Körpers ist doch die Tatsache, dass die Natur auf natürliche Art und Weise
unbewusst, d. h. ganz ohne die Lenkung durch ein bewusstes Subjekt, indem sie einfach ihren
immanenten Gesetzen folgt, quasi automatisch Himmel und Erde, unseren menschlichen Körper
und vieles andere mehr zum Vorschein bringen konnte, ohne ein kommandierendes Subjekt und
Bewusstsein, das hinter diesen natürlichen Operationen planmäßig teleologisch am Werk
gewesen wäre. Und diese, von der Natur selbst erschaffenen Körper, übertreffen doch eben bei
weitem die Komplexität von allem, was menschliche Kunst je gebaut hat. Trotz dieser Evidenz
ist sich Spinoza gewahr, dass gerade diese Theorie bei seinen Gegnern auf heftigen Widerstand
stoßen wird. „Auch werden sie wohl sagen, allein den Gesetzen der Natur, insofern sie nur als
körperlich angesehen wird, könnten nicht die Ursachen von Gebäuden, Gemälden und anderen
Dingen dieser Art, die allein aus menschlicher Kunst entstehen, entnommen werden, und der
menschliche Körper wäre doch nie imstande, eine Kirche zu erbauen, ohne dazu von dem Geist
bestimmt und angeleitet zu werden.“ (E 231). Die obigen Beispiele beweisen jedoch zur Genüge,
dass die Natur von sich aus Dinge hervorzubringen vermag, die der technischen Hervorbringung
des Menschen unendlich überlegen ist.
Offenkundig ist es der Ausblick auf die große Vernunft des Leibes, die in der Natur quasi ganz
von selbst auf natürliche Art und Weise operativ am Werk ist, die Spinoza zu der rhetorischen
Frage drängte: „Wissen wir, was ein Körper vermag?“ – – – Sie, diese Frage, ist das cutting edge,
an dem seine Ethik in der Tat bissig, giftig, spaltend und zersetzend wird. In ihr wird der alles
entscheidende Unterschied zwischen ihm und seinen Gegnern eingeführt: ein Entweder/Oder, ein
Entscheid, der die wahren Spinozisten von den Nicht-Spinozisten unterscheidbar gemacht haben
wird.
37 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 28. 38 Vgl. Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 27-28.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
18
3. Spinoza: der Geliebte Liebende.
Deleuze in Spinoza. Spinoza in Deleuze, das heißt für Deleuze also auch, die Leser seiner Ethik
als geometrische Fluchtlinien, Flächen und Körper einer affektiv-rationalen Übertragung lesen
lernen, in der es zu einer immanenten, seriellen Übertragung und modalen Aus-ein-ander-setzung
der in eine solche doppelbödige Lektüre involvierten Existenzmodi mit Spinoza kommt.
„Viele Kommentatoren liebten Spinoza so sehr, dass sie ihn mit einem Windhauch verglichen,
wenn sie von ihm sprachen. Und in der Tat gibt es keinen anderen Vergleich als den Wind. Aber
handelt es sich um den großen ruhigen Wind, von dem Belbos als Philosoph spricht? Oder gar um
den Wirbelwind, die Hexenjagd, von der der ‚Fixer’ redet, der Nicht-Philosoph par excellence
[…]?“39
Wir haben die Antwort von Deleuze schon gehört. Es handelt sich bei seiner Ethik um beides.
Um eine Ethik, die sich sowohl an Philosophen, als auch an Nicht-Philosophen wendet. Daher
muss auch die Antwort, wer Spinozist ist, für Deleuze zwiespältig ausfallen: Denn manchmal ist
Spinozist „sicherlich derjenige, der ‚über’ Spinoza, über Spinozas Begriffe, arbeitet,
vorausgesetzt, er tut es mit genügend Anerkennung und Bewunderung. Doch auch der, der als
Nicht-Philosoph von Spinoza einen Affekt empfängt, ein Bündel an Affekten, eine kinetische
Bestimmung, einen Anstoß, und so aus Spinoza eine Begegnung und eine Liebe macht. Es macht
den einzigartigen Charakter Spinozas aus, dass er, Philosoph der Philosophen (im Gegensatz zu
Sokrates reklamiert er nur Philosophie...), den Philosophen lehrt, kein Philosoph zu werden. Die
beiden, Philosoph und Nicht-Philosoph, vereinigen sich zu einem einzigen und gleichen Wesen
in Buch V, das keineswegs das schwierigste, doch das schnellste ist, dasjenige mit einer
unendlichen Geschwindigkeit.“40
Deleuze fordert also eine doppelte Lektüre von Spinozas Ethik. Sie muss, soll sie von ihrer Mitte
her gelesen und verstanden werden, sowohl dem rationalen, als auch dem affektiven Anspruch
der spinozistischen Ethik gerecht werden und zwingt uns damit Formulierungen auf wie
„Deleuze in Spinoza. Spinoza in Deleuze.“ „Wir in Spinoza. Spinoza in uns.“ „Ich in Spinoza,
Spinoza in mir.“ Zusätzlich zur Erkenntnis Spinozas in Gemeinbegriffen (notiones communes) –
in welchen sich für Deleuze keine abstrakt mathematische Ordnung, sondern weit eher ein 39 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 168. 40 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 168.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
19
(biochemischer) Ordnungszusammenhang von Körpern ausdrückt41 –, kann es bei der Lektüre
seiner Ethik aber auch zu einer unmittelbar intuitiven und unvorbereiteten Begegnung kommen;
„so wie ein Nicht-Philosoph oder auch jemand, der gar keine Kultur hat, eine plötzliche
Erleuchtung, einen ‚Blitz’ empfangen könnte. Es ist, als ob man sich als Spinozist entdeckte, man
kommt mitten in Spinoza an, wird angezogen, ins System oder in die Komposition
hineingerissen. Wenn Nietzsche schreibt: ‚Ich bin ganz erstaunt, ganz entzückt!... Ich kannte
Spinoza fast nicht: dass mich jetzt nach ihm verlangte, war eine ‚Instinkthandlung’...’, spricht er
nicht nur als Philosoph, vielleicht gerade nicht als Philosoph.“42 Spinoza von der Mitte her lesen
heißt daher auch, sich von ihm affizieren und emotional bewegen lassen.
Eine solche immanente Lektüre seiner Ethik von ihrer affektiv-rationalen Mitte her, wird für
Deleuze zwangsläufig eine zwiespältige Lektüre gewesen sein müssen. Muss sie doch durch eine
doppelbödige Lesart hindurch, die seine Ansprüche auf der Ebene der ersten und zweiten
Erkenntnisart einerseits rational überprüft, sich andererseits aber auch in eine affektive Nähe und
Distanz zu Spinoza begibt, um seine Intensitätsausbrüche in den Scholien in ihrer affektiven
Wirkkraft und Rhetorizität auch emotional verstehen zu lernen. „Ein so strenger
Philosophiehistoriker wie Victor Delbos war von diesem Zug frappiert: die Doppelrolle Spinozas,
einmal als sehr ausgeartetes äußeres Modell, aber genauso als geheime inner Triebkraft. Die
doppelte Lektüre Spinozas, einerseits systematisch, auf der Suche nach der Idee des Ganzen und
der Einheit ihrer Teile, andererseits aber, gleichzeitig, die affektive Lektüre, ohne Idee des
Ganzen, in die man hineingerissen oder gestellt wird, in Bewegung oder Ruhe versetzt, heftig
bewegt oder beruhigt entsprechend der Geschwindigkeit dieses oder jenes Teils.“43
Bei einer solchen doppelbödigen Lektüre, Wir in Spinoza, Spinoza in uns, steht also nicht nur die
intellektuelle Erörterung der rational argumentierbaren Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit seiner
geometrischen Demonstrationen, Beweise und Ableitungen auf dem Spiel – und in der Folge die
daraus erschlossenen Normen, Maximen und Regeln für eine ethische Lebensweise –, sondern
41 „Die Gemeinbegriffe (Ethik, II, 37-40) werden nicht so genannt, weil sie allen Geistern gemeinsam sind, sondern zuerst, weil sie etwas vergegenwärtigen, was den Körpern gemeinsam ist: sei es allen Körpern (Ausdehnung, Bewegung und Ruhe), sei es gewissen Körpern (mindestens zwei, meiner und ein anderer).“ Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 94. 42 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 167. 43 Deleuze, Spinoza Praktische Philosophie, 167-168.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
20
zumindest eben so sehr die Achtsamkeit und singuläre Sorgfalt in Hinblick auf die „eigene“
affektive Resonanz, die im Zuge einer solchen doppelbödigen Lektüre, ich in Spinoza, Spinoza in
mir, bei der Lektüre untergründig in Gang kommt und damit subversiv emotional mit im Spiel ist.
Eine immanente Lektüre wird in ihrer Zwiespältigkeit daher immer schon beides zumal gewesen
sein: Ethik im rational-argumentativen, aber auch Ethik im psychoanalytischen Sinne. – Wenn
wir darunter ganz undogmatisch die Achtsamkeit und Sorgfalt eines mental begabten Körpers in
Bezug auf die Mechanik des eigenen Fühlens verstehen. Psychoanalyse, also nicht als ödipale
Schule einer familiären Topik des Un/Bewussten, sondern als eine Affekten- oder
Berührungslehre, in der die Frage nach den Affekten unter anderem auch „phänomenologisch“
aus der Perspektive eines Individuums heraus gestellt wird, das selbst emotional bewegt wird und
das sich daher selbst pathisch zu fühlen und auf empfindliche Art und Weise sinnlich in Empfang
zu nehmen gelernt hat.
In einer solchen psycho-phänomenologischen Betrachtungsart unseres Thymos geht es dann aber
nicht mehr nur um den Allgemeinbegriff von Affektivität – so, als würde das Gemüt völlig
unabhängig von der eigenen „originären“ Erfahrung affektiver Übertragungsvorgänge gänzlich
außerhalb von uns selbst stattfinden –, sondern auch um die Falsifizierung einer
wissenschaftlichen Affektenlehre am Phänomen der „eigenen“, leibhaftigen Erfahrung von
Affektivität, in der sie uns selbst, in Lust und Unlustgefühlen, emotional anschaulich (also
intuitiv) gegeben ist. Auf der Ebene der dritten Erkenntnisart kann diese intuitive Ebene des
Gemüts, in der es uns fungierend im Akt des Fühlens selbst originär gegeben ist, nicht mehr
einfach übergangen werden, indem das eigene Gefühl dem stoischen Ideal einer apathischen, dem
Ideal der Objektivität verpflichteten Wissenschaftlichkeit einfach idealtypisch geopfert wird.
Ganz im Gegenteil muss eine Affektenlehre aus der Perspektive der dritten Erkenntnisart von der
Position eines von Affekten selbst betroffenen Einzeldings her betrachtet werden. Von jemandem
also, der, oder die als res particularis selbst in einem pathischen Verhältnis zu dem steht, wovon
Spinozas Affektenlehre handelt und der, oder die daher aus der in Affektionen gegebenen „first
person position“, und sei diese im Sinne von Deleuze auch durch und durch prä-individuell
konfiguriert, einen originär-intuitiven Zugang zu dem besitzt, wovon eine solche Lehre handelt.
Nicht nur als theoretisch akademischer Zuschauer, sondern auch als aisthetisch handelnder
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
21
Akteur von Affekten ist die Affektenlehre von Spinozas selbst in den Scholien konzipiert. Denn
aus einem formal-stilistischen Gesichtspunkt betrachtet erlaubt sich Spinoza in den Scholien
selbst, seiner Affektivität Luft zu verschaffen und eine ethische Bühne zu bereiten, die seinem
Gemüt Gelegenheit gibt, sich sprachlich zu artikulieren und auszusprechen. Ein theatReales44
Format, bei dem es Spinoza allerdings weniger um das unkontrollierte Ausagieren „privater“
Affekte und Stimmungslagen, als vielmehr um das Ereignis-Werden jener immanenten Dynamik
des Thymos selbst, in er sich selbst jener philosophischen Katharis unterzieht, die aktive
Affektionen der Freude in ihm fördern und passive Affektionen der Trübsal verringern. Denn
selbst in den Intensitätsausbrüchen seines Gemüts wird sich die geometrische Verfassung des
Gemüts insgesamt in einem partikulären Existenzmodus leidenschaftlich widerspiegeln müssen,
insofern auch die Dramaturgie der „privaten“ Gefühle mit absoluter Notwendigkeit der
natürlichen Dynamik der Affekte insgesamt folgen, wie es sie in seiner Affektenlehre nach
Gemeinbegriffen selbst darlegt hat.
„Mithin muss auch die Weise ein und dieselbe sein, in der die Natur eines jeden Dinges, von
welcher Art es auch sein mag, zu begreifen ist, nämlich durch die allgemeinen Gesetze und
Regeln der Natur. Also folgen die Affekte des Hasses, des Zorns, des Neides usw., in sich
betrachtet, aus derselben Notwendigkeit und internen Beschaffenheit der Natur wie andere
Einzeldinge auch. […] Die Natur und die Kräfte der Affekte und die Macht des Geistes über sie
werde ich deshalb nach derselben Methode behandeln, nach der ich in den vorigen Teilen von
Gott und dem Geist gehandelt habe, und ich werde menschliche Handlungen und Triebe geradeso
betrachten, als ginge es um Linien, Flächen oder Körper.“ (E 221).
Sie, Spinozas Ethik, zu wiederholen, indem sie nicht nur kopiert, sondern im Zuge ihrer
Wiederholung iterativ modelliert wird, um sie, ganz im kabbalistischen Sinne, im eigenen
Existenzmodus modal weiterzutreiben und weiterzuschreiben, ist die Hinsicht, von der her, und
unter der Deleuze seine eigene Spinozalektüre in Differenz und Wiederholung eigenständig
vorangetrieben hatte, und zwar parallel zum Erscheinen seiner ausgiebigen Spinozalektüre
Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie. Pierre Macherey hat daher zu Recht
betont, dass Deleuze Spinoza bei seiner Lektüre gedanklich vorausgehen wollte, nicht um ihn 44 Zum Terminus „theatReal“ vgl. Arno Böhler: „TheatReales Denken“, in: Arno Böhler; Susanne Granzer (Hg.): Ereignis Denken. Wien 2009, 11-31.
Univ.Doz.Mag.Dr. Arno Böhler Institut Philosophie der Universität Wien Universitätsstraße 7 A-1010 Wien Tel./Fax: +43/(0)1/408 49 58 [email protected]
22
getreu und sorgfältig zu rezipieren, sondern zu dynamisieren und als Sprengkapsel einer erst noch
im Kommen begriffenen höheren Kultur zu lesen.