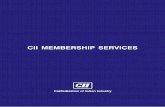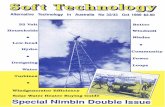Bachelor Thesis (2014): UK and its alternatives to a EU membership (German language)
-
Upload
uni-bamberg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Bachelor Thesis (2014): UK and its alternatives to a EU membership (German language)
TU CHEMNITZ
Philosophische Fakultät
Institut für Europäische Studien
Jean Monnet Professur Europäische Integration
Erstbetreuer: Prof. Dr. Matthias Niedobitek
Zweitbetreuer: Marcus Hornung M.E.S
Abgabedatum: 18.09.2014
BACHELORARBEIT
Großbritanniens Zukunft in Europa -
Zwischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union und Austritt
David Tschorr
Europa-Studien mit sozialwissenschaftlicher
Ausrichtung, 6. Fachsemester
Matrikelnummer: 289597
Mobil: 0176-31576339 / [email protected]
Steinbachstraße 12, 12489 Berlin
Inhalt
1 Einleitung ...................................................................................... 1
2 Historische Einordnung des Verhältnisses zwischen Groß-britannien und der Europäischen Union .............................................. 3
2.1 Großbritannien bis zum Beitritt in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ................................................................................. 3
2.2 Großbritannien seit dem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ................................................................................. 5
2.2.1 1973 bis 1997 ...................................................................................... 5
2.2.2 1997 bis 2007 ...................................................................................... 8
3 Das Für und Wider eines möglichen Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union .................................................................... 12
3.1 Akteure in der Europäischen Union und ihre Sichtweisen ....................... 12
3.2 Sichtweisen ausgewählter britischer Akteure........................................... 14
3.2.1 Die britische Zivilbevölkerung und die Presse ................................... 14
3.2.2 Die Regierungskoalition und das Referendum ................................... 16
3.2.3 Labour Party ..................................................................................... 18
3.2.4 United Kingdom Independence Party ................................................ 20
4 Das mögliche Ende der Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union und dessen Folgen ............................................ 22
4.1 Rechtliche Aspekte eines Austritts aus der Europäischen Union ............. 22
4.2 Politische und wirtschaftliche Folgen für Großbritannien ........................ 24
4.3 Folgen für die Europäische Union ........................................................... 27
5 Alternativmodelle zu einer EU-Mitgliedschaft ............................ 30
5.1 Überblick der möglichen Modelle ........................................................... 30
5.2 Modell 1: Der Europäische Wirtschaftsraum ........................................... 32
5.2.1 Von der Europäischen Freihandelsassoziation zum Europäischen
Wirtschaftsraum ......................................................................................... 32
5.2.2 Aufbau des ersten Modells am Beispiel Norwegens ........................... 34
5.2.3 Umsetzbarkeit des Modells in Großbritannien .................................. 37
5.2.3.1 Vorteile ..................................................................................... 37
5.2.3.2 Nachteile ................................................................................... 38
5.3 Modell 2: Das bilaterale Abkommen ....................................................... 41
5.3.1 Aufbau des zweiten Modells am Beispiel der Schweiz ........................ 41
5.3.2 Umsetzbarkeit des Modells in Großbritannien .................................. 44
5.3.2.1 Vorteile ..................................................................................... 44
5.2.2.2 Nachteile ................................................................................... 45
6 Fazit und Bewertung .................................................................... 47
Anhang: Artikel 50 des EUV ............................................................... I
Abbildungsverzeichnis ....................................................................... II
Literaturverzeichnis ............................................................................ V
Seite | 1
1 Einleitung
In den letzten Jahren hat kaum etwas die Europäische Union (EU) so sehr erschüttert wie die
stetig wachsende Kritik an ihren Methoden und Vorgehensweisen. Der durch die globalen
Finanz- und Staatskrisen genährte Unmut einzelner europäischer Mitgliedsstaaten hat sich
nach der Eurokrise 2007 zugespitzt und resultiert nun, viele Jahre danach, in dem Misstrauen
gegenüber der EU. Während einige Mitglieder der Union die wirtschaftliche Ausrichtung und
die damit verbundenen Maßnahmen zur Rettung einzelner Staaten kritisieren, sträuben sich
andere gegen eine offenere Vertiefungspolitik der Union. Ein solches Land, das die EU lieber
als Wirtschaftsgemeinschaft als eine Sozialunion sehen möchte, ist Großbritannien. Kein an-
deres Mitglied in der EU versucht so vehement, seine nationalen Interessen auf die Agenda in
Brüssel zu übertragen und weitere Vertiefungen der EU zu behindern.1
Eben jenes Verhalten soll in dieser Arbeit genauer beleuchtet werden, um herauszufinden,
welche Rolle die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union spielt und welche
Effekte bzw. Resultate ein britischer Austritt für Großbritannien und die Union haben könnte.
Dazu werden im ersten Schritt zunächst die Beziehungen zwischen Großbritannien und den
verschiedenen Europäischen Gemeinschaften2 historisch eingeordnet. Nach dieser Annähe-
rung an die geschichtliche Verknüpfung wird im zweiten Schritt das Für und Wider eines
möglichen britischen Austritts aus der Europäischen Union abgewogen und aus der Sicht von
sowohl Akteuren in der Union als auch vier verschiedenen britischen Adressaten eines Refe-
rendums dargestellt. Dabei werden sowohl die britische Öffentlichkeit in Form der Zivilge-
sellschaft sowie der Massenmedien bzw. Presse, als auch die britische Regierung unter David
Cameron und Oppositionsparteien wie die Labour Party oder die United Kingdom Indepen-
dence Party (UKIP) betrachtet. Die Akteure wurden vom Autor dieser Arbeit bewusst gewählt,
da sie alle an dem Ausgang und der Entstehung des Referendums und somit des Wunsches
nach einem Austritt aus der EU beteiligt waren/sind:
Es soll unter anderem aufgezeigt werden, dass die britische Zivilbevölkerung durch die oft
nationalistischen und europaphoben Tendenzen in der medialen Berichterstattung zu einer
abweisenden Haltung gegenüber der Europäischen Union bewegt wurde, und das der konser-
vative Premierminister Cameron daher nahezu keine andere Wahl hatte, als diesem Druck
1 Vgl. Zaschke (04.06.2014). 2 Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft und Europäische Union.
Seite | 2
nachzugeben und ein Referendum über den Verbleib in der EU anzukündigen. Für diese Re-
aktion der britischen Regierung auf das eigene Volk ist auch der Standpunkt von Camerons
Koalitionspartner Nigel Clegg von großer Bedeutung. Nachdem die Initiatoren und die durch-
führenden Akteure nun behandelt wurden, sollen kritische und oppositionelle Meinungen zu
einem Austritt aus der Europäischen Union gehört werden. Dazu wird zuerst die unter Ed Mi-
liband geführte Labour Party beleuchtet, welche sich zwar nicht komplett gegen ein Referen-
dum ausspricht, jedoch auch kein Verständnis für David Camerons Handeln zeigt. Zuletzt
wird mit der UKIP und ihrem Vorsitzenden Nigel Farage eine ganz andere Position zum Re-
ferendum abgebildet. Durch das Fehlverhalten Camerons und die Agitation UKIPs in den
letzten Jahren könnte die Partei ein wichtiger Faktor dafür sein, wie viele Briten sich gegen
die EU-Mitgliedschaft entscheiden.
Nachdem die möglichen Gründe für den Austritt der Briten aus der Perspektive verschiedener
Akteure analysiert wurden, sollen die Folgen dessen im Weiteren skizziert werden. Dazu wird
zunächst die rechtliche Grundlage eines britischen Austrittsgesuches aus dem Blickwinkel des
EU-Rechtes beschrieben, um danach die Auswirkungen einer vollständigen Abwendung von
der EU auf die britische Politik und Wirtschaft aufzuzeigen. Zuletzt werden in diesem Teil der
Arbeit die Konsequenzen eines möglichen Austritts auf die Integrationsbemühungen und
Wirtschaft der EU dargelegt.
Im fünften Teil der vorliegenden Arbeit werden, unter der Annahme eines erfolgten Rückzu-
ges/Ausscheiden der Briten aus der EU, anhand von mehreren Modellen die Alternativen
Großbritanniens umrissen, unter der Bedingung, dass das Land weiterhin eine Anbindung an
die EU und den europäischen Binnenmarkt sucht. Dabei wird jedes Modell kurz dargestellt
und durch ein Beispielland anschaulich charakterisiert. Um im Fazit die These dieser Arbeit,
dass es für Großbritannien keine Alternative zu einem Verbleib in der Europäischen Union
gibt, untermauern zu können, werden zudem bei jedem Modell die Vor- und Nachteile des
Modells im Falle Großbritanniens abgewogen.
Seite | 3
2 Historische Einordnung des Verhältnisses zwischen
Großbritannien und der Europäischen Union
2.1 Großbritannien bis zum Beitritt in die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
Schon in den 1950er- und 1960er-Jahren, in einer Phase von wirtschaftlicher und politischer
Schwäche, beneideten die Briten die ökonomische Stärke der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) bzw. der Europäischen Gemeinschaft (EG).3 Ende der 1950er, Anfang der
1960er-Jahre favorisierte Großbritannien anstatt eines Beitritts zur Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft eine Freihandelszone für Westeuropa im Rahmen der Organisation für europäi-
sche wirtschaftliche Zusammenarbeit. Diese Idee, die jedoch von den Gründerstaaten der
EWG wegen der vermeintlichen Unterminierung ihrer Ziele abgelehnt wurde, schlug Großbri-
tannien deswegen vor, weil es die Souveränität des Landes im Gegensatz zu einer Mitglied-
schaft in der EWG nicht tangiert hätte.4
Als der britische Weg in die Europäischen Gemeinschaften Jahre später dennoch beschritten
wurde, versursachten die britischen Interessen an der EWG einen Konflikt mit deren Gründer-
staaten5. Erst durch verschiedene stark wirtschaftlich terminierte Krisen, beispielsweise die
Suez-Krise 1956, in Folge derer sich die Beziehungen Großbritanniens zur USA „als Schimä-
re erwiesen“6, begann ein britisches Umdenken bezüglich der bisherigen Weltmachtstellung.7
Zudem schlug der britische Versuch, die Europäische Freihandelszone (EFTA) mithilfe der
Leitwährung Pfund Sterling als Gegengewicht zur EWG zu etablieren, fehl. Dies führte zu
einer Abwertungsspirale des Pfunds und damit einem kontinuierlichen Niedergang der briti-
schen Wirtschaft.8
Auf Grund dieser massiven wirtschaftlichen Probleme stellte das Land 1963 aus einer
Zwangslage heraus einen Antrag auf Beitritt zur EWG. Dieser sowie der zweite 1967 gestellte
Antrag wurden vom französischen Ministerpräsidenten Charles de Gaulles abgelehnt, da
Frankreich befürchtete, dass Großbritannien die Gemeinschaft von innen heraus lähmen wür-
3 Vgl. George (1998): S. 5. 4 Vgl. Kaiser (1963). 5 Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande. 6 Schieren (2011): S. 217. 7 Vgl. Becker (2002): S. 186. 8 Vgl. Schieren (2011): S. 217 f.
Seite | 4
de.9 Erst nach Rücktritt de Gaulles 1969 konnten die Verhandlungen zum Beitritt auf Grund
der Veränderung der französischen Haltung neu aufgenommen werden.10 1973 mündete der
dritte Versuch der britischen Regierung, unternommen vom britischen Premier Edward Heath,
in einer Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Heath agierte damals
als ein pro-europäisch orientierter Premierminister und schaffte es, die durch die Integration
in Europa auftretenden Vorteile immer wieder zur Diskussion zu stellen.11
Die Art und Weise, wie sich die britische Regierung für die EWG entschieden hat, lässt ver-
muten, dass hier aus einer Notlage heraus gehandelt wurde. 12 So gab es keine anderen Optio-
nen, welche Großbritannien besser aus der Krise geholfen hätten. Dieser langwierige Prozess
bis zum Beitritt erschwerte die darauffolgende Integration Großbritanniens in die Gemein-
schaft. Trotz der Schwierigkeiten war es den Gründungsstaaten wichtig, dass Großbritannien
aufgenommen wird und so waren die Erwartungen, welche die sechs EWG-Länder an den
Beitrag GBs hatten, vorrangig von politischer Natur.13 Schließlich sollte Europa nach dem
Krieg nicht nur wirtschaftlich erstarken, sondern auch politisch zusammenwachsen. Jedoch
verhielten sich die Briten von Anfang an wie, so beschreibt es Stephen George in seinem
gleichnamigen Buch, ein „widerspenstiger Partner“14(„akward partner“). Dies mag dadurch
begründet sein, dass, entgegen der bereits genannten politischen Integration Großbritanniens,
das Land stets versuchte, seine ökonomischen Interessen weiter zu verfolgen. Schieren geht
sogar so weit zu sagen, dass GB nie eine Union/Gemeinschaft politischer Natur angestrebt
habe.15
9 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 27. 10 Vgl. Becker (2002): S. 287 f. 11 Vgl. George (1998): S. 42-70, besonders S. 49 f. 12 Vgl. Wurm (1992): S. 57. 13 Vgl. Volle (2002): S. 316. 14 George (1998). 15 Vgl. Schieren (2011): S. 218.
Seite | 5
2.2 Großbritannien seit dem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft
2.2.1 1973 bis 1997
Der durch die britische Regierung und die Öffentlichkeit befürchtete Verlust von einzelstaat-
licher Souveränität blieb in der ersten Dekade nach dem Beitritt zur EWG nahezu aus. So
wurden lediglich Zuständigkeiten in den Bereichen Landwirtschaft und Binnenzölle an die
Gemeinschaften abgegeben.16 Trotz der schwierigen Umstände, unter denen das Land in die
EWG eintrat, erkannten sowohl die Regierung als auch das britische Volk den Vorteil alsbald.
Dies wird durch das 1975 stattgefundene Referendum untermauert: So stimmten 67,2% der
Briten (bei einer Wahlbeteiligung von 64,6%) mit „Ja“ und damit für einen Verbleib in der
EWG. Zwar gewannen die Befürworter der Gemeinschaft das Referendum mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit, jedoch blieben die Anforderungen der britischen Öffentlichkeit an die EWG
weit hinter der Realität zurück, da sich die britische Wirtschaft nicht wie erhofft von ihrer
jahrelangen Talfahrt erholte.17 Diese Unzufriedenheit mit der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft zeigt sich unter der britischen Bevölkerung in einer Umfrage der Gallup
Organization aus dem Jahr 1976. Angelika Volle, Chefredakteurin der Fachzeitschrift „Euro-
pa-Archiv“, verweist deshalb auf diese Umfrage, da hier rund drei Viertel der Briten angaben,
die EG für die hohe Inflationsrate, steigende Lebensmittelpreise und den schlechten Arbeits-
markt verantwortlich zu machen.18
Jedoch waren es nicht nur die britischen Bürger, sondern auch die amtierenden Politiker, die
mit ihrem Verhältnis zu der Europäischen Gemeinschaft zu hadern hatten. Schieren zeigt die
Verknüpfung Großbritanniens mit Europa durch die politischen Schicksale mehrerer briti-
scher Premierminister, besonders durch den 1990 erfolgten Sturz der „Eisernen Lady“ Marga-
ret Thatcher und die 1997 folgende Wahlniederlage ihres Nachfolgers John Major. 19 Zudem
verweist Schieren auf die britische Frage nach dem Umgang mit der europäischen Integrati-
onspolitik.20
Während Thatcher und ihre konservative Partei (Thatcher war 1975 bis 1990 Parteivorsitzen-
de) in den 1970er-Jahren einen europafreundlichen Kurs wählten – begründet durch ein wirt-
16 Vgl. Williams (1991): S. 156. 17 Vgl. Neuhäuser (2005): S. 45. 18 Vgl. Volle (1989): S. 28. 19 Vgl. Schieren (2011): S. 217. 20 Vgl. ebenda.
Seite | 6
schaftspolitisches Credo, das sich mit den vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes der Ge-
meinschaft21 deckte – wurde es Anfang der 1980er-Jahre schwieriger, eine gemeinsame Linie
mit der Gemeinschaft zu definieren.22 So wiederholte Thatcher die Äußerung der Labour Par-
ty Regierung unter James Callaghan (1976-1979 britischer Premierminister)23, dass der EWG-
Finanzierungsbeitrag unangemessen hoch sei und forderte auf Grund der angeblichen Position
Großbritanniens als Nettozahler eine Senkung des britischen Finanzierungsbeitrags24. Der bis
heute bestehende „Britenrabatt“ wurde als Folge dieser Debatte 1985 eingeführt und erst mit
der Osterweiterung der Europäischen Union neu ausgerichtet.25
Obwohl die Diskussion um den Rabatt für Großbritannien das Verhältnis mit der EWG stark
beschädigte, gab es Mitte der 1980er-Jahre tiefgreifende Änderungen in der britischen Euro-
papolitik. Nachdem die britische Politik gegenüber den Europäischen Gemeinschaften jahre-
lang eher mit „europaskeptisch“ oder „europafremd“ zu betiteln war, gab die britische Zu-
stimmung für die Einheitliche Europäische Akte (EEA) durch Thatcher neue Impulse im Be-
reich der Integration aber auch Zuversicht zu einem Paradigmenwechsel.26 Zwar ließ sie in
dem Vertragswerk den für sie unpassenden Begriff der Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) umformulieren, beschreibt aber trotz dessen in ihren Memoiren, dass sie hinter der
Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte im Februar 1986 bis heute stehen würde.
Sie unterstreicht dabei die Wichtigkeit dieser dahingehend, dass ohne jene „das britische Vor-
haben eines europäischen Binnenmarktes nicht hätte verwirklicht werden können.“27
Nur zwei Jahre später verlieh Thatcher in der bekannten „Brügger-Rede“ ihrem Unmut über
die Vorgehensweise der Europäischen Gemeinschaften Ausdruck, indem sie einen baldigen
Integrationsstopp forderte.28 Da diese negativ konnotierte Linie innerhalb ihrer Partei gegen-
über Europa nicht gänzlich mitgetragen wurde und sie auch für ihre Innenpolitik immer mehr
Kritik erfuhr, wurde sie im November 1990 von Michael Heseltine in der Wahl des Parteivor-
sitzes herausgefordert.
21 Dabei handelt es sich um Freier Warenverkehr, Dienstleistungsfreiheit, Personenfreizügigkeit und Freier Kapi-
tal- und Zahlungsverkehr. 22 Vgl. Schieren (2011): S. 219. 23 Vgl. Sturm (2009): S. 213. 24 Vgl. Gamble (2006): S. 34. 25 Vgl. Sturm (2009): S. 213 f. 26 Vgl. Thatcher (1993): S. 771. 27 Thatcher (1993): S. 767. 28 Margaret Thatcher zitiert nach Schieren (2011): S. 219 ff.
Seite | 7
Obwohl Thatcher diese Wahl gegen ihren Herausforderer gewann, musste sie durch die Ver-
fehlung einer parteiinternen Hürde und den schwindenden Rückhalt bei den Konservativen ihr
Amt als Parteichefin und Premierministerin niederlegen.29 Thatchers Nachfolger John Major,
dessen Ansichten ähnlich wie die der „Eisernen Lady“ stark konservativ geprägt waren, ver-
suchte dennoch Großbritannien und dessen Interessen in die politischen Geschehnisse der EG
zu verankern, um mehr Einfluss auf europapolitische Mitgestaltung zu erhalten.30
Die Wahl John Majors zum Nachfolger der angeschlagenen Margaret Thatcher wurde von
den Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft als „eine Neubestimmung der britischen Eu-
ropapolitik“31 gesehen und nährte dementsprechend die Hoffnungen auf eine neue Ära der
britischen Einstellung zum europäischen Integrationsprojekt. Dies bestätigte sich teilweise im
Februar 1992, als Major dem Vertrag von Maastricht zustimmte. Trotz Bemühungen wie die-
ser seitens Majors war die britische Europapolitik mit Beginn der 1990er-Jahre gezeichnet
von Debatten und Krisen. Nach Problemen des Pfund Sterling im Europäischen Währungs-
system (EWS) blieb - trotz der Hilfsversuche aus Deutschland durch Stützungskäufe – der
britischen Regierung im September 1992 keine andere Möglichkeit, als das EWS nach nur
zweijähriger Mitgliedschaft zu verlassen.32 So war dies für Major, der unter Thatcher einer
der wenigen Verfechter und Unterstützer des EWS gewesen war, eine herbe und vor allem
persönliche Niederlage.33
Obwohl Major weiterhin als „pragmatischer Pro-Europäer“34 auftrat, bekam auch er die Fol-
gen des damaligen Zögerns des Empires bezüglich des zu späten Beitritts in das Europäische
Währungssystem zu spüren. Mit der starken Abwertung des britischen Pfund Sterling Anfang
der 1990er-Jahre änderte die konservative Regierung daher ihren Kurs gegenüber der EG. Bei
den Verhandlungen und Gesprächen zum 1993 in Kraft getretenen Vertrag von Maastricht
wurde diese neue Position Majors deutlich. So blockierte die britische Regierung die Einfüh-
rung einer gemeinsamen europäischen Währung und einer Europäischen Sozialcharta ihrer-
seits nicht, hielt sich andererseits aber weitestgehend aus den Verhandlungen heraus.35
29 Vgl. Schieren (2011): S. 222 f. 30 Vgl. Sturm (2009): S. 208. 31 Fischer (1996): S. 40. 32 Vgl. Neuhäuser (2005): S. 70 ff. 33 Vgl. Fischer (1996): S. 51 ff. 34 Schieren (2011): S. 222. 35 Vgl. Sturm (2009): S. 216.
Seite | 8
Durch die Verhandlungen zum Maastrichter Vertrag erhielt Großbritannien eine „opt-out-
Klausel“36, die in dem neuen Vertragswerk speziell auf Großbritannien verwies. Diese Klau-
sel war zwar auf Wunsch der britischen Regierung unter John Major hinzugefügt worden, die
starke rhetorische Unterstreichung der Sonderrolle missfiel den Briten jedoch. Dies wird laut
Stephen George damit begründet, dass die Briten fürchteten, erneut die Rolle des seltsamen
Partners in der Gemeinschaft zugewiesen zu bekommen und somit für mögliche Investoren an
Reiz zu verlieren.37 Trotz all dieser genannten Punkte stand die britische Regierung unter Ma-
jor hinter dem Vertrag von Maastricht, wie aus einem Zitat von Major aus dem Jahr der Ver-
tragsunterzeichnung hervorgeht:
„The Maastricht treaty was negotiated in good faith by all member states. I have no in-
tention of breaking the word of the British Government that was given on that occa-
sion ; nor do I have any intention of compromising what we agreed on that occasion and wrecking this country's reputation for plain and honest dealing and good faith.“38
2.2.2 1997 bis 2007
Die Verhandlungen der europäischen Mitgliedsstaaten bezüglich des Vertrages von Amster-
dam überlappten sich mit dem Wandel in der britischen Regierung. Während John Major sei-
ne „zum Scheitern verurteilte Präsidentschaft“39 beendete, folgte ihm der europafreundliche
Tony Blair ins Amt. Dieser repräsentierte die sozialdemokratisch ausgerichtete Labour Party,
welche ihn nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Parteichefs John Smith im Juli 1994 als
Vorsitzenden der Partei wählte, um so ein neues Kapitel der Parteigeschichte, im Weiteren
„New Labour“ benannt, einzuläuten40. „New Labour“ beschreibt hierbei den Wandel der Par-
tei nicht ausschließlich, aber vor allem durch die Wahl Tony Blairs 1994 zum Vorsitzenden
und 1997 zum Premierminister, da er für einen jungen und veränderten Stil stand.41
36 Bei diesen Klauseln handelt es sich um Zusätze im Maastrichter Vertrag, die Großbritannien einseitig erlau-ben, den Zeitpunkt eines Beitritts zur europäischen Einheitswährung Euro selber festzulegen. 37 Vgl. George (1998): S. 243. 38 Major (25.06.1992). 39 Miers (2004): S. 30. [Übersetzung durch den Autor] 40 Vgl. Driver; Martell (2006): S. 10. 41
Vgl. ebenda.
Seite | 9
Mit diesem Regierungswechsel 1997, der die Labour Party nach 18 Jahren in der Opposition
wieder an die Spitze der britischen Regierung brachte, änderte sich auch die Europapolitik
Großbritanniens zunächst. Laut Becker hat es der neue Premierminister Tony Blair geschafft,
einen nachhaltigen Umschwung von der traditionell anti-europäischen Haltung der Labour
Party hin zu einer positiven Grundhaltung zu erreichen.42 So setzte er neue Akzente in Rich-
tung der Europäischen Gemeinschaft, indem er das Amt des Europaministers schuf und durch
seinen Außenminister verlautbaren ließ, dass Großbritannien in Zukunft ein führender Akteur
in Europa sein werde.43 Blair kritisierte zudem den Umgang seiner konservativen Amtsvor-
gänger mit der britischen Europapolitik dahingehend, wie sehr jene das Land innerhalb der
Gemeinschaft isoliert hatten.44 Dies betitelte er wie folgt:
„Britain’s relations with Europe have often been ambivalent or indifferent. Indeed, I believe Britain’s hesitation over Europe was one of my country’s greatest miscalcula-
tions of the post-War [sic!] years.”45
So setzte sich der Premierminister dafür ein, das britische Volk, das seit jeher skeptisch ge-
genüber übernationalen Konstruktionen wie der Europäischen Union oder einer gemeinsamen
Währungsunion war, von den Vorteilen eben jener zu überzeugen.46 Dies tat er, da er befürch-
tete, ein zu langes Zögern hinsichtlich einer Abwesenheit von der Einheitswährung Europas
könnte die Wirtschaft Großbritanniens schwächen und folglich die Einflussnahme und Mitbe-
stimmung in der EU reduzieren.47 Weiterhin trug Blair mit der Unterzeichnung der Sozial-
charta zur Integration Großbritanniens in Europa bei.48 Seine erste Amtszeit, 1997 bis 2001,
kann daher als europäische Erfolgsgeschichte angesehen werden.49
Jedoch konnte auch ein pro-europäischer Premierminister wie Tony Blair sich nicht komplett
gegen die Belange und Forderungen seiner Wähler und Parteigenossen stellen, welche schon
mit Beginn seiner Amtszeit 1997 für einen Verbleib der Bereiche Steuern, Grenzkontrollen
sowie Migrationspolitik auf nationaler Ebene argumentierten.50 So blieb es nicht aus, dass
Blair in seiner zweiten Amtszeit des Öfteren kritische Worte für die Europäische Union fand
42 Vgl. Becker (2002): S. 292. 43 Vgl. Miers (2004): S. 30 f. 44 Vgl. Neuhäuser (2005): S. 85. 45 Blair (23.02.2000). 46 Vgl. Tony Blair: Change: A Modern Britain in Modern Europe zitiert nach Neuhäuser (2005): S. 7. 47 Vgl. Neuhäuser (2005): S. 7. 48 Vgl. Schieren (2011): S. 224. 49 Vgl. Buller (2008): S. 140. 50 Vgl. Driver; Martell (2006): S. 179.
Seite | 10
und nicht alle Aktionen derer unterstützte. So war Großbritannien eines der neun Länder51, die
nach der Unterzeichnung des Entwurfes über die Verfassung für Europa ein Referendum be-
züglich der noch ausstehenden Ratifizierung ankündigten, zudem es zumindest unter Blair
nicht kam, was „wahrscheinlich ein Grund zum Feiern für die Labour Party war“.52. Ein
möglicher Begründungsansatz liegt hierbei in dem Sprichwort, welches auch die Labour Party
ernst zu nehmen schien: „National vetoes are better than opt-outs (and opt-ins)“53.
Ein entscheidender Punkt in Blairs zweiter Amtszeit, die Beteiligung am Irakkrieg, versetzte
seinem Image als besonnener Europäer einen Schlag, der ihn einige Befürworter sowohl in
den eigenen Reihen als auch in der Union kostete und eventuell zu seiner verkürzten dritten
Amtszeit führte. Zu der genannten Zeit (zweite Amtszeit Blair 2001-2005) ist auch der briti-
sche Bruch mit der Europäischen Union zu sehen, obwohl Blair mit seiner Labour Party ei-
gentlich eine Brücke zwischen den USA und der EU sein wollte.54 Jim Buller, Dozent an der
Universität York, verweist dabei auf ein privates Treffen von Blair und Bush auf dessen
Ranch in Texas im April 2002, bei welchem Blair ohne Absprache mit den anderen EU-
Mitgliedsstaaten den Amerikanern für ihre Militäraktionen im Irak Unterstützung versprochen
habe. So gab es enorme Kritik für diese Unterstützung der amerikanischen Interventionspoli-
tik, die zum Rücktritt mehrerer Politiker der regierenden Labour Party im Jahr 2003, so des
ehemaligen Außenministers Robin Cook und der Ministerin für Internationale Entwicklung
Clare Short, führte.55
Problematisch für Blairs Aktionsradius innerhalb der britischen Regierung war seit seinem
Amtsantritt als Premierminister 1997 sein Parteigenosse, Schatzmeister sowie späterer Nach-
folger Gordon Brown. Im Jahr 1994, als Tony Blair anstelle des von vielen als Favorit ange-
sehenen Gordon Brown an die Parteispitze gewählt wurde, entstand eine wenn auch nur theo-
retische und nicht in der britischen Öffentlichkeit gelebte Rivalität der beiden. 56 So war
Brown gegenteiliger Meinung, wenn es um den Charakter der Labour Party ging, denn er ver-
trat traditionellere Ansätze, die er bei einem Parteitag 2003 „real Labour“ anstatt „new La-
bour“ nannte.57
51 Dänemark, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich. 52 Driver; Martell (2006): S. 181. 53 Driver; Martell (2006): S. 180. 54
Vgl. Buller (2008): S. 146. 55
Vgl. Driver; Martell (2006): S. 191. 56 Vgl. Driver; Martell (2006): S. 11 f. 57 Vgl. Brown (2003).
Seite | 11
Obgleich Brown mit seinem Amtsantritt 2007 versuchte, die Labour Party nach den schwa-
chen Umfrageergebnissen, verursacht durch Blairs Beziehungen zu Bush, durch traditionelle
Werte zurück auf die richtige Spur zu bringen, waren die ersten Monate von Browns Präsi-
dentschaft gezeichnet von innerparteilichen Skandalen und Spendenaffären. 58 Durch diese
und andere Probleme, beispielweise sein Image als misstrauischer und kalter Premierminister,
scheiterte die Labour Party 2010 an einer erneuten Regierungsbildung.
Ähnliche Auffassungen hatten die beiden Labour-Premierminister jedoch trotz ihrer anfängli-
chen Rivalität dahingehend, dass sie, um die Forderung nach einem Referendum zu verhin-
dern, immer wieder auf die noch andauernden Debatten und Verhandlungen der EU-Verträge
verwiesen.59 Trotz aller Bemühungen der Labour Party Großbritannien auf einen neuen euro-
pafreundlichen Kurs zu bringen, verbindet man die Zusammenarbeit mit der EU heute immer
noch damit, dass Großbritannien „statt der politischen Integration […] die weitere wirtschaft-
liche Vereinigung [wolle]“60. Vor allem die Einstellung, welche Großbritannien der Europäi-
schen Gemeinschaft entgegen brachte, führte immer wieder zu Konflikten und prägte die Zu-
sammenarbeit zwischen beiden maßgeblich. Zusammenfassend kann daher resümiert werden,
dass die Einstellung Großbritanniens gegenüber der EU und ihren Institutionen bzw. Organen
seit jeher reserviert und verhalten war. So ist es nicht abwegig aber doch enorm notwendig für
den weiteren Verlauf der Arbeit zu betrachten, welche Folgen und Auswirkungen ein Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen Union haben würde. Bevor die einzelnen Alternativ-
modelle vorgestellt werden können, müssen zuvor die Beweggründe einzelner britischer Ak-
teure sowie die Sichtweise der Europäischen Union und die Folgen für alle Beteiligten darge-
stellt werden.
58 Vgl. Lee (2008): S. 194. 59 Vgl. Buller (2008): S. 148 f. 60 Vgl. Becker (2002): S. 285.
Seite | 12
3 Das Für und Wider eines möglichen Austritts Großbritanniens aus
der Europäischen Union
3.1 Akteure in der Europäischen Union und ihre Sichtweisen
Der Weg, den Großbritannien und die EU zusammen gegangen sind, war nicht immer von
beidseitiger Anerkennung, Vertrauen und Verständnis geprägt. Für sein Vorgehen und Um-
gang mit den Prinzipien der europäischen Institutionen wurde Großbritannien oft kritisiert und
als Einzelkämpfer dargestellt. 61 Besonders harsche Kritik äußerten vor allem andere EG-
Mitgliedsstaaten, als Großbritannien eine Süderweiterung der EG um Griechenland, Spanien
und Portugal verlangte. Grund für die Kritik war, dass man vermutete, die Briten würden
durch das Werben der Neumitglieder die Gemeinschaft schwächen und so die Integrations-
bemühungen erschweren.62 Zudem haben die Briten in Brüssel auch heute noch den Ruf von
„Bremser[n] und Querulanten“63, die nur an sich selbst und die Vorteile für ihr Land den-
ken.64 So kann der ständige Wechsel der britischen Europapolitik von der Europäischen Uni-
on nur als hinderlich und blockierend angesehen werden.
Daher reagierte die EU-Justizkommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission Viviane
Reding auf den Vorstoß Camerons zur Beschneidung der Rechte von EU-Migranten mit der
Forderung des Überdenkens der britischen EU-Mitgliedschaft.65
"Wenn Großbritannien aus dem Binnenmarkt austreten will, dann soll Großbritannien
dies sagen. Das Recht auf Freizügigkeit ist nicht verhandelbar – solange Großbritanni-en ein Mitglied dieser Europäischen Union und des Binnenmarktes ist."66
Weitere Kritik an dem britischen Vorhaben kam vom französischen Präsidenten François
Hollande und seinem Außenminister Laurent Fabius, die sich beide kritisch zur britischen „à
la carte-Einstellung“ aussprachen. Auch die schwedische Regierung signalisierte der briti-
schen Seite, man müsse bei solch einer schwerwiegenden Entscheidung mit äußerster Vor-
sicht vorgehen.67
61 Vgl. Neuhäuser (2005): S. 46. 62 Ebenda S. 47. 63 Zaschke (04.06.2014); ebenso Buchan (24.09.2012): S. 2. 64 Vgl. Zaschke (04.06.2014). 65 Vgl. Schiltz (29.11.2013). 66 Viviane Reding zitiert nach Schiltz (29.11.2013). 67 Vgl. House of Commons (01.07.2013): S. 12.
Seite | 13
Trotz aller Kritik an dem wechselhaften britischen Habitus ist Großbritannien für die Europäi-
sche Union als kollektive Integrationsbrücke Europas und „global player“ ein notwendiger
Partner. Der Einfluss der Briten auf das interne als auch externe Agieren der EU darf daher
nicht unterschätzt werden. So spielt die Insel eine entscheidende Rolle in der von der EU so
hochgepriesenen Außen- und Sicherheitspolitik und bringt dort vor allem seine militärische
Expertise ein.68 Zudem ist das Land im Besitz eines Vetorechts im Weltsicherheitsrat und hat
die wohl besten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika innerhalb der EU. Ein
Austritt würde die außenpolitischen Ziele der EU in weite Ferne rücken lassen.
Dies erkennen auch einzelne Mitgliedsstaaten der EU und sprechen sich für einen Verbleib
der Briten in der Union aus: Denn viele nordeuropäische Staaten sowie Deutschland teilen mit
Großbritannien eine liberale Orientierung in wirtschaftspolitischen Fragen Europas. 69 Ein
Austritt des „liberale[n] Schwergewicht[s]“70 Großbritannien würde die entscheidenden Ab-
stimmungen erschweren. Gerade Deutschland, dessen Kurs vor allem bei südeuropäischen
Krisenstaaten immer mehr in die Kritik geraten ist, braucht den britischen Partner, um solche
Kritiker in Schach zu halten.71 So werden zunehmend deutsche Stimmen aus der Politik laut,
die den Verbleib Großbritanniens in der EU fordern. Während die Kanzlerin Angela Merkel
die britische Mitgliedschaft als essentiellen Teil der EU darstellte, sprach auch der ehemalige
Verteidigungsminister und jetzige Innenminister der Bundesrepublik Deutschland Thomas de
Maizière von einer großen Enttäuschung, falls Deutschland mit dem Austritt Großbritanniens
einen so starken Partner verlieren würde.72
Ebenfalls nur einen Monat nach der im Januar 2013 erfolgten Ankündigung Camerons rea-
gierten Vertreter der Europäischen Union auf die prekäre Lage. Herman van Rompuy, Präsi-
dent des Europäischen Rates, verwies in einer Rede im Februar 2013 darauf, dass es zwar
möglich wäre die EU zu verlassen, aber so etwas nicht ohne Folgen und Kosten sei.73 Sein
Amtskollege und aktueller Kommissionspräsident José Manuel Barroso fügte dieser Aussage
zur gleichen Zeit hinzu, dass Großbritannien einen großen Beitrag zur Verwirklichung der
68 Vgl. Zaschke (04.06.2014). 69 Vgl. Oliver (2013): S. 10. 70 Busch (Juni 2014): S. 16. 71 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 16 f. 72 Vgl. House of Commons (01.07.2013): S. 12. 73 Vgl. House of Commons (01.07.2013): S. 11.
Seite | 14
europäischen Ideen und Ziele geleistet habe und dass es deswegen in dem Interesse der Briten
sein sollte, weiterhin ein aktives Mitglied in der EU zu bleiben.74
Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass zwar eine gewisse Antipathie gegenüber
der forschen Vorgehensweise der Briten besteht, jedoch den meisten europäischen Politikern
und Experten klar ist, welche Ausmaße ein Verlust Großbritanniens mit sich bringen würde.
3.2 Sichtweisen ausgewählter britischer Akteure
3.2.1 Die britische Zivilbevölkerung und die Presse
“I must say that this part of the press in Britain is the most irresponsible in Europe. It is not just to do with EU affairs; it uses xenophobia as a way to sell papers.”75
Wie bereits erwähnt, herrschten seit der Abwertung des Pfundes 1992 europakritische und
europafeindliche Tendenzen in der britischen Öffentlichkeit vor. Damals gab die britische
Boulevardpresse, verdeutlicht an dem obigen Zitat, vor allem der Deutschen Bundesbank die
Schuld an der Abwertung, da man jene als „Strippenzieher“ vermutete.76 So verweist Becker
erst auf die allgemeine Europaskepsis, welche stetig durch die mehrfach öffentlich propagier-
te ablehnende Haltung zur Europäischen Union und der Unionspolitik britischer Politiker ver-
stärkt wird.77 Danach verweist Becker darauf, wie sehr sich die Meinungen zur EU innerhalb
Großbritanniens unterscheiden. So sind laut Becker die Einwohner Schottlands und Nordeng-
lands pro-europäisch, jene im Finanzzentrum London und im englischen Südosten als mode-
rat, der Südwesten sowie die West Midlands dagegen sind als in der Tendenz stark anti-
europäisch einzuschätzen.78 Es ist in diesem Zusammenhang wenig verwunderlich, dass die
britische Bevölkerung eine andere Sichtweise auf den Nutzen der Europäischen Union hat als
die Bürger anderer Mitgliedsstaaten. In einem Beitrag der Financial Times fasste der engli-
74 Vgl. ebenda. 75 Elmar Brok (MEP) zitiert nach Pappamikail (1998): S. 219. 76 Vgl. David Marsh (1992) zitiert nach Schieren (2011): S. 223. 77 Vgl. Becker (2002): S. 299. 78 Vgl. ebenda.
Seite | 15
sche Journalist Philip Stephens die europapolitische Stimmung der britischen Bevölkerung
wie folgt zusammen:
„They have been told again and again that this is a battlefield on which Britain occa-
sionally wins but more often loses. Brussels, in tabloid parlance, is the place where
malicious foreigners conspire against noble Anglo-Saxons. The slightest possibility
that their [sic!] might be advantage for Britain in marching in step has been inadmissi-ble. Europe is something to be suffered, at very best endured.”79
Die Ergebnisse des 2009 durchgeführten Eurobarometers zeigen, dass 53% der Bevölkerung
in den EU-Mitgliedsstaaten eine Mitgliedschaft in ihrem Land unterstützen.80 Dementgegen
sahen nur 28% der Briten81 eine Mitgliedschaft als positiv an. Genauere Einblicke zur Mei-
nung der Briten gegenüber der EU erlauben die Interpretationen des Eurobarometers 2011
durch Andrew Geddes, Professor an der University of Sheffield:
Geddes analysiert und charakterisiert die öffentliche Meinung der Bürger der EU-
Mitgliedsländer, indem er Bezug auf Erkenntnisse der Umfragen eines Eurobarometers aus
dem Herbst 2011 nimmt.82 Auf die Frage hin, was die EU für jeden einzelnen Befragten per-
sönlich bedeutet, zeichnet sich klar ab, dass die britische Bevölkerung weniger von der EU
und ihren Vorteilen für Großbritannien hält als der befragte EU-Durchschnitt. Während diese
Mehrheit besonders positive Werte wie Wohlstand, Demokratie, den Euro und stärkeren Ein-
fluss in der Welt mit der EU assoziieren, antworten die Briten mit negativen Schlagwörtern
wie Verschwendung von Geldern, Bürokratie, mangelnde Grenzkontrollen und Verlust der
kulturellen Identität.83
Diese Meinungen und Ansichten der britischen Zivilgesellschaft sind, wie bereits in verschie-
denen vorhergegangen Kapiteln erkenntlich geworden ist, ein Produkt verknüpfter Aspekte
und historischer Ereignisse. So spielt bei der Meinungsbildung der Briten sowohl ihre Ver-
gangenheit im europäischen Kontext als auch die aktuelle mediale Berichterstattung der Pres-
se zu europäischen Fragen und Themen eine entscheidende Rolle. Jedoch muss man genauer
hinschauen um zu sehen, dass nicht alle Briten eine negative Grundeinstellung zu Europa und
der EU haben und pauschal einen Austritt aus der Europäischen Union fordern. Eine Umfrage
des Marktforschungsinstitutes YouGov im Oktober 201184 untermauert diese These der Viel-
79 Philip Stephens zitiert nach Sturm (2002): S.208. 80 European Commission (2009a): S. 91. 81 European Commission (2009b): S. 11. 82 Vgl. Geddes (2013): S. 32 ff. ; Eurobarometer (2011). 83 Eurobarometer (2011). [Übersetzung der einzelnen Werte durch den Autor] 84 Siehe Abbildung 1.
Seite | 16
falt der britischen Meinungen zur Zukunft Großbritanniens in der Europäischen Union. So
waren zu dem Zeitpunkt der Umfrage nur verhältnismäßig wenige Briten (27%) für den dras-
tischen Schritt eines Austritts ihres Landes aus der Union. Demgegenüber waren es 23% der
befragten Briten, die sich den Status quo (13%) oder sogar mehr Integrationsbemühungen
wünschten. Bei letzterem Aspekt ist es sehr erstaunlich, dass sich knapp 7% der Briten eine
vertiefte Integration innerhalb der EU wünschen, die zwar ohne eine europäische Regierung,
aber mit einer Einheitswährung und dem Wegfall der Grenzkontrollen ausgestattet wäre. Eine
Minderheit der bei der Umfrage beteiligten Briten waren sogar der Ansicht, ein „voll inte-
griertes Europa, in dem alle wichtigen Entscheidungen von einer europäischen Regierung
gefällt werden“85, wäre die bestmögliche Entwicklung für die Europäische Union. Die Mehr-
heit der Befragten, hierbei mit rund 40% vertreten, wünschte sich eine Neuverhandlung des
Status quo der britischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Als Ziel dieser Verhand-
lungen gab die Mehrheit einen loseren europäischen Verbund mit einer Europäischen Union
an, die nur ein wenig mehr Einfluss und Gewicht hat als eine Freihandelszone.
So sehr die britische Bevölkerung und die Medien auch in ihrer Meinung zur EU und dem
Referendum schwanken, so wichtig sollte es für sie auch sein, sich mit den langfristigen Fol-
gen eines möglichen Austritts auseinanderzusetzen. Denn ein britisches Votum gegen einen
Verbleib in der Europäischen Union wäre der Beginn eines langwierigen Austrittsprozesses,
dessen Verhandlungen sowohl aus politischer als auch rechtlicher Sicht für alle Beteiligten
„Neuland“ sein würde.86
3.2.2 Die Regierungskoalition und das Referendum
Aber nicht nur die britische Bevölkerung, sondern auch ihr konservativer Premierminister
David Cameron muss sich der Folgen eines Austritts aus der Union bewusst seien. Daher
stellt sich neben der Sinnhaftigkeit eines Referendums auch die Frage, wie es zu der Ankün-
digung jenes durch Cameron kommen konnte.
So hat David Cameron im Januar 2013 bei seiner Bloomberg-Rede angekündigt, im Falle
seiner Wiederwahl im Mai 2015 den Briten die Wahl über die Zukunft Großbritanniens in
85 YouGov (October 2011). [Übersetzung durch den Autor] 86
Vgl. von Ondarza (2013b): S. 16.
Seite | 17
Europa in Form eines Referendums Ende 2017 zu geben87, das bei einem positiven Ausgang
einen Austritt der Briten aus der EU circa 2019 bedeuten könnte. Die Referendums-Strategie
von David Cameron mag zwar aus Verzweiflung heraus geboren worden sein, jedoch scheint
sie, zumindest im Moment, teilweise aufzugehen. So konnte sich Cameron dank der steigen-
den EU-Skepsis der britischen Bevölkerung einer breiten Zustimmung, zumindest bis Ende
2012 sicher sein.88 Dass diese Zustimmung einen Wandel erlebt, zeigt sich in Abbildung 2. So
nimmt die Zahl der Briten, die für einen Austritt bei dem geplanten Referendum stimmen
würden, langsam aber stetig ab. Waren es im August 2011 noch mehr als die Hälfte aller Be-
fragten (52%), so verzeichnete der Januar 2013 nur noch rund 34%. Ende 2011 waren es so-
wohl 41% der Briten, die in der EU bleiben, als auch diese verlassen wollten.
Trotz der Schwankungen in der Befürwortung für Camerons Handlungen in der britischen
Bevölkerung stellten sich vermehrt britische Politiker hinter Camerons Vorhaben: Während
die Labour Party unter Ed Milband über ihre Stellung in der Referendumsfrage nachdenkt,
stärkt der ehemalige britische Premierminister und Parteikollege in der Conservative Party,
John Major, Cameron den Rücken und begründet die Notwendigkeit eines Referendums da-
mit, dass Europa die britische Politik sowie das nationale Parlament lange genug „vergiftet“
und die Konservativen fast vernichtet habe.89
Der Sieg von Nigel Farage und seiner UKIP bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im
Mai 2014 ist in zweifacher Hinsicht eine herbe Niederlage für die regierende Koalition von
Nigel Clegg und David Cameron. Zum einen konnte UKIP beiden Parteien Stimmen entzie-
hen und zum anderen zwingt diese Dominanz Cameron nun indirekt dazu, in den Verhand-
lungen mit Brüssel eine schärfere Position zu beziehen, um Wähler wieder von der Linie sei-
ner Partei zu überzeugen. Kielinger prophezeit daher, dass Cameron zukünftig mehr Rechte
für das britische Parlament fordert, um somit wie der „Robin Hood britischer Interessen“ zu
wirken.90 Geddes bestätigt den ansteigenden Druck auf Cameron und verweist dabei auf den
Zeitraum zwischen Oktober 2011 und Februar 2012, in welchem Camerons Rolle des Euro-
Pragmatikers mit dem Problem eines aufkommenden Rufes aus den eigenen Reihen nach ei-
nem Referendum zu der britischen EU-Mitgliedschaft zum „selbsternannten stabilen Vertei-
87 Vgl. Cameron (23.01.2013). 88 Vgl. von Ondarza (2013a): S. 2. 89 Vgl. Major (14.02.2013). 90 Vgl. Kielinger (26.05.2014).
Seite | 18
diger nationaler Interessen“91 und zurück zu dem alten Status eines Pragmatikers im Februar
2012 wechselte.92
So hat mittlerweile auch Cameron erkannt, wie wichtig eine Mitgliedschaft in der Union für
Großbritannien ist und welche isolierenden Folgen ein Austritt hätte. Trotzdem will er refor-
mieren und strebt dabei einen vereinfachten und ungebundeneren Status seines Landes an.
Von Ondarza spricht hierbei von dem Ziel, „Die EU nach britischem Gusto [zu] formen“93.
Zwei Motive stechen laut Nicolai von Ondarza94 hierbei heraus: Als erstes will Cameron er-
reichen, dass der Binnenmarkt weiter forciert wird. Daneben zielt er auf die Rückgewinnung
von Kompetenzen von der EU- auf die nationale Ebene. Vor allem die Sozialpolitik gilt im-
mer wieder als Streitpunkt mit und innerhalb der Union und wird meist von Europa-
Skeptikern als Kritik an der EU genutzt. So ist gerade dieser Aspekt ein häufiger Streitauslö-
ser in der aktuellen britischen Koalitionsregierung von Konservativen und Liberaldemokraten,
denn besonders bei dem Thema der Migration sind sich Cameron und Clegg nicht einig.95
Während Cameron eine Einschränkung der Einwanderungsgesetze vorsieht, verweist Clegg
darauf, dass circa 80% der Migranten aus anderen EU-Staaten einwandern und somit nach
EU-Recht völlig legitim nach Großbritannien kommen dürfen. Dies zeigt, wie stark die briti-
sche Regierung in ihrer Meinung über die Integrationsbemühungen der EU und somit auch zu
einem Referendum über den Verbleib in dieser divergiert.
3.2.3 Labour Party
Kritik an seinem harschen Vorgehen muss sich Cameron nicht nur vom Koalitionspartner
Clegg, sondern auch von der Opposition in Form der Labour Party gefallen lassen, welche vor
Camerons Amtsantritt 13 Jahre lang die britische Regierung bildete. Kurz nachdem Premier-
minister Cameron das Referendum ankündigte, kommentierte der Labour Party Vorsitzende
Ed Miliband diesen Vorstoß Camerons in einem Artikel der britischen, tendenziell europa-
freundlichen Zeitung „Guardian“ damit, dass er Cameron als einen „schwachen Premierminis-
ter, der nur von seiner Partei und nicht von den nationalen Wirtschaftsinteressen getrieben
91 Geddes (2013): S. 251. [Übersetzung durch den Autor] 92 Vgl. Geddes (2013): S. 251. 93 Von Ondarza (2013a): S. 2. 94 Vgl. von Ondarza (2013a): S. 2. 95 Vgl. Geddes (2013): S. 247.
Seite | 19
ist“96, ansehe. Zudem warf Miliband Cameron vor, „in Richtung eines Austritts aus der EU
schlafzuwandeln“97 und keinerlei Maßnahmen dagegen zu unternehmen. Desweiteren kriti-
sierte er Camerons ungenauen Zeitplan für ein mögliches Referendum im Jahr 2017, da die
dadurch verursachte Ungewissheit britische Unternehmen und Investoren verunsichern könn-
te.98
Als Oppositioneller und Vertreter der Labour Party bekräftigte Miliband in verschiedenen
Interviews und Pressemitteilungen99 immer wieder, dass ein Referendum über den Verbleib
der Briten in der EU bei einem Wahlsieg seiner Labour Party bei den Wahlen im Mai 2015
„eher unwahrscheinlich“100 sei. Als eine der Begründungen nannte Miliband die überragende
wirtschaftliche Verflechtung mit Europa, die durch die EU-Mitgliedschaft entstanden sei.101
Miliband ist klar, dass die EU sich reformieren muss, gegebenenfalls durch die Ausarbeitung
eines neuen EU-Vertrages102, um einen Austritt der Briten auf lange Sicht zu verhindern. So
drängt er daher auf eine schnelle Fertigstellung des europäischen Binnenmarktes, vor allem
im Energie- und Dienstleistungsbereich, sowie eine Verlängerung der Übergangsfristen hin-
sichtlich der Einschränkungen von Rechten für Migranten aus anderen EU-Ländern. Zudem
sollen Immigranten bei einem Bruch des britischen Gesetzes schneller abgeschoben werden
können – solch eine Forderung gibt es bisher von Cameron so nicht103.
Jedoch ist die Meinung der Labour Party nicht ganz so eindeutig, wenn es um ein mögliches
„in-out-referendum“ geht, als es den Anschein hat. So gab der Parteichef auch vor wenigen
Monaten bekannt, dass er den starren Prozess einer politischen Union nicht weiter unterstüt-
zen und im Falle einer erneuten Forderung Brüssels nach Übertragung nationaler Souveränität
ein Referendum - allerdings eines über den Kompetenztransfer, nicht den Verbleib in der EU -
garantieren würde.104 Diese Aussage soll wohl die konservativen Wähler der Labour Party
beschwichtigen und stellt Camerons „Monopol“ auf eine Garantie eines Referendums in Fra-
ge. Trotzdem sind sich die Labour Party und ihr Vorsitzender Ed Miliband nicht ganz einig,
wie es um die Frage nach einem Referendum und damit die weitere Anteilnahme Großbritan-
niens an der EU geht. Während die pro-europäischen Mitglieder des britischen Unterhauses
96 Miliband (22.01.2013) zitiert nach Watt (23.01.2013) [Übersetzung durch den Autor]. 97 Von Ondarza (2013b): S. 27. 98 Vgl. Grice (12.03.2014). 99
Vgl. Robinson (12.03.2014); ebenso Grice (12.03.2014). 100 Statt vieler: Buchsteiner (13.03.2014). 101 Vgl. Robinson (12.03.2014). 102 Vgl. ebenda. 103 Vgl. Buchsteiner (13.03.2014). 104 Vgl. Robinson (12.03.2014) ; ebenso Buchsteiner (13.03.2014).
Seite | 20
ein Referendum um des Referendums Willens nicht gutheißen, begrüßen EU-Skeptiker der
Labour Party dieses als Novum in der Geschichte der Partei.105 In der britischen Öffentlich-
keit trifft Miliband mit seinem wechselnden Referendumskurs jedoch auf eine gespaltene
Meinung: Während Stimmen aus der Wirtschaft dazu überwiegend positiv eingestellt sind106,
reagieren europakritische Medien wie „The Times“ auf den Vorstoß Milibands mit aggressi-
ver Berichterstattung inklusive Wörtern wie „schandhaft“ [sic!] und „Aasgeier“.107
Wie die vorhergegangenen Absätze gezeigt haben, muss Cameron der oppositionellen Labour
Party in naher Zukunft mehr Aufmerksamkeit widmen, um einen Verlust an Befürwortern
seines Referendums zu verhindern. So zeigen Umfragen108 die Problematik genauer, denn
während die Labour Party zwar in den letzten Monaten über zehn Prozentpunkte an Zustim-
mung aus der britischen Bevölkerung verloren hat, konnte die Conservative Party unter Ca-
meron dies nicht nutzen und legte daher auch in den Umfragewerten kaum zu. So waren beide
Parteien im Oktober 2013 mit knapp 35% der Wählerstimmen gleich auf, schwankten bis zum
Ende des Jahres aber nochmals. Unklar ist daher nicht nur der Ausgang der britischen Parla-
mentswahlen 2015, sondern auch, ob die Labour Party zu ihrem „Nein“ zu einem Referendum
steht.
3.2.4 United Kingdom Independence Party
„If there is a European ‘problem‘, it is not restricted to one British political party, but more generally throughout the British political and administrative establishment […].”109
So ist Cameron mit seiner Europa- und EU-kritischen Haltung nicht allein in Großbritannien.
Die United Kingdom Independence Party hat seit ihrer Gründung im Jahr 1993 und ihrer ers-
ten Teilnahme an den Europawahlen 1994 immer europakritisch agiert. In ihrem Wahlpro-
gramm mit dem aussagekräftigen Titel „We want our country back“ (den UKIP bis heute na-
hezu inflationär benutzt) aus dem Jahr 2005 fordert die Partei einen Rückzug Großbritanniens
aus der EU.110 So beschreibt die Partei in diesem „Manifesto“ [sic!], dass die EU nur eine
105
Vgl. Robinson (12.03.2014). 106 Buchsteiner (13.03.2014). 107 Statt vieler: Aaronovitch (05.09.2013). 108 Siehe dazu Abbildung 3. 109 Butler; Westlake (1995): S. 22. 110 Vgl. UKIP (2005): S. 1.
Seite | 21
Einbahnstraße in Richtung einer europäischen Regierung sei und dass diese damit sowohl
korrupt, undemokratisch als auch nicht reformierbar sei. Daher gebe es nur eine Möglichkeit
für Großbritannien, nämlich einen Austritt aus der Europäischen Union.111
So hat es sich Nigel Farage zum Ziel gemacht Großbritannien nicht nur aus den Fängen der
EU, sondern auch Europas als Integrationskonstrukt zu reißen. Mit Wahlkampfgetöse, kraftlo-
sen Drohungen und leeren Versprechungen habe UKIP versucht, die britische Bevölkerung
von einer Sinnlosigkeit der EU zu überzeugen.112 Gezielte Propaganda und Desinformations-
kampagnen sollen die Vorurteile gegenüber Europa und der EU schüren und so Großbritanni-
en in seiner Haltung zu Europa spalten.113 Als Beispiel solcher inhaltslosen und falsch beleg-
ten Fakten verfluchte UKIP vor den Europawahlen im Mai 2014 die Gesetzgebung in Brüssel,
da von dort angeblich mehr als 75% der nationalen Gesetze diktiert würden114. Diese Behaup-
tung konnte Töller widerlegen und den eigentlichen Anteil Brüssels an den nationalen Geset-
zen Großbritanniens auf rund 15,5% festlegen.115 Zudem propagierte UKIP während dieser
Wahlen mit stark EU-kritischen Plakaten, dass Großbritanniens Bürger und ihre Jobs unter
der Mitgliedschaft leiden würden und dass man daher die EU verlassen müsse.
„Die britische Europapolitik der UKIP folgt der Strategie der Trittbrettfahrer: Man drückt sich vor dem Kauf einer Fahrkarte und lässt andere für den Betrieb der Stra-
ßenbahn zahlen. Verlässt jedoch der Trittbrettfahrer das gemeinsame Fahrzeug, wer-
den ihm die übrigen Passagiere keine Tränen nachweinen.“116
Auch wenn dies der Fall und UKIP nur eine temporäre Erscheinung sein sollte, so darf man
die dadurch auftretenden Folgen und Auswirkungen nicht unterschätzen. Denn nicht nur die
Regierung Camerons, auch die britische Bevölkerung ist von dem Agieren der EU desillusio-
niert. Der daraus folgende Zulauf der europaskeptischen Parteien endete mit dem Wahlsieg
der UKIP bei den Europawahlen 2014. So beschreibt ein Artikel in der „Welt“ einen Tag nach
den Wahlen die Lage so, dass die britischen Wähler sich mehr und mehr von der Europäi-
schen Union entfremdet fühlen.117 Mit ihren beiden wichtigsten Programmpunkten, dem Aus-
tritt aus der EU und einem harten Kurs gegenüber Einwanderern, ist die UKIP vor allem für
111 Vgl. UKIP (2005): S. 5. 112 Vgl. Straubhaar (27.05.2014). 113 Vgl. Sturm (2009): S. 207. 114 Vgl. EurActiv (2014); siehe dazu auch Abbildung 4. 115 Vgl. Töller (2012). 116 Straubhaar (27.05.2014). 117 Vgl. Kielinger (26.05.2014).
Seite | 22
enttäuschte Wähler von Camerons Konservativen attraktiv – und im britischen Mehrheits-
wahlrecht damit eine ernsthafte Gefahr für die Regierung.118
4 Das mögliche Ende der Mitgliedschaft Großbritanniens in der
Europäischen Union und dessen Folgen
4.1 Rechtliche Aspekte eines Austritts aus der Europäischen Union
Um im weiteren Verlauf dieses „Neuland“ eines möglichen Austritts aus der Europäischen
Union nachvollziehen zu können, wird in diesem Abschnitt der Ablauf eines Austritts nach
EU-Recht dargestellt. Bislang ist noch kein Land aus der Europäischen Union oder einer ihrer
Vorgängerinstitutionen ausgetreten. Ein Sonderfall war Grönland, das zunächst als Teil Dä-
nemarks 1973 der EWG beigetreten war, sechs Jahre später 1979 aber Autonomiestatus er-
hielt und in Folge einer Volksabstimmung 1982 für einen Austritt votierte.119 Durch den
Grönland-Vertrag120 vom 13.03.1984 wurde die Anwendung des bisherigen Gründungsver-
trages der EWG (EWGV) damit aufgehoben. Ein explizites Austrittsrecht wurde aber einige
Zeit später im gescheiterten Vertrag über eine Verfassung für die EU aufgenommen und fand
erst 2009 Eingang in den Lissabonner Vertrag, da man befürchtete, das Recht könnte von
Mitgliedsstaaten als Druckmittel genutzt werden.121
Um einen Austritt einzuleiten, müsste die britische Regierung zunächst gemäß der Austritts-
klausel des Artikel 50122 des EU-Vertrags (EUV), der seit dem Vertrag von Lissabon einen
möglichen Rückzug aus der Union regelt, dem Europäischen Rat den Austrittswunsch mittei-
len. Entgegen einer verbreiteten Annahme ist damit aber kein einseitiger oder gar sofortiger
Austritt vollzogen. Rechtlich handelt es sich lediglich um eine Absichtserklärung.123 Diese
bildet nur den Auftakt zu Verhandlungen über ein völkerrechtliches Abkommen, das die Ein-
118 Vgl. von Ondarza (2013a): S. 1. 119 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 9 f. 120 ABl. EG 01.02.1985 Nr. L 29. 121
Vgl. Busch (Juni 2014): S. 10. 122 Den genauen Wortlaut des Artikels findet der Leser im Anhang. 123 Vgl. von Ondarza (2013b): S. 16 f.
Seite | 23
zelheiten des Austritts und die zukünftigen Beziehungen zwischen der Union und dem Verei-
nigten Königreich regelt, falls gewünscht. Mehr noch: Der Beginn solcher Verhandlungen
verpflichtet Großbritannien nicht zu einem Austritt – so kann es sich jederzeit entschließen
Mitglied der EU zu bleiben.
Für das Austrittsabkommen sieht Art. 50 Abs. 2 EUV ein Verfahren vor, das der Aushandlung
internationaler Verträge zwischen der EU und Drittstaaten entspricht. Bevor verhandelt wer-
den kann, müssen sich die übrigen EU-Mitgliedstaaten im Europäischen Rat auf die Ziele der
Gespräche verständigen. Anschließend wäre es an der Kommission, ein Verhandlungsmandat
auszuarbeiten, das der Rat im Konsens festlegen müsste. Dabei hätten sich die Mitgliedstaaten
auch auf einen Verhandlungsführer zu einigen, wofür in der Regel die Kommission vorgese-
hen ist.124 Sowohl die EU, als auch die britischen Verhandlungspartner müssten dabei Exper-
ten-Gruppen bilden, welche die genauen Konditionen eines Austritts und der damit verbunde-
nen Folgen ausarbeiten würden.125
Als problematisch wird bei Art. 50 EUV der dritte Absatz angesehen, nachdem ein Staat auch
ausscheiden kann, ohne dass bei den Verhandlungen ein Vertrag ausgearbeitet wurde.126 Dies
kann eine Folge daraus sein, dass die in dem Europäischen Parlament oder Rat benötigten
Mehrheiten nicht zu Stande gekommen sind. Ab dem 01.11.2014 ändert sich die Stimmabwä-
gung gemäß Art. 50 Abs. 4 Unterabsatz 2 EUV im Rat bezüglich einer Austrittsfrage.127 So
hat ab diesem Stichtag jeder Mitgliedsstaat der EU eine Stimme und die qualifizierte Mehrheit,
die wie oben genannt für eine „Bestätigung“ des Austritts benötigt wird. Dies wird nunmehr
durch 72% der Mitglieder (bis 31.10.2014: 73,91%) und mindestens 65% (bis 31.10.2014:
62%) der Bevölkerung der beteiligten Staaten nach Art. 238 Absatz 3 (b) Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bestimmt.
Als Resultat aus dem Scheitern des Zustandekommens einer qualifizierten Mehrheit wird der
Austritt nach einer Frist von zwei Jahren trotzdem wirksam.128 Diese Frist kann jedoch auch
auf Forderungen beider Seiten einvernehmlich verlängert werden.129 Bieber, Epiney und
Haag beschreiben die Unausgewogenheit dieses Teils des Artikel 50 dahingehend, dass er die
124 Vgl. von Ondarza (2013b): S. 16 f. 125 Vgl. Oliver (2013): S. 13. 126 Vgl. Bieber; Epiney; Haag (2011): S. 113, Rn. 42. 127 Vgl. Haratsch; Koenig; Pechstein (2010): S. 53, Rn 110. 128 Vgl. Bieber; Epiney; Haag (2011): S. 216, Rn. 36. 129 Vgl. Haratsch; Koenig; Pechstein (2010): S. 53, Rn 111.
Seite | 24
Union weiterhin an die Verträge binden würde.130 Es ist laut Art. 50 EUV auch nur die Union,
die durch den Rat Verhandlungen führen muss – Großbritannien, hier als Beispiel eines willi-
gen Austrittmitgliedes, ist nicht dazu verpflichtet.131 Gerade hier zeigt sich, wie sehr die EU
Neuland betreten müsste, falls sich mit Großbritannien ein wichtiger Mitgliedstaat zum Aus-
tritt aus der Union entscheiden würde.
4.2 Politische und wirtschaftliche Folgen für Großbritannien
„Yet I know in the 21st Century, as new Europe arises of peace and prosperity, it
would be an utterly backward and self-defeating act for us to isolate ourselves from
modern Europe. The outcome would not be a stronger Britain but a weaker one.”132 (Tony Blair)
Es ist unübersehbar, wie markant der Einfluss der EU-Mitgliedschaft auf Großbritannien und
seine Wirtschaft ist. So nehmen Forster und Blair die in den letzten Dekaden stetig wachsen-
den Handelsbeziehungen zwischen GB und EU in den Blick, die im Jahr 2002 sogar 50% des
britischen Handels ausmachten.133 Zwar meinen britische EU-Skeptiker, dass man zukünftig
verstärkt mit Brasilien, Russland, Indien oder China handeln könne, jedoch ist das Handelsvo-
lumen zwischen Großbritannien und Irland größer, als das mit all diesen vier BRICS-
Staaten134 zusammen der Fall wäre.135 Desweiteren ist das Land aus ökonomischer Sicht auf
den europäischen Binnenmarkt und damit auch die Subventionen in Bereichen wie der Land-
wirtschaft aus Brüssel angewiesen. Besonders Forschungsgelder sind ein wichtiger Faktor für
die Briten, schließlich sind sie der zweitgrößte Empfänger dieser Gelder in der Europäischen
Union.136 Ohne diese Zuschüsse würden notwendige Investitionen in Universitäten und ande-
ren Bildungseinrichtungen fehlen.
Ob britische EU-Skeptiker es wahr haben wollen oder nicht, die mehr als 40 Jahre andauernde
Mitgliedschaft in der EWG, EG und EU haben Einfluss auf das britische Alltagsleben, aber
vor allem auch auf den Finanzplatz London hinterlassen. Dieser profitiert in einem hohen
130 Vgl. Bieber; Epiney; Haag (2011): S. 113, Rn. 42. 131 Vgl. Oliver (2013): S. 13. 132 Tony Blair zitiert nach Becker (2002): S. 295. 133 Vgl. Forster; Blair (2002): S. 29. 134 Bei den BRICS-Staaten handelt es sich um die Volkswirtschaften Brasilien, China, Indien, Russland und Südafrika. 135 Vgl. Zaschke (04.06.2014). 136 Vgl. Hahne (05.06.2014).
Seite | 25
Maße von der Marktöffnung sowie der Größe der Europäischen Union. So kann das Land den
Status quo, welcher vor dem Beitritt 1973 existierte, in keinem Fall wiederherstellen. Zudem
scheinen die Skeptiker zu vergessen, dass ein Rückzug Großbritanniens aus den Strukturen
der EU die Rolle Großbritannien von einem „decision maker“ zu einem „decision taker“ um-
wandeln würde.137 Cameron geht es daher nicht mehr vorrangig um einen kompletten Austritt
aus der Union, sondern eher um eine Reform der EU nach britischem Wunschdenken. So ist
besonders die Rückführung von Kompetenzen von der Europäischen Union zu den einzelnen
Mitgliedsstaaten sein Ziel. Dabei zielt Cameron auf den Art. 48, Abs. 2 EUV, welcher regelt,
dass jeder Mitgliedsstaat der EU Vertragsveränderungen vorschlagen kann, durch die übertra-
genden Kompetenzen ausgedehnt, aber auch wie im britischen Fall, verringert werden könn-
ten.138
Eine Frage, die sich neben dem eigentlichen Austritt aus der Europäischen Union auch stellt,
ist die, wie sich eben solcher auf die Union Großbritannien, quasi die Verbindung zu Schott-
land, auswirken könnte. Schottland ist zwar auf seine eigene Unabhängigkeit innerhalb Groß-
britanniens bedacht - weswegen es am 18. September 2014 über seine Eigenständigkeit ab-
stimmen wird - jedoch sind die Schotten im Gegensatz zu den Briten eher pro-europäisch ge-
stimmt und somit für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Eine im Juli 2013
durchgeführte Studie des Institute for Public Policy Research (IPPR) hat ergeben, dass der
Norden und der Süden Großbritanniens andere Ansichten über die EU haben. So kommen die
Autoren des Berichtes zu der Erkenntnis, dass die englischen Wähler immer euroskeptischer
werden und daher „einen Austritt aus der EU ernsthaft in Betracht ziehen, während die Mehr-
heit der Schotten davon überzeugt ist, dass die Vorteile der EU-Mitgliedschaft deren Nachtei-
le überwiegen.“ 139 So könnte selbst bei einem negativen Referendum der Schotten ein positi-
ves Austrittsreferendum der Briten die Beziehung zwischen London und Edinburgh stark be-
schädigen.
Es ist daher nach Springford kaum vorstellbar, dass Großbritannien die EU verlässt, jedoch
weiterhin Zugang zum Binnenmarkt hat, ohne den damit verbundenen Abkommen bzw. Re-
geln zu unterliegen. Besonders, da das Land als Mitglied der EU zu einem der mächtigsten
Wirtschaftsblocks der Welt gehört und davon wirtschaftlich und politisch profitiert.140 Zwar
137 Vgl. von Ordanza (2013b): S. 22 f. 138 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 2 ff. 139 Vgl. Gottfried et al. (08.07.2013). 140 Springford (2012) zitiert nach Geddes (2013): S. 165.
Seite | 26
wäre das Land weiterhin Teil der NATO und des UN-Sicherheitsrates und somit eine globale
Größe, jedoch würde sein Einfluss in strategisch wichtigen Orten wie Brüssel, Berlin und
Washington stark leiden. Gerade diese Verflechtungen in der ganzen Welt und besonders aus
historischer Sicht in Europa lassen eine „freundschaftliche Scheidung“141, wie es Wheeler und
Peter nennen, sehr unwahrscheinlich erscheinen. So würden Frankreich, Deutschland und
andere einflussreiche EU-Nationen ein britisches Herauspicken der besten wirtschaftlichen
Aspekte der Europäischen Union kaum mittragen und so die Insel weiter isolieren.142
So fassen es britische Akteure der Europäischen Bewegung International (European Move-
ment International) kritisch wie folgt zusammen:
“The European Union is the most powerful body in Europe and one of the most pow-
erful in the world in dealing with these cross-border issues. For a country of the UK’s size, population and history, it would be hard for us to leave an organisation to which
most other European nations wish to belong and which provides us with a greater
share of power and influence in the world than we could hope to have on our own.”143
141 Wheeler; Peter (14.05.2013). [Übersetzung durch den Autor] 142 Vgl. Wheeler; Peter (14.05.2013). 143 European Movement (October 2011).
Seite | 27
4.3 Folgen für die Europäische Union
Während im gerade betrachteten Abschnitt die Auswirkungen eines Austritts für die britische
Politik und Wirtschaft analysiert wurden, soll im Folgenden ein Szenario skizziert werden, in
der die EU ohne Großbritannien agieren muss. „Würden die Briten tatsächlich aus der EU
austreten, wäre dies ein erheblicher Rückschlag für die europäische Integration. Das gesamte
bisherige Integrationsmodell stünde damit infrage.“144 Schließlich beruht dieses europäische
Integrationsmodell auf Art. 1 EUV und zielt auf die Schaffung „einer engeren Union der Völ-
ker Europas“145 ab.
Neben der offensichtlichsten Folge eines Austritts Großbritanniens aus der EU, nämlich dem
Verlust eines Mitgliedsstaates, nennt Oliver weitere Aspekte, mit der die EU dann arbeiten
müsste 146: Zuallererst wäre der britische Verlust eine Premiere und würde damit ein bisheri-
ges Tabu brechen. Da bisher kein Mitgliedsstaat ausgetreten ist, müsste die EU eine solche
Prozedur zum ersten Mal koordinieren, was sich durch die notwendige Einbindung aller Mit-
gliedsstaaten und Institutionen als sehr kompliziert und komplex erweisen würde. Der zweite
Aspekt wäre die fehlende Balance. So könnte die Abwesenheit Großbritanniens ein regelrech-
tes Machtvakuum innerhalb der Europäischen Union verursachen und so jene aus dem
Gleichgewicht bringen.
Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU würde diese formal knapp 13% seiner Einwoh-
ner und 15% seiner Wirtschaft einbüßen. Desweiteren würde sich die EU ohne die Briten da-
rüber klar werden müssen, wie sie mit dem Verlust des Export- und Finanzriesen umgehen
könnten, ohne in eine interne Wirtschaftskrise zu rutschen.147 Durch den Wegfall des Mit-
gliedsstaates müssten die Stimmen und Kompetenzen Großbritanniens in Brüssel und Straß-
burg gänzlich neu justiert werden. Die qualifizierte Mehrheit müsste neu berechnet und die 73
britischen Sitze im Parlament verteilt werden. Trotz eines Austrittsantrags würden die 73 Mit-
glieder des Europäischen Parlaments bis zum Datum der Nichtmitgliedschaft weiterhin im
Parlament Einfluss nehmen können, da, wie Oliver klar darstellt, Art. 50 EUV nur die Reprä-
sentanten im Europäischen Rat und Rat betreffe.148 Desweiteren würde Großbritanniens EU-
144 Busch (Juni 2014): S. 16. 145
Art. 1 EUV. 146 Vgl. Oliver (2013): S. 6. 147 Vgl. Oliver (2013): S. 10. 148 Vgl. Oliver (2013): S. 15.
Seite | 28
Kommissar sowie die Angestellten am Europäischen Gerichtshof und anderen EU-
Institutionen ihre Arbeitsplätze in Brüssel räumen müssen.
Während der letzte Absatz die Veränderung im Bereich Personal skizzierte, wird nun auf eine
andere drastische Reorganisation geblickt: Die Neubalancierung des Budgets. Dies wäre da-
hingehend auch enorm notwendig, da Großbritannien 1) der größte Nettozahler in der EU ist
und 2) seit 1985 seinen „Britenrabatt“ in Anspruch nimmt. Ohne die Briten würden zwar we-
niger Gelder in die EU fließen, aber auf der anderen Seite würde Großbritannien weniger Zu-
schüsse und Subventionen, so beispielweise den „Britenrabatt“, erhalten. Ob hierbei die posi-
tiven oder negativen Effekte für die EU überwiegen, lässt sich bis zu einem Austritt schwer
beurteilen.149
Auch könnte der britische Austritt aus der Union eine Krise in den Bemühungen der Integra-
tionspolitik verursachen und so der EU massiv schaden. Andere Stimmen sehen mit dem Aus-
scheiden des „akward partner“150 die Möglichkeit, aktuelle Probleme in Sachen Eurozone zu
lösen und eine engere Union, die seit langem angestrebt wird, anzustreben.151 Haratsch und
andere Autoren im Bereich des Europarechtes sehen in diesem Austrittsrecht den Hinterge-
danken der EU, in Zukunft flexibler bei der Vertiefung der Integrationsbemühungen152 agie-
ren zu können, wenn ein „integrationsmüder“ Mitgliedstaat austritt. Straubhaar fügt hinzu,
dass man einen Staat, der sich selbst ins Abseits stellen möchte, nicht aufhalten soll, beson-
ders im Fall Großbritannien, da das Land kein Euro-Land ist und somit eine leichtere Tren-
nung möglich sei.153
Dieses Argument scheint bei genauerer Betrachtung der bisher genannten Argumente jedoch
als positiver Aspekt nahezu unterzugehen. Ein Fehlen des wichtigen Großbritannien könnte
andere skeptische bzw. wackelige Mitgliedsstaaten der EU dazu bewegen, über die Notwen-
digkeit und den Profit einer Mitgliedschaft nachzudenken. Zudem wäre das Machtvakuum,
welches beim Verlassen eines solchen Riesen in der EU entstehen könnte, nur schwer zu fül-
149 Vgl. Oliver (2013): S. 15. 150 George (1998). 151 Vgl. Oliver (2013): S. 5. 152 Vgl. Haratsch; Koenig; Pechstein (2010): S. 52, Rn 109. 153 Vgl. Straubhaar (27.05.2014).
Seite | 29
len. Zudem befürchten manche, dass die Position Deutschlands in der Union, welche schon
aktuell sehr dominierend ist, noch an Stärke gewinnen könnte.154
Der deutsche EVP-Politiker und langjähriger Parlamentarier in Brüssel Elmar Brok sieht die
Problematik eines Austritts Großbritanniens aus der EU und somit auch den Institutionen und
Organe sehr gespalten: So seien die Briten ein wichtiger Partner in der Union und notwendig
für ein Halten der Balance. Zudem lobt er seine britischen Parlamentskollegen für ihre Struk-
turiertheit und ihre Führungsqualitäten in Diskussionen.155 Gleichzeitig stellt er jedoch auch
fest, „dass die Briten endlich ihren Frieden mit Europa schließen müssen.“156
154 Vgl. Oliver (2013): S. 19. 155 Hahne (05.06.2014). 156 Elmar Brok zitiert nach Hahne (05.06.2014).
Seite | 30
5 Alternativmodelle zu einer EU-Mitgliedschaft
5.1 Überblick der möglichen Modelle
Falls sich Großbritannien ernsthaft dazu entscheiden sollte, die Europäische Union zu verlas-
sen, wäre dies für das Land ein wirtschaftlicher und politischer Rückschlag, den es nur schwer
verkraften könnte. Aber eine völlige Loslösung von der EU und dem dazugehörigen Bin-
nenmarkt ist nicht der einzige Weg, den die Briten beschreiten könnten. So gibt es verschie-
dene Modelle und Alternativen, welche eine meist wirtschaftlich ausgerichtete Bindung an die
EU bedeuten würden. Welche Möglichkeiten Großbritannien nach einem Austritt aus der
EU – falls diese danach noch an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert wäre – hätte, soll
in diesem Abschnitt kurz dargestellt werden.
Die in Frage kommenden Modelle und Alternativen, derer sich Großbritannien bedienen
könnten, sind vielfältig und variieren in ihrem Charakter enorm: So könnte Großbritannien
auch weiterhin über eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum den Zugang zum
europäischen Binnenmarkt suchen und damit nach seinem Austritt 1973 wieder in die Europä-
ische Freihandelszone eintreten. Dieser Weg wäre für Großbritannien ein sehr komplexer, da
es all seine bestehenden Freihandelsabkommen mit Drittstaaten neu verhandeln müsste.157 Da
der EWR aber keine Zollunion ist, müsste das Land beim Warenverkehr mit anderen EU-
Mitgliedsstaaten sogenannte Ursprungsregeln beachten, was bedeutet, dass Drittlandswaren
vom Freiverkehr des EWR ausgeschlossen sind.158
Die Möglichkeit einer Zollunion, wie sie die Türkei seit 1996 mit der EU unterhält159, wäre
für Großbritannien dahingehend von Vorteil, da der freie Warenverkehr beibehalten, jedoch
unerwünschte Politikbereiche wie Strukturpolitik oder Fischereipolitik nicht mehr verbindlich
werden würden.160 Die Problematik läge bei diesem Alternativmodell in der Frage des Fi-
nanzsektors: Da Großbritannien den Zugang zum europäischen Binnenmarkt nicht verlieren
will, müsste es neben der Zollunion weiteren Abkommen mit der EU schließen. Das Vereinig-
te Königreich müsste für den Fall, dass es nicht mehr der Union angehört, ebenfalls die beste-
henden Freihandelsabkommen der EU nach- bzw. neuverhandeln.161 Insgesamt ist in Frage zu
157 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 18 f. 158 Vgl. House of Commons (01.07.2013): S. 30 f. 159 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 20. 160 Vgl. ebenda. 161 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 150.
Seite | 31
stellen, ob die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der
EU mit einer Zollunion ausreichend geregelt wären.162
Das Modell, welches die Schweiz und die Europäische Union seit einigen Jahren verbindet,
verfolgt einen bilateralen Ansatz, der auf verschiedenen Abkommen basiert. Bei dieser Alter-
native wäre das Integrationsniveau deutlich unter dem Stand, den der EWR mit der EU er-
reicht hat.163 Ein umfassendes Abkommen hinsichtlich eines freien Dienstleistungsverkehrs,
welches sicherlich für Großbritannien erstrebenswerte wäre, kam schon bei dem Musterbei-
spiel Schweiz-EU nicht zustande und könnte sich als nachteilige Situation für Großbritannien
erweisen.164
Die wohl „radikalste Variante“ wäre der Zugang zum Binnenmarkt über die Mitgliedschaft in
der Welthandelsorganisation (WTO), wodurch Großbritannien den Status eines Drittstaaten
gegenüber der EU erhalten würde.165 Der herausstechende Vorteil für die Briten wäre bei die-
sem Modell die Rückgewinnung der von EU-Vergemeinschaftung betroffenen Politikbereiche
sowie der Wegfall des britischen Beitrages zum EU-Haushalt.166 Während einige Experten die
britische Wirtschaft und Stellung in der Welt als stark genug empfinden um den Weg auch
ohne eine Mitgliedschaft in der EU zu gehen, verweisen andere auf die Einfuhrzölle, denen
Großbritannien dann unterworfen wäre. 167 Zwar sind diese EU-Außenzölle mit nur 1%168
sehr gering, aber durch die Quantität der betroffenen britischen Waren würde dies sehr
schmerzhaft für britische Unternehmen werden.
Auch wenn alle genannten Modelle eine Berechtigungsgrundlage haben, werden in der vor-
liegenden Arbeit indessen nur zwei Alternativmodelle, der Europäische Wirtschaftsraum und
die bilateralen Abkommen, genauer betrachtet. Dies geschieht daher, da diese beiden Ansätze
sowohl historisch als auch aus der Perspektive der britischen Vorstellung zwecks wirtschaftli-
cher Verknüpfung mit der EU am realistischsten und effektivsten wären.
162
Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 150. 163 Vgl. Tobler et. al (Januar 2010): S. 34. 164
Vgl. Tobler et. al (Januar 2010): S. 17. 165
Vgl. Busch (Juni 2014): S. 25. 166
Vgl. ebenda. 167
Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 134. 168
Vgl. Busch (Juni 2014): S. 25.
Seite | 32
5.2 Modell 1: Der Europäische Wirtschaftsraum
5.2.1 Von der Europäischen Freihandelsassoziation zum Europäischen Wirtschaftsraum
Um ein Verständnis für das Modell Europäischer Wirtschaftsraum zu bekommen, muss man
zuerst die einzelnen Bestandteile und Teilnehmer des Modells umreißen: So sind aktuell alle
Mitglieder der Europäischen Union sowie alle EFTA-Staaten Mitwirkende im EWR. Aber bis
es zu dieser Verbindung zwischen damals EG und EFTA kam, war es ein langer und schwie-
riger Weg:
Die Europäische Freihandelsassoziation wurde 1960 auf Initiative Großbritanniens durch die
europäischen Staaten Dänemark, Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Portugal, Schwe-
den und Schweiz als eine Art Gegenpol zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet
und sollte so als Zuflucht für solche Länder dienen, die der Gemeinschaft nicht beitreten woll-
ten oder konnten. Sie verfügt heute über mehrere Organe, so beispielweise den EFTA-Rat,
den ständigen Ausschuss oder den EFTA-Gerichtshof, die meist mit dem EWR verbunden
sind. Durch die Gründung der EFTA wurde Westeuropa endgültig in zwei Integrationszonen,
die „inneren Sechs“ (EWG) und die „äußeren Sieben“ (EFTA), gegliedert.169 So versuchte
man in Folge dessen durch Bilateralisierung des EFTA-EWG-Verhältnisses die Lage in Euro-
pa zu stabilisieren. Im Zuge dieser Bemühungen stellte zuerst Großbritannien am 31.07.1961
ein Beitrittsgesuch zur EWG, Dänemark, Norwegen und Irland folgten.170 Einige Monate spä-
ter stellten auch Österreich, Schweden und die Schweiz Assoziationsgesuche.171
Währenddessen erhielt 1961 Finnland einen Beobachterstatus und Island trat der EFTA im
Jahr 1970 bei. 1972/73 verließ sowohl Dänemark als auch der EFTA-Initiator Großbritannien
selbst die Freihandelsassoziation, um in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einzutre-
ten.172 Norwegens Gesuch scheitert im gleichen Jahr an einem nationalen Referendum. 173
1977 entsteht durch die Verbindung des EG- und des EFTA-Raumes der „Westeuropäische
Freihandelsblock“, der Zölle und mengenmäßige Beschränkungen im Bereich des Industrie-
warenhandels aufhebt.174 Sieben Jahre später, knapp 25 Jahre nach Gründung der EFTA,
kommen erstmals die Ministerräte beider Organisationen zu einem Treffen in Luxemburg
169 Vgl. Mech (2007): S. 27. 170 Vgl. Mech (2007): S. 28. 171 Vgl. ebenda. 172 EFTA (2014). 173 Vgl. Mech (2007): S. 28. 174 Vgl. Hummer (2004): Rn. 24 ff.
Seite | 33
zusammen. Hier wird zum ersten Mal von der partnerschaftlichen Errichtung eines einheitli-
chen sowie homogenen Wirtschaftsraums in Europa gesprochen. 175
Ein Jahr später (1985) entscheidet sich auch Portugal zu einem Wechsel in die EWG, während
1986 Finnland ein vollwertiges EFTA-Mitglied wird.176 Derweil kommt es zwischen 1984
und 1989 zu einer „realen Anpassung der EFTA-Staaten an die EG-Rechtsvorschriften, indem
man […] Warenstandards harmonisierte, Importrestriktionen beseitigte und andere Detailfra-
gen löste.“ 177 Während die EFTA-Mitglieder diese Neuerung mittrugen, war die am
28.02.1987 eingeführte Einheitliche Europäische Akte178, die den Binnenmarkt bis 1993 etab-
lieren sollte, in den Augen der EFTA ein Zeichen für mögliche neue Handelshemmnisse. Um
dem entgegenzuwirken, entwarf der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors 1989
eine Initiative (Delors-Initiative), welche die Form der Zusammenarbeit zwischen der EG und
der EFTA durch gemeinsame Organe und institutionelle Strukturen vertiefen sollte.179 Die
EFTA stimmte dieser Idee zu und setzte mit dem „Oslo-Brüssel-Prozess“ die Verhandlungen
zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Gang.
Die formellen Verhandlungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedern
der Europäischen Freihandelsassoziation zwecks der Schaffung eines Europäischen Wirt-
schaftsraumes begannen am 20.06.1990.180 Hauptschwerpunkt des Dialoges war die künftige
Rechtssetzung im EWR, die hauptsächlich durch die Gesetzgebung der EG beeinflusst wer-
den sollte, bei der aber die EFTA-Staaten auch mitreden wollten.
Der von der EFTA initiierte Gegenpol zur EWG/EG/EU verlief sich daher relativ schnell, da
es durch die zunehmende Kooperation beider Organisationen, aber auch durch eine steigende
Zuwendung vieler EFTA-Staaten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Richtung EG
kam. 181 So stellten Österreich 182 (17.07.1989), Schweden 183 (27.10.1990), Finnland 184
(19.03.1992) sowie Norwegen185 (25.11.1992) in kurzer zeitlicher Abfolge zwischen 1989
und 1992, also noch während der Verhandlungen zum EWR, Anträge auf eine Mitgliedschaft
175 Vgl. Mech (2007): S. 28. 176 EFTA (2014). 177 Mech (2007): S. 29. 178 ABl. EG 29.06.1987, Nr. L 169, S. 1. 179 Vgl. Mech (2007): S. 29. 180 Vgl. Mech (2007): S. 30. 181 Vgl. Gittermann (1998): S. 4. 182 Bull. EG 7/8-1989, Ziffer 1.3.2. 183 Bull. EG 7/8-1991, Ziffer 1.3.3. 184 Bull. EG 3-1992, Ziffer 1.3.1. 185 Bull. EG 11-1992, Ziffer 1.4.3.
Seite | 34
in der Europäischen Gemeinschaft und läuteten so einen Wechsel im Mächteverhältnis Euro-
pas ein. So bildet die Errichtung und Einführung des EWR durch das am 01. Januar 1994 ein-
getretene Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, welches im nächsten Ab-
schnitt beleuchtet wird, eine vorläufige Klimax in der Beziehung zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und den EFTA-Staaten.186
5.2.2 Aufbau des ersten Modells am Beispiel Norwegens
„Das am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichnete Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum stellt den Versuch dar, Staaten, die der EG einstweilen beitreten kön-
nen oder wollen, binnenmarktähnliche Rechtsbeziehungen mit der Gemeinschaft ein-
zuräumen. […] Der EWR vermittelt in gewisser Weise eine ‚Binnenmarktmitglied-schaft ohne EG/EU-Mitgliedschaft‘“.187
Der Europäische Wirtschaftsraum fungierte also gemäß dem Zitat als verlängerter Arm der
Europäischen Gemeinschaft bzw. heute dem der Europäischen Union, der den europäischen
Binnenmarkt ausdehnt und auf Länder überträgt, welche zwar keine EU-Mitgliedschaft, aber
einen Zugang zum Binnenmarkt wünschen. Das Beispiel Großbritannien ist hierbei ein No-
vum, da das Land der EG/EU beitreten konnte und wollte, jedoch nach seiner ehemaligen EU-
Mitgliedschaft jetzt nur noch die Anbindung an den Binnenmarkt sucht. Durch den EWR gel-
ten einige Regelungen der EG/EU, so auch die vier Grundfreiheiten der Union188, ebenfalls in
den am EWR beteiligten Drittstaaten und sorgen so dafür, dass eine alternative, jedoch paral-
lel zur EU verlaufende Integrationszone in Europa entsteht.
Ein europäisches Land, das sich seit der Gründung der EFTA und der Schaffung des EWR an
der europäischen Integration beteiligt, ist Norwegen. Der skandinavische Staat hat sogar, um
den rechtlichen Bedingungen der Gemeinschaft so nah wie möglich zu kommen, den Haupt-
teil des EWRA, in diesem Fall 129 Artikel, durch ein Inkorporationsverfahren in das norwegi-
sche Recht eingegliedert.189 Dies geschah durch das „Gesetz Nr. 109 vom 27.11.1992 über die
Durchführung des Hauptteils des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in
norwegisches Recht (EWR-Gesetz)“190 welches zeitgleich mit dem EWRA191 am 01.01.1994
186 Vgl. Mech (2007): S. 27. 187 Prof. Dr. Bruha und Prof. Dr. von Münch (1998): Vorbemerkung zitiert nach Gittermann (1998). 188 Freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapitel. 189 Vgl. Mech (2007): S. 72. 190 Lov Nr. 109 vom 27.11.1992 191 ABl. 03.01.1994 Nr. L 1.
Seite | 35
in Kraft trat. Die Übernahme der EWG- bzw. EG-Richtlinien sowie Verordnungen in den
„acquis communautaire“ des EWR wird durch Artikel 7192 des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum geregelt und genaue Vorgaben gemacht:
„Ein Rechtsakt, der einer EWG-Verordnung entspricht, wird als solcher in das innerstaatliche
Recht der Vertragsparteien übernommen.“193
„Ein Rechtsakt, der einer EWG-Richtlinie entspricht, überlässt den Behörden der Vertragspar-
teien die Wahl der Form und Mittel zu ihrer Durchführung.“194
Innerhalb der wenigen verbliebenen EFTA-Staaten ist Norwegen sowohl von wirtschaftspoli-
tischer Perspektive als auch an der Einwohnerzahl gemessen der wichtigste Akteur und Asso-
ziierungspartner.195 Durch die enge Bindung zu den EU-Mitgliedsstaaten nimmt Norwegen
als EFTA-EWR-Mitglied zudem an vielen Bereichen der Arbeit der EU teil, so z.B. dem
Schengenraum, Frontex oder Europol, obwohl es dort keinerlei Mitbestimmungsrechte hat. So
sind auch Regelungen in der Fischerei und Landwirtschaft, obwohl nicht offiziell Teil der
EU-EWR-Beziehung, oft Thema bei Verhandlungen und neuen Abkommen.196
Norwegen zahlt einen jährlichen Beitrag von circa 350 Millionen Euro in den EU-
Kohäsionsfonds ein – dies entspricht dem neunthöchsten Nettobetrag zum EU-Budget - aus
dem es jedoch keinerlei Zahlungen erhält.197 Zusätzlich zu diesem Beitrag hilft Norwegen
durch seine Mitgliedschaft in der EFTA der EU dabei, ökonomische Ungleichheiten in der
Union zu reduzieren, indem es angeschlagenen oder neuen Mitgliedsstaaten finanziell unter
die Arme greift, wie beispielweise bei Portugal und Spanien zwischen 2009 und 2014.
Für Norwegen ist diese Form der Bindung an die EU und die damit verbundene Positionie-
rung in Europa eine gute Wahl, da es als relativ kleiner Staat in einer ökonomischen Abhän-
gigkeit zu anderen europäischen Staaten steht. Dass die Anbindung an die Union durch eine
Mitgliedschaft im EWR für Norwegen förderlich ist, zeigt ein Evaluierungsbericht aus dem
Jahr 2012. Dieser bescheinigte Norwegen ein gut funktionierendes EWRA sowie einen wirt-
schaftlich profitablen Zugang zum Binnenmarkt198, an dem es seine starke Exportorientierung
192 Die Wirkung des Artikel 7 EWRA entspricht dem Artikel 249 EGV. 193 Art. 7 a EWRA. 194 Art. 7 b EWRA. 195 Vgl. Mech (2007): S. 16. 196 Vgl. European Movement (October 2011). 197 Vgl. Etzold (2013): S. 2; ebenso European Movement (October 2011). 198 Vgl. Etzold (2013): S. 2.
Seite | 36
gut etablieren kann.199 Folgen dieser Form abgeschwächter Integration führten in Norwegen
zu durchaus positiven Effekten auf dem Arbeitsmarkt sowie in Bereichen der regionalen Ent-
wicklung und Forschung.200
Trotz der dem Bericht entwachsenen Erkenntnisse gibt es in Norwegen Stimmen gegen diese
Art der Verbindung zur Europäischen Union. Vor allem das Wort „Demokratiedefizit“ fällt in
Verbindung mit dem Europäischen Wirtschaftsraum. 201 So gibt es drei verschiedene Vor-
schläge hinsichtlich der Zukunft Norwegens in Europa: Die konservativen Parteien wollen auf
Grund des Demokratiedefizites gerne ein vollwertiges Mitglied in der EU sein, auch im Hin-
blick auf die doch sehr einseitigen Beitragszahlungen. Dies könnte sich jedoch als schwierig
erweisen, da schon zwei Beitrittsgesuche an nationalen Volksabstimmungen, 1972 und 1994,
gescheitert sind.202 Die norwegische Regierung wiederum möchte an dem Kompromisskon-
zept EWR festhalten.203 Weitere Expertenmeinungen tendieren in die Richtung eines bilatera-
len Abkommens, wie es später in der Arbeit anhand der Schweiz behandelt wird.
Wie sich die Beziehung Norwegens zur EU, die trotz des negativen Referendums 1994 immer
enger geworden ist, in den nächsten Jahren im Bereich des EWR und eines möglichen erneu-
ten Beitrittsgesuchs zur EU verändern wird, bleibt abzuwarten. Während für Norwegen eine
EFTA-EWR-Mitgliedschaft demnach bisher vollkommen ausreichend ist und positive Effekte
auf die Politik und Wirtschaft des Landes hat, sollen im Folgenden die Vor- und Nachteile des
EWR-Modells im Falle Großbritanniens beleuchtet werden.
199 Vgl. Mech (2007): S. 60. 200 Vgl. Etzold (2013): S. 2 f. 201 Vgl. ebenda. 202 Vgl. Mech (2007): S. 16. 203 Vgl. Etzold (2013): S. 2.
Seite | 37
5.2.3 Umsetzbarkeit des Modells in Großbritannien
5.2.3.1 Vorteile
Wie das Beispiel Norwegens gezeigt hat, kann eine Binnenmarktteilnahme ohne die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union für manche europäische Länder eine dauerhafte Lösung und
Alternative sein. So hat sich dieser Weg für Norwegen durch die gescheiterten Beitrittsver-
handlungen zur EWG/EG geebnet und als vorteilhaft herausgestellt. Aber welche Vorteile
könnte dieser Weg der Anbindung an den Binnenmarkt für ein Land wie Großbritannien ha-
ben?
So argumentieren britische Euroskeptiker damit, dass der für die britische Regierung so wich-
tige Binnenmarkt auch dann Vorteile bringen würde, egal ob nun Großbritannien ein Mitglied
der EU wäre oder nicht.204 Als Alternative schlagen daher einige britische Politiker ein Mo-
dell im norwegischen Stil vor. So würde schon ein Verbleib inklusive einer Vertiefung der
Mitgliedschaft in der EWR reichen, da der Raum sehr eng mit dem Binnenmarkt der Europäi-
schen Union verknüpft ist.205 Die Befürworter der “norwegischen Option” erhoffen sich da-
von die Sicherung von Exporten an die EU-Staaten, ohne die Gesetzgebung und Kosten der
Union zu teilen. Außerdem könnte Großbritannien ihrer Meinung nach dann mit jedem Land
seiner Wahl auf bilateraler Basis ein Freihandelsabkommen schließen.206
Wie eine Grafik der EFTA207 veranschaulicht, ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den
einzelnen EFTA-Mitgliedsstaaten sowie in der EFTA als Verbund im Durchschnitt weit höher
als in der Europäischen Union. Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass die Mitglieder der
Europäischen Freihandelsassoziation auch ohne eine Mitgliedschaft in der EU eine starke und
funktionierende Wirtschaft aufweisen. Großbritannien, welches stark auf die inländische
Wirtschaft fixiert ist und dabei wenig Verständnis für andere sozial schwächere europäische
Länder hat, könnte sich in diese Reihe eingliedern.
Mech stimmt dem insofern zu, dass das Modell des Europäischen Wirtschaftsraumes generell
für Staaten geeignet ist, „die aus politischen oder verfassungsrechtlichen Gründen nicht bereit
sind, die Beschränkungen der nationalen Souveränität hinzunehmen, die eine Mitgliedschaft
204 Vgl. Geddes (2013): S. 164. 205 Vgl. ebenda. 206 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 140. 207 Siehe Abbildung 5.
Seite | 38
in der EU voraussetzt.“208 Diese Variante würde durch eine fortbestehende Assoziierung mit
dem europäischen Binnenmarkt weiterhin wirtschaftliche Vorteile bringen, ohne dabei die
staatliche Souveränität Großbritanniens zu berühren.209
5.2.3.2 Nachteile
„Both Switzerland and Norway are extensively engaged with the EU and subject to
EU rules, but have no say in the rule-making. For example, Norway as a member of
the European Economic Area does have access to the single market and is subject to a
range of associated rules on, for example, social policy.”210
Neben den eben genannten, wenn auch wenigen Vorteilen einer Rückbesinnung Großbritan-
niens zur EFTA – wobei nicht ganz klar zu erkennen ist, ob dies bei den derzeitigen EFTA-
Staaten unbedingt auf Zustimmung stoßen würde211 - und damit zum EWR, gibt es erhebliche
Nachteile für das Land, falls es diesen Schritt wirklich gehen sollte. So müsste Großbritannien
wieder ein Mitglied der EFTA sein, wie es das Land von 1960 bis 1973 schon war, um über-
haupt weiterhin einen Zugang zum Binnenmarkt zu haben. Jedoch ist es mit aktuell nur vier
Mitgliedern212 um die Freihandelsassoziation still geworden. Eine Konkurrenz zur EU, wie sie
damals kurzzeitig zur EWG bestand, gibt es in dem Sinne nicht. Denn während EFTA als
Freihandelszone agiert, hat sie im Gegensatz zur EU kaum „politische oder wirtschaftliche
Schlagkraft“213 vorzuweisen.
Während die Nähe des EWR zur EU Vorteile, wie zum Beispiel die Anbindung an den Bin-
nenmarkt hat, müssten sich Großbritannien und die Befürworter des Referendum darüber im
klaren sein, dass bestimmte Regulierungen und Gesetzgebungen, z.B. Umwelt- und Verbrau-
cherfragen der Europäischen Union, auch automatisch auf die EWR/EFTA-Staaten anzuwen-
den sind.214 So ist, wie bei Norwegen zu sehen war, das Modell zwar wirtschaftliche lukrativ,
jedoch aus politischer Sicht eine einseitige Belastung. So könnte Großbritannien keine Ent-
scheidungen der EU beeinflussen, müsste den Ausgang jener aber nahezu vollständig akzep-
tieren. Politische Debatten über die Inhalte der Rechtsakte, die Einfluss auf die britische In-
208 Mech (2007): S. 207. 209 Vgl. Mech (2007): S. 207. 210 Vgl. Geddes (2013): S. 164 f. 211 House of Commons (01.07.2013): S. 19. 212 Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz. 213 European Movement (October 2011). 214 Ebenda.
Seite | 39
nenpolitik hätten, würde es in der Form der britischen Bindung an/in Europa nicht geben. Et-
zold geht sogar so weit zu sagen, dass dies zu einer „Einschränkung der Demokratie und der
Interessen des Landes [führen würde].“215 Auf Grund des Fehlens von britischen Parlaments-
mitgliedern und anderen Abgeordneten in den EU-Institutionen wäre es so für Großbritannien
sehr schwer, alle Änderungen in Brüssel zu verfolgen und dort profitables Lobbying zu be-
treiben.216
Für Großbritannien würde das Modell des Europäischen Wirtschaftsraumes ohne eine Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union bedeuten, dass es sozial- und beschäftigungspolitische
Regulierungen beibehalten müsste.217 Außerdem wäre das Land weiterhin an die Finanz-
marktregulierungen der Europäischen Union gebunden, wenn der Knotenpunkt der britischen
Finanzwelt, die Londoner City, weiterhin in den freien europäischen Kapitalverkehr einge-
bunden werden will.218
Dass heißt im Klartext, dass Großbritannien viele Vorschriften, die es schon innerhalb einer
EU-Mitgliedschaft nicht unterstützen will, nun trotzdem beibehalten müsste und somit auch
weniger Mitgestaltungswege hätte.219 Die Eingrenzung der Personenfreizügigkeit, die mit
Auslöser des Austrittsgedanken und damit Referendums der Briten ist, könnte unter dem Mo-
dell EWR somit nicht verwirklicht werden.220
Durch die formelle Abtrennung von der Europäischen Union riskiert Großbritannien trotz
eventueller Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum einem Abfluss der Investitionen
in EU-Mitgliedsstaaten.221 Das vorher genannte Argument der freien Wahl von Partnerländern
für bilaterale Freihandelsabkommen ist insofern hinfällig, da durch den Aufbau der EFTA
Großbritannien nicht einfach alle bisherigen Freihandelsabkommen übernehmen, sondern alle
einzeln neu aushandeln müsste. Dies könnte laut der „Confederation of British Industry” für
jedes Abkommen zwischen drei und fünf Jahre dauern.222
215 Etzold (2013): S. 2. 216 Ebenda; ebenso Buchan (24.09.2012): S. 6. 217 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 141. 218 Vgl. ebenda. 219 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 18 f. 220 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 142. 221 Vgl. ebenda. 222 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 141.
Seite | 40
Eine gelungene Zusammenfassung der Nachteile einer EWR-Mitgliedschaft gibt Tim Oliver
in seinem Research Paper „Europe without Britain“, herausgegeben von der Stiftung für Wis-
senschaft und Politik (SWP), wieder:
“Paying for membership of the EEA, allowing the free movement of people into the UK and being subjected to supranational oversight of EU legislation – over all of
which it would have no direct influence – is unlikely to be popular in a UK where a
vote to leave would have secured the domination of Euroscepticism in British poli-tics.”223
223 Oliver (2013): S. 21.
Seite | 41
5.3 Modell 2: Das bilaterale Abkommen
5.3.1 Aufbau des zweiten Modells am Beispiel der Schweiz
Nachdem die Option Wiedereintritt in die EFTA und die damit verbundene Beteiligung am
EWR nun dargestellt wurde, soll beleuchtet werden, welche Auswirkungen es für Großbritan-
nien hätte, wenn das Land nach einem EU-Austritt nur noch auf bilateraler Basis mit der Uni-
on agieren würde. Zur Veranschaulichung eines solchen Beispiels wird das Modell der bilate-
ralen Abkommen anhand der Position der Schweiz skizziert.
So hat die Schweiz eine sehr spezielle Situation in Europa und Beziehung zur EU: Sie ist
Mitglied in der EFTA und im Schengen-Abkommen, jedoch weder im EWR224 noch in der
EU. Dies macht die Situation enorm komplex und schwer nachzuahmen. Die Schweiz hat
daher keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gesetzgebungen der EU, kann diese jedoch
auch in keiner Weise beeinflussen. Diese Beschränkung hält die Schweiz nicht davon ab, bei
der Entwicklung eigener Gesetze die Ideen der EU aufzugreifen.225 In Hinsicht auf den EU
Binnenmarkt haben die Europäische Union und die Schweiz verschiedene bilaterale Abkom-
men getroffen, welche die meisten der Bereiche226 des Binnenmarktes abdecken. Eine solche
Ausnahme bildet hier beispielweise der Finanz- und Bankensektor. 227
Die Schweiz ist daher also sehr darauf bedacht, die Kontrolle zu behalten und ihre Souveräni-
tät zu wahren. Diese Haltung und Strategie gehen auf ihre Einstellung in den frühen Tagen
der europäischen Integration zurück.228 Dies hat die Schweiz jedoch nicht davon abgehalten,
ein sehr enges Verhältnis zur EU zu knüpfen. So hat kein anderes Drittland so viele Abkom-
men mit der EU geschlossen wie die Schweiz – 120 an der Zahl. Die vertraglichen Vereinba-
rungen gehen bis in die 1950er-Jahre zurück, als die Hohe Behörde der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl und der Schweizerische Bundesrat ein Konsultationsabkom-
men unterzeichneten. Das Abkommen betraf den Transport von Stahl aus den Ländern der
224 Die Schweiz verlor 1992 ein Referendum zum Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. 225 Vgl. Oliver (2013): S. 21. 226 Beispiele dafür sind: Freizügigkeit von Arbeitskräften, Landwirtschaft, Abbau von Handelshemmnissen, Kriminalität etc. 227 Vgl. Oliver (2013): S. 21. 228 Vgl. Tobler et al. (Januar 2010): S. 38.
Seite | 42
Europäischen Gemeinschaften durch die Schweiz. Darauf folgte das von der Mehrheit des
Schweizer Volkes (72,5%)229 angenommene Freihandelsabkommen von 1972 mit dem Ziel
„anlässlich der Erweiterung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu festigen und aus-
zuweiten und unter Wahrung gerechter Wettbewerbsbedingungen die harmonische
Entwicklung ihres Handels mit dem Ziel sicherzustellen, zum Aufbau Europas beizu-
tragen […]“.230
Dazu vereinbarten die Parteien, die Hemmnisse für den vertraglich festgelegten freien Handel
schrittweise zu beseitigen. Ende der 1980er-Jahre folgte daraufhin ein Versicherungsabkom-
men, welches eine Niederlassungsfreiheit für Versicherungsunternehmen garantierte und den
Zweigstellen der beiden Vertragsparteien gleiche Rechte zuweisen sollte.231 1992 nahm die
schweizerische Regierung mit den anderen Mitgliedsstaaten der EFTA an den Verhandlungen
zum Europäischen Wirtschaftsraum teil, um eine weitere wirtschaftliche Integration mit den
umliegenden Ländern der Europäischen Gemeinschaft anzustreben. Gleichzeitig stellte das
Land einen Antrag auf den Beitritt zur EG.232 Da das schweizerische Volk jedoch im Dezem-
ber 1992 gegen einen Beitritt des Landes zum EWR entschied, wurde das parallel laufende
EG-Verfahren damit erst einmal eingestellt. 233 Nur einen Monat später erklärte die Regierung
der Schweiz, man wolle die Beitrittsverhandlung zur EG vorerst nicht weiter verfolgen.234
Die unmittelbare Folge auf dieses Scheitern war der sektorale Integrationsansatz, der wichtige
Bereiche wie Freizügigkeit von Personen und Waren sowie das Wegfallen von Handels-
hemmnissen beinhalten sollte. Um sich nach dem „Nein“ zum EWR trotzdem einen nahezu
unbeschränkten Marktzugang für Schweizer Unternehmen zu sichern, nahm die Schweiz 1993
sektorale Verhandlungen mit der EU auf. Diese erklärte sich daraufhin bereit, in sieben Berei-
chen zu verhandeln, falls diese gemeinsam und parallel ausgehandelt sowie unterzeichnet
werden würden. 235 Zudem sicherte sich die Europäische Union durch eine „Guillotine-
Klausel“ dahingehend ab, dass alle Abkommen aneinander gebunden sind. Würde eines dieser
Abkommen aufgekündigt werden, führte dies zu der außer Kraftsetzung aller sieben.236
229 Vgl. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2014): S. 6. 230 Freihandelsabkommen EG-Schweiz (1972). ABl. Nr. L 300 vom 31.12.1972, S. 189. 231 Vgl. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2014): S. 6 f. 232 Vgl. ebenda. 233 Vgl. Tobler et al. (Januar 2010): S. 13 ff. 234 Vgl. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2014): S. 7. 235 Vgl. ebenda. 236 Vgl. ebenda.
Seite | 43
1999 mündeten diese Verhandlungen in sieben Abkommen, welche im Gesamtpaket als „Bi-
laterale I“ bezeichnet werden.237 Von 2001 bis 2004 wurde ein neues Paket auf bilateraler
und sektoraler Basis diskutiert, woraus sich neun Abkommen und eine Absichtserklärung
(„Bilaterale II“) ergaben. Zu den Diskussionsgebieten gehörten unter anderem Umweltfragen,
der Schengen-Besitzstand sowie die Dubliner Erklärung. Das „Bilaterale II-Paket“ wurde
schließlich 2004 unterzeichnet und gab der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der
EU weiteren Auftrieb.238
Aus den Verhandlungen zu jedem Abkommen zwischen der Schweiz und der EU ergeben
sich jedoch Konfliktpotentiale, die gemeinsame Entscheidungen erschweren können. So wird
jedes sektorale bilaterale Abkommen von einem Gemischten Ausschuss verwaltet, der sich
aus Vertretern der EU und der Schweiz zusammensetzt. So ist jeder dieser für seine Strategie
der Lösung von Streitfragen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Abkommen zuständig.
Allein die Zahl der Gemischten Ausschüsse - insgesamt 27 - für die Verwaltung der Abkom-
men führt zu Schwierigkeiten, insbesondere bei der Kommunikation zwischen ihnen. In man-
chen Fällen wurde es schon zur Herausforderung, den für ein bestimmtes sektorales Abkom-
men zuständigen Bereich zu ermitteln. Ein Beispiel für eine solche Rechtsvorschrift ist die
Anerkennung von Fahrerlaubnissen, wo nicht klar ist, ob dies unter die Freizügigkeit oder
unter den Landverkehr fällt. Die Folge davon ist, dass sich Abkommen zumeist verzögern, da
das Thema nicht ausreichend besprochen wird und die meisten Gemischten Ausschüsse nur
ein- bis zweimal im Jahr zusammen kommen.239
Neben der Problematik der gemeinsamen Ausschüsse und ihrer Zuständigkeiten erschwert
auch die föderale Struktur der schweizerischen Kantone die Beziehung zur EU. So stellen
Tobler und andere fest, dass Kantone zumeist Gesetzesvorschriften aus ökonomischen Be-
weggründen harmonisieren, jedoch manche Privilegien für Unternehmen oder Aspekte in
Steuerregelungen nur schwerlich zu verändern sind.240 Das ist nicht nur ein zusätzliches Prob-
lem für die Schweizer Regierung in Verhandlungen mit der EU, es kann auch zu einem Han-
delshindernis werden.241
237 Vgl. Tobler et al. (Januar 2010): S. 14 f. 238 Vgl. ebenda. 239 Vgl. Tobler et al. (Januar 2010): S. 40. 240 Vgl. Tobler et al. (Januar 2010): S. 39. 241 Vgl. ebenda..
Seite | 44
5.3.2 Umsetzbarkeit des Modells in Großbritannien
5.3.2.1 Vorteile
Welche Vorteile des bilateralen Modells zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
würde Großbritannien bei der Implementierung des Modells haben? Die Antwort lautet: Vor
allem wirtschaftliche. So ist für viele britische Politiker eine Absicherung der nationalen
Wirtschaft ein Beweggrund, eine bilaterale Annäherung an die EU zu suchen. Auch Premier
Cameron pocht auf solche Absicherung der Wirtschaft - besonders für den Finanzmarkt Lon-
don – und fordert daher, zu sehen im Dezember 2011 bei seiner Verweigerung einen überar-
beiteten EU-Vertrag mitzuunterzeichnen, die Zusicherung von „safeguards“. 242 Durch den
Abschluss eines sektoralen Abkommens wäre es der britischen Regierung möglich, den As-
pekt der finanziellen Dienstleistungen außen vor zu lassen bzw. nicht zu verhandeln. So könn-
te Großbritannien die Finanztransaktionssteuer, die bereits von elf Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union umgesetzt wird243, vermeiden. Gerade weil das Land dann wie die Schweiz
keine Beteiligung an der Gesetzgebung der EU hätte, ist die Möglichkeit „NEIN“ zu sagen
sehr wichtig.244
Als Argument für eine Übertragung des bilateralen Modells auf Großbritannien wird ange-
führt, dass sich das Land nicht wie bei der EWR-Variante den sozial- und beschäftigungspoli-
tischen Regulierungen der EU unterwerfen müsste bzw. zumindest nicht so stark.245 So hat
sich die Schweiz in ihren Abkommen mit der Europäischen Union insofern abgesichert, dass
diese Übereinkünfte nicht ohne Neuverhandlungen substantiell verändert werden können.
Trotzdem übernimmt die Schweiz diese meist freiwillig, um die Vorzüge der Abkommen
nicht einzubüßen.246 Ein wirkliches Argument für die Vorteilhaftigkeit der Anwendung der
„schweizerischen Option“ auf Großbritannien ist dies somit nicht.
Ebenso wie die Schweiz würde Großbritannien von der Erweiterungspolitik der EU profitie-
ren, da mit jedem Mitglied der für Großbritannien zugängliche Markt wächst. So würde das
Land das erreichen, was es immer wollte und nie wirklich verheimlicht hat: Eine erweiterte,
größere, statt einer vertieften Europäische Union. Ein bedeutendes Argument des bilateralen
Modells am Beispiel Schweiz, wenn auch in der EU sicherlich nicht gerne gesehen, ist daher
242 Vgl. Traynor; Watt (07.12.2011). 243 Europäische Kommission (14.02.2013). 244 Vgl. Buchan (24.09.2012): S. 7. 245 Vgl. Busch (Juni 2014): S. 24. 246
Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 145 f.
Seite | 45
auch die Begrenzung der Einwanderungszahlen. So könnte Großbritannien ähnlich wie die
Schweiz 1999 eine „safeguard clause“ in dem Abkommen mit der EU verlangen, welches ein
Limit an Immigration von Arbeitskräften setzt.247 Diese Klausel ist zwar 2014 ausgelaufen,
jedoch haben jüngste Schweizer Referenden das Thema und die Debatte Einwanderung wie-
der entflammt.
5.2.2.2 Nachteile
„Both Switzerland and Norway are extensively engaged with the EU and subject to
EU rules, but have no say in the rule-making. Switzerland, too, is integrated within the
set of rules that constitute the EU single market and, unlike Britain, is also member of the Schengen framework for pass-port-free-travel.248
Das Schweizer Modell hat im Gegensatz zu Norwegen mehr Kontrolle über die Eingliederung
der EU-Gesetzgebung und wird daher eher von britischen Europaskeptikern als attraktiv an-
gesehen.249 Jedoch hat die Geduld der EU schon bei dem Abkommen mit der Schweiz ihre
Grenze erreicht, da eine solche Übereinkunft von der EU als eine Art “Herauspicken der luk-
rativsten Bereiche”250 angesehen wird. Dies und der Fakt, dass die bilateralen Abkommen mit
der Schweiz eigentlich als eine Art temporärer Zustand dienen sollten, frustriert die EU zu-
nehmend. Es ist daher unwahrscheinlich, dass dies ein zweites Mal angestrebt und angeboten
wird, besonders da Großbritannien politisch, strategisch und wirtschaftlich in einer anderen
Liga spielt als die Schweiz.251
Großbritannien müsste, da es ohne den Zugang zum Binnenmarkt wäre, alle Bereiche bzw.
den Zugang zu einzelnen Sektoren erst einmal mit der EU verhandeln. Dies könnte sich als
langwieriger Prozess herausstellen, der für beide Seiten schädlich sein könnte. Jedoch gerade
in diesem Bereich ist die britische Insel durch die vielen aggressiven Forderungen von Marga-
ret Thatcher und anderen konservativen Politikern stark eingenommen.
247
Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 145 f. 248 Vgl. Geddes (2013): S. 164 f. [Hervorhebung durch den Autor] 249 Vgl. Buchan (24.09.2012): S. 2. 250 Oliver (2013): S. 21. 251 Vgl. Oliver (2013): S. 21.
Seite | 46
Wie sehr, zeigt ein Zitat von David Buchan, ehemaliger Leiter des Brüsseler Büros der Finan-
cial Times und EU-Energie-Experte beim Oxford Institute for Energy Studies:
“So the notion of being half in and half out of the EU – of being part of the single
market, but not having to pay into the EU budget or be part of the common agriculture
and fisheries policies and so on – is appealing to many Britons.”252
Zwar wurde bereits der Vorteil eines „Herauspickens“ der besten Aspekte genannt, jedoch ist
es nur eine Frage der Zeit, bis die Europäische Union bei solch einer Vorgehensweise die Ge-
duld mit dem betreffenden Land verliert. So war schon bei der Schweiz zu sehen, wie wenig
die EU bereit war, auf Sonderwünsche einzugehen.253 So fordert die EU von ihren Partnern in
künftigen Verträgen nicht nur das bestehende Recht in den ausgewählten Sektoren, besonders
im Bereich des Binnenmarktes zu übernehmen, sondern auch ohne ein Mitspracherecht und
mit Überwachung- und Durchsetzungsmechanismen zukünftige Veränderungen des Rechtes
zu akzeptieren.254 Dies wäre für Großbritannien wohl ein nicht mit seiner bisherigen Politik
zu vereinbarendes Mittel, welches stark gegen dieses Modell spricht.
Desweiteren liegt das Integrationsniveau der Schweiz insgesamt deutlich unter dem Stand des
EWR.255 So verfügt die bilaterale Beziehung EU-Schweiz nicht über ein umfassendes Ab-
kommen über den freien Dienstleistungsverkehr. Dieses Beziehungsbild wird dadurch noch
komplizierter, da bilaterales Recht den Dienstleistungsverkehr kaum und wenn, dann nur
durch viele verschiedene Rechtsakte regelt.256 Ein weiterer Nachteil entstünde für das Verei-
nigte Königreich, wenn britische Unternehmen die EU-Ursprungsregeln anwenden müssten,
da dafür eine Zollabfertigung an den Grenzen der Freihandelspartner notwendig werden wür-
de.257 Wie auch schon in der “norwegischen Option” würden sich die Verhandlungen mit der
EU als langwierig und komplex gestalten, was wiederum die britische Wirtschaft auf Grund
der Unsicherheiten auf Seiten der Investoren und Unternehmen schwächen würde. So ist es
bei einer Wirtschaftskraft wie Großbritannien kaum vorstellbar, dass es sich einem solchen
Prozess wie „Bilateral I“, bei dem die Schweiz und die EU sechs Jahre verhandelten, um dann
nochmal drei Jahre auf die Implementierung zu warten, aussetzen möchte.258
252 Buchan (24.09.2012): S. 2. [Hervorhebung durch den Autor] 253 Vgl. Etzold (2013): S. 2; ebenso Buchan (24.09.2012): S. 6. 254
Vgl. Etzold (2013): S. 2 f.; ebenso Buchan (24.09.2012): S. 10. 255 Vgl. Tobler et. al (Januar 2010): S. 34. 256 Vgl. Tobler et. al (Januar 2010): S. 17; ebenso Busch (Juni 2014): S. 22. 257 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2014). 258
Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 147.
Seite | 47
6 Fazit und Bewertung
Warum sollte Großbritannien aus der Europäischen Union austreten wollen? Welche Alterna-
tiven und Anbindungsmöglichkeiten hätte das Land dann innerhalb Europas? Diese Frage und
die Suche nach einer Antwort haben sich durch die ganze vorliegende Arbeit gezogen. Viele
Faktoren und Akteure haben dafür gesorgt, dass Großbritannien in einer Position angekom-
men ist, die für ganz Europa von wichtiger Bedeutung ist. Nun kommt es darauf an, wie der
nächste Schritt der Briten erfolgt und wie er aussieht. Haben sie aus ihren Fehlern in der Ver-
gangenheit, so vor allem dem mit einem Konkurrenzkampf verbundenen späten Beitritt zur
EWG, gelernt? Miers spricht bei diesen Fehlern von “missed bus” oder “lost opportunity”259.
Er argumentiert, dass Großbritannien durch seine späte Einbindung in die Gemeinschaft und
die Haltung bezüglich einer vertieften Integrationspolitik nie die Position erreicht hat, aus der
es einen markanten Einfluss auf die Werte und Vorstellungen der Gemeinschaft hätte nehmen
können.260 Wäre ein Austritt demnach gar nicht aktueller Gesprächsstoff, wenn Großbritanni-
en früher in die Europäischen Gemeinschaften eingetreten und somit integriert worden wäre?
Wahrscheinlich ja!
Wenn Großbritannien sich tatsächlich entschließen würde, die Europäische Union zu verlas-
sen, würden beiden Seiten enormen Schaden nehmen. Die EU würde ein starkes, wenn auch
oft kontraproduktives und widerspenstiges Mitglied verlieren, ohne das sie weniger Einfluss
und Autorität sowohl in Europa als auch in globaler Hinsicht besäße. Auf der britischen Seite
wiederum würde es wie bereits in der Vergangenheit zu wirtschaftlichen Krisen und polit i-
scher Isolation kommen und dass kann sich Großbritannien im 21. Jahrhundert nicht leisten.
So beschreibt es der ehemalige Premierminister Tony Blair zur Jahrtausendwende wie folgt:
“[…] From Europe's perspective, Britain as a key partner in Europe is now a definite plus not a minus. Britain has a powerful economy, an obvious role in defence and for-
eign policy and there is genuine respect for Britain's political institutions and stability.
[…] And for Britain, as Europe grows stronger and enlarges, there would be some-
thing truly bizarre and self-denying about standing apart from the key strategic alli-
ance on our doorstep. None of this means criticisms of Europe are all invalid. They
aren't, as I shall say later. But to conduct the case for reform in a way that leaves Brit-
ain marginalised and isolated […] is just plain foolish.”261
259 Miers (2004): S. 17. 260 Vgl. Miers (2004): S. 17. 261 Blair (2000).
Seite | 48
Hier lässt sich erkennen, dass selbst britische Regierungschefs eine völlige Abkehr von der
Europäischen Union und damit auch Europa als integratives und politisches Gebilde nicht
gutheißen können. In empirischen Untersuchungen von Smith und Hay262 wird belegt, dass
der überwiegende Teil politischer Entscheider der Meinung sind, dass die Vorteile einer Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union die Nachteile überwiegen. Denn auf lange Sicht ist
erkennbar: In naher Zukunft werden die verantwortlichen, britischen Politiker feststellen müs-
sen, dass „an Europa kein Weg vorbei führe[n] [kann].“263
Auch Premierminister David Cameron hat mittlerweile die Tragweite seines angekündigten
Referendums und der möglichen Konsequenzen daraus erkannt. Während er in einer “neuen
EU nach britischem Gusto verbleiben [möchte]”264, sieht er in den beiden genannten Optionen
zu einer EU-Mitgliedschaft keine Alternativen, da sein Land weder mit der Schweiz noch mit
Norwegen in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht vergleichbar ist.265 Doch was, wenn das
von ihm initiierte Referendum 2017 den Ausgang bekommt, wie er es zu Beginn, wenn auch
auf internen Druck seiner Partei und dem äußeren Druck durch Euroskeptiker, vor hatte? Was,
wenn die Mehrheit der Briten für einen Austritt votieren? Dann bleibt Cameron keine andere
Wahl, als über eines der im Abschnitt 5.1 genannten Modelle nachzudenken, falls sein Land
den Zugang zum europäischen Binnenmarkt nicht verlieren will. Egal ob Großbritannien nach
einem EU-Austritt dem Beispiel des norwegischen Modells oder des schweizerischen Modells
folgen würde, es wäre nicht mehr Teil des bisherigen Entscheidungsprozesses in der EU und
könnte so keinen bedeutenden Einfluss mehr auf die gemeinsame Politik in Bereichen wie
Fischerei, Landwirtschaft, Sicherheitspolitik etc. nehmen.266
Würde sich das Land für die Variante des Verbleibs in dem Europäischen Wirtschaftsraum
entscheiden, so würde sich zwar der Einfluss der EFTA-Staaten durch den Wiedereintritt
Großbritanniens erhöhen, jedoch „dürfte sich das schon jetzt stark ausgeprägte Gefühl eher
noch verstärken, nationalstaatliche Souveränität eingebüßt zu haben.“267 So wäre ein Wechsel
von einer Mitgliedschaft in der EU zurück zur EFTA und damit zum EWR268 ein Rückschritt
sowohl in politischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht für die Insel, der Großbritannien nur
die Fehler der Vergangenheit wiederholen lassen und es von einem Entscheider zu einem Zu-
262 Vgl. Smith; Hay (2008): S. 374 f. 263 Sturm (2009): S. 207. 264 Etzold (2013): S. 3. 265 Vgl. Etzold (2013): S. 3. 266 Vgl. Oliver (2013): S. 21. 267 Vgl. Etzold (2013): S. 3. 268 Art. 128 EWRA setzt für die Teilnahme am EWR die zeitgleiche Mitgliedschaft in der EFTA voraus.
Seite | 49
hörer wandeln würde. Bis zum Beitritt der Briten in die EWG 1973 waren diese doch seit
1960 (Gründungs-) Mitglied in der EFTA und nutzten diese auch als Gegengewicht zur EWG.
Trotzdem würde Großbritannien als Teil der EFTA dieser einen enormen Schub geben, da es
alleine schon in der Bevölkerungsrelation der Mitgliedsstaaten hervorsticht. So hat alleine die
Stadt London mehr Einwohner als die Schweiz oder Norwegen.269 Desweiteren wäre es mög-
lich, dass durch die Stärkung durch ein weiteres Mitglied eine wenn auch minimale Verlage-
rung der Einflussmöglichkeiten der EFTA in der EWR-EU-Beziehung vollzogen wird.
Desweiteren zeigen Berichte und Positionspapiere der Stiftung Wissenschaft und Politik270
klar auf, dass, wie Cameron auch richtig erkannt hat, die Alternativmodelle bei kleineren
Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz oder Norwegen Anwendung finden mögen, dies auf
Großbritannien aber nicht so einfach zu übertragen ist. Kann demnach ein bilaterales Modell
wie bei der Schweiz angewendet oder eines auf dem Konzept der Anbindung an der Europäi-
schen Wirtschaftsraumes basierendes wie bei Norwegen wirklich für ein wirtschaftlich starkes,
aber engstirniges Land wie Großbritannien besser als eine EU-Mitgliedschaft sein? Die Ant-
wort kann resümierend, wie Autor David Buchan zustimmt, nur „NEIN“ heißen. Auch wenn
die Modelle bei der Schweiz und Norwegen oberflächlich gesehen funktionieren, sind beide
Länder als auch die EU selbst von den Assoziierungsabkommen zunehmend frustriert. So hat
das EWRA Norwegens nationale politische Debatte noch mehr angeheizt und die Schweizer
Beziehung zur EU hat eine institutionelle Sackgasse erreicht.271
Die These dieser Arbeit, Großbritannien habe keine Alternative zu einer EU-Mitgliedschaft,
die sich wirtschaftlich und politisch rentiert, ist am Ende der Arbeit nicht vollkommen eindeu-
tig zu bejahen. Es muss differenziert werden, auf welchen Bereich die britische Regierung im
Falle eines Austritts aus der Europäischen Union ihren Fokus legen würde. Falls sich Großbri-
tannien und seine Regierung dazu entscheiden würden, dass ihnen die wirtschaftlichen Di-
mensionen wichtiger sind als politische Mitbestimmung und Einfluss, so kann nach Aussagen
einiger Ökonomen272 eine Abwendung von der Europäischen Gemeinschaft hin zu einer Bin-
nenmarktanbindung durch den EWR eine relativ passable Lösung sein.
269 Vgl. European Movement (October 2011). 270 Etzold (2013); ebenso Von Ondarza (2013b). 271 Vgl. Buchan (24.09.2012): S. 2. [Übersetzung durch den Autor] 272 Trentmann (27.05.2014); dem entgegen kritisch Dams; Jost (19.08.2014): „Ein Teil des dortigen Bankge-schäfts werde zwangsläufig abwandern, wenn das Land die EU verlassen sollte.“
Seite | 50
Dies soll nicht bedeuten, dass bei einem solchen Szenario Großbritannien als Sieger hervor-
geht und seine wirtschaftliche Position in der Welt unverändert bleibt, sondern eher, dass es
zwar Abstriche an Zuwendungen und Subventionen machen muss, dies aber verhältnismäßig
gut verkraften könnte. Auf der anderen Seite steht der Drang der britischen Regierung nach
politischer Mitbestimmung und Macht innerhalb Europas. Würde Großbritannien daher aus
der EU austreten, wären die Folgen, ob im ersten oder im zweiten Modell, für die Insel mas-
siv einschneidend und gravierend. Der Verlust der Akzeptanz durch andere europäischer Staa-
ten sowie des globalen Einflusses würde die Folge sein. Und dies kann, so sehr sich Großbri-
tannien auch gegen einzelne Teilbereiche der EU-Kompetenz stellt, nicht das Ziel der Briten
sein. Wenn Großbritannien Teil des Binnenmarktes bleiben wolle, dann müsse dort die Frei-
zügigkeit von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen weiter gelten. "Das ist der Geist
des EU-Vertrags, und die Kommission wird dies unerbittlich durchsetzen", kündigte die EU-
Kommisarin Viviane Reding an.273
Keine der zwei genauer betrachteten Alternativen beinhaltet alle Vorteile einer EU-
Mitgliedschaft ohne die dazugehörigen Kosten – solch eine Wunschlösung ist unrealistisch.
Nebenbei würde ein solcher Austritt der Briten ein äußerst komplexes Ereignis darstellen,
dessen Einschlagskraft in der Gegenwart nicht bemessen werden kann. 274 Es bleibt daher nur
zu hoffen, dass sowohl britische Politiker wie David Cameron und Nigel Farage als auch die
britische Öffentlichkeit erkennen werden, wie wichtig und bedeutend ihre Mitgliedschaft in
der Europäischen Union ist, bevor es zu spät ist. Es gilt daher auch von Seiten der Europäi-
schen Union und ihrer Mitgliedsstaaten, sowohl einen Rückbau der europäischen Integration
als auch einen leichtfertigen Austritt Großbritanniens zu verhindern:
„Notwendig ist daher eine Doppelstrategie: Die EU sollte London gegenüber klare rote
Linien setzen, wo ein Zerfasern der Union droht, aber mit der britischen Regierung in
Fragen des Binnenmarkts und des Verhältnisses zwischen Euro- und Nicht-Eurostaaten konstruktiv zusammenarbeiten.“275
Nur so können weitere Konflikte und Missverständnisse zwischen der Union und Großbritan-
nien, die zu der aktuellen Krisensituation geführt haben, zukünftig verhindert werden.
Schließlich ist beiden Akteuren etwas an einer kooperativen Partnerschaft gelegen, und vor
allem Großbritannien möchte sicherlich seinen Status als teilweise jetzt schon isolierter
273 Viviane Reding zitiert nach Schiltz (29.11.2013). 274 Vgl. Confederation of British Industry (November 2013): S. 132. 275 Von Ondarza (2013a): S. 1.
Seite | 51
„akward partner“276 nicht weiter vertiefen. So bleibt nur zu hoffen, dass es in naher Zukunft
zu Verhandlungen und Absprachen zwischen Vertretern der EU und der britischen Regierung
kommt, so dass solche Szenarien, die hier behandelt wurden, nicht bald Realität sind.
276 George (1998).
Seite | I
Anhang: Artikel 50 des EUV
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften be-
schließen, aus der Union auszutreten.
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht
mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem
Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen,
wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt
wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.
(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austritts-
abkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine
Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem
betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern.
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des
Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betref-
fenden Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates
oder des Rates teil.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies
nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen.
Seite | II
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
[URL=http://www.noiseofthecrowd.com/wp-content/uploads/2011/10/EU2.jpg]
Abbildung 2
[URL=http://www.noiseofthecrowd.com/wp-content/uploads/2013/01/EU-2013.png]
Seite | III
Abbildung 3
[URL=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/12/18/article-0-1A2F1D9500000578-153_634x393.jpg]
Abbildung 4
[URL=http://www.independent.co.uk/incoming/article9273362.ece/alternates/w460/Ukip3.jpg]
Seite | V
Literaturverzeichnis
Aaronovitch, David (05.09.2013): Ed Miliband is no leader. He is a vulture. The Times.
[URL=http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/davidaaronovitch/article3860789.ece] letzter
Zugriff am 11.09.2014]
Becker, Bernd (2002): Politik in Großbritannien. Paderborn.
Buller, Jim: New Labour and the European Union, in: Beech, Matt; Lee, Simon (2008): Ten Years of
New Labour. London, S. 136 – 150.
Bieber, Roland; Epiney, Astrid; Haag, Marcel (2011): Die Europäische Union. Europarecht und Poli-
tik, 9. Auflage, Baden-Baden.
Blair , Tony (23.02.2000): Committed to Europe - Reforming Europe. Gent. [URL=
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/commons/deposited-
papers/?page=1248&sort=1#] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Blair , Tony (06.10.2000): Speech to the Polish Stock Exchange.
[URL=http://euobserver.com/news/2450] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Brown, Gordon (2003): Speech to Labour Party Conference. [URL=
http://www.theguardian.com/politics/2003/sep/29/labourconference.labour1] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Buchan, David (24.09.2012): Outsiders on the inside: Swiss and Norwegian lessons for the UK. Cen-
tre for European Reform. [URL= http://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-
brief/2012/outsiders-inside-swiss-and-norwegian-lessons-uk] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Buchsteiner , Jochen (13.03.2014): Der Miliband-Riegel.
[URL=http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-referendum-die-position-der-labour-party-
12845800.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Busch, Berthold (Juni 2014): Das Vereinigte Königreich vor dem Austritt aus der Europäischen Union?
Wirtschaftliche und politische Konsequenzen eines Austritts und mögliche Alternativen zu einer Mit-
gliedschaft. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Policy Paper 09/2014. [URL=
http://www.iwkoeln.de/de/studien/iw-policy-papers/beitrag/berthold-busch-das-vereinigte-
koenigreich-vor-dem-austritt-aus-der-europaeischen-union-171660] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Butler, David; Westlake, Martin (1995): British politics and European elections, 1994. New York.
Seite | VI
Cameron, David (23.01.2013): EU Speech at Bloomberg.
[URL=https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Carey, Sean; Burton, Jonathan (October 2004): Research Note: The Influence of the Press in Shaping
Public Opinion towards the European Union in Britain, in: Political Studies, Volume 52, Issue 3, pag-
es 623–640. [URL=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2004.00499.x/abstract]
[letzter Zugriff am 11.09.2014]
Confederation of British Industry (November 2013): Our Global Future - The Business Vision for a
reformed EU. [URL=http://www.cbi.org.uk/campaigns/our-global-future/] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Dams, Jan; Jost, Sebastian (19.08.2014): Banker warnen die Briten vor dem EU-Austritt. Die Welt.
[URL=http://www.welt.de/wirtschaft/article131350664/Banker-warnen-die-Briten-vor-dem-EU-
Austritt.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Driver , Steven; Martell, Luke (2006): New Labour. Second fully revised and updated edition. Malden.
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2014): Die Bilateralen Abkommen
Schweiz – Europäische Union. Bern. [URL=
http://www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html?lang=de] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Etzold, Tobias (2013): Großbritanniens Zukunft in Europa. SWP-Aktuell 2013/A 19, März 2013.
EurActiv (2014): UKIP startet Wahlkampf mit Hetzkampagne.
23.04.2014.[URL=http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/ukip-startet-wahlkampf-mit-
hetzkampagne-301701] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Eurobarometer (2011): Standard Eurobarometer 76. Brussels.
Europäische Freihandelsassoziation (2014): EFTA through the years. Main events in the history of
EFTA from 1960 until today. [URL=http://www.efta.int/about-efta/history#2005] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Europäische Kommission (14.02.2013): Finanztransaktionssteuer im Rahmen der Verstärkten Zusam-
menarbeit: Kommission erläutert Einzelheiten. Pressemitteillung IP/13/115. [URL=
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_de.htm] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
European Commission (2009a): Public opinion in the European Union. Eurobarometer
71. URL= http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf
[letzter Zugriff am 11.09.2014 ]
Seite | VII
European Commission (2009b): Attitudes towards the EU in the United Kingdom.
Flash Eurobarometer 203. [URL=http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl203_en.pdf] [letzter Zu-
griff am 11.09.2014]
European Movement (October 2011): Britain and the EU: are there alternatives to membership?
[URL= http://www.euromove.org.uk/index.php?id=6509] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Fischer, Kai (1996): Britische Europapolitik. Von Margaret Thatcher zu John Major. Mosbach.
Forster , Anthony; Blair, Alasdair (2002): The Making of Britain’s European Foreign Policy.
Freihandelsabkommen EG-Schweiz (1972): ABl. 31.12.1972 Nr. L 300, S. 0189 – 0280.
[URL=http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21972A0722%2803%29:DE:
HTML] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Gamble, Andrew (February 2006): The European Disunion. The British Journal of Politics &
International Relations Volume 8, Issue 1, S. 34-49. [URL=
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2006.00224.x/abstract] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Geddes, Andrew (2013): Britain and the European Union. New York.
George, Stephen (1998): An awkward partner: Britain in the European Community. Third Edition,
New York.
Gittermann, Martin (1998): Das Beschlußfassungsverfahren des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum: Ein Modell für die Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die Euro-
päische Union? Veröffentlichung aus dem Institut für Internationale Angelegenheiten der Universität
Hamburg, Band 22, Dissertation an der Universität Hamburg, Baden-Baden.
Gottfried, Glenn; Henderson, Ailsa; Jeffry, Charlie; Jones, Richard Wyn; Scully, Roger; Wincott, Dan-
iel (08.07.2013): England and its two unions: The anatomy of a nation and its discontents. Institute for
Public Policy Research, published on 8th of July 2013.
[URL=http://www.ippr.org/publications/england-and-its-two-unions-the-anatomy-of-a-nation-and-its-
discontents] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Grice, Andrew (12.03.2014): No EU referendum under Labour: Ed Miliband to reveal that vote on
membership is ‘unlikely’ in next Parliament if party wins power. [URL=
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/no-referendum-on-the-eu-under-labour-ed-miliband-
to-reveal-that-vote-on-membership-is-unlikely-in-next-parliament-if-party-wins-power-9185146.html]
[letzter Zugriff am 11.09.2014]
Seite | VIII
Hahne, Silke (05.06.2014): Großbritannien und die EU Ein EU-Austritt könnte die Briten einiges kos-
ten. Deutschlandfunk. [URL=http://www.deutschlandfunk.de/grossbritannien-und-die-eu-ein-eu-
austritt-koennte-die.795.de.html?dram:article_id=288355] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Haratsch, Andreas; Koenig, Christian; Pechstein, Matthias (2010): Europarecht. 7. völlig neu bearbei-
tete Auflage, Tübingen.
House of Commons (01.07.2013): Leaving the EU. Research Paper 13/42.
[URL=http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP13-42/leaving-the-eu] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Hummer, Waldemar: Sonderbeziehung EG-EFTA, in: Dauses, Manfred (Hrsg.) (2004): Handbuch des
EU-Wirtschaftsrechts, Band 2, Loseblatt-Ausgabe, München.
Kaiser , Karl (1963): EWG und Freihandelszone. England und der Kontinent in der europäischen In-
tegration. Leyden.
Kellner , Peter (07.05.2013): The EU Referendum Paradox. YouGov.
[URL=http://yougov.co.uk/news/2013/05/07/eu-referendum-paradox/] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Kielinger , Thomas (26.05.2014): Europa-Skeptiker treibt Establishment vor sich her. Die Welt.
[URL=http://www.welt.de/politik/ausland/article128435283/Europa-Skeptiker-treibt-Establishment-
vor-sich-her.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Lee, Simon: Conclusion, in: Beech, Matt; Lee, Simon (2008): Ten Years of New Labour. London, S.
187 – 195.
Major, John (25.06.1992): Prime Minister's Question Time from 25th June 1992.
[URL=http://www.johnmajor.co.uk/page100.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Major, John (14.02.2013): The Referendum on Europe: Opportunity or Threat? London. [URL=
http://www. chathamhouse.org/sites/default/files/public/Meetings/ Meet-
ing%20Transcripts/140213Major.pdf.] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Mech, Bettina (2007): EWR und europäische Integration. Völker- und europarechtliche Probleme dar-
gestellt am Beispiel Norwegens. Leipziger Schriften zum Völkerrecht, Europarecht und ausländischem
öffentlichen Recht, Band 9, Dissertation an der Universität Leipzig, Baden-Baden.
Miers, David: Britain in Europe: Community to Union, 1973-2001, in: Giddings, Philip; Drewry,
Gavin (Editors)(2004): Britain in the European Union. Law, Policy and Parliament, London, p. 12-36.
Neuhäuser , Alice (2005): Triebkräfte und Hemmnisse auf dem Weg zum britischen Euro-Beitritt.
Politikwissenschaft Band 123, Dissertation an der Technischen Universität Chemnitz, Münster.
Seite | IX
Oliver , Tim (2013): Europe without Britain. Assessing the Impact on the European Union of a British
Withdrawal. SWP Research Paper 2013/RP 7, September 2013.
Pappamikail, Peter Brown: Britain viewed from Europe, in: Baker, David; Seawright, David (Edi-
tors)(1998): Britain For and Against Europe. British Politics and the Question of European Integration.
Oxford, S. 206-221.
Robinson, Nick (12.03.2014): EU referendum 'unlikely' under Labour, says Ed Miliband. BBC News.
[URL= http://www.bbc.com/news/uk-politics-26538420] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Schieren, Stefan (2011): Großbritannien - Analyse politischer Systeme. 2. Überarbeitete Auflage,
Schwalbach.
Schiltz, Christoph (29.11.2013): Brüssel legt Großbritannien EU-Austritt nahe. Die Welt.
[URL=http://www.welt.de/politik/ausland/article122383394/Bruessel-legt-Grossbritannien-EU-
Austritt-nahe.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Smith, Nicola; Hay, Colin (May 2008): Mapping the political discourse of globalisation and European
integration in the United Kingdom and Ireland empirically, in: European Journal of Political Research,
Volume 47, Issue 3, Pages 359–382. [URL=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-
6765.2007.00728.x/abstract] [letzer Zugriff am 11.09.2014]
Straubhaar, Thomas: Wenn Großbritannien gehen will, lasst es ziehen. 27.05.2014, Die Welt. [URL=
http://www.welt.de/wirtschaft/article128455543/Wenn-Grossbritannien-gehen-will-lasst-es-
ziehen.html] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Sturm, Roland (2009): Politik in Großbritannien. Wiesbaden.
Thatcher , Margaret (1993): Downing Street No. 10. Die Erinnerungen. 2. Auflage, Düsseldorf.
Tobler , Christa; Hardenbol, Jeroen; Mellár, Balsás (Januar 2010): Binnenmarkt jenseits der EU-
Grenzen: EWR und Schweiz. Generaldirektion für interne Politikbereiche des Europäischen Parla-
ments. [URL=http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/429993/IPOL-
IMCO_NT(2010)429993_DE.pdf] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Töller, Annette: Concepts of Causality in Quantitative Approaches to Europeanization, in: Claudio
Radaelli and Teofanis Exadactylos (2012): Establishing Causality in Europeanization Research. Lon-
don, S. 44-63.
Trentmann, Nina 27.05.2014): EU-Austritt würde Briten extrem hart treffen. Die Welt. [URL=
http://www.welt.de/wirtschaft/article128433949/EU-Austritt-wuerde-Briten-extrem-hart-treffen.html]
[letzter Zugriff am 11.09.2014]
Seite | X
Traynor , Ian; Watt, Nicholas (07.12.2011): David Cameron threatens veto if EU treaty fails to protect
City of London. The Guardian. [URL=http://www.theguardian.com/world/2011/dec/07/cameron-
threatens-veto-eu-treaty] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
UK Independence Party: We want our country back. Manifesto 2005. [URL=
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/UKIP_uk_manifesto.pdf] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Volle, Angelika: Großbritannien und der europäische Einigungsprozess, in: Forschungsinstitut der
deutschen Gesellschaft für Internationale Politik e.V. (Hrsg.) (1989), Arbeitspapiere zur Internationale
Politik, Band 51, Bonn.
Volle, Angelika: Großbritannien in der europäischen Gemeinschaft – Vom zögernden Außenseiter
zum widerspenstigen Partner, in: Schmidt, Gustav (Hrsg.)(1992): Großbritannien und Europa – Groß-
britannien in Europa. Bochum, S. 315-346.
Von Ondarza , Nicolai (2013a): Rote Linien und eine ausgestreckte Hand- Eine Doppelstrategie für
den Umgang mit Großbritannien in der EU. SWP-Aktuell 2013/A 12, Februar 2013.
Von Ondarza , Nicolai (2013b): Brüssel und London vor dem Scheidungsanwalt. Das Management
eines britischen EU-Austritts, in: Perthes, Volker; Lippert, Barbara (Hrsg.): Ungeplant bleibt der
Normalfall. Acht Situationen die politische Aufmerksamkeit verdienen. SWP-Studien 2013/A 16,
September 2013, S. 16-19.
Watt, Nicholas (23.01.2013): EU referendum: In-out choice by end of 2017, Cameron promises. The
Guardian. [URL=http://www.theguardian.com/politics/2013/jan/22/eu-referendum-2017-david-
cameron] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Wheeler , Brian; Peter, Laurence (14.05.2013): UK and the EU: Better off out or in? [URL=
http://www.bbc.com/news/uk-politics-20448450] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Wilkes, George; Wring, Dominic: The British Press and European Integration: 1948 to 1996, in: Baker ,
David; Seawright, David (Editors) (1998): Britain For and Against Europe. British Politics and the
Question of European Integration. Oxford, S. 185-205.
Wurm, Clemens: Großbritannien, Westeuropa und die Anfänge der europäischen Integration 1945-
1951. Ein Überblick, in: Schmidt, Gustav (Hrsg.)(1992): Großbritannien und Europa – Großbritannien
in Europa. Bochum, S. 57-88.
YouGov (October 2011): Survey „People hold different views about how they would like to see the
European Union develop. Which of these statements comes closest to your view?”
[URL=http://www.noiseofthecrowd.com/wp-content/uploads/2011/10/EU2.jpg] [letzter Zugriff am
11.09.2014]
Seite | XI
YouGov (January 2013): Survey „If there was a referendum on whether or not Britain should remain a
member of the European Union, how would you vote?” [URL=http://www.noiseofthecrowd.com/wp-
content/uploads/2013/01/EU-2013.png] [letzter Zugriff am 11.09.2014]
Zaschke, Christian (04.06.2014): Großbritannien ist ein europäischer Staat. Süddeutsche Zeitung.
[URL=http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-britischen-eu-austritt-grossbritannien-ist-ein-
europaeischer-staat-1.1983682] [letzter Zugriff am 11.09.2014]