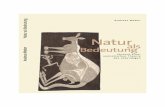Aristotelische Grundbegriffe in der Theorie der Juridischen Argumentation (GERMAN)
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Aristotelische Grundbegriffe in der Theorie der Juridischen Argumentation (GERMAN)
ARISTOTELISCHE GRUNDBEGRIFFE IN DER THEORIE
DER JURIDISCHEN ARGUMENTATION
Von Christof Rapp, München
I. Aristoteles: Zeitverschwendungfür den Rechtstheoretiker?
Die Argumentationstheorie im Allgemeinen und auch die Theorie derjuridischen Argumentation im Besonderen machen von Begriffen Ge-brauch, die ursprünglich im Umkreis von Aristoteles oder von Aristotelesselbst geprägt und definiert wurden. Zum Beispiel scheint der Begriffdes Justizsyllogismus’ weithin geläufig, und spätestens seit den Arbeitenvon Theodor Viehweg ist auch der Begriff der Topik für die Reflexionüber das Wesen juridischer Argumentation etabliert. „Syllogismus“ und„Topik“ sind nur zwei solche Beispiele für Begriffe, die letztlich auf Aris-toteles zurückgehen und heute in der Argumentationstheorie eine zentra-le Rolle spielen. Viele der Begriffe, die ursprünglich von Aristoteles oderanderen griechischen Philosophen geprägt wurden, haben eine wech-selvolle Geschichte durchlaufen und werden, wenn sie heute Gebrauchfinden, in einer Weise verwendet, die ihren Erfindern durchaus überra-schend erschienen wäre. Die entsprechende Dynamik dokumentiert diewechselnden theoretischen und praktischen Kontexte, in denen ein Be-griff benutzt und geprägt wurde. Der begriffsgeschichtliche Umstand,dass Aristoteles einen bestimmten Begriff in der einen Weise gebrauchtund wir ihn heute in einer anderen Weise verwenden, ist noch lange keinGrund, eine Rückkehr zur aristotelischen Begriffsverwendung zu emp-fehlen oder gar von einer solchen Rückkehr einen theoretischen Fort-schritt zu erwarten.
Ob es sich daher für den an der Systematik der juridischen Argumen-tation interessierten Theoretiker lohnt, sich mit Begriffs- und Philoso-phiegeschichte zu befassen – zumal dann, wenn man sich mit diesem In-teresse dem Urteil von Philosophiehistorikern ausliefert, die sich selbstin tausendseitigen Kommentaren äußern und die Texte so lange striegeln,bis sie einen als scharfsinnig empfundenen Sinn ausspucken1 – sei dahin-
RECHTSTHEORIE 42 (2011), S. 1–33Duncker & Humblot, 12165 Berlin
1 Dies scheint die Befürchtung von Dieter Simon zu sein. Vgl. D. Simon, AlleQuixe sind Quaxe – Aristoteles und die juristische Argumentation, in: Juristenzei-tung 2011, S. 697–703, hier: 700 und 703, Fußn. 21.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 1 •
gestellt. Meines Erachtens gibt es zumindest zwei Gründe, die es auchfür den Systematiker vernünftig erscheinen erlassen, sich auf einen be-griffsgeschichtlichen Ausflug einzulassen (vorausgesetzt natürlich, die be-fragten Historiker äußern sich in gebotener – nachgerade enthymemati-scher – Kürze). Der erste Grund hat mit dem schon erwähnten Umstandzu tun, dass die Verbreitung aristotelisch geprägter Grundbegriffe in derjuridischen Terminologie, die nicht selten mit der expliziten Berufungauf den griechischen Philosophen verbunden ist, eine nicht zu leugnendeTatsache darstellt. Vor diesem Hintergrund kann der Bezug auf die ur-sprüngliche Definition solcher Begriffe ein wichtiges Hilfsmittel darstel-len, um Klarheit über die betreffenden Begriffe selbst herzustellen: Waszum Beispiel als ein „topisches“ Verfahren verstanden wird, unterliegterheblichen Schwankungen, und die bloße Versicherung, dass dies „aris-totelisch“ zu verstehen sei, trägt ohne eine gewisse Beschäftigung mitden aristotelischen Texten nur wenig zur Vereindeutigung bei. Derzweite Grund berührt die sehr allgemeine Frage, warum man sich über-haupt mit Philosophiegeschichte befassen soll, wenn die in deren Verlaufformulierten Positionen oft verworren und dunkel sind, während mansich selbst in der Lage dünkt, problemorientierte und klarsichtige Theo-rien ganz ohne historische Hilfestellung zu formulieren. Eine beschei-dene und nicht allzu viel voraussetzende Antwort wäre die, dass dieKenntnis historischer Positionen unseren Vorrat an theoretischen Optio-nen vergrößert und Modelle bereithält, die manchmal als ganze, öfteraber nur selektiv übernommen werden können, um aktuellen systema-tischen Diskussionen neue Impulse zu geben und sie bisweilen auch ineine neue Richtung zu lenken. In der philosophischen Ethik der Gegen-wart, in der Handlungstheorie, in der politischen Philosophie, in der Phi-losophie des Geistes, in der Ontologie und Metaphysik sind solche Wech-selwirkungen zwischen systematischer Philosophie und Geschichte derPhilosophie in den letzten Jahrzehnten eher die Regel als die Ausnahme.Und auch für die allgemeine Argumentationstheorie und die Theorie derRhetorik2 ist dieser Austausch weitgehend selbstverständlich – ohne dassdabei irgendein Vertreter der genannten Richtungen dem plumpen histo-rischen Fehlschluss erläge, dass das historisch Ältere3, bloß weil es älterist, dem Jüngeren und Abgeleiteten vorzuziehen sei.
Was sich in anderen philosophischen Bereichen als fruchtbar erweist –der Versuch nämlich, mit einem konsequent systematischen Interesse die
2 Christof Rapp
2 Vgl. hierzu M. Kienpointners Beitrag zur modernen Rezeption der Aristote-lischen Rhetoriktheorie im Aristoteles-Handbuch, hrsg. von Christof Rapp undKlaus Corcilius, Stuttgart 2011.
3 Solcherlei Fehlschlüsse befürchtet Simon (FN 1), S. 700: „Der lakonische Hin-weis auf ,das historisch ältere Enthymem‘ ist jedenfalls nicht ausreichend.“
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 2 •
Theorien philosophischer Klassiker neu zu durchkämmen – scheint auchfür den rechtstheoretischen Teilbereich der Argumentationstheorie nichtvon vornherein abwegig. In diesem – und nur in diesem – Sinn versteheich auch den neueren Vorstoß, Momente der aristotelischen Rhetorik fürdie Theorie juridischer Argumentation nutzbar zu machen. Der zentraleBegriff in Aristoteles’ rhetorischer Argumentationslehre ist nun der desEnthymems, sodass wer sich für die rhetorisch-dialektische Position desAristoteles interessiert, auch nicht umhinkommt, den Begriff des Enthy-mems zur Kenntnis zu nehmen. Daher ist es nur konsequent, dass in die-sem Bereich eine systematisch motivierte Exploration aristotelischerTheoriemomente unmittelbar auf den aristotelischen Enthymembegriffstößt und diesen zum Ausgangspunkt weiterer Überlegungen macht.4
Das Problem im Falle dieses speziellen Begriffs aber scheint dies zusein, dass die heute dominierende Verwendung eine ist, die sich vonden Bestimmungen der ersten griechischen Rhetoriklehrer (einschließlichAristoteles) erheblich entfernt hat. Das, was der Enthymembegriff heuteherkömmlicherweise bezeichnet, nämlich einen logisch unvollständigenSchluss, ist ein für die Analyse angewandter Argumentation zentralesPhänomen, weil viele Argumente des Alltags – darunter viele, die wir alsgute und überzeugende Argumente einstufen würden – logisch nichtschlüssig oder nicht in einer logisch schlüssigen Form formuliert sind.Hätte sich zur Bezeichnung dieses Phänomens nicht der Ausdruck„Enthymem“ angeboten, hätte es eines anderen Ausdrucks dringend be-durft. Doch so sehr man auch einen Begriff braucht, mit dem man dasFehlen logisch erforderlicher Prämissen hervorheben will, so wenig lässtsich dieses Phänomen mit der aristotelischen Begriffsbestimmung zurDeckung bringen. Bei einer solchen begrifflichen Misere können Missver-ständnisse und Friktionen nicht ausbleiben, dennoch muss so viel zuge-standen sein: Wer sich in Absetzung von diesem geläufigen Enthymembe-griff auf den ursprünglichen Sinn des Enthymems bei Aristoteles beruft,der will nicht gleich das Rad der Begriffsgeschichte zurückdrehen nochwill er den Rechtstheoretikern vorschreiben, was sie „Enthymem“ nen-nen dürfen und was nicht.5 Worum es bei einem systematisch motiviertenRückgriff auf Aristoteles nur gehen kann, ist die Frage, ob sich dessenArgumentationstheorie oder einzelne Theoreme oder Begriffe daraus ge-winnbringend für drängende Probleme der juridischen Argumentation
Aristotelische Grundbegriffe 3
4 Vgl. K. Schlieffen, Wie Juristen begründen. Entwurf eines rhetorischen Argu-mentationsmodells, in: Juristenzeitung 2011, S. 109–116, sowie die von K. Schlief-fen und R. Gröschner in Hagen veranstaltete Tagung „Das Enthymem – Zur frag-mentarischen Ordnung der Jurisprudenz“ am 29. und 30. April 2011. Unter demfrischen Eindruck dieser Tagung scheint der oben zitierte, auf unterhaltsameWeise überspitzte Beitrag von Dieter Simon entstanden zu sein.
5 Vgl. Simon (FN 1), S. 703.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 3 •
einsetzen lassen oder nicht. Selbst wenn sich im Rahmen eines solchenProjekts der aristotelische Enthymembegriff als fruchtbar erweist, wirddamit noch lange nicht die Sache verdrängt, um die es beim herkömm-lichen Enthymembegriff geht.
Die umrissene Art von Diskussion, inwieweit bestimmte Theoreme undBegriffe der aristotelischen Argumentationstheorie, wie z. B. der Begriffdes Enthymems, für die juridische Argumentation erhellend sind, über-lasse ich natürlich den Rechtstheoretikern; ich kann nur einige Hinter-gründe zu dieser Diskussion vonseiten der Aristoteles-Forschung beitra-gen.
II. TopikTopik und Rhetorik:Rhetorik: Schlüssiges und Überzeugendes
Aristoteles’ Argumentationstheorie wird vor allem in zwei seiner Schrif-ten entfaltet, der Topik und der Rhetorik. Obwohl das erstere Werk zumTeil ganz allgemeine Grundsätze des Argumentierens formuliert, ist esfür eine besondere Art von Argumentation maßgeschneidert, nämlich fürdie dialektische Debatte zwischen einem Angreifer und einem Verteidi-ger, wobei der eine eine bestimmte These verteidigen soll, während derandere dieselbe These angreift und den Verteidiger in Widersprüche ver-wickelt. Die inhaltlichen Beispiele für diese Art von Debatte sind zu-meist der Philosophie aus Platons und Aristoteles’ Umfeld entliehen. DieArgumentationstheorie der Topik interessiert sich für logisch schlüssigeArgumente, denn nur durch solche kann der Kontrahent einer dialek-tischen Debatte zu Zugeständnissen gezwungen und nur durch sie kanndie gegnerische These zwingend widerlegt werden. Manche Argumentewerden vom unerfahrenen Disputanten akzeptiert, weil sie schlüssig zusein scheinen, aber in Wirklichkeit gar nicht schlüssig sind. Dieser Un-terschied ist für Aristoteles sehr wichtig; er widmet daher den Schein-schlüssen (auch „sophistische“ oder „eristische“ Schlüsse genannt) eineeigene kleine Schrift, die Sophistischen Widerlegungen (Sophistici Elen-chi), in der alle möglichen Fehlschlüsse aufgrund des je besonderen Täu-schungsgrundes klassifiziert werden sollen.
So wie es in der Topik um die logische Schlüssigkeit geht, geht es inder zweiten Schrift, der Rhetorik, um das Wesen der Überzeugung unddes Überzeugend-Seins. Obwohl Aristoteles auch hier allgemeine Ein-sichten zum Überzeugend-Sein formuliert, konzentriert sich die SchriftRhetorik auf die Überzeugung im Rahmen der öffentlichen Rede – wobeier die öffentliche Rede mit drei genau definierten Anlässen verbindet, diepolitische Rede vor der Volksversammlung, die Gerichtsrede und dieFest- oder Prunkrede. Erklärtes Ziel der Topik war es, ein Verfahren zuentwickeln, das uns in die Lage versetzt, für oder gegen jede beliebe
4 Christof Rapp
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 4 •
These zu argumentieren; ähnlich ist es die Aufgabe der rhetorischenKunst, das möglicherweise Überzeugende in jedem Fall zu sehen. Bei derdialektischen Debatte, die in der Topik angeleitet wird, werden Argu-mente aufgrund von Prämissen gebildet, die akzeptiert oder akzeptabel(endoxon) sind; dies unterscheidet das dialektische Argument vom wis-senschaftlichen Beweis, der immer von solchen Prämissen ausgeht, dienicht nur anerkannt, sondern auch wahr sind, und die sich als Ursacheoder Erklärung für den in der Konklusion genannten Sachverhalt anfüh-ren lassen. Das Argumentieren aufgrund von nur anerkannten Prämissenin der Dialektik setzt daher die in der Wissenschaft geltende Wahrheits-bindung außer Kraft: In der dialektischen Diskussion geht es nichtdarum, den wahren oder richtigen Standpunkt zu verteidigen; die wahreMeisterschaft in der Dialektik erweist sich im Gegenteil gerade dann,wenn wir für aussichtslose Thesen erfolgreich argumentieren. Auch fürdie Überzeugung in der öffentlichen Rede sind endoxa, die anerkanntenoder akzeptierten Meinungen, wichtig: Für den argumentativen Überzeu-gungsprozess muss der Redner an bestehende Überzeugungen anknüp-fen, an Dinge, die die Zuhörer bereits für wahr halten – ungeachtet des-sen, ob sie wirklich wahr sind –, und diese für wahr gehaltenen Dingesind einmal mehr als endoxa, als anerkannte oder anerkennenswerteMeinungen, gegeben. Von unterschiedlichen Adressaten werden unter-schiedliche Dinge für wahr gehalten; vor allem vertreten Experten an-dere Ansichten als die Menge der Menschen. Der Redner muss natürlichsolche Prämissen treffen, die von vielen oder allen geteilt werden, unddiese finden sich eher unter den von der Menge anerkannten Meinungenals unter den Expertenmeinungen.
Dialektik und Rhetorik haben daher für Aristoteles vieles gemeinsam.Der Dialektiker versteht sich auf das Bilden von gültigen Schlüssen undauf die Auswahl von anerkannten Meinungen (endoxa) als Prämissen,und beides ist auch für den Rhetor von Bedeutung. Das Überzeugen, sagtAristoteles in der Rhetorik, sei eine Art von Beweis, denn die Zuhörerseien dann am ehesten überzeugt, wenn sie etwas für bewiesen halten.6
Gleich zu Beginn der Schrift Rhetorik sagt Aristoteles daher auch, dieRhetorik sei ein Gegenstück zur Dialektik,7 und er erläutert diese Aus-sage u. a. damit, dass die Dialektik sich so zur Prüfung und Stützungeiner These verhalte wie die Rhetorik zum Anklagen und Verteidigen –womit er offenbar die Gerichtsrede im Sinn hat. Was die Rhetorik desAristoteles angeht, so erweist sich die derart begründete Affinität vonDialektik und Rhetorik geradezu als das kennzeichnende Merkmal von
Aristotelische Grundbegriffe 5
6 Rhetorik, I 1, 1355a5 f.7 Rhetorik, I 1, 1354a1.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 5 •
Aristoteles’ Rhetoriktheorie. Weil der Beweis eine derart eminente Rollefür die Überzeugung spielt, werden große Teile der aristotelischen Rheto-rik als die Anwendung von in der Dialektik etablierten Kategorien aufdie Redekunst angelegt. Im Zuge dieses Verfahrens wird beinahe dasganze theoretische Vokabular der Dialektik in die Rhetorik importiert.Oft geht er dabei so vor, dass er Termini der traditionellen Redekunstaufgreift und durch dialektische Begriffe neu besetzt. Dies gilt zum Bei-spiel auch für den Begriff des Enthymems; dieser wird zur Zeit des Aris-toteles auch von anderen Rhetoriklehrern benutzt. Aristoteles besetztdiesen rhetorisch geprägten Begriff neu, indem er ihn kurzerhand alseine Art von Syllogismus bestimmt (siehe unten, Abschnitt III.), einemder Grundbegriffe seiner eigenen Dialektik. Ein ähnliches Verfahrenlässt sich in einer ganzen Reihe von weiteren Grundbegriffen nachwei-sen. Die Grundidee scheint dabei immer dieselbe zu sein, nämlich dassder Dialektiker die Voraussetzungen mitbringt, auch zum erfolgreichenRhetoriker zu werden, sofern er nur einige Besonderheiten der öffent-lichen Rede berücksichtigt.8
Dass nun die dialektische Argumentationstheorie der Topik, die im-merhin ein Verfahren verspricht, um sowohl für als auch gegen jede be-liebige These zu argumentieren, auch für die Bildung von rhetorischenBeweisen nützlich sein kann, bedarf vielleicht keiner weiteren Begrün-dung (abgesehen vielleicht von einer ausführlicheren Analyse der Ge-meinsamkeiten und Unterschiede von dialektischer und rhetorischer Ar-gumentation, auf die wir weiter unten eingehen werden). Nun besteht dierhetorische Kunst des Aristoteles aber nicht allein in einer Aneinander-reihung von Beweisen. Bekanntermaßen sagt Aristoteles, es gebe dreitechnische Überzeugungsmittel: einerseits den Beweis (logos), anderer-seits aber auch den emotionalen Zustand (pathos) der Zuhörer und denCharakter (êthos) des Redners – Letzteres im Hinblick auf die Frage, obder Redner sich als vertrauenswürdig darzustellen versteht.9 In der dia-lektischen Argumentation findet sich in der Tat nichts, was der rheto-rischen Aufgabe der Emotionserregung oder der Charakterdarstellungentsprechen würde; insofern könnte man mit Recht behaupten, dass derEinfluss der Dialektik auf die Rhetorik nur den rhetorischen Beweis be-trifft. Tatsächlich aber ist die Dialektik selbst im Hinblick auf die Tech-
6 Christof Rapp
8 Rhetorik, I 1, 1355a10 ff.9 Diese drei „technischen“ Überzeugungsmittel (êthos – pathos – logos) werden
systematisch in den ersten beiden Büchern der aus insgesamt aus drei Büchernbestehenden Rhetorik behandelt; sie entsprechen einer Systematik, die Aristotelesgleich zu Beginn der Schrift, in Kap. I 2, entfaltet. Ich sehe an dieser Stelle vomInhalt des dritten Buches ab, das zwei davon weitgehend unabhängige Themen,die sprachliche Form und die Anordnung der Redeteile, behandelt, welche aber inder Systematik von Rhet. I und II keinerlei Erwähnung finden.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 6 •
niken der Emotionserregung und Charakterdarstellung nützlich. Nehmenwir zum Beispiel den Fall der Emotionserregung, dann fällt auf, dassAristoteles’ Anleitung zur Erregung bestimmter Emotionen immer voneiner provisorischen Definition einzelner Emotionstypen ausgeht. DieseDefinitionen sind in zweierlei Hinsicht mit der Dialektik verbunden:Erstens macht Aristoteles selbst deutlich, dass es sich dabei nur um pro-visorische, nur anerkannte Definitionen (also endoxa in einem besonde-ren Sinn) handelt, zweitens bezeichnet er diese Definitionen als dialek-tisch im Unterschied zu naturwissenschaftlich erklärenden Definitionen,weil sie die verschiedenen Emotionen nur begrifflich, aber nicht im Hin-blick auf ihre somatische Dimension bestimmen. Kurzum: Der dialek-tische Zugang durchdringt die aristotelische Theorie rhetorischer Über-zeugung durch und durch – selbst dort, wo es nicht ausdrücklich um Be-weise oder Argumente geht.
Eine Frage drängt sich an dieser Stelle auf: Wenn sich die Dialektikmit dem Schlüssigen und die Rhetorik mit dem Überzeugenden befasstund wenn Aristoteles die rhetorische Theorie des Überzeugend-Seins soganz der Kompetenz des Dialektikers anheimstellt, wie verhalten sichdann Schlüssigkeit und Überzeugungskraft zueinander? Die Antwort aufdiese Frage fällt einigermaßen komplex aus. Zunächst ist die ganze Ideeeiner dialektisch konzipierten Rhetorik von der Annahme abhängig, dassuns das, was wir als schlüssig oder bewiesen begreifen, auch überzeugt.Dennoch sind die beiden Begriffe nicht ganz zur Deckung zu bringen. Ineiner Hinsicht scheint das Überzeugende weiter zu sein als das Schlüs-sige, in einer anderen Hinsicht umgekehrt das Schlüssige weiter alsdas Überzeugende: Dass für Aristoteles nicht alles Überzeugende auchschlüssig ist, zeigt sich zum Beispiel daran, dass er sowohl das Beweisenals auch das nur scheinbare Beweisen zur argumentativen Überzeugungrechnet;10 scheinbar sind, wie gesagt, Beweise, die nur auf einem gül-tigen Schluss zu beruhen scheinen, in Wirklichkeit aber nicht schlüssigsind. Dieses Zugeständnis bedeutet nun wiederum nicht, dass im Hin-blick auf das Ziel der Rede, nämlich die Zuschauer zu überzeugen, derUnterschied zwischen schlüssigen und nicht-schlüssigen Argumentenverschwömme: Korrespondierend zu dem Unterschied zwischen echtenund nur scheinbaren Beweisen führt Aristoteles vorsorglich die Unter-scheidung zwischen dem wirklich und dem nur scheinbar Überzeugen-den11 ein: Das wirklich Überzeugende, so scheint Aristoteles anzuneh-men, kann nicht nur auf einer Täuschung beruhen.12 Dass nun umge-
Aristotelische Grundbegriffe 7
10 Rhetorik I 2, 1356a3–4, 1356a19–20.11 Rhetorik I 1, 1355b15–16.12 Das heißt, dass nach Aristoteles die nur scheinbaren Beweise immer auf einer
Art von Täuschung beruhen; dies entspricht seiner Auffassung über die sophisti-
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 7 •
kehrt aber auch nicht alles Schlüssige überzeugend ist, zeigt sich zumBeispiel daran, dass nach Aristoteles rhetorische Argumente nicht zu in-trikat gebaut sein und nicht von entlegenen Prämissen ausgehen dür-fen.13 Solche Argumente wären zwar schlüssig, würden aber den Zuhörernicht erreichen – denn der typische Zuhörer der öffentlichen Rede, sosetzt Aristoteles voraus, ist von eher einfacher Geistesart und an den Ar-gumentationsstil der Dialektiker nicht gewöhnt.14 Eine weitere Hinsicht,in der nicht alles Schlüssige auch schon überzeugend ist, kann man indem für die aristotelische Redekunst grundlegenden Umstand sehen,dass, wie schon gesagt, nicht nur der Beweis, sondern eben auch die Er-regung von Emotionen im Publikum sowie die Darstellung des Rednersals vertrauenswürdig zu den Überzeugungsmitteln gerechnet werden. Be-zeichnenderweise sagt nun Aristoteles an genau der Stelle, die von derBehandlung der Beweise zur Behandlung von Emotionen und Charakterüberleiten soll, dass es in der Rhetorik ja um ein Urteil gehe (das Urteilnämlich, das von den Richtern zu fällen, bzw. die Entscheidung, die vonden Mitgliedern der Volksversammlung zu treffen ist) und dass es dahernicht ausreichend sei, auf das Argument zu sehen und darauf, dass esbeweiskräftig ist.15 Die Fragen, warum Aristoteles neben dem Beweisauch noch die Emotionen und den Charakter zu den Überzeugungs-mitteln zählt, und wie sich diese drei Überzeugungsmittel zueinanderverhalten – ob z. B. alle drei auf einer Ebene anzusiedeln sind oder obEmotionen und Charakter eher dazu gedacht sind, den Beweis zu unter-stützen und die Aufnahmebereitschaft des Publikums für Argumente zuerhöhen –, diese Fragen gehören zu den am meisten umstrittenen in derAuslegung der aristotelischen Rhetorik überhaupt. Wenigstens so vielaber wird man der besagten Stelle entnehmen dürfen: dass bei der Ur-teilsbildung andere Faktoren neben der Schlüssigkeit der vorgebrachtenBeweise wirksam sind und dass es Situationen gibt, in denen auch das
8 Christof Rapp
schen Fehlschlüsse. Ob es im Bereich des Nicht-Schlüssigen für ihn noch einenSpielraum gibt zwischen dem Nicht-Schlüssigen, das nur akzeptiert wird, weil derAdressat einer Täuschung erliegt, und dem Nicht-Schlüssigen, beim dem es den-noch rational ist, den – nicht zwingenden – Übergang von der Prämisse auf dieKonklusion zu akzeptieren, soll später noch am Beispiel des Zeichenenthymemsdiskutiert werden.
13 Hierum geht es m.E. Aristoteles, wenn er das Enthymem vom Argument derdialektischen Debatte abgrenzt und dabei sagt, dass Enthymem dürfe nicht vonweither schließen und müsse weniger Prämissen gebrauchen als das Argument inder dialektischen Unterredung. Siehe dazu unten, Abschnitt V.
14 Dabei scheint Aristoteles sowohl den typischen individuellen Zuhörer eineröffentlichen Rede als auch bestimmte Reaktionsweisen eines Massenpublikums imSinn zu haben (es ist daran zu erinnern, dass sich in der Athener Demokratie zurZeit des Aristoteles auch die Gerichtsrede nicht an wenige professionelle Richter,sondern an ein demokratisches Richterkollektiv richtet, das je nach Art des Ge-richts u. U. aus fünfhundert oder eintausend Richtern bestehen konnte).
15 Rhetorik II 1, 1377b21–24.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 8 •
beste Argument nicht überzeugt – z. B. dann, wenn die Zuhörer in einemfeindseligen oder aufgebrachten Zustand sind oder wenn der Redner un-glaubwürdig wirkt.
Insgesamt also ist das Überzeugende für Aristoteles nicht vom Schlüs-sigen und Beweiskräftigen zu trennen – dies ist der Grund, warum erseine rhetorische Theorie im Wesentlichen als eine Argumentations-theorie aufbaut; allerdings entsprechen sich Schlüssigkeit und Überzeu-gungskraft nicht ganz, und es ist eine der wichtigen Aufgaben der Rhe-torik, diejenigen Aspekte auszuarbeiten, die zum schlüssigen Argumenthinzukommen müssen, um es überzeugend zu machen und um so die Ur-teilsbildung bei den adressierten Richtern und Zuhörern zuverlässig zulenken.
III. Syllogismen: Deduktiv gültige Argumente
Die vorausgegangenen Bemerkungen umreißen den allgemeinen Hin-tergrund für die Argumentationstheorie, die den beiden Werken Topikund Rhetorik entnommen werden kann. Will man sich den Grundbegrif-fen dieser Theorie weiter nähern, so kommt man nicht umhin, kurz aufden Begriff des Syllogismus’ einzugehen, der das Bindeglied zwischen al-len argumentationstheoretischen Überlegungen des Aristoteles darstellt.
Wir verstehen unter einem Syllogismus in der Regel eine Schlussfigur,die aus zwei Prämissen und einer Konklusion besteht und genau dreiallgemeine Terme enthält. Das Standardbeispiel für diese Schlussformlautet:
(Erste Prämisse/Obersatz) Menschen sind sterblich.
(Zweite Prämisse/Untersatz) Griechen sind Menschen.
(Konklusion) Griechen sind sterblich.
Diese Schlussform geht tatsächlich auf Aristoteles zurück, konkret aufdie Theorie der assertorischen Syllogistik in der Schrift Erste Analytik(Analytica Priora). Innerhalb dieser Terme ersetzt Aristoteles die allge-meinen Terme (Mensch, Griechen, sterblich) konsequent durch Buchsta-benvariablen und stellt dadurch das erste formallogische System über-haupt auf. Entscheidend in dieser Theorie der gültigen Schlüsse ist, dassin jedem gültigen Schluss genau ein Mittelterm nachgewiesen werdenkann, der in beiden Prämissen, jedoch nicht in der Konklusion vor-kommt. Im obigen Beispiel wäre das also der Term „Mensch“. Die Stel-lung dieses Mittelterms bestimmt die sogenannte „syllogistische Figur“;es bedeutet nämlich einen wichtigen Unterschied, ob der Mittelterm inbeiden Prämissen an Subjektstelle oder in beiden Prämissen an Prädi-katstelle oder einmal an Subjektstelle und einmal an Prädikatstelle vor-
Aristotelische Grundbegriffe 9
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 9 •
kommt. Weil im obigen Beispiel der Term „Mensch“ einmal Subjekt undeinmal Prädikat ist, handelt es sich um einen Syllogismus der ersten Fi-gur. Innerhalb jeder Figur bestimmt Aristoteles außerdem noch verschie-dene Modi; diese hängen von der Quantität und Qualität der verwen-deten kategorischen Aussagen ab, nämlich ob diese bejahend oder ver-neinend, allgemein („alle . . . sind“, „kein . . . ist“) oder partikulär sind(„einige . . . sind“, „nicht alle . . . sind“). Hieraus ergeben sich genau vierArten von Aussagen, die als Prämissen und Konklusionen innerhalb derassertorischen Syllogistik gebraucht werden können. Im Übrigen kenntdie Syllogistik keine singulären Aussagen, also keine Aussagen über Ein-zeldinge. Viele Beispiele, die wir heute als Syllogismen gebrauchen, wür-den also, streng genommen, nicht in Aristoteles’ syllogistische Theoriepassen – auch nicht der viel zitierte Beispielschluss „Alle Menschen sindsterblich – Sokrates ist ein Mensch – Sokrates ist sterblich“, weil „So-krates“ eben kein allgemeiner Term ist.16 Da nun unser obiger Beispiel-syllogismus nur aus allgemeinen oder generellen Termen zusammenge-setzt ist und da er aus zwei affirmativen allgemeinen Aussagen gebildetist, kann er als ein Schluss des Modus’ „Barbara“ klassifiziert werden(wobei die Bezeichnung auf eine nacharistotelische Konvention zurück-geht). Von den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, die sich durchEinsetzung der vier Aussagearten in die syllogistischen Figuren ergeben,erweisen sich genau vierzehn als gültige Modi, d. h. wenn man bejahendallgemeine, verneinend allgemeine, bejahend partikuläre und verneinendpartikuläre Prämissen entsprechend dieser vierzehn Modi kombiniert, er-geben sich deduktiv gültige Schlüsse; bei allen anderen Kombinationenist dies nicht der Fall. Aristoteles erklärt die Syllogismen der ersten Fi-gur für vollkommen, während die Schlüsse der zweiten und der drittenFigur unvollkommen sind, weswegen ihre Gültigkeit durch Rückführungauf Syllogismen der ersten Figur bewiesen werden muss. Somit gelingtes Aristoteles, mit der assertorischen Syllogistik zu zeigen, welcheSchlüsse gültig sind und warum sie gültig sind. Die Syllogistik stellt alsoAristoteles’ Theorie des gültigen Schlusses dar.
Die syllogistische Theorie gilt als eine der wichtigsten philosophischenErrungenschaften des Aristoteles. Trotz der gleichermaßen bewunderns-werten Entwicklung der Aussagenlogik durch die Stoiker prägte die aris-totelische Syllogistik die Geschichte der abendländischen Logik bis ins19. Jahrhundert, was Immanuel Kant im ausgehenden 18. Jahrhundert
10 Christof Rapp
16 Dies würde auch gelten, wenn man im sogenannten JustizsyllogismusSchlüsse über individuelle Tatbestände und fallbezogene Rechtsfolgen in syllogis-tischer Form bildet. Ähnliches gilt für die Anwendung der Syllogistik innerhalbder Rhetorik, weil es in der öffentlichen Rede nicht um allgemeine Sachverhalte,sondern um Urteile über individuelle Taten oder Entscheidungen um konkreteHandlungsoptionen geht.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 10 •
zu dem oft zitierten Diktum veranlasste, im Bereich der formalen Logikhabe es seit Aristoteles praktisch keine Neuerungen mehr gegeben. Vordem Hintergrund dieses Erfolgs der Aristotelischen Syllogistik ist eskeine Überraschung, dass wir den Begriff des Syllogismus’ sehr oft mitden Schlussfiguren der assertorischen Syllogistik gleichsetzen, d.h. wirsagen „Syllogimus“ und meinen damit eine durch die syllogistischeTheorie normierte Schlussfigur, in der Regel den oben als Beispiel ange-führten Modus Barbara. Anders verhält sich das bei Aristoteles selbst!Der syllogismos bezeichnet für Aristoteles deduktive Argumente allerArt, während die Normierung des syllogismos durch die assertorischeSyllogistik dem Zwecke dient zu zeigen, welche Schlüsse deduktiv gültigsind und warum sie gültig sind. Zwar vertritt Aristoteles das Theorem,dass letztlich alle gültigen Schlüsse auf die als gültig erwiesenen Modider syllogistischen Theorie zurückgeführt werden können. Aber das istauch für Aristoteles kein trivialer Sachverhalt, sondern eine These, fürdie er explizit argumentiert. Außerdem wäre die bloße Frage, ob allesyllogismoi auf die Figuren die assertorischen Syllogistik zurückgeführtwerden können, tautologisch, wenn die durch die assertorische Syllogis-tik aufgestellten Kriterien (dass der Schluss genau zwei Prämissen undgenau drei Terme enthält, dass er nur aus kategorischen Aussagen zu-sammengesetzt ist etc.) immer schon auf jeden syllogismos zutreffen wür-den. Wir sehen uns daher mit dem paradox anmutenden Umstand kon-frontiert, dass für Aristoteles der Begriff des syllogismos nicht dasselbebedeutet wie das, was wir unter einem aristotelischen Syllogismus ver-stehen (wenn wir damit, wie allgemein üblich, auf die Figuren der asser-torischen Syllogistik Bezug nehmen).
Das klingt wie eine exegetische Spitzfindigkeit, und es wäre nur ver-ständlich, wenn sich an dieser Stelle der eilige Leser – zumal der überdie Wirrungen der Philosophiegeschichte erhabene Systematiker – ausdem Gedankengang verabschieden würde. Es lohnt sich aber, noch einigeAbsätze lang dabei zu bleiben – und zwar aus folgendem Grund: Es gibtneben der Ersten Analytik und Zweiten Analytik noch weitere mit Ar-gumentationstheorie und Logik befasste Werke des Aristoteles, die sichausgiebig mit dem syllogismos befassen oder sogar um diesen Begriffherum zentriert sind, in denen sich aber nicht die geringste Spur der syl-logistischen Theorie findet. Hierzu gehören die Topik, die SophistischenWiderlegungen und die Rhetorik17. An der Interpretation dieser Werke
Aristotelische Grundbegriffe 11
17 Auch die Kategorien und De Interpretatione sind Werke des sog. aristoteli-schen Organons – und damit im weitesten Sinn logisch-methodische Werke –, diekeine Hinweise auf die syllogistische Theorie enthalten; jedoch kann man in die-sen beiden Fällen auch nicht sagen, dass der syllogismos darin eine zentrale Rollespielen würde. Was die Rhetorik angeht, so stammt der letzte ernst zu nehmendeVersuch, die rhetorische Argumentationstheorie vor dem Hintergrund der Syllogis-
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 11 •
und des darin enthaltenen syllogismos-Begriffs hat man, vorsichtig for-muliert, nur wenig Freude, wenn man voraussetzt, dass jedes Vorkomm-nis von syllogismos auf einen Syllogismus der assertorischen Syllogistikreferiert, denn man wird in vielen Fällen schon daran scheitern, die dortangeführten Beispiele in die von der Syllogistik geforderte Form zu brin-gen – z.B. weil sie singuläre Terme enthalten oder weil man vergeblichnach dem von der Syllogistik unbedingt geforderten Mittelbegriff sucht.Die Eintrittskarte in die logische Welt dieser Schriften stellt daher ge-wissermaßen das Zugeständnis dar, dass Aristoteles nicht immer, wenner von einem syllogismos spricht, einen Syllogismus im Sinne der Modiund Figuren der assertorischen Syllogistik meint.
Das mag vor dem Hintergrund des vorherrschenden Wortgebrauchsüberraschend wirken, ist aber am Ende genau das, was auch Aristotelesselbst sagt. Wann immer er nämlich den syllogismos definiert, fehlt indieser Definition von den Zutaten der syllogistischen Theorie jede Spur.In der Topik zum Beispiel definiert er den syllogismos wie folgt: Eshandle sich um
„. . . ein Argument (logos), in welchem sich, wenn bestimmte Dinge vorausge-setzt werden, etwas von dem Vorausgesetzten Verschiedenes durch das Voraus-gesetzte mit Notwendigkeit ergibt.“ (Topik I 1, 100a25–27)
Nach dieser Definition gehört zu einem syllogismos eine nicht näherbestimmte Anzahl von Prämissen („wenn bestimmte Dinge vorausgesetztwerden“) sowie eine Konklusion, die von dem Vorausgesetzten verschie-den sein muss („Wenn a, dann a“ wäre für Aristoteles daher kein syllo-gismos). Sodann muss sich die Konklusion mit Notwendigkeit aus denPrämissen ergeben und sie muss sich durch die Prämissen oder das Vo-rausgesetzt-Sein der Prämissen ergeben; dies Letztere heißt, dass für dasZustandekommen des Schlusses nichts Zusätzliches zu den Prämissen er-forderlich ist. Über Details dieser Definition lassen sich interessante Dis-kussionen führen – etwa über die genauen Implikationen der Anforde-rung, dass sich die Konklusion „durch das Vorausgesetzte“ ergibt –, überzwei Punkte allerdings kann es kaum eine Kontroverse geben: Erstensnämlich scheint klar, dass diese Definition dem entspricht, was wir heuteals ein „deduktives Argument“ bezeichnen würden, und zweitens ist
12 Christof Rapp
tik zu entwickeln, von J. Sprute, Die Enthymemtheorie der aristotelischen Rheto-rik, Göttingen 1982. In der Zwischenzeit haben sich die Befürworter einer syllogis-tischen Kontamination der Rhetorik auf zwei kurze Abschnitte in Kap. I 2 undII 25 zurückgezogen (vgl. M. F. Burnyeat, Enthymeme: Aristotle on the Logic ofPersuasion, in: D. J. Furley/A. Nehamas (eds.), Aristotle’s Rhetoric. PhilosophicalEssays, Princeton 1994, S. 3–55; J. Allen, Inferences From Signs, Oxford 2001), indenen Aristoteles die Zeichenschlüsse diskutiert, aber auch für diese Abschnittegilt, dass sie keinerlei Anzeichen für das theoretische Vokabular der Syllogistikenthalten.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 12 •
deutlich, dass die Elemente der assertorischen Syllogistik, wie wir sie zu-vor aufgelistet haben, in dieser Definition keinerlei Widerhall finden.Das heißt also, dass Aristoteles den syllogismos als ein deduktives Argu-ment, nicht aber als einen Syllogismus im Sinne eines der gültigen Modider assertorischen Syllogistik definiert.
Nun stammt die zitierte Definition aus der Schrift Topik, von der wirohnehin behauptet hatten, dass sie unabhängig von der syllogistischenTheorie der Ersten Analytik entfaltet wurde. Wie verändern sich aber dieDinge, wenn wir in die Schrift sehen, die die Entfaltung dieser syllogisti-schen Theorie zum Ziel und Inhalt hat? Wie wirkt sich dies auf den Be-griff des syllogismos aus? Gleich zu Beginn dieser Schrift gibt Aristoteleserneut eine Definition des syllogismos; darunter verstehe er
„. . . ein Argument (logos), in welchem sich, wenn bestimmte Dinge vorausge-setzt werden, etwas von dem Vorausgesetzten Verschiedenes mit Notwendigkeitdadurch ergibt, dass dieses der Fall ist.“ (Erste Analytik I 1, 24b18–20)
Man sieht: Die Definition des syllogismos bleibt im Wesentlichen die-selbe. Die einzige Veränderung besteht darin, dass die Formulierung„durch das Vorausgesetzte“ aus der Definition der Topik durch die For-mulierung „dadurch . . . dass dieses der Fall ist“ ersetzt wird. Deutet sichhierin eine Veränderung in Aristoteles’ Auffassung über den syllogismosan? Vermutlich deutet sich hier keine solche Änderung an, denn erstenssagt Aristoteles auch in der Topik an anderer Stelle (VIII 11, 161b30) mitden Worten der Ersten Analytik, dass die Deduktion „dadurch zustandekomme, dass dieses der Fall ist“, und zweitens erläutert Aristotelesgleich im Anschluss an die gerade zitierte Definition die Formulierung„dadurch . . . dass dieses der Fall ist“ damit, dass die Deduktion „wegendiesen (den Prämissen)“ zustande komme. Ein Unterschied im Begriffdes syllogismos lässt sich hier also keinesfalls ausmachen.
Nachdem dies nun geklärt ist, drängen sich schließlich folgende Fragenauf: Wie verhält sich die großzügige und weite Definition des syllogismoszu dem genau reglementierten Gebilde der Syllogistik, das wir als „Syl-logismus“ bezeichnen? Und wie kann es sein, dass einige Werke des Aris-toteles angeblich überhaupt keine Spuren der für die Logikgeschichte soeinflussreichen Entdeckung der syllogistischen Theorie aufweisen? DieAntwort auf diese Fragen sollte zumindest folgende drei Aspekte berück-sichtigen: Erstens wurde ja bereits angedeutet, dass Aristoteles mit derDefinition der syllogistischen Figuren keineswegs den Anspruch verbin-det, dass alle gültigen Schlüsse, so wie wir sie vorfinden, der Schematikder syllogistischen Figuren entsprechen würden. Ein solcher Anspruchwäre in Anbetracht der Vielfalt praktizierter Argumentation geradezubizarr. Seine Behauptung besteht in der viel schwächeren These, dass
Aristotelische Grundbegriffe 13
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 13 •
letztlich jedem gültigen Schluss ein solcher Syllogismus zugrunde liegtoder dass jeder gültige Schluss auf einen solchen Syllogismus zurückge-führt werden kann. Die Syllogismen der syllogistischen Figuren habendaher die Aufgabe zu zeigen, welche Schlüsse gültig sind, und indem dieGültigkeit der kanonischen Syllogismen auf unterschiedliche Weise be-wiesen werden kann, wird indirekt auch die Gültigkeit aller anderen gül-tigen Schlüsse durch die Rückführung auf die Syllogismen bewiesen.Zweitens hat man Grund zu der Annahme, dass es eine gewisse Arbeits-teilung zwischen den verschiedenen aristotelischen Schriften gibt, diesich mit dem syllogismos befassen. Während nämlich die Topik und dieSophistischen Widerlegungen den syllogismos bzw. den nur scheinbarensyllogismos als Teil der dialektischen Unterredung, die Rhetorik den syl-logismos als Teil der Argumentation in der öffentlichen Rede und dieZweite Analytik den syllogismos als die logische Struktur des wissen-schaftlichen Beweises behandeln, obliegt es allein der Ersten Analytik,die Theorie der Gültigkeit aller möglichen syllogismoi zu behandeln.Wenn nun die assertorische Syllogistik mit ihrem gesamten technischenInventar genau diesem letzteren Ziel dient, dann ist die Abwesenheit die-ses Inventars in Schriften mit einer anderen Zielsetzung nicht weiterverwunderlich.
Beinahe könnte man sich mit diesen beiden Aspekten zufrieden geben– aber eben nur beinahe, denn z. B. die Zweite Analytik, die sich eben-falls nicht mit der Gültigkeit der syllogismoi als solcher, sondern mitdem auf syllogismoi beruhenden wissenschaftlichen Beweis (apodeixis)befasst, referiert immer wieder explizit auf Theoreme der syllogistischenTheorie und macht von deren Vokabular häufig Gebrauch. Auch wäre esmerkwürdig, wenn ein Autor, der eine so dezidierte Theorie der Gültig-keit des syllogismos entwickelt hat, an anderen Stellen, die auf den syllo-gismos ausführlich eingehen, wie z.B. in der Topik, nicht wenigstens aufdiese grundlegende Theorie hinweisen würde. Das ist der Grund, warumwir noch einen dritten Aspekt berücksichtigen sollten: Im Hinblick aufdie aristotelische Logik geht die Aristoteles-Forschung schon lange understaunlich einhellig davon aus, dass in den aristotelischen Reflexionenüber Logik eine wichtige Entwicklung stattgefunden hat, die sich – vonallen anderen strittigen Details abgesehen – zumindest in eine Phase vorund eine Phase nach der Erfindung der assertorischen Syllogistik eintei-len lässt.18 So ist zum Beispiel weitgehend unbestritten, dass die SchriftTopoi, die zahlreiche Anklänge an Themen der platonisch-akademischenPhilosophie beinhaltet, die keinerlei Hinweise auf die Terminologie der
14 Christof Rapp
18 Der Klassiker der entwicklungsgeschichtlichen Deutung der aristotelischenLogik ist Friedrich Solmsen: Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhe-torik. (= Neue philologische Untersuchungen, Heft 4), Berlin 1929.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 14 •
aristotelischen Syllogistik enthält und deren paradigmatischen Schlüssewenig mit den kanonischen Syllogismen der assertorischen Syllogistik zutun haben, eine relativ frühe Schrift des Aristoteles darstellt und dasssie aufgrund dieser Frühdatierung sehr wahrscheinlich vor der Ent-stehung der syllogistischen Theorie anzusetzen ist. So betrachtet ist eskeine Überraschung, dass wir bei den syllogismoi der vor-syllogistischenWerke des Aristoteles vergeblich nach den Merkmalen der syllogistischenTheorie suchen. Nun beruhen solche Aussagen über die Chronologie deraristotelischen Werke natürlich auf Hypothesen und es ist bei solchenHypothesen nicht auszuschließen, dass sie eines Tages wieder fallen ge-lassen werden. Aus dem Hypothesencharakter auf die generelle Unzuver-lässigkeit oder gar Beliebigkeit solcher entwicklungsgeschichtlichen Aus-sagen zu schließen, wäre im vorliegenden Fall aber etwas voreilig.19 DieAristoteles-Forschung hat eine lange Erfahrung mit entwicklungsge-schichtlichen Hypothesen; die meisten von ihnen hatten keinen Bestand,z. B. weil sie mit Annahmen über Aristoteles’ biographische Entwicklungverknüpft waren. Überdauert haben die Hypothesen, die allein auf be-grifflichen Entwicklungen etwa derart beruhen, dass im einen Text etwasvorausgesetzt wird, was in einem anderen Text tatsächlich entwickeltwurde. Dies sagt uns nichts über die konkreten Entstehungsbedingungender einen oder anderen Schrift, aber einiges über die Logik einer philo-sophischen Begriffs- und Theorienbildung20 – und nur in diesem Sinnsetzen die Schriften des Aristoteles, die die syllogistische Theorie enthal-ten, diejenigen Abhandlungen voraus, die den syllogismos auf eine vonder Syllogistik ganz unberührte Weise behandeln.
Für den Umgang mit dem aristotelischen Begriff des syllogismos be-deutet dies immerhin so viel: Es besteht keine Notwendigkeit, immerdann, wenn Aristoteles von einem syllogismos spricht, an ein Argumentzu denken, das genau den Modi der assertorischen Syllogistik entspricht.Dies gilt vor allem (aber nicht nur) für die vorsyllogistischen Schriften –wie z.B. die Topik und die Sophistischen Widerlegungen. Der Begriff des
Aristotelische Grundbegriffe 15
19 So scheint Simon (FN 1), S. 700, Interpretationen, die mit den Kategorien„früher/später“ operieren, generell eine nur geringe Halbwertszeit zuzutrauen; diein dem entsprechenden Abschnitt artikulierte Skepsis gegenüber der Zuverlässig-keit bestimmter Methoden der Textinterpretation gipfelt am Ende darin, dassohne jeden Anlass sogar die Authentizität der Aristotelischen Rhetorik infrage ge-zogen wird. Zugegeben: Gerichtsverwertbare Beweise liegen für all das vielleichtnicht vor, aber zwischen diesem – hier wohl kaum zur Anwendung kommenden –Ideal und der insinuierten Haltlosigkeit ergibt sich doch ein weites Feld, für des-sen rationale Füllung sich die philologisch-philosophiehistorische Forschung seitdem 19. Jahrhundert einiges hat einfallen lassen.
20 Vgl. dazu C. Rapp, Der Erklärungswert von Entwicklungshypothesen. DasBeispiel der Aristoteles-Interpretation, in: M. v. Ackeren/J. Müller (Hrsg.), AntikePhilosophie Verstehen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, S. 178–195.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 15 •
syllogismos als solcher beinhaltet in den vor- wie in den nacharistote-lischen Schriften nicht mehr als die Merkmale eines deduktiven Argu-ments. Für den an der aristotelischen Argumentationstheorie interessier-ten Systematiker dürfte dies zunächst eine gute Nachricht sein, weil soeine unnötige Einschränkung dessen, was als deduktiv gültiger Schlussangesehen werden kann, vermieden wird. – Was dies für den rhetori-schen Beweis, das Enthymem, bedeutet, werden wir im übernächsten Ab-schnitt sehen. Im nächsten Abschnitt wenden wir uns zunächst einemPhänomen zu, das besonders der Topik und der Rhetorik gemeinsam ist,in den von der Syllogistik geprägten Analytiken hingegen praktisch voll-ständig von der Bildfläche verschwindet: dem Gebrauch von Topoi.
IV. Topoi für die Konstruktion von syllogismoisyllogismoi
Einige moderne Verfechter eines topischen Verfahrens sehen sich selbstals Anti-Deduktivisten – in dem Sinne nämlich, dass die Vorstellungeiner Deduktion der angestrebten Konklusionen aus obersten Prinzipienan der Praxis der Argumentation gänzlich vorbeigehe. Gegen ein solchesZerrbild der Argumentation verspräche die Anwendung von Topoi einenAusgang von vielen, zwar nicht deduktiv etablierten, jedoch plausiblenAnknüpfungspunkten auf einer mittleren Allgemeinheitsebene. Auch beiAristoteles ist die Anwendung von Topoi der Idee eines Rückgangs aufoder einer Herleitung aus obersten Prinzipien ziemlich fremd; jedoch istdies bei ihm nicht mit einer irgendwie anti-deduktivistischen Haltungverknüpft – im Gegenteil: Die meisten der Gebilde, die er als Topoi be-zeichnet, dienen keinem anderen Zweck als der Formulierung von syllo-gismoi, also deduktiven Argumenten. Die Anwendung von Topoi ist beiAristoteles also nicht mit der Suspendierung deduktiver Standards ver-bunden: Durch den Schluss, dessen Konstruktion mithilfe eines Topos’ermöglicht werden soll, soll der Gegner im dialektischen Gespräch ge-zwungen werden, einer Folgerung zuzustimmen, und dies lässt sich nurmit logisch notwendigen Folgerungen bewerkstelligen. Näheres könnenwir der Schrift Topik entnehmen:
Wie schon in Abschnitt II. ausgeführt, geht es in der Schrift Topik umdie Anleitung einer dialektischen Disputation zwischen einem Angreiferund einem Verteidiger. Ziel der Schrift sei es, „ein Verfahren zu finden,aufgrund von welchem wir in der Lage sein werden, über jedes vorge-legte Problem aus anerkannten Meinungen zu deduzieren, und, wenn wirselbst ein Argument vertreten, nichts Widersprüchliches zu sagen“ (To-pik I 1, 100a18–21) Angriff und Verteidigung einer These gehen in derdialektischen Praxis so vonstatten, dass der Angreifer dem VerteidigerPrämissen in der Form einer Frage vorlegt; der Verteidiger kann diese
16 Christof Rapp
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 16 •
Fragen bejahen oder verneinen und somit die entsprechenden Prämissenakzeptieren oder zurückweisen. Dabei versucht der Angreifer in der Re-gel, dem Kontrahenten nur solche Sätze als Prämissen vorzulegen, dieanerkannt oder akzeptabel sind (endoxa); denn solche wird der Verteidi-ger schwerlich zurückweisen können. Hat der Angreifer auf diese Weisegenügend einschlägige Prämissen gesammelt, dann wird er aus diesen ineinem oder mehreren Schritten Konklusionen deduzieren (also syllogis-moi formulieren) mit dem Ziel, die anfängliche These des Verteidigers zuentkräften oder das kontradiktorische Gegenteil zu der anfänglichenThese zu etablieren. Dieses Szenario ist der Hintergrund dafür, dass es inder dialektischen Auseinandersetzung (und entsprechend in der SchriftTopik) ganz zentral um syllogismoi – deduktive Argumente – geht. Undes erhellt aus demselben Szenario, warum Aristoteles den für die Dialek-tik kennzeichnenden syllogismos als einen Schluss bestimmt, der aus en-doxa, aus (nur) akzeptieren und akzeptablen Prämissen erfolgt. Damitwird der dialektische syllogismos dem syllogismos in der wissenschaftli-chen Verwendung gegenübergestellt, denn jeder wissenschafltiche Beweisoder jede wissenschaftliche Demonstration (apodeixis) ist ebenfalls einsyllogismos, allerdings einer, der aus „wahren und ersten“ Prämissen er-folgt, womit sich Aristoteles auf die wissenschaftlichen Prinzipien ausseiner Theorie der wissenschaftlichen Demonstration bezieht. Demnachhat jede wissenschaftliche Disziplin erste Prinzipien, die innerhalb die-ser Disziplin nicht mehr bewiesen werden können. Auf diese disziplin-spezifischen Prinzipien greift direkt oder indirekt jede wissenschaftlicheDemonstration zurück. Wie wir Kenntnis und Wissen von diesen obers-ten Prinzipien erlangen, wenn sie doch nicht deduziert eingeführt wer-den können, ist eine Frage, die die Aristoteles-Ausleger immer schonbeschäftigt: Viele halten die Erkenntnis erster Prinzipien für eine Sacheintellektueller Intuition; klar ist aber auch, dass Aristoteles zu diesemZweck immer wieder auf die Rolle der Induktion verweist. Für unserenZusammenhang genügt zunächst, dass während der wissenschaftlich ge-brauchte syllogismos auf solche ersten und unbeweisbaren Prinzipien alsPrämissen rekurriert, sich der dialektische syllogismos auf nur aner-kannte oder akzeptable Prämissen berufen kann. Man kann also sagen,dass sich wissenschaftlicher Beweis und dialektischer Schluss nicht hin-sichtlich ihrer logischen Struktur – die Definition des syllogismos ist inbeiden Fällen dieselbe –, sondern hinsichtlich der epistemischen Qualitätihrer Prämissen unterscheiden. Schon hier sollte angemerkt werden, dassdies alles ausdrücklich nur für die Prämissen gilt, aus denen die Konklu-sion des dialektischen Arguments gezogen wird, nicht aber für die Topoi,von denen Aristoteles nicht sagt, dass sie anerkannt sein oder dem Geg-ner vorgelegt werden müssen.
Aristotelische Grundbegriffe 17
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 17 •
Was hat es nun mit diesen Topoi auf sich? Offensichtlich stehen die To-poi im Dienste des Vorhabens, eine Methode zu finden, mit der wir füroder gegen jegliche These ungeachtet ihres Inhalts oder ihrer disziplinä-ren Herkunft argumentieren können. Da jegliches dialektische Argumen-tieren auf die Bildung von syllogismoi hinausläuft, muss die Funktionzugleich mit der Bildung solcher syllogismoi oder der Auffindung ihrerPrämissen zu tun haben. Wie genau Aristoteles sich die Funktion des To-pos’ im Hinblick auf die Bildung eines dialektischen syllogismos vor-stellt, ist nicht vollkommen klar, einmal, weil Aristoteles in der Topikden Begriff des Topos’ nirgendwo definiert, zum anderen, weil die Bü-cher I und VIII der Topik, die die Methode des dialektischen Gesprächserörtern, den Begriff des Topos’ nur flüchtig erwähnen, während die Bü-cher II bis VII, die mehrere hundert Topoi enthalten, wenig Sachdien-liches bieten, was über die reine Auflistung dieser Topoi hinausginge.Dennoch hat sich in der Forschung der letzten Jahrzehnte21 folgendesBild mehr und mehr festgesetzt:
In jedem Fall spielen die Topoi eine Rolle bei der Konstruktion vonPrämissen eines Arguments und zwar so, dass ausgehend von der ange-strebten Konklusion (also entweder der zu widerlegenden These des Geg-ners oder der zu etablierenden Kontradiktion der gegnerischen These)mithilfe des Topos’ eine Prämisse konstruiert werden soll. Der franzö-sische Topik-Forscher Jacques Brunschwig brachte das mal auf die For-mel: „Le lieu est donc une machine à faire des prémisses à partir d’uneconclusion donnée.“22 An einem Beispiel illustriert, könnte man sich dasetwa folgendermaßen vorstellen: Wir suchen nach einem Argument, umdie These zu etablieren, dass die Schildkröte über eine Seele verfügt. Wirgehen mental unsere Topoi-Listen durch, um zu sehen, ob irgendein To-pos auf den vorliegenden Fall passt. Da es sich um die Aussage über einebestimmte Art oder Spezies, die Schildkröte, handelt, achten wir beson-ders auf Topoi, die das Art-/Gattungsverhältnis thematisieren. Ein sol-cher Topos bei Aristoteles beinhaltet nun z. B., dass alles, was von derGattung allgemein ausgesagt wird, auch von allen Arten dieser Gattungmuss ausgesagt werden können. Dem können wir die allgemeinen Regelnentnehmen: „Wenn P auf die Gattung G allgemein zutrifft, dann trifft Pauch auf die Arten A1, A2, A3 . . . An von G zu“, und „Wenn P nicht aufalle der Arten A1, A2, A3 . . . An von G zutrifft, dann trifft P auch nichtauf G allgemein zu“. Nach der ersten dieser Regeln könnten wir nun zuder angestrebten Konklusion – dass die Schildkröte beseelt ist oder eineSeele hat –, eine Prämisse über die einschlägige Gattung bilden wie z. B.
18 Christof Rapp
21 Eine einflussreiche Diskussion dieser Fragen findet sich in der Einleitung zuJ. Brunschwig, Aristote, Topiques (1–4), Paris 1967.
22 Siehe ebd., S. XXXIX.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 18 •
die Gattung der Lebewesen. Die Prämisse, die demnach dem Gegner zurPrüfung und Zustimmung vorgelegt werden muss, ist die, dass die Lebe-wesen allgemein beseelt sind. Stimmt der Gegner dieser Prämisse zu,dann können wir daraus folgern, dass auch die Schildkröte beseelt seinmuss. So viel ist relativ unkontrovers und bedarf auch keiner weiterenErläuterung. Kontrovers ist hingegen unter Topik-Forschern die Frage,ob der Topos nur für den gedanklichen Rückweg von der Konklusion zurPrämisse (via inventionis/inventive Funktion) zuständig ist oder ob erauch eine Rolle beim Übergang von der Prämisse zur Konklusion spielensoll (via expositionis/probative Funktion). Eine halbwegs befriedigendeErörterung dieser Streitfrage müsste weit ausholen, ich beschränke michdaher an dieser Stelle auf die eher tentative Aussage, dass das „wenn . . .,dann . . .“-Schema, das wir im obigen Beispiel entdeckt haben und daskonstant in den Topoi der Topik wiederkehrt oder ihnen entnommenwerden kann, durchaus dazu gebraucht werden kann, den Übergang vonder Prämisse zur Konklusion zu sichern. Dies ergibt sich u. a. aus Stel-len, an denen Aristoteles empfiehlt, das maßgebliche Schema dann an-zuführen, wenn es dem Gegner unklar bleibt, wie der Schluss zustandegekommen ist. Wenn im obigen Beispiel der Gegner stutzt, wie man vonder zugestandenen Prämisse zu der deduzierten Konklusion gelangt,dann wäre ihm nach dieser Regel der Topos oder das darin enthalteneSchema zu erläutern, wonach alles, was der Gattung allgemein zu-kommt, auch der Art zukommen muss. Insofern wird der Topos zusätz-lich zu der Aufgabe der Prämissenkonstruktion auch als so etwas wie ein„inference-warrant“ herangezogen.
Das ist die eher technische Seite der Verwendung von Topoi, entschei-dender ist aber vielleicht die Frage, wo Aristoteles denn diese Topoi her-nimmt. Handelt es sich um Erfahrungswerte, um Faustregeln, um Exper-tenmeinungen, um die Überzeugungen des gesunden Menschenverstan-des? Oder wo genau sind diese Topoi anzusiedeln? Die Mehrzahl derTopoi der Topik weist in eine ganz andere Richtung. Grundlegend näm-lich für die dort explizierten Topoi ist das Schema der vier sogenanntenPrädikabilien: Aristoteles unterscheidet hierunter vier Arten der prädi-kativen Aussagen entlang des Kriteriums, ob von einer Sache ein Akzi-denz, ein Proprium, eine Gattung oder eine Definition prädiziert wird.Die Topoi-Listen der Topik sind diesen vier Prädikationsverhältnissenentsprechend angeordnet. Wenn nun Akzidenz prädiziert wird, dann istdamit impliziert, dass das entsprechende Prädikat dem Subjekt nichtnotwendig und auch nicht immer zukommt und dass Subjekt und Prädi-kat nicht konvertibel sind (wenn von „Mensch“ das Akzidenz „sitzend“ausgesagt wird, dann gilt nicht, dass auch von „sitzend“ das Prädikat„Mensch“ ausgesagt werden könnte). Wenn hingegen von einer Sache die
Aristotelische Grundbegriffe 19
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 19 •
Definition ausgesagt wird, dann steht damit auch fest, dass das Prädikatnotwendig und immer vom Subjekt gelten muss und dass Subjekt- undPrädikatsterm konvertibel sind (wenn z.B. der Mensch dadurch definiertist, dass er ein zweibeiniges Lebewesen ist, dann gilt auch, dass daszweibeinige Lebewesen ein Mensch ist). Zahlreiche Topoi der Topik erge-ben sich direkt aus diesen Prädikationsverhältnissen. Wenn daher eindialektischer Verteidiger behauptet, dass A durch B definiert sei, dannstehen dem Angreifer eine Reihe von Topoi zur Verfügung, nach denen erprüfen kann, ob z. B. B immer und notwendig A zukommt oder A und Btatsächlich konvertibel sind. Ein Proprium ist eine Eigenschaft, die nureiner bestimmten Art von Dingen und keiner anderen Art zukommt.Wenn einer der Kontrahenten daher behauptet, dass A die Eigenschaft Bals Proprium hat, dann kann sich der je andere Kontrahent derjenigenTopoi bedienen, die das Ziel haben zu prüfen, ob B vielleicht doch eineranderen Sache zukommt, denn wenn sich herausstellt, dass B auch Coder D zukommen kann, dann ist B kein Proprium von A usw. Wie ge-sagt, ergeben sich zahlreiche Topoi allein schon aufgrund dieser Prädika-tionsverhältnisse. Weitere Gesichtspunkte, aus denen Topoi gebildet wer-den, sind die Gegensatzverhältnisse (hierzu unterscheidet Aristotelesverschiedene Arten von Gegensätzen, den konträren, den kontradiktori-schen, den relationalen und den privativen), die Art-/Gattungsverhält-nisse (Art zu Art, Art zu Gattung usw.), semantische Verhältnisse (Syno-nymie, Homonymie, Paronymie, sprachliche Ableitungen), Ähnlichkeitensachlicher und sprachlicher Art (darunter auch die Analogie), undschließlich Verhältnisse des Mehr, des Minder und des Gleichen. Aus die-sem Tableau lassen sich fast alle Topoi der Topik bilden. Man wird indiesem Zusammenhang aber kaum von Elementen der Alltagsrationalitätoder von Erfahrungswerten sprechen. Vielmehr arbeiten diese Topoi zumgroßen Teil mit Implikationsverhältnissen, die unabhängig vom Inhalt ei-ner Aussage daraus resultieren, dass die aufgestellten Behauptungen im-mer einer der vier Prädikabilien zuzuordnen sind, dass die verwendetenTerme in einem Art- oder Gattungsverhältnis zu anderen Termen stehen,dass einer der verwendeten Terme in einem gegensätzlichen Verhältnis zuanderen Termen steht, dass die verwendeten Terme durch Synonyme er-setzt werden können oder homonym (mehrdeutig) sind oder in einemsprachlichen Ableitungsverhältnis zu anderen Termen stehen usw. DieseHerkunft der Topoi aus semantischen, generellen, z.T. formalen – jeden-falls nicht-inhaltlichen – Quellen dürfte auch der Grund dafür sein, dassAristoteles nicht verlangt, den verwendeten Topos jeweils dem Kontra-henten zur Zustimmung vorzulegen.23 Wohl deshalb wird die Forderung,
20 Christof Rapp
23 Diesen Umstand könnte ich nicht besser ausdrücken als O. Primavesi, DieAristotelische Topik. Ein Interpretationsmodell und seine Erprobung am Beispiel
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 20 •
dass die Prämissen der Dialektik anerkannt (endoxon) sein müssen, aus-drücklich nur auf die mithilfe der Topoi gefundenen Prämissen, nichtaber auf die Topoi selbst bezogen.
Bevor wir zu der Terminologie der Rhetorik kommen, ist dies vielleichtder richtige Punkt, um auszuführen, dass sich auch die Rhetorik in gro-ßem Maße der Topoi bedient. Dies ist aufgrund der schon in Abschnitt II.konstatierten Affinität von Dialektik und Rhetorik auch nicht weiterüberraschend. In der Rhetorik formuliert Aristoteles nicht nur so etwaswie eine Definition des Topos’ – demnach sei der Topos so etwas wie einElement, und dies wiederum sei etwas (Allgemeines), worunter viele ein-zelne Argumente fallen24 –, er führt auch einen wichtigen Unterschiedzwischen verschiedenen Topoi ein: Der Rhetorik zufolge gibt es sowohlallgemeine Topoi, die sich gleichermaßen auf Fragen der Gerechtigkeit,der Naturwissenschaft, der Politik usw. beziehen – dies scheint weitge-hend dem eher formalen Charakter der Topoi der Topik zu entsprechen –,als auch spezifische Topoi, welche über die Aussagen einer bestimmtenArt oder Disziplin wie z.B. der Ethik handeln. Für die Rhetorik seienbeide Arten von Topoi anzuwenden, wichtiger aber seien die spezifischenTopoi. Konkret gibt Aristoteles dann eine Reihe von spezifischen Topoi,die zu je einer der drei Redegattungen gehören und mit den Grundbegrif-fen der einzelnen Redegattung in Verbindung stehen: Die Topoi für dieGerichtsrede mit dem Begriff des Gerechten und des Unrecht-Tuns, dieTopoi für die Lobrede mit dem Begriff des Schönen, die Topoi der Volks-versammlung mit dem Begriff des Guten und des Nützlichen. In den ent-sprechenden Listen der Rhetorik finden wir dann Aussagen wie bei-spielsweise folgende: „Schön also ist das, was aufgrund seiner selbst ge-wählt wird und dabei lobenswert ist“, „Wenn dies das Schöne ist, dannsind die Tugenden schön, denn sie sind gut und dabei lobenswert“,„Notwendigerweise sind die Dinge schön, die Tugend hervorbringen,denn sie sind auf Tugend gerichtet“ usw. Auch diese Topoi sind zurKonstruktion von syllogismoi gedacht; anders als bei den eher formalen,in jedem Fall aber inhaltsneutralen allgemeinen Topoi ist man hier ge-neigt zu sagen, dass die Akzeptabilität dieser Topoi selbst von bestimm-ten anerkannten Prämissen abhängig ist – so wie im obigen Fall von derPrämisse, dass das Schöne eben das ist, was aufgrund seiner selbst ge-wählt wird und dabei lobenswert ist.
Aristotelische Grundbegriffe 21
von Topik B, München 1996, S. 87 f.: „Nun liegt zwar für unser Empfinden auchin den dialektischen Syllogismoi des Aristoteles dem Übergang von q (bzw. �q)nach p (bzw. �p) ein entsprechendes Implikationsverhältnis zugrunde; aber Aris-toteles legt sich in der Topik nirgends grundsätzlich darauf fest, dass als erstePrämisse eines dialektischen Syllogismos die zugrundeliegende Implikation inForm einer Prämisse auch ausgesprochen, d. h. dem Antworter ,hingestreckt‘ würde.“
24 Rhetorik II 26, 1403a18–19.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 21 •
V. Das Enthymem als deduktives Argument
Kommen wir schließlich zur Begrifflichkeit der Rhetorik. Wie wir inAbschnitt II. ausgeführt haben, ist die Rhetorik kaum weniger als dieTopik an Schlüssen und Beweisen interessiert, weil das Überzeugendenicht vom Schlüssigen zu trennen ist und weil die rhetorischen Beweiseeines der Mittel, vielleicht sogar das wichtigste, sind, um die Urteilsbil-dung der Zuhörer zu steuern. Zur Bezeichnung des typisch rhetorischenBeweises übernimmt Aristoteles einen Begriff, der in der Rhetorik seinerZeit verbreitet ist, wenn auch nicht genau in dem Sinn, der ihm vonAristoteles gegeben wird – gemeint ist der Begriff des Enthymems. DerBeweis im Bereich der Rhetorik, sagt Aristoteles, heiße Enthymem; dasEnthymem aber sei eine Art von syllogismos, ein deduktives Argumentalso, und weil außerdem die Untersuchung von jeder Art von syllogismosdem Dialektiker obliege, werde derjenige zum Meister des Enthymems,der verstehe, woraus der syllogismos gebildet werde, über welche Dingeder syllogismos im Bereich der Rhetorik handle und welche Besonderhei-ten der rhetorisch gebrauchte syllogismos aufweise.25 Die Zuständigkeitfür das Enthymem wird also vollständig dem Dialektiker anheimgestellt.Das ist ein erstes, starkes Indiz dafür, dass die Erklärung des Enthy-mems sich auf die aristotelische Dialektik bezieht, und die aristotelischeTheorie der Dialektik finden wir in der Schrift Topik. Ebenso sagt Aris-toteles, dass sich die dialektischen und die rhetorischen syllogismoi aufdieselben Dinge beziehen, über die wir Topoi formulieren; da wir Topoinur in der Rhetorik einerseits und der Topik und ihrem Appendix, denSophistischen Widerlegungen, andererseits finden, ist dies ein weiteresstarkes Indiz dafür, dass wir die Logik des Enthymems nicht unabhängigvon der in der Topik unterstellten Logik verstehen können.
In der traditionellen Auslegung der Rhetorik war es so, dass die Inter-preten, wann immer sie „syllogismos“ hörten, an die Logik der ErstenAnalytik und an die Figuren der assertorischen Syllogistik dachten.26
Wie in Abschnitt III. gesehen, ist dies vor dem Hintergrund des fast bei-spiellosen Erfolgs der syllogistischen Theorie kaum anders zu erwarten.Dass diese Assoziation dennoch irreführend sein kann, zeigt sich daran,dass die Rhetorik keinerlei Hinweise auf die syllogistische Theorie ent-hält. Aristoteles spricht nirgendwo von syllogistischen Figuren, von gül-tigen oder ungültigen Modi; er erwähnt keinen Mittelbegriff und erläu-tert nirgendwo, dass die Gültigkeit der Syllogismen der ersten Figur of-
22 Christof Rapp
25 Rhetorik I 1, 1355a12–14.26 Nur Cicero, so scheint es an einigen Stellen, dachte dabei eher an den stoi-
schen syllogismos, was zu einer anderen Art von Komplikation führte.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 22 •
fensichtlich ist, die Gültigkeit der Syllogismen der zweiten und drittenFigur aber nicht – ein Unterschied, der für die rhetorische Absicht abervon allergrößter Bedeutung wäre, denn was nützte dem Rhetor ein gülti-ger Schluss, dessen Gültigkeit niemand bemerkte? Munter und durchwegbildet Aristoteles Schlüsse über individuelle Personen, was in der Syllo-gistik ausgeschlossen ist und zumindest der Andeutung einer Rechtferti-gung bedürfte. Umgekehrt ist es auffällig, dass Aristoteles die Definitiondes Enthymems im Sinne eines syllogismos durch einen Verweis auf dieentsprechende Definition in der Topik und nicht mit einem Verweis aufdie Erste Analytik einleitet. Vieles spricht also dafür, dass die Beweis-lehre der Rhetorik mit der Argumentationstheorie der Topik zu assoziie-ren ist, und nichts27 spricht dafür, dass die Kenntnis der syllogistischenTheorie eine Voraussetzung für Aristoteles’ Ausführungen zum rhetori-schen Beweis, dem Enthymem, darstellen würde. Genau wie die dialek-tischen Argumente werden die rhetorischen Argumente aus Topoi kons-truiert, und ähnlich wie im Fall der Dialektik geht es der Rhetorik umdeduktive Argumente im weitesten Sinn – also ohne die kanonische Ein-schränkung der Syllogistik auf Zwei-Prämissen-Argumente, bestehendaus kategorischen Aussagen mit genau drei allgemeinen Termen.
Dass Aristoteles unter dem Enthymem einen syllogismos in dem in Ab-schnitt III. diskutierten Sinn eines deduktiven Prämissen-Konklusions-Arguments versteht, sagt er auch selbst deutlich in folgender Definition:
�� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ������ ���������� �� � ������ � �� ����� ����� ����� !� � "# $�% �� �! &� $��' ��� �� !(����# $������ �� $��)�*�� �� �'���.28
„. . . wenn sich aber, falls etwas der Fall ist , etwas davon Verschiedenes [wegendiesen] neben diesen ergibt, dadurch dass dies entweder allgemein oder in derRegel der Fall ist, wird es dort (in der Topik/Dialektik sc.) eine Deduktion, hieraber (in der Rhetorik/Rhetorik sc.) ein Enthymem genannt.“ (Rhetorik I 2,1356b15–17)
Wie in den bisher behandelten Definitionen des syllogismos nenntdiese Definition zunächst die Prämissen, unterscheidet davon die Kon-klusion, die von den Prämissen verschieden sein muss, und erklärtschließlich, dass sich die Konklusion wegen der Prämissen bzw. dadurch,dass die Prämissen der Fall sind, d.h. als wahr angenommen werden, er-
Aristotelische Grundbegriffe 23
27 „Nichts“, abgesehen von den Verweisen auf die Analytik, für die es hinrei-chend gute Erklärungen gibt, mit denen ich den Leser an dieser Stelle nicht behel-ligen will (vgl. C. Rapp, Aristoteles, Rhetorik, Berlin 2002, I, S. 189–191). Im Übri-gen scheint unbestritten, dass die Rhetorik eine späte Revision und Ergänzung er-fahren hat, wodurch Rück- und Vorverweise aller Art erklärt werden können. Diesalles berührt nicht den Kern der Aussage, dass die Theorie des Enthymems vordem Hintergrund der Topik und nicht der Analytik zu verstehen ist.
28 Dies entspricht dem Text von Rudolph Kassel, ich setze allerdings dasKomma hinter �� � ����� und nicht wie Kassel hinter ��� ����� �����.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 23 •
gibt.29 Bezeichnend ist hier, dass es sich – genau genommen – nicht umdie Definition des Enthymems handelt, sondern um eine gemeinsameDefinition von (dialektischem) syllogismos und Enthymem, da das Defi-niens, mit dem der Satz beginnt, zum Schluss des Satzes gleichermaßenund lediglich durch den Verwendungsbereich differenziert, sowohl aufden syllogismos in der Dialektik als auch auf das Enthymem in der Rhe-torik bezogen wird. Das einzige Anzeichen an eine Anpassung an dieVerhältnisse der Rhetorik ist die Formulierung „dadurch dass dies ent-weder allgemein oder in der Regel der Fall ist“, mit der Aristoteles aufdie Besonderheit der in der Rhetorik zur Anwendung kommenden Prä-missen verweist. Über diese Prämissen erfahren wir wenig später imText, dass es die rhetorischen syllogismoi selten mit notwendigen Dingenzu tun haben, sodass weil einerseits notwendige Dinge aus notwendigenPrämissen folgen und Dinge, die nur in der Regel so sind, wie sie sind,aus ebensolchen Prämissen, die Prämissen des Enthymems zum einenTeil notwendig, zum weitaus größeren Teil aber nur in der Regel wahrsein werden.30 Außerdem werde das Enthymem, wie man weiß, entwederaus Zeichen oder aus Wahrscheinlichem gebildet, und davon entsprechedas eine (das Zeichen, sc.) jenem (dem Notwendigen, sc.), das andereaber (was nur in der Regel wahr ist, sc.) diesem (dem Wahrscheinlichen,sc.).31 Das Enthymem wird also eingeführt als ein syllogismos genau indemselben Sinn, in dem wir den syllogismos aus der Topik kennen. Indieser definitorischen Passage sieht sich Aristoteles nur zu einem Zuge-ständnis an die Besonderheiten des Enthymems veranlasst – zu der Qua-lifikation des Sinns, in dem das in den Prämissen Vorausgesetzte der Fallist: Anders als in der Dialektik finden sich hierbei Dinge, die nicht allge-mein oder notwendig, sondern lediglich in der Regel der Fall sind; dieseEinschränkung gilt nach Aristoteles für den gesamten Bereich der indivi-duellen menschlichen Handlungen – sie gilt daher für rhetorische Argu-mente ebenso wie für praktische Abwägungen. Dem Stellenwert der rhe-torischen Argumentation wird dadurch kein Abbruch getan, es soll nursichergestellt werden, dass die Argumentation der besonderen Art desrhetorischen Gegenstands gerecht wird.
24 Christof Rapp
29 Dieser letzte Gedanke wird im überlieferten Text gleich zweimal ausge-drückt. Kassel hält daher ��� ����� für einen späteren Zusatz. Setzt man aller-dings die Kommata, wie ich es hier – einem mündlichen Vorschlag von Paolo Cri-velli (Genf) folgend – tue, ist es nicht wirklich derselbe Gedanke, der hier zweimalausgedrückt wird: ��� ����� würde sich auf das Zustandekommen der Konklusionaus den Prämissen beziehen, die Formulierung „��� ����� ����� . . .“ würde die Qua-lität der Prämissen erläutern und differenzieren.
30 Dies ist der Gedankengang von Rhetorik I 2, 1357a22–32.31 Paraphrase von Rhetorik I 2, 1357a32–33.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 24 •
Halten wir an dieser Stelle kurz inne: Es sollte deutlich geworden sein,dass Aristoteles das Enthymem als einen syllogismos zu etablieren ver-sucht. Das ist zumindest, was er uns an all diesen Stellen sagt. Nunkönnte man entgegnen, dass dasselbe Wort nicht immer dieselbe Sachebezeichnet. Theoretisch denkbar wäre es daher, dass obwohl an allen an-deren Stellen „syllogismos“ ein deduktives Argument bezeichnet, Aristo-teles ausgerechnet in der Rhetorik eine andere Bedeutung im Sinn hatte(z. B. „nicht-deduktives Argument“, „sowohl-deduktives-als-auch-nicht-deduktives Argument“ oder einfach „gelungene Formulierung“). Erfreu-licherweise lässt uns der Autor der Rhetorik nicht mit einem derart bei-ßenden Zweifel zurück: Er nennt das Enthymem nämlich nicht nur einen„syllogismos“, sondern er sagt auch, was er darunter versteht, nämlichdass es ein Argument mit Prämissen und einer davon verschiedenen Kon-klusion sei, die aufgrund der vorausgesetzten Prämissen folgt. Damitwiederholt er im Kern das, was er auch sonst als Definiens des syllogis-mos anführt und was den syllogismos als ein deduktives Argument be-stimmt. Außerdem wäre die ganze Konstruktion einer der Dialektik ver-wandten Rhetorik und eines für die rhetorische Argumentation kompe-tenten Dialektikers (welcher zudem als Spezialist für den syllogismoseingeführt wurde) vergebens und irreführend, wenn nicht Rhetorikerund Dialektiker wenigstens eines gemeinsam hätten: den syllogismos.Schließlich gibt es ein Merkmal, das die Rhetorik eng an die Topik unddie Sophistischen Widerlegungen bindet und zugleich von den Analy-tiken trennt, nämlich dass in beiden Projekten der Gebrauch von Topoieine zentrale Rolle spielt. Wenn das alles so ist, dann haben wir guteGründe – und zwar unabhängig von allen entwicklungsgeschichtlichen(„früher/später“) Thesen, die man als haltlos ansehen mag32, – die En-thymeme in engem Zusammenhang mit den syllogismoi der Topik zu se-hen. Von diesen wiederum schien unbestritten, dass sie von Aristotelesals notwendige Schlüsse gedacht waren, mit denen der Kontrahent ge-zwungen werden kann, etwas zuzugestehen, was seiner ursprünglichenAnnahme widerspricht. Weiterhin schien deutlich, dass die zwingendenSchlüsse der Topik nicht den formalen Restriktionen der assertorischenSyllogistik unterliegen: An keiner Stelle der Topik sagt uns Aristoteles,wie viele Prämissen oder wie viele Terme ein Argument haben oder dasses nur aus kategorischen Aussagen bestehen darf. Manchmal sprichtAristoteles in der Topik von „prosyllogizesthai“, der deduktiven Absiche-rung von Prämissen, die dann für den entscheidenden, den Gegnerwiderlegenden syllogismos verwendet werden sollen, sodass man eheran mehrgliedrige Deduktionen mit mehreren Prämissen denken wird.
Aristotelische Grundbegriffe 25
32 Siehe FN 19.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 25 •
Manchmal wiederum scheint es, als sei für die Bildung bestimmter syl-logismoi unter Anwendung eines bestimmten Topos’ ausreichend, dass derGegner eine einzige – als „allgemein“ oder „notwendig“ – bezeichnete Prä-misse zugesteht.33
VI. Deduktive Argumente im rhetorischen Gebrauch
Wenn wir jetzt der Frage nach der Besonderheit des rhetorischen syllo-gismos, des Enthymems, nähertreten, dann ist es wichtig, die Vorstellungfernzuhalten, dass der Standard, in Vergleich zu welchem das Enthymembestimmt wird, der normierte Syllogismus der syllogistischen Theorie sei,der uns – in Gestalt des Modus’ ,Barbara‘ – nicht nur wohlvertraut ist,sondern auch als legitime Veranschaulichung des Begriffs des Syllogis-mus’ vor Augen steht.34
Aristoteles vermittelt, wie gesagt, das Bild, dass sich der Dialektikerals der Fachmann für den syllogismos auch am besten mit dem Enthy-mem auskennen müsste unter der Bedingung, dass er sich mit den Unter-schieden zwischen dem Enthymem und dem dialektisch gebrauchten syl-logismos vertraut gemacht hat.35 Welches sind nun diese Unterschiede?Aristoteles nennt genau zwei Arten von Unterschied, wie aus dem folgen-den Abschnitt deutlich wird:
„Es ist ihre (der Rhetorik, sc.) Aufgabe, über solche Gegenstände zu handeln,über die wir beraten und von denen wir keine Kunst besitzen, und bei solchenZuhörern, die nicht in der Lage sind, über vieles hinweg zusammenzuschauenund von weither Schlüsse zu ziehen.“ (Rhetorik I 2, 1357a1–4)
Ein Unterschied betrifft daher die besonderen Gegenstände der Rheto-rik bzw. der öffentlichen Rede und ein weiterer Unterschied betrifft diebesonderen Adressaten der öffentlichen Rede. Das Thema der besonderenGegenstände hatten wir bereits gestreift, als es darum ging, dass die öf-
26 Christof Rapp
33 Siehe FN 23. Um Verwirrungen vorzubeugen, sollten man vielleicht unter-scheiden zwischen Prämissen, die Aristoteles dem Kontrahenten oder Adressatenzur Zustimmung vorlegt (oder – für rhetorische Zwecke – dem Adressaten als et-was vorlegt, wovon er Grund hat zu meinen, dass es der Adressat bereits aner-kennt oder bereits davon überzeugt ist), und der spezifischen Rolle des Topos’(oder das darin enthaltene „wenn . . ., dann . . .“-Schema), der (bzw. das) aus logi-schen Gründen als Prämisse vorausgesetzt werden muss, um einen zwingendenSchluss zu erhalten – wenngleich wir zumindest für die Dialektik festhielten, dassdieser Topos nicht im erstgenannten Sinn dem Gegenüber zur Zustimmung vorge-legt werden muss.
34 Vorausgesetzt natürlich, wir denken dabei nicht – wie Cicero – an den modusponendo ponens (dieser wird von Aristoteles nebenbei als einer von hunderten To-poi zwar beiläufig formuliert, aber erst von den Stoikern als eine aussagenlogischeGrundform reflektiert).
35 Das ist der Gedanke von Rhetorik I 1, 1355a8–14.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 26 •
fentliche Rede typischerweise von Dingen handelt, die sich – wie dasmeiste im Bereich der menschlichen Handlungen – nicht allgemein undnotwendig, sondern nur in der Regel auf eine bestimmte Weise verhalten.Für das Enthymem heißt das, dass es seine Prämissen zum größeren Teilaus Annahmen schöpft, die ebenfalls nur in der Regel, aber nicht allge-mein oder notwendig wahr sind, und die Konklusionen, die sich aus sol-chen Prämissen gewinnen lassen, gelten eben auch nur in der Regel.36
Dies ist ein wichtiger Unterschied zum dialektischen Argument, weil esdieses größtenteils37 mit der Prüfung allgemeiner philosophischer Thesenund nicht wie die öffentliche Rede mit der Erörterung von Einzelfällenzu tun hat. Dennoch ist es nicht so, dass das Enthymem dadurch defi-niert wäre, dass es von nur in der Regel geltenden Dingen handelt; eherverhält es sich so, dass das Enthymem, weil es einen in der öffentlichenRede gebrauchten syllogismos darstellt, dem Anlass entsprechend öftermit kontingenten, nur in der Regel wahren als mit notwendigen Sachver-halten zu tun hat.
Das zweite Merkmal betrifft den typischen Zuhörer der öffentlichenRede, und auch dieses Merkmal wird nur durch den abgrenzenden Ver-gleich zur Dialektik richtig verständlich: Während der Teilnehmer dia-lektischer Erörterungen als jemand gesehen wird, der sportive Argumen-tationen gewohnt und in der Lage ist, auch abstrakten Argumenten übermehrere Stationen hinweg zu folgen, heißt es vom Zuhörer der öffent-lichen Rede, er sei nicht in der Lage, „über vieles hinweg zusammen-zuschauen und von weither Schlüsse zu ziehen“. Nur wenig später sagtAristoteles über diesen Zuschauer auch, er sei ein „einfacher“ Mensch.Was auf den ersten Blick wie die Schmähung des einfachen, seine demo-
Aristotelische Grundbegriffe 27
36 Dies wiederholt Aristoteles auch in den Analytiken: „Wenn die Prämissennotwendig sind, dann ist auch die Konklusion notwendig, wenn aber nur in derRegel zutreffend, dann ist auch die Konklusion von dieser Art.“ (Zweite Analyti-ken I 28, 87b23–25) Diese deutlich artikulierte Auffassung des Stagiriten läuft dervon manchen modernen Logikern und Interpreten gehegten Erwartung entgegen,dass bei einem Schluss aus Prämissen, die nur wahrscheinlich gelten (und auf et-was Ähnliches laufen die als „nur in der Regel geltenden“ Prämissen ja hinaus),der Übergang von der Prämisse zur Konklusion selbst nicht notwendig, sondernnur wahrscheinlich sein könne (also eine probabilitas consequentiae anstelle einernecessitas consequentiae). Aristoteles hingegen möchte bei Schlüssen aus nur inder Regel geltenden Prämisse nicht am deduktiven Rahmen als solchem und ander Notwendigkeit der Übergangs rütteln, sondern ist zufrieden damit, dass dieresultierende Aussage in derselben Weise modal qualifiziert wird wie die Prämis-sen (probabilitas consequentiae im Unterschied zur probabilitas consequentiae).Auch in der Rhetorik selbst finden wir mehrere Beispiele des Typs ,Wenn das-und-das in der Regel der Fall ist, dann ist mit Notwendigkeit auch jenes in derRegel der Fall‘.
37 Eine Ausnahme von dieser Regel stellen einige Topoi des dritten Buches derTopik dar, weil diese für die Bewertung und den Vergleich individueller Sachver-halte geeignet sind. Bezeichnenderweise sind dies die einzigen Topoi der Topik,die in der Rhetorik ausdrücklich wiederholt werden.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 27 •
kratischen Rechte ausübenden Bürgers durch einen aristokratisch ge-sinnten Philosophen wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als dieberechtigte Sorge, der Zuhörer könnte durch eine Argumentation im dia-lektischen Stil überfordert werden, sodass sich das den Beweisen inne-wohnende Überzeugungspotenzial nicht entfalten und die argumentativeÜberzeugungsbemühung ihr eigentliches Ziel verfehlen würde. Die Emp-fehlung, die Aristoteles gibt, um der Überforderungsgefahr zu entgegnen,ist – in erster Annäherung gesagt – die, dass die rhetorischen Schlussfol-gerungen eben nicht „von weither“ genommen werden und nicht in dieLänge gezogen werden dürfen. Daher sollte der rhetorische syllogismoskürzer oder kompakter sein, was auch einschließt, dass er aus wenigenoder weniger Prämissen gebildet wird als das dialektische Argument.Dieses Motiv der Kürze und Kompaktheit wird an einer viel späterenStelle der Rhetorik, im dritten Buch, nochmals aufgenommen und lern-psychologisch im Sinne eines schnelleren und dadurch angenehmerenLerneffekts ausgedeutet.38 Aus solchen Überlegungen ließe sich ein plau-sibles Plädoyer für die Kompaktheit rhetorischer Argumente jenseits der– für den modernen Leser vielleicht etwas überstrapazierten – Konse-quenz ableiten, die sich aus der angeblichen intellektuellen Beschränkt-heit der Adressaten öffentlicher Reden ergibt. Wie dem auch sei, es sindgenau diese Bemerkungen über die Kompaktheit des Enthymems, dievermutlich die Hauptverantwortung für die traditionelle Auffassung tra-gen, das Enthymem werde von Aristoteles als ein Syllogismus mit einerfehlenden oder unterdrückten Prämisse definiert. Sieht man sich die ent-scheidenden Stellen jedoch genauer an, dann wird schnell klar, dass dielogische Unvollständigkeit hier gar kein Thema ist. Die Zeilen, die dervermeintlichen Kronzeugenstelle für die traditionelle Auffassung unmit-telbar vorausgehen, lauten:
„Man kann Deduktionen bilden (syllogizesthai) und Schlüsse ziehen (synagein)einmal aus dem zuvor Deduzierten, das andere Mal aus dem, was noch nichtdeduziert ist, aber der Deduktion bedarf, weil es nicht zu den anerkannten Mei-nungen gehört. Notwendigerweise verhält es sich so, dass von diesen das einenicht leicht nachvollziehbar ist wegen der Länge – es ist nämlich vorausgesetzt,dass der Richter ein einfacher Mensch ist –, das andere aber nicht überzeugendist, weil es weder aus dem, worüber Übereinstimmung erzielt wurde, noch ausden anerkannten Meinungen folgt.“ (Rhetorik I 2, 1356a7–13)
Die Beziehung dieser Überlegungen zum zweiten differenzierendenMerkmal des Enthymems gegenüber dem dialektischen syllogismos istdeutlich durch den Hinweis auf die Einfachheit des adressierten Rich-ters, sodass alle hier diskutierten Maßnahmen im Zusammenhang mitder Besonderheit der Zuhörer öffentlicher Rede stehen. Der erste Satz
28 Christof Rapp
38 Vgl. u. a. Rhetorik III 10, 1410b15–26.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 28 •
stellt zwei Verfahrensweisen gegenüber: Einmal führt man Beweise auf-grund von Prämissen, die zuvor deduktiv eingeführt wurden, einmal auf-grund von Prämissen, für die das nicht zutrifft. Letzteres ist unüberzeu-gend, wenn die Prämissen auch nicht auf andere Weise anerkannt sind,Ersteres ist wegen der Länge nur schwer nachzuvollziehen – für den ein-fachen Laienrichter allemal. Der Hintergrund, vor dem die Diskussionüber die angemessene Länge des Enthymems geführt wird, betrifft alsodie Frage, ob man die Prämissen eines rhetorischen syllogismos selbsterst durch einen syllogismos einführen soll oder nicht. Das Bedenken,dass eine solche Schlusskette wegen der Länge ungeeignet sei, greift ge-nau die Charakterisierung des für die öffentliche Rede typischen Zuhö-rers auf, wonach dieser nicht in der Lage sei, „über vieles hinweg zusam-menzuschauen und von weither Schlüsse zu ziehen“. An einer parallelenStelle, an der Aristoteles an das Ergebnis des vorliegenden Abschnittserinnert, elaboriert er denselben Gedanken wie folgt:
„. . . man darf die Schlussfolgerungen nämlich weder von weither ziehen noch,indem man alles aufgreift. Das eine ist nämlich unklar wegen der Länge, dasandere ist geschwätzig, weil man Selbstverständliches sagt.“ (Rhetorik II 22,1395b24–26)
Hier wird die Länge, die als Konsequenz aus dem Von-weither-Schlie-ßen eingeführt wird, einem Verfahren, dass sämtliche Zwischenschritte,auch die selbstverständlichen, aufgreift, gegenübergestellt. „Länge“ be-zieht sich daher nicht notwendig auf die Anzahl der deduktiven Zwi-schenschritte, sondern kann sich auch auf die sachliche Entfernung vonAusgangsprämisse und angestrebter Konklusion beziehen. Dies ist dieBedeutung, die genau mit der Beschreibung korrespondiert, dass der Zu-schauer nicht in der Lage sei „über vieles hinweg zusammenzuschauen“,d.h. Zusammenhänge im weit voneinander Entfernten zu erkennen(Letzteres ist nach Aristoteles die Fähigkeit des Philosophen, die mitdemselben Wort – synoran – bezeichnet wird). Zur Behebung dieser Ten-denz, die zur Unverständlichkeit des Arguments führt, wäre die Auslas-sung logisch erforderlicher Prämissen überhaupt nicht hilfreich. Woraufes ankommt und worauf Aristoteles offenbar in diesem Abschnitt hin-weisen will, ist die Auswahl von Prämissen, die nicht „abgelegen“, weilsehr allgemein, sind. Die Auswahl solcher Prämissen würde entweder einZusammenbinden von sachlich weit auseinander liegenden Behauptun-gen oder die Konstruktion einer aus vielen Zwischenschritten bestehen-den Beweiskette erforderlich machen. Auch die Tendenz, alles aufzugrei-fen und in vielen kleinteiligen Schritten auch selbstverständliche Vo-raussetzungen anzuführen, ist keine Frage der logischen Vollständigkeitoder Unvollständigkeit: Wer die richtigen Prämissen auswählt, die imHinblick auf die Konklusion relevant sind, aber keine Redundanz erzeu-
Aristotelische Grundbegriffe 29
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 29 •
gen, der braucht keine der logisch erforderlichen Prämissen auszulassen,um die Art von Länge zu vermeiden, die aus der vielstufigen Beweisfüh-rung entstehen kann.
Alle diese Überlegungen beziehen sich auf die Auswahl geeigneter Prä-missen und insbesondere auf die Vermeidung derjenigen allgemeinenPrämissen, die der Philosoph oder Dialektiker wählen würde und vondenen aus es ein langer Weg zu den in der öffentlichen Rede verhandel-ten Sachverhalten wäre. In diesem Zusammenhang formuliert Aristotelesnun:
„daher handeln die Enthymeme und Beispiele notwendigerweise von solchenDingen, die meistens dazu in der Lage sind, sich anders zu verhalten, undwerden gefolgert – das Beispiel induktiv und das Enthymem deduktiv – aus we-nigen Prämissen und oftmals aus weniger Prämissen als die, woraus der erstesyllogismos erfolgt.“ (Rhetorik I 2, 1357a13–17)
Rhetorische Beweise insgesamt – das Enthymem ebenso wie das Bei-spiel (welches Aristoteles als die rhetorische Art der Induktion einführt) –haben aus den oben ausgeführten Erwägungen heraus wenige Prämis-sen. „Wenige Prämissen“ bzw. „weniger Prämissen“ wären denkbar un-geschickte Formulierungen, um – der traditionellen Auffassung entspre-chend – auszudrücken, dass das Enthymem ein Syllogismus sei, dem einevon zwei Prämissen fehlt. Darüber, dass hier nicht vom kanonischenZwei-Prämissen-Syllogismus der assertorischen Syllogistik die Rede ist,haben wir ja bereits gesprochen. Außerdem handelt es sich hier offenbarum eine Gemeinsamkeit von Enthymem und Beispiel und keineswegs umdas Definiens des Enthymems. Schließlich ist klar, dass die Anforderung,weniger Prämissen zu verwenden, dadurch begründet ist, dass die obengenannten Tendenzen der Überforderung vermieden werden sollen, diesich aus der Wahl einer zu entlegenen Prämisse oder durch die Unterglie-derung des Arguments in zu viele und redundante Teilschritte ergebenwürde. Und genau hierauf reagiert die Aussage, der rhetorische syllogis-mos habe wenige oder weniger Prämissen. Für den Rhetor kommt esdarauf an, die richtigen Prämissen auszuwählen; diese dürfen weder zuentlegen sein, sodass entweder zu viele Zwischenschritte (und dadurchwiederum zu viele Prämissen) bis zu der angestrebten Konklusion erfor-derlich werden oder der Zusammenhang zwischen Prämissen und Kon-klusion unklar bleibt, noch dürfen sie aus den selbstverständlichen Vo-raussetzungen genommen sein, wodurch die Argumentation aufgrundvon Redundanz länglich und ermüdend würde.
Während die traditionelle Deutung die spezifische Differenz des Ent-hymems in einem logischen Merkmal (der Unterdrückung einer logischerforderlichen Prämisse) zu finden glaubte, ergibt sich bei dieser Lesart,dass der entscheidende Abschnitt gar nicht über die Logik des Enthy-
30 Christof Rapp
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 30 •
mems spricht, sondern darüber, was vom Zuhörer besser oder schlechterverstanden und was eher oder weniger akzeptabel ist. Die logische Un-vollständigkeit als solche würde ein Argument nicht verständlicher oderakzeptabler machen. Und die Überforderungsgefahr, die das zentrale An-liegen dieses Abschnitts ist, kann nicht am Unterschied zwischen eineroder zwei Prämissen festgemacht werden. Außerdem gibt sich der ge-samte Abschnitt – einschließlich der Aussage über die wenigen Prämis-sen – keineswegs als Definition des Enthymems (das Definiens einer Sa-che leitet man z.B. nicht mit „oft“ ein). Was hier behandelt wird, ist ei-ner der beiden Unterschiede, die es beim Enthymem im Unterschied zumdialektischen Gebrauch des syllogismos zu beachten gilt. Die richtigeWahl der Prämissen, die Aristoteles hier am Herzen liegt, ist nicht soleicht zu kodifizieren. Sie sollen nicht zu entlegen, nicht von weither ge-holt und sie sollen nicht redundant sein. Ein Enthymem, das eine dieserAnforderungen nicht optimal erfüllt, bliebe immer noch ein Enthymem –nur eben ein weniger erfolgreiches. Daher kann man über die Definitiondes Enthymems nicht sehr viel mehr sagen, als dass es ein deduktivesArgument im rhetorischen Gebrauch ist, und zwar eines, das es manch-mal mit notwendigen Dingen, häufiger aber mit Dingen zu tun hat, dienur in der Regel der Fall sind (weswegen Enthymeme besonders aus not-wendigen Zeichen oder Indizien und Wahrscheinlichem gebildet werden),und eines, das auch bei einfachen Leuten Gehör finden soll und daherweder aus entlegenen noch aus redundanten noch aus zu vielen Prämis-sen, sondern nur aus solchen Prämissen gebildet werden darf, die (wederentlegen noch redundant, jedoch) beim Zuhörer der öffentlichen Rede an-erkannt sind.39 Die logische Unvollständigkeit ist jedenfalls kein defini-torisches Merkmal des Enthymems. Dort, wo wir die Enthymeme als lo-gisch unvollständig ansehen, dürfte es für diese Art von Unvollständig-keit dieselbe Erklärung geben wie für die dialektischen syllogismoi.40
Aristotelische Grundbegriffe 31
39 Der Fußnote 8 bei Simon (FN 1), S. 700, entnehme ich, dass ich dessen Frage,wie ein Enthymem mit wahrer Prämisse als Enthymem identifizierbar sei, im Zugeeiner mündlichen Interaktion unbeantwortet gelassen haben soll. Diese Fragescheint mir nur dann verständlich, wenn man die wahren Prämissen einer eigenenKlasse neben den anerkannten Prämissen (die Simon mit den in der Regel gelten-den Prämissen gleichzusetzen scheint) und den zeichen- oder indizienartigen Prä-missen zuweist. Nach meinem Verständnis können sowohl anerkannte Prämissenals auch in der Regel geltende Prämissen als auch Prämissen, die das Vorliegeneines Zeichens behaupten, wahr sein. Die Gegenüberstellung von „wahr“ und„anerkannt“ bei Aristoteles hat vor allem den Sinn, dass anerkannte Aussagennicht als Prämissen verwendet werden, weil sie als wahr erwiesen wurden oderevidenterweise wahr, sondern eben nur, weil sie sich auf die Anerkennung durchbestimmte Personengruppen berufen können. Selbstverständlich können aner-kannte Prämissen wahr sein, das Anerkannt-Sein wird häufig sogar als Indiz fürdas Wahr-Sein einer Aussage behandelt; hierher rührt auch die antike Vorstellung,dass der consensus omnium als ein Wahrheitskriterium angesehen werden kann.
40 Vgl. FN 23 und 33.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 31 •
VII. Schluss
Die aristotelische Argumentationstheorie enthält zahlreiche Anknüp-fungspunkte – ob man sich dabei wortgetreu an das aristotelische Vor-bild hält oder ob man freier den einen oder anderen Impuls ausarbeitet.In der Topik finden wir die für Aristoteles typische Verbindung vonzwingenden deduktiven Argumenten und dem Gebrauch von Topoi fürdie Konstruktion solcher Argumente. In der Rhetorik ist dasselbe Modellin eine umfassendere Theorie des Überzeugenden eingebettet, welche be-sonderen Wert auf die Auswahl geeigneter Prämissen legt und in einemweiteren Schritt die Argumentationstheorie mit einer Psychologie derÜberzeugungsbildung verknüpft, in welcher auch die emotionale Verfas-sung des Rezipienten und die Glaubwürdigkeit des Sprechers eine Rollespielen.
Da für Aristoteles die Gerichtsrede nicht nur eine der drei in der Rhe-torik behandelten Redegattungen, sondern an vielen Stellen sogar die pa-radigmatische Redeform darzustellen scheint, enthält die Rhetorik nebenden Ausführungen zu den argumentationstheoretischen Grundbegriffenauch zahlreiche Auseinandersetzungen mit der Gerichtsrede und somitauch – im weiteren Sinn – mit einer spezifischen juridischen Form derArgumentation. In den Kapiteln I 10–14 beispielsweise setzt er sich aus-führlich mit der Frage auseinander, was Unrecht sei und in welchem Zu-stand und um welcher Dinge willen jemand Unrecht tut. Immer wiedergreift er dabei Fragen auf, die die Beschreibung und Klassifikation einesTatbestands betreffen: Die Parteien seien sich häufig einig darüber, dassetwas geschehen sei, stritten aber darüber, ob es ein Unrecht war odernicht (I 13, 1373b38–1374a9). Er unterscheidet systematisch die Fragen,was geschehen sei, wie es zu beurteilen ist (als Straftatbestand odernicht) und von welcher Größe oder Bedeutung es sei (III 16, 1416b20–21).In Kapitel I 15 erörtert Aristoteles den Umgang mit Beweismitteln, diedem direkten Einfluss des Gegners entzogen sind: Gesetze, Zeugen, Ver-träge, Eide usw. Kapitel II 19 listet Topoi auf, mit denen es ermöglichtwird zu argumentieren, dass etwas möglich oder unmöglich ist, dass et-was geschehen oder nicht geschehen ist oder dass etwas geschehen odernicht geschehen wird.
Auffallend ist Aristoteles’ Vorliebe für deduktive Argumente. Die In-duktion spielt in der Topik nur eine gewisse Nebenrolle für die Einfüh-rung von Prämissen. In der Rhetorik nennt er zwar das Beispiel als dierhetorische Form der Induktion, vernachlässigt dieses aber fast vollstän-dig gegenüber der deduktiven Beweisform, dem Enthymem. Vor allemhinsichtlich der Gerichtsrede räumt er dem Enthymem absoluten Vor-rang ein. Es scheint, als sei sich Aristoteles darüber bewusst, dass esgute und akzeptable Argumente gibt, die nicht das Kriterium der Deduk-
32 Christof Rapp
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 32 •
tivität erfüllen. Dies wird deutlich, wenn er das Zeichenenthymem be-handelt und einräumt, dass zwei von drei Formen des Zeichenenthy-mems keinen syllogismos ergeben. Allerdings ergibt die Behandlung derZeichenenthymeme in der Aristotelischen Rhetorik keinen eindeutigenBefund: Auf der einen Seite (in bestimmten Abschnitten von Kap. I 2und II 25) scheint es, als anerkenne er nicht-deduktive Zeichenargu-mente als vollständig akzeptable und legitime Argumentationsform an.In Kapitel II 24 hingegen zählt er solche Argumente zu den nur schein-baren syllogismoi, also zu Argumenten, die nur aufgrund eines spezi-fischen Täuschungsgrundes akzeptiert werden, was für Aristoteles un-möglich die Basis eines rationalen Arguments sein kann. Auf der einenSeite bezeichnet er die nicht-deduktiven Zeichenschlüsse unzweideutigals „Enthymem“, auf der anderen Seite scheint er – an den oben behan-delten Stellen – nur notwendige Zeichenschlüsse bei der Definition desEnthymems im Sinne eines syllogismos zu berücksichtigen. Wie dieseSpannung aufzulösen ist, ist nicht klar: Manche Autoren vermuten, dassdie Passagen, die von nicht-notwendigen Zeichenenthymemen sprechenund diese nicht nur als Täuschung einstufen, spätere Einschübe darstel-len.41 Möglicherweise empfand Aristoteles tatsächlich irgendwann dengewählten deduktiven Rahmen als zu eng, möglicherweise fehlte ihm dasbegriffliche Instrumentarium, um den Raum zwischen echten, d. h. de-duktiv gültigen, und nur scheinbaren syllogismoi zu explorieren.
Aristotelische Grundbegriffe 33
41 Vgl. Rhetorik I 2, 1357a22–1358a2 und II 25, 1402b13–1403a16. Vgl. hierzudie in FN 17 genannten Arbeiten von Burnyeat und Allen.
10/1/12 10:25 • Rechtstheorie 3/2011, Duncker (20901_Rapp.3d (NR)) 33 •