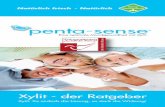Agrarwissen und Volksaufklärung im langen 18. Jahrhundert. Was sehen historische Gewährsleute und...
Transcript of Agrarwissen und Volksaufklärung im langen 18. Jahrhundert. Was sehen historische Gewährsleute und...
Agrarwissen und Volksaufklärung im langen 18. Jahrhundert. Was sehen historische Gewährsleute und was sehen ihre Historiker/innen?
Verena Lehmbrock
Michael Irlbeck aus Liebenstein bei Kötzing (Bayern) legte dem bayrischen landwirtschaftlichen Verein in den 1830er Jahren ein Manuskript mit der Bitte um ein Gutachten vor. Das Ersuchen wurde durch den Kötzinger Landrichter unterstützt; das Vereinsgutachten sollte den Druck des Irlbeckschen Erstlingswerks ermöglichen, welches eine dreibändige Ab-handlung über Landwirtschaft war. Jenes Buch, zugleich für Staatsmänner und für Landwirte gedacht, sei das erste und bis dato »einzige in seiner Art«, kündigte Irlbeck an, wofür er einerseits die Qualität seines Wissens, andererseits aber auch seinen sozialen Status geltend machte.1 Er war weder Gutsherr noch gelehrter Ökonom und hatte nicht studiert. Bevor er den halben Hof seiner Eltern übernahm, hatte er als Knecht gearbeitet und seine Fähigkeit, auf eine gelehrte Art und Weise zu schreiben, wurde von den Gutachtern des Vereins als außergewöhnlicher Einzelfall zur Kenntnis genommen. Irlbeck, als Halbbauer ein Angehöriger der dörflichen Obers-chicht und zwischenzeitlich Dorfvorsteher, bewirtschaftete vermutlich wenigstens zehn Hektar Land, besaß Zugvieh und bezahlte die Arbeit von Tagelöhnern. Eine Zeit lang testete er eine Sieben- sowie eine Vier-feldrotation, zuletzt entschied er sich jedoch für die Vorteile seiner Drei-felderwirtschaft. Sein hoch gelegenes Gelände soll kühl und steinig ge-wesen sein, die lehm- und sandhaltigen sowie humusarmen Böden waren wenig fruchtbar und gaben nur in guten Jahren das Vierfache der Aussaat wieder. Aufgrund zahlreicher Meliorationen und intensiver Arbeit gelangte er dennoch zu einem beeindruckenden wirtschaftlichen Erfolg: 23 Sommer
—————— 1 Irlbeck, Landwirthschaft, Titelblatt. Reinhart Siegert verdanke ich den Hinweis auf Michael
Irlbeck, über den im Weiteren wenig bekannt ist. Im Rahmen der von Siegert und Holger Böning geführten Projektdatenbank zur literarischen Volksaufklärung konnten jedoch über Regionalmuseen seine Lebensdaten ermittelt werden: *1786 in Liebenstein bei Kötzing, † 1869 in Deggendorf.
486 VERENA LEHMBROCK
hatte er allein mit der Urbarmachung von Ödland verbracht, Bäume und Sträucher ausgerissen, 2.000 Fuhren Steine ausgegraben, Hügel eingeebnet, Obstbaumreihen an Feldränder gepflanzt, Sümpfe ausgetrocknet und an trockenen Berghängen künstlich bewässerte Wiesen geschaffen. Kein Fleck, so scheint es, blieb in den Jahren seines Wirkens unberührt, und der landwirtschaftliche Verein hatte ihn bereits zu einem früheren Zeitpunkt für diese Leistungen ausgezeichnet. 2
Welche Perspektive auf Agrarwissen vermittelt das Buch von Michael Irlbeck und inwiefern kann es für aktuelle Forschungen interessant sein? Ich möchte argumentieren, dass gerade in den Passagen, die den Gutachtern die Empfehlung des Buches schwierig machen sollten, wert-volle Informationen insbesondere für eine Perspektive enthalten sind, die versucht, das Wissenstransferprojekt der literarischen Volksaufklärung im Rahmen einer breiter angelegten Wissensgeschichte der Landwirtschaft zu begreifen. Was passiert, wenn diese Forschungsperspektive durch die Stellungnahme eines Bauern informiert wird? Blicken wir anders auf jene von Pfarrern, Gutsherren, Beamten, Professoren und anderen getragenen Reformbewegungen, wenn wir Irlbeck kennen?
Ein imaginierter Blick durch seine Augen bildet den ersten input dieses Artikels, in dem ich über mögliche Effekte, die Irlbecks Perspektive für aufklärungs- und wissenshistorische Forschungen haben kann, reflektieren werde. Den zweiten input stellen Ausschnitte aus einer Zeitschriftenanalyse dar, in der ich Elemente einer volksaufklärerischen Perspektive herauszu-arbeiten versuche. Dazwischen wird es kurze Seitenblicke auf die Histo-riker/innen dieser historischen Gewährsmänner bzw. Perspektiven geben. Für eine Geschichte des Agrarwissens im langen 18. Jahrhundert schlage ich anschließend vor, dass gerade im Wechselspiel der verschiedenen his-torischen und der historiographischen Perspektiven ein reiches Anregungs-feld besteht.
—————— 2 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. X, in der Beschreibung der Gutachter S. XV, ders.,
Landwirthschaft, Bd. 2, u.a. S. 2ff., 49ff., 90f. Zum landwirtschaftlichen Verein Bayerns siehe die gründliche Aufarbeitung von Harrecker, Verein.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 487
1. Irlbecks Kritik an der »landwirtschaftlichen Aufklärung«
Was geschah mit Irlbecks Anliegen? Während sein Buch fachlich gelobt wurde, galten dessen polemische Passagen als hochgradig unverschämt, denn während er Sachverstand und Erfahrung in Sachen Landwirtschaft für sich geltend machte, erkannte er gelehrten Autoren diese Expertise nicht zu.3 Als ein Glücksfall kann deshalb gelten, dass dieses außeror-dentliche Buch – inklusive Begleitschreiben und Zeugnissen – trotz zwie-spältiger Gutachterposition im 250 Kilometer entfernten Augsburg ge-druckt wurde.4 Dies mag, folgt man der Studie von Stefanie Harrecker, auch auf die intellektuelle Kultur des landwirtschaftlichen Vereins in seiner frühliberalen Phase (1810–1835) zurückzuführen sein, dessen Landwirt-schaftliches Wochenblatt, in dem auch Irlbeck Beiträge publizierte, kontroverse Debatten zuließ und zunächst kaum zensiert wurde. Seine Distanz zur bäuerlichen Bevölkerung konnte (oder wollte) der Verein, dessen Mitglie-der aus der Beamtenschaft des Königshauses sowie aus adeligen und akademischen Kreisen stammten, nie überwinden.5 Nichtsdestotrotz wurden der Verein und die durch ihn geschaffenen öffentlichen Institu-tionen zu zentralen Voraussetzungen für das Erscheinen des Buches in Augsburg und Irlbecks in der Geschichte.
Sein gesundes Selbstvertrauen ließ dieser sich durch den Vorwurf der Anmaßung nicht nehmen. In seinem »Dankesschreiben« an den Verein betonte er noch einmal: »Noch kennt die Welt meines Wissens keinen Bauer, der ein Lehrbuch seines Handwerks lieferte. Sollte dasselbe auch
—————— 3 Der Irlbecksche Sprachgebrauch von »gelehrt« umfasste nicht nur Universitätsgelehrte
im engeren Sinn eines gelehrten Standes, sondern alle (meist universitär) Gebildeten, die sich als landwirtschaftliche Schriftsteller betätigten.
4 Das Buch ist im Karlsruher Metakatalog für Augsburg, München und Rostock nach-gewiesen sowie von google books digitalisiert. Es enthält über den Basistext hinaus das Irlbecksche Begleitschreiben zum Manuskript, das »Prüfungs-Zeugnis« mit der Kritik des Vereins, die Irlbecksche Reaktion auf diese Kritik sowie ein Gutachten des Kötzinger Landrichters als wertvolle Paratexte. Ich gehe hier davon aus, dass die Quelle und Irlbecks Identität authentisch sind, wenngleich nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Quelle mitsamt ihrer Beglaubigungsstrategien fingiert wurde. Zwei weitere Monographien des Autors Irlbeck, eine über Flachsbau (1836), die andere über den »Zeitgeist« der Landwirtschaft (1838), sind überliefert. Zum Vorwurf der »Anmaßung«, »Ruhmredigkeit«, »Verachtung anderer« usw. im gutachterlichen Schreiben siehe Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XIXff.
5 Bayrische Bauern, deren Interessen der Verein nicht zu vertreten vermochte, or-ganisierten sich ab 1869 in patriotischen Bauernvereinen, Harrecker, Verein , S. 353ff.
488 VERENA LEHMBROCK
gelungen seyn, so habe ich ohne Ruhmredigkeit in jeder Hinsicht etwas Außerordentliches geliefert«.6
Irlbeck übte in seinem Text rückblickend Kritik an der »land-wirtschaftlichen Aufklärung« des 18. Jahrhunderts. Zehn Kriege gegen Frankreich hätten keine vergleichbare Armut und solches Elend gebracht wie jener von Agrarschriftstellern verbreitete »blendende Zeitgeist«.7 Seine Vorwürfe zielten insbesondere auf die Propagierung neuer Feldsysteme: Während mit Fruchtwechselsystemen experimentiert wurde, die leistungs-fähiger als das bewährte Dreifeldersystem zu sein versprachen, war es im Rahmen der »landwirtschaftlichen Aufklärung« zu einer wahren Publi-kationswelle im Hinblick auf die neuen Praktiken gekommen. Insbeson-dere die Empfehlung des roten Klees im so genannten englischen System, welches auch von staatlichen Akteuren übernommen worden war, hatte, so Irlbeck, tausende junge Leute animiert: »Wir wollen Klee bauen! Prächtiges Vieh halten! Dadurch wird Dünger in Menge! Getreide in Fülle! Geld genug!! – Noch mehr Klee! Noch mehr Vieh! Noch mehr Getreide! Noch mehr Geld!! – Ach Gott! – Ist das wahr!! – – Ein Traum!!«8
Auch Irlbeck gehörte zu diesen jungen Leuten. Er hatte nach Übernahme des elterlichen halben Hofes 1808 direkt sämtliche Brachfelder hauptsächlich mit Klee bebaut, die Hälfte des Viehs verkauft und die restlichen Tiere im Stall behalten. Der Klee wuchs jedoch unerwartet nur zwei Zoll und gab damit gerade den Samen wieder – die Nachbarn ver-spotteten ihn. Vier Ochsen fraßen das ganze Grünfutter, ohne fett zu werden. Die Tiere brüllten mit »heller Stimme nach Freiheit« und vor Hunger.9 Ihm blieb wenig Stroh, wenig schlechter Dünger, die Kleefelder waren mit Unkraut übersät und trotzdem säte er noch einmal Klee aus. Im zweiten Winter konnte er das Vieh kaum noch ernähren und musste vor dem dritten Winter weitere Tiere verkaufen.10 Ein letztes Mal versuchte er es mit einer stärkeren Düngung der Brachfrüchte, die Kornfelder blieben
—————— 6 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XXXVII. In seiner folgenden Abhandlung über den
Flachsbau betonte Irlbeck seinen bäuerlichen Status nicht mehr, sondern nannte sich auf dem Titelblatt selbstbewusst »Oekonom und Verfasser des Buchs: Das Wichtigste der dermaligen Landwirthschaft, um sie zur höchsten Vollkommenheit zu bringen.« Irlbeck, Flachsbau.
7 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 75. 8 Ebd., S. 74f. Zur Diffusion des roten Klees durch staatliche und sozietäre Initiativen in
Kurhannover, Baden und Preußen siehe Ulbricht, Englische Landwirtschaft, S. 282–307. 9 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 77. 10 Ebd., S. 78.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 489
ungedüngt, worauf er sich wirtschaftlich fast ruiniert sah. Er ließ das Vieh wieder weidend auf Stoppelfelder, die »armseligen« Kleefelder, in Berge und Waldungen ziehen und brauchte nach dieser Zeit zehn Jahre, um wieder auf den Viehstock seines Vaters zu kommen.11 Warum, fragte Irlbeck, steht dennoch »in allen Schriften«, dass Klee angebaut werden soll, wenn dieser auf seinen Böden, wenn überhaupt, nur mittels intensivster Düngung gediehen sei? »Wo hat man denn da gefehlt?! – Hört! Ich spreche aus Erfahrung!«12
Irlbeck stellte als »Agrarpionier« ein ausgesprochenes Interesse am Fortschreiten der landwirtschaftlichen Praktiken zur Schau und damit mitnichten in Frage, dass verbessert werden sollte, vielmehr ging es ihm um ein qualitatives Wie.13 Das sozial hoch angesehene – aufklärerische – Wissen der landwirtschaftlichen Autoren, welchem er in seinem Reform-willen vertraut hatte, hatte in seiner Erfahrung versagt. Die Wissens-angebote enttäuschten seine Erwartungen und sein Vorschussvertrauen, da sie das Thema der Bodengüte ausgespart und auch die notwendigen Kosten kaum berührt hatten.14
Irlbeck betonte in seinem Text wiederholt, dass seine Erfahrungen repräsentativ für die ihn umgebende bäuerliche Gesellschaft waren. »Tausenden« sei es ergangen wie ihm, und zahlreiche der Mitstreiter seien inzwischen ruiniert. Nach einer zwanzigjährigen Periode fehlgeschlagener Experimente, die Bauern in allen umliegenden Dörfern unternommen hätten, wurde über den guten Willen der Aufklärer oder über ihre »gelehrte Unwissenheit« nur noch gelacht.15 Irlbeck, selbst ein Freund von technischer Innovation und Ertragssteigerung, nutzte das Vokabular einer profitorientierten Ökonomie und damit die seinerzeit verfügbaren pro-gressiven Argumentationsmuster, ohne jedoch – anders als in dem von ihm karikierten Agrarschrifttum – Formen der herkömmlichen und im Rahmen der Ökonomischen Aufklärung kritisierten Brach- und Weidewirt-schaft als rückständig zu markieren. Im Gegenteil: In Gegenden mit schlechten Böden und Düngemangel »wissen« Dorfbauern aus Erfahrung
—————— 11 Ebd., S. 79. 12 Ebd., S. 80. 13 Zum Forschungsbegriff »Agrarpionier/in« siehe Kaak, Agrarpionier/in, Sp. 117ff. 14 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XXVIII, XLI. Aus dieser Erfahrung filtriert Irlbeck
selbst einen Verbesserungsvorschlag, diesmal die »Schriftstellerei« betreffend: Landesre-gierungen sollten im Rahmen von »Kulturprüfungen« jede landwirtschaftliche Schrift vor ihrem Erscheinen prüfen lassen, Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 84.
15 Ebd., S. 76, ders., Landwirtschaft, Bd. 1, S. VI.
490 VERENA LEHMBROCK
»nur allzu gut«, so Irlbeck, dass Viehweiden unumgänglich seien, da jede andere Methode – etwa aufwendiges Düngen – doppelt soviel koste als der durch Brache und Weide gewonnene »Nutzen«. Die Brachweide sei, auch das wisse jeder, »reiner Profit«. Wird die Brache bebaut, dann muss das Produkt den »verhältnismäßigen Schaden des Winterbaus, die Brachfeld-Verschlechterung und die eigenen Aufwands-Kosten schon im Voraus vergüten.«16 Dieser Passus zeigt exemplarisch, wie geschickt Irlbeck neues Vokabular auch zur Verteidigung von Altbewährtem einsetzte. Verbesserung, das Schlagwort der Agrarreformer, ist in allen seinen drei Bänden ein Leitmotiv. »Wissen« als Substantiv und »wissen« als Verb brachte Irlbeck regelmäßig im Zusammenhang mit bäuerlichen Akteuren vor. Indem er Fortschritt und Verbesserung der eigenen Wirtschaft (und des allgemeinen Wirtschaftens) ins Zentrum seines Werkes und seiner Argumentation setzte, konnte er sich selbst als Agrarreformer beziehungsweise später ökonomischer Aufklärer in Szene setzen.17 Er verstand sein Werk explizit als Beitrag zur entstehenden Landwirtschaftswissenschaft, die in Bayern bislang ohne »Fundamental-Grundsätze« sei und die der Landwirtschaft schließlich zur Vollkommenheit verhelfen würde. Damit hatte er einen typisch aufklärerisch-ökonomischen Text geschaffen.18 Mit einer gewissen Verzögerung schrieb sich Irlbeck somit in die Diskussionen der landwirt-schaftlichen Aufklärer ein, die sich noch in den ersten Jahrzehnten nach 1800 lebhaft mit der Verhandlung dessen beschäftigt hatten, was als eine wissenschaftliche Landwirtschaft gelten durfte.19
—————— 16 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 72. 17 Der erste Irlbecksche Band erörtert die Landwirtschaft Bayerns in »staats-
wirthschaftlicher Absicht«, die zwei weiteren Bände, »praktische Ökonomie« genannt, beziehen sich auf die Führung eines Einzelbetriebes. An vereinzelten Stellen wählte Irlbeck auch einen volksaufklärerischen Duktus, etwa in Aussagen wie: »Denkt einmal darüber nach!«, Irlbeck, Landwirtschaft, Bd. 2, S. 26.
18 Ebd., S. 6f., 70. Vgl. dagegen die Schrift des »Bauerndichters« Isaak Maus in der Interpretation von Gunter Mahlerwein, die als eine Kritik von außerhalb des öko-nomischen Reformdiskurses betrachtet werden kann, nämlich vom Standpunkt einer bäuerlichen Subsistenzwirtschaft aus, Mahlerwein, Herren im Dorf, S. 242f. Eine mögliche Typologie subsistenzorientierter Ökonomie findet sich bei Dieter Groh in Groh, Subsistenzökonomien, in: Jahreskongress Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Jg. 5 (1985) 27.10.2012. Die kontinuierliche Präsenz von Misch-formen zwischen subsistenz- und marktorientierten bäuerlichen Ökonomien seit dem 16. Jahrhundert betont dagegen Werner Trossbach in Trossbach, Bauern, S. 64ff. Grundlegend zur Ökonomischen Aufklärung siehe Popplow, Ökonomische Aufklärung.
19 Die um 1800 entstandenen landwirtschaftlichen Akademien, welche im Rahmen von Musterwirtschaften auch Erfahrungswissen generierten, dessen Mangel Irlbeck agra-
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 491
Irlbecks Schrift erscheint wie eine Machbarkeitsstudie der seit Jahrzehnten im Milieu der Ökonomischen Aufklärung bzw. der Volks-aufklärung kursierenden Verbesserungsvorschläge. Im Rahmen dieses gut-achterlichen Prozesses, der vor dem Tribunal seiner 28jährigen Erfahrung stattfand, nehmen sich seine Darstellungen des volksaufklärerischen Be-wusstseins wie eine Parodie aus:
»Zwingen muß man den Bauer! Mit Gewalt muß er folgen! Er muß sein Vieh im Stall behalten! Alle seine Ödgründe kultivieren! Neue schönere Dörfer bauen! Er rührt keinen Fuß, wenn er nicht muß! Durch Ausländer muß man den Inländer Kultur lehren, der sonst immer an seinem Alten – Schlendrian ewig klebt, wie er’s von seinem Großvater sah! Das Land ist zu wenig bevölkert!«20
Die literarische Volksaufklärung kann als integraler Bestandteil einer breiter angelegten Bewegung betrachtet werden, die in der jüngeren Historiographie als »gemeinnützig-ökonomische Aufklärung« oder als »Ökonomische Aufklärung« bezeichnet wird – ein Phänomen, das auch Irlbeck mit seiner Bezeichnung »landwirthschaftliche Aufklärung« adres-siert haben mag.21 Unter dem Schlagwort Verbesserung der Landwirtschaft zielten Protagonisten der Ökonomischen Aufklärung – Pfarrer, Verwal-tungsbeamte, Ärzte, Gutsbesitzer, Universitätsgelehrte und andere – im weitesten Sinn darauf, Möglichkeiten einer optimierten Ressourcennutzung und damit mögliche Wohlstandsmehrungen für Staat und Bevölkerung zu diskutieren und teilweise zu initiieren. Dies geschah im Rahmen von Sozietäten, Akademien, Universitäten und vor allem durch vermittelnde Medienkommunikation, das heißt in allgemeinen und in Fachzeitschriften, in Zeitungen und ökonomischen Fachbüchern. Volksaufklärer sahen sich darüber hinaus mit der Aufgabe konfrontiert, jene in persönlichen und medialen Netzwerken zirkulierenden, agrarischen Wissensangebote (neben sittlichen, epistemischen, medizinischen und anderen) an ländliche Bevölkerungen weiterzugeben.22
—————— rischen Schriftstellern gerade vorwirft, finden bei ihm bezeichnenderweise keine Erwähnung, siehe für eine Auflistung der Akademien Reichrath, Agrarwissenschaften, S. 63, 68.
20 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 75. 21 Böning/Siegert, Volksaufklärung, S. XXIVff., Popplow, Ökonomische Aufklärung. 22 Eine Zusammenstellung des »Verhaltensprogramms« der Volksaufklärung liefert
Heidrun Alzheimer-Haller in Alzheimer-Haller, Narrative Volksaufklärung, S. 352ff.
492 VERENA LEHMBROCK
Irlbeck entwarf demgegenüber das Negativbild eines Volksaufklärers, der äußerlich aus Menschenliebe handelte, um in Wahrheit mit seinen landwirtschaftlichen Schriften die eigene gescheiterte Existenz zu sanieren:
»Wir sehen […] immer solche große Gelehrte, und mitunter die berühmtesten Männer, denen Kaiser und Könige Auszeichnungen und Belohnungen spendeten, nach ihrer Verarmung und Vergantung ihrer Güter, wie Waaren-Musterreiter Länder durchziehen, auf den Dörfern herumschwärmen, um, Marktschreiern und Quacksalbern nicht unähnlich, hausirend ihre Geistesprodukte zu verkaufen, oder Bestellungen auf Subscription, lieber auf Pränumeration aufzusuchen, ja jedes Mittel ergreifen, um groß zu thun – leben zu können!! Mitleidig sieht der Bauer diese großen Pilger, die sich nur allein aus allgemeiner Menschenliebe der besseren Landwirthschaft opferten, um den Bauern reich und wohlhabend zu machen!! – Und auf diese großen Musterwirthschafter, die noch meistens alle Vorteile des Lebens: als guten Boden, Brauhäuser, Zehnten und dergleichen hatten, wird der Bauer hingewiesen!!!«23
Keine von diesen Personen habe sich je durch Landwirtschaft selbst ernährt und eine Wirtschaft unter den Bedingungen einer bäuerlichen Ökonomie geführt. Daher hielt Irlbeck nicht nur ihre Ratschläge für abwegig, sondern auch die Idee, Bauern sollten in Schulen durch jene Männer belehrt werden, die gewöhnlich nur »unbehülfliche Zuseher« der Bauern seien.24 Auch die zirkulierenden Inhalte seien nicht neu, über Stallfütterung beispielsweise brauche der bayrische Bauer überhaupt keine Aufklärung, da diese, je nach Futtervorrat, schon seit »unvordenklichen Zeiten« praktiziert werde.25 Als »Sachverständige« der Ökonomie lässt Irlbeck schließlich weder Gutsbesitzer noch Gelehrte, sondern allein erfahrene Bauern gelten, das heißt in seinen Worten Grundbesitzer, die einzig von der Landwirtschaft leben.26 Diese hätten die fortlaufende Transformation der Wirtschaftssysteme bereits weiter vorantreiben kön-nen, wäre dieser Prozess durch die Interventionen besagter Männer und durch sie beeinflusste Regierungen nicht unnötig verzögert worden. Irl-becks Anspruch eines bedingungslosen bäuerlichen Expertenstatus in Fra-gen der Landwirtschaft kulminiert schließlich in der Forderung nach poli-tischer Partizipation: Bauern sollten in landwirtschaftlichen Fragen konsul-
—————— 23 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. IXf. 24 Ebd., S. V, ders., Landwirthschaft, Bd. 2, S. 75. 25 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. IX. 26 »Gewerbe treibende Bürger, Bräuer und Gutsherren« zählt er nicht dazu, obwohl diese
oft große Wirtschaften besäßen, von denen sie jedoch meist wenig Ahnung hätten, Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XII.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 493
tiert werden und wie andere Gelehrte für die Weitergabe ihrer Kenntnisse und Erfahrungen bezahlt werden. Auf nationaler Ebene wäre der Wirtschaft ebenso erst dann nachhaltig geholfen, wenn Bauern sowohl in lokalen Gremien – etwa im landwirtschaftlichen Verein – als auch auf Regie-rungsebene, namentlich mit mehreren Geheimräten und zumindest einem Minister, vertreten seien.27
Wie ist Irlbecks negative Perspektive auf Volksaufklärung und Öko-nomische Aufklärung historiographisch einzuordnen und in welchem Stil war sie aufgebaut?
2. Irlbecks Symmetrieforderung und deren historiographische Bedeutung
Auf einer literarischen Ebene bricht Irlbecks Text ein Schweigen, denn das Missverhältnis zwischen volksaufklärerischen und bäuerlichen Textquellen könnte in der Überlieferungssituation nicht größer sein. Aus der Zeit etwa zwischen 1750 und 1850 sind dank Reinhart Siegerts und Holger Bönings fortlaufender Bio-Bibliographie derzeit über 20.000 deutschsprachige volksaufklärerische Schriften in teils hohen Auflagen bekannt.28 Über die eigene Profession schreibende Bauern stellen demgegenüber rare Einzel-fälle dar. Agrarwissen begegnet Historiker/innen, wenn sie sich an Texte und Propositionen halten, in der Regel nicht aus der Sicht von Bauern und Bäuerinnen, Mägden, Tagelöhnern oder Dorfhandwerkern.29 Irlbeck, der über Landwirtschaft geschrieben hat, hebt diese ausgeprägte Asymmetrie in der Überlieferungssituation zumindest punktuell auf. Sein Fall ist nicht —————— 27 Würden Bauern Ratschläge schriftlich aufsetzen, wären die »kostspieligen Kultur-Ideen«
laut Irlbeck schnell vom Markt verschwunden, Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XXXVIII, 114. Siehe hierzu Ursula Schludes grundsätzliche Überlegungen zum Thema Agrarexpertise und Schriftlichkeit in Schlude, Naturwissen.
28 Böning/Siegert, Volksaufklärung (weitere Bände folgen, es besteht eine Projektdaten-bank).
29 Die Historiographie kennt jedoch einige Publikationen, meist Autobiographien, von Bauern wie Ulrich Bräker, Jacob Gujer-Kleinjogg, Johann Georg Pahlitzsch u.a. sowie bäuerliche Rechnungs- und Tagebücher als Quelle, siehe Böning/Siegert, Volks-aufklärung, Bd. 2, S. XXXIVf. Eine Zusammenstellung bäuerlicher Tagebuchquellen findet sich in Peters, Pflug und Gänsekiel, Forschungsarbeiten zu Rechnungs- und Tage-büchern in Lorenzen-Schmidt/Poulsen, Writing peasants, den Forschungsstand über-blickend Lorenzen-Schmidt, Schreibebücher.
494 VERENA LEHMBROCK
zuletzt deshalb bemerkenswert, weil er sich der gleichen sprachlichen Mittel bediente wie die übrigen ökonomischen Aufklärer – und damit stellte er historiographisch einen regelrechten Diskursteilnehmer dar.30
Die Aushandlung von Wissensansprüchen vollzog sich nicht nur bei Irlbeck, sondern bei allen ökonomischen Aufklärern in polemischer Weise, indem das eigene Wissen mit verschiedenen Strategien auf- und das der Gegner abgewertet wurde. Inwiefern Mitglieder der ländlichen Gesellschaft mit der Figur des »gemeinen Bauern« objektiviert wurden, wird weiter unten noch zu sehen sein. Auch Irlbeck pauschalisierte Akteure der Öko-nomischen Aufklärung mittels einer rhetorischen Figur – der Figur des »landwirtschaftlichen Schriftstellers«. Seine Gutachter warfen ihm deshalb zu Recht vor, dass er nicht zwischen guten und schlechten Büchern differenziert hatte, wenngleich sie ihm zugestanden, dass es in der Tat viele schlechte Bücher gab. Es läge jedoch in Irlbecks eigener Verantwortung, wenn er das »Halbwissen« und die »elenden Produkte dieser Schmierer« für wahr halte.31
Irlbecks Schlacht mit gleichen Mitteln erhält aus heutiger Sicht eine ethische Dimension, indem sein polemischer Eintritt in die Diskussion auch als das Einfordern einer grundsätzlichen Gleichberechtigung gelesen werden kann. Als wäre der Autor in der Kulturanthropologie oder Wis-senssoziologie des 20. Jahrhunderts geschult, stellte er konsequent Symmetrien zwischen seiner Position und der von anderen ökonomischen Aufklärern her. Dabei kehrte er eine politisch wie kulturell verankerte Hierarchie auf dem Feld der ökonomischen Expertise – im Reich des Wissens – sogar um.32 Dies zeigt exemplarisch der folgende von ihm angestellte Vergleich: Wenn Staatsbeamte, falsch informiert durch ökon-omische Schriften, Dorfbewohnern pauschal Kleeanbau raten würden, dann sei dies vergleichbar mit einer Situation, in der Bauern einem besoldeten Beamten, der über dürftiges Einkommen klagt, raten, er solle sein Jahreseinkommen so lange anlegen und nicht anrühren, bis das gesparte Kapital derart hohe Zinsen abwirft, dass er gut davon leben könne. Dieser Vorschlag sei durchaus sehr nützlich, es läge nur an den
—————— 30 Mehr zu den Subfraktionen der ökonomischen Aufklärer in Brakensiek, Feld der
Agrarreformen, speziell zur Position einer kameralistischen Landwirtschaftslehre siehe Lehmbrock, Nische.
31 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XVII, XXI. 32 Zum Symmetriepostulat im wissenssoziologischen strong programme siehe Bloor, Knowledge.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 495
»halsstarrigen Beamten«, wenn sie ihn nicht umsetzen würden.33 Es ist deutlich geworden, worauf Irlbeck hinaus wollte: In der Landwirtschaft waren ihm zufolge Bauern, und nicht Beamte, als Experten zu betrachten.34
Ist die Volksaufklärung von der Produzentenseite her – hinsichtlich ihrer Akteure, der literarischen Strategien, Wirkungsabsichten oder Pu-blikations- und Distributionspraktiken – inzwischen intensiv erforscht worden,35 so stellt die Rezeptionsseite ein Desiderat dar, das in die Frage mündet, ob das Wissen bei den Bauern angekommen sei.36 Ist Irlbecks un-differenzierte und polemisch zugespitzte Sicht im Vergleich der Positionen kaum aufrechtzuerhalten, so stellt sie aber doch ein wertvolles Korrektiv zu den ungleich stärkeren aufklärerischen Invektiven gegenüber Bauern und einer bäuerlichen Ökonomie dar. Aus seiner Sicht steht nicht das Wissen der Bauern in Frage, sondern jenes der Volksaufklärer: Wenn es um Agrarwissen im engeren Sinn gehen soll, dann fragt sich mit Irlbeck weniger, ob das Wissen bei den Bauern angekommen sei, sondern viel-mehr, ob es das aufklärerische Wissen wert war bei den Bauern an-zukommen. Die im Metadiskurs der Aufklärer verbreitete Frage, warum Bauern auf ihren Überzeugungen beharrten, obwohl gebildete Männer ihnen ein vermeintlich besseres Wissen über Landwirtschaft anboten, wird, wenn nicht ad absurdum geführt, so doch deutlich relativiert. Sein Text suggeriert ja gerade, dass reformfreudige Bauern allzu bereit waren, Vorschläge aus der ökonomischen Aufklärungsliteratur in die Praxis um-zusetzen. Eine durch Irlbeck inspirierte Forschung müsste deshalb ver-stärkt die Qualität und die Herkunft dieser Wissensinhalte thematisieren. Wo kam das Wissen ursprünglich her, welches in ökonomischen Texten zirkulierte und massenhaft reproduziert wurde? Mit Blick auf die Öko-nomische Aufklärung en gros erzeugt Irlbecks Position ein grundsätzliches Staunen: Warum und unter welchen Umständen kamen Volksaufklärer – vor allem jene ohne eigene landwirtschaftliche Erfahrung – auf die Idee, in einer Domäne, die nicht ihre war, Ratschläge zu erteilen?
—————— 33 Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. XIf. 34 Resigniert stellte er fest: »Der Schuster hat seine Lernjahre und der Kaminfeger
desgleichen, aber in der großen Wissenschaft der Landwirthschaft will jeder elende Stümper ein Sachverständiger seyn.« Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 90.
35 Siehe zusammenfassend Werner Greiling in Greiling, Gemeinnützigkeit. 36 Ebd., S. 243f.
496 VERENA LEHMBROCK
3. Dialektik der historischen und der historiographischen Perspektiven
Können wir Irlbeck glauben, dass er nicht der einzige Bauer war, der reformfreudig wirtschaftete? Sein progressives Selbstbild steht immerhin in einem scharfen Kontrast zu gängigen Bauernbildern der Aufklärung, welche einen traditionsverhafteten, »abergläubischen« und widerständigen Bauern zeichnen.37
Eine Relativierung jener Bauernbilder geht auf historiographischer Ebene insbesondere von der Agrargeschichte aus. Bestärkt die Volks-aufklärungsforschung zumindest indirekt das Selbstbild volksaufklä-rerischer Akteure und damit eine gewisse Geringschätzung der bäuerlichen Ökonomie, so tritt die Agrargeschichte indirekt als Fürsprecher der länd-lichen Gesellschaft und ihrer Akteure und damit kritisch gegenüber auf-klärerischen Invektiven auf.38 Beide Forschungsfelder stehen, mit anderen Worten, in einem positiven, affirmativen Verhältnis zu ihrem jeweiligen Gegenstand und damit in einem gewissen Widerspruch zueinander.
Eine prominente agrarhistorische These, welche mit Blick auf Irlbeck relevant erscheint, formulierte besonders deutlich Michael Kopsidis: Wachstum und Fortschritt, das heißt Ertrags- und Produktivitätszuwächse der Landwirtschaft in Vormoderne und Sattelzeit, seien kaum oder gar nicht auf intellektuelle oder administrative Interventionen zurückzuführen. Mit anderen Worten: Die Bemühungen der Aufklärer hatten, sofern sie von ›außen‹ kamen, keinen Effekt auf die Agrarentwicklung. Alle »Ressour-cen für Agrarwachstum, von der Arbeit bis zum Wissen« kamen statt-dessen, so Kopsidis, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts »immer noch aus dem landwirtschaftlichen Sektor selbst« und wurden mit den Mitteln tra-ditioneller, vorindustrieller Technologie erreicht.39 Diese These erscheint nun völlig kontraintuitiv aus einer imaginierten Sicht historischer Aufklärer, denn das Fortschritt versprechende Wissen lag ihnen zufolge im Gegenteil gerade nicht in der ländlichen, sondern in der Aufklärungs-
—————— 37 Siehe den Tagungsband Münkel/Uekötter, Bild des Bauern. 38 Werner Trossbach listet eine Reihe von Studien auf in Trossbach, Beharrung und
Wandel, S. 128ff. Siehe auch direkt zur Konfrontation von aufklärerischen Tra-ditionalismusvorwürfen mit agrarhistorischen Befunden Zimmermann, Traditio-nalismus. Grundsätzliche Kritik am Bauernbild als Fremdzuschreibung lieferte Kearney, Peasantry.
39 Kopsidis, Agrarentwicklung, S. 9.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 497
gesellschaft. Es liegt offenbar ein Widerspruch zwischen verschiedenen Interpretationen vor, die wiederum auf verschiedenen Quellsorten beruhen – jenen der historischen Aufklärer, jenen der Aufklärungshistoriographie sowie jenen der Agrarhistoriographie. Quellen einer wirtschaftsgeschicht-lich orientierten Agrargeschichte sind in der Regel – anders als die der Aufklärungsforschung – nicht narrativer, sondern cliometrischer Art: Schatzungsregister, Parzellkataster, Erntestatistiken. Ausgehend von em-pirischen Datenmengen, die daraus erhoben werden, rekonstruieren und interpretieren Agrarhistoriker/innen die historische Agrarentwicklung jeweils für den konkreten Fall – für einzelne Regionen bis hin zu einzelnen Dörfern. Relevant für die hier verfolgte Fragestellung ist, dass durch agrarhistorische Forschungen dieser Art Irlbecks Perspektive bestärkt wird. Denn basierend auf Lokalstudien sind aufklärerisch-negative Bauernbilder, insbesondere der darin liegende Traditionalismusvorwurf, von der Agrar-geschichte vielfältig kritisiert und zurückgewiesen worden. Innovative landwirtschaftliche Praktiken wurden, so das sich häufende Fazit aus Ein-zelstudien, je nach Agrarverfassung und Marktanbindung der Region, häufig gerade von bäuerlichen, kleinbäuerlichen oder auch unterbäuer-lichen Schichten mit sehr kleinen Anbauflächen zuerst als Chance wahr-genommen.40 Maßgebliche Innovationen wie die Bebauung der Brache erforderten, so Kopsidis, vor allem eine Intensivierung des Faktors Arbeit, welche im Allgemeinen von bäuerlichen Familienbetrieben am ehesten er-bracht werden konnte. Es sei deshalb zweifelhaft
»ob sich überhaupt Hinweise finden lassen, dass außerökonomische Zielsetzungen bäuerlichen Wirtschaftens mit ökonomischer Rationalität in Konflikt gerieten, Wirtschaftswachstum behinderten und somit als ökonomischer Faktor wirksam waren. Bisher konnte für Europa im 18. und 19. Jahrhundert noch kein Beispiel gefunden werden, dass fehlende ›Marktgesinnung‹ die Wahrnehmung von Marktchancen behinderte und sich der Prozeß der Marktintegration verzögerte.«41
Im Detail betrachtet können freilich für jede Region, zum Teil sogar für jedes Dorf, unterschiedliche Gruppen als besonders innovationsfreudig identifiziert werden.42 Ein besonderes Merkmal der von Kopsidis
—————— 40 Einen solchen Fall beschreibt Niels Grüne für die badische Rheinpfalz in Grüne, Dorf-
gesellschaft. 41 Kopsidis, Westfalen, S. 73. 42 Gunter Mahlerwein zeigte beispielsweise für Rheinhessen, dass bestimmte Agrar-
innovationen (Gipsdüngung, Branntweinbrennerei u.a.) zunächst von mennonitischen Familien als Pionieren ausgingen und von dörflichen Oberschichten nachgeahmt wur-
498 VERENA LEHMBROCK
vertretenen Agrargeschichtsforschung ist, dass historisches Wirtschafts-handeln ganz ohne die Kategorie der »Mentalität« erklärt wird. Sowohl progressives als auch konservatives Verhalten wird allein mit Bezug auf demographische sowie marktökonomische Faktoren als vorteilsuchendes Handeln beschrieben.43
Diese historiographische Perspektive steht, wie im nächsten Abschnitt zu sehen sein wird, in einem scharfen Gegensatz zu einem verbreiteten Erklärungsmuster innerhalb der ökonomischen und vor allem der volksaufklärerischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Diesem Muster zufolge war es nämlich in erster Linie eine Verhaltensdisposition der Bauern – eine vermeintlich bäuerliche Irrationalität –, die den agrarischen Fortschritt verhinderte.44
Auch Irlbeck war grundsätzlich an einer Information der Dorfbe-völkerungen mit Blick auf persönlichen und staatlichen Wohlstand interessiert.45 Jedoch befand er, dass den meisten Autoren das nötige A-
—————— den. Die Aufhebung der kollektiv genutzten Flächen wurde dagegen eher von dörflichen Unterschichten vorangetrieben, siehe Mahlerwein, Herren im Dorf, S. 246–262. Zu einem anderen Ergebnis kam Stefan Brakensiek für Nordwestdeutschland, wo Bauern, jedoch nicht dörfliche Unterschichten von der Aufhebung der Kollektivflächen profitierten, siehe Brakensiek, Agrarreform, S. 432ff.
43 Einen Überblick zu älteren und neueren theoretischen Erklärungsansätzen zur Agrarentwicklung gibt ebenfalls Kopsidis in Kopsidis, Agrarentwicklung, S. 65ff. Vgl. aber Plumpe, Ökonomisches Denken. Plumpe kritisiert eine neoklassisch argumentierende, den homo oeconomicus unterstellende Wirtschaftsgeschichte als zu einseitig, um der Komplexität wirtschaftlicher Entwicklung gerecht zu werden.
44 Zum selbst auferlegten Programm der Volksaufklärer gehörte demnach die »Be-kämpfung herkömmlichen Aberglaubens« und eine Einwirkung auf die »Mentalität« der Bevölkerung, um »den Benachteiligten zu einer weiteren Entfaltung ihrer Persönlichkeit und der in ihr angelegten menschlichen Möglichkeiten zu verhelfen, andererseits aber durch Verhaltensänderung zur Lösung von brennenden Problemen der Zeit (ins-besondere zur Bewältigung der durch eine Bevölkerungsexplosion eingetretenen Knappheit an Nahrungsmitteln und Energie) beizutragen.« Böning/Siegert, Volks-aufklärung, S. XXVII. Während diese Kernthemen erhalten blieben, erweiterte sich das Themenspektrum laut Siegert ab 1780 mit juristischen, historischen, politischen und zum Teil auch emanzipatorischen Wissensangeboten, ebd., S. XXVIIIff. Zum Kern-bestand des Wissenstransfers bemerkt auch Alzheimer-Haller, dass es Volksaufklärern »vor allem um die Beeinflussung und Veränderung der Mentalität [ging]: auch das Volk sollte – aus wohlverstandenem gesamtgesellschaftlichen Interesse – in die Lage versetzt werden, seine Lebensverhältnisse nach vernünftigen Prinzipien zu gestalten und zu verbessern.« Alzheimer-Haller, Narrative Volksaufklärung, S. 28. In Böning/Schmitt/ Siegert, Reformbewegung, S. 9f. sprechen die Herausgeber dagegen Distanz einnehmend von Prinzipien, »die die Aufklärer als vernünftig anerkannten«.
45 Vgl. Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 2, S. 102.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 499
grarwissen dazu fehlte und die wahren Experten der Landwirtschaft nicht gehört, ja ignoriert wurden: »Landwirthschafts-Gelehrte« seien »in ihrer Wissenschaft schon so weit gekommen, dass sie dem Bauer geradweg alle Seelenkräfte zur Beobachtung und Beurtheilung seines Faches absprechen, und eine mechanische Maschine in ihm finden, die nur nach dem Schlen-drian des alten Herkommen getrieben wird.«46
4. Der »einfache Bauer« als Symbol des Nichtwissens: eine volksaufklärerische Perspektive
Michael Irlbeck hatte sich, wie oben gesehen, in seiner Polemik nicht gegen einzelne Personen gerichtet und konkret keinen einzigen Schriftsteller in seiner Kritik namentlich benannt. Er richtete sich, so scheint es, gegen den allgemeinen Gestus einer ganzen Bewegung. Einer der Vorteile einer diskurs-geschichtlichen Methodik besteht darin, über die Auswertung vieler und im Idealfall serieller Quellen Phänomene wie das eines allgemeinen Gestus erfassen zu können. Welche Argumente, Werte oder Abgrenzungen tauchen in den untersuchten historischen Aussagegefügen immer wieder auf? Welche Verschiebungen sind über die Zeit zu verzeichnen?47 Bei der Auswertung zweier Zeitschriften der Volksaufklärung bin ich diesem Forschungsansatz gefolgt, ohne dabei individuelle Volksaufklärer mit den dominanten Zügen dieser historischen Wissensordnung vollständig iden-tifizieren zu wollen.48 Bezogen auf individuelle Aktivitäten, Motive oder Interessen von Einzelpersönlichkeiten stellt die Herausarbeitung einer allgemeinen Perspektive der Aufklärer eine grobe Abstraktion dar. Nichts-destotrotz liegt in jener medial konstituierten und überindividuellen Per-spektive selbst eine historische Wirklichkeit, mithin ein historisches Rollen-muster vor, welches kollektiv erschaffen wurde. Die Vielzahl der Autoren
—————— 46 Diese »einzige Darstellung« bringe jedoch, so holt Irlbeck zum Gegenschlag aus, die
»gänzliche Unwissenheit« jener Männer »in einem Fache zur Schau, worin sie als Gelehrte auftreten wollen«. Irlbeck, Landwirthschaft, Bd. 1, S. VI.
47 Landwehr, Historische Diskursanalyse. 48 Siehe zum Stand der Diskursanalyse resümierend Sarasin, Diskursanalyse. Zur Mög-
lichkeit einer Wissensgeschichte über Sprachanalyse siehe Breidbach, Wissensordnungen, S. 152. Zu Begriffen und Methoden siehe Bührmann/Schneider, Dispositivanalyse. Ob die in Diskursen nicht direkt zur Geltung gekommenen Stimmen überhaupt indirekt rekon-struiert werden können, bezweifelte Gayatri Spivak, u.a. in Spivak, Subaltern.
500 VERENA LEHMBROCK
macht aus den Zeitschriften diesbezüglich eine besonders aussagekräftige Quelle. Dies gilt insbesondere für die Leipziger Wochenschrift Der Fleißige und Fröhliche Wirthschaftsmann, die zwischen 1811 und 1812 über 100 Mal erschien und nach eigenen Angaben bereits in der vierten Woche mehr als 20.000 Leser hatte.49 Der Wirthschaftsmann generierte seine Inhalte zum Teil über Zuschriften, die aus so weit entfernten Orten wie beispielsweise Bres-lau kamen. Die Zuschriften wurden durch den Herausgeber Friedrich Pohl gesichtet und häufig mit seinen Kommentaren veröffentlicht. Das weniger umfangreiche Braunschweiger Blatt Der Wirth und die Wirthin von 1756/57 war eine der frühesten periodischen Schriften mit volksaufklärerischem Anspruch.50 Insgesamt ist allerdings wenig über diese Schrift bekannt. Quelleninternen Informationen nach scheinen die Artikel von einem klei-nen Redakteursteam und dessen engerem Bekanntenkreis geschrieben wor-den zu sein. Einige Artikel sind als Zuschriften gekennzeichnet, wobei ihre Einbettung in die Gesamtdramaturgie der Inhalte eine Inszenierung dieser Artikel als Zuschriften nahe legt. Welche Elemente einer allgemeinen Wis-senspolitik können aus diesem Material herausgearbeitet werden? Und können diese den Aufruhr Irlbecks erklären?
5. Verbesserung der Menschen: Bauernbilder
In beiden Bauernzeitschriften ist durchgängig festzustellen, dass ihre Autoren die agrarischen Verhältnisse, ob am Erscheinungsort der Schrift, am Wohnort des Autors oder auf einer allgemeineren Ebene, selten thematisieren.51 Bäuerliche Ökonomien erscheinen in den Zeitschriften-artikeln somit losgelöst von grundherrlichen und gemeindlichen Besitz-,
—————— 49 Wirtschaftsmann, Bd. 1, S. 113. Böning und Siegert werten den Wirthschaftsmann in ihrer
Projektdatenbank als »herausragende Volksschrift«, die aufgrund ihres großen Themen-spektrums, einer klaren aufklärerischen Tendenz sowie ihrer literarischen Formenvielfalt insgesamt »reprintwürdig« sei.
50 Böning/Siegert, Volksaufklärung, S. XXXVf. 51 Das tendenzielle Ausblenden agrarpolitischer Strukturen und Probleme ist für das
gesamte Schrifttum der Ökonomischen Aufklärung kennzeichnend, so dass diese in den Worten Popplows »nicht zuletzt als ein frühes Beispiel für Versuche gelten [kann], gesellschaftliche Problemstellungen durch technische Innovation zu lösen, ohne kon-fliktträchtige soziale Konstellationen antasten zu müssen«. Popplow, Ökonomische Auf-klärung, S. 19.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 501
Rechts- und Ordnungsverhältnissen. Eine Einbettung in jene Strukturen wird dementsprechend selten als Hindernis für eine Verbesserung der Landwirtschaft wahrgenommen (dazu stehen die politischen Streitschriften des bekannten Schubart Edler vom Kleefelde – dies sei nur am Rand bemerkt – in einem scharfen Kontrast). Vielmehr sind es in den Artikeln die Menschen. oder genauer ist es der Charakter der Bauern und Bäue-rinnen, an den das Schicksal der Agrarentwicklung geknüpft wird. In Der Wirth und die Wirthin heißt es: Die »thörichte Liebe zu dem Alten, Aber-glaube, Unverstand und Trägheit« der Bauern seien die »gewöhnlichsten Hindernisse« der landwirtschaftlichen Entwicklung. Neben einer Vielzahl von negativen Kategorien, zum Beispiel Faulheit statt Fleiß oder Diszi-plinlosigkeit statt Gehorsam, stehen häufig Sinnesorgane und Verstand der Adressat/innen unter Verdacht: Die »Wahrheiten der Wissenschaften« werden von den »rohen Sudelwirthen« nicht »geachtet und am wenigsten ausgeübt«. Der »nur sinnlich« lebende, »seichte« und »schläfrige« Bauer sehe »alles mit verkehrten Augen«, er lege »schlechtes Nachdenken« und »Widerspänstigkeit gegen allen guthen Rath und Unterricht« an den Tag. Generell bemühe sich der Bauer, der an seinen »Vexierbrillen« festhalte, zeitlebens »dumm zu bleiben«.52 Bauern und Bäuerinnen wird in diesen Artikeln eine grundsätzlich verkehrte Sicht der Dinge zugeschrieben, welche ökonomisches Fehlverhalten nach sich ziehe: »Vermöge dieser Vexierbrillen, fehlt es unsern Bauern auch wirklich am Lande und Zeit, Futter zu bauen und zu sammeln, und dennoch hätte er genug Zeit, genug Land, genug Futterpflanzen […]«, wenn er nicht »durch die Brille des alten Herkommens und muthwilliger Unwissenheit, oder dummen Einfalt, oder gar der Nachläßigkeit, und Widerspänstigkeit gegen alle Anweiseung seine ganze Wirthschaft ansähe.«53
Der »Sudelwirth« in Der Wirth und die Wirthin zeichnet ein Bauernbild, dessen Negativprägung kaum noch zu übertreffen ist, und dessen Fehler und Mängel vor allem kognitiver Art sind. Der Sudelwirt als epistemische Negativfigur steht indes in einem krassen Gegensatz zum erklärten An-spruch der Ökonomischen Aufklärung, ein ›vernünftiges‹ bzw. wissen-schaftliches landwirtschaftliches Wissensfeld zu begründen. Der »Sudel-
—————— 52 Wirth und Wirthin, 1757, S. 35, 117, 123, 130f., 135, 137, 141. Nicht zuletzt die Stabilität
dieser häufig wiederkehrenden Charakterisierungen deutet auf einen homogenen Autorenstamm hin. Bezeichnenderweise werden in einem Artikel, der als Zuschrift eines Bauern inszeniert ist, die härtesten Urteile gegenüber Bauern geäußert, siehe ebd., S. 131.
53 Ebd., S. 134f.
502 VERENA LEHMBROCK
wirth« schien sich dagegen vom Wissen, zumal von einem gelehrten Wissen, meilenweit entfernt zu befinden. Dergestalt verbannt in eine Sphäre des Nichtwissens wird dieser Bauernfigur von dort aus auch Kritik zugeschrieben, etwa wenn es heißt, dass der Sudelwirt berühmte Gelehrte verspotte, indem er ihnen die Namen »Federwirth« oder »Wirthe aus Büchern« gebe.54 »Sudelwirthe« behaupteten, so ein Autor, mit »einer weis-heitsvollen Miene, die sich so wenig zu ihren übrigen rohen Gesichtszügen schickt«, das Bücherlesen sei »unnöthig, unnütze, es wären Grillen, mü-ßiger Köpfe«.55
Vergleicht man diese negativ gezeichnete, geschmähte, aber auch kritikfähige Bauernfigur der 1750er Jahre, die auf ihrer eigenen Vexierbrille beharrt, mit Bauernfiguren, die 60 Jahre später im Fleißigen und Fröhlichen Wirthschaftsmann erscheinen, so ergeben sich zwar einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede: In der späteren Zeitschrift fehlt eine eindeutige epistemische Negativfigur, stattdessen findet sich eine aufgesplitterte Ty-pologie landwirtschaftlicher Praktiker, in der »Bauern« vergleichsweise seltener gegenüber dem »Landmann« und »Landwirth« auftreten. Nicht zuletzt in der offiziellen Ausrichtung des Blattes auf »gebildete Landleute und Hauswirthe« gründet diese zuweilen wie eine bewusste Sprachpolitik erscheinende Begriffsverwendung, die Autoren im Einzelfall zwingt zu spezifizieren, ob sie sich auf einen »gemeinen« oder den »edelsten Theil« der Landwirte beziehen.56 Die Figur des Landmanns ohne spezifizierende Attribute ist ambivalent, sie kann Bauern, aber auch Verwalter großer Güter oder Rittergutsbesitzer meinen.
In zahlreichen Umschreibungen deckt sich jedoch der »Landmann« mit der Figur des früheren Sudelwirtes als einfachem Bauern, beispielsweise wenn er dem so genannten »Schlendrian« verhaftet ist, seinen Vätern und Großvätern, das heißt den »Erfahrungssätzen der Vorzeit« sowie dem Kalender vertraut, die Landwirtschaft mit »trüben Augen«, »verblendet« und »mechanisch« betreibt und von landwirtschaftlichen Gegenständen lediglich einen »dunklen Begriff« hat.57 In derartigen Charakterisierungen findet sich eine ähnliche Metaphorik des Nichtwissens in Form einer
—————— 54 Ebd., S. 36, 56. 55 Ebd., S. 56. 56 Wirthschaftsmann, Bd. 1, S. 622f., Wirthschaftsmann, Bd. 2, S. 1218. 57 Wirthschaftsmann, Bd. 1, S. 110, 228, 729, Wirthschaftsmann, Bd. 2, S. 1219, 1357, 1450.
Dieser Befund deckt sich zum Teil mit jenem von Frank Konersmann, demnach »gemeiner Landmann« häufig synonym mit »einfacher Bauer« gebraucht wurde. Ko-nersmann, Bauern, S. 83.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 503
getrübten oder verdunkelten Sicht. Der »Landmann« ist jedoch im Ver-gleich zur älteren Bauernfigur, dem Sudelwirt, vergleichsweise stumm – er trotzt nicht, kritisiert nicht, er beharrt zwar auf auch passiv auf seinem Wissen, jedoch wird ihm keine direkte Gelehrtenkritik in den Mund gelegt. Analog zu seiner moderateren Charakterisierung, und dies markiert einen bedeutsamen Wandel innerhalb des volksaufklärerischen Diskurses bzw. allgemein im aufklärerischen Menschenbild, gilt der »Landmann« auch nicht mehr in vergleichbarer Weise als unbelehrbar und gefangen in seiner eigenen epistemischen Sphäre.58 Neu ist in den 1810er Jahren außerdem, dass eine weitere, positiv gezeichnete landwirtschaftliche Symbolfigur in Gestalt des »denkenden Landwirths« hinzutritt. Der »denkende« (manch-mal auch »wissenschaftliche«) Landwirt repräsentiert als Idealvorstellung einen aufgeklärten, reformorientierten und lernwilligen Agrarproduzenten im Gegensatz zum gemeinen »Landmann« oder »Bauern«.59 Mit dieser neuen Figur verbindet sich das pädagogische Ziel und der Anspruch der Zeitschrift, welches darin besteht aus einfachen Männern wissenschaftliche Landwirte zu machen – durch Aufklärung und Wissenstransfer und im Idealfall mit der Unterstützung von Pfarrern, Gutsbesitzern, Landschul-lehrern und Amtsleuten.60 Die Gruppe der Praktikertypen im Fleißigen und Fröhlichen Wirthschaftsmann erscheint deshalb im Vergleich zur Figur des Sudelwirtes im Wirth und der Wirthin weitaus dynamischer und in einer sozial durchlässigeren Struktur. Während der »Sudelwirt« fast hermetisch in einer fernen Sphäre eingeschlossen bleibt, ist ein sozialer Aufstieg für den »Landmann« entlang gewisser Bildungsstufen bis hin zum so genannten —————— 58 Die Bildungsfähigkeit von Bauern grundsätzlich für möglich zu halten wurde in der
Volksaufklärungsforschung als eine wichtige Voraussetzung im Menschenbild der Auf-klärer herausgearbeitet, zum Beispiel von Alzheimer-Haller, Narrative Volksaufklärung, S. 47ff.
59 Wirthschaftsmann, Bd. 1, S. 338, Wirthschaftsmann, Bd. 2, S. 960f., 1429, 1447, 1452. Siehe auch Niels Grünes Befund, in dessen südwestdeutschen Quellen »Landmann« und »Landwirth« positiv abgrenzend gegenüber »Bauer« eingesetzt wurden. »Bauer« fungierte als »Chiffre für traditionalistische Abwehrreflexe«, der »Landwirth« dagegen als agra-rischer Zukunftsträger, Grüne, Taglöhner, S. 94f.
60 »Prediger und Schullehrer, Gutsbesitzer und Gerichtshalter« werden auf dem Titelblatt der Zeitschrift ausdrücklich als befördernde Mediatoren genannt. Das Abgleiten in die dritte Person und Sprechen über Bauern in zahlreichen Artikeln deutet darauf hin, dass Autoren neben dem »gebildeten Landmann« auch diese potentielle Lesergruppe mit im Auge hatten. Obgleich Geistliche nachweislich die größte Gruppe der Volksaufklärer ausmachten, stellen einige Fallstudien ihre Funktion als Sprachrohr der Volksaufklärung in Frage, siehe zum Beispiel Wyss, Pfarrer. Weitere Literaturangaben in Alzheimer-Haller, Narrative Volksaufklärung, S. 20.
504 VERENA LEHMBROCK
wissenschaftlichen Landwirt denkbar und vorgesehen. Dies bedeutet auch, darauf haben bereits Frank Konersmann und Niels Grüne hingewiesen, dass »Landmann« und insbesondere »Landwirth« nach 1810 eine sozial inkludierende Kategorie darstellt, die semantisch über dörfliche Sozial-strukturen und auch Standesgrenzen hinweg reichte.61
Neben diesen Differenzen im Detail gilt festzuhalten, dass in beiden Zeitschriften Verbesserung der Landwirtschaft in weiten Teilen gleich-bedeutend war mit der Vorstellung einer Verbesserung von Menschen.
6. Verbesserung der Wissenspraktiken: Gelehrtenbilder
Die oben skizzierte agrarhistorische Skepsis gegenüber intellektuellen Interventionen in die bäuerliche Ökonomie wird durch die außerordentlich negative Repräsentation von Bauern in Texten der Volksaufklärung eher noch verstärkt als gemildert. Sollten diese Texte ihren Gegenstand sowie ihre offiziellen Adressaten verfehlt haben und stattdessen lediglich Infor-mationen über die Autoren enthalten? Formen der Selbstreferenz, das heißt Passagen, in denen sich Autoren direkt oder indirekt auf ihre eigenen Angelegenheiten beziehen, lassen sich in der Tat auf verschiedenen Ebe-nen herausarbeiten. Sie sind zum einen in metadiskursiven Textteilen ent-halten, in denen Autoren in der dritten Person über Bauern sprechen, statt sich direkt an sie zu wenden. Der – explizite – bäuerliche Adressat tritt hinter einer anderen – impliziten – Leserschaft zurück, die in gleichge-sinnten Volksaufklärern, in potenziellen Mediatoren und womöglich auch in einem interessierten, nicht-bäuerlichen Lesepublikum bestand, das als Käufer der Zeitschriften in Frage kam.62
Selbstreferenzielle Momente finden sich jedoch nicht nur in der Form, sondern auch auf der Ebene der Inhalte. Da eine Verbesserung der Leser/innen neben sittlichen, medizinischen und religiösen Aspekten vor allem auch in kognitiver Hinsicht thematisiert wird, finden sich passend dazu viele epistemische Wissensangebote, in denen bestimmte Arten und Weisen, sich erkenntnismäßig mit dem Gegenstand der Landwirtschaft in
—————— 61 Konersmann, Bauern, S. 82 und Grüne, Taglöhner, S. 95. 62 Der Wirth und der Wirthin richtete sich nicht nur an Land-, sondern auch an so genannte
Stadtwirte, das heißt an »Künstler, Fabrikanten, Handwerker und gemeine Bürger«, Wirth und Wirthin, S. 10.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 505
Beziehung zu setzen, anempfohlen werden. Hierbei sind es nicht ökonomische Wissensinhalte, etwa wie viele Zoll tief gepflügt werden soll, sondern bestimmte Wissenspraktiken, die zum Gegenstand des in-tendierten Wissenstransfers werden.
In einem Artikel über Winterroggen im Fleißigen und fröhlichen Wirth-schaftsmann heißt es, der beste Ratgeber des Landwirtes sei das »Nach-denken an Ort und Stelle«, man müsse sich an »Aufmerksamkeit« gewöhnen, wozu das »Lesen der Bücher« sehr viel beitrage.63 Ein Artikel, dessen Autor bäuerliche Vorbehalte gegenüber so genannten märkischen Rüben kritisiert, ruft einleitend dazu auf von den Vätern ererbte Vorurteile aufzugeben und stattdessen »weiter nachzudenken« und »Gründe zu erforschen«. Missratene Versuche müssten »unparteyisch« geprüft und untersucht werden. »Wer nur Wahrheit sucht, und bey der Sache selbst seine fünf Sinne zusammennimmt«, wer es unternimmt seinen »Kopf an-zustrengen«, der finde sie.64 Hinzu kommt die Empfehlung des Messens, Wiegens und Abzählens. »Unter den gemeinen Landwirthen giebt es wohl wenige«, heißt es im Wirthschaftsmann 1812, »die eigentlich wissen, wie viel sie Futter dem Gewichte nach dem Vieh vorlegen. Sie glauben sich der Mühe des Abwiegens überheben zu können, indem sie meynen, daß dadurch die Futtervorräthe um kein Hälmchen größer würden, mithin es ohne Nutzen bliebe. […] Da wir [aber] Maaß und Gewichte haben«, schließt der Autor, »so muß man auch diese überall nützlichen Hülfsmittel fleißig anwenden«.65
In diesen Passagen, die zwischen einem Fünftel bis hin zur Hälfte der Artikel einnehmen können, werden – nach einer heutigen Terminologie – Wissenspraktiken beschrieben, die auf den ersten Blick als typische Ingredienzien einer praktischen Gelehrsamkeit erscheinen – Lesen, Nach-denken, Experimentieren und Messen.66 Es spricht einiges dafür, aus jenen Beschreibungen, die eine andere kognitive Haltung empfehlen, ein zeitge-nössisches Bild des gelehrten Naturforschers bzw. des gebildeten Naturliebhabers herauszulesen, welches den Autoren als Ressource ihrer Beschreibungen diente. Ein Autor, der Bauern einen »flüchtige[n], unachtsame[n] Anblick
—————— 63 Wirthschaftsmann, Bd. 2, S. 983f. 64 Wirthschaftsmann, Bd. 1, S. 729f. 65 Wirthschaftsmann, Bd. 3, S. 102. 66 Man beachte aber auch, welche gelehrten oder gebildeten Praktiken kaum oder gar nicht
empfohlen wurden, etwa das naturkundliche Sammeln, das Publizieren und die Selbst-organisation in Gesellschaften.
506 VERENA LEHMBROCK
der Werke der Natur« zuschreibt, nennt als bestes »Hilfsmittel« für eine bessere Naturbetrachtung explizit die Naturgeschichte. Diese mache mit den »Resultaten der aufmerksamen Naturbetrachtung bekannt« und würde dem Landmann nicht nur ökonomisch nutzen, sondern ihm auch den »Schleier von den Augen ziehen, durch den er bisher die Schönheiten seiner Umgebung, der Natur, nur wie im Dunkeln erblickte.«67 Mit anderen Worten: es war ein anderer, speziell ein gelehrter und gebildeter Blick auf die Natur, den Volksaufklärer ihren offiziellen Adressaten empfahlen. Inwiefern Vorstellungen von der Lebensform des gebildeten Natur-liebhabers, die sich zum Teil wohl auch mit der Lebensform der Autoren deckte, ihre Wahrnehmung zu strukturieren vermochten, darauf deutet folgendes Beispiel noch plastischer hin: Ein Autor bemerkt, er könne nicht begreifen, dass bäuerliche Familienväter, obwohl sie den Platz dazu hätten, sich keine Denkerstube einrichteten, wo sie in Ruhe nachdenken könnten, ungestört von Kindern und Gesinde: »wie soll man denken, wenn man sich nicht wenigstens Stunden lang allein befinden kann? Ich kenne viel Tausend Landleute, die Vermögen und Gelegenheit genug haben, um ein eignes Stübchen außer der allgemeinen Wohnstube zu besitzen, die aber nicht einmal den Wunsch darnach äußern, weil ihnen selbst die Geistes-bildung mangelt, welche uns lehrt, zweckmäßige Bequemlichkeiten zu finden.«68
Die Annahme einer völligen Abwesenheit von Praktiken des Beobach-tens, Nachdenkens, Experimentierens, Messens und zum Teil auch des Lesens in der ländlichen Gesellschaft ist, zumal bäuerliche Schreib- und Rechnungsbücher überliefert sind, grundsätzlich fraglich.69 Dennoch kommt diese Unterstellung – die streng betrachtet auch als eine Irra-tionalitätsunterstellung betrachtet werden kann – in vielen volksaufkläre-rischen Artikeln zum Ausdruck. Sie wird unter anderem dadurch trans-portiert, dass die Vermittlung einer vermeintlich anderen kognitiven
—————— 67 Wirthschaftsmann, Bd. 2, S. 1513f. Auf eine herausragende Rolle der sich herausbildenden
Naturwissenschaften im Zusammenhang mit der Volksaufklärung wiesen bereits Böning und Siegert hin, siehe Böning/Siegert, Volksaufklärung, S. XXIIf.
68 Wirthschaftsmann, Bd. 1, S. 627. 69 Inwiefern Praktiken der Naturbeobachtung und -manipulation in europäischen
Künstler- und Handwerkerstätten gelehrte Naturforschung im 16. und 17. Jahrhundert inspiriert haben, ist in mehreren Studien gezeigt worden, siehe zum Beispiel Smith, Artisan, und Long, Artisan/Practitioners. Für landwirtschaftliches Praxiswissen existiert eine derartige Verflechtungsuntersuchung meines Wissens nicht, siehe aber konzeptuelle Ansätze hierfür in Schlude, Naturwissen.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 507
Haltung in den Texten so viel Platz einnimmt. Während mangelnde »Geis-tesbildung« dem Autor im obigen Zitat als Ursache für den Verzicht auf das Stübchen gilt, werden andere Gründe, warum die Einrichtung einer Denkerstube unter den Bedingungen einer bäuerlichen Ökonomie – selbst mit »Geistesbildung« – wenig sinnvoll sein könnte, nicht thematisiert. Der Autor war, so würde eine kulturanthropologisch informierte, retrospektive Kritik lauten, allein nach Maßgabe seiner eigenen Kriterien bereit, einen Befund (keine Denkerstube) zu werten (mangels Geistesbildung), da er auf authentische Informationen aus dem Umfeld der bewerteten Personen selbst verzichtete. Diese Art des Nichtwissens, das heißt der fehlende Einbezug bäuerlicher Informanten und ihrer vernünftigen Gründe, führte in volksaufklärerischen Artikeln, so scheint es, häufig zu einem Kurz-schluss, demzufolge Akteure, die sich nicht nach Maßgabe der Vor-stellungen des Autors verhielten, als unvernünftig galten.70
7. Volksaufklärung als Grenzziehungspraxis
Ausgehend von den oben genannten Befunden möchte ich argumentieren, dass das Projekt der Volksaufklärung als eine gelehrte bzw. gebildete Grenzziehungspraxis interpretiert werden kann, insbesondere wenn diese im breiteren Kontext der Ökonomischen Aufklärung verortet wird.
Ein Anliegen der Ökonomischen Aufklärung bestand darin, Landwirt-schaft in einen wissenschaftlichen Gegenstand zu transformieren. Dass diese Transformation nicht allein eine epistemische, sondern – angesichts des sozialen Stigmas der Landwirtschaft als Gewerbe der Bauern – vor allem auch eine soziale Herausforderung war, liegt auf der Hand. Das Vorhaben, Landwirtschaft als Wissenschaft zu betreiben, ist auch in den volksaufklärerischen Artikeln allgegenwärtig. Der immer wiederkehrende Versuch, Bauern eine gelehrte Haltung gegenüber Landwirtschaft – wie gegenüber einem wissenschaftlichen Gegenstand – zu vermitteln, reflek-tiert in gewisser Weise die in der Ökonomischen Aufklärung zirkulierenden Vorstellungen darüber, wie man Landwirtschaft anders, namentlich wissen-
—————— 70 Siehe die instruktive Adaption der Kulturanthropologie für die science and technology studies
bei Latour, Science in action. Latour kommt zu dem Schluss, dass »[a]ll questions of irrationality are merely artefacts produced by the place from which they are raised.« Ebd., S. 185.
508 VERENA LEHMBROCK
schaftlich betreiben sollte. Dass die Gestalter dieser Wissensordnung ihre Vorstellungen in einem langwierigen Prozess erst synchronisieren mussten, wird leicht übersehen, wenn, ausgehend von den modernen Agrarwis-senschaften, eine Geschichte dieser Wissenschaftlichkeit auf Albrecht Daniel Thaer fokussiert, dessen Werk um 1800 jedoch weniger einen Ursprung, sondern vielmehr das Produkt einer Entwicklung darstellt. Im ganzen 18. Jahrhundert und auch nach 1800 war das Feld einer Land-wirtschaftswissenschaft noch kaum stabilisiert im Sinne einer modernen Disziplin. Gebildete Gutsbesitzer, Universitätsgelehrte und Vertreter der Thaerschen Lehre stritten weiterhin darüber, welche Form diese Wis-senschaft annehmen sollte.71
Negativfiguren des einfachen Bauern, die sich in allen ökonomischen Textgattungen finden, erhalten vor dem Hintergrund dieser wissenschafts-rhetorischen Dynamik eine mehrdeutige Funktion. Zum einen stellten sie für viele Autoren eine konstitutive Kontrastfolie dar, vor deren Hinter-grund die neue, noch zu konstruierende und zu stabilisierende Wissens-ordnung positiv hervortreten konnte. Zum anderen war der Ausschluss von Bauern und Bäuerinnen aus jenem normativen Prozess auch aus Gründen des sozialen Status angeraten: Der neu entstehende Wissens-körper sollte die Dignität einer gelehrten Wissenschaft erhalten, die von einer bäuerlichen Landwirtschaft deutlich unterschieden werden musste.72 Volksaufklärerische Texte können deshalb mit Blick auf die Schaffung einer wissenschaftlichen Ökonomie und ihrer Subjekte, der wissenschaft-lichen Ökonomen, als Dokumente sowie als Werkzeuge einer Selbstverge-wisserung gelesen werden. Die einhellige Ablehnung einer unterstellten bäuerlichen Wissensweise und die Affirmation eines Wissens, das ganz anders als jenes der Bauern sein sollte, erhielt vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Deutungskämpfe nicht zuletzt die Funktion eines klein-sten gemeinsamen Nenners, durch den sich ökonomische Aufklärer nach ›unten‹ hin abgrenzen und als Einheit verstehen konnten. Volksaufklärer im Speziellen drückten mit jener distanzierenden Geste statt einer Zu-gehörigkeit zur ländlichen Gesellschaft nicht zuletzt eine Zugehörigkeit zu
—————— 71 Siehe Thaers Rezension zum Buch eines kameralistischen Ökonomieprofessors: Thaer,
Weber. Zur inneren Differenzierung der »Agrarexperten« siehe Brakensiek, Feld der Agrarreformen.
72 Siehe zum Thema Angst vor »Verbauerung« unter Landgeistlichen mit Quellen- und Literaturangaben Alzheimer-Haller, Narrative Volksaufklärung, S. 86ff.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 509
dem epistemisch und sozial emporkommenden Wissensfeld einer Landwirtschaftswissenschaft aus.73
8. Resümee: Historisches Agrarwissen und dessen Erforschung
Im Versuch, Dimensionen des Agrarwissens im langen 18. Jahrhunderts zu erfassen, können aktuelle Forschungen auf breite Wissensbestände der bestehenden Historiographien zurückgreifen. Da der Fokus auf Agrar-wissen mehr Wissensträger/innen einschließt als etwa ein Fokus auf frühe Wissenschaftsinstitutionen, fordert er multiperspektivische Zugriffe he-raus: Was konnten Volksaufklärer, Bäuerinnen und Bauern, Naturgelehrte, Geistliche, Verwaltungsleute und alle anderen in die Landwirtschaft in-volvierten Personen vor dem Hintergrund ihrer professionellen Erfah-rungen wissen? Wie haben sich diese Wissensbestände zueinander verhal-ten und an welchen Stellen kam es zu Verzahnungen derselben? Irlbecks vom Standpunkt eines landwirtschaftlichen Praxiswissens ausgehende Kritik konnte, agrarhistorisch gestützt, Zweifel am Anspruch der Volksauf-klärer auf Agrarwissen im engeren Sinne erheben. Die kritische (Re)Kon-struktion einer volksaufklärerischen Perspektive konnte zeigen, inwiefern aber mit dem volksaufklärerischen Wissenskörper eine negative Vision bäuerlicher (Ir)Rationalität verstärkt wurde, die einen Ausschluss von bäuerlichen Experten aus dem Feld der entstehenden Landwirt-schaftswissenschaft begünstigte. Allerdings griff dieser Ausschluss nicht auf der Ebene der Wissensformen, denn im Lauf der Ökonomischen Aufklärung gewannen bekanntermaßen gerade jene gebildeten Akteure an Gewicht, die selbst – wie bäuerliche Praktiker/innen – Wirtschaften
—————— 73 Zu gegenläufigen diskursiven Strategien, die Landwirtschaft als intellektuellen Gegen-
stand aufwerteten, siehe Popplow, Ökonomische Aufklärung, und Forschungen zum Themenbereich Patriotismus und Gemeinnutz, etwa in Vierhaus, Patriotismus, und Holenstein, Nützliche Wissenschaft. Eine verstärkte Beachtung der sozialen Spannungsver-hältnisse zwischen gelehrten versus gebildeten Öffentlichkeiten regt Denise Phillips überzeugend an, siehe Phillips, Acolytes.
510 VERENA LEHMBROCK
führten und lokal gebundene, erfahrungsbasierte Wissensbestände generierten.74
Mit Blick auf Irlbeck fällt es gleichzeitig schwer anzunehmen, dass das Einnehmen einer gelehrt-gebildeten Sicht auf Landwirtschaft, wie es in Volksaufklärung und Ökonomischer Aufklärung praktiziert wurde, völlig effektlos an der ländlichen Gesellschaft vorbei gegangen sei. Die Öffent-lichkeiten, die der landwirtschaftliche Verein geschaffen hatte und in die sich Irlbeck mit seiner Publikationspraxis einzuklinken vermochte, die Art und Weise wie er sich das Vokabular der ökonomischen Literatur ange-eignet hatte, allein diese zwei Aspekte zeigen, inwiefern zumindest er von der Ökonomischen Aufklärung berührt wurde und sie in sein Selbstbild mit eingestrickt hatte.
Daran ließe sich abschließend der Vorschlag anbinden, die Geschichte des Agrarwissens als einen koproduktiven Prozess zu verstehen, für dessen Erforschung die Frage von zentraler Bedeutung wäre, inwiefern und an welchen Schnittstellen das Wissen der Aufklärer und jenes der Agrar-praktiker miteinander in Berührung kam und aufeinander reagierte.75
Literatur Alzheimer-Haller, Heidrun, Handbuch zur narrativen Volksaufklärung. Moralische Ge-
schichten 1780–1848, Berlin 2004. Bloor, David, Knowledge and social imagery, 2. Aufl., Chicago 1998. Böning, Holger/Hanno Schmitt/Reinhart Siegert, Volksaufklärung. Eine praktische
Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts (Presse und Geschichte – Neue Bei-träge 27), Bremen 2007.
Böning, Holger/Reinhart Siegert, Volksaufklärung. Biobibliographisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen Sprachraum von den Anfängen bis 1850, voraussichtlich 5 Bände, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, 2001.
—————— 74 Zu verweisen ist hier insbesondere auf die so genannten Experimentalökonomen und
den an ihre Praktiken anschließenden »ersten Agrarwissenschaftler« Albrecht Daniel Thaer.
75 Siehe auch Plumpes Modell von Wirtschaft als »koevolutivem Komplex« aus Semantiken (Bedeutungszuweisungen), Institutionen (Regeln und Sanktionen) und Prak-tiken (alltägliche Verfahrensweisen) in Plumpe, Ökonomisches Denken, S. 30, zur Me-thodik einer Wissensgeschichte des Agrarbereichs siehe auch Popplow, Ökonomische Aufklärung, S. 44ff.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 511
Brakensiek, Stefan, Agrarreform und ländliche Gesellschaft. Die Privatisierung der Marken in Nordwestdeutschland 1750–1850 (Forschungen zur Regionalgeschichte 1), Paderborn 1991.
Brakensiek, Stefan, »Das Feld der Agrarreformen um 1800«, in: Eric J. Eng-strom/Volker Hess/Ulrike Thoms (Hg.), Figurationen des Experten. Ambivalenzen der wissenschaftlichen Expertise im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert (Berliner Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte 7), Frankfurt/M. 2005, S. 101–122.
Braunschweigische Sammlungen von Oekonomischen Sachen als des einzeln herausgekommenen Wochenblatts der Wirth und die Wirthin, nebst einer Vorrede und Register, Braun-schweig/Hildesheim 1757.
Breidbach, Olaf, Neue Wissensordnungen. Wie aus Informationen und Nachrichten kultu-relles Wissen entsteht (Edition Unseld 10), Frankfurt/M. 2008.
Bührmann, Andrea D./Werner Schneider, Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einfüh-rung in die Dispositivanalyse, Bielefeld 2008.
Der fleißige und fröhliche Wirtschaftsmann oder der allgemeine Hausfreund für gebildete Landleute und Hauswirthe. In wöchentlichen Heften mit Kupferstichen. Unter Beförderung aller Herren Prediger und Schullehrer, Gutsbesitzer und Gerichtshalter, welche für das Wohl ihrer anvertrauten Gemeinde oder Unterthanen Sorge tragen, 4 Bände, Leipzig 1811/12.
Greiling, Werner, »Gemeinnützigkeit als Argument. Zur Publikationsstrategie der Volksaufklärung«, in: Holger Böning/Werner Greiling/Reinhart Siegert (Hg.), Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung (Presse und Geschichte 58/Philanthropismus und populäre Aufklä-rung 1), Bremen 2011, S. 239–258.
Groh, Dieter, Strategien, Zeit und Ressourcen. Risikominimierung, Unterpro-duktivität und Mußepräferenz – die zentralen Kategorien von Subsistenz-ökonomien, in: Jahreskongress Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Jg. 5 (1985) 27.10.2012 (letzter Aufruf), www.http: // retro.seals.ch/digbib/view?rid=sgw-001:1985:5::11&id=&id2=&id3=
Grüne, Niels, Dorfgesellschaft – Konflikerfahrung – Partizipationskultur. Sozialer Wandel und politische Kommunikation in Landgemeinden der badischen Rheinpfalz (1720–1850) (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 53), Stuttgart 2011.
Grüne, Niels, »Vom ›Taglöhner‹ zum ›Landwirth‹. Semantische Karrieren im sozialen Wandel südwestdeutscher Dorfgesellschaften des 18. und 19. Jahr-hunderts«, in: Daniela Münkel/Frank Uekötter (Hg.), Das Bild des Bauern. Selbst- und Fremdwahrnehmungen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert, Göttingen 2012, S. 85–107.
Harrecker, Stefanie, Der Landwirtschaftliche Verein in Bayern 1810–1870/71 (Schrif-tenreihe zur bayrischen Landesgeschichte 148), München 2006.
Holenstein, André (Hg.), Nützliche Wissenschaft und Ökonomie im Ancien Régime. Akteure, Themen, Kommunikationsformen (Cardanus 7), Heidelberg 2001.
Irlbeck, Michael, Das Wichtigste der dermaligen Landwirthschaft um sie zur höchsten Vollkommenheit zu bringen; besonders in der jetzigen unglücklichen Zeit. Ein unent-behrliches Hülfsbuch für Staatsmänner, Landwirthe, Gärtner und Gewerbsleute. Bisher das
512 VERENA LEHMBROCK
einzige in seiner Art. In drei Bändchen. Nach achtundzwanzigjährigen Beobachtungen und Erfahrungen bearbeitet von Michael Irlbeck, wirklichem, und wegen glücklichen Kulturen auf das Ausgezeichnetste gerichtlich attestirtem Bauer und Mitglied der praktischen Gar-tenbau-Gesellschaft in Bayern, 3 Bde., Augsburg 1834.
Irlbeck, Michael, Vollständiger Unterricht über Flachsbau und Leinwandfabrikation. Nach den neuesten Verbesserungen und […] Erfahrungen, mit besonderer Rücksicht auf Bayern, Augsburg 1836.
Kaak, Heinrich, »Agrarpionier/in«, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 1, Stuttgart/ Weimar 2005, Sp. 117ff.
Kearney, Michael, Reconceptualizing the peasantry. Anthropology in global perspective, Boul-der, Colo. u.a. 1996.
Konersmann, Frank, »Auf der Suche nach ›Bauern‹, ›Bauernschaft‹ und ›Bauern-stand‹. Hypothesen zur historischen Semantik bäuerlicher Agrarproduzenten (15.–19. Jahrhundert)«, in: Daniela Münkel/Frank Uekötter (Hg.), Das Bild des Bauern. Selbst- und Fremdwahrnehmungen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert, Göttingen 2012, S. 61–84.
Kopsidis, Michael, Marktintegration und Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft 1780–1880. Marktorientierte ökonomische Entwicklung eines bäuerlich strukturierten Agrarsektors (Münsteraner Beiträge zur Cliometrie und quantitativen Wirt-schaftsgeschichte 3), Münster 1996.
Kopsidis, Michael, Agrarentwicklung. Historische Agrarrevolutionen und Entwicklungs-ökonomie (Grundzüge der modernen Wirtschaftsgeschichte 6), Stuttgart 2006.
Landwehr, Achim, Historische Diskursanalyse, 2. Aufl., Frankfurt/M. 2009. Latour, Bruno, Science in action. How to follow scientists and engineers through society,
Cambridge Mass. 1987. Lehmbrock, Verena, »Kreation einer intellektuellen Nische. Oder wie wurde Land-
wirtschaft zum Universitätsfach erklärt?«, in: ›Knowledge in flux‹. Wissenskulturen und Diskursivität des Wissens angesichts von Differenzierungs-, Dynamisierungs- und Transnationalisierungsprozessen, Marburg 2013 (im Erscheinen).
Long, Pamela O., Artisan/practitioners and the rise of the New Sciences 1400–1600, Oregon 2011.
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim, »Verbreitung und Überlieferung bäuerlicher Schreibebücher«, in: Holger Böning/Hanno Schmitt/Reinhart Siegert, Volks-aufklärung. Eine praktische Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts (Presse und Geschichte – Neue Beiträge 27), Bremen 2007, S. 361–366.
Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim/Björn Poulsen (Hg.): Writing peasants. Studies on peasant literacy in early modern northern Europe, Kerteminde 2002.
Mahlerwein, Gunter, Die Herren im Dorf. Bäuerliche Oberschicht und ländliche Eliten-bildung in Rheinhessen 1700–1850 (Veröffentlichungen des Instituts für Euro-päische Geschichte 189; Historische Beiträge zur Elitenforschung 2), Mainz 2001.
Münkel, Daniela/Frank Uekötter, Das Bild des Bauern. Selbst- und Fremdwahr-nehmungen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert, Göttingen 2012.
AGRARWISSEN UND VOLKSAUFKLÄRUNG 513
Peters, Jan, Mit Pflug und Gänsekiel, Selbstzeugnisse schreibender Bauern. Eine Anthologie (Selbstzeugnisse der Neuzeit 12), Köln 2003.
Phillips, Denise, Acolytes of nature. Defining natural science in Germany 1770–1850, Chicago/London 2012.
Plumpe, Werner, »Ökonomisches Denken und wirtschaftliche Entwicklung. Zum Zusammenhang von Wirtschaftsgeschichte und historischer Semantik der Ökonomie«, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Jg. 1 (2009), S. 27–52.
Popplow, Marcus, »Die Ökonomische Aufklärung als Innovationskultur des 18. Jahrhunderts zur optimierten Nutzung natürlicher Ressourcen«, in: ders. (Hg.), Landschaften agrarisch-ökonomischen Wissens. Strategien innovativer Ressourcennutzung in Zeitschriften und Sozietäten des 18. Jahrhunderts (Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 30), Münster u.a. 2010, S. 2–48.
Reichrath, Susanne, Entstehung, Entwicklung und Stand der Agrarwissenschaften in Deutschland und Frankreich (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3 494), Frankfurt/M. u.a. 1991.
Sarasin, Philipp, »Diskursanalyse«, in: Anne Kwaschik/Mario Wimmer (Hg.), Von der Arbeit des Historikers. Ein Wörterbuch zu Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft (Histoire 19), Bielefeld 2010, S. 53–57.
Schlude, Ursula, »Naturwissen und Schriftlichkeit. Warum eine Fürstin des 16. Jahrhunderts nicht auf den Mont Ventoux steigt und die Natur exakter begreift als die ›philologischen‹ Landwirte«, in: Sophie Ruppel/Aline Steinbrecher (Hg.), »Die Natur ist überall bey uns«. Mensch und Natur in der Frühen Neuzeit, Zürich 2009, S. 95–108.
Smith, Pamela H., The body of the artisan. Art and experience in the scientific revolution, Chicago 2004.
Spivak, Gayatri Chakravorty, Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation (Es kommt darauf an 6), Wien 2008.
Thaer, Albrecht Daniel, »Weber, Friedrich Benedict: Einleitung zum Studium der Oekonomie, besonders für wissenschaftlich Gebildete, Züllichau/Leipzig 1804«, Rezension, Annalen des Ackerbaus, Jg. 1 (1805), S. 222–258.
Trossbach, Werner, »Beharrung und Wandel ›als Argument‹. Bauern in der Agrargesellschaft des 18. Jahrhunderts«, in: Werner Trossbach/Clemens Zim-mermann, Agrargeschichte. Positionen und Perspektiven (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 44), Stuttgart 1998, S. 107–136.
Ulbricht, Otto, Englische Landwirtschaft in Kurhannover in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ansätze zur historischen Diffusionsforschung (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 32), Berlin 1980.
Vierhaus, Rudolf, »›Patriotismus‹ – Begriff und Realität einer moralisch-politischen Haltung«, in: ders. (Hg.), Deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften (Wolfenbütteler Forschungen 8), München 1980, S. 9–29.
Wyss, Regula, Pfarrer als Vermittler ökonomischen Wissens? Die Rolle der Pfarrer in der Oekonomischen Gesellschaft Bern im 18. Jahrhundert (Berner Forschungen zur Regio-nalgeschichte 8), Nordhausen 2007.
514 VERENA LEHMBROCK
Zimmermann, Clemens, »Bäuerlicher Traditionalismus und agrarischer Fortschritt in der frühen Neuzeit«, in: Jan Peters (Hg.), Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften (Bei-hefte der Historischen Zeitschrift 18), München 1995.