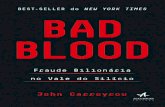2009_Das Bad des Königs - beschreibt Gallus Anonymus ein genuin piastisches/polnisches Ritual?...
-
Upload
tu-chemnitz -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 2009_Das Bad des Königs - beschreibt Gallus Anonymus ein genuin piastisches/polnisches Ritual?...
GRISCHA VERCAMER
Das Bad des Königs – beschreibt Gallus Anonymus ein genuin
piastisches/polnisches Ritual?
Überlegung zu Ehre und Herrschaftsvorstellung bei den frühen Piasten (Bolesław I. und
Bolesław III.) aufgrund des Kapitels 1,131
I. Rituale und Ehre – zwei Forschungsbegriffe, S. ■■■. – II. Analyse des Kapitels 1,13 der Chronik des Gallus
Anonymus, S. ■■■. – III. Einordnung in einen weiteren historiographischen Kontext, S. ■■■. – IV. Kritik an der
Herrschaft Bolesławs III.?, S. ■■■. – Fazit, S. ■■■. – Exkurs 1, S. ■■■.
In diesem Artikel soll der Versuch unternommen werden, anhand der Analyse eines
bestimmten Kapitels der Chronik des Gallus Anonymus2, Erkenntnisse über das
Herrschafts- und Ehrverhalten der frühpiastischen Fürsten zu erhalten. Zunächst soll, da
von Ritual und Ehre im Titel die Rede ist, die Verwendung dieser Termini geklärt
werden, die in der mediävistischen Forschung teils ambivalent gehandhabt werden.
Sodann erfolgt die genaue Analyse des 13. Kapitels vom ersten Buch der Cronica Ducum
sive Principum Polonorum. Der Vergleich mit ähnlichen Sequenzen aus anderen
historiographischen Werken schließt sich dem an und am Ende erfolgt die Frage nach der
Intention des Autors in Bezug auf dieses Kapitel. Es zeigte sich dabei, soviel sei
vorweggenommen, dass dieses Kapitel – vor dem Hintergrund des Gesamtwerkes –
durchaus ein Indiz dafür sein könnte, dass Gallus die Herrschaft Bolesław III. (1102–
1138) kritisch sah und bewusst der positiv konnotierten Herrschaft Bolesławs I.
gegenüberstellte. Auf der Suche nach Vorbildern, die Gallus in näherer Vergangenheit für
die Schilderung Bolesławs I. Herrschaft heranziehen konnte, ist der Verfasser auf die
Eltern Bolesławs III. gestoßen. Dafür sprechen einige Indizien, die diesen Verdacht
erhärten.
I. RITUALE UND EHRE – ZWEI FORSCHUNGSBEGRIFFE
Gerade in der Mediävistik ist der Terminus ‛Ritual’, welcher von der Anthropologie
und Ethnologie übernommen wurde3, noch immer stark konfliktbeladen und mehrdeutig:
1 Der Text basiert auf meinem Vortrag vom 26. 6. 2009 im Rahmen des Workshops „Die Chronik des Gallus
Anonymus im Kontext zeitgenössischer Narrativität“ in Münster und wurde aufgrund der fruchtbaren
Diskussionsbeiträge, für die ich mich an dieser Stelle bedanken will, noch einmal überarbeitet. 2 Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, hg. von KAROL MALECZYŃSKI
(Monumenta Poloniae Historica. N. S. 2) Cracoviae 1952. 3 Stellvertretend seien einige Forschungsüberblicke mit weiterführender Literatur genannt: BURCKHARD
DÜCKER, Rituale. Formen – Funktionen – Geschichte. Eine Einführung in die Ritualwissenschaft, Stuttgart
2006, bes. S. 209–213; BARBARA STOLLBERG-RILINGER, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne.
2 Grischa Vercamer
„Bis zum 12. Jahrhundert beherrschten jedenfalls die Rituale und rituellen
Verhaltensmuster die öffentliche Kommunikation“4 und „symbolische Gesten und Akte
im Mittelalter [konnten] für sich allein Verbindlichkeit beanspruchen“5 sagen die einen,
während andere dem grundsätzlich heuristischen Wert von Ritualen skeptisch
gegenüberstehen, da die Historiographen entweder die genauen Gegebenheiten nicht
mehr ebenso genau memorieren konnten und so verfälschten, oder sie schrieben sowieso
tendenziös und konstruierten daher die Rituale schlichtweg, oder die Rituale waren eher
Ausdruck von individueller Inszenierung denn von gemeinschaftlichen Handlungen6. Es
kann aber dennoch kaum bestritten werden, dass Gemeinschaft und Herrschaft über
diese ohne rituellen Charakter schlicht nicht vorstellbar ist7. Zu allen Zeiten hat es daher
Handlungen gegeben, die – besonders in Krisensituationen – stark ritualisiert8 und für die
Zeitgenossen innerhalb dieser Gemeinschaft klar ausdeutbar waren9. So gibt es
Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, S. 489–527,
bes. S. 490, S. 502–504; CHRISTOPH WULF – JÖRG ZIRFAS, Performative Welten. Einführung in die
historischen, systematischen und methodischen Dimensionen des Rituals, in: DIES. (Hg.), Die Kultur des
Rituals. Inszenierungen. Praktiken. Symbole, München 2004, S. 7–48. 4 GERD ALTHOFF, Macht der Rituale, Darmstadt 2003, S. 20. 5 GERD ALTHOFF, Symbolische Kommunikation zwischen Piasten und Ottonen, in: MICHAEL BORGOLTE (Hg.),
Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“ (Europa im
Mittelalter 5) Berlin 2002, S. 293–308; auch in: HERMANN KAMP – CLAUDIA GARNIER (Hgg.), Inszenierte
Herrschaft. Geschichtsschreibung im Mittelalter, Darmstadt 2003, S. 230–251, hier S. 232. 6 PHILIPPE BUC, Political Ritual: Medieval and Modern Interpretations, in: HANS-WERNER GOETZ (Hg.), Die
Aktualität des Mittelalters, Bochum 2000, S. 255–272, bes. S. 271–272; GEOFFREY KOZIOL, The father, his
son, memory, and hope. The joint diploma of Lothar and Louis V. (Pentecost Monday, 979) and the limits of
performativity, in: JÜRGEN MARTSCHUKAT und STEFFEN PATZOLD (Hgg.), Geschichtswissenschaft und
„performative turn“: Ritual, Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit (Norm und Struktur
19) Köln u. a. 2003, S. 83–103, bes. S. 85; JOHANNES FRIED, Die Königserhebung Heinrichs I. Erinnerung,
Mündlichkeit und Traditionsbildung im 10. Jahrhundert, in: MICHAEL BORGOLTE (Hg.), Mittelalterforschung
an der Wende 1989, München 1995, S. 267–318. 7 WULF – ZIRFAS, Performative Welten (wie Anm. 3) S. 18–19. 8 BURCKHARD DÜCKER, Rituale. Formen – Funktionen – Geschichte. Eine Einführung in die
Ritualwissenschaft, Stuttgart 2006., S. 2, „Daher ist der Begriff ‛Ritual’ nicht inhaltlich zu definieren, er
bezeichnet kein geschlossenes Register von Handlungen, die dazu gehören, sondern er fasst als Bezeichnung
eines eigenen Handlungstyps alle die Handlungsabläufe zusammen, die die Merkmale ritueller Formung
aufweisen.“ WULF – ZIRFAS, Performative Welten (wie Anm. 3), die zwischen ‛Ritual’, ‛ritualisiertem Handeln’
und ‛Zeremoniell’ unterscheiden, vgl. etwa DIES., Anthropologie und Ritual. Eine Einleitung, in: Paragrana 12,
2003, S. 11–28; DIES., Performative Welten. Einführung in die historischen, systematischen und methodischen
Dimensionen des Rituals, in: DIES. (Hg.), Die Kultur des Rituals. Inszenierung. Praktiken. Symbole, München
2004, S. 7–45; DIES., Performativität, Ritual und Gemeinschaft. Ein Beitrag aus erziehungswissenschaftlicher
Sicht, in: DIETRICH HARTH – GERRIT JASPER SCHENK (Hgg.), Ritualdynamik. Kulturübergreifende Studien
zur Theorie und Geschichte rituellen Handelns, Heidelberg 2004, S. 73–93. Bestimmte Akte wurden aus dem
religiösen Kontext genommen und somit ritualisiert: KLAUS SCHREINER, ‛Nudis pedibus’. Barfüßigkeit als
religiöses und politisches Ritual, in: GERD ALTHOFF (Hg.), Formen und Funktionen öffentlicher
Kommunikation im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 51) Stuttgart 2001, S. 53–124, hier: S. 78, bestätigt,
dass rituelle Akte (hier Buß- und Sühneakte) kirchlichen Zeremonien nachempfunden wurden und auch ohne
Beteiligung kirchlicher Amts- und Würdenträger vollzogen werden konnten. 9 Theoretische Überlegungen dazu: GERALD SCHWEDLER, Rituale als Ausdruck von Herrschaft, in: CLAUS
AMBOSS – STEPHAN HOLTZ u. a. (Hgg.), Die Welt der Rituale. Von der Antike bis heute, Darmstadt 2006,
S.171–176; STOLLBERG-RILINGER, Kommunikation (wie Anm. 3) S. 503: „Jede Art der Ritualisierung entlastet
von der Wahl zwischen prinzipiell unendlich vielen möglichen Verhaltens- und Handlungsweisen, d. h. sie
reduziert Komplexität und sorgt für Erwartbarkeit.“
Das Bad des Königs 3
anthropologische Universalien wie die berühmten Übergangsriten (rites de passage), die sich
in jeder Gesellschaft etwas anders ausformen, wodurch eben die individuellen Züge der
jeweiligen Gesellschaft oder Herrschaft hervorgehoben werden10. Dieses ist leider aber
nicht so sehr gegeben, wenn es zu bi- oder multilateralen Herrschertreffen11 bei Festen,
Verhandlungen, Konfliktbeilegungen etc. kommt, da hier immer eine Anpassung, also ein
Kompromiss, stattfindet. Man macht es dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes
‛recht’ – und beugt die eigene Art der non-verbalen Inszenierung der ‛inter-
herrschaftlichen’ Notwendigkeit12. Dass hier infolgedessen ‛überstaatliche’ Regeln zum
Tragen kamen, die also eine europäische Rituallandschaft prägten13, kann kaum
angezweifelt werden. Reine, man könnte auch sagen ‛genuine’, herrschaftlich-rituelle
Handlungen einer Gesellschaft oder eines Kulturkreises können aber nur gefasst werden,
wenn keine äußeren Einwirkungen, wie eben beispielsweise bei Herrschertreffen, gegeben
sind.
Zum Ehrbegriff (honor), der in der jüngeren deutschen Mediävistik stark mit dem
Namen Knut Görich verbunden ist14, muss Folgendes gesagt werden: Ehre wurde, so die
Theorie, von den hochmittelalterlichen Fürsten als etwas betrachtet, was sich deutlich mit
Herrschaft und Autorität verband15. Die Ehre stellte dabei ein komplexes aber auch
filigranes Gebilde dar, was sehr schnell verletzt werden konnte. Sobald sie verletzt war,
musste der Herrscher nach Genugtuung (satisfactio) durch eine öffentliche Bereinigung
oder Unterwerfung (deditio) streben16. Dieser öffentlichen Unterwerfung gingen
Absprachen voraus, wie das Ganze auszusehen hatte, auf welche sich dann beide Parteien
einlassen konnten17. Die Öffentlichkeit musste die Eindeutigkeit der Unterwerfung
verstehen, da die auctoritas des Herrschers auf dem Spiel stand; andererseits war dem
10 ARNOLD VAN GENNEP, Übergangsriten. Frankfurt am Main 1986 (Übersetzung von: DERS, Les rites de
passage, Paris 1909). 11 Die Forschungsliteratur zu der Ritualhaftigkeit dieser Herrschertreffen ist in den letzten Jahren schlagartig
angestiegen, vgl. stellvertretend und mit weiteren bibliographischen Angaben GERALD SCHWEDLER,
Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen (Mittelalter-Forschungen 21) Stuttgart
2007, S. 13–18; sowie WOJCIECH FAŁKOWSKI, Niezwykły rituał spotkań władców na wyspie, in: Przegląd
historyczny 97, 2006, S. 187–202. 12 Vgl. PHILIPPE BUC, The Dangers of Ritual. Between Early Medieval texts and Social Scientific Theory,
Princeton – Oxford 2001, S. 251. 13 ALTHOFF, Macht der Rituale (wie Anm. 4) S. 189–199, betont die Analogie von Ritualen und symbolhafter
Kommunikation, die zwar regional verschieden ausfallen konnten, jedoch dasselbe aussagten bzw.
transportierten. 14 Zu diesem Thema KNUT GÖRICH, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches
Handeln im 12. Jahrhundert (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne 1) Darmstadt 2001, bes. 27–34;
programmatisch und weiterführend auch die einzelnen Beiträge von KLAUS SCHREINER, GERD SCHWERHOF,
MARTIN DINGES und GERD ALTHOFF, in: KLAUS SCHREINER – GERD SCHWERHOFF (Hgg.), Verletzte Ehre.
Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Köln – Weimar u. a. 1995;
verschiedene Aufsätze in dem Sammelband: STEFAN ESDERS (Hg.), Rechtsverständnis und
Konfliktbewältigung. Gerichtliche und außergerichtliche Strategien im Mittelalter, Köln u. a. 2007. 15 GÖRICH, Ehre (wie Anm.14) S. 35. 16 GERD ALTHOFF, Compositio. Wiederherstellung verletzter Ehre im frühen und hohen Mittelalter, in: Verletzte
Ehre (wie Anm. 14) S. 63–76, bes. S. 68 ff. 17GERD ALTHOFF, Colloquium familiare – colloquium secretum – colloquium publicum. Beratungen im
politischen Leben des früheren Mittelalters, in: DERS. (Hg.), Spielregeln der Politik im Mittelalter.
Kommunikation in Friede und Fehde, Darmstadt 1997 (ursp. 1990), S. 157–185, hier bes. 170 f. und S. 182.
4 Grischa Vercamer
Herrscher hier die Möglichkeit gegeben, coram publico die hohe Herrschaftstugend der
Milde (clementia) zu praktizieren. Was passieren konnte, wenn diesem öffentlichen Akt
keine klaren Absprachen vorausgingen, können wir den Gesta Friderici Ottos von Freising
entnehmen. Hier versuchte ein Ministeriale des ehemaligen Herzogs und nunmehrigen
Königs bei dessen Salbung in Aachen 1152 die Gnade den Königs wieder zu erlangen,
indem er sich in aller Öffentlichkeit im Dom flach vor den König hinwarf. Er wurde aber
von Friedrich mit der Begründung abgewiesen, dass er ihn aus Gerechtigkeitsgründen
nicht wieder in seine Huld aufnehmen könne (non ex odio, sed iustitie intuitu illum a gratia sua
exclusum fuisse18) – diese Entscheidung löste bei den Anwesenden Respekt und
Überraschung aus. Die öffentliche deditio zog also nicht per se eine Bereinigung des
Konflikts hinter sich her; der Ministeriale in dem Beispiel hatte sich nicht zuvor im
kleineren Kreise der Gunst des Königs versichert. Festzuhalten allerdings ist, dass
Fehlverhalten gegenüber dem Herrscher und somit Kränkung der herrscherlichen Ehre,
eigentlich immer öffentlich bereinigt werden musste.
II. ANALYSE DES KAPITELS 1,13 DER CHRONIK DES GALLUS ANONYMUS
Bewusst wurde dieses Kapitel ausgewählt, da hier ein stark ritualisiertes,
herrschaftliches Verhalten zum Vorschein kommt, das aber wiederum keinen äußeren,
über das unmittelbare polnische Herrschaftsgebiet hinausgehenden Einflüssen unterliegt,
wie es oben angesprochen wurde. Das Kapitel ist bereits mehrfach Gegenstand anderer
Abhandlungen gewesen: So steht es bei Gerd Althoff für eine anekdotisch-unterhaltsame
Deformierung der Realität, die vom Chronisten bewusst gewählt worden sei, um das
Publikum zu erfreuen19. Jacek Banaszkiewicz stellt das Bad zentral in seine Analyse und
geht deutlicher in die Richtung meiner Interpretation. Er spricht dem Bad eine reinigende
Funktion zu, die es dem Badenden erlaubt, sein altes Leben abzustreifen und ein neues zu
beginnen20. Außerdem erkennt er dem Bad bei den Slawen eine spezifische Funktion zu
(„ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Vorstellungskraft der Zeitgenossen“21). Ihn
interessiert aber vor allem das Fabelhafte, Unwirkliche, bzw. er thematisiert eher den
Zusammenhang oder Übergang zwischen der Welt der Toten und der Lebenden22. Ein
18 Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris, hg. von GEORG WAITZ – BERNHARD VON SIMSON (MGH
SS rer. Germ. 46) Hannover 1912, lib. 2, cap. 3, S. 104–105: Nec pretereundum estimo, quod, dum finito unctionis
sacramento diadema sibi imponeretur, quidam de ministris eius, qui pro quibusdam excessibus gravibus a gratia sua adhuc
privatim sequestratus fuerat, circa mediam aecclesiam ad pedes ipsius se proiecit, sperans ob presentis diei alacritatem eius se
animum a rigore iusticiae emollire posse. Ipse vero mentem in priori severitate retinens et tamquam fixus manens constantiae suae
omnibus nobis non parvum dedit indicium, dicens non ex odio, sed iusticiae intuitu illum a gratia sua exclusum fuisse. Nec hoc
etiam sine admiratione plurium, quod virum iuvenem, tamquam senis indutum animo, tanta flectere a rigoris virtute ad remissionis
vicium non potuit gloria. 19 ALTHOFF, Symbolische Kommunikation (wie Anm. 5) S. 247–249. 20 JACEK BANASZKIEWICZ, Król i łaźnia, Bóg i łaźnia [Gott und das Bad] (Gal Anonim o Bolesławie Chrobrym
– I, 13, Povest’ vremennych let o stworzeniu pierwszego człowieka – s. a. 1071), in: TERESA MICHAŁOWSKA
(Hg.), Wyobraźnia średniowieczna, Warszawa 1996, S. 205–222, bes. S. 221–222. 21Ebd. S. 222, „Słowiańska wczesnośredniowieczna łaźnia była instytucją ważną w życiu społecznym: stanowiła
istotny składnik kulturowej wyobraźni ówczesnych ludzi.“ 22 Obgleich er hin und wieder die Ritualhaftigkeit der Szene hervorkehrt – z. B. ebd. S. 210, definiert er das
Baden als ein klares Ritual, welches der Rehabilitierung der Bestraften und Verbannten diente –, wird dieser
Gedanke nicht vertieft.
Das Bad des Königs 5
Vergleich mit der zeitgenössischen Historiographie findet dort jedoch nicht statt. In einer
jüngeren Abhandlung von Wojciech Fałkowski wird das Kapitel aufgegriffen, um die
Effektivität der Geste des ‛Füße-Umgreifens’ bzw. ‛Füße-Küssen’ des Herrschers zu
beschreiben23. Vor dem Hintergrund anderer Beispiele aus der Historiographie des
karolingischen Frankenreichs geht es Fałkowski darum, zu zeigen, dass solche Gesten
einerseits Hierarchien verdeutlichen und andererseits eben klare Demutszeugnisse bzw.
eine Unterstreichung der Loyalität zum Herrscher darstellen24. Auch hier wird aber die
Komplexität und Einmaligkeit der Szene bei Gallus nicht weiter besprochen.
Bevor wir nun direkt zur Beschreibung und Analyse des Kapitels übergehen, sollen
noch zwei Grundprämissen geklärt werden:
1. Bolesław I. der Tapfere (992–1025) diente Gallus als erster polnisch-christlicher
Idealkönig und bildete zusammen mit dem Nachfahren Bolesław III. eine klare
Klammerung für das Gesamtwerk25. Er ist das unumstößliche Vorbild in der Chronik, an
dem sich die nachfolgenden Herrscher zu orientieren hatten26. Das äußert sich allein
schon in dem Platz, den Gallus der Herrschaftsbeschreibung Bolesławs I. einräumt27. Es
ist nach meinem Dafürhalten zwar nicht ausgeschlossen, dass Gallus das rezipierende
Publikum in gewisser Weise durch bewusste Übertreibungen, die sich ja durch die ganze
Chronik ziehen, unterhalten wollte28, aber andererseits verbietet sich die Ansicht, dass
Gallus ein ‛Bloßstellen’, ein ‛Lächerlich-machen’ des ersten polnischen Königs
intendierte, da dieser eben hier den Herrscher par exellence darstellt29. Wir wollen auf
diesen Punkt nach der Schilderung des Kapitels zurückkommen.
2. Selbst wenn wir davon ausgehen müssen, dass das folgende Ritual oder die
rechtliche Gewohnheit in Polen nicht unbedingt in die Zeit Bolesław I. gehören, da die
23 WOJCIECH FAŁKOWSKI, Double Meaning in Ritual Communication, in: Frühmittelalterliche Studien 42, 2008,
S. 169–187, hier S. 172–173. Hierbei ist nebenbei anzumerken, dass ein wirkliches Ergreifen des Beines
(„gesture of clasping somebody’s legs“, S. 171) aber in der Szene mit Emnilda und Bolesław I. eigentlich gar
nicht gegeben ist. 24 Ebd. S. 187. 25 Vgl. DÁNIEL BAGI, Die Darstellung der Zusammenkunft von Otto III. und Bolesław dem Tapferen in Gnesen
im Jahre 1000 beim Gallus Anonymus, in: FERENC GLATZ (Hg.), Die ungarische Staatsbildung und
Ostmitteleuropa. Studien und Vorträge, Budapest 2002, S. 177–188, bes. 183; DÁNIEL BAGI, Królowie
węgierscy w kronice Galla Anonima, Kraków 2008, S. 154–168, bes. 167–168. Bagi geht davon aus, dass die
Umstände in Ungarn und Polen durch die Blendung und Vertreibung der jeweiligen Brüder (Zbigniew und
Almos) ähnlich waren. Beide Herrscher, Bolesław III. und Koloman der Buchkundige, waren bemüht, den
Makel ihrer Herrschaftslegitimation auszugleichen. Dieses passierte jeweils durch die Berufung auf die
‛christlichen Staatsgründer’ Stefan und Bolesław I. 26 Diese Haltung wird auch in der polnischen Mediävistik vertreten, vgl. JACEK BANASZKIEWICZ, Gall jako
historyk poważny, czyli dlaczego dzieje i Bolesława Chrobrego, i Bolesława Krzywoustego są prawdziwe i
niegroteskowe, in: Przegląd Historyczny 99, 2008, S. 399–410, hier bes. S. 403–405; MARIAN PLEZIA, Kronika
Galla na tle historiografii XII wieku (Rozprawy wydziału historyczno-filozoficznego. Ser. 2, 46) Kraków 1947,
S. 199–200. 27 Ihm sind im ersten Buch der Chronik 10 lange Kapitel (Cronicae [wie Anm. 1] S. 16–39) gewidmet, während
Bolesław II. nur 7 weitaus kürzere Kapitel (ebd. S. 47–54) zukommen und die anderen Vorgängern Boleslaws
III. jeweils meist nur in 1–2 Kapiteln beschrieben werden. 28 ALTHOFF, Symbolische Kommunikation (wie Anm. 5) S. 246–247. 29 Diese Haltung nehmen auch Jacek Banaszkiewicz und Roman Michałowski ein, vgl. BANASZKIEWICZ, Gall
jako Historyk (wie Anm. 26) S. 405; ROMAN MICHAŁOWSKi, Relacja Galla Anonima o zjeździe Gnieźnieńskim
– Problem Wiarygodności, in: BARBARA TRELIŃSKA (Hg.), Tekst źródła – krytyka i interpretacja, Warszaw
2005, S. 55–62, hier S. 58 f.
6 Grischa Vercamer
einzige Verbindung zu diesem für Gallus der verlorene Liber de passione martyris30, also die
verlorene Passion des Heiligen Adalberts, ist, so spiegelt es doch die Vorstellungswelt
eines gebildeten Mannes am Hofe Bolesławs III. Schiefmund im frühen 12. Jahrhundert
wider31. Es kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Gallus diese
Szene nicht erfunden hat, da die zeitgenössischen Rezipienten der Chronik die spezifische
Schilderung von Herrschaftsausübung (höchstwahrscheinlich auch die versteckte
Botschaft, die man der Schilderung notgedrungen zugestehen muss32) richtig einordnen
und verstehen konnten. Somit wird eine ritualisierte Handlung geschildert, die zur Zeit
des Gallus bekannt war, also ebenso gut auf die Herrschaftspraxis Bolesławs III. oder
eines seiner unmittelbaren Vorgänger zutreffen könnte – wir werden auch hierauf
zurückkommen müssen.
Das Kapitel selbst, um nun zu dem konkreten Inhalt überzugehen, wird von Gallus
mit einem Lob auf Bolesławs I. Milde begonnen: Er liebte seine Grafen und Fürsten
(comites ac principes)33 und er milderte rechtlich Verurteilten das Urteil aufgrund seiner
Gnade oder seines Mitleides ab (contra legem condempnatis iudicium misericordia temperabat). Der
nächste Satz schließt an wie eine Erläuterung: ‚Oft nämlich …‘ (Saepe namque …) rettete
seine Frau, die Königin, eine ‚kluge und diskrete Frau‘ (prudens mulier et discreta), viele zum
Tode Verurteilte aus den Händen der Henkersknechte (lictores) und bewahrte (reservavit) sie
sub custodia in einem Kerker auf. Der König wusste davon entweder nichts oder er tat so,
als ob er nichts wüsste (quandoque rege nesciente quandoque vero dissimulante). Zunächst bleibt
festzuhalten: Es handelt sich um eine wiederholte Handlung der Königin. Weiterhin
erscheint nicht der König als der Böse – eigentlich müsste er die Todesurteile
ausgesprochen haben, obgleich das aus dem Text nicht klar hervorgeht34 –, sondern die
30 Zusammenfassende Diskussion und weiterführende Literatur über den Liber in einem Exkurs bei
PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138
roku) Wrocław 2008, S. 608–615. Seine Analyse zeigt, dass ein abschließender Beweis über eine mögliche
Existenz wohl niemals erbracht werden kann. 31 Schon HELMUT BEUMANN, Die Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des
Königtums, in: Historische Zeitschrift 180, 1955, S. 449–488, hier S. 451, hat das auf den Punkt gebracht: „weit
über eine bloße Rolle eines unvollkommenen Vehikels für historische Nachrichten hinaus ist sie [die erzählende
Quelle] der zentrale Ort für die geistige Auseinandersetzung des Zeitgenossen mit der ihn umgebenden
Wirklichkeit und der Niederschlag jener immer wieder erneuerten Bemühungen, den eigenen geschichtlichen
Standort auf dem Hintergrund der Vergangenheit zu bestimmen, die geschichtliche Tradition an die Gegenwart
heranzuführen und diese mit Hilfe jener zu deuten.“ Der gegenwärtige Hauptvertreter dieser
Forschungsrichtung in Deutschland ist Hans-Werner Goetz, der verschiedene, programmatische Aufsätze zur
Thematik verfasst hat, die gut in dem von seinen Schülern herausgegebenen Aufsatzband fassbar sind: HANS-
WERNER GOETZ, Vorstellungsgeschichte. Gesammelte Schriften zu Wahrnehmung, Deutungen und
Vorstellungen im Mittelalter, hg. von ANNA AURAST – SIMON ELLING u. a., Bochum 2007. 32 GEOFFREY KOZIOL, Begging pardon and favor. Ritual and political order in early medieval France, Ithaca –
New York 1992, S. 54–58, zeigt die Verpflichtungen auf, die ein Fürst gegenüber einem Petenten hat, der
formell korrekt seine Bitte vorbringt. Die vermeintliche Wahl des Herrschers entpuppt sich dabei als sehr
eingeschränkt – besonders wohl, wenn es sich dabei um einen hochgestellten Petenten handelte. Verwiesen sei
schon einmal auf Vincentius Kadłubek, der die Szene vollkommen umgestaltete, da sein Publikum (ca. 80 Jahre
später) offenbar nicht mehr in der Lage war, die Zweideutigkeit der Szene zu dechiffrieren (vgl. Anm. 93). 33 Vgl. hier wie im folgenden Galli Anonymi Cronicae (wie Anm. 1) lib. 1, cap. 13, S. 32–34. 34 Zu dem Gewicht von iudicium und sententiae bei Konfliktaustragungen des 12. Jahrhunderts, vgl. GERD
ALTHOFF, Konfliktverhalten und Rechtsbewußtsein: Die Welfen in der Mitte des 12. Jahrhunderts, in:
Frühmittelalterliche Studien 26, 1992, S. 331–352, bes. die theoretischen Ausführungen zu Beginn, S. 331–334.
Das Bad des Königs 7
Henkersknechte werden als böser Gegenpol zur Königin aufgebaut. Nun kommen die 12
Ratgeber und ihre Frauen ins Spiel, mit denen das Königspaar zu Essen und zu Beraten
pflegt35. Während das Gespräch also hierhin und dorthin schweift, streift es wie zufällig
auch das Gedenken an die Familien der Verurteilten (in memoriam ex occasione forte generis
illorum dampnatorum), wobei Bolesław ob der Güte der Eltern (pro bonitate parentum) sehr
bereut, den Befehl zur Hinrichtung gegeben zu haben. Nun beginnt eine scheinbar
einstudierte Szene: Die Königin streichelt dem König die Brust mit der Hand (tunc regina
venerabilis pium pectus regis blanda manu demulcens) und fragt ihn, was er geben würde, wenn
irgendein Heiliger die Toten wieder zum Leben erwecken könnte. Worauf der König
erwidert, dass er alles geben würde, wenn er den Tod rückgängig und die Würde der
Familie, präziser: der Nachkommen, wiederherstellen könne (se nichil tam preciosum possidere,
quod non daret, si quis eos posset ad vitam de funere revocare, eorumque progeniem ab infamie macula
liberare). Daraufhin wirft sich die Königin mit den anderen 24 Anwesenden zu Boden und
bekennt den frommen Diebstahl (pium furtum) der zum Tode Verurteilten und bittet um
Vergebung sowohl für sich als auch für die Verurteilten36. Weder zürnt Bolesław noch
verdammt er seine Frau, sondern er umarmt sie gütig und hebt sie mit einem Kuss vom
Boden auf (Quam rex benigne complexans cum osculo de terra manibus sublevabat) und lobt ihr
frommes Werk. Während noch zur selben Stunde Pferde geschickt werden, um die
ehemals Verurteilten und nun schon fast wieder Rehabilitierten zum Hof zu bringen,
wächst die Freude der Speisenden darüber, dass die Königin es so gut vermochte, Nutzen
für das Königreich mit der Ehre des Königs zu verbinden (regina regis honorem ac regni
utilitatem sic sapienter observabat). Dieser Satz unterstreicht ebenso deutlich wie der bereits
oben zitierte Passus (‚manchmal wusste Bolesław von dem Zurückhalten der
Gefangenen, aber tat so, als ob er es nicht wüsste‘), dass das königliche Ehepaar hier als
herrschaftliches Gespann wirkte: Die Ehre des Königs musste in jedem Fall
unangezweifelt, sprich unangetastet, bleiben und dennoch sollte auch die Machtbalance
im Königreich ungestört bleiben. Es musste also die Zufriedenheit der führenden
Familien gewährleistet bleiben. Verletzte ein hochstehender (oftmals doch wohl
wahrscheinlich junger) Adeliger die Autorität des Königs – leider wird im Text kein
konkretes Beispiel genannt, aber da es sich um ein Todesurteil handelte, musste das
Vergehen schwerwiegend gewesen sein –, zwang er den König zu einer bestimmten
Reaktion, eben der Todesstrafe, um seine (des Königs) Ehre nicht zu verlieren. Durch
35 Man darf diesen Kreis sicherlich nicht nur unter freundschaftlichen Aspekten (sie werden zwar amici genannt,
aber mit dem Attributsadjektiv consiliarii umschrieben) sehen. Hier ist ein kleiner Kreis von Beratern zu fassen,
vgl. zu der Problematik ALTHOFF, Colloquium familiare (wie Anm. 17) S. 161 ff.; JAN-DIRK MÜLLER,
Ratgeber und Wissende in heroischer Epik. in: Frühmittelalterliche Studien 27, 1993, S. 124–146, betont die
Dezentralität der hochadeligen Ratgeber, die normalerweise in ihren eigenen Gebieten weilten. Ein ständig
verfügbarer Kronrat, wie er uns bei Bolesław I. entgegentritt, würde also voraussetzen, dass es sich tatsächlich
um Berater handelte, die immer am Hofe anwesend waren. 36 HANS-JÜRGEN BECKER, Art. ‛Gnade’, in: LMA 4, 1989, Sp. 1521–1522: Bezeichnend für die Gnade ist etwa
die Karls-Sequenz (12. Jahrhundert), die Karl den Großen als Hüter der Gerechtigkeit preist: iustus sed nec sine
misericordia. Im fränkischen Recht kommen Gnadenakte, etwa die Umwandlung eines Todesurteils in
Klosterhaft, so häufig vor, dass im ‛Capitulare Aquisgranense’ von 809 (MGH Capit. I, Nr. 61, S. 148) die –
geminderte – Rechtsstellung eines solcherart Begnadigten geregelt wird. Auch bei ALTHOFF, Colloquium
familiare (wie Anm. 17) S. 181–182, werden Beispiele aus dem 12. Jahrhundert genannt, in denen der
Herrscher, hier gegen Geldzahlungen, das Todesurteil zurücknimmt.
8 Grischa Vercamer
das ‛herrschaftliche Instrument’ der Königin konnte Bolesław I. aber einen Eklat
vermeiden und verlor dabei nicht sein Gesicht.
Nun folgt die eigentliche Badeszene bei Gallus: Die ursprünglich Verurteilten
wurden nicht etwa gleich dem König zur Begnadigung zugeschickt, sondern wurden
zunächst von der Königin empfangen und mit scharfen wie auch milden Worten (verbis
asperis et lenibus) auf das Treffen mit dem König vorbereitet. Dieser empfing sie im Bade
(balneum) sicut pater filios, erinnerte sie an ihre Herkunft und ihre Familie und mahnte, mit
Worten und – bei den jüngeren Delinquenten – auch mit Schlägen, ihr Verhalten als ihrer
Herkunft unangemessen an. Danach gab er ihnen königliche Kleidung, sowie, und nun ist
der lateinische Text etwas zweideutig, data munera und collati honores, also entweder
Geschenke und Ehren oder, wie es logischer erscheint, Dienste und verliehene (Ehren-)
Ämter37. Er setzte sie also wieder in Amt und Würden ein, denn ein Mitglied einer
hochstehenden Familie hatte administrative oder militärische Ämter inne38. Der Satz, mit
dem das Kapitel endet, resümiert: ‚Solcherart zeigte sich Bolesław gegenüber Volk und
Adeligen, so dass er klug bewirkte, dass ihn alle Untergebenen fürchteten und liebten‘
(Talem igitur sese rex Bolezlaus erga populum et principes exhibebat, sic sapienter et timeri et amari se a
cunctis sibi subditis faciebat). Nicht die Königin, die im Mittelpunkt des Kapitels steht und
der auch die Kapitelüberschrift gewidmet ist (De virtute et pietate uxoris Bolezlaui Gloriosi),
sondern die herrschaftlichen Qualitäten des Königs werden am Ende nochmals
hervorgehoben.
Insgesamt ergibt sich also folgender Ablauf: a. Fest, Eingeständnis der Sünde durch
die Königin, Fürbitte für den Gefangenen durch alle Anwesenden; b. Ankunft des
Gefangenen, Instruktion/Vorbereitung durch die Königin; c. gemeinsames, intimes Bad
mit dem König, der die Delinquenten schließlich nach mahnenden Worten (sowie
Schlägen bei den Jüngeren) rehabilitiert. Die Singularität des Kapitels besteht zum einen
in der Form, in der die Königin handelt und auftritt (scheinbar in einem hohen Maße
selbständig) und zum anderen in der Art und Weise, wie die Ehre des Königs
37 Die Ämter des Seneschalls und des Wojewodens sind durch Gallus, Cronicae (wie Anm. 1) S. 78 und S. 65,
bezeugt (Wojsław als Lehrer und Seneschall Bolesław; Sieciech als comes palatinus Władysławs I. Hermann); auf
niedriger Ebene sind Burgherren (Żupany, comes) bezeugt, vgl. auch MAREK KAZIMIERZ BARAŃSKI, Dynastia
Piastów w Polsce, Warszawa 2005, S. 242–246, mit weiterführender Literatur zu diesen Ämtern; wesentlich
detaillierter JANUSZ BIENIAK, Polska Elita Polityczna XII Wieku, in: verschiedenen Bänden der Serie
Spółczenstwo Polski Średniowiecznej, hg. von STEFAN KUTCZYŃSKI 2, 1982, S. 11–61; 3, 1985, S. 13–74, 4,
1990, S. 12–107; 7, 1996, S. 11–44; 8, 1999, S. 9–66; 9, 2001, S. 9–53; 10, 2004, S. 19–46. 38 JANUSZ BIENIAK, Polska Elita Polityczna XII Wieku. Część II. Wróżda i Zgoda, in: Spółczenstwo Polski
Średniowiecznej, hg. von STEFAN KUTCZYŃSKI, 3, 1985 S. 13–74, hier bes. S. 47–53, zeigt die Rivalität der
führenden Familien (Awdańcy, Sieciechowice) neben den Piasten bei dem Kampf um Einfluss. Die Awdańcy,
allen voran der Wojewode Skarbimir, blieben auch nach dem Sturz Zbigniews, mit dem sie zum Teil
zusammenarbeiteten, einflussreich. Erst im Jahr 1118 verortet Bieniak (S. 53) den Fall Skarbirms und verbindet
ihn mit dem Aufstieg des künftig sehr einflussreichen Piotr Włostowic. Man sieht an diesem Beispiel aber recht
gut, dass besonders die frühe Regierungszeit Bolesławs III. von Adelsopposition durchsetzt gewesen sein
musste. SŁAWOMIR GAWLAS, Die Territorialisierung des Deutschen Reichs und die teilfürstliche Zersplitterung
Polens zur Zeit des hohen Mittelalters, in: Quaestiones Medii Aevi Novae 1, 1996, S. 25–42, hier S. 29 ff.
betont, dass die herrschaftliche Organisation am Anfang des 12. Jahrhunderts noch nicht ansatzweise als
umfassend zu bezeichnen ist. Die regionalen comites bildeten einen nicht zu unterschätzender Machtfaktor, der
von den führenden Familien hart umkämpft war.
Das Bad des Königs 9
wiederhergestellt wird (unter vier Augen, in der Intimität des Bades, es ist nicht die Rede
von weiteren Anwesenden).
III. EINORDNUNG IN EINEN WEITEREN HISTORIOGRAPHISCHEN KONTEXT
Kommen wir zunächst zu dem Bad und der Interaktion zwischen Herrscher und
sündigem Untertanen und befragen dahingehend die gängigen Lexika: Im ‛Słownik
Staroźytności Słowiańskich’39, ‛Lexikon des Mittelalters’40 und ‛Handwörterbuch zur
deutschen Rechtsgeschichte’41 wird v. a. auf die Form des Bades eingegangen und auch
auf die Strafen, die bei der Zerstörung von Bädern anstehen. Auch wird betont, dass es
zur Pflicht des Gastgebers gehörte, dem Gast ein Bad zu bereiten. Im ‛Słownik
Staroźytności Słowiańskich’ steht, dass es eine individuelle Form des Bades bei den Polen
(ebenerdig) gab, während es bei den anderen slawischen Völkern in die Erde eingelassen
war. Es wird der alltägliche, kultische und hedonistische Charakter des Bades betont. Im
‛Lexikon des Mittelalters’ wird hervorgehoben, dass die Sauna oder das Dampfbad
besonders in Nord- und Osteuropa vorkamen und auch, dass die Bäder oftmals als
Zufluchtsort und auch als mystischer Ort wahrgenommen wurden42. Das traditionell
stärker auf archäologischen und ethnologischen Beobachtungen basierende ‛Reallexikon
der germanischen Altertumskunde’43 widerspricht vorsichtig einer geographischen
Zuweisung, da die „Aufstellung eines älteren slawisch-nordgermanischen Saunagebietes
im Gegensatz zu einem mitteleuropäischen Badewannenkreis nicht möglich“44 sei.
Weiterhin werden Bestimmungen aus den älteren Leges Gentium aufgeführt, in denen das
Anzünden von Badehäusern unter Strafe gestellt wurde, gleich beispielsweise dem
Anzünden von Ställen oder anderen Wirtschaftshäusern45. Daraus geht hervor, dass
Badehäuser im Frühmittelalter auch im Reich ziemlich verbreitet gewesen sein müssen,
obgleich direkte Beweise fehlen und es sich wohl vor allem um private Anbauten
handelte. In der Literatur des Hochmittelalters im Reich sei das Baden jedenfalls oft
erwähnt, und es gehörte zur Pflicht des Gastgebers, als Akt christlicher Nächstenliebe
dem Ankommenden ein Bad bereiten zu lassen. Im ‛Handbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte’ betont Karl Kroeschell die rechtliche Stellung des Badeners und der
öffentlichen Bäder – oftmals in den Händen des Grund- oder Stadtherren. Leider wird
aber in keinem der gängigen Lexika auf den herrschaftlichen Charakter des Bades
eingegangen.
39 MARIA WOLEŃSKA, Art. ‛Łaźnia’, in: Słownik Staroźytności Słowiańskich 3, S. 114–115. 40 GERHARD JARITZ, Art. ‛Bad’, in: LMA 1, 1980, Sp. 1331–1333. 41 KARL KROESCHELL, Art. ‛Bader, Badstube’, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1, 1971, S.
282. 42 MANFRED HELLMANN, Art. ‛Bad. Sonderformen in Nordosteuropa und Altrussland’, LMA 1, 1980, Sp. 1333–
1334. 43 HERMANN HINZ, Art. ‛Baderäume’; KURT SCHIER, Art. ‛Badewesen’, in: RGA 1, 1973, S. 579–583; S. 583–
589. 44 Ebd. S. 582. 45 Ebd. S. 585.
10 Grischa Vercamer
In den historiographischen Quellen des Früh- und Hochmittelalters selbst kommen
immer wieder Erwähnungen von Bädern (balnea) vor46, aber diese müssen im Kontext
betrachtet werden. Petrus Damiani sprach beispielsweise im Zusammenhang mit dem
Bad vom Reinigen der Seele47, in der Vita Meinwerci verlangt der im Dezember nach
Paderborn ziehende Kaiser Heinrich II. von Bischof Meinwerk durch Boten, dass ihm
ein heißes Bad zubereitet werde solle. Meinwerk nutzt diese Gelegenheit, um den Kaiser
nach dem Bade in einen feinen Wollmantel einzukleiden und ihn damit zu präsentieren,
da auch andere Große des Reiches anwesend sind48. Karl der Große, bekanntlich an
Gicht leidend, badete gewöhnlich nicht nur mit seinen Söhnen, sondern mit allen seinen
Adeligen in den heißen Quellen von Aachen, wobei Einhard betont, dass er früher sogar
seine Begleiter und Wächter (satellites et custodes) hinzugenommen habe49. Auch diente das
Bad als ein Ort des Rückzugs und somit der Wehrlosigkeit, ein ums andere Mal, hier bei
Notker dem Stammler, als Ort des Hinterhalts, z. B. dem Teufel gegen König Pippin III.
46 Aufgrund der digitalen Suchmöglichkeiten in den Editionen der Monumente Germaniae Historica lässt sich
komfortabel nach den Begriffen balneum, balnea, balneare oder stupa calefacta suchen. 47 O vita heremitica, balneum animarum, mors criminum, purgatorium sordidorum. – Die Briefe des Petrus Damiani, hg. von
KURT REINDEL (MGH Epp. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 4) München 1983–1993, 1, S. 274. 48 Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis, hg. von FRANZ TENCKHOFF (MGH SS rer. Germ. 59) Hannover
1921, cap. 181, S. 103. Heinrich II. verlangt im Jahre 1022 (im Dez.), als er Meinwerk in Paderborn besuchte,
durch vorausgeschickte Boten ein Bad (precipiens necessaria suo preparari balneo). Die ganze Szene nimmt recht
absurde Züge an, da Meinwerk für den Kaiser einen Mantel aus feinster Lammwolle fertigen lässt, wofür er
sämtliche Lämmer auf den Bischofshöfen töten lässt. Als er später auf die Vorwürfe, dass ein solches Gewand
nicht der kaiserlichen Würde entspräche, erklärt, dass er sein Bistum für diesen Mantel in Armut gestürzt habe,
muss der erzürnte Kaiser spontan lachen und verspricht Meinwerk, ihm seinen Aufwand vierfach zu erstatten
und gibt ihm ein Eigengut. Aber es zeigt, wie Meinwerk das Bad letztlich auch nutzt, um zu repräsentieren und
den Kaiser mit seiner Umsicht zu überraschen: Invitatus autem imperator adventum suum denuntiavit episcopo, precipiens
necessaria suo preparari balneo. Episcopus autem per omnes curtes suas dominicales agnas fetas occidi faciens de velleribus agnorum
infra uterum earum inventorum pelles fieri mandavit, quibus pallio novo adopertis et gulis martherinis in circuitu ornatis
imperatorem post balneum vigilię vestivit. Magnates autem regni, qui plures aderant, accedentes pallium consideraverunt et rem, ut
suspicati erant, deprehendentes imperatori innotuerunt. Qui advocato episcopo, cur pelles ovinas sibi dedisset, inquisivit et honoris ac
amoris ignarum dignitatisque Romani imperii eum oblitum proclamavit. Episcopus autem optimum genus indumenti cuique ordini,
conditioni et dignitati conveniens se dedisse asserens mercatores advocavit eosque per gratiam suam hac de re contestatos eorum
testimonio, quę dixerat, vera approbavit. Et accedens ad imperatorem, „Ego“, inquit, „Heinrice, pro corpore tuo mortali vestiendo
pauperem beatę Marię semper virginis episcopatum, a te mihi collatum, devastavi; canonicos eius, villicos et mendicos de velleribus
ovium occisorum fovendos, de lactis eorum copia cibique varii alimonia alendos fraudavi et spoliavi, cuius mali coram Deo reus tu
eris, si non velociter et pleniter ecclesię ablata restitueris“. At imperator arridens: „Ego,“ inquam, „si quem defraudavi vel mei
causa defraudatum novi, reddam quadruplum“; et sic pro huius dampni restitutione contulit ei predium in Steini. 49 Einhard, Vita Karoli Magni, hg. von OSWALD HOLDER-EGGER (MGH SS rer. Germ. 25) Hannover 1911, cap.
22, S. 27: Delectabatur etiam vaporibus aquarum naturaliter calentium, frequenti natatu corpus exercens; cuius adeo peritus fuit,
ut nullus ei iuste caleat anteferri. Ob hoc etiam Aquisgrani regiam exstruxit ibique extremis vitae annis usque ad obitum perpetim
habitavit. Et non solum filios ad balneum, verum optimates et amicos, aliquando etiam satellitum et custodum corporis turbam
invitavit, ita ut nonnumquam centum vel eo amplius homines una lavarentur. JANET L. NELSON, Aachen as a Place of
Power, in: DIES., Courts, elites, and gendered power in the early Middle Ages. Charlemagne and others
(Variorum Collected Studies Series 878) Aldershot 2007, S. 217–241, hier S. 217–218, stellt die für sie offenbar
etwas einfache Sicht Einhards, der ja auch den Schwimmer Karl den Großen betont, der von Alkuin
gegenüber, der das Bad eher als einen Raum für gelehrte oder politische Gespräche in behaglicher Umgebung
sah. Hierin erinnert es etwas, wie schon von ihr angemerkt wurde, an die antiken Bäder als Orte der Begegnung
und Diskussion. Die Wahl Aachens wird sicherlich von verschiedenen (auch geopolitischen) Aspekten
abhängig gewesen sein, aber dennoch wird der gesundheitliche Aspekt, wie er von Einhard betont wird, ein
entscheidender Faktor für Karl gewesen sein.
Das Bad des Königs 11
(714–768)50 – dieser hatte aber wohlweislich ein Schwert mitgebracht, obgleich er sonst
nackt war, konnte sich also erwehren. In der altrussischen Nestorchronik aus dem Jahr
1116 diente das Badhaus gleichzeitig als Ort der Gastlichkeit und Fürsorge wie auch der
List und des Hinterhalts. Die Fürstin Olga bestellte die hochmütigen Fürsten der
Derevljánen, welche ihren Mann zuvor getötet hatten, zu sich und befahl ihnen bei ihrer
Ankunft, sich zu waschen. Nachdem diese, nichts Böses ahnend, ins Badhaus getreten
waren, ließ Olga eben dieses abschließen und samt Insassen anzünden51 – so rächte sie
sich an den Mördern ihres Mannes. Die offensichtliche Leichtfertigkeit, mit der die
Fürsten, die sich als Mörder von Olgas Gemahl durchaus ihrer Gefahr bewusst sein
mussten, das Bad betraten, unterstreicht die Heiligkeit und auch Unantastbarkeit des
Bades, welche Olga so eklatant bricht. Als Rückzugs- und Kontemplationsort wird das
Bad wiederum bei Alkuin erwähnt: Angeklagte sollten entsprechend den Gesetzen von
Theodosius II. an jedem Sonntag (dies dominicus) zum Bade geführt werden, um dort zu
beten (religionis contemplatione)52. Eindeutig religiöse Konnotation erhält das Bad in der
Passio Sancti Adalberti Bruns von Querfurt. Brun lässt Adalbert zu den noch ungetauften
Prußen sagen: Venio ad vos tollere a manu diaboli et faucibus inmitis averni, ut cognoscatis creatorem
vestrum, ut deponatis sacrilegos ritus abrenuntiantes mortiferas vias cum inmunditiis cunctis, et ut loti
[var: utiliori] balneo salutis efficiamini christiani in Christo et habeatis in ipso remissionem peccatorum
et regnum immortalium celorum53. Durch das Bad erfolgten also die Reinigung von den
Sünden und die Bekehrung zum Christentum. In diesen religiösen Kontext gehört auch
die von Jacek Banaszkiewicz54 als Parallele zur Gallus-Passage herangezogene Stelle in der
von Liudger geschriebenen Vita Gregorii: Gregor wurde 790/791 mit der schweren
Aufgabe betraut, die Mörder seiner jüngsten Brüder zu bestrafen. Anstatt Blutrache zu
nehmen reinigte er die Mörder von ihrer Schuld: Sie wurden zunächst auf seinen Befehl
gelöst und gebadet (iussit eos absolvi et balneari), dann bekamen sie saubere Kleidung (vestibus
induti mundis) und durch ein Essen wurde die Handlung beschlossen (cibus refici)55.
Obgleich die Abfolge der Sequenzen ähnlich derjenigen bei Gallus ist, steht die
50 Notker, Gesta Karoli, hg. von HANS FRIEDER HAEFELE (MGH SS rer. Germ. N. S. 12) Berlin 1962, lib. 2,
cap. 15, S. 80. Nam cum apud Aquasgrani thermis nondum ędificatis calidi saluberrimique fontes ebullirent, iussit camerarium
suum praevidere, si fontes purgati essent et ne quis ignotus ibi dimitteretur. Quod cum factum fuisset, assumpto rex gladio in linea
et subtalaribus properavit ad balneum, cum repente hostis antiquus eum quasi perempturus aggreditur. Rex autem crucis signo
munitus, nudato gladio umbram in humana advertens effigie invincibilem gladium ita terrę infixit, ut diutino luctamine vix eum
revocaverit. Quę tamen umbra, tantę crassitudinis erat, ut cunctos illos fontes tabo et cruore abhominandaque pinguetudine
deturparet. Sed nec his motus insuperabilis Pippinus dixit ad cubicularium: „Non sit tibi cura de talibus. Fac effluere infectam
illam aquam, ut in ea, quę pura manaverit, sine mora lavari debeam“. NELSON, Aachen (wie Anm. 49) S. 240, betont,
dass diese Passage nicht nur unter dem Aspekt des Hinterhalts gesehen werden könne, sondern auch durch das
frische Wasser als Taufe und Reinwaschung vom Bösen interpretiert werden müsse. 51 Die Nestorchronik. Die altrussische Chronik, zugeschrieben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in
der Redaktion des Abtes Sil`vestr aus dem Jahre 1116, rekonstruiert nach den Handschriften Lavrent’evskaja,
Radzivilovskaja, Akademičeskaja, Troickaja, Ipat’evskaja und Chlebnikovskaja, hg. von LUDOLF MÜLLER
(Forum Slavicum 56) München 2001, S. 69. 52 Alcvini Epistolae, hg. von ERNST DÜMMLER (MGH Epp. 4) Berlin 1891, Nr. 245, S. 396. 53 Brun von Querfurt, Passio Sancti Adalberti Episcopi et Martyris, hg. von LORENZ WEINRICH und JERZY
STRZELECZYK (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-
Gedächtnisausgabe 23) Darmstadt 2005, S. 70–117, hier S. 104. 54 BANASZKIEWICZ, Król i łaźnia (wie Anm. 20) S. 211. 55 Liudgeri Vita Gregorii, hg. von OSWALD HOLDER-EGGER (MGH SS 15/1) Hannover 1963, S. 63–79, cap. 9,
S. 74.
12 Grischa Vercamer
Gesamthandlung im religiösen und nicht in einem herrschaftlichen Kontext. Liudger
betont die Religiosität und Frömmigkeit von Gregor (ut erat vir spiritualis, doctus a domino
Iesu Christo et sancto Evangeli eius56), der seinen Feinden wie in der Bibel beschrieben,
vergibt. Bei Gallus wird hingegen keine analoge Stelle aus der Bibel zitiert.
Es ergeben sich aus diesen Ausführungen folgende Überlegungen. Das Bad hat des
Öfteren in den historiographischen und hagiographischen Quellen des Früh- und
Hochmittelalters einen sehr intimen Charakter – es ist ein Rückzugsort und auch ein Ort
der Reinigung (sowohl des Körpers als auch der Seele). Ein Versuch, diese Darstellung, in
Kategorien zu fassen, könnte in etwa so aussehen:
a. Baddarstellung im religiösen Kontext;
b. Baddarstellung in gesundheitlichen/vergnüglichen Kontexten;
c. Baddarstellung in herrschaftlichen Kontexten.
Die Baddarstellung, wie sie von Gallus geschildert wird, fällt als einzige unter den
dritten Kategoriepunkt (herrschaftliche Kontexte). Sie erfüllt eine sehr intime (der
Herrscher, obgleich nicht explizit erwähnt, aber doch wahrscheinlich nackt, ist mit dem
Delinquenten allein im Dampfbad57), aber andererseits auch sakral-rituelle Funktion58.
Der Delinquent wird von seinen Sünden gereinigt; die Jüngeren empfangen, wie bei der
Andreassage in der Nestorchronik59, Schläge und werden dadurch zusätzlich gereinigt. In
keiner anderen erzählenden Quelle wird das Bad als Ort der Herrschaftsausübung und
Genugtuung bzw. Sühne inszeniert. Hierin ist die Stelle bei Gallus einzigartig und es darf
behauptet werden, dass es sich hier offenbar um ein von Gallus geschildertes besonderes
Ritual der frühpiastischen Herrschaft handelte. In den beiden osteuropäischen (Landes-
)chroniken, bei denen ein ähnlicher Wert des Bades zu erwarten wäre, die auch genau in
derselben Zeit, Anfang des 12. Jahrhunderts, geschrieben wurden, in der schon
erwähnten Nestorchronik, als dem ältesten historiographischen Zeugnis der Kiewer Rus‘,
und bei Cosmas von Prag60, kommt das Wort Bad nur sehr selten vor und nicht in
solchem Zusammenhang.
Trägt also das Bad einen individuellen Zug im Herrschaftsverständnis der Piasten, so
wäre zu fragen, ob eine ‛Kemenaten-Szene’, wie sie für die Historiographie des Reiches
gerade auch in herrschaftlicher Hinsicht vielfach beobachtet werden kann, vergleichbar
ist. Man könnte somit die Bad-Szene mit einem colloquium familiare vergleichen61, obgleich
dieses eben immer mit einem colloquium publicum gekoppelt war. Da es viele Arbeiten zu
vertrauenbildenden Einigungen im intimen Raum (z. B. Kemenaten) gibt, müssen diese
hier nicht eigens untersucht werden. Bei der Durchsicht jedenfalls der jüngeren
56 Ebd. 57 Es kann wohl kaum bezweifelt werden, dass es sich um ein Dampfbad oder eine Sauna gehandelt hat, wie sie in
Osteuropa und Skandinavien für das 12. Jahrhundert vielfach nachweisbar ist, vgl. HELLMANN, Bad (wie Anm.
42); sowie HARALD EHRHARDT, Art. ‛Bad’, ‛Sonderformen in Nordost-Europa, Skandinavien’, in: LMA 1,
1980, Sp. 1333–1334. 58 BANASZKIEWICZ, Król i łaźnia (wie Anm.20) S. 221. 59 Nestorchronik (wie Anm. 51) S. 8. Dort berichtet der Apostel Andreas, dass die jungen Männer sich bei
einigen slawischen Stämmen beim Saunagang auch peitschten. 60 Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, hg. BERTHOLD BRETHOLZ (MGH SS rer. Germ. N. S. 2)
Hannover 1923, ND 1995. – Hier kommt das Wort balneum gar nicht vor. 61 Vgl. GERD ALTHOFF, Colloquium familiare (wie Anm. 17) S. 170–173. – Wobei in solchen Fällen eigentlich
nicht von den privaten Gemächern des Herrschers die Rede ist.
Das Bad des Königs 13
Forschungsliteratur zum Thema Konflikte, Ehre, Ehrverletzung62 stellte sich heraus, dass
es sich bei der endgültigen Klärung von Konflikten immer um öffentliche Akte handelte,
die teilweise bewusst hinausgezögert wurden, um mehr Öffentlichkeit abzuwarten (ein
gutes Beispiel bietet der weiter unten geschilderte Konflikt zwischen König/Kaiser
Lothar und dem Herzog von Schwaben Friedrich III.). Klaus van Eickels hat in einer
kürzlich erschienenen Abhandlung vertrauensbildende Gesten unter Herrschern
untersucht, die aber, so sein Fazit, bezeichnenderweise immer wenig später gebrochen
wurden, also keine längere Wirkung zeigten63. Daher kann man sie mit der Einigung, wie
sie im balneum Bolesławs I. vollzogen wurde, kaum vergleichen.
Um das Bad aber nicht über Gebühr zu strapazieren, soll nun die in gewisser
Hinsicht ebenso einzigartige Handlungsweise der Königin und somit die Ehre des Königs
ins Blickfeld genommen werden. Es drängt sich auf den ersten Blick der Eindruck auf, als
ob die Königin und die Berater den König düpieren, da königliche Beratungen eigentlich
genau anders zu laufen hatten: Der König müsste die einzelnen Voten der Berater
einholen und dann seine eigene, unabhängige Entscheidung fällen64. Bei Gallus wird aber
über den Kopf des Königs, der seine eigene Entscheidung ja schon gefällt hatte , hinweg
entschieden. Dieser wird nicht nur im Unwissen gelassen, sondern schließlich wird er
sogar vor vollendete Tatsachen gestellt – der vermeintlich zum Tode verurteilte
Delinquent ist in sicherer Entfernung untergebracht und die Autorität des Königs ist
komplett untergraben. Gallus sieht das aber nicht als problematisch an, sondern kehrt
den positiven Charakter der Königin (prudens mulier et discreta) hervor. Wie stellt sich dabei
die Handlung der Königin bei Gallus im Vergleich zu anderen historiographischen
Texten dar? Für die Stellung der Königin65 und der Magnaten als Vermittler ist in
jüngerer Zeit die umfangreiche Habilitationsschrift von Hermann Kamp erschienen66.
Obgleich überraschenderweise in ihr der Fall bei Gallus nicht erwähnt wird, soll auf die
Ergebnisse von Kamp kurz eingegangen werden. Die Königin war nach ihm
prädestiniert, um Konflikte im Familienkreis zu lösen, wofür Kamp einige Beispiele
vorwiegend aus dem 10./11. Jahrhundert anführt67. Aber auch für einzelne Große legte
62 Vgl. Anm. 14. 63 KLAUS VAN EICKELS, Vertrauen im Spiegel des Verrats: Die Überlieferungschance vertrauensbildender Gesten
in der mittelalterlichen Historiographie, in: Frühmittelalterliche Studien 39, 2005, S. 377–385, hier S. 378. – Es
muss hinzugefügt werden, dass van Eickels, außer im ersten Fall, Quellenbeispiele heranzieht, die trotz der
vertrauensbildenden Geste in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber das unterstreicht auch die Schwierigkeiten,
solche Gesten überhaupt in den Quellen zu finden. 64 Vgl. ALTHOFF, Colloquium familiare (wie Anm.17) S. 163–164. 65 Eine eigene Studie zu den weiblichen Beratern bei Gallus Anonymus, Kosmas und Nestor findet sich bei
MARIA DEMBIŃSKA, Wzorzec kobiety słowiańskiej w kronikach Galla Anonima, Kosmasa i Nestora, w:
Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie
pracy naukowej, Warszawa 1991, S. 417–426. Sie stellt die erste Fürstin Böhmens, Lubossa, bei Cosmas sehr
stark heraus (S. 422), die zwar gegenüber Emnilda und Olga in der Tat selbständiger agiert, aber auf der
anderen Seite ist sie eben, gleich wie dann bei Vincentius, die polnische Wanda (Magistri Vincentii, Chronica
Polonorum, hg. von MARIAN PLEZIA [Monumenta Poloniae Historica. N. S. 11], Kraków 1994, lib. 1, cap. 7, S.
12.), die mystische erste Fürstin von Böhmen. Es wird jedenfalls in Bezug auf die Königin Emnilda leider die
Chance verpasst, ihre Handlung vor größerem Hintergrund zu betrachten. 66 HERMANN KAMP, Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter (Symbolische Kommunikation in der
Vormoderne) Darmstadt 2001, hier für die Königinnen S. 155 ff. 67 Ebd. S. 155–158.
14 Grischa Vercamer
die Königin zunehmend seit dem 9. Jahrhundert ein gutes Wort beim König ein, was im
12. Jahrhundert in der bekannten ‛Kreuzwurfszene’ in Mailand (1162) kulminierte, als die
Mailänder mit der Bitte um Barmherzigkeit Einlass bei Königin Beatrix begehrten,
nachdem ihnen von Kaiser Friedrich Barbarossa die Hoffnung auf baldige Vergebung
und somit erneute Verhandlung genommen war. Da ihnen aber auch der Eintritt zur
Kemenate der Königin verwehrt wurde, warfen sie ihre umgehängten Kreuze kurzerhand
durch das Fenster der Königin, um ihre Intervention zu erzwingen68. Insgesamt wird bei
Kamp eher die Individualität der Handlungsweise von Königinnen hervorgehoben, die
jeweils von ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhältnis zu den Konfliktparteien geprägt
war69. Dieses steht teils im Gegensatz zur Habilitationsschrift von Amalie Fößel70, die
besonders den Königinnen des 11. Jahrhunderts im Reich eine rege Interventionstätigkeit
bescheinigt, die „eine gewisse ‛Institutionalisierung’ erreicht“ habe71. In einigen wenigen
Fällen (Kaiserin Adelheid, Königin Mathilde von England, und Kaiserin Richenza)
konnte sogar die Übernahme des Königsgerichts durch die Regentinnen – in Absprache
mit ihren Gatten – nachgewiesen werden, wobei diese dann mit allen rechtlichen
Befugnissen ausgestattet waren72. Der zwischen König/Kaiser Lothar III. und Herzog
Friedrich von Schwaben seit der Königskrönung (1125) des Ersteren schwelende
Konflikt wurde vor allem durch die Vermittlung Richenzas, der Gattin Lothars und Tante
Friedrichs, gelöst. Zunächst unterwarf sich Friedrich ihr in Fulda 1134 nudis pedibus satis
humiliter flagitans73, um die Gunst des Kaisers durch sie wieder zu erlangen. Der Kaiser
selbst war zwar in dieser Zeit auch in Fulda und nahm die Huldigung der ehemaligen
Anhänger des Schwabenherzogs zur Kenntnis, wollte aber nicht mit Friedrich selbst
zusammentreffen, da offenbar nicht genug Öffentlichkeit in Fulda gegeben war –
jedenfalls wurde die Unterwerfung im nächsten Jahr in Bamberg mit größerem Publikum
‛nachgeholt’74. Daher ließ Kaiserin Richenza in Fulda Herzog Friedrich zunächst von der
Exkommunikation durch einen anwesenden päpstlichen Legaten lösen und vermittelte
Frieden zwischen Lothar und Friedrich75. Man sieht anhand dieser Beispiele, dass auch im
Reich die Königinnen des 11./12. Jahrhunderts Fürsprecherrollen einnahmen und in
68 Ebd. S. 159. Das Ereignis wird geschildert in den Annales Colonienses maximi, hg. von GEORG HEINRICH PERTZ
(MGH SS 17) Hannover 1861, S. 723–847, hier S. 776. 69 KAMP, Friedensstifter (wie Anm. 66) S. 160; ähnlich sieht das auch KNUT GÖRICH, Mathilde, Edgith,
Adelheid. Ottonische Königinnen als Fürsprecherinnen, in: BERND SCHNEIDMÜLLER – STEFAN WEINFURTER
(Hgg.), Ottonische Neuanfänge. Symposion zur Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und Europa“, Mainz
2001, S. 251–291, hier S. 290. 70 AMALIE FÖßEL, Die Königin im mittelalterlichen Reich: Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte,
Handlungsspielräume (Mittelalter-Forschungen 4) Stuttgart 2000. 71 Ebd. S. 378. 72 Ebd. S. 153–164. 73 Annales Magdeburgenses, hg. von GEORG HEINRICH PERTZ (MGH SS 16) Hannover 1859, ad a. 1134, S. 185. 74 Cesar venit in quadragesima sicut promiserat 25 ad Bavenberch, ubi facta est permaxima confluentia principum et populi, ei
Fridericus dux cum suis, licet aliquamdiu retinuisset, gratiam imperatoris, publice provolutus pedibus illius, humiliter exquisivit et
mox impetravit. Qui eciam se profecturum cum ipso imperatore in Italiam in proximo anno spopondit, et pacem per totam
Sueviam, sicut decretum fuit, firmiter observari precepit. – Ebd. (zum 17. März 1135). 75 Nam ipsa fecit eum absolvi per legatum apostolici, qui ibi tunc presens fuerat ab excommunicatione, ... – Annales
Magdeburgenses (wie Anm. 73) a. 1134, S. 185. Vgl. dazu FÖßEL, Königin (wie Anm. 70) S. 274–275, sowie
allgemein für weitere Beispiele S. 256–281.
Das Bad des Königs 15
scheinbar ausweglosen Situationen vermittelnd tätig wurden76. Eine derart krasse
Handlung wie sie die (vermutlich) dritte Frau Bolesławs, Emnilda (973–1017)77, die
Tochter des sorbischen Fürsten Dobromir aus der Lausitz, vorgenommen haben soll, ist
jedoch nicht bekannt. Hielt sie doch zum Tode verurteilte Adelige bewusst zurück und
musste damit zu einem hohen Grade die Autorität ihres Mannes untergraben78.
Auch bei den Fürsten, die als Fürsprecher und Vermittler auftreten, sind es eher die
persönlichen Beziehungsnetzwerke und alten Kontakte, die bei solchen Verhandlungen
zählten. Die Elemente der Ehre und des Vertrauens spielten dabei eine wichtige Rolle, da
die Vermittler mit ihrem guten Namen bürgten – lehnte der König die gemachten
Versprechungen der Vermittler ab, verlor dieser an Glaubwürdigkeit79. Es ist aber nicht
bekannt, dass ein ganzer Kronrat samt Ehefrauen sich als Fürbitter dem König zu Füßen
warf (et cum amicis XII et uxoribus eorum ad pedes regis pro sui dampnatorumque venia se
prosternebat). Nun hatte der deutsche König keinen förmlichen Kronrat, sondern einzelne,
je nach Region und Belang auch wechselnde Berater und Vertraute80, die durchaus
prädestiniert waren, als Streitschlichter zu fungieren. Dieses Bild also ähnelt unserem Bild
– jedoch kennen wir aus der deutschen Historiographie nicht den Fall, dass die
Vermittlerfürsten sich selbst zu Boden werfen, um für den in Ungnade gefallenen zu
bitten. Auch mutet es seltsam an, dass die Delinquenten sich persönlich offenbar selbst
dann nicht öffentlich unterwerfen mussten, sondern, bevor sie rehabilitiert wieder nach
Hause geschickt wurden, sogar noch mit königlichen Kleidern bekleidet und – je nach
Interpretation – mit Geschenken überhäuft wurden oder in ihre Ämter (wieder-
)eingeführt wurden. Es sind auch keine Gespräche mit den Familienoberhäuptern der
Delinquenten vorausgegangen, wie es Gewohnheit gewesen wäre81, sondern die Frau des
Königs scheint eigenmächtige Entscheidungen zu fällen.
76 Vgl. auch GÖRICH, Mathilde (wie Anm. 69) S. 285 f. 77 So auch DEMBIŃSKA, Wzorzec (wie Anm.65) S. 421. 78 Allerdings findet sich eine biblische Parallele, die GÖRICH, Mathilde (wie Anm. 69) S. 258–259 näher erörtert.
Er hebt in seiner Abhandlung auf das alttestamentarische ‛Modell’ Esther (Esther 4,11–8,16) ab, die ihr Volk,
die Juden, dadurch rettete, dass sie sich über die königlichen Gesetze hinwegsetzte und in den innersten Hof
des Palastes vordrang, was jedem, sei es Mann oder Frau, bei Lebensgefahr verboten war. Esther wusste um
diese Gefahr und setzte sich ihr trotzdem aus. Glücklicherweise fand sie vor dem König, ihrem Mann, Gnade
und konnte dessen engsten Vertrauten, Haman, des Verrats und der Machtanmaßung überführen. Auch hier
musste der persische König Ahasveros mit Autoritätsverlust rechnen, ließ aber gegenüber seiner Frau Esther
Gnade vor Recht walten. 79 KAMP, Friedensstifter (wie Anm. 66) S. 171. 80 Für das Reich und Frankreich gilt für das 11. und 12. Jahrhundert die Verpflichtung der Fürsten zur Beratung
des Königs (consilium et auxilium), daraus erwuchs aber keine feste Institution, wie sie zunehmend im 13.
Jahrhundert fassbar wird. – Vgl. PAUL-JOACHIM HEINIG, Art. ‛Kronrat’, in: LMA 7, 1995, Sp. 451–453; sowie
CHRISTIAN UEBACH, Die Ratgeber Friedrich Barbarossas (1152–1167), Marburg 2008, bes. S. 251 ff. Er betont
(S. 272), dass es sich um eine „in keinster Weise institutionalisierte Gruppe von Großen des Imperiums“
handelte. JAN-DIRK MÜLLER, Ratgeber (wie Anm. 35) S. 129 und 145, betont aus germanistischer Perspektive
die Schwierigkeiten des Herrschers, die entscheidungstragenden Fürsten an den Herrscherhof zu rufen. War
der eine anwesend, war der andere bereits wieder abwesend – auf diese Weise verzögerten sich herrschaftliche
Entscheidungsprozesse. 81 Vgl. ALTHOFF, Colloquium (wie Anm. 17) S. 173–175. Es scheint mir ein Forschungsdesiderat zu sein, einmal
für die Stauferzeit zu untersuchen, inwieweit ältere Familienmitglieder die Konflikte der jüngeren (und somit
wohl auch unerfahrenen, vielleicht auch hochfahrend und unvorsichtig handelnden) männlichen
Familienmitglieder glätteten und verhandelten. Als Beispiel sei hier nur die bekannte Tübinger Fehde zwischen
16 Grischa Vercamer
Die deditio – oder anders ausgedrückt satisfactio, compositio – besteht hier also nach
dem Gespräch mit der Königin nur im Ertragen der ‛Moralpredigt’ Bolesławs. Es kann
keinesfalls die Rede davon sein, dass Bolesław wie Friedrich Barbarossa an einer
öffentlichen Wiederherstellung seiner verletzten Ehre gelegen war82, es fand kein
Unterwerfungsritual, ausgedrückt etwa durch Barfüßigkeit und Büßergewand, statt83,
sondern ihm lag vielmehr an einer offenbar unprätentiösen, ausgewogenen Machtbalance
in seinem Herrschaftsgebiet84. War er darauf bedacht, seine comites ac principes als fratres vel
filios zu behandeln, so sicherlich in der Rolle des älteren, best immenden Bruders
bzw. Vaters. Diese Rolle durfte er nicht verlieren und daher konnte er bei
entsprechenden Vergehen auch keine Gnade gewähren85. Jedoch befand er sich in einem
unauflöslichen Konflikt, da die Ehre der adeligen Familie des Delinquenten durch den
Tod mit einem Makel versehen worden wäre. Auch die verletzte Ehre einer hochadeligen
Welf VI. und Welf VII. auf der einen Seite, sowie Hugo von Tübingen auf der anderen Seite genannt. Sie wird
in der Historia Welforum und bei Otto von St. Blasius behandelt (Historia Welforum, hg. von GEORG
HEINRICH PERTZ [MGH SS 21] Hannover 1869, cap. 29–31, S. 469–470; Die Chronik von Otto von St.
Blasius und die Marbacher Annalen, hg. von FRANZ-JOSEF SCHMALE [Ausgewählte Quellen zu Deutschen
Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 18a] Darmstadt 1998, S. 50–53). Aus einer
zunächst wohl eher kleineren Sache – Hugo lässt einen Ministerialen der Welfen hängen, verschont aber seine
eigenen Männer, die bei dem gleichen Verbrechen ertappt wurden, und reagiert nicht auf die Klage Welfs VI.
(des Älteren), der die Sache aber dann zunächst zurückstellt – entwickelt sich in Abwesenheit des älteren
Welfen und auch des Kaisers eine ziemlich große Fehde, die vor allem vom jüngeren Welf VII. ausging. In
diese Fehde wurden dann auch andere Reichsfürsten hineingezogen, so dass bald der gesamte schwäbisch-
bayrische Raum betroffen war. Hugo blieb dabei gegen ein Aufgebot Welfs VII. (des Jüngeren) erfolgreich und
machte viele Gefangene (aber nicht den jüngeren Welfen selbst). Darauf kam Welf VI. (der Ältere) schnellstens
aus Italien ins nördliche Reich zurück, um anstatt seines Sohnes die Herausgabe der Gefangenen zu regeln, die
Hugo auch herausgab. Ein einjähriger Waffenstillstand verzögerte den Konflikt nur. Hugo hatte mittlerweile
sowohl Herzog Friedrich IV. (den Neffen des Kaisers) als auch Wladislaw II., den König von Böhmen, auf
seine Seite gezogen und die Sache drohte zu eskalieren. Hier schritt der Kaiser ein: Eine endgültige Regelung
dieser nunmehr ziemlich kritischen Angelegenheit wurde schließlich auf einem Hoftag 1165 getroffen. Neben
Welf VI. war auch Heinrich der Löwe dort anwesend. Hugo musste sich bedingungslos dem jüngeren Welf
VII. unterwerfen. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass die Sache zwischen den älteren Mitgliedern der
Staufer (Friedrich IV., der kaiserliche Neffe, der zu dem Zeitpunkt wohl ca. 20 Jahre alt war und schließlich
auch an der Fehde beteiligt war, wurde nicht belangt) und Welfen geregelt wurde. Hugo von Tübingen (der für
seine Taten bis zum Tode Welfs VII. ins Gefängnis gehen musste) könnte man unter diesen Umständen wohl
ohne Probleme als ‛Bauernopfer’ bezeichnen, während die Ehre der jüngeren Mitglieder der Welfen und
Staufer nicht angetastet bzw. wieder hergestellt wurde. 82 GÖRICH, Ehre (wie Anm. 14) S. 369 f.; für das Verfahren der öffentlichen Unterwerfung an sich, vgl. neu und
zusammenfassend: GERD ALTHOFF, Art. ‛Friedens- und Unterwerfungsrituale’, in: GERT MELVILLE –
MARTIAL STAUB (Hgg.), Enzyklopädie des Mittelalters, Darmstadt 2008, 1, S. 254. 83 Vgl. GERD ALTHOFF, Huld. Überlegungen zu einem Zentralbegriff der mittelalterlichen Herrschaftsordnung,
in: DERS., Spielregeln der Politik im Mittelalter (wie Anm. 17, ursp. 1991), S. 211–212; SCHREINER, ‛nudis
pedibus’ (wie Anm. 8) bes. S. 111–115. 84 Schon eine Rezensentin des Buches von Görich machte darauf aufmerksam, dass Görich den Begriff honor
vielleicht etwas überstrapaziert, PETRA SCHULTE: Rezension zu: Görich, Knut: Die Ehre Friedrich
Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert. Darmstadt 2001, in: H-
Soz-u-Kult, 21. 01. 2002, URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/MA-2002-003. 85 Sehr konkret spricht der Konflikt zwischen Friedrich II. und Heinrich (VI.) hierfür. Waren es doch nicht
inhaltliche Differenzen, sondern vielmehr eine zunehmende Missbalance zwischen Respekt und Ehre
gegenüber der Autorität des Vaters. – Vgl. THEO BROEKMANN, „Rigor iustitiae“: Herrschaft, Recht und
Terror im normannisch-staufischen Süden (1050–1250) (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne)
Darmstadt 2005, S. 322.
Das Bad des Königs 17
Familie konnte selbstverständlich zur Missbalance in einem Herrschaftsgebiet beitragen86.
Dennoch musste Bolesław, seiner eigenen Autorität zuliebe (selbst also wenn er nicht
gewollt hätte – und so wird es ja im tatsächlich Text dargestellt87) auf bestimmte
Vergehen seiner Würdenträger mit dem Todesurteil reagieren88. Unter diesem Aspekt, wir
wollen es nochmals festhalten, wird die Königin zu einem regelrechten
Herrschaftsinstrument. Dem rigor iustitiae des Königs wird bewusst die clementia reginae89
gegenübergestellt. Bolesław I. Chrobry kannte seine Rolle und musste entsprechend
durchgreifend und hart reagieren, um gleichzeitig davon auszugehen, dass es ihm mit
Hilfe seiner Frau und seiner Ratgeber gelingen würde, den verurteilten Adeligen zu retten.
Da die Milde zu den wichtigsten Tugenden eines mittelalterlichen Herrschers und Richters
zählte90, bediente man sich des pium furtum der Königin. Niemandem anderem als der
Königin, auch und gerade in der Öffentlichkeit, welche durch den ‛Kronrat’ hergestellt
war, hätte der König besser verzeihen können, dass seine Autorität dadurch auf geradezu
eklatante Art und Weise untergraben wurde.
IV. KRITIK AN DER HERRSCHAFT BOLESŁAWS III.?
Der ca. 80 Jahre später schreibende Vincent Kadłubek, der generell recht viel von
Gallus übernahm91, veränderte die Stelle entscheidend. Er ließ das balneum vollständig weg
und führte nur die 12 alten und weisen Berater92 Bolesławs sowie seine Frau an. Die 12
Berater, an deren Rat der junge Bolesław saugte wie das Jungtier an der mütterlichen
Brust (quorum [der Räte] sacra iugiter sugebat ubera)93, dienen bei Vincent als Absicherung,
damit niemand sagen könne, dass der junge Bolesław hitzig oder leichtsinnig handele (et
ne ullius posset incircumspectionis argui, ne ullum in eo locum ulla inueniret leuitas, altis prodentum
gaudebat occupari consiliis). Der König selbst hob sich durch seine milde Strenge und strenge
Milde (nam neque sine ultione fuit pius nec sine pietate districtus) ab und war mit Delinquenten
oft mitfühlend, war ihnen gegenüber nicht so sehr Richter, sondern eher Anwalt oder
Schutzherr (non iudicem se gessit set patronum). Wohlbemerkt ist hier aus Gallus‘ pater ein
patronus geworden. Die familiäre Nähe wird also entrückt. Die königliche Ehefrau tritt nur
noch nebensächlich auf, indem betont wird, dass er manchmal durch ihre Umarmungen
besänftigt wurde (Nonnumquam etiam sue delinitus coniugis amplexibus mansuescebat). Obgleich
86 So z. B. die schon in Anm. 81 genannte Tübinger Fehde. – Vgl. hierzu auch ALTHOFF, Konfliktverhalten (wie
Anm. 34) S. 333–343. 87 Cui [der Königin] respondebat, se nichil tam preciosum possidere, quod non daret, si quis eos posset ad vitam de funere revocare,
eorumque progeniem ab infamie macula liberare. – Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) lib. 1, cap. 13, S. 33. 88 Eine Parallele hierzu kann man in der Art und Weise sehen, wie der Herzog von Schwaben, Friedrich III. (der
spätere Kaiser), der von König Konrad III. nach Beendigung des 2. Kreuzzuges 1149 beauftragt wurde,
vorauszureisen und die Ordnung wieder herzustellen, die Rückkehr der königlichen Autorität in Form eines
statuierten Exempels vorbereitet: Von seinen eigenen Ministerialen ließ er zur Sicherung des Friedens einige
hängen (… ex propriis ministerialibus suis pro bono pacis, boni iudicis exercens officium, suspendio peremit.). – Ottonis et
Rahewini Gesta Friderici I. (wie Anm. 18) lib. 1, cap. 64, S. 90. 89 Vgl. für den Terminus FÖßEL, Königin (wie Anm. 70) S. 8. 90 Vgl. BERNHARD STOECKLE, Art. ‛Milde’, in: LMA 6, 1993, Sp. 622–623. 91 Vgl. GERARD LABUDA, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań 1988, 2, bes. S. 20–28. 92 Erinnert sei daran: Bei Gallus waren es noch seine Gefährten mit ihren Frauen. 93 Diese und folgende Zitate bei: Magistri Vincentii Chronica (wie Anm. 65) lib. 2, cap. 10, S. 39.
18 Grischa Vercamer
Vincent wesentlich stärker als noch Gallus die Unabhängigkeit vom Reich betont94 und
somit herrschaftliche Handlungsweisen widerspiegeln könnte, die im Reich nicht bekannt
waren, scheint er die bei Gallus geschilderte Doppeldeutigkeit und sehr individuelle Rolle
der Ehefrau als nicht mehr würdig eines polnischen Königs bzw. europäischen
Herrschers zu empfinden.
War daher das bei Gallus geschilderte herrschaftliche Ritual unter Bolesław III. ein
gängiges Herrschaftsverfahren, das ca. 80 Jahre später nicht mehr bekannt war und
insofern nicht mehr dechiffriert werden konnte? Tatsächlich hätte ja die Königin auch bei
Gallus, wäre es für die Zeitgenossen nicht als klare, nachvollziehbare Herrschaftspraxis
lesbar gewesen, den König auf diese Weise kompromittiert und desavouiert. Das kann
aber angesichts der wichtigen Vorbildrolle, die Bolesławs I. bei Gallus spielt, keinesfalls
angenommen werden.
Welche Vorbilder mögen hier Gallus für die Konzeption der Szene gedient haben? –
Denn wir müssen schließlich davon ausgehen, dass die Zeitgenossen mit dieser
Herrschaftspraxis etwas Konkretes verbanden. Bolesław war seit 1115 in zweiter Ehe mit
Salomea von Berg-Schelklingen verheiratet, während seine erste Frau, Zbysława95, die
Tochter des Großfürsten von Kiew, Swiatopolk II., ein Jahr zuvor (1114) gestorben war.
Das Werk Gallus‘ (zwischen 1112–1118 zu datieren) entstand dementsprechend kurz vor
oder nach der Heirat mit der zweiten Ehefrau, die Gallus aber überraschenderweise gar
nicht erwähnt96. Auch über die erste Frau weiß er nur zu sagen, dass die Hochzeit nach
kanonischem Recht eigentlich nicht hätte zugelassen werden dürfen, da das
Hochzeitspaar im vierten Grad verwandt war. Er berichtet weiter, dass der Bischof von
Krakau die Dispens vom Papst nur mit dem Hinweis auf die Rohheit des Christentums in
Polen und die Notwendigkeit für seine Heimat (fidei ruditatem et patrie necessitatem97) erreicht
hatte. Gallus betont die Singularität (non canonice nec usualiter, sed singulariter collaudavit) des
päpstlichen Entscheids und schreibt, dass er nicht Richter über Sünden sei, sondern die
Taten der polnischen Herzöge verfasse (Nos autem de peccato tractare vel iustitia materiam non
habemus, sed res gestas regum ducumque Polonie sermone tenui recitamus98). Überhaupt aber ist es
äußerst auffällig, dass Bolesław III. vor allem durch seine Kriegstaten glänzt99; wir
94 SŁAWOMIR GAWLAS, Der Blick von Polen auf das mittelalterliche Reich, in: BERND SCHNEIDMÜLLER (Hg.),
Heilig – Römisch – Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa, Dresden 2006, S. 266–285, hier S. 274. 95 Vgl. ANDRZEJ MARZEC, Art. ‛Bolesław III Krzywousty’, in: STANISŁAW SZCZUR – KRZYSTOW OŻÓG (Hgg.),
Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999, S. 75–84. 96 Dieses Faktum ist bislang für die Datierung anscheinend nicht näher beachtet worden, könnte aber als Indiz
für eine Entstehung vor 1115 sprechen. Leider kann aber im Rahmen dieses Aufsatzes nicht näher darauf
eingegangen werden. Auch BAGI, Królowie (wie Anm. 25) S. 27–37, bringt Argumente um den bislang von der
polnischen Forschung eher weiter (1112–1118) gesetzten Entstehungszeitraum auf die Jahre 1113–1115
einzuengen. 97 Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) lib. 2, cap. 23, S. 90. 98 Ebd. 99 Zwar schickt Gallus selbst im Widmungsbrief zum 3. Buches an die Geistlichen in Polen voraus, dass in den
Kirchen Heiligenviten, aber in capitoliis der Mut und Sieg der Könige und Fürsten als Vorbild dienen sollen
(‚Denn so wie man die heiligen Männer um ihrer guten Werke und Wunder willen feiert, so werden die
weltlichen Könige und Fürsten durch ihre triumphalen Kriege und Siege erhöht.‘), aber trotzdem zeigt das Bild
von Bolesław I., welches Gallus entwirft, dass ihm selbst in einer Beschreibung eines idealen Herrschers
eigentlich bloße Kriegstaten nicht reichen. In dieser Hinsicht stimme ich auch nicht ganz mit BANASZKIEWICZ,
Das Bad des Königs 19
erfahren wenig bis gar nichts über seine Administration, seinen Umgang mit seinen
Großen oder der Bevölkerung. Wir haben also definitiv mehr Informationen über ein
(angeblich) frühmittelalterliches Polen zur Zeit von Bolesław I. als über das seines
Nachfahren und Zeitgenossen Gallus‘100.
Dennoch lässt sich bei Gallus ein Vorbild seiner Zeit für die Rolle der Königin
finden, da er an mehreren Stellen die Mutter Bolesławs III., Judith von Böhmen, die
Enkelin jenes böhmischen Herzogs Bretislav I., der 1039 ganz Polen plünderte und die
Reliquien Adalberts nach Prag brachte, nennt und näher beschreibt. Judith starb 1085 an
den Folgen der Geburt von Bolesław III. Durch ihr Streben und ihren Kinderwunsch
wurde sehr wahrscheinlich der Kontakt zum Kloster Saint-Gilles in der Provence
hergestellt, mit dem Gallus bislang nach wie vor von der Forschung verbunden wird101.
Judith war jedenfalls laut Gallus eine Frau, die gute Werke an Armen und Gefangenen
getan habe und viele Christen aus der jüdischen Gefangenschaft102 befreit habe103.
Obgleich das Porträt von Judith damit recht knapp ausfällt, stellt es vor dem
Hintergrund, dass Gallus über die anderen piastischen Frauen gar nichts schreibt, etwas
Besonderes dar. Es spiegelt außerdem in etwa die Tätigkeit wider, die Gallus der Ehefrau
Bolesławs I. zuschrieb. Die Gattin von Władysław I. Hermann jedenfalls lebte zeitlich
dermaßen nahe am Abfassungsdatum der Chronik, dass sich die Zeitgenossen Gallus‘
noch an sie und ihr Wirken erinnern mussten. Es wäre also möglich, dass Gallus einen
Teil der Herrschaftspraxis respektive der Herrschaftsrituale von Władysław I. Hermann
auf seine Beschreibung von Bolesław I. übertrug. Da besonders die letzten Jahre der
Regierung Władysławs I. von Konflikten mit den Söhnen, also auch mit dem künftigen
Herzog Bolesław III., durchsetzt waren, konnte Gallus gerade diesen polnischen Herzog
nicht so sehr als leuchtendes Beispiel herausheben wie er es vielleicht gerne getan hätte104.
Zumindest für die letzten Regierungsjahre von Władysław I. Hermann, nach der
Verbannung des Palatins Sieciech, attestiert ihm Gallus aber eine weise und
verantwortungsvolle Herrschaft, die mit seinem Tode endet105. Auffallend dabei ist, dass
eben jener Erzbischof Martin, den Gallus im Widmungsbrief zu dem ersten Buch seiner
Gall jako historyk (wie Anm. 26) S. 403, überein, der das Gewicht der Kriegstaten gegenüber den anderen
herzoglichen Taten meines Erachtens etwas zu stark betont. 100 Vgl. die kritische Anm. 108 und Exkurs 1. 101 Vgl. BAGI, Królowie (wie Anm. 25) 176–201; ZBIGNIEW DALEWSKI, Ritual and Politics: Writing the History
of a Dynastic Conflict in Medieval Poland, Leiden – Boston 2008, S. 3. Die exakte Herkunft dieses Chronisten
wird sich vermutlich niemals nachweisen lassen, aber zumindest lassen sich Orte längeren Aufenthalts des
Chronisten herausstreichen: Frankreich, Ungarn, Polen. 102 Hier ist vermutlich der in Prag abgewickelte Sklavenhandel gemeint. – Vgl. DMITRIJ MISHIN, Saqlabī servants
in Islamic Spain and North Africa in the Early Middle Ages, Budapest 1999, S. 76–79. 103 Que mulier in pauperes et captivos ante diem precipue sui obitus opera pietatis exercebat et multos christianos de servitute
Iudeorum suis facultatibus redimebat. – Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) lib. 2, cap. 1, S. 63. 104 Vgl. LIDIA KORCZAK, Art. ‛Wladysław I Hermann’, in: Piastowie (wie Anm. 95) S. 63–66; sowie konkret bei
Gallus (Galli Anonymi, Cronicae [wie Anm. 1] lib. 2, cap. 16, S. 79–84), wo die Brüder gegen den Vater
militärisch vorgehen und der Vater von den Vornehmen als wahnsinnig hingestellt wurde (Unde cuncti proceres
indignati asserebant, quia deserere filios totque principes cum exercitu non sapientis, sed consilium delirantis, … decreverunt, ebd.
S. 83). 105 Dux igitur Wladizlauus pristine sedicionis reminiscens, quoniam Zetheum de Polonia profugavit, quamvis etate debilis et
infirmitate fuerit, nullum tamen in curia sua palatinum vel palatini vicarium prefecit. Omnia namque per se ipsum vel s u o
c o n s i l i o sagaciter ordinabat, vel cuilibet comiti, cuius provinciam visitabat, curie responsionem et sollicitudinem commendabat. Et
sic per se patriam sine palatino comite rexit … – Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) lib. 2, cap. 21, S. 88–89.
20 Grischa Vercamer
Chronik an erster Stelle grüßen lässt106, der also sicherlich zu den Auftraggebern und auch
Beschützern des Werkes107 zählte, über fünf Tage die Exequien für den Toten halten ließ,
es aber aus Furcht vor den Erben, Zbigniew und Bolesław, nicht wagte, die Leiche zu
bestatten. Als diese schließlich eintrafen, entstand laut Gallus sogleich ein großer Streit
um die Teilung des Erbes. Dieser anhaltende Bruderkonflikt, bei dem Bolesław III. von
Gallus durchaus kritisiert wird108, sollte das Land in den nächsten Jahren in eine tiefe
Krise stürzen, die erst mit der Verbannung Zbigniews endete und die beinahe bis zur
Abfassung der Chronik reichte. Hierin wird schließlich nicht umsonst der Hauptgrund
für den Auftrag zum Schreiben der Chronik gesehen, da die angeschlagene Ehre
Bolesławs III. wieder hergestellt werden musste109. Die Art und Weise, wie Gallus
insgesamt die Herrschaft Bolesławs beschreibt, zeugt davon, dass er diese durchaus
kritisch sah, auch wenn er sich davor hütete, dies offen zu schreiben (vgl. Exkurs 1).
Davon allerdings, dass auch andere einflussreiche Personen am Herzogshof diese Kritik
durchaus wahrnahmen, zeugt der Passus im 3. Widmungsbrief: „Darüber hinaus möge
um Gottes und Polens willen die Klugheit eurer [der herzoglichen Kapläne] Tüchtigkeit
dafür sorgen, dass nicht Neid oder ein eventuell meinerseits vorkommendes Unvermögen
den Lohn für eine so große Mühe verhindere. Denn wenn mein Werk von den Weisen
als für die Ehre des Vaterlandes gut und nützlich beurteilt wird, wäre es unwürdig und
unangebracht, wenn auf den Rat gewisser Leute dem Verfasser der Lohn für sein Werk
entzogen wird“110. Es wird also auf die Ehre des Vaterlandes und nicht etwa auf den
Fürsten Bolesławs III. abgehoben.
FAZIT
106 Ebd. Epistola, S. 1–4. 107 Schon in demselben Widmungsbrief wird von Gallus deutlich unterstrichen, dass die Abfassung der Chronik
von Argwohn und Feindschaft einflussreicher Personen begleitet wurde (Et cum tales premiserim causidicos
defensores, floccipendam quicquid mussitando murmurrant invidiosi detractores. – Ebd. S. 2–3). 108 Wohl gegen DALEWSKI, Ritual (wie Anm. 101) der im 3. Kap., Penance, S. 85 ff., vor allem darauf eingeht,
dass nur der Bruder ein negatives Image bekommt und Bolesławs Handeln verteidigt. Wir müssen uns aber
erinnern, dass Gallus (Galli Anonymi, Cronicae [wie Anm. 1] lib. 3, cap. 25, S. 156), über Zbiegniew schreibt,
dass er satis humili satisque simplici war und dass er ihn von der Schuld befreit, die Gallus eben auf seine bösen
Berater bezieht. Obgleich er im selben Atemzug Bolesławs Verhalten als spontan-reagierend und eben nicht
geplant verteidigt, fragt er im nächsten Satz. Quid ergo? Acusamus Zbigneuum et excusamus Boleszlauum? Nequaquam.
Sed minus est peccatum ira precipitacionis ex occasione data perpetrare, quam illud faciendum ipsa deliberatione pertractare (ebd.
S. 156 f.). Die spontane, durch Zorn geleitete Reaktion von Bolesław wird hier über die kaltblütig überlegte
Reaktion gestellt, aber Zorn ist wohl immer eine schlechte Herrschertugend und der Herrscher sollte sich milde
verhalten; daher überrascht es nicht, dass Gallus die nächsten Seiten der anschließenden und lang anhaltenden
Buße Bolesławs widmet. Vgl. zum Zorn etwa die Selbsteinschätzung von Kasimir II. dem Gerechten bei
Vincentius, als er einem armen Adeligen beim Würfelspiel viel Geld abgewinnt und der Adelige daraufhin
aufspringt und Kasimir im Affekt schlägt. Nachdem er gefasst wurde, erwartete Kasimirs gesamter Hof ein
schweres Urteil, Kasimir lässt sich aber überhaupt nicht vom Zorn leiten, sondern bleibt milde und dankt dem
Adeligen sogar für die Lektion, da ein richtiger Fürst nicht spielen sollte. – Magistri Vincentii, Chronica
Polonorum (wie Anm. 65) lib. 5, cap. 15–21, S. 141–142. 109 DALEWSKI, Ritual (wie Anm. 101) S. 6. 110 Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) lib. 3, Epistola, S. 123, Insuper illud causa Dei causaque Polonie provideat
vestre discrecio probitatis, ne mercedem tanti laboris impediat vel odium vel occasio mee cuiuslibet vanitatis. Nam si bonum et utile
meum opus honori patrie a sapientibus iudicatur, indignum est et inconveniens, si consilio quorundam artifici merces operis
auferatur.
Das Bad des Königs 21
Wir sind zunächst von der Besonderheit des Kapitels 1, 13 in der Chronik des
Gallus Anonymus ausgegangen, die im Vergleich zu anderer erzählenden Quellen aus der
Zeit – sowohl in Bezug auf die Rolle der Königin und der Berater als auch in Bezug auf
die konkrete Szene des Königs im Bade – keine Analogien besitzt. Die daraus
resultierenden Überlegungen zur Herrschaftspraxis respektive zu Herrschaftsritualen bei
den piastischen Herzögen führten zu dem Schluss, dass wir es mit einer sehr spezifischen
Form konsensualer Herrschaft111 zu tun haben, bei der die ausgleichende Rolle der
Königin äußerst wichtig war, um einerseits die Ehre des Königs zu wahren und
andererseits die Machtbalance zwischen den führenden Familien im Land
aufrechtzuerhalten112. Diese ausgleichende Herrschaftsform des ersten Königs von Polen
bildet in der Beschreibung Gallus’ gewissermaßen einen konstruierten Gegenpol zu der
äußerst kriegerischen (und vielfach vom Zorn gelenkten, also unbedachten)
Herrschaftspraxis Bolesławs III.113 Auf der Suche nach historischen Vorbildern für diese
Herrschaftspraxis könnten die Eltern Bolesławs III., Władysław I. und Judith von
Böhmen, in Frage kommen. Obgleich die Indizien dafür jeweils für sich genommen nicht
deutlich genug sind, bilden sie doch in der Gesamtheit ein kohärentes Bild: Judith bekam
von Gallus exakt jene Charaktereigenschaften zugeschrieben, die Emnilda, die Frau
Bolesławs I., in Kapitel 1,13 ebenfalls auszeichneten – Güte und Milde gegenüber Armen
und Gefangenen. Des Weiteren war die Herrschaft Władysławs den rezipierenden
Zeitgenossen noch geläufig und auch Gallus musste auf ein zeitgenössisches Vorbild
zurückgreifen, da die von ihm (angeblich) benutzte, heute verlorene Passio sicherlich nicht
ein so vollständiges Bild der Herrschaft Bolesławs I. Chrobry übermittelt hat. Die letzten
Jahre der Regierung Władysławs I. waren durch den Konflikt des Vaters mit seinen
Söhnen gekennzeichnet – Gallus durfte also höchstwahrscheinlich diesen piastischen
Herrscher nicht allzu positiv darstellen und so reduzierte er dessen Beschreibung vor
allem auf seine Rolle als Vater Bolesławs. Dennoch wird Władysław I. in kurzen
Passagen bei Gallus als weiser und verantwortungsvoller Herrscher skizziert.
Herrschereigenschaften, die Bolesław III., jedenfalls in der Chronik Gallus’, deutlich
fehlen.
EXKURS 1:
Es werden im folgenden einige Passagen genannt, in denen ein kritischer Ton von Gallus unterstellt
werden kann: Das dritte Buch bricht leider mitten in der Belagerung des pommeranischen Kastells Nakel ab
und es ist Maleczyński in dem Kommentar am Ende der Edition, Galli Anonymi, Cronicae (wie Anm. 1) S.
163–164, Anm. 4, zuzustimmen, dass wohl hier mitten im unvollendeten Kapitel abgebrochen wurde und ein
111 Zu diesem noch recht jungen Forschungsterminus vgl. BERND SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft.
Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: PAUL-JOACHIM HEINIG –
BARBARA KRAUß (Hgg.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit: Festschrift für Peter Moraw
(Historische Forschungen 67) Berlin 2000, S. 53–87. 112 Das Fazit von GAWLAS, Territorialisierung (wie Anm. 38) S. 42, stützt diese Ansicht, indem er die besonders
im 12. Jahrhundert herrschende Konkurrenz der „oligarchischen Elite“ gegenüber den Herrschern betont.
Dieser Gefahr seien die piastischen Teilfürsten erst im späten 13. Jahrhundert mit dem Instrument der
deutschen Ostsiedlung Herr geworden. 113 Vgl. Exkurs 1.
22 Grischa Vercamer
erheblicher Teil fehlt, vielleicht kurz nach Fertigstellung verloren ging. Wir könnten also von einer
Interpretation ausgehen, dass Gallus zur näheren Beschreibung von Bolesławs Herrschaftsform noch den
verlorenen Teil vorgesehen hatte, aber dennoch haben wir immerhin die 50 Kapitel des 2. Buches und die 26
Kapitel des 3. Buches, die sich fast ausschließlich den Kriegstaten und dem Ruhmstreben (und kaum etwas
anderem!) Bolesławs III. widmen. Nicht selten wird dabei das eigensinnige und auf Ruhm bedachte Handeln
Bolesławs versteckt getadelt, wie in den folgenden Beispielen illustriert: Noch unter der Herrschaft von
Władysław I. Hermann, als die beiden jungen Brüder vom alten Fürsten mit Truppen losgeschickt wurden,
um gegen die Pommern in den Krieg zu ziehen, zeigten sie sich völlig unfähig und kehrten unverrichteter
Dinge zurück – Gallus weiß selbst nicht genau, was passierte war: Illi autem abeuntes et quale nescio consilium
capientes, inperfecto negocio ex itinere redierunt. (lib. 2, cap. 7, S. 74). Es wird deutlich, dass auch Bolesław,
vermutlich im Konflikt mit seinem Bruder, hier die Befehle seines Vaters missachtete und somit eine Gefahr
für die polnische Herrschaft des Vaters darstellte, was Gallus aber nicht näher ausdrücken durfte. Der Vater
jedenfalls nimmt sofort nach dieser Erfahrung eine Teilung der Herrschaftsgebiete seiner Söhne vor – die
Bruderkonkurrenz, die zu nicht wenigen Teilen auch von Bolesław ausgehen musste, war also schon spürbar.
Auch in der nächsten Passage (lib. 2, cap. 9, S. 76) wird das eigensinnige Verhalten des jungen Bolesław,
offenbar oftmals gegen die Befehle des Vaters, betont (Nondum enim equum ascendere vel descendere suis prevalebat et
iam inv i t o p a t r e vel aliquotiens nesciente, super hostes in expeditionem dux militie precedebat). Beim Lesen besonders
des 2. Buches bekommt man ohnehin von Bolesław III. den Eindruck eines jungen Heißsporns, der sich für
seinen Kampfesruhm wenig um andere oder das Gemeinwohl kümmerte: Als Bolesław, viel zu unerfahren
offenbar, um so etwas zu vollbringen, einem starken Eber nachjagte, wird er von einem seiner Jäger
aufgehalten, der ihn wahrscheinlich vor der Gefahr schützen wollte. Mit diesem kämpfte er um seinen
Jagdspeer und Gallus betont, dass der starke Boleław hier einen doppelten Kampf gegen den Jäger und gegen
den Eber bestand. Es klingt aber deutlich zwischen den Zeilen an, dass Gallus dieses Verhalten als töricht
betrachtet (Quadam vice puer Martis ad gentaculum in silva resideus, aprum immanem transeuntem, ac densitatem silve
subeuntem, vidit, quem statim de mensa surgens, assumpto venabulo subsecutus, s i n e c om i t e v e l c an e presumptuosus
invasit. Cumque fere silvestri propinquasset et iam ictum in eius gutture vibrare voluisset, ex adverso quidam miles eius occurrit,
qui vibratum ictum retinuit, et venabulum ei auferre voluit. Tum vero Boleslauus ira, immo audacia stimulatus, geminum
duellum mirabiliter, humanum scilicte et ferinum, singulariter superavit. Nam et illi venabulum abstulit et aprum occidit. Ille
vero miles postea, cur hoc fecerit requisitus, se nescivisse, quid egerit, est professus et ob hoc tamen est ab eium gratia longo
tempore sequestratus. – lib. 2, cap. 11, S. 77) Es scheint doch offensichtlich, dass der Ritter aus Bolesławs
Gefolge, der im Nachhinein nicht mehr wusste, warum er überhaupt Bolesław aufgehalten hatte, den jungen
Fürsten schützen wollte – wahrscheinlich war er überdies für dessen Wohl verantwortlich. Auch in einer
anderen Szene wird Bolesławs ruhm- und beutebedachtes Handeln, indem Gallus durch die älteren und
erfahrenen Adeligen spricht, verdeckt kritisiert: Bolesław war bei einem Festmahl mit seinen jungen
Gefährten, die seniores beim Fest zurücklassend, auf die Jagd im Grenzgebiet zu Pommern gegangen. Als er
dort Pomoranen antraf, die räuberisch das Grenzland durchzogen, setzte er zur Verfolgung an und geriet in
einen Hinterhalt. Gallus kommentiert: incidit inscius in insidias, ubi dampnum inreparabile pateretur (lib. 2, cap. 33, S.
101). Unvorsichtig (oder unwissentlich) ist er also in einen Hinterhalt geraten, wo er nicht wiederherstellbaren
Verlust hätte erleiden können. Bolesław entscheidet sich trotz der Übermacht des Gegners – er selbst hatte
nur 80 Mann dabei, gegenüber 3000 Kämpfer der Pomoranen – zum Kampf. Gallus dazu: utrum presumpcioni
vel audacie, nescio, si fuerint ascribenda. ‚Ist das Anmaßung oder Kühnheit?‘ – fragt sich Gallus. Nachdem ein
Großteil seiner jugendlichen, adeligen Begleiter dahingemetzelt wurde, kamen ihnen die beim Festmahl
verbliebenen restlichen Krieger zur Hilfe. Die Pomeranen flohen und die älteren Vornehmen der Polen
tadelten Bolesław wegen einer solchen Tollkühnheit und trauerten um die zahlreichen Toten. Bolesław
scherte sich, wie man dem Text entnehmen kann, kein bisschen um den Tadel und bereute auch nicht seine
Das Bad des Königs 23
Tat, sondern erinnerte sie nur an den Treueeid, der sie dazu verpflichtete weiterhin mit ihm zu kämpfen:
Advenientes autem illuc proceres dolorem de dampno tante nobilitatis habuerunt et Bolezlauum de audacia tante presumptionis
reverenter increpuerunt. Filius vero Martis Bolezlauus non solum aurem correctoribus non adhibuit, nec se talia presumpisse
penituit, sed per eos se iuvandum et de hostibus vindicandum sub testatione fidelitatis ammonuit (lib. 2, cap. 33, S. 102). Das
Bild eines selbstherrlichen und rücksichtslosen Herrschers wird hier gezeichnet, der nicht einmal nach der
Schlacht der Toten gedenkt und auf seine älteren Berater kaum Rücksicht nimmt. Das Bild wiederholt sich
übrigens auch noch in einem anderen Kapitel: Die älteren Berater raten aus Umsicht während eines
Kriegszug gegen Böhmen von einem Vorrücken gegen Prag ab, während Bolesław III. und seine jungen
Krieger unvorsichtig die Gefahr eingehen wollen. Letztlich wurden sie aber durch die unzureichenden
Vorräte davon abgehalten, offenbar ein Glücksfall (lib. 3, cap. 22).
An mehreren Stellen wird auf Bolesław als Sohn des antiken Kriegsgottes Mars (puer Martis) rekurriert
(lib. 2, cap. 11, 13, 14, 17, 18) und auch sein Zorn wird an nicht wenigen Stellen betont (lib. 2, cap. 11, 24, 33;
lib. 3, cap. 25, 26). Die Unfähigkeit, seine von Blutdurst und Beutelust gelenkten Krieger bei Belagerungen
oder Angriffen diszipliniert zurückzuhalten, wird zweimal erwähnt (lib. 2, cap. 28 und 48). Hingegen mit der
christlichen Frömmigkeit Bolesławs III. geht Gallus äußerst sparsam um und nennt diese vor allem an
Stellen, wo es tatsächlich merkwürdig wäre, würde er sie weglassen (z. B. bei der Pilgerfahrt Bolesławs nach
Ungarn nach der Sünde, die er an seinem Bruder begangen hat, lib. 3, cap. 25). Geradezu offen tadelt Gallus
die Teilnahme Bolesławs an einer Hochzeit, die mit der Einweihung einer Kirche zusammenfiel. Gallus
kritisiert hier entweder die bewusste Missachtung der kanonischen Gesetze oder er hält Bolesław Naivität
bzw. Unkenntnis vor, dass er so etwas überhaupt zulassen konnte, saepe namque cernimus, ubi simul ecclesie
consecracio ac nupcialis desponsacio fiunt, seditiones et homicidia comitari (lib. 2, cap. 33, S. 100). Es sei doch, laut
Gallus, landläufig bekannt, dass eine Hochzeit gemeinsam mit einer Einweihung von einer Kirche von
Aufruhr und Mord begleitet werde.
Herrschaftstugenden wie Milde, Zurückhaltung, Bildung oder Umsicht sind dem Bericht Gallus’ über
Bolesław III. kaum zu entnehmen. An einer Stelle wird die Bildung und Umsicht Zbigniews gegenüber
Bolesław regelrecht herausgestellt. Bolesław erfuhr von seinen Leuten, dass ihm der Palatin Sieciech nach
dem Leben trachtete; er wird in diesem Augenblick als völlig apathisch und unfähig zur Entscheidung
dargestellt: Hiis dictis (seine Kriegsgefährten berichten Bolesław von den Plänen Sieciechs) puer Bolzlauus
vehementissime metuebat, totusque sudore (et lacrimis) manantibus affluebat (lib. 2, cap. 16, S. 80). Ein Plan wurde
gefasst – es scheint dieser eher von den Begleitern Bolesławs, als von ihm selbst ausgegangen zu sein – und
man verabredete mit Zbigniew, dass man sich in Breslau treffen wolle. Als Zbigniew in Breslau eintraf,
brachte er als der Ältere und Gebildetere die Bürger Breslaus durch eine Rede, die Bolesław offenbar nicht in
der Lage war zu halten, auf ihre gemeinsame Seite: …, orationem fratris (Bolesławs), ut litteratus et maior etate
(Zbigniew ist gemeint), rethorice coloravit, ac populum tumultuantem ad fidelitatem fratris et contrarietatem Zethei luculenta
oratione sequenti vehementer animavit. (ebd. S. 81). Die Vermählung Bolesławs mit seiner ersten Frau Zbysława,
die kanonisch nicht korrekt war (vgl. Anm. 97 und 98; lib. 2, cap. 23) wird von Gallus ausweichend
kommentiert – er enthält sich einer Wertung, aber eben durch diese Enthaltung wird seine Abneigung
deutlich. Die großzügigen Geschenke, die Bolesław III. anlässlich seiner Vermählung machte, haben offenbar
auch etwas mit dem Krieg zu tun, waren vielleicht nicht selten Kriegsbeute, denn Bolesław wird von Gallus
beim Schenkungvorgang nicht mit dem Attribut ‛freigiebig’ sondern kriegerisch (belliger) umschrieben (lib. 2,
cap. 23, S. 90).
Nach Aufzählung all dieser Stellen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Bolesław III. ein
ausgezeichneter und äußerst wagemutiger Krieger war, was vielleicht der Zeit (Kämpfe mit den Pomeranen,
mit den Prußen, mit den Böhmen und mit dem Kaiser werden geschildert) angemessen war. Aber neben
diesen kämpferischen und strategischen Fähigkeiten, die oftmals in ihrer Umsetzung von Gallus als riskant
24 Grischa Vercamer
und rücksichtslos charakterisiert werden, bleibt das Bild des Herrschers und seiner sonstigen Qualitäten völlig
verschleiert. Im Kontrastprogramm zu den omnipräsenten Kriegstaten, wird in den letzten Kapiteln des 3.
Buches auf die Bußfahrt Boleslaws eingegangen (lib. 3, cap. 25). Plötzlich ist er nicht mehr der tollkühne,
zornige Kriegsfürst, sondern benimmt sich demütig und freigiebig gegenüber den Armen und der Kirche. Es
ist bezeichnend, dass Gallus, nachdem er die fromme Pilgerfahrt ausgedehnt geschildert hat, wieder zu den
Kriegstaten zurückkehrt, die nicht, wie Gallus sich ausdrückt, aus ‚unserem Herzen … getilgt‘ seien und
‚niemand soll das für eine verfehlte Anordnung halten, denn wenn das [die Belagerung] dazwischen eingefügt
worden wäre, hätte es die ganze Abfolge der begonnen Erzählung verwirren können (non ideo tamen est obsessio
facta prius, de cordis nostri memoria sic delata nec debet quisquam illud preposterum ordinem reputare, quod, si fuerit
intersertum, poterit cepte narrationis totam seriem perturbare. – lib. 3, cap. 25, S. 160). Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass das 25. Kapitel des 3. Buches nachträglich eingebracht wurde, da es ohne jegliche
Anbindung erscheint. Gerade dieses Kapitel soll aber die Taten Bolesławs gegenüber seinem Bruder
rechtfertigen – sicherlich ein zentrales Anliegen der Auftraggeber Gallus’. Es gelingt dem Chronisten (und
will ihm vielleicht auch nur bedingt gelingen) nur hinlänglich, das Bild des zornigen, jungen Kriegsfürsten in
das eines frommen, umsichtigen Fürsten zu wandeln. Die Herrschaftsqualitäten Bolesławs I. aus dem ersten
Buch stehen dem hier geschilderten diametral gegenüber.