2000 Orientalische Kulte
Transcript of 2000 Orientalische Kulte
LIMESMUSEUM ITHEISS
AUGUSTUS BIS ATTILA
Os\v
LEBEN AM UNGARISCHEN
v * * * * * * j r :A
DONAULIMES
ZWEIGMUSEUM DES WÜRTTEMBERGISCHEN LANDESMUSEUMS
L I M E S M U S E U M A A L E N
Z W E I G M U S E U M
D E S W Ü R T T E M B E R G I S C H E N
L A N D E S M U S E U M S
S T U T T G A R T
Ö F F N U N G S Z E I T E N :
TÄGLICH AUßER MONTAGS V O N 1 0 - 1 2 U H R U N D 1 3 - 1 7 U H R
T E L E F O N : 0 7 3 6 1 / 9 6 1 8 3 9
T E L E F A X : 0 7 3 6 1 / 9 6 1 8 3 9
U M S C H L A G V O R D E R S E I T E :
VERGOLDETE B R O N Z E B Ü S T E DES K A I S E R S V A L E N T I A N I I .
U M S C H L A G R Ü C K S E I T E :
S I L B E R N E S F I BELPAAR MIT GOLDBLECHAUFSATZ
UND KARNEOLPERLE .
Von Augustus bis Attila LEBEN AM
UNGARISCHEN DONAULIMES
L I M E S M U S E U M AALEN Z W E I G M U S E U M
DES WÜRTTEMBERG ISCHEN LANDESMUSEUMS
STUTTGART
THEISS
S C H R I F T E N DES L I M E S M U S E U M S A A L E N
5 3
H E R A U S G E G E B E N
VON DER G E S E L L S C H A F T
F QR V O R - UND F R Ü H G E S C H I C H T E
N W Ü R T T E M B E R G UND H O H E N Z O L L E R N E . V .
M I T U N T E R S T Ü T Z U N G
D E S W Ü R T T E M B E R G I S C H E N
L A N D E S M U S E U M S STUTTGART
U N D DER STADT A A L E N
Z U B E Z I E H E N Ü B E R DEN
K O N R A D T H E I S S V E R L A G G M B H IN STUTTGART
DIE DEUTSCHE B I B L I O T H E K - C I P - E I N H E I T S A U F N A H M E
E IN TITELDATENSATZ FÜR D IESE P U B L I K A T I O N
IST BEI DER D E U T S C H E N B I B L I O T H E K ERHÄLTL ICH
L S ß N 3 - 8 0 6 2 - 1 5 4 1 - 3
© W Ü R T T E M B E R G I S C H E S L A N D E S M U S E U M
STUTTGART, 2 0 0 0 ALLE RECHTE V O R B E H A L T E N
S C H R I F T L E I T U N G : M A R T I N K E M K E S
R E D A K T I O N :
SUSANNE B I E G E R T , F R A N K F U R T A. M .
CLAUDIA N I C K E L , S C H M I T T E N / T .
SATZ UND P R O D U K T I O N :
VERLAGSBÜRO W A I S 6t P A R T N E R , STUTTGART
LAYOUT UND U M S C H L A G :
H A N S - J Ü R G E N T R I N K N E R , STUTTGART
LITHO: D D S - L E N H A R D , STUTTGART
D R U C K UND B I N D E N :
W E I N B R E N N E R G M B H E t C o , L E I N F E L D E N - E C H T E R D I N G E N
1
ERSCHIENEN ANLÄSSLICH DER GLEICHNAMIGEN SONDERAUSSTELLUNG DES UNGARISCHEN NATIONALMUSEUMS BUDAPEST,
IN Z U S A M M E N A R B E I T MIT DEM A Q U I N C U M - M U S E U M DER STADT BUDAPEST ,
DEM ARCHÄOLOGISCHEN L A N D E S M U S E U M B A D E N - W Ü R T T E M B E R G , DEM KURPFÄLZ ISCHEN M U S E U M DER STADT HE IDELBERG
UND DEM W Ü R T T E M B E R G I S C H E N L A N D E S M U S E U M STUTTGART
VOM D E Z E M B E R 2 0 0 0 - J A N U A R 2 0 0 2 .
6 •
8 •
11 •
19 •
23 •
33 •
37 •
41 •
45 •
48 •
53 •
57 •
60 • 64 •
68 •
73 •
79 •
84 •
Inhalt
Vorwort (Zsolt Visy)
Vorwort (Dieter Planck)
Zur römischen Geschichte Pannoniens
Historischer Überblick (Zsolt Visy)
Pannonien und die römischen Kaiser (Margit Nemeth)
Römisches Militär in Pannonien
Der Grenzschutz (Zsolt Visy)
Römische Binnenkastelle in den Provinzen Pannonia Prima und Valeria (Endre Töth)
Die Helme vom Typ „Intercisa" (Läszlö Kocsis)
Die Tuba aus Zsämbek (Eszter Fontana)
Truppenstandorte im ungarischen Teil Pannoniens -Römische Ziegelstempel (Barnabas Lörincz)
Römische Militäranlagen im Barbaricum (Zsolt Mräv)
Wirtschaft, Handel und Verkehr
Römische Straßen in Ungarn (Endre Töth)
Ein Meilenstein aus Savaria (Otto Sosztarits)
Handel (Denes Gabler)
Villae rusticae -Römische Gutshöfe (Sylvia Palägyi)
Tierhaltung im römischen Ungarn (Istvän Vörös)
Nichtstädtische Siedlungen (Peter Koväcs)
Stadtentwicklung in Pannonien (Mihäly Nagy)
Das Silber- und Goldschmiedehandwerk (Endre Töth)
89 • Spätrömische glasierte Keramik (Gabriella Nädorfi)
92 • Römische Deckenmalerei aus Brigetio (Läszlö Borhy)
Kult und Religion
95 • Römische Religion und Kaiserkult in Ungarn (Adam Szabö)
103 • Orientalische Kulte (Istvän Töth)
Grabbrauch und Bestattungswesen
109 • Bestattungen am pannonischen Limes (Paula Zsidi)
115 • Römische Hügelgräber (Sylvia Palägyi)
121 • Die pannonische Frauentracht und römische Bekleidungstraditionen (Judit P. Szeöke)
126 • Literatur
129 • Autoren
130 • Schriften des Limesmuseums Aalen
131 • Abbildungsnachweis
• ORIENTALISCHE KULTE
Orientalische Kulte lstvän Töth
Kanne und Griffschale mit Silber- und Gold-einlage. Dargestellt sind ägyptische Götterfiguren (Kanne) sowie eine Nil-landschaft (Schale). Fundort: Egyed, Datierung: 2.-3. Jh. n.Chr.
Die zunehmende Orientalisierung des re-ligiösen Lebens der römischen Kaiserzeit ab dem 2. Jh. n.Chr. erreichte auch Pan-nonien. Die Götter der drei großen terri-torialen Einheiten des hellenistischen Ostens Kleinasien, Syrien, Ägypten wur-den auch in den Städten der Provinz ver-ehrt. Zuerst erschien die Verehrung der Magna Mater, der kleinasiatischen großen Mut-tergöttin in der Provinz. Der zwei Jahr-hunderte früher in Rom eingeführte Kult ist im Pannonien des 1. Jhs. n.Chr. mit den aus Italien gekommenen Ansiedlern verknüpft: In der Handelsstadt Poetovio an der Drau wurde zur Ehre der Göttin ein repräsentatives Heiligtum errichtet.
Die Verehrung der ägyptischen Götter, vor allem von Isis und Sarapis kam eben-falls von Italien her nach Pannonien. Ei-ne entscheidende Rolle spielte in der Ver-breitung des Kultes die norditalische Großstadt Aquileia. Hier begann auch die wichtigste Handelsstrasse des westlichen Pannonien: die „Bernsteinstraße" über Emona, Poetovio, Savaria und Carnun-tum. Die Verehrung der ägyptischen Göt-ter tauchte zuerst in den Städten auf. In Poetovio und in Savaria wurde schon En-de des 1. Jhs. n.Chr. ein Heiligtum zur Verehrung von Isis errichtet. Die Fassade des Isis-Heiligtums in Savaria war mit Reliefs aus steierischem Marmor verziert. Die Darstellung der auf dem So-this-Hund reitenden Göttin ist am besten erhalten. Wahrscheinlich zum Inventar dieses Hei-ligtums gehörte der in Egyed zum Vor-schein gekommene spätägyptische Schatz. Die feinen mit Niellotechnik ver-
1 0 3 •
• KULT UND RELIGION
zierten Darstellungen zeigen die ägypti-schen Götterfiguren bzw. ein üppiges Landschaftsbild am Nil, welches mit dem Fruchtbarkeitskult zusammenhängt. Den Schatz haben wahrscheinlich die letzten Anhänger des Kultes vor den Angriffen der Christen am Ende des 4. Jhs. n.Chr. verborgen. Von den Göttern Syriens war der Kult des Hauptgottes der am Euphrat liegenden Handelsstadt Doliche in Pannonien am weitesten verbreitet. Die in den Inschrif-ten luppiter Dolichenus genannte Gott-heit wurde auf dem Rücken eines Stiers
stehend, in der Bekleidung der römischen Heeresführer mit den Symbolen des römi-schen Hauptgottes dargestellt. Die Dar-stellungsweise zeigt eindeutig das dop-pelte Gesicht des Gottes: Die Züge des himmlischen Stiers der orientalischen Mythologien und des römischen luppiters sind für ihn gleichermaßen typisch. Wie bei seinen Begleitgöttern, der sieggeben-den Victoria und dem die rohe Kraft sym-bolisierenden Hercules, sind astrale Sym-bole angebracht, die auf die Stern-Gott-heit der großen Sturmgötter des Ostens hinweisen. Diese Religion wurde trotz der für Rom sprichwörtlichen Toleranz als eine der er-sten verfolgt und mit Gewalt unterdrückt. Als 235 n.Chr. die Heere an Rhein und Donau mit einem Putsch die Herrschaft der severischen Dynastie beendeten, fand nach der Niedermetzelung der Familien-mitglieder des kaiserlichen Hauses syri-scher Herkunft ein organisiertes Pogrom gegen die Anhänger und Heiligtümer des auch von den Kaisern unterstützten Doli-chenus-Kultes statt. Die Schätze der da-mals abgebrannten Tempel kamen zum größten Teil ans Tageslicht, und auch die Tempel selbst mit den Spuren gewaltsa-mer Beschädigung. Bea Syria, deren Andenken auf einem Medaillon von Intercisa überliefert wur-de, verkörperte die Heimat der in Interci-sa stationierten syrischen Kohorte. Auch der Kult des trakisch-phrygischen Deus Sabazios war im religiösen Leben der Provinz zu finden; davon zeugen die bronzenen Votivhände mit Tierfiguren. Einige Inschriften belegen das Judentum in der Provinz. In der Umgebung von In-tercisa und in Brigetio sind Inschriften von Synagogen zum Vorschein gekom-men. Die Denkmalgruppe der fälschlich Kult der „Donauer Pferdegötter" genannten Religion bilden die in mehrere Zonen un-terteilten Täfelchen aus Blei und Marmor, deren Exemplare in fast allen Städten
Bronzestatuette der Isis-Fortuna, Fundort: Badacsony, Datierung: 2.-3. Jh. n.Chr.
Bronzene Votivhand des Sabazios-Kultes, Fundort: Zsena, Datierung: 2.-3. Jh. n.Chr.
104 •
Votivtafel aus Blei für den „Donauer Reiter-gott". Die Hauptfiguren sind Sol unter dem Him-melsgewölbe, eine Mut-tergöttin und die Dios-curen. Darunter die Dar-stellung eines Kultmahls. Fundort: Szlakamen, Datierung: 3. Jh. n.Chr.
• ORIENTALISCHE KULTE
zum Vorschein gekommen sind. Als Aus- ter erscheint. An manchen Stellen kann gangspunkt des Kultes gibt man im all- man hinter den Reitern stehende Figuren gemeinen die Umgebung von Sirmium sehen. Die unterste Bildreihe zeigt sepul-an, da die meisten und frühesten Denk- krale Symbole wie Tripos, Krater, Hahn, mäler dort zum Vorschein gekommen Löwe oder Schlange. Die Zahl der Sze-sind. Auf dem oberen Teil der Votivtafel- nenfiguren ist unterschiedlich, aber die chen sieht man Sol auf einer Quadriga, Komposition ist einheitlich. Die Entwick-darunter als Hauptszene der Bildreihen lungsgeschichte dieses rätselhaften Kul-eine Muttergöttin, zu der von rechts und tes mit bis heute unbekanntem Hinter-links je ein den Feind niederreitender Rei- grund und unbekannter Bedeutung kann
1 0 5
• KULT UND RELIGION
Bronzeplatte des Mithraskultes mit Darstellung der Stiertötung durch Mithras. Fundort: Brigetio/ Szöny, Datierung: 3. Jh. n.Chr.
im allgemeinen zu den orientalischen Re-ligionen, obwohl diese Religion ein gei-stiges Produkt des Römischen Reiches war. Diese Religionskonstruktion, die ver-schiedene orientalische, hellenistische, griechische und römische Gedanken ver-einigte, entstand in Rom selbst und viel-leicht gerade in Pannonien während des 1. Jhs. n.Chr. Das ganze Gebiet von Pan-nonien ist vom Mithras-Kult durchzogen. In den großen Städten - Poetovio, Car-nuntum, Aquincum - wurde dieser Gott in mehreren (in Aquincum z. B. in mehr als zehn) Heiligtümern verehrt; es gibt
man aufgrund seiner Ikonographie in drei Perioden teilen. Die Szenenreihen und dargestellten Figuren weisen auf eine Re-ligion hin, die durch bewussten Synkretis-mus geschaffen wurde. Die Symbolik der Figuren und der Komposition betont die orientalischen Züge des Kultes. Bislang können wir die Votivtafeln der „Donauer Pferdegötter" mit keiner bekannten rö-merzeitlichen Religion verbinden. Ihre Ikonographie trägt die Züge mehrerer ori-entalischer Mysterien, in größter Anzahl der des Mithras-Kultes. Auch das Mithras-Mysterium zählt man
1 0 6 •
• ORIENTALISCHE KULTE
Isis
Herkunft: ägyptisch. Wesen: Schutz- und Schöpfergöttin. Attribute: Hörnerkrone mit Kuhohren, Sonnenscheibe, Federschmuck, Sistrum, Mondsichel, Steuerruder, Füllhorn.
luppiter Doliehenus
Herkunft: syrisch; Verehrung im römi-schen Reich seit dem 2. Jh. n.Chr. verbrei-tet. Wesen: Himmels- und Stadtgott, militäri-sche Potenz. Attribute: phiygische Mütze, üoppelaxt, Stier.
Magna Mater (Mater deum Magna ldaea) - Kybele
Herkunft: kleinasiatisch; 205/204 v.Chr. in Rom eingeführt. Wesen: Muttergöttin. Attribute: Mauerkrone, Opferschale.
Mithras
Herkunft: kleinasiatisch-römisch; seit dem 2. Jh. n.Chr. im römischen Reich stark verbreitet. Wesen: Sonnengott, Schöpfer des Kos-mos und der Welt. Attribute: orientalisches Gewand und phtygische Mütze, Stier.
(Deus) Sabazios
Herkunft: phrygisch-thrakisch. Wesen: Gott der vegetativen Fruchtbar-keit. Attribute: Votivhände; Schlange, Widder, Adler, Pinienzapfen.
Die Verbreitung des Christentums in Pan-nonien erfolgte langsamer als in den an-deren Gebieten des Reiches. Einerseits war die bedeutende Rolle des Heeres in
1 0 7 •
Marmorstier des luppiter Doliehenus, Fundort: Szlankamen, Datierung: 2.-3. Jh. n.Chr.
kaum einen bedeutenderen archäologi-schen Fundort, an dem die Spuren dieses Kultes nicht bekannt wären. Während des Kaisertreffens am Anfang des 4. Jhs. n.Chr. in Camuntum ließen Diocletian und seine Mitkaiser noch ei-nen Altar zur Verehrung von Mithras er-richten, in dessen Widmung sie diesen Gott „Unterstützer ihrer Macht" (fautor imperii sui) nannten - es war aber die letzte Kraftanstrengung des Heidentums gegenüber dem sich immer kräftiger ver-breitenden Christentum.
• KULT UND RELIGION
gesellschaftlicher Hinsicht hinderlich, an-dererseits stand der Ausbreitung die tra-ditionelle Religiosität, vor allem die be-sonders weite Verbreitung des Mithras-Kultes im Wege. Trotzdem kennen wir schon aus der Zeit um die Wende vom 3. zum 4. Jh. n.Chr. große Christenverfol-gungen und zahlreiche Märtyrer in der Provinz. Diese kamen in erster Linie aus den Städten des Gebietes zwischen der Drau und der Save - aus Poetovio, Siscia, Mursa, Sirmium. Nach der Aufhebung der Verfolgung ver-breitete sich der neue Glaube auch in Pannonien schnell. Bekannt sind früh-christliche Grabsteine in den Gräberfel-dern von Sirmium und Savaria, aus den Grabkapellen von Sopianae die bisher nördlichsten christlichen Fresken, von
zahlreichen anderen Orten der Provinz gehauene Werke, Bronzegegenstände, Trinkgläser mit Goldeinlage (fondo d'oro), mit christlichen Symbolen verzier-te Kästchen und Kleiderschmucksachen. Der endgültige Sieg des Christentums ist auf das Ende des 4. Jhs. n.Chr. zu datie-ren. Die heidnischen Tempel wurden ver-lassen, ihre kultischen Gegenstände ver-borgen, in die Gräber gelangten nun kei-ne in heidnischer Tradition stehenden Beigaben mehr. Mitte des 5. Jhs. n.Chr. fanden die von Osten kommenden Hunnen eine rein christliche Provinz vor.
Goldglas mit Darstellung eines Ehepaares. Die Umschrift lautet: SEM-PER GAU DEATIS IN NOMINE DEI „Freut Euch im Herrn zu jeder Zeit" (Paulusbrief an die Philipper 4,4).
Gewandschließe mit Christogramm, Fundort: Dombövär, Datierung: 4. Jh. n.Chr.
1 0 8 •













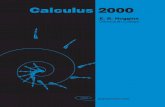


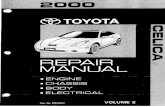




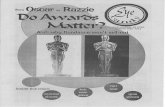


![Studer v Boettcher [2000] NSWCA 263 (24 November 2000)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633372df3108fad7760f0e34/studer-v-boettcher-2000-nswca-263-24-november-2000.jpg)









