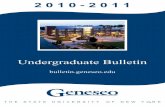1 MASTERARBEIT 2
Transcript of 1 MASTERARBEIT 2
Universität Zürich
Rechtwissenschaftliche Fakultät
Masterarbeit
Häusliche Gewalt im Kanton Tessin
Rechtlicher Rahmen und aktuelle Praxis
bei
Prof. Dr. iur. Christian Schwarzenegger
vorgelegt von
Sarah Schwerzmann
Riva San Bartolomée 6
6922 Morcote
079 823 72 58
06-726-715
4. Semester
Master of Law (Legal Practice)
Muttersprache Italienisch
FS 13
I
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis IV
Verzeichnis der Ansprechpersonen XIV
Abkürzungsverzeichnis XV
I. Einleitung 1
II. Häusliche Gewalt in der Partnerschaft 3
1. Begriff der häuslichen Gewalt 3
1.1 Der Begriff im Allgemeinen 3
1.2 Erscheinungsformen der häuslichen Gewalt 4
1.2.1 Sexuelle Gewalt 4
1.2.2 Psychische Gewalt 5
1.2.3 Physische Gewalt 5
1.2.4 Wirtschaftliche Gewalt 5
1.2.5 Soziale Gewalt 6
1.3 Der Begriff im Sinne der Offizialisierung 6
2. Fakten: Zahlen zur häuslichen Gewalt in der Schweiz 7
2.1 Studien 7
2.2 Statistiken 8
2.3 Zahlen der Straftaten im häuslichen Bereich 9
2.4 Strafarten 10
2.5 Dunkelziffer 11
2.6 Wirtschaftliche Auswirkungen der häuslichen Gewalt 11
3. Ursachen, Risikofaktoren und Risikosituationen 11
3.1 Gewalttätige Partner 12
3.2 Die Opfer 13
4. Reaktion auf das Phänomen: Was ist das juristische Regulativ? 14
4.1 Gesetzgebung auf Bundesebene 14
4.1.1 Überblick 14
4.1.2 Offizialisierung 15
4.1.3 Art. 55a StGB 16
4.1.3.1 Im Allgemeinen 16
4.1.3.2 Anwendungsbereich 17
II
4.1.3.3 Sistierung des Verfahrens (Art. 55a Abs. 1 StGB) 17
4.1.3.4 Wiederaufnahme des Verfahrens (Art. 55a Abs. 2 StGB) 19
4.1.3.5 Definitive Einstellung des Verfahrens (Art. 55a Abs. 3 StGB) 19
4.1.4 Gewaltschutznorm: Art. 28b ZGB 19
4.1.4.1 Überblick 19
4.1.4.2 Voraussetzungen 20
4.1.5 Opferhilfe 23
4.2 Auf kantonaler Ebene 24
4.3 Koordinations- und Kooperationsmassnahmen 25
III. Häusliche Gewalt im Kanton Tessin 26
1. Fakten 26
1.1 Im Allgemeinen 26
1.2 Tatzeitpunkt 27
2. Wer schlägt, muss raus 28
2.1 Überblick 28
2.2 Polizeigesetz 28
3. Praxis 30
3.1 Wer handelt? 30
3.2 Kantonspolizei 30
3.2.1 Einschreiten 31
3.2.2 Wegweisung 32
3.2.3 Wirkungsgrad der Wegweisung 33
3.2.4 Erfahrungen aus der Praxis 34
3.3 Bezirksgericht 34
3.3.1 Aufgabe 34
3.3.2 Erfahrungen aus der Praxis 35
3.4 Staatsanwaltschaft 35
3.4.1 Überblick 35
3.4.2 Erfahrungen aus der Praxis 35
3.4.3 Problemstellen 37
3.5 Krankenhäuser und Ärzte 39
3.5.1 Überblick 39
3.5.2 Art. 68 Legge sanitaria cantonale (Lsan) 39
3.5.3 Meldeformular 39
III
3.5.4 Das Beispiel Mendrisio 40
3.5.5 Erfahrungen aus der Praxis 40
3.6 Bewährungshilfe 41
3.6.1 Tätigkeitsbereich 41
3.6.2 Problemstellen 42
3.7 Opferberatungsstellen 43
3.8 Beratungsstellen und Frauenhäuser 43
3.8.1 Überblick 43
3.8.2 Frauenhäuser 44
3.8.3 Beratungsstellen 45
3.8.4 Associazione Armònia 45
3.8.4.1 Consultorio Alissa 45
3.8.4.2 Casa Armònia 46
3.8.5 Associazione consultorio delle donne 47
3.8.5.1 Consultorio delle Donne 47
3.8.5.2 Casa delle Donne 47
4. Die Problematik der Datenübermittlung 47
5. Prävention 47
IV. Schlussfolgerungen 50
Anhänge:
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Anhang 4
Anhang 5
Anhang 6
Anhang 7
Anhang 8
IV
Literaturverzeichnis
Die nachfolgenden Werke werden, wo nicht anders vermerkt, mit dem Nachnamen des Autors
bzw. der Autorin und der Seitenzahl, der Randziffer oder der Randnote der Fundstelle zitiert.
BREITSCHMID, PETER/RUMO-JUNGO, ALEXANDRA (Hrsg.): Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht,
2. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2012.
(zit. CHK-BEARBEITERIN, Art. ..., N ...)
BÜCHLER, ANDREA: Gewalt in Ehe und Partnerschaft, Polizei-, straf- und zivilrechtliche In-
terventionen am Beispiel des Kantons Basel-Stadt, Diss. Basler Studien zur Rechts-
wissenschaft. Reihe C: Strafrecht, Band 10, Basel-Genf-München 1998.
(zit. BÜCHLER, Gewalt)
BÜCHLER, ANDREA: Zivilrechtliche Interventionen bei Gewalt in Lebensgemeinschaften:
Rechtstatsachen – Rechtsvergleich – Rechtsanalyse, in: FamPra.ch 2000, S. 583 ff.
(zit. BÜCHLER, FamPra 2000)
BÜCHLER, ANDREA/JAKOB, DOMINIQUE (Hrsg.): Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB Kurz-
kommentar, Basel 2012.
(zit. KUKO ZGB-BEARBEITERIN, Art. ..., N ...)
COLOMBI, ROBERTO: Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft – zur Auslegung der neuen
Art. 126, 126 und 180 StGB, in ZStrR 123/2005, S. 297 ff.
(zit. COLOMBI, ZStrR 2005)
COLOMBI, ROBERTO: Häusliche Gewalt – die Offizialisierung im Strafrecht am Beispiel der
Stadt Zürich. Eine dogmatische und empirische Studie, Diss. Zürcher Studien zum
Strafrecht, Band 52, Zürich 2009.
(zit. COLOMBI, Häusliche Gewalt)
V
DUPUIS, MICHEL/GELLER, BERNARD/MONNIER, GILLES/MOREILLON, LAURENT/PIGUET
CHRISTOPHE/BETTEX CHRISTIAN/STOLL, DANIEL (Hrsg.): Petit Commentaire Code
pénal, Basel 2012.
(zit. PC CP, Art. ... N ...)
FREI, PETER : Wegweisung und Rückkehrverbot nach st.gallischem Polizeigesetz. Eine Bes-
tandesaufnahme, in : AJP 2004, S. 547 ff.
(zit. FREI)
GILLIOZ, LUCIENNE/DE PUY, JACQUELINE/DUCRET, VÉRONIQUE: Domination et violence en-
vers la femme dans le couple, Lausanne 1997.
(zit. GILLIOZ/DE PUY/DUCRET)
GLESS, SABINE: Verfahrenserledigungen ohne Urteil: Pragmatismus und Gerechtigkeit, in:
ZStrR 127/2009, S. 377 ff.
(GLESS)
GLOOR, DANIELA/MEIER, HANNA: Interventionen von Polizei und Justiz bei Anzeigen zu Ge-
walt im sozialen Nahraum. Empirische Untersuchung zu Veränderungen im Kanton
Basel-Stadt, 1995-2000, in: FamPra.ch 2001, S. 651 ff.
(zit. GLOOR/MEIER)
GREBER, FRANZISKA/KRANICH SCHNEITER, CORNELIA: Schutz bei häuslicher Gewalt, Zürich
2008 .
(zit. GREBER/KRANICH SCHNEITER)
HONSELL, HEINRICH/VOGT, NEDIM PETER/GEISER, THOMAS (Hrsg.), Basler Kommentar zum
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 4. Auflage, Basel 2010.
(zit. BSK ZGB I-BEARBEITERIN, Art. ... N...)
JOSITSCH, DANIEL: Strafbefreiung gem. Art. 52 ff. StGBneu und prozessrechtliche Umset-
zung, in: SJZ 100/2004, S. 2 ff.
(zit. JOSITSCH)
VI
KEEL, JOE: „Wer schloht, dä goht“: Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Das St. Galler Mo-
dell in: ZStrR, 124/2006, S. 321 ff.
(zit. KEEL)
KILLIAS, MARTIN/KUHN, ANDRÉ/AEBI, MARCELO F.: Grundriss der Kriminologie, eine euro-
päische Perspektive, 2. Auflage, Bern 2011.
(zit. KILLIAS/KUHN/AEBI)
KILLIAS, MARTIN/SIMONIN, MATHIEU/DE PUY, JACQUELINE: Violence experienced by women
in Switzerland over their lifespan, Results of the International Violence against Wo-
men Survey (IVAWS), Bern 2005.
(zit. KILLIAS/SIMONIN,/DE PUY)
KRANICH SCHNEITER, CORNELIA/EGGENBERGER, MARLENE/LINDAUER, URSULA: Gemeinsam
gegen häusliche Gewalt, Eine Bestandesaufnahme im Kanton Zürich, Zürich-Basel-
Genf 2004.
(zit. KRANICH SCHNEITER/EGGENBERGER/LINDAUER)
KREN KOSTKIEWICZ, JOLANTA/NOBEL, PETER/SCHWANDER, IVO/WOLF, STEFAN: ZGB Kom-
mentar, 2., aktualisierte Auflage, Zürich 2011.
(zit: OFK ZGB-BEARBEITERIN, Art. ... N ...)
LEUBIN MÜLLER, GABRIELA: Die Stellung und Rechte des erwachsenen Opfers im Strafpro-
zess, in: AJP 2012, S. 1585 ff.
(zit. LEUBIN MÜLLER)
NUSSBAUMER, DANIEL: Massnahmen gegen nicht fassbare Gewalt, Diss. Universität Zürich,
2009.
(zit. NUSSBAUMER)
STEINER, SILVIA: Häusliche Gewalt, Erscheinungsformen, Ausmass und polizeiliche Bewälti-
gungsstrategien in der Stadt Zürich, Zürich/Chur 2004.
(zit. STEINER)
VII
NIGGLI, MARCEL ALEXANDER/WIPRÄCHTIGER, HANS (Hrsg.): Basler Kommentar Strafrecht I,
Art. 1-110 StGB, Jugenstrafgesetz, 2. Auflage, Basel 2007.
(zit. BSK StGB I-BEARBEITERIN, Art. ... N ...)
NIGGLI, MARCEL ALEXANDER/WIPRÄCHTIGER, HANS (Hrsg.): Basler Kommentar Strafrecht II,
Art. 111-392 StGB, 2. Auflage, Basel 2007.
(zit. BSK StGB II-BEARBEITERIN, Art. ... N ...)
RIEDO, CHRISTOF: Delikte im sozialen Nahraum, in: ZStrR 122/2004, S. 267 ff.
(zit. RIEDO)
SCHMID, LORENZ: Hohe Dunkelziffer bei häusliche Gewalt gegen Männer, in: Tages Anzeiger
vom 16.02.2009.
(zit. SCHMID, Tages Anzeiger vom 16.02.2009)
SCHWANDER, MARIANNE: Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt: Neue Erkenntnisse –
neue Instrumente, in: ZstrR 121/2003, S. 195 ff.
(zit. SCHWANDER)
SCHWARZENEGGER, CHRISTIAN/HUG, MARKUS/JOSITSCH, DANIEL: Strafrecht II, Strafen und
Massnahmen, 8., aktualisierte und teilweise vollständige überarbeitete Auflage,
Zürich-Basel-Genf 2007.
(zit. SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH)
STRATENWERTH, GÜNTER/WOHLERS, WOLFGANG: Schweizerisches Strafgesetzbuch – Hand-
kommentar, 2. Auflage, Bern 2009.
(zit. HandKomm StGB-STRATENWERTH/WOHLERS, Art. ... N ...)
TRECHSEL, STEFAN/PIETH, MARK (Hrsg.): Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommen
tar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen, 2013.
(zit. PK StGB-BEARBEITERIN, Art. ... N ...)
ZINGG RAPHAEL, Schutz der Persönlichkeit vor Gewalt, Drohungen und Nachstellungen nach
Art. 28b ZGB, in: Jusletter 28. Juni 2008.
(zit. ZINGG)
VIII
Materialien
Bericht des Bundesrates über Gewalt in Paarbeziehungen. Ursachen und in der Schweiz ge-
troffene Massnahmen, (in Erfüllung des Postulats Stump 05.3694 vom 7. Oktober
2005) vom 13. Mai 2009.
(zit. Bericht BR 2009)
Parlamentarische Initiative, Schutz vor Gewalt im Familienkreis und in der Partnerschaft. Be-
richt der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 18. August 2005.
(zit. BBl 2005)
Parlamentarische Initiative, Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt, Revision von Arti-
kel 189 und 190 StGB, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates
vom 28. Oktober 2002. Stellungnahme des Bundesrates vom 19. Februar 2003.
(zit. BBl 2003)
Parlamentarische Initiative, Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt, Revision von Arti-
kel 189 und 190 StGB, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates
vom 28. Oktober 2002.
(zit. BBl 2002)
Internetquellen
Alle untengenannten Internetquellen wurden zum letzten Mal am 29. April 2013 besucht.
Associazione Armònia.
Abrufbar unter: < http://www.associazione-armonia.ch/index.php>
(zit. www.associazione-armonia.ch)
Associazione Consultorio delle donne: Città di Lugano, Associazioni.
Abrufbar unter: <http://www.lugano.ch/associazioni/Consultorio-delle-donne.html>
(zit. www.lugano.ch)
IX
Associazione Ticinese delle Famiglie Monoparentali e Ricostituite: violenza domestica.
Abrufbar unter: < http://www.famigliemonoparentali.ch/altreinfo/la-violenza-
domestica>
(zit. www.famigliemonoparentali.ch)
Beratungs- und Informationsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft.
Abrufbar unter: < http://www.bif-frauenberatung.ch/typo3/>
(zit. www.bif-frauenberatung.ch)
Bundesamt für Statistik: Häusliche Gewalt.
Abrufbar unter: < http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/
key/02/04.html>
(zit. www.bfs.admin.ch)
Bundesamt für Statistik (Hrsg.), Polizeilich registrierte häusliche Gewalt: Übersichtspublika-
tion, Neuchâtel 2012.
Abrufbar unter: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/
02/key/02/04.html>
(zit. Polizeilich registrierte häusliche Gewalt)
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann: Häusliche Gewalt.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/0089/00094/index.html?
lang=de>
(zit. www.ebg.admin.ch)
EGGER, THERES/SCHÄR MOSER, MARIANNE in: Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann (Hsrg.), Gewalt in Paarbeziehungen – Ursachen und in der
Schweiz getroffene Massnahmen, Schlussbericht, Bern 2008.
Abrufbar unter: < http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/
index.html?lang=de>
(zit. Gewalt in Paarbeziehungen)
X
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Häusliche Gewalt –
Informationsblatt 1: Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt, 2012.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?
lang=de>
(zit. Informationsblatt 1)
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Häusliche Gewalt –
Informationsblatt 9: Zahlen zu Häuslicher Gewalt in der Schweiz, 2013.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?
lang=de>
(zit. Informationsblatt 9)
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Häusliche Gewalt –
Informationsblatt 11: Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung, 2012.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?
lang=de>
(zit. Informationsblatt 11)
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Häusliche Gewalt –
Informationsblatt 16: Aktueller Forschungsstand zu Opfern und Tatpersonen
Häuslicher Gewalt, 2012.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?
lang=de>
(zit. Informationsblatt 16)
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Gewalt in Paarbe-
ziehungen: Studie und Bericht des Bundesrates, Materialien zur Medienmitteilung
vom 13. Mai 2009.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00311/00333/>
(zit. Medienmitteilung Studie und Bericht)
XI
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Hsrg.), Medienmitteilung
vom 23.11.2012: Rückgang der polizeilich registrierten häuslichen Gewalt, Zunahme
bei schweren Fällen physischer Gewalt.
Abrufbar unter: <http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00500/00538/index.
html?lang=de>
(zit. www.ebg.admin.ch/dokumentation)
ENDRASS, JÉRÔME: Risk-Assessment bei Häuslicher Gewalt, Vorlesung forensische
Psychiatrie HS 2012.
Abrufbar unter: < http://www.ri-sk.org/index.cfm?action=act_getfile&doc_id=1
00836&CFID=16642611&CFToken=446acdecd9eb8e68-4B75D148-13D4-FEFB-
5E2205F0F8280A14>
(zit. JÉRÔME ENDRASS, Vorlesung Forensische Psychiatrie vom 16.10.2012.)
KILLIAS, MARTIN/STAUBLI, SILVIA/BIBERSTEIN, LORENZ/BÄNZIGER, MATTHIAS: Häusliche
Gewalt in der Schweiz, Analysen im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung
2011, Zürich 2012.
Abrufbar unter: <http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/
ber-haeuslichegewalt-2011-d.pdf>
(zit. KILLIAS/STAUBLI/BIBERSTEIN/BÄNZIGER)
Messaggi governativi e atti parlamentari: Istituzione della misura dell’allontanamento e del
divieto di rientro in ambito di violenza domestica e introduzione della base legale per
l’impiego di strumenti di lettura e di registrazione delle targhe di veicoli (modifica
della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989). Numero: 5805, data: 27.06.2006.
Abrufbar unter: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes
/5805.htm>
(zit. Messaggio 27.06.2006)
Mozione DELCÒ PETRALLI: Procedura in ambito di violenza domestica, del 27 giugno 2012.
Abrufbar unter: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/MO
914.htm>
(zit. Mozione DELCÒ PETRALLI)
XII
Mozione PELIN KANDEMIR BORDOLI et al.: Consulenze e programmi in Ticino per autori e
autrici di violenza domestica, del 29 novembre 2010.
Abrufbar unter: < http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/mozioni/pdf/
MO784.pdf>
(zit. Mozione PELIN KANDEMIR BORDOLI)
Polizia cantonale della Repubblica e Cantone Ticino: violenza domestica.
Abrufbar unter: <http://www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/violenza-domestica/>
(zit. www.polizia.ti.ch)
Repubblica e Cantone Ticino, area servizi amministrativi e gestione del web.
Abrufbar unter: <http://www4.ti.ch/can/asagw/pari-opportunita/violenza-domestica/
introduzione/>
(zit. www.ti.ch/asg)
Repubblica e Cantone Ticino, servizio per l’aiuto alle vittime di reati:
Abrufbar unter: <http://www4.ti.ch/index.php?id=24469>
(zit. www.ti.ch/lav)
Repubblica e Cantone Ticino, violenza domestica.
Abrufbar unter: <http://www4.ti.ch/index.php?id=55103>
(zit. www.ti.ch/violenza)
SCHWANDER, MARIANNE: Häusliche Gewalt: Situation Kantonaler Massnahmen aus
rechtlicher Sicht. Bericht von Marianne Schwander, im Auftrag des eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann, Fachstelle gegen Gewalt, Bern
2006.
Abrufbar unter: < http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?
lang=de>
(zit. SCHWANDER, Bericht)
Schweizerische Vereinigung Bewährungshilfe und soziale Arbeit in der Justiz.
Abrufbar unter: <http://www.prosaj.ch/web/vereinigung/bereich/bewaehrungshilfe>
(zit. www.prosaj.ch)
XIII
SIMONIN, MATHIEU/KILLIAS, MARTIN/DE PUY JACQUELINE: Gewalt gegen Frauen in der
Schweiz – Resultate einer internationaler Befragung, in: Crimiscope, 25/2004.
Abrufbar unter:
http://www.unil.ch/webdav/site/esc/shared/Crimiscope/crimiscope033_2006_D.pdf
(zit. MARGOT/KILLIAS)
SKP – Schweizerische Kriminalprävention: Häusliche Gewalt.
Abrufbar unter: <http://www.verbrechenspraevention.ch/10/de/3gewalt/520_
kampagne_stopp_haeusliche_gewalt.php#.UXq_55U5sY8>
(zit. www.verbrechenspraevention.ch)
XIV
Verzeichnis der Ansprechpersonen
Mit den untengenannten Personen haben mehrmalige Telefongespräche, Austausch von E-
Mails und/oder persönliche Treffen stattgefunden. In der Arbeit werden die
Ansprechpersonen jeweils mit dem Namen und dem Datum, an dem wir in Kontakt getreten
sind, zitiert.
AKBAS, ZACCARIA, Staatsanwalt im Kanton Tessin.
(zit. AKBAS)
CARRARA, GIORGIO, Feldweibel, Koordinator für die Abteilung häusliche Gewalt, Kantonspo
lizei TI.
(zit. CARRARA)
CIMA-VAIRORA, LINDA, Psychologin und Psychotherapeutin, Präsidentin der Associazione
Armònia.
(zit. CIMA-VAIRORA)
COCCHI, GIANMARIO, Chef Adjutant, territorialen Gendarmerie, Kantonspolizei TI.
(zit. COCCHI)
DE MARTINI, LUISELLA, Leiterin der Stelle für Bewährungshilfe, Lugano.
(zit. DE MARTINI)
FADINI, DAVIDE, Dr. Med., Leiter der Notfallstation – Notfallmedizin, Ospedale Regionale di
Mendrisio.
(zit. FADINI)
PEDROTTI, MATTEO, Richter der 6. Abteilung des Bezirksgerichts von Lugano.
(zit. PEDROTTI)
ZAMPROGNO EMANUELA, Dr. Med., Leiterin der Notfallstation, Ospedale Regionale di
Lugano.
(zit. ZAMPROGNO)
XV
Abkürzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AJP Aktuelle Juristische Praxis, zitiert nach Jahrgang und Seitenzahl.
Art. Artikel
asg area servizi amministrativi e gestione del web
BBl Bundesblatt, zitiert nach Jahrgang und Seitenzahl
BFS Bundesamt für Statistik
BSK StGB II Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II(siehe im
Literaturverzeichnis bei NIGGLI et al.)
BSK ZGB I Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I (siehe im
Literaturverzeichnis bei HONSELL et al.)
bzw. beziehungsweise
CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (siehe im Literaturver-
zeichnis bei BREITSCHMID et al.)
d.h. das heisst
Diss. Dissertation
Dr. Med. doctor medicinae = Doktor der Medizin
DVRAG Domestic Violence Risk Appraisal Guide
DVSI Domestic Violence Screening Instrument
EBG Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
ehem. ehemalig
eidg. eidgenössisch
EOC Ente Ospedaliero Cantonale
et al. et alii = und andere
f. folgende
ff. fortfolgende
FamPra.ch Praxis des Familienrechts, zitiert nach Jahrgang, Jahr und Seitenzahl
HandKomm Handkommentar (siehe im Literaturverzeichnis bei STRATENWERTH et
al.)
h.L. herrschende Lehre
Hrsg. Herausgeber
HS Herbstsemester
i.S.v. im Sinne von
XVI
IVAWS International Violence Against Women Survey
Kap. Kapitel
KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KUKO Kurzkommentar (siehe im Literaturverzeichnis bei BÜCHLER et al.)
LAV/lav Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo
2007 (Legge sull’aiuto alle vittime)
LPol Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
Lsan Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18
aprile 1989 (Legge sanitaria)
m.E. meines Erachtens
N Randnote
ODARA Ontario Domestic Assault Risk Assessment
OFK Orell Füssli Kommentar (siehe im Literaturverzeichnis bei KREN
KOSTKIEWICZ et al.)
OHG Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März
2007 (Opferhilfegesetz)
PK Praxiskommentar (siehe im Literaturverzeichnis bei TRECHSEL et al.)
PKS Polizeikriminalstatistik
Rz. Randziffer
S. Seite
SARA Spouse Assault Risk Assessment
SKP Schweizerische Kriminalprävention
sog. sogenannt
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
(Strafgesetzbuch)
TI Ticino
u.U. unter Umständen
vgl. vergleiche
VRAG Violence Risk Appraisal Guide
z.B. zum Beispiel
zit. zitiert
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
(Zivilgesetzbuch)
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008
(Zivilprozessordnung)
1
I. Einleitung
Obwohl häusliche Gewalt seit jeher Beziehungen befällt, stand sie nicht schon immer im
Fokus der Gesellschaft und der Medien wie heute1. Vor nicht allzu langer Zeit wurde
häusliche Gewalt in der Schweiz als rein private Angelegenheit betrachtet, in die sich der
Staat nicht einmischte2. In den 199er Jahren hat jedoch ein Umdenken auf breiter Ebene
stattgefunden, wonach häusliche Gewalt vermehrt als lösungsbedürftiges gesellschaftliches
Problem angesehen wurde3. Das Phänomen der partnerschaftlichen Gewalt ist somit
allmählich in die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft gerückt und man beschäftigt sich
heutzutage nicht nur verstärkt damit, sondern vor allem auf eine andere Weise als in der
Vergangenheit. In der Schweiz hat sich die Öffentlichkeit in den letzten Jahren mannigfach
mit dem Thema der partnerschaftlichen Gewalt auseinandergesetzt. Daraus sind mehrere
parlamentarische Vorstösse hervorgegangen, die sich in unterschiedlicher Form mit dem
Thema der häuslichen Gewalt befassen4. Als Folge der veränderten Wahrnehmung dieses
Phänomens sind auch viele Änderungen im rechtlichen Bereich vorgenommen worden. Ziel
dieser Änderungen ist unter anderem, die Opfer besser zu schützen, die Täter zur
Verantwortung zu ziehen und vor allem klarzustellen, dass häusliche Gewalt in unserer
Gesellschaft fehl am Platz ist5. Dies deutet auf einen wichtigen Paradigmenwechsel hin: Der
private Bereich ist in der Schweiz für staatliche Eingriffe zum Schutz von Opfern häuslicher
Gewalt kein Tabu mehr6. Der Privatbereich ist kein rechtsfreier Raum, innerhalb dessen alles
erlaubt ist. Wird hinter verschlossenen Haustüren gegen die von unserer Gesellschaft und
vom Staat aufgestellten Regeln verstossen, kann man nicht einfach wegschauen.
Die vorliegende Arbeit soll die Leserin bzw. den Leser an die Problematik der häuslichen
Gewalt heranführen und eine ganzheitlichere Sichtweise ermöglichen. Zudem soll diese
Arbeit einen Einblick in das Phänomen der häuslichen Gewalt und seine Ausprägung im
Kanton Tessin verschaffen.
Diese Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil wird zunächst der Begriff der
häuslichen Gewalt geklärt und im Hinblick auf die auf den darauffolgenden Seiten
angesprochenen Themen erläutert und eingeschränkt. Anschliessend wird das Phänomen der
häuslichen Gewalt, wie es sich auf nationaler Ebene präsentiert, anhand statistischer Daten
1 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 583. 2 Bericht BR 2009, 4092. 3 Bericht BR 2009, 4092. 4 Bericht BR 2009, 4094. 5 Bericht BR 2009, 4094. 6 www.ebg.admin.ch.
2
veranschaulicht, um danach auf die juristischen Aspekte der Problematik einzugehen. Die
Darstellung des juristischen Regulativs im Bereich häusliche Gewalt ist deshalb wichtig, weil
es einerseits erlaubt, die aktuelle Lage auf eidgenössischer Ebene besser zu verstehen, und
zum Anderen grundlegend für das Verständnis des zweiten Teils der Arbeit ist. Im zweiten
Teil findet eine vertiefte Beschäftigung mit der Problematik der häuslichen Gewalt im Kanton
Tessin statt. Auch in diesem Teil werde ich mich der verfügbaren statistischen Daten
bedienen und das juristische Regulativ erläutern, darüber hinaus ist es hier jedoch
unumgänglich, auch die Praxis mit in den Blick zu nehmen. Hinter dem zweiten Teil stehen
nicht nur eine vertiefte Auseinandersetzung mit Rechtsprechung und Literatur, sondern auch
Feldforschung, Gespräche und Meinungsaustausch mit Personen, die im Bereich häusliche
Gewalt auf dem Gebiet im Kanton Tessin tätig sind. Die Beschaffung der erforderlichen
Informationen, die es mir ermöglicht haben, einen Bild der Situation der häuslichen Gewalt
im Kanton Tessin zwischen Recht und Praxis zu machen, wurde durch die Hilfsbereitschaft
von Personen ermöglicht, die tagtäglich mit der Problematik konfrontiert sind und damit mit
hohem Engagement in diesem komplexen Bereich arbeiten.
3
II. Häusliche Gewalt in der Partnerschaft
1. Begriff der häuslichen Gewalt
1.1 Der Begriff im Allgemeinen
Der Begriff „häusliche Gewalt“ bezeichnet Gewalttaten zwischen Menschen, die in einer
engen sozialen Beziehung stehen oder standen7. Häusliche Gewalt ist ein Geflecht von Macht
und Kontrolle und es geht um das Erzeugen von Angst8. Es handelt sich um ein
facettenreiches Phänomen, das mehrere Personen involvieren und unterschiedliche
Dynamiken aufweisen kann. Der Oberbegriff der häuslichen Gewalt ist durch Anwendung
oder Androhung von Gewalt (hier in einem umfassenden Sinne verstanden) unter Paaren in
bestehender oder aufgelöster ehelicher oder partnerschaftlicher Beziehung, zwischen Eltern
bzw. Stief- oder Pflegeeltern und Kind, zwischen Geschwistern oder zwischen weiteren
Verwandten gekennzeichnet9. Die vorliegende Masterarbeit beschränkt sich jedoch auf die
Analyse der Gewalt in der Partnerschaft, als die häufigste Form von Gewalt im sozialen
Nahraum10. Aus diesem Grund sind alle nachstehenden Ausführungen in diesem Sinne zu
verstehen, es sei denn, es wird explizit auf eine abweichende Bedeutung hingewiesen.
Bei häuslicher Gewalt kontrolliert die gewaltausübende Person die Beziehung einseitig, zum
Nachteil des Partners11. Je nachdem, ob man häusliche Gewalt aus einer psychologischen,
soziologischen, kriminologischen oder rechtlichen Perspektive betrachtet, wird der Begriff
unterschiedliche Merkmale aufweisen12 bzw. eingegrenzt oder ausgeweitet. Damit ist
verbunden, dass sich je nach Begriffsdefinition auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten
ergeben, dass eine Person von irgend einer Form von Gewalt in der Partnerschaft betroffen ist
oder eine solche Situation schon einmal erlebt hat.
Im Zusammenhang mit der häuslichen Gewalt spricht man oft von Frauen als Opfern.
Häusliche Gewalt wird aber auch gegen Männer verübt13. Dennoch ist dieses Thema ein noch
junges Forschungsfeld14, das unter anderem mit einer noch höheren Dunkelziffer konfrontiert
ist als bei der Gewalt gegen Frauen. Der Einfachheit halber, werden in dieser Arbeit die
7 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 7. 8 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 585. 9 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 7; www.bfs.admin.ch. 10 Bericht BR 2009, 4091. 11 STEINER, S. 23. 12 GREBER/KRANICH SCHNEITER, 101/1. 13 www.ebg.admin.ch. 14 www.ebg.admin.ch.
4
gewalttätige Personen bzw. die Täter dem männlichen Geschlecht zugeordnet und die Opfer
dem weiblichen. Jedoch gelten die Ausführungen für beide Geschlechter.
Der Vollständigkeit halber werden in den folgenden Unterkapiteln die verschiedenen Formen
der häuslichen Gewalt im weiteren Sinne kurz erläutert. Anschliessend wird in Kapitel 1.2 der
Begriff der häuslichen Gewalt erklärt, wie er aus strafrechtlicher Sicht verstanden wird. Wird
im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Begriff der häuslichen Gewalt in der Partnerschaft ohne
weitere Erläuterungen verwendet, so ist er so gemeint, wie es in Kapitel 1.2 dargelegt ist.
1.2 Erscheinungsformen der häuslichen Gewalt
Häusliche Gewalt manifestiert sich nicht nur in körperlichen Übergriffen, sondern auch in
subtileren Gewaltformen15. Einige Formen der Gewalt lassen sich ohne Zweifel erkennen,
während andere eher verborgen und nicht leicht identifizierbar sind. Bei häuslicher Gewalt
geht es meistens um Machtverhältnisse, aus denen die Opfer nicht leicht und vor allem nicht
ohne Spuren entkommen. Wo es zu körperlicher Gewalt kommt, sind höchstwahrscheinlich
auch andere Merkmale bzw. andere Erscheinungsformen der Gewalt vorhanden, die früher
oder später zu einer Eskalation führen. Grundsätzlich wird zwischen sexueller, physischer,
psychischer, ökonomischer und sozialer Gewalt unterschieden.
Unabhängig davon, in welcher Form Gewalt auftritt, ist sie nach den Vorstellungen unserer
Gesellschaft inakzeptabel. Darüber hinaus kann sie auch gravierende physische und
psychologische Folgen haben: Es geht bei häuslicher Gewalt gerade um Delikte, welche die
intimste Sphäre der Beteiligten betreffen und meistens mehr als rein rechtliche Folgen nach
sich ziehen16.
1.2.1 Sexuelle Gewalt
Die sexuelle Gewalt ist durch Verhaltensweisen gekennzeichnet, die einen sexuellen
Hintergrund haben. Der Begriff ist verhältnismässig weit: Er umfasst sowohl aktive als auch
passive Formen der Sexualität, die gegen den Willen des Betroffenen aufgedrängt werden17.
Als Beispiele mässigerer Formen sexueller Gewalt kommen in Betracht: jede Form der
Verleumdung18, Benutzung einer explizit sexualisierten Sprache, das Weiterleiten von
sexualisierten Bildmaterial und so weiter19. Schwerere Formen variieren dagegen von der
Nötigung zu sexuellen Handlungen (sowohl mit Dritten als auch gegen Entgelt) bis zur
15 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 11. 16 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 2. 17 www.ti.ch/violenza. 18 www.ti.ch/violenza. 19 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 10.
5
Vergewaltigung20.
1.2.2 Psychische Gewalt
Unter dem Begriff der psychischen Gewalt versteht man gewisse Verhaltensweisen,
Handlungen oder Aussagen, die dem Selbstwertgefühl und der Identität einer Person
schaden21. Als Beispiele kommen in Frage: Kontrollsucht, Gewaltdrohungen, Mord- oder
Suiziddrohungen, Vereinsamung, Erpressung, Beschädigung von Objekten, Quälerei bis hin
zur Tötung von Haustieren und so weiter22. Zu den weniger drastischen Formen der
psychischen Gewalt zählen Beschimpfung, Bevormundung, Demütigung, Einschüchterung
und ähnliche Verhaltensweisen seitens des Täters23.
1.2.3 Physische Gewalt
Physische Gewalt manifestiert sich in der Form einer körperlichen Aggression gegen eine
Person. Sie kann in verschiedenen Handlungen bestehen, wie z.B. Stossen, Schütteln,
Schlagen, mit Gegenständen bewerfen, Ohrfeigen, Würgen, an den Haaren reissen, Fusstritte,
Beissen, Herbeiführen körperlicher Verletzungen mittels Anwendung stumpfer Gegenstände
und/oder Schusswaffen, Verstümmelung der Sexualorgane und so weiter24.
Die Schwere der körperlichen Beeinträchtigung variiert zwischen weniger beeinträchtigenden
Verletzungen, wie Hämatomen oder Schürfungen, bis hin zu gravierenden Formen, wie
Brüchen von Knochen oder Zähnen, schwere oder sogar tödlichen Körperverletzungen25.
1.2.4 Wirtschaftliche Gewalt
Darunter werden Verhaltensweisen verstanden, die tendenziell eine wirtschaftliche
Abhängigkeit generieren oder eine unerwünschte ökonomische Verbindung verursachen26.
Als Beispiele kommen in Betracht: die Kontrolle des Einkommens oder Vermögens, das
Verbot des Zugangs zum gemeinsamen Konto, das Verbot oder Erzwingung, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen, die Erzwingung des Unterschreibens von Dokumenten oder –
oft sogar betrügerisch – wirtschaftliche Handlungen zu unternehmen, die gegen den Willen
des Opfers verstossen27.
20 www.ti.ch/violenza. 21 www.ti.ch/violenza. 22 www.ti.ch/violenza. 23 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 10. 24 www.ti.ch/violenza; vgl. auch COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 10. 25 www.ti.ch/violenza. 26 www.ti.ch/violenza. 27 www.ti.ch/violenza; vgl. auch COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 10.
6
1.2.5 Soziale Gewalt
Bei dieser Form der häuslichen Gewalt geht es um das Verhindern, Verbieten und
Kontrollieren von Sozialkontakten28. Das Opfer wird gewissermassen von der Aussenwelt
isoliert oder sogar eingesperrt29.
1.3 Der Begriff im Sinne der Offizialisierung
Im juristischen Kontext wird bei der Begriffsumschreibung auf das äusserliche, meistens
strafrechtlich relevante Verhalten des Gewalttäters fokussiert30. Auch in diesem
Zusammenhang werden aber zum Teil weiterreichende Ansätze herangezogen. BÜCHLER legt
den Begriff z.B. so aus, dass sie häusliche Gewalt als „die Verletzung der körperlichen oder
seelischen Integrität (auch) unter Ausnützung eines Machtverhältnisses durch die strukturell
stärkere Person“ sieht31.
Der Begriff der häuslichen Gewalt, der mit der Offizialisierung in die Normen des StGB
eingeflossen ist, ist relativ eng. Es ist dabei von spezifischen Konstellationen die Rede32. Für
die häusliche Gewalt ist „das Bestehen einer besonderen emotionalen Bindung zwischen
Gewalttäter und Opfer, welche diese Gewaltform von jeder anderen Art der Gewaltausübung
unterscheidet“ charakterisierend33.
Nach SCHWANDER liegt häusliche Gewalt vor, wenn „eine Person in einer bestehenden oder
aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, sexuellen
oder physischen Integrität verletzt oder gefährdet wird und zwar entweder durch Ausübung
oder Androhung von Gewalt oder durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder
Nachstellen“34. Diese Definition ist ursprünglich vom Berner Interventionsprojekt gegen
häusliche Gewalt erarbeitet worden und danach von der schweizerischen Konferenz für
Verbrechensbekämpfung übernommen worden35.
Mit dieser Definition soll verdeutlicht werden, dass alle Formen von Gewalt erfasst werden,
dass sowohl Männer als auch Frauen Opfer von häuslicher Gewalt sein können und dass
zwischen dem gewalttätigen Person und dem Opfer eine besondere Beziehung besteht36.
28 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 10. 29 NUSSBAUMER, S. 11. 30 GREBER/KRANICH SCHNEITER, 101/1. 31 BÜCHLER, Gewalt, S. 4 und 8 ff. 32 BÜCHLER, Gewalt, S. 3 ff. 33 BÜCHLER, Gewalt, S. 3. 34 SCHWANDER, S. 199. 35 SCHWANDER, S. 199. 36 NUSSBAUMER, S. 18.
7
2. Fakten: Zahlen zur häuslichen Gewalt in der Schweiz
2.1 Studien
Surveys oder Prävalenzstudien basieren auf repräsentativen Befragungen und beleuchten das
Feld der versteckten, nicht gemeldeten Gewalt37.
In der Schweiz fehlt es bislang an einer Prävalenzstudie, welche Gewalt in Paarbeziehungen
umfassender beleuchtet, d.h. sowohl Gewalt gegen als auch Gewalt durch Männer wie
Frauen38. Einige für die Schweiz wichtige vorhandene Studien werden im Folgenden kurz
erläutert.
Im Jahre 1997 wurde die erste repräsentative Studie zum Ausmass häuslicher Gewalt in der
Schweiz durchgeführt39. In der Studie von GILLIOZ, DE PUY und DUCRET (1993) wurden 1'500
Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren über in den letzten zwölf Monaten in der
Paarbeziehung erfahrene Gewalt telefonisch interviewt40. Die Befragung ergab, dass jede
fünfte Frau bereits Opfer physischer und/oder sexueller Gewalt seitens des Partners gewesen
war41. Bezog man auch die psychische Gewalt, mit ein, ergab sich, dass ungefähr 40% der
befragten Frauen bereits eine solche Erfahrung erlebt hatten42. In den darauffolgenden Jahren
haben sich Experten vertieft mit dem Thema der Gewalt in der Partnerschaft
auseinandergesetzt und weitere Studien dazu durchgeführt.
Ähnliche Studien wurden auch in weiteren Ländern durchgeführt, wie den Niederlanden,
Kanada und den Vereinigten Staaten. Die ausländischen Studien förderten Zahlen zutage, die
zweimal so hoch wie diejenigen der schweizerischen Studie waren43. Aus den wenigen
Studien, die über Gewalt an Männern durchgeführt worden sind, hat sich ergeben, dass es sich
in 5 – 10% der Fälle ein Mann das Opfer ist44.
Im Jahre 2003 fand eine weitere bedeutende Studie über häusliche Gewalt statt. Dabei ging es
um eine repräsentative Stichprobe, die durch telefonische Befragung von 1'975 Frauen
zwischen 18 und 70 Jahren erhoben wurde45. Diese Studie ergab, dass im Durchschnitt zwei
von fünf Frauen mindestens einmal in ihrem Erwachsenenleben Opfer körperlicher oder
sexueller Gewalt geworden waren46. Das hohe Ausmass von Gewalt durch Bekannte oder
37 Bericht BR 2009, 4096. 38 Bericht BR 2009, 4109. 39 GILLIOZ/DE PUY/DUCRET, Domination et violence envers la femme dans le couple, Lausanne 1997. 40 GILLIOZ/DE PUY/DUCRET, S. 39. 41 GILLIOZ/DE PUY/DUCRET, S. 69. 42 GILLIOZ/DE PUY/DUCRET, S. 69. 43 Informationsblatt 9, S. 8. 44 www.ti.ch/violenza. 45 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 24. 46 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 36.
8
Unbekannte (32%) im Vergleich zu jenem von häuslicher Gewalt (10,5%) war bei dieser
Studie besonders augenfällig47.
Im Jahre 2011 wurde eine weitere Opferbefragung auf dem schweizerischen Territorium
durchgeführt48. In diesem Zusammenhang wurden zum ersten Mal auch Männer als Opfer
von häuslicher Gewalt in Betracht gezogen49. Häusliche Gewalt gegen Männer steht jedoch
wie bereits erwähnt bis heute immer noch wenig im Fokus der Öffentlichkeit.
Ein direkter Vergleich der Ergebnisse dieser Studien ist aus methodischen Gründen nicht
zulässig50. Die Resultate geben jedoch klare Hinweise zum Ausmass der Gewalt.
2.2 Statistiken
Den Statistiken ist gemeinsam, dass sie nur die Hellfeldziffer zeigen, d.h. sie erfassen nur die
gemeldete, sichtbare Gewalt51. Dank der Revision der Polizeikriminalstatistik (PKS) werden
seit 2009 gesamtschweizerisch Daten gesammelt und Statistiken zu den polizeilich
registrierten Straftaten sowie den geschädigten und beschuldigten Personen im häuslichen
Bereich erstellt52. Diese sind seit 2010 auf der Homepage des Bundesamtes für Statistik
(BFS) abrufbar53. Die Fülle an Informationen, die seit 2009 gesammelt werden, erlaubt nicht
nur, die häusliche Gewalt in einem Gesamtbild zu betrachten, sondern auch, gewisse
Informationslücken zu schliessen54.
Die PKS versteht unter dem Begriff der häuslichen Gewalt „die Anwendung oder Androhung
von Gewalt unter Paaren in bestehender oder aufgelöster oder partnerschaftlicher Beziehung
zwischen (Stief-/Pflege-) Eltern- Kind oder weiteren Verwandten“55. Diese Definition geht
ein bisschen zu weit, als das Interessensbereich dieser Arbeit darstellt, weshalb in der Folge
nur auf die bezüglich partnerschaftlicher Gewalt relevanten Daten fokussiert wird.
47 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 38. 48 KILLIAS/STAUBLI/BIBERSTEIN/BÄNZIGER, S. 2 ff. 49 KILLIAS/STAUBLI/BIBERSTEIN/BÄNZIGER, S. 23. 50 Bericht BR 2009, 4097. 51 Bericht BR 2009, 4096. 52 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 7. 53 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 7. 54 Informationsblatt 9, S. 3. 55 Informationsblatt 9, S. 2.
9
2.3 Zahlen der Straftaten im häuslichen Bereich
Im Jahr 2012 wurden 15'810 Straftaten registriert, die im häuslichen Bereich stattgefunden
haben und der obengenannten Definition der häuslichen Gewalt entsprechen56.
In 48,9% der Fälle bestand zwischen Täter und Opfer eine Paarbeziehung und in 27,4% der
Fälle handelte es sich um eine ehemalige Paarbeziehung bzw. Partnerschaft57.
Anhand der statistischen Daten ist von 2009 bis 2011 ein Rückgang der Straftaten im Bereich
häuslicher Gewalt von 7,3% zu beobachten, jedoch ist der Trend bei den schweren physischen
Straftaten (+8% vollendete Tötungsdelikte, +20,4% versuchte Tötungsdelikte, +27,3%
schwere Körperverletzung, +17% schwerstgeschädigte und Todes-Opfer) und der
psychischen Straftaten (+58,1% üble Nachrede, +22,4% Verleumdung, +14,9%
Beschimpfung) steigend58.
Den Statistiken kann man auch entnehmen, dass häusliche Gewalt, was die Verteilung nach
Tageszeit angeht, ab den frühen Morgenstunden einen kontinuierlichen Anstieg zeigt, mit
einem Höhepunkt gegen 19–20 Uhr59. Diese Tendenz ist für alle Wochentage vorhanden,
56 Informationsblatt 9, S. 2. 57 Informationsblatt 9, S. 2. 58 Informationsblatt 9, S. 3. 59 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 16; vgl. auch Grafik auf S. 28.
10
jedoch sind Unterschiede zwischen den Wochentagen zu erkennen60. An Samstagen und
Sonntagen wurde eine Zunahme der häuslichen Gewalt registriert61.
2.4 Strafarten
Laut Daten der PKS handelt es sich bei den Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt
meistens um Tätlichkeiten und Drohungen, gefolgt von Beschimpfungen und einfache
Körperverletzungen62. In den Statistiken erscheinen aber natürlich auch schwerere Straftaten,
wie Nötigung, schwere Körperverletzung, versuchte und vollendete Tötungsdelikte63.
2.5 Dunkelziffer
Problematisch für die Aussagekraft der Statistiken ist, dass darin nur diejenigen Fälle
erscheinen, die den Behörden bekannt sind64. Trotz aller Bemühungen ist nach wie vor mit
einer hohen Dunkelziffer zu rechnen, d.h. mit zahlreichen Delikten im häuslichen Bereich, die
den Strafverfolgungsbehörden nicht zur Kenntnis gelangen und aus diesem Grund auch nicht
Eingang in die PKS finden. Gerade im Bereich der häuslichen Gewalt ist mit einer hohen
Dunkelziffer zu rechnen65. Dies könnte daran liegen, dass es für die Opfer oft schwierig ist,
sich mit dem Geschehen auseinanderzusetzen, eine Strafanzeige überhaupt zu erstatten, die
Familienwohnung zu verlassen und an einem Verfahren teilzunehmen. Andererseits muss
man damit rechnen, dass in der Schweiz eine Koexistenz mehrerer Kulturen Realität ist, die
Gewalt – vor allem in der Partnerschaft – nicht in einer einheitlichen Weise wahrnehmen.
Eine besonders hohe Dunkelziffer ist bei häuslicher Gewalt gegen Männer anzunehmen, da
Männer ungern als Opfer in Erscheinung treten66.
Surveys bzw. Prävalenzstudien erweisen sich in diesem Zusammenhang als besonders
wichtig; sie ermöglichen es, gewisse Lücken zu schliessen und ein vollständigeres Bild zu
erstellen67, anhand dessen das Nötige unternommen werden kann, um die Absichten zu
präzisieren.
60 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 16; vgl. auch Grafik auf S. 27 f. 61 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 16; vgl. auch Grafik auf S. 27. 62 Informationsblatt 9, S. 3. 63 Informationsblatt 9, S. 3. 64 Bericht BR 2009, 4096. 65 SCHWANDER, S. 200. 66 SCHMID, Tages Anzeiger vom 16.02.2009. 67 Bericht BR 2009, 4096.
11
2.6 Wirtschaftliche Auswirkungen der häuslichen Gewalt
Die Kosten häuslicher Gewalt für Staat und Privatwirtschaft sind beachtlich68. Die
Betrachtung der volkswirtschaftlichen Kosten häuslicher Gewalt zeigt, dass die Folgen von
häuslicher Gewalt nicht nur die Betroffenen belasten, sondern die gesamte Gesellschaft69. Bis
anhin durchgeführte Berechnungen zeigen, dass Prävention weniger kostet als Intervention70.
Die Folgekosten für die Öffentlichkeit betragen laut einer Studie aus dem Jahre 1998 mehr als
400 Milionen Franken, die grösstenteils im Gesundheitswesen aufgewendet werden71. Zurzeit
ist eine neue Studie in Arbeit, die im Laufe des Jahres 2013 publiziert wird72.
3. Ursachen, Risikofaktoren und Risikosituationen
Das Problem der Gewalt ist durch eine hohe Komplexität gekennzeichnet, weshalb sich
einfache Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge nicht herstellen lassen73.
Fachleute aus Forschung und Praxis sind sich einig, dass das Phänomen der häuslichen
Gewalt nicht auf einen einzelnen Risikofaktor zurückgeführt werden kann74. Vielmehr ist ein
Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren auf unterschiedlichen Ebenen für
partnerschaftliche Gewalt massgebend75. Risikofaktoren sind beim Individuum selber, in der
Partnerschaft bzw. Gemeinschaft oder Gesellschaft, im Zusammenhang mit
Lebensereignissen, die Stresssituationen auslösen können, im Verhältnis zum sozialen
Umfelds, usw. zu finden76. Bei partnerschaftlicher Gewalt ist somit von einem multikausalen
Phänomen zu sprechen77.
Faktoren wie Staatsangehörigkeit, Wohnort, Bildungsgrad und Schichtzugehörigkeit weisen
keinen bedeutsamen Zusammenhang mit der Ausübung oder dem Erleiden von häuslicher
Gewalt auf78. Jedoch haben mehrere von Experten durchgeführte Studien gezeigt, dass
gewisse Risikofaktoren und Bedingungen häusliche Gewalt zu begünstigen scheinen. Als
Konstante hat sich gezeigt, dass häusliche Gewalt hauptsächlich (jedoch nicht ausschliesslich)
68 KRANICH/SCHNEITER/EGGENBERGER/LINDAUER, S. 29. 69 Informationsblatt 1, S. 7. 70 Informationsblatt 1, S. 8. 71 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 13. 72 Informationsblatt 1, S. 8. 73 Bericht BR 2009, 4097. 74 Bericht BR 2009, 4097; KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 11. 75 NUSSBAUMER, S. 20; KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 11. 76 Bericht BR 2009, 4098. 77 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 11. 78 GILLIOZ/DE PUY/DUCRET, S. 88, 194.
12
von Männern ausgeübt wird79.
3.1 Gewalttätige Partner
Risikofaktoren für häusliche Gewalt sind oft auf der Ebene des Individuums zu finden. Wenn
eine Person Gewalterfahrungen aus der Kindheit hat, beträchtliche Mengen Alkohol
konsumiert, einen antisozialen oder kriminellen Verhalten ausserhalb der Beziehung aufweist,
so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person in der Paarbeziehung Gewalt
ausübt80.
Bei den Tätern handelt es sich vorwiegend um Männer: Diese üben 4,1-mal häufiger
häusliche Gewalt aus als Frauen81. Wie sich bei multivariaten Analysen in der Schweiz zeigte,
hängt Partnergewalt kaum von Eigenschaften der Frau, sondern fast ausschliesslich von
solchen des Mannes ab82, d.h. von dessen Gewaltprofil83. Eine allgemeine Tendenz des
Partners zur Gewalttätigkeit ist ein wichtiger Hinweis: Männer, die ausser Haus handgreiflich
werden, sind wesentlich häufiger gegen ihre Frauen gewalttätig als andere84.
In den Statistiken kommt registrierte Partnerschaftsgewalt bei ausländischen und binationalen
Paaren überdurchschnittlich häufig vor85. Bei den Beschuldigten ist eine hohe Prävalenz
ausländischer Täter und Täterinnen zu sehen: Ausländerinnen werden 3,4-mal häufiger als
Schweizerinnen polizeilich als Beschuldigte häuslicher Gewalt registriert, Ausländer 3,5-mal
häufiger als ihre Geschlechtsgenossen schweizerischer Nationalität86. Auch bei den Opfern
lässt sich eine Übervertretung (4,5-mal mehr als Schweizerinnen) von Ausländerinnen in allen
Altersklassen und Beziehungstypen feststellen87.
Studien haben bestätigt, dass ungleiche Machtverteilung in der Paarbeziehung im
Zusammenhang mit der Tendenz eines Partners zur Dominanz und Kontrolle einen weiteren
Risikofaktor für häusliche Gewalt darstellt88. Das Fehlen von konstruktiven
Konfliktbewältigungsstrategien erhöht zudem das Risiko, dass es in einem Konflikt zur
Anwendung von Gewalt kommt89. Zudem können gewisse Lebensereignisse wie
Schwangerschaft, Geburt und Trennung Stresssituationen bewirken, die als Risikofaktor zu
79 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 584. 80 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 81 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 5. 82 KILLIAS/KUHN/AEBI, N 553; vgl. auch Bericht BR 2009, 4098. 83 SIMONIN/KILLIAS/DE PUY, S. 5. 84 KILLIAS/KUHN/AEBI, N 553. 85 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 86 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 5. 87 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 5. 88 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 89 Bericht BR 2009, 4098.
13
betrachten sind90. Weiter wird häusliche Gewalt auch von Faktoren wie einer sozialen
Isolation des Paares oder einer gewaltbejahende Einstellung der Partner oder des sozialen
Umfelds des Paares bzw. der Gesellschaft begünstigt91.
Patriarchalisch geprägte Geschlechterverhältnisse, gewaltgeprägte Erziehungsmethoden bzw.
eigene Erfahrungen mit Gewalt in der Familie und eine gesellschaftliche Banalisierung des
Phänomens gelten als ursächliche Bedingungen für häusliche Gewalt92. Dagegen bilden aus
der Sicht der Experten ein respektvoller Umgang mit dem Partner und mit den gegenseitigen
Gefühlen, sowie die Gleichstellung in der Partnerschaft und ein konstruktiver Umgang mit
Konfliktsituationen Schutzfaktoren dar93.
3.2 Die Opfer
Viele Opfer haben eine lange Geschichte von Herabwürdigung, Unterdrückung und Gewalt in
Beziehungen hinter sich, mit dem Resultat, dass ihr Selbstvertrauen beinahe vernichtet
worden ist94. Oft fühlen sich Opfer häuslicher Gewalt entmutigt und resigniert und glauben
sogar, am Geschehen schuld zu sein95. Andererseits bleiben oft Frauen in Gewaltbeziehungen,
weil sie glauben, auf diese Weise die Verantwortung für ihre Kinder wahrzunehmen, sind
finanziell abhängig, oder sie befürchten den Verlust der Aufenthaltsbewilligung96. Häusliche
Gewalt bewirkt stark ambivalente Gefühle in den Opfern, die sich dann auch widersprüchlich
verhalten97. Zum Beispiel ersucht ein Opfer häuslicher Gewalt zunächst die Polizei um Hilfe
und Schutz, um kurze Zeit danach den Täter in Schutz zu nehmen und einen entsprechenden
Antrag auf Verfahrenseinstellung zu stellen98.
Sich aus einer Gewaltbeziehung zu befreien, kann durch mehrere Faktoren erschwert werden,
wie zum Beispiel „wirtschaftliche Abhängigkeiten, emotionale und soziale Bindung,
Schuldgefühle, tradierte und gesellschaftlich festgeschriebene Familienideale, seelischer
Belastung, Angst vor weiteren Gewalthandlungen des Partners“ und so weiter99. Auch das
Verlassen einer gewaltbelasteten Beziehung bedeutet zudem nicht unbedingt, dass die
90 Bericht BR 2009, 4098. 91 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 92 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 93 Gewalt in Paarbeziehungen, S. II. 94 www.verbrechenspraevention.ch. 95 www.verbrechenspraevention.ch. 96 www.verbrechenspraevention.ch. 97 STEINER, S. 24. 98 STEINER, S. 24. 99 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 584.
14
Misshandlungen zu einem Ende kommen100.
4. Reaktion auf das Phänomen: Was ist das juristische Regulativ?
Sowohl die Gewaltforschung als auch die in diesem Bereich tätigen Experten sind der
Meinung, dass Gewalt in der Partnerschaft durch den gleichzeitigen Einsatz verschiedener
Massnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu bekämpfen ist101. In den letzten beiden
Jahrzehnten wurden in der Schweiz Massnahmen auf allen Ebenen getroffen102.
Im Jahre 1996 verlangte di Nationalrätin MARGRITH VON FELTEN in zwei parlamentarischen
Initiativen, dass im sozialen Nahraum begangene Delikte von Amtes wegen zu verfolgen sein
sollen103. Anlass der Revision war „der kriminologisch unumstrittene Befund, dass Gewalt
auch und gerade im sozialen Nahraum, also in Familien und Partnerschaften, und dort
regelmässig zum Nachteil von Frauen ausgeübt wird“104. Im Jahre 1997 wurde ein
entsprechender Gesetzesentwurf erarbeitet, der im Herbst 2003 in den beiden Räten ohne
wesentliche Änderungen angenommen wurde und per 1. April 2004 in Kraft getreten ist105.
4.1 Gesetzgebung auf Bundesebene
4.1.1 Überblick
Seit dem 1. April 2004 werden gewisse Gewaltdelikte gem. StGB, die in einer Ehe bzw.
Partnerschaft bzw. bis zu einem Jahr nach deren Auflösung verübt werden, explizit von
Amtes wegen verfolgt. Bei gewissen Tatbeständen ist die Einstellung des Verfahrens auf
Antrag des Opfers möglich (Art. 55a StGB)106. Diese Regeln gelten seit dem 1. Januar 2007
auch für die eingetragene Partnerschaft. Zudem ist am 1. April 2007 die neue
Gewaltschutznorm im Zivilgesetzbuch in Kraft getreten (Art. 28b ZGB). Ausserdem
verpflichtet das Opferhilfegesetz die Kantone, Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer
häuslicher Gewalt zu schaffen107. Das Ausländergesetz räumt zudem Ausländerinnen, die sich
aus „wichtigen Gründen“ trennen (namentlich bei häuslicher Gewalt), die Möglichkeit eines
individuellen Anspruchs auf Erlangen der Aufenthaltsbewilligung ein108.
100 KILLIAS/SIMONIN/DE PUY, violence, S. 10. 101 Bericht BR 2009, 4100. 102 Bericht BR 2009, 4100. 103 RIEDO, S. 268. 104 RIEDO, S. 268. 105 RIEDO, S. 268. 106 Bericht BR 2009, 4100. 107 Bericht BR 2009, 4100. 108 Bericht BR 2009, 4100.
15
4.1.2 Offizialisierung
In der Schweiz gilt der Grundsatz, dass sich strafbar macht, wer Gewalt anwendet,
unabhängig davon, ob er diese in der Öffentlichkeit oder im privaten Umfeld verübt109. Seit
dem 1. April 2004 werden Gewalthandlungen in Ehe und Partnerschaft von Amtes wegen als
Delikt verfolgt und sanktioniert, d.h. auch ohne Antrag des bzw. der Gewaltbetroffenen110.
Dadurch wird dem Wunsch des Gesetzgebers entsprochen, die Opfer von Gewalttaten zu
entlasten, indem die Durchführung des Strafverfahrens nicht mehr ausschliesslich von ihrem
Willen abhängt111. Hinter der Offizialisierung solcher im familiären Nahraum begangener
Delikte steht der Umstand, dass solche Delikte sehr oft aus den verschiedensten Gründen
nicht angezeigt werden112. Indem diese Tatbestände als Offizialdelikte ausgestaltet sind, wird
den Strafverfolgungsorganen unabhängig vom Verhalten des Opfers bzw. dessen Passivität
eine Eingriffsmöglichkeit eingeräumt113. Dadurch soll das Opfer besser geschützt werden und
zwar auch vor sich selbst114. Mit anderen Worten wird dadurch auch eine verbesserte
generalpräventive Wirkung und eine effektivere Strafverfolgung angestrebt115.
Von der Revision waren fünf Bestimmungen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches
betroffen. Die sexuelle Nötigung (Art. 189 StGB) und die Vergewaltigung (Art. 190 StGB)
werden seit dem 1. April 2004 ausnahmslos von Amtes wegen verfolgt116. Damit ist die
Privilegierung für den Täter aufgehoben worden, der Ehegatte des Opfers ist117. Die Revision
betraf sodann drei weitere Tatbestände: einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB),
wiederholte Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b und c StGB) sowie Drohung (Art. 180 Abs.
2 StGB). Diese werden seit dem 1. April 2004 immer dann von Amtes wegen verfolgt, wenn
der Täter mit dem Opfer verheiratet ist bzw. die Tat bis zu einem Jahr nach der Scheidung
begangen wurde oder der Konkubinatspartner das Opfer ist oder die Tat bis zu einem Jahr
nach der Scheidung, Auflösung bzw. Trennung des gemeinsamen Haushaltes begangen
wurde118. Die obengenannten Straftaten bleiben grundsätzlich Antragsdelikte, mit der
Ausnahme der Verfolgung von Amtes wegen, wenn gewisse Konstellationen der Täter-Opfer-
109 www.ebg.admin.ch. 110 BSK StGB II-ROTH/BERKEMEIER, Art. 123 N 30. 111 RIEDO, S. 269. 112 SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, S. 69. 113 SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, S. 69. 114 BSK StGB II- ROTH/BERKEMEIER, Art. 123 N 34. 115 RIEDO, S. 269. 116 RIEDO, S. 270. 117 COLOMBI, ZStrR 2005, S. 297. 118 RIEDO, S. 270.
16
Beziehung vorliegen119. Man spricht in diesem Zusammenhang von „relativen“
Offizialdelikten120.
Zu beachten ist, dass gem. Art. 126 Abs. 2 StGB eine einmalige bzw. erstmalige Begehung
für die Einleitung des Strafverfahrens von Amtes wegen nicht genügt121. Vielmehr ist eine
wiederholte tätliche Auseinandersetzung verlangt, die praktisch als „Methode“ des Täters zur
Durchsetzung seines Willens gilt122.
Zum Kreis der geschützten Opfer gehören sowohl Eheleute und eingetragene Partner als auch
hetero- und homosexuelle Partner, soweit sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen
Haushalt führen123. Erfolgen Tätlichkeiten, einfache Körperverletzung und Drohung
ausserhalb der Ehe bzw. der Partnerschaft, so werden diese weiterhin nur auf Antrag
verfolgt124. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches sind geschlechtsneutral zu verstehen,
weil als Täter und Opfer sowohl Männer als auch Frauen in Betracht kommen125.
Als zeitliche Voraussetzung gilt, dass die Tat während der Ehe bzw. der eingetragenen
Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung bzw. Auflösung begangen worden
ist126. Für (sowohl hetero- als auch homosexuelle) Lebenspartner ist das Führen eines
gemeinsamen Haushalts auf unbestimmte Zeit bzw. dessen Auflösung seit nicht mehr als
einem Jahr massgebend127.
4.1.3 Art. 55a StGB
4.1.3.1 Im Allgemeinen
Art. 55a StGB könnte als eine Art „Kompensationsmechanismus“ in der Strafverfolgung
bestimmter Delikte in Ehe und Partnerschaft angesehen werden128. Dem Opfer häuslicher
Gewalt werden besondere Rechte eingeräumt, wie das Antragsrecht auf
Verfahrenseinstellung129. Damit sollte eine aurea mediocritas zwischen Antrags- und
Offizialdelikt gefunden werden130.
119 RIEDO, S. 270. 120 RIEDO, S. 270. 121 BSK StGB II-ROTH/KESHELAVA, Art. 126 N 10. 122 BSK StGB II-ROTH/KESHELAVA, Art. 126 N 10. 123 BSK StGB II-ROTH/KESHELAVA, Art. 123 N 30. 124 Informationsblatt 11, S. 2. 125 COLOMBI, ZStrR 2005, S. 298 f. 126 COLOMBI, ZStrR 2005, S. 301. 127 COLOMBI, ZStrR 2005, S. 310. 128 JOSITSCH, S. 6. 129 LEUBIN MÜLLER, S. 1594. 130 JOSITSCH, S. 6.
17
4.1.3.2 Anwendungsbereich
Eine Sistierung des Verfahrens gestützt auf Art. 55a StGB ist von vornherein nur bei
bestimmten Delikten und Beziehungsmustern möglich (Art. 55a lit.a StGB).
Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 55a StGB ist somit auf die Tatbestände der
einfachen Körperverletzung (Art. 123 StGB), der wiederholten Tätlichkeit (Art. 126), der
Drohung (Art. 180) und der Nötigung (Art. 181) beschränkt131, wobei für die Prüfung der
Tatbestandsmässigkeit die Normen des Allgemeinen Teils und des Besonderen Teils des
StGB zur Anwendung kommen 132. Demgegenüber überwiegt bei der sexuellen Nötigung
(Art. 189 Abs. 1 StGB) und bei der Vergewaltigung (Art. 190 StGB) das Interesse an der
Strafverfolgung die Opferinteressen, weshalb ein Antrag auf Sistierung des Verfahrens nicht
in Frage kommt133.
Das Recht, die Sistierung des Verfahrens zu verlangen, steht zudem nur denjenigen Personen
zu, die einem Beziehungsmuster gem. Art. 55a Abs. 1 lit. a Ziff. 1–3 StGB zugehören134.
Diese haben eine sog. Desinteresseerklärung zu formulieren135. Ferner ist die Anwendbarkeit
von Art. 55a StGB einer zeitlichen Beschränkung unterworfen, indem die betreffende Tat
während des Bestehens oder innerhalb eines Jahres seit Auflösung des jeweiligen
Beziehungsmusters begangen worden sein muss136.
4.1.3.3 Sistierung des Verfahrens (Art. 55a Abs. 1 StGB)
Voraussetzung der Sistierung ist, dass das Opfer ein entsprechendes Gesuch stellt oder einem
Antrag der Behörde zustimmt137. I.d.R. muss das Opfer seine Zustimmung zur Sistierung
selbst erteilen, d.h. eine sog. Desinteresseerklärung formulieren138. Aus dem Ersuchen des
Opfers (bzw. seines gesetzlichen Vertreters) muss sich sein eindeutiger Wille ergeben139.
Wird die Sistierung dagegen durch die Strafverfolgungsbehörde beantragt, so genügt es, dass
das Opfer auf den Antrag Bezug nimmt und diesem Zustimmt140. In Bezug auf die Form des
Antrags macht das Bundesrechts keine Vorgaben, jedoch kann man aus Art. 55a Abs. 2 StGB
entnehmen, dass Mündlichkeit genügt141.
131 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 42. 132 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 130. 133 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 55. 134 LEUBIN MÜLLER, S. 1594. 135 COLOMBI, Häusliche Gewalt, S. 127. 136 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 76. 137 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 88. 138 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 90. 139 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 95. 140 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 96. 141 PK StGB-TRECHSEL/KELLER, Art. 55a N 4.
18
Dem Opfer steht auch die Möglichkeit zu, mehrmals um die Sistierung des Verfahrens zu
ersuchen, falls diese nicht gewährt wurde142. Damit will der Gesetzgeber der Möglichkeit
Rechnung tragen, dass sich die Verhältnisse im Laufe des Verfahrens verändern und eine
Sistierung dann doch sinnvoll wird143. Diese Regel ist auf den Antrag seitens der
Strafverfolgungsbehörde analog anwendbar144.
Zu beachten ist, dass die zuständige Behörde auf Antrag das Verfahren sistieren kann, aber
nicht muss145. Dies bedeutet einerseits, dass hier nicht einzig die Interessen des Opfers
entscheidend sind, sondern eine Abwägung mit dem Strafverfolgungsinteresse vorzunehmen
ist146. Der Strafverfolgungsbehörde wird somit die Möglichkeit belassen, trotz des Antrags
auf Verfahrenseinstellung, an die Durchführung des Verfahrens festzuhalten147. Andererseits
wird auch das Bestehen von Willensmängeln berücksichtigt: Entspricht das Ersuchen bzw.
die Zustimmungserklärung nicht dem freien Willen des Opfers, so hat die Sistierung zu
unterbleiben148.
Bei der Entscheidung über die Sistierung des Verfahrens muss die Strafverfolgungsbehörde
eine Interessenabwägung vornehmen149. Dabei ist weniger der Wille des Opfers als das
öffentliche Interesse an der Strafverfolgung entscheidend150. Folgende Fragen können bei der
Entscheidfällung helfen: Ist der Täter bereits einschlägig vorbestraft151? Wurde ein Verfahren
schon proviorisch eingestellt152? Worin liegen die Gründe der Entgleisung des Täters153?
Haben sich Täter und Opfer auf eine Lösung der Konfliktsituation einigen können154? Hat
sich die Gefahr neuer Vorfälle verringert155? Wird die Sistierung des Verfahrens tatsächlich
eine Erleichterung für das Opfer bringen156?
Ob damit der angestrebte Opferschutz erreicht werden kann, ist fraglich. Für die
Strafverfolgungsbehörde ist die Einsicht in die Gründe, die das Opfer zum Antrag auf
142 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 107. 143 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 107. 144 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 107. 145 HandKomm StGB-STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 55a N 3. 146 HandKomm StGB-STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 55a N 3. 147 SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, S. 69. 148 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 104. 149 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 115. 150 BGer 6S.3/2006 E. 11.1. 151 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 118. 152 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 119. 153 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 120 f. 154 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 122. 155 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 123. 156 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 124.
19
Verfahrenseinstellung bewogen haben, oft nicht möglich157. Auch die meist bereits hohe
Arbeitsbelastung der Strafverfolgungsbehörde macht eine vertiefte Nachforschung der
Gründe, die den Opfer zur Antragsstellung veranlasst haben, praktisch unmöglich158.
4.1.3.4 Wiederaufnahme des Verfahrens (Art. 55a Abs. 2 StGB)
Widerruft das Opfer innerhalb von sechs Monaten schriftlich oder mündlich seine
Zustimmung zur Sistierung, macht er also eine sog. Widerrufserklärung159, wird das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 55a Abs. 2 StGB). Der vorläufige Charakter der
Suspendierung ermöglich nicht nur dem Opfer allenfalls seine Meinung zu ändern, sondern
soll auch dazu beitragen, dass es frei entscheiden kann160. Nach h.L. ist nach einer
Wiederaufnahme des Verfahrens eine erneute Einstellung ausgeschlossen161.
4.1.3.5 Definitive Einstellung des Verfahrens (Art. 55a Abs. 3 StGB)
Wird die Zustimmung innerhalb der sechsmonatigen Frist nicht widerrufen, so wird das
Verfahren definitiv eingestellt (Art. 55a Abs. 3 StGB).
4.1.4 Gewaltschutznorm: Art. 28b ZGB
4.1.4.1 Überblick
Die Anwendung zivilrechtlicher Instrumente ist in der Bekämpfung häuslicher Gewalt von
grosser Bedeutung, da damit versucht wird, dem konzeptionellen Defizit des Strafrechts
entgegenzuwirken162. Während beim Strafrecht grundsätzlich vergangenes Verhalten Folgen
auslöst, wird mit dem Zivilrecht eine präventive Wirkung bezweckt, indem das Opfer vor
weiterer Gewalt geschützt werden soll163.
Im Bereich der zivilrechtlichen Intervention drängen sich vor allem zwei Fragen auf: Erstens,
geht es um die unmittelbare Trennung vom gewalttätigen Partner und zweitens geht es um
den Umgang mit dem Gefährdungspotential, das für den Gewaltbetroffenen auch nach der
wohnlichen Trennung bestehen kann164.
157 SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, S. 69. 158 CARRARA (07.03.2013), AKBAS (24.04.2013). 159 COLOMBI, S. 127. 160 PC CP, Art. 55a N 14. 161 PK StGB-TRECHSEL/KELLER, Art. 55a N 6; BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 163. 162 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 586. 163 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 586 f. 164 BÜCHLER, FamPra 2000, S. 587.
20
Die in der Vergangenheit als unbefriedigend angesehene Rechtslage wurde 2007 mit dem
Inkrafttreten der Gewaltschutznorm von Art. 28b ZGB verbessert165. Diese Norm sieht
mehrere Massnahmen vor, welche die in Art. 28a ZGB geregelten Abwehrmassnahmen gegen
Persönlichkeitsverletzungen konkretisieren und ergänzen166. Ziel von Art. 28b ZGB ist es,
betroffene Personen vor häuslicher Gewalt und Stalking besser zu schützen167 und zu regeln,
welche Massnahmen zum Schutz betroffener Personen beim Gericht beantragt werden
können168.
Die Bestimmung verwirklicht sich nach dem Leitsatz „wer schlägt, der geht“169. Die
widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung gem. Art. 28b ZGB umfasst nicht nur körperliche
Angriffe und Drohungen, sondern das gesamte Spektrum von Gewalt, Drohungen,
Nachstellungen und Stalking170.
4.1.4.2 Voraussetzungen
Damit das Gericht die in Art. 28b ZGB enthaltenen Schutzmassnahmen anordnen kann, muss
der Beklagte die Persönlichkeit der Klägerin durch Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen
widerrechtlich verletzt oder an der Verletzung wenigstens mitgewirkt haben171. Unter dem
Begriff der Gewalt wird hier „eine unmittelbare Beeinträchtigung des physischen,
psychischen, sexuellen oder sozialen Integrität“ einer Person verstanden172. Drohung i.S.v.
Art. 28b ZGB bedeutet „ein Inaussichtstellen von widerrechtlichen Verletzungen der
Persönlichkeit“ und als Nachstellung ist das „zwangshafte Verfolgen und Belästigen einer
Person über längere Zeit“ zu verstehen173. Im Zusammenhang mit den erwähnten
widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzungen ist anzumerken, dass die Beeinträchtigung aus
einer objektiven Betrachtungsweise mehr als geringfügig sein muss174.
Die Anordnung einer Massnahme nach Art. 28b ZGB setzt zudem kein Verschulden
voraus175.
165 www.ebg.admin.ch. 166 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 2. 167 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 2. 168 NUSSBAUMER, S. 140. 169 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 1. 170 BBl 2005, 6883. 171 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 3. 172 NUSSBAUMER, S. 141. 173 NUSSBAUMER, S. 141. 174 BBl 2005, 6884. 175 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 7.
21
Die gerichtliche Massnahme muss dem Verhältnismässigkeitsprinzip genügen176, da mit der
Anordnung solcher Massnahmen auch in den grundrechtlich geschützten Bereich der
verletzenden Person eingegriffen wird177.
Dem Verhältnismässigkeitsprinzip ist insofern zu genügen, als gleichzeitig die für den Täter
am wenigsten einschneidende Massnahme anzuordnen ist, welche jedoch für das Opfer
genügend wirksam ist178: „Je schwerer die Bedrohung oder Gewaltanwendung wiegt, desto
einschneidender darf der gerichtliche Eingriff in die Bewegungsfreiheit des Täters sein“179.
Entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip muss die Massnahme geeignet sein, die
Persönlichkeit des Opfers vor weiteren Verletzungen durch den Täter zu schützen180. Zudem
muss unter dem Aspekt der Erforderlichkeit ein angemessenes Verhältnis zwischen der
Intensität der Persönlichkeitsverletzung und jener des Eingriffs des Gerichts in die
Rechtsstellung des Täters bestehen181. Je schwerer eine Bedrohung bzw. Gewaltanwendung
wiegt, desto einschneidender kann eine Massnahme ausgestaltet werden182. Dem Gericht steht
die Möglichkeit zu, die Schutzmassnahme einzelfallgerecht zu gestalten183. Eine allfällige
Befristung muss unter Berücksichtigung der vorangegangenen Verletzungen erfolgen184. In
gewissen Konstellationen bleibt jedoch eine befristete Massnahme eher wirkungslos, weshalb
sich eine unbefristete Massnahme als empfehlenswert erweist185. Zum Beispiel kann es in
Fällen telefonischer Belästigung sinnvoll sein, eine unbefristete Massnahme anzuordnen186.
Das Gericht erlässt eine verbindliche Verhaltensanweisung, die sowohl Gebote als auch
Verbote umfassen kann187. Als Massnahmen gem. Art. 28b ZGB kommen das
Annäherungsverbot, das Ortsverbot und das Kontaktverbot in Betracht188. Die Aufzählung ist
jedoch nicht abschliessend, womit dem Gericht ein grosser Spielraum bei der Ausgestaltung
der Schutzmassnahme eingeräumt wird189. Die Massnahmen nach Art. 28b Abs. 1 und 2 ZGB
sind zudem kombinierbar190. Die Anordnung der Verhaltensanweisung erfolgt unter
176 ZINGG, N 107 ff. 177 BBl 2005, 6885. 178 BBl 2005, 6886. 179 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 5. 180 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 4. 181 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 4. 182 NUSSBAUMER, S. 142. 183 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b, N 6. 184 NUSSBAUMER, S. 142. 185 BBl 2005, 6885 f. 186 BBl 2005, 6886. 187 BBl 2005, 6886. 188 NUSSBAUMER, S. 143. 189 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b, N 6. 190 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b, N 11.
22
Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche
Verfügungen)191.
Art. 28b Abs. 2 ZGB normiert die Wohnungsausweisung. Das Gericht kann eine Wegweisung
verfügen, und zwar ungeachtet der dinglichen bzw. obligatorischen Rechten am
Wohnobjekt192. Zu bemerken ist auch, dass diese Bestimmung auf alle Formen von Lebens-
und Wohngemeinschaften anwendbar ist, ohne Berücksichtigung des formellen Bestehens
einer Ehe bzw. einer eingetragenen Partnerschaft193. Das Gericht muss bei der Festlegung der
Dauer der Wegweisung dem Verhältnismässigkeitsprinzip Beachtung schenken, eine
Obergrenze ist jedoch nicht vorgesehen194.
Leben Täter und Opfer gemeinsam in einer Wohnung, kann das Gericht eine angemessene
Entschädigung für die Alleinbenutzung der Wohnung durch das Opfer festlegen, wenn die
Umstände dies rechtfertigen (Art. 28b Abs. 3 Ziff. 1 ZGB). Diese Massnahme ist
insbesondere bei längerfristigen Wegweisungen von Bedeutung195. Ist der Weggewiesene
Mieter der Wohnung und besteht die Gefahr, dass er den Mietvertrag kündigt, kann das
Gericht – nach vorhergehender Einholung der Zustimmung des Vermieters – die Rechte und
Pflichtev aus dem Mietvertrag dem Opfer übertragen (Art. 28b Abs. 3 Ziff. 2 ZGB).
Bei häuslicher Gewalt ist oft ein sofortiges Eingreifen, d.h. bei jeder Tages- und Nachtzeit,
unumgänglich196. Bis das Gericht eine superprovisorische Massnahme gem. Art. 265 ZPO
anordnet, kann es unter Umständen zu spät sein197. Daraus folgt, dass die Kantone gem. Art.
28b Abs. 4 ZGB verpflichtet sind, „eine Stelle zu bezeichnen, die im Krisenfall die sofortige
Ausweisung der verletzenden Person aus der gemeinsamen Wohnung verfügen kann“198. Es
handelt sich dabei um eine sog. „super-superprovisorische Massnahme“199. Daraus folgt, dass
die Kantone einerseits dazu verpflichtet sind, eine Stelle zu schaffen, die im Krisenfall sofort
intervenieren kann und die gewalttätige Person nötigenfalls von der eigenen Wohnung
191 BBl 2005, 6886. 192 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 10. 193 BBl 2005, 6886 f. 194 OFK ZGB-BÜCHLER/FREI, Art. 28b N 10. 195 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b 10. 196 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 10. 197 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 10. 198 KUKO ZGB-DÖRR, Art. 28b N 10. 199 CHK-AEBI-MÜLLER, Art. 28b N 10.
23
ausweisen kann und andererseits, haben sie das Verfahren für die Anordnung von
Massnahmen durch diese Stelle zu regeln200.
Davon ausgehend, dass das Eingreifen bei Krisensituationen sehr rasch erfolgen muss, haben
einige Kantone der Polizei die Kompetenz eingeräumt, die sofortige Ausweisung der
gefährdenden Person aus der Wohnung und ihr Fernbleiben für eine bestimmte Zeit zu
verfügen201. Auch im Kanton Tessin ist die Polizei gem. Art. 9a des Polizeigesetzes (LPol)
dazu ermächtigt worden202.
Art. 28b ZGB weist jedoch einige Schwachstellen auf. Erstens ist zu erwähnen, dass nur die
von der Persönlichkeitsverletzung unmittelbar betroffene Person, d.h. die verletzte, bedrohte,
von einer Nachstellung betroffene Person, aktivlegitimiert ist, nicht aber nahestehende
Personen203. Zudem erfordert ein Eingreifen nach Art. 28b ZGB das Vorliegen einer
bewiesenen Persönlichkeitsverletzung, was beträchtliche Schwierigkeiten mit sich bringen
kann (Zeitaufwand und Kosten im Zusammenhang mit dem Beweisverfahren, allfälliger
Misserfolg des Beweises mit anschliessendem Dahinfallen der Massnahmen)204. Des
Weiteren erscheint die tatsächliche Überprüfung der Einhaltung der Massnahmen
problematisch. Der Täter wird zwar auf die Folgen von Art. 292 StGB aufmerksam gemacht,
eine unfehlbare Kontrolle ist jedoch faktisch nicht möglich205.
4.1.5 Opferhilfe
Bis zum Inkrafttreten des Opferhilfegesetzes (OHG) war Opferhilfe weitgehend privaten
Initiativen und Institutionen überlassen, weil sich der Staat nur um die Täter kümmerte206. Mit
der Schaffung des Opferhilfegesetzes, das im Jahre 1993 in Kraft trat, sind alle Kantone
verpflichtet worden, Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer, auch von häuslicher Gewalt,
einzurichten207. Diese Stellen leisten und/oder vermitteln Opfern von Gewalttaten
medizinische, psychologische, soziale, materielle und juristische Hilfe ambulant und wenn
nötig über längerer Zeit208. Der Anspruch auf Opferhilfe setzt keine Durchführung eines
Strafverfahrens voraus209 und hat ein solches auch nicht zwingend zur Folge210.
200 SCHWANDER, Bericht, S. 24. 201 BBl 2005, 6889. 202 Vorn Kapitel III. 203 BBl 2005, 6885. 204 NUSSBAUMER, S. 168. 205 NUSSBAUMER, S. 168 f. 206 Informationsblatt 11, S. 3. 207 Informationsblatt 11, S. 3. 208 Informationsblatt 16, S. 13. 209 Informationsblatt 11, S. 3. 210 Informationsblatt 9, S. 5.
24
Opfer im Sinne des OHG ist jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen,
psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 1 Abs. 1
OHG).
Jeder Kanton stellt die Möglichkeit zur Verfügung, sich an Opferhilfestellen zu wenden211.
Dem Opfer steht es frei zu entschieden, an welche Stelle in welchem Kanton es sich wenden
will212. Auf dem Gebiet des Kantons Tessin bestehen vier Stellen in vier verschiedenen
Städten: Bellinzona, Locarno, Lugano und Mendrisio213.
Das Angebot an Opferhilfe bei häuslicher Gewalt ist für Frauen relativ umfangreich, für
männliche Opfer jedoch weitaus dürftiger214. An Fachstellen, die auf Männer als Opfer von
häuslicher Gewalt spezialisiert sind, fehlt es ganz allgemein215. Der Grund dafür könnte darin
liegen, dass häusliche Gewalt gegen Männer heute bis heute ein tabuisiertes Thema darstellt
und zu wenig darüber gesprochen wird216.
Auf der anderen Seite stehen sowohl für männliche, als auch für weibliche Täter Beratungs-
und Hilfsangebote zur Verfügung217. Für männliche Täter bestehen zusätzlich zu den
freiwilligen Hilfsangeboten auch einige von gewissen Kantonen (z.B. Basel-Landschaft)
geschaffene „zwingende“ Trainigsprogramme218.
4.2 Auf kantonaler Ebene
Die Kantone haben Massnahmen gegen häusliche Gewalt in unterschiedlicher Weise in die
kantonalen Gesetzgebungen aufgenommen219. Die Kantone können weder im Zivil- noch im
Strafrecht tätig werden, da diese eine ausschliessliche Kompetenz des Bundes ist, wohl aber
im Bereich des Polizeirechts220. Die von den Kantonen erlassenen Bestimmungen
unterstützen und ergänzen zivilrechtliche Massnahmen221. Durch die Schaffung kantonaler
Regeln wurde die Lücke beim kurzfristigen Opferschutz geschlossen222.
Die Kantone haben in unterschiedlicher Weise Massnahmen gegen häusliche Gewalt in ihre
Gesetze aufgenommen. Einige Kantone, wie St. Gallen und Tessin, haben die entsprechenden 211 www.ti.ch/lav. 212 www.ti.ch/lav. 213 www.ti.ch/lav. 214 Informationsblatt 16, S. 13. 215 Informationsblatt 16, S. 13. 216 Informationsblatt 16, S. 13. 217 Informationsblatt 16, S. 14. 218 Informationsblatt 16, S. 14. 219 Bericht BR 2009, 4100. 220 KEEL, S. 322. 221 KEEL, S. 322. 222 Bericht BR 2009, 4100.
25
Regelungen in ihre Polizeigesetze integriert, andere, wie Zürich, haben Gewaltschutzgesetze
erlassen223. St. Gallen beansprucht die Schweizer Pionierrolle mit dem „Wegweisungsmodell
bei häuslicher Gewalt“224. Die Ziele des St. Galler Modells umfassen die unmittelbare
Gefahrenabwehr, die nachhaltige Änderung der Situation und die Prävention225.
4.3 Koordinations- und Kooperationsmassnahmen
Auf nationaler, regionaler und kantonaler Ebene wurden Vernetzungs-, Koordinations- und
Kooperationsstrukturen eingerichtet226.
In allen Kantonen bestehen ständige Kommissionen bzw. Runde Tische zur Förderung der
Kooperation zwischen den Behörden und den Fach- und Beratungsstellen227. Das
Vorhandensein von Koordinations- und Kooperationsstellen wird von den Experten für
äusserst wichtig erachtet, weil diese einen fundamentalen Beitrag zur Sensibilisierung für das
Thema und zur Sicherung der wirksamen und effizienten Präventionsarbeit leisten228.
223 Informationsblatt 11, S. 3 f. 224 KEEL, S. 327. 225 KEEL, S. 323. 226 Medienmitteilung Studie und Bericht, S. 4. 227 Medienmitteilung Studie und Bericht, S. 4; Näheres zum Kanton Tessin unter III. 228 Bericht BR 2009, 4101.
26
III. Häusliche Gewalt im Kanton Tessin
1. Fakten
Häusliche Gewalt ist eines der grössten Sicherheitsprobleme unserer Gesellschaft229. Auch im
Kanton Tessin stellt das Phänomen der häuslichen Gewalt ein nicht zu unterschätzendes
Problem dar, das viele Haushalte betrifft.
1.1 Im Allgemeinen
Zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2012 hat die Kantonspolizei in 3'321
Fällen wegen häuslicher Gewalt interveniert. Das bedeutet, dass die Polizei im Kanton Tessin
im Durchschnitt fast alle 13 Stunden wegen häuslicher Gewalt eingreift. Zwischen 2008 und
2012 wurden in 400 Fällen Männer durch die Polizei weggewiesen, dagegen nur in 16 Fällen
Frauen230. Das heisst, dass im Durchschnitt alle 4,5 Tage ein Mann wegen häuslicher Gewalt
aus der Familienwohnung weggewiesen wird. Es gibt jedoch auch Täter, welche die
Wohnung freiwillig verlassen. Dies ist im selben Zeitraum in 310 Fällen erfolgt.
Quelle: Kantonspolizei TI
229 STEINER, S. 25. 230 Statistik der Kantonspolizei TI.
3321
13591081 995
1243
310 40026
778
308 134 187
Dati dal 2008 al 2012
Interventi Reati d'ufficio Famiglie CHFamiglie miste Famiglie straniere Allontanamenti volontariAllontanamenti uomini Dec Uff Allontanamenti donne Dec Uff FeritiAvvisi tutoria Avvisi LAV Notifiche patronato
27
1.2 Tatzeitpunkt
In den von der Kantonspolizei gesammelten Daten fällt auf, dass sich bei Gewalttaten im
häuslichen Bereich ein bestimmtes Schema in Bezug auf Tageszeiten und Wochentagen zeigt.
Die untenstehende Grafik zeigt, an welchen Wochentagen die Tessiner Polizei im Jahre 2012
wie häufig wegen häuslicher Gewalt interveniert hat. Das Wochenende scheint besonders
risikoreich zu sein: Die Polizei interveniert am häufigsten an Samstagen und Sonntagen. Dies
deckt sich mit den Daten des Bundes. Die Erklärung dieses Muster könnte darin liegen, dass
man am Sonntag i.d.R. nicht zur Arbeit geht und öfter beisammen ist. Durch dieses
Beisammensein wird auch die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation erhöht.
Quelle: Kantonspolizei TI
Die untenstehende Grafik teilt die polizeilichen Interventionen wegen häuslicher Gewalt im
Jahre 2012 nach Tagesstunden ein. Besonders in den Nacht- und Morgenstunden scheint die
Atmosphäre relativ friedlich zu sein. Die Anzahl polizeilicher Interventionen nimmt jedoch
im Laufe des Tages zu und erreicht einen Höhepunkt während der Abendstunden. Meines
Erachtens ist dieser Höhepunkt damit begründbar, dass die Partner oft nur am Abend
gemeinsam Zeit verbringen und sich zur gemeinsamen Mahlzeit treffen. Wenn bereits
Spannungen bestehen, kann es bei dieser Gelegenheit jedoch leicht zu einem Streit kommen,
der unter Umständen ausser Kontrolle gerät und zu einem Vorfall häuslicher Gewalt führt.
28
Quelle: Kantonspolizei TI
2. „Wer schlägt, muss raus“
2.1 Überblick
Die seit 2004 nacheinander eingetretenen Gesetzesänderungen im Bereich häuslicher Gewalt
haben auf nationaler Ebene und natürlich auch im Kanton Tessin wichtige Beiträge geleistet
und ermöglicht, das Problem im Griff zu bekommen231. Gem. Art. 28b ZGB sind die Kantone
verpflichtet, eine Kriseninterventionsstelle für häusliche Gewalt zu bezeichnen232. Diese
Kriseninterventionsstelle muss unabhängig von jeglichen Bürozeiten, Feiertagen und zu allen
Tages- und Nachtstunden in der Lage sein, unverzüglich zu intervenieren233. Diese Aufgabe
wird im Kanton Tessin von der Kantonspolizei wahrgenommen. Bei der Tätigkeit der
Kriseninterventionsstelle handelt es sich um eine eigenständige Kompetenz und richtet sich
nach einem besonderen Verfahren, das kantonal geregelt ist234. In concreto liegt es in der
Kompetenz des Kantons, die Dauer der Wegweisung, die richterliche Genehmigung und
Überprüfung, die Rechtsbelehrung usw. zu regeln235.
2.2 Polizeigesetz
Gestützt auf Art. 9a LPol ist die Polizei befugt, eine Person für eine Dauer von zehn Tagen
aus ihrer Wohnung wegzuweisen, falls sie eine Gefahr für die physische, sexuelle oder
psychische Integrität der mit ihr in Hausgemeinschaft lebenden Personen darstellt (Abs. 1).
231 Die im Kap. II gemachten Ausführungen gelten auch für den Kap. III, weshalb auf eine Wiederholung ver-
zichtet wird. 232 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b N 12. 233 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b N 12. 234 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b N 12. 235 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b N 12.
29
Diese Kompetenz kommt auch der Gemeindepolizei zu, unter der Voraussetzung, dass sie
dazu vom Regierungsrat i.S.v. Art. 26 ermächtigt ist (Abs. 2).
Die Polizei verlangt von der wegzuweisenden Person die Herausgabe des Hausschlüssels und
die Hinterlassung einer Anschrift (Abs. 3, 1. Satz). Weiter wird der wegzuweisenden Person
die Möglichkeit gegeben, das Allernötigste für die Dauer der Wegweisung aus der Wohnung
zu holen (Abs. 3, 2. Satz).
Sowohl das Opfer als auch die weggewiesene Person werden auf Beratungsstellen und
Therapieangebote hingewiesen (Abs. 4, 1. Satz). Das Opfer wird auch darüber informiert,
dass es die Möglichkeit hat, sich bis zum Ende der zehntägigen Frist an den Bezirksrichter zu
wenden, um die Verlängerung der Wegweisung zu verlangen und allenfalls die Anordnung
weiterer Massnahmen zu beantragen (Abs. 4, 2. Satz).
Entscheidung über die Wegweisung wird der weggewiesenen Person innert 24 Stunden durch
den zuständigen Polizeibeamten mitgeteilt (Abs. 5, 1. Satz). Die Entscheidung enthält die
Erklärung der Gründe für die Wegweisung, die Orte, an denen der Weggewiesene sich nicht
aufhalten darf, und die Konsequenzen bei Nichteinhaltung (Abs. 5, 1. Satz). Eine Kopie der
Entscheidung wird unverzüglich auch den anderen involvierten Personen und dem
zuständigen Bezirksrichter zugestellt (Abs. 5 zweiter Satz). Der Bezirksrichter bestimmt
innert drei Tagen anhand der Akten, ob eine mündliche Verhandlung erforderlich ist (Abs. 5
zweiter Satz und dritter Satz). Art. 261 ff. ZPO sind analog anwendbar (Abs. 5, 4. Satz). Die
Urkunde wird der weggewiesenen Person durch die Polizei zugestellt (Abs. 5, 5. Satz).
Entscheidend für den Erfolg des Instruments der Wegweisung ist, dass es von den
diensthabenden Polizisten vor Ort rasch eingesetzt werden kann236.
Mit der Wegweisung mit Rückkehrverbot während zehn Tagen werden mehrere Ziele
verfolgt. Zuallererst geht es um den Schutz vor einer unmittelbar bestehenden Gefahr, die nur
mit der Entfernung der gefährlichen Person abgewendet werden kann. Zweitens werden damit
auch weitere Vorkommnisse vermieden, zumindest in der nahen Zukunft. Drittens handelt es
sich bei der Wegweisung um einen Erziehungseingriff gegenüber dem Paar, der ein klares
Zeichen dafür setzt, dass häusliche Gewalt nicht toleriert wird. Schliesslich kann die
Wegweisung auch als eine zehntägige Nachdenkfrist betrachtet werden237.
236 KEEL, S. 324. 237 CARRARA (07.03.2013).
30
Die Zusprechung der Wohnung zur temporären Alleinbenutzung bzw. die Wegweisung der
gewalttätigen Person schafft insbesondere für gewaltbetroffene Frauen und allenfalls ihre
Kinder eine Alternative zur Flucht in ein Frauenhaus238.
3. Praxis
3.1 Wer handelt?
Im Jahre 2007 wurde durch den Regierungsrat das „Gruppo d’accompagnamento permanente
in materia di violenza domestica“ gegründet. Es handelt sich dabei um eine ständige
Begleitgruppe, die unter anderem auch Koordinationsfunktionen übernimmt239. Darüber
hinaus hat diese Begleitgruppe auch Informations- und Präventionsfunktion, arbeitet mit der
Kantonspolizei zusammen und bereitet Vorschläge für die Verbesserung der Unterstützung
der Opfer vor240. Zudem treffen sich die Mitglieder der Begleitgruppe regelmässig zum
Erfahrungs- und Meinungsaustausch241.
Zur Gruppe gehören Beauftragte der Kantonspolizei, der Frauenhäuser und der Stelle für
Opferhilfe, sowie Vertreter der KESB, des Migrationsamtes und des Büros für
Gleichbehandlung unter den teilnehmenden Personen242.
Auf kantonaler Ebene eine weitreichende Zusammenarbeit verschiedener Dienststellen zu
finden. Die Dienststellen, die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigen, sind: Die
Kantonspolizei, die Bezirksgerichte, die Staatsanwaltschaft, die KESB, die Stellen für
Bewährungshilfe, die Opferberatungsstellen, das EOC, Beratungsstellen und Frauenhäuser,
der Tessiner Mediationsverein und „antenna mayday“243.
3.2 Kantonspolizei
Die Polizei ist diejenige Instanz, die in Fällen häuslicher Gewalt zuerst interveniert. Sie
handelt hauptsächlich auf Abruf, kann aber natürlich auch infolge eigener Wahrnehmungen
einschreiten. Die Tätigkeit der Polizei ist zweigleisig in dem Sinne, dass sie sich einerseits auf
der verwaltungsrechtlichen und andererseits auf der strafrechtlichen „Schiene“ bewegt. Es
geht dabei um zwei verschiedene, von derselben Situation ausgelöste Auswirkungen. Folge
der polizeilichen Intervention wegen häuslicher Gewalt ist einerseits die Einleitung einer
238 BSK ZGB I-MEILI, Art. 28b N 7. 239 www.ti.ch/asg. 240 www.ti.ch/asg. 241 www.ti.ch/asg. 242 www.ti.ch/asg. 243 www.ti.ch/violenza.
31
Strafuntersuchung, was die strafrechtliche Seite betrifft. Die zehntägige Wegweisung
andererseits bildet die verwaltungsrechtliche Seite des Verfahrens.
Dank der „relativen“ Offizialisierung hat sich die Einsatzdoktrin der Polizei verändert244.
Früher hatten die Eingriffe der Polizei hauptsächlich einen schlichtenden Charakter245.
Heutzutage handelt die Polizei nach dem Motto „ermitteln statt vermitteln“: Ihr wurde die
Pflicht auferlegt, die notwendigen Beweissicherungsmassnahmen zu treffen246.
3.2.1 Einschreiten
Das Thema häusliche Gewalt ist schweizweit in die Grundausbildung der Polizeibeamten
integriert247.
Die intervenierenden Polizeibeamten müssen vorab die Streitenden trennen und anschliessend
feststellen, ob häusliche Gewalt vorliegt, und sich allenfalls überlegen, ob eine Wegweisung
erforderlich ist248. Wird festgestellt, dass es sich um einen Fall häuslicher Gewalt handelt,
müssen die intervenierenden Polizeibeamten einen spezifischen Polizeirapport ausfüllen249.
Für die Einordnung des Geschehens als häusliche Gewalt müssen die einschreitenden
Polizeibeamten wissen, welche Beziehung zur Tatzeit zwischen der geschädigten und der
beschuldigten Person bestand250. Handelt es sich bei der beschuldigten Person um den
aktuellen bzw. ehemaligen Partner des Opfers, werden die polizeilich registrierten Straftaten
dem häuslichen Bereich zugerechnet251.
Die Fähigkeit, eine Situation häuslicher Gewalt zu erkennen, ist für einen Polizeibeamten
deswegen wichtig, weil ein solcher Fall gewisse anschliessend unmittelbar zu treffende
Vorkehrungen auslöst252.
Die von den intervenierenden Polizeibeamten ausgefüllten Rapporte werden anschliessend
zum Teil an die Staatsanwaltschaft und zum Teil an den kantonalen Koordinator für häusliche
Gewalt überwiesen253. Letzterer hat die ihm zugekommenen Rapporte zunächst der jeweils
zuständigen Stelle weiterzuleiten254. Ferner sammelt er die Daten, erstellt Berichte und
244 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 40. 245 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 40. 246 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 40. 247 Bericht BR 2009, 4105. 248 CARRARA (07.03.2013). 249 Anhang 1. 250 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 7. 251 Polizeilich registrierte häusliche Gewalt, S. 7. 252 COCCHI (07.03.2013). 253 CARRARA (07.03.2013). 254 CARRARA (07.03.2013).
32
Statistiken255. Geht es um von Amtes wegen zu verfolgende Delikte, erhält der Staatsanwalt
sowohl den Polizeirapport als auch allfällige Arztzeugnisse und die Protokolle der
polizeilichen Einvernahmen256. Dem zuständigen Bezirksrichter wird innert 24 Stunden eine
allfällige Wegweisungsentscheidung weitergeleitet. Er hat innert einer 3-tägigen Frist den
Entscheid zu überprüfen und die Wegweisung entweder zu bestätigen oder aufzuheben257.
Waren beim Vorfall Kinder anwesend, wird ein entsprechender Rapport ausgefüllt und die
KESB benachrichtigt258. Sowohl dem Opfer als auch dem Gewalttäter steht die freiwillige
Entscheidung zu, ob sie mit der Opferberatungsstelle bzw. der Stelle für Bewährungshilfe in
Kontakt treten wollen. Ist das Opfer damit einverstanden, werden seine Angaben einer der
zwei auf dem kantonalen Gebiet tätigen Stellen mitgeteilt259. Der Gewalttäter wird
demgegenüber auf die Existenz der Stelle für Bewährungshilfe und ihren Angebot für Täter
häuslicher Gewalt hingewiesen260. Ihm steht es offen, sich selber zu melden oder sich von der
Stelle für Bewährungshilfe kontaktieren zu lassen261.
3.2.2 Wegweisung
Bei der Wegweisung handelt es sich um eine Massnahme, welche die Grundrechte des
Betroffenen berührt262. Die Wegweisung der gefährdenden Person muss nicht nur im
Interesse des Opfers erfolgen, sondern auch im öffentlichen Interesse sein und dem
Verhältnismässigkeitsprinzip genügen263. Die Massnhame hat den Schutz des Opfers und
gewissermassen auch eine präventive Wirkung zum Ziel, die Nachteile die für die
weggewiesene Person daraus entstehen, sollen jedoch dem Verhältnismässigkeitsprinzip
genügen264.
Der Anwendungsbereich des Art. 9a LPol beschränkt sich nicht auf die Wegweisung eines
gewalttätigen Partners. Vielmehr erstreckt sich der Anwendungsbereich auf jede Person, die
andere im selben Haushalt lebende Personen gefährdet. Das heisst, dass die Wegweisung
nicht nur im Falle partnerschaftlicher Gewalt angeordnet werden kann, sondern auch im
Zusammenhang mit anderen Personen, wie zum Beispiel einem gewalttätigen Onkel oder
Grossvater, der mit dem Opfer im gemeinsamen Haushalt lebt.
255 CARRARA (07.03.2013). 256 CARRARA (07.03.2013). 257 CARRARA (07.03.2013). 258 Anhang 3. 259 Anhang 4. 260 Anhang 5. 261 Vgl. Anhang 5. 262 Messaggio 27.06.2006. 263 Messaggio 27.06.2006. 264 Messaggio 27.06.2006.
33
Die Möglichkeit der Wegweisung der gefährdenden Person schafft einige Vorteile für die
gefährdete Person. Gleichwohl müssen die Rechte des Weggewiesenen gewahrt werden und
es muss eine möglichst einheitliche Anwendung der Wegweisung gewährleistet werden265.
Schätzen die intervenierenden Polizisten die Situation als gefährlich ein und kommen sie zum
Schluss, dass eine Wegweisung erforderlich ist, haben sie den Pikett leistenden
Kaderangehörigen einen Antrag auf Anordnung der Wegweisung zu stellen266. Der Entscheid
über die Wegweisung mit Rückkehrverbot ist somit nicht in der Kompetenz der
intervenierenden Polizeibeamten, sondern des diensthabenden Offiziers267.
Auf dem Wegweisungsentscheid werden die Orte an denen sich der Betroffene nicht
aufhalten darf, vermerkt268. Wenn der Weggewiesene Objekte von den Orten braucht, welche
er nicht betreten darf, darf er diese nur in Anwesenheit der Polizei holen269.
Wie schon erwähnt, muss der Wegweisungsentscheid gem. Art. 9a LPol unter anderem dem
zuständigen Bezirksrichter weitergeleitet werden. Dieser hat die Entscheidung innert drei
Tage zu überprüfen und sie zu bestätigen oder aufzuheben. Besteht begründeter Anlass dazu,
kann er die Frist der Wegweisung verlängern oder weitere Massnahmen anordnen270.
3.2.3 Wirkungsgrad der Wegweisung
Die Wegweisung hat sich in der Praxis als eine wirkungsvolle Massnahme erwiesen. Dies
hängt hauptsächlich mit drei Faktoren zusammen. Erstens muss der Weggewiesene das Haus
in Anwesenheit der Polizei verlassen und es wird ihm der Hausschlüssel entzogen, damit es
für ihm unmöglich ist, selbstständig wieder ins Haus zu kommen. Zweitens werden dem
Weggewiesenen innert 24 Stunden die Gründen der Wegweisung schriftlich mitgeteilt, was
zudem die Ernsthaftigkeit der Situation betont. Drittens wird das Opfer darauf aufmerksam
gemacht, dass es sich bei der Wegweisung um eine amtliche Verfügung handelt und deren
Ungehorsam Folgen gem. Art. 292 StGB auslösen kann. Somit ist das Opfer nicht befugt, auf
eigenen Wunsch die ausgewiesene Person wieder zurückkehren zu lassen, bevor die Frist
verstrichen ist. Dadurch wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der
Versuchung für das Opfer vorgebeugt, den Täter wieder nach Hause kommen zu lassen, bevor
die Frist abgelaufen ist.
265 KEEL, S. 325. 266 KEEL, S. 325. 267 CARRARA (07.03.2013). 268 Anhang 2. 269 Vgl. Anhang 2. 270 Vgl. Anhang 2.
34
3.2.4 Erfahrungen aus der Praxis
Die Schaffung des Wegweisungsartikels wurde von der Polizei begrüsst. Vor 2008 herrschte
nicht nur bei den intervenierenden Polizisten, sondern auch bei allen anderen Beteiligten eine
nicht leicht überwindbare psychologische Belastung und ein Gefühl der Machtlosigkeit, da
die Wegweisung der gefährdenden Person im Falle häuslicher Gewalt noch nicht in Frage
kam271. Oft hatten die intervenierenden Polizisten mit schwierigen und belastenden
Situationen zu tun, in welchen sie verletzlichen Frauen und verängstigten Kinder nicht weiter
helfen durften und den Frauen bloss raten konnten, dass sie und die Kinder die Nacht
irgendwo anders verbringen sollten272. Die Situation war aus jedem Blickwinkel
unbefriedigend und gefährlich. Abhilfe wurde mit dem Inkrafttreten von Art. 9a LPol
geschaffen: Die Machtlosigkeit der Polizisten wandelte sich in eine Handlungsbefugnis um.
Mit dem Inkrafttreten des Wegweisungsartikels und der Offizialisierung bestimmter
Straftatbestände hat die Gesellschaft zudem ein eindeutiges Zeichen gesetzt, dass häusliche
Gewalt nicht (mehr) toleriert wird273. Damit wurde der Mythos klar entkräftet, dass innerhalb
der eigenen vier Wände alles erlaubt sei.
Allerdings bestehen trotz Wegweisungsartikel und Offizialisierung immer noch gravierende
Probleme im Bereich häuslicher Gewalt, vor allem in Bezug auf die Prävention274. Zudem
sieht sich auch die Kantonspolizei ständig mit der Problematik der hohen Dunkelziffer
konfrontiert275. Man rechnet damit, dass nur ungefähr 20% der Fälle häuslicher Gewalt der
Polizei gemeldet werden276.
3.3 Bezirksgericht
3.3.1 Aufgabe
Die zweite handelnde Instanz in Fällen häuslicher Gewalt ist das jeweilige zuständige
Bezirksgericht. Diesem werden von der Kantonspolizei innert 24 Stunden die Rapporte über
die Wegweisung überwiesen. Der zuständige Bezirksrichter muss innert drei Tagen
entscheiden, ob er die Wegweisung bestätigt oder sie aufhebt (Art. 9a LPol).
Während der zehntägigen Frist kann sich das Opfer beim zuständigen Bezirksrichter melden
und weitere Massnahmen beantragen bzw. weitere Verfahren einleiten, wie z.B. ein
Scheidungsverfahren verbunden mit den notwendigen Schutzmassnahmen. Dabei handelt es
271 COCCHI (07.03.2013). 272 COCCHI (07.03.2013). 273 COCCHI (07.03.2013); vgl. auch Messaggio 27.06.2006. 274 COCCHI (07.03.2013). 275 CARRARA (07.03.2013). 276 CARRARA (07.03.2013).
35
sich aber um ein zweites Verfahren, das vom Verfahren wegen häuslicher Gewalt unabhängig
ist.
3.3.2 Erfahrungen aus der Praxis
Seit dem Inkrafttreten von Art. 9a LPol am 1. Januar 2008 sind bis heute alle
Wegweisungsentscheidungen durch die jeweiligen Bezirksrichter bestätigt worden und keine
Entscheidung ist vom Belasteten angefochten worden277.
Am 27. Juni 2012 hat MICHELA DELCÒ PETRALLI für die Grüne Partei eine Motion an den
Regierungsrat eingereicht. Unter anderem wird dem Regierungsrat beantragt, durch eine
Revision des Polizeigesetzes den Verwaltungsaufwand der Behörden zu reduzieren, indem
man auf die Bestätigung des Wegweisungsentscheids durch den Bezirksrichter verzichtet278.
Diese soll durch die Einräumung der Rekursmöglichkeit ersetzt werden279.
3.4 Staatsanwaltschaft
3.4.1 Überblick
Die Staatsanwaltschaft erhält in den Fällen häuslicher Gewalt sowohl die Polizeirapporte280
bzw. die Meldeformulare der Notfalldienste des Kantons281 als auch alle notwendigen
Informationen, die sie für die Einleitung des Verfahrens benötigt282. Dem Polizeirapport
beigefügt werden somit auch eine allfällige Desinteresseerklärung des Opfers, das Formular,
in dem dieses den Verzicht auf die bzw. die Zustimmung zur Kontaktaufnahme seitens der
Bewährungshilfe283 respektive der Opferhilfe erklärt284, und bei Vorhandensein von
minderjährigen Kindern auch der Rapport für die KESB285. Wurde der Täter gem. Art. 9a
LPol weggewiesen, ist auch eine Kopie der Wegweisungsverfügung anzuhängen286.
3.4.2 Erfahrungen aus der Praxis
Die Rolle der Staatsanwaltschaft ist vor allem in Bezug auf die Möglichkeit der Einstellung
des Strafverfahrens (Art. 55a StGB) bei den neuen Offizialdelikten relevant.
Bei einfacher Körperverletzung, wiederholten Tätlichkeiten, Drohung und Nötigung können
die Staatsanwaltschaft und die Gerichte das Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen
277 Mozione DELCÒ PETRALLI. 278 Mozione DELCÒ PETRALLI. 279 Mozione DELCÒ PETRALLI. 280 Anhang 1. 281 Anhang 6. 282 AKBAS (24.04.2013). 283 Anhang 5. 284 Anhang 4. 285 Anhang 3. 286 Anhang 2.
36
sistieren (Art. 55a Abs. 1 StGB). Es handelt sich dabei um sog. „einfache“ häusliche Gewalt
und das Opfer kann ohne weitere Begründung die Einstellung des Verfahrens beantragen287.
Einzige Bedingung ist, dass das Opfer den Antrag eigenverantwortlich und ohne Druck
seitens des Täters stellt288. Die Einstellungsmöglichkeit wird mit dem Schutz bestimmter
Opferinteressen begründet289. Art. 55a StGB soll nicht das Bekenntnis zur Offizialmaxime in
Frage stellen, sondern lediglich bei bestimmten Delikten die negativen Folgen für das Opfer
korrigieren, die ein Strafverfahren mit sich bringen könnte290.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es sich um eine „Kann-Vorschrift“ handelt. Falls
der Richter für die Einstellung des Verfahrens optiert, muss er sich darüber vergewissern,
dass der Antrag des Opfers nicht das Resultat von Drohungen bzw. Druck seitens des Täters
ist291. Ist die Eigenständigkeit der Entscheidung des Opfers zweifelhaft, so hat der Richter das
Verfahren weiterzuführen292.
Dem Opfer steht bereits bei der ersten Ermittlung die Möglichkeit zu, den Antrag auf
Verfahrenseinstellung zu stellen293. Anhand der verfügbaren Daten ist festzustellen, dass im
Tessin in mehr als 60% der Fälle innert der sechsmonatigen Frist das Verfahren eingestellt
wird294. In einigen Fällen wurde das Verfahren bereits vor Ablauf von sechs Monaten
eingestellt295.
Die Entscheidung über die Weiterführung oder Sistierung des Strafverfahrens fällt nicht
immer leicht. Sie wird stark davon abhängig gemacht, ob der Täter das erste Mal wegen
häuslicher Gewalt vor dem Richter sitzt oder ob es bereits weitere Vorfälle gab296.
Beim ersten bekannten Vorfall häuslicher Gewalt seitens eines Beschuldigten wird tendenziell
die Einstellung des Verfahrens bevorzugt297. Handelt es sich jedoch um einen gravierenden
Fall – zum Beispiel, wenn das Opfer hospitalisiert werden musste, Verletzungen einer
bestimmter Art oder von einer bestimmten Schwere erlitten hat – werden die intervenierenden
Polizeibeamten oft um weitere Auskunft gebeten und/oder die Parteien angehört, damit die
tatsächliche Lage besser festgestellt werden kann298. Die Gewährung der Einstellung des
287 GLESS, S. 382. 288 GLESS, S. 382. 289 BGer 6S.454/2004, Urteil vom 21. März 2006. 290 BBl 2002, 1922. 291 BGer 6S.454/2004, Urteil vom 21. März 2006. 292 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 104. 293 Mozione DELCÒ PETRALLI. 294 Mozione DELCÒ PETRALLI; bestätigt durch AKBAS (23.04.2013). 295 Mozione DELCÒ PETRALLI. 296 AKBAS (23.04.2013). 297 AKBAS (23.04.2013). 298 AKBAS (23.04.2013).
37
Verfahrens ist von der Ernsthaftigkeit des Tatgeschehens abhängig299. Bei gravierenden Taten
wird die Einstellung nicht gewährt und meistens auch gar nicht beantragt300.
Handelt es sich um das zweite Mal, dass die gleiche Person beschuldigt ist und dem Richter
ein Antrag auf Verfahrenseinstellung zugestellt wird, so ist eine sorgfältige Abwägung der
konkreten Umstände erforderlich301. In diesem Fall wird in der Praxis das erste Dossier
wieder hervorgenommen und im Zusammenhang mit dem zweiten analysiert, um die
Ernsthaftigkeit der aktuellen Situation einzuschätzen302. Wenn zum dritten Mal die gleichen
Parteien in eine solche Situation involviert sind und ein Antrag auf Verfahrenseinstellung
gestellt wird, fällt die Antwort auf diesen negativ aus303.
Zu beachten ist weiter, dass das Verfahren bloss sistiert wird (Art. 55a Abs. 1 StGB). Wenn
das Opfer bzw. sein gesetzlicher Vertreter die Zustimmung zur Sistierung des Verfahrens
innerhalb von sechs Monaten schriftlich oder mündlich widerruft, wird das Verfahren wieder
aufgenommen (Art. 55a Abs. 2 StGB). Dabei ist die Entscheidung des Opfers endgültig und
das Verfahren schreitet somit fort. Es passiert manchmal, dass das Opfer erneut die
Einstellung des Verfahrens beantragt und als Grund angibt, es habe irrtümlich die Sistierung
widerrufen lassen304. In diesem Fall ist es unmöglich, dem Opfer entgegenzukommen, da die
Wiederaufnahme des Verfahrens definitiv ist305.
3.4.3 Problemstellen
Die Verfahrenseinstellung nach Art. 55a StGB ist gewissermassen vom Legalitätsprinzip
losgelöst, da das Opfer sich wünschen kann, dass der Staat auf die Verfolgung häuslicher
Gewalt von Amtes wegen verzichtet und somit eine Art „straffreien Raum“ in Partnerschaften
schafft306.
Dies könnte mit dem Zweck der Einführung von Art. 55a StGB und der Offizialisierung
gewisser Straftatbestände kollidieren, weil damit eigentlich die öffentliche Missbilligung der
häuslichen Gewalt als nicht akzeptiertes gesellschaftliches Phänomen verfolgt wäre.
In der Motion DELCÒ PETRALLI wird die Anwendung von Art. 55a StGB sogar als
missbräuchlich bezeichnet, da es Anlass zu einer unverhältnismässig hohen Anzahl von
299 AKBAS (23.04.2013). 300 AKBAS (23.04.2013). 301 AKBAS (23.04.2013). 302 AKBAS (23.04.2013). 303 AKBAS (23.04.2013). 304 AKBAS (23.04.2013). 305 AKBAS (23.04.2013). 306 GLESS, S. 383.
38
Verfahrenseinstellungen gegeben hat. Aus diesem Grund stellt die obengenannte Motion dem
Regierungsrat den Antrag, die Praxis bei der Anwendung von Art. 55a StGB zu ändern307.
Dass Art. 55a StGB ein heikles rechtliches Instrument ist, ist nunmehr ein Faktum. In der
Praxis sind die Motive, die ein Opfer zur Einreichung einer Desinteresseerklärung veranlassen
so vielfältig und breit gefächert wie die Gefahren, die sich dahinter verbergen. Der Widerruf
der Zustimmung zur Sistierung des Verfahrens ist ausserdem in der Praxis eine Seltenheit308.
Vor allem die sechs Monate zwischen der Sistierung und der definitiven Einstellung können
sich als besonders kritisch erweisen: Der Täter könnte beispielsweise Druck ausüben, damit
das Opfer die Sistierung nicht widerruft, oder aber er könnte sich während dieser Frist
zurückhalten, um dann nach der definitiven Einstellung wieder gewalttätig zu werden309.
Sind sechs Monate verstrichen und ist das Verfahren nicht wiederaufgenommen worden, so
verfügt die zuständige Behörde die definitive Einstellung des Verfahrens (Art. 55a Abs. 3
StGB).
Staatsanwalt ZACCARIA AKBAS empfindet die durch Art. 55a StGB geschaffene Ambivalenz
als problematisch, weil man auf der einen Seite intervenieren muss, aber auf der anderen Seite
eine Abmilderung bzw. eine Lenkung des Verfahrens in Richtung der Einstellung mittels der
Möglichkeit der Sistierung quasi gefördert wird. Den Entscheid zu fällen, dem Antrag des
Opfers nicht Folge zu leisten und mit dem Verfahren weiterzufahren ist alles Andere als
einfach310. In diesem Zusammenhang äussert er folgende Überlegungen311: Würde durch eine
Verurteilung des Täters dem Wohl des Paares Rechnung getragen, obwohl ihm das Opfer
verziehen hat? Welches ist die beste Lösung für die Familie? Sind die für die Beantwortung
dieser Fragen notwendigen Kenntnisse vorhanden? Es stellt sich zudem die Frage, ob eine
vertiefte Kenntnis der konkreten Umstände und der involvierten Persönlichkeiten hilfreich
wäre und ob ein Beizug von Fachspezialisten empfehlenswert wäre.
Eine Neuorientierung in der Praxis könnte nach der Ansicht des Staatsanwaltes ZACCARIA
AKBAS dazu führen, dass die Entscheidung über die Sistierung des Verfahrens dem Richter
statt dem Opfer zusteht. Zur Entscheidung sollten nach der Ansicht des Staatsanwalts
307 Mozione DELCÒ PETRALLI. 308 AKBAS (23.04.2013). 309 AKBAS (23.04.2013). 310 AKBAS (23.04.2013). 311 AKBAS (23.04.2013).
39
objektive Kriterien herangezogen werden, z.B. könnte in Anlehnung an Art. 194 Abs. 2 StGB
dem Täter die Bedingung auferlegt werden, dass er sich in eine Therapie begibt312.
Zusammenfassend gesagt, gilt es ein Gleichgewicht zwischen den Recht des Opfers und dem
gesamtgesellschaftlichen Interesse an der Durchführung des Verfahrens zu finden313. Aus den
obengenannten Erwägungen ergibt sich auch ein klarer Bedarf nach weiterführenden Studien.
3.5 Krankenhäuser und Ärzte
3.5.1 Überblick
Fachpersonen aus dem medizinischen Bereich stellen eine wichtige Berufsgruppe dar, sowohl
im Hinblick auf die Prävention als auch im Zusammenhang mit der qualitativen klinischen
Dokumentation der Fälle häuslicher Gewalt314.
3.5.2 Art. 68 Legge sanitaria cantonale (Lsan)
Die Situation im Kanton Tessin weist in Hinblick auf die Meldung von Straftaten einige
Besonderheiten auf. Gem. Art. 68 Abs. 2 Lsan ist jede Person, die eine selbstständige oder
unselbstständige Erwerbtätigkeit im Gesundheitsbereich ausübt, dazu verpflichtet, die
Staatsanwaltschaft zu informieren, wenn sie den Verdacht oder die Gewissheit hat, dass ein
Patient Krankheiten bzw. Verletzungen aufweist, die Folge einer Straftat sind, bzw. dass ein
Todesfall die Folge einer solchen ist. Dies bedeutet, dass die meldepflichtige Person in diesen
Fällen vom Berufsgeheimnis befreit und dazu verpflichtet ist, eine solche Meldung mittels
eines entsprechenden Formulars der Staatsanwaltschaft weiterzuleiten315. Dem Patienten wird
ein Informationsblatt ausgehändigt316.
3.5.3 Meldeformular
Das Formular, das von den Krankenhäusern für die Meldung an die Staatsanwaltschaft
benutzt wird, ist von einer Arbeitsgruppe erstellt worden317. Dieser Arbeitsgruppe gehören die
Leiter der Notfallstationen des Kantons, der Kantonsarzt und die Direktion des EOC an318.
Das bislang angewandte Formular wird in den kommenden Monaten einige Änderungen
erfahren319. Der Inhalt wird grundsätzlich beibehalten, es wird aber im Hinblick auf die
Weiterleitungsmodalitäten präzisiert und der Begriff der partnerschaftlichen Gewalt besser
312 AKBAS (23.04.2013). 313 AKBAS (23.04.2013). 314 Bericht BR 2009, 4105. 315 Anhang 6. 316 Anhang 7. 317 ZAMPROGNO (11.04.2013). 318 ZAMPROGNO (11.04.2013). 319 FADINI (15.04.2013), Anhang 8.
40
umschrieben320. Zudem wünscht sich die Staatsanwaltschaft auch eine genauere
Umschreibung des Geschehens, was durch blosses Ankreuzen der Felder wie es bis heute
gebräuchlich ist, nicht gewährleistet werden kann321.
3.5.4 Das Beispiel Mendrisio
Während etwa 55’000 Personen, die in der Region Mendrisiotto leben, besuchen im
Durchschnitt 16'500 Personen pro Jahr die Notfallstation des Regionalspitals Mendrisio322. In
der untenstehenden Tabelle sind die Zahlen der Opfer häuslicher Gewalt aufgelistet, die
zwischen 2007 und 2012 die Notfallstation des Regionalspitals Mendrisio besucht haben323.
3.5.5 Erfahrungen aus der Praxis
Die Schaffung der Meldepflicht hat sich vor allem bei den Krankenhäusern insgesamt als
erfolgreich erwiesen. Es ist zu beachten, dass dabei bloss eine Meldung eingereicht wird und
eine Strafanzeige. Die Einreichung der Meldung an die Staatsanwaltschaft ist zwingend und
muss unabhängig davon erfolgen, ob das Opfer damit einverstanden ist oder nicht324. Die
Gründe, die von den intervenierenden Ärzten in einem solchen Fall angeführt werden, sind
einfach und kategorisch: Im Falle häuslicher Gewalt hat das Opfer keine Wahl, weil das
Gesetz ja zu einer solchen Meldung verpflichtet (Art. 68 Abs. 2 Lsan). In diesem
Zusammenhang besteht jedoch das Risiko, dass sich Opfer nicht mehr an das Krankenhaus
wenden, um sich behandeln zu lassen, sondern für eine Selbstmedikation optieren, was u.U.
320 FADINI (15.04.2013), Anhang 8. 321 FADINI (15.04.2013), Anhang 8. 322 FADINI (24.04.2013). 323 FADINI (24.04.2013). 324 FADINI (15.04.2013).
Mendrisio Frauen Männer
2007 15 3
2008 12 4
2009 11 3
2010 4 0
2011 8 3
2012 19 5
41
gefährlich sein kann325. In solch heiklen Fällen versucht die Notfallstation den Hausarzt zu
kontaktieren, was aber nicht immer möglich ist326.
Die Mitwirkung der Hausärzte entspricht meistens nicht den Erwartungen327. Obwohl auch
Hausärzte gesetzlich verpflichtet sind, eine Meldung gem. Art. 68 Abs. 2 Lsan zu erstatten,
erfolgt diese in der Praxis nur selten328. Die Gründe dafür könnten m.E. im tiefen
Vertrauensverhältnis und der langjährigen Bekanntschaft liegen, die oft zwischen Patient und
Hausarzt entstehen. Es kann sein, dass sich der Hausarzt vom Opfer selbst von der Meldung
abbringen lässt, dass er eine andere Lösung herbeizuführen versucht, oder aber auch, dass er
den Täter kennt und diesem eine solche Tat nicht zutraut. Das Resultat ist jedenfalls, dass
viele Fälle häuslicher Gewalt nicht bekannt werden und dagegen keine Massnahmen ergriffen
werden können.
3.6 Bewährungshilfe
3.6.1 Tätigkeitsbereich
Die Bewährungshilfe steht seit Juni 2011 auch den Tätern häuslicher Gewalt offen329.
Dadurch wurde im Kanton Tessin ein weiteres Ziel erreicht, d.h. das Netz von Institutionen
und Stellen, die sich mit der Prävention und Bekämpfung der häuslichen Gewalt beschäftigen,
ist erweitert und ergänzt worden330.
Die Tätigkeit der Bewährungshilfe gliedert sich in eine Art „Interventionskette“ ein, welche
von der Polizei angefangen wird. Es geht hier um eine Art „Sekundärprävention“, da die
häusliche Gewalt bereits stattgefunden hat, man allerdings einen Rückfall zu vermeiden
versucht331.
Im Rahmen einer Intervention kommt der Polizei die Pflicht zu, die gewaltausübende Person
auf die Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen, die es gibt. Dafür steht ein entsprechendes
Formular zur Verfügung332. Der gewaltausübenden Person werden dabei drei Möglichkeiten
angeboten: Sie kann entweder ganz auf die Bewährungshilfe verzichten, oder wählen, ob sie
selber den Kontakt mit der Bewährungshilfe aufnehmen will, oder lieber von der Stelle für
Bewährungshilfe kontaktiert werden will333.
325 FADINI (15.04.2013). 326 FADINI (15.04.2013). 327 CARRARA (07.03.2013). 328 CARRARA (07.03.2013). 329 DE MARTINI (26.10.2012). 330 DE MARTINI (26.10.2012). 331 DE MARTINI (26.10.2012). 332 Anhang 5. 333 Vgl. Anhang 5.
42
Durch eine professionelle täter- und deliktorientierte Beratung und Betreuung soll der Täter
verantwortungsbewusster werden und die Anwendung von Gewalt als Mittel zur Schlichtung
partnerschaftlicher Konflikte vermeiden334.
3.6.2 Problemstellen
In der Praxis hat sich bei der Kundschaft der Bewährungshilfe ein gewisser roten Faden
gezeigt. Die Personen, die sich von der Stelle für Bewährungshilfe helfen lassen, weisen
meistens eines oder mehrere der folgenden Probleme auf: wirtschaftliche Schwierigkeiten,
Fehlen eines sozialen Netzwerks, kulturelle Unterschiede, grosser Altersunterschied in der
Beziehung oder problematischer Alkoholkonsum335.
Das Unterstützungsangebot der Bewährungshilfe ist – wie bereits erwähnt – freiwillig, d.h.
Täter kann nicht dazu gezwungen werden, sich helfen zu lassen. Diese Tatsache gibt Anlass
zu Diskussionen und zu Vergleichen mit anderen Kantonen, die bereits Erfahrungen mit einer
zwingenden Kontaktaufnahme und darauffolgenden Therapiebesuchen gemacht haben. In den
Kantonen Basel-Landschaft und Zürich kommt z.B. der „proaktive Beratungsauftrag“ zum
Zuge: Verfügungen von Schutzmassnahmen werden von Amtes wegen an spezialisierte
Beratungsstellen weitergeleitet, die mit den Involvierten direkt Kontakt aufnehmen336. Die
Fachleute sind davon überzeugt, dass das Durchlaufen eines obligatorischen
Resozialisierungspfades es eine einschneidende Wirkung auf das Verhalten des Täters
hätte337. Dies würde ausserdem auch dem Richter helfen, den Entscheid über die definitive
Einstellung des Verfahrens zu treffen338.
Die Kantonsregierung ist bereits durch zwei Motionen auf gewisse Problematiken des
aktuellen Systems aufmerksam gemacht worden339. Die Tätigkeiten der Bewährungshilfe und
der Beratungsstellen weisen eine fundamentale präventive Wirkung auf340. Die Auswertung
der Ergebnisse der Tätigkeit der Bewährungshilfe haben jedoch unter anderem ergeben, dass
gewisse Schwachstellen in der Organisation bestehen341. Die Dienstleistungen der
Bewährungshilfe zum Thema häusliche Gewalt sind nach zwei Jahren seit deren Entstehung
noch relativ unbekannt342.
334 www.prosaj.ch. 335 DE MARTINI (26.10.2012). 336 Medienmitteilung Studie und Bericht. 337 DE MARTINI (26.10.2012); derselben Meinung: COCCHI (07.03.2013) und AKBAS (23.04.2013). 338 DE MARTINI (26.10.2012); derselben Meinung: COCCHI (07.03.2013) und AKBAS (23.04.2013). 339 Mozione DELCÒ PETRALLI; Mozione PELIN KANDEMIR BORDOLI. 340 Mozione PELIN KANDEMIR BORDOLI. 341 DE MARTINI (26.10.2012). 342 DE MARTINI (26.10.2012).
43
Vor diesem Hintergrund entsteht das Bedürfnis, nach der Schaffung von ad hoc Therapien für
gewalttätige Personen die u.U. zwingend zu besuchen sind343, unabhängig davon, ob der Täter
schlussendlich Sanktioniert wird oder nicht344.
3.7 Opferberatungsstellen
Die Kantone sind verpflichtet, spezifische Beratungs- und Anlaufstellen einzurichten, die den
Opfern von häuslicher Gewalt eine kostenlose und vertrauliche Beratung anbieten345.
Nahestehende Personen und Angehörige sind ebenfalls berechtigt, das Unterstützungsangebot
der Opferberatungsstelle in Anspruch zu nehmen346.
Ist das Opfer damit einverstanden, gibt die Polizei seine persönlichen Daten einer der zwei
auf dem Kantonsgebiet tätigen Opferberatungsstellen mittels eines dafür vorgesehenen
Formulars weiter347. Die Polizei ist verpflichtet, das Opfer über die Angebote der
Opferberatungsstellen zu informieren, kann es jedoch in keinem Fall zu einer
Inanspruchnahme des Unterstützungsangebots bzw. zur Kontaktaufnahme zwingen (Art. 9a
Abs. 4 LPol). Es ist aber für den Anspruch auf Opferhilfe nicht relevant, ob ein Strafverfahren
durchgeführt wird oder nicht348.
Die Opferberatungsstelle unterstützt die Opfer häuslicher Gewalt nicht nur bei der
Verarbeitung der Straftat und beim Management der Krisensituation, sondern leistet auch
soziale, materielle und juristische Hilfe, z.B. bei der Geltendmachung finanzieller
Ansprüche349.
3.8 Beratungsstellen und Frauenhäuser
3.8.1 Überblick
Auf dem Gebiet des Kantons Tessin sind zwei Vereine tätig, die Beratungsstellen und
Frauenhäuser führen350. Im Sopraceneri351 ist die Associazione Armònia tätig, während für
den Sottoceneri352 die Associazione Consultorio delle donne entsprechende Leistungen
343 Mozione PELIN KANDEMIR BORDOLI. 344 Mozione DELCÒ PETRALLI. 345 www.bif-frauenberatung.ch; vgl. auch Informationsblatt 11, S. 6. 346 Informationsblatt 11, S. 6. 347 Anhang 4. 348 Informationsblatt 11, S. 6. 349 www.bif-frauenberatung.ch; vgl. auch Infomationsblatt 11, S. 6. 350 www.ti.ch/violenza. 351 Als Sopraceneri wird der nördliche Teil des Kantons Tessin bezeichnet, d.h. die Region nördlich des Monte
Ceneri. 352 Mit diesem Begriff ist das Südtessin gemeint, d.h. die Region südlich des Monte Ceneri.
44
erbringt. Die Beratungsstellen stehen sowohl Männern als auch Frauen offen, dagegen
nehmen Frauenhäuser nur Frauen und ihre Kinder auf353.
3.8.2 Frauenhäuser
Frauenhäuser sind stationäre Einrichtungen (Notunterkünfte) für Frauen und deren Kinder,
die meist aufgrund einer akuten Gewaltsituation sofortigen Schutz, Unterkunft und Beratung
benötigen354. Sie stehen allen Frauen offen, die von Gewaltsituationen betroffen sind,
unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder finanziellen Situation355. Aus
Sicherheitsgründen sind die Adressen der Frauenhäuser geheim und werden der betroffenen
Frau i.d.R. persönlich mitgeteilt356.
Bei dem durch den Frauenhäuser gewährleisteten Schutz handelt es sich auf jeden Fall um
eine bloss vorübergehende Lösung, weshalb die Aufenthaltszeit im Frauenhaus auch dazu
genutzt werden soll, sich allenfalls neu zu organisieren und das Nötige vorzukehren357. Wie
lange der Aufenthalt in einem Frauenhaus dauert, ist einzelfallabhängig358.
Vor 2008 stellten Frauenhäuser oft die einzige Fluchtmöglichkeit für gewaltbetroffene Frauen
und ihre Kinder dar359. Mit der Schaffung des Wegweisungsartikels, so dachten die Experten
des Bereichs, könnten die Frauenhäuser geschlossen werden, da endlich eine gesetzliche
Grundlage geschaffen wurde, die es den Frauen ermöglicht, in Sicherheit in der
Familienwohnung zu bleiben und den gewalttätigen Mann nicht nur wegzuweisen, sondern
ihn auch fernzuhalten360. Die Erwartungen wurden jedoch gewissermassen enttäuscht: Die
Frauenhäuser spielen immer noch eine grundlegende Rolle in solchen Krisensituationen361.
Diese Tatsache öffnet die Tür zur Diskussion über die Wirksamkeit der aktuell zur Verfügung
stehenden Massnahmen und der Zweckmässigkeit der geltenden Normen gegen häusliche
Gewalt. Nichtsdestoweniger stellt sie auch eine Gelegenheit dar, sich mit dem Problem der
häuslichen Gewalt nicht nur aus der rechtlichen, sondern auch aus einer gesellschaftlichen
bzw. psychologischen Perspektive zu beschäftigen. Der Umstand, dass Frauenhäuser immer
noch eine wichtige Rolle spielen, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass im Bereich Schutz
und Prävention vor häuslicher Gewalt Raum für Verbesserungen besteht.
353 www.ti.ch/violenza. 354 KRANICH SCHNEITER/EGGENBERGER/LINDAUER, S. 74; www.ebg.admin.ch. 355 www.ebg.admin.ch. 356 www.famigliemonoparentali.ch. 357 www.ti.ch/violenza. 358 www.ebg.admin.ch. 359 www.ebg.admin.ch. 360 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 361 CIMA-VAIRORA (01.03.2013).
45
Die Kasuistik zeigt, dass öfter Frauen um eine Unterkunft in einem Frauenhaus ersuchen, die
einer tieferen Einkommensschicht angehören und/oder aus dem Ausland stammen362. Dies
hängt meistens damit zusammen, dass Frauen, die genügende finanzielle Mittel haben bzw.
sich an hilfsbereite Angehörige wenden können, selbstständiger sind und sich leichter von
einem gewalttätigen Partner trennen können363.
3.8.3 Beratungsstellen
Beratungsstellen stehen grundsätzlich sowohl Männern als auch Frauen offen und bieten
Unterstützung und Beratung über mehrere Themen an364. Das Angebot richtet sich an
Personen, die Probleme in der Partnerschaft oder innerhalb der Familie haben, bzw. eine
schwierige Zeit erleben (z.B. Trennung, Scheidung, Leben als alleinerziehende Mutter,
Misshandlungen in der Familie usw.)365.
In einigen Kantonen sind Opferberatungsstellen zu finden, die sich zum Teil auf männliche
Opfer spezialisiert haben366. Im Kanton Tessin ist dies nicht der Fall: Es bestehen kaum auf
Männer spezialisierte Angebote und Einrichtungen367.
3.8.4 Associazione Armònia
Dieses Verein ist im Jahre 1991 mit dem Zweck gegründet worden, Frauen, die sich in einer
schwierigen Lebensphase befinden, aufzunehmen, zu unterstützen und zu beraten368. Er ist im
Sopraceneri tätig.
3.8.4.1 Consultorio Alissa
Beim Consultorio Alissa handelt es sich um eine im Jahre 2006 entstandene Beratungsstelle
der Associazione Armònia369. Das Consultorio Alissa hat seinen Sitz in der Stadt Bellinzona
und stellt Beratungsmöglichkeiten für Frauen und Männer zur Verfügung, die schwierige
Situationen in der Familie bzw. in der Partnerschaft erleben370.
Consultorio Alissa schenkt Gehör, bietet moralischen Halt und gibt zudem die notwendigen
Informationen, damit sich die Person entsprechend der Situation orientieren kann, wie zum
Beispiel Hilfe bei der Beurteilung der persönlichen Situation und der eigenen Fähigkeiten und
362 www.famigliemonoparentali.ch. 363 www.famigliemonoparentali.ch; derselben Meinung ist CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 364 www.ti.ch/violenza. 365 www.ti.ch/violenza. 366 Informationsblatt 15, S. 6. 367 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 368 www.associazione-armonia.ch. 369 www.associazione-armonia.ch. 370 www.associazione-armonia.ch.
46
Möglichkeiten371. Weiter werden der betroffenen Person Hinweise auf die anderen im Kanton
Tessin bestehenden Stellen gegeben, die ihr Hilfe leisten können372.
3.8.4.2 Casa Armònia
Casa Armònia ist das Frauenhaus der Associazione Armònia. Es handelt sich genauer gesagt
um eine 4-Zimmer Wohnung mit sechs bis sieben Schlafplätzen373. Je nach Länge des
Aufenthalts werden in einem Jahr zwischen 7 und 20 Frauen aufgenommen374. Manchmal
kann es sogar vorkommen, dass eine Frau nicht aufgenommen werden kann, weil die
Wohnung vollständig besetzt ist375. Das Alter der Bewohnerinnen variiert zwischen 20 und 60
Jahren, manchmal werden sogar ältere Frauen aufgenommen, was wiederum bestätigt, dass
häusliche Gewalt nicht nur Personen eines bestimmten Alters betrifft376.
Damit die Sicherheit der Bewohnerinnen garantiert werden kann, bleibt die Adresse geheim.
Es ist notwendigerweise auch im Interesse der Frauen, dass der Standort der Wohnung
geheim bleibt. Geschieht es jedoch, dass eine die Sicherheit der Frau gefährdende Person das
Frauenhaus erreicht, wird die betroffene Frau an einem anderen Ort untergebracht377.
Casa Armònia verfügt über einen Pikettdienst, damit sind die Mitarbeiterinnen rund um die
Uhr und sieben Tage die Woche per Telefon erreichbar378. Während des Aufenthaltes in der
Casa Armònia wird den Frauen nicht nur Sicherheit geboten, sondern wird die
Mitarbeiterinnen bieten auch Hilfe, um mit der Situation klarzukommen, sich über die
Zukunftsperspektiven Klarheit zu verschaffen und allenfalls mit den im Kanton zuständigen
Stellen in Kontakt zu treten379.
Für den Aufenthalt im Frauenhaus werden für Frauen 50 Franken pro Tag und für
Minderjährige 35 Franken pro Tag verrechnet380. Die Opferhilfe unterstützt die
Bewohnerinnen mit 20 Franken für Frauen bzw. 15 Franken für Kinder381.
371 www.associazione-armonia.ch. 372 www.associazione-armonia.ch. 373 www.associazione-armonia.ch. 374 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 375 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 376 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 377 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 378 www.associazione-armonia.ch. 379 www.associazione-armonia.ch. 380 www.lugano.ch. 381 CIMA-VAIRORA (01.03.2013).
47
3.8.5 Associazione Consultorio delle donne
Die Associazione Consultorio delle donne erfüllt dieselben Funktionen wie die Associazione
Armònia, weshalb auf nähere Ausführungen an dieser Stelle verzichtet wird. Dieser Verein ist
im Sottoceneri tätig.
3.8.5.1 Consultorio delle donne
Auch dieser Verein stellt eine Beratungsstelle zur Verfügung, die Frauen offen steht, die
Opfer häuslicher Gewalt sind oder andere Ehe-, Konkubinats- oder Scheidungsprobleme
haben382. Die Leistungen der Beratungsstelle sind unentgeltlich383.
3.8.5.2 Casa delle donne
Auch hier handelt es sich um eine Wohnung, die eine bestimmte Anzahl Frauen und Kinder
aufnehmen kann. Die Aufenthaltsdauer ist hier jedoch auf eine höchstens drei Monate
beschränkt384. Der Aufenthalt im Frauenhaus ist auch hier nicht kostenlos: Frauen bezahlen
ebenfalls 50 Franken pro Tag und Minderjährige 35 Franken pro Tag385, wobei sie auch hier
mit einer finanziellen Unterstützung seitens der Opferhilfe rechnen können386.
4. Die Problematik der Datenübermittlung
Fast alle befragten Fachpersonen haben erwähnt, dass die Normen zum Datenschutz viele
Barrieren bei der Datenübermittlung aufstellen387. Es wäre begrüssenswert, eine automatische
Übermittlung der Daten der Opfer und der Täter an die entsprechenden Beratungsstellen
vorzusehen388.
5. Prävention
Besonders wichtig und leider immer noch lückenhaft ist m.E. die Prävention. Eigentlich wird
häusliche Gewalt als Thema deutlich öfter als früher in den Medien thematisiert, es finden
immer wieder Konferenzen darüber statt, man interessiert sich im Allgemeinen vermehrt für
das Thema und es steht auch viel Literatur zur Verfügung. Ist die Prävention wirkungsvoll,
wird sie m.E. nach auch für diejenigen Personen augenfällig, die sich nicht aus eigener
382 www.lugano.ch. 383 www.lugano.ch. 384 www.lugano.ch. 385 www.lugano.ch. 386 CIMA-VAIRORA (01.03.2013). 387 z.B.: COCCHI (07.03.2013), AKBAS (23.04.2013), DE MARTINI (26.10.2012). 388 Bericht BR 2009, 4120.
48
Initiative für das Thema interessieren bzw. nicht direkt davon betroffen sind. Interessiert sich
eine Person für das Thema häusliche Gewalt, nur weil sie selbst betroffen ist, ist es für die
Prävention bereits zu spät und man versucht nur noch den Schaden zu begrenzen. Die
Fachleute sind sich darin einig, dass es von grundlegender Bedeutung ist, Paare und Familien
möglichst früh zu erreichen, was die Bekanntheit der Angebote voraussetzt389. Zudem ist eine
intensivere Nutzung der Angebote zentral390. Auf die Verantwortung des Bundes in diesem
Bereich wurde mehrfach hingewiesen391.
Um die Wirksamkeit der Prävention zu verbessern, ist es zentral, dass auf nationaler Ebene
Strukturen geschaffen und ausreichend finanziert werden392. Eine sinnvolle Vernetzung der
Angebote, Koordination und die Schaffung von Synergien erweisen sich für eine
wirkungsvolle Prävention als unerlässlich393.
Im Kanton Tessin findet seit einigen Jahren jeweils anlässlich des internationalen Tages
gegen Gewalt an Frauen (25. November) eine Sensibilisierungskampagne statt, die „oltre il
silenzio“ („Jenseits der Stille“) heisst394. Diese Kampagne hat die Information und die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Ziel und wird in Form eines Theaterstücks an
öffentlich zugänglichen Orten vorgeführt395. Zweckmässig könnte auch eine Sensibilisierung
in den Schulen sein, bei der Rollenbilder, häusliche Gewalt und Konflikten in der
Partnerschaft thematisiert werden396.
Heute stehen mehrere Risk-Assessment-Instrumente für häusliche Gewalt zur Verfügung397.
Zu diesen zählen DVSI, SARA, ODARA, DVRAG und VRAG398. Conflict Tactic Scales
(CTS) ist die am weitesten verbreitete Forschungsmethode, um das Vorkommen von
Partnergewalt zu identifizieren399. Der Einsatz eines Diagnoseinstrumentes, um das
Vorkommen eines Vorfalls häuslicher Gewalt mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit frühzeitig zu erkennen, wäre wohl begrüssenswert, meines Erachtens
jedoch in der Praxis nicht umsetzbar. Dass ein Vorfall gewisse Indizien aufweist, ist ohnehin
nachvollziehbar, jedoch ist häusliche Gewalt von so vielen weiteren Faktoren abhängig, dass
389 Bericht BR 2009, 4104. 390 Bericht BR 2009, 4122. 391 Bericht BR 2009, 4106. 392 Bericht BR 2009, 4101. 393 Bericht BR 2009, 4101. 394 www.ti.ch/asg. 395www.ti.ch/asg. 396 Bericht BR 2009, 4123. 397 JÉRÔME ENDRASS, Vorlesung Forensische Psychiatrie vom 16.10.2012. 398 JÉRÔME ENDRASS, Vorlesung Forensische Psychiatrie vom 16.10.2012. 399 JÉRÔME ENDRASS, Vorlesung Forensische Psychiatrie vom 16.10.2012.
49
eine zuverlässige Prognose wohl nicht möglich wäre. Die Motion DELCÒ PETRALLI verlangt,
dass ein Diagnoseinstrument angewendet werden soll, das geeignet ist, die Rückfallgefahr
einzuschätzen. Diese Prognose sollte ausserdem als Orientierungshilfe für die Strafbehörde
bei der Anordnung der Massnahmen dienen400.
Von fundamentaler Bedeutung, um die Prävention künftig zu verbessern, ist dass auf
nationaler Ebene Strukturen garantiert und ausreichend finanziert werden, welche die
bestehenden Angebote gut vernetzen, koordinieren und Synergien nutzen401.
400 Mozione DELCÒ PETRALLI. 401 Bericht BR 2009, 4101 f.
50
IV. Schlussfolgerungen
Gewalt im sozialen Nahraum ist ein soziales Übel und bringt nur negative Folgen mit sich:
ängstliche, unglückliche und frustrierte Erwachsene, Menschen ohne Selbstwertgefühl und
nicht zuletzt auch traumatisierte und verwahrloste Kinder. Es ist ein unendlicher Teufelskreis:
Das Leben schwebt von einer Krisensituation zur anderen. Dass Gewalt in Partnerschaften
nichts zu suchen hat, ist ein Faktum und bedarf keiner weiteren Rechtfertigung402.
Die Ziele, die sich der Gesetzgeber vorgenommen hat, sind nobel und jeder Unterstützung
würdig, ihre Umsetzung hat sich jedoch – wie oben mehrmals dargelegt – alles Andere als
einfach herausgestellt. Die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen erweist sich in diesem
Zusammenhang als fundamental: Ohne Kooperation wäre es unmöglich, den Kampf gegen
häusliche Gewalt zu führen und die vorausgesehene Ziele zu erreichen.
Die normativen Neuerungen, die in den letzten Jahren sowohl auf Bundesebene als auch in
den Kantonen stattgefunden haben, sind begrüssenswert und deuten auf einen sehr wichtigen
Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung häuslicher Gewalt hin403. Allerdings sind gewisse
Schwachstellen vorhanden, die Raum für Verbesserung lassen.
Aus den obigen Analysen hat sich insbesondere ergeben, dass Fachleute vor allem gegenüber
Art. 55a StGB die Nase rümpfen. Die provisorische Einstellung des Verfahrens hätte
eigentlich zu einer massgeblichen Entlastung der Opfer führen sollen404, was aber
schlussendlich nicht geschehen ist. Übte der Täter früher Druck auf das Opfer aus, damit es
keine Strafanzeige erstatte, kann er heute seinen Druck darauf richten, dass das Opfer eine
Desinteresseerklärung einreicht. Somit ist der Druck nicht beseitigt, sondern bloss verschoben
worden. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob mit der Schaffung des Art. 55a
StGB nicht bloss eine administrative Hürde eingeführt worden ist, die gerade dort versagt, wo
das Opfer den Einschüchterungen des Täters ausgesetzt ist405. Die Initiative zur Sistierung des
Verfahrens kann gem. Art. 55a Abs. 1 StGB nur vom Opfer oder von der Behörde
ausgehen406. Wichtig ist, dass ein solches Ersuchen wirklich dem freien Willen des Opfers
entspricht407. In der Praxis verfügen aber die Organe der Strafrechtspflege meistens nicht über
402 RIEDO, S. 271. 403 Bericht BR 2009, 4101. 404 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 35. 405 JOSITSCH, S. 6. 406 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 89. 407 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 104.
51
die erforderliche Einsicht in das Privatleben der Personen, um die Situation angemessen
beurteilen zu können408.
In diesem Zusammenhang ist auch die Problematik des Beweisrechts zutage getreten. Da sich
Beziehungsdelikte meistens innerhalb der eigenen vier Wände abspielen, sind i.d.R. keine
Zeugen vorhanden409. Aus diesem Grund erweist sich die Durchführung eines Verfahrens
ohne die Mitwirkung des Opfers als praktisch unmöglich410.
Als problematisch fallen auch die neuen strafrechtlichen Bestimmungen ins Auge, mit denen
bedingte oder unbedingte kurze Freiheitsstrafen durch bedingte oder unbedingte Geldstrafen
ersetzt werden411. Die Zweckmässigkeit einer Geldstrafe ist jedoch in gewissen Fällen
zweifelhaft, da bei prekären wirtschaftlichen Verhältnissen die ganze Familie, und damit auch
das Opfer und die Kinder, noch zusätzlich finanziell belastet wäre412.
Das geltende Recht ist jedoch im Grossen und Ganzen kein Fehlschlag. Im Gegenteil hat sich
durchaus erwiesen, dass der Gesetzgeber fundamentale Verbesserungen vollgebracht hat.
Heute wird häusliche Gewalt vermehrt mit den Mitteln des Zivil- und des Verwaltungsrechts
angegangen413. Unsere Rechtsordnung stellt ergänzende Schutzinstrumente bei häuslicher
Gewalt zur Verfügung, die auf Ehe-, Scheidungs- und Persönlichkeitsrecht gestützt sind414.
Weiter haben sich die Interventionsmöglichkeiten der Polizei im Vergleich zu früher deutlich
verbessert. Wichtig ist dabei, dass sich der Täter der Intervention der Polizeikräfte
gegenübersieht, was einen starken Eindruck macht415. Entscheidend ist schliesslich auch die
symbolische Bedeutung der Offizialisierung416. Dadurch ist endlich klargestellt worden, dass
häusliche Gewalt erstens nicht toleriert wird und zweitens rechtliche Konsequenzen
auslöst417.
408 JOSITSCH, S. 6. 409 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 36. 410 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 36. 411 Bericht BR 2009, 4101. 412 Bericht BR 2009, 4101. 413 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 39. 414 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 198 ff. 415 FREI, S. 561; vgl. auch GLOOR/MEIER, S. 660 ff.; derselben Ansicht auch COCCHI und CARRARA. 416 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 41. 417 BSK StGB I-RIEDO/SAURER, Art. 55a N 41.
52
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und nur unter
Zuhilfenahme der in den Verzeichnissen oder in den Anmerkungen genannten Quellen
angefertigt habe. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als
Leistungsnachweis verwendet zu haben. Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate unter
Einsatz entsprechender Software darf vorgenommen werden.
Ort, Datum: Unterschrift:















































































![1-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)-2-(2-furyl)ethyl]-1 H -benzimidazole](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63152ec4fc260b71020fe0ce/1-2-26-dichlorobenzyloxy-2-2-furylethyl-1-h-benzimidazole.jpg)