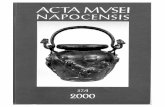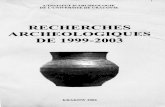Zwischen baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis –...
Transcript of Zwischen baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis –...
STUDIEN ZUR ARCHÄOLOGIE IN OSTMITTELEUROPA · Band 9STUDIA NAD PRADZIEJAMI EUROPY ŚRODKOWEJ · Tom 9
Herausgegeben von / Redaktorzy
JOHANNES MÜLLER JANUSZ CZEBRESZUK SŁAWOMIR KADROW
Kiel Poznań Kraków
Enclosed Space — Open Society.Contact and Exchangein the Context of Bronze AgeFortified Settlementsin Central Europe
Edited by Mateusz Jaeger, PoznańJanusz Czebreszuk, PoznańKlara P. Fischl, Miskolc
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, PoznańDr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn2012
The publication was financed by Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań
Faculty of History AMU
Institute of Prehistory AMU
Project of National Science Center of Poland – no. NN 109 053539
Secretary of volume: Mateusz Cwaliński, Jakub Niebieszczański
Distribution Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
DTP & technical editor Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Cover design Holger Dieterich und Ines Reese, Kiel
ISBN 978-3-7749-3791-8 (Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn)
978-83-63400-44-6 (Bogucki Wydawnictwo Naukowe)
Printed by Uni-Druk, Luboń, Poland
Copyright © by Authors
No part of the book may be, without the written permission of the authors:reproduced in any form (print, copy, CD, DVD, the Internet or other means)as well as working through, reproduced or distributed
2012
CONTENTS
Preface from series’ editors ______________________________________7
Preface _______________________________________________________9
Tomas Alusik Aegean Elements and Influences in Central European Bronze AgeDefensive Architecture: Fact or Fiction? Local or Imported? __________11
János Dani Fortified Tell Settlements from the Middle Bronze Agein the Hungarian Reach of the Berettyó Valley ______________________27
Klara P. Fischl The Role of the Hernád Valley in the Settlement Structureof the Füzesabony Culture ______________________________________39
Tünde Horváth Metallurgy of the Vatya Culture — Technological Observationson the Stone Tools of the Culture ________________________________53
Tünde Horváth The Chronological Role of Chipped Stone Implementsin the Early and Middle Bronze Ages ____________________________117
Mateusz Jaeger Kościan Group of Únìtice Culture and Fortified Settlementin Bruszczewo. Their Role in Micro- and Macro-regional Exchange ___167
Przemysław Makarowicz Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold.Der Trzciniec-Kulturkreis — nordöstlicher Partnerder Otomani/Füzesabony-Kultur ________________________________177
Klára Marková Die befestigten Siedlungen im Kommunikationnetz des Bernsteinsim Karpatenbecken ___________________________________________215
Marcin S. Przybyła,Magdalena Skoneczna
& Adam Vitoš
Interregional Contacts or Local Adaptation? Studieson the Defensive Settlement from the Bronze and Early Iron Agein Maszkowice (Western Carpathians) ___________________________225
László Reményi The Defensive Settlements of the Vatya Cultureand the Central European Bronze Age Exchange System ____________275
Vajk Szeverényi & Gabriella Kulcsár Middle Bronze Age Settlement and Society in Central Hungary ______287
Claes Uhnér Society and Power: Political Economy in Bronze AgeTell-Building Communities _____________________________________353
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischemGold. Der Trzciniec-Kulturkreis – nordöstlicher Partnerder Otomani/Füzesabony-Kultur
Przemysław Makarowicz, Poznań
Einleitung
Die Archäologie verfügt über kein Univer-salinstrument zur Behandlung der komple-xen Problematik der überregionalen Kul-turkontakte. Die archäologischen Quellen– Befunde (z.B. Gebäude) und Funde – be-zeugen zwar kulturelle Kontakte in Formvon bestimmten Gegenständen, Rohstof-fen, Technologien, Ideen, Bräuchen, vonknow-how und auch die Anwesenheit vonMenschen (z.B. JOCKENHÖVEL 1991; MAKA-
ROWICZ 2009) aus weit entfernten Regio-nen, doch sind Interpretationen in dieserHinsicht nie eindeutig. In diesem Beitragbefasse ich mich mit der verbreitetstenForm der Ausbreitung von Gütern, Ideen,Mustern, Wissen, Fertigkeiten und Men-schen – dem Austausch zwischen verschie-denen Gruppen. Natürlich können mancheGegenstände – besonders die mit Statusund Prestige verbundenen – in die jeweili-gen Gebiete auch aus anderen Gründen ge-langt sein, etwa als Trophäen im Gefolgebewaffneter Konflikte (RASSMANN/SCHOK-
NECHT 1997; OSGOOD/MONKS/TOMS 1999;CARMAN/HARDING 2000; OTTO/THRA-
NE/VANDKILDE 2006). Krieg war mit Si-cherheit ein stimulierender Faktor beiüberregionalen Kontakten, wohl aber nichtderart allgemein wie Austausch und Han-del (HÄNSEL 1995; KOŚKO/KLOCHKO 2009).
Interregionale und interkulturelle Kon-takte hatten sicher verschiedene Ausprä-gungen. Sie liefen auf persönlicher oderfamiliärer Ebene ab, zwischen Repräsentan-ten von Siedlungen oder Verwandtschafts-bzw. Abstammungsgruppen und zwischenEliten. Die Kontakte waren in unterschiedli-chem Maße institutionalisiert und konntenspezielle formelle Rahmen haben, sie führ-ten zu Ortswechseln von Menschen, zur
Zirkulation von Prestigegütern, Gebrauchs-gegenständen, landwirtschaftlichen Erzeug-nissen, Tieren, zum Austausch von Ideen,Codes und kulturellen Mustern und führtenzum Transfer von Wissen, Fähigkeiten undneuen Technologien (z.B RENFREW/BAHN
2002, 355–368). In Hinsicht auf die Bronze-zeit stellt sich die Frage nach der Bedeutungvon Reisen, Wanderungen und Raubzügender Angehörigen der Eliten, wie politischeFührer (chiefs), Entdecker, spezialisierterHandwerker sowie Krieger bei der Verbrei-tung von Erfindungen, neuer Technologienoder Methoden der Kriegsführung (KRIS-
TIANSEN/LARSSON 2005, 39f; 2007, 26f).Dank dieses Personenkreises können be-stimmte Gegenstände, Innovationen undVerhaltensmuster weitab ihres Ursprungs-oder Herstellungsgebietes auftreten.
Das Gebiet der Trzciniec-Gemeinschaftdes Trzciniec-Kulturkreises (weiter TKK) –einer kulturellen Formation, die fast dasganze zweite vorchristliche Jahrtausendlang in Ostmitteleuropa bestand – warzwar sehr ausgedehnt, aber ungleichmäßigbesiedelt (MAKAROWICZ 2009; 2010a) undumfasste verschiedene Umwelt- und Kli-mazonen. Seine Ausdehnung in der Breitebetrug etwa 800 km, in Nord-Süd-Rich-tung etwa 600 km (Abb. 1). Innerhalb die-ses Gebietes zeichnen sich mehrere größe-re und kleinere Besiedlungskonzentratio-nen ab. Die überregionalen Kontakte desTKK förderten mehrere Faktoren, wie einausgedehntes Besiedlungsgebiet, welchesmit der Ostsee einerseits und mit demSchwarzen Meer verbundene Stromgebieteandererseits umfasste, weiterhin eine stra-tegische Position an regionalen wie auchüberregionalen Kommunikationswegen,
177M. Jaeger/J. Czebreszuk/K.P. Fischl (eds.) Enclosed Space — Open Society. Contact and Exchange in the Contextof Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe. SAO/SPEŚ 9. Poznań–Bonn 2012.
ein in vielen Gegenden dichtes Besied-lungsnetz, verfügbare Rohstofflagerstättenund die Nachbarschaft zu vielen Kultur-gruppen. Am bedeutendsten für den zivili-satorischen Fortschritt waren unzweifel-haft Interaktionen mit der südlichbenachbarten Otomani/Füzesabony-Kul-tur, welche die höchstentwickelte Kultur-einheit der Frühbronzezeit in Europa warund eine protostaatliche Struktur aufwies(BADER 1998; KADROW 2001; GANCARSKI
2002; MAKAROWICZ 2009).Im vorliegenden Beitrag werden die
weitreichenden und die regionalen Kontak-te der Gesellschaft des TKK mit anderenKulturgruppen, besonders mit der Otoma-ni/Füzesabony-Kultur behandelt. Von In-teresse ist dabei, inwiefern diese Kontakteein Netz potentieller Kommunikationswe-ge (vor allem in Richtung Ostsee undSchwarzem Meer) im 2. Jahrtausend v.Chr.widerspiegelt? Der hier präsentierte Vor-schlag zur Konzeptionalisierung der Kon-takte genannter Kultureinheit mit anderenKulturformationen sollte aber eher alsSkizze eines bestimmten Interpretations-spielraumes gesehen werden als die Vor-stellung der vielfältigen Möglichkeiten der
Rekonstruktion von der Form und der Me-chanismen dieser Interaktionen.
Marcel Mauss bezeichnete in seinemklassischen Werk den Austausch als ge-samtheitlichen sozialen Fakt (MAUSS 2001,167f.). In traditionellen Gesellschaften warer nie lediglich eine rein wirtschaftlicheTransaktion, sondern hatte auch zeremo-nielle Bedeutung, wurde stark und in ver-schiedener Weise ritualisiert (vgl. auchSAHLINS 1972, 149–183; SAHLINS 1992;LÉVI-STRAUSS 1992, 107f.; KADROW 2001,163). In traditionellen, schriftlosen Gesell-schaften mit einfacher sozialer Organisati-on waren Zeremonien gegenseitiger Ge-schenkgabe (gift-giving exchange), die u.a.im Rahmen von alljährlichen Feierlichkei-ten vollzogen wurden, wohl am bedeu-tendsten. In Gruppierungen mit differen-zierterer Sozialstruktur spielte auch dieRedistribution von Gütern eine wichtigeRolle. Der Austausch von Prestigegüternwar einer der die Gesellschaftsstrukturprägenden Faktoren, er initiierte und för-derte die gesellschaftliche Interaktion, wasbesonders Systeme mit noch nicht voll he-rausgebildeten Institutionen betraf (EARLE
1997, 198f.).
178 P. Makarowicz
Abb. 1. Das Gebiet desTrzciniec-Kulturkreises (A)und des Otomani/Füzesa-
bony-Kultur (B), NachGARNCARSKI 2002;
MAKAROWICZ 2010a
In der Fachliteratur wird eine Reihe vonFormen, Arten und Abläufen von Aus-tausch/Handel (eine Übersicht bietet:RENFREW 1984, 119–121; RENFREW/BAHN
2002, 335–368) beschrieben. Mehrheitlichhandelt es sich dabei um „theoretische“Konstrukte ohne konkrete Anwendungs-beispiele, andere betreffen z.B. die Ägäisoder den Nahen Osten – Regionen also mitvöllig anderem Entwicklungsstand der so-ziopolitischen und wirtschaftlichen Struk-tur als die Gemeinschaften Ostmitteleuro-pas. Daher kann hinsichtlich der hieruntersuchten Räume nur ein Teil von ihnenAnwendung finden. Es scheint, als doni-nierten hier nichtkommerzielle und nichtmassenhafte Transaktionen, als überwogeher der Austausch gegenüber dem Handelin seiner klassischen Form (z.B. SHERRATT
1993; KRISTIANSEN 1998, 374f.; HARDING
2000, 185–196; KRISTIANSEN/LARSSON
2005; KOŚKO/KLOCHKO 2009). Doch hatder Austausch eine zweifache Dimension:Er ist eine Form von ökonomischer Aktivi-tät mit dominierendem merkantilemAspekt, aber auch eine soziale Aktivität. Erkann folglich als Teil der Wirtschaft, aberzugleich auch als konstitutiver, strukturel-ler Faktor der meisten Gesellschaften ver-standen werden.
Ausgangspunkt unserer Erörterungensind die schon klassischen Vorschläge zurBeschreibung von Austausch (POLA-
NYI/RENSBERG/PEARSON 1957). Von dendrei als grundlegend herausgestellten Ty-pen – auf der Grundlage von Wechselseitig-keit (zweiseitiger Austausch – SAHLINS
1972, 140f.; MAUSS 2001), Redistributionund Markttätigkeit – kommen hinsichtlichder Gesellschaft der TKK, wie auch derMehrheit der bronzezeitlichen Kulturen inOstmitteleuropa, die beiden ersten in Be-tracht. Dem ausgeglichenen, symmetri-schen Austausch, der wohl in der Gesell-schaft des hier betrachteten Kulturkreisesdominierte, widmete Marshall Sahlins be-sondere Aufmerksamkeit. Er stellte mehre-re Varianten dieses Austausch heraus, diefür verwandte „Stammesgemeinschaften“
charakteristisch sind, und diskutierte auchdas Problem der Redistribution, die eineZentralmacht voraussetzt, wie sie Häup-tlingssystemen (chiefdoms) eigen ist (SAH-
LINS 1972, 185–275; 1992, 193–195). Sol-che eine Austauschform könnte im Südteildes Gebietes des TKK von Bedeutung ge-wesen sein, in dem reich ausgestattete Hü-gelgräber auftreten (MAKAROWICZ 2010a,270–276). Traditionelle Gemeinschaftentauschten nicht nur wertvolle Gegenständeund Waren, sondern auch Menschen, be-sonders Frauen, die den hauptsächlichengesellschaftlichen Wert darstellten undObjekt von Heiratstransaktionen exogamefunktionierender Gruppen waren, wieClaude Lévi-Strauss vermerkte (LÉVI-STRAUSS 1949; 1992; SZYNKIEWICZ 1987,370; MAKAROWICZ 1998, 269; 2003). In Sto-ne Age Economics merkte Marshall P. Sahlins(1972) die grundsätzliche Andersartigkeitdes Austauschs bei traditionellen, vorindu-striellen (ursprünglichen) Gemeinschaftenund in der Industriegesellschaft an. EinUnterschied war grundlegend: In den tradi-tionellen Gemeinschaften war der Aus-tausch mehr mit der Distribution als mitden Produktionsmitteln verknüpft. Erkennzeichnete soziale Strukturen, in denendie Güterredistribution überwog, die land-wirtschaftliche Produktion die Schlüssel-rolle spielte, die Arbeitsteilung mit Ge-schlechts- und Alterstruktur verknüpft warund die Produktion hauptsächlich auf dieBedürfnisse der Familie – auf die Hauswirt-schaft – ausgerichtet war. Solche Gruppenhatten in der Regel kein Problem mit demunmittelbaren Zugang zu den grundlegen-den Vorräten; der Erwerb vererbbarerRechte und Titel war eingeschränkt undein eventuelles Kontrollrecht mit demRecht auf die Produktionsmittel verbun-den. Mehrheitliche spielten in solchen Ge-sellschaften die verwandtschaftlichenStrukturen die dominierende Rolle (SAH-
LINS 1972, 196f.; 1992, 133f.). Den TKKkennzeichneten wohl die meisten der ange-führten Merkmale.
A. Austausch auf regionaler und überregionaler Ebene im Trzciniec-Kreis –Belege im Fundstoff
Einer der archäologischen Anzeiger vonAustauschwegen ist die Verteilung von
Prestigegütern (Luxus- und statusanzei-genden Gegenständen) aus exotischen
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 179
Materialien. Ihr von den Herstellungszen-tren weit entferntes Auftreten muss mit ir-gendeiner Form organisierter, vereinzelteroder zufälliger Distribution verbunden ge-wesen sein, des Austauschs oder Handels(ohne auf die semantische Verschiedenheitbeider Begriffe weiter eingehen zu wollen)über Kurz- oder Langstrecken mit Zwi-schenstationen. Die Kartierung bestimm-ter Erzeugnisse erlaubt die potientiellenRouten zu bestimmen, auf denen sichMenschen und Gegenstände bewegtenoder über die kulturelle Muster, Wissen-stransfer und Technologien vermittelt wur-den.
Zu Prestigegütern, gelegentlich sogarmit Insigniencharakter, die in Grab- oderSiedlungszusammenhängen im Gebiet desTKK registriert wurden, zählen Objekteaus Bernstein, Glas (Perlen – Halskettenbe-standteile), Bronze (Dolche, Lanzenspit-zen, Diademe, Äxte, Beile, Körper-schmuck), Gold (Schmuck), Silex (Äxteund Sicheln) und Stein (Keulen, Äxte undBeile), Ton (eckige Wirtel) und Ge-weih/Knochen (Trensenknebel) (MAKARO-
WICZ 2009, 2010a, 335f.). Manche dieserArtefakte treten im Trzciniec-Gebiet rechtzahlreich auf, weshalb anhand ihrer Ver-breitung eventuelle Routen ihrer Vermitt-lung abgesteckt werden können, anderesind nur vereinzelt bezeugt, weshalb beider Interpretation ihrer Anwesenheit aufkartographische Unterstützung verzichtetwerden muss.
Aus den Karten mit Darstellungen vonVerteilungen jener Prestigegegenstände,die aus exotischen, im Gebiet des TKKnicht allgemein oder gar nicht zugängli-chen Materialien gefertigt sind, aber auchder gewöhnlichen Gebrauchsgegenstände,wie einiger Keramikformen, ergibt sich dasBild ausgedehnter, in Nord-Süd- und inOst-West-Richtung verlaufender Kommu-nikationsverbindungen der Trzciniec-Ge-sellschaft (MAKAROWICZ 2009).
Die Verteilung von Prestigegegenstän-den kann man hauptsächlich als Resultateines handelsähnlichen, weitreichenden,direkten oder über über Etappen verlaufen-den Austauschs ansehen, aber auch als Er-gebnis lokaler Herstellung nach fremdenVorbildern (RENFREW 1972; SAHLINS 1972;RENFREW/BAHN 2001, 352; HARDING 2000,185f.). Hingegen dürfte die Verteilung vonstilistisch fremdartigen Gebrauchsgegen-
ständen, besonders leicht abnutzbarer, imGebiet des TKK eher mit nachbarschaftli-chem (regionalem) Austausch und derNachahmung fremder Vorbilder als mit derAusbreitung von Ideen, Wissen, Vorbildernoder Menschen über größere Entfernungenzu verbinden sein.
Man darf annehmen, dass LuxusgüterGegenstand institutionalisierten, von Eli-ten getragenen, nicht-kommerziellen Aus-tauschs waren, aber auch Resultat der An-näherung verschiedener Eliten (u.a. durchEheallianzen als spezielle Form von wech-selseitigem Austausch) aus mitunter weitvon einander entfernt gelegenen Gebieten(JOCKENHÖVEL 1991; KRISTIANSEN/LARSSON
2005). Sie gelangten – in Anlehnung anden Vorschlag von Sławomir Kadrow – so-zusagen „im Springerzug“ in die Gebiete,in denen (ideologische, politische oderwirtschaftliche) Bedürfnisse nach ihnenund entsprechende Bedingungen für ihrenEmpfang bestanden (KADROW 2001, 224f.).Die Verteilung dieser Artefakte muss dem-nach nicht linear und systematisch jedenAbschnitt ihrer „Wanderung“ wiederge-ben. Man kann weiterhin voraussetzen,dass einige Prestigegegenstände auch un-abhängig vom breit verstandenen Aus-tausch in das Gebiet des TKK gelangten,etwa als Kriegstrophäe bei bewaffnetenKonflikten (hinsichtlich der AunjetitzerKultur vgl. z.B. RASSMANN/SCHOKNECHT
1997). Diese interessante Annahme lässtsich jedoch kaum untermauern, denn dieBesiedlungsspuren (das Fehlen von Wehr-anlagen), die gesellschaftliche Struktur derTräger des TKK sowie der prinzipiellnicht-mitltärische Charakter ihrer mate-riellen Kultur stützen sie nicht. Ähnlichverhält es sich mit weiteren Interpreta-tionsmöglichkeiten, die zwar Einzelfällebetreffen, aber nicht für die systematischeErklärung von Mechanismen des Auftre-tens fremder Muster und Artefakte heran-gezogen werden können. In diesem Kon-text offenbart sich der Austausch als derHauptfaktor dafür.
Neben Prestigegegenständen treten inInventaren des TKK auch stilistisch fremdeObjekte auf, die aus allgemein zugängli-chen, sich leicht abnutzenden oder zu be-schädigenden Materialien bestanden (z.B.Tongefäße), die man – im Gegensatz zu denprestigeträchtigen Bechern der Schnurke-ramik oder der Glockenbecherkultur –
180 P. Makarowicz
kaum als Luxusgüter oder Statusanzeigerbezeichnen kann. Die Verteilung von demTKK fremden Tongefäßtypen, Ziermusternoder auch anderen, allgemein benutztenGegenständen erinnert an die Ausbreitungeiner Welle, wenn auch nicht immer ingleichmäßiger und gleichzeitiger Form(KADROW 2001, 224). Abgesehen von ehereinmaligen Übermittlungen über großeEntfernungen ist die Verteilung derartiger
Artefakte Resultat von nachbarschaftli-chen Kontakten – von Siedlung zu Siedlung(Austauschkette) auf der familiären Ebene,ist Ergebnis von Nachahmungen, der Wis-sensvermittlung und angenommener tech-nologischer Fertigkeiten in anzunehmen-dem Zusammenhang mit Exogamie oderüberhaupt der Wahl des Ehepartners (MA-
KAROWICZ 2010a).
Erzeugnisse aus Bernstein und Glas
Die Verbreitungskarte von Bernsteinarte-fakten – ausschließlich Perlen als Bestand-teile von Halsketten und hauptsächlich aussepulkralem Kontext, seltener aus Siedlun-gen oder Horten – im Gebiet des TKK zeigtihre Konzentration im Westteil des klein-polnischen Hochlandes (Abb. 2). Sonst lie-gen Funde vereinzelt und aus verschiedenenRegionen vor. Die geographische Verteilungder Artefakte suggeriert ihre Distributionentlang der großen Flüsse (Weichsel, Wart-he, Bug, Styr, Dniepr, Boh) oder in ihrerNähe (an Wasserscheiden) von Nord nachSüd sowie Südost und zeigt die Konzentrati-on in den wichtigsten Besiedlungsgebieten.
Die kleinpolnische Konzentration kannmit der benachbarten Otomani/Füzesabo-ny-Kultur verbunden werden. In den befes-tigten Siedlungen und auf den Gräberfel-dern dieser Kultur in der Ostslowakei, inRumänien, in Ungarn und vereinzelt amNordhang der Karpaten treten Bernsteinar-tefakte auf, wobei es sich meist um Hals-schmuckelemente handelt (GAŠAJ 2002,Photo 38; OLEXA 2002, Photo 61; SPRINCZ
2003). Diese Funde und auch nachweisli-che Anregungen aus den Kulturgebietennördlich der Karpaten (z.B. CABALSKA 1980;MARKOVÁ 1993; MAKAROWICZ 1999; DĄB-
ROWSKI 1994; 2003; GANCARSKI 2002b,
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 181
Abb. 2. Verbreitung derBernsteinperlen im Trzci-niec-Kulturkreis (Stern) imKontext von Funden andererKulturgruppen (ohneAunjetitzer Kultur). Quadrat– Fundplatz der Otomani/Füzesabony-Kultur, Trapez –Fundplatz derMad’arovce-Kultur; Kreis –Fundplatz der Hügelgräber-kultur, Fünfeck – Fundplatzder Suciu de Sus-Kultur;Dreieck – Fundplatz derPiliny-Kultur; auf der Spitzestehendes Dreieck –Fundplatz der Belozerka-Ku-ltur; Sonne – Fundplatz vonHordeevka. Nach MAKARO-WICZ 2009; 2010a. 1 –Teofilki, Fpl. 1; 2 – ŻernikiGórne, Fpl. 1, Grab 3, 10,12, 54, 69, 71, 72, 73, 86,99; 3 – IwanowiceWłościańskie, Fpl. 1 (“GóraKlin”), Grab 26/64; 4 –Komarów, Hügel-grab 33; 5 – Gródek nadBugiem; 6 – Jakuszowice,Fpl. 2; 7 – Biechowy; 8 –Wieliszew; 9 – Mala Osnica(Obołon); 10 – SwolszowiceMałe – Borki; 11 – Gru-dziądz-Mniszek, Fpl. 3; 12 –Putkowice Nadolne; 13 –Żydów (Wola Żydowska); 14– Bocheniec, Fpl. 2, Grab126; 15 – Błogocice
2006; GÓRSKI 2003, 2004, 2007; BÁTORA
2006, vgl. auch verallgemeinerndere Auffa-sung – KADROW 2001) machen die Annah-me eines weitreichenden Austauscheszwischen TKK und Otomani/Füzesabo-ny-Kultur (über die Vatja-Kultur?) glaub-würdig. Eines der Äquivalente in diesemAustausch war baltischer Bernstein – Suk-zinit (DĄBROWSKI 2004, 127; GÓRSKI/MA-
KAROWICZ 2007a) und dank dessen kam erauch in die mykenischen Schachtgräber(HARDING 1984, 2000; CHOIŃSKA-BOCHDAN
2003, 53). Der frühmykenische, nach Spät-helladisch I–II bzw. in die Zeitperiode1600–1400 BC (CZEBRESZUK 2007) nachder sog. kurzen Chronologie datierendeStil ist besonders bedeutsam (HAR-
DING/HUGES-BROCK 1974, 152; HARDING
2000, 70). Im Rahmen dieser Chronologiekann auch die Bevölkerung der Hügelgrä-berkultur als Vermittler bei der Güterver-teilung berücksichtigt werden (MARKOVÁ
1993, 173, 175; BUKOWSKI 2001, Karte II,63–72). Es scheint jedoch, dass in der be-sprochenen Zeit besonders die über die Be-skidenpässe (GANCARSKI 2002a, Abb. 2;MAKAROWICZ 1999, Fig. 1; 2009; GÓR-
SKI/ MAKAROWICZ 2007a), dann entlangdes östlichen, in Theiss-Nähe liegendenTeils der Karpaten (BUKOWSKI 2001, 130)und weiter über die Balkanhalbinsel bisnach Griechenland verlaufende Route eineRolle spielte. Die Zentren im Gebiet derHügelgräberkultur erlangten gewiss inspätmykenischer Zeit (1400–1200 BC –CZEBRESZUK 2007) eine Schlüsselbedeu-tung. Selbst wenn man die lange Chronolo-gie anwendet (DIETZ 1991, 316; MANNING
1995; KADROW 2001, 48), sind kaum ande-re Kulturmilieus als die Otomani/Füzesa-bony-Kultur und der TKK als nördlichePartner der mykenischen Kultur zu finden.
Es sei an dieser Stelle die Anwesenheitvon Perlen vom Typ Tiryns und Allumiere(spätmykenisch – HARDING 1984, 85f.;2000, 190 u. Fig. 5.12) auf dem elitären –dem hier diskutierten Kulturkreis aller-dings schon nicht mehr zugehörigen – Hü-gelgräberfeld von Hordeevka (BEREZANSKA-
JA/ KLOCKO 1998) angemerkt, derMerkmale der Belogrudovka-Kultur, derBelozerka-Kultur und der Hügelgrä-
ber-Kultur vereint und gegenwärtig in dieZeit zwischen 1400 und 1000 BC datiertwird (ŚLUSARSKA 2003, 2009).
Das Auftreten von Bernstein in Wolhy-nien könnte mit der archäometrisch gut do-kumentierten Anwesenheit von Gruppender Otomani/Füzesabony-Kultur in dieserGegend zusammenhängen (BALAGURI 1985,420–428, 1990, 92–95; KRUŠELNIĆKA 1985,18f.). Es ist auch eine andere Erklärungs-möglichkeit für die fremde Gegenstände ausBernstein in Inventaren des TKK zu erwä-gen: die potentielle Ausbeutung von in derWestukraine befindlichen Lagerstätten bal-tischen Bernsteins (Sukzinit) (CZEBRESZUK
2009, Fig. 2; MAKAROWICZ 2009, Fig. 23).Schon im Tertiär wurden über die aus demNordwesten kommenden Ströme harzrei-che Baumstämme in die Region umgelagert,auch quartiäre Bernsteinlager sind bekannt1
(KATINAS 1971; LOZE 1993, Fig. 1; TUTS-
KIJ/STEPANJUK 1999; TUCKI 2005). Noch zuBeginn des 20. Jhs. wurden in Polesienknapp unterhalb der Oberfläche liegendeBernsteinbrocken von bis zu 2–3 kg Ge-wicht gefunden (CYNKAŁOWSKI 1961, 9).Aufgrund des schlechten Forschungsstan-des zu dieser Thematik und der Region so-wie wegen des Fehlens chemischer Analy-sen lassen sich über diese allgemeinenhinaus keine konkreteren Aussagen treffen.
Glasperlen, die Elemente von statusan-zeigenden Kolliers waren und zu denenauch Schmuckstücke aus anderen Rohstof-fen gehörten, treten im Gebiet des TKK sel-tener auf als Bernsteinartefakte (Abb. 3).Grundsätzlich kommen sie in Gräbern zuTage, nur äußerst selten in Horten oder aufSiedlungen. Wie im Falle von Bernstein isteine Konzentration von Glasperlen imkleinpolnischen Hochland zu verzeichnen,aus sonstigen Regionen liegen Funden nurvereinzelt vor. Offenbar gelangten Glasper-len über die Otomani/Füzesabony-Kulturin das Trzciniec-Milieu, doch sind auchEinflüsse aus dem Hügelgräberkultur (z.B.Horte von Błogocice und Wola Żydowska –BLAJER 1999, 118) nicht auszuschließen,wo derartige Artefakte relativ häufig sind(GEDL 1984, 48, Abb. 21; FLOREK/TARAS
2003, 45–47 u. Abb. 19). Es liegen bishernoch keine chemischen Analysen vor, wes-
182 P. Makarowicz
1Vgl. auch den Ortsnamen „Bursztyn” (Bernstein)an Svir und Gnila Lipa – zwei rechtenNebenflüssen des Dniestr.
halb es nicht möglich ist festzustellen, obeinige Perlen aus der in der Bronzezeit be-liebten Fayence gefertigt sind (ROBIN-
SON/BACZYŃSKA/POLAŃSKA 2004; BÁTORA
2006, 193–203 u., Fig. 135).
Erzeugnisse aus Bronze und aus Gold
Chemische Zusammensetzung und Stilvon im Gebiet des TKK gefundenen Metall-gegenständen bezeugen die intensiven undin verschiedene Richtungen weisendenKontakte der ansässigen Bevölkerung. DieLegierung von Bronzeartefakten aus Grab-und Hortfunden, seltener von Siedlungen,deuten auf Kupferlagerstätten des Karpa-tenbeckens, vor allem Transsilvaniens, hin(BEREZANSKAJA 1972, 64; CERNYCH 1965,102; 1976; DĄBROWSKI/HENSEL 2005, 12).Zu den die Metallurgie des TKK inspirie-renden sowie Bronzegegenstände und ihreMuster liefernden Kulturen gehörten Aun-jetitzer und Iwno-Kultur, Otomani/Füze-sabony-Kultur, Mad’arovce-Kultur, Noua-Kultur, Sabatinivka-Kultur, die Hügelgrä-berkultur, aber auch die Srubrna- und dieLausitzer Kultur (MAKAROWICZ 2010a).Einflüsse äußerten sich nicht nur in derÜberreichung fertiger Gegenstände undvon Rohstoff im Rahmen eines Austauschs
über weite Srecken, sondern auch imTransfer von Technologien und stilisti-schen Anregungen. Die drei am inten-sivsten auf die Metallverarbeitung im Ge-biet des TKK einwirkenden Einheitenwaren Otomani/Füzesabony-Kultur, dieHügelgräberkultur und der KomplexNoua-Sabatinovka. Füzesabony-Traditio-nen sind in fast allen Regionen des TKK zubeobachten, wobei diese nach Nordostenzu, in Richtung Dniepr, Desna und Sejm,immer schwächer werden. Einflüsse derHügelgräberkultur sind vor allem in derwestlichen Provinz des TKK spürbar, Inpi-rationen des Noua-Sabatinovka-Komple-xes (hauptsächlich der Noua-Kultur) amdeutlichsten in den höher gelegenen Re-gionen der Ukraine und Moldaviens.
Die wenigen Goldgegenstände – Finger-ringe, Ohrringe und Anhänger als Bestand-teile von Halsketten – treten in verschiede-nen Regionen des TKK-Gebietes auf, die
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 183
Abb. 3. Verbreitung derGlasperlen im Trzciniec-Kul-turkreis. Nach MAKAROWICZ2009; 2010a. 1 – Komarów,Hügelgrab 33; 2 – Dacha-rzów, Fpl., Grab 2; 3 –Żydów; 4 – Błogocice, Fpl.1; 5 – Żerniki Górne, Fpl. 1,Grab 3 u. 99; 6 – Bocheniec,Fpl. 2, Grab 126; 7 – Kobylin
aber mehrheitlich im Hochland liegen. Siestammen aus Hügelgräbern, nur einmal istein aus einem Hort stammendes Artefaktbelegt (Abb. 4). Die Goldfunde aus demOstteil des TKK, hauptsächlich Finger- undOhrringe, stammen aus Hügelgräberfel-dern, die in der Nähe großer Flüsse –Dniestr, Boh, Sluc, Horyn – und innerhalbgrößerer Besiedlungskonzentrationen lie-gen. Der Stil dieser Erzeugnisse verweistauf Verbindungen zur Otomani/Füzesabo-ny-Kultur. Transsilvanien zeichneten größeGoldvorkommen aus, die auch währendder Bronzezeit ausgebeutet wurden (GIM-
BUTAS 1965; HARDING 2000, 229).Ohrringe aus Gold und Bronze sind
charakteristische Erzeugnisse der Otoma-ni/Füzesabony-Kultur und treten häufig inbefestigten Siedlungen und auf Gräberfel-dern in der Slowakei (z.B. Košice-Barca I,Spišski Štvrtok, Nižnia Myšla – GAŠAJ 2002;OLEXA 2002), in Ungarn (z.B. Jászdósa-Ká-polnahalom – STANCZIK/TÁRNOKI 1992)und in Rumänien auf (Otomani – ORDENT-
LICH 1969). Eher mit der Metallindustriedes Karpatenbeckens und weniger mit derAunjetitzer Kultur sind goldene Noppen-ringe aus Netišyn, Grabhügel VIII, Grab 1und Grab 2, Ivanje, Grabhügel II, Grab 2,
Komarov, Grabhügel 6, sowie in Komarovgefundene Ohrringe und mehrwindigeRinge als Elemente eines Kolliers ausGrabhügel 8 sowie die Ohrringe aus Grab-hügel 28 (KOZŁOWSKI 1939, Abb. XIII: 1–4;SVEŠNIKOV 1968; SULIMIRSKI 1968, Fig. 26:1–6, 8; BEREZANSKAJA/ GOŠKO/ SAMOLIUK
2004; MAKAROWICZ 2008; 2010) zu verbin-den.
Zu den frühesten Artefakten aus deröstlichen Provinz des TKK, die im transkar-patischen Stil gefertigt wurden, gehörendie Äxte aus Ivanje, Grabhügel I (Abb. 5.1)sowie von einem unbekannten Fundort imHochland Wolhyniens (Abb. 5.2) und dieSchaftröhrenaxt vom gleichfalls in dieserRegion gelegenen Zabolotiv (Abb. 5.3).Der erstgenannte Fund hat keine genauenParallelen (am ähnlichsten ist eine Axt vonDražna de Džos – ANDRIEªESCU 1925, PL.IV: 4, 5; KRUŠELNIĆKA 1985, 15) und ist viel-leicht eine Variante der Axthämmer vomTyp B des Horizontes Hajdúsámson nachAmalia Mozsolics (KLOCKO 2006, 133). Derzweite Fund ist eine Kopie der Axt aus demHort von Larga in Rumänien (PETRES-
CU-DIMBOVITA 1977, Taf. 19: 6; KLOCKO
2006, 133). Der im oberen Bereich beschä-digten Schaftröhrenaxt von Zabolotov äh-
184 P. Makarowicz
Abb. 4. Verbreitung vonGoldgegenständen im
Trzciniec-Kulturkreis. NachMAKAROWICZ 2009; 2010.1 – Łubna 1, Hügelgrab 9;
2 – Netišyn, Hügelgrab VIII;3 – Ivanje, Hügelgrab II,Grab 2,; 4 – Kolosivka,
Hügelgrab 9; 5 – Komarów,Hügelgrab 6, 8 u. 28; 6 –
Mękarzowice (Hort)
nelnde Äxte gehören in die HorizonteHajdúsámson und Kosziderpadlás in Un-garn (MOZSOLICS 1967). Volfgang Davidrechnet das besprochene Stück zur Varian-te Szeghalom (DAVID 2002, Taf. 81 i 82).
Parallelen in Horten und Gräbern vielerKulturen (etwa in der Otomani/Füzesabo-ny-Kultur und der Vatja-Kultur) des Karpa-tenbeckens, besonders in der mittlerenund späten Bronzezeit nach ungarischerTerminologie (MOZSOLICS 1973; BÓNA
1975), haben Nadeln mit konischem Kopf,die u.a. aus Grabhügeln von Ivanje, Narodi-ci (BEREZANSKAJA 1972, Taf. XXII: 13, 14)und Łubna (GARDAWSKI 1951, Taf. 5i) vor-liegen. Ein vergleichbares Exemplarstammt aus dem Hort von Kolodnoje in derUkraine (KAISER 1997, Abb. 23). SolcheNadeln, gelegentlich mit Durchlochungunterhalb des Kopfes, sind von Füzesabony(HÄNSEL 1968, Taf. 9: 24), Megyaszó undVörösmart (MOZSOLICS 1967, Taf. 7: 1; Taf.29: 5 – mit verziertem Kopf), Lovasberé-ny-Mihályvár (BÓNA 1975, Abb. 12: 6, 7, 9,10) und Százhalombatta bezeugt (BÓNA
1975, Abb. 14: 3).Ein charakteristisches Merkmal für die
bronzezeitlichen Kulturen des Karpatenbe-ckens und ihrer Nachbarn (Otomani/Fü-zesabony-Kultur, Gulavarsand-Kultur undfrühe Hügelgräberkultur) war die Tordie-
rung von Nadelschäften (vgl. z.B. DAVID
2002, Taf. 261: 1; 262 307: 1, 2, 21; 308: 1,2, 7, 8; 309: 1, 2, 12), was besonders beiStücken mit Nagelkopf bzw. der Hirtenst-abnadel mit einem mit Spirale abschließen-dem Kopf der Fall ist. Diese stammenhauptsächlich aus Hügelgräbern der Gebie-te am oberen Dniestr und des HochlandesWolhyniens, u.a. aus Beremiany, Ustensko-je, Putiatynce, Komarov, Hügel 6 und 8,Bukivna, Hügel III, Ditinici, Hügel 2(SWIESZNIKOW 1967, tabl. I: 1; V; 1; VI: 13;VII: 1; VIII: 1), und von Malopoloveckoje,Fpl. 3, Grab 1/93 und 72 im Gebiet ammittleren Dniepr.
Die Horte von Jaworze Dolne im Karpa-tenvorland, Stawiszyce im Nida-Beckenund Mniszewo in der Radom-Ebene, diealle zur westlichen Provinz des TKK gehö-ren, können mit dem Milieu der spätenOtomani/Füzesabony-Kultur (HorizontKoszider) verbunden werden (DĄBROWSKI
1977; BLAJER 1998; DĄBROWSKI/HENSEL
2005). Transkarpatische Einflüsse zeigenNadeln aus Gräbern im kleinpolnischenHochland, z.B. eine sichelförmig gebogenezyprische Schleifennadel sowie Nadeln mitSpiralscheibenkopf aus Grab 99 von Żerni-ki Górne, Fpl. 1 (KEMPISTY 1978, 403;GÓRSKI 2007, 85). Formal stehen ihnen Na-deln aus Grabhügeln in der östlichen Pro-
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 185
Abb. 5. Prestigegegenständeim Trzciniec-Kulturkreis ausdem Wolhyner Bergland. -1 – Ivanje, Grabhügel I;2 – unbekannter Fundort inWestwolhynien; 3 – Zabolo-tov, unbekannter Kontext.Nach MAKAROWICZ 2009;2010a
vinz des TKK von Vojcechivka und Ditiniciin Wolhynien (LAGODOVŚKA 1948; BERE-
ZANSKAJA 1972; LYSENKO 2005, 351) undeine zyprischen Schleifenkopfnadel vonPutiatynce nahe (SULIMIRSKI 1968, Fig. 19:15; LYSENKO 2005, 352). Auf dem Gräber-feld von Łubna, Fpl. 1, und im Hort von Ja-worze Dolne (GARDAWSKI 1951, Taf. V:E;BLAJER 1990, Taf. XLI) traten Schilde mitengen Parallelen in Alsónémedi und Ráko-spalota in Ungarn auf (MOZSOLICS 1967,Taf. 59: 14–18; DAVID 2002, Taf. 186: 7–17).Zum Bronzehort des letztgenannten Fund-platzes gehören auch trichterförmige An-hänger, die für Horte des Koszider-Hori-zontes typisch sind und im Hort vonJaworze Dolne sowie im Grab von Grabhü-gel 8 von Komarov als Elemente einer Hals-kette vertreten sind (SULIMIRSKI 1968, Fig.26: 5, 6). Mit diesem Hortfundhorizontoder auch mit der Dolný Peter-Phase sindwohl den Typen Dunaújváros und Regels-brunn nahestehende Nadeln aus einemKollektivgrab von Dacharzów, Fpl. 1, in derSandomierz Hochebene verbunden (FLO-
REK/TARAS 2003, 42).Stilistische Anregungen aus dem Kar-
patenbecken (und seiner Nachbargebiete)sind generell bei vielen anderen Artefakten
aus dem TKK-Gebiet zu erkennen: vielwin-digen Handgelenkringen und Armbergen,mit Spirale abschließenden Armringen,Oberarmringen und Halsringen sowie beiDiademen. Sie treten überall im Karpaten-becken in Gräbern, Horten und Siedlungenauf. Als wichtigste archäologische Einhei-ten, von denen die erwähnten Funde ausdem Gebiet des TKK herzuleiten bzw. inderen Gebieten ihre Vorbilder zu suchensind, müssen Otomani/Füzesabony-Kul-tur, Hügelgräberkultur (einschließlich desKoszider-Horizontes), Mad’arovce-Kulturund wohl auch Piliny- und Vatja-Kultur gel-ten (vgl. z.B. MOZSOLICS 1967, 1973, HÄN-
SEL 1968; DAVID 2002).Mehrwindiger Armschmuck (Handge-
lenk- und Oberarmringe) des TKK tritt inHorten (vor allem in der Westprovinz) so-wie in Gräbern (im Prinzip in der Ostpro-vinz) auf. Im Osten stammt er mehrheit-lich aus Hügelgräbern oder aus reichenGräbern ohne Überhügelungen (am mittle-ren Dniepr). Kleine Konzentrationen ent-sprechender Funde aus sepulkralem Kon-text sind am oberen Horyn sowie ammittleren Dniepr, zwischen Teterev undRos, zu beobachten (Abb. 6). Allgemeinkommen diese Funde in größeren Besied-
186 P. Makarowicz
Abb. 6. Verbreitung vonvielwindigem Bronzesch-
muck (Armringe undArmbergen) im Trzciniec-Kul-turkreis. Nach MAKAROWICZ
2009; 2010a. 1 – Ivanje,Hügelgrab II, Grab 2; 2 –
Tripillja; 3 – Dorogošca,Hügelgrab 1, Grab 1 u. 3; 4– Małopołoveckoje, Fpl. 3,
Grab 1 u. 63; 5 –Peresopnica; 6 – Grišcency;
7 – Skurc; 8 – Bar; 9 –Kustovcy; 10 – Netišyn,
Hügelgrab VIII; 11 –Kolosivka (Vojcechivka); 12 –Cebotarka; 13 – Chodosivka,
Haus 1; 14 – Kozarovici,Grab 43; 15 – Kamienka
Bugska; 16 – Radojewice,Fpl. 29; 17 – Borówek, Fpl.
3; 18 – Dratów; 19 – Kraski;20 – Mniszew; 21 – Rawa
Mazowiecka
lungszentren des TKK vor, die innerhalb ei-nes breiten, sich von Nordwesten nachSüdosten erstreckenden Streifens liegen,wobei die Fundpunkte die hoch gelegenenRegionen und ihr nördliches Vorland mar-kieren, während sie im Tiefland nördlichvon mittlerer Weichsel bis zum Pripjet aus-bleiben.
Nadeln im Stil der Otomani/Füzesabo-ny-Kultur mit Nagel- oder Schneckenkopf,gelegentlich tordiert, erscheinen haupt-sächlich in Gräbern. Zwischen Ostsee undPontus sind sie nicht sehr zahlreich undliegen aus einigen Besiedlungszentren desTKK im großpolnisch-kujawischen Tief-land, im kleinpolnischen Hochland, imDniestr-Gebiet sowie in den höher gelege-nen Regionen Wolhyniens vor. Einzelstü-cke sind vom mittleren Dniepr und der un-teren Weichsel bekannt (Abb. 7).
Hand-, Fuß- und Halsschmuck mitscheibenförmigen Abschlüssen stammenaus ähnlichem Kontext wie die mehrwindi-gen Ringe. In der Westprovinz des TKK tre-ten sie im Grunde (wenn auch nicht aus-schließlich) in Horten auf, in derOstprovinz meist in Gräbern, besonders inHügelgräbern. Die größte Kontentrationdieser Funde liegt zwischen oberer und
mittlerer Weichsel und Prosna, kleinere imBergland am Dniepr, am oberen Sluè sowieim Gebiet zwischen Dniestr und Prut (Abb.8). Vereinzelte Funde liefern Wolhynienund Žytomir-Polhesien und das mittlereDniepr-Gebiet. Weniger zahlreich sind Fi-beln mit Spiralscheibe am Abschluss, die inder Hauptsache aus der Ostprovinz desTKK vorliegen.
Diademe aus Bronze waren Prestige-genstände und eventuell auch Statusanzei-ger, die meist aus Gräbern (besonders ausHügelgräbern) vorliegen, vereinzelt auchaus Horten. Sie treten in geringer Zahl aufund sind in verschiedenen Besiedlungszen-tren präsent (Abb. 9). Stilistisch sind siemit Otomani/Füzesabony-Kultur und derHügelgräberkultur zu verbinden (GEDL
1975, 43–46; DAVID 2002).Aus der Westprovinz des TKK liegen
Artefakte vor, die als Nachahmungen vonErzeugnissen der Hügelgräberkultur gel-ten. Starke Einflüsse von dieser Seite sindbei Bronzegegenständen des TKK zwi-schen Prosna und Weichsel zu bemerkenund auch weiter im Osten noch erkennbar.Derartige Funde treten sowohl in Hortenals auch in Gräbern auf. Die meisten Im-pulse seitens der Hügelgräberkultur kamen
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 187
Abb. 7. Verbreitung vonBronzenadeln mit Nagelkopf(Sonne) und schnecken-förmigem Kopf (Stern) imTrzciniec-Kulturkreis. NachMAKAROWICZ 2009; 2010a.Sonne: 1 – Putiatynce,Hügelgrab; 2 – Netišyn,Hügelgrab 8, Grab 2; 3 – Ko-marów, Hügelgrab 8; 4 – Bu-kivna, Hügelgrab 3; 5 – Ka-niv; 6 – Ustenskoje; 7 – Ma-lopoloveckoje, Fpl. 3, Grab1, 8 – Beremiany, Hügelgrab;9 – Dacharzów, Fpl. 1, Grab1a; 10 – Łubna, Fpl. 1, Hü-gelgrab 13. Stern: 1 – Ditini-ci, Hügelgrab 2; 2 – Kolosiv-ka (Vojcechivka), Hügelgrab5, Grab 2 u. 3; 3 – Radoje-wice, Fpl. 29, Grab A110; 4– Borek, Fpl. 1, Grab 7; 5 –Łubna, Fpl. 1, Hügelgrab 20u. 25; 6 – Wojdal, Fpl. 1; 7 –Żerniki Górne,Fpl. 1, Grab98 u. 99; 8 – PruszczGdański, Fpl. 10
aus Schlesien und Großpolen, seltener ausPommern und dem Gebieten außerhalbdes Karpatenbogens (DĄBROWSKI 1977,208; BLAJER 1998). Mit dieser Kulturtraditi-on sind Oberarmringe mit Spiralscheibenaus dem Hort von Dratów (GARDAW-
SKI/WESOŁOWSKI 1956) sowie die mitWolfszahnmuster verzierten Oberarmrin-ge aus dem Hort von Piastów in Südostpo-len verknüpft (DĄBROWSKI 1977; BLAJER
1998, 338f.). Von einer besonders dasgroßpolnisch-kujawische Tiefland und dieangrenzenden Regionen Kleinpolens bzw.Masowiens auszeichnenden, lokalen Ferti-gung von Bronzeerzeugnissen im Stil derHügelgräberkultur zeugt die Spezifik eini-ger der dort gefundenen Artefakte (BLAJER
1998, 339, 342).Neben den schon genannten Funden
zeigen u.a. auch weitere Artefakte Verbin-dungen zur Hügelgräberkultur an, wie dieNadeln aus Grab 11/64 von Iwanowice,Fpl. Góra Klin. Die beiden Stücke verfügenüber einen durchlochten, gebogenenSchaft und scheibenförmigen bzw. halbku-geligen Kopf und entsprechen den Varian-ten Sudomeøice und Leobensdorf. SolcheNadeln treten in Inventaren der Hügelgrä-berkultur in Schlesien, im Karpatenbecken
und in Deutschland auf (GEDL 1975, 17f.;DAVID 2002, Taf. 323: 3; 327: 7; 333: 1). Indiesem Kulturmilieu müssen auch die Vor-lagen für die reich verzierten Nadeln ausden Gräbern von Wolica Nowa, Fpl. 1, undfür die Nadel und den Handgelenkring ausdem Kollektivgrab von Gustorzyn, Fpl. 1,in Kujawien (GRYGIEL 1987, Abb. 9: 1, 2, 13;BLAJER 1998, 338) gesucht werden. Zahl-reiche Erzeugnisse dieser Provenienz wur-den in Gräbern bei Borek, Fpl. 1, einemFundplatz im Gebiet zwischen Prosna undWeichsel, deponiert, die ansonsten nachTrzciniec-Regeln angelegt worden sind(ZIĄBKA 1987). Vorbilder aus dem Bereichder Hügelgräberkultur sind auch bei Bron-zeartefakten aus Horten erkennbar. AlsBeispiele mögen Handgelenkringe, Ober-armringe mit Spiralscheiben, Nadeln undeine Lanzenspitze aus Żyrardów in Maso-wien oder die Gegenstände aus dem Hortvon Niechmirowo an der mittleren Warthedienen (BLAJER 1998, 340). Einflüsse sei-tens der Hügelgräberkultur sind auch inder Lubliner Gegend zu bemerken (TARAS
2007, 260); im entsprechenden Stil sindschließlich auch Spiralarmbergen von Ko-sin in Kleinpolen gefertigt (CHOMENTOW-
SKA 1964).
188 P. Makarowicz
Abb. 8. Verbreitung vonArm-, Bein- und Halss-chmuck aus Bronze mitSpiralscheiben im Trzci-
niec-Kulturkreis. Nach MAKA-ROWICZ 2009; 2010a. 1 –Malopoloveckoje, Fpl. 3,
Grab 1, 63, 68 u. 72; 2 –Kolosivka (Vojcechivka),
Hügelgrab 9, Grab 2; 3 –Kanivski ujezd; 4 – Stavišca-
ny (Unijev); 5 – Ivanje,Hügelgrab II, Grab 1; 6 –Trojaniv; 7 – Ovruc; 8 –Kustovcy; 9 – Bukivna,
Hügelgrab 3; 10 – Cersk; 11– Vasiliev; 12 – Komarów,
Hügelgrab 8; 13 – Teklino,Hügelgrab 347; 14 – Bar,
Hügelgrab; 15 – Barłogi; 16– Błogocice; 17 – Borówek,
Fpl. 3; 18 – Kraski; 19 –Krzyż; 20 – Mękarzowice; 21– Mniszew; 22 – Piastów; 23
– Rawa Mazowiecka; 24 –Stawiszyce; 25 – Żydów; 26 –
Żyrardów; 27 – Kosin; 28 –Łubna, Fpl. 1; 29 – Borek,
Fpl. 1
Starke Beeinflussungen seitens derSteppen- und Waldsteppenkulturen(Noua-Kultur und Sabatinivka-Kultur, diemitunter auch zum Noua-Sabatinovka-(FLORESCU 1964; ŠARAFUTDINOVA 1986;SAVA 1998; KLOCKO 2006) oder Noua-Saba-tinovka-Coslogeni-Kulturkreis zusammen-gefasst werden (GERŠKOVIC 1998; 1999;WIETTENBERGER 2005, 2f.) bezeugt eineReihe von Metallerzeugnissen aus derUkraine und vom mittleren Dniepr. Inner-halb des genannten Milieus muss die Ge-nese der Metallartefakte aus dem Grabhü-gel II der erwähnten Nekropole von Ivanjegesucht werden (SVEŠNIKOV 1968). Derreich verzierte Dolch aus Grab 2 (Abb. 10)hat zwar keine engen Parallelen, jedochdürften seine stilistischen Vorlagen in denMetallverarbeitungszentren zu suchensein, welche Einflüssen seitens der Kultu-ren des Karpatenbeckens und indirekt auchdes östlichen Mittelmeergebietes ausge-setzt waren (MAKAROWICZ 2008).
Für den Noua-Sabatinovka-Komplexsind die vereinzelt auch in Wietenberg-,Monteoru- und Coslogeni-Kultur auftre-
tenden Nadeln mit rhombischen Kopf cha-rakteristisch, welche in den Gräbern desTKK von Komarów, Grabhügel 6, und Bu-kivna, Grabhügel 1/20102 a, oberenDniestr sowie von Gulaj Gorod und Malo-poloveckoje, Fpl. 3, im mittleren Dnieprge-biet gefunden wurden (SULIMIRSKI 1964; BE-
REZANSKAJA 1972; BIEREZAŃSKA 1972, 296;LYSENKO 2001). Mehrheitlich treten sie amOsthang des Karpatenbogens (Rumäni-sches Tiefland, Moldau) sowie in der südu-krainischen Steppe am Schwarzen Meerauf (Abb. 11 – ŠARAFUTDINOVA 1987, 73,Abb. 2). Verschiedene Varianten dieser Na-deln ercheinen in Inventaren der frühbron-zezeitlichen Kulturen Mittel- und Osteuro-pas (KAISER 1997; SAVA 2002, 181). Für dieNoua-Kultur ist die Warzennadel charakte-ristisch, welche im genannten Grabhügelvon Ivanje gefunden wurde. Derartige Na-deln bestehen aus Bronze oder Knochen(HOCHSTETTER 1981; KRUŠELNIĆKA 2006,144, Abb. 56), die meisten Parallelen stam-men aus dem Ungarischen Tiefland, ausTranssilvanien, Moldavien und Podolien(u.a. Ghindeºti, Rîºeºti, Cluj, Fst. „Strada
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 189
Abb. 9. Verbreitung derDiademe aus Bronze imTrzciniec-Kulturkreis. NachMAKAROWICZ 2009; 2010. 1– Iwanowice, Fpl. Góra Klin,Grab 26/64; 2 – Borek, Fpl.1, Grab 13; 3 – Netišyn,Hügelgrab VIII; 4 –Malopoloveckoje, Fpl. 3,Grab 104-2002; 5 – Dratów,Hort; 6 – Ditinici, Hügelgrab2; 7 – Bar, Hügelgrab; 8 –Żdanów, Fpl. 1
2Untersuchungen von Dr. Hab. PrzemysławMakarowicz vom Prähistorischen Institut derAdam Mickiewicz-Universität in Poznań und von
Dr. Sergiej Lysenko vom Archäologischen Institutder Staatlichen Akademie der Wissenschaften derUkraine in Kiew.
Banatului”, Grab 13, 18, Dealu Morii, Nyir-karász-Gyalaháza, Czechy, Magala i Ostri-vec – DERGACEV 1975; HOCHSTETER 1981;KAISER 1997; SAVA 2002: Taf. 137: 10; Taf.138: 5; Taf. 139: 10).).
Sehr konzentriert – in den am dichtes-ten besiedelten Gebieten der TKK-Ökume-ne – treten Bronzedolche auf, die sowohlaus Gräbern und Horten als auch aus Sied-lungen bekannt sind (Abb. 12). Funde lie-gen aus mehreren Gebieten an Weichsel
und Warthe, zwischen oberem Dniestr,Bug und Horyn, vom oberen Boh, demmittleren Dniepr und von der oberen Des-na vor. Die Mehrzahl der Bronzelanzenspit-zen hingegen stammt aus dem Gebiet ammittleren Dniepr, aus anderen Regionenliegen nur vereinzelte Funde vor (Abb. 13).Die Lanzenspitzen und Dolche aus derOstprovinz des TKK, besonders jene ausdem Gebiet am mittleren Dniepr, weisenhauptsächlich Verbindungen zur Leboikov-
190 P. Makarowicz
Abb. 10. Der Dolch aus demGrabhügel II (Grab 2) in
Ivanje, Westwolhynien. Fot.Igor Markus
Abb. 11. Verbreitung vonBronzenadeln mit
rhombischem Kopf (Stern:Fundplatz des Trzciniec-Kul-
turkreises). Nach KAISER1998; SAVA 2002; MAKARO-
WICZ 2009; 2010a.1 – Komarów, Hügelgrab 6;
2 – Gulaj Gorod, Hügelgrab;3 – Ulmu; 4 – 4. Medgidia;
5 – Bãleni; 6 – Małopolo-veckoje, Fpl. 3; 7 – Vyšeta-
rasovka; 8 – Trikaty; 9 –Gîrbovat; 10 – Simoneæti;
11 – Kolodnoje; 12 –Candeºti; 13 – Frãteºti; 14 –
Borodino; 15 – Sabaoani;16 – Sebeº; 17 – Bukivna,
Hügelgrab
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 191
Abb. 12. Verbreitung derDolche imTrzciniec-Kulturkreis. NachMAKAROWICZ 2009; 2010a.1 – Dumanci; 2 – Piljava; 3 –Polesie, Fpl. 1; 4 – Łubna,Hügelgrab 2; 5 – Ivanje,Hügelgrab II; 6 – Komarów,Hügelgrab 6; 7 – Rožubovici;8 – Sandraki; 9 – Kvetuń,Hügelgrab; 10 – Gołosok,Hügelgrab; 11 – Keleberda;12 – Iwanowice, Góra Klin,Grab 11/64; 13 – Chmilna14 – Ivankovici; 15 – Goło-vuriv; 16 – KamienkaBugska; 17 – Gorodok; 18 –Smila, Hügelgrab; 19 –Leski-Chudjaki; 20 – Zoloto-noša; 21 – Gładkivšcina; 22– Derevjane; 23 – Stepanci;24 – Mazepincy; 25 –Sobkivka; 26 – Wieliszew;27 – Kobylin; 28 – Prusi-nowice; 29 – Ślipcz; 30 –Jakuszowice, Fpl. 2
Abb. 13. Verbreitung derLanzenspitzen imTrzciniec-Kulturkreis. NachMAKAROWICZ 2009; 2010a.1 – Kozincy; 2 – Višenki;3 – Kvetuń; 4 – Sandraki;5 – Ivankovici; 6 – Golovu-riv; 7 – Chmilna; 8 – Neti-šyn; 9 – Lepljava; 10 –Grišceńci 11 – Kaleberda;12 – Šabelniki; 13 – Stajki;14 – Veremje; 15 – Pereja-słav Chmelnickij; 16 – Goło-govka; 17 – Lisovici; 18 – Se-lišce; 19 – Peńkyvka; 20 –Grebeni; 21 – Dumancy;22 – Prochorivka Ług; 23 –Żyrardów; 24 – Kraski; 25 –Tyszowce, Fpl. 25A; 26 –Berezino; 27 – Malij Bukrin;28 – Suchini; 29 – Judinovo;30 – Kovalicha
ka-, Krasnyj Majak- und Kardašino-Metall-industrie auf, also zu fremden Traditionen,die aber Einfluss auf die Fertigung vonBronzeerzeugnissen im TKK hatten. Eingroßer Teil der Dolche und (die Mehrzahl?)der Lanzenspitzen aus dem mittleren
Dnieprgebiet zeichnen Merkmale der mitder Sabatinovka-Kultur verknüpften Kras-nyj Majak-Tradition aus (MAKAROWICZ
2010a).
Gegenstände aus Stein
Prestigegegenstände aus Stein liegen indrei Arten vor: kannelierten Keulen, Beilenund Äxten. Die Verbreitung der kannelier-ten Keulen spielte eine Schlüsselrolle beider Diskussion zu Verlauf und Identifizie-rung der Verbindungswege zwischen Ost-see- und dem Nordschwarzmeergebiet(KOŚKO 2001, 2002; MAKAROWICZ 2009).Das Auftreten der kannelierten (melonen-förmigen) Keulen verbindet AleksanderKośko (KOŚKO 2001, 288, 2002, 70) mit derVermittlung von Vorbildern aus dem ponti-schen Raum. Dorthin wiederum gelangtedie Idee der Streitkeulen als Prestigegegen-stände und Machtinsignien der präsentier-ten Meinung nach über Austausch undHandel aus dem Entstehungsgebiet im Na-hen Osten. Wegen des bedeutenden Fund-aufkommens in Kujawien soll diese Region
als „Zwischenstation” eine wichtige Rolleauf dem nach mesopotamisch-pontischemMuster ablaufenden Fernhandel gespielthaben. Anschließend gelangten die Arte-fakte in den Oderraum, nach Mähren undin das Donaugebiet sowie in den Raum vonmittlerer und oberer Weichsel, über Raba,Poprad und Wisłoka in Richtung Waag undDonau. Die frühbronzezeitlichen Gemein-schaften integrierten die Keulen in das be-stehende Nord-Süd ausgerichtete Aus-tauschsystem, welches Ägäis, Adria undOstsee verband. Sie wurden Symbol eineshohen Ranges (KOŚKO 2002, 63, 72).
Das Verbreitungsbild der kanneliertenKeulen (Abb. 14) läßt eine Distribution au-ßerhalb der Steppengebiete vermuten, diewährend des zweiten vorchristlichen Jahr-tausends an drei Kultureinheiten gebun-
192 P. Makarowicz
Abb. 14. Verbreitung derkannelierten Keulen (meist
ohne sicheren Fundkontext)in Ostmitteleuropa. Nach
KOŚKO 2002; MAKAROWICZ2009; 2010a. 1 – Barczewo;
2 – Białcz; 3 – Borek; 4 – By-chowo; 5 – Dłużniewo; 6 –Dusetos; 7 – Frydman; 8 –
Gorczenica; 9 – Grochowis-ka Księże; 10 – Güstow; 11 –
Hohenhameln; 12 – Ino-wrocław-Mątwy, Fpl. 1; 13 –
Inowrocław-Mątwy, Fpl. 3;14 – Jordanów; 15 – Kietrz,Fpl. 1; 16 – Kościelec; 17 –
Krusza Zamkowa, Fpl. 3; 18– Kupiskis; 19 – Kuznocin;
20 – Laski; 21 – Lygšis; 22 –Łatawice; 23 – Łubnice; 24 –
Masłów; 25 – Maszewo; 26– Mydłów; 27 – Niegibalice;
28 – Niełążkowo; 29 – Oj-ców; 30 – Orany; 31 –
Ostrowo nad Gopłem; 32-33– Prenzlau; 34 – Przezdrowi-
ce; 35 – Puczniew; 36 –Smroków; 37 – Sokolniki; 38
– Sulmierzyce; 39 – Sumin;40 – Vielikuskesk; 41 – Wie-trzychowice; 42 – Wissritten;43 – Wronin; 44 – Wygoda;45 – Wymysłowo; 46 – Ze-lgno; 47 – Żelisławiec; 48 –
Bronocice; 49 – Brzezina; 50– Kraków-Nowa Huta-Mogi-ła, Fpl. 55; 51 – Jastrzębiec;
52 – Polesie, Fpl. 1; 53 – Po-wodów, Fpl. 23; 54 – Roga-
szyn, Fpl. 2-4; 55 – BiałaPodlaska; 56 – Chylin; 57 –
Sielec; 58 – Zabrodzie; 59 –Grodzisko Dolne, Fpl. 22; 60
– Eggenburg; 61 – Guta; 62– Hlinsko; 63 – Horodno; 64
– Kalancak; 65 – Kladniky;66 – Klichav; 67 – Lotsman-
ska Kamenka; 68 – Micha-ilivka; 69 – Michailivka; 70 –Nemetice; 71 – Nesvady; 72– Oganino; 73 – Pińsk; 74 –Šily; 75 – Slatinky; 76 – Ste-pan Razin; 77 – Tarakija; 78– Tršice; 79 – Veletiny; 80 –
Volchansk; 81-82 – Druževi-ci; 83 – Adyn; 84-86 – Niko-laiv; 87 – Vychodoslonensky;
88 – Vivnja
den war: hauptsächlich die Hügelgräber-kultur, den TKK und die Lausitzer Kultur(BEROUNSKÁ 1987; GEDL 1996; KOŚKO 2001;2002; KOŚKO/KLOCHKO 2009, Fig. 17; MA-
KAROWICZ 2009). Dieses betrifft vor allembestimmte Varianten des melonenförmi-gen Typs B1 (mit breiten Rillen ohne Fort-sätze an den Öffnungen), die zwischenOder und Weichsel in der klassischen Hü-gelgräberkultur und dem späten TKK auf-treten. Vielleicht breitete sich von hier dieIdee der Keulen auch in östlicher und nord-westlicher Richtung aus. Zwischen Oderund Dniepr treten einige Fundkonzentra-tionen hervor: in Schlesien, im westlichenGroßpolen, in Kujawien, an der Bzura, inKleinpolen, im Gebiet von Sandomierz undum das Lubliner Hochland. Kleinere Kon-zentrationen und vereinzelte Funde sind inden östlich anschließenden Regionen zuregistrieren: im Pripjetgebiet Polesiens, anunterem Dniestr und Boh, an oberemDniestr und zwischen Niemen und Dauga-va. Die Mehrzahl der Keulen des genanntenTyps aus der Trzciniec-Ökumene tritt inden wichtigsten Besiedlungszentren aufund seltener in den Gebieten zwischen ih-
nen, auf Kommunikationsrouten. Eine Ver-knüpfung mit der Tätigkeit besagter Ge-meinschaften belegt der Fundkontext derKeulen – die meisten Exemplare stammenaus Trzciniec-Inventaren. Man kann dieVermutung wagen, dass Keulen innerhalbdieses Kulturkreises eine Art Symbol fürdie Zugehörigkeiten zu den Eliten warenund Gegenstand des über kurze und langeStrecken ablaufenden Austauschs (MAKA-
ROWICZ 2009; 2010a).Stilistische Merkmale und die Vertei-
lung sonstiger Erzeugnisse aus Stein imTKK-Kontext bieten keine Hinweise aufBeziehungen zu anderen kulturellen Milie-us. Steinäxte und -Beile (Abb. 15) kommenin Gräbern und auf Siedlungen der Haupt-besiedlungzentren vor, besonders am obe-ren Dniestr, mittleren Dniepr und auch – inlockerer Streuung – zwischen untererWeichsel und Prosna sowie am Oberlaufder Weichsel. Axt- und Beilfunde an denFlussläufen sowie an den Wasserscheidenkönnen von einer Zirkulation derartigerErzeugnisse und der Existenz von Kommu-nikationsrouten des nahen und des überre-gionalen Austauschs zeugen.
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 193
Abb. 15. Verbreitung der Ste-inäxte und Beile im Trzci-niec-Kulturkreis. Nach MAKA-ROWICZ 2009; 2010a. Beil(Stern): 1 – Malopolovecko-je, Fpl. 3; 2 – Zazimje; 3 –Zdviživka; 4 – Charjevka; 5 –Bukivnaa, Hügelgrab II u. IV;6 – Vołyncevo; 7 – Ivanivka;8 – Opatów; 9 – Rybiny, Fpl.17; 10 – Toruń, Fpl. 243; 11– Grecaniki; 12 – Litvinivka,Fpl. 1; 13 – Polesie, Fpl. 1;14 – Gostomel; 15 – Chodo-sivka; 16 – Jakuszowice, Fpl.2. Axt (Kreis): 1 – Mošny; 2 –Zazimje; 3 – Zdviživka; 4 –Pustynka; 5 – Bukivna, Hü-gelgrab VI; 6 – Vołyncevo; 7– Komarów, Hügelgrab 20 u.48; 8 – Łubna, Hügelgrab12; 9 – Rybiny, Fpl. 17; 10 –Okalew, Fpl. 3, Hügelgrab 6;11 – Honcary; 12 – Kotjala,Fpl. La gredine; 13 – Polesie,Fpl. 1; 14 – Tyszowce, Hü-gelgrab 16; 15 – Chodosivka;16 – Zdrojki; 17 – Kra-ków-Nowa Huta-Mogiła, Fpl.55; 18 – Nezvisko; 19 – Vo-rošyłovka; 20 – Košciivka,Fpl. 4; 21 – Słochy Annopol-skie („Czerwony Borek”); 22– Sabkivka; 23 – Nova Ukra-inka; 24 – Jakuszowice, Fpl. 2
Silexartefakte
Die Verteilung solcher Gegenstände wieBeile, Lanzenspitzen (Abb. 16) und Sichelnaus Silex (BEREZANSKAJA 1972; ŠVESNIKOV
1990; TARAS 1997; LIBERA 2001), die mander Kategorie der Prestigegegenstände zu-rechnen kann, ist recht deutlich an das na-türliche Vorkommen des Ausgangsmateri-als gekoppelt. Sie konzentrieren sich imPrinzip im südlichen, bergigen Teil desTKK-Gebietes und treten in Besiedlungs-zentren mit Nähe zu Silexlagerstätten Wol-hyniens, im wolhynischen Hochland (be-sonders am mittleren Styr und am oberen
Horyn), am oberen Dniestr und im Lubli-ner Hochland auf, aber auch in geringeremMaße in Kleinpolen. In den übrigen Besied-lungszonen des TKK sind Silexartefaktenur vereinzelt zu finden. Aus diesem Mate-rial wurden die Mehrzahl der Sicheln undein bedeutender Teil von Beilen und „Trzci-niec“-Lanzenspitzen gefertigt. Eine Viel-zahl der Artefakte liegt als Einzelfundeohne aussagekräftigem Kontext vor, wes-halb ihre Zugehörigkeit zum TKK nicht im-mer gesichert ist (TARAS 1997; LIBERA
2001).
Wirtel aus Geweih/Horn
Wirtel aus Geweih/Horn werden – wie dieKeulen – als Statusanzeiger mit Insignien-charakter gewertet (BEREZNASKAJA 1972;TARAS 2007; MAKAROWICZ 2010a). Derarti-ge Artefakte treten im Grunde in denHauptbesiedlungskonzentrationen desTKK innerhalb eines sich von Wieprz undBug bis zum Mittelauf des Dniepr erstre-ckenden Gebietes auf (Abb. 17). EinzelneKonzentrationen befinden sich im Lubliner
Hochland und in Polesien, in Wolhynienund auch in einen Streifen vom Rand Pole-siens um Žitomir über die Kiewer Hoch-ebene und die Ros-Niederung bis zum Kre-miencuk-Staudamm des Dnieprs auf.Keine Funde lieferten hingegen andere Be-siedlungszentren, etwa in Kleinpolen,Großpolen, Kujawien, an Sluc, Styr, imPripjet-Gebiet Polesiens oder am Dniepr.Das „unnatürliche” Verbreitungsbild in
194 P. Makarowicz
Abb. 16. Verbreitung der Be-ile (Stern) und Lanzenspitzen
(Kreis) aus Feuerstein imTrzciniec-Kulturkreis. Nach
MAKAROWICZ 2009; 2010a.Stern: 1 – Zazimje; 2 –Ty-
szowce, Hügelgrab 15; 3 –Guciów, Hügelgrab XIII; 4 –
Honcary; 5 – Słavuta; 6 –Rybiny, stan. 17; 7 – Nova
Ukrainka; 8 – Kulików, Fpl.7; 9 – Velbovno; 10 – Usteń-
ski, Fpl. II; 11 – Mežirecje;12 – Malopoloveckoje, Fpl.
3; 13 – Tristenja; 14 – Kopa-civka; 15 – Kryživka; 16 – Ja-
senivka; 17 – Požarki; 18 –Bukivna, Hügelgrab IV; 19 –
Komarov; 20 – Kazimie-rzów?; 21 – Warszawa-Gro-
dzisko; 22 – Osowa; 23 –Babino; 24 – Charjevka; 25
– Dacharzów, Fpl. 1; 26 –Boršivka; 27 – Svjatoje; 28 –
Biały Potok, Grab 3; 29 –Bonowice; 30 – Błonie/San-domierz; 31 – Netišyn; 32 –Busówno; 33 – Zalesie. Kre-
is: 1 – Łubna, Fpl. 1, Hü-gelgrab 6; 2 – Tyszowce, Hü-gelgrab 24; 3 – Guciów, Fpl.
6, Hügelgrab XIX; 4 – Maj-dan-Lipne; 5 – Słavuta; 6 –Wolica; 7 – Beremiany; 8 –
Bratkowce; 9 – Dašava; 10 –Strachosław?; 11 – Trzciniec;
12 – Nowy Majdan
Wolhynien scheint forschungsstandbe-dingt zu sein, da die Gegend am Horynrecht gut, das Gebiet der übrigen großen
Nebenflüsse des Pripjet hingegen schlech-ter untersucht ist.
Erzeugnisse aus Geweih und Knochen
Von zentraler Bedeutung für die Rekon-struktion von Routen des Austausch vonGegenständen und Ideen/Vorbildern zwi-schen den einzelnen Gesellschaften derBronzezeit ist die Verbreitung von Elemen-ten des Pferdegeschirrs, besonders derTrensenknebel aus Geweih oder Knochen(Abb. 18). Aus Trzciniec-Kontext liegennur einige wenige Exemplare vor, die stilis-tisch Erzeugnissen der Otomani/Füzesa-bony-Kultur und der Noua-Kultur entspre-chen. Doch ist nicht auszuschließen, dasseinige der ohne Fundzusammenhang über-lieferten Stücke auch dem TKK selbst ent-stammen. Trensenknebel kamen haupt-sächlich im westkleinpolnischen Gebietund sonst in anderen Regionen nur verein-zelt zu Tage. Die Stücke von Jakuszowice,
Fpl. 2, Kraków-Nowa Huta-Cło, Fpl. 65,Pełczyska, Fpl. „Cmentarzysko” (GÓR-
SKI/MAKAROWICZ/TARAS 2004, 208), Sło-nowice, Fpl. G (unpubl.)3 sowie von Belzam oberen Bug haben ihre Parallelen imMilieu von Otomani/Füzesabony-Kulturim Karpatenbecken (BOROFFKA 1998). Siesind verziert und entsprechen dem aus derSlowakei bekannten Typ Spisz (Jakuszowi-ce – BĄK 1992) oder Artefakten mit zweiDurchlochungen (Bełz im Gebiet zwischenoberem Wieprz und Bug – KRUŠELNIĆKA
1976, 19, Abb. 4: 1), aus Rumänien (z.B.Salcea), Ungarn (u.a. Budapest-Lágymá-nyos) und der Slowakei (z.B. SpišskyŠtvrtok – BĄK 1992, Abb 4: 1, 2 6; BOROFFKA
1998, Abb. 6: 11, 12).
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 195
Abb. 17. Verbreitung vonGeweih-Wirteln imTrzciniec-Kulturkreis. NachTARAS 2007; MAKAROWICZ2009; 2010a. 1 – GutaMichajlivska; 2 –Malopoloveckoje, Fpl. 2A; 3– Malopoloveckoje, Fpl. 3,Grab 12; 4 – Capaivka/VitaLitovska; 5 – Teklino,Hügelgrab 347; 6 –Mogiljany (Ostrog); 7 –Narodici, Fpl. 1, Grab 6; 8 –Mošny; 9 – Sołovje; 10 –Bortnici; 11 – NovaUkrainka; 12 – Tacenki; 13 –Svjatoje; 14 – Zdvižeivka; 15– Zavadnja; 16 – Bubniv; 17– Golišiv; 18 –Majdan-Lipno; 19 –Zastavja; 20 – Teptiuków,Fpl. 6; 21 – Teptiuków, Fpl.7; 22 – Hanna, Fpl. 1; 23 –Rogatka, Fpl. 12; 24 –Czerlonka; 25 – Guciów, Fpl.6, Hügelgrab 21; 26 –Dubeczno, Fpl. 1; 27 –Garbatówka Kolonia, Fpl. 1;28 – Paszenki; 29 – Żerocin,Fpl. 3; 30 – Kijów-Obałoń;31 – Żdanów; 32 – Doro-gošca
3Untersuchungen von Dr. Krzysztof Tunia vomArchäologisch-Ethnologischen Instutut derAkademie der Wissenschaften in Kraków.
Die analysierten Objekte zeugen vonder Nutzung des Pferdes nicht nur als Reit-tier, sondern auch als Zugtier von leichtenWagen, wie sie bei den frühbronzezeitli-chen Kulturen des Karpatenbeckens und inOsteuropa Verwendung fanden (BOROFFKA
2004; KRISTIANSEN/LARSSON 2005, 181f.,
Fig. 79, 2007). Die Rolle des Pferdes alsgrundlegendes Haustier bezeugen zahlrei-che Depots von Schlachtabfällen sowieGräber als rituelle Bestattungen im TKK(MAKAROWICZ 2010a, Abb. 3.5).
Gefäßkeramik
Wie im Falle der Prestigegegenstände ausexotischen Materialien lassen sich auch an-hand von Silistik (Morphologie und Verzie-rung) der Tongefäße enge Kontakte derTKK-Gemeinschaften mit anderen kultu-rellen Milieus nachweisen (Abb. 19).
Entlehnungen aus dem Formenschatzder Keramik und gelegentliche Imitate vonderartigen Gefäßen sind ein weiterer Hin-weis auf Beziehungen zu Nachbargebieten,wobei hierbei wiederum das Karpatenbe-cken und seine Umgebung hervortreten.An Trzciniec-Keramik zu bemerkende mor-phologische Merkmale und Verzierungentreten aber auch im Gebiet von Otoma-ni/Füzesabony-Kultur sowie von Noua-,Piliny- und Hügelgräberkultur auf. Mandarf also vermuten, dass die Vermittlung
von Wissen und Mustern in diesem Fall inbeide Richtungen erfolgte (näher dazu:GÓRSKI 2003; 2004; 2007; MAKAROWICZ
1999; 2010a). Sicher war sie nicht Resultateines Langstreckenaustauschs, der Presti-geobjekte betraf, sondern eher mit der Be-wegung von Menschen verbunden, wofürbesonders Exogamie in Frage kommt. DerTransfer verlief auf persönlicher, mitunterfamiliärer bzw. Abstammungsebene (MA-
KAROWICZ 1998, 269). Ein instruktives Bei-spiel ist die Art der Ausbreitung vonOtomani/Füzesabony-Mustern im klein-polnischen Hochland, zuletzt von JacekGórski (GÓRSKI 2003; 2007) ausführlichbesprochen und weiter nach Norden (MA-
KAROWICZ 1999). Weniger deutlich sind dieEinflüsse der Keramikproduktion der Oto-
196 P. Makarowicz
Abb. 18. Verbreitung vonTrensenknebeln in Ostmitte-
leuropa (Stern – Fundplatzdes Trzciniec-Kulturkreises).
Stern und Dreieck – Tren-senknebel des mitteleuro-
päischen Typs; Kreis – Tren-senknebel des osteuro-
päischen Typs. NachBOROFFKA 1998; KRISTIAN-SEN/LARSSON 2005; 2007;
MAKAROWICZ 2009; 2010a.1 – Jakuszowice, Fpl. 2; 2 –Pełczyska, Fpl. „Cmentarzy-
sko”; 3 – Kraków-NowaHuta-Cło, Fpl. 65; 4 – Belz;
5 – Słonowice, Fpl. G
mani/Füzesabony-Kultur in nordöstlicherRichtung. Mit der Anwesenheit von Grup-pen aus diesem Kulturmilieu ist im Falleder Karpato-Ukraine zu rechnen, in denübrigen Regionen zwischen Bug undDniestr sind transkarpatische Einflüsse vorallem bei Metallgegenständen und be-stimmten Gefäßtypen erkennbar (BALAGU-
RI 1985, 420–428; 1990, 92–95; KRUŠELNIĆ-
KA 1985, 18f.; SVEŠNIKOV 1990, 93–95).Zwischen Prosna und Bug lassen sich
drei Zonen (A–C – MAKAROWICZ 1999, Fig.1; GÓRSKI/MAKAROWICZ 2007a, Fig. 10) derRezeption transkarpatischer Muster –meist in Form von Nachahmungen des Sti-les – unterscheiden, die mit der nördlichenPeripherie von Otomani/Füzesabony-Kul-tur verknüpft sind: das Beskidengebiet(Zone A), die Lössregion des westkleinpol-nischen TKK (Zone B) sowie die Gebiet imnördlich davon liegenden Tiefland (ZoneC). In der Zone A ist die physische Anwe-senheit von Gruppen der Otomani/Füze-sabony-Kultur gut belegt (GANCARSKI 1994;1999; 2002), in den beiden anderen Zonenhaben wir es mit Einflüssen zu tun – stär-keren in Kleinpolen (vielleicht auch Anwe-senheit von Menschen aus dem Otoma-ni/Füzesabony-Kultur-Gebiet?) und vielschwächeren in den nördlichen Gebieten.
Im westlichen Kleinpolen ist darüberhin-aus eine stete transkarpatischeBeeinflussung in Form von Merkmalen derKeramik der Mad’arovce-Kultur (direkt ausder Slowakei oder über Vermittlung durchdie Otomani/Füzesabony-Kultur), der Hü-gelgräberkultur und der Piliny-Kultur er-kennbar. Die Stilistik der Piliny-Kultur istbesonders in Inventaren des TKK in Klein-polen zu bemerken (SZYMASZKIEWICZ 1985;GÓRSKI 2003; 2007, 92–97; RODAK 2003).In dieser Region sind die Einflüsse aus demKarpatenbecken besonders deutlich undauch am besten dokumentiert (DOBRZAŃS-
KA/RYDZEWSKI 1992; GÓRSKI 2003; 2007).Stilistische Einflüsse der transkarpati-
schen Gefäßkeramik lassen sich auch in deröstlichen Provinz des TKK erkennen. Stil-merkmale der Otomani/Füzesabony-Kul-tur in Komarov-Ensembles sind klar beleg-bar, aber nicht so zahlreich wie im Westen.Derartige Funde lassen sich für das ukrai-nische Karpatenvorland und das Gebiet amoberen Dniestr anführen, seltener für dasHochland Podoliens und Wolhyniens. DieRegion zwischen Seret und oberem Dniestrund in lockerer Streuung auch das Hoch-land Podoliens, Wolhyniens und amDniepr zeigen Einflüsse der Noua-Kultur.Der Südteil wiederum lässt auch Einflüsse
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 197
Abb. 19. Stilmerkmale derOtomani/ Füzesabony-Kulturim Trzciniec-Kulturkreis(Krüge). Nach MAKAROWICZ1999; GÓRSKI 2003. 1 –Babia, Fpl. 6; 2 – Gabułtów,Fpl. 1; 3 – Czyżowice; 4 –Kazimierzów; 5 –Kraków-Nowa Huta-Mogiła,Fpl. 55; Linin, Fpl. 3; 7 –Łubna, Fpl. 1; 8 –Mysławczyce, Fpl. 1; 9 –Obdzierz; 10 – Rosiejów,Hügelgrab (KopiecWschodni); 11 – Rosiejów,Fpl. 8; 12 – Słonowice, Fpl.G; 13 – Strugi, Fpl. 1; 14 –Świniary Kościelne; 15 –Wolica Nowa, Fpl. 1; 16 –Złota, Fpl. „Nad Wawrem”;17 – Żerniki Górne, Fpl. 1;18 – Zdrojki; 19 – SłochyAnnopolskie; 20 – Komarov;21 – Bukivna; 22 –Stopczatów; 23 – Wolica; 24– Ditinici; 25 – Marocna; 26– Polesie, Fpl. 1; 27 –Malopoloveckoje, Fpl. 3,Fundkomplex 2, Grab 1
der Costisa-Kultur erkennen, wodurch En-sembles mit gemischtem Stil entstanden(DUMITROAIA 2000).
Mit Vorbildern aus dem Milieu der spä-ten Otomani/Füzesabony-Kultur muss dieExistenz von Kannen, Terrinen und Tassenmit Knubben und Spiral-Knubben-Verzie-rung auf einer Reihe von Hügelgräberne-kropolen im oberen Dniestrgebiet verbun-den werden (SWIESZNIKOW 1967; SULIMIRSKI
1968; LYSENKO 1998, Abb. 7: 2). In densüdlichen Besiedlungszentren des Ostteils
des TKK sind Einflüsse seitens derNoua-Kultur am deutlichsten und konntenan Prut und Dniestr, weiter nördlich anoberem Styr, an Horyn und Sluè registriertwerden (SWIESZNIKOW 1967; SULIMIRSKI
1968; KRUŠELNIĆKA 1976, 18–26; 1985,30–40; 1990, 99–104; 2006; BALAGURI
1985, 481–489; DEGRACEV 1986, 153–171;SAVA 2002; MALEJEW 2006). Merkmale dergenannten Kultur sind in Gräbern – über-hügelt oder ohne Überhügelung – sowie inSiedlungen präsent.
B. Austauschmechanismen
Die zahlreich auftretenden Prestigegegen-stände, Keramik mit fremden Stilmerkma-len sowie einheimische Nachahmungenzeugen von einem dichten Netz von Ver-bindungen der Gemeinschaften im Gebietdes TKK mit verschiedenen anderen kultu-rellen Milieus. Ein Teil dieser Kontakte be-ruhte auf Fernhandel (direkt oder in Etap-pen), der über schon im zweitenvorchristlichen Jahrtausend bestehendenKommunikationswegen ablief, welche dieverschiedenen Trzciniec-Besiedlungszen-tren mit den Zivilisationen Südosteuropasverbanden. In den Randgebieten muss derAustausch wegen der benachbarten Lagenicht unbedingt den Charakter eines Fern-handels gehabt haben, sondern kann imRahmen von festen oder periodisch statt-findenden Treffen an bestimmten Orten(z.B. im Kontaktgebiet von TKK und Hü-gelgräberkultur zwischen Warthe undProsna, von TKK und Noua-Kultur zwi-schen Dniestr und Prut oder von TKK undOtomani/Füzesabony-Kultur an der obe-ren Weichsel und in der Karpato-Ukrainestattgefunden haben.
Die Vermutung der Existenz eines weit-reichenden Kommunikationssystems, wel-ches die bedeutendsten Besiedlungszen-tren des TKK miteinander und diese mitanderen kulturellen Einheiten verband, er-fordert notwendigerweise auch Überlegun-gen zur Form der Organisation dieser Kon-takte. Diese prägen die Größe des zuüberwindenden Raumes, die Ausgangs-und Endpunkte, Etappenstationen, geogra-phische Hindernisse, Kontaktzonen etc,weiterhin diejenigen Personen, welche denKontakt tragen, die Formen der Personen-bewegungen (KOŚKO 2001; 2002), die Zir-
kulation von Gegenständen, die Übertra-gung von Vorbildern, Technologien, Inno-vationen, Wissen, Ideen usw.
Prestigegenstände sowie einige allge-meiner verbreitete Erzeugnisse (bzw. ihrerMerkmale), wie z.B. Gefäßformen bzw. Ver-zierungen, zeigen innerhalb des TKK-Ge-biets Konzentrationen in den Besiedlungs-zentren. Mehrheitlich treten sie in rituellemKontext (Gräber, Horte, Zeremonialobjek-te) oder ohne konkreten Fundzusammen-hänge (Einzelfunde) auf, lediglich eine ge-ringe Zahl der Funde stammt vonSiedlungen. Diese dominierenden Kontextewidersprechen jedoch der Existenz von Ver-bindungswegen zu Lande und zu Wassernicht. Luxusgegenstände werden selten aufsolchen Wegen zurückgelassen („verlo-ren“). Sie gelangten in die Besiedlungszen-tren, die sich sowohl in der Nähe der Rou-ten als auch in gewisser Entfernung vonihnen befanden. Eine solche Verteilung derPrestigeobjekte scheint unnatürlich. In vie-len Fällen erscheinen wertvolle, symbol-trächtige Gegenstände oder Muster inBesiedlungszentren, die abseits von strate-gischen (transkontinentalen) Routen undan zweitrangigen Wegen lagen. SławomirKadrow hat bemerkt, dass sich Einflüssevon außen – technologische Erfindungen,Muster, Organisationsformen, Prestigege-genstände – nicht wellenförmig oder linearausbreiten und nicht unbedingt Spuren aufEtappenstationen hinterlassen müssen (KA-
DROW 2001; 225). Im Gegenteil, im Sinneder Theorie vom Weltsystem, welche eineHierarchisierung jedes kulturellen, wirt-schaftlichen und politischen Raumes vor-aussetzt (WALLERSTEIN 1974; BRAUDEL
1992), treten bestimmte Erscheinungen
198 P. Makarowicz
(z.B. die Bronzeverareitung oder komplexeOrganisationsformen wie das Häuptlings-tum) nur in den Regionen auf, in denen einBedürfnis danach bestand und die entspre-chenden Rahmenbedingungen für dieAdaption vorlagen. Die Mechanismen derDistribution von Prestigeobjekten u.ä. wa-ren entsprechend verschieden: von direk-tem oder sukzessivem Fernhandel bis hinzu lokalen Transfers down the line oder nach-barschaftlichem Austausch (prestige chain ex-change – DĄBROWSKI 1972, 193; RENFREW
1984, 119–121; RENFREW/BAHN 2002,335–368; HARDING 2000, 187–196; KRISTI-
ANSEN/LARSSON 2005; 2007; SUCHOWSKA
2010).Anders waren die Mechanismen bei der
Ausbreitung von bestimmten Keramiksti-len, bestimmten Gefäßtypen oder Verzie-rungsformen. In diesem Fall wird es sichschwerlich um eine Distribution auf langenKommunikationswegen gehandelt haben.Dem widersprechen etwa mineralogischeAnalysen von Tonmassen, welche klar be-legt haben, dass Trzciniec-Keramik – selbstim transkarpatischem Stil – aus lokalemTon hergestellt wurde (DĄBROWSKI/PAWLI-
KOWSKI 2002; PAWLIKOWSKI/DĄBROW-
SKI/BUGAJ 2007). Vielmehr dürfte die Aus-breitung von Kenntnissen zu Vorbildern,Tendenzen und Moden bei der Keramik-produktion eine Rolle gespielt haben, wasallgemein mit der Übermittlung von Wis-sen und der Nachahmung fremder Vorbil-der in einen Zusammenhang zu stellen ist.In der Hauptsache dürften bei diesen Pro-zessen Heiratsverbindungen, etwa über diesicher in Kontaktzonen häufig Exogamie,die Hauptrolle gespielt haben.
Das Auftreten mancher Artefakte in derNähe von Flüssen oder an Wasserscheidenzwischen Flüssen, die sowohl durch dieGebiete des TKK als auch außerhalb davonin Richtung der erwähnten, zivilisatori-schen Zentren fließen, kann feste odertemporär funktionierende Kommunika-tionswege markieren. Ein Beispiel für sta-bile, über lange Zeiträume genutzte Rou-ten (mit allerdings gelegentlichverändertem Wegeverlauf) sind die Verbin-dungen von der Ostsee über das Karpaten-becken bis hin zur Ägäis. Gegen Mitte deszweiten vorchristlichen Jahrtausends spiel-te der Kontakt zwischen dem kleinpolni-
schen Besiedlungszentrum des TKK mitder nahe gelegenen, nördlichen Gruppie-rung der Otomani/Füzesabony-Kultureine wichtige Rolle. Entlang der aus demNorden kommenden, durch das kleinpolni-sche Gebiet und weiter entlang Laborec,Ondava, Topel, Torys verlaufende Routengelangte Bernstein in den Karpatenraum(MARKOVÁ 1993; OLEXA 2002; GAŠAJ 2002;BÁTORA 2006, 203–208; MAKAROWICZ
2010a), in die am Nordrand des Karpaten-bogens gelegenen Siedlungen auch Trzci-niec-Keramik (GANCARSKI 2002A; infolgevon Exogamie?). In den Raum zwischenProsna und Dniestr hingegen – besondersin das Tiefland – wurden im transkarpati-schen Stil gefertigte Prestigegegenständeaus Bronze vermittelt (GÓRSKI/MAKARO-
WICZ 2007a).Unzweifelhaft waren für die Koma-
rów-Gemeinschaft sowie die Besiedlungs-zentren des TKK in Wolhynien und amDniepr die Kontakte mit dem Karpatenbe-cken und seiner Umgebung, besonders mitTranssilvanien und der Moldau, genausowichtig (besonders mit Trägern der Otoma-ni/Füzesabony-Kultur und sodann derNoua-Kultur). Die nicht geringe Zahl vonGegenständen mit Herkunft aus dem Kar-patenbecken zwischen Weichsel undDniepr, die in Streuung auch noch weiter imnordlichen Teil des Raumes zwischen Ost-see und Pontus auftreten, zeugen von einemmöglichen Anteil von Otomani/Füzesabo-ny-Kultur-Gruppen auch bei der Organis-ation von Kommunikationsverbindungenzwischen Ostsee und Schwarzmeerküste(GÓRSKI/MAKAROWICZ 2007a; 2007b; MAKA-
ROWICZ 2009; 2010a). Die Ostsee-Schwarz-meer-Routen waren gewiss von geringererwirtschaftlicher und gesellschaftlich-politi-scher Bedeutung als die Verbindungen zwi-schen Baltikum und Karpatenbecken, aberdennoch für die Ausbreitung und Zirkulati-on bestimmer Muster, Gegenstände, Ideenund auch bei Bevölkerungsbewegungenwichtig. Ihren Rang und Dynamik lernenwir eigentlich erst allmählich zu verstehen(KOŚKO/KLOCHKO 2009).
Die regionalen und überregionalenKommunkiationsaterien der Gemeinschaf-ten des TKK gliedern sich in Wasser- und inLandwege.
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 199
C. Wasserwege
Die wichtigsten Wasserwege, die mit Flüs-sen und Bächen verknüpft sind und imPrinzip in Nord-Süd-Richtung verlaufen,führten entlang von Weichsel, Warthe undProsna in Richtung Kleinpolen, flußauf-wärts entlang von Wisłok, Wisłoka, Duna-jec und kleineren Wasserläufen bis zumKarpatenkamm, weiter über Ondava, La-borec, Topla und kleineren Flüssen schließ-lich in das Karpatenbecken (Abb. 20). Vonihrem Bestehen zeugt der Bootsfund vonPińczów in Südostpolen mit 14C-Datierungin die Zeit zwischen 1500 und 1300 v.Chr.(DĄBROWSKI 2004, 41, Abb. 41). Eine wich-tige Rolle bei der Vermittlung von kulturel-len Mustern und von Artefakten spieltewohl auch die flussabwärts entlang desSoteš zur Theiss und dann flussaufwärtsführende Trasse. auch Wege über die rech-ten Nebenflüsse der Theiss in Richtungrechter Nebenflüsse des Dniestr und wei-ter nach Norden und Osten über Styr, Ho-ryn und Sluè waren sicher von Bedeutung(OTROŠCENKO 2009). Sie führten zu den Be-siedlungszentren in Wolhynien, Polesienund im Hochland am Dniepr, anschließendin das Mitteldnieprgebiet und weiter nach
Osten flussaufwärts über Dniepr, Desnaund Sejm. Die wichtigsten Fernstrecken in-nerhalb der TKK-Ökumene führten von derWeichsel über den San zum Dniestr, vonder Weichsel über die Wieprza zumDniestr, von der Weichsel über den Bugzum Boh, von der Weichsel über den Bugzum Pripjet, von der Weichsel über die Na-rew zum Niemen und von der Weichselüber den Bug zu den rechten Nebenflüssendes Pripjet (Styr, Sluc, Horyn). Als Zielge-biet diente – mehr als der pontische Raum– das Gebiet am mittleren Dniestr. Vielschwieriger lassen sich die Kommunika-tionsrouten im östlichen Teilgebiet desTKK rekonstruieren, das sich nördlich,nordwestlich, nordöstlich und östlich vonDniepr erstreckt. Vermittlung und Distri-bution von Anregungen, Artefakten undBewegungen von Menschen verliefen ge-wiss vom Mitteldnieprgebiet aus entlangder Desna und ihrer Nebenflüsse, beson-ders des Sejms, und auch den kleineren,linken Nebenflüssen des Dniepr sowieflussaufwärts über Dniepr und Pripjet(Abb. 20 – LYSENKO/LYSENKO 2009).
200 P. Makarowicz
Abb. 20. Potentielle Wegezwischen der Ökumene desTrzciniec-Kulturkreises undden Hauptkulturzentren imzweiten Jahrtausend v.Chr.
BC. Nach MAKAROWICZ2009; 2010a. Durchgezoge-ne Linie – Routen nach GIM-
BUTAS (1965) und KOŚKO(2002). Gestrichelte und ge-punktete Linie – andere po-
tentielle Routen im Gebietdes TKK. I-IV – historisch be-legte Fernwege zwischen denMeeren: I – Wolochy-Weg; II– Kucman-Weg; III – Schwa-rzer Weg; IV – Wolhynischer
Weg. Prestigegenenständeim Trzciniec-Kulturkreis: 1 –ein Artefakt aus Bronze; 2 –
zwei oder mehr Artefakteaus Bronze; 3 – Goldgegen-stand; 4 – Bernsteinartefakt;
5 – Glasgegenstand
D. Landwege
Die zweite Kategorie von Routen bildetenWasserstraßen meidende Landverbindun-gen entlang der Wasserscheiden. Ein in-terssantes Licht auf die Bewegung vonMenschen, die Ausbreitung von Waren(darunter Luxusgütern), von Innovationenund Ideen in der Bronzezeit wirft der Ver-lauf von gut dokumentierten Landwegen,die von Nomadenvölkern und später im 17.Jh. von den Tartaren genutzt wurden (GLO-
GER 1978, 329). Aus dem Raum zwischenOstsee und Pontus sind mehrere bekannt:der Kucman-Weg über die Dniestr-Boh-Wasserscheide, der Schwarze Weg (mitAbzweigungen) zwischen Dniepr und Boh,der Murawski-Weg zwischen Dniepr undDon sowie der Wolochy-Weg südlich desDniestr. Der eher regionale Cumak-Wegverlief u.a. am großen TKK-Gräberfeld vonMalopoloveckoje, Fpl. 3, vorbei (LYSENKO
2001; 2004; LYSENKO/LYSENKO 2009). Be-deutsam war ebenfalls der wolhynischeHandelsweg zwischen oberer Weichsel(Gegend um Zamość) und Kiew, der dieMittelläufe von Styr, Horyn, Sluc und Tete-rew kreuzte (Abb. 20 – SUJKOWSKI 1919;MAKAROWICZ 2010a, Fig. 6.17). Belege für
die Nutzung dieser in historischer Zeit be-zeugten Routen in der Bronzezeit sindkaum zu erbringen, doch sprechen zahlrei-che Funde von Prestigegenständen in ihrerNähe für ihre Existenz auch in dieser Peri-ode.
Landverbindungen hatten nicht denCharakter von Wegen, sondern waren eherhunderte Meter oder sogar mehrere Kilo-meter breite Trassen, die der Fortbewe-gung von Mensch und Tier, eventuell auchvon Wagen, dienten. Ein Merkmal dieserRouten war die Existenz (an manchen Ab-schnitten) von Hügelgräbern, welche denVerlauf markierten (GLOGER 1978, 329;MAKOHONIENKO 2009). Die häufig in linea-rer Anordnung errichteten Grabhügel be-sonders im südlichen Teil des TKK, in ent-waldeten Kammregionen, könnte einHinweis auf die ehemalige Existenz einerWegetrasse sein. Die Funktion von Hügel-gräbern auch als Landmarken wird häufigin der Literatur betont (MAKAROWICZ 2009,2010a; 2010b; 2011).
Funde von Bestandteilen von Pferdege-schirr, besonders von Trensenknebeln, aberauch Pferdegräber und zahlreiche Depots
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 201
Abb. 21. Verbreitung vonPferdegräbern und Depotsmit Schlachtabfällen(Pferdeknochen) inSiedlungen und aufGräberfeldern. Stern – Grab;Dreieck – Depot mitSchlachtabfällen. NachMAKAROWICZ 2009; 2010a.1 – Bukivna; 2 – Gabułtów,Fpl. 1; 3 – Koszyce, Fpl. 3; 4– Malopoloveckoje, Fpl. 3, 5– Pełczyska, Fpl.„Cmentarzysko”; 6 –Słonowice, Fpl. G; 7 –Smroków, Fpl. 3; 8 – ŻernikiGórne, Fpl. 1; 9 – Biskupin,Fpl. 2a; 10 – Dolinskije; 11 –Ivanivka; 12 – Malopolovec-koje, Fpl. 2A; 13 – Malopo-loveckoje, Fpl. 2D; 14 – Na-rodici; 15 – Polesie, Fpl. 1;16 – Pustynka; 17 – Sinia-rzewo, Fpl. 1; 18 – Sośnica;19 – Vołyncevo; 20 –Dacharzów, Fpl. 1; 21 –Jakuszowice, Fpl. 2; 22 –Podlodów, Fpl. 2; 23 –Rosiejów, Hügelgrab (KopiecWschodni); 24 – Stavok; 25– Złota Pińczowska, Fpl. 27;26 – Goszczewo, Fpl. 14; 27– Nezvisko
von Knochenabfällen von Pferden könnenvon der Nutzung als Reit, Zug- und Lasttie-re zeugen (Abb. 21). Sie stammen nichtnur aus den hochentwickelten Zivilisatio-nen des Nahen Ostens und Anatoliens(BOLLWEG 1999; BURMEISTER 2004; CROU-
WEL 2004a; BERNBECK 2004; KRISTIAN-
SEN/LARRSON 2005; 2007). Aus dem Gebietder Katakomben-Kultur und demSintašta-Komplex sind hölzerne Wagen,Pferdegräber und Bestandteile von Pferde-geschirren bekannt (GENINGZ/DANO-
VIC/GENING 1992, Abb. 94, 106; LICHAR-
DUS/VLADÁR 1996; JONES-BLEY 2000; EPI-
MACHOV/KORJAKOVA 2004; ANTHONY 2007,371–377; OTROŠCENKO 2009). Im Karpa-tenbecken sowie im nördlichen Karpaten-vorland wurden Tonmodelle von Wagenoder ihrer Teile sowie Trensenknebel ausKnochen gefunden (BOROFFKA 2004, Abb.
15); aus dem ägäischen Raum sind Terra-kottamodelle und ikonographische Dar-stellungen von Wagen bekannt (DREWS
1993, 104–134; CROUWEL 2004b). DieNähe der Otomani/Füzesabony-Kulturförderte die Ausbreitung dieser Innovationin das Gebiet des TKK. Die Reise mit einemPferdegespann konnte aber nicht entlangder Flüsse verlaufen, sondern nur in eini-ger Entfernung zu diesen – wohl auf denRouten an den Wasserscheiden. Als Pack-oder Zugtiere kommen auch Ochsen inFrage. Zwar gibt es dafür keine direktenBelege, zahlreiche Tierfiguren der mittel-bronzezeitlichen Kulturen des Karpatenbe-ckens sprechen aber dafür (CSÁNYI/TÁRNO-
KI 1992, 205, 403–413, 417–419;GANCARSKI 1994; OLEXA 2002, Photo 111).
E. Organisation der Routen
Die Schaffung eines weitreichenden, meh-rer Hundert oder gar über tausend Kilome-ter zählenden Wegenetzes einschließlichder regionalen Abzweige erforderte eineentwickelte Fähigkeit zur Organisationund unzweifelhaft auch zur Kooperationder jeweiligen Gemeinschaften, durch de-ren Gebiete die Wege führten. Die Existenzvon zivilisatorischen Mustern aus demKarpatenbecken, besonders der Otoma-ni/Füzesabony-Kultur, im nördlichen Vor-land des Karpatenbogens verweist auf die-ses Milieu als Ideengeber und Organisatorder Unternehmungen (Netz von Repräsen-tanten in den lokalen Gruppen?). GegenMitte des zweiten vorchristlichen Jahrtau-sends verfügten nur die Eliten dieses Kul-turkomplexes (als am meisten entwickel-tes System in Mitteleuropa – KADROW
2001, 230) über die technischen Mittel unddas Potential, um das nördliche Segmentdes Kontaktnetzes aufzubauen. Die Oto-mani/Füzesabony-Kultur charakterisierteeine bis dahin in diesem Teil Europas unbe-kannte soziale und politische Komplexheit(Stratifizierung) von protostaatlicher Formund mit Anfängen eines Kriegeradels. Siezeichnete sich durch befestigte Siedlungen,die Größe der Gräberfelder, den enormenReichtum in Gräbern und Horten, eine ent-wickelte Metallindustrie, entwickelte
Transportmittel und handwerkliche Spe-zialisierung aus (BADER 1990; KADROW
2001, 83, 125f.; GANCARSKI 2002b; KRIS-
TIANSEN 1998, 370f.; KRISTIANSEN/LARSSON
2005). Bernsteinfunde in Grabhügel 33von Komarov in Begleitung von Gefäßenim Stil der Noua-Kultur sprechen auch fürdie Beteiligung anderer Kulturmilieus(auch der Costisa-Kultur) am Fernhandel(als Vermittler?).
Hauptantrieb für die Eliten war sicherdas Bedürfnis nach Rohstoffen aus demNorden. Sie interessierten hauptsächlichdie Bernsteinlagerstätten – vielleicht nichtnur die baltischen, sondern auch die ukrai-nischen (Abb. 22 – CZEBRESZUK 2009; MA-
KAROWICZ 2009; 2010a), weiterhin Salz ausdem Baltikum, dem Schwarzen Meer(KOŚKO 2001; 2002) und von Vorkommenin der Karpato-Ukraine (KRUŠELNIĆKA
2002), in der Moldau, in Nordrumänien(DIMITROAIA 2000), im Kujawien sowiezwischen Warthe und Weichsel (vgl. denBriquetagefund mit TKK-Keramik mit Oto-mani/Füzesabony-Kultur-Merkmalen vonPolesie, Fpl. 1 in Zentralpolen – GÓR-
SKI/MAKAROWICZ/WAWRUSIEWICZ 2011).Theoretisch kommen auch Kupfer aus demKarpatenvorland, den Gebieten am oberenDniestr und aus Wolhynien (Abb. 23) so-wie Basalt und Silex aus Wolhynien in Be-
202 P. Makarowicz
tracht (MAKAROWICZ 2009; 2010a; CHACH-
LIKOWSKI 2011). Der Norden könnteunzweifelhaft auch Lieferer von landwirt-
schaftlichen Produkten, Leder, Fellen undHonig gewesen sein, aber auch ein Reser-voir für die Partnerwahl (vor allem von
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 203
Abb. 22. Bernsteinlager-stätten im Gebiet zwischenOstsee und SchwarzemMeer. 1 – Sukzinit, 2 –andere Arten. Nach KATINAS1971; CZEBRESZUK 2009;MAKAROWICZ 2009; 2010a
Abb. 23. Kupferlagerstättenim Gebiet zwischen Ostseeund Schwarzem Meer (NachMAŁKOWSKI 1931; 1933;CERNYCH 1976; KLOCHKO etal. 2003; BROVENDER 2009;MAKAROWICZ 2009; 2010a)
Frauen) bei Heiratsverbindungen. Der ent-wickeltere Süden bot hingegen das Wissenzu Technologien für die Herstellung vonGegenständen aus Bronze, weiterhin ferti-ge Pretigegegenstände aus Metall (Kupfer,Bronze, Gold), Bernstein, Glas und Horn.Diese Erzeugnisse wurden von den Elitendes TKK thesauriert und kamen bei derHerrschaftslegitimierung der entstehen-den politischen Schicht zum Einsatz, aberauch bei Zeremonien, welche u.a. die Ein-heit stärken und das Selbstverständnis derGruppe fördern sollten (MAKAROWICZ
2010a). Das Verlangen nach transkarpati-schen Waren war mit dem Bedürfnis ver-knüpft, über fertige Luxusgegenstände mitstatusanzeigender Funktion (Isignien) zuverfügen. Ein solcher Austausch ist – in derTheorie des Weltsystems – typisch für Be-ziehungen zwischen zentralen und peri-pheren Gebieten (z.B. FRANK 1993; SHER-
RATT 1993; KARDULIAS 1999; KADROW 2001;für den TKK – MAKAROWICZ 1998,292–298; GÓRSKI/MAKAROWICZ 2007a).
Man kann vermuten, dass die einzelnenAbschnitte der oben genannten Routenvon den Eliten des TKK kontrolliert wur-den, welche – ohne eventuell unmittelbareDistributoren zu sein – aus der Vermitt-lung oder der Aufrechterhaltung bestimm-ter Wegeabschnitte Kapital schlugen, den
Austausch beeinträchtigende Konflikte inihrer Nähe zu verhindern versuchten, fürdie Sicherheit der Kontaktpunkte und derTransporteure aufkamen etc. Diese Elitenließen für ihre Verstorbenen Gräbhügel er-richteten und statteten sie mitunter über-aus reich aus (z.B. Grabhügel I und II vonIvanje – Abb. 24, Grabhügel VIII vonNetišyn – Abb. 25, Grabhügel 9 und 12 vonKolosivka in Wolhynien oder die Grabhü-gel 6, 8 und 33 von Komarov am oberenDniestr – Abb. 26). Die Ausstattung mitPrestigeobjekten aus Bronze ist für Hügel-gräber bezeugt, die in der Nähe potentiel-ler Wegetrassen liegen, wie etwa Komarovund Bukivna am Dniestr, Bar am Boh oderDitinici am oberen Horyn (SULIMIRSKI
1968), aber auch für zahlreiche Kollektiv-gräber in Kleinpolen, wie von Żerniki Gór-ne, Fpl. 1 (KEMPISTY 1978), wo Reste einerHalskette aus Bernstein, Glas und Bronzegefunden wurden, und Dacharzów im San-domierz Hochland, wo in monumentalenGräbern mit Holz-Stein-KonstruktionBronzeeartefakte lagen (FLOREK/TARAS
2003), oder auch für Bronzegegenständebergende Elitebestattungen von Malopolo-veckoje, Fpl. 3, an der Grenze vom Hoch-land am Dniepr zur Ros-Ebene gelegen(Abb. 27).
204 P. Makarowicz
Abb. 24. Reich ausgestatteteGräber des Trzciniec-Kultur-
kreises von Ivanje, GrabhügelII, Bergland von Wolhynien.A, B – Grab 2; C – Grab1. A– 1 – Ton, 2, 3 – Bronze; 4 –Gold; 5 – Silex. B – 1, 4, 5 –Bronze; 2, 3 – Ton. C – 1, 8– Ton; 2–7 – Bronze. NachSVEŠNIKOV 1968; MAKARO-
WICZ 2008; 2009; 2010a
Der Status der Personen, die sich aufden Austauschrouten mit den Waren be-wegten und auch kulturelle Anregungenvermittelten, ist schwer zu bestimmen. Si-cherlich beschäftigten sie sich berufsmäßigmit Austausch/Handel (Handwerker,Händler), waren also Spezialisten, die inbekannte und unbekannte Gebiete vor-drangen KRISTIANSEN/LARSSON 2005;2007). Der Austausch von Rohstoffe undFertigwaren aus Bronze oder Bernsteinwird oft mit dem wandernen Schmied oderdem Priester-Schmied verbunden – wan-dernden, spezialisierten Metallurgen, dieBronzeerzeugnisse in weit entfernten Ge-bieten absetzten (SANGMEISTER 1972;KOŚKO 1979, 172f.; BUTLER 1990; SHERRATT
1994, 259f.; VANDKILDE 1996, 265; MAKA-
ROWICZ 1998, 260f.; 2003; 2005; KRISTIAN-
SEN 1998, 379 – warrior chiefs/bronzesmiths;HARDING 2000, 236f.). Hinweise auf einelokale Metallindustrie sowohl im westli-chen (BLAJER 1998; DĄBROWSKI 1985, 2004;MAKAROWICZ 1998, 250; 2010a) als auchim östlichen Teilgebiet des TKK (BEREZANS-
KAJA 1972, 76–92; BIEREZANŚKA 1972,275–280; DĄBROWSKI 1972; DERGACEV
1986, 151f; KLOCKO 1994, 115–118; 1998,2006; LYSENKO 2005; LYSENKO/LYSENKO
2009) liegen in Form von Tiegeln, Gussfor-men, Gußlöffeln, Blasebalgdüsen und zahl-reichen Bronzeartefakten vor. Es scheintaber, als hätte die Fortbewegung auf denKommunikationswegen eher in größerenPersonenverbänden stattgefunden undwäre aus verschiedenen Gründen keineWanderung Einzelner gewesen (vgl. dieKritik am Konzept des Wanderschmieds –VANDKILDE 1996, 263; MAKAROWICZ 1998,251). Es ist zu vermuten, dass die Vermitt-lung von Anregungen/Ideen und Erzeug-nissen fremder Herkunft in die Tiefe desTKK-Gebietes über jene Wege verlief, wel-che das nördliche, an der Küste liegendeGebiet mit dem Landesinneren und denSiedlungszentren im Bergland verbanden.
Die Mehrzahl der frühbronzezeitlichenKulturgruppen Ostmitteleuropas warenVerwandtschaftsgemeinschaften, die sichaus Familien zusammensetzten, die wie-derum Bestandteile größere Segmente wa-ren – Verwandtschaftsgruppen oder Ab-stammungsgemeinschaften (MAKAROWICZ
2010a, 294f.). Zwar sind derartige Ge-meinschaften viel beweglicher und operati-ver bei der Organisation verschiedener re-
gionaler Unternehmungen, doch dürfte dieStabilität, das langfristige und konstanteFunktionieren der Wegetrassen und ihreErhaltung (Weg als wirtschaftlich-gesell-schaftliche und soziale „Institution“) eherein Abgehen von der Verwandtschaft alsBasis solcher Unternehmungen bedeutetund zur Entstehung protostaatlicher Ge-meinschaften (wie im Falle von Otoma-ni/Füzesabony-Kultur) geführt haben.Denkbar ist auch eine Evolution der Ver-wandtschafts- und Abstammungsgemein-schaften zu – meist recht einfach organi-sierten – segmentierten (Stammes-)Gesellschaften in Richtung Häuptlingstü-mern. Im besprochenen Zeitabschnitt deszweiten vorchristlichen Jahrtausends warzwischen Ostsee und Pontus lediglich dieBildung von räumlich begrenzten Einhei-
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 205
Abb. 25. Reich ausgestatteGräber des Trzciniec-Kultur-kreises von Netišyn, Grabhü-gel VIII, Bergland vonWolhynien. 1–3, 6, 9,11–18? – Grab 1 (west-liches); 4, 5, 7, 8, 10 – Grab2 (östliches), 19 – aus derAufschüttung. 1–3, 5, 7, 8 –Bronze; 6, 19 – Ton; 4 –Gold. Nach BEREZANSKA etal. 2004
ten vom Typ chiefdom mit einer sich entwi-ckelnden Kriegeraristokratie möglich.Dazu gehörten vermutlich das westlicheKleinpolen, die Gebiete am oberen Dniestr,am oberen Styr, Horyn und Sluè oder einige
Regionen am mittleren Dniepr. Es sei auchan den Fall von Post-TKK-Fundplätzen wieHordeevka und ähnlichen Sepulkralanla-gen am Boh erinnert, die radikale sozialeVeränderungen in der zweiten Hälfte des
206 P. Makarowicz
Abb. 26. Reich ausgestatteteGräber des Trzciniec-Kultur-
kreises von Komarow amoberen Dniestr. A – Grab un-
ter Grabhügel 8: 1; 3, 5 –Bronze; 2, 4, 7, 9, 10 – Ton;6 – Gold; 8a und 8b – Bron-ze und Gold. Nach SULIMIR-
SKI 1964; 1968. B – Grab un-ter Grabhügel 6: 1–5 – Ton;
2 – Gold, 3, 4 – Bronze.Nach SULIMIRSKI 1964
Abb. 27. Reich ausgestatteteGräber des Trzciniec-Kultur-kreises von Malopolovecko-
je, Fpl. 3, Grab 1–93, amMitteldniepr. 1–7 – Bronze.
Nach LYSENKO 1998
zweiten vorchristlichen Jahrtausends wi-derspiegeln (BEREZANSKAJA/KLOCKO 1998;ŚLUSARSKA 2009). Die überregionalen Rou-ten im Gebiet des TKK bestanden wohlnicht ständig und ihre Nutzung hatte
Höhe- und Tiefpunkte. Ein der ersterenwar zweifelsohne die hier besprochene Pe-riode.
Schlussfolgerungen
Im vorliegenden Beitrag wird die Verteilungvon frühbronzezeitlichen Prestigeobjektendes Gebietes zwischen Ostsee und Schwar-zem Meer mit dem Bestehen von überregio-nalen und regionalen Kommunikationswe-gen als hauptsächlichem Stimulator vonKontakten zwischen Gemeinschaften ver-bunden. Am Ende des dritten Jahrtausendsv.Chr. waren die Hinweise auf das Bestehensolcher Routen noch nicht sehr deutlich(MAKAROWICZ 2009, 307–311). Eine Inten-sivierung des Austausch in dem besproche-nen Gebiet erfolgte in der ersten Hälfte deszweiten Jahrtausends. Als sein Initiator undhauptsächlicher Begünstigter der nordwest-lich-südöstlich verlaufenden Kommunika-tionswege tritt die Otomani/Füzesabo-ny-Kultur hervor. Ihr nördlicher Partnerwar der TKK, dessen Eliten an der Organi-sation und der Erhaltung des Kommunika-tionsnetzes teilnahmen. Diese Interpreta-
tion stützen Funde von Metall-, Bernstein-und Glasgegenständen, Trensenknebel ausKnochen sowie Gefäße im transkarpati-schen Stil tief im Gebiet des TKK und ande-rerseits Gegenstände aus baltischemBernstein in Gräbern und Siedlungen imKarpatenbecken und in seiner Umgebung.
Der Umfang des Austauschs und die re-gistrierte Verteilung der Prestigegegen-stände lässt vermuten, dass die Übermitt-lung von Vorbildern, Fertigprodukten undKnow-How zwischen Ostsee und Pontus instarkem Maße formalisiert war. Die bis da-hin nur vorübergehend genutzten Kommu-nikationswege wurdem im besprochenenGebiet im zweiten vorchristlichen Jahrhun-dert eine bedeutende kulturelle Instituti-on, welche den zivilisatorischen Fortschrittstimilierte.
Übersetzung: Jan Schuster, Łódź
References
ANDRIEªESCU I. 1925, Nouvelles contributionssur L’age du bronze en Roumanie. Dacia 2,345–384.
ANTHONY D.W. 2007, The horse, the wheel,and language. How Bronze-Age riders fromthe Eurasian steppes shaped the modernworld. Oxford.
BADER T. 1998, Bemerkungen zur bronzezeit imKarpatenbecken Otomani/Füzesabony--Komplex. Überblick und Fragenstel-lung. Jahresschrift für mitteldeutscheVorgeschichte 80, 43–108.
BALAGURI E. 1985, Kultura Noa. In: Archeolo-gija Ukrainskoj SSR. Tom I. Pervobytna ar-cheologija. Kiev, 481–489.
BALAGURI E. 1990, Kultury srednego periodaepochi bronzy Zakarpat’ja. In: ArcheologijaPrikarpat’ja, Volyni i Zakarpat’ja (eneolit,bronza i rannee železo). Kiev, 92–95.
BÁTORA J. 2006, Štúdie ku komunikácii medziStrednou a Východnou Európou v dobe bron-zovej. Bratislava.
BĄK U. 1992, Bronzezeitliche Geweihknebel inSüdpolen. Archäologisches Korrespon-denzblatt 22, 201–208.
BEREZANSKAJA S.S. 1972, Srednij period bron-zovogo veka v Severnoi Ukraine. Kiev.
BEREZANSKAJA S.S./GOŠKO T.J./SAMOLIUK
V.O. 2004, Kolektivne pochovannja tšinec-koj kulturi na r. Goryn’. Archeologija 1,111–125.
BERNBECK R. 2004, Gesellschaft und Technolo-gie im frügeschichtlichen Mezopotamien. In:FANSA M./BURMAISTER S. (eds), Rad undWagen. Der Ursprung einer Innovation Wa-gen im Vorderen Orient und Europa. Maizam Rhein, 49–68.
BIEREZAŃSKA Z. 1972, Kultura trzciniecka naUkrainie. Archeologia Polski 17,259–305.
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 207
BLAJER W. 1990, Skarby z wczesnej epoki brązuna ziemiach polskich. Wrocław–Warsza-wa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
BLAJER W. 1998, Przyczynek do dyskusji o zna-czeniu metalurgii brązu w zachodnim od-łamie kultury trzcinieckiej. In: KOŚKO
A./CZEBRESZUK J. (Hrsg.), „Trzciniec” –system kulturowy czy interkulturowy pro-ces?. Poznań, 337–342.
BLAJER W. 1999, Skarby ze starszej i środkowejepoki brązu na ziemiach polskich. Kraków.
BOLLWEG J. 1999, Vorderasiatische Wagentypenim Spiegel der Terracottaplastik bis zur Alt-babylonischen Zeit. Orbis Biblicus et orienta-lis 167. Freiburg.
BÓNA I. 1975, Die Mittlere Bronzezeit Ungernsund Ihre Südöstlichen Bezihungen. Buda-pest.
BOROFFKA N. 1998, Bronze- und früheisenzeit-liche Geweihtrensenknebel aus Rumänienund ihre Beziehungen. Alte Funde aus demMuseum für geschichte Aiud, Teil 2. EurasiaAntiqua 4, 81–135.
BOROFFKA N. 2004, Bronzezeitliche Wagenmo-delle im Karpatenbecken. In: FANSA M./BURMEISTER S. (Hrsg.), Rad und Wagen.Der Ursprung einer Innovation. Wagen imVorderen Orient und Europa. Mainz,347–354.
BRAUDEL F. 1992, Kultura materialna, gospo-darka i kapitalizm XV–XVIII wiek. Vol. III.Czas świata. Warszawa.
BROVENDER Y.M. 2009, Copper Ores of theNorthern Pontic Region as Raw Materials forProduction Activity in the Paleometal Age(Based on the Study of the Kartamysh OreMining and Metallurgy Complex. In: KośkoA./Klochko V. (Hrsg.), Routes betweenthe seas: Baltic – Boh – Bug – Pont from the3rd to the middle of the 1st millennium BC.Baltic-Pontic Studies 14, 103–123.
BUKOWSKI Z. 2002, Znaleziska bursztynu w ze-społach z epoki brązu i z wczesnej epoki żela-za z dorzecza Odry i Wisły. Warszawa.
BURMEISTER S. 2004, Der Wagen im Neolithi-kum und Bronzezeit: Erfindung, Ausbreitungund Funktion der ersten Fahrzeuge. In:FANSA M./BURMAISTER S. (Hrsg.), Radund Wagen. Der Ursprung einer InnovationWagen im Vorderen Orient und Europa.Mainz am Rhein, 13–40.
BUTLER J.J. 1990, Bronze Age metal and amberin the Netherlands (I). Paleohistoria 32,47–110.
CABALSKA M. 1980, Związki między kulturąOtomani a kulturą trzciniecką. Archeolo-gia Polski 24, 53–62.
CARMAN J./HARDING A. (Hrsg.) 1999, An-cient Warfare. Phenix Mill-Stroud.
CHACHLIKOWSKI P. 2011, Wołyńskie reminis-cencje. Ze studiów nad identyfikacją i re-cepcją surowca bazaltowego w strefie circum-bałtyckiego kręgu kulturowego. In:IGNACZAK M./KOŚKO A./SZMYT M.(Hrsg.), Między Bałtykiem a Morzem Czar-nym: szlaki Międzymorza w IV – I tys. przedChr.“ Archaeologia Bimaris – Dyskusje,tom 4 (im Druck).
CHOIŃSKA-BOCHDAN E. 2003, Bursztyn w kul-turze. In: KOSMOWSKA-CERANOWICZ
B./CHOIŃSKA-BOCHDAN E. (Hrsg.), Zbursztynem przez tysiąclecia. Gdańsk,29–135.
CHOMENTOWSKA B. 1964, Masowy grób kul-tury trzcinieckiej w Kosinie, pow. Kraśnik.Światowit 24, 237–251.
CROUWEL J. 2004a, Der Alte Orient und seineRolle in der Entwicklung von Fahrzeugen.In: FANSA M./BURMAISTER S. (Hrsg.),Rad und Wagen. Der Ursprung einer Inno-vation Wagen im Vorderen Orient und Euro-pa. Maiz am Rhein, 69–86.
CROUWEL J. 2004b, Bronzezeitliche Wagen inGriechenland. In: FANSA M./BURMAISTER
S. (Hrsg.), Rad und Wagen. Der Ursprungeiner Innovation Wagen im Vorderen Orientund Europa. Mainz am Rhein, 341–346.
CYNKAŁOWSKI A. 1961, Materiały do pradzie-jów Wołynia i Polesia Wołyńskiego. Wars-zawa.
CZEBRESZUK J. 2007, Amber Between the Balticand the Aegean in the Third and Second Mil-lennia BC (An Outline of Major Issues). In:GALANAKI I./TOMAS H./GALANAKIS
Y./LAFFINEUR R. (Hrsg.), Between the Ae-gean and Baltic Seas. Prehistory Across Bor-ders. Preceedings of the International Confe-rence “Bronze and Early IronInterconnections and Contemporary Deve-lopments between the Aegean and the regionsof the Balkan Peninsula, Central and Nort-hern Europe”, University of Zagreb, 11–14April 2005. Liège, 363–370.
CZEBRESZUK J. 2009, Ways of Amber in theNorthern Pontic Area. An outline of issues.In: KOŚKO A./KLOCHKO V. (Hrsg.), Rou-tes between the seas: Baltic – Boh – Bug –Pont from the 3rd to the middle of the 1st mil-lennium BC. Baltic-Pontic Studies 14,87–102.
208 P. Makarowicz
CERNYCH E.N. 1965, Spiektralnyj analiz i izu-
cenije drevniejšej metallurgii vostocnoj Evro-py. In: Archeologija i jestvennyje nauki.Moskva, 97–111.
CERNYCH E.N. 1976, Drevniaja metalloobra-botka na Jugo-Zapade SSSR. Moskva.
CSÁNYI M./TÁRNOKI J. 1992, Katalog der aus-gestellten Funde. In: MEIER-ARENDT W.(Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungenin Tell-Sidlungen an Donau und Theiss.Frankfurt am Main, 175–210.
DAVID V. 2002, Studien zu Ornamentik undDatierung der bronzezeilichen Depotfund-gruppe Hajdùsámson-Apa-Ighiel-Zajta.Alba Iulia-Karlsburg/Weissenburg.
DĄBROWSKI J. 1972, Powiązanie ziem polskichz terenami wschodnimi w epoce brązu.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
DĄBROWSKI J. 1977, Oddziaływania śląs-ko-wielkopolskie na metalurgię kultury trzci-nieckiej. In: Geneza kultury łużyckiej naterenie Nadodrza. Wrocław, 201–224.
DĄBROWSKI J. 2004, Ältere Bronzezeit in Polen.Warszawa.
DĄBROWSKI J./HENSEL W. 2005, Metallgieße-rei in der älteren Bronzezeit in Polen. Prae-historische Zeitschrift 80/1, 5–48.
DĄBROWSKI J./PAWLIKOWSKI M. 2002, Wyni-ki badań surowcowo-technologicznych cera-miki kultury trzcinieckiej. Przegląd Arche-ologiczny 50, 57–69.
DERGACEV V.A. 1975, Bronzovyje predmetyXIII–VIII ww. do n.e. iz dniestrovsko-pruts-kogo mežyrecja. Kišiniev.
DERGACEV V.A. 1986, Moldavija I sosednie ter-ritorii v epochu bronzy. Kisziniev.
DIETZ S. 1991, The Argolid at the Transition tothe Mycenaean Age. Studies in the Chronolo-gy and cultural Development in the shaftGrave Period. Copenhagen.
DOBRZAŃSKA H./RYDZEWSKI J. 1992, Elemen-ty zakarpackie w materiałach kultury trzci-nieckiej w Mysławczycach. Acta Archaeo-logica Carpatica 31, 91–106.
DREWS R. 1993, The end of the Bronze Age.Changes in warfare and the catastrofe ca.1200 B.C. Princeton.
DUMITROAIA G. 2000, Comunitãþi preistoricedin nord-estul Rumâniei. De la cultura Cucu-teni pânã în bronzul mijlociu. Piara-Neamþ.
EARLE T. 1997, How Chiefs Come to Power. ThePolitical Economy in Prehistory. Stanford.
EPIMACHOV A./KORJAKOVA L. 2004, Streitwa-gen der eurasischen Steppe in der Bronzezeit:Das Wolga-Uralgebirge und Kasachstan. In:FANSA M./BURMAISTER S. (Hrsg.), Rad
und Wagen. Der Ursprung einer InnovationWagen im Vorderen Orient und Europa.Mainz am Rhein, 221–236.
FLOREK M./TARAS H. 2003, Dacharzów.Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Lublin.
FLORESCU M. 1964, Contributii la cunoaætereaculturii Noua. Archeologia Moldovei 2–3,143–216.
FRANK A.G. 1993, Bronze Age World SystemCycles. Current Anthropology 34,383–429.
GANCARSKI J. 1994, Pogranicze kultury trzci-nieckiej i Otomani-Füzesabony – grupa ja-sielska. In: Problemy kultury trzcinieckiej.Rzeszów, 75–104.
GANCARSKI J. (Hrsg.) 1999, Kultura Otoma-ni-Füzesabony – rozwój, chronologia, gospo-darka. Krosno.
GANCARSKI J. 2002, Kultura Otomani-Füzes-abony po północnej stronie Karpat. In: GAN-
CARSKI J. (Hrsg.), Między Mykenami aBałtykiem. Kultura Otomani-Füzesabony.Krosno-Warszawa, 103–124.
GANCARSKI J. (Hrsg.) 2002, Między Mykena-mi a Bałtykiem. Kultura Otomani-Füzes-abony. Krosno-Warszawa.
GANCARSKI J. 2006, Trzcinica – karpacka Troja.Krosno.
GARDAWSKI A. 1951, Niektóre zagadnieniakultury trzcinieckiej w świetle wykopalisk wmiejscowości Łubna, pow. Sieradz. Wiado-mości Archeologiczne, 18, 1–84.
GARDAWSKI A./WESOŁOWSKI K. 1956. Zagad-nienie metalurgii kultury trzcinieckiej wświetle „skarbów” z Dratowa, pow. Puławy iRawy Mazowieckiej. Materiały Starożyt-ne, 1, 59–103.
GAŠAJ D. 2002, Osady warowne i życie gospo-darcze. In: GANCARSKI J. (Hrsg.), MiędzyMykenami a Bałtykiem. Kultura Otoma-ni-Füzesabony. Krosno-Warszawa, 21–51.
GEDL M. 1975, Kultura przedłużycka. Wroc-ław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
GEDL M. 1984, Wczesnołużyckie groby z kon-strukcjami drewnianymi. Wrocław–War-szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
GEDL M. 1996, Uwagi o datowaniu i przynale-żności kulturowej kamiennych główek buławna Śląsku. Silesia Antiqua 38, 35–43.
GENING V.F./ZDANOVIC G.B./GENING V.V.1992, Sintašta. Archeologiceskije pamjatni-ki ariiskich plemen Uralo-Kazachstanskichstepej 1. Celabinsk.
GERŠKOVIC J.P. 1998, Westliche Impulse bei derFormierung des Kulturkomplexes “Noua-Sa-batinovka-Coslogeni”. In: HÄNSEL B./
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 209
MACHNIK J. (Hrsg.), Das Karpatenbeckenund die Osteuropaische Steppe. Nomadenbe-wegungen und Kulturaustausch in den vor-christlichen Metallzeiten (4000–500 v. Chr.).München-Rahden/Westf., 317–324.
GERŠKOVIC J.P. 1999, Studien zur spätbronze-zeitlichen Sabatinovka-Kultur am unterenDnepr und an der Westküste des Azov’schenMeeres, Archäologie in Eurasien, T. 7,Rahden/Westf.
GIMBUTAS M. 1965, Bronze Age Cultures inCentral and Eastern Europe. The Hague.
GLOGER Z. 1978, Encyklopedia straropolska, t.I–IV. Warszawa.
GÓRSKI J. 2003, Uwagi o datowaniu i kontekś-cie znalezisk ceramiki o „cechach południo-wych” w strefie zasięgu kultury trzcinieckiej.In: GANCARSKI J. (Hrsg.), Epoka brązu iwczesna epoka żelaza w Karpatach polskich.Krosno, 89–137.
GÓRSKI J. 2004, Die Grundlagen einer relativenDatierung und Periodisierung der Trzci-niec-Kultur im Lößgebiet westlichen Kleinpo-lens. Sprawozdania Archeologiczne 56,155–184.
GÓRSKI J. 2007, Chronologia kultury trzcinie-ckej na lessach niecki nidziańskiej. Kraków
GÓRSKI J./MAKAROWICZ P. 2007a, Interakcjekulturowe między zachodnim i południo-wo-wschodnim (pontyjskim) odłamem trzci-nieckiego kręgu kulturowego. In: BAKALAR-
SKA L. (Hrsg.), Wspólnota dziedzictwa ar-cheologicznego ziem Ukrainy i Polski. Mate-riały z konferencji zorganizowanej przezOśrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicz-nego Łańcut (26–28 X 2005 r.). Warsza-wa, 148–170.
GÓRSKI J./MAKAROWICZ P. 2007b, Receptionof Transcarpathian influence in Trzciniec cul-tural circle as a sign of long-distance exchan-ge contacts. In: BARON J./LASAK I. (Hrsg.),Long Distance Trade in the Bronze Age andEarly Iron Age, Studia ArcheologiczneXL. Wrocław, 101–116.
GÓRSKI J./MAKAROWICZ P./TARAS H. 2004,Podstawy gospordarcze ludności trzcinieckie-go kręgu kulturowego w dorzeczach Wisły iOdry. In: KOŚKO A./SZMYT M. (Hrsg.),Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczuWisły i Dniepru (neolit, eneolit, epokabrązu), Archaeologia Bimaris, tom III. Po-znań, 191–213.
GÓRSKI J./MAKAROWICZ P./WAWRUSIEWICZ
A. 2011, Osady i cmentarzyska trzcinieckie-go kręgu kulturowego w Polesiu, pow. łowic-ki, woj. łódzkie, stan. 1. Łodź (im Druck).
GRYGIEL L. 1987, Z badań nad kulturą trzci-niecką w rejonie Brześcia Kujawskiego. In:Kultura trzciniecka w Polsce. Kraków,73–88.
HÄNSEL B. 1968, Beiträge zur Chronologie dermittleren Bronzezeit im Karpatenbecken.Bonn.
HÄNSEL B. (Hrsg.) 1995, Tausch und Verkehrim bronze- und früheisenzeitlichen Südosteu-ropa. München-Berlin.
HARDING A.F. 1984, The Mycenaeans and Eu-rope. London.
HARDING A.F. 2000, European Societies in theBronze Age. Cambridge.
HARDING A./HUGHES-BROCK H. 1974, Am-ber in the Mycenean World. Annual of theBritish School at Athens, 69, 145–172.
HOCHSTETTER A. 1981, Eine Nadel der No-ua-Kultur aus Nordgriechenland. Eine Bei-trag zur absoluten Chronologie der spätenBronzezeit im Karpatenbecken. Germania59/2, 239–259.
JONES-BLEY K. 2000, The Shistashta “Chari-ots”. In: DAVIS-KIMBALL J./MURPHY
E.M./KORYAKOVA L./YABLONSKY L.T.(Hrsg.), Kurgans, ritual sites, and Settle-ments Eurasian Bronze and Iron Age, Bri-tish Archaeological Report, Internatio-nal Series, 890. Oxford, 126–133
JOCKENHÖVEL A. 1991, Räumlische Mobilitätvon Personen in der mittleren Bronzezeit deswestlichem Mitteleuropa. Germania 69,49–62.
KADROW S. 1995, Gospodarka i społeczeństwo.Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce.Kraków.
KADROW S. 2001, U progu nowej epoki. Gospo-darka i społeczeństwo wczesnego okresu epo-ki brązu w Europie Środkowej. Kraków.
KAISER E. 1997, Der Hord von Borodino. Kriti-sche Anmerkungen zu einem berühmtenbronzezeitlichen Schatzfund aus dem nord-westlichen Schwarzmeergebiet, Universitäts-forschungen zur prähistorischen Archäologie,Band 4. Bonn.
KARDULIAS P.N. (Hrsg.) 1999, World-SystemsTheory in Practice. Leadership, Production,and Exchange. Lanham-Boulder–NewYork–Oxford.
KATINAS V. 1971, Jantar i jantarnosnye olłženi-ja Južnoj Pribałtyki. In: Trudy LitovskogoNaucnogo Issledovatelnogo Instituta20, 1–151.
KEMPISTY A. 1978, Schyłek neolitu i początekepoki brązu na Wyżynie Małopolskiej wświetle badań nad kopcami. Warszawa.
210 P. Makarowicz
KLOCKO V.I. 1994, Melallurgicheskoe proiz-vodstvo v eneolite – bronzovom veke. In: Re-meslo epochi eneolita – bronzy na Ukraine.Kiev.
KLOCKO V.I. 1998, „Leboikivska metalurgija”(do problemy schidnogo kordonu Schidnot-szinieckoi kultur. In: KOŚKO A./CZEBRE-
SZUK J. (Hrsg.), „Trzciniec – system kulturo-wy czy interkulturowy proces?”. Poznań,217–238.
KLOCKO V.I. 2006, Ozbroennja ta vijśkovasttrava davńogo naselennja Ukraini. Kiev.
KLOCHKO V.I./MANICHEV V.I./KAMPANEC
G.S./KOVALCHUK M.S. 2003, Wychodnierud miedzi na terenie Ukrainy zachodniejjako baza surowcowa metalurgii kolorowej wokresie funkcjonowania kultury trypolskiej.Folia Praehistorica Posnaniensia,10–11, 47–77.
KOŚKO A. 1979, Rozwój kulturowy społeczeństwKujaw w okresie schyłkowego neolitu i wcze-snej epoki brązu. Poznań.
KOŚKO A. 2001, Zagadnienie wczesnobrązowejcezury w rozwoju „szlaku” Krym – Jutlan-dia. In: CZEBRESZUK J./KRYVALCEVIC
M.,/MAKAROWICZ P. (Hrsg.), Od neolity-zacji do początków epoki brązu. Przemianykulturowe w międzyrzeczu Odry i Dnieprumiędzy VI i II tys. przed Chr. Poznań,283–290.
KOŚKO A. 2002, Fluted maces in cultural sys-tems of the borderland of Eastern and West-ern Europe: 2350–800 BC. Taxonomy, gene-sis, funcion. In: KOŚKO A. (Hrsg.), Flutedmaces in the system of long-distance exchangetrails of the Bronze Age: 2350–800 BC, Bal-tic-Pontic Studies 11, 31–81.
KOŚKO A./V. KLOCHKO 2009, The Societies ofCorded Ware Cultures and Those od BlackSea Steppes (Yamnaya and Catacomb GraveCultures) in the Route Network Between theBaltic and Black Seas. In: KOŚKO A./KLOCHKO V. (Hrsg.), Routes between theseas: Baltic – Boh – Bug – Pont from the 3rd tothe middle of the 1st millennium BC. Bal-tic-Pontic Studies 14, 269–301.
KOZŁOWSKI L. 1939, Zarys pradziejów PolskiPołudniowo-Wschodniej. Lwów.
KRISTIANSEN K. 1998, Europe before history.Cambridge.
KRISTIANSEN K./LARSSON T.B. 2005, The Riseof Bronze Age Society. Travels, Transmissionsand Transformations. Cambridge.
KRISTIANSEN K./LARSSON T.B. 2007, Contactsand Travels during the 2nd Millennium BC.Warriors in Move? In: GALANAKI J./TOMAS
H./GALANAKIS Y./LAFFINEUR R. (Hrsg.),Between the Aegean and Baltic Seas. Prehis-tory Across Borders. Liège, 25–32.
KRUŠELNIĆKA L.I. 1976, Pivnicna Prikarpattjai zachidna Voliń za dobi ranńogo zaliza.Kiev.
KRUŠELNIĆKA L.I. 1985, Vzaemozv’jazki nase-lennja Prikarpattja i Volini z plemenamischidnoj i centralnoj Evropi. Kiev.
KRUŠELNIĆKA L.I. 1990, Kultura Noa. In: Ar-cheologija Prikarpat’ja, Volyni i Zakarpatja.Kiev, 99–104.
KRUŠELNIĆKA L.I. 2002, Pam’jatka solevarinn-ja rubežu ranńoj i seredńoj bronzi v pivnic-no-schidnich Karpatach. Zapiski Nauko-vogo Tovaristva Imeni Shevchenka 244,Praci Archeołogicnoj komisii, 140–154.
KRUŠELNIĆKA L.I. 2006, Kultura Noa nazemljach Ukraini. Lviv.
LÉVI-STRAUSS C. 1949, Les structures élémen-taires de la parenté. Paris.
LÉVI-STRAUSS C. 1992, Zasada wzajemności.In: KEMPNY M./SZMATKA J. (Hrsg.),Współczesne teorie wymiany społecznej.Zbiór tekstów. Warszawa, 106–130.
LAGODOVŚKA O. 1948, Vojcechivskij mogilnikbronzovoi dobi na Volini. Archeologija 2,62–77.
LIBERA J. 2001, Krzemienne formy bifacjalne naterenach Polski I zachodniej Ukrainy (odśrodkowego neolitu do wczesnej epoki żela-za). Lublin.
LICHARDUS J./VLADÁR J. 1996, Karpatenbe-cken – Sintašta – Mykene. Ein Beitrag zurDefinition der Bronzezeit als HistorischeEpoche. Slovenská Archeológia 44/1,25–93.
LOZE I. 1993, Stone age amber in the EasternBaltic. In: BECK C./BOUZEK J. (Hrsg.),Amber in Archaeology. Proceedings of the Se-cond International Conference on Amber inArchaeology, Libice 1990. Praha, 129–140.
LYSENKO S.D. 1998, Rezultaty issledovaniamogilnika Malopolovetskoje–3 na Kievsciniev 1993–1997 godach. In: KOŚKO A./CZE-
BRESZUK J. (Hrsg.) „Trzciniec” – system kul-turowy czy interkulturowy proces? Poznań,95–117.
LYSENKO S.D. 2001, Sredne Podniprov’ya zadobi piznoi bronzi. Manuscript, InstitutArcheologii Nacionalnoj AkademiiNauk Ukraini. Kiev.
LYSENKO S.D. 2004, Doslidženiya k archeologi-cheskoy karte Fastivskogo raiona(1999–2004 gg.). In: Archeologicni pam-
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 211
jatki Fastivšcini. Materiali do archeologicnojkarti Kiivśkoj oblasti Fastiv, 85–152.
LYSENKO S.S. 2005, Ukrašenija epochi pozdnejbronzy Ukrainy. Archeologicni dos-lidžennja v Ukraini 7, 348–355.
LYSENKO S.D./LYSENKO S.S. 2009, GroundCommunications of the Eastern Area of theTrzciniec Culture Circle. In: KOŚKO
A./KLOCHKO V. (Hrsg.), Routes betweenthe seas: Baltic – Boh – Bug – Pont from the3rd to the middle of the 1st millennium BC.Baltic-Pontic Studies 14, 338–367.
MALEJEW J. 2006, Uwagi o kulturze Noa w do-rzeczu Dniestru. In: TARAS H. (Hrsg.),Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarow-skiego. Kształtowanie się nowej rzeczywisto-ści kulturowej w środkowej i młodszej epocebrązu. Lublin, 179–186.
MAKAROWICZ P. 1998, Rola społeczności kultu-ry iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgukulturowego (2000–1600 BC). Poznań.
MAKAROWICZ P. 2003, The Construction of So-cial Structure: Bell Beakers and TrzciniecComplex in North-Eastern Part of CentralEurope. Przegląd Archeologiczny 51,123–158.
MAKAROWICZ P. 2005, Gesellschaftliche Struk-turen der Glockenbecherkultur im Gebietzwischen Weichsel und Oder, Ethnogra-phisch-Archäologische Zeitschrift 46,1, 27–58.
MAKAROWICZ P. 2008, Elitarne pochówki zkurhanu komarowskiego w Ivanju na Wo-łyniu – zarys możliwości interpretacyjnych.In: BEDNARCZYK J./CZEBRESZUK J./MA-
KAROWICZ P./SZMYT M. (Hrsg.), Na po-graniczu światów. Studia z pradziejów mię-dzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowaneProfesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocz-nicę urodzin. Poznań, 333–352.
MAKAROWICZ P. 2009, Baltic-Pontic Interregio-nal Routes at the Start of the Bronze Age In:KOSKO A./KLOCHKO V. (Hrsg.), RoutesBetween the Seas: Baltic – Boh – Bug – Pontfrom the 3rd to the Middle of the 1st Millenni-um BC. Baltic-Pontic Studies 14,301–336.
MAKAROWICZ P. 2010a, Trzciniecki krąg kultu-rowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Za-chodu Europy. Poznań.
MAKAROWICZ P. 2010b, The Creation of NewSocial Space. Barrows of the Corded WareCulture and Trzciniec Circle as markers of amental map in the upland parts of Polandand western Ukraine. In: KIEL GRADUATE
SCHOOL “HUMAN DEVELOPMENT IN LAND-
SCAPES” (Hrsg.), Landscapes and HumanDevelopment: The Contribution of EuropeanArchaeology. Proceedings of the Internatio-nal Worksop “Socio-environmental dynamicsover the last 12,000 years: The creation oflandscapes, (1st–4th April 2009)”, Universi-tätsforschungen zur PrähistorischenArchäologie 191, Bonn, 203–215.
MAKAROWICZ P. 2011, Geneza kurhanów wtrzcinieckim kręgu kulturowym. In: KOWA-
LEWSKA-MARSZAŁEK H./WŁODARCZAK P.(Hrsg.), Kopce neolityczne i z początkówepoki brązu w świetle nowych i najnowszychbadań. Materiały z konferencji w Nie-połomnicach 20–21.09.2007. Kraków––Warszawa, 134–154.
MAKOHONIENKO M. 2009, Natural ScientificAspects of Prehistoric and Early HistoricTransit Routes in the Baltic-Pontic CulturalArea, In: KOŚKO A./KLOCHKO V. (Hrsg.),Routes Between the Seas: Baltic – Boh – Bug– Pont from the 3rd to the Middle of the 1st
Millennium BC. Baltic-Pontic Studies 14,19–71.
MAŁKOWSKI S. 1931, Z geologii Wołynia. Rocz-nik Wołyński 2, 385–391.
MAŁKOWSKI S. 1933, Nowe wiadomości o wys-tępowaniu miedzi w dorzeczu Horynia. Biu-letyn P.I.G. 36, 352–361.
MANNING S.W. 1995, The Absolute Chronologyof the Aegean Early Bronze Age. Archaeolo-gy, Radiocarbon and History. Sheffield.
MARKOVÁ K. 1993, Bersteinfunde in der slowa-kei während der Bronzezeit. In: BECK
C./BOUZEK J. (Hrsg.), Amber in Archaeo-logy. Preceedings of the Second InternationalConference on Amber in Archaeology, Libice1990. Praha, 171–178.
MAUSS M. 2001, Antropologia strukturalna.Warszawa.
MOZSOLICS A. 1967, Bronzefunde des Karpa-tenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdú-sámson und Kosziderpadlás. Budapest.
MOZSOLICS A. 1973, Bronze- und Goldfundedes Karpatenbeckens. Dopotfundhorizontevon Forró und Ópályi. Budapest.
OLEXA L. 2002, Kult. In: GANCARSKI J.(Hrsg.), 2002, Między Mykenami a Bałty-kiem. Kultura Otomani-Füzesabony. Kro-sno-Warszawa, 89–93.
ORDENTLICH I. 1969, Probleme der Befesti-gungsanlagen in der Siedlungen der Otoma-nikultur in deren rumänischen Verbreitungs-gebiet. Dacia 14, 457–474.
OSGOOD R./MONKS S./TOMS J. 1999, BronzeAge Warfare. Stroud.
212 P. Makarowicz
OTTO T.O./THRANE H./VANDKILDE H.(Hrsg.) 2006, Warfare and Society. Ar-chaeological and social Anthropological Per-spectives. Aarhus.
PAWLIKOWSKI M./DĄBROWSKI J./BUGAJ U.2007, Badania surowcowo-technologiczneceramiki ze starszej epoki brązu. Materiały iSprawozdania Rzeszowskiego OśrodkaArcheologicznego 28, 29–43.
PETRESCU-DIMBOVITA M. 1977, Depozitele debronzuri din România. Bucareæti.
POLANYI K./ARENSBERG M./PEARSON H.(Hrsg.) 1957, Trade and Market in the Ear-ly Empires. Illinois.
RASSMANN K., SCHOKNECHT U. 1997, Insyg-nien der Macht – die Stabdolche aus dem De-pot von Melz II. In: HÄNSEL A. u. B.(Hrsg.), Gaben an die Götter. Schätze derBronzezeit Europas. Berlin, 43–47.
RENFREW C. 1984, Approaches to Social Ar-chaeology. Edinburgh.
RENFREW C./BAHN P. 2002, Archeologia. Teo-rie. Metody. Praktyka. Warszawa.
ROBINSON CH./BACZYŃSKA B./POLAŃSKA M.2004, The Origins of Faience in Poland.Sprawozdania Archeologiczne 56,79–120.
RODAK T. 2003, Grób kultury pilińskiej ze sta-nowiska 1 w Chełmie, pow. Bochnia. In:GANCARSKI J. (Hrsg.), Epoka brązu i wcze-sna epoka żelaza w Karpatach polskich. Kro-sno, 205–214.
SAHLINS M. 1972, Stone Age Economics. Chi-cago.
SAHLINS M. 1992, Socjologia wymiany w spo-łeczeństwach pierwotnych. In: KEMPNY
M./SZMATKA J. (Hrsg.), Współczesne teo-rie wymiany społecznej. Zbiór tekstów. War-szawa, 131–172.
SANGMEISTER E. 1972, Social-ökonomischeAspekte der Glockenbecherkultur. Homo:Zeitschrift für die vergleichende For-schung am Menschen 23, 188–203.
SAVA E. 1998, Die Rolle der “östlichen” und“westlichen” Elemente bei der Genese desKulturkomplexes Noua-Sabatinovka. In:HÄNSEL B./MACHNIK J. (Hrsg.), Das Kar-patenbecken und die Osteuropaische Steppe.Nomadenbewegungen und Kulturaustauschin den vorchristlichen Metallzeiten (4000–500 v. Chr.). München-Rahden/Westf.,267–312.
SAVA E. 2002, Die Bestattungen der Noua-Kul-tur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronze-zeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestrund Westkarpaten. Kiel.
SHERRATT A. 1993, What Would a Bronze-AgeWorld System Look Like? Relations betweenTemperature Europe and the Mediterraneanin Later Prehistory. Journal of EuropeanArchaeology 1/2, 1–57.
SHERRATT A. 1994, The Emergance of Élites:Earlier Bronze Age Europe, 2500–1300 BC.In: CUNLIFEE B. (Hrsg.), The Oxford Illu-strated Prehistory of Europe. Oxford–NewYork, 244–276.
SPRINCZ E. 2003, Amber Artifacts of Hungaryfrom the Middle Bronze Age to the Hungari-an Conquest (from 1600 BC to 896 AD).In: BECK C.W./LOZE I.B./TODD J.M.,(Hrsg.), Amber in Archaeology. Proceedingsof the International Conference of Amber inArchaeology. Talsi-Riga, 203–212.
STANCZIK I./TÁRNOKI J. 1992, Jászdósa-Ká-polnahalom. In: MEIER-ARENDT (Hrsg.),Bronzezeit in Ungarn. Forschungen inTell-Siedlungen an Donau und Theiss.Frankfurt am Main, 120–127.
SUCHOWSKA P. 2010, Kontakty pomiędzy Eu-ropą Środkową i strefą egejską w drugimtysiącleciu p.n.e. PhD Manuscript. Po-znań.
SUJKOWSKI A. 1919, Geografia ziem dawnejPolski. Warszawa.
SULIMIRSKI T. 1964, Barrow-Grave 6 at Koma-rów. University of London Institute ofArchaeology Bulletin 4, 171–188.
SULIMIRSKI T. 1968, Corded Ware and GlobularAmphorae North-East of the Carpathians.London
SVEŠNIKOV I.K. 1968, Bogatyje pogrebenija ko-marovskoj kultury u s. Ivan’ja rovenskojoblasti, Sovetskaja Archeologija 2,159–168.
SVEŠNIKOV I.K. 1990, Srednij period bronzovo-go veka Prikarpat’ja i Volyni. Tshinetsko-ko-marovskaja kultura. In: Archeologija Prikar-pat’ja, Volyni i Zakarpatja. Kiev, 78–88.
SWIESZNIKOW I. 1967, Kultura komarowska.Archeologia Polski 12/1, 39–107.
SZYMASZKIEWICZ M. 1985, Wstępne badaniawykopaliskowe na cmentarzysku kultury pi-lińskij w Chełmcu, gm. loco, woj. nowosadec-kie. Acta Archaeologica Carpatica 24,147–152.
SZYNKIEWICZ S. 1987, Wymiana małżeńska.In: STASZCZAK Z. (Hrsg.), Słownik etnolo-giczny. Terminy ogólne. Warszawa–Po-znań, 370–371.
ŚLUSARSKA-MICHALIK K. 2003, Paciorki bur-sztynowe z Gordijewki. Vita Antiqua 5–6,76–84.
Zwischem baltischem Bernstein und transylvanischem Gold. Der Trzciniec-Kulturkreis... 213
ŚLUSARSKA K. 2009, Hordeevka – implicationsof archeological research on extra-regional re-lations (cultures of the Boh-Bug rivers ba-sin). In: KOŚKO A./KLOCHKO V. (Hrsg.),Routes between the seas: Baltic – Boh – Bug –Pont from the 3rd to the middle of the 1st mil-lennium BC. Baltic-Pontic Studies 14,368–374.
ŠARAFUTDINOVA I.N. 1986. Sabatinovskajakultura. In: BEREZANSKAJA S.S./OTRO-
ŠCENKO V.V./CEREDNICENKO N.N./ŠARA-
FUTDINOVA I.N. (Hrsg.), Kultury epochibronzy na territorii Ukrainy. Kiev, 83–116.
TARAS H. 1997, Krzemieniarstwo kultury trzci-nieckiej na wyzynach Wschodniomałopol-skiej i Zachodniowołyńskiej oraz na zachod-nim Polesiu. In: LECH J./PIOTROWSKA D.(Hrsg.), Z badań nad krzemieniarstwemepoki brązu i wczesnej epoki żelaza. War-szawa, 163–183.
TARAS H. 2007, The Directions of the LublinRegion Connections in the Older Bronze Peri-od. In: BARON J./LASAK I. (Hrsg.), LongDistance Trade in the Bronze Age and EarlyIron Age, Studia Archeologiczne XL.Wrocław, 251–269.
TUCKIJ W. 2005, Złoża bursztynu na Ukrainie iich wykorzystanie. In: KOSMOWSKA-CERA-
NOWICZ B./GIERŁOWSKI W. (Hrsg.),Bursztyn. Poglady, opinie. Materiały z semi-nariów Amberif 1994–2004. Gdańsk,36–39.
TUTSKIJ W./STEPANJUK L. 1999, Geologie undMinerologie des Bernsteins von Klessow,Ukraine. In: KOSMOWSKA-CERANOWICZ
B./PANER H. (Hrsg.), Investigations intoAmber. Proceedings of the International In-terdisciplinary Symposium: Baltic Amberand Other Fossil Resins 997 UrbsGyddanyzc. Gdańsk, 53–60
VANDKILDE H. 1996, From Stone to Bronze.The Metalwork of the Late Neolithic andEarliest Bronze Age in Denmark. Moes-gard.
WALLERSTEIN E. 1974, The Modern World-Sy-stem: Capitalist Agriculture and the Originsof the European World-Economy in the Six-teenth Century. New York.
WIETTENBERGER M. 2005, The Noua Cultureof Transilvania, PhD Manuscript, AICUniversity. Iaºi.
ZIĄBKA L. 1987, Cmentarzysko z II okresu epo-ki brązu z Borku, gm. Godzieszce Wielkie(stanowisko 1). In: Kultura trzciniecka wPolsce. Kraków, 89–105.
214 P. Makarowicz