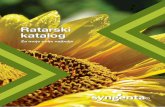Kernbereiche und Reformbedarf Auswärtiger Kultur - Katalog ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Kernbereiche und Reformbedarf Auswärtiger Kultur - Katalog ...
1
Kernbereiche und Reformbedarf Auswärtiger Kultur- und
Bildungspolitik des Bundes –
unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit ausgewählter
Goethe-Institute und Deutscher Schulen in Europa
Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
durch den
Promotionsausschuss Dr. phil.
der Universität Bremen
vorgelegt von
Elisabeth Altmann
Hohenstadt, den 10.04.2003
2
Die Arbeit hat dem Promotionsausschuss als Dissertation vorgelegen.
Gutachter:
1. Prof. Dres. Lutz Dietze
2. Prof. Dr. Alois Wierlacher
Colloquium am 27. August 2003
Nach dem Colloquium erfolgte für die Drucklegung eine redaktionelle
Überarbeitung. Inhaltlich wurde die Arbeit insbesondere durch die
Aufnahme von Literatur in den Teilen A und C11, sowie E aktualisiert
und ergänzt.
3
Inhaltsverzeichnis
Kernbereiche und Reformbedarf Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik des Bundes –
unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit ausgewählter Goethe-Institute und
Deutscher Schulen in Europa
A Einleitung ...................................................................................................................... 10
1. Abgrenzung des Themenbereichs und begriffliche Klärung........................................ 10
1.1. Das Untersuchungsfeld dieser Arbeit................................................................... 10
1.2. Begriffliche Klärungen......................................................................................... 13
1.3. Leitlinien für eine Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik................................ 30
1.4. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Zeichen der Globalisierung............ 35
1.5. Kulturföderalismus............................................................................................... 37
1.6. Absichten und Ziele der Arbeit ............................................................................ 38
2. Methodisches Vorgehen............................................................................................... 41
2.1. Primär- und Sekundärquellen............................................................................... 41
2.2. Aussagen, Selbstdarstellungen, Zitate.................................................................. 43
2.3. Interviews und Meinungsbilder............................................................................ 44
2.4. Fragebögen ........................................................................................................... 46
2.5. Teilnehmende Beobachtung................................................................................. 47
3. Wissenschaftliche Beiträge zum Reformbedarf ........................................................... 48
3.1. Deutsch als Fremdsprache................................................................................... 49
3.2. Die auswärtige Sprachpolitik .............................................................................. 50
3.3. Deutsche Universitäten und ihre Leistung für Deutsch als Fremdsprache .......... 51
B Aufbau und Mängel der dritten Säule der Außenpolitik.......................................... 58
1. Mittlerorganisationen .................................................................................................... 58
1.1. Die Mittlerorganisationen als Kultur- und Bildungsvermittler............................. 58
1.2. Auswärtige Bildungspolitik im Schulwesen ........................................................ 60
1.3. Geförderte Schulen............................................................................................... 69
1.4. Goethe-Institut...................................................................................................... 73
4
1.5. Inter Nationes (IN) bis 2001 ................................................................................ 82
1.6. Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)................................................................. 85
2. Herausforderungen für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik .......................... 91
2.1. Rückläufige Ausgaben und mangelnde Transparenz ........................................... 91
2.2. Das Goethe-Institut: Ein Markstein wird demontiert........................................... 92
2.3. Expertenanhörung zur Auswärtigen Kulturpolitik............................................... 94
3. Die Politik vernachlässigt die Akzeptanz der deutschen Sprache ............................. 104
3.1. Migranten in Deutschland haben schlechte Spracherwerbsbedingungen. ......... 105
3.2. Die Deutsche Sprache ist in der EU nicht ausreichend repräsentiert................. 106
C Goethe-Institute und Deutsche Schulen und ihr Reformbedarf.......................... 115
1. Auswahlkriterien...................................................................................................... 115
2. Großbritannien ........................................................................................................... 121
2.1. Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht in Großbritannien .................. 121
2.2. Goethe-Institut London ...................................................................................... 129
2.3. Interviewserie im Goethe-Institut London im September 1998......................... 131
2.4. Deutsche Schule London.................................................................................... 152
2.5. Interviews Deutsche Schule London.................................................................. 156
3. Frankreich................................................................................................................... 159
3.1. Das Goethe-Institut Paris ................................................................................... 161
3.2. Die Deutsche Schule Paris (DSP) ...................................................................... 162
4. Schweden ................................................................................................................... 167
4.1. Rahmenbedingungen zur Förderung der deutschen Sprache ............................. 167
4.2. Das Goethe-Institut Stockholm .......................................................................... 169
4.3. Die Deutsche Schule Stockholm........................................................................ 171
5. Tschechien.................................................................................................................. 177
5.1. Rahmenbedingungen zur Förderung der deutschen Sprache ............................. 177
5.2. Interview mit dem Leiter der Abteilung für Auslandsbeziehungen................... 184
5.3. Das Goethe-Institut Prag .................................................................................... 186
5.4. Interviews im Goethe-Institut ............................................................................ 187
5.5. Die Deutsche Schule Prag .................................................................................. 192
5.6. Interview in der Deutschen Schule Prag ............................................................ 197
6. Slowakei ..................................................................................................................... 204
6.1. Rahmenbedingungen für die Vermittlung der deutschen Sprache..................... 204
5
6.2. Das Goethe-Institut Bratislava ........................................................................... 210
6.3. Die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums Poprad................................ 212
7. Italien.......................................................................................................................... 217
7.1. Das Goethe-Institut Neapel ................................................................................ 217
7.2. Goethe-Institute in Italien unter Sparzwang ...................................................... 219
8. Portugal ...................................................................................................................... 222
8.1. Kulturpolitische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland .................. 222
8.2. Das Goethe-Institut Porto................................................................................... 223
8.3. Die Deutsche Schule Porto................................................................................. 224
9. Türkei ......................................................................................................................... 228
9.1. Rahmenbedingungen für die Vermittlung der deutschen Sprache..................... 228
9.2. Das Goethe-Institut Istanbul .............................................................................. 233
9.3. Die Schulreform in der Türkei ........................................................................... 235
9.4. Die Deutsche Schule Istanbul (Alman Lisesi) ................................................... 236
10. Russland ....................................................................................................................... 242
10.1. Das Goethe-Institut Moskau .......................................................................... 242
10.2. Bericht des Leiters des Goethe- Instituts ....................................................... 244
10.3. Die Deutsche Schule Moskau ........................................................................ 245
11. Reformbedarf, der sich aus Teil C ableitet............................................................ 250
11.1. Analyse der typischen Ergebnisse untersuchter Einrichtungen ..................... 250
11.2. Anstehende Reformen inhaltlicher Art .......................................................... 252
11.3. Organisatorischer und struktureller Reformbedarf ........................................ 270
D Befragung von Beschäftigten an Goethe-Instituten und Deutschen Schulen ........ 279
1. Die Entstehung des Fragebogens ............................................................................... 279
2. Methodische Vorgehensweise bei der Erstellung und Auswertung........................... 282
3. Fragebogenerhebung .................................................................................................. 284
4. Fragenbereiche ........................................................................................................... 286
4.1. Ausbildung/ Fortbildung .................................................................................... 286
4.2. Dialog und Partnerschaft.................................................................................... 286
4.3. Lehre vor Ort ...................................................................................................... 287
4.4. Europafragen ..................................................................................................... 287
4.5. Deutschlandbild.................................................................................................. 287
4.6. Zukunftspläne..................................................................................................... 288
6
4.7. Forderungen für die Zukunft .............................................................................. 288
5. Statistische Auswertung der Fragebögen ................................................................... 288
6. Interpretation und Ergebnisse der Untersuchung....................................................... 300
6.1. Ausbildung und Fortbildung .............................................................................. 300
6.2. Dialog und Partnerschaft.................................................................................... 305
6.3. Lehre vor Ort - Medieneinsatz im Fach Deutsch als Fremdsprache.................. 307
6.4. Europafragen ...................................................................................................... 309
6.5. Deutschlandbild/Studium in Deutschland.......................................................... 310
6.6. Zukunftspläne..................................................................................................... 312
6.7. Forderungen für die Zukunft .............................................................................. 313
7. Weitere Reformvorschläge aus den Fragebögen........................................................ 315
7.1. Verbesserungen für die Deutschen Schulen....................................................... 315
7.2. Abgleich mit politischen Entscheidungsträgern, sowie Primärquellen: ............ 317
7.3. Goethe-Institute - in Zukunft Europäische Kulturinstitute? .............................. 320
7.4. Unterschiedliche Sichtweisen ............................................................................ 321
E Zukunftsfähigkeit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ...................... 326
1. Politische Neuorientierung in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ........... 326
1.1. Für eine bessere Finanzierung der deutschen Auslandsschulen ........................ 333
1.2. Deutsche Schulen zukünftig in der Hand der Wirtschaft? ................................. 336
1.3. Stiftungen und Sponsoring in der Auswärtigen Kulturpolitik ........................... 339
2. Umstrukturierung von Goethe-Institut und Inter Nationes ........................................ 344
2.1. Finanzielle Aspekte und Schließungen .............................................................. 344
2.2. Vorstellungen zur Neuorganisation von Inter Nationes..................................... 348
3. Die Fusion zum Goethe-Institut Inter Nationes ......................................................... 351
3.1. Bergers Detailkonzept ........................................................................................ 351
3.2. Der Fusionsprozess ............................................................................................ 356
3.3. Altes Fundament ehrt man ................................................................................. 358
3.4. Eine Frau an der Spitze des Goethe-Instituts ..................................................... 359
F Fazit: Die Reform der dritten Säule ist unerlässlich............................................. 365
G Literaturverzeichnis ................................................................................................... 374
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS AA Auswärtiges Amt AKBP Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
7
AKP Auswärtige Kulturpolitik ADLK Auslandsdienstlehrkraft AvH Alexander von Humboldt-Stiftung BLASchA Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland BAT Bundes- Angestellten-Tarif BMBW Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft BMFT Bundesministerium für Forschung und Technologie BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (aktuell) BMW Bayerische Motoren Werke BMI Bundesministerium des Innern BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit BPLK Bundesprogrammlehrkraft BVA Bundesverwaltungsamt CDG Carl Duisberg Gesellschaft DaF Deutsch als Fremdsprache DAG Deutsche Auslandsgesellschaft DaZ Deutsch als Zweitsprache DiDaZ Didaktik des Deutschen als Zweitsprache DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst DFJW Deutsch-Französisches Jugendwerk DS Deutsche Schule DSL Deutsche Schule London DW Deutsche Welle EU Europäische Union FB Fachberater GDS Großes Deutsches Sprachdiplom GI Goethe-Institut GIIN Goethe-Institut Inter Nationes GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten HRK Hochschulrektorenkonferenz ifa Institut für Auslandsbeziehungen IN Inter Nationes KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland LPLK Landesprogrammlehrkraft MOE Mittel- und Osteuropa MOE /GUS Mittel- und Osteuropa und Gemeinschaft Unabhängiger Staaten PWD Prüfung für Wirtschaftsdeutsch PLK Programm Lehrkraft PV Pädagogische Verbindungsarbeit StADaF Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache SteuDaF Steuerungsausschuss Deutsch als Fremdsprache SMV Schülermitverantwortung VDA Verein für das Deutschtum im Ausland VIZ Vereinigung für Internationale Zusammenarbeit ZfA Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZD Zertifikat Deutsch ZDaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache ZDFB Zertifikat Deutsch für den Beruf ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung ZOP Zentrale Oberstufenprüfung
8
Vorwort
Als ich 1994 in den Bundestag eintrat, habe ich mich um das Gebiet der Auswärtigen
Kulturpolitik bemüht und wurde Sprecherin meiner Fraktion für diesen Bereich. Ich war
Mitglied und Verwaltungsrätin bei Inter Nationes und Mitglied im Goethe-Institut bis zum
Jahr 2001. So konnte ich mir viele Informationen direkt aus den Zentralen zugängig machen
und verwerten.
Entsprechende Berufserfahrung brachte ich mit: Unterricht von Kindern in Deutsch als
Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache, Ausbildung ausländischer Lehrkräfte in
Deutsch, die Abnahme und Erstellung abschließender Leistungsfeststellungen ”Deutsch für
ausländische Lehrer” für das Bayerische Kultusministerium, die Mitwirkung und Teilnahme
an der Lehrerfortbildung für interkulturelle Modellklassen sowie Erstellung von
Schulbuchgutachten im Bereich Deutsch als Zweitsprache für das Bayerische
Kultusministerium waren seit vielen Jahren meine beruflichen Aufgabengebiete.
1998 nahm ich in Stockholm als Mitglied der deutschen Delegation an der UNESCO-
Konferenz “Kultur und Entwicklung” teil, welche die Nachhaltigkeit der Auswärtigen Kultur-
und Bildung zum Thema hatte und die teilnehmenden Länder zu diesbezüglichen Aktivitäten
verpflichtete.
Ich erarbeitete ein breites Spektrum von Anfragen und Anträgen im Bundestag. Die Absicht
bei den Anfragen war, den Hintergrund der Auswärtigen Kulturpolitik auszuleuchten,
Schwachstellen zu erkennen und entsprechendes Zahlenmaterial für Verbesserungsvorschläge
zu erhalten. Damit befassen sich die Teile B “Aufbau und Mängel der dritten Säule der
Außenpolitik” und E “Zukunftsfähigkeit Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik” meiner
Arbeit.
Was mich besonders interessierte, waren die Aktivitäten der verschiedenen Einrichtungen. Ich
besuchte Goethe-Institute und Deutsche Schulen im Ausland, um ein klares Bild von den
Verhältnissen und Erfordernissen für zukunftsorientiertes Handeln zu gewinnen. Dabei
standen mir viele Gesprächspartner mit wertvollen Anregungen zur Verfügung. Die
Ergebnisse sind im Teil C “Ausgewählte Goethe-Institute und Deutsche Schulen in Europa
und ihr Reformbedarf” festgehalten und unter C11 zusammengefasst.
9
Die Akteure der Auswärtigen Kulturpolitik, bzw. die der Institutionen der Kulturarbeit, haben
in allen Teilen der Arbeit ihren Platz unter verschiedenen Gesichtspunkten. Z. B. wird die
Institution Inter Nationes im Teil B vorgestellt und ihr Aufgabenspektrum erläutert. In den
empirischen Teilen C und D zeige ich, wie Medien von Inter Nationes in den Deutschen
Schulen im Ausland und in den Goethe-Instituten eingesetzt werden. Dazu äußern die
Akteure Wünsche und Verbesserungsmöglichkeiten in den Interviews und den Fragebögen.
Im Teil E werde ich Vorschläge aus Politik und Gesellschaft, sowie auch meine eigenen Ideen
zur Erneuerung der Einrichtung von Inter Nationes und zur besseren Koordination mit
anderen Mittlern unterbreiten. Außerdem werde ich im Teil E den Vorgang der Fusion mit
dem Goethe-Institut zum Goethe-Institut Inter Nationes aufzeigen und kritisch hinterfragen.
Um eine breit gefächerte Informationsgrundlage zu erhalten, entwickelte ich einen
Fragebogen, den ich an die von mir besuchten Schulen und Goethe-Institute zur
Beantwortung schickte. Dieser Fragebogen entstand mit Unterstützung von Fachkräften aus
dem Goethe-Institut. Bei einem Rücklauf von ca. 80% erhielt ich eine Fülle von Material, das
ein Überdenken der bisher üblichen Vorgehensweise nötig macht. Dieses ist im empirischen
Teil D “Befragung der Beschäftigten an Goethe-Instituten und Deutschen Schulen” unter D 6,
D7: ”Interpretation und Ergebnisse der Befragung” als Analyse der typischen Ergebnisse
untersuchter Einrichtungen exemplarisch ausgewertet. Teil F “Fazit: Die Reform der dritten
Säule ist unerlässlich” richtet den Blick auf die Zukunft und zeigt kurz zusammengefasst
Reformvorschläge für eine transparente Entwicklung der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik auf, die aus den Befunden der vorliegenden Arbeit abgeleitet wurden.
10
A Einleitung
1. Abgrenzung des Themenbereichs und begriffliche Klärung
1.1. Das Untersuchungsfeld dieser Arbeit
Das Untersuchungsfeld dieser Arbeit ist die Auslandskulturpolitik und Kulturarbeit des
Bundes, im Bundeshaushaltsplan als “Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland” definiert.
Die “Ausgaben des Bundes auf dem Gebiet der Auswärtigen Kulturpolitik”1 sind auf neun
Ministerien und zahlreiche Institutionen öffentlicher und privater Art verteilt, deren Arbeit
unter den unterschiedlichsten Zielsetzungen und Aspekten, Aufgaben und Problemfeldern,
Schwerpunkten und Wirkungen skizziert und interpretiert werden könnten, allein
konzeptionell verbindlich sind bestenfalls die jeweiligen Rechtsgrundlagen. Nicht einmal die
Auftraggeber und Financiers und nicht die Verantwortlichen der maßgeblichen Träger
interpretieren diese Arbeit hinreichend präzise und operationalisierbar. Dies anhand von
einigen untereinander verschränkten Arbeitsschwerpunkten und durch Befragungen und
Stellungnahmen der Akteure in den Instituten und Schulen zumindest bereichsspezifisch und
beispielhaft herauszufinden, ist Thema dieser Arbeit.
Bezüglich der Ebene der Ministerien geht es in der Arbeit einerseits um den Geschäftsbereich
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, welchem bisher z.B. die
institutionelle Förderung von Inter Nationes oblag, und andererseits vor allem um den
Aufgabenbereich des Auswärtigen Amtes. Die Gesamtausgaben des Bundes auf diesem
Gebiet betragen im Jahr 1999 in etwa 3,29 Milliarden DM, auf neun Ministerien verteilt. Im
6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik (2001)2 wird aus der Statistik
1 Deutscher Bundestag: Entwurf zum Haushaltsplan des Bundes 1999, Einzelplan 05, Übersicht 2. Anlage zur
Drs.13/11100. 2 Deutscher Bundestag: 6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik (2001). Drs.14/9760.
3.7.2002. S.7.
11
der diesbezügliche Ansatz des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung herausgenommen, sodass als Ausgaben des Bundes insgesamt für 2002 1.127,6
Millionen € erscheinen, davon 564, 7 Millionen € für den Bereich des Auswärtigen Amtes.
Etwas mehr als die Hälfte der Gesamausgaben für die AKBP wird also über den Einzelplan
des Auswärtigen Amtes ausgegeben, davon in etwa je ein Drittel für das Goethe-Institut und
für die Deutschen Schulen im Ausland.
Im Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 2001 wird eine wichtige
Namensänderung bekannt gegeben: “Über die Hälfte Mittel im Kulturhaushalt des
Auswärtigen Amtes ist dem Bildungsbereich gewidmet [...]. Damit dies auch nach außen zum
Ausdruck kommt, hat das Auswärtige Amt zu Beginn des Jahres 2001 die Kulturabteilung in
‚Abteilung für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik,’ umbenannt.”3 (Abgekürzt: AKBP)
Der Begriff “Bildung”, der im Bericht der Bundesregierung für die Arbeit der Deutschen
Schulen im Ausland steht, war bis zu diesem Zeitpunkt unter dem Oberbegriff der Kultur
subsumiert.
Aus den Bereichen der Kultur und der Bildung rücken aufgrund der Umstrukturierungen des
Goethe-Instituts (Kultur) und der Veränderungen in den Deutschen Schulen im Ausland
(Bildung) diese beiden Themenspektren in den Vordergrund. Vor allem soll der
Umstrukturierungsprozess des Goethe-Instituts dargestellt und die Situation in den
Deutschen Schulen im Ausland zur Diskussion gestellt werden.
Zentrale Institutionen der Auswärtigen Kulturpolitik des Bundes sollen präsentiert werden.
Dazu gehören ebenso das Weltstadtinstitut in London wie das kleine, von der Schließung
bedrohte Institut in Neapel.
Meine Erfahrungen als Mitglied des Bundestages mit dem Aufgabenschwerpunkt
“Auswärtige Kulturpolitik” fließen hier ein. Sie beruhen auf Teilnahmen an Anhörungen und
Sitzungen sowie auf meinen Fragestellungen z. B. zur Anhörung “Bestandsaufnahmen und
Perspektiven der auswärtigen Kulturpolitik” an die Experten. Bisher waren Doktoranden auf
diesem Gebiet noch nicht Mitglieder des Bundestages. Wäre diese Arbeit nicht geschrieben
worden, so würden die dort gemachten Erfahrungen der Öffentlichkeit verloren gehen. Die
3 Deutscher Bundestag: 6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik (2001). Drs.14/9760.
3.7.2002. S.4.
12
Form der in den Bundestag eingebrachten Anträge sagt oft noch nichts darüber aus, wie die
Erkenntnisse gewonnen wurden. Das möchte ich in vorliegender Arbeit darlegen.
Ferner soll es darum gehen folgende Absichtserklärungen der Politik auf ihre Ernsthaftigkeit
zu überprüfen: “Die Auswärtige Kulturpolitik ist die dritte Säule der Außenpolitik” und: “Die
Kulturpolitik ist ein wichtiger Eckpfeiler für die nachhaltige Entwicklung.”4
Während Teil B die offiziellen Aufgaben der Kernbereiche skizziert und Mängel benennt,
stellt Teil C die Arbeit einzelner Deutscher Schulen und Goethe-Institute und den Einsatz der
Mitarbeiter in den Einrichtungen in ausgewählten Ländern Europas dar. Die Präferenz der
Institute und Schulen war allerdings nicht, wie zu zeigen sein wird, zufällig. Der Einfluss der
Politik auf die Gedankenwelt und auf die Handlungsebene in der Auswärtigen Kulturarbeit
kommt in den Interviews zum Vorschein. Dabei ist es ein Anliegen, die Schieflage zwischen
dem Engagement der Beschäftigten und den oft abstrakten Aussagen und Allgemeinplätzen
der Politik aufzuzeigen. Die hinterfragende Darstellung des Aufgaben- und
Arbeitsverständnisses der Vermittler ist der Schwerpunkt. Nur teilweise untersucht wurde die
Wirkung auf die Adressaten der kulturellen Arbeit und der Bildungsaktivitäten.
Im Teil C und D soll in den Fragebögen und Interviews eruiert werden, ob das Personal in der
Kulturarbeit an Fragen der Zukunftsfähigkeit, an globalen und ökologischen
Herausforderungen, an Fragen der Völkerverständigung, der realistischen Außendarstellung
Deutschlands, an interkulturellem Zusammenleben und Lernen interessiert ist.
Dabei waren im Interesse der Aussagekraft des empirischen Materials Eingrenzungen
vorzunehmen, insbesondere im Hinblick auf die kulturellen Themen, Aktivitäten und deren
Reichweite für die Zukunft. Ausgangspunkt ist hierbei das derzeitige Aktionsprogramm, aber
ebenso sind es die Wortmeldungen der Betroffenen. Dadurch wird hoffentlich ein kleiner,
aber sehr wichtiger Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik verständlicher als
bisher. Es hätte den Rahmen gesprengt, die Auswärtige Kulturarbeit anderer Nationen zu
untersuchen, dies ist auch für das Ziel der Arbeit nicht erforderlich. Auf die Auswärtige
Kulturpolitik Großbritanniens allerdings soll, weil sie im Gegensatz zur deutschen
Kulturpolitik zentral über eine Institution vermittelt wird, ein Blick geworfen werden. Die
institutionellen Strukturen der Mittlerorganisationen sollen als Bestandteile der “dritten
4 Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung: Kultur und Nachhaltigkeit. Thesen und Ergebnisse aus
einem Ideenworkshop. Berlin, 11./12.12.2001.
13
Säule” Auswärtiger Kulturpolitik und deren dauerhafter Tragfähigkeit betrachtet werden.
Eine Institutionenkritik findet im Rahmen dieser Arbeit in Hinblick auf die vorgenommenen
Umstrukturierungen statt.
Die zentralen Begriffe waren so abzugrenzen, bzw. so zu definieren, dass sie als
Orientierungsmarken für den empirischen Teil der Arbeit und den daraus zu ziehenden
Folgerungen passten, ohne den durchaus divergenten Positionen der Akteure vor Ort
Schablonen anzupassen (Interkulturalität bzw. erweiterter Kulturbegriff, statt
Multikulturalität). Mit der empirischen Untersuchung ist angestrebt worden, aussagekräftige,
d.h. für die Zukunft bedeutsame Ergebnisse zu erhalten. Der Untersuchungszeitraum
erstreckte sich auf die Jahre 1996-2002. Die Interviews und Beschreibungen der
ausgewählten Goethe-Institute und Deutschen Schulen in Europa sowie die Fragebögen an die
Beschäftigten entstanden vor allem im Jahre 1998.
1.2. Begriffliche Klärungen
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Bundes
Nach Gründung des Norddeutschen Bundes ging 1870 aus dem Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten das Auswärtige Amt hervor. Das Ende der Monarchie brachte 1918/19 eine
Umgestaltung des Amtes, indem die alte Unterscheidung zwischen diplomatischem und
konsularischem Dienst gemildert wurde, die wirtschaftspolitischen Außenbeziehungen
gestärkt, eine verwaltungsmäßige Aufgliederung des Amtes nach Weltregionen
vorgenommen und erstmalig eine Kulturabteilung gegründet wurde. Nach dem
Zusammenbruch des Dritten Reiches kam es 1950 zur Eröffnung einer “Dienststelle für
auswärtige Angelegenheiten” im Kanzleramt. Erst im März 1951 wurde das Auswärtige Amt
wieder eingerichtet, dessen Leitung Bundeskanzler Adenauer übernahm. Der erste
Außenminister war dann Heinrich von Brentano 1955-1961. Die Auswärtige Kulturpolitik
(AKP) wurde im Jahre 2001 in “Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Bundes”
(AKBP) umgenannt. Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik des Bundes pflegt die
internationalen kulturellen Beziehungen Deutschlands, ist finanziert über den
Bundeshaushalt, organisiert in Kooperation des Auswärtigen Amtes (AA) und anderer
Ministerien mit den Mittlerorganisationen. Durchgeführt wird die konkrete Arbeit im Ausland
durch die von den Mittlerorganisationen betriebenen Institutionen vor Ort. Die Auswärtige
Kulturpolitik des Bundes will die deutsche Sprache im Ausland fördern, die kulturelle
14
Präsenz gewährleisten, Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland, die sich im Ausland
befinden, Anschluss an die kulturelle Entwicklung in Deutschland geben, sowie deren
Kindern eine Schulbildung nach deutschen Standards ermöglichen. Schülern aus den
Gastländern soll in Deutschen Schulen im Ausland der Zugang zu deutscher Bildung und
deutschen Abschlüssen ermöglicht werden. Dabei folgen aus politischen
Schwerpunktsetzungen auch kultur- und bildungspolitische Aktivitäten. „Bei dem Begriff
„auswärtige Kulturpolitik“ handelt es sich um ein semantisches Feld, das sich im Laufe seiner
geschichtlichen Entwicklung mit immer neuen Inhalten angereichert hat. Es ist ein
sogenanntes „mot-valise“, ein Terminus, in den, wie es auch bei einem Koffer möglich ist, je
nach Bedarf Unterschiedlichstes hineingesteckt werden kann.“5 Es werden zum Beispiel die
kulturellen Beziehungen zu Ländern besonders betont, mit denen Deutschland eng verbunden
ist oder verstärkte Kontakte knüpfen will. Nach der Wende war dies zu den Ländern
Mitteleuropas (MOE) der Fall. Wie sich aus den empirischen Untersuchungen der
vorliegenden Arbeit zeigen wird, manifestiert sich Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
und ihre Ausführung in einer Vielfalt von erzieherischen, informativen und künstlerischen
Angeboten. Sie ist bestimmt von der örtlichen Nachfrage und von politischen und
wirtschaftlichen Absichten im Heimatland.
Auswärtige Kultur und Bildung als dritte Säule der Außenpolitik
„Eine der wichtigsten und am meisten zitierten Selbstkennzeichnungen auswärtiger
Kulturpolitik [...] ist die Metapher der ´dritten Säule´ staatlicher Außenpolitik.“6 Bei seiner
Regierungserklärung 1969 rief der damalige Bundeskanzler Willy Brandt die Auswärtige
Kulturpolitik zur “dritten Säule” der Außenpolitik, neben der Außenwirtschafts- und der
Sicherheitspolitik, aus. Formuliert hatte er diese Metapher schon 19677. Hatte sich doch bei
ihm die Erkenntnis durchgesetzt, dass man vor allem über den Austausch, in den Deutschen
Schulen im Ausland, in den Goethe-Instituten, über die Arbeit des Deutschen Akademischen
5Znined-Brand, Victoria: Deutsche und französische auswärtige Kulturpolitik. Eine vergleichende Analyse.
Frankfurt am Main, 1999. S.17. 6Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation. Möhnesee, 2000. S.447. 7 Brandt, Willy: Bemerkungen zur auswärtigen Kulturpolitik. In: Auswärtige Kulturbeziehungen 4 (1967),
S.11-13.
15
Austauschdienstes (DAAD) junge Menschen vieler Nationen ansprechen, ihnen ein
aktualisiertes Deutschlandbild vermitteln und damit gegenseitig Verständnis und Toleranz
befördern und Vorurteile abbauen könne. Die Auswärtige Kulturpolitik, die dazu die
Rahmenbedingungen stellen sollte, wurde zu einem “tragenden Pfeiler”8 der deutschen
Außenpolitik erklärt. Diese Metaphern sind bis heute in ihrer programmatischen Aussagekraft
nicht zurückgenommen worden. Damit ist anzunehmen, dass die Bedeutung der dritten Säule
auch für die Bedeutung der ersten und zweiten Säule virulent ist.
Fünf Hypothesen über die funktionale Bedeutung der dritten Säule sollen genannt werden:
1. Auswärtige Kulturpolitik ist in Abhängigkeit von der ersten Säule zu sehen. So stand
sie z. B. in der DDR im Dienste der ersten Säule. In der Vermehrung der Staatsmacht
wurde ihr Dienst gesehen. Auch Huntington sieht den Zweck der Kulturpolitik wohl
eher fremdbestimmt durch die Politik, um der eigenen Nation größeres Gewicht und
damit Handlungsfreiheit zu gewähren. (Siehe B 2.3.)
2. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass die Funktion der Kulturpolitik darin besteht,
Ansehen und Reputation zu gewinnen und einen guten Ruf für ein Land herzustellen.
3. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Auswärtige Kultur in den Dienst der zweiten
Säule, der Wirtschaft, zu stellen und als Exportmotor zu sehen.
4. Es gibt es eine Konstruktion, in der es nur um den Austausch geht, Multikulturalität,
ein respektiertes Nebeneinander, keiner darf verlieren, eine win-win Situation soll
entstehen.
5. Die Eigenständigkeit Auswärtiger Kultur und Bildung, das heißt eine weitgehende
Unabhängigkeit der dritten von den beiden anderen Säulen und eine entsprechende
Standfestigkeit, ist eine fünfte Alternative.
Eine Untersuchung etwaiger Eigenständigkeit mit dem Recht z. B. auf die eigene Sprache
lässt sich nicht unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftspolitik sehen, beinhaltet nicht
wirtschaftlichen oder politischen Imperialismus. Eigenständigkeit mit dem Recht der
Förderung des Deutschen als Fremdsprache hat Auswirkungen auf das Feld der Wirtschaft.
Eine einseitige Betonung des Deutschen als Fremdsprache ist in diesem Untersuchungsfeld
nicht hilfreich.
8 Auswärtiges Amt 1972: Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik, Bonn, S.781.
16
Das Epitheton ´auswärtig´
So fragt Victoria Znined-Brand: „Wie sind die einzelnen Bestandteile, „auswärtig“, „Kultur“,
und „Politik“ zu determinieren? Wie sind sie untereinander zu gewichten?“9 Richard
Martinus Emge definiert folgendermaßen: „Was soll uns auswärtig bedeuten? Es ist zu
erwarten, dass der Begriff für den Soziologen weiter gefasst werden muss als für den Staats-
und Völkerrechtler, und dass er damit, wie in allen solchen Fällen, an Schärfe verliert, liegt
auf der Hand. [...] Von auswärtigen Angelegenheiten spricht man in Hinblick auf Staaten. Es
handelt sich um die Beziehungen eines Staates zu den anderen, um den Bereich derjenigen
staatlichen Aktivität, die die Interessen des eigenen Landes oder die Interessen der eigenen
Staatsangehörigen im Ausland wahrnimmt.“10 Grenzüberschreitende staatliche Aktivitäten
werden im auswärtigen Bereich wahrgenommen, die immer auch mit der Auseinandersetzung
mit dem Anderen, dem Fremden zu tun haben. So stellt Barthold C. Witte fest: „Wenn
Außenpolitik die Gesamtheit staatlichen Handelns ist, das sich auf das Verhältnis zu anderen
Staaten bezieht, so besteht sie weitgehend aus dem Umgang mit dem ´Fremden´. Dies gilt
verstärkt für auswärtige Kulturpolitik, weil diese die gesellschaftlichen Lebensbedingungen
und das kulturelle Schaffen der Völker unmittelbar, nicht erst in politischen und
ökonomischen Sachfragen, zum Thema zwischengesellschaftlicher und kultureller Begegnung
macht.“11 Alois Wierlacher, der den cultural turn der Geisteswissenschaften und den
xenologischen turn der Fremdkulturwissenschaften in zahlreichen Publikationen ausleuchtet,
weist auf die Doppelbedeutung des Begriffs ´fremd´ hin: „Der lateinische Ausdruck ´hospes´
heißt im Deutschen ´Gast´ und ´Fremder´; diese Doppelbedeutung ist im englischen
´hospitality´ und frz. ´hospitalité´ erhalten geblieben; [...] Menschen benötigen den Stachel
des Fremden, um nicht früher oder später zu erstarren. Er ist lebenswichtig, weil das Andere
als das Fremde immer auch das Neue ist, in der Neuheit aber die fermentive Kraft des
Fremden steckt, die uns zu irritieren und zu verängstigen und über diese irritierende
9 Znined-Brand Victoria: Deutsche und französische Kulturpolitik. Frankfurt am Main, 1999. S.17. 10Emge, Richard Martinus : Auswärtige Kulturpolitik. Eine soziologische Analyse einiger ihrer Funktionen,
Bedingungen und Formen. Berlin 1967. S. 43. 11Witte, Barthold C.: Fremdheitswissen als Basis auswärtiger Kulturpolitik. In: Kulturthema Fremdheit. Alois
Wierlacher. Hg., München 1993, S.451.
17
Verängstigung zu verlebendigen und auf andere Gedanken, Ansichten und Überzeugungen zu
bringen vermag. Dieses Neue ist auf der Zeitachse zugleich das Zukünftige; alle Angst vor
der Zukunft besitzt Eigenschaften der Xenophobie, die kulturelle Wandlungen auch dann
erschwert, wenn diese unvermeidlich zu sein scheinen.“12 In diesem Zusammenhang erscheint
es auch wesentlich, zu fragen, inwieweit das Auswärtige im Sinne einer Bestätigung
anerkannt wird. Wird das auswärtige Land als anderes Land mit anderem aber gleichwertigem
kulturellem Umfeld betrachtet? Sollen die eigenen Maßstäbe angesetzt werden oder soll der
Versuch unternommen werden, im Akt der Anerkennung, „das erkennende, prüfende und
bestätigende Zuschreiben einer Identität als Alterität“13 zu vollziehen? Denn „Anerkennung
im beschriebenen Sinne des Wortes ist da gegeben, wo sich das erkennende Ich mit der
reflexiv prüfenden Zuerkennung von Identität dialektisch mitbegründet“14 und nur unter
dieser Voraussetzung kann es Partnerschaft und partnerschaftlichen Austausch geben.
Für die vorliegende Arbeit relevante Aspekte der Kultur und Interkulturalität
Wie schon unter 1.2.1. festgestellt, ist der Bereich der Kultur- und Bildungspolitik, den diese
Arbeit umfasst, einerseits durch politisch festgelegte Aufgaben beschrieben, andererseits
sollen die Rahmenbegriffe Kultur, Interkulturalität und interkulturelle Bildung, die dieser
Arbeit zu Grunde liegen, näher definiert werden.
Dem Kulturbegriff in der Auswärtigen Kulturpolitik ist ein Kapitel des Werkes von Alois
Wierlacher “Architektur Interkultureller Germanistik” gewidmet. Hier legt er einen
Begriffsdissens offen: “Lattmann aber, 1969-1973 Vorsitzender des Verbandes deutscher
Schriftsteller (VDS), denkt bei Kultur an “zeitgenössische Kunst und Literatur. In Beispielen
aus der Literatur zeigt Wierlacher den Kulturbegriff Max Frischs und Heinrich Bölls auf.
“Der Begriff der Kultur wird von Benn und Böll hauptsächlich im Sinne der lateinischen
12 Wierlacher Alois: Kulturwissenschaftliche Xenologie. 4. Zur Xenologie als Wissenschaft vom epistemisch
Fremden und vom Neuen. In: Konzepte der Kulturwissenschaften. Nünning/Nünning, Hg. Stuttgart, 2003.S.298. 13 Wierlacher, Alois. Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg.:
Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart, 2003. S.200. 14 ebd.
18
cultura verwandt; mit Frisch fordert Böll den Staat zu dieser cultura auf.”15 [...]„Kultur wird,
so ist zu resümieren, auch in der auswärtigen Kulturpolitik weiterhin als “Rubrik, abseits von
Politik und Wirtschaft” begriffen, die Frisch mit Thomas Mann, Böll und Benn aufzusprengen
suchten. Insofern ist das Resultat unserer Untersuchungen auch ein Indiz für die politische
Wirkungslosigkeit der Literatur. Die Kunstträger auf der einen, die Kulturträger auf der
anderen Seite, zu der auch die in den Assoziationsübungen Befragten zu rechnen sind, haben
gruppendivergierende Begriffe. Darüber hinaus besteht über die Relation der Begriffe ´Kunst`
und ´Kultur` auch unter den Schriftstellern keine Einigkeit.”16
In der vorliegenden Arbeit findet unter dem Kapitel “Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
als wichtiger Bestandteil der deutschen Außenpolitik” eine Verortung der Autorin in einem
erweiterten Kulturbegriff17 statt, dessen Prinzip durch den offenen Kulturbegriff gefestigt
wird: „Diese Forderung nach der Erweiterung des Kulturbegriffs wird zum ersten Mal in den
Leitsätzen für Auswärtigen Kulturpolitik (1973) (vom Kabinett nicht verabschiedet)
aufgestellt.”18 „Zur Festigung dieses Prinzips wurde in den neunziger Jahren vorgeschlagen,
die Konzeption des erweiterten Kulturbegriffes durch das Konzept eines offenen
Kulturbegriffes zu ersetzen, der seine Offenheit auch als Anschlussfähigkeit definiert.”19/20
Hier bezieht sich der Autor Gerd Ulrich Bauer, dessen akademischer Lehrer Alois Wierlacher
war, auf die erste der 25 Thesen des Beirats Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts
15 Wierlacher, Alois: Die Gemütswidrigkeit der Kultur. In: Architektur interkultureller Germanistik, München,
2001, S 213. 16 ebd. S.217. 17 Zu den verschiedenen mehr als 150 Kulturbegriffen siehe Baecker, Dirk: Kultur. In: Ästhetische Grund-
begriffe, Barek, Karlheinz, Hg., Band 3, Stuttgart, 2001, S.510ff., (S.555f.) sowie
Baecker, Dirk: Wozu Kultur? Programm und Kultur S.133, unbestimmte Kultur S.133, Einwand und Kultur
S.98, Kultur als Medium S.110. 2. Auflage, Berlin 2002.
Eagleton, Terry: Was ist Kultur?. Versionen der Kultur. S.7. Kultur in der Krise. S.48. München, 2001.
Esser, Hartmut: Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 6: Sinn und Kultur. Frankfurt/Main. 2001. 18 Wierlacher, Alois: Der Kulturbegriff in der Auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. In:
Architektur interkultureller Germanistik, München, 2001, S.214. 19 Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation. Wierlacher, Alois, Hg.,
Möhnesee, 2000, S. 445. 20 vgl. Strecker, Ivo: Kultur. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Gert Ueding, Hg., Band 4, Tübingen,
1998, Spalte 1384ff (1437f).
19
aus dem Jahr 1991. Dem erweiterten Kulturbegriff wurde eine Absage erteilt, weil dieser sich
beliebig ausgedehnt habe und man forderte eine Neuakzentuierung in Richtung offener
Kulturbegriff. Dieser solle stärker ethisch verantwortet, historisch begründet und ästhetisch
akzentuiert sein. Joachim Sartorius, ehemaliger Generalsekretär des Goethe Instituts, der die
Wendung zum „offenen Kulturbegriff“ unterstützte, wendete sich darüber hinaus gegen
Lehrwerke, die sich zu sehr an Alltagssituationen orientieren und plädierte für die Aufnahme
von Kunst und Literatur in diesen Werken.21 In der zweiten These - Zum politischen
Kulturbegriff - heißt es: „Der Antagonismus „Kultur/Zivilisation ist veraltet.“22 Ein kurzer
Rückblick in die Geschichte des Kulturbegriffs verdeutlicht den Grund dieser Aussage.
„Kultur und Bildung besetzen im deutschen Idealismus eine zunehmend antiaristokratisch
und anti-französisch konnotierte Gegenposition zu ´Zivilisation´ und beide Begriffe
verfestigen sich u.a. bei Johann Heinrich Pestalozzi und Wilhelm von Humboldt und v.a. ab
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur scharfen Antithese.“23
„Nach einer Bedeutungsverengung auf religiösen cultus und landwirtschaftliche cultura im
Mittelalter setzt mit der Renaissance der Antike die neuzeitliche Entwicklung von cultura und
´Cultur´ zu einem abstrakten und selbständigen Begriff in der Gelehrtensprache ein. Dessen
erweitertes Bedeutungsfeld betrifft nun die verbesserbaren, insofern historische kontingenten
- wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, religiösen Bedingungen menschlicher Sozialität
insgesamt und wird nur durch den Gegenbegriff einer ´Natur´ begrenzt, die es zu bearbeiten
und zu domestizieren gilt.“24 Ein erweiterter Kulturbegriff versteht Erweiterung in dem Sinne,
dass Alltagskultur als Teil der Kultur verstanden wird. Der “erweiterte Kulturbegriff” geht auf
Pufendorf (1684) zurück. “Er subsumiert der ‚cultura’ sämtliche von Menschen als
gesellschaftliche Wesen gestaltete Lebensformen und Objektivationen.”25
21 Sartorius, Joachim: Für eine subversive Kultur. In: Die Zeit. 6.12.96. S.45. 22Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts 1991: 25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung im
Ausland. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18 (1992), Hg. Alois Wierlacher u. a., S. 547-551 23 Ort, Claus-Michel: Kulturbegriffe und Kulturtheorien. Vom normativen Kulturbegriff zur Kulturtheorie. In:
Konzepte der Kulturwissenschaften. Ansgar Nünning und Vera Nünning, Hg., Stuttgart 2003. S. 19. 24 Ebd. 25 Ueding, Gert, Hg.: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Band 4, S.1411, [20].
20
Das enge, traditionelle Kulturverständnis wird in den 70er Jahren mit dem erweiterten
Kulturbegriff durch eine Soziokultur ergänzt. Die Leitkulturdebatte aus den Jahren 2000/2001
in Deutschland zielte hingegen nicht auf Offenheit und Erweiterung, sondern eher auf eine
spezifisch “deutsche Kultur”, die Vielfalt und Toleranz ausschließen wollte.
Interkulturalität ist ein Rahmenbegriff, der sich aus den Wörtern ´inter´ und ´Kultur´
zusammensetzt: „In seiner weiteren Bedeutung wird der Begriff der Interkulturalität im
Folgenden als Bezeichnung eines auf Verständigung gerichteten, realen oder dargestellten
menschlichen Verhaltens in Begegnungssituationen verstanden, an denen einzelne Menschen
oder Gruppen aus verschiedenen Kulturkreisen in diversen zeitlichen continua beteiligt
sind.“26[...]„Mit der interkulturellen Pragmatik werden als interkulturell also solche
Kommunikationsprozesse angesehen, in denen, bezogen auf den jeweiligen dialogischen
Prozess, geteiltes Wissen als Grundlage der Verständigung gezielt hergestellt wird, aber nicht
um unterschiedliche kulturelle Orientierungen zu überbrücken.27 Diese Divergenzen gilt es
bewusst zu machen. Um für Verständnis der Andersartigkeit bei den jeweiligen Partnern zu
werben, bedarf es der interkulturellen Vermittlungsarbeit.
In “Was soll Vermittlung heißen?” schlägt Wierlacher am Ende des Kapitels ‚Vom Begriff
des Blickwinkels’ vor: “Mit dem Wort Vermittlung soll zukünftig, so möchte ich die
Überlegungen resümieren und abschließend empfehlen, der Versuch bezeichnet werden, eine
tragfähige kulturelle Zwischenposition sowohl im kulturellen Dialog der Wissenschaft als
auch bei der Verknüpfung von Interessen der Lehrenden und der Lernenden zu
konstruieren.”28
Neuorientierung: Interkulturelle Erziehung und Interkulturelles Lernen
Eine Neuorientierung der Interkulturalität stellt Gabriele Pommerin im Handbuch Deutsch als
Fremdsprache unter dem Kapitel “Interkulturelles Lernen” vor. Zur begrifflichen Klärung
stellt sie fest, “dass die in diesem Kontext gebräuchlichen Begriffe sowohl das Arsenal einer
26Wierlacher, Alois: Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. In: Handbuch interkulturelle Germanistik.
Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg.. Stuttgart, 2003. S.257. 27ebd. S.262. 28 Wierlacher, Alois: Vom Begriff des Blickwinkels. In: Architektur interkultureller Germanistik, München,
2001, S.318.
21
pädagogischen Fachsprache darstellen, zugleich aber auch in den Medien und in der
Umgangssprache verwendet werden, so dass einmal die gleichen Begriffe sehr
Unterschiedliches meinen.”29 “In Konzepten der interkulturellen Erziehung steht der
Educandus und die Erziehung, die ihm angediehen wird, im Vordergrund.[...] In Konzepten
des “Interkulturellen Lernens” dagegen werden zwar auch Menschen unterschiedlichen Alters
[...] angesprochen; die Beziehung zwischen ihnen ist aber auf Symmetrie angelegt.
Interkulturelles Lernen ist auch nicht beschränkt auf schulische Ausbildung oder akademische
Bildung; es findet lebenslang und in allen Lebensbereichen statt.”.30 Die Situation ließe sich,
wie zu zeigen sein wird, zur Interkulturellen Erziehung an Deutschen Auslandsschulen
trefflich nutzen, um “.. die Vorteile der Bilingualen Erziehung, nämlich die Berücksichtigung
der Herkunftssprache und -kultur von Kindern und Jugendlichen nicht-deutscher Herkunft,
mit den positiven Möglichkeiten eines Integrierenden Unterrichts, der den Kontakt zur
Mehrheitsgesellschaft in allen Bereichen des Lebens fördert”31, umzusetzen. Für Deutsche
Auslandsschulen aller Schultypen kann der Vorschlag gelten: „Beide Sprachen und Kulturen
müssen von klein auf kontinuierlich und systematisch berücksichtigt werden. Sie müssen
Eingang in die Curricula aller Schultypen und Schulformen finden, nicht nur im
Sprachunterricht selbst, sondern in allen ´kultursensitiven´ Fächern (Reich 1993).”32 Hier
kann bei Fortbildungen der Lehrkräfte angesetzt werden, wo Interkulturelle Lernkonzepte, die
von Gemeinsamkeiten und nicht vom Trennenden zwischen den Schüler/innen verschiedener
Nationen ausgehen, erarbeitet werden. Sie intendieren, nach Gabriele Pommerin, Erziehung
zu Mehrsprachigkeit und ermöglichen Fremdheitserfahrungen. Sie bedürfen zur Umsetzung
einer inneren und einer äußeren Schulreform.33 Interkulturelle Erziehung kann dann mit der
“Europäischen Dimension” [...] „mit den für interkulturelles Lernen spezifischen Prinzipien
von Handlungsorientierung, Situationsbezug, Dialogorientierung und Nachbarschafts-
orientierung durch entsprechende Angebote eines “Lernens in und für Europa” kombiniert
29Gabriele Pommerin-Götze: Interkulturelles Lernen. In: Deutsch als Fremdsprache Ein internationales
Handbuch. Gerhard Helbig/Lutz Götze/Gert Henrici/Hans-Jürgen Krumm Hg.,
Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001, , S 973. 30ebd. S. 977 31ebd. S 975 32ebd. S.975 33 ebd. S 978
22
werden (Reiberg 1994).[...] Eine “Synthese zwischen Interkulturellem Lernen und der sog.
Europäischen Dimension könnte von Leitgedanken geprägt sein:”34 Ein liberalisiertes und
erweitertes Fremdsprachenangebot, Öffnung von Schulen nach beiden Seiten – also Experten
rein in die Schule und Schüler /innen raus aus der Schule- auch für die höheren
Jahrgangsstufen, handlungsorientierte Arbeitsweisen, internationale Begegnungen, “die
Bildungsangebote dürfen nicht nationalstaatlich sein.”35 Sollte die Verwirklichung dieser
Leitgedanken noch nicht angegangen sein, so müsste das Deutsche Auslandsschulwesen in
Europa in ein Reformprojekt verwandelt werden, welches aller Ressourcen und aller
Kenntnisse von Fachleuten bedürfte.
Für diese Arbeit relevante Kriterien der interkulturellen Bildung
In der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik des Bundes werden Kultur und Bildung als
Ressortbezeichnungen verstanden. Selbst dort, wo es um Lehrpläne, Lehrmittel, Lernerfolge
geht, sind oft nicht die Deutschen Schulen im Ausland, sondern die Goethe-Institute gemeint,
und damit wird im offiziellen Sprachgebrauch der Bundesregierung die Kulturvermittlung
angesprochen. Bildung wird in ihrer Bedeutung in Bezug auf die Deutschen Schulen gesehen.
„Abzugrenzen ist der Bildungsbegriff der interkulturellen Germanistik zunächst gegen den
staatlich und institutionell akzentuierten Begriff, der den politischen Kämpfen und
administrativen Geschäften der Bildungspolitik zugrunde liegt.“36
Ein solcher inhaltlich bestimmter Bildungsbegriff muss die Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik bestimmen. Jedoch soll hier keine Abhandlung über die Theorie und die
Wandlung des Bildungsbegriffs geleistet werden. Bildung ist nicht nur als Unterbegriff zur
Kultur zu verstehen. Bildung und Kultur bedingen einander. Ohne Bildung keine Kultur und
ohne Kultur wenig Möglichkeiten zur Bildung. Bildung hat auch Gebrauchswert - Kultur ist
eher zweckfrei. Die Bildung verfolgt Ziele, hat eine bestimmte Programmatik und Curricula,
bietet Abschlüsse und Zertifikate. Doch die Eingrenzung des für die
34ebd. S 979 35ebd. S 980 36Reich, Hans R.; Wierlacher, Alois. Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. Bildung. In: Handbuch
interkulturelle Germanistik. Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg. Stuttgart, 2003. S.203.
23
Untersuchungsgegenstände erforderlichen Bildungsbegriffs als engerer funktionaler Teil des
Kulturbegriffs würde der Sache nicht gerecht. Bildung ermöglicht auch das Lernen des
Lernens - im Bereich der vorliegenden Arbeit also des interkulturellen Lernens. Hartmut von
Hentig schickt seinen Überlegungen beim Suchen eines Maßstabs für Bildung Folgendes
voraus: „´Bildung´ hat drei Bestimmungen. Sie ist erstens das, was ´der sich bildende
Mensch` aus sich zu machen versucht, ein Vorgang mehr als ein Besitz. Diesem Streben folgt
er auch unabhängig von der Gesellschaft. [...] Das ist die persönliche Bildung, die, wie man
sieht, stark von der Kultur bestimmt ist, in der einer aufgewachsen ist, die aber auch ohne sie
Geltung hat.
Bildung ist zweitens das, was dem Menschen ermöglicht, in seiner geschichtlichen Welt, im
état civil, wie Rousseau das nennt, zu überleben: das Wissen und die Fertigkeiten, die
Einstellungen und Verhaltensweisen, die ihm ermöglichen, sich in der von seinesgleichen
ausgefüllten Welt zu orientieren und in der arbeitsteiligen Gesellschaft zu überleben. [...]
Bildung ist drittens das, was der Gemeinschaft erlaubt, [...] in Freiheit zu bestehen. Sie richtet
den Blick des einzelnen auf das Gemeinwohl, auf die Existenz, Kenntnis und Einhaltung von
Rechten und Pflichten, auf die Verteidigung der Freiheit und die Achtung für Ordnungen und
anstand..[...] Das ist die politische Bildung.“37
In der traditionellen Bildungstheorie wird Bildung als Emanzipation des Individuums zu
eigenverantwortlichem Denken und Handeln gegenüber der Natur und Gesellschaft, Welt und
Gott angesehen. Humboldt entwickelt diesen Begriff weiter: „Bildung ist für Humboldt
primär Kraftzentrum (energeia), das ihn befähigt alle Anregungen von außen so in sein
Inneres aufzunehmen, dass sie individuell-einmalig zu einem harmonischen Ganzen werden.
Nur wo es gelingt, die Buntheit, ja Zerrissenheit der modernen Welt in sich zu einem
persönlichen Bild zu integrieren, nur dort hat sich der Mensch zu seiner vollen Bestimmung
gebildet.”38 Doch diese Definition kann nicht ausreichen, es gehören der Wille und die
Aktivität des Menschen dazu, die zu interkultureller Kompetenz und Bildung führen:
37 von Hentig, Hartmut: Die Schule neu denken. Weinheim 2003, V26. 38 Wehners, Franz-Josef: Grundlagen, Voraussetzungen und Absichten pädagogischen Handelns. In:
Pädagogik. Roth, Leo (Hg.).München 2001.S.282.
24
„dass Bildung mit dem Wissen und dem Können auch den Willen zur prüfenden
Anerkennung von Andersheiten als einer zentralen Bedingung der Selbstkonstitution
umfasst, und zwar:
• den Willen, Angehörige anderer Kulturen als Mitmenschen zu sehen [...]
• den Willen, sich selber und den Nächsten bei dem Versuch zu stützen, sich zu bilden
[...]
• den Willen, an der kulturellen Überlieferung, als wertschöpfender Fortschreibung des
kulturellen Gedächtnisses bewusst teilzunehmen [...]
• den Willen, zum Aufbau einer persönlichen Mehrkulturen- und
Mehrsprachenkompetenz [...]
• den Willen zur selbst gesteuerten Ausbildung einer selbstkritischen Urteilkraft und
der folgenden Teilkompetenzen und Schlüsselqualifikationen: [...] Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, [...] und Fähigkeit zu kooperativer
Erkenntnisarbeit.“39
Diese Art der Bildung befähigt den Menschen zu gemeinschaftlichem Handeln. Pluralität zu
fördern und mit Unterschieden zu leben, dafür plädiert Hartmut von Hentig in seiner 2. von
sechs Thesen für eine neue Schule: „Dass Unterschiede zwischen Menschen etwas
Natürliches sind und dass die Bejahung der Unterschiedlichkeit jedem von uns zugute kommt,
erfährt man in gemischten Gruppen. Die neue Schule wird, wo immer sie das kann, Kinder
verschiedener Alter, Begabungsarten, Kulturen Interessen und Religionen
zusammenbringen.“40 Auch für Johannes Beck ist Bildung ein anspruchsvolles Wort, das die
„Hoffnung auf die Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und Erkenntnis und vernünftige
Praxis, auf ´Freiheit´ enthält“41: „Gerade im Dialog der Verschiedenen könnte das entstehen,
was wir Erkenntnis, Wissen, Moral und Zuständigkeit, also Praxis einer gemeinen Bildung
nennen können. Bildung ist kein Zustand. Das Wort selbst weist sie am Ende als Bewegung
aus. In seiner Geschichte kommt nicht nur das Bild, das Vorbild, die Formgebung, sondern
auch das Benehmen, Gestaltgeben, Bilden und einbilden vor. Ich verstehe Bildung als eine
39 Reich, Hans R.; Wierlacher, Alois: Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. Bildung. In: Handbuch
interkulturelle Germanistik. Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg. Stuttgart, 2003. S.206. 40 von Hentig, Hartmut: Die Schule neu denken. Weinheim 2003, S.221. 41 Beck, Johannes: Der Bildungswahn. Reinbek, 1994. S. 57, 58.
25
Haltung zur Welt und zu meinen Nächsten, die ohne Wissen, Können, Moral, und Vernunft
nicht entstehen kann.“42
Reformbedarf: Nachhaltigkeit als neuartiger Schlüsselbegriff für Bildung
Reformen sind nicht Selbstzweck, sie können in diesem Kontext auch nicht vor dem
Hintergrund allein finanzieller Überlegungen stehen. Dieses würde Auswärtige Kultur- und
Bildung auf rein pragmatische materielle Überlegungen reduzieren. Daher müssen andere
Komponenten und Entwicklungen den Reformbedarf anzeigen. Die Konferenz der Vereinten
Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro hat in ihrer Agenda 21
aufgefordert, die Menschen zum Erhalt der kulturellen Identität und zur globalen
Zusammenarbeit zu befähigen. Dieses könnte Anhaltspunkte für die Richtung, in die sich die
Reformen bewegen sollen, geben.
180 Staaten haben sich in der Agenda im Kapitel 36 zur “education for sustainable
development” zur “Bildung für nachhaltige Entwicklung” verpflichtet. Im Kapitel 36 heißt es:
“Bildung/Erziehung, einschließlich formaler Bildung, öffentliche Bewusstseinsbildung und
berufliche Ausbildung sind als ein Prozess zu sehen, mit dessen Hilfe die Menschen als
Einzelpersonen und die Gesellschaft als Ganzes ihr Potential voll ausschöpfen können.
Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung.”43 Dort wird auch festgestellt, dass Bildung und Erziehung mit den sozialen und
wirtschaftlichen Dimensionen, der Erhaltung und Bewirtschaftung der Umweltressourcen, der
Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen, der Förderung der Rolle der Jugend sowie
Kooperation und Stärkung von institutionellen und personellen Kapazitäten, in Verbindung
steht. Als Maßnahmen zur Verwirklichung werden vorgeschlagen: die Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit, um vorhandene wirtschaftliche, soziale und
geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu beseitigen, soziokulturelle Aspekte und
Verknüpfungen zu berücksichtigen, internationale Partnerschaften zu fördern und
Weiterbildungsprogramme zu unterstützen. Traditionelle Systeme der Wissensvermittlung
sollen anerkannt werden und auf die unter unterschiedlichen Bedingungen arbeitenden
42 Beck, Johannes: Der Bildungswahn. Reinbek, 1994. S. 57. 43 Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Dokumente
Agenda 21. In: Eine Information des Bundesumweltministeriums. Bonn. (ohne Jahreszahl)
26
Lehrkräfte eingegangen werden. Untersuchungen über Möglichkeiten der Mobilisierung
verschiedener Bevölkerungsteile sollen durchgeführt werden, um so deren Bedarf an
entwicklungsorientierter Bildung zu bestimmen und darauf einzugehen. Die einzelnen Länder
sollen untereinander und mit den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und
Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten und mit Unterstützung nichtstaatlicher Institutionen
Erwachsenenbildungsprogramme aller Art fördern sowie Leistungszentren für die
interdisziplinäre Forschung errichten.
Auch wenn die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
1998 Eckpunkte zur ”Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” verabschiedet hat, die
Anregungen für alle Bereiche unseres Bildungssystems gibt und die von allen Bundesländern
und der Bundespolitik im Umlaufverfahren zur Kenntnis genommen wurden44, so steht doch
diese Begrifflichkeit noch relativ unvermittelt da für alle, die sie umsetzen sollen. Trotzdem
scheinen mir obengenannte gedankliche Verknüpfungen wesentlich genug, um sie in meine
Überlegungen zur Reform auswärtiger Bildung einzubeziehen.
Nachhaltigkeit als neuartiger Schlüsselbegriff für Auswärtige Kultur
Auch die Auswärtige Kultur rückt in den Blickpunkt der Nachhaltigkeitsdebatte. Daraus
können Anregungen für ihre Reform gewonnen werden.
Verbindungen zwischen Kultur und Bildung und der Idee der Nachhaltigkeit zu suchen,
wurde bei den “Toblacher Gesprächen” unternommen. Die 3.These im Jahr 1998 lautete:
Gefragt sind Produktionsformen, die mit zukunftsfähigem Leben Hand in Hand gehen, die die
Schönheit der ökologischen und der kulturellen Vielfalt sowie deren Eigenart und
wiedergefundene lokale Identität betonen.45
44 Siehe auch: Singer, Otto: Kultur und Nachhaltige Entwicklung. In: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen
Bundestages. Reg.-Nr.: WFX- 50/02. Berlin 2002. S.32f. 45 Toblacher Gespräche des Öko-Instituts Tirol. Ergebnisse sind in den “Toblacher Thesen” zusammengefasst,
z.B.: “Schönheit –Zukunftsfähig leben”, 1998.
27
Die UNESCO-Konferenz 1998 in Stockholm hat das Prinzip der wechselseitigen
Abhängigkeit von nachhaltiger Entwicklung und kultureller Entfaltung erkannt und
formuliert.46
Ist die Kultur eine vernachlässigte Größe im Nachhaltigkeitsdiskurs?47, war die Fragestellung
eines Artikels vier Jahre später, der die inzwischen versandete Diskussion zum Thema hatte.
Nachhaltige Entwicklung ist in den vergangenen Jahren insbesondere in Zusammenhang mit
der Ökologie diskutiert worden. Stammt doch der Begriff Nachhaltigkeit aus der
Forstwirtschaft und meint, dass man von den Erträgen und nicht der Substanz lebt, es darf
also nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwächst. Immer steht dabei im Vordergrund,
wie sich unser gegenwärtiges Tun in der Zukunft auswirkt. Auch in der Kulturpolitik rücken
die nachfolgenden Generationen bei den Überlegungen zur Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.
Nachhaltigkeit ist nicht ein vorwiegend technisches oder umweltpolitisches Problem, welches
sich auf ressourceneffizienteren Umgang mit unseren Lebensgrundlagen beschränkt.
Nachhaltigkeit soll sich auch mit der Qualität unseres politischen und kulturellen Handelns,
als Beitrag zur Möglichkeit eines freien, friedlichen und selbsterfüllten Lebens der Menschen
verschiedener Nationen, Sprachen, Religionen und Ethnien der kommenden Generationen
befassen.
Dies bedeutet eine vorausschauende Kulturpolitik. Macht die Politik Vorgaben, die kulturelle
Entfaltung und Beteiligung am kulturellen Leben als Form des gegenseitigen Austauschs
fördern? Sind die strukturellen Voraussetzungen gegeben, den Dialog der Kulturen zu
ermöglichen und kulturelle Kreativität als Quelle menschlichen Fortschritts zu sehen?
Nachhaltigkeit muss auf Menschenrechten und demokratischen Werten gründen, die zu
Toleranz gegenüber kulturellen Unterschieden verpflichten, vom Untergang bedrohte
Kulturen verteidigen, den kulturellen Pluralismus erhält und das kulturelle Erbe achten. Zum
kulturellen Pluralismus gehört der Erhalt und die Pflege der deutschen Sprache, die neben
ihrer Schönheit auch die Möglichkeit bietet, sich präzise auszudrücken, und als Schrift-,
Wissenschafts- und Literatursprache große kulturgeschichtliche Bedeutung hat. Aus diesem
46Zur Umsetzung des Stockholmer Aktionsplanes. In: Kultur und Entwicklung. Deutsche UNESCO-
Kommission e.V., Bonn, 1998.S.11ff. 47 Singer, Otto: Kultur eine vernachlässigte Größe im Nachhaltigkeitsdiskurs. In: Das Parlament, Berlin,
29./30.Dezember 2002. S.15.
28
Grund spielt Deutsch als Fremdsprache, deren Vermittler die Auswärtige Kultur ist, eine
zentrale Rolle bei der Betrachtung der Konstruktion und Standfestigkeit der dritten Säule der
Außenpolitik.
Der globale Aktionsplan für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung (Agenda 21)48 sieht
die Erhöhung des Frauenanteils bei politischen und kulturellen Entscheidungsträgern,
Fachberatern, Planern und Managern vor. Auch in der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik ist diese Frage von großer Relevanz. Bei Beginn meiner Arbeit war noch
keine Frau Vorstand oder Manager einer Mittlerorganisation oder an leitender Stelle im
Auswärtigen Amt tätig. Strategien und Pläne zur Durchsetzung der Gleichberechtigung, der
Abbau kultureller, verhaltensbedingter, gesellschaftlicher Hindernisse auf dem Weg zur
vollen Beteiligung der Frauen an einer nachhaltigen Entwicklung und am öffentlichen Leben
sind - laut Agenda 21- zu konzipieren, Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen
von Frauen und Mädchen in Wissenschaft und Technik, Programme zur Ausräumung
negativer Klischees über Frauen, Herbeiführung eines Wandels in den Sozialisationsmustern,
in den Medien, im formalen und nonformalen Bildungswesen zu verwirklichen. Die
Regierungen werden aufgefordert frauenrelevante Übereinkommen zu ratifizieren.
Ferner sieht die Agenda 21 die Stärkung der Rollen der nichtstaatlichen Organisationen als
Partner für eine nachhaltige Entwicklung vor, die in der Auswärtigen Kulturpolitik von großer
Bedeutung sind. So wird denn Nachhaltigkeit auch “als neues Paradigma für politische Kultur
”49 begriffen. “Dies gilt für Entscheidungsprozesse, die in Form des Dialogs und der
Kooperation ablaufen, ohnehin.[...]Es setzt voraus, dass zwischen unterschiedlichen
politischen Handlungsfeldern eine Abstimmung stattfindet, dass Zusammenhänge entdeckt
und hergestellt werden, dass sektorales Denken überwunden wird.”50 In einer Welt, die
einerseits immer näher zusammenrückt, andererseits tiefe Gräben zwischen Menschen
verschiedener Nationen, Religionen und Ethnien, Menschen unterschiedlicher sozialer
48 Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Dokumente
Agenda 21. In: Eine Information des Bundesumweltministeriums. Bonn. Kapitel 24.(ohne Jahreszahl) 49 Siehe auch: Hennecke, Frank J.: ”Nachhaltigkeit”- Modewort oder ein neues Paradigma für die politische
Kultur und die Bildungspolitik: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/ Hg.: Pädagogisches Zentrum., Bad
Kreuznach 2001. S.11ff. 50 ebd.S.28
29
Herkunft und Bildung aufreißt, kann eine Zukunftsperspektive, die Verständigung zum Ziel
hat, nur über einen interkulturellen Dialog ermöglicht werden.51 Die Fähigkeit zum
interkulturellen Dialog ist Vorbedingung für eine zukunftsfähige, nachhaltige Auswärtige
Kulturpolitik.
Diesem Themenbereich widmet sich die vorliegende Arbeit, da zur Nachhaltigkeit ebenso
gehört, dass das der Auswärtigen Kultur übertragene Aufgabenspektrum effizient bewältigt
werden kann. Gerade in Zeiten des finanziellen Drucks ist eine zielorientierte Struktur und
Arbeitsweise der Institutionen und die Erschließung aller möglichen Geldquellen zu
gewährleisten. Dialogische Formen des kulturellen Gestaltens, Kooperationen der
verschiedenen nationalen und internationalen Mittler, sowie mit anderen europäischen
Partnern - im oben genannten Sinne umgesetzt - sind Teil der Nachhaltigkeit wie auch
Abgrenzung der Kompetenzen, Nutzung der Synergien, Anpassungen an neue Gegebenheiten
und Anforderungen.
Kultur- bzw. Bildungspolitik und Kultur- bzw. Bildungsarbeit
In dieser Arbeit wird zwischen Kulturpolitik und Kulturarbeit (bzw. Bildungspolitik und
Bildungsarbeit) unterschieden. “Kulturpolitik ist schon in der Weimarer Republik zur
Bezeichnung staatlicher ´Förderung der kulturellen Pflege und Kreativität´ verwandt
worden.”52 Kulturpolitik versteht sich als Gesellschaftsgestaltung und Umsetzung von
gesellschaftlicher Macht. Kulturarbeit ist die konkrete Ausführung unter den Bedingungen der
gesellschaftlichen Wirklichkeit vor Ort. Um begrifflich das Politische von anderen damit
zusammenhängenden Aspekten abzugrenzen, beziehe ich mich auf Hermann Heller. Er sagt
in seiner Staatslehre zur Unterscheidung der politischen von anderen gesellschaftlichen
Funktionen: “Ein Begriff des Politischen ergibt sich uns nur aus der Sinnfunktion, die das
Politische innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Lebens ausübt. Nur dadurch, dass die
Politik einerseits ein nach relativ eigenen Gesetzen entstehender und bestehender
Wirkungszusammenhang ist, dem andererseits als Teil eine bestimmte Bedeutung für das
51 Siehe: Themenheft II/2002 “Kultur der Nachhaltigkeit-nachhaltige Kultur”. Hg.:Kulturpolitische
Mitteilungen. 52 Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation, Wierlacher, Alois, Hg.,
Möhnesee 2000, S. 443.
30
Ganze des gesellschaftlichen Lebens zukommt, lässt sich die Eigenart der politischen von
anderen Funktionen unterscheiden.[...] Nur durch Beziehung des Politischen auf die Polis und
ihre entwickeltste Form, den Staat, kann ein klarer Grundbegriff gefasst werden.”53
Nicht die Absichten bestimmen, was Kultur politisch bedeutet, sondern die Leistung der
kulturell Engagierten. Der Wert der Kulturpolitik misst sich daran, was die Akteure daraus
machen, nicht daran, was die Politiker dazu verkünden, das ist Grundidee und Inhalt der
Arbeit.
1.3. Leitlinien für eine Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
Auswärtige Kulturpolitik soll dazu dienen, Verständnis für das Fremde, das Andere, eine
Haltung der Offenheit und kritischen Toleranz zu vermitteln.54 ”Kultur ist nicht angeboren,
sie wird mit der Erziehung vermittelt, wird überliefert und begleitet jeden Menschen
kontinuierlich von Geburt an das ganze Leben lang. Erziehung und Kultur beeinflussen sich
gegenseitig: Erziehung ist von der jeweiligen Kultur abhängig und umgekehrt auch die Kultur
von der jeweiligen Erziehung. Die Vorstellungen von Erziehung in den verschiedenen
Kulturkreisen unterscheiden sich deshalb in der Regel ebenfalls.”55
Zentrale Aufgabe der Auswärtigen Kulturpolitik muss es sein, Brücken zwischen Menschen
verschiedener Sprachen und mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zu schlagen. Sie
53Heller, Hermann: Staatslehre (1934): In: Gesammelte Schriften, Band 3, Leiden 1971, S.3ff (S.311). 54Altmann Elisabeth: Im Teil B finden sich verschiedentlich Erwägungen aus meinen Reden während der
Bundestagszeit, aus meinen Anträgen zur Auswärtigen Kulturpolitik, damals gefasst und noch aufrecht
erhalten.
Bundestagsdrucksachen:
13/4844 Auswärtige Kulturpolitik: Den Standort neu bestimmen - den Stellenwert erhöhen (Antrag)
13/5424 Jugendaustausch als Aufgabe der Auswärtigen Kulturpolitik (Kleine Anfrage)
13/6040 Zur Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen (Kleine Anfrage)
13/6544 Förderung der deutschen Sprache und des Auslandsschulwesens (Kleine Anfrage)
13/7366 Die Arbeit von Inter Nationes e. V. (Kleine Anfrage)
13/8679 Neuordnung des Zuständigkeiten in der Auswärtigen Kulturpolitik (Antrag).
Verwendet sind ferner Formulierungen aus einem Flugblatt zur Auswärtigen Kulturpolitik, an dem mein
damaliger Mitarbeiter Dr. Rolf Weitkamp mitgewirkt hat. 55 Kupfer-Schreiner, Claudia: Sprachdidaktik und Sprachentwicklung im Rahmen interkultureller Erziehung.
Das Nürnberger Modell. Ein Beitrag gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Weinheim 1994, S. 15.
31
wirkt gerade in unserer Gesellschaft, indem sie dazu beiträgt, im eigenen Land Vorurteile
gegenüber dem Fremden abzubauen. Besonderen Stellenwert für eine nachhaltige
Entwicklung hat die Auswärtige Kulturpolitik bei der Stärkung demokratischer Kräfte in
undemokratischen und autoritären Staaten und für den Aufbau ziviler Gesellschaften in
Ländern, in denen sich Demokratie erst entwickeln muss. Auswärtiger Kulturpolitik kommt
eine große Bedeutung bei der moralischen und praktischen Unterstützung von
Menschenrechtsorganisationen und Demokratiebewegungen zu. Dies gilt gerade für die
Informations- und Bildungseinrichtungen der Auswärtigen Kulturpolitik in abgeschotteten
Gesellschaften. Der Austausch über Länder, Kulturen und gesellschaftliche Strukturen hilft
dem Abbau von Vorurteilen und dem Zurückdrängen von Fremdenfeindlichkeit, von
nationalistischen und rassistischen Tendenzen. Dem geht ein Lernvorgang voraus.
”Interkulturelles Lernen geht von einem erweiterten Kulturbegriff aus, der im Goetheschen
Sinne keineswegs auf das ‚Schöne, Wahre und Gute‘ beschränkt ist, sondern alle geistigen
und manuellen Hervorbringungen des Menschen umfasst. Dieser Kulturbegriff ist durch vier
Aspekte gekennzeichnet:
- Kulturen sind nicht homogen, sondern vielgestaltig; damit wird Abschied genommen
von der These, es gäbe so etwas wie die deutsche, französische, russische usw. Kultur.
Alle europäischen Kulturen beispielsweise sind seit langem Mischkulturen.
- Kulturen sind nichts Statisches, sondern historisch gewachsen und Veränderungen
unterworfen.
- Kulturen umfassen den gesamten Lebensraum des Menschen, d. h. alle Produkte und
Tätigkeiten menschlichen Denkens und Handelns (also Dichtung und Straßenbau,
Musik und Umweltschutz, Philosophie und Landwirtschaft ...), weiterhin Erfahrungen,
Gesetze und Regeln, die das menschliche Zusammenleben bestimmen, insbesondere
aber die Haltung von Menschen gegenüber Neuem und Fremdem sowie gegenüber
Ideen, Wertsystemen und Lebensformen.
- Kulturen sind prinzipiell gleichwertig.”56
56 Götze, Lutz: Interkulturelles Lernen und Interkulturelle Germanistik – Konzepte und Probleme. In: Deutsch
als Fremdsprache. Wo warst Du, wo bist Du, wohin gehst Du? Zwei Jahrzehnte der Debatte über die
Konstituierung des Fachs Deutsch als Fremdsprache. Gert Henrici, Uwe Koreik, Hrsg., BAsweiler 1994, S.
264.
32
Diese Anliegen zu vermitteln, ist auch Aufgabe der Auswärtigen Kulturarbeit.
“1970 formulierte der damalige parlamentarische Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ralf
Dahrendorf, Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik, in denen er mit der Abkehr vom
Primat der einseitigen Selbstdarstellung und unter dem programmatischen Schlagwort
Austausch und Zusammenarbeit die Richtung für weitere Entwicklungen vorzeichnete.”57 Die
Leitlinien für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sollen die Richtung -basierend auf
einem erweiterten Kulturbegriff- aufzeigen, an denen sich die Entscheidungen und das
Handeln orientieren:
- Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit
- Förderung des Dialogs der Kulturen
- Pflege der deutschen Sprache im Ausland
- Förderung der Kenntnis der deutschen Sprache für Immigranten und Studierende aus
anderen Ländern im Inland
- Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes
- Förderung des politischen und gesellschaftlichen Zusammenwachsens Europas
- Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit und Demokratie
- Gleichberechtigung der Geschlechter
- Erziehung zu Umweltbewusstsein und Umweltwissen
- Förderung der friedlichen Konfliktbewältigung
- Strukturverbesserung der Auswärtigen Kulturpolitik
- Ausreichende Finanzierung der Auswärtigen Kulturpolitik
Auf der zwischenstaatlichen Konferenz über Kulturpolitik und Entwicklung im April 1998
in Stockholm wurden fünf thematische Hauptgedanken und Aktionsleitlinien58 anerkannt,
die in politische Selbstverpflichtung der Teilnehmerstaaten münden sollten. Es sind dies:
57 Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation. Alois Wierlacher, Hg.,
Möhnesee, 2000, S. 440. 58 Deutsche UNESCO-Kommission: Kultur und Entwicklung. Zur Umsetzung des Stockholmer Aktionsplanes.
Zwischenstaatliche Konferenz über Kulturpolitik für Entwicklung vom 30.März bis 2.April 1998 in Stockholm.
Präambel. Bonn, S.11ff.
33
1. Kulturpolitik soll zu einem Schlüsselelement einer Entwicklungsstratgie gestaltet
werden. Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung wird untrennbar mit kultureller
Entfaltung verknüpft.
2. Die Kreativität und die Teilnahme am kulturellen Leben sind zu fördern und die volle
Teilnahme am kulturellen Leben aktiv oder passiv zu garantieren.
3. Politikplanung und politische Praxis muss die Wahrung und Aufwertung des
Kulturerbes gestalten. Dazu gehören auch die neuen Kategorien wie
Kulturlandschaften und das Industrieerbe. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung
und Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen soll angestrebt werden.
4. Kulturelle Vielfalt muss bei aller Rücksichtnahme auf kulturelle Identität ein Leitziel
zur Förderung von Toleranz und Dialog sein. Die neuen Informationstechnologien und
die unaufhaltsame Globalisierung dürfen nicht zur Bedrohung für die kulturelle
Vielfalt werden.
5. Die Aufgaben der Kulturpolitik liegen darin, Lebensqualität und Gleichberechtigung
zu sichern und soziale Integration ebenso wie kulturelle Vielfalt zuzulassen. Dies
bedeutet auch, mehr personelle Kapazitäten und finanzielle Mittel für kulturelle
Entwicklung verfügbar zu machen und die Unterstützung der Wirtschaft als auch
durch Sponsoren zu erhöhen.
Wenn auch die Umsetzung obengenannter Zielvorstellungen wegen ihrer Komplexität kaum
überprüft werden kann, so ist dies doch eine bedeutsame Weiterentwicklung des
interkulturellen Verständnisses. Der Gipfel in Rio wird nachträglich auch zu einem
Kulturgipfel erklärt, mit dem Appell, auch sozial schwachen Menschen, Behinderten,
Kranken und Alten, allen Menschen die Teilnahme an Kultur zu ermöglichen.
Rücksichtnahme auf kulturelle Identität darf nicht Intoleranz legitimieren, sondern soll bei
aller Vielheit den Dialog über ein kooperatives, tolerantes und friedliches Zusammenleben
fördern. Dabei soll Auswärtige Kultur an der Herstellung eines Klimas arbeiten, welches
Lebensqualität und gleichberechtigten Zugang zu kulturellem Leben ermöglicht, das den
universellen Werten verpflichtet ist und gleichzeitig die Vielfalt anerkennt, ganz im Sinne
folgender Überlegung: “Eine demokratische, humanistische Kulturauffassung erkennt die
Vielschichtigkeit und Mehrdimensionalität der kulturellen Probleme, die durch interkulturelle
Lebensweise entstanden sind bzw. entstehen. Sie sieht die kulturelle Vielfalt als eine
unerschöpfliche Quelle an, aus der sich die Gesellschaft bereichert, sowohl an Chancen der
kulturellen Entfaltung als auch an Problemstellungen, die mögliche Lösungen im Sinne teil-
34
oder gesamtgesellschaftlicher Entwicklung in sich bergen.”59 Diese Aspekte gelten auch in
globalen Zusammenhängen. Auswärtige Kulturpolitik soll auch als Instrument der friedlichen
Konfliktbewältigung eingesetzt werden und die Konflikte, die nach dem Ende des kalten
Krieges zunehmend kulturell begründet oder kulturell verbrämt werden, durchleuchten und
aufarbeiten. So wäre zur Förderung einer Nord-Süd-Kooperation eine engere Zusammenarbeit
zwischen der ”reinen” Kulturpolitik und der Entwicklungspolitik vorzunehmen. Ebenfalls
sollte die kulturelle Dimension eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit der
Bundesrepublik mit den Entwicklungsländern spielen. Dies müsste sich auch in einem
verstärkten Wissenschafts- und Kulturaustausch ausdrücken.
1992 wurden zum ersten Mal im Artikel 128 im EU-Vertrag die Kompetenzen der
Gemeinschaft in diesem Bereich eindeutig festlegt, dieser wurde durch den Artikel 151 des
Vertrages von Amsterdam 1997 bestätigt. „Eigenständigkeit und Bedeutung der Kultur im
Gemeinschaftsrecht zeigen sich bereits in der gesonderten Stellung des Kulturartikels unter
Titel IX (=Titel XII neu). Artikel 128 (= Artikel 151 neu) wurde durch den Vertrag von
Maastricht eingefügt. Die Kulturpolitik der Gemeinschaft steht seither auf einer eigenen
vertragsrechtlichen Grundlage.“60
Art. 128 (1) (Artikel 151 neu): Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der
Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie
gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes.
Art.128 (2): Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedsstaaten und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeiten in
folgenden Bereichen:
- Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der
europäischen Völker;
- Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung;
- nichtkommerzieller Kulturaustausch,
59 Kula, Onur Bilge: Türkische Migrantenkultur als Determinante der Interkulturellen Pädagogik. Versuch der
Erstellung eines kulturellen Bezugsrahmens für eine pädagogische Praxis. Die Brücke e. V, Hg., Saarbrücken,
1986. S. 19. 60 Fechner, Frank: Kultur. In: Das Recht der Europäischen Union. Hg.: Grabitz/Hilf u.a. Loseblattausgabe.
Stand 08/02. München 2003. 3/1490.
35
- künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.
(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten
Ländern und den für den Kulturbereich zuständigen internationalen Organisationen,
insbesondere mit dem Europarat.61
Art. 149 befasst sich mit dem Beitrag der Gemeinschaft zur allgemeinen Bildung,
insbesondere mit der europäischen Dimension durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen
der Mitgliedsstaaten, Art. 150 betont Mobilität und Zusammenarbeit in der beruflichen
Bildung. Der Europäische Konvent hat diese Artikel bei seinem Verfassungsentwurf im Jahre
2003 berücksichtigt und Kultur und Bildung als Bereiche definiert, bei denen die Europäische
Union unterstützende und ergänzende Maßnahmen durchführt.
1.4. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Zeichen der Globalisierung
”Das Stichwort Globalisierung zeichnet das Bild einer sich vereinheitlichenden Welt. Aber
während die Oberfläche der einen Welt immer einförmiger wird, stoßen darunter häufiger als
je zuvor die unterschiedlichen Lebenswelten der einzelnen aneinander. Diese Lebenswelten
sind keineswegs einheitlich geprägt, sondern bilden stets Mischformen.[...] viel wird in der
Weltgesellschaft davon abhängen, dass sich zwischen den Kulturen zunehmend Lern-
gemeinschaften herausbilden.”62
Auswärtige Kulturpolitik kann die Aufgabe wahrnehmen, ”Lerngemeinschaften” im Sinne
von Lepenies zu formen, nicht zu belehren, sondern Deutschland und Europa anderen
Gesellschaften näher zu bringen. Sie muss aber auch die sozialen, kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten anderer Gesellschaften in der hiesigen
Öffentlichkeit vermitteln. Denn die Welt außerhalb unserer Grenzen betrifft immer mehr
jeden von uns, und zwar ganz unmittelbar. “Die zunehmenden nationalen Interdependenzen -
v.a. in Fragen der Sicherheit, der Ressourcen, des Umweltschutzes - machten eine
Kulturpolitik erforderlich, die nicht länger auf einseitigen Kulturexport (u.a. von Sprache,
61 Dörr, Renate: Europäische Kulturpolitik-gibt es das? In: Handbuch Kultur Management, Düsseldorf, 1998. A
1.3, S. 3. 62 Lepenies, Wolf: Das Ende der Überheblichkeit. Wir brauchen eine neue Auswärtige Kulturpolitik. Statt
fremde Gesellschaften zu belehren, müssen wir bereit sein von ihnen zu lernen. Vortrag am 23.10.95 in der
DG Bank in Frankfurt. U.a. in: Die Zeit, 24.11.95.
36
Wissenschaft, Kultur und Kunst) beschränkt bleibt; die Maximen heißen nun ´kulturelle
Wechselbeziehungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit´.”63 Was Globalisierung
bedeutet, erleben wir Tag für Tag fast in jedem Lebensbereich. ”Die Jahrhundertchance der
Einigung ganz Europas, die ‚Globalisierung‘, und die große innere Anspannung unserer
Kräfte – das sind die drei wichtigsten Herausforderungen, denen sich die dritte Säule unsere
Außenpolitik heute stellen muss. Hier in Deutschland haben wir mit 8 Millionen
ausländischen Mitbürgern die Kulturen der Welt im Land. Ihre Einflüsse spüren wir in allen
Bereichen. Auch im Weltmaßstab sind sich die Gesellschaften politisch, wirtschaftlich und
kulturell so nahe gekommen wie noch nie zuvor. Diese ‚Begegnung‘ und ‚Neuentdeckung‘
der Kulturen geschieht nicht problemfrei und hat widersprüchliche Tendenzen ausgelöst.”64
Die ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in unserer Stadt, die Musik, die wir hören,
die Filme, die wir sehen, die Waren, die wir kaufen, Dienstleistungen, die wir in Anspruch
nehmen - internationale Einflüsse finden wir in allen Lebensbereichen. Was in Europa und in
der Welt geschieht, prägt nicht nur die Freizeit und unser häusliches Leben, es beeinflusst
auch unsere Schulen, die Hochschulen und Arbeitsplätze unmittelbar.
Vor allem die Existenz globaler Wirtschaft und globaler Kommunikations- und
Verkehrsmittel belegt ständig, dass weltweite Veränderungsprozesse in Gang sind.
Unterschiedliche kulturelle Räume berühren sich nicht nur, sondern stehen in ständigem
Austausch miteinander.
Auswärtige Kulturpolitik hat ihren Schwerpunkt im internationalen, zwischenmenschlichen,
kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Austausch. Im Mittelpunkt der
Kompetenzfelder der Interkulturalität stehen Institutionen der Auswärtigen Kultur,
Universitäten, Wirtschaftsunternehmen, Städte- und Schulpartnerschaften sowie
Jugendaustausch, Mittlerorganisationen wie auch kulturpädagogische Einrichtungen und
Eine-Welt-Initiativen.
63 Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation, Wierlacher, Alois, Hg.,
Möhnesee, 2000, S. 445. 64Kinkel, Klaus: Aus der Rede des Bundesministers des Auswärtigen Dr. Klaus Kinkel auf der
Mitgliederversammlung des Goethe-Instituts am 19. Juli 1996 im München.
37
1.5. Kulturföderalismus
Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verfügen die Länder über die
Kulturhoheit. Der Bund jedoch ist für die auswärtigen Beziehungen zuständig, so auch für die
Auswärtige Kultur und Bildung. Trotzdem gibt es Überschneidungen, der Bund ist auf
Absprachen mit den Ländern angewiesen z. B. bei der Lehrerentsendung. Auch bei der
Betrachtung der Entwicklung der Bundeskulturstiftung, die durch vielfältige Anregungen und
Visionen die Entwicklung vorantreiben soll, wird das Spannungsverhältnis zwischen
Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik des Bundes und dem Kulturföderalismus der Länder
angesprochen. Die Aktivitäten der Länder in Zusammenarbeit mit dem Bund werden im
Rahmen der Mischfinanzierungen berücksichtigt. Z. B. gibt es im Zusammenhang mit der
Lehrerentsendung neben den Bundesprogrammlehrkräften (BPLK) auch die Landes-
programmlehrkräfte (LPLK). Landesprogrammlehrkräfte werden von den jeweiligen Ländern
ausgewählt und finanziert, ihr Tätigkeitsbereich ist dann aber identisch mit dem der Bundes-
programmlehrkräfte. Die Lehrpläne der untersuchten Schulen entsprechen denen der
unterschiedlichsten Bundesländer. Gremien und Ausschüsse wie der Bund-Länder-Ausschuss
für schulische Angelegenheiten im Ausland (BLASchA) sollen in den vorliegenden
Ausführungen in ihrer Arbeitsweise vorgestellt werden. In einer Sitzung des
Unterausschusses für Auswärtige Kulturpolitik auf der die Mitglieder des BLASchA
anwesend waren, konnte konkret Einblick gewonnen werden in die unterschiedliche
Interessenlage der Bundes- und Ländervertreter. Dies soll in der Arbeit wiedergegeben
werden, wobei sich zeigen wird, ob und inwieweit Kulturföderalismus eine positive
Bereicherung oder überholtes Relikt ist. Zum Kulturföderalismus schreibt Axel Schneider:
“In ihrem Bericht zum Stand der auswärtigen Kulturbeziehungen65 würdigte die
Bundesregierung nicht nur den Beitrag der Länder zu gemeinsamen Programmen, sondern
konstatiert zunehmend eigenständige kulturelle Kontakte und Aktivitäten im Ausland, die sie
als ‚Bereicherung und Verdichtung der deutschen Kulturpräsenz im Ausland‘ grundsätzlich
begrüßt. Trotz der bestehenden und vor allem am Beginn der 90er Jahre verstärkten
Anstrengungen zur Koordinierung sieht sich die Bundesregierung an gleicher Stelle zu dem
Hinweis veranlasst, dass ihre volle und rechtzeitige, zumindest informatorische Einbindung
65 Bundesregierung: Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 1996/97. Drucksache: 13/9999.
38
[...] für die Wahrung ihrer Koordinierungsfunktion in der auswärtigen Kulturpolitik
unerlässlich ist‘. Zusammenfassende Statistiken und Übersichten, die diese Beiträge inhaltlich
oder zahlenmäßig abschließend darstellen, gebe es nicht; sie seien aber wünschenswert.
Lothar Wittmann66 räumte Informationsdefizite gerade auch im Hinblick auf die
Kulturförderung durch Bund und Länder ein.”67
Anzumerken ist, dass die Bundesländer seit der Diskussion um die Bundeskulturstiftung eine
Entflechtungsdebatte führen, Mischfinanzierungen sollen aufgehoben werden. “In der Bun-
desrepublik haben Bund und Länder auf der Grundlage der Rechtssprechung des
Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1971 den Entwurf einer ‘Verwaltungsvereinbarung über
die Finanzierung öffentlicher Aufgaben von Bund und Ländern (in der Praxis “Flur-
bereinigungsabkommen” bezeichnet) erarbeitet. [...]Vor diesem Hintergrund gibt es einen
Dissens über die Grundsätze einer Neuordnung, die die Ministerpräsidenten der Länder am
20.12.2001 als Basis für Gespräche mit der Bundesregierung formuliert haben.”68 Der
erwähnte Dissens berührt jedoch nicht die im Folgenden besprochenen Einrichtungen wie das
Goethe-Institut Inter Nationes. “Es gibt eine nationale Verantwortung für die Kultur, der die
Politik gerecht werden muss. Dies schließt eine gestaltende Kulturpolitik des Bundes ein.”69
Darum soll es in vorliegender Arbeit im auswärtigen Bereich gehen.
1.6. Absichten und Ziele der Arbeit
Das Forschungsziel dieser Arbeit ist nicht unabhängig von den politischen Vorgaben, aber
durch deren empirische Ergänzungen exemplarischer Aussagen über Konstruktion, Qualität
66Wittmann, Lothar: Förderung der deutschen Sprache im Ausland. Im Rahmen der Veranstaltung
“Sprachenpolitik in Europa-Politik für eine Verständigung der Regionen?” des Lessing-Kollegs in Marburg
vom 6.-8.10. 1995. (Typoskript). 67 Schneider, Axel: Die auswärtige Sprachpolitik der BRD. Eine Untersuchung zur Förderung der deutschen
Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und in der GUS 1982 bis 1995. In: Dr. Rabes
Doktorhüte, Bd. 2, Helmut Glück, Hg., Bamberg 2000, S. 166 f. 68 Nida-Rümelin, Julian: Die kulturelle Dimension des Nationalstaates. In: Frankfurter Rundschau, 8. März
2002, S 21. 69 Nida-Rümelin, Julian. In: Frankfurter Rundschau, 8. März 2002, S. 21.
39
Möglichkeiten der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik mit deren Konsequenzen zu
gewinnen. Es werden Klärungen für die Zukunft anzustreben sein.
Wie steht es mit der Eigenständigkeit und Brückenfunktion Auswärtiger Kultur- und
Bildungspolitik?
Ist Hildegard Hamm-Brüchers auf dem Symposium `8070 geprägter, bildhafter Vergleich für
die Auswärtige Kulturpolitik als Brücke relevant, eine Brücke die Menschen, Gesellschaften
und Kulturen verbinde? “..die Verankerungspunkte der Konstruktion einer solchen Brücke
liegen an beiden Ufern, also notwendigerweise immer auch und zunächst in der jeweiligen
Heimat.”71 Dies zu klären, tragen folgende Parameter bei: Das Deutschlandbild, welches
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik vermittelt, entscheidet mit über eine gemeinsame
friedliche Zukunft, das Lehren des Deutschen als Fremdsprache trägt zum Verständnis
unseres Landes und der Kultur bei und befördert wirtschaftlichen Austausch. Deutsch als
Fremdsprache, ein realitätsnahes Deutschlandbild, auch vermittelt über entsprechende
Lehrwerke, verankern die Brücke an einer Seite des Ufers. Gemeinsam mit Partnerländern
erstellte Lehrmittel, Länder übergreifende Lehrerausbildung, Begegnungsschulen,
Partnerschaften im Bibliotheks- und Ausstellungsbereich, gemeinsames Musizieren, die
Darstellung und Vorstellung Kulturschaffender beider Länder und Austausch bedeuten außer
dem Beschreiten der Brücke, deren Überquerung und der Möglichkeit der Begegnung auch,
Einblick in die Hindernisse, die einen Brückenbau notwendig machten und diesen auch auf
der anderen Seite zu verankern. Das Erlernen der Sprache der Partnerländer sowie
gemeinsame Kultur- und Bildungsabkommen und Verträge zwischen den Partnerländern
dienen der Befestigung der zweiten Seite.
Dabei ist zu fragen, welche Ausbildung die Kultur- und Bildungsarbeiter haben, die am
Brückenbau beteiligt sind, an welchen Fortbildungen sie teilgenommen haben und ob
deutsche Universitäten die für diesen Bereich notwendigen Vorlesungen und Übungen bieten.
Es ist aber auch nach der Konstruktion der Brücke zu fragen. Gewährt sie Einblick in das
scheinbar Unüberbrückbare? Ohne diese Beschreibung kann nicht geklärt werden, ob die
Brücke tragfest ist und ob ihre Strukturen und die Organisation einzelner Teile zueinander
70 Deutscher Bundestag: Symposium ´80, 26.-30. Mai 1980 in Bonn, Brücke über Grenzen. Bonn,1980. 71 Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation, Alois Wierlacher, Hg.,
Möhnesee. S. 440 .
40
zweckdienlich sind. Für eine dauerhafte Tragfähigkeit muss auch die Frage der Einstellung
der nötigen Mittel erörtert werden. Gibt es Lösungen - z. B. das Sponsoring- oder
gemeinsame Baumaßnahmen zweier Länder, die zur besseren Finanzierung der Brücke
beitragen können? Müssen Einzelteile neue Strukturen erhalten und wie sieht es bei der
personellen Situation der Brückenbauer aus. Dieses will die Arbeit klären. Dabei ist durchaus
das Bewusstsein vorhanden, dass auch das Brückenbild nur eine Hilfskonstruktion sein kann.
Es muss darauf geachtet werden, dass dieses Bild nicht zu technizistisch verwendet wird, da
ansonsten leicht das Unüberbrückbare aus dem Blickwinkel gerät. Bleibt man im Bild, so
kann es sein, dass beim Überschreiten der Brücke die Topographie nicht mehr erkannt wird.
Auf diese Gefahren weist Alois Wierlacher auch angesichts der sich zuspitzenden Irak-Krise
hin. Wenn Gräben einfach überfahren werden sollen, bevor ihre Beschaffenheit erkannt
wurde, stellt sich Orientierungslosigkeit ein. 72
Weil ganz offensichtlich eine gewisse Orientierungslosigkeit und Stagnation festzustellen ist,
soll ein Beitrag zur aktuellen Auseinandersetzung in der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik geleistet werden. Die politische Diskussion dreht sich nicht mehr in erster
Linie um das, was Anliegen der Entscheidungsträger oder ein von Betroffenen vorgetragenes
Anliegen ist, sondern wird bestimmt davon, was nicht notwendig erscheint. Die Negation
beherrscht das Geschehen.
Die Brücke oder die Säule - zwei Metaphern, die jeweils trotz aller Begrenzung der
Aussagekraft - ihre Berechtigung haben, sind nach der Wichtigkeit quantifizierbar. Ist es
Bombast oder eine der Realität entsprechende Behauptung – bei Ausgaben von 0,03% des
BIP für diesen Bereich - Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sei die “dritte Säule”?
Funktioniert Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik darüber hinaus im Sinne einer Brücke?
Um es zusammenzufassen, die Absichten und Ziele dieser Arbeit sind:
• die These von der dritten Säule der Außenpolitik, Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik neben der Außenwirtschafts- und der Sicherheitspolitik, wie
Willy Brandt es 1967 formuliert hat,73 bzw. einen “tragenden Pfeiler”74 zu
72 Siehe auch: Wierlacher, Alois: Distanz. In: Handbuch interkulturelle Germanistik, S. 222 Stuttgart, 2003. 73 Brandt, Willy: Bemerkungen zur auswärtigen Kulturpolitik. In: Auswärtige Kulturbeziehungen 4 (1967),
S.11-13.
41
überprüfen – als Alternative oder Ergänzung stünde das Bild der
Brückenfunktion (Hildegard Hamm-Brüchers auf dem Symposium `8075 geprägter
bildhafter Vergleich) zur Verfügung und wie die Betroffenen selbst diese Säule
bzw. Brückenfunktion sehen. Für die Betrachtung des Aufbaus der Säule rücken
die Mittlerorganisationen, vor allem aber das Goethe-Institut und die Deutschen
Schulen in den Mittelpunkt.
• der Debatte um die Zukunftsfähigkeit und damit über den Reformbedarf im
Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik des Bundes Anregungen zu
geben. Hierbei gibt die subjektive Sicht der Führungskräfte und Mitarbeiter
wertvolle Vorschläge für einen Wandel der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik.
Die wörtliche Wiedergabe der Äußerungen von Fachkräften, nicht abnickend affirmativ, ist
mir ein zentrales Anliegen. Menschen, die jahrzehntelang Erfahrung gewonnen haben,
kommen exemplarisch ausgewählt zu Wort, weil ihre Ideen und Vorschläge zur Veränderung
der Situation nicht überhört werden sollen.
2. Methodisches Vorgehen
2.1. Primär- und Sekundärquellen
Erfahrungen in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und Kulturarbeit haben
ergeben, dass bisherige normative oder induktive Versuche zu deren Erfassung unzureichend
waren. Deshalb soll auf diesem Gebiet durch Deskription eine Verdeutlichung herbeigeführt
werden. “Die Descriptio ist seit der griechischen Antike wichtiger Bestandteil der
rhetorischen Theorie und bezeichnet die kunstvolle Beschreibung von Personen, Dingen und
Orten.”76 Eine entsprechende Abgrenzung des Deskriptiven zum Normativen findet sich bei
74 Auswärtiges Amt 1972: Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik, Bonn,S.781. 75 Deutscher Bundestag: Symposium ´80, 26.-30. Mai 1980 in Bonn, Brücke über Grenzen. Bonn,1980. 76 Harshall, Albert W.: In: Ueding, Gert/ Niemeyer, Max, Hrsg., Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd.2,
Tübingen 1994, S.549.
42
Philippe Mastronardi. “Juristisches Denken ist normativ. Dadurch grenzt es sich ab vom
Beschreiben der beobachtenden Wissenschaften.”77 Mit Normativem meine ich geschriebene
Vorgaben durch die Politik oder die Institutionen, die prägend wirken sollen. Mit
Deskriptivem ist die Methode zur Beschreibung dessen gemeint, was die Kulturarbeit
ausmacht.
Das Forschungsthema ist durch die Quellenlage und die institutionellen Bedingungen nicht
deutlich erfasst. Die tatsächliche Arbeit ist bisher noch nicht in Zusammenhang mit den
institutionellen und staatlichen Vorgaben gebracht worden. Meine Frage ist deshalb: Was
unterscheidet die beiden Bereiche inhaltlich und organisatorisch, wo sind die
Berührungspunkte? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich u.a. für folgende
heuristische Vorgehensweise entschieden: “Das heuristische Verfahren in einer
wissenschaftlichen Darstellung besteht in der Darstellung des Weges, auf dem die Resultate
einer Wissenschaft gefunden worden sind.”78 “Von großem heuristischen Wert sind gute
Hypothesen.”79 Den Hypothesen entsprechen die Ziele und Absichten der vorliegenden
Arbeit, anhand derer die Wirklichkeit überprüft wird. Sie sind zur Orientierung notwendig.
“Der ganze Erkenntnisprozess – von seinem wie auch immer angenommenen Ausgangspunkt
– durch alle seine heuristischen Stadien hindurch bis zu seinem (immer nur vorläufigen)
Endpunkt – unterliegt methodologischer Regulierung und Bewertung, liefert keineswegs also
nur fertige Theorien.”80 Da Kulturpolitik und Kulturarbeit ständig im Fluss bleiben, kann das
auch nicht anders sein, gleichwohl wird mit dieser Arbeit angestrebt, dass künftig Wege und
Ziele der Auswärtigen Kultur und Bildung einleuchtender bestimmt und unter dem Aspekt
des Reformbedarfs und damit der Zukunftsfähigkeit ausgewertet werden können.
In der Arbeit sind infolgedessen Sekundärquellen wie Positionsberichte, Stellungnahmen,
Dialoge, Fragebögen die wesentlichen Stützpfeiler. Ich habe mir vorgenommen, handelnden
Personen, die die Kultur- oder Bildungsarbeit leisten und ein breites Erfahrungswissen
erworben haben, zu befragen und deren Aussagen der wissenschaftlichen und politischen
Diskussion um die Reform der Kultur- und Bildungspolitik zugängig zu machen. Leider
77 Mastronardi, Philippe: Juristisches Denken. Bern, Stuttgart 2001. S. 88 Randnote, S. 293 ff, S. 261 ff. 78 Philosophisches Wörterbuch: Hg. Heinrich Schmidt, Georg Schischkoff. Stuttgart 1957, S. 242 ff. 79 Philosophisches Wörterbuch: Hg. Heinrich Schmidt, Georg Schischkoff. Stuttgart 1957, S. 242 ff. 80 Spinner, Helmut F.: Theorie. In: Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Bd. 5. München 1993, S. 1502 ff.
43
machen die Institutionen und die Politik häufig keinen Gebrauch von diesem Potenzial und
berücksichtigen es zu wenig bei ihren Planungen.
Die oben beschriebenen Sekundärquellen werden in Zusammenhang mit den Primärquellen
gebracht, von jenen ergänzt, überprüft oder untermauert. Dadurch wird die Spannung
zwischen normativ eingrenzbarer Kulturpolitik und der praktischen Kulturarbeit
(Bildungspolitik, bzw. Bildungsarbeit) aufgezeigt. Im Vergleich zu bisherigen
Vorgehensweisen ist dieser Ansatz von Bedeutung, denn die Auswärtige Kulturpolitik lebt
sowohl von der Arbeit derer, die die Vorgaben machen, die Richtlinien planen als auch von
der Umsetzung durch die Akteure, die diese Vorgaben mit Leben erfüllen. Auch im Bereich
der Kulturwissenschaften in den Universitäten gibt es wissenschaftliche Entwicklungen, die
auf den Erwerb kreativer, kritischer und praxisnaher Kompetenzen für die Kulturarbeit
zielen. So heißt es bei der Beschreibung des Studienganges Kulturwissenschaft in Bremen:
“Kulturwissenschaft in Bremen hat deutschlandweit eine besondere Ausrichtung: Wir legen
großes Gewicht auf die Vermittlung von Methoden, die geeignet sind, kulturelle Milieus in
ihrer Bewegtheit zu untersuchen. Feldforschung und Teilnehmende Beobachtung sind
altbewährte ethnologische Vorgehensweisen, die eine verstehende Annäherung an das
Fremde erlauben. Mit dem Angebot von Feldforschungsübungen und Forschungsprojekten zu
aktuellen Themen wird den Studierenden die Chance geboten, interkulturelle Kompetenzen
zu entwickeln, die für die spätere Berufsarbeit von großer Bedeutung sind.”81
2.2. Aussagen, Selbstdarstellungen, Zitate82
Im Teil B finden sich unter der Überschrift: “Aufbau und Mängel der dritten Säule” die
Grundlagen und der Rahmen für das untersuchte Themenfeld. Es werden Selbstdarstellungen
der Mittler aufgenommen, weil auch dies eine Facette des gesamten Bildes ist. Akteure der
Auswärtigen Kulturpolitik im Bereich der Goethe-Institute und der Deutschen Schulen bis
zum Jahr 2002 kommen zu Wort, ebenso diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, dass
die Arbeit vor Ort ausgeführt wird. Sie haben einen guten Einblick in Gegebenheiten, die
81 http://wir.kultur.uni-bremen.de:8081. Stand 2.12.2002. 82 Siehe auch: Bortz, Jürgen. Döring, Nicole: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
Sozialwissenschaften. Berlin 2002.
44
verändert werden sollten. Dies unmittelbar aufzuzeigen war möglich, da ich einen direkten
Zugang zu den Institutionen, ihren Vertretern, den Leitern der Institute und Schulen und den
dort arbeitenden Personen hatte. Zitate dieses, die Auswärtige Kultur und Bildung prägenden
Personenkreises, sind in der Arbeit ausführlich gehalten, da sie bestimmend für die
Diskussion und zukünftige Gestaltung der von ihnen vertretenen Fachbereiche sind. Dazu
gehören z. B. Rolf Ehnert zum “Fach Deutsch als Fremdsprache”, Keith Dobson als Direktor
des British Council in Deutschland, aber auch Samuel Huntington mit seiner Vorstellung vom
“Clash of Civilizations.” Aussagen des Ministers Fischer sind aufgenommen, weil die
Zuständigkeit für die Auswärtige Kulturpolitik, die hier beschrieben wird, ihm in seiner
Eigenschaft als Außenminister obliegt.
Alle Zitate, ausgenommen aus drucktechnischen Gründen in C11, werden der besseren
Lesbarkeit halber nicht in Kursivschrift, sondern mit Anführungs- und Schlusszeichen
gekennzeichnet.
Im Teil C werden die Rahmenbedingungen für die einzelnen Schulen und Goethe-Institute
aufgezeigt und in einer Analyse unter C11 die typischen Ergebnisse zusammengefasst.
2.3. Interviews und Meinungsbilder
Durch Experteninterviews83 und Meinungsbilder mit Fachleuten auf verschiedenen Ebenen
und aus unterschiedlichen Bereichen werden Informationen über ihre Ansichten, die
zukünftigen Herausforderungen und den Reformbedarf konkret vermittelt. Die hohe
Bereitschaft und die Offenheit der Befragten, Auskünfte zu geben, ihre eigene Sicht zu
erläutern und Verbesserungsvorschläge zu machen, hat diese Arbeit mit einer Fülle von
Informationen ausgestattet. “Das Intensivinterview unterscheidet sich von Befragungen
anhand von Leitfäden durch Dauer und Intensität. Es setzt außerordentlich hohe Bereitschaft
des Befragten voraus und wird dort angewendet, wo es beispielsweise darum geht, besonders
individuelle Erfahrungen zu eruieren.”84 Bei den Interviews und Meinungsbildern wurden
offene Verfahren verwendet und auf eine streng vorstrukturierte Vorgehensweise verzichtet.
Im Vordergrund standen immer Aspekte zukünftiger Entwicklungen und anstehender
83 Siehe auch: Koch, Patricia, Maria: Qualitative Mitarbeiterbefragungen. Fern Universität Hagen, August
2003. (Typoskript) 84 Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin, New York, 8.Aufl, S.174.
45
Reformen. Es wurde auf genaue Vorformulierung der Fragen verzichtet, um den Gesprächen
und Interviews nicht die Spontaneität und den kommunikativen Fluss zu nehmen. „Aus dieser
Vorgehensweise ergeben sich eine Reihe von Nachteilen gegenüber dem standardisierten
Interview: z. B. höhere Anforderungen an die Bereitschaft des Befragten zur Mitarbeit und an
seine sprachliche und soziale Kompetenz.”85 Von einer hohen Kompetenz der Befragten zur
Schilderung des Zustandsbildes und seines Reformbedarfs konnte ausgegangen werden.
Jedoch wurden Indikatoren benötige, um eine Operationalisierung vornehmen zu können. Als
Akteurin, die bemüht war, ihre Vorstellungen an den Realitäten, die sie vorgefunden hatte, zu
orientieren, nahm die Verfasserin dabei die Rolle einer sachorientierten Gesprächspartnerin
mit Forschungsinteresse ein. Kommunikativität war konstitutiver Bestandteil der Befragung.
Daraus resultierte, zu spezifizieren, was die Befragten mit ihren Äußerungen genau meinten.
Die Interviews wurden auf Band aufgenommen, um eine volle Konzentration auf die
Gesprächssituation zu ermöglichen und komplexe Zusammenhänge zu erörtern. Das
Untersuchungsfeld war die möglichst „natürliche“ Welt. Bei einigen Gesprächen wurden
Notizen gemacht, die dann zusammengefasst wurden. Gesprächsaufzeichnungen finden sich
im Teil B, z.B. unter “Fachgespräche im Goethe-Institut” oder unter “Auswärtige
Kulturpolitik im Schulwesen”, um die Aufgaben, die sich der Kultur- und Bildungsarbeit
stellen, von kompetenter Seite verdeutlichen zu lassen. Die Interviews finden sich im Teil C
2..-10., da die direkte Gesprächsform am ehesten in einen vorwiegend empirischen Teil passt.
Insgesamt wurde eine möglichst naturalistisch-kommunikative Situation hergestellt, durch die
erst eine Interpretation von Ergebnissen und deren Bedeutung möglich wurde. Ziel war es,
Informationen zu vorab formulierten Problembereichen zu erhalten und den Befragten die
Möglichkeit zu geben, ihre eigene Sichtweise- auch mit ihren eigenen Worten und
Relevanzstrukturen- zu verdeutlichen. Als Leitfaden dienten die Themenbereiche, die Alois
Wierlacher und Hans R. Reich als „zentrale Bedingungen der Selbstkonstitution“86 für die
interkulturelle Bildung benennen, sowie die Themenschwerpunkte der Analyse von
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten, die für die Fragebögen unter D aufgestellt sind. Um
85 Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin, New York, 8.Aufl, S.175. 86 Reich, Hans R.; Wierlacher Alois: Bildung. In: Handbuch interkulturelle Germanistik. Wierlacher Alois u.
Bogner Andrea, Hg., Stuttgart, 2003. S.206. Siehe auch unter: Begriffliche Klärung. A.1.2. Interkulturelle
Bildung.
46
das, was der Befragte gemeint hat, genauer zu verstehen, wurde beim Nachhaken, manchmal
gebeten, den Sachverhalt genauer auszuführen, um relevante Aspekte des
Untersuchungsphänomens zu veranschaulichen.
2.4. Fragebögen
Unter D1. ist die Entstehung der Fragebögen, im Teil D2. die methodische Vorgehensweise
bei der Befragung der Beschäftigten genauer erläutert. Um den Fragebogenteil nicht zu
zerreißen, werden die vorläufigen Ergebnisse und der benannte Reformbedarf nicht in den
Teil E integriert, sondern bleiben dem Teil D vorbehalten. Typische Ergebnisse mit konkreten
Veränderungsvorschlägen der Befragten werden unter D 6 aufgezeigt und unter D7 werden je
ein Fragenkomplex für die Deutschen Schulen und die Goethe-Institute aufgenommen, die in
Bezug auf neue Konzepte von besonderer Bedeutung sind: D 7.1. Forderungen für die
Zukunft Deutscher Schulen und D 7.2. Goethe-Institute - in Zukunft Europäische
Kulturinstitute? Während im Teil C das Forschungsinteresse in den Interviews auf direkte Art
zum Tragen kommt, erscheint es im Teil D, in den Fragebögen, auf indirekte Art. Im
Gesprächs- und Interviewteil handelt es sich ganz klar um qualitative Studien87. Für die
vorliegende Arbeit gilt die Interpretation von Patricia M. Koch: “Der Begriff der
‘qualitativen’ im Gegensatz zur ‘quantitativen’ Forschung ist eher irreführend als
bezeichnend. Qualität wollen beide Richtungen, wenn auch auf anderen Wegen. Der Begriff
‘qualitativ’ wird dem Begriff ‘quantitativ’ entgegengesetzt, d. h. es soll primär nicht
quantifiziert werden. Diese Begrifflichkeit lässt keine genauere Operationalisierung dessen
zu, was überhaupt definiert werden soll.”88 Die Befragung der Beschäftigten an Goethe-
Instituten und Deutschen Schulen, (Schulleiter, Lehrkräfte, Leiter der Institute, Entsandte,
Ortslehrkräfte) in ausgewählten Ländern Europas ist zum Teil quantitativ – statistisch.
Anfolgend werden die Fragen gebündelt und unter bestimmten sachlichen Gesichtspunkten
87 Siehe auch: Mayring, Philipp: Einführung in dir qualitative Sozialforschung. Untersuchungspläne S.40ff.. Zur
qualitativen Analyse S.65ff., zur Interpretation S.145. Basel. 2002. Friedrichs, Jürgen. Methoden empirischer Sozialforschung. Methoden S.162ff, zu Fragen S.192ff., Interview
S.207, Tiefeninterview S.224, schriftliche Befragung S.236, Inhaltsanalyse S.314, Auswertung, Interpretation
S.338. Opladen, 1990.
47
z.B. “Ausbildung, Fortbildung” zusammengefasst, die Antworten statistisch erfasst,
strukturiert und klassifiziert. Die Auswertung wird nach den Zwischenergebnissen qualitativ
ausgeweitet im Fazit. “Qualität gibt Auskunft über die Beschaffenheit, das ‘Wie’ der
Dinge.”89
Bei den Teilen C “Goethe-Institute und Deutsche Schulen in Europa und ihr Reformbedarf”
und D “Befragung der Beschäftigten” handelt es sich um zwei voneinander unabhängige
Bereiche mit Quellen empirischer Art. Die Fragebögen dienen zur Vertiefung und
Erweiterung des ersten Ergebnisses, welches durch die eigene Beobachtung, durch die
offiziellen Quellen der Bundesregierung, der Mittler, der Schulen und der oben erwähnten
Sekundärquellen entstanden ist. Was nicht im Teil C, dem ersten empirischen Teil dargestellt
wurde, wird zusätzlich exemplarisch in den Fragebögen ermittelt. Es ist das zweite Ergebnis
und dient zur Korrektur, Bestätigung und zur Erweiterung.
2.5. Teilnehmende Beobachtung90
Die Teile E und F “Zukunftsfähigkeit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik” und
“Die Reform der dritten Säule ist unerlässlich” beinhalten folgende Aspekte: Aufnahme,
Wiedergabe und Interpretation. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Fazit zu einer
Handlungsanleitung für reformorientierte Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und
Kulturarbeit umgestaltet. Die eigenen Vorstellungen zur Neuorientierung fließen hier mit ein:
„Die teilnehmende Beobachtung ist die Form der Beobachtung, bei der der Forscher
(Beobachter) das Sprachverhalten von Personen in natürlichen Kontexten beobachtet, indem
er an Aktivitäten der Personen teilnimmt, ohne diese Aktivitäten zu stören.”91
Es wird sich erweisen, dass dieser Ansatz unter dem methodischen Aspekt der teilnehmenden
Beobachtung (und der “beobachtenden Teilnahme”), mit der Beschränkung auf Exemplarität,
88 Koch, Patricia Maria: Doktorandinnen. Der Wille zur wissenschaftlichen Anerkennung. Prof. Dr. Ilse
Modelmog, Hg., Hamburg, 1995, S.83. 89 Koch, Patricia Maria: Doktorandinnen. Der Wille zur wissenschaftlichen Anerkennung, Hamburg, 1995, S.84. 90Siehe auch: Dieckmann, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen.
Planung S.200ff., Befragung S.371ff. Reinbek, 2002. 91 Schlobinski, Peter: Empirische Sprachwissenschaft, WV studium, Band 174, Opladen, 1996, S.50.
48
einer Wiedergabe der inneren Vielfalt der Auswärtigen Kulturpolitik am ehesten gerecht wird
und dem Ziel der Arbeit dienlich ist.
3. Wissenschaftliche Beiträge zum Reformbedarf
Kürzere Beiträge zum Reformbedarf Auswärtiger Kulturpolitik finden sich vor allem in
Studien, Sammelbänden, Festschriften, Akten von Symposien, Feuilletons und
wissenschaftlichen Zeitschriften. Einige dieser Beiträge sind in die Arbeit eingeflossen. Die
wenigen ausführlicheren wissenschaftlichen Publikationen, die sich nicht in Sammelbänden
befinden und sich inhaltlich bis zum Jahr 1990 mit der Auswärtigen Kulturpolitik des Bundes
befassen, berühren das Thema der Arbeit nur sehr begrenzt. Einige seien aber hier genannt:
“Die Politik des Kulturaustausches. Was fehlt in der Bundesrepublik Deutschland?”,
erschienen München 1977 von Oskar Splett, “Die auswärtige Kulturpolitik der
Bundesrepublik Deutschland. Sozalwissenschaftliche Analysen und Planungsmodelle”,
Stuttgart 1978, verfasst von Hansgert Peisert, “Die auswärtige Kulturpolitik der
Bundesrepublik Deutschland. Grundlagen, Ziele, Aufgaben. Eine Titelsammlung”, von Udo
Rossbach, Stuttgart, 1980, “Auswärtige Kulturpolitik. Stellungnahme der Bundesregierung
zum Bericht der Enquête-Kommision”, erschienen 1980 in Bonn und Barbara Lipperts
“Auswärtige Kulturpolitik im Zeichen der Ostpolitik. Verhandlungen mit Moskau 1969 -
1990” (1996). Fast alle diese Veröffentlichungen befassen sich mit der Zeit vor der Ära Kohl.
Die Jahresbibliographie des Jahrbuches Deutsch als Fremdsprache der Herausgeber Alois
Wierlacher u. a. bietet seit 1975 eine Fülle fremdheitswissenschaftlicher Beiträge. Weitere
Werke des Herausgebers Alois Wierlacher sind die Festschrift des Instituts für Internationale
Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit (IIK Bayreuth) aus Anlass seines zehnjährigen
Bestehens 1990-2000 mit dem Titel “Kulturthema Kommunikation. Konzepte, Inhalte,
Funktionen”, aus dem Jahr 2000, sowie Forschungsarbeiten zur “Architektur interkultureller
Germanistik”92 und das „Handbuch interkulturelle Germanistik“ aus dem Jahr 2003,
Mitherausgeberin Andrea Bogner. Beiträge zahlreicher Autoren geben mit ihrer Vielfalt eine
zusammenfassende Darstellung der neuen Entwicklungen, worauf insbesondere bezüglich der
Rahmenbegriffe in dieser Arbeit zurückgegriffen wird. In „Konzepte der Kultur-
wissenschaften“, herausgegeben von Ansgar und Vera Nünning, wird ein interdisziplinärer
92 Wierlacher, Alois: Architektur interkultureller Germanistik.- München ,2001.
49
Diskussionszusammenhang hergestellt. Zu “Deutsch als Fremdsprache” wurde ein
“Internationales Handbuch”, herausgegeben von Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici,
Hans-Jürgen Krumm93 mit Beiträgen zu Forschung und Lehre. Stellvertretend sollen mit
diesem Werk und einer weiteren grundlegenden neueren Veröffentlichung: “Die auswärtige
Sprachpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung zur Förderung der
deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und der GUS 1982 bis 1995”
(2000) von Axel Schneider, meine Arbeit betreffende Kapitel schlaglichtartig beleuchtet
werden. Deutschen Universitäten und ihrer Leistung für die Ausbildung zur Auslandskultur-
und Bildungsarbeit in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache ist das abschließende Kapitel
gewidmet.
3.1. Deutsch als Fremdsprache
Das Handbuch Deutsch als Fremdsprache: “Ein internationales Handbuch”, herausgegeben
von Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici im Verlag Walter de Gruyter, Berlin, New
York, 2001 ist das derzeit umfangreichste neuere Werk (1720 Seiten) zum Bereich Deutsch
als Fremdsprache. “Das Handbuch will den erreichten Entwicklungs- und Erkenntnisstand des
Faches sowohl in seinen theoretischen und empirischen Grundlagen als auch in seinen
Konsequenzen in der Praxis des Lehrens und Lernens darstellen. Es zielt auf interdisziplinäre
Sicht.”94 Deutlich kommt zum Ausdruck, dass es nicht nur um ein Aufzeigen des Ist-
Bestandes geht, sondern um eine Weiterentwicklung des Fachbereichs. Für die vorliegende
Arbeit ist die von Gabriele Pommerin vorgenommene Präzisierung des Begriffs des
Interkulturellen Lernens, wie unter 1.2. aufgezeigt, von Bedeutung. Darüber hinaus
interessiert besonders der Abschnitt über den “Deutschunterricht und Germanistikstudium im
fremdsprachigen Ausland.”, der auch für verschiedene Länder “Rahmenbedingungen für den
Deutschunterricht.” beschreibt, wie es diese Arbeit exemplarisch für die Rahmenbedingungen
in der Türkei, in Großbritannien, in Schweden, in Tschechien und der Slowakei vornimmt.
93 Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici, Hans-
Jürgen Krumm, Hrsg., Berlin , New York, 2001. 94 Deutsch als Fremdsprache: Ein internationales Handbuch;
Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert Henrici, Hrsg., Berlin, New York, 2001, Klappentext.
50
Im Gegensatz zum Bericht von Nilüfer Tapan, die eingehend den Deutschunterricht an
türkischen Schulen auf der S. 1565ff. im Handbuch behandelt, befasst sich die vorliegende
Arbeit bei der Türkei schwerpunktmäßig mit der Schulreform sowie ihren Auswirkungen auf
das Alman Lisesi. Der Bericht aus Großbritannien von Dietmar Rösler auf S. 1464ff.
beschreibt vor allem die geschichtliche Entwicklung des Deutschunterrichtes an den Schulen
und die jetzige Situation von Deutsch als Fremdsprache an den Universitäten. Mein Bericht
jedoch stellt die Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht an den Schulen heute dar. Er
ist außerdem geprägt durch Aufenthalte (1998) und die dort gemachten Erfahrungen in der
Deutschen Schule und dem Goethe-Institut.
Zum Deutschunterricht in Italien erläutert Donatella Ponti auf S.1509ff. im Handbuch die
Situation für Deutsch an allen Schularten sowie die Fremdsprachenlehreraus- und --
fortbildung. Christian Timme führt auf S. 1557ff. ganz allgemein die Situation für den
Deutschunterricht in Frankreich aus, differenziert dann nach Deutsch in der Primarstufe und
Deutsch in der Sekundarstufe I und II. Von Anatoli Donaschew ist eine eingehende
Beschreibung des Deutschen im Schulcurriculum in Russland auf S. 1557ff. zu finden. Zu den
Bedingungen in Italien, Frankreich und Russland wurde im Handbuch so ausführlich
gearbeitet, dass sie deshalb hier nicht weiter ausgeführt werden.
Für Portugal (Anita Dreischer auf S. 1523ff. im Handbuch) wurde das kulturelle Umfeld,
welches den Deutschunterricht befördert, geschildert. Zu den Berichten zu Schweden,
Tschechien und der Slowakei gibt es keine Parallelen im Handbuch. Insgesamt werden in
vorliegender Arbeit Rahmenbedingungen vor allem für das schulische Umfeld und die
Goethe-Institute dargestellt, nicht für die Universitäten, die Deutsch als Fremdsprache lehren.
Dieses leistet das Handbuch.
3.2. Die auswärtige Sprachpolitik
Eine neuere Forschungsarbeit, die sich mit der Auswärtigen Kulturpolitik und ihrer Förderung
auseinandersetzt, ist bei Dr. Rabes Doktorhüte “Arbeiten zur germanistischen
Sprachwissenschaft und zum Deutschen als Fremdsprache” erschienen. Der Titel lautet: “Die
auswärtige Sprachpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung zur Förderung
der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und der GUS 1982 bis
1995” (2000) von Axel Schneider. Auf diese Untersuchung wird häufiger in der vorliegenden
Arbeit Bezug genommen. Die Ausgangslage für Axel Schneider war eine politische Situation
in Deutschland, in der die Auswärtige Kulturpolitik wieder an Bedeutung gewann, Zeiten des
51
politischen Umbruchs und der knappen Kassen, in denen über die Prioritäten der Kulturpolitik
diskutiert wurde. Axel Schneider arbeitete zu der Zeit wissenschaftlich am Thema, in der ich
intensive politische und organisatorische Erfahrungen im Bundestag und bei den
Mittlerorganisationen sammelte. Umfangreiches Datenmaterial: das vorgestellte Detailwissen
über die Organisation der Auswärtigen Kultur, die Vorstellung der verantwortlichen
Personen, die Geschichte der Auswärtigen Kulturpolitik von 1949 bis 1995, ist von ihm
zusammengetragen worden. Mittlerorganisationen und ihr Aufgabenfeld, Programme und
Projekte zur Förderung des schulischen Deutschunterrichts sind untersucht. Die Fragestellung
unter der die Deutschen Schulen im Ausland von Axel Schneider betrachtet werden,
unterliegt dem Gesichtspunkt der Förderung auswärtiger Sprachpolitik. Unter “Schwerpunkt
im Konzept der Sprachverbreitung” sind “Neuansätze bei der Vermittlung von Lehrkräften”
aufgezeigt. Axel Schneider bietet eine Vielzahl von Tabellen und Diagrammen, z. B.
“Entsendung deutscher Lehrkräfte durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, nach
MOE und GUS im Schuljahr 1994/1995” oder “Schließungen und Zusammenlegungen von
Goethe-Instituten seit 1989” oder “Verbreitung von Medien im Rahmen der Förderung der
deutschen Sprache in MOE/GUS 1994 nach StADaF”. Die Untersuchung Schneiders
benennt akribisch Stellenwert, Zielsetzung, Funktion der Auswärtigen Kulturpolitik
innerhalb der Außenpolitik.
Was Axel Schneider nicht leisten konnte, nämlich das Spannungsfeld zwischen Theorie und
Praxis der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und der praktischen Kulturarbeit
aufzuzeigen und daraus Vorschläge zu ihrer Förderung zu entwickeln, soll in vorliegender
Arbeit versucht werden.
3.3. Deutsche Universitäten und ihre Leistung für Deutsch als Fremdsprache
Auf die Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache ist unter 1.6. hingewiesen worden.
Daraus ergibt sich, dass Lehre und Forschung sich dergestalt mit diesem Fachbereich
befassen müssen, dass zukünftige Kulturvermittler und Lehrer so ausgebildet sind, dass sie
die Verbreitung des Deutschen als Kultursprache in ihrem Arbeitsfeld beherrschen.
Es ist zu befürchten, dass viele Sprachen nicht überleben werden, weil sie in der geistigen
Auseinandersetzung verstummen, weil ein Sprachen-Konzentrationsprozess eingesetzt hat.
Sprachen sind als Teil lebendiger Organismen zu verstehen, die aufeinander wirken und sich
in einer Symbiose fortentwickeln. Die Vielfalt der Sprachen erhalten unsere Sprech- und
Denkkulturen durch gegenseitiges Einwirken aufeinander. Wie viele Worte aus anderen
52
Sprachen und Kulturen sind uns in einer gemeinsamen europäischen Sprachenwelt
selbstverständlich, man denke an die Vielzahl der aus dem Arabischen stammenden Wörter
wie “Algebra, Ziffer, Chemie”, die bei uns verwendet werden. Deutsch und das Beharren auf
Deutsch - in verschiedenen nationalen Standardvarietäten95 - als wesentlichem Bestandteil
der kulturellen Entwicklung, soll dazu beitragen die Sprachen der Welt vielfältig und lebendig
zu erhalten. Der Überlebenswillen der großen Sprachen mit großen Territorien und vielen
Sprechern ist auch ein Garant für den Fortbestand der kleineren Sprachen mit kleinen oder
keinen Territorien und wenig Sprechern96. Ein Großteil der 25 Thesen zur Sprach– und
Kulturvermittlung im Ausland97 sind der Spracharbeit gewidmet. So heißt es z. Bsp. in These
18.: „Spracharbeit und Kulturarbeit: Jede Form von Spracharbeit mit jedweder Adressaten-
gruppe ist immer auch Kulturarbeit. Die Begegnung mit der fremden Kultur beginnt in der
ersten Stunde des Sprachunterrichts. Von daher ist eine Abtrennung der Spracharbeit von der
Kultur nicht angemessen.“
These 22 ´Lebendigkeit´ lautet: „Der Sprachunterricht steht immer in einem Spannungsfeld
privaten und öffentlichen Kulturverständnisses. Aus dieser Spannung erhält er seine
Lebendigkeit.“ Daraus ergeben sich neue Zielsetzungen der Sprachpflege, nicht mehr nur die
„defensiv-puristische, nationalsprachliche Sprachpflege von einst, sondern zu einer
offensiven, Internationalität fördernden Sprachkultivierung bzw. Kommunikations-
kultivierung führen. Unter Kommunikationskultivierung verstehe ich alle sprachpflegerischen
Aktivitäten, die sich in den Dienst der im deutschen Sprachgebiet lebenden und
kommunizierenden Menschen stellen,“98 so Albrecht Greule, der auch auf den Regional-
95 Ammon, Ulrich: Die nationalen Varietäten des Deutschen im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache. In:
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23. München, 1997. S.143. 96 Vergleiche: Zu “großen” und “kleinen” Sprachen. Alleman-Ghionda, Christina. Mehrsprachige Bildung in
Europa. In: Grundlagen interkulturellen Lernens. 1.1.1. BMW Arward für interkulturelles Lernen. München,
1997. 97 Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts. 25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung im
Ausland, 1991. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18, Alois Wierlacher u. a. Hg., München,1992. S. 218ff. 98 Greule, Albrecht: Deutsch am Scheideweg: National- oder Internationalsprache? In: Thema Deutsch , Band 3:
Deutsch, Englisch, Europäisch. Matthias Wermke u.a. Hg., Mannheim 2002,S. 63.
53
variantenreichtum innerhalb der deutschen Schriftsprache hinweist, der seiner Meinung nach
„für den „DaF – Unterricht eine interessante Herausforderung“99 darstellt. Ulrich Ammon
wendet sich in seinen Überlegungen zu den „nationalen Varietäten des Deutschen im
Unterricht von Deutsch als Fremdsprache“100, dem Fakt zu, dass Deutsch nicht mehr regional
einheitlich, sondern differenziert gesehen wird: „Es gibt eine nicht unbeträchtliche Zahl von
Sprachformen, die standardsprachlich, aber nicht gemeindeutsch (einheitssprachlich) sind.[...]
Sofern solche Varianten national verteilt sind, nennt man sie heute zumeist nationale
Varianten. Die durch sie gebildeten spezifischen Sprachsysteme heißen dann nationale
Varietäten. Sprachen mit verschiedenen nationalen Varietäten nennt man plurizentrisch oder
berechtigterweise auch plurinational.“101 Er fährt dann fort: „Die Deutsche Sprache ist
plurizentrisch und plurinational, was zumindest intensional nicht identisch ist.[...]Dass die
Zentren einer Sprache nicht unbedingt identisch sein brauchen mit den Nationen, lässt sich in
Bezug auf die Zeit vor der Neuvereinigung Deutschlands verdeutlichen. Damals gab es
durchaus standarddeutsche Unterschiede zwischen BRD und DDR, und zwar auch über den
ideologischen Wortschatz hinaus.“102 Für den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache folgt
daraus, dass es nicht nur eine standardsprachliche Norm gibt, sondern regionale Varianten,
die gelehrt und gelernt werden.
Zum Thema, welches Deutsch denn nun angesichts der Dominanz der englischen Sprache
gelehrt werden soll, gibt These 24 Hinweise: „Intellektualität: Ein Sprachunterricht, der nur
triviale Alltagskommunikation im Blick hat, unterfordert die Lernenden. Der Kulturbegriff ist
so auszulegen, dass er die Intellektualität der Lernenden von Anfang an herausfordert. Dies
gilt für alle Lern- und Arbeitsgruppen.“103 Ulrich Ammon stellt einen engen Bezug zwischen
99 Greule, Albrecht: Deutsch am Scheideweg: National- oder Internationalsprache? In: Thema Deutsch , Band 3:
Deutsch, Englisch, Europäisch. Matthias Wermke u.a. Hg., Mannheim 2002,S. 58. 100 Ammon, Ulrich: Die nationalen Varietäten des Deutschen im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache. In:
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23. München, 1997. S.141-158. 101 ebd. 102 Ammon, Ulrich: Die nationalen Varietäten des Deutschen im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache. In:
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23. München, 1997. S.148. 103Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts. 25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung im
Ausland, 1991. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18, Alois Wierlacher u. a. Hg., München,1992. S. 218ff.
54
wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Potential fest und begründet die Dominanz der
englischen Sprache als Wissenschafts- und Wirtschaftssprache aus der geschichtlichen
Perspektive: „Spezifisch deutsch war allerdings die Vertreibung und Tötung eines Großteils
der besten eigenen Wissenschaftler im Nationalsozialismus: Schon bis 1936 hatten 1617
Hochschullehrer das Land verlassen müssen, von denen die meisten, nämlich 1160 in
englischsprachige Länder gingen, 825 in die USA.; die wenigsten wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg zurück berufen. Im Zweiten Weltkrieg wurden die deutsch- und die
französischsprachigen Länder erneut verwüstet. Die USA stiegen zur unumschränkt stärksten
Wirtschafts- und Wissenschaftsmacht der Welt auf.“104 Barthold C. Witte, Leiter der
Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes von 1983-1991, hebt in seinem Vortrag anlässlich
der Feier zum zehnjährigen Bestehen von interDaF e.V. am Herder-Institut der Universität
Leipzig am 25.10.2002 die Problematik der Verschiebung hin zum Englischen hervor: „Wir
brauchen in dieser komplizierten Lage eine kohärente Sprachpolitik, welche die Frage nach
ihrem ´Warum´ ebenso beantwortet wie die Frage nach ihren Handlungsräumen sowie nach
dem Umfang und dem Einsatz der Mittel.“
Deutsche Universitäten leisten einen wichtigen Beitrag zur Lösung der oben gestellten
Fragenkomplexe. Wer das breite Spektrum der Wissensvermittlung in diesem Fachbereich an
den Universitäten betrachtet, wird deren Bedeutung für die Auslandskulturarbeit im Sinne der
25 Thesen erkennen. Daher wird in den Fragebögen nach der Ausbildung und der
Fortbildung in diesem Bereich gefragt. Im Fach Interkulturelle Germanistik und der mehr auf
die praktische Anwendung bezogenen Varianten Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als
Zweitsprache wird durch die Benennung der Inhalte der Seminare und Vorlesungen deutlich:
Ohne eine an den 25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung im Ausland orientierte
Ausbildung muss Auslandskulturarbeit Stückwerk bleiben. Daher im Folgenden ein kurzer
Einblick in diesbezügliche Veranstaltungen an Universitäten in Deutschland:
Im „Handbuch interkulturelle Germanistik“ beschreibt Alois Wierlacher zur Entwicklung des
Faches Interkulturelle Germanistik an der Universität Bayreuth (1986-2002) „Nur wenige
Monate nach seiner Institutionalisierung hat das junge Fach unter Förderung durch die
104Ammon, Ulrich: Deutsch unter Druck von Englisch in Wissenschaft und Politik. In: Thema Deutsch, Band 3:
Deutsch, Englisch, Europäisch. Matthias Wermke u.a. Hg., Mannheim 2002, S. 141.
55
Deutsche Forschungsgemeinschaft, mit dezidierter Zustimmung des bayerischen Wissen-
schaftsministers und der Universitätsleitung im Juli 1987 den ersten Kongress für
interkulturelle Germanistik veranstaltet. Er hat sich inzwischen diskursführend in die
Theoriearbeit interkultureller Germanistik engagiert. [...] Als Wissensformen hat das Fach vor
allem das Theoriewissen, Sprach- und Kulturwissen sowie das Fremdheits- und komperative
Weltwissen in die übergeordnete Reflexion interkultureller Kommunikation integriert. [...]
Eine separate Didaktik-Komponente hat die Bayreuther Interkulturelle Germanistik nicht
eingerichtet. Stattdessen wurde angestrebt, sprach-, literatur- und kulturdidaktische Aufgaben
des Faches im Sinne der Praxisorientiertheit einer angewandten Kulturwissenschaft in die
verschiedenen Komponenten zu integrieren. [...] Die Hauptprogrammziele des Faches waren
von Beginn an: Erforschung und Vermittlung deutschsprachiger Kulturen unter der
Bedingung und in der Perspektive ihrer Fremdheit.
Befähigung deutscher und ausländischer Studierender zu verschiedenen Berufen der
internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel in der internationalen Wirtschaft, der
grenzüberschreitenden Verwaltung und den auslandsbezogenen Bildungsbereichen, in der
Wissenschaft, der Kulturarbeit, den Medien oder der Diplomatie.“105
Auf den Sammelband der „Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache: Das Fach Deutsch als
Fremdsprache in den deutschsprachigen Ländern”, herausgegeben von Rolf Ehnert und
Hartmut Schröder,106 wird in dieser Arbeit häufiger zurückgegriffen. Dieser befasst sich mit
der Geschichte, der Didaktik und dem Selbstverständnis des Faches und liefert zur
Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für Deutsch als Fremdsprache in Deutschland (Rolf
Ehnert) und der Schweiz (Martin Müller) einen Überblick bis 1994.
“Informationen zu einem besonderen Germanistikstudium”, so ist die Darstellung des
Diplomstudiums in Bamberg betitelt. Die Studierenden leisten ein wenigstens vier Wochen
dauerndes Praktikum im Ausland während des Grundstudiums ab, sowie 6 Wochen
Praktikum im Hauptstudium. Mindestens an einem der Praktika sollte während eines
105Wierlacher, Alois: Interkulturelle Germanistik in Deutschland. In: Handbuch interkulturelle Germanistik.
Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg... Stuttgart, 2003, S.612 ff. 106 Ehnert, Rolf, Schröder, Hartmut, Hrsg.: Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache. Das Fach Deutsch als
Fremdsprache in den deutschsprachigen Ländern. Frankfurt, u.a., 2. korrigierte Auflage 1994.
56
Auslandssemesters oder -jahrs teilgenommen werden. Es werden Symposien veranstaltet wie
“Probleme der Qualifizierung für Sprach- und Kulturarbeit im Ausland.“
Die Universität Bayreuth hat das Institut für internationale Kommunikation und Auswärtige
Kulturarbeit (IIK Bayreuth, jetzt Würzburg) mit ins Leben gerufen. ”Zweck der
Institutsgründung war der Aufbau eines Gemeinschaftshandelns im Problembereich der
Fremdheitserfahrung und interkulturellen Kommunikation. [...] Grundlegend für die
Institutsarbeit [...] war von Anfang an der beständig geführte Dialog zwischen Wissenschaft
und Praxis.”107 Die “Akademie für interkulturelle Studien an der Universität Würzburg”
verleiht jährlich den Akademie-Preis für besonders qualifizierte Arbeiten für interkulturelle
Studien und setzt somit ein Zeichen für die Bedeutung interkulturellen Lernens.
Das Institut „Deutsch als Fremdsprache“ der Ludwig-Maximilians-Universität München
befasst sich u.a. mit partnerschaftlicher Lernmaterialentwicklung in Zusammenarbeit mit
dem Goethe-Institut München.
An der Universität Bielefeld findet sich als Angebot “Interkulturelle Pädagogik.
Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern für deutsche und ausländische Kinder” mit den
Lehrenden Dr. Rolf Ehnert und Prof. Dr. Gert Henrici, die ihre Studenten für ihr zukünftiges
Aufgabenfeld vorbereiten.
Die Universität Leipzig mit dem Herder-Institut beschäftigt sich im Bereich “Deutsch als
Fremdsprache” im Hauptseminar “Deutsche Außenpolitik unter Berücksichtigung der
Kulturpolitik (1945-1989)” speziell mit der Außenpolitik der ehemaligen DDR. In der
Humboldt Universität in Berlin gibt es im gleichen Fachbereich z.B. ein Seminar “Literatur
über Berlin und Literatur aus Berlin.” Die Johannes Gutenberg Universität Mainz veranstaltet
ein Seminar “Sprechtechniken und Sprechsicherheit” für Studierende der Zusatzqualifikation
DaF.
Auch das folgende Beispiel zeigt, dass Universitäten die 11. These zur Sprach- und
kulturvermittlung im Ausland zu ihrer Angelegenheit machen: „Sprachkultur: Für die Kultur
im Sinne der auswärtigen Kulturpolitik ist die Sprachkultur zentral. Unter den Künsten,
verstanden als ausgezeichnete Äußerungen der Kultur, hat die Literatur in diesem Rahmen
einen besonderen Stellenwert, da sie der Sprachkultur näher steht als andere Künste. Aber
107 Wierlacher, Alois: Begründung und Entwicklungsgeschichte des Instituts. In: Kulturthema Kommunikation,
Wierlacher, Alois, Hg., Möhnesee, 2000, S. 19.
57
auch der Sprachgebrauch außerhalb der Literatur, beispielweise in den Fachsprachen, steht
unter dem Postulat der Sprachkultur.“ Interdisziplinäre Projekte wie z.B. an der Universität
Trier im Zusammenhang mit dem Fach DaF “Deutschlernen mit Theaterspielen” und
“Interkulturelle Schreibwerkstatt”108 verwirklichen Intentionen der These 11.
Diese Arbeit soll untersuchen, ob das Personal, welches in der Auslandskulturarbeit tätig ist,
vom Angebot der Universitäten schon profitiert hat und in dieser Richtung vorbereitet wurde
oder an einschlägigen Fortbildungen teilgenommen hat.
Die Erkenntnis, dass wissenschaftlicher Transfer auf die Politik kaum zustande kommt, dass
Beratung der Entscheidungsträger auf Bundesebene dringend nötig wäre, wurde mir als
Abgeordnete, als Mitglied in den Mitgliederversammlungen des Goethe-Institutes und Inter
Nationes deutlich vor Augen geführt. Erfahren werden konnte, dass man in der Politik oft
kein “Hineinreden” und Mitdenken von wissenschaftlicher Seite wollte, da vieles kurzfristig
und tagespolitisch nach ”Erfolgskriterien” und “Finanzierbarkeit” entschieden wurde. Das
Wissen der Universitäten wurde kaum genutzt, obwohl ein Zusammenführen der
Auswärtigen Kulturpolitik und der Wissenschaft Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit ist.
108 Vorlesungsverzeichnisse deutscher Universitäten 98- 2002.
58
B Aufbau und Mängel der dritten Säule der Außenpolitik
1. Mittlerorganisationen
1.1. Die Mittlerorganisationen als Kultur- und Bildungsvermittler
Vermittler der Auswärtigen Kultur- und Bildung sind die Mittlerorganisationen. In “Was soll
Vermittlung heißen?” schlägt Wierlacher am Ende des Kapitels ´Vom Begriff des
Blickwinkels´ vor: “Mit dem Wort Vermittlung soll zukünftig, so möchte ich die
Überlegungen resümieren und abschließend empfehlen, der Versuch bezeichnet werden, eine
tragfähige kulturelle Zwischenposition sowohl im kulturellen Dialog der Wissenschaft als
auch bei der Verknüpfung von Interessen der Lehrenden und der Lernenden zu
konstruieren.”109 ´Vermittlung´ ist „das Sichtreffen der am Lernprozess Beteiligten in jener
offenen Mitte [...], die nicht als räumliche oder geographische Größe [...] sondern als mittlerer
Weg der Erkenntnis begriffen wird.”110
Die nachfolgend aufgeführten Mittlerorganisationen, deren Hauptaufgaben die Sprach- und
Kulturvermittlung sind, spielen in dieser Arbeit eine tragende Rolle. Staatliche Trägerin
Auswärtiger Kulturpolitik ist vor allem die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA). Die Förderung und Finanzierung von Deutschen Schulen im Ausland wird hier
verwaltet. Nichtstaatlicher Träger der Auswärtigen Kulturpolitik ist z.B.: Das Goethe-
Institut e.V. Die Aufgaben des Goethe-Instituts e.V. (GI) sind die Pflege der deutschen
Sprache im Ausland und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Seiner
Vertragsaufgabe kommt das Goethe-Institut durch Sprachkurse, durch Lehrerfortbildung und
durch Konzeption und Organisation von Kulturprogrammen im Ausland nach. Das Institut
für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa) will die Verbindung zwischen Deutschland und dem
Ausland auf allen Gebieten internationaler Zusammenarbeit vertiefen, führt internationale
109 Wierlacher, Alois: Vom Begriff des Blickwinkels. In: Architektur interkultureller Germanistik, München,
2001, S.318. 110 ebd.
59
Treffen und Tagungen durch und fördert den Abschluss internationaler Kulturabkommen. Die
Schwerpunkte der Arbeit von Inter Nationes e.V (IN) sind die Erstellung von
Bildungsmedien, Filmen und Printmedien sowie die Betreuung des Besucherprogramms der
Bundesregierung. Weitere Mittlerorganisationen fördern und pflegen die deutsche Sprache im
Ausland und DaF im Inland.
Alle Mittlerorganisationen haben sich mit unterschiedlicher Intensität die Förderung und
Pflege der deutschen Sprache zur Aufgabe gemacht. Die Entwicklung des Faches Deutsch als
Fremdsprache in der Bundesrepublik und in der Welt beruht auf der Leistung und der
Zusammenarbeit vieler Akteure aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
“Trotzdem mag es erlaubt sein, das Goethe-Institut mit an erster Stelle in der Aufzählung der
Pioniere und Wegbereiter des Faches Deutsch als Fremdsprache aufzuführen. Die Einbindung
des Goethe-Instituts als eingetragenem Verein in die Auswärtige Sprach- und Kulturarbeit der
Bundesrepublik Deutschland und nicht als staatliche Institution kennzeichnet den vom
ehemaligen Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts, Dieter Sattler, initiierten
föderativen Charakter dieser und aller anderen Mittlerorganisationen im Bereich der
auswärtigen Sprach- und Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Seitdem ist an dem
Grundsatz einer abgestimmten Arbeitsteilung zwischen staatlichen Stellen und
Mittlerorganisationen festgehalten worden, wobei Planung und Koordinierung‚ unter
systematischer Beteiligung der Mittlerorganisationen zu übertragen ist.”111 Weitere
Mittlerorganisationen sind:
- Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH);
- Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ);
- Carl Duisburg Gesellschaft e. V. und Carl Duisburg Centren (CDC);
- Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE);
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD);
- Der Pädagogische Austauschdienst (PAD);
- Deutsch-Fränzösisches Jugendwerk (DFJW);
111 Faber von, Helm: Die Entwicklung von Deutsch als Fremdsprache in der Bundesrepublik Deutschland unter
besonderer Berücksichtigung des Goethe-Instituts. In: Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den
deutschsprachigen Länden. Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache, Rolf Ehnert, Hartmut Schröder, Hrsg.,
2. Aufl., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. 1994, S.27ff.
60
- Deutscher Entwicklungsdienst.
1.2. Auswärtige Bildungspolitik im Schulwesen
Das auswärtige Schulwesen hat eine lange Tradition.112 Es begann 1878 mit der Schaffung
des Reichsschulfonds, der 15 deutsche Auslandschulen mit 75.000 Reichsmark unterstützte.
Eine Neuorientierung in der auswärtigen Schulpolitik erstrebte der Rahmenplan 1978. Da
heißt es, dass die Begegnung mit den Menschen und der Kultur der Gastländer und die
deutsche Sprache zu fördern und die schulische Versorgung deutscher Kinder im Ausland
sicherzustellen sei. Als regionalen Schwerpunkt bezeichnete der Rahmenplan den EU-Raum.
In Entwicklungsländern sollten vermehrt berufsbildende Fächer angeboten werden. Eine
verstärkte Förderung des Deutschunterrichts im ausländischen Schulwesen sollte durch Aus-
und Fortbildung örtlicher Deutschlehrer und Erweiterung der Austauschprogramme für
Lehrer und Schüler erreicht werden.
Der Deutsche Bundestag schrieb in seiner Entschließung vom 7. März 1990 den Rahmenplan
fort. Der Begegnungscharakter deutscher Auslandsschulen sollte nun stärker verwirklicht
werden. Regionaler Schwerpunkt bleibt auch nach dieser Entschließung der EU-Raum. Durch
den Zusammenbruch des sozialistischen Systems entstanden in Mittel-Ost-Europa (MOE)
neue Herausforderungen. Hier sollten Angebote für die Förderung des Deutschunterrichts
sowie für kulturelle und soziale Begegnung im Schulbereich gemacht werden. Ziele waren
und sind verstärkter Einsatz deutscher Lehrkräfte und Fachberater im Ausland. Außerdem
wurde gefordert, eine Bund-Länder-Vereinbarung vorzulegen. 1950 wurden für das
Auslandsschulwesen 180 000 DM ausgegeben, im Jahr 1967 waren es schon 78 Millionen
DM. 1994 wurden für die Förderung von 114 deutschen Auslandsschulen 365 Millionen
Mark ausgegeben. Die Mittel für die Auslandsschulen sanken zwischen 1995 und 2001 um
fast 10%. Die Entwicklung des Schulfonds des Auswärtigen Amtes verzeichnet einen
Rückgang von 193,78 Mio € in 1998 auf 172,3 Mio € in 2002.
Bei Gespräch zum Auslandsschulwesen im Mai 1998 mit Walter Schmidt, dem damaligen
Abteilungspräsidenten und Leiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und Dr. Bernd
112 Nach: Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen. Dokumentation. Auswärtiges Amt, Referat
Öffentlichkeitsarbeit, Hg., Bonn, 1998, sowie mündliche Informationen des Auswärtigen Amtes und der ZfA
im November 2002.
61
Fischer, Legationsrat Erster Klasse, zu dieser Zeit Leiter des Auslandsschulreferats im
Auswärtigen Amt (AA), ergaben sich folgende Informationen: Das AA ist federführend für
das gesamte Auslandsschulwesen inklusive Schüleraustausch. Für diese Aufgaben standen
im Haushalt 1998 ca. 380 Millionen DM Personalmittel und ca. 27 Millionen DM Sachmittel
v.a. für Gebäude zur Verfügung. Im Referat Auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt
arbeiten 10 Personen an der "administrativen Führung" dieses Bereichs. Als
"organisatorischer Unterbau" dient die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Köln mit
ihren etwa 100 Mitarbeitern. Hier werden Besoldung, “Rekrutierung” bzw. Entsendung sowie
eine konzeptionelle und statistische Begleitung der Arbeit geleistet. Walter Schmidt, Leiter
der Zentralstelle wurde auf der ”Regionaltagung Europa” der 40 deutschen Auslandsschulen
am 19. März 2001 vom Präsidenten des deutschen Schulvereins Brüssel, Dr. Klaus Meyer-
Horn, verabschiedet. ”Ein Jubilar, der auf 37 Jahre Arbeit im Schulwesen zurückblicken
kann, und Mitveranstalter der ersten Europa-Tagung ‘seiner’ deutschen Auslandsschulen
ist.”113
Sozusagen als "Partner" kommt für die Arbeit im Auslandschulwesen der Bund-Länder-
Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) der Kultusministerkonferenz
(KMK) hinzu. In ihm sind die 16 Bundesländer und der Bund vertreten. Der Vorsitz wird
alternierend im jährlichen Wechsel von einem Ländervertreter bzw. einem Vertreter des AA
übernommen, 1998 hatte Dr. Bernd Fischer den Vorsitz. (Im Jahr 2001 wurde er zum
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Washington ernannt.) Der BLASchA trifft
sich vier Mal im Jahr. Er fungiert "primär als Prüfungsausschuss".114 Er wird deswegen auch
als "17. Bundesland" bezeichnet, da er vergleichbar den Bundesländern den Rahmen für alle
Prüfungen an deutschen Auslandsschulen festlegt. Hierfür reisen Vertreter des BLASchA das
ganze Jahr über an die verschiedenen Schulstandorte und überwachen dort die Prüfungen. Die
Zusammenarbeit im Ausschuss - es gilt das Einstimmigkeitsprinzip - ist durch eine große
113 Meyer-Horn: Rede an der deutschen Schule Brüssel am 19. 3. 2001. 114 Schmidt, Walter: 29 Jahre in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Rückblick und Ausblick. In:
Neue Akzente in der Auswärtigen Kulturpolitik. Schulische Arbeit zwischen Ökonomisierung und
interkulturellem Auftrag. Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft. 19. bis 24. November 2000 im Internationalen Haus Sonnenberg, St. Andreasberg.
62
“Harmonie"115 gekennzeichnet. Diese Harmonie birgt m. E. die Gefahr des Stillstandes in
sich. An den Deutschen Schulen im Ausland soll es nur maximal 20% - 25% Schüler aus dem
Partnerland geben. Voraussetzung für die Aufnahme ist die Beherrschung der deutschen
Sprache. Es wird jedoch versucht, Deutsche Schulen in Begegnungsschulen umzuwandeln,
den Anteil der Schüler aus dem Gastland über 25% hinaus, manchmal gegen den Widerstand
der Schulen, zu steigern. Die 25%-Vorgabe ist für eine Entwicklung der Schulen zu
Begegnungsschulen hinderlich. In einigen Schulen wird angeboten, einheimische Schüler
durch gesonderte Deutschkurse und das sukzessive Umstellen des Fachunterrichts auf die
deutsche Sprache, nach und nach an den rein deutschen Zug und an eine gemeinsame
Abschlussprüfung mit den Muttersprachlern heranzuführen.
Walter Schmidt berichtet über die Abstimmung mit Gremien, Ausschüssen und den anderen
Mittlern:
“1976 wurde die StADaF [Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache] ins Leben
gerufen, indem mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes je ein Vertreter von DAAD, GI und
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ad personam für regelmäßige Treffen reihum in den
drei Häusern berufen wurden. Vorsitz und Protokoll übernahm der jeweilige Gastgeber, der
auch die Vertretung des Auswärtigen Amtes zur Teilnahme einlud. [...] Doch gegenüber den
Fachreferaten im Auswärtigen Amt musste immer wieder betont werden, dass die StADaF
keine ‚Beschlüsse‘ fassen konnte und wollte.[...]. Für Grundsatzfragen dagegen wurde der
Steuerungsausschuss Deutsch als Fremdsprache (SteuDaF) gebildet, in dem die Leiter der
drei Institutionen zusammen mit den StADaF-Vertretern auf Einladung und unter Vorsitz des
Leiters der auswärtigen Kulturabteilung gemeinsam mit den Leitern der AA-Fachreferate
beraten und Absprachen in Grundsatzfragen treffen konnten. [...] Als noch allgemeinere
Fragen der Auswärtigen Kulturpolitik erörtert werden sollten, hat der Leiter der
Kulturabteilung Vertreter auch der anderen Mittler sowie den Generalsekretär der KMK
[Kultusministerkonferenz, die Verfasserin] zu einem ‚Operativen Gesprächskreis‘ eingeladen.
Anfangs wurde auch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen zu den Sitzungen der
Vereinigung für Internationale Zusammenarbeit (VIZ) gebeten, wozu u.a. das Institut für
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Hg., Braunschweig, 2001. S. 32ff. 115 ebd.
63
Auslandsbeziehungen in Stuttgart, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung sowie die
politischen Stiftungen gehören. Als Vertreter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in
all diesen Gremien bekam ich Einblick in die Vielfalt und Wirkungsweise der Aktivitäten im
Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik als Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft.”116
Der Einblick in die Organisation des Auslandsschulwesens und seine vielfältigen
Verflechtungen in Ausschüssen und Gremien macht klar, dass Veränderungen schwer zu
bewirken sind. Entscheidungen durchlaufen zahlreiche Kompetenzebenen, das dauert Zeit
und erschwert Beschlüsse zu Neuerungen- ein Grund mehr für Empirie. Es ist sinnvoll, die
Maßnahmen zur Förderung der deutschen Sprache zwischen DAAD, Goethe-Institut und der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen abzustimmen und es ist ebenso sinnvoll zu vorher
bei den Bildungs- und Kulturarbeitern anstehende Optionen zu eruieren, wie dies in der
Fragebogenaktion z. B. geschieht.
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen117
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen wurde 1968 eingerichtet. Sie betreut die
schulische Arbeit im Ausland. Weltweit werden über 500 Schulen, darunter 117 deutsche
Auslandsschulen, die überwiegend in privater Trägerschaft geführt werden, personell und
finanziell gefördert. Etwas weniger als 2000 Auslandsdienstlehrkräfte plus
Programmlehrkräfte und ca. 50 Fachberater befinden sich an diesen Einrichtungen. Sie
werden während ihrer Tätigkeit im Ausland organisatorisch, pädagogisch und finanziell von
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen betreut. Für die Förderung der schulischen
Arbeit im Ausland sind im Haushalt des Auswärtigen Amtes rund 350 bis 400 Millionen DM
jährlich veranschlagt. Zu den Aufgaben der Zentralstelle gehören:
- Gewinnung, Auswahl und Vermittlung von Lehrkräften für den Einsatz an den
deutschen Auslandsschulen sowie im öffentlichen Bildungswesen (Stellenangebote,
Stellenausschreibungen),
116 ebd. 117 Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: www.auslandsschulwesen.de/zfa/zentralstelle.htm: Homepage der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Stand: 27. 11. 2001.
sowie : Auswärtiges Amt, Hg.: Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen, Dokumentation, 1998.
64
- Organisatorische, pädagogische und finanzielle Betreuung der deutschen Schulen und
Bildungseinrichtungen im Ausland,
- Durchführung, Abnahme und Auswertungen der Prüfungen zum Deutschen
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz,
- Betreuung von Auslandsdienstlehrkräften und Programmlehrkräften,
- Zuwendungen im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik,
- Beratung und Betreuung der deutschen Schulen im Ausland in finanziellen
Angelegenheiten,
- Entwicklung und Pflege des Informationssystems Auslandsschulwesen (ISAS),
- Rechts- und Prozessangelegenheiten des Auslandsschulwesens, pädagogische und
didaktisch-methodische Fragen des Auslandsschulwesens.
Rahmenstatut für die Tätigkeit deutscher Lehrkräfte im Ausland Dezember 1994118
Hier ist die Definition mehrerer Gruppen von Lehrern, die sich nach ihrem rechtlichen Status
und nach ihren Aufgaben unterscheiden, festgelegt. Folgende Gruppen von Lehrkräften
werden unterschieden:
- Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK) sind beamtete oder festangestellte Lehrkräfte, die für
eine Auslandstätigkeit freigestellt worden sind. Ihr Einsatz ist für gehobene und
Leitungsaufgaben vorgesehen. Nach Ende der befristeten Beurlaubung, meist 8 Jahre,
kehren sie in den inländischen Schuldienst zurück. (Richtzahl der Planstellen 1245, für
eine Erstvermittlung liegt die Altersgrenze bei 45, für eine Zweitvermittlung bei 57 im
Jahr 2002.)
- Bundes- und Landesprogrammlehrkräfte (BPLK/LPLK) sind voll ausgebildete
Lehrkräfte, die bisher meist nicht im Schuldienst tätig waren. Sie werden über die
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen bzw. über die Kultusministerien entsandt.
Bei Rückkehr ist die Übernahme in den Landesschuldienst nicht gewährleistet.
Deshalb werden hier Lehrerverbände zunehmend aktiv. (ca. 400 BPLK plus ca. 200
LPLK im Jahr 2002)
118 Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesminister des Auswärtigen und den Kultusministern der
Länder in der BRD, vertreten durch den Präsidenten der Ständigen Konferenz der Kultusminister, über den
Einsatz deutscher Lehrkräfte im Ausland. (‚Rahmenstatut’) 1994.
65
- Ortslehrkräfte (OLK) sind von der Auslandsschule angeworbene und dort tätige
Lehrkräfte, die in Deutschland oder im Ausland eine Lehrbefähigung erworben haben.
Sie leben dauernd oder vorübergehend im Ausland. Sie erhalten vom Schulträger eine
mit ihnen vertraglich vereinbarte Vergütung. (ca. 6000 im Jahr 2002)
Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK) und Bundesprogrammlehrkräfte (BPLK)
Weil die Deutschen Schulen die Möglichkeit haben sollen, zu ihrem Profil passende Lehrer
zu finden, können jetzt ADLK von Schulleitern über eine von der ZfA angebotene
Datenbank, die die Daten der Lehrkräfte, ihre Fächerverbindungen, ihre Spezialisierungen
etc. enthält, ausgesucht werden. So trägt der Schulleiter ein Stück weit selbst die
Verantwortung für die Zusammensetzung des Personals an seiner Schule.
Der politische Trend ging 1998 verstärkt zum Einsatz von Programmlehrkräften gegenüber
Auslandsdienstlehrkräften, um den deutschen Arbeitsmarkt zu entlasten. Klar ist aber auch,
dass die BPLK dem deutschen Staat weniger Geld kosten. Wie kurzfristig jedoch Trends sind,
zeigt Folgendes: Die Zahl der Bundesprogrammlehrer ging von 1999 bis 2001 um 27%
zurück, denn in einigen Fächern war auch im Inland, die für viele Lehrer attraktivere
Nachfrage gestiegen. Die Anwerbung der BPLK erfolgt über Anzeigen in großen Tages- und
Wochenzeitung sowie in kleineren Regionalzeitungen. Zudem gibt es Werbesendungen an die
jeweiligen Lehrerseminare (wobei hier nicht immer eine Weitergabe an die Referendare
stattfindet). Zum arbeits- und sozialrechtlichen Status deutscher Lehrkräfte im Ausland gab es
immer wieder Diskussionen im deutschen Bundestag. Die berufliche und materielle
Nichtabsicherung der Programmlehrkräfte nach ihrem Auslandseinsatz wird auch in meinen
Kleinen Anfragen ”Arbeits- und sozialrechtlicher Status deutscher Lehrkräfte im Ausland”119
und ”Deutsch als Fremdsprache in dem MOE/GUS-Staaten” thematisiert.120 In der Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen an Bundesprogrammlehrkräfte heißt es unter Punkt 2:
119Altmann Elisabeth: Deutsch als Fremdsprache in dem MOE/GUS-Staaten. Kleine Anfrage Deutscher
Bundestag, Bundestagsdrucksache 13/10854. 120Altmann Elisabeth: Arbeits- und sozialrechtlicher Status deutscher Lehrkräfte im Ausland Deutscher
Bundestag, Bundestagsdrucksache 13/11357.
66
”Zuwendungen an Bundesprogrammlehrkräfte sind keine gesetzlichen Pflichtleistungen,
sondern freiwillige Leistungen des Bundes.” 121
Bei der Auswahl gelten folgende Kriterien. Die Bewerber müssen das zweite Staatsexamen
abgelegt haben. Sprachkenntnisse für das Zielland sind nicht unbedingt erforderlich, jedoch
erwünscht, da sie die Arbeit vor Ort sehr erleichtern. Die Interessenten werden dann in einem
zweiten Schritt mit Hilfe eines Psycho- bzw. Leistungstest auf "Stressverhalten" und
"Flexibilität" überprüft. Die Bewerber bekommen von dort, wenn gewünscht, ein Feedback -
auch wenn sie für nicht geeignet befunden wurden. Dritter und letzter Schritt ist ein
persönliches Auswahlgespräch bei der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Köln. Die
ausgewählten Bewerber erhalten einen auf ein oder zwei Jahre befristeten Vertrag von den
Schulen. Die Stellen werden dabei präventiv überbesetzt, da ein bestimmter Prozentsatz der
Bewerber, noch bevor sie ihren Dienst antreten oder kurz nachdem sie dies getan haben,
direkt auf eine Arbeitsstelle in Deutschland wechselt. Der dabei begangene Vertragsbruch
wird von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen toleriert.
Lehrerentsendeprogramme
Die Zahl der Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, kann man nicht genau
bestimmen, sie liegt zwischen 25 und 50 Millionen. Von den 20 bis 21 Millionen Deutsch
Lernenden leben 13,5 Millionen in Mittelosteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. Weil
diese wichtigen Länder nicht einbezogen wurden, gibt die Antwort auf die Große Anfrage zur
Verbreitung, Förderung und Vermittlung der Deutschen Sprache im Jahre 2001 nur etwa 8,5
Millionen Deutschlernende an. Die Anzahl der Deutschlernenden geht in Russland und in der
Ukraine seit 1992 drastisch zugunsten des Englischen zurück. Das mag der Globalisierung
geschuldet sein, jedoch darf man es sich so einfach dabei nicht machen, es fehlt auch an
richtig eingesetztem Engagement der Verantwortlichen in der Politik. Für Mittel-Ost-Europa
(MOE) und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) wurde vom Auswärtigen Amt
und den Kultusministern gemeinsam ein Lehrerentsendeprogramm entwickelt. 1999 waren
448 Programmlehrkräfte in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie Zentralasiens tätig. Ihr
121 Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: AA/ZfA- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an
Bundesprogrammlehrkräfte. In: Mitteilungen - Meinungen – Materialien: 2/96, Grüne Blätter, 43. Jahrgang.,
VDLiA,Hg., Schroedel Verlag. S. 109.
67
Einsatz konzentriert sich auf Lehreraus- und -fortbildung, bilinguale Schulen, Schulen in
Gebieten mit deutschen Minderheiten, sowie Spezialgymnasien, die zur deutschen bzw.
nationalen Hochschulreife führen. Dabei kommt den Fachberatern große Bedeutung zu. Diese
sollen vor Ort den Einsatz deutscher Lehrkräfte koordinieren, sie fachlich betreuen, die
Ministerien und Schulverwaltungen bei der Erarbeitung von Lehrplänen für den
Deutschunterricht beraten und einheimische Deutschlehrer aus- und fortbilden. Es sind ca. 90
Fachberater in 50 Ländern tätig. “Mit Hilfe des Lehrerentsendeprogramms haben Bund und
Länder gegenüber den osteuropäischen Staaten bewiesen, dass sie im Bedarfsfall zu rascher
Hilfe vor Ort bereit und fähig sind. [...] Dennoch stößt das Lehrerentsendeprogramm an
gewisse Grenzen, deren Beseitigung weder im Vermögen der fördernden deutschen Stellen
noch des entsandten Personals liegt.”122 Allerdings hat sich eine Aufgabenverlagerung der
Fachberater ergeben. Seit 1.1.1999 verbleiben von den vormals 90 nur ca.50 Stellen bei der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Ihnen werden Koordinatorenaufgaben weiterhin
übertragen, insbesondere in Verbindung mit der fachlichen und organisatorischen Betreuung
von Programmlehrkräften sowie der Auswahl und Betreuung von Prüfungszentren für das
Deutsche Sprachdiplom der KMK.
Neben den Deutschen Auslandsschulen - als traditionellem Zweig der Arbeit - wurde in den
90er Jahren ein zweiter Strang für Osteuropa bzw. die GUS-Staaten aufgebaut. Da in dieser
Region - wenn überhaupt - nur eine Zusammenarbeit mit der DDR bestand und nur selten
deutsche Schulen vorhanden sind, werden hier die Bundesprogrammlehrkräfte und
Landesprogrammlehrkräfte v.a. in den traditionellen Schulen integriert. Diese Zusammen-
arbeit ist als Fortsetzung einer langen Tradition der osteuropäischen Länder im Umgang mit
der deutschen Sprache und Kultur zu werten. Vertraglich wird das Entsendungsprogramm
durch bilaterale Schulabkommen abgesichert. Die Schulen stellen dabei das reguläre
Ortsgehalt, aber beispielsweise in Polen und Ungarn auch eine Wohnung.
Als bemerkenswerte deutsche Schulaktivitäten in den MOE sind die bilingualen Gymnasien
in Estland (Tallin und Tartu), in Tschechien (Prag), in Rumänien (Bukarest), in Bulgarien
(Sofia) und in der Slowakei (Poprad) zu nennen. Zur Unterstützung für das
122 BLASchA, Hg.: Evaluierung des Programms zur Entsendung deutscher Lehrkräfte in die Staaten Mittel-,
Ost- und Südosteuropas, des Baltikums und in die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Stand: 15.
12. 1994.
68
Entsendeprogramm steht der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ein Budget für
Weiterbildung für Lehrer - aber auch für Ministerialbedienstete der Gastländer - zur
Verfügung. Die Maßnahmen finden zum Teil in Deutschland statt.
Gefördert werden durch das Lehrerentsendeprogramm: Einsatz von Lehrkräften, Schul- und
Sprachbeihilfen, Lehr- und Lernmittel und Baumaßnahmen. ”Die Mittel, die viele Jahre lang
in entsprechende Programme geflossen sind, dürfen schließlich nicht umsonst ausgegeben
worden sein. Kein Gedanke daran, dass die Deutschlehrer in vielen Ländern den Schuldienst
quittieren, weil die Bezahlung unter dem Existenzminimum liegt, kein Gedanke daran, dass
deutsche Programmlehrer in Osteuropa jahrelang Potemkinsche Dörfer bewirtschaftet haben,
indem sie den Deutschunterricht aufrechterhielten, wo einheimische Deutschlehrer
aufgegeben hatten”123, so die berechtigte Kritik von Helmut Glück am Programm. Zu
kurzfristig scheint das Lehrerentsendeprogramm angelegt, zu wenig auf Ausbildung von
Multiplikatoren zugeschnitten. Damit kann Nachhaltigkeit nicht erreicht werden.
Interessenvertretungen der deutschen Lehrer im Ausland
Die Arbeitsgruppe Auslandslehrer in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
AGAL, 1955 gegründet, lange Zeit von Herbert R. Koch geleitet, der auch einer der
Initiatoren des Aufbaus der ZfA war, veranstaltet im zweijährigen Turnus eine, mit Experten
aus Politik, Wissenschaft, ZfA und Auswärtigem Amt besetzte Fortbildung auf dem
Sonnenberg im Harz, die in dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Über die AGAL sind die
Lehrer auch rechtsschutzversichert. “Die Aufnahme eines Rechtsanspruches auf Rechtsschutz
für GEW-Mitglieder in die Satzung der Abteilung Rechts- und Haftpflichtschutz würde für
die rechtliche Stellung besonders der Auslandslehrer einen Fortschritt bedeuten, da diese dann
in jedem Falle bei der Rechtsabteilung ihrer Gewerkschaft Rückhalt finden würden, den sie
bei keiner anderen Lehrerorganisation erhalten.”124 Der Bereich der Auslandsschulen ist
konfliktträchtig, so ist die Aufnahme in den Rechtsschutz für viele Lehrer hilfreich und wird
über die Rechtsschutzstelle der GEW in Frankfurt gut genutzt.
123 Glück, Helmut: Deutschland zerstört seinen Muttersprache, F.A.Z. vom 24.1.2002. S.45. 124vgl: Harms, Uwe. In: GEW und Auslandsschule. Geschichte und Probleme und Konzeptionen der
gewerkschaftlichen Arbeit im Hinblick auf die deutsche Auslandsschule nach 1945. Oldenburg, Mai 1970, S.
39.
69
Des weiteren ist zu nennen: Der Verein der deutschen Lehrer im Ausland, VDLIA, “der
nicht müde werden wird[...]gegen den sich abzeichnenden Qualitätsverlust des
Auslandsschulwesens vorzugehen”125, so sein Vorsitzender Waldemar Gries.
1.3. Geförderte Schulen
Deutschsprachige Schulen mit deutschem Schulziel 126/127
Diese Schulform, wie sie im empirischen Teil dieser Arbeit durch die Deutschen Schule
London und Paris differenziert dargestellt wird, stellt die schulische Versorgung (nach
deutschem Vorbild) der Kinder vorübergehend im Ausland lebender deutscher
Staatsangehöriger sicher. Im Jahre 2002 sind dies 44 von 117 Schulen. Die Schulen bieten in
einer Vielzahl von Fällen die Voraussetzung dafür, dass die im Interesse der deutschen
Wirtschaft, Forschung, sowie der Auswärtigen Politik und der Entwicklungshilfe notwendige
Entsendung einer wachsenden Zahl deutscher Staatsbürger in das Ausland durchführbar wird.
Viele im Ausland tätigen deutschen Staatsbürger möchten bei ihrem Auslandseinsatz für ihre
Kinder ein Schulangebot, das diesen bei der Rückkehr nach Deutschland eine problemlose
Fortsetzung ihres Bildungsweges sichert. Die Förderung einer deutschsprachigen
Auslandsschule mit deutschem Schulziel aus Mitteln der Bundesregierung an einem
bestimmten Ort wird von der Prüfung abhängig gemacht, ob ein öffentliches Interesse besteht.
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Schule über eine unverzichtbare
Mindestzahl deutscher Schüler verfügt. Es werden 42 Schulen dieses Typs gefördert. Sie
führen, wo immer möglich, von der Primarstufe bis zum Abitur, einige Schulen nur bis zum
Abschluss der Sekundarstufe I. Jedoch werden auch mittlere Abschlüsse immer begehrter.
Die deutschsprachigen Auslandsschulen sind - nach Meinung der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen- Stätten bikultureller Begegnung, da sie in begrenztem Umfang Kinder
anderer Muttersprache aufnehmen, sofern sie die für die Erreichung deutscher Unterrichts-
125 Gries, Waldemar. In: Der deutsche Lehrer im Ausland. Münster, September 2002. S.146. 126 Informationen aus dem Auswärtigen Amt, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen von
Auslandsschullehrkräften, aus eigener Anschauung und Erfahrung.
70
und Schulziele zu stellenden Anforderungen erfüllen. Im Unterricht wird der Sprache des
Partnerlandes ein bedeutender Platz eingeräumt. In welchem Umfang die Unterrichtsinhalte
gesellschaftlich-kultureller Fächer und Arbeitsgemeinschaften an den spezifischen
Gegebenheiten des Partnerlandes ausgerichtet sind und inwieweit auch außerhalb des
Unterrichts diese Schulen bestrebt sind, im musisch - künstlerischen Bereich und im Sport die
Begegnung ihrer Schüler mit der Kultur und mit der Jugend des Partnerlandes zu fördern,
wird sich in der empirischen Untersuchung dieser Arbeit zeigen.
Begegnungsschulen
Begegnungsschulen mit bikulturellem Schulziel.
An Schulen dieses Typs, 48 von 117 Schulen, die im empirischen Teil mit der Deutschen
Schule Stockholm und dem Alman Lisesi in Istanbul vorgestellt werden, werden Schüler
deutscher und anderer Muttersprache auf der Grundlage der Bildungsinhalte des
Partnerlandes und der Bundesrepublik gemeinsam und überwiegend auf Deutsch unterrichtet.
Sie werden zu einem bikulturellen Abschluss geführt, der den Zugang zu den deutschen
Hochschulen und den Hochschulen des Partnerlandes eröffnet. Diese Schulen werden auch
Begegnungsschulen genannt, wobei der Begriff ”Begegnung” m. E. ein Attribut für ein
Konglomerat unterschiedlichster Erwartungen ist.
Kriterien für eine Begegnungsschule
Eine Begegnungsschule, die ihren Namen verdient, sollte den folgenden Kriterien
entsprechen:
Es findet gemeinsamer Unterricht deutscher Schüler mit den Schülern des Gastlandes statt.
Deutsche und einheimische Schüler nehmen gleichberechtigt am Unterricht teil. Dieses
bedeutet für alle Schüler den Erwerb der Mehrsprachigkeit. Sachfächer finden keine additive
Doppelung, sondern sind substitutiv. Das setzt die Anerkennung curricularer Inhalte des
Gastlandes voraus. Deshalb wird, in bestimmten Fächern in integrierten Lerngruppen, der
Unterricht in der Landessprache erteilt. Der Unterricht an diesen Schulen sollte so angelegt
sein, dass die Zielsetzung für alle Schüler, unabhängig von ihrer jeweiligen Muttersprache,
127 Auswärtiges Amt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Referat Öffentlichkeitsarbeit: Entwicklung und
Stand der Auswärtigen Kulturpolitik im Schulwesen. Bonn 1998.
71
erreichbar ist. Abitur-Abschlüsse werden für den Hochschulzugang im Sitzland und in
Deutschland erworben.
Zweisprachige Schulen mit integriertem Unterrichtsprogramm und bikulturellem
Abschluss stellen die eigentliche Form der Begegnungsschule dar. Die Schaffung der
Grundlage für ihre Entstehung und Arbeit bedarf eines sehr weitgehenden und nicht leicht
herstellbaren politischen Einvernehmens zwischen den beteiligten Staaten, da beide den für
alle Schüler, ohne Rücksicht auf ihre Muttersprache, vorgesehenen bikulturellen Abschluss
gleichermaßen als Berechtigung für den Zugang zu ihren Hochschulen anerkennen müssen.
Die Zahl der geförderten Schulen dieses Typs ist gegenüber dem Stand von 1978 von 9 auf 26
Schulen angewachsen.. “Es zeigt sich, dass dieser Bereich des Unterrichts nicht nur an den
weit über 200 sogenannten bilingualen Zügen an Gymnasien in Deutschland, sondern auch an
bestimmten herausgehobenen Sekundarschulen in Mittel- und Osteuropa immer mehr an
Bedeutung gewinnt. Hierbei ist zu unterscheiden, ob der fremdsprachlich erteilte
Fachunterricht an den bilingualen Gymnasien in Ungarn wie auch in Deutschland nach
nationalen Lehrplänen erteilt wird oder ob er, wie an den Spezialgymnasien mit
einheimischem Abschluss kombiniert mit deutscher Reifeprüfung deutsche Lehrpläne und
Zielvorstellungen sowie die des Partnerlandes erfüllen muss, aus dem auch die dort
unterrichtenden Fachlehrer kommen.”128 Die Möglichkeiten des bilingualen Sachfach-
unterrichts als Chance für interkulturelles Lernen werden gegenwärtig ausführlich diskutiert.
Zweisprachige Schulen mit gegliedertem Unterrichtsprogramm und bikulturellem
Schulziel, die sich auch Begegnungsschulen nennen.
Diese Schulen gliedern sich in zwei Zweige:
1. Im Schulzweig mit verstärktem Deutschunterricht werden überwiegend einheimische
Schüler mit Hilfe eines Lehrprogramms, das in der Landessprache und auf der Grundlage der
128 Schmidt, Walter: 29 Jahre in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Rückblick und Ausblick. In:
Neue Akzente in der Auswärtigen Kulturpolitik. Schulische Arbeit zwischen Ökonomisierung und
interkulturellem Auftrag. Dokumentation der Sonnenberg-Gewerkschaft-für-Erziehung-und-Wissenschaft-
Tagung vom 19. bis 24. November 2000 im Internationalen Haus Sonnenberg, St. Andreasberg.
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Hg., Braunschweig 2001, S.23f.
72
im Sitzland für das Erziehungswesen bestehenden Vorschriften durchgeführt wird, auf die
dortigen Schulabschlüsse vorbereitet. Nach den oben aufgestellten handelt es sich bei Schulen
dieses Typs nur in Ansätzen um eine Begegnungsschule, obwohl diese von der ZfA darunter
subsumiert werden. Die Schüler erhalten verstärkten Deutschunterricht und werden in einigen
weiteren Fächern auf Deutsch unterrichtet. Am Ende ihrer Schulausbildung nehmen die
Schüler an den Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz teil.
Besonders befähigte und interessierte einheimische Schüler werden in den unteren
Jahrgangsstufen in einer Weise gefördert, die es ihnen ermöglicht, auf den mittleren
Jahrgangsstufen in den zweiten Zweig der Schule überzuwechseln. Der bilinguale Zweig des
Gymnasiums in Poprad in der Slowakei, der im empirischen Teil vorgestellt wird, gehört
dazu.
2. Im Schulzweig mit integriertem Unterrichtsprogramm werden deutsche und
einheimische Schüler gemeinsam überwiegend auf Deutsch unterrichtet. Das
Unterrichtsprogramm ist weitgehend an deutschen Bildungs- und Schulzielen orientiert.
Daneben werden entsprechend den im Sitzland bestehenden Vorschriften, einige Fächer in
der Landessprache erteilt. Voraussetzung für die Aufnahme einheimischer Schüler in diesen
Schulzweig ist die gute Beherrschung der deutschen Sprache. Alle Schüler werden zum
Sekundarschulabschluss des Sitzlandes sowie zur deutschen Hochschulreifeprüfung geführt.
Streng genommen ist auch dies keine Begegnungsschule, denn die curriculare Akzeptanz des
Gastlandes fehlt.
Landessprachige Schulen mit verstärktem Deutschunterricht, der zum Deutschen
Sprachdiplom der KMK führt
Schüler, deren Muttersprache die Landessprache ist, werden mittels des einheimischen
Unterrichtsprogramms zum Sekundarabschluss des Sitzlandes geführt. Dies betrifft 25 von
117 Schulen. Vergleichbar mit dem Schulzweig der zweisprachigen Schule nimmt im
Unterricht die deutsche Sprache einen herausgehobenen Platz ein. Deutsch, das als
Fremdsprache unterrichtet wird, ist für alle Schüler verbindliches Unterrichtsfach und mit
dem fremdsprachlichen Deutschunterricht wird Deutschlandkunde verbunden. Jedoch werden
darüber hinaus “zur fachlichen Unterstützung der einheimischen Deutschlehrer gegenwärtig
100 landessprachige Schulen mit Deutschunterricht von entsandten Fachberatern für Deutsch
oder von Lehrerbildungsinstituten, die durch die Bundesregierung gefördert werden, beraten.
73
Dabei steht die Förderung der deutschen Sprache als Mittel internationaler Kommunikation
und des Zugangs zu der deutschen Kultur im Vordergrund.”129
Sprachgruppen- und Siedlerschulen, Sonnabendschulen und sonstige Träger von Sprach-
kursen werden ebenso vom Auswärtigen Amt gefördert.
1.4. Goethe-Institut
Das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet. Als wesentliche Aufgaben sind in einem 1976 mit
dem Auswärtigen Amtes geschlossenen Rahmenvertrag festgelegt: die Pflege der deutschen
Sprache und die Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit. Es bietet
Sprachkurse, unterstützt Organisationen und Personen, die im Ausland die deutsche Sprache
vermitteln, mit Hilfe der Pädagogischen Verbindungsarbeit. Es veranstaltet
Sprachkursprüfungen in speziellen Sprachkurszentren. Mit den Partnern im Gastland werden
Kulturprogramme durchgeführt. Eine Kulturkonzeption, die neben ästhetischer auch
gesellschaftlich-politische Kultur einschließt, ist das Grundprinzip. Das Goethe-Institut ist
dem Werk Johann Wolfgang Goethes verpflichtet, Idee und Ideal des internationalen
kulturellen Austauschs sind zur Zeit des Weimarer Kreises entstanden.
Zur Zeit bestehen 128 Kulturinstitute (2002) in 76 Ländern und 15 Institute in Deutschland.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Institute kontinuierlich abgenommen. 1997 waren es
noch 141 Auslandsinstitute und 18 Inlandsinstitute. Das Besucherprogramm bietet jährlich
über 1500 ausländischen Multiplikatoren aus Presse, Medien und Kultur einen informativen
Bildungsaufenthalt in Deutschland. Einige Zahlen über das Goethe-Institut:
- weltweit ca. 3500 Mitarbeiter
- Gesamtetat 1999 ca. 487 Millionen DM (davon ca. 130 Millionen DM
Eigeneinnahmen, ca. 340 Millionen DM Zuwendungen vom AA)
- Rechtsform: Eingetragener Verein
- Zentralverwaltung in München
- Präsident: Prof. Dr. h. c. mult. Hilmar Hoffmann bis zum Frühjahr 2002
- Präsidentin ab Mai 2002 Jutta Limbach
129LauerJ./B.Menrath: Ein Stück Deutschland jenseits der Grenzen. In: Begegnung - Deutsche Schulen im
Ausland. Auswärtiges Amt und Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Hg., Nr. 2/95, S.7ff.
74
Im Jahr 1995/96 gab es einen wichtigen Personalwechsel in der Zentralverwaltung und
Führungsspitze. Der damalige Generalsekretär des Instituts, Horst Harnischfeger erklärte im
Sommer 1995, dass er nach zwanzigjähriger Amtszeit nicht wieder zur Verfügung stehen
werde. Ebenfalls 1995 fiel die Entscheidung darüber, dass Dr. Joachim Sartorius im Herbst
1996 ihn im Amt des Generalsekretärs ablösen solle. Am 1. 4. 1995 trat der neue
Abteilungsleiter für die Inlandsinstitute und stellvertretende Generalsekretär Ulrich Braeß ein.
Und im Frühjahr 95 wurde Martin Schumacher als stellvertretender Generalsekretär für
Personal und Verwaltung nominiert. Auch er hat im Herbst 1996 seinen Dienst angetreten.
“Dies alles ging einher mit Veränderungen in der Vorstandsstruktur, die Teil der
organisatorischen Neuordnung der Zentralverwaltung überhaupt ist, in ihrer Bedeutung
jedoch darüber hinausgeht. Die Mitte 1994 von der Unternehmensberatung Booz, Allen &
Hamilton abgeschlossene Untersuchung der Zentralverwaltung enthielt unter anderem die
Empfehlung, schlankere Verwaltungsstrukturen einzuführen, d. h., einfachere und rationellere
Arbeitsabläufe zu finden, Hierarchieebenen abzubauen, Verantwortung nach unten zu
delegieren. Im Jahre 1995 ist auf der Grundlage des Gutachtens von Booz, Allen & Hamilton
die erste Stufe der Neuorganisation der Zentralverwaltung abgeschlossen worden. Auch die
Vorstandsstruktur wurde modifiziert: Der Vorstand wird nun als Kollegialorgan arbeiten, das
wichtige Fragen gemeinsam entscheidet und in dem jedes Vorstandsmitglied den ihm
zugewiesenen Zuständigkeitsbereich in eigener Verantwortung leitet."130
Der Rahmenvertrag des Goethe Instituts mit dem Auswärtigen Amt
Der Rahmenvertrag des Goethe-Instituts mit der Bundesrepublik Deutschland vertreten
durch das Auswärtige Amt vom 17. Januar 2001, im Einvernehmen mit dem Leiter des
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, definiert als "Vertragsaufgaben":
§ 1 (1)1. Förderung der Kenntnis deutscher Sprache im Ausland durch:
• Erteilung und Förderung von Deutschunterricht im Ausland
• Zusammenarbeit mit Unterrichtsverwaltungen, Institutionen und Lehrkräften im
Ausland
• fachliche Förderung ausländischer Sprachlehrer und Germanisten
130 Goethe-Institut: Jahrbuch 1995/96 München. Bericht des Vorstands, S. 9 f.
75
• Entwicklung und Verbesserung von Unterrichtsmethoden, Materialien und
Sprachprüfungen sowie Mitwirkung an entsprechenden Maßnahmen Dritter
• Verteilung von Stipendien zur Erlernung der deutschen Sprache
(1) 2. Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit durch
• Durchführung und Vermittlung kultureller Veranstaltungen
• Vermittlung von Informationen im Ausland über das kulturelle Leben in
Deutschland,
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Besucherprogramms des
Vereins Goethe-Institut Inter Nationes,
• sonstige Beteiligung an kultureller Zusammenarbeit und Austausch mit kulturellen
Einrichtungen im Ausland nach vorheriger Abstimmung mit dem Auswärtigen
Amt,
• Förderung deutsch-ausländischer Kulturgesellschaften,
• Vergabe von Sprachstipendien an Multiplikatoren aus allen gesellschaftlichen
Bereichen.
(1) 3. Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes durch Informationen über das
kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben mittels
a) Durchführung des Besucherprogramms der Bundesrepublik
Deutschland,
b) Vorbereitung, Herausgabe, Herstellung, Beschaffung und
Verbreitung von Printmedien, Filmen, elektronischen Medien,
c) Vergabe von Sachspenden,
d) Übersetzungsförderung.
In der aktuellen Satzung wird dieses bestätigt: “Vereinszweck sind die Förderung der
Kenntnis deutscher Sprache im Ausland, die Pflege der internationalen kulturellen
Zusammenarbeit und die Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbildes durch
Informationen über das kulturelle gesellschaftliche und politische Leben.”131
Der Sprachunterricht wird also in den rechtlichen Grundlagen der Vertragsaufgaben prioritär
genannt. Die Kulturhoheit ist Ländersache in Deutschland, aus diesem Grunde versucht man
131 Goethe-Institut Inter Nationes: Satzung vom 21.9.2000 i. d. F. vom 8.1.2001.
76
einer Debatte über den Föderalismus in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aus dem
Wege zu gehen und die Vermittlung der Deutschen Sprache im Ausland, eine
Bundeskompetenz, in den Mittelpunkt zu stellen. Aktuelle Überlegungen über die
Auslagerung des Sprachunterrichts greifen dann in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen
jedoch die Substanz der Arbeit des Instituts an. Folglich können solche Umgestaltungen nicht
einseitig und als bloße Verwaltungsmaßnahme in Angriff genommen werden.
Sprachprüfungen des Goethe-Instituts.132
Das Goethe-Institut führt in seinen Prüfungszentren folgende Prüfungen durch:
Fit in Deutsch 1 und 2
Die Prüfungen Fit in Deutsch 1 und 2 sind zentrale, lehrwerksunabhängige Prüfungen, die für
jugendliche Lerner bestimmt sind. Sie orientieren sich an den Sprachkompetenzen Lesen,
Hören, Schreiben und Sprechen. Die mündliche Prüfung ist meist eine Prüfung in der
Kleingruppe. Die Schülerinnen und Schüler weisen allgemein-sprachliche Deutschkenntnisse
auf dem Niveau A1 des Referenzrahmens des Europarats nach.
Zertifikat Deutsch (ZD)
Voraussetzung: Circa 400 bis 600 Unterrichtseinheiten (45 Minuten) Intensivunterricht.
Sprachniveau: Der Prüfungsteilnehmer / die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass er / sie
über solide Grundkenntnisse in der deutschen Umgangssprache verfügt, die es ihm / ihr
ermöglichen, sich in allen wichtigen Alltagssituationen sprachlich zurechtzufinden. D. h. der
Prüfungsteilnehmer / die Prüfungsteilnehmerin soll imstande sein, ein Gespräch über
Situationen des täglichen Lebens zu verstehen und sich daran zu beteiligen. Ebenso soll er /
sie fähig sein, einfache Sachverhalte mündlich und schriftlich darzustellen und Texte zu
Alltagsthemen zu verstehen.
Prüfungsteile: Schriftliche Prüfung: Leseverstehen und Sprachbausteine, Hörverstehen,
Schriftlicher Ausdruck und mündliche Prüfung.
Bedeutung: Es wird aufgrund des weltweit hohen Bekanntheitsgrades von privaten und
öffentlichen Arbeitgebern als Nachweis von Grundkenntnissen in der deutschen Sprache
132 Goethe-Institut: Informationen entnommen aus der Homepage des Goethe-Instituts: www.goethe.de, Stand
28. 11. 2001.
77
geschätzt; in Deutschland anerkannt als Nachweis von Deutschkenntnissen zur Erlangung der
deutschen Staatsangehörigkeit.
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Voraussetzung: Circa 800 bis 1 000 Unterrichtseinheiten (45 Minuten) Intensivunterricht.
Sprachniveau: Der Prüfungsteilnehmer / Die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass ihm / ihr
die überregionale deutsche Standardsprache geläufig ist. D. h. er / sie soll in der Lage sein,
sich auch zu anspruchsvolleren Themen mündlich und schriftlich korrekt zu äußern und
authentische Texte von mittlerem Schwierigkeitsgrad zu verstehen.
Bedeutung: Weltweit hoher Bekanntheitsgrad, von Arbeitgebern als Nachweis solider
allgemeinsprachlicher Deutschkenntnisse anerkannt. Das Zeugnis der bestandenen ZMP
befreit an einer Reihe von deutschen Hochschulen von der sprachlichen Aufnahmeprüfung
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Voraussetzung: Circa 1 200 Unterrichtseinheiten (45 Minuten).
Sprachniveau: Der Prüfungsteilnehmer / Die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass er/ sie die
überregionale Standardsprache differenziert beherrscht. D. h. er / sie soll fähig sein,
schwierige authentische Texte zu verstehen und sich mündlich und schriftlich gewandt
auszudrücken. Die Prüfung liegt im Schwierigkeitsgrad auf der Stufe des "Kleinen Deutschen
Sprachdiploms".
Prüfungsteile: Schriftliche Prüfung: Texterklärung, Aufgaben zur Ausdrucksfähigkeit,
Aufsatz und Hörverstehen; mündliche Prüfung.
Bedeutung: Als Bescheinigung der qualifizierten Beherrschung der deutschen Sprache im
Berufsleben geschätzt. Das Zeugnis der bestandenen ZOP befreit an deutschen Hochschulen
von der sprachlichen Aufnahmeprüfung.
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Sprachniveau: Entspricht im Schwierigkeitsgrad der Zentralen Oberstufenprüfung. Der
Prüfungsteilnehmer / die Prüfungsteilnehmerin weist zusätzlich nach, dass er/ sie einen
Überblick über Gebiete der deutschen Kultur und Landeskunde besitzt.
78
Prüfungsteile: Mündliche Prüfung und schriftliche Prüfung: Erklärung eines Textes nach
Inhalt und Wortschatz, Aufgaben zur Ausdrucksfähigkeit, Fragen zur Lektüre ausgewählter
Bücher, Diktat.
Bedeutung: Weltweit hoher Bekanntheitsgrad und daher von privaten und öffentlichen
Arbeitgebern als Nachweis qualifizierter Kenntnisse in der deutschen Sprache anerkannt.
Absolventen des KDS sind von der sprachlichen Aufnahmeprüfung an deutschen
Hochschulen und Universitäten befreit.
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Sprachniveau: Nahezu muttersprachlich.
Prüfungsteile: Mündliche Prüfung und schriftliche Prüfung: Aufsatz, Erklärung eines Textes
nach Inhalt, Wortschatz und Stil, Aufgaben zur Ausdrucksfähigkeit, Fragen zu einem der drei
Gebiete "Deutsche Literatur", "Wirtschaftswissenschaften" oder "Naturwissenschaften",
Fragen zur Landeskunde, Diktat.
Bedeutung: Höchstqualifizierender Abschluss in Deutsch als Fremdsprache, der nicht im
Rahmen eines Universitätsstudiums oder einer Dolmetscher-/Übersetzer-Ausbildung
erworben ist; hoher Bekanntheitsgrad und weltweit von privaten und öffentlichen
Arbeitgebern geschätzt als Nachweis von Deutschkenntnissen, die auf nahezu
muttersprachlichem Niveau liegen. Wie die ZOP und das KDS anerkannt als Befreiungsgrund
von der sprachlichen Aufnahmeprüfung an deutschen Hochschulen und Universitäten (das
GDS überschreitet deren Anforderungen bei weitem). In einzelnen Ländern anerkannt als
Sprachnachweis für angehende Deutschlehrer / -innen. Das GDS dient als Sprachnachweis für
Lehrer / -innen aus der EU, die in Deutschland arbeiten wollen.
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDFB)
Voraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau des Zertifikats Deutsch (ZD) mit
zusätzlich ca. 100 bis 120 Unterrichtseinheiten ( 45 Minuten) Berufssprache Deutsch.
Sprachniveau: Der Prüfungsteilnehmer / die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass er / sie
sich schriftlich und mündlich in berufsalltäglichen Situationen in der deutschen Sprache
angemessen verständigen kann. D.h. der Teilnehmende / die Teilnehmende soll imstande sein,
einfache Texte zu verstehen und routinemäßige Schreiben zu verfassen, die sich auf den
Firmenalltag beziehen, und in Gesprächen des beruflichen Alltags adäquat zu reagieren.
79
Prüfungsteile: Schriftliche Prüfung: Strukturen/Wortschatz, Leseverstehen, Hörverstehen,
Korrespondenz; mündliche Prüfung.
Bedeutung: Aufgrund der berufssprachlichen Ausrichtung der Prüfung darf ein hohes Maß an
Anerkennung in Industrie und Handel erwartet werden.
Außerdem wird eine Prüfung ”Wirtschaftsdeutsch international” (PWD) abgenommen
Fachgespräche in der Zentrale des Goethe-Instituts133
Spracharbeit
Bei Fachgesprächen im Goethe-Institut in der Abteilung 20 “Spracharbeit Ausland”, an
denen deren Leiter Dr. Wolfgang Bader, Chr. M für den Bereich Pädagogische
Verbindungsarbeit und die Vertreterin des Leiters, Dr. K-R, zuständig für das
Sonderprogramm MOE/ GUS, am 18.06.1998 teilnahmen, wurden fachspezifische Probleme
der Spracharbeit des Goethe-Instituts angesprochen.
Als erstes wurde auf den Besuch von Wolfgang Schäuble, damals Fraktionsvorsitzender der
CDU/ CSU Bundestagsfraktion, im GI in München hingewiesen. W. Schäuble hatte den
Konsens in der Auswärtigen Kulturpolitik betont und den Schwerpunkt Sprachförderung
herausgestellt. Die Fachgesprächteilnehmer des GI stellten jedoch fest, dass die Arbeit
umfangreicher sei. Die Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit und die Ver-
mittlung eines umfassenden Deutschlandbildes gehöre laut Vertragsaufgaben dazu. Hier
wurden die Unterschiede in der Definition von Auswärtiger Kulturpolitik zwischen der
damaligen Bundesregierung und dem Goethe-Institut festgestellt. So wurde bemängelt, in
den MOE-Staaten seien 600 Programmlehrer tätig, aber nur 34 Experten des Goethe-Instituts.
Eine Änderung sei nach Meinung von Dr. Bader und Frau K-R notwendig. Denn Lehrer
allein genügten nicht, hier müsse umfassender vorgegangen werden. Es wurde auf die
Broschüre "Förderung der deutschen Sprache" hingewiesen, wo neben dem obigen
Arbeitsgebiet die Arbeitsfelder Lehrmaterialentwicklung, Sprachkurse, Aus- und Fortbildung,
133 Bader, Dr Wolfgang, Fachgespräche im Juni 1998 im GI München.
80
spezielle Kulturprogramme, Information und Service, Kooperation und Koordination und
Sprachpolitik im Grundsatz genannt werden.134
Übereinstimmend ergab das Gespräch folgende Einschätzungen: Die Mittel für Bundes- oder
Landesprogrammlehrer sind an Personen gebunden, während die Mittel des Goethe-Instituts
für Projektarbeit verwendet werden und somit nachhaltig wirken. Sie dienen vor allem dem
Aufbau von Strukturen, die nicht an eine bestimmte Person gebunden sind.
Im Berufsbereich stehe das Wirtschaftsdeutsch im Mittelpunkt der Bemühungen. Die
Wirtschaft kooperiere und finanziere Projekte (DIHT), das GI übernehme den sprachlichen
Teil der Kurse. So profitiere die Wirtschaft direkt von den Erfahrungen des GI.
Grundsätzlich gelte für die Sprachabteilung das Motto: Nicht Abbau, sondern
Leitbildentwicklung. Der Lehrer soll ein Projekt aufbauen, welches eine
Selbstläuferentwicklung anrege. Reine Programmlehrer könnten dies nicht leisten. In die
gleiche Richtung gehe auch die Vergabe von Prüfungslizenzen für Volkshochschulen und
Universitäten. Hierbei werde unterschieden nach autorisierten Prüfern (Stufe1) und
Lizenznehmern (Stufe 2). Der Schritt vom einen zum andern hänge von den abgenommenen
Prüfungen ab. In Zukunft würden hier Fernstudienprojekte an Bedeutung gewinnen. Diese
gebe es bereits in 23 Ländern auf multiplikatorischer Basis. Wichtig seien dabei auch
Tutorien und Kontakte. Ebenso müsse auch die räumliche Dimension der Länder einbezogen
werden. Multiplizieren sei leistbar, überall Programmlehrer hinzuschicken, hingegen
utopisch.
Wenn man die Programmlehrermittel der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (46
Millionen DM) hätte, wäre mehr Leistung möglich, Lehrer und Bücher genügten zum Lernen
der deutschen Sprache allein nicht.
Die Ergebnisse dieses Gesprächsteils zeigen deutlich die Konkurrenzsituation um die
knappen Mittel zwischen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, anderen Mittlern und
dem Goethe-Institut. Darüber hinaus werden kreative Gedanken entwickelt, die Mittel nicht
nur punktgenau, sondern auch im Sinne nachhaltiger Entwicklung wirkungsvoll einzusetzen.
134 Goethe-Institut Zentralverwaltung, Abteilung Spracharbeit Ausland: Mit der Welt im Dialog, Broschüre :
Förderung der deutschen Sprache. Der Beitrag des Goethe-Instituts in Mittel- und Südosteuropa und in der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Joachim Sartorius, Hg., 1998.
81
Kulturprogramme135
Der Überblick über die Kulturprogramme ist dem Text des Jahrbuchs zu entnehmen.136
Entscheidend für den Erfolg der Kulturprogramme ist es, nach Dr. Georg Lechner, an
vorhandene Arbeit anzuknüpfen und sich an den Vorleistungen der Partner zu orientieren.
Dies sieht in einzelnen Bereichen (Theater, Belletristik) sehr unterschiedlich aus. Wichtig ist
es, den Entwicklungsstand zu Beginn festzustellen und die beiderseitigen Interessen
abzugleichen.
Offensichtlich ist Kultursponsoring nicht der große Erfolg und wird überbewertet. Die
vorliegenden Zahlen zeigen, dass von 4 Millionen DM im Haushalt der Kulturarbeit in
Deutschland nur 0,5 Millionen DM durch Sponsoring gesichert werden konnten. Auch sind
die Spenden nicht frei von Erwartungen. Die Bemühungen für Kultursponsoring ersetzen aber
nicht die Leistungen der öffentlichen Hand. Sinnvoll wäre eine Formel wie die folgende: 1/3
Sponsoring, 2/3 öffentliche Gelder.
Die Kulturarbeit muss sich neben anderen diplomatischen Ebenen einordnen. Sie hat nach
Meinung von Georg Lechner keine Legitimationsprobleme. Gerade in der
Globalisierungsdebatte kann der kulturelle Dialog eine tragende Säule für die Außenpolitik
darstellen. Hier ist es entscheidend, welche Schlüssel- und Kernbegriffe die Bundesregierung
und das Parlament für die Kulturarbeit definieren und welchen Rang Kulturpolitik in der
Außenpolitik hat. Grundsätzlich fordert der Leiter der Abteilung für Kulturprogramme Dr.
Georg Lechner, das Verhältnis von Spracharbeit und Kulturarbeit zu ändern. Kulturarbeit
muss -seiner Meinung nach- breiter gefördert werden. Statt 1/3 Kultur und 2/3 Sprache ist ein
ausgewogenes Verhältnis zu erreichen. Denn mit Kultur und Kunst, z.B. mit Ausstellungen,
erreicht man mehr Menschen als mit Spracharbeit. Es sollte aber kein Gegensatz zwischen
Spracharbeit und Kulturarbeit aufgebaut werden, auch wenn die Zahlen der Kulturarbeit klar
sind: 1997 gab es 9000 kulturelle Veranstaltungen in allen Goethe-Instituten mit immerhin
4,5 Mio Besucher. Die Kulturprogramme der Pädagogischen Verbindungsarbeit des GI
stellen – nach Meinung Lechners- eine unnötige Doppelarbeit dar. Daher sollten diese Mittel
135Lechner, Dr. Georg: Gespräch mit dem Leiter der Kulturprogramme des Goethe-Instituts in der
Zentralverwaltung, Dr. Georg Lechner, Juni 1998. 136 Goethe-Institut: Jahrbuch 1997/1998.
82
zwischen Sprach- und Kulturbereich gerecht aufgeteilt werden Als Beispiel für die derzeitige
Mittelverteilung soll das MOE-Projekt 1997 dienen: 35 Mio DM für Spracharbeit, 5 Mio DM
für Bibliotheksausstattung, 15 Mio DM für Kulturarbeit.
Die Akzentsetzung wird durch dieses Informationsgespräch in der Abteilung für
Kulturprogramme sehr deutlich: Gewünscht ist eine neue Schwerpunktsetzung bei der
Kulturarbeit.
1.5. Inter Nationes (IN) bis 2001
Inter Nationes war eine Mittlerorganisation der Auswärtigen Kulturpolitik. Sie war die
Medieninstitution Deutschlands für das Ausland. Ihre Aufgaben erstreckten sich über die
Bereiche:
- Bildungsmedien und Film (Landeskunde und Sprachkurse, Spiel- und Dokumentarfilme,
Buch- und Medienversorgung von Schulen und Hochschulen)
- Printmedien / Internet (Publikationen und Kulturzeitschriften, Buchankauf, Übersetzungs-
förderung)
- Zentralbereich und Verwaltung mit den Arbeitsgruppen Personal und Recht, Haushalt und
Finanzen, EDV, innerer Dienst
- Vertrieb. Der Vertrieb war zuständig für die weltweite Verteilung aller bei IN
produzierten und angekauften Materialien. Über 60000 Kunden wurden weltweit betreut.
Es handelte sich dabei fast ausschließlich um Multiplikatoren, d. h. Menschen in
einflussreichen Positionen, wie Professoren, Lehrer, Journalisten. Zu den Hauptkunden
zählten das Goethe-Institut, die Botschaften, DAAD-Lektoren und Kulturinstitute im
Ausland. Im Aufgabenfeld Logistik verfügte Inter Nationes über Erfahrungen und
Kenntnisse, die im Bereich der Mittler einzigartig waren.
- Besucherdienst (Gästeprogramm, Redaktion und Gästeinformation)137
- Peter Sötje war seit 1999 Vorstand von Inter Nationes
Der Verwaltungsrat bestand aus 10 Mitgliedern, die auch zur Mitgliederversammlung zählten.
Die Namen finden sich im Tätigkeitsbericht von Inter Nationes.138
137 Inter Nationes: Tätigkeitsbericht 1999, Inter Nationes, S.37ff. 138 Inter Nationes: Tätigkeitsbericht 1999, Inter Nationes, S. 54, 55.
83
Wie das GI war IN ein eingetragener Verein, eine nichtstaatliche Einrichtung, jedoch mit
staatlichen Zuschüssen. Inter Nationes wurde finanziert vom Presse- und Informationsamt
(BPA) der Bundesregierung und vom Auswärtigen Amt (AA), (ca. 25 Mio DM Zuschüsse
vom BPA und ca. 30 Mio DM vom AA). Weiterer Zuwendungsgeber in geringerem Maße
war u.a. das Bundesministerium für Verteidigung.
Fachgespräche bei Inter Nationes
Mit Herrn van B, dem Bereichsleiter audiovisuelle Medien/ Film, und Frau MM,
Arbeitsgruppenleiterin für Informations- und Bildungsmedien, wurde im Oktober 1998 ein
Gespräch geführt, von dem hier Auszüge wiedergegeben werden.
Im Bereich der Spielfilme gibt es eine steigende Nachfrage. Die Botschaften machen IN
Vorschläge, welche Filme geeignet sind. IN klärt die Lizenzproblematik ab und organisiert
die Untertitelung. Für diese Fragen gibt es ein Gremium bestehend aus 2 Vertretern von IN, 2
Vertretern des Goethe-Instituts und 2 Vertretern des Auswärtigen Amtes. Dabei werden aus
einem Vorschlagsbestand von 15-20 Spielfilmen insgesamt 7-8 Filmen ausgewählt. Alle
Filme werden in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch untertitelt. Auf Anfrage
gab es auch schon Untertitel in türkischer und japanischer Sprache. Die Produktion der
Untertitel erfolgt technisch bedingt im Ausland. Die Filme sind auf 16mm verfügbar und als
Video.
Insgesamt verfügt I N über 350 Filme und 34 Depots zur Verteilung in der ganzen Welt. Von
34 Depots sind 28 an ein Goethe-Institut angegliedert, sechs an die Botschaften.
Hauptprobleme der Depots sind die Personalknappheit bei den GIs, Unterfinanzierung der
Pflege des Materials. Für den Notfall gibt es auch in Bonn ein Depot. Neueste Filme sind
z.B.: ”Das Leben ist eine Baustelle”, ”Jenseits der Stille”, ”Der Totmacher” und ”Comedian
Harmonists”.
Die neuen Filme werden über ein Rundschreiben bekannt gemacht. Dieses geht an alle
Depots, an die GIs, die Botschaften und Kulturvereine. Sie liegen als 16mm Filme und als
Videos in den landesüblichen Normen (PAL, SECAM, NTSC) vor. 1998 sind es 12 Filme. Es
werden dann von den Goethe-Institute entsprechende Filmwochen durchgeführt. Die
Verwendungsdauer hängt von einer Umfrage ein halbes Jahr vor Auslauf der Lizenz ab.
Gefragt wird nach dem Einsatz, der Zuschauerreaktion und nach der künstlerischen Wirkung
in den GIs. In den MOE-Staaten gibt es kein Depot. Hier laufen alle Anfragen über Bonn, den
Sitz von Inter Nationes.
84
Bei den Dokumentarfilmen steht als erster Schritt die Marktbeobachtung im Mittelpunkt der
Arbeit. Es geht darum das Angebot im Auge zu haben. Erworben werden dann die nicht
kommerziellen Leinwandrechte. Auf Fernsehrechte wird aus Kostengründen verzichtet. Nach
einer Vorauswahl erfolgt eine Prüfung der Filme anhand folgender Kriterien:
- Kosten der Filme,
- Eignung für die Arbeit im Ausland.
Über die Eignung der Filme befindet ein Programmaustauschtreffen, welches einmal im Jahr
von I N und GI veranstaltet wird.
IN tritt auch als Produzent und Koproduzent auf. Zunehmend, besonders im TV Bereich,
werden Koproduktionen erstellt. Anstelle von Untertiteln gibt es für die Sprachen Englisch,
Französisch und Spanisch eine Synchronisation. Weiterhin wird dabei die Methode des
"Voice over " verwendet. Dies bedeutet, dass kurz der deutsche Originalton zu hören ist und
dann überlagert wird. Neu ist auch der Test, deutsche Filme auf Deutsch zu untertiteln. Dies
gilt als doppelte Stütze im Bereich des Deutschlernens, Hören und Lesen ergänzen sich.
Dokumentarfilme werden nur als Video angeboten. Die Zukunft gilt dem neuen Medium
DVD. Dies erst ermöglicht es, Filme mit verschiedenen Synchronisationen auf einem
Medium mit einer Norm zu vereinen. Man könnte dann während der Verwendung des
Mediums DVD von Sprache zu Sprache springen.
Der Gesprächsteil über Filme belegt doch sehr klar, wie wichtig die Detailplanung dieses
Bereiches ist. Gerade durch die Ergebnisse der Pisa-Studie im Jahre 2001 wurde deutlich,
welche positive Rolle für die Lesekompetenz und das Erlernen einer fremden Sprache z.B.
Untertitel in einer Fremdsprache oder Filme in der Landessprache mit fremdsprachlichen
Untertiteln spielen.
Der weitere Inhalte des Gesprächs konzentrierte sich vor allem auf die Herstellung von
landeskundlichem Material als Ergänzung zu den Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache
oder Deutsch als Zweitsprache.
Landeskundliche Materialien
Diese Materialien werden speziell von Inter Nationes (IN) hergestellt und vom Auswärtigen
Amt institutionell anerkannt und gefördert. Der Grundsatz ist dabei: Verlage machen
Lehrbücher, IN macht landeskundliche Zusatzinformationen als Ergänzung der Lehrbücher.
In diesem Bereich sind IN, GI und Fachberater tätig. Schulen und Fachberater vor Ort als
Autoren kennen die Zielgruppen und entwerfen Materialien. Die Ausnahmesituation war
85
1990 nach dem Fall der Mauer gegeben: Da es keine GI Autorengruppe gab, hat Inter
Nationes im Rahmen des MOE-Programms Materialien in Klassenstärke produziert, um
"Deutsch als lingua franca" neu zu begründen.
Ein umfangreicher Katalog von Inter Nationes enthält alle Materialien. Es gibt binationale
und bilaterale Materialien, allgemeine Materialien, Folien, Kassetten und Landkarten.
Wichtig sind auch für landeskundliche Sprachkurse eine Kombination von Print-, Video- und
Audiomaterialien. Sie wurden erstmals in den MOE-Staaten eingesetzt. Die Themenauswahl
ist progressiv oder konservativ, je nach Land. Eine Gruppe von GI-Dozenten, Fachberatern
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und Autoren aus dem Land ist jeweils daran
beteiligt. Sie legen die Themen fest, die verwendet werden und erstellen ein Manuskript.
Allerdings muss der Bedarf dabei erkennbar sein und nachgewiesen werden
In den USA gibt es bilateral erstelltes Material. Es wird die Unterrichtserfahrung der
Lehrenden des Gastlandes einbezogen. Deutschkenntnisse sind in den USA nicht weit
verbreitet. Da man diesem Land große Bedeutung zumisst, wird hier ausschließlich
englischsprachiges Material erstellt, um zumindest das Interesse an Deutschland zu fördern.
Es werden nur Kopiervorlagen verteilt. In MOE Ländern werden ganze Klassensätze
geliefert, da oft keine Kopiergeräte zur Verfügung stehen. Das Material enthält sehr viele
Vorschläge zur Didaktik und wird über Lehrerseminare verbreitet.
In jeder Deutschen Schule im Ausland gibt es einen Ansprechpartner für IN. Material wird
nur auf Anforderung erneuert. Aus Kostengründen werden maximal fünf Exemplare umsonst
geliefert. Sehr gut ging die Mappe ”Aachen-Zwickau”, 1990 erstellt zu Jugendthemen. Zur
Bewertung liegt immer ein Fragebogen bei. Die Autoren müssen diesen lesen und auswerten
für Verbesserungen bei einer Neuauflage. Als weitere Materialien sind zu nennen: Die
Chronik des Jahrhunderts aus dem Bonner Generalanzeiger. Dazu gibt es 100
Wochenendbeiträge zu jedem Jahr von 1990-2000. Zur Südwestfunkreihe ”100 Jahre
deutsche Geschichte” sind 52 Beiträge zu je 30 Minuten vorrätig.
1.6. Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)139
Das Institut für Auslandsbeziehungen ist die älteste deutsche Kulturmittlerorganisation (1917
von Wilhelm II. als ”Werk des Friedens” ins Leben gerufen). Seit 1997 gibt es eine neue
139 Institut für Auslandsbeziehungen (Ifa): Vorstellung anhand des Tätigkeitsberichts 1995/96/97.
86
Satzung mit dem Kernanliegen, zur Völkerverständigung durch kulturelle Zusammenarbeit
beizutragen. Durch Kultur- und Kunstausstellungen im In- und Ausland, Vortrags- und
Informationsveranstaltungen, Seminare mit auslands- und deutschlandkundlichen sowie
kulturpolitischen Inhalten, verwirklicht das ifa seine Ziele. Eine Dokumentationsstelle und
eine Bibliothek zur Auswärtigen Kulturpolitik, die ”Zeitschrift für Kulturaustausch”,
Deutschkurse und Förderung deutschsprachiger Bildungseinrichtungen im Ausland sind wei-
tere Aufgabenschwerpunkte.
Das ifa ist die einzige Institution, die im Rahmen von Auswärtiger Kulturpolitik Aus-
stellungen mit Originalkunst konzipiert und organisiert.
Die Bibliothek ist die größte auslandskundliche Spezialbibliothek im deutschsprachigen
Raum. Sie beinhaltet eine amtliche Dokumentationsstelle zur Auswärtigen Kulturpolitik und
zu internationalen Kulturbeziehungen. Als öffentlich zugängliche Einrichtung verleiht sie ins
In- und Ausland, auf Anfrage findet eine individuelle Literaturzusammenstellung zu
speziellen Themen statt, Auswertung und Archivierung von Pressedokumentation gehören
zum Arbeitsbereich. Auswärtige Kulturpolitik und internationale Kulturbeziehungen als zwei
inhaltliche Schwerpunkte erfordern auch Veröffentlichungen nicht nur deutschsprachiger
Texte sowie einen Literaturdienst, der einen Überblick zu ausgewählten Themen der
Auswärtigen Kulturpolitik und der internationalen Kulturpolitik erstellt. (Pressespiegel
wöchentlich für ein ausgewähltes Publikum, z.B. Bundeskanzleramt, AA, Presse- und
Informationsamt des Bundestages etc.) Es werden Zeitschriften und Zeitungen aus dem In-
und Ausland ausgewertet. Die ”Zeitschrift für Kulturaustausch” ist das Fachmagazin, das
Themen kultureller Provenienz enthält.
Die Zielgruppe der Multiplikatoren spricht das ifa an durch Vortragsveranstaltungen, gezielte
Information wie Wirtschaftsmessen, Buchmessen, Dokumentationsausstellungen (Zielgruppe
Journalisten), interkulturelles Training und Auslandsvorbereitung, nicht nur für Diplomaten.
Weitere Dienstleistungen und Angebote sind Sprachkurse, Beratung für Auslandstätige und
Auswanderer, sowie eine Auslandsinformations- und -beratungsstelle.
Der Gesamthaushalt des ifa betrug 1997: 22,8 Millionen DM.
87
Es findet sich eine umfassende Darstellung der Angebote und Dienstleistungen des ifa im
Internet.140 Nachrichten zur Auswärtigen Kulturpolitik, eine ifa-Künstlerdatenbank und der
Hinweis auf aktuelle Literatur und internationalem Kulturaustausch. Auch pflegt das ifa einen
virtuellen interkulturellen Dialog in Zusammenarbeit mit seinen Partnern, z.B. der Stadt
Stuttgart, in gemeinsamen Projekten.
Das ifa blickte im Juni 2001 auf 50 Jahre seiner Wiedererrichtung (als Nachfolgerin des
Deutschen Ausland-Instituts) zurück. 1951 prägte der erste Bundespräsident Theodor Heuss
in der Eröffnungsrede für das neue Institut für Auslandsbeziehungen jenen Grundsatz, der seit
50 Jahren zu einer der meist zitierten Definitionen für das gehört, was unter Auswärtiger
Kulturpolitik verstanden wird: »Freudiges Geben und Nehmen«, also nicht einseitiger
deutscher Kulturexport, keine deutsche »Leit-Kultur« für das Ausland, sondern ein lebendiger
Austausch von Erfahrungen, Perzeptionen, Ideen und Visionen.
Besuch im Institut für Auslandsbeziehungen
Von einem Besuch des ifa im Oktober 1998 werden aus den Gesprächen mit dem
Generalsekretär des Instituts Dr. Kurt-Jürgen Maass und seinem Stellvertreter Udo Rossbach
sowie anderen Mitarbeitern vor allem die Inhalte wiedergegeben, welche die Zusammenarbeit
oder die Aufgabenüberschneidungen mit anderen Mittlern betreffen. Noch offene Fragen, die
auch die Bundesregierung auf meine Kleinen Anfragen zu “Deutsch als Fremdsprache in den
MOE/GUS-Staaten und “Zur Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen” nicht klären
konnte, werden ebenfalls angesprochen.
Dr. Maass und Herr Rossbach berichteten u. a. von der Sprachschule des ifa. Es würden dort
Sprachkurse in DaF angeboten, die auf die selben Prüfungen wie das Goethe-Institut
vorbereiteten. Die Schule sei dem Goethe-Institut zur Weiterführung angeboten worden, da
das ifa seine Hauptaufgaben nicht in der Sprachvermittlung sähe. Das Angebot sei aber vom
Goethe-Institut nicht wahrgenommen worden und so werde die Schule, die sich in zwei
Jahren selbst trage, weiter vom ifa betrieben. Pro Jahr besuchten ca. 800 Schüler die Schule
und blieben zwischen 3 Wochen und 3 Monaten.
140 Bericht über die Tätigkeit der Abteilung Medien 1998-2000. In:ifa/bericht/1998/1999/2000. www.ifa.de
Stand:18.10.2002
88
Kunstausstellungen machten einen großen Teil der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
aus, da 60-70% der Ausstellungen in den Goethe-Instituten stattfänden. Jedoch bezögen beide
Institutionen Gelder für diesen Bereich, wobei, so Dr. Maass, das ifa auf diesem Gebiet das
absolute Know-how habe.
Im Oktober 2002 erläuterten bei einem Fachgespräch Dr. Maass und der Präsident Alois Graf
Waldburg-Zeil die Weiterentwicklung des ifa, insbesondere in Bezug auf den Einsatz der
neuen Medien. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Geflecht der deutschen Vertretungen
und Institutionen im Ausland aus immerhin ca. eintausend diplomatischen, kulturellen und
politischen Dependancen in einhundertfünfzig Staaten bestehe. Mit dem Einsatz neuer
Medien müsse dieses Potenzial deutscher und europäischer Kulturpolitik besser genutzt und
vernetzt werden. Unter Deutschland-Netz hat das ifa deshalb ein Verzeichnis aller deutscher
Vertretungen, (einschließlich handels- und entwicklungspolitischer Vertretungen) sowie
geisteswissenschaftlicher Forschungseinrichtungen erstellt. Das ifa leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Vernetzung.141
Förderprogramme MOE
Ausgangspunkt der Gespräche waren die Kleinen Anfragen ”Deutsch als Fremdsprache in
den MOE/GUS-Staaten”142 vom 28.05.98, die von der Bundesregierung unbefriedigend
beantwortet worden waren und ”Zur Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen”.143 vom
15.10.96.
Frau A-P, die seit 1993 für die Förderprogramme in MOE zuständig ist, berichtete, dass das
ifa seit 1945 die Aufgabe der Informationsüberlieferung in den Osten übernommen habe.
Jedoch habe es bis zum Fall der innerdeutschen Mauer keine speziellen Programme gegeben.
Erst 1990 sei vom Auswärtigen Amt ein möglicher Mittler gesucht worden, um ein spezielles
Förderprogramm für deutsche Minderheiten auszuführen. Das Goethe-Institut habe diese
Aufgabe abgelehnt. Das ifa sei der einzige Mittler, der sich dieses Programms angenommen
habe und sich dem inhaltlich und politisch schwierigen Thema der Minderheiten widme. Das
ifa habe einen Arbeitschwerpunkt in Polen, einen zweiten in Rumänien. Daneben würden
141 Unter “Deutschland-Netz”. In: www.ifa.de Stand:18.10.02 142 Altmann Elisabeth: Deutsch als Fremdsprache in den MOE/GUS-Staaten, Kleine Anfrage, 28.05.98. 143 Altmann Elisabeth : Zur Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen, Kleine Anfrage vom 15.10.96.
89
noch Tschechien, Litauen und Kasachstan betreut. Das ifa entsende zwei- bis dreimal pro Jahr
eine Reisegruppe nach Polen und einmal eine Gruppe nach Rumänien, die die Lage vor Ort
begutachteten.
Aus den Anfragen wurden weitere Themenbereiche besprochen: Fortbildungen an
Minderheitenschulen und Kindergärten sowie die Stellung der Fachberater.
Die Förderung der Fortbildungen an Minderheitenschulen und Kindergärten sei aus
folgenden Gründen zunächst sehr problematisch gewesen: Es seien Prestigebauten erstellt und
andere Geldverschwendung betrieben worden. Mit der Zeit habe sich diese Haltung jedoch
verändert. Inzwischen sei die Fortbildung mit Gebühren verbunden und damit für die meisten
Lehrer nicht tragbar, weil sie zu wenig verdienten.
Fachberater seien die Ansprechpartner für die Minderheiten und somit auf diesem Gebiet die
entscheidende und kompetente Instanz. Diese Ansprechpartner könne sich das ifa nur in den
Schwerpunktländern leisten. Für Tschechien und die Slowakei beispielsweise sei dafür kein
Geld da. Hier stoße das ifa immer wieder auf Probleme, da dort der Informationsweg (zuerst
wendeten sich die Minderheitenvertreter an das Auswärtige Amt oder das Generalkonsulat
bzw. die Botschaft, dann erst an das ifa, sehr lang seien und somit lähmend auf die
Entwicklung wirkten. Da die betroffenen Mittler, das Auswärtige Amt, die Generalkonsulate
oder das Innenministerium den anderen Beteiligten oft, ohne dies zu beabsichtigen,
Informationen vorenthielten, sei es sehr schwierig, Doppelung der Arbeit in den
verschiedenen Bereichen auszuschließen.
Das Auswärtige Amt habe ein Programm initiiert, bei dem Sprachassistenten der Bundes-
republik als Ansprechpartner zu einer Minderheit geschickt würden, um Kontakt nach
Deutschland zu gewährleisten. Die Durchführung habe das ifa übernommen. Die Dauer des
Aufenthalts der Assistenten sei auf zwei Jahre begrenzt, da das ifa verhindern wolle, dass die
Assistenten im Gastland integriert würden und vor allem selbst nicht den Bezug zu
Deutschland verlören. Bei ihrer Arbeit rückten die Sprachkurse aber in den Hintergrund und
die wirkliche Aufgabe liege im Bereich der Kulturarbeit. Das ifa habe momentan 12
Sprachassistenten in Polen, 2 in Rumänien, 2 in Litauen und einen in Kasachstan. Wichtigstes
Anliegen dort sei die Veränderung eines immer noch vorherrschenden Deutschlandbildes von
1945. Hier werde versucht, den Minderheiten ein modernes Bild zu vermitteln Dies sei durch
die jungen Sprachassistenten gewährleistet. Auf die Frage, warum man Sprachkurse nicht
gleich an die Goethe-Institute delegiere, entgegnete Frau Arlt-Palmer, dass die
Sprachassistenten vor Ort besser wüssten, welcher Markt gerade bestehe. Außerdem erreiche
90
man ein bestimmtes Niveau bezüglich der Sprachförderung, das durch die Assistenten
zielorientiert gehalten und verbessert werden könne.
Wie Medienprojekte organisiert würden und wie mit der Deutschen Welle
zusammengearbeitet werde, waren weitere Themen. Meine Gesprächspartnerin erklärte, dass
das ifa andere Aufgaben erfülle als die Deutsche Welle. Das ifa unterstütze Minderheiten,
eigene Medienprojekte zu organisieren. Zu Beginn würden diese Projekte finanziell getragen,
mit der Zeit aber die Produktionskosten mit Hilfe des ifa gesenkt und damit erreicht, dass sie
sich selber trügen, beispielsweise das ”Schlesien Journal”, eine zwanzigminütige
Magazinsendung der deutschen Minderheit in Polen, das im Zwei-Wochen-Rhythmus
bilingual ausgestrahlt wird. Bei dieser Sendung gäbe es immer wieder politische Probleme in
Polen mit der Zensur, sodass es nicht als wöchentliches Magazin genehmigt werde.
Herr Kö stand für Auskunft über die Zeitschrift für Kulturaustausch zu Verfügung. Die
Vierteljahreszeitschrift beinhalte aktuelle Nachrichten, einen Magazinteil mit Artikeln zur
Auswärtigen Kulturpolitik und zum internationalen Kulturaustausch sowie einen Europateil
mit Nachrichten zur Europapolitik. Die Zeitschrift für KulturAustausch erscheine in einer
Auflage von 6000 Exemplaren mit 4000 freien und 1000 zahlenden Abonnenten und
publiziere auch im Internet.
Frau Ku, die das Vortragsprogramm und die Mediendialoge betreut, erklärte, dass das ifa seit
den sechziger Jahren vom Bundespresseamt die Aufgabe übernommen habe, in den östlichen
Ländern politische und gesellschaftliche Informationen zu verbreiten. Das sei meist auf
Messen und durch Messeberichte geschehen. Nach 1989 sei diese Öffentlichkeitsarbeit
umgestellt worden.
Vorgestellt wurde von ihr das Vortragsprogramm, das vom Bundespresseamt getragen wird.
Es gebe verschiedene Verfahren, das Vortragsprogramm zu erstellen. Wichtig sei es, die
Botschaften zu fragen, was momentan thematisch von Interesse sei. Wenn dann ein Thema
angegeben werde, suche das ifa passende Referenten und organisiere für sie eine
Vortragsreise, die vom Bundespresseamt finanziert werde. Eine andere Möglichkeit biete das
ifa, indem es den Botschaften ein Thema vorschlage, wenn ein Referent sich angeboten habe.
Werde dieses Thema gewünscht, so werde das Vortragsprogramm ausgearbeitet und
durchgeführt. Ebenso könne es sein, dass eine Botschaft einen Referenten zu einem
bestimmten Thema wünsche, ihm den Stand der Diskussion unterbreitet werde und der
Referent dann das Thema spezifiziere.
91
Am Beispiel der deutsch-arabischen Mediendialoge zeigte Frau Ku auf, wie das Programm
konzipiert ist. Der Grundgedanke des Bundespresseamts sei es gewesen, arabische und
deutsche Journalisten zusammenzubringen. Das ifa habe entschieden, einen Mediendialog zu
ermöglichen ”Der deutsch-arabische Mediendialog trägt der gewachsenen Bedeutung des
Journalismus Rechnung. Er bietet ein Forum, auf dem Journalisten aus Deutschland und aus
zahlreichen arabischen Ländern dringende Probleme der Gegenwart im Rahmen eines
professionellen Dialogs erörtern und auf diese Weise neue Perspektiven für ihre Arbeit
gewinnen können.”144 Frau Ku berichtete von den Erfolgen der Dialoge, die auf kollegialer
Ebene ermöglichten, auch strittige Themen zu bearbeiten, denen sich die Beteiligten nicht
entziehen könnten. Dabei werde auf Fachebene diskutiert und grenzübergreifende
Kommunikation ermöglicht. Diese Diskussionsmöglichkeit, so Ku, sei ein wichtiges
Instrument der Auswärtigen Kulturpolitik.
Fazit des Gesprächs: Ohne den Besuch im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart
wäre das komplexe Arbeitsfeld des Instituts nicht zugängig gewesen. Was durch die
Bundesregierung nicht hatte erfahren werden können, konnte hier geklärt werden,
insbesondere die spezifische Ausprägung des ifa in Bezug auf die Arbeit mit Minderheiten,
die Zusammenarbeit mit den Goethe–Instituten bei den Kunstausstellungen und die
Spezialangebote in der Bibliothek.
2. Herausforderungen für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
2.1. Rückläufige Ausgaben und mangelnde Transparenz
Die Ausgaben für Auswärtige Kulturpolitik im Bereich des Bundes insgesamt sind in den
letzten Jahren rückläufig. Die Aufteilung auf zahlreiche Bundesministerien und Abteilungen
verhindert die Übersicht über die Aktivitäten der Bundesregierung in der Auswärtigen
Kulturpolitik, führt zu mangelnder Transparenz, beträchtlichen Reibungsverlusten und zur
Verschwendung von Steuergeldern. So ist es z. B. unverständlich, warum das Innenmi-
nisterium für die Bürger Polens, Russlands oder Tschechiens zuständig ist, oder warum unter
144 Institut für Auslandsbeziehungen: Deutsch-arabischer Mediendialog: Aus dem Programm des Deutsch-
arabischen Mediendialogs vom 12./13. Mai 1998 in Amman/ Jordanien. Stuttgart, 1998.
92
der Regierung Kohl der zivile Teil der NATO beim Auswärtigen Amt die Be-
treuungsmaßnahmen für deutsche Soldaten im Ausland aber als Teil der Auswärtigen Ku-
lturpolitik beim Verteidigungsministerium angesiedelt waren. Dazu schreibt Hans Magnus
Enzensberger: ”Dies alles vorausgesetzt, grenzt es an ein Wunder, was sich die alte
Bundesrepublik über Jahrzehnte geleistet hat: ein weltweites Netz von Einrichtungen, die in
rund 80 Ländern und mit verblüffendem Erfolg auswärtige Kulturpolitik betreiben. Ein
ehemaliger Außenminister namens Brandt hat dieses Arbeitsfeld sogar als die ‚dritte Säule
der deutschen Außenpolitik‘ bezeichnet. Das waren noch Zeiten! Institutionen wie die
Humboldt-Stiftung, das Goethe-Institut, Inter Nationes und der Deutsche Akademische
Austauschdienst galten damals nicht als lästige Kostgänger, sondern als wesentliche
Aktivposten der deutschen Politik.
Die Bundesrepublik hatte gute Gründe für ihr Engagement. Den gründlich verwüsteten Ruf
des Landes in der Welt vorsichtig und geduldig aufzubessern, andere Völker von den guten
demokratischen Vorsätzen der Deutschen zu überzeugen, das war eine Aufgabe, die über die
Eitelkeiten der bloßen Selbstdarstellung hinausging. Mit Schönfärberei war da nichts
auszurichten.”145
2.2. Das Goethe-Institut: Ein Markstein wird demontiert
Das Goethe-Institut gehört im In- und Ausland zu den angesehensten Kulturinstitutionen
überhaupt. Die verschiedenen Goethe-Institute stellen einen wichtigen Faktor in der
internationalen kulturellen Zusammenarbeit und bei der Vermittlung eines kritisch -
konstruktiven Bildes der Bundesrepublik Deutschland im Ausland dar. Gerade die Goethe-
Institute bieten vielen Menschen im Ausland die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu
erlernen und einen Zugang zur deutschen Kultur zu erhalten. Darüber hinaus leisten sie eine
umfassende Informationsarbeit.
In den vergangenen Jahren hat das Goethe-Institut mit seinen relativ geringen Mitteln viel
geleistet. Auch in Regierungskreisen wird seine Arbeit regelmäßig besonders gewürdigt.
Leider entspricht diesem Lob nicht das Handeln der Regierungsparteien. Wenn auch ein
objektiver Gesamtanstieg der Ausgaben für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik seit
145 Enzensberger, Hans Magnus: Auswärts im Rückwärtsgang. Hans Magnus Enzensberger über die Blamage
der deutschen Kulturpolitik im Ausland. In: Der Spiegel Nr. 37/1995. S. 215.
93
ihrer Wiederaufnahme nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in den letzen dreißig
Jahren zu verzeichnen ist, so ist doch gemessen am prozentualen Anteil der AKBP des AA
am Bundeshaushalt in den vergangenen zehn Jahren ihr Anteil gesunken, von 0,27% im Jahre
1993 auf 0,23% im Jahre 2002. Im Jahrbuch 1997 des Goethe-Instituts heißt es dazu:
"Weitere Kürzung der Stellen und Haushaltsmittel erweist sich auf mittlere Sicht als ein
unvermeidlicher Prozess, mit dem man sich abzufinden hat. 1995 mussten Kürzungen von 2,7
Millionen bei den Betriebskosten hingenommen werden; 2,1 Millionen der Investitionsmittel
wurden gesperrt. Die ausgegebenen Projektmittel lagen um 1,2 Millionen unter dem Stand
des Vorjahres und betrugen in absoluten Zahlen 65,8 Millionen Die Stellenkürzungsauflagen
des öffentlichen Dienstes mussten umgesetzt werden und kosteten etwa 30 Stellen weltweit.
1995 konnten all diese Auflagen durch 'Verschlankung' schon bestehender Institute erbracht
werde. 1996 jedoch mussten 5 Institute geschlossen werden.
Neue Chancen, aber auch Risiken bietet die Zukunftsperspektive eines kameralistisch nicht
mehr einzeln abzurechnenden Globalzuschusses; schon für 1997 konnte weitgehende
Deckungsmöglichkeit der einzelnen Titel mit dem Auswärtigen Amt vereinbart werden. Es
steht zu hoffen, dass durch diese Flexibilisierung ein effektiveres Wirtschaften ermöglicht
wird.”146
Die finanziellen Kürzungen der Bundesregierung im Jahr 1998 führten zu Schließungen von
neun Instituten: Reykjavik, St. Louis, Arhus, Canberra, Lahore, Tampere, Marseille und
Brasilia. Das Goethe-Institut in Palermo wurde von 18 Stellen und 1 Entsandten auf eine
Kulturvertretung mit 1,5 Stellen und einem Entsandten zusammengestrichen. Für die
bisherigen Abteilungen bedeutete dies das Aus.
Durch die Umstrukturierungen wird die Politik der personellen Ausdünnung und der
Schließung von Instituten fortgesetzt. In langen Jahren aufgebaute Beziehungen werden
abgebrochen und nicht nur finanzielles, sondern auch Vertrauenskapital vernichtet.
Hilmar Hoffmann hatte bereits am Beginn seiner Amtszeit als Präsident des Goethe-Instituts
im Juli 1993 vor den Folgen einer weltweit zurückgehenden Präsenz gewarnt. Kürzungen bei
Personal und Projektmitteln führten seiner Auffassung nach unvermeidlich zu einer
Auflösung von wertvollen, in Jahrzehnten gewachsenen Verbindungen und damit zu einem
Ansehensverlust für die Bundesrepublik Deutschland. Immer wieder drohte er mit Rücktritt,
146Goethe-Institut: Jahrbuch 1995/96. München. Bericht des Vorstands, S. 9 f.
94
falls noch ein weiteres Institut geschlossen würde. Er war insofern inkonsequent, als er trotz
weiterer Schließungen im Amt verblieben ist. Es war wohl ein taktisches Mittel, das nicht
gegriffen hat, sonst hätte er nicht ordnungsgemäß seine Amtszeit im Mai 2002 beendet. Trotz
der deutlichen Kritik aus Deutschland und aus den betroffenen Ländern wurden fast alle Pläne
zur Schließung von Instituten vollzogen. Nur in Einzelfällen konnten Proteste dies
verhindern. Die Entscheidung der Bundesregierung für das von Hoffmann seit Jahren
geforderte (und von mir in den Bundestag eingebrachte) Stellenstreichungs-Moratorium im
Juni 1998 brachte hier Entlastung.
2.3. Expertenanhörung zur Auswärtigen Kulturpolitik147
Unter Vorsitz von Alois Graf von Waldburg-Zeil und Prof. Dr. Karl-Heinz Hornhues fand
die Sachverständigenanhörung ”Bestandsaufnahme und Perspektiven der deutschen
Auswärtigen Kulturpolitik” des Auswärtigen Ausschusses in Bonn am 14. 4. 1997 statt. Die
zahlreichen Defizite auf diesem Gebiet waren deutlich geworden, die organisatorischen
Rahmenbedingungen der Auswärtigen Kulturpolitik mussten neu geordnet werden, um die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Auswärtige Kultur ihre wichtigen Aufgaben erfüllen
kann. Dass die Anhörung zustande kam, war vor allem dem kenntnisreichen, weltgewandten
und aktivem Vorsitzenden des Unterausschusses für Auswärtige Kulturpolitik Alois Graf-
Waldburg-Zeil zu verdanken. Experten wie Frau Bozkurt, türkische Professorin für
Rechtsgeschichte, Wolf Lepenies, Keith Dobson, Horst Harnischfeger, Joachim Sartorius,
Herr Schwinkendorf von der Unternehmensberatung Roland Berger, Samuel Huntington u. a.
waren geladen. Aus der aktuellen Situation heraus standen folgende Themen auf der
Tagesordnung:
Auswärtige Kulturpolitik. Bestandsaufnahme und Perspektiven
Frage 1: Worin bestehen die Aufgaben der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik? Worin
liegen die Möglichkeiten einer stärkeren europäischen Kooperation?
Frage 2: Wie kann die Arbeit der Mittlerorganisationen effizienter gestaltet und kontrolliert,
die ministerielle Zuständigkeit konzentriert, private Mittel für die Auswärtige Kulturpolitik
mobilisiert und die Arbeit mit neuen Medien integriert werden?
147 Deutscher Bundestag: Bundestagsdrucksache 13/ 62/.. Teil 1 des Protokolls der 62. Sitzung des Auswärtigen
Ausschusses am 14. 4. 1997.
95
Deutschland im Dialog der Kulturen der Welt.
Frage 3: Welche Herausforderungen an die westlichen Kulturtraditionen ergeben sich aus
- der neuen Rolle Asiens?
- dem Selbstbewusstsein islamischer Staaten?
- der Krise vieler afrikanischer Staaten?
Frage 4: Welches Spannungsfeld ergibt sich für die Auswärtige Kulturpolitik aus
unterschiedlichen religiösen und kulturellen Traditionen?
Zum einen ging es bei der Anhörung darum, den Kompetenzwirrwarr der Auswärtigen
Kulturpolitik aufzuzeigen und Lösungen anzubieten, aber organisatorische Reformen nicht
auf Kosten der Vielfalt des kulturellen Angebots der Mittlerorganisationen durchzuführen.
(Fragen 1 und 2). Zum anderen ging es um eine engere Zusammenarbeit der Staaten der
westlichen Hemisphäre bei der Förderung gemeinsamer Grundüberzeugungen auch in
anderen Teilen der Welt (Fragen 3 und 4). Menschenrechte und demokratische Grundwerte
waren ein Thema, der Konflikt der Kulturen ein anderes. Dazu waren Experten eingeladen,
die Antworten auf die Fragen der Abgeordneten gaben.
Aus den Fragebereichen der Anhörung werden im Folgenden Meinungsbeiträge dargestellt.
Diese beschränken sich nicht auf das bei der Anhörung Gesagte, sondern werden ergänzt
durch Aussagen in Interviews oder entsprechende Passagen in Veröffentlichungen. Die
Beiträge geben die Richtung wieder, die von den Experten während der Anhörung
eingeschlagen wurde. Zu “Bestandsaufnahme und Perspektiven” soll Keith Dobson zu Wort
kommen, zu “Deutschland im Dialog der Kulturen der Welt”, Samuel Huntington, zum Teil
“Wie kann die Arbeit der Mittlerorganisationen effizienter gestaltet und kontrolliert, die
ministerielle Zuständigkeit konzentriert werden” eine Zusammenfassung von Axel Schneider.
Der Verlauf der Anhörung
Ein Zusammenprall der Kulturen war schon durch die Auswahl der Experten gegeben. Nicht
deutlicher als durch die unterschiedlichen Auffassungen der türkischen Professorin Bozkurt
und Samuel Huntington, dem Verfasser des “Clash of Civilizations” hätte dieser dargestellt
werden können. Graf Waldburg-Zeil hatte Samuel Huntington eingeladen, nicht um dessen
96
Thesen zu verbreiten, sondern um den Kulturdialog anzuregen und äußerte sich dazu wie
folgt: “Wenn man denn die Gefahr einer Bruchlinie zwischen islamischen Fundamentalismus
und westlichem Denken sieht, so kann man dieser nur durch Kulturdialog vorbeugen.”148
Samuel Huntington, davon ausgehend, dass die Welt im 21. Jahrhundert von acht großen
Kulturkreisen geprägt und beherrscht wird, die sich mit großer Intensität aufeinander zu
bewegen und mehr oder weniger aufeinander prallen werden, war die Person, der am meisten
Beachtung gezollt wurde. Das globale Gleichgewicht wird sich - seiner Meinung nach- wegen
des Bevölkerungswachstums mit einem Machtzuwachs nach Osten verschieben und der Krieg
im 21. Jahrhundert wird ein Krieg sein, der aus der Verschiedenheit des Kulturellen herrührt.
Frau Bozkurt hingegen fühlte sich als Mensch, allen kulturellen Unterschieden zum Trotz,
den Menschen anderer Länder und Traditionen verbunden. Sie suchte nach dem
Gemeinsamen, was alle Menschen verbindet. ”Ich habe mich nie als Moslem gefühlt, ich habe
mich immer als Mensch gefühlt”149, so ihre Aussage.
Samuel P. Huntington: Clash of Civilizations
Eine exponierte und viel diskutierte Position war und ist die von Samuel Huntington, dem
prominentesten Teilnehmer der Runde. In der Anhörung gab er eine kurze Zusammenfassung
seines Werkes ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” wieder. Sein
Buch kam zu ungeahnter Popularität nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New
York am 11. November 2001. Macht und Dominanz der westlichen Hemisphäre und das sich
daraus ergebende Spannungsfeld religiöser und kultureller Traditionen sind sein Thema. So
war es nicht verwunderlich, dass er zum Thema “Deutschland im Dialog der Kulturen der
Welt. Welche Herausforderungen an die westlichen Kulturtraditionen ergeben sich aus der
neuen Rolle Asiens und dem Selbstbewusstsein islamischer Staaten?” sprach:
”Two pictures exist of the power of the West in relation to other civilizations. The first is of
overwhelming, triumphant, almost total Western dominance. The disintegration of the Soviet
Union removed the only shaped by the goals, priorities, and interests of the principal Western
148 Vortrag und schriftliche Stellungnahme zur Anhörung “Bestandsaufnahme und Perspektiven der deutschen
Auswärtigen Kulturpolitik” des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, 14. April 1997. Drucksache 62/12 149 Vortrag und schriftliche Stellungnahme zur Anhörung “Bestandsaufnahme und Perspektiven der deutschen
Auswärtigen Kulturpolitik” des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, 14. April 1997. Drucksache 62/12
97
nations, with perhaps an occasional assist from Japan. As the one remaining superpower, the
United States together with Britain and France make the crucial decisions on political and
security issues; the United States together with Germany and Japan make the decisions on
economic issues. The West is the only civilization which has substantial interests in every
other civilization or region and has the ability to affect the politics, economics, and security of
every other civilization or region. Societies from other civilizations usually need Western
help to achieve their goals and protect their interests. [...]
The second picture of the West is very different. It is of a civilization in decline, its share of
world political, economic, and military power going down relative to that of other
civilizations. The West’s victory in the Cold War has produced not triumph but exhaustion.
The West is increasingly concerned with its internal problems and needs, as it confronts slow
economic growth, stagnating populations, unemployment, huge government deficits, a
declining work ethic, low savings rates, and in many countries including the Unites States
social disintegration, drugs, and crime. Economic power is rapidly shifting to East Asia, and
military power and political influence are starting to follow. India is one of the verge of
economic takeoff and the Islamic world is increasingly hostile toward the West. The
willingness of other societies to accept the West’s dictates or abide its sermons is rapidly
evaporating, and so are the West’s self-confidence and will to dominate. The late 1980s
witnessed much debate about the declinist thesis concerning the United States.”150
Bei der Suche nach neuen Feinden und der Rechtfertigung für die Beibehaltung des Systems
globaler Steuerung gibt das Werk Samuel Huntingtons Hilfestellung. Es wird von dem
drohenden Einflussverlust des Westens ausgegangen, dem ein wirtschaftlicher, militärischer
und politischer Machtanstieg der asiatischen Kulturen sowie eine Bevölkerungsexplosion des
Islam gegenübersteht. Die Lehre Huntingtons vom Kampf der Kulturen sorgt so für ein neues
Feindbild nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation.
Mit praktischen Empfehlungen allerdings hielt sich Samuel Huntington während der
Anhörung nicht auf. Mit Konkretem dazu konnten Joachim Sartorius, Generalsekretär des
Goethe Institutes, der frühere Parlamentarische Staatssekretär Volkmar Köhler oder der
Direktor des British Council in Deutschland Keith Dobson aufwarten, der nun zu Wort
kommen soll.
150 Huntington, Samuel: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York 1996. S. 81 f.
98
Keith Dobson, Arbeitsweise des British Council und Vergleich mit den deutschen
Kulturinstituten151
Zum Themenkomplex “Auswärtige Kulturpolitik. Bestandsaufnahme und Perspektiven” leis-
tet Keith Dobson einen wertvollen Beitrag:
Der British Council ist nahezu der ausschließliche Mittler für kulturelle Außenbeziehungen
Großbritanniens. Er untersteht dem Außenministerium, das aber nur ein Leitungsreferat hat,
welches sich mit kulturpolitischen Außenbeziehungen befasst. Der British Council, der 1995
als ”Hauptakteur der britischen Auslandsbeziehungen”152 beschrieben wird, ist eine Mittler-
organisation, die als Eingangstor zu allen britischen Ressourcen in den Bereichen Kultur und
Wissenschaften dient. Der British Council hat seinen Schwerpunkt im dem Bereich der
Spracharbeit, so auch in der Satzung des Instituts zu lesen: ”Der British Council soll durch
Anregungen zum Erlernen und Gebrauch der englischen Sprache das Ansehen der britischen
Kultur und Zivilisation im Ausland verbreiten und Kenntnisse über den britischen Beitrag zu
Literatur, Musik, Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Politik fördern."
Von Sprachkursen bis hin zu elektronischen Datenbanken versucht der British Council seinen
Kunden ein breiten Spektrum anzubieten. Er verfügt in 45 Ländern über 95 ”Teaching
Centres” für englischen Sprachunterricht und über ein Netzwerk mit 228 Büros in 109
Ländern (Stand 1996). Die Einführung und Etablierung des Studiengangs ”British Studies” an
ausgewählten Universitäten im Ausland wurde dort erarbeitet. Ein neuerer Teil des British
Council ist das ”Central Bureau for Educational Visits and Exchange”, das für den Austausch
von Schülern und Lehrern sowie für Schulpartnerschaften zuständig ist. Neben der
Spracharbeit fördert und organisiert der British Council aber auch Ausstellungen, Symposien,
Vorträge, Konferenzen, Filmwochen, etc. z.B. die Organisation ”Visiting Arts”, die
151 Darstellung auf der Grundlage von Dobson, Keith., Direktor des British Council Deutschland: Vortrag und
schriftliche Stellungnahme zur Anhörung “Bestandsaufnahme und Perspektiven der deutschen Auswärtigen
Kulturpolitik” des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, 14. April 1997. Drucksache 62/12 und
folgender Artikel: Britischer Pragmatismus in der Auswärtigen Kulturarbeit. Interview mit dem Direktor des
British Council in Deutschland. In: Zeitschrift für KulturAustausch, 2/98. S.11-13. Hier und im Teil B 3.2.
finden sich auch Formulierungen, die von meiner Mitarbeiterin Christiane Firsching während meiner
Bundestagszeit getroffen wurden. 152 Tait, Simon: Wieviel Staat braucht die Kultur ? In: Zeitschrift für Kultur Austausch, 2/96. Stuttgart, S. 68 f.
99
ausländische Kunst in Großbritannien fördert. Sie bietet den aus- und inländischen Partnern
Information, Beratung, Trainingsprogramme und Stipendien.
Das politische Ziel des British Council ist es, wirtschaftliche mit kulturellen Veranstaltungen
zu verbinden. Daraus ergibt sich dann die Möglichkeit, für verschiedene Länder regionale
Schwerpunkte auszuarbeiten, die den wirtschaftlichen und politischen Interessen des Landes
entsprechen. Besonderes Augenmerk bei seiner Förderung legt der British Council auf Europa
und die Commonwealth-Staaten.
Getragen wird der British Council zur Hälfte aus Mitteln des britischen Commonwealth- und
Außenministeriums, die andere Hälfte kommt aus eigenen Einnahmen des Instituts. Durch
eine derart ausgewogene Finanzierung bleibt das Institut unabhängig. Beispielsweise wurden
im Jahr 1994/95 zu 56 verschiedenen Ländern Kontakte geknüpft und 170 Partnerschaften
geschlossen. Zusätzlich wurden rund 210 Millionen Pfund vom British Council (mit einem
Jahresetat von 430 Millionen Pfund) erwirtschaftet. Besonders ist hervorzuheben, dass die
Spracharbeit kostendeckend wirtschaftet. Für seine Arbeit ist der British Council niemandem
Rechenschaft schuldig. Sie muss allerdings mit den Zielen der britischen Außenpolitik
übereinstimmen. Institutsintern wird der “Output” nicht über die Finanzen kontrolliert,
sondern es wird verlangt, dass beispielsweise bei Kürzungen die Direktoren der
verschiedenen Vertretungen selbst entscheiden, wie sie ihren finanziellen ”Input in Output”
umsetzen. Dobson selbst sagt dazu: “In meinen Augen kann eine überdetaillierte Kontrolle
der finanziellen Inputs u. U. einen paradoxen Effekt haben, indem sie nicht zu mehr, sondern
zu weniger Effektivität öffentlicher Gelder im Bereich der Auswärtigen Kulturpolitik
leitet”153 Die Zeit der Finanzkürzungen war eine der schwierigsten Epochen für den British
Council. Die Regierung forderte eine Kürzung der öffentlichen Gelder vom Jahr 1995/96 bis
zum Jahr 1999 um 16,5%. Dies hätte zur Folge gehabt, dass ca. 12% der Mitarbeiter im
Ausland hätten entlassen werden müssen. Außerdem waren auch die Kultureinrichtungen in
insgesamt 32 Ländern bedroht. Diese Pläne wurden in einem Abschlussdokument im März
1996 vom außenpolitischen Ausschuss des Unterhauses wie folgend bewertet: ”Im Zuge der
153 Deutscher Bundestag. Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages: Bestandsaufnahme und
Perspektiven der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Vortrag von Keith Dobson, Direktor des British
Council Deutschland. Drucksache 13/62/12.
100
Globalisierung sind der BBC World Service und der British Council keine Randinstrumente,
sondern die Speerspitze unserer Politik.”154
Mit dieser Beurteilung erhitzte das Thema erneut die Gemüter der Parlamentarier, was eine
Reduzierung der Kürzungen auf ”nur” noch 10% der Regierungszuwendungen einbrachte.
Damit blieben Überseeinstitute von Stellenkürzungen verschont und nur der inländische
Mitarbeiterstab der Zentrale musste innerhalb von drei Jahren um 25% verkleinert werden.
Ausschlaggebendes Argument gegen diese drastischen Kürzungen war vermutlich ein
internationales Ausbildungsprogramm. Schätzungen besagten, dass mit Hilfe dieses
Programms im Jahr 2002 rund eine Milliarde Englischsprechende in der Welt leben. Die
damit verbundenen Vorteile für Handelsbeziehungen waren überzeugend genug. Der Wert
des British Council für die Exportindustrie hat ihn vor seinem Untergang bewahrt. Die
enorme finanzielle Beschneidung führte trotzdem zu großen strukturellen Veränderungen.
Eine Vielzahl der Tätigkeiten, die der British Council selbst ausführte, wurden ausgelagert.
Dobson dazu: ”Anstatt das Know-how für einige Dienstleistungen in unserer Zentrale
anzusiedeln, arbeiten wir nun mit Consulting-Firmen und Beratern, die solche
Dienstleistungen anbieten.”
Eine erfolgreiche deutsche Auswärtige Kulturpolitik soll, nach Dobson, folgende Leistung
erbringen:
• die weltweite Verbreitung eines zutreffenden Bildes von Deutschland als
Kulturnation, das den Status Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht ergänzt und für
das Land bei der Förderung seiner Werte ein Empfehlungsschreiben ist
• das Erlernen und den Gebrauch der deutschen Sprache im Ausland fördern, wobei in
erster Linie auf die historische Stärke Deutschlands aufgebaut wird (z.B. in
Lateinamerika und Mittel- und Osteuropa)
• für einen Ausgleich des Mangels an internationaler Verbreitung der deutschen
Volkskultur, wie Film, Fernsehen und Popmusik sorgen
• Auch die mangelnde Attraktivität des deutschen Hochschulwesens sollte sich ändern.
Diese Punkte könnten einen entscheidenden Beitrag zur Kulturpolitik leisten. Sie sollten – so
Dobson- deshalb verwirklicht werden, weil Deutschland nicht in der glücklichen Lage ist,
154 Tait, Simon: Wieviel Staat braucht die Kultur? In: Zeitschrift für KulturAustausch, 2/96, Stuttgart, S. 69.
101
diese Vorteile, die für den Staat nicht einmal Ausgaben bedeuten, für sich zu nutzen (ganz
anders als die britische oder amerikanische Populärkultur). 155
Die neuen Ideen einer Kosten-Leistungs-Rechnung, die zur größeren Wirtschaftlichkeit der
Institute beitragen soll, wird in Zukunft - nach Dobsons Meinung- die Kultur abhängiger von
der Politik und Wirtschaft machen.
Dobson gibt zu bedenken, dass durch die vielen Mittlerorganisationen in Deutschland viel
höhere finanzielle Aufwendungen betrieben werden müssen. Der British Council dagegen, der
den gesamten auswärtigen Kulturbereich abdeckt, benötigt viel geringere Zuwendung von
staatlicher Seite, da nicht verschiedene Institutionen, sondern nur die eine finanziert werden
muss. Dennoch, so Dobson, ist es wichtig festzustellen, dass die deutschen Mittler weltweit
einen hervorragenden Ruf genießen, den man nicht durch die Zusammenfassung der Institute
aus finanziellen Gründen zerstören darf.
Einen großen Unterschied macht Dobson auch in der Kontrolle der Institutionen aus. Er findet
die deutschen Institutionen eher überkontrolliert als zu wenig beaufsichtigt und schildert, dass
er die “Output-Kontrolle” für die bessere Variante hält. Die Bürokratie und deren finanzielle
Vorschriften machen das System unflexibel und damit sicherlich zu einem Teil auch
uneffektiv. Er schildert das an einem Beispiel: ”Wenn ich etwa, um meinen Haushalt zu
sanieren, die Anweisung gebe, weniger zu telefonieren und dadurch 1000 Mark einspare,
dann kann ich das Geld benutzen, um einen britischen Professor nach Deutschland
einzuladen. Wenn der Leiter des Goethe-Instituts in London seinen Telefonkosten reduziert,
dann erhält er im nächsten Jahr weniger Geld für diesen Haushaltstitel. Sie werden verstehen,
dass ich das britische Modell vorziehe.” Und weiter: “Meine Zentrale erwartet im Gegenteil
von mir, dass ich ihr sage, wie ich die erforderlichen Kürzungen beim finanziellen Input
umzusetzen gedenke, und zwar so, dass meine Ziele (Output) so wenig Schaden wie möglich
nehmen.”156
155 Deutscher Bundestag: Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages: Bestandsaufnahme und
Perspektiven der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Vortrag von Keith Dobson, Direktor des British
Council, Deutschland. Drucksache 13/62/12. 156Dobson, Keith: Britischer Pragmatismus in der Auswärtigen Kulturarbeit. In: Zeitschrift für KulturAustausch,
1/98, Stuttgart, S. 11. Interview mit Keith Dobson.
102
Bei der Finanzierung der Institute ist in Deutschland eine ganz andere Situation gegeben als
in Großbritannien, denn- wie gesagt- die britische Regierung unterstützt den British Council
nur mit der Hälfte der benötigten Mittel In Deutschland dagegen ist es Tradition, die
Kulturpolitik aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Eine neuere Entwicklung will die
öffentlichen Zuwendungen durch eine Steigerung der privaten Finanzierung ersetzen. Dobson
meint dazu, dass es sinnvoller sei, sich nicht auf die Substitution durch private Mittel zu
verlassen, vielmehr sollte eine Ergänzung zu den öffentlichen Mitteln die Institute belohnen
(und nicht bestrafen, indem die öffentlichen Mittel gestrichen werden). Die Hoffnung auf
großzügige Unterstützung der Kulturarbeit durch die Wirtschaft ist –seiner Meinung nach-
einer gewissen Ernüchterung gewichen. Die Sponsoringgelder halten sich bisher in Grenzen
und bergen zudem die Gefahr eines Rückzugs der staatlichen Verantwortung. Der British
Council spart Kosten, indem er im Ausland Veranstaltungen nicht in seinen eigenen
Lokalitäten durchführt, sondern in Partnerinstitutionen. So müssen durchschnittlich nur 15%
der Kosten aufgebracht werden. Die deutschen Institutionen dagegen sehen sich, so Dobson,
viel stärker als Veranstaltungsorte. Der British Council will sich in Zukunft mehr auf
Informationsvermittlung spezialisieren. In Zeiten der Informationsflut ist es die wichtige
Rolle des British Council dem Interessenten bei der Auswahl behilflich zu sein.
Axel Schneider – Positionen zum Problem der Koordination
Axel Schneider kommentiert in seiner Dissertation ”Die auswärtige Sprachpolitik der BRD”
die Stellungnahmen der Experten zum Themenkomplex “Wie kann die Arbeit der
Mittlerorganisationen effizienter gestaltet und kontrolliert, die ministerielle Zuständigkeit
konzentriert werden”, zielgenau und trifft die Ergebnisdarstellung so exakt, dass auf andere
Interpretationen im weiteren verzichtet wird:
“Joachim Sartorius, seit 1996 Generalsekretär des Goethe-Instituts, betonte in seiner
Stellungnahme die Notwendigkeit, gerade für die Region MOE/GUS bei der Sprachförderung
Doppelarbeit zu vermeiden. Sein Amtsvorgänger Horst Harnischfeger, als Generalsekretär
des Goethe-Instituts 1976 bis 1996 einer der erfahrensten Experten auf diesem Gebiet, wies
hier besonders auf die strukturellen Schwächen der Selbstkoordination der
Mittlerorganisationen hin, wo‚ mehr oder weniger naturwüchsig Zuständigkeiten und
Kompetenzen, Überschneidungen und Überlappungen entstanden seien, die sich vor allem
auch auf dem Gebiet der Sprachförderung auswirkten. Harnischfeger zeigte außerdem die
besondere Bedeutung des Koordinationsproblems unter den Bedingungen einer zunehmend
103
ungünstiger werdenden Relation zwischen Haushaltsmitteln und Aufgaben in den 90er Jahren
auf:
‚Ich betrachte im übrigen die Frage der Mittlerorganisationen auch jetzt auf Deutschland
bezogen und die Zentralen unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeiten. Hier haben wir in
den vergangenen Jahren den Weg verfolgt, die Mittlerorganisationen sollten die Fragen, die
sich möglicherweise als konfliktträchtig erweisen, untereinander klären. Das ist gelegentlich
versucht worden, aber ich glaube, es ist eine Illusion, sich vorzustellen, dass verschiedene
Mittlerorganisationen sich zusammensetzen und etwa auf Zuständigkeiten und Kompetenzen
verzichten. Das ist, glaube ich, für jede Institution das Schwierigste, was sie überhaupt
machen kann, und deshalb wird es auch nicht passieren. Es ist für meine Begriffe deshalb an
der Zeit, nach rund vierzig Jahren Auswärtiger Kulturpolitik in der Bundesrepublik, in denen
vieles, weil immer Geld vorhanden war, entstanden ist und gefördert wurde, sich die Frage zu
stellen, ob man nicht die Dinge stärker konzentrieren und damit eigentlich auch mit größerer
Effizienz versehen kann. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den großen Bereich
Deutsch als Fremdsprache, wo sehr viele Organisationen sehr unterschiedliche, aber doch sich
sehr stark überlappende Aufgaben wahrnehmen. Das ist nicht nur für die sogenannte
Pädagogische Verbindungsarbeit der Fall, sondern es werden z.B. Landeskundematerialien
von nicht weniger als fünf Organisationen für die ganze Welt hergestellt.‘
Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
wurden zwar diskutiert, führten aber bisher zu keinen konkreten Ergebnissen. So schlug
Volkmar Köhler vor zu prüfen, ob das Goethe-Institut und Inter Nationes mittelfristig
zusammengeführt werden könnten. Fragen zur Abgrenzung und Koordination der Träger
auswärtiger Kulturpolitik enthielt eine Bundestags-Anfrage der Abgeordneten Elisabeth
Altmann und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 1996, die unbeantwortet blieb.
Auch ein Antrag von Altmann und den Bundestags-Grünen vom Oktober 1997, der auf eine
umfassende Neuordnung der Zuständigkeiten in der auswärtigen Kulturpolitik abzielte, führte
nicht zu grundlegenden Reformschritten. Ähnlich wie auf der Sachverständigenanhörung
104
wenige Monate zuvor wurde hier eine Querschnittskompetenz und die Federführung des
Auswärtigen Amts in den Belangen der auswärtigen Kulturpolitik sowie eine bessere
Abstimmung zwischen den Mittlerorganisationen gefordert.
Die Positionen Harnischfegers, Köhlers und Altmanns sind vor allem deshalb bemerkenswert,
weil sowohl die Bundesregierung als auch die Repräsentanten der größten
Mittlerorganisationen im Zuge der Reformdiskussion zwar Defizite bei der Zusammenarbeit
einräumten, als Gegenmaßnahme aber lediglich eine verstärkte Selbstkoordination bei
gleichzeitiger Wahrung einer möglichst weitgehenden Autonomie der einzelnen Träger
befürworteten. Unabhängige Kritiker der bestehenden Koordinationspraxis, die wie Helmut
Glück für weitergehende Eingriffe zur Steuerung der auswärtigen Kulturpolitik vor allem im
Sprachsektor eingetreten waren, waren bis dahin von der Bundesregierung und den
Mittlerorganisationen immer wieder auf die Effizienz der bestehenden Regulierungs-
mechanismen verwiesen worden.”157
So weit die Darstellung Axel Schneiders zu den Kompetenzschwierigkeiten im Bereich der
Auswärtigen Kulturpolitik, die in dieser Arbeit an unterschiedlichen Stellen Beachtung findet.
(Siehe A1.2., B 1.6....)
3. Die Politik vernachlässigt die Akzeptanz der deutschen Sprache
Unter der Prämisse, dass es Aufgabe der nachhaltigen Kulturpolitik ist, das Recht der
Teilhabe Anderer an der Kultur Deutschlands einzufordern, wird diese Teilhabe in
Deutschland ermöglicht über die Kenntnis der deutschen Sprache. Wie die PISA- Studie
zeigt, ist diese nicht in ausreichendem Maße für Migrantenkinder im Inland gegeben. Deutsch
als Fremdsprache im Ausland erbringt letztlich die gleichen Leistungen wie Deutsch als
Zweitsprache im Inland.
157 Schneider, Axel: Die auswärtige Sprachpolitik der BRD. Eine Untersuchung zur Förderung der deutschen
Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und in der GUS 1982 bis 1995. In: Dr. Rabes
Doktorhüte, Bd. 2, Helmut Glück, Hg., Bamberg, 2000, S. 165 ff.
105
3.1. Migranten in Deutschland haben schlechte Spracherwerbsbedingungen.
“Auswärtige Kulturpolitik überhaupt fängt im Inland an: Wie gehen wir mit den Fremden um,
schützen wir auch deren Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, wie gehen wir mit
Minderheiten um? Nach diesem Verhalten werden wir im Ausland beurteilt.”158 Dies sagt die
Präsidentin des Goethe-Instituts bei ihrer Amtsübernahme. Deshalb sei an dieser Stelle der
Blick auf Migranten in Deutschland gerichtet und ihre Chancen Deutsch als Fremdsprache so
zu erlernen, dass eine volle Teilnahme am kulturellen Leben, wie es die UNESCO- Konferenz
1998 gefordert hat, ermöglicht wird. Im Frühjahr 2001 hat die CDU/CSU Bundestagsfraktion
eine ”Große Anfrage zur Verbreitung, Förderung und Vermittlung der deutschen Sprache” in
das Parlament eingebracht, deren Diskussion im Januar 2002 erfolgte. Darin antwortet z.B.
die Regierung, die Deutschkenntnisse der ausländischen Schüler in Deutschland seien positiv
zu sehen. Allerdings gebe es keine repräsentativen Untersuchungen darüber. Allein diese
Antwort zeigt vor dem Hintergrund des Ergebnisses der PISA - Studie, wie wenig Interesse
und Kenntnisse bei den Verantwortlichen vorhanden ist, wenn es um die Sprachkompetenz
von Migrantenkindern geht. Dazu sagt die PISA- Studie: ”Seit 1955 hat sich Deutschland -
oder besser die alte Bundesrepublik- allmählich und in Wellen zu einem Einwanderungsland
entwickelt. Wenn auch die Dynamik der Zu- und Abwanderung immer erheblich war,
überwiegt im Saldo die Zuwanderung. Die Schule ist der beste Spiegel dieses Trends”159.
”Der Anteil unter den Familien mit Migrationshintergrund, in denen die Verkehrssprache des
Aufenthaltslandes nicht familiäre Umgangssprache ist, schwankt zwischen einem Drittel und
mehr als der Hälfte [...] Die soziale Lage der Zuwandererfamilien ist, solange die
Sprachdistanz besteht, in der Regel deutlich ungünstiger als die der einheimischen
Familien.160” Die PISA- Studie weist nach, dass der Sprachkompetenzerwerb im hohen Maße
von der sozialen Herkunft und Bildungsbeteiligung abhängt. Migrantenkinder haben dabei
schlechte Voraussetzungen. In Deutschland sind die Unterschiede zwischen der mittleren
158Bahners, Patrick und Hintermeier, Hannes: Deutsche Kultur braucht keine neuen Etiketten, F.A.Z. vom
21.Mai 2002, S. 52. 159 PISA 2000, Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Deutsches Pisa-
Konsortium, Hrsg., Opladen, 2001, S.340. 160 a. a. O. S.351.
106
Lesekompetenz von 15- jährigen aus Familien des oberen und des unteren Viertels der
Sozialstruktur am ausgeprägtesten von allen Ländern, in denen getestet wurde.161 Als
Risikofaktor für schwache Lesekompetenz gilt schon die Zuwanderung eines Elternteils.
Dieses hätte den Verantwortlichen bei der Beantwortung der ”Großen Anfrage zur
Verbreitung und Förderung der deutschen Sprache” nicht entgehen dürfen. ”Theoretisch
gesehen liegen demnach sehr gute Spracherwerbsbedingungen für den Erwerb der Erst- oder
Zweitsprache Deutsch sowie der Migrantensprachen vor, und die Gleichung könnte einfach
aufgehen: Natürlicher und gesteuerter Spracherwerb unterstützen gemeinsam bei allen
Kindern die Spracherwerbsprozesse der Muttersprache und der Zweitsprache, unabhängig
davon, ob es sich um ein Kind deutscher oder nicht-deutscher Muttersprache handelt. Doch
die (zweisprachige) Realität schaut in der Praxis leider ganz anders aus: Zu niedrig ist die
Zahl der wirklich bilingualen Kinder, die in Mutter- und Zweitsprache eine hohe Kompetenz
erreichen, zu hoch dagegen die Zahl der Halbsprachigen in beiden Sprachen, der Kinder und
Jugendlichen (und Erwachsenen), die sich in keiner der beiden Sprachen so ausdrücken
können, wie sie es möchten. Offensichtlich wirken unter den spezifischen Bedingungen der
Migration (und dies nicht nur in Deutschland) Faktoren, die dafür Sorge tragen, dass die
eigentlich erfolgversprechende Kombination ‚Förderung der beiden Sprachen in und
außerhalb der Schule‘ nicht zu den Ergebnissen führt, die man eigentlich erwarten dürfte.”162 .
Weitgehend vernachlässigt werden auch die Sprachkenntnisse von jungen Migranten, die in
das Herkunftsland ihrer Familie ausreisen. Die deutsche Beteiligung bei den Anadolu Lisesi
in der Türkei war in erster Linie als Rückkehrerleichterung gedacht. Für die vielen
Flüchtlingskinder aus Bosnien und dem Kosovo gibt es dazu keine Überlegungen. Dass eine
größere Zahl Griechen und Italiener im Laufe ihrer Schulzeit mehrmals hin und her pendelt,
findet ebenfalls keine Beachtung.
3.2. Die Deutsche Sprache ist in der EU nicht ausreichend repräsentiert
Einer der Leitgedanken der Stockholmer Konferenz für kulturelle Entwicklung war, die
kulturelle Vielfalt zu erhalten. Viele Sprachen werden nicht weiterbestehen, weil ein
161 a. a. O. S 384. 162Kupfer-Schreiner, Claudia: Sprachdidaktik und Sprachentwicklung im Rahmen interkultureller Erziehung.
Das Nürnberger Modell. Ein Beitrag gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Weinheim, 1994, S. 59.
107
Verdrängungsprozess eingesetzt hat. “Auch im zusammenwachsenden Europa wird weiter ein
friedlicher – und legitimer- Wettbewerb herrschen. Und dieser Wettbewerb besteht nicht nur
zwischen den Volkswirtschaften und den außenpolitischen Interessen der Mitgliedsländer,
sondern es existiert auch eine Konkurrenz der Sprachen.”163 Deutsch war die erste lebende
Literatursprache auf dem europäischen Festland. Es würde den Rahmen dieses Kapitels
sprengen den Nachweis zu erbringen über den Wert des Einsatzes für Deutsch als wichtigem
Beitrag der kulturellen europäischen Vielfalt.
Alle Mittlerorganisationen haben über ihre speziellen Ausrichtungen hinaus eine gemeinsame
Aufgabe: Die Vermittlung der deutschen Sprache. Deshalb empfiehlt es sich an dieser Stelle
nach der Rolle der deutschen Sprache in Europa zu fragen.
In den Ländern der Europäischen Union nimmt Deutsch als Schulfach kontinuierlich ab.
Während bis in die Mitte der neunziger Jahre die Nachfrage, Deutsch zu lernen in
Mittelosteuropa anstieg, geht der Wunsch nun auch dort stetig zurück. Die Bemerkung des
ehemaligen Kulturstaatsministers Julian Nida-Rümelin, Deutsch als Wissenschaftssprache sei
”tot” und die Erklärung der Regierung dazu, das Englische sei Wissenschaftssprache und
”lingua franca”, zeigen, wie gering die eigene Muttersprache bewertet wird und welche
Bedeutung ihr von Regierungsseite zugemessen wird. Diese Einschätzung zeigt sich auch in
der Konzeption 2000, dem Strategiepapier ”Förderung der deutschen Sprache” des
Auswärtigen Amtes. Lapidar wird dort erklärt: “Nach erfreulichem Aufschwung für die
deutsche Sprache im Gefolge der Wiedervereinigung flacht sich in den letzten Jahren in
vielen Ländern diese Tendenz ab. Ausschlaggebend ist hierbei der Aufstieg des Englischen
zur (nahezu) weltweiten lingua franca. [...] Hauptziel der Sprachförderung sind aktuelle und
künftige Führungsschichten in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien sowie
Angehörige deutscher Minderheiten in Mittel- und Osteuropa.”164 Dem muss man den
Gedanken von Franz Stark entgegensetzen: “ Ebenso wie in Wörtern und Begriffsbildungen
drückt sich die kulturelle Vorprägung durch die Sprache auch in ganzen Texten und
163 Stark, Franz: Faszination Deutsch. München, 1993,S.14. 164Auswärtiges Amt - Kulturabteilung: Auswärtige Kulturpolitik-Konzeption 2000. Strategiepapier ”Förderung
der deutschen Sprache.” Stand: 5.4.2000.
108
Gesprächsstrukturen aus. Dem Aufbau und Verlauf eines Diskurses in Englisch zum Beispiel
liegen andere Kulturwerte zugrunde als dem in den kontinentaleuropäischen Sprachen”165
Das Sprachenregime der Europäischen Union
Das aufwendige Sprachenregime der Europäischen Union hängt eng mit dem einzigartigen
supranationalen Charakter der Gemeinschaft zusammen. Keine andere internationale
Organisation verfügt über derart viele Vertrags-, Amts- und Arbeitssprachen wie die EU.
Derzeit existieren elf sogenannte Amtssprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch,
Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch und
Spanisch.166 Mit der Erweiterung im Jahre 2004 kommen noch einmal acht Sprachen hinzu.
Grundlegendes Prinzip des gemeinschaftlichen Sprachenregimes ist der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller nationalen Amtssprachen. Dies führt dazu, dass alle Verträge, die im
Rahmen der EU geschlossen werden in allen elf Amtssprachen der fünfzehn Mitgliedsstaaten
sowie auf Irisch (=zwölf Vertragssprachen) abzufassen sind.
Deutsch ist eine von elf gleichberechtigten Amts- und Arbeitssprachen, wobei zwischen
Amts- und Arbeitssprache kein juristischer Unterschied zu erkennen ist. Bei der Verwendung
des Deutschen als Arbeitssprache ist zwischen den EU-Organen einschließlich ihrer
Dienststellen einerseits und den Verhandlungsgremien der Europäischen Union andererseits
zu unterscheiden.
So wird die sog. Amtssprache im Sekundärrecht wie z.B. bei Verordnungen, Richtlinien,
Entscheidungen verwendet, d.h. sämtliche Organe kommunizieren, bzw. sämtliche Arbeit in
den Organen der EU erfolgt in den Amtssprachen. Verordnungen und Schriftstücke von
allgemeiner Geltung sind in diesen Sprachen abzufassen [vgl. Art. 4]. Außerdem erscheint das
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in den elf Amtssprachen [vgl. Art. 5]. Geregelt
ist auch der Gebrauch der Amtssprachen im Schriftverkehr zwischen den
Gemeinschaftsorganen und den Mitgliedstaaten oder deren Angehörigen. So können
Schriftstücke, die ein Mitgliedstaat oder auch beliebige Bürger des jeweiligen Staates an die
165 Stark, Franz: Faszination Deutsch. München, 1993, S.32 166Verordnung zur Regelung der Sprachenfrage in der EU[Artikel 1, Verordnung Nr. 1/58 EWG/EAG zur
Regelung der Sprachenfrage], sowie 12 sog. Vertragssprachen (inklusive 12. Irisch/Gälisch als eigenständige
Definition), [Art. 248 EGV, Art. 225 EAGV ].
109
Organe der Gemeinschaft richten, nach Wahl des Absenders in einer der elf Amtssprachen –
z.B. Deutsch – verfasst sein. Die Antwort muss dann von der angesprochenen Einrichtung in
derselben Sprache erteilt werden [vgl. Art. 2] selbst wenn im jeweiligen Mitgliedsstaat
mehrere Amtssprachen gesprochen werden [vgl. Art. 8]. Genauso verhält es sich mit
Schriftstücken, die ein Organ der EU (von sich aus) an einen Mitgliedstaat oder einen
Unionsbürger richten [vgl. Art. 3]. Somit können nur EU-Bürger bzw. Mitgliedsländer die
Sprache frei wählen, nicht jedoch die Organe der Gemeinschaft.
Die Verwendung als Arbeitssprache in den Institutionen selbst ist hingegen nicht ausreichend
geregelt, sondern durch die Organe der Gemeinschaft in deren jeweiligen
Geschäftsordnungen im einzelnen festzulegen [vgl. Art. 6]. Einzige Ausnahme bildet der
Europäische Gerichtshof: hier wird die Sprachenfrage ausschließlich in dessen
Verfahrensordnung geregelt [vgl. Art 7]. Die in den beiden Artikeln 6/7 formulierten
Modalitäten haben mit verursacht, dass sich einige Amtssprachen zu bevorzugten
Arbeitssprachen entwickelt haben.
Denn trotz dieser Verordnungen [Art. 1 – 8] lässt die EU – wie Art. 6 verdeutlicht – große
Ermessensspielräume zu, was die Auswahl der Amts- bzw. Arbeitssprachen im Alltag betrifft.
So erfolgt die interne Arbeit der Organe und Dienststellen schon aus Kostengründen
weitgehend ohne Übersetzung in den Abeitssprachen Englisch und Französisch.
Im Gegensatz zu den Organen der Europäischen Union werden in deren
Verhandlungsgremien grundsätzlich alle Amtssprachen gedolmetscht und übersetzt. Im
Hinblick auf Mittelosteuropa machte sich Franz Stark 1993 über die Zukunft der externen
europäischen Verkehrs- oder internen Arbeitssprache Deutsch Gedanken: ”Die Zukunft der
europäischen Verkehrssprache Deutsch hängt nicht nur vom Umfang des Engagements im
Osten ab, sondern auch vom Ansehen und vom Gebrauch dieser Sprache in den europäischen
und den internationalen Institutionen, mit denen die Osteuropäer immer stärker in Berührung
kommen. Die Erfahrungen, die sie bislang dort machen müssen, ermuntern sie nicht
unbedingt, auch künftig noch Deutsch zu lernen.
Dabei besäße Deutsch alle Voraussetzungen einer wichtigen europäischen Verkehrssprache.
Der Raum, in dem es gesprochen wird, liegt im Zentrum des Kontinents und besitzt mit 93
Millionen die größte Zahl muttersprachlicher Sprecher. Die Zahl der Fremdsprachsprecher
lässt sich (bei allen Sprachen) weniger verlässlich ermitteln. Doch kann hier eine Erhebung,
die das Londoner Gallup-Institut für das westliche Europa durchführte, zumindest einen
Anhaltspunkt liefern. Danach gaben etwa 27 Millionen Erwachsene Deutschkenntnisse und
110
39 Millionen Französischkenntnisse an. Addiert man diese Zahlen mit jenen der
Muttersprachler, so wird schon in Westeuropa Deutsch von mehr Menschen gesprochen als
Französisch (ca. 120 gegenüber ca. 100 Millionen).
Der Abstand vergrößert sich jedoch erheblich, wenn man das östliche Europa mit einbezieht.
Für diesen Raum liegt keine Gesamterhebung vor; es existieren nur Einzeluntersuchungen für
einen Teil der Länder, und diese stammen auch unterschiedlichen Zeiträumen Trotzdem
erlauben sie den Schluss, dass dort wenigstens 40 Millionen Menschen Deutsch sprechen,
während Französisch im östlichen Europa nur gering verbreitet ist. Nimmt man West- und
Osteuropa zusammen, so reicht die Sprecherzahl des Deutschen fast an das Englische heran. [
Trotz dieser Zahlen und Fakten spielt die deutsche Sprache praktisch keine Rolle in den
meisten europäischen Institutionen. In den folgenden Organisationen hat Deutsch weder den
Status einer internen Arbeits- noch den einer externen Verkehrssprache:
- EU-Kommission, Brüssel (engl., frz.)
- Europarat, Straßburg (engl., frz.)
- Westeuropäische Union WEU, London (engl., frz.)
- Europäische Freihandelsorganisation EFTA, Genf (engl., frz.)
- Europäische Weltraumorganisation ESA, Paris (engl., frz.)
- Europäische Rundfunkunion, Genf (engl., frz.)
Unverständlich ist, dass ausschließliche Arbeitssprache der Europäischen Zentralbank, mit
Sitz in Frankfurt am Main, Englisch ist. Die gleiche Situation ergibt sich für nahezu alle in
Europa angesiedelten Sitze oder Filialen internationaler Organisationen. Die Ausklammerung
der deutschen Sprache in diesen Organisationen verschlechtert zweifellos ihre
Zukunftschancen auch dort, wo sie (noch) Verkehrssprache ist. Wenn Ungarn, Tschechien,
Polen oder Russland mit der EU und anderen europäischen Organisationen nicht mehr auf
Deutsch verkehren können, dürfte längerfristig auch ihr Interesse an dieser Sprache erlahmen.
Auf Verblüffung und Unverständnis stößt man dort schon jetzt, dass die Deutschen selbst ihre
Sprache so wenig verteidigen.”167 Helmut Glück meint dazu: ”Eine Weltsprache war das
Deutsche nie. Aber es war einige Generationen lang eine der großen internationalen
Sprachen, namentlich in den Wissenschaften. Traditionell wurde Deutsch vor allem in Nord-,
167 Stark, Franz: Faszination Deutsch. Die Wiederentdeckung einer Sprache für Europa. München, 1993, S.295
ff.
111
Mittel- und Osteuropa als Fremdsprache gelernt. [...] Das Deutsche ist Amts- und
Arbeitssprache der Europäischen Union - offiziell. In der Praxis wird das Deutsche allerdings
kaum verwendet, und Fälle von absichtlicher Diskriminierung sind belegt. Deshalb ist es
abwegig, dass die Regierung verspricht, sich `auch weiterhin für eine Festigung der Position
der deutschen Sprache einzusetzen` - inexistente Positionen kann man nicht festigen,
allenfalls anstreben. [...] Die Regierung verschweigt, dass die Sprachpolitik der anglophonen
Länder offensiv angelegt und sehr erfolgreich ist, dass die vergangenen Jahre dem Deutschen
als Fremdsprache vor allem Rückschläge eingebracht haben, dass inzwischen absehbar ist,
was Außenminister Fischer im Sommer 2000 als Menetekel an die Wand gemalt hatte: die
kulturelle Außenpolitik werde `in einem bloßen weiter so etablierter Strukturen ersticken.`
Dafür trägt er die Verantwortung.”168
Die Amtssprachen im Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament hat den Grundsatz der Gleichberechtigung aller nationalen
Amtssprachen bisher am konsequentesten umgesetzt. So werden alle Schriftstücke des
Parlaments in den Amtssprachen abgefasst, Ausführungen in einer der Amtssprachen werden
simultan in alle anderen Amtssprachen übersetzt [vgl. Art. 102 der Geschäftsordnung des
Parlaments].
Diese absolute Gleichstellung der Amts- und Arbeitssprachen erklärt sich vornehmlich aus
der unmittelbar demokratischen Legitimation des Europäischen Parlamentes. So stellt das
Parlament ein direkt gewähltes Repräsentativorgan aller Völker der Gemeinschaft dar.
Außerdem sieht sich das Parlament – auch hinsichtlich der Sprachenfrage – den
demokratischen Prinzipien (keine Einschränkung der Wählbarkeit aufgrund fehlender
sprachlicher Fähigkeiten) bzw. der unterschiedlichen kulturellen Identität Europas
verpflichtet.
Dennoch kommt es besonders in den vorbereitenden Arbeiten und in den Ausschusssitzungen
häufig und aus rein praktischen Gründen (zeitlicher und materieller Art) vor, dass nur eine
begrenzte Zahl der Arbeitssprachen zur Anwendung gelangt. Allerdings ist im Europäischen
Parlament im Einzelfall auch der entgegengesetzte Fall möglich, also beispielsweise eine
Einbeziehung von Minderheitensprachen wie Katalanisch oder Baskisch.
168 Glück, Helmut: Deutschland zerstört seine Muttersprache. F.A.Z. vom 24.1.2002, S.45.
112
Gemeinschaftssprachen im Rat und der Europäischen Kommission
Nicht gewährleistet ist die Gleichbehandlung aller Amtssprachen auf Regierungskonferenzen
und bei Beratungen des EU-Ministerrates. Im Gegensatz zum Parlament hat sich in Rat und
Kommission die Gewohnheit herausgebildet häufiger nur in den drei verbreitetsten
Gemeinschaftssprachen Englisch, Französisch und in begrenztem Maße auch Deutsch zu
arbeiten bzw. zu verhandeln. Obwohl vom Prinzip der Sprachengleichheit laut der
Geschäftsordnung des Rates nur aus Dringlichkeitsgründen (nach einstimmigem Beschluss)
abzuweichen ist [vgl. Art. 10 GO], wird dieses Prinzip in der Praxis durch die ”Drei-
Sprachen-Regelung” durchbrochen.
Noch deutlicher wird in der Kommission verfahren: In deren Verfahrenshandbuch ist
festgelegt, dass die Dokumente, die der Kommission vorgelegt werden sollen, in den für die
Bedürfnisse der Kommissionsmitglieder erforderlichen Sprachen zu übergeben sind. Konkret
bedeutet dies, dass nach außen gerichtete Dokumente in allen Amtssprachen vorgelegt
werden, für den internen Dienstgebrauch bestimmte dagegen nur in den Arbeitssprachen
Französisch, Englisch und Deutsch.
In beiden Institutionen ist allerdings zu beobachten, dass bei dieser Regelung ein deutlicher
Rückstand im Gebrauch der deutschen Sprache vorliegt. Französisch und Englisch
dominieren klar, was zum Teil sicherlich auf die französisch inspirierte Verwaltungstradition
der Brüsseler Gremien und deren langjährige, meist französische Führungskräfte (man denke
nur an den Verfechter französischer Interessen, Jacques Delors) zurückzuführen ist. Nicht
zuletzt mögen auch die persönlichen sprachlichen Präferenzen der einzelnen Beamten eine
Rolle bei der Benachteiligung des Deutschen als Arbeitssprache spielen. (So gaben 1994 in
einer Umfrage 70% der höheren Beamten der Kommission Französisch oder Englisch als
erste oder zweite ”Lieblingssprache” an, dagegen nur 15% Deutsch.)
Sprachenfrage im Europäischen Gerichtshof
Die Regelungen zur Sprachenfrage im Europäischen Gerichtshof unterscheiden sich wegen
dessen offizieller Funktion erheblich von denen der politischen Organe. Einerseits sind wegen
des Grundsatzes auf rechtliches Gehör alle nationalen Amtssprachen zuzüglich Irisch
gleichzeitig auch Verhandlungssprachen, andererseits sollen einzelne Gerichtsverfahren aus
prozessökonomischen Gründen immer nur in einer Sprache geführt werden. Die Wahl der
Vertragssprache liegt grundsätzlich immer beim Kläger, Abweichungen sind nur auf Antrag
113
möglich. Alle Beteiligten haben sich dann dieser einheitlichen Verfahrenssprache zu
bedienen. Dies gilt sowohl für die mündliche Verhandlung als auch für sämtliche Schriftsätze
(z.B. Protokolle oder Urteile). Als Konsequenz daraus ist jedes Verfahren auf Dolmetscher
sowie umfangreiche Übersetzungen angewiesen.
Die Richter bedienen sich untereinander in nichtöffentlichen Beratungen je nach Situation so
pragmatisch wie möglich einer Sprache, die sie gemeinsam beherrschen. Lange Zeit war
dieses ausschließlich Französisch. Begründet wurde diese höchst fragwürdige Praxis u.a. mit
der Vertraulichkeit der Beratungen, die keine Dolmetscher zulasse. Dieses Argument
überzeugt jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht: Erstens wird auch in anderen, nicht
minder vertraulichen Sitzungen (Rat, Kommission) gedolmetscht, zweitens ist nicht
einzusehen, dass ausgerechnet Französisch diese Rolle einnimmt, was unter Umständen auch
ein gewisses ”französisches Rechtsdenken” bzw. sprachliches Fachverständnis voraussetzt.
Auch im Gerichtshof war es daher wünschenswert, dass in informellen Besprechungen die
”Drei-Sprachen-Regelung” Einzug halten konnte. Das Englische und das Deutsche, als für
alle Richter doch wohl zumindest passiv beherrschte Sprachen, sollten in den internen
Beratungen angewandt werden. Die Entscheidungen des Gerichtshofes müssen jedoch in
allen elf Amtssprachen (ohne Irisch) und ab 2004 in weiteren acht Amtssprachen
veröffentlicht werden.
In sämtlichen Nebenorganen und nachgeordneten Institutionen der Gemeinschaft gilt
grundsätzlich das Prinzip der Gleichberechtigung der nationalen Amtssprachen. Vielfach
erfolgt jedoch auch dort in unterschiedlichem Umfang eine Reduzierung auf die drei ”großen”
Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch, bzw. auch teilweise auf ein ”Fünf Sprachen-
Reglement”, bestehend aus Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch,
zukünftig wohl erweitert um Polnisch.
Europa ist trotz aller Bemühungen noch weit von einer tatsächlichen gemeinschaftlichen
Identität entfernt, nationale Interessen ihrer Mitgliedsstaaten erschweren leider nach wie vor
eine partnerschaftliche, d.h. sprachlich gleichberechtigte, Zusammenarbeit. Die Verant-
wortlichen in der Politik müssten sich für eine akzeptable Repräsentation der deutschen
Sprache einsetzen, die den Anteil der Deutschsprachigen im EU Bereich widerspiegelt. Sie
sollten die Angebote der Goethe-Institute zur sprachlichen Förderung der Beamten publik
machen. Es reicht nicht, dass gerade einmal zwei Gruppenkurse mit 29 EU-Bediensteten,
sowie 7 Individualkurse 1997 durchgeführt werden konnten. Es ist allerdings kein Wunder,
dass die Kurse von der Verwaltung der EU nicht angenommen wurden, wenn man auch ohne
114
Deutsch durchkommt. Abschließend lässt sich sagen, dass Deutsch immer noch
unterprivilegiert ist, trotz der Bemühungen des Goethe-Instituts, die Deutschkenntnisse der
EU-Bediensteten zu verbessern. Die Auswärtige Kulturarbeit kann dazu ihren Beitrag leisten,
wenn die Politik sie unterstützt. Pavel Cink aus dem Prager Erziehungsministerium berichtete
auf der Internationalen Deutschlehrertagung im August 2001 in Luzern, “dass sogar die
deutschen EU-Beamten im beruflichen Umgang kaum Interesse an der Pflege ihrer
Muttersprache zeigten; immer wieder werde er, der das Deutsche fließend beherrscht, von
diesen aufgefordert, mit ihnen Englisch zu reden.”169 Wenn dann in der Resolution der
Deutschlehrertagung170 Mehrsprachigkeit und die Förderung der deutschen Sprache als
Zweit-Dritt- oder Viertsprache als Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Friedensförderung
benannt wird, so ist es auch Aufgabe der Auswärtigen Kulturpolitik und Kulturarbeit, dieses
auch im Interesse für die nachfolgenden Generationen in die Praxis umzusetzen.
169 Gassmann, Michael: Laut und deutlich. Die Schweiz zum Mitschreiben: Deutschlehrer tagen in Luzern. IN:
FAZ vom 3.8.2001. 170 Mehrsprachigkeit, Resolution zur Deutschlehrertagung. In: FAZ vom 6.8.2001. S.41
115
C Goethe-Institute und Deutsche Schulen und ihr Reformbedarf
1. Auswahlkriterien
Die Auswahl orientiert sich an der Neugliederung der Regionen des Goethe-Instituts Inter
Nationes in Europa. Aus den alten Regionen des Goethe-Instituts schälten sich im Jahre 2001
im Zuge der Umstrukturierung des Goethe-Instituts Inter Nationes die Regionalinstitute
London, Paris, Prag, Athen und Moskau heraus, wobei man trefflich über den Zuschnitt der
neuen Regionen streiten kann. Die folgende Tabelle ist dem Anhang zur Präsidiumssitzung
des Goethe-Instituts Inter Nationes vom 19. 9. 2001 entnommen und gibt Aufschluss über die
geplante Neuaufteilung der Regionen und Regionalinstitute:
Region: Standorte: Regionalinstitut: Anzahl:
Nord-West-Europa Brüssel, Amsterdam,
Rotterdam,
Luxemburg, London,
Manchester, Glasgow,
Dublin, Stockholm,
Oslo, Kopenhagen,
Helsinki
London 9 Länder, 12 Institute
Süd-West-Europa Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Nancy,
Toulouse, Madrid,
Barcelona, Lissabon,
Porto, Rom, Mailand,
Genua, Triest, Neapel,
Palermo
Paris 4 Länder, 17 Institute
Mittelost-Europa Prag, Warschau,
Krakau, Budapest,
Prag 7 Länder, 8 Institute
116
Bratislava, Riga,
Tallinn, Vilnius
Süd-Ost-Europa Athen, Thessaloniki,
Ankara, Istanbul,
Izmir, Tel Aviv,
Jerusalem, Bukarest,
Sofia, Belgrad, Zagreb,
Sarajewo
Athen 8 Länder, 12 Institute
Es zeigte sich, dass der beabsichtigte Zuschnitt der Regionen bis zur folgenden
Präsidiumssitzung verändert wurde. Die Regionalinstitute für Europa sind jedoch festgelegt.
Bei der Präsidiumssitzung des Goethe-Instituts Inter Nationes vom 21. 11. 2001 heißt es unter
dem Tagesordnungspunkt: “Neugliederung der Regionen und Geschäftsverteilung innerhalb
des Vorstands: Das Institutsnetz des GIIN (z. Zt. 128 Kulturinstitute) ist derzeit in 16
Regionen gegliedert. Die einzelnen Regionen weisen eine - einerseits historisch gewachsene,
andererseits durch die Umstrukturierungsprozesse der vergangenen Jahre entstandene - höchst
unterschiedliche Struktur hinsichtlich der darin zusammengefassten Länder und Institute auf.
Diese reicht von einer äußerst kleinräumigen Gliederung vor allem in Europa: ein Land = eine
Region (z. B. Frankreich, Italien mit 6-7 Instituten) bis hin zu einer nahezu kontinentalen
Gliederung etwa in Subsahara Afrika: 9 Länder = eine Region (mit je einem Institut pro
Land). Unabhängig von der regionalen Zugehörigkeit wurden die Institute bislang als
individuelle Arbeitseinheiten vom Generalsekretär des GI gesteuert.
Mit der Fusion von Gl und IN wurde eine grundlegende Veränderung in der Steuerung der
GIIN-Arbeit eingeleitet. [...]
Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen den Großraum Europa, der ausgehend von der
bisherigen feingliedrigen Struktur von acht Regionen in der Vorausschau der Osterweiterung
der EU in künftig vier Regionen neu gegliedert wird. Das GI Brüssel erhält im Hinblick auf
die für das gesamte GIIN wahrzunehmenden EU-Aufgaben (Schnittstelle zur EU-
Kommission, zu EU-Projekten, EU-fundraising) eine Sonderrolle.”171
Auch hier ist die geplante Neugliederung wieder tabellarisch dargestellt: “
171 Goethe-Institut Inter Nationes: Anhang zur Präsidiumssitzung vom 21. 11. 2001.
117
Region: Länder: Institutsorte: Regionalinstitut: Anzahl:
Nord-West-Europa Großbritannien,
Irland, Schweden,
Norwegen, Finnland,
Dänemark
London,
Manchester,
Glasgow, Dublin,
Stockholm, Helsinki,
Kopenhagen, Oslo
London 8 Institute
Süd-West-Europa Frankreich, Spanien,
Portugal, Italien
Paris, Lyon,
Bordeaux, Nancy,
Toulouse, Lille,
Madrid, Barcelona,
Lissabon, Porto,
Rom, Mailand,
Neapel, Turin,
Genua, Triest,
Palermo
Paris 17 Institute
Mittelost-Europa Polen, Tschechien,
Slowakei, Ungarn,
Estland, Lettland,
Litauen
Bratislava,
Budapest, Riga,
Warschau, Krakau,
Prag, Vilnius,
Tallinn
Prag 8 Institute
Süd-Ost-Europa Bulgarien,
Rumänien, Kroatien,
Jugoslawien,
Bosnien-
Herzegowina,
Griechenland,
Türkei, Israel
Sofia, Bukarest,
Zagreb, Belgrad,
Sarajewo, Athen,
Thessaloniki,
Ankara, Istanbul,
Izmir, Tel Aviv,
Jerusalem
Athen 12 Institute
Osteuropa/
Zentralasien
Russland,
Weißrussland,
Ukraine, Georgien,
Kasachstan,
Usbekistan
Moskau, St.
Petersburg, Minsk,
Kiew, Tiflis,
Almaty, Taschkent
Moskau 7 Institute
118
Ziele der Neugliederung:
1. Verstärkung und Intensivierung der unmittelbaren Führungs- und
Steuerungsmöglichkeit der Regionen durch die drei für die Auslandsinstitute
zuständigen Mitglieder des Vorstands. Künftig wird ein Mitglied des Vorstands die
Steuerung von 4 Regionen übernehmen. Die verbleibenden 12 Regionalbeauftragten
übernehmen die Steuerung von maximal 13 Instituten. Einzige Ausnahme ist die neue
Region ‚Süd-West-Europa‘ (Frankreich, Iberische Halbinsel, Italien) mit 17 Instituten.
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass fünf der 17 Institute infolge der
Umstrukturierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren teilgeschlossen bzw. in
Außenstellen umgewandelt wurden. Der Steuerungsaufwand in der Region wird hier
durch die Festlegung arbeitsteiliger, aufgabenbezogener Zuständigkeiten von
Institutsleitern in den Ländern kompensiert.
2. Straffung der strategischen Führung in einem integrierten Europa durch Verringerung
der Zahl der Regionen von bisher 7 auf künftig 4 Regionen. Durch die Zuordnung von
künftig 4 Regionen zu einem Mitglied des Vorstands bzw. von 45 Instituten zu 4
Regionalbeauftragten wird ein hohes Maß an einheitlicher Führung und Steuerung
garantiert.
3. Schaffung der strukturell-administrativen Voraussetzungen für die strategische
Steuerung: Die in ihrer Größe (Zahl der Länder bzw. Institute) und Komplexität
vergleichbaren Regionen bilden einen überschaubaren und handhabbaren Rahmen für
die strategische Planung (Rahmenplanung für die Regionen, Planungsverfahren), die
finanzielle und personelle Ressourcenplanung (Budgetierung der Projektmittel,
Budgetierung der Betriebsmittel, KLR und Controlling, Personalbedarfsermittlung) wie
auch für die Weiterentwicklung der neuen Führungsstruktur (Dezentralisierung).”172
Die Länderauswahl erfolgte unter der oben aufgezeigten Schwerpunktsetzung in Europa. Die
Regionalinstitute London für Nord-West-Europa, Paris für Süd-West-Europa, Prag für
Mittelost-Europa und Moskau für Osteuropa finden sich in meiner Bearbeitung. Für die
Region Südost-Europa wählte ich Istanbul statt Athen, da ich leichteren Zugang zur Türkei
172 Goethe-Institut Inter Nationes: Anhang zur Präsidiumssitzung vom 21. 11. 2001.
119
habe, die Türkei außerdem ein islamisches Land ist, und ich eigene Erfahrungen mit dem
türkischen Erziehungswesen habe.
Zur Region Nord-West-Europa wählte ich Stockholm, welches bei der alten
Regionenverteilung die tragende Rolle in Nord-Europa spielte. Stockholm war außerdem
Kulturhauptstadt Europas im Jahr 1998 und beherbergte die UNESCO-Konferenz für
lebenslanges Lernen 1998, an der Delegierte aus 150 Nationen teilnahmen.
Für Süd-West--Europa brachten die aktuelle Entwicklung und die Schließungspläne für das
Institut Neapels mit sich, dieses in die Arbeit aufzunehmen. Porto wurde im Zusammenhang
mit der Schließung des Goethe-Instituts in Coimbra wichtig. Die Bürgerbewegung für den
Erhalt der Institute war in Neapel erfolgreich, in Coimbra nicht. Portugal hat als Land am
Rande Europas intensive kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen nach Südamerika. Hier
war es von Interesse, die Entwicklung eines neuen Mitglieds der EU im kulturellen Kontext
zu betrachten.
In der Region Mittelost-Europa wurde die Slowakei miteinbezogen.
Damit sind also folgende Länder in die Untersuchung eingegangen:
Großbritannien: Goethe-Institut London,
Deutsche Schule London,
Frankreich: Goethe-Institut Paris,
Deutsche Schule Paris,
Schweden: Goethe-Institut Stockholm,
Deutsche Schule Stockholm,
Tschechien: Goethe-Institut Prag,
Deutsche Schule Prag,
Slowakei: Goethe-Institut Bratislava,
Gymnasium Poprad,
Italien: Goethe-Institut Neapel,
Portugal: Goethe-Institut Porto,
Deutsche Schule Porto,
Türkei: Goethe-Institut Istanbul,
Deutsche Schule Istanbul,
GUS: Goethe-Institut Moskau,
Deutsche Schule Moskau.
120
Die Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht in einigen Ländern werden vorgestellt,
ebenso die Beschreibung der Goethe-Institute in den oben genannten Städten sowie
Interviews wiedergegeben. Für London und Prag werden eine exemplarische Interviewserie
und umfangreiche Berichte vorgestellt.
In diesem empirischen Teil der Arbeit erfolgt auch eine differenzierte Beschreibung der
deutschen Schulen. Die organisatorischen und strukturellen Grundlagen sind im Teil B unter
2.2. “Auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen mit dem Schwerpunkt Europa” ausgeführt.
Teil C dient der Vorstellung der Goethe-Institute und Deutschen Schulen in Europa, deren
Mitarbeiter an der Befragung durch die Fragebögen Teil D teilgenommen haben.
Folgende Deutsche Schulen werden beschrieben:
Die Deutsche Schule London, eine aus der Tradition bevorzugte deutsche Auslandsschule in
ausgezeichneter Lage in der Nähe von London, ermöglicht ihren Absolventen das Antreten
eines Studiums im Gastland. Die Deutsche Schule Paris hat mit starker Konkurrenz zu
kämpfen. Andere Schulen bieten ein interkulturelles und preiswerteres Angebot. Die
Deutsche Schule Stockholm, vom Königreich Schweden mitfinanziert, ist eine
Begegnungsschule mit bikulturellem Schulziel. Sie endet mit dem deutschen Abitur und
bietet auf Wunsch auch ein schwedisches Abschlusszeugnis. Die Deutsche Schule Prag ist
zusätzlich ein pädagogisches Fortbildungszentrum für Lehrer für die Region Osteuropa. Die
Schulleitung ist bestrebt, eine Begegnungsschule zu entwickeln, was auch aus den Interviews
hervorgeht. Die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums Poprad ist eine von drei
Abteilungen. Neben der slowakischen Sektion und der fremdsprachlichen Sektion ist sie als
drittes Angebot die bilinguale Sektion mit Slowakisch und Deutsch als Unterrichtssprache.
Sie endet mit der deutschen Reifeprüfung und dem slowakischen Abitur. Zwei Drittel der
Schüler sind Mädchen, zwei Prozent der Schüler sprechen Deutsch als Muttersprache. Die
Deutsche Schule Porto ist eine deutschsprachige ausländische Privatschule mit der
Anerkennung durch das portugiesische Unterrichtsministerium. Dadurch können Schüler
jederzeit in das portugiesische Schulsystem wechseln. Um eine Universität zu besuchen,
müssen sie entsprechend ihrem Studienwunsch Zulassungsarbeiten schreiben. Die Deutsche
Schule Istanbul, das Alman Lisesi, ist ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium.
Es nimmt eine Sonderrolle ein: Die türkische Schulreform betrifft die Deutsche Schule
Istanbul beträchtlich, weil sie zwar eine von Deutschland geförderte Schule ist, aber auch den
Vorgaben des türkischen Erziehungsministeriums unterliegt. 80 Prozent der Schüler sind
121
Türken, drei Viertel davon Jungen. Das Alman Lisesi wurde gegründet, als Deutschland als
erster Verbündeter und Vorbild gesehen wurde. Es erhielt seine Bestätigung zur Zeit
Atatürks. Jetzt ist es eine Schule für die gehobene Schicht und bietet die Möglichkeit, einen
internationalen Hintergrund zu finden. Hier bekommen die Schüler auch eine
Studienberechtigung für Deutschland, was sonst in der Türkei so leicht nicht zu erreichen ist.
2. Großbritannien
2.1. Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht in Großbritannien
Kulturpolitische Beziehungen zu Deutschland173
Rechtliche Grundlage für kulturpolitische Austauschbeziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien bildet das Kulturabkommen vom 17. April
1959.
Großbritanniens politische Beziehungen zur EU und insbesondere zu Deutschland waren in
den zurückliegenden Jahrzehnten - trotz gemeinsamer Mitgliedschaft in EU und NATO - von
verhaltener Kritik, teilweise auch von Ablehnung geprägt. Der Regierungswechsel von den
konservativen Tories hin zu New Labour mit dem europafreundlichen Vorsitzenden und
jetzigen Premierminister Blair, lassen allerdings auf eine Verbesserung und Intensivierung in
den Beziehungen zu Deutschland hoffen. Auch die Option, der europäischen Währungsunion
vielleicht in Zukunft beizutreten, dürfte diesen Trend unterstützen. Eine stark antieuropäische
und antideutsche Position nehmen allerdings die in England dominierenden Medien des
australisch-amerikanischen Unternehmers Rupert Murdoch ein. Vor allem dessen Boulevard-
Blätter Sun oder Daily Mirror bedienen sich nur allzu oft eines Jargons, der die, in der
Nazizeit berechtigten, Stereotypen besetzt. Besonders die Europäische Union und deren
fortschreitende Integration wird in diesem Umfeld als ein Instrument zum Erreichen deutscher
Großmachtinteressen dargestellt. Die oft einseitige Darstellung Deutschlands in den
173Auswärtiges Amt: Auf der Grundlage der Länderkonzeption der Sprachförderung Großbritannien, erarbeitet
von GI, DAAD und Fachberater unter Koordination der Deutschen Botschaft, London. Stand: 1. Juli 1998.
122
englischen Medien beklagte auch Michael Naumann 1999 in seiner Eigenschaft als
Kulturstaatsminister, was in Großbritannien eine lebhafte Diskussion auslöste. Der Leitartikel
im “Spiegel”, vom 27.5.2002, in dem aus Anlass des Thronjubiläums das britische
Königshaus kritisiert wurde, rief wiederum heftige Reaktionen der britischen Presse hervor,
gespickt mit Vorurteilen über Deutschland und die Deutschen. Aufgrund dieser tendenziell
kritischen bis negativen Einstellung seitens der veröffentlichten Meinung fällt es der jetzigen
Regierung schwer, gegen den Willen der Bevölkerung entscheidende Schritte in Richtung
mehr europäische Integration zu gehen, wobei sich immerhin der politische Wille
dahingehend verstärkt hat.
Im wirtschaftlichen Kontext dagegen hält sogar die proeuropäische Labour-Regierung eine
deutliche Distanz zu den kontinentaleuropäischen Regierungen. Hierin spiegelt sich eine
grundsätzlich andere Einstellung in Bezug auf ökonomische Freiheit und die Rolle des Staates
wieder. Die Erfolge Großbritanniens hinsichtlich des Abbaus der Arbeitslosigkeit, der
Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums (gemessen an der Veränderung des realen
Bruttoinlandprodukts) oder der höheren Investitionsquote haben die Labour-Regierung darin
bestärkt, in wirtschaftspolitischer Kontinuität zur konservativen Vorgängerregierung und auf
Distanz zu kontinentaleuropäischen Modellen zu bleiben.
In der Fremdsprachenausbildung weicht Großbritannien ebenfalls vom Rest Europas ab.
Durch die Rolle der Muttersprache als Weltsprache besteht für die meisten Briten kein
Anlass, Fremdsprachen zu erlernen. Auch die geografisch-geschichtliche Orientierung
Englands am Commonwealth und die emotionale Distanz zum Kontinent finden in dieser
geringen Fremdsprachbereitschaft ihren Ausdruck. So kommt es, dass die Kenntnis einer
Fremdsprache in Großbritannien im Vergleich zu anderen EU-Ländern unterdurchschnittlich
verbreitet ist.
Obgleich sich Irland in seiner politisch-gesellschaftlichen Struktur sowie in seiner Einstellung
zu Deutschland maßgeblich von Großbritannien unterscheidet, bildet es mit diesem für die
Arbeit des Goethe-Instituts dennoch eine organisatorische Einheit.
123
Charakteristik des Bildungswesens in Bezug auf Deutsch als Fremdsprache174
Das für Bildungsfragen zuständige Ministerium “Department for Education and Employment
(DfEE)” überträgt die verschiedenen Bildungsaufgaben auf staatliche oder staatlich geförderte
Institutionen. Obligatorische Schulpflicht besteht für Kinder im Alter zwischen 5 und 16
Jahren, wobei sich die Schulen in Primar- (Primary Schools, 5 - 11 Jahre) und Sekundarstufe
(Secondary Schools, 11 - 16 Jahre) untergliedern. Insgesamt ist das Bildungswesen
vielfältiger als in Deutschland. So entfallen etwa 35% des Schulangebots auf die diversen
Privatschulen (wenngleich sie nur ca. 8% der Schüler unterrichten). Spiegelbildlich zur
Gesellschaft ist auch das Bildungssystem von einem ausgesprochenen Klassenbewusstsein
geprägt, d.h. die Universitäten, Colleges und Schulen weisen eine starke Image-Hierarchie
auf. Diese gründet allerdings auch auf Qualität, wie die Bestenlisten der Abschlussprüfungen
belegen, welche von Absolventen privater Träger angeführt werden. Parallel zur Vielfalt der
Bildungseinrichtungen sind die Universitäten und Schulen in Verwaltung, Lehr- und
Unterrichtsangebot und Personalbewirtschaftung autonom. Die Abschlussprüfungen GCSE
(General Certificate in Secondary Education) und A-Level, die dem deutschen Abitur
entsprechen, werden von ebenfalls unabhängigen Prüfungsboards entworfen und kontrolliert.
Die Schulen können sich dabei aussuchen, an welchem Prüfungsgremium sie sich ausrichten
wollen. Ähnlich verhält es sich mit der Fremdsprachenausbildung: Innerhalb bestimmter
Vorgaben entscheidet allein der Schulleiter über das Angebot von Fremdsprachen an seiner
Schule. Festzuhalten ist, dass Schottland im Bildungswesen weitgehend autonom ist.
Ziel der traditionsreichen Universitäten, Colleges und Schulen ist neben der rein fachlichen
auch die persönliche Bildung der Schüler und Studenten im Sinne von “social values". Um
dies zu erreichen und eine individualisierte und binnendifferenzierte Unterrichtsmethodik zu
verwirklichen, sind die Bildungsgänge generell stärker “verschult". Die Lehrerschaft ist im
Vergleich schlecht bezahlt und steht vom sozialen Image her weit unten auf der Skala.
Besonders drastisch fällt diese Missachtung für die Fremdsprachenlehrer aus, die in der
Mehrzahl nach dem Studium versuchen in die Wirtschaft abzuwandern.
Obwohl das Thema “Education" auf der Prioritätenliste der Regierung ganz oben steht, ist zu
befürchten, dass die Bedeutung der Fremdsprachenausbildung - insbesondere die Stellung von
174Diverse Formulierungen meines Mitarbeiters Thomas Hertlein wurden in den Teil C 2-10 aufgenommen.
124
Deutsch - nach der Umsetzung des “National Curriculum" im Jahre 2000 weiter abnehmen
wird. Der Schwerpunkt dieser Bildungsreform liegt vor allem in der Verbesserung der
schriftlichen Fertigkeiten, vor allem in der Förderung der drei großen "R" im
Primarschulbereich: reading, writing und arithmetic. Die Verbesserung der
Fremdsprachenausbildung ist dabei nicht vorgesehen, was der allgemeinen Geringschätzung
und der generell untergeordneten Rolle der Fremdsprachen in Großbritannien entspricht.
Erstaunlich wirkt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass ausgerechnet die britische
Presse vor einer neuen Isolation Großbritanniens im Zeitalter der Globalisierung der
Arbeitsmärkte und vor einer kulturellen Verarmung durch den Mangel an
Fremdsprachenkenntnissen warnte. Gleichwohl ist die wirtschaftliche Verwertbarkeit von
Sprachkenntnissen im Sinne einer “employability" offenbar die Hauptmotivation des
“Department for Education and Employment (DfEE)”. Als Maßnahme zur Förderung der
Fremdsprachenausbildung wurde immerhin die Einrichtung von 50 Language Colleges
vollzogen, die alle auch Deutschunterricht anbieten. Schulen können sich bei entsprechenden
Angeboten und curricularen Schwerpunkten für diesen Status bewerben. Obwohl vom
nationalen Curriculum nicht vorgeschrieben, setzt sich die Einführung einer Fremdsprache in
der Praxis bereits schon in der Primarstufe durch (ca. 25% der Schulen).
Stellung von Deutsch im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen
Im “National Curriculum” ist nur eine Fremdsprache Pflicht. Durch weitere curriculare
Auflagen werden Fremdsprachen jedoch an den Rand gedrängt. Deutsch als Fremdsprache
steht zwar mit weitem Abstand zu Französisch an zweiter Stelle, führt aber in absoluten
Schülerzahlen gemessen eher eine Randexistenz. Der exorbitant hohe Vorsprung des
Französischen liegt sowohl in dessen traditioneller Rolle als Kultursprache und
Nachbarschaftssprache begründet, als auch in dem Ruf des Deutschen als schwierige und eher
spröde Sprache. Selbst bei dem Wunsch, Deutsch an den Schulen wirklich zu etablieren,
scheuen viele Schulleiter oft die damit verbundenen Mühen bei der Realisierung, zumal im
Falle des Französischen die curricularen und personellen Voraussetzungen weitaus günstiger
sind. Erschwerend hinzu kommt ein seit einigen Jahren ungebrochener Trend hin zum
Spanischen. Die Rolle von Deutsch als Fremdsprache entspricht damit keineswegs den
gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftspolitischen Realitäten, denn Deutschland ist
Großbritanniens zweitwichtigster Handelspartner.
125
Im Primarschulbereich ist nach dem “National Curriculum” zwar keine Fremdsprache
vorgesehen, in der Realität bieten die Schulen jedoch mehrheitlich ein entsprechendes
Programm an. 95% der Schüler optieren dabei für Französisch, ca. 3% für Deutsch.
Besonders im Raum Manchester und Kent gibt es einige vielversprechende Pilotschulen für
Deutsch. Der Sprachunterricht erfolgt dabei in Form einer Einführung in die Landeskunde, als
reiner Sprachunterricht oder in einer Kombination aus beidem. Englische oder schottische
Lehrwerke für Deutsch liegen für die Primarstufe bislang nicht vor, das Goethe-Institut
entwickelte allerdings zusammen mit dem Kent County Council ein Video-Paket mit dem
Titel “3-2-1- LOS". Ein anderes Hindernis ist die mangelnde Qualifikation der Lehrer in
diesem Bereich, für die es - bis auf eine Ausnahme in Schottland - keine spezielle
Sprachausbildung gibt.
In der Sekundarstufe beginnt die Mehrheit der Schulen mit Französisch als erster
(vorgeschriebener) Fremdsprache (lediglich 8 bis 10 % der Schüler lernen kontinuierlich zwei
Fremdsprachen). Deutsch ist an ca. 40% der Schulen die zweite Fremdsprache. Selbst in der
ersten Fremdsprache beträgt die wöchentliche Unterrichtszeit nicht mehr als 90 bis 180
Minuten. Verlässliche Zahlen und Vergleiche zwischen Deutsch, Französisch und Spanisch
lassen sich nur anhand der Abschlussprüfungen des “General Certificate in Secondary
Education (GCSE)”, welches die Schüler nach der 10. und 11. Klasse ablegen und der A –
Level- Prüfungen nach der 12. und 13. Klasse ablesen:
Anteil der Schüler, die 1997 an den GCSE - Prüfungen teilnahmen:
Französisch Deutsch Spanisch
337.993 135.466 44.703
6% 2,4% 0,8%
In den Jahren 1989 bis 1997 fand bei Französisch ein Wachstum von 26,1%, bei Deutsch ein
Wachstum von 76% und bei Spanisch eines von 133,7% der Schülerzahlen statt. Durch das
rasante Wachstum des Spanischen ist eine Verbesserung der Position von Deutsch als
Fremdsprache mittelfristig nicht zu erwarten.
Anteil der Schüler, die 1997 an den A-Level-Prüfungen teilnahmen:
Französisch Deutsch Spanisch
25.916 10.516 5.826
126
3,3% 1,4% 0,7%
Nach der deutschen Wiedervereinigung stieg die Belegung von Deutsch bei A-Level-
Prüfungen von 1,09% auf 1,8% aller Schüler an und sank bis 1997 wieder auf 1,4%. Daraus
wird deutlich, dass auch hier die Position von DaF kaum wesentlich verbessert werden kann,
zumal es für Deutsch keine Lobby gibt: Viele Lehrerstellen werden nach der Pensionierung
einfach nicht mehr besetzt.
Die Trends aus dem Schulbereich setzten sich auch in der Hochschule fort: Während die
Anfängerzahlen für Studiengänge in Deutsch (und Französisch) stagnieren, steigen sie in
Spanisch an.
Einstellungen zu Deutsch und Deutschland
Wesentlich beeinflusst wird die öffentliche Meinung über Deutschland wie schon erwähnt
durch die “Tabloids", d.h. die britische Boulevardpresse. Dementsprechend kritisch
betrachten große Teile der Bevölkerung die Bundesrepublik als eine Demokratie auf dem
Prüfstand. Da das Image Deutschlands in erster Linie von seiner Politik abhängt, korreliert die
Einstellung zu DaF stark mit der deutschen (Außen-)Politik, was von vielen deutschen
Politikern nicht in diesem Umfang wahrgenommen wird.
Bedarf und Interesse an Deutschkenntnissen resultieren in erster Linie aus der
wirtschaftlichen Verflechtung Großbritanniens mit Deutschland (zweitgrößter gegenseitiger
Handelspartner) und dessen wirtschaftlichem Gewicht innerhalb des europäischen
Binnenmarkts, weniger aus kulturellen Motiven. Auch touristisch gilt Deutschland -
besonders unter Jugendlichen - als wenig attraktiv.
Im Schulbereich ist die ablehnende Haltung gegenüber Deutschland besonders bei jenen
Schülern virulent, die noch keine persönlichen Beziehungen mit der Sprache oder den
Deutschen gemacht haben. So zeigte eine Umfrage des Goethe-Institut 1996 bei britischen
Schülern zur Einstellung gegenüber Deutschland hartnäckige Vorurteile auf: Deutschland
wird hier als armes, mit Bosnien vergleichbares Land gesehen, seine berühmteste
“Persönlichkeit" war Adolf Hitler. Jürgen Klinsmann war den meisten Jugendlichen als
positive Identifikationsfigur bekannt. Als typische deutsche Eigenschaften sehen sie
Aggressivität, Arroganz, Militarismus, Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und
Arbeitssucht. Bei Schülern mit Deutschkenntnissen zeigte sich jedoch ein auffallend anderes,
127
überwiegend positives Bild. Als Konsequenz auf diese Umfrage titelte die britische Zeitung
Guardian: “Learn German".
Die Zusammenarbeit zwischen den Goethe-Instituten und dem DAAD mit den britischen
Partnerinstitutionen im Bereich Bildung sind dagegen traditionell gut und verlaufen
reibungslos.
Besuch der deutschen Botschaft in London
Um einen Überblick über die Träger der auswärtigen Kulturpolitik in London zu gewinnen,
besuchte ich die Deutsche Botschaft, führte dort ein Gespräch mit dem Kulturreferenten,
besuchte das “German Information Centre". Dies ist ein von der Botschaft betriebenes
Zentrum, welches allgemeine Informationen über Deutschland und seine gesellschaftlichen
Strukturen bietet. Das Gespräch mit dem Kulturreferenten und die Kurzbeschreibung des
Programms “German Season", welches die Botschaft in Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut anlässlich des Besuchs des Bundespräsidenten durchführte, sind hier angefügt.
Das Programm “German Season" umspannte den Zeitraum vom 7. Oktober 1998 bis zum 30.
Januar 1999. Es wies insgesamt 40 verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen,
Ausstellungen, Theater-, Tanz- und Filmaufführungen, Symposien, Konferenzen, einen
Weihnachtsmarkt und ein Tennisspiel aus. Hauptveranstaltungsort für die 21 verschiedenen
Konzerte war die “Wigmore Hall". Vier Veranstaltungen fanden im Goethe- Institut statt,
aber auch die Deutsche Schule und St. Margaret´s Church und Westminster Abbey waren
unter den Veranstaltungsorten zu finden.
Zu Charlotte Salomon fanden eine Ausstellung, ein Konzert und ein Symposium zum Thema
“Charlotte Salomon: Life?- Or Theatre?" statt. Die Veranstaltungen wurden ohne die
finanzielle Hilfe des Auswärtigen Amtes initiiert. Als Sponsoren waren verschiedene Banken
und Firmen vertreten wie die Commerzbank London, Deutsche Bank, Hoechst UK Group
Ltd., Helaba-Landesbank Hessen-Thüringen, West-LB, Rover Group Ltd., BMW, Financial
Service (Großbritannien) Ltd., BMW (Großbritannien) Ltd..
Eine Neuheit ist das “German Information Centre" der deutschen Botschaft. Das Zentrum
vertreibt allgemeine Informationen über Deutschland und seine Gesellschaft. Erstaunlich ist
dabei, dass das Zentrum eine sehr ähnliche Arbeit wie das Goethe- Institut leistet und damit
auch in Konkurrenz zu diesem tritt.
128
Alles zur Verfügung stehende Material wird von Inter Nationes und dem Bundespresseamt
bezogen. Die Einrichtung dieses Instituts ist von der Regierung finanziert und laut Botschaft
eine Antwort für die Nachfrage aus der Bevölkerung. Beispielsweise gibt es ein “Fact Sheet
on Germany”. In ihm werden auf 8 Seiten Zahlen angegeben zu Struktur, Wirtschaft,
Inflation, Arbeitslosigkeit, öffentlichen Finanzen, Außenhandel und eine Vergleichstabelle
der letzten 50 Jahre, mit der Produktivität, Arbeitslosenquote, Inflationsquote und dem realen
wirtschaftlichen Wachstum Deutschlands.
Gemeinsam mit anderen Mittlern wurden die Websites zum deutsch - britischen
Jugendaustausch erstellt. Eine Liste mit 20 Kapiteln bietet Zugang zu Informationen über
deutsch - britischen Austausch. Das einleitende Kapitel “What´s new?" bietet zu Programmen
und Special events, Hyperlinks zu den verschiedenen beteiligten Organisationen wie
beispielsweise zur Deutschen Botschaft in London/ “Kulturkalender”, zur Britischen
Botschaft in Bonn/Berlin, zum Goethe- Institut in Großbritannien, zu “Exchange Programs
for young people”, zum British Council in Deutschland, “German-British Forum” und zum
Youngnet (BMBF). Man kann alle kulturellen Einrichtungen erreichen und Informationen zu
allen Bereichen des kulturellen Lebens abrufen.
Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst e. V. (DAAD) ist in London sehr aktiv
Deshalb sollen seine Aufgaben hier kurz exemplarisch beschrieben werden.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterhält 13 Auslandbüros, eines
befindet sich seit 1954 in London. Dort sind 7 Mitarbeiter beschäftigt, die als mittel- und
langfristige Arbeitsschwerpunkte den Hochschulbereich in Großbritannien und Irland
bearbeiten. Hauptaufgabe des DAAD ist die Auswahl und Vergabe von Stipendien an
Studierende und Wissenschaftler. Weitere Schwerpunkte liegen in der Vermittlung deutscher
Lehrkräfte, vor allem in der Betreuung und Weiterbildung der ca. 70 Lektoren verschiedener
Fachrichtungen, in der flächendeckenden Versorgung mit Sprachlektoren und darin, die
Anzahl der Fachlektorate in Richtung “German Studies Dozenturen” zu erweitern.175
Außerdem soll die Werbung für Stipendienprogramme und die Bewerberzahlen für
Jahresstipendien erhöht sowie die Nachkontaktarbeit und Stipendienbetreuung intensiviert
129
werden. Infolge der attraktiven Angebote gibt es viermal so viele Bewerber wie Plätze zur
Verfügung stehen. Hier einige Zahlen zum Austausch:
“Beim projektbezogenen Wissenschaftleraustausch mit dem British Council zusammen
(Academic Research Corporation) wurden 1997 insgesamt 669 Deutsche gefördert, davon
263 neue Förderungen.”176 Über das Programm ERASMUS der EU wird seit 20 Jahren
studentischer Austausch betrieben. Inzwischen hat sich mit ihm ein Netzwerk von
Universitäten gebildet, wie z. B. die Coimbra- Gruppe. In Deutschland unternehmen 9% aller
Studierenden einen studienbezogenen Aufenthalt im Ausland. Rund 25% von ihnen leisten
dabei ein Praktikum ab. Für Großbritannien wurden 4087 und für Irland 735 Deutsche mit
ERASMUS gefördert und ca. 3000 Briten für Deutschland.
Im deutsch-britischen Vergleich muss man leider feststellen, dass von Deutschland aus
dreimal soviel Austausch nach Großbritannien unternommen wird wie von Großbritannien
nach Deutschland.
2.2. Goethe-Institut London177
Kulturprogramme
Es finden verschiedenste Veranstaltungen aus den Bereichen Wissenschaft und Literatur,
Musik, Film, Medien/Rundfunk/visuelle Kommunikation, Theater/ Theaterprojekte sowie
Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen statt. So z.B. im Herbst 1998 im Rahmen der
Wortveranstaltungen die Reihe "Germany, My Germany", in der berühmte Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ihre persönliche Beziehung zu Deutschland
berichten. Hier konnten bereits so namhafte Referenten wie Lord Ralf Dahrendorf, Sir
Christopher Mallaby oder Ignatz Bubis gewonnen werden. Aus Anlass der Rolle Weimars als
"Kulturstadt Europas 1999" veranstaltete das Goethe-Institut einen internationalen Essay-
Wettbewerb zum Thema "Die Zukunft von der Vergangenheit befreien? Die Vergangenheit
von der Zukunft befreien?". Fester Bestandteil der Kulturprogramme sind auch Schriftsteller-
und Dichterlesungen wie der Besuch von Petra Morsbach zu ihrem Buch "Opernroman" in
176 Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD. Aus: Ländertabelle des DAAD, Referat 212 Westeuropa.
Nr. 9, Großbritannien. 177 Goethe-Institut London, Jahrbuch 1997/98 und Internetseite des Goethe-Instituts. Einbezogen habe ich meine
Eindrücke zur Arbeit des Instituts.
130
der Reihe "Neue deutsche Literatur". Auch des 100. Geburtstags Brechts wurde mit
unterschiedlichen Veranstaltungen wie z.B. einer Filmreihe und einem Seminar gedacht.
Besucher '98: 44423.
Deutsch lehren und lernen
Integraler Bestandteil der Arbeit des Goethe-Instituts London ist die Spracharbeit für
interessierte Engländer im allgemeinen und für britische Deutschlehrer im besonderen.
Sprachkurse für Einheimische sind - je nach Vorkenntnissen - aufgeteilt in Grund-, Mittel-
und Oberstufenkurse, wobei jeder dieser Kurse für die Dauer eines Jahres ausgelegt ist. Die
Kurse führen bis hin zum Großen Deutschen Sprachdiplom (GDS). Unterstützt werden die
Lernenden dabei durch moderne Methodik sowie spezielle PC-Programme in einem gut
sortierten Selbstlernzentrum. Für Geschäftsleute werden ferner aufbauende Kurse in
Wirtschaftsdeutsch angeboten; auf Anfrage finden auch spezielle Individual- oder
Kleingruppenkurse statt. Für britische Deutschlehrer leistet das Goethe-Institut vielfältige
pädagogische Verbindungsarbeit: Einführungstage für deutschsprachige Fremdsprachen-
Assistenten, Deutschlehrertage, Sonderkurse für Deutschlehrer (Linguistik, Grammatik,
Landeskunde, Methodik), Bildungsreisen nach Deutschland oder spezielle Seminare zu
ausgewählten Themen (z.B. zu Kommunikationsformen in Deutschland oder juristischer
Fachsprache).
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek weist einen Bestand von 27501 Exemplaren, davon 24557 Bücher, 154
Zeitungen und Zeitschriften und 2790 audiovisuelle Medien aus, der gut (etwa zu einem
Drittel) umgeschlagen wird. Bestandsschwerpunkt sind Werke nach 1945. Deutsche Literatur
findet sich dabei oft auch in englischer Übersetzung. Ergänzend zu den Deutschkursen bietet
die Bibliothek außerdem eine breite Palette von Materialien und Lehrwerken zum Thema
“DaF". Für Deutschlehrer gibt es eine eigene Serviceabteilung im Informationszentrum, das
generell auch Anfragen zu deutschlandbezogenen Themen beantwortet. Darüber hinaus
organisiert die Bibliothek auch Veranstaltungen, wie z.B. die Ausstellung “Was bleibt?
Deutsche Prosa (Ost und West) seit 1945".
131
2.3. Interviewserie im Goethe-Institut London im September 1998
Interview mit dem Leiter des Goethe-Instituts, W
A: Herr W, wir haben im Bundestag über das Thema Synergien, Kooperationen und Überschneidungen der
Arbeit im Auswärtigen Kulturbereich gesprochen. Wie ist die Situation in London?
W: Mittlerweile fange ich an zu zweifeln, ob es heute noch sinnvoll ist, die Goethe-Institute in den westlichen
Weltstädten in der jetzigen Form zu betreiben. Die größte Skepsis habe ich im Bereich der Programmarbeit.
Zuerst möchte ich Ihnen die anderen Bereiche schildern die weniger problematisch sind.
Am unproblematischsten ist hierbei der Bereich Bibliotheks- und Informationsarbeit, mit dem wir kürzlich ins
Internet gegangen sind. Die Bibliothekarin ist dabei sehr engagiert und nutzt die neuen Medien bestmöglichst
aus. Wenn ich mir das Goethe-Institut London im Jahre 2010 vorstelle, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel,
dass es dann eine vernetzte, multimediale Bibliotheksarbeit geben wird. In diesem Zusammenhang stellt sich
allerdings dann die Frage, ob wir zusätzlich noch ein Informationszentrum in der deutschen Botschaft brauchen.
Hier kommt es zu Überschneidungen. Dort wird zwar auch politische Informationsarbeit betrieben, die wir in
dieser Art sicher nicht leisten könnten und wollen. Wenn man sich allerdings überlegt, was das Goethe-Institut
leistet und sich ansieht, was die deutsche Handelskammer tut, wenn man außerdem bedenkt, was ein schlichtes
Pressereferat konventioneller Art bei der Botschaft auch machen könnte, dann frage ich mich, was eigentlich
noch für das sehr kostspielige Informationszentrum übrig bleibt. Ich halte das Informationszentrum der
Botschaft - unter uns gesagt - für obsolet, man könnte es schließen. Die Tätigkeiten unserer Bibliothek bestehen
ja schon im Wesentlichen darin, Fragen und Anfragen zu praktisch allen Bereichen des kulturellen, sozialen und
politischen Lebens zu beantworten, Informationen zu beschaffen, zu recherchieren. Ich bin voll davon
überzeugt, dass hier eine gute Arbeit geleistet wird auch in der Zukunft.
Hinzu kommt, dass wir im GI zusätzlich noch etwas fördern, was auch Zukunft hat, nämlich das von uns
herausgegebene Heft “New Books in German", in dem zweimal jährlich neue deutsche Bücher vorgestellt
werden. Dieses Heft wird gemeinsam von uns, dem Börsenverein, dem Auswärtigen Amt, dem Bund sowie der
schweizerischen und österreichischen Botschaft, finanziert. Es wird an englische Verlage und außerdem in ca.
60 verschiedene Länder der Welt verschickt, wobei die Auswahl der Titel in diesen Ländern vom englischen
Übersetzerverband getroffen wird. Dieses Heft möchten wir gerne noch zwei bis drei Jahre herausgeben. Mir
persönlich wäre es lieber, die gesamte Finanzierung und Verantwortung dafür läge auf deutscher Seite beim
Goethe-Institut, wo durch die entsandten Mitarbeiter eine hohe Sachkompetenz vorhanden ist, während die
Botschaft durch eine Sachbearbeiterin vertreten ist. Leider kommt jedoch die größte Summe vom Auswärtigen
Amt und nur eine kleine Summe - die wir unserer Zentrale jedes Mal von neuem “abschwätzen" müssen - tragen
wir dazu bei. Das Know-How, die Sachkompetenz von deutscher Seite kommt allerdings ausschließlich vom
Goethe-Institut: Ich sitze z.B. im Steering-Komitee und unsere Bibliothekarin D sitzt auch noch im
Arbeitskomitee. Im ersten Komitee werden die allgemeinen Grundthemen behandelt, beispielsweise Fragen nach
neuen Zielgruppen oder ähnliches. Im Arbeitskomitee werden dann die operativen Probleme bearbeitet, z.B. die
Zielgruppenadressen beschafft, der Versand, das Layout gestaltet, die Qualität der Texte geprüft etc.. Die
Auswahl der vorgestellten Titel überlassen wir, wie gesagt, ausschließlich den Engländern, weshalb wir kürzlich
132
sogar einen kleinen Streit oder wenigstens Meinungsunterschiede mit den Schweizern hatten, die selbst an der
Auswahl ihrer Bücher teilnehmen wollten. Dabei vertrat ich die Auffassung, die Glaubwürdigkeit dieser
Publikation hinge im Wesentlichen davon ab, dass die Ausländer hier nicht hineinreden und dass wir die
Entscheidung denjenigen überlassen, die den britischen Buchmarkt selbst am besten kennen. Das ist übrigens
auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen wichtig, denn auch die Leute von Marketing
Großbritannien kennen die Briten besser als jeder Vertreter einer ausländischen Institution.
Bei “New Books in German" ist unsere Bibliothek also auch stark involviert, auch was die Arbeitskapazität
angeht. Wir unterstützen die Initiative auch sonst: Ich selbst z.B. habe einmal einen Empfang gegeben für alle,
die an dieser Arbeit beteiligt sind. Wir veranstalten außerdem demnächst ein Arbeitsseminar, auf dem die Frage
geklärt werden soll, warum das deutsche Buch im englischen Sprachraum nicht genügend gefördert wird. Auf
dieser Veranstaltung treffen englische und deutsche Verleger, Übersetzer, Buchhändler und Kritiker zusammen.
In diesem Bereich haben wir die entscheidende Arbeit zu übernehmen, da außer uns auf deutscher Seite niemand
die Sachkompetenz hat. Hierin liegt eine unserer Hauptaufgaben im Bibliotheksbereich.
A: Wie sieht es für den Komplex der Sprachförderung Ihrer Meinung nach aus?
W: Was die Sprachkurse anbelangt, so sehe ich deren Zukunft etwas skeptischer als die Leiterin der
Spracharbeit. Das ist Frau C, die erst seit diesem Jahr bei uns ist. Die Spracharbeit ist ihrer Ansicht nach deshalb
so wichtig, weil an diesen Kursen nicht nur Privatpersonen, sondern vor allem auch viele Geschäftsleute
teilnehmen. Für diese “business people” bieten wir außer den normalen Sprachkursen noch spezielle
wirtschaftssprachliche Kurse an, teilweise sogar in den Unternehmen. Daneben bieten wir auch noch
Privatunterricht an.
Ich bin deswegen skeptisch, weil ich glaube, dass wir sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein können,
da das Fremdsprachenlernen in England traditionell sehr defizitär ist. Eigentlich müsste das englische
Schulsystem dieses Problem lösen. Wir können die Defizite dieses Systems ohnehin nicht ausgleichen. Daher
frage ich mich natürlich, ob denn wirklich viel passieren würde, wenn wir die Sprachkurse - unter Umständen
zwangsweise - auslagern und kommerziell arbeitenden Sprachschulen übertragen würden, wie das in
Griechenland oder anderen Ländern auch der Fall ist. Dann würden wir uns auf die hoch qualifizierenden
Spezialkurse beschränken. Frau C ist allerdings der Meinung, dass das ausschließliche Angebot von
Spezialkursen nicht ausreichen würde. Nebenbei bemerkt bieten wir auch regelmäßig einen Sprachkurs im
House of Parliament an, an dem Abgeordnete und Angestellte des Parlamentes teilnehmen, und der gut besucht
wird.
A: Kommen wir zur pädagogischen Verbindungsarbeit - und wichtigen Aktivitäten in diesem Zusammenhang.
W: Dieser Bereich wird meiner Meinung nach im Jahre 2010 ebenfalls eine wichtige Rolle in unserer Arbeit
spielen. Hierbei konzentrieren wir uns auf die traditionelle Aufgabe der Fortbildung englischer Deutschlehrer,
aber wir sind auch auf anderen Gebieten aktiv: So produzieren wir derzeit unseren dritten größeren Sprachfilm
zusammen mit der BBC. Dafür stellt uns das Goethe-Institut München eine größere Summe zur Verfügung -
sechsstellige Beträge, ca. 275. 000 DM. Unser Beitrag besteht neben dieser Summe vor allem aus dem
Einbringen unseres Know-Hows. Herr B, der Leiter der pädagogischen Verbindungsarbeit, mein Stellvertreter,
war bei den Filmaufnahmen anwesend, überprüfte die Manuskripte. Wir überprüfen u.a. die deutschen Dialoge
auf Verständlichkeit und Authentizität etc.. Wir helfen bei der Suche nach Schauplätzen für die Filme, wir
133
suchen die Darsteller aus den deutschen Schülern aus und stellen den Kontakt zu den Schulen, in denen gedreht
werden soll, her usw.. Auf diese Art und Weise garantieren wir, dass wirklich ein authentisches Deutschlandbild
entsteht. Diese Sprachfilme werden von der BBC weltweit vertrieben, so dass eine sehr große kulturpolitische
Reichweite erreicht wird.
A: Was kann getan werden, um die Rolle der deutschen Sprache in England zu verbessern?
W: Die Rolle der deutschen Sprache in Großbritannien wird erst wirklich verändert bzw. verbessert, wenn eine
zweite Fremdsprache in der Sekundarstufe an britischen Schulen obligatorisch wird. Wenn wir in Deutschland
die obligatorischen Fremdsprachen allerdings selbst abbauen, wird es kulturpolitisch ziemlich schwierig sein,
den Engländern die Bedeutung einer zweiten Fremdsprache zu verdeutlichen. Da die Engländer als erste
Fremdsprache natürlich immer erst Französisch bevorzugen, konkurrieren wir mit Spanisch. Mich verwundert
deshalb, dass die Deutschen im europäischen Rahmen nicht nachdrücklicher auf eine Harmonisierung
hinsichtlich von zwei obligatorischen Fremdsprachen in der Sekundarstufe drängen. Dieses halte ich für
unabdingbar. Erst wenn die Engländer diese Regelung einführten, würde Deutsch eine gewichtigere Rolle
spielen. Darauf haben wir als Goethe-Institut allerdings keinen Einfluss.
A: Sie sind ja bekannt für erfolgreiche Programmarbeit. Zu Beginn unseres Gespräches äußerten Sie Skepsis...
W: Ja, am meisten zweifle ich an der Programmarbeit, was ich auch in München nachdrücklich angesprochen
habe. Ich arbeite jetzt seit 35 Jahren für das Goethe-Institut, und in dieser Zeit war ich wohl immer für
erfolgreiche Programmarbeit bekannt. Wenn ich jetzt an meiner eigenen Biographie zweifle, dann müssten mir
die Verantwortlichen eigentlich glauben, dass hier etwas geändert werden muss. Trotz einiger Zustimmung zu
meinen Überlegungen zur Arbeit an Weltstadtinstituten wird leider trotzdem nichts geändert. Ich möchte Ihnen
einmal genau schildern, woran ich zweifle: Erstens glaube ich, wir machen hier noch die Programmarbeit der
70er Jahre auf der gesamten Bandbreite. Symposien, Ausstellungen, Konzerte, Filmwochen und ähnliches. Wir
gehen nach wie vor davon aus, dass das, was wir bieten, irgendein wesentliches Feld ausfüllen sollte, das ohne
uns nicht ausgefüllt werden würde. Dieses ist das Hauptkriterium bei der Auswahl von Schwerpunkten. Aber ich
finde eben, wir können gerade hier in London nur noch auf wenigen Gebieten etwas anbieten, was nicht auch
schon ohne uns in irgendeiner Form angeboten werden würde. Außerdem haben wir inzwischen erheblich
weniger Mittel als früher und können größere Veranstaltungen nicht mehr wie früher bezuschussen. Wir sind
dadurch letztendlich marginalisiert. In Paris und New York zweifeln meine Kollegen allerdings auch schon an
der Notwendigkeit einer Programmarbeit, die das gesamte Spektrum der früheren Programme weiter aufrecht zu
erhalten versucht. Ich hörte, in unserer Zentrale argumentieren manche mit dem erfolgreichen Gegenbeispiel der
Programmarbeit an Plätzen wie Mexiko, aber ich bin der Meinung, dass man London oder New York und
Mexiko nicht vergleichen kann. Die Kaufkraft, die mir heute in London zur Verfügung steht, ist übrigens etwa
ein Drittel der Kaufkraft, die meinem Vorgänger noch 1990 zur Verfügung stand!
A: Am Geld hängt alles! Man hört dann häufig, man müsse eben mehr Kreativität an den Tag legen, z.B. durch
Sponsoring?
W: Dies ist aber ein Kapitel für sich... . Ich muss dagegen ankämpfen, dass man glaubt, es läge nicht am Geld:
es liegt im Wesentlichen eben schon am Geld. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich etwa
zur London School of Economics gehe und dort ein gemeinsames Symposium vorschlage, dann sind die
Verantwortlichen dort nur dann dazu bereit, wenn meine Kompetenz über deren eigener liegt, d.h. wenn ich
134
ihnen eine ganz neue Qualität der Deutschlandkenntnisse vermittele, und wenn ich soviel Geld dazu gebe, dass
die Veranstaltung ohne Belastung ihrer Finanzen läuft. Auch unsere Kompetenz wird in London heute ganz
anders gefordert als früher oder als das an anderen Orten der Fall ist. Als ich z.B. früher in Israel gearbeitet
habe, war es für mich ein Leichtes, eine Vortrags- oder Seminarveranstaltung an die Tel Aviver oder
Jerusalemer Universität zu vermitteln und bei der Gestaltung kompetent mitzureden, weil ich damals immer
noch mehr Deutschlandkenntnisse (Namen, Fakten und Zusammenhänge) hatte als die dortigen Professoren an
den politologischen Fakultäten. An der hiesigen London School of Economics kennen die Dozenten nicht nur
jeden deutschen Referenten, den ich ihnen nenne, sondern sie kennen ihn sogar persönlich und ich meist nur aus
seinen Publikationen! Ich habe also keinerlei Kompetenzvorsprung gegenüber diesen Fachkräften mehr, und das
habe ich in unserer Zentrale auch klarzumachen versucht. Die Konsequenz daraus ist, dass der Leiter des
Weltstadtinstituts London in Zukunft ein gutes Team von Kuratoren haben muss, statt mehr oder weniger gut
qualifizierter Sachbearbeiter, am besten einen für Politik und Gesellschaft, einen für Theater, einen für Kunst,
einen für Musik etc., falls wir auf diesen Gebieten den Briten qualifizierte Beratung anbieten wollen.
Nun zum finanziellen Aspekt: Die London School of Economics, eine international renommierte Universität hat
sehr viel Geld zur Verfügung. Bei einer Veranstaltung mit uns vor zwei Jahren trugen sie gar zwei Drittel der
Kosten. Kürzlich sagten sie mir aber, sie hätten zur Zeit massive Finanzprobleme, und ein geplantes Seminar mit
ihnen müssten wir alleine bezahlen. Wir müssten also nicht nur dafür sorgen, dass die deutschen Teilnehmer
kämen, sondern auch die Teilnahme sämtlicher anderer europäischen Teilnehmer organisieren und finanzieren.
Das Seminar sollte sich mit der Frage beschäftigen, wer kulturell und im Hinblick auf die Werte der "Civil
Society" zu Europa gehört, also wer konkret und politisch zu Europa gehört. Vertreter einer anderen Stiftung,
mit der wir in Umweltthemen zusammenarbeiten, des ”International Institute for Environment and
Development”, haben mir auf meine neuerliche Anfrage gesagt, sie seien finanziell so am Ende, dass ihnen ihr
Aufsichtsrat aufgetragen habe, sogar die vorbereitenden Gesprächskosten mit mir abzurechnen. Ich sollte ihnen
nicht nur die Veranstaltung und die Teilnahme der deutschen Referenten finanzieren, sondern auch noch die
Stunden, die sie mit mir zur Vorbereitung verwendeten. An diesem Punkt hört mein Verständnis dann auf, denn
dann finanzierten wir praktisch den gesamten Dialog nur noch alleine. Also noch einmal: Geld fehlt, nicht nur
uns, und wir haben auch keinen Kompetenzvorsprung mehr, was soziopolitische Veranstaltungen angeht. Das
gleiche gilt im übertragenen Sinne auch für kulturelle Veranstaltungen wie Musik-events, Ausstellungen usw.
Eine neue Kollegin von uns, Frau H, ist zwar sehr versiert in Themen wie Bildender Kunst u.ä., aber die Leiter
der Londoner Museen kennen selbst alle wichtigen deutschen Museen, d.h. wenn meine Kollegin etwa unsere
Mithilfe an bestimmten Ausstellungen anbieten würde, dann würde wahrscheinlich nicht mal ein persönliches
Gespräch mit den dortigen Verantwortlichen zustande kommen, es sei denn, wir gäben ihnen 80 - 90.000 DM!
Die Kuratoren der großen Londoner Museen brauchen nicht den Rat von uns und auch nicht den Rat vom
Direktor des Goethe-Instituts. Einen Kompetenzvorsprung haben wir allenfalls noch gegenüber kleineren
Galerien. Das gleiche gilt für den Bereich Musik.
A: Sie betonen die Wichtigkeit des Kompetenzvorsprungs. Gibt es da noch andere Rollen für das Goethe-Institut
London?
W: Die Gebiete, in denen wir momentan wirklich noch eine Rolle spielen, sind wie gesagt einerseits die
Literaturförderung (new books in german), andererseits die Filmförderung, z.T. auch die Theaterförderung. Wir
135
haben eine sehr gute, englische Filmsachbearbeiterin, die ihre Arbeit besser macht als alle vergleichbaren
Institutionen, d.h. die Filmveranstaltungen, die wir durchführen, würden ohne uns nicht passieren. Gleiches
kann man auch für die Theaterförderung sagen: Wir fördern szenische Lesungen im Royal Court Theatre, wir
stellen junge deutsche Theaterautoren vor, wir übersetzen deren Stücke. Eingeladen wird dazu jeder, der im
Theaterleben in London und ganz England “gut und teuer" ist. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass diese
betreffenden Stücke meist auch wirklich in die Aufführung übernommen werden. Wir übernehmen dabei
praktisch die Funktion, den Anstoß zu geben. Auf diesen drei Gebieten, Literatur-, Theater-, und Filmförderung,
haben wir heute noch einen Kompetenzvorsprung, auf allen anderen Gebieten stelle ich unsere Tätigkeit heute
mehr und mehr in Frage. Unser Hauptproblem ist dabei, dass von uns gleichzeitig Sichtbarkeit und
Nachhaltigkeit verlangt wird. Maßnahmen wie die Literaturförderung sind natürlich nachhaltig, wir regen damit
britische Institutionen an, sich ernsthaft mit deutscher Literatur zu befassen. Aber sichtbar ist dieses Engagement
deswegen noch nicht unbedingt. Die Botschaft und das Auswärtige Amt, sowie manche Leute in der
Zentralverwaltung möchten am liebsten, dass wir außerdem noch eine große Medienwirkung erzielen. Diesen
Spagat schaffen wir beim besten Willen nicht mehr! Ein anderer Widerspruch ist, wenn es heißt, wir sollten nur
noch Programmverbindungsarbeit leisten, d.h. wir sollen Reisen organisieren, wir sollen networken, wir sollen
Kontakte herstellen. Wenn wir uns tatsächlich darauf konzentrieren würden, so wäre das erstens auch nicht
sichtbar, sondern stille Hintergrundarbeit, und zweitens haben wir den Kompetenzvorsprung vielfach nicht
mehr. Die Engländer haben heute ihre eigenen Kontakte nach Deutschland, wir können bestenfalls noch
unterstützend wirken. Gerade zwischen London und Berlin besteht heute auf nahezu allen Gebieten recht
intensiver Kontakt, auch ohne unsere Hilfe.
A: Welche zentrale Forderung würden Sie stellen?
W: Was ich verlange, ist, dass man uns entweder für unsere gesamte Arbeit mehr Geld und mehr Personal zur
Verfügung stellt - was ich für unwahrscheinlich halte- oder man konzentriert die Ressourcen in den Ländern
Europas und in den USA auf die Weltstadt-Institute London, Paris und New York. Moskau ist in diesem
Zusammenhang ein Sonderfall, jedenfalls nicht mit den Weltstädten der westlichen Welt vergleichbar. In
Westeuropa sollte man, zu Lasten der provinzielleren Niederlassungen die Mittel bündeln. Ich halte es z.B. nicht
für sinnvoll, bei knappen finanziellen Mitteln in Westeuropa noch Institute in Lyon, Bordeaux, Lille, Genua,
Neapel, Palermo, Porto, Göteborg oder ähnlichen Städten zu unterhalten. Wenn man dies trotzdem will, so muss
man auch mehr Geld und Personal zur Verfügung stellen.
Interview mit dem Leiter des “Teaching Advice Department”, Dr. B
A: Spracharbeit hat auch etwas mit der Vermittlung des Deutschlandbildes zu tun. Wie sieht das Bild
Deutschlands in Großbritannien aus?
B: Das Image Deutschlands in Großbritannien ist dominant von der Wirtschaft geprägt. Unsere Aufgabe ist es
aber vor allem auch, gewisse Klischees, die hier über Deutschland existieren, zu bekämpfen und das Image zu
verbessern. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, in denen wir mit Deutsch vertreten sind, haben wir
es als Deutsche in Großbritannien einfach schwerer. Das ist zum Teil unsere eigene Schuld, das ist nicht zu
leugnen. Selbst bei jungen Leuten, Kindern und Jugendlichen, ist der Austausch mit Deutschland viel
problematischer, als beispielsweise der mit den USA. Wenn Sie vor diesen jungen, 17- bis 18-jährigen Leuten
136
sitzen und sagen, dass Sie Deutscher sind - selbst wenn Sie in Italien aufgewachsen wären - stoßen Sie bei ihnen
auf Ablehnung. Es ist wieder eine neue Welle des Bewusstseins dafür entstanden, welche Schuld wir früher als
Volk und Gesellschaft auf uns geladen haben. Goldhagen hin oder her, das kann man kritisch betrachten,
Tatsache ist aber, dass es die Gesellschaft, also fast alle Deutschen waren, die da mitgemacht haben. Dieses
Bewusstsein hat sich jetzt auch in der neuen Generation, die das alles nicht mehr erlebt hat, durchgesetzt. Unsere
Vergangenheit ist immer ein großes Thema. Wir haben jahrelang gesagt, dieses Thema wollen wir nicht mehr
anrühren, haben uns aber nun entschlossen, diese Themen auch im Schulbereich als Prüfungs- und
Abiturthemen zuzulassen. Das ist nicht zu vermeiden. Wir zeigen, was in Deutschland zur
Vergangenheitsbewältigung getan wird. Die Wirtschaft hat hier auch eine bedeutende Funktion, z.B. bei der
Entschädigung der Zwangsarbeiter. Es ist ein großes Anliegen der Sprachförderung, im Erwachsenen- und
Hochschulbereich genau wie im Schulbereich, ein zeitgemäßes Image von Deutschland zu vermitteln. Im
Schulbereich ist unsere Sprachförderung koordiniert und integriert in die aktuellen Entwicklungen dieses
Landes. Wir sind von den hiesigen Institutionen als "national partner" anerkannt. Das große Fortbildungsinstitut
des Ministeriums führt unsere Veranstaltungen - und uns selbst als “national partner" - in seinem
Jahresprogramm. Wir sind mit unserer Arbeit also bestens integriert.
A: Gibt es mehrere deutsche “national partners" im Sprachbereich?
B: Für Deutschland sind wir die einzige Institution im Bereich der Sprachförderung und als solche auch
anerkannt. Da brauchen wir uns also nicht hineinzudrängen, sondern werden gefragt. Gerade am Samstag war
ich wieder in einer Komiteesitzung des Fremdsprachenlehrerverbandes, in dem die Deutschlehrer über die
Hälfte der Mitglieder stellen. Wir haben diese Treffen auch für das nächste Jahr fest eingeplant. Auch mit den
Schülerzahlen können wir zufrieden sein, verglichen mit anderen Sprachen sind wir deutlich besser. Wir müssen
uns damit abfinden, dass wir nicht immer die Nummer eins sind, das sind von der Tradition und vom Image her
eben die Franzosen, das sind für die Engländer halt die engsten Nachbarn. Wenn Sie das mit Deutschland und
unseren Nachbarn vergleichen, in Baden-Württemberg ist Französisch die erste Fremdsprache, in
Norddeutschland Englisch. Darüber hinaus gibt es zwischen Deutschland und Großbritannien auch kein
Jugendwerk wie mit Frankreich.
A: Sie wollen aus dieser Not eine Tugend machen und als kleine Lösung ein “virtual youth office" im Internet
einrichten?
B: Ja, dieses erfolgt zusammen mit der Botschaft. Hier sollen sich junge Leute alle Informationen direkt holen
können. Dazu gibt es noch eine “chat corner", Musik und Videos, sowie Adressenaustausch usw. . Diese
homepage soll, zusammen mit der Botschaft, alle zwei Wochen erneuert werden.
A: Wie klappt im Bereich der Sprachförderung die Zusammenarbeit zwischen den Mittlern?
B: Hervorragend! Unsere Hauptaufgabe besteht in der Förderung von Deutsch, indem wir ein Service- und
Informationszentrum anbieten. Wir entwickeln dazu Material und stellen es Lehrern und Schülern zur
Verfügung. Die Lehrer sollen damit landeskundliche Kompetenz erwerben, methodisch, didaktisch und
sprachlich. Parallel dazu bieten wir Seminare zum sinnvollen Einsatz dieser Materialien. Außerdem haben wir
Seminare für Deutschlehrer in Deutschland im Angebot. Diese Maßnahmen zeigen unsere landeskundliche und
methodische Kompetenz, die wir weitervermitteln.
A: Haben die Materialien von Inter Nationes an der Vermittlung von landeskundlicher Kompetenz einen Anteil?
137
B: Die Materialien, die wir hier vertreiben, haben wir entweder selbst erarbeitet und konzipiert, oder sie sind im
Einzelfall von Inter Nationes. Die Materialien, die wir selbst entwickelt haben, basieren auf sogenannten “A-
level"-Themen, vergleichbar also mit deutschen Abiturthemen. Es gibt beispielsweise Dokumentationsmappen
zu deutscher Literatur und Geschichte, zu Berlin und den neuen Bundesländern, Drittes Reich etc.. Zu diesen
Themen stellen wir die neuesten Texte und Literatur zusammen und laden auch Schüler ein - ca. 1000 Schüler
im letzten Jahr aus über 50 Schulen - was deren Motivation natürlich extrem fördert. Die Materialien für unseren
Eigenbedarf können wir hier - mit Hilfe unserer Bibliothek - selbst produzieren oder sie kommen aus München.
Allerdings liefert uns auch die Zentrale nur auf Bedarf. Was von Inter Nationes kommt, ist - sofern es nicht mit
uns zusammen entwickelt wurde - entweder zu schwer, oder geht am Bedarf total vorbei.
A: Können Sie I N-Material benennen, welches Ihren Anforderungen nicht entspricht?
B: Beispielsweise deren Lehrübungen oder die Mappen über deutsche Städte sind größtenteils viel zu schwer.
Wir versuchen Inter Nationes, bereits bevor sie produzieren, zu einer Kooperation zu bewegen. Das Problem am
Inter Nationes-Material ist einfach, dass die örtlichen Bedürfnisse zu unterschiedlich sind, um auf einheitliches
Material aufzubauen.Das Inter Nationes-Deutschlandspiel war beispielsweise ein ziemlich dröges Ding. Jetzt
heißt es “Kubuk", und schon das klingt ziemlich eckig. Diese Materialien sind entweder nicht ausführlich genug,
oder schlichtweg zu langweilig. In der Sprache etwa haben sie eine viel zu dichte Information. Auch beim
Thema Deutsch als Wirtschaftssprache muss man sich fragen, was deren Materialien mit Wirtschaft zu tun
haben. Das Zeug ist sprachlich und didaktisch völlig unbrauchbar, das kann man vergessen.
A: Was ist mit dem Kinderkoffer “KiKo”?
B: Ja, der ist ganz gut, und kommt bei den Kindern an. Es gibt einige Medien und Materialen, die hervorragend
sind, wie der "KiKo", den wir auch integrieren. Sehr gut ist außerdem die Videoreihe "Turbo".
A: Diese Reihe ist gut? Ich habe mir einige Folgen angesehen und halte sie für sehr schwer verständlich.
B: Ja, schon. Es kommt immer auf die Lerner an. Wir hatten bei Lehrerfortbildungen großen Erfolg damit. Wir
bieten dazu natürlich noch viele vorbereitende Zusatzprogramme an, aber generell sticht diese Reihe aus dem
übrigen Material positiv hervor.
Interview mit der Leiterin der Bibliothek D und dem Institutsleiter W, Interviewerin A
D: Ich bin erst seit etwa einem Jahr in London und habe davor in unserem Hauptquartier gearbeitet, im
Bibliotheks- und Informationsbereich. In den 5 1/2 Jahren, die ich dort arbeitete, wurde mir die Misere der
Bibliotheksschließungen deutlich vor Augen geführt. Mir kommt bei meiner jetzigen Arbeit mein
Hintergrundwissen, z.B. über die damals von uns entwickelten Konzeptionen aus München zu Gute. Als ich hier
anfing, war ich skeptisch, wie groß das Interesse an meiner Arbeit sein würde. Mittlerweile bin ich insgesamt
positiv überrascht. Bei der Bereitstellung eines multimedialen Bestandes, der sich an den Bedürfnissen vor Ort
ausrichtet, gilt es abzustimmen, welche Bestände in Londons Bibliotheken selbst vorhanden sind, was bei
anderen deutschen Anbietern, z.B. dem Deutschen Historischen Institut vor Ort oder dem Informationszentrum
der deutschen Botschaft.
A: Ist eine Abgrenzung zu anderen Bibliotheken nötig, womit auch ein anderes Publikum erreicht würde?
D: Abgrenzung ist wichtig, d.h. wir müssen unseren Platz im Umfeld definieren. Unser eigener Bestand wird
entgegen meinen ersten Befürchtungen sehr gut genutzt, und das freut mich natürlich. Der gesamte Bestand, das
138
sind 27.000 Medieneinheiten, wird einmal im Jahr umgeschlagen, das ist für ein Goethe-Institut ein guter
Schnitt. Das Interesse an deutscher Literatur ist also generell groß. Unsere Ausleiher haben von vorne herein ein
ganz bestimmtes Interesse. Es kommen sehr viele Schüler, aber z.B. auch Schriftsteller, Übersetzer, Journalisten
zu uns. Schwerpunkte sind neben der Literatur vor allem die Sozialwissenschaften, Film- und Theaterliteratur
und natürlich sämtliche Materialien für den Deutschunterricht. Besonders die Literatur zum Deutschunterricht ist
momentan sehr stark gefragt, dort gab es enorme Zuwachsraten von bis zu 200%. Das hat auch damit zu tun,
dass es hier im Lande sonst keine vergleichbare Einrichtung gibt. Die Stellen, die in Frage kämen, schaffen
nichts mehr in dieser Richtung an, da Französisch mit einem Anteil von 80% aller Fremdsprachen-Lernenden
klar vor dem Deutschen dominiert. Deshalb wird auch auf breiter Basis in den examination-boards auf uns
verwiesen, was unseren Boom erklärt. Wir versuchen dieser Aufgabe, so gut es geht, gerecht zu werden, obwohl
wir natürlich auch noch andere Zielgruppen haben. Wir wären also froh, wenn uns in diesem Bereich irgendeine
Institution entlasten könnte. Dies sehe ich jedoch im Moment nicht, denn wenn wir andere, z.B.
Schulbibliotheken, ansprechen, wird uns immer wieder gesagt, dass außer den entsprechenden Mitteln auch die
Kompetenz fehle.
A: Gibt es eine Möglichkeit, sich aktuell über Deutschland-relevante Themen zu informieren?
D: Mit Unterstützung der Sprachabteilung entwickeln wir Schülermappen, das sind 70 Dokumentationsmappen
jeweils zu aktuellen Abiturthemen. Diese Dokumentation pflegen wir in der Bibliothek und sie wird unglaublich
stark genutzt, von Schülern genauso wie von anderen externen Stellen. Hierfür müssen wir jetzt sogar noch
zusätzlich studentische Hilfskräfte oder Praktikanten einsetzen, damit wir wenigstens von den technischen
Arbeiten etwas entlastet sind.
A: Kann man durch diese Informationsarbeit das Deutschlandbild facettenreicher machen oder korrigieren?
D: Ich vergleiche immer das Wissen, was in Dänemark - wo ich vorher beim Goethe-Institut gearbeitet habe -
vorhanden ist, mit dem hier unter Schülern feststellbaren Wissen. Ich bin sehr erstaunt über das vergleichbar
geringe Wissen und Interesse der Londoner Jugend. Da kommen beispielsweise Schüler zu mir, die etwas über
die Todesstrafe in Deutschland wissen wollen. Man kann das Themenspektrum zu dem man gefragt wird, kaum
eingrenzen. Hier haben wir, wie ich glaube, eine entscheidende Funktion: Zum einen können wir das
Deutschlandbild korrigieren, und zum anderen können wir einen positiven Eindruck von Deutschland
vermitteln. Wir wollen, dass die Menschen sich bei uns - speziell in der Bibliothek als Kommunikationsplatz -
wohl fühlen. Man kommt leicht ins Gespräch und entwickelt lebhafte Diskussionen. Diese Sympathiewerbung
darf man nicht unterschätzen.
A: Gibt es weitere Infmations- und Dialogmöglichkeiten?
D: Das zweite Feld neben der Ausleihe ist die Informationsarbeit, die sehr spezialisiert ist. Hier gehören die
größten Bibliotheken des Landes zu unseren Partnern, unsere Bibliothek hat sich gut ins Land integriert.
Beispielsweise haben wir für die Zeitschrift "Die Welt" Material für einen Artikel über die Situation von Frauen
in England bei den hiesigen Bibliotheken gesucht. Im Gegenzug haben wir hier entsprechendes Material zur
Situation der Frauen in Deutschland zusammengestellt. Wir verfügen also über ausgezeichnete Kontakte,
besonders in dem Fall, dass wir über bestimmte Informationen nicht selbst verfügen. Genauso verweisen wir
auch britische Institutionen nach Deutschland weiter, wenn wir nicht direkt helfen können. Unser anerkanntes
139
Know-How, unser Informationsservice wird von allen deutschsprachigen Institutionen in Großbritannien
genutzt, so z.B. von der deutschen Handelskammer, den Botschaften oder dem österreichischen Kulturinstitut.
W: Hier komme ich auf das zurück, was ich bereits vorhin zum Informationszentrum der Botschaft gesagt habe:
Zieht man die Informationsarbeit der Handelskammer zu Wirtschaftsfragen, die soziokulturellen Informationen
des Goethe-Instituts und die Informationen, die von jedem normalen Sachbearbeiter der Botschaft vermittelt
werden können ab, so bleiben nicht mehr viele Aufgaben für dieses Informationszentrum übrig. Man sollte es
schließen!
D: Natürlich halten die Verantwortlichen im Informationszentrum Vorträge zu bestimmten deutschen Themen,
sie empfangen Schulklassen und Politiker. Auf Anfragen zur Regierungspolitik wollen wir selbstverständlich
nicht antworten, trotzdem legitimiert diese Aufgabe nicht diese “aufgeblasene" Einrichtung. Der derzeitige
Leiter dieses Informationszentrums ist allerdings sehr einsichtig und weiß, dass wir nur durch gute
Zusammenarbeit, d.h. durch Arbeitsteilung weiterkommen.
W: Der vorige Leiter wollte uns verbieten, uns als Bibliothek- und Informationszentrum zu bezeichnen, da
dieser Titel seiner Institution zustehe. Wir können aber auf das Element "Information" in der
Aufgabenbeschreibung unserer Bibliothek nicht verzichten. Es gab eine Auseinandersetzung, in die ich auch
unsere Zentrale eingeschaltet habe. Wir heißen danach weiter Bibliothek und Informationszentrum. Unterm
Strich muss man allerdings einfach sagen, dass dort unwahrscheinlich viel Geld falsch investiert wird.
D: Die Botschaft bietet z.B. einen Internet-Katalog mit deutschsprachigen Filmen an, die von dpa und Inter
Nationes vertrieben werden. Für diesen Katalog zahlte das Auswärtige Amt 8.000 DM. Einen vergleichbaren
Katalog aus unserem Hause erstellten wir für ungefähr 120£! Es fließt da sehr viel Geld, aber man muss sich
nach dem Nutzen dieser Maßnahmen fragen.
W: Die Botschaft baut über dieses Informationszentrum eine Art eigener Mittlerorganisation auf. Da der dortige
Kulturreferent z.B. auch Themenveranstaltungen zu deutscher Literatur organisiert, ist hierin eine klare
Kompetenzüberschreitung zu unseren Ungunsten zu sehen.
Wenn I N sein Material wenigstens noch selbst an die Schulen verschicken würde, wäre das noch eher
verständlich. Aber die Botschaft zwischenzuschalten, halte ich für unsinnig.
A: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen deutschsprachigen Institutionen?
D: Was immer unterschätzt wird, ist die Tatsache, dass wir eine beträchtliche Infrastrukturleistung für die
anderen deutschsprachigen Institutionen - Österreicher und Schweizer - bieten. Da diese Länder keine eigenen
Bibliotheken haben, kommen sie natürlich auf unser Angebot zurück. Ich habe bestimmt jeden zweiten Tag eine
österreichische Anfrage zu bearbeiten.
W: Wenn z.B. jemand beim Informationszentrum der Botschaft anruft und den englischen Text der deutschen
Nationalhymne haben will, muss sich die Botschaft auch wieder an uns wenden. Das ist doch widersinnig!
A: Wie sieht Ihre Kenntnis des englischen Buchmarktes aus?
D: Das einzigartige an uns ist unsere genaue Beobachtung des englischen Buchmarktes. Wir bekommen
sämtliches Material, Verlagskataloge, Textproben usw. .Wir wissen genau, was neu erscheint, insbesondere über
Deutschland oder aus dem Deutschen übersetzt. Ein Drittel unseres Bestandes ist in englischer Sprache.
A: Wieso ist ein Drittel Ihrer Medien in englischer Sprache verfasst?
140
D: Weil sehr oft die Informationen gebraucht werden, und wir nicht immer davon ausgehen können, dass der
Betreffende Deutsch spricht. Wenn wir diesen englischen Bestand nicht hätten, müssten wir oft selbst etwas
zusammenschreiben, wenn wir die Interessenten nicht verprellen wollen. Obendrein ist natürlich auch der
Aspekt interessant, dass wir aus der englischen Literatur über Deutschland direkt mitbekommen, wie die Briten
Deutschland sehen. Es ist traurig, dass es sich für eine einzelne Bibliothek in England nicht lohnt, neue deutsche
Literatur oder übersetzte deutsche Titel in ihr Programm aufzunehmen.
W: Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen vorher sagte, ich glaube dass das Goethe-Institut im Bibliotheks-
und Informationsbereich im Jahre 2010 noch eine bedeutende Rolle hier spielen kann und wird.
A: Partnerarbeit ist eine Maxime des Goethe-Instituts. Wie wird diese in Ihrem Bereich verwirklicht?
D: Ein weiteres Arbeitsfeld, das in den letzten Jahren erst hinzugekommen ist - und gleichzeitig ein
Grundprinzip der Goethe-Institute verkörpert - ist die Partnerarbeit. Wir arbeiten heute verstärkt mit anderen
Bibliotheken, mit Übersetzern, mit Verlegern und Buchhändlern. Diese Entwicklung ging von Osteuropa aus.
Dort hat man frühzeitig festgestellt, dass mit dem wenigen zur Verfügung stehenden Personal keine effiziente
deutschsprachige Bibliothek dauerhaft zu erhalten ist. Man wollte die Infrastruktur dort statt-dessen durch
verstärkte Zusammenarbeit mit ortsansässigen Bibliotheken verbessern. Dabei wurde viel erreicht. Wir setzen
heute einen Schwerpunkt unserer Arbeit in die Verbesserung der Zusammenarbeit mit hiesigen Institutionen.
Ein Beispiel, das schon genannt wurde, sind die “new books in german"-Broschüren, die ja in Kooperation mit
einer britischen Initiative erarbeitet und verbreitet werden. Der wichtigste Punkt an diesem Projekt ist, dass die
britische Seite die Titel auswählt. Die Initiative zu dem Projekt kam übrigens ebenfalls von britischer Seite und
wurde von uns aufgegriffen und unterstützt. Deutsche Verleger schicken ihre Publikationen hierher an die
Bibliothek des Goethe-Instituts, und hier entscheidet dann ein Gremium aus britischen Experten - Verleger,
Schriftsteller und Übersetzer - welche Titel in die Broschüre aufgenommen werden. Dabei kommt es auf
österreichischer und schweizer Seite leicht zu Irritationen, weil man dort meint, unterrepräsentiert zu sein und
gern selbst über die Buchauswahl mitreden möchte.
A: Aus welchem Angebot wählt die britische Seite die entsprechenden Titel für die “new books in german" aus?
D: Es gibt ein Herausgeber-Komitee, das aus den eingeschickten Büchern deutschsprachiger Verlage eine
Vorauswahl trifft. Hierbei entscheidet vor allem auch die Aktualität, denn die Auswahl soll einen
repräsentativen Querschnitt des jeweils neuesten Buchmarktes in den deutschsprachigen Ländern
wiederspiegeln, sowohl im Herbst, wie im Frühjahr. Hierfür schicken die Verleger sogar teilweise ihre
Manuskripte.
Nach dieser Vorauswahl treffen sich die Briten mehrmals, um aus den ca 100 vorgeschlagenen Titeln in einem
ersten Schritt 60 näher zu beurteilen. Hierzu werden Gutachten erstellt, die in einem zweiten Treffen vorgestellt
und diskutiert werden. Danach wird entschieden, welche Bücher in die "new books in german"-Broschüre
aufgenommen werden. Die Testleser wechseln übrigens auch regelmäßig. Dieses Engagement ist durchwegs
positiv zu sehen. Bei der Finanzierung ist das Hauptproblem, dass die Mittel von deutscher Seite [zur
Finanzierung s. Gespräch mit Herrn W] vom Auswärtigen Amt kommen, und in erster Linie der Botschaft
zugeteilt werden, obwohl wir im Goethe-Institut die inhaltliche Arbeit machen.
141
W: Die Botschaft ist nicht durch Kenner der deutschen oder britischen Literatur- und Verlagsszene vertreten.
Solche Fachleute gibt es dort nicht. Es wäre sinnvoll, wenn wir dieses Projekt - auch finanziell - alleine betreuen
könnten.
A: Gibt es im Bereich Literatur- und Übersetzungsförderung auch Ausstellungen?
D: Zu dieser Partnerarbeit - sie nennt sich jetzt auch Bibliothekarische Verbindungsarbeit - gehört z.B. auch eine
Ausstellung, die wir hier gehabt haben. Die ist in unserer Bibliothek in Brüssel entstanden, und wir haben die
englische Version ausgestellt. Darin ging es um deutsche Literatur nach 1945. Wir überlegen, eine
Folgeausstellung zu organisieren, die besonders die Literatur nach der deutschen Vereinigung wiederspiegeln
soll. Diese Wanderausstellung wurde bereits in England sehr positiv aufgenommen. In ihr werden Bücher und
Profile der verschiedenen Autoren nach 89 vorgestellt. Im Herbst kommt die Ausstellung nach London, und
dann wollen wir sie zeigen.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt also in der Literaturförderung und der Übersetzungsförderung deutscher
Literatur.
W: Es ist übrigens, wie ich finde, interessant, dass ich für die Vortragsserie "1949 - 1999", von der ich Ihnen
vorhin erzählt habe, keinen einzigen großen Namen aus der deutschen Kunst- und Literaturszene gewinnen
konnte. Ich erhielt nur Absagen, keiner war bereit, über seine 50 Jahre Deutschlanderfahrung in London einen
Vortrag zu halten.
A: Woher kommt das Ihrer Ansicht nach?
W: Ich denke, das direkte politische Reden fällt den Autoren heute schwerer als früher. Vielleicht ist ein
Auftreten beim Goethe-Institut mit dessen Honorarsätzen auch nicht mehr so interessant für bekannte Autoren.
A: Zu Dialog und Partnerschaft gehört auch, dass man das Land der "anderen" kennt. Gibt es dazu Initiativen?
D: Es gibt natürlich verschiedenste Gruppen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ein von der Initiative her
vorbildliches Projekt war die Reise zweier deutscher Bibliothekare durch britische Bibliotheken. Nachdem sie so
begeistert von ihren Erlebnissen waren, wollten sie die Reise erwidern und den Briten ihre Bibliotheken zeigen.
Es besteht auch ein großes Interesse an Bibliotheksbauten und Einbindung der neuen Medien, z.B. mit den
neuen Nationalbibliotheken in Frankfurt und London. Mit dem Anliegen des gegenseitigen Kennenlernens sind
beide Seiten an das Goethe-Institut und das British Council herangetreten, und zusammen haben wir es
tatsächlich geschafft, diese Besuche zu organisieren. Finanziell wurden wir dabei vom Kultusministerium in
Halle, der Generaldirektion der staatlichen Bayerischen Bibliotheken und der Bibliothekarischen Auslandsstelle
des Deutschen Bibliotheksinstitutes unterstützt. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte wiederum in London. Wir
organisierten die Ausschreibung und trafen die Auswahl. Die Gruppe bestand aus 10 britischen Bibliothekaren
und einem Architekten. Es wurden besonders Bibliotheks-Neubauten besichtigt. Die Fahrt führte die Teilnehmer
nach München, Göttingen, Frankfurt und Halle.
W: Solche Begegnungsreisen müsste man in allen Bereichen fördern.
D: Diese Fahrt war ein unglaublicher Erfolg, es gab im Nachhinein sehr viel positives Feedback. Die Kontakte
zu den Teilnehmern bestehen noch heute. Die Teilnehmer werden in einer Arbeitsgruppe für geplante
Bibliotheken in den neuen Bundesländern Empfehlungen ausarbeiten. Besonders der Architekt zeigte sich
interessiert an den neuen Bauvorhaben, die erfreulicherweise recht unbürokratisch verwirklicht werden.
Erfreulich war auch, dass die Verantwortlichen in Ostdeutschland nicht immer nur die Westdeutschen als
142
Vorbilder anerkannten, sondern auch den Blick über die Grenzen gewagt haben. Als eine Konsequenz dieser
positiv verlaufenen Reise will der britische Bibliotheksverband jetzt das British Council, das französische
Kulturinstitut und das Goethe-Institut zusammenbringen, um die Frage zu diskutieren, was jeweils unter
Bibliotheks- und Informationsarbeit im Rahmen auswärtiger Kulturpolitik verstanden wird.
A: Das heißt, der direkte menschliche Austausch ist ein wesentliches Element Auswärtiger Kulturpolitik?
D: Ja! Es entwickelt sich im Moment eine sehr ungute Diskussion darüber, was Auswärtige Kulturarbeit kosten
solle, z.B. wird Personaleinsatz nur unter Gesichtspunkten der Kosten gesehen. Personalkosten werden kritisch
gesehen, indem man unterstellt, es handele sich um zu hohe Verwaltungskosten. Dabei machen die Menschen
Kulturarbeit erst möglich. Die Art, wie Menschen auftreten und Dienstleistungen erbringen, hat bereits eine
kulturpolitische Wirkung.
W: Die Mitarbeiter in der Bibliothek, die jeden Tag Freundlichkeit und gute Laune verbreiten und Sachkunde
ausstrahlen, "leben" Kulturpolitik. Bevor überhaupt die erste objektive Information weitergegeben worden ist,
fand dabei schon die erste auswärtige Kulturpolitik statt! Das gilt für uns alle. Es stimmt einfach nicht, dass wir
hier nur uns selbst verwalten.
A: London ist ein Regionalinstitut. Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
D: Wir haben hier erst kürzlich ein Konzept eingeführt, mit dem die Kollegen in Frankreich schon ein ganzes
Stück weiter sind. Um Kosten einzusparen, ist die Zusammenarbeit mit anderen Goethe-Instituten verstärkt
worden, d.h. Informationen werden ausgetauscht und verbunden. Dazu sind die Institute in der Region
mittlerweile sehr gut technisch ausgerüstet. Wir können uns über E-mail verständigen und Anfragen zu anderen
Bibliotheken direkt weiterleiten. Bücher und Materialien werden untereinander ausgetauscht. Das gleiche gilt für
unsere eigenen Bibliotheken in den Goethe-Instituten in Manchester, Glasgow und York. Hierbei haben wir
einen Informationsfluss geschaffen, der beispielhaft ist und den einzelnen Mitgliedern eine Spezialisierung auf
bestimmte Gebiete erlaubt. Dabei haben alle Bibliotheken natürlich einen ähnlichen Grundbestand, aber jede hat
ihren eigenen Schwerpunkt, wir z.B. im Bereich Film. Diese Arbeitsteilung leuchtet auch dem
Bundesrechnungshof ein, denn durch diese städteübergreifende Kooperation werden drastisch Kosten gespart.
Allerdings ist in diesem Fall auch eine spezielle Schulung des Personals, abhängig vom jeweiligen
Bibliotheksschwerpunkt, erforderlich.
A: Hier betonte Herr W, dass Kompetenz mit Weiterbildung und Kosten zusammenhängt.
W: Da komme ich noch einmal auf die Kompetenzfrage zurück. Wir sind letztendlich alle zu wenig aus- und
fortgebildet. Unsere Filmsachbearbeiterin, die sich wirklich hervorragend in ihrem Gebiet auskennt, ist dabei
eher die Ausnahme. Sie besitzt eigentlich Kuratoren-Qualität und ist sogar, da die Zentrale dies nicht bezahlte,
auf Kosten des Instituts London zur Berlinale geflogen. Sie hat ihre erstklassigen Kontakte zu allen bekannten
deutschen Filmemachern erhalten können. Durch ihre Reise wurde aber die Reisekasse von London, z.B. zu
Lasten meiner Reisemöglichkeiten als Regionalbeauftragtem, gemindert.
D: Die Regelung zur Wiederverwendung von Einnahmen ist momentan eines der meist diskutierten Probleme,
nicht nur in unserem Hause. Uns wird immer erzählt, wir müssten ein stärkeres Kostenbewusstsein entwickeln.
Das führt uns - übrigens auch die Österreicher und Schweizer - zu der Frage, ob wir nicht Gebühren für Leser
erheben, wobei wir natürlich Kursteilnehmer und andere Bibliothekare ausnehmen würden. Ich denke, das wäre
einfacher. Dadurch würden wir unsere finanzielle Situation drastisch verbessern. Wir müssten in diesem Falle
143
zwar damit rechnen, dass ein Teil unserer Leser ausbleiben würde, würden aber ca. 60 bis 80.000 DM pro Jahr
einnehmen. Wir kämpfen deshalb mit unserer eigenen Zentrale um die Erlaubnis, dieses Geld dann behalten und
wiederverwenden zu dürfen, bisher vergeblich. Wir wollen die Gebühren freilich nur einführen, wenn wir die
Einnahmen auch wieder investieren dürfen, z.B. für ein angemessenes Kopiergerät in der Bibliothek.
W: Die Leser, die die Gebühren bezahlen, müssten dann auch das Gefühl haben, sie bekommen zusätzliche
Dienstleistungen.
D: Unsere Leser schätzen unseren Service sehr, ich glaube nicht, dass wir mit einer Gebührenerhebung ein
großes Akzeptanzproblem hätten. “Je mehr man umsonst macht, desto weniger ist es wert", dieses Dilemma ist
besonders hier in London stark ausgeprägt. Wir erwarten deshalb von der Zentralverwaltung ein positives
Signal, uns unser Geld zu belassen.
A: Wie viel Personal arbeitet in der Bibliothek?
D: Damit Sie die Zahlen noch einmal haben, Wir sitzen zu fünft in der Bibliothek. Rom und Paris haben mehr
Personal. Wir liegen ungefähr im Durchschnitt, für ein Weltstadtinstitut ist es aber etwas weniger als üblich. Die
Projekte, die wir in London betreuen, sind nicht mit denen irgendeines anderen Regionalinstituts zu vergleichen.
Deshalb sind diese fünf Stellen auch voll gerechtfertigt. Ich selbst war aufgrund der beschriebenen
Aufgabenvielfalt seit meinem Dienstantritt zu 50% der Zeit nicht in der Bibliothek anwesend! Hier sind also
eher noch mehr Mitarbeiter wünschenswert! Es bringt nichts, das Bibliothekspersonal in allen Goethe-Instituten
z.B. auf drei Mitarbeiter zu begrenzen.
Interview mit der Leiterin der Sprachabteilung C, Leiter der Verwaltung K, Interviewerin A
A: Sie teilen sich mit Ihrem Kollegen Herrn Bauer die Spracharbeit?
C: Ja, er betreut den Primar- und Sekundarbereich und ich den Erwachsenenbereich hier im Hause mit
Sprachkursen. Die Tätigkeiten im Grundstufenbereich teilen wir uns mit anderen Anbietern, die es vor Ort gibt.
Ab dem Fortgeschrittenen-Niveau jedoch gibt es kein entsprechendes Angebot, das ähnlich qualifizierende
Kurse anbietet wie das Goethe-Institut. Hier stehen wir außer Konkurrenz da, d.h. für eine bestimmte Klientel
stehen wir als einzige Institution in London offen. Wir bemühen uns, mit Partnerinstitutionen
zusammenzuarbeiten um ähnliche Kurse auch dort anzubieten, aber im großen und ganzen muss man nach wie
vor feststellen, dass derartige Interessenten sich bevorzugt bei uns wiederfinden. Das gilt bis hoch auf ein
Niveau, das dem kleinen oder großen deutschen Sprachdiplom entspricht, d.h. fast muttersprachliches Niveau.
Wenige akademisch ausgerichteten Kurse finden sich dann in den Germanistikstudien oder “german studies” an
den Universitäten wieder.
Der andere Bereich für den ich zuständig bin, ist der Erwachsenenbereich außerhalb des Institutes. Das ist zum
einen die sogenannte “adult education”, die in etwa unserem Volkshochschulsystem entspricht, zum anderen die
sogenannte “further education”, die bei einem Alter von 16 Jahren beginnt, und schließlich die “higher
education”, die unserem universitären Betrieb entspricht. Meine besondere Aufgabe ist die Betreuung dieses
nachschulischen Bereichs, im Zusammenhang mit den “german studies”, die in Zusammenarbeit mit dem
DAAD und in Absprache mit Partnern auf der britischen Seite durchgeführt werden.
A: Dann haben Sie sicher auch an der Länderkonzeption für Deutsch als Fremdsprache in Großbritannien
mitgearbeitet?
144
C: Das ist richtig. Ein interessanter Punkt innerhalb der Länderkonzeption ist das Kapitel über die
Zusammensetzung der Klientel in unseren Kursen. Diese Zusammensetzung unterscheidet sich erheblich von
anderen Instituten wie z.B. Paris. Unsere Klientel ist ganz international, so wie die Stadt. Es spielt keine Rolle
ob Lateinamerikaner, Israelis, Spanier oder Skandinavier, die Zusammensetzung ist wahrhaft multikulturell. Das
macht die Kurse so lebendig und natürlich auch anregend. Manche dieser Leute möchten sich beruflich
weiterqualifizieren in Deutschland. Im Erwachsenenbereich wird Deutsch vor allem in der Altersgruppe um 40
gelernt, Französisch und Spanisch eher von einer Altersgruppe um 50 und aufwärts. Deutsch gilt als berufliche
Zusatzqualifikation, da Französisch als einzige Fremdsprache selbst in England nicht mehr ausreicht.
A: Das ist ein Manko des hiesigen Erziehungssystems. Heute sind die Einschreibungen in Ihrem Haus. Wie
sehen die Zahlen aus?
C: Wir haben bis jetzt über die Sommerpause 262 Wiedereinschreibungen, das sind Kursteilnehmer, die im
vorigen Jahr oder Semester bei uns gelernt haben. Die Neueinschreibungen beginnen erst ab heute. Mit 262
Anmeldungen haben wir bereits ein Viertel aller Einschreibungen vollzogen, und wir hoffen auf die weiteren
drei Viertel im Laufe dieser und der kommenden Wochen.
K (Leiter der Verwaltung): Vielleicht sollte man noch etwas zu den Zahlen sagen, die sich dahinter verbergen.
Die Leute, die sich im Laufe des Jahres einschreiben, erbringen uns 1,2 Millionen DM, d.h. diese Sprachkurse
tragen sich finanziell, wir erwirtschaften damit Gewinne.
C: Damit werden die Lehrergehälter und die Sekretariatskosten gedeckt, und es bleibt immer noch ein Gewinn,
was doch sehr beachtlich ist für ein Goethe-Institut im weltweiten Vergleich.
W: Das gilt wohlgemerkt nur für London, nicht für die anderen Institute, besonders in Westeuropa.
A: Wie kommt es zu einem solchen Unterschied auf der Einnahmenseite der Institute und zu Ihrem Plus?
K: Gute Kalkulation, angemessene Kursgebührengestaltung, obwohl die Lehrergehälter auch nicht gerade
niedrig sind.
C: Die Gehälter sind nicht so hoch, wie an anderen Orten. Aber es spielen mehrere Parameter eine Rolle, z.B.
haben wir eine sehr geringe Ausfallquote unter den Lehrern. Um die 1,2 Millionen DM verkürzt sich aber
gleichzeitig unser Zuschuss aus dem Kulturhaushalt des Bundes - das ist durchaus eine hohe Summe.
K: Obwohl unsere Werbungskosten nebenbei bemerkt auch sehr hoch sind, reicht uns die zur Verfügung
stehende Summe aus.
A: Wo werben Sie für die Sprachkurse?
K: In Zeitungen hauptsächlich, und das ist teuer, besonders in London.
C: Wobei diese Anzeigen gleichzeitig noch eine sprachpolitische Funktion haben, besonders wenn wir mit den
anderen Kulturinstituten zusammen werben. Damit können wir nämlich den Akzent darauf setzen, dass
Sprachen zu lernen generell eine wichtige Sache ist - in Europa und dem Rest der Welt. Damit können wir quasi
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
K: Das ist eine geniale Sache. Konzentrierte Werbeaktionen finden zusammen mit französischen und
spanischen, sowie mit anderen europäischen Kulturinstituten statt. Da haben wir auch sehr gute Slogans.
A: Wie sieht denn Ihr täglicher Arbeitsablauf aus?
C: Geregelte Arbeitsabläufe im klassischen Sinne existieren bei uns fast nicht. Jeder Tag ist praktisch anders. Es
gibt natürlich Rhythmen, z.B. im Zwei-Semester-Rhythmus Prüfungspläne, Prüfungsabnahme, Sommerkurse,
145
Lehrerkonferenzen und Fortbildungen, Außentermine mit Partnerinstituten und Universitäten. Nach einem Jahr
kann ich heute sagen, dass der nachschulische Bereich in England immer mehr an Bedeutung gewinnt, d.h. der
Fremdsprachenunterricht setzt hier zu spät und quantitativ zu gering ein, so dass die wirklichen sprachlich
Bedürftigen letztendlich bei uns landen. Das wäre noch ausbaufähig.
A: Wie viele Teilnehmer haben die Kurse?
C: Im Schnitt haben die Kurse 16 Teilnehmer. Davon sind die Anfängerklassen meist etwas stärker belegt als die
stark spezialisierten Kurse.
A: Und welche Lehrwerke verwenden Sie?
C: Die, die auf dem neuesten methodischen Stand sind. In der Mittelstufe nehmen wir jetzt einen Wechsel vor,
wir haben in Großbritannien/Irland ein Mittelstufen-Curriculum entwickelt. Parallel dazu haben die Verlage
neue Lehrwerke entwickelt. Auch die abschließende zentrale Mittelstufenprüfung basiert darauf. Diese
Lehrwerke werden heuer eingeführt.
A: Was sind das für Lehrwerke?
C: Im Jahr 4 ist es der "Brückenkurs" im Hueber Verlag, die Nachfolge davon ist das Lehrbuch "M" im Jahr 5,
und im Jahr 6 das Werk "Unterwegs". Diese drei neuen Lehrwerke werden im kommenden Pilotjahr von uns
getestet, bevor wir uns endgültig für ein Werk entscheiden, welches am besten mit unserem eigenen Curriculum
harmoniert. In der Grundstufe werden wir den Wechsel spätestens ein Jahr darauf vornehmen, der ist überfällig.
A: Bieten Sie über die Parlamentskurse hinaus auch für andere Berufsbereiche Kurse an?
C: Neben dem bereits von Herrn W erwähnten Parlamentarierkurs bieten wir im Bereich der Firmenkurse
besonders "City-" und "Anwaltskurse" an. Diese betreffen alles, was mit dem Bereich der Wirtschaft bzw. mit
juristischem Wirtschaftsdeutsch zu tun hat. Diese Kurse expandieren. Im letzten Jahr fanden ungefähr 800
Stunden in solchen Kursen statt. Meist werden sie als Individualkurse durchgeführt, manchmal auch als
Firmenkurse im kleineren Kreis von 4 bis 5 Teilnehmern. Für diese Geschäftsleute können schon ein paar
Brocken “Alltagsdeutsch" in Verhandlungen mit ihren deutschen Partnern wichtig sein, selbst wenn die
Verhandlungssprache Englisch ist. Rezeptives Verstehen, wenn auch nur im small talk, kann im Geschäftsleben
oft entscheidend sein. Oft wird von den Teilnehmern auch der Wunsch geäußert, Wirtschaftsmeldungen in den
Zeitungen zu verstehen, wenigstens das eine oder andere wichtige Wort.
Ich möchte in diesem Zusammenhang zwar keine Prognose wagen, aber ich stelle schon fest, dass selbst hier in
England, dem Land der lingua franca, die Bereitschaft zum Umdenken, d.h. zum Erlernen einer anderen Sprache
wächst. Dies mag mit der europäischen Einigung zu tun haben und man merkt, dass man in Englisch zwar
kaufen, aber nicht verkaufen kann. Auf Initiative von Tony Blair untersucht die Nuffield Foundation gerade in
einer groß angelegten Studie, warum es in Großbritannien so schlecht um das Erlernen von Fremdsprachen
bestellt ist und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Egal, was dabei heraus kommt, so zeigt sich hierin
doch ein Bewusstseinswandel, denn so etwas hat es früher nie gegeben. Dies ist ein Schritt nach vorn.
A: Ist Spracharbeit Kulturvermittlung oder Wirtschaftsförderung?
W: Die Start-Debatte von Herrn Naumann fordert, dass Deutsch vor allem als Kultursprache, und nicht als reine
Wirtschaftssprache gefördert wird. Aus unserer Erfahrung müssen wir allerdings klar feststellen, dass die
Motivation unserer Teilnehmer wenig kulturrelevant ist.
146
C: So pauschal würde ich das nicht sehen. Sicher ist die wirtschaftliche Motivation bei einem gewissen Kreis
von Teilnehmern evident, der in kürzester Zeit ein bestimmtes Ziel erreichen will. Es gibt aber auch andere, die
Deutsch sehr wohl aus kulturellem Interesse lernen. Diese Menschen, ob sie Kunsthistoriker, Musiker oder
Journalisten sind, bringen jedenfalls ein kulturelles Hintergrundwissen mit, auch wenn sie Geschäftsleute sind.
W: Auch im Selbstverständnis der Lehrer ist die Betonung auf das Wirtschaftsdeutsch gerichtet. Hier stecken
die einzigen echten Wachstumspotentiale. Oft ist dies jedoch nur der Aufhänger: Wenn die Teilnehmer erst
einmal Kontakt mit uns haben, interessieren sie sich auch für andere Aspekte, z.B. für kulturelle. Im Gegensatz
etwa zu Italien, wo Deutsch hauptsächlich aus kulturellen Aspekten gelernt wird, liegt hier die Betonung klar
auf der pragmatischen Verbesserung der Geschäftsmöglichkeiten.
C: Durch meine Besuche in allen Klassen vergangenes Jahr würde ich die These vertreten, dass eine gesunde
Mischung aus wirtschaftlich orientierten Pragmatikern und allgemein Kulturinteressierten in den Kursen besteht.
W: Herr Naumann griff ja die Argumentation von Herrn Sartorius auf, wonach der Hauptgrund für
Deutschförderung ein kultureller sein sollte. Die frühen Äußerungen Satorius' stießen bei den Lehrern auf breite
Kritik. Sie warfen ihm vor, an der Realität vorbei zu argumentieren.
C: Außerdem bezogen sich die Äußerungen von Sartorius auf ein Buch, das im Jahre 1978 erschienen ist. Das
zeigt, wie fern Sartorius vom heute praktizierten Deutschunterricht steht.
Interview mit der Leiterin der Programmabteilung, Dr. H
H: Ich bin Programmreferentin des Instituts London. Ich bin Stellvertreterin von Herrn W im Bereich der
Programmarbeit und speziell zuständig für die Bereiche Theater, Literatur, Musik und Ausstellungen. Im
Bereich Ausstellungen betreue ich auch regionale Projekte. U.a. organisiere ich verschiedene Ausstellungen mit,
die wir oft auch noch anderen Institutionen zur Verfügung stellen. Es werden auch viele Anfragen an uns
herangetragen, ob wir nicht innerhalb Großbritanniens interessante, kleinere Ausstellungen vermitteln können.
A: Was die Ausstellungen betrifft, arbeiten Sie hier mit dem ifa zusammen?
H: Die ifa-Ausstellungen sind in der Regel sehr schön gemacht, auch mit sehr schönen Katalogen, das Problem
dabei ist nur, sie sind viel zu groß. Das haben wir den Verantwortlichen dort auch schon gesagt, auch mein
Kollege in der Zentralverwaltung, Herr P, sprach dieses Problem bereits an. Ein aktuelles Beispiel dazu ist die
vor kurzem vom ifa organisierte Ausstellung über Kunst, Landschaft und Gartenbau in Wörlitz im Zeitalter der
Aufklärung. Wir wurden dann sehr kurzfristig gebeten, hier in England einen Ausstellungsplatz zu finden.
Gerade heute morgen führte ich ein Telefonat mit einem Interessenten, der zwar keine idealen, aber immerhin
kleine Räume zur Verfügung stellen könnte, relativ kurzfristig für nächstes Jahr im Sommer. Museen wie z.B.
das Kenwood House planen 4 bis 5 Jahre im Voraus, da können wir nicht erst ein Jahr vorher kommen. Die
Wörlitzer Park-Ausstellung benötigt darüber hinaus eine Fläche von über 300 Quadratmeter und das ist für die
meisten kleineren Museen schlichtweg zu groß. Wenn das ifa dagegen kleine, gute "Kabinettausstellungen"
produzieren würde, die flexibel einsetzbar wären, d.h. z.B. kompatibel wären mit hiesigen Dauerausstellungen,
dann würde das unsere Arbeit sicher erleichtern. Die Ausstellungen sind qualitativ sehr hochwertig, aber leider
viel zu groß.
147
W: Die deutschen Aussteller produzieren gelegentlich einfach am Bedarf vorbei, wir werden nicht gefragt. Die
Konzentration von Ausstellungszuständigkeiten im Goethe-Institut wäre daher sehr wünschenswert, d.h. nur
eine Institution mit Kenntnis des lokalen Bedarfs und mit unmittelbaren lokalen Kontakten wäre zuständig.
H: Grundsätzlich sind die Ausstellungen, die das ifa produziert schon hilfreich für uns, sie müssten aber wie
gesagt vor allen Dingen kleiner sein. Außerdem müssten wir erheblich mehr Kataloge und ähnliches Material
haben, das wir an die potentiellen Partner weiterreichen könnten. Ich glaube nicht, dass das ifa grundsätzlich am
Bedarf vorbei produziert, deren aufgegriffene Themen sind interessant und die Qualität ist hoch. Das
Hauptproblem ist die Größe, und wenn sich das ifa dazu durchringen könnte, kleinere Ausstellungen zu
produzieren, die auch in den Goethe-Instituten gezeigt werden könnten, wäre schon viel gewonnen. Außerdem
gibt es viele Ausstellungen von denen das ifa gar nicht will, dass sie im Museum gezeigt werden, weil sie diese
nicht für tauglich genug halten. Im Sommer hatten wir z.B. eine ifa-Ausstellung über Fotokunst, die
hervorragend in unsere Räumlichkeiten passte. Es gibt also seitens des ifa Angebote, die wir sehr gut verwenden
können. Wenn diese Angebote noch etwas stärker auf unsere Möglichkeiten der Vermittlung abgestimmt werden
könnten, wäre das sehr wünschenswert.
W: Also ganz abstrakt gesagt: Die Institutionen in Deutschland einschließlich der Zentralverwaltung des
Goethe-Instituts, müssten viel genauer den Bedarf im Ausland eruieren, bevor produziert wird.
A: Ist da nicht eine direkte Korrespondenz mit der Abteilung "Ausstellungen" des ifa möglich?
H: Ich persönlich habe zu meinem Münchener Kollegen ganz hervorragende Kontakte, dort funktioniert die
Abstimmung mit Herrn Pöhlmann bestens, wir haben eine große Flexibilität erreicht, das ist gar kein Problem.
Auch zu den ifa-Büros in Berlin und Stuttgart habe ich enge schriftliche und telefonische Kontakte, und habe
mir vorgenommen, bei nächster Gelegenheit einmal das Stuttgarter Büro persönlich zu besuchen. Der Kontakt
zu den dortigen Mitarbeitern ist sehr direkt und unkompliziert. .
A: Aber an irgendeiner Ebene hängt es offenbar, dass die Abstimmung nicht optimal ist.
H: An welcher Ebene das liegt, weiß ich leider auch nicht, aber wir haben kürzlich noch einmal in unserer
Zentralverwaltung verabschiedet, dass darauf hingearbeitet wird, die Ausstellungen in Zukunft tendenziell
kleiner zu gestalten. Die großen Museen hier, wie das Victoria and Albert z.B., möchten besonders ihre großen
Ausstellungen selbst konzipieren, anstatt vorgefertigte Entwürfe zu übernehmen. Selbst wenn die hiesigen
Institutionen mit anderen Museen in Deutschland eine Ausstellung gemeinsam gestalteten, würden sie dies
niemals mit einem anderen Mittler tun.
W: Da sind wir dann wieder bei der Kompetenzfrage...
H: Wie gesagt, ein positives Beispiel für die Arbeit des ifa war die letztjährige Fotokunstausstellung, die vom
Konzept her sehr gut in unseren Rahmen passte.
A: Wie kamen Sie auf die Wahl dieser Fotokunstausstellung?
H: Das hat meine Vor-Vorgängerin Karin Herrmann initiiert, die jetzt in Genua ist. Die Ausstellung wurde
bereits 1994 produziert.
A: Die Ausstellung wurde 1994 konzipiert. Wir leben in einem rasanten Wechsel. Gibt es
Nachfolgeausstellungen?
W: Das ist ein interessanter Punkt. Hier komme ich noch einmal auf das Informationszentrum der Botschaft
zurück, das kürzlich selbst eine Ausstellung mit britischen und deutschen politischen Karikaturen durchgeführt
148
hat, ohne dies vorher mit uns abzusprechen. Ich musste sie erst darauf hinweisen, dass es eine solche
Ausstellung bereits bei uns gab und der Gedanke nicht ganz neu war. Obwohl das Ausstellungsreferat unserer
Zentrale über ständigen Geldmangel klagt, gab es für die Ausstellung des Informationszentrums Mittel aus Bonn
für diese neue Ausstellung. Im kulturpolitischen Zusammenhang muss man sich hier natürlich fragen, warum
diese Institution und nicht wir - als Kulturinstitut - das Geld hat, die Fortsetzung der Karikaturen-Ausstellung zu
präsentieren.
H: Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir mit unseren gegenwärtigen Personalkapazitäten eine solche Ausstellung
produzieren könnten, aber wenn wir kurzfristiger und einfacher ähnliche Angebote aus der Zentralverwaltung
vermitteln könnten, dann wäre das gut. Dabei müssten wir solche Ereignisse gar nicht unbedingt hier in London
produzieren, es würde reichen, wenn unsere Zentrale oder das ifa entsprechende Angebote hätte.
A: Wo mangelt es in dem Kompetenzwirrwarr an der Abstimmung? Wie könnte man solche Irritationen
vermeiden?
H: Das ifa hat natürlich, was das Know-How und die Koordination von Ausstellungen, sowie qualifiziertes
Personal angeht, Vorteile, die wir im Goethe-Institut nicht haben. Insofern muss man sagen, dass die Produktion
von Kunstausstellungen - die Abteilung für Kunstausstellungen ist ja beim ifa, die Abteilung für
Dokumentationsausstellungen bei uns - bei vorheriger Absprache auch weiterhin beim ifa liegen sollte.
W: Es sei denn, die Zuständigkeiten und das Personal fließen zusammen..
A: Beim ifa gibt es die drei Abteilungen "Wortprogramme", "Medien" und "Kunst und Kultur". Wird nicht doch
manches doppelt erstellt?
H: Die Abteilung "Kunst und Kultur" zeichnet das Profil des ifa in besonderer Weise aus. In den anderen
Abteilungen würde ich auf jeden Fall sagen: ja. Es ist für mich nicht zu verstehen, dass das ifa z.B.
Vortragsreihen organisiert, da haben wir im Goethe-Institut viel bessere fachliche und personelle Ressourcen.
Gerade in diesem Fachbereich haben wir in der Zentrale drei sehr versierte Referenten.
W: Generell muss man sich natürlich fragen, warum verschiedene Organisationen aus Stuttgart, Berlin oder
München die Ausstellungspolitik machen müssen. Das kostet uns alle doppeltes Geld. Da helfen alle Aufrufe
zur Zusammenarbeit nichts.
H: Im Gegenteil, es ist eher noch ein gegenseitiger Konkurrenzdruck entstanden, jeder will den anderen
übertreffen, z.B. schneller und aktueller sein. Das war ja auch beabsichtigt.
W: Das Auswärtige Amt nutzt diese Konkurrenz ja auch voll aus. Man hat uns offen zu verstehen gegeben,
Konkurrenz belebe das Geschäft. Leider führt diese Politik nicht zu der bestmöglichen, und auch nicht zu der
billigst möglichen Kulturpolitik. Es hat wohl eher etwas mit “Teile und herrsche” zu tun.
A: Gibt es noch einen Vorschlag zur Veränderung im Ausstellungsbereich?
H: Noch ein konkretes Beispiel zum ifa: Eine sinnvolle Veränderung im Ausstellungsbereich wäre nötig bei der
sogenannten Einzelkünstlerförderung. Wenn heute ein britisches Institut überlegt, einen deutschen Künstler
auszustellen, dann kommt es in der Regel zu uns ins Goethe-Institut, um unsere Unterstützung zu erhalten.
Daraufhin muss ich die Interessenten an das ifa in Stuttgart verweisen, weil die Einzelkünstlerförderung direkt
über das ifa läuft. Das ifa fördert dies mit max. 10.000 DM pro Ausstellung, aber wir haben dann überhaupt
keinen Einfluss mehr darauf, etwa durch Empfehlungen u.ä.. Das ifa tagt unabhängig von uns. Meiner Meinung
nach sollte diese Einzelkünstlerförderung wieder beim Goethe-Institut angesiedelt sein, weil wir hier vor Ort
149
einfach viel besseren Einblick in den Stellenwert der hiesigen Institutionen haben. Es geht ja nicht nur um die
Künstler, sondern auch um die Ausstellungsorte. Hier können wir viel besser beurteilen, welches Museum für
welchen Künstler geeignet sein könnte, ob das Gesamtprojekt sinnvoll zu unterstützen ist. A: Gibt es ein
Beispiel, wo das Kompetenzgerangel mit ifa zu Spannungen mit den englischen Partnern führte?
H: Ja. Das renommierte Museum für zeitgenössische Kunst, die Whitechapel Art Galery, führt Ende dieses
Jahres eine Ausstellung von Rosemarie Trockel durch. Am Anfang des Jahres fand dort eine Ausstellung von
Thomas Schütte statt. Zu dieser Ausstellung hatten wir als Goethe-Institut - auf Beschluss unserer Zentrale -
30.000 DM oder 10.000 £, ein für unsere Verhältnisse sehr hoher Betrag, dazugegeben. Daraufhin ging die
Whitechapel Art Galery davon aus, sie würde auch 10.000 £ für die Trockel-Ausstellung bekommen, und haben
einen entsprechenden Antrag an das ifa gestellt. Sie wussten noch nicht, dass in der Zwischenzeit der
Förderungshöchstbetrag beim ifa auf 10.000 DM herabgesenkt worden war. Jetzt haben sie die umgerechnet
3.000 £ erst relativ spät bekommen, und müssen sehen, wo sie die restlichen 20.000 DM herkriegen. Wir als
Goethe-Institut können sie ihnen nicht geben, selbst wenn wir wollten, weil es sich dann um Doppelfinanzierung
handeln würde. Solche Missverständnisse würden nicht auftreten, wenn die britischen Partner einen
Ansprechpartner in London hätten. In diesem Falle hätten wir frühzeitig alle Fragen und Formalitäten klären
können. Dass mich jetzt der Kulturreferent der Botschaft fragt, ob mir noch irgendetwas einfällt, wo wir die
restlichen 20.000 DM herbekommen könnten, zeigt das ganze Dilemma.
A: Sie können von hier aus auch besser Prioritäten setzen, da Sie Land und Leute kennen.
H: Richtig, wir können die Prioritäten sinnvoll setzen. Manchmal lehnen wir ein Projekt auch ab, das uns nicht
förderungswürdig erscheint.
A: Welches Deutschlandbild wird bei solchen Ausstellungen vermittelt? Was erscheint Ihnen dabei besonders
wichtig?
H: Also hier gilt es zunächst einmal zu trennen zwischen dem, was wir bezuschussen, und dem, was wir in
unserer eigenen Galerie zeigen. Bei den auswärtigen Institutionen hier im Land ist es für mich entscheidend,
qualitativ hochwertige zeitgenössische Kunst zu zeigen, natürlich in ständiger Rücksprache mit den Kollegen in
der Zentrale. Hier geht es darum, gute deutsche Künstler, die ohne uns vermutlich nicht nach England kommen
würden, zu unterstützen. Künstler vom Rang eines Gerhard Richter, der jetzt gerade in einer der bedeutendsten
Galerien Londons ausstellt, bedürfen unserer Hilfe natürlich nicht mehr. Wir konzentrieren uns eher auf die
nachfolgende "Garde" deutscher und internationaler Künstler. Bei den Fotoausstellungen, die in unserer Galerie
einen Schwerpunkt bilden, erachte ich es als wichtig, solche auszuwählen, die auch eine dokumentarische
Qualität haben, die Einblick geben in den deutschen Alltag. Hier ist eine Ausstellung über Berlin Anfang dieses
Jahres zu nennen, die auch mit anderen Berlinprogrammen kombiniert wurde, sowie eine Ausstellung, die
nächstes Jahr Goethes "Hexeneinmaleins" illustriert und neue Aspekte in Goethes Werken verdeutlichen soll.
Generell sollte man die Ausstellungen auf unsere jeweiligen Programmschwerpunkte abstimmen und auf
aktuelle deutsche Ereignisse abstellen.
A: Wer erstellt diese Konzeptionen? Welche Rolle spielt dabei die Zentrale und das Auswärtige Amt?
W: Wir hier im Institut, im Rahmen der Leitlinien darauf bestehe ich auch ausdrücklich. Ich wehre mich gegen
jegliche Kompetenzbeschneidung seitens mancher Fachreferate unserer Zentrale, die glauben, sie wüssten besser
als wir, was in London geschehen soll. Die Entscheidung kann nur bei uns getroffen werden, die Zentrale kann
150
nur die Grundtendenz vorgeben. Es darf jedenfalls nicht passieren, dass das Auswärtige Amt oder - wenn auch
selten - unsere Zentrale sich für uns Projekte ausdenken. Konkret darf uns das AA z.B. nicht vorschreiben,
welche Jahrestage wir zu beachten haben. Das widerspricht dem Grundsatz der partnerschaftlichen
Projektplanung. Wir können unseren britischen Partnern die Anlässe für Projekte nicht vorschreiben und uns
diese also erst recht nicht von grünen Tischen in Deutschland vorgeben lassen..
H: Wir meinen damit die Jubiläumsjahre, wie etwa "100 Jahre Goethe", oder das Brecht-Jubiläum.
W: Wir nutzen die Jahrestage, um durchzuführen, was wir sowieso für wichtig halten. So werden wir etwa das
50-jährige Bestehen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Vortragsreihe begehen, nicht jedoch den 100.
Geburtstag des deutschen Börsenvereins.
H: Zu manchen Jahrestagen, an denen wir keine Veranstaltungen durchführen, könnten jedoch die Botschaften
aktiv werden. Wichtig wäre dabei vor allem die Abstimmung, dass auch der Informationsfluss seitens der
Botschaft so funktioniert, wie wir ihn - durch Programmvorschauen und Berichte - gewährleisten.
A: Es interessiert mich, wie das Übersetzungsprogramm von Inter Nationes angenommen wird.
H: Das ist sehr gut, es wird sehr gut angenommen und es wird eng mit I N zusammengearbeitet. In dem
Gremium bei I N, in dem ausgewählt wird, welche Bücher ins Englische übersetzt werden, sitzt auch ein
Vertreter des Goethe-Instituts. Für diese Übersetzungen steht übrigens jährlich ein Betrag von 1,1 Millionen DM
zur Verfügung.
W: Wir fördern selbst keine Übersetzungen. Unser Programm besteht aus den vorhin erwähnten "new books in
german" und der Arbeitsbesprechung von deutschen und britischen Verlegern, Übersetzern, Literaturagenten
und Kritikern, bei der über eine bessere Förderung des deutschen Buches geredet wird.
Interview mit dem Leiter der Verwaltung K, Institutsleiter W, Interviewerin A
A: Sie sind der Verwaltungsleiter des Hauses. Welche Aufgaben haben Sie?
K: Die Verwaltung ist hier nur eine unterstützende Arbeitseinheit, die sich bemüht, den operativen Kräften im
Hause "den Rücken frei zu halten", von Themen wie Haushaltsrecht und Bau-Formalitäten u.ä. . Diese Aufgabe
ist nicht zu unterschätzen, da es besonders in großen Weltstadtinstituten immer viel zu tun gibt. Je mehr
Aktivitäten stattfinden, um so kreativer müssen die Mittel verwaltet werden, um nicht in Konflikte mit dem
Haushaltsvolumen zu kommen.
Um mit dem Personal anzufangen: Es gibt in London 27 fest angestellte Mitarbeiter, von denen 14 erst kürzlich
eingestellt wurden. Bei ihnen handelt es sich um Honorarlehrkräfte, die bisher mit freien Verträgen an das
Institut gebunden waren und die wir jetzt mit festen Verträgen bei uns beschäftigen. Dies ist notwendig, da das
europäische Arbeitsrecht dies - auch in England - so bestimmt. Dieser besondere Mitarbeiterkreis wird auch aus
besonderen Haushaltsmitteln bezahlt. Es gibt weiterhin 6 Entsandte und 13 BAT-Mitarbeiter. BAT-Mitarbeiter
sind den Goethe-Instituten von der Politik gekündigt, bei ihnen handelt es sich sozusagen um eine "aussterbende
Rasse", die nach und nach ersetzt werden durch örtliche Mitarbeiter.
W: Die deutschen Ortskräfte wurden bisher und werden weiterhin alle nach BAT bezahlt, aber die neu
eingestellten Deutschen dürfen nicht mehr nach BAT bezahlt werden, sie werden schlicht nach englischem
Arbeitsrecht bezahlt.
A: Nach welcher Vergütungsgruppe ist die Tätigkeit der Entsandten gewertet?
151
W: Die Entsandten werden immer noch nach BAT bezahlt. Ich bin in der Kategorie
Ia mit Zuschlag, Herr Bauer als mein Stellvertreter ist ebenfalls in Ia, Frau H und Frau C haben Ib und Herr K
hat IIa.
K: Das ist vergleichbar dem höheren Dienst bei uns. Der übliche BAT-Einstieg dort ist bei IIa bis IaZ, bei den
Bibliothekaren fängt es bei IVa an und im gehobenen Dienst liegen die Verdienstspannen zwischen BAT VIa
und IIa. Diese Verdienstmöglichkeiten gelten allerdings nur für die Weltstadtinstitute wie Paris, New York,
Tokio oder London.
Insgesamt gibt es bei uns 47 Mitarbeiter, inklusive Hauspersonal. Damit gehört London zu den eher kleineren
Weltstadtinstituten, weil in der Spracharbeit eben weniger mit festangestellten Lehrern gearbeitet wird als
beispielsweise in Paris, wo bereits alleine 40 Lehrer beschäftigt sind. Dies hat natürlich auch einen Einfluss auf
die Kostenrechnung dieser Institute - die Sprachkurse in Frankreich z.B. sind in der Regel eher defizitär.
A: Wie sieht das Haushaltsvolumen dieses Hauses aus?
K: Das Haushaltsvolumen dieses Institutes liegt bei insgesamt 3,9 Millionen DM. Eigentlich kann man aber
sagen, dass es rund 4 Millionen DM sind, da im Laufe des Geschäftsjahres noch einiges an Zuschüssen oder
Mehreinnahmen hereinkommt. Von diesen 4 Millionen DM erwirtschaften wir 1,2 Millionen DM selbst und der
Rest kommt vom Auswärtigen Amt über den Gesamthaushalt unserer Zentralverwaltung in München. Für
operative Mittel, also für die Arbeit von Herrn W, Frau H und Frau D, sowie für die Programmarbeit generell,
stehen uns in diesem Haushalt leider relativ wenig Mittel zur Verfügung. Dafür stehen in diesem Jahr insgesamt
220.000 DM bereit. Darin sind allerdings die Mittel für die “Pädagogische Verbindungsarbeit”,
“Bibliothekarische Verbindungsarbeit”, Film, Theater und Sonstiges enthalten. Dazu werden vielleicht noch die
ein oder anderen Zuschüsse kommen, aber insgesamt sind diese Mittel - verglichen mit dem Gesamthaushalt -
eher gering.
W: Wir müssen auch noch den Kaufkraftverlust der DM gegenüber dem Pfund berücksichtigen, die DM hat seit
1990 um ein Drittel an Wert verloren. Diese Tatsache kann man auch nicht mit noch soviel Phantasie und
Kreativität wettmachen.
K: Davon sind aber alle Institute gleichermaßen betroffen, zumindest in dieser Kategorie. Sponsoring ist hierbei
ein häufig überschätzter Faktor.
A: Kommen wir doch noch einmal zum Sponsoring.
W: Nur einmal zur Größenordnung des Sponsoring: Der Botschafter hat sich bemüht, anlässlich eines
Staatsbesuches Gelder zu sammeln. Ich glaube, er hat 800 Briefe an deutsche Industrievertreter in
Großbritannien geschrieben, davon sind ganze 100 bis 200 Briefe überhaupt beantwortet worden. Von den
Beantwortern wiederum war nur ein Bruchteil bereit, tatsächlich etwas zu spenden. Das war noch eine
konventionelle und unkomplizierte Veranstaltung. Ich selbst habe bis jetzt noch keine großen Summen
heranschaffen können, egal für was. Als Beispiel habe ich die Berliner Bank angeschrieben, bei der Ralf
Dahrendorf Direktor ist und habe um Unterstützung für das Goethe-Jubiläum im nächsten Jahr gebeten. Selbst
für diese hochkonventionelle Veranstaltung im South Bank Centre, für die ich genaue Angaben zu
Werbungskosten in britischen Zeitungen u.ä. gemacht habe, hat die Bank mir geschrieben, der Betrag von
15.000 DM, den ich erbat, sei um ein Vielfaches höher als das, was sie dafür aufbringen könnten. Letztendlich
haben wir gar nichts bekommen. Was meinen Sie, was ich erst für ein Schwulenfestival bekommen würde... ?
152
Gar Nichts! Schön wäre es natürlich, wenn wir wenigstens für die Vortragsreihe "1949 - 1999" ein paar Mark
bekommen könnten, immerhin sind ja einige ganz interessante Namen unter den Rednern. Da diese Reden im
Nachhinein auch noch gedruckt werden, bin ich diesbezüglich hoffnungsvoll. Aber wir brauchen uns keine
Illusionen machen, dass wir die 400 bis 500.000 DM für die operative Arbeit, die meinem Vorgänger noch zur
Verfügung standen, jemals durch Sponsoring einholen können! Man kann auf der Erwartung von Sponsoring-
Geldern natürlich auch keinerlei Planung aufbauen. Entweder, die Bundesrepublik ist bereit, die Kulturpolitik zu
finanzieren, oder aber es läuft nichts.
A: Vielleicht noch ein Wort zum Haus ...
K: Gegenüber dem grässlichen 60er- Jahre-Zweckbau des Goethe-Instituts in Paris ist dieses Gebäude natürlich
sehr viel schöner, auch durch den Park dahinter. Obwohl das Haus also sehr viel mehr Charakter als sein Pariser
Pendant hat, sieht man auch hier die Sünden der ehemaligen Bundesbaudirektion, angefangen bei diesen
unansehnlichen abgehängten Decken, mit denen wir nichts als Ärger haben. Dieses Haus kostet leider auch
einen hohen Unterhalt; zum Bauerhalt stehen uns allerdings nur sage und schreibe 5.000 DM pro Jahr zur
Verfügung. Wenn wir damit zwei Eimer Farbe streichen lassen, ist das Geld schon fast weg. In diesem Jahr habe
ich meine Kollegin, die unseren Haushalt verteilt, überzeugt, dass diese Summe viel zu gering für irgendeine
vernünftige Maßnahme ist. So wie es jetzt aussieht, haben wir zukünftig ganze 10.000 DM zur Verfügung! Alles
andere, und sei es auch noch so klein, muss ich über Baubedarfsnachweise beantragen, und zwar in fünffacher
Ausfertigung an die Botschaft, das BM Bau usw. . Selbst bei Notbaumaßnahmen, als etwa Gips von der Wand
abgefallen ist, hat es ein 3/4 Jahr gedauert, bis wir das Geld erhalten haben. Das kostete 30.000 DM, die wir
nicht aufbringen konnten, und so hing in der Bibliothek für diese Zeit der Gips von der Wand, und wir mussten
sie mit Brettern und Styropor-Platten behelfsmäßig ausbessern. Das war wohlgemerkt eine Notbaumaßnahme.
Andere Baumaßnahmen, wie z.B. der Aufzug, der im Schnitt alle zwei Tage stehen bleibt, kosten 100.000 bis
300.000 DM. Da brauche ich gar nicht erst zu fragen! Zur Ergänzung: Es sind neue Baumaßnahmen geplant.
2.4. Deutsche Schule London178
Die Deutsche Schule in London liegt etwas abseits in einer ruhigen Wohngegend zwischen
Themse und Richmond Park im Südwesten der britischen Hauptstadt. Sie bietet
deutschsprachigen Schülern, deren Eltern in London und Umgebung wohnen, vom
Kindergarten an eine deutsche Schulbildung, die zum Abitur führt. Auch Real- und
178 Deutsche Schule London. Die Beschreibung der Deutschen Schule, des Douglas House, in London ist eine
Zusammenfassung der in eigener Anschauung gewonnenen Erkenntnisse, den Informationen der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen sowie des Jahrbuchs der Deutschen Schule London 1997/98, der Festschrift der
Deutschen Schule London zum 20-jährigen Bestehen und einer Schrift des Freundeskreises "Friends of Douglas
House". Die "Friends of Douglas House" ist eine Vereinigung, die an den Entscheidungen des Schulträgers
mitwirkt und Kontakte innerhalb der Schulgemeinde und mit dem Umfeld pflegt.
153
Hauptschüler aus Deutschland gehen in die Gymnasialklassen, auch wenn sie das Abitur nicht
erreichen.
Schulträger ist der Deutsche Schulverein, der auch den Schulvereinsvorstand aus seiner Mitte
wählt. Der Schulverein hat sich eine Satzung gegeben, welche die Zuständigkeit für die
finanziellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten der Schule regelt. Nur in
Personalfragen entscheidet der Schulleiter im Einvernehmen mit dem Vorstand des Deutschen
Schulvereins. Der Schulverein orientiert sich in seiner Tätigkeit an den Richtlinien, die die
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen herausgibt und stellt sicher, dass diese eingehalten
werden.
Erwünscht ist, dass auch die Eltern dem Deutschen Schulverein beitreten. Auf diese Art und
Weise haben sie die Möglichkeit, an Entscheidungen des Schulträgers mitzuwirken.
Die Höhe des Schulgeldes wird unter Berücksichtigung der allgemeinen Kosten vom
Vorstand des Schulvereins festgelegt. Es wird pro Trimester erhoben. Dabei gelten folgende
Sätze:
Schulgeld pro Trimester:
0. – 4. Klasse £ 655.00
5. – 10. £ 819.00
11. – 13. £ 960.00
Die Deutsche Schule in London wird zu über 90 Prozent von Kindern besucht, deren
Muttersprache Deutsch ist. Der offene Charakter der Schule lässt allerdings zu, dass sie allen
Kindern mit deutschen Sprachkenntnissen offen steht.
Die Eltern der Schüler sind meist bei international tätigen Unternehmen wie zum Beispiel
DaimlerChrysler, Allianz, Deutsche Bank oder Siemens angestellt. Außerdem sind natürlich
auch die Kinder von Botschafts- und Konsulatsangehörigen unter den Schülern von
Richmond.
In den Klassen 0 - 13 besuchen zur Zeit etwa 600 Schüler in 25 Klassen die Deutsche Schule
in Richmond. Etwa 80 % von ihnen sind Deutsche und 12% Österreicher und Schweizer. Die
restlichen 8% sind Kinder und Jugendliche aus verschiedenen anderen Ländern. Von der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen entsandt sind etwa ein Drittel der Lehrkräfte.
Ungefähr zwei Drittel sind Ortslehrkräfte, die in London wohnen und meist eine längere
Unterrichtserfahrung in der Bundesrepublik hinter sich haben. Sie gewährleisten eine gewisse
Kontinuität. Während die von der Zentrale für das Auslandsschulwesen entsandten Lehrkräfte
nach einem bestimmten Turnus wieder nach Deutschland zurückkehren, bleiben die
154
Ortslehrkräfte der Schule meist erhalten. Sie beziehen erhalten ein Gehalt, welches den
Bedingungen der englischen Besoldung entspricht. Der Englischunterricht wird
ausschließlich von native-speakers erteilt, von denen sich zur Zeit drei an der Schule
befinden.
Die Schule hat einen Förderverein. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, die Schule ideell und
vor allem materiell zu unterstützen, und hat durch vielfältige Aktivitäten bereits einige
wichtige Projekte finanziert. Die "Friends of Douglas House" spielen somit eine große Rolle
im sozialen und gesellschaftlichen Leben der zumeist deutschen Gemeinde. Benannt ist dieser
Förderkreis nach dem 1690 erbauten "Douglas House", das heute die Schulverwaltung
beherbergt und von einem großen Park umgeben ist. 1980 wurde das moderne Schulgebäude
mit großer Turnhalle und Schwimmbad erbaut. Ein Sportplatz grenzt an das Schulgelände und
erstreckt sich bis an das Themse-Ufer.
Zur Struktur der Schule: Die Deutsche Schule London entspricht einer Schule im deutschen
Bildungssystem. Sie umfasst eine Vorschule (Klasse 0), eine Grundschule (Klasse 1 - 4), eine
Sekundarstufe I (Klassen 5 - 10) und die Sekundarstufe II (Klassen 11 - 13). Die gymnasiale
Oberstufe führt zum Abitur. Die Schule ist zweizügig in den Klassen 1 - 11. Die
Stundenpläne, Lehr- und Lernpläne entsprechen denen eines deutschen Gymnasiums. Die
Sekundarstufe II ist jeweils in zwei Halbjahre gegliedert. Der Unterricht wird im
Wesentlichen im Klassenverband organisiert. Prüflingen, die die Reifeprüfung bestanden
haben, wird die Allgemeine Hochschulreife zuerkannt. Richtlinien für die DSL stellen die
"Richtlinien für eine Schulordnung für deutsche Schulen im Ausland" (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 15. 1. 1982) dar. Sie folgen den Leitsätzen im "Rahmenplan für
die auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen" vom 14.9.1978 und der “Stellungnahme der
Kultusministerkonferenz zum Rahmenplan für die auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen"
vom 18. 1. 1979.
Die Deutsche Schule London bietet den Schülern eine Menge außerunterrichtlichter
Veranstaltungen, so zum Beispiel Deutsch-Förderunterricht für die Klassen 5, 6, 7 und 8,
Latein als dritte Fremdsprache für die Klassen 9 - 11, Englisch, Lernen lernen, Theater, Film
Club, Radieren-Tiefdruck, Fotowerkstatt, Cartoon AG, Holzarbeit, Töpfern, Chor,
Kammerorchester, Leistungsturnen, Fußball, Basket- und Volleyball usw..
Das Auslandsschulwesen in London kann auf eine über dreihundertjährige Geschichte
zurückblicken; es bietet einen Erlebnisraum deutscher Kultur. Schon in der Grundschule gibt
es ein reichhaltiges Angebot an Theater, Tanz und Musik. Seit 1982 findet das jährliche
155
Oktoberfest der DSL unter der Schirmherrschaft des deutschen Botschafters statt. Am 3.
Oktober 1990 trafen sich über 1000 Deutsche um gemeinsam diesen Tag zu feiern. Im
Mittelpunkt stand das Referat des stellvertretenden Direktors des Deutschen Historischen
Instituts London und die Ansprache des Botschafters. Dieser 3. Oktober war ein besonderer
Tag im Leben der Deutschen Schule in London, wie auch in Deutschland. Darüber hinaus
markierte dieses Datum einen besonderen Tag in der deutschen und europäischen
Nachkriegsgeschichte. Die DSL nimmt lebhaften Anteil am politischen Geschehen in
Deutschland und der übrigen Welt.
Das traditionelle Oktoberfest, das als interkultureller Begegnungstag besonders den
englischen Gästen neben bayerischer Küche ein Stück deutscher Kultur und Lebensart
näherbringen soll, erfreut sich unter den Engländern großer Beliebtheit.
Durch erheblich bessere Ausstattung an Unterrichtsmitteln als dies an innerdeutschen Schulen
üblich ist, haben die Schüler der DSL im Fach "Kunst" außerordentliche Leistungen erzielt.
So gewann man in London bereits zahlreiche Preise und Wettbewerbe wie z. B. die “National
Gallery Art Competition" (1980). Diese Tradition wird fortgesetzt und aktiv gefördert, so
etwa durch das jährlich stattfindende Projekt “Artist at school", bei dem Künstler mit den
Schülern verschiedene kreative Arbeiten durchführen.
Im literarischen Bereich tut sich die Schule besonders durch die jährlichen Dichterlesungen
hervor, die regelmäßig ein Publikum von über 500 Zuschauern nach Richmond locken.
Hierzu haben sich bereits weltbekannte Schriftsteller wie Günther Grass, Siegfried Lenz oder
Friedrich Dürrenmatt die Ehre gegeben. Parallel zu diesen Dichterlesungen finden zudem
noch Übersetzungswettbewerbe der Schüler zu den Werken ihrer Gäste statt, an denen sich
Schulen aus ganz Großbritannien beteiligen. Durch diese Kontakte ist bereits ein reger
Austausch mit Schulen und Schülern im Gastland entstanden, der sicherlich viel zum
beiderseitigen kulturellen Verständnis beiträgt. Begleitend zu diesen Veranstaltungen werden
Lesehefte in beachtlicher Auflage (1991: 1100 Stück) herausgegeben, die neben dem
eigentlichen Text auch noch zahlreiche deutsch-englische Anmerkungen der Schüler
enthalten. Darüber hinaus sind zwei Romane von Schülern der DSL als Taschenbücher
erschienen. Das literarische Engagement der Schule hat in England ein landesweites, positives
Echo erfahren und dazu beigetragen, das Bild der Deutschen in England zu verbessern. Dafür
spricht auch das - im Vergleich zu anderen deutschen Schulen im Ausland - enge und
herzliche Verhältnis zu den Anwohnern, beziehungsweise dem sozialen Umfeld der Schule.
So wird der Deutschen Schule London die Ehre zuteil, seit 1973 an der “Petersham Flower
156
Show", einer Garten- bzw. Kunstausstellung in der Nachbarschaft, mit Schülerarbeiten
teilzunehmen. 1986 durfte der Direktor der DSL Edgar Windemuth diese Ausstellung gar
eröffnen. Beweis für die gute Zusammenarbeit der deutschen Gäste und ihrer britischen
Gastgeber sind ferner die vielfältigen Besuche englischer, aber auch internationaler
Austauschklassen oder Sport- und Musikgruppen auf dem Gelände der DSL. Für besondere
Verdienste um das deutsch-britische Verhältnis sind inzwischen zahlreiche Mitarbeiter,
darunter auch der ehemalige Direktor Windemuth mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet worden.
Eine Besonderheit der Deutschen Schule London im Vergleich mit anderen deutschen
Auslandsschulen ist auch darin zu sehen, dass überdurchschnittlich viele ehemalige Schüler
ein Studium im Gastland antraten und meist auch sehr erfolgreich abschlossen. So traten
beispielsweise 1990 55% der Absolventen einen Studienplatz in Großbritannien an, hingegen
nur 18% in Deutschland. Hier wird der gute Ausbildungsstand deutlich, den der Besuch der
DSL gewährleistet - auch im Hinblick auf ein Studium in Großbritannien.
Fragt man ehemalige Schüler nach dem Einfluss ihrer Schulzeit an der DSL auf ihre
berufliche Karriere, so betonen die meisten deren herausragende Unterrichtsqualität und das
besonders enge und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Hierin ist
auch ein spezifisch britisch geprägtes Traditions-, vielleicht gar "Elite"- Bewusstsein der
Schüler zu erkennen, zumal die Schule durch ihren Förderverein Gedenkmünzen verteilt und
Ehemaligentreffen fördert, sowie Informationsveranstaltungen ehemaliger Schüler für die
Abiturienten durchführt.
2.5. Interviews Deutsche Schule London
Interview mit dem Direktor OStD Ke:
A: Sie haben erst im September 98 Ihren Dienst in Richmond angetreten. Was wird anders werden an der
Schule?
Ke: Zum Beispiel der "jour fix". Der "jour fix" ist ein Treffen aller Lehrkräfte, das wöchentlich stattfindet.
Meine Maxime ist: "Erst sehen, was sich machen lässt, dann machen, was sich sehen lässt". Ich habe erst im
September 98 meinen Dienst in Richmond angetreten. Wichtig ist für mich, dass die Nutzung der neuen Medien
in der Schule konsequent vorangetrieben wird. Alle Schüler sollen lernen, mit ihnen umzugehen. “Schulen ans
Netz", lautet hier die Devise. Auch die Zusammenarbeit verschiedener Schulformen ist mir wichtig. Aus diesem
Grund ist auch die Koordinatorin für die Grundschule beim "jour fix" anwesend. Erst so kann auch ich als
Direktor einen Überblick über die Probleme der Schule gewinnen, z.B. was man unter der "Busstunde" in der
157
Grundschule versteht, was man mit den Eltern machen könnte, die rund um die Uhr in der Schule sind, oder wie
der Kontakt zu anderen Schulen verbessert werden könnte.
A: Welche Vorschläge haben Sie für die Arbeit der SMV?
Ke: Ich glaube, dass Demokratie nicht an der Schule, sondern in der Schule gelebt werden muss. Die SMV soll
regelmäßig informiert werden, wofür ein eigenes SMV-Büro mitsamt den erforderlichen Mitteln bereitgestellt
werden wird. Wünsche und Vorhaben sollen so an der richtigen Stelle geäußert werden können. Bisher wurden
die Schülervertretungen nicht ernst genug genommen. Es besteht seitens der Schüler ein großer Wunsch, an
ihren eigenen Belangen mitzuarbeiten. Neben mir unterstützen auch die Eltern und der Förderverein diesen Plan.
A: Wie macht sich das Umfeld der Schule bemerkbar?
Ke: Ich war sehr überrascht, als anlässlich meiner Vorstellung an einem Elternabend rund 400 Eltern kamen.
Dabei kritisierten die Eltern als erstes, dass auf der Schule kein vernünftiger Umgangston mehr herrsche, z.B.
begrüßten sich die Schüler morgens nicht mehr. Dies nahm ich zum Anlass, mich jeden Morgen an die
Eingangstüre der Schule zu stellen, um jeden Schüler einzeln zu begrüßen. Seit dem ist das Grüßen wieder zur
Gepflogenheit an unserer Schule geworden. Heute Abend findet eine Begrüßungsveranstaltung zu Ehren des
neuen Schulleiters statt, an der der Council, die Botschaft, der örtliche Bürgermeister und die Schulleiter der
Umgebung teilnehmen. Am 18. Oktober 98 findet ein Frühschoppen mit Flohmarkt statt, der zusammen mit den
"Friends of Douglas House" veranstaltet wird. Ich möchte einen guten Kontakt zur Stadt herstellen, um aus
unserer Ghetto-Situation herauszukommen. In Richmond wohnen vorwiegend deutsche und französische
Familien. Ein evangelischer Pfarrer hat hier eine deutsche Gemeinde. Viele Kinder sind bilingual aufgewachsen.
In der neunten Klasse etwa sprechen 80 bis 90% der Schüler fließend Englisch.
A: Der Bundespräsident macht in Großbritannien einen Staatsbesuch im Dezember 98. Ist Ihre Schule darin
eingebunden?
Ke: Ja, der Bundespräsident möchte bei seinem Staatsbesuch im Dezember auch in Richmond Station machen.
Voller Eifer bereiten wir diesen Besuch vor. Auch die Kingston Grammar School soll besucht werden. Unsere
Schule ist sehr europäisch geprägt, da 11 Nationen hier vertreten sind. Ich möchte die Kontakte zu britischen
Schulen sowie deren Leitern intensivieren bzw. herstellen. Hierin sehe ich einen enormen Nachholbedarf.
A: Welchen Beitrag kann Ihre Schule oder ganz allgemein das Bildungssystem zur europäischen Einigung
leisten?
Ke: In Bezug auf Europa scheint es mir besonders wichtig zu sein, die Integration im Arbeitsleben
voranzutreiben. Ich frage mich allerdings, ob man dazu eine Abiturisierung Europas braucht, d.h. es erscheint
mir fraglich, ob man in Deutschland eine Verkürzung des Abiturs auf 12 Jahre oder die Einschulung schon mit 5
Jahren anstreben sollte. Die Abschlüsse müssten angeglichen werden.
A: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit des Goethe-Instituts mit der Deutschen Schule London?
Ke: Die Zusammenarbeit der Schule mit dem Goethe-Institut muss gut aufeinander abgestimmt werden,
besonders im Bereich der Veranstaltungen. So hat z.B. das Konzert von Wolfgang Biermann aus räumlichen
Gründen bei uns in der Deutschen Schule stattgefunden. Die Theatergruppe der Deutschen Schule London kann
andererseits demnächst vielleicht sogar im Goethe-Institut auftreten. Besonders im Rahmen des Umbaus des
Goethe-Instituts können wir in der DSL flexibel mit unserem Raumangebot aushelfen. Die DSL ist jedoch
ziemlich weit vom Zentrum abgelegen, was für Veranstaltungen oft hinderlich ist.
158
Das Goethe-Institut ist wichtig für die Fortbildungen unserer Ortslehrkräfte. Sie haben oft nicht die deutsche
Lehramtsausbildung. Besonders in didaktisch-methodischen Seminaren unterstützt das Goethe-Institut die
Lehrer/innen unserer Schule. Darüber hinausgehend haben das Goethe-Institut und die Deutsche Schule London
allerdings eine unterschiedliche Klientel, d.h. unsere beiden Adressatengruppen sind verschieden. Die Schule ist
der Ort des Lernens für die Kinder von deutschsprachigen Eltern, das Goethe-Institut ist der Ort des Lernens für
die deutschlernenden Engländer.
Interview mit zwei Schülersprechern T und L
A: Ihr macht in diesem Jahr Abitur. Wie geht's dann weiter?
T: Ich möchte in Oxford "philosophy", "politics" und "economics" studieren.
L: Ich will ebenfalls in Oxford studieren, allerdings den Studiengang "Politische Wissenschaften und
Europapolitik".
A: Ihr seit beide SMV (Schülermitverantwortungs)-Vertreter. Welche Ziele habt Ihr dort?
T: Wir möchten bei der Lehrerkonferenz mit anwesend sein, um zu hören, was die Lehrer über uns Schüler
denken, um dann mit den Lehrern die Problemfelder zu erörtern. Fast jede Entscheidung in der Schule betrifft
die Schüler, deshalb sollen unsere Vorstellungen mit in die Entscheidungsfindung eingebracht werden.
L: Die Schüler der DSL wohnen weit von einander entfernt. Deshalb wäre ein Aufenthaltsraum in der Schule
nötig, um soziale Kontakte knüpfen zu können. Die Friends of Douglas House haben bereits einen Billardtisch
gespendet, was sehr zur Verbesserung der Kontakte und zur Freude der Schüler beiträgt.
A: Wie empfindet Ihr die Deutsche Schule London?
L: Wir empfinden die Deutsche Schule wie ein Ghetto, weil sie sich fern ab der Stadt auf einem abgegrenzten
Areal befindet, wir nur für uns sind, und nur selten mit englischen Schülern in Kontakt kommen. Deshalb haben
wir mit zwei bis drei englischen Schulen Treffen vereinbart, um gegenseitige Beziehungen aufzubauen. Die
Deutsche Schule veranstaltet am 2. Dezember eine große Disko, wozu wir auch die beiden englischen Schulen
einladen wollen. Die einzige Ebene, um mit englischen Jugendlichen in Kontakt zu treten, ist die private, z.B. in
Form von Sportveranstaltungen. Deshalb wollen wir in Zukunft auch gemeinsame Sportveranstaltungen nach
Schulschluss organisieren, z.B. Basketball-Wettbewerbe.
A: Gibt es da nicht sprachliche Verständigungsprobleme?
T: Die sprachlichen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, sind groß. Es ist allerdings sehr schwer, die
englische Sprache perfekt zu beherrschen, wenn man sie im Alltagsleben nicht spricht! Außerdem ist es sehr
schwer, die englische Kultur kennenzulernen, wenn der alltägliche Kontakt zu Einheimischen fehlt.
A: Gibt es politische Vorbehalte gegenüber Deutschen?
T: Die mangelnde Kontaktbereitschaft der Engländer führen wir darauf zurück, dass die englischen Schüler
einen völlig anderen Geschichtsunterricht haben als wir. Das Haupthindernis ist die deutsche Vergangenheit.
Die Nazi-Vergangenheit und Hitler werden im englischen Unterricht ganz bewusst in engen Zusammenhang zu
Deutschland gestellt. Daraufhin ziehen sich die englischen Jugendlichen zurück. Das gleiche gilt allerdings auch
für die Deutschen. In der Nähe unserer Schule gibt es 14 Häuser, die mit einem elektrischen Zaun umgeben sind.
Dort wohnen deutsche Familien, die ihre Kinder in unsere Schule in Richmond schicken. Es gibt sogar eine
eigene deutsche Bäckerei und andere Möglichkeiten, sich nur auf Deutsch zu unterhalten und deutsche
159
Infrastruktur zu benützen. Als Deutschland bei der Fußballeuropameisterschaft siegte, wurden unserer Schule in
Richmond Fensterscheiben eingeworfen. Der zweite Weltkrieg ist auch noch ständiges Thema in den Medien.
L: Sport hat ja nichts mit Geschichte zu tun, sondern soll ein fairer Wettkampf zwischen den Nationen sein.
Wenn die Engländer gewonnen hätten, wären allerorts englische Fahnen gehisst worden. Selbst der Pub
gegenüber hisste bei den Siegen der Engländer demonstrativ den Union-Jack. Die Engländer empfinden dies
allerdings nicht "rassistisch", im Gegensatz zu uns, wenn wir im Falle unseres Sieges deutsche Flaggen hissen
würden.
A: Setzt Ihr euch in der Schule mit dem europäischen Gedanken auseinander?
L: Ich interessiere mich sehr für Europapolitik. Mein Vater arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich
selbst war sogar in Italien und habe dort an einem Seminar für Europapolitik teilgenommen. Mich interessiert
besonders die Frage, wie Europa in Zukunft aussehen wird. Ich finde es faszinierend zu verfolgen, wohin die
Entwicklung im Moment geht.
3. Frankreich
1998, 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages, fand die Ausstellung ”vis-à-
vis - zur Kultur der Verständigung” im Haus der Geschichte in Bonn statt, die unter der
Schirmherrschaft des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac stand. Die
umfangreiche Dokumentation zeigte viele Aspekte der deutsch-französischen Beziehungen.
Im Mittelpunkt stand die Geschichte des Elysée-Vertrages, der am 22.1.63 von
Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem Präsidenten der Französischen Republik General
Charles de Gaulle unterzeichnet worden war. Das Ziel des Vertrages war die “Versöhnung
zwischen dem deutschen und dem französischen Volk, eine Jahrhunderte lange Rivalität zu
beenden und ein geschichtliches Ereignis darzustellen, welches das Verhältnis der beiden
Völker von Grund auf neu gestaltet.” Victoria Znined-Brand beschreibt den primären Sinn
des Vertrages wie folgt: „Der Elysée-Vertrag darf also nicht als eine „harmlose
Selbstverständlichkeit geschichtlicher Zwangsläufigkeiten“179 verstanden werden, sondern
war im Gegenteil ein Schritt, den sowohl Adenauer als auch de Gaulle bewusst gegen
herrschende Widerstände vollzogen. Primärer Sinn des Vertrages war auch nicht, einen
Schlussstrich unter die negativen Erfahrungen der vergangenen Zeit zwischen den beiden
Völkern zu ziehen, sondern einen Antrieb zur politischen Union Westeuropas zu geben. Die
179 Weidenfeld in Außenpolitik 39/1988, S.5.
160
Basis der deutsch-französischen Verklammerung sollten zwei Gesichtspunkte bilden:
einerseits der vertraglich festgelegte Zwang zu regelmäßigen Konsultationen, andererseits der
breite gesellschaftliche und kulturelle Austausch.“180
Auch das beeindruckende Bild der symbolträchtigen Friedensgeste auf dem Soldatenfriedhof
in Verdun vom September 84 als Kanzler Kohl und Präsident Mitterand sich an den Händen
halten, spielte eine große Rolle bei der Ausstellung „vis-à-vis“ im Bereich der
Veranschaulichung der Verwirklichung des Vertrages. Gerade für Schüler und Studenten
belegten die 1500 Exponate, die auch Alltagsgegenstände umfassten, das wechselvolle
Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich.181 Ein Mitveranstalter der Ausstellung, das
Deutsch-Französische Jugendwerk, wurde in Folge des Elysée-Vertrages am 5. Juli 1963
gegründet. Bis zum Jahr 2002 konnten 7 Millionen junge Deutsche und Franzosen an den
Austauschprogrammen des DFJW teilnehmen. Zum 40. Geburtstag des Deutsch-
Französischen Jugendwerkes wurde das Orpheus-Projekt verwirklicht. Unter Leitung des
renommierten slowakischen Pantomimen Milan Sladek schufen 500 junge Künstler,
Handwerker und Köche, Designstudenten und Musiker aus beiden Ländern ein Kunstwerk
über den Orpheus-Mythos. Dieses wurde im südfranzösischen Cap d´Ail uraufgeführt.
Das Jugendwerk wirkt an vielfältigen Formen deutsch-französicher Begegnungen mit:
Schüleraustausch, Lehreraustausch, Ausbildungs- und Fortbildungskurse für Sprachlehrer und
Forschungsaufenthalte für Studenten umfasst das Spektrum.182 Jährlich rund 7000 Treffen mit
fast 200 000 jungen Deutschen und Franzosen werden vom DFJW gefördert und initiiert.
Wettbewerbe sollen das Interesse an der Literatur des Nachbarn wecken, das Lesen fördern
und den Unterricht in beiden Ländern anregen. Einen Beitrag zum dialogischen Austausch,
zur interkulturellen Kommunikation und zu kooperativem Lernen leisten auch verschiedene
Projekte sowie themenzentrierter Materialaustausch.183
180 Znined-Brand, Victoria: Deutsche und französische Kulturpolitik. Eine vergleichende Analyse. Frankfurt am
Main 1999, S.103. 181 Ausstellungskatalog: ”vis-à-vis”, Köln, 1998. 182 Deutsch-Französisches Jugendwerk: Fakten, Daten und Zahlen. Bad-Honnef,1998. Internet: www.dfjw.org 183Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW): Arbeitsmaterialien. Zusammen arbeiten – Gemeinsam lernen.
Die Literatur des Nachbarn. ‚Impression-Expression‘ Wettbewerb 1993/1994., 1994.
161
3.1. Das Goethe-Institut Paris184
Ich besuchte das Goethe-Institut Paris, führte ein ähnliches Interview mit dem Leiter wie in
London, verzichte aber im folgenden auf die Beifügung, da wesentliche Details eines
Großstadtinstituts schon in London eruiert wurden.
3.1.1. Kulturprogramme
Zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit unterstützt und organisiert das
Goethe-Institut Paris ein breites Spektrum von Veranstaltungen zur Präsentation deutscher
Kultur. Anlässlich des 200. Geburtstages des Dichters Heinrich Heine etwa wurde ein
Verbundprogramm mit Ausstellungen, Konzerten, Filmen, literarischem Kabarett, Lesungen
und dem Kolloquium ”De la France et de l’Allemagne”, mit verschiedenen zeitgenössischen
Schriftstellern durchgeführt. Ein vergleichbares, literarisches Verbundprogramm fand auch
zum Thema ”Berlin – Paris” statt, unter Mitwirkung von z.B. Nicolaus Sombart, Brigitte
Olechinski, Friedrich Dieckmann, Bert Papenfuss oder Katja Lange-MM. Im Rahmen der
Ausstellungsreihe ”Saison photographique allemande” zeigte das Goethe-Institut Paris z.B. 10
Einzelausstellungen, u.a. von Thomas Ruff, Anna und Bernhard Blume oder Esther und
Jochen Gerz. Diese Ausstellungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Centre National de
la Photographie und dem Maison Européene de la Photographie. Besucher ’98: 25.135.
Deutsch lehren und lernen
Die Deutschkurse für die Allgemeinheit basieren auf dem kommunikativen Ansatz und
bringen den Teilnehmern neben den reinen Sprachkenntnissen auch das alltägliche soziale
Leben in Deutschland näher. Darüber hinaus werden eine Reihe von Sonderkursen angeboten,
beispielsweise für Jugendliche, oder Fachsprachkurse für Wirtschaftswissenschaften, für
soziale Berufe, Geisteswissenschaften, Philosophie/Theologie, Geschichte und
Kunstgeschichte. Besondere Betreuung kommt den französischen Deutschlehrern zugute:
Innerhalb der pädagogischen Verbindungsarbeit werden Veranstaltungen aus den Bereichen
Bildungs- und Sprachpolitik, Didaktik/Methodik, Fachsprachen, Fortbildungsdidaktik,
184 Goethe-Institut: Jahrbuch 1997/98, www.goethe.de: Wir über uns. Internetseite des Goethe-Instituts Paris,
verschiedene Programmhefte des Goethe-Instituts Paris, u. a. zur Veranstaltungsreihe ”Présences Allemandes”
und ”Centenaire Bertolt Brecht” 1998, sowie eigene Anschauung.
162
Landeskunde, Linguistik, Literatur und Mediendidaktik durchgeführt. Ein Höhepunkt hierbei
ist der Deutschlehrertag mit Vorträgen, Workshops und Seminaren, der 1998 von über 1000
Teilnehmern aus ganz Frankreich besucht wurde.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst derzeit einen Bestand von 34.300 Exemplaren, darunter 31.625
Bücher, 129 Zeitungen und Zeitschriften sowie 2546 audiovisuelle Medien. Dabei findet sich
deutsche Literatur im Original und meist auch in französischer Übersetzung. Die Bestände
werden dabei laufend aktualisiert; Schwerpunkt sind Literatur und Sprache, Philosophie,
moderne Kunst, Film, deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert und Politik und Wirtschaft
nach 1945. Darüber hinaus beantwortet das Informationszentrum Anfragen zu
deutschlandbezogenen Themen, so z.B. CD-ROM-Recherche oder Online-Recherche im
Internet. Außerdem vermittelt das Infozentrum französischen Bibliotheken und
Fachverbänden Kontakte zu deutschen Bibliothekseinrichtungen und Informationen über das
deutsche Bibliothekswesen. Deutschlehrer können in der Bibliothek eine Fülle von Büchern
und audiovisuellen Medien für den Unterricht (DaF) entleihen und eine persönliche
Fachberatung hierzu in Anspruch nehmen. Schließlich führt die Bibliothek auch noch eine
Reihe von eigenen Veranstaltungen durch, wie z.B. 1998 eine Europäische Biblio-
thekskonferenz in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque Publique d’Information, der
Direction du Livre et de la Lecture und dem British Council, oder eine Ausstellung der
Illustratoren des Atelier 9 aus Hamburg. Aus Anlass des 40-jährigen Jahrestages des Élysée-
Vertrages wurden auf Initiative des Goethe-Instituts Bibliothekspartnerschaften zwischen
deutschen und französischen Bibliotheken geschlossen.
3.2. Die Deutsche Schule Paris (DSP)185
Die Deutsche Schule Paris ist eine deutschsprachige Auslandsschule, die als einzige Schule
ihrer Art im Pariser Raum über das Bildungsangebot des dreigliedrigen deutschen
Schulwesens verfügt. Die Schule bietet einen deutschen Bildungsweg vom Kindergarten über
Grundschule bis zum Abitur bzw. Real- oder Hauptschulabschluss. Kern der Schule ist dabei
185 Deutsche Schule Paris: Informationsheft ”Deutsche Schule Paris 1997/98” sowie Mitteilungen des Leiters der
deutschen Schule in Paris und Informationen des Auswärtigen Amtes.
163
das Gymnasium, das die weitaus meisten Schüler besuchen. Nach der Orientierungsstufe in
den Klassen 5 und 6 sowie nach entsprechender Empfehlung der Schule werden für einige
Schüler ab der 7. Klasse – entsprechende Schülerzahlen vorausgesetzt – kombinierte Haupt-
und Realschulklassen gebildet. Diese enden nach der 10. Klasse mit dem deutschen
Realschulabschluss, ohne eine eigene Abschlussprüfung zu durchlaufen. Der Haupt-
schulabschluss wird innerhalb der Realschulklassen vergeben, da die Schülerzahl für eigene
Klassen zu gering ist. Die Benotung der Hauptschüler erfolgt differenziert, z.B. durch einen
Notenbonus im Vergleich zu den Realschülern. Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe
ist seit dem Schuljahr 1996/97 im Klassenverband organisiert. Durch die Abschaffung des
personalintensiven Grund- und Leistungskurssystems erhofft sich die KMK eine
Kostenersparnis für kleinere Auslandsschulen. An der Qualität und Gleichwertigkeit des
Abiturs ändert sich dadurch nichts: Die Abiturprüfung der DSP ist ebenso wie der Real- und
Hauptschulabschluss von der Kultusministerkonferenz anerkannt und die Prüfungen werden
von einem aus Deutschland entsandten Prüfungsleiter überwacht. Dadurch ist die
Vergleichbarkeit der DSP-Zeugnisse mit denen einer innerdeutschen Schule gewährleistet.
Das Abitur berechtigt neben dem Studium in Deutschland auch zum Studium an einer
französischen Hochschule. Dem Unterricht in allen Schultypen, einschließlich der
Grundschule, liegen die Lehrpläne des Bundeslandes Baden-Württemberg zugrunde.
Die Schüler der deutschen Schule Paris sind vorwiegend Kinder von im Pariser Raum
ansässigen deutschen (359 Schüler und Kindergartenkinder), österreichischen (9) und
schweizer (24) Experten, aber auch von Franzosen (69) und anderen Nationalitäten (44).
Außerdem sind von den insgesamt 408 Schülern und Kindergartenkindern 97 solche, die eine
doppelte Staatsangehörigkeit besitzen (Stand: Juni 1998). Allerdings hat sich in den letzten
Jahren eine rückläufige Entwicklung der Schülerzahlen abgezeichnet, die noch nicht
abgeschlossen sein dürfte. Neben dem Rückgang der klassischen Klientel (Unternehmen
entsenden immer weniger teures Personal ins Ausland), ist auch der Anteil der längerfristig in
Paris lebenden Deutschen und der Franzosen zurückgegangen, die an einer
gebührenpflichtigen, ausschließlich deutschen Schulbildung interessiert sind.
Diese Entwicklung ist besonders auf die in Paris herrschende starke Konkurrenz für die
deutsche Schule zurückzuführen: Es existieren zwei staatliche französische Schulen, das
Lycée Franco-Allmand und das Lycée International, die kostenlos ein interkulturelles
Unterrichtsprogramm anbieten. Die Kostenfreiheit wird unter anderem dadurch gewährleistet,
dass die Lehrer des deutschen Zweiges an diesen Schulen von der Bundesrepublik
164
Deutschland besoldet werden. An diesen Gymnasien kann zusätzlich zum staatlich
anerkannten deutschen Abitur gleichzeitig auch das französische Baccalauréat erworben
werden, und das schon in 12 statt in 13 Jahren. Aufgrund dieser offensichtlichen Vorteile
ziehen viele Interessenten diese Schulen der Deutschen Schule Paris aus kulturellen wie aus
finanziellen Gründen vor. Diese bemüht sich deshalb im Verbund mit der Botschaft intensiv,
eine gleichzeitige Vergabe des deutschen Abiturs und des französischen Baccalauréat (sog.
”Abi-Bac”- Regelung) zu ermöglichen, scheiterte aber bisher am zuständigen Ausschuss der
KMK.
Um ihre Stellung zu festigen, hat die Schule einen wichtigen Schritt in Richtung
zweisprachige Ausbildung getan. Seit dem Schuljahr 1994/95 gibt es an der DSP einen
bilingualen deutsch-französischen Zweig, in dem in den Jahrgangsstufen 7 bis 13 die Fächer
Geographie bzw. Französische Geschichte auf Französisch unterrichtet werden. Im nächsten
Schritt will man das Fach ”Geschichte auf Französisch” als mündliches Abiturfach
genehmigen lassen.
Bei der Spracherziehung an der DSP kommt natürlich der Sprache des Gastlandes,
Französisch, eine besondere Bedeutung zu: Bereits im Kindergarten werden die Kinder von
einer Fremdsprachenpädagogin spielerisch in die Grundzüge der französischen Sprache
eingeführt. Der Französischunterricht wird danach schon ab der 1. Klasse der Grundschule –
altersgemäß und in verschiedenen Niveaugruppen – fortgesetzt, und umfasst pro Jahrgang
drei Wochenstunden. Dieser Prozess setzt sich konsequenterweise auch im Gymnasium (bzw.
der Orientierungsstufe) fort, wo ab der 5. Klasse als erste Fremdsprache Französisch gelernt
wird. Parallel dazu wird allerdings zusätzlich – jedoch auf deutlich niedrigerem Niveau als in
Französisch – Englisch ab Jahrgangsstufe 5 unterrichtet, um der überragenden internationalen
Bedeutung dieser Sprache gerecht zu werden. Der sich daraus ergebende Rückstand im
Vergleich mit den innerdeutschen Schulen wird ab der 7. relativ zügig wieder aufgeholt. Um
die Vergleichbarkeit mit innerdeutschen Gymnasien zu wahren, wird zusätzlich ab Klasse 9
Latein als Wahlfach angeboten, allerdings mit höherer Stundenausstattung als normalerweise
für Wahlfächer vorgesehen. Nach 3 bis 5 Jahren können so die verschiedenen Stufen des
Latinums erworben werden.
Träger der privaten deutschen Schule in Paris ist der Schulverein, der sich, wie in anderen
Auslandsschulen üblich, vorwiegend aus den Schülereltern zusammensetzt. Rechtsorgane des
Schulvereins sind die Mitgliederversammlung und der daraus gewählte Vorstand
(Vorsitzende/r, Schatzmeister/in, Schriftführer/in, jeweils samt Stellvertreter/in sowie drei
165
zusätzliche Mitglieder), der für alle finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten der Schule
zuständig ist. Finanziert wird die Schule zum einen von der Bundesrepublik Deutschland,
hauptsächlich aber durch die Schulgebühren der Eltern. Die Hilfe aus der Bundesrepublik
besteht im Wesentlichen aus der Vermittlung und Entsendung deutscher Lehrkräfte, die für
die Zeit ihres Aufenthaltes vom deutschen Schuldienst freigestellt werden. Im Schuljahr
1997/98 waren dies 13 Lehrerinnen und Lehrer. Die meisten Lehrer im Kollegium waren
jedoch vom Schulverein angeworbene Ortslehrkräfte, 29 von den insgesamt 42 Lehrkräften
der DSP (ohne Kindergarten und Vertretungslehrer). Weitere Hilfe vom Bund kommt in Form
der jährlich neu festzusetzenden Schulbeihilfe, sowie durch Gelder zur Erhaltung der
Bausubstanz.
Den größten Posten des Haushaltes stellte jedoch das Schulgeld dar, das 1997/98 pro
Schuljahr 24.100 FF für das jeweils erste Kind und 19.280 FF, 14. 470 FF bzw. 9.640 FF für
jedes folgende Kind betrug. Zusätzlich dazu ist noch eine einmalige Zahlung von 200 FF,
entweder als Mitgliedsbeitrag für den Schulverein oder als Verwaltungsgebühr zu entrichten.
Unabhängig davon kann das Schulgeld in Einzelfällen – nach vorheriger Prüfung – ermäßigt
werden. Aufgrund des geographisch weitverzweigten Einzugsgebietes der Schule ist ein
eigenes, gebührenpflichtiges Schulbusnetz eingerichtet worden, für das jährlich zu bezahlen
ist.
Durch die Einnahmen aus dem Schulgeld war es dem Schulverein in den vergangenen Jahren
möglich, viele wichtige Neuanschaffungen zu tätigen, von denen manch eine deutsche Schule
nur träumen kann: den Schülern steht ein großzügig angelegtes Schulgebäude mit gut
ausgestatteten Fachräumen für Physik, Chemie und Biologie zur Verfügung, außerdem gleich
zwei Bibliotheken, ein Musikzentrum sowie eine große Aula mit Platz für 400 Personen. Im
sportlichen Bereich ist neben einem eigenen großen Sportplatz samt Turnhalle vor allem ein
eigenes Hallenschwimmbad als besondere Bereicherung hervorzuheben. Dank der
Schulgelder konnte der Schulverein auch auf die neusten Entwicklungen im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie reagieren, und richtete einen voll vernetzten,
leistungsfähigen Computerraum mit 20 Internet-PCs ein. Neben dem Schulverein, der
Schulleitung und dem Kollegium wird das schulische Leben in Paris noch maßgeblich mit
von dem engagierten Förderverein, (der viele der o.g. Anschaffungen mit finanzierte) dem
Schulelternbeirat und nicht zuletzt der SMV mitbestimmt.
Außerhalb des regulären Unterrichts prägen vor allem die Arbeitsgemeinschaften die
Schulatmosphäre mit. Die Palette an Angeboten reicht hier von zusätzlichen Sprachen wie
166
Spanisch über Informatik und Umweltgruppe bis hin zu musischen Aktivitäten wie Theater,
Chor und Orchester. Nicht zu vergessen sind dabei natürlich die vielen Sportmöglichkeiten.
Darüber hinaus werden – auch außerhalb der Schule – eine Reihe von guten Beziehungen zu
französischen Schulen und anderen Institutionen gepflegt.
Im Rahmen der Reihe ”Kulturelle Begegnungen” präsentierte die deutsch-französische
Projektgruppe des ”Forum des Arts Franco-Allmand de Paris” ein ”spectacle – miroir”. Bilder
von Caspar David Friedrich wurden etwa mit Musik von Franz Schubert untermalt. Aufgrund
des Erfolges und der großen Nachfrage derartiger bikultureller Veranstaltungen hat man im
September 1998 eine deutsch-französische Musikschule (Ecole de Musique Franco-
Allemande, E.M.F.A.) in den Räumen des Musikzentrums der DSP gegründet. Neben dem
stets bilingualen Unterricht in Instrumentalgruppen werden auch noch zahlreiche literarische
oder künstlerische Tätigkeiten ausgeübt. In den zugehörigen Ateliers werden zudem noch
Tanz/Rhythmik- und Tai-chi-Kurse angeboten, ebenso Opernbesuche, jeweils in Abstimmung
zum Instrumentalunterricht. Außerdem werden literarische Texte gelesen und entsprechende
Vorträge zu Themen wie ”Rilke, Rodin und Debussy” gehalten. Es ist allerdings eine
Teilnahmegebühr für die Musikschule zu entrichten. Zusammen mit dem Goethe-Institut und
dem Förderverein wurde eine Aufführung des Berliner ”Theater im Palais” in der Aula der
DSP ermöglicht, das einen Themenabend zu Heinrich Heine bot. Dabei wurden dessen
Gedichte, Lieder und Texte vorgetragen, die dem begeisterten Publikum sein Leben und Werk
näherbrachten. Im März 1998 inszenierte die Theatergruppe der Schule unter großen
Vorbereitungen Shakespeares Stück ”Ein Sommernachtstraum” und erregte damit weit über
die Grenzen der Schule hinaus Aufsehen. Die Tanz-AG führte das Tanzspektakel ”Cinama”
in echter Musical-Manier mit 52 Tänzerinnen und Tänzern auf. Ein Highlight im literarischen
Bereich war die Dichterlesung der Schriftstellerin Gudrun Pausewang, die mit ihren
nachdenklich-kritischen Romanen zu Themen wie Jugend im Dritten Reich,
Umweltzerstörung oder Krieg besonders die Klassen 5 bis 8, aber auch deren Eltern
beeindruckte.
Ein traditioneller Höhepunkt des Schuljahres ist außerdem der alljährlich stattfindende
Weihnachtsmarkt, der vom Förderverein organisiert wird. Die Einnahmen aus dieser
Veranstaltung sowie die zu diesem Anlass reichlich eingehenden Firmenspenden kommen
voll dem materiellen Wohl der Schule zugute und tragen somit dazu bei, das Niveau der
deutschen Schule Paris zu sichern.
167
4. Schweden
4.1. Rahmenbedingungen zur Förderung der deutschen Sprache186
Kultur187
1998 war Stockholm nicht nur die 14. ”Kulturstadt Europas” seit 1985, sondern auch Ort der
Ausstellung “Wahlverwandtschaften” , sowie der weltweiten Kulturkonferenz der UNESCO
“Kulturpolitik für Entwicklung”. Dort wurde ein Aktionsplan entworfen, dessen Leitgedanke
die Nachhaligkeit Auswärtiger Kultur war. (Siehe A 1.2.)
Die Kulturstadt Europas ist eine zwischenstaatliche Initiative. Die Bewerberstädte müssen
ihre Anmeldungen über ihre ständigen Vertretungen bei der Europäischen Union an den Rat
leiten. Entscheidungen müssen einstimmig vom Rat der Kulturminister getroffen werden.
“Die Wahl der Kulturstadt Europas ist eine politische Entscheidung, die von den Vertretern
der Mitgliedsstaaten getroffen wird, während es Aufgabe der Kommission ist, die
Veranstalter (auch finanziell) zu unterstützen (Globalsumme von ca. 600 000 € jährlich).
Außerdem fördert die Kommission seit 1991 das Sekretariat der Netzwerke der Kulturstädte
Europas und unterstützt Tagungen, die den Veranstaltern erlauben, ihre Ideen und ihre
Erfahrungen in diesem Bereich auszutauschen.”188
Mit einem Etat von knapp 120 Millionen DM (Hauptgeber waren das Kultusministerium, die
Stadt Stockholm und Sponsoren aus der Wirtschaft) wurde die Durchführung von über 1000
186 Auswärtiges Amt: Länderkonzeption. Auf der Grundlage der Länderkonzeption zur Förderung der deutschen
Sprache und der damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in Schweden 1998. 187 Auswärtiges Amt: Politischer Halbjahresbericht. Auf der Grundlage des Politischen Halbjahresberichts
Schweden, Stand: März 998.
(Der Politische Halbjahresbericht ist ein zur Unterrichtung des Auswärtigen Amtes regelmäßig erstellter
Bericht.) 188 Dörr, Renate: Europäische Kulturpolitik- gibt es das? In: Handbuch Kultur Management, RAABE
Fachverlag Hg., Düsseldorf, aktualisierte Auflage 1998, A 1.3 S. 3. Für die Auswahl der Kulturhauptstadt gilt ab
2005 ein neues Verfahren. Es gilt das Rotationsprinzip der einzelnen Mitgliedsstaaten: Wenn das innerstaatliche
Verfahren abgeschlossen ist, wird auf Empfehlung der Kommisssion - auf der Grundlage der Stellungnahme des
Europäischen Parlaments und einer Jury - vom Rat die betreffende Kulturhauptstadt Europas ernannt. Eine
Vorbereitungszeit von vier Jahren ist wünschenswert.
168
Einzelveranstaltungen aus allen Kulturbereichen 1998 geplant. Die Veranstalter haben sich
dabei um ein ausgewogenes Programm bemüht. Kein wichtiger Kulturbereich wurde
übersehen, keiner zu sehr betont. Die große Repräsentationskultur war genauso vertreten wie
Hunderte lokaler Initiativen.
Das Goethe-Institut in Stockholm hat mit Zuwendungen des Auswärtigen Amts, einiger
Bundesländer und Eigenmitteln eine Vielzahl von deutschen Beiträgen organisiert, vorbereitet
und mitfinanziert.
Außerschulischer Deutschunterricht und Erwachsenenbildung
Der außerschulische Deutschunterricht findet in Schweden hauptsächlich durch
Erwachsenenbildung statt. Es gibt 11 anerkannte und staatlich unterstützte
Erwachsenenbildungsverbände mit großer Tradition. Die fünf größten Verbände erreichen pro
Jahr 30.000 Kursteilnehmer in allen Teilen des Landes. Sie sind in dem ”Verein Deutsch in
der schwedischen Erwachsenenbildung” zusammengefasst. Das Goethe- Institut hat in diesem
Verband seit 2 Jahren den Vorsitz und ist gleichzeitig wichtigster Ansprechpartner der
Verbände. In Stockholm und Uppsala werden auch Vorbereitungskurse auf das Kleine
Deutsche Sprachdiplom angeboten, die das Goethe-Institut im Auftrag der Ludwig-
Maximilian- Universität München betreut. In den drei Ballungszentren Stockholm, Göteborg
und Malmö gibt es Kurse der Grund- und Mittelstufe, in den Kleinstädten in der ”Provinz”
finden vor allem Kurse der Grundstufe statt.
Außerdem gibt es noch eine kommunale Erwachsenenbildung, bei der viele Deutsch lernen.
Deutsch kann auch kostenlos in einem sogenannten freistehenden Kurs gelernt werden. Diese
Form der Bildung steht in immer stärkerer Konkurrenz mit den Studienverbänden. Die
kommunale Erwachsenenbildung wird zum Teil von den ansässigen Deutschlehrern
übernommen, so dass nur 400 hauptberufliche Lehrer für die kommunale
Erwachsenenbildung ”KOMVUX” tätig sind, für die es keinen Zentralverband gibt. In 248
schwedischen Gemeinden gibt es mindestens eine KOMVUX- Schule. Über die berufliche
Ausbildung und Qualifikation der Lehrer gibt es keine empirischen Untersuchungen.
Das Goethe-Institut veranstaltet Gruppenfortbildungen für Deutschlehrer in Deutschland
sowie methodisch-didaktische Seminare in Schweden in Zusammenarbeit mit den
Studienverbänden. Die Studienverbände ihrerseits laden bei eigenen Veranstaltungen
Referenten des Goethe-Instituts ein.
169
Die Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) Lübeck bietet jährlich 10 Stipendienplätze für
Deutschlehrer der schwedischen Erwachsenenbildung für ein Seminar in Lübeck an.
Auf dem Gebiet der Sprachförderung arbeiten zwei Fachberater, zwei DAAD- Lektoren, die
Deutsche Auslandsgesellschaft in Lübeck, die in der gesamten Region Nordeuropa und dem
Baltikum tätig ist, und zwei Kulturinstitute mit insgesamt vier Dozenten, wobei der
Göteborger Kollege in Personalunion auch Institutsleiter ist.
4.2. Das Goethe-Institut Stockholm189
Kulturprogramme
Zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit und zur Präsentation deutscher
Sprache und Kultur organisiert und unterstützt das Goethe-Institut Stockholm ein breites
Spektrum von Angeboten. Im Rahmen der Wortveranstaltungen konnten bereits namhafte
Referenten gewonnen werden: Joachim Gauck, ehemaliger Leiter der nach ihm benannten
Bundesbehörde, die das Archiv des Staatssicherheitsdienstes verwahrt, hielt im Oktober 1998
einen Vortrag zum Thema ”Das Vermächtnis der Vergangenheit – Deutschland nach der
Öffnung der Stasi-Akten”, der großen Anklang fand. Auch der renommierte Schriftsteller
Hans Magnus Enzensberger, der mit Skandinavien seit seinem mehrjährigen Aufenthalt in
den 50er Jahren enge Kontakte pflegt, stellte sich im Goethe-Institut Stockholm den Fragen
nach seinem Kinderbuch ”Der Zahlenteufel” sowie der Rolle der Kinder in der deutschen
Gesellschaft. Zu Leben und Werk Heinrich Heines entstand in Zusammenarbeit mit dem
Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf eine Ausstellung, die in der Bibliothek der jüdischen
Gemeinde Stockholm gezeigt wurde. Mit dem Norrköpings Kunstmuseum, dem
Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung
konzipierte man eine Ausstellung mit Gemälden und Zeichnungen des deutsch-jüdischen
Expressionisten Felix Nussbaum, der 1944 in Auschwitz ermordet wurde, und dessen Bilder
das Leben der Lagergefangenen wiederspiegeln. Im Theaterbereich führten die Ruhrfestspiele
Recklinghausen das Stück ”Gustav Adolf” von August Strindberg auf, welches das Leben des
berühmten Schwedenkönigs während des 30jährigen Krieges thematisiert und von den
189Goethe-Institut. Jahrbuch 1997/98. Internetseite Goethe-Institut Stockholm, www.goethe.de: Wir über uns.
Programmhefte des Goethe-Instituts Stockholm, sowie eigene Anschauung.
170
Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde. Zum 100. Geburtstag des politisch engagierten
Wiener Komponisten Hanns Eisler stellte man ein Programm aus Vorträgen,
Diskussionsrunden, Filmen und Konzerten/Liederabenden sowie einer Ausstellung
zusammen. (Besucher der Kulturprogramme im Goethe-Institut Stockholm im Jahre 1998:
27.479.)
Deutsch lehren und lernen
Deutschkurse werden einerseits für interessierte schwedische Bürger, andererseits für
schwedische Deutschlehrer konzipiert und durchgeführt. Den Kursen für die Allgemeinheit
kommt dabei in Stockholm eine untergeordnete Bedeutung zu: 1998 wurden in diesem
Bereich lediglich 46 Prüfungen abgehalten. Die Pädagogische Verbindungsarbeit organisierte
für schwedische Deutschlehrer verschiedene Seminare und Workshops, die dagegen
wesentlich besser besucht wurden, z.B. zu Themen wie Curricula, Didaktik/Methodik,
Dolmetschen/Übersetzen, Grammatik, Landeskunde, Literatur, Mediendidaktik und
Prüfungsmethodik. Damit spielt die Pädagogische Verbindungsarbeit in Stockholm eine
wichtigere Rolle als die allgemeine Spracharbeit. In Schweden werden keine institutseigenen
Kurse angeboten. Ziel ist es vielmehr, die einheimischen Partner für die Durchführung von
Kursen mit hohem Niveau auszubilden, da so die multiplikatorische Leistung viel höher ist.
Alle Prüfungen werden vom Goethe- Institut angeboten.
Das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) wird auch von den schwedischen
Studienverbänden abgenommen, die die Sondergenehmigung haben, auch externe Kandidaten
zu prüfen. Für ZDaF gibt es 60 Prüfer, die fast alle vom Goethe- Institut ausgebildet wurden.
Die ZMP wird zweimal jährlich in Stockholm im Anschluss an die Deutschkurse der
Erwachsenenbildungsverbände angeboten. Wenn nötig wird die Prüfung auch vor Ort
durchgeführt, wobei ein Referent des Goethe-Instituts (auf Kosten des Verbands) anreist und
die Prüfung durchführt.
In den Gymnasien gibt es Interesse an den Goethe-Instituts Prüfungen. Seit diesem Jahre
werden in einem Gymnasium Stockholms bereits im dritten Jahr ZDaF und ZMP durch-
geführt.
Das Kleine Deutsche Sprachdiplom wird abwechselnd in Göteborg und Stockholm im Mai
und November vergeben.
171
Es gibt die Zusammenarbeit des GI Stockholm mit dem Beraterkreis, einem
Zusammenschluss von Vertretern deutsch-schwedischer Industrie, der Handelskammer, der
Stockholmer Universität und Erwachsenenverbänden.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 11.910 Exemplaren, darunter 10.456
Bücher, 46 Zeitungen und Zeitschriften sowie 1.408 audiovisuelle Medien. Der Bestand wird
allerdings nur geringfügig umgeschlagen (1998: 325 Entleiher/innen). Der größte Teil der
entliehenen Literatur dürfte somit wahrscheinlich auf die Sprachkursteilnehmer
beziehungsweise die Deutschlehrer entfallen, die besonders auch Materialien zum Thema
”Deutsch als Fremdsprache” im Angebot der Bibliothek finden.
4.3. Die Deutsche Schule Stockholm190
Im Gegensatz zu den deutschsprachigen Auslandsschulen mit deutschem Schulziel ist die
Deutsche Schule Stockholm eine Begegnungsschule, d.h. eine zweisprachige Schule mit
integriertem Unterrichtsprogramm und bikulturellem Schulziel.
Offensichtlich ist es nicht leicht, solche Schulen zu gründen. Bei Behörden und Politik
müssen Widerstände überwunden werden. Die beteiligten Staaten müssen in weiten Berei-
chen politisch einvernehmlich sein, da beide Seiten den bikulturellen Abschluss für alle
Schüler, unabhängig von ihrer Muttersprache, als Hochschulzugangsberechtigung anerkennen
sollen.
Die Arbeitsweise der deutschen Schule Stockholm
Die Deutsche Schule Stockholm ist eine Begegnungsschule, die deutsch- und schwedisch-
muttersprachliche Schüler umfassend bilingual schult. So soll die Allgemeinbildung der
Schüler in beiden Sprachen voll erreicht werden. Die DSS versteht sich im Kern als
Gymnasium, je nach Qualifikation der Schüler besteht allerdings die Möglichkeit eines
differenzierten Unterrichts zur Erlangung des Haupt- bzw. Realschulabschlusses. Alle
sonstigen Schüler erhalten eine gymnasiale, deutschsprachige Ausbildung, die mit der
allgemeinen deutschen Hochschulreife abschließt. Die Richtlinien für Lehrpläne und
172
Abiturprüfungen orientieren sich dabei an denen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die
Gymnasialausbildung zur Vorbereitung auf das deutsche Abitur wird ausschließlich von
muttersprachlich deutschen Lehrkräften vermittelt, die über ein abgeschlossenes deutsches
Lehramtsstudium verfügen. Der schwedischsprachige Unterrichtsanteil, der für alle Schüler
verpflichtend ist, wird dagegen ausschließlich von voll ausgebildeten schwedischen Lehrern
gemäß schwedischen Lehrplänen erteilt. Auf Wunsch und je nach Fächerbelegung erhalten
die Abiturienten danach zusätzlich zum deutschen ein schwedisches Abschlusszeugnis.
Kindergarten
Das Begegnungsprogramm der Schule beginnt bereits im Kindergarten, wo die Kinder im
Rahmen eines Sprachprogrammes – ihrer Aufnahmefähigkeit entsprechend in spielerischer
Form – einen ersten Einstieg in die jeweils andere Sprache erhalten. Außer der Förderung der
sprachlichen Begabung und des positiven Erlebens der neuen Sprache vermittelt das
Begegnungsprogramm den Kindern auch die Grundzüge von Sitten und Gebräuchen der
jeweils anderen Kultur. Obwohl der Besuch des Kindergartens noch keine automatische
Aufnahme in die Deutsche Schule impliziert, ist er doch eine überaus sinnvolle Vorbereitung
auf den künftigen Schulalltag.
Grundschule
Bevor die Kinder dann in den Grundschulzweig der DSS überwechseln, klärt die Schule sehr
sorgfältig, ob die Eingangsvoraussetzungen des sehr fordernden bilingualen Bil-
dungskonzeptes erfüllt werden. Um dies zu gewährleisten, lädt die Schule die interessierten
Kinder zu einem Begegnungstag in die Grundschule ein, wo sie sich in Kleingruppen, bei
Gesprächen, Spiel- und Bastelarbeiten kennen lernen. Dabei ”bewerten” die Lehrkräfte, wie
selbstverständlich sich die Kinder in diesen Begegnungssituationen verhalten, wie sie bei der
Konfrontation mit der anderen Sprache reagieren. Nach der Aufnahme in die erste Klasse ist
das Erlernen von zwei Sprachen, Deutsch und Schwedisch, in Wort und Schrift obligatorisch.
Die Grundschule umfasst entsprechend dem deutschen Schulsystem die Klassenstufen 1 bis 4
mit je einer deutschen und schwedischen Klasse. Die Zuweisung der Kinder in diese Klassen
190 Deutsche Schule Stockholm: Jahresbericht 1996/97 der Deutschen Schule Stockholm Tyska Skolan,
verschiedene Informationsbroschüren sowie eigene Anschauung.
173
erfolgt nach ihrem sprachlichen Können, wobei in jeder Klasse auch die jeweils andere
Sprache unterrichtet wird. In den schwedischsprachigen Klassen, die von einem/einer
schwedischen Klassenlehrer/in betreut werden, lernen die Kinder die Grundfertigkeiten
Lesen, Schreiben und Rechnen auf schwedisch, haben allerdings auch 5 Wochenstunden
Deutschunterricht bei einer deutschen Lehrkraft. Umgekehrt lernen die Erstklässler in den
deutschsprachigen Klassen ihr Grundschulprogramm von deutschen Klassenleitern auf
Deutsch, aber haben auch 5 Stunden Schwedischunterricht bei einheimischen Lehrern. Ab
Klasse 3 haben auch die schwedischen Klassen einen deutschen Klassenleiter und der Anteil
der deutschen Sprache nimmt immer mehr zu – in manchen Fächern wie Mathematik wird
z.B. ausschließlich auf Deutsch unterrichtet – da die Deutschkenntnisse der schwedischen
Schüler zum Ende der 4. Klasse denen der deutschen angeglichen sein müssen. Außerdem
finden vielfältige gemischtsprachige Aktivitäten wie Theater, Werken, Handarbeit, Sport oder
Chor statt.
Kindertagesstätte
Den Begegnungscharakter setzt die Schule darüber hinaus mit einer eigenen Kindertagesstätte
fort. In ihr werden Kinder der Klassen 1 bis 3 nach Schulschluss bis 17.30 betreut, bekommen
eine Zwischenmahlzeit und können den Nachmittag durch Spiele, Ausflüge und
Hausaufgaben sinnvoll ausfüllen. Als Korrektiv zu der ab Klasse 3 zunehmend
deutschsprachigen Grundschule ist die Umgangssprache in der Tagesstätte ”Fritidshem” in
der Regel Schwedisch.
Gymnasium
Nach der 4. Klasse werden die Schüler der bisherigen deutsch- und schwedischsprachigen
Klassen zu zwei neuen, gemischtsprachigen 5. Klassen integriert. Ab Klasse 5 wird ca. 85 %
des Unterrichts von deutschen Lehrern gemäß dem innerdeutschen Gymnasiallehrplan auf
Deutsch erteilt. In der Integrationsstufe, die die Klassen 5 und 6 umfasst, bemüht sich die
Schule durch organisatorische und pädagogische Maßnahmen die Voraussetzungen für den
gymnasialen Unterricht zu schaffen, vor allem auch auf sprachlichem Gebiet. Deswegen
stehen für Schüler mit sprachlichem Förderungsbedarf in Deutsch mehrere Wochenstunden
Deutschunterricht (DeFö) in Kleingruppen zur Verfügung.
Schwedisch, schwedische Geschichte und schwedische Gemeinschaftskunde werden
hingegen von schwedischen Lehrkräften in schwedischer Sprache unterrichtet. Damit die
174
nicht-schwedischsprachigen Schüler, die nicht den DSS-Kindergarten besucht haben bzw.
nach Klasse 2 in die Schule kommen (sog. ”Seiteneinsteiger”), an den 5 bis 7 Wochenstunden
auf Schwedisch aktiv teilnehmen können, wird ein besonderer Unterricht ”Schwedisch als
Fremdsprache” angeboten. Dieser Förderunterricht findet zeitlich parallel zu einem Teil der
normalen Schwedisch-Stunden statt und wird von speziell ausgebildeten Lehrern abgehalten.
Diese Förderkurse werden maximal 4 Schulhalbjahre durchgeführt, wobei im 4. Halbjahr
erstmals eine Schwedisch-Note vergeben wird.
Am Ende der 6. Klasse erfolgt dann für die zeitweilig in Schweden ansässigen deutschen
Kinder eine Einstufung in das deutsche dreigliedrige Schulsystem bestehend aus Gymnasium,
Realschule und Hauptschule. Hierfür spricht die Schule eine Empfehlung aus, die sich an
erzielten Leistungen, Ausdrucks- und Abstraktionsfähigkeit sowie Anpassungsbereitschaft
und Engagement des Schülers orientiert. Spätere Umstufungen sind dabei bis zum Ende der 9.
Klasse möglich. Auch für die nicht-gymnasialen Schultypen stehen Lehrwerke und Lehrpläne
bereit.
Für die deutschen Schüler ist Französisch ab der 7. Klasse obligatorisches Unterrichtsfach,
anderssprachige Schüler mit Lücken in Deutsch belegen anstelle von Französisch in der 7.
und 8. Klasse verpflichtend das Fach ”Deutsch als Fremdsprache” (Defa). Dabei erfolgt
dieser Unterricht auch fachbezogen in Geschichte, Erdkunde, Biologie oder Physik. In der 9.
Und 10. Klasse wird Defa durch Sozialkunde und Informatik abgelöst. Der
Deutschförderunterricht (DeFö) läuft zum Ende der 9. Klasse aus.
Die gymnasiale Oberstufe der Klassen 11, 12 und 13 endet mit dem deutschen Abitur. Je nach
Kurswahl – es existieren Leistungskurse in Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik und
Biologie – erhalten die Schüler auf Wunsch auch ein schwedisches Abschlusszeugnis, das den
N (naturwissenschaftlichen)-, S (gesellschaftswissenschaftlichen)- oder H (humanistischen)-
Zweig bestätigt.
Struktur der Deutschen Schule Stockholm
An der Schule unterrichten 46 Lehrer (davon 36 auf Vollzeit-Basis), zum einen Teil
ortsansässige deutsch- und schwedischsprachige Lehrkräfte zum anderen Teil Lehrer, die von
der Bundesrepublik Deutschland und Österreich für einen gewissen Zeitraum nach Stockholm
vermittelt wurden (14). Der Schulleiter ist ebenfalls aus Deutschland vermittelt.
Träger der Schule ist der Deutsche Schulverein Stockholm, der sich aus Schülereltern und
Freunden der Schule zusammensetzt und einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählt. Der
175
Schulverein regelt alle rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten der Schule. Die
Mitgliedschaft von Schülereltern ist ausdrücklich erwünscht und bietet den Eltern neben
einem besseren Einblick in Geschehen und Entwicklung der Schule auch die Möglichkeit der
persönlichen Mitgestaltung. Wie alle Privatschulen erhebt auch die Deutsche Schule
Stockholm ein Schulgeld. Im Gegensatz zu den ”normalen” deutschen Auslandsschulen wird
die DSS nämlich nicht nur von der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch durch
Zuschüsse des Königreiches Schweden finanziert. Der Großteil dieser Einnahmen kommt
vom Staat. Den Gemeinden ist es freigestellt, zusätzlich dazu noch Schulgeld für die in ihrem
Gebiet lebenden Schüler zu zahlen, wie dies im Fall der staatlichen schwedischen Schulen
geschieht. Die dabei ggf. entstehenden finanziellen Einbußen der Schule müssen über
Schulgeld für die Klassen 1 bis 13 kompensiert werden. Reguläre Kosten entstehen allerdings
bei der Aufnahme (1997: 500 SEK), im Kindergarten (1997: 4.400 bis 7.000 SEK pro
Halbjahr) und im Freizeitheim (1997: 1.400 SEK/Monat fürs 1. Kind, 900 SEK/Monat für
folgende Kinder). Für nachgewiesen Bedürftige besteht außerdem die Möglichkeit einer
Befreiung vom Schulgeld.
Die Schule verfügt über einen engagierten Elternbeirat, der die Interessen der Eltern und der
Schüler gegenüber der Schule und dem Schulverein vertritt. Aus jeder Klasse werden zwei
Elternvertreter für je zwei Jahre gewählt. Die Elternvertreter aller Klassen, einschließlich der
Kindergartengruppen, wählen aus ihren Reihen schließlich einen Vorstand samt Vor-
sitzendem. Auch die Schülerseite engagiert sich in Form der Schülermitverwaltung (SMV)
mit eigenen Vertretern (Schülersprecher, Stufensprecher) bei den Entscheidungen der Schule.
Als Besonderheit im Vergleich zu anderen Auslandsschulen bietet die Deutsche Schule
Stockholm einen Gesundheitsdienst für ihre Schüler an. Die Betreuung der Schüler wird von
einer täglich erreichbaren Schulschwester sowie einem eigenen Schularzt mit wöchentlicher
Sprechstunde gewährleistet. Durch die große Nähe der Schulschwester wird sie als
Ansprechpartnerin für vielfältige Bedürfnisse und Wünsche der Schüler genutzt.
Zusätzliche Aktivitäten der Schule 1996/97
Es gibt Arbeitsgruppen zu den verschiedensten Themen, wie Sport, Musik, künstlerische
Gestaltung, Naturwissenschaften oder Informatik, für die eine ISDN-Anlage zur Verbindung
aller Schulcomputer mit dem Internet angeschafft wurde. Im Rahmen des Religions-
unterrichtes fand ein “indischer Abend” statt, auf dem die Schüler die indische Kultur in Form
von Verkleidungen, Tänzen, Ratespielen, Musik und vor allem indischem Essen live
176
”erleben” konnten. Eine elfte Klasse besuchte das regionale Büro der Associated Press (AP)
in Högtorget. Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, fanden zwei
Schülerwettbewerbe statt: ein Wettbewerb ”Geschichte” für Schüler der 9. und 10. Klassen
sowie ein Sonderwettbewerb in Musik, in dem die deutsche Nationalhymne interpretiert
werden musste.
Im literarischen Bereich hatte die Schule ein ”Highlight” im Programm: den Kurt-Tucholsky-
Abend, an dem insgesamt 11 verschiedene Stücke des Autors aufgeführt wurden, der einst aus
Deutschland nach Schweden emigriert ist und sich schließlich dort umbrachte. Das große
persönliche Engagement der beiden Gruppen der Theater-AG und die liebevoll in Handarbeit
erstellten Requisiten trugen zum großen Erfolg dieses Theaterabends bei.
Auch die Musik spielt in der Schule eine große Rolle. So war am 4. Oktober der
Jugendkammerchor aus Ahrensburg zu Gast, der eine bunte Mischung an Musikstücken zum
Besten gab. Im klassischen Bereich ist besonders der ”Wettbewerb Jugend musiziert” zu
nennen, der erstmals in der Geschichte der Deutschen Auslandsschulen auch außerhalb
Deutschlands stattfand. Veranstaltet wurde er in Helsinki, das alle nordeuropäischen
Deutschen Schulen dazu eingeladen hatte. Schülerinnen und Schüler aus Helsinki, Moskau,
Oslo und Dublin trafen sich, um gemeinsam in verschiedenen Musikrichtungen zu
musizieren. Nach vier Tagen voll von internationalen – nicht nur musischen – Erfahrungen,
konnten zwei erste und ein zweiter Preis in den Kategorien ”Streichinstrument mit Klavier”
und ”Blasinstrumente mit Klavierbegleitung” mit nach Stockholm gebracht werden.
Enge und herzliche Beziehungen werden außerdem zur schwedischen Katedralskola
(Kathedral-Schule) in Uppsala gepflegt. Diese Schule hat einen bilingualen
Deutschunterricht, in dem Deutsch nicht nur als Fremdsprache, sondern auch in
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern gesprochen wird. Damit ist diese Schule für einen
Schüleraustausch mit der DSS prädestiniert, der auch rege praktiziert wird. So besuchten sich
jeweils zwei 10. Klassen der Schulen gegenseitig, um aktuelle Fragen auf Deutsch zu
diskutieren, die Schulen miteinander zu vergleichen und dabei einander kennenzulernen und
die Kultur der anderen besser zu verstehen. Beim Gegenbesuch der 10a und 10b der DSS
gaben sich die Schüler aus Uppsala große Mühe, eine Stadtrallye für ihre Gäste zu
organisieren und einen ausführlichen Rundgang durch das – wie man feststellen musste
weitaus besser ausgestattete – Schulgebäude samt schmackhaftem Schulessen anzubieten.
Höhepunkt war für die Schüler das abschließende kul-i-jul-Programm, auf dem die Lehrer
177
beider Schulen ihre musikalischen, artistischen oder mimischen Talente unter Beweis stellen
mussten.
Im Rahmen des Biologieunterrichts konnte die DSP den bekannten schwedischen Professor
Ake Seiger an der Schule begrüßen, der einem Vortrag über die Parkinsonsche Krankheit
hielt. In plastischer Art und Weise und ohne zu sehr ins Fachspezifische abzugleiten, klärte er
seine Zuhörer aus der 12. und 13. Klasse über Entstehung, Symptome und
Behandlungsmöglichkeiten dieser tückischen Krankheit auf.
Ein traditioneller Höhepunkt in jedem Schuljahr ist der Frühjahrsbasar sowie der jährlich
stattfindende Weihnachtsbasar, zu denen der Elternbeirat der DSS Firmenspenden von
Unternehmen wie Lufthansa, BASF, BMW, Siemens, Swissair und Austrian Airlines aber
auch von schwedischen Unternehmen wie etwa Stena Line, erhalten konnte. Die Einnahmen
aus diesen Veranstaltungen tragen erheblich zur guten Ausstattung der Schule bei und helfen,
den Integrationsgedanken der DSS auch im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der
schwedischen Hauptstadt bewusst werden zu lassen.
5. Tschechien
5.1. Rahmenbedingungen zur Förderung der deutschen Sprache191
Kulturpolitische Grundlagen und Beziehungen
Die Jahre 1997/98 waren geprägt durch krisenhafte innenpolitische Entwicklungen, die am
30. 11.1997 zum Rücktritt der bürgerlichen Koalitionsregierung unter Ministerpräsident
Vaclav Klaus und am 02.01.1998 zur Bildung einer neuen, nur zur Hälfte aus Parteipolitikern
bestehenden Regierung unter dem früheren Zentralbankgouverneur Josef Tosovsky führten.
Staatspräsident Vaclav Havel wurde am 20.01.1998 im zweiten Wahlgang denkbar knapp für
eine zweite, fünfjährige Amtszeit gewählt, die er am 02.02.1998 antrat. Als Präsident
verkörperte Havel die Stabilität des noch jungen demokratischen Systems inmitten der Krise
der Parteien. Vaclav Klaus wurde Oppositionsführer, Ministerpräsident M. Zeman.
191 Länderkonzeption der Tschechischen Republik 1998: Auf der Grundlage der Länderkonzeption zur
Förderung der deutschen Sprache und der damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Tschechischen
Republik 1998 und auf der Grundlage der Länderaufzeichnung Tschechische Republik, Stand: März 1998.
178
Zu Deutschland gibt es weiterhin das intensivste, zugleich ambivalente bilaterale Verhältnis.
Präsident Havels Worte von 1995: ”Deutschland ist unsere Inspiration und unser Schmerz”,
besitzt unverändert Gültigkeit. Im Juni 2002 trafen Havel und der deutsche Bundespräsident
Rau sich in Prag, wobei sich die beiden Präsidenten bemühten, die im Vorfeld des
tschechischen Wahlkampfes aufgebrochenen Diskussionen um die Beneš–Dekrete zu
entschärfen und zur Versöhnung zu mahnen. Nach 13 Jahren Präsidentschaft auf dem
Hradschin trat der Dissident und Dichter Vaclav Havel, der sich immer wieder für die
Völkerversöhnung zwischen Tschechien und Deutschland eingesetzt hat, im Januar 2003 ab.
Im Februar 2003 hat das tschechische Parlament Vaclav Klaus, den politischen Kontrahenten
Vaclav Havels, der der Demokratischen Bürgerpartei angehört, im dritten Wahlgang zum
Staatspräsidenten gewählt. Diese Entscheidung verursacht für den tschechischen
sozialdemokratischen Regierungschef Vladimir Spidla und seine sozialliberale Koalition kurz
vor der Aufnahme seines Landes in die EU eine schwierige Situation.
Grundlage des bilateralen deutsch-tschechischen Verhältnisses ist der Freundschafts- und
Nachbarschaftsvertrag von 1992 sowie die Gemeinsame Erklärung über die gegenseitigen
Beziehungen und ihre künftige Entwicklung vom Januar 1997.
Die Kulturbeziehungen der tschechischen Republik mit Deutschland sind besonders eng und
haben seit 1989 einen beispiellosen Aufschwung genommen. Allgemein haben die
Bundesländer (allen voran Bayern und Sachsen) einen regen grenzüberschreitenden
Kulturaustausch entwickelt. Seit 1993 besteht in Prag ein Goethe-Institut, seit April 1997
gibt es zwei Koordinierungsstellen zur Förderung des deutsch- tschechischen
Jugendaustauschs in Pilsen und Regensburg.
Das zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der damaligen CSSR geschlossene
Kulturabkommen vom 11.4.1978 gilt auch heute noch für die Tschechische Republik, die
Verhandlungen über ein neues Kulturabkommen zwischen beiden Ländern wurden zwar
begonnen, aber seit 1995 nicht weiter fortgeführt. Im politisch-ökonomischen Kontext sind
die Beziehungen vor allem im wirtschaftlichen Bereich sehr eng: Deutschland ist für
Tschechien wichtigster Handelspartner und zugleich größter ausländischer Investor.
Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Gründen bilden auch die gemeinsamen kulturellen
Traditionen, die durch das jahrelange Zusammenleben entstanden sind, fruchtbare
Grundlagen für das Erlernen der deutschen Sprache und Kultur. Verstärkt wird das Interesse
an Deutsch durch dessen Rolle als traditionelle ”Nachbarsprache”, durch die gemeinsamen
Grenzen mit Deutschland und Österreich. Beeinträchtigt werden die kulturellen Beziehungen
179
durch die Last der Geschichte. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus traten auch in
Tschechien Deutsch und Englisch an die Stelle von Russisch als erste Fremdsprachen, wobei
im Schuljahr 1996/97 an allen Schulen mehr Schüler Deutsch (700.000) als Englisch
(650.000) lernten.
Charakteristik des Bildungswesens in Bezug auf DaF
Das tschechische Bildungssystem nach der Wende kann grob in drei Blöcke aufgeteilt
werden: Grundschule (Klassen 1 – 9), Mittelschule (Klassen 10 – 13) und
Hochschule/Universität, wobei die allgemeine Schulpflicht bis zur 9. Klasse geht und das
Abitur nach der 13. Klasse abgelegt wird. Der Besuch des Gymnasiums ist in zwei Formen
möglich: 8-stufig ab Klasse 5 oder 6-stufig nach Klasse 7 der Grundschule. Begabte Schüler
erhalten außerdem die Möglichkeit, nach Abschluss der Grundschule ein 4-stufiges
Gymnasium zu durchlaufen. Neben dem Gymnasium existieren noch eine Reihe anderer
weiterführender Schultypen, die ebenfalls zum Abitur führen, z.B. Fachschulen,
Berufsfachschulen und Berufsschulen mit dualem Charakter. Voraussetzung für den Besuch
aller weiterführenden Schulen ist eine Aufnahmeprüfung. Gleichgültig auf welchem Weg das
Abitur erreicht wurde, eröffnet es grundsätzlich den Zugang zu allen Studienfächern
(vorausgesetzt die Aufnahmeprüfung der Universitäten und Hochschulen wird bestanden).
Die überwiegende Anzahl der Schulen ist autonom und gestaltet selbstverantwortlich ihren
Haushalt und ihre Personalangelegenheiten.
Parallel zur Situation in der Slowakei ist das Ansehen des Lehrerberufs in der Gesellschaft
gering; die Gehälter liegen noch unter dem Landesdurchschnittsniveau und lassen kaum die
Ernährung einer Familie zu. Die Schule kann zwar zusätzlich zum Grundlohn noch eine 10
bis 20prozentige Leistungszulage gewähren, gleichzeitig aber den Lehrer als Angestellten
auch ohne großen Schutz entlassen. Etwa 70% aller Lehrkräfte sind Frauen, Männer wollen
nur selten in der Schule arbeiten
Die Fremdsprachenausbildung beginnt seit dem Schuljahr 1997/98 in den Grundschulen
obligatorisch ab Klasse 4, in vielen weiteren Grundschulen fakultativ schon ab der 1. Klasse.
Bereits ab 25 Schülern pro Klasse kann der Sprachunterricht geteilt werden, was den hohen
Stellenwert von Fremdsprachen in Tschechien unterstreicht. Seit 1996 werden auch
alternative Schulmodelle mit offenen Lern- und Unterrichtsformen erprobt. So können die
Eltern z.B. die übliche Notenbewertung von 1 bis 5 durch schriftliche Beurteilungen ersetzen
lassen oder Nichtversetzungen können durch Nachprüfungen revidiert werden. Diese
180
Regelungen könnten Deutsch zugute kommen, da es für schwieriger als Englisch gehalten
wird.
An den meisten Schultypen wird trotz solcher oder ähnlicher Reformansätze der
lehrerzentrierte Frontalunterricht praktiziert, der auch strenge Unterrichtsrituale wie z.B. das
Aufstehen zu Beginn der Stunde impliziert. Das Lernverhalten ist besonders durch
Auswendiglernen und Faktenwiedergabe gekennzeichnet. Beim fremdsprachlichen Unterricht
bedeutet dies vor allem eine starke Betonung der Grammatikregeln. Die Schüler sehen in
guten Noten die besten Voraussetzungen für ihren beruflichen Werdegang.
Alle Curricula sind so weit offen gefasst, dass für die Schulen noch genügend Freiraum für
die individuelle Gestaltung des Sprachunterrichts besteht. Im Programm ”Qualität und
Verantwortung” des Schulministeriums von 1994 werden für die Bildungspolitik die fünf
Schwerpunkte Standards (d.h. die einheitliche Festlegung von Inhalt und Niveau der
Schulbildung), Qualität (d.h. die systematische Kontrolle der Schulen seitens der
Schulaufsicht und der Öffentlichkeit), Finanzierbarkeit (d.h. unmittelbare Abhängigkeit der
Finanzierung vom jeweiligen Leistungsniveau der Schule und von der Qualität ihrer Arbeit),
Information (d.h. unproblematischer Zugang aller Verantwortlichen wie z.B. Eltern,
Arbeitgeber, Gemeinden und Staat zu den erforderlichen Informationen über das Schulwesen)
und Förderung (d.h. alle Maßnahmen, die zur Verbesserung der Arbeitsqualität von Schulen
und Lehrern führen), gesetzt.
Stellung von Deutsch im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen
”Das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache ist nach wie vor sehr hoch. Als erste
Fremdsprache ist Deutsch in der Präferenz der Schüler dem Englischen etwa vergleichbar.
Dabei ist Deutsch an berufsbildenden Schulen am häufigsten erste Wahl, an Gymnasien gibt
es eine leichte Präferenz für Englisch. Das deutsche Abitur kann neben der Deutschen Schule
Prag an den bilingualen Gymnasien in Prag und in Reichenberg erworben werden.
Zusätzlich zur Bibliothek des Goethe-Instituts in Prag gibt es Lesesäle mit deutschsprachiger
Literatur in Olmütz und Brünn.”192
Von den insgesamt 727.000 Grundschülern (zum 30.09.1997), die Fremdsprachen lernen,
entfallen 371.000 auf Englisch, 366.000 auf Deutsch und 7.500 auf Französisch (Russisch:
192 Politischer Halbjahresbericht Tschechische Republik, Stand: März 1998.
181
750, Spanisch: 363). Damit ergibt sich eine Verteilung von 51,0% für Englisch, 50,3% für
Deutsch und 1,0% für Französisch (Russisch: 0,1%, Spanisch: < 0,1%)
In den Sekundarschulen ergibt sich im Verhältnis von Deutsch und Englisch ein umgekehrtes
Bild: von den 427.000 Fremdsprachenschülern lernen 316.000 Deutsch (entspricht einem
Anteil von 66,9%), 294.000 Englisch (62,3%) und 27.000 Französisch (5,7%) (Russisch:
5.500, Spanisch: 5.200, jeweils ca. 1%). Auffällig ist, dass an Gymnasien mehr Schüler
Englisch (88,1%) als Deutsch (67,5%) lernen.
Einstellungen zu Deutsch und Deutschland
Weit verbreitet ist das Vorurteil, Deutschland wolle Tschechien kulturell und wirtschaftlich
vereinnahmen. Das Wort vom ”Ausverkauf” an die Deutschen ist Allgemeinplatz. Diese
Stereotypen sind besonders auf die negativen Erfahrungen mit den Deutschen im letzten
Jahrhundert begründet: Der Einmarsch der Wehrmacht ins Sudetenland und die
darauffolgende Zwangserrichtung eines ”Protektorat Böhmen und Mähren” durch Hitler
haben tiefe Spuren der nationalen Demütigung hinterlassen. Weiter belastet werden die
Einstellungen der Menschen zu Deutschland von den als ungerecht empfundenen
Forderungen der Sudetendeutschen Landsmannschaften nach einem ”Recht auf Heimat” und
Aufhebung der sog. Beneš-Dekrete. Die Vertreibung von Millionen Sudetendeutschen wird
vielfach nicht als Unrecht beurteilt, sondern als ”gerechte Strafe” für die Aggression der
Deutschen. Die Diskussion um die Benesch-Dekrete erfuhr eine Neuauflage im Jahr 2002 im
Zusammenhang mit dem Beitritt Tschechiens in die EU. Eventuellen
Rückerstattungsansprüchen der Vertriebenen wurde am 24. April 2002 vom tschechischen
Parlament eine Absage erteilt. Auswirkungen zeigt auch immer noch der Geschichtsunterricht
des alten Systems, der die Rolle der Deutschen in Böhmen verzerrt darstellte. Auch die EU-
Kommission befand am 17.10.02 die Dekrete seien mit europäischem Recht vereinbar.
Entscheidend sei die politische Situation, die Präsident Eduard Benesch bei seiner Rückkehr
im Mai 1945 aus dem Londoner Zwangsexil vorgefunden habe.
Die Motivation zum Deutschlernen ist somit wesentlich durch wirtschaftlichen Pragmatismus
zu erklären; Deutschland ist nicht nur größter Handelspartner der Tschechischen Republik,
sondern teilt sich zusammen mit Österreich auch die längste Sprachgrenze des Landes. Hinzu
kommt zweifellos auch die traditionelle Rolle des Deutschen als Akademiker-Sprache,
besonders unter Historikern und Juristen.
182
Bedingungen für den Deutschunterricht an Schulen
In Prag und Reichenberg gibt es Spezialgymnasien mit bilingualem Zweig, die zur deutschen
und tschechischen Hochschulreife führen, daneben gibt es die Deutsche Schule Prag als
Auslandsschule. Außerdem führen 13 Schulen zum Deutschen Sprachdiplom der KMK. Im
Schuljahr 1997/98 waren insgesamt 65 entsandte Lehrkräfte, davon 54 Programmlehrkräfte
und 11 Auslandsdienstlehrkräfte in Tschechien tätig.
Die Berufsschulen, die eher mit deutschen Fach- bzw. Fachoberschulen zu vergleichen sind,
umfassen drei- bis fünfjährige Ausbildungsgänge im Sekundarbereich 2, sowie zwei- bis
dreijährige nicht-universitäre Ausbildungsgänge nach dem Abitur. In dieser Schulform findet
sich die höchste Zahl an Deutsch lernenden Schülern im tschechischen Schulsystem.
Qualitativ jedoch bleibt die Sprachbeherrschung hinter der in anderen Schultypen zurück, was
damit zusammenhängt, dass sich der Sprachunterricht in diesen Schulen an berufsrelevanten
(Grund-) Kenntnissen orientiert.
Versorgung mit Unterrichtsmaterialien
Die Versorgung mit Lehr- und Lernmaterial ist gut. Die meisten Grundschulen verwenden das
einheimische Lehrbuch ”Heute haben wir Deutsch”, an zweiter Stelle folgt das Lizenzwerk
”Wer? Wie? Was?” aus dem Gilde-Verlag. Zwar wurden Autoren und curriculare Arbeit nach
der Wende massiv vom Ausland unterstützt, der heutige leistungsfähige Zustand der
einheimischen Verlage im Lehrmittelbereich macht eine anhaltende finanzielle Förderung
allerdings obsolet: Seit 1990 erschienen auf dem tschechischen Lehrbuchmarkt (ohne
Lizenzausgaben) u.a. 21 Titel im Grundschulbereich (einige davon sogar mehrbändig), 23
Titel für Fachsprachen und 27 Titel mit Grammatik-, Lehr- und Wortschatzübungen.
Lehrmaterialien für den Deutschunterricht werden von insgesamt 48 tschechischen Verlagen
bereitgestellt.
Bedingungen für das Studium an Hochschulen
Angehende Deutschlehrer für Grundschulen (Klassen 1 – 9) absolvieren ein vierjähriges
Magisterstudium an pädagogischen Fakultäten oder der Pädagogischen Hochschule in
Königgrätz, in dem neben Deutsch ein zweites Fach gleich gewichtet studiert wird. Dazu
kommen zwei bis drei obligatorische Praktika. Das Studium endet mit den Magisterprüfungen
und einer Diplomarbeit. Deutschlehrer im Gymnasialbereich (Klassen 10 – 13) durchlaufen
183
einen fünfjährigen Magisterstudiengang an pädagogischen oder philosophischen Fakultäten.
An den pädagogischen Fakultäten ist die wissenschaftliche Komponente des Studiums kleiner
als an den philosophischen, dafür schließen erstgenannte mehrere Schulpraktika ein. Das
Germanistikstudium an philosophischen Fakultäten eignet sich daher eher für spezielle
Ausbildungsgänge wie etwa Sprachgeschichte, Linguistik oder Literaturwissenschaft
Studenten aus solchen Studiengängen müssen für das Lehramt an Gymnasien eine zusätzliche
pädagogische Ausbildung innerhalb ihres Studiums absolvieren, die auch zwei kurze
Unterrichtspraktika einschließt und kein Referendariat anschließt. Die Gestaltung der
Studiengänge und Curricula ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich und verändert
sich häufig; dies erschwert den Wechsel während des Studiums.
Für Absolventen der Germanistik an philosophischen Fakultäten gibt es in der Regel drei
mögliche Berufsfelder: Etwa ein Drittel der Absolventen wird Deutschlehrer an den Schulen,
ein geringer Prozentsatz der Absolventen qualifiziert sich im akademischen Bereich (vor
allem in der wissenschaftlichen Ausbildung, meist über ein dreijähriges
Promotionsstipendium zum Dr. phil.), und der größte Teil wandert in die freie Wirtschaft ab,
z.B. als Dolmetscher oder Übersetzer großer Firmen, zu Zeitungen oder Verlagen. Gerade für
diese letztgenannte Berufsgruppe (und aufgrund rückläufiger Studentenzahlen) beginnen
einige pädagogische Fakultäten, Studiengänge mit konkretem betriebswirtschaftlichen Bezug
zu konzipieren. So existieren beispielsweise in Budweis ein Bakkalaureatstudiengang
”Deutsch und Russisch für die ökonomische Sphäre”, oder in Troppau ein vierjähriger, Zwei-
Sprachen-Kombinationen umfassender Studiengang, der explizit auf die Erfordernisse der
Wirtschaft ausgerichtet ist.
Auch der damalige tschechische Bildungsminister Jiri Grusa betonte die Sprache als
Möglichkeit des Austauschs mit benachbarten Kulturen auf den verschiedensten Gebieten:
”Sprachkenntnisse im Allgemeinen und Deutschkenntnisse im Besonderen bereichern auf
verschiedenen Ebenen und auf vielfältige Weise. Sie erleichtern das Reisen, die
Kommunikation mit den Nachbarvölkern im Alltag. Sie helfen uns, intensiver miteinander
Handel zu betreiben und die Zusammenarbeit im Wirtschaft und Industrie zu vertiefen. Sie
öffnen den Weg zum Austausch in Unterricht, Wissenschaft und Forschung. Sie erlauben uns
schließlich durch die Lektüre deutschsprachiger Werke in die geistigen Sphären unserer
Nachbarn vorzudringen und tragen so dazu bei, dass aus dem vormals Fremden etwas
Vertrautes wird, zu dem wir freundschaftliche Gefühle hegen können.
184
Aus eigener Erfahrung weiß ich, welch ein mühevolles Unternehmen es ist, sich die deutsche
Sprache anzueignen. Trotzdem möchte ich Ihnen Mut zusprechen und Sie dazu aufrufen,
nicht müde zu werden, sich dieser Mühe zu unterziehen, denn Sie werden später reichlich
dafür beschenkt werden.”193
5.2. Interview mit dem Leiter der Abteilung für Auslandsbeziehungen
(September 1998)
E. A: Herr Dr. C, Sie sind im tschechischen Schulministerium verantwortlich für die deutschen
Mittlerorganisationen in der Tschechischen Republik?
Dr. P. C: Ja, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, das Goethe-Institut, der pädagogische
Austauschdienst und der DAAD gehören zu den von mir betreuten Institutionen. In Tschechien gibt es derzeit
60 aus der Bundesrepublik entsandte Lehrkräfte, die an bilingualen Diplomschulen – es gibt landesweit 10
Gymnasien, die das Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz anbieten – unterrichten.
E. A: Wie gestaltet sich für Sie die Zusammenarbeit mit der deutschen Seite?
Dr. P. C: Die Zusammenarbeit mit der Lehrerentsendestelle in Deutschland ist gut. Es gibt in der Tschechischen
Republik eine heimische Sprachprüfung in Deutsch, die sich besonders für Personen eignet, die in einem
tschechischen Unternehmen arbeiten. Darüber hinaus existiert die Sprachprüfung im Goethe-Institut, die sich
besonders an solche Menschen richtet, die eine Beschäftigung in einem deutschen Unternehmen anstreben.
E. A: Tschechien möchte der EU beitreten. Gibt es Probleme im Bildungsbereich?
Dr. P. C: Zu bemängeln sind die Ungenauigkeiten in der Präsentation der Bildungspolitik der EU in Tschechien.
Darin wird von Förderprogrammen gesprochen, was jedoch nicht der Wahrheit entspricht, da Tschechien diese
Programme selbst finanziert. Es ist mir aus politischen Gründen wichtig, dies zu betonen, da vollwertige EU-
Mitglieder für derartige Programme stets selbst zahlen müssen.
E. A: Sie sind für die europäische Integration im tschechischen Bildungswesen zuständig?
Dr. P. C: Ja, der Antrag auf Mitgliedschaft im Bereich ”Schule” ist bereits gestellt. Auf dem Luxemburger EU-
Gipfel 1998 wurden 6 Länder aufgefordert, ein Positionspapier zu erarbeiten. Die EU-Bildungslegislation ist in
einem Gesetzestext vorgegeben, worauf das nationale Bildungsprogramm abgestellt werden muss. Bevor sich
die volle EU-Mitgliedschaft vollziehen kann, müssen beispielsweise das tschechische Berufsbildungssystem und
die Schulgesetze geändert werden. Es gibt z.B. in Tschechien Berufe, bei denen bisher eine Trennung nach
Geschlechtern vorgeschrieben ist. Dies widerspricht den Vorgaben aus Brüssel. In der Schulgesetzgebung muss
Tschechien sich darauf einstellen, dass man auf Migrantenkinder in der Frage der Unterrichtssprache Rücksicht
193Grusa, Jiri.: Aus dem Vorwort des Bildungsministers der Tschechischen Republik, Jiri Grusa, zur Broschüre:
”Deutsch in der Tschechischen Republik” Goethe-Institut Prag, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Hrsg.
Prag/Köln u. a.. 1998/1999.
185
nehmen muss. Dies impliziert aber eine finanzielle Frage, da wir beispielsweise keine 10.000 Kinder aus
anderen EU-Staaten auf eigene Kosten unterrichten können und wollen.
E. A: Wie stehen Sie zu einer Weiterentwicklung der Deutschen Schule Prag in eine Begegnungsschule?
Dr. P. C: Die Deutsche Schule Prag ist autark und autonom, jedoch würden wir auf tschechischer Seite eine
Begegnungsschule bevorzugen. Die Vorgabe der schulischen Rechtsgebung an der DSP müsste sich dann
allerdings am tschechischen Schulgesetz orientieren. Dies bedeutet, dass die Kinder in Tschechisch unterrichtet
werden müssten, und die Pflichtschulzeit für Kinder unter 15 Jahre sich nach den tschechischen Gesetzen zu
richten hätte. Bis 1995 gab es in Tschechien viele private Bildungseinrichtungen, da das alte Schulgesetz
keinerlei Einschränkungen kannte. Mit der Einführung des neuen Gesetzes im gleichen Jahr wurden
Einschränkungen vorgenommen. So müssen sich nun auch Privatanbieter dem Schulgesetz unterwerfen, was
auch die Deutsche Schule betrifft – sie soll sich letztendlich sogar in eine Begegnungsschule umwandeln. Dies
wird allerdings nicht allzu schnell vor sich gehen können, eine Umgestaltung der DSP wäre ab 2001 möglich. Es
müsste eine Ausnahmeregelung in das Schulgesetz eingebaut werden, da auch schon von französischer Seite,
vom Lycée Prague 5, bereits der Wunsch nach Umwandlung geäußert wurde. Die Ausnahme müsste sich auf
außenpolitische Interessen berufen. Trotzdem ist der Parameter ”Tschechisch als Unterrichtssprache” für mich
wesentlich.
E. A: Sie betonen als Parameter ”Tschechisch als Unterrichtssprache”?
Dr. P. C: Ja, da die Mittlerorganisationen vor allem auf Sprachexport eingestellt sind. Freilich kommuniziert das
Goethe-Institut mit dem Deutschlehrerverband und dem Lehrstuhl für Germanistik, was mich nicht stört, ebenso
wenig wie das geflügelte Wort des ”Sprachexports” in diesem Zusammenhang. Immerhin wird der Markt durch
Angebot und Nachfrage bestimmt, und dieser Logik will ich mich nicht widersetzen. Es gibt ja schließlich auch
40 tschechische Lektorate im Ausland.
E. A: Es gibt auch bilinguale Schulen in Prag.
Dr. P. C: In bilingualen Schulen, wie der Schule im Bezirk Prag 3, liegen die meisten Kompetenzen bei der
jeweiligen Schulverwaltung, der Schulminister hat hier nur beschränkte Einflussmöglichkeiten. So bestimmen
diese Schulen beispielsweise die Stellvertreter des Direktors, die Anzahl der Klassen, Aufnahmeprüfungen
sowie finanzielle Angelegenheiten. Hier sorgt das staatliche Gymnasium sowohl für die Vermittlung des
deutschen, wie auch des tschechischen Bildungsgutes. Die Auslandsabteilung für europäische Integration in
Sachen Bildung, dessen Leiter ich bin, hat 35 bilaterale Verträge über schulische Zusammenarbeit
abgeschlossen. Darunter waren z.B. Verträge mit Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen
usw. . Beide Seiten bieten einander Stipendien, Sommer-Unis u.ä. . Es gibt auch Hospitations-Aufenthalte oder
Lehrerfortbildung wie in Dillingen.
E. A: Immer wieder werden Schwierigkeiten benannt, die durch ein fehlendes Kulturabkommen entstehen...
Dr. P. C: Zum Kulturabkommen führte ich viele Gespräche mit dem Auswärtigen Amt, die jetzt allerdings
eingefroren sind. Die tschechische Rechtsordnung kann man wegen eines Kulturabkommens nicht ändern. Im
Ausländergesetz ist z.B. eine Frist von 60 Tagen vorgesehen, in der bestimmte Formalitäten erledigt werden
müssen. Das betrifft hier z. B. die einreisenden Lehrer. Es gibt eine freiwillige Vereinbarung, dass die deutschen
Anträge binnen einer Frist von 30 Tagen erledigt werden. Die deutsche Seite möchte hier Inventur machen. Von
60 Lehrern haben aber nur drei bis vier Probleme mit den Behörden. Sie müssen einen Nachweis über ihre
186
Wohnverhältnisse beibringen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Oft genügt eine diesbezügliche
Erklärung der Botschaft nicht, sondern die Fremdenpolizei verlangt einen notariell beglaubigten Mietvertrag.
Hierbei macht die Fremdenpolizei keinen Unterschied etwa zwischen Usbeken und Deutschen. Die Deutschen
erleben hier ihrerseits das Ausländerrecht der EU.
5.3. Das Goethe-Institut Prag
Kulturprogramme
Es finden unterschiedlichste Veranstaltungen aus den Bereichen Wissenschaft und Literatur,
Musik, Film/Fernsehen, Medien/Rundfunk/visuelle Kommunikation und Theater/Theater-
projekte sowie verschiedene Ausstellungen statt. Im Rahmen der Wortveranstaltungen las
z.B. der Berliner Autor und Jurist Bernhard Schlink aus seinem mehrfach ausgezeichnetem
Roman ”Der Vorleser”. Ebenfalls im Herbst fand das Mediensymposium ”Softmoderne” statt,
auf dem mit renommierten Experten eine Bestandsaufnahme der interaktiven Netzliteratur
versucht wurde. Beispielhaft für die Ausstellungen des Goethe-Instituts Prag war etwa die
Vernissage zu Klaus Kinski und dessen Regisseur Werner Herzog mit Fotografien des
Schweizer Kameramanns Beat Presser, oder die in Brünn gezeigte Ausstellung ”Der
geschundene Mensch” von Günther Uecker, Mitbegründer der Künstlergruppe ”ZERO”.
Passend zur Vernissage führte das Institut z.B. im Bereich Film und Medien die
bedeutendsten Filme Werner Herzogs auf. Im Theatersektor gab beispielsweise die
Volksbühne Berlin ein Gastspiel, in dem sie das Tanzstück ”Frida Kahlo”, - dem Lebenswerk
einer politisch aktiven mexikanischen Malerin gewidmet - von Johann Kresnik in Pilsen zum
besten gab. Auch zum Thema “Luther, Bach, Goethe – Kultur aus Thüringen” fanden 1998
Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen statt. Im
Jahre 1998 besuchten 40.912 Zuschauer die Programme des Instituts.
Die tschechische Schriftstellerin Lenka Reineròva wurde im März 2003 in Weimar mit der
Goethe-Medaille ausgezeichnet, die das Goethe-Institut Inter Nationes für besondere
Verdienste für die deutsche Sprache vergibt. Lenka Reineròva konnte als tschechische Jüdin
als Einzige ihrer Familie dem Nazi-Terror entfliehen. Sie, die bilingual in Westböhmen
aufgewachsen war, schrieb trotz der belastenden Erfahrung mit Hitler-Deutschland, weiter auf
deutsch.
187
Deutsch lehren und lernen
Das Goethe-Institut Prag steht sowohl interessierten tschechischen Bürgern, als auch
tschechischen Deutschlehrern für Sprachkurse bzw. Fortbildungsveranstaltungen offen.
Deutschkurse für tschechische Bürger sind unterteilt in Standardkurse, die wiederum in
Grund-, Mittel-, und Oberstufenkurse aufgegliedert sind. Diese werden jeweils semesterweise
angeboten. Daneben finden sich auch Spezialkurse, etwa in Fachdeutsch für Wirtschaft, Bank,
Jura oder Journalistik. Außerdem finden spezielle Grammatik-, Konversations-,
Landeskunde- Literatur- und Kulturkurse statt. Es kann auch das Kleine bzw. Große Deutsche
Sprachdiplom (KDS, GDS) abgelegt werden. Für Deutschlehrer wird pädagogische
Verbindungsarbeit geleistet, in Form von Veranstaltungen aus den Bereichen Bildungspolitik,
Sprachpolitik, Didaktik/Methodik, Fachdeutsch, Fortbildungsdidaktik, Landeskunde,
Linguistik, Literatur, Mediendidaktik sowie Phonetik. Besonders erwähnenswert ist hier z.B.
der Deutschlehrertag 1997 mit 35 Einzelveranstaltungen, Workshops, Vorträgen und Filmen
in Zusammenarbeit mit Professor Eberhard Piepho. Ähnliche Ansätze hatte auch die
Curriculumentwicklung ”Training of Trainers”, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
Bratislava und der Robert Bosch-Stiftung.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 14513 Exemplaren, davon 12456 Bücher,
95 Zeitungen und Zeitschriften und 1962 audiovisuelle Medien. Mit über 3000
Entleiher/innen im Jahr 1998 war die Bibliothek gut genutzt. Sie bietet vor allem den
deutschlernenden tschechischen Bürgern und Lehrern nützliche Hintergrundmaterialien und
Hilfsmittel.
5.4. Interviews im Goethe-Institut
Interview (Interviewerin E.A.) mit der Leiterin des Goethe-Instituts Prag, G. B.
E. A: Frau B, Sie konnten an den verschiedensten Orten der Welt Erfahrungen in den Goethe-Instituten
sammeln.
G. B: Ich bin seit 1981 Mitarbeiterin im Goethe-Institut. Bevor ich nach Prag kam, war ich in den Goethe-
Instituten in Nairobi und Karthum sowie in Berlin und New York tätig. Aus meinen Erfahrungen habe ich
gelernt, dass die Goethe-Institute in den verschiedenen Ländern oft völlig verschiedene Hintergründe haben. So
muss man etwa in New York die Leute “mit dem Lasso einfangen”, um sie zur Teilnahme an einer
Veranstaltung zu bewegen. In Afrika dagegen fühlte man sich wie in einer Oase der Ruhe. Seit 1996 leite ich
188
das Goethe-Institut in Prag, welches ein Regionalinstitut ist. Darin betreue ich 8 mittelosteuropäische Länder, 9
Institute und 20 deutsche Lesesäle.
E. A: Sind die 8 mittelosteuropäischen Länder, die Sie betreuen miteinander vergleichbar?
G. B: Im Kontext europäischer Bündnisstrukturen sind Polen, Ungarn und Tschechien einerseits, die Slowakei,
Rumänien, Bulgarien und Kroatien andererseits miteinander vergleichbar. In den Ländern Mittelosteuropas
besteht ein großes Informationsbedürfnis. Es existieren verschiedene Bibliotheken und insgesamt 42 Lesesäle,
davon 20 in Mittelosteuropa und 18 in Zentral- und Ostasien. Diese werden mit Mitteln des Auswärtigen Amtes
und mit Mitteln des jeweiligen Landes errichtet und unterhalten. 35 weitere Lesesäle stehen zur Diskussion. Die
Betreuung der Lesesäle würde eigentlich eine zusätzliche Stelle erfordern...
E. A: Im Goethe-Institut Prag gibt es eine große Bibliothek...
G. B: ...diese bietet als die erste ihrer Art eine vollautomatische Ausleihe und wird sehr gut besucht. So werden
alle Medien in Prag pro Jahr drei mal ausgeliehen. Seit 1997 erfolgt bei uns im Goethe-Institut auch die
Betreuung neuer Lehrwerke.
E. A: Wie sieht die Situation bei Ihnen im Goethe-Institut konkret aus?
G. B: Weltweit werden in den Goethe-Instituten Sprachkurse angeboten. Außerdem wird an der Schaffung
internationaler Netzwerke in der Curriculum-Entwicklung gearbeitet. In den mittelosteuropäischen Staaten ist
Deutsch die zweite Fremdsprache, weshalb 2/3 aller Deutsch lernenden Menschen aus diesen Staaten kommen.
Sehr gefragt sind auch die Fachsprachen Wirtschaftsdeutsch sowie juristisches Deutsch. Hierzu ergänzend dient
auch das Kulturprogramm, welches gut genutzt wird. Diese beiden Fachrichtungen der deutschen Sprache
werden besonders auch von den Beamten erlernt, die in den Harmonisierungsausschüssen für den EU-Beitritt
Tschechiens arbeiten. Beim Unterricht dieser Fachsprachen wirken auch Österreich und die Schweiz mit, genau
wie an der Sprachverwaltung Deutsch in Tschechien.
Das Publikum wird generell langsam wählerischer: fehlende kulturpolitische Konzepte fallen auf. Anfang 1999
findet am Goethe-Institut Prag eine Veranstaltung über die Bedeutung der Kultur im europäischen
Einigungsprozess statt. Auch der Kulturkanal ”Arte” verstärkt sein Engagement in bzw. seine Berichterstattung
aus Mittelosteuropa. Im Oktober wird aus diesem Grund ein Festakt von ”Arte” stattfinden.
Zum Deutschlandbild in Mittelosteuropa trägt maßgeblich auch das Fernsehen bei, woraus die Menschen ihre
Informationen beziehen. Zudem findet bald eine Ausstellung zum Thema ”Bayern in Kiew” statt sowie eine
Übersetzung von Habermas‘ ”Anthologie”, die bei Inter Nationes angefertigt wurde.
E. A: Es wird beim Goethe-Institut jetzt viel über die Rolle der Regionalbeauftragten gesprochen. War dies auch
ein Thema in der Regionalkonferenz?
G. B: Ja. Dieses Thema war neu. Man will kürzere Leitungsspannen erreichen und zu einer Dezentralisierung
kommen. Momentan stehen drei verschiedene Modelle zur Diskussion. Der bzw. die Regionalbeauftragte soll
Vorgesetzte/r der anderen Institutsleiter in der Region sein. Das bedeutet, der oder die Regionalbeauftragte führt
Jahresgespräche, auf denen Ziele benannt und Jahresprogramme vorgestellt werden. Der oder die
Institutsleiter/in bleibt natürlich weiterhin Chef des Hauses. Die Regionalbeauftragten sollen zukünftig auch bei
der Beurteilung mitwirken. Bis zur nächsten Konferenz im Sommer 1999 soll dieses Modell stehen. Wichtig
dabei ist vor allem das Jahresgespräch, das als Einzelgespräch stattfindet, und partizipative Mitarbeiterführung
bewirken soll. Man verständigt sich über Ziele, die anschließend evaluiert werden sollen.
189
E. A: Wie steht es um den Haushalt des Goethe-Instituts Prag?
G. B: Es gibt für die Programmarbeit einerseits, und die Spracharbeit andererseits einen Sockel, der aus
Erfahrungswerten besteht. Dieser Sockelbetrag richtet sich nach Größe und Leistungsfähigkeit des Instituts. Für
die Programmarbeit entspricht dieser Sockel ungefähr einem Betrag von 70.000 DM und für die Spracharbeit
einem Betrag von 80.000 DM. Dazu gibt es Zuschüsse in etwa gleicher Höhe aus Sondergeldern. Interessant
dabei ist, dass für die Kulturarbeit in allen Goethe-Instituten 16 Millionen DM ausgegeben werden, die vom
Auswärtigen Amt kommen. 40 Millionen DM kommen über die Partner hinein. Lediglich 5 Millionen DM
kommen von den Sponsoren. Hierbei zeigt sich, dass unsere Partnerinstitute nicht nur für die Dialogfähigkeit
unserer Institute wichtig sind, sondern auch für unsere Finanzierung. Generell wird etwa ein Drittel der
Ausgaben für Kulturprogramme ausgegeben, und zwei Drittel für die Spracharbeit.
E. A: Wie erfolgte für Sie der Einstieg in Prag vor zwei Jahren?
G. B: Das Goethe-Institut Prag wurde mit einem unglaublichen Aufwand aufgebaut. Dr. Blos, der jetzt in
Madrid ist, hat die Beziehungen zu den wichtigsten Institutionen der Stadt aufgebaut und mir diese sehr
sorgfältig ”übergeben”. Seine Hauptaufgabe war es, die seit 40 Jahren aufgestauten Bedürfnisse zu decken, was
ihm sehr gut gelang.
Als ich 1996 Institutsleiterin wurde, vollzog ich als erstes einen Schwenk. Mir ist eine Hinwendung zum
heutigen Deutschland wichtig. Deshalb bemühe ich mich, besonders auch jüngere Deutsche hier vorzustellen, da
die Tschechen sehr wenig über das heutige Deutschland wissen. Ich möchte also den Dialog zwischen
Deutschen und Tschechen herstellen. Noch ist dieser Dialog deutlich überlagert von der Diskussion, die von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgeht, aber meiner Meinung nach repräsentieren die Sudetendeutschen
nicht die Mehrheit bei uns.
E. A: Haben Sie denn mit der Landsmannschaft auch im Goethe-Institut zu tun?
G. B: Ja, das Bundesministerium des Inneren stellt Mittel für Begegnungszentren bereit. Wir erhalten daraus
31.000 DM. In dieser Woche findet hier ein Treffen der Leiter der Begegnungszentren statt. Ich glaube, auf
diesem Wege kann man den Dialog zwischen Sudetendeutschen und Tschechen fördern. Man kann das hiesige
Deutschlandbild aktualisieren, was dringend notwendig ist. Für uns bedeutet das ein verstärktes Engagement in
der Provinz, wo sich die Begegnungszentren befinden. Diese Stationen in der Provinz können dadurch intensiver
mit uns im Goethe-Institut zusammenarbeiten und z.B. Materialien von uns erhalten oder mit uns entwickeln.
E. A: Wie ist die Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern?
G. B: Die Zusammenarbeit ist hervorragend, wobei auch die tschechischen Institutionen über knappe Mittel
klagen. Wir haben zu allen wichtigen Einrichtungen hier einen guten Kontakt, sei es die Karls-Universität, das
Tanztheater, die Film- oder Kunsthochschule. Auch in Zukunft wollen wir auf ein kooperatives Miteinander in
unseren Veranstaltungen drängen. Wir sollen beispielsweise eine Veranstaltung zum Thema ”Multimedia und
Kunst” zusammen mit unseren tschechischen Partnern veranstalten. Obwohl diese Veranstaltung schon sehr
kurzfristig stattfinden soll, bemühen wir uns intensiv, da wir das Thema für sehr zukunftsträchtig und
förderungswürdig halten.
Interview mit der Programmsachbearbeiterin, Frau L
Frau L hat 1990 das Goethe-Institut Prag mit gegründet, das zunächst nur aus zwei Personen bestand.
190
E. A: Was war am Anfang Ihrer Arbeit hier Ihre wichtigste Aufgabe?
M. L: Im Kulturbereich musste ich sensible Fragen aufarbeiten, z.B. die Frage der Vertriebenen, der Juden oder
der Intellektuellen. Wir hielten literarische Lesungen ab, die all diese heiklen Themen beinhalteten.
E. A: Durch die Vertreibung ist die multikulturelle Identität doch gebrochen. Wie ist die Situation jetzt?
M. L: Das ist richtig, die Deutschen und Juden sind praktisch alle vertrieben oder ausgewandert. Wir führten zu
dieser Thematik eine Veranstaltung mit dem Titel ”Verlorene Geschichte” durch. In vielen Vorträgen wurde die
Historie aufgearbeitet.
E. A: Wie gestaltet sich die multikulturelle Zusammenarbeit in Prag?
M. L: Diese Zusammenarbeit verläuft vor allem trilateral, auf polnisch-tschechisch-deutscher Ebene und ist sehr
intensiv. Dabei spielt die Problematik der Sudetendeutschen natürlich auch noch eine Rolle.
E. A: Unsere gemeinsame Geschichte ist ja sehr belastend. Wie bringt man die unterschiedlichen Partner
zusammen?
M. L: Das Goethe-Institut ist neutral, d.h. es kann in Konkurrenz zueinander stehende Partner zum Gespräch
einladen und vermitteln. So haben wir z.B. eine Ausstellung in Theresienstadt mit vorbereitet. Die
Dokumentation erfolgte dabei zusammen mit polnischen Jugendlichen, und es fand eine Diskussion über Leben
und Werk der tschechischen Juden statt. Wichtig ist, dass man in Prag nicht provokativ agiert, es gibt hier
deutliche Tabugrenzen, die nicht durchbrochen werden dürfen. Wir haben wertvolle Freundschaften zu den
hiesigen Partnern aufgebaut, und um diese nicht zu gefährden, müssen wir mit unseren Projekten hier sehr
dezent vorgehen.
E. A: Wie empfinden Sie die Präsenz Deutschlands in Prag?
M. L: Deutschland ist in der Medienlandschaft nicht präsent. Der deutsche Massentourismus in Prag verbindet
sich nicht mit dem Deutschland der Arbeitslosigkeit.
E. A: Müsste Ihrer Meinung nach ein anderes Deutschlandbild entstehen?
M. L: Das Goethe-Institut muss mit daran arbeiten, ein anderes Deutschlandbild zu erstellen, es muss eine
Stimme für dieses andere Bild sein, z.B. in Theresienstadt. Ich denke, das Goethe-Institut ist dafür ein gutes
Instrument.
E. A: Wie kann ein anderes Deutschlandbild konkret entstehen, und wie kann das Goethe-Institut darauf
einwirken?
M. L: Eine gute Möglichkeit sind unsere Austauschprogramme. So gibt es z.B. 15 Stipendienplätze in
Deutschland, jeweils für 4 bis 8 Wochen. Dort lernen die jungen Tschechen Deutschland kennen und kommen
mit einem ausgewogenen Deutschlandbild zurück. Es ist auch wichtig, dass Journalisten nach Deutschland
gehen, und dass sie das Land auf individuell zusammengestellten Reisen kennenlernen.
E. A: Was könnten Sie außerdem für ein neues Deutschlandbild tun?
M. L: Wir haben z.B. ein kritisches Medienseminar geboten. Es ist wichtig, die sich rasch verändernde
Medienlandschaft in unseren Ländern darzustellen. Hier sei das Goethe-Institut als Trendsetter dabei. Auch die
germanistische Abteilung der Karls-Universität hat an diesem Medienseminar teilgenommen. Ein Thema dieses
Seminars war etwa ”Medien und Gewalt”, wozu drei Fachleute aus Deutschland gekommen waren, und der
Kulturreferent war ein Tscheche. Dieses Thema ist auch hochaktuell für Tschechien.
191
E. A: Noch einmal zum 100. Geburtstag von Bert Brecht. Wie haben Sie die Möglichkeit wahrgenommen, ihn
zu präsentieren?
M. L: Unter den vielen Möglichkeiten, das Thema Brecht im Jahre seines 100. Geburtstages zu präsentieren,
haben wir uns für ein Programm entschieden, das den Theatermann Brecht so authentisch wie möglich zeigt. Es
versammelt erstmalig alles noch vorhandene Filmmaterial, das Brecht als Regisseur sichtbar macht. Der Kurator
dieses Programmes – er ist Autor eines Buches über Brecht – gibt eine Einführung in die Filme. Er hat außerdem
die Texte für die Filme gestaltet, die in deutschem Orginalton ausgestrahlt und simultan übersetzt werden. Über
unser Programm haben wir das Brecht-Zitat von 1926: ”Der Film macht dem Drama das Bett” geschrieben.
E. A: Was wird denn im einzelnen dargestellt?
M. L: Ich nenne Ihnen einige Dinge: Am Montag, den 28. Juni lief der Film ”Die Mysterien eines Frisiersalons”
von 1923, ein 24-minütiger Stummfilm mit Zwischentiteln, den Bert Brecht zusammen mit Erich Engel gedreht
hat. Der junge Brecht inszenierte diese Groteske mit dem legendären Münchner Komiker Karl Valentin, dessen
Kunst Brecht in grellere Bahnen führte. Oder der am 11. Juni aufgeführte Brecht-Film ”Die Dreigroschenoper”
von 1931, der von Georg Wilhelm Pabst inszeniert wurde. Dieser berühmte Film mit seinen neblig-diesigen
Bildern vom Hafenviertel wurde besonders durch seine optischen Brechungen mittels Spiegeleffekten, sowie
durch weich angelegte Großaufnahmen zum Klassiker seines Genres. Auch die Brecht-Klassiker ”Die Mutter”
von 1958, und ”Mutter Courage und ihre Kinder” von 1961, die nach seinem Tode gedreht wurden, hatten wir
im Programm. ”Mutter Courage und ihre Kinder” stellte die berühmteste Inszenierung des Berliner Ensembles,
Brechts Wirkungsstätte, dar, welche bei den Theaterfestspielen 1954 in Paris sowohl als Stück wie auch als
Inszenierung den ersten Platz erhielt. Beide Filme setzten der Schauspielkunst von Helene Weigel ein
legendäres Denkmal und halten die historischen Leistungen Brechts fest.
Erwähnenswert ist auch unser Tanzfestival mit Anna Huber, das in diesem Monat stattfindet. Seit diesem Jahr
gilt die junge Schweizer Tänzerin und Choreographin, die 1989 nach Berlin übersiedelte und ihre Ausbildung
bei den ganz Großen ihres Faches erhielt, als Geheimtipp. Nach ihrem Auftritt beim Tanz-Zeit-Festival 1995
schwärmen die Kritiker von ihr. Unser Festival ”Tanec Praha” zeigt zwei Soloproduktionen von Anna Huber an
zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Am ersten Abend, ”in zwischen räumen”, wird sich ein menschliches
Wesen seines Körpers bewusst, entdeckt seine Möglichkeiten und stößt auf innere und äußere Grenzen. Das
Solo ist ein Spiel um imaginären Raum und reale Raumbegrenzungen. In ”brief letters” malt die Tänzerin am
nächsten Abend Körperbriefe in die Luft und der Musiker schickt Töne durch den Raum. Tänzerin und Musiker
versuchen den Dialog in zwei unterschiedlichen Sprachen, wobei verstörende und betörende Klang- und
Körperbilder entstehen.
E. A: Wie sieht es mit der Spracharbeit in Prag aus?
M. L: Die Sprachabteilung des Goethe-Instituts Prag arbeitet mit allen Einrichtungen, die in der Tschechischen
Republik Deutschunterricht erteilen oder planen, partnerschaftlich zusammen. Dabei werden vor allem
Lehrer/innen aller Schultypen über Kontaktadressen im Bereich DaF oder Stipendienangebote beraten, und
Lehrwerke- und Materialien erarbeitet und bereitgestellt, sowie Prüfungen abgehalten. Ein wesentlicher
Bestandteil des Engagements besteht in der Fortbildung von tschechischen Deutschlehrer/innen. So organisieren
wir selbst oder mit ortsansässigen Institutionen – aber auch mit solchen in Österreich, der Schweiz und anderen
europäischen Ländern – Fortbildungen zu vielen Aspekten des Deutschunterrichts. Dies geschieht auf allen
192
Stufen des Bildungssystems, von der Grundschule bis zur Universität, und wird zudem von der Europäischen
Kommission finanziell unterstützt. Diese Aktivitäten verfolgen das Ziel, die Teilnehmer zu befähigen, ihre
erworbenen Kenntnisse im Kollegenkreis selbständig weiter zu vermitteln, um so selbst multiplikatorisch tätig
zu werden. Damit sollen die Ergebnisse dieser Veranstaltungen letztendlich allen Deutsch-Lehrkräften zugute
kommen, da es nicht möglich ist, alle Maßnahmen landesweit anzubieten. Außerdem bieten wir noch unsere
Sommerintensivkurse an, die interessierten Tschechen die Möglichkeit bieten sollen, in einem eng begrenzten
Zeitraum viel komprimiertes sprachliches Wissen zu erwerben. Diese Kurse dauern in der Regel nur etwa drei
Wochen. Dem Sommerintensivkurs schließt sich eine Abschlussprüfung an, wahlweise als ZDaF- oder ZMP-
Prüfung, die wiederum kostenpflichtig sind – 1.650 bzw. 2.400 tschechische Kronen.
E. A: Welche anderen kulturellen Veranstaltungen führen Sie noch durch?
M. L: Eine sehr wichtige Veranstaltung für das Zusammenleben und gegenseitige Verständnis von Deutschen
und Tschechen ist unser internationaler Essay Wettbewerb ”Die Zukunft von der Vergangenheit befreien? Die
Vergangenheit von der Zukunft befreien?” In Anlehnung an die Tradition der Akademien der Wissenschaften
und Künste im Europa des 18. Und 19. Jahrhunderts schreiben wir zusammen mit der renommierten Zeitschrift
”Lettre International” und der GmbH ”Weimar 1999 – Kulturstadt Europas” diese Preisfrage zur Beantwortung
in Form eines Essays aus. Teilnehmen kann jeder Interessierte. Die ersten drei Gewinner erhalten hoch dotierte
Geldpreise in Höhe von 50.000 DM, 30.000 DM und 20.000 DM und werden zur Preisverleihung nach Weimar
eingeladen. Außerdem erhalten sie ein Arbeitsstipendium in Deutschland und ihre Essays werden in den
verschiedensprachigen Ausgaben von ”Lettre International” sowie anderen internationalen Kulturzeitschriften
veröffentlicht. Die Essays müssen in einer der sechs UNO-Sprachen, Arabisch, Chinesisch, Englisch,
Französisch, Russisch und Spanisch oder der Sprache des Gastgebers Deutschland eingereicht werden. Über die
Vergabe der Preise entscheidet eine international und interdisziplinär zusammengesetzte Jury, die durch ein
ebenfalls internationales Kuratorium ausgewählt wird, in dem die unterschiedlichsten Länder vertreten sind.
Eine weitere erwähnenswerte Veranstaltung unseres Hauses ist die Theaterstudie ”Der Besuch der alten Dame”
nach Friedrich Dürrenmatt, die wir in Zusammenarbeit mit Germanistikstudenten der Karlsuniversität
durchführen. Einige dieser Studenten haben sich zu einer Theatergruppe formiert und spielen dieses Stück mit
großer Freude an der zeitgemäßen Sprache Dürrenmatts sowie der Zeitlosigkeit und Ortsungebundenheit der
Handlung. Wir unterstützen dieses Engagement durch die Bereitstellung unserer Räumlichkeiten, auch für die
Aufführung.
5.5. Die Deutsche Schule Prag194
Die Deutsche Schule Prag liegt am westlichen Stadtrand von Prag, einem – trotz hoher
Umweltbelastung – sehr attraktiven Standort. Sie ist eine deutschsprachige Auslandsschule,
die deutsche und ausländische Schüler vom Kindergarten bis zur Allgemeinen Hochschulreife
führt. Daneben wird auch der Realschulabschluss angeboten.
193
Die Schule umfasst die Grundschule (Klassen 1 – 4), die Sekundarstufe I (Klassen 5 – 10) mit
einem Realschulzweig (Klassen 7 – 10) und die Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mit dem
Abschluss des deutschen Abiturs. Dafür besitzt die Schule die Anerkennung durch die
Ständige Konferenz der Kultusminister der Bundesländer.
Träger der Schule ist der Deutsche Schulverein Prag (Nemecká škola v Praze, s.r.o.), der die
Schule in der Rechtsform einer tschechischen GmbH (”Deutsche Schule in Prag GmbH”)
führt . Eigentümer dieser GmbH ist die Bürgervereinigung zur Gründung und Förderung der
Deutschen Schule Prag, die sich vornehmlich aus den Eltern der Schüler (Diplomaten,
Botschaftsangehörige, Mitarbeiter international tätiger Unternehmen und anderen
Geschäftsleuten) zusammensetzt und die Schule besonders materiell unterstützt. Durch
finanzielle Mittel dieses Fördervereins konnten viele neue Vorhaben erst realisiert, bzw.
Vorhandenes verbessert werden. So ist z.B. die überdurchschnittlich gute Versorgung mit
Lehrkräften sowie die Verbesserung der Räumlichkeiten und Lernmittel maßgeblich auf den
Förderverein zurückzuführen. Außerdem haben die Schülereltern dadurch den Vorzug, die
Geschicke der Schule, also die Bildung ihrer Kinder verantwortlich mit zu gestalten. Neben
den finanziellen Mitteln, die der Schule durch die Bundesrepublik Deutschland zugute
kommen, erhebt der Schulverein zusätzlich noch – wie in allen Privatschulen – ein Schulgeld.
Dessen Höhe richtet sich nach dem Alter der Schüler, bzw. ihrer Jahrgangsstufe und variiert
von 5000 DM im Kindergarten bis zu 6500 DM in der Oberstufe.
219 Schüler besuchen zur Zeit die DSP, von denen 157 deutschsprachig sind (128 Deutsche,
13 Österreicher, 7 Schweizer, 15 Schüler, die die deutsche und eine andere
Staatsangehörigkeit haben, davon 9 deutschsprachige), die übrigen kommen vor allem aus
Tschechien (25) und anderen Ländern (31).
Die Schüler sind in 14, sehr kleinen Klassenverbänden organisiert: die größte Klasse hat 25
Schüler, die kleinste gerade 5, wobei es lediglich zwei Klassen mit über 20 Schülern, und nur
eine Jahrgangsstufe mit zwei Klassen (3a, 3b) gibt. Auffallend ist besonders die sehr geringe
Anzahl von Oberstufenschülern (1997/98: 11. Klasse: 8, 12. Klasse: 5, 13. Klasse: 6). Der
Kindergarten umfasst zwei Gruppen mit 25 bzw. 15 Kindern.
Das Lehrerkollegium besteht aus insgesamt 28 Lehrkräften, davon 9 aus der Bundesrepublik
entsandte Lehrer-/innen sowie zwei Programmlehrkräfte, 4 deutschsprachige Ortslehrkräfte
, 194 Deutsche Schule Prag: Jahrbuch 1997/98 sowie eigene Anschauung.
194
sowie 5 frei angeworbene, deutschsprachige Ortslehrkräfte und 8 fremdsprachige
Ortslehrkräfte.
Unterrichtssprache ist Deutsch, erste Fremdsprache (ab 5. Kl.) Englisch und zweite
Fremdsprache (ab 7. Kl.) Französisch. Latein wird nicht als zweite FS angeboten, dafür aber
Tschechisch in den Klassen 1 – 8. Neben den allgemeinen Gymnasiums- bzw.
Realschulfächern stehen noch eine Reihe von zusätzlichen Wahlfächern zur Auswahl, die in
Arbeitsgemeinschaften unterrichtet werden. Neben einem umfangreichen Sportangebot (AG’s
für Schwimmen, Leichtathletik, Basketball, Fußball) werden auch noch AG’s für Musik,
Chor, Oper, Theater, Literatur/Film, Keramik, Kunst, Latein, Physik und Zoologie angeboten.
Zusätzlich dazu stehen den Schülern auch noch einige Neigungsgruppen, wie z.B.
Tischtennis, Volleyball, Teakwondo oder Modern Dance offen.
Zu den Fächern Musik, Kunst, Physik und Chemie stehen Fachräume bereit, für das Fach
Sport wurde zum Schuljahr 1997/98 eigens ein neuer Sportplatz gebaut, der als
Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Praha-Repy und der Laudová-Schule realisiert
wurde.
Als Auslandsschule hat die Deutsche Schule Prag über den engen unterrichtlichen Rahmen
hinaus immer auch einen kulturpolitischen Auftrag, den sie sehr ernst nimmt. So betätigt sich
die Schule besonders im literarisch-musischen Bereich auf vielfältige Art. Höhepunkt des
Schuljahres 1997/98 war unter anderem sicherlich die ”Bertold-Brecht-Revue”, eine
Aufführung der Theatergruppe der DSP die fünfmal vorgestellt wurde und mit einem großen
Empfang für die zahlreichen Gäste endete. Insgesamt wurden 7 bekannte und weniger
bekannte Stücke Brechts anlässlich seines hundertsten Geburtstags aufgeführt, unter
beachtlicher Beteiligung der Lehrer, von denen ein Viertel des gesamten Kollegiums an der
Aufführung teilnahm. Bestimmt hat auch die multikulturelle Zusammensetzung der
Schauspieler zum großen Erfolg der Revue beigetragen. Für die Theatergruppe fand
außerdem eine Fahrt nach Berlin zur Aufführung von Goethes ”Iphigenie auf Taurus” statt.
Weitere Höhepunkte im kulturellen Leben der Schule stellen auch die häufigen
Autorenlesungen dar: Bereits ab der Grundschule konnten immer wieder namhafte Autoren
für Lesungen gewonnen werden. Für die Klassen 3 – 5 bzw. 1 - 6 lasen die
Kinderbuchautorinnen Marlies Bardeli und Christine Nöstlinger aus ihren Werken; die älteren
Klassen kamen in den Genuß von Lesungen von Dr. Peter Becher und Rudolf Tomšú. Die
Autorenlesungen der beiden letztgenannten wurden mit einem anderen, sehr bedeutenden
Projekt der Schule verknüpft, der Reihe ”Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts”. Im Rahmen dieser
195
Veranstaltungen las auch die Schriftstellerin Lenka Reinerová – eine Kollegin von Kafka und
Brod aus der Zeit zwischen den Weltkriegen – aus ihren Erinnerungen und diskutierte
anschließend mit den Zuhörern. Ein weiterer ”Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts” war mit
Eduard Goldstücker, einem jüdischen Autor, der nach dem Weltkrieg in Prag geblieben war
und die Ereignisse des ”Prager Frühlings” hautnah miterlebte, in der DSP zu Gast. Ihn hatte
Gysis Vater 1968 als “bankrotten Revisionisten” beschimpft. Diese Autoren faszinierten die
Schüler und ließen sie aktiv an der Geschichte unseres Jahrhunderts teilhaben.
In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist das Engagement der Schule im Bereich der
Völkerverständigung. So folgte die Schule einer Einladung, für eine Ausstellung im früheren
KZ Theresienstadt die Bilder vorzubereiten. Diese Ausstellung stand unter dem Thema
”Frieden für Israel – Frieden für alle”, und wurde von Vertretern der Deutschen Botschaft, der
Gemeinde Theresienstadt, des Fonds Theresienstadt und der Jüdischen Gemeinde in Usti nad
Labem besucht. Der Fonds Theresienstadt und die Jüdische Gemeinde wollen diese
Ausstellung auch in einer Galerie in Israel zeigen. Die gesamten 6., 7., 8. und 9. Klassen
besuchten im letzten Schuljahr Konzerte des Prager Symphonischen Orchesters. Außerdem
fand erstmalig ein gut besuchtes Schülerkonzert statt, das von nun an jährlich wiederholt
werden soll.
Schließlich ist noch auf das soziale Engagement der Schule zu verweisen. Jedes Jahr
veranstaltet die Deutsche Schule Prag einen traditionellen Weihnachtsmarkt. 2.000 Kronen
aus dem Verkauf von selbstgebackenen Crêpes wurden einer Taubstummenschule in Prag in
Form von Sachgeschenken wie Fußbällen anlässlich eines Schülerbesuches übergeben. Hohe
Geldbeträge der Schule kamen im Rahmen des alljährlichen Wohltätigkeitsbasars zusammen:
zwei Kinderheime am Rande Prags, die sich in finanzieller Not befinden, konnten sich über
üppige Spenden freuen. Das Kinderheim in Prag-Klánovice erhielt einen Spendenbetrag für
eine Dachreparatur, das Kinderheim von Dolni Pocernice für einen neuen Wandschrank und
eine Heizungsreparatur. Diese Aktivitäten ebenso wie der jährlich stattfindende Flohmarkt
mit den tschechischen Nachbarn tragen dazu bei, das deutsch-tschechische Verhältnis zu
verbessern.
Die Deutsche Schule Prag als Pädagogisches Fortbildungszentrum
Der Deutschen Schule Prag wurde im Schuljahr 1997/98 eine weitere wichtige Aufgabe
übertragen. Sie wurde zum Pädagogischen Fortbildungszentrum für die Region Osteuropa
und organisiert seither die Lehrerfortbildung für die Deutschen Schulen in Moskau, Prag und
196
Warschau. Diese Fortbildungsveranstaltungen wurden bisher von der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen in Köln selbst zentral durchgeführt. Aus unterschiedlichen Gründen
funktionierte die konkrete Wahrnehmung dieser Veranstaltungen seitens der Lehrer jedoch oft
nicht. Deshalb ist man im letzten Schuljahr versuchsweise dazu übergegangen, die
pädagogische Fortbildung zu dezentralisieren. Hierfür wurden die drei Auslandsschulen in
Moskau, Prag und Warschau zu einer Region (Osteuropa) zusammengefasst. Die inhaltlichen
Entscheidungen bezüglich der Fortbildungen werden von einem sog. Pädagogischen Beirat
getroffen, der sich aus den drei Schulleitern zusammensetzt. Auch die Lehrkräfte aller Fächer
und Jahrgangsstufen sollen künftig an der Entwicklung von Inhalten und Formen ihrer
Fortbildung beteiligt werden, um ihre Unterrichtsarbeit gezielt zu verbessern. Hierbei sind
gegenseitige Unterrichtsbesuche, Pädagogische Tage und Konferenzen an den drei Schulen
geplant, wobei mehrtägige Treffen ausnahmslos in Prag stattfinden werden. Für größere
Fortbildungsveranstaltungen, etwa unter Einbeziehung von Experten anderer Schulen und
Hochschulen ist Prag prädestiniert. In dieser Rolle ist die DSP auch gerade dabei, eine kleine
Bibliothek aus Handbüchern, Fachzeitschriften und ähnlichen Medien aufzubauen.
Bayern zeigt reges Interesse an einem Austausch mit Tschechien. So heißt es im Artikel 2 des
Protokolls über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schul- und Hochschulwesens:
”Beide Seiten werden den Deutschunterricht in der Tschechischen Republik stärker fördern.
Die bayrische Seite bietet die Entsendung von bis zu fünf bayrischen Lehrern an bilinguale
Gymnasien an. Beide Seiten werden neue Schulpartnerschaften mit denjenigen bayrischen
Schulen, die Tschechisch als Fremdsprache anbieten, anregen.”195
195 Tschechische Republik und Bayrisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst:
Protokoll über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schul- und Hochschulwesens, zwischen dem
Ministerium für Schulwesen, Jugend und Körpererziehung der Tschechischen Republik und dem Bayrischen
Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst für die Jahre 1996 bis 1998. München 1998.
197
5.6. Interview in der Deutschen Schule Prag
Interview mit dem Schulleiter Dr.v. H., dem stellvertretenden Schulleiter H.-W. F, dem Vorsitzenden des
Personalrats G.Kr, der Koordinatorin der Grundschule und Vorsitzenden des Elternbeirates D. de F, EA
Interviewerin
E. A: Herr Dr.v. H., im Juli haben wir in angeregter Runde aller an der Auswärtigen Kulturpolitik Beteiligten in
Prag darüber diskutiert, die Deutsche Schule Prag in eine Begegnungsschule umzuwandeln.
Dr.v. H.: Längerfristig werden sich wahrscheinlich die deutschen Auslandsschulen so wie hier in die Richtung
einer Begegnungsschule entwickeln müssen. Das ist vom politischen Gesichtspunkt, vom Zusammenleben der
Deutschen und Tschechen hier in Prag sehr sinnvoll. Dadurch ließe sich ein besseres Verständnis für einander
aufbauen, und das ist ein sehr wichtiges Anliegen, gerade nach unserer gemeinsamen, schwierigen Geschichte.
Die Schwierigkeiten liegen sicherlich darin, dass wir zusätzlich hier in Prag eine deutschsprachige Abteilung in
einem tschechischen Gymnasium haben, die regen Zulauf hat. Ich bin allerdings der Auffassung, dass wir dieser
Einrichtung keine grundsätzliche Konkurrenz machen würden, da unser Schülerklientel deutlich anders
strukturiert wäre. Das Thema Begegnungsschule ist für uns eine Perspektive, die wir längerfristig verfolgen. Ich
gehe nicht davon aus, dass sich unsere Schule in den nächsten Jahren bereits umwandeln lassen wird. Wir haben
auch immer wieder interessierte tschechische Schüler, aber bei ihnen handelt es sich vorwiegend um
Rückwanderer oder ehemalige Emigranten, aber auch um Eltern, die ihre Kinder vom Kindergarten an zu uns
schicken wollen. Dazu muss man sagen: Es hat bei uns noch nie den Fall gegeben, dass wir ein Kind aus
finanziellen Gründen ablehnen mussten. Wir haben immer Mittel und Wege gefunden, solche Schüler bei uns
aufzunehmen. Es gibt zwar eine Vorgabe des Außenministeriums die besagt, dass ein bestimmter Anteil von
muttersprachlichen Schülern nicht unterschritten werden darf, d.h., dass der Anteil von fremdsprachigen
Schülern nicht mehr als 20 v.H. sein darf, aber es ist ein Unterschied, ob man die Öffnung schon im
Kindergarten zulässt. Deshalb halten wir diesen Prozentsatz nicht genau ein, wir liegen derzeit bei etwa 25%, da
die Schüler nach der Aufnahme im Kindergarten Deutsch bereits fast perfekt sprechen. Für die wenigen Schüler,
bei denen dies nicht der Fall ist, geben wir zusätzlichen Deutschunterricht.
E. A: In den Klassen, die wir gerade besucht haben, sind Schüler sehr vieler unterschiedlicher Nationen
vertreten?
Dr.v. H.: Das ist richtig. Die meisten dieser Schüler sind Kinder von Mitarbeitern des ”Radio freies Europa” in
Prag. Dies sendete früher aus München, wo die meisten Kinder damals auch zur Schule gegangen sind und eine
deutschsprachige Schulbildung genossen haben. Langfristig verfolge ich aber das Ziel, die Schule auch für
solche Schüler zu öffnen, die bisher keine Möglichkeit hatten, Deutsch zu sprechen. Dies müsste dann bereits in
unserem Kindergarten anfangen, um nicht das Niveau zu senken. Jeder, der die Fähigkeit oder den Willen hat,
eine deutschsprachige Schulausbildung zu durchlaufen und damit deutsche Kultur kennen zu lernen, soll auch
die Chance dazu erhalten. Dies soll unabhängig von dem vorgeschriebenen Prozentsatz erfolgen, der wie ein
Damoklesschwert über uns hängt. Die tschechischen und anderen nicht muttersprachlichen Oberstufenschüler
sprechen praktisch perfekt Deutsch, so dass diese Vorgabe ihre Sinnhaftigkeit verliert. Trotzdem fallen diese
Schüler – in meiner nicht ”frisierten” Statistik – in den Prozentsatz der nicht muttersprachlichen Schüler, und
198
verengen den Spielraum! Darüber hinaus wollen diese perfekt Deutsch sprechenden, multinationalen Schüler
sich mit der deutschen Kultur vertraut machen und identifizieren. Dieser Gesichtspunkt erscheint mir auch aus
außenpolitischen Gesichtspunkten sehr wichtig und nützlich für Deutschland zu sein. Wir machen diese jungen
Leute – die längerfristig einmal die Führungspositionen in ihren Ländern einnehmen – mit der deutschen Kultur
vertraut, und sie lieben diese Kultur! Ich glaube schon, dass die Schüler unsere Schule mögen und sich hier wohl
fühlen.
Als ich merkte, dass ich mit der Einrichtung einer Begegnungsschule nicht entscheidend voran kam, habe ich in
diesem Schuljahr damit begonnen, tschechische Schüler auf das tschechische Abitur vorzubereiten. Deshalb
habe ich vier Stunden pro Woche darauf verwendet, mit diesen Schülern tschechische Literatur, tschechische
Stilistik, tschechische Aufsätze und tschechische Landeskunde zu behandeln. Dieses Angebot wird immerhin
von etwa 10 Schülern wahrgenommen. Mein Ziel dabei ist, dass ich diese Schüler außer auf das deutsche,
gleichzeitig – aber sicher nicht perfekt – auch auf das tschechische Abitur vorbereite. Die Erfahrungen, die diese
Schüler jetzt mit dem tschechischen Abitur und dessen Prüfungsaufgaben haben, sollen ihnen natürlich auch
alsbald zu gute kommen. Deshalb befinde ich mich momentan im Kontakt zu mehreren tschechischen Stellen,
wie es organisiert werden könnte, dass diese Schüler bei uns, oder an hiesigen Schulen die Prüfung ablegen.
Dieses Engagement ist mir sehr wichtig, auch wenn wir deshalb noch längst keine Begegnungsschule haben.
H.-W. F: Sie merken also, dass wir der Idee der Begegnungsschule sehr positiv gegenüber stehen, aber Sie
müssen sehen, dass diese Bemühungen nur langfristig verwirklicht werden können. Dies widerspricht aber dem
eher kurzfristigen Dasein der Auslandsschulen, da wir eine enorme Fluktuation sowohl bei den Schülern, als
auch den Lehrern haben. Für das Konzept einer Begegnungsstätte wäre es daher notwendig, ein
Kulturabkommen mit der Tschechischen Republik zu schließen, das beispielsweise auch den längerfristigen
Einsatz deutscher Lehrkräfte erlaubt. Auch in Bezug auf das Schulgebäude wären gänzlich neue Überlegungen
nötig. Selbst wenn wir um- oder anbauen würden, ist dieser Komplex für eine deutsche Expertenschule
konzipiert. Wenn man in Zukunft eine Begegnungsschule errichten wollte, müsste man praktisch einen völlig
neuen Plan entwickeln. Die jetzt seit drei Jahren entwickelten Umbaupläne wären dann umsonst gewesen.
E. A: Warum müssten die Räumlichkeiten im Fall der Umstrukturierung in eine Begegnungsschule größenmäßig
verändert werden?
H.-W. F: Wir brauchten in diesem Fall mindestens 6 Klassenräume mehr, da man in Begegnungsschulen
spezielle Klassen für die Kinder braucht, die von Jahr zu Jahr stärker integriert werden sollen.
Dr.v. H.: Zum Gebäude selbst muss man sagen, dass es ein sehr unattraktiver, hässlicher Bau ist. Wir planen
allerdings schon, das Gebäude zu verändern. Es soll aufgestockt werden, die hinteren Teile sollen abgerissen
werden, so dass wir auch im rein räumlichen Bedarf Fortschritte erzielen. Wir haben momentan sogar einen Teil
der Schüler ausgelagert. Um die verstärkte Integration einer Begegnungsschule zu erreichen, brauchen Sie
mindestens 6 Klassenzimmer und zwei Gruppenräume mehr, zuzüglich neuer Fachräume. Das ist unser
Dilemma. Wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, eine Begegnungsschule einzurichten unter Umgestaltung
der Gesamtkonzeption. Es könnte aber auch zu gewissen Bedenken seitens der Elternschaft kommen, wenn man
die Schule umwandeln würde...
E. A: Welches sind die Bedenken der Eltern bei der Umwandlung der Schule?
199
V. R.: Die größten Bedenken der Eltern sind in der Unterrichtssprache zu sehen. In der Begegnungsschule
würde normalerweise auch für die deutschen Kinder der Unterricht in der Landessprache stattfinden. Gerade
eine slawische Sprache zu lernen empfinden die Eltern als problematischer als etwa eine westeuropäische.
Dr.v. H.: Das stimmt aber nicht ganz. Die Sprachproblematik wird oft völlig falsch dargestellt. Überall dort, wo
wir über Begegnungsschulen diskutiert haben, ist die Landessprache in einer falschen Form als Teil der
Konzeption dargestellt worden. Unsere Schüler würden im Falle einer Begegnungsschule nur unwesentlich mehr
Tschechisch lernen als jetzt. Nehmen wir das Beispiel der Begegnungsschule in Budapest: Die Schüler haben
dort das Fach ”ungarische Kultur und Sprache”. Dieses Fach wird als eine Art ”Kulturfach” gesehen. Dies muss
auch unser Ziel sein: die Vermittlung der tschechischen Kultur und Angebote zum Erlernen der Sprache, die
individuell angenommen werden können. Dass beispielsweise ein Schüler der 9. Klasse, der bisher keine
Ahnung von Tschechisch hat, dieses Angebot wahrscheinlich ablehnen würde, ist klar. Die Befürchtungen der
Eltern sind also in diesem Fall schlicht nicht korrekt.
E. A: Der Schulbesuch in der DS Prag kostet hohe Gebühren. Wenn die 8.500 DM Schulgebühren pro Jahr
privat aufgebracht werden, ist das sehr viel Geld. Wenn der jeweilige deutsche Arbeitgeber das Geld bezahlt, ist
es freilich für die Eltern leichter. Können tschechische Familien sich die Begegnungsschule überhaupt leisten?
Dr.v. H.: Obwohl sich die Unternehmen das auch sehr genau überlegen. Die rechnen das schon durch, und wenn
es sich für die Firma ab einer bestimmten Kinderzahl nicht mehr lohnt, dann werden solche Familien auch nicht
ins Ausland geschickt. Es sind aber auch zum Teil erhebliche Ermäßigungen möglich. Durchschnittliche
tschechische Haushalte können diese Beträge in der Regel bei weitem nicht zahlen, deshalb ermäßigen wir. Der
Mindestbetrag, der für jeden Schüler zu zahlen ist, liegt bei 25.000 Kronen im Jahr, das sind rund 1.500 DM,
d.h. es ist schon ein sehr großer Unterschied zu dem normalen Betrag möglich. Diese Ermäßigungen erfolgen
allerdings nur in Einzelfällen, nach Offenlegung aller Einkommensarten der Eltern.
Eine echte Konkurrenz für uns ist übrigens die österreichische Schule, die den tschechischen Schülern auch nur
die letzten 4 Jahre Schulzeit – von der Matura ab gerechnet – anbietet. Es gibt also durchaus tschechische
Schüler, die von unserer Schule abgehen und auf die österreichische wechseln. Dies geschieht aber weniger aus
finanziellen Gründen, obwohl die österreichische Schule, die in das tschechische Schulnetz eingebunden ist,
lediglich 500 DM im Jahr kostet. Die Hauptattraktivität dieser Schule liegt darin, dass sie – im Gegensatz zu uns
– die Matura und das tschechische Abitur anbietet.
E. A: Wie ist die Höhe des deutschen Schulgeldes zu erklären?
Dr.v. H.: Primär aus unseren eigenen Kosten. Wir verfügen über ein Gesamtbudget von 1,2 Millionen DM und
bilden daraus auch Rücklagen in Höhe von ca. 300.000 DM für unseren Neubau. Unsere Personalkosten sind
sehr hoch, d.h. die finanziellen Angebote für die von uns in Deutschland angeworbenen Lehrer sind sehr
attraktiv. Die Nettogehälter sind wesentlich höher als in Deutschland üblich. Die zusätzliche Belastung dieser
Gehälter ist hier extrem hoch. Steuern, Abgaben und ähnliches sind hier etwa doppelt so hoch wie bei uns, d.h.
4.200 DM netto sind 8.400 DM brutto. Wenn es z.B. darum geht, eine Klasse zu teilen, weise ich immer erst auf
die finanziellen Mehrbelastungen hin – obwohl das nach Erpressung klingt. Ein Lehrer mehr bedeutet 80.000
DM Mehrkosten. Wenn man dabei bedenkt, wie viele Leute das volle Schulgeld tatsächlich bezahlen, heißt das
für alle anderen Eltern sofort 400 bis 500 DM mehr Schulgeld.
200
H.-W. F: Um in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Begegnungsschule zu kommen: Hier brauchen Sie
natürlich auch noch zusätzliche Lehrkräfte, zusätzliche Ausstattung und damit zusätzliches Geld.
E. A: Würde denn im Falle einer Begegnungsschule das Schulgeld für die Eltern teurer werden?
Dr.v. H.: Das kommt darauf an. Ich gehe davon aus, wenn wir Begegnungsschule wären, würden wir auch vom
Bund besser ausgestattet werden. Wir würden zuerst sicherlich fünf bis sechs neue Lehrer bekommen. Wir
haben eine Lehrerversorgung, die sehr gut ist.
H.-W. F: Das Splitten von Klassen und Fördern von Gruppen ist für uns deshalb so wichtig, weil wir den
Schülern bei einer enorm hohen Fluktuation und unterschiedlichsten persönlichen Hintergründen, die Chance
geben wollen, auch wieder an die fortgeschritteneren Gruppen in ihrem Leistungsniveau heranzukommen.
Unsere spezielle Situation macht diese Praxis notwendig.
E. A: Das fördert die Schlüsselqualifikationen wie Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen...
Dr.v. H.: Das Einstellen auf neue Situationen ist tatsächlich eine der großen Qualifikationen, die unsere Schüler
haben, ohne dass wir allzu viel dazu tun müssten. Mein Ziel ist eine Schule, die von ihren Schülern zwar
Leistung fordert, gleichzeitig aber auch Spaß macht, und an der sich die Schüler wohl fühlen. Unsere Schule soll
hier in Prag der Mittelpunkt der deutschen Gemeinde sein, nicht nur für die Schüler, sondern darüber hinaus
auch noch für die Eltern, die häufig bei uns zu Gast sind. Manchmal müssen wir die Eltern regelrecht vertreiben,
damit der Unterricht nicht gestört wird. Wir haben den Eltern für den Kontakt mit ihren Kindern sogar einen
eigenen Aufenthaltsraum angeboten. Wir haben in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal konsequent
Warteklassen eingerichtet, d.h. wir halten bei Stundenausfällen Unterricht bis zur 6. Stunde bzw. vertreten
erkrankte Lehrer bis zur 6. Stunde. Die Eltern können sich somit – im Gegensatz zu Deutschland – darauf
verlassen, dass ihre Kinder bis zur 6. Stunde bei uns bleiben.
E. A: Wie schaffen Sie es, den Vertretungsplan so gut zu organisieren?
Dr.v. H.: Die meisten Lehrer haben einen relativ zusammenhängenden Stundenplan, bis auf Herrn Fischer und
mich. Deshalb bleiben Vertretungsstunden meistens an uns ”hängen”.
H.-W. F: Unsere Lehrer sind sich natürlich unserer besonderen Situation bewusst, deshalb sind kurzfristige
Vertretungen in der Regel auch überhaupt kein Problem. Wir haben bei uns ein sehr kollegiales Verhältnis.
E. A: Nach welchem bundesdeutschen Lehrplan unterrichten Sie?
Dr.v. H.: Grundsätzlich gilt für Auslandsschulen folgendes: Man lehnt sich an den Lehrplan eines Bundeslandes
an, das bestimmt die KMK. Aufgrund der Entwicklung unserer Schule hat bereits mein Vorgänger – da wir
einen bayerischen Prüfungsbeauftragten hatten – die bayerischen Lehrpläne übernommen. Teilweise müssen wir
die Lehrpläne aber auch anpassen, da wir auch andere Stundentafeln und eine andere Oberstufenorganisation –
statt im Kurssystem unterrichten wir im Klassenverband – haben. Wir verwenden also bayerische Lehrpläne, die
wir an unsere eigenen Verhältnisse angepasst haben. Dass wir viele bayerische Lehrer haben, liegt an der
geographischen Nähe Bayerns, und daran, dass es nicht leicht ist, für Staaten des ehemaligen Ostblocks
Kollegen in Deutschland zu finden. Wir suchten beispielsweise händeringend Mathematiker und Physiker und
fanden keine. Dabei wäre es gerade für junge Referendare in diesen Fächern sehr hilfreich, sich erst einmal bei
einer Auslandsschule zu bewerben. Wer bereit ist, in die Welt zu gehen, kommt als Naturwissenschaftler
ziemlich sicher im Ausland unter.
E. A: Wie viele Schüler hat die Grundschule?
201
D. de F, Koordinatorin für die Grundschule: In der ersten Klasse sind 24 Schüler, in der zweiten 17, in der
dritten Klasse sind 26 Schüler und in der vierten 28. Somit haben wir drei sehr starke Klassen. Ich koordiniere
die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und Eltern, sowie die Schülerinteressen.
E. A: Wie lange sind Sie schon hier?
D. de F: Seit einem Jahr.
Dr.v. H.: ... und sie ist eine tolle Schauspielerin! Wir hatten im letzten Jahr unsere Brecht-Revue, da hat Frau de
F auf sehr eindringliche Art und Weise eine Jüdin gespielt, die deportiert wird.
D. de F: Ganz im Ernst: Ich kann bei meiner Arbeit nur bestätigen, was auch schon gesagt wurde: Hier an der
Auslandsschule herrscht ein exzellenter Zusammenhalt – sowohl unter den Lehrern als auch unter Schülern und
Eltern.
Dr.v. H.: Ich möchte Ihnen nun Herrn G. Kr, den Vorsitzenden des Personalrats vorstellen.
G. Kr: Vom Status her bin ich allerdings nur Lehrerbeirat und nicht Personalrat. Es ist also nicht genau
vergleichbar mit Deutschland, obwohl die Arbeit die gleiche ist.
E. A: ... d.h. Kollegen treten bei Problemen an Sie heran?
G. Kr: Hier hat sich in den letzten zehn Jahren sehr vieles zum Positiven verändert. Ich verweise auf eine
Versammlung in der nächsten Woche, in deren Vorfeld ich eine ”Wunschliste” zur Diskussion von
Problemthemen ausgelegt habe und überhaupt keine Einträge vorfand.
Dr.v. H.: Jeder Schulleiter versucht, in seiner Schule das zu verwirklichen, was er sich pädagogisch vorstellt. Ich
möchte die Schüler fordern und versuche gleichzeitig zu erreichen, dass sie dabei Spaß haben. Dazu müssen alle
mitarbeiten: die Eltern, die Schüler und auch die Lehrer. Ich glaube es ist uns gelungen, ein sehr förderliches
Schulklima zu etablieren. Das schließt gelegentliche Probleme natürlich nicht aus, aber insgesamt ist die
Atmosphäre sehr gut. Da wir alle um unsere gegenseitige Abhängigkeit wissen, gibt es nur wenig Probleme.
G. Kr: Auch das Verhältnis zwischen Schülern und dem Lehrerkollegium ist ein sehr enges und
freundschaftliches, nicht zuletzt aufgrund der geringen Schulgröße. Ich kenne keinen Lehrer, der nicht alle
Namen seiner Schüler kennt. Es finden auch immer wieder sehr viele gemeinsame Aktivitäten statt – auch
außerhalb der Schule, z.B. gemeinsame Theater- oder Kinobesuche oder im Sportbereich.
E. A: Wie empfinden Sie die Wohnsituation hier in Prag? Ist es für Sie eine Verschlechterung im Verhältnis zu
den Wohnungen in Deutschland?
G. Kr: Nein, überhaupt nicht. Das Verwaltungsamt schreibt mir natürlich vor, in welcher Größenordnung meine
Wohnung sein kann, d.h. meine Frau und ich leben schon etwas beengter als in Deutschland. Aber nach einem
halben Jahr der Suche, haben wir eine sehr schöne Wohnung im Altbau-Jugendstil-Viertel von Prag gefunden.
Ich bin daher einer der wenigen im Kollegium, der von hier aus gesehen jenseits der Moldau wohnt. Bei der
Suche war auch viel Glück dabei. So habe ich erst am letzten Tag, an dem ich zur Wohnungssuche hier war,
dieses Angebot bekommen. Ich sagte sofort zu, obwohl die 2-Zimmer-Wohnung damals noch im Rohbau war.
E. A: Es gibt für Sie im Ausland eine Arbeits- und eine Aufenthaltserlaubnis. Wie oft müssen Sie die jeweiligen
Dokumente erneuern lassen?
Dr.v. H.: Die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis müssen wir jedes Jahr neu beantragen.
202
H.-W. F: Voraussetzung für die Arbeitserlaubnis ist die Aufenthaltserlaubnis. Diese Arbeitserlaubnis kann nicht
zentral vergeben werden, es sind – je nach Wohnort – unterschiedliche Ämter zuständig. Da gibt es manchmal
wirklich extreme Schwierigkeiten.
G. Kr: Mit dem Zoll gibt es große Probleme, die bei jedem Umzug offensichtlich werden. Wir können
beispielsweise kein Merkblatt als Umzugshilfe für unsere Kollegen erstellen, weil tatsächlich jedes Zollamt
anders verfährt. Meine Möbel etwa wurden bei der Einreise als Waren deklariert, weil das Wort ”Möbel” auf
dem Zollzettel auf tschechisch mit dem Begriff ”Waren” übersetzt wurde und nicht mit dem Begriff
”Gegenstände”. Da Waren natürlich handelsfähig sind, sollte ich sie verzollen. So verbrachte ich einen
Nachmittag auf dem Zollamt, mein LKW war verplombt und konnte nicht ausgeladen werden. Nach
langwierigen Gesprächen konnte ich den Zöllnern klarmachen, dass sie meine Wohnung einfach zum Zolllager
erklären sollen. Normalerweise hätte mein gesamter Hausstand ausgeladen werden müssen, um zu klären, ob es
sich um Waren oder Gegenstände handelt. Das dauert ungefähr vier bis sechs Wochen und ist einer Kollegin
von uns bereits passiert. Sie ist mit einem Beutel Wäsche und zwei Pflanzen vier Wochen lang, immer für zwei
bis drei Tage, von Kollege zu Kollege gezogen, bis dieses Problem geklärt worden ist.
Dr.v. H.: Ich hoffe stark, dass auch dies im Rahmen eines Kulturabkommens vereinfacht wird.
G. Kr: Ich habe z.B. auch schon eine ganze Reihe von Abonnements abbestellen müssen, weil ich nach jeweils
10 Nachlieferungen jedes Mal aufs Zollamt musste, um fünf Prozent Zoll nachzuzahlen, obwohl die Hefte in
Deutschland bereits bezahlt waren.
Dr.v. H.: Die Verfahren sind eben extrem unterschiedlich, einmal geht es sehr schnell, das andere Mal geht
überhaupt nichts voran.
G. Kr: Einmal wollten wir uns z.B. CDs schicken lassen. Nach tschechischem Recht ist jede CD
Unterhaltungsware, obwohl es sich in unserem Fall um eine CD-Rom für den Geschichtsunterricht handelte.
Zum Beweis musste ich diese CD dann mit dem Zollbeamten abhören, und weil dort auch – als
Tonunterstützung – alte Arbeiterlieder zu hören waren, musste ich lange erklären, dass es sich nicht um eine
Audio-CD handelte. Solche Auswüchse sind dabei jedoch nur die Spitze des Eisbergs.
E. A: Dass eine CD-Rom für den Geschichtsunterricht vom Zoll als Unterhaltungsware deklariert wird, ist
extrem.
G. Kr: Ich habe zum Beispiel den ”Spiegel” abonniert. Es passiert ungefähr einmal im Monat, dass ich am
Dienstag statt des ”Spiegel”, einen Zettel mit der Aufforderung, zum Hauptpostamt zu kommen, in meinem
Briefkasten finde. Davor muss ich dann allerdings zum Zollamt und den ”Spiegel” auslösen. Ich protestiere zwar
ständig dagegen, aber ändern tut sich nichts. Es passiert auch öfters, dass Sachen auf dem Postweg
verschwinden. Gerade der ”Spiegel” hat ja oft z.B. eine CD-Rom für Abonnenten aufgeklebt, die nicht mehr bei
mir ankommt...
Dr.v. H.: Die meisten Probleme gibt es aber nach wie vor beim Umziehen.
E. A: Was sollte ich bei meinem morgigen Besuch im tschechischen Schulministerium ansprechen?
Dr.v. H.: Wir haben selbst relativ gute Beziehungen zu Herrn C, dessen Frau ja auch für uns arbeitet. Wir sind
im Prinzip eine Schule, die für das Schulministerium nicht sehr interessant ist, weil wir nicht in das hiesige
Schulnetz eingebunden sind. Längerfristig ist für uns die Frage interessant, wie wir unsere Schule zum
203
tschechischen Abitur führen können. Unser diesbezügliches Vorhaben könnten Sie noch einmal ansprechen und
um Beratung und Hilfe bitten. Im Bezirk Prag 3 ist das Schulministerium natürlich genau die richtige Adresse.
G. Kr: Wir sind ja integriert in das tschechische Schulsystem und arbeiten deshalb auch mit dem
Schulministerium zusammen. Unsere Beziehungen zum Ministerium sind sehr gut, wir pflegen ganz
hervorragende – auch persönliche – Kontakte.
Dr.v. H.: Richtig, wir pflegen diese Kontakte auf persönlicher, nicht auf offizieller Ebene. Wir brauchen das
Schulministerium aber nicht und wollen daher bis jetzt auch noch nicht stärker eingebunden sein.
E. A: Spielt für Sie die Erneuerung des Kulturvertrages eine wichtige Rolle?
Dr.v. H.: Sicher, vor allem in der Hinsicht, dass wir darin eingebunden werden.
G. Kr: Wir haben ja auch Abiturienten bei uns, die tschechischer Staatsangehörigkeit sind. Für die ist ein
Kulturabkommen natürlich besonders wichtig, damit das deutsche Abitur hierzulande auch anerkannt wird, etwa
von den tschechischen Universitäten. Deutsche und andere nicht-tschechische Staatsangehörige müssen sich vor
dem Besuch einer tschechischen Universität einer tschechischen Abiturprüfung unterziehen. Unsere
tschechischen Abiturienten haben die denkbar ungünstigsten Startbedingungen: Beim Wechsel auf eine
tschechische Universität müssen sie Studiengebühren zahlen und außerdem noch die Sprachprüfung bzw. das
tschechische Abitur absolvieren. Wir sollten daher in die Lage kommen, Vorbereitungskurse für tschechische
Staatsangehörige anzubieten, die zum Besuch von tschechischen Universitäten qualifizieren. Der einfachste
Weg wäre freilich, wenn bereits das deutsche Abitur für den Besuch des Grundstudiums an tschechischen
Universitäten qualifizieren würde. Zumindest sollten die tschechischen Schüler aber den deutschen gleichgesetzt
werden.
H.-W. F: Die Zugangsberechtigungen für die tschechischen Universitäten müssen für alle unsere Abiturienten
gleich sein, egal welcher Nationalität sie sind.
Dr.v. H.: Im Moment sind die Tschechen wirklich am schlechtesten dran.
E. A: Welche Stelle ist dafür zuständig, d.h. wer kann diesen Zustand ändern?
Dr.v. H.: Das Schulministerium.
G. Kr: Dieser Punkt müsste auf jeden Fall im Kulturabkommen geregelt werden, um den Zugang zu einer
tschechischen Universität mit dem deutschen Abitur, von unserer Schule, zu ermöglichen.
H.-W. F: Man könnte noch ergänzen, dass Schüler nicht-deutscher Nationalität, die auf einer deutschen Schule
im Ausland das deutsche Abitur gemacht haben, beim Studienwunsch in Deutschland andere, bevorzugte
Zulassungsvoraussetzungen haben sollten, als irgendwelche anderen Nationalitäten aus dem Rest der Welt.
Dr.v. H.: Ein ganz wichtiges Beispiel: Eine weißrussische Schülerin unseres Gymnasiums mit deutschem Abitur
hatte größte Schwierigkeiten, überhaupt nach Deutschland einzureisen, um sich die Universität in Passau
anzuschauen.
E. A: Das heißt, dass die Voraussetzungen ein Studium aufzunehmen für Ausländer-/innen bei uns in
Deutschland genauso schwierig sind...
Dr.v. H.: Studieren könnte sie natürlich ohne Probleme. Die Schwierigkeiten beginnen bei der
Aufenthaltsgenehmigung.
G. Kr: Es ist aber meiner Ansicht nach schon für Schüler in der 12. Klasse wichtig, sich bereits ein Jahr vor
Studienbeginn zur Vorbereitung über die Studienbedingungen vor Ort zu informieren. Dafür ist es notwendig,
204
potentielle Studienorte direkt in Deutschland zu besichtigen, d.h. beispielsweise einmal von Hamburg über
Göttingen nach München zu reisen und sich Universitäten und Wohnsituation anzuschauen. Dies ist zur Zeit nur
möglich, wenn das Abitur bereits absolviert ist, d.h. schwarz auf weiß vorliegt, obwohl eigentlich schon das
Jahreszeugnis der 12. Klasse genügend Aufschluss über die Qualifikation eines Bewerbers erkennen ließe. Von
unseren ausländischen Abiturienten wird im Moment verlangt, nach ihrem Abschluss sämtliche Formalitäten
wie z.B. Immatrikulationsunterlagen von Prag aus direkt mit der betreffenden Universität bzw. der ZVS auf dem
Postwege zu erledigen. Erst nach erfolgreichem Zulassungsbescheid durch die ZVS ist eine Einreise nach
Deutschland möglich, durch ein vorher bei der Botschaft zu beantragendes Studentenvisum. Nachdem sich der
Student dann mit seinem Studentenvisum beim zuständigen Ausländeramt der jeweiligen Universitätsstadt
gemeldet hat, erhält er schließlich eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Dieser Prozess ist derart langwierig,
dass unsere Schülerin – nachdem Passau aus NC-Gründen gescheitert war – nach München wollte, und dort
aufgrund von nicht eingehaltenen Fristen abgelehnt wurde. Nun ist sie schließlich in Regensburg gelandet. In
der nächsten Woche muss sie – früher hat sie das deutsche Visum nicht erhalten – zum ersten Mal nach
Regensburg fahren, um sich eine Wohnung zu suchen: Das Semester beginnt allerdings schon in drei Wochen!
E. A: Besteht für nicht-deutsche, nicht-tschechische Schüler überhaupt keine Möglichkeit, schon vor dem Abitur
nach Deutschland einzureisen um sich über die Studienbedingungen zu informieren?
G. Kr: Es gibt einen Trick, der auch bereits von vielen unserer Schüler angewandt wird: Die Schüler berufen
sich auf das Schengener Abkommen. In der Praxis sieht das so aus: Die Schüler gehen hier zur französischen
Botschaft und besorgen sich ein Touristenvisum für Frankreich, was dort sehr leicht möglich ist. Daraufhin
müssen sie mit dem Flugzeug nach Paris fliegen und haben von dort aus die Möglichkeit, ohne Visum per Zug
nach Deutschland einzureisen. Dass dies mit erheblichen Kosten und Mühen verbunden ist, versteht sich von
selbst.
Dieses Vorgehen birgt allerdings einen weiteren Nachteil: Bei der Einreise nach Deutschland, wird der
Sachverhalt der Einreise über Frankreich registriert und als ”nicht sehr freundlicher Akt” gesehen. Bei einer
erneuten Beantragung eines Visums wird dann seitens der deutschen Behörden deutliche Missbilligung gezeigt.
Dr.v. H.: Das ist für uns ein sehr ernstes Problem, da wir in der Oberstufe viele Schüler ausländischer
Nationalität haben.
6. Slowakei
6.1. Rahmenbedingungen für die Vermittlung der deutschen Sprache
Kulturpolitische Grundlagen und Beziehungen
Die Kultur- und Bildungspolitik der Regierung Meciar bis 1998 verfolgte meistens relativ
eindimensionale, stark national geprägte Ziele. Dies erklärte sich zum Teil aus dem in der
Vergangenheit recht ambivalenten und keineswegs spannungsfreien Verhältnis zu den
großen, oft als übermächtig empfundenen Nachbarkulturen Deutschlands und Österreichs
205
bzw. Tschechiens und Ungarns. Die unbestreitbar multikulturelle Vergangenheit der Slowakei
– Jahrhunderte lange Zugehörigkeit zu Ungarn bzw. die teilweise als ”Kolonisierung”
empfundene Zugehörigkeit zur Tschechoslowakei – bewirkt deshalb heute oft eine
demonstrative Betonung der eigenen kulturellen Identität. Ein besonders beredtes Beispiel für
die Kulturpolitik der Meciar-Regierung ist das ”Gesetz über die Staatssprache”. Es greift
derart in einen sensiblen Bereich der Menschen - den der sprachlichen Verständigung - ein,
dass sich die Berliner Tageszeitung, taz, an Orwell erinnert sieht. “Ein pathologischer Kult”
so titelt sie in einer Meldung am 17. 11. 1995, S.10: „So wird – zumindest in der Theorie –
bestimmt, dass sich slowakische Staatsbürger auf slowakisch zu verständigen haben. Von
anderssprachigen Veranstaltungen wird der Tribut gefordert, dass der erste Satz in der
Staatssprache formuliert werden muss. Nichtslowakische Schriftzüge dürfen slowakische in
der Größe nicht übertreffen und das Übersetzen von Fremdwörtern zu unterlassen, kann
bestraft werden.”
Deutschland ist neben Österreich der wichtigste Partner der Republik im Kultur- und
Bildungsbereich. Neben der unbestreitbaren kulturhistorischen Affinität spielt dabei auch die
Deutschland zugemessene Rolle als kulturpolitischer Mittler im Rahmen des europäischen
Integrationsprozesses eine wichtige Rolle. Deshalb stoßen deutsche Mittlerorganisationen auf
großes Interesse, besonders bei deren Programmen vor Ort. Ein gegenseitiges
Kulturabkommen wurde schließlich am 1. Mai 1997 unterzeichnet und ist seit 28. Mai 1998
in Kraft. Auch das Ansehen deutscher Universitäten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen ist in der Slowakei sehr hoch, nicht zuletzt durch die vielfältigen
Stipendien und wissenschaftlichen Austauschprogramme, die von deutscher Seite finanziert
werden. Solche Mittel bilden für slowakische Hochschullehrer oftmals die einzige
Möglichkeit des Verbleibs an ihren Hochschulen, da die eigentliche Bezahlung so schlecht
ist, dass sie zum Familienunterhalt nicht ausreicht. Hinzu kommen noch Sachspenden der
DFG, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung oder des DAAD. Die geographische Nähe zum
deutschen Sprachraum, die wirtschaftlichen Verflechtungen (besonders im Raum Wien-
Preßburg) sowie die Vorstellung von der deutschen Sprache als Schlüssel für die
westeuropäischen Institutionen, bewirken eine nahezu ideale Voraussetzung für eine
erfolgreiche Spracharbeit. Allerdings wendet sich das Blatt sukzessive. Englisch wird mehr
und mehr lingua franca.
Die Zusammenarbeit im Schulbereich ist vielfältig und wird stark nachgefragt; die
Entsendung deutscher Lehrkräfte verläuft ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem
206
Schulministerium reibungslos. Obwohl es noch kein offizielles Abkommen über die
Entsendung deutscher Lehrkräfte und die schulische Zusammenarbeit gibt, wird in der Praxis
bereits nach den dort zu treffenden Regelungen bzw. Bestimmungen gehandelt. Universitäten
und Schulen sind an entsprechenden Kontakten zu Deutschland hochinteressiert, und es gibt
bereits zahlreiche Schul- und Hochschulpartnerschaften. Im DaF-Bereich sind neben dem GI,
dem DAAD und der BVA-Zentralstelle für das Auslandsschulwesen auch die Robert-Bosch-
Stiftung, der PAD, der Freistaat Bayern sowie das Land Sachsen-Anhalt unterstützend tätig,
wobei die Nachfrage nach Gastlektoren bei weitem nicht befriedigt werden kann.
Charakteristik des Bildungswesens in Bezug auf DaF196
Das slowakische Bildungssystem befindet sich seit 1989 in ständigem Umbau, ist jedoch
immer noch stark von der Zeit vor 1989 geprägt. Besonders gilt dies für die Lehr- und
Lerntraditionen: Ein frontaler Unterrichtsstil wird bevorzugt. In erster Linie sollen Fakten
vermittelt und Fachwissen abgefragt werden, Methodik und Transferfähigkeit werden kaum
gelehrt. Ebenfalls noch aus kommunistischer Zeit stammt die starke Betonung der
Naturwissenschaften im Unterrichts-/Studienangebot. Die Fremdsprachen, die nach 1989
stark an Bedeutung gewonnen haben, werden auch eher ”auswendig” gelernt, als nach
modernen Lehrmethoden unterrichtet.
Im Schulbereich gibt es eine 9- bis 10-jährige Grundschule, ein 4- bzw. 8-jähriges
Gymnasium, sowie an die Grundschule anschließende Berufsschulen. Sämtliche Schultypen
unterstehen hinsichtlich der Erarbeitung von Lehrplänen oder Curricula und Bestimmung von
Lehrbüchern etc. dem Schulministerium und dessen nachgeordneten Institutionen. Gleiches
gilt für die Universitäten, die allerdings seit dem Hochschulgesetz von 1996 weitgehend
autonom sind. Die Motivation zu akademischen Abschlüssen in der Slowakei ist auch vom
späteren finanziellen Nutzen des Abschlusses geprägt, was mit der schwierigen
wirtschaftlichen Lage des Landes zusammenhängt. Die akademischen Grade haben einen
hohen gesellschaftlichen Stellenwert.
196 Länderkonzeption der Slowakischen Republik 1998: Auf der Grundlage der Länderkonzeption zur
Förderung der deutschen Sprache und der damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Slowakei 1998
und auf der Grundlage der Länderaufzeichnung Slowakei, Stand: März 1998.
207
Der Beruf des Lehrers hat dagegen ein schlechtes Image. Im Schulwesen werden die
zweitniedrigsten Gehälter im Lande überhaupt bezahlt, Lehrer können als Angestellte
jederzeit entlassen werden. Die meisten Lehrer sind übrigens (Haus-)Frauen und Mütter, die
sich durch diesen Beruf etwas Geld nebenher verdienen. Das Niveau der Ausbildung und die
Weiterbildungsbereitschaft ist niedrig. Die DaF-Hochschullehrer verdienen nur geringfügig
mehr als die Lehrer und bessern ihr Gehalt meistens durch eine Reihe von Nebentätigkeiten
wie z.B. Dolmetschen auf, weshalb sie nur die nötigste Zeit am Lehrstuhl sind. Außerdem
gibt es in der Slowakei keinen einzigen regulären Professor für Germanistik.
Stellung von Deutsch im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen
Auf mittlere Sicht wird Englisch Deutsch als meistgelernte Sprache in der Slowakei
verdrängen, nicht zuletzt auch durch eine große Zahl freiwilliger muttersprachlicher
Englischlehrer. Noch liegt Deutsch knapp vor Englisch, was die prozentuale Verteilung der
Fremdsprachen auf alle Schultypen (Grundschule, Gymnasium, Berufschulen) und
Universitäten angeht, wobei Englisch an den Gymnasien bereits dominiert:
Deutsch: 46% (Gymnasien: 41%), Englisch: 44,6% (Gymnasien: 50%), Russisch: 5,6%
(Gymnasien: 2%) und Französisch: 3% (Gymnasien: 5%).
Einstellungen zu Deutsch und Deutschland
Die Einstellung zu Deutschland ist grundsätzlich positiv, oft bewundernd und nicht immer
realistisch. Die Bewunderung erklärt sich besonders aus dem wirtschaftlichen Aufschwung
Deutschlands nach dem Krieg, wobei unsere aktuellen wirtschaftlich-sozialen Probleme kaum
wahrgenommen werden. Das Gesellschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft gilt als
vorbildlich und die politisch-wirtschaftliche Ordnung imponiert. Damit verbunden sind auch
hohe politische und wirtschaftliche Erwartungen an die Bundesrepublik, wobei man sich von
entsprechenden Forderungen der EU und besonders Deutschlands in diesem Bereich (z.B.
nach mehr Demokratie und Liberalisierung der Wirtschaft) leicht unter Druck gesetzt fühlt.
Die deutschen Universitäten genießen einen ausgezeichneten Ruf, wenngleich über das
deutsche Bildungssystem wenig bekannt ist. Durch die enge kulturhistorische Verflechtung
der Slowakei mit dem deutschen Sprachraum und die seit 800 Jahren im Land lebenden
Deutschen fühlen sich viele Slowaken – verstärkt durch persönliche Erfahrungen (z.B.
Arbeits- oder Studienaufenthalte) – Deutschland eng verbunden.
208
Bedingungen für den Deutschunterricht an Schulen
An den allgemeinbildenden Schulen existieren Lehrpläne für DaF für den Anfangsunterricht
ab den Klassen 3, 5 und ab der Sekundarstufe I. Für die Fortgeschrittenenkurse in der
Sekundarstufe II und für die Klasse 1 (besonders für die deutschsprachige Minderheit
relevant) fehlt hingegen ein geeigneter Lehrplan. Die Ausstattung der Schulen mit
Lehrwerken und sonstigen Materialien unterscheidet sich sowohl bedingt durch den
jeweiligen Schulträger (95% der Schulen sind staatlich), als auch durch die Lage der Schule
(je ländlicher, desto ärmer). Die Qualifikation der Deutschlehrer unterscheidet sich stark und
ist vor allem davon abhängig, wann die Lehrkräfte ausgebildet wurden: Vor 1990
ausgebildete Lehrer haben im Allgemeinen bessere Kenntnisse (da sie oft durch großzügige
Stipendien in der DDR motiviert wurden), nach 1990 ausgebildete Lehrer schlechtere (dies
hängt damit zusammen, dass seit dieser Zeit viele ehemalige Russischlehrer, deren
Sprachkenntisse obsolet geworden waren, innerhalb kurzer Zeit auf Deutsch ”umschulten”
und dementsprechend fachlich oft unsicher sind).
Die meisten Deutsch lernenden Schüler finden sich allerdings auf den Berufsschulen, wo sie
neben dem allgemeinsprachlichen Unterricht zunehmend auch Fachsprachenunterricht er-
halten.
Unterrichtsmaterialien
Im SNP-Verlag, dem wichtigsten Schulbuchverlag des Landes, der nach wie vor quasi über
ein Monopol verfügt, sind mit Unterstützung des Goethe-Instituts die Lehrwerke ”Hallo, da
bin ich” für die Primarstufe, und ”Schau mal” für die Sekundarstufen I und II erschienen. Die
Zulassung der Lehrbücher erfolgt durch das Schulministerium, das oft nach Finanzierbarkeit
auswählt, da es hierfür auch die Kosten übernehmen muss. Für Lehrwerke aus Deutschland
bedeutet dies, dass sie praktisch ausgeschlossen bleiben.
Bedingungen für das Studium an Hochschulen
Die derzeit etwa 970 Germanistikstudenten der Slowakei verteilen sich auf vier Universitäten,
die Deutschlehrer ausbilden. An der bedeutendsten Universität des Landes, der Comenius-
Universität in Bratislava, liegt dem Germanistikstudium z.B. ein fünfjähriger Lehrplan
zugrunde, wobei Germanistik in Verbindung mit einem zweiten Fach studiert wird, welches
bereits vor Studienbeginn aus einem vorgegebenen Angebot ausgewählt werden muss. An der
209
gleichen Universität besteht schon seit 25 Jahren zusätzlich ein Studiengang Dolmetschen und
Übersetzen für Deutsch und je eine weitere Fremdsprache. Für alle Unis gibt es außerdem ein
drei- bis fünfjähriges Ein-Fach-Studium Deutsch. Da der Beruf des Lehrers kein hohes
Prestige genießt und schlecht bezahlt wird, arbeiten die meisten Germanistikabsolventen als
freie Dolmetscher und Übersetzer, als Mitarbeiter bei Verlagen, Zeitungen, TV oder Hörfunk
oder sind in der Wirtschaft und Verwaltung des Landes tätig. Besonders in Bratislava gibt es
im letztgenannten Bereich viele gutbezahlte Stellen.
Für angehende Deutschlehrer fehlt ein dem zweiten deutschen Staatsexamen entsprechender
Referendardienst: praktische Erfahrungen sammeln die Studenten nur innerhalb eines kurzen,
mehrwöchigen Schulpraktikums, das meist schlecht organisiert ist. Die Lücke zwischen
Theorie und Unterrichtspraxis verstärkt sich durch den geringen Anteil an methodisch-
didaktischen Veranstaltungen (alle zwei Semester jeweils zwei Wochenstunden). Die
durchschnittliche Veranstaltungsgröße umfasst aufgrund der strengen Aufnahmetests (nur ca.
10% der Studienbewerber werden angenommen) ca. 20 Studierende, was im Vergleich zu
Deutschland sehr gering erscheint. Die Zahl der Hochschullehrer ist aber aus den oben
genannten – v.a. finanziellen – Gründen konstant niedrig, während die Zahl der
Studienanfänger seit einigen Jahren steigt. Die Ausstattung der Bibliotheken ist im
allgemeinen unzureichend und für ein Germanistikstudium bzw. für Forschungsaufgaben zu
gering. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der slowakischen Hochschulen ist
Abhilfe nur durch den DAAD, das GI zu erwarten (besonders gilt dies für elektronische
Medien).
Beim Deutschunterricht für andere Fakultäten ist besonders unter den
Wirtschaftswissenschaftlern (auf Druck der Wirtschaft) ein starker Trend hin zu verbesserter
fachsprachlicher Ausbildung zu konstatieren. Von den Studenten werden hier mit großem
Abstand Englisch und Deutsch gewählt, wobei ein Grundkurs in Wirtschaftsdeutsch für die
meisten Studenten obligatorisch ist. Weiterführende Kurse können aufgrund des
Personalmangels trotz großen Bedarfs oft nicht angeboten werden. Ausnahme bilden Vorträge
von deutschsprachigen Gastdozenten und Vorbereitungskurse auf die GI-Kurse in
Wirtschaftsdeutsch. Im interdisziplinären Bereich plant die Comenius-Universität in
Bratislava einen Studiengang ”Deutschlandstudien” einzurichten, mit Ausrichtung auf
Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft, Soziologie, Politologie und Wirtschaft. Auch die
Wirtschaftsuniversität Bratislava plant einen Studiengang, der wirtschaftswissenschaftliche
Grundkenntnisse mit Deutsch als Fremdsprache kombiniert, außerdem gibt es noch drei reine
210
Fachstudiengänge, die auf Deutsch stattfinden: Verwaltungswissenschaften (Uni Kosice),
Volkswirtschaftslehre und ein MBA-Studium (=Master of Business Administration, beide an
der WU Bratislava).
6.2. Das Goethe-Institut Bratislava197
Kulturprogramme
Das Goethe-Institut Bratislava fördert die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und der Slowakei durch Veranstaltungen im Bereich Musik, Film, Tanz und Theater,
Ausstellungen, Literatur und Wortprogramme zu historischen, soziologischen oder wirt-
schaftswissenschaftlichen Fragen. Diese Veranstaltungen dienen der Präsentation eines
modernen Deutschlandbildes und entstehen durch enge Zusammenarbeit mit den
slowakischen Partnern. Beispiele dafür bieten z.B. die Ausstellung ”Theaterplakate aus der
Zeit des ‚Berliner Ensembles‘” anlässlich des 100. Geburtstags von Bertholt Brecht oder der
Vortrag von Prof. Thomasz Szarota zum Thema ”Hitler und die Nazis in der deutschen
Karikatur (1923 – 1933)”. Charakteristische kulturelle Programmarbeit wird auch durch
zahlreiche Autorenlesungen verwirklicht: Milan Rúfus, der große slowakische Dichter las aus
seinem Buch ”Strenges Brot” oder Mila Haugová, bekannte slowakische Dichterin, aus den
Gedichten des emigrierten jüdischen Schriftstellers Paul Celan. Weitere Beispiele für
kulturelle Veranstaltungen sind auch die Filmvorführungen, wie etwa von Filmen der beiden
jungen slowakischen Filmemachern Peter Kerekes und Martin Repka oder des vor 10 Jahren
gestorbenen deutschen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. Besucher 1998: 10430.
Anlässlich der Unterzeichnung des Kulturvertrages der Slowakei mit Deutschland referierte
ich am 2. Mai 1997 im Goethe-Institut zu den Inhalten des Vertrages.
Deutsch lehren und lernen
Für deutschinteressierte slowakische Bürger ab 18 Jahren werden allgemeinsprachliche und
Fachsprachenkurse mit kommunikativem Ansatz angeboten. Die allgemeinsprachlichen Kurse
gliedern sich dabei in solche der Mittelstufe (1, 2A, 2B, 3A, 3B), der Oberstufe (1,2), einen
Vorbereitungskurs auf das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), einen
211
Kommunikationskurs und einen für kreative Grammatik. Fachsprachliche Kurse werden zu
den Themenkomplexen ”Deutsch für den Beruf” sowie ”Wirtschaftsdeutsch” angeboten.
Darüber hinaus gibt es zu beiden Kursgruppen vierwöchige Sommer-Intensivkurse. Im
Bereich der Deutschlehrerfortbildung führt das Goethe-Institut Bratislava in Zusammenarbeit
mit den staatlichen slowakischen Institutionen Workshops und (Multiplikatoren-)Seminare
durch. Im Mittelpunkt stehen Seminare zur Methodik/Didaktik, Landeskunde, Linguistik,
Literatur, Bildungs- und Sprachpolitik sowie Prüfungsfragen. Zusammen mit den
Hochschulen der Tschechischen und Slowakischen Republik erarbeitet man ein Curriculum
zum studienbegleitenden Deutschunterricht. Zusätzlich arbeitet das Institut im
Vorbereitungskomitee der Tagungen mit, die der slowakische Deutschlehrerverband SUNG
alle zwei Jahre durchführt. Dieser Verband wird regelmäßig auch finanziell unterstützt, genau
wie die Deutschlehrerzeitung ”Begegnungen”. Außerdem werden die Lehrer durch das
Goethe-Institut Bratislava in individuellen Beratungsgesprächen über Lehrmaterialien,
Methodik und andere fachliche Fragen informiert. Es werden auch Lehrmaterialien
entwickelt, die auf die spezifischen Anforderungen vor Ort zugeschnitten sind. “Schau mal”,
ist ein Lehrwerkprojekt des GI Bratislava in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut
der Stadt Bratislava.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 10940 Exemplaren, davon 8772 Bücher, 63
Zeitungen und Zeitschriften sowie 2105 audiovisuelle Medien. Die Bibliothek betreut
außerdem die Lesesäle in Banska Bystrica und Kosice mit Materialien und betreibt aktive
Verbindungsarbeit zu slowakischen Bibliotheken: Slowakische Bibliothekare nehmen z.B. an
Bibliothekskonferenzen in Deutschland teil oder stellen deutsche Werke in ihren Bibliotheken
aus. Daneben vergibt die Bibliothek Buchspenden und unterstützt slowakische Verleger
finanziell.
197 Goethe-Institut: Jahrbuch 1997/98, Homepage des Goethe-Instituts Bratislava, Programmhefte des GI
Bratislava sowie eigene Anschauung.
212
6.3. Die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums Poprad
Im Gegensatz zu den deutschen Auslandsschulen wurde im slowakischen Poprad das System
der bilingualen Schule verwirklicht. Das staatliche slowakische Gymnasium Tatarku Poprad
(Gymnázium UDT Poprad) verfügt über drei Abteilungen: die achtjährige Sektion (Klassen 5
bis 12) mit der Fachrichtung Fremdsprachen, die slowakische Sektion (Klassen 9 bis 12) mit
allgemeiner Fachrichtung und der Fachrichtung Informatik, sowie die bilinguale Sektion
(=deutschsprachige Abteilung, Klassen 9 bis 13) mit Slowakisch und Deutsch als
Unterrichtssprachen und der Fachrichtung Sprachen und Naturwissenschaften.
Das bilinguale Bildungskonzept wird in Poprad stufenweise verwirklicht. In der
Jahrgangsstufe I (= 9. Klasse) werden die vorwiegend slowakischen Schüler (s.u.) in 5
homogene Lerngruppen für den Deutschunterricht aufgeteilt. In diesem Spracherwerbs- bzw.
Verbesserungsjahr erhalten die Schüler 16 Stunden intensiven Deutschunterricht von
slowakischen Deutschlehrern. Zusätzlich dazu werden 4 Unterrichtsstunden von deutschen
Programmlehrkräften erteilt, so dass in dieser Jahrgangsstufe insgesamt 20 Stunden
Deutschunterricht zur Sprachschulung bereitstehen. Die so gewonnene Grundkompetenz
kommt den Schülern dann in der II. Jahrgangsstufe zugute, wenn der deutschsprachige
Fachunterricht beginnt. Der Unterricht in deutscher Sprache erfolgt dabei zunächst je
zweistündig in den Fächern Biologie und Chemie, Physik und Mathematik. Parallel dazu
findet der Unterricht in diesen Fächern mit je einer Stunde in Slowakisch statt. Auch Englisch
wird hier erstmals dreistündig unterrichtet. Das Fach Deutsch selbst wird vierstündig erteilt.
In der dritten Klasse wird zusätzlich dazu auch noch Geschichte / Sozialkunde auf Deutsch
erteilt. Die Zensierung in diesen drei ersten Jahrgangsstufen erfolgt in Form einer
slowakischen Note, die mit dem deutschen Notensystem abgestimmt ist. Ab der IV. Klasse
beginnt die Oberstufe, in der durchgängig nach dem deutschen 15er-Punktesystem bewertet
wird sowie zusätzlich in Form einer slowakischen Note. Das einzige Fach, das in der
Oberstufe noch bilingual unterrichtet wird, ist Mathematik (12. Klasse: 3 Std. Deutsch, 2
Stunden Slowakisch; 13. Klasse: 4 Std. Deutsch, 1 Std. Slowakisch), alle anderen
Hauptfächer (D, G, Bio, C, Ph) werden in Deutsch erteilt, ausgenommen die Wahlfächer,
dazu kommt Slowakisch.
Die Schule geht nach dem bayrischen Curriculum vor und endet mit der von der KMK
anerkannten und beaufsichtigten deutschen Reifeprüfung sowie zusätzlich dem slowakischen
Abitur und dem slowakischen Sprachdiplom in Deutsch. Für den Abschluss sind vier
213
schriftliche Prüfungen abzulegen (Slowakisch, Deutsch, Mathematik und eine
Naturwissenschaft), von denen drei auf Deutsch geschrieben werden. Von den vier
mündlichen Prüfungsfächern (Deutsch, Slowakisch, sowie zwei Wahlfächer) finden dagegen
nur zwei auf Deutsch statt. Das Abitur des bilingualen Gymnasiums Poprad berechtigt sowohl
zum Studium in Deutschland als auch in der Slowakei. Die Ergebnisse der Abiturprüfung
liegen seit ihrer erstmaligen Durchführung im Jahre 1996 weit über dem durchschnittlichen
innerdeutschen Abiturniveau (1996:1,9, 1997: 2,3, 1998: 2,09), was den Schülern in Poprad
außerordentlichen Fleiß und Interesse bescheinigt und damit zusätzlich zum ausgezeichneten
Ruf dieser Schule in der Slowakei beigetragen hat.
Untrügliches Indiz für die hohe Wertschätzung des Angebots in der Bevölkerung sind die
kontinuierlich steigenden Bewerberzahlen (1997: 105). Der Zugang zum deutschen Zweig
erfolgt einerseits durch die ”zuliefernde” Grundstufe des Gymnasiums (bis zur 8. Klasse),
deren dreißig beste Schüler die Ausbildung ohne Aufnahmeprüfung beginnen dürfen,
andererseits aber auch durch eine solche, durch die weitere dreißig Plätze vergeben werden.
Dabei müssen sich die Bewerber schriftlichen Prüfungen in den Fächern Slowakisch, Deutsch
und Mathematik unterziehen, die dabei gleichrangig (max. 30 Punkte) bewertet werden.
Außerdem werden die Vorleistungen der Grundschule (Durchschnitt der Gesamtnoten: max.
30 Punkte) sowie eventuelle Siege bei Lern-Olympiaden (z.B. Deutscholympiade: max. 10
Punkte, andere Olympiaden: max. 5 Punkte) berücksichtigt. Wegen der hohen
Bewerberzahlen, des Erfolgs der Ausbildung, sowie der Förderung durch das slowakische
Schulministerium und der Stadt Poprad, möchte die Leitung des deutschsprachigen Zweiges
die Jahrgangsstärke in der Klasse I in den kommenden Jahren von bisher 60 auf 72 bis 78
Schüler erhöhen. Damit könnten drei statt bisher zwei Eingangsklassen gebildet werden, was
die Aufteilung der Lerngruppen erleichtern würde. Die ca. 50% der Schüler, die aus dem
eigenen Unterbau der Schule kommen, stammen aus Poprad oder der näheren Umgebung. Für
Schüler, die sich von außerhalb bewerben, steht zusätzlich ein eigenes Internat zur
Verfügung. Deutsche Schüler erhalten automatischen Zugang, was nicht unproblematisch ist,
da der Besuch des bilingualen Zweiges nur dann erfolgversprechend ist, wenn slowakische
Sprachkenntnisse vorhanden sind.
Zur Zeit umfasst der bilinguale Zweig insgesamt etwa 300 Schüler, davon übrigens zwei
Drittel Mädchen. Nur ca. 2% der Schüler sprechen Deutsch als Muttersprache, noch weniger
besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Außer der Slowakischen besitzen nur etwa 3% der
214
Schüler eine andere Nationalität (v.a. Tschechen und Ungarn). Die Klassenstärke ist gering
und beträgt in der Regel nicht über 21 Schüler.
Mit insgesamt 13 deutschen Lehrkräften ist die Abteilung sehr gut besetzt. Es unterrichteten
im Schuljahr 1997/98 2 Auslandsdienstlehrkräfte, 1 LP-Lehrkraft, sowie 10
Bundesprogrammlehrkräfte. Im Schuljahr 1998/99 findet gar noch eine Aufstockung der
ADLK auf 4 statt. Längerfristig strebt die Schule allerdings mindestens 5 ADLK-Stellen an.
Außerdem gehören etwa 20 slowakische Lehrer dem Kollegium an, von denen etwa die
Hälfte ausschließlich am bilingualen Zweige unterrichtet.
Schulträger (aller drei Abteilungen) des Gymnasiums ist der slowakische Staat, repräsentiert
durch die Stadt Poprad. Die deutschsprachige Abteilung ist sachlich und gesetzlich dem
slowakischen Schulleiter bzw. dem slowakischen Schulministerium unterstellt. Dabei wird
die bilinguale Abteilung kooperativ von einem deutschen Lehrer und einer slowakischen
Kollegin geleitet. Aufgrund der staatlichen Schulträgerschaft haben die deutschen Lehrkräfte
wenig Einfluss auf den Schuletat. Dem bilingualen Zweig steht von deutscher Seite lediglich
ein Bürokostenzuschuss in Höhe von jährlich 6.000 DM aus Bundesmitteln zur Verfügung.
Dieser Betrag scheint dem deutschen Leiter der Abteilung (LdA) zu gering: mit ihm lassen
sich weder laufende Kosten decken, geschweige denn außerordentliche Anschaffungen wie
z.B. der dringend erforderlichen Grundausstattung im naturwissenschaftlichen Bereich. Ein
Grundstock für das Fach Erdkunde sowie eine Sonderzuwendung für die Einrichtung eines
Klassen-Computerraumes sind deshalb beantragt worden.
Die deutsche Abteilung der Schule besitzt einen eigenen Gebäudekomplex am östlichen Rand
des Stadtzentrums, der aus insgesamt vier großen Häusern und einer kleinen Turnhalle
besteht. Die Häuser gliedern sich in das alte und – seit Beginn des Schuljahres 1997/98 –das
neue Unterrichtsgebäude (mit Bibliothek und Schülerratszimmer), das Verwaltungsgebäude
samt den Lehrerzimmern sowie das Gebäude mit den naturwissenschaftlichen Fachräumen.
Somit besteht räumlich kein Problem – wohl aber qualitativ: Der Zustand der Gebäude ist
erbärmlich, jedweder Komfort, der über das sprichwörtliche ”Dach über dem Kopf”
hinausgeht, fehlt. Besonders die naturwissenschaftlichen Fachräume der Abteilung erlauben
aufgrund ihres desolaten Zustandes kaum Experimente, diese sind nur durch aufwendige
Stundenänderungen im 15 Minuten entfernten Hauptgebäude möglich. Diesen Zustand könnte
jedoch nur der Schulträger, d.h. der slowakische Staat wirklich ändern.
Wie generell in der Slowakei üblich ist der Unterricht im Gymnasium Poprad stark kognitiv
ausgerichtet. Besonders im bilingualen Zweig mit seiner Doppelbelastung durch
215
Zweisprachigkeit und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Dadurch kommen oftmals die
musisch-künstlerischen bzw. kreativen Elemente des Schullebens, wie sie an deutschen
Gymnasien oder reinen deutschen Auslandsschulen praktiziert werden, zu kurz. Trotzdem
wurden einige Versuche unternommen, dieses Vakuum durch Veranstaltungen, Tagungen
oder Exkursionen zu füllen. Zum einen wurde versucht, den Unterricht in den
naturwissenschaftlichen Fächern in die regionalen und gesellschaftlich-politischen
Gegebenheiten der Slowakei einzubeziehen, z.B. durch Besichtigung einer örtlichen Brauerei,
eines Chemie-Werkes, einer Zellulose-Fabrik oder eines technischen Museums. Im Rahmen
des Geschichtsunterrichts besuchten die Abschlussklassen das (relativ nahegelegene)
ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Im literarischen Bereich fand eine Autorenlesung
eines Breslauer Lehrers mit anschließender Diskussion statt, und als musische Bereicherung
gab ein Jugendmusikorchester aus Ilmenau in Thüringen ein Konzert.
Stolz ist man in der deutschsprachigen Abteilung besonders auf die vielfältigen
Schüleraustausch-Programme, die mittlerweile schon fast zum Alltag gehören. So fanden
1997/98 vier Besuche in bzw. Gegenbesuche von ausländischen Schulen statt.
Austauschbeziehungen über längere Zeiträume (nicht unter 10 Tage) bestehen mit Schulen in
Westerstede, Lübsz, Guben, Weilburg und Freiberg. Außerdem nahm die Schule im Verbund
mit 7 anderen Schulen aus 6 europäischen Ländern an dem EU-Projekt ”Nachbarn in Europa”
teil. Darüber hinaus wurde bisher schon 2 Schülern und mehreren slowakischen
Deutschlehrern die Teilnahme an Sprachkursen in Deutschland auf Stipendienbasis
ermöglicht. Erwähnen sollte man schließlich auch die Kontakte der Abteilung zur deutschen
Minderheit in der Slowakei, den Karpaten-Deutschen. Die Teilnahme des LdA an
verschiedenen Treffen der Karpaten-Deutschen in Poprad, sowie gemeinsame Ausflüge in die
nähere Umgebung belegen dies. Mit Vertretern des Ortsvereins in Chmelnica wurden bereits
Aufklärungsgespräche über den Zugang von deutschstämmigen Schülern in den bilingualen
Zweig in Poprad geführt.
Abschließend sei noch auf die Tatsache hingewiesen, dass die deutschsprachige Abteilung
des Gymnasiums Poprad in der Slowakei nach wie vor einen Experimentierstatus genießt.
Durch den Experimentierstatus der Schule wird es weiter möglich sein, nach der 8. Klasse in
den bilingualen Zweig zu wechseln und so in 13 Jahren zum slowakischen wie deutschen
Abitur zu gelangen.
216
Gespräch mit dem Fachberater
Herr Heinrich Heinrichsen arbeitet in der Slowakei als Fachberater für Deutsch und als
Koordinator des Lehrerentsendeprogramms.
Dem Gespräch mit dem Fachberater entnahm ich folgende Informationen:
Es gibt insgesamt rund 40 Lehrkräfte der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in der
Slowakei, davon arbeiten 13 im Bilingualen Gymnasium in Poprad. Die restlichen sind auf
Bildungsinstitute in der ganzen Slowakei verteilt. Dabei sind maximal zwei Lehrer an einer
Bildungseinrichtung zusammen. Auch gibt es fünf Minderheitenschulen, die betreut werden
müssen. Hier wird in der Primarstufe der Sprachersterwerb eingeübt, da die Deutsch-
kenntnisse in den Familien nur noch gering sind.
Das Bilinguale Gymnasium in Poprad ist dabei ein Kosmos für sich, der seinen Schwerpunkt
bei den Naturwissenschaften hat. Eine Zusammenarbeit gibt es mit den Gymnasien in Prag,
Sofia und Reichenberg .
Das Aufgabengebiet von Heinrich Heinrichsen umfasst nach eigenen Angaben derzeit:
- Festlegung der Teilabordnungen zur Lehrerfortbildung
- Fachschaftsberatung, Fortbildung und Prüfungsüberwachung
- Modellstundenunterricht
- Kontakte zum Bildungsministerium
Alle Nachbarländer haben mindestens zwei Fachberater. So gibt es in Ungarn drei und in
Tschechien zwei Fachberater. Damit ist dort eine fundierte Tätigkeit wirklich möglich. In der
Slowakei muss man sich hingegen auf Gymnasien und die Hauptstadt beschränken. Die
Nachfrage und das Interesse für die deutsche Sprache sind groß.
Es gibt Probleme bei der Abstimmung zwischen den Bundesländern und dem
Bundesverwaltungsamt. Dabei ist klar, dass der Schwerpunkt auf das bilinguale
Sprachdiplom gesetzt wird. Ein breiteres Bildungsangebot der deutschen Sprache wäre jedoch
nach H. Heinrichsen sinnvoller.
Jetzt ist man gezwungen, freie Programme zu kürzen und bestehende Projekte zu vernetzen.
Insgesamt ist es jedoch erfolgversprechend in der Slowakei zu arbeiten.
Die Fragebögen zur Verbesserung der DAF-Förderung (Teil E dieser Arbeit) sollen nach der
Sommerpause an die Lehrkräfte herausgegeben werden, so Heinrichsen. Wichtig ist ihm
dabei, dass die Aktion wirklich Chefsache ist. Interessant sei dann die Umsetzung der
Ergebnisse in den nächsten Jahren.
217
Insgesamt gelte: "Die Schere läuft auseinander." Schulen in der Hauptstadt geht es gut, auf
dem Land gibt es Probleme. Förderlich sind auch die acht Lektoren der Boschstiftung in der
Slowakei.
Die IV. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei vom 24.-
28.8.1998 in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Bratislava unter der Schirmherrschaft
der Ministerin des Schulwesens der Slowakischen Republik und Unterstützung u. a. der
Botschaft der BRD hat die Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache hervorgehoben. Die
Vielzahl der Fachreferenten im Bereich der Fachsprache, der Didaktik, der Grammatik, der
Literatur, der Landeskunde, beim frühen Fremdsprachlernen, bei der Deutschlehreraus- und
-fortbildung und in den Workshops hat das breite Spektrum des Interesses an DAF aufgezeigt.
7. Italien
7.1. Das Goethe-Institut Neapel198
Kulturprogramme
Das Goethe-Institut Neapel führt unterschiedliche Veranstaltungen zur Präsentation deutscher
Kultur in Italien durch. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Vorträge und Seminare zu
Wissenschaft und Literatur, Musik, Film- und Videovorführungen, Konzert- und Theater-
vorführungen, sowie Kunst- und Dokumentationsausstellungen. Anlässlich des 100.
Geburtstages von Berthold Brecht organisierte das Institut (in Zusammenarbeit mit der Coop.
Le Nuvole und der Cità della Scienza) ein Verbundprogramm mit Filmreihe, Liederabend,
Lesungen, Ausstellung und Vorträgen. Besonders durch die Zusammenarbeit mit italienischen
Hochschulen profitiert das Goethe-Institut Neapel, nicht nur fachlich, sondern auch
programmatisch: mit der Università Orientale entstand der Kongreß ”Die Funktion der
Stimme in Kultur und Alltagsleben”, mit der Architekturfakultät der Universität Neapel der
Kongreß ”Dresden und Neapel”, an dem Städteplaner aus beiden Städten teilnahmen. Im
Theaterbereich etwa inszenierte die Gruppe ”Metastudio ‘89” das Fassbinder-Stück ”Die
bitteren Tränen der Petra von Kant”, im Ausstellungsbereich organisierte die Pädagogische
Verbindungsarbeit des Instituts z.B. die zeitgeschichtliche Ausstellung ”Was im Gedächtnis
198 Goethe-Instituts Neapel: Programmhefte und Broschüren des Goethe-Instituts Neapel, Napoli, 1996- 1998.
218
bleibt”, mit Begleitprogramm. Im Jahre 1998 besuchten 15 888 Interessierte die kulturellen
Angebote des Instituts.
Deutsch lehren und lernen
Fit in Deutsch 1 und 2
Die Prüfungen „Fit in Deutsch 1 und 2“ sind im Goethe-Institut in Neapel entwickelt worden.
Es sind zentrale Prüfungen, die für jugendliche Lerner bestimmt sind. Diese Prüfungen
erfreuen sich nicht nur in Neapel zunehmender Beliebtheit. Im Jahre 2003 nehmen in ganz
Italien 9000 Prüflinge daran teil. Die Schülerinnen und Schüler weisen allgemein-sprachliche
Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 des Referenzrahmens des Europarats nach.
Im Goethe-Institut Neapel wird darüber hinaus ein umfangreiches Sprachprogramm für
interessierte Bürger, die hierfür mindestens 16 Jahre alt sein müssen, angeboten. Im
Programm sind sowohl Extensiv- als auch Intensivkurse, Kurse für Allgemein- und
Fachsprache, auf Anfänger- und Fortgeschrittenenniveau. Fachsprachenkurse umfassen etwa
Wirtschaftsdeutsch, Konversations- oder Lesekunde. Der Unterricht folgt dabei stets dem
kommunikativen Ansatz und wird durch modernste Medien und neueste Lernmethodik,
beispielsweise teilautonome Kleingruppenarbeit, unterstützt. Dabei werden auch
unterschiedlichste Prüfungen abgehalten wie etwa die zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom
(KDS). Im Bereich der pädagogischen Verbindungsarbeit leistet das Goethe-Institut Neapel
italienischen Deutschlehrern wertvolle Hilfe, z.B. methodisch-didaktische Beratung für
Lehrer staatlicher und privater Schulen oder auch Lehrerfortbildungen in speziellen
Workshops und Seminaren, z.B. zu Landeskunde, Grammatik, Literatur, Linguistik oder
Mediendidaktik. Im Jahr 2003 finden darüber hinaus eine Ausstellung und Fachvorträge zu
Maria Montessoris Pädagogik statt. Die aktuelle pädagogische Diskussion um individuelle
Förderung und Handlungsorientierung soll hiermit Impulse bekommen.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 7647 Exemplaren, darunter 7155 Bücher,
21 Zeitungen und Zeitschriften und 471 audiovisuelle Medien. Im Jahr 1998 waren es 761
Entleiher/innen . Der Bestand wird also nur relativ wenig umgeschlagen. Viele deutsche
Fachbücher werden auch in italienischer Übersetzung ausgeliehen. Der Bibliothek steht ein
219
Lesesaal zur Verfügung. Neben dem reinen Verleihen des Bestandes gibt das
Bibliothekspersonal in individueller Beratung auch Auskunft auf verschiedene Anfragen
bezüglich deutschlandrelevanter Themen. Hierbei werden den Interessenten bezüglich ihrer
Fragen detaillierte Literaturangaben zur Verfügung gestellt beziehungsweise persönlich
erläuternde Hinweise gegeben. Auch bei der Bereitstellung von Hintergrundmaterial für die
Sprachkurse und für die Pädagogische Verbindungsarbeit leistet die Bibliothek wertvolle
Hilfe: ortsansässige Deutschlehrer können z.B. auf umfangreiches Lehrmaterial zum Thema
”DaF” zurückgreifen.
7.2. Goethe-Institute in Italien unter Sparzwang
Im März 1996 lud man die sieben Leiter der italienischen Goethe-Institute nach München zu
einer Besprechung, über die Möglichkeit ein, 19 Stellen einzusparen und somit Institute
personell auszudünnen oder zu schließen. In ernsthafte Gefahr der Schließung geriet dabei u.
a. das Institut in Neapel. Als Begründung wurde von der Bundesregierung angeführt, dass es
in Italien 7 Goethe-Institute gibt - neben Frankreich und den USA die höchste Anzahl für ein
einzelnes Land. Ein langjähriger Schüler des Goethe-Instituts formulierte einmal sinngemäß:
”Reich geworden bin ich nicht mit dem, was ich hier gelernt habe, aber Goethe hat mir
geholfen, die Welt und das Leben ein bisschen liebenswerter zu finden.” Im Zusammenhang
mit den Protesten gegen die von der Münchner Zentrale geplante Schließung des Goethe-
Instituts in Neapel äußerten sich deutsche und italienische Intellektuelle sehr kritisch, so z. B.
Professor Marcello Gigante, Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Göttingen und
Heidelberg ”Wenn das Goethe-Institut jetzt gezwungen wird, sich aus Italien zurückzuziehen,
entsteht zwangsläufig der Eindruck, die Deutsche Regierung wolle mit den Kriegsfolgen
nichts mehr zu tun haben. Frankreich als weitblickendes Land baut seine kulturelle Präsenz in
Neapel aus.”199 Und er erinnerte daran: “Das Deutschland, das wir lieben, ist nicht das
Deutschland der Deutschen Mark”. Der große deutsche Philosoph, Hans-Georg Gadamer, hat
in Neapel gelehrt und war Ehrenbürger der Stadt. Die Zeitung “Il Mattino” veröffentlichte am
20.2.96 einen Leserbrief von Gadamer, an Bassolino den Bürgermeister gerichtet, mit der
Überschrift: “Gadamer: salviamo il Goethe.”200 Prof. Amato Lamberti, Präsident der Provinz
199 Gigante, Marcello: Pressekonferenz im Palazzo Serra di Cassano, Neapel, 2.4. 1996. 200 Gadamer, Hans Georg: Gadamer: salviamo il Goethe. In: Il Mattino, Leserbrief, 20.2.96.
220
von Neapel, äußerte sich so: “Als Soziologe kann ich nur sagen, dass wir in Neapel eher der
deutschen als der angelsächsischen Fachtradition verbunden sind.”201 Besondere Beziehung
Neapels mit der deutschen Kultur seit dem vorigen Jahrhundert bescheinigt der Präsident des
Nationalen Philosophischen Forschungsinstituts in Neapel, Advokat Gerardo Marotta: “Das
Nationale Philosophische Forschungsinstitut ist hier ansässig, es ist Herausgeber zahlreicher
deutscher philosophischer Reihen.”202 Zwischen Italien und Deutschland bestehen intensive
kulturelle Beziehungen und besonders zu Neapel. Goethe spricht in seiner “Italienischen
Reise” 1787, eingehüllt und eingefühlt in neapoletanische Atmosphäre, davon, dass die
charakterliche Prägung des Temperaments und der Kultur eines Volkes durch das Klima
beeinflusst würden. In Kenntnis seiner schriftstellerischen Mittel, die ihm plötzlich als
begrenzt erscheinen, stellt er fest, dass er nach dem Weggang aus Italien sich wehmütig und
unfroh fühle. Doch der Gedanke an Neapel versöhne mit der Trennung: “Man sage, was man
will, der Versuch, das tagsüber Gesehene in Worten festzuhalten, führt zu Reflexionen über
die Grenzen schriftstellerischer Mittel."203 In Neapel schreibt er ferner, dass einer nach
seinem Weggang aus Italien nicht wieder froh werde. “Und wenn ich Worte schreiben will, so
stehen mir immer Bilder vor Augen der fruchtbaren Länder, des freien Meeres, der duftigen
Inseln, des rauchenden Berges und mir fehlen Organe, das alles darzustellen." Auch ich habe
diese Erfahrung gemacht.
Geplante Schließung des Goethe-Instituts in Neapel
Die geplante Schließung des Goethe-Instituts führte zu großer Empörung der Betroffenen.
Das engagierte Kollegium, Schüler und Schülerinnen, sämtliche Hochschulen, Studenten und
Studentinnen, musische Einrichtungen, Abgeordnete, Politiker und Politikerinnen in
Süditalien, selbst der Gemüsehändler an der Ecke setzten sich für das Institut ein. “Non
chiudete il Goethe” hieß es: “Schließt das Goethe-Institut nicht!” Bürgermeister Bassolino
bemühte sich um den Erhalt des Instituts. Nach den Zeiten der Mafia und Camorra war eine
Politik der sauberen Hände sein großes Anliegen. Dazu schreibt die Wirtschaftswoche unter
201 Lamberti, Amato: Sondersitzung des Consiglio Provinciale di Napoli, Neapel 4.2.1996. 202 Marotta, Gerardo: La Politica Culturale Della Germania All´Estro. Versammlung im Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Neapel., 14.Februar 1996. 203 Goethe, Johann Wolfgang : Italienische Reise. In: Werke, Hamburger Ausgabe, Band 11, 10. neubearbeitete
Aufl. München 1982, S.178 ff. auch S.186,S.199, S.217, S.326ff.
221
der Überschrift “Emsige Kehrer. Wie ein Exkommunist aus dem sinnenfrohen Sündenbabel
Neapel eine Vorzeigekommune macht: Neapels Exportschlager waren bislang vornehmlich
kulinarisch-künstlerischer Natur: Die Pizza und "0 sole Millionen", Enrico Caruso und Sophia
Loren traten vom Fuße des Vesuv ihren weltweiten Siegeszug an. Was die 1,2-Millionen-
Metropole nun hervorgebracht hat, passt so gar nicht ins Bild vom sinnenfrohen, aber
hoffnungslos verlotterten Sündenbabel am Vulkan: Im Schatten des schlummernden Kraters
kämpft ein wackerer Bürgermeister erfolgreich für die moralische und wirtschaftliche
Wiedergeburt Neapels. Verdutzt blickt die Nation gen Süden. Und sogar im tüchtigen Norden
liebäugelt mancher mit dem Import des Saubermannes. "Bassolino, komm nach Mailand!”
wurde Neapels Bürgermeister in der vergangenen Woche in Italiens Wirtschaftsmetropole
stürmisch begrüßt. Dort galten Neapolitaner bisher bestenfalls als durchtriebene Schlawiner,
ihre Stadt als die Bronx Europas – von der Camorra beherrscht und in Dreck und Lethargie
versunken. [...] Das allein ist schon ein kleines Wunder. Wenige Monate, bevor sich
Bassolino bei den Bürgermeisterwahlen im Dezember gegen die neofaschistischen Duce-
Enkelin Alessandra Mussolini durchsetzte, hatte die Stadt Bankrott erklärt. [...] Wie ernst es
den linken Stadtvätern mit dem Neuanfang ist, lassen unpopuläre Maßnahmen erahnen.
Einem Heer von 4000 ehemaligen Kommunalangestellten, die aus nicht nachvollziehbaren
Gründen in den Genuss von Berufsunfallrenten gekommen waren, strich Bassolino
kurzerhand die Bezüge. Die Botschaft war unmissverständlich: Auch für die kleinen
Nutznießer der Plünderung Neapels, die Politiker und Camorra-Bosse jahrzehntelang vereint
und unbehelligt betreiben konnten, ist die Schonfrist vorbei.”204
Bassolino hat in Neapel, statt der Patenschaften der Camorra, Patenschaften von Schulklassen
für Kulturdenkmäler anregen und verwirklichen können. Sie sorgen für Brunnen, Kirchen,
Museen, legen selbst Hand an bei Renovierung und Instandhaltung und machen Führungen.
Im Vorfeld der italienischen Parlamentswahlen und unter Einbindung des Wahlbündnisses
L’ULIVO (der Ölbaum), dem grünen Kandidaten und späteren Minister in Rom aus Neapel
Alfonso Pecoraro, gelang der Erhalt des Instituts.
204 Wirtschaftswoche: Emsige Kehrer. Wie ein Exkommunist aus dem sinnenfrohen Sündenbabel Neapel eine
Vorzeigekommune macht. Ausgabe Nr. 15 vom 4. 4. 1996. S. 30.
222
8. Portugal
8.1. Kulturpolitische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland205
Enge politische Beziehungen und eine breite wirtschaftliche Basis geben dem Verhältnis zu
Deutschland besondere Solidität. Deutschland ist zusammen mit Spanien größter Han-
delspartner Portugals und wichtiger Investor, vor allem in zukunftsweisenden Industrien.
Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich gut: Die Bundesrepublik stärkte 1997
ihre Stellung als wichtigster Abnehmer Portugals und zweitwichtigster Lieferant (jeweils im
Wechsel mit Spanien). Deutschland führt bei den Industrieinvestitionen. Von 450 deutschen
Unternehmen sind über 300 im industriellen Bereich angesiedelt und beschäftigen mit 60.000
Arbeitnehmern 1% der Erwerbstätigen im Land. Die Verbleibquote deutscher Investitionen
liegt bei über 85% (internationaler Schnitt für Portugal 35%). Rund 500.000 Deutsche (mit
insgesamt 5 Millionen Übernachtungen) reisten 1997 nach Portugal und trugen als drittgrößte
Gruppe (nach Spaniern und Briten) zu den Tourismus-Einnahmen des Landes bei. Ein
besonderes Ereignis war im Oktober 1997 die erfolgreiche Beteiligung Portugals an der
Frankfurter Buchmesse. Aus diesem Anlass wurde eine eindrucksvolle Darstellung der
portugiesischen Kultur auch über die Literatur hinaus unter Einschluss der
portugiesischsprachigen Länder Afrikas geboten. Bei der Eröffnung am 14. Oktober waren
der portugiesische Staatspräsident, der deutsche Bundespräsident und der Präsident der
Europäischen Kommission anwesend. Am 18. Oktober besuchten der damalige
Ministerpräsident Guterres und Bundeskanzler Kohl den portugiesischen Stand in Frankfurt.
Portugal war das Thema auf der Frankfurter Buchmesse und mit einer Gruppe von 40
Schriftstellern vertreten. 1998 kamen aus dieser Gruppe 14 nach Frankfurt, unter ihnen José
Saramago.206
“Als erster Portugiese ist José Saramago mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden.
Sein Verleger sprach von einem stolzen Moment für Portugal. Die Schwedische Akademie in
205 Politischer Halbjahresbericht Portugal: Auf der Grundlage des Politischen Halbjahresberichts Portugal,
Stand: März 1998. 206 Frankfurter Buchmesse: Portugal ’98. Ein Meer von Büchern. Herausgegeben zur 50. Frankfurter
Buchmesse, Hg., 7. – 12. Oktober 98.
223
Stockholm sagte zur Begründung ihrer Entscheidung, der 75-jährige lasse mit seinen Parabeln
die Menschen ‘die trügerische Wirklichkeit’ fassen.”207 Im Moment, da am portugiesischen
Messestand die Nachricht von der Verleihung des Preises bekannt wurde, war Saramago
gerade auf dem Weg zum Rückflug nach Portugal und wurde von der Nachricht überrascht.
Man holte ihn vom Flughafen zurück und feierte ihn begeistert auf der Buchmesse. Der Weg
durch die Menge wurde ihm gebahnt, und er musste auf einen Tisch steigen, um im Gedränge
der Journalisten und Messebesucher sprechen zu können. Saramago, aus ärmsten
Landarbeiterverhältnissen stammend, ein linker Autor, der sich auch heute noch als
Kommunist bezeichnet, veröffentlichte neun Bücher. Zur Buchmesse wurde auf deutsch ”Die
Stadt der Blinden” herausgegeben, eine Parabel über die geblendete Vernunft unter der
Herrschaft der Instinkte, in der die Hauptfiguren auf eine furchtbare Irrfahrt geschickt
werden. Das wichtigste Kulturereignis des Jahres 1998 in Portugal war die Weltausstellung
Expo `98 in Lissabon. Hierzu wurde von den portugiesischen Veranstaltern u.a. die deutsche
Choreographin Pina Bausch eingeladen, eine Tanzchoreographie über die portugiesische
Hauptstadt im 500. Jahr nach der Entdeckung Indiens durch Vasco da Gama, zu erstellen.
Die Entscheidung, die Zweigstelle des Goethe-Instituts in Coimbra zu schließen, hat zu
erheblichem Unverständnis und Protesten geführt. Im Juni 1997 konnte ein ”Deutsch-
Portugiesischer Kulturverein” gegründet werden, der mit Unterstützung des Goethe-Instituts
die Sprachkurse weiterführen soll. Noch ist die Zahl der Sprachschüler gering. Die
Aussichten für eine erfolgreiche Fortführung der Sprachkurse bleiben jedoch abzuwarten.
8.2. Das Goethe-Institut Porto208
Das Goethe-Institut Porto – geografisch gesehen – am Rande Europas wurde im Jahr 1957
gegründet. Mit nur 1 Entsandtem und 4 Lehrkräften ist es ein kleines Institut. Unter Leitung
dieser 5 Mitarbeiter kamen 1997/98 immerhin 5 Veranstaltungen, aus dem Bereich
Wissenschaft und Literatur und 5 Filmreihen, zustande. 9 Ausstellungen wurden der
Öffentlichkeit vorgestellt. Diese 17 originären Goethe-Instituts-Veranstaltungen zogen binnen
Jahresfrist über 4200 Besucher an. In 62 Deutschkursen wurden im genannten Zeitraum 6.050
Unterrichtseinheiten einschließlich der Prüfungen angeboten. Bei den 112 Prüfungen betrug
207 Meldung der Süddeutschen Zeitung vom 9. 10. 1998. S. 1. 208 Goethe-Institut: Jahrbuch 1997/98. S. 116.
224
die Durchfallquote 12,5 Prozent. 18 Veranstaltungen der Pädagogischen Verbindungsarbeit
befassten sich mit verschiedenen Themen, wie Didaktik/Methodik, Landeskunde, Literatur,
sprachlicher Fortbildung und Kinderkursen. Auch Sonderkurse für Germanistikstudenten und
Deutschlehrer wurden angeboten.
Zur Veranschaulichung seien hier einige Höhepunkte aus dem Jahresprogramm angeführt:
- Europa-Galerie. Reihe von Künstlergesprächen, Ausstellungen und Workshops in der
Galerie des Instituts, ermöglicht durch die "Kunstbrücke" von Dr. Klaus Schulz, u.a.
mit Steffen Vollmer und Brigitte Volz, in Zusammenarbeit mit der Hochschule der
Bildenden Künste (Porto)
- Die europäische Herausforderung. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Kolloquium,
u.a. mit Mario Soares und Freimut Duve, MdB
- Heiner-MM-Projekt. In Zusammenarbeit mit dem Rivoli-Theater
- Projekte mit portugiesischen Schulklassen. Programmvorführungen im Rahmen der
Pädagogischen Verbindungsarbeit
8.3. Die Deutsche Schule Porto209
Die Deutsche Schule Porto ist eine deutschsprachige Privatschule, die als eine von zwei
deutschen Auslandsschulen in Portugal das dreigliedrige deutsche Schulsystem dort verfügbar
macht. Dabei wird sie im Auftrag des Auswärtigen Amtes vom Bundesverwaltungsamt
unterstützt. Die Schule führt zu den Abschlüssen der deutschen Allgemeinen Hochschulreife,
dem Mittleren Abschluss, und dem Hauptschulabschluss (bzw. qualifizierenden Haupt-
schulabschluss). Die Gleichwertigkeit der Zeugnisse mit denen im innerdeutschen
Schulwesen ist durch eine Zuerkennung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
deutschen Bundesländer (KMK) gewährleistet. Durch die gleichzeitige Anerkennung der
Schule durch das portugiesische Unterrichtsministerium können Schüler, die ein
Versetzungszeugnis der DSP erhalten haben, in jedem Jahrgang in die folgende Klasse des
portugiesischen Schulsystems wechseln. Dies gilt jedoch nicht mehr automatisch für den
anschließenden Besuch einer portugiesischen Hochschule: bis 1988 galt auch hier das
Abschlusszeugnis der Deutschen Schule Porto als generelle Zugangsberechtigung; seit 1989
209Deutsche Schule Porto: Informationsbroschüren 1998/99, Schulleiterjahresbericht 1997/98.
225
müssen sich die Schüler aus Porto jedoch wie alle anderen Bewerber dem System des
portugiesischen Hochschulzugangs (provas especificas) unterwerfen, bei dem sie ent-
sprechend ihrem Studiengang in zwei Fächern Zulassungsarbeiten schreiben müssen. Hierbei
bestätigt sich aber schon seit Jahren eine große Überlegenheit der Schüler der beiden
deutschen Schulen, deren Ergebnisse in der Regel weit über dem portugiesischen
Durchschnitt liegen. Der Schule gehört neben dem Gymnasium auch eine Grundschule sowie
ein eigener Kindergarten an. Haupt- und Realschüler werden in den regulären
Gymnasialklassen unterrichtet und verlassen die Schule entsprechend früher, Hauptschüler
nach der Klasse 9, Hauptschüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss und Realschüler
nach der 10. Klasse. Beide Gruppen werden nach den gymnasialen Lehrplänen unterrichtet
und durchlaufen die gleichen Prüfungen wie die Gymnasiasten, erhalten allerdings stets einen
differenzierten Notenbonus. Der Kindergarten umfasst zwei Jahrgänge mit jeweils vier
Gruppen, drei vormittags und eine nachmittags. Entsprechend dem Anspruch der Schule
machen die portugiesischen Kinder hier erste spielerische Erfahrungen mit der deutschen
Sprache (begrenzter Sprachunterricht), die deutschen Kinder ebenso mit der portugiesischen.
Die Aufnahme deutscher Kinder in Kindergarten, Grundschule und Gymnasium (nach
Vorlage eines vorausgehenden deutschen/deutschsprachigen Zeugnisses) ist jederzeit
möglich, ortsansässige portugiesische Kinder werden nur dann in die Grundschule
aufgenommen, wenn sie auch schon den Kindergarten der DSP besucht haben. Der Besuch
der Grundschule ist wiederum Voraussetzung für den Besuch des Gymnasiums für die
portugiesischen Schüler. Schwierigkeiten für manche deutschen Kinder bereitet beim
Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule das portugiesische Recht, das praktisch ein
Höchstalter von 6 Jahren bei Eintritt in die Schule festlegt .Die Grundschule umfasst wie in
Deutschland vier Jahrgänge mit bisher je zwei Klassen. Seit dem Schuljahr 1997/98 ist jedoch
ein dritter Grundschulzug aufgebaut worden, der durch die erhöhte Zahl von Bewerbungen
erforderlich wurde (1997/98 überstieg die Zahl der Bewerber mit 105 die der angebotenen
Plätze mit 70). Zur notwendigen Auswahl der gymnasial geeigneten Schüler hat die
Grundschule in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium ein Kriteriensystem entwickelt,
welches nicht der objektiven Bewertung dient, sondern eine Relation zwischen den Schülern
herstellen soll. Durch dieses Verfahren rechnet man mit einem Durchschnitt von etwa 25%
der Schüler, die nach der Grundschule die DSP verlassen müssen und somit das überlaufene
Gymnasium zumindest partiell entlasten. Da die Grundschule vom portugiesischen
Unterrichtsministerium als portugiesische Grundschule anerkannt ist, müssen die Lehrpläne
226
entsprechende nationale Elemente, wie etwa verstärkten Mathematikunterricht,
berücksichtigen. Etwa die Hälfte des Unterrichts wird in portugiesischer Sprache erteilt. Im
Gymnasium müssen ebenfalls deutsche und portugiesische Lehrpläne berücksichtigt werden,
was zu einer deutlich höheren Wochenstundenbelastung als in Deutschland führt. Ab der 7.
Klasse findet täglicher Nachmittagsunterricht zwischen 14.30 und 17.50 statt (7. Bis 10.
Stunde). Dies ist teils durch die sprachliche Integration der deutschsprachigen und
portugiesischen Schüler bedingt: Deutsch wird von Klasse 1 bis 8 größtenteils getrennt in
Deutsch als Mutter-, bzw. für die portugiesischen Schüler Deutsch als Fremdsprache erteilt.
Ab der 9. Klasse ist der Deutschunterricht integriert. Portugiesisch wird außer für später
eintretende deutsche Schüler weitgehend nach muttersprachlichen Kriterien unterrichtet. Im
Schuljahr 1997/98 hat der Fachbereich DaF einen Schulversuch unternommen, der zur
Vermeidung späterer Sprachprobleme in Jahrgangsstufe 9, eine Teilintegration bereits ab der
7. Klasse vorsieht. Neben drei Wochenstunden DaF/DaM werden die Schüler der 7. und 8.
Klassen integriert in drei Klassengruppen mit einem stärker auf altersgemäße Literatur
ausgerichteten Curriculum unterrichtet. Durch diese Maßnahmen erhofft man sich einerseits
sprachliche Synergieeffekte zwischen muttersprachlichen Schülern und ihren
Klassenkameraden, andererseits eine bessere Vorbereitung auf Inhalte und Arbeitstechniken,
die sonst erst von den Fremdsprachlern in Klasse 9 (zum Nachteil der Muttersprachler)
eingeführt werden müssten. Schüler ohne Portugiesischkenntnisse müssen diese innerhalb
von drei Jahren erwerben, nach dieser Zeit nehmen sie am normalen Portugiesischunterricht
teil und werden entsprechend (versetzungsrelevant) benotet. Für solche Schüler werden
allerdings spezielle Portugiesischkurse organisiert und in den Stundenplan integriert. Erste
”reguläre” Fremdsprache ist Englisch ab der 5. Klasse und Französisch ab der 7. Klasse. In
der 10. Klasse müssen sich die Schüler dann für eine der beiden entscheiden. Die
Entwicklung von gymnasialen Lehrplänen erfolgt in enger Abstimmung mit den deutschen
Schulen auf der iberischen Halbinsel.
Die Deutsche Schule Porto hatte 1997 insgesamt 713 Schüler bzw. Kindergartenkinder, davon
besuchten 337 das Gymnasium, 229 die Grundschule und 147 den Kindergarten. Das
Lehrerkollegium umfasste zu diesem Zeitpunkt 14 vermittelte Lehrkräfte aus der
Bundesrepublik, 30 deutschsprachige und 9 portugiesische Ortslehrkräfte, sowie 8
Kindergärtnerinnen. Inzwischen wurde für den 3. Grundschulzug eine weitere
Grundschullehrerin aus Deutschland angeworben, die aus den Schulgeldern dieser Klassen
finanziert wird. Schulträger der DSP ist der Deutsche Schulverein zu Porto, dessen Mitglieder
227
sich vorwiegend aus den Eltern der Schüler zusammensetzen. Die Mitgliederversammlung
wählt den Schulvereinsvorstand, nimmt Berichte des Schulleiters entgegen und entscheidet
über den Erwerb bzw. Verkauf von Immobilien. Mitglied des Schulvereins können dabei
volljährige Personen mit guten deutschen Sprachkenntnissen werden, deren Aufnahmeanträge
von zwei Mitgliedern des Vereins befürwortet werden müssen. Der Vorstand des
Schulvereins, in dem der deutsche Konsul in Porto sowie der Schulleiter von Amts wegen
einen Sitz haben, vertritt die Schule in allen rechtlichen Fragen und lenkt das Schulgeschehen
in finanzieller Hinsicht: er entscheidet über die Dienstverträge der Lehrer (in Absprache mit
dem Schulleiter) und stellt den Schulhaushalt auf. Im Rahmen des Haushaltsplanes legt der
Schulvereinsvorstand auch die Höhe des Schulgeldes fest, das die DSP als Privatschule
erhebt. Die Höhe des Schulgeldes richtet sich nach der Kinderzahl (differenziert werden die
Beträge bis zu einer Kinderzahl von 4) sowie der Schulart (Kindergarten, Grundschule,
Gymnasium) und wird pro Trimester erhoben. Im Kindergarten sind es für das erste Kind pro
Jahr 325.000 Escudos, für das zweite Kind im Jahr 315.000 Esc., für das dritte 305.000 Esc.
und für das vierte 295.000 Esc. In der Grundschule erhöhen sich die Beträge, und zwar auf
355.000 Esc. für das erste Kind pro Jahr, 345.000 Esc., 335.000 Esc. bzw. 325.000 Esc. für
die folgenden Kinder im Jahr. Für das Gymnasium gelten schließlich die höchsten Sätze, mit
380.000 Esc. für das erste Kind im Jahr, bzw. 370.000 Esc., 360.000 Esc. und 350.000 Esc.
für die folgenden drei p.a. Für alle Schüler ist bei der Ersteinschreibung eine einmalige
Gebühr in Höhe von 55.000 Esc. fällig sowie jedes weitere Schuljahr für den selben Zweck
eine in Höhe von 15.000 Esc. Für Kindergartenkinder fällt für didaktisches Material eine
Jahresgebühr von 5.000 Esc. an, für Grundschüler müssen ebenfalls 5.000 Esc. bezahlt wer-
den. Zusätzlich werden für Grundschüler jährlich 2.000 Esc., für Mittelstufenschüler der
Klassen 5 bis 10 jeweils 3.500 Esc. sowie für Oberstufenschüler 4.000 Esc. an Kopierkosten
berechnet. Schließlich stellt der Schulvereinsvorstand für alle Schüler noch eine Ver-
sicherungsprämie in Höhe von 3.000 Esc. in Rechnung. Ermäßigungen beim Schulgeld
können auf Antrag bei nachgewiesener Bedürftigkeit gewährt werden.
Weitere Zuschüsse erhält die Schule aus Mitteln des Bundes. In den Sommerferien 1998
begann die umfangreiche Sanierung der Heizung und der Turnhalle der Schule. Weitere
absehbare Sanierungsmaßnahmen dürften die Türen und Fenster des Gebäudes betreffen. Auf
längere Sicht hin reicht auch das Sporthallenangebot für die Schulgröße nicht aus, so dass
mittelfristig mit dem Neubau einer Turnhalle gerechnet werden muss. Eltern können ihre
Interessen auch über den Elternbeirat artikulieren; gleiches gilt für die Schüler, denen dafür
228
die Schülermitverwaltung zur Verfügung steht. Die Rechte und Arbeitsweise beider
Institutionen sind dabei in der Schulordnung bzw. der Satzung festgelegt. Trotz der starken
Stundenbelastung werden an der Schule viele extracurriculare Aktivitäten durchgeführt: es
bestehen Arbeitsgemeinschaften für Mannschaftssportarten, Selbstverteidigung, Judo,
Wirtschaft, Theater, Mittel- und Oberstufenchor sowie Astronomie, die meistens von
vermittelten Lehrkräften betreut werden. Im Schuljahr 1997/98 wurden in diesem
Zusammenhang zwei Singspiele und ein Theaterstück aufgeführt. Die Sportgruppen stellten
sich Wettkämpfen mit Schulen in Madrid und Lissabon, und konnten sich erfolgreich an zwei
Turnieren mit der Englischen und der Internationalen Schule beteiligen. In der Grund- und
Mittelstufe wird zusammen mit der Firma Futurekids eine informationstechnische
Grundausbildung angeboten. Hierbei wurden zwei Internetanschlüsse installiert und
entsprechende Hard- und Software für die Arbeitsgruppe ”Internet” beschafft. Im kulturellen
Bereich konnten darüber hinaus auch noch einige Veranstaltungen mit Künstlern aus
Deutschland organisiert werden, beispielsweise ein Konzert mit dem Kammerchor des
Stiftsgymnasiums Verden oder ein Konzert mit den Bundespreisträgern des Wettbewerbs
”Jugend musiziert”. Besondere Erwähnung gebührt auch der traditionellen Feier zum Tag der
Deutschen Einheit. Schüler der 12. Klassen führen eine traditionelle Deutschlandfahrt durch.
Diese Veranstaltungen, die oft unter tatkräftiger Mithilfe von Schulverein, Elternbeirat und
Privatpersonen stattfanden, verdeutlichen den starken Zusammenhalt der mit der Schule
verbundenen Menschen und fördern deren hohe Identifikation mit ihr.
9. Türkei
9.1. Rahmenbedingungen für die Vermittlung der deutschen Sprache210
Kulturpolitische Grundlagen und Beziehungen
Grundlage der deutsch-türkischen Kulturbeziehungen ist das Kulturabkommen vom 8. Mai
1957. Dort ist vor allem der Austausch deutscher Lehrkräfte durch das BVA bzw. die
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen an türkischen Gymnasien geregelt (dies schließt
210 Länderkonzeption Türkei: Auf der Grundlage der Länderkonzeption zur Förderung der deutschen Sprache
und der damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Türkei. Auswärtiges Amt, Hg., Bonn, 1998.
229
auch die Vermittlung von Lehrern an die private Elite-Schule Özel Alman Lisesi in Istanbul
mit ein). Zusätzlich dazu wurde am 26. Mai 1986 ein Zusatzabkommen zum
Kulturabkommen (”Anadolu-Programm”) mit dem Ziel geschlossen, die Entsendung von
deutschen Lehrern an die staatlichen Anadolu-Gymnasien mit intensivem Deutschunterricht
zu ermöglichen. Im akademischen Bereich wirkt besonders der DAAD mit verschiedenen
Austauschprogrammen und Stipendien für Studenten und Dozenten. Ein im Jahre 1991
geschlossenes Abkommen legte die Grundlage für zwei deutschsprachige Fachbereiche
”Wirtschaftsinformatik” und ”Betriebswirtschaft” an der Marmara-Universität Istanbul, die
Pläne zur Gründung einer eigenen deutschsprachigen Universität in Istanbul wurden jedoch
nicht weiter verfolgt. Im politisch-ökonomischen Kontext ist Deutschland mit großem
Abstand wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner der Türkei. Verstärkt werden diese
Interaktionsprozesse durch die mehr als 2,2 Millionen in Deutschland lebenden Türken, von
denen sich etwa 40.000 selbständig gemacht haben, oder als Arbeitnehmer einen erheblichen
volkswirtschaftlichen Faktor darstellen. Auf der anderen Seite kamen, mit mehr als 2,3
Millionen jährlich, die weitaus meisten Touristen in der Türkei aus Deutschland und mehr als
700 deutsche Unternehmen sind in der Türkei mit Tochtergesellschaften oder
Niederlassungen präsent.
Charakteristik des Bildungswesens in Bezug auf DaF
Die Bildung hat in der Türkei seit Atatürk einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert
bekommen. Eltern scheuen oft keine Kosten oder persönliche Mühen, ihre Kinder in den
Schulen optimal betreuen zu lassen, sei es durch teuere Nachhilfe oder durch Erneuerungen
am Schulgebäude. Obwohl Lehrer laut Atatürks Definition die ”Retter der Nation” darstellen
und ihr Beruf gesellschaftlich geachtet ist, verdienen sie so wenig, dass etwa 40% von ihnen
noch einen zweiten Beruf ausüben, um das Durchschnittseinkommen von 550 DM im Monat
aufzubessern. Die Erziehungsreform ist ein mutiges und ehrgeiziges Unterfangen, dessen
weitere Elemente die Verbesserung der Schulsituation im Osten der Türkei, die Verringerung
der Klassengröße, eine Erhöhung der Qualität des Unterrichts und eine verbesserte
Beschulung von Mädchen sein sollen. Zuständig für die Lehrpläne, Curricula und
Lehrwerkgenehmigungen in allen Schulformen ist allein das Nationale Türkische
Erziehungsministerium in Ankara. Die Provinzen haben praktisch keine Kompetenzen.
Obgleich im Rahmen der Lehr- und Lernreformen neuerdings auf einige fast revolutionäre
230
Verhaltensweisen, wie selbständiges und eigenverantwortliches kritisches Urteilsvermögen
oder vernetzte und problemorientierte Handlungskompetenz, Wert gelegt wird, bleibt die
Türkei doch größtenteils ein Hort überholter Lernformen: lehrerzentrierter Frontalunterricht,
prüfungsfixiertes Lernen, unkritisches, detailgenaues Repetieren von auswendig gelerntem
Wissen und nationalen Parolen etc. sind noch immer die entscheidenden Charakteristika.
Peter Scholl-Latour schreibt in Allahs Schatten über Akatürk - Die Türkei in der Zerreißprobe
über Reise in die Osttürkei, bei der ihn Ekin Deligöz, eine grüne Bundestagsabgeordnete, in
ihr Heimatdorf begleitet. “Wir machen einen Rundgang durch das Dorf. Da existiert zwar ein
bescheidenes Schulhaus, vor dem eine grobe Atatürk-Büste aus Bronze aufgepflanzt ist. An
der Wand lesen wir den unvermeidlichen Spruch “Welch ein Glück, Türke zu sein”. Aber der
Unterricht wurde hier eingestellt. Der Lehrer hat das Dorf verlassen, und die Kinder müssen
täglich den langen Weg nach Havza zu Fuß zurücklegen.”211
Stellung von Deutsch im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen
Deutsch ist, zusammen mit Englisch und Französisch (und Arabisch auf den religiösen
Schulen) eine der drei wichtigsten Fremdsprachen in der Türkei. Dabei liegt Deutsch weit
abgeschlagen hinter Englisch, dass mit 95% der Schüler eine absolute Monopolstellung
genießt (Deutsch: 4%, Französisch: 1%). Auch in den Grundschulen, die seit der
Erziehungsreform ab der 4. Klasse eine erste Fremdsprache lehren, zeigt sich ein ähnliches
Bild: Englisch lernen etwa 98% der Schüler. An ungefähr 9% der fremdsprachlich
ausgerichteten Anadolu-Schulen wird Deutsch neben Englisch als erste Fremdsprache
angeboten. Auf den Regelschulen, die sich der Grundstufe anschließen – immerhin für 2/3
aller Schüler, die die Aufnahmeprüfung in die Elite-Schulen nicht schaffen maßgeblich –
sinkt die Bedeutung des Deutschen kontinuierlich: von ca. 200.000 Deutsch lernenden im
Jahre 1992 auf ca. 80.000 in 1996. Dies hat auch zu einer massiven Verschlechterung der
Arbeitsplatzsituation der Deutschlehrer für diesen Schultyp geführt: von etwa 5.000
Deutschlehrern werden nur ca. 1.800 als solche eingesetzt. Die weitaus größte
Deutschlernergruppe stellen die Schüler dar, die Deutsch auf den Anadolu-Gymnasien mit
Englisch als erster Fremdsprache, als zweite Fremdsprache lernen. Deren Zahl wird auf
100.000 bis 130.000 Schüler geschätzt. Aufgrund der geringen Wochenstundenzahl, Deutsch
211 Scholl-Latour, Peter: Allahs Schatten über Atatürk. Die Türkei in der Zerreißprobe. München 2001. S. 343.
231
wird vier Jahre lang als zweistündiges Wahlfach angeboten, ist das Sprachniveau dieser
Schülergruppe allerdings eher gering. In 34 Anadolu- Schulen wird Deutsch unterrichtet. An
19 dieser Schulen hat die Bundesregierung augenblicklich insgesamt 71 deutsche Lehrer
vermittelt. An zwei weiteren Schulen in Istanbul (staatliches Istanbul Lisesi mit besonderem
Status und privates Alman Lisesi) unterrichten nochmals 60 Lehrer aus Deutschland.
Entsprechend dem Verhältnis im Schulbereich gibt es mehrere englischsprachige
Universitäten in der Türkei (z.B. die renommierte Middle East Technical University in
Ankara) aber nur eine Universität, die deutsche Studiengänge anbietet (s.o. die Marmara-
Universität in Istanbul). Der Hauptgrund für das schlechte Abschneiden von Deutsch als
Fremdsprache im Vergleich zu Englisch liegt, neben dessen Bedeutung als Weltsprache
Nummer eins, auch in der geringen Attraktivität des Deutschen als Ausbildungssprache:
aufgrund der nivellierten deutschen Massen-Universitäten, des ökonomischen Gefälles und
der Schwierigkeiten bei der Visa-Beantragung, erscheint Deutschland als Studienstandort
unattraktiv. An den Universitäten studieren derzeit zwischen 5.000 und 6.000 Studenten an
den Deutschfachbereichen. Neuzugelassen werden jährlich etwa 7.000. Ebenso viele absol-
vieren jährlich die Diplomprüfung. Die Tendenz ist allerdings eher rückläufig. Insgesamt gibt
es an den derzeit 55 Universitäten des Landes 24 Deutschabteilungen, von denen jeweils die
Hälfte philologisch bzw. didaktisch ausgerichtet sind. Besonders groß ist die Nachfrage nach
Deutsch an den Universitäten mit wirtschafts- und betriebswirtschaftlichen Fakultäten und an
Tourismushochschulen. Besonders durch die starke Verflechtung des Landes mit Deutschland
in der Wirtschaft, im Handel und durch den Tourismus, sehen viele Türken eine Motivation
zum Erlernen der deutschen Sprache. Im Schulbuchsektor gibt es praktisch keine eigene
Verlagslandschaft: das Regionallehrwerk für Regelschulen entstammt dem staatseigenen
Schulbuchverlag, die in den Anadolu-Schulen eingesetzten Werke für DaF stammen
durchweg aus deutschen Verlagen.
Bei der Bewilligung ausländischer Literatur legt das Erziehungsministerium strenge Maßstäbe
an: deutschen Verlagserzeugnissen wurde in der Vergangenheit schon mehrfach die
Zulassung verweigert, z.B. aufgrund der Problematisierung der Kurdenfrage, der Fotos
nackter Männer oder der als diskriminierend empfundenen Darstellung türkischer
Gastarbeiter in Deutschland. Fast noch strenger werden die Zulassungsanträge von Lektüren
überprüft: so wurden z.B. Texten von Berthold Brecht die Zulassung als Schullektüre
verweigert, da dieser Kommunist war.
232
Einstellungen zu Deutsch und Deutschland
Die Türken sind traditionell positiv gegenüber Deutschland eingestellt. Dies ist begründet
durch die lange politische Zusammenarbeit. Deutschland wurde besonders seit dem ver-
gangenen Jahrhundert gerne als ”großer Bruder” und ”Freundesland” bezeichnet. Es beteiligte
sich an der Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten des Osmanischen Reiches und
deutsche Fachleute spielten eine wichtige Rolle bei der Modernisierung des Landes im
Rahmen der Atatürkschen Reformen. Oft wird auch heute noch an die Waffenbrüderschaft
im 1. Weltkrieg erinnert. Andererseits trugen die vielen türkischen Gastarbeiter als
Heimkehrer oder auf Heimaturlaub zu diesem positiven Bild bei. Hinzu kommen noch die
größtenteils freundschaftlichen wirtschaftlichen und touristischen Beziehungen zwischen
beiden Staaten.
Auf der anderen Seite provozieren einige türkische Politiker Deutschland mit polemischen
Ausfällen, da sie in den Deutschen die Drahtzieher für den Ausschluss aus den
Verhandlungen zum EU-Beitritt 1997 in Luxemburg sehen. Auch die ausländerfeindlichen
Anschläge in Deutschland trüben das Verhältnis. Deutschland ist weiterhin der bedeutendste
Handelspartner der Türkei. Die Exporte nach Deutschland betrugen 1997 im Zeitraum Januar
bis November 4,67 Mrd. US$ (+0,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) und somit 20,5%
aller türkischen Exporte. Mit Investitionen in Höhe von 281,6 Millionen US$ für 1997 stand
Deutschland zum Jahresende an erster Stelle (vor den USA und den Niederlanden). 1997
stellte Deutschland 39% des Tourismuskontingents in der Türkei, mit einem Zuwachs der
Besucherzahlen von 10% im Vergleich. zum Vorjahr. Als mit der Wahl vom 3.11.02 die
konservative islamisch-demokratische Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei AKP mit
ihrem Vorsitzenden Tayyip Erdogan mit 34% stärkste Partei im türkischen Parlament wurde,
waren die Reaktionen auf den Wahlsieg sehr skeptisch. War doch Erdogan in der
islamistischen Bewegung unter Necmettin Erbakan groß geworden. Nun muss Erbakan, der
infolge eines Gerichtsurteils zur Zeit noch nicht Ministerpräsident werden kann, (dazu
benannte Staatspräsident Sezer den stellvertretenden AKP Vorsitzenden Abdullah Gül) in den
fünf Jahren der Regierungszeit seiner Partei beweisen, dass er die kemalistischen und
laizistischen Prinzipien der Türkei anerkennt und so hilft, den Weg zum Beitritt in die EU zu
öffnen.
233
Bedingungen für den Deutschunterricht und das Studium an Hochschulen
Das Deutschstudium an türkischen Hochschulen dauert in der Regel vier Jahre und wird mit
einem Diplom abgeschlossen. Für Studenten mit unzureichenden Vorkenntnissen verlängert
sich das Studium um ein Vorbereitungsjahr. Das Niveau der Aufnahmeprüfung hat in den
letzten Jahren allerdings rapide abgenommen: Heute erhalten praktisch auch Studenten ohne
jegliche Vorkenntnisse einen Regelstudienplatz für Deutsch. Die Studienschwerpunkte sind
verschieden, meistens steht ein Kanon aus den Bereichen Spracherwerb, Literatur-
wissenschaft, Sprachwissenschaft, Übersetzung, Kulturgeschichte/Landeskunde und u.U.
pädagogischer Fächer zur Auswahl. Der Praxisbezug der Lehrerausbildung lässt stark zu
wünschen übrig. Im Rahmen des Studiums (didaktischer Teil) ist eine Praktikumszeit von
lediglich drei Wochen fest eingeplant, faktisch bedeutet dies für angehende Lehrer oft, dass
sie nur eine Stunde Unterrichtet haben, ehe sie in ihren Beruf starten. Die Berufsaussichten
bei den beiden vorhandenen Studiengängen Allgemeines Germanistikstudium und
Berufsbezogenes Deutschstudium (beide gleichen sich in Aufbau, Fächern
Abschlussverfahren) sind gleichermaßen schlecht: nach dem Einstellungsstop für
Deutschlehrer finden bei weitem nicht alle (s.o.) Absolventen einen Job als Lehrer. Lukrativer
– aber nicht unbedingt zahlreicher – sind die Betätigungsfelder Tourismus und Wirtschaft.
Hierbei werden Absolventen vor allem von Unternehmen mit Geschäftskontakten nach
Deutschland oder von Banken nachgefragt.
9.2. Das Goethe-Institut Istanbul
Kulturprogramme
Die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei sowie
die Präsentation deutscher Kultur wird durch das Goethe-Institut Istanbul auf vielfältige Art
verwirklicht. So konzipierte man zusammen mit dem Französischen Kulturinstitut eine
Filmreihe in Erinnerung an die gesellschaftlich umwälzenden Ereignisse im Mai 1968.
Gezeigt wurden u.a. ein Film über Leben und politische Wirkung der RAF-Gründerin Ulrike
Meinhof oder die Dokumentation ”Aufrecht gehen – Rudi Dutschke ‚Spurensuche‘”.
Besondere Mühe gab man sich auch bei der Reihe ”Retrospektive Deutsch-Türkischer
Filmemacher”, mit Beiträgen und Podiumsdiskussionen türkischer Filmemacher in
234
Deutschland, deutscher Filmemacher mit Türkei-, bzw. türkischen Regisseuren mit
Deutschland-Bezug. Im musikalischen Bereich gaben z.B. die “Akademie für alte Musik”,
Berlin oder das international mehrfach ausgezeichnete Leipziger Streichquartett Konzerte, die
vom Goethe-Institut organisiert wurden. Auch im Theatersektor kamen auf Einladung des GI
zwei der bekanntesten deutschsprachigen Regisseure, Philippe Besson und Paul Plamper, mit
je einem Stück, nach Istanbul. Im Rahmen der Ausstellungen stand beispielsweise eine zum
Thema ”Exil Türkei” auf dem Programm, die anlässlich des 75jährigen Jubiläums der
Türkischen Republik an die Epoche besonders fruchtbarer Zusammenarbeit zwischen
Deutschen und Türken in der Zeit nach 1933 erinnern sollte, als die Türkei von den Nazis
verfolgten Wissenschaftlern, Künstlern und Politikern Zuflucht gewährte, die wiederum
ihrerseits zum Aufbau der modernen Türkei beitrugen. Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche
Ausstellungsarbeit bot das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart: Es zeigte zusammen
mit DaimlerChrysler die Ausstellung ”Ein Stück Großstadt als Experiment - Planungen am
Potsdamer Platz”. Schließlich fanden, als Beispiel für die Wortveranstaltungen, noch
verschiedene Symposien statt, etwa zur Tourismuspolitik im Mittelmeerraum im 21.
Jahrhundert. 1998 besuchten 85.270 Zuschauer die Programme.
Deutsch lehren und lernen
Das Goethe-Institut Istanbul bietet differenzierte, lernorientierte Sprachkurse mit einem
umfangreichen Prüfungsprogramm für interessierte Türken an. Darüber hinaus werden im
Rahmen der pädagogischen Verbindungsarbeit verschiedene Workshops und Seminare für
Deutschlehrer durchgeführt, differenziert in die Bereiche: Bildungs-/Sprachpolitik, Curricula,
Didaktik/Methodik, Landeskunde, Literatur und Mediendidaktik. Die Sprachkurse sind
getrennt in Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse, die jeweils einem kommunikativen Ansatz
folgen und aufeinander aufbauen. Inhaltlich sind sie für über 16jährige konzipiert und in
Winter-, Frühjahrs- und Sommertrimester unterteilt. Im Sommer werden außerdem
Intensivkurse angeboten. Standardkurse gliedern sich dabei in Grund-, Mittel- und
Oberstufenniveau, Spezialkurse werden zu Grammatik, Konversation und Deutsch für den
Beruf angeboten.
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 16.127 Exemplaren, darunter 14.000
Bücher, 53 Zeitungen und Zeitschriften sowie 2.073 audiovisuelle Medien. Schwerpunkte
235
bilden dabei deutsche Literatur, Philosophie, Geschichte / Politik des 20. Jh. Außerdem
beantwortet das Infozentrum Anfragen zu deutschlandbezogenen Themen und vermittelt
Kontakte zu deutschen Bibliotheken. Deutschlehrer erhalten umfangreiche Materialien zum
Thema DaF. Außerdem unterstützt man türkische Schulen und Bibliotheken mit
Buchspenden.
9.3. Die Schulreform in der Türkei
Hintergrund der Schulreform
Die türkische Regierung unter Ministerpräsident Yilmaz hatte am 18. August 1997, als erstes
und wichtigstes innenpolitisches Vorhaben, eine umfassende Erziehungsreform im Parlament
verabschieden lassen. Hauptsächlich ausschlaggebend dafür war ein Beschluss des Nationalen
Sicherheitsrates vom 28.2.1997, der sich vornehmlich aus türkischen Generälen
zusammensetzt und die eigentliche politische Entscheidungsgewalt in der Türkei inne hat.
Kern dieser Reform ist die Einführung einer 8-jährigen, durchgehenden Schulpflicht für alle
türkischen Kinder. Damit wollte das Militär, das sich traditionell als Hüter des laizistischen,
kemalistischen Erbes der Türkei versteht, dem Einfluss der religiös orientierten Imam-Hatip-
Schulen auf die Kinder im sensiblen Alter entgegenwirken. Diese Schulen schlossen sich an
die bisherige 5-jährige (Pflicht-) Grundschule an. Ein weiteres Bestreben war sicherlich auch
die Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus besonders in ländlichen Bevölkerungs-
schichten im Südosten, wo viele Kinder die Schule bereits nach 5 Jahren verließen.
Situation vor der Reform / Besonderheiten des türkischen Schulsystems
Bisher verpflichtete die Grundschule lediglich zum fünfjährigem Besuch. Für ca. 30 – 35%
der Schüler endete damit jeglicher Schulbesuch, knapp zwei Drittel setzten den Schulbesuch
allerdings fort. Auf die 5-jährige Grundschule folgten drei sog. Orta-Klassen (Orta 1-3), die
der deutschen Mittelstufe (Sekundarstufe I) ähnelten und drei sog. Lise-Klassen (Lise 1-3),
vergleichbar der deutschen Oberstufe (Sekundarstufe II). Während ein Großteil der Schüler
ohne Aufnahmeprüfung in die Sekundarstufe vorrückte, bewarben sich besonders talentierte
Schüler über eine Aufnahmeprüfung an folgende, im Vergleich zu den normalen Gymnasien
(Lise), weit renommiertere Schultypen: die naturwissenschaftlich ausgerichteten FEN-Lisesi,
236
die fremdsprachigen Anadolu-Lisesi und die sog. Süper-Lisesi. Letztere beiden Typen setzten
allerdings nach dem Grundschulbesuch noch eine einjährige Vorbereitungsklasse, die sog.
Hazirlik voraus. Eine weitere Alternative stellte, wie erwähnt, der Besuch der Mittelstufe auf
den islamischen Imam-Hatip-Schulen dar, die von immerhin 13-15% der Schüler nach der
Grundschule besucht wurden. Generell lässt sich also sagen, dass das türkische Schulsystem
nach der Formel 5 + 3 + 3, bzw. bei Besuch der Elite-Schulen nach der Formel 5 + 1 + 3 + 3
funktionierte.
9.4. Die Deutsche Schule Istanbul (Alman Lisesi)212
Die Deutsche Schule Istanbul ist eine deutschsprachige Auslandsschule, die deutsche und
nicht-deutsche Schüler zur deutschen allgemeinen Hochschulreife führt. Daneben werden
auch noch der Real- und Hauptschulabschluss angeboten, jedoch nicht durch eine gesonderte
Prüfung, sondern nur durch die Jahresendzeugnisse der 10. Klasse. Das Alman Lisesi ist in ein
mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, Haupt- und Realschüler werden mit in
die Gymnasialklassen integriert. Alle Abschlüsse der Schule sind denen innerhalb des
deutschen Schulsystems gleichwertig. Die zum Schuljahr 1997/98 in Kraft getretene türkische
Schulreform betrifft auch die Deutsche Schule Istanbul zum Teil erheblich [siehe eigenen
Bericht hierzu!], da sie eine Privatschule des türkischen Rechts ist, und damit den Weisungen
des türkischen Schulministeriums unmittelbar unterliegt. Auf der Grundlage des türkischen
Privatschulgesetzes dürfen die nicht-türkischen Schüler pro Schule jeweils nur 20% der
türkischen ausmachen. Ferner schreibt das Erziehungsgesetz von 1961 den türkischen
Kindern im Grundschulbereich den Besuch von rein türkischen Schulen vor. Aus diesem
Grund kann das Alman Lisesi – im Vergleich zu den meisten anderen Privatschulen in der
Türkei – keine eigene Grundschule einrichten. Besonders betroffen von der Ausweitung der
allgemeinen Schulpflicht auf 8 Jahre in der Türkei sind die türkischen Kinder, für die die
Möglichkeit entfällt, bereits die bisherige Mittelstufe (Orta-Stufe, Klassen 6 bis 8) auf der
deutschen Schule zu besuchen. Sie können heute erst zu Beginn der 9. Klasse in diese Schule
überwechseln, wo sie – wie auch schon vor der Reform nach der 5. Klasse – in die
212 Deutsche Schule Istanbul: Jahrbuch der Deutschen Schule 1997/98, Schulleiterjahresbericht 1997/98,
Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum der Deutschen Schule Istanbul 1993, Informationsblatt für künftige
Auslandslehrer über die Deutsche Schule Istanbul.
237
Übergangsklasse (Hazirlik) kommen. In dieser einjährigen Vorbereitungsklasse erhalten sie
intensiven Deutschunterricht im Umfang von 25 Wochenstunden. Vor der Aufnahme in die
Vorbereitungsklasse durchlaufen alle türkischen Bewerber nach der Grundschule eine
zentrale Aufnahmeprüfung in Istanbul. In der Aufnahmeprüfung werden neuerdings verstärkt,
neben dem reinen Fachwissen der Schüler, zusätzlich noch deren Denk- und Urteilsfähigkeit
getestet. Der Wegfall der Orta-Stufe hat vor allem eine negative Auswirkungen auf
Rückkehrerkinder, die künftig nicht mehr vor der 8. Jahrgangsstufe aufgenommen werden
dürfen, und denen somit der direkte Anschluss an das deutsche Schulsystem in ihrer Heimat
verwehrt bleibt. Es hat sich allerdings für die türkischen Neuankömmlinge gezeigt, dass diese
auch mit geringeren Vorkenntnissen im Deutschen hochmotiviert sind, und den sprachlichen
Anschluss binnen kurzer Zeit schaffen. Künftig unterstehen die deutschen Kinder der
Jahrgangsstufen 5 bis 8 (in der Türkei: ”Sekundarstufe I”) der ”Privatschule der Deutschen
Botschaft Ankara – Zweigstelle Istanbul”, d.h. dem deutschen Generalkonsulat, und sind
somit nicht an die türkische Schulreform gebunden. Sie können nach wie vor im Gebäude des
Alman Lisesi von den dortigen, regulären Lehrkräften unterrichtet werden. Dadurch werden
die deutschen Schüler, dem Aufbau des innerdeutschen Schulsystems entsprechend, von der
5. Klasse an als Gymnasiasten geführt. Ab der 9. Klasse gelten die deutschen Schüler dann als
Gastschüler. Für die rein türkischen Klassen der auslaufenden Mittelstufe (Orta, Klassen 6 bis
8) gilt das türkische Gesetz. Alle Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12, also das eigentliche
Lise, unterstehen ebenso wie die Vorbereitungsklasse (Hazirlik) dem türkischen
Schulministerium.
Am Ende des Schuljahres 1997/98 befanden sich 898 Schüler auf der Schule. Rund 80% von
ihnen waren Türken (750), 11,4 % Deutsche (108) und 8 % Schüler anderer Nationalitäten,
vor allem Österreicher. Deutsch ist somit für ca. 15% der Schüler Muttersprache. Auffällig ist
auch der außerordentlich hohe Anteil der Jungen (569) von fast 2/3 aller Schüler im Vergleich
zum Anteil der Mädchen von gut 1/3 (329). Dies mag mit dem traditionellen islamischen
Rollenverständnis zu tun haben. Die Klassenstärken sind, im Vergleich zu Deutschland, mit
durchschnittlich 30 Schülern sehr hoch, im Vergleich zur übrigen Türkei jedoch eher niedrig.
Aufgrund ihres Charakters als Begegnungsschule wird versucht, türkische und nicht-türkische
Schüler, so weit wie möglich, zu integrieren, d.h. in gemeinsamen Klassen zu unterrichten.
Durch den hohen Anteil türkischer Schüler ist dies nur begrenzt möglich: in der Praxis
werden die einzelnen Klassenstufen vierzügig unterrichtet, mit nur je einer gemischt-national
besetzten Klasse. Das Lehrerkollegium bestand 1998 aus 25 vermittelten deutschen
238
Auslandsdienstlehrkräften, 7 Bundesprogrammlehrkräften, sowie aus deutschen (8) und
türkischen Ortslehrkräften. Letztere, etwa 20 Lehrer, unterrichten neben Türkisch, Sport,
Musik und Kunst vor allem die türkischen Kulturfächer (Religion, nationale
Geschichte/Revolutionsgeschichte, Ethik, Logik u.a.). Unterrichtssprache ist – gemäß der
Zielsetzung der Schule – Deutsch. Türkisch wird von türkischen Lehrern nur für die
türkischen Schüler erteilt. Gleiches gilt für die türkischen Kulturfächer. Für türkische Schüler
gilt außerdem die Sprachenfolge: Deutsch ab der Vorbereitungsklasse, d.h. zukünftig ab
Klasse 8, Englisch (zukünftig) ebenfalls ab Klasse 8 und Französisch ab Klasse 9 in
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Türkische Schüler erhalten keinen Lateinunterricht. Die
deutschen Schüler lernen wie im innerdeutschen Gymnasialsystem: Englisch ab der 5. Klasse,
Französisch ab der 7. Klasse als zweite verpflichtende Fremdsprache, und Latein nur in den
Arbeitsgemeinschaften. Alle Schüler werden bei den Naturwissenschaften in Biologie ab
Klasse 6, in Physik ab Klasse 7 und in Chemie ab Klasse 8 unterrichtet. Da die deutschen
(bzw. nicht-türkischen) Schüler seit 1966 einen Gastschülerstatus haben, entfällt für sie die
Verpflichtung zum Unterricht in türkischer Sprache und Kultur. Allen deutschsprachigen
Fächern liegen deutsche Lehrpläne zugrunde, die von der KMK genehmigt wurden. Da die
Schule allerdings der staatlichen türkischen Schulaufsicht untersteht, sind einige
Einschränkungen zu befolgen: formal wird dies besonders durch die vorgeschriebene
Kleiderordnung (Schuluniformen) sowie durch die stark betonte äußerliche Disziplin deutlich,
die einen schülerzentrierten Unterricht nach deutschen Vorstellungen verhindert. Inhaltlich
dürfen entsprechend den türkischen Vorschriften z.B. keine politischen Diskussionen im
Unterricht stattfinden. Deutsche Schüler legen ihr Abitur in der 12. Klasse ab, Haupt- und
Realschüler erhalten ihre Abschlüsse mit dem Zeugnis der 9. bzw. 10. Jahrgangsstufe. Bisher
erlangten türkische Schüler nach 12 Jahren das ”Lise Diplomasi”. Freiwillig konnten sie dazu
noch die deutsche Reifeprüfung ablegen. Von dieser Möglichkeit machte gut die Hälfte aller
türkischen Schüler – mit steigender Tendenz – Gebrauch. Ab dem Jahr 2002 wird dieses
durch gemeinsame Abschlüsse eher die Regel. Nach dem Abschluss finden noch separate
Aufnahmeprüfungen zum Besuch der türkischen Universitäten statt, zu deren Vorbereitung
meist intensive Nachhilfe an den Wochenenden genommen wird. Schulträger ist der ”Verein
zum Betrieb der Deutschen Schule Istanbul”. Er ist für alle wirtschaftlich-rechtlichen und
personellen Angelegenheiten der Schule zuständig und erhebt das Schulgeld von derzeit etwa
5.500 DM, das in 4 unterjährlichen Raten zu zahlen ist. Für die Schuluniform sowie für die
selbst zu zahlenden Schulbücher sind ca. weitere 500 DM pro Jahr zu veranschlagen. Die
239
Bücher werden über eine deutsche Buchhandlung vor Ort aus Deutschland bestellt. Das
Gebäude der Schule liegt im Herzen des stark europäisch geprägten Stadtteils Beyoglu-Pera,
in unmittelbarer Nähe des Galataturms und des Tünelplatzes. Die Schule verfügt über je zwei
Fachräume für Biologie und Physik sowie über einen für Chemie. Darüber hinaus gibt es
Fachräume für Deutsch, Geographie, Kunst, Werken, Musik und Informatik (die Schule ist
unter http://www.shuttle.de/dsi-tr im Internet zu erreichen). Aufgrund der Innenstadtlage sind
die Sportmöglichkeiten begrenzt: es gibt lediglich eine kleine Turnhalle von 19 x 10 Metern,
einen Gymnastiksaal für Mädchen sowie eine asphaltierte Laufstrecke von 120 x 10 Metern
samt einer Sprunggrube. Darüber hinaus verfügt man über je eine Schüler- und
Lehrerbibliothek, Videoräume und ein kleines Fotolabor. In der nächsten Zukunft steht der
Schule eine Grundrenovierung bevor. Im Rahmen einer 1991 gegründeten Musikschule findet
Instrumentalunterricht auf schuleigenen Instrumenten statt. Außerdem werden zahlreiche
Arbeitsgemeinschaften angeboten, z.B. in Sport, Musik, Kunst, Informatik, Biologie,
Sprachen, Schach oder Theater.
Die Schule pflegt enge Verbindungen zu Schulen in Deutschland: mit Gymnasien in
Würzburg, Hamburg (2 Schulen) und Berlin (3 Schulen) bestehen Schüleraustausch-
Programme und Partnerschaften, die einen bedeutenden Anteil am erzieherischen
Begegnungsauftrag der Schule haben. Zum guten Ruf der Deutschen Schule Istanbul, die
traditionell als eine der angesehensten Schulen in der Türkei gilt, trägt bei, dass es nun
binationale Abschlüsse gibt. Erstmals wurden im Jahre 2002 binationale Abschlüsse am
Alman Lisesi und am Istanbul Lisesi durchgeführt. Gegenseitiges Vertrauen in
Gleichwertigkeit drückt sich auf diese Weise aus.
Inhaltliche Auswirkungen der Schulreform
Die türkische Erziehungsreform, die bereits mit dem Schuljahr 1997/98 in Kraft trat, sieht die
schrittweise Abschaffung des bisherigen differenzierten Schulsystems vor, d.h. konkret die
Abschaffung der Mittelstufe. Die Jahrgangsstufen 1 – 8 werden von nun an als Grundstufe
(Ilk Ögretim) definiert, die jedes türkische Kind besucht haben muss. Alle
Differenzierungsformen, die bislang nach Klasse 5 einsetzten, werden also ab jetzt um drei
Jahre verschoben und beginnen erst mit der Jahrgangsstufe 9.
Für die achtjährige Grundstufe sieht die Reform genaue Stundentafeln vor. Bezüglich der
Fremdsprachenausbildung bedeutet dies:
- für die Klassen 4 und 5 jeweils zwei Stunden Fremdsprachenunterricht
240
- für die Klassen 6 bis 8 jeweils vier Stunden.
Ferner wird ab Klasse 4 ein dreistündiges Wahlfach angeboten, das jedoch von Schule zu
Schule unterschiedlich gestaltet, bzw. von den Eltern gewählt wird. Dafür steht ein Katalog
aus ca. 18 Fächern zur Auswahl, beispielsweise eine zweite Fremdsprache, Informatik,
Zeichnen usw.. Somit wird die fremdsprachliche Ausbildung – jedenfalls was die erste
Fremdsprache anbelangt – zwar um zwei Jahre vorgezogen, aber die Möglichkeit
standardmäßig eine zweite Fremdsprache zu erlernen besteht nur, wenn die Eltern diese
zweite Fremdsprache als Wahlfach benennen.
Die oben erwähnte, schrittweise Abschaffung der differenzierten Mittelstufe vollzieht sich
wie folgt:
Schuljahr 1997/98:
letztmaliges Angebot der Vorbereitungsklassen (Hazirlik) in den Anadolu-Schulen /
letztmaliges Angebot der 6. Klassen in Iman-Hatip-Schulen
Schuljahr 1998/99:
letztmaliges Angebot der 6. Klasse auf Anadolu-Schulen nach den alten Lehrplänen
Schuljahr 1999/00: letzte 7. Klasse usw.
Organisatorische Auswirkungen der türkischen Schulreform
Die Schulreform wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf deutsche und türkische Schüler
sowie daraus resultierend auch auf die Lehrkräfte / Verwaltung und das allgemeine
Zusammenleben aus.
Auswirkungen für die türkischen Schüler:
Für die türkischen Schüler steht nach dem Wegfall von drei bzw. vier (inkl.
Vorbereitungsklasse) Jahren intensivem Deutschunterricht zu befürchten, dass deren bisherige
Leistungen – Deutsches Sprachdiplom DSD II, Reifeprüfung – nicht mehr erbracht werden
können. Ein Sonderfall wäre darin zu sehen, dass die Eltern Deutsch bereits ab der 6. Klasse
als Wahlfach benennen. Selbst dann jedoch würde die bisherige Intensität des
Deutschunterrichtes (bis zu 24 Stunden in den Hazirlik-Klassen) nicht mehr erreicht werden
können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern Deutsch als erste Fremdsprache in der
Grundschule bevorzugen, ist angesichts der überragenden Bedeutung des Englischen als
unbestreitbarer ”lingua franca” eher unwahrscheinlich, bzw. hängt auch davon ab, wie sicher
den Eltern Englisch als 2. Fremdsprache (Wahlfach ab Klasse 6) zugesichert wird.
241
Ein Ausweg für die türkischen Kinder könnte die Gründung einer Grundschule am Alman
Lisesi durch den Absolventenverein oder eine türkische Stiftung sein oder die Einrichtung
einer sprachintensiven Vorbereitungsklasse vor der 9. Jahrgangsstufe. Dazu bedarf es
allerdings der Genehmigung durch den türkischen Staat. Damit könnte der Deutschunterricht
wenigstens auf 4 Jahre ausgedehnt werden, obwohl einige deutsche Konzeptionen sogar 4
Jahre zur Heranführung an das Abitur plus einer Hazirlik-Klasse vorsehen. Zur
Aufrechterhaltung des Abiturniveaus könnte außerdem eine zusätzliche Deutschprüfung für
alle türkischen Bewerber erforderlich werden, d.h. eine Aufnahme nur für diejenigen Kinder
erfolgen, die bereits in der Grundschule Deutsch gelernt haben. Generell aber soll die
Oberstufe weiterhin auch den türkischen Kindern und Jugendlichen offen stehen.
Die türkischen Offiziellen machten daraufhin deutlich, dass die Gesetzeslage eine Ausnahme
für ausländische Kinder nicht vorsehe, und dass somit auch die Mittelstufe für deutsche
Kinder nicht unter derselben Schulverwaltung wie das Gymnasium weitergeführt werden
dürfe. Dieser Teil der Schule müsse selbständig verwaltet werden. Da das türkische
Schulgesetz jedoch auch Schulen verschiedener Schulträger in einem Gebäude verbietet, sei
ein gemeinsamer Verbleib beider Schulen am Ort problematisch. Nicht zu vergessen ist
außerdem das nach der Reform neu zu bewertende, im Privatschulgesetz festgesetzte 20 v.H.-
Kontingent, das den Anteil deutscher Schüler auf 20% der türkischen reduziert. Dies ist unter
den neu entstandenen Bedingungen nicht mehr einzuhalten, bzw. nur für die Oberstufe
praktikabel. Allerdings war von der türkischen Seite auch zu hören, dass man dort – im
Rahmen der bestehenden Gesetze – an für beide Seiten akzeptablen Lösungen interessiert sei.
Ein Ausweg könnte es sein, den Teil des Gebäudes in dem der Mittelstufenunterricht für
deutsche Schüler stattfindet, abzutrennen (z. B. durch zwei verschiedene Eingänge) und diese
neu entstandene Schule formell der deutschen Botschaft bzw. der Zweigstelle der
Botschaftsschule in Istanbul (bisher nur Klassen 1 – 5) zu unterstellen. Daraus würden sich
wiederum administrative Schwierigkeiten (Schulleitung, zwei Schulvereine ) und Probleme
für die Lehrkräfte (Erteilung von Unterricht an zwei verschiedenen Schulen,
Stundenplanabstimmung) ergeben. Diese Alternative könnte allerdings am Rechtsstatus der
Botschaftsschule scheitern: der Verein zum Betrieb der Schule ist kein türkischer Verein.
Schließlich böte sich als letztes Mittel noch eine Umwandlung des deutschen Zweiges in eine
Privatschule an, womit freilich der kulturpolitische Charakter der Schule als binationale
Begegnungsstätte verloren ginge.
242
10. Russland
10.1. Das Goethe-Institut Moskau
Kulturprogramme
Das Goethe-Institut Moskau organisiert verschiedenste Veranstaltungen aus den Bereichen
Wissenschaft und Literatur, Musik, Film/Filmreihen, Medien/Rundfunk/visuelle Kommu-
nikation, Theater/ Theaterprojekte, sowie Ausstellungen zur Präsentation deutscher Kultur.
Einer der Schwerpunkte der kulturellen Programmarbeit des Instituts war z.B. die Konferenz
”Bauliche, soziale und kulturelle Entwicklung von Plattenbau-Großsiedlungen”, die in
Zusammenarbeit mit dem Senat der Stadt Berlin und der Stadt Moskau durchgeführt wurde.
Diese Konferenz wurde begleitet von einer Ausstellung und verschiedenen Konzerten, u.a.
mit einer der wenigen deutschen, international maßgeblichen Musikgruppen, der Kultband
”Einstürzende Neubauten”. In der Reihe ”Heimatfilme” zeigte das Kino des Goethe-Instituts
verschiedene deutsche Filme, die dem russischen Publikum den Wandel Deutschlands von der
Zeit des ersten Weltkriegs bis heute vor Augen führen sollten. Die Palette der Filme reichte
dabei von Werken wie ”Fernweh” (stellvertretend für die Zeit zwischen 1919 – 1928) und
”Heimatfront” (1943), über ”Grün ist die Heide”, ”Schwarzwaldmädel” oder ”Sissi”
(Nachkriegszeit), bis hin zu moderneren Filmen wie ”Der wilde Clown”, ”Herbstmilch” oder
”Die Krücke”. Im Anschluss an die Vorführungen fanden oftmals noch zusätzliche
Diskussionsrunden statt. Im Rahmen der Musik- und Theateraufführungen gaben die Opern
Bonn und Moskau unter der Regie von Jurij Liubumow das Stück ”Pique Dame” zum Besten,
im März ’98 folgte ein Tschechov-Festival. Natürlich wurde auch des 100. Brecht –
Geburtstags mit einem Vortrag zum Thema ”Brecht und das Schicksal der Kunst im 20.
Jahrhundert” gedacht. 1998 besuchten 53 018 Zuschauer die Programme des Instituts.
Deutsch lehren und lernen
Für interessierte russische Bürger wird ein differenziertes Sprachkurs-Angebot bereitgehalten.
Anfänger und Fortgeschrittene können dabei unter allgemeinen Sprachkursen und speziellen
Sprachkursen wählen. Die allgemeinen Deutschkurse untergliedern sich wiederum in ein
dreisemestriges Grundstufenprogramm (optional: 2 Semester Intensivkurs), ein drei-
semestriges (optional zweisemestriges) Mittelstufenprogramm und in ein zweisemestriges
243
Oberstufenprogramm. Alle drei Kurse können mit jeweils angemessenen Prüfungen
abgeschlossen werden: mit dem Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF), der Zentralen
Mittelstufenprüfung (ZMP) und der Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP). Spezielle
Deutschkurse werden in Form eines zweisemestrigen Wirtschaftsdeutschkurses, der mit der
Prüfung für Wirtschaftsdeutsch (PWD) abgeschlossen werden kann, und einem Kurs für
juristisches Fachdeutsch, angeboten. In Sonderfällen werden auch externe Kurse, etwa in
Unternehmen, durchgeführt. Im Bereich der pädagogischen Verbindungsarbeit führt das
Institut u.a. Seminare und Workshops, zu den Themen Bildungs-/Sprachpolitik,
Didaktik/Methodik, Fachsprachen, Landeskunde, Literatur und Mediendidaktik für russische
Deutschlehrer, durch. Das GI ist auch Partner für die Entwicklung von Lehrmaterialien, wie z.
Bsp. für das Werk “Hallo Nachbarn”, für deutsche Minderheiten bestimmt.
Es werden Fernstudiengänge angeboten, deren Zielgruppe vor allem Deutschlehrer und
Studenten der Germanistik sind.
Das Stipendienprogramm ”Russlandfonds der deutschen Wirtschaft”, initiiert von Botschafter
Dr. von Studnitz, hat bei deutschen Unternehmen sowie auf russischer Seit positive Resonanz
gefunden. Mit der Durchführung wurde der DAAD beauftragt. Das Programm ist auf 10 Jahre
angelegt. Die finanziell Ausstattung pro Jahr beträgt gegenwärtig 130.000 DM (66 468 €).
Damit können zur Zeit über 60 Stipendien à 20.000 DM (10 226 €) finanziert werden.
Im Verlauf des 1. Förderjahres (1997/98) wurden 20 Kandidaten ausgewählt, die ihr Studium
im Oktober 1997 in Deutschland aufgenommen haben. Es werden für die folgenden Jahre ca.
70-80 Stipendien vergeben.213
Informationszentrum / Bibliothek
Die Bibliothek umfasst einen Gesamtbestand von 10. 433 Exemplaren, davon 9.034 Bücher,
69 Zeitungen/Zeitschriften und 1.330 audiovisuelle Medien. Der Bestand wird nur mäßig
umgeschlagen (1998: 1.614 Entleiher/innen), vielfach von den eigenen Kursteilnehmern oder
den Lehrern. Die Bibliothek organisierte 1998 eine deutsch-russische Bibliothekskonferenz.
213Politischer Halbjahresbericht Russische Föderation. Auf der Grundlage des Politischen Halbjahresberichts
Russische Föderation (Russland). Auswärtiges Amt, Hg., Bonn, Stand: März 1998.
244
10.2. Bericht des Leiters des Goethe- Instituts
In einem Bericht des Institutsleiters Kahn-Ackermann im Goethe-Institut in München im
Februar 99 stellte sich die Situation in Russland und der GUS wie folgt dar: Die
Kulturangebote aus Deutschland sind weitestgehend reduziert, ohne dass bisher neue
Möglichkeiten aufgebaut wurden.. Institutionelle Strukturen existieren so gut wie gar nicht
mehr. Der Verband der Schriftsteller besaß z.B. ein eigenes Gebäude welches häufig genutzt,
dann jedoch zu einem Luxusrestaurant umfunktioniert und dadurch zweckentfremdet wurde.
Der intellektuelle Diskurs in Russland ist praktisch zusammengebrochen. Ein
Substanzverlust, der sich künstlerisch-intellektuell festmacht, ist zu verzeichnen. Die Elite-
Strukturen funktionieren nicht mehr, wobei man sich im Sprachbereich noch Partner
aussuchen kann.
Deutschlehrer müssen sich monatelang ohne Gehalt über Wasser halten und sind zum Teil
sogar unterernährt. Trotzdem kommen sie oft über Hunderte von Kilometern zu
Fortbildungen ins Goethe-Institut durch die GUS gereist. Dafür gibt es in Russland 100
Kontaktstellen für Weiterbildungsmaßnahmen an verschiedenen Orten wobei das Goethe-
Institut an 48 vertreten ist. 30 Netzwerk Orte, in denen oft freiberufliche Mitarbeiter des
Goethe-Instituts Fortbildungsseminare durchführen, befinden sic darunter. Häufig ist das
Goethe-Institut auf die Ortskräfte angewiesen, d.h. auf Ehefrauen, die im Gastland geheiratet
haben. Sie sind die Basis der Arbeit vor Ort, haben allerdings keinerlei Chancen, beruflich
weiter aufzusteigen. Die Möglichkeit ihre Position zu verändern oder ihren Dienstort zu
wechseln besteht nicht. Deshalb ist eine Forderung des Institutsleiters, die Möglichkeit des
beruflichen Aufstiegs für diese Lehrkräfte zuzulassen, bzw. andere, leistungsfördernde
Maßnahmen ergreifen zu können. Die Ortslehrkräfte sind überqualifiziert, werden jedoch nur
als Sachbearbeiter bezahlt. Diese qualifizierten Fachleute haben Zugang zur lokalen bzw.
regionalen Szene, oder können diesen Zugang eröffnen. Sie müssen jedoch, formal und
finanziell Sachbearbeiter sein. Somit ist es nur eine logische Konsequenz, dass sich
mittlerweile auch die Konkurrenz für diese unterforderten und frustrierten Lehrkräfte
interessiert und eine massive Abwerbung betreibt. So wurde zum Beispiel eine Ortslehrkraft
Marketingleiter in einer neu gegründeten Bertelsmann-Buchhandlung in Moskau. Auch aus
diesen Gründen sind dringend gegensteuernde Maßnahmen zu treffen. Es gab eine Puschkin-
Ausstellung im Goethe-Institut Moskau, in der dessen zweihundertsten Geburtstags gedacht
wird. Puschkin (1799-1837) gilt als der größte russische Dichter. Puschkin trägt zum
245
emotionalen Selbstverständnis und zur nationalen Selbstaufwertung vieler Russen bei.
Deswegen kann dieses Jubiläum durchaus auch als eine Art ”Medizin” zur Heilung des
gekränkten russischen Nationalstolzes angesehen werden. Ein großes Fest wurde gefeiert, ein
Erlebnis für Moskau mit Ausstrahlungskraft für Europa.
Ansonsten wird in Moskau Kulturpolitik vollständig politisiert bzw. fragmentarisiert, und es
gibt keinen kulturpolitischen Diskurs.
10.3. Die Deutsche Schule Moskau214
Die Deutsche Schule Moskau ist eine deutschsprachige Auslandsschule, die in Russland
deutsche Bildungsziele vermittelt und zu deutschen Abschlüssen führt. Die Schule bietet
dabei den Hauptschulabschluss nach der Jahrgangsstufe 9, den Realschulabschluss nach der
Jahrgangsstufe 10, sowie die Reifeprüfung nach der 13. Klasse an. Das Abitur berechtigt zum
Studium an deutschen und russischen Hochschulen, Haupt- und Realschulabschluss sind
denen im innerdeutschen Schulwesen ebenfalls gleichwertig. Alle drei Stufen des deutschen
Schulsystems sind somit auch in Moskau verfügbar.
An die übliche, vierjährige Grundschule schließt sich in den Klassen 5 und 6 die
Orientierungsstufe an, nach der die Schüler – entsprechend ihrer Neigungen und Fähigkeiten
– entweder in den Haupt-, Realschul- oder den gymnasialen Zweig überwechseln. Dabei
gliedert sich die Schule in die Sekundarstufen I (7. bis 10. Klasse) und II (10. bis 13. Klasse),
wobei in Stufe I je nach Schultyp die verschiedenen Zweige gefahren werden. Grundlage für
die Unterrichtsgestaltung an der deutschen Schule Moskau sind die Lehrpläne des
Bundeslandes Baden-Württemberg. Die Schule hat derzeit etwa 350 Schüler, von denen die
meisten die Grundschule bzw. die Sekundarstufe I besuchen. Den angeschlossenen
Kindergarten besuchten 1997 95 Kinder. Die Klassenstärken der DSM liegen mit
durchschnittlich ca. 18 Schülern deutlich unter dem innerdeutschen Niveau, wobei es in der
Sekundarstufe II – ihrer geringen Schülerzahl entsprechend – lediglich jeweils eine Klasse
pro Jahrgangsstufe gibt. Aufnahmekriterien für den Besuch der Schule sind entweder die
deutsche Staatsangehörigkeit oder entsprechend der Zielsetzung der Schule auch nicht-
214 Hackenberg, Jürgen: Auf der Grundlage des Berichts des Schulleiters Jürgen Hackenberg, Jahresrückblick,
Moskau, 1997/98.
246
deutsche Schüler, sofern sie die deutsche Sprache beherrschen und ihre Eltern innerhalb der
Russischen Föderation leben. Die meisten Schüler kamen aus Deutschland (246), gefolgt von
Russland (50), Österreich (19) und der Schweiz (6). Aus anderen Ländern kamen schließlich
noch 24 Schüler. Deutsch ist die Muttersprache von insgesamt 273 Kindern. Wie in vielen
anderen deutschsprachigen Auslandsschulen macht sich auch in Moskau das Problem stetig
sinkender Schülerzahlen bemerkbar. Grund für diese Entwicklung sind zum einen die
katastrophale wirtschaftliche Lage in Russland, zum anderen aber auch eine sich zunehmend
verändernde Personalpolitik deutscher Unternehmen mit der Tendenz, weniger teueres
Personal, d.h. vor allem solches ohne Kinder, ins Ausland zu entsenden. Eine erneute
Steigerung der Schülerzahlen hofft man dadurch zu erreichen, dass die Schule mehr als bisher
auch für russische Schüler geöffnet wird. Die russische Sprache ist beispielsweise seit kurzer
Zeit fest im sprachlichen Unterrichtsangebot der Schule verankert: erste Fremdsprache ist
Englisch ab der 5. Jahrgangsstufe, zweite Fremdsprache jedoch entweder Französisch oder
Russisch. Für die Schüler, die Russisch nicht als zweite Fremdsprache gewählt haben, kommt
dies allerdings ab der 11. Jahrgangsstufe als dritte Fremdsprache verpflichtend hinzu.
Russisch wird außerdem in Form einer Arbeitsgemeinschaft schon ab der ersten Klasse
angeboten. Um der zunehmenden Anzahl russisch sprechender Kinder in der Grundschule den
Eintritt in das deutschsprachige Schulsystem zu erleichtern, wurde in Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten ein Konzept entwickelt, bei dem die angehenden ABC-Schützen in
spielerischer Form in die deutsche Sprache eingeführt werden: dreimal pro Woche treffen sich
die Kinder mit ihren künftigen Lehrern zum Deutsch-Intensiv-Kurs, in dem sie Personen,
Gegenstände und Verhaltensweisen des Schulalltags kennen und verstehen lernen. Zusätzlich
dazu wurde der Intensiv-Kurs (DIK) auch innerhalb der Klassen eins bis drei eingeführt. Hier
beschäftigen sich die Schüler unter sich in kleinen Gruppen mit der deutschen Sprache. Mit
diesem Angebot wird die Schule ihrer selbstgestellten Aufgabe gerecht, die Schüler neben der
fachlichen Qualifikation auch mit der russischen (bzw. deutschen) Sprache und Kultur
vertraut zu machen sowie durch außerschulische Aktivitäten menschliche und kulturelle
Verbindungen zum Gastland zu pflegen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Das Lehrerkollegium setzt sich zum größten Teil aus ortsansässigen deutschsprachigen
Lehrern (24 Ortslehrkräfte), 2 freien Lehrern, sowie 13 von der Bundesrepublik entsandten
Auslandslehrkräften und 3 Bundesprogrammlehrkräften zusammen (1997). Träger der
deutschen Schule Moskau ist der Deutsche Schul- und Kindergartenverein, der eigene
Rechtsfähigkeit besitzt und für finanzielle und personelle Angelegenheiten zuständig ist. Wie
247
alle deutschen Schulen im Ausland finanziert sich die DSM nur zum Teil durch Gelder aus
dem Bundeshaushalt. Deshalb erhebt der Schulverein der DSM ein Schulgeld, dessen Höhe
sich nach der Anzahl der Kinder richtet: beim 1. Kind sind es 7.200 DM pro Jahr, beim 2.
7.056 DM, beim 3. 6.915 DM, beim 4. 6.777 DM und beim 5. Kind ist schließlich ein
Jahresbeitrag von 6.641 DM zu zahlen. Beim Kindergarten erfolgt die Staffelung ebenfalls
nach der Anzahl der Kinder, zusätzlich dazu allerdings noch nach Ganz- oder
Halbtagsbetreuung, wobei folgende Sätze gelten: 1. Kind: 5.400 DM / 3.600 DM, 2. Kind:
4.300 DM / 2.900 DM, 3. Kind: 3.200 DM / 2.200 DM. Weitere Kosten entstehen ferner bei
der Anmeldung (300 DM), bei eventueller Aufnahmeprüfung (50 DM), sowie in Form einer
Kaution von 1.600 DM zur Zwischenfinanzierung größerer Sonderausgaben, die allerdings
nach Abmeldung von der Schule zuzüglich 2% Jahreszinsen zurückerstattet wird. Mitglieder
des Schulvereins zahlen einen Jahresbeitrag von 20 DM. Eine weitere Besonderheit der
Schule ist auch der angeschlossene Hort für Grundschulkinder, bei dem die Kinder nach
einem Mittagessen und den Hausaufgaben von drei Erzieherinnen beim Spielen, Basteln oder
Singen betreut werden, sowie ein eigener Busservice, um die großen räumlichen Distanzen
Moskaus zu überbrücken. Für den Hort ist pro Kind ein Jahresbeitrag von 3.500 DM zu
entrichten, bei Teilzeit (3Tage/Woche) 2.100 DM bzw. 1.400 DM (2 Tage/Woche). Die
Busgebühr beträgt pro Jahr – in vier Zonen gestaffelt – 1.900 DM, 2.200 DM, 2.550 DM bzw.
2.900 DM.
Die Deutsche Schule Moskau liegt im Südwesten der russischen Hauptstadt in unmittelbarer
Nähe der Metro-Station Jugo-Sapadnaja. Die Gebäude der DSM (Hauptgebäude und
Nebengebäude mit Kindergarten, gymnasialer Oberstufe sowie Fachräumen für Kunst und
Werken) wurden 1996/97 vollständig saniert und befinden sich in einem sehr guten Zustand.
Bereits kurz nach der Vereinigung der beiden deutschen Schulen in Moskau am 3. Oktober
1990 war klar, dass das Gebäude aus dem Besitz der ehemaligen DDR von Grund auf saniert
werden musste. Nach Beginn der Bauarbeiten im März 1996 fand der Unterricht
behelfsmäßig in zwei Schichten von 8.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends im
Kindergartengebäude statt. Die Kindergartenkinder selbst mussten gar in die leerstehende
Etage eines benachbarten Hochhauses umziehen. Am 3. Oktober 1997, also sieben Jahre nach
der Gründung der Deutschen Schule Moskau, wurde der erfolgreiche Abschluss der
Bauarbeiten mit einem großen Festakt in der Aula der Schule gefeiert. Aus diesem Anlas
reiste der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Werner Hoyer nach Moskau, um
die persönlichen Grüße des Außenministers zu übermitteln. Kinkel betonte in seinem
248
Glückwunschtelegramm die besondere Aufgabe der Schule als Mittler zwischen den beiden
Kulturen, und hob die Bedeutung von Toleranz und Weltoffenheit im Unterricht hervor. Die
gemeinsame Erziehung von Schülern unterschiedlicher Nationalitäten solle ihnen helfen, das
gemeinsame Haus Europa zu bauen. Neben der Schulkantine, der Bibliothek, dem Kinderhort
und den Fachräumen wurde im Schuljahr 1997 mit Unterstützung des Elternbeirates ein
Aufenthaltsraum zur Erledigung der Hausaufgaben eingerichtet. Reichhaltige Spenden des
Schul- und Kindergartenvereins ermöglichten außerdem die Einrichtung eines, mit modernen
PCs ausgestatteten, Computerraumes, in dem alle Workstations über einen Server ans Internet
angeschlossen sind. Seit dem Frühjahr 1998 hat die DSM durch die tatkräftige Mithilfe ihrer
Schüler auch eine eigene Web-Site: unter http://www.aha.ru/~dsm kann man die Schule über
die Datenautobahn erreichen.
Das kulturelle Leben an der Schule kann sich ebenfalls sehen lassen: besonders im musischen
Bereich bietet die DSM vielfältige Betätigungsmöglichkeiten und organisiert hochkarätige
Musikveranstaltungen. Glanzpunkt im Schuljahr 1996/97 war die Aufführung der, unter
immensen Eigenleistungen vorbereiteten, Oper ”Orpheus und Eurydike” von Christoph
Willibald Gluck. Unter der Mithilfe einer eigens (für 7 Wochen) aus Stuttgart eingeflogenen
Regisseurin, einer professionellen Choreographin, Ton- und Beleuchtungstechnikern sowie
insgesamt 120 Mitwirkenden, darunter auch der Chor der Pädagogischen Universität Moskau,
wurde die Aufführung schließlich ein phänomenaler Erfolg. Sogar die ”Frankfurter
Allgemeine Zeitung” berichtete ganzseitig von diesem Ereignis. Bei der Aufführung der Oper
wurden erstmals völlig neue Darbietungsformen gewählt: Elemente des Schatten- und
Figurentheaters wurden mit Tanzelementen und musikalischen Solos, Chor und Orchester
kombiniert. Im musikalischen Bereich hat sich außerdem die Musikschule der DSM etabliert.
Hier wollen musisch engagierte und interessierte Deutsche, die in Moskau leben, den
Schülern die Möglichkeit geben, bei guten (vorzugsweise deutschsprechenden) Lehrern
Instrumentalunterricht zu erhalten und das Zusammenspiel verschiedener Instrumente zu
üben. Die Musikschule der DSM veranstaltet nebenbei auch noch Konzerte, die sich großer
Beliebtheit erfreuen. So gab der deutsche DAAD-Stipendiant Holger Berndsen vom
Moskauer Konservatorium ein Klavierkonzert und beriet die Schüler in einer anschließenden
Diskussion. Im März 1998 nahmen 10 Schüler der DSM-Musikschule am Wettbewerb
”Jugend musiziert” in Helsinki teil. Im Theaterbereich wurden zwei Vorstellungen gegeben,
einmal das moderne russische Theaterstück ”Aus der Tierwelt” von dem in Deutschland
lebenden Moskauer Dramatiker Ilja Tschlaki, der sich danach persönlich einer angeregten
249
Diskussion stellte, und die Aufführung des ”Dornröschen Syndrom” der Theater AG der
Schule. Auch in ihrem kulturellen Umfeld ist die Schule gut verankert. Zusammen mit der
Moskauer Schule Nr. 1277 führte die 10. Klasse der Realschule ein dreitägiges Projekt zum
Thema ”Vorurteile, Klischees und Konflikte im interkulturellen Zusammenleben” durch,
dessen Ausgangspunkt Max Frischs Lektüre ”Andorra” war. Dabei berichteten die russischen
Schüler von den Eindrücken ihrer Klassenfahrten nach Deutschland und die deutschen
Schüler von ihren Erfahrungen in Moskau. Die Schüler kamen so zu dem Ergebnis, dass sie
sich trotz der jeweils fremden Umgebung nicht fremd im Sinne eines ”Ausgegrenztseins”
gefühlt haben bzw. fühlen, so wie es Max Frisch in seinem Stück thematisiert. Besonders die
deutschen Schüler begrüßten die Gelegenheit, mit ihren russischen Altersgenossen
zusammenzuarbeiten und Kontakte aufzubauen. Anlässlich des 850-jährigen Jubiläums der
russischen Hauptstadt nahmen Kinder der Klassen 4 bis 6 am internationalen Wettbewerb
”Moskau in den Zeichnungen der Kinder aller Welt” teil. Hierbei wurde ein Gemein-
schaftsbild von mehreren Schülern erstellt. Lohn dieser Mühen war ein vom Moskauer
Bürgermeister Juri Luschkow unterschriebenes Diplom und ein Buch, mit allen prämierten
Zeichnungen samt Beschreibung und Namen des ”Künstlers”.
250
11. Reformbedarf, der sich aus Teil C ableitet
11.1. Analyse der typischen Ergebnisse untersuchter Einrichtungen
Bei der nun folgenden Untersuchung geht es darum, einige Beispiele aus Teil C
zusammenzufassen, um zu zeigen wo Vorstellungen von Reformen umgesetzt werden
sollen, wo Indikatoren für eine Operationalisierung im Sinne von Verständnisbildung
füreinander, wo grenzüberschreitende Kooperation, das Lernen mit- und voneinander
zu finden sind.
Als Leitfaden für die Analyse des Reformbedarfs dienen die Themenbereiche, die Alois
Wierlacher und Hans R. Reich als „zentrale Bedingungen der Selbstkonstitution“215 für
die interkulturelle Bildung benennen, sowie die Themenschwerpunkte, die für die
Fragebögen unter D aufgestellt sind.
Aus drucktechnischen Gründen ist der übliche Fußnoten-Verweis auf bereits gebotene
Textstellen und Zitate, aus den aus C 2.-10. wiedergegebenen Passagen, nicht möglich.
Diese Textdoppelungen sind durch kursive Setzung kenntlich gemacht, womit sie
zugleich bei der anfolgenden Auswertung als zitierte Belege leichter auffindbar werden
sollen. Absichtlich wird auf den Originaltext zurückgegriffen, um nicht die
Interpretation der Interpretation vornehmen zu müssen und die Aussagen so
authentisch wie möglich zu belassen.
Die Beschreibungen der Rahmenbedingungen für die Goethe-Institute und Deutschen Schulen
in den Partnerländern in Teil C verdeutlichen die Substanz und Tragfähigkeit der dritten
Säule und dienen somit ihrer Darstellung. Um sich eine Vorstellung von der Zukunft der
Einrichtungen und den anstehenden Reformen machen zu können, ist es wichtig, die
tatsächlichen Verhältnisse zu kennen. Deshalb habe ich die Ansichten der Deutschen Schulen
und der Goethe-Institute wie folgt entworfen:
215 Reich, Hans R.; Wierlacher Alois: Bildung. In: Handbuch interkulturelle Germanistik. Wierlacher Alois u.
Bogner Andrea, Hg., Stuttgart, 2003. S.206. Siehe auch unter: Begriffliche Klärung. A.1.2. Interkulturelle
Bildung.
251
Deutsche Schulen: die Lage, der Schulverein und die Eltern, das Schulgeld, Anzahl der
Schüler, Lehrkräfte, Struktur der Schule, Abschlüsse, außerunterrichtliche Veranstaltungen,
interkulturelle Komponente. Die Beschreibung der Goethe-Institute konzentriert sich auf drei
Punkte: Kulturprogramme, Deutsch lehren und lernen, Bibliothek. In den Beschreibungen
finden sich die spezifischen Ausprägungen im Kontext mit dem jeweiligen Land und seiner
Kultur.
Hildegard Hamm-Brücher hat, wie unter A 1.3 ausgeführt, den bildhaften Vergleich der
Brücke bei der Beschreibung der Funktion Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik gewählt.
Um dies auf die Brückenfunktion der Kultur und Bildungsarbeit zu übertragen, müsste dort,
wo einst ein Hindernis bestand, ein konstruktiver Dialog durch Anschauungsgewinnung, auch
im Bewusstsein des Trennenden, ermöglicht werden. Dass im zusammenwachsenden Europa
dieses für einen dauerhaften Bestand von immenser Bedeutung sein wird, ist ja offenkundig.
Es stellen sich die Fragen: (Siehe A 1.2.) Wo gibt es grenzüberschreitende Kooperation, wird
mit- und von einander gelernt, findet interkulturelle Bildung statt (Siehe A 1.2.), in welchem
Maß wird Deutsch als Fremdsprache angenommen, wird die Sprache des Partnerlandes
gelernt? Werden andere Vorgehensweisen als gleichwertig anerkannt, kreative
Vorgehensweisen bei der Organisation von interkulturellen Veranstaltungen in dem von mir
untersuchtem Spektrum umgesetzt?
Der zweite von mir zu untersuchende Punkt, der institutionelle Reformbedarf (Siehe A 1.2.),
müsste als Ziel unterstellen, dass die den Einrichtungen übertragenen Aufgaben den
formulierten Zielsetzungen entsprechend bewältigt werden können. Gerade unter dem Druck
der Sparforderungen zeigt sich, wie wichtig eine zielorientierte Organisation und die
Erschließung aller möglichen Geldquellen ist. Zu diesem Komplex gehören neue Formen des
kulturellen Gestaltens, der Bildungsarbeit und intensivierte Zusammenarbeit unter den
verschiedenen Mittlern sowie die Kooperation mit anderen europäischen Partnern. Auch
örtliche Mängel können den Bestand ganzer Einrichtungen in Frage stellen. Wichtig ist hier
auch, dass die Kompetenzen klar verteilt sind. Die Nutzung der Synergien ist ein in die
Zukunft weisendes Thema. Stetige Anpassungen an neue Gegebenheiten und Anforderungen,
vor allem auch im Hinblick auf die Akzeptanz der Nutzer, ist zudem weiterhin unerlässlich.
Ob die von mir oben genannten Punkte realisiert werden, soll deshalb untersucht werden.
252
Zielrichtung der Reformen
Bei der Nennung der Leitlinien unter A 1.3. werden mehr Optionen offeriert als übersichtlich
und operationalisierbar sind, jedoch würde das Weglassen dieser auch bedeuten, ineinander
verschränkte und verwobene Leitlinien nicht zu benennen. Genauso wenig praktikabel scheint
mir, Ziele umzusetzen, wie sie auf der zwischenstaatlichen Konferenz über Kulturpolitik und
Entwicklung im April 1998 in Stockholm als Selbstverpflichtung der Teilnehmerstaaten
münden sollten.
Da unsere gesellschaftliche Zukunft auch davon beeinflusst werden wird, ob wir es vermögen
im Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungsarbeit Reformen umzusetzen und
Nachhaltigkeit zu bewirken, soll noch mal ein Blick auf die Ausrichtung sinnvoller Reformen
geworfen werden, auch ohne die Verifizierung dieser im Detail zu beschreiben.
Darüber hinaus wird danach gefragt, in wieweit die von der UN-Kommission zur Umsetzung
und Einbeziehung in den Agenda Prozess wichtigen Gruppen: Frauen, Wissenschaftler und
nichtstaatliche Organisationen beteiligt sind.
11.2. Anstehende Reformen inhaltlicher Art
Deutschlandbild
Dass Bild, das sich die Menschen der Partnerländer vom jeweilig anderen machen, ist durch
viele Komponenten geprägt und bestimmt auch die Zugänglichkeit für Begegnungen. Die
Situation in Großbritannien, wie unter C 2. beschrieben, weist erhebliche Störungen einer
konstruktiven Kommunikation zwischen Deutschland und England aus. Die historischen
Belastungen wiegen selbst heute noch so schwer, dass immer wieder nur mit großen
Bemühungen beider Seiten ein akzeptables Bild voneinander entstehen kann.
Europafeindliche und kritische Tendenzen in England verbinden sich mit der Propagierung
von Vorurteilen gegenüber Deutschland, weil unterstellt wird, es stünden deutsche
Großmachtinteressen hinter der europäischen Einigung. Dieses Vorurteil wird von einigen
Boulevardblättern wie zum Beispiel der Sun, dem Mirror oder dem Daily Telegraph vielleicht
schwerer als in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg aufgegriffen und gepflegt. Die Rolle der
Muttersprache als “Weltsprache” schafft in England zusätzlich eine Distanz zum Kontinent.
Dem Erlernen einer anderen Sprache wird nicht prioritär Bedeutung zugemessen. Die
253
Verwertbarkeit einer zu lernenden Sprache steht im Vordergrund. Frankreich ist der
unmittelbare Nachbar und langjährige Verbündete, wer nach Frankreich reisen will, braucht
schon Kenntnisse in Französisch, da dort das Fremdsprachenlernen nicht sehr ausgeprägt ist.
Auf die Balearen reist man touristisch, also ist Spanisch eine weitere gefragte Sprache. Wie
sich unter C 2.1. bei der Umfrage des Goethe Instituts gezeigt hat, herrschen unter britischen
Jugendlichen hartnäckige Vorurteile gegenüber Deutschland, die sich erst allmählich beim
Erlernen von Deutsch oder dem Besuch des Landes auflösen. Dahingehend wirkt auch das
Programm “German Season” mit web sides zur Information über deutsch-britischen
Jugendaustausch, sowie Stipendienprogrammen des DAAD. Leider geht der Austausch bisher
einseitig (dreimal soviel) von Deutschland nach England. Im Sinne des Abbaus von
Vorurteilen und um sich ein eigenes Bild zu machen, müssten Programme stärkere Förderung
erfahren, die englischen Schülern, Studenten und Wissenschaftlern einen Besuch in
Deutschland und das Erlernen der deutschen Sprache ermöglichen.
44500 Besucher der Kulturprogramme des GI in London zeigen, dass dieses Institut etwas zu
bieten hat. Durch die Auswahl der Referenten (wie unter C 2.2. beschrieben), wie z. B. der
bekanntlich aus Deutschland stammende Lord Dahrendorf, der in England studiert hat, dessen
Frau Engländerin ist, oder der ebenfalls bei uns wie international hoch angesehene frühere
Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, beide in Deutschland als
moralische Instanz respektiert, stehen für ein nicht unkritisches aber eben doch sehr
differenziertes, positives Deutschlandbild. Die neuen Bundesländer, vertreten durch die
Vorstellung Weimars als Kulturstadt Europas 1999, sollen neue Informationen und
Entwicklungen vermitteln.
Fazit: Das Deutschlandbild, welches sich Menschen anderer Länder machen,
entscheidet mit über eine gemeinsame friedliche Zukunft.
Beziehung zum Partnerland
Ebenso schwierig gestaltet sich der Dialog mit Tschechien. Hartnäckig werden die
Beneschdekrete von 1948, welche “ alle Akte der gerechten Vergeltung” an
Sudetendeutschen für straffrei erklären, vom Tschechischen Parlament verteidigt. Vaclav
Havel, dessen Amtszeit im Frühjahr 2003 zu Ende ging, hat zwar einen Neubeginn
angestoßen, konnte aber letztlich das verkrampfte Verhältnis nicht wesentlich beeinflussen.
Dass die EU- Kommission die Dekrete als mit dem europäischen Recht vereinbar fand, war
254
im Sinne eines Brückenbaus nicht hilfreich, weil Mord, Vertreibung und Enteignung
nachträglich, gleich von welcher Seite, nicht legalisiert werden können. In der deutsch-
tschechischen Erklärung von 1997 wird die “Zwangsmigration der Sudetendeutschen”
tschechischerseits bedauert. Auch das Goethe-Institut Prag leistet seinen Beitrag zur
Verständigung zwischen den beiden Völkern durch Vermittlung eines aktuellen
Deutschlandbildes, wie im Interview mit der Leiterin des GI Prag unter 5.4. klar zum
Ausdruck kommt:
“Mir ist eine Hinwendung zum heutigen Deutschland wichtig. Deshalb bemühe ich mich,
besonders auch jüngere Deutsche hier vorzustellen, da die Tschechen sehr wenig über das
heutige Deutschland wissen. Ich möchte also den Dialog zwischen Deutschen und Tschechen
herstellen. Noch ist dieser Dialog deutlich überlagert von der Diskussion, die von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgeht, aber meiner Meinung nach repräsentieren die
Sudetendeutschen nicht die Mehrheit bei uns.
E. A: Haben Sie denn mit der Landsmannschaft auch im Goethe-Institut zu tun?
G. B: Ja, das Bundesministerium des Inneren stellt Mittel für Begegnungszentren bereit. Wir
erhalten daraus 31.000 DM. In dieser Woche findet hier ein Treffen der Leiter der
Begegnungszentren statt. Ich glaube, auf diesem Wege kann man den Dialog zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen fördern. Man kann das hiesige Deutschlandbild
aktualisieren, was dringend notwendig ist.
Die Programmreferentin des GI stellt eine Möglichkeit vor, aktuell Verbindungen zwischen
der tschechischen und deutschen Kultur aufzubauen:
5.4. Eine sehr wichtige Veranstaltung für das Zusammenleben und gegenseitige Verständnis
von Deutschen und Tschechen ist unser internationaler Essay Wettbewerb ”Die Zukunft von
der Vergangenheit befreien? Die Vergangenheit von der Zukunft befreien?” In Anlehnung an
die Tradition der Akademien der Wissenschaften und Künste im Europa des 18. Und 19.
Jahrhunderts schreiben wir zusammen mit der renommierten Zeitschrift ”Lettre
International” und der GmbH ”Weimar 1999 – Kulturstadt Europas” diese Preisfrage zur
Beantwortung in Form eines Essays aus. Teilnehmen kann jeder Interessierte. Die ersten drei
Gewinner erhalten hoch dotierte Geldpreise in Höhe von 50.000 DM, 30.000 DM und 20.000
DM und werden zur Preisverleihung nach Weimar eingeladen. Außerdem erhalten sie ein
Arbeitsstipendium in Deutschland und ihre Essays werden in den verschiedensprachigen
Ausgaben von ”Lettre International” sowie anderen internationalen Kulturzeitschriften
veröffentlicht.
255
In manchen Ländern sind die Beziehungen nicht von historischen Belastungen geprägt. Wie
unter 9.1. beschrieben, sind die Türken traditionell positiv gegenüber Deutschland eingestellt.
Dies ist begründet durch die lange politische Zusammenarbeit. Deutschland wurde besonders
seit dem vergangenen Jahrhundert gerne als ”großer Bruder” und ”Freundesland”
bezeichnet. Es beteiligte sich an der Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten des
Osmanischen Reiches, und deutsche Fachleute spielten eine wichtige Rolle bei der
Modernisierung des Landes im Rahmen der Atatürkschen Reformen. Oft wird auch heute
noch an die Waffenbrüderschaft im 1. Weltkrieg erinnert. Andererseits trugen die vielen
türkischen Gastarbeiter als Heimkehrer oder auf Heimaturlaub zu diesem positiven Bild bei.
Hinzu kommen noch die größtenteils freundschaftlichen wirtschaftlichen und touristischen
Beziehungen zwischen beiden Staaten.”
Diskussionsgegenstand auch zur Einschätzung und Erfahrung eines Deutschlandbildes bot in
Moskau ein Zyklus der Heimatfilme, wie unter 10.1. beschrieben. Deutsche Landschaft,
Tradition, Dorfleben, Vergangenes wurde gezeigt. Heimeliges, Erwärmendes aus einer Zeit,
die nicht mehr ist, im Gegensatz zu den gegenwärtig harten Lebensbedingungen für viele
Menschen in Russland.
Wie beim Interview mit den Schülersprechern unter 2.5. deutlich wird, sind auch Deutsche im
Ausland geneigt, sich in Parallelgesellschaften einzurichten. Erscheinungen, die wir hier bei
Immigranten kritisieren, treten auch bei Auslandsdeutschen auf:
T: Wir empfinden die Deutsche Schule wie ein Ghetto, weil sie sich fern ab der Stadt auf
einem abgegrenzten Areal befindet, wir nur für uns sind, und nur selten mit englischen
Schülern in Kontakt kommen. Deshalb haben wir mit zwei bis drei englischen Schulen Treffen
vereinbart, um gegenseitige Beziehungen aufzubauen. Die Deutsche Schule veranstaltet am 2.
Dezember eine große Disko, wozu wir auch die beiden englischen Schulen einladen wollen.
Die einzige Ebene, um mit englischen Jugendlichen in Kontakt zu treten, ist die private, z.B.
in Form von Sportveranstaltungen. Deshalb wollen wir in Zukunft auch gemeinsame
Sportveranstaltungen nach Schulschluss organisieren, z.B. Basketball-Wettbewerbe.
A: Gibt es da nicht sprachliche Verständigungsprobleme?
T: Die sprachlichen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, sind groß. Es ist
allerdings sehr schwer, die englische Sprache perfekt zu beherrschen, wenn man sie im
Alltagsleben nicht spricht! Außerdem ist es sehr schwer, die englische Kultur kennen zu
lernen, wenn der alltägliche Kontakt zu Einheimischen fehlt.
A: Gibt es politische Vorbehalte gegenüber Deutschen?
256
T: Die mangelnde Kontaktbereitschaft der Engländer führen wir darauf zurück, dass die
englischen Schüler einen völlig anderen Geschichtsunterricht haben als wir. Das
Haupthindernis ist die deutsche Vergangenheit. Die Nazi-Vergangenheit und Hitler werden
im englischen Unterricht ganz bewusst in engen Zusammenhang zu Deutschland gestellt.”
Fazit: Auch die Schulen sind gehalten sich der Gesellschaft des Gastlandes zu öffnen.
Isolation kann durch eine Deutsche Schule noch verstärkt werden. Umso mehr muss die
Aufgabe gesehen werden, von der Schule her die deutsche Gemeinde zu öffnen zum Nutzen
der Völkerverständigung. Auch die Deutsche Schule Prag engagiert sich in diesem Sinne,
wenn sie wie unter 5.5. dargestellt z.B. für eine Ausstellung “ Frieden für Israel, Frieden für
alle” im früheren KZ Theresienstadt, Bilder erstellt. Dieses dient nicht nur der
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sondern auch dem Friedenserhalt in der Welt.
Fazit: Unsere Beziehung zum Partnerland muss vor dem Hintergrund der gemeinsamen
Geschichte reflektiert werden.
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache findet in einer Weltstadt wie London besonders als
Wirtschaftsdeutsch seine Interessenten. Dem gemäß muss das Angebot zunächst sehr sach-
orientiert sein. Jedoch lehrt die Erfahrung, dass die zunächst utilitaristischen Motive einen
stabilen Bezug zur deutschen Sprache begründen und darauf aufbauend Nähe und Offenheit
für kulturelle Inhalte hergestellt werden.
2.1.A: Ist Spracharbeit Kulturvermittlung oder Wirtschaftsförderung?
C: So pauschal würde ich das nicht sehen. Sicher ist die wirtschaftliche Motivation bei einem
gewissen Kreis von Teilnehmern evident, der in kürzester Zeit ein bestimmtes Ziel erreichen
will. Es gibt aber auch andere, die Deutsch sehr wohl aus kulturellem Interesse lernen. Diese
Menschen, ob sie Kunsthistoriker, Musiker oder Journalisten sind, bringen jedenfalls ein
kulturelles Hintergrundwissen mit, auch wenn sie Geschäftsleute sind.
W: Auch im Selbstverständnis der Lehrer ist die Betonung auf das Wirtschaftsdeutsch
gerichtet. Hier stecken die einzigen echten Wachstumspotentiale. Oft ist dies jedoch nur der
Aufhänger: Wenn die Teilnehmer erst einmal Kontakt mit uns haben, interessieren sie sich
auch für andere Aspekte, z.B. für kulturelle. Im Gegensatz etwa zu Italien, wo Deutsch
hauptsächlich aus kulturellen Aspekten gelernt wird, liegt hier die Betonung klar auf der
pragmatischen Verbesserung der Geschäftsmöglichkeiten.
257
C: Durch meine Besuche in allen Klassen vergangenes Jahr, würde ich die These vertreten,
dass eine gesunde Mischung aus wirtschaftlich orientierten Pragmatikern und allgemein
Kulturinteressierten in den Kursen besteht.
Die Frage ist, was die dritte Säule der Außenpolitik zur Stabilisierung der zweiten Säule
beiträgt. Ist die Spracharbeit nun Kulturvermittler oder Wirtschaftsförderer? Nach den
Aussagen der Leiterin der Sprachabteilung ist eine solche Abgrenzung nicht möglich.
Fazit: Deutsch als Fremdsprache trägt zum Verständnis unseres Landes und unserer
Kultur bei und befördert auch das wirtschaftliche Miteinander.
Zwei Fremdsprachen lernen
Das Goethe-Institut beansprucht für sich die Vermittlung der Schlüsselfunktion der
Mehrsprachigkeit. Jeder sollte seine Muttersprache, Englisch als lingua franca und eine
weitere Sprache lernen. Insofern argumentiert der Leiter des GI London konsequent dafür,
Deutsch als zweite Fremdsprache zu lernen. Es ist nicht anzunehmen, dass die britische
Regierung von sich aus weitere Anstrengungen unternehmen wird, um den Fremdsprachen-
unterricht auszuweiten:
2.1.Der Schwerpunkt dieser Bildungsreform liegt vor allem in der Verbesserung der
schriftlichen Fertigkeiten, vor allem in der Förderung der drei großen "R" im
Primarschulbereich: reading, writing und arithmetic.
Sehr wohl würde sich aber eine Verbesserung ergeben, wenn durch Vorgaben der EU generell
dem Fremdsprachenunterricht eine größere Bedeutung beigemessen würde. Auch zwischen
Deutschland und Frankreich wird beklagt, dass das Interesse an der jeweiligen
Nachbarsprache nachlässt. Selbst in der Deutschen Schule Paris wird neben der französischen
Sprache die englische ab der fünften Jahrgangsstufe unterrichtet und man bemüht sich, in
Englisch keinen “Rückstand” gegenüber Deutschland entstehen zu lassen. Man geht davon
aus, dass es ohne Englisch keine Zukunftschance für junge Leute geben wird. Nur über eine
stärkere Verbindlichkeit einer zweiten Fremdsprache kann eine Lösung gefunden werden, wie
es auch der Leiter des GI bestätigt.
2.3.W: Die Rolle der deutschen Sprache in Großbritannien wird erst wirklich verändert bzw.
verbessert, wenn eine zweite Fremdsprache in der Sekundarstufe an britischen Schulen
obligatorisch wird. Wenn wir in Deutschland die obligatorischen Fremdsprachen allerdings
selbst abbauen, wird es kulturpolitisch ziemlich schwierig sein, den Engländern die
258
Bedeutung einer zweiten Fremdsprache zu verdeutlichen. Ich möchte in diesem
Zusammenhang zwar keine Prognose wagen, aber ich stelle schon fest, dass selbst hier in
England, dem Land der lingua franca, die Bereitschaft zum Umdenken, d.h. zum Erlernen
einer anderen Sprache wächst. Dies mag mit der europäischen Einigung zu tun haben und
man merkt, dass man in Englisch zwar kaufen, aber nicht verkaufen kann. Auf Initiative von
Tony Blair untersucht die Nuffield Foundation gerade in einer groß angelegten Studie,
warum es in Großbritannien so schlecht um das Erlernen von Fremdsprachen bestellt ist und
welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Egal, was dabei heraus kommt, so zeigt sich
hierin doch ein Bewusstseinswandel, denn so etwas hat es früher nie gegeben. Dies ist ein
Schritt nach vorn.
Zur Stellung von Deutsch im Verhältnis zu anderen Fremdsprachen in der Türkei ist unter
9.1. zu lesen:
Deutsch ist, zusammen mit Englisch und Französisch (und Arabisch auf den religiösen
Schulen) eine der drei wichtigsten Fremdsprachen in der Türkei. Dabei liegt Deutsch weit
abgeschlagen hinter Englisch, das mit 95% der Schüler eine absolute Monopolstellung
genießt (Deutsch: 4%, Französisch: 1%). Auch in den Grundschulen, die seit der
Erziehungsreform ab der 4. Klasse eine erste Fremdsprache lehren, zeigt sich ein ähnliches
Bild: Englisch lernen etwa 98% der Schüler. An ungefähr 9% der fremdsprachlich
ausgerichteten Anadolu-Schulen wird Deutsch neben Englisch als erste Fremdsprache
angeboten. Auf den Regelschulen, die sich der Grundstufe anschließen – immerhin für 2/3
aller Schüler, die die Aufnahmeprüfung in die Elite-Schulen nicht schaffen – sinkt die
Bedeutung des Deutschen kontinuierlich.
Für die Türkei ist Deutschland der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner. Die meisten
Touristen kommen von dort. In Deutschland lebt die größte Zahl von Auslandstürken.
Trotzdem hat die Türkei die Sprachenfrage eindeutig zugunsten des Englischen entschieden.
Für ein freiwilliges zusätzliches Erlernen des Deutschen ist der Studienstandort Deutschland
zu unattraktiv, weil die Einreisebedingungen nicht flexibel gehandhabt werden können. Die
deutsche Bürokratie will hier nicht unterscheiden zwischen einem Studenten und einem
Hilfsarbeiter. Die Gefahr, dass sich Deutschland intellektuell abschottet, wird an diesem
Beispiel belegt. Ähnliche Schwierigkeiten gelten für die meisten Länder. Während sich die
USA bemühen, Begabungen aus der ganzen Welt anzulocken, reagiert die Bundesrepublik
restriktiv und kleinlich.
259
Fazit: Junge Europäer sollten in Zukunft zwei Fremdsprachen lernen, wobei Deutsch
als zweite Fremdsprache eine besondere Rolle einnehmen könnte.
Die Sprache des Partnerlandes
Problematisch wird es, wenn die deutschen Schüler die Sprache eines Gastlandes lernen
sollen, die nicht von vorne herein als existenziell bedeutsam eingeschätzt wird. Dazu äußert
sich der Leiter der Deutschen Schule Prag.
5.6. Dr.v. H.: Die Sprachproblematik wird oft völlig falsch dargestellt. Überall dort, wo wir
über Begegnungsschulen diskutiert haben, ist die Landessprache in einer falschen Form als
Teil der Konzeption dargestellt worden. Unsere Schüler würden im Falle einer
Begegnungsschule nur unwesentlich mehr Tschechisch lernen als jetzt. Nehmen wir das
Beispiel der Begegnungsschule in Budapest: Die Schüler haben dort das Fach ”ungarische
Kultur und Sprache”. Dieses Fach wird als eine Art ”Kulturfach” gesehen. Dies muss auch
unser Ziel sein: die Vermittlung der tschechischen Kultur und Angebote zum Erlernen der
Sprache, die individuell angenommen werden können. Dass beispielsweise ein Schüler der 9.
Klasse, der bisher keine Ahnung von Tschechisch hat, dieses Angebot wahrscheinlich
ablehnen würde, ist klar. Die Befürchtungen der Eltern sind also in diesem Fall schlicht nicht
korrekt.
Fazit: Die Sprache des Partnerlandes zu lernen, bedeutet, auch interkulturelles Lernen
zu verwirklichen.
Bürokratische Hemmnisse für ein Studium im Partnerland
Die Staaten Mittelosteuropas in die EU aufzunehmen, bedeutet auch für die Bundesrepublik,
sich gemeinsamer Wurzeln zu entsinnen, das Gewirr bürokratischer Hemmnisse zu beseitigen
und ein Studium in Deutschland zu ermöglichen. Erscheinungen wie in der Deutschen Schule
Prag unter 5.6. beschrieben, müssen schnellsten beseitigt werden.
E. A: Besteht für nicht-deutsche, nicht-tschechische Schüler überhaupt keine Möglichkeit,
schon vor dem Abitur nach Deutschland einzureisen, um sich über die Studienbedingungen zu
informieren?
260
G. Kr: Es gibt einen Trick, der auch bereits von vielen unserer Schüler angewandt wird: Die
Schüler berufen sich auf das Schengener Abkommen. In der Praxis sieht das so aus: Die
Schüler gehen hier zur französischen Botschaft und besorgen sich ein Touristenvisum für
Frankreich, was dort sehr leicht möglich ist. Daraufhin müssen sie mit dem Flugzeug nach
Paris fliegen und haben von dort aus die Möglichkeit, ohne Visum per Zug nach Deutschland
einzureisen. Dass dies mit erheblichen Kosten und Mühen verbunden ist, versteht sich von
selbst.
Fazit: Bürokratische Hemmnisse für ein Studium im Partnerland müssen abgebaut
werden.
Gemeinsam mit Partnern erstellte Lehrmittel
Im Folgenden erklärt eine Fachkraft, die die örtlichen Gegebenheiten genau kennt, warum das
Lehrmaterial, welches in Deutschland von Inter Nationes ohne Mitarbeit im Partnerland und
ohne das Goethe-Institut entstanden ist, didaktisch unbrauchbar und der Zukunftsfähigkeit
abträglich ist:
2.3.B: Beispielsweise deren Lehrübungen oder die Mappen über deutsche Städte sind
größtenteils viel zu schwer. Wir versuchen Inter Nationes, bereits bevor sie produzieren, zu
einer Kooperation zu bewegen.
Das Problem am Inter Nationes-Material ist einfach, dass die örtlichen Bedürfnisse zu
unterschiedlich sind, um auf einheitliches Material aufzubauen. Das Inter Nationes
Deutschlandspiel war beispielsweise ein ziemlich dröges Ding. Jetzt heißt es “Kubuk", und
schon das klingt ziemlich eckig. Diese Materialien sind entweder nicht ausführlich genug,
oder schlichtweg zu langweilig. In der Sprache etwa haben sie eine viel zu dichte
Information. Auch beim Thema Deutsch als Wirtschaftssprache muss man sich fragen, was
deren Materialien mit Wirtschaft zu tun haben. Das Zeug ist sprachlich und didaktisch völlig
unbrauchbar, das kann man vergessen.
Hingegen wurden im Lehrwerkprojekt des GI “Schau mal”, welches z. B. in Bratislava (Siehe
unter 6.2.) entstanden ist, unter Mitarbeit von Partnern wie der Gesamthochschule Kassel,
unterstützt vom Pädagogischen Institut der Stadt Bratislava, Themenbereiche berücksichtigt,
die aus einem gemeinsam von slowakischen, polnischen, tschechischen und ungarischen
Fachleuten erarbeiteten Curriculum stammen. Ein Themenbereich ist “das Eigene und das
Fremde” benannt. Globale Aspekte interkulturellen Miteinanders werden hier angesprochen.
261
In Zusammenarbeit hat das GI in Moskau mit der GTZ und russischen Autoren Material vor
allem für deutsche Minderheiten erarbeitet (Siehe 10.1. “Hallo Nachbarn”), welches während
der Erstellungsphase im Unterricht getestet wurde. Russische Lehrer wurden fortgebildet, es
zu nutzen. Wie zu erwarten, war die Nachfrage nach diesem Unterrichtsmaterial von Anfang
an stark. Ausschlaggebend dafür waren die länderübergreifende Zusammenarbeit und ein auf
die Nutzer zugeschnittenes Unterrichtswerk sowie entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen
für die Lehrkräfte.
Fazit: Gemeinsam mit Partnern anderer Länder hergestellte Lehrmittel erleichtern den
Lernerfolg der Benutzer.
Länder übergreifende Lehrerausbildung
Unter 5.5. wird geschildert, wie das Pädagogische Fortbildungszentrum für Lehrer der
Deutschen Schule Prag Länder übergreifend wirkt:
Der Deutschen Schule Prag wurde im Schuljahr 1997/98 eine weitere wichtige Aufgabe
übertragen. Sie wurde zum Pädagogischen Fortbildungszentrum für die Region Osteuropa
und organisiert seither die Lehrerfortbildung für die Deutschen Schulen in Moskau, Prag und
Warschau. Diese Fortbildungsveranstaltungen wurden bisher von der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen in Köln selbst zentral durchgeführt. Aus unterschiedlichen Gründen
funktionierte die konkrete Wahrnehmung dieser Veranstaltungen seitens der Lehrer jedoch oft
nicht. Deshalb ist man im letzten Schuljahr versuchsweise dazu übergegangen, die
pädagogische Fortbildung zu dezentralisieren. Hierfür wurden die drei Auslandsschulen in
Moskau, Prag und Warschau zu einer Region (Osteuropa) zusammengefasst. Die inhaltlichen
Entscheidungen bezüglich der Fortbildungen werden von einem sog. Pädagogischen Beirat
getroffen, der sich aus den drei Schulleitern zusammensetzt. Auch die Lehrkräfte aller Fächer
und Jahrgangsstufen sollen künftig an der Entwicklung von Inhalten und Formen ihrer
Fortbildung beteiligt werden, um ihre Unterrichtsarbeit gezielt zu verbessern. Hierbei sind
gegenseitige Unterrichtsbesuche, Pädagogische Tage und Konferenzen an den drei Schulen
geplant, wobei mehrtägige Treffen ausnahmslos in Prag stattfinden werden. Für größere
Fortbildungsveranstaltungen, etwa unter Einbeziehung von Experten anderer Schulen und
Hochschulen, ist Prag prädestiniert.
262
Diese Fortbildungsveranstaltungen dienen der gegenseitigen Verständigung ebenso wie der
Qualifikation. Es gilt, kreativ in der Organisation zu sein, um diese Treffen effizient zu
gestalten.
Eine andere Variante der Deutschlehrerausbildung, die unter schwierigen regionalen
Bedingungen kreativ eingesetzt wird, sind Fernstudiengänge. 30 Netzwerkorte und 100
Kontaktstellen für Weiterbildungsmaßnahmen der Deutschlehrer nennt der Leiter des Goethe-
Instituts Moskau unter 10.2.
Fazit: Länder übergreifende Lehrerausbildung schafft Verbindungen und befördert den
Dialog.
Begegnungsschule
Deutsche Schulen im Ausland werden sich die Frage stellen müssen, ob die herkömmlichen
Expertenschulen, die das Deutsche Schulwesen im Ausland kopieren, in einer
multikulturellen Gesellschaft noch zeitgemäß sind, oder ob Schulen, die mehr Begegnung mit
Menschen des Partnerlandes ermöglichen, zukunftsfähiger sind. Dazu führte ich mit dem
Schulleiter der DS Prag ein Gespräch (Siehe 5.6.), welcher diese Frage eindeutig zugunsten
der Begegnungsschulen ( wie unter B 2.3. definiert) beantwortet:
E. A: Herr Dr.v. H., wir haben darüber diskutiert, die Deutsche Schule Prag in eine
Begegnungsschule umzuwandeln.
Dr.v. H.: Längerfristig werden sich wahrscheinlich die deutschen Auslandsschulen so wie
hier in die Richtung einer Begegnungsschule entwickeln müssen. Das ist vom politischen
Gesichtspunkt, vom Zusammenleben der Deutschen und Tschechen hier in Prag sehr sinnvoll.
Dadurch ließe sich ein besseres Verständnis für einander aufbauen, und das ist ein sehr
wichtiges Anliegen, gerade nach unserer gemeinsamen, schwierigen Geschichte. Die
Schwierigkeiten liegen sicherlich darin, dass wir zusätzlich hier in Prag eine
deutschsprachige Abteilung in einem tschechischen Gymnasium haben, die regen Zulauf hat.
Ich bin allerdings der Auffassung, dass wir dieser Einrichtung keine grundsätzliche
Konkurrenz machen würden, da unser Schülerklientel deutlich anders strukturiert wäre. Das
Thema Begegnungsschule ist für uns eine Perspektive, die wir längerfristig verfolgen. Ich
gehe nicht davon aus, dass sich unsere Schule in den nächsten Jahren bereits umwandeln
lassen wird. Wir haben auch immer wieder interessierte tschechische Schüler, aber bei ihnen
263
handelt es sich vorwiegend um Rückwanderer oder ehemalige Emigranten, aber auch um
Eltern, die ihre Kinder vom Kindergarten an zu uns schicken wollen.
Die Deutsche Schule in Stockholm (4.3.) erfüllt die wesentlichen Kriterien der
Begegnungsschule. Ein schwedischsprachiger Unterrichtsanteil ist für alle Schüler
verpflichtend, bikulturelle Abschlüsse als Hochschulzugangsberechtigung werden geboten,
das Begegnungsprogramm beginnt im Kindergarten, eine eigene Kindertagesstätte mit der
Eingangssprache Schwedisch existiert, kleine Sprachfördergruppen für Deutsch erleichtern
das Lernen. Sachfächer werden von schwedischen Lehrern in Schwedisch unterrichtet.
Gemeinsame Anstrengungen zweier Länder bedeutet es, eine solche Schule zu unterhalten:
Die Schule Stockholm wird nicht nur von Deutschland, sondern auch vom Königreich
Schweden finanziert:
In Begegnungsschulen wird interkulturelle Erziehung ermöglicht (siehe auch unter A 1.2.
begriffliche Klärung). Dazu sagt Dagmar Schipanski auf der Konferenz deutscher
Auslandsschulen 2002: “Deutsche Schulen im Ausland sind Begegnungsschulen, sie erziehen
zu Mehrsprachigkeit und zu interkultureller Kompetenz. In einer Zeit, in der nicht sicher ist,
ob der “Clash of Civilizations” wirklich durch einen Dialog der Kulturen verhindert werden
kann, dienen diese Schulen der Friedenssicherung. Ein Dialog der Kulturen ist nur mit
Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenz seiner Akteure erreichbar.”216
Fazit: Die Schule der Zukunft ist die Begegnungsschule und verwirklicht interkulturelle
Erziehung.
Anerkennung von Abschlüssen
Hier setzt auch der Vorschlag des BLASchA ein, ein europäisches Abitur, “E-BAC” als
Ergänzung zum internationalen Abitur, dem “I-BAC” auf den Weg zu bringen. Gerade im
Zusammenhang der europäischen Erweiterung wird dies als eine gewichtige und
216 Schipanski, Dagmar: Auslandsschulen im Spannungsfeld zwischen Bildungsqualität und Budget. Rede
anlässlich der Konferenz Deutscher Auslandsschulen- weltweit, vom 4. bis 6. April 2002 in Mexiko-Stadt.
www.ds2002.org
264
hochdifferenzierte Aufgabe gesehen.217 Dialogische, bikulturelle, übernationale Abschlüsse
sind sicher das Modell der Zukunft. In einigen Deutschen Schulen sind sie schon verwirklicht,
andere müssen noch nachziehen:
3.2.Es existieren zwei staatliche französische Schulen, das Lycée Franco-Allmand und das
Lycée International, die kostenlos ein interkulturelles Unterrichtsprogramm anbieten. Die
Kostenfreiheit wird unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Lehrer des deutschen
Zweiges an diesen Schulen von der Bundesrepublik Deutschland besoldet werden. An diesen
Gymnasien kann zusätzlich zum staatlich anerkannten deutschen Abitur gleichzeitig auch das
französische Baccalauréat erworben werden, und das schon in 12 statt in 13 Jahren.
Aufgrund dieser offensichtlichen Vorteile ziehen viele Interessenten diese Schulen der
Deutschen Schule Paris aus kulturellen wie aus finanziellen Gründen vor. Diese bemüht sich
deshalb im Verbund mit der Botschaft intensiv, eine gleichzeitige Vergabe des deutschen
Abiturs und des französischen Baccalauréat (sog. ”Abi-Bac”- Regelung) zu ermöglichen,
scheiterte aber bisher am zuständigen Ausschuss der KMK.
1972 wurde in Folge des Elysée- Vertrages ein Abkommen über die Einrichtung binationaler
Gymnasien und die Einführung des deutsch-französischen Abiturs unterzeichnet. Also müsste
die Durchführung des Erwerbs gemeinsamer Abschlüsse zwischen Deutschland und
Frankreich forcierter durchgesetzt werden.
Das Alman Lisesi in Istanbul gewährt durch gut organisierten Austausch schon frühzeitig
Einblick in das deutsche Schulsystem und ermöglicht seit dem Jahr 2002 den binationalen
Abschluss.
9.4.Die Schule pflegt enge Verbindungen zu Schulen in Deutschland: mit Gymnasien in
Würzburg, Hamburg (2 Schulen) und Berlin (3 Schulen) bestehen Schüleraustausch-
Programme und Partnerschaften, die einen bedeutenden Anteil am erzieherischen
Begegnungsauftrag der Schule haben. Zum guten Ruf der Deutschen Schule Istanbul, die
217 Stoldt, Peter, bis 2001 Ländervorsitzender des BLASchA In: Nachhaltigkeit Auswärtiger Kulturpolitik.
Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrer in der GEW) vom 17. bis
22. November 2002 im Internationalen Haus Sonnenberg, St. Andreasberg. Internationaler Arbeitskreis
Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Drucklegung erfolgt :
Braunschweig, 2003.
265
traditionell als eine der angesehensten Schulen in der Türkei gilt, trägt bei, dass es nun
binationale Abschlüsse gibt. Erstmals wurden im Jahre 2002 binationale Abschlüsse am
Alman Lisesi und am Istanbul Lisesi durchgeführt. Gegenseitiges Vertrauen in
Gleichwertigkeit drückt sich auf diese Weise aus.
Die Anerkennung der Abiturzeugnisse ermöglicht den Schülern ein problemloses Studieren
im Gastland oder in Deutschland, welches freilich immer mit dem Nachweis der
Sprachkenntnisse verbunden sein sollte. Auch die deutschsprachige Abteilung des
Gymnasiums Poprad bietet die gegenseitige Anerkennung seit 1998 (siehe 6.3.). Allerdings
gibt es ohne Kulturabkommen für den gegenseitigen Austausch Hürden, die für angehende
Studenten schwer zu überwinden sind wie das Beispiel unter 5.6. zeigt. Das dient der
Brückenbildung nicht. Das vom BLASchA vorgeschlagene E-BAC allerdings kann noch
nicht erworben werden.
Fazit: Gegenseitig anerkannte Abschlüsse zeigen Respekt und schaffen Vertrauen.
Bibliothekspartnerschaften und gemeinsame Ausstellungen
Zusammenarbeit mit den Institutionen und Bibliotheken, die ein Interesse an deutscher
Literatur haben- wobei es nicht immer wichtig ist, diese Literatur auch auf deutsch zu
publizieren- sind Voraussetzungen guter Bibliotheksarbeit des Goethe- Institutes, wie sich
unter 2.3. beim Gespräch mit der Leiterin der Bibliothek D und dem Institutsleiter W in
London ergibt:
A: Wie sieht Ihre Kenntnis des englischen Buchmarktes aus?
D: Das einzigartige an uns ist unsere genaue Beobachtung des englischen Buchmarktes. Wir
bekommen sämtliches Material, Verlagskataloge, Textproben usw. Wir wissen genau, was
neu erscheint, insbesondere über Deutschland oder aus dem Deutschen übersetzt. Ein Drittel
unseres Bestandes ist in englischer Sprache.
A: Wieso ist ein Drittel Ihrer Medien in englischer Sprache verfasst?
D: Weil sehr oft die Informationen gebraucht werden, und wir nicht immer davon ausgehen
können, dass der Betreffende Deutsch spricht. Wenn wir diesen englischen Bestand nicht
hätten, müssten wir oft selbst etwas zusammenschreiben, wenn wir die Interessenten nicht
verprellen wollen. Obendrein ist natürlich auch der Aspekt interessant, dass wir aus der
englischen Literatur über Deutschland direkt mitbekommen, wie die Briten Deutschland
266
sehen. Es ist traurig, dass es sich für eine einzelne Bibliothek in England nicht lohnt, neue
deutsche Literatur oder übersetzte deutsche Titel in ihr Programm aufzunehmen.
W: Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen vorher sagte, ich glaube dass das Goethe-
Institut im Bibliotheks- und Informationsbereich im Jahre 2010 noch eine bedeutende Rolle
hier spielen kann und wird.
A: Partnerarbeit ist eine Maxime des Goethe-Instituts. Wie wird diese in Ihrem Bereich
verwirklicht?
D: Ein weiteres Arbeitsfeld, das in den letzten Jahren erst hinzugekommen ist - und
gleichzeitig ein Grundprinzip der Goethe-Institute verkörpert - ist die Partnerarbeit. Wir
arbeiten heute verstärkt mit anderen Bibliotheken, mit Übersetzern, mit Verlegern und
Buchhändlern. Diese Entwicklung ging von Osteuropa aus. Dort hat man frühzeitig
festgestellt, dass mit dem wenigen zur Verfügung stehenden Personal keine effiziente
deutschsprachige Bibliothek dauerhaft zu erhalten ist. Man wollte die Infrastruktur dort
stattdessen durch verstärkte Zusammenarbeit mit ortsansässigen Bibliotheken verbessern.
Dabei wurde viel erreicht. Wir setzen heute einen Schwerpunkt unserer Arbeit in die
Verbesserung der Zusammenarbeit mit hiesigen Institutionen. Ein Beispiel, das schon
genannt wurde, sind die “new books in german"-Broschüren, die ja in Kooperation mit einer
britischen Initiative erarbeitet und verbreitet werden. Der wichtigste Punkt an diesem Projekt
ist, dass die britische Seite die Titel auswählt. Die Initiative zu dem Projekt kam übrigens
ebenfalls von britischer Seite und wurde von uns aufgegriffen und unterstützt. [...]
W: Die Botschaft ist nicht durch Kenner der deutschen oder britischen Literatur- und
Verlagsszene vertreten. Solche Fachleute gibt es dort nicht. Es wäre sinnvoll, wenn wir dieses
Projekt - auch finanziell - alleine betreuen könnten.
Fazit: Genaue Kenntnis des Buchmarktes im Partnerland ist nötig, um zielorientiert zu
arbeiten.
2.3. A: Gibt es im Bereich Literatur- und Übersetzungsförderung auch Ausstellungen?
D: Zu dieser Partnerarbeit - sie nennt sich jetzt auch Bibliothekarische Verbindungsarbeit -
gehört z.B. auch eine Ausstellung, die wir hier gehabt haben. Die ist in unserer Bibliothek in
Brüssel entstanden, und wir haben die englische Version ausgestellt. Darin ging es um
deutsche Literatur nach 1945. Wir überlegen, eine Folgeausstellung zu organisieren, die
besonders die Literatur nach der deutschen Vereinigung wiederspiegeln soll. Diese
Wanderausstellung wurde bereits in England sehr positiv aufgenommen. In ihr werden
267
Bücher und Profile der verschiedenen Autoren nach 89 vorgestellt. Im Herbst kommt die
Ausstellung nach London, und dann wollen wir sie zeigen.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt also in der Literaturförderung und der
Übersetzungsförderung deutscher Literatur.
Für einzelne Bibliotheken in Großbritannien lohnt es sich nicht mehr, deutsche Bücher im
Bestand zu haben. Doch das Goethe-Institut hält dagegen. Es hat 1998 eine Studienreise
britischer Bibliothekare nach Deutschland realisiert, deutsche Bibliotheksarbeit konnte vor
Ort demonstriert werden, auch Interesse und Begeisterung an räumlicher und baulicher
Gestaltung wurde dabei geweckt. Ein Jahr zuvor hat der British Council europäische
Bibliothekare nach Großbritannien eingeladen. Die Konsequenzen aus einer erfolgreichen
Zusammenarbeit sind vielschichtig. U. a. will der britische Bibliotheksverband den British
Council, das Institut Francais und das Goethe-Institut zur europäischen Zusammenarbeit im
Bibliothekswesen zusammenbringen. Eine Stufe auf dem Weg dorthin sind Partnerschaften:
Aus Anlass des 40. Jahrestages des Élysée-Vertrages (Siehe 3.1.) wurde auf Initiative des
Goethe-Institutes Paris ein Netz deutsch-französischer Bibliotheks-Partnerschaften geknüpft.
Den Anfang machten die Zentral- und Landesbibliothek Berlin und die Bibliothèke Publique
d´Information du Centre Georges Pompidou am 7.2.03.
Fazit: Bibliothekspartnerschaften und gemeinsame Ausstellungen im Bereich Literatur-
und Übersetzungsförderung erhöhen die Möglichkeit der Teilnahme der Nutzer an der
Wissensgesellschaft.
Partnerschaftliche Ausstellungsmodelle
Aus der Fülle des unter C angebotenen Materials seien hier nur einige Beispiele genannt: das
Ausstellungsmodell, wie unter 2.3. von der Programmreferentin des Goethe-Instituts genannt,
kann ohne gegenseitige Absprache der Mittlerorganisationen und ohne genaue Abstimmung
auf die örtlichen Gegebenheiten trotz hoher Qualität keinen Erfolg haben. Gerade die
Gartenkunst in Wörlitz, man denke an Fürst Pückler Muskau, der England bereiste, um
Gartenkunst zu studieren und sich Anregungen für seine Gartenparadiese in Deutschland zu
holen, verbindet England und Deutschland. Ausstellungen sind Katalysatoren für kulturelle
Entwicklungen, die aufzeigen können, wo z. B. Gemeinsames in der Geschichte der
268
Gartenkunst die lebendige Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksformen verbindet. Es hätte
einen hohen Stellenwert, diese dann auch optimal zur Geltung zu bringen:
H: Die ifa-Ausstellungen sind in der Regel sehr schön gemacht, auch mit sehr schönen
Katalogen, das Problem dabei ist nur, sie sind viel zu groß. Das haben wir den
Verantwortlichen dort auch schon gesagt, auch mein Kollege in der Zentralverwaltung, Herr
P, sprach dieses Problem bereits an. Ein aktuelles Beispiel dazu ist die vor kurzem vom ifa
organisierte Ausstellung über Kunst, Landschaft und Gartenbau in Wörlitz im Zeitalter der
Aufklärung. Wir wurden dann sehr kurzfristig gebeten, hier in England einen
Ausstellungsplatz zu finden. Gerade heute morgen führte ich ein Telefonat mit einem
Interessenten, der zwar keine idealen, aber immerhin kleine Räume zur Verfügung stellen
könnte, relativ kurzfristig für nächstes Jahr im Sommer. Museen wie z.B. das Kenwood House
planen 4 bis 5 Jahre im Voraus, da können wir nicht erst ein Jahr vorher kommen. Die
Wörlitzer Park-Ausstellung benötigt darüber hinaus eine Fläche von über 300 Quadratmeter
und das ist für die meisten kleineren Museen schlichtweg zu groß. Wenn das ifa dagegen
kleine, gute "Kabinettausstellungen" produzieren würde, die flexibel einsetzbar wären, d.h.
z.B. kompatibel wären mit hiesigen Dauerausstellungen, dann würde das unsere Arbeit sicher
erleichtern. Die Ausstellungen sind qualitativ sehr hochwertig, aber leider viel zu groß.
W: Die deutschen Aussteller produzieren gelegentlich einfach am Bedarf vorbei, wir werden
nicht gefragt. Die Konzentration von Ausstellungszuständigkeiten im Goethe-Institut wäre
daher sehr wünschenswert, d.h. nur eine Institution mit Kenntnis des lokalen Bedarfs und mit
unmittelbaren lokalen Kontakten wäre zuständig.[...]
W: Also ganz abstrakt gesagt: Die Institutionen in Deutschland einschließlich der
Zentralverwaltung des Goethe-Instituts, müssten viel genauer den Bedarf im Ausland
eruieren, bevor produziert wird.
Fazit: Partnerschaftliche Ausstellungsmodelle verbinden die lebendige Vielfalt der
künstlerischen Ausdrucksformen.
Partnerschaftliche Projektplanung
Partnerschaftliche Projektplanung und Nutzen des Wissens um lokale Gegebenheiten, ganz
im Sinne der Agenda 21: “Global denken, lokal handeln”, erhöht die Motivation der
Mitarbeiter und die Wirksamkeit der Kulturarbeit. Die sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Lebensbedingungen müssen mit in eine zukunftsfähige Kulturarbeit einfließen.
269
(Siehe auch unter 2.3.Gespräch mit der Leiterin der Programmabteilung des GI in London)
W: Ich wehre mich gegen jegliche Kompetenzbeschneidung seitens mancher Fachreferate
unserer Zentrale, die glauben, sie wüssten besser als wir, was in London geschehen soll. Die
Entscheidung kann nur bei uns getroffen werden, die Zentrale kann nur die Grundtendenz
vorgeben. Es darf jedenfalls nicht passieren, dass das Auswärtige Amt oder - wenn auch
selten - unsere Zentrale sich für uns Projekte ausdenken. Konkret darf uns das AA z.B. nicht
vorschreiben, welche Jahrestage wir zu beachten haben. Das widerspricht dem Grundsatz der
partnerschaftlichen Projektplanung. Wir können unseren britischen Partnern die Anlässe für
Projekte nicht vorschreiben und uns diese also erst recht nicht von grünen Tischen in
Deutschland vorgeben lassen.
Fazit: Kompetenzbeschneidung der einzelnen Institute in der Projektplanung hat
negative Auswirkung.
Dichterlesungen, sowie Programme zu Gedenktagen von Dichtern und Schriftstellern
So wurde Brechts 100. Geburtstag in allen Goethe-Instituten gedacht, aber dabei wurden
durchaus örtlich eigene Akzente gesetzt. Für alle Länder jedoch gilt, dass Brecht als
entschiedener Gegner der Nationalsozialisten das “andere Deutschland” verkörpert.
Die Programmgestalterin des Goethe- Instituts in Prag unter 5.4. erklärt ihre Präsentation wie
folgt:
M. L: Unter den vielen Möglichkeiten, das Thema Brecht im Jahre seines 100. Geburtstages
zu präsentieren, haben wir uns für ein Programm entschieden, das den Theatermann Brecht
so authentisch wie möglich zeigt. Es versammelt erstmalig alles noch vorhandene
Filmmaterial, das Brecht als Regisseur sichtbar macht. Der Kurator dieses Programmes – er
ist Autor eines Buches über Brecht – gibt eine Einführung in die Filme. Er hat außerdem die
Texte für die Filme gestaltet, die in deutschem Orginalton ausgestrahlt und simultan übersetzt
werden. Über unser Programm haben wir das Brecht-Zitat von 1926: ”Der Film macht dem
Drama das Bett” geschrieben.
Auch die Deutsche Schule Prag widmet Brecht als Sympathieträger mehr Aufmerksamkeit als
ihm oft im eigenen Land entgegengebracht wird, wo er manchmal als Kommunist und
Kollaborateur verfemt wurde (5.5.). Die Präsentation in der DSP unterscheidet sich
gravierend von der des Goethe-Instituts: Höhepunkt des Schuljahres 1997/98 war unter
270
anderem die ”Bertold-Brecht-Revue”, eine Aufführung der Theatergruppe der DSP die
fünfmal vorgestellt wurde und mit einem großen Empfang für die zahlreichen Gäste endete.
Insgesamt wurden 7 bekannte und weniger bekannte Stücke Brechts anlässlich seines
hundertsten Geburtstags aufgeführt.
Fazit: Dichterlesungen, sowie Programme zu Gedenktagen von Dichtern und
Schriftstellern können das Verständnis für deutsche Geschichte und Kultur verstärken.
11.3. Organisatorischer und struktureller Reformbedarf
Doppelarbeit und Überschneidungen
Ganz klare Worte hierzu findet der Leiter des Goethe-Instituts London unter C 2.3.
Er bezweifelt, dass Goethe-Institute in westlichen Großstädten in dieser Form weiterbetrieben
werden sollten. Er sieht den Bereich der Bibliotheken am unproblematischsten. Das German
Information Center der Deutschen Botschaft leistet dabei kostenintensive Doppelarbeit,
Informationsarbeit, die das Goethe-Institut besser zu leisten im Stande wäre:
A: Herr W, wir haben im Bundestag über das Thema Synergien, Kooperationen und
Überschneidungen der Arbeit im Auswärtigen Kulturbereich gesprochen. Wie ist die Situation
in London?
W: Mittlerweile fange ich an zu zweifeln, ob es heute noch sinnvoll ist, die Goethe-Institute in
den westlichen Weltstädten in der jetzigen Form zu betreiben. Die größte Skepsis habe ich im
Bereich der Programmarbeit. Zuerst möchte ich Ihnen die anderen Bereiche schildern, die
weniger problematisch sind.
Am unproblematischsten ist hierbei der Bereich Bibliotheks- und Informationsarbeit, mit dem
wir kürzlich ins Internet gegangen sind. Die Bibliothekarin ist dabei sehr engagiert und nutzt
die neuen Medien bestmöglichst aus. Wenn ich mir das Goethe-Institut London im Jahre 2010
vorstelle, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass es dann eine vernetzte, multimediale
Bibliotheksarbeit geben wird. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings dann die Frage,
ob wir zusätzlich noch ein Informationszentrum in der deutschen Botschaft brauchen. Hier
kommt es zu Überschneidungen. Dort wird zwar auch politische Informationsarbeit
betrieben, die wir in dieser Art sicher nicht leisten könnten und wollen.
D: Die Botschaft bietet z.B. einen Internet-Katalog mit deutschsprachigen Filmen an, die von
dpa und Inter Nationes vertrieben werden. Für diesen Katalog zahlte das Auswärtige Amt
8.000 DM. Einen vergleichbaren Katalog aus unserem Hause erstellten wir für ungefähr
271
120£! Es fließt da sehr viel Geld, aber man muss sich nach dem Nutzen dieser Maßnahmen
fragen.[...]
W: Die Botschaft baut über dieses Informationszentrum eine Art eigener Mittlerorganisation
auf. Da der dortige Kulturreferent z.B. auch Themenveranstaltungen zu deutscher Literatur
organisiert, ist hierin eine klare Kompetenzüberschreitung zu unseren Ungunsten zu sehen.
Wenn I N sein Material wenigstens noch selbst an die Schulen verschicken würde, wäre das
noch eher verständlich. Aber die Botschaft zwischenzuschalten, halte ich für unsinnig.
Fazit: Effektiver Einsatz der Mittel bedeutet Doppelarbeit und Überschneidungen zu
meiden.
Kompetenzvorsprünge im Partnerland
Deutlich wird auch unter 2.3. erkannt, in welchen Bereichen der Kompetenzvorsprung der
Goethe-Institute einer Weltstadt verloren gegangen ist :
Also noch einmal: Geld fehlt, nicht nur uns, und wir haben auch keinen Kompetenzvorsprung
mehr, was soziopolitische Veranstaltungen angeht. Das gleiche gilt im übertragenen Sinne
auch für kulturelle Veranstaltungen wie Musik-events, Ausstellungen usw. Eine neue Kollegin
von uns, Frau H, ist zwar sehr versiert in Themen wie Bildender Kunst u.ä., aber die Leiter
der Londoner Museen kennen selbst alle wichtigen deutschen Museen, d.h. wenn meine
Kollegin etwa unsere Mithilfe an bestimmten Ausstellungen anbieten würde, dann würde
wahrscheinlich nicht mal ein persönliches Gespräch mit den dortigen Verantwortlichen
zustande kommen, es sei denn, wir gäben ihnen 80 - 90.000 DM! Die Kuratoren der großen
Londoner Museen brauchen nicht den Rat von uns und auch nicht den Rat vom Direktor des
Goethe-Instituts. Einen Kompetenzvorsprung haben wir allenfalls noch gegenüber kleineren
Galerien. Das gleiche gilt für den Bereich Musik.
Fazit: Kompetenzvorsprünge im Partnerland müssen erkannt werden.
Gemeinsames Einbringen der unterschiedlichen Kompetenzen
Auf Aufgaben, die in der Zukunft gemeinsam mit Partnern bewältigt werden sollten und
deren finanzielle Aspekte zielt das folgende Beispiel der Erstellung eines Sprachfilms unter
2.3. ab:
272
W: Dieser Bereich wird meiner Meinung nach im Jahre 2010 ebenfalls eine wichtige Rolle in
unserer Arbeit spielen. Hierbei konzentrieren wir uns auf die traditionelle Aufgabe der
Fortbildung englischer Deutschlehrer, aber wir sind auch auf anderen Gebieten aktiv: So
produzieren wir derzeit unseren dritten größeren Sprachfilm zusammen mit der BBC. Dafür
stellt uns das Goethe-Institut München eine größere Summe zur Verfügung - sechsstellige
Beträge, ca. 275. 000 DM. Unser Beitrag besteht neben dieser Summe vor allem aus dem
Einbringen unseres Know-Hows. Herr Bauer, der Leiter der pädagogischen
Verbindungsarbeit, mein Stellvertreter, war bei den Filmaufnahmen anwesend, überprüfte die
Manuskripte. Wir überprüfen u.a. die deutschen Dialoge auf Verständlichkeit und
Authentizität etc.. Wir helfen bei der Suche nach Schauplätzen für die Filme, wir suchen die
Darsteller aus den deutschen Schülern aus und stellen den Kontakt zu den Schulen, in denen
gedreht werden soll, her usw.. Auf diese Art und Weise garantieren wir, dass wirklich ein
authentisches Deutschlandbild entsteht. Diese Sprachfilme werden von der BBC weltweit
vertrieben, so dass eine sehr große kulturpolitische Reichweite erreicht wird.
Fazit: Gemeinsames Einbringen der unterschiedlichen Kompetenzen erhöht die
Wirksamkeit Auswärtiger Kulturpolitik.
Gemeinsames Einbringen der finanziellen Ressourcen
Das folgende Beispiel schildert anschaulich unter 2.3., wie es nicht gehen kann im
partnerschaftlichen Miteinander:
Nun zum finanziellen Aspekt: Die London School of Economics, eine international
renommierte Universität hat sehr viel Geld zur Verfügung. Bei einer Veranstaltung mit uns
vor zwei Jahren trugen sie gar zwei Drittel der Kosten. Kürzlich sagten sie mir aber, sie
hätten zur Zeit massive Finanzprobleme, und ein geplantes Seminar mit ihnen müssten wir
alleine bezahlen. Wir müssten also nicht nur dafür sorgen, dass die deutschen Teilnehmer
kämen, sondern auch die Teilnahme sämtlicher anderer europäischen Teilnehmer
organisieren und finanzieren. Das Seminar sollte sich mit der Frage beschäftigen, wer
kulturell und im Hinblick auf die Werte der "Civil Society" zu Europa gehört, also wer
konkret und politisch zu Europa gehört. Vertreter einer anderen Stiftung, mit der wir in
Umweltthemen zusammenarbeiten, des ”International Institute for Environment and
Development”, haben mir auf meine neuerliche Anfrage gesagt, sie seien finanziell so am
Ende, dass ihnen ihr Aufsichtsrat aufgetragen habe, sogar die vorbereitenden
273
Gesprächskosten mit mir abzurechnen. Ich sollte ihnen nicht nur die Veranstaltung und die
Teilnahme der deutschen Referenten finanzieren, sondern auch noch die Stunden, die sie mit
mir zur Vorbereitung verwendeten. An diesem Punkt hört mein Verständnis dann auf, denn
dann finanzierten wir praktisch den gesamten Dialog nur noch alleine.
Fazit: Gemeinsames Einbringen der finanziellen Ressourcen bedeutet Fairness im
Umgang miteinander.
Der Zustand der Gebäude
Das Äußere spiegelt oft den inneren Zustand wieder. In maroden Gebäuden zu lernen und zu
arbeiten, für internationales Ansehen und für Partnerschaft zu werben, fällt nicht leicht. Eltern
schicken ihre Kinder nicht gerne in baulich heruntergekommene Schulen. Mit Gips oder
Platten notdürftig verkleisterte oder vernagelte Wände zeugen nicht von dem nötigen Respekt
gegenüber an deutscher Kultur Interessierten und Lernwilligen und lassen gegenüber
Schülern an Fürsorgepflicht mangeln. So wird im Goethe-Institut London unter 2.3. vom
Leiter der Verwaltung berichtet:
...zum Bauerhalt stehen uns allerdings nur sage und schreibe 5.000 DM pro Jahr zur
Verfügung. Wenn wir damit zwei Eimer Farbe streichen lassen, ist das Geld schon fast weg.
In diesem Jahr habe ich meine Kollegin, die unseren Haushalt verteilt, überzeugt, dass diese
Summe viel zu gering für irgendeine vernünftige Maßnahme ist. So wie es jetzt aussieht,
haben wir zukünftig ganze 10.000 DM zur Verfügung! Alles andere, und sei es auch noch so
klein, muss ich über Baubedarfsnachweise beantragen, und zwar in fünffacher Ausfertigung
an die Botschaft, das BM Bau usw. Selbst bei Notbaumaßnahmen, als etwa Gips von der
Wand abgefallen ist, hat es ein 3/4 Jahr gedauert, bis wir das Geld erhalten haben. Das
kostete 30.000 DM, die wir nicht aufbringen konnten, und so hing in der Bibliothek für diese
Zeit der Gips von der Wand, und wir mussten sie mit Brettern und Styropor-Platten
behelfsmäßig ausbessern. Das war wohlgemerkt eine Notbaumaßnahme. Andere
Baumaßnahmen, wie z.B. der Aufzug, der im Schnitt alle zwei Tage stehen bleibt, kosten
100.000 bis 300.000 DM. Da brauche ich gar nicht erst zu fragen!
Flexibel im Raumangebot zu sein, sich gegenseitig aushelfen, wenn Renovierungsarbeiten
anstehen, das schlägt der Schulleiter der Deutschen Schule London unter 2.5.vor:
274
Ke: Die Zusammenarbeit der Schule mit dem Goethe-Institut muss gut aufeinander
abgestimmt werden, besonders im Bereich der Veranstaltungen. So hat z.B. das Konzert von
Wolfgang Biermann aus räumlichen Gründen bei uns in der Deutschen Schule stattgefunden.
Die Theatergruppe der Deutschen Schule London kann andererseits demnächst vielleicht
sogar im Goethe-Institut auftreten. Besonders im Rahmen des Umbaus des Goethe-Instituts
können wir in der DSL flexibel mit unserem Raumangebot aushelfen. Die DSL ist jedoch
ziemlich weit vom Zentrum abgelegen, was für Veranstaltungen oft hinderlich ist.
Auch in der Frage der baulichen Substanz müssen sich beide Partnerländer um
Verbesserungen bemühen.
Beispielhaft für eine Schule, deren baulicher Zustand beklagenswert ist und den Lernerfolg
behindert, sei hier die deutschsprachige Abteilung des Gymnasiums Poprad in der Slowakei
genannt. Da heißt es unter 6.3.:
Die deutsche Abteilung der Schule besitzt einen eigenen Gebäudekomplex am östlichen Rand
des Stadtzentrums, der aus insgesamt vier großen Häusern und einer kleinen Turnhalle
besteht. [...] Somit besteht räumlich kein Problem – wohl aber qualitativ: Der Zustand der
Gebäude ist erbärmlich, jedweder Komfort, der über das sprichwörtliche ”Dach über dem
Kopf” hinausgeht, fehlt. Besonders die naturwissenschaftlichen Fachräume der Abteilung
erlauben aufgrund ihres desolaten Zustandes kaum Experimente, diese sind nur durch
aufwendige Stundenänderungen im 15 Minuten entfernten Hauptgebäude möglich. Diesen
Zustand könnte jedoch nur der Schulträger, d.h. der slowakische Staat wirklich ändern.
Fazit: Der Zustand der Gebäude soll einen positiven Einfluss auf die Lernenden
ausüben.
Gestaltung der Begegnungsschulen
Unter 5.6. erläutert der Schulleiter der Deutschen Schule Prag, dass räumliche Erweiterungen
für die Umwandlung der Schule in eine Begegnungsschule notwendig sind. Eine Schule, die
als Begegnungsschule funktionieren soll, müsste einladend gestaltet sein, mehr
Gruppenräume und Fachräume, auch wegen eines erweiterten Sachfachangebotes in den
verschiedenen Sprachen, aufweisen:
Dr.v. H.: Zum Gebäude selbst muss man sagen, dass es ein sehr unattraktiver, hässlicher Bau
ist. Wir planen allerdings schon, das Gebäude zu verändern. Es soll aufgestockt werden, die
275
hinteren Teile sollen abgerissen werden, so dass wir auch im rein räumlichen Bedarf
Fortschritte erzielen. Wir haben momentan sogar einen Teil der Schüler ausgelagert. Um die
verstärkte Integration einer Begegnungsschule zu erreichen, brauchen Sie mindestens 6
Klassenzimmer und zwei Gruppenräume mehr, zuzüglich neuer Fachräume. Das ist unser
Dilemma. Wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, eine Begegnungsschule einzurichten
unter Umgestaltung der Gesamtkonzeption.
Fazit: Begegnungsschulen müssen einladend gestaltet sein.
Schließungen deutscher Kulturinstitute im Ausland
Schließungen oder beabsichtigte Schließungen deutscher Kulturinstitute haben vordergründig
mit “Finanzknappheit” zu tun, drücken aber mangelnde Wertschätzung gegenüber der
gemeinsamen Geschichte, gegenüber dem betroffenen Institut und den Menschen, die dies
als wertvollen Kulturvermittler erachten, aus. Dieses kam deutlich bei der beabsichtigten
Schließung des Goethe-Instituts in Neapel – unter 7.2.- zum Ausdruck:
Ein langjähriger Schüler des Goethe-Instituts formulierte einmal sinngemäß: ”Reich
geworden bin ich nicht mit dem, was ich hier gelernt habe, aber Goethe hat mir geholfen, die
Welt und das Leben ein bisschen liebenswerter zu finden.” Im Zusammenhang mit den
Protesten gegen die von der Münchner Zentrale geplante Schließung des Goethe-Instituts in
Neapel äußerten sich deutsche und italienische Intellektuelle sehr kritisch, so z. B. Professor
Marcello Gigante, Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Göttingen und Heidelberg:
“Wenn das Goethe-Institut jetzt gezwungen wird, sich aus Italien zurückzuziehen, entsteht
zwangsläufig der Eindruck, die Deutsche Regierung wolle mit den Kriegsfolgen nichts mehr
zu tun haben. Frankreich als weitblickendes Land baut seine kulturelle Präsenz in Neapel
aus.”218 Und er erinnerte daran: “Das Deutschland, das wir lieben, ist nicht das Deutschland
der Deutschen Mark”. Der große deutsche Philosoph, Hans-Georg Gadamer, hat in Neapel
gelehrt und war Ehrenbürger der Stadt. Die Zeitung “Il Mattino” veröffentlichte am 20.2.96
einen Leserbrief von Gadamer, an Bassolino, den Bürgermeister gerichtet, mit der
Überschrift: “Gadamer: salviamo il Goethe.”219 Prof. Amato Lamberti, Präsident der
218 Gigante, Marcello: Pressekonferenz im Palazzo Serra di Cassano, Neapel, 2.4. 1996. 219 Gadamer, Hans Georg: Gadamer: salviamo il Goethe. In: Il Mattino, Leserbrief, 20.2.96.
276
Provinz von Neapel, äußerte sich so: “Als Soziologe kann ich nur sagen, dass wir in Neapel
eher der deutschen als der angelsächsischen Fachtradition verbunden sind.”220 Besondere
Beziehung Neapels zu der deutschen Kultur seit dem vorigen Jahrhundert bescheinigt der
Präsident des Nationalen Philosophischen Forschungsinstituts in Neapel, Advokat Gerardo
Marotta: “Das Nationale Philosophische Forschungsinstitut ist hier ansässig, es ist
Herausgeber zahlreicher deutscher philosophischer Reihen.”221 Zwischen Italien und
Deutschland bestehen intensive kulturelle Beziehungen und besonders zu Neapel. Goethe
spricht in seiner “Italienischen Reise” 1787, eingehüllt und eingefühlt in neapoletanische
Atmosphäre, davon, dass die charakterliche Prägung des Temperaments und der Kultur eines
Volkes durch das Klima beeinflusst würden. In Kenntnis seiner schriftstellerischen Mittel, die
ihm plötzlich als begrenzt erscheinen, stellt er fest, dass er nach dem Weggang aus Italien
sich wehmütig und unfroh fühle. Doch der Gedanke an Neapel versöhne mit der Trennung:
“Man sage, was man will, der Versuch, das tagsüber Gesehene in Worten festzuhalten, führt
zu Reflexionen über die Grenzen schriftstellerischer Mittel."222 In Neapel schreibt er ferner,
dass einer nach seinem Weggang aus Italien nicht wieder froh werde. “Und wenn ich Worte
schreiben will, so stehen mir immer Bilder vor Augen der fruchtbaren Länder, des freien
Meeres, der duftigen Inseln, des rauchenden Berges und mir fehlen Organe, das alles
darzustellen."
Auch die Entscheidung z. B. das Goethe-Institut in Coimbra zu schließen, hat zu
europaweiten Protesten – siehe unter 8.1.- geführt. Ob die dann neu gegründeten
“Kulturvereine” deren Arbeit übernehmen können, bzw. ersetzen, mag angezweifelt werden.
Eine Evaluation wäre nötig, um eine “erfolgreiche Fortführung” wenigstens der Sprachkurse
zu beweisen.
Fazit: Schließungen deutscher Kulturinstitute im Ausland werden als Affront gewertet
und müssen verhindert werden.
220 Lamberti, Amato: Sondersitzung des Consiglio Provinciale di Napoli, Neapel 4.2.1996. 221 Marotta, Gerardo: La Politica Culturale Della Germania All´Estro. Versammlung im Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Neapel., 14.Februar 1996. 222 Goethe, Johann Wolfgang : Italienische Reise. In: Werke, Hamburger Ausgabe, Band 11, 10. neubearbeitete
Aufl. München 1982, S.178 ff. auch S.186,S.199, S.217, S.326ff.
277
Finanzielle Mittel, um den kulturellen Auftrag zu erfüllen
Nicht nur die Konferenz für Kultur und Entwicklung hat- wie oben unter 5. beschrieben-
gefordert, mehr personelle Kapazitäten und finanzielle Mittel für kulturelle Belange zur
Verfügung zu stellen und die Wirtschaft sowie Privatleute zugleich aufgefordert durch
Sponsoring kulturelle Aktivitäten zu unterstützen. Die Grenzen des Sponsoring jedoch
werden, sowohl unter 2.3. beim Gespräch mit dem Leiter der Verwaltung des GI London, als
auch an anderer Stelle in dieser Arbeit deutlich aufgezeigt, dass es eine Aufgabe der
Bundespolitik ist, Auswärtige Kultur- und Bildung zu finanzieren:
W: Nur einmal zur Größenordnung des Sponsoring: Der Botschafter hat sich bemüht,
anlässlich eines Staatsbesuches Gelder zu sammeln. Ich glaube, er hat 800 Briefe an deutsche
Industrievertreter in Großbritannien geschrieben, davon sind ganze 100 bis 200 Briefe
überhaupt beantwortet worden. Von den Beantwortern wiederum war nur ein Bruchteil
bereit, tatsächlich etwas zu spenden. Das war noch eine konventionelle und unkomplizierte
Veranstaltung. Ich selbst habe bis jetzt noch keine großen Summen heranschaffen können,
egal für was. Als Beispiel habe ich die Berliner Bank angeschrieben, bei der Ralf Dahrendorf
Direktor ist und habe um Unterstützung für das Goethe-Jubiläum im nächsten Jahr gebeten.
Selbst für diese hochkonventionelle Veranstaltung im South Bank Centre, für die ich genaue
Angaben zu Werbungskosten in britischen Zeitungen u.ä. gemacht habe, hat die Bank mir
geschrieben, der Betrag von 15.000 DM, den ich erbat, sei um ein Vielfaches höher als das,
was sie dafür aufbringen könnten. Letztendlich haben wir gar nichts bekommen. Was meinen
Sie, was ich erst für ein Schwulenfestival bekommen würde... ? Gar Nichts!
Fazit: Ausreichende finanzielle Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden, um den
kulturellen Auftrag zu erfüllen.
Politische Veränderungen bedeuten institutionelle und systemorientierte
Veränderungen
Da kann die Erweiterung der EU nicht ohne Folgen bleiben. Dies verdeutlicht das Interview
mit der Leiterin des Goethe-Instituts in Prag unter 5.4. Die Betreuung und Zusammenarbeit
von acht Goethe-Instituten in MOE wird von Prag aus organisiert. Die Dezentralisierung der
pädagogischen Fortbildung in den Regionalinstituten, wie unter 5.5. beschrieben, bedeutet
278
auch, auf die örtlichen Gegebenheiten besser eingehen zu können. Die geographische Lage,
das Eintreten in die EU, die Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache (siehe unter
“Rahmenbedingungen zur Förderung der deutschen Sprache” und “Einstellung zu Deutsch
und Deutschland”) unterscheiden sich in Mittelost- Europa – auch durch die geschichtlichen
Bedingungen- von anderen europäischen Ländern. Arte, der 1992 ins Leben gerufene
deutsch-französische Kulturkanal, hat sein Engagement und seine Berichterstattung aus MOE
mit Unterstützung des Goethe-Instituts verstärkt. Dieses bedeutet auch ein Einbinden der
Beitrittsländer aus MOE in das bestehende Europa.
Auch die Schulreform in der Türkei- unter 9.3. beschrieben- und die Einführung einer 8-
jährigen durchgehenden Schulpflicht ist dem europäischen Zusammenwachsen geschuldet.
Sie ist die Voraussetzung für einen Beitritt in die EU. Die allgemeine Anhebung des
Bildungsniveaus auch in ländlichen Bevölkerungsschichten, das gleichzeitige Zurückdrängen
der Imam-Hatip-Schulen (Prediger- Schulen) und somit des islamischen Einflusses auf den
Unterricht, sind positive Begleiterscheinungen dieser Entwicklung. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Filmreihe des GI Istanbul gemeinsam mit dem Institut Francais geboten über
die Umwälzungen 1968, den Studentenaufstand im Mai 68 in Paris. In der Türkei spielt das
Militär traditionell eine wichtige politische Rolle. Viele Politiker- wie Ecevit, Erbakan,
Demirel waren Jahrzehnte in unterschiedlichen politischen Ämtern. Die Strukturen waren
verkrustet wie in Deutschland und Frankreich vor 1968. Deshalb fand dieser Themenkomplex
des Aufbruchs Interesse vor allem bei Intellektuellen und Kulturschaffenden. Der Aufbruch
wurde auch politisch umgesetzt. Tayyip Erdogan, Vorsitzender der bei den Parlamentswahlen
2002 siegreichen islamischen Partei AKP besuchte, wie auch seine vier Kinder, eine Imam-
Hatip-Schule. Befürchtungen eines Europa-feindlichen Kurses jedoch tritt er durch offensive
Vorschläge zur Frage türkischer Beitrittsverhandlungen entgegen. Nach der Abspaltung der
AKP vom fundamentalistischen Flügel um Erbakan ist damit eine neue politische Öffnung
vollzogen, bei der die Anpassung an internationale Entwicklungen nicht versäumt wird.
Fazit: Aufgrund der politischen Veränderungen müssen Veränderungen der
institutionellen Strukturen und im Schulsystem stattfinden.
279
D Befragung von Beschäftigten an Goethe-Instituten und Deutschen Schulen
1. Die Entstehung des Fragebogens
Bei Reisen in verschiedene Länder, beim Besuch der Goethe-Institute und Deutschen Schulen
stellten sich stets ähnliche Fragen, die sich an die dort unterrichtenden Lehrkräfte, Instituts-
und Schulleiter und zuständigen Kulturreferenten, Eltern, Schüler und Studenten richteten.
Aus dem Kreis der Beschäftigten betraf dies an den Deutschen Schulen die
Auslandsdienstlehrkräfte, die Programmlehrkräfte und die Ortslehrkräfte. An den Goethe-
Instituten die Entsandten und die Ortslehrkräfte.
So entwickelte sich die Idee, einen Fragebogen zu entwerfen, um einen besseren Überblick zu
bekommen, Aussagen zu erhalten, die allgemeiner gültig sind, und Problemstellungen zu
erkennen, die häufig wiederkehren. Den Kreis der Befragten musste abgegrenzt werden –
geographisch, zahlenmäßig und personell.
Geographisch war das Thema durch die politische Diskussionsebene vorgegeben. Das
Zusammenwachsen Europas und das Hinterfragen dieses Zusammenwachsens auf der Ebene
der Bildung ist ein Thema des 21. Jahrhunderts. So war die Eingrenzung sowohl dadurch, als
auch durch persönliche Schwerpunktsetzung gegeben. Die Befragung sollte in
verschiedenen europäischen Ländern stattfinden. Um einen umfassenden Überblick zu
bekommen, wählte ich zwei westeuropäische Länder, England und Frankreich, ein Land aus
”Randeuropa”, Portugal, zwei südeuropäische Länder, Italien und die Türkei, sowie zwei
mittelosteuropäische Länder Tschechien und die Slowakei sowie Russland.
Die Wahl und Zahl der Probanden entwickelte sich folgendermaßen: Zwei zu befragende
Personen pro Land aus zwei verschiedenen Institutionen waren zuerst beabsichtigt. Jedoch
erschien mir dies im Laufe des Prozesses zu wenig. Dabei könnte eine subjektive
Meinungsbildung eines bestimmten Menschen zum Tragen kommen, die unter Umständen
noch von Tagesstimmungen abhängig ist. Dieses wollte ich vermeiden. So weitete ich dann
das Vorhaben auf 3 bis 5 Personen einer Institution aus, um repräsentative Aussagen zu
erhalten.
280
Der Personenkreis wurde auf die Beschäftigten eingegrenzt, Schüler bzw. Eltern und sonstige
Beteiligte wurden mit anderen Methoden einbezogen.
In Vorüberlegungen wurde eine inhaltliche Untergliederung nach Fragerichtungen und
Schwerpunkten vorgenommen. Es entstanden folgende Gliederungspunkte:
• Persönlicher Werdegang, Ausbildung und Bewerbung,
• Vorstellungen vom Gastland,
• Schulinterne / institutsinterne Arbeitsbedingungen,
• Eigenes didaktisches / methodisches Konzept, Medien und Bücher,
• Deutschlandbild der SchülerInnen, StudentInnen und die Korrektur des Bildes,
• Perspektiven und Kontakte der SchülerInnen, StudentInnen nach Abschluss der
Ausbildung ,
• Kontakte der SchülerInnen, StudentInnen nach Deutschland,
• Europa im Unterricht,
• Berufliche Perspektiven.
So entstand ein erster Fragebogen mit 54 Fragen, der als Pretest an einige Goethe-Institute
und Deutsche Schulen verschickt wurde. Auf diese ersten Fragebögen gab es nur eine
geringe Resonanz. Lediglich die Deutsche Schule in Poprad, das Goethe-Institut und die
Deutsche Schule in Porto und Stockholm schickten Fragebögen bearbeitet zurück.
Auf Nachfrage bei den anderen Institutionen und Schulen kam die Antwort, dass manche
Fragen nicht die Situation der Beschäftigten träfen. So trifft z.B. die Frage nach dem
Sprachunterricht Deutsch als Fremdsprache viele Entsandte des Goethe-Instituts nicht, da sie
nicht mit Sprachunterricht, sondern mit Kulturprogrammen befasst sind. Auch die Ortskräfte
der Deutschen Schulen und des Goethe-Instituts sahen sich mit einer speziellen Problematik
konfrontiert, die sie in den Bögen nicht entsprechend beachtet fanden. So schrieb etwa Dr.
Johannes D, der Leiter des Goethe-Instituts in Stockholm: „Der Fragebogen, so wie ich ihn
verstehe, richtet sich an Kollegen, die Sprachunterricht im Ausland erteilen. Die Goethe-
Institute in Schweden haben jedoch keinen eigenen Sprachbetrieb. Statt dessen arbeiten wir
mit den Verbänden der Erwachsenenbildung zusammen. Auf diese Weise erreichen wir
letztlich mehr Sprachlehrer.” Das Goethe – Institut in Stockholm, beteiligte sich deshalb nicht
an der Beantwortung.
Daraufhin wurden mit der zuständigen Abteilung des Goethe-Instituts in München zusammen
die Fragebögen überarbeitet.
281
Hier war vor allem die Abteilung 20 (Spracharbeit Ausland) betroffen. Mit dem Leiter, Dr.
Wolfgang Bader, der Vertreterin des Leiters, den Zuständigen für Pädagogische Ver-
bindungsarbeit, Christine M und Edeltraud K-R, Betreuerin des Sonderprogramms
MOE/GOS, fanden intensive Gespräche statt.
Veränderungen wurden vorgenommen. So wurden einige Fragen präzisiert, zum Teil
Ankreuzverfahren und Multiple Choice zur Erleichterung der Beantwortung (und Aus-
wertung) angeboten und zum Teil eine andere, logischere Reihung vorgenommen (z.B.
berufliche Perspektiven alt: Punkt 9 zum Schluss. Neu: Punkt 3 im Anschluss an die Fragen
nach dem Persönlichen Werdegang). Weiterhin wurden die Punkte 4-9 gesondert auf die
Bedingungen von Ortskräften ausgerichtet. Die Fragebögen für die Lehrer an Deutschen
Auslandsschulen und Deutschunterrichtende an den Goethe-Instituten erhielten einen
gesonderten Mittelteil, der sich auf ihre spezielle Unterrichtssituation bezog. Der
Fragenkatalog wurde von 54 auf 43 Fragen reduziert.
Mit den neu konzipierten Fragebögen schickten Edeltraud K-R und Christine M ein
Unterstützungsschreiben an die Goethe-Institute in London, Paris, Neapel, Istanbul, Prag und
Bratislava.
In diesem Schreiben wurden die Leiter der Goethe-Institute gebeten, KollegInnen aus
verschiedenen Aufgabenbereichen für eine Mitarbeit an der Fragebogenaktion zu bewegen.
Weitere Unterstützung im Goethe-Institut in München erfuhr ich in Gesprächen mit Dr.
Georg Lechner und Dr. Peter Bumke, die mit der Leitung der Abteilung 10
(Kulturprogramme) betraut waren.
Nach diesen vorbereitenden Aktionen rief ich nach drei Wochen in den Instituten an und
fragte nach, wie es mit der Weitergabe und Bearbeitung der Unterlagen stünde. Jeder
Fragebogen war darüber hinaus mit einem persönlichen Anschreiben versehen.
Ähnlich verlief die Vorgehensweise bei den Deutschen Schulen. Mit dem Leiter der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Walter Schmidt in Köln, ebenso wie mit dem
Verantwortlichen für die Deutschen Auslandsschulen im Auswärtigen Amt, Dr. Fischer,
wurden Gespräche geführt. Fast alle Goethe-Institute und die Deutschen Schulen, hatte ich
entweder schon besucht, oder besuchte sie während der Fragebogenaktion, um ein Bild von
der Situation vor Ort zu machen. Dort fanden auch die Interviews mit Schulleitern und
Institutsleitern sowie Lehrern und Schülern, Eltern und sonstign Beteiligten statt.
Bei den Institutionen, bei denen weniger als 3 Fragebögen zurückkamen, hakte ich dann
nochmals nach. So entstand ein lebhafter Briefwechsel. Zum Teil waren aber die Befragten
282
derart mit den Problemen vor Ort beschäftigt, wie z. B. in Moskau im Goethe-Institut, dass sie
sich an der Aktion nur mit 3 Fragebögen beteiligen wollten. Das Gespräch mit dem Leiter des
Goethe-Instituts in Moskau zeigt deutlich auf, wo die Belastungen liegen.
Nun erfolgte der Rücklauf der Fragebögen bis Ende Oktober 1998. Die Rücklaufquote lag
nach den intensiven vorangegangenen Dialogen jetzt bei etwa 80%.
Im November konnte mit der Auswertung der zurückgesandten Fragebögen begonnen
werden.
2. Methodische Vorgehensweise bei der Erstellung und Auswertung
Als wissenschaftliche Grundlage der Durchführung einer Fragebogenerhebung und deren
Auswertung diente u. a. Peter Atteslanders Methoden der empirischen Forschung.
Spezifischen Forschungsprinzipien gemäß wurden die Fragebögen nach verschiedenen
Kriterien erstellt, die in ihrer Gesamtansicht eine qualitativ orientierte Beobachtung ergeben.
Kriterien dafür waren:
• Die Offenheit des Untersuchungsgegenstandes.
So wurde durch den Untersuchungsgegenstand der Inhalt, die Untersuchungssituation, die
Methoden und der Ablauf der Befragung vorgegeben. Die befragten Personen wurden dabei
nicht gezielt für die Befragung ausgewählt, sondern beteiligten sich selbstständig in den
betroffenen Institutionen. Daraus resultiert eine flexible und offene Forschung.
• Der ”Prozesscharakter von Gegenstand und Forschung.”223
Durch den direkten Kontakt mit den Leitern und Mitarbeitern der angesprochenen
Institutionen, einerseits durch persönliche Besuche und andererseits durch briefliche
Kontakte, trat ein Prozess der Kommunikation in Gang. Dadurch gelang es nicht nur
objektive Realitäten abzubilden, sondern auch Konstitutionsprozesse sozialer Realität
nachzuzeichnen.
”Durch die Anwendung der alltagssprachlichen Regeln der Kommunikation wird eine
Ähnlichkeit der ”Alltagstheorien” mit wissenschaftlichen Aussagen unterstellt. Forschung
verhält sich hier analog den kommunikativen Vorgängen des Alltagslebens, sie beruht auf
223 Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin,1995, S. 92 ff.
283
kommunikativen Vorgängen und wird durch sie begründet. Forschung kann ohne
Kommunikation nicht existieren. Forschung ist Kommunikation.”224
Die hier gestellte Forschungsfrage ist problemorientiert. Durch das Ansprechen der
Problematik von Beschäftigten an deutschen Institutionen im Ausland wird eine aktuelle
Problematik, die sich auf berufliche Perspektiven und das Umfeld bezieht, thematisch
erarbeitet und in qualitative Forschung umgesetzt. Die Ergebnisse daraus können als Basis für
vielerlei Aktivitäten, sei es Verbesserungen oder weitere forschende Tätigkeiten in diesem
Arbeitsfeld dienlich sein.225
Bei der Erstellung der Fragebögen wurde nach den von Peter Atteslander vorgeschlagenen
Faustregeln gearbeitet226:
Fragen sollten einfache Wörter enthalten.
Fragen sollten möglichst kurz formuliert werden.
Fragen sollten konkret sein.
Fragen sollten möglichst nicht suggestiv sein.
Fragen sollten keine eigenen Werteinschätzungen beinhalten.
Fragen sollten nicht im Konjunktiv formuliert werden.
.Fragen sollten sich nur auf einen Sachverhalt beziehen.
Fragen sollten keine doppelten Negationen enthalten.
Fragen sollten zumindest formal ”balanciert” sein, es sollten alle Antwortmöglichkeiten
enthalten sein
Um bei der Auswertung den Standards zu entsprechen, wurden die durch die Fragebögen
erhaltenen Daten gemäß der in der qualitativen Sozialforschung entwickelten Verfahren
ausgewertet. Ausgehend von vorläufigen Ergebnissen und Interpretationen wurden im
laufenden Forschungsprozess Daten und Hypothesen verknüpft und zunehmend
verallgemeinert.
Die Durchführung der Fragebogenerhebung habe ich wie von Peter Schlobinski in seiner
Empirischen Sprachwissenschaft vorgeschlagen in fünf verschiedene Phasen eingeteilt:
”Fragebogenaufbau und Formulierung der Fragen,
224 ebd. 225 ebd. 226 a. a. O., S. 192 f.
284
Festlegung der Stichprobe,
Pretest: Überprüfung des Fragebogens an kleiner Teilstichprobe,
Erhebung und
Statistische Auswertung”.227
Die Auswertung fand für Goethe-Institute und Deutsche Schulen getrennt statt. Die
Antworten wurden so reduziert, dass die zentralen Inhalte erhalten blieben, wiederholende,
verdeutlichende Wendungen wurden gestrichen. Dabei zeigte sich, dass die Unterschiede bei
der Beantwortung der Fragen in den Deutschen Schulen und Goethe-Instituten nicht so groß
waren, dass sie bei der Endauswertung relevant blieben. Ich habe die Trennung deshalb im
letzten Schritt aufgehoben, um bei der Generalisierung die Aussagen auf ein höheres
Abstraktionsniveau zu heben und in nun folgenden Reduktionen ähnliche Aussagen
zusammenzufassen. Dabei wurden Fragen und Aussagen von besonderer Dichte deutlich. Die
Ergebnisse finden sich unter Fazit aus der Befragung.
3. Fragebogenerhebung
Insgesamt wurden 90 Fragebögen ausgewertet, die ich an 17 verschiedene Institutionen
verschickt habe. Davon wurden an den Goethe-Instituten 42 Fragebögen beantwortet und an
den Deutschen Schulen 48 Fragebögen.
Die Befragungen wurden in 9 verschiedenen Ländern durchgeführt und staffeln sich
folgendermaßen:
Großbritannien
Insgesamt 11 Fragebögen
5x GI London
6x DS London
Frankreich
Insgesamt 9 Fragebögen
5x GI Paris
4x DS Paris
Schweden
Insgesamt 7 Fragebögen
227 Schlobinski, Peter: Empirische Sprachwissenschaft. WV studium, Band 174, Opladen, 1996, S. 40.
285
7x DS Stockholm
Tschechien
Insgesamt 10 Fragebögen
6x GI Prag
4x Fachberater Prag
Slowakei
Insgesamt 12 Fragebögen
4x GI Bratislava
8x DS Poprad
Italien
Insgesamt 6 Fragebögen
6x GI Napoli
Portugal
Insgesamt 14 Fragebögen
7x GI Porto
7x DS Porto
Türkei
Insgesamt 13 Fragebögen
3x GI Ankara
3x GI Istanbul
7x DS Istanbul
GUS
Insgesamt 8 Fragebögen
3x GI Moskau
5x DS Moskau
286
4. Fragenbereiche228
Die Fragen wurden unter inhaltlichen Aspekten zusammengefasst, um Aussagen zu
verdichten und die Auswertungen übersichtlicher zu machen. Relevante Fragenbereiche, in
denen eine Zusammenstellung besonders für einen Gesamtvergleich geeignet waren, wurden
nach der Gesamtauswertung noch einmal statistisch und inhaltlich aufbereitet, um ein Fazit zu
ziehen.. Die Fragenbereiche und die enthaltenen Fragen sind die folgenden:
4.1. Ausbildung/ Fortbildung
Im Fragebogen entsprechen die Fragen dieser Nummerierung:
1.7 Welche Ausbildung haben Sie?
1.8 Sind Sie im Bereich DaF oder DaZ ausgebildet?
1.9 Wie wurden Sie auf den Einsatz im Partnerland vorbereitet?
1.10 Wie sind Sie besoldungsmäßig eingestuft?
1.11 An welchen Fortbildungen haben Sie im Bereich DaF/ DiDaZ teilgenommen? Von wem
wurden die Fortbildungen angeboten?
1.12 Haben Sie selbst schon Fortbildung erteilt? Welche?
4.2. Dialog und Partnerschaft
Im Fragebogen tragen die Fragen zu Dialog und Partnerschaft folgende Nummerierung:
1.5 Inwieweit beherrschen Sie die Sprache des Gastlandes?
1.9 Wie wurden Sie auf den Einsatz im Partnerland vorbereitet?
2.1 Sind deutliche politische Veränderungen im Gastland seit Ihrer Anfangszeit zu
verzeichnen? Worin bestehen diese?
2.2 Welche sozialen Vorstellungen bzw. Bedingungen im Partnerland machen Ihnen
Schwierigkeiten? Welche sonstigen Probleme tauchen auf?
2.3 Welche kulturellen Zusatzaufgaben und Repräsentationspflichten fallen an?
3.5 Welche Verbesserung Ihrer Situation könnten von Deutschland aus initiiert werden?
228 ALTMANN, ELISABETH: Fragebögen an die Beschäftigten ausgewählter Deutscher Schulen und Goethe-
Institute in Europa. Die wissenschaftlichen Rohdaten der Auswertung sind für Interessierte nach Vereinbarung
mit der Autorin einsehbar.
287
4.7 Wie gestaltet sich der kollegiale Umgang (mit der Schulverwaltung des Partnerlandes)?
4.8 Gibt es organisatorische Schwierigkeiten?
4.9 Worin bestehen die Kontakte zur dt. Botschaft bzw. Konsulat?
9.1 Wieweit und in welcher Form haben Sie Kontakt zur Bevölkerung des Landes?
9.2 Wenn Sie in einem Land in Mittel und Südosteuropa und in der GUS arbeiten:
Wieweit und in welcher Form haben Sie Kontakt zur deutschsprachigen Minderheit?
4.3. Lehre vor Ort
Im Fragebogen entsprechen die Fragen zur Lehre vor Ort folgender Nummerierung:
4.4 Welche Klassen bzw. Kurse unterrichten Sie?
5.1 Mit welchen Büchern/ Medien arbeiten Sie?
5.2 Entspricht das Unterrichtsmaterial Ihren Vorstellungen?
5.3 Welche Vorkenntnisse haben Ihre Schüler/Studierenden?
6.2 Welches sind die Erwartungen der Schülereltern an Ihren Unterricht?
6.3 Welche Besonderheiten im Lernverhalten Ihrer Schüler fallen Ihnen im Vergleich zu
Ihren Erfahrungen in Deutschland auf?
2.4 Welche landeskundlichen Materialien werden/wurden im Unterricht in der letzten Zeit
eingesetzt?
4.4. Europafragen
Bei den Fragen zum Europa- Komplex wurden die folgende Fragen ausgesucht:
4.5 Welche Vorteile können Sie sich vorstellen bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute
verschiedener Länder unter einem Dach?
8.1 Spielt der europäische Gedanke im Unterricht eine Rolle?
Die Fragen 9.3 und 11.1 ist aus dem Fragenkomplex zur Pädagogischen Verbindungsarbeit:
9.3 Welche Vorteile können Sie bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute verschiedener
Länder unter einem Dach vorstellen?
11.1 Spielt der europäische Gedanke in Ihrer Arbeit eine Rolle?
4.5. Deutschlandbild
Zum Deutschlandbild wurden folgende Fragen ausgewählt:
6.1 Wie ist das Interesse an einem Studium in Deutschland?
288
6.4 Welches sind die Erwartungen der Schüler/ Studenten bezüglich der Zukunftsaussichten,
wenn sie Deutsch gelernt haben?
2.4 Welche landeskundlichen Materialien werden/wurden im Unterricht in der letzten Zeit
eingesetzt?
10.1 Entspricht das Deutschlandbild Ihrer Partner in der Spracharbeit der Realität?
10.2 Welche Kulturveranstaltung in Ihrer Institution hat besonders guten Anklang gefunden?
4.6. Zukunftspläne
Bei den Fragen zur Zukunft der Lehrenden wurden folgende Fragen ausgesucht:
3.1 Wann kehren Sie nach Deutschland zurück?
3.2 Welches wird Ihre nächste Tätigkeit sein?
3.3 Kann es zur Kündigung kommen, aus Gründen, die von Ihnen nicht zu verantworten sind?
3.7 Welches ist Ihr persönlich wichtigstes Berufsziel?
4.7. Forderungen für die Zukunft
Hierzu wurden für die Lehrenden folgende Fragen ausgesucht:
Im Fragebogen tragen die Fragen folgende Nummerierung:
3.5 Welche Verbesserungen Ihrer Situation könnten von Deutschland aus initiiert werden?
3.6 Welche einsatzbezogenen Forderungen stellen Sie an die Bundespolitik?
5. Statistische Auswertung der Fragebögen
Zahlenmaterial zur Befragung
Besetzung der Leitungsstellen der untersuchten Einrichtungen 14 männlich, 3 weiblich
Ausbildung und Fortbildung
1.7. Welche Ausbildung haben Sie?
Abgeschlossenes Studium
Davon mit Promotion
83
6
Deutschlehrerdiplom
Abgeschlossene Berufsausbildung
1
1
289
1.8. Sind Sie im Bereich DaF oder DaZ ausgebildet ?
ja
34
nein
50
1.9. Wie wurden Sie auf den Einsatz im Partnerland vorbereitet?
gar nicht.
29
durch einen Vorbereitungslehrgang, ein Ausreiseseminar 32
durch Einführung bzw. Hospitation vor Ort 14
Ortskraft 1
vorheriger Auslandsschuldienst 1
eigene Vorbereitung
1
1.10. Wie sind Sie besoldungsmäßig eingestuft?
BAT I a
3
BAT I b 6
BAT II a 10
BAT III 3
BAT IV a 5
BAT IV b 1
Bundesprogrammlehrer 8
Ortskraft 8
A 12 2
A 13 10
A 14 5
A 15 2
A 16 2
Honorarkraft 8
Unklare Angaben 14
290
1.11. An welchen Fortbildungen haben sie teilgenommen?
Das ist nicht meine Aufgabe.
1
GI Seminare 30
Management bei Zentralverwaltung (ZV) 1
Lehrpläne bei ZV 1
viele verschiedenartige 13
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 7
schulinterne Fortbildungen 11
gar keine 13
1.12. Haben Sie selbst schon Fortbildungen erteilt?
für Verwaltung 3
zu methodischen Fragen, Lehrerbildung, im Partnerland und in Deutschland 39
schulinterne Fortbildungen für andere Fächer und allgemeine Fragen 10
keine
23
Dialog und Partnerschaft (Deutsche im Ausland)
1.5. Beherrschung der Sprache des Gastlandes
erste Kenntnisse
15
mäßige Kenntnisse 13
gute Kenntnisse 18
sehr gute Kenntnisse 15
keine Kenntnisse 1
2.1. Sind deutliche politische Veränderungen im Gastland seit ihrer Anfangszeit zu
verzeichnen. Worin bestehen diese ?
291
politische Umgestaltung, Änderung des Wirtschaftssystems,
Islamisierungstendenzen
15
Wechsel der parlamentarischen Mehrheit 8
keine Veränderung 22
2.2. Welche sozialen Vorstellungen bzw. Bedingungen im Gastland machen Ihnen
Schwierigkeiten ? Welche sonstigen Probleme tauchen auf?
andere Mentalität 23
Ablehnung von Deutschen, von Ausländern, anderen Kulturen 4
Bürokratie 6
schlechte Bezahlung der Ortskräfte 6
soziale Kluft zu den einheimischen Kräften 2
Kriminalität 1
eigene soziale Probleme, Gesundheitssystem 5
Rückgang der Schülerzahlen 1
4.7. Wie gestaltet sich der Umgang mit Lehrern und der Schulverwaltung des
Partnerlandes ?
enge Zusammenarbeit mit Lehrern 8
Gut 14
Problemlos 13
mäßig 5
offiziell gut ! 1
gelegentlich problematisch 3
kaum vorhanden 5
4.8. Gibt es organisatorische Schwierigkeiten?
Ja 19
292
ja, viele 4
keine nennenswerten 3
Keine 7
keine Angaben 10
4.9. Gibt es Kontakte zur deutschen Botschaft bzw. zum Konsulat?
gute Kontakte
6
kaum Kontakte 34
keine Kontakte 6
keine Angabe 10
9.1.Wieweit und in welcher Form haben Sie Kontakte zur Bevölkerung des Landes?
private
4
dienstliche
geringe
7
8
keine 2
........zur deutschen Minderheit
private
2
Dienstliche 2
Geringe 1
keine 1
Lehre vor Ort
4.4. Welche Klassen bzw. Kurse unterrichten Sie?
(Mehrfachnennungen möglich)
Grundkurs 6
Mittelstufe 8
Oberstufe 6
Fachunterricht Wirtschaftsdeutsch 1
293
Grundschule 10
Sek. I 23
Sek. II 22
Studenten 1
2.4. Welche landeskundlichen Materialien werden/wurden im Unterricht in der
letzten Zeit eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich)
wie bei DaF in Deutschland 5
Audiokassetten, Videos, Filme aus dem Haus 10
deutsche Literatur 8
eigene Mitschnitte aus den Funkmedien 8
Zeitungen 7
Material von IN und GI 7
sehr vielfältiges Material 1
Ausstellungsbesuche 1
BBC Projekt 1
keinerlei 5
5.1. Mit welchen Büchern/Medien arbeiten Sie?
vor allem Lehrbuch 15
Lehrbuch + Video + Kassetten 14
vor allem aktuelles Material 3
Ich erteile Fachunterricht. 2
Ich verwende ein eigenes Werk, Tandemunterricht deutsch/ französisch. 1
5.2.Entspricht das Unterrichtsmaterial Ihren Vorstellungen ?
sehr 4
ja 1
weitgehend 26
294
kaum 3
nicht 2
gar nicht 1
keine Angaben 7
5.3. Welche Vorkenntnisse haben Ihre Schüler?
Mäßige 1
aus dem Kindergarten 1
seit der Grundschule 2
gute 2
wie in Deutschland 9
Sek. I 7
Sek. II 11
sehr unterschiedliche 4
keine 3
6.2. Welches sind die Erwartungen der Schülereltern an Ihren Unterricht?
guter Erfolg in Deutsch 3
Grammatikvermittlung 1
gute Noten 3
fachliche und soziale Leistung der Schüler fördern 9
modernerer Unterricht als im einheimischen System 3
nur Wissensvermittlung 5
das deutsche Niveau (Rückkehrabsicht) 5
großes Interesse der Eltern allgemein 1
keine Forderungen, kein Interesse 4
Ich arbeite mit Erwachsenen. 9
6.3. Welche Besonderheiten im Lernverhalten Ihrer Schüler fallen Ihnen im Vergleich
295
auf?
Motivation und Disziplin sind hoch 12
starke Leistungsorientierung, Noten werden sehr wichtig genommen 4
wenig leistungsbewusst, passiv 2
wenig teamfähig 2
gravierende Lernprobleme 5
nicht kritikfähig 1
lernen viel auswendig, sind fleißig aber unselbstständig 8
auch Studenten wollen Lenkung 1
keine Angaben 8
Europafragen
9.3 Welche Vorteile können Sie sich vorstellen bei der Zusammenarbeit der
Kulturinstitute verschiedener Länder?
Bessere Zusammenarbeit: 3
vielfältigere Angebote 2
organisatorische Erleichterungen, effektivere Arbeit, Materialeinsatz, Raumnutzung 12
multikulturelles, intereuropäisches Denken, Abbau von Vorurteilen 10
Bessere Absprache, gemeinsame Projekte 13
Erfahrungsaustausch 7
vergleichbare Abschlüsse 2
keine Vorstellungen 2
keine Vorteile 1
keine Angaben 5
Deutschlandbild /Studium in Deutschland
6.1. Wie ist das Interesse an einem Studium in Deutschland?
296
Gering 6
mäßig 15
groß, aber kaum zu verwirklichen 18
groß 18
sehr groß 4
6.4 Welches sind die Erwartungen der Schüler/ Studenten bezüglich der
Zukunftsaussichten, wenn sie Deutsch gelernt haben?
Arbeit im Heimatland bei einer deutschen Firma 17
” ” ” im Tourismus 4
Studium in Deutschland 17
Arbeit ” ” 12
allgemein bessere berufliche Aussichten 20
allgemeines Interesse 3
Kontakte nach Deutschland 12
10.1. Entspricht das Deutschlandbild Ihrer Schüler/Studenten in der Spracharbeit der
Realität?
ja 3
nicht feststellbar 2
weitgehend 3
manchmal nicht 15
oft nicht 11
keine Angaben 2
10.2. Welche Kulturveranstaltung in Ihrer Institution hat besonders guten Anklang
gefunden?
Dichterlesungen 4
historische Ausstellung 2
297
Informationsveranstaltung 1
Jugendkonzert 1
Kunstausstellungen 3
weiß nicht 2
Zukunftspläne
Wann kehren Sie nach Deutschland zurück?
in diesem Jahr 2
in ein bis drei Jahren 21
in drei bis fünf Jahren 16
später 5
unbestimmt 9
gar nicht 14
3.2.Welches wird Ihre nächste Tätigkeit sein?
Lehrtätigkeit in Deutschland 29
Schulaufsicht 1
Bibliothek, Sprachabteilung 4
Selbstständigkeit 2
keine Veränderungen zu erwarten 12
unbestimmt 19
Weiterstudium 1
Lehrer in einem anderen Land 2
Ruhestand 3
3.3. Kann es zu Kündigungen kommen?
Ja 22
298
bei Mittelkürzungen ja 1
kaum 8
unbestimmt 3
nein 32
3.7. Welches ist Ihr persönlich wichtigstes Berufsziel?
Weiterarbeit mit inhaltlichen Schwerpunkten:
Entwicklung von Lehrmaterial 2
Völkerverständigung, Deutschland darstellen, Jugendarbeit ,interkulturelle Ziele 17
Weiterarbeit und Karriere 6
weitere Qualifizierung 4
wieder ins Ausland gehen 2
Weiterarbeit ohne besonders ausgeführte Perspektive:
soziale Absicherung der Familie 4
ein Arbeitsplatz in Deutschland 3
eine zufriedenstellende, sinnvolle Tätigkeit 18
Einbringung der Erfahrung aus dem Ausland 3
Forderungen für die Zukunft
3.6. Welche einsatzbezogenen Forderungen stellen Sie an die Bundesrepublik?
Abbau der deutschen Bürokratie, des Kulturföderalismus 4
Unterstützung bei Schwierigkeiten mit der Verwaltung des Gastlandes 7
finanzielle Besserstellungen 2
steuerliche Besserstellung 1
längere Vertragsdauer 2
Bewerbungsmöglichkeit im Auslandsdienst 1
diplomatischer Status 1
bessere soziale Absicherung 17
kürzere Arbeitszeit 2
299
einfachere Vermittlung 1
Einstellungsgarantie bei der Rückkehr nach Deutschland
berufliche und aufenthaltsrechtliche Absicherung des Partners
4
5
Anerkennung für die Auslandstätigkeit nach der Rückkehr 1
bessere Vorbereitung auf den Aufenthalt im Gastland 11
mehr Verständnis für das Gastland 2
mehr Fortbildung 4
mehr Ortskräfte zur besseren Einbindung vor Ort 2
Qualität der Schule kontrollieren 1
Verbesserung der wirtschaftlichen Kontakte mit dem Partnerland 1
mehr Autonomie der Schule, organisatorische Straffung 3
Es fehlt ein Konzepte für die AKP, der Stellenwert ist zu gering. 9
politische Unabhängigkeit von den Geldgebern 1
Erhalt der Schule 1
bessere Ausstattung der Schulen 5
keine Kürzungen 3
Schulleiterschulungen 2
300
6. Interpretation und Ergebnisse der Untersuchung
Die Fragebögen ließen Raum für eigene Angaben. Die Befragten antworteten nicht auf alle
Fragen, was sich aus der zahlenmäßigen Auswertung leicht ersehen lässt. Es gibt also nicht 90
Antworten auf eine Frage, sondern so viele Antworten, wie Befragte es für wichtig und
notwendig erachteten. Sicherlich ist die unverfängliche Aussage die einfachere und mancher
hat z.B. nach seinen Sprachkenntnissen im Gastland befragt, dazu lieber keine Angaben
gemacht. Während auf die Frage zur Ausbildung und Besoldung noch fast alle antworteten,
haben die Befragten im Laufe des doch sehr umfangreichen Fragebogens sich die Bereiche
ausgewählt, die ihnen relevant erschienen. So ist z. B. bei der Frage nach der Vorbereitung
auf die Arbeit im Gastland klar, dass die Ortskräfte, weil dort ansässig, darauf nicht
antworteten. Zur Auswertung selber gab es mehrere Vorstufen. Eine war die Zählung und
inhaltliche Fixierung der Antworten der einzelnen Institute und Schulen. Nachdem sich aus
der geringen Zahl der Antworten einzelner Einrichtungen kein Fazit ziehen ließ, wurden die
Antworten aller Institute und Schulen, wie oben beschrieben, inhaltlich zusammengefasst. Da
die Art der Antworten der Deutschen Schulen sich nicht wesentlich von denen der Goethe-
Institute unterschieden, wird bei der statistischen Auswertung auch beim Fazit nicht nach
Deutschen Schulen und Goethe-Instituten getrennt. Wo es notwendig ist und unterschiedliche
Ergebnisse deutlich werden, wird dies benannt.
6.1. Ausbildung und Fortbildung
Besetzung von Leitungsstellen
14 der von mir untersuchten Einrichtungen hatten einen männlichen Leiter, 3 eine Leiterin.
Dies ist ein eklatantes Ungleichgewicht, zumal es im Lehrberuf, je nach Schulart, mal mehr,
mal weniger, statistisch gesehen etwa ebenso viele Männer wie Frauen gibt. Von der
Beförderung hängt auch die besoldungsmäßige Einstufung ab. In den oberen Gehaltsstufen
befinden sich demnach vorwiegend Männer. Dazu sagt der Frauenförderplan des Goethe-
Instituts: “Aus der Statistik ‚Besetzung nach Funktionen’ geht hervor, dass Frauen in der
Führungsebene so gut wie nicht vorhanden sind, nur 3%! [...] Auf der Leitungsebene sind
Frauen mit 29% innerhalb der DozentInnenlaufbahn vertreten.[...] Nur 15% der
301
Bereichsleitungen in der Zentralverwaltung sind mit Frauen besetzt.”229 In den Deutschen
Schulen im Ausland sieht es nicht anders aus. So sind z.B. alle in dieser Arbeit
vorkommenden Schulleiter - aus dem Jahr 1998 - männlich. Inzwischen gibt es im Jahr 2002
Schulleiterinnen an der DS Paris und Stockholm. Wenn Paare sich bewerben, geht –bei
gleicher Ausbildung- meist er als ADLK und sie als Ortskraft.
Im Bereich Ausbildung und Fortbildung zeigt sich, dass die Spanne der schulischen und
beruflichen Abschlüsse der Befragten von der mittleren Reife bis zum Abitur, vom
Wirtschaftskorrespondenten über den Diplomlehrer zum Grund- und Hauptschullehrer bis
zum Lehramt am Gymnasium, zur Promotion auch in Theologie und Kunstgeschichte reichen.
Ein abgeschlossenes Studium ist die Regel. Die Ausbildungen der Befragten sind vielfältig
und die Befragten weiterbildungswillig. Die besoldungsmäßige Einstufung und Absicherung
sowie der Kündigungsschutz der Programmlehrkräfte, bedingt, der Ortskräfte und der
Honorarkräfte hingegen deutlich, liegen weit unter den sehr günstigen Bedingungen für die
Entsandten des Goethe-Instituts oder für die Auslandsdienstlehrkräfte. Auch die Zulagen und
Spesen, die die letzteren erhalten, unterscheiden sich gravierend. Auf dieses Problem wird an
mehreren Stellen in der Arbeit eingegangen.
Im Bereich DaF oder DaZ wurde ca. 60% der Befragten nicht ausgebildet. Am Goethe-
Institut nahmen einige der Befragten an der Dozentenausbildung Deutsch als Fremdsprache in
München teil. Manche gaben an, in diesem Bereich Autodidakten zu sein. Henrici äußert sich
dazu in seinen 10 Thesen wie folgt:
“10. These: Deutsch als Fremdsprache ist ein Fach, das in besonderer Weise auf
internationale Beziehungen angewiesen ist und der Stärkung internationaler Verständigung
dient. Die Praxis des Unterrichts DaF ist ein ständiger Ort der internationalen Begegnung, des
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Austauschs: Jeder erfährt, lernt etwas vom
anderen. Vorbereitet werden die zukünftigen DaF-Lehrenden für diese Praxis im In- und
Ausland[…]in der konkretesten Form durch Praktika, die im Inland und/oder Ausland
stattfinden und die intensiv vor- und nachbereitet werden. Praxiserfahrungen außerhalb der
Hochschule, bei denen Fremdheit am differenziertesten und eindringlichsten erfahren wird,
sind ein hoher Motivationsfaktor für die theoretische Beschäftigung mit Unterrichtsproblemen
229 Goethe-Institut, Frauenförderplan: Ist-Analyse der Situation von Frauen im Goethe-Institut und
Zielvorgaben. München, Oktober 1996, S.7.
302
und mit dem zu ihrer Bewältigung notwendigen Basis- und Spezialwissen der Bezugs- und
Inhaltswissenschaften. Diese Fremdheitserfahrungen vor Ort sind nicht nur für die
Studierenden, sondern auch für die Lehrenden eine notwendige Bedingung für ihre
kompetente Berufsausübung.”230
Für den Einsatz im Partnerland erhielten ca. 20% eine Einweisung vor Ort, ca. 40 % wurden
weitgehend sich selber überlassen, 20% hatten keine Vorbereitung erhalten. Persönliche
Einführung durch die Vorgänger fand kaum statt, eher selten wurde an
Hospitationsprogrammen teilgenommen. Lehrer der Deutschen Schulen erhielten auf einer
eintägigen Einweisung des Bundesverwaltungsamts wichtige Informationen zu formalen
Bereichen, andere nahmen am zweiwöchigen Vorbereitungslehrgang dort teil. Auch
Probekurse mit Betreuung durch die Leiter der Sprachabteilungen der Goethe-Institute und
spezielle Deutschlehrerseminare im Goethe-Institut wurden absolviert.
Während des Einsatzes im Ausland nahmen die Befragten an vielfältigen Fortbildungen im
Bereich DaF und DaZ des Goethe-Instituts, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, an
verschiedenen Instituten für Lehrerfortbildung und Universitäten teil. Verlage, Management-
seminare, Sprachschulen und Volkshochschulen boten weitere entsprechende Fortbildungen.
Von den Befragten wurden auch zahlreiche Fortbildungen durchgeführt.
Zwischenergebnis
Bei der Stellenbesetzung und bei den Bewerbungen vor allem von Leitungsfunktionen liegt
eine Benachteiligung von Frauen vor. Ein erster Schritt, der Benachteiligung entgegen zu-
wirken ist ein Frauenförderplan, wie er beim Goethe-Institut mit der “Betriebsvereinbarung
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen im Goethe-Institut”, vorliegt. Darin werden
konkrete Zielvorgaben benannt, um zukünftig eine unbewusste Diskriminierung von Frauen
auszuschließen. Hier muss die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen nachziehen.
230 Henrici, Gert: Deutsch als Fremdsprache. Quo Vadis? Konstituierungsprobleme eines jungen akademischen
Fachs. In: Deutsch als Fremdsprache. Wo warst Du, wo bist Du, wohin gehst Du? Zwei Jahrzehnte der Debatte
über die Konstituierung des Fachs Deutsch als Fremdsprache. Gert Henrici und Uwe Koreik, Hrsg.. BAsweiler,
1994, S. 200 f.
303
Lehrer, die für die im wesentlichen gleiche Arbeit unterschiedlich besoldet werden,
Entsandte der Goethe-Institute, die Vergütungen und Spesen weit über dem Niveau der
Ortskräfte erhalten, produzieren Gefühle der Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie den
Wunsch nach Reformen. Umso mehr gilt es Arroganz von Entsandten, die sich bei manchen
am höheren Verdienst festmacht, entgegen zu wirken. Gerade durch die Ergebnisse der Pisa-
Studie wurde dem Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Bildungssystemen ein Dämpfer
versetzt. Sich überheblich gegenüber den Kollegen des Gastlandes oder Ortskräften zu
verhalten, konterkariert den interkulturellen Ansatz.
Deutsch als Fremdsprache hat für Lehrende und Lernende mit Lernen und Erfahrung zu
tun, mit Methoden und der Darstellung der Sprache. Dies ist nicht etwas, was dem Lehrenden,
der Deutsch als Muttersprache spricht, rein intuitiv zur Verfügung steht. Sich mit der
Wissenschaft des Faches Deutsch als Fremdsprache und dessen Didaktik zu befassen, steht
vor der Vermittlung des Deutschen. Diese Voraussetzung wird im Gesamtkontext zu wenig
beachtet. Der ”interkulturellen Germanistik” muss im Gesamtgefüge des deutschen
Universitätsbetriebs mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Insbesondere, wenn sich die
Deutschen Schulen vermehrt den Schülern des Gastlandes öffnen werden, entsteht hier ein
immenser Nachholbedarf. Auch wenn die Schulen in der Bundesrepublik immer
multikultureller werden, im Sinne eines Nebeneinanders, ist der Anteil der
Lehramtsstudenten, die DaF, DaZ belegen, um dies zu verändern, zahlenmäßig nicht
ausreichend. Da auch die meisten Bewerber für den Auslandsschuldienst nicht langfristig
geplant haben, ist es erklärlich, dass sie in diesem Bereich über keine Vorbildung verfügen,
zumal sie in den Deutschen Schulen im Ausland häufig ihre Fächer, wie in Deutschland nach
deutschem Lehrplan vor vorwiegend deutschen Schülern unterrichten.
Als Konsequenz einer gewünschten zunehmenden Internationalisierung ergeben sich vor
allem verbindlichere Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen. Dazu ist mehr nötig
als die folgenden Absichtserklärungen:
”Um die Attraktivität der verschiedenen Formen der Auslandsschularbeit zu erhalten, bedarf
es einer permanenten Fortbildung aller Lehrkräfte sowie des Leitungs- und
Verwaltungspersonals. Langfristig sollen auch Schulträger und Eltern in die Auslandsschul-
entwicklungspläne einbezogen werden. Das Auswärtige Amt wird darüber ständig informiert
304
und um politische Unterstützung gebeten.”231 ”Die Information über das Tätigkeitsfeld
Auslandsschularbeit muss schon während der Ausbildung in den Studienseminaren einsetzen,
damit der Arbeitsplatz Auslandsschule in die Karriereplanung einbezogen werden kann.” 232
Was diese Aus- und Fortbildung konkret leisten soll, muss noch näher diskutiert werden.
Selbst die Türkei bildet nun in mehrmonatigen Seminaren, die für den Auslandsschuldienst
vorgesehenen Lehrer in der entsprechenden Landessprache aus und bemüht sich um
berufliche Information. Eine Woche Vorbereitung, wie sie die ZfA bietet, reicht nicht aus.
Allerdings sind die neueren Anstrengungen anzuerkennen, während des Auslandseinsatzes
den Lehrkräften Fortbildungen anzubieten. Eine Wochenstunde steht dafür zur Verfügung.
Die Ausgestaltung erfolgt vor Ort. Für den Einsatz im Ausland werden Intensivsprachkurse
vor und während des Aufenthaltes, sowie rechtzeitige Aufklärung über die realen
Bedingungen von den Befragten gewünscht.
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen sieht zurecht die Fortbildung der
Auslandsdienstlehrkräfte als ein wesentliches Merkmal für die Zukunftsfähigkeit. Die
wöchentliche Reduzierung des Stundendeputats um eine Stunde, um sich fachdidaktisch und
interkulturell bezogen auf die Schulortsituation fortzubilden, ist ein erster Schritt. “Die
Zukunft wird wesentlich dadurch bestimmt, dass die Fortbildungszentren ab 1999 die
Auslandsteile der Vorbereitungslehrgänge im ADLK- und PLK - Bereich übernehmen. Diese
konkrete Aufgabe soll nicht nur die Perspektiven von neuen und an der Schule bereits
heimisch gewordenen Lehrkräften vermitteln. Die dort aufgeworfenen pädago-
gisch/inhaltlichen Fragen können in Fortbildungsveranstaltungen mit dem Ziel der
Schulentwicklung bearbeitet werden.”233 So trafen sich zum Beispiel Rektoren aller 22
Fortbildungsregionen im November 2002 auf Veranlassung der ZfA, um den Themenkomplex
Schulentwicklung zu diskutieren.
231 http://www.auslandsschulwesen.de/zentralstelle für das Auslandsschulwesen/fortbild.htm (Stand: 28.11.01). 232 Petry, Wolfgang: Wie lässt sich die ‚Ressource’ Auslandskontakte und Auslandserfahrung für die
Entwicklung des Inlandsschulwesens besser als bisher nutzen? Dokumentation der Sonnenberg-Tagung der
GEW 1998, S.13ff. 233 http://www.auslandsschulwesen.de/Zentralstelle für das Auslandsschulwesen/fortbild.htm (Stand: 28.11.01).
305
Fazit: Ein Frauenförderplan für die Deutschen Schulen, der eine größere Anzahl von
Frauen in Leitungsfunktionen zum Ziel hat, muss in Kraft treten, der bereits
existierende Frauenförderplan des Goethe-Instituts umgesetzt werden.
Ungleiche Einstufung und Absicherung bei Beschäftigten mit vergleichbarer
Qualifikation müssen abgebaut werden.
Mehr Ausbildung in Deutsch als Fremdsprache ist nötig, deshalb ist auch
der interkulturellen Germanistik im Gesamtgefüge des deutschen Universitätsbetriebs
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Sprachkurse zum Erlernen der Sprache des Partnerlandes, sowie Vorbereitung auf das
Gastland durch Einführungs- und Fortbildungsveranstaltung sollen angeboten werden.
6.2. Dialog und Partnerschaft
Danach gefragt, ob die Sprache des Gastlandes beherrscht wird, wurde vielfach angegeben,
keine oder Anfangssprachkenntnisse zu besitzen. Etwa die Hälfte der Beantwortenden gab an,
die Sprache mittelmäßig zu beherrschen. Sehr gute Sprachbeherrschung nimmt ein Viertel der
Befragten für sich in Anspruch. Die zum Teil unzureichenden Sprachkenntnisse müssen sich
negativ auf die Ergebnisse des Deutsch als Fremdsprache (DaF) - Unterrichtes auswirken,
da kontrastive Vergleiche nicht möglich sind. Dazu stellt Ehnert fest: ”Da im Kontrast der
Sprachen und Kulturen die deutsche Sprache jeweils unterschiedlich zu betrachten und zu
lehren ist, müssen kontrastive oder, im Sinne wirklicher zweiseitiger Vergleiche,
konfrontative Studien betrieben werden. Sie sind mehr als Fehleranalyse und Prophylaxe
durch Sprachvergleich, können aber auch nicht unmittelbar zu einer geeigneten Grammatik
der Zielsprache Deutsch für SprecherInnen einer bestimmten Ausgangssprache führen.
Vielmehr liefern diese Untersuchungen bessere Einsichten in beide verglichene Sprachen und
damit eine Basis für eine didaktische Grammatik des jeweiligen Sprachenpaares. Um
Lernersprachen einzuordnen, Fehlerquellen beurteilen zu können, sollten Lehrerinnen und
Lehrer über Sprachentypologie und Universalienforschung Bescheid wissen, in einigen Fällen
auch mit der Sprachplanung vertraut sein.”234
234 Ehnert, Rolf: Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den deutschsprachigen Ländern. Hartmut Schröder, Hg..
2. Korr. Aufl. (Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache. Bd. 26) Frankfurt am Main, u.a., 1994. S. 224.
306
Bei der Frage nach politischen Veränderungen im Gastland während des Aufenthaltes
werden häufig aktuelle landestypische Entwicklungen benannt. Soziale Vorstellungen und
Bedingungen im Partnerland, die Schwierigkeiten machen, hängen oft mit der schlechteren
materiellen Situation zusammen, auch mit dem Gegensatz zwischen arm und reich, einem
starken Autoritätsbegriff, sowie bürokratischen Hindernissen und Unübersichtlichkeiten im
Schul- und Ausbildungssystem sowie im Gesundheitssystem. Die Kontakte zur deutschen
Botschaft bzw. zum Konsulat sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, z. B. sind sie in Moskau
sehr eng, in Prag weniger, bei der großen Mehrheit kaum vorhanden.
Der Kontakt zur Bevölkerung des Landes hängt in hohem Maße vom Sprachvermögen
ab. Nur eine Minderheit gab an, dass sie gute und problemlose Kontakte habe. Auch die
organisatorischen Probleme waren zahlreich.
An kulturellen Zusatzaufgaben fallen die Präsentation der Schule oder des Instituts an, die
Kontaktpflege zu Bildungsinstitutionen, Interviews und Vorträge, Gestaltung von Festen und
Konzerten. Repräsentationsaufgaben hängen jedoch stark von der Position ab, die der
Befragte in seinem Arbeitsumfeld einnimmt. Die Kontakte zur deutschsprachigen Minderheit
in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sind nur wenig ausgeprägt, oft erfolgte keine
Angabe dazu in den Fragebögen. Auch Kontakte mit der Schulverwaltung des Partnerlandes
oder der deutschen Botschaft bestehen nur wenige.
Ergebnis
”Interkulturelle Bildung ist eine objektive Notwendigkeit, und keine Frage des persönlichen
oder bildungspolitischen Geschmacks”235 Zur interkulturellen Bildung gehört auch die
Mehrsprachigkeit. Dieses darf nicht nur für Schüler- es muss auch für Lehrer gelten.
Mehrsprachigkeit hilft bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.
Da es sich bei den Deutschen Schulen oft um Spiegelbilder der Schulverhältnisse in
Deutschland handelt, werden die Möglichkeiten zu einem interkulturellem Miteinander im
Gastland nicht genutzt. Allerdings sind die Deutschen Auslandsschulen faktisch Gesamt-
schulen, das unterscheidet sie von einem deutschen Gymnasium. Alle Schüler gehen zusam-
men in eine Klasse, von der aus dann der Hauptschulabschluss, der Mittlere Schulabschluss
235 Heine, Marcella: Vortrag ”Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule”, Sonnenberg- Tagung der
GEW 1998.
307
oder das Abitur gemacht werden kann. Deutsch wird fast ausschließlich als Muttersprache
gelehrt. Vielfach wird gefordert, die Deutschen Schulen für einen größeren Anteil von
Schülern des Gastlandes zu öffnen. Dann würde verstärkt Deutsch als Fremdsprache
unterrichtet und der interkulturelle Austausch gefördert.
Ausbildung ohne Auslandsaufenthalt, eine Art ”Ghettoleben”, ein Abschotten vor der
fremden Kultur und Sprache, sind eher die Regel. Schüler, Schulvorstand, Lehrerschaft leben
im Gastland oft nah beieinander. Sie bilden eine “community”, sie leben wie in einem kleinen
Dorf, dementsprechend bilden sich Grüppchen, blüht der Klatsch. Es entstehen
“Kumpelverpflichtungen”, denen man sich nur schwer entziehen kann. Die Entsandten und
Mitarbeiter der kulturellen Einrichtungen sollten, gerade im Interesse ihrer Schüler und
Studenten, auf eine intensive Kontaktpflege im Gastland vorbereitet werden. Die Tatsache
dass viele der Befragten keinen oder kaum Kontakt zur deutschen Botschaft oder zum
Konsulat haben, sollte nachdenklich machen. Austausch auch auf dieser Ebene bringt
Synergieeffekte.
Fazit: Organisatorische Schwierigkeiten werden abgemildert durch das Erlernen der
Sprache des Gastlandes. Der Umgang mit der anderen Mentalität kann durch intensive
Kontaktpflege schon bei der Vorbereitung eingeübt werden. Kontakte zur Botschaft
müssten im Sinne der Vernetzung von Seiten der Botschaft intensiviert werden.
Deutsche Schulen müssen aus der “Ghettobildung” raus und Begegnungsschulen
werden.
6.3. Lehre vor Ort - Medieneinsatz im Fach Deutsch als Fremdsprache
Im Unterricht werden Lehrbücher, Videos und Kassetten eingesetzt und landeskundliches
Material benutzt, welches auch in Deutschland zum Einsatz kommt. Audiovisuelle Medien,
bezogen über Inter Nationes, bereichern den Unterricht und sind unumgängliche
Notwendigkeit im Zeitalter der Neuen Medien und weltweiten Kommunikation. Aktuelle
Zeitungen und Zeitschriften, Literatur, diverse Lektüren, Fernsehmitschnitte, eigene
Materialien werden eingesetzt. Die Vielfalt der Medien ist beachtenswert. Weitgehend
entspricht das Unterrichtsmaterial den Vorstellungen der Lehrenden. Die Herstellung der
Medien erfordert “Bei allem Engagement für die von der Zentralstelle geförderten und damit
letztlich auch propagierten Lehrwerke hat die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen stets
308
großen Wert darauf gelegt, dass die Entscheidung über Auswahl und Beschaffung für die
einzelnen Schulen allein bei den dort Verantwortlichen liegen kann.”236
Geringe Kenntnisse über die momentanen Verhältnisse in Deutschland sahen die Befragten
bei den meisten ihrer Schüler und Studenten als gegeben. Mit Hilfe von geeigneten Medien
könnte hier gegengesteuert werden. Höhere Lernmotivation, größerer Fleiß, weniger Kritik,
manchmal aber auch geringeres Sozialempfinden als in Deutschland wurden konstatiert.
Zwei- oder Mehrsprachigkeit, auch mit Einsatz aktueller Medien vermittelt, wird von den
Studenten als Bereicherung empfunden.
Zwischenergebnis
Immer wieder wird von Fachwissenschaftlern ein gutes Fundament für die Vermittlung von
Deutsch als Fremdsprache gefordert, welches auch landeskundliches Fachwissen und Wissen
um den geeigneten Medieneinsatz einschließt.
Der Medieneinsatz in DaF geht von bekannten Lehrwerken zu Foliensammlungen, von
landeskundlichen Medien aller Art bis zu eigenen Materialien für aktuelle Themen, sowie
Verwendung von Lehrwerken, an denen die Unterrichtenden selber mitgewirkt haben. ”Ich
verwende ein eigenes Werk im Tandemunterricht Deutsch/Französich”, so lautet eine
Antwort. Das bedeutet, dass trotz vielseitigen Angebots zusätzlich in Eigenarbeit das genau
für den Unterricht passende Lehrmaterial erstellt wird. In den Goethe-Instituten kommen
mehr unterschiedliche landeskundliche Materialien wie z.B. Originalmitschnitte von
Rundfunk und Fernsehnachrichten, Originalliteratur, von IN hergestellte Videofilme zum
Einsatz als in den Deutschen Schulen. Es stellt sich bei den Antworten allgemein heraus, dass
Materialien von Inter Nationes Medien sehr gefragt sind und gerne eingesetzt werden. Von
den Studenten des Goethe-Instituts wird häufig modernerer Unterricht als im einheimischen
System erwartet, dem wird, das ergibt die Befragung, entsprochen.
236 Schmidt, Walter: 29 Jahre in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Rückblick und Ausblick. In:
Neue Akzente in der Auswärtigen Kulturpolitik. Schulische Arbeit zwischen Ökonomisierung und
interkulturellem Auftrag. Dokumentation der Sonnenberg-Gewerkschaft-für-Erziehung-und-Wissenschaft-
Tagung vom 19. bis 24. November 2000 im Internationalen Haus Sonnenberg, St. Andreasberg. Hg.
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Braunschweig, 2001, S. 23 f.
309
Fazit: Zwei- oder Mehrsprachigkeit, auch mit Einsatz aktueller Medien vermittelt, wird
von den Studenten als Bereicherung empfunden. Motivation und Disziplin der
Lernenden werden als hoch eingestuft.
Die Entscheidung über Auswahl und Beschaffung des Lehrmaterials für die einzelnen
Schulen liegt allein bei den dort Verantwortlichen, das bedeutet, dass trotz vielseitigen
Angebots zusätzlich in Eigenarbeit das genau für den Unterricht passende Lehrmaterial
erstellt wird. Von den Studenten des Goethe-Instituts wird häufig moderner Unterricht
erwartet, dem wird, das ergibt die Befragung, entsprochen.
6.4. Europafragen
“Sich einerseits mit dem europäischen Gedanken zu identifizieren und andererseits den
Nationalstaat in seiner Bedeutung zurücktreten zu lassen, bedeutet ja auch einem
Widerspruch in sich selber Raum zu geben. Denn was wäre ein vereinigtes Europa anderes als
nur ein größerer Nationalstaat, der zu Lasten der kleineren Staaten entsteht. Diese Paradoxie
verdoppelt sich, wenn man historisch in Rechnung stellt, dass die Idee des europäischen
Nationalstaates ausgerechnet in dem Augenblick entsteht, als mit der französischen
Revolution für die Durchsetzung von Rechten gekämpft wird, die keineswegs auf einen
Nationalstaat beschränkt sein können. Diese heute im wesentlichen als Menschenrechte
bezeichneten Standards sind inzwischen aber europäische Orientierung.”237 Bei den
Antworten der Befragten zeigt sich, in das zukünftige Europa werden positive prozesshafte
und strukturelle Entwicklungsmöglichkeiten impliziert.
Bei der Zusammenarbeit verschiedener Kulturinstitute unter einem Dach werden als Vorteile
benannt: gegenseitige Befruchtung, direkte Absprachen, Erfahrungsaustausch, Austausch im
Bereich Methodik und Didaktik, Abbau von Vorurteilen, bessere Verständigung und
interkulturelle Zusammenarbeit, Einsparung überflüssigen Verwaltungsaufwandes und
Standardisierung der Abschlüsse. Der europäische Gedanke äußert sich konkret im Fach
Wirtschaft in Zusammenhang mit dem Euro, in der Erweiterung der EU, in der Teilnahme an
237 Lenzen, Dieter: Schulen für Europa - Europa für Schulen, aus einem Vortrag am 16.9.98 im Zentrum für
Europäische Integrationsforschung, Bonn, 98. (Typoskript).
310
Comeniusprojekten, trinationalen Veranstaltungen TRIANGLE (Deutschland, Frankreich,
Großbritannien), bei Projektwochen oder bei Diskussion über die Herkunftsländer der
Schüler, in der Auseinandersetzung mit fremden und eigenen Traditionen, bei der Ökologie
und bei der Begegnung mit der Literatur.
Zwischenergebnis
“Es gibt keinen Unterricht, in dem der europäische Gedanke nicht dominieren würde”, so die
Aussage eines Befragten.
Die Grundlage der europäischen Zusammenarbeit bildet ein gemeinsamer Kulturkreis mit
einem 2000-jährigen gemeinsamen kulturellen Erbe. Die Vorreiter des europäischen
Gedankens sind die Universitäten Europas gewesen. Diese multinationalen Universitäten
schufen trotz der Vielfältigkeit Europas ein europäisches Identitätsgefühl. Daran muss wieder
angeknüpft werden. Organisatorische Erleichterungen, effektivere Arbeit, bessere Material-
und Raumnutzung würden sich viele der Befragten bei einer Zusammenlegung der euro-
päischen Kulturinstitute wünschen. Sie äußern, dadurch könnten auch europäisches Denken
und Abbau von Vorurteilen gefördert werden.
Unter 7. wird dieser Fragenkomplex in Bezug auf die Fragebögen noch einmal ausführlicher
angesprochen.
Fazit: Es werden eine große Anzahl organisatorischer Erleichterungen, wie effektivere
Arbeit, bessere Material- und Raumnutzung genannt, die bei der Zusammenarbeit der
Kulturinstitute verschiedener Länder entstehen können. (Siehe 7.)
6.5. Deutschlandbild/Studium in Deutschland
Für die Schüler der Deutschen Schulen und die Lerner der Goethe-Institute wäre ein
Studium in Deutschland in der Regel sehr interessant, jedoch häufig nicht finanzierbar.
Wenn nun deutsche Universitäten beginnen, Studenten aus dem Ausland für ein Studium in
Deutschland zu gewinnen, hätten Absolventen der dortigen deutschen Bildungseinrichtungen
relativ geringe Schwierigkeiten, sich bei uns zu integrieren. Im aktuell diskutierten
”Wettbewerb um die besten Köpfe” kann Deutschland nicht mithalten. Beim internationalen
Studentenaustausch ist von Deutschland aus mehr zu leisten als bisher. Werbung und
Information könnten an den Schulen und an den Goethe- Instituten erfolgen. Beratung und
finanzielle Förderung in Deutschland wären allerdings unerlässlich. In der Türkei sind
englischsprachige Universitäten sehr beliebt. Die Planungen für eine deutsche Hochschule in
311
Istanbul sind zunächst gescheitert, Hauptursache ist geringes Engagement der deutschen
Ansprechpartner.
Man erwartet, wenn auch nicht in Deutschland, so doch im eigenen Land mit guten
Deutschkenntnissen bessere Chancen auf eine lukrative Anstellung. Vorteile im
Wirtschaftsleben im europäischen Raum in leitenden Funktionen werden als
Zukunftsaussichten gesehen.
Als Kulturveranstaltungen haben Lesungen zum 100. Geburtstag von Brecht, zum Heine-Jahr,
historische Ausstellungen und Jugendrockkonzerte besonders guten Anklang gefunden.
Dichterlesungen, Kunstausstellungen, z.B. vom ifa zusammengestellt, Musikveranstaltungen
mit deutschen Künstlern sind im Goethe-Institut ein Teil der Kulturarbeit, finden aber auch in
den Deutschen Schulen statt. Obwohl die Befragung ergibt, dass das Deutschlandbild,
welches die Lernenden haben häufig nicht der Realität entspricht, möchten viele Lernende in
Deutschland studieren oder eine Arbeit bei einer deutschen Firma aufnehmen. Wie richtig
erweist es sich auch unter diesem Aspekt, dass in den Schulen und Goethe-Institutionen ein
umfassendes Deutschlandbild vermittelt wird, wie sich aus der Beschreibung der Deutschen
Schulen und der Goethe-Institute unter C entnehmen lässt, welches Absolventen auch anregt,
ihre Wünsche zu hinterfragen.
Zwischenergebnis
Trotz der begrenzten Möglichkeiten wird viel versucht, um deutsche Kultur, Lebensweise und
Denkart den Interessierten nahe zu bringen. Dieses geht deutlicher aus dem Teil C hervor als
aus den Antworten im Fragebogen. Aber auch in Zukunft sollte das Angebot nicht in
Englisch, so die Befragten, sondern vorwiegend in deutscher Sprache offeriert werden. Nur so
kann dem Wunsch nach stärkerem Kontakt mit Deutschland entsprochen werden. Würden alle
Deutschen Schulen in Begegnungsschulen umgewandelt, bestünde intensiver und direkter die
Möglichkeit, ein umfassendes Deutschlandbild zu vermitteln und den Austausch zu
befördern. Bisher kommen von den jungen Menschen, die ein Studium in Deutschland
aufnehmen, ein Drittel als Absolventen von Begegnungsschulen, zwei Drittel von den rein
deutschen Auslandsschulen. Seit dem Jahr 2001 gibt es intensive Beratung durch den DAAD
zum Studium in Deutschland. 60 nichtdeutsche Stipendiaten, die einen sehr guten Abschluss
an einer Deutschen Schule gemacht haben, können an einer Universität in Deutschland
studieren. Deutsche haben generell das Recht auf BAFöG.
312
Fazit: Das Interesse an einem Studium in Deutschland ist groß, für viele angehende
Studenten aber kaum zu verwirklichen. Die Erwartungen der Lernenden zielen auf das
Erlernen des Deutschen, um ein Studium in Deutschland aufnehmen zu können, eine
Arbeitsstelle bei einer deutschen Firma im Sitzland zu übernehmen, allgemein bessere
berufliche Bedingungen und Kontakte nach Deutschland zu bekommen. Das
Deutschlandbild der Lernenden entspricht jedoch häufig nicht der Realität.
6.6. Zukunftspläne
Nur wenige der Lehrenden erwarten in der Hierarchieleiter hinauf zu steigen. Manche hoffen
in dem Beruf, in dem sie sich zur Zeit der Befragung befinden, bis zur Pensionierung zu
bleiben. Sie planen keine Rückkehr und möchten ihre Tätigkeit fortsetzen. Frustration über
die wahrscheinlich bevorstehende Schließung des Goethe-Instituts Neapel drückt sich wohl in
der Antwort auf die Frage nach der Zukunftstätigkeit eines Befragten aus: ”Lumpensammler
in Timbuktu.” Bei einer Schließung des Goethe-Instituts werden Kündigungen befürchtet. Die
Angst vor der Arbeitslosigkeit und der ungesicherten Zukunft macht sich in diesen Fällen
breit. Das ist keine gute Grundlage, um ein Bild zu vermitteln, welches Vertrauen zu Deutsch-
land schafft. Als persönlich wichtigste Berufsziele nennt man die Zufriedenheit der Arbeits-
und Projektpartner, der Schüler und Studenten, eine interessante Arbeit zu haben, dem
Aufwand gemäß bezahlt zu werden, für größeres Verständnis zwischen Deutschland und dem
jeweiligen Gastland zu wirken, aber auch die Arbeit in einem Schulsystem, das mehr
Offenheit, Toleranz und weniger Bürokratie produziert.
Berücksichtigung der eigenen Erfahrung nach der Rückkehr wünschen sich viele Lehrer.
Zwischenergebnis
In diesem Fragekomplex zeigte sich, dass persönliche und berufliche Zukunftspläne bzw.
Wünsche oft zusammenfallen. Als persönlich wichtigstes Berufsziel wurden häufig das Anlie-
gen genannt, einen Beitrag zur Völkerverständigung und zur Verwirklichung von interkul-
turellen Zielen zu leisten. Ergänzend dazu wurden eigene Karriereplanungen sowie die
Absicherung der beruflichen Stellung für wichtig gehalten.
Die Berücksichtigung der eigenen Erfahrung nach der Rückkehr ist ein Bereich mit dem
sich, nach jahrelanger Argumentation der AGAL, nun auch die Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder befasst. Im Beschluss der KMK heißt es dazu unter der
Überschrift: “Nutzung der Auslandskontakte und Auslandserfahrungen in Unterricht und
313
Schule: An den Schulen in Deutschland gewinnen die Ziele und Maßnahmen internationaler,
vorrangig europäischer Erziehung zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung lässt sich
durch Lehrkräfte mit Auslandserfahrungen positiv mitgestalten. In vielfältiger Weise können
sie ihre Kenntnisse, Überzeugungen und Haltungen in das Bemühen um internationales
Verstehen einbringen.”238
Fazit: Bei einem großen Teil der befragten Mitarbeiter kann es zu einer Kündigung
kommen. Unter diesem Druck macht sich die Gefahr der Demotivation breit.
Als wichtigste Berufsziele nennt man die Zufriedenheit der Arbeits- und Projektpartner,
der Schüler und Studenten, eine interessante Arbeit zu haben, dem Aufwand gemäß
bezahlt zu werden, für größeres Verständnis zwischen Deutschland und dem jeweiligen
Gastland zu wirken, aber auch die Arbeit in einem Schulsystem, das mehr Offenheit,
Toleranz und weniger Bürokratie produziert sowie die Berücksichtigung der eigenen
Erfahrung nach der Rückkehr.
6.7. Forderungen für die Zukunft
Von Deutschland aus wird die Verbesserung der Rückkehrbedingungen von Bun-
desprogrammlehrkräften in den Schuldienst und der sozialen und arbeitsrechtlichen
Absicherung gefordert. Dazu gehört auch die problemlose freiwillige Krankenversicherung in
der Heimat für Urlaubsaufenthalt und Anrechtsbewahrung.
Bereits jetzt haben die Schulbehörden große Probleme bei der Stellenbesetzung für den
Auslandsschuldienst. Bisher waren unter den Programmlehrkräften viele, die die Wartezeit
auf einen Arbeitsplatz in Deutschland überbrückt haben. In Zukunft ist anzunehmen, dass der
Bedarf im Ausland nicht gedeckt werden kann, denn die Wartelisten für Lehrer sind
leergefegt.
Das föderalistische System im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik wird von vielen
Befragten als Grund für zahlreiche Schwierigkeiten und als Hindernis für eine gemeinsame
Auswärtige Kulturpolitik angesehen. 16 Bundesländer, 16 verschiedene Beurteilungs-
richtlinien und 16 Verfahrensregeln verhindern die Transparenz und öffnen das Tor für
Willkür. Dies kann auch Konflikte mit dem Schulleiter verursachen.
238 Beschluss der KMK: Nutzung der Auslandskontakte und Auslandserfahrungen der im Ausland tätigen und
aus dem Ausland zurückgekehrten Lehrkräfte. 6.12.2001. S.3.
314
Die Höhe der Wochenstundenzahl der Lehrkräfte wird moniert und Möglichkeiten für ein
Sabbatjahr gefordert. Der Stellenabbau bei den Goethe-Instituten soll gestoppt und die
Mittelausstattung auch für Kulturprogramme verbessert werden. Für viele Lehrer
erfordert der Formular- und Antragskrieg mit dem Bundesverwaltungsamt zuviel Energie.
Auch die Anreiseprozedur - häufig festgelegt im Schulabkommen - müsste erleichtert
werden. Die finanzielle Besserstellung der kulturellen Programmarbeit im Goethe-Institut
und politische Unabhängigkeit - auch von den Geldgebern - wird als ein wichtiges Ziel
gesehen. Weitere Schließungen von Goethe-Instituten werden als Armutszeugnis deutscher
Auswärtiger Kulturpolitik gewertet.
Zwischenergebnis
”Mit Befriedigung stellt die Bundesregierung fest, dass sich trotz dieser einzelnen
Schwierigkeiten viele Lehrkräfte um den Einsatz als Bundesprogrammlehrkräfte bemühen
und ihre Aufgabe im Ausland gewöhnlich mit großem Engagement und hohem persönlichen
Einsatz erfüllen,” so beantwortete die Bundesregierung die kleine Anfrage zur Situation der
Programmlehrkräfte.239 Paul Michel in der Bundesstelle für Rechtsschutz beim GEW-
Hauptvorstand kann von vielerlei Problemen und Rechtsschutzfällen während des Einsatzes
und bei der Rückkehr der Bundesprogrammlehrkräfte aus dem Auslandsdienst berichten. Die
diesbezüglichen Erfahrungen der Rückkehrer müssen genutzt werden, um derartigen
Schwierigkeiten vorzubeugen.
Eine KMK-Vereinbarung, die verbindlich klärt, wie Beurteilungen zu gestalten sind, sollte in
allen Deutschen Schulen gelten. Dazu müssten alle 16 Beurteilungskataloge durchgesehen
werden. Manche Schulleiter haben niemals beurteilt. Persönliche Abrechung bei
Beurteilungen darf nicht vorkommen. Hierbei ist auch zu monieren, dass die
Personalvertretung für Auslandsschullehrer nicht klar geregelt ist. Eine Personalvertretung
vor Ort und eine bundesweite Personalvertretung ist dringend notwendig.
Mehr Interesse an Kulturpolitik, Mäßigung des finanziellen Drucks von Deutschland und ein
deutliches Bekenntnis zur Auswärtigen Kulturpolitik wird erwartet. Kurt Simon, Vorsitzender
239 Altmann, Elisabeth: Zur sozialen Situation der Bundesprogrammlehrkräfte und zur finanziellen Ausstattung
des Bereichs Deutsch als Fremdsprache in Europa. Deutscher Bundestag, Kleine Anfrage, Drucksache.
13/11316, 1998.
315
der AGAL, der Arbeitsgruppe der Auslandslehrer und Auslandslehrerinnen der GEW sagt
dazu auf der GEW-Sonnenberg-Tagung im November 2002: „Man muss immer wieder sagen:
Die wirklichen Erfolge jeglicher Bildungsarbeit im In- und Ausland werden frühestens in 10
Jahren sichtbar.”
Für die Lehrerfortbildung im Bereich des Konfliktmanagements stellt das
Bundesverwaltungsamt fest: “Lehrerfortbildung im Auslandsschulwesen muss weiterhin die
"klassischen" Aufgaben wahrnehmen.[…]Aber Lehrerfortbildung muss sich darüber hinaus
auch neuen Bereichen widmen: Teamteaching und Teamcoaching, Methodentraining,
Kommunikations- und Beratungstraining und verstärkte Entwicklung einer interkulturellen
Kompetenz der Lehrkräfte”240 Diese Schlüsselqualifikationen sind unabdingbar, um die
Europäisierung der Auswärtigen Kulturpolitik kompetent in Angriff zu nehmen.
Die föderalistische Struktur im Auslandsschulwesen, die von vielen der Befragten als eher
hinderlich gesehen wird, könnte überwunden werden. Hier steht der Vorschlag der
Arbeitsgruppe Auslandslehrer und Auslandslehrerinnen der GEW für die Errichtung eines
“Auswärtigen Schulamtes”. Es sollten nach den Vorschlägen im Gutachten von Prof. Battis,
Kompetenzen die beim Bund und bei den Ländern liegen, zusammengefasst werden. Der
Vorteil wäre eben auch eine gemeinsame Personalvertretung. Das “Auswärtige Schulamt”
könnte sich intensiver um die Bündelung fachlicher Notwendigkeiten kümmern. Diese
Forderung ist bei der KMK allerdings nicht beliebt.
Fazit: An dieser Stelle wurde eine Fülle von Vorschlägen unterbreitet, die im Folgenden
wörtlich aufgeführt werden, weil sie erheblichen Reformbedarf erkennen lassen.
7. Weitere Reformvorschläge aus den Fragebögen
7.1. Verbesserungen für die Deutschen Schulen
Exemplarisch sollen hier aus dem Fragenkomplex “Forderungen für die Zukunft”
einige Aussagen, die für das Handlungsfeld bestimmend sind, wörtlich wiedergegeben
werden und anschließend die unterschiedliche Sichtweise der Befragten und der
Entscheidungsträger auf der offiziellen Ebene unter 7.2. verdeutlicht werden:
Dazu wird zuerst auf die Auswertung der Fragebögen in einzelnen Schulen zurückgegriffen.
240 http://www.auslandsschulwesen.de/zentralstelle für das Auslandsschulwesen/fortbild.htm (Stand: 28.11.01).
316
Deutsche Schule Poprad
Welche Verbesserungen Ihrer Situation könnten von Deutschland aus initiiert werden?
Im Folgenden werden die Anliegen der befragten Lehrer/innen genannt:
Eine Stellenzusage in Deutschland nach endgültigem Vertragsende ( bzw. verwertbare
Anerkennung des Auslandsdienstes), soziale und arbeitsrechtliche Absicherung,
Möglichkeit in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen, Bewahrung des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld über die Gesamtdauer des Auslandsaufenthalts, problemlose freiwillige
Krankenversicherung in Deutschland zwecks Urlaubsaufenthalt und Anrechtsbewahrung,
Erleichterung der Einreise durch entsprechende Schulabkommen, Schaffung einer
Vermittlungsstelle für BPLK nach deren Rückkehr, mehr DaF- Einsatzmöglichkeiten nach
der Rückkehr z.B. in der Unternehmensberatung und in Schulen.
Weitere Vorschläge bezogen sich eher auf den pädagogischen Bereich: Mehr Ortslehrkräfte
aus dem Partnerland, würden breitere berufliche Erfahrungen vermitteln. Genauere
Information über die Arbeit, Fortbildungsveranstaltungen mit Zukunftsperspektiven,
intensiver Dialog, Berücksichtigung eigener Erfahrungen bei der Fortschreibung des
Programms, Aufklärung über die real vorherrschenden Bedingungen vor Ort, umfangreiche
und schnellere Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, bessere sprachliche Vorbereitung der
Lehrkräfte v.a. auf dem Gebiet der nicht gängigen Sprachen, Fortbildungsangebote im
Bereich DaF in Deutschland, (während der Unterrichtszeit und voll finanziert),
Intensivsprachkurs während des Aufenthalts. Dies waren die einsatzbezogenen Forderungen.
Deutsche Schule Istanbul
Welche Verbesserungen Ihrer Situation könnten von Deutschland aus initiiert werden?
Die Antworten, die ebenfalls wörtlich wiedergegeben werden, waren: Aufnahme in die
Arbeitslosenversicherung und Übernahme in den staatlichen Schuldienst. Die Bedingungen
für die Programmlehrer sind ausgesprochen ”Single - freundlich”. Es sollte vom Bundestag
aus, mehr dem sozialen Bereich und den familienpolitischen Aspekten Rechnung getragen
werden. Lehrer, die als Bundesprogrammlehrkräfte ins Ausland gehen und in Deutschland
verbeamtet sind, sollten im Ausland unter gleichen materiellen Bedingungen arbeiten wie in
Deutschland, also gleiche Bruttobezüge, gleiche Abzüge, Beihilfe usw. haben. Bessere soziale
Absicherung der Programmlehrkräfte, evtl. Erhöhung der Chance auf einen Arbeitsplatz, ein
317
festes Stellenangebot in Deutschland für Programm- und Ortslehrkräfte nach 3-4 jährigem
”Auslandsdienst”, Rücknahme der finanziellen Kürzungen (Umzugsfinanzierung, etc.),
Reduzierung der Pflichtstundenzahl, da erhebliche zusätzliche Belastungen im Ausland
auftreten, bessere Familienförderung, wie in Deutschland auch. So die sozialpolitischen
Anliegen der Befragten der Deutschen Schule in Istanbul.
Als eher fachliche Vorstellungen wurden geäußert: Ermöglichung von Sprachkursen,
bessere Vorbereitung auf das Gastland, zielgerichtete Sprachkurse zur Bewältigung des
Schullebens und Alltags, verpflichtend und unter Stundenermäßigung einzurichten.
Entwicklung und Betreuung pädagogischer Konzepte, spezifische Beratung durch die
Fachberater, die fundierte Kenntnisse im DaF-Bereich haben sollten.
Deutschland sollte besser prüfen, in welche Städte es deutsche Lehrer schickt: Es ist in den
Städten Bedarf an Deutsch, in denen Universitäten mit deutschsprachigen Fakultäten
betrieben werden oder in denen Betriebe Wirtschaftskontakte mit Deutschland pflegen. Dann
ist der Deutschunterricht nicht nur eine Mode oder Reklame für eine Schule, sondern es gibt
langfristige Nachfrage.
Durch vermehrten Einsatz von Programm- und Ortslehrkräften kommt es häufig zum Wechsel
im Kollegium. Zur Aufrechterhaltung der Kontinuität des Schulbetriebs sollte man die
vermittelten Lehrkräfte länger als 8 Jahre im Auslandsschuldienst lassen oder die
Programmlehrkräfte für mehrere Schuljahre einstellen und ihnen dann eine feste Stelle in
Deutschland zusichern.
7.2. Abgleich mit politischen Entscheidungsträgern, sowie Primärquellen:
Es findet sich eine unterschiedliche Sichtweise vor allem zur materiellen Absicherung
deutscher Lehrer im Ausland zwischen den Betroffenen und der politischen Ebene. Jedoch
zeigt sich ein Problembewusstsein, was die verschiedenen “Lehrerkategorien” betrifft. Die
Diskussion um die “teuren” Auslandsdienstlehrkräfte wird schon lange auf der politischen
Ebene geführt: “Außenminister Kinkel hat dann Anfang der 90er Jahre selbst die Leiter der
großen Mittler, wozu auch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen gezählt wird, jährlich
zu Arbeitsessen ins Gästehaus der Bundesregierung eingeladen, an denen selbstverständlich
auch der Leiter der Kulturabteilung sowie der Leiter des Grundsatzreferates teilnahmen. Hier
wurden konzeptionelle Fragen der Außenkulturpolitik angesprochen und unter dem
Blickwinkel der beteiligten Institutionen in aller Offenheit erörtert. Das war die Ebene, in der
318
u.a. Klage geführt wurde über die teuren Auslandslehrer. [...] So war auch die
Gesprächsrunde, zu der Außenminister Fischer im Sommer 1999 nach Berlin eingeladen
hatte, u.a. richtungsweisend für das künftige Verhältnis von GI und Inter Nationes sowie für
die Vorstellungen von Art und Umfang der in Zukunft finanzierbaren Lehrerkategorien im
Auslandsschulwesen. So konnte ich bereits auf die Reduzierung der Kosten für die
Auslandsdienstlehrkräfte durch die Umstellung ihrer finanziellen Versorgung auf
Zuwendungsrecht hinweisen.”241
Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesminister des Auswärtigen und den Kul-
tusministern der Länder in der BRD, vertreten durch den Präsidenten der Ständigen
Konferenz der Kultusminister, über den Einsatz deutscher Lehrkräfte im Ausland.
(‚Rahmenstatut’) 1994 wird zur Zeit (Juni 2002) vom Bund- Länder-Ausschuss für schulische
Arbeit im Ausland (BLASchA) überarbeitet. Hier ist die Definition mehrerer Gruppen von
Lehrern, die sich nach ihrem rechtlichen Status und nach ihren Aufgaben unterscheiden,
festgelegt. (Siehe B 1.2.) Für die soziale Absicherung der Bundesprogrammlehrkräfte ist der
Bundestag zuständig. Die Wiedereinstiegschancen der Programmlehrkräfte haben sich seit
der Durchführung der Befragung zum Positiven verändert. Vertreter der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen treten an die Länder heran mit dem Wunsch, dass Lehrer/innen mit
Auslandserfahrung einen Bonus bei der Einstellung bekommen. Für den Dienst an Deutschen
Schulen im Ausland finden sich besonders im naturwissenschaftlichen Bereich und im
Bereich moderner Sprachen allerdings zunehmend weniger Bewerber, sodass für das
Schuljahr 2002/2003 der Bedarf kaum gedeckt werden kann. Die durch das Rahmenstatut
festgelegten Lehrerkategorien müssen revidiert werden. Im Entwurf des überarbeiteten
Rahmenstatuts, bleiben die Lehrerkategorien erhalten, es wird aber viel stärker als bisher auf
unterschiedliche Ausbildung der Ortslehrkräfte eingegangen.
241Schmidt, Walter: 29 Jahre in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Rückblick und Ausblick. In:
Neue Akzente in der Auswärtigen Kulturpolitik. Schulische Arbeit zwischen Ökonomisierung und
interkulturellem Auftrag. Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrer
in der GEW) vom 19. bis 24. November 2000 im Internationalen Haus Sonnenberg, St. Andreasberg.
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
,Hg.. Braunschweig, 2001, S. 32 f.
319
Im Rundschreiben an die Fachberater sowie die Goethe-Institute hat die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen im November 98 über Umstrukturierungen berichtet. Fachberater-
aufgaben sollten aus ihrem bisherigem Zuständigkeitsbereich auf das Goethe-Institut
übergehen. Das bedeutete, dass im Januar 1999 ca. 40 von 90 Fachberaterstellen auf das
Goethe-Institut übertragen wurden. Betroffen waren Fachberater deren Aufgaben- und
Einsatzbereich vor allem der Förderung der deutschen Sprache in der Pädagogischen
Verbindungsarbeit gewidmet ist. So fährt Walter Schmidt in seinen Erläuterungen auf der
Sonnenbergtagung fort: “Ebenso kann ich hinweisen auf den Abbau von
Aufgabenüberschneidungen durch die zwischen GI und Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen in Abstimmung mit dem Leiter der Kulturabteilung vereinbarte
Abgrenzung beim Einsatz von Fachberatern für Deutsch, nämlich zwischen der
Pädagogischen Verbindungsarbeit des GI einerseits und der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen-Fachberatung sowie Koordination des Einsatzes von
Programmlehrkräften an Sprachdiplomschulen in der Verantwortung des BLASchA
andererseits, wobei auch weiterhin eine vertrauensvolle Kooperation im Rahmen der im
Auftrag der Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache (StADaF) in den Hauptstädten
weltweit erarbeiteten Länderkonzeptionen erfolgen soll.”242 Fachberaterstellen der ZfA auf
das Goethe-Institut zu übertragen, stieß auf den Unwillen der Betroffenen. Denn ”Fachberater
der ZfA sind vor Ort präsent und garantieren die kontinuierliche Verknüpfung pädagogischer
Aktivitäten und unterrichtlicher Praxis. Sie initiieren durch unterrichtsbegleitende dezentrale
Lehrgangs- und Projektangebote, Schulpartnerschaftsinitiativen, Hospitationen,
Durchführung von Stipendienauswahlverfahren u.v.m..”243 Fachlich handelt es sich bei der
Unterrichtung von Schülern in den Deutschen Schulen um einen anderen Aufgabenbereich,
als ihn Fachberater des Goethe-Instituts wahrnehmen. Deshalb wird abzuwarten sein, ob die
Veränderung der Rolle der Fachberater, in der geplanten Form zu sinnvollen Ergebnissen
242 ebd. 243 Proksch, Josef: Neue Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Goethe-Institut und Bundesverwaltungsamt-
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Tagung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Der
Auslandsschuldienst- ein Beitrag zur Interkulturellen Erziehung vom 15.-20.11.1998. Dokumentation der
Sonnenberg - Tagung in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Braunschweig,
1999, S. 144.
320
führen wird. Hier wurden Veränderungen vorgenommen, ohne zu fragen, was es bringen
wird oder gebracht hat. Sind positive oder negative Effekte eingetreten? Wurde die Zahl der
Fachberater beim Goethe-Institut erhalten oder die Mittel anderweitig ausgegeben? Diese
Fragen wären Anlass für eine gründliche Evaluation.
7.3. Goethe-Institute - in Zukunft Europäische Kulturinstitute?
Exemplarisch soll hier auf die Frage nach der Zusammenarbeit der Kulturinstitute
verschiedener Länder aus den Fragebögen eingegangen werden und mit der Einstellung der
Entscheidungsträger unter 7.4. abgeglichen werden. Dazu wird auf die Auswertung der
Fragebögen in einzelnen Goethe-Instituten zurückgegriffen.
Goethe-Institut Prag
Welche Vorteile können Sie sich vorstellen bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute
verschiedener Länder unter einem Dach?
Auch hier werden die Antworten auf die Fragen wörtlich wiedergegeben:
Bessere Zusammenarbeit, Koordinierung von kulturellen und sprachlichen Aktivitäten.
In welchen Themenbereichen äußert sich konkret in Ihrem Unterricht die Annäherung
der europäischen Länder?
Beim interkulturellen Lernen, in Reise und Verkehr, in der Wirtschaft.
Welche Vorteile können Sie bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute verschiedener
Länder unter einem Dach vorstellen?
Absprachen zu gemeinsamer Finanzierung z.B. von Musik-, Kunst-, Sportprogrammen. Ende
der Konkurrenzgefühle! Synergien aller Art, anregende Konkurrenz. Überzeugendes
Vorleben europäischer Zusammenarbeit und Gemeinsamkeiten in einem ”Kandidatenland”.
Schnellere gegenseitige Information, gemeinsame Projekte.
Spielt der europäische Gedanke in Ihrer Arbeit eine Rolle?
Der Versuch besteht ihn in Landeskundeseminaren zu entwickeln..
Besonders intensiv in der Arbeit mit Hochschuldozenten, weil sie die zukünftige akademische
Elite des Landes unterrichten.
321
Punktuell besonders Euregio Tirrhena (Südbaden, Basel, Südelsass), die 30
Jahre funktioniert und viele konkrete Projekte über die Grenzen verwirklicht.
Goethe-Institut Paris
In welchen Themenbereichen äußert sich konkret in Ihrem Unterricht die Annäherung
der europäischen Länder?
Im Bereich der Landeskunde, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Pressekursen.
Welche Vorteile können Sie sich bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute
verschiedener Länder unter einem Dach vorstellen?
Kosteneinsparung durch gemeinsame Nutzung der Ressourcen (Personal, Räume,...)
Intensivierung der Zusammenarbeit und Verbreiterung des Angebots im Kulturbereich,
gemeinsames Programm. In einer Stadt wie Paris sehe ich persönlich keinen Vorteil.
Liegt in Europa auf der Hand (aber nicht nur da): Gemeinsamer übernationaler Dialog großer
europäischer Themen: Kulturelle und sprachliche Vielfalt, Lernen und Bildung, Arbeit und
Arbeitslosigkeit, Immigration, Jugend, Globalisierung, u. v. m. Außerhalb Europas hilft das in
ähnlicher Weise, Dialog mit europäischen. Kulturen, eigene Wurzeln (z.B. Südamerika).
Spielt der europäische Gedanke in Ihrer Arbeit eine Rolle?
Die Frage des Zusammenlebens, des Umgangs mit Fremden, interkulturelles Lernen,
Mehrsprachigkeit.
Spielt eine große Rolle und verlangt nach Konkretisierung. Leitmotiv = Realisation der
Mehrsprachigkeit in einer europäischen Bildungssprachenpolitik.
Werbung für Deutsch nicht national pointiert, sondern dem allgemeinem Gedanken des
Plurilinguismus untergeordnet.
Zunehmend diskutieren wir innovative Fachfragen auf europäischem Niveau. z.B. seit 15
Jahren trinationales Kolleg TRIANGLE (D,F,GB), demnächst ”Autonomes Lernen” mit
Belgien und den Niederlanden.
7.4. Unterschiedliche Sichtweisen
Während die Kulturhandelnden eine vorwiegend positive Sichtweise auf die sich anbahnende
Zusammenarbeit europäischer Kulturinstitute haben, sind diesbezügliche Vorstellungen an
der Kulturpolitik Mitwirkender eher als abwartend und kritisch zu beurteilen:
322
Hans- Werner Bussmann244 ist gegen eine allzu starke Vereinheitlichung europäischer
Kultur. Er hält ein Plädoyer für eine pragmatische Form kultureller Zusammenarbeit
europäischer Kulturinstitute. Auf die Frage, ob durch Schaffung europäischer Kulturinstitute
wieder mehr Spielraum für die durch Budgetkürzung in Bedrängnis geratene Programmarbeit
bereitsteht, sollte man, so Bussmann, fordern: Auf Grund der finanziellen Beschränkungen
sollten alle Spar- und Synergieeffekte auch auf europäischer Ebene genutzt werden, aber
dabei sollten nicht nur die finanziellen Probleme Motor sein.
Die starke Stellung der unterschiedlichen Institute verschiedener Länder könne seiner
Meinung nach nicht einfach durch ein einziges Institut übernommen werden. Das breite
Spektrum der Nationen innerhalb der EU und ihrer Mitgliedstaaten solle genauso wie die
Tatsache, dass der permanente Austausch der Kulturen Europas auch maßgeblich zum
wirtschaftlichen Reichtum beigetragen habe, nach innen und nach außen für alle sichtbar
bleiben. Daher hätten die europäischen Kulturinstitute die Aufgabe ”Einheit in Vielfalt” zu
zeigen. Es sei aber fraglich, ob ein gemeinschaftliches europäisches Kulturinstitut
wünschenswert sei, wegen des deutlichen Wettbewerbs zwischen den einzelnen Nationen.
Das dezentrale Prinzip der EU und die berechtigten Interessen der Mitgliedstaaten und ihrer
Bürger an einem kulturellen Profil, das die historisch geprägte, nationale Identität weiterhin
tragen soll, spreche selbst gegen eine integrierte und zwangsläufig auch harmonisierte
europäische Kulturpolitik. Die rechtlichen Grundlagen der EU lassen hier nur eine
zwischenstaatliche Lösung zu. Jeder Staat muss selbst die Auswahl seiner Partner treffen, so
Bussmann.
Auch Keith Dobson spricht sich gegen eine von der Europäische Union angeordnete
Zusammenarbeit aus: “Tempo und Muster der europäischen Zusammenarbeit werden am
besten von den Anforderungen der kulturellen und akademischen Gemeinschaften bestimmt,
wie sie sich durch die Vermittlerorganisationen manifestieren, statt in Brüssel angeordnet zu
werden. Vorschläge für die Errichtung eines Netzwerkes aus ‚Europäischen Kulturhäusern‘,
die von der EU- Kommission als Plattform für die auswärtigen Kulturaktivitäten ihrer
244 vgl. Bussmann, Hans-Werner: Europäische Kulturinstitute - Mehr als Retter aus der finanziellen Not? In:
Zeitschrift für KulturAustausch 3/97, Stuttgart, S. 11 f.
323
Mitgliedstaaten eingerichtet werden sollen, haben mich nicht überzeugt.”245 Für ihn sind sich
selbständig entwickelnde Programme unter den verschiedenen Mittlerorganisationen viel
wichtiger und langfristig auch erfolgreicher. Als Beispiel beschreibt er das LINGUA-
Programm, ein gemeinsames Unternehmen von Deutschen, Franzosen und Briten, das zur
Förderung des Erlernens europäischer Sprachen eingerichtet wurde. Dabei, so Dobson, hat
das Goethe-Institut, durch hervorstechendes Engagement, das hohe Maß an Professionalität
und seinen guten Ruf als aktiver Förderer der europäischen Zusammenarbeit im Bereich der
Kulturarbeit eine führende Rolle gespielt. Solche Initiativen sind - seiner Meinung nach - gute
Entwicklungen in die richtige Richtung, wobei die deutschen Mittlerorganisationen allgemein
besonders aktiv und maßgeblich am Vorankommen beteiligt sind. Die Kooperation unter der
Leitung der Mittlerorganisationen und der kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen
Vereinigungen, die von ihnen vertreten werden, ist auf Europaebene zu bevorzugen, äußert
der Pragmatiker Dobson.246
Meiner Ansicht nach sind europäische Projekte bei allen Kulturorganisationen zu fördern. Die
Schaffung eines “Europäischen Kulturinstituts” liegt jedoch in weiter Ferne und würde die
Vielfalt der kulturellen Ausprägungen beschneiden. Gemeinsame Aktivitäten der nationalen
Institute würden exakte Planung und Festlegung eines gemeinsamen Ziel- und Aufgaben-
kataloges erfordern. Für solche Projekte müsste eine Leitung, die das Wissen und die
Fähigkeiten hätte, den Mitarbeitern ermöglichen, das gesamte kulturelle Spektrum
entsprechend ausgewogen darzubieten, gesucht werden. Kooperative, interaktive und
praktische Zusammenarbeit der nationalen Institute in möglichst vielen Bereichen, ist
wünschenswert. Es gibt schon heute gemeinsame Lesesäle und Zusammenarbeit bei
bestimmten kulturellen Veranstaltungen. Diese Lesesäle ermöglichen den kleineren
Mitgliedstaaten, mit eigenen Büchern präsent zu sein.
245 Deutscher Bundestag. Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages: Bestandsaufnahme und
Perspektiven der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Vortrag von Keith Dobson, Direktor des British Council,
Deutschland. 246 vgl. Dobson, Keith: Britischer Pragmatismus in der Auswärtigen Kulturarbeit. Interview mit dem Direktor
des British Council in Deutschland. In: Zeitschrift für KulturAustausch, 2/98. S.11-13, sowie
Dobson, Keith: Bestandsaufnahme und Perspektiven der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Vortrag bei der
Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages am 14. April 1997. Drucksache 13/62/12.
324
Die von mir entwickelten Gedanken haben eine aktuelle Entsprechung gefunden: Mit dem
Kulturministerium des Großherzogtums Luxemburg und dem Institut Francais will man ein
gemeinsames Institut einrichten. Wie das trinationale Institut aussehen wird, welche
rechtlichen Grundlagen es haben soll, verhandeln die Zuständigen zur Zeit allerdings noch. Es
soll eine integrierte Organisation werden. Der Direktorposten, so ist es angedacht, könnte im
zweijährigen Turnus zwischen den Nationen wechseln. “Die Arbeit, die das neue Institut
leisten soll, nimmt sich im Vergleich zur völkerverbindenden Rhetorik bescheiden aus,”247
bemerkt dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ein Weg europäische Kulturarbeit zu betreiben ist, örtliche interkulturelle Initiativen als
Modelle aufzugreifen und finanziell zu unterstützen. Immer zählt das Engagement und die
Begeisterung der Menschen, die Projekte verwirklichen wollen. Von höherer Stelle
aufoktroyierte, komplexe Ideen werden von den Partnern nur mit halbem Herzen realisiert.
Man könnte auf positive Erfahrungen z.B. bei der Durchführung des gemeinschaftlichen
Aktionsprogramms im Bereich der allgemeinen Bildung “SOKRATES” zurückgreifen. Das
Programm ist Gegenstand gründlicher Evaluierung. Sicher ließen sich gewonnene Infor-
mationen auf Kooperationsprojekte der nationalen Kulturinstitute übertragen.
247 Reiter, Markus: Babylon in Luxemburg. In: F.A.Z. vom 19.6.2002, S. 45.
325
Die Diskussion ist in Bewegung. Dieter Strauss, Leiter des Pariser Goethe-Instituts sagt dazu:
“Der Zusammenschluss ist vielmehr eine Chance für den innereuropäischen, vor allem aber
auch für den übereuropäischen Dialog mit fernen Kulturregionen.”248 Robert Peise, der Träger
des Rave-Preises 2002 für Auswärtige Kulturpolitik, den er für seine Diplomarbeit mit dem
Titel: “Ein Kulturinstitut für Europa. Untersuchungen zur Institutionalisierung kultureller
Zusammenarbeit” erhalten hat249, plädiert für eine intensivere Zusammenarbeit der
europäischen Kulturinstitute in Drittländern. In der Laudatio250 zur Verleihung wird
dargestellt, wie sinnvoll eine “EUKAP”, eine europäische Kulturaußenpolitik in einer
globalisierten Welt sein wird.
248 Dann kann man sogar Piraten jagen. Ein Gespräch mit Dieter Strauss, dem Leiter des Pariser Goethe-
Instituts. In: FAZ, 4.10.2002. S.39. 249 Rave-Forschungspreis des Instituts für Auslandsbeziehungen 2002 für Auswärtige Kulturpolitik. Preisträger
Robert Peise für seine Diplomarbeit mit dem Titel: “Ein Kulturinstitut für Europa. Untersuchungen zur
Institutionalisierung kultureller Zusammenarbeit.” 250 Weber, Raymond: Elemente für eine europäische Kulturaußenpolitik: Ziele, Prinzipien und Strukturen. In:
Zeitschrift für KulturAustausch 3/02, S. 114.
326
E Zukunftsfähigkeit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
Aus den in der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen und der politischen Situation ergeben sich
auf der Grundlage der Aufgaben und der Leitlinien der Auswärtigen Kultur folgende
Ansatzpunkte für eine Neuorientierung.
1. Politische Neuorientierung in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
In der Aussprache zum Koalitionsantrag ”Auswärtige Kulturpolitik für das 21. Jahrhundert”
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und dem Antrag der FDP “Public Private Partnership”
am 24.1.2002 wurde sehr deutlich, dass der Dialog der Kulturen nach dem 11.September
2001 im Mittelpunkt der Auswärtigen Kulturpolitik steht. Für alle Rednerinnen und Redner
des Bundestages war folgende Frage von zentraler Bedeutung: Haben wir eine Chance, solche
Anschläge in Zukunft mit Hilfe interkultureller Dialoge zu verhindern?
Den eigenen kulturellen Erfahrungshorizont für neues Denken zu öffnen, partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Kulturen zu verwirklichen, sowie Wissen und
Kenntnisse über fremde Kulturen bei uns im breiteren Rahmen zu vermitteln, war das
gemeinsame Anliegen in dieser Aussprache. Mit welchen Maßnahmen dieses Anliegen
verwirklicht werden soll, blieb allerdings offen.
Vor dem Hintergrund des 11. Septembers 2001 und der großen politischen Umbrüche der
letzten Jahre, dem Fall der innerdeutschen Grenze, der Beendigung des Kalten Krieges und
der Entstehung neuer Demokratien in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas hat die deutsche
Auswärtige Kulturpolitik erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser größeren Bedeutung
muss politisch endlich Rechnung getragen werden. ”Die deutsche Politik war in den ersten
Jahren nach der Vereinigung zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um ihr neues Bild im
Ausland zu reflektieren,”251 1993 schrieben, um Abhilfe zu schaffen, 26 Autoren aus dem In-
und Ausland, unter ihnen Hildegard Hamm-Brücher, einen Sammelband über die Defizite der
Auswärtigen Kulturpolitik mit dem Titel “Freund oder Fratze? Das Bild von Deutschland in
251 Maass, Kurt- Jürgen: Vor neuen Herausforderungen. In: Musikforum. Nr. 90/1999. S. 24 ff.
327
der Welt und die Aufgaben der Kulturpolitik”252. Hilmar Hoffmann forderte darin, eine
Offensive zu starten, weil die neue Weltlage eine neue Politik nötig mache und eine
veränderte Aufgabenstellung beinhalte. Diese Aufgaben der Auswärtigen Kulturpolitik
formuliert Kurt-Jürgen Maass, der Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen:
“Ein weiteres Ziel der Auswärtigen Kulturpolitik hat sich besonders nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs herausgebildet. Unterstützt durch die Außenkulturpolitik wird danach
auch die europäische Wertegemeinschaft, die Vermittlung von Werten, Normen und
Prinzipien, der Transformationsprozess ehemals sozialistischer Staaten in Richtung auf
Demokratien und soziale Marktwirtschaften.”253 Die Zäsur der Auswärtigen Kulturpolitik
nach der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands beschreibt Bernd Wagner, Vorstand der
Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. und Redakteur deren Zeitschrift “Kulturpolitische
Mitteilungen”254: “Auch wenn sich an den allgemeinen Zielsetzungen der kulturellen
Auslandsarbeit, wie sie in den 70er Jahren entwickelt und diskutiert wurde, nichts
grundlegend geändert hat, so steht sie doch vor einer Neuorientierung und Umstrukturierung.
Zum einen hinkt seit den 80er Jahren die reale Praxis auswärtiger Kulturpolitik hinter den
formulierten Zielen hinterher. Zum anderen hat sich durch die Zäsur von 1989 nicht nur die
bundesrepublikanische Gesellschaft verändert, sondern 1989 markiert einen weltweiten
Umbruch.”255
Wegweisend für eine zweite, wesentlich veränderte Sichtweise der deutschen Außenpolitik
nach dem 11.September 2001 war die Rede des Bundesaußenministers Fischer zur Eröffnung
der dritten Konferenz der Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen am 27.
Mai 2002. In vier Thesen begründete Joschka Fischer die Zäsur in der internationalen Politik
252 Hoffmann, Hilmar; Maass, Kurt Jürgen (Hg.): Freund oder Fratze. Frankfurt, 1994. 253 Maass, Kurt-Jürgen. In: Forum. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und Internet. Auswärtiges Amt,
Hg., 27.11.2001. 254 Die “Kulturpolitischen Mitteilungen” der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. mit Sitz in Bonn, einem
bundesweiten Zusammenschluss kulturpolitisch interessierter und engagierter Menschen, bringen aktuelle
Informationen über allgemeine kulturpolitische Trends und Entwicklungen. 255 Wagner, Bernd: Felder und Aufgaben von Kulturpolitik auf Bundesebene. In: Zwischen
Leuchtturmprogramm und Warnblinkanlage. Bündnisgrüne Kulturpolitik auf Bundesebene. Dokumentation des
Kulturpolitischen Ratschlags am 8. Juli 1995 in Bonn. Albert Schmidt (MdB), Hg., für die Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen. S. 26 f.
328
durch den Tag der “alles verändert hat.”256 Er plädierte für ein starkes Europa, welches
gemeinsam mit Amerika die globalen Herausforderungen bewältigen kann und begründete die
stärkere Zurückhaltung Europas beim Einsatz militärischer Mittel in einer langen, durch
Kriege geprägten Vergangenheit. Eine europäische Friedensordnung und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Russland müssten die Ziele sein. Nur wenn sich Europa und die USA
stärker den Problemen des ärmeren Teils der Welt zuwenden, so Fischer, könne dauerhaft
eine Friedensordnung Bestand haben. Europa müsse dabei auch den Frieden im Nahen und
Mittleren Osten als prioritär begreifen und seinen Platz in der Welt neu definieren. Dazu
gehörte - so Fischers 4. These- auch die Schaffung einer europäischen Verfassung und einer
funktionierenden europäischen Demokratie. Er sieht die Auswärtige Kulturpolitik als einen
integralen Bestandteil einer auf Konfliktprävention und Friedenssicherung ausgerichteten
Außenpolitik257. In der Frage der Irak-Krise zu Beginn des Jahres 2003 hat gerade diese
Einstellung des Bundesaußenministers dazu geholfen, andere Länder dazu zu bewegen, vor
einem Militärschlag der USA mit Unterstützung Englands gegen den Irak, mögliche
Friedensoptionen zu durchdenken. Jedoch verursachen die Differenzen in der Irak-Politik in
den Vereinigten Staaten eine zunehmend antieuropäische Stimmung. Wie aktuelle politische
Auseinandersetzungen und unterschiedliche Interessenlagen das Bild des “befreundeten”
Landes in ein “schiefes” Bild verwandeln können, zeigen rhetorische Entgleisungen von
Medien und von Politikern, vor allem gegen Frankreich und Deutschland, am Beginn des
Jahres 2003 Donald Rumsfeld, US- Verteidigungsminister, bezeichnete denn auch diese
beiden Länder als zum “alten Europa” gehörend, für ihn ein negatives Bild. Er meint damit
Länder, die seiner Meinung nach unmodern sind und zum Klub der Undankbaren gehören..
Dabei versucht er zu trennen, was sich langsam in Europa verbindet, das “alte” und das
“neue” Europa, welches keine historische Kategorie bezeichnen kann, wenn er zur gleichen
Zeit Italien, Spanien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Kroatien, die
die USA bei ihrem Waffengang gegen den Irak unterstützen wollen, als “neues” Europa
wertet.. Da dieser Aussage keine begriffliche Klarheit unterliegt, ist sie in den Bereich der
Polemik zu verweisen. Dabei muss unterstellt werden, dass hier kein realistisches Bild der
256 Rede des Bundesaußenministers Fischer zur Eröffnung der dritten Konferenz der Leiterinnen und Leiter der
deutschen Auslandsvertretungen, Berlin 27.Mai 2002. 257 Fischer, Joschka:Vortrag auf dem Forum zur Auswärtigen Kulturpolitik, München, 2000.
329
Bundesrepublik Deutschlands und Frankreichs in den USA als Kulturnation vermittelt werden
sollte, sondern das langsam entstehende europäische Selbstbewusstsein aus machtpolitischen
Gründen beschädigt werden sollte. Dazu sagt der italienische Philosoph und Gadamer Schüler
Gianni Vattimo, der für eine Selbstbegrenzung der einzig noch gebliebenen
Hegemonialmacht plädiert: “Es gibt in Europa schon länger eine Tendenz, sich, wenn auch
nicht in Gegnerschaft, so doch als Alternative zu den USA zu konstruieren. [...] Wenn dies
dazu führt, dass wir unsere Verfassung besser gestalten, ist das ausgezeichnet.”258 Die
Einschätzung Jutta Limbachs, dass die “herkömmlichen Konzepte politischer
Zusammenarbeit mit der weltweiten Entwicklung nicht Schritt halten” 259wird durch diese
politische Situation bestätigt und so verweist Jutta Limbach auch auf die “langfristigen
Perspektiven, die Auswärtige Kulturpolitik dem Krisenmanagement der Regierungspolitik”
entgegen setzen kann durch das “Erarbeiten eines gemeinsamen Verständigungshorizontes”260
Nach dem Attentat am 11.September 2001 wird man gut daran tun, die wirtschaftlichen
Niederlassungen, Verflechtungen und Interessen der radikal islamischen Gruppen in der
Schweiz, in den USA und in Großbritannien, Deutschland und Frankreich zu beobachten und
zu zerstören. Der fundamental-islamische Terrorismus speist sich auch aus eben dem Geld,
welches in Europa und den USA “gewaschen” oder erwirtschaftet wird. Hier versuchen zu
wollen, mit “interkulturellem Dialog” Abhilfe zu schaffen, hieße blauäugig zu sein. Die
saudi-arabischen Netzwerke des Fundamentalismus greifen weit, Verwirklichung der
Demokratie oder des Dialogs mit Andersdenkenden ist nicht ihr Ziel, Gleichberechtigung und
Bildung für Frauen schon gar nicht. “Von nun an kann sich in den reichen Ländern niemand
mehr einer kritischen Betrachtung der Außenpolitik der letzten 50 Jahre entziehen,
insbesondere der Erdölpolitik, wie sich an der Irak-Krise zeigt. Unsere wirtschaftliche
Entwicklung beruht unter anderem auf Bündnissen mit Öldiktaturen und bestärkt diese darin,
vollkommen überholte Glaubenslehren zu begünstigen.”261 José Saramago beklagt das
258 Vattimo, Gianni: Nicht mehr Terror. Interview mit Luca di Blasi in der Frankfurter Rundschau. 23.2.03. S.9. 259 Limbach, Jutta: Rede bei Amtsantritt.. München, 21. Mai 2002. Typoskript 260 Limbach, Jutta: Rede bei Amtsantritt.. München, 21. Mai 2002. Typoskript
261 Brisard, Jean-Charles; Dasquié, Guillaume: Die verbotene Wahrheit. Die Verstrickungen der USA mit
Osama bin Laden. Zürich, München, 2001, S.189.
330
Fehlen einer weltweiten Demokratiedebatte. Eine schleichende Militarisierung zur Sicherung
der wirtschaftlichen Dominanz der USA sei erkennbar. “Was die Spannungen zwischen der
christlichen und islamischen Welt angeht, wird vom Kampf der Kulturen gesprochen. Die
Einschätzung teile ich nicht. Denn die Wechselwirkungen zwischen unseren Kulturen sind
enorm und der Aspekt des Zusammenprallens, den ein Clash of Civilisations voraussetzt, ist
meines Erachtens nicht gegeben”262 Er fordert auf, sich einzumischen und die Macht der
multinationalen Konzerne mit demokratischen Mitteln zu begrenzen.
So gilt es, die Rolle der Auswärtigen Kulturpolitik als Bestandteil der Außenpolitik neu zu
bestimmen. Diese Neubestimmung muss dem tatsächlichen gestiegenen Gewicht der
Bundesrepublik Deutschland und ihrer veränderten Rolle im internationalen Staatengefüge
gerecht werden. Gerade vor dem bedrohlichen Hintergrund des Krieges gegen den Irak, der
am 20. März 2003 seinen Anfang nahm, muss es eine wichtige Aufgabe der Auswärtigen
Kulturpolitik sein, unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten zu erkennen und auch eine von
wirtschaftlichen Interessen unabhängige Rechtsauffassung zu fordern. Zentrale Praxisfelder
der Auswärtigen Kulturpolitik sind die von Bundesaußenministers Fischer geforderte
Friedensordnung, Demokratievermittlung, eine Politik der Offenheit und der kritischen
Toleranz auf den verschiedensten Politikfeldern. Eine Anpassung an die politischen und
wirtschaftlichen US-amerikanischen Vorstellungen ist dabei wenig hilfreich. Die USA, die
nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums die einzige supranationale globale
Supermacht geblieben ist, braucht ein Regulativ. Wer heute von sozialen, demokratischen und
friedenspolitischen Zielen redet, findet sich nicht im mainstream der amerikanischen
Gesellschaft des Jahres 2003. Rita Süßmuth, langjährige Präsidentin des Deutschen
Bundestages mahnte an, dass in den Texten zur Auswärtigen Kulturpolitik in Deutschland die
Rolle der Demokratie und der Menschenrechte zukünftig mehr Berücksichtigung finden
sollte. Sie erinnerte daran, dass das europäische Menschenrechtsverständnis in einem
historischen, europäischen Kontext entstanden ist. Dies müsse in Deutschen Schulen und den
Goethe-Instituten deutlich gemacht werden. Die Fragen nach den Widersprüchen der
Demokratie müsse gestellt werden. Diese müssten konkret beim Namen genannt werden.263
262 Die Welt ist blind. Interview der FR mit José Saramago. In: Frankfurter Rundschau. S.9., 22.März, 2003. 263 Süßmuth, Rita In: Nachhaltigkeit Auswärtiger Kulturpolitik. Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der
AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrer in der GEW) vom 17. bis 22. November 2002 im Internationalen Haus
331
Auswärtige Kulturpolitik muss die Verschiedenheit der Aufgaben nach der jeweiligen
Situation des Landes sehen, abhängig vom wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Stand.
”Der Preis für dies Vertrautwerden in der Distanz ist die alte Erfahrung der Auslandsbildung,
dass jeder, der gelernt hat, soweit möglich mit fremden Augen zu sehen, nun vieles auch in
seiner angestammten Welt mit anderen Augen sieht und selbst anders gesehen wird. Es mag
auf eine Bewertung dieser Konsequenz als Preis, nicht als Gewinn hinweisen, dass die
literarische Hermeneutik der kulturellen Fremde bislang so wenig Aufmerksamkeit geschenkt
hat.”264 In Staaten, in denen die Demokratie unterentwickelt ist, soll Auswärtige Kulturpolitik
das demokratische Potenzial stärken und Menschenrechtsbewegungen unterstützen. Nur so
kann eine Informationsvermittlung und ein Meinungsaustausch über Länder, Kulturen und
Gegebenheiten erfolgen, die der Bevölkerung in autoritär bestimmten Gesellschaften sonst
vorenthalten sind. Auswärtige Kulturpolitik kann so in unterschiedlichen Situationen durch
ihren interkulturellen Anspruch z.B. gegen diktatorische, nationalistische, ethnische, und
religiöse Bewegungen wirken.
Alois Graf von Waldburg-Zeil, der Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen stellt fest,
dass die Globalisierung zu einem euro-islamischen Dialogs führen muss: “Es wäre ein Dialog,
bei dem es nicht um einen Wettstreit der Werte, sondern um eine gemeinsame Suche nach den
besten politischen Lösungen für den Umgang mit gemeinsamen Herausforderungen geht. Je
überzeugender demokratische Entwürfe hierbei abschneiden, umso größer wäre die Chance
für Demokratie und Menschenrechte.”265 Auswärtige Kulturpolitik hat ihr Zentrum im
internationalen, kulturellen und wissenschaftlichen Geben und Nehmen, in der Förderung des
Deutschlernens im Ausland und des Fremdsprachenlernens in der Bundesrepublik
Deutschland als Prinzip des gleichberechtigten Austausches. Dazu kritisierte Helmut Glück
auf dem Symposium der Universität Bamberg mit dem Thema ”Wozu DaF studieren?” die
Sonnenberg, St. Andreasberg. Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft. Drucklegung erfolgt : Braunschweig, 2003. 264 Wierlacher, Alois: Vertrautwerden in der Distanz. In: Fremdgänge. Eine anthologische Fremdheitslehre für
den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Wierlacher, Alois /Albrecht Corinna, Hrsg., Inter Nationes, Bonn,
1998, S. 127. 265 Waldburg-Zeil, Alois: Schleichendes Gift. In: Der Dialog mit dem Islam. Zeitschrift für KulturAustausch.
1/02, Stuttgart, S.10.
332
Praxis, wenig qualifizierte Menschen mit diesen Aufgaben zu betreuen.: “In allen diesen
Fällen liegt das politische Deutschland mit dem gelehrten Deutschland über Kreuz, hier
klaffen tiefe Risse zwischen dem, was in der Wissenschaft unstrittig ist und dem, was aus
politischen Gründen für opportun gehalten wird. ‚Die Politik’ will häufig scheinbar billige
Lösungen, die à la longue sehr teuer sind.” 266 Ab Januar 2003 tagt der ‚Beirat für Deutsch als
Fremdsprache’, der vom Auswärtigen Amt eingerichtet wurde. Es beraten 10 Professoren der
Fachrichtung mit.
Realisiert werden sollten diese Aufgaben nicht nur mit Hilfe der dafür zuständigen
Wissenschaftsbereiche wie Deutsch als Fremdsprache, den Rechtswissenschaften, sondern
genauso im Rahmen von Immigrations-, Innen- und Friedenspolitik und in der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Gerade eine ausgezeichnete Qualifikationsgrundlage macht
es den Agierenden möglich, sich am Grundsatz kultureller Wechselbeziehungen im Sinne
einer gegenseitigen Bereicherung nationaler Kulturtraditionen zu orientieren. Interkulturelle
Kompetenz zu erwerben, sich in anderen Kulturen zurecht zu finden, Minderheiten zu
unterstützen und die Menschenrechte einzufordern und umzusetzen, das sind die
Herausforderungen. Die Bundesregierung darf nicht dabei stehen bleiben, vor allem die
aufgeklärten Eliten in der Gesellschaft sowie jetzige und zukünftige Entscheidungsträger in
anderen Nationen mit Mitteln der Auswärtigen Kulturpolitik zu gewinnen, denn das
widerspräche dem demokratischen und friedensfördernden Prinzip des gleichberechtigten
Zugangs zu Fremdsprachen und anderen Kulturen für Frauen wie Männer und für alle
gesellschaftlichen Schichten.
Daraus ergibt sich zwingend, dass sich die gestiegene Bedeutung der Auswärtigen
Kulturpolitik auch in entsprechend aufgestockten Haushaltsansätzen niederschlagen muss.
Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Haushaltsansatz des Jahres 2002 ist auf 0,22 Prozent des
Haushaltes des Bundes abgesunken. 1997 betrug er noch 0,26 Prozent des Bundeshaushaltes.
Eine effektivere, zielorientierte und gut koordinierte Verwendung der Mittel – bei klarer
Abgrenzung der Kompetenzen – versteht sich von selbst und muss sichergestellt werden, wo
das nicht der Fall ist. Insbesondere die Verteilung der Mittel für Auswärtige Kulturpolitik auf
neun Bundesressorts und das Fehlen nachweisbar effizienter Koordinierungsinstrumente im
266 Glück, Helmut: Wozu DaF studieren? In: Dr. Rabes Hochschulreihe Band 6, 1998, Helmut Glück/Kristine
Koch, Hrsg., S.76.
333
Bereich der Mittlerorganisationen, wie es auch aus dem empirischen Teil C dieser Arbeit
heraus deutlich wird und wie in der Expertenanhörung des Auswärtigen Ausschusses
festgestellt, fordern Kritik heraus. Es ist ein orientierungsloses Herumlavieren, indem man
einerseits fordert, dass ”die Mittel für die Auswärtige Kulturpolitik und ihre Träger [...]
erhöht werden [müssen]”267 und andererseits im Bericht der Bundesregierung vom 14.
Februar 1996 hervorhebt, dass ”auch mit weniger Geld [eine] umfassende und überzeugende
Auswärtige Kulturpolitik [betrieben]” werden muss. Es sollte Außenminister Fischer, trotz
der beengten Haushaltslage, ermöglicht werden, die Prioritäten, die er in der Auswärtigen
Kulturpolitik erkannt hat, auch mit den dafür nötigen Finanzen in Zukunft umzusetzen.
1.1. Für eine bessere Finanzierung der deutschen Auslandsschulen
Die Finanzierung der Auswärtigen Kulturpolitik gibt Anlass zu breiter Diskussion. Häufig
steht die Umstrukturierung der Auswärtigen Kulturpolitik unter dem Primat der
Haushaltsdiskussion. Zum Kurs der Bundesregierung bemerkt Hans Zehetmaier, sie käme
ihren Verpflichtungen nicht nach: “Erst vor zwei Wochen stellte der für die Auslandsschulen
im Auswärtigen Amt zuständige Staatssekretär Jürgen Chrobog in der Kultus-
ministerkonferenz fest: ‘Die deutschen Auslandsschulen sind ans Ende gespart.’ Und so
kommt es, dass der Außenminister in glühenden Farben vom Dialog der Kulturen schwärmt,
der nach dem 11. September so besonders wichtig sei, während sich andererseits die kleine
Deutsche Schule in Teheran wegen finanzieller Auszehrung kaum noch über Wasser halten
kann. Ich zitiere aus der Kultusministerkonferenz vom November, was beim letzten Treffen
über alle Parteigrenzen hinweg für einhellige Empörung gesorgt hat: ‘Die Haushaltsplanung
des Bundes bis 2004 sieht eine weitere Absenkung des Schulfonds vor. Damit können
laufende Verpflichtungen der Auslandsschularbeit im Sinne der von Bund und Ländern
gemeinsam getragenen Auswärtigen Kulturpolitik nicht mehr unter den bisherigen
Ansprüchen von Unterrichtsqualität und Schulabschlüssen erfüllt werden und auch die
267 Deutscher Bundestag, Bericht der Bundesregierung: Kinkel, Klaus, Bundesaußenminister Rede vom 23. Mai
1995.
334
notwendige Berücksichtigung von Wirtschaftswachstumsregionen in der Auslandsschularbeit
kann nur sehr eingeschränkt erfolgen.’” 268
Im Konzept zum Auslandsschulwesen stellt die Bundesregierung im März 2000 fest:
“Von den Sparmaßnahmen der Bundesregierung zur Konsolidierung des Bundeshaushalts
2000 bis 2003 bleiben die Auslandsschulen nicht ausgenommen. Im Jahr 2000 sinkt der
Schulfonds um 7% auf 357 Millionen DM. Bis 2003 folgen weitere jährliche Absenkungen
um 8 Millionen DM. Nach sorgfältiger Einzelprüfung wird die personelle und materielle
Förderung der Schulen den Sparbeschlüssen angepasst. Notwendige Baumaßnahmen (Neu-
bauten u.a. in Peking, Budapest und Prag sowie Sanierungen in Paris und Istanbul) werden
fortgesetzt. Die Einsparungen werden erreicht durch:
Ergänzung des Einsatzes vergleichsweise teurer Auslandsdienstlehrkräfte durch kostengüns-
tigere Bundes- und Landesprogrammlehrkräfte sowie Ortskräfte.
Straffung des Lehrerentsendeprogramms MOE/GUS (Konzentration auf Sprachdiplomarbeit,
Pädagogenfortbildung und Mittelpunktschulen der deutschen Minderheit).
Qualität und Substanz des deutschen Auslandsschulwesens bleiben trotz der Kürzungen und
der daraus oft folgenden Schulgelderhöhungen gewahrt. ”269
Dass trotz massiver Kürzungen Qualität und Substanz des Auslandsschulwesens erhalten
bleiben werden, ist die übliche Beschwichtigungsformel von Haushaltspolitikern. Die Realität
wird anders aussehen. Allein in den Haushaltsjahren 2001/2002 betrugen die Kürzungen für
die deutschen Auslandsschulen 10,84 Millionen Euro, von 1998 bis 2003 trotz des Ausbaus
der Europäischen Schulen 20,45 Mio €. Unter der sich entscheidend verändernden
Berufsperspektive für Lehrer ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren kaum noch
qualifizierte Bewerber für Arbeitsplätze bei den deutschen Kulturinstituten im Ausland zur
Verfügung stehen. Die Kultusministerien werden ihrerseits unter dem drohenden
Lehrermangel dafür sorgen, dass die Zahl der von ihnen Entsandten drastisch reduziert wird.
268 Zehetmeyer, Hans: Anmerkungen zum Sparkurs der Bundesregierung. In: Frankfurter Rundschau vom 20.
12. 2001. 269 Bundesregierung: Auswärtige Kulturpolitik-Konzeption 2000 für das Auslandsschulwesen, Berlin, März
2000.
335
Auf ihrem ersten Weltkongress in Mexiko-Stadt im April 2002 suchten die deutschen
Auslandsschulen nach Möglichkeiten, mit dem knappen Budget umzugehen. “So beschlossen
die Teilnehmer, noch vor Jahresende in Berlin einen ‚Weltverband der Schulträger Deutscher
Auslandsschulen” zu gründen. Er soll die Zusammenarbeit mit staatlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Einrichtungen verbessern – nicht zuletzt um die Finanzen zu sichern.”270
Befremdlich ist es, die für die Schulen vorgesehenen Mittel von zwischen 1998 und 2001 von
192 Millionen Euro auf 177 Millionen Euro zu senken und dann in einer Bundestagsdebatte
zu sagen: “Wir haben im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens im Haushalt den Titel für
die Auslandsschulen aufgestockt – und zwar um 5 Millionen Euro.”271 Die Bundestagsdebatte
am 21. März 2002 zur Zukunft der Deutschen Auslandsschulen hat verdeutlicht, dass weitere
Einsparungen nicht möglich sind, selbst Mitglieder der Regierungsfraktion sehen dies so:
“Die Auslandsschulen sind in einem sehr guten Zustand. Aber man muss dazu sagen, dass wir
uns allmählich doch überlegen müssen, ob noch weitere Kürzungen vorgenommen werden
dürfen.272 Im Gesamthaushalt der Auswärtigen Kulturpolitik sind für 2003 Kürzungen
vorgesehen. Jedoch wird eine Bestandssicherung für die Deutschen Schulen gegeben. Das
heißt, die Kürzungen werden das Goethe-Institut treffen.
Wie sich bei der Beschreibung der Deutschen Schulen im Ausland im Teil C zeigt, variiert
das Schulgeld sehr stark. Vielen Eltern fällt es schwer, bei solch hohen Zahlungen – bis 8000
Euro jährlich – ihre Kinder weiterhin auf die Deutschen Schulen zu schicken. Auch Firmen
und Unternehmen, denn sie bringen oft das Schulgeld auf, werden sich in Zukunft den Wirt-
schaftlichkeitsfaktor von Mitarbeitern mit mehreren schulpflichtigen Kindern im Ausland vor
Augen führen. Die Zukunft der Schulen hängt auch davon ab, ob ihr Besuch erschwinglich
bleibt. Man versucht von politischer Seite Kosten zu dämpfen, z. B. mit folgendem Vor-
schlag: “Die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern wird verstärkt und
kontinuierlich besser: der Ausbau der EuroCampus-Schulen z. B. in Kooperation zwischen
270 Geinitz Christian: Lehren in Zeiten des Sparens. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. April 2002, S.
10. sowie Geinitz Christian: Deutsche Schulen im Ausland. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.4.2002, S.10. 271 Grießhaber, Rita. In: Protokoll der 227.Sitzung des deutschen Bundestages vom 21.März 2002. S.22532-
225318. 272 Mark, Lothar (SPD). In: Protokoll der 227.Sitzung des deutschen Bundestages vom 21.März 2002 S.22532-
22539.
336
Frankreich und Deutschland in Shanghai oder das gemeinsame Kulturzentrum von Goethe-
Institut und British Council in der Ukraine sind nicht nur Ausdruck sparsameren
Wirtschaftens, sondern auch Beispiele für die zurecht geforderte europäische
Zusammenarbeit.”273
Das Thema der Rede von Dagmar Schipanski (damalige Präsidentin der
Kultusministerkonferenz) auf der ersten weltweiten Konferenz Deutscher Auslandsschulen,
war: “Das Auslandsschulwesen im Spannungsfeld zwischen Bildungsqualität und Budget.”
Sie appellierte vor allem an die Länder, die Unterstützung der Deutschen Auslandsschulen
fortzusetzen. Auch brachte sie ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass deutsche
Unternehmen im Ausland die Schulen oft finanziell unterstützen und rief zu weiteren Spenden
auf. Zum Stichwort ”sponsoring” ist dennoch dem Bildungsrechtler L. Dietze zuzustimmen,
wenn er sagt: “Doch ist nicht zu erwarten, das bei allen Bemühungen um die Erschließung
neuer Einnahmequellen für die Schulbildung das öffentliche Schulwesen nach
niederländischem Vorbild privatisiert wird, oder die Schulaufsicht nach schwedischem
Vorbild radikal reduziert werden wird.”274
1.2. Deutsche Schulen zukünftig in der Hand der Wirtschaft?
Nachhaltigkeit Auswärtiger Bildungspolitik war das Thema der Sonnenberg-Tagung der
GEW im November 2002. Eva-Maria Stange, Vorsitzende des Bundesverbands der GEW
fragte bei der entsprechenden Podiumsdiskussion die Teilnehmer, ob sich ein neues
Bewusstsein anbahne, ob eine Modernisierung der inhaltlichen Arbeit stattfinde in Anbetracht
dessen, dass bis zum Jahr 2020 die Hälfte der jetzigen Lehrerschaft in Pension gehen werde.
Der Abteilungspräsident der ZfA, Lauer, betonte, dass Nachhaltigkeit eine Frage der
Auswirkung auf die nächsten Generationen sei. Es gebe seit 1999 einen Fragebogen an die
Schulleitungen, von denen mehr als zuvor Rechtfertigung verlangt werde. Es werde gefragt,
welche Persönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, kulturellem und öffentlichem Leben die
Schule hervorgebracht habe. Dabei werde ein besonderes Augenmerk auf die Leistungsträger
der Gesellschaft gerichtet. Es werde auch gefragt, wie man durch Veranstaltungen auf die
273 ebd. 274 Dietze, Lutz: Bildungsrecht. Aktuelle und europäische Aspekte. In: Pädagogik. Handbuch für Studium und
Praxis, Leo Roth, Hg. München, 2001, S.613.
337
Schule aufmerksam mache. Er betonte den Wunsch der Eltern, dass die Schule für ihre Kinder
international eine Spitzenstellung einnehme und dass der Schulentwicklung breiter Raum
eingeräumt werde. Die Netzwerkbildung der Deutschen Schulen zu einem Weltverband
werde eine positive Rolle spielen. Er bemängelte, dass die Wahrnehmung der Deutschen
Schulen im Ausland in Deutschland zu wünschen übrig lasse. Vieles, was geleistet werde, sei
wenig glamouröse Kleinarbeit. Er wertete die Tätigkeit im Ausland auch als Investition in die
Zukunft für die Inlandsschulen.
Der Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHK), Klause, konterte und hob
die Leistung der deutschen Wirtschaft für die Deutschen Auslandsschulen hervor. Seine Frage
war: Wo bewegen wir uns im globalen Bildungsmarkt? Er meinte, es fehle die ordnende
Hand. Die Deutschen Schulen seien lange Zeit in ihrer quantitativen Wirkung unterschätzt
worden. “Bei Begegnungsschulen laufen sie bei uns offene Türen ein,” so seine Aussage. Im
schwierigen Umfeld der Schule müsse der Lehrer die Qualität aufrecht erhalten. Berufliche
Bildungsgänge müssten weiter gefördert werden. Er wies auf die Stellungnahme des DIHK
hin, in der es heißt: “Der DIHK hat mit einem Tag der Deutschen Auslandsschulen am
19.März 2002 erstmals für die deutsche Wirtschaft auf die Bedeutung der Auslandsschulen
für den Standort Deutschland und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Unternehmen hingewiesen. In Briefen an die Bundesregierung, einschlägige Ausschüsse des
Parlaments und an die Kultusminister der Länder wurde vom DIHK auf die Konsequenzen
einer falschen Sparpolitik aufmerksam gemacht.”275 Schule laufe nicht mehr so, wie die
Wirtschaft sich das vorstelle. Man fordere mehr Personal- und Rückkehrer-
Entwicklungsmöglichkeiten für die Lehrer. Die Politik habe die strategischen Positionen nicht
im Blickfeld: Eine Brücke zu Deutschland, auch als Exportnation zu schlagen, Deutsche
Schulen sollten zur Elitebildung beitragen und einen positiven Beitrag zur
Einwanderungspolitik und zur Außenwirtschaft bilden. Die Schulen seien aus Projekten der
Wirtschaft hervorgegangen, sie gehörten grundsätzlich in den Rahmen der Wirtschaftspolitik.
Auf die Frage der Gewerkschaftsvorsitzenden Stange, ob die Schulen weiterhin unter der
Kontrolle des Auswärtigen Amtes stehen sollten oder in privater Trägerschaft weitergeführt
werden, antwortete der DIHK-Vertreter, dass es die Forderung des DIHK sei, den Schulen
einen stärkeren unternehmerischen Status zu verleihen, über den sie mit mehr Verantwortung
275 DIHK: Zur Zukunft der Schulen im Ausland. 16.4.2001.S.1
338
für ihre Leistungserstellung auch eine größere Unabhängigkeit und Eigenverantwortung
erhalten sollten. Das ginge über den Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
weit hinaus. Der Leiter der Schulabteilung im Auswärtigen Amt, Vortragender Legationsrat
Lauk, widersprach dieser Auffassung. Die Schulen seien Teil einer außenpolitischen
Philosophie und ihre Inhalte außenpolitischer Natur. Der europäisch-islamische Dialog z.B.
sei ein politischer Auftrag der Erziehung zu Weltoffenheit, Austausch und Multiethnizität.
Deshalb sei auch in der Konzeption 2000 in den Leitlinien für die Deutschen Schulen die
Begegnung mit der Gesellschaft und der Kultur des Gastlandes als erstes Ziel benannt
worden. Die Deutschen Schulen im Ausland seien eine originäre Aufgabe des Auswärtigen
Amtes, das gehe allein aus der haushaltsrechtlichen Lage hervor. Das AA stelle die Mittel.
Schulbeihilfe, Regelförderung, Projektförderung für pädagogische und soziale Projekte, das
alles sei Sache des AA. Warum sollten die Länder sonst bereit sein, die Lehrkräfte zu
beurlauben? Die ordnende Hand sei durch das pädagogische Grundkonzepte gegeben. 12-
jährige Schulzeit, ein eigenes Schulprofil und Schulentwicklung seien hier zu nennen. Die
Tatsache, dass der Bundespräsident auf seinen Reisen auch die Auslandsschulen besuche,
ebenso wie der Außenminister und die Abgeordneten, zeige dass großes
Verantwortungsbewusstsein bestehe. Die Deutsche Sprache schaffe Zugang und Affinität zur
deutschen Kultur und Wirtschaft.
Es tat sich bei der Diskussion eine Gemengelage zwischen Kultur und Wirtschaft auf. Die
Unmittelbarkeit der Bedürfnisbefriedigung und des Mehrwertes sind Faktoren der Wirtschaft,
nicht der Kultur. Kultur beinhaltet Werte, die nicht in Zahlen auszudrücken sind.
Wirtschaftsgüter kann man zwar kulturell betrachten und die Außenseite der Kultur ist
marktfähig, insofern begegnen sich beide. Im Kern geht es aber um einen eigenen
Wertbereich, der eigenen Gesetzen unterliegt und darin von der Wirtschaft unterstützt werden
sollte. Wirtschaftliche und kulturelle Nachhaltigkeit sind darüber hinaus unterschiedlich zu
sehen. Kulturelle Nachhaltigkeit kann auch gegeben sein, wenn die wirtschaftliche Präsenz
nicht (mehr) gegeben ist.
339
1.3. Stiftungen und Sponsoring in der Auswärtigen Kulturpolitik276
Für die im argen liegende Finanzierung der Auswärtige Kulturpolitik sollen Stiftungen eine
zunehmende Rolle spielen. Aus diesem Grunde wurde auch über ein neues Stiftungsgesetz
diskutiert. Eine Veränderung des Sponsoring- und Stiftungsrechts war dringend notwendig,
um der Kultur weitere Einnahmen aus dem privaten Sektor zukommen zu lassen. Stiftungen
bieten als gemeinnützige Einrichtungen engagierten Bürgern, Unternehmen und Institutionen
die Möglichkeit, Kunst und Kultur finanziell zu unterstützen und damit auch die öffentliche
Hand zu entlasten. In den Vereinigten Staaten ist die Tradition Geld in Stiftungen zu
investieren viel weiter verbreitet. J. F. Kennedy prägte dieses Bewusstsein mit dem
Ausspruch ”Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für euer Land tun
könnt.”
Auch in Deutschland ist der gute Wille vorhanden: Jedes fünfte Unternehmen will künftig
seine Kulturausgaben erhöhen, so wie auch kulturbegeisterte und wohlhabende Menschen in
Zukunft privates Vermögen in den Kulturbereich einfließen lassen wollen. Mit Forderungen
276 Stiftungsdebatte:
Es lagen folgende Texte vor:
Neue Stiftung will gegen Feindbilder angehen. In: Die Welt vom 6. 6. 1998, S. 4.
Hammerthaler, Ralph: Jenseits des Lamentierens. In: Süddeutsche Zeitung vom 5. 6.1998, S. 14.
Ziegert, Susanne: Imagetransfer über Kultur. In: Die Welt vom 13. 5. 1998, S. 26.
Maass, Kurt- Jürgen: Wider die Verstaatlichung des Daseins. In: Wirtschaft und Wissenschaft. Stifterverband
für die deutsche Wissenschaft, Hg. Nr. 1, 1998.
W, Albert: Die Zukunft des Goethe-Instituts, Brief an die Regionalbeauftragten, Juni 1998.
Vollmer, Antje: Die Neuorientierung und Weiterentwicklung der Bundeskulturpolitik ist überfällig. (Antrag)
Bundestagsdrucksache 13/9796, vom 28. 1. 1998.
Vollmer, Antje: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Stiftungswesens, (Gesetzentwurf), Bundestags-
drucksache 13/9320, 1.12.97.
Vollmer, Antje: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Stiftungswesens. Drucksache 14/.. Fassung vom
23.März 1999.
Glasmacher, Virginia: Staat in Bringeschuld. In: Zeitschrift für KulturAustausch 2/96, Stuttgart, S.26ff.
Bertram, Hans-Bodo: Kultur ist kein Hilfsmotor der Exportwirtschaft. In: Zeitschrift für KulturAustausch. 2/96,
S.32ff.
Strahlendorf, Peter: Kultursponsoring – Retter der Auswärtigen Kulturpolitik? In: Zeitschrift für Kultur-
Austausch. 2/96, S.34ff.
340
für attraktiveres Sponsoring wurden außerdem von verschiedenen Seiten Vorschläge für ein
besseres Konzept des Gesetzgebers ausgearbeitet, wie z.B. ”10 Empfehlungen zur
Verbesserung des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts”, die vom Bundesverband
Deutscher Stiftungen, dem Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dem
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft vorgelegt wurden. Außerdem gibt es viele
Initiativen zur Ankurbelung des Kultursponsorings, wie z. B. die “Düsseldorfer Erklärung”277
von Klaus Staeck und Hans Haacke.
Einen etwas anderen Weg schlägt die “Gemeinsame Erklärung der Konrad-Adenauer-Stiftung
e. V., Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Friedrich-Naumann-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
und der Heinrich-Böll-Stiftung zur staatlichen Finanzierung der Politischen Stiftungen”278
ein. Darin vertreten die der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der Freien Demokratischen Partei Deutschlands
und der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen nahestehenden Stiftungen, dass sie “von den
Parteien rechtlich und tatsächlich unabhängig sind und ihre Aufgaben selbstständig,
eigenverantwortlich und in geistiger Offenheit wahrnehmen.” Aus ihrem Aufgabenkatalog
leiten die Stiftungen ihren Anspruch auf staatliche Förderung: “Die Förderung der
gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit, Information und Politikberatung
der Politischen Stiftungen ist Bildungsförderung im gesellschaftlichen Pluralismus.”279 Ein
Aufgabenschwerpunkt der Politischen Stiftungen ist die Auswärtige Kulturpolitik: Ziel ist
u.a.“durch Informationen und internationale Begegnungen die europäischen
Einigungsbestrebungen unterstützen und zur Völkerverständigung beitragen.”280
Gemeinsames Anliegen aller ist es für verbesserte Rahmenbedingungen in der privaten
Kulturförderung einzutreten, aber gleichzeitig vor dem Rückzug des Staates aus seiner
Verantwortlichkeit in der Kulturförderung zu warnen: Jede private Mark, die zusätzlich in die
Kultur fließt, ist zu begrüßen. Jede private Mark jedoch, die eine öffentliche ablöst, birgt eine
Gefahr einseitiger Einflussnahme von Privatpersonen und Unternehmen auf öffentliche
277 Staeck, Klaus; Haacke, Hans: Düsseldorfer Erklärung. In: Zeitschrift für KulturAustausch 2/96, S. 55. 278 Gemeinsame Erklärung zur staatlichen Finanzierung der Politischen Stiftungen. In: Friedrich Naumann
Stiftung, http://www3.fnst.de/stiftung/datenundfakten/gemerkl.phtml vom 22.07.2002 279 a.a.O. Dritter Abschnitt 1. 280 ebd. S.1.
341
Institutionen, so die einhellige Meinung aller Initiativen. 1998 wurde der erste Antrag für ein
neues Stiftungsrecht in den Bundestag eingebracht. Die Kulturausschussvorsitzende, Monika
Griefahn, und die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer entwickelten diesen mit dem
Rechtsexperten Ludwig Stiegler in der 14. Legislaturperiode weiter. Das neue Stiftungsrecht
gäbe es nicht ohne sie. “Stiftungen waren immer ein freiheitliches Instrument, mit dessen
Hilfe Bürger ihren Willen und ihre Fähigkeit zur Gestaltung ihrer sozialen und kulturellen
Umwelt zum Ausdruck gebracht haben, [....] Wir werden mit dem ‘Gesetz zur weiteren
steuerlichen Förderung von Stiftungen’ die finanziellen Rahmenbedingungen von Stiftern und
Stiftungen wesentlich verbessern.”281
Als Konsens aller Bemühungen wurde durchgesetzt:
- Verbesserung des Betriebsausgabenabzugs bei Kultursponsoring,
- Das Engagement der Sponsoren wird steuerlich honoriert.
Als der Bundesfinanzminister Hans Eichel bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2002
vorschlug, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an kulturelle Einrichtungen wieder
zu streichen, hagelte es Protest. Die designierte Kulturstaatsministerin Christina Weiss
äußerte dazu: “Damit hätte ich meinen Job nicht angetreten, das habe ich dem Kanzler klar
gesagt. Nein, das wäre ein zu schlechter Start gewesen.” 282 So wurde das Vorhaben Hans
Eichels nicht umgesetzt.
Peter Strahlendorf sieht in einem Artikel ”Kultursponsoring – Retter der Auswärtigen
Kulturpolitik?” den Widerspruch zwischen Wirtschaft auf der einen und Kultur auf der
anderen Seite in dem Bestreben der beiden Seiten, die eigene Position zu wahren. Das heißt,
die Kunst will unabhängig sein und nicht dem Einfluss der Sponsoren unterliegen und die
Wirtschaft bzw. die Sponsoren können nur investieren, wenn sich das Engagement lohnt. Als
ein dritter Faktor tritt die Politik hinzu, die auf die leeren Kassen verweist und nach
innovativen Handlungen und Denkanstößen sucht. Die erreichte attraktivere Gestaltung des
Kultursponsorings kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Das Zusammenwirken von
Außenpolitik, Kommerz und Kultur hat gute Chancen, Erfolg zu haben, indem der Staat die
Basisarbeit sichert und die Wirtschaft durch kulturelle Top-Events die Öffentlichkeit für sich
281Vollmer, Antje: Partner im öffentlichen Diskurs. In: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 18.2.2000,
Artikel AG 7/2000, Gastkommentar: Antje Vollmer. 282 Schlüter, Christian: Kultur-Lobby- Arbeit. In: Frankfurter Rundschau. 6.11.2002. S.17.
342
gewinnt. Dabei besteht die Gefahr, dass sich der Staat um die mühsame Basisarbeit kümmern
muss, während sich die Wirtschaft die Rosinen heraus pickt.
Als Förderer des Kultursponsorings zeigt sich Hilmar Hoffmann. Er wirbt um Mitglieder für
die ”Freunde und Förderer des Goethe-Instituts.”283 So wurde z. B. im Jahr 2000 auf der
EXPO der Themenpavillons des Goethe-Instituts ”Forum Wasserwelten” gesponsert. Zu den
Bemühungen des Präsidenten um Sponsoring, bemerkt die FAZ: ”Inzwischen nutzte
Hoffmann seine Kontakte in Politik und Wirtschaft zum Klinkenputzen - er ging, neudeutsch
gesprochen, zum ‚fundraising‘. Fünf Millionen Euro will er als Kapitalstock für eine Goethe-
Stiftung sammeln, die Projekte im Ausland unterstützen soll. [...] Als ‚Partner der Wirtschaft‘
hat er sein Haus in Stellung gebracht, bietet Imagetransfer mit kulturellem Gütesiegel für
Firmen wie BMW, Preussen Elektra, DaimlerChrysler. Im ‚Freundeskreis Wirtschaft‘ des
Instituts sitzen mehrheitlich [...] hochvermögende Industrieführer.”284 Doch sei hierbei auch
an die Aussage des Leiters der Kulturprogramme in München, Dr. Georg Lechner erinnert,
der das Kultursponsoring für völlig überbewertet hält. Im Schulbereich wird das Sponsoring
in etwa auf 1% der Ausgaben, mit der baulichen Komponente auf 5% geschätzt.
Bundeskulturstiftung
Eine Bundeskulturstiftung wird schon seit der Ideengebung von Willy Brandt diskutiert. Was
diese genau tun soll, wer Geldgeber ist, darüber streiten sich die Politiker. Das wichtigste
Kulturthema des Jahres 2001 war die Frage, ob und wann es zur Gründung einer weiteren
gemeinsamen Kulturstiftung von Bund und Ländern kommen wird und ob der Bund eine
solche Stiftung gegebenenfalls auch allein einrichten kann oder will. “Fünfundzwanzig
Millionen Mark hat Hans Eichel für das kommende Jahr spendiert, ohne genau zu wissen,
wofür; im Jahr darauf sollen es fünfzig werden und ein weiteres Jahr später gar
fünfundsiebzig - falls es die Haushaltslage dann noch hergeben sollte. Zum Ausgleich für
diese Spendierfreudigkeit spart sich der Bund ein schlüssiges Konzept, wofür das viele Geld
denn nun eigentlich ausgegeben werden soll. Die Zwecke haben sich seit den Tagen Michael
Naumanns und der Erstvorstellung des Projekts durch Julian Nida-Rümelin bis zur
283 Goethe-Institut - Partner der Wirtschaft. http//www.goethe.de, Internetseite Stand: 2001. 284Geyer, Christian: Partnerin, Achtundsechzig verweht: Das Goethe- Institut wählt. In: Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 15.1.2002, S.41.
343
vollständigen Beliebigkeit geändert. Weder der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien
noch sonst irgendein Verfechter der geplanten neuen Kulturstiftung hat bisher die simple
Frage beantwortet: Gibt es irgendein Vorhaben, das die geplante neue Kulturstiftung besser,
effektiver, umfassender fördern könnte als die bisherige Kulturstiftung der Länder? Im
Wissen darum, dass man sich auf verfassungsrechtlich dünnem Eis bewegt, wurde aus der
ursprünglich beabsichtigten Förderung innovativer Projekte im Bereich zeitgenössischer
Kunst – die Länder sollten dafür exklusiv die Denkmalpflege bekommen! – die Förderung
‘innovativer Projekte im internationalen Kontext’.”285
Martina Meister stellt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fest: ”Als Julian Nida-Rümelin
Naumanns Erbe antrat, erklärte er das Projekt einer Bundeskulturstiftung sofort zur
Herzensangelegenheit. [...] Nida-Rümelins Vorgänger Michael Naumann hatte vor zwei
Jahren die alte Idee von Günter Grass und Willy Brandt wiederbelebt und die Gründung einer
Bundeskulturstiftung angeregt. Naumann dachte damals noch an eine Art Feuerwehrtopf, der
überall dort zum Einsatz kommen sollte, wo Not an der Kultur ist. Ihm schwebte
beispielsweise der Rückkauf von Beutekunst vor. [...] Als Think-and-Money-Tank gedacht,
sollte sich um die Kulturstiftung ein Netzwerk bilden mit einem Schwerpunkt im
internationalen Austausch.”286
Eine solche Stiftung, glaubte seinerzeit Willy Brandt, würde viele Träume erfüllen. Nun ist
der Traum in Erfüllung gegangen. Die Nationalstiftung wird ab 2002 über einen Etat von 12,8
Millionen Euro, im folgenden Jahr über 25,6 und schließlich über 38,3 Millionen Euro zur
Förderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbesondere zur
kulturellen Integration, Kooperation und Innovation verfügen.
Als die UNESCO im August 2002 die internationale Gemeinschaft aufrief, die durch das
Hochwasser in Deutschland, Österreich und Tschechien beschädigten Kulturgüter zu
bewahren und zu sanieren, reagierte Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin sofort. Er
stellte zwei Millionen Euro Soforthilfe als Grundstock aus der Bundeskulturstiftung für die
im Verlauf der Katastrophe beschädigten oder auch gefährdeten Kulturgüter zur Verfügung.
Diese befinden sich entlang der Flussläufe von Mulde, Elbe und Moldau und deren
285 Zehetmeyer, Hans: Anmerkungen zum Sparkurs der Bundesregierung. In: Frankfurter Rundschau vom 20.
12. 2001. 286 Meister, Martina: Alleingang - Quo vadis Kulturstiftung? Frankfurter Rundschau vom 20. 12. 2001, S.17.
344
Nebenflüsse. Auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes stehen der Zwinger und die
Semperoper in Dresden, die von den Fluten umspült waren. In Dessau konnte ein Deich an
der Mulde nicht gehalten werden, die Bauhausarchitektur ist gefährdet. Das historische
Zentrum und das alte jüdische Viertel in Prag, standen unter Wasser, die Moldau wurde zum
reißenden Strom. Die Gedenkstätte im früheren Konzentrationslager Theresienstadt musste in
aller Eile geräumt werden. In Südböhmen stand das Wasser ebenfalls in den Altstädten der im
Weltkulturerbe verzeichneten Städte von Cesky Krumlov und Ceske Budejovice. Hier bieten
sich Ansätze zu einer freundschaftlichen deutsch-tschechischen Zusammenarbeit, um das
gemeinsame europäische Kulturerbe zu erhalten. Beiträge der Bundeskulturstiftung sind
sicher ein richtiger Schritt dazu. Man darf gespannt sein, wie sich die Stiftung
weiterentwickelt.
2. Umstrukturierung von Goethe-Institut und Inter Nationes
2.1. Finanzielle Aspekte und Schließungen
”Wo es im tiefsten Innern grollt und zürnt, ist Sarkasmus keine rhetorische Entgleisung. Und
es scheint, als habe sich tief im Innern Hilmar Hoffmanns, des scheidenden Präsidenten des
Goethe-Instituts Inter Nationes, ein enormes Frustrationspotential angesammelt. Kurz vor
Beendigung seiner fast neunjährigen Amtszeit zog Hoffmann in Berlin Bilanz - hinsichtlich
der Aktivitäten seines Instituts im vergangenen Jahr, der Erfolge und Rückschläge,
insbesondere aber hinsichtlich der Verheerungen, die durch die rigide Sparpolitik der
Bundesregierung in der auswärtigen Kulturarbeit entstehen. Resignative Untertöne waren
unüberhörbar, so in der sarkastisch geäußerten Erkenntnis, das einzige stabile Moment in der
auswärtigen Kulturpolitik seien Haushaltskürzungen. Man dürfte aus solcherlei harscher
Kritik am ‚Eichel-Plan‘ und den damit verbundenen Mittelkürzungen wohl die Philippika
eines Mannes herausfiltern, der fürchtet, um die Früchte seiner Arbeit gebracht zu werden.
Offenkundig sind die Schließungen auswärtiger Institute für Hoffmann kein purer
administrativer Akt, und wenn er wiederholt von einer ‚Chronique scandaleuse‘ sprach,
verdichtete sich der Eindruck, hier zähle einer nicht nur exotische Städtenamen auf, sondern
Leidensstationen. Es war anrührend und sollte als Appell des scheidenden Präsidenten nicht
im Raum verhallen, wenn von ‚Liebesentzug‘ für die betroffenen Länder die Rede war und
nicht etwa nur von einem Prestigeverlust für die Bundesrepublik und ihre Regierungsorgane.
345
Man spürte, dass die geplante Rückführung des Etats auf den Status von 1989 wie ein
Damoklesschwert über dem Goethe-Institut und seinem Fusionspartner Inter Nationes liegt.
Rund 4,5 Millionen Mark sollen durch die übliche ‚Verschlankung‘ des Apparats eingespart
werden, eine abstrakte Summe, die erst an kurios anmutenden Beispielen anschaulich wird,
etwa wenn zu hören ist, dass es im Goethe-Institut in Kairo fast zu Prügeleien um deutsche
Tageszeitungen kommt, weil diese nur in jeweils einem Exemplar vorhanden sind.
Bestürzend, vielleicht aber auch heilsam, ist, dass erst der Septemberterror die Einsicht
fördern musste, dass Friedenspolitik über Kulturpolitik erfolgen muss und allemal billiger ist
als ein Spürpanzer. ”287
Das vom Goethe-Institut, nach dem "Eichel-Plan" zu erbringende Kürzungsvolumen beläuft
sich zum Jahr 2003 auf ca. 14 Millionen €. Die Maßnahmen der Bundesregierung zwangen
das Goethe-Institut allein im Jahr 1999 zwölf Institute im In- und Ausland zu schließen. Seit
1989 wurden insgesamt achtunddreißig Institute geschlossen und neunzehn eröffnet. Da die
Schließungen immer auf erheblichen Widerstand aller Betroffenen stoßen, verfolgt das
Goethe-Institut offensichtlich seit einigen Jahren die Strategie der sogenannten
‘Umstrukturierungen’.”288 Hilmar Hoffmann, hat sich immer wieder vehement gegen
Schließungen von Goethe-Instituten gewandt. “Die uns durch den Sparkurs der Regierung
aufgezwungenen Maßnahmen", so Hoffmann, "berühren den Kern unseres Auftrags und
zerstören an einigen Standorten die Früchte jahrzehntelanger Arbeit. Wir können der
Bundesregierung die Nachricht nicht ersparen: Deutschland wird durch diese Politik Freunde
verlieren."289 Auch der Betriebsrat befasst sich mit den Institutsschließungen, den
Stellenkürzungen und den allgemeinen Sparmassnahmen: “Zusätzlich zu den finanziellen
Kürzungen von 7,6 Mio DM erhielt das Goethe-Institut erstmals keine sogenannten
Personalverstärkungsmittel mehr, d. h. der personell verursachte, aber nicht planbar gewesene
finanzielle Mehrbedarf musste aus eigenem Haushalt erwirtschaftet werden. [...] Das Goethe-
Institut wird ein anderes werden, und zwar ‚freiwillig’. Es wird nicht nur die Landkarte für
287 Lehnart, Ilona: Der Betrogene. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. 12. 2001, S. 49. 288 ebd. 289 ebd.
346
das GI verändert, sondern die Identität des Goethe-Institute selbst, und die der einzelnen
Institute wird anders,”290 so Marion Haase in den Mitteilungen des Betriebsrats.
Unter den oben beschriebenen Voraussetzungen wurden folgende elf Institute bis zum 31.
12.1999 geschlossen:
York, Großbritannien;
Patras, Griechenland;
Chania, Griechenland;
Nicosia, Zypern;
Genua, Italien;
Toulouse, Frankreich;
Seattle, USA;
Ann Arbor, USA;
Houston, USA;
Vancouver, Kanada;
San José, Costa Rica.
Betroffen von diesen Maßnahmen waren insgesamt ca. 130 Arbeitsplätze an den genannten
Instituten, d. h. überwiegend Ortskräfte und 10 Entsandte im höheren Dienst. Die
Schließungen des Jahres 1998 habe ich im Teil B dieser Arbeit unter dem Kapitel: ”Ein
Markstein wird demontiert”, aufgeführt. Bei den Schließungen oder Zusammenlegungen von
Goethe-Instituten war Europa seit 1989 am stärksten betroffen, während gleichzeitig die
anderen Mittler, wie der DAAD, hier ihre Präsenz ausbauen. Die oben genannten Goethe-
Instituten und z. B. die in Malmö Turku, Bergen, Coimbra, Reykjavik, Marseille Patras,
Chania, Genua, Toulouse sind hier zu nennen.
Inkonsequent, angesichts der Klagen über die Schließungen, wurden von Hilmar Hoffmann
und den zuständigen Fachkräften Kriterien für erhaltenswerte Institute benannt.291 Im
Folgenden Beispiele aus dem Kriterienkatalog, der als Hintergrund für weitreichende
Entscheidungen wie Schließungen von Instituten, dient :
290 Haase, Marion : Mitteilungen des Betriebsrats 1/98. In: Auslandsinstitute- auf dem Weg wohin? München,
1998, S.11ff. 291 Goethe – Institut: Umstrukturierung des Institutsnetzes im Ausland: Schließungen. Standortanalyse. Goethe-
Institut Bereich 02, Planung und Kontrolle. München, 1997.
347
Auskunft über die Anzahl der Goethe-Institute in dem Land. Handelt es sich um ein
Hauptstadtinstitut. Wie sind die Verkehrsverbindungen zum nächsten Goethe-Institut? Zu
untersuchen sind das kulturpolitische und das sprachpolitische Umfeld im Gastland,
insbesondere die Situation des Faches Deutsch als Fremdsprache. Auf der Grundlage einer
Reihe weiterer Kriterien werden die Wirkungsmöglichkeiten des Goethe-Instituts unter
kultur- und sprachpolitischen Rahmenbedingungen analysiert. Die Kriterien zur politischen
Bewertung sollten in Absprache mit dem Auswärtigen Amt untersucht werden. Nach der
Darstellung der Kosten sind institutspolitische Aspekte darzustellen. Dazu zählt
beispielsweise die erfolgte Schließung eines Instituts im gleichen Land. Schließlich werden
Auffangmöglichkeiten für die Aktivitäten des Goethe-Instituts gesucht. Im Kriterienkatalog
werden die Kulturinstitute anderer Nationen vor Ort aufgeführt und die weitere deutsche
Präsenz vor Ort durch andere Institutionen dargestellt.
Im Mittelpunkt der Überlegungen stand, die Wirkungsmöglichkeiten des Goethe-Instituts im
Rahmen des vorgegebenen kultur- und sprachpolitischen Umfelds, in einem Land bzw. an
einem Standort, zu untersuchen. Wenn sich diese Wirkungsmöglichkeiten - trotz intensiven
Engagements der Mitarbeiter des Goethe-Instituts vor Ort - im regionalen Vergleich als
gering erweisen und keine Perspektiven erkennbar sind, wird eine Schließung vorgeschlagen.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der ebenfalls mit der Abschätzung der Wirkungs-
möglichkeiten des Goethe-Instituts zusammenhängt, ist die Dichte des Institutsnetzes. So viel
zum Skript ”Standortanalyse” des Goethe-Instituts. Es ist zu bezweifeln, dass taugliche Daten
für eine Umstrukturierung und für Schließungen anhand dieser Kriterien ermittelt werden
konnten. Bisher wurden kaum zwingende Argumente vorgelegt, es galt also eher, eine bereits
vorgesehene Aufgabe des Standortes zu rechtfertigten. In der Diskussion vor Ort zeigten sich
vielmehr häufig gute Gründe, die für eine Erhalt sprachen. Prof. Dr. Schneider292 von der
Universität Konstanz beschäftigt sich mit diesem Themenkomplex. Er fordert
Kriterienvergleichbarkeit und eine systematische Evaluation. Man solle nicht Ziele, die mit
dem Rotstift zu erreichen seien, festlegen. Der neueste Stand der Sozialwissenschaften sei
hier gefragt.
292 Schneider, Gerald. In: Sonnenberg-Tagung 2002.
348
2.2. Vorstellungen zur Neuorganisation von Inter Nationes
Der Reformbedarf für Inter Nationes war 1998 offensichtlich, denn der Versuch der
Kohlregierung, Inter Nationes vielfach wie eine Regierungsorganisation zu vereinnahmen,
hatte zu heftigem Reibungsverlusten vor allem im Umgang des Vorstands mit den
Mitarbeitern geführt. Der Wunsch nach ruhigerem Fahrwasser war verstärkt gegeben bei der
Wahl eines neuen Vorstands nach der Bundestagswahl 1998. Dass die Wahl des Vorstands
aber unmittelbar mit dem Verlust der Eigenständigkeit und der Aufgabe vieler
Tätigkeitsbereiche von Inter Nationes zusammenhängen sollte, erwartete man damals nicht.
Vorschläge des Bundesrechnungshofes
Im Folgenden seien Kritik und Vorschläge genannt, die der Bundesrechnungshof
äußerte,angesichts des ökonomischen Drucks unter dem das Goethe-Institut und Inter
Nationes standen. Im Bericht des Bundesrechnungshofes zur Haushaltsführung des Goethe-
Instituts wird moniert, dass im Wege einer Ausdünnung von Personal- und Projektmitteln an
einer Vielzahl von Standorten nach der Rasenmähermethode gespart worden sei und
hierdurch Strukturveränderungen versäumt worden seien. Über Institutsschließungen sei stets
unter dem ökonomischen Druck zurückgehender öffentlicher Zuschüsse entschieden, und dies
in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen worden. “Der Bundesrechnungshof hat ferner
die Spracharbeit der Institute in Westeuropa näher untersucht. Nach den Ergebnissen der
Teilkostenrechnung subventioniert das Auswärtige Amt die betreffenden Sprachkursbetriebe
derzeit mit Beträgen zwischen 5 und 60 DM je durchgeführter Unterrichtseinheit. Diese
Subventionierung erfolgt nach dem Gießkannenprinzip, d.h. unabhängig davon, ob sie
angesichts bestehender Sprachkursangebote im Gastland oder der finanziellen
Leistungsfähigkeit des einzelnen Kursteilnehmers, überhaupt notwendig ist. Das Goethe-
Institut beabsichtigt, bis spätestens zum Jahre 2003, den überwiegenden Teil der vor Ort
entstehenden Kosten dieser Sprachkurse (sog. lokale Kosten) mit den jeweiligen
Gebühreneinnahmen zu decken.”293
293 Bundesrechnungshof: Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO
über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Goethe-Instituts e.V. vom August 2000, S. 17.
349
Im Bericht des Bundesrechnungshofes über die Prüfung der Vergabe von Zuwendungen an
Inter Nationes wird untersucht, ob die Aufgaben, die bisher von Inter Nationes
wahrgenommen wurden ”aus wirtschaftlichen oder organisatorischen Gründen besser von
anderen Mittlern übernommen werden sollten.”294 ”Der BRH empfiehlt daher, ähnlich wie
beim AKP-Einsatz in den mittel- und osteuropäischen Staaten und in der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, für den gesamten Bereich der AKP und insbesondere für die
Mittlerorganisationen, eine langfristige Gesamtplanung zu erarbeiten.”295 Im Kapitel
”Neustrukturierung von Inter Nationes” empfiehlt der Bundesrechnungshof, die Gesamtzahl
der bei Inter Nationes vorhandenen Stellen von 147 auf 83 zu reduzieren, sowie die Über-
tragung der Aufgaben der Auswärtigen Kulturpolitik auf einen anderen Mittler des Aus-
wärtigen Amtes. Hier denkt der Bundesrechnungshof besonders an das Goethe-Institut. Es
heißt, dies könne ”sozialverträglich organisiert werden, indem Arbeitsbereiche in Bonn be-
lassen werden.” 296
Mein Vorschlag eines neuen Konzeptes für Inter Nationes
Unter der Prämisse, Inter Nationes als selbständige Einheit erhalten zu können, stellte ich mir
1998 folgendes neues Konzept vor:
Inter Nationes sollte zu den Zielgruppen und ausländischen Multiplikatoren guten Kontakt
pflegen und ausbauen, sowie im In- und Ausland Inter Nationes geeigneten Multiplikatoren
nahe bringen. Dazu gehören besonders Repräsentanten der Botschaften, Ansprechpartner im
Inland sind multinationale Wirtschaftsunternehmen und internationale Organisationen im
Bereich Kultur und Bildung. Es ist wichtig, Inter Nationes innerhalb des Netzwerkes der
Mittlerorganisationen zu stärken. Das Profil von Inter Nationes als Medienorganisation muss
294 Bundesrechnungshof: Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
über die Prüfung der Vergabe von Zuwendungen, die das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und
das Auswärtige Amt zur Förderung von Inter Nationes e.V. Bonn gewähren. Frankfurt am Main, August 1999,
S. 2. 295 Bundesrechnungshof: Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO an den Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages
über die Prüfung der Vergabe von Zuwendungen, die das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und
das Auswärtige Amt zur Förderung von Inter Nationes e.V. Bonn gewähren. Frankfurt am Main, August 1999,
S. 6. 296 ebd.
350
besser herausgestellt werden. Für im Ausland tätige Mittler sowie Universitäten,
Bibliotheken, Schulen und Journalisten muss Inter Nationes ganz selbstverständlich die erste
Adresse für deutsche und fremdsprachige Medien sein.
Eine Arbeitsgruppe soll die Ziele genau formulieren und Zielgruppen für jedes erstellte
Material benennen,
- Brainstorming über Verbesserungsmöglichkeiten und neue Ideen findet statt,
- der Plan zur Umsetzung der Ideen wird aufgestellt,
- der zeitliche und organisatorische Ablauf wird festgelegt,
- ein einheitliches gut wieder erkennbares Auftreten in Print-, Digitalmedien und
Veröffentlichungen wird entwickelt (Corporate Idendity),
- das Logo wird optimiert.
Angestrebt wird eine Organisation, die sich als Corporate-Community versteht. Die
Organisationsstruktur muss so beschaffen sein, dass Entscheidungswege nicht zu lang
werden. Wichtig sind überschaubare Bereiche, klare Einheiten, in denen Verantwortung
transparent delegiert und kontrolliert werden kann. Dazu gehört unabdingbar die Motivation
der Mitarbeiter. Mitarbeiter bei IN müssen an Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter und Anregungen der Abnehmer sollen geprüft
werden und dem Vorstand vorgelegt werden. Die anstehenden Reformen bieten Gelegenheit,
das innerbetriebliche Miteinander auf Anforderungen nach den Grundsätzen eines modernen
Projektmanagements zu organisieren: Training on the Job, Supervision und Weiterbildung
müssen zu selbstverständlichen Aspekten der Arbeit werden.
Die Kontakte zu den Mitgliedern und deren Know How ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche Tätigkeit. Bisher sind der enorme Sachverstand und die gesellschaftlichen
Möglichkeiten dieses Personenkreises in keiner Weise genutzt worden. Vorstand und
Verwaltungsrat müssen kontinuierlich eng zusammenarbeiten und sich abstimmen.
Konstruktive Planungsgespräche mit dem Bundespresseamt und dem Auswärtigen Amt sind
selbstverständlich. Parteipolitische Neutralität zu wahren ist für die Arbeit des Vorstandes
Voraussetzung. Außerordentlich wichtig ist die Abstimmung der Aufgaben der
Mittlerorganisationen untereinander. Die Einführung einer Corporate Identity, gerade in
Abgrenzung zu den anderen Mittlern, muss unter Hinzuziehung von Fachleuten geplant und
durchgeführt werden. Hier ist die Koordination mit dem Verwaltungsrat, der
Mitgliederversammlung und den Ämtern von größter Bedeutung. Die Verwendung der
zugewiesenen Mittel muss zu jeder Zeit einer Überprüfung standhalten. Das Gästeprogramm
351
ist eine ganz starke und wichtige Seite der Arbeit von Inter Nationes. Dem Kontakt mit
ausländischen Multiplikatoren muss Priorität eingeräumt werden. Dabei soll den
ausländischen Journalisten, Politikern, Fachleuten und Verantwortlichen aus dem
Kulturbereich neben der landeskundlichen Kenntnis über Deutschland ein realistisches
Deutschlandbild vermittelt werden. Der Rahmenvertrag muss um den Punkt ”Herstellung,
Beschaffung und Verbreitung von Online-Medien” erweitert werden. Wie bisher sind neue
Medien zu benutzen, um Inhalte zu vermitteln, z.B. landeskundliche Materialien online oder
per CD-ROM.(z. B. die CD ”Von Aachen bis Zwickau”). Weitaus stärker als bisher ist die
Nutzung neuer Medien (Internet, DVD, CD-ROM) von Bedeutung, um alle Nutzergruppen zu
erreichen. Fernlehrgänge über Internet, Bestellen von Material, Dienstleistungen per Internet,
die einen echten Mehrwert für Benutzer darstellen, sorgen für Kundenorientierung.
Ergebnis:
Die Diskussion um die Vermeidung von Doppelarbeit und Überschneidungen, die Berichte
des Bundesrechnungshofes, der Einfluss des organisatorisch stärkeren und größeren Goethe-
Instituts, sowie seine medienwirksame Außenvertretung durch Hilmar Hoffmann,
verursachten, dass die Eigenständigkeit von Inter Nationes nicht erhalten blieb und viele
Tätigkeitsbereiche ebenfalls nicht. Dennoch sind die oben von mir ausgeführten
Vorstellungen auch für die erhaltenen Aufgabenbereiche beim Goethe-Institut Inter Nationes
heute noch von Bedeutung.
3. Die Fusion zum Goethe-Institut Inter Nationes
3.1. Bergers Detailkonzept
Peter Soetje, Vorstand von Inter Nationes und aktiver und engagierter Befürworter einer
Fusion des Goethe-Instituts mit Inter Nationes, hatte noch bei seiner Vorstellung im August
1998 in seinem Bewerbungsschreiben Gegenteiliges geäußert: “Für den neuen Vorstand sehe
ich folgende vorrangige Aufgaben und empfinde diese als eine besonders reizvolle
Herausforderung: Der Verein muss im Kreis der Mittlerorganisationen und in der politisch
interessierten Öffentlichkeit deutlich profiliert werden. Profilschärfung bedeutet
352
Existenzsicherung - dazu gehört, die eigenen Stärken auszubauen und neue Tätigkeitsfelder
zu erschließen.”297
Am 18. November 1999 hat die Mitgliederversammlung von Inter Nationes dem Vorstand auf
seine Vorlagen hin das Mandat erteilt, in Verhandlungen mit dem Goethe-Institut mit dem
Ziel einer Fusion einzutreten. Der zukunftseröffnende Antrag in der entscheidenden Sitzung
von Inter Nationes, die Fusion als die Schaffung einer neuen, dritten Mittlerorganisation zu
verstehen, war von Alois Wierlacher formuliert und gestellt worden und auch ursprünglich
von Roland Berger und anderen so aufgefasst worden. Nach Vorbereitung durch beide
Vorstände wurden die rechtlichen Regelwerke298, d. i. Verschmelzungsvertrag, Satzung und
Rahmenvertrag, intensiv mit den Arbeitsgruppen der gewählten Vertreter aus den
Mitgliederversammlungen von Inter Nationes und dem Goethe-Institut beraten. Beratungs-
punkte waren:
− Die Rechtsform der Fusion
− Der Name der Institution nach der Fusion
− Die Zusammensetzung des Präsidiums
− Die Zusammensetzung des Vorstandes
− Die Zusammensetzung der Mitgliederversammlung.
Nach Ausschreibung und Präsentation haben die Vorstände, Anfang März 2000, die
Unternehmensberatung Roland Berger & Partner GmbH beauftragt, auf der Basis einer
Funktionsanalyse beider Fusionspartner, einen Vorschlag für die Aufbauorganisation der
fusionierten Institutionen zu erarbeiten. Sie legte im August 2000 ein Detailkonzept vor:
”Goethe-Institut - Inter Nationes – Die Fusion gemeinsam gestalten. Die Fusion von Goethe-
Institut und Inter Nationes führt zu einer neuen, gemeinsamen Organisation.”299
Vor der Betrachtung seines Detailkonzeptes soll jedoch aus der Sicht des Managermagazins
die Arbeit von Roland Berger & Partner GmbH - International Management Consultants
297 Soetje, Peter: Bewerbungsschreiben von Peter Soetje vom August 1998 an Inter Nationes. 298 Goethe-Institut Inter Nationes: Satzung (vom 21. 9. 2000 i. d. F. vom 8. 1. 2001) und Rahmenvertrag
zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut Inter Nationes. 299Berger, Roland: Detailkonzept Boland Berger & Partner GmbH- International Management und Consultants.
Die Fusion gemeinsam gestalten – Goethe-Institut - Inter Nationes. München, 3. August 2000, S. 4.
353
beleuchtet werden. Das Managermagazin fragte, wie Unternehmen die Arbeit von
Beratungsfirmen wie Boston Consulting, Roland Berger und McKinsey beurteilen.
Wie gut erfüllten Berater die an sie gestellten Erwartungen?
Boston Consulting Roland Berger McKinsey
Voll 50 % 45 % 40 %
Zum Teil 50 % 45 % 60 %
Gar nicht 0 % 10 % 0 %
Wurden die Geschäftsergebnisse durch die Projekte verbessert?
Boston Consulting Roland Berger McKinsey
Deutlich 33 64 39
Mäßig 58 18 50
Gar nicht 9 18 11
”Das Managermagazin hat dazu Führungskräfte der 200 bedeutendsten deutschen
Unternehmen befragt. Wie groß das Interesse an diesem brisanten Thema in den Chefetagen
ist, beweist der Rücklauf. Nahezu die Hälfte der Angeschriebenen beteiligte sich - so viel wie
bei kaum einer zweiten Studie dieser Art. Rund 30 Consultingfirmen wurden bewertet, die
drei Branchenriesen noch einmal gesondert analysiert. [...]” Und weiter: “Kaum ein Deutscher
verfügt in Wirtschaft und Politik über solch ein Beziehungsgeflecht wie Roland Berger (63).
Er trifft sich mit Gerhard Schröder und dessen potenziellem Herausforderer Edmund Stoiber.
Er verkehrt mit vielen Vorständen und Firmenchefs, auch privat. In über 30 Jahren baute er
sein Netzwerk auf. ‚Es gründet auf persönlichem Vertrauen, und deshalb bin ich stolz darauf‘,
sagt der Unternehmensgründer.
Bergers Unternehmensberatung bietet alles an, ist nahezu ein Vollsortimenter. Wer so viel
macht, macht natürlich auch Fehler. Wie bei keinem anderen Consultant, das zeigt die
Managermagazin-Umfrage, streuen bei Berger die Noten: Es gibt Spitzenwerte, aber auch
etliche Ausreißer nach unten. Ein Manager des Hamburger Modeunternehmens Wünsche
klagt über die ‚Abzocker‘ aus München, sie hätten ‚Zahlen verglichen, die nicht vergleichbar
waren‘ und dem Unternehmen strategisch nicht weitergeholfen. Bei einer Tochter der Essener
RAG (früher: Ruhrkohle) versuchte sich eine Berger-Truppe als Berater für Fusionen und
Übernahmen. Erfolglos. ‚Die haben nicht einen einzigen Interessenten angeschleppt, den wir
354
nicht schon vorher kannten‘, ereifert sich ein RAG - Manager, die hatten überhaupt keine
Ahnung.‘”300 Soweit das Managermagazin.
Nun wieder zurück zur Fusion Goethe-Institut Inter Nationes. Schon der erste Satz in Bergers
Detailkonzept ”Die Fusion gemeinsam gestalten” ist nicht umgesetzt worden. Berger arbeitet
mit einem wirtschaftspolitisch vielleicht vertretbaren Tableau, jedoch nicht mit einem
kulturpolitisch adäquaten Instrumentarium. Deshalb kann man seinen Erkenntnissen wenig
kulturpolitisch-analytische, geschweige denn zukunftsträchtige Bedeutung beimessen. Die
Fusion wurde nicht gemeinsam gestaltet, sondern diktiert, und es gibt einen großen Verlierer:
Inter Nationes. Claus Detjen, der ehemalige Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung und
stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates von Inter Nationes, hatte diese
Entwicklung vorausgesehen, wie er gegenüber dem Generalanzeiger301 in Bonn erklärte.
Nicht nur mehr als ein Drittel sogenannter MAK (nach Roland Berger:
Mitarbeiterkapazitäten) wurden bei Inter Nationes eingespart, auch der Mitgliederanteil
wurde eingegrenzt. Ebenso verfuhr man bei der Wahl des Präsidiums. Die
Mitgliederversammlung von Goethe-Institut Inter Nationes wählte, entsprechend der Satzung,
aus ihrer Mitte sechs Mitglieder ins Präsidium. Auf der Versammlung am 22. November 2001
fand die Neuwahl des Präsidiums statt. Erst beim dritten Wahlgang wurde eines der früheren
Mitglieder von Inter Nationes ins Präsidium gewählt und dies erst nachdem der bisherige
Vorsitzende des Verwaltungsrates von Inter Nationes, der renommierte Fernsehjournalist
Roland Appel seine Kandidatur zurückgezogen hatte und die Mitglieder ausdrücklich gebeten
hatte, wenigstens ein ehemaliges IN - Mitglied, Frau Professor Dr. Inge C. Schwerdtfeger,
bisher stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats von Inter Nationes, in das Präsidium
zu wählen. Auch der Vertreter der Arbeitnehmer von Inter Nationes im Präsidium, Jochen
Windt, der nicht nur die Arbeitsgruppe Vertrieb bei Inter Nationes leitete, sondern sich auch
in vielen Jahren durch ständigen Einsatz für die Belange der Mitarbeiter und des Betriebes
über das normale Maß hinaus stark gemacht hat, wurde nicht in das neue Präsidium gewählt.
Somit eliminierte man in der Anfangssituation Inter Nationes Vertreter und mögliche Kritiker
der neuen Institution.
300 Hirn ,Wolfgang/ Student, Dietmar: Gewinner ohne Glanz. In: Managermagazin 7/01, S. 50 ff. 301 General-Anzeiger: Inter Nationes: Kritik an Fusionsmodell, 18.11.99, Bonn, S.16.
355
In seinem Detailkonzept302 gibt Roland Berger an, die “Dimensionierungsvorschläge sind
ausschließlich als ein erster Vorschlag zu verstehen und stellen kein endgültiges Ergebnis dar.
Die endgültige Dimensionierung der einzelnen Bereiche kann erst zusammen mit den
Verantwortlichen im Rahmen der Umsetzungsphase erfolgen.”303 Von daher war ein genauer
Überblick über die Auswirkungen des Detailkonzeptes lange nicht möglich. Roland Berger
befasste sich in weiten Teilen seiner Konzeption mit der Einsparung oder Umsetzung von
”Mitarbeiterkapazitäten”, ”MAK”. Die Sprache seiner Konzeption ist technokratisch. So heißt
es “Für den Aufbau einer nach Regionen segmentierten Abteilung Strategie & Controlling
werden 10,5 bis 13,5 zusätzliche MAK benötigt.” Das bedeutet, in München entsteht eine
neue Abteilung ”Strategie & Controlling”. In der Zentrale in München werden keine
Mitarbeiterstellen abgebaut. Es wird zusätzlich eine neue Hierarchieebene eingeschoben
zwischen Vorstand und Institutsleitung, die 12 Regionalbeauftragten. Vier Regionaltische in
München in der Zentrale, bestehend aus einem Abteilungsleiter für alle vier Tische, jeweils
zwei Referenten nach I b bezahlt und einem Sachbearbeiter übernehmen die ”strategische
Steuerung” . Sie sollen die Tätigkeit der Institute vor Ort ”strategisch steuern”, nach den
Grobzielen, die der Institutsleiter festgelegt hat.
Der Institutsleiter wird also in Zukunft bei seinem Regionaltisch in München nachfragen,
welche Themenpalette mit welchen Referenten zu bestimmten kulturellen Gegebenheiten
empfohlen wird. Der Regionaltisch wird dann seinem Abteilungsleiter die erarbeiteten
Vorschläge vorlegen, nachdem er die entsprechende Abteilung dazu befragt hat. Die Zahl der
an die Goethe-Institute ins Ausland entsandten Kräfte wird jedoch drastisch gekürzt. Es wird
12 Regionalinstitute geben, 15 wichtige Institute und 100 Institute mit je einem Entsandten.
Die Frage stellt sich, woher weiß man in der Zentrale, was vor Ort ankommt? Der
Institutsleiter in London und die dortige Programmreferentin haben dazu folgende
Einstellung: “Wir hier im Institut erstellen die Konzeption im Rahmen der Leitlinien und
wehren uns gegen jegliche Kompetenzbeschneidung seitens mancher Fachreferenten in
unserer Zentrale.”304 Im Januar 2002 fand eine wichtige Weichenstellung im Goethe-Institut
302Detailkonzept Boland Berger & Partner GmbH- International Management und Consultant: Die Fusion
gemeinsam gestalten – Goethe-Institut - Inter Nationes. München, 3. August 2000. 303ebd. 304 Interviews in Teil C
356
Inter Nationes statt. Auf der konstituierenden Präsidiumssitzung wurden Personal-
entscheidungen von großer Tragweite für das Institut getroffen. Da scheint es im Sinne des
Goethe-Instituts sinnvoll, wenn man sich vorher weitgehend der Altlast Inter Nationes ent-
ledigt hat. Die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, des Finanzausschusses, des Per-
sonalausschusses, die Besetzung der Leitungen für die Abteilungen ”Strategie und Control-
ling”, ”Kultur und Gesellschaft”, ”Wissen und Literatur”, ”Künste” und ”Zentraler Dienst”,
standen an.
Der Betriebsrat von Inter Nationes beurteilt die Beratungsfirma Roland Berger und sein
Konzept so: “Nachweislich wurde keine komplette Ist-Analyse gestellt. Ein Berufsanfänger
und ein Berater mit wenig Berufserfahrung haben das Konzept erstellt und erläutert. Roland
Berger erhielt etwa eine halbe Million für sein Konzept. In München wurde eine neue
Abteilung ”Strategie und Controlling” geschaffen, also die Zentrale gestärkt, anstatt die
Kapazitäten in die Arbeit vor Ort zu stecken. Die Institutsleiter werden zukünftig zu
Managern, die die Vorgaben dieser Abteilung erfüllen.” 305
3.2. Der Fusionsprozess
Der Mietvertrag für Inter Nationes in Bonn läuft bis 2005, auch die Bestandsgarantie.
Langfristig gesehen, so nimmt der Betriebsrat an, wird ein Sog nach Berlin wirken, da im Prä-
sidium von Goethe-Institut Inter Nationes starke Befürworter eines Berlin-Umzuges
hinzugekommen sind. Die Personalsituation bei Inter Nationes in Bonn sieht wie folgt aus:
Über den Sozialplan werden es über kurz oder lang 33 Stellen weniger am Standort Bonn
sein. Die Beschäftigten gehen entweder in Altersteilzeit oder in den Vorruhestand bzw. wer-
den mit einer Abfindung freiwillig ausscheiden. Bis zum Jahr 2008 sollen noch weitere 50
Arbeitsplätze eingespart werden. Inzwischen wird ein eventueller Schließungstermin zum
31.12.2002 diskutiert, so berichtete das Mitglied des Goethe – Institut Vorstands Schumacher
am 8.3.2002 in Bonn. Der Betriebsrat von Inter Nationes hatte recht, als er sich wie folgt über
den Fusionsprozess äußerte: “Am vergangenen Freitag, den 16. 6. 2000, fand die dritte (und
voraussichtlich letzte) Sitzung des Lenkungsausschusses in Berlin statt. Der Eindruck der
letzten Wochen wurde noch einmal bestätigt und verstärkt: Unsere Arbeit ‚geht auf‘ in
305Windt, Jochen: Mitarbeitervertreter im Präsidium des Goethe-Instituts, Präsidiums-
sitzung,19.9.01.(Typoskript)
357
Goethe (man könnte auch sagen, sie ist nicht mehr wiederzufinden bzw. zu erkennen),
Kompetenzen werden in die Zentrale und v. a. in die Auslandsinstitute verlagert. Etwas
überspitzt könnte man auch sagen: Alle Macht den Instituten! Die von den Vorständen
entwickelten "strategischen Ziele" dokumentieren eine erschreckende Unkenntnis unserer
bisherigen Arbeit und lassen für die Zukunft Schlimmes befürchten. Bei der Fixierung des
Goethe-Instituts auf ‚Sprache‘ ist zu vermuten, dass z. B. die angestrebte Konzentration auf
Schlüsselthemen im Umkehrschluss bedeutet, Themen und Projekte, die dazu nicht passen,
wegzulassen. Leidtragende einer solchen Konzentration sind natürlich wir, denn unser
Aufgabenspektrum war immer sehr viel breiter angelegt als das von Goethe. Dies wird uns
heute oft als Nachteil vorgehalten mit dem Hinweis, wir hätten kein geschärftes Profil.
Andererseits waren wir immer flexibel genug, kurzfristig auch neue und zusätzliche Aufgaben
zu übernehmen. Wenn das die versprochene Fusion‚ gleichberechtigter Partner auf
Augenhöhe ist, kann man nur sagen: Klassenziel nicht erreicht, Versetzung ernsthaft
gefährdet, Herr Sötje! Lieber keine Fusion als eine so schlechte Fusion! Diese Fusion wird
dazu führen, dass der Standort Bonn in wenigen Jahren aufgegeben wird.”306
Die “Verhandlungsstrategie" von Peter Sötje war charakterisiert von “vorauseilendem
Gehorsam" gegenüber seinem zukünftigen Arbeitgeber und der Preisgabe bisheriger und
zukünftiger Aufgaben und Produkte von Inter Nationes, so der damalige Betriebsrat: „Die
Gründe für die Haltung von Sötje sind allgemein bekannt. Nach der seit langem erwarteten
Bekanntgabe des Ausscheidens von Generalsekretär Joachim Sartorius zum Jahresende 2001
machte Sötje sich Hoffnungen auf dessen Nachfolge. Seine Bewerbung sollte offensichtlich
dadurch unterstützt werden, dass er sich dem Goethe-Institut als derjenige präsentierte, der
den stets ungeliebten Konkurrenten Inter Nationes als leicht verdaulichen Happen auf dem
Silbertablett serviert. Den zukünftigen Generalsekretär oder wahlweise Vorstand des Goethe-
Instituts ficht das nicht an, er hat sie ohnehin nie verstanden und gemocht – “profilloser
Bauchladen" war und ist seine Einschätzung, die wir so krass bislang weder von Mitgliedern
noch von Mittelgebern oder den Beziehern unserer Materialien gehört haben”307.
306 Windt, Jochen, Betriebsrat von Inter Nationes: Am vergangenen Freitag. In: BR aktuell, 19.Juni 2000 zur 3.
Sitzung des Lenkungsausschusses in Berlin am 16.6.2000. 307 Windt, Jochen, Betriebsrat von Inter Nationes auf der Verwaltungsratssitzung von Inter Nationes, Bonn,
September 2000.
358
Peter Sötje muss sich fragen lassen, was er denn in den knapp eineinhalb Jahren seiner Zeit
als Vorstand von Inter Nationes getan hat, um das seiner Meinung nach fehlende Profil zu
schärfen. Bei seiner Bewerbung für den Vorstandsposten von Inter Nationes hatte er noch
Profilschärfung und Existenzsicherung von Inter Nationes auf seine Fahnen geschrieben. Er
hat sich, unmittelbar nachdem er das Amt des Vorstands bei Inter Nationes angenommen
hatte, für eine Fusion mit dem Goethe-Institut stark gemacht, sich sobald es möglich war, als
Generalsekretär dort beworben. Die Präsidiumsmitglieder des Goethe-Institutes wurden vom
damaligen Kulturstaatsminister Naumann telefonisch beredet, die Kandidatur Soetjes zu
unterstützen. Die Mitglieder haben dieses Ansinnen zurückgewiesen, worauf sich Soetje
veranlasst fühlte, seine Kandidatur zurückzunehmen. Soetje wurde Mitglied des Vorstandes.
Seit November 2002 ist Soetje der Leiter des Goethe-Instituts in New York. Der Vorstand des
GIIN wurde ‚verschlankt’, auch sein Kollege Braeß ist Leiter eines Goethe-Instituts
geworden- in Barcelona.
3.3. Altes Fundament ehrt man
Weitere Fusionen stehen an. Das Goethe-Institut hat massive Probleme mit der Finanzierung
und der Personalstruktur. Die einzige Rettung ist, sich auf Kosten zu fusionierender Betriebe
zu sanieren. In der Sitzung des Präsidiums im November 2001 berichtete der Vorstand über aktuelle
Entwicklungen. Da hieß es: “Im Rahmen seiner Intensivierung der Beziehungen zu Institutionen in
Deutschland plant der Vorstand die Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen
(ifa). Im Gespräch zwischen den beiden Generalsekretären von Goethe-Institut und dem ifa,
wurde dem ifa dargelegt, dass aus Sicht des Goethe-Instituts die Bündelung vorhandener
Aktivitäten, die Vermeidung von Doppelstrukturen, von nicht abgestimmtem Nebeneinander
und die gezielte Verbesserung des Informationsaustausches vor dem Hintergrund der allen
Mittlern auferlegten Sparzwänge sinnvoll sei. Das Goethe-Institut hat konkrete Vorschläge
unterbreitet zwecks Einleitung von Gesprächen mit ifa.”308
Wie im Interviewteil von der Programmreferentin des Goethe-Instituts in London ausgeführt,
ist es sicher von Bedeutung, dass das ifa sein Angebot stärker auf die Möglichkeit der
Vermittlung im Goethe-Institut abstimmt. Man wird aber aufpassen müssen, ob bei “der
308 Goethe-Institut: Sitzung des Präsidiums des Goethe-Instituts Inter Nationes am 21. November 2001.
359
Einleitung von Gesprächen” nicht mit der Planung einer Vereinnahmung, nach dem Modell
der Fusion mit Inter Nationes, gerechnet werden muss. Dann würde die Maxime Goethes
nicht zum Tragen kommen:
”Altes Fundament ehrt man, darf aber das Recht nicht aufgeben, irgendwo wieder einmal von
vorn zu gründen.”309 Das alte Fundament würde in diesem Falle nicht geehrt sondern einfach
abgebrochen.
3.4. Eine Frau an der Spitze des Goethe-Instituts
Zur personellen Erneuerung des Goethe-Instituts
Generalsekretär Leonhard ins Amt eingeführt
Am 12. 10. 2001 hat in München Präsident Hilmar Hoffmann den neuen Generalsekretär des
Goethe-Instituts Inter Nationes, Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, in sein Amt eingeführt.
Zuletzt war Leonhard Vorstand des Deutschen Rundfunkarchivs in Frankfurt/M. und
Potsdam-Babelsberg. Leonhard nannte die Vollendung der Fusion als erstes Ziel, die auch
eine neue Aufmerksamkeit für das bislang unterentwickelte “institutionelle Gedächtnis" des
Hauses voraussetze. “Nur wenn man wisse, woher man komme, könne man das "Wohin"
aktiv gestalten. Wichtig sei zudem, dass man trotz finanzieller Engpässe in näherer Zukunft
einen Generationenwechsel im Personal ermögliche. Zudem sei ein intensiver Personalaus-
tausch mit deutschen und europäischen Mittlern und Partnern zu verwirklichen.
Eine in München und Bonn angesiedelte Zentrale des Instituts sei stärker als Teil eines
Netzwerks in Deutschland zu verstehen, das, ausgehend von den Inlandsinstituten neue Ko-
operationen sowohl mit anderen Mittlern als auch mit Medien und Kulturinstitutionen aller
Art eingehen werde. Nur so sei die Zweibahnstraße im Kulturdialog glaubhaft und nachhaltig
zu realisieren. In diesem Kulturdialog werde sich, so Leonhard weiter, das Gl mit neuen
Themen, die nicht nur dem klassischen Kanon entsprächen auch jüngeren Zielgruppen
nähern. Eine nicht unwesentliche Rahmenbedingung für die Wahrnehmung dieser Aufgabe
sei auch das äußere Erscheinungsbild der Institute. Hier sei der Gesetzgeber gefragt, die
309 Goethe, Johann Wolfgang: Maximen und Reflexionen Nr. 548.
360
Sparauflagen zu überdenken, die das Bild Deutschlands im Ausland auf Dauer negativ
beeinflussten. 310
Am 12. März 2003, also genau 17 Monate später, stellte Roland Koch, hessischer
Ministerpräsident, neue Gesichter vor, unter ihnen Joachim-Felix Leonhard, die
Staatssekretäre der hessischen CDU-Landesregierung werden. Lange hielt es Leonhard also
nicht im wichtigen Amte als Goethe-Generalsekretär. Laut Angaben des hessischen
Innenministeriums verdienen Staatssekretäre 8097 € monatlich plus Zulagen. Die
Entscheidung zum Wechsel dürfte Leonhard auch dadurch erleichtert worden sein. Nachdem
der berufliche Neustart des Generalsekretärs sich für das Goethe-Institut überraschend
vollzog, wurde als Interimssekretär der erfahrene, langjährige Generalsekretär, der das Institut
über 25 Jahre bis 1996 geleitet hatte, Horst Harnischfeger berufen. Andreas Schlüter, der
zuletzt Geschäftsführer der Bertelsmann-Stiftung war, ein Fachmann für deutsches und
internationales Stiftungsrecht, Gründungsgeschäftsführer der ersten deutschen Bürgerstiftung,
der von Reinhard Mohn gegründeten Stadtstiftung Gütersloh, wurde im September 2003 zum
Nachfolger gewählt. Für welche Inhalte er steht, lässt sich bei Abschluss dieser Arbeit noch
nicht absehen.
Hilmar Hoffmann geht
Das Präsidium des Goethe-Instituts in München musste in einer Zeit, in der die Sachzwänge
des Sparens die Auswärtige Kulturpolitik bestimmen, über die Nachfolge von Hilmar
Hoffmann als Chef der Institution, entscheiden. “Dabei hatte das Goethe-Institut mit
Bundesaußenminister Joschka Fischer im Rücken auf frischen Wind bei der Vermittlung
deutscher Kultur im Ausland gehofft. Doch nach dem Antrittsbesuch des Grünen-Politikers
im November 1998 in der Münchner Zentrale folgte schnell Ernüchterung. Zwar hatte Fischer
keine ausdrücklichen Versprechungen gemacht, aber die Bedeutung auswärtiger Kulturpolitik
auch vor dem Hintergrund zunehmender wirtschaftlicher Globalisierung herausgestrichen.
Gleichwohl machte der Rotstift vor Institutsschließungen nicht halt. So hat Hoffmann, für
seine Verdienste als Kulturpolitiker soeben mit dem Bundesverdienstkreuz mit Stern
ausgezeichnet, auch eigentlich nur einen Wunsch‚ ‚dass endlich hier im Haus nicht mehr über
310 Goethe-Institut: Wesentliche Gedanken aus einer Pressemitteilung des Instituts vom 15. 10. 2001.
(Typoskript)
361
Kürzungen gesprochen werden muss.‘ Sein eindringlicher Appell zum Abschied nach neun
Jahren an der Spitze der größten deutschen Mittlerorganisation: aus der Anti-Terror-Allianz
eine Pro-Kultur-Allianz zu machen. Dabei ist Hoffmanns Rechnung ziemlich einfach: So
würde die Wiederbegründung des Goethe-Instituts im Kabul rund 400 000 Euro (782 000
Mark) kosten, sehr viel weniger als ein Spürpanzer, meinte der frühere Frankfurter
Kulturdezernent, in dessen Amtszeit mehr als 30 Institute geschlossen werden mussten.
Hoffmann sieht die auswärtige Kulturpolitik von übermotivierten Sparkommissaren immer
mehr an den Rand gedrängt. Um erfolgreich und nicht nur aktionistisch wirken zu können,
bedürfe es mittel- und langfristiger Perspektiven. Institutsschließungen gerade in islamischen
Ländern hätten sich als eklatante Fehlentscheidungen erwiesen. ‚So muss mit viel Geld jetzt
aktionistisch wiederbelebt werden, was zuvor gewaltsam unterbrochen wurde‘, meinte
Hoffmann. Gerade vor dem Hintergrund der Terroranschläge in den USA sei mehr denn je
der Dialog der Kulturen gefordert..”311
Lassen wir zum Abgang des Präsidenten einen Literaten sprechen, Stephan Wackwitz, den
langjährigen Pressesprecher des Goethe-Instituts, der in seinem Roman ”Walkers Gleichung”
eine amüsante, satirische und unterhaltsame Schilderung der deutschen Kulturpolitik im
Ausland gibt.312 “In der Tiefe des großen Raumes, ragte der genialische Schopf des
berühmten Hilmar Hoffmann, des Präsidenten des Goethe-Instituts, über die Menge hinaus.
Er unterhielt sich, wie es schien, angeregt mit einer jungen Dame und ließ das gebieterische
Auge goethegleich, jedoch andererseits auch wieder sehr steinadlerhaft unter den buschigen
Augenbrauen hervor über die glänzende Besetzung des Salons schweifen. Und bei dem nun
folgenden Empfang im gotischen Saal wurden so viele Freundschaften geschlossen, Fehden
begraben, Geschäfte angebahnt, Konzerte, Gastregien, Tourneen, Gastprofessuren verabredet
und Brüderschaften getrunken, dass die Beziehungen zwischen Bonn und der kleinen
tropischen Hauptstadt nicht nur als vollkommen repariert gelten konnten, sondern in der
Folgezeit einen lang anhaltenden und für alle Seiten äußerst profitablen Aufschwung nehmen
sollten”.313 Man spürt die leise Ironie aus den Worten eines Insiders.
311 Nürnberger Nachrichten: Fataler Sparzwang, 15. 1. 2002. S. 27. (dpa) 312 Wackwitz, Stephan: Walkers Gleichung, Göttingen, 1996, S.215. 313 Wackwitz: Walkers Gleichung, Göttingen, 1996, S.282.
362
Eine Präsidentin wird das Goethe-Institut Inter Nationes leiten
Am Donnerstag, den 17. Januar 2002 wählte das Präsidium Jutta Limbach, die Sozial-
demokratin und als Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, mächtigste Frau in Deutsch-
land als Nachfolgerin von Hilmar Hoffmann zur Präsidentin des Goethe-Instituts. Wie Hilmar
Hoffmann ist sie bei Amtsantritt 67 Jahre. Vor dem Hintergrund der neuen europäischen
Entwicklung ist dies eine wichtige reformorientierte Entscheidung. Der Vertrag über eine
Verfassung für Europa wird vom Europäischen Konvent entworfen. Nicht nur in den
Bereichen, in denen die Europäische Union beschließen kann, unterstützende Maßnahmen
durchzuführen, wie in der Kultur und der Bildung, wird Jutta Limbach kompetent das Goethe-
Institut vertreten können, sondern auch die Entwicklung des gesamten Verfassungstextes wird
ihr ein großes Anliegen sein und sie wird den schwierigen Verständigungsprozess begreifbar
machen können.
Wie unter A.1.2. festgestellt sieht der globale Aktionsplan der Konferenz der Vereinten
Nationen von 1992 die Erhöhung des Frauenanteils bei kulturellen Entscheidungsträgern vor.
Für eine Kulturinstitution in Deutschland ist die Vergabe einer solchen Funktion an eine Frau
eine Premiere. Ein Einblick in die Presseberichterstattung und Äußerungen wichtiger
Persönlichkeiten zeigt die Bedeutung dieses Ereignisses.
In der Frankfurter Rundschau heißt es: “Über kleinlichen Parteienproporz hinaus ist Jutta
Limbach wegen ihrer juristischen Kompetenz weithin akzeptiert.”314
“Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) begrüßte die Wahl. Limbach sei auf Grund
ihrer langen Erfahrung im politischen und öffentlichen Bereich hervorragend geeignet, die
Arbeit des Goethe-Instituts als größte Mittlerorganisation für auswärtige Kulturpolitik
fortzuführen. Auch Hoffmann zeigte sich von seiner Nachfolgerin hoch erfreut: ‚Mit Jutta
Limbach haben wir einen erstklassigen Griff getan. Als höchste Richterin des Landes und
zupackende Politikerin wird sie den Berliner Sparkommissaren sicher gut Paroli bieten
können.’ ” 315
314 Nutt, Harry: Anderes Spielbein, Valmy: Eine Präsidentin wird das Goethe-Institut leiten. In: Frankfurter
Rundschau, 18.1.2002 .S. 17. 315Nürnberger Nachrichten: Frau an der Spitze, 18. 1. 2002. S. 21.(dpa)
363
Am 21. Mai 2002, dem Tag der Amtseinführung von Jutta Limbach in Berlin durch
Bundesaußenminister Fischer, veröffentlichte die F.A.Z. ein Interview über die “grund-
sätzliche Ausrichtung der ,dritten Säule` der Außenpolitik.”316 Jutta Limbach äußerte sich
darin nach der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem Mäzenatentum befragt, - wie
folgt: “Auch in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft muss Kulturarbeit ihre
Eigenständigkeit bewahren können. Dass ich nicht ein so genialer Klinkenputzer (wie Hilmar
Hoffmann) sein werde und glücklich bin, den BMW-Aufsichtsratsvorsitzendem Volker
Doppelfeld an meiner Seite zu wissen, das können sie mir glauben”317.
Zu Vize-Präsidenten des Goethe-Instituts wurden Volker Doppelfeld und Klaus-Dieter
Lehmann (Präsident Stiftung Preußischer Kulturbesitz) gewählt. Zusammen mit dem
amtierenden Generalsekretär Joachim-Felix Leonhard und dem insgesamt vierköpfigen
Vorstand werden sie das neue Führungsteam des Goethe-Instituts Inter Nationes bilden.
Leonhard betonte das hohe fachliche Ansehen der neuen Präsidentin: Frau Limbach sei eine
ausgewiesene Expertin in einem Schlüsselthema des GI, nämlich in Menschenrechtsfragen.
Ihre Wahl dürfe getrost auch als inhaltlich-politisches Signal verstanden werden.
“Die am 27. März 1934 geborene Berlinerin begann ihre Karriere 1971 als Rechtsprofessorin
an der FU Berlin. In den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückte die Sozialdemokratin
schließlich 1989, als sie zur Berliner Justizsenatorin ernannt wurde. Limbach setze sich
entschieden für eine strafrechtliche Verfolgung der DDR-Regierungskriminalität ein. Eines
ihrer Lieblingsthemen blieb auch in Karlsruhe, wo sie seit 1994 an der Spitze des obersten
deutschen Gerichts steht, die Gleichberechtigung der Frauen. Doch bei aller Sympathie für
eine gezielte Frauenförderung hat Limbach, die selbst drei Kinder großgezogen hat, eines
stets vertreten: “Ohne Selbstbehauptungswillen kommt eine Frau in unserer Gesellschaft nicht
voran.”318
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet: “ ‚Wenn ich aufrichtig bin’, teilte Frau
Limbach im feministischen Sammelwerk ‚Juristinnen‘ 1982 mit, ‚kann ich keinen
hindernisreichen Berufsweg nachzeichnen, den ich allein, mit eigener Kraft,
316 Bahners, Patrick und Hintermeier, Hannes: Deutsche Kultur braucht keine neuen Etiketten, F.A.Z. vom
21.Mai 2002, S. 52. 317 ebd. 318 Nürnberger Nachrichten: Frau an der Spitze, 18. 1. 2002. S. 21.(dpa)
364
geschlechtsdiskriminierenden Widrigkeiten trotzend, die Professur stets im Blick, gemeistert
hätte.‘ Doch niemand vermute jetzt umgekehrt Protektion. Wer sowohl als Berliner
Justizsenatorin wie im höchsten Richteramt reüssiert, der kann nicht als Eliza Doolittle
beschrieben werden, die auf einen Professor Higgins angewiesen wäre. Sie war schlauer als
die Schlauesten, härter als die Härtesten, und sie ist eine ehrliche Frau dabei geblieben.
Hilmar Hoffmann freut sich deshalb auf seine Nachfolgerin; sie könne ja so gut mit Schröder.
Und Joschka Fischer, quasi ihr Dienstherr, weil das Außenministerium den größten Teil des
Institutsetats aufbringt, hat gleichfalls eine Willkommensfanfare in Richtung Karlsruhe
geschmettert.”319
Die Zukunft wird uns zeigen, wie sie das Institut aus der Diskussion um die Sparzwänge
herausführt, welche neuen “Strukturen und Projektformen”320, die sie jetzt ganz allgemein im
Interview der F.A.Z. anregt, realisiert werden und wie ihre Pläne für das “Goethe- Institut
und Inter Nationes”321, wie sie das Institut , nicht ganz korrekt nennt, aussehen werden.
Kurze Zeit später sollte, wie zu erwarten, auch mit ihrer Zustimmung aus dem Namen
Goethe- Institut Inter Nationes wieder der ursprüngliche Name Goethe- Institut gelten. Das
lästige Anhängsel Inter Nationes wurde fallen gelassen.
319 Platthaus, Andreas: My fair Lady, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. 1. 2002, S. 43. 320 Bahners, Patrick und Hintermeier, Hannes: Deutsche Kultur braucht keine neuen Etiketten, F.A.Z. vom
21.Mai 2002, S. 52. 321 ebd.
365
F Fazit: Die Reform der dritten Säule ist unerlässlich
”Was auf administrativer Ebene eher einer ferngesteuerten Verschickungspolitik glich, folgte
in der Nahperspektive der jeweiligen Institute mit ihren zahlreichen sogenannten Ortskräften
seit jeher einer Politik des Kulturkontaktes. Goethe machte auch dann noch weiter und konnte
weiter machen, wenn die politische Kommunikation abgebrochen war. In diesem Sinne war
die Auswärtige Kulturpolitik nie eine Säule wie in der Metapher Willy Brandts, sondern
vielmehr ein Spielbein mit vielfältigen Optionen jenseits der Politik.”322 Bei der
Amtseinführung der neuen Präsidentin Jutta Limbach in der GI-Zentrale in München war die
Tendenz klar: Keine grundsätzliche Finanzverbesserung, so Außenminister Fischer, der
gleichzeitig die Bedeutung des interkulturellen Dialogs als Beitrag zur Offenheit unserer
Gesellschaft würdigte. Ist die Auswärtige Kulturpolitik die dritte Säule der Außenpolitik? Die
Ergebnisse meiner Arbeit zeigen, dass sie eine Säule ist, welche jedoch wegen ihres
erheblichen Renovierungsbedarfs nicht tragfähig ist.
Die Auswärtige Kulturpolitik wurde nicht neugeordnet, sondern nur um einige ihrer
vielfältigen Optionen durch mangelnde Finanzierung gebracht. Eine Neuordnung erfolgte
bisher auf der strukturellen Ebene insofern, als Inter Nationes quasi aufgelöst wurde. Die
inhaltliche Reform wurden in Ansätzen umgesetzt, wie unter C 11. gezeigt, die institutionelle
und die Strukturreform wurden nicht ausreichend angepackt.
Nach dem Wahlausgang der Bundestagswahlen im September 2002 teilte der amtierende
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin Anfang Oktober mit, dass er sein Amt zur Verfügung
stellen werde. Seine Nachfolgerin Christina Weiss, die viele Jahre das Amt der
Kultursenatorin in Hamburg innehatte, wollte eine Neuordnung der ministeriellen
Zuständigkeiten durchsetzen. Die Goethe-Institute sollten aus dem Auswärtigen Amt
herausgelöst und der Kulturstaatsministerin zugeordnet werden, die wiederum dem
Kanzleramt untergeordnet ist. Dies hätte nicht nur eine Machtverschiebung vom Auswärtigen
Amt zum Kanzleramt bedeutet, sondern auch die Auswärtige Kulturpolitik in weiten
Bereichen aus den Zusammenhängen der Außenpolitik gerissen. Die “dritte Säule” der
Außenpolitik wäre in Gefahr geraten im Machtpoker um ihre Eigenständigkeit gebracht zu
322 Harry Nutt: Anderes Spielbein. Eine Präsidentin wird das Goethe-Institut leiten. Frankfurter Rundschau, 18.
1. 2002. S. 17.
366
werden und in Abhängigkeit von der ersten mächtigeren Säule zu geraten und demontiert zu
werden. Dieses durchzusetzen ist nicht gelungen. Jedoch muss gehandelt werden. Es sollten
die Äußerungen des Leiters des Pariser Goethe–Instituts beherzigt werden: “Man muss
aufhören die Kulturarbeit, einschließlich der Sprachkurse, Stipendien und dergleichen kaputt
zu machen. Das richtet sich nicht nur an die Politiker, sondern auch an die Industrie, die
exportieren will, aber nicht kapiert, wie viel Kapital im Kulturbereich gerade in entfernteren
Weltregionen zerstört wird.”323
Die inhaltliche Neuorientierung der Auswärtigen Kultur im zusammenwachsenden Europa
steht an. Erste Schritte hat Bundesaußenminister Fischer mit seinem Friedensappell auf der
Botschafterkonferenz 2002 (Siehe E 1.) unternommen. Strukturen haben den Inhalten zu
folgen. Der Weg zur inhaltlichen Erneuerung wird häufig durch Kompetenzwirrwarr, wie er
an unterschiedlichsten Stellen der Arbeit aufgezeigt wird, erschwert. Bezeichnend für den
gegenwärtigen Zustand heißt es in einem Artikel der FAZ mit dem Titel: BMZ? AA? GTZ?
DAAD? “Das feingewebte Tuch, das die Bundesregierung [...] für den Wiederaufbau ziviler
Strukturen in Afghanistan bereit gelegt hat, wurde nämlich sogleich wieder zerschnitten: in
einen größeren, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)
zufallenden und einen kleineren, vom Auswärtigen Amt verwalteten Teil. Dieses wiederum
hat, da es ja im akademischen Bereich über keine eigenen Kompetenzen verfügt, die
Universitätstranche an den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) vergeben, die
nun den Vergaben des Bewirtschaftungs- und Zuwendungsrechtes unterliegt. Und da sind -
leider- Mittel für den technischen Wiederaufbau der Universitäten nicht vorgesehen. Aus den
Mitteln des BMZ lässt sich auch nichts machen: Universitäten fallen absprachegemäß nicht in
seinen Kompetenzbereich.
Die deutschen Hochschullehrer in Kabul haben einen Staketenlauf zwischen DAAD,
Auswärtigem Amt und BMZ rasch drangegeben: Kurz entschlossen beschafften sie die
erforderlichen Elektro-Utensilien auf eigene Kosten und begannen mit der Sanierung einiger
Arbeitsräume.”324
323 Dann kann man sogar Piraten jagen. Ein Gespräch mit Dieter Strauss, dem Leiter des Pariser Goethe-
Instituts. In: FAZ vom 4.10. 2002.S.39. 324 Naumann, Clas M. In: BMZ? AA? GTZ? DAAD?. FAZ, 21.11.2002. S.40.
367
Damit Auswärtige Kulturpolitik ihren Aufgaben gerecht werden kann „Ansprechpartner zu
sein und zu gewinnen, der internationalen Verständigung zu dienen und diesem Zweck
dienliches Kulturwissen zu fördern“325, sowie den Erwerb interkultureller Bildung326 zu er-
möglichen, bietet sich deshalb an auf der Grundlage der Befunde in der vorliegenden Arbeit,
die Struktur unter folgenden Gesichtspunkten zu verändern:
1. Die Auswärtige Kulturpolitik muss besser koordiniert werden. Auf der Ebene der
Ministerien ist deshalb festzuschreiben, dass das Auswärtige Amt die Federführung in
allen Belangen hat.
2. Das Geflecht der deutschen Vertretungen und Institutionen im Ausland, welches aus
immerhin ca. eintausend diplomatischen, kulturellen und politischen Dependancen in
einhundertfünfzig Staaten besteht, muss u.a. durch den Einsatz neuer Medien besser
genutzt und vernetzt werden. (Siehe B 1.6.)
3. Der Grundsatz, die Auswärtige Kulturpolitik nach Möglichkeit an nichtstaatliche
Träger zu delegieren, ist stärker zu beachten. Ein zusätzliches Informationszentrum,
wie z. B. das ”German Information Centre” als Mittler Auswärtiger Kultur der
deutschen Botschaft in London, ist in Frage zu stellen.
4. Die Vergabe von Haushaltsmitteln an Träger der Auswärtigen Kulturpolitik muss
gründlicher daraufhin überprüft werden, ob die jeweils für eine bestimmte Aufgabe am
besten geeignete Organisation gefördert wird. Die Aufgaben der Auswärtigen Kultur-
arbeit müssen von dafür qualifizierten Menschen wahrgenommen werden.
5. Die Studienfächer Interkulturelle Germanistik-Deutsch als Fremdsprache und Didaktik
des Deutschen als Fremdsprache müssen einen höheren Stellenwert bekommen.
6. Die Arbeit der Trägerorganisationen ist ausreichend zu finanzieren.
7. Bei Kooperationen im Ausland sollten sich alle Organisationen nach ihren
Möglichkeiten finanziell beteiligen.
325Bauer, Gerd Ulrich: Auswärtige Kulturpolitik. In: Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea, Hg.: Handbuch
interkulturelle Germanistik. Stuttgart, 2003. S.132. 326Reich, R. Hans; Wierlacher, Alois: Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. Bildung. In: Wierlacher,
Alois; Bogner, Andrea, Hg.: Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart, 2003. S.132. Siehe unter A 1.2.
368
8. Anstatt die Kapazitäten in der Verwaltung der Zentralen der Institute zu verstärken,
sollten für die eigentliche Aufgabe im In- oder Ausland genügend Personal und Mittel
zur Verfügung gestellt werden.
9. Bei Zusammenlegungen und Fusionen ist darauf zu achten, dass es keine ”feindliche
Übernahmen” gibt.
10. Grundsätzlich ist eine Überprüfung der Entscheidungskriterien des Goethe-Instituts zu
fordern, die bei zukünftigen Überlegungen über die Schließung und die Eröffnung
eines Goethe-Instituts sowie bei der Auslagerung der Spracharbeit anzuwenden sind.327
Mit der Veränderung der Struktur ist immer auch eine Veränderung der Inhalte gegeben. Eine
inhaltliche Reform ist unverzichtbar: Um hier wirksam zu werden, ist mehr auf die
Kompetenz und den reichen interkulturellen Erfahrungsschatz der Beschäftigten vor Ort zu
setzen: “Man soll die Arbeit vor Ort lassen, weil wir vor Ort einen besseren Einblick in die
hiesigen Institutionen haben,” so Dr. Barbara H, Programmreferentin im Goethe-Instituts in
London. Die Wissenschaften im Bereich der Kultur, des Deutschen als Fremdsprache, der
Didaktik des Deutschen als Zweitsprache und der Interkulturellen Pädagogik und Germanistik
sind gefragt, neue inhaltliche Impulse zu geben. Interdisziplinäre Studiengänge, in dem
Kultur- und Lernstile vermittelt werden, sind die Antwort auf das Zusammenwachsen
Europas. Die Politik ist gehalten, sich intensiver mit inhaltlicher Weiterentwicklung zu
beschäftigen, vorliegende Konzepte zu diskutieren und sie umzusetzen. “Wir sind letztlich
alle zu wenig aus- und fortgebildet”, stellte der Leiter des Goethe-Instituts London zur Frage
nach der Ausbildung in meiner Erhebung fest. Dies ist eine Aufforderung an die
Mittlerorganisationen, mehr für die Aus- und Fortbildung derer zu tun, die im ständigen
Kontakt mit einem anspruchsvollen, internationalen Publikum stehen. Die Leiterin der
Sprachabteilung, ergänzt dazu: “Unser Klientel ist ganz international, die Zusammensetzung
wahrlich multikulturell. Das macht die Kurse so lebendig und natürlich.”328 Die
Zusammensetzung, die multikulturell ist, in eine interkulturelle Lerngruppe zu verwandeln,
327Altmann Elisabeth: Für eine Neuordnung der Zuständigkeiten in der Auswärtigen Kulturpolitik, (Antrag)
Bundestagsdrucksache 13/8679 . 328 Die genannten Zitate finden sich in der Interviewserie, durchgeführt im Goethe-Institut in London, im Teil C
der vorliegenden Arbeit. S.107ff.
369
erfordert viel Wissen, gutes Unterrichtsmaterial und die Bereitschaft mit den Institutionen im
Partnerland zusammen zu arbeiten. Das Verständnis für die Kultur und für die Deutschen
wird ohne die Kenntnis der deutschen Sprache unvollständig bleiben müssen, ebenso ist es
umgekehrt mit dem Verständnis für andere europäische oder internationale Kulturen. Die
Neigung zu Vorbehalten, die Goethe am 19.3.1807 seinem Gesprächspartner Riemer
darstellte, muss überwunden werden: “Darum werden so viele Menschen durch die
Erscheinung eines neuen, fremden Menschen in der Gesellschaft beunruhigt. Er entdeckt
ihnen, was sie nicht haben und dann hassen sie ihn, oder er entdeckt ihnen durch sein
Gegenteil, was sie haben, und so verachten sie ihn wieder.”329
Auch die Deutschen Schulen können sich der Internationalität nicht mehr entziehen. Es
genügt nicht, ein zu kritisierendes “deutsches” dreigliedriges Schulsystem (Siehe: B 4.1.:
Migranten in Deutschland haben schlechte Spracherwerbsbedingungen) zu etablieren. Wie
sich aus der Untersuchung der Deutschen Schulen im Ausland ergeben hat, gehen Haupt-,
Realschüler und Gymnasiasten gemeinsam in eine Klasse, d. h. der erste Schritt zur
Aufhebung der Dreigliedrigkeit des deutschen Schulalltags ist schon getan. Allerdings ist die
Grundlage vieler Deutscher Schulen ein deutscher Lehrplan. Nicht mehr als 25%
“fremdsprachige” Schüler, die häufig gut Deutsch sprechen, besuchen diese Schulen in einem
anderen europäischen Land. Dieses ist keine interkulturelle Leistung und die Forderungen,
die an interkulturelles Lernen gestellt werden müssen (Siehe A 1.2.), werden so nicht erfüllt.
Von den deutschen Auslandsschulen könnten Impulse nach Deutschland ausgesandt werden,
das übliche System zu überwinden. Die Grundlagen sind vorhanden. Alle Schüler besuchen
gemeinsam eine Schule und machen ihren Abschluss von der gleichen Klasse aus. Um aber
die deutschen Auslandsschulen zu interkulturellen Einrichtungen zu machen, bedarf es
vermehrter Öffnung. “Langfristig verfolge ich aber das Ziel, die Schule auch für solche
Schüler zu öffnen, die bisher keine Möglichkeiten hatten, Deutsch zu sprechen. Dies müsste
dann bereits in unserem Kindergarten anfangen, um nicht das Niveau zu senken. Jeder, der
die Fähigkeit oder den Willen hat, eine deutschsprachige Schulausbildung zu durchlaufen und
damit deutsche Kultur kennen zu lernen, soll auch die Chance dazu erhalten. Dies soll
unabhängig von dem vorgeschriebenen Prozentsatz erfolgen,” so der Schulleiter der
329 Johann Wolfgang von Goethe am 19. März 1807 an Friedrich Wilhelm Riemer, zitiert nach Dobel, Richard,
Hg., Lexikon der Goethe-Zitate Bd.1, (1968), München 1972, Sp. 220.
370
Deutschen Schule in Prag, Dr.v. H. in der Interviewserie dieser Arbeit. Der
Personalratsvorsitzende H.-W. F ergänzt: “Wir stehen der Idee der Begegnungsschule sehr
positiv gegenüber, aber wir sehen, dass diese Bemühungen nur langfristig verwirklicht
werden können”. Die neuen Schulen, die Deutschland über die Auswärtige Kultur finanziert,
müssen Begegnungsschulen sein und zwar im weiteren Sinne als durch die Aufnahme
nichtdeutscher Schüler. “Interkulturelle Erziehung heißt nicht Integration ausländischer
Kinder in die deutsche Regelklasse”330 Auch die Aussage der Ländervertreter ist noch zu
begrenzend: “Kulturelle Begegnung bildet das Strukturprinzip der deutschen
Begegnungsschulen in aller Welt. Kultureller Dialog gehört zum integralen Programm auch in
den deutschsprachigen Schulen im Ausland. Kultureller Dialog durch die Einbeziehung
begegnungsspezifischer Inhalte ist eines der tragenden Prinzipien für die
Lehrplanentwicklung an deutschen Auslandsschulen.”331 Die Begegnungsschulen sollen sich
durchaus am Schulsystem der Partnerländer orientieren. “Darüber hinaus sind alle Schulen
dem Begegnungsgedanken verpflichtet. Diese Begegnung mit der Kultur und mit der
Gesellschaft des Landes, in dem deutsche Kinder und deutsche Schulen Gastrecht genießen,
macht den besonderen Charakter unserer Auslandsschulen aus,”332 urteilt Dagmar Schipanski,
die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, auf dem weltweiten Kongress der
Auslandsschulen optimistisch und fährt fort: “Die Länder wollen Bilinguale
Unterrichtsprogramme und –abschlüsse noch stärker in die deutschen Auslandsschulen
tragen.”333 Die Herausforderungen, die sich an alle Schulen in Europa richten, erfordern
Anstrengungen und nicht Beharrung. Das bedeutet, dass Lehrer die Möglichkeit zu
330Götze,Lutz/Pommerin Gabriele: Bilinguale Konzepte vor dem Hintergrund der
Zweitspracherwerbsforschung.- In: Zielsprache Deutsch,19 (1988) 4, S.31f.. 331BLASchA: Stellungnahme der Ländervertreter im Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland
(BLASchA), 24. 2. 1997.(Typoskript) 332 Schipanski, Dagmar: Auslandsschulen im Spannungsfeld zwischen Bildungsqualität und Budget. Rede
anlässlich der Konferenz Deutscher Auslandsschulen- weltweit, vom 4. bis 6. April 2002 in Mexiko-Stadt.
www.ds2002.org 333 ebd.
371
spezifischer Weiterbildung als “organisiertes Lernen”334 erhalten. Lutz Dietze führt diesen
Gedanken unter rechtlichen Gesichtspunkten in einem Essay “Recht auf Weiterbildung unter
Aspekten der europäischen Integration,”335 aus. Auch für die Deutschen Schulen im Ausland
bedeutet der Prozess der Europäisierung die Aufgabe der Nationalschulen zugunsten
zumindest bilingualer Schulen, in denen junge Menschen verschiedener Regionen und
Staaten friedlich zusammen leben und lernen. Für die Schulen in Deutschland fordert dies
auch Prof. Dietze: “Bei dieser kulturpolitischen Brückenbildung empfiehlt sich künftig
vermehrt, das persönliche Umfeld der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen, um die
Wirkung der Schulen nachhaltiger zu verstärken. Insbesondere die Eltern könnten an der
Gestaltung des Schullebens und bei deren Außenwirkung noch mehr integriert werden als
bisher.”336 Was läge näher als auch die Eltern, die aktiv am Schulleben der Deutschen
Schulen teilnehmen, wie sich im Teil C der Arbeit zeigt, auch zu den inhaltlichen und
strukturellen Reformen der Deutschen Schulen ihren Beitrag leisten zu lassen.
Die Europäische Union sollte bildungspolitisch aktiviert werden. Die Bewältigung des
Spagats zwischen größerer Autonomie für die Schulen und föderalistischer Schulaufsicht im
Europa der Regionen ist nicht leicht. “Schulen in Europa sollen sich in ihrer Arbeit und ihren
Perspektiven zu ‘Europäischen Schulen’ entwickeln. Mit diesem Begriff möchte ich nicht nur
die explizit multinational-integrativen Institutionen erfassen, die sich direkt der Förderung des
Zusammenlebens junger Menschen in dem sich vereinigenden Europa verpflichten; dieser
wachsende Kreis ist durch vielfältige Spielarten charakterisiert, in denen Fremd-
sprachenförderung und Vermittlung einer ‘europäischen Geschichte’ einerseits, grenzüber-
schreitende Begegnungen andererseits praktiziert werden.”337
Um es zusammenzufassen, für eine inhaltliche Reform sind folgende Aspekte unverzichtbar:
334 Dietze, Lutz: Recht der Weiterbildung unter Aspekten der europäischen Integration: primär, akzessorisch,
subsidiär. In: Bildungspolitik im Umbruch. Staatsmonopol in der Weiterbildung. Verlag Neue Zürcher
Zeitung.1991. S.834. 335 ebd. S.831ff. 336 Dietze, Lutz: Elternrecht macht Schule. 2. Aufl. Düsseldorf, 1987, S.221. Siehe auch: Schulleitung. Ein
Lernsystem. Band 1: Schulorganisation Schulrecht. Vor einer Renaissance der Elternbeiräte? LE 16.06.
Neuwied, 2003. 337Mitter, Wolfgang: Welche Schulen braucht Europa? Vortrag im Zentrum für europäische Integrations-
forschung, Bonn. 16. 9. 1998. (Typoskript)
372
1. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass die Beschäftigten ebenso Vermittler
deutscher Kultur wie Bindeglieder des interkulturellen Bereichs als auch diejenigen
sind, die den Reformbedarf erkannt haben. Deren Kompetenz und Erfahrungsschatz
bilden einen Grundstock von künftig nicht zu unterschätzender Bedeutung bei den
anstehenden Reformen. (Siehe z.B. C 11.)
2. Die maßgeblichen Säulen nationaler Außenpolitik würden ohne Vermittlung der
Sprache der Deutschen und ihrer Kultur in der Tragfähigkeit beeinträchtigt sein, was
ebenso für das Verständnis anderer nationaler Kulturen und den Zugang zu ihnen gilt.
3. Die deutschen Schulen im Inland können von dieser Interkulturalität bei den nun
bevorstehenden Reformen profitieren. Hier ist der national interne Informationsbedarf
bei weitem nicht befriedigt. Ich plädiere daher entschieden dafür, dass sich dies
zukünftig ändert.
4. Diese Gedanken gilt es auch auf das Deutsche Auslandsschulwesen zu übertragen, die
auf den Weg gebracht werden müssen, interkulturelle Einrichtungen und
Begegnungsschulen zu werden. Die Lehrer müssen in diesen Entwicklungsprozess
einbezogen werden. Die Verbreitung ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in den
verschiedenen Gremien und Organen der Schule sollten nach dem Auslandsaufenthalt
besser als bisher genutzt werden.
5. Die Deutschen Schulen im Ausland sollten sich von der Serviceleistung ehemaliger
Konsulatsschulen zur Schule junger Europäer, zu Begegnungsschulen mit bilingualem
Angebot entwickeln. Der Prozess der Europäisierung bedeutet die Aufgabe der
Nationalschulen zugunsten zumindest bilingualer Schulen.
6. Von den deutschen Auslandsschulen. könnten Impulse ausgesandt werden, andere
Optionen als das dreigliedrige Schulsystem zu bieten. Die Herausforderung, die sich
an alle Schulen in Europa richtet, erfordert Anstrengung und nicht Beharrung
7. Deshalb sind die Chancen gut, dass die Erziehungs- und Kulturwissenschaften,
insbesondere die Interkulturelle Germanistik, die Didaktik des Deutschen als Zweit-
und Fremdsprache der Auswärtigen Kulturpolitik neue inhaltliche Impulse geben
können.
8. Die Politik indes ist stärker als bisher aufgefordert, die inhaltliche Weiterentwicklung
sowie die vorliegenden Konzepte kritisch zu begleiten und deren Umsetzung zu
erleichtern.
373
9. Die Europäische Union sollte bildungspolitisch aktiviert werden. Dabei sehe ich
keinen Widerspruch zwischen einer föderalistischen, europäischen Schulaufsicht und
Verwirklichung größerer Autonomie für die Deutschen Schulen.
So könnte die Debatte um die Zukunftsfähigkeit und damit über den Reformbedarf im Bereich
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik des Bundes angeregt werden.
Die Befragung belegt, dass die Beschäftigen dies für wünschenswert und möglich halten. Es
zeigt sich, dass Kulturpolitik, Gestaltungswille, Sachverstand, Reformwille und Demokratie
zusammen gehören.
374
G Literaturverzeichnis
Albrecht, Corinna u. Wierlacher Alois: Kulturwissenschaftliche Xenologie. In
Konzepte der Kulturwissenschaften, Hg. Nünning/ Nünning. Stuttgart 2003, S. 280ff.
Albrecht, Corinna u. Wierlacher Alois: Fremdgänge. Eine anthologische
Fremdheitslehre für Deutsch als Fremdsprache. Bonn 1995.
Altmann, Elisabeth: Deutscher Bundestag, Auswärtiger Ausschuss. Positionspapier:
Zur finanziellen Situation der Goethe-Institute. Moratorium im Bundeshaushalt nötig,
Mai 1998.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/10854, (Kleine Anfrage) Deutsch
als Fremdsprache in den MOE/GUS-Staaten.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/11357, (Kleine Anfrage) Zur
sozialen Situation der Bundesprogrammlehrkräfte und zur finanziellen Ausstattung
des Bereichs Deutsch als Fremdsprache in den MOE/GUS-Staaten.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/4618 (Grosse Anfrage))
Aktivitäten und Ziele der Bundesregierung in der Auswärtigen Kulturpolitik; Nutzung
der Potentiale für Demokratisierung und friedliche Konfliktbewältigung.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/4844, (Antrag) Auswärtige
Kulturpolitik: Den Standort neu bestimmen - den Stellenwert erhöhen.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/5424 (Kleine Anfrage)
Jugendaustausch als Aufgabe der Auswärtigen Kulturpolitik.
Altmann, E.: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/5479,(Kleine Anfrage)
Informationsarbeit im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik.
Altmann, E: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/6040 (Kleine Anfrage) Zur Arbeit
des Instituts für Auslandsbeziehungen.
Altmann, E: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/6544 (Kleine Anfrage) Förderung
der deutschen Sprache und des Auslandsschulwesens.
Altmann, E: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7366 (Kleine Anfrage) Die Arbeit
von Inter Nationes e. V.
Altmann, E. Deutscher Bundestag, Drucksache 13/8679 (Antrag) Neuordnung des
375
Zuständigkeiten in der Auswärtigen Kulturpolitik.
Altmann, E: Fragebögen an die Beschäftigten ausgewählter Deutscher Schulen und
Goethe Institute in Europa. (Die wissenschaftlichen Rohdaten der Auswertung sind
für Interessierte nach Vereinbarung mit der Autorin einsehbar.)
Ammon, Ulrich: Deutsch unter Druck von Englisch in Wissenschaft und Politik. In:
Thema Deutsch, Band 3: Deutsch, Englisch, Europäisch. Matthias Wermke u.a. Hg.,
Mannheim 2002, S. 141.
Ammon, Ulrich: Die nationalen Varietäten des Deutschen im Unterricht von Deutsch
als Fremdsprache. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23. Alois Wierlacher u.a.
Hg., München, 1997. S.141-158.
Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin, New York,
8.Aufl., S.92ff,175ff,192ff,274ff.
Auswärtiges Amt - Kulturabteilung: Auswärtige Kulturpolitik-Konzeption 2000.
Strategiepapier ”Förderung der deutschen Sprache.” Berlin, Stand: 5.4.2000.
Auswärtiges Amt, Hg.: Politischer Halbjahresbericht Portugal Stand: März
1998.(Typoskript)
Auswärtiges Amt, Hg.: Politischer Halbjahresbericht Russische Föderation, Stand:
März 1998. (Typoskript)
Auswärtiges Amt, Hg.: Politischer Halbjahresbericht Schweden, Stand: März 1998.
(Typoskript)
Auswärtiges Amt, Hg.: Politischer Halbjahresbericht Tschechische Republik, Stand:
März 1998. (Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderaufzeichnung Tschechische Republik. Stand: 1. März 1998.
(Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderkonzeption der Sprachförderung Großbritannien: Erstellt
vom Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem
Fachberater, Koordination: Deutsche Botschaft, London. 1. Juli 1998. (Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderkonzeption zur Förderung der deutschen Sprache und der
damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Türkei. Juli 1998, Deutsche
Botschaft Ankara. (Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderkonzeption zur Förderung der deutschen Sprache und der
damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Tschechischen Republik 1998,
376
Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache, Prag. (Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderkonzeption zur Förderung der deutschen Sprache und der
damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in Schweden, Juni 1998. Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland, Stockholm. (Typoskript)
Auswärtiges Amt: Länderkonzeption zur Förderung der deutschen Sprache und der
damit verbundenen Wissenschaftsdisziplinen in der Slowakei, 1998. Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland, Bratislava. (Typoskript)
Auswärtiges Amt, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Hg.,: Auswärtige Kulturpolitik im
Schulwesen, Bonn 1998.
Auswärtiges Amt: Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik, Bonn 1972, S.781.
Auswärtiges Amt: 6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik (2001)
Bahners, Patrick und Hintermeier, Hannes: Deutsche Kultur braucht keine neuen
Etiketten, F.A.Z. vom 21.Mai 2002, S. 52.
Bauer, Gerd Ulrich: Die dritte Säule der Politik. In: Kulturthema Kommunikation,
Wierlacher Alois Hg., 1. Aufl., Möhnesee 2000, S. 439ff., S.445ff.
Bauer, Gerd Ulrich: Auswärtige Kulturpolitik. In: Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea,
Hg.: Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart, 2003. S.132.
Beck, Johannes: Der Bildungswahn. Reinbek, 1994.S. 57.
Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts 1991: 25 Thesen zur Sprach-
und Kulturvermittlung im Ausland. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18 (1992),
München 1992. Hg. Alois Wierlacher u. a., S. 547-551.
Benning Maria: Eindrücke vom Leben als Deutschlehrerin in Mittel-Ost-Europa, In:
Der deutsche Lehrer im Ausland 1/98. Verband deutscher Lehrer im Ausland (VdLiA),
Hg., 1/98, S.24.
Berger, Roland: Detailkonzept Boland Berger & Partner GmbH- International
Management und Consultants: Die Fusion gemeinsam gestalten – Goethe Institut -
Inter Nationes. München, 3. August 2000. (Typoscript)
Berkenbrink-Martens, Ursula: Was erwarten Bundesprogrammlehrkräfte von der
GEW. In: Der Auslandsschuldienst: Ein Beitrag zur interkulturellen Erziehung,
Dokumentation der Sonnenberg-GEW-Tagung vom 15.-20.11.1998, Internationaler
Arbeitskreis Sonnenberg Hg., Braunschweig 1999, S.67f.
Bertram, Hans-Bodo: Kultur ist kein Hilfsmotor der Exportwirtschaft. In: Zeitschrift für
377
KulturAustausch 2/96.S.32f.
Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland (BLASchA) Hg.:
Evaluierung des Programms zur Entsendung deutscher Lehrkräfte in die Staaten
Mittel-, Ost- und Südosteuropas, des Baltikums und in die Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion. Bonn, Stand: 15. 12. 1994. (Typoscript)
BLASchA: Stellungnahme der Ländervertreter im Bund-Länder-Ausschuss für
schulische Arbeit im Ausland (BLASchA), Bonn, 24. 2. 1997. (Typoscript)
BLASchA, Bund-Länder–Ausschuss für schulische Angelegenheiten: Stoldt, Peter, bis
2001 Ländervorsitzender des BLASchA. In: Nachhaltigkeit Auswärtiger Kulturpolitik.
Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrer
in der GEW) vom 17. bis 22. November 2002. Internationaler Arbeitskreis
Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Drucklegung erfolgt : Braunschweig, 2003.
Brisard, Jean-Charles; Dasquié, Guillaume: Die verbotene Wahrheit. Die
Verstrickungen der USA mit Osama bin Laden. Zürich, München, 2001, S.189.
Brandt, Willy: Bemerkungen zur auswärtigen Kulturpolitik. In: Auswärtige
Kulturbeziehungen 4(1967), S.11 ff.
Bundesrechnungshof: Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO über die Prüfung der Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Goethe-Instituts e.V. Frankfurt am Main, August 2000.
Bundesrechnungshof: Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO an den Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages über die Prüfung der Vergabe von Zuwendungen, die das
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und das Auswärtige Amt zur
Förderung von Inter Nationes e.V. Bonn gewähren. Frankfurt am Main, August 1999.
Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 1996/97.
Drucksache: 13/9999.
Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 2001
Drucksache: 14/2002.
Bussmann, Hans-Werner: Europäische Kulturinstitute - Mehr als Retter aus der
finanziellen Not? In: Zeitschrift für KulturAustausch 3/97 S. 11 f.
Bortz, Jürgen. Döring, Nicole: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
Sozialwissenschaften. Berlin 2002.
378
DAAD: Ländertabelle des DAAD, Referat 212 Westeuropa. Nr. 9 Großbritannien,
Stand 1998. (Typoscript)
Deutsche Schule Istanbul: Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum der Deutschen
Schule Istanbul, 11. Mai 1993.
Deutsche Schule Istanbul: Fragebogen für Deutsche Auslandsschulen, Meldedatum
1.10. 1997 an die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Istanbul 1997.
Deutsche Schule Istanbul: Informationsblatt für künftige Auslandslehrer über die
Deutsche Schule Istanbul, März 1998.
Deutsche Schule Istanbul: Jahrbuch der Deutschen Schule 1997/98, Istanbul 1998.
Deutsche Schule Istanbul: Schulleiterjahresbericht 1997/98, vorgelegt von R.
Stürzenhofecker, Schulleiter, Oktober1998 Istanbul. (Typoskript)
Deutsche Schule London: Schrift des Freundeskreises "Friends of Douglas House",
Januar 1998.
Deutsche Schule London: 1971-1991, Festschrift der Deutschen Schule London zum
20-jährigen Bestehen, London 1991.
Deutsche Schule London: Jahrbuch der Deutschen Schule London 1997/98,
vorgelegt von Erich Backhaus, Schulleiter, London 1998.
Deutsche Schule Moskau: Jahrbuch 1997, vorgelegt von Jürgen Hackenberg,
Schulleiter, Moskau 1997. (Typoskript)
Deutsche Schule Paris: Informationsheft: Deutsche Schule Paris 1997/98, vorgelegt
von Siegfried Huber, Schulleiter, Paris 1998.
Deutsche Schule Paris: Mitteilungen des Leiters der deutschen Schule in Paris vom
17.8.98. (Typoskript)
Deutsche Schule Porto: Informationsbroschüre der Deutschen Schule Porto, Stand
März 1997.
Deutsche Schule Porto:, Schulleiterjahresbericht 1997/98, vorgelegt von Rudolf
Sperlich, Schulleiter, Porto 1998. (Typoskript)
Deutsche Schule Prag: Jahrbuch der Deutschen Schule Prag 1997/98, vorgelegt von
Wolfgang von Hinten, Schulleiter, Prag 1998.
Deutsche Schule Stockholm: Jahresbericht 1996/97 der Deutschen Schule
Stockholm, Tyska Skolan, Deutscher Schulverein, Hg., Stockholm 1997.
Deutscher Bundestag: Brücke über Grenzen. Symposium ´80, 26.-30. Mai 1980,
379
Bonn,1980.
Deutscher Bundestag: Entwurf zum Haushaltsplan des Bundes 1999, Einzelplan 05,
Übersicht 2. Anlage zur Drs.13/11100.
Deutscher Bundestag: Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik
2001. Drs.14/9760. 3.7.2002. S.4.
Deutscher Bundestag: Protokoll der 227.Sitzung des deutschen Bundestages vom
21.März 2002. S.22532-22539.
Deutscher Bundestag: Schriftliche Stellungnahmen zur Vorbereitung der Anhörung
im Protokoll der 13. Sitzung des Auswärtigen Ausschusses am 14. 4. 1997.
Drucksachen 13/62/....
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW): Arbeitsmaterialien. Die Literatur des
Nachbarn. ‚Impression-Expression‘ Wettbewerb 1993/1994. Bad-Honnef, 1994.
Deutsch-Französisches Jugendwerk: Fakten, Daten und Zahlen. Bad-Honnef, 1998.
Deutschsprachige Abteilung, Gymnasium Poprad: Jahresbericht des Leiters, Hartmut
König, 1997/1998. Poprad 1998. (Typoskript)
Deutsche UNESCO-Kommission e.V., Bonn, In: Kultur und Entwicklung 1998.S.11ff.
Zur Umsetzung des Stockholmer Aktionsplanes.
Dietze, Lutz: Elternrecht macht Schule. Econ Verlag. 2. Aufl. Düsseldorf, 1987 S. 221
Dietze, Lutz: Bildungsrecht. Aktuelle und europäische Aspekte. In: Pädagogik.
Handbuch für Studium und Praxis, Leo Roth, Hg., München, 2001,S.613.
Dietze, Lutz: Recht der Weiterbildung unter Aspekten der europäischen Integration:
primär, akzessorisch, subsidiär. In: Bildungspolitik im Umbruch. Staatsmonopol in der
Weiterbildung. Verlag Neue Zürcher Zeitung.1991. S.834.
Dietze, Lutz: In: Schulleitung. Ein Lernsystem. Band 1: Schulorganisation Schulrecht.
Vor einer Renaissance der Elternbeiräte? LE 16.06. Neuwied, 2003.
DIHT, Deutscher Industrie- und Handelstag: Zur Zukunft der Deutschen Schulen im
Ausland. (Typoskript) 16.4.2002.
Dieckmann, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden,
Anwendungen. Planung S.200ff., Befragung S.371ff. Reinbek, 2002.
Dobson, Keith: Britischer Pragmatismus in der Auswärtigen Kulturarbeit. Interview mit
dem Direktor des British Council in Deutschland. In: Zeitschrift für KulturAustausch,
2/98, S.11-13.
380
Dobson, Keith: Deutscher Bundestag Drucksache 13/62/112. Anhörung des
Auswärtigen Ausschusses des Bundestages: Bestandsaufnahme und Perspektiven
der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik, 14.4.97. In: Stellungnahme der
Sachverständigen.
Ehnert, Rolf/ Schröder, Hartmut Hg.: Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den
deutschsprachigen Länden. Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache. 2. Aufl. 1994
Verlag Peter Lang, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien.
Ehnert, Rolf: Lehreraus- und fortbildung für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in
der Bundesrepublik Deutschland. In: Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache. Das
Fach Deutsch als Fremdsprache in den deutschsprachigen Ländern, Ehnert, Rolf,
Schröder, Hartmut, Hrsg., 2. korrigierte Auflage Frankfurt u. a.,1994, S.221.
Emge, Richard Martinus: Auswärtige Kulturpolitik. Eine soziologische Analyse einiger
ihrer Funktionen, Bedingungen und Formen. Berlin 1967. S.43.
Enzensberger, Hans Magnus: Auswärts im Rückwärtsgang. Hans Magnus
Enzensberger über die Blamage der deutschen Kulturpolitik im Ausland. In: Der
Spiegel Nr. 37/199, S. 215.
Europa-Recht. München, 2003. S.85f.
Faber von, Helm: Die Entwicklung von Deutsch als Fremdsprache in der
Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Goethe-Instituts.
In: Das Fach Deutsch als Fremdsprache in den deutschsprachigen Länden.
Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache, Rolf Ehnert/Hartmut Schröder, Hrsg., 2.
Aufl. Frankfurt 1994, S.27f.
Fechner, Frank: Kultur. In: Grabitz/ Hilf: Das Recht der europäischen Union.
Loseblattausgabe, Kommentar. Stand 08/02. München 2003.3/1487 ff.
Fischer, Joschka: Rede von Bundesaußenminister Fischer zur Eröffnung der dritten
Konferenz der Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen am 27.Mai
2002, Berlin.
Fischer, Joschka:Rede des Bundesaußenministers Fischer zur Eröffnung der dritten
Konferenz der Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen, Berlin
27.Mai 2002.
Frankfurter Buchmesse Hg.: Portugal 98, Katalog zur 50.Buchmesse: Ein Meer von
Büchern. Frankfurt 1998.
381
Gadamer, Hans Georg: Gadamer: salviamo il Goethe. In: Il Mattino, Leserbrief,
20.2.96.
Geinitz, Christian: Deutsche Schulen im Ausland. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung:
8. April 2002, S. 10.
Geinitz, Christian: Lehren in Zeiten des Sparens. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
8. April 2002, S. 10.
Geyer, Christian: Partnerin, Achtundsechzig verweht: Das Goethe- Institut wählt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.1.2002, S.41.
Gigante, Marcello: Pressekonferenz im Palazzo Serra di Cassano, Neapel, 2.4. 1996.
Glasmacher, Virginia: Staat in Bringeschuld. In: Zeitschrift für KulturAustausch 2/96.
Stuttgart, S.26ff.
Glück, Helmut: DaF-Studiengänge an deutschen Universitäten: Die germanistische
Perspektive. In: Wozu DaF studieren? Probleme der Qualifizierung für die Sprach-
und Kulturarbeit im Ausland. In: Dr. Rabes Hochschulreihe, Band 6. Glück,
Helmut/Christine Koch, Hrsg.Bamberg,1998, S.76.
Glück, Helmut: Deutschland zerstört seine Muttersprache. F.A.Z. vom 24.1.2002,
S.45.
Glück, Helmut: Meins und Deins = Unsers? Über das Fach ”Deutsch als
Fremdsprache” und die ”Interkulturelle Germanistik”. In:. Deutsch als Fremdsprache.
Wo warst Du, wo bist Du, wohin gehst Du? Zwei Jahrzehnte der Debatte über die
Konstituierung des Fachs Deutsch als Fremdsprache. Gert Henrici und Uwe Koreik,
Hrsg., Baltmannsweiler, 1994. S146 ff.
Goethe – Institut: Umstrukturierung des Institutsnetzes im Ausland: Schließungen.
Standortanalyse. Goethe-Institut Bereich 02, Planung und Kontrolle. 1997.
(Typoskript)
Goethe, Johann Wolfgang : Italienische Reise. In: Werke, Hamburger Ausgabe, Band
11, 10. neubearbeitete Aufl. München 1982, S.178 ff. auch S.186,S.199, S.217,
S.326ff.
Goethe, Johann Wolfgang von: Italienische Reise. In: Werke, Hamburger Ausgabe
Band 11, 10.Aufl., München 1982, S.178ff.
Goethe, Johann Wolfgang: Maximen und Reflexionen Nr. 548. In: Hamburger
Ausgabe, Band 12, München 1982, S.440.
382
Goethe-Institut Brastislava: Jahrbuch 1997/98.
Goethe-Institut Brastislava: Programmhefte des GI Bratislava, 1997/1998.
Goethe-Institut Inter Nationes: Anhang zur Präsidiumssitzung vom 21. 11. 2001.
(Typoskript)
Goethe-Institut Inter Nationes: Rahmenvertrag in der Fassung. vom 8.1.2001.
(Typoskript)
Goethe-Institut Inter Nationes: Satzung (vom 21. 9. 2000 i. d. F. vom 8. 1. 2001) und
Rahmenvertrag zwischen dem AA und dem GIIN. (Typoskript)
Goethe-Institut Inter Nationes: Satzung vom 21.9.2000 i. d . F. vom 8.1.2001.
(Typoskript)
Goethe-Institut London: Jahrbuch 1997/98.
Goethe-Institut Neapel: Programmhefte und Broschüren des Goethe-Instituts Neapel
1998.
Goethe-Institut Paris: Jahrbuch 1997/98, Programmhefte des Goethe-Instituts Paris,
u. a. zu den Veranstaltungsreihen: Présences Allemandes und Centénaire Bertolt
Brecht, Paris 1998.
Goethe-Institut Stockholm: Programmhefte des Goethe-Instituts Stockholm 1998.
Goethe-Institut, BR-Aktuell: Haase, Marion: Auslandsinstitute –auf dem Weg wohin?
In: BR-Aktuell, Mitteilungen des Betriebsrats, 1/98, München, S.11ff. (Typoskript)
Goethe-Institut, Jahrbuch 1997/1998.
Goethe-Institut, Jahrbuch 2000/2001.
Goethe-Institut, Zentralverwaltung, Abteilung Spracharbeit Ausland: Mit der Welt im
Dialog, Broschüre : Förderung der deutschen Sprache. Der Beitrag des Goethe-
Instituts in Mittel- und Südosteuropa und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.
Joachim Sartorius, Hg., München 1998.
Goethe-Institut, Zentralverwaltung: Kulturprogramm der Pädagogischen
Verbindungsarbeit 1991-1997, Dokumentation, München 1997.
Goethe-Institut: Bericht des Vorstands Horst Harnischfeger. Jahrbuch 1995/96
München, S. 9 f.
Goethe-Institut: Homepage des Goethe-Instituts, www.goethe.de, Stand 28. 11. 2001.
Goethe-Institut: Ist-Analyse der Situation von Frauen im Goethe-Institut und
Zielvorgaben. In: Frauenförderplan München 1996, S.5.
383
Goethe-Institut: Partner der Wirtschaft In: www.goethe.de. Stand 2001
Goethe–Institut: Sitzung des Präsidiums des Goethe-Instituts Inter Nationes am 21.
November 2001. (Typoskript)
Goethe-Institut: Wir über uns. Homepages der Institute. www.goethe.de, Stand:
10/1998.
Götze, Lutz/ Pommerin Gabriele: Bilinguale Konzepte vor dem Hintergrund der
Zweitspracherwerbsforschung.- In Zielsprache Deutsch,19 (1988) 4, S.31ff.
Götze, Lutz: Interkulturelles Lernen und Interkulturelle Germanistik – Konzepte und
Probleme. In: Deutsch als Fremdsprache. Wo warst Du, wo bist Du, wohin gehst Du?
Zwei Jahrzehnte der Debatte über die Konstituierung des Fachs Deutsch als
Fremdsprache.. Gert Henrici und Uwe Koreik , Hrsg., Baltmannsweiler 1994, S. 264.
Greule, Albrecht: Deutsch am Scheideweg: National- oder Internationalsprache? In:
Thema Deutsch , Band 3: Deutsch, Englisch, Europäisch. Matthias Wermke u.a. Hg.,
Mannheim 2002,S. 58, S.63.
Gries, Waldemar, VDLIA Verband Deutscher Lehrer im Ausland. In: Der deutsche
Lehrer im Ausland. Münster, September 2002. S.146.
Grondin, Jean: Hermeneutik. In: Ueding, Gert/ Niemeyer, Max, Hrsg., Historisches
Wörterbuch der Rhetorik Bd.3,Tübingen 1996, S.1350ff.
Grusa, Jiri: Aus dem Vorwort des Bildungsministers der Tschechischen Republik, Jiri
Grusa am 10.10.97. In: Deutsch in der Tschechischen Republik, 1998/99. Hg.
Goethe-Institut Prag, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Prag/Köln,1999.
Hammerthaler Ralph : Jenseits des Lamentierens. In: Süddeutsche Zeitung vom 5.
6.1998, S. 14.
Harms, Uwe. In: GEW und Auslandsschule. Geschichte und Probleme und
Konzeptionen der gewerkschaftlichen Arbeit im Hinblick auf die deutsche
Auslandsschule nach 1945. Oldenburg, Mai 1970, S. 39.
Harshall, Albert W.: In: Ueding, Gert/ Niemeyer, Max, Hrsg., Historisches Wörterbuch
der Rhetorik, Bd.2, Tübingen 1994, S.549.
Helbig, Gerhard/ Götze, Lutz/ Henrici, Gert/ Krumm, Hans-Jürgen, Hrsg.: Deutsch als
Fremdsprache Ein internationales Handbuch. Berlin, New York, 2001.
Heller, Hermann: Staatslehre (1934): In: Gesammelte Schriften, Band 3, Leiden 1971,
S.3ff (S.311).
384
Hennecke, Frank J.: ”Nachhaltigkeit”- Modewort oder ein neues Paradigma für die
politische Kultur und die Bildungspolitik: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung/
Hg.: Pädagogisches Zentrum., Bad Kreuznach 2001. S.11ff.
Hentig, Hartmut von: Die Schule neu denken. München 2003. V26. S. 219ff
Henrici, Gert: Deutsch als Fremdsprache. Quo Vadis? Konstituierungsprobleme eines
jungen akademischen Fachs. In: Deutsch als Fremdsprache. Wo warst Du, wo bist
Du, wohin gehst Du? Zwei Jahrzehnte der Debatte über die Konstituierung des Fachs
Deutsch als Fremdsprache. Gert Henrici und Uwe Koreik, Hrsg., BAsweiler 1994, S.
200 f.
Hirn Wolfgang/ Student Dietmar: Gewinner ohne Glanz. In: Managermagazin 7/01. S.
49ff.
Historisches Wörterbuch der Rhetorik: Gerd Ueding, Max Niemeyer Hrsg., Tübingen
1994.
http://www.auslandsschulwesen.de/zfa/fortbild.htm (Stand: 28.11.01).
Huntington, Samuel: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
New York 1996, S. 81 f.
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18 (1992), S. 547-551
Institut für Auslandsbeziehungen e.V.(ifa): Tätigkeitsbericht 1995/96/97. Stuttgart
1997. In: www.ifa.de. Stand 2001.
Inter Nationes e.V. : Tätigkeitsbericht 1999, Bonn 1999.
Inter Nationes, BR aktuell: Am vergangenen Freitag. Zur 3. Sitzung des Lenkungs-
ausschusses in Berlin am 16.6.2000. Windt, Jochen Betriebsratsvorsitzender, 19.Juni
2000, Bonn.
Inter Nationes: Prüfungsbericht der Jahresrechnung 1999, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dr. Harzem und Partner, Bonn 1999.
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18 (1992), Hg. Alois Wierlacher u. a., S. 547-
551.
Koch, Patricia Maria: Doktorandinnen. Der Wille zur wissenschaftlichen Anerkennung,
Modelmog, Ilse, Hg., Hamburg 1995, S.83f.
Koch, Patricia, Maria: Qualitative Mitarbeiterbefragungen. Fern Universität Hagen, im
August 2003. (Typoskript)
KMK, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder: Nutzung der
385
Auslandskontakte und Auslandserfahrungen der im Ausland tätigen und der aus dem
Ausland zurückgekehrten Lehrkräfte. Beschluss der KMK vom 6.12.2001.
Kula, Onur Bilge: Türkische Migrantenkultur als Determinante der Interkulturellen
Pädagogik. Versuch der Erstellung eines kulturellen Bezugsrahmens für eine
pädagogische Praxis. Die Brücke e. V, Hg., Saarbrücken 1986. S. 19.
Kupfer-Schreiner, Claudia: Sprachdidaktik und Sprachentwicklung im Rahmen
interkultureller Erziehung. Das Nürnberger Modell. Ein Beitrag gegen Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit, Weinheim 1994.
LauerJ./B.Menrath: Ein Stück Deutschland jenseits der Grenzen. In: Begegnung -
Deutsche Schulen im Ausland. Auswärtiges Amt und Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen, Hrsg., Nr. 2/95, S.7ff.
Lehnart, Ilona: Der Betrogene. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. 12. 2001, S.
49.
Lenzen, Dieter: Schulen für Europa - Europa für Schulen, Vortrag auf der Tagung:
Lernen für das neue Europa: Bildung zwischen Wertevermittlung und High Tech,
23.März 98, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn 1998.
Lepenies, Wolf: Das Ende der Überheblichkeit. Vortrag am 23.10.95 in der DG Bank
in Frankfurt. U.a. in: Die Zeit, 24.11.95.
Limbach, Jutta: Rede bei Amtsantritt.. München, 21. Mai 2002. Typoskript
Maass, Kurt-Jürgen: Vor neuen Herausforderungen. In: Musikforum. Nr. 90/1999. S.
24 ff.
Maass, Kurt-Jürgen: Wider die Verstaatlichung des Daseins. In: Stifterverband für die
deutsche Wissenschaft, Hg., Wirtschaft und Wissenschaft, Nr. 1, 1998.
Marotta, Gerardo: La Politica Culturale Della Germania All´Estro. Versammlung im
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Neapel, 14.Februar, 1996. (Typoskript)
Mastronardi, Philippe: Juristisches Denken. Bern, Stuttgart 2001. S. 88 Randnote, S.
293 ff, S. 261 ff.
Meister, Martina: Alleingang - Quo vadis Kulturstiftung? Frankfurter Rundschau, 20.
12. 2001, S.19.
Mitter, Wolfgang: Welche Schulen braucht Europa? Vortrag auf der Tagung: Lernen
für das neue Europa: Bildung zwischen Wertevermittlung und High Tech, 23.März 98,
Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Bonn.
386
Müller, Reinhard: Neue Aufgaben. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. 1.
2002, S.12.
Naumann, Clas M. In: BMZ? AA? GTZ? DAAD?. FAZ, 21.11.2002. S.40.
Naumann Michael: Das hängt ja verkehrt herum! Die Zeit : 17. 1. 2002, S.33.
Nida-Rümelin, Julian: Die kulturelle Dimension des Nationalstaates. In: Frankfurter
Rundschau, 8. März 2002, S 21.
Nida-Rümelin, Julian: Die kulturelle Dimension des Nationalstaates. Frankfurter
Rundschau, 8. März 2002, S. 21.
Nürnberger Nachrichten: Frau an der Spitze, 18. 1. 2002. S. 21.(dpa)
Nünning Ansgar/Nünning Vera: Konzepte der Kulturwissenschaften.
Nutt, Harry: Anderes Spielbein. Valmy: Eine Präsidentin wird das Goethe-Institut
leiten. Frankfurter Rundschau vom 18. 1. 2002, S. 17.
Ort, Claus-Michael: Kulturbegriffe und Kulturtheorien. In :Konzepte der Kultur-
wissenschaften. Stuttgart, 2003. S.19ff.
Peise, Robert: Preisträger des Rave-Forschungspreis des Instituts für
Auslandsbeziehungen 2002 für Auswärtige Kulturpolitik für seine Diplomarbeit mit
dem Titel: “Ein Kulturinstitut für Europa. Untersuchungen zur Institutionalisierung
kultureller Zusammenarbeit.” Stuttgart, 2002.
Petry, Wolfgang: Lernen ohne Grenzen. Ein Projekt zur interkulturellen
Verständigung in NRW. Sonnenberg-Tagung der GEW 1998 vom 19. bis 24.
November 2000. In: Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hg., Braunschweig 2001,S. 84ff.
Petry, Wolfgang: Wie lässt sich die ‚Ressource’ Auslandskontakte und
Auslandserfahrung für die Entwicklung des Inlandsschulwesens besser als bisher
nutzen? Dokumentation der Sonnenberg-Tagung der GEW 1998, Braunschweig
1999, S.13ff.
Philosophisches Wörterbuch. Heinrich Schmidt, Georg Schischkoff Hrsg., Stuttgart
1957, S. 242 ff.
PISA 2000, Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen
Vergleich, Deutsches Pisa-Konsortium, Hrsg., Opladen 2001, S.340
Platthaus, Andreas: My fair Lady. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. 1. 2002,
S.43.
387
Pommerin-Götze Gabriele: Interkulturelles Lernen. In: Deutsch als Fremdsprache. Ein
internationales Handbuch. Herausgegeben von Gerhard Helbig, Lutz Götze, Gert
Henrici. Berlin, New York, 2001. S. 973ff.
Proksch, Josef: Neue Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Goethe-Institut und
Bundesverwaltungsamt-Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Tagung der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Der Auslandsschuldienst- ein Beitrag zur
Interkulturellen Erziehung vom 15.-20.11.1998. Dokumentation der Sonnenberg -
Tagung in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Braunschweig,1999, S. 142ff.
Reich, Hans R.; Wierlacher, Alois. Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik.
Bildung. Wierlacher Alois; Bogner, Andrea, Hg.: Handbuch interkulturelle Germanistik.
Stuttgart, 2003. S.206.
Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung: Kultur und Nachhaltigkeit.
Thesen und Ergebnisse aus einem Ideenworkshop. Berlin, 11./12.12.2001.
Schipanski, Dagmar: Auslandsschulen im Spannungsfeld zwischen Bildungsqualität
und Budget. Rede anlässlich der “Konferenz Deutscher Auslandsschulen – weltweit”,
vom 4. bis 6. April 2002 in Mexiko-Stadt. www.ds2002.org
Schlobinski, Peter: Empirische Sprachwissenschaft. WV studium, Band 174, Opladen
1996. S. 40., S.171ff.
Schmidt, Walter: 29 Jahre in der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –
Rückblick und Ausblick. In: Neue Akzente in der Auswärtigen Kulturpolitik. Schulische
Arbeit zwischen Ökonomisierung und interkulturellem Auftrag. Dokumentation der
Sonnenberg - Tagung, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft vom 19. bis 24.
November 2000. Arbeitskreis Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, Hrsg., Braunschweig 2001, S.17ff.
Singer, Otto: Kultur und Nachhaltige Entwicklung. In: Wissenschaftliche Dienste des
Deutschen Bundestages. Reg.-Nr.: WFX- 50/02. Berlin 2002. S.32f.
Singer, Otto: Kultur eine vernachlässigte Größe im Nachhaltigkeitsdiskurs. In: Das
Parlament, Berlin, 29./30.Dezember 2002. S.15.
Sonnenberg-Tagung der GEW 2002: Nachhaltigkeit Auswärtiger Kulturpolitik.
Dokumentation der Sonnenberg – Tagung der AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrer
in der GEW) vom 17. bis 22. November 2002. Internationaler Arbeitskreis
388
Sonnenberg in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Drucklegung erfolgt : Braunschweig, 2003.
Schneider, Axel: Die auswärtige Sprachpolitik der BRD. Eine Untersuchung zur
Förderung der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und in
der GUS 1982 bis 1995. In: Dr. Rabes Doktorhüte, Bd. 2, Helmut Glück, Hg.,
Bamberg 2000. S. 165 ff.
Scholl-Latour, Peter: Allahs Schatten über Atatürk. Die Türkei in der Zerreißprobe.
München 2001. S. 343.
Spinner, Helmut F.: Theorie. In: Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Bd. 5.
München 1993. S. 1486 ff.
Stark, Franz: Faszination Deutsch. Die Wiederentdeckung einer Sprache für Europa.
München 1993, S. 295 ff.
Strahlendorf, Peter: Kultursponsoring – Retter der Auswärtigen Kulturpolitik? In:
Zeitschrift für KulturAustausch 2/96. S.34f.
Tait, Simon: Wieviel Staat braucht die Kultur? In: Zeitschrift für KulturAustausch, 2/96.
S.68ff.
Toblacher Gespräche des Öko-Instituts Tirol. Ergebnisse sind in den “Toblacher
Thesen” zusammengefasst, z.B.: “Schönheit –Zukunftsfähig leben”, 1998.
Tschechische Republik und Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur,
Wissenschaft und Kunst: Protokoll über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Schul- und Hochschulwesens, zwischen dem Ministerium für Schulwesen, Jugend
und Körpererziehung der Tschechischen Republik und dem Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst für die Jahre 1996
bis 1998. (Typoskript)
UNO: Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in
Rio de Janeiro. Dokumente Agenda 21. In: Eine Information des
Bundesumweltministeriums. Bonn. (ohne Jahreszahl)
Vattimo, Gianni: Nicht mehr Terror. Interview mit Luca di Blasi in der Frankfurter
Rundschau. 23.2.03. S.9.
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesminister des Auswärtigen und den
Kultusministern der Länder in der BRD, vertreten durch den Präsidenten der
Ständigen Konferenz der Kultusminister, über den Einsatz deutscher Lehrkräfte im
389
Ausland. (“Rahmenstatut für die Tätigkeit deutscher Lehrkräfte im Ausland”),
21.12.94.
Vollmer Antje: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Stiftungswesens,
(Gesetzentwurf), Bundestagsdrucksache 13/9320, 1.12.97.
Vollmer, Antje: Die Neuorientierung und Weiterentwicklung der Bundeskulturpolitik ist
überfällig. (Antrag) Bundestagsdrucksache 13/9796, vom 28. 1. 1998.
Vollmer, Antje: Partner im öffentlichen Diskurs. In: Deutsches Allgemeines
Sonntagsblatt,18.2.2000. Artikel AG 7/2000 Gastkommentar: Antje Vollmer.
Wackwitz, Stephan: Walkers Gleichung, Göttingen 1996, S.215.
Wagner, Bernd: Felder und Aufgaben von Kulturpolitik auf Bundesebene. In:.
Dokumentation des Kulturpolitischen Ratschlags am 8. Juli 1995 in Bonn. Albert
Schmidt (MdB) Hg. für die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. S. 26 f.
Waldburg-Zeil, Alois: Schleichendes Gift. In: Der Dialog mit dem Islam. Zeitschrift für
KulturAustausch. 1/02, Stuttgart, S.10.
W, Albert: Die Zukunft des Goethe-Instituts, Brief vom Juni 1998 an die
Regionalbeauftragten des Goethe-Instituts.(Typoskript)
Weber, Raymond: Elemente für eine europäische Kulturaußenpolitik: Ziele, Prinzipien
und Strukturen. In: Zeitschrift für KulturAustausch 3/02.S. 114.
Wierlacher, Alois u.a., Hg.: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, seit 1975. 1992. S.
Wierlacher, Alois: Vertrautwerden in der Distanz. In: Fremdgänge, Eine anthologische
Fremdheitslehre für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Wierlacher, Alois
/Albrecht Corinna Hg., Bonn 1998, S. 127.
Wierlacher, Alois: Begründung und Entwicklungsgeschichte des Instituts. In:
Kulturthema Kommunikation, Wierlacher, Alois, Hg., 1. Aufl., Möhnesee 2000, S. 19.
Wierlacher, Alois: Das Kulturthema Toleranz. In: Architektur interkultureller
Germanistik, München 2001, S. 413.
Wierlacher, Alois: Internationalität und Interkulturalität. In: Architektur interkultureller
Germanistik, München 2001, S 266.
Wierlacher, Alois: Laudationes. Akademie für interkulturelle Studien. Netzwerk
wissenschaftlicher Weiterbildung. Universität Würzburg. Zur Verleihung des
Akademie-Preises für interkulturelle Studien. Würzburg, 23.2.2002,
Wierlacher, Alois: Vom Begriff des Blickwinkels. In: Architektur interkultureller
390
Germanistik, München 2001, S.318.
Wierlacher, Alois:. Begründung und Entwicklungsgeschichte des Instituts. In:
Kulturthema Kommunikation.1. Aufl., Möhnesee 2000, S.20.
Wierlacher, Alois: Rahmenbegriffe interkultureller Germanistik. Bildung, S.203ff.
Distanz S.222, Interkulturelle Germanistik in Deutschland. S. 612ff. In: Wierlacher,
Alois; Bogner, Andrea (Hg.): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart 2003.
Witte, Barthold C.: Festvortrag anlässlich der Feier zum zehnjährigen Bestehen von
interDaF am Herder-Institut der Universität Leipzig, am 25.10.2002, Leipzig,
(Typoskript).
Witte, Barthold C.: Fremdheitswissen als Basis auswärtiger Kulturpolitik. In:
Kulturthema Fremdheit. Alois Wierlacher. Hg., München 1993, S.451.
Wirtschaftswoche: Wirtschaftswoche: Emsige Kehrer. Wie ein Exkommunist aus dem
sinnenfrohen Sündenbabel Neapel eine Vorzeigekommune macht. Ausgabe Nr. 15
vom 4. 4. 1996. S. 30.
Zehetmeyer, Hans: Anmerkungen zum Sparkurs der Bundesregierung. Frankfurter
Rundschau vom 20. 12. 2001.
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: AA/ZfA- Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen an Bundesprogrammlehrkräfte. In: Mitteilungen-Meinungen–
Materialien: 2/96,Grüne Blätter, 43. Jahrg., VDLiA,Hg., Schroedel Verlag. S. 109.
Ziegert Susanne: Imagetransfer über Kultur. In: Die Welt 13. 5. 1998, S. 26.
Znined-Brand, Victoria: Deutsche und auswärtige Kulturpolitik. Eine vergleichende
Analyse. Frankfurt am Main, 1999. S. 17f. S.103.
391
ANHANG
D 3. Befragung von Beschäftigten an Goethe-Instituten und Deutschen Schule
Fragebogen
3.1. Gestaltung des Fragebogens
1. Persönlicher Werdegang, Ausbildung und Bewerbung
1.1. An welcher Institution arbeiten Sie?
Goethe-Institut O
Deutsche Schule O
1.2. Was hat Sie veranlasst, sich bei dieser Institution zu bewerben ?
1.3. Wie und wo haben Sie sich beworben?
1.4. Seit wann arbeiten Sie in diesem Land?
seit 0-5 Jahren O
seit 5-10 Jahren O
seit 10-15 Jahren O
seit 15-20 Jahren O
seit mehr als 20 Jahren O
1.5. Inwieweit beherrschen Sie die Sprache des Gastlandes?
zweisprachig O
sehr gut O
gut O
mittelmäßig O
erste Kenntnisse O
1.6. In welchen anderen Ländern haben Sie schon gearbeitet?
392
1.7. Welche Ausbildung haben Sie?
Abitur O
1. Staatsexamen O
abgeschlossenes Studium O
sonstiges:__________________________
1.8. Sind Sie auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als
Zweitsprache ausgebildet?
ja O
nein O
1.9. Wie wurden Sie auf den Einsatz im Partnerland vorbereitet?
1.10. Wie sind Sie besoldungsmäßig eingestuft?
1.11. An welchen Fortbildungen haben Sie im Bereich DaF bzw. DiDaZ
teilgenommen?
Von wem wurde die Fortbildung angeboten?
1.12. Haben Sie schon selbst Fortbildung erteilt? Welche?
2. Vorstellungen/ Aufgaben vom Gastland/ im Land
2.1. Sind deutliche politische Veränderungen im Gastland seit Ihrer Anfangszeit zu
verzeichnen? Worin bestehen diese?
2.2. Welche sozialen Vorstellungen bzw. Bedingungen im Partnerland machen Ihnen
Schwierigkeiten? Welche sonstigen Probleme tauchen auf?
2.3. Welche kulturellen Zusatzaufgaben und Repräsentationspflichten fallen an?
2.4. Welche landeskundlichen Materialien (Audio- und Videokassetten, Filme,
Literatur, usw.) werden/ wurden im Unterricht in der letzten Zeit eingesetzt?
393
3. Berufliche Perspektiven
3.1. Wann kehren Sie nach Deutschland zurück?
gar nicht O
in diesem Jahr O
in 1-3 Jahren O
in 3-5 Jahren O
späterer Zeitpunkt O
3.2. Welches wird Ihre nächste Tätigkeit sein?
3.3. Kann es zur Kündigung kommen, aus Gründen, die von Ihnen nicht zu
verantworten sind?
ja O
nein O
3.4. Sind Sie sozial abgesichert am Arbeitsplatz im Ausland oder nach Ihrer
Rückkehr nach Deutschland?
Im Ausland: ja O
nein O
in Deutschland: ja O
nein O
3.5. Welche Verbesserungen Ihrer Situation könnten von Deutschland aus initiiert
werden?
3.6. Welche einsatzbezogenen Forderungen stellen Sie an die Bundespolitik?
3.7. Welches ist Ihr persönlich wichtigstes Berufsziel?
394
Bitte beantworten Sie die Fragenkomplexe 4 - 9 nur, wenn
Sie an einer Schule oder an einem Goethe-Institut als
Ortskraft im Unterricht tätig sind.
4. Schulinterne/ institutsinterne Arbeitsbedingungen
4.1. Wie viele Schüler bzw. Studenten gibt es in Ihrer Einrichtung?
4.2. Arbeiten Sie auch in der Verwaltung?
ja O
nein O
4.3. Wie viel Wochenstunden unterrichten Sie?
5-10 O
10-15 O
15-20 O
20-25 O
25-30 O
4.4. Welche Klassen bzw. Kurse unterrichten Sie?
Goethe-Institut: GS O
MS O
OS O
Deutsche Schule: Sek I O
Sek II O
Sek I+II O
4.5. Welche Vorteile können Sie sich vorstellen bei der Zusammenarbeit der
Kulturinstitute verschiedener Länder unter einem Dach?
4.6. Wie schätzen Sie die Verteilung Ihrer Studierenden bzw. Schüler nach
Nationalitäten ( in %)?
395
4.7. Wie gestaltet sich der kollegiale Umgang?
(mit der Schulverwaltung des Partnerlandes?)
4.8. Gibt es organisatorische Schwierigkeiten? ( Bücher, Räume, Stundenpläne)
4.9. Worin bestehen die Kontakte zur Botschaft bzw. zum Konsulat?
5. Eigenes didaktisches/ methodisches Konzept, Medien und Bücher
5.1. Mit welchen Büchern bzw. Medien arbeiten Sie im Deutschunterricht?
5.2. Entspricht das Unterrichtsmaterial Ihren Vorstellungen ?
ja, sehr O
weitgehend O
kaum O
überhaupt nicht O
5.3. Welche Vorkenntnisse haben Ihre SchülerInnen bzw. StudentInnen?
Deutsch seit: Kindergarten O
Grundschule O
Sek I O
Sek II O
Keine Vorkenntnisse O
6. Perspektiven und Kontakte der SchülerInnen/ StudentInnen
nach Abschluss der Ausbildung
6.1. Wie ist das Interesse an einem Studium in Deutschland?
6.2. Welches sind die Erwartungen der Schülereltern an Ihren Unterricht?
6.3. Welche Besonderheiten im Lernverhalten Ihrer SchülerInnen fallen Ihnen auf im
Vergleich zu Ihren Erfahrungen in Deutschland?
6.4. Welches sind die Erwartungen Ihrer SchülerInnen bzw. StudentInnen bezüglich
der Zukunftsaussichten, wenn sie Deutsch gelernt haben?
7. Kontakte der SchülerInnen/ StudentInnen in Deutschland
7.1. Was könnte getan werden, um die Kontakte Ihrer SchülerInnen
mit Deutschland zu intensivieren?
8. Europa im Unterricht
396
8.1. Spielt der europäische Gedanke im Unterricht eine Rolle?
ja O
manchmal O
kaum O
nein O
8.2. In welchen Themenbereichen äußert sich konkret in Ihrem
Unterricht die Annäherung der europäischen Länder?
O Welche Frage hat Ihnen gefehlt?
O Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir für eventuelle Rückfragen Ihren Namen und
Ihre Adresse auf.
Bitte beantworten Sie die Fragenkomplexe 9-11 nur, wenn
Sie als entsandte MitarbeiterIn des Goethe-Instituts oder
als Ortskraft in der Pädagogischen Verbindungsarbeit tätig
sind.
9. Spezifizierung der Tätigkeitsfelder
9.1. Wieweit und in welcher Form haben Sie Kontakt zur Bevölkerung des Landes?
9.2. Wenn Sie in einem Land in Mittel- und Südosteuropa und in der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten arbeiten:
Wieweit und in welcher Form haben Sie Kontakte zur deutschsprachigen
Minderheit?
9.3. Welche Vorteile können Sie sich bei der Zusammenarbeit der Kulturinstitute
verschiedener Länder unter einem Dach vorstellen?
10. Deutschlandbild und Korrektur
10.1. Entspricht das Deutschlandbild Ihrer Partner in der Spracharbeit der Realität?
10.2. Welche Kulturveranstaltung in Ihrer Institution hat besonders guten Anklang
gefunden?
11. Europa in der auswärtigen Kulturarbeit
11.1. Spielt der europäische Gedanke in Ihrer Arbeit eine Rolle?
O Welche Frage hat Ihnen gefehlt?
397
O Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir für eventuelle Rückfragen Ihren Namen und
Ihre Adresse auf.