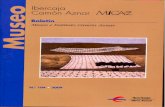„Weder römisch, noch antik“? Pieter Bruegels Calumnia des Apelles in neuer Deutung, in: Gernot...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of „Weder römisch, noch antik“? Pieter Bruegels Calumnia des Apelles in neuer Deutung, in: Gernot...
Gernot Kamecke, Bruno Klein, Jürgeri Müller (Hg.)
Antike als Konzept
Lesarten i n Kunst, Literatur und Politik
»Weder römisch, noch antik«?
Pieter Bruegels Verleumdung des Apelles i n neuer Deutung
Ber t ram Kaschek
Ein Aspekt iitl Werk I'ieter Briiegels d.Ä. hat der Forschung iriimer wieder Kopf-
zerbrechen bereitet: der Unistand, dass sein ltalienaufenthalt zu Beginn der 1550t.r
Jahre scheinbar iiiir riiiiiimale Spuren i i i seinem Werk hinterlassen hat.' Zwar zeigt
sich in nianclicii seiner friihen Lai-idschaftsenrwürfe ein Naclihall venezianischer
Druckgraphik, doch das Gros jener Bildfindungen, die er nach seiner Rückkehr nach
Antwerpei-i geschaffen hat, ist gänzlich frei von iralienischeii Reniiniszenzen.' Vor
allcin 3~ifctt.m Gebiet der Figi i rc~idarstel lun~ hat Briiegel sich d e m italienischcri Idiom
offenbar völlig verschlosse~~. Erst a b Mit te der 15GOer, also zehn Jahre riacli seiner
Reise, tauchen plötzlich vzreinzelte formale Anleihen bei italienischen Vorbildern in
seinen Werken niif. Carl Gustav Stridbeck lind andere haben hierfiir in erster Linie
Bruegels Umzug von Antwerpen nach Brüssel in1 Jahr 1563 verai~rwortlich gemacht:
Im Milieu der Rrüsseler Romanisten sci der Maler verstärkt init italienischen und
it,ilianisierenden Vorbildern, etwa den Apostel-Kartons von Kaf f~e l und den Werken
Bernard vaii Orleys, in Kontakt gekominei-i iind habedadiirch entscheidende Irnpiilsz
erhaltei~. ' I3iesz Hypothese kann nicht iiberj.eugeii. D e n n sie ignoriert den Umstand,
dass der Kiiiistler während und nach seiner Italici~reihe sich keineswegs ben1üf<igt sah,
ein italienisches Idioni anzi i i~zhmen. Zudein war auch Antwerpen eine Hochburg
rorn:inistischer Malerei, ohne d ~ s s sich dies in Briiegels Stil niedergeschlagen hätte -
ganz zu schweigen von der Driickgraphik nach italienischer tiiinst, die jederzeit und
über,iII verfügbar war. I>er Ortswechsel ist also sicher keine hinreichende Erklärung
für den iiiierwarteteii )stilistische11 Uinschwurig< (Stridbeck).
Vorliegender Beitrag niöctite eine11 ileueri Lösungsvorschlag iinterbreiten und
versiichen. Bruegzls Motiv fiir seine Anleihen bei italienischer Kunst genauer zu
bestimmen. 111i Zencriini soll hierbei das Blatt init der Glu~rlilin (Verleumdung) des Apelles (Abb. 1 ) aus den1 lalir 1565 stehen, das im Hinblick autRruegels Umgang niit
italienisch-antike11 Fornivorgabcneiii Schlüsselwerkdarstellt." Bemerkenswert ist diese Zeichniiiig iriiierhrilb des Briiegelschen E u v r e s schon allein aufgriind ihres aritiken
1 I.ür kririsclic 1.cktiii.c iiiid liilfrciilie I liriwcise ci.iiilic i ihJiil i~iii B l~ ink , Tere.\n Eiide, I\;rr\riii Ktiyrcr iilicl Jürgcii hliillcr \ o~v ic clcii 'li~iliieliriierri des Rr»rl,hliop\ hontinuitiit urict A'oilfi.or2ii1itor2. AntiRr ~? ' [? / /~ /~O?IC, ) I 111 . \ / i t t~/ , / / td~. 1111/1 /:~II/Ic,?' I\'C>IIZCJ~~ ~1111 hiiiiihrcraiier C~r~iduicrrcnl~c~l Ic$ <;f,~.f,//~c/~ift/icbr .Sviwl/o/ik in1 bi'~iti,/,i/ti~r i i i i .April 2008.
2 Liic:~. ic)rr.
3 VKI. S I K I I ) H I : < . ~ 19 j0 , S. 266-280: ( ;NO\\ \T. \NN 1961 ; (;rnsos 1977. 5. 120-145 (Kap. A<iilngf,uf citr~. ,I c/iii><yc .i<l'/f).
4 MII.I.I;I 1996. Ni-. 03, S . 6hf. Ziiiii rr\tfi i Ll.il piiblizicrt iiiid kuiidig koinincnrirrr wuriie die Zcicliiiiiiig vor1 W'III-I I I950.
1 Pieter Bruegel der Ältere: Die Verleumdung des Apelles, 1565, Feder i n Graubraun, braun und grau Laviert, 20,3 x 30.6 Cm, Bri t ish Museum, Department o f Prints and Drawings, London, 1nv.-Nr. 1959-2-14-1 (P.16)
Siijets. Dariiber hinaus handelt es sich bei der Caluniviia u m ein kunsttheoretisch auf-
geladenes ' lhema, das nur in literarischer Form aus der Antike iiberliefert ist.j Es geht
zurück aiifeiiie Rildbeschreibung, die dergriechische Dichter Lukian nach einem nicht
erhaltenen Geniälde des Apelles verfasst hat und die von Leon Rattista Alberti in De pictzt)ir (1435) als vorbildliche irll~u)ltio (Erfiridung, Rildidee) und somit als Grundlage für eine vollkommeiie l~istorin gepriesen wurde." Künstler wie Rotticelli, Mantegna,
Raffiel, Dürer lind Holbein haben Albertis Empfehlung Folge geleistet und sich an
einer bildlichen Rekonstruktion des verlorenen Meisterwerks versucht.- Schließlich
war dies ein prestigetrichtiges Unternehmen, denn wer immer eine Cnlurnrlia ins
Bild setzte, tr;it dami t das verlorene Erbe des größten Malers des Alterturiis a n und
erklärte sich selbst zum zweiten Apelles<. I m Fall der soeben genannten Künstler, die sich alle beständig ~ i n d intensiv niit der Kunst der Antike auseinandersetzten, liegt
eine solche Identifikation nahe. D e n n mit ihren Rekonstruktionen der Cnlltinrlia re-
flektieren sie gewissermaflen ihr tägliches Geschäft, das nicht zuletzt in der kreativen
Aiiverwa~idlungailtiker Formvorgaben lind literarischer Impulse bestand. Bei Rruegel
hingegen bleibt die Wahl des Themas rätselhaft. Schlieglich bestand sein Werk bis
1505 aiisschlie~~lich aus Landschaften, biblischen Darstellungen, enzyklopidischen
Schaubildern ~ i n d Höllenphantasien in der Nachfolge Hieronymus Boschs. Wenn er
nun plötzlich ein antikes S~ijet wählt, darf man vermuten, dass er dafür einen guten
Grund hatte. Doch worin bestand dieser? Ein erster Hinweis auf eine mögliche Antwort ist der Rahmenerzählung der
Caluw2t2inzuentnehmen. Laut Lukian hatte Apelles sein allegorisches Gemäldeeinst
aus Anlass einer i h n betreffenden Verleuindung geschaffen: D e r Maler war von sei-
nem neidischen Kollegeii Antiphilus beim ägyptischen König Ptolemäus bezichtigt
worden, a n einer politischen Verschwörung teilgenommen zu haben, woraufhin
der Herrscher Apelles einsperren ließ u n d z u m Tode ver~irteilte. Die Vollstreckung
des ~l'odesurteils konnte nur durch den Einspruch eines tatsächlichen Verschwörers
abgewendet werden, der die Ui~schuld des Apelles bezeugte. Z u r Erinnerung a n
das ihm beinahe widerfahrene Unrecht schufApelles schließlich jene Allegorie, die
sich n u n auch Bruegel zu eigen macht . M a n k a n n von daher durchaus die Frage
stellen, o b nicht a ~ i c h Hruegels Cnlumnia als Reaktion a ~ i f eine Verle~imdung durch Kollegen entstanderi sein könnte. Obwohl bereits das Thema diese Möglichkeit
nahelegt" ,wurde sie von der Forschung meines Wissens bisher nicht in Betracht
gezogen.
So wenig wir iiber das Leben Rruegels wissen - in diesem Fall lässt sich ein inte-
ressantes Szenario rekonstr~iieren. D e n n tatsächlich gibt es einen Hinweis d a r a u t dass
der Kiinstler 1565 Anlass hatte, sich gegen einen schlechten L e ~ i m ~ i n d zur Wehr zu
setzen. In diesem Jahr erschien nämlich Lucas d'Heeres Gedichtanthologie Den Hof
en Roomga~rdder Poesien, in der sich ein Schmähgedicht findet, bei dessen Adressat es
sich uin Bruegel handeln könnte." D'Heere war selbst Maler ~ i n d ergebener Schüler
des einflussreichen Romanisten Frai-is Floris."' In besagtem Gedicht mit dem Titel
Inuectiue, a n eenen Quidnm srhilder: de welcke beschimpte de Schilders van Handwer-
perl (Schrnühgedicht a n einen gewissen Maler, der die Maler von Antwerpen beschirnpfi
hnt) verteidigt er seinen verehrten Lehrer gegen die harsche Kritik eines namentlich
nicht genannten Kollegen.' ' Dieser hatte offenbar die Gemälde von Floris und seinen
Anhängern (van Florz~s, en sijns ghelijcke) als ),Zuckerbildcheni< (suuckerbeeldekens)
abq~ialifiziert." Gegen diese vern~utl ich mündlich vorgetragene Provokation n i m m t
8 L'gl. W , \ I < N K ~ 1996, S. 155f. 0 Lliese Mögliclil<cir wurde ersriii.ils 1975 von Carl van de Velde erwogen - lind sogleicti wieder
verworFeii. Vgl. v,\x nr: VCLDE 1975, S. 2 . 10 %ii d'Hcci-c vnl. R F ( . K F R 1972175 Beclier idencifizierr den ,~Quidi im sctiilder<< allerdings nicht niit
Hr~icgel. soridern gI.i~ihr, dass es sich Lirn einen ent t i~ischte i i ehenialigeii Werkstattgehilfen naus Floris' Malfahrik,' (S. 1 2 i ) ti.iiidclc.
I 1 Der 'l.cxc findcc sich in D ' H F F R F 1969, 5. 80-82. Eine koniniencierce Textversion findec sich auch in M~,&oon, 1996. VgI. a ~ i c h Fi<rr.i~sri<c; 1989. Freedlierg war der erste, der die Iiivekcive als Indiz f'iir eine kurisrrheorecisctie I3eharce wercece, die zwischeri den Verrrecerii einer eher klassizisrisch- i c~ l i~n i \ i e r e r iden L I I I C ~ einer eher ~~~iroclithon-fläiiiisclieii Kuiiacpraxis auapefoclireii w~ i rde . Dabei ordriec er \ \ i c dann .i~ich Me.ido\\ - Hrucgel dem leciceren Flügel LLI, ohne ihn niic den1 Quidani ZLI idericifiziercii.
12 Nricli ~ \ I F A I > O W 1996, S. 202, spieleri die ~,s~iuckerlieeldekens,, a ~ i f jenes gleichnamige skiilprural g e h r i r i ~ e Weihriachtsgehäck aii. das irii 16. Jahrliniiderr a~ifgrurid seiner reichen Verzierungen als Iiesondcri l~ixiiri0s palc. Die Iiier voiri Quidaiii iria Spiel gebrachte Spe i~en ie ra~hor ik verweist nicht
I>ieter Brz~egrls l'c.i.lruindilng des Apelles, in tzeuer Deutung 169
d'Hecre seinen Lrhriiieister in Schutz lind holt in1 selbeii Z u g zum Gegenschlag aus,
iiideni er den ailoiiymeri Z i i~ i f t~e i iossen nun seiiierseits nach aller1 Regeln der Kunst deii~inziert: Er sei ein neidischer, hasserfüllter, ja u,ahnsiiiiiiger Pfuscher, Narr und
D~ii i inikopf , dei- sich diirch das Schlechtniachen seiner Kollegen selbst erheben wolle;
in seiner Veracht~iiig der Schönheit der Vencis - die doch sonst ein jeder in Ehren
l i ~ l t e - iihertreffe cr sogar den antiken hloriicis, der nur deren Pantoffel kritisiert
h'ibe; während Floria seiiie Ceni i lde angemessen und reich (bec-mnelic en rzjcke) zu
\,erzieren wisse, scliiiiiicke er seiiie Bilder in inm manierlicher Weise wie Kirriiesp~ippen
(/zIs klrrrrwzespoppen) lind verfiige nur beiiir Prahlen und Liigeii über A n m u t (gr~zci'); bitterer als Galle sei sein Werk, das er mit miicri Borsten (groue bostels) anstatt iriit feinen Pinseln gescliafkn habe; ii~ich merke iniiii seinen Geniälden, dievoller schlechter
Striche (vul lnmr)re, ylrrzde tl-eken) seien, iiicht an, dass er in Rom gewesen ist, denn
sie säheii weder römisch iioch antik (noc-h Rnornnchtig, noch ooc /~//tzjcx) aus."
»'Heeres Kritik ist veriiichtend. Sie lässt keiii gutes Haar a n dem Unruhestifter.
der es gew,isr liar, den iiiäcIitigeii Frans Floris in Zweifel zu ziehen. I>och bereits
dcr rhetorisclic Auf\varid, den d'Heere betreibt, lässt verinuten, dass es sich bei den1
kritisclicii Kollegen ~ i i i i einen diirchaus eriisrz~iiiehnienden Gegner gehandelt Iiaberi
ni~iss. Vei-sucht inaii, desscn Anliegen aus d'Heeres Invektivez~i erschließen, so gelangt
inan iiberdies zii einer ersta~inlich kohärenten Positioii, die sich ofFenbar bewusst und
sysrernatisch den ästhetischen Noriiieii des flämischen Roinaiiiariius widersetzt."' Und
einiges spricht dafür, dass der Provokate~ir tatsächlich mit Rr~iegel identisch ist: Auch Rr~iegel isr i i i Rom gewesen, ohne dass dies seinen Werkcn anzuseheii wäre. Bilder
wie die Kir/dellcpic./e oder der Khw//f'zu~ische)/ K/zvnevil/ zi//ti Fhsten erscheinen aus der
I'erspektive des Llnssischeii d~zcorum, die d'Heere einiiimint. tatsichlich als nunrna-
iiierlicli(< und 1:isseii an die von d'Heere genannten k/revemespopper~ denken. Bruegels
Vorliebe fiir p~iiiiinelige Ra~iernfigureii kann z ~ i d r m als Ausdr~ick seiner Verachtung
einer vornehmlich auf die Darbierung körperlicher Schönheit ausgerichreren Kunst
versraiideii werden. Schließlich lässt sich aiicli die Zeichnung init der Vevleunltizl//g des Apellex als weireres Arg~iiment ins Feld fiihreii. Denn durch sie konnte Bruegel alle
Vor\rürfe d'Hccres init einen] Schlag entkräften: Formal u n d inhaltlich liefert sie den
k l ~ r e i i N,ichzvcis, ciass seine sonstige >IJ[rirrianierlichkeit( nicht auf sein Unverriiögen,
sonder11 auf seinen dezidierten Unwillen zurückzuführen ist. Doch wem war er eine
solche Kccliciiscliaft iiberlia~ipt sch~ildig?
Als d'Heeres (;ediclit 1565 erschien, arbeitete Briiegel gerade an? griißteii Auf-
trag seiner Karriere: Für den ä~ifierst \vohl habenden An rwerpenei- Steuerbearnten
\ori iiiisct.ilii- . i~ i i 'd i r ei-.i\iiii\chc L l r ~ i k l i ~ i i i - clei- Jilciii.-l/i.iLinilis, dri- ;liiFolgr die :iiiRc.i-c Scliiiiihcir
i i i ~ r dciii h l ~ k r l l> lo lk~ i Siliciiis hrIi:iFie[ ist: Llir \v,ilirc Sii[.k iiiid dic \ v ,~h r r Schijnt~cit liegrii dril l-
ii.icli Fc~ . ,~de iiii Hittrrcri iiiid Hiisslic-hrri verh«isrri. \'gI. hirizii hii'.i.i F R ii)qi). 5 . 00-125. \przirII
~ i i i Sl>circiiirr31ihoril< S . 120. I h1;iii tüh l i \icli ,111 t l i i r v r ei-iiiiici-r, Jrr iii ciiiciii Brief .iii Willihald Pli-cl<liriiiier aus Veiicilig hr-
r i ih tc t . d ~ s \ dir j ~ i e ~ d i \ ~ l i e i i ) ~~ . i l i c i i i s~ I l r i i t i ~ l l r g c i i ihn1 \.nr\vfirFe~i, seit1 Werk »SC!. 11ir . i~ii isisch
. i r ~ , doi-iiiii SC? cs iiil siir,,. VSI. I l r ! i~rnic ;~ ik)ih. 5 . 44. I+ Liiie .iii\ltitii-liclie Ai ia l ! .~~ dc.r Iniircr~l~c diii-cli cirn Auroi- ist iii Vr(>rl~rrciriiiig.
Niclaes Jorigeliricl< scliiif ei- die aus urspriinglich sechs Tafelii bestehende Serie der
Monatsbilder. I i i deii beideii Jahren zuvot hatte Jongelinck sich voii Bruegel bereits
eiiieii Turvnbnu zu Brzbcl (150.3), einen Aufiticx zunz Knlvnrienber'q (1564) und ver-
rnutlicli einige kleinei-e Bilder iiialen l a ~ s e n . ' ~ Zugleich besaß Jongelinck aber aiicli
22 Geriiälde voii Frans Floris. die er z i ~ r n größten 7eil wohl noch in den 1550er Jnh-
ren erworbcii hatte - ciaruiirer zwei monurneiitale Geniäldezykleii: die Arbeiten lies
H~zi.klrlc~ lind die S i ~ b e r ~ /i.<~i(v~ Ki/iijtc.'(' Joiigeliiick hegte also Sympathien für beide
Maler. doch oHiiibar ist eiii CJriiscIiwiirigseiner Vorlieben iii deii friiheii 156Oer Jahren
zu verzeicliiieri: Bruegel scheint Floris aiis der Rolle des 1,iebliiigsmalers verdi-äiigt zu hribcii. Angcsiclits dieser direkten Konl<iirreiizsituation gewiiinr dic in d'Heeres
Invekti\.c greifb;irc Koiitroverse deutlich an Brisaiiz. Deiiii die Auseinanderserzcirig
uni die bessere küiistlerische I1»sitiori erscheint ii i i i i zugleicli als Streit um die Gciiist
eines potenten Miizens, was Neid, Missgunst uiid Häine zwischen den verfeinderen
Parteien sicher befördert hat. I l a Briiegel zu Begiiiii der 156Oer Jahre scheinbar die
Oherhand gewoniieri liatte, mag er es sich erlaubt Iinbeii. selbstbewcissr lind etwas groiSspiirig über das )Zuckrige( des abgemeldetei~ Fa\.«riteri zu spotten - i i r i i diidcirch
ciie giftige Reaktioii d'Heeres zu provoziereii.
Jorigeliiick, als bedeiireiidster Samrnler der Werke Briiegels wie auch des Fraiis
Floris, wird dlHeeres Jnurctiue gewiss mit großem Interesse zur Kenntnis genommen
iind ini gescholteiieii Quidnnz schilder mühelos denjenigen Künstler erkannt haben,
der Für ihn gerade eincil sechsteiligeri (~einäldezyklus iiialrr. Vor diesem Hiiiter-
griind ist es äiißerst reizvoll anzunehineii, dass Bruegels C'nlunzunin als gewitzte
Er\vider~iiig 2iufd'Heei-es Vorwürfe ursprünglich aii Jongelinck adressiert war. Nicht
dass dicscr von der Haltlosigkeit der Anschiildiguiigcn tatsächlich hätte überzeugt
werden niiissrri - der Sanimler war gewiss über die Qualitäteri seines Schützlings
im Bilde. Eher ist die Zcichiiiiiig als iroriisclie Gesce zci verstehen, die dem Mäzen
vor Augeii führen sollte. wie leichfCif<ig lind hiiniorvoll sein iieuer Favorit böswillige
Kritik zu koritern weil;.
„Weder röriiisch, riocli r i r i t i k ~ ~ s o la~itetd:is~ciicraIe~~erdikt d'Heeres überdie Kunst
des Quidaw2 srhildcr. Br~iegels C;rlr/iiiiri,l ;iiicworcer auf diese Anklage auf mehreren
Ebeiieii z~igleicli. Bereits mit der \XraIil des Sujecs gihc er ZLI erkennen, dass er über
eine f~iiidierte huniariistiscli-kiiiisttlieoretische Bildiiiig verfügt lind eine adäquate
künstlerisclie Antwort auf eine L~erleuiiiduiig zu gebeii weiG. D'imit einher geht cine Rollenziiweisuiig i i i der Gcgcii\vrirt: Bruegel selbst übernimmt den Part des Apelles,
der neidische und verleuinderisclie Rivale Antiphilus wird mit Floris (bzw. seiiiein
ErfC~lliingsgehilfei~ d'Heere) hcsetzr, iiiid Jongelinck erscheiiit als neuer Ptoleniäus.
Pikant ist dabei, dass d'Heere i i i einem anderen Gedicht seines Boow2gnerdFraris Floris
nicht iiiir 31s >>excelleiit Scliilder« preist, sondern ihn sogar als den1 Apelles überlege11
bezeichiiet: Llas Iiiicliste Loh, das rriari eiiieiii Maler machen könne - so der sclimeich-
lerische Schüler - bestüiide dariii, i l i i i iiiclit nApelles<,. sondern nFlorus(< LI nennen."
Viel leicht ist es genaii dieseAninaRung, die Bruegel aufdit. Idee gehrachr hat, rriit einer
Verlezrmdung des Aprllex auf die Vorwiirfe zii reagieren und sich aiigenzwitikertid mit
dem antiken Maler zii idenrifizieren.lVeine künstlerische U ~ i i s c t z ~ i n g des Thernas
deinonstriert denn auch, wiesoiiveräri er über das italienisch-airtikt. Forinenvokabulai.
verfügt. Die nun folgende Arialyse der Zeichnung soll zudem zeigen, dass das soeben
angedeiitcte Rollenspiel auf hildlicher Ebene seine Fortsetzung findet.
Bruegel hiit die CI[rltii,~,iili als lavierte und stellenweise weiß gehöhte Federzeich-
iiuiig aiifgt.lblicheni l'apier a~isgefuhrt , die weitestgehend der Lukiaiischen Ekphrasis
folgt."' Iii dt.~itsclier Ü l ~ e r s e t z i i i i ~ lautet diese wie folgt:
Keches sie([ ciii iM.111ii iiiit ;ILIEII leiid I,iiisrii Olircii . d i e Lisr dciieii d r s h l idas gleich koiiiriien.
F.1- s t reckt \.oii \veireiii dr.1 lier.iiil~oiiiiiiciidc~i Vcrleiiniiliiiig (C',iluiiiiiia) seine H a n d ciitgcgcii.
I l i i i ~iii iri i izcii (c i rc i i i i>sr~i i t ) /\\,ei j~iiige F r ~ ~ ~ r i i , d i e L~ri\\,i<sciiscIieit ( Ig i iora i i t ia)~ \veiiri ich
iiiicli iiiclir r;iiisclir, iiiiii d r r Arg\\,oliii (Suspicio). \'oll der aiidri-rii 5eirs eilt d i r Verlcuiiidung,
l i i ä i l i r i S ~ c l ~ ~ i c ~ t , c l i n e l l Iirr,in. Mi r ihrer Miciic i i i i ~ l ilirci- KiirprrliaIt~iiig J r i ickr sie d i r wilde
\);.'ur iiiictctc~i> Zor i i ~ L L S . d ens i e in ilirrriigliiliriidrii I l c r ~ e i i c i i i p f ~ i i g e i i liar: sir Iiält in der Lirikrii
ciiic Iirciiiiciiilc T,ickel, i i i i r d e r Krclireri ~ c r r c sic iiiic sich eiiirn lu i igen bei der1 H.i.irrii, de r
d i r H:iiide 7.~1111 tjiiiiriicl L i ~ ~ ~ g e ~ t r ~ ~ k r liat und d i r C;laiib\vürdigkeir de r ~iristcrblichcii G ö r t r r
L L I I ) ~ Z C L I ~ C I ~ riiiriifr. I l i i ic~i gellt \wraii riri bleicher hlaiii i von lc~srri-liafrrr E r sc l i e i i i~ i i i~ , iiiir
\ t~ i i i i~> t i i n i i i g strclieiidrri Augeii, i r i i ~ ~ h r i ~ c i i ~ b f i - off r i ik~ir id ig jeiieii ~ilirilicli, d i c diircli ri i ir
c l i i d l i c l i e Kr'iiiklirit ~i. i l i in\cli\viiidrri . I)icsc.ii wird iiiaii Iriclir .ils Neid (Livorciii) crrarcii.
A ~ i c l i folgeii ein p.i.ir jiiiigr I-r.iiieri d r r Vcrlciiriiduiig als Rrgleireriiirieii. dercii 1)Hichr CS isc,
d i e Hr r r i i i a i i rurr r ihr i i , 711 i ~ i i t r r \ \ e i ~ c ~ i iliid 711 l > u r ~ e n . Ei11 Dri i ter dcs Bildes sagrc, daR sie
Hiiirrrlisr (Irisidi.ie) ~iiid H c i r i i ~ ( I - a l l a~ ia ) cl.ir,rrlleii. Vori Iiirireii folgt d i e KuRc (I 'oeiii tri i t i~)
i n ~ ~ I I C I I I I C ~ I L I I I I P ~ C I I ' I ' r ;~ i~er~c\v , I I ld , d i c ~ ~ L ' I I Kopf I ~ J C ~ r ü ~ k w ~ ä r t ~ Iirr~ibgriirigr h , ~ t ~irid inir
Tririeii iirid S c l i ~ i i i d i c \o i i liiiircii koniiiiri idr \Xr.ihrlieir (\Crir.i<) ciiipf;iiigr."'
Bei Bruegel ist die Szene friesartig aiigelegt und entwickelt sich auf der RildHäche
dyna~iiiscli von liril<s iiach seclits - das Kraftzentriim des Be\veg~ingszugrs liegt dabei
in der bildriiirtig positioiiiei.teii Calumnia, die entschlosseii ri~if den rechts sitzenden
Herrscher ~ ~ i s t ü r i i i t . Tieferiräumlichkeit ist nur an wenigen Elementen - etwa den1
Throripodest reclits oder den 'irchitektonischen Versatzstücken links - ablesbar. Wie
Bart Raniiikers tret+>nd heriierkt hat, erinnert der dargestellte Raum eher aii eine
improvisierte Re~ierijker-Rühiie als a n einen tatsächlichen Palast." So kiinnre sich
auch die seltsame Gcstal t~i i ig des Hintergrundes erklären, der wie mit Tüchern ab-
iiirii drii groocscrii d r r clii ldei- \rrscaec.Gc 18 i\hr,ili,irii Orcrliii\ u i r d R r ~ i r ~ r l 1574 i i i ciiicin N.icliruF i i i i r A-\l>slls \.erzlcichcii - niöglichrrwrisr
i i i \ ' rrteic~iS~~iig grgriiLiI>rr i i ' t l t r r r i ~ i i d Floris. \ 'LI. h l t . * ~ ) o w 1996, S. 1'16. I 0 Wie c l io i i W H I T ~ i c ) r < ) , S. 339, fcscscellc, Ii.ic Ariirgrl vrrriiurlich die 154.3 i i i Fr.irikhire erschie-
~ i c ~ i i . I.ieeiiiiscIic Über seez i i~ i~ i l e Mel~irictithoii \crwciiJL.r. Vsl. liierzii aucli Ri &(HA< H L O O L .
5 . 2--iI. 2 0 Li[. risicli : \ ~ ~ ~ . i . ~ . w s t i ~ / l ~ i ~ i : ~ r . i ~ 11)7j, S , 83f. 21 K ! \ ~ . \ t i ~ U\ 1996, hier S. 85E.
gehangen wirkt. Die handelnden Figuren schlief3en sich entsprechend der vertikalen
Gliederung des Hintergruiides zu drei distinkten Gruppen zusammen und erlauben dad~irch die Lektüre des Vorgaiigs im Sinne eines dreistufigen Prozesses: Die vom
Neid iniriierte, von Hinterlist ~ i n d Betr~ig vorangetriebene \rerleumdurig ist in vol-
l e n ~ G;iiige (1); ein voii Argwohn und Crriwissenheit beratenes Urteil ist in Kürze
zu erwarten (2); \X7:ihrheit ~ i n d B~ifie werden wohl erst mit Verzögerung eintreffen
(3). Uherdies ist dem Geschehen auf der Bildfläche eine ansteigende Diagonale ein-
geschrirhen, die von der deiiiütig kauernden Veritas bis zum thronerideri
König reicht iiild dem Blatt eine antithetische, gegenläufige Struktur verleiht. Dem
vis~iellen Ai~srieg entspricht nämlich eine moralische Abwärrsbewegung, die im aus-
stehenden Urteil des Hcrrschers ihren traurigen Tiefpunkt findet. Bruegel hat, so
kaiiii inan diese kurze An'ilyse zusanlmenfassen. zii einer erzähltechnisch äußerst
effizienteii C;liederung der Handlung gefunden, in der die formale Disposition durch-
gängig inhaltlich lesbar ist.
Eine Besonderhcir der Bruegelschen Glumnicr, durch die sie sich von allen Vor-
gänger-Versioneii unterscheidet, besteht in der betonten Einhindung des Rezipienten
in das Bildgeschehen. Dcr ausgeiiiergelte ~ i n d verluinpte Lyvor nimmt hierbei eine
Schliisselrol Ie ein. Denn zum einen ist er durch eine subtile Isolierung hervorgehoben:
Seine Körpcrko~itur ist die einzige, die sich nicht mit der einer anderen Figur über-
schneidet. Zum aiiderei~ aber wendet er sich mir einem Schweige- bzw. Narrengesrus
an den Betrachter, tim diesen zum heinilicheri Mitwisser der neidgetriebenen Ver-
I e ~ ~ ~ ~ i d ~ i ~ i g s a k t i o i i zu machen." Doch auch Suspicio ~ i n d Ignorancia, die eigentlich den1 König iiiit den Midasohren beigesellt sind, scheinen sich weniger an ihren Herrn
als vielinehr an den Betrachter ZLI wenden, der dadurch unversehens in die Position
des schlecht herareiien Herrschers rückt.
Wenn Jongelinck tatsächlich der Adressat der Zeichnung war, dann darf dieses
hintersinnige Spiel der Rlicke als ironische Warn~ ing an den Mäzen verstanden wer-
den, sich i~ icht d~ircli die dubiosen Diiinen bezirzen ~ i n d zu einem dummen Urteil
verführen zu lasseil: Anstatt sich selbst zum Midas zu machen, soll sich Jongelinck
als iin~sichtigei- K~instrichrcr erweise11 - indem er zur Kenntnis nimmt, wie tadel-
los ~roonlachtig~ und >antiicx< Hruegel seine (I,~lun~niu gestaltet hat. Und in der Tat
straft der Kiiristler init dieser Zeichnung seine Kritiker aus dem klassizistischen
Liigcr eiiidr~icksvoll 1,iigeii. So hat er etwa in der Disposirion der Fig~iren Albertis Fordcr~i i~g, dass „die Srcll~ingeil und Rewegungen der Körper untereinander unähn-
lich« sein riiögeii, cbcnao mustergültig erfüllt wie dessen Verlangen nach >)Würde und
Anstailct<( rllittels M;iniiigf;ilrigkeit ohne Üherflille.'.' Selbst die Retrachteransprache
23 Ar nFKi.1 rooo, S. 26-. I.et/.rei-caiar besoriders hciiirrkrriswrrr, da diesesf»rni3lc. Mnl(ha1reiiBriicgels friilirri .Wiriiniclbilclerri, di:inicrr:il ciirgegengrser~.r ihr: Iii den k7iwd'uppir/en oder drni .\pi.~chuiör- tribild isr d;is C;esclirlirn i i i ciiicr Weise über d.15 Bildkld verteilr. die Alherti iii schärhrrr Forrri .ibleliiit. ivenn er sclii-ciht: ,-So k.iiin ich diejriiigeri Maler iiiclit giir findcii, die [ . . . I sich ;i i i keine k;»iiip(iirioii halten, soii~icrii ~ ~ ~ i g r o r d n e t uncl zügellos alles \.er.\treueri, niit derri Ergrbiiis, dass der Vorfi,iiig rniclit eirir I I~iiidliiiig dar-zii\trllen. sc~iiderri sich in Aiifriihr zu befinden schei i i t .~
cies Lyvor kann auf Albertis Empfeh-
lung ziirückgef<ihrt werden, eine Figur
ins Bild einzufligen, ))welche den Be-
tr:ichter auf Dinge hinweist, die sich da abspielen: sei es, dass sie mit der H a n d
zum geiiduen Hinschauen auffordert,
oder dass sie - gleichsam als niiisse die
betreffende Sache geheim bleiben - mit
finsterem Aiiblickcirolit, man dürfe nicht hiiizutreten [. . .].<<"
Br~iegel demoiistriert aber nicht nur
seine Vertriicirtieit mit der ltlassischen
Kunsttheorie, sondern a ~ i c h seine genaue
Kenntnis der K ~ i n s t der Renaissance ~ i n d der Antike. S o sind mehrere seiner Figli-
ren entweder als konkrete Zitate oder '11s
stilistische Paraphrasen ZLI identifizieren.
Llie Calumiiia selbst Iässt mit ihrer dy- namischen Schrittstell~ing und dem we-
henden Gewand etwa a n die sogeiiariiite
Niobid~ (~-/1it1m1/tonti denken." (Abb. 2) 2 Niob ide Chiaramonti , Marmor, H. 1,76 m, Die Fallacia hingegen ist Rafiiels Beth- Museo Gregoriano Profano. Vat ikan, 1nv.-Nr. lr/?ernitijr.herr2 kYnderrnord (Ahb. 3) ent- 1035 lehnt: Aus einer wehklagenden Mutter
ist die I'ersoriifikation des Betrugs ge-
worden, ~ i n d so ist der gestische Ausdruck seelischen Schmerzes in die Gebärde des
begeisterten Antreibens 7,111- bösen Tat verwandelt. O b nun dcr in schuldige Junge,
den die Ver le~ in id~ing an den Haaren herbeizerrt, init seinen schmerzverdrelitei~
Aiigen a ~ i f d e n w,iIinsinnigeii Jungen aus Raffaels ik~znrjgur~ztion ziirüchzufiihi-en
ist. ni~iss offen bleiben. Doch immerhin lässt sich feststellen, dass auch die Veritas -
Bruegcls ciiizige Akrdarstelluiig! - a n eine RafTael-Figlir gemahnt: jene kniende Frau
in der C ; I . ~ ~ ( , ~ I . ~ I ~ I ~ ) I ~ (,%i.irti (Pnln Wnglioni), die der ohnmächtigen Maria in gewagter
24 r\i i(i.iii I zooo. 5. 2-3 . Hicr.i~itiii.iclii hrreir\ R.irii.ikrr\ .iiitiiirrl\~.iiii. oliiic jedoch d i r ir»rii\che i - c / t . l x i<~ i i~ : i \ r l i c r i sc l ie Poiiiir des hlorivs 7u bciricikcii. KAXIAKFR. \ i<jyh, S. 90.
25 L)ic4k~il~~i~ir\\~~ii-clcrii~~liclici-\vci\cl~e1-~'it<;MirirJr\16.J.ilirlii~iidtrr\bri'l'i\~oli\vieder.i~ifgef~iiiden
~ i i i ~ l . ~ ~ i ~ c l i I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c l \ o ~ i l ~ ~ ~ ~ c ~ l i r o d ' E ~ r c i r i c i r n ~ ~ ~ i i r i i i ~ i l ~ - ~ ~ ~ i i r r ~ i ~ i ~ ~ f g ~ ~ r c l l r . A i i d e ~ - e i i E i i ~ t c l i ~ i r z ~ ~ r ~ g r ~ i z~ifolgc \v~ii-clc \ic ci\r i i i i i 1795 iii der Villa H:i<li-i.iii.1 \\.iedci-ciitdecki. \Ig[. Vons-II.R 1993, S. 77. Hr~irgr l li,irrc .ibci- .iiicli ührr S.irkoplidFrt.licf\~grrli'f i i i i r dcrii hloriv der dyriariiisch \clirrirriidrii Ge - i ~ i c l h g ~ ~ ~ c ~ i~ i i i i i . i i igcsiclirs dci iclicCii-riyii Aiioi-dri~iiigdrr Koiiipoaitioii liest eiii \olcher H C L L I ~ «~111c~iill ii.iIi~. \'$I. hici-~ll ~i ivrrsr Bri\pirlr iii F,\r',4i O / ~ / . A Y K ~ . R 2004, Ahh. 5'1, 60. 64. 1)ci- ,iiiril<iscliir (:li.ir.ikrrr \«ii liiiicgcls C.il~iiiinin stelir iii jedrrii Fall aufirr 1.i-'igr: Mit ilirciii \\elieiidrri (;e\v,iiicl \ v ~ i \ r \ic jciic.; .Iit\\cgre Beiwerk< auf, das bei-eita Alhcrri t o tehr schärzte ~ i i i d das Ahy W.ii-b~i i -~ $er.ider~i ..rLiiii Ki-it~,i-i~iiri des )Fiiifiiisscs der Aritikr,,, rrkl;irtr. \ \ 'AKHLIKG
iclq8 (iX<)j). liiei- S. 10.
3 Marcanton io Raimondi nach Raffael : Der Beth lehemi t ische Kindermord, 1. Zustand, um 1511, Kupferst ich, 2 8 , 3 x 4 3 , 4 Cm, B r i t i sh Museum, Depar tment o f Pr in ts and Drawings, London
I l reh~i i ig ~ i n r e r d i e Sch~ilrci-11 greift. hl;iii
kann sich aber diircli:iiis ;i~icli ;iii eine
Besonders inreress;iiic ist die Fiy~ii- der
I'oeiiitentia. Ileriii mir ihrer geneigten
Kopf l ia l t~ i i~g , ilireiii ~i inl ia i igarr i~ei i Ge-
wand, ihren vor deiri Ba~icli gefalteten
Händen ~ i n d dein sceifeii Aii~f,illsc1iritt
trägt sicei~ii~ccliarakreriscisctie Zügedes
Lorbrrrbrkriz'irzteri Aprllr~.\ vor1 Niiolzrro
da Modeii;i. (Abb. 41 So liac Hr~iegel
der Koniposiriori i tircii ~isspsiingl ichzn Irivenror gar in vcsbosgciier \Y!zisz ziri-
geschsieberi. W'eiiil der Eiiids~ick iiictic
r;i~ischr, d a n n handelt cs sich bei dc.1.
Crilunzniiz geradezu Liin ein I'fistI'.c.Io
aus italienisch-ailriken Versatzstücken.
Entscheidend ist jedoch weniger der
Nacliweis tarsächlicli erwe wend er er Vor-
bilder als vielniehr der Unlsrand, dass
Bruegel das ant ikis ierend-iral ic~~iscl~c
Id~oln perfekt ~ i i beherrschen scheint.
4 Nico le t t o da Modena: Der lo rbeerbekränzte Apel les m e d i t i e r t über geometr ische Figuren, um 1510, Kupferst ich, Kupfers t ichkab inet t der Ö f fen t l i chen Kunstsammlung, Basel
5 Pieter Bruegel der Ä ~ t e r e : Der Maler und der Kenner, um 1565, Feder i n Graubrau 25,5 x 21,5 Cm, Graphische Sammlung A lber t ina , Wien, 1nv.-Nr. 7500 (N.84)
Irritierend hleiht in dieseiii Zusaiiii~ieiihaiigder betont liiisslich dargestellte Lyvor
(Neid), der riiit seinen dürren Gliednial3eii und seiner linkischen Körperhaltung
kaum einer kl:issischen Norm entspricht. Vielniehr lassen seine eigeiiartige Kopf-
bedeckuiig und sei11 wirres Haar an eine andere Zeichnuiig Aruegels denken, die
von der Forscli~iiig in etwa dieselbe Zeit datiert wird: das Blatt Maler und Kennel. in der Albertin:i.'" (Abb. 5 ) Dcr Maler, der niit rnissrii~itigeni Gesicht und wirrerii
Haar vor der - im Bild nicht gczeigteii - Staffelei steht, ist zwar kauni als Selbst-
porträt, wohl aber als allegorisclic Sclbstparodie z ~ i de~iren: OEenbar hat Aruegel
sich hier als eben jeiicr griesgriiiiiige Scliönheirsverächrer niit grobem Pinsel dar-
gestellt, als der er in d'Heeres Gedicht diffaf'arnierr wird.'- Irn kurzsiclitigen >Kenner<,
der dein Maler mit zusamriiciigckiiiffffe~le~i Augen - also unverstäiidig - über die
Scliulter blickt ~ir id bereits in seine prallgefüllre Börse greift, hätten wir dann die
wenig sclinieichelliafte Llarstell~ing eines reiclicii abcr dunirnen Kä~ifers zu erken-
rieri. Sollte diese Zeicliriurig ebenfalls an Jongeliiick adressiert ge\i8eseri sein, daiiii
26 M i t i ~ t 1996. Ni-. 60. S. 64f. 27 I i i ciiiciii I-etcrireii llcirrdg Ii,ir 1-ycklt. dt. Vrit.s die Ideiiiiriir voii Qiiidani iiiid Hriit.gt.1 vrliiiiiirir
hesri-irrcii. t1.i er die Aiiii,ihiiic c,iiics Koiiflikrs z\vischrn Rrurgrl ~ i i i d drri Roiii.iiiisreii Fiir eiiir ii,i- r i o i i ~ i l ~ l i ~ ~ ~ ~ \ ~ i n i ~ r i ~ c l i t . I ' ro j i l i~io~i cir\ 10. ~ ~ h r l i ~ ~ i i d e i - r s hilr . L~i~srh4riiiiinggründerai1fdt.r~iilligi1i lgiior.iii/ ~cgc.iiiil)cr cicii jiiiigcrcn I-oracliiiiigt.ii von FREI:DBI:R~; 19x9, M E A D ~ W 1996 uiid hICii i t K
r ~ < ) y . (Jlricliwolil Iiriiigr L)t. \'rir\ deii ~M~ile i -C .iiifder Zeicliiiiiiig .iiifgruiid seirir\ ,)co<irse hruch,. i i i i r tlciii (jiiitlniii i i i \ ' ~ ~ r h i i i t l i i i i g olirir frt.ilicli d i r durcli iiiid durcli selbsriroiiische Disp«\irioii dc\ i \~ . r<~~ igc~ i i c t i r \ 111 bc.iiic,rkc,ti. VgI. I > F VRII:S 2004.
muss Bruegel niit eirier gehörigen I>ortioii Selbstironie seiteiis seines Auftraggebers
gerechiiet haheii.
Auch in1 Fall der C;zlllmnin ist demiiach denkbar, dass Bruegel sich mir der Figur
dcs Lyvor selbst bezeichnet hat ~ i i i d soniit in derjeiiigeii Rolle auftritt, die i h m durch
die I~zuekt i~ie zcigewieseri wird: als eiiifältiger Neid. So macht er deutlicli, dass er sich
nicht iiiit den1 r i i i deii Haareii herbeigezogeiieii J ~ i n g e n identifiziert, sich also keines-
wegs als ~inschcildiges Opfersieht. Dies ist nur koiisequeiit, denii schließlich war essr,in
Vorwurfder ~~su~ic l ie rbee lde l te~ is~~ , der die Debatte überhaupt erst iiis Rollen gebracht hat. Brciegel - als ~\,erleuiiidetcr Verleuinder< - treibt mit den1 Lyvor seiiie paradoxe
Apologie wahrlich a ~ ~ f die Spitze: Wshreiid er als Autor der Zeichnung meisrerliaft
alle Renaissance-Kegister zu ziehen weiK agiert sein Alter Ego in1 Bild als tumber
Narr. In einer Ierzten Volte fordert er daniit den Betracliter dazu auf , der schöneii
italieiiischeii Ri ldord i i~ i i~g zu niissrrcicien, die er doch selbst verfcigt hat.
Ur~iegels CL7/ztini~ir7 zielt ~iiiz~veifelhaft acit die diskursive Einhiiid~ing eines aiif- nierltsaineii Kezipieiiteii. Dass Niclaes Jongeliiick, als Adressat sowic als passionierter
Keiiner ~iiid Saiiiiiiler, diese witzige Versiichsanordii~~iig 7.11 lesen lind z ~ i schätzen
wusste, dürfeii wir getrost annchnieii. I11 den1 persönlichen Zuscliiiirr der Zeichnung
köniire auch der GriiiiJ d a t ~ ~ r liegeii, waruni ihr offenbar weder eiii Stich noch eiri
(;eniäIde befolgt ist: DAS Blatt warverincitlich als Hai idreich~ing für den A~iftraggeber
gedacht. Der niediale St;it~is der Zeichii~irig ist dabei i i i anibivalenrcr Weise codiert:
Eii~erseirs steht sie - als dijr;qno - für der1 hehren Anspruch, uninitrelbares Abbild
eiiies priiiiär geistigen Eiitwurfcs %LI sein: andererseits markiert sie den Zustand des
Vor1ä~if;gcii ciiid Flüchtigen. Und dies ist wohl 'iuch die Botscliaft des Mediums:
Eiiie beiläcifige Zeichnurig iiiuss gcnbgeii, iim die Widersacher der Verleurndung zu
üherführeii - eiii voll acisgeführtes Werk ist liierfiir iiicht nötig. Die Nähe der Das-
stellung zci einer Rederijker-lnszcnieruiig kann ebeiifalls als Ges t~ is der Abwertung
eelesen werdeii: Rr~iegel iiiszcniert die C~zlr~wrr~in letztlich doch iiicht als ehrwürdige
historiu, soriderii als schiii~iddelige zeitgeiiiissisclie Farce.
Blickt rnaii voii diesen) Pciiiltr acis zuriick ~ u f Bruegels Gesanitwerk, dariii er-
scheinen die gelegeritliclieii Anleihen bei it~lieiiischeii Vorbildern, die i r i der zwriteii
Hälfte der 1iOOer Jahre i i i seiiicin O e ~ i v r e zci verzeichiieii sind, weniger als Zeiignisse
eiiies ~stilistisclieii Unischwuiigs( deiiii als späte Keflexe aufdie hier skizzierte Debatte.
Dabei gilt es zu betoiieii, dass Brciegels V'ertiältnis zu Aiitike cind Renaissance durch- weg kritisch b l ~ i b r . ' ~ Von daher verbietet es sich auch, die p~i i ikt~iel len - urid nieist
i r o n i s c l i e n E n t l e l i i i ~ i n ~ e i i als bildkünstlerische Parallelezur Pleiade-Poetikzudeiiten, der es uni eiiie \'erbesscriing ~ i n d Aufwertuiig volksspracliiger Llichtung durch Aii-
leihen bei u n d Orieiitieruiig aii klassiscli-lateinischeii Modellen geht."' Für Bruegel
dieiit weder die Anrike, noch die Hochreiiaissaiice als mustergültiges Paradigma der
28 Zur Iroiiie hriiii .\piitrii. I3r~irgrl \.$I. Mili i F K ri)i)i), S. öiH: L9 So ersriii,ils S i R I I I I I ~ ( . K 1i)iG. S. LXXf. Oiesir frlilgeliciiclrii Fiiiscli:ir7ciiiS hlgcii rt\\.i ( ; I R S ~ N
iq;:, KA\I.\KI,.I<S 1~196, M~.AI>O\Y: ii)c)6 (~i i i r F ~ i i i ~ c l i r i i ~ i l ~ ~ ~ i i ~ e ~ i ) oiid ~ i r ~ ~ r r c l i ~ i ~ < niir N ~ ~ c h d r u c k
[~1<.13~111>0h ZOO-.
eigeiieii Kliristprod~ikrioii . Vielnielir- a tmen all seine Bez~igndhnler l a u f italienische
Kunsr cii irn subversiven Geis t , de r d e n noi-niariven Arispruch dei- zirier-ten Werke
iii Z\r,eifcI ziehr. W i e d i c C,rl~iw~t/in zeigt, gerät unrer Rr~iegels Häi iden selbst e ine i i l i <I;i-~inde r ~ ~ e l r r r l ~ i e Unisetzurig eines rrzklassizisrisclieri Thenias zu eiiiei- subrilen
l i i f ~ a ~ e s t e l lurig l<lassisclicr Maßs täbe .
Literatur Ai H F K I - I 2000: Alhci-ti. I.co11 ßattista: »J( St,iridbild. Die Malk~iiist. (;ruridlagcii J r r RZalci-ci,
11g. 1,. O\l<ai- H5rscliiiiciiiii, Llar-riisrLicit 2000. ANZEI ~ .U~SKY/L)RLYEK 1975: AiizeIe\vsl<y, Fcdja; Drc}.ci-, I'cter u.a. (Hg.): Pirrrr ßrucgel r1.Ä.
als Zcicliiicr. Hei-liurift ~ i i i d N.icliFolgc. Eiiie A ~ i s s r c l l ~ i n ~ cic. Kiipfcrsriilik~hiiicrts Berliii 19. Sep tc r i ibc r I ( > . Novcriibcr, Berliii 19-5.
H . ~ I ~ ~ ~ H , \ c I I 2002: ßCi~iiiih;ich. I \ ~ ~ I I L I C ~ : LLI!~~,I I I i i i ~ e ~ i t s c h l a r i ~ ~ . Eine Forschiirigs- iind liczcp- rioiisgcscliichtliclie Aii;ily~r voiii Hiiriianisnius bis z ~ i r Gegcri\v.ii.r, Rtüiiclicii 2002.
~ E ( : K ~ . K 10-11-j: Becl<cr, ]oclieii: %ur riicderlindisclicii tiuiistlirci-ntur d e 16. J,ilir-huiicierts: I.iicns cic Hccrc. i i i : Siiiiiolus 6 (10-1IT3), S. 11.3-12-.
HK\N.I. 2005: Hi-aiit. Scli:istiaii: Llas Narreiischiff. S t~idicr ia~~s~. i l )e . Iig. voii Joachiiii Kiinpr, S t ~ i t t ~ ~ i r t 2005.
HLJ(:H , \ u . \ N I < ) ~ o : 13~icIinnnii, l n i i i : n i e collecrioii of Nicl'ies lorigeliiicli: I I 7hc )Moiiths< by l'ictci- Hriicgrl tlic Iildcr, i i i : 'llic Kiii-liii_~toii M:iga~iiir 1-32, 1990, S. 5 4 1 5 5 0
C:.\sl- 1981: C;isr, r h i d : 'llic C:nluniii!. o tApr l l e . A Stiidy in tlir H~iriianist T'radirion, New Hiivciill oiidoii 1981 .
1 1 ' H ~ t n t . I ' ) ( ,<) : d'Hccrc, 1.iicns: Deri Hof cii Boonig.icr-d dei- PoCsicri. Met irilcidiiig en a,iii- tckciii iigcii door W'. Writersclioor, %wolle 19(>9.
i ) t . Vr<ii:s 2004: dc Vrics, Lycl<lc: Witli a coai-sc hrusli: Pictcr UrueSel's )Bi-ooding nrrisr., iii: So~ii-cc. Notes i i i rlic Histoi-J. ofArts 2.314, 1004, S. 38-48.
Ea~~i . i ) /%: \~ ic i : i< 1004: l<\s,.ild, ßjiii-ii Chi-isti,iii; Zaiikcr. I',iul: Mir hl)-rlirii Ichcii. Die Bildcr- welt der riiriiisclicn Sarl<opli:isc. Müiiclicii 2004.
FORS.I.~,K 1886: Fiii.ster. Ricliai-d: Luci.iii i i i der Reiiaissaricc, iii: Arcliiv fiir Liter,ir~irgcschichte 14. 188(1. S . 33--36.3
I;iii<s I t . ~ 1887: Fiirstcr, Ric1i;ird: Oie \/crliiuiiid~iii~ des Apellcs i r i der Reiinissaiice, in: Jalir- h~icli der Kiiriitilicli I'rcul<iscIic.ii Kiiiistsnriiiiil~iiigeii 8. 188-, 5. 29-56, 80-1 13.
l :~ t t . i> i r t .~c ; 19Xi): I:rccdbcr_~, D;i\~ici: Allusio~i aiid Topic.iliry iii tlic Woi-k of Pictcr ßruegcl. -nie 11ii~~lic;uioiis o f3 Forgorreii I'olciiiic. in: Frecdberg, Davici (Hg.): n i e I'riiirs oi'Pieter ßriiegel tlic flldcr. Tokyo 1989, S. 53-65,
G I H S O N I<)--: (;ihsoii, \Y:iIrei 5.: ßr~iegel, Ncw Ihr-kl'li~i-oiito I')--. GKOSSXIANN 1961: (;rossiiinriri, F r i r~ : ß~-uegeIs Vrrliältiiis (11 Rafi,iel iirid ~ i i i - R,ifFacl-Nach-
folg" iii: (;oscl->i-~iili. M;iriiii (Hg.): Fcsrsctirifr für Kurt ßndr7~11ii s i ch~ i~s t e i i Gcbiir-rrage. 1Seiti-igc aiis K~iiisr- iiiid (;cisrcsgcschiclitr, Kerliii 1961, S. 1.35-143.
1,oc:iiili~ i i )Y i ) : I.ciiticr, Huhci-r: .Albcrtis Erfiiidiing cio (;eiiiildes aus cicni (;eist der Antike: iicr Tralirar L)c pictiira, i i i : Forstcr. Kurr W.; Locher, H~iher-t (Hg.): Tlicor-ie der I'raxis. l.coii ßatri\r;i Allicrti ,ils Huriiaiiisr ~iiicl 'Ilicoretikrr dei- hildciideii Küristc, ßrrliii 1999, S. 75-107.
1,~ic.i. 1927: 1.iigr. Frita: I)icrc,r Rriiegcl iiiid Irnlicii, in: Fricdläiicier, h l , i ~ J . (Hg.): Festschrift
fiii- M a x J . Fric<ll~iiidci- l i i i i i 60. (;chiii-rsr.igc, L c i p ~ i g 192', S. 1 1 1-12'). h l ~ s s i ~ c : 1990: hla\ \ i i is . lc,ciii Miclicl: L,) C-hloiiiriic d'Apcllc er ,on i co~ iog ra~h ie . DLI texte
I'iiii:i~c, Srr , i l~I~iirs lc)c)O. M r , \ i )ou</ I <)96: i\lc.ido\r. Ll.ii-!i A.: 131-liege1 's Proccssion ro (:nlvary. Aenililario ancl rhe Sp'ice
of\ici-ii.ic~il.i~- Srylc, in: Nccicrl:iiids K~irisrtiisrorisch Jriai-boek 4', 1 9 9 6 S. 180-205.
MIELKI: 19')6: hlicI!ic, HJIIS: I'icrcr ßr~icgel . Die Zeichnlingen, 7iirtihour l')Oh.
h 4 j i 1 . 1 . ~ ~ 1 9 9 ~ ) : Miillei-, Jiirgen: Das Paradox als Rildfortii. Sriidicri zur Ikoriologic I'icrrr
H r ~ i c ~ c l s cl.,A,, MCincIicn 100'). R A ~ I . ~ K ~ R S 1.196: I<aiiiakei-s, Uai-r A. ill.: ßruegel tri dc rcdcrijI<cra. Scliildcrkurisr cri 1ircr.itiiiir
i i i C I C /c\ricildc CCLI\Y, in: Ncdcrlniids K~iiisrhisroriscli Jnnrboek 4', 1996, S. 81-10i.
Ric ti \ K I ) > O U 2007: I<icli;irdori, lodd M.: 1)icrcr Kr~icgcl. Art Discourse in rhe Sixreeiith Cciiriii-y Ncrlici-laiids, 1.cidcii 200' (~iiivcröffCiitl. [)iss.).
K L I I ' I ~ K I ( . I I 1c)j6: R L I ~ ~ I - i c h , Hans (Hg.): L3iircr. Der schriftliche Nachlnss, Bd. 1 , Rrrliii 1')iO.
S-r.nir,rtrc.~ rc)i6: Sri-idhecl<, (:,irl ( ;~i\rav: ßr~ic~cls rudicr i . Uiirci-siichurigcii rii dcri ikoriologi-
.;clieii I'robleiiieii hei Pierer Bruegel d.Ä. so\\,ie desseri Her ieh~i i i~e i i rurii tiicdcrliridisclic.ri I<c)iii.iiiisiiiiis, Srocklioliii 1050.
V t t i t I : V c V c I : r ~ s I r ( 5 / 2 - I 5'0). 1,cvcii cii wcrkeii. Bd. I , Hr~i\\cI 111-5.
Yens I t R rL)c)j: Vorsrcr, C'liri.\ri.iiic: liiiriiischc Sk~ilprurcii des späten Hcllcnismus u n d dr r
ti,ii\crvcii, 1: Wci-kc ii.icli Vorlngcii ~ i i id ßildformelii des 5. u n d 4. Jnhi-hundei-rs V. Chr. .
hI'iin/ I')').;. W,\RHL.KI. 19,)s ( 1 s ~ ) ~ ) : W J ~ ~ L I I - ~ . Aby: S:iiidr» Borriccllis )(;eb~ii-r der der Venl i ' iiiid ) l~rü l i -
liiig, (lXc).i), iii: Hrcdcl<aiiip, llorsr: 1)ici-s, Mich;icl (Hg.): L3ic E r n c i ~ c r i i n ~ d c r Iicidiiischen
Anrilce. K~ilriii-wisseiiscli~ifrlichc. Beiri-äge zur (;ecliiclirc dei- Iicri,ii,s,iriec (Kcpriiir der
\.oll (;errrud King unter MirCi~.l-)eir \ Jo~ i brir7. lio~igeriiorit cdierrcii Ai15g.lhc \.oll Ic)32),
Bei-liri 10')X. S. 1-00. W , \ K V K ~ 1996: \X'.i~-~il<e. h1.11-riii: ~ lo f l< i i i i~ r I c~ - . %ur Vorgc.\chicIirc des riiodcriieii Künstlers.
Kijlii 19')6. Klirr I i rq j9: Wrliirc. (:lirisroplici-: I'icrcr 131-iicgcl rtic cldci.. Two iir\v cir.i\viiigs, iii: The Bur-
liiigtoii MCig:i7inc 101, 1'15'1, S. .3.3(>-.3+ I .