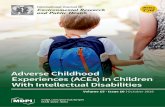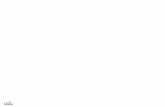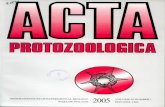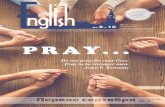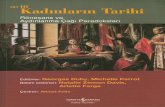Untitled - magzDB
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Untitled - magzDB
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 3
DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN
Hausmitteilung5. Juli 2010 Betr.: Titel, Prostitution, Fußball
Ein großes Durcheinander erlebte SPIEGEL-Autor Thomas Darnstädt, 61, als er Schulen und Universitäten in den 16 Bundesländern inspizierte. Ihm ging
es wie der griechischen Sagengestalt Sisyphos: Immer wenn er glaubte, fertig zu sein, fing die Arbeit von vorn an. Allein fünf Kultusministersessel wurden wäh-rend der laufenden Recherchen neu besetzt, überall im Lande gab es Bildungs -reformen, allzu oft wurde bald zurückreformiert. „Die Politik hat den Überblickverloren“, sagt Darnstädt. Seine Forderung: „Zum Schutz der Schüler und Studenten muss der Bund den Ländern die Bildungshoheit aus der Hand nehmen.“Das Titelbild entwarf der Wiener Illustrator Michael Pleesz, 46. Es kann als Kunstdruck im Format 50 x 70 Zentimeter für 13 Euro im SPIEGEL-Shop unterwww. spiegel.de/shop bestellt werden (Seite 56).
Die Methoden der sogenannten Loverboys sind ebenso simpel wie effektiv: Siesprechen Mädchen auf dem Schulweg oder bei Facebook an, umgarnen und
verwöhnen sie und beuten sie dann als Prostituierte aus. SPIEGEL-RedakteurinDialika Krahe, 27, recherchierte inAmsterdam, wie raffiniert Lover-boys bei Schülerinnen Gefühle er-zeugen, die ihre Opfer für Liebehalten. Etwa 1500 Mädchen fallenim Jahr in den Niederlanden aufZuhälter herein, und Krahe regi -strierte, „wie überfordert Eltern,Lehrer und Strafverfolger damitsind“. Angelique war 15 Jahre altund ging in die achte Klasse, als sieeinem Marokkaner verfiel. Jetzt,fünf Jahre später, schafft sie für ei-nen anderen Zuhälter an (Seite 48).
Mit Bundestrainer Joachim Löw, 50, hatte er einen hässlichen Streit über dessenVertragsverlängerung geführt, doch während der Weltmeisterschaft in Süd-
afrika lobte DFB-Präsident Theo Zwanziger, 65, seinen Widersacher plötzlich überalle Maßen. Was den obersten Funktionär des größten Sportverbands der Welt an-treibt, beobachtete SPIEGEL-Reporter Alexander Osang, 48, wochenlang. SeinUrteil: Zwanziger regiere den deutschen Fußball „recht selbstherrlich, wie einKönig ohne Volk“. Dem SPIEGEL-Team bei der WM gehören auch die RedakteureCathrin Gilbert, 26, Maik Großekathöfer, 38, und Jörg Kramer, 48, an. Kramerund Gilbert trafen in Johannesburg Siphiwe Tshabalala, 25, Südafrikas Helden der
ersten Weltmeister-schaftswochen, zumSPIEGEL-Gespräch.„Er hat das erste Torder WM geschossen,und obwohl Südafri-ka so früh ausgeschie-den ist, ist er stolzdar auf, welch großeBegeisterung er in sei-nem Land ausgelösthat“, sagt Gilbert(Seiten 128, 131).
Im Internet: www.spiegel.de
Angelique, Krahe in Amsterdam
MA
RC
US
KO
PP
EN
SIM
ON
E S
CH
OLT
Z
Osang, Großekathöfer, Gilbert, Kramer in Südafrika
TO
BY
SE
LA
ND
ER
/ D
ER
SP
IEG
EL
4
In diesem Heft
Kein Neustart, nirgends Seite 16Die Präsidentenwahlgeriet für Kanzlerin An-gela Merkel zur Blama-ge, der Koalitionsstreithört nicht auf, die Ge-sundheitsreform wirdzur Farce. VergangeneWoche zeigte die Bun-desregierung das ganzeSpektrum ihres Unver-mögens. Doch Merkelwill an ihrem Führungs-stil nichts ändern.
Verfeindete Linke Seiten 24, 26SPD und Grüne haben mit der Nominierung Joachim Gaucks einen Achtungs-erfolg erzielt. Oskar Lafontaines Blockade am Tag der Kandidatenkür offenbart aber: Eine funktionierende Mehrheit links der Mitte gibt es nicht.
Die Wirtschaft wächst – und zittert Seiten 70, 73Einen solchen Aufschwung hat es noch nicht gegeben. Die Wirtschaft wächstschneller als erwartet, doch gleichzeitig wächst auch die Angst vor einem kon -junkturellen Rückschlag und vor neuen Turbulenzen auf den Finanzmärkten.
Westerwelle, Merkel
Die deutsche Bildungskatastrophe Seite 56Gegeneinander, ohneeinander, durch einander: 16 deutsche Bundeslän-der sind dabei, die nächste Bildungskatastrophe anzurichten. Im Födera-lismus gehen Geist und Expertise der jungen Genera tion verloren.
HA
RT
MU
T S
CH
WA
RZ
BA
CH
/ A
RG
US
TO
BIA
S S
CH
WA
RZ
/ R
EU
TE
RS
Titel
Die Bildungskleinstaaterei gefährdet die Zukunft des Landes ....................................... 56
Deutschland
Panorama: FDP gegen Währungsfonds für überschuldete EU-Länder / Merkel stärkt Kontrolle des Kanzleramts über das Verteidigungsministerium / Deutscher Fußball-Bund unterliegt Atomlobby im Werbestreit ... 13Bundesregierung: Kanzlerin Merkel verliert an Macht und Einfluss ....................... 16SPIEGEL-Gespräch mit Jürgen Rüttgers über sein Karriereende und das Berliner Koalitions-Chaos ........................ 21Opposition: SPD, Grüne und Linke finden keinen gemeinsamen Nenner ......................... 24SPIEGEL-Gespräch mit SPD-Parteichef Sigmar Gabriel über seine große Skepsis gegenüber der Linkspartei ............................. 26Debatte: Über das schwierige Verhältnis von Krieg und Demokratie ............................ 30Zeitgeschichte: Wie die Stasi Willy Brandts Ostpolitik verhindern wollte .......................... 34Justiz: Der Bundesgerichtshof bremst die Generalbundesanwältin aus ........................... 36Banken: Die dubiosen Fondsgeschäfte der Deutschen Bank ....................................... 39Prozesse: Das tödliche Bergwerksunglück von Stolzenbach wird nach 22 Jahren vor Gericht aufgearbeitet ............... 40
Gesellschaft
Szene: Wie Ballspiele Gelähmte heilen sollen /Die Ex-Chefin von Amnesty International über ihre Kindheit in Bangladesch ................. 46Eine Meldung und ihre Geschichte –ein US-Bürger saß 30 Jahre unschuldig im Gefängnis ................................................. 47Prostitution: Wie Kinder in die Abhängigkeit von Zuhältern geraten ............. 48Justiz: Ein deutscher Fußballfan steht vor einem südafrikanischen Schnellgericht .......... 52Ortstermin: Die harte Arbeit der Autoren von WM-Livetickern ...................................... 55
Wirtschaft
Trends: TUI sucht Investor für toskanisches Feriendorf / Koalitionskrach rund um den Arbeitnehmer-Datenschutz / Zweifel an Brennelemente-Steuer wachsen ..................... 68Konjunktur: Während die Wirtschaft brummt, kehrt an den Finanzmärkten keine Ruhe ein ............................................... 70Banken: Thomas Mirow, Chef der Osteuropa-Bank, über drohende Risiken im Euro-Raum .... 73Affären: Neue Dokumente und Aussagen belasten den PR-Schattenmann Norbert Essing ................................................ 74Versicherungen: SPIEGEL-Gespräch mit Munich-Re-Chef Nikolaus von Bomhard überdie Risiken der Fußball-WM und den Glaubenskrieg um den Klimawandel ....... 76Handel: KitchenAid verärgert mit Zweite-Wahl-Geräten seine Kunden .......................... 79
Ausland
Panorama: Simbabwe will Diamanten für eine Milliarde Dollar verkaufen / Europäische und arabische Politiker zu Besuch im Gaza-Streifen................................... 80Frankreich: Eine reiche Witwe gefährdet Sarkozys Rentenreform .................................. 82Afghanistan: Geldkisten nach Dubai .............. 85
5
Eiskalte Rettung Seite 114Nach Herzinfarkten und Schlaganfällen, aber auch bei großen Herz-OPs drohenHirnschäden. Um sie zu verhindern, setzen Ärzte auf ein ungewöhnliches Mittel: Kälte. Selbst eine geringe Abkühlung kann Menschenleben retten.
Moskaus Spione in Amerika Seite 88Jahrelang haben sich russische Agenten in den USA als perfekte Durchschnitts -amerikaner getarnt, nun hat das FBI elf Spione festgenommen. In Moskau wiein Washington bemühen sich Politiker, den Schaden zu begrenzen.
Žižek
RE
INE
R R
IED
LE
R
Der Marx-Brother Seite 98Der Kapitalismus steckt in der schwersten Kriseseit langem – eine neueGeneration von Marxistenwähnt sich im Aufwind.Der Star dieser Bewegungist der slowenische Philo-soph, Psychoanalytikerund Kulturkritiker SlavojŽižek. Seine Auftritte sind eine Mischung ausideologischen Jubelfeiernund Stand-up-Comedy.
Frankreichs neueStaatsaffäre Seite 82
Fragwürdige Verbindungen zur Milliar-denerbin Liliane Bettencourt bringenSarkozys Arbeitsminister Woerth in Bedrängnis. Dessen Rentenreform galtbisher als wichtigstes Regierungsprojektvon Nicolas Sarkozy.
RE
X F
EA
TU
RE
S L
TD
. /
AC
TIO
N P
RE
SS
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Vatikan: Papst Benedikts Zorn auf die weltliche Justiz in Belgien............................... 86USA: Russische Spione entlarvt ...................... 88Vereinigte Arabische Emirate: Machtkampf um die Herrschaft an der Straße von Hormus ...... 92Global Village: Im Kampf gegen die Malaria setzt Swasiland auf das Gift DDT .................. 94
Kultur
Szene: Der Schweizer Egon Ammann über das Ende seines Literaturverlags / Die Bielefelder Kunsthalle lädt zum Koch-Happening ............................................ 96Ideologien: Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek ist der neue Star der linksradikalen Avantgarde ....................... 98Pop: Schock-Rocker Marilyn Manson versucht sich jetzt auch als Maler ................. 102Oper: SPIEGEL-Gespräch mit dem RegisseurHans Neuenfels über sein spätes Bayreuth-Debüt und Wagners „Lohengrin“ ... 104Bestseller ..................................................... 107Einspruch: Ferdinand von Schirach über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Sicherheitsverwahrung ........................... 108Buchkritik: „Der Augensammler“, der Erfolgskrimi des Berliner Autors Sebastian Fitzek .................. 110
Wissenschaft · Technik
Prisma: Herzinfarktrisiko für Marathonläufer / Genprogramm für 100-jähriges Leben ........... 112Medizin: Ärzte entdecken die Kälte als Heilmittel bei Herz-OPs .......................... 114Bildung: Die geplante Schließung der Lü becker Medizin-Fakultät spaltet die Kieler Koalition ............................ 117Abenteuer: Ein Österreicher will die Schallmauer im freien Fall durchbrechen ...... 118Motorroller: Dreirad mit Hybridantrieb ........ 122
Medien
Trends: ZDF-Moderatorin bedauert Werbeaktion / Al-Qaida verpatzt Premiere ihres neuen Online-Magazins ....................... 123Public Relations: Eine neue Hochschule in Berlin soll PR salonfähig machen ............. 124Presse: „SZ“-Mitgesellschafter Friedmannüber die neue Chefredaktion des Blattes ...... 126
Sport
Szene: Der Unternehmer Christian Holzer über die Serienreife elektronischer Tor-Erkennungssysteme / Die Freun din des Nationaltorwarts Iker Casillas berichtet als TV-Journalistin über Spaniens Team ............ 127Deutsche Mannschaft: DFB-Präsident Theo Zwanziger und sein Konflikt mit Bundestrainer Joachim Löw ......................... 128Südafrika: SPIEGEL-Gespräch mit dem WM-Star Siphiwe Tshabalala über den Stolz seiner Landsleute auf das Bafana-Team ........ 131
Briefe ............................................................... 8Impressum, Leserservice .............................. 136Register ........................................................ 138Personalien ................................................... 140Hohlspiegel / Rückspiegel ............................. 142Titelbild: Illustration Michael Pleesz für den SPIEGEL Umklapper: Foto Ralph Sondermann
Zum Machtspektakel verkommenNr. 26/2010, Titel: Die Wahl, die keine ist
1990: Wir träumten vom Paradies undwachten auf in Nordrhein-Westfalen;2010: Wir träumten vom PräsidentenGauck und erwachten mit einem Nieder-sachsen. Schade!BERLIN JENS-K. GEISSLER
Ist es nicht ein Anachronismus der Ge-schichte, wenn eine ehemalige Freiheits-kämpferin für Demokratie und freie Wah-len den seinerzeitigen Mitstreiter vomAmt des Bundespräsidenten fernhält?MÜNSTER (NRDRH.-WESTF.) JOACHIM HOMANN
Parteipolitikern Parteipolitik vorzuwerfenist ebenso wohlfeil wie heuchlerisch.Denn schließlich ist es gerade auch derSPIEGEL, der kaum eine Gelegenheitausließ zu betonen, wie sehr die Kanzlerinbeschädigt worden wäre, wäre ChristianWulff nicht Bundespräsident geworden.Wenn diese Wahl publizistisch so starkzur Entscheidungsschlacht für die Koali-tion hochstilisiert wird, ist es kaum ver-wunderlich, wenn Schwarz-Gelb alles tat,diese Schlacht für sich zu entscheiden.HAMBURG FLORIAN HUBER
Der Präsident steht über dem Machtspiel,für seine Kür müssen andere Regeln gelten.DETMOLD WOLFGANG WALDHANS
Ich habe das Amt und die Person des Bun-despräsidenten immer respektiert, ja ichkam nicht einmal auf die Idee, dies in Fra-ge zu stellen, bis Bundespräsident a. D.Köhler das Thema selbst aufbrachte. Aberdem Ansehen des zukünftigen Bundes-präsidenten in der Öffentlichkeit konntewohl kein schlimmerer Schaden zugefügtwerden als durch eine solche „Wahl“.HAMBURG PHILIPP KORTH
Wozu braucht eine parlamentarische De-mokratie einen Bundespräsidenten? Dafür,dass die freie Wahl immer mehr und im-mer wieder zum politischen Machtspekta-
kel verkommt? Und damit die Würde desAmtes auch. Die, die das Volk als Interes-senvertreter und als Hüter der Gewissens-freiheit gewählt hat, sollten – nein müssen– sich schämen, dass sie sich immer wiederbereitwillig instrumentalisieren lassen. WIESBADEN WALTER WALENZIAK
Weder die SPD noch die Grünen standeninhaltlich hinter Herrn Gauck, Sie be-schreiben das sehr schön. Somit wurdeer nur aufgestellt, um CDU und FDP zuentzweien. Also aus reiner, negativer Par-teipolitik. Pfui SPD, pfui Grüne!REINHEIM (HESSEN) PAUL KAMPSCHULTE
Ebenso verlogen wie der Wahlvorgangist das ewige Argument gegen die Direkt-wahl des Bundespräsidenten: Nichtskäme aus dem Lot außer gewohntenDenkstrukturen, und es gäbe eine Posi -tion weniger, die sich parteipolitisch ver-schachern ließe. MÜNCHEN DR. KLAUS NEUMANN
Briefe
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 08
SPIEGEL-Titel 26/2010
„Bei dem Debakel der Wahl zum Bundespräsidenten frage ich mich: Wo bleibt die Wählerstimme? Interessieren sich Merkel, Westerwelle und Gysi & Co. eigentlich für die Umfrage -ergebnisse, die für Joachim Gauck als Staatsoberhaupt Deutschlands sprachen?“
Andreas Arndt aus Hörnum auf Sylt zum Titel „Die Wahl, die keine ist“
Diskutieren Sie auf SPIEGEL ONLINE
‣ Titel Nützt ein längeres gemeinsames Lernen den Schülern?www.spiegel.de/forum/Primarschule
‣ Koalition Platzt die Koalition vor dem Ende der Legislaturperiode? www.spiegel.de/forum/Merkel
‣ Intellektuelle Gibt es ein Comeback für den Kommunismus? www.spiegel.de/forum/Intellektuelle
Mit Ihrem Titelbild haben Sie billigsteStammtischinstinkte bedient. Dabei wissenSie ganz genau, dass eine nachhaltig wirk-same Beeinflussung der Wahlmänner und-frauen schlicht unmöglich ist. Die Mitglie-der der Bundesversammlung geben in einerKabine ihre Stimme ab. Geheim und frei,da kann jeder seinem Gewissen folgen. AACHEN RÜDIGER STOBBE
Mehltau über DeutschlandNr. 25/2010, Bundeswehr: Der Kampf der
Wehrpflichtigen gegen Frust und Langeweile
Der Artikel ist wunderbar geschrieben undtrifft den Nagel 110-prozentig auf denKopf. Ich musste das Geschilderte 2005 er-leben – und als Außenseiter abgestempelt,gegen meinen größten Feind, die Lange-weile, ankämpfen: allein im Zimmer inder Hoffnung auf ein baldiges Ende.NÜRNBERG ALEX NEUWIRT
Die Wehrpflicht liegt wie Mehltau überDeutschland. Es ist eine unsägliche Ver-schwendung humaner Ressourcen, dassMänner im Alter allerbester Gesundheitund Auffassungsgabe nicht in praktischerArbeit, Ausbildung oder Studium sind. BONN DR. DIETRICH WOLF
Die genannten Beispiele über den „Dumm-fick“ treffen sicherlich in Einzelfällen zu,aber als stellvertretender Kompaniechef ei-ner Grundausbildungskompanie kann ichdie Situation aus einer Perspektive schil-dern, die Ihr einseitiger Artikel komplettausblendet: Nach der Allgemeinen Grund-ausbildung verbleibt ein Teil der Wehr-pflichtigen in unserer Kompanie und wirdgemäß seiner Vorbildung fachgerecht ein-gesetzt, als Lkw-Fahrer, in der Materialbe-wirtschaftung oder auch als Hilfsausbilder. WAGHÄUSEL (BAD.-WÜRTT.) MARC FÜGER
Der Artikel trifft voll ins Schwarze! AlsGrundwehrdienstleistender in einer Kfz-Gruppe musste ich vor vier Jahren denBrigadekommandeur chauffieren. Niewerde ich die Anweisung meines Haupt-feldwebels vergessen: „Weckenbrock, derGeneral wird Sie fragen, was Sie den gan-zen Tag so machen … überlegen Sie sichwas, Rumpimmeln ist keine Antwort!“OSNABRÜCK (NIEDERS.) KAI WECKENBROCK
Demonstration für Kandidat Gauck in München
Parteipolitisches Schachern
LU
KA
S B
AR
TH
/ D
DP
Wer eine „gigantische Jungsparty“ oderPersönlichkeitstraining in Uniform betrei-ben will, kann sich dafür Freiwillige su-chen. Als Begründung für einen Zwangs-dienst taugt beides schon verfassungsrecht-lich nicht. Bereits im Jahr 2000 hat dieWeizsäcker-Kommission festgestellt, dass„die militärische Relevanz die wesentliche
Bedingung für die Beibehaltung der Wehr-pflicht ist“. Nachdem eine solche ganz of-fenbar nicht besteht, ist die Abkehr vonder Wehrpflicht geradezu zwingend.
BERLIN PAUL SCHÄFEROBMANN DER FRAKTION DIE LINKE
IM VERTEIDIGUNGSAUSSCHUSS
Briefe
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 010
Wehrpflichtiger bei der Mittagspause
„Rumpimmeln ist keine Antwort“
TH
OM
AS
KÖ
HLE
R/P
HO
TO
TH
EK
.NE
TVorgegebene Planungskatastrophe
Nr. 25/2010, Städtebau: SPIEGEL-Gespräch mit dem Architekten Christoph Ingenhoven über den
Kampf um Stuttgarts neuen Hauptbahnhof
Sie diskreditieren die Gegner von S21 alsNostalgiker und von Angst vor Verände-rung Getriebene und gehen kaum auf dieTatsache ein, dass das Projekt durchausanders interpretiert werden kann. Hoffent-lich räumen Sie einem renommierten S21-Gegner ein ähnlich langes Interview ein.NEW YORK JOHANNES NOVY
Leider wird der Bahnhof gar nicht soschön und elegant aussehen, wie er aufden lecker gefälschten Werbegrafiken aus-sieht. Die nicht einmal sechs Meter hoheHalle wird viel düsterer und braucht stän-dig Kunstlicht, wegen der wichtigen Mi-neralwasserschichten kann man nicht tiefgenug gehen. Wie kann sich eine moderneWirtschaftsmetropole leisten, ihre Gästeim Keller zu empfangen?STUTTGART DR. DIETRICH W. SCHMIDT
Die Verteidigung seines Entwurfes hätteein Architekt wie Ingenhoven nicht nötiggehabt. Er kann ja nichts dafür, dass eineJury seinen Entwurf für „Stuttgart 21“mit dem ersten Preis ausgezeichnet hat.Die verhängnisvolle Querdrehung desBahnhofs war jedoch die Vorgabe für denWettbewerb. Damit war die Planungs -katastrophe vorgegeben – um für vieleMilliarden Euro circa 25 Minuten früherin Ulm anzukommen? DARMSTADT PROF. DR. MAX BÄCHER
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mitAnschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elek-tronisch zu veröffentlichen. Die E-Mail-Anschrift lautet:[email protected]
Respekt statt SchamNr. 25/2010, Zeitgeist: Auch die 68er müssen
sich einer Missbrauchsdebatte stellen
Unter „Besondere Erkrankungen im Spiel-und Schulalter“ findet sich die Onanie indem „neuen Gesundheitsbuch“ von 1962.Bei der sexuellen Revolution ging es umdie Befreiung kindlicher Sexualität vonSchuldgefühlen, nicht um die Förderungvon Sexualität zwischen Kindern und Er-wachsenen. Irrtümer gibt es in jeder neuenEntwicklung, so auch in der heutigen. FAAK AM SEE (ÖSTERREICH) BEAT WINTER
Bravo für diesen gelungenen Artikel, dersich bis auf eine unglückliche Formulie-rung über die „echten Pädophilen“ (gibtes falsche?) mit großer Stringenz liest.LYON (FRANKREICH) DOROTHÉE HEUEL
Es geht um Respektgrenzen, nicht „Scham-grenzen“ – darum, Kinder als Persönlich-keiten zu respektieren, ebenso wie ihre Ab-hängigkeit zu erkennen. Keiner soll sichseines Körpers oder seiner Sexualität schä-men (müssen). Gunter Schmidt hat recht,wenn er sagt, dass „die (68er) Veränderun-gen eher zu einer Prophylaxe des Miss-brauchs geführt“ haben. Schließlich erlaubtdas offenere Klima diese Diskussionen undMissbrauchsopfern das Coming-out. BAD HOMBURG (HESSEN) DR. GERHARD RUDOLF
Da liegt der Hase im PfefferNr. 25/2010, Essay: Ein Plädoyer für die Frauenquote
Fakt ist, dass inzwischen oft Männer mit-telbar diskriminiert werden – dank desDrucks aus der Politik und weil es längsten vogue ist, eine Frau als Führungskraftzu präsentieren. Was wir wirklich benö-tigen, ist eine Verbesserung der Bedin-gungen für Beschäftigte, die sich verstärktum ihre Familie kümmern wollen – alsoVerbesserung für Frauen und Männer.STUTTGART MICHAEL KEMPTER
Es fällt in der McKinsey-Studie auf, dassder Unterschied in der Kapitalrendite inFirmen mit einem höheren Frauenanteilim Management nur elf Prozent beträgt.Da liegt der Verdacht nahe, dass die soerfolgreichen Frauen vielleicht eher inumsatzstarken Unternehmen mit gerin-gem Kapitalbedarf tätig sind, beispiels-weise Mode, Kosmetik, Lifestyle. LAUTERSTEIN (BAD.-WÜRTT.) EBERHARD BERGER
Unternehmen benötigen jemanden, der be-reit ist, sich ohne Rücksicht auf andere undsich selbst für das Unternehmen aufzuop-fern. Unzweifelhaft, dass dies in der RegelMänner sind und sein werden. Für eineFrau wäre es genauso „einfach“, wenn derMann zu Hause bleibt. Aber genau da liegtder Hase im Pfeffer: Es ist ein gesellschaft-liches Problem und keines, das die Ober-manns und Ackermanns zu lösen hätten. BONN GERALD ERNST
Mittlerweile sind nicht nur an den Gym-nasien, sondern auch an Universitätendie Frauen in der Überzahl. In der Politikwimmelt es von weiblichen Führungskräf-ten, und Sie singen das alte Lied der Frau-enförderung weiter. Dabei wird eine im-mer größer werdende Gruppe männlicherKinder in unserem Bildungssystem abge-hängt. Ist hier nicht längst ein wesentlichdringenderer Handlungsbedarf vorhan-den, als den hochstudierten Frauen weiterzu helfen? Und angesichts der geringenGeburtenzahlen – liegt da nicht eine Quo-tenregelung ganz neuer Art auf der Hand:Eltern (egal ob Mann oder Frau) werdenbei gleicher Eignung bevorzugt einge-stellt.SCHÖNHORST (SCHL.-HOLST.)
DR. GERD DINGEBAUER
1968 schrieb Günter Amendt in dem vonihm herausgegebenen „Kinderkreuzzug“:„Räumen Sie die Recks und Schwebebal-ken, Kisten und Kasten, kurz alle Kastra -tions- und Entjungferungswerkzeuge ausden Turnhallen, und lassen Sie als Einzigeszurück Decken und Matten, auf denen Siesich paarweise ausstrecken, à faire l’amour,um Liebe zu machen.“ Ich wundere michnur, wie anpassungsfähig Amendt ist, derheute wieder auf der richtigen Seite, diefrüher Repression hieß, steht.GÜTERSLOH (NRDRH.-WESTF.) DR. HELMUT GATZEN
Kinderladen in Frankfurt am Main 1970
Paarweise ausstrecken
ER
IKA
SU
LZ
ER
-KLE
INE
ME
IER
Ingenhoven-Entwurf für Stuttgarter Bahnhof
Lecker gefälschte Werbegrafik?
BA
HN
/ D
PA
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 13
Panorama Deutschland
Im Fall des vor zwei Wochen in Pakistan verhafteten deutschen Isla-
misten Rami M. gerät die Bundes -regierung weiter unter Druck. AmMittwoch dieser Woche soll das Kanz-leramt im geheim tagenden Parlamen-tarischen Kontrollgremium Rechen-schaft darüber ablegen, auf welchemWeg der pakistanische GeheimdienstISI von dem geplanten Botschaftsbe-such Rami M.s Kenntnis erhalten hat.Auch der Innen- und der auswärtigeAusschuss werden sich mit dem Vor-gang befassen. Rami M. war am 21.Juni festgenommen worden, nachdemer sein Versteck in den pakistanischenBergen verlassen hatte. Zuvor hatte ersich telefonisch an die deutsche Bot-
schaft gewandt und angekündigt, erbitte zur Abholung eines neuen Reise-passes um einen Termin. Daraufhinhatte ihm das Auswärtige Amt Unter-stützung zugesichert und für das aus-
gemachte Datum eine Art Passier-schein zugeschickt. Parallel informier-te das Bundeskriminalamt allerdingsdie pakistanische Polizei; auch derBundesnachrichtendienst hatte vor derVerhaftung Kontakt mit dem ISI. Dar -aufhin nahmen pakistanische SoldatenM. gezielt fest. Die Familie des mit internationalem Haftbefehl gesuchtenDeutsch-Syrers wirft der Bundesregie-rung deshalb „Verrat“ vor, Rami M.habe sich stellen wollen (SPIEGEL26/2010). Der pakistanische Geheim-dienst ISI, der in der Vergangenheitwiederholt Gefangene gefoltert hat,verweigert der deutschen Regierungbislang jeden konsularischen Zugang,der Gefangene werde derzeit „inten-siv verhört“. Zumindest informell hatdie pakistanische Regierung inzwi-schen bestätigt, dass es sich bei demInhaftierten um Rami M. handelt.
T E R R O R I S T E N
Heikle Kooperation mit Pakistan
Deutsche Botschaft in Islamabad
TH
OM
AS
IM
O /
PH
OTO
TH
EK
Kachelmann
RO
NA
LD
WIT
TE
K /
DD
P
A F F Ä R E K A C H E L M A N N
Prozess im HerbstNachdem das Landgericht Mannheim die Aufhebung des
Haftbefehls gegen Jörg Kachelmann abgelehnt hat, musssich der Wettermoderator auf eine monatelange Verlänge-rung seiner Untersuchungshaft einstellen. In Justizkreisengeht man von einem Prozessbeginn erst nach den Sommer-ferien aus, also frühestens im September. Kachelmann wirdvorgeworfen, seine ehemalige Freundin vergewaltigt zu ha-ben, was dieser bestreitet. In den kommenden Wochen solldie nächste Instanz, das Oberlandesgericht in Karlsruhe, aufBeschwerde der Verteidigung über die Aufhebung des Haft-befehls entscheiden. Große Chancen werden Kachelmannallerdings nicht eingeräumt, da es um die Frage des „drin-
genden Tatverdachts“ geht. Diesen haben die MannheimerRichter in ihrer Entscheidung bekräftigt. Sie halten Kachel-manns Einlassungen zur Tat für wenig plausibel. In ihremausführlichen Beschluss spielt die Expertise des von derStaatsanwaltschaft bestellten Rechtsmediziners nur eine nach-rangige Rolle – diese schließt auch eine Selbstverletzung derFrau nicht aus. Keine umfassende Berücksichtigung fand zu-dem das Resümee der Bremer Psychologin Luise Greuel, dieein Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt hat. Greuel war zudem Schluss gekommen, die Aussage der Frau sei nicht aus-reichend belastbar. Das Gericht bezog sich hingegen auf jeneTeile ihres Gutachtens, in denen Greuel Hinweise für eineGlaubhaftigkeit der Aussage gesehen hatte. Eine besondereRolle spielt für die Mannheimer Kammer KachelmannsSchweizer Staatsbürgerschaft. Bei der drohenden Freiheits-strafe von mindestens fünf Jahren gehen sie von einem „ganzerheblichen Fluchtanreiz“ aus.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 014
Die Grünen-AbgeordneteUlrike Höfken, 55, will inden Kantinen des Bundes-tags und der Ministerieneinen fleischfreien Tag proWoche einführen.
SPIEGEL: Frau Höfken, warum wollen Sieden Fleischkonsum ausgerechnet unterBundespolitikern reduzieren?Höfken: Der Bundestag und die Ministeriensollten sich an die Spitze der internationa-len Bewegung für den „Veggie-Day“ set-zen. Die Deutschen essen zu viel Fleisch.SPIEGEL: Ihre Kollegen im Bundestag dürf-ten begeistert sein …Höfken: … da muss ich in der Tat einigeÜberzeugungsarbeit leisten. Selbst bei
den Grünen haben manche reagiert wievon der Tarantel gestochen und sagten:Ich esse, was ich will.SPIEGEL: Freies Fleisch für freie Bürger?Höfken: Ganz so schlimm war es nicht,aber gerade Grüne lassen sich ungern wasvorschreiben. Andere in meiner Fraktionfanden, man könnte viel weiter gehen.SPIEGEL: Wie weit wollen Sie gehen?Höfken: Ich werbe bei Abgeordneten undMitarbeitern für einen Antrag an den Äl-testenrat: Der Bundestag soll in seinenKantinen einen fleischfreien Tag einfüh-ren und die Bundesregierung auffordern,in den Ministerien das Gleiche zu tun.SPIEGEL: Die Fleischesser werden auf dieStraße gehen – zumindest bis zur nächs-ten Würstchenbude.
V E R T E I D I G U N G
Zur Chefsache erklärt
Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) baut im Kanzleramt ein
Gegengewicht zum Verteidigungsmi-nisterium auf. In der Abteilung für dieBelange der Bundeswehr, der soge-nannten Gruppe 22, lässt die Kanzle-rin derzeit alle für den Afghanistan-Einsatz relevanten Informationen be-werten. Auch für die Reform der Bun-deswehr erarbeitet der Leiter derGruppe 22, Erich Vad, eigene Konzep-te. Beim Thema Wehrpflicht sympa -thisiert das Kanzleramt mit dem SPD-Modell, wonach nur noch Freiwilligezum Grundwehrdienst eingezogenwerden sollen. Vads gewachsene Be-deutung dokumentiert nicht zuletztseine Beförderung in der vergangenenWoche zum Brigadegeneral, für diesich Merkel eingesetzt hatte. Der Vor-gang ist ungewöhnlich: Zahlreiche Vorgänger Vads auf dieser Positionhatten sich vergeblich um eine solcheBeförderung bemüht. Zuletzt saß un-ter SPD-Kanzler Helmut Schmidt einBrigadegeneral auf dieser Planstelle.
W E R B U N G
DFB contra Atomlobby
Theo Zwanziger, Präsident des Deut-schen Fußball-Bundes (DFB), ist
mit dem Versuch vorerst gescheitert,der deutschen Kernkraftlobby die Wer-bung mit Fußballmotiven zu unter -sagen. Der Chef des Deutschen Atom -forums, Ralf Güldner, weigert sich,eine von Zwanziger geforderte Unter-lassungsverpflichtungserklärung zu unterschreiben. Der DFB wirft demAtomforum vor, in den Anzeigen wer-de „eine Parteinahme des DFB für dieweitere Nutzung der Kernkraft sugge-riert“. In den Werbetexten heißt eszum Beispiel, dass „nicht nur für unse-re Jungs das Zusammenspiel der
Schlüssel zum Erfolg“ sei, sondernauch für Kernenergie und erneuerbareEnergiequellen. „Merkmal jeder dieserAnzeigen ist, dass zwischen den Leis-tungen der deutschen Nationalmann-schaft und dem Anliegen des Atom -forums ein Zusammenhang hergestelltwird“, hatte Zwanziger die juristischen
Schritte begründet und eine Vertrags-strafe angedroht. Atom-PräsidentGüldner wies in seiner Antwort denVorwurf zurück, den Deutschen Fuss-ball-Bund vereinnahmt zu haben. Manhabe die Motive sorgfältig geprüft undsei von der DFB-Attacke „überrascht“,heißt es beim Atomforum.
Panorama
E R N Ä H R U N G
„Die Deutschen essen zu viel Fleisch“
Merkel, Vad
Restaurant im Berliner Parlamentsgebäude Paul-Löbe-Haus
LA
IF
Atomforum-Werbung
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 15
E U R O
FDP gegen Schäuble
Die FDP wendet sich gegen einen europäischen Währungs-fonds zur Rettung hochverschuldeter Euro-Länder, wie er
unter anderem von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäubleins Spiel gebracht wurde. Das gegenwärtige Rettungspaket fürden Euro dürfe nicht zu einer dauerhaften Einrichtung werden,sagt der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion,Michael Link: „Damit würden wir das Grundproblem nicht lösen, sondern verlängern.“ Die Liberalen plädieren für eine Regelung, die eine geordnete Insolvenz von Pleitestaaten er-möglicht. Die Parlamentarier der FDP wollen gemeinsam mitden Unions-Kollegen im Herbst eine Stellungnahme des Bun-destags verabschieden, die die Bundesregierung bei ihren Ver-handlungen in Brüssel berücksichtigen müsste. „Wir dürfennicht länger nur reagieren, während andere agieren“, sagt Link.Die Koalition will sich darum bemühen, SPD und Grüne füreinen gemeinsamen Vorstoß zu gewinnen.
B N D
Tödliche Autofahrt eines Agenten
Ein tödlicher Zwischenfall in Georgien hat den Bundesnach-richtendienst (BND) in Erklärungsnöte gebracht. Der deut-
sche Resident des Geheimdienstes, Andreas D., hatte im No-vember vergangenen Jahres in Tiflis nach einem Zechgelageeine georgische Straßenkehrerin angefahren; die Frau erlagspäter ihren Verletzungen. Anstatt auf die Polizei zu warten,floh der offenbar stark angetrunkene Geheimdienstmann inseinem Mercedes-Geländewagen. Allerdings hatten Überwa-chungskameras das Geschehen aufgezeichnet, so dass die geor-gischen Behörden alsbald herausfanden, welcher Mitarbeiterder deutschen Botschaft in den tödlichen Unfall verwickeltwar. Als Ergebnis intensiver diplomatischer Verhandlungenmusste der BND seinen Residenten abziehen; die georgischenBehörden verzichteten ihrerseits auf weitere Konsequenzen.Der Nachrichtendienstler muss nun mit einer Anklage inDeutschland und dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Deutschland
Höfken: Das muss nicht sein. Ich hättenichts dagegen, wenn die Kantinen fürHärtefälle Ausnahmewürste braten.SPIEGEL: Ist der Kampf um den Speiseplannicht Symbolpolitik?Höfken: Man braucht doch Symbole, wennman was ändern will. Der überhöhteFleischkonsum schadet nicht nur unsererGesundheit und dem Klima. Er gefährdetauch die Ernährungssicherheit: Die Welt-meere sind bald leergefischt, die Fleisch-produktion verschwendet unglaublich vielNahrung und Energie. Hier können dieAbgeordneten mal mit gutem Beispielvor angehen.SPIEGEL: Wie viel Fleisch essen Sie?Höfken: Mindestens einmal die Woche gibtes was gutes Fleischloses, in der Fastenzeitsowieso. Zu Hause kaufe ich Fleisch ausartgerechter Tierhaltung, aber ich bin sehrauf Kantinen angewiesen. Deswegen wäreich froh, wenn es da Alternativen zumFleisch gäbe.
V E R B R E C H E N
Neue Ermittlungen im Fall Krombach
Im Fall des Lindauer Arztes DieterKrombach hat die französische Jus-
tiz neue Ermittlungen angeordnet.Krombach war 1995 in Paris wegen desTodes seiner französischen Stieftoch-ter in Abwesenheit zu 15 Jahren Frei-heitsstrafe verurteilt worden. Nun lässtein Richter die Vorwürfe neu überprü-fen. „Das ist gleichbedeutend mit ei-nem neuen Verfahren, in dem alles beinull beginnt“, sagt Krombachs Vertei-diger Yves Levano. Der Richter fordertzusätzliche Gutachten und Zeugenbe-fragungen. Krombachs Stieftochter Kalinka Bamberski war 1982 in seinerVilla am Bodensee tot aufgefundenworden. Zuvor hatte ihr der Arzt eineSpritze gegeben. Kalinkas leiblicherVater André Bamberski verdächtigteKrombach, das Mädchen vergewaltigt
und getötet zu haben; der Stiefvaterwies dies zurück. Der Europäische Ge-richtshof für Menschenrechte missbil-ligte 2001 das in Abwesenheit verhäng-te Urteil, der Haftbefehl indes bestandweiter. In Deutschland wurden die Er-mittlungen gegen Krombach schonfrüh eingestellt. Da der Haftbefehl nievollstreckt werden konnte, veranlassteBamberski im letzten Oktober Krom-bachs Entführung nach Mulhouse – woder Arzt von der Polizei inhaftiertwurde. Die Bundesregierung hatte diePariser Justiz daraufhin aufgefordert,Krombach freizulassen, da gegen ihnin Deutschland nichts vorliege und ergewaltsam verschleppt worden sei. Pa-ris lehnte ab. Inzwischen beschränktsich Deutschland auf die konsularischeBetreuung Krombachs.
Bamberski (M.) bei einer Demonstration vor dem Deutschen Konsulat in Toulouse 2002
PA
SC
AL P
AV
AN
I /
AF
P
PO
NIZ
AK
/ C
AR
O
In der Politik gibt es Wörter, die ver-derblich sind. In der rot-grünen Ärawar „Reform“ so ein Wort, in den Zei-
ten von Schwarz-Gelb ist es „Neustart“.Beide Wörter waren einst stolz und strah-
lend, dann sind sie durch allzu häufigenoder müßigen Gebrauch verblasst, schließ-lich verkommen. Bei „Neustart“ ging dasrasend schnell. Nach den vermasselten Koalitionsverhandlungen im Oktober 2009hoffte Angela Merkels Regierung mehrmalsauf einen Aufbruch in bessere Zeiten, zu-letzt am Mittwoch vergangener Woche.
Die Wahl von Christian Wulff zumBundespräsidenten sollte zum neuerli-chen Neustart werden, aber sie wurdeverpatzt, weil Wulff erst im dritten Wahl-gang durchkam. Seither ist der Begriffpraktisch aus dem Wörterbuch desschwarz-gelben Regierens verschwunden.Wer jetzt noch von der Hoffnung auf ei-nen Neustart spricht, macht sich lächer-lich. Niemand glaubt mehr daran.
Gleichzeitig ist der Zustand dieser Re-gierung so, dass alle denken, es könne sonicht weitergehen, außer eine. Diese eineist ausgerechnet die Bundeskanzlerin.Deshalb könnte Deutschland ein Sommerder Agonie bevorstehen, dazu ein Herbst,vielleicht ein Winter, ein Frühling undwieder ein Sommer. Erst 2013 stehen, beiregulärem Verlauf, die nächste Bundes-tagswahl an.
So wurde die vergangene Woche zumAusblick auf das, was bleibt. Die Bundes-regierung zeigte das ganze Spektrum ih-rer Unfähigkeiten und Unvereinbarkeiten,ein Panoptikum des schlechten Regierens,das leider zur Dauerausstellung werdenkönnte.
Es begann am Dienstag mit einem hef-tigen Streit zwischen Merkel und demGeneralsekretär der FDP, Christian Lind-ner, einer Eskalation der permanentenGereiztheit zwischen den Partnern. AmMittwoch erwies sich, dass Merkel nichtgenug Bindungskraft hat, um ihre Koali-tion, einschließlich der eigenen Partei,zur pannenfreien Wahl eines Bundesprä-sidenten zu bewegen. Am Donnerstagund Freitag konnte sich die Koalition nurauf einen schwachen Kompromiss zur Ge-sundheitsreform einigen.
Nun zeigen sogar die Stillen der Bundes-regierung ihren Unmut. Bildungsministerin
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 016
B U N D E S R E G I E R U N G
Die UnerschrockenenDie Präsidentenwahl war ein weiterer Rückschlag für Angela Merkels Regierung.
Auch die Gesundheitsreform fiel dürftig aus. Aber es sieht nicht so aus, als wolle die Bundeskanzlerin ihre Politik ändern.
Deutschland
Parteispitzen Seehofer, Merkel, Westerwelle: Ein Panoptikum des schlechten Regierens, das zur
Annette Schavan sagt: „Man darf nicht je-des Ringen um gute Konzepte bei Bildungoder Gesundheit durch eine parteipoliti-sche Brille sehen. Die Welt ist eine andere,die alten Muster passen nicht mehr.“ Trotz-dem mag Schavan, die auch stellvertreten-de Vorsitzende der CDU ist, die Hoffnungnicht aufgeben. Das Wort „Neustart“ stehtauch bei ihr auf dem Index, sie drückt esso aus: „Wenn alle genug erschrocken sind,müsste es eigentlich klappen.“
Aber sind alle genug erschrocken? AmMittwoch, während die Bundesversamm-
lung endlos tagte, und an den Tagen da-nach wurden verschiedene Erwartungengeäußert, was Merkel ändern könnte. Esgeht nicht um einen Neustart, es sind diebescheidenen Erwartungen an eine all-mähliche Verbesserung.
Eine wichtige Erwartung ist eine per-sonelle Erneuerung. Wie dringend sie ist,wurde am Mittwoch zwischen fünf undsechs Uhr nachmittags besonders deut-lich.
Um halb sechs versammeln sich dieWahlleute von CDU und CSU im Saal
der Unionsfraktion, Christian Wulff istgerade zum zweiten Mal durchgefallen,weil ihn nicht genug Abgeordnete ausUnion und FDP gewählt haben. Es gehtjetzt um alles oder nichts.
Merkel will die Stimmung drehen, dieZukunft der Regierung steht auf demSpiel, aber sie spricht, als bitte sie umeine Mehrheit für die Altautoverordnung,so jedenfalls empfinden es viele Abge-ordnete. „Wir haben die Verpflichtung,unsere Verantwortung deutlich zu ma-chen“, sagt sie. Es gibt nur dünnen Ap-plaus.
Ein paar Minuten später bittet der hes-sische Ministerpräsident Roland Koch umdas Wort. Er stellt sich als „designiertesParteifossil“ vor, weil er seinen Rückzugaus der Politik für Ende August angekün-digt hat. „Wir sind in einem tieferenSchlamassel, als wir alle geahnt haben“,sagt er. Es gebe Verletzungen und Ent-täuschungen, aber das dürfe jetzt nichtdazu führen, alles wegzuwerfen. „DieThese, aus Angst vor dem Tod Selbst-mord zu begehen, diese These geht im-mer fehl.“
Die Union müsse nun im dritten Wahlgang zeigen, dass sie aus eigenerKraft die absolute Mehrheit auf die Beine stelle. Joachim Gauck sei ein re -spektabler Kandidat. „Aber er lässt sichvon Leuten wählen, die seine Prinzipiennicht teilen.“
Im Saal brandet Applaus auf, er gehtschnell über in rhythmisches Klatschen.Merkel merkt, wie unangemessen ihr Bei-trag war, sie meldet sich noch einmal zuWort. Sie vergleicht die Situation der Union mit der Lage der Nationalmann-schaft. Das Serbien-Spiel, das verlorenwurde, sei vorbei, nun könne man sichauf die politische Entsprechung der PartieDeutschland– England freuen, die ja 4:1ausgegangen sei. Es soll kumpelhaft undbodenständig klingen, doch viele haltenden Vergleich für unwürdig.
Die verpatzte Wahl gibt einer DebatteNahrung, die Merkel für erledigt hielt –die um die Zukunft Kochs. Viele in derUnion wollen sich nicht mit seinem Rück-zug abfinden.
„Roland Koch hat in der Unionsfrak -tion eine einfühlsame Rede gehalten undin schwieriger Situation ein Wir-Gefühlerzeugt“, sagt der CSU-EhrenvorsitzendeEdmund Stoiber. „Ich fühle mich bestä-tigt, dass man Roland Koch unbedingt inder Politik halten sollte.“
Das sieht der Europaabgeordnete El-mar Brok von der CDU genauso. „Ro-land Koch hat eine überragende Fähigkeitin wirtschafts- und finanzpolitischen Fra-gen. Deswegen würde ich ihn in der Politik halten.“ Der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Josef Schlar-mann, sagt: „Der kleine Kreis um FrauMerkel kann nicht all die schwierigen Fra-gen lösen, die im Moment anstehen. Sie
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 17
Dauerausstellung werden könnte
RE
INE
R Z
EN
SE
N/I
MA
GO
muss Partei und Regierung personell bes-ser aufstellen.“
Doch Merkel mag nicht. Sie fürchtetoffenbar, dass sich ein BundesministerKoch zum Ersatzkanzler aufschwingenkönnte, außerdem, so heißt es im Kanz-leramt, müsste für Koch ein anderer wei-chen, Finanzminister Wolfgang Schäublezum Beispiel, und das würde Merkel wie-der den Vorwurf einbringen, Menschenwie Schachfiguren zu verschieben. Des-halb wird es voraussichtlich keine Kabi-nettsumbildung geben.
Die zweite Erwartung ist, dass Merkelihren Regierungsstil ändert, dass sie nichtnur die engsten Vertrauten in ihre Ent-scheidungen einbindet.
Als am Tag der Bundesversammlungder erste Wahlgang schiefgeht, spricht derschleswig-holsteinische MinisterpräsidentPeter Harry Carstensen CDU-Generalse-kretär Hermann Gröhe an und schlägtvor, noch am selben Tag eine außeror-dentliche Aussprache der Parteiführungeinzuberufen. Die Niederlage für Wulffsei ein deutliches Zeichen. „Wir könnenjetzt nicht einfach so auseinandergehen“,sagt Carstensen.
Als der zweite Wahlgang schiefgeht,verlangt auch der Ministerpräsident vonSachsen, Stanislaw Tillich, eine Sonder-sitzung des CDU-Präsidiums. Gröhe undUnions-Fraktionschef Volker Kauderdrängen darauf, den dritten Wahlgang ab-zuwarten. Als der doch noch die Mehr-heit für Wulff bringt, ist das Krisentreffenvom Tisch. Jetzt, an diesem Montag, stehtdie Nachlese des Wahldebakels auf derTagesordnung des Präsidiums.
Insgesamt gibt es den Wunsch nach ei-nem offeneren Regierungsstil. Im Kanz-
leramt herrsche eine „Bunkermentalität“,sagt der Hesse Michael Brand, Mitgliedder Unionsfraktion im Bundestag. Er be-klagt, dass inhaltliche Vorschläge nichtsachlich bewertet würden, sondern nachder Frage, ob man als Freund oder Feinddes Merkel-Lagers gelte. „Ein solcherUmgang schadet der Union, und letztlichauch unserer Arbeit für das Land.“
Eine dritte Erwartung ist, dass MerkelUnion und FDP in der Koalition mitein -ander aussöhnt.
Wie angespannt die Lage ist, zeigte sichim Koalitionsausschuss am vergangenenDienstag. FDP-Generalsekretär Lindnerwartete schon im Kanzleramt, als Merkelden Raum betrat. „Ich dachte, wir wolltenhier etwas ruhiger werden, und dannmuss ich in der Früh so etwas hören“,fauchte sie Lindner an.
Der hatte am Morgen im Deutschland-funk die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelbetriebe in Frage gestellt. In denersten Regierungsmonaten seien der Koalition Fehler passiert, sagte er. Merkelbegriff die Sätze als Angriff auf den Koalitionsfrieden.
Merkel habe das missverstanden, sagteLindner, er habe nicht die Hotelsteuer ei-nen Fehler genannt, sondern bemängelt,dass man die Mehrwertsteuer nichtgrundsätzlich reformiert habe.
Der Vorfall zeigt aus Sicht der Libera-len, wie nervös die Kanzlerin mittlerweileist. Früher hätte Merkel sich nicht die Blö-ße gegeben, den Generalsekretär des Koalitionspartners wegen einer Interview -Äußerung anzupfeifen.
Natürlich weiß man in der Spitze derLiberalen, dass die eigene Partei maß-geblich zu den Problemen der Regierung
beigetragen hat. Aber man hat die Kon-sequenzen gezogen. Auf einer Klausur-tagung beschlossen Partei- und Fraktions-vorstand am vorvergangenen Wochenen-de eine inhaltliche „Neujustierung“. Stattimmer nur niedrigere Steuern zu fordern,will die FDP sich künftig stärker bei denThemen Bürgerrechte, Bildung, Gesund-heit und Haushalt profilieren.
Guido Westerwelle durfte den neuenKurs verkünden, wird ihn aber nicht ver-körpern. Seine Kollegen in der Parteispit-ze wollen, dass sich der Vorsitzende umseine eigentliche Aufgabe, die Außen -politik, kümmert; Lindner und Fraktions-chefin Birgit Homburger sollen die neueFDP repräsentieren.
Die Liberalen finden, dass sie sich da-mit genug reformiert haben. Nun sei dieCDU dran. Also wird unerschrocken wei-tergestichelt.
Als Wulff im ersten Wahlgang durch-fiel, sprach Lindner von „chaotisierendenElementen“ in der Union. Sogar Chris-toph Steegmans blies in dieses Horn. Derist zwar von der FDP, sollte aber als stell-vertretender Regierungssprecher loyal zuMerkel sein. Doch während der Bundes-versammlung war er vor allem damit be-schäftigt, die Schuld an den vergeigtenWahlgängen Merkel und der CDU zuzu-schieben.
Er stand im Reichstag und sagte zu denJournalisten: „Wir haben unsere Stimmengeliefert, da bin ich hundertprozentig si-cher.“ Für Guido Westerwelle sei deshalbkein Schaden entstanden, eher müsse sichMerkel fragen lassen, was in der CDU lossei. Ihm sei zugetragen worden, dassKoch nach dem ersten Wahlgang geraunthabe: „Jetzt ist alles möglich.“ Der Spre-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 018
Ehepaar Wulff vor dem Schloss Bellevue: Wer jetzt noch von der Hoffnung auf einen Neustart spricht, macht sich lächerlich
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ D
ER
SP
IEG
EL
cher Merkels wirkte in diesem Momentwie ein Spin Doctor der Opposition. Wiewill Merkel ihre Koalition befrieden,wenn ihr selbst ein enger Mitarbeiter aufder Nase herumtanzt?
Eine vierte Erwartung ist schlicht, dassMerkel Macht abgibt.
Merkel schafft es nicht, die Regierungzusammenzuhalten, das ist die Analyseder FDP-Führung. Damit es trotzdemweitergeht, sollen nach dem Willen der Liberalen die Fraktionen diese Auf-gabe teilweise übernehmen. FDP-Frak-tionschefin Birgit Homburger will zusam-men mit Unions-Fraktionschef VolkerKauder zeigen, dass es noch einen ge-meinsamen politischen Willen in der Ko -alition gibt.
Eine besonders umstrittene Fra-ge wollen die beiden Fraktions-chefs nun selbst entscheiden. DieRegierung kann sich nicht daraufeinigen, um wie viele Jahre sie dieLaufzeiten der Atomkraftwerkeverlängern soll. Bundesumwelt -minister Norbert Röttgen willhöchstens 10, WirtschaftsministerRainer Brüderle mindestens 15 Jah-re. Merkel hat sich wie so oft nichtfestgelegt.
„Alle Politiker scheuen sich vorPolarisierung und Konflikten, weilsie Angst haben, die Mehrheits -fähigkeit zu verlieren“, sagt derscheidende NRW-Ministerpräsi-dent Jürgen Rüttgers (siehe Seite21). „Nur sehen wir jetzt, dass dasnicht zu starken Parteien führt,sondern dass auch wir als CDU –das ist ja wohl die Botschaft derNordrhein-West falen-Wahl – in-zwischen darum kämpfen müssen,Volkspartei zu sein.“
Die Entscheidung im Streit umdie Laufzeiten wird Merkel nunabgenommen. Kauder und Hom-burger haben vereinbart, einenGesetzentwurf erarbeiten zu las-sen, der sich auf der Linie Brüder-les bewegt. Das Thema soll zu -sammen mit dem Haushalt und der Bun-deswehr auf einer Klausurtagung derUnionsfraktion am 7. und 8. Septemberbesprochen werden. Das Kabinett willdas Thema am 28. September behandeln.In derselben Woche wollen die beidenFraktionschefs ihren Gesetzentwurf ein-bringen.
Bislang haben Homburger und Kauderihre Aufgabe darin gesehen, Beschlüsseder Regierung im Parlament durchzuset-zen. Beide gelten als loyal bis zur Selbst-aufgabe. Dass sie diese Rolle verlassenwollen, zeigt, wie ernst die Lage für Mer-kel ist.
Eine fünfte Erwartung, vor allem derBürger, ist, dass Merkel solide Gesetzes-arbeit mit ordentlichen Ergebnissen vor-legt. Die Chance dafür bot sich am Don-
nerstag und Freitag nach der Präsiden-tenwahl.
Am frühen Abend des vergangenenDonnerstags treffen die Gesundheitsexper -ten von Union und FDP im Berliner Paul-Löbe-Haus ein. Im Sitzungssaal im drittenStock beraten die Politiker, wie sie Geldfür die gesetzlichen Krankenkassen zu-sammenkratzen wollen. Trotz anziehenderKonjunktur werden im kommenden Jahrneun bis elf Milliarden Euro fehlen. Dieersten Kassen stehen vor der Pleite.
Allen im Raum ist klar, dass das Spar-programm gnadenlos sein muss. Nullrun-den bei den Ärzten? Weniger Geld fürdie Krankenhäuser? Eine Neuregelungder Praxisgebühr? Bei fast allen Punktengibt es Streit.
Röslers Parlamentarischer Staatssekre-tär Daniel Bahr legt sich mit CSU-MannJohannes Singhammer an. Was dem ei-gentlich einfalle, bei einem Ärzteemp-fang zu behaupten, es gebe keine Null-runden für Mediziner? Der Münchnergiftet zurück: Einfach Nullrunden zu ver-ordnen, das sei „keine pragmatische Politik“. Dann kommt eine Attacke Sing-hammers gegen den Gesundheitsminis-ter: Wann der denn endlich selbst malkonkrete Sparvorschläge vorlegen wer-de? „Da ist uns dann endgültig die Kinn-lade runtergefallen“, sagt ein FDP-Teil-nehmer.
Seit der Bundesgesundheitsminister imAmt ist, hat die CSU unverhohlen Freudedaran, alles plattzumachen, was Röslerauf den Weg bringt. Kopfpauschale, Spar-
maßnahmen, auch eine Erhöhung der Zu-satzbeiträge: schwierig.
Bis vergangene Woche hatte er immer-hin noch die Hoffnung, Merkel werde derCSU endlich Widerworte geben und sichhinter ihren jungen Minister stellen. Dochseit am Freitag die ersten Details aus derSpitzenrunde von Union und FDP unterLeitung Merkels bekanntgeworden sind,ist auch hier klar: Seehofer hat sich weit-gehend durchgesetzt.
Um das Kassendefizit auszugleichen,müssen Ärzte oder Apotheker nur einengeringen Beitrag leisten. Stattdessen wol-len die Koalitionäre die Verwaltungskos-ten der Krankenkassen einfrieren, wasdas System um rund 300 Millionen Euroentlastet und rund 600 Millionen Eurobei den Kliniken einspart. Statt um vierMilliarden Euro, wie ursprünglich ge-plant, wird der Gesundheitskompromissdie Ausgaben wohl eher um gut drei Mil-liarden Euro senken.
Deshalb müssen die Beiträge erhöhtwerden, mit unschönen Folgen für dieKonjunktur: Die Versicherten haben vor -aussichtlich drei Milliarden Euro wenigerin der Tasche, die sonst dem heimischenKonsum zugutegekommen wären. Unddie Betriebe müssen im selben Umfanghöhere Lohnkosten schultern, was die Be-reitschaft zum Einstellen neuer Mitarbei-ter hemmt.
So beginnt der erste freidemokratischeGesundheitsminister seine Amtszeit miteinem Flop. Geplant war eine tiefgrei-fende Strukturreform, es kommt einesimple Abgabenerhöhung.
Im Prinzip machen alle so weiter wiebislang, vollkommen unerschrocken. So-lange Merkel nicht freiwillig etwas än-dert, wird sich nichts ändern. Und nie-mand hat die Macht, sie zu stürzen. EineKronprinzessin gibt es zwar jetzt, das istArbeitsministerin Ursula von der Leyen,die derzeit die besten Chancen hat, Mer-kels Nachfolgerin zu werden. Aber des-halb ist sie keine Herausforderin. Von derLeyen ist loyal zu Merkel.
Es gibt auch niemanden, der sie odereinen anderen ins Kanzleramt hievenkönnte. Die einst starken Ministerpräsi-denten Roland Koch, Jürgen Rüttgers undChristian Wulff spielen machtpolitischkeine Rolle mehr. Ein anderes Machtzen-trum gibt es nicht in der CDU. Wenn Mer-kel nicht selbst ihr Amt riskiert, indemsie Seehofer herausfordert oder aus Ver-druss eines Tages an von der Leyen über-gibt, kann sie lange Kanzlerin bleiben.
Ihre eigene Erwartung ist, dass sienichts ändert. Politiker, die sie in der ver-gangenen Woche gesprochen haben, tra-fen auf eine Bundeskanzlerin, die nichtdie geringsten Andeutungen machte, dasssie etwas ändern will. Erschrocken wirktesie kein bisschen, sondern so, als sei allesnormal. KATRIN ELGER, DIRK KURBJUWEIT, RALF NEUKIRCH, RENÉ PFISTER, MERLIND THEILE
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 020
Deutschland
CDU-Mann Koch: „Designiertes Parteifossil“
STA
R P
RE
SS
/ A
ED
T
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 21
SPIEGEL: Herr Rüttgers, sind Sie erleichtert,dass Sie es hinter sich haben?Rüttgers: Das kann ich nicht sagen, nein.Niederlagen sind nie schön. Es tropftauch nicht so einfach an einem ab. Aberich bin nicht verbittert. Ich glaube, dasswir das Land fünf Jahre lang gut regiertund nach vorne gebracht haben. Politikersagen immer: Ämter sind auf Zeit – undsind dann doch überrascht, wenn es sokommt. Ich persönlich hatte mich inner-lich darauf eingestellt.SPIEGEL: Ist Ihre politische Karriere damitam Ende?Rüttgers: Ich bleibe ein politischer Mensch,aber ich strebe keine neuen Ämter mehr
an. Was ich machen werde, kann ich Ihnennoch nicht sagen; ich weiß es auch nicht.Ein Freund hat mir eine SMS geschickt:Entscheide dich nicht zu früh. Ich glaube,das ist klug. Ich laufe jetzt nicht irgend -etwas hinterher. Und ich habe genug Auf-gaben, die ich weitermachen möchte: meinEngagement für die Rettung der Gedenk-stätte in Auschwitz zum Beispiel.SPIEGEL: Geht das überhaupt nach dreiJahrzehnten in der Politik? Ein Lebenvöllig ohne?Rüttgers: Das sage ich ja nicht. Wenn manein politischer Mensch ist, wird einen dasweiter interessieren, auch das Nachden-ken. Aber ich werde garantiert nicht je-
mand sein, der vom Spielfeldrand an -dauernd kommentiert und es anderenschwermacht. Ich glaube aber schon, dasses ein Bedürfnis vieler Menschen gibt,öffentlich über die Zukunft nachzuden-ken. Der Anteil der Inszenierungen inder Politik …SPIEGEL: … an dem Sie selbst einen nichtunwesentlichen Anteil hatten …Rüttgers: … muss zurückgeführt werden.Und stattdessen das Ringen um die Inhal-te wieder mehr in den Mittelpunkt rü-cken. Das gilt auch für meine eigene Par-tei. Im Landtagswahlkampf mussten wirfeststellen, dass die Frage „Wofür stehtdie CDU?“ schwer zu beantworten war.SPIEGEL: Und? Wissen Sie es jetzt?Rüttgers: Man glaubt einem Politiker janicht, wenn er nach einer verlorenenWahl sagt, wir machen jetzt eine Wahl-analyse. Damit haben wir begonnen.330000 Menschen haben im Mai nicht dieCDU gewählt, sondern sind zu Hause ge-blieben. Helmut Kohl hat immer gesagt,die CDU sei eine Familie. Dieses Gefühlund der Zusammenhalt sind zunehmendschwächer geworden.SPIEGEL: Vermutlich, weil niemand mehrweiß, wofür Ihre Partei noch steht. Dasletzte Mal, dass Angela Merkel eine klarePosition bezogen hat, war auf dem Leip-ziger Reform-Parteitag 2003.Rüttgers: Da möchte ich widersprechen.Die Debatte ist nach Leipzig weiter -gegangen. Auf dem Dresdner Partei tag2006 sind viele der neoliberalen Fehlervon Leipzig, die damals dem Zeitgeistgeschuldet waren, korrigiert worden. Wir haben festgestellt, dass wirtschaftli-che Vernunft und soziale Gerechtigkeiteben keine Gegensätze sind. In Wahrheit war das die Wiederbelebung des Politi-schen.SPIEGEL: Sie bestreiten ernsthaft, dass dasProfil der CDU in den vergangenen Jah-ren immer verschwommener gewordenist?Rüttgers: Alle Politiker scheuen sich vorPolarisierung und Konflikten, weil sieAngst haben, die Mehrheitsfähigkeit zuverlieren. Nur sehen wir jetzt, dass dasnicht zu starken Parteien führt, sonderndass auch wir als CDU – das ist ja wohldie Botschaft der Nordrhein-Westfalen-Wahl – inzwischen darum kämpfen müs-sen, Volkspartei zu sein. SPIEGEL: Familien bestehen aus Menschen.Unter der Kanzlerin sind mehr und mehrprofilierte Köpfe wegregiert worden:Friedrich Merz, Günther Oettinger, Ro-land Koch und jetzt auch noch Sie.Rüttgers: Das Argument kenne ich schonseit meiner Schulzeit. Dass immer die al-ten Zeiten die besseren waren und dassalle klugen und profilierten Leute aus-sterben. SPIEGEL: Nicht „aussterben“ …Rüttgers: … oder weggehen. Die Zeitensind schnelllebiger geworden. Ich versu-
Rüttgers
RA
LP
H S
ON
DE
RM
AN
N
MA
RIO
VE
DD
ER
/ A
PN
Merkel-Rivalen Koch, Oettinger, Merz: „Die Zeiten sind schnelllebiger geworden“
MA
RIJ
AN
MU
RA
T /
DP
A
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ D
ER
SP
IEG
EL
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Ich bin nicht verbittert“Der scheidende nordrhein-westfälische Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers, 59, über das Berliner Koalitions-Chaos, sein Karriereende und Freundschaften in der Politik
che, meinen Beitrag zur Zukunft diesesLandes und für seine Menschen jetzt ineiner anderen Funktion zu leisten.SPIEGEL: Ein Zeichen von Führungsstärkewäre es, starke Leute einzubinden, selbstwenn sie zwangsläufig auch Konkurren-ten sind. Fühlen Sie sich als Opfer derKanzlerin, die einmal mehr einen Wett-bewerber losgeworden ist?Rüttgers: Die Bundeskanzlerin hat mitmeiner Entscheidung nichts zu tun.SPIEGEL: Ohne das Chaos in Berlin hättenSie Ihre Wahl womöglich gewonnen.Rüttgers: So sehen es die Demoskopen.SPIEGEL: Im Kanzleramt soll man amAbend der NRW-Wahl frohlockt haben,dass es nun einen lästigen politischenKonkurrenten weniger gebe.Rüttgers: Da wissen Sie mehr als ich. SPIEGEL: Man hätte Männer wie Koch oderSie ja auch nach Berlin holen können, umsie stärker einzubinden.Rüttgers: (lacht) Im Moment ist es ganzschwierig, mich einzubinden, weil ichselbst noch nicht weiß, was ich machenwerde.SPIEGEL: Angenommen, Sie wären Füh-rungscoach der Berliner Koalition. Wel-chen Ratschlag würden Sie geben?Rüttgers: Viel mehr miteinander reden.Nicht jede Reform muss gleich als Jahr-hundertreform angepriesen werden.Wenn der Coach sagen würde: „Ihr müsstnur eure Performance verändern, eurenMedienauftritt gestalten“, dann würde ichihm keinen Euro bezahlen. Das ist nichtdas Problem.SPIEGEL: Fehlt die politische Führung inBerlin?Rüttgers: Nein. SPIEGEL: Was dann?Rüttgers: Wir könnten jetzt wieder einengroßen Exkurs zum Thema Führung ma-chen. Der eine haut auf den Tisch, hatdauernd blaue Flecken, und der Tisch isttrotzdem immer der Stärkere. Der an-dere versucht, es auf eine andere Art zumachen. Das eine Mal wird es als großeLeistung bewundert, das andere Malwird es als nicht ausreichend kritisiert.Dass die Zusammenarbeit besser werdenmuss, haben inzwischen alle Beteiligtenbegriffen.SPIEGEL: Die alte politische Steigerungs-form „Freund – Feind – Parteifreund“scheint vor allem in der CDU im Momentzu gelten.
Rüttgers: Das ist so ein Klischee. Ich habeviele persönliche Freunde, gerade auchim politischen Leben.SPIEGEL: Auch auf Ihrer Ebene?Rüttgers: Ja.SPIEGEL: Wen?Rüttgers: Die Frage würde ich Ihnen nurbeantworten, wenn ich sie vorher gefragthätte, ob ich das darf. Wir sind Freunde,wir wissen das, wir verhalten uns so, aberwir proklamieren das nicht.SPIEGEL: Warum?Rüttgers: Weil es dann später womöglichheißt: Guck mal, da ist eine Truppe, diehält nur deshalb zusammen, um sich ge-gen irgendwen durchzusetzen.SPIEGEL: Klingt – offen gestanden – ziem-lich merkwürdig, wenn Sie noch nichteinmal die Frage beantworten wollen,wer Ihre Freunde in der Politik sind, weildas aus politischen Gründen nicht oppor-tun ist.Rüttgers: Das hat mit politischen Gründennichts zu tun. Ich lasse niemanden an mei-nen Freundeskreis heran und auch nurganz eingeschränkt an meine Familie. Esist mir gelungen, unsere Kinder aus demPolitikbetrieb herauszuhalten. Das ist un-ser Leben. Dieses Stück Privatheit warmir immer wichtig.SPIEGEL: Ist es einsamer um Sie geworden,seit klar ist, dass Sie wahrscheinlich keineherausragende Rolle mehr spielen werden?
* Mit den Redakteuren Barbara Schmid und Konstantinvon Hammerstein in der Düsseldorfer Staatskanzlei.
Rüttgers: Meine Freunde halten zu mir.SPIEGEL: Und die anderen?Rüttgers: Es gibt natürlich Leute, auch inden Medien, die vor ein paar Monatennicht nah genug an einem dran sein konn-ten und sich heute nicht mehr melden –ja gut, das ist eine menschliche Erfahrung.Das weiß man.SPIEGEL: Demnächst haben Sie viel Zeitfürs Private. Macht sich Ihre Frau schonSorgen?Rüttgers: Ich werde jetzt nicht anfangen,die Spülmaschine neu einzuräumen.Aber im Ernst: In all den Jahren habe ichmich bemüht, ein normales Privatlebenwie jeder andere auch zu führen, mit Fa-milie, Freunden und der Nachbarschaft.Ich fahre nach wie vor selbst Auto undkenne die Milchpreise.SPIEGEL: Wenn dem so ist, warum wollenSie sich dann vom Staat fünf Jahre langeinen Wagen mit Chauffeur bezahlen lassen?Rüttgers: Wer sagt Ihnen, dass es so ist?Die Staatskanzlei hat vergangene Wocheein Gespräch mit der Fraktionsvorsitzen-den der SPD auch zu dieser Frage ge-führt.SPIEGEL: Wie viele Jahre hielten Sie dennfür angemessen?Rüttgers: Ich will keine Sonderbehand-lung. Bei mir gilt nichts anderes als beimeinen Vorgängern.SPIEGEL: Als Sie bei einem Treffen derKreisvorsitzenden Ihren Rücktritt ange-kündigt haben, geschah das so verklau-suliert, dass es einige gar nicht mitbekom-men haben. Warum können Politiker wieSie nicht Klartext reden?Rüttgers: Ich habe klar erklärt, dass ichkein weiteres Amt mehr anstrebe. Daswar und ist klar und deutlich. SPIEGEL: Wenn Sie noch einmal die Wahlhätten: Würden Sie wieder Politiker werden?Rüttgers: Ja. SPIEGEL: Uneingeschränkt? Rüttgers: Ja. Bei allem, was ich erlebthabe, was auch belastend war: Es ist wun-derschön, wenn Menschen auf einen zu-kommen, einem vertrauen, einem aucheinfach einmal ein gutes Wort sagen. Dasist mir noch vorgestern am Flughafen pas-siert, wo irgendjemand auf mich zukamund sagte: „Ich habe noch nie einen Poli-tiker angesprochen, aber ich wollte Ihnendanke sagen. Sie haben das gut gemacht.“Ich weiß nicht, wer das war. Es gibt sehrviele, die das tun. Bei allem, was manselbst vielleicht falsch gemacht hat, beiallen Fehlern, die man auch gemacht hat,und wenn man auch nicht immer das er-reicht hat, was man erreichen wollte: Ichwürde es wieder machen. SPIEGEL: Trotz öffentlicher Demütigungenwie durch eine verlorene Wahl?Rüttgers: Ja.SPIEGEL: Herr Rüttgers, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 022
Rüttgers (M.) beim SPIEGEL-Gespräch*
„Ich kenne die Milchpreise“
RA
LP
H S
ON
DE
RM
AN
N
CDU-Chefin Merkel
„Politiker scheuen sich vor Konflikten“
HA
NS
-CH
RIS
TIA
N P
LA
MB
EC
K /
LS
PR
ES
S
Gregor Gysi will jetzt reden, er stehtin der Tür von Zimmer 3 S 018 desReichstags, dem Vorzimmer von
Frank-Walter Steinmeier, bei ihm die Lin-ken-Parteispitze und Oskar Lafontaine.Gysi sagt: „Wir sind jetzt da. Und wirkommen kein zweites Mal.“
Es ist Mittwoch, 17.20 Uhr, ChristianWulff ist auch im zweiten Wahlgang nichtzum Bundespräsidenten gewählt worden.Sozialdemokraten, Grüne und Linke wol-len in Steinmeiers Büro verhandeln, obes nicht doch eine Chance gibt, das linkeLager hinter Joachim Gauck zu einen. Esgeht auch darum, ob Rot-Rot-Grün einModell für Deutschland wird. Ob zusam-menpasst, was doch scheinbar zusam-mengehört.
Leider fehlt Gastgeber Steinmeier, dermuss erst geholt werden. Dann sitzen sichSteinmeier und Lafontaine gegenüber,der Architekt der Agenda 2010 und derMann, der aus Protest gegen diese Agen-da die Partei Die Linke schuf. Sie müssendie Zeit überbrücken, bis alle da sind.
Es ist seit mehr als elf Jahren das erstepolitische Gespräch zwischen den beiden.Lafontaine macht Steinmeier gleich klar,dass er keine Möglichkeit sieht, die Links-partei hinter Gauck zu versammeln. DieSPD solle ihn zurückziehen und sich mitder Linken auf einen neuen Kandidatenverständigen. Härter geht es kaum.
Die Nominierung von Joachim Gauckzum rot-grünen Präsidentschaftskandida-ten mag ein großer Erfolg für SPD undGrüne gewesen sein. Im großen Spiel umdie Macht aber hat Gauck ihnen keinenVorteil beschert. Im Gegenteil.
Wegen Gaucks Nominierung haben So-zialdemokraten und Grüne sich mit derLinken überworfen, jener Partei, die siewohl brauchten, wenn sie künftig gemein-sam regieren wollen.
Das Verhältnis zwischen Rot-Grün undder Linken ist in der vergangenen Wochean einem neuen Tiefpunkt angelangt. Al-les ist anders gekommen, als man das vorneun Monaten erwartet hatte. Damals lagdie SPD am Boden, auf 23 Prozent warsie bei der Bundestagswahl abgestürzt.Alle Welt rechnete nun damit, dass derneue SPD-Chef Sigmar Gabriel seine Par-tei nach links öffnen, die Annäherung inder Opposition suchen würde, um spä-testens 2013 mit einer rot-rot-grünenMehrheit ins Kanzleramt zu gelangen.
Doch inzwischen trennt die drei Par-teien mehr, als sie eint. Die eiserne Ab-lehnung Gaucks durch die Linke, auchim dritten Wahlgang, war nur der spek-takulärste Beleg dafür. Zuvor war bereitsder Versuch gescheitert, in Nordrhein-Westfalen eine Koalition zu bilden.
In allen drei Parteien gibt es erheb -lichen Widerstand gegen eine Annä -
herung. Nichts deutet derzeit darauf hin, dass sich dies bis zur nächsten Bundestagswahl ändern lässt. Wenn kein Wunder geschieht, wird sich das linke Lager auch 2013 weiter selbst blo-ckieren.
SPD-Chef Gabriel sagt: „Ich werde diePartei Kurt Schumachers nicht in einBündnis mit einer Partei führen, die einungeklärtes Verhältnis zum DDR-Unrechtund zum Parlamentarismus hat“ (sieheSPIEGEL-Gespräch Seite 24).
Grünen-Chef Cem Özdemir sagt, dieLinken hätten „die Chance gehabt, dieGeister der Vergangenheit los- und einenormale Partei zu werden. Sie haben sienicht ergriffen“.
Und Oskar Lafontaine sagt, die Fragenach einer Perspektive für Rot-Rot-Grünsei eine „inhaltliche“ Frage. Auch wennsich die Sozialdemokraten bewegt hätten,sei „eine ernsthafte Abkehr von der ver-fehlten Politik der rot-grünen Koalition“noch nicht erkennbar.
Das Gesagte ist eindeutig. Rote, Grüneund Dunkelrote trennt tatsächlich mehrals ihre Haltung zu Joachim Gauck. Siepassen derzeit weder inhaltlich noch kul-turell zusammen.
Um kurz nach halb sechs sind alle 14Teilnehmer des Spitzentreffens endlichin Steinmeiers Büro versammelt, sie quetschen sich aufs Mobiliar. Lafontaine
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 024
Rot-grüne Spitzenleute Steinmeier, Künast, Gabriel, Roth: Ein großer Erfolg, der keinen Vorteil beschert
O P P O S I T I O N
Rot-Grün plus nixNach der Präsidentenwahl ist die politische Linke zerstrittener, ein rot-rot-grünes Bündnisunrealistischer denn je – dank Oskar Lafontaines Rückkehr als heimlicher Linken-Chef.
„Das nehm ich euch übel, dass ihr unsin diese Situation gebracht habt.“ Halb im Scherz fügt er hinzu: „Wenn ichkann, werde ich mich dafür rächen.“
Nach dem Zerwürfnis vom Mittwochsieht nichts mehr danach aus, dass sichSPD, Grüne und Linke in nächster Zeitzu einem gemeinsamen Projekt zusam-menraufen könnten. Es fehlt nicht nurein gemeinsamer Wille, sondern auch dasVertrauen in das Gegenüber. In allen dreiParteien haben nun die Gegner einer An-näherung die besseren Argumente.
Bei den Grünen sind es nicht nur dieehemaligen Bürgerrechtler aus der DDR,die Kompromisse mit der Linken ableh-nen. Es gibt auch jene Grüne, die lieberauf ein Bündnis mit der CDU zusteuernwürden. Sie sind die Fixierung auf dieSPD ohnehin leid.
In der SPD ist das Lager der Gegnerebenfalls einflussreich. Es handelt sichum konservative Sozialdemokraten undüberzeugte Antikommunisten, deren Er-innerung an die Zwangsvereinigung mitder KPD in Ostdeutschland noch nichtverblasst ist.
In der Linken hingegen erscheint dieAussicht, demnächst Deutschland zu re-gieren, den wenigsten wirklich verlo-ckend. Bis auf den Realo-Flügel fürchtenviele Linke, sich dann von ihrem Mar-kenkern verabschieden zu müssen: derAblehnung des Afghanistan-Einsatzes so-wie der Radikalopposition gegen HartzIV und die Rente mit 67.
Es ist 19.15 Uhr im Reichstag, die Frak-tionssitzung der Linken ist beendet, Gysiverkündet, dass Jochimsen im drittenWahlgang nicht mehr antreten wird. Nun würden sich wohl die meisten ent-halten.
„Buuhhh“, ertönt es aus dem Pulk derZuhörer. Es stammt vom grünen Europa -abgeordneten Werner Schulz, einem ehe-maligen DDR-Bürgerrechtler. „Das ist einVersagen der Linken!“
Nun entspinnt sich ein Dialog, dessenUnmittelbarkeit selten ist in der Politikund der viel aussagt über die gegenseiti-gen Ressentiments im linken Lager.
„Wenn ich ’ne Pressekonferenz gebe,hast du keine Pressekonferenz, und wenndu ’ne Pressekonferenz gibst, quatscheich nicht dazwischen. Aber das lernenwir noch“, ruft Gysi.
„Das ist ein Beispiel für nachhaltigePolitik, mein Lieber.“
„Ja, das ist ein Beispiel, dass die Grü-nen und die SPD nicht in der Lage sind,einmal anzurufen und mit uns zu reden.Und dann verlangt ihr: Rennt hinterher.“
„Aber die haben doch jetzt mit euchgesprochen“, ruft Schulz.
„Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ist vielleicht ’n biss-chen spät, ’n bisschen spät, mein Lieber.“
„Ihr hättet über euren SED-Schattenspringen können, mit einer symbolischenHandlung“, gibt Schulz zurück.
Gysi wirkt außer sich in diesem Au-genblick, er verliert die Kontrolle übersich. Das geschieht ihm sonst nie.
Dass das Klima derzeitso verheerend ist, scheintSPD-Chef Gabriel nicht zustören. Er hat wenig Inter -esse, auf die Linken zuzu-gehen. Gabriel will erst ein-mal die Mitte zurückgewin-nen und seiner Partei ihrSelbstwertgefühl zurückge-ben. Da kann Geschmusemit den Linken momentannur stören. Am Mittwoch-abend stand er im Reichs-tag und dampfte vor Rauf-lust: „So rum ist das Spieldoch mal richtig gespielt.Nich’ immer nur wir! DerDruck is’ jetzt da!“
Auch bei den Grünen gehen selbst jene auf Di s -tanz zur Linken, die voneinem linken Dreier ge-träumt hatten. „Auch unterden Freunden von Rot-Rot-Grün herrscht Ernüchte-rung“, räumt Parteiratsmit-glied Arvid Bell ein. „Wenndie drei linken Parteien soweitermachen, verderbensie ihre gemeinsame Regie-rungschance.“ Parteivorsit-zende Claudia Roth („Ichbin mittelmäßig wütend“)
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 25
PDS-Politiker Gysi (3.v. l.)*: „Geister der Vergangenheit“
DD
RB
ILD
AR
CH
IV.D
E /
IM
AG
O
Linken-Fraktion: Nicht vom Markenkern verabschieden
DA
RM
ER
/ D
AV
IDS
AX
EL S
CH
MID
T /
DD
P
hockt mit den Grünen Jürgen Trittin und Cem Özdemir auf einem Sofa. Es istheiß und stickig, aber das Fenster bleibtgeschlossen. Gabriel eröffnet die Dis -kussion.
Er redet von den Chancen, die eineZustimmung der Linken für Gauck mitsich brächte. Manche hören daraus dasAngebot der SPD, die Beziehungen zur verhassten Linkspartei zu normali-sieren.
Er habe „gebetet“, dass eine solche Situation nicht eintreten möge, gestehtGysi: „Das habt ihr uns eingebrockt.“Dann wird Lafontaine deutlich: „Selbstwenn wir uns vor die Fraktion knien,kriegen wir nicht mehr als die Hälfte derStimmen für Gauck.“
Trittin und Lafontaine diskutieren dar -über, dass ein rot-rot-grünes Bündnis stra-tegisch vorbereitet werden müsse. „Mirmuss man das nicht sagen“, erwidert Lafontaine gereizt. „Ich war ja der, derRot-Grün auf den Weg gebracht hat.“Schließlich verlangt er, SPD und Grünemüssten sich bewegen und Gauck zu-gunsten eines gemeinsamen Kandidatenfallenlassen.
Gabriel versucht es noch einmal:Wenn die Linken im Parlament akzep-tiert werden wollten, sei es doch klar,dass sie sich bewegen müssten.
Schließlich unterbreitet Matthias Plat -zeck einen Vorschlag zur Güte: Wenndie Linken schon nicht die Wahl Gaucksempfehlen könnten, sollten sie wenigs-tens ihre Kandidatin Luc Jochimsen zu-rückziehen und die Wahl freigeben.
Gysi lobt das Angebot als Fortschritt.Man müsse aber erst Jochimsen fragenund dann mit der Fraktion reden.
Die Versammlung geht auseinander,ohne Ergebnis. Beim Aufstehen sagt Gysi:
* Bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin 1994.
SPIEGEL: Herr Gabriel, hat Ihnen AngelaMerkel schon per SMS zu Ihrem Erfolgbei der Präsidentenwahl gratuliert?Gabriel: Ich glaube, sie hat derzeit genugdamit zu tun, ihren eigenen Leuten Mit-teilungen zu schicken.SPIEGEL: Abgesehen vom Übermittlungs-weg hätte sie Ihnen durchaus zu einemAchtungserfolg gratulieren können.Gabriel: Das war nicht nur ein Achtungs-erfolg. Die letzten Wochen haben ge-zeigt, wie viele Menschen in Deutschlandsich für unseren Staat interessieren. Joachim Gauck hat es geschafft, die Erinnerung daran wachzurufen, dass die Demokratie eine eigene Schönheithat – auch wenn das pathetisch klingenmag.SPIEGEL: Auch bei Ihnen? Gabriel: Es erinnert uns Politiker daran,dass wir die wachsende Kluft zwischender Bevölkerung und dem Staat dringendschließen müssen. Mehr Demokratie zuwagen ist eine Daueraufgabe, die nichtmit Willy Brandt endete. Wir Politikerdürfen nicht nur Techniker der Machtsein, sondern müssen unser Handeln immer wieder an die Prinzipien undWerte von Freiheit und Verantwortungbinden.SPIEGEL: Sie selbst haben doch mit Gauckschiere Machttechnik demonstriert.Gabriel: Das war keine machttechnischeKandidatur. Ich weiß ja, dass uns vieleJournalisten ständig ausschließlich Taktik
und nie innere Überzeugung unterstellen.Das gehört zum Demokratiezynismus, derin Deutschland Mode geworden ist.SPIEGEL: Sie wollen nicht ernsthaft abstrei-ten, dass es bei Gaucks Nominierung umTaktik ging.Gabriel: Doch. Bereits am Tag des Rück-tritts von Horst Köhler war mir klar, dasswir jetzt nicht nach den klassischen Mustern handeln dürfen. Aber das wer-den Sie mir so lange nicht glauben, biswir uns mit einer eigenen Mehrheit genauso verhalten. Und weil unsere ein-zige Chance darin besteht, Glaubwürdig-keit zurückzugewinnen, werden wir das machen. SPIEGEL: Sollte die SPD also in der nächs-ten Bundesversammlung die Mehrheit ha-ben, wird sie keinen verdienten Genossenaufstellen?Gabriel: Wenn ich in fünf Jahren nochSPD-Vorsitzender bin, werden wir jeman-den präsentieren, der wie Joachim Gaucküber die Parteien hinaus wirkt.SPIEGEL: Und rein taktisch hat es Ihnennicht gefallen, dass es die drei Wahlgängefür Frau Merkel nicht einfacher gemachthaben?Gabriel: Es ging nicht darum, Schwarz-Gelb vorzuführen. Dann hätte ich dochAngela Merkel nicht das Angebot ge-macht, einen geeigneten Kandidaten zuunterstützen. Das habe ich erstmals be-reits getan, als von Joachim Gauck nochgar nicht die Rede war.
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 026
wirft den Linken „Politikunfähigkeit“vor: „Die Linken haben gezeigt, dass sienicht angekommen sind.“
Die Pragmatiker in der Linkspartei, dieeigentlich auf eine linke Perspektive für2013 hoffen, sind ebenfalls schwer ent-täuscht. Parteivize Halina Wawzyniaksieht die aktuellen Führungsriegen zusehr ineinander verkeilt, gestärkt würdendiejenigen, die in der Radikalisierung dasHeil suchen. Dass Lafontaine sich bei derPräsidentenwahl wieder als heimlicherLinken-Chef erwies, stimmt das Refor-merlager nicht gerade glücklich.
Vor kurzem saßen Vertreter aller dreiParteien bei einer Podiumsdiskussion zu-sammen. Für die Grünen war Bundesge-schäftsführerin Steffi Lemke gekommen.Sie zeigte den anderen einen knallhartenZeitplan auf. Der „Kernpunkt“ sei, „obman 2013 sagt, es gibt eine linke Alter-native zu Schwarz-Gelb“, erklärte dieGrüne. An den SPD-Linken Björn Böh-ning gewandt fügte sie hinzu: „Björn, ihrhabt keine paar Jährchen Zeit, das zu klä-ren.“ SPD und Linke müssten „24 Monatevor der Bundestagswahl“ entscheiden,„ob man das anstrebt“.
Ein rot-rot-grünes Projekt müsse manzwölf Monate lang „gesellschaftlich vor-bereiten, dafür werben“ und dann „zwölfMonate dafür Wahlkampf machen“, argu -mentierte Lemke. Die politische Linkemüsse ihre Scheu ablegen, „über Macht,Notwendigkeit von Macht und Regie-rungsperspektiven zu diskutieren“. Davonsind die Parteien jedoch weit entfernt.
Zwar stehen SPD und Grüne besser da,als ihre Anführer sich das im September2009 erträumt hatten. Der Macht hat siedas aber nicht viel näher gebracht. Die wirdes wohl nur mit Hilfe der Linken geben.
In einer gemeinsamen Fraktionssitzunggenossen die rot-grünen Partner am Mitt-wochabend den gefühlten Sieg. JürgenTrittin sprach die SPD-Delegierten liebe-voll mit „Genossinnen und Genossen“an, Claudia Roth umarmte die rot-grüneGemeinde erst physisch und dann verbal,indem sie den Gegner beschimpfte:„Links heißt ab heute, einen CDU-Mi-nisterpräsidenten zum Bundespräsiden-ten zu wählen“, spottete Roth. „Linkswurde heute neu definiert.“
Nachdem man sich lange genug derGemeinsamkeiten versichert hatte, mel-deten sich Hannelore Kraft und SylviaLöhrmann zu Wort. Die beiden wollennächste Woche in Düsseldorf zusammendie Landesregierung bilden. Die GrüneLöhrmann sagte: „Und all das Gute, wasjetzt gesagt wurde, setzen wir demnächstum in NRW.“ Die Zuhörer erhoben sichzu stehendem Applaus, denn das Rezeptder NRW-Frauen gefiel ihnen: ohne dieLinken regieren.
Leider auch ohne Mehrheit. RALF BESTE, MARKUS DEGGERICH,
MARKUS FELDENKIRCHEN, CHRISTOPH HICKMANN
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ O
ST
KR
EU
Z
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Ich bin nicht Kanzlerkandidat“Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, 50, über Seriosität
und Zynismus in der Politik, seine Abgrenzung von der Linkenund sein kommunikatives Verhältnis zu Angela Merkel
Linken-Kritiker Gabriel: „Kein Fleisch von unserem Fleische“
SPIEGEL: Wäre sie darauf eingegangen, hät-ten Sie hinterher allen erzählt, dieser Kan-didat sei Ihre Idee gewesen.Gabriel: Mein erstes Angebot und AngelaMerkels Antwort darauf sind nicht öffent-lich geworden, weil das ein Kontakt nurzwischen uns beiden war ohne andereBeteiligte. Frau Merkel wollte eine reineMachtdemonstration der Koalition beider Wahl des Bundespräsidenten. Dassdas gründlich schiefgegangen ist, liegtdoch nicht an der Machttaktik der SPD,sondern an der Machtlosigkeit AngelaMerkels. SPIEGEL: War es machttaktisch geschickt,der Linken Ihren Kandidaten vor denLatz zu knallen?Gabriel: Wenn ich Frau Merkel einen ge-meinsamen Kandidaten von SPD, Grü-nen und Linken angeboten hätte, dannhätte sie zu Recht gesagt: Lieber Herr Gabriel, das wissen Sie doch ganz genau,dass das bei uns nicht geht, das ist einrein taktisches Manöver. Deswegen wares gar nicht möglich, das Angebot gemein-sam mit der Linken zu formulieren. Wirwollten ja mit Union und FDP einen ge-meinsamen Präsidenten wählen. Dennschließlich haben die die Mehrheit in derBundesversammlung.SPIEGEL: Finden Sie als ehemaliger Lehrerdiese Art der Frontalpädagogik nicht et-was veraltet?Gabriel: Ich bin nicht der Erziehungsbeauf-tragte der Partei Die Linke. Außerdem
können Sie im Mathematikunterricht nichtdurch pädagogische Tricks erklären, dasszwei mal zwei fünf ist.SPIEGEL: Was hat das mit der Linksparteizu tun?Gabriel: Es gibt auch im Verhältnis zu de-nen ein paar Grundsätze. Vor allem, dassdie SPD mit dieser in sich so gespaltenenLinken auf Bundesebene und manchmalauch auf Landesebene derzeit nicht zu-sammenarbeiten kann.SPIEGEL: Warum nicht?Gabriel: Ich werde die Partei Kurt Schu-machers nicht in ein Bündnis mit einerPartei führen, die ein ungeklärtes Verhält-nis zum DDR-Unrecht und zum Parla-mentarismus hat. Das ist keine Frage derPädagogik und keine Frage der Taktik.Seit ich Vorsitzender bin, erkläre ich derSozialdemokratie, dass ihre anfänglicheSentimentalität gegenüber der Partei DieLinke Unsinn ist. Das ist nicht Fleisch vonunserem Fleische.SPIEGEL: Sondern? Ein Tumor?Gabriel: Nein. Das ist eine ganz normaleandere Partei. Oskar Lafontaine hat mirgesagt, ich solle doch endlich dafür sor-gen, dass man sie behandelt wie alle an-deren Parteien. SPIEGEL: Was haben Sie geantwortet? Gabriel: Dass wir genau das machen. Esgibt keine prinzipiellen Vorbehalte dage-gen, mit einer Partei zusammenzuarbei-ten, die sich politisch als links von derSPD einstuft. Aber wie bei jeder anderen
Partei müssen wir prüfen, ob wir das in-haltlich verantworten können. Und wennes inhaltlich nicht geht, dann werden wirnicht nur der Machtperspektive wegendie Augen zumachen und da reingehen.SPIEGEL: Ohne Machtperspektive machenSie sich lächerlich, so wie im letzten Bun-destagswahlkampf.Gabriel: Lächerlich machen sich die, dieglauben, aus einer rechnerischen Mehr-heit ohne inhaltliche Gemeinsamkeitenließe sich eine handlungsfähige Regierungbilden. Ich habe von den Linken in denletzten Monaten häufig genug gehört, dieSPD müsse sich irgendwie ändern. SPIEGEL: Stimmt das denn nicht? Gabriel: Es gibt schon Dinge, die wir än-dern müssen, aber nicht, weil eine anderePartei sich das von uns wünscht, sondernweil wir es selbst für richtig halten. Undauch die Partei Die Linke muss sich än-dern.SPIEGEL: Sie dürfen sich also was wün-schen? Gabriel: Jetzt müssen die Demokraten,Pragmatiker, Realisten dort endlich umdie Zukunft ihrer Partei kämpfen, stattdie Vergangenheit zu beschönigen. Wennsie das tun und gewinnen, dann gibt esgenug Gemeinsamkeiten mit der SPD,um auch über Regierungshandeln imBund und in den Ländern zu reden. Undtrotzdem kommt dann immer irgendeinJournalist und fragt mich nach der Macht-perspektive.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 27
Präsidentschaftskandidat Gauck mit Lebensgefährtin Daniela Schadt: „Er hat die Schönheit der Demokratie in Erinnerung gerufen“
GE
OR
G H
ILG
EM
AN
N /
AC
TIO
N P
RE
SS
SPIEGEL: Das wollten wir gerade tun.Gabriel: Weil auch Sie unterstellen, dasses in der Politik immer nur um Machtgeht, nie um Inhalte. SPIEGEL: Wir sind die bösen Buben?Gabriel: Ich gebe zu, Sie haben es ja auchimmer wieder so erlebt. Ich kann dochgar nicht bestreiten, dass im Zweifel umder Macht willen immer wieder Dingeüber Bord gekippt wurden. In den Augenvieler Bürger machen die Parteien denEindruck, als hielten sie den Wortbruchfür ein legitimes Mittel des Wahlkampfes.Das ist sicher einer der Gründe, warumMenschen sich von der Parteipolitik ab-wenden.SPIEGEL: War es nicht Ihre Partei, die erstvor der Merkel-Steuer gewarnt und danngemeinsam mit Frau Merkel die Mehr-wertsteuer erhöht hat?Gabriel: Wir haben ja nicht deshalb 23 Pro-zent kassiert, weil wir alles richtig ge-macht haben. Vor allem darf die SPD beigrundsätzlichen Fragen der Demokratienicht nur um der scheinbaren „Macht -perspektive“ wegen zu allem ja und amensagen.SPIEGEL: Sie sind vor acht Monaten zumSPD-Vorsitzenden gewählt werden, alsdie Partei am Boden lag. Kann sie wiederaufrecht gehen?Gabriel: Ab und zu gucken wir mal nachunten, ob da etwas im Weg liegt, überdas wir früher gestolpert sind. Aber an-sonsten gehen wir sehr aufrecht und mitfröhlichem Gemüt.SPIEGEL: Dank Ihnen?Gabriel: Nein. Das ist ein Verdienst der ge-samten Partei. Unsere Aufgabe war es inden letzten acht Monaten einerseits, ei-niges zu korrigieren, was zu unserenWahlverlusten beigetragen hat. Das ha-ben wir weitgehend getan. Die SPD mussim besten Sinne des Wortes sozial und li-beral aufgestellt sein. SPIEGEL: Also nicht zurück zur alten Ar-beiterromantik? Gabriel: Die SPD war immer erfolgreich,wenn sie sich sowohl um die klassischensozialen Interessen von Arbeitnehmernund ihren Familien gekümmert hat wieum das aufgeklärte und intellektuelleBürgertum. Es kann uns eben nicht umirgendeine „neue Mitte“ gehen, von derniemand weiß, wer das eigentlich seinsoll.
SPIEGEL: Ach, Sie auch nicht?Gabriel: Nein. Mir geht es um die alte Mit-te: bildungsorientiert, am sozialen Aus-gleich orientiert, auch leistungsorientiert.Willy Brandt hat die angesprochen, Hel-mut Schmidt auch. Die müssen wir zu-rückgewinnen.SPIEGEL: Über den Bundesrat haben Siedemnächst mit den Stimmen aus Nord-rhein-Westfalen wieder einen bundes -politischen Hebel in der Hand. Wie wol-len Sie den nutzen?Gabriel: Jedenfalls nicht als Blockade -instrument, wie das manche glauben. Wir werden das stoppen, was wir fürfalsch halten. Wir werden nicht zulassen,dass mit Zustimmung des Bundesratesdie Laufzeiten für alte Atommeiler ver-längert werden. Wir werden nicht denWeg in die Kopfpauschale und die Drei-Klassen-Medizin zulassen. SPIEGEL: Also doch Blockade?Gabriel: Nein. Es gibt natürlich Dinge,über die wir uns im Vermittlungsaus-schuss verständigen müssen. Etwa wennes um mehr Geld für die Städte und Ge-meinden geht.SPIEGEL: Dafür werden Sie auch wiedermit Frau Merkel kommunizieren müssen.Sie konnten doch mal mit ihr.Gabriel: Wir werden sehen, ob sie ein In-teresse daran hat, Probleme zu lösen,oder ob sie weiterhin Probleme gar nichterst angehen will. Das ist ja ihr Regie-rungsstil in der schwarz-gelben Koalition.Nun hofft sie auf Wirtschaftswachstumaus dem Ausland, damit nicht mehr soauffällt, dass in Deutschland eigentlichgar nicht regiert wird.SPIEGEL: Die Leute mögen Angela Merkellangweilig finden, aber sie empfinden sieauch als solide und seriös. Bei Ihnen istdas eher umgekehrt.
* Links: Christoph Schwennicke und Christoph Hick-mann in Gabriels Berliner Büro; oben: 1998.
Gabriel: Uns allen in derPolitik werden gelegent-lich Urteile von Men-schen zugeschoben, dieuns nicht kennen. Wennwir ehrlich sind, passiertuns das ja auch in der Be-urteilung anderer Men-schen ab und zu. Wichtigist doch nur, dass wir be-reit sind, uns immer über-raschen zu lassen.SPIEGEL: Woher kommtdas in Ihrem Fall?Gabriel: Na, ich geb mir jedenfalls täglich Mühe,Sie zu überraschen. Aberim Ernst: Ich bin in kei-nem Schönheitswettbe-werb mit Angela Merkel.Ich bin auch nicht Kanz-lerkandidat. Ich bin Par-teivorsitzender der SPD.
Und die Mehrheit der Parteimitgliederscheint zu finden, dass ich das ganz gutmache.SPIEGEL: Noch sind Sie kein Kanzlerkan-didat, oder?Gabriel: Eine Partei, die ein Dreivierteljahrnach einer herben Niederlage anfängt,über einen Kanzlerkandidaten zu speku-lieren, die hätte sie nicht alle beisammen.Ich habe noch nie viel davon gehalten,dass der SPD-Vorsitzende das erste Zu-griffsrecht auf eine Kanzlerkandidatur ha-ben soll. Es geht darum, den zur Wahl zustellen, der 2013 die besten Chancen hat.SPIEGEL: Jemanden mit einem seriöserenImage? Gabriel: Journalisten unterstellen Politikernja gerne Seriositätsdefizite. Politische Se-riosität entsteht durch Stimmigkeit in ihrenVorstellungen, Übereinstimmung von Re-den und Handeln und auch Finanzierbar-keit ihrer Forderungen. Das alles erreichtman nicht über einzelne Personen, sondernüber harte Arbeit mit vielen anderen.SPIEGEL: Aber im Kanzlerzimmer stehtnur ein Sessel.Gabriel: Keine Sorge, wir finden schon je-manden, der da draufpasst. Aber wir wer-den bestimmt mehr zu bieten haben alseine Einzelperson, so wichtig die amEnde auch ist. Wenn wir uns sozial undliberal aufstellen wollen, dann werdenwir das inhaltlich, aber auch personellzeigen müssen.SPIEGEL: Also das Tandem Steinmeier/Ga-briel?Gabriel: Das gibt es doch schon. Aber ichfinde es lustig, dass Sie die Kandidaten-frage so interessiert. Vor einem halbenJahr hätten Sie uns doch noch empfohlen,am besten gar keinen Kandidaten aufzu-stellen, weil Sie dachten, es lohne sichnicht. Da finde ich Ihre Fragen heutedoch schon sehr beruhigend.SPIEGEL: Herr Gabriel, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 028
Gabriel, SPIEGEL-Redakteure*
„Aufrecht und mit fröhlichem Gemüt“
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ O
ST
KR
EU
Z
MA
RC
O-U
RB
AN
.DE
Partner Lafontaine, Schröder*: „Die Linke muss sich ändern“
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 030
Die ersten Demokraten waren Krieger. Im fünf-ten Jahrhundert vor Christus mussten die BürgerAthens ihre Freiheit ständig verteidigen, zu-nächst gegen die Perser, dann gegen die Sparta-ner. Sie leisteten ihren Kriegsdienst als Hoplitenin der Phalanx oder als Ruderer auf den Trieren.Damals fiel niemandem ein, dass eine Demo-
kratie sich mit Kriegen schwerer tun würde als eine andereStaatsform. Die Bürger Athens und anderer Stadtstaaten töteten und starben für ihre Werte. Der Historiker Robin LaneFox schreibt in seinem Buch „Die klassische Welt“, dass genaudies der Vorteil der Griechen war. Sie kämpften furios, umfrei bleiben zu können. Die Perser dagegen waren Untertaneneines grausamen Königs und nur mäßig motiviert.
Heute ist die Demokratie die Staatsform, die sich amSchwersten tut mit dem Krieg. Das gilt sogar für die USA, wodie Regierungen oft leichter Hand Truppen in Marsch setzen,die Öffentlichkeit aber bald skeptisch wird. Das ist kein Makel,denn im Krieg geht es immer um das Sterben und das Ver-stümmeln von Menschen, und da sind Skrupel richtig. Am al-lerschwersten tut sich Deutschland, und auch das ist vollkom-men in Ordnung. Deutschland hat zwei Weltkriege begonnenund den zweiten als totalen Krieg geführt, als Orgie der Zer-störung und Selbstzerstörung. Nie wieder Krieg – dieser bun-desrepublikanische Satz ist eine naheliegende Konsequenz.
Doch dieser Satz wurde von der Realität eingeholt. Die Bun-desrepublik ist seit acht Jahren in einen Krieg verwickelt. Ersthat dies kaum einer so richtig gemerkt, aber seitdem sich dieschlechten Nachrichten aus Afghanistan häufen, ist eine De-batte um diesen Krieg entbrannt. Zwei Drittel der Deutschenwollen nicht, dass die Bundeswehr in Afghanistan bleibt.
Aber es gibt gute Argumente dafür, dass sie bleibt. Darumgeht es jetzt hier: um die Frage, was es für eine Demokratieheißt, einen Krieg zu führen, und warum es für die deutscheDemokratie richtig sein kann, diesen Krieg zu führen. Die Ar-gumente folgen der Chronologie eines Krieges. Zunächst gehtes um den Kriegseintritt, also die Gründe für einen Krieg, danngeht es um den Verlauf eines Krieges, also um das Töten undSterben, dann um die Frage, wann man einen Krieg beendenkann. Zum Schluss geht es darum, wer über Kriegsbeginn und-ende entscheiden soll und auf welcher Grundlage.
DER BEGINN:TERROR UND SOLIDARITÄT
Für einen Krieg gibt es gute und schlechte Gründe. Wohlniemand würde bestreiten, dass es gut war, dass Ameri-kaner, Briten, Kanadier, Australier und andere gegen das
Deutschland der Nazis in den Krieg gezogen sind. Hätten siesich pazifistisch verhalten, wäre die Demokratie in Europa un-tergegangen, und unser Leben heute sähe anders aus.
Aber auch Demokratien haben aus schlechten Gründen Krie-ge begonnen. Schon die Athener setzten ihre Waffen ein, umTribut von anderen Staaten einfordern zu können. Frankreichund Großbritannien haben aus wirtschaftlicher Gier Kolonial-kriege geführt. Die USA haben den Irak auch deshalb ange-
griffen, weil es dort riesige Ölvorkommen gibt. In Vietnamging es um Machtfragen im Kampf der Systeme.
In der kurzen Kriegsgeschichte der Bundesrepublik kommenschlechte Gründe nicht vor. Die Bundeswehr zog 1993 nachBelet Huen in Somalia, weil ein Bürgerkrieg das Land in Chaosgestürzt hatte und eine Hungerkatastrophe drohte. Der Einsatzwar ausschließlich humanitär begründet. Im Krieg gegen Ser-bien 1999 ging es darum, einen Völkermord im Kosovo zu ver-hindern.
Am 11. September 2001 wurde die USA mit entführten Flug-zeugen attackiert, rund 3000 Menschen starben. Dies war dieTerrortat eines kriegerischen Islamismus, der sich durch diewestliche Lebensweise und durch die Freiheiten, die Demo-
kratie und Marktwirtschaft den Menschen lassen, herausgefor-dert fühlt. Der Anführer von al-Qaida, Osama Bin Laden, ließin seinen Botschaften keinen Zweifel, dass er diesen Kriegfortführen will. Afghanistan war eine Heimstatt seiner Terror-gruppe, geduldet und unterstützt vom Regime der Taliban.Deshalb haben die Amerikaner in Afghanistan eingegriffen.
Wirtschaftliche Gründe spielten damals keine Rolle. Es gingnicht um das Lithium, das es in der afghanischen Erde gebensoll. Es ging um den Kampf gegen den Terror.
Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder versprachden Vereinigten Staaten „uneingeschränkte Solidarität“ beimKampf gegen den Terrorismus, der auch die deutschen Wertebekämpft. Das war richtig. Die USA waren angegriffen worden,die USA sind unsere Verbündeten. Wenn sie einen Krieg ausguten Gründen führen, sollte die Bundesrepublik ihnen helfen,auch weil sie im Kalten Krieg nur durch die Hilfe der Ameri-kaner als Staat überleben konnte.
Es gab auch kein „Augusterlebnis“ wie 1914, keine Begeis-terung für diesen Krieg. Die Politiker haben die Soldaten schwe-ren Herzens nach Afghanistan geschickt. Nach einem Beginnin Kabul wählte die Bundeswehr schließlich den relativ siche-ren Norden als Einsatzgebiet. Sie wollte nicht ein neues Hel-dentum fördern oder Waffen in großen Schlachten testen. Siewollte still und möglichst ohne Kampf einen Beitrag leisten.
Was den Beginn angeht, ist dieser Krieg gut begründet.
E S S A Y
DIE ZÄHMUNG DER BESTIEÜBER DAS SCHWIERIGE VERHÄLTNIS VON DEMOKRATIE UND KRIEG
VON DIRK KURBJUWEIT
Deutsche Soldaten in Afghanistan
FA
BR
IZIO
BE
NS
CH
/ R
EU
TE
RS
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 31
DER VERLAUF:BESTIE UND OPFER
Wenn es einen anerkannt guten Krieg gibt, dann denKrieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Wennes einen anerkannt guten Soldaten gibt, dann den
amerikanischen GI, der im Landungsboot die Küsten der Nor-mandie gestürmt hat, obwohl das Risiko extrem hoch war. Vonden Überlebenden wird erinnert, dass sie Schokolade an deut-sche Kinder verteilt haben.
Der britische Historiker Antony Beevor hat in seinem jüngs-ten Buch enthüllt, dass einige dieser Helden der DemokratieKriegsverbrecher waren. Sie haben deutsche Soldaten, die sichergeben hatten, niedergemetzelt. Wahrscheinlich sind dieseGIs als gute Menschen in die Landungsboote gestiegen. Aberder Krieg hat die Bestie in ihnen geweckt.
Ein Projekt der Demokratie ist die Zähmung dieser Bestie.Schon die Griechen haben damit begonnen, denn ihre Demo-kratie war eine Antwort auf die Willkür grausamer Tyrannen.Sie suchten und fanden ein Verfahren, wie sich politische Fragen, die immer auch Machtfragen sind, ohne Gewalt lösenlassen. Im Krieg allerdings war ihnen die Bestie, die in ihrenSeelen weiterschlummerte, nach wie vor willkommen. Es gabkeine humanitäre Rücksicht gegenüber dem äußeren Feind.
Was für den Sieg notwendig schien, wurde getan. Die Demo-kratien von heute gehen einen anderen Weg. Ihr Menschenbildhat sich so verfeinert, dass auch der Gegner von außen, derFeind, nicht mit äußerster Gewalt bekämpft werden soll. DieÖffentlichkeit zu Hause, die Heimatfront, verlangt einen an-ständigen, einen sauberen Krieg. Sie verlangt Rücksicht aufden Gegner.
Demokratien versuchen, ohne Hass auszukommen. Andersals man vielleicht vermuten würde, gehört zum Wesen einerDemokratie nicht die Friedlichkeit, sondern der Kampf. Allesist immer umstritten, es gibt keine Permanenz, keine Ein -heitlichkeit wie in der Diktatur. Minütlich bricht ein neuerStreit aus, niemand kann sich seines Amtes sicher sein. Damitdas funktioniert, muss der Kampf zivil sein. Gewalt ist einTabu. Das ist nicht paradox, sondern logisch: Gerade die, dieden permanenten Kampf zur Staatsform gemacht haben, achten empfindlich darauf, dass fair und gewaltfrei gekämpftwird.
Über das Christentum, die Aufklärung und einen humani -tären Universalismus hat sich dieses Konzept so vertieft, dassselbst im Krieg Regeln gewahrt werden sollen. Auch ein Talibanist nicht nur Feind, sondern auch Mensch. So sieht man das inden demokratischen Gesellschaften, und das zu Recht.
Ein Krieg ist also der permanente Tabubruch. Demokratienversuchen ihn deshalb so human wie möglich zu gestalten.
Weil die deutsche Öffentlichkeit wegen der beiden Welt-kriege besonders empfindlich ist, hat die Bundeswehr sogarversucht, einen neuen Soldatentypus zu schaffen: den guten,gutmütigen Krieger, den Mann mit der Rose im Gewehrlauf,nett, hilfreich, bestienfrei. In den ersten Jahren in Afghanistanhat sich die Bundeswehr vor allem um den Wiederaufbau desLandes gekümmert. Die Einsatzregeln waren zum Teil so grotesk rücksichtsvoll, dass sich die Soldaten schutzlos gefühlthaben.
Auch die Amerikaner, oft gescholten, versuchen in Afghani -stan durchaus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen.Die US-Zeitschrift „The Atlantic“ hat kürzlich berichtet, dassamerikanische Soldaten bei ihren Operationen die Felder einesbestimmten Bauern nicht mehr betreten, damit er nicht ver -ärgert ist. Das ist gleichsam so, als würden bei einem Krieg inDeutschland die Schilder „Das Betreten des Rasens ist verbo-ten“ von Soldaten beachtet, um sich die Hausmeister gewogenzu halten. So führt nur eine Demokratie Krieg.
Gleichwohl ist die Heimatfront immer unzufrieden, immeralarmiert. Das ist folgerichtig, weil jeder Krieg ein Tabubruchbleibt, egal wie human man ihn führt. Die Kritik ist allerdingsan zwei Punkten ungerecht.
Der eine Punkt ist die Kritik an der langen Dauer des Krie-ges. Der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld hatin seinem Buch „Gesichter des Krieges“ zwei Arten des Kamp-fes gegen Aufständische beschrieben, die erfolgreich waren.1982 hat der syrische Diktator Hafis al-Assad den Widerstandder Muslimbruderschaft mit bestialischer Härte in kurzer Zeitniedergeschlagen. Bis zu 25000 Menschen sollen umgekommensein, darunter viele Frauen und Kinder. Damit konnte Assaddie Macht seiner Familie bis heute absichern.
Das zweite Beispiel ist der Kampf der Briten in Nordirland.Nachdem sie zunächst brutal vorgegangen waren, haben sieüber Jahrzehnte durch strikte militärische Zurückhaltung dieZustimmung der Bevölkerung gewonnen, bis die IRA die Sinn-losigkeit ihres Kampfes eingesehen hat.
Für eine Demokratie gibt es nur die zweite Variante. DieBestialität widerspricht dem Menschenbild, auf dem sie auf-baut. Aber für das zweite Verfahren braucht eine GesellschaftGeduld. Es dauert, es ist teuer, es gibt Rückschläge. Der Erfolgist nicht gewiss, aber möglich.
Die andere ungerechte Kritik heißt, der Krieg in Afghanistansei schmutzig.
Der hehre Anspruch einer Demokratie überfordert oft dieSoldaten, die den Krieg führen. Sie können nicht so abgeklärtbleiben wie die Redner einer Debatte im Bundestag. Ihre Be-gleiter in den Kämpfen sind Angst, Blutrausch, Hass, Größen-wahn, irgendwann auch Kälte, Abstumpfung – und all dastreibt die Bestie noch immer hervor. Deshalb kommt es zu Ta-ten, die unerträglich sind.
Weil der deutsche Oberst Georg Klein das deutsche Campin Kunduz bedroht sah, ließ er zwei entführte Tanklaster bom-bardieren. Er belog die amerikanischen Piloten, um ihre Be-denken gegen den Einsatz zu löschen. Bis zu 142 Menschen,darunter viele Zivilisten, starben. Oberst Klein ist ein Mensch,der in Deutschland wahrscheinlich niemandem etwas zuleidegetan hätte. Aber er war im Krieg, und der Krieg hat ihn dazugebracht, diesen fatalen Befehl zu geben.
Deshalb ist nicht der ganze Krieg schmutzig. So bitter dasist, aber im Chaos eines Krieges kommt es immer wieder zuIrrtümern und Exzessen mit schrecklichen Folgen. Man kannnicht darauf vertrauen, dass jeder Soldat seinen Krieg so führt,wie es für eine Demokratie angemessen ist. Aber man kanndarauf vertrauen, dass der Staat, die Bundesrepublik Deutsch-land, diesen Krieg nicht bestialisch oder schmutzig führen will.Alle Politiker, die maßgeblich für diesen Einsatz verantwortlichsind, die Bundeskanzler Gerhard Schröder und Angela Merkelsowie sämtliche Verteidigungsminister, sind zivile, kriegsscheueMenschen, die mit großen Skrupeln an diese Sache her an-
Schlacht bei Salamis 480 vor Christus
ULLS
TE
IN B
ILD
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 032
gehen. Sie wollten und wollen diesen Krieg so führen, wie esder deutschen Demokratie gemäß ist.
Sie sind auch nicht Politikertypen, die Menschen leichtfertigin den Tod schicken. Napoleon hat zu Klemens Wenzel Fürstvon Metternich am 26. Juni 1813 gesagt: „Ich bin in den Feld -lagern aufgezogen worden, ich kenne nichts als das Feld, einMensch wie ich scheißt auf das Leben von einer Million Men-schen.“ Ein größerer Gegensatz zu Angela Merkel ist nicht denk-bar. Aber auch sie nimmt den Tod deutscher Soldaten in Kauf.
Wahrscheinlich kennt fast jeder etwas Höheres als das eigeneLeben. Viele Eltern würden sich opfern, um das eigene Kindzu retten. Von den Leibwächtern wird erwartet, dass sie diePolitiker mit ihrem Körper schützen. Polizisten und Feuer-wehrleute setzen sich immer wieder lebensgefährlichen Situa-tionen aus, um gefährdete Menschen zu retten.
Das alles ist nicht umstritten. Wer jedoch sagen würde, essei vertretbar, dass deutsche Soldaten ihr Leben für die Staats-räson der Bundesrepublik geben, löste damit viel Unbehagenaus. Nicht zufällig hat sich die Debatte um den Krieg in Af-ghanistan verschärft, als dort kurz hintereinander sieben Sol-daten der Bundeswehr gefallen sind. Das Gefühl herrscht vor,dass ihr Opfer vergebens ist, dass ihr Tod keinen Wert hat.Das hat auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun. Die Nazis schickten Millionen Deutsche in den Tod, der dann alsOpfertod gefeiert wurde. Es gibt seither hierzulande keinenBedarf mehr an Heroismus. Man braucht ihn auch nicht.
Traurig ist etwas anderes. Es gibt in Deutschland kaum nochein leidenschaftliches Verhältnis zur Demokratie und zur Frei-heit. Für die Griechen war es ein Vorteil, dass sie als Demo-kraten in den Kampf gegen die Perser gezogen sind. Die deut-sche Friedensbewegung dagegen hat den Satz erfunden: Lieberrot als tot. Mit diesem Satz hat der Pazifismus die Demokratieverraten.
Pazifismus ist die Haltung einer Minderheit. Aber auch dieanderen Deutschen haben kein pathetisches Verhältnis zur De-mokratie und zum Staat, wie viele Amerikaner oder Franzosen,deren Vorfahren die Freiheit erkämpft haben. Tod ist aber nurmit Pathos halbwegs zu ertragen,wie sich an vielen Trauerzeremo-nien zeigt. Gerade wenn ein jünge-rer Mensch stirbt, muss ein höhererSinn her, sonst gibt es keinen Trost.
Es liegt daher nahe, dass sichdie postpathetische, postheroischeBundesrepublik besonders schwertut mit dem Tod ihrer Soldaten,zumal ihre Bürger über Jahrzehn-te gewohnt waren, dass ein Soldatein Mensch ist, der gebührenfreieinen Lkw-Führerschein machenwill und sich bei Biwaks in derHeide wohl fühlt. Jetzt ist ein Sol-dat ein Mensch, der bald in Afgha -nistan sterben kann.
Der Tod eines jungen Men-schen ist immer eine Katastrophe.Die Frage ist, ob die Bundesrepublik manchen Bürgern dieseKatastrophe zumuten darf. Die Antwort ist: ja. Auch hier gilt,dass die Bundesrepublik ein bewährter Staat ist. Bei allen Män-geln macht sie ihren Bürgern ein vergleichsweise gutes Lebenmöglich, sie gewährt und sichert große Freiheiten, sie ist einefunktionierende Demokratie. Die Bundesrepublik gibt ihrenBürgern so viel, dass sie auch Opfer mancher ihrer Bürger er-warten darf.
Bislang sind 43 deutsche Soldaten in Afghanistan ums Lebengekommen. Das ist eine schrecklich hohe Zahl, aber auch eineunerwartet niedrige. Welche Nation war schon einmal achtJahre lang in einen Krieg verwickelt, ohne Tausende oderHunderttausende Tote betrauern zu müssen? Mit Toten Rech-
nungen anzustellen wirkt immer zynisch, aber man kann wirk-lich nicht sagen, dass dieser Krieg einen wahnsinnig hohenBlutzoll fordert.
Insgesamt ist also auch der Verlauf dieses Krieges nicht so,dass ein Rückzug der Bundeswehr notwendig wäre.
DAS ENDE:ORDNUNG UND MÄDCHEN
Wie geht ein Krieg zu Ende? Auch das ist eine Frage,die sich einer Demokratie heute anders stellt als eineranderen Staatsform. Wer früher ein Land aus ökono-
mischer Gier überfiel, konnte abziehen, sobald er genug ge-raubt hatte oder die militärischen Kosten der Ausbeutung denErtrag überstiegen. Das Elend, das zurückblieb, war den Sie-gern egal. Sie genossen den neuen Reichtum.
Einer modernen Demokratie ist das zum Glück nicht mög-lich. Es gibt kein „egal“, auch nicht, was die Zeit nach demKrieg angeht. Das heißt, wer einen Krieg führt, der übernimmtauch die Verantwortung dafür, was nach dem Krieg geschieht,für die Nachkriegsordnung also. Leider gelingt es den Demo-kratien fast nie, in kurzer Frist eine befriedigende Ordnungherzustellen.
Dem Ersten Weltkrieg folgte das Regime von Versailles, dasin den Zweiten Weltkrieg mündete. Dem Zweiten Weltkriegfolgte die Spaltung Europas, die nur für den Westen Freiheitund Wohlstand brachte. Im Osten ersetzte der Stalinismus dieNS-Herrschaft, und es folgte der Gulag für viele, die Freiheitund Demokratie wollten. Somalia ist heute kein Staat mehr,sondern eine Heimstatt der Gewalt und des Elends. In Bos-nien-Herzegowina und dem Kosovo herrscht ein prekärer Frie-den, der nur durch die ständige Präsenz äußerer Mächte er-halten wird.
Das ist eine traurige Bilanz. Und dennoch war es nur in einemdieser Fälle ein Fehler, einen Krieg geführt zu haben. Das istSomalia. Der Westen überließ die Menschen einem trostlosen
Schicksal, als klar war, dass es äu-ßerst schwierig und verlustreichsein würde, eine neue Ordnung zuschaffen. Nun terrorisieren Piratenvon der somalischen Küste aus dieHandelswege.
In Bosnien und im Kosovo hatder Kriegseinsatz von Amerika-nern und Europäern immerhinfür Ruhe und Ordnung gesorgt.Die Barbarei ist beendet, keineBlutbäder mehr, keine Massen -vergewaltigungen. Beide Ländergehören zu Europa, und Europadarf es nicht zulassen, dass Zivili-sation und Zivilität von den Rän-dern her ausfransen. Hier verbin-den sich ein moralisches und eingeopolitisches Argument. Wenn
es anders nicht geht, wird die Bundeswehr noch hundert Jahredort bleiben.
Afghanistan dagegen ist weit weg. Zudem ist das ursprüng-liche Argument für diesen Einsatz brüchig geworden. Niemandweiß, ob man Osama Bin Ladens dort habhaft werden kann.Der kriegerische Islamismus ist beweglich genug, um sich an-dernorts Basen zu schaffen, in Pakistan oder im Jemen. Dochwürde die Nato jetzt abziehen, wären die Taliban bald wie deran der Macht. Die neue Ordnung wäre die alte. Der Un terschied:Die Taliban würden regieren, weil der Westen versagt hat.
Die Bundeswehr hat die Verantwortung übernommen fürdie Menschen im Norden. Es geht ihnen insgesamt recht gutdamit. In Kunduz, Masar-i-Scharif und anderswo gibt es einen
Invasion der Allierten in der Normandie 1944
RO
BE
RT
CA
PA
/
MA
GN
UM
/
AG
. F
OC
US
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 33
normalen, nichtkriegerischen Alltag. Die Leute gehen ihrerArbeit nach, Mädchen können Schulen besuchen. Die Nach-richten von getöteten Soldaten verdecken, dass es diesen Alltaggibt. Er ist auch ein Erfolg der Bundeswehr.
Gleichwohl ist Afghanistan ein Land, das unseren Vorstel-lungen von einer Demokratie überhaupt nicht entspricht. UndKorruption ist eine schlimme Geißel, aber das, was Afghanistanjetzt ist, ist immer noch besser als das, was es war.
Zurzeit berichten die Medien groß über tote Soldaten. Sinddie Deutschen erst raus, werden sie über Vergeltung berichten,über Mädchen, die nicht zur Schule gehen dürfen. Die neueOrdnung Afghanistans dürfte auswestlicher Sicht schwer erträglichsein. Der Pazifismus ist keine un-schuldige Position. Der unterlasse-ne Krieg kann genauso verwerflichsein wie der Krieg. Selbstgerech-tigkeit kann man sich also sparen.
Zudem wird ein Staat Afgha-nistan, der von den Taliban re-giert wird, wahrscheinlich dafürsorgen wollen, dass auch derNachbar Pakistan unter die Herr-schaft religiöser Ultras fällt. Dakönnte eine Ordnung entstehen,die für den Westen bedrohlichwird, weil Pakistan angereichertesUran und Atomwaffen hat.
Der kriegerische Islamismusbleibt eine Herausforderung, dadarf man sich nicht täuschen. Wenn die Nato jetzt abzieht,ohne für eine halbwegs gute Ordnung gesorgt zu haben, hatsie die erste Runde eines grundlegenden Konflikts verloren.Das wird den anderen Mut machen.
Es gibt gute Gründe, diesen Krieg noch nicht zu beenden.
DIE LEGIT IMATION:STIMMUNG UND VERANTWORTUNG
Zum Wesen einer Demokratie gehört auch, dass sie nichtauf Dauer gegen den Willen der Mehrheit handeln darf.Deshalb könnte es sein, dass die Regierung die Bundes-
wehr abziehen muss, obwohl gute Gründe dafür sprechen, sienoch in Afghanistan zu lassen. Das wäre dann eine akzeptableEntscheidung. Für eine Demokratie ist die Legitimation despolitischen Handelns durch die Bürger das Wichtigste. Geradeein Krieg muss sauber legitimiert sein, weil damit manchenBürgern die Bereitschaft zum Tod abverlangt wird.
Angeblich ist der Krieg in Afghanistan schlecht legitimiert,weil zwei Drittel der Bundesbürger dagegen sind. Das aber istder größte Irrtum in dieser Debatte. Deutschland hat eine re-präsentative Demokratie. Die Politiker stellen sich den Bürgernalle vier Jahre zur Wahl. In der Zwischenzeit haben sie imRahmen des Grundgesetzes und der Gesetze freie Hand. Dasist mit gutem Grund so entschieden worden, damit nicht Stim-mungen das politische Handeln übermäßig bestimmen.
Stimmungen sind leicht zu beeinflussen und schwer zu mes-sen. Zwar äußern sich die Deutschen in Umfragen überwiegendskeptisch zu diesem Krieg. Das motiviert sie aber nicht, innennenswerter Zahl dagegen zu kämpfen. Dabei ist die Bun-desrepublik eigentlich ein Land der Pazifisten. Gegen die nu-kleare Nachrüstung gingen Hunderttausende auf die Straße,gegen den ersten Irak-Krieg der USA Zehntausende. Nun ster-ben deutsche Soldaten in Afghanistan, aber im Land der Frie-densbewegungen gibt es keine Friedensbewegung. Was ist alsowirklich die Stimmung im Land?
Selbst wenn man es genau wüsste, kann das nicht der Maß-stab für die Politik sein. Angela Merkel wird häufig vorgewor-
fen, sie richte sich in ihrer Politik zu sehr nach Umfragen, alsoStimmungen in der Bevölkerung, und das ist ein berechtigterVorwurf. In Sachen Afghanistan tut sie das nicht, sie regiertgegen die angebliche Stimmung im Volk. Das aber soll auchfalsch sein. Da stimmt die Argumentation nicht.
Jeder vernünftige Mensch ist grundsätzlich skeptisch ge-genüber dem Krieg, auch Angela Merkel. Aber sie kann esnicht nur schrecklich finden, dass deutsche Soldaten sterben.Sie findet das sicherlich auch schrecklich, aber sie muss sichfragen, ob sie diese Opfer nicht in Kauf zu nehmen hat. EinPolitiker bewegt sich da im Bereich furchtbarer Kalküle. Der
Schutz der Bürger gehört zu sei-nen wichtigsten Aufgaben. Aberer muss auch die Weltlage berück-sichtigen, die deutschen Interes-sen und das Verhältnis zu denVerbündeten, in diesem Fall vorallem zu den Vereinigten Staaten.Er kann dann zu dem Schlusskommen, dass 43 tote Deutscheder Preis sind, den die Bundes -republik zu zahlen hat, vielleichtauch 100 oder 200. Und warumvielleicht noch 200, aber nichtmehr 300?
Niemand möchte solche Kalkü-le anstellen müssen. Aber sie sindnotwendig, solange nicht Imma-nuel Kants ewiger Friede herrscht.Sogar ein Pazifist macht mindes-
tens unbewusst eine solche Rechnung auf. Oder warum meldeter sich bei 43 Toten zu Wort, nicht aber bei einem oder fünf?Doch nur Politiker müssen solche Gedanken bis zur letztenKonsequenz denken. Sie müssen entscheiden, sie tragen dieVerantwortung. Repräsentative Demokratie heißt eben auch,dass man die folgenschweren Entscheidungen den Politikernüberlässt. Nur sie bringen die professionelle Kühle auf, dienotwendig ist. Diese Entscheidungen müssen sie dann der Be-völkerung erklären.
Leider aber wurde der Einsatz in Afghanistan lange be-schwiegen. Der Krieg sollte aus dem Bewusstsein der Bürgerverschwinden. Rund um den fatalen Befehl von Oberst Kleinwurde sogar vertuscht und gelogen. Es war auch ein Fehler,dass Afghanistan im Wahlkampf 2009 keine Rolle gespielt hat.Die Parteien, die sich für diesen Einsatz entschieden haben,wollten sich im Wahlkampf nicht dazu bekennen. Union, SPDund FDP schwiegen zum Krieg, weil sie Angst hatten, einklares Bekenntnis könnte Stimmen kosten. Auch viele Medienhielten es für richtig, dass Afghanistan im Wahlkampf nichtvorkommt. Das war ein Fehler, muss man selbstkritisch sagen.Die Legitimation des Krieges hat hier eine Schwäche.
Ein Argument für das Schweigen im Wahlkampf war, dassdie deutschen Soldaten in Afghanistan von einer Debatte ver-unsichert werden könnten. Aber das ist ein schlechtes Argu-ment. Die Bundeswehr ist die Armee einer Demokratie, unddas Wesensmerkmal einer Demokratie ist nicht die Einhellig-keit, sondern der Streit. Alles ist umstritten, alles wird erstrit-ten. Das Thema Krieg kann davon nicht ausgenommen wer-den. Die Soldaten, Staatsbürger in Uniform, müssen das er-tragen.
Und die Politiker müssen sich trauen. Nach den jüngstenAngriffen auf die Bundeswehr hat sich Angela Merkel klar zudiesem Einsatz bekannt, spät, aber immerhin. Auch im Wahl-kampf 2013 sollte sie das nicht verstecken. Bis dahin mussauch die SPD eine klare Haltung finden. Dann können dieBürger das Thema Afghanistan in ihre Entscheidung prominentaufnehmen und dem Krieg eine klare Legitimation geben odereben nicht. Bis dahin muss ständig diskutiert werden, undnicht immer nur dann, wenn es Tote gibt. �
Kanzlerin Merkel bei Trauerfeier für gefallene Soldaten
DD
P /
DD
P I
MA
GE
S
Der Kalte Krieg war zu Ende, dieMauer gefallen, die deutsche Ein-heit stand unmittelbar bevor, da
schrieb der ehemalige Stasi-General-oberst und DDR-Spionage-Chef MarkusWolf einen Brief an Willy Brandt, in demer wortreich bedauerte, „dass der untermeiner Leitung stehende Nachrichten-dienst der DDR zu den politisch so nega-tiven Vorgängen beigetragen hat, die 1974zu Ihrem Rücktritt führten“. Brandt hattedamals das Kanzleramt aufgegeben, nach-dem sein Referent Günter Guillaume alsDDR-Agent enttarnt worden war.
„Das hilft nun auch nichts mehr“, sollder Ex-Kanzler nach Lektüre der Ent-schuldigung altersmilde bemerkt haben.
Wolfs Schreiben war eine weitere Vol-te in einem undurchsichtigen Spiel, dasden Historikern seit Jahren Rätsel auf-gibt. Welche Rolle nahmen die Geheim-dienste während der brandtschen Ostpoli -tik ein, die 1969 begann und dem Sozial-demokraten den Friedensnobelpreis ein-brachte?
Diverse Bundespolitiker pflegten Kon-takte zu DDR-Vertretern oder sowjeti-schen Funktionären, die für die Stasi oderden KGB arbeiteten. Allein der ostdeut-sche Geheimdienst führte Hunderte Spio-ne in der Bundesrepublik. Wolfs Exper-ten verwanzten sogar das Haus vonBrandts engstem Mitarbeiter Egon Bahr.
Aber was taten die Dienste mit demso erworbenen Wissen?
Nur Gutes – das zumindest hat Wolfbis zu seinem Tod 2006 behauptet. „DieVorbereitungen der Entspannungspolitikwaren über meinen Dienst gelaufen“,rühmte sich der gebürtige Schwabe, des-sen Spionageabteilung Teil der Stasi war.Immer wieder habe er der DDR-SpitzeBelege dafür geliefert, dass die Absichtendes charismatischen Brandt ernst zu neh-men seien, der nach 20 Jahren KaltemKrieg eine Verständigung mit den östli-chen Nachbarn anstrebte.
Nun hat der DDR-Experte Siegfried Suckut bislang unbeachtete Dokumenteder Stasi ausgewertet*. Die Papiere ent-standen 1969/70 jeweils vor Treffen derStasi-Spitze um Minister Erich Mielke mitKGB-Kollegen.
* Siegfried Suckut: „Probleme mit dem ,großen Bruder‘.Der DDR-Staatssicherheitsdienst und die Deutschland-politik der KPdSU 1969/70“, in: „Vierteljahrshefte fürZeitgeschichte“, Nr. 3/2010.
Mal kamen die Geheimdienstler in Berlinzusammen, mal in Moskau, aber die Rol-lenverteilung war stets die gleiche – undsie widerspricht der Version Wolfs. DenUnterlagen zufolge hetzten die DDR-Ver-treter in bester Propaganda-Manier gegenBrandt. Über Dutzende Seiten ziehen sichdie Vorwürfe, der Kanzler ziele auf eine„Restauration der Macht des Monopol-kapitals in der DDR“ und strebe die „poli -tisch-ideologische Aufweichung und Zer-setzung der sozialistischen Staaten“ an.
Die Einheitssozialisten fürchteten offenkundig die Anziehungskraft derbrandtschen Politik auf die sowjetischenGenossen und warnten diese immer wieder, die „wachsenden Gefahren desSozial demokratismus und Revisionismusniemals (zu) unterschätzen!“. Selbst als
1970 Bonn und Moskau bereits über einen Gewaltverzichtsvertrag verhandelten, liefdie Stasi den Dokumenten zufolge nochSturm. Die sozial-liberale Bundesregie-rung wolle nur einen „Keil treiben zwi-schen UdSSR und DDR“.
Der KGB zählte zu den Befürworterneiner Entspannungspolitik, weil der kühlkalkulierende KGB-Chef Jurij Andropowwohl hoffte, mit Bonner Hilfe die rück-ständige Sowjetunion zu modernisieren.Von Andropow – später ein Förderer Mi-chail Gorbatschows – war dann auch daserste Signal an Brandt ausgegangen, Mos-kau sei gesprächsbereit. Andropow schlugeine geheime Verbindung zwischenKreml-Chef Leonid Breschnew und demKanzler vor, die dann über einen KGB-Mann und Brandt-Mitarbeiter Bahr lief.Der diskrete Meinungsaustausch erleich-terte die offiziellen Gespräche enorm.
An den neu aufgetauchten Papieren erstaunt, wie selbstbewusst die Stasi Kri-tik am großen Bruder übte. Auf einemSprechzettel Mielkes für ein Treffen mitAndropow im Sommer 1970 werden offenskeptische Fragen formuliert, etwa: „Wirdin der UdSSR Brandts Friedens- und Ent-spannungsdemagogie richtig beurteilt?“
Als Unterstützer der Ostpolitik wieSPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augsteinoder der Schriftsteller Günter Grass beieiner Tagung mit sowjetischen Vertreternsprachen, ätzte die Stasi, es wäre „inter -essant zu erfahren, mit welcher Begrün-dung und Zielsetzung mit solchen Auf-weichspezialisten diskutiert wurde“.
Die Dokumente widerlegen auch dieThese, der zufolge DDR-Spione stets als„Kundschafter des Friedens“ (SED-Pro-paganda) wirkten. Wolf behauptete nachdem Mauerfall sogar, er und seine Leute
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 034
Z E I T G E S C H I C H T E
Groteske LageBislang unbeachtete Dokumente
legen nahe, dass die Stasi die Ostpolitik Willy Brandts verhin-dern wollte. Der KGB brachte
die Genossen schließlich auf Linie.
SED-Genossen Wolf, Honecker 1980
Warnung vor der SPD
Kanzler Brandt, Kreml-Chef Breschnew auf der Krim 1971: DDR von hinten aufrollen
JÜR
GE
NS
PH
OTO
hätten Informationen aus dem Westenmanipuliert, damit sie nicht den Hard -linern der eigenen Seite, also in der SED,in die Hände spielten.
Von wegen.Den vorliegenden Papieren nach ver-
suchte die Stasi, mit ihren Spionage-Re-sultaten die Ostpolitik beim KGB anzu-schwärzen. Mehrfach zitierten die Gehei-men interne Äußerungen des Kanzlersoder seiner Minister, um zu belegen, dassdiese die DDR „von hinten aufrollen“(Brandt) oder „in die Ecke“ drängen (Au-ßenminister Walter Scheel) wollten.
Allerdings handelt es sich bei den Do-kumenten um Analysen und Sprechzettel,nicht um Gesprächsprotokolle. Sollte esdiese gegeben haben, sind sie vermutlichvernichtet worden. In der intrigenreichenWelt der Dienste lässt sich daher auchnicht ausschließen, dass Stasi-Mitarbeiterdie Unterlagen nur verfassten, um sichabzusichern. So konnte ihnen niemandeinen Mangel an ideologischer Härte vor-werfen. Die Gespräche mit der KGB-Spit-ze könnten also auch einen anderen Ver-lauf genommen haben.
Nach Aktenlage sprach der KGB jeden-falls Ende 1970 ein Machtwort. Inzwischenhatten Scheel und sein sowjetischer Kolle-ge Andrej Gromyko den sogenanntenMoskauer Vertrag unterzeichnet, ein ähn-liches Abkommen der Bundesrepublik mitPolen war einige Monate später gefolgt.Andropow ließ der Stasi ausrichten, siemöge das bitte „positiv werten“.
Mielke verkündete daraufhin leitendenStasi-Offizieren, die eben noch bekämpf-ten Ostverträge seien in Wirklichkeit „Aus-druck der gewachsenen Stärke der sozia-listischen Staaten“.
Insofern verwundert es nicht, dass dieStasi ein Jahr später mindestens einenBundestagsabgeordneten bestach, um einMisstrauensvotum der CDU/CSU gegenBrandt scheitern zu lassen, was auch ge-lang. Wissenschaftler Suckut vermutetaufgrund der neuen Papiere, dass die Ostdeutschen dabei einer Vorgabe desKGB folgten. Ihre Abneigung gegenüberBrandt sei „zu groß gewesen“.
Einem glaubwürdigen Zeugen zufolgestanden dem für die DDR zuständigenKGB-General eine Million Dollar Beste-chungsgeld zur Verfügung. Suckut ver-weist zudem auf eine Äußerung von SED-Chef Erich Honecker wenige Tage nachdem gescheiterten Misstrauensvotum.Der Parteiführer fand es eine „groteskeLage“, dass ausgerechnet die Ostdeut-schen „als die stärksten Helfer für die Stabilisierung der Regierung Brandt auf-treten mussten“.
Über Brandts Rücktritt nach der Ent-tarnung Guillaumes war Honecker dennauch nicht sonderlich betrübt.
Nur Wolf will das Ende der Kanzler-schaft schon damals bedauert haben.
KLAUS WIEGREFE
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 35
Deutschland
Sie haben seine Telefone überwacht,seine Briefe gelesen, Videokamerasvor seiner Arbeitsstelle und seinem
Haus installiert. Sie haben überprüft, wel-che Internetseiten er anschaute, und dasTelefon seines Sohnes abgehört. Einmal haben sie sogar seinen VW Passat entführt,um ihn zu verwanzen – und solange einenbaugleichen Wagen vorm Haus geparkt.
Fast zehn Jahre lang ist der studiertePhysiker Jochen U., 62, überwacht wor-den. Die Späher führten über sein Lebenminutiös Protokoll: Sie notierten, dass erbei Lidl einkauft, gelegentlich den Sperr-müll im Innenhof inspiziert und manch-
* Am 2. Juni 2007 in Rostock.
mal trotz Grippe bei seiner Arbeitsstellein einer Bäckerei erscheint.
Beantragt wurden diese massivenGrundrechtseingriffe von der obersten Ermittlungsbehörde des Landes, der Bun-desanwaltschaft in Karlsruhe. Sie vermu-tete in dem Berliner einen linken Staats-feind und Terroristen.
Spätestens seit 1998 schnüffelte der Verfassungsschutz hinter U. her, einembekennenden Linken, der sich unter an-derem für Häftlinge engagiert. Die Ge-heimen hielten ihn und zwei weitere Ber-liner für Gründer einer „militanten grup-pe“, die sich ab 2001 zu Brandanschlägenbekannte. Als in jenem Jahr unter ande-ren der FDP-Politiker Otto Graf Lambs-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 036
J U S T I Z
Karlsruher KabaleDer Bundesgerichtshof wirft der Bundesanwaltschaft unan ge -
messene Härte bei Ermittlungen gegen linke Gruppen vor. Auch in Berlin ist Generalbundesanwältin Monika Harms isoliert.
dorff in einem Brief eine scharfe Patronefand und damit erstmals auch Menschenins Visier gerieten, eröffneten die Bun-desanwälte ein Verfahren.
Das war lang, teuer – und rechtswidrig.Zu diesem Schluss kommt der Bundes -gerichtshof (BGH), an den sich Jochen U.gewandt hatte. Aufgrund „bloßer Vermu-tungen“ habe man U. und die weiterenBeschuldigten als potentielle Terroristenabgestempelt und trotz ausbleibender Erfolge jahrelang weiterermittelt. DieFahnder hätten gar Entlastendes vorent-halten, monieren die Richter ungewöhn-lich scharf.
Der Beschluss ist der vorläufige Höhe-punkt in einer Serie von Belehrungen,Rügen und Korrekturen, die die Bundes-anwaltschaft seit dem Amtsantritt vonMonika Harms 2006 einstecken musste.Vor allem bei Verfahren gegen die linke Szene werfen die Richter den Ermittlern übertriebene Härte vor, in diversen Fällen seien die Bundes-
anwälte über das Ziel hin -ausgeschossen.
Bei der Kabale aus Karls-ruhe geht es allerdings ummehr als nur um Zwist zwi-schen Spitzenjuristen. Dasssich Harms, die anfangs soforsche Generalbundesanwäl-tin, mehr und mehr ins Ab-seits ermittelt hat, dämmertauch der Bundesregierung.Der ehemalige BGH-Richterund heutige Rechtspolitikerder Linkspartei, WolfgangNeskovic, spricht von „ekla-tanten juristischen Blamagen“und fordert ihren Rücktritt.
Im Kern geht es um die Frage, was imZeitalter des islamistischen Terrorismusund zwölf Jahre nach Auflösung der Roten Armee Fraktion (RAF) als Ter -rorismus anzusehen ist – und entspre-chend hart bekämpft werden darf. Wäh-rend die Gefahr heutzutage von islamis-tischen Attentätern ausgehe, heißt es inBerlin, verfolgten die Ermittler jede au-tonome Kleingruppe wie einen Wieder-gänger der RAF, aus Sicht des Bundesge-richtshofs häufig jenseits der Legalitäts-grenze.
So kassierte der BGH Harms’ Bewer-tung der „militanten gruppe“ als terroris-tische Vereinigung und stufte sie als kri-minelle Vereinigung ein, die zwar schwereStraftaten begehe, nicht aber wie einstdie RAF den Staat als Ganzes gefährdenkönne. Die Razzien bei Globalisierungs-kritikern vor dem G-8-Gipfel 2007, diebundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat-ten, werteten die Richter als unzulässig.Und den Versuch der Bundesanwälte, dieehemalige RAF-Frau Verena Becker we-gen Mittäterschaft am Mord des General-bundesanwalts Siegfried Buback neu zuverfolgen, kommentierte das Gericht skep-
Demonstration Autonomer zum G-8-Gipfel*, Chefermittlerin Harms: Bloße Vermutungen?
AN
DR
EA
S H
ER
ZA
U /
LA
IF (
L.)
; Z
EN
TR
IXX
/ I
MA
GO
(R
.)
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 038
tisch: Die Beweise rechtfertigten lediglichden Verdacht auf Beihilfe.
Besonders der BGH-Beschluss zum Fallder drei Berliner Beschuldigten hat es insich. Es habe zu „keinem Zeitpunkt einenausreichenden Tatverdacht“ für eine der-art weitreichende Überwachung gegeben,heißt es darin. Der 3. Strafsenat sah sogar„Anlass“, die Kollegen von der Bundes-anwaltschaft „darauf hinzuweisen, dassdie präventive Gefahrenabwehr nicht Auf-gabe der Strafverfolgungsbehörden ist“.Zwar hatte Harms das Verfahren nichtselbst gestartet, sondern von ihrem Vor-gänger übernommen. Sie betrieb es abermit besonderem Eifer. Auch die Durchsu-chung von Auto, Arbeitsstelle und zweiWohnungen 2007 habe „keine Hinweiseauf eine Mitgliedschaft“ in der „militan-ten gruppe“ oder „sonstige relevante Er-kenntnisse“ erbracht, heißt es im Ab-schlussbericht zum Verfahren, das 2008
gegen U. und die zwei anderen Beschul-digten eingestellt wurde.
Die Kritik offenbart Fehler im System.Eigentlich sollen Ermittlungsrichter jedeÜberwachung überprüfen. Doch in derPraxis agieren sie meist weniger als Kontrolleure denn als Partner der Staats -anwälte – und lassen die Anträge in der Regel anstandslos passieren. „Das Im-munsystem hat versagt“, sagt der AnwaltSönke Hilbrans, der die Sache vor Gerichtgebracht hat. „Insgesamt hat der BGHbei einem einzigen Betroffenen 39 Ent-scheidungen von Ermittlungsrichtern alsrechtswidrig aufgehoben, die meist wört-lich den Anträgen der Bundesanwaltschaftentsprachen.“ Jochen U. sagt, es werde„sichtbar, wie groß die Bereitschaft ist,auch bei dünnsten Grundlagen weitrei-chende Überwachungen zu genehmigen“.
Wie schnell sich Spekulationen zu jahrelangen Ermittlungen verselbständi-gen, zeigen auch die Anti-Terror-Ver -
fahren gegen Gegner des G-8-Gipfels inHeiligendamm. Im März 2006 hatte dasBundesamt für Verfassungsschutz denBundesanwälten einen 20-seitigen Ge-heimvermerk übersandt, der Aufschlussüber angebliche Hintermänner mehrererBrandanschläge geben sollte. Eine Grup-pe um den Brandenburger Autonomen-Veteran Armin M., 68, sei für die „mili-tante Kampagne“ verantwortlich.
Belege? Der Rentner habe an öffent -lichen Vorbereitungstreffen gegen das G-8-Treffen teilgenommen. Zudem seienin einem Autonomen-Handbuch, das M.und andere herausgegeben hatten, ähnli-che Begriffe wie in Bekennerschreibenbenutzt worden. Das Dossier aus derGrauzone der Geheimen bildete dieGrundlage für ein Ermittlungsverfahrengegen 21 Personen und mündete in einebundesweite Razzia im Mai 2007, vierWochen vor dem G-8-Gipfel. Die öffent-
liche Kritik konterte Harms damals: „Wirsind nicht über das Ziel hinausgeschos-sen.“ Wer „aus politischen Gründen denStaat in organisierter Weise mit Gewaltüberziehe“, sei nun einmal Mitglied einerterroristischen Vereinigung.
Am Ende blieb nichts von den Vorwür-fen bestehen, 2008 stellten die Ermittlerdie Verfahren in aller Stille ein. Der Bun-desgerichtshof sprach der Bundesanwalt-schaft sogar die Zuständigkeit ab: Die not-wendige Gefahr einer erheblichen Schä-digung des Staates habe nie bestanden.
Mittlerweile hat der BGH die Ermittlernicht nur beim Linksextremismus zurück-gepfiffen, sondern auch in Proliferations-verfahren. „Wir haben eine Tendenz inder Rechtsprechung, die die Gefahr ausdem Blick nimmt und mit feinen juristi-schen Überlegungen darzulegen versucht,dass alles nicht so schlimm ist“, verteidig-te sich Harms in einem ihrer seltenen öf-fentlichen Auftritte.
Konflikte zwischen Bundesanwältenund den Richtern am Bundesgericht sindin der juristischen Gewaltenteilung ange-legt, doch in diesem Fall gibt es auch einepersönliche Komponente. Harms hatselbst fast 20 Jahre am BGH gerichtet.Als sie Chefanklägerin wurde, stand ihrehemaliger Kollege Klaus Tolksdorf demfür Staatsschutzsachen zuständigen Senatvor, unter seiner Regie entstand etwa derbesonders scharfe G-8-Beschluss. Die inCDU-Kreisen gut vernetzte Harms sprachsich gegen Tolksdorfs Aufstieg zum BGH-Präsidenten aus – vergebens. Die „Span-nungen zwischen den Hausspitzen habenleider auf das Verhältnis der Institutionendurchgeschlagen“, sagt ein BGH-Insider,der namentlich nicht zitiert werden will.
Dazu kommt, dass Harms die politischeRückendeckung fehlt, seit sich auch in Ber-lin die Zeiten geändert haben. Die Juristinwurde in einer Phase ernannt, als die Gro-ße Koalition Sicherheitsgesetze in Serieverschärfte und Innenminister WolfgangSchäuble (CDU) laut über die präventiveTötung von Terroristen nachdachte. Dapassten manche Sätze von ihr gut in dieZeit – zum Beispiel der, wonach es nichtsein könne, dass die Freiheitsrechte Ein-zelner die Schutzrechte Vieler überwögen.
Heute hat sie es mit Thomas de Maizièreals Innenminister zu tun, der neuen Sicher-heitsgesetzen eine Absage erteilt hat – undihre direkte Vorgesetzte ist Bundesjustizmi-nisterin Sabine Leutheusser-Schnarrenber-ger (FDP), eine ausgewiesene Bürgerrecht-lerin. Noch aus der Opposition heraus hattedie FDP-Politikerin Verfassungsbeschwerdegegen die Vorratsdatenspeicherung einge-legt. Harms hingegen hält die Pflicht zurSpeicherung aller Verbindungsdaten für ei-nen „wichtigen Ermittlungsansatz“.
Das schwierige Verhältnis wird durchdie politischen Aktivitäten der General-bundesanwältin nicht herzlicher. Für Är-ger sorgte im Justizministerium etwa einBesuch von Harms bei Verteidigungsmi-nister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU),von dem die Ministerialen durch Zufallerfuhren. Es ging um die Zuständigkeitbei Auslandseinsätzen der Bundeswehr.Auch dass Harms vor Vertretern der Unionsfraktion Zweifel an der vom Justiz -ministerium vorgeschlagenen Schwer-punktstaatsanwaltschaft in Leipzig anmel-dete, ist der Ministerin nicht entgangen.
Harms hat sich mittlerweile zurück -gezogen, sie will nicht ständig öffentlichgerügt werden. Neue Großverfahren ge-gen linke Gruppen werde es von der Bun-desanwaltschaft nur in spektakulären Aus-nahmefällen geben, heißt es in der Behör-de. Von einem „Hauch von Resignation“ist in Karlsruhe die Rede. Harms, 63, habesich entschieden, die Zeit bis zu ihrer Pensionierung im kommenden Jahr mög-lichst frei von weiteren Unfällen zu ver -walten. DIETMAR HIPP, MARCEL ROSENBACH,
HOLGER STARK
Richter Tolksdorf: Belehrungen, Rügen, Korrekturen
WIN
FR
IED
RO
TH
ER
ME
L /
AP
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 39
Peter Schmidt war schon zu Beginnskeptisch. Was er mit Riesenrädernsolle, fragte sich der Rentner aus Ber-
lin und zog seinen Bankberater auf: „Ichbin doch nicht beim Zirkus oder auf demRummel.“ Doch der Finanzexperte von derDeutschen Bank malte die Anlagemöglich-keit in leuchtenden Farben, sprach, so zu-mindest erinnert sich Schmidt, von zwei-stelligen Renditen, von gigantischen Aus-sichtsrädern wie dem London Eye – jenerAttraktion in der britischen Hauptstadt, dieseit 2000 Besuchermassen anlockt.
Irgendwann war Schmidt überzeugtund zeichnete für 15000 Euro Anteile amRiesenradfonds Global View. Schließlich,glaubte er im November 2006, stünde hin-ter dem Investment ja die Deutsche Bank,der er seit Jahrzehnten in finanziellen An-gelegenheiten vertraute.
Heute weiß Schmidt, dass die Empfeh-lung kein guter Ratschlag war. GlobalView, angepriesen als „hochattraktives In-vestment“, hat 208 Millionen Euro größ-tenteils verschleudert, ohne dass auch nurein Riesenrad gebaut wurde – weder inPeking noch in Florida oder Berlin. Inzwi-schen interessiert sich die Berliner Staats-anwaltschaft für den Fonds: Sie ermittelt,ob die Initiatoren des luftigen InvestmentsAnlegergelder veruntreut haben. Die be-streiten die Vorwürfe. Ob Schmidt seinGeld jemals wiedersieht, ist offen.
Für die Deutsche Bank war das Riesen-radprojekt dagegen ein richtig gutes Ge-schäft. 19,2 Millionen Euro hat das Frank-furter Geldhaus an Global View verdient,weil seine Kundenberater innerhalb vonzehn Wochen 160 Millionen Euro bei ih-ren Kunden eingesammelt hatten, über-wiegend von deutschenKleinanlegern wie Schmidt.Am Fonds selbst war dieDeutsche Bank nie beteiligt.Global View hatte das Bank-haus Delbrück BethmannMaffei (DBM) aufgelegt. Ei-genes Geld, etwa als Kredi-te, wollten die Deutschban-ker lieber nicht in das Pro-jekt stecken. Selbst als esbitter gebraucht wurde, ver-wies das Geldhaus nur nochauf ein „Marktrisiko“, das„bankseitig nicht einge-schätzt und getragen wer-den“ könne.
Der Eklat um die Luftnummer wirfteinmal mehr jene Frage auf, die seitFinanz krise und der Pleite des Invest-menthauses Lehman Brothers weltweitdiskutiert wird: Inwieweit haftet einBank haus für jene Investitionen mit, diees seinen Kunden empfiehlt? Trägt dieDeutsche Bank eine Mitverantwortungfür ein Projekt, das sie ihren Kunden erstschmackhaft machte, intern aber späterals riskant betrachtete? Diese Einschät-zung findet sich in einer Korrespondenzzwischen Deutscher Bank, der DBM undden Projektinitiatoren. Der Schriftwech-sel gewährt Einblick in ein fragwürdigesGeschäftsgebaren des größten deutschenGeldhauses. Die Schreiben und E-Mailslegen den Verdacht na he, dass die Deut-sche Bank nicht nur auf ungewöhn-lich hohen Provisionen bestand, die vor den Anlegern verschleiert wer den sollten, sondern auch am Erfolg des Projektszweifelte.
So kalkulierten die Frankfurter von Be-ginn an mit einer „Eigenkapitalvermitt-lungsprovision von zwölf Prozent“. Weilim Verkaufsprospekt nur zehn Pro zenterscheinen sollten, musste eine kre ativeLösung her. Die überhöhte Provi sion sollte, so der schriftliche Vorschlag ei-nes Deutsche-Bank-Mitarbeiters, einfach„nicht mehr prospektiert werden“ müs-
sen. Im Klartext: Den Anle-gern sollte die zusätzlicheMarge verschwiegen wer -den. Die federführendenDBM-Banker waren damiteinverstanden, wollten aberden Aufschlag von zweiProzent an die DeutscheBank erst auszahlen, wennder Bau der Riesenrädervertraglich gesichert war.
Vergebens: Man habesich schließlich, heißt es ineiner E-Mail eines Mitarbei-ters der Deutschen Bank,Abteilung Asset Finance &Leasing, „auf eine erhöhte
Provision geeinigt“, die schon früh aus-gezahlt werden sollte – nach Schließungdes Fonds, also im März 2007.
Im Sommer 2009 traten die ersten Rea-lisierungsprobleme auf, in den Zeitungenwar von „finanzieller Schieflage“ dieRede. Kleinanleger Peter Schmidt sollvon seinem Anlageberater aber versichertworden sein, alles sei „auf einem gutenWeg“, seine Bank stehe hinter dem In-vestment.
Kurze Zeit später, als eine Finanzie-rung für Peking platzte, war es so weit:Das Anlegerkapital von 208 MillionenEuro war aufgezehrt, von Grundstücks-käufen, Bankgebühren und fragwürdigenProjektentwicklungskosten – teils abge-flossen über Briefkastenfirmen in der Ka-ribik. In der Stunde der größten Not woll-te DBM die Deutsche Bank als Kreditge-ber für das Berliner Rad gewinnen. Dochdie reagierte kühl: Bankdarlehen seien„erst nach Fertigstellung und Generierungvon kapitaldienstdeckenden Umsätzendenkbar“, heißt es in einem Schreibenvom 10. Dezember 2009.
DBM schweigt zu den Vorgängen, auchein Sprecher der Deutschen Bank möchteetwaige Kredit- und Anlagegesprächenicht kommentieren. Den Vorwurf über-höhter Provisionen weist er zurück: „Wirhaben zehn Prozent für die Kapitalver-mittlung bekommen, wie es im Prospektsteht.“ Für Beratungsleistungen habe ein„Tochterunternehmen weitere zwei Pro-zent des von der Deutschen Bank akqui-rierten Kapitals bekommen“.
Die Riesenräder selbst werden wohlnie gebaut. DBM hält nur noch das Ber-liner Projekt für realisierbar, wenn einkapitalkräftiger Investor ge funden wird.Den meisten Anlegern hat die Bank in-zwischen ihre Anteile abgekauft – für 60Prozent des ursprünglichen Werts.
Peter Schmidt ist auf das Angebot nichteingegangen. Der Rentner will wie 300andere Geschädigte klagen – gegen denFonds und notfalls auch gegen die Deut-sche Bank. ANDREAS WASSERMANN
B A N K E N
Kühle AbfuhrDie Deutsche Bank gerät beim
Flop eines Riesenradfonds ins Zwielicht: Kunden wurde das
Investment empfohlen, später bewertete man es als hochriskant.
Berliner Riesenrad (Computersimulation): Ermittlungen wegen Untreue
SÖ
RE
N S
TA
CH
E /
PIC
TU
RE
-ALLIA
NC
E /
DP
A
Anleger Schmidt
Klage gegen den Fonds
AN
DR
EA
S W
AS
SE
RM
AN
N /
DE
R S
PIE
GE
L
Manche Worte brennen sich für einLeben lang ins Gedächtnis, dieersten Worte des eigenen Kindes
zum Beispiel oder die letzten eines ster-benden Angehörigen.
Bei Erika Specht ist es ein Satz ihrerSchwägerin Doris, die am Nachmittag des1. Juni 1988 angerannt kam von der Arzt-praxis, in der sie arbeitete, über die Kreu-zung zum Bergmannshäuschen der Fami-lie Specht im hessischen Borken. Atemloswar sie und völlig aufgelöst. Sierief: „Da muss was Schrecklichespassiert sein in Stolzenbach.“
Mit diesem Satz beginnt eine Fol-ge von Szenen in Erika SpechtsKopf, wie ein Film, der sich nichtabstellen lässt, der immer wiederabläuft, wenn etwa nachts keinSchlaf kommen will. Er zeigt sieals 37-jährige Frau, als Mutter zwei-er Kinder, die von ihrer Schwäge-rin erfährt, dass alle Ärzte der Re-gion zur Grube gerufen wurden.
Erika Specht weiß sofort, dasssie auch dorthin muss, zu demknapp 6,5 Kilometer entfernten
Schacht, in den ihr Mann Hans-Jürgenam Morgen zur Frühschicht eingefahrenist. Ein Nachbar nimmt sie im Auto mitbis zur Straßensperre, die schon einge-richtet ist. Sie steigt aus, läuft nun durchden Wald, so schnell sie kann, in den Oh-ren das Gejaule von Martinshörnern.
Dann steht sie vor dem Werkstor, bittetum Einlass, darf erst nach einer gefühltenEwigkeit hinein, wird über den Hof derZeche geführt in einen Aufenthaltsraum,
in dem noch andere Frauen von Bergleu-ten erst mal sitzen sollen, aber nicht kön-nen, sondern herumlaufen, um Informa-tionen betteln, um eine Schaufel oder ir-gendetwas, womit man helfen kann.
Später am Abend ist sie wieder bei ih-ren Kindern in Borken, wartet dort, dreiTage lang, mehr als 80 Stunden, fast ohnezu essen und zu trinken. Samstagmorgenum 5.30 Uhr schöpft sie kurz Hoffnung,als das Radio meldet, sechs Kumpel seien
überraschend lebend gerettet wor-den, ganz sicher ist Hans-Jürgendabei, denkt sie, bis dann spät amSamstagabend das Telefon klingelt.
Der Bergmann Hans-JürgenSpecht wird später als Opfer Nr. 34in den Ermittlungsakten der Staats-anwaltschaft geführt, gefunden inBauchlage, Gesicht nach unten,verschüttet bis zur Hüfte, gestor-ben an Kohlenmonoxidvergiftungin der Pfeilerstrecke 5a West. SeinTod, wird 16 Monate danach dieStaatsanwaltschaft Kassel erklären,sei die Folge eines „tragischen Un-glücks“ gewesen, einer nicht vor-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 040
P R O Z E S S E
Tödlicher Staub51 Bergleute starben vor 22 Jahren im hessischen Bergwerk Stolzenbach. Das größte Unglück
im deutschen Braunkohlebergbau war angeblich ein tragischer Unfall, den niemand voraussehen konnte. Jetzt sorgt ein altes Gutachten dafür, dass der Fall doch noch vor Gericht kommt.
Bergmann Specht (links oben), Kumpel: An Weihnachten Christbäume mit brennenden Kerzen in den Stollen gestellt
Rettungseinsatz nach der Explosion: Zehn Ladungen Donarit
DP
A
hersehbaren Kohlenstaubexplosion, aus-gelöst durch eine Routinesprengung.
Durch Verfügung vom 13. Oktober1989 stellt die Staatsanwaltschaft Kasseldie Ermittlungen ein. Sie sieht „keine An-haltspunkte für ein strafbares oder ord-nungswidriges Verhalten“.
Die Explosion, durch die 51 Bergleutein der Grube starben, sei „nach demStand von Wissenschaft und Techniknicht für möglich gehalten worden“, Ver-gleichbares habe sich „auch noch nie er-eignet“.
Das ist bis heute die amt -liche Erklärung für eine dergrößten Bergwerkskatastro-phen der Bundesrepublik.Aber stimmt sie auch?
Einige der damals beteilig-ten Ermittler sind heute nichtmehr so sicher. Denn inzwi-schen sieht es so aus, als hättenAufsichtsbehörden und Gru-benbetreiber schon lange vordem Unglück gewusst, dassder Staub in der Braunkohle-grube hochexplosiv und brand-gefährlich war, wenn er Zeitgenug zum Trocknen hatte.Das lässt sich aus einem Gut-achten schließen, das sowohlder damaligen BetreiberfirmaPreußenelektra (Preag) alsauch hessischen Bergämternseit Ende der sechziger Jahrevorlag.
Wer dieses Gutachten heuteliest, muss den Eindruck ge-winnen, dass die Bergleute inder Grube Stolzenbach jahre-lang sehenden Auges demenormen Risiko ausgesetztwurden, jederzeit bei einerSprengung in Stücke gerissenzu werden. Erika Specht und15 andere Angehörige der Ex-plosionsopfer haben deshalbKlage eingereicht gegen denehemaligen Bergwerksdirektor und denEnergiekonzern E.on, das Nachfolgeunter -nehmen der Preußenelektra.
Mit einem Zivilverfahren, das am Mitt-woch vor dem Landgericht Kassel begin-nen soll, wollen sie jetzt nachholen, wasihrer Ansicht nach schon vor zwei Jahr-zehnten hätte geschehen müssen: eine gerichtliche Klärung der Frage, ob ihreEhepartner, Väter und Söhne 1988 in derGrube umkamen, weil trotz eindeutigerWarnungen aus Schludrigkeit, Ignoranzoder Profitgier versäumt wurde, die nöti-gen Vorkehrungen gegen eine permanen-te Explosionsgefahr zu treffen.
Die Grube Stolzenbach war Ende derachtziger Jahre eines der wenigen deut-schen Bergwerke, in denen Braunkohlenoch aus unterirdischen Stollen gefördertwurde. In der Regel wird diese geologischvergleichsweise junge, nahe an der Erd-
oberfläche liegende Kohle mit riesigenBaggern im Tagebau abgeräumt. Das istbilliger und weit weniger gefährlich.
Als der Bergmann Hans-Jürgen Spechtam 1. Juni 1988 zur Frühschicht antrat,war ihm daher längst klar, dass sein Ar-beitsplatz auf Dauer keine Zukunft habenwürde. Seit Jahren machten Schließungs-gerüchte in Stolzenbach die Runde, zwei,drei Jahre noch, hieß es, dann werde dieZeche dichtgemacht.
Für Specht war das kein Grund zu gro-ßer Sorge. Die Preußenelektra werde
schon für ihre Leute sorgen und ihm ei-nen neuen Job anbieten, im Tagebau oderin einem Kraftwerk. „Mein Mann war im-mer Optimist“, sagt seine Witwe. IhreTochter Tanja, 37, erinnert sich an einengutgelaunten Vater, der abends, wenn ervon der Spätschicht kam, sie und ihrenälteren Bruder André noch mal weckteund Eis austeilte, das er mitgebracht hatte:„Er hat immer gesagt, dass ihm gar nichtspassieren kann bei der Arbeit. Er hat ge-glaubt, die Grube ist sicher.“
Nur in den letzten Monaten vor derExplosion, erinnert sich Tanja, mischtesich Skepsis in den Optimismus des Va-ters. Es werde immer weniger investiertin die Zeche, habe er geklagt, die Förder-bänder würden nicht mehr sorgfältig frei-geschippt, und von der staubbindendenChemikalie, mit der die Gefahr durchKohlenstaub vermindert werden soll, wer-
de immer weniger verstreut. Ein Vorwurf,dem die Preußenelektra nach dem Un-glück vehement widersprach.
Der Braunkohlebergbau, war den Kum-peln immer eingebläut worden, sei einesichere Sache. So sicher, dass die Berg-leute sich früher sogar unbesorgt ihre Zi-garetten im Schacht angesteckt hättenoder an Weihnachten Christbäume mitbrennenden Kerzen in die Stollen stellten.Da sei nie etwas passiert.
Deshalb machten sich Specht und seineKumpel auch keine Gedanken darüber,
dass sie da unten den gewöhn-lichen Gesteinssprengstoff Do-narit 1 einsetzen sollten. Derwar stärker und billiger als diesichereren Sprengstoffe, dieetwa im Steinkohlebergbauvorgeschrieben waren. DieBraunkohle, hieß es, enthalteja viel mehr Wasser als Stein-kohle.
Das stimmte allerdings nichtin jedem Fall, wie Fachleutenspätestens seit dem 4. März1966 bekannt war. Damals gabes in der niedersächsischenBraunkohlegrube Treue nacheiner Sprengung mit Donariteine Kohlenstaubverpuffung,die zu einem Glimmbrandführte. Das zuständige Berg-amt Wolfenbüttel zeigte sichüberrascht. Normalerweise lie-ge der Wassergehalt der Kohledort im Mittel bei fast 50 Pro-zent, meldete das Amt an dievorgesetzte Behörde in Claus-thal-Zellerfeld. Untersuchun-gen nach dem Vorfall hättenaber gezeigt, dass Kohlenstauban Stellen, wo er sich über län-gere Zeit ablagern konnte, aufweniger als 30 Prozent Wassergetrocknet war. Dieser trocke-ne Staub sei „entzündungs -fähig“, warnte das Amt.
Auch die Behörden in Hessen warendurch diesen Vorfall alarmiert. Das Ober-bergamt in Wiesbaden verlangte eine Un-tersuchung. Darauf schickte die Preußen-elektra eine Staubprobe an die „Berg -gewerkschaftliche Versuchsstrecke“ inDortmund-Derne.
Das Ergebnis war eindeutig. Bei derangelieferten Probe betrug der Wasser-gehalt nur noch 21,4 Prozent, heißt es imDortmunder Gutachten vom 14. Juli 1967.Es handle sich um einen „explosionsge-fährlichen, vergleichsweise sehr zündwil-ligen Braunkohlenstaub“.
Der Staub stammte aus der 1980 still-gelegten Stolzenbacher NachbargrubeWeingrund und damit aus demselbenBraunkohleflöz, das auch von Stolzen-bach ausgebeutet wurde. Im November1967 machten die Dortmunder eine Kon-trolluntersuchung, bei der auch eine Pro-
Deutschland
42 D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Bergwerksdirektor Walter L. (r.): Eindeutige Warnungen
AP
Gutachten von 1967 (Ausriss): Nie danach gefragt
be aus Stolzenbach direkt getestet wurde.„Das Ergebnis war im Grunde das glei-che“, erinnert sich der damalige Gutach-ter Dieter Reeh heute. Aus seiner Sichthätte allen Beteiligten damals klar seinmüssen, dass in der Nähe eines solchenStaubs nicht mit Donarit gesprengt wer-den durfte, sondern allenfalls mit siche-rerem Wettersprengstoff.
Reehs Gutachten ging sowohl an diePreag als auch an das hessische Oberberg-amt. Die Behörde hielt im März 1969 ausdrücklich fest, durch diese Tests seinun „erwiesen“, dass explosionsgefähr-liche Braunkohlenstäube „an begrenztenBetriebspunkten auch unter Tage vor-kommen“.
Danach wurden einige Re-geln erlassen, um Bränden vor-zubeugen. Aber die entschei-denden Schlüsse wurden nichtgezogen. Bis zur Katastrophewurde in Stolzenbach weitermit Donarit 1 gesprengt – undzwar nicht nur beim Abbau„frischer“, relativ feuchterBraunkohle, sondern auchbeim sogenannten Ausbau-sprengen, also um bereits nichtmehr gebrauchte Stollen kon-trolliert zum Einsturz zu brin-gen. Dabei war Donarit 1 vonder Bundesanstalt für Material -prüfung ausdrücklich „nichtfür Betriebspunkte mit Schlag-wetter- oder Kohlenstaubex-plosionsgefahr“ zugelassenwor den.
Genau um einen solchen Be-triebspunkt handelte es sichaber bei der Streckenkreuzung5w/5 in der PfeilerstreckeWest, zu der am 1. Juni 1988zur Mittagszeit ein Trupp Bergleute mitzehn Ladungen Donarit 1 anrückte. DieKreuzung wurde zuvor als Übergabe -stelle von einem Kohleförderband zumnächsten genutzt. An solchen Punktenstaubt es besonders stark, und eine ganzeMenge Staub hatte sich über Jahre aufder Stützkonstruktion angesammelt. Die-se Stahlschienen sollte der Trupp spren-gen, um einen nicht mehr benötigten Ab-zweig zu verschließen.
Als die Donaritpatronen etwa um 12.35Uhr zündeten, wirbelte der auf nur noch15 bis 17 Prozent Wassergehalt getrockneteStaub in die Höhe. Das Staub-Luft-Ge-misch entzündete sich und setzte eine Ex-plosion in Gang, die sich kilometerweitdurch das Stollensystem fortsetzte. DieDruckwelle zerstörte Betonteile am Stol-leneingang, warf sie bis zu 200 Meter weitüber das Betriebsgelände und verletzteacht Arbeiter auf dem Zechenhof schwer.Die 57 Kumpel, die zu diesem Zeitpunktin der Grube waren, hatten kaum eineChance. Bei einigen der 51 Todesopfer stell-te der Leichenbeschauer später schwerste
Verbrennungen fest, multiple Knochenbrü-che und abgerissene Gliedmaßen.
Schon eine halbe Stunde nach demKnall stand der Kasseler Oberstaatsan-walt Stephan Walcher auf dem Hof derZeche. Als Abteilungsleiter war er 16 Mo-nate lang für die Aufklärung des Vorfallsverantwortlich. In der ganzen Zeit, sagtder heute 68-Jährige, der seit drei Jahrenpensioniert ist, habe keiner der Beteilig-ten ihn oder seine Kollegen auf das Gut-achten von 1967 hingewiesen: nicht derBetreiber, nicht das Bergamt, nicht ein-mal der Gutachter Reeh selbst, obwohlder von der Staatsanwaltschaft 1988 miteiner Expertise zur Explosionsursache be-auftragt worden war. Reeh sagt, er sei nie
danach gefragt worden – und überdiesdavon ausgegangen, dass die Unterlageja bei der Preag und beim Bergamt in denAkten sein müsse.
Da war sie wohl auch, aber niemandkonnte oder wollte sich daran erinnern.Die Kasseler Staatsanwälte stützten sichbei ihrer Einstellungsverfügung auf eineEinschätzung des Bergoberrats HaraldFranz vom Bergamt Weilburg, der im Au-gust 1989 schrieb, „auch Fachleute“ hät-ten eine Explosion wie in Stolzenbachbislang „nicht für möglich gehalten“. Manhabe immer gedacht, die Braunkohle inder Grube sei dafür zu feucht.
Von dem Dortmunder Gutachten, dasschon 20 Jahre zuvor das Gegenteil beleg-te, will auch Franz erst 2008 erfahren ha-ben, als der Hessische Rundfunk in einemFilm über das Unglück das Dokument er-wähnte, das zwei seiner Reporter in altenBehördenarchiven gefunden hatten. Alser davon erfuhr, sagt Franz, „hat es mirdie Sprache verschlagen“. Hätte ihm dieExpertise 1988 vorgelegen, formuliert Ex-Staatsanwalt Walcher vorsichtig, „hätte
das natürlich noch eine Reihe von Fragenund Ermittlungen aufgeworfen“.
Diese Fragen stellen nun die Witwen,Töchter, Söhne und Geschwister der To-ten. Strafrechtlich, erfuhr Erika Specht,sei alles schon verjährt, die Staatsanwalt-schaft könne den Fall nicht neu aufrollen.Die Angehörigen suchten einen anderenWeg und fanden ihn mit Hilfe einesRechtsanwalts. Der Kasseler Jurist SvenSchoeller reichte eine Zivilklage aufSchmerzensgeld gegen E.on und den da-maligen Bergwerksdirektor Walter L. ein.
Es ist ein komplizierter Weg. Schoellermuss nicht nur schuldhaftes Verhalten derfrüheren Bergwerksbetreiber nachweisen,sondern auch schwere Traumata der Klä-
ger durch den Verlust ihrer An-gehörigen. Für ein erstes Mus-terverfahren hat er eine Witweausgewählt, die Atteste undGutachten darüber vorlegenkann, wie sie nach dem Tod ihres Mannes aus der Bahn geworfen wurde. Viele vonSchoel lers Klienten waren jah-relang in psychotherapeutischerBehandlung, hatten Zusammen-brüche, Todessehnsucht. „Ichfühlte mich zeitweise nichtmehr fähig, meine Kinder zu er-ziehen“, sagt Erika Specht.
E.on weist die Forderungenzurück. Die Sprengungen mitDonarit hätten damals dem„Stand der Technik“ entspro-chen. Schmerzensgeldansprü-che seien verjährt und stündenden Angehörigen schon des-halb nicht mehr zu, weil diePreußenelektra von 1988 bis1992 bereits viel Geld für dieBetreuung der Angehörigen
aufgewandt habe. Der frühere Bergwerks-direktor will sich wegen des laufendenVerfahrens nicht äußern.
Erika Specht hofft, dass in dem Verfah-ren die Wahrheit über den Tod ihres Man-nes herauskommt. Vielleicht helfe ihr das,mit den Erinnerungen fertig zu werden.
Manche Erinnerungen, das weiß sie,werden dennoch bleiben. Etwa die an denersten Jahrestag der Katastrophe. Im Bür-gerhaus fand eine Trauerfeier statt, zweiPfarrer sprachen und ein Hodscha für dietürkischen Kumpel. Am Ende standen 51brennende Kerzen vorn, für jeden gestor-benen Bergmann eine. Die Frauen undMütter der Opfer sollten sie zum Geden-ken mit nach Hause nehmen.
Aber wie?„Ich stand dann da, und das Wachs lief
über meine Hand“, erinnert sich ErikaSpecht. Sie war den Tränen nahe. Die Flam-me auspusten? „Das habe ich nicht übersHerz gebracht.“ Wieder war es die Schwä-gerin, die auftauchte: „Die Doris hat dasdann gemacht.“ MATTHIAS BARTSCH,
RALPH-NICOLAS PIETZONKA, OLIVER SCHMID
Deutschland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 044
Klägerin Specht, Tochter Tanja: Ein Film, der sich nicht abstellen lässt
RO
LA
ND
GE
ISH
EIM
ER
/ A
TT
EN
ZIO
NE
Die Menschenrechtlerin und Ex- Chefin von Amnesty International Irene Khan, 53, über ihre Kindheit in Bangladesch
SPIEGEL: Frau Khan, wie sind Sie auf -gewachsen?Khan: Das Land war schrecklich arm,doch meine Familie war reich. Mein Va-ter arbeitete als Arzt, mein Großvaterwar Anwalt. Wir hatten Bediente, undals Kind spielte ich oft mit Fajal, demSohn unseres Hausmädchens. Wir hat-ten Spielzeuge aus Blech oderLehm, einfache Dinge, wie es inEntwicklungsländern so ist. Spä-ter wurden wir eingeschult, dochFajal verließ die Schule nach ei-nem Jahr: Die Lehrer und seineMitschüler hatten ihn verspot-tet – als Sohn einer Putzfrau.SPIEGEL: Blieben Sie Freunde?Khan: Wir haben uns sehr un-terschiedlich entwickelt. Fajalarbeitete in einer Fabrik. Mit 18heiratete er ein minderjährigesMädchen vom Land und wurdebald Vater. Als die Fabrik pri-vatisiert wurde, protestierte erdagegen. Er wurde trotzdem
entlassen. Fajal wurde dann Rikscha-Fahrer. Als seine Geschäfte schlechtergingen, rutschte er in die Kriminalitätab. Schließlich wurde er erwischt undvon der Polizei zum Krüppel geschla-gen. Heute ist er behindert, wohnt mitseinen Kindern und Enkeln in einemSlum und lebt von Almosen. SPIEGEL: Und Sie?Khan: Ich ging mit 14 Jahren nachEuropa auf ein Internat, studierte inHarvard und machte Karriere, Verein-te Nationen, Amnesty International.
SPIEGEL: Denken Sie oft an Fajal?Khan: Fajals Geschichte deprimiertmich. Wer arm ist, hat keine Kontrolleüber sein Leben. Fajal war ein talen-tierter und intelligenter Junge, aber erkonnte sich nicht entfalten. Armut istdeshalb mehr als nur eine Frage desEinkommens, Armut ist eine Verlet-zung der Menschenrechte. SPIEGEL: Wann sind Sie nach Bangla-desch zurückgekehrt? Khan: Als Generalsekretärin für Am-nesty International habe ich versucht,eine Veränderung auf Politikebene zuerreichen. Jetzt möchte ich Menschen-rechte in der Praxis durchsetzen. Ichbin für eine bangladeschische Organi-
sation unterwegs, die Brac. Ichbesuche Dörfer, spreche mitMenschen und kann direkt etwas für sie tun. SPIEGEL: Und Fajal?Khan: Ich schicke ihm jedenMonat etwas Geld. Undmanchmal kommt er zu Be-such. Seine Kinder sind nun erwach sen, haben eigene Familien. Sie leben in Armut.Aber Fajals Enkel gehen zurSchule.
Irene Khan: „Die unerhörte Wahrheit –Armut und Menschenrechte“. S. FischerVerlag, Frankfurt am Main; 320 Seiten;22,95 Euro.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 046
Szene
Was war da los, Frau Roisah?
Die indonesische Pflegerin Roisah, 35,über Spiele ohne Bewegung
„Wir müssen die Kinder an einen Rahmen binden, damit sie auf ihrenFüßen stehen können. Normalerweiseliegen sie nur oder sitzen: Sie leidenunter zerebraler Lähmung, ihr Gehirnist nicht fähig, die für Bewegungennötigen Signale an alle Körperregio-nen zu senden. Unsere jüngsten Pa-tienten hier im Rehabilitationszen-trum sind vier Jahre alt. Ich werfe ihnen Bälle zu in der Hoffnung, dasssie den Impuls auslösen, zu fangenoder die Füße zu bewegen. Meist bekomme ich nur ein Lächeln. Aberimmerhin: Es scheint Spaß zu machen.Manche weinen allerdings auch. Dastut mir weh, aber es ist eine Reaktion,und die ist wichtig, um Fortschritte zuerzielen. Wir hoffen, dass sie nachzwei Jahren eigenständig stehen.“ Roisah (l.) B
EA
WIH
AR
TA
/ R
EU
TE
RS
Khan
AM
NE
ST
Y I
NT
ER
NA
TIO
NA
L
A R M U T
„Er wurde Rikscha-Fahrer, ich ging nach Harvard“
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 47
Gesellschaft
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE
Die Freiheit der PizzaWarum ein US-Bürger 30 Jahre unschuldig im Gefängnis saß
Raymond Towler lächelt, als ihmder Polizist Handschellen an-legt. „Sorry, aber muss sein“,
sagt der Polizist. Towler nickt. Er setztsich auf die Rückbank des Polizeiautosund schaut auf das Gefängnis, das seinZuhause geworden ist.
Der Wagen beschleunigt, TowlersHerz schlägt stark. Vielleicht ist es die Aufregung über den Tag, diesen 5. Mai, oder es ist die Geschwin-digkeit. Er hat Angst. Er lehnt sichnach vorn zu den Polizisten, so-weit das mit Metallfesseln an Hän-den und Füßen geht. Er sagt: „Bit-te, fahrt vorsichtig, ich habe nicht30 Jahre gewartet, um bei einemVerkehrsunfall zu sterben.“
Raymond Towler aus Cleveland,Ohio, ist 53 Jahre alt. Als er 24war, verurteilte ihn ein Gericht da-für, ein elfjähriges Mädchen in ei-nem Park vergewaltigt zu haben.Das Mädchen hatte den Ermittlernden Täter beschrieben: jung, dun-kelhäutig mit krausem Haar. Tow-ler war jung, dunkelhäutig, seinHaar war kraus. Er kannte dasMädchen nicht. Er hatte es nichtvergewaltigt. Aber er fuhr einigeWochen nach der Tat mit seinemAuto durch den Park. Die Polizeistoppte ihn. Er hatte kein Alibi.Das Mädchen identifizierte ihn alsseinen Vergewaltiger. Towler be-kam 22 Jahre Gefängnis.
„Ich war ein völlig normalerMensch bis zu diesem Urteil“, sagtRaymond Towler. Er angelte imLake Erie, er war ein passablerBasketballspieler, er verdiente seinGeld mit Gelegenheitsjobs, er aßgern Pizza mit Salami und doppeltKäse, er schlief oft bis mittags undliebte es. Dann kam das Urteil:Aus Raymond Towler wurde derGefängnisinsasse A16468. Von die-sem Tag an wurde er morgens um halbsechs geweckt. Und im Gefängnis gabes keinen See.
Doch nun liegt der Overall mit Tow-lers Häftlingsnummer in einem Spindim Lorain County Jail. Towler, hintenim Polizeiwagen, trägt schwarzes Sweat-shirt und weißes Hemd, es fühlt sich gutan, so schön zivil. Der Polizeiwagen hältvor dem Gerichtsgebäude in Cleveland.
Im Saal warten Towlers Anwälte, seinBruder ist gekommen, die Schwesterauch. Reporter sind da. Und Schaulusti-ge, Fans, wenn man so will, Menschen,die Towler später nach Autogrammenfragen werden wie einen Rockstar.
Im Gefängnis war Towler ein verur-teilter Kinderschänder. Er sagte zwar,dass er unschuldig sei, aber im Knastist ja eigentlich jeder unschuldig. „Es
war hart, aber an die Häftlinge habeich mich gewöhnt“, sagt Towler, „vielschlimmer ist es, dass du nicht mehrtun kannst, was du magst.“ Es gab einen Basketballkorb im Gefängnis,aber die Wärter entschieden, werwann einen Ball darauf werfen durfte.Es gab sogar manchmal Pizza, aber sieerinnerte ihn eher an Brot mit Toma-tensauce. Eine Pizza braucht doppelt
Käse, sagt Towler, und sie schmecktnur, wenn man selbst entscheidet, wasdraufliegt. „Es geht nicht um den Ge-schmack, sondern um die Freiheit, diedamit verbunden ist“, sagt er. Die Frei-heit der Pizza.
Towler merkte, dass er etwas findenmusste, das nur ihm gehört, sonst würde er verrückt werden. Er hatte alsKind Gitarrenunterricht gehabt. Im Gefängnis hatte er keinen Lehrer, aberZeit. Das Licht ging immer noch jedenMorgen viel zu früh an, und ihm fehlteseine Angel. Aber die Gitarre gab Tow-ler ein Stück Freiheit zurück. Er lernte Noten, spielte sanften Jazz, lernte auchKlavier und Trompete. Er unterrichteteandere Häftlinge. Er komponierte.
Als Towler 15 Jahre seiner Stra -fe abgesessen hatte, durfte er vor einem Bewährungsausschuss spre-chen. Towler bekam weitere 15 Jah-re. Wieder in seiner Zelle, nahm erdie Gitarre aus dem Schrank. Erspielte lange an diesem Abend.
Im Jahr 2004 setzte sich eineMenschenrechtsgruppe dafür ein,dass die Staatsanwaltschaft die Be-weise im Fall Towler neu prüft.Die Justiz brauchte danach sechsJahre, um die DNA-Spuren in derUnterwäsche des Opfers mit Tow-lers Erbgut zu vergleichen. An die-sem Tag soll das Ergebnis verkün-det werden.
Raymond Towler sitzt zwischenseinen Anwälten, die Finger ver-schränkt im Schoß, die Richterinfasst das Verfahren in ein paar Sät-zen zusammen, es dauert viel-leicht zwei Minuten. Zwei Minu-ten, um zu sagen, dass RaymondTowlers Erbgut nicht mit der DNAin der Unterwäsche des Opfersübereinstimmt. Zwei Minuten, umfast 30 Jahre Haft zu einem Irrtumzu erklären. „May the road rise tomeet you“, sagt die Richterin,möge dein Weg ein leichter sein,sie weint ein wenig, steht auf undschüttelt Towler die Hand.
„Sie hatten den Falschen, und eshat eine Weile gedauert, bis sie das ausgebügelt haben, aber dasEinzige, wofür ich mich interessie-
re, ist, dass sie es ausgebügelt haben“,sagt Towler.
Er tritt aus dem Gerichtssaal inCleveland, es riecht nach gemähtemGras. Er hat für jedes Jahr in Haft ei-nen Anspruch auf 40 330 Dollar Ent-schädigung, das sind rund 1,2 Millio-nen Dollar für 30 Jahre. Mit dem Geldwill sich Towler ein kleines Musikstu-dio finanzieren. TAKIS WÜRGER
Towler (l.)
TO
NY
DE
JAK
/AP
Aus dem „Hamburger Abendblatt“
Gestern Abend war es wieder soweit, einer ihrer Freier kam zu ihrhinter die Scheibe, grapschte,
wollte mehr, als es für 50 Euro gibt.„20 Minuten, normalen Sex“, das habe
sie immer wieder zu ihm gesagt, aber derMann hörte nicht, schlug um sich, schrie,er wolle Analverkehr. Sie drückte denAlarmknopf, die einzige Zuflucht in die-ser Zelle aus Glas, Kacheln, einem Bettmit abwaschbarem Bezug.
In diesem Moment, sagt Angelique, alsdie Polizei wieder einmal nicht kam undder Mann randalierte, da habe sie sichgefragt, warum zum Teufel sie das allestue. Warum sie so dumm sei, sich herzu-geben, ihre Jugend, ihren Körper, hier imAmsterdamer Rotlichtbezirk, bis zu 20-mal am Tag.Warum?
„Ich hab eben nie was anderes gelernt“,sagt Angelique. Sie war 15 Jahre alt, alssie sich in ihren ersten Zuhälter verliebte.Wenn sie aus der Schule kam, wartete erin seinem Auto. Er hatte kurze Röcke ge-kauft, hohe Schuhe, große Ohrringe, siesollte das alles tragen. Sie stieg ein, weilsie ihn liebte. Dann fuhr er sie auf Park-plätze, brachte sie in Wohnungen undvermietete ihren Körper, ein 15-jährigesMädchen. Angelique wurde zum Sex er-zogen.
„Er sah aus wie ein Model“, sagt Ange-lique nun. Sie steuert durch das kopfstein-gepflasterte Straßenlabyrinth des Ams-terdamer Rotlichtviertels De Walen, eingroßes Mädchen mit klimpernden Gold-ohrringen und langem Haar. Touristendrücken sich durch die engen Gassen,Dealer, Freier.
„Ich habe ihn nach der Schule kennen-gelernt“, erzählt Ange lique, nach demUnterricht sei sie mit einer Freundin eineCola trinken gegangen, da habe ihr dieserJunge einen Stuhl angeboten, ein hüb-scher Marokkaner, 19 Jahre alt, er lud sie auf einen Drink ein, dann in sein Au-to, ein bisschen Musik hören. Bald nahmer sie mit auf Partys, in Discotheken, gab ihr Alkohol. Sie verliebte sich. Weni-
ge Wochen später zwang er sie zum ersten Mal, mit fremden Männern zuschlafen.
Loverboys, so nennt man in den Nie-derlanden diese Typen, die Schulmäd-chen durch ihre Liebe an sich binden undsie anschaffen schicken. Junge Männer,die 13-, 14-, 15-jährige Mädchen vor derSchule abfangen oder sie über das Inter-net ansprechen, soziale Netzwerke wieFacebook; die sie abhängig machen vonihrer Aufmerksamkeit, ihrer Zuneigung,von Drogen, bis es zu spät ist und dieMädchen ihnen gehören.
So war es bei Angelique, sie ging da-mals in die achte Klasse; so war es beiMaria, 12, er achtete darauf, dass sie wei-terhin zur Schule ging; so war es auchbei Mowitha, einem 13-jährigen Mädchen,das gern Fußball spielte und Gitarre, be-vor es diesen Jungen traf.
Morgens Mathe, mittags Hure, manch-mal Sex in den Freistunden dazwischen,diese Geschichten erschüttern die hollän-dische Gesellschaft. Weil es nicht Mäd-chen aus zerrütteten Familien, aus sozialschwachen Milieus sind, die hier in dieUnterwelt rutschen und verschwinden,sondern Mädchen aus der Mitte der Ge-sellschaft, Töchter von Lehrerinnen, Café -besitzerinnen, manchmal läuft es überJahre, ohne dass es jemand merkt.
Emotionale Abhängigkeit zwischenProstituierten und Zuhältern hat es im-mer schon gegeben. Frauen werden durchDrogen, Gewalt, auch durch Zuneigunghörig gemacht, damit sie funktionieren.Dass aber junge Männer systematischnach Schulmädchen suchen, um sie zuHuren heranzuziehen, ist ein bisher un-bekanntes Phänomen, das Eltern, Lehrerund Polizei überfordert.
Niederländische Schulen veranstaltendeshalb Aufklärungsseminare, Sozialein-richtungen richten Häuser für die Opferein, Kriminologen beschäftigen sich mitdem Thema. Und auch in Deutschlandwerden die ersten Eltern wach, wendensich an Hilfsorganisationen, weil sie nicht
Gesellschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 048
Amsterdamer Rotlichtviertel, Prostituierte Angelique
P R O S T I T U T I O N
Morgens Mathe, mittags Hure
Sie sind noch Kinder, 12, 13 Jahre alt. Sie verlieben sich zum ersten Mal – und geraten an einen Zuhälter, auf dem Schulhof oder
bei Facebook. Eltern und Polizei kämpfen gegen die Machtsogenannter Loverboys. Oft ist es schon zu spät. Von Dialika Krahe
wissen, wie sie ihre Töchter vor derenZuhältern retten sollen.
„Bald gab er mir auch Marihuana undKokain“, erzählt Angelique. Am Morgenlief sie in die Schule, versuchte, anwesendzu wirken. Am Nachmittag lief sie zuTreffpunkten und stieg in sein Auto.
Wenn sie sich weigerte, kniff er sie,schlug sie, an Armen, Beinen, dort, woniemand es bemerken würde. Ständigklingelte ihr Handy, kamen Nachrichtenvon ihm, „wo bist du?“; „du musst her-kommen, sofort“. Zu Hause erzählte sie,sie gehe zu einer Freundin.
„Ich weiß, dass er schlecht war fürmich“, sagt Angelique, „dass er mein Le-ben versaut hat“, aber wenn sie ehrlichsei, träume sie noch immer von seinenAugen.
Wahrscheinlich steckte sie schon zu tiefdrin, wahrscheinlich war sie nicht mehrerreichbar für fremde Hilfe. „Ab einemgewissen Punkt sind die Mädchen nichtmehr in der Lage, die Realität zu sehen“,sagt Bärbel Kannemann, der Loverboy seidann ihre einzige Wirklichkeit. Kanne-mann ist eine kleine, runde Frau, pensio-nierte Kommissarin, 35 Jahre lang hat siein Deutschland bei der Polizei gearbeitet,nun lebt sie abwechselnd in Deutschlandund den Niederlanden. Sie wurde durcheine Vermisstensendung auf das Thema Lo -verboys aufmerksam. Seit zwei Jahren istsie in der Stiftung „stoploverboys“ tätig.
Jedes Jahr werden in den Niederlandenrund 1500 junge Mädchen Opfer dieserForm von Prostitution, das schätzen Hilfs-organisationen. Die Opfer trauen sich nurselten, zur Polizei zu gehen, weil sie be-droht werden, weil sie sich schämen, sichselbst schuldig fühlen oder keine Beweisehaben. 180 Anzeigen gegen Loverboysgab es vor zwei Jahren, die Dunkelziffer,das vermutet die Polizei, liegt höher.
Die Mädchen sind in der Beweispflicht.Aber wie beweist man Jahre später, dassman als Kind missbraucht wurde? Oft ste-hen die Mädchen während dieser Tatenunter Drogen, unter Schock, die Monateverschwimmen zu einem Brei aus Orten,Gewalt und Sex. Und überhaupt: Werglaubt schon einer Hure?
„Nach der Schule gehe ich zu meinertäglichen Vergewaltigung“, sagt BärbelKannemann, an diesen Zustand hättensich viele der Mädchen gewöhnt. Gemein-sam mit Angeliques Mutter, Anita de Wit,geht sie in Schulen, spricht mit Eltern undOpfern; erst gestern war sie in einem Rot-terdamer Rotlichtviertel unterwegs, aufder Suche nach einer verschwundenenTochter. Allein in diesem Jahr haben siesieben Mädchen aus den Fängen des je-weiligen Loverboys befreit. Und auch inDeutschland versucht Bärbel Kannemannaufzuklären, vor wenigen Wochen mel-deten sich bei ihr die ersten Opfer.
Die Mechanismen, mit denen die Mäd-chen hörig gemacht werden, sagt Kanne-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 49
MA
RC
US
KO
PP
EN
AC
TIO
N P
RE
SS
(l.), Mutter: „Ich hab eben nie was anderes gelernt“
mann, sind gleich: Die Zuhälter entfrem-den sie ihrem Umfeld, hetzten sie gegendie Familie auf, bis sie die einzige Be-zugsperson der Mädchen geworden sind.
Es ist ein ausgeklügeltes System ausKontrolle, Macht und Belohnung. Irgend-wann wissen die Mädchen kaum noch,wer sie ohne diese Männer sind, sagt Bär-bel Kannemann. Manchmal dauert es Jah-re, bis sie wieder ein eigenes Leben füh-ren können.
Maria Mosterd hat das geschafft, dieFrage ist, wie lange es hält. „Wenn ermich finden würde“, sagt sie, „ich weißnicht, ob ich nicht wieder zurückgehenwürde zu ihm.“
Sie sitzt im Garten eines Reihenhausesin einer holländischen Kleinstadt, ein hüb-sches Mädchen, ihre Haare sind zu Zöp-fen geflochten. Niemand solle wissen, wosie lebt, sagt sie. Sie ist 22 Jahre alt, hateine kleine Tochter jetzt, ein Leben,„aber es ist schwer für mich“, sagt sie.Jahrelang hat sie nach Befehlen gelebt,„was ich anziehen soll, was ich sagen soll,mit wem ich schlafen soll“, über alleshabe er bestimmt, „und plötzlich muss ichso viele Entscheidungen allein treffen“.
Der Tag, an dem Maria ihren Loverboytraf, war sommerlich, August oder Sep-tember, sie fuhr mit dem Fahrrad zur neu-en Schule, Maria war 12 Jahre alt.
Er lehnte an seinem Wagen auf demSchulparkplatz, sein Auto hatte verdun-kelte Scheiben, ein dicklicher Typ,schwarze Haut, schwere Goldkette umden Hals, wie ein Darsteller aus einemRap-Video.
„Hallo“, rief er ihr hinterher, mehrnicht, cool klang das, fand Maria, sie fühl-te die Blicke der anderen Mädchen, be-wundernd, neidisch vielleicht. „Hallo“,rief sie, dann fuhr sie in die Schule.
Wenige Tage später stand er wieder da,diesmal wollte er mit ihr reden, machteKomplimente. Er sei Manou, sagte er.Beim übernächsten Mal nahm er sie inseinem Auto mit, brachte sie in ein Haus,vergewaltigte sie, so erzählt Maria es. Ersagte ihr, es sei normal, dass Mädchen inihrem Alter so etwas täten. Sie war nunseine Prostituierte, sein Eigentum.
Er holte sie nach der Schule ab, gabihr Marihuana, vermietete sie in den Frei-stunden, passte auf, dass sie rechtzeitigwieder im Unterricht saß, wichtige Testsmitschrieb, er sorgte dafür, dass niemandetwas merkte.
Marias Mutter, Lucie Mosterd, eineLehrerin an einer benachbarten Schule,beobachtete, wie sich ihre Tochter ver -änderte in dieser Zeit, wie sie eine Frem-de wurde. „Sie war aggressiv, ihre Spra-che änderte sich“, sagt sie. Früher sei Ma-ria schüchtern gewesen, ausgeglichen.„Plötzlich war sie ein Biest, eine Schlam-pe.“ Wenn Maria am Nachmittag nachHause kam, ging sie zuallererst unter dieDusche. „Ich dachte, sie sei verschwitzt
vom Fahrradfahren“, sagt ihre Mutter, inWirklichkeit wusch sich ihre Tochter dieFreier vom Körper, dann knallte sie ih- re Tür.
Für Eltern ist es schwer einzuschätzen,ob die Veränderung ihrer Töchter nochauf die Pubertät zu schieben ist. Es istdie Zeit, in der sich ohnehin Risse bildenin der Beziehung zwischen Eltern undKindern. „Ich dachte, das sei pubertäts-bedingt“, sagt Lucie Mosterd, Marias Mut-ter. „Vielleicht auch Depressionen. OderBorderline.“ Sie schickte ihre Tochter zueiner Therapeutin, „aber ich war eine bril-lante Lügnerin geworden“, sagt Maria,für alles habe sie eine Erklärung gehabt.
Auch in der Schule merktelange Zeit niemand, was mitMaria los war. Ihr Loverboydosierte ihre Fehlzeiten so,dass es grenzwertig, abernicht alarmierend war. Wennsie den Unterricht verlas-sen sollte, erzählte Maria, siemüsse zum Arzt, oder sie ließ sich andere Lügen ein -fallen.
Nach zwei Jahren, als Maria 14 war,ging ihr Loverboy zum ersten Mal mit zuihr nach Hause, ein nettes Reihenhaus,an einer kleinen Gracht gelegen. Er stelltesich der Mutter als neuer Freund vor, ersagte, er mache eine Ausbildung an derBerufsschule neben der Schule von Maria.Die Mutter fand den Jungen zu alt, erhatte ja schon ein Auto, aber er war nett,und so erlaubte sie ihm, Maria zu besu-chen, solange sie zu Hause war.
Er saß mit der Familie am Tisch beimAbendessen, er spielte mit Marias kleinenBrüdern. Es gibt Fotos von ihm und Ma-ria, auf manchen hält er sie im Arm. Aufanderen ließ er sich mit Kampfhundenfotografieren.
Maria war nun fast nur noch auf Dro-gen. Sie war brutal geworden, wer sie inder Schule ansprach, bekam Schläge. Siedealte für ihn, stellte ihm andere Mäd-chen vor. Irgendwann, als Maria 16 war,wurde sie von einer Lehrerin angespro-chen, ihr aggressives Verhalten, ihre Fehl-zeiten in der Schule, die rotgerändertenAugen waren der Pädagogin aufgefallen.Weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte,erzählte Maria der Lehrerin, wie sie vonvier Männern in einer Wohnung verge-waltigt worden sei.
„Ich habe damals gar nicht verstanden,warum sie und meine Mutter so eine gro-ße Sache daraus machten“, sagt Maria,
„für mich war das Alltag.“ Sieführte die Polizei zu der Woh-nung, in der es passiert war,drei der Männer wurden ver-urteilt, zu lächerlichen Haft-strafen, wegen Sex mit Min-derjährigen, nicht wegen Ver-gewaltigung. Manou, ihrenZuhälter, brachten sie nichtdamit in Verbindung, Mariahielt dicht. „Ich war so abhän-
gig von ihm“, sagt Maria, „es war wieeine Sucht.“
In den Niederlanden kommen Mädchenwie Maria, die Opfer von Loverboys wur-den, zu ihrer eigenen Sicherheit in eineSpezialabteilung des Jugendgefängnisses.Ihre Mutter war verzweifelt, stellte die Toch-ter vor die Wahl: Gefängnis oder ein the-rapeutisches Projekt in Indien, so weit wegvon ihm, dass er sie niemals finden würde.Maria ging nach Indien, sie war jetzt 16,arbeitete dort mit Kindern in einem Wai-senhaus, sprach täglich mit ihrer Sozialar-beiterin. Es dauerte lange, bis sie einsah,dass dieser Mann ein Täter war. „Ich kann-te mich ja gar nicht ohne ihn“, sagt sie, eswar, als sei sie mit ihm groß geworden.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 050
Der Loverboy
saß mit der
Familie am Tisch,
er spielte mit
Marias kleinen
Brüdern.
Mutter Kempen im Kinderzimmer der vermissten Tochter: Spur in ein deutsches Bordell
MA
RC
US
KO
PP
EN
Gesellschaft
„Mein Leben ist langweilig heute“, sagtMaria jetzt, in ihrem kleinen Garten, hin-ter ihrem Reihenhaus. Ja, sagt sie, dashört sich absurd an, aber irgendwie, aufeine kranke Art und Weise, vermisse siedie Aufregung ihres früheren Lebens. Siesei ein stumpfer, harter Mensch gewordendurch ihn, sagt sie. Es sei schwer für sie,mit anderen Menschen mitzufühlen. Lie-be, eine Beziehung, das kann sie sichnicht vorstellen. „Männer sind für michwiderliche Kreaturen.“
Es ist früh am Morgen, ein klarer Früh-lingstag im südholländischen Maasland,70 Kilometer weiter bereitet sich Ange -lique, das Amsterdamer Mädchen, aufihre nächste Schicht hinter der Schaufens-terscheibe vor, als sich ihre Mutter, Anitade Wit, in einem stickigen Klassenzimmervoller Teenager hinter das Pult setzt. Siewill verhindern, dass es noch mehr Mäd-chen gehen wird wie ihrem eigenen.
„Was ist ein Loverboy?“, fragt sie. „EinPimp, Zuhälter“, sagen die Schüler undkichern.
Anita de Wit startet einen Film, einMädchen ist zu sehen, das erzählt, wiees von seinem Loverboy zum Sex ge-zwungen wurde, wie es für ihn Drogenschmuggelte, wie es erwischt wurde undnun im Gefängnis sitzt. Auch Maria Mos-terd ist zu sehen. Und dann ist da nocheine Aufzeichnung aus einer holländi-schen Vermisstensendung von 2007.
Angelique war damals aus einer thera-peutischen Einrichtung verschwunden,zusammen mit einem Jungen, und Anitade Wit suchte ihre Tochter mit Flyern, inRotterdam, in anderen Städten, immer inBegleitung eines Kamerateams.
Plötzlich, nach sechs Wochen, erhieltsie einen Anruf von ihrer Tochter. „Wobist du, wo bist du?“, fragte die Mutter.„Ich weiß es nicht“, sagte Angelique, Pa-
nik lag in ihrer Stimme, „irgendwo in Rot-terdam.“
Sie sei aus einem Haus weggelaufen,voller Männer, sie sei in ein Telefonge-schäft gerannt. Man sieht in dem Film,wie sich Mutter und Tochter das erste Malwiedersehen, Angelique ist verquollen,die Augen verweint. „Sie haben mich ge-zwungen, Drogen zu nehmen und mitMännern zu schlafen“, sagt sie. Die Poli-zei stürmte das Haus und nahm die meis-ten von ihnen fest.
Danach schien es Angelique besserzu-gehen. Sie half ihrer Mutter in der Stif-tung stoploverboys, sie schien es über-standen zu haben. Sie war inzwischen 19Jahre alt. Dann, an einem Wochenendein Amsterdam, traf sie Yassin, ihren nächs-ten Zuhälter, verliebte sich, der Horrorbegann von vorn.
Angelique, die eine, ist inzwischen sogehirngewaschen, dass sie sich freiwilligfür einen Mann prostituiert. Maria, dieandere, lebt versteckt an einem geheimenOrt und trauert ihrer Vergangenheit hin-terher. Mowitha Wittmer wird sich nochentscheiden müssen, in welche Richtungdas Leben für sie gehen soll, sie ist ab -gehauen, weg, verschollen, seit dem 5. November 2009 einfach nicht mehr da.
„Die letzte Spur von ihr führt in eindeutsches Bordell“, sagt Estella Kempen,ihre Mutter. Sie sieht sich um im Kinder-zimmer unter dem Dach ihres Hauses inMaastricht, hier hat Mowitha gelebt.Estella Kempen ist eine zierliche Frau,verzweifelt, aber aufrecht. „Happy Birth-day Mowitha, Sweet 16“, steht an einerTafel, an den Wänden Urlaubsbilder, Pos-ter von Bob Marley, Lichterketten, einnormales Teenagerzimmer. „In Wirklich-keit habe ich sie schon viel früher verlo-ren“, sagt die Mutter nun. Mowitha war13 Jahre alt, als sie ihren Loverboy traf.
Vor fünf Monaten ist sie weggerannt, siewar da gerade in einer geschlossenen Ein-richtung für Mädchen.
Estella Kempen ist Musiklehrerin, sowie ihr Mann, sie lebt in einem schönen,warmen Zuhause, liebevoll eingerichtet,ihre Stimme klingt erstaunt, wenn sieüber die Geschichte ihrer Tochter spricht,so, als wäre das alles eine Geschichte, diesie gerade zum ersten Mal hört. Doch vorihr auf dem Tisch liegen Polizeiunter -lagen, Gerichtsvorladungen, Beweise ausvier Jahren, Spuren einer Tochter, dieverlorengegangen war.
Mowitha war in demselben therapeuti-schen Projekt in Indien gewesen, in demauch Maria Mosterd war, um von ihremLoverboy loszukommen. Fotos von ihrim Sari liegen auf dem Tisch, ein strah-lendes Mädchen mit Locken und Som-mersprossen. Zurück in den Niederlan-den, sah es eine Zeitlang aus, als kämesie wieder zu sich, als wolle sie ein nor-males Leben führen. Aber dann rutschtesie noch einmal ab, und ihre Mutter konn-te sich nicht anders helfen, als sie ins Ju-gendgefängnis einzuweisen.
Von dort ist sie im November mit ei-nem anderen Mädchen über den Zaungeflüchtet. Ihr Loverboy hatte wieder zuihr Kontakt aufgenommen, über das In-ternet, über E-Mail und MSN.
Die Ermittler haben seine Mails ge-knackt. Er nennt sich babsycle23. Sie müs-se sich jetzt, steht in einer Mail, ihrenPass besorgen, er wolle sie ins Auslandbringen. Sie solle sich auch zwei Tattoosmit seinem Namen auf die Brüste machenlassen. So markieren Zuhälter ihre Pro -stituierten.
Zusammen mit Anita de Wit, der Mut-ter von Angelique, und Bärbel Kanne-mann von stoploverboys sucht EstellaKempen nach ihrer Tochter. Sie hat Flyergedruckt, einmal auf Holländisch, einmalauf Deutsch, darauf ein Foto von Mowi -tha, 17 Jahre alt, 1,60 Meter groß. Sie fol-gen den Hinweisen von Informanten ausder Szene. Ein Mädchen hat sich gemel-det, das sagte, es habe mit Mowitha in ei-nem Bordell bei Kleve gearbeitet. EstellaKempen wird dorthin fahren, wird Flyerverteilen, Bordelle durchsuchen.
Vor ein paar Wochen legte der nieder-ländische Justizminister Ernst Hirsch Bal-lin einen Gesetzesentwurf vor, der dasMindestalter für Prostituierte von 18 auf21 anheben will, um dadurch auch Min-derjährige besser vor unfreiwilliger Pro -stitution zu schützen, vor Menschenhan-del, Loverboys.
Estella Kempen wird das vermutlichnicht mehr helfen. Sie hat ihre Tochterschon fast verloren. Im Oktober wird Mo-witha 18 Jahre alt, dann ist sie nicht mehrminderjährig. Dann wird sie eine sein wieAngelique, eine Prostituierte hinter derFensterscheibe oder in irgendeinem Bor-dell auf der Welt. �
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 51
Loverboy Manou: Er achtete darauf, dass sie rechtzeitig zum Unterricht zurück war
„Ich bin unschuldig“, sagt David, aberda ist ein zweifelndes Flackern in seinemBlick, und es flackert immer stärker, jelänger der Abend wird. Neben ihm er-scheint nun eine Frau mit glattgeföhntenHaaren und einer schwarzen Robe. Dasist seine Pflichtverteidigerin NaseemaKhan. Sie lächelt begütigend, mehr kannsie im Moment nicht tun. Sie kennt dieAkte noch nicht, und der Fall klingt voll-kommen fremd für sie.
Der Gang des Gerichtsgebäudes ist mitden Fahnen der WM-Teilnehmerländergeschmückt. In der Lobby steht ein Papp-aufsteller mit den Richtlinien der Fifa, de-ren Auftrag sich die südafrikanische Justizwohl verpflichtet fühlt. Die Schnellgerich-te, die überall im Land arbeiten, solltendie Kriminellen, vor denen sich die Organisatoren der Weltmeisterschaft imVorfeld fürchteten, abschrecken. Entspre-
Johannesburger Stadtteil Sandton, wo jeden Tag Hunderte Fußball-Fans nachKarten anstehen, und wartete. Er wurdemehrfach von einem Mann mit Schal an-gesprochen, der Karten kaufen wollte,aber David sagte ihm jedes Mal, er wollenicht verkaufen, sondern tauschen, undirgendwann nickte der Mann. David folg-te ihm und wurde von einem Polizeibe-amten verhaftet. Sie fanden 25 Tickets inseiner kleinen Umhängetasche. Sie legtenihm Handschellen an, brachten ihn aufeine Wache, nahmen seine Fingerabdrü-cke, seinen Reisepass und steckten ihn ineine Zelle. Nach etwa einer Stunde wurdeer gegen eine Kaution von umgerechnet200 Euro freigelassen und aufgefordert,vier Tage später in Randburg zu erschei-nen, wo eines der 56 Schnellgerichte tagt,die für die Zeit der WM in Südafrika ein-gerichtet wurden. Da ist er nun.
Am Abend, als das letzteAchtelfinale der Fußball -weltmeisterschaft 2010gespielt wird, wartet eineinsamer Mann mit ei-nem Deutschland-Schalim Gerichtsgebäude von
Randburg darauf, dass er weiterkommt.Randburg ist ein Vorort von Johannes-burg, in dem Villen stehen, die von Si-cherheitsanlagen umstellt sind, die an dieBerliner Mauer erinnern. Die Bürger vonRandburg schützen sich vor der Krimina-lität, die dort draußen lauert, und instink-tiv begreift der Mann mit dem Deutsch-land-Schal, dass diese allgegenwärtigeAngst vorm Bösen auch ihm zum Ver-hängnis werden könnte. Er ist in Zusam-menhänge geraten, die er nicht mehr ein-schätzen kann, und möchte deshalb nicht,dass sein vollständiger Name bekanntwird. Sein Vorname ist David.
David ist Ende dreißig, er wurde in ei-nem mittelöstlichen Land geboren, lebtaber seit über 30 Jahren in Deutschland,er ist deutscher Staatsbürger, Mitglied imFan-Club der deutschen Nationalmann-schaft sowie im Fan-Club von Hannover96. Er ist verheiratet, hat zwei Kinderund betreibt zusammen mit seiner Frauein kleines Reisebüro. Als die Weltmeis-terschaft begann, saß David auf seinerCouch in Hannover und entdeckte imFernsehen, dass es in den Stadien freiePlätze gab. Je mehr Spiele er sah, destomehr frei Plätze entdeckte er, und irgend-wann konzentrierte er sich mehr auf diePlätze als auf den Ball. Da sagte seineFrau: Komm, fahr hin! Sie schenkte ihmein billiges Ticket, das ihn am 15. Juniüber Istanbul nach Johannesburg brachte.Dort lernte er schnell ein paar neue Fuß-ballfreunde kennen, die in ihrem Apart-ment im Viertel Melrose Arch noch einBett frei hatten. David bezahlt 40 Europro Nacht, inklusive Frühstück, und be-gab sich auf Kartensuche.
Er sah die Spiele Südafrika gegen Uru-guay und Frankreich gegen Mexiko undkaufte für sich und seine neuen Freundeauch Karten für Viertelfinalspiele, derenAnsetzungen noch nicht feststanden. Lei-der interessierten ihn und seine Freundediese Spiele später gar nicht, und so ver-suchte er, die Karten umzutauschen. Erging zum großen Fifa-Ticket-Schalter im
Gesellschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 052
J U S T I Z
Ein vorübergehendes VerbrechenBei der Fußball-WM müssen südafrikanische Schnellgerichte auf Wunsch
der Fifa für Abschreckung sorgen. So ist ein bedrohliches juristisches Getriebe entstanden, in das auch ein deutscher Fan geriet. Von Alexander Osang
Fifa-Präsident Blatter bei der WM-Eröffnung in Johannesburg am 11. Juni, Fußball-Fan David: Diese
chend drastisch sind die Strafen ausgefal-len. Vor ein paar Tagen ist vorm Schnell-gericht in Soweto ein Südafrikaner fürfünf Jahre ins Gefängnis geschickt wor-den, weil er einem Touristen das Handystahl. In Rustenburg musste ein Mann,der eine kostenlose Werbedecke und einpaar Flaschen Bier klaute, für zwei Jahreins Gefängnis. Juristen aus dem In- undAusland beklagten sich in den vergan- genen Tagen über „Polizeistaat-Metho-den“. Südafrika habe sich zum Büttel der
Fifa gemacht, erklärte ein hoher westli-cher Diplomat.
David hat davon gehört, er ahnt, dassseine Zukunft ungewiss ist. Fünf Jahre fürein gestohlenes Handy, da würde er auchnoch die nächste WM verpassen. Er nes-telt an seinem Schal und schaut auf diebeiden Männer, die im hinteren Teil desGangs warten. Es sind die Männer, die Da-vid verhaftet haben. Der Polizeibeamteist bullig, trägt ein fliederfarbenes Hemdund eine Krawatte, die seltsam unpassendan ihm hängt. Der Mann, der David an-lockte, trägt ein schwarzweiß kariertes Ja-ckett mit einer großen Fifa-Brosche amRevers. Er erinnert an einen Zauberkünst-ler, aber später erfährt David, dass der Mannfür „Crime Line“ arbeitet, einen privatenDienst, der anonyme Anzeigen per SMSentgegennimmt und der hier bei der WMTrickbetrüger ausfindig machen will. Der
Mann von Crime Line und der Polizistsind die beiden Hauptzeugen im Prozess.David konnte keine Zeugen beibringen.
Es ist kurz nach halb sechs. Die WM-Gerichte arbeiten bis 23 Uhr. David undseine Pflichtverteidigerin warten auf dieAkte und den vereidigten Übersetzer. DiePflichtverteidigerin hofft, dass der Über-setzer nicht auftaucht, weil es ohne Über-setzer keinen Prozess geben kann. Im-merhin sei das hier ein Rechtsstaat undkeine Bananenrepublik.
David lächelt leicht. Er zeigt Fotos, dieer mit dem Handy aufgenommen hat. EinFoto aus der Zelle. Ein Foto, das ihn mitHeiner Brand und Mirko Slomka zeigt,die er vor Soccer City getroffen hat. Erhat auch ein Foto mit Jörg Berger, aberdas ist älter. Die Fotos aus besseren Tagenerinnern David an seinen ursprünglichenPlan, die deutsche Mannschaft bis ins Finale zu begleiten.
„Das ist doch ein Schlag gegen dasHerz von jedem Fußball-Fan“, sagt David,ein bisschen aufmüpfiger jetzt, moralischentrüstet. Doch seine kleine Wut ver-fliegt, als der Oberstaatsanwalt auf denFlur tritt, um eine schnelle Zigarettedurchzuziehen. Er heißt Thys de Jager,ist knapp zwei Meter groß und trägt einebeeindruckende Robe.
„Das ist doch der Diebstahl“, sagt erdurch den Zigarettenrauch, der ihm in
den Augen brennt, und nickt in Richtungvon David. „Ein klarer Fall.“
„Diebstahl?“, fragt die Pflichtverteidi-gern Naseema Khan. Aber der Staats -anwalt ist schon weg. David wird blass.Seine Anwältin zuckt mit den Schultern.Sie muss erst die Akte sehen.
Auf dem Gang nähert sich ein ältererHerr mit wippendem silbrigem Scheitelund rotem Gesicht. Das ist Berndt Hasl-beck von der Deutschen Botschaft in Pre-toria. Er ist schon im Ruhestand, wohntin seiner Heimatstadt Regensburg, aberfür die Weltmeisterschaft haben sie ihnnoch mal reaktiviert, weil er früher einpaar Jahre an der Botschaft gearbeitet hat.Er ist eigentlich nur für die Betreuung desFan-Camps der deutschen Nationalmann-schaft zuständig. Sie haben ihn hierherge-schickt, weil kein anderer da war.
„Ich bin die konsularische Betreuung“,sagt Berndt Haslbeck.
„Regensburg ist ja eine schöne Stadt“,sagt David.
Schließlich kommt die Akte, und alssie wenig später in den Gerichtssaal ge-rufen werden, ist auch der vereidigte Dol-metscher da. Er heißt Prince Edoba NinoOni, stammt ursprünglich aus Nigeria undhat ein abgegriffenes Cassell’s-Wörter-buch für Englisch-Deutsch in der Hand.Er begrüßt David mit den Worten: „InAfrika Gefängnis nisch gut.“
Der Staatsanwalt erklärt, dass sie denGerichtssaal wechseln müssen. Der hiersei nicht für internationale Kriminalitätzuständig.
„Ist das gut oder schlecht?“, fragt Davidseinen Dolmetscher.
„Scheiße“, sagt Prince Oni und wackeltmit dem Kopf. David starrt ihn hilfe -suchend an.
„Keine Angst, keine Angst“, sagt PrinceOni. Dann sagt er „Afrika!“, lacht undschüttelt den Kopf. Er wird noch oft kopf-schüttelnd lachend „Afrika!“ rufen an die-sem Abend. Einmal sagt er auch „Mugabe!Ach!“. Prince Oni ist einer der 200 Dol-metscher, die zusammen mit 110 Richtern,260 Staatsanwälten und fast 1500 Hilfskräf-ten für WM-Schnellgerichte freigestelltworden sind. Er bekommt umgerechnet2000 Euro im Monat, sagt er. Dafür sprichter auch ein wenig Zulu und Russisch, weiler, wie er sagt, „in Tage von Kommunis-mus“ in Moskau studiert habe.
Die Pflichtverteidigerin schlägt vor, dassDavid sich schuldig bekennt, die Absichtgehabt zu haben, fünf Karten zu verkau-fen. Fünf ist offenbar die magische Grenzeeines Verbrechens, von dem hier niemandso richtig weiß, wie er es bewerten soll.Die Wünsche der Fifa mischen sich mitdem südafrikanischen Recht zu einem be-drohlichen juristischen Ausnahmezustand.
„Ich wollte doch aber nur tauschen“,sagt David.
Die Anwältin erklärt, dass man aus derTatsache, dass er 25 Karten bei sich hatte
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 53
PE
DR
O U
GA
RT
E /
AF
P
KA
Y M
ITN
AC
HT
allgegenwärtige Angst vor dem Bösen
und zwischen lauter Händlern stand, so-wie der Aussage der beiden Zeugen Indi-zien basteln könne. Deswegen sei es bes-ser, er gestehe die fünf Tickets. Aus demEingeständnis würde sie mit dem Staats-anwalt, den sie gut kenne, einen Deal aus-handeln, der ihm auf jeden Fall eine Ge-fängnisstrafe erspare. Die Belastungszeu-gen würden im Falle eines Geständnissesgar nicht erst aufgerufen.
„Kann ich mich darauf verlassen?“,fragt David. „Ich kriege meine Kautionwieder, meinen Pass und kann das Landverlassen?“
Die Anwältin nickt leicht, Prince Onisagt: „Normal“.
„Ich will so schnell wie möglich raus“,sagt David.
„Rufen Sie mich bitte an, wenn Sie dasLand verlassen“, sagt Berndt Haslbeckvon der Deutschen Botschaft.
David nickt. Haslbeck lädt, als sei nunbereits etwas erledigt, alle zum Bierabendin die Deutsche Handelskammer ein.Donnerstag. Es gibt Bustransfers. DerLockvogel von Crime Line erfährt ausseinem Handy, dass Paraguay Japan imElfmeterschießen besiegt hat. Der Krimi-nalbeamte, der eher aussieht wie ein Rug-by-Fan, nickt anerkennend. Prince Oni,der Dolmetscher, schreibt sich ein paarVokabeln aus seinem Englisch-Deutsch-Wörterbuch auf ein A4-Blatt.
Die Anwältin zieht sich mit David ineine Art Lüftungsschacht zurück, der vol-ler Taubendreck ist, schließt die Tür underfindet hier ein günstiges Leben für ih-ren Mandanten. Das geht in etwa so: Erist ein armer, deutscher Fußball-Fan, dersich die Reise hierher nie hätte leistenkönnen. Er verdient 800 Euro im Monat.Er hat gute Freunde, die Geld für ihn sam-melten, Freunde aus dem Fan-Club derdeutschen Nationalmannschaft. Von denSpenden hat er ein äußerst günstiges Flug-ticket gekauft. Als er hier war, hat er imAuftrag von weiteren Freunden Fußball-Tickets gekauft. Dann stellte sich aberher aus, dass diese Freunde es nicht zuden Spielen schaffen. Ihr Mandant habezunächst versucht, der Fifa die Ticketszurückzuverkaufen, aber die sei nicht in-teressiert gewesen, da habe er den Ticket-Schalter verlassen und all die Händler ge-sehen und sich gedacht, dann verkaufeich sie eben so.
Ab und zu wehrt sich David gegen die-se Phantasie, aber irgendwann gibt er auf.Er will nur noch gerettet werden. Er bittetallerdings, den Fan-Club der deutschenNationalmannschaft aus dem Spiel zu las-sen. Das ist auch im Sinne von BerndtHaslbeck.
David fragt seinen Dolmetscher PrinceOni, ob das Geständnis so gut sei.
„Kein Problem“, sagt Prince Oni.„Brauch kein Angst“.
Es ist halb neun. Das Spiel Spanien ge-gen Portugal beginnt. Der Richter bittet
alle in den Gerichtssaal. Er ist ein älterer,unglaublich müde wirkender Herr in ro-ter Robe, der ruhig im schnarrenden Eng-lisch der südafrikanischen Weißen spricht.Er hört sich kurz die Anwältin an undbittet sie dann, in 45 Minuten wieder -zukommen. Das wäre in der Halbzeit -pause, vielleicht ein Zufall. Während sei-ne Pflichtverteidigerin das Geständnisschreibt, geht David mit seinem Dolmet-scher und seinen beiden Belastungszeugenin den kleinen Aufenthaltsraum der Ge-
richtsdiener, um Fußball zu schauen. Inder 35. Minute, es steht immer noch 0:0,ruft der Richter sie zurück in den Saal.
Die Pflichtverteidigerin liest die Phan-tasieversion der Geschehnisse vor, auf diesie sich geeinigt haben, der Gerichtsdol-metscher übersetzt einzelne Brocken ausihrem Vortrag in Ausrufe, die nur entferntdeutsch klingen. Der Richter hört gedul-dig zu. Am Ende sagt er, dünn lächelnd:„Sie führen ein ziemlich ausschweifendesLeben für jemanden, der nur 800 Euroim Monat verdient, Herr Angeklagter.“
David starrt durch ihn hindurch. SeineVerteidigerin erzählt schnell, dass ihrMandant zwei kleine Kinder habe, dasser Ausländer sei und seine Tat zutiefstbereue. Der Richter schaut ernst undmüde und schweigt einen Moment. In derkleinen Pause schwebt das Schicksal vonDavid, dem größten Deutschland-FanHannovers. Er könnte gleich in das dunk-le Loch fallen wie der Deckendieb ausRustenburg oder der Telefondieb aus So-weto. Ein Loch, das entstanden ist, weildie Fifa unbedingt recht behalten wolltemit ihrer Entscheidung, diese Weltmeis-
terschaft nach Afrika zu geben, weil diealten Männer der Organisation ein wei-ßes, unbeflecktes Turnier wünschten undSüdafrika sie nicht enttäuschen möchte.Aber der Richter füllt das Loch mit Worten.
„Das Verbrechen, das wir hier verhan-deln, war vor zweieinhalb Wochen nochkein Verbrechen, und ich bin mir nichtsicher, ob es in zwei Wochen immer nochein Verbrechen sein wird“, sagt er undblättert in den Unterlagen auf seiner Rich-terbank. „Das ist alles ungewohnt für unsin Südafrika, aber wir sind ein jungesLand, wissen Sie. Ich lese hier, dass ichSie zu fünf Jahren Haft verurteilen könn-te oder zu einer Geldstrafe von 20000Euro.“
„Ohhh“, übersetzt Prince Oni. „Teuer,und du musst in Gefängnis, lang, viel-leischt.“
David schwankt leicht in seiner Bank,Herr Haslbeck öffnet den Mund.
„Wenn ich es richtig verstehe, hindertder illegale Handel mit Tickets die wirk-lichen Fußball-Liebhaber daran, die Spie-le hier zu erschwinglichen Preisen zu be-suchen“, sagt der Richter.
„Du hast gemacht Leute kaputt“, sagtPrince Oni.
„Deswegen verurteile ich Sie zu einerStrafe von 2000 Rand. Das sind 200 Euro.Wenn Sie die nicht bezahlen, müssen Siefür 100 Tage ins Gefängnis. Ich hoffe, esist Ihnen eine Lehre.“
„Du bezahlen kleine Geld, mach bitte,dann nach Hause, auf Wiedersehen“, sagtPrince Oni. Besser kann man es nicht zu-sammenfassen. Es ist zehn Uhr. Im Fifa-Hotel „Michelangelo“ in Sandton flanie-ren die Könige der Organisation in langenGewändern über dicke Teppiche. Manchevon ihnen sehen aus, als hätten sie nichtsdagegen, denjenigen, der ihre Geschäftebedroht, auch steinigen zu lassen. Etwa50 Urteile haben die WM-Schnellgerichtebislang gefällt, jedes von ihnen kostet densüdafrikanischen Steuerzahler im Schnitt200 000 Euro.
Als er seinen Pass zurück und die 2000Rand Kaution als Strafe hinterlassen hat,fragt David: „Da bin ich doch gut weg -gekommen?“
„Sehr gut, sehr gut“, sagt Herr Hasl-beck von der Deutschen Botschaft. „Siesollten schnell das Land verlassen. Undmöglichst nicht mehr telefonieren. Diehören hier auch gern die Telefone ab.“
David nickt versteinert. Er verspricht,sein Zimmer bis zu seiner Abreise nichtmehr zu verlassen. Berndt Haslbeck er-innert an den Bierabend in der DeutschenHandelskammer, und dann verlässt dernigerianische Dolmetscher das Gerichts-gebäude von Randburg.
„Afrika!“, sagt Prince Edoba Nino Onizum Abschied. Es klingt wie eine Erklä-rung, aber es ist nicht einmal die halbeWahrheit.
Gesellschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 054
Übersetzer Oni
„Du bezahlen kleine Geld“
MA
RK
US
ULM
ER
/ P
RE
SS
EF
OTO
ULM
ER
Bitte keine Verlängerung“, sagt DirkGieselmann, bevor das Spiel über-haupt losgeht. Gieselmann ist seit
vier Wochen im Einsatz. Tagsüber ver-leiht er den matten Sportseiten des „Ta-gesspiegels“ ein bisschen Frische, dann,wenn es dunkler wird in Berlin, abernicht kühler, muss er oft für die Internet-seite der Zeitschrift „11 Freunde“ denLiveticker schreiben. Außerdem ist danoch das Bundesliga-Sonderheft. Also bit-te keine Verlängerung.
Draußen vor der Großbildlein-wand im kurzfristig aufgebautenStadion der „11 Freunde“ trinkenetwa tausend junge MenschenBier aus Plastikbechern, singenfür Portugal oder Spanien. Hinten,in einem schachtartigen Raum,schließt Gieselmann sein weißesMacbook an. Fünf Meter weiterhockt sein Kollege Andreas Bockauf einem grauen Sperrmüllstuhl,Macbook auf dem Schoß. Die bei-den trinken Cola, sie reden keinWort. So ähnlich wie hier mussdie Luft in Bunkern sein.
Mit blauen Müllsäcken sind dieScheiben gegen Blicke von außenabgedichtet. Eine Kevin-Kuranyi-Puppe steht herum, nackt, be -kleidet nur mit roten Stutzen. Inder Ecke ein Beck’s-Gold-Kühl-schrank, in dem A&P-Käseschei-ben welken. Sonst Elektronik,Dreck und ein HD-Bildschirm.Man ist hier unter sich.
„Olli Kahn hat sich heute denAnzug von seiner Konfirmation(1983) angezogen. Inklusive Sei-dentaschentuch. Würde das TV-Bild nun stehen, man sähe denkommenden C&A-Herbstkatalogvor sich. Doch es flimmert weiter. Immerweiter. Kahnig eben“, schreibt Bock. Gie-selmann starrt stumm auf seinen Bild-schirm. Kein Lächeln, kein Kommentar.Liveticker, also minütliche Berichte überein Fußballspiel im Internet, lesen sichlocker, aber es ist schwere Arbeit.
„11 Freunde“ – das steht für die etwasandere Fußballberichterstattung. Nachenglischen Vorbildern wie dem Schrift-steller Nick Hornby oder der Zeitschrift„FourFourTwo“ entstand ein Heft, dasweniger „Kicker“ ist, weniger Pomade,mehr Popkultur. Die Frisuren von GünterNetzer oder Rudi Völler gehören dazu
wie ein Interview mit César Luis Menottiüber seine argentinische Siegermann-schaft bei der WM 1978.
Der Muff deutscher Stammtische hatsich aus dem Fußball verzogen, und des-halb gibt es in linksalternativen Viertelnwie dem Hamburger Schanzenviertel oderdem Berliner Prenzlauer Berg bei dieserWM kaum eine Kneipe ohne Fernseher.
Es verwundert dann nicht, wenn „11Freunde“ den begehrtesten deutschenJournalistenpreis gewinnt, in der Katego-
rie Humor, oder wenn, wie es vor einpaar Tagen passierte, diese Zeitschriftvom Großverlag Gruner+Jahr gekauftwird. Liveticker sind zum Grundnah-rungsmittel geworden in diesen Tagen derWM, auf Mobiltelefonen, auf Laptops,aber auch vor dem Fernseher, wenn derModerator nervt oder die Vuvuzela.
„Schon wieder ein Schuss, diesmal vonVilla. Die Spanier dringen in den portu-giesischen Strafraum ein wie Ameisen ineine verwahrloste Küche. Keine Frau imHaus, aber das liegt beim Fußball ja inder Natur der Sache. Was macht eigent-lich Heidi Mohr?“, schreibt Gieselmann.
Als einer nachfragt, wer Heidi Mohr sei,antwortet er: „Mittelstürmerin der Deut-schen Fußballnationalmannschaft 1988.“Er habe auch keine Erklärung dafür, war -um er sich so was merken könne.
Mit einem Deal, den seine Zeitschriftvor vier Jahren mit Ebay schloss, fing derLiveticker an, sagt Gieselmann. Er habegelitten, damals. Die anderen tranken Bier,jubelten oder weinten gemeinsam vor demFernseher, er saß in einem Zimmer mitruntergelassenen Rollläden, allein, und
schrieb Sätze wie „Ecke Schwein-steiger, abgewehrt“. Als er erfuhr,dass gerade einmal 70 Menschenseine Zeilen lasen, wurde er mutig.„Diese 70 Leute sind jetzt meineFreunde“, dachte sich Gieselmann,„denen erzähle ich jetzt meine Ge-schichte.“ Inzwischen hat Giesel-mann pro Spiel zwischen 50 000und 100 000 Freunde.
Es ist immer noch still im Bun-ker, das Tor, das Spanien gegendie Portugiesen erzielt, übersetztGieselmann in Worte: „Das Schöns-te an diesem Treffer“, schreibt er,„ist ja tatsächlich, dass dieser Ro-naldo uns jetzt nicht mehr so me-galoman entgegenpenissen kannwie sonst immer. Tschüss, ihr Par-tys mit Paris Hilton, ihr Bling -blings, du Champagner aus flie-derfarbenen Fußballschuhen. Hal-lo, Aus im Achtelfinale.“
Gieselmann packt seinen Lap-top in die Tasche. Ist es nichtmerkwürdig, fragt einer, dass dieWelt sich mehr denn je für Fuß-ball interessiert, aber die WM-Spiele im Durchschnitt grauer,bleierner werden? Die Mythensind oft größer als die Spiele, sagt
Gieselmann, der etwas davon verstehenmuss, weil es „11 Freunde“ ohne Legen-den nicht geben würde. Zum Beispiel Italien– Deutschland, Halbfinale, Mexiko1970. Er habe mal mit Gianni Rivera ge-sprochen, jenem Spielmacher der Italie-ner, der in der Verlängerung den Siegtref-fer zum 4:3 erzielte. „War nicht das Jahr-hundertspiel“, habe Rivera gesagt, „diemeisten auf dem Platz waren Kettenrau-cher. Man hörte in der Hitze die Lungenrasseln. Die Spieler konnten nicht mehr.Die Tore mussten fallen.“
Gieselmann steckt sich eine an. THOMAS HÜETLIN
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 55
100 000 FreundeOrtstermin: In einem Verschlag in Berlin-Friedrichshain entstehtdie schönste Fußball-Prosa der Nation.
Journalist Gieselmann: „Megaloman entgegenpenissen“
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ D
ER
SP
IEG
EL
MA
UR
ICE
WE
ISS
/ D
ER
SP
IEG
EL
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 056
Ein Abgrund von FöderalismusFast hundert Ausbildungswege zum Lehrer, Tausende verschiedener Lehrpläne und miserable Ergebnisse im internationalen Vergleich – die Bildungs-Kleinstaaterei hat dazu geführt, dass
Deutschlands wichtigste Ressource knapp geworden ist: Geist und Expertise. Von Thomas Darnstädt
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 57
Titel
Feiernde Abiturienten in Husum
HARTMUT SCHWARZBACH / ARGUS
Immer im Februar holt Gerald Taubertdie lila Schachtel aus dem Wand-schrank in seinem Direktorenzimmer.
Seine Sekretärin schreibt dann die Na-men hessischer Schulkinder auf kleineweiße Zettel, auf jeden einen.
Die Zettel werden gerollt, durch kleineweiß-rot gestreifte Ringe gezogen und indie lila Schachtel geworfen. Unter Auf-sicht eines Rechtsanwalts pult dann derDirektor ein paar Röllchen nacheinanderwieder heraus, zieht den weiß-roten Ring
mit den Fingernägeln herunter und liestlaut vor, was eine Schreibkraft auf einerListe vermerkt: die Gewinner.
Die Eltern der Glücklichen werden miteinem Formschreiben, das von Schul -leiter Taubert entworfen wurde, benach-richtigt, dass ihre Söhne und Töchter einen Platz am Gerstunger Philipp-Me-lanchthon-Gymnasium gewonnen ha -ben. Für die Verlierer hat Taubert auchein Schreiben entworfen. Es beginnt mit„Leider“.
Leider, leider. „Es tut weh“, sagt derPädagoge, „aber so ist das im Föderalis-mus.“ Da muss man in der Schulpolitikein bisschen improvisieren.
Leider, leider. Tauberts Melanchthon-Schule liegt in Thüringen, die Bewerberaber, die, immer wenn das Schuljahr be-ginnt, das hundert Jahre alte Bildungs-institut überlaufen, sind Bildungsauslän-der, die über die Grenze kommen, ausdem Problemschulland Hessen ins Pisa-Erfolgsland Thüringen.
„Schule der Deutschen Einheit“, diesenBeinamen hat Taubert seinem begehrtenGymnasium verschafft, weil es tatsächlichfast auf der Grenze zwischen den beidenLändern liegt, die einst durch den Todes-streifen zwischen Ost und West getrenntwaren. Am Bahnhof, wo heute die „Fahr-schüler“ aus Hessen in Rudeln eintreffen,wurden einst die Interzonenzüge derReichsbahn abgefertigt, im Keller desSchulhauses saßen damals die Sicherheits-organe der DDR und belauschten den Ost-West-Telefonverkehr.
Doch die tolle Geschichte vom wieder-vereinten Lernen beeindruckte die Thü-ringer Schulobrigkeit wenig. Als sich her -ausstellte, dass mehr als die Hälfte derMelanchthon-Schüler aus Hessen kam,beschloss der Kreis das unter FöderalistenNaheliegende: zumachen. Denn warumsoll Thüringen die Schulausbildung hes-sischer Kinder finanzieren?
Schule ist ein Thema für Volkszorn. Esgab einen Elternaufstand, Protestdemos,sogar die Wildecker Herzbuben („Herzi-lein“) aus dem benachbarten West-Kreiskamen und sangen. Auf dem Höhepunktließ Taubert eine neue Mauer aus Kartonserrichten. Ergebnis: Die Schule bleibt,aber für Hessen gilt ein strenger Numerusclausus. Seitdem hat Taubert die lilaSchachtel im Schrank. Denn der Ansturmder Schulflüchtlinge aus Hessen wird im-mer größer. „Sie sollten mal morgens umacht kommen“, empfiehlt der Direktor,„da stauen sich hier die Taxi-Kolonnen.“Im Taxi zum Bildungsaufstieg: Kosten
spielen für Hessen-Eltern offenbar kei -ne Rolle. In Naturwissenschaften stehtThüringen auf Platz 3, Hessen auf Platz12 der deutschen Länder im Pisa-Ran king.Mag auch Thüringen im neuen Englisch-Leseleistungstest schlecht abgeschnittenhaben, der gute Ruf des Gymnasiums ander Grenze ist ungebrochen. Denn derMann mit der lila Glückskiste versprichtLeistung: „Schule ist kein Spaß, das istdie Arbeit der Kinder.“
Diese pädagogische Einsicht muss nichtjeder teilen. Doch dass sich morgens dieTaxi-Kolonnen aus Hessen durchs Werra -tal quälen, lässt ahnen, unter welchem
Druck das deutsche Bildungssystem steht.Auf der Suche nach dem Besten für ihreKinder nehmen Eltern nicht mehr als gottgegeben, welche Bildungspolitik auf-grund welcher Koalitionsvereinbarung inihrem Bundesland gerade Mode ist.
Die meisten Bildungsbürger sind ein-gesperrt in das Labyrinth der 16 deut-schen Schulsysteme in 16 deutschen Bil-dungs-Zwergstaaten, deren Politik sichhäufig auch noch im Rhythmus der Land-tagswahlen und wechselnder Koalitionenalle vier bis fünf Jahre ändert. „Was dieEltern am meisten nervt“, weiß auchChristoph Matschie, der SPD-Kultus -minister in Thüringen, „ist die Zersplit -
terung des Bildungssystems.“ Und der Zorn wächst. Der „provinzielle Bildungs -Länderheckmeck“ – so der ehemaligeBerliner und neue Hamburger Uni-Präsi-dent Dieter Lenzen – hinterlässt Bildungs-verlierer. Deutschland hat nicht nur inder Qualität seiner Schüler und Studen-ten den Anschluss ans Weltniveau verlo-ren, in der Folge wird allen Prognosenzufolge auch die wichtigste Ressource ver-knappen, die Deutschland im weltweitenwirtschaftlichen Wettbewerb überhauptzu bieten hat: Geist und Expertise.
Wer das Pech hat, im falschen Bundes-land zu wohnen, muss machtlos mit an-sehen, wie die eigenen Kinder verloren-gehen im Durcheinander, das inkompe-tente Politiker anrichten. So zeigte erstim vergangenen Monat der neue Schul-leistungs-Ländervergleich über sprachli-che Kompetenzen im Auftrag der Kultus-ministerkonferenz das Bildungsgefälle inder 9. Klasse: Bremer und Berliner Schü-ler starten mit verminderten Chancen insBerufsleben, sie finden sich am unterenEnde der Lernerfolgsskala.
Der Bildungs-Länderheckmeck stößtzunehmend auf Widerstand. „Wir wollenlernen“ ist die Parole, mit der HamburgerBildungsbürger und ihre Kinder auf dieStraße gingen, um per Volksentscheid diePläne der schwarz-grünen Koalition fürdie Einführung der „Primarschulen“, ei-ner Verlängerung der Grundschulzeit biszur Klasse 6, zu verhindern. CDU-Regie-rungschef Ole von Beust („Diesen erbit-terten Widerstand habe ich nicht erwar-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 058
Die Bürger sind eingesperrtin das Labyrinth der
16 deutschen Schulsysteme.
Protest gegen die Hamburger Schulreform: Eine neue Bildungs-Apo?MIKE SCHRÖDER / ARGUS
tet“) hatte den Schulgroßversuch demgrünen Koalitionspartner im Tausch ge-gen die Erlaubnis eingeräumt, die Elbeauszubaggern.
Ein ähnlicher Schulkrieg droht nun inNordrhein-Westfalen, wo die künftige rot-grüne Minderheitsregierung ohne hinrei-chende finanzielle und mit wackeliger par-lamentarischer Basis das neue Schulmodellder Gemeinschaftsschulen einführen will –falls sie sich noch über den Weg dahin ei-nig wird. Es könnte dann zu Prozessen ge-gen diese in der Landesverfassung nichtvorgesehene Schulform kommen – und da-mit für Tausende Schulkinder zu Unklar-heit über ihren künftigen Bildungsweg.
In Niedersachsen läuft mittlerweileebenfalls ein Volksbegehren. Hier richtetsich der Zorn gegen die Einführung derTurbo-Gymnasien, die in acht Jahrenzum Abi führen sollen. Im Bürgerzornüber die „G-8-Reform“ hat-te schon zuvor die hessi-sche CDU-KultusministerinKarin Wolff ihr Amt verlo-ren, ihr Regierungschef Ro-land Koch schrammte 2008wegen des Streits um bes-sere Schulen knapp an sei-ner Abwahl vorbei. Des G-8-Ärgers überdrüssig, istdie Regierung in Schleswig-Holstein derweil dabei, dasalte, neunjährige Gymna -sium wieder einzuführen.
Es reicht. „Kein Gesetzder Welt“, schimpft Päd -agogikprofessor Lenzen,„kann Eltern verbieten, dieSache der Bildung selbst indie Hand zu nehmen. Wo-rauf warten wir noch?“Lenzen hoffte schon aufeine neue „Bildungs-Apo“.Bildungs-Länderheckmeck:Die große Mehrheit derDeutschen, 61 Prozent, will laut einer Allensbach-Umfrage von März dieSchulen nicht länger denLändern anvertraut sehen. Der Bund soll die Kontrolle über die Schulen über-nehmen.
Und erst die Universitäten: Waren esnicht die vereinigten Länder, die überhas-tet und unterfinanziert jene Bologna-Re-formen eingeführt haben, an der Studen-ten allerorten mittlerweile verzweifeln?Massenproteste, Sit-ins und Studenten-streiks haben die Landespolitiker zumkopflosen Einlenken gebracht. Nun wirdüberall ebenso überhastet zurückrefor-miert. Das Durcheinander ist perfekt.Quote und Qualität der Hochschulab-schlüsse liegen deutlich unter dem inter-nationalen Durchschnitt. Die Abschaf-fung der Diplom- und Magister-Stu -diengänge zugunsten der Bachelor- und Master-Abschlüsse hat die Lage an den
Unis eher noch angespannter gemacht.„Teilweise höhere Abbruchquoten“ alsvor der Bologna-Reform meldete derBildungs bericht 2008, „Orientierungspro-bleme“, „Entscheidungsunsicherheiten“,„Informationsdefizite“ haben HumboldtsUnis zu Tollhäusern gemacht.
„Nur eine Handvoll Experten ist in derLage zu erklären, wie die Bundesländerihren Freibrief zur Ausgestaltung ihrerBildungssysteme im Detail interpretierthaben“, klagt der Dortmunder Bildungs-forscher Ernst Rösner. „Blankes Unver-ständnis“ sei im Ausland über das deut-sche Durcheinander anzutreffen.
Erklären kann man in diesem Landnicht einmal mehr, was ein Lehrer ist. 98verschiedene Ausbildungswege habenForscher der Berliner Humboldt-Uni undder Uni Hamburg ermittelt. Es gibt keineEinigkeit, was jene Männer und Frauen
können müssen, denen die Nation ihreZukunft anvertraut.
Am schlimmsten geht es am unterenEnde der Bildungsleiter zu. Die Zahl derjungen Leute, die durch die Ritzen desSchuldurcheinanders rutschen und im ge-sellschaftlichen Abgrund verschwinden,ist alarmierend hoch. Fast 20 Prozent der20- bis 30-Jährigen in Deutschland drü-cken sich ohne Berufsabschluss in den Ni-schen der Leistungsgesellschaft herum:Bildungsverlierer.
Eine düstere Zukunft prophezeit derBildungsbericht 2010: 1,3 Millionen Deut-sche, so die Prognose, werden bis 2025mangels brauchbarer Ausbildung dauer-haft keine Arbeit finden.
* In Saarbrücken 2008.
In Problemländern wie Hamburg gel-ten mehr als 25 Prozent der 15-Jährigenals „Risikoschüler“, deren Lesebildungauf Grundschulniveau stehengebliebenist. An Berlins Hauptschulen findet Bil-dung praktisch nicht mehr statt. Mehr als 70 Prozent der Schüler erreichten 2006nicht die Minimalanforderungen für Le-sen und Rechnen.
Das „Bildungsminimum“, das der Staatseinen Bürgern schulde, sei in vielen Ge-genden Deutschlands nicht mehr gesi-chert, „alarmierend“ sei der Anteil derchancenlosen „Risikoschüler“, „offen-sichtliche Fehlplatzierungen“ der Schülerbelasteten des Schulsystem, „unange-nehm“ sei es, dies so „offen auszu -sprechen“, aber die Zeit für die Rettungdes deutschen Schulsystems werde knapp:So warnte in einem internen Papier der „Wissenschaftliche Beirat für die Ge-
meinschaftsaufgabe Fest-stellung der Leistungsfähig-keit des Bildungswesens iminternationalen Vergleichgemäß Art. 91b Abs. 2Grundgesetz“.
Der was? Die Bezeich-nung dieser hochkarätigenWissenschaftlerrunde istAlarmruf genug: Sie lässt ineinen Abgrund von Verant-wortungslosigkeit blicken,der noch bedrohlicher wird,wenn man weiß, dass jenesunaussprechliche Gremiummit seinem Notruf seineKompetenzen überschrittenhat.
Ein Abgrund von Födera-lismus: Niemand in diesemLand ist befugt, der von An-gela Merkel ausgerufenen„Bildungsrepublik Deutsch-land“ den Weg zu weisen.Der Beirat, dessen Bezeich-nung sich niemand merkenkann, ist das machtlose Pro-dukt jahrelangen Gezerresum die Bildungszuständig-
keit im Bundesstaat, ohne Kompetenzen,ohne Gehör. Seine Warnungen bliebenebenso folgenlos wie ein Bericht der Ver-einten Nationen, deren Schul-Tester in ei-nem Bericht die Befürchtung äußerten,im Mitgliedstaat Deutschland werde dasMenschenrecht auf Bildung verletzt.
Sollen sich raushalten, sind ja nicht zu-ständig.
„Das System kann es sich nicht leisten,seine Bildungsverlierer einfach zu miss-achten“, warnt der Berliner Bildungs -experte Hans-Peter Füssel, Mitautor desneuen Bildungsberichts vom DeutschenInstitut für Internationale PädagogischeForschung (Dipf). Beunruhigen müssendie Dritte-Welt-Zustände in den Slumsdes deutschen Bildungswesens genausodie Väter und Mütter, die ihre Kinder im
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 59
Titel
Sitzung der Kultusministerkonferenz*: Kein Geist, nirgendwo
SV
EN
PA
US
TIA
N /
AG
EN
TU
R F
OC
US
gepflegten Privatgymnasium unterge-bracht haben. „Was nützen den Bildungs-bürgern noch ihre schönen Gymnasien“,überlegt ein Bildungsexperte in Hamburg,„wenn ihnen die Verlierer aus den Haupt-schulen ihre Häuser anzünden?“
„Wie schafft es unser Bildungssystem,zugleich leistungsfeindlich und ungerechtzu sein?“, fragt der SPD-Politiker KarlLauterbach, der sich als Gesundheits -experte seiner Partei auch um die geistigeGesundheit der Nation Gedanken macht.„Wir sind nicht nur schlecht, wir sind auchgemein“ – so karikiert sich das Systemnach einem Berliner Schulbehörden-schnack selbst.
So schlecht und so gemein: Wer ist das,dieses System?
Adresse: Taubenstraße 10, Berlin Mitte.Erster Stock: „Auslandsschulen“, zweiterStock: „Allgemeinbildende Schulen“, drit-ter Stock: „Berufliche Bildung“, vierterStock: „Europa-Angelegenheiten“ , fünf-ter Stock: „Generalsekretär“. Da sitzt er.Der Chefdirigent des Bildungswesens, Generalsekretär der Kultusministerkon-ferenz, Professor Erich Thies. Der weißalles über die deutsche Bildungskatastro-phe. Aber so viel muss klar sein: Verant-wortlich ist er für gar nichts.
KMK, das Kürzel für Kultusminister-konferenz, kennen alle Eltern, alle Stu-denten. Die KaEmKa ist schuld, dass esim Schulwesen drunter und drüber geht,die KaEmKa ist schuld, dass die Univer-sitäten flächendeckend zugrunde refor-miert worden sind. Die haben alle, macht
der Generalsekretär deutlich, das Pro-blem nicht begriffen: „Die KMK produ-ziert eine Menge Papier. Und das Sekre-tariat hat hier häufig nur die undankbareAufgabe, all dieses Papier hin und her zuschieben.“ Mit der wirklichen Politik sei man „nicht direkt“ befasst. Auch die KaEmKa kann nichts dafür.
Niemand kann etwas dafür. Neun Mil-lionen Schüler werden jeden Morgen vonihren Eltern auf den Weg geschickt, im Ver-trauen, dass einer sich für sie verantwortlichfühlt. Hunderttausende Lehrer versuchenjeden Morgen pünktlich zum ersten Klin-geln den Jungen und Mädchen etwas fürs
Leben zu erklären – im Vertrauen darauf,dass es sinnvoll organisiert und ausgesuchtist, was sie da lehren müssen. 2,1 MillionenStudenten schlagen sich Tage und Nächtein den Bibliotheken und Seminaren um dieOhren, im Vertrauen dar auf, dass sie diebeste Zeit ihres Lebens in etwas investieren,womit sie mal etwas anfangen können. Werträgt für all das die Verantwortung?
„Die abschließende gesamtpolitischenationale Verantwortung“ für die Bildungder Deutschen werde von der KMK wahr-genommen, so drückte das einmal dieehemalige KMK-Präsidentin und neueniedersächsische WissenschaftsministerinJohanna Wanka (CDU) aus. Im fünften
Stock kann man lernen, dass das gar nichtgeht: Alles hängt von den Ländern ab.Und die Länder, sagt Thies, „sind nichtimmer bereit, gesamtstaatliche Verant-wortung zu übernehmen“. Jeder im Clubdenkt zuerst an sich: „Das eigene Landsteht im Mittelpunkt des politischen Inter -esses.“ Irgendwo im Kreis der 16 stehenimmer Wahlen bevor. Und mit solchenLändervertretern ist erfahrungsgemäßüberhaupt nichts anzufangen.
„Mit dem Thema Schulen verliert manWahlen“ – die Warnung des Dipf-Exper-ten Füssel ist Grundregel Nummer einsin den meisten Länder-Staatskanzleien.
Kein Geist, nirgendwo, Thies sitzt jaimmer dabei, wenn die Vorkämpfer desBildungsföderalismus miteinander ringen.„Politische Entscheidungen haben oft ei-nen irrationalen Anteil“, sagt er ganz di-plomatisch. Jedenfalls „so fundamentaleFragen wie die Verkürzung der Lernzeitvon Jugendlichen sollten gründlicher dis-kutiert werden“, findet der General. Acht-jähriges Gymnasium, Umbau des Schul-systems, Umbau der Universitäten: Jederhat’s gewollt, weil die anderen es ja auchwollten. Keiner hat gefragt: wozu?
Wozu soll Bildung dienen? Die Länder-herrlichkeit der Kultus-Kompetenz, dasBildungskartell mit den drei Buchstabenfunktionierte so lange unauffällig, wiesich in Deutschland diese Frage nicht stell-te. Die Bildungsidee des KulturstaatesDeutschland stand mit Verabschiedungdes Grundgesetzes weitgehend fest. DerGeist muss in die Köpfe, weil dies ein Er-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 060
Jeder hat es gewollt,weil die anderen
es ja auch wollten.
Deutschunterricht im Gerstunger Philipp-Melanchthon-Gymnasium: Taxi-Kolonnen morgens um achtBERT BOSTELMANN / BILDFOLIO
Neuer LändervergleichLeseleistung in Deutsch
von Schülern der 9. Klasse
Leseleistung in Englisch
1. Bayern 521
2. Baden-Württemberg 507
3. Rheinland-Pfalz 502
4. Hessen 501
Durchschnitt 500
5. Nordrhein-Westfalen 499
6. Schleswig-Holstein 492
7. Hamburg 490
8. Sachsen 489
9. Berlin 487
10. Thüringen 486
11. Sachsen-Anhalt 486
12. Niedersachsen 484
13. Saarland 483
14. Mecklenburg-Vorpommern 481
15. Brandenburg 468
16. Bremen 467
1. Bayern 509
2. Sachsen 508
3. Baden-Württemberg 504
4. Thüringen 497
5. Rheinland-Pfalz 497
Durchschnitt 496
6. Sachsen-Anhalt 496
7. Mecklenburg-Vorpommern 493
8. Saarland 492
9. Hessen 492
10. Nordrhein-Westfalen 490
11. Niedersachsen 490
12. Schleswig-Holstein 488
13. Brandenburg 485
14. Hamburg 484
15. Berlin 480
16. Bremen 469
Quelle: IQB-Studie „Sprachliche Kompetenzen“ 2008/09
fordernis der im Artikel 1 der deutschenVerfassung statuierten Menschenwürdeist: Die allseits entwickelte, mündige Per-sönlichkeit, tolerant, weil klug, klug, weilgebildet, das war die Idee der neuenmenschlichen Gesellschaft, dafür kämpf-ten noch die Revoluzzer von ’68, derenZorn ja zuerst vor allem ein Verzweifelnam Bildungssystem war.
Für Linke wie Rechte stand stets alseinigendes Band das Erneuerungswerkdes preußischen Bildungspolitikers Wil-helm von Humboldt zur Verfügung, des-sen Humanismusidee Lernen zum Selbst-zweck, zur Bildung des Menschen erhob.Von da an war ausgemacht, dass Bildungnicht dem Gemeinwohl dienen muss, sondern selbst das Gemeinwohl ist. Und es war ein genialer PR-Coup der DDR-Führung, die alte Uni gleich hinter demBrandenburger Tor zur „Humboldt-Univer sität“ zu taufen. Dieser Geist einteBildungswelten über Stacheldraht undMauer. Streit gab es im Westen allenfallsum die gerechte Verteilung der schonstets knappen Ressourcen. Die SPD en-terte in den Siebzigern weite Teile derSchul politik, um die Wohltat der höherenBildung auch Arbeiterkindern zukom-men zu lassen.
Doch zehn Jahre nach dem Fall derMauer gab es eine Wende, die den deut-schen Bildungsföderalismus in seinenGrundfesten erschütterte. Bildungsexper-ten der OECD testeten weltweit und auchin Deutschland die Fertigkeiten 15-jähri-ger Schüler. Das Ergebnis stellte alles inFrage, was bislang in Deutschland überBildung gedacht worden war. „Pisa warein Schock“, erinnert sich heute die Main-zer SPD-Kultusministerin Doris Ahnen.
Schlimm für die Länder: Die ganzeSelbstsicherheit der Länderfürsten, die ingemeinsamen Statements so gern be-schworene „Kernkompetenz“ für Bil-dung, war dahin. Schlimm war nicht nur,dass Deutschland beim Lesen im Staaten-ranking auf Platz 21 landete, dass ein Vier-tel der deutschen Schüler im Rechnenund Lesen nicht mehr den Mindestanfor-derungen genügte, das Schlimmste: Nie-mand hatte es über Jahrzehnte gemerkt.
Das war auch gar nicht zu merken.Deutsche Bildung, wie sie von Philolo-genverbänden, Lehrer-Lobbys und demTraditionsclub der KMK verstanden wur-de, bestand aus Beschulung. „Input-Bil-dung“ heißt das Modell, das mit demNürnberger Trichter versinnbildlicht wur-de. Das Lernen findet nach Lehrplänenstatt. Lernerfolg ist, wenn die Lehrpläneabgearbeitet sind. Wer nicht hinterher-kommt, bleibt sitzen oder fliegt raus. 4403Lehrpläne aus den deutschen Ländernverwaltete zeitweise die KMK in ihrenSchubladen, jedes Land machte seine ei-genen. Was in den Köpfen der Kinder an-kam, wie kompatibel es war mit dem In-halt der Köpfe anderer Kinder, mit den
Erwartungen der Universitäten, der Un-ternehmen, ging niemanden etwas an.
Der Pisa-Schock brachte erstmals dendeutschen Föderalismus an den Rand sei-ner Glaubwürdigkeit. Der Bund griff imDurcheinander nach der Bildungskompe-tenz. Kanzler Gerhard Schröder (SPD)hatte sich von seinen Beratern eine Rede
schreiben lassen, eine Rede ganz im Sinneder kritischen Geister, die das Bildungs-system nicht nur als schlecht, sondernauch noch als gemein bezeichnen. „Wirsind nicht nur schlecht, sondern auch ge-mein“, sollte Schröder sagen, und auchdies: „Die KMK ist nicht mehr Herrin desVerfahrens – wir müssen die deutscheSchule retten und nicht die Kultusminis-ter“, und ergo: „Wir brauchen eine gewal-tige nationale Kraftanstrengung. Ein na-tionales Rahmengesetz für die Schule.“
Die Rede lag schon auf SchrödersSchreibtisch, aber gehalten hat er sienicht. Vielleicht war es klüger so. Es hätteeinen Krieg mit den Ländern bedeutet,den der Kanzler nicht hätte gewinnenkönnen. Für ein Bundesbildungsgesetzmüsste die Verfassung geändert werden.
Doch diesmal, dieses eine Mal, bewegtesich die KMK. In einem historischen Beschluss verpflichtete sich 2003 die Run de, das Heft der Reform gemeinsamin die Hand zu nehmen. Gemeinsam wer-de man für alle Länder geltende Bildungs-standards ausarbeiten lassen, jedes Landsei verpflichtet, die Einhaltung dieser Stan-dards an seinen Schulen zu überprüfenund die Lehrer entsprechend zu schulen.
Damit bei Überprüfungen nicht mehr,wie bislang üblich, gemogelt werden kön-ne, gründete die KMK 2004 ein eigenes„Institut zur Qualitätsentwicklung im Bil-dungswesen“ (IQB), das möglichst schnellMusteraufgaben für bundesweit verbind-liche Tests an den Schulen entwickelnsollte. Thies sicherte dem Institut durchAnbindung an die Berliner Humboldt-Uni wissenschaftliche Unabhängigkeit:„Das ist schon etwas Besonderes.“
Die „empirische Wende“, wie unter Bil-dungsexperten der Systemwechsel voninputorientierten Lehrplänen auf output-orientierte, abprüfbare Kompetenzstan-dards gedeutet wird, war bei Thies’ 16er-Bande nicht einfach durchzusetzen. Von„Brüllereien“ zwischen Staatssekretärenüber die Einzelheiten der Ländertests be-richtet ein Schulwissenschaftler, der be-ratend dabeisaß.
Immerhin ging es um das „Krongut desFöderalismus“, wie das einmal ein baye-rischer Kultusminister ausdrückte, die Hoheit über die Lehrpläne. Dieselben Bildungsautoritäten, die hinter den deut-schen Pisa-Tests steckten, eine Gruppevon Wissenschaftlern um den langjähri-gen Chef des Berliner Max-Planck-Insti-tuts für Bildungsforschung Jürgen Bau-mert, sollten künftig die Verantwortungfür die Schulbildung übernehmen.
Nicht mehr Wissen soll seitdem in denKöpfen der Kinder akkumuliert werden,sondern die Fähigkeit, Probleme zu lösen,sich Wissen kraft des eigenen Kopfes an-zueignen. Die neue Generation der Un-terrichtspläne für Deutsch setzt nichtmehr auf die Lektüre von Kafka und dasAuswendigkönnen von Gedichten, son-
61D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Gerstunger Schulleiter Taubert, Losbox
„Es tut weh“
Titel
BE
RT
BO
ST
ELM
AN
N /
BIL
DF
OLIO
dern auf die Kompetenz, schwierige Tex-te zu entschlüsseln. Abgeprüft in den IQB-Tests werden auch ganz unliterarischeAufgaben, eine Gebrauchsanweisung fürein Handy zum Beispiel.
Oder in Mathe: „Maria lebt zwei Kilo-meter von der Schule entfernt, Martinfünf Kilometer. Wie weit leben Martinund Maria voneinander entfernt?“ DieAufgabe ist unlösbar, und dies zu erken-nen und zu begründen wird von denSchülern der neuen Generation erwartet.
Für Deutsch und Mathe an den Grund-schulen, für den Sekundarbereich auchin der ersten Fremdsprache und in denNaturwissenschaften liegen mittlerweileStandards vor. Aber sie legen, entgegenden Ratschlägen der Experten, keine ver-bindlichen Mindestkenntnisse für alleSchüler einer Altersgruppe fest, sondernsind nach Schulformen abgestuft und ver-langen auch nur ein Erreichen der Leis-tungsgrenzen „in der Regel“.
Dennoch sind die Kultusminister mäch-tig stolz auf ihre dünne Suppe. „Wir ha-ben jetzt die Standards“, antwortet diehessische Kultusministerin DorotheaHenzler (FDP), wenn man sie fragt, wel-che nationale Verantwortung für Bildungzum Beispiel sie in der Runde der KMKbisher wahrgenommen habe.
Fragt man dann, warum die hessischenLehrpläne noch immer nicht auf die Standards umgestellt sind, kommt dieWahrheit ans Licht: Sie lässt sie jetzt um-schreiben. „Zu wenig Inhalte, zu vielKompetenzen.“ In Deutsch vermisst sieeine Liste der Pflichtlektüre, wenigstenseine kleine: „Ohne Faust geht das nicht.“
Manche Kultusminister, beobachtendie Bildungsprofis, haben das mit der em-pirischen Wende nie richtig verstanden.Es ist eine Wende weg von Humboldt:Nun zählt nicht mehr, wie viel in denKöpfen ist, sondern was es nutzt. WozuBildung? Die neue Antwort lautet: damitdie Bürger in Zukunft noch einen Job fin-den. Auf den Output kommt es an. Bil-dung soll wieder einen Zweck haben.
Am weitesten in der Umsetzung über-prüfbarer Standards ist nach Einschät-zung von Bildungsexperten Hamburg, amweitesten entfernt vom gemeinsamenZiel sind Bayern und Baden-Württem-berg. „Die reichen Südländer“, sagt Thies,„haben nach der Föderalismusreform ih-ren größeren Spielraum stark genutzt, umihre eigenen Wege zu verfolgen.“
Da, wo die Bayern versuchten, ihreLehrpläne eilig der neuen Zeit anzupas-sen, ist es deutlich misslungen. Die Kon-trolleure vom IQB schickten dem Münch-ner Kultusministerium die Reformpläneals weitgehend unbrauchbar zurück. „Wirgehen nicht davon aus“, heißt es in einemGutachten der Qualitätsagentur, dass mitdem bayerischen Französischunterricht„die Erwartungen der Bildungsstandardserreicht werden können“. In Englisch sei-
en „die bayerischen Planungen der Jahr-gangsstufen 5 bis 10 in einem doch sehrtraditionellen Sinne auf einzelne Gram-matikkapitel hin fokussiert“. Zum Bei-spiel das „past perfect progressive“, Phi-lologenspielerei von fragwürdiger „kom-munikativer Relevanz“, mit der man denSchülern des Jahrgangs sieben doch nichtim Ernst kommen könne.
Mit solchem Unterricht, drohten die In-spektoren, könnten bayerische Schülermodernen Anforderungen nicht mehr ge-nügen. Es sei denkbar, dass „bayerischeAbiturienten in Zukunft im Fach Englischeher auf der Seite ,ausreichend‘ als aufder Seite ,gut‘ angesiedelt sind“.
Doch das „mit Abstand beste Schulsys-tem“ – so der Fußballmanager Uli Hoe-neß – hält eisern an seiner traditionellenBildung fest und sortiert gnadenlos dieje-nigen aus, die nicht mitkommen. Der An-teil der Schüler, die es aufs Gymnasium
schaffen, ist in Bayern am geringsten, dieQuote der Hauptschüler am größten.
Yanneck Kirsten, 11, haben sie aussor-tiert. Der kleine Blonde kam im Mai voreinem Jahr heulend von der Schule nachHause: „Mami, ich will nicht auf dieHauptschule. Da wird man Hartz IV.“
Yanneck will Lehrer werden. Aber amEnde seiner Grundschulzeit im nordbaye-rischen Hösbach hieß es im „Übertritts-zeugnis“: „Der Schüler ist für den Besucheiner Hauptschule geeignet.“ Fassungslos,so Mutter Kerstin, habe der Bub seinenEltern das Zeugnis hingeknallt, für ihnwar das Verbot, aufs Gymnasium zu ge-hen, so etwas wie ein Todesurteil.
Mathe drei, Deutsch drei, Heimat- undSachunterricht zwei. Der ehrgeizige Yan-neck, in dessen Zimmer schon jetzt mehrBücher stehen, als manche Menschen ihrganzes Leben lang lesen, bekam am Endeseiner Grundschulzeit in den wichtigen
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 062
Berliner Humboldt-Universität, Namensgeber: Lernen als Selbstzweck
GE
RD
LU
DW
IG /
VIS
UM
Schulpendler Yanneck: „Auf der Hauptschule wird man Hartz IV“
BE
RT
BO
ST
ELM
AN
N /
BIL
DF
OLIO
3142
42
4140
36
35
34
4140 39
38
38
34 323232
5,6
7,1
34
6,6
32
6,4
6,9
7,3
8,4
8,7 8,3
16,8
14,9 11,513,0
11,18,97,0
3142
42
4140
36
35
34
4140 39
38
38
35
7,1
34
6,9
36
7,3
38
8,4
42
8,7
31
8,342
16,8
40
14,9
39
11,5
41
13,0
38
11,1
41
8,9
40
7,0
4
4
6
66
4
4
4
4
444
444
4
BADEN-
WÜRTTEMBERG
BAYERN
NORDRHEIN-
WESTFALEN
BERLIN2
MECKLENBURG-
VORPOMMERN
SCHLESWIG-
HOLSTEIN2
NIEDERSACHSEN
HESSEN
RHEINLAND-
PFALZ
SACHSEN
SACHSEN-
ANHALT
THÜRINGEN
BRANDEN-
BURG
HAMBURG2
SAARLAND
BREMEN2
Bildungs-Dschungel Schulformen der Bundesländer
und beschlossene Reformen
Weiterführende Schulen
Klassisch dreigliedrigGymnasium, Realschule, Hauptschule
Dreigliedrig und Gesamtschule
Sekundarschule1
und Gymnasium
Sekundarschule 1,Gesamtschuleund Gymnasium
32
64
Grundschule
Schuljahre
14,9
2 Schulsystem im Umbau
Gymnasiasten
Anteil an den Acht-klässlern in Prozent,2007
Abgänger ohne
Schulabschluss
in Prozent der Gleichaltrigen
1 Meist können hier sämtliche Abschlüsse bis zum Abitur erworben werden. Je nach Bundesland: Oberschule, Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Mittelschule, Stadtteilschule oder Regionale Schule
Fächern eine Durchschnittsnote von 2,66.Das reicht nicht. Aufs Gymnasium kannin Bayern nur, wer mindestens 2,33 hat.Bis 2,65 reicht’s dann grad noch für dieRealschule: Lebenschancen, festgelegt bisauf zwei Stellen hinterm Komma.
Um sieben aus dem Haus, mit demAuto zum Bahnhof Hösbach, Regional-bahn nach Aschaffenburg, Umsteigen aufGleis 5 nach Babenhausen, vom Bahnhofmit dem Bus zur Schule. Die Eltern schi-cken ihren Yanneck jetzt über die Grenzenach Hessen, in der Joachim-Schumann-Schule haben sie ihn für den gymnasialenZug gern genommen, in Hessen geltenkeine strengen Übertrittsnoten. Aber verschenken tun sie auch in Hessen nix.Deutsch vier, Mathe vier, aber Englischdrei, Bio zwei, das war das erste Zeugnis.
Yannecks Eltern haben jetzt die bayeri-schen Schulbehörden verklagt. Die Behör-de erstattet die Fahrtkosten ins Bildungs-ausland nicht, weil sie 31,10 Euro höhersind als die erstattungsfähigen Kosten zumnächsten bayerischen Gymnasium. Natür-lich haben die Kirstens den Prozess vordem Verwaltungsgericht in Würzburgkürzlich verloren, aber natürlich wollensie notfalls bis zum Bundesverfassungsge-richt gehen. Denn es geht ihnen nicht umdie paar Euro, es geht ums Prinzip: „UnserSohn wird von den bayerischen Behördendiskriminiert. In Hessen kann er aufs Gym-nasium, in Bayern nicht – daran sieht mandoch: Mit Leistung hat das nichts zu tun.“
Bayern ist nicht das einzige Land mitstrengen Übertrittsregeln, in Sachsen ha-ben sie Mitte April erst die Grenznote2,0 eingeführt. Aber in Sachsen haben siedafür überhaupt keine Hauptschule. ImReich des „past perfect progressive“ gilt hingegen der Lehrsatz des renommiertenAltphilologen Heinrich Weinstock ausdem Jahr 1955: „Dreierlei Menschenbraucht die Maschine: den, der sie be-dient, den, der sie repariert, schließlichden, der sie erfindet und konstruiert.“Dieser Erkenntnis aus der industriellenRevolution wiederum dient das aus dem19. Jahrhundert stammende dreigliedrigeSchulsystem, das in seiner reinen Form,Hauptschule, Realschule, Gymnasium,heute nur noch in Bayern fortbesteht.
Und womit? Mit Recht, sagt Klaus Wen-zel, der Präsident des Bayerischen Lehrer -verbands. Die Maschine braucht das. Esgebe „einen gesellschaftlichen Bedarf anUngleichheit“.
Was das bedeutet, weiß Yannecks Vaterganz gut. Er war Hauptschüler, hat eszum Schlosser gebracht und betreibt heu-te zusammen mit seiner Frau, auch ehe-malige Hauptschülerin, eine kleine Firmafür Leiharbeit: „Ich hätte auch gern wasanderes gemacht. Aber ich habe immerkämpfen müssen, und schuld seid ihr undeuer System!“
Das System zuckt mit den Schultern.Es muss im Leben auch Hauptschüler ge-
ben. Die Hauptschule sei unnütz herun-tergeredet worden, sagt Thies: „Wenn einSystem sich auf die Kategorie der Bil-dungsgewinner einlässt, gibt es logischer-weise auch Bildungsverlierer.“
„Dafür“, sagt Burkhard Vollmers, derDirektor der Joachim-Schumann-Schule,„sind nun morgens die Züge voll, die vonBayern nach Hessen kommen.“ Es ist das-selbe Hessen, an dessen anderem Endedie Züge mit Bildungsflüchtlingen nachThüringen gefüllt sind.
In Thüringens Hauptstadt Erfurt aber –nichts ist einfach im deutschen Bildungs-föderalismus – sitzt nun BildungsministerChristoph Matschie von der SPD, der ver-sprochen hat, auch in Thüringen nun wie-der einiges zu ändern. Dort werden künf-tig, so ist es im schwarz-roten Koalitions-vertrag vereinbart, Gymnasiasten mitSchülern aller anderen Schulstufen ge-
meinsam in neuzuschaffenden „Gemein-schaftsschulen“ unterrichtet, wo sie, je-denfalls bis Klasse 8, diskriminierungsfreiund chancengleich zusammen lernen sollen. „Natürlich ganz behutsam undSchritt für Schritt“ soll die Reform von-stattengehen, verspricht Matschie.
Etwaigen Bildungsflüchtlingen aus Thü-ringen sei Schleswig-Holstein ans Herzgelegt. Denn dort werden zurzeit solche„Gemeinschaftsschulen“ gerade wiederabgeschafft.
Wehe, wer nach Hamburg ausweicht.Der Regent der Hansestadt, Ole vonBeust (CDU), hat sich dort vor zwei Jah-ren auf das halsbrecherische Experimenteingelassen auszuprobieren, ob Schwarz-Grün eine regierungsfähige Kombinationist. Der Stresstest wird nun an den Schü-lern exekutiert. So ist der Stadtstaat mitdem gemessen am Reichtum der Stadt
Titel
63
ärmsten Bildungsbudget der Nation da-bei, seine Hauptschulen mit seinen Real-schulen und seinen Gesamtschulen zu Ge-samt-Gesamtschulen zusammenzuwer-fen. In den neuen „Stadtteilschulen“ wirdvom Hauptschulabschluss bis zum Abituralles angeboten, was das Bildungswesenan Zertifikaten bereithält.
Zugleich aber werden die Gymnasiender Stadt, noch immer unter dem Stressder dilettantisch durchgesetzten G-8-Re-form und desorientiert von der ebensoüberhasteten Reform der Oberstufe zur„Profiloberstufe“ nun von Bauarbeiterngenervt. Die fünfte und sechste Klassewerden mit laut „Hamburger Abendblatt“behördenintern geschätzten 390 Millio-nen Euro abgemauert und künftig denGrundschulen zugeschlagen. „Primar-schule“ heißt das Konstrukt der so ent-stehenden sechsjährigen Grundschule, inder alle gemeinsam zur Schule gehen.
Übrig bleibt ein am Kopf und an denFüßen amputiertes hanseatisches Gym-nasium, einst G9, dann G8, nun G6 – soähnlich wie in Berlin, wo schon immeralle sechs Jahre zur Grundschule gehen.Fast alle. Denn Berlin bietet alternativauch den Wechsel aufs Gymnasium nachder vierten Klasse an.
Der überraschende Erfolg der Eltern-initiative, die sehr schnell 182000 Unter-schriften für ein Hamburger Volksbegeh-ren gegen die Primarschule zusammen-brachte, führte nicht etwa zum Stopp aufder Großbaustelle. Umso größer ist viel-mehr die Eile, das Projekt voranzubrin-
gen. Weil die Primarschule starten soll,bevor der Umbau fertig ist, sollen 45 Klas-sen fürs Schulsystem der Zukunft vorerstin Containern unterrichtet werden.
Der Volksentscheid am 18. Juli wirdmit hoher Wahrscheinlichkeit gegen diePrimarschulen ausgehen. Dann stehen inHamburg nicht nur das Schulumbau-Ge-werbe und die Lehrerschaft vor einemProblem – sondern die schwarz-grüne Koalition vor dem Ende. BürgermeisterBeust soll seine Demission für die nächs-ten Wochen bereits vorbereitet haben.
Dabei hat die Frage, wie Schulen orga-nisiert und Schüler sortiert werden, keine
Bedeutung für die Qualität von Bildung.Bildungspolitisch gesehen ist jede Schul-strukturreform Geldverschwendung. Indieser Einsicht sind sich alle einig, dievon Schulqualität etwas verstehen. Keine„belastbare Evidenz“, so fein drückt dasder Bildungsforscher Jürgen Baumert aus,gebe es für den Nutzen einer Verlänge-rung der Grundschule.
Annette Schavan, als Kultusministerinin Stuttgart selbst heftige Reformerin,steht als Bundesbildungsministerin übersolchen Spielen: „Es kommt nicht auf die Strukturen an, sondern auf die Inhal-te.“ Und selbst bei Kultusministernwächst der Überdruss. Das Thema der
Schulgliederung, sagt Jan-Hendrik Ol-bertz, ehemals parteiloser Ressortchef inSachsen-Anhalt, „hängt mir zum Halsraus. Strukturfragen sind Fragen von gestern.“
Dass dennoch so heftig um Projektewie „Länger gemeinsam lernen“, denUmbau des gegliederten Schulsystems inGemeinschaftsschulen gerungen wird, beruht auf einem bildungspolitischen Missverständnis. Wahrscheinlich ist diezwangsweise Zusammenführung hetero-gener Schülerschichten zwar ein Schrittgegen Ungerechtigkeit. In allen Bundes-ländern haben Kinder aus „bildungs -fernen Schichten“ geringere Chancen, aufdie höhere Schule zu kommen, als Kin -der, deren Eltern viele Bücher im Schrankhaben.
Aber das bringt wenig. Untersuchun-gen von Forschern des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung belegen, dass dieser Effekt minimal ist –gemessen an dem Einfluss, den die Bil-dungswelt daheim auf die Schulkarrierender Kinder hat. „Eine bestimmte Schul-form im Sekundarbereich hat nahezu keinen Einfluss auf die vorgefundeneQualität von Unterricht“, schrieben dieSchulexperten des Hamburger Institutsfür Bildungsmonitoring ihrer Senatorinin eine Studie. Vergebens.
Dass die meisten der 16 Kultusministerder Länder dennoch unverdrossen ihrenso teuren wie aufsehenerregenden Schul-reformen nachgehen, liegt daran, dassman die richtigen Reformen nicht sehen
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 064
Übrig bleibt ein am Kopfund an den Füßen
amputiertes Gymnasium.
Abiturienten im Schülerlabor der Universität Frankfurt: Bildungspolitisch gesehen ist jede Strukturreform GeldverschwendungM. LEISSL / VISUM
Flucht ins PrivateSchüler an Privatschulen*
in Deutschland, in Tausend
* Allgemeinbildende Schulen
Quelle: Statistisches
Bundesamt
1992
446
487
560
639
691
1995 2000 2005 2008
0
+ 55%gegenüber
1992
kann. Sie finden in den Köpfen statt. DerFluch dieser „empirischen Wende“ in derBildungspolitik liegt darin, dass sie ihrenEntdeckern keinen Lorbeer bringt, weilsie Zeit braucht.
„Es ist schön, etwas gestalten zu kön-nen“, freut sich die hessische Kultusmi-nisterin Dorothea Henzler (FDP). Für sojemanden ist es reizlos, sich mit den Ant-worten von morgen, der Verbesserungder Schulqualität zu beschäftigen. ZehnJahre, schätzen die Qualitätsexpertenbeim IQB ebenso wie Bildungsforscher,dauert es mindestens, bevor man etwasmerkt von der Wende. Bevor die Testsnach oben gehen.
Die Ochsentour zur besseren Bildungliegt in der Verbesserung der Lehrer. „Inkeinem Bundesland“, weiß der BerlinerBildungsforscher Hans-Peter Füssel, las-sen sich die neuen Bildungsstandards ein-fach „von oben“ durchsetzen: „Das müs-sen die 800000 Lehrer machen.“
Die können es aber nicht. Generatio-nen deutscher Schulmeister sind daraufgetrimmt, ihre Lehrpläne abzuar beiten –wenn ein Schüler nicht mitkommt, bleibter sitzen oder muss schlimmstenfalls dieSchule verlassen. Es gilt auch an deut-schen Schulen das Prinzip der Verantwor-tungslosigkeit. Kein Lehrer ist schuld,wenn seine Schüler nichts lernen.
Die neue Output-Philosophie derSchulqualität verlangt eine neue Lehrkul-tur. Jeder Lehrer ist danach verpflichtet,definierte Kompetenzen, einen vernünf-tigen Lernerfolg herzustellen. Der Kernder Reform des Lernens ist die individu-elle Förderung: „Ein Stachel im Fleisch“des Bildungswesens sei das, meint der Di-rektor des Hamburger Instituts für Leh-rerbildung und Schulentwicklung PeterDaschner, eine Herausforderung: „Wirmüssen uns etwas einfallen lassen, für je-den einzelnen Schüler.“
Daschner steht vor der Herkules-Auf-gabe, die „neue Lernkultur“ bei den15000 Hamburger Lehrern durchzuset-zen. Durch 80000 Schulungen im Jahrwerden die Hamburger Pädagogen ge-schleust, mit leichtem Druck: In Hamburggilt Fortbildungspflicht.
Das Ziel liegt in weiter Ferne. „GroßeDefizite“ beim individuellen Fördern anden Gymnasien bescheinigt der Hambur-ger Jahresbericht der Schulinspektionvon 2008 den Hamburger Lehrern. „Nurwenigen beobachteten Schulen gelingt es,schulweite Konzepte für Binnendifferen-zierung zu entwickeln.“ Ja, gerade unterden Hamburger Nobelgymnasien in bes-ten Lagen gibt es behördenintern als „Fai-ling Schools“ eingestufte Problemanstal-ten: eine besondere Art von pädagogi-scher Wohlstandsverwahrlosung.
Immer zu dritt fallen nun die Inspekto-ren über die Hamburger Schulen her, set-zen sich, immer 20 Minuten lang, in denUnterricht und legen Dossiers über Schu-
len, Klassen, Lehrer an: Wo werden dieSchüler erreicht, welche Klassen fallenzurück, woran liegt das?
Die sanfte Tour in Deutschland kostetnicht nur Zeit, sie kostet auch Geld. Nie-mand kann zurzeit ausrechnen, was eskosten würde, genügend geeignete Lehrerfür die individuelle Betreuung von Schü-lern auszubilden. Absprachen in der KMKüber gemeinsam organisierte Lehrerbil-dung blieben im Ansatz stecken. Denn je-des Bundesland hütet die Ausbildung sei-ner Lehrer als Teil seiner Kernkompetenz.
So bleiben Qualitätsoffensiven wie inHamburg Einzelfälle und ungeliebt beivielen Politikern. Schleswig-Holstein hatdie Schulinspektion, die 2003 unter derGroßen Koalition eingeführt wurde, nachdem Farbenwechsel zu Schwarz-Gelbganz schnell wieder abgeschafft, in ande-ren Ländern ist man kurz davor. „Die zu-verlässigsten Partner können leicht weg-brechen“, ahnt der BildungsprofessorOlaf Köller, der bis vor kurzem Chef desBerliner IQB war. Das Gefeilsche unterden Ländern um die Überprüfung derSchulqualität werde immer schlimmer:„Na klar, kein Kultusminister mag ständigschlechte Nachrichten hören.“
Nur etwa in der Hälfte der Bundeslän-der, so rechnen Beobachter, kommen dieBildungsstandards wirklich an den Schu-len an. Viele Politiker haben keine Lustmehr auf Reformen, die vorerst nichts alsÄrger bringen. Denn jeder Experte weiß:Die Ergebnisse der Neuordnung sind erstin der nächsten Generation sichtbar.
Etwas für gleich war gesucht im Kreisder Kultusminister. So verabredeten sie,die Gymnasiumszeit auf acht Schuljahrezu verkürzen. Die Mainzer SchulchefinAhnen legte sich quer und beschränktedas Schnell-Modell auf Ganztagsschulen.„Ich mache keinen Hehl daraus“, klagtedie Ministerin öffentlich, „dass ich zeit-weise sehr unter Druck gestanden habe,weil wir den bundesweiten Weg nicht mit-gegangen sind.“
Dass man in acht Jahren nur schlechtein Qualitäts-Abitur machen kann, warim Kreis der KMK lange Zeit nahezuKonsens. Bayern und Baden-Württem-berg vertraten die Ansicht, den neuenLändern könne nur gestattet werden, dasaus der DDR geerbte G-8-Modell weiter-zuführen, wenn sichergestellt sei, dass inder verkürzten Schulzeit das westdeut-sche Abi-Niveau erreicht werden könne.Sonst werde man den Ost-Abschlussnicht anerkennen. Die magische Zahl,einst von der KMK festgelegt, beträgt265 Jahreswochenstunden Gymnasiumbis zum Abi.
265 Stunden? Die ostdeutschen Lehrer,Stress und Leistungsdruck schon stets gewohnt, steckten das, ohne zu murren,in acht Schuljahre, was die Westdeut-schen damals noch in neun Jahren ab -solvierten. Als dann auch West-LänderG8 einführten, schlugen die tapferen Ost-Schulmeister zurück. Selbstverständ-lich, so hielten sie Wünschen nach Unter-richtskürzungen der West-Kollegen ent-gegen, müssten auch im verkürzten Gymnasium die 265 Stunden abgeleistetwerden. Dass das „nun plötzlich nichtmehr erfüllbar sein soll“, lästerte Sach-sen-Anhalts Kultusminister Olbertz,„stößt im Osten sauer auf“.
Empörte Eltern, überforderte Kinder –auch in Bayern mussten mehrfach dieüberladenen Lehrpläne gekürzt werden.In Hessen musste die verantwortliche Ka-rin Wolff ihren Hut nehmen. „Sicher ha-ben wir in kurzer Zeit sehr viel verändernund damit aufholen wollen, vielleicht wa-ren wir dabei zu schnell“, sagt sie heute.
Zu schnell zu viel: Für individuelle För-derung braucht es Zeit, länger, nicht kür-zer müssen sich die Lehrer gerade um dieProblemkinder kümmern. G8 entpupptesich schnell als Zeitdiebstahl. Als Ersteswurden, zur Besänftigung von Eltern undSchülern, häufig die gerade erst einge-führten Zusatzstunden für individuelleFörderung gestrichen. „Die Umsetzungvon G8 war falsch“, sagt die HamburgerReformerin Christa Götsch, „aber daswar vor meiner Zeit.“
Auch Christa Götsch kann nichts dafür.Aber wer denn dann? Eine Umfrage un-ter deutschen Kultusministern, wer ei-gentlich die Idee hatte und was er sichdabei gedacht hat, ist nicht sehr ergiebig.
„Die Schavan war’s“, ist die häufigsteAntwort, die man hört. Tatsächlich ver-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 65
Hamburger Lehrer-Trainer Daschner
„Stachel im Fleisch“
GR
EG
OR
SC
HLÄ
GE
R
Titel
teidigt Annette Schavan, die ehemaligeStuttgarter Kultusministerin, auch in ihrerneuen Rolle als Bundesforschungsminis-terin noch immer die unsinnige Reform:„Ein Gymnasium für 50 Prozent einesSchülerjahrgangs muss anders aussehen,als wenn, wie früher, nur 5 Prozent dieseSchulform besuchen.“
Weil die Bundesministerin in den Schu-len der Länder nichts zu sagen hat, ist sieauf solche Statements angewiesen, dieewig wahr und völlig nutzlos sind. Dassdie deutschen Schulen sich verändernmüssen, wird niemand bestreiten. Wasaber soll geschehen?
Wer hat ein Konzept zur Rettung derdeutschen Schulpolitik? Die Kultusminis-ter haben es jedenfalls nicht, und wennsie es hätten, dürften sie es nicht sagen.Denn die Länder, von Finanznot ausge-zehrt und immer öfter im Stress knappkalkulierter Koalitionsregierungen, habenandere Sorgen. Bildungspolitiker habenan den Kabinettstischen wenig Ansehen;regelmäßig, so die heimliche Klage ausvielen Ländern, zerhaut der Ministerprä-sident mit seiner Richtlinienkompetenzzarte Pflänzchen der in der KMK verab-redeten Reformen. Denn viele Chefs wol-len sich für die Bundespolitik profilieren,wo man mit guten Schulen wenig Ein-druck macht.
„Ich wünsche mir manchmal“, sagtThies, „eine Instanz, die stark genug ist,die Weichen richtig zu stellen.“ Die KMKkönnte das sein. Aber das Gremium seibehindert „unter dem Druck der Einstim-migkeit“.
Nicht nur die KMK, die ganze Bil-dungspolitik leidet unter einem „Legiti-mationsdefizit“ (Thies) gegenüber der kri-tischen öffentlichen Meinung. Anders alseine Regierung ist die KMK von nieman-dem legitimiert, Entscheidungen zu tref-fen: „Sie kann nur Empfehlungen geben,die man befolgen kann“, sagt Thies,„oder eben auch nicht.“
Die Länder-Runde sucht sich jedes Jahreinen anderen Landesminister als ihrenPräsidenten, aber dessen Befugnisse rei-chen auch nicht über die Richtlinien derLandespolitik hinaus, die der Minister-präsident daheim verkündet hat. Der Ge-neralsekretär wünscht sich „einen für
mehrere Jahre gewählten Präsidenten“,der dem Gremium neue Entscheidungs-kraft geben könnte.
Der noch amtierende Düsseldorfer Wis-senschaftsminister Pinkwart schlägt vor,„dem Bund Sitz und Stimme in der KMKzu geben“, um so die „Bildungspartner-schaft“ zwischen Bund und Ländern zustärken. Doch die Idee würde alles nochkomplizierter machen. Statt 16 gibt esdann 17 Vetomächte.
Es geht vielleicht so, wie es die kleineföderale Schweiz 2006 vorgemacht hat.Die Eidgenossen haben in ihre Verfassungeine Klausel aufgenommen, die es derBundesregierung in Bern erlaubt, die Ent-
scheidungsgewalt in Bildungsfragen zuübernehmen, wenn sich die Kantonenicht einigen können. Eine solche „Er-satzvornahme“ des Bundes könnte nachThies’ Vorstellungen auch in DeutschlandVerbesserungen bringen. Doch wieschlecht muss es den Ländern gehen, bissie endlich das Elend des deutschen Föderalismus durch eine Verfassungs -änderung lindern?
Es gibt in der Bildungsrepublik Deutsch-land kein demokratisches Verfahren füreinen nationalen Konsens über das, wasim Land der Dichter und Denker geltensoll. Dabei wird nichts dringender als diesgesucht. Eine neue Bildungsidee, die ausdem Gezerre zwischen Humboldt undPisa herausführt. „Man muss Humboldtneu denken“, fordert ganz oben die Bun-desforschungsministerin Schavan.
Wer ist man?In der Bildungswüste Nordrhein-West-
falen klagt die grüne Spitzenkandidatinund Schulexpertin Sylvia Löhrmann überden „Treppenwitz, dass im Land der Dich-ter und Denker an der Spitze niemandfür die Bildung verantwortlich ist“. Dennin den Ländern, pflichtet ihr der SPD-Schulexperte im Bayerischen LandtagMartin Güll bei, gibt es „keine Visionäre,nur Verwalter“.
Soll die nationale Aufgabe Bildung einReservat föderaler Vielfalt sein? Nur vor-sichtig fragte Horst Köhler, wenige Wo-chen vor seinem Rücktritt, ob in der Bil-dungspolitik „nicht die derzeit geltendenBedingungen des Föderalismus selbst aufden Prüfstand gehören“.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 066
In der Bundespolitik machtman mit guten
Schulen wenig Eindruck.
Titel
Abiturprüfung am Gymnasium: „Dreierlei Menschen braucht die Maschine“FALK HELLER / ARGUM
Da waren sie nun lange genug. DieKonsequenz der deutschen Schulmiserewäre eine Kompetenzverlagerung vonden Ländern zum Bund. Bildungspolitikist zu wichtig, um sie weiterhin engagier-ten und wohlmeinenden Studienrätinnenzu überlassen. Berufspolitiker mit einemgroßen Apparat, mit der Rückendeckungder Kanzlerin und Zugriff auf die Bun-desfinanzen müssen sich dranmachen –das Thema muss wahlentscheidend fürdie nächsten Bundestagswahlen werden.
Die Länder, die ihre Kernkompetenzin Gefahr sehen, haben sich mit Gegen-argumenten gut ausgerüstet. Der frühereKultusminister Sachsen-Anhalts und künf-tige Präsident der Humboldt-UniversitätOlbertz etwa warnt: „Ich kenne das nochaus der DDR: Macht die Zentrale einenFehler, wird er überall und gründlich ge-macht.“
Solche Argumente aber sind Irrefüh-rung. Dem Bund Kompetenzen für dieSchulpolitik einzuräumen bedeutet ledig-lich, ihm Gesetzgebungsmacht zu geben:Die Grundfragen der deutschen Schulbil-dung können zentral als Ergebnis einernationalen demokratischen Debatte ver-bindlich für alle Länder geregelt werden.Die Aufgabe der Länder-Kultusministerbeschränkt sich dann auf die Durchfüh-rung der Bundesgesetze.
Der Verlust der Länder-Herrlichkeitwäre ein Verlust von Vielfalt. Doch wemaußer der teuren Kultusbürokratie undden Verlagen, die Sammlungen der Län-der-Schulgesetze herausgeben, nutzt die-se Vielfalt? Ein Schüler, der in seinemBundesland bleibt, hat nichts davon, dasses in anderen Bundesländern anders ist.Und wer das Land wechseln will, leidetmeist unter solchem Föderalismus.
Vielfalt ist eine Chance für Politiker,die lernen wollen – von denen im Nach-barland. Doch darauf hat sich kaum jeein Kultusminister eingelassen. Sie ha-ben ja die KMK – ein Kartell der Dumm-heit.
An der Grenze zwischen Thüringenund Hessen bedeutet Vielfalt nichts alsÄrger. All die Absagebriefe, die der Gers-tunger Schulleiter an die Eltern drübenin Hessen schicken muss, all die Diskus-sionen, die dann wieder losgehen.
Wäre es da nicht sinnvoll, sich mal mitden Schulleitern von jenseits der Grenzezusammenzusetzen? Einfach so, auf einBier, und mal Erfahrungen über Schülerund Lehrer auszutauschen. „So weit“,sagt Taubert, „ist es noch nie gekommen.“Was soll man da auch besprechen, fragtsich der Schulmeister: „Wir haben dochFöderalismus.“
Im nächsten Heft:Wie die Länder die Universitäten zu Tode re-
formieren – Warum die Bologna-Reform ge-
scheitert ist – Der Bund muss die finanzielle
Verantwortung für Bildung über nehmen.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 67
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 068
Trends
H A N D E L S P O L I T I K
EU will China bremsen
Zulieferer der Automobilindustriefürchten, Opfer der großen Politik
zu werden. Die europäischen Herstel-ler von Aluminiumrädern haben in einem Anti-Dumping-Verfahren derEU zwar Recht bekommen. Die Euro-päische Kommission verhängte einenZoll von 20,6 Prozent auf Einfuhrenvon Aluminiumrädern aus China. DasLand verschaffe seinen Herstellern ei-nen Wettbewerbsvorteil, indem es denPreis für Aluminium künstlich niedrighalte. Die chinesischen Herstellerkonnten ihre Exporte nach Europa um65 Prozent steigern. Mehrere euro -päische Produzenten mussten Konkursanmelden. Die EU verhängte den Zollauf diese chinesischen Einfuhren abernur vorläufig. Jetzt müssen die betrof-fenen Länder Stellung nehmen. ImBundeswirtschaftsministerium sindVertreter Chinas vorstellig geworden.Sie wiesen auf die große Bedeutung ih-res Landes für die deutsche Wirtschafthin. „Der Druck ist enorm, dass wiruns gegen den Zoll aussprechen“, sagtein Berliner Spitzenbeamter.
W E R F T E N
Strohmann für Moskau?
Das russische StaatsunternehmenVereinigte Schiffbau Korpora tion
(OSK) greift nach den Nordic YardsWerften in Wismar und Rostock-War-nemünde, die seit September 2009dem Moskauer Geschäftsmann WitalijJussufow gehören. Der30-Jährige war zuvorLeiter des MoskauerBüros der von Wladi-mir Putin und GerhardSchröder 2005 beschlos-senen Ostsee-Pipeline„Nordstream“. An derSpitze des Direktoren-rates von OSK stehtder für Industrie- undEnergiepolitik zustän -dige stellvertretendeMinisterpräsident IgorSetschin, einer derengsten Putin-Vertrau-ten. OSK führt bereitsseit Ende 2009 Ver-handlungen mit Jussu-fow. „Bis jetzt aberkonnten wir uns nicht
auf einen Preis einigen“, sagt der OSK-Sprecher Igor Rjabow. Bei den 700von ehemals 2400 Arbeitern herrschtdie Befürchtung, dass sie eines Tagesdie eigenen Anlagen abbauen undnach Russland verschicken müssen.Viele glauben, dass der Jungunterneh-mer von Anfang an nur als Zwischen-lösung vor einer Übernahme durchden russischen Staat diente.
T O U R I S M U S
TUI sucht Partner für Toskana-Feriendorf
Die ursprünglich bereits für Ende 2009geplante Eröffnung des ersten TUI-
Feriendorfs in der Toskana verzögertsich weiter. Grund sind nicht nur die zu-nächst eher zögerlich eintreffenden Ge-nehmigungen für das Tourismusprojekt„Tenuta di Castelfalfi“ auf einem elf Qua-dratkilometer großen Gelände unweitvon San Gimignano. Auch die Finanz-krise machte TUI-Chef Michael Frenzelund seinen Kollegen offenbar einen
Strich durch die Rechnung. Der Konzernwollte zunächst selbst einen mittlerendreistelligen Millionenbetrag in Hotels,ein Kongresszentrum oder einen Robin-son-Club investieren. Stattdessen muss-ten die TUI-Manager jedoch im vergan-genen Herbst unerwartet ihrem Contai-nerschiff-Ableger Hapag Lloyd beisprin-gen. Der Logistikanbieter stand damalskurz vor der Pleite, verdient inzwischenaber wieder gut. Frenzel und seine Kol-
legen wollen das Ferienparadies trotz-dem nicht länger überwiegend allein fi-nanzieren. Sie suchen neuerdings nachFinanz- oder Hotelpartnern, die auch inebenfalls vorgesehene luxuriöse Ferien-häuser und -wohnungen investieren kön-nen. Übernachten müssen potentielle Interessenten bislang allerdings in be-nachbarten Unterkünften. Außer einemGolfplatz ist auf dem Areal noch keineandere Anlage fertiggestellt.
Nordic-Yards-Arbeiter
BE
RN
D W
ÜS
TN
EC
K /
PIC
TU
RE
ALLIA
NC
E /
DP
A
Castelfalfi
LO
RE
NZ
O G
ALA
SS
I /
AP
Wirtschaft
H A U S H A L T
Bedenken gegenBrennelemente-Steuer
Bei der Einführung einer Brennele-mente-Steuer könnte das Bundes -
finanzministerium (BMF) auf größereHürden stoßen als zunächst angenom-men. Zu diesem Schluss zumindestkommt die Anwaltskanzlei CliffordChance in einem bislang unveröffent-lichten Gutachten. Nach Einschätzungder Juristen würde die Einführung einer Brennelemente-Steuer als soge-nannte Verbrauchsteuer mit „europäi-schen Richtlinienvorgaben unverein-
bar sein“. Grund: Der Strom aus Kern-energie würde durch eine Verbrauch-steuer gegenüber Strom aus anderenEnergieträgern benachteiligt. Genaudiese Variante jedoch hatte das BMFgeplant. Mit der neuen Steuer solltenab 2011 rund 2,3 Milliarden Euro jähr-lich von den Betreibern der Meilerkassiert werden. Bei einem Gesprächmit Vertretern der Energiewirtschaft inder vergangenen Woche haben Mit -arbeiter des Ministeriums offenbarrechtliche Schwierigkeiten eingeräumt.Zumindest könne es schwierig werden,den gesteckten Zeitplan einzuhalten,hieß es aus Teilnehmerkreisen. DieGespräche sollen in den nächsten Wochen fortgeführt werden.
D A T E N S C H U T Z
Koalitionsstreit umArbeitnehmerrechte
Der Gesetzentwurf von Innenminis-ter Thomas de Maizière (CDU)
zum Arbeitnehmerdatenschutz stößt inder Koalition auf Ablehnung. „DerEntwurf enthält gravierende Mängelbei der Frage, unter welchen Vorausset-zungen Arbeitnehmer an ihrem Ar-beitsplatz überwacht werden dürfen“,sagt Max Stadler (FDP), Parlamentari-scher Staatssekretär im Justizministe -rium. Anlass der Novelle waren dieSpitzelaffären bei Unternehmen wieLidl oder der Telekom. In den vergan-genen Wochen hatten vor allem Daten-schützer und Gewerkschaften bemän-gelt, der Entwurf verschlechtere denDatenschutz für Beschäftigte sogar.Auch in den Fraktionen von Unionund Liberalen ist der Entwurf umstrit-ten. Im Koalitionsausschuss vergange-ne Woche empfahl das Innenministe -rium dennoch, den Entwurf am 4. Au-gust im Kabinett zu behandeln. Darauf-hin erklärten die Fraktionsvertreter,die Zustimmung der Abgeordneten sei unsicher. Wegen des desolaten Erschei-nungsbilds der Koalition sollten vor einer Kabinettsberatung die Streitpunk-te einvernehmlich geklärt sein. Hans-Peter Uhl (CSU), innenpolitischer Spre-cher der Unionsfraktion, empfiehlt,nach der Sommerpause in der Koali -tion über den Entwurf zu sprechenund ihn erst im Herbst ins Kabinett zubringen: „Was ist ein Kabinetts -beschluss wert, wenn wir ihn dann imParlament komplett umkrempeln?“Brennelemente-Lagerbecken im Atomkraftwerk Krümmel
NIG
EL T
RE
BLIN
/ D
DP
Diskretion ist Ehrensache, wennsich die Elite der deutschen Fi-nanzwirtschaft versammelt. Kein
Bild hielt das denkwürdige Treffen fest,das am Mittwoch vergangener Wochestattfand, nur eine dürre Meldung, neunZeilen kurz, informierte anschließend dieÖffentlichkeit.
Die Vorstandsvorsitzenden der größtenBanken waren der Einladung von Bun-desbankpräsident Axel Weber und demChef der Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio,gefolgt. Deutsche-Bank-Chef Josef Acker-mann kam nicht persönlich, sondernschickte einen Vertreter, seinen Risiko-manager Hugo Bänziger.
Um die Risiken der Banken sollte esgehen in diesem Gespräch, sie sollen ineinem sogenannten Stresstest erfasst –und dann veröffentlicht werden. Dazu,so hieß es im anschließenden Statement,hätten die anwesenden Banker „ihregrundsätzliche Bereitschaft“ erklärt.
Ob das eine gute Idee ist, darüber kannman lange streiten. Und das haben dieBankenvertreter bei diesem ungewöhn -lichen Treffen auch getan.
Denn solch ein Stresstest soll Transpa-renz schaffen und damit Vertrauen. Wasaber, wenn er neue Risiken offenlegt?Oder die alten wieder sichtbar macht, diein der öffentlichen Wahrnehmung längstverdrängt sind?
Der großangekündigte Stresstest könn-te also neuen Stress bedeuten für eineBranche, die doch nichts dringenderbraucht als gegenseitiges Vertrauen undRuhe. Er könnte neue Unsicherheit in dieFinanzmärkte tragen, die schon jetzt hy-pernervös auf jede Nachricht reagieren.
Nichts spiegelt diese Unsicherheit sominutengenau wider wie das Auf und Abder Märkte und ihrer Indizes. Die Risiko-prämien für Staatsanleihen von Griechen-land und Spanien steigen, obwohl sichdoch der Euro-Verbund verpflichtet hat,die Finanzierung angeschlagener Mit-gliedsländer zu sichern.
Die Aktienbörsen schalten oftmals bin-nen weniger Stunden von Depression aufOptimismus um – und wieder zurück.Jede nicht ganz so positive Nachricht ausden USA oder aus China wird als Indizdafür gewertet, dass ein neuer Rückschlag
droht und die überraschend schnelle Erholung der Weltwirtschaft nicht vonDauer sein wird.
Der Goldpreis stieg allein seit Jahres-beginn noch einmal um 13 Prozent (sieheGrafik). Gold ist immer dann gefragt,wenn das Vertrauen in Wirtschaft undWährung sinkt – ein vermeintlich sichererHafen in unsicheren Zeiten.
Gute Nachrichten haben es schwer insolchen Zeiten, sie werden kaum wahr-genommen und sind schnell wieder ver-gessen. Und doch gibt es sie, sie kommenaus den Unternehmen und vom Arbeits-markt, sie künden von erstaunlichenWachstumsraten, vollen Auftragsbüchernund neuen Jobs – vor allem in Deutsch-land.
Die Konjunkturexperten blicken im-mer zuversichtlicher in die nahe Zukunft.
Kürzlich hob das Institut für Weltwirt-schaft (IfW) seine Vorausschau für diesesJahr deutlich an. Die Wissenschaftler ausKiel rechnen derzeit für 2010 mit einemWachstum von 2,1 Prozent. Eine ähnlicheGrößenordnung erwartet auch das Rhei-nisch-Westfälische Institut für Wirt-schaftsforschung (RWI) aus Essen. DerDeutsche Industrie- und Handelskam-mertag (DIHK) geht sogar von 2,3 Pro-zent Wachstum aus.
Der Optimismus erfasst auch die Kon-junkturexperten der Bundesregierung,die in ihrer letzten Prognose aus demApril noch mit einem Plus von 1,4 Pro-zent rechneten. Auch wenn sie ihre Be-rechnungen nicht laufend aktualisieren,ahnen sie dennoch, dass ihre Schätzungüberholt ist. „Alles läuft auf eine Grö-ßenordnung von zwei Prozent hinaus,
Wirtschaft
K O N J U N K T U R
Welt im StresstestDie deutsche Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet. Doch die Gefahr eines Rückschlags
ist nicht gebannt. Auf den Finanzmärkten drohen die ungelösten Probleme der Banken und der angeschlagenen Euro-Staaten für neue Turbulenzen zu sorgen.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 070
Bankenkontrolleure Sanio, Weber: Unsicherheit schürt Misstrauen
TO
BIA
S S
CH
WA
RZ
/ R
EU
TE
RS
vielleicht sogar etwas darüber“, sagt einerdieser Regierungsexperten.
Die Fachleute sind selbst erstaunt, wiegut die deutsche Wirtschaft wieder Trittfasst. Noch vor einigen Monaten hieß es,Deutschland werde auf Jahre hinaus an-deren Ländern hinterherhinken, weil esunter seiner einseitigen Ausrichtung aufdie Exportindustrie zu leiden habe, wennandere Länder wegen der Krise wenigerimportieren.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Welt-wirtschaft legt dieses Jahr um vier Pro-zent zu, der Welthandel sogar um sieben.Davon profitieren zurzeit gerade die aufden Außenhandel ausgerichteten Firmenin Deutschland. „Da müssen wir dabeisein. Und da werden wir dabei sein“, gibtWirtschaftsminister Rainer Brüderle(FDP) die Parole aus. Während andere
Länder wie Frankreich oder Großbritan-nien nur mit Mühe aus der Rezessionkommen, übernimmt Deutschland inEuropa die Lokomotivfunktion.
Die Forscher fürchten auch nicht, dassdas Sparpaket der Bundesregierung denAufschwung abwürgt. Das Plus dürfte imnächsten Jahr, wenn die Maßnahmengreifen, allenfalls um zwei Zehntel-Pro-zentpunkte geringer ausfallen.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) hält die Sorgen für unbegründet.Das Sparpaket mache im nächsten Jahrnur einen Bruchteil der gesamten Bun-desausgaben von rund 300 MilliardenEuro aus.
Zudem bleibe die deutsche Finanz -politik expansiv. Ihr Beleg: Auch imnächsten Jahr wird der Bund 57,5 Mil -liarden Euro neue Schulden aufnehmen.
Das sieht der Haushaltsentwurf der Re-gierung vor, den das Kabinett an diesemMittwoch beschließen will. Vom Kaputt-sparen der Konjunktur könne deshalbkeine Rede sein, findet die Kanzlerin.
Der Optimismus wird befeuert durchdie Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.Die deutsche Jobmaschine brummt, alshabe die Wirtschaft in den vergangenenzwei Jahren bestenfalls eine konjunk -turelle Delle und nicht die weltweitschwerste ökonomische Krise seit Jahr-zehnten erlebt.
Als im Gefolge der Lehman-Pleite imHerbst 2008 die Aufträge in den Kern -bereichen der deutschen Industrie um 40Prozent und mehr einbrachen, wurdeschon eine nahende Massenarbeitslosig-keit prognostiziert. Monat um Monatmusste der Eintritt des Horrorszenarios
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 71
Wertentwicklung derWeltaktienmärkte
Goldpreis Wertverlust des Eurogegenüber dem Dollar
Rendite zehnjährigerdeutscher Bundesanleihen
–9 % –24 %+13 % –15 %
Krisensignale Wirtschaftsdaten, Veränderung gegenüber Jahresanfang
Containerschiff in Hamburg
CH
RIS
TIA
N O
. B
RU
CH
/ V
ISU
M
verschoben werden, weil die Arbeitslo-sigkeit allenfalls marginal stieg. Milliar-den für die Kurzarbeit halfen als Puffer.Nun erholt sich der Arbeitsmarkt mit un-geahnter Kraft.
Im Juni dieses Jahres waren 3,15 Mil-lionen Menschen arbeitslos, gut eine Vier-telmillion weniger als vor einem Jahr. Esist der niedrigste Stand seit Dezember2008. In Ostdeutschland ist die Aufwärts-dynamik besonders stark. Mit 977000 Ar-beitslosen im Juni wurde der niedrigsteWert überhaupt seit 19 Jahren erreicht.
Die Lage sei „deutlich günstiger als an-gesichts der wirtschaftlichen Rahmenbe-dingungen erwartet“, stellt die Bundes-agentur für Arbeit fest. Und alle Indika-toren sprechen dafür, dass bereits in denkommenden Monaten die Arbeitslosen-zahl erstmals wieder unter die Drei-Mil-lionen-Grenze fallen könnte.
Doch nicht nur die Zahl der Arbeitslo-sen ist in den vergangenen Monaten deut-lich gesunken, zugleich stieg die Zahl derErwerbstätigen auf 40,28 Millionen. Fürden Monat Mai ist es „der höchste Standseit der Wiedervereinigung“, stellte dasStatistische Bundesamt vergangene Wo-che fest.
Die Experten bieten viele Gründe fürdas deutsche Jobwunder an: den massen-haften Einsatz der Kurzarbeit in der Kri-se, das Anziehen des Exports, den schwä-chelnden Euro, der die deutschen Aus-fuhren zusätzlich verbilligt.
Vor allem aber übten die Gewerkschaf-ten über viele Jahre Lohnzurückhaltung,was die Wettbewerbsfähigkeit erhöhte.Die Tarifpartner einigten sich auf diffe-renzierte und flexible Arbeitszeitsysteme.Die rot-grüne Regierung unter GerhardSchröder befreite mit den Hartz-Refor-men den Arbeitsmarkt aus seiner Er -starrung.
So entstand im abgelaufenen Jahrzehnteine der robustesten und flexibelstenVolkswirtschaften weltweit. Deutschlandist das einzige europäische Land, in demdie Arbeitslosenquote heute niedrigerliegt als vor dem Ausbruch der Weltwirt-schaftskrise im Frühjahr 2008. In denUSA hat sie sich seitdem verdoppelt.
Auf Dauer aber wird sich gerade dieexportabhängige deutsche Wirtschaftnicht von der Entwicklung der Weltkon-junktur abkoppeln können – und die zeigtbereits erste Anzeichen der Ermüdung,sowohl in den USA als auch in China.
Manche Experten fürchten sogar, dassdie Wirtschaft nach kurzem Aufflackernder Wachstumskräfte weltweit wieder indie Rezession zurückfällt, weil zahlreicheKonjunkturprogramme auslaufen. Siesprechen in diesem Zusammenhang voneinem „Double Dip“, also einem zweifa-chen Knick nach unten.
Ohnehin ist das Fundament des neuenAufschwungs brüchig, solange auf den Fi-nanzmärkten extreme Nervosität und
blanke Angst herrschen. Neue Turbulen-zen sind programmiert.
Noch immer liegen gewaltige Lastenin den Büchern der Banken. Niemandweiß, wann und in welcher Höhe sie ab-geschrieben werden müssen.
Zum Teil sind es die alten Lasten, dieSchrottpapiere aus den Zeiten vor derKrise, zweitklassige amerikanische Immo-bilienkredite, sogenannte Subprimes, bei-spielsweise. Zum Teil sind es aber auchLasten, die vor einem Jahr noch kaumbewusst waren – Staatsanleihen aus Grie-chenland und anderen südeuropäischenLändern galten damals als halbwegs si-chere Anlage.
Für die Analysten der US-Investment-bank Morgan Stanley steckt Europa ineinem „Teufelskreis“. Statt in der Finanz-krise alle Banken nach US-Vorbildzwangsweise mit Staatsgeld zu rekapita-lisieren, wählten die Euro-Länder einenanderen Weg. Viele Banken saugten sich
nach der Lehman-Pleite mit billigem Geldder Europäischen Zentralbank voll.
Sie finanzierten damit laut MorganStanley seit Oktober 2008 den Kauf vonStaatsanleihen im Umfang von 420 Mil -liarden Euro. Mit Vorliebe griffen sie da-bei zu hochverzinsten Staatspapieren ausder südlichen Krisenzone, am liebstenaus Spanien, Griechenland oder Portugal.Diese Papiere hinterlegten sie wiederumbei der EZB als Sicherheit für neues Zen-tralbankgeld.
Anfangs sorgten diese lukrativen Ge-schäfte für Entspannung, inzwischen ent-puppen sie sich als Zeitbombe. Niemandweiß so richtig, wie diese Papiere in denBilanzen bewertet sind. Und noch weni-ger lässt sich sagen, was sie am Ende tat-sächlich wert sind.
Denn trotz aller Rettungspakete derEuro-Länder für angeschlagene Mitglied-
staaten rechnen viele damit, dass eineUmschuldung Griechenlands unaus-weichlich ist. Die Gläubiger müsstendann auf einen Teil ihrer Forderungenverzichten, um dem Schuldner einenNeustart zu ermöglichen.
Würden alle Banken einen solchen so-genannten Haircut überleben? Und wasist, wenn anschließend weitere Euro-Staaten kippen und noch mehr Bankenin Schwierigkeiten geraten?
Die Unsicherheit ist groß, sie schürt dasMisstrauen. Über Nacht parkten die Ban-ken deshalb zuletzt über 300 MilliardenEuro auf den Konten der EZB für den lä-cherlichen Zinssatz von 0,25 Prozent. Wersich also für ein Prozent Geld leiht, um esdann über Nacht lieber verlustreich für0,25 Prozent bei der EZB als für deutlichmehr bei einem Konkurrenten zu depo-nieren, hat vor allem ein Problem: Angst.
Dass die Banken sich in der vergangenenWoche erheblich weniger Geld neu pump-ten, als sie an die Bundesbank zurückzah-len mussten, konnte die Nervosität nur fürkurze Zeit dämpfen. „Es herrscht immernoch eine erhebliche Verspannung“, sagtHans-Günter Redeker, Devisenstratege derfranzösischen Großbank BNP Paribas. DieBilanzen seien zu undurchsichtig. „Es mussein vernünftiger Stresstest auf den Tisch,der auch veröffentlicht wird.“ Grundsätz-lich waren sich darüber auch die Teilneh-mer des Frankfurter Treffens vom vergan-genen Mittwoch einig. Allerdings gingendie Meinungen durcheinander, was ver-nünftig ist und was nicht.
Stresstests hat es in der Vergangenheitschon mehrmals gegeben. Sie wurden je-doch nicht veröffentlicht. Und sie berück-sichtigten ausgerechnet das derzeit größteRisiko in den Bankbilanzen nicht: dieStaatsanleihen der sogenannten PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Grie-chenland und Spanien).
Dass diese Werte verfallen, weil dieStaaten pleite sind und umschulden müs-sen, fürchten die Märkte am meisten.Aber dieses Horrorszenario wird auchder aktuelle Stresstest außer Acht lassen.Sonst könnte ja der Bundesbank und derBaFin unterstellt werden, sie würden amErfolg des Rettungsschirms zweifeln.
In ihrem Szenario unterstellen die Ban-kenprüfer stattdessen, dass eine Verschär-fung der Schuldenkrise die Ausfallversi-cherungen auf Papiere von Ländern wiePortugal oder Spanien verteuert – unddeshalb deren Kurse sinken lässt, was Ab-schreibungen bei den Banken zur Folgehat. Ein weiteres Szenario unterstellt rou-tinemäßig einen erneuten Konjunkturein-bruch.
Viele Fragen sind allerdings noch un-geklärt. Die Vertreter der Banken, derBundesbank und der BaFin werden sichdeshalb bald wieder treffen müssen.
BEAT BALZLI, MARKUS DETTMER,ARMIN MAHLER, CHRISTIAN REIERMANN
Wirtschaft
TrendumkehrPrognosen für das deutsche Wirtschafts-
wachstum 2010, in Prozent
Bundesregierung
DIW
Ifo
IfW
IWH
RWI
jeweils erstePrognose 2009für 2010
jeweils aktuellstePrognose 2010für 2010
0,5
1,4
–0,1
2,1
–0,2
1,8
0,5
1,9
1,1
1,7
–0,3
2,1
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 072
Mirow, 57, ist Präsident der EuropeanBank of Reconstruction and Develop-ment in London, bis 2008 war der Sozial-demokrat Staatssekretär im Bundes -finanzministerium.
SPIEGEL: Herr Mirow, es gibt Rettungsschir-me für Banken und Staaten. Warum istdie Nervosität auf den Finanzmärkten im-mer noch so groß?Mirow: In einem ersten Schritt musste manMaßnahmen ergreifen, die kurzfristig hel-fen, aber einige langfristige strukturelleProbleme sind noch nicht gelöst.SPIEGEL: Wie hoch ist die Wahrscheinlich-keit, dass Griechenland oder Spanientrotz aller Rettungspakete die Staatsan-leihen nicht vollständig zurückzahlen?Mirow: Es ist nicht sinnvoll, darüber zuspekulieren.SPIEGEL: Aber die Banken gehen offenbarvon diesem Szenario aus. Deshalb leihensie sich gegenseitig kaumnoch Geld.Mirow: Es ist richtig, dassdie Vertrauenskrise nochnicht wirklich überwundenwerden konnte. Das istauch der Hintergrund fürdie aktuelle Debatte überdie Stresstests, mit denendie Widerstandsfähigkeitder Banken gegenüber neuen Verwerfungen aufden Finanzmärkten geprüftwerden. Dabei muss auchvorab geklärt werden, wie
kapitalschwache Banken mit zusätzli-chem Eigenkapital ausgestattet werden. SPIEGEL: Wie viele Banken werden einenerneuten Test nicht bestehen?Mirow: Bei den Großbanken scheint dieLage weitgehend stabil. Die Risiken wer-den eher zum Beispiel bei einigen spani-schen Sparkassen oder deutschen Landes-banken vermutet.SPIEGEL: War das Rettungspaket für denEuro in erster Linie ein Rettungspaket fürdie Banken?Mirow: Das Paket sollte die grundsätz -lichen Zweifel am Euro ausräumen, vorallem auch außerhalb Europas.SPIEGEL: Gerade in den USA geht so man-cher Fondsmanager davon aus, dass derEuro am Ende doch abgewickelt wird.Wie oft zweifelten Sie an der Überlebens-fähigkeit des Euro?Mirow: Wenn die in der Krise sichtbar ge-wordenen Konstruktionsfehler jetzt be-
seitigt werden, gibt es kei-nen Grund zu zweifeln.SPIEGEL: Lassen sich dieMängel beheben, wenn dieam stärksten betroffenenStaaten mitbestimmen dür-fen?Mirow: Das kann man nichtmit Sicherheit sagen. Aller-dings wäre es vor einigenMonaten noch undenkbargewesen, mit welcher In-tensität heute etwa in Spa-nien und Griechenland Fragen wie Budgetdefizite
oder Wettbewerbsfähigkeit angegangenwerden.SPIEGEL: Trotz aller Anstrengungen bleibtder zentrale Mangel des Euro bestehen.Starke Volkswirtschaften gehören zusam-men mit schwachen wie Griechenland zueinem Währungsraum. Ist der Euro nichtzum Scheitern verurteilt?Mirow: Es gibt ja auch in den USA großeUnterschiede zwischen Bundesstaaten.Die Frage ist, in welchem Maße steht man füreinander ein und ob es wirksameAusgleichsmechanismen gibt. Das hatman der Öffentlichkeit lange Zeit ver-schwiegen.SPIEGEL: Dann ist die Währungsunion eineTransferunion?Mirow: Ja, das muss sie in Maßen sein.SPIEGEL: Hätte man das der Bevölkerungvorher gesagt, wäre der Euro zumindestin Deutschland wohl nicht eingeführtworden.Mirow: Das könnte sein. Aber heute mussman den Deutschen auch sagen, wie sehrunsere Wirtschaft mit ihren Arbeitsplät-zen vom Euro profitiert.SPIEGEL: Ist es sinnvoll, nach Estland wei-tere Staaten aus Osteuropa aufzuneh-men?Mirow: Ja, allerdings erwarte ich in naherZukunft keine weiteren Beitritte.SPIEGEL: Weil uns sonst neue Griechen-lands drohen?Mirow: Mögliche Kandidaten sind nochnicht so weit. Aber es bleibt sehr wichtig,dass sie sich konsequent darauf vorbe -reiten.SPIEGEL: Wagen Sie eine Prognose: Wiegeht es mit der Konjunktur und dem Euroweiter?Mirow: Die Risiken in den Finanzmärktenbleiben ein Fragezeichen. Aber nicht nurder Euro und Griechenland spielen eineRolle, sondern auch die Nachhaltigkeitdes Wachstums in den USA.SPIEGEL: Muss sich die Welt künftig nichtsowieso auf deutlich kleinere Wachstums-raten einstellen? Mirow: Die Frage ist tatsächlich, welchesWachstumsmodell wir in den Industrie-staaten haben wollen. Vor der Krise wardies stark durch die Finanzbranche unddie Kapitalmärkte bestimmt. Jetzt brau-chen wir eine neue Perspektive. Diskus-sionen über Stresstests und Regulierungalleine helfen da nicht weiter. Die beidenWelten Finanzmarkt und Realwirtschaftdürfen nicht getrennt voneinander dis-kutiert werden. Ich fand es deshalb auchbedauerlich, dass beim letzten G-20-Gip-fel in Toronto erneuerbare Energien undKlimaschutz kaum eine Rolle gespielt haben. SPIEGEL: Schlittern wir also ohne Konzeptin eine ungewisse Zukunft?Mirow: Jedenfalls bleibt viel zu tun, umin den Industriestaaten dauerhaft gerin-ges Wachstum zu vermeiden.
INTERVIEW: BEAT BALZLI, ARMIN MAHLER
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 73
„Keine weiteren Beitritte“ Thomas Mirow, Chef der Osteuropa-Bank, über nervöse
Finanzmärkte und die Zukunft der Währungsunion
Demonstranten in Athen: „Vertrauenskrise noch nicht wirklich überwunden“
OR
ES
TIS
PA
NA
GIO
TO
U /
DP
A
Banker Mirow
„Konsequent vorbereiten“
TH
IER
RY
MO
NA
SS
E /
PIC
TU
RE
-ALLIA
NC
E /
DP
A
Der Unternehmer Jürgen K. wollteeigentlich nur einen Kaffee trin-ken an jenem 26. Februar 2008 in
der Raststätte Nievenheim West an derA57 zwischen Düsseldorf und Köln. Dasser ausgerechnet in dieser kleinen Pausein einen Wirtschaftskrimi geraten würde,konnte er nicht ahnen, als kurz nachzwölf Uhr die Tür aufsprang.
Herein stürmte ein großgewachsenerMann mit weißem Hemd, Brille und ho-her Stirn. Er hatte nicht getankt und frag-te die Kassiererin nur, wo das Faxgerätstehe.
„Barsch“ sei der Mann gewesen, erin-nert sich K. heute. Er habe nicht gegrüßt,sich immer wieder umgeschaut und dann„zwei Faxe verschickt“.
Irgendwie kamen ihm der Mann undsein Auftritt dubios vor. „Da ist etwasfaul“, dachte K. Deshalb will er späterdie beiden Papiere aus dem Papierkorbgefischt haben. Die obligatorische Video-aufzeichnung aus der Raststätte zeigt das,was K. beschreibt – den eigentlich un-spektakulären Vorgang eines Faxversan-des, wenn man nicht weiß, wer der Mannam Gerät war und was er da mög -licherweise verschickt hat.
Denn die Papiere aus der Müllton-ne sind brisant: Das eine Blatt waranonym an das Finanzamt Bochumgerichtet, Abteilung Steuerstrafsa-chen. Der Urheber beschuldigte einenrenommierten Stuttgarter Rechtsan-
walt, vor Jahren eine Liechtensteiner Stif-tung gegründet zu haben. Auf dem ande-ren war die Kopie einer Pressemeldungüber einen pädophilen Banker, verbundenmit dem handschriftlichen Hinweis: „Dasist doch sicher Herr Christ, oder?“
Seit vergangener Woche liegen beideDokumente bei der StaatsanwaltschaftDüsseldorf. Sie könnten wichtige Beweisein einer Affäre der besonderen Art sein.Es geht um Verleumdung, Nötigung undanonyme Beschuldigungen.
Im Mittelpunkt steht Norbert Essing,einer der einflussreichsten PR-Berater derRepublik. Essing ist ein Stimmungsma-cher im Auftrag von Konzernen und Top-Managern. „Ich habe beobachtet, dassHerr Norbert Essing Faxe verschickt hat,die ich später dem Papierkorb entnom-men habe“, behauptete der Raststätten-zeuge K. gegenüber dem SPIEGEL nunin einer eidesstattlichen Versicherung. Sei-ne Aussage will er bei Bedarf vor der Düs-seldorfer Staatsanwaltschaft demnächstwiederholen.
Seit Wochen bereits ermittelt die Be-hörde in Sachen Essing, der alle Vorwürfe
vehement bestreitet. Grundlage ist eineStrafanzeige des Ex-Bankers HaraldChrist, laut der Essing den Banker in ei-nem anonymen Fax in die Nähe der Pä-dophilie gerückt haben soll (SPIEGEL5/2010).
Mit den neuen Aussagen könnten sichdie Untersuchungen weiter in die Längeziehen. Denn sie könnten belegen, dasses sich bei dem anonymen Schreiben ge-gen Christ nicht nur um einen Einzelfallgehandelt haben mag.
Dabei geht es nicht mal um die rechtli-che Problematik allein. Es geht vor allemum die Methoden jener Schattenmänner,die ihren Auftraggebern gern verspre-chen, das öffentliche Meinungsklima inDeutschland verändern zu können.
„Mich gibt es eigentlich nicht“, sagteEssing immer schon gern. Und tatsächlichgehört die Unsichtbarkeit von ihm undmanchen seiner Konkurrenten fast zu ih-rer Geschäftsgrundlage. Sie operieren amerfolgreichsten verdeckt.
Begonnen hatte Essings steiler Aufstiegals PR-Mann bei Audi und der DeutschenBörse, bevor er sich als Berater 1999 selbständig machte. Seitdem hat der 49-Jährige einige der mächtigsten Wirt-schaftslenker der Republik betreut. ZuMedienmogul Leo Kirch pflegte er genau-so langjährige Geschäftsbeziehungen wiezu dem früheren Metro-Chef Hans-Joa-chim Körber oder dem aktuellen LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter.
Der Kommunikationsberater nutzt dieAngst vieler Wirtschaftsgrößen vor derMacht der Öffentlichkeit. Er begleitet sie
in heiklen Situationen, etwa bei Fir-menübernahmen, Auseinanderset-zungen im Vorstand oder Aufsichts-rat – und bei der eigenen Karriere-planung.
Ein freundliches Foto hier, ein paarnette Zeilen da, man kennt den zu-ständigen Redakteur. Ein Verriss über
Wirtschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 074
A F F Ä R E N
„Wie ein Pfau“Einst galt Norbert Essing als einer der mächtigsten
Schattenmänner des Landes. Nun sollen neue Dokumente zeigen,mit welchen Tricks der PR-Profi gearbeitet haben könnte.
Fax-Ausriss: „Das ist doch sicher Herr Christ, oder?“
Zeuge K., PR-Berater Essing auf einer Sequenz der Videoüberwachungskamera in der Autobahnraststätte Nievenheim West: „Mich gibt es eigentlich
den vermeintlichen Konkurrenten? KeinProblem. So sieht das Versprechen sol-cher „Berater“ aus.
Das Vertrauen in Essings Diensteschwand, seit der SPIEGEL im Februarzum ersten Mal über die dubiosen Ma-chenschaften des PR-Einflüsterers berich-tete. Damals hatte sich Ex-Banker HaraldChrist, der im Wahlkampf 2009 als Mit-telstandsexperte im Kompetenzteam derSPD angetreten war, zu einer spekta -kulären Anzeige gegen seinen eigenenEx-Berater Essing durchgerungen. DerPR-Mann, so der Vorwurf, habe ihn beiseinem früheren Arbeitgeber, der Weber-bank, mit einem anonymen Schreiben indie Nähe der Pädophilie gebracht, weiler ihm seinen hochdotierten Berater -vertrag nicht habe verlängernwollen.
Als Beleg präsentierte Christnicht nur ein anonymes Fax mitder Kennung einer Autobahn-raststätte in der Nähe von Düs-seldorf. Gleichzeitig legte ChristAusschnitte eines Überwa-chungsvideos der Raststätte vor.Und das zeigt – ohne jedenZweifel – Norbert Essing, wieer zwischen 12.13 und 12.18 UhrPapier in ein Faxgerät in derRaststätte einlegt und anschlie-ßend an der Kasse bezahlt.
Christ stellte mittlerweileStrafanzeige gegen Essing. Es-sing hatte zuvor ebenfalls Strafanzeige gegen Christ ein-gereicht. Er sei das Opfer einesKomplotts, keilte er zurück. Dievermeintlichen Belege, sagt seinStrafverteidiger Norbert Gat-zweiler, seien äußerst fragwür-dig.
Zwar räumt Essing ein, erhabe zum betreffenden Zeit-punkt tatsächlich ein Fax aus
Nievenheim verschickt – allerdings nichtanonym und auch nicht an die Weber-bank. An den Adressaten kann sich derPR-Berater allerdings auch nicht mehr er-innern.
Kunden aus der Wirtschaft und einigeChefredakteure großer Zeitungen gingenseither auf Distanz zu ihm. Und die nunaufgetauchten Dokumente deuten zumin-dest darauf hin, dass er möglicherweisesogar zwei Schmuddelfaxe verschickt ha-ben könnte.
Vergangene Woche gingen die Papierebei der Staatsanwaltschaft in Düsseldorfein: die beiden Faxvorlagen samt Adresseund Namen des Zeugen K., der den Auf-tritt von Essing auf dem Autobahnrasthofim Jahr 2008 minutiös beobachtet habenwill.
K. war früher Unternehmer im Ruhr-gebiet. Als Essing an jenem 26. Februarum 12.13 Uhr die Raststätte NievenheimWest betritt, steht er bereits seit einigenMinuten an einem kleinen Tisch. Essinghabe sich aufgeführt „wie ein Pfau“, er-innert sich der Zeuge. Als er die Zetteldann beim Verlassen des Verkaufsraumsin einen Mülleimer schmiss, sei er, K.,neugierig geworden und habe die zerris-senen Dokumente herausgefischt. Mitdem Papier über den angeblich pädophi-len Banker, so der Zeuge, habe er damalsnicht viel anfangen können. Dafür elek-trisierte ihn das zweite Schreiben.
Darin nämlich wurde der ihm nament-lich bekannte Mittelstandsanwalt Brun-Hagen Hennerkes aus Stuttgart bei derBochumer Steuerfahndung bezichtigt, inLiechtenstein eine Stiftung aufgebaut zuhaben. Außerdem wurde darin der Ein-druck erweckt, Hennerkes könne persön-
lich Steuern hinterzogen haben. Unter-zeichnet ist das Fax mit „xy“.
So eine anonyme Verdächtigung seiihm „schlichtweg gegen den Strich gegan-gen“, sagt der Ex-Unternehmer. Deshalbrief er in der Kanzlei Hennerkes an, umden Anwalt von dem ungewöhnlichenVorgang zu unterrichten. Zwei Tage spä-ter trafen sich die beiden Männer imRuhrgebiet in einem Hotel.
Hennerkes ist der Seniorpartner einergutgehenden Kanzlei in Stuttgart, die vie-le renommierte deutsche Familienunter-nehmen zu ihren Kunden zählt. Er hateine Münchner Stiftung Familienunter-nehmen gegründet, bei deren Veranstal-tungen gelegentlich auch die Bundeskanz-lerin oder ihre Minister vorbeischauen.So einer lebt vom guten Ruf.
Doch auch Hennerkes hat nicht nurFreunde. Der Jurist zeigte dem Fax-Fin-der K. einige Fotos von Menschen, denener eine solche Denunzierung zutrauenwürde. Doch keinen von denen erkannteder Zeuge. Am Ende übergab K. die Ori-ginaldokumente an den Anwalt, der siein Stuttgart in seinem Büro-Tresor depo-nierte.
Dass die Anzeige gegen ihn tatsächlichbei den Steuerbehörden eingegangen war,wurde Hennerkes einige Monate späterklar. Steuerprüfer gingen den Verdächti-gungen im Rahmen einer Betriebsprü-fung minutiös nach.
„Die Verdächtigungen erwiesen sich alshaltlos. Das konnten wir in kurzer Zeitklären“, sagt Hennerkes. Danach war dasThema für ihn erst einmal erledigt. Zu-mindest bis zum Februar 2010.
Da nämlich stieß ein Anwalt der Kanz-lei im SPIEGEL auf die Geschichte um
Essing, das erste Fax von derAutobahn und die AffäreChrist. Es war genau jenes Fax,das neben der Steueranzeige andas Finanzamt Bochum seit Mo-naten im Original in Hennerkes’Tresor lag. Plötzlich bekamendie bis dahin anonymen Vor-würfe ein Gesicht.
Essing war dem Stuttgarterkein Unbekannter. In einigenProjekten hatten sie in der Ver-gangenheit sogar zusammenge-arbeitet.
Hennerkes griff zum Telefon-hörer und rief den Zeugen K.an. Der erkannte in dem SPIE-GEL-Bericht nicht nur Essingals Absender der beiden Faxe„zweifelsfrei“ wieder, auch erselbst, so der Zeuge, sei auf denim SPIEGEL abgedruckten Vi-deobildern zu sehen.
Zur Rede gestellt, stritt Es-sing die Vorwürfe vehement ab.Er habe sich, sagt der PR-Bera-ter, zu einer Gegenüberstellungmit dem Zeugen bereit erklärt,
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 75
RA
INE
R J
EN
SE
N /
PIC
TU
RE
-ALLIA
NC
E/
DP
A
gar nicht“
Jurist Hennerkes, Kanzlerin Merkel: Leben vom guten Ruf
SPIEGEL: Herr von Bomhard, die MunichRe ist unter anderem der größte Rückver-sicherer der Welt. Sie beschäftigen sichalso mit der Berechnung von Risiken undWahrscheinlichkeiten aller Art, richtig?Bomhard: Kann man so sagen, ja.SPIEGEL: Dann müssten Sie uns sagen kön-nen, wer Fußball-Weltmeister wird.Bomhard: Eine schon diplomatisch schwie-rige Aufgabe. Unser Konzern operiert glo-bal, so dass – egal, wer gewinnt – in irgend -einem unserer Büros immer jemand jubelnkann. Aber natürlich sind wir in Südafrikaauch geschäftlich stark involviert.SPIEGEL: Was genau versichern Sie rundum die Weltmeisterschaft?Bomhard: Wir waren schon bei den teilssehr großen Risiken im Zuge des Auf- undAusbaus der Infrastruktur engagiert. Jetztsind wir vor allem gefragt, wenn Spieleausfallen – und damit die werbeträchtigen
Fernsehübertragungen. Insgesamt wirdrund um die WM ein Wert von rund fünfMilliarden Dollar versichert. Wir alleinsind mit rund 350 Millionen im Spiel. Da-bei sind die vielfältigen Einzelversiche-rungen, die für die Spielerstars oder derenVerbände und Vereine abgeschlossen wer-den, noch nicht mit berücksichtigt.SPIEGEL: Ihre Fachleute berechnen öko-nomische, politische, meteorologische Risiken für solche Sportgroßereignisse.Auch Terrorgefahren?Bomhard: Klar, wobei wir die im Fall Süd-afrikas für sehr überschaubar halten. Dasist ja kein Land, das besonders terrorge-fährdet wäre. Gleichwohl besteht immerGefahrenpotential, weshalb wir uns auchregelmäßig mit nationalen Sicherheits -behörden austauschen.SPIEGEL: Am bedrohtesten war sicher ei-nes der Spiele der US-Nationalelf …
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 076
auch die Faxe wollte er auf mögliche Fin-gerabdrücke untersuchen lassen. Dochdarauf wiederum ließ sich der Anwaltnicht ein. Er schickte die Dokumente ver-gangene Woche an die DüsseldorferStaatsanwaltschaft.
Die muss nun prüfen, ob die Vorwürfevon Christ und die Beobachtungen desZeugen K. wirklich stimmen. Die Ermitt-lungen gestalten sich zäh. Einige mögli-che Straftatbestände sind verjährt, anderewie etwa Nötigung lassen sich kaum be-legen.
Deshalb steht das Ermittlungsverfahrenoffenbar kurz vor der Einstellung. Darandürften selbst die neuen Hinweise nichtsändern. Aber das ist eben nur die eine,die juristische Seite der Affäre, in der sichEssing selbst mittlerweile als Opfer einergroßen Verschwörung sieht.
Hinweise dafür glaubt sein AnwaltGatz weiler gefunden zu haben: DasSchriftbild der Faxkennung stimme nichtmit dem ehemaligen Faxgerät in Nie- venheim überein. Viele Aussagen vonChrist hätten sich als falsch entpuppt. Zudem gebe es klare Hinweise, dass Essing von Detekteien beschattet wordensei. Möglicherweise gehöre der vermeint-liche Zeuge ja sogar zu der Gesamt- inszenierung. Nur: K. stand bereits vorseinem Kaffee, als Essing die Raststättebetrat.
Wie absurd die Behauptung sei, Essinghabe noch ein zweites Fax von der Tank-stelle versandt, werde sogar durch die An-zeige von Christ gegen ihn untermauert.Darin gebe es die eidesstattliche Versi-cherung einer Kassiererin. Die habe aus-gesagt, dass Essing 40 Cent für die Über-sendung eines Blatts gezahlt habe. Voneinem zweiten Fax sei nie die Rede ge-wesen.
Tatsächlich ist das ein eklatanter Wi-derspruch zur Aussage von K. Aber viel-leicht hat sich die Kassiererin auch nurvertan?
Inzwischen liegt dem SPIEGEL daselektronische Kassenjournal der Tankstel-le vor, in dem sämtliche Zahlungen des26. Februar 2008 mit Datum, Uhrzeit undBezeichnung aufgelistet sind. In der ent-sprechenden Zeit vermerkt die Aufzeich-nung nämlich nur eine einzige Nutzungdes Faxgeräts.
Aufgeführt ist sie unter der Rubrik„963568 Telefongebühr“. Abgerechnet,heißt es dort, wurden „2 St“ zum Preisvon jeweils „0,20 Euro/St“ und einem Ge-samtbetrag von „0,40 Euro“.
Das wiederum lässt zwei Interpretatio-nen zu: Entweder Essing hat, wie er selbstbehauptet, nur ein Fax versandt, dessenÜbermittlung hätte dann aber zwei Tele-foneinheiten gedauert.
Oder es handelt sich um Seitenpreise.Dann wären zwei Faxe versandt worden –und Essings Rechtfertigungen kaum nochzu halten. FRANK DOHMEN, CHRISTOPH PAULY
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Die Zeit drängt“Munich-Re-Chef Nikolaus von Bomhard, 53, über dieBerechenbarkeit von Naturkatastrophen, die Evidenz
des Klimawandels und den kommenden Fußball-Weltmeister
Versicherungschef Bomhard: „Wir können die Erwärmung belegen“
RO
BE
RT
BR
EM
BE
CK
/ V
ISU
M
Bomhard: … stimmt, in dem Fall das gegenEngland, einfach, weil da die zwei großenFeindbilder mancher terroristischer Grup-pierungen gemeinsam auf dem Rasenstanden. Bei diesem Spiel wurden die Si-cherheitsmaßnahmen rund ums Stadionentsprechend verschärft.SPIEGEL: Die Munich Re zahlt sicher auchrund um die Havarie der Ölplattform„Deepwater Horizon“. Bomhard: Sie können davon ausgehen,dass es global kaum eine Katastrophegibt, an deren finanzieller Aufarbeitungwir nicht in irgendeiner Weise beteiligtsind. Das bringt schon unsere Markt -position mit sich.SPIEGEL: In dem Fall haben die Folgekos-ten mittlerweile atemraubende Höhen erreicht. Von 40, 60, 80 Milliarden Dollarist bereits die Rede.Bomhard: Ja, und die Kosten der unter -gegangenen Plattform von „nur“ rund 600Millionen Dollar fallen im Vergleich dazugering aus. Unsere eigene Schadenschät-zung beläuft sich auf einen niedrigen drei-stelligen Millionenbetrag in Euro. DerSachschaden ist dabei klar, die Frage derHaftpflichtschäden und ihrer Verteilungist aber noch völlig offen. BP hat einenfreiwilligen Fonds mit 20 Milliarden Dollaraufgelegt, mit Haftungsfragen und derenVersicherung hat das jedoch nichts zu tun. SPIEGEL: Aber mit Anstand.Bomhard: Ja, sehe ich auch so. Es gibt jasehr viele Anspruchsteller, und es ist be-kannt, dass BP keine Haftpflichtversiche-rung hatte. Aus Sicht der Versicherer gehtes jetzt um die Frage, wer wo in haftungs-rechtlich relevanter Form gehandelt hat.Das sind sehr schwierige Fragen. SPIEGEL: Hat man das Risiko solcher Boh-rungen auf offenem Meer unterschätzt?Bomhard: Auf jeden Fall müssen es alleAkteure neu einschätzen und bewerten,auch wir Versicherer. Wir können Sicher-heitsstandards setzen, zum Beispiel da-hingehend, nur noch doppelwandige Öl-tanker zu versichern. Bei Offshore-Boh-rungen haben alle Beteiligten jetzt neueErkenntnisse gewonnen, die noch nichtabschließend verarbeitet werden konn-ten. Es geht letztlich darum herauszufin-den, welche und wie viele Sicherheits-netze der Betreiber einer Ölplattformübereinanderlegen muss, um solche Ka-tastrophen künftig zu vermeiden.SPIEGEL: Was jagt Ihnen als Versicherermehr Angst ein: so eine Ölkatastrophe,ein Terroranschlag, ein Erdbeben oderder eher schleichende Klimawandel?Bomhard: Mich schreckt weniger die Größeeines Ereignisses: Erdbeben oder andereNaturkatastrophen sind für uns insoweitberechenbare Ereignisse, von den mensch-lich tragischen Folgen natürlich abgesehen.SPIEGEL: Immerhin muss Ihr Konzern al-lein für das Erdbeben in Chile vor einigenMonaten mittlerweile mit rund einer Mil-liarde Dollar geradestehen.
Bomhard: Aber damit wissen wir auch, wowir stehen. Schleichende Entwicklungenund Trends sind für uns eine größere Her -ausforderung. Dies wird besonders deut-lich in der Haftpflichtversicherung mitder oft lang andauernden Schadensent-wicklung und -abwicklung. Die Asbest-Folgeschäden sind das bekannteste Bei-spiel. Aber auch die Sachversicherungkann betroffen sein, wie etwa durch denKlimawandel – für die Weltgemeinschaftsicher eine enorme Herausforderung.SPIEGEL: Ihr Konzern war einer der erstenWarner vor den Folgen des Klimawan-dels. Zuletzt gerieten aber etliche Wis-senschaftler in Misskredit. Sie selbst glau-ben weiterhin an die Erderwärmung?Bomhard: Das ist keine Glaubensfrage,sondern Fakt. Wir können diese Erwär-mung und ihre Folgen ja belegen. Die In-tensität von Stürmen, aber auch das Aus-maß von Überschwemmungen hat mess-bar zugenommen. Es hat zwar in jüngsterVergangenheit auf Seiten der Wissen-
schaft Fehler bei Einzelfragen der Dar-stellung gegeben. Aber die vorliegendenDaten geben uns eine klare Botschaft.SPIEGEL: Nutzen Sie für Ihre Expertiseauch die Studien von erklärten Gegnernder Klimawandeltheorie?Bomhard: Natürlich. Darauf legen wirWert, denn wir wollen uns keinesfallsdem Vorwurf der Einseitigkeit, der Be-triebsblindheit aussetzen.SPIEGEL: Es scheint auch ein Glaubens-krieg geworden zu sein.Bomhard: Wir haben keine Zeit mehr fürdiese Diskussionen. Wenn wir noch 100Prozent Sicherheit in letzten Detailfragenhaben wollen, wird es für Lösungen zuspät sein. Gerade wir als Unternehmensehen uns hier als Stimme der Vernunft.SPIEGEL: Als Assekuranz müssen Sie Ge-fahren immer höher einschätzen, als siewomöglich sind.
Bomhard: Wir müssen vor allem realistischsein. Denn Risiken werden genauso häufigüber- wie unterschätzt. Beim Klimawandellaufen wir Gefahr, dass sich Menschen undUnternehmen gar nicht mehr versichernkönnen, weil die Risiken zu groß werdenund die notwendigen Prämien unbezahl-bar wären. Wir müssen also alles unter-nehmen, um die Erwärmung auf die oftzitierten zwei Grad einzudämmen.SPIEGEL: Kritiker werfen Ihnen vor, dassSie mit Ihren Kassandrarufen eben auchdie Preise Ihrer Policen befeuern.Bomhard: Das ist abwegig. Wir wollen imGegenteil, dass die Risiken vermindertwerden, versicherbar bleiben und unserePreise bezahlbar sind. SPIEGEL: Sie kombinieren Gemeinsinn mitRenditestreben?Bomhard: Das halte ich jedenfalls fürglaubwürdig und volkswirtschaftlich sinn-voll zugleich. Unsere Aufgabe ist es, dieFolgen des Klimawandels mit einemPreisschild zu versehen, das macht es den
Entscheidern gerade in Politik und Wirt-schaft leichter. SPIEGEL: Die Munich Re ist auch Initiatordes Wüstenstromprojekts Desertec. Kannman das als Versuch interpretieren, ausdem Klimawandel Kapital zu schlagen?Bomhard: Missinterpretieren kann man alles. Wir nehmen hier, bei allen mittelbarimmer gegebenen Geschäftsinteressen,durchaus eine gesellschaftliche Aufgabewahr. Ohne uns wäre die fast hundertJahre alte Idee nicht so umfassend, je-denfalls nicht jetzt, aufgegriffen worden.Die Zeit drängt. Der Durchbruch kam,als sich der jetzige Unternehmenskreiszusammenfand, die Technologie gibt esja schon länger. Über das weltweite Echowaren dann selbst wir überrascht. SPIEGEL: Am Ende sollen die Wind- undSolaranlagen 400 Milliarden Euro kos-ten.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 77
Wirtschaft
Sicherheitskräfte bei WM-Spiel: „Immer Gefahrenpotential“
CA
ME
RO
N S
PE
NC
ER
/ G
ET
TY
IM
AG
ES
Bomhard: Das klingt natürlich atemrau-bend, aber wenn Sie sich die Budgets dergroßen europäischen Energiekonzerneanschauen, ist das darstellbar. Am schwie-rigsten zu handhaben ist der politischeAspekt, die sehr unterschiedliche Interes-senlage der potentiell beteiligten Länder.Aber es ist politisch auch eine enormeChance, dass mit Desertec Staaten ausEuropa, Afrika und dem Mittleren undNahen Osten über konkrete Wirtschafts-projekte miteinander kooperieren wollen.Damit ergibt sich eine entwicklungs- undsicherheitspolitische Dimension.SPIEGEL: Ihr Kontakt zur Politik war auchbei den Staatsanleihen von Vorteil. Siehaben griechische Wertpapiere im Wertvon rund zwei Milliarden Euro in den Bü-chern. Den sogenannten PIIGS-StaatenPortugal, Irland, Italien, Griechenlandund Spanien haben Sie insgesamt sogarzwölf Milliarden geliehen. Haben Siemittlerweile Angst um das Geld?Bomhard: Nein. Als Großinvestor müssenwir unser Kapital streuen. Und der weit-aus größere Teil unserer Anlagen liegt indeutschen und US-Anleihen, bei denenwir aus den gleichen Gründen, die diePIIGS-Anleihen belasten, ordentlicheKursgewinne verzeichnen.SPIEGEL: Finden Sie es richtig, dass die Eu-ropäische Zentralbank (EZB) Ihnen nunmit einem Milliardenpaket hilft?Bomhard: Wieso uns? SPIEGEL: Die EZB kauft alles auf, was anschwer verkäuflichen europäischen An-leihen auf den Markt kommt.Bomhard: Versicherer halten ihre Papiereja meist recht lang. Und die Aktion hilftvor allem und direkt den notleidendenEuro-Staaten …SPIEGEL: … und indirekt den Banken unddamit Versicherungen.
* Thomas Tuma und Christoph Pauly.
Bomhard: Okay.SPIEGEL: Nur bei einem „Haircut“, wennalso alle Gläubiger auf einen Teil ihrerForderungen zum Beispiel gegenüberGriechenland verzichten müssten, wür-den auch Sie bluten.Bomhard: Im Prinzip ist das so auch richtig.Gläubiger müssen dem Risiko ausgesetztbleiben, ihr Geld zu verlieren. Dafür be-kamen sie höhere Renditen. Im konkretenFall Griechenland gab es aber politischeGründe, diesen Weg nicht zu gehen, dieFolgen wären unabsehbar gewesen. SPIEGEL: Sie würden als Konzernchef ei-gene Verluste akzeptieren?Bomhard: Selbstverständlich. Ich kanndoch nicht in guten Zeiten die Gewinnemitnehmen und in schlechten Zeiten nachstaatlichen Hilfen rufen.SPIEGEL: Machen aber viele Banker.Bomhard: Habe ich auch gehört, aber dasist unsere Sache nicht. Wer ins Risiko geht,muss bei dessen Eintreten die Kosten tra-gen. Mit Blick auf die Politik ist es jetztwichtig, eine einmal getroffene Entschei-dung konsequent umzusetzen und nichtwankelmütig zu werden. Unsicherheit istGift für die Kapitalmarktentwicklung.SPIEGEL: Zu Beginn der Griechenland-Kri-se wurde die Politik doch von reinemWankelmut regiert.
Bomhard: Ich will der Politik keine Notengeben, aber auch der Chor der Ökonomenwar und ist doch sehr vielstimmig. Selbsteine nicht ganz richtige Lösung ist jeden-falls besser als eine 100 Prozent richtige,die aber nicht konsequent umgesetzt wird.SPIEGEL: Ihnen muss angst und bange wer-den angesichts des vielen billigen Geldes,mit dem die Notenbanken die Märkteüberschwemmen.Bomhard: Die enorme Liquidität findenwir in der Tat nicht gut. Die Niedrigzin-sen sind gerade für uns Versicherer eineHerausforderung. Auch beim Thema Li-quidität muss man fragen dürfen: Wieviel, für wen, wie lange?SPIEGEL: Warum ist weiterhin so viel Ner-vosität in den Finanzmärkten? Bomhard: Weil das Vertrauen noch immernicht zurückgekehrt ist. Auch ist einegrundlegende Frage weiter unbeantwor-tet: Wie müsste ein effektives und effi-zientes Bankensystem zukünftig ausse-hen, und wie müsste man es steuern?Hier müssen auch radikalere Ansätze ge-dacht werden. Die extreme Verknüpfungder Banken untereinander ist jedenfallsnach wie vor ein Problem.SPIEGEL: Das Gipfeltreffen der G-20-Staa-ten in Toronto hat kaum Ergebnisse ge-bracht, was die künftige Regulierung derFinanzmärkte angeht. Sind Sie enttäuschtoder erleichtert?Bomhard: Eher enttäuscht. Aber das Dilem -ma ähnelt ein bisschen der Klimadiskus -sion: Wenn man so viele, so unterschied-liche Länder an einen Tisch bringt, ist esunrealistisch, den einen, den großenDurch bruch zu erwarten. Man muss dieErwartungen zurückschrauben. Auch soll-te die Politik nicht die Hoffnung nähren,dass weltweite Lösungen greifbar nahesind. Bei der Regulierung der Finanzmärk-te wird man eine globale Veränderung nurschwer erreichen, regionale und nationaleRegelungen sind wahrscheinlicher – undnicht immer schädlich für den Wettbewerb. SPIEGEL: Die Finanzmärkte brennen nochimmer, die Konjunktur dagegen blüht ge-rade auf. Können Sie uns diese Diskrepanzerklären?Bomhard: Die in der Krise verabschiedetenFinanzhilfen entfalten gerade erst ihreWirkung. Aber fürs zweite Halbjahr binich deutlich skeptischer. Die aktuellenWachstumsraten sehen besser aus, als esdie Entwicklung der Nachfrage in vielenLändern vermuten lässt. SPIEGEL: Sie machen sich besonders umGriechenland Sorgen?Bomhard: Schon wegen der Größe vielmehr um Großbritannien und die USA.Die Situation dort, etwa die wachsendenstaatlichen und die hohen privaten Schul-den sowie die impliziten Defizite aus den Sozialversicherungen, halte ich fürbesorgniserregend.SPIEGEL: Herr von Bomhard, wir dankenIhnen für dieses Gespräch.
Wirtschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 078
Havarierte Ölplattform „Deepwater Horizon“: „Sehr schwierige Fragen“
US
CO
AS
T G
UA
RD
/ D
PA
Bomhard (M.), SPIEGEL-Redakteure*
„Fürs zweite Halbjahr deutlich skeptischer“
MA
NF
RE
D W
ITT
Die Hamburger Ärztin hät-te vielleicht misstrauischwerden müssen, der Preis
war einfach zu gut: 379 Euro soll-te die Küchenmaschine Artisander Firma KitchenAid kosten –rund 200 Euro weniger als üblich.Die 38-Jährige zögerte nicht undbestellte sich das Gerät der ame-rikanischen Kultmarke.
Was ihr der Online-HändlerComtech lieferte, entsprach aller-dings überhaupt nicht dem, wassie sich versprochen hatte: Schonbeim Auspacken entdeckte sie offensichtliche Verarbeitungsfeh-ler, eine Metallabdeckung direktüber dem Rührer saß schief, un-ter der Rührschüssel schlug derMetallrand Wellen.
Das Gerät gilt eigentlich alsRolls-Royce unter den Küchen-maschinen. Was sie geliefert be-kam, war allenfalls ein schedde-riger Oldtimer mit Pedalantrieb.Sie konnte das Ding nicht malstarten.
Als sie aber beim Kunden-dienst der Firma in Süddeutsch-land anrief, teilte man ihr mit,dass für die Geräte einiger Inter-nethändler gar keine Garantiegelte – darunter auch Comtech.
Der Grund für die Ablehnung:Die Maschine, die die Hamburge-rin im Internet gekauft hatte, warnicht auf dem offiziellen Ver-triebsweg über Brüssel von Kit-chenAid nach Europa importiert worden,sondern auf dubiosen Wegen in den Handel gelangt. Ein Problem, das nichtnur der amerikanische Küchenmaschinen-hersteller hat.
Graumarktimporte nennen Expertendas Verfahren, bei dem Markenprodukteunter Umgehung der üblichen oder ver-einbarten Handelswege in den Verkaufgelangen. Modemarken wie Abercrombie& Fitch kämpfen mit dem Problem, aberauch Pharmariesen, Elektroanbieter wieSony oder der Schmuckhersteller Tiffany.
Manchmal handelt es sich um schlichteFälschungen, oft ist die Herkunft des Pro-dukts, wie im Fall KitchenAid, komplexer:
Entweder verkaufen die offiziell vom Her-steller beauftragten Händler überschüssi-ge Ware trotz Verbots unter der Handweiter. Oder mangelhafte Chargen undGeräte aus Rückrufaktionen werden nichtvernichtet, sondern heimlich weiterge-reicht. Andere Händler machen sich dieoft eklatanten Preisunterschiede etwa beiParfums und Kosmetikprodukten zunutze,kaufen Markenprodukte in Asien ein undverkaufen sie dann in Europa weiter – mitbeträchtlichen Gewinnspannen.
Woher die Comtech-Geräte stammen,will der Internethändler nicht verraten.
Nur, dass sie innerhalb Europas einge-kauft worden seien. Das ist wichtig, denninnerhalb des europäischen Wirtschafts-raums dürfen offiziell importierte Warenfrei gehandelt werden. Der Markenschutzdes Herstellers gilt als erloschen.
Die Geräte aber, die auch bei mehrerenanderen Internetanbietern aufgetauchtsind, will KitchenAid nicht in die EU ein-geführt haben. „Wir wissen derzeit nochnicht, woher diese Maschinen kommen“,sagt Deutschland-Verkaufschef FalkoLanghorst. Immerhin geht es offenbar ummehrere tausend Geräte.
Die US-Firma ist geschüttelt, nicht ge-rührt: Sie kann aber nicht alle Kunden
abweisen, die sich beschweren. Schließ-lich ist für ein Unternehmen wie Kitchen -Aid nichts schädlicher als enttäuschteKonsumenten, die sich über den Serviceoder das Produkt ärgern – ganz gleich,wo sie es gekauft haben. Es gibt indeskeine genauen Zahlen, in welchem Um-fang Hersteller mit solchen Grauimportenkonfrontiert sind und welcher Schadenihnen entsteht. Kein Unternehmen beich-tet gern, nicht mal die eigenen Vertriebs-kanäle unter Kontrolle zu haben.
Nur so viel ist sicher: Der Handel mitMarkenprodukten zweifelhafter Herkunft
ist ein Wachstumsmarkt – zurFreude findiger und mitunter jen-seits der Legalität arbeitenderHändler und zum Schaden vonVerbrauchern und Herstellern.
Früher waren solche Produkteauf Flohmärkten oder Kaffeefahr-ten zu finden. Heute sorgt das In-ternet dafür, dass auch noch dieentlegensten Flecken mit Elektro-schrott bedient werden können.
„Das Internet produziert dasProblem häufig überhaupt erst“,sagt Alexander Dröge vom Mar-kenverband. „Der Verbraucherhat plötzlich Zugriff auf Quellen,die ihm bislang nicht zugänglichwaren – die aber nicht immer se-riös sind.“ Und Unternehmenwie KitchenAid haben gar dasRecht auf ihrer Seite. Als Mar-keninhaber darf der Hersteller be-stimmen, wo und durch wen erseine Produkte verkaufen lässt.Aber es ist offenbar schwierig, illegale Vertriebswege juristischdichtzumachen.
„Der Hersteller muss erst be-weisen, dass die beanstandeteWare nicht für den jeweiligenMarkt bestimmt war“, sagt Mar-kenrechtsexperte Arne Björn Seg-ler von der Frankfurter KanzleiWinterstein. Dafür gibt es durch-aus einfache Möglichkeiten: DieHersteller müssten ihre Gerätedurch elektronische Chips oderSeriennummern kennzeichnen.Dann wäre exakt nachvollzieh-
bar, wann und wo das Gerät gefertigt undwohin es geliefert wurde. Genau das willKitchenAid jetzt versuchen.
Bislang ist der Kunde in diesen Fällenentweder der König, wenn er dank Inter-net Markenprodukte zu Supersonder an -gebotspreisen bekommt. Oder er ist derDepp, wenn die Ware Macken hat und diesonst übliche Herstellergarantie nicht gilt.
Die Hamburger Schnäppchenjägerinhat ihre Konsequenzen gezogen: Nach-dem auch die Ersatzmaschine, die Com-tech ihr geschickt hatte, Mängel aufwies,reichte es ihr: „Ich werde nie wieder einGerät von KitchenAid kaufen, egal zuwelchem Preis.“ SUSANNE AMANN
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 79
H A N D E L
Mangelwarevia Netz
Die US-Küchengeräte von Kitchen-Aid verärgern deutsche Kunden.
Viele im Internet vertriebeneMaschinen sind zweite Wahl – unddann gibt’s noch nicht mal Garantie.
KitchenAid-Werbung: Der Kunde ist König – oder Depp
P.
GA
RC
IA/M
AD
AM
E F
IGA
RO
/LA
IF
C H I N A
Langer Arm des Zensors
Ex-Premier Li Peng, 81, einer derHauptverantwortlichen für das
Massaker vom Tiananmen-Platz 1989,kann seine Sicht der Ereignisse nichtöffentlich machen – weder auf demFestland noch in der Sonderverwal-tungsregion Hongkong. Der ehemaligeRegierungschef hat seine Memoirengeschrieben, doch nur ein paar ausge-wählte Funktionäre durften sie lesen.Gleichwohl gelangte ein Manuskriptnach Hongkong, wo der Verleger BaoPu einige tausend Exemplare druckenließ. Auf Intervention von KP-Kadernmusste er das Vorhaben „wegen Urhe-berrechtsproblemen“ stoppen. Kritikerschließen daraus, dass der Arm vonPekings Zensoren auch dorthin reicht.Der Herausgeber hatte 2009 die Erin-nerungen von Zhao Zi yang veröffent-licht, der infolge des Blutbads als Par-teichef abgesetzt wurde und bis zu sei-nem Tod 2005 unter Hausarrest saß.Um sich reinzuwaschen, stellt sich seinGegenspieler Li nun als treuer Gefolgs-mann dar. Er habe dem KP-Patriar-chen Deng Xiaoping gehorcht, der be-reit war, „einiges Blut zu vergießen“,um die Proteste der Studenten zu unterdrücken. Die KP versucht das Tiananmen-Massaker aus dem Ge-dächtnis der Bevölkerung zu tilgen.
80
Panorama
S T E U E R F L Ü C H T L I N G E
Rückzugsparadies fürEuropas Reiche
Mit zweistelligen Zuwachsraten sei-nes Finanzsektors wird Panama
zum neuen Vorzugsziel von Steuer-flüchtlingen vornehmlich aus Europa.Die glänzenden Geschäfte der Bankenhaben inzwischen einen Boom der ge-samten Wirtschaft ausgelöst. PanamasGeldhäuser übernehmen große Beträ-ge, die bislang vor allem in den Safesetwa von Schweizer oder Liechtenstei-ner Banken lagerten. Seit dem 14. Fe -
bruar 2008, als Klaus Zumwinkel,der einstige Chef der DeutschenPost, mit seinem Schwarzgeld- Depot in Liechtenstein aufflog, sinddie europäischen Banken den Steu-ersündern und Geldwäschern desKontinents nicht mehr sicher genug.Sie verlegen ihre Depots und Fi-nanztransaktionen in andere Regio-nen. Panama, mit dem US-Dollarals Zahlungsmittel, kommt in demMilieu offenbar besonders gut an.Dort könne jeder, behaupten Anla-geexperten, billig und unbüro -kratisch eine Stiftung, einen Fonds
S I M B A B W E
Diamanten für Freunde
Dem Kimberley-Prozess – eine Verein-barung von 75 Staaten zur Herkunfts-
deklaration von Diamanten – droht einRückschlag. In Tel Aviv konnte sich derClub vor zwei Wochen weder auf eineFortsetzung noch auf ein Ende des beste-henden Verbots für Diamanten aus Sim-babwe verständigen. Nun kündigte dieRegierung in Harare an, aus ihren Lager-beständen Steine für über eine MilliardeDollar zu verkaufen. Noch immer kon-trollieren die Sicherheitskräfte von Staats-chef Robert Mugabe die 68500 Hektargroße Marange-Mine im Osten Simbab-wes, eines der ergiebigsten Diamantenfel-der der Welt. Untersuchungen von Men-
schenrechtsorganisationen belegen, dassMinenarbeiter dort ermordet, gefoltertoder zur Arbeit gezwungen werden. DerErlös der Diamanten kommt überwiegendder Armee und der politischen Elite inHarare zugute. Nun wächst die Kritik an dem Abkom-men. „Der Kimberley-Prozess riskiert, be-deutungslos zu werden, wenn er diese an-haltenden Übergriffe ignoriert“, sagt RonaPeligal, die Afrika-Chefin von HumanRights Watch. Und Elly Harrowell vonGlobal Witness meint, in den letzten Jah-ren habe fehlender politischer Wille denKontrollprozess schwer beschädigt. DerAnteil sogenannter Blutdiamanten – Stei-
Li-Peng-Memoiren in Hongkong
TY
RO
NE
SIU
/ R
EU
TE
RS
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Finanzzentrum Panama-Stadt
ALA
MY
/ M
AU
RIT
IUS
IM
AG
ES
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 81
Ausland
H O N D U R A S
Zwischen den Fronten
Ein Jahr nach dem Sturz von Präsi-dent Manuel Zelaya droht dem
mittelamerikanischen Land womöglicherneut ein Putsch. Der neugewählteStaatschef Porfirio Lobo, ein reicherRinderzüchter, warnte davor, dass dierechtsgerichtete Oligarchie erneut ei-nen Staatsstreich plane. EinflussreicheUnternehmer hatten sich mehrmals inder Hauptstadt Tegucigalpa getroffen,um über „radikale Aktionen“ gegenden Präsidenten zu beraten. Farmerund Geschäftsleute sind gegen eine Er-höhung des Mindestlohns um 30 Pro-zent, wie die Gewerkschaften fordern.Den hatte schon Lobos Amtsvorgän-ger Zelaya um 38 Prozent auf knapp
300 Dollar anheben wollen und damitseine gewaltsame Absetzung provo-ziert. Jetzt muss Präsident Lobo gleichan mehreren Fronten kämpfen. Aufder einen Seite bedrängen ihn die Ge-werkschaften und die sozialen Bewe-gungen mit Demonstrationen, sie for-dern die Rückkehr Zelayas aus demExil in der Dominikanischen Republik.Die Oligarchen, die seit Jahrzehntenin dem verelendeten Kleinstaat das Sa-gen haben, betrachten Lobo dagegenals Verräter an ihrer Klasse, weil erder Einsetzung einer Wahrheitskom-mission zugestimmt hat, die Men-schenrechtsverletzungen während desPutsches aufklären soll. Überdies er-kennen wichtige lateinamerikanischeStaaten wie Brasilien oder Argenti-nien Lobo weiterhin nicht an und un-terstützen noch immer den Vorgänger.
N A H O S T
Gaddafi nach Gaza?
In den kommenden Wochen erwartetder Gaza-Streifen einen regelrechten
Ansturm hochrangiger ausländischerBesucher. Nach der Lockerung derHandelsblockade will Israel seineGrenze zum palästinensischen Küsten-streifen jetzt auch für Vertreter be-freundeter Regierungen öffnen. DieEinladung von Israels AußenministerAvigdor Lieberman an seine Amts -kollegen in der Europäischen Unionsei „kein luftleeres Gerede“ gewesen,bestätigte ein israelischer Diplomatdem SPIEGEL. Hinter den Kulissenwerden bereits die Modalitäten ausge-arbeitet. Geplant ist der Besuch vonbis zu sieben EU-Außenministern, darunter Italiens Franco Frattini und
Deutschlands Guido Westerwelle. ZurBedingung machen die Europäer aller-dings ein weitgehendes Ende der israelischen Blockade. Israel will deminsofern nachkommen, als dass esdemnächst auch dringend benötigtesBaumaterial in den Gaza-Streifen lassen will. Die arabischen Staaten planen eben-falls eine Besuchsoffensive. Den An-fang soll der libysche Revolutionsfüh-rer Muammar al-Gaddafi machen. DerGeneralsekretär der Arabischen Liga,Amr Mussa, sondierte entsprechendePläne bei seinem Besuch in Libyenvergangene Woche. Anders als die EU-Vertreter würde der Libyer überÄgypten einreisen und sich auch mitder Hamas-Regierung treffen. Die EU- Außenminister dagegen wollen sichauf keinen Fall für Propagandazweckemissbrauchen lassen.
oder eine anonyme Briefkastenfirmagründen. Zu den Neukunden panamai-scher Banken zählen in den vergangenenMonaten vermehrt reiche Spanier, denendie gewohnten Anlageplätze in Europanicht mehr sicher genug sind. Überdieshat der spanische Fiskus Ermittlungen ge-gen 1500 mutmaßliche Steuerflüchtlingeeingeleitet, die bis zu sechs MilliardenEuro bei der HBSC in der Schweiz gebun-kert haben sollen. Selbst der kalabrischenMafia-Gruppe ’Ndrangheta scheint es inPanama zu gefallen. Die Mailänder Staats-anwaltschaft behauptet, die Gangster hät-ten auch dort mit Hilfe zweier Telekom-munikationsunternehmen bis zu zwei Mil-liarden Euro gewaschen.
ne aus afrikanischen Bürgerkriegsgebie-ten, die den Konflikt finanzieren – warnach der Einführung des Herkunftszerti-fikats von rund 15 auf 1 Prozent des Welt-handels geschrumpft. Das dürfte sich nunändern. Fachleute schätzen das Potentialder Marange-Mine auf bis zu 1,7 Milliar-den Dollar jährlich. Der Verkauf einerJahresproduktion wäre nicht nur ein mas-siver Anschub für Simbabwes Wirtschaft,die 2009 ein Bruttoinlandsprodukt vonnur 4,4 Milliarden Dollar erzielte. Er wür-de auch die Position von Präsident Muga-be stabilisieren, der mit einem Teil derErlöse seine Freunde und Unterstützer inPartei und Armee an sich bindet.
Gewerkschaftsdemonstration in Tegucigalpa
OR
LA
ND
O S
IER
RA
/ A
FP
Minenarbeiter in Marange
TS
VA
NG
IRA
YI
MU
KW
AZ
HI
/ A
P
Das Ganze hat, natürlich, mit Liebezu tun: mit der Liebe und Zu- neigung einer 87-jährigen Milliar-
därin zu einem 25 Jahre jüngeren Mann,dem Fotografen François-Marie Banier.Und es hat, natürlich, auch mit Geld zutun: Seit 1995, so heißt es, habe der Foto-graf Geschenke von der reichen L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt entgegenge-nommen, insgesamt eine Summe zwi-schen 600 Millionen und einer MilliardeEuro, so genau weiß das niemand.
„Das sind nur wenige Prozente ihresGesamtvermögens“, sagt der Anwalt derWitwe dazu. Außerdem könne Betten-court ihr Geld doch ausgeben, wie siewolle. „All das ist nichts, verglichen mitdem, was ich von ihr lernen durfte“, sagtder Fotograf.
Seit 1987 war der homosexuelle Banierein Freund der Familie, damals lebte nochBettencourts Mann, man reiste zu dritt.Er habe stets den unabhängigen Geistvon Liliane geschätzt, sagte Banier in einem Interview. Sie finanzierte im Ge-genzug seine Ausstellungen und lernteRock’n’Roll für ihn.
Kurz nach dem Tod ihres Vaters vorzweieinhalb Jahren reichte die Betten-court-Tochter Françoise dann Klage ge-gen den Gefährten ihrer Mutter ein. Siewarf ihm vor, die Schwächen der altenDame auszunutzen, um sich Zuwendun-gen zu erschleichen. Das Verfahren wur-de zunächst ausgesetzt.
Dann aber versteckte ein Butler derFamilie ein Aufnahmegerät auf demSchreibtisch von Liliane Bettencourt,nahm die dort geführten Gespräche mitihrem Vermögensverwalter auf und über-gab die Mitschnitte im Mai der Tochter.28 CD-Rom, insgesamt fast 100 Stundenlang. Irgendjemand spielte die Bänderder Internetseite Mediapart zu.
Seither bringen die Aufnahmen nichtnur die Witwe und den Fotografen in Be-drängnis, sie bedrohen auch die politischeKarriere des französischen Arbeitsminis-ters Eric Woerth und die einschneidends-te Reform, die Nicolas Sarkozy sich fürseine Amtszeit vorgenommen hat: dieRentenreform. Denn Woerth, der sich zu-vor schon als Haushaltsminister bewährthatte, soll das umstrittene Vorhaben fürden Präsidenten durchsetzen.
Seit Monaten hatte der ArbeitsministerExperten befragt, Modelle durchrechnenlassen und Sozialpartner an den RundenTisch gebeten – wissend, dass er damitseinen bisher größten politischen Kampfaufnimmt. Scheitert die Rentenreform,könnte das den Präsidenten schwer be-schädigen. Bringt er sie durch, schafft Sar-kozy, was seinem Vorgänger nicht gelang,und bewahrt Frankreichs Pensionskassenvor einem wachsenden Milliardenloch.
All das hängt nun auch ein wenig vonden Gesprächen ab, die der Butler heim-lich aufnahm, weil er nicht länger mit an-sehen wollte, wie seine Chefin ausgenutzt
wurde. Denn die Aufnahmen enthüllennicht nur die Existenz von Konten mitinsgesamt 78 Millionen Euro in derSchweiz, eine im persönlichen Vermögennicht deklarierte Seychellen-Insel und du-biose Transaktionen in Liechtenstein. Siebelegen auch, wie sich der Elysée undPräsident Sarkozy direkt in das Gerichts-verfahren der Bettencourt-Tochter ein-mischten.
Und sie belegen Beziehungen der rei-chen Witwe zu Minister Eric Woerth, unddie waren durchaus eng, womöglich einwenig zu eng. So arbeitete Woerths FrauFlorence bis vor wenigen Tagen bei derFinanzgesellschaft Clymène, einem Un-ternehmen, das Bettencourts Vermögenverwaltet. Der Minister soll Bettencourtbeim Erwerb einer Immobilie behilflichgewesen sein, außerdem hat er ihren Fi-nanzberater Patrice de Maistre persönlichzum Ritter der Ehrenlegion ernannt undmehrere Schecks von der L’Oréal-Erbinfür seine Partei entgegengenommen.
Das alles passt eigentlich nicht zumImage von Eric Woerth, der sich bishersachlich, kompetent und integer gab. Zueinem Mann, der Informationen zu meh-reren tausend französischen Steuersün-dern, die ihr Geld in der Schweiz angelegthatten, in die Hände bekam und sie derStaatsanwaltschaft übergab. Die Opposi-tion fordert nun einen Untersuchungs-ausschuss, die Finanzbehörden ermittelnund vernehmen Zeugen.
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 082
F R A N K R E I C H
Die Liebe und die RenteDie Rentenreform sollte zum Kernstück von Sarkozys Amtszeit werden – doch seit
Enthüllungen den zuständigen Arbeitsminister Eric Woerth mit einem Finanz- und Steuerskandal in Verbindung bringen, ist Sarkozys wichtigstes Projekt gefährdet.
Milliardärin Bettencourt mit Freund Banier, Arbeitsminister Woerth mit Ehefrau: „Eric ist die menschgewordene Ehrlichkeit“
ER
IC F
EF
ER
BE
RG
/ A
FP
HO
RS
T O
SS
ING
ER
Eines steht jetzt schon fest: Der Minis-ter trennte nicht immer sauber zwischenministeriellen Aufgaben und parteipoli-tischen Interessen. Das ist in Frankreichnicht unbedingt ungewöhnlich, könnteihm aber nun zum Verhängnis werden.
So gab Woerth im Frühjahr 2008 einenEmpfang in einem Stadtpalais der Regie-rung in der Rue de Lille mit Blick auf Seine und Tuilerien, im Garten des An-wesens liegt Coco, der letzte Hund vonKönigin Marie-Antoinette, begraben. Aufder Gästeliste standen an diesem Abendein Dutzend Banker, Industrielle und Im-mobilienhändler sowie Patrice de Mai-stre, der persönliche Vermögensverwaltervon Liliane Bettencourt. Auch der reicheAutoerbe Robert Peugeot war dabei.
Eric Woerth, der Hausherr, hatte dies-mal allerdings nicht als Minister geladen,sondern als Schatzmeister der konserva-tiven Regierungspartei UMP. Jahrelangfüllte er geschmeidig diese Doppelrolleaus, trieb tagsüber die Steuern ein, ver-waltete den Staatshaushalt und akquirier-te abends Spenden für die Partei, unteranderem auch bei Steuersündern.
Seit den Enthüllungen des Butlers fragtsich die Nation nun, inwieweit die Ver-pflichtungen des Ministers und die desParteisoldaten kollidierten. VerhinderteWoerth 2009 etwa Nachforschungen derJustiz nach schwarzen Konten derL’Oréal-Erbin Bettencourt? Deckte erSteuerhinterziehung bei der Witwe? Hät-te er seine Ehefrau nicht davon abhaltenmüssen, für Bettencourt zu arbeiten?
„Eric ist die menschgewordene Ehrlich-keit“, verteidigte Nicolas Sarkozy seinenMinister am vergangenen Dienstag. Pre-mier François Fillon stellte sich am selbenTag im Parlament in der letzten Frage-stunde vor der Sommerpause vor Woerthund warf den Sozialisten vor, mit ihrenAngriffen „die demokratischen Regelnder Republik zu ohrfeigen“. Der Ministerselbst erklärte sich zum Opfer einer Men-schenjagd, im Übrigen habe er mit seinerFrau sensible professionelle Informatio-nen nie ausgetauscht und sich nichts vor-zuwerfen.
Da allerdings hatten der InternetdienstMediapart und das Wochenmagazin „LePoint“ den inkriminierenden Wortlautder Mitschnitte längst veröffentlicht. Seit-her hat der Architekt und Chefunter-händler des ehrgeizigsten Sarkozy-Pro-jekts große Mühe, sein Gesicht zu wah-ren. Dabei ist die Runderneuerung desmaroden französischen Renten- und Pen-sionssystems schon kompliziert genug.
Die Rentenzahlungen für Frankreichsalternde Bevölkerung hinterlassen einjährlich steigendes Defizit, ohne einenUmbau des Systems könnte das Finanz-loch bis 2018 auf 42 Milliarden Euro an-wachsen. Geplant ist daher – neben einerReihe von Steuererhöhungen – vor allemdie schrittweise Anhebung des Renten -
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 83
Präsident Sarkozy, Gattin Bruni: „Untadelige Republik“
IP3
PH
OTO
PR
ES
S A
GE
NC
Y /
IN
TE
RTO
PIC
S
Privileg der Franzosen Tatsächliches
Erwerbsaustrittsalter
Quelle: OECD
FRANKREICH ..............58,7 (60)....... 59,5 (60)
ITALIEN ......................60,8 (65).......60,8 (60)
DEUTSCHLAND ..........62,1 (65) ........61,0 (65)
GROSSBRITANNIEN ... 63,2 (65)........61,9 (60)
USA ...........................64,6 (66) .......63,9 (66)
JAPAN ........................69,5 (64)....... 66,5 (62)
offizielles Rentenalter
MÄNNER FRAUEN
alters um zwei Jahre. Vomkommenden Sommer an, soder Plan, will die Regierung dasRentenalter jährlich um vierMonate steigern, damit es dann2018 bei 62 liegt. Womit es im-mer noch eher niedrig wäre imeuropäischen Durchschnitt.
Die Franzosen sehen das an-ders, trotz Krise, trotz steigen-der Arbeitslosigkeit und rigo-roser Sparpläne. 63 Prozentvon ihnen, so eine Umfrage,wollen nicht länger arbeitenals bisher. Woerths Reform giltals Angriff auf hart erkämpfteErrungenschaften, gar als An-fang vom Ende des französi-schen Sozialstaats. Das gesetz-liche Rentenalter von 60 Jah-ren, von Präsident FrançoisMitterrand 1983 eingeführt, istihnen heilig.
„40 ans – c’est déjà trop“,„40 Jahre Arbeitszeit sindschon zu viel“ stand auf aus-gerollten Bannern, als, nachGewerkschaftsangaben, bis zuzwei Millionen Arbeitnehmervor elf Tagen gegen die Reformdemonstrierten – ein jakobini-scher Massenprotest, landes-weit. Angeführt wird die Front der Re-formgegner von der sozialistischen Par-teivorsitzenden Martine Aubry, die schonjetzt erklärte, im Falle eines Machtwech-sels 2012 das Ganze wieder rückgängig zumachen. Sechs Gewerkschaften stehen ihrzur Seite, von den Kommunisten bis zur„Force ouvrière“, Beamte, Lehrer undBahnangestellte, kurzum: halb Frankreich.
Dabei weiß schon jetzt niemand mehr,wie das französische Rentensystem zu finanzieren ist. Denn die Franzosen ver-lassen sehr viel früher den aktiven Ar-beitsmarkt als Arbeitnehmer in anderenLändern: laut einer Studie der Organisa-tion für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung (OECD) bereits mitdurchschnittlich 58,7 Jahren. In Deutsch-land liegt das sogenannte Erwerbsaus-trittsalter im Vergleich dazu bei 62,1 Jah-
ren. Problem Nummer zwei: Franzosenleben auch noch länger als andere, inKombination mit dem frühen Rentenalterwird das zur finanziellen Herausforde-rung. Der durchschnittliche OECD-Ar-beitnehmer lebt ab dem Moment, in demer aufhört zu arbeiten, noch 18 Jahre.Der Franzose dagegen 24 Jahre. Das istschön, aber teuer. Die höhere Lebens -erwartung wird mit gesünderer Ernäh-rung, Rotwein und Olivenöl, guter medi-zinischer Versorgung, aber auch mit einergeringeren Arbeitsbelastung erklärt.
Hinzu kommen zahlreiche Sonder -regelungen im Rentensystem, vereinbartwurden sie einst in den „régimes spé -ciaux“, für Feuerwehrmänner, Lokführer,aber auch für arbeitende Frauen mit dreiKindern. Viele dieser Arbeitnehmer kön-nen schon mit Anfang 50 in Rente gehen.
Dann haben sie oft weit wenigerals 40,5 Jahre Arbeitsleben hintersich, die eigentlich geltende Min-destdauer für die Inanspruchnahmevoller Rentenbezüge.
Die französischen Gewerkschaf-ten versuchen nun, zahlreiche Aus-nahmeregelungen zu erreichen, vorallem für Berufsgruppen, die körper-lich hart arbeiten: Dachdecker, Mau-rer, Schichtarbeiter. Dagegen wie-derum sträuben sich der zuständigeMinister Woerth und Präsident Sar-kozy. Sonderregelungen sollen nachder Reform nur nach Prüfung durchArbeitsmediziner und nach festge-stellter Invalidität gewährt werden.
Im Übrigen gibt es in Frank-reich ein ganz neues Phäno-men der Berufsunfähigkeit:2007 waren Depressionen undAngstzustände die am häufigs-ten diagnostizierte Ursachevon Berufskrankheiten. „Hältman an den traditionellen Kri-terien für Schwerstarbeit fest,fallen viele Betroffene aus demSystem“, sagt Monika Queis-ser, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der OECD. Indi-viduelle medizinische Unter-suchungen im Einzelfall seiendaher der einzige Weg.
Die Rentenreform ist schonjetzt eine der kompliziertesten,aber auch eine der notwen-digsten Reformen, die Sarkozybislang in Angriff genommenhat. Mit Eric Woerth schien ihrGelingen gesichert zu sein, bis„Bettencourtgate“ kam, wiedie Medien die Affäre um dieWitwe Bettencourt, ihren Fo-tografenfreund, ihre Milliardenund den Minister inzwischennennen.
Er wolle eine „untadeligeRepublik“, mehr Effizienz,mehr Transparenz, hatte Sar-
kozy einst im Wahlkampf versprochen.Doch mittlerweile steht sein Arbeitsmi-nister täglich unter Beschuss. Freitag ver-gangener Woche musste er sich sogar gegen Vorwürfe verteidigen, er habe eineSteuerrückzahlung von 30 Millionen Euroan Liliane Bettencourt im März 2008 per-sönlich bewilligt.
Ein Minister kümmere sich nicht umdie Steuererklärungen einzelner Bürger,entgegnete Woerths Ministerium, dafürseien andere zuständig. „Man will nurden Erfolg der Reformen verhindern. Ichsoll abgeschossen werden, weil ich sicht-bar bin“, hatte der Politiker zuvor erklärt.
„Es ist deprimierend“, sagte Betten-court in einem Interview in den Abend-nachrichten von TF1 am Freitag, meintedamit aber eher das getrübte Verhältniszu ihrer Tochter als die politischen Ver-wicklungen der Affäre. Die 87-Jährigetrug weiße Turnschuhe, weiße Hosen,eine apricotfarbene Strickjacke, dazu ein Halstuch. Sie sprach langsam, aberklar.
15 Jahre lang, auch das kam nun her -aus, sollen keine Steuerprüfungen mehrbei ihr stattgefunden haben. Eigentlichsind sie bei großen Vermögen alle dreiJahre üblich. Präsident Sarkozy hat sichunterdessen für weit weniger umstritteneSparmaßnahmen entschieden. Die tradi-tionelle „Garden Party“ im Elysée zumNationalfeiertag am 14. Juli wird diesesJahr ersatzlos gestrichen – das bringt700000 Euro. Mindestens.
BRITTA SANDBERG, STEFAN SIMONS
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 084
Protest gegen die Rentenreform in Marseille: Ende des Sozialstaats?
CLA
UD
E P
AR
IS /
AP
Es sind nur wenige Schritte von Bri-gadegeneral Mohammed Asif Ja-barkhels Büro zur Sicherheitskon-
trolle im Kabuler Flughafen. Der 59-jäh-rige Chef der Grenzpolizei hat die Armeverschränkt, ein Ventilator surrt. „Ichweiß natürlich, was hier los ist, aber werin diesem Land darf schon die Wahrheitsagen?“, knurrt der Offizier unter seinemdichten Schnauzbart hervor.
Es geht um riesige Geldmengen, die regelmäßig in Kisten und Koffern perFlugzeug außer Landes geschafft wer-den – über drei Milliarden Dollar in barwaren es, mindestens, seit 2007. Der be-
vorzugte Bestimmungsort: die SteueroaseDubai. Bei dem Geldabfluss kann es sichnicht nur um Gewinne aus legalen Ge-schäften handeln: Das gesamte Brutto -inlandsprodukt des Landes beläuft sichumgerechnet auf gerade mal 13,5 Milliar-den Dollar.
Seine Versuche, diesen Aderlass zustoppen, seien immer wieder gescheitert,klagt Jabarkhel. „Die Zentralbank hatein Abkommen mit der Regierung ge-schlossen, nachdem solche Transfers an-geblich legal sind, und wenn wir versu-chen zu prüfen, woher das Geld stammt,kommt Druck von ganz oben.“
Fast 300 Milliarden Dollar investiertenbislang allein die USA in Krieg und Auf-bau Afghanistans, die erhofften Fortschrit-te aber bleiben weit hinter den Erwartun-gen zurück. Ein wesentlicher Grund dafürdürfte sein, dass immer wieder große Tei-
le der Aufbau-Millionen abgezweigt wer-den. Profiteure sind häufig engste Ge-schäftspartner der Geberländer.
Tatsächlich aber sind die offiziellen Zoll-bilanzen bei weitem nicht vollständig. Sieenthalten nicht jene undeklarierten Geld-mengen, die an den Sicherheitskontrollenvorbei ins Ausland geschleust werden. Oftsteigen im Kabuler Flughafen wichtige Poli -tiker und Unternehmer unkontrolliert überden VIP-Zugang ins Flugzeug. Sollten dochmal Koffer mit Millionen Dollar vom Si-cherheitsdienst abgefangen werden, dannsorgen einflussreiche Leute dafür, dass dasGepäckstück doch mit seinem Begleiterunbehelligt ausfliegen kann. „Ein paar An-rufe, und der Mann kann passieren“, erin-nert sich General Jabarkhel frustriert.
Die Krisenregion Afghanistan ist in denvergangenen neun Jahren zur Goldgrubefür eine ganze Reihe abenteuerlustigerUnternehmer geworden. Die erfolgreichs-ten Geschäftsleute sind häufig genug Ver-wandte von Regierungsmitgliedern undverfügen über beste Kontakte in die Ent-scheidungsspitzen. Ihre Finanzbewegun-gen sind kaum zu durchschauen.
Viele afghanische Geschäftsleute besit-zen inzwischen teure Immobilien im eins-tigen Golfwunderland Dubai, darunterein Bruder und ein Cousin von StaatschefHamid Karzai. Auch der ehemalige Vize-präsident und der Bruder des derzeitigenVizepräsidenten Mohammed Fahim ha-ben im Emirat eine Villa. Die schickenHäuser im römischen Stil am Strand derkünstlich erbauten Insel Palm Jumeirahkosten ab zwei Millionen Dollar aufwärts,viele ihrer Besitzer waren bis vor weni-gen Jahren keineswegs wohlhabend.
Als Eigentümer ist, wie die „Washing-ton Post“ herausfand, oft nur der Kredit-geber eingetragen, zum Beispiel derGründer und Vorsitzende der KabulBank, Sherkhan Farnood, der auch denWahlkampf des Präsidenten unterstützthat. Wie viele seiner Kunden lebt er diemeiste Zeit in Dubai. Der geschäftstüch-
tige Karzai-Bruder Mahmoud und derBruder des Vizepräsidenten Fahim haltenAnteile an Farnoods Kabul Bank.
Die meisten Geldgeschäfte in Afgha-nistan werden ohnehin über sogenannteHawala-Unternehmen abgewickelt, einaltes orientalisches Überweisungssystem,das ohne Quittungen auskommt und da-für auf Ehre und gutem Glauben beruht.Für die Korruptionsermittler des Westenssind diese Geldströme so gut wie nichtnachzuvollziehen.
Auch der Banker Farnood verfügt inKabul über ein in Dubai registriertes Ha-wala-Unternehmen, das nach Auskunfteines Wirtschaftsprüfers half, HunderteMillionen Dollar aus Afghanistan nachDubai zu transferieren. Das wären auf je-den Fall deutlich mehr als jene 150 Mil-lionen Dollar, die Kreditnehmer seinerBank laut der „Washington Post“ offiziellin Dubai-Immobilien investierten.
Ein wenig transparenter wurde derGeldabfluss immerhin, als im Sommer2009 die internationale SicherheitsfirmaGlobal Strategies Group die Sicherheits-kontrollen am Kabuler Flughafen über-
nahm. Das Unternehmen arbeitete engmit dem afghanischen Geheimdienst zu-sammen. Doch der Datenabgleich mitden Geheimen wurde laut „WashingtonPost“ bereits im September wieder ein-gestellt, er war an höherer Stelle offenbarnicht erwünscht.
Wegen der Berichte über die anhalten-de Korruption wollen empörte US-Politi-ker nun die 3,9 Milliarden Dollar Hilfs-gelder zurückhalten, die für das Haus-haltsjahr 2011 bereits genehmigt sind.Nita Lowey, die Vorsitzende des Bewilli-gungsausschusses im Washingtoner Re-präsentantenhaus, erklärte ihren Kolle-gen: „Bevor nicht sichergestellt ist, dassamerikanisches Steuergeld nicht in denTaschen korrupter afghanischer Regie-rungsmitglieder, Drogenbarone und Ter-roristen landet, gebe ich keinen einzigenCent frei.“ SUSANNE KOELBL
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 85
A F G H A N I S T A N
Druck von obenViele Milliarden Dollar werden
in Kisten und Koffern nach Dubai transportiert. Der Westen
hat den Überblick über seine Hilfsgelder verloren.
TH
OM
AS
EB
ER
T/L
AIF
LYN
SE
Y A
DD
AR
IO
Präsident Karzai, künstliche Villeninsel Palm Jumeirah in Dubai: Goldgrube für Unternehmer und Regierungsmitglieder
Bis kurz nach zehn Uhr am Donners-tagmorgen war Mechelen einfachnur eine blitzsaubere Provinzstadt
im flämischen Teil Belgiens: Tausend Jah-re Geschichte, blankgeputztes Unesco-Welterbe, acht Kirchen, eine Kathe drale –Mechelen ist das amtskirchliche Zentrumdes katholischen Königreichs Belgien.Um 10.15 Uhr klingelte es an der Pfortedes Erzbischöflichen Palastes.
Vor der Tür des Erzbischofs André Léo-nard stand ein Untersuchungsrichter, derzusammen mit 20 Ermittlern erschien. Eswar der 24. Juni, im Palast tagte die bel-gische Bischofskonferenz. Unter Punkt 5auf der Tagesordnung stand ein heiklesThema: Wohin mit den alten Akten überbelgische Priester, die sich an Kindernvergangen haben.
Es waren diese Akten, welche die bel-gische Justiz angelockt hatten. Für siesteht außer Frage: Belege über schwereVergehen gehören in die Hände derStaatsanwaltschaft. Den Tipp bekamendie Ermittler von einem pensionierten
Priester. Seit Jahren schon, berichtete derfrustrierte Geistliche, habe er seinen Kir-chenoberen geheime Dossiers ausgehän-digt, die sexuelle Übergriffe von Priesternauf Jugendliche belegen. Doch in all denJahren sei nichts geschehen.
Die Ermittler arbeiteten gründlich, kon-fiszierten Handys, Terminkalender und 55 Computer, dann verhörten sie die Geist-lichen bis in den Abend hinein. Die Razziawar noch nicht zu Ende, als ein paar hun-dert Meter weiter, in Mechelens Varkens-straat 6, der Schweinestraße, weitere Be-amte in das Büro von Kardinal GodfriedDanneels eindrangen, der bis Januar Ober-hirte der belgischen Katholiken war.
Auch Danneels musste seine Akten-schränke öffnen, Laptop und PC überge-ben und die Ermittler in die nahe gelege-ne Kathedrale führen. Vor den Absperr-bändern draußen standen Schaulustigeund drinnen, im gotischen Gewölbe, stan-den Polizisten mit Staubmasken, Brech-eisen und Bohrern. Bei Renovierungs -arbeiten der Kathedrale, so hatten die Er-
mittler erfahren, sollen Grabkammern zuGeheimarchiven umfunktioniert wordensein. Sie bohrten Löcher in die Sarkopha-ge zweier Erzbischöfe, führten kleine Ka-meras hinein, fanden aber keine Spur.
Ist das vorstellbar? Bischöfe, die Be-weismaterial in Grabmälern verstecken,als wären sie Schurken aus einem Welt-bestseller von Dan Brown? Waren daübereifrige Ermittler am Werk? Oder warder Ortstermin von Mechelen nur eineweitere Folge in dem höchst realen Doku-Drama um die katholische Kirche und ih-ren Umgang mit dem Kindesmissbrauch?
So viel steht fest: Die Razzia in Belgienmag unangemessen gewesen sein, abersie ist ein weiteres Zeichen dafür, dassdie von Skandalen erschütterte katholi-sche Kirche fortan keine Schonung mehrerwarten kann. Weder in Belgien, nochin den USA, wo vergangenen Montag derOberste Gerichtshof entschied, dass derVatikan im Falle von Missbrauchsvorwür-fen gegen Priester keine Immunität ge-nießt, so dass theoretisch auch Papst Be-nedikt XVI. vor Gericht gestellt werdenkönnte. Zunehmend mischt sich die welt-liche Justiz in Kirchenangelegenheiten,wenn sie von der Kirche nicht die nötigeUnterstützung erhält.
Der Vatikan reagierte, wie er schonzum Höhepunkt der Krise Ende März rea-giert hatte – er schloss seine Reihen.Scharf rügte der Heilige Stuhl die belgi-sche Justiz und bestellte umgehend denBotschafter ein.
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 086
VA T I K A N
Krimi in der SchweinestraßeAuf Ermittlungen gegen die belgische Bischofskonferenz reagiert
der Vatikan empört. Im Kampf um den Umgang mit Missbrauchsfällen haben sich die Konservativen durchgesetzt.
Kirchenoberhaupt Benedikt XVI., belgische Ermittler in Mechelen: Botschafter einbestellt
AN
DR
EA
S S
OLA
RO
/ A
FP
(L
.);
GIL
PLA
QU
ET
/ R
EP
OR
TE
RS
/ L
AIF
(R
.)
Monate hatte es gedauert, bis sichPapst Benedikt XVI. zu den Missbrauchs-skandalen in Irland und Deutschland äu-ßerte. Im April traf er sich mit Opfernauf Malta und prangerte den Feind im In-neren der Kirche an, Anfang Juni bat erum Vergebung für die Sünden seinerPriester und gelobte, alles zu tun, umkünftiges Unheil zu verhindern.
Jetzt aber, als weltliche Ermittler dieKonsequenzen ziehen wollten, verurteilteer die „überraschenden und beklagens-werten“ Umstände der belgischen Razzia.In einer Solidaritätsbotschaft an die Bi-schöfe in Belgien plädierte Benedikt füreine Zusammenarbeit mit der weltlichenJustiz, aber er pochte auch auf das Rechtder Kirche auf interne Ermittlungen.
Ebenso schnell sorgten Benedikts rö-mische Verbündete dafür, dass sich dasVerhältnis von Kirche und Welt abermalsverkrampft. Das italienische Bischofs-blatt „Avvenire“ sieht in der Gräber-schändung einen „gewaltigen Akt, dermitten ins Herz der Kirche trifft“. UndKardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone,nach dem Papst der zweitmächtigsteMann im Vatikan, empörte sich darüber,wie es denn möglich sei, dass ehrenwerteBischöfe neun Stunden lang ohne Essenund Trinken festgehalten wurden, „alswären sie Kinder“. Nicht mal unter Kom-munisten seien Kirchenleute so verfolgtworden.
Es sieht so aus, als sei wieder alles beimAlten im Vatikan, die Zeit der Reumütig-keit scheint abgelaufen, und geändert hatsich wenig.
Auch im sechsten Jahr von BenediktsPontifikat gibt der Vatikan den Landes-kirchen noch immer kein universell ver-bindliches Regelwerk an die Hand, wiemit Missbrauchstätern umzugehen sei,wie sie unter Kirchenrecht angezeigt undbestraft werden sollen, wie die Zusam-menarbeit mit der weltlichen Justiz aus-zusehen hat.
Es gibt alte Leitlinien, die teilweiseschon in den zwanziger Jahren des vori-gen Jahrhunderts in Kraft gesetzt wurden.Seit April stehen sie im Netz auf der Va-
tikan-Homepage, aber das sind Empfeh-lungen, keine Regeln. Und die beharrli-che Weigerung, örtlichen Bischöfen mehrFreiheit bei der Behandlung von Miss-brauchsfällen zu lassen, ist Grund dafür,warum immer öfter Fälle aus Brasilien,Italien oder jetzt auch aus Belgien be-kannt werden, wo die Bischöfe versuchen,die Missbrauchsfälle auf eigene Art zu lö-sen, ohne sie dem Vatikan – oder derStaatsanwaltschaft – anzuzeigen.
Die Kirchenfürsten in Belgien hattenden Besuch von der Polizei dagegen weit-aus zurückhaltender kommentiert. Wozu
sie offenbar gute Gründe haben. WenigeTage nach der Durchsuchungsaktion inMechelen machte ein Dutzend Männerauf den Stufen der Kathedrale von Brüs-sel bekannt, was sie wenig später auchihren Bischöfen hatten vortragen wollen:Schon vor zehn Jahren, am 25. Januar2000, hätten sie in einer Gruppe von etwa20 Männern Erzbischof Danneels berich-tet, wie sie von belgischen Geistlichenmissbraucht worden waren. Danneels hät-te sie abgewiesen. Er könne nicht wissen,habe er damals gesagt, ob sie die Wahr-heit vortrügen oder pure Phantasien.Dann habe er sie zum Schweigen er-mahnt, denn ihr Getratsche würde derKirche schaden.
Erst Irland, dann die Vereinigten Staa-ten, Deutschland, Österreich und nun Bel-gien – die katholische Weltkarte füllt sichmit Ländern, in denen immer neue undimmer mehr Missbrauchsfälle ans Lichtkommen. Es ist längst ein globales Pro-blem, doch der Vatikan unter BenediktXVI. reagiert darauf nach seinen eigenenZeitvorstellungen. Benedikt versteht dasals Fürsorge für die eigenen Leute, auchwenn sie sich versündigt haben. Theolo-gisch bleibt ein Priester, egal wie schuldiger ist, Priester in Ewigkeit, und nur dieZentrale, so sieht man es im Vatikan,kann einen Kirchenrechtsprozess gegenschwarze Schafe führen.
Das führt zu einem Machtkampf zwi-schen liberalen und konservativen Kräf-ten im Vatikan. Die Null-Toleranz-Politikamerikanischer Bischöfe gilt den Konser-vativen im Kirchenstaat als eine Beschnei-dung von Rechten beschuldigter Priester.Liberale Geister drängen dagegen auf ra-sche Aufklärung und zügige Weiterlei-tung an die weltliche Justiz.
Derzeit, so sieht es aus, haben die Kon-servativen wieder größeres Gewicht. Amvergangenen Montag reiste der WienerKardinal Christoph Schönborn nach Rom,er gilt als mutigster Kämpfer für die Auf-klärung der Missbrauchsfälle. Schönbornkam, um sich eine persönliche Rüge desPapstes abzuholen, weil er einem Kardi-nalskollegen vorgeworfen hatte, Miss-brauchsermittlungen jahrelang behindertzu haben. Nur der Papst dürfe Kardinälezurechtweisen, sonst niemand.
Auch die deutschen Bischöfe RobertZollitsch und Reinhard Marx erhielten ei-nen Rüffel. Ihnen hält Benedikt vor, siehätten sich nicht liebevoll genug um ihrenKollegen Walter Mixa gekümmert, als erins Kreuzfeuer der Kritik geriet.
Wie man in wahrhaft christlichemGeist mit gefallenen Brüdern umgeht,machte der Heilige Vater deutlich. Er ließverkünden, dass Bischof Mixa „nach ei-ner Periode der Heilung und Versöhnung“wie andere emeritierte Bischöfe für Auf-gaben der Seelsorge zur Verfügung stehe.
FIONA EHLERS, HANS-JÜRGEN SCHLAMP
Kardinal Danneels
Besuch von der PolizeiD
OLC
E V
ITA
/
PIC
TU
RE
TA
NK
Wenige Tage nachdem Staatsbesuchvon Russlands Präsi-
dent Dmitrij Medwedew inden USA, trifft sich ein ameri-kanischer Undercover-Beam-ter des FBI mit einer Frau, diedie Ermittler der Bundespoli-zei für ein Mitglied eines rus-sischen Spionagezirkels hal-ten. Er hat sie in ein Café inManhattan bestellt, unter demVorwand, dass die Zentrale inMoskau einen Auftrag für siehabe. Es ist der letzte, ent-scheidende Abschnitt einerJagd nach Beweisen dafür,dass Russland, der großeAngstgegner aus den Zeitendes Kalten Krieges, Amerikaimmer noch ausspioniert.Mehr als zehn Jahre hat dieJagd insgesamt gedauert.
Die Frau ist erst 28 Jahrealt, rothaarig, attraktiv, sie betreibt eine Online-Immo -bilienagentur in New York, ihr russischer Name ist AnjaKuschtschenko, ihr amerika-nischer Anna Chapman, aberbald wird alle Welt sie nurnoch als die „sexy Spionin“kennen oder, wie die „Wa-shington Post“ schreiben wird,als die Frau, „die sogar diefrostigste Nacht im KaltenKrieg aufgewärmt hätte“.
Immer wieder haben dieBeamten sie beobachtet, wennsie sich regelmäßig mittwochsin ein Café in Manhattan setz-te und von ihrem Laptop Da-ten mit dem Laptop eines Mit-telsmannes austauschte. Ihren Verfolgernwar schnell klar, dass Chapman für Russ-land spionierte. Nun wollen sie die Agen-tin überführen.
Der FBI-Agent hat sich als russischesKonsulatsmitglied ausgegeben und willChapman nun dazu bewegen, am nächs-ten Tag einen gefälschten Pass an eineKontaktperson zu übergeben. Er geht alleErkennungszeichen mit ihr durch – dasMagazin, das sie unter dem Arm tragensoll, die Sätze, die zur Begrüßung gewech-selt werden müssen. „Entschuldigen Sie“,werde die Kontaktperson fragen, „haben
wir uns nicht letzten Sommer in Kalifor-nien getroffen?“ Dann Chapman: „Nein,ich denke, es waren die Hamptons.“ DasSignal. „Okay“, sagt sie, „ich bin bereit.“Jäger und Gejagte verabschieden sich.
Es klingt alles wie das Drehbuch zu einem klassischen Spionagethriller undviel zu klischeehaft. Ist es wirklich vor-stellbar, dass Geheimdienste heute nochso arbeiten? Vielleicht kommen dem Beamten auch deshalb Zweifel, ob Chap-man nicht gemerkt haben könnte, dassan dieser Begegnung etwas nicht stimmt.Und so wird sie nach dem Treffen im
Zickzack durch Brooklyn verfolgt, erstin den Drogeriemarkt CVS, dann in einTelefongeschäft der Firma Verizon, her -über in die Apotheke RiteAid und dannwieder zurück in den Verizon-Shop. DasFBI will wissen, ob sie mit der Zentralein Moskau telefoniert.
Später finden die Beamten die Verpa-ckung eines Handys, das Ladegerät undauch den Kaufvertrag. Chapman hat alleseinfach in einen Mülleimer geworfen. Es
ist ein Dokument, das einigesaussagt, denn darauf stehtnicht nur ein falscher Name,sondern auch eine Adresse,die so offensichtlich falsch ist,dass man nicht weiß, ob essich dabei um Dreistigkeitoder Dummheit handelt: „99Fake Street“, „AusgedachteStraße 99“.
Mit was hatte man es hierzu tun? Mit Profis oder Dilet-tanten? War es ein Fehleroder Provokation, so offenauf die falsche Identität zuverweisen? Wie ernst warendie anderen Spione zu neh-men? Und was bedeutet dasfür das Verhältnis zu Russ-land? Es sind Fragen, die in-zwischen ganz Amerika be-schäftigen.
Elf mutmaßliche Spionehatten die Beamten im Visier,manche davon mehr als zehnJahre, alles offenbar Russen,die sich in amerikanischenVorstädten ein amerikani-sches Leben eingerichtet ha-ben, rund um die MetropolenBoston, Washington und NewYork, Menschen mit bürger -lichem Leben und falschemPass, sogenannte Illegale, diesich nicht wie andere Spioneals Diplomaten tarnten undfolglich auch keine Immunitätgenießen. Solche Agenten waren in der Branche bisherals „Wunderkinder“ der rus -sischen Spionage bekannt,mehrsprachig, akzentfrei. Siewerden mit einer komplett falschen Identität ins Land ge-
schleust und bleiben dort 10 bis 20 Jahre,manche auch länger. Sie müssen nichtauto ma tisch mit umfassender Überwa-chung rechnen, denn „Illegale“ geratenzumindest anfänglich selten ins Visier derSpionageabwehr.
Am nächsten Tag erschien Chapmanallerdings nicht am vereinbarten Ort, umden gefälschten Pass zu übergeben. Nungerieten die FBI-Agenten in Panik. Warihre Überwachung aufgeflogen? Würdensich die Verdächtigen in Sicherheit brin-gen? Und so rückte die Polizei aus, umalle Verdächtigen festzunehmen – in New
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 088
U S A
Spione von nebenanKalter Hauch aus der Vergangenheit: Elf russische Agenten, diedas FBI enttarnt hat, führten das Vorzeigeleben braver Mittel -
standsamerikaner. An Staatsgeheimnisse kamen sie nicht heran.
Russische Spionin Chapman: Ein amerikanischer Traum
AP
N
York, New Jersey, Massachusetts, Virginiaund auf Zypern. Sie konnten keine Rück-sicht darauf nehmen, dass erst 72 Stundenzuvor die Staatschefs Medwedew undObama ihre gemeinsamen Ziele bekräf-tigt hatten: die Stärkung der wirtschaft -lichen Zusammenarbeit und die Fortset-zung der Abrüstungspolitik für Nuklear-waffen. Danach hatten die beiden Politi-ker noch bei Ray’s Hell Burger im Wa-shingtoner Vorort Arlington zusammenCheeseburger und Pommesfrites gegessen, betont ameri-kanisch.
Nun aber störte die Spiona-geaffäre das schöne Bild. JohnBolton, republikanischer Fal-ke und Ex-Uno-Botschafter,nutzte die Gelegenheit und interpretierte die Affäre alsBeleg dafür, dass in Mos-kau weiterhin „tiefsitzendeAbneigung“ gegen die USAvorherrsche. Stephen Flana-gan vom Center for Strategicand International Studies hieltes für möglich, dass die Rati -fizierung des neuen Atom -waffen-Abrüstungsvertrags er-schwert werden könnte. UndSamuel Charap vom Centerfor American Progress, einemdemokratischen Think-Tank,sagte: „Der Vorfall ist eine -Erinnerung daran, dass Russ-land immer noch Russlandist.“ Und Wladimir Putin, derEx-Spion, immer noch Wladi-mir Putin.
Tatsächlich ist es der russi-sche Regierungschef, der esgeschafft hat, den Spionage-apparat seines Landes nachdem Ende des Kalten Kriegeswieder aufzurüsten. Dafürfehlte den Russen lange dasGeld. Aber Putin stellte dasAnsehen des Geheimdiensteswieder her und sorgte für dienötigen Haushaltsmittel, nach-dem ihn Russlands erster Prä-sident Boris Jelzin 1998 zu-nächst zum Chef des Inlands-geheimdienstes FSB ernannthatte, im Jahr darauf zum Pre-mierminister und von Silvester 1999 anzu seinem designierten Nachfolger. An-ders als die Vereinigten Staaten, die beider Spionage vor allem in hochmoderneTechnik investieren, setzt Moskau bei derNachrichtenbeschaffung immer nochstark auf Menschen; und Putin führte diese Tradition fort – vor allem mit „Illegalen“.
Die tauchten dann ein in die amerika-nische Gesellschaft, in die Vorstädte, womehr als die Hälfte aller Amerikaner leben. Sie pflegten ihre Hortensien, siebuken Plätzchen, manchmal in Form von
New Yorker Taxis, manchmal in Formder Freiheitsstatue. Sie trafen sich im Star-bucks, und an Weihnachten stellten siesich aufblasbare Weihnachtsmänner vordie Tür, amerikanischen Kitsch, der zumStandardprogramm jedes Vorstädters ge-hört. Viele von ihnen hatten amerikani-sche Namen, amerikanische Jobs, ameri-kanische Hobbys übernommen wie AnnaChapman, die schöne Immobilienmakle-rin aus New York. Ihr Ziel war es, „aus-
reichend amerikanisiert“ zu werden, wiesie Nachbarn erzählte. Manchmal warensie amerikanischer als die Amerikaner.
Donald Heathfield etwa, angeblich ge-bürtiger Kanadier, heute Amerikaner. Sei-nen Namen stahl Donald Heathfield voneinem Baby, das 1962 im Alter von nursechs Wochen in Kanada gestorben war.Er absolvierte ein Graduiertenprogrammin Harvard und gründete 2006 die Soft-ware-Firma Future Map, die Unterneh-men eine „Zukunfts-Software“ anbot, dieer von zu Hause aus vertrieb. Seine FrauTracey Foley, angeblich ebenfalls gebür-
tige Kanadierin, arbeitete als Immobilien-maklerin.
Oder die Murphys, amerikanischeDurchschnittsbürger. Sie lebten in Mont-clair, einem Vorort in New Jersey. Sie hat-ten ein Haus, zwei junge Töchter, Katieund Lisa, elf und sieben Jahre alt, Cyn-thia Murphy arbeitete für die Steuer -beratungs- und Buchhaltungsfirma Mo-rea Financial Services in Lower Manhat-tan, verdiente 130000 Dollar im Jahr und
studierte zugleich an der Columbia University; RichardMurphy war Hausmann undein Fan des EishockeyteamsNew Jersey Devils. In derNachbarschaft waren dieMurphys als das „personifi-zierte Suburbia“ bekannt, als„Vorzeige-Vorstädter“.
Vor zwei Jahren kauften sieein Haus für 481000 Dollar,zweistöckig, im Kolonialstil,mit beigefarbenen Holzschin-deln, braunen Fensterlädenund einem sauber gemähtenRasen mit Blumenrabatten da-vor. Damals, so die Ermittler,stellten die Murphys in Mos-kau einen Antrag auf Finanz-hilfe: „Der Hauskauf ist die na-türliche Konsequenz unsereslangjährigen Aufenthalts hier.“
Nicht ohne Grund war dieZentrale manchmal besorgt.Dann musste sie ihre Spionean den eigentlichen Auftragerinnern: „Ihr wurdet in dieUSA auf eine langfristige Mis-sion geschickt. Eure Bildung,euer Bankkonto, Auto, Haus– all das hat nur ein Ziel: dieHauptmission zu erfüllen, Ver-bindungen zu politischen Krei-sen aufzubauen.“
Das System, sich den Zu-gang zu Informationen durchperfekte Mimikry zu erschlei-chen, war nicht billig. Diezwei Spione in Boston etwarechneten 8500 Dollar für Mie-te ab, 160 Dollar für Telefon,2180 Dollar für Autoleasing,aber Geheimdokumente lie-ferten sie nie, überhaupt: Er-
gebnisse ihrer Informationsbeschaffungblieben rar. Für die amerikanische Ankla-ge dürfte es noch nicht einmal für denVorwurf der Spionage reichen, lediglichGeldwäsche und Verschwörung wird denSpionen jetzt von der Staatsanwaltschaftvorgeworfen. „Wenig Geheimnisse“ titel-te die „New York Times“. Und Olga Oli-ker, Analystin bei der Rand Corporation,sagt: „Es ist ein schrecklich ineffizienterAnsatz, der vielleicht in früheren Zeitendurchaus Sinn gemacht hat.“
Es gibt jedenfalls erhebliche Zweifeldaran, dass die Vorstadt-Spione wirklich
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 89
FBI-Agenten bei Ermittlungen in Massachusetts: Perfekte Tarnung
RIC
HA
RD
STA
NLE
Y /
AP
Ministerpräsident Putin: Vertrauen in „Illegale“
AB
AC
A P
RE
SS
/ A
CT
ION
PR
ES
S
auf der Höhe der Zeit waren. Sie unter-hielten zwar Accounts bei Facebook,Twitter und in dem Sozialnetzwerk LinkedIn, sie stellten auch Videos aufYouTube ein. Dann aber immer wiederder Rückgriff auf die alten Agenten-Klas-siker: geheime Geldübergaben in orange-farbenen Säcken, konspirative Treffen inU-Bahn-Stationen, Briefe in unsichtbarerTinte. Und wenn sie sich ein Passwortnicht merken konnten, schrieben sie eseinfach auf einen Zettel.
Dazu die merkwürdigen Aufgaben, dieihnen aus Moskau zugeteilt wurden: Sosollten sie „herausfinden, was Obamabeim Weltwirtschaftsgipfel im Juli errei-chen will“. Was nur ist darüber in Yon-kers, New York, zu erfahren? Ein anderesMal wollten die Chefs wissen, wie dieAussichten „des globalen Goldmarkts“seien. Im April 2006 interessierte die Mos-kauer Spionagezentrale, wie die USA aufdie zunehmende Nutzung des Internetsdurch Terroristen reagierten und wie dierussische Außenpolitik imWesten eingeschätzt wird. VorObamas Russland-Reise imvergangenen Jahr wollte sie wissen, welche Position die US-Regierung gegenüberIrans Atomprogramm ein-nimmt. Das alles sind Infor-mationen, die einfacher inden Kommentar- und Klatsch-spalten der Zeitungen nach -zulesen sind oder auch in Be-richten von Analysten, aberirgendwie schienen diese Spio-ne noch nicht angekommenzu sein im Zeitalter von freienInformationen, von Internetund Google.
Als „lächerliche Provoka -tion“ bezeichnet dagegen derRusse Jurij Drosdow die Festnahmen unddie Anschuldigungen der Amerikaner.„Da wird offenkundig Politik gemacht“,sagt er. „Mit den Deutschen zum Beispielregeln wir solche Dinge diskret hinterden Kulissen.“
Elfeinhalb Jahre lang stand der 84-jähri-ge KGB-Veteran Drosdow der geheimstenAbteilung der sowjetischen Auslandsauf-klärung vor, der Abteilung S für Sonder-operationen. Er befehligte die Komman-doaktion zum Sturm des Präsidentenpa-lasts in Kabul zu Beginn des sowjetischenEinmarschs in Afghanistan. Drosdows Ab-teilung S war aber nicht nur für Morde imAusland zuständig, sie führte auch die „Illegalen“. „Zehn Jahre will das FBI dieseLeute beschattet haben und alles, was siein der Hand halten, sind Geldwäschevor-würfe“, sagt er. „Wenn meine Leute so ge-arbeitet hätten, hätte ich sie rausgeworfen,und zwar ohne Rentenanspruch.“
Die russische Regierung ist derzeit aneinem Neuaufflammen des alten Kon-flikts ebenso wenig interessiert wie Oba-
ma. Das russische Außenministerium hat-te die Vorwürfe zunächst als „unbegrün-det“ und als Rückfall in den Kalten Kriegkritisiert. Ein Sprecher des Außenminis-teriums bestätigte dann aber, dass es sichbei den Spionen um russische Bürger han-delt, offenbar auch bei der peruanischenKolumnistin Vicky Peláez, deren Sohnbehauptet, ihre einzige Verbindung zuRussland sei ihre Liebe zur Musik Tschai-kowskis. Man werde den inhaftiertenLandsleuten „diplomatische Unterstüt-zung“ zukommen lassen, versprachen dieMoskauer Arbeitgeber.
In Amerika überwiegt derzeit eher derSpott über die verhinderten Schnüffler,und das ist vor allem Obama recht. Inden Medien wird einstweilen nicht disku-tiert, welchen Schaden die Spione Ame-rika zugefügt haben könnten, sondernwas mit den Kindern der Verhafteten passiert und, natürlich, was aus dem neu-en Superstar wird, der rothaarigen AnnaChapman.
Längst wird sie nicht mehr als möglicheBedrohung für die nationale Sicherheitgesehen, sie ist aufgestiegen in das Reichder B-Promis, ihre körperlichen Vorzügewerden ausführlicher diskutiert als ihreprofessionellen Defizite.
Inzwischen kennen die Amerikanerihre „Luxuswohnung“ im Finanzdistrikt,einen Block von der Wall Street entfernt,mit Blick auf die Brooklyn Bridge, siewissen auch, dass sie sich vor einem hal-ben Jahr die Haare rot färben ließ, in Na-dine’s Ellysium Hair Salon. Auf Facebookhat sie 180 Freunde, und ihr Video, dasauf YouTube zu sehen ist, hat inzwischenhunderttausendfache Klicks. „Amerikaist ein freies Land“, sagt sie in diesem Video. „Hier ist es sehr einfach, erfolg-reiche Leute zu treffen. In Moskau ist dasso gut wie unmöglich, weil man erst soerfolgreich sein muss wie sie.“
Ein amerikanischer Patriot hätte seinLand nicht mehr loben können.
MARC HUJER, MARC PITZKE, MATTHIAS SCHEPP, GREGOR PETER SCHMITZ
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 090
Präsidenten Medwedew, Obama in Arlington
Neustart über Cheeseburger und Pommes frites
BR
EN
DA
N S
MIA
LO
WS
KI/
TH
E N
EW
YO
RK
TIM
ES
/ L
AIF
Der greise Herrscher liegt im Ster-ben, nacheinander treten die Söh-ne an sein Krankenbett, darunter
auch der seit langem verstoßene Erst -geborene. Alle versuchen sie, ihren An-teil an seinem Reich zu bekommen. Derverstoßene Sohn will sogar das ganzeErbe für sich allein zurück. Doch der Alteerkennt seine Söhne schon nicht mehr.Verwechselt Mohammed mit Faisal undChalid mit Saud.
Was sich derzeit hinter der streng be-wachten Tür des Krankentrakts A im„Scheich Chalifa“-Krankenhaus von AbuDhabi abspielt, ist der Stoff für Shake-speare-Dramen. Nur dass es um Welt -politik geht, nicht bloß um eine Hofintrige.
Seit Ende April liegt Scheich Sakr BinMohammed Al Kassimi auf der Intensiv-station, Herrscher seit 62 Jahren über dasso unbekannte wie strategisch bedeut sameEmirat Ras al-Chaima. Über 90 Jahre sollder Scheich sein und damit der älteste Mo-narch der Welt. Nun aber todkrank, mitstreitenden Söhnen am Sterbebett.
Ras al-Chaima ist das nördlichste dersieben vereinigten Emirate, 100 Kilometervon Dubai entfernt, in unmittelbarerNähe der Straße von Hormus gelegen,der Meerenge, durch die täglich 17 Mil-lionen Barrel Rohöl transportiert werden.Das ist auch der Grund, warum die Erb-folgekämpfe von Ras al-Chaima selbst inWashington verfolgt werden.
Das Emirat macht seit einiger Zeit son-derbare Schlagzeilen. Ras al-Chaima seiein Knotenpunkt für den illegalen Handelmit Iran, berichten Zeitungen in den USA,in Israel und Kanada. Die Regierung för-dere Teherans Atomprogramm, auch die-ne das kleine Reich als Operationsbasisfür iranische Terrorzellen. Diese hättenetwa versucht, das höchste Gebäude derWelt zu sprengen, den Burdsch Chalifa
in Dubai. Wegen der unklaren Sicher-heitslage sei überdies die SegelregattaAmerica’s Cup vor Ras al-Chaima abge-sagt worden.
Diese Schlagzeilen sind vermutlichaber kein Zufall, sondern Teil einer hoch-professionellen Lobby- und Medienkam-pagne, die der vor sieben Jahren als Kron-prinz abgesetzte Scheich Chalid Bin Sakrgegen seinen Bruder Saud führt. Chalidwill sich als Mann Washingtons aufbauenund durch Warnungen vor der iranischenGefahr sein Emirat zurückgewinnen.
Warum Chalid 2003 abgesetzt wurde,drang nie an die Öffentlichkeit. Fest stehtnur, dass ihm in seiner bis dahin mehrals 30-jährigen Zeit als faktischer Herr-scher nicht gelang, was sein jüngerer Bru-der und Nachfolger Saud in den fünfBoom-Jahren danach schaffte: aus demEmirat ein kleines Dubai zu machen.
Gleich hinter der Landesgrenze wirbteine Tafel mit den wesentlichen Vorzügendes Emirats für seine Freihandelszone:„100 Prozent steuerfrei – 100 Prozent Eigentum“.
Am Strand reihen sich die Bettenbur-gen, eine Art Costa Brava am PersischenGolf. Entlang der Straßen funkeln Shop-ping-Malls, Autohäuser, Hotels und Filia-len diverser Handelsfirmen. Bisweilenhängt an Häuserwänden das Bild einesbärtigen, ein wenig an den Beatle RingoStarr erinnernden Mannes mit Ray-Ban-Sonnenbrille: Das ist der geliebte Herr-scher, Scheich Sakr, in jüngeren Jahren.
Es hat viel Geld gekostet, gegen diesesblühende Emirat so viel Stimmung zu ma-chen, dass manche es in Washington mitt-lerweile als eine Art Schurkenstaat sehen.
Scheich Chalid, der gestürzte Kron-prinz, hat das Geld. Mit professionellerPR gelang es ihm, amerikanische Abge-ordnete, Senatoren und Diplomaten zuüberzeugen, das kleine Ras al-Chaima seiin Wahrheit der willige Helfer des Mul-lah-Regimes in Teheran.
Die Kampagne erinnert an den Fall desIrakers Ahmed Tschalabi, Gründer desoppositionellen „Irakischen Nationalkon-gresses“ im Exil. Nach dem 11. September2001 redete er der US-Regierung ein, derirakische Diktator Saddam Hussein besit-ze Massenvernichtungswaffen und steckemit al-Qaida unter einer Decke – frei er-fundene Märchen, wie nach der US-Inva-sion in den Irak von Journalisten wie BobWoodward aufgedeckt wurde. Tschalabihatte sich der Hilfe einer prominentenWashingtoner PR-Firma bedient: Black,Kelly, Scruggs & Healey.
Auch Scheich Chalid ließ sich in der US-Hauptstadt zunächst als deren Kunde re-gistrieren. Im Juli 2008 schloss er einenVertrag mit der Agentur California Strate-gies. Er zahlte seither mehr als 3,7 Millio-nen Dollar an sie. Die PR-Firma verpflich-tete sich, eine „diplomatische Kampagne“zu planen, die Scheich Chalid als „positiveFührungspersönlichkeit“ aufbaut.
92
V E R E I N I G T E A R A B I S C H E E M I R A T E
Ein Prinz zu vielMit einer millionenschweren PR-Kampagne kämpft ein verstoßener
Scheich um die Macht im Golf-Emirat Ras al-Chaima –und versucht, westliche Medien und Politiker zu manipulieren.
Moschee in Ras al-Chaima
100 kmSAUDI-ARABIEN
IRAN
KATAR
Persischer Golf
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
Emirat Ras al-Chaima
OMAN
zu Oman
Ras
al-Chaima
Abu Dhabi
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
JÜR
GE
N S
TU
MP
E /
LO
OK
-FO
TO
Und so geschieht es. Um in den USAbekannt zu werden, lässt Scheich Chalidin Zeitungen auf ganzseitigen Anzeigensein Foto drucken. Nach der Wahl vonBarack Obama fahren in WashingtonStadtbusse mit seinem Gesicht herum:„Glückwunsch, Präsident Obama“, stehtda zu lesen. Unterzeichnet mit „SeineHoheit Prinz Chalid, Kronprinz und Vize-Herrscher, Ras al-Chaima“.
Die Agentur lässt ein Dossier schrei-ben, in dem behauptet wird, das Emiratbeherberge „mehr als 600 Firmen“, dieim Besitz von Iranern seien. Im Anhangder Studie werden allerdingsnur 111 Firmen genannt. „DieFakten sind auf der Seite Sei-ner Hoheit Scheich Chalid“,schreibt Jason Kinney vonCalifornia Strategies demSPIEGEL auf Anfrage. Wo-her die Informationen überdie übrigen 489 Firmen kom-men, erklärt er nicht.
Mitte September 2009 tau-chen dann Meldungen übereinen angeblichen Anschlags-versuch auf das höchste Ge-bäude der Welt, den BurdschChalifa in Dubai, auf. Auslö-ser ist ein Artikel der israeli-schen Tageszeitung „Maariv“vom 15. September. Darinnennt Reporter Jacki HugiRas al-Chaima als Opera -tionsbasis der Terrorzelleund die iranischen Revo- lu tionswächter als wahr-schein lichen Auftraggeber.Herkunft der Nachricht:„westliche Quellen“. Die Re-gierung der Vereinigten Emi-rate dementiert, dass es ei-nen solchen Plan je gegebenhabe. Reporter Hugi erklärt,er könne nichts zu seinenQuellen sagen. Auf die Frage,ob er von California Strate-gies benutzt worden sei, ant-wortet er: „Wir Journalistenwerden von unseren Quellendoch tagtäglich instrumen -talisiert.“
Noch am selben Tag be-richtet Chef-Lobbyist JasonKinney dem Anwalt vonScheich Chalid in einer E-Mail, die Story sei erfolg-reich „platziert“ worden.„Die Geschichte ist jetzt drau-ßen und beginnt sich auszu-breiten“, schreibt der Anwaltdaraufhin an Scheich Chalid:„Das ist der Anfang vonSauds Ende.“ Aus E-Mails,die dem SPIEGEL vorliegen,geht außerdem hervor, dasssich Vertreter von CaliforniaStrategies mit verschiedenen
Journalisten namhafter amerikanischerMedien getroffen haben.
Ende des Jahres gelingt es den Lobby-isten, Ras al-Chaima die Austragung desAmerica’s Cup zu entreißen, des ältestenund renommiertesten Segelwettbewerbsder Welt. Das Team Alinghi hat die Küs-tengewässer vor Ras al-Chaima gewählt,um den Titel im Februar 2010 gegen dasamerikanische Team BMW Oracle Racingzu verteidigen.
Kurz darauf stellt California Strategiesein „America’s Cup Dossier“ zusammen.Darin behauptet die Agentur, zwischen
Ras al-Chaima und Iran bestünden engeBeziehungen. Das Dossier übergeben siemehreren Journalisten, unter anderenBernie Wilson, dem Sportreporter derNachrichtenagentur AP in San Diego.„Ich fühle mich von California Strategiesinstrumentalisiert“, sagt Wilson demSPIEGEL. Zwar habe ihn California Stra-tegies kontaktiert, seine Informationenaber habe er hauptsächlich von BMWOracle bezogen. Doch auch BMW Oraclewar von den Lobbyisten mit dem „Ame-rica’s Cup Dossier“ gefüttert worden. ImDezember entscheidet ein New YorkerGericht, dass der Segelwettbewerb ausSatzungsgründen nicht in Ras al-Chaimaausgetragen werden dürfe.
Um seinen Plan voranzutreiben, ver-schafft California Strategies seinem Auf-traggeber auch Termine bei Spitzen -politikern, so mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi,und – noch im US-Wahlkampf – mit derzukünftigen Außenministerin HillaryClinton. Selbst der israelische Botschafterin London, Ron Prosor, empfängt denScheich und empfiehlt ihn weiter an diePro-Is rael-Lobby Aipac in Washington.Auf entsprechende Nachfragen reagiertProsor empfindlich. „Kein Kommentar“,lässt er seinen Sprecher ausrichten.
In einem internen Memorandum vom11. Dezember 2009 ziehen die Beratervon California Strategies schließlich einepositive Zwischenbilanz. Scheich Chalidhabe „das Interesse der US-Regierung ge-weckt“, während „das derzeitige Regimedes Emirats in einem sehr negativen Lichtdargestellt wurde“.
Für das Jahr 2010 schlagen die Beratervor, das Emirat weiter mit Iran in Verbin-dung zu bringen. Der Herrscher der Ver-einigten Arabischen Emirate in Abu Dha-bi solle so in die Enge getrieben werden,dass er sich am Ende entscheiden müsse,ob er weiterhin das derzeitige Regime inRas al-Chaima unterstütze „oder einenWechsel betreibt“.
Nur in Ras al-Chaima selbst ist von die-sen Machtspielen weder die Rede nochetwas zu spüren. Die Geschäfte gehengut, die Hotels sind ausgebucht, die Shop-ping-Malls wuchern auf dem roten Wüs-tenboden des Emirats.
Der Clan des alten Scheichs Sakr AlKassimi scheint sich der Unterstützungder anderen Emirate sicher. Die Herr-scher von Abu Dhabi und Dubai habendem Sterbenden ihre Aufwartung ge-macht. Der verstoßene Sohn, Prinz Cha-lid, konnte das Krankenzimmer seinesVaters dagegen nur in aller Heimlichkeitbetreten und unter Polizeischutz.
Er jedenfalls setzt weiterhin sein Ver-trauen darauf, dass die Bemühungen sei-ner kalifornischen Freunde ihre Wirkungzeigen, solange der alte Monarch noch inseinem Krankenzimmer dahinsiecht.
CHRISTOPH SCHULT, ALEXANDER SMOLTCZYK
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 93
Gestürzter Scheich Chalid: PR-Firma engagiert
Vater Sakr, Sohn Chalid 2003: Machtspiele im Emirat
AF
P
Bis 2015, sagt Kunene deshalb, soll Swa-siland in der Lage sein, die Malaria aus-zurotten. „Wir glauben, das wir das schaf-fen können“, sagt er. „Wir haben alles,was wir dafür brauchen.“
Swasiland gehört zu den ärmeren Län-dern der Erde, ein winziges Königreichim Süden Afrikas: kleiner als Sachsen,kaum mehr Einwohner als Köln. Einge-schlossen von Südafrika im Süden, Nor-den und Westen und von Mosambik imOsten, eine Insel, umgeben von Land. DieSäuglingssterblichkeit ist hoch, mehr alsein Drittel der Erwachsenen ist mit demHI-Virus infiziert. Die durchschnittlicheLebenserwartung beträgt 45 Jahre.
Kunene leitet das staatliche Malaria-programm seit 23 Jahren. Er will Swasi-land zum Modell machen, zum Muster-land der Malariabekämpfung. Sicher, esist kaum Geld da, die Malariabekämp-fung ist abhängig vom politischen Kräf-tefeld, auch von der gesundheitspoliti-schen Disziplin der Nachbarländer, „einJob mit Höhen und Tiefen“, so vorsichtigbeschreibt es Kunene.
Auf der anderen Seite hat Kunene ei-nen mächtigen Verbündeten, mit einemkomplizierten Namen (Dichlordiphenyl-trichlorethan) und einer weltbekanntenAbkürzung: DDT. DDT ist ein Kontakt-und Fraßgift. Aufgesprüht auf die Außen-und Innenwände der Hütten tötet es dieMücken, die den Malariaerreger übertra-gen, sobald diese sich dort niederlassen.DDT ist billig, und es ist einfach zu hand-haben, das bedeutet viel in Swasiland.
Früher wurde DDT in der Ersten Weltproduziert, in Deutschland, Italien, vorallem aber in den USA.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sprühtendie Industrieländer das Insektizid gegenLäuse und Mücken, Ulmensplintkäferund Schwammspinner und schnell gegenalles, was flog und krabbelte. So besieg-ten die reichen Länder Malaria und Ty-phus, irgendwann waren sie so gut wieschädlingsfrei.
Bis 1962 das Buch „Stummer Frühling“erschien. Die Autorin Rachel Carson wiesnach, dass sich DDT in der Muttermilchanlagert, dass es die Eierschalen vonWeißkopfseeadlern gefährlich dünn wer-
den lässt. Plötzlich schlug dieEuphorie um in Angst. 2001einigten sich 122 Staaten dar -auf, das Gift künftig nichtmehr einzusetzen.
Außer im Kampf gegenSeuchen. Swasiland impor-tiert das Insektizid inzwi-schen aus China, die ErsteWelt hat die Produktion ein-gestellt. Weil die Industrie -länder nur noch Meinungenin die Dritte Welt exportier-ten, klagt Kunene, kämen beiihm am Ende nur noch Fra-gen, Forderungen und Vor-würfe an: DDT könne Diabe-tes und Krebs verursachen, eslöse Frühgeburten aus undmache unfruchtbar.
Simon Kunene hat die Vor-würfe der Ersten Welt gründ-lich satt. „Was glauben Sie
denn, wo wir DDT einsetzen?“, ruft er.Malaria sei ein Armutsproblem. Je wohl-habender Swasiland werde, desto weni-ger Menschen in Lehmhütten leben wür-den, desto weniger DDT müssten sie ein-setzen, auch dieses Versprechen ist Teildes Traums.
„Natürlich kann es sein, dass DDT ge-fährlich ist“, sagt Kunene. „Aber immer-hin weiß ich, dass es gegen Malaria funk-tioniert. Ich habe in meinem Leben vieleGräber von Malariaopfern gesehen. Aberkein einziges von einem DDT-Opfer.“
Es ist eine afrikanische Sichtweise,pragmatisch, nicht ideologisch. Es be-schreibt ziemlich präzise den Unterschiedzwischen Risiko und Gefahr.
„Ich liebe Erfolge“, sagt Kunene. Dannzündet er sich eine Zigarette an und hum-pelt über den Rasen zurück zur Gesund-heitskonferenz. HAUKE GOOS
Ausland
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 094
MA NZ IN I
Eigentlich, sagt Simon Kunene, ha -be er keine Lust mehr, über denKampf gegen die Malaria zu disku-
tieren. Ein Gespräch sei sinnlos, jedenfallsmit Europäern. Der Europäer bringt we-nige Fragen mit nach Afrika und vieleAntworten, das jedenfalls ist Kunenes Er-fahrung. Der Europäer will nicht lernen,sondern belehren.
Andererseits ist Kunene ein höflicherMensch, und so lässt er sich am Endedann doch in einen weichen Sessel imTum’s George Hotel in Manzini fallen,ein hagerer, ernster Mann, schwarzer Pull-under, weißes Hemd, ein wenig sieht erso aus wie ein Bestatter. Vor vier Jahrenhatte Kunene einen Auto -unfall, seitdem humpelt er,weil er immer noch Schmer-zen hat, liegt er fast, währender redet.
Manzini ist neben derHauptstadt Mbabane diegrößte Stadt in Swasiland. Eigentlich sollte Kunene ne-benan auf einer Tagung derWHO sein, bei der es um die Zukunft des Gesundheits -wesens in seinem Land geht,aber weil ohne ihn ohnehinnichts beschlossen wird, ver-sucht er, den Traum seines Le-bens zu beschreiben.
Der Traum hat mit der Tro-penkrankheit Malaria zu tun.Wann sie zuschlägt, wen sietrifft. Jedes Jahr fallen fasteine Million Menschen demFieber zum Opfer. Nirgendwowütet die Malaria verheerender als inAfrika. Alle 30 Sekunden stirbt dort einKind an der Krankheit.
Natürlich, sagt Kunene, er selbst habeeine Menge Glück gehabt im Leben. Erwurde im gebirgigen Nordwesten vonSwasiland geboren, die Gegend gilt alsweitgehend malariafrei. So überlebte erdie Säuglingszeit, die frühe Jugend, dieSchulzeit.
Andererseits erwischte die Malaria Ku-nene natürlich irgendwann doch. 1986war das, Kunene war inzwischen 27 Jahrealt, die Krankheit lehrte ihn eine Lektion,die er nie wieder vergaß. „Dies ist dieschmerzhafteste Attacke, die man sichüberhaupt vorstellen kann. Wer nie Ma-laria hatte, der weiß nicht, welche Qualeneinem diese Krankheit auferlegt. Wenndu dich davon erholst, dann hast du einenschmerzhaften Weg hinter dir.“
Malariabeauftragter Kunene: „Ich liebe Erfolge“
HA
UK
E G
OO
S /
DE
R S
PIE
GE
L
Das ersehnte GiftGlobal Village: Warum das Königreich Swasiland das Insektizid DDT für einen Segen hält
F E R N S E H E N
Das letzte Buch Mosi
Schickeriafigur, Obdachlosenengel,Getriebener antiquierter Moral –
der 2005 im Alter von 64 Jahren er-mordete Modeladenbesitzer RudolphMoshammer war ein Star auf demBoulevard, besonders dem des barock-verliebten München. Es ist das Ver-dienst der Autoren Danuta Harrich-Zandberg und Walter Harrich, dieserbizarren Gestalt in ihrem Beitrag fürdie erfolgreiche Reihe „Die großenKriminalfälle“ (Montag, 21 Uhr, ARD)Respekt zu erweisen. Der Film ent -ledigt sich elegant und zügig der Chro-nistenpflicht, die Polizeiarbeit zu schildern, die nach zwei Tagen zum Erfolg führte. So bleibt Platz für dieBeschwörung der Tragödie eines ein -samen Mannes. Mosi, wie ihn dieMünchner nannten, hatte in der Kind-heit erlebt, wie der Alkohol seinen Vater erst den Job eines Versicherungs -direktors und dann die Familie gekos-tet hatte und wie er schließlich als ein-samer Obdachloser in der Gosse ende-
te. Das vergaß Moshammer nie undunterstützte Nichtsesshafte. Aber derDruck, der auf dem Leben des Mode-machers lastete, ließ sich durch guteTaten nicht mindern. Seine Homose-xualität lebte Moshammer auf schizo-phrene Weise aus, zwischen Heimlich-keit und Hochrisiko bei nächtlichenTouren durchs Strichermilieu, wo erauch seinen Mörder traf. Erschüttert,aber nicht moralisch entrüstet, so zeigtder Film, nahm das Münchner Volk ineiner pompösen Grablegung von Mos-hammer Abschied. Die Prominenz derIsarstadt, die bei ihm einkaufte und zuder er zu gehören glaubte, kam nicht.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 096
Szene
A U S S T E L L U N G E N
Das Koch-Museum
Brotlose Kunst? Davon kannbei Rirkrit Tiravanija wirk-
lich keine Rede sein. Der 1961 inArgentinien geborene Thailän-der wurde Anfang der neunzigerJahre bekannt, als er währendseiner Kunstinstallationen Spei-sen zubereiten und an die Mu -seumsbesucher verteilen ließ. In-zwischen ist der Mann ein welt-weit beachteter Künstler. VonSonntag an zeigt die KunsthalleBielefeld eine Retrospektive mitdem Titel „Just Smile and Don’tTalk“, bei der auch Tiravanija-Kochrezepte aus 20 Jahren aus-gestellt und in einer kleinen Kü-che nachgekocht werden: jeweilsmittwochs und sonntags. Derheute in Berlin und New York lebende Künstler will mit seinen Koch-Aktionen die sozialeFunktion von Ausstellungen thematisieren. „Nicht das, wasman sieht, ist wichtig, sondern das, was sich zwischen den Per-sonen im Raum abspielt“, erklärt der Buddhist. SpektakulärstesWerk der Ausstellung ist die Bodeninstallation „Untitled (The
Magnificent Seven, Spaghetti Western)“ mit sieben orangefar-benen Propangasflaschen, die jeweils eine Kochstelle versorgen.Auf dem Menüplan: Thai-Hühnersuppe. Das benutzte Geschirrsoll, so will es der Künstler, bis zum Ausstellungsende stehenbleiben, um damit an das Eröffnungsevent zu erinnern.
„Mr. Nobody“ ist im Jahr 2092 der letzteMensch auf Erden, der noch sterblichist. In einer bizarren Zukunftsweltewiger Jugend blickt er zurück auf dieEntscheidungen, die er im Laufe derJahrzehnte treffen musste. Jaco VanDormaels furiose Collage erzählt vondem, was war, und dem, was gewesenwäre, hätte der Held (Jared Leto) imrechten Moment einen anderen Satzgesagt, einen anderen Schritt gemacht.Und weil der Film genauso schnell ist,wie das Leben im Rückblick vorüber-zuziehen scheint, bleibt für Wehmutkaum Zeit.
Kino in Kürze
Szene aus „Mr. Nobody“
CO
NC
OR
DE
Moshammer 2004D
IWA
FIL
M /
HR
Tiravanija-Installation „Untitled (The Magnificent Seven, Spaghetti Western)“
PH
ILIP
P O
TT
EN
DÖ
RF
ER
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 97
Kultur
M U S I K
Fröhliche Geiselnahme
Viele Jahre lang hat man die Klassi-ker der modernen E-Musik nur in-
terpretiert, es kommt jetzt darauf an,sie zu verändern. So etwa lautet dieLosung, unter der am Donnerstag derNew Yorker Jazz- und Pop-Avantgar-dist Marc Ribot bei den Ludwigsbur-ger Schlossfestspielen mit einem wage-mutigen Experiment antritt. Ribot, 56,bekannt unter anderem durch seine
Zusammenarbeit mit Musikern wieTom Waits, Elvis Costello und JohnZorn, will mit einer Begleitband Wer-ke des legendären Komponisten JohnCage (1912 bis 1992) zerlegen, neu mi-xen und „als Geisel nehmen“. Ribotmeint, in der Musik des notorischenJazz-Verächters Cage „trotz seines zurSchau getragenen Desinteresses“ aller-lei Querverweise ins Reich des Jazzund der schwarzen Musik entdeckt zuhaben, und verspricht: „Wir verwan-deln einige seiner Stücke in Funk-Songs und Rhythm’n’Blues.“
L I T E R A T U R
LSD-Trip für AnfängerEin unverlangt eingesandtes Manu-
skript, ein unbekannter Autor mitdem bizarren Pseudonym „einzlkind“.Und ein Glücksfall für den BerlinerVerleger Klaus Bittermann, der mitdem Roman „Harold“ pures Gold ge-griffen hat. Harold ist ein kontaktar-mer Fleischwarenverkäufer, eine sanf-te Seele, dem eines Ta-ges eine Katastrophe inkurzen Hosen auf dieTürmatte gestellt wird.Melvin, elf, weitsichtig,genial, kann 1238 Bü-cher auswendig. Aufden soll Harold eineWoche lang aufpassen,weil die Mutter malwegmuss. Melvin machtsich nicht viel aus dem kinderüblichenAusflugsquatsch in den Zoo. Lieberschmuggelt er Harold einen LSD-Tripin die Kakaotasse, um mit ihm an-schließend eine Ausstellung modernerFotografie zu begutachten. Noch viellieber will er seinen verschollenen Vater auffinden, mit Mutters Saab,und unversehens sind wir in einem irrwitzigen britischen Roadmovie ge-landet. Die Geschichte von Haroldund Melvin hat Anklänge an NickHornbys Vater-Sohn-Plots, ist aber absurder, witziger, schwärzer. Melvinliebt es, sich und Harold in Gefahr zu bringen, etwa wenn er in einemPub zwei zwielichtige Muskelmännermit der Frage traktiert: „Können Siedas Wort Plebiszit buchstabieren?“ –„Leck mich am Arsch“, ist die Ant-wort. „Hast du sonst noch Fragen, Jun-ge?“ – „Sicher“, sagt Melvin. „Wann hatten Sie Ihr erstes homosexuelles Er lebnis?“ Die Suche nach Melvins Vater führtkreuz und quer durchs Königreich,durch alle Milieus. In Frage kommenein schwuler Theatermann, ein Mafio-so sowie ein kaputter Boxer, dessenversoffener Coach genau die richtigenWorte findet: „Deine Nase ist eineWaffe. Zweifelsohne. Aber du musstihn überraschen, schlag doch mal mitder Faust zu. Auch wenn’s weh tut.“Hans Magnus Enzensberger, dem dasBuch zuging, schrieb dem Verleger:„Das ist ja ziemlich wunderbar.“ Dasist es. „Harold“ ist das irrwitzige Buchzum Sommermärchen – voller Spiel-laune, zügig nach vorn erzählt undpunktgenau im Abschluss.
Einzlkind: „Harold“. Edition Tiamat, Berlin; 224 Seiten; 16 Euro.
Der Zürcher Verleger Egon Ammann,68, über die Gründe für die Schlie-ßung seines Verlags
SPIEGEL: Herr Ammann, Sie und IhreFrau haben jetzt Ihren 1981 gegründe-ten Verlag geschlossen. Warum?Ammann: Fast 30 Jahre sind eine langeZeit für eine so diffizile und kräfterau-bende Arbeit. Es war eine wunderbareund intensive Zeit für alle Beteiligten,denn es war ein Ausnahmezustand: Esging um Literatur! An die tausend Ti-tel haben wir verlegt. Was davon nochvorhanden ist, wird weiter lieferbarsein, es wird nichts verramscht.SPIEGEL: Warum haben Sie denVerlag nicht in junge Hände gege-ben? Ammann: Wir haben nach Nachfol-gern Ausschau gehalten, vielleichthaben wir sie oder ihn einfachnicht erkannt. Streng auf den Ver-leger ausgerichtete Verlage wieunserer haben in der nächsten Generation oft Probleme, von löb-lichen Ausnahmen abgesehen.SPIEGEL: Verkaufen wollten Sienicht?Ammann: Das Profil des Verlagshätte sich gewiss so sehr verän-dert, dass es mit uns nichts mehrzu tun gehabt hätte – und wir hät-ten dem hilflos zusehen müssen.Das wollten wir nicht. Ammannsoll in seiner ganz eigenwilligenArt in Erinnerung bleiben.SPIEGEL: Werden so nicht einigeAutoren auf der Strecke bleiben?Ammann: Neun von zehn haben ei-nen neuen Verlag gefunden. Es istalles in lebhafter Bewegung, undunsere großen Editionen sind inguten Händen.
SPIEGEL: Und Ihre Mitarbeiter?Ammann: Auch für sie haben wir neueArbeitsstellen gefunden. Ammannscheint eine gute Kaderschmiede ge-wesen zu sein.SPIEGEL: Kein Abschiedsschmerz?Ammann: Unser letztes Buch trägt denTitel „Beständig ist das leicht Verletz-liche“, eine Lyrik- Anthologie vonWulf Kirsten, an der 20 Jahre gearbei-tet wurde. In dem Titel sehe ich auchunseren Verlag charakterisiert, aberdas leicht Verletzliche zu haltenbraucht immense Kraft. Wir hatten dieund haben es zu einem guten Ende ge-bracht. Das ist ein großes Glück.
V E R L A G E
„Eine gute Kaderschmiede“
RE
GIN
A H
ÜG
LI
/ 1
3P
HO
TO
Ammann
Schon als er sich auf den Weg zumKommunismus-Kongress macht, aneinem Freitag morgens um fünf, von
Ljubljana über Zürich nach Berlin, ärgertsich Slavoj Žižek zum ersten Mal. Wiesohält eigentlich Alain Badiou, der franzö-sische Maoist, die Einführung?
Und stimmt es, dass Toni jetzt dochkommt, also Antonio Negri, der ehemali-ge Rote-Brigaden-Sympathisant, wo derdoch immer so viel streitet mit Alain?Und außerdem: Wann wird Negri dennreden und worüber, und vor allem – wie-so weiß er, Slavoj Žižek, nichts davon?
Žižek aber hat keine Zeit, sich zu är-gern. Er hat ein paar Stapel vollgeschrie-bener Zettel dabei, aus denen er jetzt aufden kurzen Flügen einen einstündigenVortrag zusammenschrauben muss. Ein
bisschen über Marx, viel über Hegel, überBadious „kommunistische Hypothese“,die könnte er ein bisschen angreifen, überNegris Begriff der „Multitude“, den könn-te er sogar stark angreifen, mal sehen.
Er findet die verdammten Zettel nicht,egal, die Gedanken in ihm warten eh nurdarauf herauszusprudeln. Ein Ersatz-T-Shirt für morgen oder übermorgen hat erauch dabei, es ist heiß, obwohl die Sonnein Ljubljana gerade erst aufgegangen ist,Žižek schwitzt jetzt schon, in ein paar Stun-den beginnt der Kommunismus-Kongress.
Ein Wochenende Ende Juni in der Ber-liner Volksbühne, und die Big Three, diegroßen Denker der neuen Linken, sindangekündigt: Antonio Negri, Italiener,Ende siebzig, ein ehemaliger politischerHäftling, Autor von „Empire“, dem be-
kanntesten neomarxistischen Bestsellerder vergangenen zehn Jahre; Alain Ba-diou, Philosophieprofessor in Paris, An-fang siebzig, sehr abstrakt, Maoist undUniversalist, sucht eine neue „kommunis-tische Hypothese“; Slavoj Žižek, Slowe-ne, Psychoanalytiker, Philosophieprofes-sor in Ljubljana, Gastprofessor in Saas Feund London, Anfang sechzig, der „Elvisder Kulturtheorie“ (so der Untertitel ei-nes Films über ihn). Oder: „Der gefähr-lichste Philosoph des Westens“. Einer seiner erbittertsten Gegner hat ihn so ge-nannt. Es war nicht als Kompliment ge-meint, gerade deswegen gefällt es Žižek.
Die drei sind Intellektuelle, aber sie sindauch Stars, wie früher Sartre und Camus,die Existentialisten, oder zuletzt Foucault,Deleuze oder Derrida, die Poststrukturalis-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 098
I D E O L O G I E N
Der DenkautomatMitten in der Kapitalismuskrise entdeckt die Subkultur den Kommunismus neu. Ihr Star ist der
slowenische Philosoph Slavoj Žižek, der Marxismus mit Pop und Psychoanalyse mischt. Seine Auftritte bieten Stand-up-Comedy für eine linksradikale Avantgarde. Von Philipp Oehmke
Kultur
Philosoph Žižek: „Ich weiß, die Leute halten mich zu oft für einen Idioten, aber ich bin nicht crazy“R
EIN
ER
RIE
DLE
R (
L./
R.)
ten, alles Franzosen. Aber seit deren Hoch-phase, also seit bald 20 Jahren, war diesePlanstelle des Pop-Philosophen unbesetzt,sieht man einmal von Bernard Hénri-Levyab, den Žižek vor allem deswegen verab-scheut, weil er immer so viel Brusthaar zeigt.
Es war der Italiener Negri, der vor zehnJahren die linksradikale Theorie wieder-belebte. Der Sozialismus des Ostblockswar gescheitert, der US-Politologe FrancisFuku yama hatte den ewigen Sieg des Ka-pitalismus ausgerufen und damit „das Endeder Geschichte“. Dann kam Negri. Er wartheoriebeschlagen, aber auch glaubwürdigals Klassenkämpfer. Er hatte im Gefängnisgesessen, weil die Behörden ihn für dasGehirn der Roten Brigaden hielten. Deramerikanische Literaturprofessor MichaelHardt half ihm, seine Gedanken in dreiBüchern zusammenzufassen. Es wurdenWeltbestseller, das berühmteste ist das ers-te, „Empire“ von 2000, eine Art neue Mao-Bibel für eine junge, hippe Anti-G-8-Linke.
Žižek, Badiou und Negri kennen sichseit Jahren, sie arbeiten mitunter zusam-men, aber noch viel genauer beobachtensie, was der andere gerade macht, was ersagt oder worüber er schreibt, auch wennsie wahrscheinlich die Bücher des ande-ren gar nicht lesen. Zu wenig abgehobenund zu real klassenkämpferisch ist Negriden beiden anderen; viel zu sehr im luft-leeren Raum ist Badiou für Negri, undŽižek veröffentlicht so viele Bücher, dass
wahrscheinlich noch nicht einmal erselbst dazu kommt, sie alle zu lesen.
Am frühen Nachmittag endlich sitztŽižek in der ersten Reihe im großen
Saal der Volksbühne, er muss jetzt eineStunde lang schweigen. Er kann vieles,aber das ist eine fast unlösbare Aufgabe.Neben sich hat er eine Plastiktüte von Sa-turn, in der er alles transportiert, was erbraucht in diesen drei Tagen. Der Saal istvoll, die rund tausend Zuhörer sitzen so-gar auf den Treppenstufen. Es sind jungeMenschen, die meisten unter dreißig, einPanoptikum linker Subkulturen, manchehaben sich als Brecht verkleidet, andereals Sartre, viele sehen aus, als wären sieauf Rucksacktrip durch Südostasien undwürden gleich anfangen, mit brennendenKeulen zu jonglieren. Alle haben Simul-tanübersetzungskopfhörer auf den Ohren,denn die Vorträge sind auf Französisch(Badiou), Italienisch (Negri) oder Englischmit starkem Akzent (Žižek und der Rest).Nur Žižek hat keinen Kopfhörer auf denOhren, er braucht keinen, er ist fließendin sechs Sprachen, darunter auch Deutsch.
Dabei sind die meisten Wortbeiträgeschon in ihrer Originalsprache kaum zuverstehen. Simultan übersetzt werden siezu sinnfreier Lyrik. Aber es soll hier nichtum einfache, um konkrete Antworten ge-hen, die gibt es bei der Linkspartei oderden Gewerkschaften. Genauso wenig soll
es um einen Blick zurück in die Geschich-te gehen, zurück in das düstere 20. Jahr-hundert, zu seinen Katastrophen, die imNamen des Kommunismus geschehensind, zu seinen Opfern, zu den mehr als30 Millionen Ermordeten, zu Stalin, zuPol Pot, den Arbeitslagern, der Überwa-chung. Nein, es soll hier um Theorie ge-hen, um eine neue „kommunistische Hy-pothese“, wie Badiou es nennt, um Uni-versalismus, das Subjekt in der Geschich-te, Wahrheitsereignisse, um Hegel undum Psychoanalyse nach Jacques Lacan.
„Kommunismus“ steht in großen Buch-staben auf dem Dach des Theaters amRosa-Luxemburg-Platz. Aber was wollenall die Menschen hier? Draußen, in denStraßen Berlins, ist endlich Sommer, eslaufen Fußballspiele auf großen Leinwän-den, man könnte Bier trinken.
20 Jahre nach dem vorläufigen Endedes kommunistischen Experiments undgenau 21 Monate nach dem Fastkollapsdes kapitalistischen Status quo gibt es of-fenbar eine Sehnsucht: nicht nach linkerPolitik, sondern nach linker Theorie. Jedrängender die praktischen Probleme, jemüder unsere Demokratie, je kaputterder Euro, je schlechter die Koalition, jeunkontrollierbarer die Banken – destoabstrakter die Suche nach Wahrheit, des-to interessanter die Philosophie.
Die Philosophie habe nicht mehr denEinfluss auf die Gesellschaft, wie sie ihn
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 99
RE
INE
R R
IED
LE
R
bis Ende der sechziger Jahre hatte,schreibt Karl Heinz Bohrer im aktuellen„Merkur“. Doch das Denken der ver -gangenen Jahrzehnte hat sich verändert,Philosophie ist Kulturkritik geworden, es-sayistischer, sprunghafter, anekdotischer, literarischer, wie es die Franzosen um Gil-les Deleuze, Michel Foucault und RolandBarthes vorgemacht haben, aber auchLeute wie Peter Sloterdijk.
Diese Theorie muss auch immer sexysein, sie muss unterhalten, provozieren,bruchstückhaft und leicht zitierbar sein,physisch spürbar wie Rockmusik. All dasliefert Žižek. Man könnte sagen, er hatdiesen Beruf neu erfunden. Man könnteauch sagen, er hat diesen Beruf entehrt.
Alain Badiou hält die Einführung, undŽižek in der ersten Reihe hält es kaumauf dem Stuhl. Er bewegt die Lippen, alsspräche er mit. Badiou ist ein netter älterer Herr mit ordentlichem Hemd, ersieht nicht aus wie ein Staatsfeind, eherwie ein gemütlicher DDR-Rentner. Aufdem Podium sitzt auch Antonio Negri. Erist äußerlich das Gegenteil von Badiou.Ausgezehrt wirkt er, als wäre er geradeerst aus dem Gefängnis entlassen wordenund nicht vor neun Jahren. Badiou zitiertin seiner Einführung sogleich Mao: „VonNiederlage zu Niederlage zum Sieg!“
Und gerade als es einen schaudern will,ruft Žižek dazwischen, er würde es ehermit Beckett sagen: „Scheitern, nochmalsscheitern, besser scheitern.“ Žižek lacht,guckt sich nach Mitlachern um.
Er kann schneller reden, als er denkt,er ist wie ein Presslufthammer. Mehr als
50 Bücher hat er veröffentlicht, in mehrals 20 Sprachen, zuletzt ist „Living in theEnd Times“ erschienen, über 400 SeitenNiedergang der liberalen Demokratie.
Er hält mehr als 200 Vorträge im Jahr,neulich in Buenos Aires kamen 2000 Men-schen, hatte Lehraufträge an amerikani-schen Eliteuniversitäten. Es gibt zwei Dokumentarfilme über ihn und einen, indem er Filme psychoanalytisch deutetund dabei in einem Motorboot übersMeer rast. Es gibt Žižek-T-Shirts, einenŽižek-Club, Žižek-Records und ein inter-nationales Žižek-Journal.
Sein Repertoire ist ein Mix aus der Psychoanalyse des obskuren Jacques
Lacan und der Idealismusphilosophie Hegels, aus Filmanalyse, Demokratie-,Kapitalismus- und Ideologiekritik und einem manchmal autoritärem Marxismusgepaart mit Alltagsbeobachtungen. Er erklärt das ontologische Wesen der Deut-schen, Franzosen und Amerikaner an-hand ihrer Toiletten und dem daraus ab-zuleitendem Verhältnis zu ihren Fäkalienund reagiert auf Kritik zunächst mit ei-nem fröhlichen „Fuck you!“, ausgerufenin harten slawischen Konsonanten. Kol-legen, die er schätzt, aber eine andereLehre vertreten, teilt er mit, sie könntensich darauf einrichten, in den Gulag zugehen, sollte er, Žižek, bald an der Machtsein. Žižek mag den Schauder, den dasWort Gulag ausstrahlt.
„Mein Freund Peter, zum Beispiel, fu-cking Sloterdijk, ich mag ihn sehr, abernatürlich muss er in den Gulag. Aber er
wird ein bisschen besser gestellt dort, viel-leicht kann er Koch werden.“
Man kann das lustig finden, vor allemin der Art, wie Žižek es vorträgt, über-trieben und emphatisch. Man kann natür-lich auch an die über 30 Millionen Men-schen denken, die dem Sowjetterror zumOpfer fielen. Wer das lustig findet, kanngleich Witze über Konzentrationslagermachen.
„Aber wissen Sie was?“, sagt Žižek da.„Die besten, eindrücklichsten Filme überden Holocaust sind Komödien.“
Žižek liebt es, Sichtweisen zu ihremRecht zu verhelfen, wenn eigentlich dasGegenteil als richtig gilt, kontraintuitiveBeobachtungen nennt er das. Seine liebsteDenkform ist die des Paradoxons, mit Hil-fe seines psychoanalytischen Rüstzeugsversucht er nachzuweisen, wie die liberaleDemokratie die Menschen manipuliert.Eine seiner berühmten Alltagsbeobach-tungen dazu betrifft die Tür-zu-Knöpfe inFahrstühlen. Er hat herausgefunden, dasssie Placebos sind. Die Türen schließen keine Sekunde schneller, wenn man denKnopf drückt, aber das müssen sie auchnicht. Es reicht, dass der Drückende dieIllusion hat, er könnte etwas beeinflussen:Genauso, sagt Žižek, funktioniere auchdie politische Illusionsmaschine, die sichwestliche Demokratie nennt.
Seine Gegner werfen ihm vor, die libe-rale Demokratie zu bekämpfen und durchautoritären Marxismus, Stalinismus gar,ersetzen zu wollen. Sie finden, dass er besonders gefährlich sei, weil er seinenTotalitarismus als Pop verkleide. Der Um-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0100
Rote-Armee-Soldaten in Leningrad 1933: Keinen Blick zurück in das düstere 20. Jahrhundert
LE
NS
OV
IET
schlag seines Buchs „Auf verlorenem Pos-ten“ zeigt eine Guillotine, das Symbol fürden linken, von oben verordneten Terror,„guten Terror“, wie Žižek auch schon ge-sagt hat. Der Suhrkamp-Verlag hat in derdeutschen Ausgabe Teile des Textes nichtveröffentlicht, es waren Passagen, die mitdem Totalitären spielten, heißt es.
Wer Žižeks Wohnung in einem Neu-bau der Innenstadt Ljubljanas be-
tritt, dem guckt Josef Stalin von zwei Pla-katen entgegen.
„Das bedeutet nichts! Das ist nur einWitz“, ruft Žižek sofort.
Er bietet an, Stalin sofort abzuhängen,falls er störe. Er habe genug davon, sagter, als Stalinist bezeichnet zu werden. Inden vergangenen Wochen sind wie-der einige Beiträge erschienen, dieihn scharf angreifen, in der links -liberalen US-Zeitschrift „The NewRepublic“, im deutschen „Merkur“,auch in der „Zeit“. Geschichts -vergessen sei sein Nachdenkenüber den Kommunismus, zu wenig ernsthaft, seine Revolutionstheorieschlicht faschistisch. Jetzt haben sieihm sogar wieder Antisemitismusvorgeworfen. Selbst Suhrkamp hateinige Passagen von ihm nicht ver-öffentlicht, weil sie – böswillig – alsantisemitisch ausgelegt werdenkönnten. Diese Vorwürfe sind in-fam, doch Žižek weiß, dass er anihnen nicht unschuldig ist. Seinständiges Bohren, Stechen, Infrage-stellen ist wahrlich subversiv. Abermanchmal führt es dazu, dass esihn extrem angreifbar macht. Ersagt, die, die ihn so attackieren, hätten sein Denken selten durch-drungen.
Philosophie, wie sie Žižek ver-steht, ist grenzenloses Denken, weitentfernt von jeder Umsetzung, undkeine praxisbezogene Politikwissen-schaft, die Schranken haben muss.Wenn ihm die linksliberalen Ameri-kaner vorwerfen, er wolle einer neuen Linksdiktatur das Wort reden,verweist Žižek darauf, dass er es war undnicht sie, der unter Tito gelebt hat und alsjunger Professor nicht lehren durfte.
Žižeks Wohnung sieht aus, als wäreTito noch immer an der Macht. Sie hatdrei kleine Zimmer, vielleicht 50 Quadrat-meter und ist programmatisch lieblos eingerichtet. Über dem Sofa in Ostblock-farben hängt ein Plakat von einer Mark-Rothko-Ausstellung. Ansonsten DVD-Ständer, Bücherregale, Berge von „StarWars“-Lego, seine Wäsche ist in denSchränken der Einbauküche verstaut. Esgibt Eistee aus Disneyland-Bechern.
Žižek wohnt hier allein und zeitweisemit seinem Sohn aus zweiter Ehe. Er hatauch noch einen aus erster Ehe. Er warzuletzt mit einem 30 Jahre jüngeren argen -
tinischen Unterwäschemodel verheiratet,der Tochter eines Lacan-Schülers, die zuallem Überfluss auch noch Analia heißt.
Slavoj Žižek trägt Jeans und T-Shirt,blaue Badelatschen mit dem Aufdruckdes Adlon-Hotels und Socken aus derLufthansa-Business-Class. „Ich habe mirseit Jahren schon keine Socken mehr gekauft“, sagt er. Er wohnt in den bestenHotels, gerade kommt er zurück von ei-ner Reise, die ihn nach China und LosAngeles führte. In China ging es um Mao,in Los Angeles um Richard Wagner. DieChinesen hatten ihn eingeladen als kom-munistischen Vordenker, aber er glaubtnicht, dass sie seine Theorien verstehen.
„Die haben zehn meiner Bücher über-setzt, die Idioten“, sagt Žižek. Die Chi-
nesen haben die Bücher als Poesie über-setzt und nicht als philosophisch-politi-sche Schriften. Die Übersetzer hatten an-geblich noch nie von Hegel gehört undkeine Ahnung, was sie da eigentlich über-setzten. Also versuchten sie, es wenigs-tens schön klingen zu lassen.
Das Erlebnis, auf Slavoj Žižek zu tref-fen, ist für jeden zunächst faszinierend(die erste Stunde), dann frustrierend (mankommt nicht zu Wort) und schließlich er-lösend (es hört tatsächlich irgendwannauf). Žižek beginnt von der ersten Sekun-de an zu reden, und reden heißt bei ihmschreien, gestikulieren, spucken, schwit-zen. Er hat einen S-Fehler, der Buchstabeklingt bei ihm wie eine Fahrradluftpumpe.Seine Vorträge beginnen meist mit „Did
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 101
Kultur
Debattanten Badiou, ŽiŽek in Berlin Drei Star-Philosophen auf der Suche …
TH
OM
AS
AU
RIN
Kontrahent Negri … nach dem revolutionären Subjekt
TH
OM
AS
AU
RIN
you know …“, und dann springt er vonThema zu Thema, wie ein Denkautomat,den man mit Münzen stopft und der nichtmehr aufhört zu rattern.
Žižek hat eine Kunstfigur erschaffen,seine Auftritte sind Performances, irgend-etwas zwischen Kunst und Comedy. Ersagt, er möchte weg von diesen Stand-up-Comedy-Auftritten, in Berlin will ereinen ernsthaften Vortrag halten, vor al-lem über Georg Wilhelm Friedrich Hegel,von ihm handle auch sein neues Buch,700 Seiten habe er schon geschrieben. Für700 Seiten über den vielleicht schwierigs-ten Denker der Philosophiegeschichtebraucht ein normaler Mensch zehn Jahre.Žižek hat es in den vergangenen Monatenim Flugzeug geschrieben.
Nach exakt drei Stunden Žižek-Timepassiert Tröstliches. Plötzlich scheint seinAkku leer, die Maschine stoppt. Žižekhat Diabetes, der Blutzucker ist viel zuhoch, nein, viel zu niedrig, die Krankheitscheint im Moment besonders schlimmzu sein. Doch Slavoj Žižek wäre nichtSlavoj Žižek, wenn er das so banal sagenwürde. Er sagt lieber: „Wissen Sie, meineDiabetes ist inzwischen ein sich selbst er-haltendes System: völlig unabhängig vonäußeren Einflüssen! Sie macht, was siewill. Und jetzt muss ich schlafen.“
Auf dem Weg nach Berlin ist es Žižeknicht gelungen, seinen Vortrag wie
angekündigt im Flugzeug zusammenzu-schrauben. Während sein Vorredner inder Volksbühne noch spricht, ein kleinerHerr aus der Türkei mit langen Haarenund langem Bart, schichtet Žižek Papierevon einem Stapel auf den anderen, sucht,notiert, liest angestrengt. Seine Haare kle-ben an der Stirn, Žižek schwitzt nicht nurbeim Reden, sondern auch beim Denken.
Es ist schon der zweite Tag des Kon-gresses, bis hierhin musste er sich mitZwischenfragen über Wasser halten. Ergreift sofort Antonio Negri an, der amVortag Badiou und ihm vorgeworfen hat-te, sie vernachlässigten den Klassen-kampf. Negris Theorie von der „Multitu-de“, also seine Idee eines revolutionärenSubjekts, das in der Unterschiedlichkeitder Einzelnen das Gemeinsame sieht,geht davon aus, dass der Spätkapitalismussich selbst abschaffe und allein dadurcheine revolutionäre Situation entstehe.Žižek und Badiou ist das viel zu konkretund realpolitisch. Žižek bewaffnet sichmit Hegels Totalitätsbegriff, mit PlatonsWahrheitsbegriff und Heideggers Ereig-nisbegriff. Man müsse außerhalb des Staa-tes stehen, um ihn abzuschaffen, Negriaber bleibe innerhalb des Systems, des-halb könne seine Multitude niemals eineRevolution in Gang setzen.
Negri, sein ledernes Gesicht in Falten,reagiert heftig. Žižek sei das revolutionäreSubjekt verlorengegangen, aber ohne revo -lu tionäres Subjekt gebe es keinen Wider -
stand. Badiou verfolgt den Streit mit demGesicht einer alten Schildkröte, als würdees sich überlegen, wen er zuerst ins Ar-beitslager schicken möchte. Ob er daraufeingehen wolle, wird Badiou von dem Mo-derator gefragt. Badiou winkt ab und blecktein Wolfsgrinsen. Er wolle sich am nächstenTag zu Negri äußern und vielleicht auchzu Žižek. Es klingt wie eine Drohung.
Am Ende von Žižeks Vortrag stellt einZuschauer eine ziemlich komplizierte Fra-ge, die nicht zu verstehen ist. „You madea good point“, sagt Žižek und redet wei-ter über Hegel. Seine Antwort hat nichtsmit der Frage zu tun, die wiederum über-haupt nichts mit dem Vortrag zu tun hat.So könnte das Spiel endlos weitergehen.Plötzlich schiebt Žižek die Pappfassadenbeiseite und unterbricht seinen Hegel- Vortrag. „Na ja! Egal. Wie ich schon sagte,Sie hatten einen ziemlich guten Einwand.Und die Wahrheit ist, ich habe keine Ant-wort. Mein langwieriger Talk war auchnur ein Versuch, das zu verschleiern!“Dankbarkeit im Publikum. Man darf alsosagen, dass man nichts versteht und keineAhnung hat, Žižek tut es auch.
„Ich weiß, die Leute halten mich zu oftfür einen Idioten“, sagt er am Abend,„für diesen nostalgischen Leninisten.Aber ich bin nicht crazy. Ich bin viel be-scheidener und viel pessimistischer.“
Warum pessimistisch? Es ist ja tatsäch-lich nicht abwegig anzunehmen, dass Ka-pitalismus und Demokratie an einen to-ten Punkt gekommen sind. „Das stimmt“,sagt Žižek, „aber ich glaube, dass die Lin-ke auf tragische Weise bar jeder ernstzu-nehmenden Vision ist. Wir alle wünschenuns eine richtige authentische Revolution!Aber sie muss weit weg stattfinden, ambesten in Kuba, in Vietnam, China, Nica-ragua. Das hat nämlich den Vorteil, dasswir hier unsere Karrieren weiterführenkönnen.“ Dann muss er ins Hotel, dieDiabetes, man wisse doch.
Spät am Samstagabend, die USA spie-len gerade in der Verlängerung gegenGhana, ruft Žižek noch einmal an. Er istaufgeregt. „Haben Sie heute meinenClash mit Negri mitgekriegt? Unglaub-lich! Wovon redet der? Dass der Spätka-pitalismus sich selbst abschafft?“
Žižek sagt, die Revolution funktionierenie ohne eine Obrigkeit, ohne Lenkung.Das sei schon bei der Französischen Re-volution und den Jakobinern so gewesen.
Er macht eine Pause. Gesprächspausengibt es eigentlich nicht bei Žižek, weil sieihn augenblicklich verlegen machen.
Schließlich sagt er: Das mit dem Staatund der Revolution sei wie mit den Frau-en. „Es ist unmöglich mit ihnen, abernoch unmöglicher ist es ohne sie.“
Er will sich gerade wieder in Rage reden, der Automat kommt auf Touren,dann bricht er plötzlich ab.
„Ach, lassen wir das. Wir sehen unsmorgen, lieber Freund!“
Auf den ersten Blick erinnern dieBilder an die Aquarelle von EgonSchiele. Sie sind Nass in Nass ge-
malt, so nennt sich die Technik, die dieFarben leicht ineinander übergehen lässt.Fast immer sind Menschen zu sehen,sonst nichts. Auf den zweiten Blick habendie Bilder des Rockstars Marilyn Mansonaber so gar nichts mit den überhitztenAkten des Wiener Expressionisten zu tun.Sie tragen Titel wie „I Got My ArmsAround No One“ und zeigen einen Mas-kenkopf, der ins Leere greift; „SkopticSyndrome“, hier schnürt sich ein Mannsein Geschlechtsteil ab; oder „ElizabethShort as Snow White, ‚You’re sure youwill be comfortable?‘“: eine zerstückelteFrauenleiche. Short war die sogenannteSchwarze Dahlie, Opfer eines der bekann-
testen Morde der US-Geschichte, der Tä-ter wurde nie gefunden.
Es ist die erste MuseumsausstellungMansons, die Wiener Kunsthalle zeigt unter dem Titel „Genealogies of Pain“ 20seiner Bilder. Als er die Halle betritt,drängeln sich die Fotografen und Kamera -leute so dicht, dass sie beinahe einen Drei-jährigen umrennen, der seinem Vater entwischt ist. Früher hätte niemand Klein-kinder zu Manson mitgebracht.
Er trägt einen schwarzen Trenchcoat,schwarze Stiefel, sein Gesicht ist weiß ge-schminkt, er hat eine Sonnenbrille auf,die Haare seines schwarzen Seitenschei-tels flattern über die linke Kopfseite, dierechte hat er ausrasiert. Seine Schminkeist so dick aufgetragen, dass sie an einerStelle feine Risse hat. „Malen ist das Ge-
Kultur
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0102
P O P
Das Ende des SchockstarsDer Rockmusiker Marilyn Manson
provozierte aus Prinzip. Nun versucht er sich als Maler.
Maler Manson: „Ich musste mir eine neue Perspektive suchen“
RE
INE
R R
IED
LE
R
genteil von Rockmusik“, sagt er. „Alles,was du als Rockstar machst, hat mit Kom-munikation zu tun, man hat immer dasPublikum und seine Reaktionen im Kopf.Malen ist anders.“
Es wäre wohl zu früh zu behaupten,Marilyn Manson würde sich zur Ruhe set-zen, auch wenn er in Wien sagt, malensei für ihn nun so wichtig wie Musik.Aber der Mann, der sich nach einerchristlich fundamentalistischen Schul -erziehung zum „Repräsentanten desamerikanischen Alptraums“ stilisierteund damit Millionen Platten verkauft hat, baut nach zahllosen Skandalen undKontroversen sein Image um. Einer dergrößten Popstars Amerikas will nun einMaler sein.
Der Schockstar, eines der erfolgreichs-ten Starmodelle der vergangenen 15 Jah-re, hat offensichtlich ausgedient. Mansonist nicht der Einzige. Der Rapper Eminem,ehemals genauso umstritten wie Manson,versucht es als geläuterter Ex-Drogenab-hängiger, gerade ist sein neues Album„Recovery“ erschienen. Es funktioniertnicht so richtig, die alte Frechheit verträgtsich nicht mit der neuen Vernunft.
Der Schockstar setzte ein Kunstwerkin die Welt, das auf möglichst eingängige,aber doch verstörende Art und Weise ex-treme Sexpraktiken, Drogenmissbrauch,Serienmorde, Teenage-Angst und totali-täre Symbolik zu kombinieren wusste.Dann wartete er auf Reaktionen.
Die stellten sich rasch ein und liefenimmer auf das Gleiche hinaus: DieseKunst gefährdet, wenn nicht das Abend-land, dann doch die Jugend. Daraufhinberief sich der Schockstar auf die Freiheitder Kunst. Sie müsse ein Raum sein, indem auch dunkle Phantasien ihren Platzhaben könnten. Und sei es nicht so, dasswir alle, auch die Moralapostel, manch-mal solch dunklen Gedanken nachhin-gen? Darauf schwieg die Gegenseitemeist, wahrscheinlich aus Angst, das kön-ne stimmen.
Wieder und wieder spielten Manson,Eminem, aber auch die Metalband Slip-knot dieses Spiel. Es war die popkultu-relle Reaktion auf Jahre, in denen dieUSA erst von einem Präsidenten regiertwurden, der zwar zugab, gekifft, aber be-stritt, inhaliert zu haben, für den einBlow-Job der Praktikantin kein Sex warund dessen Vize mit der Chefin jener El-ternvereinigung verheiratet war, die dafürgesorgt hatte, dass CDs von Schockstarsmit „Parental Advisory“-Aufklebern aus-gezeichnet werden mussten. Die nächsteRegierung führte das Land unter Vorspie-gelung falscher Tatsachen in einen Krieg.Kurz: Es waren verlogene Zeiten. Sie sindvorbei.
Die Nachfolge der Schockstars habenjunge Frauen wie Lady Gaga oder Rihan-na angetreten. Die wissen zwar auch, wieman provoziert. Ihre Inspiration beziehen
sie jedoch aus den Reichen der Phantasieund Artifizialität. Mode, Pornografie,Kunst. Die Schockstars dagegen – allesMänner – versuchten für ihr Theater derGrausamkeit die Grenzen zwischen Wirk-lichkeit und Alptraum einzuebnen.
Sie schlugen sich mit Verbotsvorwürfenherum, freuten sich an einem Leben, indem alles erlaubt war, der Erfolg basierteja gerade auf dem ruinierten Ruf. Emi-
nem schluckte Unmengen von Drogen.Slipknot dachten sich immer gemeinereGesichtsmasken aus. Marilyn Manson hei-ratete das Fetisch-Model Dita von Teese,die sich dann von ihm trennte, weil ermit „zu vielen Dämonen zu kämpfen“hatte, wie ein Freund sagte. Zuvor hatteer eine Affäre mit der PornodarstellerinJenna Jameson, ihr passten seine sexuel-len Vorlieben nicht. Schließlich landeteer bei der Schauspielerin Evan RachelWood, damals 19. Wood ist auch das Mo-dell für zwei Bilder, die in der Ausstellunghängen. Es sind düstere Werke.
Manchmal gelang es den Schockstarswirklich, Debatten anzustoßen. Etwanach dem Schulmassaker im amerikani-schen Littleton, als 1999 zwei Jugendlicheeinen Lehrer und 12 Mitschüler erschos-
sen und 24 zum Teil schwer verletzten.Sie erschossen sich selbst. Manson wurdevorgeworfen, durch seine Musik Gewaltzu verherrlichen und so mitverantwort-lich dafür zu sein, dass aus JugendlichenKiller wurden.
Mit Musik und einem Auftritt in demDokumentarfilm „Bowling for Colum -bine“ wehrte er sich. Er schrieb einen Essay für den „Rolling Stone“. In Wien
hängt auch ein Bild Mansons,das die beiden Attentäter alslachende Fingerpuppen zeigt.
„In den USA wird das Verbrechen leicht zu Unter-haltung. Es ist schwer ausein -anderzuhalten, wo das eineanfängt und das andere be-ginnt“, sagt er jetzt. „Aus die-sem Teufelskreis heraus habeich die Figur Marilyn Mansonentwickelt. Heute bin ich Teildavon, ich bin selbst beschul-digt worden, für Verbrechenverantwortlich zu sein. Ichmusste mir neue Perspekti-ven suchen. Deshalb die Ma-lerei.“
Es ist aufschlussreich, Man-son in seinem neuen Milieuzu beobachten. Wie er aufdem Podium der Pressekon-ferenz sitzt und mit den Fo-tografen flirtet – noch ganzPopstar. Wie er der Kuratorinzuhört, wenn sie Nietzschezitiert – schon ganz bildenderKünstler. Wie er bei einer Frage nach dem Preis auf dieGaleristin verweist – ein Ge-nie, das die Gelddinge ande-ren überlässt. Wie er späterdamit angibt, 90000 Euro fürein Bild zu nehmen – ein Pop-star, für den Reichtum Da-seinsbeweis ist.
Für den Wiener Museums-direktor Gerald Matt ist Man-son „ein Poet des Grauens,des Schmerzes, der Gewalt“.
Matt erzählt, dass er vor einigen Jahrenzum ersten Mal Bilder Mansons gesehenhabe und von dessen Können überraschtgewesen sei.
Natürlich ist „Genealogies of Pain“auch das Rückbauprogramm einesschrumpfenden Stars. Vor allem ist dieAusstellung aber für beide Seiten ein guter Deal. Bilder in einer öffentlichen Institution zu zeigen, die nur den Idealender Kunst verpflichtet ist und nicht demprivatwirtschaftlichen Interesse, gilt alsAdelsschlag für einen Künstler. DenKünstler in einem Rockstar zu entdeckenist der Beweis für die Fähigkeiten einesDirektors.
So wird aus einem Verderber der Ju-gend ein ernstzunehmender Künstler.
TOBIAS RAPP
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 103
Manson-Aquarell: „Malen ist anders“
KA
TJA
HA
AS
/ A
GE
NC
Y P
EO
PLE
IM
AG
E
SPIEGEL: Herr Neuenfels, Sie inszenierengerade „Lohengrin“ in Bayreuth, Ihre erste Arbeit auf dem Grünen Hügel. Wiefühlen Sie sich als 69-jähriger Debütant?Neuenfels: Es ist sehr anstrengend hier. Es gibt keinen Samstag, keinen Sonntag.Wir probieren durch. Ich bin nicht derMensch, der in einer solchen Situationvon Natur aus sieben bis acht Stundenschläft. Da brauche ich manchmal einbisschen Alkohol und auch Tabletten. SPIEGEL: Warum tun Sie sich das an, Siekönnten doch überall unter weniger an-strengenden Bedingungen arbeiten?Neuenfels: Weil es natürlich aufregend ist,an einem Ort zu sein, wo es immer nurum einen Komponisten und ein Ziel geht.Es gibt hier nur ein Thema: Richard Wagner.SPIEGEL: Bislang nicht gerade Ihr Lebens-thema. Neuenfels: Nicht direkt, es ist meine dritteWagner-Regie von 34 Opern insgesamt,die ich inszeniert habe. Wagner ist in denletzten Jahren für mich immer wichtigergeworden, nach Verdi und Mozart.SPIEGEL: Was fasziniert Sie an Wagner, einem antisemitischen Egomanen?Neuenfels: In seiner Musik, anders als inseinen Schriften, ist er auf keinen Fall antisemitisch. Am meisten fasziniert michan ihm, dass er gesellschaftliche und in-dividuelle Abhängigkeiten durchschautwie kaum ein anderer. Das muss man ihmlassen. Seine Opern sind prophetische Be-obachtungen über Massenbewegungenund über die Verführbarkeit Einzelner.Die Werke stecken voller Fallen, die erhöchst raffiniert auslegt. SPIEGEL: Charlie Chaplin hat für seinenFilm „Der große Diktator“ mit dem Vor-spiel zu „Lohengrin“ die berühmte Szeneunterlegt, in der der Diktator selbstver-liebt und größenwahnsinnig mit der Welt-kugel spielt. Da wirkt Wagners Musikplötzlich auch lächerlich. Neuenfels: Finde ich nicht. Für mich wirktsie eher filmisch. Ich habe immer schonbehauptet, dass Wagner ein großer Film-komponist gewesen wäre, wenn er dieGelegenheit dazu gehabt hätte. Seine Musik ist immer gefährdet, in die Ge-schmacklosigkeit abzugleiten. Ich glaubeallerdings, dass Wagner sehr bewusst zwi-schen Pathos und dem Lächerlichen ba-lanciert. Das ist ein gefährliches Spiel,aber er hat es im Griff.
Kultur
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0104
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Hätte Elsa doch nie gefragt“Der Regisseur Hans Neuenfels über seinen Bayreuther „Lohengrin“, Wagner als Prophet
und über seine berühmte „Aida“, in der er mit Brathähnchen werfen ließ
Hans Neuenfelsinszeniert in diesem Jahr die einzige Neuproduk tion bei den Bayreuther Festspielen.Sein „Lohengrin“ hat am 25. Juli Premiere. Neuenfels, 69, gilt als einer der kreativsten und mutigsten Regisseure des Sprech- und Musiktheaters. Schon als Oberspielleiter in Trier er arbeitete er sich Mitte der sechziger Jahre den Ruf eines provozierenden Regisseurs. Mit 28 Jahren hatte Neuenfels bereits 30 Stücke inszeniert. 1974 brachte er seine ersteOpern regie heraus, Verdis „Troubadour“. Bis heute polarisieren seine psychologischstringenten und gesellschaftskritischen Arbeiten das Publikum. Neuenfels-Premieren endenmeist mit zornigen Buhs und enthusiastischen Bravos.
CH
RIS
TO
PH
BU
SS
E
Identität ist dort, wie beim geheimnisvol-len Ritter Lohengrin, das letzte Tabu.Neuenfels: So ist es. Deswegen hat michdas Stück auch so unglaublich interes-siert. Und deswegen übt es auch heutenoch so eine Magie aus. Und ab einemgewissen Moment kommt dann die Ent-täuschung. Man sagt sich, hätte Elsa dochbloß nicht gefragt. SPIEGEL: Diese Verklärung einer bedin-gungslosen Liebe, das ist doch der Gipfelder Romantik?Neuenfels: Ja, es ist gleichzeitig der Ver-such, ein Gefühl zu installieren, das mehrist als die Realität. Diese Überhöhung.Alles, was mit Kunst zu tun hat, ist letzt-lich romantisch, weil Kunst ein Versuchist, dem schnöden „Es ist so, wie es ist“zu entgehen.
SPIEGEL: Und wo siedeln Sie Ihre Rea li täts -fluchtburg an? Doch wohl nicht im 10. Jahr -hundert wie bei Wagner.Neuenfels: Natürlich nicht. Es spielt beiuns in einer imaginären Zeit, in einer vonuns erfundenen Zeit, ja, das Ganze ist ei -ne Art Labor.SPIEGEL: Mit Menschen als Laborratten?Neuenfels: Es sind schon ordentliche Men-schen: zwei leidenschaftliche Frauen, Elsaund ihre Rivalin Ortrud, die mit ihremMann Telramund an die Macht will, undein mit einem übergroßen Auftrag sehrbeschäftigter Lohengrin. Figuren mitwirklichen Problemen. SPIEGEL: In Salzburg haben Sie 2001 mitIhrer kruden „Fledermaus“ den Festspiel-gästen die heiteren Operetten-Erwar -tungen vermasselt. War es Ihr Auftrag für Bayreuth, den Wagnerianern den „Lohengrin“ ähnlich gründlich zu ver -miesen?
Neuenfels: Nein, ich denke nicht, also mei-ne Beziehung zu Katharina Wagner, derneuen Co-Chefin hier, ist eine besondersgute. Sie sagt, dass sie sich bei ihren eige-nen Inszenierungen von mir animiertfühlt. Verabredet habe ich diesen „Lohen-grin“ ja noch mit ihren verstorbenen El-tern Wolfgang und Gudrun.SPIEGEL: Haben Sie gefragt, warum Sie sospät nach Bayreuth gebeten wurden?Neuenfels: Das habe ich mich erst viel spä-ter getraut, nachdem wir schon etwas ge-trunken hatten. SPIEGEL: Und?Neuenfels: Nie sollst du mich befragen!Das blieb im Nebel. Die beiden neuen In-tendantinnen kümmern sich sehr. Die fra-gen, ob ich etwas brauche, oder sie sindbesorgt, dass ich zu viel rauche. Und dann
habe ich hier ein durch und durch wun-derbares Ensemble. Ich nenne nur JonasKaufmann als Lohengrin, Evelyn Herlit-zius als Ortrud und Annette Dasch alsElsa. Der phänomenale Dirigent AndrisNelsons ist erst 31 und schon bei den Pro-ben eine große Freude. Aber nichts wäremöglich ohne meinen langjährigen Kos-tüm- und Bühnenbildner Reinhard vonder Thannen.SPIEGEL: Fühlen Sie sich eigentlich als Va-ter des deutschen Regietheaters?Neuenfels: Nein. Ich war nur eines vonden Fingerchen der Hände, die daranrumgedreht haben. Es waren nicht so vie-le. Das hat damit zu tun, dass dieser Berufdie Tendenz hat, einen entweder fertig-zumachen oder aufzuweichen. SPIEGEL: Aber Sie machen weiter?Neuenfels: Ja, solange ich das Gefühl habe,dass beim Regieführen von den Stückennoch Schichten abzukratzen sind, dass
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 105
Komponist Wagner, Förderer Ludwig II.: „Sein Können kotzte ihn an“
AK
G
SPIEGEL: Können Sie das belegen?Neuenfels: Ja, zum Beispiel mit der Raffi-nesse des musikalischen Aufbaus. Wie erdie Chöre behandelt, wann er schichtet,wann er zudeckt. Wie er stereotyp etwaswiederholt bis zum Wahnsinnigwerden,und zwar mechanisiert wiederholt. Dasist kein Zufall, so viel Gedöns und so vielAufwand. Das ist eine Gestik, die sich be-wusst entleert. Dieses Hochgipfeln genau-so wie die darauffolgende Entleerung, dasist unglaublich gekonnt. SPIEGEL: Wagner will überwältigen.Neuenfels: Er will mit Musik verführen.Wie er privat die Frauen verführt hat. Erwill verführen, und er will gewinnen. SPIEGEL: Und warum dann dieses musika-lische Leerlaufen, das Pathos? Neuenfels: Dieses Wechselspiel aus Hoch-türmen und Entleerung finde ich das Gro-ße an ihm. Ich sehe darin Spuren vonEkel und Desillusionierung. Für mich istdas ein Indiz dafür, dass er nie ein Macht-haber war, ein unreflektierter Durchset-zer. Er ist einer, der beschwört. Er kannteseine ungeheuren Mittel, aber irgendwiekotzte ihn sein Können auch an.SPIEGEL: Im „Lohengrin“ erzählt er unteranderem die Geschichte von Elsa von Bra-bant, die, vor Gericht in höchster Not,von einer Traumvision berichtet: Ein ret-tender Ritter werde erscheinen und allesrichten. Und wirklich. Wie im Wundererscheint er tatsächlich in seinem von einem Schwan gezogenen Nachen in sil-berner Rüstung und rettet Elsa aus ihrerBedrängnis.Neuenfels: Das ist doch unglaublich, oder?Und er fordert, dass sie ihn nie, unter kei-nen Umständen nach seinem Namen fra-gen dürfe. Sonst, ja sonst zerplatze dieganze Herrlichkeit. Eine irre Forderung.SPIEGEL: Wir werden bei Ihnen kaum einenaturalistisch aufbereitete Ritterromanzeerwarten können. Was erzählen Sie, dieunmögliche Liebesgeschichte von Elsaund Lohengrin, dessen Name natürlichdoch herauskommt?Neuenfels: Eine Liebesgeschichte ohnehin.Aber vor allem Programme über absoluteForderungen. Einmal Lohengrins Auffor-derung „Nie sollst du mich befragen“,dann aber auch die Geschichte der Elsa,die ihre Lage nicht erträgt, so dass sie fürdie Forderung von Lohengrin am Anfanganfällig ist, bis es dann ab irgendeinemPunkt nicht mehr geht, sie ihn doch fragtund untergeht.SPIEGEL: Viel verlangt, jemanden zu lie-ben, den man nicht kennt und dessenIdentität man nicht erforschen soll.Neuenfels: Es ist spannend in unserer heu-tigen Gesellschaft, eine radikale These zuhören inmitten all der Indifferenz undscheinbarer Liberalität. SPIEGEL: Die Kommunikation im Internetunter Pseudonymen in sozialen Netzwer-ken oder in Chatrooms ermöglicht letzt-lich das gleiche Versteckspiel. Die wahre
sich dadurch meine Existenzerweitert.SPIEGEL: Wäre denn ChristophSchlingensief mit seinem um-strittenen „Parsifal“ hier inBayreuth 2004 ohne Ihren Bei-trag zum Regietheater möglichgewesen?Neuenfels: Wenn ich ehrlich seindarf, nein. Das ist eine gewisseGenugtuung, aber nicht im mo-ralischen Sinn, sondern das isteine Freude. Ich bin oft belä-chelt und auch zum Teil ver-höhnt worden, besonders nachmeiner Frankfurter „Aida“ 1981.SPIEGEL: Das war die berühmteInszenierung, in der Sie denChor beim Triumphmarsch mitBrathähnchen werfen ließen.Neuenfels: Ja, die berühmteBrathähnchen-„Aida“. Für diebin ich vehement angegriffen worden. Damuss man aufpassen, dass man nicht ver-bittert. Verbitterung ist die erste Stufezum Zynismus, und als Zyniker kommtman nicht mehr an die großen Werke heran, du kannst sie nicht mehr inter pre -tieren.SPIEGEL: Weil sie aufrichtig sind?Neuenfels: Weil sie radikal aufrichtig sind.Und dann ist die Verbitterung oder derZynismus wie ein klebriger Lack, der sich darüberlegt. Als Regisseur wirst duschlecht. Und beim dritten oder viertenMal fängst du an, das auch für dich zu le-gitimieren, und sagst dir, die Gesellschaftist halt so. Und dann bist du nicht mehrkritisch und sitzt der Gesellschaft auf demSchoß, statt sie zu beobachten und ihrins Kreuz zu treten.SPIEGEL: Erkennt man Scharlatanerie inder Regie?Neuenfels: Ich ja.SPIEGEL: Woran?Neuenfels: Ich glaube, ich erkenne genau –von den Materialien bis zu den Konstel-lationen der Figuren –, wo der Pfusch an-fängt. Ich sage immer, es macht keine mo-derne Inszenierung aus, wenn statt einerKutsche ein Porsche da steht. Man mussden Porsche schon begründen.SPIEGEL: Sie sprechen von Pfuschen. Bei der Debatte ums Regietheater ginges um Blut, Sperma und Exkremente auf der Bühne. Fühlten Sie sich da ge-meint?Neuenfels: Nein, aber berechtigt ist na -türlich, dass ein Publikum, das sich fürdramatische Kunst interessiert, aufbe-gehrt, wenn es konfrontiert wird mit einer subjektiven Behandlung von Dich-tung. Bei mir hört der Spaß auf, wennich bei einer Regie keine Interpretationsehe. Aber Regie ist nicht Autorenschaft.SPIEGEL: Die Brathähnchen stehen auchnicht im Libretto von „Aida“.
* Joachim Kronsbein in Bayreuth.
Neuenfels: Ja, das Brathähnchen stehtnicht drin, aber das Geflügel ermöglichtees dem Dirigenten Michael Gielen, dieÜberschwänglichkeit dieses Triumphmar-sches von Verdi so zu dirigieren, wie Ver-di es sich vorgestellt hat. Gielen meintedamals, er könne doch die Sieger nichtkommentarlos losjubeln lassen. Okay, sag-te ich, da muss halt die Regie ran. SPIEGEL: Ist Ihnen unreflektierter Jubel unangenehmer als verstörtes Buh?Neuenfels: Wenn Sie so wollen, ja. Ich ha -be immer Angst, dass meine Arbeit leer-läuft, dass sie verpufft. Und diese Angsthabe ich auch bei „Lohengrin“.SPIEGEL: Mit welchen Figuren sympathi-sieren Sie?Neuenfels: Logischerweise ist es erst malwie bei Wagner selbst mit Lohengrin.Während der Proben haben sich aller-dings Elsa und Ortrud in den Vordergrundgeschoben.SPIEGEL: Weil man Elsa, die sanfte Liebende,und Ortrud, die machtbesessene Intrigantin,als Facetten eines Charakters sehen kann?Neuenfels: Ja, die beiden kann man auchals eine Frau sehen.
SPIEGEL: Frauen sind komplexerals Männer?Neuenfels: Unbedingt. Männersind punktueller und helfensich durch Systeme, währendFrauen das nur durch die je-weilige Person schaffen. Män-ner sind simpler. Das hat zurFolge, dass man glaubt, Män-ner seien sachlich, was aber na-türlich nicht stimmt, das ist nurdie Eigenversicherung durchden anderen. Frauen sindreichhaltiger, weil sie den an-deren stärker zulassen.SPIEGEL: Sind Sie ein Frauenver-steher?Neuenfels: Ich habe mich immerfür Frauen interessiert, sagen wirmal so. Ich mag die lyrischenFrauen nicht so, die verhuschten.SPIEGEL: Aber die Amazonen?
Neuenfels: Ja, die Amazonen.SPIEGEL: Weil Sie gerne Angst haben vorstarken Frauen?Neuenfels: Vielleicht. Sicher aber, weil ichdie Aufregung durch das Unbekannte soelementar finde. Nicht nur in der Oper.SPIEGEL: Da strömen tausend und mehrBesucher am Abend ins Opernhaus, hul-digen mit Hingabe einer feudalen Kunst-form, die über 400 Jahre alt ist und in einer Gesellschaftsform hervorgebrachtwurde, die längst untergegangen ist. War -um funktioniert das noch?Neuenfels: Die Antwort ist kompliziertund einfach. Nehmen wir mal die ein-fachste Variante: weil die Oper bestimmteMenschen tief berührt.SPIEGEL: Und die lassen sich von Regisseu-ren wie Ihnen auch noch vorhalten, wieverlogen die bürgerliche Gesellschaft ist. Neuenfels: Das ist wahrscheinlich eine Artvon Sucht nach Vergewisserung.SPIEGEL: Oder die Regie ist ihnen herzlichegal, und sie kommen wegen der Musikund der schönen Stimmen. Neuenfels: Entschuldigen Sie mal: Natür-lich gehen sie hin, weil die schönen Stim-men und Melodien sie über die Regie hin-wegheben und sie trösten.SPIEGEL: Bringt Musik Erkenntnisgewinn?Neuenfels: Für mich in hohem Maße: Alsich als junger Mensch zum ersten MalVerdis „Troubadour“ gehört habe, warmir klar, dass auch mein Leben abenteuer -lich und ganz anders gedacht sein kann,als ich es bis dahin geführt hatte. Ich habemein Leben nach diesem „Troubadour“zwar nicht grundsätzlich ändern können,aber es ist mir, sagen wir, eine Womög-lichkeit von etwas erschienen.SPIEGEL: Kann die Regie das auch?Neuenfels: Ja. Und das ist für mich die ein-zige Legitimation von Theater. Wenn ichnichts nach Hause mitnehmen kann, binich sauer.SPIEGEL: Herr Neuenfels, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0106
Neuenfels-„Aida“ in Frankfurt 1981: „Okay, da muss die Regie ran“
MA
RA
EG
GE
RT
Neuenfels (r.), SPIEGEL-Redakteur*
„Man muss den Porsche begründen“
CH
RIS
TO
PH
BU
SS
E
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 107
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -
kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestsellerBestsellerBelletristik
1 (1) Stephenie MeyerBis(s) zum ersten SonnenstrahlCarlsen; 15,90 Euro
2 (2) Tommy JaudHummeldummScherz; 13,95 Euro
3 (7) Leonie SwannGarou –Ein Schaf-ThrillerGoldmann; 19,95 Euro
4 (4) Cecelia AhernIch schreib dir morgen wiederW. Krüger; 16,95 Euro
5 (3) Sebastian FitzekDer AugensammlerDroemer; 16,95 Euro
6 (14) Christa Wolf Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. FreudSuhrkamp; 24,80 Euro
7 (5) Henning MankellDer Feind im SchattenZsolnay; 26 Euro
8 (6) Donna LeonSchöner ScheinDiogenes; 21,90 Euro
9 (9) Jussi Adler-OlsenErbarmendtv; 14,90 Euro
10 (8) John IrvingLetzte Nacht in Twisted RiverDiogenes; 26,90 Euro
11(11) Stephenie MeyerBis(s) zum Ende der NachtCarlsen; 24,90 Euro
12(10) Suzanne CollinsDie Tribute von Panem –Gefährliche Liebe Oetinger; 17,95 Euro
13(13) Nicholas SparksMit dir an meiner SeiteHeyne; 19,95 Euro
14(12) Sarah LarkDas Gold der MaoriLübbe; 14,99 Euro
15 (–) Richard PriceCashS. Fischer; 19,95 Euro
16(18) Martin SuterDer KochDiogenes; 21,90 Euro
17(19) Suzanne CollinsDie Tribute von Panem –Tödliche Spiele Oetinger; 17,90 Euro
18(15) Trudi CanavanSoneaPenhaligon; 19,95 Euro
19(16) Anna GavaldaEin geschenkter TagHanser; 12,90 Euro
20 (–) Anne FortierJuliaW. Krüger; 19,95 Euro
Sachbücher1 (1) Margot Käßmann
In der Mitte des LebensHerder; 16,95 Euro
2 (2) Ulrich Detrois Höllenritt – Eindeutscher Hells Angel packt ausEcon; 18 Euro
3 (3) Michael MittermeierAchtung Baby!Kiepenheuer & Witsch; 14,95 Euro
4 (4) Eckart von HirschhausenGlück kommt selten allein …Rowohlt; 18,90 Euro
5 (7) Richard David PrechtWer bin ich – und wenn ja, wie viele? Goldmann; 14,95 Euro
6 (5) Roman Maria KoidlScheißkerleHoffmann und Campe; 17 Euro
7 (6) Manfred LützIrre! Wir behandeln die FalschenGütersloher Verlagshaus; 17,95 Euro
8 (10) Joachim GauckWinter im Sommer – Frühlingim Herbst Siedler; 22,95 Euro
9 (8) Helmut Schmidt / Fritz SternUnser JahrhundertC. H. Beck; 21,95 Euro
10 (9) Werner BartensKörperglück Droemer; 19,95 Euro
11(11) Kester SchlenzAlter Sack, was nun?Goldmann; 16,95 Euro
12(13) Julia Heilmann / Thomas Lindemann Kinderkacke –Das ehrliche Elternbuch Hoffmann und Campe; 15 Euro
13(12) Michael GrandtDer Staatsbankrott kommt!Kopp; 19,95 Euro
14(17) Rhonda ByrneThe Secret – Das Geheimnis Arkana; 16,95 Euro
15(14) Miriam MeckelBrief an mein LebenRowohlt; 18,95 Euro
16(16) Jay Dobyns / Nils Johnson-SheltonFalscher EngelRiva; 19,90 Euro
17(18) Jens Lehmann mit Christof SiemesDer Wahnsinn liegt auf dem PlatzKiepenheuer & Witsch; 16,95 Euro
18 (–) Anna von BayernKarl-Theodor zu GuttenbergFackelträger; 19,95 Euro
19 (–) Josef WilflingAbgründeHeyne; 19,95 Euro
20 (–) Hans KüngWas ich glaube Piper; 18,95 Euro
Neues wollsträubendesAbenteuer der
Schafe aus Glennkill:Ein Werwolf
treibt sein Unwesen
Schmeichelhaft statt kritisch: Schwärmerei fürden Verteidigungsminis-
ter ohne Nennenswerteszur Regierungspolitik
Kultur
Schirach, 46, ist Strafverteidiger undSchriftsteller in Berlin. Für den SPIEGELschreibt er monatlich die Kolumne „Ein-spruch“.
Der Mann in der Besprechungszelleist riesig, er scheint den ganzenRaum auszufüllen. Sein Kopf ist
kahlrasiert. Der Schweiß läuft in dünnenBahnen über seinen Nacken in das grobeHemd. Es ist eng in der Zelle. Wenn mansich an die Wucht seines Auftretens ge-wöhnt hat, fällt als Erstes auf, dass er nureinen sehr kleinen Kopf hat, nichts passtzusammen. Er hat keine Augenbrauenmehr, die Haare hat er sich mit einer Pin-zette einzeln ausgezogen. Für viele Ge-fangene ist ihr Körper das Letzte, was ih-nen gehört. Sie tätowieren ihn, trainierenihn zu grotesken Muskelbergen oder rei-ßen sich eben Haare aus. Ich kenne seineAkte, ein typischer Fall für die Siche-rungsverwahrung, der erste Diebstahl alser 14 war, Totschlag kurz nachdem er 24wurde. Dazwischen nur wenige Tage inFreiheit, „draußen“, wie es hier heißt. Im-mer wieder wurde er eingesperrt, in sei-nem Vorstrafenregister ist beinahe jedeVorschrift des Strafgesetzbuchs genannt,die meisten mehrfach. Ein „Drehtürge-fangener“, rein, raus und wieder rein.
Am Ende reichte es seinen Richtern,sie verhängten Sicherungsverwahrung ge-gen ihn. Einige Jahre später verlängerteein Gericht die Verwahrung auf unbe-stimmte Zeit. Er gilt nicht als krank, aberimmer noch als gefährlich, als unbelehr-bar. Der Mann ist länger in diesem Ge-fängnis, als ich Anwalt bin, er ist hier er-wachsen geworden. Er hat seine Strafeseit 13 Jahren verbüßt. Niemand kann etwas mit ihm anfangen, und niemandversucht es mehr. Vor ein paar Jahren hater einen Wärter angegriffen.
Im Dezember 2009 erging zur Siche-rungsverwahrung eine Entscheidung desEuropäischen Gerichtshofs für Menschen-rechte in Straßburg. Das Urteil hatten allelange erwartet. Die Entscheidung fiel ein-stimmig. Die sieben Richter erklärten,Deutschland habe gegen eine Bestim-mung verstoßen, die Grundlage jedes
* Einwohner demonstrieren im Januar im nordrhein-westfälischen Randerath gegen den Zuzug eines ver -urteilten, aus der Haft entlassenen Pädophilen in ihreGemeinde.
Rechtsstaats ist: „Keine Strafe ohne Ge-setz“. Dem Kläger sei zu Unrecht die Frei-heit entzogen worden. Die Bundesregie-rung legte Widerspruch ein und verlor.Seit dem 11. Mai 2010 ist es rechtskräftig:Deutschland handelte menschenrechts-widrig.
Geklagt hatte ein Mann, der wegen ei-ner ganzen Reihe von Gewalttaten ver-urteilt worden war, zuletzt 1986 wegenversuchten Mordes zu fünf Jahren mit an-schließender Sicherungsverwahrung. DieSicherungsverwahrung war auf zehn Jah-re beschränkt, so war das Gesetz. DerKläger hatte seine Strafe 1991 verbüßt,zehn Jahre später, 2001, hätte er spätes-tens entlassen werden müssen. Tatsäch-lich aber blieb er weiter eingesperrt, denn1998 wurde das Gesetz geändert: Diezehn Jahre Höchstfrist galten nicht mehr,die Sicherungsverwahrung konnte imNachhinein jetzt auf unbestimmte Zeitverlängert werden.
Heute sind rund 200 Menschen inDeutschland so verwahrt, allein in Berlinsind es 10. Manche davon werden direktins Altersheim kommen, andere werdenvon der Polizei nach ihrer Entlassungüberwacht werden. Es gibt Gerichte, diesich noch gegen die Umsetzung des Be-schlusses des Europäischen Gerichtshofswehren, das Oberlandesgericht Celle bei-spielsweise will die Verwahrten noch
nicht entlassen – juristisch ist das alleskaum noch nachvollziehbar.
Eigentlich zweifelt niemand daran,dass ein Strafgesetz erst wirken darf,nachdem es erlassen wurde. Die Juristennennen dies „Rückwirkungsverbot“: DerBürger muss wissen können, was verbo-ten ist, er muss die Strafen kennen kön-nen. Der Grundsatz hat Verfassungsrang,und er hat das aus gutem, historischemGrund: Der Präsident des nationalsozia-listischen Volksgerichtshofs Roland Freis-ler galt als brillanter Jurist, er war derHenker auf dem höchsten Richterstuhl.
Freisler interessierten solch kleinlicheRechtsgrundsätze nicht, im Durchschnittfällte er jeden Tag drei Todesurteile. Erwollte, als er noch Staatssekretär war, diezwei Brüder Götze, die damals Autofal-len auf den neuen Autobahnen aufstell-ten und Kraftfahrer überfielen, zum Todeverurteilt sehen. Einer der Brüder hattezwei Menschen getötet, der andere hattenur die Fallen mitgebaut, an den Mordenwar er nicht beteiligt. Als die Brüder ver-haftet wurden, sorgte Freisler für ein Ge-setz, das rückwirkend das Aufstellen vonAutofallen unter Todesstrafe stellte. Da-nach konnten beide Brüder verurteilt wer-den, sie wurden hingerichtet. Es war inder Bundesrepublik völlig undenkbar,dass der Gesetzgeber bewusst gegen die-sen Grundsatz verstoßen würde.
Kultur
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0108
E INSPRUCH
Vergessene GummistiefelFerdinand von Schirach über das Straßburger Urteil zur Sicherungsverwahrung
Protestaktion gegen einen Sexualstraftäter*: Für immer wegschließen?
CLE
ME
NS
BIL
AN
/ D
DP
/ D
DP
IM
AG
ES
Aber die Sicherungsverwahrung trafden Zeitgeist. Eine Untersuchung der Uni-versität Bochum aus dem Jahr 2008 zeigt,dass die Gerichte sie mittlerweile fastmaßlos anordnen: Seit 1990 stieg die Zahlder Inhaftierten um 140 Prozent. Der frü-here Bundeskanzler Gerhard Schrödermeinte 2001 zur „Bild am Sonntag“, dassMänner, die sich an kleinen Mädchen ver-gingen, nicht therapierbar seien. Er sagte:„Deswegen kann es da nur eine Lösunggeben: wegschließen – und zwar für im-mer.“ In einem solchen Klima beginnendie Dinge, schiefzugehen. Gesetze wer-den in immer schnellerem Rhythmus er-lassen, die Menschen sind zornig undängstlich, sie wollen beruhigt werden,und Politiker wissen, dass Härte gegenKinderschänder immer gut ankommt.Verbrecher haben keine Lobby.
Sogar das Bundesverfassungsgerichtentschied, der rückwirkende Wegfall derHöchstfrist sei rechtens. Die Sicherungs-verwahrung sei ja keine Strafe, sonderneine Maßregel, das Gesetz könne dahergar nicht gegen das Rückwirkungsverbotverstoßen, das gelte nämlich nur für Stra-fen. Das war zwar juristisch elegant, tat-sächlich aber ist es zynisch. Es kommtnicht auf die Begriffe an, mit denen wiretwas bezeichnen.
Für die Inhaftierten im Gefängnis gibtes keinen Unterschied zwischen Siche-rungsverwahrung und Freiheitsstrafe. Sieleben zwar in anderen Gebäuden, aberimmer noch in der gleichen Haftanstalt,sie bleiben eingesperrt.
Die Gefängnisse hier sind besser als invielen Ländern Europas, trotzdem mussteder Gerichtshof in Straßburg feststellen,dass es zu den normalen Gefangenen„keine substantiellen Unterschiede“ gibt.Sicherungsverwahrung ist in DeutschlandStrafe und nichts anderes.
Das Gesetz selbst ist Stückwerk, dau-ernd wurde es verändert, ein verwirren-
des Sammelsurium. Offiziell sind Richterfür die Gefangenen verantwortlich, tat-sächlich aber sind es längst die Gutachter.Natürlich sind sie ängstlich, niemand willeinen Fehler machen, zu viel steht aufdem Spiel, wenn ein Kindermörder frei-gelassen wird. Und was heißt es denn,wenn die Rückfallwahrscheinlichkeit ei-nes Täters 20 Prozent beträgt? Vergewal-tigt er dann nur jedes fünfte Kind? In derStudie der Universität Bochum wurden89 Fälle ausgewertet. Die Staatsanwalt-schaften hatten die Täter als „besonders
gefährlich“ eingeschätzt, sie hatten Siche-rungsverwahrung beantragt, die psych -iatrischen Gutachter hatten sie in jedemeinzelnen Fall befürwortet. Die Anträgewurden zwar abgelehnt, aber das Ergeb-nis der Untersuchung war erschreckend.Von den 89 Fällen haben später lediglich3 Täter erneut ähnlich schwere Straftatenbegangen. 86 Menschen wären nach demWillen der objektivsten Behörde derWelt – der Staatsanwaltschaft – einge-sperrt geblieben, viele für immer, obwohlsie für niemanden gefährlich waren. Derkluge, alte Grundsatz, lieber zehn Schul-dige laufen zu lassen, als einen Unschul-digen zu verurteilen, scheint nicht mehrzu gelten.
Tatsächlich geht es nicht nur um dieSicherungsverwahrten. Es geht um mehr,es geht um das Menschenbild unseresGrundgesetzes, und am Ende geht es umuns selbst. Würde ist nichts, was verliehenwird, sie kann nicht entzogen werden.
Die Prinzipien im Strafrecht sind ein-fach: Ein Gericht verurteilt einen Täterzu einer Strafe. Nachdem er sie verbüßt
hat, ist der Rechtsfrieden wieder herge-stellt: Seine Schuld ist getilgt, die Strafesöhnt ihn mit der Gesellschaft aus. Da-nach ist er frei, er hat die gleichen Rechtewie jeder andere. Natürlich muss die Ge-sellschaft vor den gefährlichsten Verbre-chern geschützt werden, vor Männern,die gern Frauen umbringen oder Kindervergewaltigen. Aber in Sicherungsver-wahrung sitzen auch Diebe, Betrüger undBankräuber.
Einen vollkommenen Schutz in einerfreien Gesellschaft wird es nie geben, undauch wenn es fürchterlich klingt: UnsereFreiheit bedeutet, dass wir mit vielen Ri-siken leben müssen. Die Bundesregierungwill jetzt endlich Sicherungsverwahrungnur noch in schweren Ausnahmefällen zu-lassen. Ein richtiger Schritt. Aber notwen-dig ist auch eine viel bessere Ausstattungder Anstalten. Die Fußfessel allein ist sicher keine Lösung.
Der Mann, der mir in der Zelle gegen-übersitzt, wird bald entlassen. Er wirdüberwacht werden. Vermutlich wird diePolizei die Menschen in seinem Dorf vorihm warnen. Es wird Demonstrationenvor seiner Tür geben, das Fernsehen wirdihn filmen, wenn er in den Supermarktgeht. Er ist nicht darauf vorbereitet, nie-mand hat ihm gesagt, was er draußen tunsoll. Ich frage ihn, ob er schon einmalglücklich war. Ja, sagt er, als Kind bei sei-ner Mutter. In der Akte steht, dass er ineinem Waisenhaus aufwuchs, er kannteseine Mutter gar nicht.
Der riesige Mann erinnert mich anMoosbrugger, den Mörder aus Robert Mu-sils „Mann ohne Eigenschaften“. Moos-brugger hatte eine Prostituierte getötet.Er hatte geglaubt, sie sei sein eigenerSchatten. In seiner Zelle dachte Moos-brugger, sein Schädel sei oben offen, derMond würde manchmal hineinleuchten.Er wurde hingerichtet.
Heute töten wir die Moosbruggersnicht mehr. Wir „verwahren“ sie für im-mer, kaum besser als ein paar alte Gum-mistiefel, die man in den Schrank stelltund vergisst. Der Bundesgerichtshof hieltdas vor kurzem sogar bei Jugendlichenfür zulässig, ein Gesetz erlaubt es seit2008. Hans-Ludwig Kröber, einer der be-kanntesten Gerichtspsychiater, sagt: „Un-befristete Freiheitsentziehung ist immereine Sackgasse.“ Und Werner Platz, einebenso erfahrener forensischer Psychiater,sagt: „Zwangsstrukturen für Sicherungs-verwahrte, wie sie gegenwärtig existieren,werden diesen Menschen mit überwie-gend vorhandenen Persönlichkeitsstörun-gen nicht gerecht.“
Die Ärzte haben recht. Ulrich, der Prot -agonist in Musils Buch, denkt, wenn dieMenschheit als Ganzes träumen könnte,würde dabei Moosbrugger entstehen.
Wir müssen bessere Möglichkeiten fin-den. Das schulden wir den Mördern. Undwir schulden es uns selbst. �
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 109
Der Bürger muss wissen,was verboten ist. Er mussdie Strafe kennen können.
Justizvollzugsanstalt mit Sicherungsverwahrung in Bruchsal: Verbrecher haben keine Lobby
WIN
FR
IED
RO
TH
ER
ME
L
Das todsichere Rezept fürs Schrei-ben eines Bestsellers wird demFranzosen Michel Houellebecq
zugeschrieben. „Sei so gemein wie mög-lich“, hat Houellebecq angeblich seinemSchriftstellerkollegen Frédéric Beigbedereinst geraten und ihm prompt Erfolg be-schert. Genau dieser Regel folgt auch der38-jährige Berliner Autor Sebastian Fit-zek. In seinem neuen Buch wird Frauenund Kindern brachial Böses angetan.
„Der Augensammler“ heißt das Werk,das von der Jagd auf einen unbekanntenSerientäter (oder eineTäterin) handelt*. DerVerbrecher fällt mittenin Berlin über Mütterund Kinder her. DieMütter bringt er sofortum, die Kinder ver-schleppt er. Und er gibtderen Vätern exakt 45Stunden Zeit, um dieEntführungsopfer zu fin-den. Danach tötet erauch die Kleinen. Denbislang drei entdecktenKinderleichen fehlt je-weils das linke Auge.
Da morde ein Psycho-path, der auf grausams-te Weise „Familien zer-stört“, befindet der Bou-levardblattreporter undEx-Polizist AlexanderZorbach, der Held desBuchs.
Fitzeks Werk ist einsogenannter Psycho-thriller. Er ist vor einpaar Wochen erschienen und bereits weitvorn in den deutschen Bestsellerlisten. Erbeginnt mit dem Satz: „Es gibt Geschich-ten, die sind wie tödliche Spiralen undgraben sich mit rostigen Widerhaken tie-fer und tiefer in das Bewusstsein dessen,der sie sich anhören muss.“
Der Schriftsteller Fitzek ist den meistenLiteraturkritikern kein Begriff. Von sei-nen Büchern sind dennoch schon mehrals zwei Millionen Exemplare verkauftworden. Insgesamt sechs Romane hat erveröffentlicht, allesamt im Thrillergenre.Sie heißen „Die Therapie“ oder „Der Seelenbrecher“, die ersten erschienen als Taschenbuch. Alle wurden in viele Spra-
* Sebastian Fitzek: „Der Augensammler“. Droemer Ver-lag, München; 448 Seiten, 16,95 Euro.
chen übersetzt, nach Auskunft des Autorssollen sie auch verfilmt werden. „Der Au-gensammler“ ist nun der dritte Fitzek-Ro-man, der als teures Hardcover erscheint –und der bislang spektakulärste Knüllervon „Berlins Star-Autor“, wie die „Bild“-Zeitung Fitzek nennt.
Fitzek hat lange für diverse Radiosen-der gearbeitet und versieht bis heute anzwei Tagen der Woche einen Job als stell-vertretender Programmdirektor des Ber-liner Senders 104.6 RTL. Es heißt, dass ermit seinen Manuskripten bei mehreren
Verlagen abgeblitzt sei, bevor er 2006 mit„Die Therapie“ den ersten Hit landete.Psychothriller galten als Genre, in demdeutsche Autoren keine Chance haben.Bis Fitzek kam. Heute schreibt er auf seiner Web-Seite: „Selbst meine Elternverschlingen jede Seite, die ich schreibe.“Und: „Mein Stil, meine Begabung undmeine Persönlichkeit sind das Produktmeiner Erziehung.“
Fitzeks Begabung liegt vor allem in ei-ner schönen Dreistigkeit beim Austüftelnder Wendungen und Clous seiner Ge-schichten. In „Der Augensammler“ ist dieHandlung, wie stets bei Fitzek, nach guterThrillertradition in knappe Kapitel geglie-dert, die zuverlässig mit dem Cliffhangerenden. Naturgemäß sollte der eine Über-raschung bereithalten. Zu denen gehört
es in diesem Fall, dass der journalistischeErmittler Zorbach selbst in Verdacht ge-rät, der psychopathische Frauen- und Kin-dermörder zu sein.
Eine blinde Physiotherapeutin wird diewichtigste Verbündete des Helden, deransonsten seine intimsten Stunden an derBar eines Berliner Swingerclubs mit einerschönen Bonzengattin verplaudert: „Wäh-rend die anderen Gäste kopulierten, un-terhielten wir uns stundenlang.“
Die Rohheit des Plots findet ihre Entsprechung im Sprachstil dieses
Buchs, in dem zum Beispiel ein Blick demIch-Erzähler „das letzteFünkchen grässlicherGewissheit“ verschafft.Kinoweis heiten über Serienmörder werdenals „gequirlte Scheiße“verworfen. Über einen jungen Zeitungsreporterheißt es: „Für ihn warJournalismus kein Be-ruf, sondern eine Be -rufung.“ An einer an -deren Stelle steht: „Wirhinterfragen meist nurunsere Fehler. Nie un se -re Erfolge.“
Hölzerner Stil, Man-gel an sprachlicher Ele-ganz, dazu neigen auchdie Großmeister desThriller-Fachs, ThomasHarris („Das Schweigender Lämmer“) zum Beispiel, Michael Crich-ton oder John Grisham.
Dennoch dominieren heute Thriller undKriminalromane mehr denn je die Listender bestverkauften Bücher. Ist die Lang-weiligkeit der spätkapitalistischen Lebens-verhältnisse schuld? Oder eine Lust ander Aufklärung (von Verbrechen und an-derem), die man als Triumph des ratio-nalen Geistes feiern kann? Offenbart sichda ein Eskapismus oder einfach nur derLeserüberdruss an der Handlungsarmutder sogenannten anspruchsvollen Litera-tur?
Erfolgsbücher, sagt der Autor SebastianFitzek, brauchten einen Helden, der imVerlauf der Story eine Niederlage nachder anderen erlebe, „nur einmal obsiegter: im grandiosen Finale“.
Er weiß also auch keine Antwort.WOLFGANG HÖBEL
Kultur
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0110
Grässliche GewissheitBuchkritik: Der Bestseller-Krimi „Der Augensammler“ des Berliner Autors Sebastian Fitzek
Schriftsteller Fitzek
SA
BE
TH
ST
ICK
FO
RT
H /
IM
AG
O
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0112
Prisma
A U T O M O B I L E
Kultige Sparbüchse
Eine neue Variante des Nostalgie -autos Fiat 500 wird wieder mit
einem Zweizylindermotor ausgestattet,wie er schon vor 50 Jahren verbautworden war. Anders als das 13-PS- Urtriebwerk wird das moderne Aggre-gat dank einer neuartigen Ventilsteue-rung und Turboaufladung 85 PS leis-ten. Fiat gibt einen Norm-Verbrauchs-
wert von vier Litern an. Damit ist dasneue Turiner Zweitopf-Mobil eines der sparsamsten Benzinautos der Welt.Die Ingenieure des italienischen Kon-zerns sind für Pioniertaten im Moto-renbau bekannt, scheitern aber zu -weilen an der finanziellen Kurzatmig-keit ihres Arbeitgebers. So erfandensie etwa die inzwischen weltweit be-währte Diesel-Einspritztechnik „Com-mon Rail“, mussten die Entwicklungjedoch später an Bosch weiterreichen,weil das Budget knapp wurde.
A R C H Ä O L O G I E
Kolumbus’ Konkurrenz
Chinesische Archäologen haben beiNanjing, an der Ostküste Chinas,
das Grab eines kühnen Seefahrers ent-deckt: Hong Bao diente dem als Natio-nalhelden verherrlichten AdmiralZheng He, dem es zwischen 1405 und1433 siebenmal gelang, bis an die Küs-ten des heutigen Kenia und Somaliazu navigieren und dabei „gewaltigeOzeane zu befahren und riesigen Wel-len zu trotzen, die sich wie Berge in den Himmel erhoben“ – so steht es
auf einer Säule im Hafen von Changlein Südchina. Seine Dschunken hattenbis zu neun Masten, waren mehrereStockwerke hoch, über 120 Meter langund 50 Meter breit. Hong Bao gehörteauch zu jenen Entdeckern aus Fernost,die nach einer umstrittenen Theoriedes britischen Hobbyhistorikers GavinMenzies schon rund 70 Jahre vorChristoph Kolumbus nach Amerika ge-segelt sein sollen. Zunächst glaubtendie Experten des städtischen MuseumsNanjing, dass es sich bei der Grab -stelle wegen ihrer Größe um die Gruftvon Zheng He selbst handeln könnte.Doch dann fanden sie eine Steinplatte,die das Grab als dasjenige seines Mitstreiters Hong Bao identifiziert.
Matthias Platzer, 55, Ge-netiker am Leibniz-Insti-tut für Altersforschung inJena, über eine neue US-Studie, die genetische Ur-sachen der Langlebigkeitentdeckt hat
SPIEGEL: Herr Platzer, die Forscher um Pao-la Sebastiani von der Boston Universityhaben das Erbgut von über 100-Jährigenuntersucht. Anhand der Ergebnisse glau-ben sie, Langlebigkeit mit 77-prozentigerTreffsicherheit voraussagen zu können.Klingt das für Sie plausibel?Platzer: Ja, absolut. Wir vermuten ja schonlänger, dass nicht die Umwelt, sonderndie Gene den stärksten Einfluss darauf
haben, ob jemand ein sehr hohes Altererreicht. Aber das muss man erst mal be-weisen können. Das ist eine tolle Leistungder amerikanischen Kollegen. SPIEGEL: Ein überraschendes Ergebnis war,dass die über 100-Jährigen ein kaum ge-ringeres genetisches Risiko für bestimmteVolkskrankheiten wie Diabetes oder Blut-hochdruck hatten.Platzer: Das widerspricht in der Tat einerbisherigen Annahme der Altersforschung.Offenbar gibt es andere biologischeGrundlagen, die für extreme Langlebig-keit die maßgebliche Rolle spielen.SPIEGEL: Könnte es schon bald einen Lang-lebigkeitstest für alle geben?Platzer: Es ist wohl unvermeidlich, dasskommerzielle Anbieter so etwas ent -
G E N E T I K
„Ein Meilenstein der Altersforschung“
100-Jährige in Georgien
Admiral Zheng He
ALA
MY
/ M
AU
RIT
IUS
Fiat 500
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 113
Wissenschaft · Technik
M E D I Z I N
Laufen bis zumHerzinfarkt
Marathonläufer gefährden ihr Herz.Diese Warnung kommt von grie-
chischen Medizinern um Despina Kar-dara vom Hippokration Hospital undder Athens Medical School. Verglichenmit einer Kontrollgruppe, die Sport in Maßen betrieb, hatten männliche
Marathonläufer zwischen 29 und 47Jahren, die regelmäßig um die 15 Stun-den pro Woche trainierten, einen deutlich höheren Blutdruck und eineversteifte Hauptschlagader – was alsAnzeichen für Gefäßerkrankungenund einen drohenden Herzinfarkt gilt.„Das Herz-Kreislauf-System ist wieder Motor eines Rennwagens“, so Kar-dara, „wenn man ihn nicht benutzt,rostet er, aber wenn man ihn zu langezu schnell laufen lässt, kann er eben-falls kaputtgehen.“
wickeln – aber einen solchen Test zu machen wäre in den meisten Fällen nicht viel aussagekräftiger als zu würfeln.Die Trefferquote von 77 Prozent beziehtsich ja nicht auf Einzelne, sondern auf eine Gruppe von tausend Probanden, die zwischen 1890 und 1910 geboren und unter ähnlichen Umweltbedingungen aufgewachsen sind. Es könnte durchaussein, dass die genetischen Varianten, die ein langes Leben begünstigen, vorhundert Jahren ganz andere waren alsheute. SPIEGEL: Worin sehen Sie den praktischenNutzen dieser Studie?Platzer: Von den 150 Varianten im Genom,welche die Forscher entdeckt haben, lie-gen nur 77 in den Genen – die übrigenbefinden sich in DNA-Abschnitten zwi-schen den Genen. Niemand kennt bisherdie genaue Funktion dieser Abschnitte.Deshalb werden wir sie jetzt ergründenmüssen. Die Studie ist ein Meilenstein inder Altersforschung – und wie jede be-deutende Arbeit wirft sie unzählige neueFragen auf.
E R N Ä H R U N G
Ramadan gefährdetUngeborene
A K U S T I K
Verbot für Fiep-Sender gegen Jugendliche
LA
UN
OIS
JO
HN
/ L
AIF
Schwangere Musliminnen, die wäh-rend des Ramadan fasten, haben
ein erhöhtes Risiko, Frühchen mitgeistigen Behinderungen zur Welt zu bringen. Zwar gestattetder Islam Ausnahmen vondem Fastengebot, wenn dieGesundheit der Mutteroder des Kindes gefährdetist. Umfragen deuten aberdar auf hin, dass die Mehr-heit der muslimischenSchwangeren sich daranhält. Um das damit verbun-dene Risiko zu ermitteln,werteten die US-ForscherDouglas Almond von derColumbia University undBhashkar Mazumder vonder Federal Research Bankof Chicago statistische Daten aus den VereinigtenStaaten, dem Irak undUganda aus. Sie stellten da-bei fest, dass der Schadenfür die Kinder dann amgrößten ist, wenn die Fas-
Gegen junge Störenfriede, die auföffentlichen Plätzen herumlun-
gern, feiern oder vandalieren, gibt esein ebenso perfides wie wirkungsvollesMittel: Störsender im Ultraschall -bereich zwischen 17 und 18,5 Kilohertz,die nur Menschen unter 25 Jahren hören können – und zwar als unerträg -liches Fiep-Geräusch. Nun aber hat dieParlamentarische Versammlung des Europarats die Regierungen der EU-
Staaten dazu aufgefordert, die soge-nannten Mosquitos zu verbieten. DieBegründung: Es sei diskriminierend,Jugendliche „wie unerwünschte Vögeloder Insekten“ zu behandeln. Vor allem in Großbritannien werden dieGeräte derzeit zu Tausenden ein -gesetzt – aber auch in Deutschlandwerden sie an einigen Schulen abendsangeschaltet, um Jugendliche vom Pausenhof zu vertreiben.
tenzeit in eine frühe Phase derSchwangerschaft fällt – und wenn sie,wie in diesem Jahr, im Sommer liegt,wo die Zeit bis zum Fastenbrechennach Sonnenuntergang besonders langist. Insgesamt hatten die Kinder derFastenden ein um 20 Prozent erhöhtesRisiko, in späteren Jahren an Lern-schwäche und geistigen Behinderun-gen zu leiden.
Marathonläufer in Berlin
C.
BE
IER
/
CH
RO
MO
RA
NG
E /
ULLS
TE
IN B
ILD
KA
TE
HO
LT /
EY
EV
INE
/ P
ICT
UR
E P
RE
SS
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0114
M E D I Z I N
Herzstillstand bei 28 GradKälte schützt das Hirn. Eine wachsende Zahl von Ärzten entscheidet sich deshalb dafür, Patienten
nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall abzukühlen – mit verblüffendem Erfolg.Besonders die Kinder-Herzchirurgen operieren gern bei Körpertemperaturen von unter 30 Grad.
Wissenschaft
Operation von Leonhardt am Deutschen Herzzentrum Berlin
RO
NA
LD
FR
OM
MA
NN
Aktivierung des programmierten Zelltods
Bildung aggressiver freier Radikale
Ungünstige Beeinflussung des Immun-systems
Aktivierungder falschen Gene
BildungschädlicherNeuro-transmitter
Gehirn-schwellung
Übersäuerungdes Hirngewebes
Entstehung giftiger Stoffwechsel-produkte
Umfassender SchutzDie therapeutische Kühlung bewahrt das Gehirn
vor den Folgeschäden eines Sauerstoffmangels:
ist einmalig“, urteilt KatharinaSchmitt, die am Berliner Herz -zentrum ein eigenes Forschungs-labor zum Thema Kühlung leitet.
Dabei ist die Idee der „thera-peutischen Hypothermie“, wiedie Kühlung zu Behandlungszwe-cken genannt wird, keineswegsneu. Schon zu Napoleons Zeitenwar bekannt, dass verwundeteSoldaten im Schnee eher überleb-ten, als wenn man sie ans Feuerbrachte. Und für die ersten gro-ßen Herzoperationen in den fünf-ziger Jahren packten die ÄrzteHerzkranke einfach von oben bis unten in Eis, bis das Herz stillstand – und operierten dannganz ohne Herz-Lungen-Maschi-ne. Nach dem Eingriff wärmtensie ihre Patienten wieder auf, bisihr Herz aufs Neue zu schlagenbegann.
In sibirischen Kliniken operie-ren Ärzte sogar bis heute auf dieseWeise – und berichten von ver-blüffend niedrigen Sterblichkeits-raten. In der westlichen Welt da-
gegen verlor die therapeutische Kühlungnach der Erfindung der Herz-Lungen-Maschine stark an Bedeutung. Erst jetzterlebt sie plötzlich einen breiten Boom.In immer mehr Bereichen der Medizinhält sie Einzug: Bei Kindern, die währendder Geburt unter Sauerstoffmangel litten,aber auch nach Schlaganfällen, Herz -infarkten und Kopfverletzungen wird dieKühlung erprobt. Besonders verbreitet istsie in der Kinder-Herzchirurgie.
Lange ist es nicht her, dass es bei gro-ßen Operationen wie bei dem SäuglingLeonhardt ums nackte Überleben ging.Inzwischen jedoch liegt die Sterblichkeit
selbst bei komplizierten Eingriffen nurnoch bei ungefähr einem Prozent.
„Jetzt“, sagt Felix Berger, Direk-tor der Klinik für angeborene
Herzfehler und Kinderkardio-logie am Herzzentrum Ber-lin, „geht es darum, dassdie Kinder die OP ohneSchaden überstehen.“
Langzeitstudien be-richten, dass bei denOperierten später nichtselten Konzentrations-schwächen, Wortfin-dungsprobleme, leichtemotorische Auffälligkei-ten oder andere Leis-tungsstörungen auftre-
ten – wahrscheinlich sinddies unter anderem auch
Folgen einer subtilen Min-derversorgung des Gehirns
während der OP. „Die Kinderkönnen ein normales Leben füh-
ren, und durch Training lässt sichviel ausgleichen“, sagt Berger, „aber
115
Weich ist Leonhardts Brust-bein und kaum dicker alsein Streichholz. Aber Mi-
chael Hübler durchtrennt ja nichtzum ersten Mal einen Säuglings-knochen. Ganz behutsam führt erdie zierliche Knochensäge.
Schließlich liegt das Herz frei.Kaum größer als eine Pflaumeschlägt es im offenen Brustkorb.Mit zwei Kanülen schließt Hübleres an die Herz-Lungen-Maschinean. „28 Grad?“, fragt der Kardio-techniker Wolfgang Böttcher, derdie Maschine bedient. Hübler be-stätigt mit einem knappen Ja.
Böttcher tippt die Zieltempera-tur ein. Der Kältetauscher in derleise summenden Herz-Lungen-Maschine springt an. 35,5, 33,4,31,7 – rasant sackt der Tempera-turwert auf dem Anästhesiemoni-tor. 14 Minuten später erreicht erschließlich 28,0 – fast 10 Grad Cel-sius unter der Normtemperatur.
Drei Tage alt und sieben Pfundschwer ist der Patient im OP 5 desDeutschen Herzzentrums Berlin.Nicht einmal die Nabelschnur ist schonabgefallen.
Leonhardt wurde mit einem schwerenHerzfehler geboren. Die Anschlüsse sei-ner großen Körper- und Lungenschlag-adern sind vertauscht. Das Blut des Jun-gen fließt deshalb in zwei getrenntenKreisläufen. Hätten die Ärzte in den ver-gangenen drei Tagen die vorgeburtlicheVerbindung der beiden Kreisläufe nichtkünstlich offen gehalten, wäre der Jungewahrscheinlich schon tot. Jetzt aber istes höchste Zeit für die Operation.
Die Kälte hat Leonhardts Herzschlagbereits auf 45 Schläge pro Minute verlang-samt. Jetzt befiehlt Hübler: „Kardiople-gie vor!“ Eine kaliumhaltige Flüssig-keit läuft in das winzige Herz. Se-kunden später steht es still.
Jetzt arbeitet nur noch die Herz-Lungen-Maschine.Hübler kann sich daran -machen, Körper- undLungenarterie vom Her-zen abzutrennen und in der richtigen Positionwieder anzunähen –eine langwierige, kom-plizierte Prozedur, des-halb die radikale Ab-kühlung.
„Von Lawinenopfernund Menschen, die insEis eingebrochen sind,wissen wir ja schon seitlängerem, dass Kälte dasGehirn vor Sauerstoffmangelschützen kann“, erklärt Hüb-ler. „Genau diese Wirkung er-hoffen wir uns auch von der Küh-lung während der Operation.“
Denn niedrige Temperaturen schützenumfassend wie kein anderes Verfahrenvor Sauerstoffmangel. Wenn die Versor-gung knapp wird, reagiert das Gehirnempfindlich – ganze Kaskaden schäd -licher Reaktionen werden in Gang ge-setzt: Aggressive freie Radikale und toxi -sche Stoffwechselprodukte fluten das Gewebe, das Blut übersäuert, das Gehirnschwillt. Ein Medikament kann allenfallseinzelne dieser Reaktionen verhindern.Kühlung jedoch vermag fast alle Kas -kaden gleichzeitig herabzuregeln. „Das
Gekühltes Kind in Sibirien: OP ohne Herz-Lungen-Maschine
PA
ND
IS
bei der Frage Abitur oder nicht kann dasdas Zünglein an der Waage sein.“
Ein zentrales Ziel der Ärzte ist es des-halb, den Schutz des Gehirns währendder OP zu verbessern. Allein in BergersAbteilung befassen sich zehn Mitarbeitermit diesem Thema. Am Berliner Herz-zentrum ist es inzwischen zum Beispielselbstverständlich, dass während derOperation auch die Sauerstoffsättigungdes Gehirngewebes mit Hilfe optischerSensoren ständig überwacht wird.
Doch einfach immer tiefer zu kühlenist riskant. „Hypothermie kann nicht nurschützen, sondern auch schaden“, warntSchmitt, „das zeigt die klinische Erfah-rung ebenso wie unsere Forschungen anZellen.“
Unterhalb von 30 Grad kann es zu ge-fährlichen Herzrhythmusstörungen kom-men. Blutgefäße werden undicht, es drohtein Kapillarlecksyndrom, bei dem Flüssig-keit aus den Adern austritt, bis der Körpergrotesk angeschwollen ist. Selbst bei ge-ringer Abkühlung, so zeigten Untersuchun-gen von Schmitts Mitarbeiterin Antje Dies-tel, schrumpfen längliche Zellen bereits zuKugeln. Dies kann winzige Wunden in dieBlutgefäße reißen oder eine Entzündunganheizen. „Eine Kühlung ist ein großer Ein-griff in den Körper“, sagt Schmitt.
Wie tief also sollte gekühlt werden?Wie lange? Und wie schnell darf man denPatienten wieder erwärmen? All dies sindFragen, die Schmitt und ihre Arbeitsgrup-pe klären wollen. Zudem haben sie her -ausgefunden, dass die Kombination zwei-er gängiger Medikamente möglicherweisehelfen könnte, ein Kapillarlecksyndromzu verhindern.
Etliches könnten die Herzchirurgenmöglicherweise auch von den Notfall -medizinern lernen. In den Notarztwagen
gehört vielerorts inzwischen ein Spe -zialkühlschrank zur Standardausrüstung,in dem sich Infusionen mit vier Grad Celsius kalter Salzlösung befinden. „Da-mit“, erklärt Alex Lechleuthner, Leiterdes Kölner Rettungsdienstes, „kühlen wirallein in Köln jedes Jahr etwa 400 Men-schen, die wir nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand wiederbelebt haben.“ Knappzwei Liter eiskalte Infusionsflüssigkeitsenken die Körpertemperatur schon aufdem Weg ins Krankenhaus um rund einGrad. Auf der Intensivstation kühlt dannein Spezial katheter, der über die Leisten-vene eingeschoben wird und der wie derKältetauscher eines Kühlschranks funk-tioniert, den bewusstlosen Patienten wei-ter herab: 24 Stunden lang auf 33 Grad.Danach wird er ganz langsam wieder er-wärmt.
Es hat sich gezeigt, dass dies schon aus-reicht, um die Überlebenschancen deut-lich zu verbessern. „Jeder sechste Todes-fall lässt sich so verhindern“, sagt BerndBöttiger, Direktor der Kölner Universi-tätsklinik für Anästhesiologie und Ope-rative Intensivmedizin. Böttiger sorgtedafür, dass die Hypothermie in die euro-päischen Leitlinien zur Herz-Kreislauf-Wiederbelebung aufgenommen wurde.Seit Januar übernehmen auch die deut-schen Krankenkassen die Kosten dafür.
Immer wieder zeigt sich, dass selbsteine geringfügige Abkühlung den Aus-schlag geben kann. Lange bevor sich dasVerfahren etabliert hatte, rettete etwa derBonner Notarzt Markus Födisch einen37-Jährigen, der mit einem Herzinfakt ineinem Supermarkt zusammengebrochenwar, indem er nach der Reanimation Tü-ten mit Tiefkühl-Pommes-frites auf denBewusstlosen häufte. „Nur so“, ist Fö-disch überzeugt, „konnte der Mann sei-
nen Herzstillstand ohne neurologischeSchäden überstehen.“
Auch auf Neugeborenenstationen zähltdie Kühlung oftmals schon zur Routine:Die Körpertemperatur von Säuglingen,die während der Geburt unter Sauerstoff-mangel litten, wird drei Tage lang auf33,5 Grad gesenkt. Die Ärzte gehen da-von aus, dass dies ihre Aussichten deut-lich verbessert.
Selbst zur Verhinderung von Quer-schnittslähmungen bei Rückenmarks -verletzungen wird die Hypothermie er-probt. Einzelne spektakuläre Heilungs-erfolge gibt es bereits. So verletzte sichder Footballspieler Kevin Everett vonden Buffalo Bills das Rückenmark, als erversuchte, einen Gegenspieler zu Fall zubringen. Sein Mannschaftsarzt war geis-tesgegenwärtig genug, Everett noch aufdem Spielfeld eine eisgekühlte Infusionzu legen – und tatsächlich erholte sichder Mann zur Überraschung der Ärzteweitgehend.
Auch Patienten mit Schlaganfall oderHerzinfarkt könnten in Zukunft gekühltwerden. „Man hat schon über tausendSubstanzen erprobt, mit denen man dasGehirn nach einem Schlaganfall vor Sauerstoffmangel schützen wollte – aberalles ohne Erfolg“, sagt der NeurologeRainer Kollmar von der Universität Er-langen. „Das einzige aussichtsreiche Mit-tel ist – die Kühlung.“ Kollmar will dasVerfahren jetzt in einer größeren Studiean Schlaganfallpatienten erproben.
Auch hier gibt es Hinweise, dass schoneine geringe Kühlung, ja allein das kon-sequente Senken des Fiebers, das beiSchlaganfällen häufig auftritt, erstaunli-che Effekte haben kann.
Noch aber fehlt es an Förderung. Zwarist das Kühlen eines Patienten einfachund billig – doch paradoxerweise ist ge-rade dies der Grund für Kollmars Geld-nöte. Denn für die Pharmaindustrie, diesonst in der Regel die klinischen Studienfinanziert, ist ein Verfahren, das kaumetwas kostet, nicht von Interesse. „Es isteine verrückte Situation“, sagt Kollmar.„Wir haben die Waffe in der Hand – aberirgendwie fehlt uns die Munition.“
Auch sein Kölner Kollege Böttigerkennt das Problem. Erst als er begann,potentielle neue Medikamente zu er -proben, mit denen sich Patienten inner-halb von Minuten um etliche Grad he-runterkühlen lassen sollen, boten sichplötzlich Sponsoren an. Noch allerdingswerden diese Substanzen – zum BeispielHormone, die bei Tieren den Winter-schlaf steuern – lediglich im Tierversucherprobt.
Im OP 5 fängt unterdessen LeonhardtsHerz von selbst wieder an zu schlagen.Sein Herzfehler ist vollständig behoben,offiziell gilt er nun als herzgesund.
Draußen im Vorraum wartet sein Wär-mebettchen. VERONIKA HACKENBROCH
Wissenschaft
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0116
Mit Pommes frites gekühlter Herzinfarkt-Patient: Rettung durch Tiefkühltüten
DR
. M
AR
KU
S F
ÖD
ISC
H
Teure MedizinerAusgaben deutscher Universitäten pro
Studienabschluss 2007, in Euro
Humanmedizin/
Gesundheits-
wissenschaften
Ingenieur-
wissenschaften
Naturwissenschaften
Sprach-, Kultur-
wissenschaften
Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwissenschaften
211400
54900
52500
24 400
31200
Quelle:Statistisches
Bundesamt
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 117
Gewöhnlicherweise wird hier gebe-tet und gesungen, aber darauf al-lein wollen sich die Lübecker
nicht mehr verlassen. Ein großes Trans-parent trugen Demonstranten am vergan-genen Donnerstag in die Marienkirche,den mächtigen Backsteinbau mitten inder Innenstadt. Unter Glockengeläut ent-rollten sie es hoch oben vom Turm: „Lü-beck kämpft für seine Uni!“
Dann sangen die Protestler doch noch.Allerdings keine Kirchenverse, sonderneinen Schmähgesang auf die schwarz-gel-be Landesregierung und deren Wissen-schaftsminister Jost de Jager (CDU).Diesmal forderten sie den Rücktritt desMinisters, sonst singen sie zur Melodiedes Schlagers „An der Nordseeküste“gern: „In der Bildungswüste, im nord-deutschen Land, ist de Jager Minister,dem fehlt Sachverstand.“
Mit Geläut und Gesang wollen die Lü-becker verhindern, dass die Landesregie-rung die Medizinerausbildung an ihrerUniversität abwickelt, um zunächst proJahr 24 Millionen Euro einzusparen. Da-mit droht der gesamten Einrichtung dasAus, denn die feine, aber kleine Hoch-schule hat wenig mehr zu bieten als ihreerstklassige Medizin mit 1500 Studenten.
So könnte die Kieler Regierung dafürsorgen, dass die Bundesrepublik eine trau-rige Premiere erlebt: die Schließung einerstaatlichen Universität.
Die Sparpläne sorgen nicht nur in Lü-beck, sondern auch im Rest der Republikfür Entsetzen. Bundesgesundheitsminis-ter Philipp Rösler (FDP) hatte erst kürz-lich versprochen, den Ärztemangel zubekämpfen. Bundesgesundheitsministe-rin Annette Schavan (CDU) lässt im Hin-tergrund bereits prüfen, was der Bundtun kann. Und die anderen Bundesländersind sauer, dass sich Schleswig-Holsteinaus der Verantwortung stehlen will.
Eigentlich ist man sich darüber einig,dass Deutschland eher mehr Studien -plätze in Medizin braucht. Vielerortsmüssen die Hochschulen immer wiederInteressenten abweisen, weil die Plätzenicht reichen. Bei den Verwaltungsgerich-ten häufen sich die Klagen von Stu -denten, die draußen bleiben mussten.Doch Medizinstudienplätze sind sehr teu-
er, die Last lädt sich kein Bundeslandgern auf.
Die bundesweite Aufregung dürfte derLandesregierung freilich weniger Sorgenbereiten als ein einziger Mann, der mitden 10000 Protestlern vergangenen Don-nerstag durch die heiße Lübecker Innen-stadt marschierte: Gerrit Koch, LübeckerFDP-Abgeordneter im Kieler Landtag, indem die schwarz-gelbe Regierung mit nureiner Stimme Mehrheit herrscht.
„Ich werde mich dafür einsetzen, dassdie Medizinfakultät in Lübeck erhaltenbleibt“, sagt Koch. Einem Sparpaket, das
die Schließung vorsehe, werde er nichtzustimmen.
Die Willensbekundung ist brisant,denn in der nächsten Woche soll das Pa-ket vom Kieler Kabinett verabschiedetwerden. Im Dezember steht dann derDoppelhaushalt für die Jahre 2011 und2012 zur Abstimmung im Landesparla-ment.
Um dabei eine Niederlage zu vermei-den, könnten Regierungschef Peter HarryCarstensen (CDU) und sein Wissen-schaftsminister de Jager schon vorher bei-drehen und auf die Schließung der Lübe-cker Uni-Medizin verzichten.
„Ich gehe nicht davon aus, dass sichdiese Frage noch stellen wird“, sagt der
CDU-Landtagsabgeordnete Hartmut Ha-merich. Er stammt aus dem WahlkreisEutin-Süd, gleich neben Lübeck, undauch er stellt sich gegen seine Partei:„Wir werden eine andere Lösung finden.“
So könnte ein Sparkonzept zum Zugkommen, das die Hochschulleitung aufDruck der Landesregierung selbst erar-beiten musste und nun am Dienstag imBeisein von Abweichler Koch vorstellenwill. Danach soll Lübeck in eine Stif-tungsuniversität verwandelt werden. ImWissenschaftsministerium verweist manhingegen auf viele ungeklärte Punkte,
etwa woher denn plötzlich die edlenSpender für eine solche Stiftung kommensollten.
Die Landesmittel seien bisher ohnehinfalsch ausgegeben worden, bemängelthingegen der Medizinische Fakultätentag.Ein allzu großer Teil der Gelder, die fürForschung und Lehre gedacht sind, werdetatsächlich für die Krankenversorgungverwendet – weit mehr als in anderenBundesländern. Das Wissenschaftsbudgetkönnte leicht entlastet werden, indem dieLandesregierung diese Subventionierungder Krankenversorgung zurückfahre.
Mit der Kritik von allen Seiten wächstder Druck auf die Landesregierung, dasAus abzuwenden. Es sei wichtig, dass dieLandesregierung jetzt schnell ein klaresBekenntnis zu Lübeck abgebe, heißt esaus dem Hause Schavan – das klingt fastwie ein Ultimatum. Dabei belegt dasHickhack um Lübeck einmal mehr, wiemachtlos die Bundesregierung ist, wennin der Bildungspolitik Budgetzwängeüber hehre Absichten siegen.
Wenigstens auf kirchlichen Beistanddürfen die bedrohten Mediziner zählen.Der Lübecker Pastor Bernd Schwarzewählte dazu markige Worte. Er habe niegedacht, dass aus seiner Kirche mal „eineFestung gegen politischen Irrsinn“ wer-den würde. Aber „so viel Böses, so vielLüge und so viel Dummheit“ habe ernoch nie gehört. JAN FRIEDMANN,
MARKUS VERBEET
H O C H S C H U L E N
Mit Geläut und Gesang
Schleswig-Holstein will die Medizinerausbildung an der Uni
Lübeck abwickeln. Die Pläne entsetzen die Republik und ent-
zweien die Regierungsfraktionen.
Protest gegen die Landesregierung in Kiel: „In der Bildungswüste“
AN
GE
LIK
A W
AR
MU
TH
/ D
PA
Er fällt und fällt und fällt. Dann, ir-gendwann, zieht er die Reißleine,es kracht, der Fallschirm schießt
hervor, entfaltet sich. Ein Mann im Astro -nautenanzug schwebt auf den staubigenFlugplatz von Perris, gut eine Autostundesüdöstlich von Los Angeles.
Männer in Arbeitskleidung laufen aufihn zu, befreien ihn von Helm und Fall-schirm. „Feels like coming home“, sagter, breitbeinig und mit kantigem Grin-sen – ich bin wieder daheim.
Der Fallschirmsprung des Astronautenist die Generalprobe für ein weit größeresDrama: Felix Baumgartner, ein Auto -mechaniker aus Salzburg, plant den tiefs-
ten Sprung der Weltgeschichte. Vom Ran-de des Weltalls will er gen Erde stürzen.
Felix im Glück. Schon als kleiner Jungesprang er von Bäumen, später von Felsenund von Wolkenkratzern. Nun steht erauf dem Flugplatz, umringt von Film -leuten der BBC. Fast hat er es geschafft.In diesem Jahr will er, 41 Jahre alt, seinLebenswerk krönen: durch einen Sprungaus 36000 Metern. Nur Raketen und Bal-lons drangen bisher in solche Höhen; biszu minus 80 Grad Celsius kalt kann esauf dem Weg dorthin werden.
„Red Bull Stratos“ heißt das Projekt,benannt nach einer österreichischen Brau -se firma, die der Aktion mit ihrem schier
unerschöpflichen Werbeetat finanziell Flü-gel verleiht. Als erster Mensch will Baum-gartner die Schallmauer durchbrechen, ungeschützt vom Metallkokon eines Cock-pits. Niemand weiß, was mit dem mensch-lichen Körper passiert in dieser Höhe, beidieser Kälte, mit dieser Geschwindigkeit.
„Es ist ganz schön ungemütlich dortoben“, sagt Baumgartner bei der Manö-verkritik in einem leeren Flugzeughangar.Gerade ist er aus über 8000 Metern ab-gesprungen – immerhin schon fast sohoch wie der Mount Everest, und dochnur knapp ein Viertel dessen, was er sichvorgenommen hat. Das Problem sei nichtdie Kälte, auch nicht die dünne Luft. Ihm
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0118
A B E N T E U E R
Testpilot ohne FlugzeugDer Österreicher Felix Baumgartner will als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer
durchbrechen. Von einem Ballon lässt er sich dafür bis an den Rand des Weltalls hieven. Unterstützt wird er von amerikanischen Raumfahrtveteranen.
Technik
Extremspringer Baumgartner (r.) nach Testsprung aus 8000 Meter Höhe
macht das Gewicht des Fallschirms undder beiden Sauerstoffflaschen zu schaf-fen, vor allem aber der steife Raumanzug:„Ich fühle mich darin, als wäre ich um 50Jahre gealtert“, klagt Baumgartner.
Trainer, Berater, Testpiloten: Ein Teamaus über einem Dutzend Leuten wuselt umden Extremspringer herum. Sie analysierenseinen Sprung, studieren Videos. Die spek-takulärsten Aufnahmen stammen vonLuke Aikins, am Boden ein behäbiger Bär,in der Luft aber ein Balletttänzer,der bei Testsprüngen stets gemein-sam mit Baumgartner abspringtund neben ihm herfliegt mit seineram Helm befestigten Filmkamera.
Die Bewegungsabläufe des Fall-schirmspringers sind für Aikinsalltägliche Reflexe: Wenn er dieArme nach hinten streckt, geht erin den Sturzflug mit über 200 Ki-lometern pro Stunde, wenn er sieausbreitet wie zum Segen, hebtsich sein Oberkörper und bremstden Sturz. Hält er einen Arm zur
* Beim Sprung vom 509 Meter hohen „Taipei101“ in Taiwan am 12. Dezember 2007.
Seite, kullert er auf den Rücken und liegtwie auf einem Luftkissen. Aikins gehörtzu einer Fallschirmspringer-Dynastie;vom Großvater über die Eltern und Ge-schwister bis zu den Cousins – alle sindsie gesprungen. Er wuchs auf einem Flug-platz auf.
Baumgartner sitzt nebenan in einemumfunktionierten Baucontainer, passivwie ein Boxer in der Ringpause. Vier Mit-arbeiter helfen ihm, binden seine Stiefel,zurren den Fallschirm fest, den er selbstnicht erreicht. Ungelenk wie ein Miche-lin-Männchen stapft Baumgartner in sei-nem mit Druckflaschen aufgepumptenAnzug umher. Auf seinen Handschuhensind Autorückspiegel montiert, damit erdie Geräte an seinem Bauch sehen kann.
Es ist Aikins’ Aufgabe, dem tapsigenRaumfahrer den Tanz in der Leere bei-zubringen. In der Stratosphäre, sagt er,sei die Luft hundertfach dünner als aufMeereshöhe, ein Springer falle hilflos insNichts: ohne Luftwiderstand keine Kon-trolle.
Alles hänge deshalb vom korrektenAbsprung ab, erklärt Aikins seinem Schü-ler: kein Hechter wie beim Klippensprin-gen, eher ein sanftes Vornüberkippen,ein winziger Schritt, keine hastigen Be-wegungen. Um das zu üben, hat Baum-gartner sich an einem Kran hochziehenlassen und ist in ein Bungeeseil gesprun-gen; wie Frachtgut baumelte der Astro-naut damals am Haken.
„Das Gefährlichste ist der Kontrollver-lust“, sagt Aikins: „Wenn du anfängst,dich um die eigene Achse zu drehen ineinem ,Flat Spin‘, verlierst du das Be-wusstsein.“ Natürlich würde eine Notfall-automatik den Fallschirm dennoch öff-nen – aber ein kreiselnder Springer kannsich in den Leinen verheddern. In denSchirm eingewickelt wie eine Seiden -raupe, würde er dann zu Boden stürzen.
Wie es sich anfühlt, hilflos trudelnd vomRand des Alls zur Erde zu fallen? Bislangweiß das nur ein einziger Mensch: JosephKittinger. Baumgartner nennt ihn Joe. Ge-rade ist er mit seinem Audi TT auf denSchotterplatz gerast wie ein testosteron-gesteuerter Teenager. Kittinger ist 81.
„Ich war der erste Mensch im All“, prahlter. Im Jahr 1959, wenige Wochen nachdemdie Sowjetunion den „Sputnik“ ins All ge-schossen hatte, wagte Kittinger den gewal-tigen Satz: Er stürzte sich aus über 20000Metern in die Tiefe, geschützt allein durcheinen Raumanzug und ein Gebet.
Ein hochhaushoher Ballon trug ihn em-por. Der Sturz war ein Alptraum: Hilflosruderte Kittinger in der dünnen Atmo-sphäre. Irgendwann geriet er in den ge-fürchteten Flat Spin, rotierte mit 120 Um-drehungen pro Minute.
Als er wieder zu sich kam, baumelteer unterm Fallschirm, der sich automa-tisch geöffnet hatte.
Kittinger, damals Testpilot bei der U.S.Air Force, verbuchte seinen Absturz alsErfolg und plante sogleich den nächstenSprung. Im August 1960 erreicht er 31000Meter – unter bestialischen Schmerzen:Ein Handschuh war undicht, seine rechteHand schwoll wegen des geringen Drucksauf wie Hefeteig.
Kittinger verschwieg das Problem beiseinem letzten Funkspruch aus der Gon-del. „Über mir ist ein feindseliger Him-mel“, orakelte er stattdessen. „DerMensch mag im All leben, aber er wirdes nie erobern.“
Dann löste er seine Gurte, stöhnte„Herr, steh mir jetzt bei“ und stürzte,schneller und immer schneller, schließlichmit über 900 Kilometern pro Stunde. Am16. August 2010 jährt sich sein Rekordflugzum 50. Mal.
Jetzt hat sich Baumgartner vorgenom-men, Kittingers Rekord zu übertrumpfen.Die beiden stehen oft beisammen aufdem Testgelände, Kittinger berät seinenHerausforderer. „Rekorde sind dazu da,gebrochen zu werden“, sagt er.
Jahrzehntelang wurde Kittinger immerwieder von Nachahmern als Berater um-worben, über 20 Versuche hat es gegeben.Der Colonel ließ alle Interessenten ab-blitzen. Viele waren nur auf den schnel-len Kick aus, schlecht vorbereitet, mitmangelhafter Ausrüstung.
Am nächsten kam dem Ziel wohl deramerikanische Abenteurer Nicholas Pian -tanida 1966. Er erreichte mit seinem
Ballon eine Höhe von 37000 Me-tern, konnte aber nicht aus derGondel springen, weil es Proble-me mit der Sauerstoffversorgunggab. Beim folgenden Versuchsprang er zwar, aber als er untenankam, war er im Koma, aus demer nie wieder erwachte.
Seit zehn Jahren hat der Sturzaus dem All wieder Konjunktur.Im Rennen waren zwischenzeit-lich fünf Aspiranten: ein Minen-spezialist aus Australien, eine Be-rufspilotin aus den USA, ein Spa-nier, ein britischer Stuntman.
Baumgartners größter Konkur-rent dürfte Michel Fournier sein,
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 119
Zum Vergleich:Passagierflugzeug12 km Höhe
30 km
– 50 °C
20 km– 60 °C
10 km– 50 °C
Meeres-spiegel
+ 15 °C
50 km
Obergrenze der
Stratosphäre
Luftdruck:
1 Hektopascal
40 km
Temperatur:
– 10 Grad
Celsius
100 hPa
1000 hPa
Aufstieg mitdem Heliumballon
1
Beschleunigung auf über 1100 km/h
3
Durchbrechen
der Schallmauerin ca. 30 km Höhe
4
Abbremsen
durch immer dich-
tere Atmosphäre
auf 200 km/h
5
Der Fallschirmöffnet sich nach ca. 5,5 Minuten freiem Fall in 1,5 km Höhe
6
Absprung 36 km2
Geplanter Sprung
des Felix
Baumgartner
10 hPa
Basejumper Baumgartner*: Berühmt durch groben Unfug
RO
BE
RT
YA
GE
R (
O.)
; D
PA
(L
.)
ein pensionierter Franzose und großerPechvogel. Für seinen Sprung hat der 66-Jährige eine Villa, seine Möbel und seineBriefmarken- und Waffensammlung ver-kauft. In Frankreich bekam er keineStarterlaubnis, also trainiert er in den kanadischen Weiten von Saskatchewan.Einmal riss sich sein Ballon los und flogohne ihn gen Himmel – ein Verlust vonrund einer Drittelmillion Euro. Nun bet-telt er auf seiner Website um Spendenfür „Le Grand Saut“ – den GroßenSprung.
Felix Baumgartner stieg spät ins Ren-nen ein. Jahrelang hatte er sich als Zeit-soldat, Boxer und Motocrossfahrer ver-sucht. Aber den größten Erfolghatte er mit grobem Unfug: alsBasejumper von Felsen undBrücken zu springen. So machteer das Stürzen zu seinem Voll-zeitberuf.
Um auf die Petronas Towersin Malaysia zu gelangen, ver-kleidete er sich als Geschäfts-mann und sprang mit Anzugund Krawatte herunter. Im Ge-büsch unter der Christus-Statue in Rio deJaneiro versteckte er sich nächtelang, bissich die Gelegenheit bot, mit einer Arm-brust ein Seil über den Arm der Figur zuschießen. Daran kletterte er empor, umvon Jesu rechter Hand aus in den Son-nenaufgang zu springen.
2003 stürzte er im freien Fall von Eng-land nach Frankreich – auf den Rückenhatte er sich Stummelflügel aus Carbon-faser geschnallt, die ihm bei der Über-querung des Ärmelkanals das Steuern er-laubten. Gesponsert wurde er vom Kof-feinbrausekonzern aus seiner Heimat.
Immer wieder wurde er von Sicher-heitskräften geschnappt, musste Bußgel-der zahlen, spielte sich als grinsender
Dauerprovokateur auf. Er brachte es zugewissem Wohlstand, leistete sich einenSportwagen. Daheim regelt nach wie vorseine Mutter die Finanzen.
Diesmal aber hat sein Sturz eine an-dere Fallhöhe. „Wer die Schallmauerdurchbrechen will“, sagt er, „der darf sichkeinen einzigen Fehler leisten.“
Seit 2007 bereitet sein Team den gro-ßen Sprung vor: Er hat einen Raumanzugmaßschneidern lassen von derselben Fir-ma, die schon die „Apollo“-Astronautenfür ihre Tests eingekleidet hatte; stunden-lang hat er in Kältekammern gebibbertbei minus 50 Grad Celsius; und er ist ausFlugzeugen und von Bungeekränen ge-
sprungen – alles gefilmt von derBBC. Jeder Schritt seiner akri-bischen Vorbereitung steigertdie Spannung seiner Helden-story und erhöht damit seinenMarktwert, denn damit köderter die Sponsoren.
Drei Jahre währen nun schondie Vorbereitungen – doch wirdalles nach fünfeinhalb Minutenvorbei sein, wenn Baumgartner
in anderthalb Kilometer Höhe die Reiß-leine zieht. Er spricht vom Trainingszen-trum als „Set“, er sieht sich als Schau-spieler, als Heldendarsteller in einemTechnik-Epos. Sein Lieblingsfilm: „DerStoff, aus dem die Helden sind“ über dieAnfänge des amerikanischen Raumfahrt-programms.
„Felix ist der Richtige, um meinen Re-kord zu brechen“, sagt der Veteran Kit-tinger: „Hier herrscht Aufbruchstimmungfast wie damals in den Fünfzigern.“
Es ist eine illustre Schar von Pionieren,die im Halbkreis um Baumgartner herum-stehen und unheilschwanger wie ein grie-chischer Chor die Katastrophen ausmalen,die auf den modernen Ikarus lauern.
„Etwa 30 Sekunden nach dem Ab-sprung dürfte Felix die Schallmauerdurchbrechen“, sagt Teammitglied EinarEnevoldson, der lange für die Nasa alsTestpilot gearbeitet hat. Er ist 78 undplant derzeit einen eigenen Segelflug-Hö-henrekord.
„Wenn Felix springt, ist die Körperhal-tung das Entscheidende“, sagt Enevold-son. „Beim Durchbrechen der Schall-mauer entstehen extreme Turbulenzen.“Am Rande des Alls breiten sich Druck-wellen langsamer aus, die Schallgrenzeliegt mit rund 1100 Kilometern pro Stun-de gut zehn Prozent niedriger als aufMeereshöhe. Gerät ein Springer jedochins Trudeln, könnten etwa seine Händedie Schallmauer vor dem Rest des Kör-pers durchbrechen und dadurch verletztwerden. „Felix ist ein Testpilot ohneFlugzeug, und es ist der Job von Testpi-loten, herauszufinden, was schiefgehenkann.“
Enevoldson sagt das ganz ruhig undsachlich. Er schlägt vor, dass Baumgartnersich beim nächsten Sprung im Freifall aufden Rücken dreht, hilflos wie ein Käfer,um zu sehen, ob er sich selbst wieder aufden Bauch drehen kann. Baumgartnersagt nur: „Okay“.
Er will alle erdenklichen Horrorszena-rien durchspielen. Denn wenn er zum„Big One“ ansetzt, kann ihm niemandmehr helfen. „Was immer schiefgehenkann, wird schiefgehen“, so lautet „Mur -phys Gesetz“. Major Edward AloysiusMurphy, dem dieser Spruch zugeschrie-ben wird, war ein Kollege von Kittinger.
„Wir schreiben Geschichte und Ge-schichten“, sagt Art Thompson, einschlaksiger Mann, der durchaus als Cou-sin von Clint Eastwood durchgehen wür-de. Er hat nicht nur bei der Entwicklungvon Tarnkappenbombern mitgearbeitet,sondern 1997 auch das Batmobil für denFilmhelden Batman entworfen.
„Die Kapsel, die wir entwickelt haben,ist ein komplettes kleines Raumschiff“,sagt Thompson. Ohne diesen Schutzkönnte Baumgartner seinen stunden -langen Aufstieg nie überleben. Schon inder Tropopause, in etwa 15 KilometerHöhe, ist die Atmosphäre so dünn, dass ein Druckabfall nach wenigen Se-kunden Ohnmacht bedeutet, nach weni-gen Minuten den Tod. Die Sonne brenntgnadenlos, der Strahlenschirm aus Ozonverliert oberhalb von rund 30 KilometerHöhe seine Wirkung.
Baumelnd unter einem riesigen He -liumballon, wird Baumgartner himmel-wärts steigen. Größer als 20 Fußballfelderist die Ballonhaut aus Po lyethylen undzehnmal dünner als ein Luftballon – einHauch aus Plastik, der aber stark genugsein muss, die mehr als eine Tonne schwe-re Kapsel emporzutragen.
„Da oben merkt man gar nicht, dass man fällt, es ist ganz still“, sagt Kit-
Technik
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0120
Rekordspringer Baumgartner: Das Stürzen als Vollzeitberuf
RO
BE
RT
YA
GE
R
Von Jesu
rechter
Hand aus
sprang
er in den
Sonnen -
aufgang.
tinger. Der schnellste Mensch der Weltwird auf dem Weg zur Schallgrenze kaumeinen Hauch spüren. So dünn ist die Hö-henluft, dass es auch keinen Knall gebendürfte.
Das Weltall beginnt zwar offiziell erstbei 100 Kilometer Höhe, doch viele Naturgesetze führen an der Grenze zwischen Himmel und Erde schon weit-aus tiefer zu überraschenden Effekten:Trotz der klirrenden Kälte in der Strato-sphäre könnte das Fleisch des Springerszu kochen beginnen. „Dort oben passiertÄhnliches wie bei Tauchern, wenn sie zuschnell zur Oberfläche zurückkehren“,erklärt Jonathan Clark, der als Arzt sechsSpace-Shuttle-Missionen betreut hat –dar unter die Mission der „Columbia“-Fähre, die 2003 abstürzte. Auch LaurelClark kam dabei um – seine Frau. Manch-mal wache er nachts auf, sagt er, undhabe eine neue Idee, wie sich Raumfahrerretten lassen.
„Das Gefährlichste ist ein Leck imDruckanzug“, sagt Clark: „Der Stickstoffin den Zellen beginnt Blasen zu bilden,das Fleisch schwillt auf.“ Genau das warseinerzeit Kittingers Hand widerfahren –für ihn ein lebensrettender Glücksfall,weil die aufgequollene Hand das Leck inseinem Raumanzug verschloss.
Zeit für den nächsten Testsprung.Baumgartner schlüpft in die Thermo -unterwäsche. Zwischen die Schulterblät-ter hat er sich die Zahl 502 tätowierenlassen, seine Mitgliedsnummer in derBase jumper-Bruderschaft. Auf seinemrechten Arm steht „Born To Fly“.
Vier Helfer zwängen „Fearless Felix“in den Raumanzug. Dann schlurft dervielleicht bald schnellste Mann der Weltbehäbig über das „Set“ zum Flugzeug.Der „Skyvan“ brummt in den Himmelwie ein alter Lastwagen, steigt höher, einwinziger Punkt, hoch wie der Everest unddirekt vor der Sonne.
Techniker und Fotografen, Testpilotenund Raumfahrtveteranen blinzeln insLicht. Kittinger verfolgt den Probesprungseines Herausforderers am Monitor. DerAstronaut steht an der Heckklappe desFlugzeugs, macht einen Schritt, tappt insLeere. Er stürzt und stürzt, purzelt aufden Rücken, dreht sich im Kreis im FlatSpin – genau die Horrorshow, die dieTestpiloten sehen wollten.
Dann die Erleichterung: Baumgartnerdreht sich auf den Bauch, geht in denkontrollierten Sturzflug. Schließlich glei-tet der Astronaut zwischen den Wolkenhervor, surreal wie eine Fotomontage.Und eine perfekte Projektionsfläche.
Die alten Recken sehen das Spektakelals nostalgische Huldigung an sie selbst,die Helden von einst. Für die jungen Basejumper ist es die Himmelfahrt einesSpaß-Guerilleros. Und für die Brausefir-ma eine lebende, schwebende Litfaß -säule. HILMAR SCHMUNDT
Technik
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0122
Kaum etwas scheint beständiger inItalien als der Erfolg der Roller-Ikone Vespa. Ihr Hersteller Piaggio
ist der größte Motorradproduzent Euro -pas, die klassische Baureihe noch immertragende Säule seines Geschäfts. Die Kon-strukteure in Pontedera bei Pisa trachtenindes unverdrossen nach einem neuengroßen Wurf.
Der bislang letzte Versuch liegt vierJahre zurück. Piaggio präsentierte einwunderliches Dreirad, dessen gelenkigeAchsmechanik Schräglagen erlaubt. Esheißt MP3, wirkt etwa so grazil wie einMähdrescher und verkauft sich schlep-pend. Immerhin erfreut sich die breitereVariante, die auch ohne Motorradführer-schein gefahren werden darf, etwas grö-ßeren Zuspruchs.
Nun soll neben Fahrschulmuffeln einneuer, weit nobler motivierter Käuferkreiserschlossen werden. Marketingleiter Giu-seppe Molinari spricht von „Menschenmit besonderem Gewissen“ und meint da-mit wohl eine Mischung aus feiner Öko-Sensibilität und robuster Investitionsbe-reitschaft. Zu Preisen um 9000 Euro bringt
Piaggio in diesem Sommer eine neue Variante des MP3 in den Handel. An denhinteren Flanken dieses Gefährts lockt einmagischer Begriff: „Hybrid“.
Piaggio, erklärt Molinari, wolle „derToyota des Roller-Markts“ werden. Ähn-lich wie der japanische Autokonzern inden Neunzigern sei der toskanische Zwei-und Dreiradproduzent nun der weltwei-ten Konkurrenz um Jahre voraus: Als ers-tes Serienprodukt seiner Art verfügt derMP3 über eine Kombination aus Benzin-und Elektromotor.
Rein elektrisch kann der MP3 Hybridmit bis zu 30 Kilometern pro Stunde eineStrecke von etwa 20 Kilometern zurück-legen. Rund drei Stunden dauert es da-nach, die unter der Sitzbank verstauteBatterie an der Steckdose nachzuladen.
Wählt der Fahrer den Arbeitsmodus„Hybrid Power“, leisten Benziner undElektromotor zusammen etwa 25 PS, vondenen 3,5 PS aus dem E-Antrieb stam-men. Zugeschaltet werden diese nur beim
Beschleunigen. Eine weitereWahlmöglichkeit heißt „HybridCharge“; in dieser lädt der Ver-brennungsmotor über einen Ge-nerator die Batterie, so dass im-mer ein voller Stromtank für rei-ne Elektrofahrten bereitsteht.
Die Option, ganz ohne Ver-brennungsmotor zu fahren, istheute schon ein Vorteil in man-chen italienischen Städten, inderen Zentren nur noch ab -gasfreie Fahrzeuge zugelassensind. Der kombinierte Betriebaus Fahrten im Hybrid- undElektromodus soll überdies mitextrem niedrigen Verbrauchs-werten möglich sein. Piaggionennt als Beispiel ein gemisch-tes Fahrprofil aus 30 Kilometern,auf denen der Hybridroller nureinen halben Liter Benzin ver-brauche. Ein vergleichbaresFahrzeug mit konventionellemAntrieb benötigt für dieselbeStrecke im selben Tempo dop-pelt so viel Treibstoff.
Das vermeintliche Technikwunder er-klärt sich dadurch, dass der Hybridrollermit voller Batterie startet und mit leererankommt. Auf der Fahrt wird nebenbeialso Netzstrom verzehrt, und zwar guteine Kilowattstunde; der Treibstoffmixaus Strom und Benzin für die 30 Kilo -meter kostet derzeit etwa 90 Cent, im-merhin 50 Cent weniger als der Kraftstofffür dieselbe Fahrt mit reinem Benzin -motor.
Ein Pendler, der an 200 Tagen im Jahreine solche Strecke zurücklegt, würde sojährlich 100 Euro sparen. Jegliche Wirt-schaftlichkeitsrechnung erübrigt sich da-mit: Der Hybridroller ist knapp 3000 Euroteurer als ein vergleichbares konventio-nelles Modell. CHRISTIAN WÜST
M O T O R R O L L E R
Stromtankunterm Sitz
Mit einer Hybridversion seinesskurrilen Dreiradrollers
MP3 empfiehlt sich Piaggio alsÖko-Pionier. Die Kosten aller-
dings sind höher als der Spareffekt.
Piaggio MP3 Hybrid: „Toyota des Roller-Markts“
Trends Medien
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 123
W E R B U N G
Fernsehlotterieverstimmt ARD
Für Ärger hat der neue Sponsor ver -trag der ARD Fernsehlotterie mit
dem Fußballbundesligisten FC St. Pauligesorgt. Das eigenständige Unterneh-men hatte mit dem Verein eine Verein-barung über Trikotwerbung über an-geblich 3,2 Millionen Euro pro Bundes-ligasaison geschlossen – dabei aber of-
fenbar nicht bedacht, die Sache vorhermit der ARD zu klären. Dort sorgteder Plan, mit dem Schriftzug „ARDFernsehlotterie“ und womöglich mitdem Markenzeichen der ARD-Eins zuwerben, für Unmut. Man besitze alleRechte an den Markenzeichen undwerde sie für die Trikotwerbung nichtfreigeben, beschieden die ARD- Oberen den Lotto-Leuten. Auf die Trikots darf nun bloß noch der Slogan„Ein Platz an der Sonne“. Die Sender-hierarchen, vor allem NDR-IntendantLutz Marmor, wollten den Eindruck
vermeiden, Gebührenmillionen für Reklame zu verpulvern. Zum anderenwollten sie verhindern, dass etwa inder „Sportschau“ Berichte über einenBundesliga-Club gesendet werden, derfür die ARD zu werben scheint. Beiden Intendanten ist noch in Erinne-rung, wie viel Ärger ein Sponsorver-trag mit dem Radteam der DeutschenTelekom eingebracht hatte. Damalswaren Jan Ullrich und Kollegen mitder Eins auf dem Shirt in das Rennengegangen, das zugleich von der ARDübertragen wurde.
Z D F
Müller-Hohenstein bedauert Werbeeinsatz
ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein – zurzeit an der Seite vonOliver Kahn bei der Fußball-WM in Südafrika – hat sich für ihre Werbeaktion
für das Molkereiunternehmen Weihenstephan entschuldigt. „Das Engagementwar ein Fehler, den ich bedaure“, sagte sie dem SPIEGEL. „Es war nie meineAbsicht zu werben. Ich beende die Arbeit als Schirmherrin des Beirats.“ Zugleichdistanzierte sie sich von Äußerungen ihrer Agentur, die verbreitet hatte, Ex-Chefredakteur Nikolaus Brender habe ihr die jetzt umstrittene Tätigkeit einsterlaubt. „Die Äußerungen sind nicht mit mir abgesprochen.“ Brender erklärtedem SPIEGEL, seine Erlaubnis habe er lediglich „für die Mitwirkung bei einerunabhängigen Stiftung zur gesunden Ernährung von Kindern“ erteilt. „Eine Ak-tion für irgendein Produkt hätte ich niemals genehmigt.“ In den Arbeitsverträgenvon Müller-Hohenstein mit dem ZDF, die er selbst noch abgesegnet habe, seiihr zudem „insgesamt jede werbliche Tätigkeit ausdrücklich untersagt“ worden.Der jetzige Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, bestätigte, dass der werblicheCharakter der Aktion im Nebentätigkeitsantrag nicht ersichtlich gewesen sei.Er gehe jedoch davon aus, dass Müller-Hohenstein selbst nicht klar war, dassmir ihr geworben werden sollte.
T E R R O R I S M U S
Qaida-Magazin verpatzt Premiere
Das Terrornetzwerk al-Qaida gehtneue Wege in der Propaganda.
Mit einem englischsprachigen Magazinnamens „Inspire“, das im Internet heruntergeladen werden kann, suchtdie Dschihadisten-Gruppe neuerdingsnach Rekruten. Die Qaida-Filiale aufder Arabischen Halbinsel produziertdas Magazin, vergangene Woche wur-de es auf einschlägigen Qaida-nahenWebsites veröffentlicht. Doch unterliefden Machern gleich in der ersten Aus-gabe ein Patzer: Obwohl die Veröffent-lichung eine Woche lang angekündigtworden war, waren von den 67 Seitenwegen eines technischen Fehlers zumStart nur drei lesbar. Die Gruppe willmit dem Magazin vor allem terrorwilli-ge junge Männer aus dem Westen undder nichtarabischen Welt ködern, dieüber das Internet Kontakt zu dschiha-distischen Terrorgruppen suchen – einTrend, den Geheimdienstanalystenschon seit einiger Zeit mit Sorge beob-achten. Der Nachwuchs wird in demMagazin mit exklusiven Botschaftenvom jemenitisch-amerikanischen Hass -prediger Anwar al-Awlaki gelockt.Auch englische Übersetzungen derletzten Reden Osama Bin Ladens feh-len nicht. Ein Teil des Inhalts scheint
allerdings recy-celt zu sein. DerBeitrag „Baueeine Bombe inder Küche dei-ner Mutter“etwa entstammtder Oktober -ausgabe desschon länger be-stehenden arabi-schen Magazinsvon al-Qaida.„Inspire“-Titel
Brender, Kahn, Müller-Hohenstein
IMA
GO
(L
.);
TO
BIA
S H
AS
E /
DP
A (
R.)
Medien
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0124
Wenn es in der Bundesrepublikan einem nicht mangelt, dannsind es Lobbyisten. Allein in
Berlin schwirren rund 6000 hauptberuf -liche Interessenvertreter aller Couleurher um, viele von ihnen verfügen über einen Hausausweis des Bundestags undwerden angehört zu allen Geset-zen, die ihre Branche betreffen.
Die PR-Zunft ist mächtig. Wasihr bisher fehlte, waren ein guterRuf und eine spezielle Ausbil-dungsstätte. Beides soll seit Aprileine neue Institution liefern: dieQuadriga Hochschule Berlin, ge-gründet von dem umtriebigen Me-dienunternehmer Rudolf Hetzel,zugleich Chef von Helios Media.
Schlappe 20000 Euro kostet es,sich hier in einem Aufbaustudien-gang zum „ganzheitlichen“ Kom-munikationsmanager ausbilden
zu lassen, zum „Vordenker, Strategen undGeneralisten“. Am Ende winkt ein Mas-ter-Abschluss.
Drei Studiengänge mit jeweils 18 Stu-denten offeriert die Quadriga. Wer beson-ders talentiert ist, für den übernehmenBMW, SAP oder der Bundesverband der
Deutschen Industrie 50 Prozent der Stu diengebühren. Nach einer Reihe von Skandalen hat es die Branche dringend nötig, in eigener Sache aktiv zu werden.Die Deutsche Bahn beispielsweise gab un-ter ihrem neuen Chef Rüdiger Grube zu,dass sie einstmals mehr als eine Million
Euro für fingierte Leserbriefe, ge-steuerte Lobhudeleien in Internet-foren und verschiedene Medien-manipulationen ausgegeben hatte.Der PR-Berater Norbert Essing,eine Art Stimmungsmacher vielerTop-Manager, muss sich gegen denVorwurf wehren, er habe Gegnerverleumdet (siehe Seite 74).
Die PR-Branche steht mehrdenn je im Ruf professionellerManipulation. Für Journalistengibt es dazu eigentlich nur eineHaltung: misstrauische Distanz.Bei der Quadriga hat sich indes
P U B L I C R E L A T I O N S
Lehrer für die LobbyFür die neue PR-Hochschule Quadriga in Berlin geben mehrere Top-Journalisten, die Vorsitzende von
Transparency International Deutschland und ein Ex-ARD-Vorsitzender ihre guten Namen her.Doch ein Fall von dubioser Öffentlichkeitsarbeit kratzt bereits am sorgsam aufgebauten Renommee.
Quadriga-Akteure Müller, Hetzel: In eigener Sache aktiv
KA
RL-B
ER
ND
KA
RW
AS
Z (
L.)
; C
. K
IELM
AN
N /
IM
AG
O (
R.)
Quadriga-Studenten mit Präsident Voß (l.): „Musterbeispiel dafür, wie man es gerade nicht machen darf“
MO
RIT
Z V
EN
NE
MA
NN
blematisch: „Das Geschäftsmodell von He-lios Media basiert auf der Förderung derPR- und Lobbyszene. Damit die Quadrigaernst genommen wird, braucht sie drin-gend renommierte Personen von außen.Dass die Transparency-Vorsitzende sichdafür hergibt, einer PR-Schmiede Renom-mee zu verschaffen, finde ich schade.“
Ihren Fachbereich leitet Edda Müllernun gemeinsam mit einem Dozenten, des-sen eigene Firma zuletzt mit einer höchstzweifelhaften PR-Aktion ausgerechnetfür die Atomindustrie aufgefallen ist:Thorsten Hofmann.
Er ist geschäftsführender Gesellschaftereiner Agentur für Krisenkommunikationnamens PRGS in Berlin. Das Unterneh-men erstellte für den Energieriesen E.onein Papier mit dem harmlos klingendenTitel „Kommunikationskonzept Kern-energie“. Tatsächlich liest es sich wie einBrevier für die Manipulation der öffent -lichen Meinung.
Hofmann bestreitet die Existenz desKommunikationskonzepts nicht, lässtaber ausrichten: „Wir gehen davon aus,dass unsere Arbeit keinen Anlass zur Be-anstandung gibt.“ E.on selbst gibt zu, dasses einen Auftrag an PRGS gab, allerdingssei es nur darum gegangen, „neue Bot-schaften und Argumente zu entwickeln“.Mit der Studie sei PRGS aber „weit dar -über hinausgegangen“, sagt eine Spre-cherin von E.on Kernkraft.
Auf 109 Seiten listet Hofmanns PRGSallerlei Tricks auf, wie man die Stimmungin der Bevölkerung so drehen kann, dass
eine Verlängerung der Laufzeitfür Atomkraftwerke mehrheits-fähig wird. Das Arsenal reichtvon geeigneten Studien undUmfragen bis zu „Grassroots“-Aktivitäten wie Unterschriften-und Call-Center-Aktionen.
Transparenz? Fehlanzeige.Für die Studie, heißt es auf Seite9, habe die PRGS zahlreichevertrauliche Gespräche mit Ver-tretern aus Politik, Energiewirt-schaft und Medien geführt.„Selbstverständlich wurden die-se Gespräche ohne NennungE.ons oder des Auftrags ge-führt.“
Die Studie „las sich damalsin Einzelpassagen wie ein Mus-terbeispiel dafür, wie man es gerade nicht machen darf, wennman das Transparenzgeboternst nimmt“, sagt Quadriga-Präsident Voß.
Das Atom-Papier beschreibttatsächlich eine PR-Praxis, diejedem Journalisten zuwider seinmüsste. Die PRGS führte Ge-spräche „mit Journalisten der
,Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘̒, des,Handelsblattes‘, der ,Wirtschaftswoche‘und der ,Welt‘“. 16 Journalisten, die vorallem über Energiethemen berichten. An-schließend wurden sie politisch auf einerLinks-rechts-Achse eingeordnet.
Warum der ganze Aufwand? Auch dar -auf gibt Hofmanns Papier eine Antwort:Politiker und Journalisten bevorzugten„quellenbasiertes Informationsmaterial,das die Neutralität der Information sug-geriert“.
Es geht also weniger um neutrale In-formationen, sondern um eine Illusionvon Wahrheit.
Doch können Journalisten und PR-Ma-nager überhaupt zusammenarbeiten –selbst wenn es nur um Fragen der Ausbil-dung geht? Sollten beide Welten nichteher getrennt bleiben?
Quadriga-Präsident Voß hält das Zu-sammenspiel für wichtig. Sein Argument:Da viele Zeitungen und Redaktionen im-mer weniger Mittel zur Recherche hätten,könne sich die Gesellschaft nicht mehrdarauf verlassen, dass der Journalismusdie Wirtschaft kontrolliere. Es müsstenauch in den PR-Abteilungen der Unter-nehmen Menschen sitzen, die „begriffenhaben, dass letztlich nur Transparenz undOffenheit für Glaubwürdigkeit sorgen“.
Voß nervt das grundsätzliche Misstrau-en: „Auch PR-Leute sind nicht generellÜbeltäter, sondern unentbehrliche, tüch-tige Leute.“
Tüchtig ist auch Rudolf Hetzel, zu dessen Mini-Medienimperium die neuge-
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 125
eine ganze Reihe von Chefredakteurenund Herausgebern in den Dienst der Sa-che stellen lassen: Thomas Schmid vonder „Welt“, Steffen Klusmann von der„Financial Times Deutschland“, Sven Gös-mann von der „Rheinischen Post“, Wolf-gang Kenntemich vom MitteldeutschenRundfunk sowie die ARD-Generalsekre-tärin Verena Wiedemann dekorieren dasKuratorium der Hochschule.
Ex-„Cicero“-Chef Wolfram Weimerhat sein Engagement erst beendet, als erjüngst an die Spitze von „Focus“ wech-selte – einen Grund nannte er nicht. DieHomepage der Hochschule wirbt weiter-hin mit Weimer als Kuratoriumsmitglied.
Galionsfigur ist indes Quadriga-Grün-dungspräsident Peter Voß. Der frühereSWR-Intendant und einstige ARD-Vorsit-zende ist von seinem Engagement restlosüberzeugt. Voß will eine neue Generationvon PR-Leuten prägen. „PR-Arbeit kannman nur von innen verändern“, sagt er.„Appelle an Transparenz von außen klin-gen gut, bringen aber nichts.“
Nur – wie transparent ist die staatlichanerkannte Quadriga selbst? Perfekt indas polierte Image passt zunächst, dassauch Edda Müller an der privaten Hoch-schule arbeitet, früher Umweltministerinin Schleswig-Holstein und seit zwei Wo-chen Vorsitzende der deutschen Sektiondes Anti-Korruptions-Vereins Transparen-cy International. An der Quadriga leitetsie nun den Fachbereich Politik.
Ulrich Müller, Sprecher der Bürgerinitia -tive Lobbycontrol, hält schon das für pro-
Krisenkommunikator Hofmann
Arsenal der Manipulation
WE
RN
ER
SC
HÜ
RIN
G
Medien
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0126
gründete Hochschule gehört, obwohlauch er sich zu seinem Engagement nichtäußern möchte. Der Unternehmer ist je-denfalls findig darin, Journalisten und PR-Leute zusammenzubringen.
Sein Helios-Verlag hat jahrelang dieVerleihung des Journalistenpreises „Gol-dener Prometheus“ mitorganisiert. Auchetliche SPIEGEL-Journalisten wurden da-bei ausgezeichnet, aber mancher Preis-träger fühlte sich veralbert und für PRmissbraucht. Der Preis verlor zügig anRenommee, und weil sich im vergange-nen Jahr auch nicht mehr genug Sponso-ren fanden, wurde die Show schließlicheingestellt.
Hetzels Verlag hat darüber hinaus denBundesverband deutscher Pressesprechergroß gemacht. Helios übernimmt die Or-ganisation, Öffentlichkeitsarbeit und dasAnwerben neuer Mitglieder und kassiertdafür bei jedem Mitgliedsbeitrag mit. DerVerband ist bei Pressesprechern wohlauch deshalb beliebt, weil jedes Mitgliedeine Art Rabattkarte erhalten kann, mitder es billigere Flüge, Mietwagen oderHotels gibt.
Das Geschäftsmodell ist so erfolgreich,dass Helios seit kurzem auch die Neu-gründung Bundesverband der Personal-manager betreut. Die Veranstaltungenund Vereine, die Helios organisiert, zeich-nen sich vor allem durch pompöse Na-men aus: „Globales Wirtschafts- undEthik Forum“ zum Beispiel oder „Euro-pean Communication Summit“.
Gewaltig klingt auch die „DeutschePresseakademie“. Doch selbst das ist keinFörderinstitut für Journalismus, wie derName suggeriert, sondern nur eine Firma,die Weiterbildung für PR-Leute und Pres-sesprecher anbietet. So erfolgreich aller-dings, dass zusätzlich die Quadriga ge-gründet wurde. Hetzel und sein Co-Ge-schäftsführer Torben Werner haben die-ses kleine Reich in nur wenigen Jahrenerrichtet: „Wir lassen der Quadriga inhalt-lich völlig freie Hand, wir mischen uns indie Lehrpläne nicht ein“, sagt Werner.
Doch nun kommt Druck aus der eige-nen Branche. Der Deutsche Rat für PublicRelations (DRPR) hat ein Verfahren ge-gen Hofmanns PRGS eröffnet und willdie Hintergründe der dubiosen E.on-Stu-die untersuchen.
Auf der Sitzung des Rats Ende Mai er-klärte sich DRPR-Mitglied Günter Bente-le bereit, die Untersuchung zu überneh-men. Bentele selbst unterrichtet PR ander Universität Leipzig. Er will Hofmannund E.on Kernkraft „einige kritische Fra-gen“ stellen. Wie unabhängig der Leipzi-ger Professor in seiner Untersuchung seinwird, muss sich zeigen. Auch Bentele unterrichtet an der Quadriga. Und der Vizepräsident der Mini-Hochschule, RenéSeidenglanz, war einer von BentelesSchülern. Es bleibt alles in der Familie.
MARKUS BRAUCK, MARKUS GRILL
Friedmann, 59, ist Vorsitzender des Her -ausgeberrats der „Süddeutschen Zeitung“,der vergangene Woche einen neuen Chef-redakteur berief: den bisherigen Vize KurtKister.
SPIEGEL: Die neue „SZ“-Chefredaktionkommt komplett aus dem eigenen Haus.Eine Zeitlang war vorher offenbar „Zeit“-Chef Giovanni di Lorenzo im Gespräch,der aber absagte. Haben Sie noch über andere externe Kandidaten nachgedacht?Friedmann: Nachgedacht schon. Wir hättenunsere Sorgfaltspflicht verletzt, wenn wirnicht sichergestellt hätten, dass unsereLösung am Ende die beste ist, die wir aufdem deutschen Markt kriegen können.SPIEGEL: In der Redaktion gab es lange Befürchtungen, der neue „SZ“-Mehrheits-
gesellschafter, die Südwestdeutsche Me-dien Holding (SWMH), wolle womöglicheinen Sparkommissar an die Spitze set-zen.Friedmann: Die Fama, wonach die SWMHaus der „Süddeutschen“ einen Goldeselauf Regionalbasis machen möchte, istnicht nachvollziehbar. Die SWMH-Leutewissen sehr genau, was sie da für eineZeitung erworben haben. Und auch ihnenwar klar, dass in der redaktionellen Füh-rungsspitze nur jemand sein kann, derdie Kontinuität wahrt.SPIEGEL: Die „Süddeutsche Zeitung“musste in den vergangenen Monaten im-merhin schon etliche Redakteursstellenstreichen.Friedmann: Auch wir können nicht beliebiglang in den roten Zahlen bleiben. Abbauwird sich in einer wirtschaftlich so dra-matischen Umbruchphase nicht verhin-dern lassen. Wir haben die Phase ja auchgenutzt, um unseren Regionalteil zu re-formieren.
SPIEGEL: Sie kennen die Redaktion längerals alle anderen Mitglieder des Heraus-gebergremiums. Mussten Sie Überzeu-gungsarbeit für den nun inthronisiertenKurt Kister leisten?Friedmann: Natürlich habe ich mich für ihnverwendet. Es ist ja nicht nur er, sondernmit Wolfgang Krach als Stellvertreter undHeribert Prantl als Mitglied der Chefre-daktion ein sehr gutes Gesamtpaket. SPIEGEL: Kister soll vor einigen Monatenmit dem mächtigen SWMH-Miteigen -tümer Dieter Schaub aneinandergeratensein. Friedmann: Es liegt in Kisters Natur, dasser nicht nur der beste Schreiber der Re-publik ist, sondern gelegentlich mit je-mandem aneinandergerät. Die Frage istdoch: Wie empfindlich ist man da? Ich
bin da nicht sehr sensibel, HerrSchaub offenbar auch nicht. SPIEGEL: Ursprünglich soll maleine Doppelspitze geplant gewe-sen sein.Friedmann: Bei uns im Heraus -geberrat zumindest nicht. Unswar klar: Am Ende muss einerdas Sagen haben. Das wollte ichso und auch die SWMH. SPIEGEL: Sie selbst sind Spross einer Zeitungsmacherfamilie. Ih-nen gehört auch die „Abendzei-tung“. Dort haben Sie vor zweiJahren einen neuen Chefredak-teur berufen, eine Blattreform
durchgezogen. Der Auflage hat das nichtgeholfen. Sind Sie frustriert?Friedmann: Oh ja. Es ist traurig. Uns fehlendie jungen Leser. Die sind, was Fakten angeht, durchs Internet schon morgens aufdem neuesten Stand. Da müssen wir unsumorientieren und weg von der Faktenlas-tigkeit. Es wird wichtiger, Zusammenhängeherzustellen und Orientierung zu geben.SPIEGEL: Gibt es auch für die neue „SZ“-Chefredaktion einen Aufgabenkatalog?Friedmann: Wir hatten ja Ideen für eine ei-gene Sonntagszeitung, die aber daran ge-scheitert sind, dass es zu teuer wäre, dafüreinen eigenen bundesweiten Vertrieb auf-zubauen. Jetzt denken wir darüber nach,wie wir die Wochenendausgabe so gestal-ten können, dass wir damit die Sonntags-zeitungen der Konkurrenz ersetzbar ma-chen. Das könnte auch das „SZ-Magazin“einbeziehen. Und wir brauchen eine be-hutsame Modernisierung unseres Layouts,das ja schon mehr als traditionell ist.
INTERVIEW: MARKUS BRAUCK
„SZ“-Druckerei: „Einer muss das Sagen haben“
TH
OM
AS
EIN
BE
RG
ER
/ A
RG
UM
RE
TO
ZIM
PE
L
P R E S S E
„Sehr gutes Gesamtpaket“„SZ“-Herausgeber Johannes Friedmann über seine
neue Chefredaktion und die Zukunft der Tageszeitung
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 127
Szene Sport
S P I E L E R F R A U E N
Freundin hinterm Tor
Für die WAGs, wie die Frauen undFreundinnen – Wives and Girl-
friends – der englischen Nationalspie-ler genannt werden, war die Weltmeis-terschaft in Südafrika nicht nur wegendes frühen Ausscheidens im Achtel -finale eine trostlose Veranstaltung:Trainer Fabio Capello hatte den Profiswährend des Turniers nur zeitlich sehrbegrenzte Treffen mit ihren Partnerin-nen gestattet. Spaniens NationalcoachVicente del Bosque zeigt im Umgangmit den Spielerfrauen deutlich mehrGelassenheit. Ihn störte es offensicht-lich nicht einmal, dass die Lebens -gefährtin seines Torwarts Iker Casillasbei den WM-Spielen zuweilen unmit-telbar hinter dem spanischen Torstand – Sara Carbonero, 25, ist Fern-
sehjournalistin für den spanischen Sen-der Telecinco, die ihren Iker nach Ab-pfiff des verlorenen Auftaktspiels ge-gen die Schweiz vor laufender Kameraauch fragte, wie der große Favorit Spa-
nien so eine wichtige Partie verlierenkonnte. Die Liaison mit dem Torwartvon Real Madrid hat die Sportreporte-rin in der Heimat des Europameisterszu einer Berühmtheit gemacht – in
Spanien zählt Sara CarbonerosName seit Beginn der WM zuden meistgesuchten im Internet,Hunderte Bilder und Videos vonder TV-Journalistin kursieren be-reits im Netz. Kritik an der Miss-achtung „arbeitsethischer Grund-sätze“, wie sie der Präsident desPresseverbandes von Madrid imHinblick auf Carboneros Doppel-rolle als Freundin und Fragestel-lerin äußerte, konterte Spanienswichtigste Sportzeitung „Marca“ganz in ihrem Sinne: „Frau Car-bonero macht ihre Arbeit sehrprofessionell und ist um eine um-fassende Berichterstattung be-müht.“
S C H I E D S R I C H T E R
„Signal an dieArmbanduhr“
Christian Holzer, ehemaligerProfi-Torwart des TSV 1860München und Vorstand derFirma Cairos TechnologiesAG, über die Serienreife elek-tronischer Tor-Erkennungs-systeme
SPIEGEL: Unter dem Druck der vielen fal-schen Schiedsrichterentscheidungen beider WM diskutiert die Fifa, ob die Ent-scheidung Tor oder kein Tor künftig elek-tronisch überwacht werden soll. Ihre Fir-ma hat mit dem Sportartikelkonzern Adi-das ein Tor-Erkennungssystem entwickelt.Rechnen Sie mit einem Großauftrag?Holzer: Wir harren der Dinge. Unser System wurde bei derFifa-Klub-WM 2007 getestet und für tauglich befunden. Eswäre sofort einsatzfähig.SPIEGEL: Wie funktioniert es?Holzer: Hinter der Torlinie ist ein Kabel verlegt, durch das einschwacher Strom fließt, der ein Magnetfeld erzeugt. Nähertsich der Ball der Linie, registriert ein im Ball implantierterSender das Magnetfeld und schickt Daten an zwei Antennen,die neben dem Tor stehen. Hat der Ball die Linie vollständigüberquert, wird der Schiedsrichter mit einem Funksignal anseine Armbanduhr über das Tor informiert. Das Spiel mussalso nicht unterbrochen werden. Der Unparteiische guckteinfach nach einer heiklen Situation auf die Uhr und weißBescheid.SPIEGEL: Was kostet so ein System?
Holzer: Rund 2500 Euro. Es ist fest im Stadion installiert undkann je nach Bedarf wie ein Computer angeschaltet werden.Hinzu kommen die Kosten für die mit einem Sender ausge-statteten Bälle, pro Stück rund 200 Euro.SPIEGEL: Wo sitzt der Sender im Ball?Holzer: Der Chip, etwa 20 Gramm schwer, befindet sich inder Mitte des Balls, damit die Flugeigenschaften optimal blei-ben. Er ist durch spezielle Fäden fixiert.SPIEGEL: In welchen Ligen ergibt die Einführung einer Mess-technik Sinn?Holzer: Überall dort, wo mit Fußball Geld verdient wird. InDeutschland also in den drei Profiligen.SPIEGEL: Könnte es kommende Saison schon losgehen?Holzer: Das wäre zu kurzfristig. Aber bis zur übernächstenSpielzeit könnten wir alle Vereine bestücken.
Casillas, Carbonero
JOH
N S
IBLE
Y /
AC
TIO
N I
MA
GE
S /
PIX
AT
HLO
N
Nicht gegebenes Tor für England im Spiel gegen Deutschland am 27. Juni
ALE
SS
AN
DR
A T
AR
AN
TIN
O /
AP
Vor ein paar Tagen saßWolfgang Niersbach, Ge-neralsekretär des Deut-schen Fußball-Bundes,im Quartier der National-mannschaft in Südafrikaund wartete auf eine Vi-
deokonferenz, die sein Präsident TheoZwanziger anberaumt hatte, der sich zurgleichen Zeit in der Frankfurter DFB-Zen-trale aufhielt. Niersbach hatte gerade Mit-tag gegessen und nun noch etwa 20 Mi-nuten Zeit bis zum Gespräch mit dem Mann auf der anderen Seite des Äquators. Dr. Zwanziger, Leiter der deutschen De-legation in Südafrika, war zwischen Eng-landspiel und Argentinienspiel für dreiTage nach Hause geflogen, um ein paarDinge zu erledigen.
Worüber werden sie reden?„Tja“, sagte Wolfgang Niersbach und
leckte sich die Zähne. „Wir haben eigent-lich momentan gar kein richtiges Thema.“
Es war nicht viel passiert im Leben derbeiden Funktionäre in den vergangenendrei Tagen. Niersbach war ins Mann-schaftsquartier umgezogen, weil im She-raton Pretoria, wo die DFB-Delegationbislang wohnte, die Zimmer ausgebuchtwaren. Er hatte eine Mail aus dem Kanz-
leramt bekommen, in der mitgeteilt wur-de, dass Angela Merkel 25 Karten für dasArgen tinienspiel benötige. Er hatte sichein wenig um die Organisation des Jubi-läumstreffens der Weltmeister von 1990gekümmert, das demnächst im Europa-park Rust stattfinden würde, und er hattetelefonische Glückwünsche von GuusHiddink zum erfrischenden Spiel derdeutschen Fußballer entgegengenommen.
Theo Zwanziger seinerseits hatte sei-nen Schreibtisch in Frankfurt aufgeräumt,er hatte in seinem Haus in Altendiez nachdem Rechten gesehen, wo gerade neueFenster und Rollläden eingebaut wordenwaren, er hatte seine Enkel besucht, under war viel Rad gefahren. Auf einer seinerRadwanderungen im südlichen Wester-wald hatte er in der Fußgängerzone vonDiez zwei türkische Jungs getroffen, dielaut „Deutschland! Deutschland!“ riefen,was ihn sehr freute.
Wird er das gleich alles erzählen? War -um nicht.
Man stellt sich vor, wie die beidenmächtigsten Männer des größten Sport-fachverbands der Welt auf Videoschirmeschauen, Tausende Kilometer voneinan-der entfernt, es knistert ein bisschen, unddann erscheint auf der einen Seite der
Weltkugel Niersbachs Kopf und auf deranderen der von Theo Zwanziger. Niers-bach sagt: Na, Theo, und Zwanziger:Grüß dich, Wolfgang, und dann reden sieüber Rollläden in Altendiez und AndiBrehme im Europapark Rust, weil essonst nichts zu sagen gibt, was irgendwievon Belang wäre.
Zwanziger hat lange über einen Terminnachgedacht, an dem er sich aus Südafri-ka unbemerkt entfernen kann. Die Zeitzwischen Achtelfinale und Viertelfinaleerschien ihm perfekt. Es gab sechs Tagelang kein Spiel, das die Deutschen gewin-nen oder verlieren konnten. In dieser Pha-se wird er als Präsident weder zum Jubelnnoch zum Trösten gebraucht. Er kannnicht viel falsch machen. Und Theo Zwan-ziger hat genug falsch gemacht in letzterZeit. Er hat sich im Skandal um die an-gebliche sexuelle Belästigung eines Bun-desligaschiedsrichters zu früh auf eineSeite geschlagen, und er hat bei Ver -tragsverhandlungen mit der sportlichenLeitung der Nationalmannschaft den Bun-destrainer verärgert. Die Auseinanderset-zungen bewegten sich weg von Zwanzi-ger, er wirkte wie ein Präsident, dem dieGeschäfte entgleiten.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0128
D E U T S C H E M A N N S C H A F T
König ohne VolkDFB-Präsident Theo Zwanziger führt den größten Sportfachver-
band der Welt fast ganz allein nach seinen Vorstellungen. Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika wirkt er neben dem jungen
deutschen Nationalteam seltsam überflüssig.
Deutsche Nationalspieler bei einer Safari: „Mit
MA
RK
US
GIL
LIA
R /
DP
A
Sport
OLIV
ER
LA
NG
/ D
DP
MA
RK
US
GIL
LIA
R /
GE
S-S
PO
RT
FO
TO
Bundestrainer Löw, DFB-Boss Zwanziger: Der Eindruck, dass etwas zerrissen ist
Zwanziger hat sich bemüht, durch viel-fältige Erklärungen und Solidaritätsadres-sen die Lage zu beruhigen, aber es bleibtder Eindruck, dass etwas zerrissen ist zwi-schen ihm und Joachim Löw. Schon vorvier Jahren schienen es die Funktionäregewesen zu sein, die Jürgen Klinsmann,den Sommermärchenmacher, am Endeso verärgerten, dass er ging.
Von 2006 blieb ein strahlender Klins-mann, eine Erinnerung an Theo Zwanzi-ger gibt es nicht. Das könnte ihm wiederpassieren. Je erfolgreicher und schönerdie junge deutsche Nationalmannschaftin Südafrika spielte, desto absurder er-schien es, dass man ihrem Trainer keinenneuen Vertrag gegeben hatte. Die Fuß-baller wirkten immer weniger deutsch,die Funktionäre immer mehr.
Deswegen gab es für Theo Zwanzigerhier in Südafrika vor allem eine Aufgabe.Er musste als Teil dieser neuen, jungenMannschaft empfunden werden.
Auf der Pressekonferenz nach dem ers-ten Spiel der Deutschen lobte Zwanzigerden Bundestrainer so euphorisch, dassman den Eindruck hatte, er wolle ihn hei-raten. Deutschland hatte gegen Australienbrilliert, und Theo Zwanziger erklärte die
jungen Spieler zu Botschaftern eines neu-en, leichten Deutschlands. Er sagte, dasser Joachim Löw, der diese Mannschaft ge-formt habe, „sehr, sehr schätze“ und „sehr,sehr glücklich“ sei, ihn als Bundestrainerzu haben. Er bedankte sich auch beimTeammanager Oliver Bierhoff, der nochvor kurzem als geldgieriger Schuldiger fürdie gescheiterten Vertragsverhandlungengalt, und beim Mediendirektor HaraldStenger, den Zwanziger noch vor einemhalben Jahr entmachtet hatte. Er liebte siejetzt alle. Zwanziger saß zwischen Stengerund Löw auf der Tribüne und hielt seineErgebenheitsadresse. Löw hatte die Lip-pen gespitzt, als wollte er einen Marschdazu pfeifen, Stengers Mundwinkel zogensich abwechselnd nach oben und nach un-ten, als könnte er sich nicht entscheiden,ob er weinen oder lachen sollte.
Einen Tag später saß Zwanziger in derDFB-Lounge des Hotels Sheraton und be-mühte sich, ein etwas genaueres Bild derneuen deutschen Leichtigkeit zu zeich-nen, nicht weniger euphorisch, aber dochgroß genug, dass auch er Platz darin hatte.Er trug ein hellblaues Campinghemd, undmit am Tisch saß Stephan Brause, seinpersönlicher Assistent. Brause servierte
Kaffee, im Fernsehen lief ein Vorrunden-spiel, der Präsident erklärte, dass der Fuß-ball tief in der deutschen Gesellschaft ver-wurzelt sei. Er sprach von der WM 1954,die dem deutschen Volk half, wieder ansich zu glauben. Seine Rede trieb zügigdurch die sechziger und siebziger Jahreauf die neunziger zu, in denen sich plötz-lich eine Nachwuchslücke auftat.
„Das Ergebnis haben wir 1998 bei derWM zum ersten Mal schmerzlich ge-spürt“, sagte Zwanziger und lehnte sichzurück.
Gemeinsam mit seinem Vorgänger Ger-hard Mayer-Vorfelder hat er an einem Sys-tem gearbeitet, das diese Lücke füllen soll-te. Er zerlegt die Idee der deutschen Nach-wuchsförderung 20 Minuten lang bis inihre Einzelteile. Er spricht über Eliteschu-len, Leistungszentren, Bundesliga-Nach-wuchsmannschaften, die in den letztenJahren Spieler wie Mesut Özil, ManuelNeuer, Sami Khedira und Dennis Aogoproduziert haben wie Mikrochips. Zwan-ziger hat viel erreicht in den ersten Jahrenseiner Amtszeit, er hat sich um Frauen,Nachwuchs und Minderheiten gekümmertund manch bewegende Rede gehalten,aber manchmal hatte man den Eindruck,
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 129
diesen Spielern kann Löw ein System spielen, das sowohl erfolgreich als auch attraktiv ist“
dass er das moderne, aufgeschlossene Fuß-balldeutschland als eine Art Königreichbetrachte. Sein Königreich.
Kollegen sagen, dass es für Zwanzigerinzwischen schwer möglich ist, Wider-spruch zu ertragen. Sie berichten von cho-lerischen Ausbrüchen, wenn ihn jemandkritisiert oder das Auto zu spät kommt,das ihn abholen soll. Bei Flügen mit derMannschaft sitzt Zwanziger in der erstenReihe, noch vor dem Trainer und nurknapp hinterm Piloten. Der Sportjourna-list Jens Weinreich, der von Zwanzigerund seinen Anwälten in eine juristischeSchlacht getrieben wurde, weil er es ge-wagt hatte, den Präsidenten in einemBlog zu kritisieren, hatte das Ge-fühl, dass man ihn zerstören woll-te. „Im Unterschied zur Politikgibt es in diesen Verbänden kei-nerlei Kontrollinstanz, die Präsi-denten können eigentlich nicht ab-gewählt werden. Sie können nurgewählt werden“, sagt Weinreich.
Man kann sich vorstellen, wieschwer es Zwanziger fiel, einenVertrag des Trainerteams zu un-terzeichnen, den nicht er entwor-fen hatte, der Präsident.
„Jeder Trainer braucht aucheine Mannschaft“, sagte Zwanzi-ger irgendwann, am Ende seinerReise durch die Zeit. „Wir sindjetzt vier Jahre weiter, weitere jun-ge Spieler sind nachgerückt, unddie Mannschaft ist spielstärker.Löw glaubt an diese Mannschaft.Mit diesen Spielern kann er einSystem spielen, das sowohl erfolg-reich als auch attraktiv ist. Dubrauchst die Spieler dafür. Die hater jetzt.“
Er sei sehr optimistisch, dassJoachim Löw diese Mannschaftweiterführen will, einfach, weil erdie Mannschaft so gut finde. Zwan-ziger lächelte in seinem Lounge-stuhl, er wirkte in seinem kurz-ärmligen, knapp sitzenden Cam-pinghemd wie eine Mischung auseinem Parteifunktionär und einemGeistlichen. In diesem Moment inder DFB-Lounge sah es so aus, als müsseLöw bei ihm unterschreiben, wenn er wei-ter mit dieser schönen Mannschaft spielenwill. Theo Zwanziger hatte eine Stundegeredet, das Wort Dank, mit dem er nochgestern so verschwenderisch umgegangenwar, fiel nicht ein einziges Mal.
„Darf ich Ihnen jetzt ein Stück Scho-koladenkuchen bringen?“, fragte StephanBrause.
„Gern“, sagte Theo Zwanziger. In den Tagen, nachdem Deutschland
gegen Serbien verloren hatte, wollte derPräsident ursprünglich zusammen mit derFußballerin Steffi Jones und ein paar an-deren Präsidiumsmitgliedern zu einer Rei-se nach Namibia aufbrechen, um dort ir-
gendein Projekt zu besichtigen. Er sagtedie Reise ab, weil er das Gefühl hatte,nun für die Mannschaft da sein zu müs-sen. Er hätte ein schlechtes Gewissen ge-habt, wenn er die Mannschaft „in denschwierigen Tagen vor dem Ghanaspiel“im Stich gelassen hätte.
„Wir sind doch alle ein Team“, sagteZwanziger.
Es war nicht ganz klar, wie seine Un-terstützung für die deutsche National-mannschaft konkret aussah, man kannaber sagen, dass der Präsident in denschweren Tagen vor dem Ghanaspiel imHotel Sheraton eine Präsidiumssitzungdes DFB anleitete, bei der es unter ande-
rem um die Spielklassenstrukturreform,die Vorbereitung des DFB-Bundestags imOktober und die Zukunft von RasenBall-sport Leipzig ging. Und einmal, kurz vordem wichtigen Ghanaspiel, hat er die Präsidiumsmitglieder zum Training derMannschaft geführt. Die meisten Präsidi-umsmitglieder waren schon etwas älter,viele trugen Windjacken und Deutsch-landschals. Sie hatten kleine Fotoapparatedabei, denn es war ihnen versprochenworden, dass sie sich zusammen mit derMannschaft fotografieren lassen können.
Das klappte dann leider nicht, wie ihnen Oliver Bierhoff mitteilen musste.Bierhoff ist der Mann, der sich zwischenMannschaft und Verband bewegt. Es ist
keine leichte Aufgabe, nicht an diesemNachmittag, aber auch sonst nicht. Als ervor sechs Jahren als Teammanager beimDFB anfing, gaben sie ihm ein Büro imKeller, inzwischen hat er eines mit Fens-tern, aber die Hierarchien sind geblieben.Die in der Nationalmannschaft ist ganzflach, sagt Bierhoff, die im DFB sieht eheraus wie ein Pyramide. Ganz oben in derSpitze sitzt Theo Zwanziger, dessen Hander nun auf der Gästetribüne schüttelte.Bierhoff bezeichnet ihr Verhältnis als in-takt. Er sagt aber auch, dass er die Weltdes DFB nicht ändern könne. Ein paarPräsidiumsmitglieder machten Fotos vonBierhoff und Zwanziger. Sie waren na-
türlich ein bisschen enttäuscht we-gen des Mannschaftsfotos, weil sieja schon auf der Safari vorhin kei-nen Löwen gesehen hatten.
„Ihr werdet gegen Ghana Lö-wen sehen“, rief Theo Zwanziger,„die deutschen Löwen.“ Die Prä-sidiumsmitglieder lachten. Einigegratulierten ihrem Präsidentennachträglich zum 65. Geburtstag.Die Leute in den Windjacken ge-hören zu den Leuten, die ihn wählen.
Irgendwann zog sich Zwanzigerauf die Tribüne des Stadions zu-rück. Er setzte sich in die obereReihe ganz nach außen und sahschweigend der Nationalmann-schaft zu, die dort unten auf demRasen eine Art Rugby spielte. Erschien sehr weit weg vom Teamzu sein, ein Zuschauer nur, einerder Rentner, die beim Training amZaun stehen, um am Leben teil-zuhaben. Man musste an das Por-trät denken, das anlässlich seines65. Geburtstags in der „Bunten“erschienen war. Da redete erübers Fahrradfahren, seine Enkelund über die Frau, mit der er seitüber 40 Jahren verheiratet ist. Siesucht ihm die Hemden und Kra-watten aus und weiß, dass sie ihnzwei Stunden vor einem wichti-gen Spiel nicht mehr ansprechendarf.
Aber dann gewannen die Deutschendas schwere Spiel gegen Ghana, und dasLeben ging weiter. Die Präsidiumsmitglie-der fuhren nach Hause, Zwanziger trafsich mit dem EntwicklungshilfeministerDirk Niebel, der es gerade auch nichtleicht hat, er öffnete einen Brief, in demdeutsche Sportjournalisten sich für denMediendirektor Stenger stark machten,der bei ihm in Ungnade gefallen war, eraß Schokoladenkuchen und wartete dar -auf, dass ihn die deutsche Nationalmann-schaft brauchte.
Wenn man Zwanziger und seinen Ge-neralsekretär Niersbach fragt, was dieDFB-Delegation während einer Weltmeis-terschaft eigentlich so macht, ist viel von
Sport
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0130
Fan des deutschen Teams: „Sehr, sehr glücklich“
BO
RIS
RO
ES
SLE
R /
DP
A
gestern und morgen die Rede, von denProblemen bei der WM 1994, von Rudi,Jürgen und Lothar sowie von der Jubilä-umsveranstaltung zur 20-jährigen deut-schen Fußballeinheit im Herbst, wenigervom Heute, das Mesut Özil, Thomas Mül-ler sowie Oliver Bierhoff und JoachimLöw gehört.
„Dr. Zwanziger und ich praktiziereneine klare Aufgabenteilung, die von gro-ßem gegenseitigem Vertrauen geprägt ist“,sagt Niersbach. „In die Turnierabläufe umdie Mannschaft mischen wir uns nicht ein,das ist Sache der sportlichen Leitung.“
Zwanziger sagt, dass er in Südafrikableibe, bis Philipp Lahm den Weltpokalin Empfang nehme oder die deutscheMannschaft ausscheide. Zwischen beidenMöglichkeiten liegt eine große Leere, diemit gelegentlichen Besuchen beim deut-schen Botschafter gefüllt wird oder mitder Einweihung eines Bolzplatzes in einerTownship. Er ist immer noch ein König,aber er hat hier in Südafrika kein Reichund auch kein Volk. Er hat nur StephanBrause.
Nach dem Englandsieg treten Brauseund Zwanziger als Erste aus der Tür, vorder die internationale Presse wartet, umWayne Rooney zu interviewen sowie Miroslav Klose und Sami Khedira. Einuntersetzter älterer Herr und ein großer,kahlköpfiger junger, die in riesigeDeutschlandschals gehüllt sind. Sie sehenaus wie zwei Schlachtenbummler, die sichim Bauch des Stadions von Bloemfonteinverlaufen haben, und werden von den an-wesenden Journalisten auch nicht beläs-tigt. Am Ende des Gangs entdeckt TheoZwanziger zwei Kollegen von der „SportBild“, stürzt auf sie zu und erklärt ihnenatemlos, dass das, was sie eben gesehenhaben, dieses großartige, wunderschönedeutsche Angriffsspiel, Produkt der DFB-Nachwuchsarbeit sei. Die Worte „Leis-tungszentren“ und „Eliteschulen“ und„Talentecamps“ wirbeln durch die MixedZone.
Dann zieht Theo Zwanziger weiter zurARD-Kamera und von da in den Bus, derihn auf seinen Weg zurück nach Deutsch-land bringt, weil er hier gerade nicht ver-misst wird. In Altendiez, dem Dörfchenam Westerwald, musste er darunter viel-leicht am allerwenigsten leiden. In Alten-diez gibt es den Salon Doris, die Jagdstu-be Hartenfels, das Sonnenstudio Lukasund einen Fußballplatz. Es gibt keine Vu-vuzelas und kein Hupen, ab und zu belltein Hund, ansonsten schnurren in Alten-diez nur die Rasenmäher. Wer von dortzu einer Weltmeisterschaft aufbricht,muss sich wieder einigermaßen bedeut-sam fühlen.
Am vorigen Freitagmittag landete derPräsident in Kapstadt, vor der Kanzlerin,und wartete mit neuer Kraft darauf, ge-braucht zu werden. Es schien, als sei ernie weg gewesen. ALEXANDER OSANG
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 131
SPIEGEL: Mr. Tshabalala,mit Ihrem fulminantenTor im Eröffnungsspielgegen Mexiko haben Sieim ganzen Land die Be-geisterung für SüdafrikasNationalmannschaft ent-
facht. Am Ende schlug die Elf sogar denFavoriten Frankreich, schied aber als ers-tes WM-Gastgeberteam überhaupt schonnach der Vorrunde aus. War das Ganzefür Sie eine Enttäuschung?Tshabalala: Für mich war es phantastisch,ein ganz großer Erfolg. Es war meine ers-te WM, die erste in Afrika, ich habe daserste Tor geschossen, das ist bislang dasHighlight meiner Karriere.SPIEGEL: Teile der südafrikanischen Pressewerteten das Abschneiden als Flop.Tshabalala: Wir haben unser Bestes gege-ben, haben aber nun mal diese 0:3-Nie-derlage im zweiten Spiel gegen Uruguaykassiert. Beim zweiten Tor kam alles zusammen: Elfmeter gegen uns, Platz -verweis für unseren Torwart, ein überse-henes Abseits. Man kann es nicht mehr ändern. SPIEGEL: Zuletzt wurden Exekutivmitglie-der des südafrikanischen Verbands zitiert,wonach der sportliche Ertrag des Bafana-
* Beim Treffer zum 1:0 im WM-Eröffnungsspiel Südafri-ka gegen Mexiko am 11. Juni in Johannesburg.
Teams enttäuschend gewesen sei. Sinddiese Leute ungerecht?Tshabalala: Die meisten von uns hattennoch nie auf diesem hohen Level gespielt.Ich habe solch eine Reaktion dieser Leutenicht erwartet. Kaum sind wir ausgeschie-den, sehen sie alles negativ, es ist das genaue Gegenteil der Unterstützung, diewir zuvor erfahren haben. Erst hieß es,wir hätten das Ansehen der National-mannschaft total verändert und wir könn-ten stolz sein. Ich bleibe dabei: Wir habenden Südafrikanern Freude gebracht. Wiralle haben zusammen gewonnen, schwar-ze, weiße, alle Südafrikaner. SPIEGEL: Hat diese Erfahrung Ihr Lebenverändert?Tshabalala: Sicher. Ich habe die Menschenstolz gemacht mit meinem Einsatz undmeiner Leistung. So etwas vergisst mannicht.SPIEGEL: Der Anspruch war, dass dieMannschaft mit begeisterndem Fußballdas zerrissene Land einen sollte. HabenSie diese Verantwortung gespürt?Tshabalala: Gespürt schon. Als wir EndeApril aus dem Trainingslager in Deutsch-land zurückkamen und dann die fünfFreundschaftsspiele zu Hause bestritten.Da begannen wir, die Leute zu überzeu-gen und gewannen ihre Herzen.SPIEGEL: Zwei Tage vor dem ersten Spielfuhren Sie auf Anordnung des Verbands
S P I E G E L - G E S P R Ä C H
„Wir haben Freude gebracht“Südafrikas WM-Star Siphiwe Tshabalala, 25, über den Stolz
seiner Landsleute auf das Team Bafana Bafana, seine Kindheit inder Township Phiri und ein Treffen mit Nelson Mandela
Profi Tshabalala (r.)*: „Am Strafraum haue ich öfter mal mit links drauf“
CLIV
E M
AS
ON
/ G
ET
TY
IM
AG
ES
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0134
im offenen Bus durch Johannesburg. Trai-ner Carlos Alberto Parreira war nicht be-geistert.Tshabalala: Vielleicht war das im Sinne einer guten Vorbereitung nicht klug. Aberdie Aktion hat uns klargemacht, dass dieganze Nation hinter uns stand. Da warenfast 200 000 Menschen auf der Straße,kreischend, fahnenschwenkend, in ihreVuvuzelas blasend. Da rauszugehen warso was von emotional, das war wirklichganz stark. Wir wussten dann: All dieseLeute würden uns helfen, auch durchschwierige Zeiten. Wir wussten aber auch:Wir durften die jetzt nicht ent täuschen.SPIEGEL: Wie war es bei Ihnen zu Hause?Tshabalala: In der Nacht vor dem erstenSpiel bekam ich einen Anruf von meinerFamilie: Hör mal, die Leute aus unse rerGegend sind alle auf der Straße und singen! SPIEGEL: Sie kommen aus der TownshipPhiri, einem Teil von Soweto. Tshabalala: Ich hatte dort eine schöneKindheit. Meine Familie war nicht arm.Auch nicht reich, so Durchschnitt, würdeich sagen. Das Leben war okay. Mein Va-ter arbeitete als Taxifahrer. Wir wohntenim Haus meiner Großeltern, meine Cou-sins und Cousinen, meine Eltern, Onkel,Tanten, alle. Es gab das große Haus undnoch Zimmer außerhalb. SPIEGEL: Wie viele Leute lebten unter ei-nem Dach?Tshabalala: Da muss ich zählen. Also, umdie zehn. Ich konnte zum Glück meinenEltern inzwischen ein Haus kaufen, ichselbst bin auch in ein eigenes Haus um-gezogen, in Littlefox. Ich habe auch einekleine Schwester, sie ist elf, sie spielt auch
schon ein bisschen Fußball. Ich kann Ih-nen ein Foto von ihr auf meinem Handyzeigen.SPIEGEL: Ihr Mannschaftskapitän AaronMokoena erzählte, dass er mit elf Jah-ren versteckt und dann in Mädchen -kleider gesteckt werden musste, weil einMob in den Häusern seiner Township Jungen suchte, um sie zu töten. Habenauch Sie politische Unruhen hautnah erlebt?Tshabalala: Nein, aber meine Eltern. BeimAufstand in Soweto 1976 waren sie Stu-denten. SPIEGEL: Damals wurden Hunderte Schwar-ze erschossen.Tshabalala: Da waren sie in der Nähe. ZuHause wurde oft davon erzählt.SPIEGEL: Wie viele der Landessprachensprechen Sie?Tshabalala: Drei. Zulu, Englisch und Sotho.Dann spreche ich noch drei andere, abernicht fließend, und Afrikaans kann icheinigermaßen verstehen. Wie viele Spra-chen haben Sie?SPIEGEL: In Deutschland haben wir eine.Tshabalala: Oh. Wirklich?
SPIEGEL: Welche Schulausbildung habenSie?Tshabalala: Ich war auf drei Schulen, habeden Abschluss der Oberschule gemacht.Dann musste ich mich entscheiden, obich studieren sollte oder professionell Fuß-ball spielen.SPIEGEL: Das fiel wohl nicht so schwer?Tshabalala: Ich habe schon mit sieben inPhiri Fußball gespielt. Erst bei Phiri Arse-nal, später bei den Phiri Movers. Ich warschon mal als Jugendlicher bei meinemheutigen Club Kaizer Chiefs. Aber da fingdas Training immer um vier Uhr an, unddie Schule ging bis vier. Also habe ichmich für die Schule entschieden und gingzurück nach Phiri, dann zu Moroka Swal-lows. Da musste ich mit dem Zug zumTraining fahren. Ich habe immer am Bahn-steig gewartet, bis jemand kam, der mirGeld geben oder seine Monatskarte bor-gen konnte. Wenn keiner kam, ging ichzu Fuß. Das dauerte etwa eine Stunde. SPIEGEL: Sie wurden als Zweitligaspielererstmals in die Nationalmannschaft be -rufen.Tshabalala: Ja, ich spielte Zweite Liga beiAlexandra United und bei Free State, wis-sen Sie, wo das ist? Das ist von Johannes-burg vier Autostunden entfernt. Als ichdorthin ging, war ich 20. SPIEGEL: Wann spielten Sie das erste MalFußball mit Weißen?Tshabalala: Als Kind nie. Mit Kaizer Chiefsin der Jugend habe ich gegen Weiße ge-spielt. Die Weißen sind nicht so talentiert,aber sie wollen lernen und machen die
* Mit den Redakteuren Jörg Kramer und Cathrin Gilbertin Johannesburg.
Tshabalala beim SPIEGEL-Gespräch*
„Sie mögen meinen Namen? Cool“
FIR
O S
PO
RT
PH
OTO
Tshabalala-Fans in Soweto: „Hör mal, die Leute aus unserer Gegend sind alle auf der Straße und singen!“
YA
SU
YO
SH
I C
HIB
A /
AF
P
Grundlagenarbeit richtig. Lauftraining,akkurate Pässe, freilaufen, diese Sachen.Das lernen sie sehr sorgfältig. Sie verste-hen es, im Leben erfolgreich zu sein. Wirdagegen sind geschickt, aber eher träge. SPIEGEL: Genau so ein Tor wie gegen Me-xiko, mit links in den Winkel, sollen Siemit 17 schon mal geschossen haben, sosagt es Ihr Jugendcoach, und zwar im Ba tho-Batsho-Bakopane-Cup. Tshabalala: Wie, das weiß er noch? Umehrlich zu sein: Ich schieße oft solcheTore. Am Strafraum haue ich öfter malmit links drauf. SPIEGEL: Das wussten Ihre WM-Gegneraber nicht.Tshabalala: Genau das war ihr Problem.SPIEGEL: Ihre Mannschaft war vorher dreiMonate in Trainingscamps. Musste dassein?Tshabalala: Wir haben dort unsere Identi-tät im Spiel gesucht. Wir haben einenMix gefunden zwischen dem technischguten südamerikanischen Stil und demtaktisch disziplinierten europäischen. Dashat uns besser gemacht. Es war anstren-gend, klar. Man muss sich aber fragen,was man will im Leben. Dann muss man
auch dafür arbeiten. Zweimal am Tag trai-nieren, andere Teams anhand von DVDanalysieren.SPIEGEL: Nach dem Sieg gegen Frankreichund dem WM-Aus kam StaatspräsidentJacob Zuma in die Mannschaftskabine.Was wollte er?Tshabalala: Wir waren überrascht, ihn dazu sehen. Er baute uns auf mit Worten,bedankte sich. Er sagte, die Nation seistolz auf uns. SPIEGEL: Kennen Sie „Invictus“, den Filmvon Clint Eastwood über den WM- Triumph der südafrikanischen Rugby-Mannschaft 1995? Sie war ein Symbol derApartheid, aber Nelson Mandela hat sieals Präsident bei der WM unterstützt.Tshabalala: Den Film habe ich mir am Tagvor unserem ersten Spiel angeschaut. ZweiTage vorher hatten wir ihn als Team ge-meinsam gesehen, dann habe ich ihn nochmal allein angeguckt. Ich fand ihn sehr in-spirierend. Da ist der Moment im Film, indem die Dinge schlecht laufen für das Rug-byteam, und Mandela lädt den Kapitänzum Kaffee ein. Er erzählt ihm von seinerZeit im Gefängnis und dem Glauben ansich selbst. Auch wir haben Mandela ge-
troffen, eine Woche vor dem Eröffnungs-spiel hat er uns im Haus der Mandela-Stif-tung empfangen. Er trug ein Trikot mitder Nummer unseres Kapitäns. Mokoenahat uns alle der Reihe nach vorgestellt. SPIEGEL: Was bedeutet diese WM für diesüdafrikanische Nation?Tshabalala: Es ist nicht nur der Fußball,der zählt. Es geht auch um die ganzenJobs, die geschaffen wurden. SPIEGEL: Die Fifa spricht immer beschwö-rend von einem Vermächtnis der WM.Welches Erbe wird sie den Menschen hin-terlassen?Tshabalala: Manche Jobs enden natürlichnach der WM. Aber schon die Zeitspanne,in der die Leute Arbeit hatten und dasGeld verdienen durften, ist ein großesErbe. Die Menschen wurden wie verspro-chen bezahlt, das ist nicht selbstverständ-lich, und sie konnten Geld zurücklegen.Wir Fußballer haben auch versucht, durchSpenden an humanitäre Stiftungen zu helfen.SPIEGEL: Nur eines von sechs afrikanischenTeams, das aus Ghana, überstand bei derWM die Vorrunde. Wie kann dem afrika-nischen Fußball geholfen werden?Tshabalala: Ich glaube, die europäischenSpieler werden schon als Kinder zu einergewissen Professionalität erzogen, sie ha-ben eine gute Infrastruktur. Mit 16, 17 Jah-ren erreichen sie deshalb schon ein hohesLeistungsniveau, mit 22 Jahren sind sieWeltklassespieler. Man braucht aber auchdie richtige Mentalität. Du musst dichzwingen können, hart zu arbeiten.SPIEGEL: Braucht Afrika mehr gute Trainer?Tshabalala: Es gibt keine Kontinuität,wenn viele ausländische Trainer nur füreinen kurzen Job nach Afrika kommen.Sie müssen sich über den Stil des Fußballsund die Kultur hier informieren, bevorsie ein afrikanisches Team trainieren. Beiuns, bei den Kaizer Chiefs, hat sich dieJugendarbeit schon sehr gebessert, dieTrainer kommen von hier.SPIEGEL: In Europa kennt man Sie nun,Ihr Tor hat Sie berühmt gemacht, die Leu-te mögen Ihren Namen. Möchten Sie dortspielen?Tshabalala: Sie mögen meinen Namen?Cool. Natürlich träume ich von Europa.Am liebsten möchte ich schon zur nächs-ten Saison dorthin. Welches Land, ist egal. SPIEGEL: In der südafrikanischen Liga sol-len Top-Spieler rund 150000 Rand, gut15000 Euro also, im Monat verdienen …Tshabalala: … im Monat? Nein, vielleicht3000 Euro. Selbst das verdiene ich nicht.SPIEGEL: Haben Sie eigentlich eine WM-Prämie bekommen für die Freude, dieSie im Land verbreitet haben?Tshabalala: Ja, sie haben Geld geschickt,aber schon vor der WM. Für die Teil -nahme. SPIEGEL: Mr. Tshabalala, wir danken Ihnenfür dieses Gespräch.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 135
Sport
Südafrikanische Nationalspieler beim Torjubel: „Ich träume von Europa“
HE
NR
Y R
OM
ER
O /
RE
UT
ER
S
Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax -2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)
E-Mail [email protected] · SPIEGEL ONLINE www.spiegel.de
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0136
Impressum Service
HERAUSGEBER Rudolf Augstein (1923 – 2002)
CHEFREDAKTEURE Georg Mascolo, Mathias Müller von Blumencron (V. i. S. d. P.)
STELLV. CHEFREDAKTEUR Dr. Martin Doerry
DEUTSCHE POLIT IK · HAUPTSTADTBÜRO Leitung: Dirk Kurbjuweit,Markus Feldenkirchen (stellv.), Michael Sauga (stellv.). RedaktionPolitik: Ralf Beste, Petra Bornhöft, Ulrike Demmer, Christoph Hick-mann, Kerstin Kullmann, Ralf Neukirch, René Pfister, ChristianSchwägerl, Merlind Theile. Autoren, Reporter: Henryk M. Broder,Christoph Schwennicke
Meinung: Dr. Gerhard Spörl
Redaktion Wirtschaft: Markus Dettmer, Katrin Elger, Alexander Neu-bacher, Christian Reiermann, Wolfgang Johannes Reuter. Autor: JanFleischhauer
DEUTSCHLAND Leitung: Konstantin von Hammerstein, Alfred Wein-zierl. Redaktion: Jan Friedmann, Michael Fröhlingsdorf, CarstenHolm (Hausmitteilung, Online Koordination), Ulrich Jaeger, GuidoKleinhubbert, Bernd Kühnl, Gunther Latsch, Udo Ludwig, ChristophScheuermann, Andreas Ulrich, Dr. Markus Verbeet. Autoren, Reporter: Jürgen Dahlkamp, Dr. Thomas Darnstädt, Gisela Fried-richsen, Bruno Schrep, Hans-Ulrich Stoldt, Dr. Klaus Wiegrefe
Berliner Büro Leitung: Holger Stark, Frank Hornig (stellv.). Redak-tion: Markus Deggerich, John Goetz, Wiebke Hollersen, Sven Röbel,Marcel Rosenbach, Michael Sontheimer, Andreas Wassermann, PeterWensierski. Autor: Stefan Berg
WIRTSCHAF T Leitung: Armin Mahler, Thomas Tuma. Redaktion:Susanne Amann, Beat Balzli, Markus Brauck, Isabell Hülsen, Alex-ander Jung, Nils Klawitter, Martin U. Müller, Jörg Schmitt, JankoTietz. Autoren, Reporter: Markus Grill, Dietmar Hawranek, MichaelaSchießl
AUSLAND Leitung: Hans Hoyng, Dr. Christian Neef (stellv.), BrittaSandberg (stellv.), Bernhard Zand (stellv.). Redaktion: Dieter Bednarz, Manfred Ertel, Joachim Hoelzgen, Juliane von Mittelstaedt,Jan Puhl, Mathieu von Rohr, Sandra Schulz, Helene Zuber. Reporter:Clemens Höges, Marc Hujer, Susanne Koelbl, Walter Mayr
Diplomatischer Korrespondent: Dr. Erich Follath
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Johann Grolle, Olaf Stampf.Redaktion: Jörg Blech, Manfred Dworschak, Dr. Veronika Hacken-broch, Julia Koch, Beate Lakotta, Cordula Meyer, Hilmar Schmundt,Matthias Schulz, Samiha Shafy, Frank Thadeusz, Christian Wüst.Autorin: Rafaela von Bredow
KULTUR Leitung: Lothar Gorris, Dr. Joachim Kronsbein (stellv.). Redaktion: Verena Araghi, Lars-Olav Beier, Susanne Beyer, JuliaBonstein, Nikolaus von Festenberg, Dr. Volker Hage, Ulrike Knöfel,Philipp Oehmke, Tobias Rapp, Elke Schmitter, Martin Wolf. Autoren,Reporter: Wolfgang Höbel, Dr. Romain Leick, Matthias Matussek,Katja Thimm, Dr. Susanne Weingarten
KulturSPIEGEL: Marianne Wellershoff (verantwortlich). Tobias Becker, Anke Dürr, Daniel Sander, Claudia Voigt
GESELLSCHAF T Leitung: Matthias Geyer, Cordt Schnibben, BarbaraSupp (stellv.). Redaktion: Hauke Goos, Barbara Hardinghaus, RalfHoppe, Ansbert Kneip, Dialika Krahe. Reporter: Uwe Buse, UllrichFichtner, Jochen-Martin Gutsch, Thomas Hüetlin, Alexander Osang
S P O RT Leitung: Gerhard Pfeil, Michael Wulzinger. Redaktion: Cathrin Gilbert, Maik Großekathöfer, Detlef Hacke, Jörg Kramer
SONDERTHEMEN Leitung: Dietmar Pieper, Norbert F. Pötzl (stellv.).Redaktion: Karen Andresen, Annette Bruhns, Angela Gatterburg,Annette Großbongardt, Uwe Klußmann, Joachim Mohr, Bettina Musall, Dr. Johannes Saltzwedel, Dr. Rainer Traub
PERSONALIEN Katharina Stegelmann; Petra Kleinau
C H E F VO M D I E N ST Thomas Schäfer, Katharina Lüken (stellv.), Holger Wolters (stellv.)
SCHLUSSREDAKTION Gesine Block, Regine Brandt, Reinhold Buss-mann, Lutz Diedrichs, Bianca Hunekuhl, Anke Jensen, Maika Kunze,Stefan Moos, Reimer Nagel, Dr. Karen Ortiz, Manfred Petersen,Fred Schlotterbeck, Tapio Sirkka, Ulrike WallenfelsSonderhefte: Karl-Heinz Körner
BILDREDAKTION Michael Rabanus (verantwortlich für Innere Heft-gestaltung), Claudia Jeczawitz, Claus-Dieter Schmidt; Sabine Dött-ling, Torsten Feldstein, Thorsten Gerke, Andrea Huss, Antje Klein,Elisabeth Kolb, Matthias Krug, Peer Peters, Karin Weinberg, AnkeWellnitz. E-Mail: [email protected] Foto USA: Susan Wirth, Tel. (001212) 3075948
GRAFIK Martin Brinker, Johannes Unselt (stellv.); Cornelia Baumer-mann, Ludger Bollen, Thomas Hammer, Gernot Matzke, CorneliaPfauter, Julia Saur, Michael Walter
LAYOUT Wolfgang Busching, Ralf Geilhufe, Reinhilde Wurst; MichaelAbke, Christel Basilon, Katrin Bollmann, Claudia Franke, BettinaFuhrmann, Petra Gronau, Kristian Heuer, Sebastian Raulf, BarbaraRödiger, Martina Treumann, Doris WilhelmSonderhefte: Jens Kuppi, Rainer Sennewald
PRODUKTION Christiane Stauder, Petra Thormann
T ITELBILD Stefan Kiefer; Iris Kuhlmann, Gershom Schwalfenberg,Arne Vogt
REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND
BERL IN Pariser Platz 4a, 10117 Berlin; Deutsche Politik, WirtschaftTel. (030) 886688-100, Fax 886688-111; Deutschland, Wissenschaft,Kultur, Gesellschaft Tel. (030) 886688-200, Fax 886688-222
DRESDEN Steffen Winter, Wallgäßchen 4, 01097 Dresden, Tel. (0351)26620-0, Fax 26620-20
DÜSSELDORF Georg Bönisch, Andrea Brandt, Frank Dohmen, Bar-bara Schmid-Schalenbach, Carlsplatz 14/15, 40213 Düsseldorf, Tel.(0211) 86679-01, Fax 86679-11
FRANKFURT AM MAIN Matthias Bartsch, Simone Kaiser, ChristophPauly, Oberlindau 80, 60323 Frankfurt am Main, Tel. (069) 9712680,Fax 97126820
KARLSRUHE Dietmar Hipp, Waldstraße 36, 76133 Karlsruhe, Tel.(0721) 22737, Fax 9204449
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Conny Neumann, Rosental 10, 80331München, Tel. (089) 4545950, Fax 45459525
STUT TGART Eberhardstraße 73, 70173 Stuttgart, Tel. (0711) 664749-20, Fax 664749-22
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND
ABU DHABI Alexander Smoltczyk, P.O. Box 35 209, Abu Dhabi
BANGKOK Thilo Thielke, Tel (0066) 22584037
BRÜSSEL Hans-Jürgen Schlamp, Bd. Charlemagne 45, 1000 Brüssel,Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436
ISTANBUL Daniel Steinvorth, PK 90 Beyoglu, 34431 Istanbul, Tel.(0090212) 2432080, Fax 2432079
JERUSALEM Christoph Schult, P.O. Box 9369, Jerusalem 91093, Tel.(00972) 26447494, Fax 26447501
KAIRO Volkhard Windfuhr, 18, Shari’ Al Fawakih, Muhandisin, Kairo,Tel. (00202) 37604944, Fax 37607655
LONDON Marco Evers, Suite 266, 33 Parkway, London NW1 7PN,Tel. (0044207) 2430889, Fax 2430899
MADRID Apartado Postal Número 100 64, 28080 Madrid, Tel. (0034)650652889
MOSKAU Matthias Schepp, Ul. Bol. Dmitrowka 7/5, Haus 2, 125009Moskau, Tel. (007495) 96020-95, Fax 96020-97
NAIROBI Horand Knaup, P.O. Box 1402-00621, Nairobi, Tel. (00254)207123387
NEW DELHI Padma Rao, 101, Golf Links, New Delhi 110003, Tel.(009111) 24652118, Fax 24652739
NEW YORK Klaus Brinkbäumer, Thomas Schulz, 10 E 40th Street,Suite 3400, New York, NY 10016, Tel. (001212) 2217583, Fax 3026258
PARIS Dr. Stefan Simons, 12, Rue de Castiglione, 75001 Paris, Tel.(00331) 58625120, Fax 42960822
P E K I N G Andreas Lorenz, Sanlitun Dongsanjie Gongyu 2-1-31, Peking 100 600, Tel. (008610) 65323541, Fax 65325453
R I O D E JA N E I RO Jens Glüsing, Caixa Postal 56071, AC Urca, 22290-970 Rio de Janeiro-RJ, Tel. (005521) 2275-1204, Fax 2543-9011
ROM Fiona Ehlers, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel. (003906) 6797522,Fax 6797768
SAN FRANCISCO Dr. Philip Bethge, P.O. Box 151013, San Rafael,CA 94915, Tel. (001415) 7478940
SHANGHAI Dr. Wieland Wagner, Grosvenor House 8 E/F, JinjiangHotel, 59 Maoming Rd. (S), Shanghai 200020, Tel. (008621) 54652020,Fax 54653311
SINGAPUR Jürgen Kremb, 5 Hume Avenue # 05-04, Hume Park 1,598720 Singapur, Tel. + Fax (0065) 63142004
STAVANGER Gerald Traufetter, Rygjaveien 33a, 4020 Stavanger, Tel.(0047) 51586252, Fax 51583543
WARSCHAU P. O. Box 31, ul. Waszyngtona 26, PL- 03-912 Warschau,Tel. (004822) 6179295, Fax 6179365
WASHINGTON 1202 National Press Building, Washington, D.C. 20045,Tel. (001202) 3475222, Fax 3473194
DOKUMENTATION Dr. Hauke Janssen, Axel Pult (stellv.), Peter Wahle(stellv.); Jörg-Hinrich Ahrens, Dr. Anja Bednarz, Ulrich Booms, Dr. Helmut Bott, Viola Broecker, Dr. Heiko Buschke, Heinz Egleder,Johannes Eltzschig, Johannes Erasmus, Klaus Falkenberg, CordeliaFreiwald, Anne-Sophie Fröhlich, Dr. André Geicke, Silke Geister,Catrin Hammy, Thorsten Hapke, Susanne Heitker, Carsten Hellberg,Stephanie Hoffmann, Bertolt Hunger, Joachim Immisch, Marie-OdileJonot-Langheim, Michael Jürgens, Renate Kemper-Gussek, JessicaKensicki, Jan Kerbusk, Ulrich Klötzer, Anna Kovac, Sonny Krauspe,Peter Lakemeier, Dr. Walter Lehmann, Michael Lindner, Dr. PetraLudwig-Sidow, Rainer Lübbert, Nadine Markwaldt-Buchhorn, Dr. Andreas Meyhoff, Gerhard Minich, Cornelia Moormann, TobiasMulot, Bernd Musa, Nicola Naber, Werner Nielsen, Margret Nitsche,Malte Nohrn, Sandra Öfner, Thorsten Oltmer, Andreas M. Peets,Thomas Riedel, Andrea Sauerbier, Maximilian Schäfer, Marko Schar-low, Rolf G. Schierhorn, Mirjam Schlossarek, Dr. Regina Schlüter-Ahrens, Mario Schmidt, Andrea Schumann-Eckert, Ulla Siegenthaler,Rainer Staudhammer, Dr. Claudia Stodte, Stefan Storz, RainerSzimm, Dr. Eckart Teichert, Nina Ulrich, Hans-Jürgen Vogt, UrsulaWamser, Peter Wetter, Kirsten Wiedner, Andrea Wilkens, HolgerWilkop, Karl-Henning Windelbandt, Anika Zeller
LESER-SERVICE Catherine Stockinger
N AC H R I C H T E N D I E N ST E AFP, AP, dpa, Los Angeles Times / Washington Post, New York Times, Reuters, sid
SPIEGEL -VERLAG RUDOLF AUGSTEIN GMBH & CO. KG
Verantwortlich für Anzeigen: Norbert Facklam
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 64 vom 1. Januar 2010Mediaunterlagen und Tarife: Tel. (040) 3007-2540, www.spiegel-qc.de
Commerzbank AG Hamburg, Konto-Nr. 6181986, BLZ 200 400 00
Verantwortlich für Vertrieb: Thomas Hass
Druck: Prinovis, DresdenPrinovis, Itzehoe
VERLAGSLEITUNG Fried von Bismarck, Matthias Schmolz
GESCHÄF TSFÜHRUNG Ove Saffe
DER SPIEGEL (USPS No. 0154520) is published weekly by SPIEGEL VERLAG. Subscription price for USA is $340 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St, Englewood, NJ 07631. Periodicals postage is paid at Englewood, NJ 07631, and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to: DER SPIEGEL, GLP, PO Box 9868, Englewood, NJ 07631.
LeserbriefeSPIEGEL-Verlag, Brandstwiete 19, 20457 HamburgFax: (040) 3007-2966 E-Mail: [email protected] zu SPIEGEL-Artikeln / RechercheTelefon: (040) 3007-2687 Fax: (040) 3007-2966E-Mail: [email protected] für Texte und Grafiken:Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schrift-licher Genehmigung des Verlags. Das gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Mail-boxen sowie für Vervielfältigungen auf CD-Rom.Deutschland, Österreich, Schweiz:Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: [email protected]übriges Ausland:New York Times Syndication Sales, ParisTelefon: (00331) 53057650 Fax: (00331) 47421711für Fotos:Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: [email protected]ücher, SPIEGEL-TV-DVDs, Titelillustra -tionen als Kunstdruck und eine große Auswahl an weiteren Büchern, CDs, DVDs und Hörbüchern unterwww.spiegel.de/shopAbonnenten zahlen keine Versandkosten.SPIEGEL-Einzelhefte (bis drei Jahre zurückliegend)Telefon: (040) 3007-2948Fax: (040) 3007-857050E-Mail: [email protected]Ältere SPIEGEL-AusgabenTelefon: (08106) 6604 Fax: (08106) 34196E-Mail: [email protected]önlich erreichbar Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,Sa. 10.00 – 16.00 UhrSPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,20637 HamburgUmzug/Urlaub: 01801 / 22 11 33 (3,9 Cent/Min.)*Fax: (040) 3007-857003Zustellung: 01801 / 66 11 66 (3,9 Cent/Min.)*Fax: (040) 3007-857006* aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.Service allgemein: (040) 3007-2700Fax: (040) 3007-3070E-Mail: [email protected] SchweizTelefon: (0049) 40- 3007-2700 Fax: (0049) 40-3007-3070E-Mail: [email protected] für BlindeAudio Version, Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.Telefon: (06421) 606265 Fax: (06421) 606259E-Mail: [email protected] Version, Stiftung Blindenanstalt Frankfurt am MainTelefon: (069) 955124-15 Fax: (069) 5976296E-Mail: [email protected]: zwölf Monate € 189,80Sonntagszustellung per Eilboten Inland: € 709,80Studenten Inland: 52 Ausgaben € 145,60 inkl.6-mal UniSPIEGELSchweiz: zwölf Monate sfr 351,00Europa: zwölf Monate € 244,40Außerhalb Europas: zwölf Monate € 322,40DER SPIEGEL als E-Paper:zwölf Monate € 189,80Halbjahresaufträge und befristete Abonnementswerden anteilig berechnet.
Abonnementsbestellungbitte ausschneiden und im Briefumschlag senden anSPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg – oder per Fax: (040) 3007-3070.Ich bestelle den SPIEGEL❏ für € 3,65 pro Ausgabe (Normallieferung)❏ für € 13,65 pro Ausgabe (Eilbotenzustellung amSonntag) mit dem Recht, jederzeit zum Monatsende zu kündigen.Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Heftebekomme ich zurück.Bitte liefern Sie den SPIEGEL an:
Name, Vorname des neuen Abonnenten
Straße, Hausnummer oder Postfach
PLZ, OrtIch zahle❏ bequem und bargeldlos per Bankeinzug (1/4-jährl.)
Bankleitzahl Konto-Nr.
Geldinstitut❏ nach Erhalt der Jahresrechnung. Ein Widerrufsrecht
besteht nicht.
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten SP10-001-WT127
✂
www.spiegel.de – Schneller wissen, was wichtig ist
Jeden Tag. 24 Stunden.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0 137
Chinesische Schülerinnen in Sachsen: Mit Übersetzungscomputer im Literaturunterricht
SCHULSPIEGEL | Abi für AsienDie deutsche Reifeprüfung ist international kaum etwas wert? Von wegen! InWaldenburg büffeln seit Jahren Schüler aus China – in ihrer Heimat steht der sächsische Ort für höchste Bildung. SPIEGEL ONLINE hat den Unterrichtbegleitet.
SPORT | Schlusspfiff am KapWer wird Weltmeister? In Johannesburg kämpfen die beiden erfolgreichstenTeams der WM 2010 um den Titel. SPIEGEL ONLINE ist live dabei im Soccer-City-Stadion, berichtet mit Liveticker, Porträts und Analysen.
WIRTSCHAFT | Totgesagte leben längerEs wird ein gigantischer Börsengang: Der Pleitekonzern General Motors will bald Milliarden Dollar von Investoren einsammeln. SPIEGEL ONLINEanalysiert, wie es um den Opel-Mutterkonzern wirklich steht.
PANORAMA | Kafka bei der PolizeiSchon 2001 schmiss ein Kölner Polizist im Frust seinen Job hin, doch seineoffiziellen Kündigungspapiere will er nie erhalten haben – seitdem kämpft erfür seine Entlassung. SPIEGEL ONLINE über einen bizarren Behördenstreitund den Showdown vor Gericht.
REISE | Insel der GeschichtenSchafe in der Seilbahn, Seetang im Schwimmbad, Ponys im Armenviertel –Irland überrascht. SPIEGEL ONLINE porträtiert die Insel im Video-Spezial.
| Einsatz in der Todeszone
Sie betonierten den Reaktor zu, schaufeltenradioaktive Trümmer beiseite, ebnetenganze Dörfer ein: Nach dem Super-GAUvon Tschernobyl 1986 schufteten Zehn-tausende Arbeiter im Katastrophengebiet.Anatolij Podlesni war einer von ihnen. Auf einestages.de erinnert er sich an seinedrei Wochen in der Strahlenhölle – und die jahrelangen Qualen danach.
DIENSTAG, 6. 7., 23.00 – 23.50 UHR | VOX
SPIEGEL TV EXTRA
Mayday – Alarm im Cockpit,Teil 4
Eine Dokumentationsreihe über töd-liche Zwischenfälle in der Luftfahrtund die Frage, wie und warum es zusolchen Katastrophen kommt. Dienachgestellten Szenen basieren aufAuswertungen von Flugschreibernund Interviews mit Überlebenden.
SAMSTAG, 10. 7., 21.55 – 23.40 UHR | VOX
SPIEGEL TV SPECIAL
Drama am Himmel –Die Geschichte der fliegendenFlugzeugträger
Die Luftschiffe USS „Macon“ unddie USS „Akron“ waren die einzigenfliegenden Flugzeugträger, die es jegab. Die U. S. Navy hatte sie Anfangder dreißiger Jahre bauen lassen, um sie als Scouts einzusetzen. Dochdas ehrgeizige Projekt war kein Erfolg: 1933 stürzte die „Akron“
während eines Sturms über dem Atlantik ab, zwei Jahre später gerietdie USS „Macon“ in schwere Turbu-lenzen und versank. Durch eineTauchfahrt zu dem Wrack der „Ma-con“ versuchen die Autoren, die letzten offenen Fragen des Unglückszu klären.
SONNTAG, 11. 7., 22.30 – 23.15 UHR | RTL
SPIEGEL TV MAGAZIN
Schweine auf der Durchreise – TierischeZollkontrolle am Frankfurter Flug -hafen; Riskante Befreiungsaktion –Eine Mutter kämpft um ihre Kinder; Eigentum verpflichtet zu gar nichts –Das Horrorhaus von Langen
DP
A
Tierkontrolle beim Zoll
USS „Macon“
AN
NIC
K E
IME
R
SP
IEG
EL T
VS
PIE
GE
L T
V
Nicolas Hayek, 82. „Echte Unternehmersind Künstler, welche die Kreativität undNeugier eines Sechsjährigen behalten ha-ben“, lautete das Credo des Firmengrün-
ders. 1949 war derSohn einer christlichgeprägten Familie,die zur Oberschichtim Libanon gehörte,in die Schweiz gezo-gen. Mitte der Acht -ziger übernahm derinzwischen als Unter-nehmensberater er-folgreiche Hayek mitanderen Industriellen
zwei Schweizer Uhrenfirmen und sanier-te sie mit der Einführung der bunten Plas-tikuhr Swatch. Später baute er die SwatchGroup zum weltgrößten Uhrenherstelleraus. Doch das reichte ihm nicht. Der unkonventionelle Unternehmer wollteauch die Autoindustrie revolutionierenund entwickelte einen Kleinstwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb. Mer -cedes-Benz wagte die Produktion desSmart, allerdings nur mit Verbrennungs-motor. „Ich war einfach zu früh dran“,kommentierte Hayek unverbittert, alsDaimler ein Jahrzehnt später anfing, ei-nen Elektro-Smart zu produzieren. Nico-las Hayek starb am 28. Juni in seinem Firmenbüro in Biel.
Algirdas Brazauskas, 77. Der studierteBauingenieur verstand sich schon 1988bei seiner Ernennung zum Chef der li-tauischen Kommunistischen Partei mehrals Litauer denn als echter Kommunist.Er verurteilte die Annexion seines Hei-matlandes durch Stalin. Nach dem Unab-hängigkeitsreferendum 1991 brachte derals Held gefeierte Brazauskas seine Parteiauf einen sozialdemokratischen Kurs undwurde schließlich 1993 zum Präsidentengewählt. Er führte ein Mehrparteiensys-
tem sowie Litauischals Amtssprache ein.Doch schon nach Ab-lauf seines erstenMandats zog er sichaus der Politik zu-rück: Jüngere Leuteund solche ohne kom-munistische Vergan-genheit sollten dieMacht übernehmen.Mit dieser Haltungverdiente sich Bra -
zauskas Respekt weit über die Landes-grenzen hinaus. 2001 kehrte er an derSpitze einer Linkskoalition als Minister-präsident zurück nach Vilnius. Konse-quent bereitete er seinem Land weiterden Weg in die Nato und in die EU, derLitauen 2004 beitrat. Algirdas Brazauskasstarb am 26. Juni in Vilnius an Krebs.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0138
Register
Rudolf Leopold, 85. Sein erstes Kunstwerkkaufte sich der österreichische Sammlerim Jahr 1947 – zu einer Zeit, als der Groß-teil der Bevölkerung hungern musste. DerStudent investierte das Geld, das er sichmit Nachhilfestunden verdient hatte, inein Gemälde des Biedermeier-MalersFriedrich Gauermann. Im Laufe seines Lebens sollten mehr als 5000 Kunstwerkedazukommen: zunächst Malerei des 19.Jahrhunderts, später Gustav Klimt, EgonSchiele, Oskar Kokoschka, auch Otto Muehl. Seine Kunstsammlung wurde zurbedeutendsten privaten Sammlung Öster-reichs, deren Wert bereits Mitte der Neun-ziger auf 575 Millionen Euro geschätztwurde. Seit 2001 wird sie in dem nach ihmbenannten Leopold Museum, einem wei-ßen Kubus im Wiener Museumsquartier,
gezeigt. Umstritten war der Kunstliebha-ber vor allem deshalb, weil er verdächtigtwurde, wissentlich NS-Raubkunst erwor-ben zu haben. Er beharrte jedoch darauf,als Privatsammler nicht zur Restitutionverpflichtet zu sein. Rudolf Leopold starbam 29. Juni in Wien.
Adam Zielinski, 81. In dem Werk „Zwölfjüdische Erzählungen“ verarbeitete der inDrohobycz bei Lemberg geborene Schrift-steller die Ermordung seiner Eltern durchdie Nazis. Zielinski gehörte zu den wenigender 17000 Juden aus seinem Heimatort, dieden Holocaust überlebten. Mit Gelegen-heitsjobs verdiente sich der verwaiste Jungeseinen Unterhalt und ging 1945 nach Kra-kau, um Schule und Studium abzuschlie-ßen; später arbeitete er als Journalist inWarschau. 1957 emigrierte er nach Öster-reich und gründete dort eine Exportfirma.Erst im Alter von 60 Jahren begann er zuschreiben – und wurde zu einem literari-scher Senkrechtstarter: In „Die buckligeWelt“, „Unweit von Wien“, „Die stille Do-nau“, „An der Weichsel“ erzählt er vomUntergang des jüdischen Galizien, vomkommunistischen Polen und von seinerWahlheimat Österreich. Adam Zielinski,der mit dem „Manès-Sperber-Würdigungs-preis für Leben und Werk“ ausgezeichnetwurde, starb am 26. Juni in Wien.
GE S T O R BE N
ET
IEN
NE
DE
MA
LG
LA
IVE
/ R
EA
/ L
AIF
HA
NS
KLA
US
TE
CH
T /
DP
A
GE
RA
RD
CE
RLE
S /
AF
P
140
Personalien
Ludwig Erhard, 1977 verstorbener Vaterdes Wirtschaftswunders, soll einer deut-schen Investorengruppe postum zu ei-nem lukrativen Deal verhelfen. Die Ge-schäftsleute bieten jetzt – kurz nach dem33. Todestag am 5. Mai – den Nachlassdes ehemaligen Bundeskanzlers für rundzwei Millionen Euro an. Die üppigeSammlung besteht nicht nur aus Antiqui-täten, Silberbesteck, teurem Geschirr undGemälden. Auch 450 Zigarren, zwei Spa-zierstöcke, ein Zylinder sowie ErhardsSmoking und Frack aus Kanzlerzeitensind auf dem Markt. Ebenso seine liebs-ten Spielkarten, mit Aufdrucken wie„Pepsi gibt Schwung“ oder „CSU stichtimmer“. In einer Brieftasche, die Erhardvom Henkel-Konzern geschenkt bekom-men hatte, fand sich ein Notizzettel. Dar -auf hatte der CDU-Politiker, der offen -bar den Banken wenig traute, vermerkt:„Geld ist noch verborgen: a) in der großenKommode hinter dem alten Kaffeeserviceb) in dem Kleiderschrank in der Nischedes Korridors links unter dem Papier“.1993 hatte Erhards Tochter den Nachlassan die Investoren verkauft, seither lagerndie Stücke in einem Container.
Zoe Saldana, 32, Schauspielerin („Avatar“) mit spätem Karrieresprung, setztauf Frauensolidarität. Als blaues Phantasiewesen Neytiri im erfolgreichstenFilm aller Zeiten trat Saldana aus der eintönigen Masse der Action-Darstel -lerinnen hervor. Jetzt wird sie mit Auszeichnungen und Aufmerksamkeit
überhäuft. Der neue Hollywood-Star gewannnicht nur den renommierten Förderpreis„Face of the Future“ bei den „Women inFilm Awards“, sondern wurde auch als Jury-Mitglied für die Oscars berufen. Die Toch-ter einer Puerto Ricanerin, die in beschei-denen Verhältnissen groß geworden ist, willnun ihren Geschlechtsgenossinnen Mut ma-chen und bekennt selbstbewusst: „Ich glaube,ich bin jetzt ein Vorbild.“
und dafür einige Veränderungen auf denWeg bringen. Die strengen Visa-Bestim-mungen für Besucher aus dem Westenmüssten reformiert, die Verkaufsverbotevon Alkohol wenigstens in Luxushotelsauf gehoben werden. Mit dem Aufbau einer florierenden Tourismusindustriehofft er die wirtschaftliche Abhängigkeitdes Landes vom Öl zu mindern. Dasschwarze Gold sei nämlich „ein Fluch, essorgt für viele Probleme in Libyen“, so
Gaddafi.
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Walther Leisler Kiep, 84, ehemaligerCDU-Schatzmeister und zentrale Figurim Parteispendenskandal, soll vorm Gor-leben-Untersuchungsausschuss erschei-nen. Er ist als Zeuge vorgesehen, um dieRolle der Energiekonzerne bei der Aus-wahl Gorlebens als mögliches Atommüll-endlager aufzuklären. Mitte Juni hatte indem Gremium ein Historiker ÄußerungenKieps vor dem niedersächsischen Land -tag zitiert. Danach hatte sich Kiep 1976,seinerzeit niedersächsischer Wirtschafts-und Finanzminister, mit einem Vor-standsmitglied von RWE und wei -teren Industrievertretern getrof-fen, bevor er mit dendrei Bundesminis-tern Hans Fride-richs, Hans Matt -höfer und WernerMaihofer eine Ent-scheidung fällte.Aus den Aufzeich-nungen geht auch her-vor, dass Kiep in derRunde mit den Mana-gern von sich aus Gorle-ben als möglichen Stand-ort ins Gespräch gebrachthat. „Kiep war die Schnitt-stelle zwischen Politik undAtomwirtschaft“, vermutetSylvia Kotting-Uhl, atompoli-tische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, „der Druck derAKW-Betreiber hat zum Tempo derGorleben-Auswahl beigetragen.“
Saif al-Islam al-Gaddafi, 38, Sohndes libyschen Diktators Muam-mar al-Gaddafi, glaubt, die Tageseines alten Herrn seien gezählt. Ineinem Interview mit der „Sunday Times“sagt Gaddafi junior, dass Libyen keinen„großen Führer“ mehr benötige. Die Zeitfür „Militärregime, Könige und Kronprin-zen“ sei vorbei. In der Demokratie liegedie Zukunft. Der zweitälteste Sohn desexzentrischen Staatschefs will Touristenaus aller Welt nach Libyen locken –
Erhard um 1958
KU
RT
RO
HW
ED
DE
R /
BP
K
Saldana in „Avatar“
20
TH
CE
NT
UR
Y F
OX
SH
ER
YL N
EE
DS
/ A
UG
US
T
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0
Horst Köhler, 67, ehemaliger Bundesprä-sident, tummelte sich einen Monat nachseinem rätselhaften Rücktritt wieder un-befangen in der Öffentlichkeit. In Füssenbesuchte Köhler gemeinsam mit seinerFrau Eva den ehemaligen Bundesfinanz-minister Theo Waigel und dessen Frau
Irene Epple-Waigel. Köhler war in denneunziger Jahren Waigels Staatsse-kretär; seitdem pflegen die beidenein gutes Verhältnis. Die Waigelswollten dem Ex-Präsidentenpaarim Allgäu die ersten Alpenrosenzeigen, zuvor besuchten sie jedochden Gottesdienst der EvangelischenChristusgemeinde. Beim anschlie-ßenden Sommerfest blieben die Köh-lers über zwei Stunden und plauder-ten mit den Gemeindemitgliedern.
„Köhler war sehr aufgekratzt und fröh-lich“, berichtet Heiko Thiele, Sprecherdes Kirchenvorstands. Kritik an seinem
Rücktritt musste der Ex-Präsident sichnicht anhören, nur Bedauern über denSchritt – und immer wieder die Frage,warum er denn gegangen sei. „Die An-teilnahme hat Köhler sehr gefreut“, soThiele, „aber die Frage hat er nicht be-antwortet.“
Al Gore, 62, ehemaliger US-Vizepräsident,fürchtet nicht nur um sein Image als Saubermann, sondern offenbar auch umsein Vermögen. Gore galt lange als mus-terhafter Gatte und Familienvater, dochseitdem die Eheleute Gore ihre Trennungbekanntgegeben haben, reißen die Be-richte über angebliche außereheliche Eskapaden des Friedensnobel-preisträgers nicht ab. Außer-dem wird ihm sexuelle Beläs-tigung vorgeworfen: Gore solleine Masseurin 2006 nach einerMassage in einem Hotelzim-mer bedrängt haben. Die Frauwill sich laut Ermittlungsaktegegen seine Avancen mit demSatz gewehrt haben: „Geh run-ter von mir, du dicker Tölpel.“Die Polizei in Oregon schenkteihr zunächst keinen Glauben, leitete nunaber ein Ermittlungsverfahren ein. Gorebestreitet alle Vorwürfe. Seit die Mas-seurin sich voriges Jahr bei der Polizeimeldete, haben der Politiker und seineNoch-Ehefrau Tipper neun Immobilien inTennessee in eine Gesellschaft beschränk-ter Haftung verschoben. „Das ist ein Weg,um diese Besitztümer vor möglichen Scha-densersatzklagen zu schützen“, sagt dieNew Yorker Fachanwältin Sherri Dono-van. Eine 8,8 Millionen Dollar teure Villain Kalifornien mit sechs Schlafzimmernund neun Bädern erwarb das mittlerweilegetrennt lebende Ehepaar vergangenesJahr über eine Stiftung. So könn te auchdieses Haus vor Klagen sicher sein.
Alison Jackson, 50, britischeFoto- und Videokünstlerin, erfülltdie Träume ihrer Landsleute – zu-mindest optisch. Die Lichtbild -nerin ist bekannt für ihre Auf-nahmen von Doppelgängern be-rühmter Leute, die sie in intimen
oder lustigen Situa-tionen inszeniert.Jetzt hat sie eineSerie über dasLieblingspaar derBriten, Prinz Wil-liam und KateMiddleton, kreiert.Die Nation fiebertseit Monaten demTag entgegen, an
dem William um die Hand seinerKate anhält und die beiden end-lich, endlich offiziell verlobt sind.Deswegen hat Jackson sich derSache angenommen: „Ich versu-che darzustellen, was die Öffent-lichkeit bewegt.“
141
bellisch – und schwingt à la Jimi Hendrixdrohend eine Gitarre durch die Luft. „Ichkann mich nicht unterwerfen“, trällert siepassend dazu in ihrem neuen Album, mitdem sie als Bad Girl auftrumpfen will. Diejunge Frau dürfte nach all den Jahren alsHannah Montana Lust auf etwas Neueshaben, doch ihre Metamorphose hat auchhandfeste Gründe: „So können auch älte-re Fans mein neues Album kaufen.“
Manuel Noriega, 76, wegen Drogenhan-dels verurteilter Ex-Diktator von Panama,erinnert die Franzosen an alte Sünden.An seinem ersten Verhandlungstag in Pa-ris, wo ihm derzeit unter strengen Sicher-heitsvorkehrungen wegen Geldwäscheder Prozess gemacht wird, erschien derberüchtigte Ex-Potentat vor Gericht in einem dunkelblauen Anzug, geschmücktmit dem Orden der französischen Ehren-
legion. Der damalige PräsidentFrançois Mitterrand hatte No-riega während eines Staatsbe-suchs in Paris 1987 ausgezeich-net und dabei die „exzellentendiplomatischen Beziehungen“zwischen beiden Ländern ge-priesen. Noriega ist Ende Aprilvon den USA nach Frankreichausgeliefert worden, zuvor hat-te er eine 20-jährige Haftstrafein Miami wegen Drogenhan-
dels abgesessen. Bevor er von amerikani-schen Truppen während einer Militär inva -sion 1990 festgenommen wurde, war erbestens vernetzt im Reich der Mächtigen:Er pflegte gleichzeitig gute Kontakte zuKolumbiens Drogenkönig Pablo Escobar,Kubas Revolutionsführer Fidel Castro undzum amerikanischen Geheimdienst CIA.
Miley Cyrus, 17, Teenie-Star und Sängerin,bastelt eifrig weiter an einem neuen, er-wachseneren Image. Die millionenschwe-re Heldin der amerikanischen TV-Serie„Hannah Montana“ galt dem amerikani-schen Mittelstand lange als Idealjugend -liche: sauber, christlich, angepasst. Jetztgibt sie sich im Magazin „Paris Match“ re- Cyrus („Paris Match“-Ausriss)
Gore
CH
RIS
CR
ISM
AN
/ R
ED
UX
/ L
AIF
ALIS
ON
JA
CK
SO
N /
SU
ND
AY
TIM
ES
/ B
ULLS
PR
ES
SP
EG
GY
SIR
OTA
EY
EV
INE
/ P
ICT
UR
E P
RE
SS
Aus „Sonntag Aktuell“: „Auf dem nor-wegischen Inselchen Nord-Hidle stehenuralte Phallusstatuen. Was aber nicht dereinzige Grund ist, warum sich Gäste dortso wohl fühlen.“
Aus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“:„Keinesfalls sollten Sie die Schnecken ein-fach in der Plastiktüte in die Mülltonneschmeißen: Die Tiere ersticken dort qual-voll. Überbrühen Sie die Schnecken mitkochendem Wasser, sorgen Sie nachhaltigfür Ruhe.“
Bildunterschrift aus dem österreichischen„Bezirksblatt“: „Betriebshelferin Marian-ne Nefischer und Andrea Thier (kurz vorihrer Geburt)“
Aus der „Frankfurter Allgemeinen“:„Kompetenzen mögen noch keine Bil-dung sein. Wer freilich seine Handyrech-nung nicht lesen kann, der wird sich‚Faust II‘ auch nicht aufs iPhone laden.“
Zitate
Die „International Herald Tribune“zum SPIEGEL-Bericht
„Konzerne – Steve sieht alles“ über die Entwicklung von Apple
zum Datenkraken (Nr. 26/2010):
Die deutsche Justizministerin brachte amMontag ihre Bedenken über Apples Vor-gehen, Daten von iPhone-Nutzern zusammeln, zum Ausdruck. Der Smart -phone-Hersteller ist der neueste Techno-logie-Gigant aus Amerika, der die strik-ten deutschen Datenschutzgesetze ver-letzt … „Hier sehe ich Apple in derBringschuld, die von Steve Jobs vielbe-schworene Transparenz auch tatsächlichumzusetzen“, sagte Leutheusser-Schnar-renberger dem Magazin SPIEGEL. BethanLloyd, eine Sprecherin von Apple, sagte,das Unternehmen würde an einer Ant-wort arbeiten.
Die „Süddeutsche Zeitung“ über Wolfram Weimer, den neuen
Chefredakteur von „Focus“:
Der SPIEGEL ist Weimers größtes Pro-blem. Der Hamburger Verlag hat diestärkste Magazinredaktion des Landes,die mit am besten recherchiert und inzwi-schen auch schreibt. Es mag defätistischklingen, aber eigentlich hat Weimer nurdann eine Chance, wenn er diesen Kampfgar nicht erst aufnimmt. Denn das, wasdie Hanseaten können, kann seine ver-brauchernahe Truppe nicht leisten, vonwenigen Redakteuren abgesehen. Wenn,dann muss Weimer etwas anderes ma-chen. Nur was?
Der „Stern“ zum Buch „Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung?
Der große SPIEGEL-Wissenstest zum Mitmachen“, herausgegeben von
Martin Doerry und Markus Verbeet (Kiepenheuer & Witsch):
Die Mischung ist clever, wie immer man Allgemeinbildung auch interpre -tieren mag, denn irgendwas weiß ja schließlich jeder. Wie man ja weiß, istauch das Halbwissen recht willkürlichverteilt: Wer die „Buddenbrooks“ nachDanzig verlegt, könnte trotzdem ahnen,dass bei der Bundestagswahl die Zweit-stimme – entgegen dem Namen – überdie Sitzverteilung entscheidet. So be-schert das auf der schier endlosen Quiz-welle surfende Werklein dem wackerenLeser einige unerwartete Erfolgs er -lebnisse, doch auch Menschen, die regel-mäßig Zeitung lesen (nicht bloß denSportteil!), dürfen sich bestätigt fühlen.Es ist just dieses Pendeln zwischen er -freutem Staunen und ansatzlosem Ent -setzen, das für Ego-Thrill mit einfachenMitteln sorgt.
Hohlspiegel Rückspiegel
D E R S P I E G E L 2 7 / 2 0 1 0142
Aus dem „Anzeiger für Harlingerland“
Aus einer Anzeige im „burgbergblick“
Aus dem Brandenburger „PreußenSpiegel“
Aus den „Nürnberger Nachrichten“
Aus dem „Journal“ der Uni Leipzig