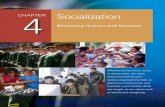STADTNETZE - RWTH Publications
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of STADTNETZE - RWTH Publications
STADTNETZE
Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung
I.A.S
Band 3 3. Symposium 22. - 24.06.1995 Paris
Herausgegeben von Michael Jansen und Jochen Hoock
Aachen 2002
Wir danken dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW für die Unterstützung des Forschungsvorhabens sowie der
Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Finanzierung der Tagung.
Wir danken dem Lehr- und Forschungsgebiet Stadtbaugeschichte der RWTH Aachen
für die Erstellung der Publikation.
Copyright: bei den Autoren Herausgegeben für den Verein der Freunde des Reiff e.V., Schinkelstraße 1, 52062 AachenISSN 0947-3394 ISSN 1437-1774ISBN 3-936971-15-3
INHALT Michael Jansen, Aachen
Stadt und Netz in der Indus-Kultur..................................................................... 5
Reinhard Dittmann, Münster Stadtnetze - Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte........ 25
Reinhard Senff, Bochum Milet. Die archaische Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes..... 87
Hartmut Galsterer, Bonn Zentrale Plätze in antiken Städten Architektur und politische Verfassung bei Forum Romanum und Agora...... 121
Wolfgang Kaiser, Marseille "Fremde in anderen Ländern oder Fremden gleich in ihrer Heimat" Refugiantennetze im 16. Jahrhundert................................................................. 141
Eckart Pankoke, Essen Stadtkultur im Industrierevier. Lokale Nähe und regionale Netze..................
151
Helmut Schneider, Düsseldorf Soziale Netze und städtische Existenzsicherung. Ein Vergleich von Sekundärzentren in Kenya, Thailand und den Philippinen nach ausgewählten Beispielen........................................... 171
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 5
5
Michael Jansen (Aachen)
STADT UND NETZ IN DER INDUS-KULTUR
'Netze' sind verknüpfte Wege. Wege sind optimierte Verbindungsstränge, die sich aus Gesetzen auch der Notwendigkeit in der Topographie ergeben. Oft sind sie ephemer: die Fußspur einer Karawane, die Kielwasserlinie eines Schiffes oder der Kondensstreifen eines Flugzeuges am Himmel. Sie können aber auch prägende Markierung sein, allerdings nur auf dem Lande, wie die römischen Militärstraßen oder unsere Autobahnen. 'Knoten' sind fixe Verbindungen dieser Strän-ge, sind immer materiell. Es sind Zeugen längeren Bleibens des Menschen, Behausungen an Kreuzpunkten, Rastplätze entlang eines Stranges wie Perlen an einer Kette, Siedlungen dort auch, wo sich Transportsysteme verschiedener Medien schneiden: Furtplätze und Häfen an Straßen und Wasserwegen, Flughäfen an Land- und Luftwegen. Immer aber sind es Knotenpunkte eines mehr oder minder komplexen Systems von Kommu-nikation. Daher ist die Geschichte der Stadt immer mit der Geschichte von Wegen und Kommunikation verbunden: Stadt alleine ist nicht existent. Das kann so weit gehen, daß der Weg wesentlicher Bestandteil des eigentlichen Zieles wird, wie etwa die alten Pilgerwege der Hindus auf dem indischen Subkontinent, oder aber auch etwa die Pilgerstraße nach Santiago di Compostela. Stadt und Netz in der Indus-Kultur
Die Indus-Kultur ist mit mehr als 1000 bis heute bekannten Fundorten innerhalb eines Territoriums von über einer Million Quadratkilometern, die größte der frühen Hochkulturen der Menschheit. Erst durch die Forschung der letzten 20 Jahre zeichnet sich ein klareres Bild der Entstehungsgeschichte ab. Hierbei ist eine der zentralen Fragen die der Verbreitung und Veränderung der Gesellschaften, welche die heute vorzufindenden archäologischen Zeugnisse schufen. Dabei ist nicht nur die einzelne Siedlung und ihre innere Struktur von Bedeutung, sondern ebenfalls die Struktur der Siedlungen untereinander sowie die Art wie sie miteinander verknüpft waren.1 Betrachtet man eine Kultur als ein Phänomen, das sich geographisch-zeitlich darstellt, so können zu verschiedenen Zeiten verschiedene Zustände der Ausdehnung beobachtet werden.2 Bei der (hypothetischen) zeitlichen Klassifizierung kultureller Phänomene in 'früh' – 'mittel' – 'spät' ist bei Fortschreiten kultureller Entwicklung in der Regel eine territoriale Ausdehnung zu beobachten, die sich in der 'Spätzeit' entweder reduziert, zu deren Regionalisierung führt oder sogar zu deren 'Untergang'. Mit 'Stadt und Netz', oder neutraler 'Siedlung und Netz', wäre demnach ein Thema abzuhandeln, das nicht nur synchron, sondern auch diachron das Phänomen 'Siedlungen und ihre Relation' aufzeigt. Analog zum 'Netz'3 wären die Knoten die Siedlungen, die Stränge des Netzes die Wege,
1 Da ein Netz mit seinen Knoten, um beim anschaulichen Teil des Begriffs zu bleiben, im Gegensatz zu einem Gitter zweidimensional ist, wird im folgenden nicht von Kulturräumen, sondern von Kulturflächen (im Sinne zweidimensionaler Verteilung) gesprochen. 2 Zum Begriff der 'mobilen' und 'immobilen' Gesellschaft siehe W.E. Mühlmann, Geschichte der Anthropologie, Wiesbaden 1984, 223ff. 3 Spätestens hier wird klar, daß bei einer diachronen Betrachtung des Phänomens die Analogie 'Netz' und 'Knoten'
6 Michael Jansen
6
'Kommunikationsstränge' (etwa physische wie Land-, Wasser- und Luftwege, aber auch akustische, optische, elektronische4 etc.). Da ohne Kommunikation 'Kultur' nicht möglich ist, wäre eine Untersuchung zu Siedlungen ohne Untersuchung der 'Kommunikationsstränge' un-vollständig. In der Indus-Kultur scheint das die Siedlungen verbindende Erschließungssystem maßgeblich prägender Faktor für das Siedlungsnetz dieser Kultur gewesen zu sein. Untersuchungen zu 'Siedlungsnetzen' werden im Rahmen der archäologischen Forschung seit den 60er Jahren, ausgehend von der amerikanischen Anthropologie, betrieben. Robert Adams und Hans Nissen entwickelten in dieser Zeit ein Verfahren, ausgehend von dem von Walter Christaller in den 30er Jahren entwickelten System des 'zentralen Ortes'5 (Abb. 1), mit dem sie Siedlungen der Diyala Region des 4.-3. Jts. v. Chr. in Mesopotamien untersuchten. Dieses Verfahren fand bald vielfache Nachahmung und Erweiterung.6 Im Bereich der Indus-Kulturen wurde ein solches Verfahren erstmals von Louis Flam angewandt (Abb. 2).7 Erste vage
unzureichend wird, da sie lediglich zweidimensional ist. Auch weisen Netze regelmäßige Verbindungen auf, die in einem Zeit-Raummodell von Siedlungsverknüpfungen kaum vorliegen. 4 Diese neuste Möglichkeit von Verknüpfung, etwa per Internet, ist eine zukunftsweisende, die hier nur kurz an-gedacht werden kann. Sie bringt völlig neue Dimensionen. So kann etwa die Stadt Bangalore als neuer Sitz der Elektro-Industrie durchaus als 'Erstweltstadt' betrachtet werden. Qualitäten werden nicht mehr alleine über geo-graphische Positionen vergeben, sondern auch über kommunikative. 5 W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933; R. McAdams, Land Behind Bagdad, Chicago 1965; Ders.; H. Nissen, The Uruk Contryside. The Natural Setting of Urban Societes, Chicago 1972. 6 P. Kohl, The ‚World-Economy‘ of West Asia in the Third Millenium B.C., SAA 1979, 55-85. 7 L. Flam, The Palaeography and Prehistoric Settlement Patterns in Sind, Pakistan (ca. 4000-2000 B.C.), Philadelphia 1981.
Abb. 1: System der zentralen Orte in Süddeutschland
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 7
7
Abb. 2: Siedlungsmuster der Harappa mit Mohenjo-Daro (schwarzer Punkt)
8 Michael Jansen
8
Aussagen über die Gewichtung der Siedlungen untereinander waren bereits in den 30er Jahren erfolgt. Erst durch Stuart Piggott und vor allem Mortimer Wheeler entstand die Vorstellung eines 'Indus-Imperiums' mit Harappa und Mohenjo-Daro als 'Zwillingshaupt-städten'.8 Seit Mitte der 60er Jahre9 kam etwas Bewegung in das mittlerweile erstarrte, von Wheeler dominierte Interpretationsbild. Stark beeinflußt von seinem Lehrer George Dales10 vertrat Rafiq Mughal zum ersten Mal in seiner Dissertation die These einer frühharappazeitlichen Phase, aus der sich – seiner Meinung nach fließend – die städtische Harappa-Kultur ent-
8 S. Piggott, Prehistoric India to 1000 B.C., ND Harmondsworth 1961; Sir M. Wheeler, The Indus Civilization, Cambridge 1953. 9 etwa: D.P Agrawal; H. Nissen, Harappa Culture: New Evidence for a Shorter Chronology, Science 143, 1964, 950f.; D.P. Agrawal, The Copper Bronze Age in India. New Delhi 1971; B. Allchin; F.R. Allchin, The Birth of Indian Civilization, Harmondsworth 1968; G.F. Dales, Harappan Outposts on the Makran Coast, Antiquity 36, 1962, 86-92; Ders., Civilization and Floods in the Indus Valley, Expedition 7/4, 1965, 10-19; W.A. Fairservis, The Harappan Civilization. New Evidence and More Theory, AMN 2055, 1961; Ders., The Origin, Character and Decline of an Early Civilization, AMN 2302, 1967; Ders., The Roots of Ancient India, New York 1971. 10 G.F. Dales, Civilization and Floods in the Indus Valley, Expedition 7/4, 1965, 10-19.
Abb. 3: Verbreitung der frühharappazeitlichen Keramiken
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 9
9
wickelte.11 Für diese frühe Phase waren Kot-Diji, Amri und Sothi Leitfundorte von Regio-nalkulturen, aus denen sich die städtische Phase entwickelt haben soll. Damit widersprach er Wheeler, der die Kot-Diji-, Amri- und Sothikultur als Vor- und nicht als Frühkulturen ansah und somit Kontinuität ablehnte.12 Nach seiner Meinung war die 'Idee der Stadt' aus Mesopotamien importiert worden. Mughals Untersuchung schloß Studien zur Verbreitung der jeweiligen materiellen Hinterlassenschaften (vor allem Keramik) ein, die regionale Begrenzungen der einzelnen Kulturen aufzeigten (Amri im Süden und Südwesten, Sothi im Nordosten (Ghaggar Hakra) und Kot-Diji entlang des Indus von Süden bis Norden einschließlich Ausdehnung in den Amri- und Sothibereich) (Abb. 3). Sich im wesentlichen auf den Übergang 'frühharappazeitlich' – 'reifharappazeitlich' im Bereich der materiellen Hinterlassenschaften konzentrierend, führte Mughal keine Untersuchungen zu den Siedlungsnetzen der einzelnen Kulturen und deren Veränderung hin zur Phase der städtischen Harappa-Kultur durch. S.R. Rao, ein Gegner der Mughal'schen 'Evolutionsthese' wich 1973 von der über 20 Jahre alten 'Zwillingshauptstadtthese' Wheelers ab, indem er zwei auf indischem Territorium befindliche Siedlungen, Kalibangan in Rajastan und Lothal in Gujarat, in die Liste der 'Hauptstädte'13 aufnahm. Das 'Imperium' teilte er in vier Provinzen, eine westliche, eine zentrale, eine östliche und eine südliche (Abb. 4) mit jeweils einer Hauptstadt, wobei Mohenjo-Daro und Harappa im Terri-torium der Zentralprovinz, Kalibangan in dem der Nordprovinz und Lothal in dem der Südprovinz liegt. Im Größenvergleich ist Lothal fast fünfzehn Mal kleiner als Mohenjo-Daro.14 Rao betrieb darüber hinaus keinerlei Untersuchung bezüglich der weiteren Siedlungshierarchie und der kommunikativen Verknüpfung. Er wies jedoch auf die mögliche Existenz eines in jener Zeit östlich des Indus verlaufenden Flusses (Western Nara) hin, der in den Gulf von Kutch gemündet haben könnte. Acht Jahre später veröffentlichte Louis Flam mit seiner Dissertation eine erste Untersuchung zu möglichen Hierarchien von Siedlungen und deren Verknüpfung im Industal (vgl. Abb. 2).15 Hierin kam er bei einem Vergleich der frühharappazeitlichen Siedlungsmuster mit denen der reifen Harappazeit entgegen Mughals These zu der Erkenntnis, daß wesentliche Abweichungen zwischen den beiden Siedlungsformen festzustellen sind und es sich somit um verschiedene Besiedlungsflächen handeln muß.16 Der Untersuchung Flams fehlt es bei weitem an der Dif-ferenziertheit, die etwa den Arbeiten Adams und Nissens zugrunde liegt. Es wurde weder eine Konzeption zur Hierarchisierung der Siedlungen, noch eine solche zur Verknüpfung erarbeitet.
11 R. Mughal, The Early Harappan Period in the Greater Indus Valley and Northern Baluchistan (ca. 3000-2400 B.C.), Ann Arbor 1971. 12 M. Jansen, Stadt und Macht in der Induszivilisation, in: Ders.; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 53-69. 13 S.R. Rao, Lothal and the Indus Civilization, Bombay 1973. Die meisten Siedlungen der Harappa-Kultur befinden sich im heutigen Pakistan, das 1947 von der Indischen Union aus dem ehemaligen British Raj getrennt wurde. Es war (und ist) sicherlich ein Politikum, daß die Suche nach harappazeitlichen Siedlungen in der Indischen Union nach der Teilung intensiv (und erfolgreich) weitergetrieben wurde. Mit zusätzlichen zwei 'in-dischen' Hauptstädten der Harappa-Kultur war das Äquilibrium wieder hergestellt. 14 Mohenjo-Daro umfaßt mindestens 100 ha, Harappa mindestens 45 ha, Kalibangan ca. 12 ha und Lothal ca. 7,5 ha. 15 L. Flam, The Palaeography and Prehistoric Settlement Patterns in Sind, Pakistan (ca. 4000-2000 B.C.), Phila-delphia 1981. 16 Ich halte diese Beobachtung nicht für überzeugend, zumal die graphische Darstellung wenig Informations-wert besitzt.
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 11
11
Abb. 4: Die vier "Provinzen" des "Indus-Reiches" nach Rao
12 Michael Jansen
12
Den neuesten Versuch einer siedlungsvergleichenden und verknüpfenden Untersuchung startete Rafiq Mughal.17 Seine Klassifizierung von Siedlungen basiert im wesentlichen auf dem Faktor 'Größe'.18 So ist 'city' 30 ha und größer, 'town' 10 bis 30 ha und 'village' bis 10 ha groß. Später
17 R. Mughal, The Harappan Settlement Systems and Patterns in the Greater Indus Valley (ca. 3500-1500 B.C.), Pakistan Archaeology 25, 1990, 1-72; Ders., The Harappan 'Twin Capitals' and Reality, Journal of Central Asia XIII,1, 1990, 155-162; Ders., Further Evidence of the Early Harappan Culture in the Greater Indus Valley 1971-90, SAS 6, 1990, 175-199; Ders., The Cultural Patterns of Ancient Pakistan and Neighbouring Regions circa 7000-1500 B.C., Pakistan Archaeology 26, 1991, 218-237; Ders., Ancient Cities of the Indus, Lahore Museum Bulletin VII,1&2, 1994, 53-59. 18 R. Mughal, The Harappan Settlement Systems and Patterns in the Greater Indus Valley (ca. 3500-1500 B.C.), Pakistan Archaeology 25, 1990, 1-72, hier 7. Der alleinige Parameter 'Größe' ist zur qualifizierten Siedlungs-
Abb. 5: Hauptstädte der Indus-Kultur nach Mughal
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 13
13
(1990) führte er mit Siedlungen größer als 80 ha eine vierte Kategorie ein. Die Größenuntersuchungen führten schließlich zur Beobachtung, daß die großen Siedlungen Harappa, Ganweriwala, Dholavira und Lothal einen Abstand zueinander aufweisen, der etwa bei 400 km gemittelt werden kann (Abb. 5). Rafique Mughal bezeichnet dieses Phänomen, das seiner Meinung nach das alte Modell der Zwillingsstädte Mohenjo-Daro und Harappa endgültig ablöst, als einmalig.19 Um eine differenziertere Untersuchung der Siedlungen, ihrer hierarchischen Relation und ihrer Verknüpfung durchführen zu können als bisher beschrieben, bedarf es weiterer umfangreicher Siedlungsforschung, die noch geleistet werden muß. Trotz dieser Lakune sei an dieser Stelle vor dem Hintergrund der neuen Daten über Mohenjo-Daro ein weiterer Ansatz gewagt: Unsere Untersuchungen der 80er Jahre in Mohenjo-Daro haben viele neue Daten und Erkenntnisse erbracht, die wegen des großen Umfangs bisher nicht veröffentlicht werden konnten und die auch Aussagen über das Siedlungsverhalten in Mohenjo-Daro beinhalten.20 Das bezieht sich unter anderem auch auf die Siedlungsform und Größe. 1987 wurden bei Arbeiten an den Buhnen im Indusbett zwei Meter unterhalb der heutigen Oberfläche ausgedehnte Siedlungszeugnisse gefunden, die nahelegen, daß Mohenjo-Daro sich unterhalb der heutigen alluvialen Ebene bis mindestens dorthin (ca. 1,5 km Entfernung vom Zentrum!) erstreckte. Mohenjo-Daro ist mit geschätzten mindestens 200 ha die bei weitem größte aller Siedlungen der Indus-Kultur. Durch Bohrungen um Mohenjo-Daro wissen wir, daß sich die Stadt unterhalb der heutigen Ebene noch weit nach Süden und Osten, auch etwas nach Norden, aber nicht nach Westen fortsetzt (Abb. 6, 7). Größenmäßig wäre diese Stadt das alleinige Zentrum dieser Zivilisation. Aber nicht nur durch seine Größe zeichnet Mohenjo-Daro sich aus. Keine der anderen Siedlungen weist so viele Sonderarchitekturen (vor allem das Große Bad, Abb. 8), so viele Bauwerke in gebranntem Ziegel und so viele Brunnen auf.21 An Größe und Reichtum ist bisher keine der anderen bekannten Siedlungen dieser Stadt vergleichbar. Damit nähme sie die Spitze der Siedlungshierarchie ein. Alle Anzeichen belegen, daß diese Stadt eine völlige Neugründung war.22 Das besagt aber auch, daß der Träger dieses Vorhabens nicht nur die gesamte Bau-technologie (Präfabrikation der genormten Ziegelformate, Mauern im Blockverband, Nivelle-ment der Abwasserkanäle, Abteufen der Brunnen bis in über 20 Meter Tiefe etc.) voll beherrschte, sondern auch planungsmäßig und organisatorisch in der Lage war, eine Stadt von mehr als 100 ha Größe in kurzer Zeit auf vorgefertigten Lehmziegelunterbauten von bis zu sieben Metern Höhe inmitten des alluvialen Industales nahe dem jährlich überflutenden Indus zu errichten (Abb. 9)! Alleine mit den Substruktionen zum Schutz gegen die jährlichen Fluten wären 5.000 Menschen mehrere Jahre beschäftigt gewesen.23 Diese außerordentliche Anstrengung erforderte hohen Planungsgeist, das notwendige Men-schenpotential und eine entsprechende Ökonomie. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer solchen Anstrengung. Wie wir von den neuesten Grabungen in Harappa wissen, wurde dort unter den reifharappazeitlichen Schichten eine ausgedehnte frühharappazeitliche Siedlung gefunden.
bestimmung völlig unzureichend. 19 R. Mughal, Ancient Cities of the Indus, Lahore Museum Bulletin VII,1&2, 1994, 53-59. 20 Mit den neuen Mitteln von CAD und Textdatenverarbeitung erscheint es erneut realistisch, daß das Korpus doch noch veröffentlicht werden kann. 21 Es muß hier erwähnt werden, daß Harappa durch seine Zerstörung im 19. Jh. so gelitten hat, daß ein unmittel-barer Vergleich nur schwer geführt werden kann. Neueste Untersuchungen (M. Kenoyer; R. Meadow) werden weitere Daten liefern. Jedoch ist Harappa eindeutig kleiner als Mohenjo-Daro. 22 Siehe hierzu M. Jansen, Mohenjo-Daro and the Indus, London (in Vorbereitung). 23 Bei einer Jahresleistung von ca. 300 Kubikmetern Lehmziegeln pro Person!
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 15
15
Abb. 8: Mohenjo-Daro, das Große Bad
Abb. 9: Mohenjo-Daro, Substruktionen
16 Michael Jansen
16
Nach Kenoyer und Meadow ist hier der Übergang von früh- zu reifharappazeitlichen Schichten fließend, wobei bisher allerdings die Transitphase keinen Übergang zur Schrift, zum gebrannten Ziegel und zum Brunnenbau, um einige technische Aspekte zu nennen, zeigt. In Mohenjo-Daro sind die untersten Schichten im Grundwasser begraben, allerdings scheinen alle bisherigen Infor-mationen (Tiefgrabungen, Bohrungen) auf keine frühere Besiedlung hinzuweisen. Das würde die Hypothese stützen, daß das Siedeln auf unmittelbar alluvialem Grund im Bereich des Indus langfristig aufgrund der Überschwemmungsgefahr und eine frühere Langzeitsiedlung ohne Er-höhung durch künstliche Plattformen nicht möglich gewesen wäre. Somit war Mohenjo-Daro nicht der Beginn der reifen Harappazeit, sondern ist ihr erstes großes Bauergebnis, das Resultat eines außerordentlichen Bedürfnisses einer bereits potenten Kultur. Sollte diese Hypothese stimmen, so stellt sich sofort die Frage nach dem Bedürfnis und die nach dem vorherigen Aktionszentrum (Ursprungsort/Gebiet) dieser Kultur. Die Frage nach dem Bedürfnis, in alluvialen Zonen zu siedeln wird traditionell mit der land-wirtschaftlichen Nutzung der fruchtbaren Böden erklärt.24 Dieses mag durchaus für neolithische Siedlungen zutreffen, scheint mir aber für die bronzezeitlichen Städte unerheblich geworden zu sein. Zumindest ist Mohenjo-Daro in seiner Baustruktur keine Ackerbürgerstadt. Vielmehr scheint der Indus selbst das Ziel der Begierde gewesen zu sein. Damals wie bis zum frühen 20. Jahrhundert überschritt der Indus ab Mitte Juli seine Ufer, um in seinem unteren Lauf das Land rechts und links seiner Ufer meilenweit zu überschwemmen.25 Dieses besagt aber, daß das untere alluviale Industal für mindestens vier Monate im Jahr für Landtransporte nicht nutzbar war.26 Nutzbar dagegen war der Indus selbst per Boot. Mit der ganzjährigen Nutzung des Indus als Ver-kehrsader wurde das System effizient, konnte das gesamte Industal samt seiner Nebenflüsse und samt der Küstenzonen erschlossen werden. Die außerordentliche Expansionsfreude der reifen Harappakultur, vor allem Richtung Saurastra und entlang der Makranküste, scheinen diese Phase zu markieren. Damit wäre die Notwendigkeit zur Wahl des Standortes in so gefährlicher Nähe des Indus nach-vollziehbar. Hinzu kommt noch das Zusammentreffen des Indus mit der großen westöstlich verlaufenden Handelsroute, die vom Quettatal entlang des Flusses Bolan hin nach Kot-Diji führte, wo die reichsten Flintminen in den Rohri-Bergen seit alters her erschlossen wurden. Wo aber kamen die Menschen her, die diese Stadt bauten und die Träger dieser Kultur waren? Die Einwohnerzahl Mohenjo-Daros wird allgemein auf 40.000 geschätzt, was mir aber für die Größe von 100 ha als zu hoch erscheint.27 Sie mag unter der Annahme der neuesten Daten (mindestens 200 ha) realistisch sein. Nimmt man aber die Zahl von 1.000 harappazeitlichen Siedlungen und setzt pro Siedlung nur 600 Bewohner (etwa 100 Familien) durchschnittlich an, so ergäbe das bereits eine Gesamtbevölkerung von 600.000 ohne die der großen Städte. Derzeit werden im wesentlichen zwei Hypothesen diskutiert: Die eine nimmt das Gebiet um Harappa als Ursprungsgebiet an, die andere das Gebiet um Mohenjo-Daro. Wo immer dieses Ge-biet auch war, kann bereits gesagt werden, daß die Leute zumindest in mittelbarer Nähe des Indus gelebt haben müssen, von wo sie, noch nicht direkt periodisch gefährdet, den Indus aber
24 K.A. Wittfogel, Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht, Köln 1977. 25 E.H. Aitkin, Gazetteer of the Province of Sind, Karachi 1907. 26 Daher führen die Landwege dort traditionell nicht durch das Industal, sondern durch die westlichen Hoch-ebenen Sind Kohistans. Erst nach der Eindämmung des Indus unter den Engländern wurde das alluviale Tal besiedelt und mit Straßen erschlossen. Die 1857 errichtet Eisenbahn führte noch westlich entlang der Berge oder auf erhöhten Dämmen. 27 Die Zahl wurde von W.A. Fairservis errechnet, basierend auf vergleichenden Studien mit Siedlungen aus dem 19. Jh. aus dieser Gegend.
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 17
17
studieren konnten und zumindest extensiv das Boot nutzten. Auch der Bewässerungsfeldbau –Voraussetzung dafür ist das Nivellieren der Kanäle – muß bekannt gewesen sein. Mit dem Manchhar-See südlich von Mohenjo-Daro und der Kachhi-Ebene, Gebiete, die eine lange Siedlungstradition, am Manchhar See sicherlich auch mit dem Boot, aufweisen, scheint das geeignetste Gebiet früher Entwicklung aufgezeigt zu sein. Viele Siedlungen in dieser Gegend bis hin zum Quettatal wurden zur Mitte des 3.Jts verlassen, vielleicht, um Mohenjo-Daro zu besiedeln. Da das frühere Siedlungsgebiet der Kot-Diji-Kultur in das der späteren reifen Harappa-Kultur einging, ist auch vor dem Hintergrund des großen Menschenbedarfs zu vermuten, daß die eine sich aus der anderen entwickelte. Wesentliche Elemente der reifen Harappa-Kultur sind bereits in der Kot-Diji-Kultur vorhanden, vor allem die Tatsache, daß bereits eine große Fläche des Industals besiedelt war. Dieses läßt vermuten, daß schon zu dieser Zeit das Boot genutzt wurde, wenn auch nicht so intensiv wie in der folgenden Harappa-Kultur. Wo immer es liegen mag, das Gebiet der letzten Entwicklung hin zu den großen Städten muß technisch gesehen die Entwicklung der Brunnentechnologie (keilförmige Ziegel, Entwicklung zur Kreisform, Abteufen) und Mauertechnik sowie die Entwicklung der Schrift aufzeigen. Durch die bereits erfolgte großflächige Erschließung des Industals muß sich eine Gesellschaft zum Ende der frühen Harappazeit entwickelt haben, die sich dann in ein System überführte (oder überführt wurde), das wir heute als reife Harappazeit oder Indus-Zivilisation bezeichnen und das schon bald organisatorisch und finanziell in der Lage war, Mohenjo-Daro als ersten monu-mentalen Ausdruck zu schaffen. Unter Betrachtung aller Befunde wird klar, daß Mohenjo-Daro keine Produktions-, sondern eine Verwaltungsstadt war; sie war das neue Zentrum am Haupt-kommunikationsstrang, dem Indus gelegen. Außen- Innen Wenn wir von der Indus-Kultur sprechen, so müssen wir ebenfalls von der Nicht-Indus-Kultur sprechen. Was war da, wo die 'Indus-Kultur' nicht war und wie verhielten sich diese zwei Räume zueinander? Zuerst ist da der Westen, über dessen Netze Prof. Lamberg sprechen wird. In unmittelbarer Nähe ist das Bergland Baluchistans, die Khirtar und nördlich die Sulaiman Berge. Das Flußsystem des Bolan entspringt im Hochtal von Quetta, der Bolanpaß ist eine der Haupt-West-Ost-Achsen, genau auf Mohenjo-Daro zielend und von dort vermutlich den Indus überschreitend und in Kot-Diji als Zentrum des Flinthandels aus den Rohri-Bergen endend (wenn nicht bereits in Mohenjo-Daro). Das Quettatal seinerseits ist weiter nach Westen etwa archäologisch durch die Siedlung Mundigak angebunden, die wiederum mit der Hilmond- und Namazga-Kultur sowie mit dem Gebiet von Elam und Damt mit Mesopotamien verbunden war. Diese Landverbindung war vor allem in der ersten Hälfte des 3. Jts. stark, wie Tosi zeigen konnte. In der zweiten Hälfte des 3. Jts. bricht diese Landverbindung weitgehend zusammen. Dafür entwickelt sich offensichtlich die Seeverbindung entlang der Makranküste hin zur Umm an Nar-Kultur der arabischen Halbinsel und hin nach Dilmun. Der Landhandel scheint durch den Seehandel ersetzt worden zu sein, Motivationen dazu mögen ähnlich denen gewesen sein. Die 1492 zur Entdeckung des Seeweges nach Amerika und 1498 nach Indien geführt haben: Blockade des Landweges und Verlagerung auf ein neues Transportmedium, das sicherere Wasser. Erst nach dem Untergang der reifen Harappa-Kultur ab 2000 v. Chr. sind erneut und verstärkt Einflüsse von Westen und aus Zentralasien zu verzeichnen (Mergarh VIII) und danach vollzieht sich ab 1400 v. Chr. die Einwanderung der Arier.
18 Michael Jansen
18
Ein Phänomen soll hier besonders diskutiert werden: das der Siedlung Shortugai. Während zur reifen Harappazeit keine Siedlungen dieser Kultur im direkten Hochland von Baluchistan zu finden sind, ist bisher nur eine Ausnahme zu registrieren: der Lapis-Handelsplatz Shortugai in Badakhshan. Offensichtlich die Lapisminen kontrollierend, ist diese Siedlung ab 2500 v. Chr. reifharappazeitlich. Die Präsenz der Industal-Leute geht einher mit der Umlagerung der Handels-wege vom Land auf das Wasser, wobei von Badakhshan der Lapis zuerst in das Industal transportiert werden mußte, um von dort über Wasser zur arabischen Halbinsel und dann weiter bis nach Ägypten gebracht zu werden. Dieses ist eine bisher kühne Behauptung. Liest man im "Periplus Maris Erithraei" nach, so gehört der Lapis zur Römerzeit zu den wichtigen Handels-gütern aus dem Industal. Warum dieses nicht auch bereits 2500 Jahre früher? Mit dem Ersatz des Landhandels durch den Seehandel war das Indussystem allerdings auch isolationsgefährdet geworden, da die Unterbrechung des Seehandels nach Westen auch die Unterbrechung der allgemeinen Kontakte bedeutet hätte, ein weiterer Grund vielleicht für die spätere anonyme Auflösung. Richtung Osten wurde das Industal durch die Wüste Thar vom übrigen Subkontinent getrennt. Lediglich im Norden über die Delhische Pforte und im Süden über die damaligen Inseln Kutch und Saurashtra bestanden Verbindungsmöglichkeiten zu den neolithisch-megalithischen Kul-turen des Landesinneren. Wie weit Küstenschiffahrt entlang der Westküste nach Süden erfolgte, ist noch nicht untersucht. Lothal wird als eine 'gate-way' Siedlung verstanden, über die Kontakte 'nach außen' gehalten wurden. Kontakte nach Norden über die Pässe des Himalaja (etwa Karakorum) hin nach Tibet sind nicht bekannt. Den Süden begrenzt das Arabische Meer, von dem wir wissen, daß es über den Indus wichtiges Transportmedium für die Küstenschiffahrt war. Viele der Grenzsiedlungen nach Westen können als Kontroll-Befestigungssiedlungen verstanden werden. Sie waren oft in strategisch günstiger Lage (etwa Gaj Naig) gebaut und mit starken Verteidigungsanlagen versehen. Im Westen scheint ein territoriales Verteidigungssystem gegen den traditionellen westlichen Invasionsdruck errichtet gewesen zu sein, was erklären könnte, daß Mohenjo-Daro, zumindest nach Auffassung von V.G. Childe, verteidigungsmäßig schwach ausgebaut war. Zentrum-Peripherie Die Indus-Zivilisation begann nicht mit Mohenjo-Daro, sondern sie brachte Mohenjo-Daro hervor. Mohenjo-Daro, am Kreuzpunkt der ost-westlichen Handelsstraße Quetta, Kachhi und Indus (als Furt weiter nach Kot-Diji?) gelegen und in Reichweite des offenen Meeres war als Neugründung das Ergebnis von Notwendigkeit und Erfahrung.28 Mit der Gründung Mohenjo-Daros setzte die Indus-Zivilisation ihre große Blütezeit fort, mar-kiert von einem außerordentlichen Expansionsdrang, verständlich vor dem Hintergrund der Tatsache, daß das alluviale Industal außer Lehm keinerlei Rohstoffe aufweist. Während das alluviale Industal dünn besiedelt blieb,29 sind die Randgebiete (ökologische Nischen) dicht besiedelt. Dazu zählt das Gebiet des Manchhar-Sees (I), die Kachhi-Ebene (II), die Gomal-Ebene (III), der Punjab (IV), das Gebiet des oberen Sutlej, das Ganges Jamuna Doab (V), das alte Flußsystem des Ghaggar einschließlich Cholistan (VI) sowie in seiner Fortsetzung nach Süden
28 Damals befand sich die Küstenlinie ca. 100 km näher an Mohenjo-Daro. 29 Einige Autoren führen die heutige dünne Besiedlung auf die Tatsache zurück, daß die meisten Orte unter den Ablagerungen des Indus verschwunden sind.
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 19
19
das Gebiet des Eastern Nara (VII) hin bis nach Saurastra (VIII). Erste Betrachtungen zeigen, daß die verschiedenen peripheren Bereiche verschiedene Versor-gungsfunktionen hatten.30 So ergab ein Survey in Bahawalpur, daß dort Produktionssiedlungen bestanden, wogegen auf Saurastra Baumwolle angebaut wurde. Wieweit das aktiv alluviale Industal zu intensivem Feldbau genutzt wurde, ist noch nicht bekannt. Bewässerungsfeldbau war nur in den sekundären Flußsystemen denkbar, da diese kontrolliert werden konnten, was im Falle des Indus nicht möglich war. Hier kam lediglich die Nutzung31 des noch feuchten Bodens nach Rückgang der jährlichen Fluten ab Oktober für Feldbau in Frage.32 Darüber hinaus wissen wir noch nichts über das Verhältnis der einzelnen Regionen untereinander und zum Zentrum. Dieses Verhältnis könnte nur durch weitere Forschung geklärt werden. Verbindungswege Die Untersuchung hat gezeigt, daß die kulturelle Entwicklung Nord-West-Indiens im Rahmen unserer Betrachtung von Netzen (Knotenstränge) auch mit der Veränderung der Art der Kommunikationswege verbunden war. Dabei spielt eine wesentliche Rolle die Verlagerung des Transports vom Landweg hin zum Wasserweg. Die alten Landwege führen westlich des Indus über das Hochland von Sind-Kohistan. Die Indusebene war entweder überflutet oder nach Rückgang der jährlichen Fluten sumpfig. Östliche nord-südlich verlaufende Landrouten sind nicht bekannt. Damit war das westliche Bergland und seine Piedmont-Bereiche bis zur Erschlie-ßung der Wasserwege selber wesentlicher Kommunikationsbereich nicht nur in west-östlicher Richtung. Dieses ist archäologisch in den bekannten neolithischen Kulturen (vor allem auch dem Amri-Komplex) nachvollziehbar. Mit dem Kot-Diji-Komplex33 scheint die Erschließung des Industals zu Wasser zu beginnen. Die Ausdehnung dieses Materialkomplexes bezieht sich bereits auf den wesentlichen alluvia-len Kernbereich des Industals. Zentrum könnte durchaus Harappa im Punjab gewesen sein,34 aber auch der Bereich der Gomalebene mit so mächtigen Anlagen wie Rahman-Dheri aus der ersten Hälfte des 3. Jts. v. Chr. Der Manchhar-See-Bereich käme ebenfalls in Frage mit dem Vorteil, nicht nur das größte Süßwasserreservoir des Indischen Subkontinents zu sein, son-dern auch im See Siedlungen des ausgehenden 4. Jts. aufzuweisen, die das Boot als Kom-munikationsvoraussetzung hatten. Hier mag der Ursprung für die Entwicklung des Bootes zu finden sein, das, über die Mohana bis heute überliefert, zunächst ein Flachbodenboot war, das für Gewässer mit geringem Tiefgang gebaut war. Parallel dazu entwickelte sich die Sothi-Kultur östlich entlang des Ghaggar. Daß das Verkehrsnetz wesentlich nord-südlich aus-geprägt war, ist bereits von anderen Autoren festgestellt worden. Mir scheint nur wesentlich, daß offensichtlich parallel zum Indus in der Verlaufslinie des Ghaggar und weiter des Eastern Nara eine zweite Achse bestand, die viel dichter besiedelt war als die des Indus und die im Run of Kutch mündete, wo hunderte Siedlungen auf den Inseln Kutch und Saurasthtra vorzufinden sind. Die zeitliche Relation zur Indusachse (parallel, später) 30 R. Mughal, Ancient Cholistan. Archaeology and Architecture, Lahore 1997. 31 Bis zur Errichtung der Sukkur Barrage 1932. 32 Es wäre absurd, die Existenz Mohenjo-Daros nahe dem Indus alleine aus agrarischen Argumenten abzuleiten. 33 Diese Kultur ist nach Kot-Diji als erstem Fundort benannt, hatte diesen aber sicherlich nicht zum Hauptort. 34 Die neuesten Grabungen der Amerikaner haben gezeigt, daß Harappa ein Zentrum der Kot-Diji-Kultur war. Da die Verbreitung der Kultur über Keramik festgestellt wird und diese in solch ausgeprägter Form nur in Harappa zu finden ist (nicht in Rahman Dheri und nicht am Manchhar-See), könnte Harappa das Zentrum sein, wobei die Aneignung des Bootes sowie das Bedürfnis zur Expansion zu klären wäre.
20 Michael Jansen
20
ist nicht geklärt. Verständlich ist aber die hohe Siedlungsdichte, da dieses Flußsystem kleiner, sprich kontrollierbarer war als das des Indus. Es wäre eine Parallelverschiebung der Nord-Südachse im Industal, chronologisch mit dem Westen beginnend und nach Osten in den folgenden Schritten fortschreitend, denkbar:
1. 4. Jt. Landwegachse durch das Hochland von Baluchistan 2. Anfang des 3. Jts. bis ca. 1900 das Indussystem 3. Ab 2300 bis 1900 zusätzlich das Ghaggar-Eastern Nara System.
Mit der Blütezeit der Indus-Zivilisation wurde das komplexe Netzsystem von Mohenjo-Daro aus gesteuert. Wie und unter welchen Bedingungen ist Teil weiterer Untersuchungen.
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 21
21
Literaturverzeichnis
Adams, R. Mc, Land Behind Baghdad, Chicago 1965.
Ders., The Uruk Countryside. The Natural Setting of Urban Societies, Chicago 1972.
Agrawal, D.P.; Nissen, H., Harappa Culture: New Evidence for a Shorter Chronology, Science 143, 1964, 950f.
Agrawal, D.P., The Copper Bronze Age in India, New Delhi 1971.
Aitkin, E.H., Gazetteer of the Province of Sind, Karachi 1907.
Allchin, B.; Allchin, F.R., The Birth of Indian Civilization, Harmondsworth 1968.
Dies., Origins of a Civilization, New Delhi 1997.
Childe, V.G., Social Evolution, London 1951.
Christaller, W., Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Unter-suchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städti-schen Funktionen, Jena 1933.
Dales, G.F., Harappan Outposts on the Makran Coast, Antiquity 36, 1962, 86-92.
Ders., Civilization and Floods in the Indus Valley, Expedition 7/4, 1965, 10-19.
Ders., Recent Pre- and Protohistoric Researches in Pakistan and Afghanistan, in: D.P. Agrawal; A. Ghosh (Eds), Radiocarbon and Indian Archaeology, 2 Vols., Bombay 1973, 118-130.
Fairservis, W.A., The Harappan Civilization. New Evidence and More Theory, AMN 2055, 1961.
Ders., The Origin, Character and Decline of an Early Civilization, AMN 2302, 1967.
Ders., The Roots of Ancient India, New York 1971.
Flam, L., The Palaeography and Prehistoric Settlement Patterns in Sind, Pakistan (ca. 4000 – 2000 B.C.), Philadelphia 1981.
Ders., Fluvial Geomorphology of the Lower Indus Basin (Sindh, Pakistan) and the Indus Civilization, in: J.F. Shroder, Himalaya to the Sea. Geology, Geomorphology and the Quarter-nary, London; New York 1993, 265-287.
Jansen, M., Pre, Proto-, Early, Mature-, Urban, Late-, Post Harappan. Linearity, Multi-Linearity: "Babylonian Language Confusion" or Ideological Dispute?, SAA 1991, 135-148.
Ders., Mohenjo-Daro: Type Site of the Earliest Urbanization Process in South Asia, in: H. Spodek, D. Srinivasan (Eds.), Urban Form and Meaning in South Asia. The Shaping of Cities
22 Michael Jansen
22
from Prehistoric to Precolonial Times, Washington 1993, 35-52.
Ders.; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994.
Ders., Mohenjo-Daro Photographic Data Bank, CD-Rom. Aachen 1998.
Kohl, P., The 'World-Economy' of West Asia in the Third Millennium B.C., SAA 1979, 55-85.
Martindale, D., Max Weber. The City, London; New York 1958.
Meadows, A.; Meadows, P.S.; Neuwirth, G., Indus River. Biodiversity, Resource, Humankind, Karachi 1999.
Mühlmann, W.E., Geschichte der Anthropologie, Wiesbaden 1984.
Mughal, R., The Early Harappan Period in the Greater Indus Valley and Northern Baluchistan (ca. 3000-2400 B.C.), Ann Arbor 1971.
Ders., The Harappan Settlement Systems and Patterns in the Greater Indus Valley (ca. 3500-1500 BC), Pakistan Archaeology 25, 1990, 1-72.
Ders., The Harappan 'Twin Capitals' and Reality, Journal of Central Asia XIII,1, 1990, 155-162.
Ders., Further Evidence of the Early Harappan Culture in the Greater Indus Valley 1971-90, SAS 6, 1990, 175-199.
Ders., The Cultural Patterns of Ancient Pakistan and Neighbouring Regions circa 7000-1500 B.C., Pakistan Archaeology 26, 1991, 218-237.
Ders., Ancient Cities of the Indus, Lahore Museum Bulletin VII,1&2, 1994, 53-59.
Ders., Ancient Cholistan. Archaeology and Architecture, Lahore 1997.
Panhawar, M.H., Source Material on Sind, Jamshoro 1977.
Piggott, S., Prehistoric India to 1000 B.C., ND Harmondsworth 1961.
Possehl, G. (Ed.), Harappan Civilization: A Recent Perspective. 2nd Ed., Delhi 1993.
Ders., The Transformation of the Indus Civilization, Journal of World Prehistory 11,4, 1997, 425-472.
Rao, S.R., Lothal and the Indus Civilization, Bombay 1973.
Ders., Lothal, a Harappan Port. Vol. 1, MASI 78, New Delhi 1979.
Ders., Lothal 1955-62. Vol. 2, MASI 78, New Delhi 1985.
Ratnagar, S., Enquiries into the Political Organization of Harappan Society, Pune 1991.
"Stadt und Netze in der Indus-Kultur" 23
23
Schroder, J., Himalaya to the Sea. Geology, Geomorphology and the Quaternary, London; New York 1993.
Wheeler, Sir M.,The Indus Civilization, Cambridge 1953.
Wittfogel, Karl A., Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht, Köln 1977.
Abbildungsnachweis Abb.1: W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena 1933, Karte 4; Abb.2: L. Flam, The Palaeography and Prehistoric Settlement Patterns in Sind, Pakistan (ca. 4000 – 2000 B.C.), Philadelphia 1981, Abb.27; Abb.3: R. Mughal, The Early Harappan Period in the Greater Indus Valley and Northern Baluchistan, Ann Arbor 1971, 169, Fig. 10; Abb.4: S.R. Rao, Lothal and the Indus Civilization, Bombay 1973, Abb.1; Abb.5: R. Mughal, Ancient Cities of the Indus, Lahore Museum Bulletin VII,1&2, 1994, 53-59, Karte 2; Abb.6-9: Ver-fasser.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
25
Reinhard Dittmann (Münster)
STADTNETZE - STÄDTISCHE FUNKTIONEN AM BEISPIEL
ALTORIENTALISCHER STÄDTE 1. Einleitung Eine Zusammenfassung von altorientalischen Stadtnetzen, bzw. städtischen Funktionen erstellen zu wollen grenzt bei heutiger Datenlage, zumal in dem hier vorgegebenen, notwendigerweise engen Rahmen, an Anmaßung. Zu unterschiedlich sind die verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren in den unterschiedlichsten Sozio-/Ideo-/Öko- und Ökonomiesystemen in dem ge-waltigen Untersuchungsbereich der Vorderasiatischen Archäologie, nicht zu sprechen von der vergleichsweise großen zeitlichen Tiefe, die zu berücksichtigen ist. Wollte man sich dagegen nur auf ein oder wenige Fallbeispiele beschränken, läuft man Gefahr, den Sonderfall zur Regel zu machen und zum vermeintlich Typischen zu erheben. Im folgenden soll versucht werden, ausgehend von den großen Netzen der Siedlungssysteme hin zu den innerstädtischen Netzen der Siedlungen einen allgemeinen Überblick zu bieten. Ziel ist es, Ansätze einer Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen, die bei einer tiefergehenden Analyse des Komplexes der "alt-orientalischen Stadt" zu berücksichtigen wären.1 Zunächst ist die Frage zu stellen, ob der Begriff Stadt, wie wir ihn heute benutzen, ausgehend von Traditionen des westeuropäischen Raumes, auf altorientalische Gegebenheiten übertragbar ist. In jüngerer Zeit ist in der altorientalischen Philologie und Wirtschaftsgeschichte zunehmend der Trend zu beobachten, nicht das formale Kontinuum Dorf – Stadt – Metropole2 in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen, sondern Haushalte unterschiedlicher Komplexität, also
1 Zusammenfassende und überregionale Studien wie H. Boockmann, Die Stadt im Mittelalter, 2. Aufl. München 1987 oder gar M. Girouard, Die Stadt. Menschen, Häuser, Plätze. Eine Kulturgeschichte, Frankfurt a.M.; New York 1987 oder die wesentlichen Bemerkungen von F. Braudel, Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. I. Der Alltag, München 1985, 523-612 fehlen zum alten Orient. Einen vorläufigen Ersatz bieten: I.R.A. Lapidus (Hrsg.), Middle Eastern Cities. Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism. A Symposium, Berkeley; Los Angeles 1969; M. Hammond, The City in the Ancient World, Cambridge Mass. 1972 sowie A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 109ff.; T.C. Young, The Origin of the Mesopotamian City, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 11, 1986, 3ff. und J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 22ff. und 73ff. Siehe auch die diversen Beiträge in P.J. Ucko u.a., Man, Settlement and Urbanism, London 1972. Im folgenden wird nur auf zentrale Orte und Stadtanlagen eingegangen werden; die verschiedenen Formen von Weilern, Dörfern, spezialisierten Dörfern, Vorwerken und Camps, die vor allem auch in der textlichen Überlieferung reichhaltig belegt sind, werden hier weitgehend ausgeklammert, da dies den Rahmen der Übersicht sprengen würde. Siehe auch die philologischen Belege zu Akkadisch Stadt = ālu bei I.J. Gelb u.a., "ālu", in: The Assyrian Dictionary, Chicago 1964, 379ff. Dieser Aufsatz ist H.J. Nissen zu seinem sechzigsten Geburtstag gewidmet. 2 Wie trügerisch rezente Termini und ihre Implikationen für den akademischen Diskurs sein können, wird innerhalb der historischen Wissenschaften vor allem in der Mediävistik diskutiert; als Beispiel möge O.G. Oexle, Die funktionale Dreiteilung der Gesellschaft bei Adalbero von Laon, in: M. Kerner (Hrsg.), Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 1982, 421ff. dienen. Für die Archäologie vgl. u.a. die diversen Beiträge in: J.-Cl. Gardin; Ch. Peebles, Representations in Archaeology, Indiana 1992. Zur Problematik der Rekonstruktion alter semantischer Felder vgl. den vergnüglichen Beitrag von R.K. Englund , „There’s a Rat in my Soup!“, Altorien-talische Forschungen 23, 1995, 37ff. Zu den rein formalen Aspekten des hier diskutierten Betrachtungsgegenstandes siehe auch die Zusammenstellung von W. Nagel; E. Strommenger, Altorientalische Städte - von der Dorfkultur zur Hochkultur seit Habubah bis Babylon, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 16, 1978-79, 61ff.
Reinhard Dittmann
26
letztlich oikenhafte Systeme.3 Dieser Ansatz findet seine Rechtfertigung vor allem in der keilschriftlichen Überlieferung von Tausenden von Wirtschaftstexten und deren Auswertung. Die Vorderasiatische Altertumskunde, deren Betrachtungsraum jedoch auch weite Gebiete und Perioden umfaßt, aus denen keine schriftliche Überlieferung vorliegt, hat in den letzten Jahrzehnten einen modifizierten Ansatz verfolgt, der sich primär mit siedlungssystemischen Funktionen auseinandersetzt, also mit den Funktionen, die Siedlungen innerhalb eines erkenn-baren und zu definierenden Siedlungssystems erfüllten. Anstelle von Städten wird hier eher der neutralere, und aus diesem rein auf einer phänomenologischen Ebene erfahrbaren und definierbaren Terminus lokales/regionales Zentrum verwendet.4 Im folgenden wird auch hier diesem Begriff der Vorzug gegeben, da nur er mit rein archäologischen Mitteln definier- und begründbar ist, auch in Regionen ohne keilschriftliche Überlieferung. Besonders in diesen Regionen, in denen die historische Topographie mangels konkreter Toponyma nicht zu ermitteln ist, wird der zentrale Ort eines Siedlungssystems in der Regel, in Ermangelung anderer Parameter, an der Ortsgröße festgemacht. Es ist aber zu beachten, daß die Größe einer Siedlung allein, wie die Siedlungsgeographie lehrt, keine verläßliche Variabel für die Definition eines Zentrums sein kann, sondern aus archäologischer Sicht die uns einzig pragmatisch faßbare.5 2. Zentrum und Umland, Typen von Zentren Inwieweit die Masse der altorientalischen Bevölkerung eine konkrete Vorstellung von den außerhalb ihres unmittelbaren Siedlungsbereiches liegenden topographischen Verhältnissen hatte, ist im Einzelfall nicht zu entscheiden. Grundkenntnisse entfernterer geographischer Bereiche werden in verschiedenen Mythen ab dem 3. Jt. v. Chr. reflektiert,6 und es wurden auch systematisch Flurnamen auf Listen festgehalten.7 Gute geographische Kenntnisse sind dann selbstredend auch den gewaltigen Militäraktionen in der altorientalischen Geschichte zugrunde zu legen.8 Ebenso gab es Itinerare, also Wegstreckenbeschreibungen,9 und eine Tontafel aus
3 I.J. Gelb, Household and Familiy in Early Mesopotamia, in: E. Lipiński (Hrsg.), State and Temple Economy in the Ancient Near East I-II, Louvain 1979, 1ff.; J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 191ff. und vor allem J. Renger, Different Economic Spheres in the Urban Economy of Ancient Mesopotamia, in: E. Aerts; H. Klengel (Hrsg.), The Town as Regional Economic Center in the Ancient Near East, Studies in Social and Economic History 20, 1990, 20ff.; ders., Wirtschaft und Gesell-schaft, in: B. Hrouda (Hrsg.), Der Alte Orient, Gütersloh 1991, 187ff. und J.-P. Grégoire, L’origine et le développement de la civilisation mésopotamienne du troisième millénaire avant notre ére, Paris 1976, bes. 67-73. 4 H.J. Nissen, Grundzüge einer Geschichte der Frühzeit des Vorderen Orients, Grundzüge 52, Darmstadt 1983, bes. 8ff. 5 P. Haggett, Einführung in die kultur- und sozialgeographische Regionalanalyse, Berlin; New York 1973, bes. 315ff. will die Siedlungssystemhierarchien lieber an der Güter- und Interaktionsstromdichte als nur an der Ortsgröße festmachen. 6 So zum Beispiel in den Mythen, die sich um die Stadt Aratta auf dem iranischen Hochland ranken: S. Cohen, Enmerkar and the Lord of Aratta, Ann Arbor 1973 und C. Wilcke, Das Lugalandaepos, Wiesbaden 1969. Oder der Zedernwald des Libanons, der im Gilgamešepos evoziert wird: A. Falkenstein, „Gilgameš“, in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 3, Berlin; New York 1968, 357ff. und S.M. Dalley, Myths from Mesopotamia, Oxford 1989. 7 Solche Listenwerke sind schon in den ältesten überlieferten archaischen Texten belegt: H.J. Nissen; P. Damerow; R.K. Englund, Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient, 1990 und H.J. Nissen, Bemerkungen zur Listenliteratur Vorderasiens im 3. Jt., in: L. Cagni (Hrsg.), La Lingua di Ebla, Neapel 1981, 99ff. 8 Siehe auch W. von Soden, Einführung in die Altorientalistik, Darmstadt 1985, bes. 151f. 9 Zum Beispiel W.W. Hallo, The Road to Emar, Journal of Cuneiform Studies 18, 1964, 57ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
27
Abb. 1: Sogenannte "Weltkarte" dem 1. Jt. v. Chr. verzeichnet sogar eine Grundskizze größerer geographischer Einheiten (Abb. 1). Der ziemlich beschädigte Text mit Zeichnung einer Scheibe mit ursprünglich acht (sieben?) Sternzacken wurde von Peiser im British Museum entdeckt und 1889 bekannt gemacht. Die Karte zeigt eine Scheibe, die von einem breiten Fluß umgeben ist, der viermal als maratu "das Bittere" bezeichnet wird, was in geographischen Angaben die Lagune am Persischen Golf, das Mittelmeer oder (mit den Kennzeichnungen "das Obere" bzw. "Untere“ beide den Babyloniern bekannte Meere bezeichnen kann. Von oben nach unten - die Karte ist annähernd nach unserer Windrose orientiert - verläuft ein doppelter Strich ohne Eintragung, wohl der Euphrat. Er mündet in bitqu 'Schleuse' und apparu 'Sumpf'; dabei liegt links (westlich Bīt Jakīn, rechts zweigt offenbar ein Kanal ab, dessen Name nicht erhalten ist. In der oberen Hälfte zieht sich ein breites Rechteck über den Euphrat hin; seine Inschrift TIN.TIR.KI (= Babylon) soll wohl tatsächlich die auf den Flußufern erbaute Hauptstadt des Chaldäerreiches in den Mittelpunkt stellen. Andere Städte sind durch Kreise in üblicher Weise gekennzeichnet, oft aber nicht benannt. Auf der rechten (östlichen) Kartenhälfte findet sich KUR. Aš -šur. KI und BAD.AN.KI (= Der). Schließlich ist auf der linken Kartenhälfte oben zwischen zwei unbenannten Städten ha-ab-ban zu lesen, auf der rechten oben, durch einen Halbkreis selbst über den Euphrat hinweg symbolisiert ist, das Gebirge (šadû) eingezeichnet, womit wohl der Taurus gemeint sein wird. An den 'Bitterstrom' angelehnt sind 8? (sichtbar 4) spitzwinklige Dreiecke, durch Umschrift als nagû, 'Bezirk' [...] bezeichnet; sie werden auf der Rückseite des Textes offenbar erläutert, wobei die Entfernungsangaben abweichen. Der nördlichste 'Bezirk' ist der nagû 'wo die Sonne nicht gesehen wird' [...]".10 10 W. Röllig, "Landkarten", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 464ff., hier 466f. Abb. 2; siehe auch die wesentlich ausführlichere Beschreibung bei E. Unger, Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin, New York 1970, 20ff. Abb. 3-4 und die Übersetzung des Textes ebd. 254ff.
Reinhard Dittmann
28
Abb. 2: Relief auf einem Silbergefäß aus Maikop Solche Vorstellungen konnten auch nur rein bildlich ausgedrückt werden, wie eine Darstellung auf einer Silbervase aus Maikop (Kaukasus) zeigt (Abb. 2).11 Die Masse der Bevölkerung, so nicht durch exogame Familien-/Clanbindungen mit anderen Orten verbunden, dürfte jedoch nur das nähere Umland eines Zentrums zur Kenntnis genommen haben. Eine Kartenskizze auf einer Tontafel aus dem späten 3. Jt. v. Chr. illustriert solch eine abstrakte Umsetzung der realen geographischen Kenntnisse von der engeren Umgebung einer altorientalischen Stadt (Abb. 3): "Der kleine Text (7,5 x 6,5 cm) aus Gasur (Nuzi) ist nicht stratigraphisch, wohl aber durch seine Sprach- und Schriftform ins 3. Jt. v. Chr. (altakkadische Schicht von Jorgan-Tepe) zu datieren. Er ist, wählt man die Hauptschriftrichtung, nach den Himmelsrichtungen orientiert, wobei Westen (Beischrift) unten ist. Ein Flußlauf namens Rakhium ('der sich ergießt') mit mehreren Zuflüssen, durch Wellenlinien symbolisiert. Er ist - in etwas Abstand - von zwei schuppenartig gezeichneten Hügel- oder Bergketten begrenzt, die einzige Darstellung von Gebirge auf einer Karte. Ortschaften werden durch die Kreise, teilweise mit eingeschriebenem Namen, gekenn-zeichnet. BAD-eb-la in der linken unteren Ecke dürfte Dur-ubla in jüngeren Nuzi-Texten ent-sprechen; die Karte gibt folglich einen Landstrich im Gebiet von Nuzi wieder."12 11 V. Haas, Hethitische Berggötter und Hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen, Kulturgeschichte der antiken Welt 10, Mainz 1982, 207 Abb. 41: "Auf-gerollte Verzierung eines Silbergefäßes aus Maikop (im Kubangebiet), die möglicherweise die in den Persischen Golf mündenden Flüsse Euphrat und Tigris darstellen soll, im Hintergrund ist der Kaukasus zu sehen. Das Gefäß könnte um 2000 v. Chr. zu datieren sein, wahrscheinlich aber doch später", vgl. F. Hançar, Urgeschichte Kau-kasiens. Von den Anfängen seiner Besiedlung bis in die Zeit seiner Metallurgie, Wien; Leipzig 1937 und A.M. Tallgren, Maikop, in: M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte Bd. 7, 1926. 12 W. Röllig, "Landkarten", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 464ff., hier Abb. 1.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
29
Zwar gab es diverse Wegstrecken und Routen, der Ausbau von befestigten Straßensystemen mit Versorgungsstationen erfolgte im Vorderen Orient jedoch erst ab dem 1. Jt. v. Chr., und es war ein königliches Privileg, dieses Netz zu unterhalten.13
Abb. 3: Kartenskizze von der Umgebung von Nuzi (?)
auf einer Tontafel Die Zentren dienten als Kumulationspunkt des unmittelbar sie umgebenden Kulturlandes und die hier erzielten agrarischen Produkte wurden in ihnen gespeichert und über lange Zeiträume in unserem Betrachtungsraum dann wieder von den Zentren an das gros der lohnabhängigen Be-völkerung redistribuiert. Das Umland wurde von den zentralen Einrichtungen der Stadt gestaltet, das heißt vermessen, parzelliert und bewirtschaftet, wie eine Felderskizze aus dem 21. Jh. v. Chr. auf einer Tontafel illustriert (Abb. 4),14 und - so zum Beispiel im Falle des intensiv bewässerten babylonischen Raumes - Dattelplantagen im Stockwerkbau angelegt (Abb. 5).15 Das Kanalsystem Babyloniens diente jedoch nicht nur der Bewässerung, sondern auch als Hauptverkehrsweg,16 nicht nur für den Warenverkehr, sondern auch für Kultreisen der Götter anläßlich der großen Kultfeiern, besonders zum babylonischen Neujahrsfest.17
13 L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 119. 14 J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 231 Abb. 12,3. Die Dörfer mit ihren jeweiligen Dorfvorstehern waren in der Regel für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auch in ihrem näheren Einzugsbereich als Rechtsinstanz verantwortlich (Codex Hammurabi § 23); nur im Zweifelsfalle wurden die höheren Instanzen in den Zentren bemüht (ebd., 276). Das Verwalten von Vieh und das Bemessen von Feldern ist schon in den ältesten bekannten, sogenannten archaischen Texten voll entwickelt, vgl. H.J. Nissen; P. Damerow; R.K. Englund, Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient, 1990. 15 J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 173ff., Fig. 9,1 und K. Butz, “Landwirtschaft“, in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 470ff. zur altmesopotamischen Landwirtschaft allgemein. 16 Kanalanlagen wurden auch im unwegsamsten Gelände angelegt, so zum Beispiel im 13. Jh. v. Chr. um Tell Šeikh Hamad (am Khabur in Syrien) oder bei Kar-Tukulti-Ninurta (am Tigris im Nordiraq) vgl. R. Dittmann, Die inneren und äußeren Grenzen der mittelassyrischen Residenzstadt Kar-Tukulti-Ninurta/Nord Iraq, in: M. Jansen; P. Johanek (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkultur-forschung 2, Aachen 1997, 101ff. Auch große Aquädukte sind zur Wasserversorgung im 1. Jt. v. Chr. z.B. in
Reinhard Dittmann
30
Zu einem regionalen Zentrum gehören in der Regel abhängige Siedlungen, die untereinander noch hierarchisch gestaffelt sind, was ihre Funktion und Größe im System betrifft. Die Analyse von solchen Siedlungssystemen ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorderasiatischen Archäo-logie, wenngleich es selten gelingt über eine rein phänomenologische Beschreibung der Grund-prinzipien der Siedlungssystemordnungen/-klassen hinauszugelangen. Neben Zentralortssystem-Typen, die vor allem in den großen Alluvialebenen des Betrachtungs-raums angetroffen werden (bestuntersuchtes Beispiel für Babylonien ist das Hinterland von Uruk) und die mit den verschiedenen, teils auch in Mischform auftretenden Siedlungssystemen Kristallers verbunden werden können (Stichwort "K3-, K4- und K7-",18 sowie abgewandelt vom letzteren, mit sogenannten solaren Systemen),19 sind für Bergregionen und ökologisch und/oder reliefabhängig diffizilere Siedlungskammern auch lineare und dendritische Siedlungssysteme bezeugt.20 In den ein bis zwei stufigen Siedlungssystemen des 5. Jts. v. Chr. in Südwest-Iran (ähnliches dürfte auch für zeitgleiche Siedlungen in Babylonien gelten) ist zu beobachten, daß die lokalen Zentren mit durchschnittlichen Größen um 12-15 ha nur wenig größer sind als die von ihnen abhängigen Siedlungen innerhalb der Ranggrößenordnung der Siedlungen. Man vermutet, zu-mal Anzeichen von Redistribution (Maßsysteme, Speichereinheiten) bisher nicht nachzuweisen sind, daß in diesen Zentren nicht andere, notwendigerweise grundsätzlich übergeordnete Funk-tionen erfüllt wurden, wie in den anderen Siedlungen, sondern nur mehr der gleichen Art, Assyrien und Urartu (Ost-Türkei und Nordwest-Iran) bezeugt: O. Belli, Urartian Dams and Artificial Lakes in Eastern Anatolia, in: A. Çingiroglu; D. French (Hrsg.), Anatolian Iron Age 3, British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 16, Ankara 1994, 9ff.; M. Stol, "Kanal(isation), A. Philologisch", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 5, Berlin; New York 1976-1980, 355ff. und H.J. Nissen, "Kanal(isation), B. Archäologisch", ebd., 365ff. Zu den Kanalsystemen und ihren Funktionen allgemein vgl. R. Mc Adams, Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago 1981 und J. Oates, Archaeology and Geography in Mesopotamia, in: J. Bintliff (Hrsg.), Mycenaean Geography, Proceedings of the Cambridge Colloqium Sept. 1976, Cambridge 1977, 101ff. Der Kampf um die Wasserversorgung war auch im Alten Orient ein Thema, wie D.R. Frayne, A Struggle for Water. A Case Study from the Historical Records of the Cities Isin and Larsa (1900-1800 B.C.), Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 17, 1989, 17ff. jüngst diskutiert hat. 17 Zum Zeitbegriff im alten Orient vgl. R.K. Englund , Administration and Timekeeping in Ancient Mesopotamia, Journal of the Economic and Social History of the Orient 31, 1988, 121ff.; speziell zum Kultkalender vgl. B. Landsberger, Der kultische Kalender der Babylonier und Assyrer, Leipziger Semitische Studien, Leipzig 1915 und W. Sallaberger, Der kultische Kalender der Ur III-Zeit, Untersuchungen zur Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 7,1-2, Berlin; New York 1993; zu den Götterreisen vgl. A.W. Sjöberg, "Götterreisen", in: Reallexikon der Assyriologie und der Vorderasiatischen Archäologie Bd. 3, Berlin; New York 1957-1971, 480ff. Daß solche Götterreisen möglicherweise schon in ältesten Textzeugnissen des ausgehenden 4. Jt.s v. Chr. bezeugt sein könnten, diskutierte jüngst P. Charvát, Early Texts and Sealings. ‘Divine Journeys’ in the Uruk IV Period, Altorientalische Forschungen 22, 1995, 30ff. 18 Siehe auch H.J. Nissen, Macht und Stadt in der babylonischen Kultur, in: M. Jansen; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 13ff., bes. Abb. 4. 19 Zur Definition vgl. C.A. Smith, Exchange Systems and the Spatial Distribution of Elites. The Organization of Stratification in Agrarian Societies, in: Dies., Regional Analysis II. Social Systems, 1976, 317ff., Tab. 1 Fig. 1c. 20 C.A. Smith, Exchange Systems and the Spatial Distribution of Elites. The Organization of Stratification in Agrarian Societies, in: Dies., Regional Analysis II. Social Systems, 1976, 317ff.; dies., Regional Economic Systems. Linking Geographic Models and Socioeconomic Problems, in: Dies., Regional Analysis I. Economic Systems, 1976, 34ff. Dieser Kategorie sind auch die Siedlungsketten der Oasensysteme im ehemaligen südrussischen Raum, in Turkmenien und in der Margiana zuzuordnen: P.M. Dolukhanov, The Ecological Prerequisites for Early Farming in Southern Turkmenia, in: Ph.L. Kohl (Hrsg.), The Bronze Age Civilization of Central Asia. Recent Soviet Discoveries, New York 1981, 359ff. und V.I. Sarianidi, Margiana in the Bronze Age, ebd.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
31
bestenfalls gebunden an einen Clanführer oder lokalen Schrein, dessen Sitz die zentrale Funk-tion letztlich begründet. Erst in dem Augenblick, wo die Zentren wesentlich größer werden und für das Umland und ihre abhängigen Siedlungen übergeordnete - also andere - Funktionen er-füllen, und mit Auftreten einer mittleren Siedlungsgrößenkategorie erfolgt der Übergang vom lokalen zum regionalen Zentrum (bzw. vom "Immature" zum "Mature Dendritic System").21 Dieser Prozeß wird in Babylonien erst mit der Herausbildung eines hoch komplexen Zentral-ortssystem um das Zentrum Uruk im 4. Jt. v. Chr. erreicht.22 Gegen Ende des 4., am Übergang zum 3. Jt. v. Chr. gelingt es ansatzweise in einem anderen Beispiel, um Tall-i Malyan (dem alten Anšan, in der heutigen Provinz Fars des Südwest-Iran gelegen), einem dendritischen Zentralortsystem auch funktionale Definitionen der einzelnen Systemsegmente zuzuordnen und somit die ökonomische Grundstruktur des Systems zu ermitteln (Abb. 6a-b).23 Nachgewiesen sind verschiedene Produktionseinheiten in den kleinsten Siedlungen (die zum Teil rohstofforientiert liegen), unmittelbar kontrolliert von mittleren Siedlungsgrößen, die ihrerseits wiederum direkt abhängig vom zentralen Ort sind.
Abb. 4: Felderplan auf einer Tontafel
21 Zusammenfassend R. Dittmann, Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 4,1-2, 1986, 471ff. Zur Unterscheidung von "Immature-" und "Mature Dendritic Systems" vgl. K.B. Kelley, Dendritic Central Place Systems and The Regional Organization of Navajo Trading Posts, in: C.A. Smith (Hrsg.), Regional Analysis I. Economic Systems, 1976, 232ff. 22 Vgl. H.J. Nissen, Macht und Stadt in der babylonischen Kultur, in: M. Jansen; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 13ff., 17f. 23 R. Dittmann, Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 4,1-2, Berlin 1986, 443-445, Abb. 24 und Karte 61.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
33
Abb. 6a: Plan eines Siedlungssystems in der Fars
Abb. 6b: Struktur eines Siedlungsplans in der Fars
Reinhard Dittmann
34
In einem anderen Fall gelang es, den historisch überlieferten Konflikt zwischen zwei baby-lonischen Städten, Lagaš und Umma (im 3. Jt. v. Chr.), auch aus der Entwicklung des be-treffenden Siedlungssystems heraus zu begründen, in dem die Sphären des mittelbaren Ein-flusses bei zunehmendem Anwachsen der Zentren miteinander kollidierten.24 Ein weiteres Beispiel soll jedoch potentielle Schwierigkeiten illustrieren: betrachtet man die Equidistanzen zwischen den Zentren der sogenannten Indus-Kultur,25 so entsteht zwar auf der Darstellungsform von Thiessenpolygonen26 ein vernünftiges System von phänomenologisch offenbar gleichrangig nebeneinander geordneten Zentren. Betrachtet man jedoch die unter-schiedlichen beteiligten Ökosysteme, die stark zu differenzierende materielle Kultur sowie die offenbar gänzlich unterschiedliche Verteilung von wohl standort- und ressourcenabhängigen Produktionseinheiten, so ist die Frage ob diese Struktur eine Gleichrangigkeit diskreter Stadt-staaten oder ein weitgehend integriertes politisches System reflektiert, bei aktueller Datenlage noch nicht zu entscheiden (Abb. 7).27 Verschiedene Zentren konnten auch größere Verbindungen eingehen, sei es durch Handels-beziehungen, sei es durch politisch begründete Bezüge. Besonders im babylonischen Siedlungs-bereich, der ja durch ein das gesamte Gebiet umfassendes hoch komplexes Bewässerungssystem gekennzeichnet ist, mußten sich auch Regularien herausbilden, die das System im Interesse aller aufrecht erhielten. Ein Beispiel für solch eine Verbindung von Zentren (ohne daß wir in der Lage wären, diese inhaltlich zu definieren) kann an den oft zitierten sogenannten Städtesiegeln am Beginn des sogenannten Frühdynastikums in der ersten Hälfte des 3. Jts. v. Chr., erahnt werden, auf denen mehrere Städte in Folge genannt sind (Abb. 8a-b).28 Zu nennen ist z.B. auch das sogenannte Karum-System der altassyrischen Zeit (Abb. 9) in der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. Hierbei handelt es sich um Siedlungen bzw. Siedlungsannexe an lokale, anatolische Zentren, untereinander hierarchisiert, die von assyrischen Kaufleuten aus dem heutigen Nord-Iraq gegründet worden waren, zwecks Handel zwischen dem anatolischen und assyrischen Bereich.29 Eingriffe von zentraler Macht in den größeren Hinterlandbereich eines Zentrums konnten aber auch auf subtilere Weise erfolgen als durch militärischen Druck oder durch Handel(simperia-lismus), nämlich durch die Stiftung von Heiligtümern durch das Zentrum. So zum Beispiel während der sogenannten Mittelelamischen Zeit im Südwest-Iran (zweite Hälfte des 2. Jts. v.
24 H.J. Nissen, Grundzüge einer Geschichte der Frühzeit des Vorderen Orients, Grundzüge 52, Darmstadt 1983, 143ff., Abb. 28; ders., Macht und Stadt in der babylonischen Kultur, in: M. Jansen; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 13ff., 18, Abb. 9. 25 R. Mughal, The Harappan Settlement Systems and Patterns in the Greater Indus Valley, Pakistan Archaeology 25, 1990, 1ff., bes. 40ff. Fig. 18. 26 Zur Methode vgl. P. Haggett, Einführung in die kultur- und sozialgeographische Regionalanalyse, Berlin; New York 1973, 310f. 27 Zusammenfassend vgl. R. Dittmann, Die inneren und äußeren Grenzen der mittelassyrischen Residenzstadt Kar-Tukulti-Ninurta/Nord Iraq, in: M. Jansen; P. Johanek (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 101ff. Einen weitgehend traditionalisti-schen Ansatz, der von einer quasi homogenen Kulturäußerung ausgeht, vertritt dagegen U. Franke-Vogt, Tradition und Transformation am Indus. Die Entstehung der Induskultur, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995, 97ff. 28 Die jüngste und umfassendste Bearbeitung erfolgte duch R.J. Matthews, Cities, Seals and Writing. Archaic Seal Impressions from Jemdet Nasr and Ur, Materialien zu den Frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients II, Berlin 1993. 29 Die Assyrer lieferten Zinn und Textilien nach Anatolien und tauschten es gegen Silber und Gold; vgl. M. Larsen, The Old Assyrian City-State and its Colonies, Kopenhagen 1976.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
35
Abb. 7: Siedlungssystem der Indus-Kultur
Reinhard Dittmann
36
Abb. 8: Sogenannte Städtesiegel: Beispiel eines Siegels (a), Städtenamen (b)
Abb. 9: Netz des Karumsystems in Anatolien
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
37
Chr.).30 Daß die daran gebundene ideologische Abhängigkeit in Zusammenhang mit der wirt-schaftlichen Potenz und dem Besitz dieser religiösen Einheiten dann mindestens genauso erfolg-reich in der Anbindung vorher ungebundener Bevölkerungsgruppen war wie der militärische oder handelspolitische Druck, versteht sich von selbst. Zentren, die an der Peripherie von Siedlungssystemen gelegen sind, markieren aber auch Gren-zen, so z.B. zwischen städtisch und agrarisch genutzten Siedlungskammern und solchen, die vorwiegend von mobilen Gruppen genutzt werden, die in unterschiedlich komplexer Beziehung zu den Erstgenannten stehen.31 Solche peripher gelegenen Zentren können zusätzlich auch sogenannte "Gateway"-Funktionen für das größere Siedlungssystem erfüllt haben, dergestalt, daß über diese Orte von außen Rohstoffe und/oder Halbfertigprodukte dem eigentlichen Siedlungssystem zugeführt wurden. In diesem Falle sind dann auch marktaffine Funktionen zwischen den Austauschpartnern an dem Ort gegeben.32 Neben den normal aus dörflichen Anwesen gewachsenen Siedlungen, die ihre Funktion im Siedlungssystem aus ihrem Umlandspotential gewonnen hatten, zum Teil in Kombination mit der Bedeutung ihrer Lokalschreine und/oder ihrer strategisch günstigen Lage, bildeten sich im Lauf der altorientalischen Geschichte weitere Typen heraus. Zum einen sind Siedlungs-neugründungen in Form von Statthaltersitzen in den eroberten Gebieten, die dann zum Teil Pro-vinzen wurden,33 zum anderen sind Residenzstädte, bzw. Hauptstadtneugründungen zu nennen, sei es aus strategischen Gründen34 und/oder auf "Geheiß der Götter".35 Neben diesen Zentren gab es aber auch eine Art von "Freien Städten" (kidinnu), die von Steuer-freiheit und Militärdienstverpflichtungen weitgehend entbunden waren und für deren Einwohner besondere Strafffreiheitsformen garantiert wurden. Solche Städte wurden durch ein entsprechen-des Symbol am Stadttor markiert.36 30 Besonders der mittelelamische Herrscher Šilak-Inšušinak (Mitte 12. Jh. v. Chr.) wandte diese Methode erfolgreich an; E. Carter; M. Stolper, Elam. Survey of Political History and Archaeology, Near Eastern Studies 25, 1984, bes. 41. 31 I.R. Hodder; C. Orton, Spatial Analysis in Archaeology, Cambridge 1976, 75ff. Siehe auch die Ausführungen von J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 83ff. 32 Als Beispiele könnten Altin-Depe in Turkmenien sowie Harappa und Lothal in der Indus-Kultur angeführt werden: R. Ratnagar, The Location of Harappa, in: G.L. Possehl (Hrsg.), Harappan Civilization. A Contem-porary Perspective, Warminster 1982, 261ff. und G.L. Possehl, Lothal. A Gateway Settlement of the Indus Civilization, in: Ders. (Hrsg.), Ancient Cities of the Indus, 1979, 212ff. In Babylonien erfüllte solch eine "Port-of-Trade"-affine Funktion wohl Sippar zwischen den Schafnomaden der Steppe und dem bewässerten Siedlungsgebiet des Euphrats: L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 116. 33 Ein Modell, wie die Assyrer benachbarte Gebiete nach ersten Erkundungen mit Machtdemonstrationszügen einschüchterten, sie dann Tributabhängig machten, um sie schließlich dem Reich als Provinz einzuverleiben, hat jüngst R. Lamprichs, Die Westexpansion des neuassyrischen Reiches. Eine Strukturanalse, Alter Orient und Altes Testament 239, Neukirchen-Vluyn 1995 vorgestellt. 34 Die Verschiebung der assyrischen Hauptstädte immer weiter nach Norden, ab dem 9. Jh. v. Chr., ist sicher aus strategischen Überlegungen erfolgt. 35 Zu solch einem Beispiel mit einer Textprobe vgl. R. Dittmann, Die inneren und äußeren Grenzen der mittel-assyrischen Residenzstadt Kar-Tukulti-Ninurta/Nord Iraq, in: M. Jansen; P. Johanek (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 101ff. 36 Dieser Stadttyp tritt mit der Mitte des 2. Jts. v. Chr. in Babylonien auf (vor allem Babylon genoß dieses Privileg), wurde dann aber auch auf Assyrien übertragen (z.B. Assur); vgl. L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 120f.; W.F. Leemans, Kidinnu. Un Symbole de droit divin Baby-lonien, in: M. David et al. (Hrsg.), Symbolae ad Jus et Historiam Antiquitatis Pertinentes Julio Christiano van Oven Dedicatae, Leiden 1946, 36ff.; H. Reviv, Kidinnu. Oberservations on Privileges of Mesopotamian Cities, Journal
Reinhard Dittmann
38
Die urartäischen Zentren (erste Hälfte des 1. Jts. v. Chr./Ost-Türkei und Nordwest-Iran) des Hauptgegners Assyriens sind mit Ausnahme der Hauptstadt Tušpa am Van-See nicht in Ebenen gelegen, sondern in Bergregionen in Form von zum Teil gigantischen Fluchtburgen wie Karmir Blur (Abb. 10), eingebettet in ein Netz, bestehend aus vorgeschalteten kleineren Stationen und Stützpunkten, immer auf Sicht und somit auf optischer Kommunikationsweite.37
Abb. 10: Die urartäische Festung Karmir Blur
of the Economic and Social History of the Orient 31, 1988, 286ff. und D.J. Wiseman, Nebuchadnezzar and Babylon, Oxford 1985, 78f., 107f. 37 Zu Urartu allgemein vgl. W. Kleiss; H Hauptmann, Topographische Karte von Urartu. Verzeichnis der Fund-orte und Bibliographie, Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungsband 3, Berlin 1976 und Wartke, R.-B., Urartu. Das Reich am Ararat, Mainz 1993; zu den Befestigungsanlagen und Systemen vgl. W. Kleiss, Größen-vergleiche urartäischer Burgen und Siedlungen, in: R.M. Boehmer; H. Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur Altertums-kunde Kleinasiens. Festschrift für K. Bittel, Mainz 1983, 283ff. mit weiterführender Literatur. Zu mesopotamischen Städten auf Anhöhen vgl. L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chi-cago 1977, 131f.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
39
Abb. 11: Harappa: "Arbeitshäuser + Plattformen"oberhalb der "Zitadelle"
Reinhard Dittmann
40
Die Analyse der unterschiedlichen Komplexität und Struktur der Siedlungssysteme, vor allem benachbarter Regionen, sollte in Zukunft in Abhängigkeit zur sonstigen Kenntnis der politischen und ökonomischen Organisationsform (die aus der Analyse des archäologischen, ergrabenen Befundes abzuleiten wäre) der entsprechenden Systeme gebracht werden. Hierzu sind jedoch noch eine Fülle von Regionaluntersuchungen und systemorientierter Auswertung derselben vonnöten. Ein Beispiel, wie nicht vorzugehen ist, hat M. Wheeler, gefolgt von J.-M. Casal, vorgeführt: Angeregt von Vorstellungen englischer Arbeitersiedlungen interpretierte Wheeler eine Reihung von mehrräumigen Anlagen in Harappa, einem der zentralen Orte der Indus-Kultur, als Arbeiterquartiere für die vermeintlich dahinter liegenden Produktionsbereiche mit den berühmten "Arbeitsplattformen" (Abb. 11); Casal sah diesen Befund, ausgehend von bestimmten Terrakottentypen, sogar als einen Ort an, an dem Sklaven gehalten wurden.38 So schillernd diese Interpretation auch ist, die Arbeitsplattformen und die Baureihung gehören völlig unterschiedlichen Schichten an und können somit nicht in einer funktionalen Beziehung stehen. Die Rekonstruktion von ökonomischen und sozialen Systemen kann nur durch überaus penible Beobachtung und Dokumentation des Befundes in Verbindung mit modellhaften Über-legungen erfolgen.39 3. Genese von Zentren, Stadtplanung (?) Die Genese von altorientalischen Zentren- bzw. Zentralortsystemen, worunter wir der Ein-fachheit halber große Siedlungen verstehen wollen mit öffentlichen Einrichtungen, die einen bestimmenden Faktor innerhalb ihres (und/oder benachbarten) Hinterlands (Siedlungssystems/ Ressourcenraums) ausmachen, ist ebenfalls vielschichtiger Natur. Schon früh organisierten sich mehr oder weniger und in Ermangelung von großflächigen Grabungen zumeist nicht näher definierbare Siedlungsbereiche um lokale Schreine und Heilig-tümer.40 Dieser Typus von (nicht immer notwendigerweise einer) Großsiedlung begegnet bereits früh im akeramischen Neolithikum, so zum Beispiel in Çayönü oder Nevalla Çori (Abb. 12).41 Dabei ist nicht zu entscheiden, ob die Herausbildung von Schreinen die Folge der Agglo-
38 M. Wheeler, The Indus Civilization, 3. Aufl. Cambridge 1968, 31f.; J.-M. Casal, La civilisation de l’Indus et ses énigmes, Paris 1969, 195f. Daß keinerlei stratigraphische Verbindung zwischen beiden Komplexen besteht, hat M.A. Fentress, Resource Access, Exchange Systems and Regional Interaction in the Indus Valley, Ann Arbor 1976, 174 diskutiert. 39 Zu sehr detaillierten Oberflächenuntersuchungen vgl. M.A. Halim; M. Vidale, Kubes, Bangles and Coated Vessels. Ceramic Production in Closed Containers at Moenjodaro, in: M. Jansen; G. Urban (Hrsg.), Reports on Field Work at Mohenjo-Daro, Interim Reports 1, Aachen 1984, 63ff.; M. Tosi, The Distribution of Industrial Debris on the Surface of Tappeh Hesar as an Indication of Activities Areas, in: R.H. Dyson; S.M. Howard (Hrsg.), Tappeh Hesar. Reports of the Restudy Project 1976, Monografie di Mesopotamia II, Firenze, 1989, 13ff.; zur Interpretation archäologischer Befunde vgl. M. Tosi, The Notation on Craft Specialization and its Representation in the Archaeological Record of Early States in the Turanian Basin, in: M. Spriggs (Hrsg.), Marxist Perspectives in Archaeology. Cambridge 1984 und R. Bernbeck, Die Auflösung der häuslichen Produktionsweise. Das Beispiel Mesopotamiens, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 14, Berlin 1994. 40 Die Genese von Städten war darüber hinaus natürlich von ökologischen Basisfaktoren wie ausreichendem Umland und Ressourcenaccess sowie von ausreichender Bodenqualität und vor allem durch die Nähe zu Flußläufen bestimmt. 41 Siehe die Beiträge von W. Schirmer, Drei Bauten des Çayönü Tepese, in: R.M. Boehmer; H. Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift für K. Bittel, Mainz 1983, 463ff. und H. Hauptmann, Ein Kultgebäude in Nevalli Çori, in: M. Frangipane a.o. (Eds.), Between the Rivers and Over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata, Roma 1993, 37ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
41
meration von Wohneinheiten und baulichen Manifestationen ihrer Ideosysteme war, oder um-gekehrt lokale Schreine, "heilige Orte", erst zur Ansiedlung größerer Bevölkerungsgruppen führten.42 In einem Falle, bei Susa, dem ehemaligen zentralen Ort der Susiana, der Hauptebene der heutigen Provinz Khuzestan in Südwest-Iran, wurde zu Beginn des 4. Jts. v. Chr. der Ort nach-weislich in einem zuvor unbesiedelten (und von seinen Bodenverhältnissen nicht gerade begünstigten) Bereich um eine Nekropole angelegt, die offenbar sozial gehobenere Bestattungen aufwies. Erst zu einem etwas jüngeren Zeitpunkt wird neben dieser baulich besonders aus-gestatteten Nekropole eine gewaltige Terrassenanlage gegründet, auf der sich Kulteinrichtungen befunden haben dürften (Abb. 13a-b).43 Für die zeitgleichen Kultbauten im babylonischen Bereich der sogenannten Ubaid-Zeit, die ebenfalls auf großen Hochterrassen angelegt wurden, fehlen Hinweise auf die eben skizzierte Genese von zentralen Einrichtungen. Da aber noch im 3. Jt., so auf den schon genannten Städte-siegeln, die Namen der großen babylonischen Zentren im Schriftbild durch einen Sockel/Altar und ein (Totem?-)Symbol ausgedrückt wurden (Abb. 8+14),44 erscheint die originäre An-bindung von lokalen Zentren zumindestens an lokale Schreine für wahrscheinlich. Als weitere Faktoren für die Genese von Zentren sei nochmals auf die schon erwähnten, neugegründeten Statthalterresidenzen oder die Usurpation, verbunden mit einer Neubenennung, schon vorhandener Städte hingewiesen. Die Frage nach einer etwaigen Stadtplanung ist ebenfalls differenziert zu beantworten. Die Binnenstruktur der Zentren war von den politisch-ideologischen Anforderungen der sie dominierenden politischen Entitäten abhängig. Gleichwohl wird man nur im Ausnahmefall eine wirkliche, alle Bereiche der Siedlungen umfassende Stadtplanung nachweisen können. Wirklich geplant war, zumal bei Neugründungen, wohl nur die Gesamtfläche und das Layout der Ver-teidigungsanlagen, so im Falle der sogenannten Kranzhügel, einer Siedlungsform, die am Beginn des dritten Jahrtausends im Khabur-Dreieck von Nordsyrien plötzlich auftritt (Abb. 15).45 Zu nennen sind auch die umwallten Stadtanlagen der altassyrischen Zeit (Anfang des 2. Jts. v. Chr.) in dieser Region (Abb. 16)46 sowie die Grundstruktur der zentralen Einrichtungen und der
42 L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 113f. visua-lisiert die Genese von Zentren wie folgt: Oikenhafte Großhaushalte, die auf dem Land liegen, gründen aus Prestigegründen Sekundärhaushalte nahe bei Lokalschreinen. Dies wiederum führt zu einer Kumulation von Prestigegütern und Einrichtungen (die Dependancen werden jetzt zu den Primärhaushalten) in der Nähe dieser Schreine, diese gewinnen damit ebenfalls an Bedeutung und es entsteht ein Anreiz für weitere Bevölkerungsteile daran teilzuhaben, was zu einer Zunahme der Bevölkerung führt. Siehe auch den Beitrag von T.C. Young, The Origin of the Mesopotamian City, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 11, 1986, 3ff. Wenig informativ ist dagegen für den Alten Orient die Arbeit von A. Segal, Stadtplanung im Altertum, Zürich; Köln 1979. Mir z.Zt. nicht zugänglich ist die Arbeit von S. Mazzoni (Hrsg.), Nuove Fondazioni nel Vicino Oriente Antico. Realtà e Ideologia, Pisa 1995. 43 P. Amiet, L'Age des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C., Notes et Documents des Musées de France 11, Paris 1986, 32-39, Ill. 234,1-235,3; R. Dittmann, Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 4,1-2, 1986, 212-215 und Karten 2 und 5. 44 J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 32f., Fig. 2,8a-b. 45 Zum Siedlungstyp vgl. U. Moortgat-Correns, Die Bildwerke vom Djebelet el-Beda, Berlin; New York 1972, 25ff. und S. Eichler u.a., Tall Al-Hamadiya 1, Orbis Biblicus et Orientalis Series Archaeologica 4, 1985, 18. 46 Die Struktur dieser altassyrischen Ruinen mit einem zentralen Tepeteil, umschlossen von einem polygonen bis runden Ring, bringt Oates mit einer Schutzfunktion im Krisenfalle für die hohen Viehanteile der
Reinhard Dittmann
42
(zeremonielle) Zugang zu denselben (Abb. 17). Die Stadtanlagen konnten auch durch Binnen-wälle weiter segmentiert werden, so daß auch soziale und/oder ethnische Abgrenzungen voll-zogen werden konnten.
Abb. 12a: Schrein von Nevalla Çori
Abb. 12b: Schreine von Çayönü
umliegenden Dörfer in Verbindung: D. Oates, Walled Cities in Northern Mesopotamia in the Mari Period, MARI 4, 1985, 585ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
43
Abb. 13a: Susa, Terrasse und Nekropole
Abb. 13b: Susa, Terrasse und Nekropole, Profilschnitt
Reinhard Dittmann
44
Abb. 15: Ein Kranzhügel in Nord-Syrien: Tell Beydar
Abb. 14: Eridu, Abfolge der Ubaid-Tempel (XVI-VI)
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
45
Abb. 16: Altassyrische Wallanlage: Tell al-Rimah
Abb. 17: Ištar-Tor von Babylon
Reinhard Dittmann
46
Abb. 18: Tempelplan auf einer Tontafel
Die Ausgestaltung der zentralen Einrichtungen stand wiederum in direkter Abhängigkeit zu den kultischen Anforderungen (bei den Kultbauten) und zum Machtdarstellungswillen bzw. –bedürf-nis der jeweiligen spezifischen Herrscherideologie, bzw. neutraler: der zugrunde liegenden Organisationsform (auch bei den eher palatialen bzw. säkularen Einrichtungen).47 Daß der Grundplan der zentralen Bereiche auf abstrakter Ebene reflektiert wurde, zeigen nicht nur die bekannten Tempelpläne (Abb. 18), die auf Tontafeln, aber auch auf der Herrscherstatue "B" des 47 Dieser Begriff wird hier verwendet, weil es denkbar ist, daß keine an eine einzelne Person, einen Clan o.ä. gebundene Herrschaftsform vorliegen könnte. Im 3. Jt. v. Chr. (zur sogenannten Frühdynastischen-Zeit) wird für Babylonien von einem Herrschaftssystem ausgegangen, welches zwar einen "Big-Man" (sumerisch LUGAL = "König", wörtlich: "Großer Mann") an der Spitze sieht, dem aber eine Ratsversammlung zur Seite steht, die nicht ohne Einfluß war (L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 360, Anm. 44; J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 80f. mit weiterführender Literatur). Geht man davon aus, daß diese Versammlung der Ältesten mit einem gewählten Anführer eine Urform babylonischer Herrschaftsform ist, dann würde dies erklären, warum im 4. Jt. v. Chr. sich noch keine wirklichen Palastanlagen nachweisen lassen, da sie als Repräsentation eines Königtums nicht vonnöten waren, sondern für diesen Zweck Versammlungshäuser ausreichten. Erst im 3. Jt., mit einer Zunahme der individuellen Macht des "Big-Man", führte dies auch auf der baulichen Ebene zur Reflektion der Machtrepräsentanz in ersten Palastbauten. Für die Indus-Kultur fehlt bisher, trotz gegenteiliger Beteuerungen, der Nachweis für ein Priesterkönigtum o.ä. Zumindestens reflektiert sie sich nicht im städtischen Layout der Zentren. Eine Erklärung könnte u.a. auch in Analogie zum Beispiel von Chiang Mai gesucht werden: H. Schneider, Zivilisationsprozess, Macht und städtische Form in einer buddhistischen Kultur. Das Beispiel von Chiang Mai/Nordthailand, in: M. Jansen; J. Hook; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 195ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
47
Gudea, vom Anfang des 21. vorchristlichen Jahrhunderts, überliefert sind, sowie der "Bauplan" einer Ziqqurrat (Abb. 19), sondern auch der gleichermaßen überkommene berühmte Stadtplan von Nippur (Abb. 20).48
Abb. 19: Bauplan einer Ziqqurrat auf einer Tontafel
48 Zu altorientalischen Grundrißzeichnungen allgemein vgl. E. Heinrich; U. Seidl, Grundrißzeichnungen aus dem alten Orient, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 98, 1967, 24ff. Zur Konzeption von altorien-talischen Bauwerken vgl. R. Eichmann, Aspekte prähistorischer Grundrißgestaltung in Vorderasien. Beiträge zum Verständnis bestimmter Grundrißmerkmale in ausgewählten neolithischen und chalkolithischen Siedlungen des 9.-4. Jahrtausends vor Chr., Baghdader Forschungen 12, Mainz 1991.
Reinhard Dittmann
48
Abb. 20: Stadtplan von Nippur, Skizze auf einer Tontafel Siedlungsstrukturen könnten aber auch (zusätzlich) auf einem auf einer Abstraktion der Welt-ordnungsvorstellungen beruhenden Konzept begründet worden sein, so vielleicht bei einigen Ruinen im baktrischen Bereich des 2. Jts. v. Chr. (Abb. 21a-b), in deren Grundplan “B”. Brent-jes "Mandalas", reflektiert sehen will.49 Daß das Errichten von Bauwerken in der Tat auch an "religiöse Netze" gebunden war, zeigt das Vorkommen von Bauomina und Bauriten im Vor-deren Orient.50 In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten sich Grundtypen von Bauten nachweisen lassen, die einzelne Wohn-/und Residenzquartiere determinieren konnten, sei es als lose Gruppierung gleichförmiger Strukturen (wie am Beispiel von Tell as-Sawwan, Mitte des 6. Jts. v. Chr. (Abb. 22), Habuba Kabira-Süd, zweite Hälfte des 4. Jts. v. Chr. (Abb. 23) oder im Falle von Munbaqa, zweite Hälfte des 2. Jts. v. Chr. (Abb. 24)), sei es in Form von addierten Grundtypen zu einem größeren Komplex, so bei Tell Abada, 5. Jt. v. Chr. (Abb. 25). Ähnliches gilt auch für die "Zwillings-Zentren" Šahr-i Sokhta und Mundigak, der sogenannten Hilmand-Zivilisation des dritten vorchristlichen Jahr-
49 B. Brentjes, Das ‘Ur-Mandala’(?) von Daschly-3, Iranica Antiqua 18, 1983, 25ff. Zu etwas jüngeren Konzepten vgl. G. Michell, Der Hindu-Tempel. Bauform und Bedeutung, Köln 1979, bes. 69-71. 50 Zu Gründungsriten und -beigaben in Mesopotamien, ein Konzept, das zumindest im zweiten Fall in der Indus-Kultur völlig zu fehlen scheint (oder zumindestens bisher nicht erfaßt wurde), vgl. R.S. Ellis, Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, Yale Near Eastern Researches 2, New Heaven 1968. Für Kleinasien vgl. V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, in: Handbuch der Orientalistik I,15, Leiden 1994, 250ff.; zu den Bauomina vgl. F. Nötscher, Die Omen-Serie Šumma âlu ina mêlê šakin, Orientalis 39-42, Rom 1929, bes. 13ff. Zu Bauritualen vgl. das Beispiel für den Anu-Tempel von Thureau-Dangin, F., Rituels Accadiens, ND Osnabrück 1975, bes. 35 (AO.6472) oder W. Farber, Rituale und Beschwörungen in akkadischer Sprache, in: M. Dietrich u.a. (Hrsg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments II. Religiöse Texte, Gütersloh 1986-1991, 241ff. (Ritual für das Legen eines Tempelgrundsteins). Siehe in diesem Zusammenhang auch die instruktive Beschreibung von dem "Gesichte der künftigen Gottesstadt" bei Hesekiel 40-47,12.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
49
tausends in Ost-Iran und Südwest-Afghanistan, wo die residenziellen Quartiere ebenfalls große Übereinstimmungen in den Bautypen aufweisen (Abb. 26). Innerhalb der Indus-Kultur scheint es ebenfalls funktional bedingte (?) Grundlayoutformen für einige Siedlungstypen gegeben zu haben (Abb. 27-30).51 Saisonal genutzte Kultstätten, wie der Göllüdağ in Anatolien (8. Jh. v. Chr.), oder funktional determinierte Garnisonsstädten, wie das urartäische Zernaki-Tepe (Abb. 31),52 welches erstaunlicherweise schon im 8. Jh. v. Chr. dem in Kleinasien (Altsmyrna) im 7. Jh. v. Chr. aufkommenden hippodamischen Planungsprinzip verpflichtet zu sein scheint,53 konnten ebenfalls, ob ihrer speziellen Funktion, in Gänze geplant werden. Solche Siedlungen sind aber eher die Ausnahme als die Regel. 4. Stadtelemente und ihre Funktion
Die Städte waren, je nach Anforderung,54 schon früh mit Wällen umgeben worden als Abgren-zung nach Außen mit gleichzeitig integrativer Wirkung, bzw. sozialer Abgrenzung nach Innen. Bestimmte Grundrißformen wie rechteckige und kreisrunde Wallanlagen sprechen für in diesem Detail geplante Neugründungen, zumindestens im 1. Jt. v. Chr., die - besonders im assyrischen Bereich - wohl (ähnlich römischen Stadtneugründungen) Militärcamps im Layout verpflichtet waren (Abb. 32).55 Diese Wälle konnten der Verteidigung dienen oder aber, wie bei einigen Städten der Indus-Kultur zu vermuten ist, zusätzlich auch die Funktion des Schutzes vor Über-schwemmungen bieten. Bei letzterem Beispiel wurde diesem Problem auch durch die Erhöhung der Siedlungsbereiche durch die Anlage von Lehmziegelterrassen begegnet.56 Der Übergang vom inneren zum äußeren Bereich erfolgte durch je nach Region und Zeit unterschiedlich ausgestaltete Toranlagen,57 die neben dieser Abschluß- und Durchlaßfunktion
51 Zur Architektur der Indus-Kultur und den Problemen, die mit einer vermeintlichen Planung der Siedlungen, bzw. bestimmten regionalen Bautraditionen verbunden werden können, vgl. die Arbeiten von M. Jansen, City Planning in the Harappan Culture, AARP 14, London 1978; ders., Architektur in der Harappa-Kultur. Eine kritische Betrachtung zum umbauten Raum im 3.-2. Jahrtausend, Bonn 1979; ders., Architectural Problems of the Harappan Culture, South Asian Archaeology 1977, Naples 1979, 405ff. und ders., Architectural Remains in Mohenjo-Daro, in: B.B. Lal; S.P. Gupta (Eds.), Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Com-memoration Volume, New Dehli 1984, 75ff. Planerische Elemente werden vor allem bedingt durch die Errich-tung von Bauten aus gebrannten Lehmziegeln, die z.T. auf künstlich erhöhten Terrassen errichtet wurden (um die Siedlungen aus dem saisonalen Überschwemmungsbereich der Flüsse herauszuheben) und die - ob des begrenzten Siedlungsraumes - nicht ohne ein gewisses Maß an Planung bebaut werden konnten. 52 Im Göllüdag werden zur Zeit Grabungen von K. Schirmer durchgeführt. Zu Zernaki-Tepe vgl. C.A. Burney, Urartian Fortresses and Towns in the Van Region, Anatolian Studies 7, 1957, 37ff. und W. Kleiss; H. Hauptmann, Topographische Karte von Urartu. Verzeichnis der Fundorte und Bibliographie, Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungsband 3, Berlin 1976, 10. 53 G. Gruben, “Stadt, I. Griechische Stadt“, in: C. Andresen u.a. (Hrsg.), Lexikon der Antiken Welt Bd. III, Zürich; München 1994, 2882ff., bes. 2886f. 54 Zur Frage von offenen Städten im nordsyrischen Raum vgl. J.-W. Meyer, Offene und geschlossene Siedlungen - Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte in Nordsyrien während des 3. und 2. Jts. v. Chr. (im Druck). 55 L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 134. 56 Zur Funktion der Wälle in der Indus-Kultur vgl. K.M. Srivastava, The Myth of Aryan Invasion of Harappan Towns, in: B.B. Lal; S.P. Gupta (Hrsg.), Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, 437ff. Zu den Lehmziegelplattformen der Siedlungsbereiche vgl. M. Jansen, Die Indus-Zivilisation. Wiederentdeckung einer frühen Hochkultur, Köln 1986, bes. 195ff. und ders., Some Problems Regar-ding the Forma Urbis Mohenjo-Daro, in: K. Frifelt; P. Sorensen (Eds.), South Asian Archaeology 1985. Papers from the 8th International Conference of South Asian Archaeologists in Western Europe. (Curzon Press) 1987. 57 Die bebaute Fläche der Zentren war aber nicht nur auf den umwallten Raum beschränkt, sondern es gab Vorstädte, Gehöfte und Camps außerhalb der Mauern (L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead
Reinhard Dittmann
50
jedoch auch andere Aufgaben zu erfüllen hatten. Zum einen konnte an diesem Focus der Personen- und Güterverkehr kontrolliert und notiert werden,58 so z.B. nachgewiesen durch eine differenzierte Begehbarkeit in Altintepe (3. Jt. v. Chr., Turkmenien, Abb. 33)59 oder in der Archivierung von Warenplomben an einem Tor in Arslantepe (spätes 4. Jt. v. Chr. Südost-Türkei).60 Zum anderen diente das Tor durchaus auch der Repräsentanz, auch durch die Plazierung von Königsbildnissen (sei es des eigenen oder eines über die Lokalität triumphieren-den Herrschers),61 diente der Rechtssprechung, der Zeremonie62 und wesentlich der Magie in Form der Ausübung von Übergangs- und Durchschreitungs-, also letztlich von Reinigungsriten, in denen kultische Verunreinigungen von "innen nach draußen" befördert wurden und der Schutz der umschlossenen Gemeinschaft damit gesichert war.63 Durchlässe können z.B. aber auch rein strategischen Anforderungen unterliegen wie Poternenanlagen, die eine Verteidigung vor den Toren ermöglichen.64 Als nächste Konstituente der altorientalischen Stadt wäre dann der Bereich der Wohnstadt, ge-gebenenfalls der Gartenanlagen65 und der zentralen Einrichtungen zu nennen. Besonders der
Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 115f.; J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 76, Anm. 89). Zu den Toranlagen im vorderen Orient vgl. Z. Herzog, Das Stadttor in Israel und in den Nachbarländern, Mainz 1986; zum Indus vgl. A. Kesarwani, Harappan Gateways. A Functional Reassessment, in: B.B. Lal; S.P. Gupta (Eds.), Frontiers of the Indus Civilisation. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, 63ff. und für den hethitischen Bereich R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971, 266ff. Allgemein zu Tür und Tor siehe auch M.S. Damerji, Die Tür nach Darstellungen in der altmesopotamischen Bildkunst von der `Ubaid- bis zur Akkad-Zeit, Baghdader Mitteilungen 22, 1991, 231ff. 58 Am Stadttor wurden, ähnlich wie am Kai der Kanäle, für die einkommenden Güter Zölle von speziell dafür angestellten Beamten erhoben: B. Meissner, Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg 1920, I, 122. 59 Ph.L. Kohl, Central Asia. Palaeolithic Beginnings to the Iron Age, Éditions Recherche sur les Civilisations, Synthèse 14, Paris 1984, 111f., Fig. 13. 60 P. Ferioli; E. Fiandra, Clay Sealings from Arslantepe VIA. Administration and Bureaucracy, in: M. Frangipane; A. Palmieri (Hrsg.), Perspectives on Protourbanization in Eastern Anatolia: Arslantepe (Malatya). An Interim Report on 1975-1983 Campaigns, Origini 12,2, 1983, 455ff. 61 D. Ussishkin, The Erection of Royal Monuments in City Gates, in: K. Emre; B. Hrouda; M. Mellink; N. Özgüç (Eds.), Anatolia and the Ancient Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgüç, Ankara 1989, 485ff. 62 L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 128 sieht zahlreiche Verwaltungsfunktionen allgemeiner Art mit den Torbereichen verbunden. 63 So besonders im hethitischen Bereich: V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, in: Handbuch der Orientalistik I,15, Leiden 1994, 276, 283 und bes. 898ff. Siehe auch ders., Hethitische Berggötter und Hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen, Kulturgeschichte der antiken Welt 10, Mainz 1982 und ders., Magie und Mythen im Reich der Hethiter I. Vegetationskulte und Pflanzenmagie, Hamburg o.J., 179f. Erdreich aus dem Tor war auch Bestandteil der baby-lonischen Medizin: Meissner, B., Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg 1920, II, 309 und 322. Tore bildeten auch den Eingang zur Unterwelt (ebd. I, 21), und durch sie fuhr der Sonnengott bei seinem Tag- und Nachtzyklus durch die Ober- und Unterwelt (ebd. II, 403 und 419). Zeremonialtore und Palasttore konnten auch von Wächter-figuren, sei es in Mischwesenform (ebd. I, 50 und 72) oder als gedachte Götterdyade (V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, in: Handbuch der Orientalistik I,15, Leiden 1994, 473) geschützt werden. 64 R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971, 302ff. 65 Zu Gartenanlage in frühen Städten vgl. den hier in Abschnitt 5 zitierten Auszug aus dem Gilgamešepos; J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 183f.; D.J. Wiseman, Mesopotamian Gardens, Anatolian Studies 33, 1983, 137ff. und ders., Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, 59. Es gab auch, im modernen Sinne, Rotlicht-Bezirke, an der Peripherie der Siedlungen, in Verbindung mit Gaststätten, vgl. L. Trümpelmann, Eine Kneipe in Susa, Iranica Antiqua 16, 1981, 35ff.; zu den beteiligten Randgruppen und zur sogenannten Tempelprostitution vgl. die Beiträge in V. Haas (Hrsg.), Außenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orient, XENIA 32, Konstanz 1992.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
51
Abb. 21a: Tibetanisches Mandala
Abb. 21b: Dashly-Plan
Reinhard Dittmann
52
Abb. 22: Tell es-Sawwan, Bebauungsplan
Abb. 23: Mittelsaalbau (R 1-8) mit Anbauten aus Habuba, Kabira-Süd
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
53
Abb. 24: Mittelsaalbau aus Munbaqa
Abb. 25: T-förmige Mittelsaalbauten aus Tell Abada
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
55
Abb. 27: Kalibangan II
Abb. 28: Surkotada
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
57
Abb. 31: Zernaki-Tepe
Abb. 32: Assyrisches Militärcamp auf einem neuassyrischen Relief (B7, oben links)
Reinhard Dittmann
58
Abb. 33: Altintepe, Toranlage der Periode IV letzte Bereich ist in der Regel von den übrigen Bereichen noch einmal abgeschlossen und in sich zum Teil hoch komplex strukturiert. Die Weg- und Straßenführung ist - mit Ausnahme von Prozessionsstraßen66- in der Regel willkürlich angelegt und folgt meist keiner Planung.67 Die Bebauung der Wohnstätten und häuslichen Produktionseinheiten68 kann grosso modo dem sogenannten insulae-Typus zugeordnet werden, der durch Anbauten, Abbrüche, Dazuerwerb etc. in seinem Layout permanenter Veränderung unterworfen war.69 Jedoch ist, mangels Gra-
66 Zu Prozessionsstraßen im Alten Orient vgl. W. Andrae, Alte Feststraßen im Nahen Osten, Sendschrift der Deutschen Orient-Gesellschaft 10, Leipzig 1941. 67 Zu Straßenanlagen vgl. J. Schmidt, Straßen in altorientalischen Wohngebieten, Baghdader Mitteilungen 3, 1964, 125ff. Allerdings gibt es auch Beispiele für das planerische Gestalten des Königs, so z.B. im Falle des neuassyrischen Herrschers Sanherib (704-681 v. Chr.), der Plätze an den Toren in Ninive erweiterte und Straßen verbreitern ließ (L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 140). Anders als im Indus-Bereich, wo die Kanalisation in allen Siedlungen auf das Perfekteste ausgebaut war (wahrscheinlich weil die Terrassen, auf denen die Bauten errichtet wurden, keine Versickerung ermöglichten), sind solche flächendeckenden Entwässerungsanlagen in mesopotamischen Ruinen eher selten; vgl. Ch. Hemker, Altorientalische Kanalisation. Untersuchungen zu Be- und Entwässerungsanlagen im mesopotamisch-syrisch-anatolischen Raum, Abhandlungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 22, Münster 1993. 68 Zu solchen Produktionseinheiten vgl. J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 78f. und 229. 69 Eine gute Fallstudie zu einem Beispiel aus Babylonien bietet E.C. Stone, Nippur Neighborhoods, Studies in Ancient Oriental Civilisation 44, Chicago 1987. Allgemein vgl. M. Krafeld-Daugherty, Wohnen im Alten Orient. Eine Untersuchung zur Verwendung von Räumen in altorientalischen Wohnhäusern, Altertumskunde des Vorderen Orients 3, Münster 1994 und E. Heinrich, „Haus“, in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 4, Berlin; New York 1972-1975, 176ff. Zu modernen Verhältnissen vgl. z.B. D. Sack, Damaskus. Entwicklung und Struktur einer orientalisch-islamischen Stadt, Mainz 1988 und A. Nippa, Haus und Familie in arabischen Ländern. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Darmstadt 1991. Zu Wohnbauten des 1. Jts. v. Chr. in Mesopotamien vgl. P. Miglus, Das neuassyrische und neubabylonische Wohnhaus. Die Frage nach dem Hof, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 84, 1994, 262ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
59
bungen in Wohnbereichen, nur wenig über das großflächige Layout altorientalischer Siedlungen bekannt. Kleine Kultschreine können sich ebenfalls im Stadtgebiet befinden.70 Über die Sozialstruktur können, zumal wenn Tontafelarchive einzelner Familien in den Ge-bäuden gefunden wurden, zum Teil detaillierte Aussagen getroffen werden.71 Die Stadtbezirke waren ab der altbabylonischen Zeit (Beginn des 2.Jts. v. Chr.) in Mesopotamien untereinander verwandtschaftlich strukturiert, dominiert von einem Vorsteher (ähnlich den Dorfvorstehern), der seinerseits wiederum dem "Bürgermeister" untergeordnet war. Diese Clan-Bezirke wurden offenbar durch unterschiedliche Tore erschlossen, und im Falle von Deportationen wurden diese Einheiten auch immer benachbart zwangsangesiedelt, so z.B. in Kar-Tukulti-Ninurta.72 Plätze wurden in größeren mesopotamischen Wohnbereichen nicht planerisch angelegt, sondern waren das Ergebnis des eben beschriebenen Veränderungsprozesses im Baugefüge. Basare, also Bereiche in denen produziert und gehandelt wurde und wie sie seit dem frühen Mittelalter im Orient bezeugt sind, sind in dieser Form nicht nachgewiesen,73 und auch die Frage, ob es einen Markt(platz) im europäischen Sinne in altorientalischen Städten gegeben hat, ist noch strittig.74 Gleichwohl gibt es auf der siedlungssystemischen Ebene Siedlungen, z.B. im Hinterland von Uruk (ausgehendes 4. Jt. v. Chr.), die aufgrund ihrer Position im heutigen Verständnis sied-lungsgeographischer Gegebenheiten eine marktaffine Funktion erfüllt haben dürften.75 Im Bereich der zentralen Einrichtungen entstanden Plätze durch die Umfriedung größerer Bereiche durch Raumzingel, in denen durchaus weitere Kapellen eingefügt sein können. Streng genommen handelt es sich jedoch eher um großflächige Hofanlagen.76 Produktionseinheiten, zumal von kommunaler Bedeutung, sowie Nekropolen, lagen oft ent-gegen der Windrichtung und außerhalb der Siedlung, so daß Gerüche und böse Geister nicht durch den Wind in die Gemeinschaft getrieben werden konnten.77 70 So gut nachgewiesen in Ur, vgl. D. Charpin, Le clergé d’Ur au siècle d’Hammurabi, XIXe-XVIIIe siècles av. J.-C., Genève 1986; vgl. auch Abb. 46b. 71 Vgl. E.C. Stone, Texts, Architecture and Ethnographic Analogy. Patterns of Residence in Old Babylonian Nippur, Iraq 43, 1981, 19ff.; dies., Nippur Neighborhoods, Studies in Ancient Oriental Civilisation 44, Chicago 1987 und V. Haas (Hrsg.), Außenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orient, XENIA 32, Konstanz 1992 mit weiterführender Literatur. 72 J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 81f.; für Kar-Tukulti-Ninurta vgl. R. Dittmann, Die inneren und äußeren Grenzen der mittelassyrischen Residenzstadt Kar-Tukulti-Ninurta/Nord Iraq, in: M. Jansen; P. Johanek (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 101ff. 73 Verkaufsläden und kleine Produktionsstätten hat es aber im Siedlungsbereich gegeben; vgl. L. Woolley; M. Mallowan, The Old Babylonian Period, Ur Excavations VII, London; Philadelphia 1976 und J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 78f. und 229. 74 Wahrscheinlich bezeichnet das akkadische Wort makhiru so etwas ähnliches wie einen Marktplatz, vgl. C. Zaccagnini, "Markt", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 7, Berlin; New York 1987-1990. L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 129 vermutet, daß "Märkte" eher im elamischen (Südwest-Iran) oder hethitischen Bereich (Anatolien, 2. Jt. v. Chr.) vorhanden waren. 75 Ob ihrer K 3-affinen Position im Siedlungssystem vgl. z.B. R. Dittmann, Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vor-deren Orient 4,1-2, Berlin 1986, 481. 76 In diesen Tempelhöfen konnte auch Gericht abgehalten werden, so im Hof des Šamaš-Tempels in Sippar in Babylonien (Tempel des Sonnengottes und des Gottes der Gerechtigkeit und des Rechts); vgl. J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 277. 77 Gebäude und Straßen wurden nach bzw. gegen die vier Winde ausgerichtet, die nur grob equivalent mit unseren vier Himmelsrichtungen sind, oder an dem Sonnenauf- bzw. Untergang orientiert (besonders im Falle von Tempelpforten) vgl. E. Unger, Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin; New York 1970, 122ff. Zu institutionalisierten Produktionseinheiten vgl. auch J.N. Postgate,Early Mesopotamia.
Reinhard Dittmann
60
Kernpunkt der Siedlungen waren die schon angesprochenen zentralen Einrichtungen des Tem-pels, bzw. der Tempel und des Palastes. Es ist nicht immer letztlich gesichert, welche der ergra-benen Strukturen welche Funktion hatte, zumindestens gilt dies für das 4. Jt. v. Chr. in "Größer Mesopotamien", wo ein Grundhaustyp, der sogenannte Mittelsaalbau78 (eine dreischiffig gegliederte Struktur) alle funktionalen Felder vom Wohnhaus bis zum Tempel abdecken kann (Abb. 23 + 34-35). Unterschiede in der Funktion manifestieren sich lediglich in der unterschied-lichen Größe mancher Bauten und in deren Rangmarkierungen in Form von reichhaltig mit Nischen, Pilastern u.ä. gegliederten Fassaden und/oder der Kombination mit gleichen oder anderen Bautypen. Ab dem 3. Jt. v. Chr. ermöglichen zum Teil Bauinschriften, zumeist in Gründungsdepots oder auf Ziegel gestempelt gefunden, die Identifikation einer Vielzahl von offiziellen Bauten. Im Tempelbereich bilden sich jetzt auch in Mesopotamien die Grundtypen heraus, die bis zum Ende der altorientalischen Kultur bestimmend bleiben.79 Neben den ebenerdigen Tempelanlagen etablierte sich, zumal für die Hauptgötter mancher Zentren, eine eigene Kultbauform, die ihren Ursprung in den ubaidzeitlichen Tempelanlagen auf Hochterrassen hat, die diese Bauten aus dem übrigen Siedlungsbereich heraushoben und ab dem ausgehenden 5. Jt. v. Chr. im babylonischen und südwest-iranischen Bereich zu finden sind (Abb. 14). Mit der sogenannten 3. Dynastie von Ur (21. Jh. v. Chr.) entwickelt sich in Baby-lonien für die Hauptgötter des Pantheons eine kanonische Bauform, die sogenannten Ziqqurrati, hohe Stufentürme mit aufsitzendem Tempel wie im Beispiel von Nippur und Ur (Abb. 36 Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 230f. mit weiteren Belegen. Betreffs der Entwicklung der Lage von Produktionseinheiten läßt sich in manchen Gegenden eine interessante Entwicklung beobachten: sowohl in der sogenannten Hilmand-Zivilisation (3. Jt. v. Chr., Ost-Iran und West-Afghanistan mit den Zentren Šahr-i Sokhta und Mundigak), als auch in der Indus-Kultur und (wahrscheinlich auch) am Ende des hethitischen Großreichs in Hattuša (der Hauptstadt des Reiches, um 1200 v. Chr.; also alles drei politische Entitäten, die in ihrem urbanen Layout der zentralen Orte ein ansatzweise planerisches Konzept erkennen lassen, sei es an den einzelnen Bauten oder im Gesamtlayout) konnte beobachtet werden, daß stark umweltbelastende Produktions-einheiten am Anfang der Nutzung der Zentren sich außerhalb derselben befanden und oft kommunal genutzt wurden. Zum Ende der Besiedlung der Zentren wurden diese Einheiten dann plötzlich in den Siedlungsbereich verlagert, oftmals vorherige zentrale Einrichtungen überbauend. Diese Produktionseinheiten wurden nunmehr nicht mehr kommunal genutzt, was zu einer Diversifikation an solchen Einheiten und Produkten führte (Archäologen simplifizieren die auf der Ebene der materiellen Kultur zu fassenden Ergebnisse dieser dahinter zu vermutenden hochkomplexen sozialen und ökonomischen Prozesse gerne als "verschliffener, dekadenter, später" - oder schlimmer noch - "unverstandener Stil"). Ob die Faktoren, die in allen drei Beispielen zu ähnlichen Phänomen geführt haben, unmittelbar vergleichbar sind, weil vielleicht ähnlich uneffektive Organisationsformen zum Kollaps des Einflusses auf die kommunale Produktionsweise führten, ist unklar. Vgl. L. Mariani, The Monumental Area of Shahr-i Sokhta. Notes from a Surface Reconnaissance, in: K. Friefelt; P. Sorensen (Hrsg.), South Asian Archaeology 1985, Scan-dinavian Institute of Asian Studies Occasional Papers 4, 1987, 114ff., bes. 131, Fig. 17; M. Jansen, Die Indus-Zivilisation. Wiederentdeckung einer frühen Hochkultur, Köln 1986, 202ff. und P. Neve, Hattuša, Stadt der Götter und Tempel, Mainz 1992, 32f. Zu Theorien zum Zusammenbruch früher Hochkulturen vgl. auch allgemein: N. Yoffee; G.L. Cowgill, The Collaps of Ancient States and Civilizations, University of Arizona Press 1989. 78 Zur Definition des Typs vgl. E. Heinrich, Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien. Typologie, Morphologie und Geschichte, Denkmäler antiker Architektur 14, Berlin 1982, 7ff. 79 Zu Mesopotamien vgl. ebd.; zu Syrien-Palästina vgl. G.H.R. Wright, Ancient Building in South Syria and Palestine, in: Handbuch der Orientalistik 3,1, Leiden; Köln 1985 und P. Werner, Die Entwicklung der Sakral-architektur in Nordsyrien und Südostkleinasien. Vom Neolithikum bis in das 1. Jahrtausend v. Chr., Münchner Vorderasiatische Studien 15, München 1994. Zu Kleinasien vgl. R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971, 433ff. Im südrussisch-baktrischen Bereich sind, trotz gegenteiliger Annahmen, bisher noch keine Kultbauten gesichert nachgewiesen worden. Für den Iran gibt es ebenfalls noch keine Synopsis zu Kultanlagen. Für die Problematik des Erkennens von Kultanlagen in der Indus-Kultur vgl. M. Jansen, Mohenjodaro HR-A House I, a Temple?, South-Asian Archaeology 7, Naples 1985, 157ff.; vgl. auch den Beitrag von R.M. Smith, India and Mesopotamia. Gods, Temples and Why, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 17, 1984, 29ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
61
[“Enlil-Tempel”], Abb. 37).80 Einer Idee W. Andraes folgend, ist letzterer Bau der Wohntempel der Gottheit, und die ebenerdigen Tempelanlagen sind ihre Erscheinungstempel.81 Die Ziqqur-rati bildeten somit also den Mittler zwischen den göttlichen Sphären und der profanen Welt, bzw. präziser: des Wohnbereiches der weltlichen Macht. Andere Interpretationen sehen die Ziqqurrati als Altar/Sitz der entsprechenden Gottheit.82 Sie waren mit diversen, für den Kult wichtigen Installationen wie z.B. Tempelküchen umgeben.83 Diese Bauformen, die vom Be-gründer der 3. Dynastie von Ur, Ur-Nammu, im gesamten babylonischen Herrschaftsbereich errichtet wurden, markierten nicht nur die reichsbezogene Angleichung von Kultbauformen und ihrer Wirtschaftsbereiche, sondern eben auch den Herrschaftsbereich mit sichtbaren Land-marken der Macht in den Hauptkultorten. Die Bedeutung dieser Bauwerke an sich wurde durch die Abgrenzung des heiligen Bezirks durch gewaltige Zingelanlagen noch gesteigert.84 Diese Form der Erhöhung kultischer und/oder auch palatialer Bauten ist auch für das 3. Jt. v. Chr. in dem schon erwähnten zentralen Ort Mundigak der Hilmand-Zivilisation nachgewiesen (Abb. 38a-b), eine gestufte, ziqqurrat-affine, an den Siedlungshang angelehnte Struktur liegt im turkmenischen Bereich zum Beginn des 2. Jts. v. Chr. in dem zentralen Ort Altin-Depe vor (Abb. 39). Der Palast- und Tempelbereich war bei den Assyrern weitgehend integriert. Hohe Beamte und Angehörige der großen Familien wohnten meist in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Be-reiches. Die Hierarchie der Macht konnte baulich auch dadurch ausgedrückt werden, daß die einfachen Wohnstätten ebenerdig lagen, die der hohen Beamten und großen Familien von diesen abgefriedet wurden und der eigentliche Palast- und Tempelkomplex auf einer höheren Terrasse angesiedelt wurde. Bestes Beispiel hierfür ist das neuassyrische Dur-Šarrukin (Abb. 40). Die Erhöhung der Palast- und Tempelbereiche auf künstlichen oder gewachsenen Zitadellen ist Ausdruck des assyrischen Königtums. Diese Anlagen liegen fast immer an der Peripherie der Siedlungen, an der Stadtmauer und sind im assyrischen Bereich auch nur über die Wohngebiete erschlossen.85 Auch in Assyrien be-gegnen Ziqqurrati, jedoch ist es mehr als fraglich, ob diese, wie die Babylonischen, immer be- 80 Zu Kultbauten in Mesopotamien vgl. E. Heinrich, Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien. Typo-logie, Morphologie und Geschichte, Denkmäler antiker Architektur 14, Berlin 1982. Zur Ziqqurrat allgemein und bes. der aus Babylon: H. Schmid, Der Tempelturm Etemenanki, Babylon, Baghdader Forschungen 17, Berlin 1995. 81 W. Andrae, Das Gotteshaus und die Urform des Bauens im Alten Orient, Studien zur Bauforschung 2, Berlin 1930. Zur Ziqqurrat allgemein siehe auch H.J. Lenzen, Die Entwicklung der Zikurat von ihren Anfängen bis in die Zeit der III. Dynastie von Ur, Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 4, Berlin 1941. 82 Diese Bauform wurde erst zum Beginn des 2. Jts. auch in Assyrien übernommen, zur Zeit des Herrschers am i-Adad I., der einer babylonischen Dynastie angehörte. Die Vorstellung, daß die Ziqqurrat ein Gottesthron sei, vertritt Th. Dombart, Der Sakralturm. 1 Zikkurrat, München 1920, die eines Altars H.J. Lenzen, Die Entwicklung der Zikurat von ihren Anfängen bis in die Zeit der III. Dynastie von Ur, Ausgrabungen der Deutschen Forschungs-gemeinschaft in Uruk-Warka 4, Berlin 1941. 83 Zu diesen für den Alten Orient in ihrer Wichtigkeit für den Kult völlig unterschätzten Einrichtungen vgl. M.-Th. Barrelet, Dispositifs à feu et cuisson des aliments à Ur, Nippur, Uruk, Paléorient 2, 1974, 243ff. Zur Frage nach der Existenz einer Art von Klöstern im Zusammenhang mit diesen Kulteinrichtungen vgl. J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 128ff. 84 Die Analyse und Darstellung altorientalischer Bedeutungsebenen in der Architektur wäre ein dringendes Desi-derat. Man denke nur an Studien zum europäischen Mittelalter wie etwa G. Bandmann, Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger, 10. Aufl. Berlin 1994 oder E. Schirmacher, Stadtvorstellungen. Die Gestalt mittelalterlicher Städte. Erhaltung und planendes Handeln, Zürich 1988. 85 Siehe dazu die Studie von L.D. Levine, Cities as Ideology. The Neo-Assyrian Centres of Ashur, Nimrud and Ninive, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 1ff. und die Ausführungen von L.A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977, 133.
Reinhard Dittmann
62
gehbar waren. Auch von den Größendimensionen her sind sie oft kleiner als die des baby-lonischen Bereiches.86 In Babylonien kann eine deutliche Trennung von Palast87 und Haupt-Tempeln festgestellt werden (nur kleine Schreine können sich im Palast befinden), was unmittelbar die unter-schiedliche Stellung des Königs im Vergleich zum assyrischen System reflektiert.88 War der König eingebettet in ein festgefügtes, überaus rigides Ritual- und Zeremonialsystem, wie zum Beispiel bei den Hethitern (erste Hälfte bis Ende 2. Jt. v. Chr. in Anatolien),89 dann lassen sich auch Grundelemente beim Ausbau der zentralen (und vielleicht nicht nur beschränkt auf diese) Orte (Abb. 41-44) im Layout der Gesamtanlage (Plazierung der Tempel und des Palastes nach offenbar allgemeingültigen rituellen Vorgaben) und in der Struktur der zentralen Einrichtungen wie Tempel (Abb. 45) und Palast nachweisen bzw. kann es sogar unmöglich sein,Palast- und Tempel funktional voneinander zu trennen.90 Die Ausschmückung der assyrischen Palastanlagen ist unterschiedlich zu der Babyloniens. Ausgehend von der assyrischen Königsideologie war der assyrische Palast Sitz des Königs, des Stellvertreters der Götter und des obersten Kriegsherrn. Die assyrische Außenpolitik, ge-kennzeichnet durch das Bestreben, die benachbarten Gebiete - zwecks Optimierung der Res-sourcenausnutzung dieser Regionen - erst durch Feldzüge und dann durch administrative Kon-trolle der eroberten Gebiete in Form von Provinzen dem assyrischen Staatswesen einzuver-leiben, hat direkten Einfluß auf die Bildprogramme der königlichen Paläste genommen. Anfänglich, ab dem 9. Jh. v. Chr, dominieren in jenen den tributzahlenden Repräsentanten der eroberten Regionen zugänglichen Palastpartien noch Schlachten-, Bestrafungs- und Tributs-szenen die Reliefdarstellungen, die Allmacht des assyrischen Herrschers zusätzlich durch drastische Voraugenführung der Bestrafung bei Verweigerung des Tributes hervorhebend. Diese Palastteile erfüllten also eindeutig die Funktion der Einschüchterung und Machtrepräsen-tanz, bei gleichzeitiger Darstellung der göttlich bewirkten Legitimation der Herrschaft. Nachdem die meisten Regionen um Assyrien, mit kurzem Zwischenspiel sogar bis nach Ägyp-ten hin, erobert und größtenteils zur assyrischen Provinz geworden waren, änderte sich auch die Bildprogrammatik der Reliefs in den königlichen Residenzen. Die Darstellungen werden nunmehr nicht ausschließlich von Tributzügen, Bestrafungen und Eroberungen dominiert, son- 86 Die Frage nach der Begehbarkeit assyrischer Ziqqurrati wurde zusammenfassend behandelt von F.M. Stepniowski, ‘Upper Temples‘ on Assyrian Ziqqurats – Did They Ever Exist?, in: B. Hrouda; S. Kroll; P.Z. Spanos (Hrsg.), Von Uruk nach Tutul. Eine Festschrift für Eva Strommenger, Münchner Vorderasiatische Studien 12, München 1992, 197ff. 87 Zum Palast im alten Orient vgl. E. Heinrich, Die Paläste im Alten Mesopotamien, Denkmäler antiker Architektur 15, Berlin 1984, J. Margueron, Recherches sur les palais mésopotamiens de l’Age du Bronze, in: Institut Français d’Archéologie du Proche Orient, Bibliothèque Archéologique et Historique 107, Paris 1982 und J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 137ff. Zu den Palastanlagen im hethitischen Bereich vgl. R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethi-tischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971, 389ff. 88 Der assyrische König war nicht nur oberster Feldherr, sondern auch Stellvertreter der Götter. Demgegenüber war der babylonische Herrscher dem babylonischen Hauptgott Marduk untergeordnet und mußte es sich gefallen lassen, sich anläßlich des Neujahrsfestes, bei einem Bußritus für das gesamte Land in aller Öffentlichkeit vom obersten Priester der genannten Gottheit, nackt und bloß, ohrfeigen und am Ohr ziehen zu lassen, ein Vorgang, der bei einem assyrischen Herrscher nicht denkbar wäre; vgl. W. von Soden, Einführung in die Altorientalistik, Darmstadt 1985, bes. 182ff. und A.K. Grayson, Ninive, Capital of the World. Rome on the Tigris, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 9ff. 89 V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, in: Handbuch der Orientalistik I,15, Leiden 1994, bes. 188ff. 90 Ebd., 623. Auch der jüngst ergrabene Tempel von Kuşaklı, in der Nähe von Sivas/Anatolien, entspricht dem in Hattuša belegten Layout und zeigt, daß auch Tempel außerhalb der hethitischen Hauptstadt Hattuša einem ver-bindlichen Grundplan folgten (freundliche Mitteilung von A. Müller-Karpe).
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
63
dern es wurden auch königliche Bautätigkeiten und Gartenanlagen, also den Aspekt des Wahrers und Mehrers des Wohles des Reiches des assyrischen Königs hervorhebende Szenen verstärkt dargestellt.91 Wenn überhaupt, so finden sich im babylonischen Bereich nur Darstellungen rein religiös-mythischer Motivik (wie in der Prozessionsstraße von Babylon) oder Herrscherrepräsentationen, die den Erhalt und Aufbau des Staates und der Tempel signalisieren.92 Palast und Tempel waren aber nicht nur Wohnstadt des Herrschers und der Götter, sondern vor allem die Hauptwirtschaftseinrichtungen der Länder.93 Das Verhältnis beider zueinander war Schwankungen unterworfen, und die übermäßige Rolle der Tempelwirtschaft, die die ältere Forschung noch für das 3. und frühe 2. Jt. v. Chr. postulierte, relativiert sich heute.94 Dennoch gehörte diesen zentralen Einrichtungen die Masse des Landes. Privatbesitz spielte meist eine nur untergeordnete Rolle. Zu bewirtschaftendes Land wurde von den zentralen Einrichtungen meist nur zur Pacht vergeben.95 Über die dritte Konstituente der zentralen Einrichtungen, nämlich die großen, aus den Texten zu erschließenden Speichereinheiten zur Redistribution von Gütern an die Lohnabhängigen, ist archäologisch so gut wie nichts bekannt, denn bis heute wurden kaum größere Speicheranlagen ergraben, in denen diese Güter gelagert und verwaltet wurden. Bekannt sind nur königliche Schatzhäuser aus dem 1. Jt. v. Chr. in Babylonien, Assyrien und im Achämenidenreich des 6.-4. Jts. v. Chr., sowie die großen Magazine in den Fluchtburgen der Urartäer.96
91 Dazu J. Bär, Der Assyrische Tribut und seine Darstellung. Eine Untersuchung zur imperialen Ideologie im neuassyrischen Reich, Alter Orient und Altes Testament 243, 1994. Zu den Bildprogrammen vgl. ferner I.J. Winter, Royal Rhetoric and the Development of Historical Narrative in Neo-Assyrian Reliefs, Visual Communication 7, 1981, 1ff. und dies., The Programm of the Throneroom of Assurnasirpal II, in: P.O. Harper; H. Pittman (Eds.), Essays on Near Eastern Art and Archaeology in Honor of Ch.K. Wilkinson, New York 1983, 15ff. sowie J.M. Russel, Sennacherib’s ‘Palace Without Rival’. A Programmatic Study of Texts and Images in a Late Assyrian Palace, Ann Arbor 1985. 92 Eine gute, knappe Darstellung bietet W. Orthmann (Hrsg.), Der Alte Orient, Propyläen Kunstgeschichte 14, Berlin 1975, bes. 76ff.; siehe auch den Beitrag von K. Karstens, Überlegungen zur Rekonstruktion der Fassade am Thronsaal Nebukadnezars II., Babylon, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995, 57ff. 93 Siehe die verschiedenen Beiträge in E. Lipiński (Hrsg.), State and Temple Economy in the Ancient Near East I-II, Orientalia Lovaniensia 5-6, Louvain 1979 und J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 114f. Eine sehr umfassende monographische Darstellung zum Innana-Tempel in Nippur, der die ganze Komplexität darstellt, hat R.L. Zettler, The Ur III-Tempel of Inanna at Nippur. The Operation and Organization of Urban Religious Institutions in Mesopotamia in the Late Third Millenium B.C., Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 11, Berlin 1992 vorgelegt. 94 B. Foster, A New Look at the Sumerian Temple State, Journal of the Economic and Social History of the Orient 24, 1981, 225ff. und K. Maekawa, The Development of É-MI in Lagash during Early Dynastic III, Mesopotamia 8-9, 1973-74, 77ff. 95 Vgl. J. Renger, Wirtschaft und Gesellschaft, in: B. Hrouda (Hrsg.), Der Alte Orient, Gütersloh 1991, 187ff. 96 Zu den Speicheranlagen in Mesopotamien vgl. E. Heinrich, Die Paläste im Alten Mesopotamien, Denkmäler antiker Architektur 15, Berlin 1984 bei der Beschreibung der konkreten Palastanlagen; zur Türkei vgl. R. Naumann, Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971, 430ff., 476ff.; zu Urartu siehe W. Kleiss, Urartäische Architektur, in: H.-J. Kellner (Hrsg.), Urartu. Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, Ausstellungskataloge der Prähistorischen Staatssammlung 2, München 1976, 28ff. hier 39ff. und zur Indus-Kultur vgl. die kritischen Ausführungen bei M. Jansen, Architektur in der Harappa-Kultur, eine kri-tische Betrachtung zum umbauten Raum im 3.-2. Jahrtausend, Bonn 1979, 118ff. und 260ff. sowie M.A. Fentress, The Indus „Granaries“. Illusion, Imagination and Archaeological Reconstruction, in: K.A.R. Kennedey; G.L. Pos-sehl (Hrsg.), Studies in the Archaeology and Palaeoanthropology of South Asia, New Delhi 1984, 89ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
65
Abb. 36: Nippur, Ur III-Zeit, Ziqqurrat
Abb. 37: Ur, Ur III-Zeit, Stadtanlage
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
67
Abb. 39: Altin-Depe, ziqqurrat-ähnliche Struktur am südöstlichen Teperand
Abb. 40: Dur Šarrukin, Plan und Aufriß der zentralen Einrichtungen
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
69
Abb. 42: Alaça-Höyük, Palastbereich
Abb. 43: Maşat-Höyük, Palastbereich
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
71
Abb. 46: Babylon, Tempel und Schreine innerhalb der Stadtbezirke
5. Lesbarkeit und Selbstdarstellung der zentralen Orte Das Problem der Lesbarkeit und der Selbstdarstellung altorientalischer Städte ist indirekt schon verschiedentlich angesprochen worden. Im Selbstverständnis der Babylonier war Babylon der "Nabel der Welt" (Abb. 46) und die oben angeführte "Weltkarte" mit Babylon im Zentrum ist, wie Unger nachweisen konnte,97 als direkte irdische Reflexion der kosmischen Ordnung aufzufassen. Daß Städte als Instanz eine Identität hatten, zeigt nicht nur, daß sie als "juristische Person" fungieren konnten, bzw. präziser: benutzt wurden,98 sondern zeigen auch die Epitheta einzelner Städte, wie zum Beispiel wiederum Ba-bylon: "Babylon, Wohnung des Überflusses", "Babylon, Himmelskraft", "Babylon, Stadt, deren Lehmziegel uralt sind", "Babylon, Stadt, deren heilige Satzung kostbar ist"99 oder "Babylon, die Stadt der Weisheit" (ein Titel, den Assur zuvor inne hatte).100 Die Wichtigkeit Babylons reflektiert sich auch im Schöpfungsepos zu Ehren des Marduk (ober-ste Gottheit des babylonischen Pantheons) und Babylons:
"'1. Ein heiliger Tempel, ein Götterhaus war an heiliger Stätte noch nicht gemacht. 2. Ein Rohr war noch nicht hervorgesprossen, ein Baum noch nicht gebildet.
97 E. Unger, Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin; New York 1970, 20ff., Abb. 3-4. Dies reflektiert auch Jesaja 13,19: "Also soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herr-liche Pracht der Chaldäer, umgekehrt werden von Gott, wie Sodom und Gomorrah". 98 I.J. Gelb a.o., „alu“, in: The Assyrian Dictionary, Chicago 1964, 383f., supra 2b. 99 E. Unger, Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin; New York 1970, 241. 100 D.J. Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, 86.
Reinhard Dittmann
72
3. Ein Ziegel war noch nicht gelegt, eine Ziegelform noch nicht geschaffen. 4. Ein Haus war noch nicht gemacht, eine Stadt noch nicht gebildet. 5. Eine Stadt war noch nicht gebaut, [ein] Volk noch nicht hineingesetzt. 6. Nippur war noch nicht gemacht, Ekur (= Tempel in Uruk) war noch nicht gebaut. 7. Uruk war noch nicht gemacht, Eanna (= Tempel in Uruk) war noch nicht gebaut. 8. Der Ozean war noch nicht gemacht, Eridu war noch nicht gebaut. 9. Eines Heiligen Tempels, eines Gotteshauses Stätte war noch nicht gemacht. 10. Alle Länder waren Meer. 11. Als die Mitte des Meeres ein Rinnsal(?) war, 12. Da wurde Eridu gemacht, Esagila [Hauptheiligtum des Marduk in Babylon] gebildet, 13. Esagila, das inmitten des Ozeans Lugaldukugga (= Marduk) zum Wohnsitz erkor. 14. Babylon wurde gemacht, Esagila wurde vollendet. 15. Die Annunnaki (= Erdgötter) allesamt schufen die Stadt. 16. Mit hohem Namen benannten sie sie als die "Heilige Stadt", die "Stätte der Herzens-freude'. (Es folgt die Schöpfung von Haus, Mensch, Tier, Euphrat und Tigris, sowie der Pflan-zenwelt)."101
Die Bindefunktion Babylons zwischen den himmlischen und irdischen Sphären wird auch im Namen der Ziqqurrat reflektiert: "Etemenanki = Gebäude, welches das Fundament von Himmel und Erde ist".102 Die programmatisch begründete prächtige und monumentale bewußte Ausgestaltung Babylons zum Zentrum der alten Welt verdeutlicht auch eine Nebukadnezar II. zugeschriebene Äußerung auf dem Dach seines Palastes gegenüber dem Propheten Daniel: "Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit".103 Die Bedeutung einer altorientalischen Stadt wurde im alten Selbstverständnis ferner an zwei weiteren Faktoren festgemacht, zum einen an der Größe und zum anderen an der Mächtigkeit der Stadtmauern. So galt die spätassyrische Hauptstadt Ninive (Mitte 8. bis Anfang 7. Jt. v. Chr.) als bedeutend, weil sie riesige Ausmaße hatte und in biblischer Tradition die Größe mit drei Tagesreisen angegeben wurde: "Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! Da machte sich Jonas auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß."104 Zusammen mit den mächtigen Ziqqurrati waren es, auch im alten Selbstverständnis, die ge-waltigen Stadtmauern und Toranlagen, die als entscheidende Erkennungsmerkmale einer altorientalischen Stadt fungierten. Sie reflektierten weit über die Grenzen der Stadt hinaus die
101 E. Unger, Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin; New York 1970, 264. 102 D.J. Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, 68. 103 Daniel 4,27; solcher Größenwahn mußte in biblischer Tradition natürlich sofort sanktioniert werden, und die Strafe erfolgte umgehend: "Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar wird gesagt: Dein Königreich ist dir genommen, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben; Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder, und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, daß der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will". ebd., 28-29. Vgl. ferner die Geschichte vom Fall Babylons, z.B. Jesaja 13 und 14. Allein dies ist alttestamentliches Wunschdenken als Reaktion auf die Einnahme Jerusalems und die Deportation großer Teile der Bevölkerung durch Nebukadnezar II. im März 597 v. Chr., denn das Reich der chaldäischen Dynastie bestand noch weiter, bis 539 v. Chr. Bei Hesekiel 29-32 wird Nebukadnezar durchaus als Erfüller der Pläne Gottes dargestellt. 104 Jonas 3,2-3.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
73
staatlich-königliche Macht und dienten zugleich der Einschüchterung und der Abschreckung. Eine bewundernde Beschreibung der Stadtmauer von Uruk und Glorifizierung derselben liegt schon im Gilgamešepos vor:
"See if its wall is not (as straight) as the (architect's) string. Inspect its ... wall, the likes of which no-one can equal; Touch the treshold-stone - it dates from ancient times. Approach the Eanna Temple, the dwelling of Ishtar, such as no later king or man will ever equal. Go up on the wall and walk around. Examine its foundations, inspect its brickwork thoroughly, is not its masonery of baked brick, did not the Seven Sages themselves lay out its plans? One square mile city, one square mile palm grooves, one square mile brick pits (and) the ....of the Ishtar Temple; 3 square miles and the ... of Uruk it encloses".105
Ähnlich wie bei den diversen Bauinschriften für öffentliche Gebäude dient die Betonung des Alters der Anlagen und der Solidität der Fundamente gleichsam als Parabel für das altmesopo-tamische Königtum dessen oberstes Prinzip - bis hin zur Geschichtsfälschung106-, die Heraus-streichung der Kontinuität der Herrschaft und der darin begründeten Legitimation war. Anhand dieses Symbolwertes von Stadtmauern wird auch verständlich, wieso die Darstellung des Erstürmens, Unterminierens und Schleifens von Stadtmauern auf assyrischen Reliefs so betont wird, denn durch ihre Zerstörung entfällt nicht nur der Schutz für die betroffene Gemeinschaft vor äußerem Übel, sondern auch die Funktion des betroffenen Lokalherrschers als Hüters derselben, die ihm damit eindrucksvoll entzogen wird. Zwar wurden in der assyrischen Reliefkunst große Mengen an feindlichen Stadtmauern dar-gestellt (Abb. 47),107 die Wiedergabe einer eigenen Stadtanlage ist dagegen nur einmal - und hier nicht ohne letzte Zweifel108- bezeugt in Relieffragmenten, welche möglicherweise die Stadt-mauern und einen Palast der assyrischen Hauptstadt Ninive wiedergeben (zu einem dieser Fragmente mit der Darstellung einer Palastfassade (?) vgl. Abb. 48). Auch die zentralen Einrichtungen von Tempel und Palast sind im Zusammenhang der Selbst-darstellung und Lesbarkeit einer altorientalischen Stadt nochmals zu nennen. Selbstredend muß die Errichtung der Ziqqurrati mit den sie umgebenden Kulteinrichtungen, die ab der Ur III-Zeit
105 Zitiert nach J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 74. 106 Bestes Beispiel ist die sogenannte assyrische Königsliste, die zur Zeit des Herrschers Šamši-Adad I. (Anfang 2. Jt. v. Chr.) kompiliert wurde, und zwar so, daß der Eindruck erweckt wurde, als ob die Dynastie dieses Herrschers in direkter Folge der lokalen assyrischen Herrscherdynastien stünde. Vgl. A.K. Grayson, "Königslisten und Chro-niken", in: Reallexikon für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1981, 77ff., hier 103; F.R. Kraus, Könige, die in Zelten wohnten, Amsterdam 1965 und J.J. Finkelstein, The Genealogy of the Hammurapi Dynastie, Journal of Cuneiform Studies 20, 1966, 95ff. 107 B. Meissner, Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg 1920, I, 111: "Die eroberten Städte wurden zerstört, verbrannt und zu Trümmerhaufen und Ruinen verwandelt, die Fruchtbäume und Dattelpalmen wurden abgehauen und auf das Land umher Salpeter und andere den Pflanzenwuchs hindernde Substanzen gestreut. Als Symbol der vollkommenen Eroberung nahmen die Assyrerkönige auch etwas Erde der eroberten Stadt mit und häuften sie in dem Stadttor der Hauptstadt auf. Das Vieh wurde weggetrieben, und die Kostbarkeiten fortgeschleppt. Schreiber standen dabei und nahmen die ganze Beute auf". 108 Zum Für und Wider vgl. W. Orthmann (Hrsg.), Der Alte Orient, Propyläen Kunstgeschichte 14, Berlin 1975, 324, Abb. 241 aus der Zeit des Assurbanipal (668-631 v. Chr.) aus dem Nord-Palast von Ninive.
Reinhard Dittmann
74
Abb. 47: Neuassyrisches Relief mit Darstellungen von Angriffen auf Städten
Abb. 48: Neuassyrisches Relief mit der Darstellung einer Palastanlage aus Ninive
initiiert worden war und zu weitgehend ähnlichen Grundplänen von Stadtanlagen in dieser Zeit führte, auch im Zusammenhang mit einer eindeutigen Zuordnung solchermaßen gestalteter Einrichtungen zum Ur III-Reich gesehen werden. Man wußte, wenn man solche Anlagen sah, in welchem Herrschaftsbereich man sich befand. Gleiches gilt auch für das Layout assyrischer Städte mit der Akropolislage der zentralen Einrichtungen.109 Die Städte waren, ob ihrer Ver-bindung mit einem Stadtgott und seinem Kreis, auch in dieser Hinsicht unverwechselbar, und sogenannte Götteradreßbücher wurden ihnen zugeordnet. Solche Kompendien sind aus dem 1. 109 L.D. Levine, Cities as Ideology. The Neo-Assyrian Centres of Ashur, Nimrud and Ninive, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 1ff.; A.K. Grayson, Ninive, Capital of the World. Rome on the Tigris, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 9ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
75
Jt. v. Chr. für Assur, Babylon, Kiš, Nippur, Ur und Uruk überliefert, und in ihnen sind u.a. die stadtspezifischen Götter und Tempel mit ihren Epitheta aufgelistet.110 Die Paläste dienten nicht nur der Verwaltung und als Repräsentations- und Wohnsitz des Königs, sondern ebenso als Symbol und Legitimation der Herrschaft.111 Einige Paläste waren sogar berühmt, wie der schon erwähnte Palast Sanheribs in Ninive, der "Ohnegleichen" war,112 und in einem Falle ist am Beginn des 2. Jts. v. Chr. überliefert, daß der Herrscher von Ugarit um Vermittlung beim Herrscher von Aleppo suchte, um den prächtig ausgeschmückten Palast des Zimrilim in Mari besichtigen dürfen zu können.113 Außerhalb Mesopotamiens und Anatoliens (vor allem zur Hethiterzeit) ist es mit dem un-mittelbaren Erkennen eines Herrschaftsbereiches, festgemacht an dem Layout der Städte, schwierig. Dies ist sicher dadurch bedingt, daß viele solcher politischen Entitäten einfach zu klein und kurzlebig waren, als daß es auch auf einer städtebaulichen Ebene zu einer unver-wechselbaren Identifikationsform ihrer Herrschaft hätte kommen können. Sie hatten weder den globalen Herrschaftsanspruch (der sich in Titulaturen, wie "Herrscher der Gesamtheit" oder "Herrscher der vier Weltgegenden" in den Königsinschriften äußert) und eine entsprechende Königsideologie wie die größer-mesopotamischen Staaten, noch war ihnen das Bestreben nach der Kontinuität der Herrschaft im Herrschaftsbereich wichtig, eine Grundkonstante für die Legitimierung auch nach außen, durch bauliche und bildprogrammatische Elemente. Innerhalb des Verbreitungsbereiches der Indus-Kultur sind bekanntermaßen auch durchaus Gemeinsamkeiten im Layout vieler Anlagen zu erkennen, besonders anzusprechen ist das Phänomen von mindestens zwei unterschiedlichen Stadtteilen, allgemein als Akropolis und Unterstadt aufgefaßt, wobei man eigentlich besser von zwei funktional unterschiedlichen Stadt-bereichen reden sollte, ohne die sozialhierarchischen Implikationen der anderen beiden Begriffe. Inwieweit das Layout mancher baktrisch-uzbekischer Orte, wie Brentjes vermutete, Mandala-Vorstellungen entspricht, bedarf noch der weiteren Analyse; sollte dies zutreffen, dann wäre auch hier eine evidente Lesbarkeit der Anlagen gegeben. Abschließend bleibt festzuhalten, daß es nur ansatzweise gelingt, alle Netze, in die die Städte des Alten Orients eingebunden waren, aufzuspüren und zu erfassen. Dies liegt sicher weniger am Befund, sondern daran, daß die Vorderasiatische Archäologie bisher die für diese Fragen relevanten Daten bestenfalls nur unter formal-typologischen Gesichtspunkten aufgearbeitet hat, und an dem bisher noch weitgehend mangelnden Vermögen des Faches, zumal in Deutschland, nicht nur aus den Artefakten einen Sinn herauszulesen, sondern modellhaft begründete Fragen zu stellen.
110 Zusammenfassend jetzt A. George, Babylonian Topographical Texts, Orientalia Lovaniensia Analecta 40, Leuven 1992. 111 So soll Nebukadnezar II. von seinem Palast gesagt haben: "a building for the administration of my people, a place of union for the land" (D.J. Wiseman, Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, 55). 112 Beste zusammenfassende Darstellung ist J.M. Russel, Sennacherib’s ‘Palace Without Rival’. A Programmatic Study of Texts and Images in a Late Assyrian Palace, Ann Arbor 1985. 113 J.N. Postgate,Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, 141.
Reinhard Dittmann
76
Literaturhinweise
Adams, R. Mc, Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago 1981.
Amiet, P., L'Age des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C., Notes et Documents des Musées de France 11, Paris 1986.
Andrae, W., Das Gotteshaus und die Urform des Bauens im Alten Orient, Studien zur Bauforschung 2, Berlin 1930.
Ders., Alte Feststraßen im Nahen Osten, Sendschrift der Deutschen Orient-Gesellschaft 10, Leipzig 1941.
Bär, J., Der Assyrische Tribut und seine Darstellung. Eine Untersuchung zur imperialen Ideologie im neuassyrischen Reich, Alter Orient und Altes Testament 243, 1996.
Bandmann, G., Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger, 10. Aufl. Berlin 1994.
Barrelet, M.-Th., Dispositifs à feu et cuisson des aliments à Ur, Nippur, Uruk, Paléorient 2, 1974, 243ff.
Belli, O., Urartian Dams and Artificial Lakes in Eastern Anatolia, in: A. Çingiroglu, D. French (Hrsg.), Anatolian Iron Age 3, British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 16, Ankara 1994, 9ff.
Bernbeck, R., Die Auflösung der häuslichen Produktionsweise. Das Beispiel Mesopotamiens, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 14, Berlin 1994.
Bittel, K., Hattusha. The Capital of the Hittites, Oxford 1970.
Boockmann, H., Die Stadt im Mittelalter, 2. Aufl. München 1987.
Braudel, F., Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts I. Der Alltag, München 1985.
Brentjes, B., Das 'Ur-Mandala'(?) von Daschly-3, Iranica Antiqua 18, 1983, 25ff.
Bretschneider, J.; Dietrich, A. (Hrsg.), Beydar. Mitteilungen über die Erforschung eines urbanen Zentrums im Norden Alt-Syriens. Bd. 1, Münster 1994.
Burney, C.A., Urartian Fortresses and Towns in the Van Region, Anatolian Studies 7, 1957, 37ff.
Butz, K., "Landwirtschaft", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-logie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 470ff.
Carter, E.; Stolper, M., Elam. Survey of Political History and Archaeology, Near Eastern Studies 25, 1984.
Casal, J.-M., Fouilles de Mundigak, Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan XVII,1-2, Paris 1961.
Ders., La civilisation de l'Indus et ses énigmes, Paris 1969.
Charpin, D., Le clergé d'Ur au siècle d'Hammurabi, XIXe-XVIIIe siècles av. J.-C., Genève 1986.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
77
Charvát, P., Early Texts and Sealings. 'Divine Journeys' in the Uruk IV Period, Alt-orientalische Forschungen 22, 1995, 30ff.
Cohen, S., Enmerkar and the Lord of Aratta, Ann Arbor 1973.
Dalley, S.M., Myths from Mesopotamia, Oxford 1989.
Damerji, M.S., Die Tür nach Darstellungen in der altmesopotamischen Bildkunst von der `Ubaid- bis zur Akkad-Zeit, Baghdader Mitteilungen 22, 1991, 231ff.
Dittmann, R., Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 4,1-2, Berlin 1986.
Ders., Anmerkungen zur Genese und Transformation des Reif-Harappa-Komplexes (in Vorbereitung).
Ders., Die inneren und äußeren Grenzen der mittelassyrischen Residenzstadt Kar-Tukulti-Ninurta/Nord Iraq, in: M. Jansen, P. Johanek (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 101ff.
Dolukhanov, P.M., The Ecological Prerequisites for Early Farming in Southern Turkmenia, in: Ph.L. Kohl (Hrsg.), The Bronze Age Civilization for Central Asia. Recent Soviet Dis-coveries, New York 1981, 359ff.
Dombart, Th., Der Sakralturm. 1 Zikkurrat, München 1920.
Eichler, S.; Haas, V.; Steudle, D.; Wäfler, M.; Warburton, D., Tall Al-Hamadiya 1, Orbis Biblicus et Orientalis Series Archaeologica 4, 1985.
Eichmann, R., Aspekte prähistorischer Grundrißgestaltung in Vorderasien. Beiträge zum Ver-ständnis bestimmter Grundrißmerkmale in ausgewählten neolithischen und chalkolithischen Siedlungen des 9.-4. Jahrtausends v. Chr., Baghdader Forschungen 12, Mainz 1991.
Ellis, R.S., Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, Yale Near Eastern Researches 2, New Heaven 1968.
Englund, R.K., Administration and Timekeeping in Ancient Mesopotamia, Journal of the Economic and Social History of the Orient 31, 1988, 121ff.
Ders., "There's a Rat in my Soup!", Altorientalische Forschungen 23, 1995, 37ff.
Falkenstein, A.,"Gilgameš", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-logie Bd. 3, Berlin; New York 1968, 357ff.
Farber, W., Rituale und Beschwörungen in akkadischer Sprache, in: M. Dietrich u.a. (Hrsg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments II. Religiöse Texte, Gütersloh 1986-1991, 212ff.
Fentress, M.A., Resource Access, Exchange Systems and Regional Interaction in the Indus Valley, Ann Arbor 1976.
Ders., The Indus "Granaries". Illusion, Imagination and Archaeological Reconstruction, in: K.A.R. Kennedey; G.L. Possehl (Hrsg.), Studies in the Archaeology and Palaeoanthropology of South Asia, New Dehli 1984, 89ff.
Ferioli, P.; Fiandra, E., Clay Sealings from Arslantepe VIA. Administration and Bureau-cracy, in: M. Frangipane; A. Palmieri (Hrsg.), Perspectives on Protourbanization in Eastern
Reinhard Dittmann
78
Anatolia: Arslantepe (Malatya). An Interim Report on 1975-1983 Campaigns, Origini 12,2, Naples 1983, 455ff.
Finkelstein, J.J., The Genealogy of the Hammurapi Dynastie, Journal of Cuneiform Studies 20, 1966, 95ff.
Foster, B., A New Look at the Sumerian Temple State, Journal of the Economic and Social History of the Orient 24, 1981, 225ff.
Franke-Vogt, U., Tradition und Transformation am Indus. Die Entstehung der Induskultur, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995, 97ff.
Frayne, D.R., A Struggle for Water. A Case Study from the Historical Records of the Cities Isin and Larsa (1900-1800 B.C.), Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 17, 1989, 17ff.
Gardin, J.-Cl./Peebles, Ch., Representations in Archaeology, Indiana 1992.
Gelb, I.J. a.o., "ālu", in: The Assyrian Dictionary, Chicago 1964, 379ff.
Ders., Household and Family in Early Mesopotamia, in: E. Lipiński (Hrsg.), State and Temple Economy in the Ancient Near East I-II, Louvain 1979, 1ff.
George, A., Babylonian Topographical Texts, Orientalia Lovaniensia Analecta 40, Leuven 1992.
Girouard, M., Die Stadt. Menschen, Häuser, Plätze. Eine Kulturgeschichte, Frankfurt; New York 1987.
Grayson, A.K., "Königslisten und Chroniken", in: Reallexikon für Assyriologie und Vorder-asiatische Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1981, 77ff.
Ders., Ninive, Capital of the World. Rome on the Tigris, Bulletin of the Society for Meso-potamian Studies 12, 1986, 9ff.
Grégoire, J.-P., L’origine et le développement de la civilisation mésopotamienne du troi-sième millénaire avant notre ére, Paris 1976, bes. 67-73.
Gruben, G., "Stadt, I. Griechische Stadt", in: C. Andresen u.a. (Hrsg.), Lexikon der Antiken Welt Bd. III, Zürich; München 1994, 2882ff.
Haas, V., Hethitische Berggötter und Hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen, Kulturgeschichte der antiken Welt 10, Mainz 1982.
Ders. (Hrsg.), Außenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orient, XENIA 32, Konstanz 1992.
Ders., Geschichte der hethitischen Religion, in: Handbuch der Orientalistik I,15, Leiden 1994.
Ders., Magie und Mythen im Reich der Hethiter I. Vegetationskulte und Pflanzenmagie, Hamburg o.J.
Haggett, P., Einführung in die kultur- und sozialgeographische Regionalanalyse, Berlin; New York 1973.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
79
Halim, M.A./Vidale, M., Kubes, Bangles and Coated Vessels. Ceramic Production in Closed Containers at Moenjodaro, in: M. Jansen; G. Urban (Hrsg.), Reports on Field Work at Mohenjo-Daro, Interim Reports 1, Aachen 1984, 63ff.
Hallo, W.W., The Road to Emar, Journal of Cuneiform Studies 18, 1964, 57ff.
Hammond, M., The City in the Ancient World, Cambridge Mass. 1972.
Hauptmann, H., Ein Kultgebäude in Nevalli Çori, in: M. Frangipane a.o. (Eds.), Between the Rivers and Over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata, Roma 1993, 37ff.
Heinrich, E.; Seidl, U., Grundrißzeichnungen aus dem alten Orient, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 98, 1967, 24ff.
Heinrich, E., "Haus", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 4, Berlin; New York 1972-1975, 176ff.
Ders., Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien. Typologie, Morphologie und Geschichte, Denkmäler antiker Architektur 14,1-2, Berlin 1982.
Ders., Die Paläste im Alten Mesopotamien, Denkmäler antiker Architektur 15, Berlin 1984.
Hemker, Ch., Altorientalische Kanalisation. Untersuchungen zu Be- und Entwässerungs-anlagen im mesopotamisch-syrisch-anatolischen Raum, Abhandlungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 22, Münster 1993.
Herzog, Z., Das Stadttor in Israel und in den Nachbarländern, Mainz 1986.
Hodder, I.R.; Orton, C., Spatial Analysis in Archaeology, Cambridge 1976.
Jansen, M., City Planning in the Harappan Culture, AARP 14, London 1978.
Ders., Architektur in der Harappa-Kultur. Eine kritische Betrachtung zum umbauten Raum im 3.-2. Jahrtausend, Bonn 1979
Ders., Architectural Problems of the Harappan Culture, South Asian Archaeology 1977, 405ff.
Ders., Architectural Remains in Mohenjo-Daro, in: B.B. Lal; S.P. Gupta (Hrsg.), Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, 75ff.
Ders., Mohenjo Daro HR-A House I, a Temple?, South Asian Archaeology 7, 1985, 157ff.
Ders., Die Indus-Zivilisation. Wiederentdeckung einer frühen Hochkultur, Köln 1986.
Ders., Some Problems Regarding the Forma Urbis Mohenjo-Daro, in: K. Frifelt; P. Sorensen (Hrsg.), South Asian Archaeology 1985. Papers from the 8th International Conference of South Asian Archaeologists in Western Europe, (Curzon Press) 1987, 247ff.
Jasim, S.A., The Ubaid Period in Iraq. Recent Excavations in the Hamrin Region, BAR International Series 267,1-2, Oxford 1985.
Karstens, K., Überlegungen zur Rekonstruktion der Fassade am Thronsaal Nebukadnezars II., Babylon. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995, 57ff.
Reinhard Dittmann
80
Kelley, K.B., Dendritic Central Place Systems and The Regional Organization of Navajo Trading Posts, in: C.A. Smith (Ed.), Regional Analysis I. Economic Systems, 1976, 232ff.
Kesarwani, A., Harappan Gateways. A Functional Reassessment, in: B.B. Lal; S.P. Gupta, Frontiers of the Indus Civilisation. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, 63ff.
Kleiss, W., Urartäische Architektur, in: H.-J. Kellner (Hrsg.), Urartu. Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, Ausstellungskatalog der Prähistorischen Staatssammlung 2, München 1976, 28ff.
Ders./Hauptmann, H., Topographische Karte von Urartu. Verzeichnis der Fundorte und Bibliographie, Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungsband 3, Berlin 1976..
Ders., Größenvergleiche urartäischer Burgen und Siedlungen, in: R.M. Boehmer; H. Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift für K. Bittel, Mainz 1983, 283ff.
Kohl, Ph.L. (Hrsg.), The Bronze Age Civilization of Central Asia. Recent Soviet Discoveries, New York 1981.
Ders., Central Asia. Palaeolithic Beginnings to the Iron Age, Éditions Recherche sur les Civilisations, Synthèse 14, Paris 1984.
Koşay, H.K.; Akok, M., Ausgrabungen von Alaça Höyük. Vorbericht über die Forschungen und Entdeckungen von 1940-1948, Ankara 1966.
Krafeld-Daugherty, M., Wohnen im Alten Orient. Eine Untersuchung zur Verwendung von Räumen in altorientalischen Wohnhäusern, Altertumskunde des Vorderen Orients 3, Münster 1994.
Kraus, F.R., Könige, die in Zelten wohnten, Amsterdam 1965.
Lal, B.B.; Gupta, S.P. (Hrsg.), Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984.
Lamprichs, R., Die Westexpansion des neuassyrischen Reiches. Eine Strukturanalyse, Alter Orient und Altes Testament 239, Neukirchen-Vluyn 1995.
Landsberger, B., Der kultische Kalender der Babylonier und Assyrer, Leipziger Semitische Studien, Leipzig 1915.
Lapidus, I.R.A. (Hrsg.), Middle Eastern Cities. Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism. A Symposium, Berkeley; Los Angeles 1969.
Larsen, M., The Old Assyrian City-State and its Colonies, Kopenhagen 1976.
Leemans, W.F., Kidinnu. Un Symbole de droit divin Babylonien, in: M. David et al. (Hrsg.), Symbolae ad Jus et Historiam Antiquitatis Pertinentes Julio Christiano van Oven Dedicatae, Leiden 1946, 36ff.
Lenzen, H.J., Die Entwicklung der Zikurat von ihren Anfängen bis in die Zeit der III. Dynastie von Ur, Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 4, Berlin 1941
Levine, L.D., Cities as Ideology. The Neo-Assyrian Centres of Ashur, Nimrud and Ninive, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 1ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
81
Lipiński, E. (Hrsg.), State and Temple Economy in the Ancient Near East I-II, Orientalia Lovaniensia 5-6, Louvain 1979.
Machule, D., Ausgrabungen in Tall Munbaqa 1984, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 118, 1986, 67ff.
Maekawa, K., The Development of É-MI in Lagash during Early Dynastic III, Mesopotamia 8-9, 1973-74, 77ff.
Margueron, J., Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Age du Bronze, in: Institut Français d'Archéologie du Proche Orient, Bibliothèque Archéologique et Historique 107, Paris 1982.
Mariani, L., The Monumental Area of Shahr-i Sokhta. Notes from a Surface Reconnaissance, in: K. Friefelt; P. Sörensen (Hrsg.), South Asian Archaeology 1985, Scandinavian Institute of Asian Studies Occasional Papers 4, 1987, 114ff.
Matthews, R.J., Cities, Seals and Writing. Archaic Seal Impressions from Jemdet Nasr and Ur, Materialien zu den Frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients II, Berlin 1993.
Mazzoni, S. (Hrsg.), Nuove Fondazioni nel Vicino Oriente Antico. Realtà e Ideologia, Pisa 1995.
Meissner, B., Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg 1920.
Meuszynski, J., Die Rekonstruktion der Reliefdarstellungen und ihrer Anordnung im Nord-westpalast von Kalhu (Nimrud), Baghdader Forschungen 2, Mainz 1981.
Meyer, J.-W., Offene und geschlossene Siedlungen - Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte in Nordsyrien während des 3. und 2. Jts. v. Chr. (im Druck).
Michell, G., Der Hindu-Tempel. Bauform und Bedeutung, Köln 1979.
Miglus, P., Das neuassyrische und neubabylonische Wohnhaus. Die Frage nach dem Hof, Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 84, 1994, 262ff.
Moortgat-Correns, U., Die Bildwerke vom Djebelet el-Beda, Berlin; New York 1972.
Mughal, R., The Harappan Settlement Systems and Patterns in the Greater Indus Valley, Pakistan Archaeology 25, 1990, 1ff.
Nagel, W.; Strommenger, E., Altorientalische Städte - von der Dorfkultur zur Hochkultur seit Habubah bis Babylon, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 16, 1978-79, 61ff.
Naumann, R., Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit, 2. Aufl. Tübingen 1971.
Neve, P., Hattuša, Stadt der Götter und Tempel, Mainz 1992.
Nippa, A., Haus und Familie in arabischen Ländern. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Darmstadt 1991.
Nissen, H.J., "Kanal(isation), B. Archäologisch", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 5, Berlin; New York, 1976-1980, 365ff.
Ders., Bemerkungen zur Listenliteratur Vorderasiens im 3. Jahrtausend, in: L. Cagni (Hrsg.), La Lingua di Ebla, Neapel 1981, 99ff.
Reinhard Dittmann
82
Ders., Grundzüge einer Geschichte der Frühzeit des Vorderen Orients, Grundzüge 52, Darm-stadt 1983.
Ders., Macht und Stadt in der babylonischen Kultur, in: M. Jansen; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeits-gruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 13ff.
Ders.; Damerow, P.; Englund R.K., Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient, 1990.
Nötscher, F., Die Omen-Serie Šumma âlu ina mêlê šakin, Orientalia 39-42, Rom 1929.
Oates, D., Walled Cities in Northern Mesopotamia in the Mari Period, MARI 4, 1985, 585ff.
Oates, J., Archaeology and Geography in Mesopotamia, in: J. Bintliff (Hrsg.), Mycenaean Geography. Proceedings of the Cambridge Colloquium Sept. 1976, Cambridge 1977, 101ff.
Oexle, O.G., Die funktionale Dreiteilung der Gesellschaft bei Adalbero von Laon, in: M. Kerner (Hrsg.), Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 1982, 421ff.
Oppenheim, A.L., Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization, 2. Aufl. Chicago 1977.
Orthmann, W. (Hrsg.), Der Alte Orient, Propyläen Kunstgeschichte 14, Berlin 1975.
Özgüç, T., Maşat Höyük II. A Hittite Center Northeast of Bogazköy, Ankara 1982.
Parrot, A., Tello. Vingt Campagnes de Fouilles, Paris 1877-1933, Paris 1948.
Possehl, G.L. (Hrsg.), Ancient Cities of the Indus, New Delhi 1979.
Ders., Lothal. A Gateway Settlement of the Indus Civilization, in: Ders. (Hrsg.), Ancient Cities of the Indus, New Delhi 1979, 212ff.
Ders. (Hrsg.), Harappan Civilization. A Contemporary Perspective, Warminster 1982.
Postgate, J.N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992.
Ratnagar, R., The Location of Harappa, in: G.L. Possehl (Hrsg.), Harappan Civilization. A Contemporary Perspective, Warminster 1982, 261ff.
Renger, J., Different Economic Spheres in the Urban Economy of Ancient Mesopotamia, in: E. Aerts; H. Klengel (Hrsg.), The Town as Regional Economic Center in the Ancient Near East, Studies in Social and Economic History 20, 1990, 20ff.
Ders., Wirtschaft und Gesellschaft, in: B. Hrouda (Hrsg.), Der Alte Orient, Gütersloh 1991, 187ff.
Reviv, H., Kidinnu. Observations on Privileges of Mesopotamian Cities, Journal of the Economic and Social History of the Orient 31, 1988, 286ff.
Roaf, M., Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Paris 1991.
Röllig, W., "Landkarten", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-logie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 464ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
83
Rosenberg, M., The Evidence for Craft Specialization in the Production of Chipped Stone Blades at Tappeh Hesar, in: R.H. Dyson; S.M. Howard (Hrsg.), Tappeh Hesar. Reports of the Restudy Project 1976, Firenze 1989, 111ff.
Russel, J.M., Sennacherib's 'Palace Without Rival'. A Programmatic Study of Texts and Images in a Late Assyrian Palace, Ann Arbor 1985.
Sack, D., Damaskus. Entwicklung und Struktur einer orientalisch-islamischen Stadt, Mainz 1988.
Sallaberger, W., Der kultische Kalender der Ur III-Zeit, Untersuchungen zur Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 7,1-2, Berlin; New York 1993.
Sarianidi, V.I., Margiana in the Bronze Age, in: Ph.L. Kohl (Hrsg.), The Bronze Age Civili-zation of Central Asia. Recent Soviet Discoveries, New York 1981.
Schirmacher, E., Stadtvorstellungen. Die Gestalt mittelalterlicher Städte. Erhaltung und planendes Handeln, Zürich 1988.
Schirmer, W., Drei Bauten des Çayönü Tepese, in: R.M. Boehmer; H. Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift für K. Bittel, Mainz 1983, 463ff.
Schmid, H., Der Tempelturm Etemenanki. Babylon, Baghdader Forschungen 17, Berlin 1995.
Schmidt, J., Straßen in altorientalischen Wohngebieten, Baghdader Mitteilungen 3, 1964, 125ff.
Schmökel, H., Ur, Assur und Babylon, Große Kulturen der Frühzeit, Stuttgart o. J.
Schneider, H, Zivilisationsprozess, Macht und städtische Form in einer buddhistischen Kultur. Das Beispiel von Chiang Mai/Nordthailand, in: M. Jansen; J. Hoock; J. Jarnut (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeits-gruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 195ff.
Segal, A., Stadtplanung im Altertum, Zürich; Köln 1979.
Sjöberg, A.W., "Götterreisen", in: Reallexikon der Assyriologie und der Vorderasiatischen Archäologie Bd. 3, Berlin; New York 1957-1971, 480ff.
Smith, C.A., Regional Economic Systems. Linking Geographic Models and Socioeconomic Problems, in: Dies., Regional Analysis I. Economic Systems, 1976, 34ff.
Dies., Exchange Systems and the Spatial Distribution of Elites. The Organization of Strati-fication in Agrarian Societies, in: Dies., Regional Analysis II. Social Systems, 1976, 317ff.
Smith, R.M., India and Mesopotamia. Gods, Temples and Why, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 17, 1984, 29ff.
Srivastava, K.M., The Myth of Aryan Invasion of Harappan Towns, in: B.B. Lal; S.P. Gupta (Hrsg.), Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, New Delhi 1984, 437ff.
Stepniowski, F.M., 'Upper Temples' on Assyrian Ziqqurats - Did They Ever Exist?, in: B. Hrouda; S. Kroll; P.Z. Spanos (Hrsg.), Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger, Münchner Vorderasiatische Studien 12, München 1992, 197ff.
Stol, M., "Kanal(isation), A. Philologisch", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorder-
Reinhard Dittmann
84
asiatischen Archäologie Bd. 5, Berlin; New York 1976-1980, 355ff.
Stone, E.C., Texts, Architecture and Ethnographic Analogy. Patterns of Residence in Old Babylonian Nippur, Iraq 43, 1981, 19ff.
Dies., Nippur Neighborhoods, Studies in Ancient Oriental Civilisation 44, Chicago 1987.
Strommenger, E., Habuba Kabira. Eine Stadt vor 5000 Jahren, Mainz 1980.
Süel, A., Ortaköy. Eine hethitische Stadt mit hethitischen und hurritischen Tontafel-entdeckungen, in: H. Otten a.o. (Eds.), Hittite and other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp, Ankara 1992, 487ff.
Thureau-Dangin, F., Rituels Accadiens, ND Osnabrück 1975.
Tosi, M. u.a., Craft Activity Areas and Surface Survey at Mohenjo-Daro, in: M. Jansen; G. Urban (Hrsg.), Reports on Field Work at Mohenjo-Daro, Interim Reports 1, Aachen 1984, 9ff.
Ders., The Notation on Craft Specialization and its Representation in the Archaeological Record of Early States in the Turanian Basin, in: M. Spriggs (Hrsg.), Marxist Perspectives in Archaeology, Cambridge 1984.
Ders., The Distribution of Industrial Debris on the Surface of Tappeh Hesar as an Indication of Activities Areas, in: R.H. Dyson; S.M. Howard (Hrsg.), Tappeh Hesar. Reports of the Restudy Project 1976, Monografie di Mesopotamia II, Firenze 1989, 13ff.
Trümpelmann, L., Eine Kneipe in Susa, Iranica Antiqua 16, 1981, 35ff.
Ucko, P.J.; Tringham, R.; Dimbleby, P. (Hrsg.), Man, Settlement and Urbanism, London 1972.
Unger, E., Babylon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der Babylonier, 2. Aufl. Berlin; New York 1970.
Ussishkin, D., The Erection of Royal Monuments in City Gates, in: K. Emre; B. Hrouda; M. Mellink; N. Özgüç (Hrsg.), Anatolia and the Ancient Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgüç, Ankara 1989, 485ff.
Von Soden, W., Einführung in die Altorientalistik, Darmstadt 1985.
Wartke, R.-B., Urartu. Das Reich am Ararat, Mainz 1993.
Werner, P., Die Entwicklung der Sakralarchitektur in Nordsyrien und Südostkleinasien. Vom Neolithikum bis in das 1. Jahrtausend v. Chr., Münchner Vorderasiatische Studien 15, Mün-chen 1994.
Wheeler, M., The Indus Civilization, 3. Aufl. Cambridge 1968.
Wilcke, C., Das Lugalandaepos, Wiesbaden 1969.
Winter, I.J., Royal Rhetoric and the Development of Historical Narrative in Neo-Assyrian Reliefs, Visual Communication 7, 1981, 1ff.
Dies., The Programm of the Throneroom of Assurnasirpal II, in: P.O. Harper; H. Pittman (Hrsg.), Essays on Near Eastern Art and Archaeology in Honor of Ch.K. Wilkinson, New York 1983, 15ff.
"Städtische Funktionen am Beispiel altorientalischer Städte"
85
Wirth, E., Die orientalische Stadt. Ein Überblick aufgrund jüngerer Forschungen zur materiellen Kultur, Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 26, 1975, 45ff.
Wiseman, D.J., Mesopotamian Gardens, Anatolian Studies 33, 1983, 137ff.
Ders., Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985.
Woolley, L.; Mallowan, M., The Old Babylonian Period, Ur Excavations VII, London; Phila-delphia 1976.
Wright, G.H.R., Ancient Building in South Syria and Palestine. Handbuch der Orientalistik 3,1, Leiden; Köln 1985.
Yoffee, N.; Cowgill, G.L., The Collaps of Ancient States and Civilizations, University of Arizona Press 1989.
Young, T.C., The Origin of the Mesopotamian City, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 11, 1986, 3ff.
Zaccagnini, C., "Markt", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-logie Bd. 7, Berlin; New York 1987-1990.
Zettler, R.L., Enlil's City, Nippur, at the End of the Third Millennium B.C., Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 14, 1987, 7ff.
Ders., The Ur III-Tempel of Inanna at Nippur. The Operation and Organization of Urban Religious Institutions in Mesopotamia in the Late Third Millenium B.C., Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 11, Berlin 1992.
Abbildungsnachweis Abb.1: Röllig, W., "Landkarten", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 464ff., Abb. 2; Abb.2: Haas, V., Hethitische Berggötter und Hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen, Kulturgeschichte der antiken Welt 10, Mainz 1982, Abb. 41; Abb.3: Röllig, W., "Landkarten", in: Reallexikon der Assyriologie und Vorder-asiatischen Archäologie Bd. 6, Berlin; New York 1980-1983, 464ff., Abb. 1; Abb.4: Postgate, J.N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, Fig. 12,3; Abb.5: ebd., Fig. 9,1; Abb.6a-b: Dittmann, R., Betrachtungen zur Frühzeit des Südwest-Iran. Regionale Entwicklungen vom 6. bis zum frühen 3. vorchristlichen Jahrtausend, Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 4,1-2, 1986, Karte 61 und Abb. 24; Abb.7: Verf.; Abb.8a-b: Postgate, J.N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, Fig. 2,8; Abb.9: Roaf, M., Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Paris 1990, S. 113; Abb.10: Wartke, R.-B., Urartu. Das Reich am Ararat, Mainz 1993, Abb. 36; Abb.11: Wheeler, M., The Indus Civilization, 3. Aufl. Cambridge 1968, 30f.; Abb.12a-b: Hauptmann, H., Ein Kultgebäude in Nevalli Çori, in: M. Frangipane a.o. (Eds.), Between the Rivers and Over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata, Rom 1993, 37ff., Abb. 9 und 28; Abb.13a-b: Amiet, P., L’Age des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C., Paris 1986, Ill. 1 und 3; Abb.14: Postgate, J.N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, Fig. 2,2.; Abb.15: Bretschneider, J./Dietrich, A. (Hrsg.), Beydar. Mitteilungen über die Erforschung eines urbanen Zentrums im Norden Alt-Syriens Bd. 1, Münster 1994, Abb. 7; Abb.16: Oates,
Reinhard Dittmann
86
D., Walled Cities in Northern Mesopotamia in the Mari Period, MARI 4, 1985, 585ff., Fig. 2; Abb.17: Heinrich, E., Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien. Typologie, Mor-phologie und Geschichte, Denkmäler antiker Architektur 14, Berlin 1982, Abb. 383; Abb.18: Heinrich, E.; Seidl, U., Grundrißzeichnungen aus dem alten Orient, Mitteilungen der Deut-schen Orient-Gesellschaft 98, 1967, Abb. 7; Abb.19: Wiseman, D.J., Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, Fig. 12; Abb.20a-b: Schmökel, H., Ur, Assur und Babylon, Große Kulturen der Frühzeit, Stuttgart o.J., Taf. 101; Abb.21a-b: Brentjes, B., Das ‘Ur-Mandala’(?) von Daschly-3, Iranica Antiqua 18, 1983, 25ff., Abb. 3 und 1; Abb.22: Heinrich, E., Die Paläste im Alten Mesopotamien, Denkmäler antiker Architektur 15, Berlin 1984, Abb. 5; Abb.23: Strommenger, E., Habuba Kabira. Eine Stadt vor 5000 Jahren, Mainz 1980, Abb. 16; Abb.24: Machule, D., Ausgrabungen in Tall Mumbaqa 1984, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 118, 1986, Abb. 19; Abb.25: Jasim, S.A., The Ubaid Period in Iraq. Recent Ex-cavations in the Hamrin Region, BAR International Series 267, Oxford 1985, Fig. 13; Abb.26: Mariani, L., The Monumental Area of Shahr-i Sokhta. Notes from a Surface Reconnaissance, in: K. Friefelt; P. Sörensen (Hrsg.), South Asian Archaeology 1985, Scandinavian Institute of Asian Studies Occasional Papers 4, 1987, Fig. 11; Abb.27: Jansen, M., Die Indus-Zivilisation. Wieder-entdeckung einer frühen Hochkultur, Köln 1986, Abb. 93; Abb.28: ebd., Abb. 91; Abb.29: Franke-Vogt, U., Tradition und Transformation am Indus: Die Entstehung der Induskultur, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 127, 1995, Abb. 19; Abb.30: Possehl, G.L., Lothal: A Gateway Settlement of the Indus Civilization, in: Ders. (Hrsg.), Ancient Cities of the Indus, 1979, 212ff., Fig. E; Abb.31: Kleiss, W., Urartäische Architektur, in: H.-J. Kellner (Hrsg.), Urartu. Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, Ausstellungskatalog der Prähistorischen Staatssammlung 2, München 1976, Abb. 26; Abb.32: Meuszynski, J., Die Rekonstruktion der Reliefdarstellungen und ihrer Anordnung im Nordwestpalast von Kalhu (Nimrud), Baghdader Forschungen 2, Mainz 1981, Taf. 2; Abb.33: Kohl, Ph.L., Central Asia. Palaeolithic Beginnings to the Iron Age, Éditions Recherche sur les Civilisations, Synthèse 14, Paris 1984, Fig. 13; Abb.34: Strommenger, E., Habuba Kabira. Eine Stadt vor 5000 Jahren, Mainz 1980, Abb. 54; Abb.35: Postgate, J.N., Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, London; New York 1992, Fig. 6,4; Abb.36: Heinrich, E., Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien. Typologie, Morphologie und Geschichte, Denkmäler antiker Architektur 14, Berlin 1982, Abb. 220; Abb.37: ebd., Abb. 221; Abb.38a-b: Casal, J.-M., Fouilles de Mundigak, Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan XVII, Paris 1961, Fig. 22 und 24; Abb.39: Kohl, Ph.L., Central Asia. Palaeolithic Beginnings to the Iron Age, Éditions Recherche sur les Civilisations, Synthèse 14, Paris 1984, Fig. 19; Abb.40: Levine, L.D., Cities as Ideology. The Neo-Assyrian Centres of Ashur, Nimrud and Ninive, Bulletin of the Society for Mesopotamian Studies 12, 1986, 6; Abb.41: Bittel, K., Hattusha. The Capital of the Hittites, Oxford 1970, Fig. 19; Abb.42: Koşay, H.K.; Akok, M., Ausgrabungen von Alaça Höyük. Vorbericht über die Forschungen und Entdeckungen von 1940-1948, Ankara 1966, Lev. 79; Abb.43: Özgüç, T., Maşat Höyük II. A Hittite Center Northeast of Bogazköy, Ankara 1982, Plan 2; Abb.44: Süel, A., Ortaköy. Eine hethitische Stadt mit hethitischen und hurritischen Tontafelentdeckungen, in: H. Otten a.o. (Eds.), Hittite and other Anatolian and Near Eastern Studies in Honour of Sedat Alp, Ankara 1992, 487ff., pl. 1; Abb.45: Neve, P., Hattuša, Stadt der Götter und Tempel, Mainz 1992, Abb. 37; Abb.46: Wiseman, D.J., Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, Fig. 5; Abb.47: Meuszynski, J., Die Rekonstruktion der Relief-darstellungen und ihrer Anordnung im Nordwestpalast von Kalhu (Nimrud), Baghdader For-schungen 2, Mainz 1981, Taf. 2; Abb.48: Meissner, B., Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg 1920, I, Abb. 94.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 87
Reinhard Senff (Bochum)
MILET, DIE ARCHAISCHE STADT
IM ZENTRUM EINES HANDELS- UND KULTURNETZES
In der Geschichte des Mittelmeerraumes spielt die Epoche der griechischen Kolonisation, der Zeitraum vom ausgehenden 8. Jh.v.Chr. bis zum Ende des 6. Jhs.v.Chr., eine herausragende Rolle für die Verbreitung griechischer Stadtkultur.1 Die Griechen waren nicht die einzigen Koloniegründer, sogar noch vor ihnen hatten die Phönizier mit der Anlage von Nieder-lassungen in Übersee begonnen. Bereits im ausgehenden 8. Jh.v.Chr. war das Mittelmeer-becken in unterschiedliche Einflußgebiete geteilt. Während die Phönizier sich vor allem auf Zypern, im westlichen Nordafrika, auf Sardinien, West-Sizilien und in Spanien niederließen, kolonisierten die Griechen Unteritalien, Ost-Sizilien, Südfrankreich, Dalmatien, den östlichen Teil der Nordküste Afrikas und den Schwarzmeerraum. Unter den griechischen Koloni-satoren sind wiederum verschiedene Interessensgebiete auszumachen. Die Euböer wandten sich hauptsächlich Mittelitalien und der Straße von Messina zu, Phokäa dem süd-französischen Raum und Mittelitalien, Spartaner Süditalien, Milet kolonisierte einen Großteil der Propontis und den gesamten Schwarzmeerraum. Verästelungen des ursprünglichen Be-ziehungsnetzes entstanden durch weitere Koloniegründungen von Seiten der Tochterstädte. Auf diese Weise formierten sich kulturell unterschiedlich geprägte Großräume. Für jeden, der sich mit der Geschichte Milets, insbesondere seiner materiellen Hinterlassen-schaft beschäftigt, muß dieser Zeitraum zu den interessantesten Abschnitten gehören, hatte doch die Stadt an der Gründung von Apoikien und dem damit verbundenen Handel einen größeren Anteil als jede andere. Seneca spricht von 75 milesischen Gründungen, Plinius der Ältere gar von 90.2 Auch wenn hier Sekundärgründungen und spätere abhängige Orte mit-gezählt worden sein sollten, kommt die heutige Forschung immerhin noch auf 40-50 sicher von Milet aus gegründete Städte.3 Milet begann mit der Gründung von Kolonien in der Propontis gegen 700 v.Chr., um dann seit der Mitte des Jahrhunderts im Schwarzmeergebiet Fuß zu fassen (Abb. 1).4 1 Für eine Übersicht über diese Epoche vgl. Boardman, J., Kolonien und Handel der Griechen. Vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr., 1981, 192ff.; A.J. Graham, The colonial expansion of Greece, 5, Hellespont, Propontis, Bosporus, CAH 3,3, 2. Aufl. 1982, 83ff., 83ff; N. Ehrhardt, Probleme der griechischen Kolonisation am Beispiel der milesischen Gründungen, Eos 73, 1985, 81ff., Anm. 1, m. weiterer Lit., sowie die Beiträge in G. Tsetskhladze, F. De Angelis, (Hrsg.), The Archaeology of Greek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, 1995. Zur phönikischen Kolonisation; vgl. die entsprechenden Beiträge H.G. Niemeyer, (Hrsg.), Phönizier im Westen, 1982. 2 Sen. dial. 12,7,2; Plin. n.h. 5,112. 3 N. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 96; ders. Probleme der griechischen Kolonisation am Beispiel der milesischen Gründungen, Eos 73, 1985, 81ff., 88. 4 Die z.Zt. umfangreichste Darstellung der milesischen Kolonien gibt N. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983. Vgl. auch ders., Probleme der griechischen Kolonisation am Beispiel der milesischen Gründungen, Eos 73, 1985, 81ff. und 1987, sowie C.M. Danov, Pontos Euxeinos, RE Suppl. 9, 1962, Sp. 866 - 1175; ders., Altthrakien, 1976, 175ff. Ausführliche Zusammenfassung mit den neuesten Ergebnissen archäologischer Forschungen bei G. Tsetskhladze, F. De Angelis, (Hrsg.), The Archaeology of Greek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, 1995, bes. 118ff. Zu den Problemen der Chronologie vgl. N. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 44ff.; 1985, 87ff.; A.J Graham, Pre-Colonial Contacts: Questions and Problems, in: J.-P. Descoeudres (Hrsg.), Greek Colonists and Native Polpulations, 1990, 52ff.
88 Reinhard Senff
Abb. 1: Karte des Mittelmeeres mit den wichtigsten genannten Orten
Außer Milet haben nur wenige andere griechische Städte Kolonisten in das Pontosgebiet gesandt und so ist der milesische Kultureinfluß bei der Urbanisierung und dem "Kultur-transfer" in diese Gebiete sehr hoch zu veranschlagen.5 Wichtig für das Thema dieses Kolloquiums ist die Tatsache, daß die Koloniegründung immer von florierenden Städten aus erfolgte und für das Bewußtsein der antiken Zeitgenossen ein lang andauerndes Zusammengehörigkeitsgefühl von Kolonie und Mutterstadt begründete.6 Die griechische Kolonisation ist zweifellos ein frühes Produkt der Stadtkultur. Die über-seeischen Niederlassungen wurden mit unterschiedlichen Zielsetzungen angelegt. Während die phönizischen Gründungen in der Regel nur kleine Handelsniederlassungen waren, die sich nur selten, wie im Fall von Karthago, zu urbanen Zentren entwickelten, legten die Griechen Städte an, die sowohl dem Handel als auch der Versorgung einer expandierenden Bevölkerung mit Ackerland dienten.7 Die griechischen Kolonien waren von Anfang an rechtlich und politisch von der Mutterstadt unabhängige, selbständige Poleis und keineswegs nur angelegt, um Rohstoffe zu gewinnen und zur Mutterstadt zu transportieren und von dorther Fertigprodukte zu beziehen.8 Das ist höchstens anfänglich der Fall, bis in den Neu-gründungen eine eigene Infrastruktur aufgebaut ist. Die in den Inschriften der milesischen Kolonien genannten Titel der städtischen Beamten wie Epistaten, Aisymneten oder der Priester finden sich auch auf Inschriften in der Mutterstadt und lassen eine genaue Über-
5 Nur Heraklea Pontica wurde von Megarern und Boeotern, Phanagorea von Teos aus gegründet. 6 So bezeichneten sich noch zu Herodots Zeiten die Einwohner von Berezan als aus Milet stammend, Herodot 4, 78. Am deutlichsten kommt dies in den Isopolitieverträgen zwischen den Kolonien und der Mutterstadt zum Ausdruck, vgl. Ehrhardt, N., Milet und seine Kolonien, 1983, 227. 7 Zu den verschiedenen Gründen, besonders im Falle von Milet, vgl. N. Ehrhardt, Probleme der griechischen Kolonisation am Beispiel der milesischen Gründungen, Eos 73, 1985, 81ff., hier 89ff.; G. Kochelenko, V. Kouznetsov, La colonisation grecque du Bosphore cimmérien, in: O. Lordkipanidze, P. Leveque, (Hrsg.), Le Pont-Euxin vu par les Grecs, 1990, 67ff; Tsetskhladze 1994, 123ff. Zu der unterschiedlichen Bezeichnung von Gründungen als Emporion oder Polis s. Ehrhardt, N., Milet und seine Kolonien, 1983, 69 f. 8 Zu den rechtlichen Fragen vgl. Werner, Probleme der Rechtsbeziehungen zwischen Metropolis und Apoikie, Chiron 1, 1971, 19ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 89 tragung der politischen und religiösen Strukturen mit den dazugehörigen Ämtern und der gesellschaftlichen Rangordnung in die Kolonien erkennen. Jede der Apoikien stellt nach unseren bisherigen Kenntnissen von Anfang an eine autonome Polis mit allen dazugehörigen Einrichtungen dar, sozusagen ein verkleinertes Abbild der Mutterstadt.9 Da sich in einigen Städten sogar Amtstitel aus der Frühzeit der milesischen Verfassung von der Mitte des 7. Jhs.v.Chr. erhalten haben, die sich später in Milet änderten, kann man davon ausgehen, daß schon in dieser frühen Zeit die entsprechenden politischen Institutionen in den Kolonien existierten.10 Dies ist ein gewichtiges Argument dafür, daß schon in der Gründungsphase nicht nur Handelsinteressen im Vordergrund standen, sondern die Suche nach neuen Siedlungs- und Ackergebieten für eine autonome Bürgerschaft ein ebenso wichtiger Grund für die Kolonisation gewesen ist. Wir haben zwar keine Nachrichten von einer Über-bevölkerung mit Hungersnöten u.ä. in der Mutterstadt, wie es als Anlaß für die Aus-wanderung in anderen Poleis überliefert ist, doch zeigt ein Blick auf die Karte der milesischen Halbinsel, wie eingeschränkt das landwirtschaftlich nutzbare Land war - und wie verlockend die Nachrichten von den riesigen fruchtbaren Flächen und fischreichen Strömen in Thrakien und Skythien auf die Ostgriechen wirken mußten. Im Mutterland befand man sich dazu noch in ständiger Rivalität mit den umliegenden Poleis und Königreichen und auch innere politische Spannungen in Milet könnten zur Auswanderung eines Teils der Be-völkerung beigetragen haben.11 Die schriftlichen Zeugnisse zeigen, daß die Vorbildfunktion der Mutterstadt viele Bereiche umfaßte. Neben den Beamten- und Priestertiteln finden sich Hinweise auf Übereinstim-mungen in der Einteilung der Bevölkerung nach der heimischen Phylenordnung, in den Kulten und in dem die Feste in ihrem Ablauf regelnden Kalender mit seinen Monatsnamen, im Alphabet und den sprachlichen Dialektformen. In den Inschriften tauchen Eigenamen auf, die als Bestandteil den Namen einer in Milet besonders verehrten Gottheit wie Apollo oder Hekate besitzen oder auf eine gesellschaftliche Gruppe wie das einflußreiche, adlige Priester-kollegium der Molpoi verweisen.12 Wenn die Kolonien sich in ihren politischen und religiö-sen Einrichtungen also nach der Mutterstadt richten, stellt sich natürlich für den Archäologen die Frage, ob dies auch in den Relikten der materiellen Kultur erkennbar ist. Inzwischen steht aus Ausgrabungen eine große Anzahl von Denkmälern der verschiedensten Gattungen zur Verfügung, die möglicherweise eine Antwort auf diese Frage geben können. Für die Stadtkulturgeschichte sind dabei nicht nur Untersuchungen zur Architektur und Urbanistik von Belang, sondern auch Objekte wie Scherben oder Skulpturen geben wichtige Hinweise. Die spontan auftauchende Frage ist natürlich, wie es sich mit dem Gesamtplan der Stadt und einzelnen Häusern oder öffentlichen Gebäuden verhält. Die Ausgrabungen der letzten fünf Jahre im archaischen Wohnviertel am Kalabaktepe in Milet haben gezeigt, daß wir es hier in der zur Diskussion stehenden Epoche häufig mit Komplexen zu tun haben, bei denen auf einer Fläche von ca. 100 m2 mehrere Räume um einen zentralen Hof angeordnet sind (Abb. 2).13
9 Dies ist hier etwas vereinfacht ausgedrückt, zu den unterschiedlichen lokalen Ausprägungen vgl. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 98ff.; 192ff. 10 Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 200ff. 11 G. Kochelenko, V. Kouznetsov, La colonisation grecque du Bosphore cimmérien, in: O. Lordkipanidze, P. Le-veque, (Hrsg.), Le Pont-Euxin vu par les Grecs, 1990, 67ff, 80ff. Vgl. o. Anm.7. 12 Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 98ff.; 127ff. 13 V. v.Graeve, Der Schnitt auf dem Gipfelplateau des Kalabaktepe 1988, in: V. v. Graeve, Milet 1989, IstMitt.40, 1990, 39ff, R. Senff, Die Grabung am Kalabaktepe, in: v.Graeve, V. Milet 1992-1993, AA 1995,
90 Reinhard Senff
Abb. 2: Milet, archaisches Wohnviertel am Kalabaktepe, Steinplan Die aufgehenden Wände waren zum größten Teil aus Lehm und standen auf einem 20-40 cm hohen Steinsockel. Wie gleichzeitige Beispiele aus anderen Orten des griechischen Ostens, etwa aus Alt-Smyrna zeigen, waren Bauweise und Organisationsform nicht auf Milet beschränkt.14 Die dichte Bebauung wurde in Milet spätestens seit dem 3. Viertel des 7. Jhs. v.Chr. durch eine ca. 4 m dicke Stadtmauer mit polygonaler Außenschale aus Gneisblöcken geschützt. Ein übergeordnetes planerisches Schema ist nicht zu erkennen, vielmehr richten sich die Gebäude nach den Geländelinien und umgeben daher radial den Kalabaktepe. Lediglich archaische Häuser und Straßen in der Ebene, nahe dem späteren Bouleuterion scheinen bereits in dieser Zeit nach einem ”vorhippodamischen” regelmäßigen Plan angelegt worden zu sein.15 In den Siedlungen am Schwarzen Meer begegnet man erst in der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v.Chr., also über drei Generationen später soliden Häusern, deren Lehmwände auf Stein-sockeln stehen.16 Die Behausungen der früheren Zeit sind einheitlich bescheidene Einraum-
208ff. Zusammenstellung der bisher bekannten archaischen Siedlungsreste in Milet bei W. Müller-Wiener, Be-merkungen zur Topographie des archaischen Milet, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 95ff. und F. Lang, Archaische Siedlungen in Griechenland, Struktur und Entwicklung, 1996, 198ff. 14 E. Akurgal, Alt - Smyrna 1, Wohnschichten und Athenatempel, 1983, 35ff.; F. Lang, Archaische Siedlungen in Griechenland, Struktur und Entwicklung, 1996, 238ff. Vgl. auch Beispiele aus dem angrenzenden lydischen Raum, A. Ramage, Lydian Houses and Architectural Terracottas, Archaeological Exploration of Sardis, Mono-graph 5, 1978, 4ff. 15 W. Müller-Wiener, Bemerkungen zur Topographie des archaischen Milet, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 95ff., hier 102; F. Lang, Archaische Siedlungen in Griechenland, Struktur und Entwicklung, 1996, 205. 16 Z.B. in Olbia: J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarz-meerraum, 1995, 30; 64; oder Pantikapaion: V.D. Blavatskij, Pantikapeji, 1964, 18 Abb. 5; V.P. Tolstikov,
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 91
Abb. 3b: Olbia, Zentrum der archaischen Siedlung, Rekonstruktion
Abb. 3a: Olbia, Zentrum der archaischen Siedlung, Plan
Archäologische Forschungen im Zentrum von Pantikapaion und einige Probleme der Stadtplanung vom 6. bis zum 3. Jh. v.Chr., in: W. Schuller, W. Hoepfner, E.L. Schwandner, Demokratie und Architektur, Wohnen in der klassischen Polis 2, 1989, 69ff., 73.
92 Reinhard Senff hütten mit rundem oder rechteckigem Grundriß, die ganz oder zum Teil in den Boden ein-getieft sind.17 (Abb. 3a/b). Als Baumaterial dienten Holz oder lehmverputztes Flechtwerk und Schilf für die Dächer. Da alle Wohnhäuser dieser Epoche so gebaut sind, steht fest, daß es sich nicht um unter-schiedliche Wohnungen von Griechen und "Barbaren" handeln kann. Städte wie Berezan, Olbia oder Histria scheinen nicht nach einem übergeordneten Rastersystem angelegt worden zu sein. Die Gebäude orientieren sich lediglich oft an einer Hauptlängsstraße, ohne zu grös-seren Komplexen mit Mauern oder Zäunen zusammengeschlossen zu sein. Dafür existieren schon früh zwei wesentliche Kristallisationspunkte des griechischen städtischen Lebens, der Temenos mit Kultbau und Altar für den Hauptgott und die Agora. In Olbia sind zwei Bezirke ausgegraben worden, in denen Apollon verehrt wurde, der für die Seefahrt und Kolonisation Milets eine wichtige Rolle spielte. Der sog. westliche Temenos war ihm mit dem Beinamen Ietreus geweiht, am Rande der Agora im Zentrum der Stadt galt der Kult dem Apollon Delphinios.18 Hier haben sich Reste von Inschriften gefunden, die zeigen, daß der Temenos gleichzeitig als eine Art Staatsarchiv fungierte. Auch in Milet liegt der Bezirk dieses Gottes neben dem Nordmarkt beim Hafen.19 Das Delphinion war Ausgangspunkt der zum Tempel des Apollon in Didyma führenden Prozessionen und diente wie in Olbia als Inschriftenarchiv. Bezeichnenderweise haben sich hier bei den Ausgrabungen Isopolitieverträge mit einigen der Apoikien gefunden; diese Dokumente stammen sogar aus dem ausgehenden 4. Jh.v.Chr., sind also fast 200 Jahre nach Gründung der Städte abgefaßt, die sich bei ihren Anträgen auf Milet als ihre Mutterstadt berufen.20 Hier stieß man auch auf eine Weihung an Hekate, eine Göttin, die außer in Milet und seiner unmittelbaren Umgebung in archaischer Zeit hauptsächlich in den milesischen Kolonien verehrt wurde. In Histria steht der Tempel der Aphrodite, einer auch für Milet wichtigen Göttin, und daneben der des Zeus Polieus im Zentrum der Stadt.21 Die bei den bei Ausgrabungen gefundenen Pfostenlöcher geben einen Hinweis darauf, daß den steinernen Kultbauten aus der Mitte des 6. Jhs.v.Chr. bescheidene Vorläufer aus Holz vorangingen. Immerhin waren diese Holzgebäude aber schon mit aufwendigen Tondächern 17 Diese Gebäudetypen bestimmen das Bild aller Schwarzmeerstädte bis zur zweiten Hälfte des 6. Jhs.v.Chr. vgl. zu Histria M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff. , 53, A.S. Dimitriu, Cartierul de locuinte din zona de vest a cetatii în epoca arhaica, Histria 2, 1966, 21ff. ; 1982, 312ff.; zu Berezan und Olbia vgl. J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 28ff; 64 Abb. 8-10. Auch auf der Krim gehen die Grubenhäuser den stabileren Gebäuden mit Steinsockeln im 6. Jh. voran, vgl. zu Pantikapaion: Tolsti-kov 1989 72ff; 79, Vinogradov 1980; zu Nymphaion Khudiak 1952, 235ff. Einen zusammenfassenden Über-blick gibt Kryzickij 1982. An der östlichen Schwarzmeerküste (Kolchis) lassen sich bisher für die archaische Zeit und das frühe 5. Jh. keine sicheren Aussagen über das Aussehen griechischer Siedlungen machen. Die aus dieser Zeit bekannten Häuser, am besten erforscht in Simagre, sind von Einheimischen bewohnte Bauten aus Holz und Flechtwerk, vgl. Lordkipanidze 1991, 114ff. Unklar infolge mangelnder Ausgrabungsergebnisse ist auch die Situation in der Propontis in diesem Zeitabschnitt, vgl. Loukopoulou 1989, 161. 18 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 27ff. Zur Rolle des Apollon Delphinios in der Kolonisation vgl. Ehrhard 1983, 145ff.; J.G. Vinogradov, Der Pontos Euxeinos als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Rapports et commu-nications. 9e Congrès international d'épigraphie grecque et latine. (Trinovi 1987), 1986, 9ff., 24ff. Zu Olbia vgl. außerdem E. Belin de Ballu, Olbia, 1972, 17ff.; A. Wasowicz, Olbia Pontique et son territoire, 1975, 41ff. und J.G. Vinogradov, Olbia, Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer, Xenia, Konstanzer Alt-historische Vorträge und Forschungen, hrsg. von W. Schuller 1981, 1. 19 G. Kawerau, A. Rehm, Das Delphinion, Milet 3, 1914; G. Kleiner, Die Ruinen von Milet, 1968, 33ff. 20 Zu den milesischen Isopolitieverträgen vgl. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 235ff. 21 M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 52.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 93 versehen. Wie bei der Hausarchitektur ist also bei den öffentlichen Gebäuden eine Ver-zögerung in der ”Monumentalisierung” um zwei bis drei Generationen nach der Gründung festzustellen. Die Agora in Olbia ist zunächst wie in anderen archaischen griechischen Städten nur ein freier Platz, der vielen Zwecken dienen kann, bei denen es auf die Versammlung einer größeren Menge von Menschen ankommt.22 Erst viel später werden hier Gebäude der Selbstverwaltung errichtet, erhält der Platz durch den Bau einer Säulenhalle und einer Reihe von Lager- oder Verkaufsräumen eine architektonische Fassung. Einen deutlichen Unterschied im Erscheinungsbild der archaischen Schwarzmeerkolonien zu den mittelmeerischen Griechenstädten muß neben der einfachen Hausform auch das weit-gehende Fehlen stattlicher Verteidigungsanlagen ausgemacht haben. Während die Orte an der Westküste des Pontos im zweiten Viertel des 6. Jhs.v.Chr., also zwei Generationen nach ihrer Gründung die ersten Befestigungen erhielten, sind sie in der nördlichen Region erst am Ende des Jahrhunderts angelegt worden, in Kolchis sogar noch wesentlich später.23 Anfangs be-rücksichtigte man lediglich eine besonders günstige strategische Position mit natürlichem Schutz, wie im Falle der ältesten Siedlung Berezan auf einer Halbinsel in der Mündung des Bug.24 Offenbar war das Zusammenleben mit der umwohnenden Bevölkerung auf friedliche Weise durch Verträge oder Tribute zunächst soweit geregelt, daß man auf eine aufwendige Verteidigungsanlage in archaischer Zeit verzichten konnte.25 Stärkere Befestigungen sind erst im 5. Jh.v.Chr. nachzuweisen, als nach dem mißglückten Feldzug des Dareios gegen die Skythen die Steppenvölker ihrerseits nach Süden ziehen und das griechische Siedlungsgebiet verheeren. In der Chora von Olbia ist im Zusammenhang damit die Aufgabe der meisten ländlichen Siedlungen im ersten Drittel des 5. Jhs.v.Chr. festzustellen.26 Zunehmender Druck von Seiten der Skythen scheint die Landbevölkerung in die Stadt gedrängt haben, die nun stark mit Mauern und Türmen befestigt wird.27 Im Laufe des 5. und 4. Jhs.v.Chr. nähern sich
22 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 27ff. S. D. Kryzickij, Antike Stadtstaaten im nördlichen Schwarzmeergebiet, in: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hrsg.), Gold der Steppe, Archäologie der Ukraine, 1991, 189ff.; 198; vgl. z.B. die Agorai von Athen: J. Camp, The Athenian Agora, 1986, 35ff oder Megara Hyblaea: G. Vallet, F. Villard, P. Auberson, Megara Hyblaea 1, Le Quartier de l`Agora Archaique, 1976, 387ff. Übersichtlich zusammengefaßt bei F. Lang, Archa-ische Siedlungen in Griechenland, Struktur und Entwicklung, 1996, 63ff. (Agorai); 68ff. (Tempel). 23 M. Coja, P. Dupont, Histria 5, Ateliers céramiques, 1979; A. Wasowicz, Le système de défense des citès grecques sur les côtes septentrionales de la mer noire, in: Leriche, P.; Tréziny, H. (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 79ff.; V.P. Tolstikov, L'apport de la fortification a l`histoire du Bosphore antique, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 167ff.; O. Lordkipanidze, The Fortifications of Ancient Colchis, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 179ff. 24 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 62ff. 25 A. Avram, Das histrianische Territorium in griechisch - römischer Zeit, in: P. Alexandrescu, W. Schul-ler(Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990, 9ff., 66ff; M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff. , 50 und Anm. 24 mit weiterer Literatur. 26 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 130 f. Auch Histria scheint in diesem Zusammenhang erstmals zerstört worden zu sein, vgl. M. Coja, Les fortifications grecques dans les colonies de la côte ouest du Pont Euxin, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 95ff., 98 f.; M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 66ff. 27 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 33ff. Mit den kriegerischen Auseinandersetzungen könnten die Bestattungen von durch Pfeile Getöteter stehen,
94 Reinhard Senff die Städte dann in ihrem äußeren Erscheinungsbild immer mehr den mutterländischen Griechenstädten an, sei es durch ihre schon von weitem das Weichbild bestimmenden Ver-teidigungsanlagen, sei es durch den aufwendigen Ausbau von öffentlichen Gebäuden wie Hallen und Tempeln.28 Ansätze dafür lassen sich aber anscheinend schon bis ins 6. Jh.v.Chr. zurückverfolgen. Von der Ablösung der Grubenhäuser durch Rechteckbauten mit Steinsockel war schon die Rede; allerdings weicht die Technik der recht grob gefügten Steinsetzungen in den Schwarzmeerstädten stark von der Sorgfalt bei den angeführten ionischen Beispielen ab. Zusätzlich läßt sich am Ende des ausgehenden 6. Jhs.v.Chr. z.B. in Berezan oder Pantika-paion eine Neuordnung der Wohnbebauung mit einem geordneten Straßenraster feststellen. Bei neuen Städten des 5. Jhs.v.Chr., wie dem 421 v.Chr. gegründeten Chersonnesos ist dann sowohl ein regelmäßiges Raster der Innenstadt als auch eine im Zusammenhang damit erfolgte Parzellierung des umliegenden Ackerlandes festzustellen.29 Daß hier allerdings das nach der Perserzerstörung in ”hippodamischer Weise” neu erbaute Milet das Vorbild war, läßt sich nicht behaupten, denn die neuen urbanistischen Errungenschaften sind schnell zu überall gültigen Standards geworden.30 Auch die Neugründung Prienes oder die Anlage des Piräus richten sich danach und in diesem Zeitraum ist es Athen, das durch die Erweiterung seines Seebundes militärisch und kulturell im Schwarzmeergebiet bestimmend wird.31 Der kurze Blick auf die bauliche Erscheinung der milesischen Kolonien zeigt, daß wir bisher nur hinsichtlich der öffentlichen Bauten mit sakralen Funktionen oder übergreifender Bedeutung für die politische Identität der Bürger deutliche Einflüsse griechischer Traditionen finden. Da wir bisher über die öffentlichen Bauten Milets in archaischer Zeit nur sehr wenig wissen, lassen sich hier nur allgemein mittelmeerisch - griechische Vorbilder, in einigen Fällen wenigstens etwas präziser Bauformen aus Ionien anführen. Immerhin bezeugen ein-zelne Bauglieder und Skulpturenfragmente, daß Heiligtümer in den Kolonien schon im 6. Jh.
vgl. M.J. Treister, Y.G. Vinogradov, Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea, AJA 97, 1993, 521ff., hier 539 f. 28 Zum Ausbau Olbias in dieser Zeit vgl. J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nord-westlichen Schwarzmeerraum, 1995, 34ff.; Kryzickij 1990, 190ff. Von einem Tempel des frühen 5. Jh. stammt ein ionisches Kapitell in Hermonassa: M.J. Treister, Y.G. Vinogradov, Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea, AJA 97, 1993, 521ff., hier 558 f. Abb. 26. Auch in Olbia wird der Temenos des Apollon Delphinios im 5. Jh. mit einem Tempel der ionischen Ordnung ausgestattet: J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 36 f. Abb. 17. 29 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 64; V.P. Tolstikov, Archäologische Forschungen im Zentrum von Pantikapaion und einige Probleme der Stadtplanung vom 6. bis zum 3. Jh.v.Chr., in: W. Schuller, W. Hoepfner, E.L. Schwandner, Demokratie und Architektur, Wohnen in der klassischen Polis 2, 1989, 73ff., 79. Eine Übersicht über die Einteilung des Agrarterritoriums verschiedener pontischer Städte in der Antike mit der älteren Literatur gibt F. Favory, Propositions pour une modélisation des cadastres ruraux antiques, in: M. Clavel - Lévêque (Hrsg.), Cadastres et espace rural, 1983, 102ff. Eine plastische Vorstellung vom Aussehen des hellenistischen Pantikapaion vermittelt die Rekonstruktionszeichnung von V.P. Tolstikov, Archäologische Forschungen im Zentrum von Pantikapaion und einige Probleme der Stadtplanung vom 6. bis zum 3. Jh.v.Chr., in: W. Schuller, W. Hoepfner, E.L. Schwandner, Demokratie und Architektur, Wohnen in der klassischen Polis 2, 1989, 69ff., 79 Abb.10. 30 W. Hoepfner, E.L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Neubearbeitung, Wohnen in der klassischen Polis, Band 1, 1994, 11ff. Vgl. auch Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983 Anm. 76 zu Teil III mit weiterer Diskussion dieser Frage. In Kolchis und dem angrenzenden Iberien entstehen Städte mit eindeutig griechischen Bauformen und Architekturteilen (Quader, Säulen, Kapitelle usw.) erst seit dem 4. Jh.v.Chr. vgl. O. Lordkipanidze, Archäologie in Georgien, 1991, 148ff. 31 Zu Priene und dem Piräus vgl. Höpfner; Schwandner 1994, 22ff.; 188ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 95 v.Chr. hinsichtlich ihrer Ausstattung keineswegs hinter den ionischen Vorbildern zurück-standen.32 Im privaten Hausbau scheint man sich bis in die zweite Hälfte des 6. Jhs.v.Chr. den lokalen Gegebenheiten angepaßt und ältere einheimische Bautraditionen fortgesetzt zu haben. So könnte ein Mangel an lokalem Steinmaterial gegenüber der leichteren Verfügbarkeit von Holz in vielen Fällen ein Grund für die einfachen Hüttenunterkünfte gewesen sein.33 Stein-bauten setzen ja Steinbrüche, Transportwege, ausgebildete Werkleute und einen konstanten, lohnenden Absatz voraus, was sich in diesen Siedlungen erst sehr langsam herausgebildet haben wird. Eine eigenständige technischen Entwicklung der nördlichen Schwarzmeerregion ist die als "olbianisch" bezeichnete Fundamentierung größerer Bauten.34 Bei dieser Bauweise, die ebenfalls ohne große Steinmengen auskam und gleichzeitig der Isolierung gegen Bodenfeuchtigkeit diente, wechseln Lagen von Lehm und stark aschehaltiger Erde. Die Gründung von aufgehendem Mauerwerk auf Schichten von Sand und Asche ist zwar schon aus archaischer Zeit bekannt und zu diesem Verfahren gibt es auch Parallelen aus dem ostgriechischen Raum,35 in ihrer spezifischen Ausprägung läßt sich diese Technik aber erst seit dem späten 4. Jh.v.Chr. und nur in einigen Schwarzmeerstädten wie Histria, Olbia und deren Chora nachweisen. Wenn auch die Ausformung der Bauten und der städtischen Strukturen in archaischer Zeit bescheiden ist, so bleibt doch festzuhalten, daß alle ent-scheidenden, in den nachfolgenden Jahrhunderten in stärkerem Maße ausgeprägten Charak-teristika griechischer Städte in dieser "Gründerzeit" bereits vorgegeben sind. Bisher war nur von übergeordneten Fragen der Urbanistik die Rede, doch gibt es eine ganze Reihe von Denkmälergattungen, innerhalb derer sich die kulturellen Verflechtungen genauer untersuchen lassen. Um bei der Architektur zu bleiben, kann man z.B. in einzelnen Schmuck-formen, die ja konkrete Vorbilder voraussetzen, durchaus eine deutliche Leitfunktion von Erfindungen der Mutterstadt erkennen. Besonders deutlich wird dies an Tondächern, da zu ihrer Herstellung neben der Erfahrung und handwerklichen Tradition auch aufwendige Produktionsanlagen wie große Töpferöfen gehörten. In Histria, Olbia und Tyras sind Detailformen von reliefgeschmückten Verkleidungsplatten, die zu den archaischen Tempeln 32 Vgl. z.B. den Zentralakroter des Apollon-Ietreus-Tempels von Olbia, J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 31 Abb. 31, oder eine marmorne Altar-volute aus Pantikapaion, V.D. Blavatskij, Pantikapeji, 1964, 31 Abb. 8. Dazu einen Volutenakroter aus Milet, W. Königs, Reste archaischer Architektur in Milet, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 116 f. Nr. 2 Taf. 11,4: "Eine milesische Bauform ist sicher ... die Altarvolute, die sich aus dem hori-zontalen Band nach oben aufrollt, ohne sich von der Platte zu lösen." Zur Rekonstruktion vgl. den Poseidonaltar von Kap Monodendri bei Milet, A. v.Gerkan, Der Poseidonaltar bei Kap Monodendri, Milet 1, 1915, 4. Das gleiche geht auch aus einzelnen Ausstattungsstücken hervor, vgl. z.B. eine Kalksteinschüssel aus Histria, M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 67 Abb. 8. Zu den Dachterrakotten von Histria vgl. unten Anm. 36. 33 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, VIII, M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 53. Hinweise auf Holz als wichtigsten einheimischen Baustoff gibt es von Thrakien bis in das skythische Siedlungsgebiet, vgl. den Namen einer einheimischen Stadt, die griechische Siedler aus Ainas vorfanden und mit ”Bretterstadt” überlieferten, C.M. Danov, Zur Geschichte der griechischen Kolonien an der ägäischen und propontischen Küste Altthrakiens. - Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von H. Vetters, 1985, 52ff., 53, und die von Herodot 4, 122 überlieferte Zerstörung der hölzernen Stadt der Budiner durch die Perser. 34 Dazu ausführlich A Wasowicz, Les ”fondations en terre” d’ Olbia et d’ Histria, ArcheologiaWarsz 20, 1969, 39ff. mit der älteren Literatur. 35 A. S. Dimitriu, Paläste und Hütten in der milesischen Kolonie Istros, in: D. Papenfuss, V.M. Strocka, (Hrsg.), Palast und Hütte, 1982, 309ff.
96 Reinhard Senff gehören, so gut mit denen von in Milet gefundenen Exemplaren vergleichbar, daß vielleicht ein direkter Import aus der Mutterstadt vorliegt.36 Fast noch wichtiger als die Versorgung von Bürgern mit neuer Siedlungsfläche waren die Kolonien als Handelsplätze, von denen aus die Ressourcen des Hinterlandes erschlossen werden konnten. Damit fügen sie sich in ein weiteres umfassendes Beziehungsfeld ein, in dessen Zentrum die Mutterstadt liegt, denn gerade Milet war im 7. Jh.v.Chr. eine der führen-den ostgriechischen Handelsstädte. Sein weit gespanntes Handelsnetz erstreckte sich über das gesamte östliche Mittelmeer, reichte vom Schwarzmeergebiet bis nach Naukratis im Nildeltal und hat auch in Italien und Südfrankreich deutliche Spuren hinterlassen (vgl. Abb. 1).37 Der Geograph Strabo bezeichnet Naukratis geradezu als eine Gründung der Milesier, die sie anlegten, nachdem sie schon vorher eine Siedlung, die sog. ”Milesiermauer” im Nildelta ge-gründet hatten.38 Durch Herodot ist bezeugt, daß Naukratis der einzige Ort in Ägypten war, an dem sich griechische Händler niederlassen durften und daß hier neben den Milesiern auch viele andere wichtige ostgriechische Städte vertreten waren.39 Allerdings scheint der Einfluß der Milesier hier bedeutend gewesen zu sein, da sie ihren Gott Apollon in einem eigenen großen Temenos verehrten, der auch ausgegraben worden ist; das zeigt auch die hier gefun-dene Keramik (Abb. 4a-c) und die Tatsache, daß der in Naukratis in Gebrauch befindliche Kalender der milesische war.40 Naukratis und die Stützpunkte an der syrischen Küste unter-scheiden sich allerdings von den Schwarzmeerkolonien darin, daß sie nur Emporia sind, Handelsniederlassungen ohne ein zugehöriges Agrarterritorium und ohne die Bürgerschaft, die Institutionen und Gebäude, die für griechische Poleis unerläßlich waren.Über Naukratis und die auf dem Wege dahin liegenden Handelsplätze der palästinensischen Küste und Zyperns erfolgte der Austausch Milets und der anderen ionischen Städte mit dem Orient und Ägypten; über diese Stützpunkte fanden viele Produkte aus diesen Regionen ihren Weg nach Griechenland.41 In dem seit der Mitte des 7. Jhs. v.Chr. im milesischen Vorort Oikous existie-
36 K. Zimmermann, Zu den Dachterrakotten griechischer Zeit aus Histria, in: Alexanrescu, P.; Schuller, W. (Hrsg.) Histria, Xenia 25, 1990, 155ff, 158; 161 Anm. 19 und 20. Zu Tyras vgl. M.J. Treister, Y.G. Vinogradov, Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea, AJA 97, 1993, 521ff., hier 533 f. 37 Zum Handel von Milet vgl. J. Röhlig, Der Handel von Milet, 1933; C. Roebuck, Ionian Trade and Colonization, 1959, 116ff, Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 230 f., 1985, 89ff., G. Tsetskhladze, F. De Angelis (Hrsg.), The Archaeology of Greek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, 1995, 124ff. Zu milesischen Funden in Naukratis vgl. H. Prinz, Funde aus Naukratis, Klio 7.Beih., 1906, bes. 15ff., E.R. Price, Pottery of Naucratis, JHS 44, 1924, bes. 180ff. Funde im griechischen Heiligtum von Gravisca in Etrurien lassen sich mit Milet verbinden, vgl. S. Boldrini, Le Ceramiche Ioniche, Gravisca 4, 1994 und hier Abb.6. Milesische Amphoren bilden z.B. in einem der archaischen Schiffswracks von Pointe Lequin bei Mas-salia/Marseille den größten Teil der Transportgefäße, vgl. F.G. Lo Porto, Le importazioni della Grecia dell’Est in Puglia, in: Vallet (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978, 220 f. Zur Verbreitung von ostgriechischer Keramik und Terrakotten im Westen vgl. die zahlreichen Beiträge in G. Vallet (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978. 38 Strabo 17, 801. 39 Herodot 2, 178. 40 Flinders Petrie, Naukratis 1, Third Memoir of the Egypt Exploration Fund, 1988, bes. 11ff., E.A. Gardner, Naukratis 2, Sixth Memoir of the Egypt Exploration Fund, 1888, 9ff. Taf. 4 gibt einen Eindruck von den Größenverhältnissen, vgl. J Boardman, Kolonien und Handel der Griechen. Vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr., 1981, 137ff. Zur Keramik s.o. Anm.38, zum Kalender Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 89 f. Das hier (Abb. 4 c) abgebildete Amphorenfragment in Alexandria dürften aller Wahrscheinlichkeit nach aus Naukratis stammen. 41 R.M. Cook, The Greeks in Ionia and the East, 1962; J Boardman, Kolonien und Handel der Griechen. Vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr., 1981, 41ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 97 renden Aphroditeheiligtum hat die Verzweigtheit der Kulturkontakte inzwischen in zahl-reichen Objekten aus dem vorderasiatischen und ägyptischen Kulturkreis deutliche Gestalt angenommen.42 An dieser Stelle kann der Frage, was die ostgriechische, speziell die südionische Kultur dem Orient und Ägypten verdankt, nicht weiter nachgegangen werden.43 Insgesamt läßt sich wie auch in anderen griechischen Zentren im 7. und 6. Jh.v.Chr. eine starke Beeinflussung durch die orientalischen Kulturen auf vielen Ebenen feststellen. Neben dem direkten Import von Artefakten, etwa in der Kleinkunst, stehen Nachahmungen in der Ikonographie und der Tech-nik, wie beispielsweise in der Verwendung von Matrizen bei der Herstellung von Terra-kotten. Die Einflüsse erstrecken sich aber auch auf Kultbräuche, wie das Tieropfer mit an-schließendem Festmahl der Gemeinde. Im Bereich der Architektur finden sich orientalische Vorbilder in vielen Bereichen, vom Befestigungsbau bis zu Dekorationsformen wie den vorderasiatischen Volutenkapitellen, die auf äolische oder ionische Bauformen eingewirkt haben.44 Aber auch die Ruhebetten für das Symposion, das uns heute als eine der wichtigsten Formen des griechischen Gesellschaftslebens erscheint und ihrerseits wieder die Dimen-sionen der dafür erforderlichen Räume im Hausbau bestimmten, gehören zu dem Kulturgut, das neben vielem anderen die Griechen von ihren östlichen Nachbarn übernahmen.45 Die Mutterstadt wird in dieser Hinsicht zur Schaltstelle für kulturelle Errungenschaften, die hier umgewandelt und weitergegeben werden. Die Möbelindustrie von Milet scheint gerade für ihre Klinen besonders berühmt gewesen zu sein, da sie sogar in den erhaltenen Versteiger-ungslisten des Hausrates von Alkibiades und seinen Anhängern in Athen gesondert auf-geführt sind.46 Solche Ruhebetten werden von Xenophon als Teil des Strandgutes erwähnt, das nach Schiff-brüchen nahe der thrakischen Stadt Salmydessos angeschwemmt wurde.47 Es ist zwar nicht überliefert, daß diese Klinen aus Milet stammen, die Nachricht verdeutlicht aber exem-plarisch, daß man auch in den Pontosstädten auf eine gehobene Lebensweise nach mutter-ländischem Vorbild Wert legte. Es ging sicher nicht mehr nur um die rein praktische Funktion, da man in der holzreichen Schwarzmeerregion einfache Möbel bestimmt billiger herstellen und den Transport hätte sparen können. Die in dieser Region gefundene importierte Trinkkeramik, die z.T. sogar aus dem 7. Jh.v.Chr. stammt, läßt auf die Beibehaltung der gewohnten Lebensweise schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt schließen.
42 Von den Funden ist bisher nur wenig publiziert, vgl. M Heinz, R. Senff, Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: V. v.Graeve, Milet 1992 - 1993, AA 1995, 220ff.; Hiller, H., Ionische Grabreliefs aus der ersten Hälfte des 5.Jh.v.Chr. 12. Beih. IstMitt, 1975, 223 f. In ähnlicher Weise reflektieren die Funde im Heraion von Samos die vielfältigen Verbindungen mit dem Orient, so z.B. die Bronzen, s. Jantzen 1972. Zu "exotischen" Funden in den Schwarzmeerstädten vgl. M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 61 f.; E. Belin de Ballu, Olbia, 1972, Taf. 44 f. 43 Vgl. dazu T.J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern Neighbours, 1957, bes. 55ff.; T.F.R.G. Braun, The Greeks in Egypt, CAH 3,3, 2. Aufl. 1982; M. Alexandrescu Vianu, M., Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 59ff.; 1982. 44 H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit, Archaologia Homerica 2, 1969, 101; A.M. Snodgrass, The Historical Significance of Fortifications in Archaic Greece, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 125ff.; Ph. Betancourt, The Aeolic Style in Greek Archi-tecture, 1977. 45 B. Fehr, Orientalische und griechische Gelage, 1971; J.M. Dentzer, La représentation du banquet couché, 1982. 46 W.K. Pritchett, The Attic Stelai, Part 2, Hesperia 1956, 211; 226ff. J. Röhlig, Der Handel von Milet, 1933, 43. 47 Xen. Anabasis 7, 5, 12.
98 Reinhard Senff
Abb. 4a: Tierfrieskeramik aus Histria, Ende 7. Jh.v.Chr.
Abb. 4b: Tierfrieskeramik in Alexandria, Ende 7.Jh.v.Chr.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 99
Abb. 4c: Tierfrieskeramik aus Milet, Ende 7.Jh.v.Chr. aus Milet
100 Reinhard Senff Handelskontakte vor der Gründung dauerhafter griechischer Siedlungen sind im süd-russischen Hinterland bereits im 7. Jh.v.Chr. bezeugt.48 Die im Laufe des 6. und 5. Jhs.v.Chr. deutlich zunehmden griechischen, speziell ostgriechischen Importe in skythischen Siedlungs-zentren wie Bel’sk zeigen deutlich die starke Nachfrage nach griechischen Produkten wie Wein oder Erzeugnissen des Kunsthandwerks.49 Daß die Ausweitung des Handelsnetzes einer der wichtigsten Gründe für die Milesier gewesen ist, sich in der Propontis und später im Schwarzmeergebiet anzusiedeln, geht schon daraus hervor, daß alle Niederlassungen am Meer liegen, einen günstigen Hafen besitzen und mit dem Landesinnern durch Wasserstraßen verbunden sind. An der thrakischen Küste ließen sich die Griechen stellenweise auf älteren Siedlungsplätzen nieder, von denen aus die Thraker sogar in beschränktem Maße Seefahrt betrieben hatten.50 Allerdings klafft offenbar zwischen der jüngsten einheimischen Siedlungs-phase und der griechischen Kolonisation eine Lücke, so daß die Griechen wie im skythischen Machtgebiet weiter im Norden keine konkurrierenden Agrar- oder Handelszentren an der Küste vorfanden.51 Besonders deutliche Relikte des Handels sind Münzen. Auf der einen Seite spielt ihr Material- und Tauschwert eine Rolle, die auf ihnen erhaltenen Bilder geben aber als eine Art von Hoheitsabzeichen auch Aufschlüsse über die Selbstauffassung der prägenden Städte. Die wichtige Vorbildfunktion von Milet kommt nicht nur darin zum Ausdruck, daß der mile-sische Münzfuß in den Apoikien übernommen wird, viele Münzen dieser Städte tragen genau wie die der Mutterstadt auf einer Seite den Löwenkopf, der sich mit dem gleichfalls in diesen Orten bezeugten Apollonkult verbinden läßt.52 Sogar Kolonien an der kolchischen Küste, die wir erst in Ansätzen kennen, zeigen in diesen Münzen ihre Zugehörigkeit zur ostgriechischen Kultur milesischer Prägung.53 Die Artefakte, die bei Ausgrabungen meist zu Tage kommen, sind allerdings nicht die gerade genannten Klinen, sondern meist Scherben, seltener Skulpturen aus Ton oder Stein und Metallgegenstände. Bei eingehender Betrachtung können diesen Gegenständen für unser Thema eine ganze Reihe von Aussagen abgewonnen werden. Dazu müssen allerdings be- 48 Zu diesen Funden und dem Problem der "präkolonialen" Kontakte vgl. T.S. Noonan, The Origin of the Greek Colony at Pantikopaeum, AJA 77, 1973, 77ff.; J. Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea area, 1990, 172ff.; G. Kochelenko, V. Kouznetsov, La colonisation grecque du Bosphore cimmérien, in: O. Lordkipanidze, P. Leveque, (Hrsg.), Le Pont-Euxin vu par les Grecs, 1990, 67ff; A.J Graham, Pre-Colonial Contacts: Questions and Problems, in: J.-P. Descoeudres (Hrsg.), Greek Colonists and Native Polpulations, 1990, 45ff.; Tsedzskladze 1995, 113ff. Ein sprechendes Zeugnis für den frühen Kontakt zwischen Schwarzmeerraum und Ionien ist der in Alt-Smyrna gefundene Kraterrand des mittleren 7. Jh.v.Chr. mit der Weihung des Istrokles, ein Männername, der von dem Fluß Istros abgeleitet ist, vgl. M. Alexandrescu Vianu, M., Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 293 Abb. 289; zur Ausstrahlung griechischer Artefakte ins nordpontische Hinterland in archaischer Zeit vgl. A. Wasowicz, Olbia Pontique et son territoire, 1975, 35ff. m. Abb. 10. 49 Zu Bel’sk vgl. R. Rolle; V.J. Murzin, B.A. Sramko, Das Burgwallsystem von Bel’sk (Ukraine). Hamburger Beiträge zur Archäologie 18, 1991, 57ff., hier 72. 50 So im Falle von Mesembria, das seinen thrakischen Namen behielt, vgl. V. Velkow, Mesambria Pontica, in: W. Schuller (Hrsg.), Die bulgarische Schwarzmeerküste im Altertum, Xenia 16, 1985, 29ff., 29 f. 51 A. Avram, Das histrianische Territorium in griechisch - römischer Zeit, 1990, 9ff., 18. 52 H.A. Cahn, Die Löwen des Apoll, MusHelv 7, 1950, 185ff., vgl. Erhardt 1983, 232. Zu den sog. Pfeilmünzen und den olbischen Münzen mit Delphindarstellungen, die ebenfalls mit Apollon in Zusammenhang stehen, vgl. zusammenfassend M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 59 f. 53 O. Lordkipanidze, Das alte Kolchis und seine Beziehungen zur griechischen Welt vom 6. zum 4. Jh.v.Chr. Xenia, Konstanzer Althistorische Vorträge und Forschungen , hrsg. von W. Schuller, 1985, 14, 40ff. bes. 42.; 1991 131ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes" 101 stimmte Bedingungen erfüllt sein, etwa die Möglichkeit, den Typus oder die Herkunft eines Gefäßes aufgrund des Dekors oder der Form zu bestimmen oder stilistische und ikono-graphische Einflüsse einer Skulptur ableiten zu können. Bei der dekorierten Keramik interessieren in der Gründungsphase der Kolonien während der zweiten Hälfte des 7. Jhs.v.Chr. zunächst Gefäße der sogenannten Tierfries - Gattung, deren Dekoration im Wesentlichen aus friesartig angeordneten äsenden Ziegen, Steinböcken, Hirschen und anderen Tieren besteht (vgl. Abb. 4a-c).54 Ein Dekorationsthema, das die ostgriechische Kunst in ihrer sogenannten orientalisierenden Epoche aus dem Vorderen Orient entlehnt und abgewandelt hat. Diese Tierfrieskeramik findet sich nun in Histria, Olbia, Berezan und zahlreichen anderen Schwarzmeerorten.55 Die quantitative Analyse der an diesen Orten gefundenen dekorierten Feinkeramik zeigt deutlich ein Überwiegen der ost-ionischen vor allen anderen griechischen Herstellungszentren.56 Demgegenüber würde eine ähnliche Analyse der Scherben etwa in dorischen Kolonien der Kyrenaika oder in Unter-italien/Sizilien eine ganz andere Zusammensetzung mit höheren Anteilen korinthischer oder lakonischer Keramik und auch absolut gesehen weniger Tierfrieskeramik ergeben. Das gleiche gilt für die dem Tierfries folgende Keramik des sog. Fikellurastils, für den Milet wahrscheinlich das wichtigste Herstellungszentrum war (Abb. 5a/b).57
Abb. 5a/b: Fikellurakeramik, Mitte 6. Jh.v.Chr. aus Milet und Berezan
54 Grundlegend dazu R.M. Cook, Greek Painted Pottery, 1972, 117ff.; H Walter, Frühe Samische Gefäße, Samos 5, 1968, 63ff.; E. Walter-Karydi, Samische Gefäße des 6. Jh.v.Chr., Samos 6,1, 1973 55 Zusammenfassend J. Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea area, 1990mit Nachweisen, vgl. bes. 29; 32ff.; ders. 1994. W. Voigtländer, Zur archaischen Keramik Milets, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 35ff. Zu Histria vgl. bes. P. Alexandrescu, La céramique d`epoque archaique et clas-sique, Histria 4, 1978, 19ff.; ders., Histria in archaischer Zeit, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990, 47ff, 53ff. 56 S. Anm. 55, sowie P. Dupont, Classification et détermination de provenance des céramiques grecques orien-tales archaiques d'Istros, Dacia 27, 1983, 19ff.; 1986. 57 J. Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea area, 1990, 36; grundlegend zur Fikellura-Keramik Cokk 1936; E. Walter-Karydi, Samische Gefäße des 6. Jh.v.Chr., Samos 6,1, 1973, vgl. auch die Anm. 55 genannte Literatur.
Reinhard Senff
102
Aber auch weniger hochwertig, nur mit umlaufenden Reifen dekorierte Gefäße und sogar Transportamphoren, die man aufgrund ihrer Formeigentümlichkeiten bestimmten Herstel-lungszentren zuweisen kann, bestätigen dieses Ergebnis.58 Die differenzierte Untersuchung aller Gattungen macht deutlich, daß aus Chios, Klazomenai und anderen ionischen Städten ebenfalls sehr viel Keramik vertreten ist, im Laufe des 6. Jhs. zunehmend auch aus Athen.59 Im Hinblick auf Produktion und Absatz von Tongefäßen zumindest läßt sich damit fest-stellen, daß wir es beim Handel zwischen den milesischen Kolonien und Ionien nicht mit einem monopolistischen Unternehmen zu tun haben, bei dem es nur um den Absatz mile-sischer Produkte ging.60 Allerdings sind zu wenig Einzelheiten über die konkreten Mechanis-men im Handelsverlauf bekannt, etwa, wem die Schiffe, die die Fracht beförderten, wirklich gehörten, oder wie eine Handelsfahrt ins Pontosgebiet genau verlief, welche Zwischen-stationen eine Rolle spielten usw.61 Bei einer Stadt wie Milet mit mehreren Häfen und einer schon im 7. Jh.v.Chr. bezeugten starken Flotte kann es kaum Zweifel daran geben, daß mile-sische Händler einen großen Anteil an diesen Geschäften hatten. Möglicherweise wurde die Seefahrt z.T. sogar von Angehörigen der adligen Oberschicht betrieben, die nach Plutarch offenbar Schiffe besaßen und wie in anderen Städten eine wichtige Rolle in der Kolonisation gespielt haben werden.62 Man darf natürlich die erhaltenen Reste nicht ohne weiteres mit den Handelsgütern gleich-setzen, die quantitativ von wirtschaftlicher Bedeutung waren, von denen aber aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Reste erhalten sind. So wurden Lebensmittel oder Rohstoffe auch in Säcken oder Holzbehältern transportiert, wir können aber lediglich Aussagen über diejenigen machen, die in Amphoren oder Pithoi aufbewahrt wurden, weil wir nur die Relikte dieser Transportgefäße bei den Ausgrabungen finden. Leider lagen den meisten antiken Autoren ökonomische Probleme sehr fern, so daß wir zu diesen Fragen bei ihnen kaum aufschluß-reiche Informationen finden. Es gibt aber Hinweise darauf, daß es beim Handel in erster Linie um Produkte wie Erze, Getreide, Teer, Honig, Fisch oder um Sklaven aus den pontischen Gebieten ging, die gegen Öl, Wein und spezielle Erzeugnisse milesischer Werkstätten, zu denen auch Möbel, Wollstoffe und Keramik gehörten, gehandelt wurden.63
58 P. Dupont, Amphores commerciales archaiques de là Grèce de l`Est, PP 37, 1982, 193ff., zu den ostgriechischen Transportamphoren, speziell zu den milesischen a.O. 203ff. Zu Histria vgl. Coja; Dupont 1979. 59 Hier ist einschränkend anzumerken, daß noch viele Unklarheiten bei der Bestimmung von einzelnen Herstel-lungszentren innerhalb der übergreifenden ostgriechischen Kunstlandschaft bestehen, der Anteil Milets in letzter Zeit gestützt auf neue Ausgrabungen und naturwissenschaftliche Analysen aber beträchtlich zugenommen hat: P. Dupont, Classification et détermination de provenance des céramiques grecques orientales archaiques d' Istros, Dacia 27, 1983, 19ff.; ders., Naturwissenschaftliche Bestimmung der archaischen Keramik Milets, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 57ff., bes. 64: "Alle Fikellura-Importe aus Istros und Naukratis erweisen sich nach ihrer chemischen Zusammensetzung als milesische Produkte". Vgl. M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 53, Anm. 48. 60 C. Roebuck, The organization of Naucratis, ClPhil 44, 1951, 212ff; 1959, 151; M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 54. 61 Vgl. zu diesen Fragen die kritischen Bemerkungen von A.J Graham, Pre-Colonial Contacts: Questions and Problems, in: J.-P. Descoeudres (Hrsg.), Greek Colonists and Native Polpulations, 1990, 45ff., hier 50. 62 Plutarch Quaest. Graec 32; vgl. dazu Pippidi 1971, 59ff.; A. S. Dimitriu, Paläste und Hütten in der milesischen Kolonie Istros, in: D. Papenfuss, V.M. Strocka, (Hrsg.), Palast und Hütte, 1982, 309. 63 Z.B. bei Polybios 4, 38.; Herodot 7, 147. Nachdem bei den Grabungen in Milet inzwischen zahlreiche Töpferöfen der archaischen Zeit gefunden worden sind, wird man die Keramikindustrie hier wohl doch als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor ansehen dürfen, vgl. W. Voigtländer, Zur archaischen Keramik Milets, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 35ff., hier 41ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
103
Wie die Amphoren ein Indiz für die damit transportierten Waren sind, so gibt die bemalte Keramik Hinweise auf komplexe Verhältnisse im kulturellen Kontext. Die Vielzahl der daraus zu gewinnenden Informationen läßt ihren Stellenwert über den für uns heute schwer abzuschätzenden antiken Marktwert hinausgehen.64 Zum größten Teil diente sie als Trink-keramik bei Festen oder geselligen Zusammenkünften, den Symposia, auf die auch ihre Bemalung gelegentlich eindeutig Bezug nimmt. Geht man nun von einem solchen Ge-brauchszusammenhang aus, so ist die Verbreitung der Keramik gleichzeitig ein Indiz für die Verbreitung einer Lebensform, in der diese Dinge eine Rolle spielten. Tatsächlich scheinen die Funde in griechischen Städten und hier in von Griechen bewohnten Regionen zu über-wiegen - vielleicht hatten diese Geräte und die Rituale, in denen sie gebraucht wurden, sogar eine besonders wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung der Gruppenidentität durch den griechischen Lebensstil innerhalb der barbarischen Umgebung.65 In den griechischen Her-kunftsorten läßt sich dazu auch der entsprechende architektonische Rahmen finden, in dem die Gegenstände genutzt wurden, sei es der private Andron oder der Bankettraum in einem Heiligtum. Im Falle der Schwarzmeerstädte ist darauf hingewiesen worden, daß, etwa in Histria, diese Keramik auch in Haushalten vorkommt, deren Überwiegen einheimischer, "barbarischer" Keramik eher auf nichtgriechische Besitzer schließen läßt. Im thrakischen oder skythischen Umfeld erfreute sich der Wein ja auch schon sehr früh einer großen Beliebtheit. Gefäße aus Edelmetall waren ein besonderes Privileg der aristokratischen Stammesober-schichten, wie die Funde von goldenen und silbernen Trinkgefäßen in den Kurganen zeigen.66 Griechische Tongefäße könnten ein luxuriöser, aber nicht ganz so aufwendiger Ersatz gewesen sein, aber man muß auch damit rechnen, daß skythische Trinkgefäße aus anderen Materialien, wie etwa Holz bestanden, überliefert ist z.B. auch die Verarbeitung der Schädel-knochen erschlagener Feinde zu Trinkschalen.67 Durch die gleichermaßen große Beliebtheit des Weines bei Griechen und Barbaren gab es genügend Anlässe zur Verbreitung von Transportgefäßen und dekorierter Trinkkeramik. Skulpturen aus Stein oder Ton sind dagegen bisher fast nur im Bereich der von Griechen benutzten Heiligtümer oder Versammlungsplätze zu Tage gekommen. Ihre Funktion blieb an bestimmte Bräuche oder Rituale gebunden, die von der Mutterstadt mitgebracht wurden, aber nicht an die einheimische Bevölkerung weitergegeben werden konnten. Wie stark die reli-giösen Vorstellungen hier getrennt blieben, verdeutlicht die Erzählung Herodots vom Schick-sal des Skythen Anarchasis, der von seinen Landsleuten getötet wurde, weil er wie ein Grie-che mit heiligen Figuren behängt das Fest der Göttermutter gefeiert hatte.68 Besonders gut mit 64 Zum Handelswert bemalter Keramik vgl. R.M. Cook, Die Bedeutung der bemalten Keramik für den grie-chischen Handel, JdI 74, 1959, 114ff, J. Boardman, Trade in Greek decorated Pottery, OJA 7,1, 1988, 27ff.und ders., The Trade Figures, OJA 7,3, 371ff., 1988, basierend auf attischem Material. 65 J. Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea area, 1990, 86ff. Der Fund eines importierten ostgriechischen Ton-kraters in einem archaischen Grubenhaus in Gorgippia zeigt, daß auch in dem bescheidenen architektonischen Rahmen wichtige gesellschaftliche Gepflogenheiten wie das Symposion ausgeübt wurden M.J. Treister, Y.G. Vinogradov, Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea, AJA 97, 1993, 521ff., hier 560 f. Abb. 28. 66 Sehr selten sind griechische Metallgeräte, die einen sehr großen Wert hatten, wie z.B. der Rest eines Voluten-kraters aus Martonosa erkennen läßt: E. Belin de Ballu, Olbia, 1972, 39 Taf. 68, vgl. Ausstellungskatalog, Gold der Skythen aus der Leningrader Eremitage, München 1984, 70 f. Die vereinzelten ostgriechischen Gefäße in Kolchis scheinen bisher auch alle aus einheimischen Siedlungen oder Begräbnissen zu stammen, vgl. O. Lord-kipanidze, Archäologie in Georgien, 1991, 129. 67 Herodot 4, 65 68 Herodot 4, 76. Zu archäologischen Zeugnissen aus dem 6. Jh.v.Chr. für den bei Herodot erwähnten Kult in Hylaia vgl. A.S. Rusjaeva, J.G. Vinogradov, Der "Brief des Priesters" aus Hylaia, in: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hrsg.), Gold der Steppe, Archäologie der Ukraine, 1991, 201ff..
Reinhard Senff
104
milesischer Plastik sind in verschiedenen Schwarzmeerorten, aber auch in Städten des westlichen Mittelmeers gefundene Terrakottafiguren zu vergleichen, die eine Frau in ehr-fürchtiger Haltung mit einem Vogel als Opfergabe zeigen (Abb. 6a-e). Dieser Votivtypus ist in spätarchaischer Zeit in Milet sowohl in großplastischer Form als Marmorstatue wie auch als billigeres Tonvotiv verbreitet.69 Die Tonfiguren sind gleichzeitig Parfümbehälter und wurden in mehreren Exemplaren in dem Heiligtum der Aphrodite von Oikous gefunden.70 Ebenfalls von dort stammen Darstellungen von sitzenden Frauen, die zum Teil einen Schleier oder einen hohen Polos tragen. Typologisch und stilistisch lassen sich auch mit ihnen Terrakotten aus Histria vergleichen, die gleichfalls in einem Temenos der Aphrodite ge-funden wurden.71 Zur Herstellung von Tonfiguren benutzte man Formen und da solche Modeln auch in den Schwarzmeerstädten ausgegraben worden sind, zeigt sich, daß man nicht nur Terrakotten importierte, sondern bald auch selbständig zu produzieren begann. In Nym-phaion auf der Krim konnte ein archaischer Töpferofen ausgegraben werden, der eine enge Parallele in einem auf dem Kalabaktepe in Milet entdeckten Ofen hat.72 Es verwundert nicht, daß in Nymphaion auch Formen für Tonfiguren gefunden wurden, die entweder aus Milet stammen oder milesische Vorbilder abformen, wie an einem Dickbauchdämon zu erkennen ist, der ebenfalls in mehreren Exemplare im Aphroditeheiligtum von Milet belegt ist.73 Die Darstellung ist möglicherweise von ägyptischen Ptah- oder Besfiguren angeregt und wäre dann ein weiterer Hinweis auf die Funktion der Mutterstadt als Schaltstelle in einem großen, überregionalen kulturellen Netzwerk. Auch in anderen Schwarzmeerkolonien sind inzwischen Töpferviertel ausgegraben worden, z.B. in Histria, die zeigen, daß man für die Deckung des täglichen Bedarfs mit Gebrauchs-keramik sich schon früh von der Mutterstadt unabhängig machte.74 Darüber hinaus versuchte
69 Die Marmorkore dieses Typus in Berlin, C. Blümel, Die archaischen griechischen Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin, 1963, Nr. 49 stammt aus Milet. 70 R. Senff, Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: V. v.Graeve, Milet 1991, IstMitt 42, 1992, 105ff, hier 107 Taf. 15, 1-2. Aus Kyzikos stammen die Exemplare Higgins 1954, 48 f. Nr. 57ff. Taf. 13, aus Histria ein Exemplar bei Alexandrescu Vianu 1990, 182 f. Abb. 53 f. Zu Olbia vgl. J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine alt-griechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, Abb. 108,1. Auch in Gravisca wurden zahlreiche Vertreter dieses Typus gefunden, vgl. S. Boldrini, Le Ceramiche Ioniche, Gravisca 4, 1994, 47ff. Nr. 23. Zu Exemplaren aus Tarent vgl. F.G. Lo Porto, Le importazioni della Grecia dell’Est in Puglia, in: Vallet (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978, 131ff.. Zu weiteren Beispielen aus dem westliche Mittelmeerbereich siehe die entsprechenden Beiträge in G. Vallet (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978. 71 Alexandrescu Vianu 1990, 183, Abb. 57 f.; R. Senff, Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: V. v. Graeve, Milet 1991, IstMitt 42, 1992, 105ff., hier 107, Taf. 15,3-4. Aus Tyritake auf der Krim: V. E. Gajdukevich, Das bosporanische Reich, 1971, 46 Abb. 5. Weitere Beispiele aus dem westliche Mittelmeerbereich (Tarent u.a.), siehe die entsprechenden Beiträge in G. Vallet (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978 72V. v.Graeve, Der Schnitt auf dem Gipfelplateau des Kalabaktepe 1988, in: V. v. Graeve, Milet 1989, IstMitt. 40 1990, 40 f. M.M. Khudiak, Raskopii Svjatiliza Nimfeja, SovA 16, 1952, 256ff. Abb. 18. Die einhenkeligen Gefäßständer, die in Nymphaion, Milet und an vielen anderen Orten gefunden wurden, sind in griechischen Siedlungen so weit verbreitet, daß man keinen ursprünglichen Herkunftsort namhaft machen kann, vgl. S.P. Morris, LASANA, A contribution to the Ancient Greek Kitchen, Hesperia 54, 1985, 393ff.; M.J. Treister, T.S. Shelov-Kovedyaev, An Inscribed Clay Object from Hermonassa, Hesperia 58, 1986, 289ff. 73 M.M. Khudiak, Raskopii Svjatiliza Nimfeja, SovA 16, 1952, 252ff., Abb. 15,3; Senff, 1992, 108 Taf. 18, 1-2. Auch in Olbia und Gravisca wurden Terrakotten dieses Typus gefunden: J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 116 Abb. 110,4; S. Boldrini, Le Cera-miche Ioniche, Gravisca 4, 1994, 62ff. Nr. 99ff. 74 Coja; Dupont 1979.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
105
Abb. 6a-c: Vogelkoren aus Milet, Gravisca und Tarent
Abb. 6d-e: Vogelkoren aus Histria und Olbia
Reinhard Senff
106
man auch hochwertigere Feinkeramik der sog. Fikelluragattung aus der zweiten Hälfte des 6. Jhs.v.Chr. nachzuahmen, was aber nur in sehr grober Weise gelang. Allerdings kam mit den lokalen Erzeugnissen auch eine Art Binnenhandel in diesem neuen wirtschaftlichen Groß-raum in Gang.75 So wurden Dachziegel aus Heraklea Pontica in Histria gefunden.76 Aus Kolchis im heutigen Georgien stammen besonders große, pithosartige Tongefäße, die sich im gesamten Schwarzmeergebiet einer großen Beliebtheit erfreuten, und die an mehreren Stellen auch der Nord- und Westküste, aber nicht außerhalb dieses Wirtschaftsraumes gefunden worden sind.77 Was immer der Grund für die Bevorzugung dieser Gefäße gewesen sein mag, sie bezeugen jedenfalls ein neues Handels- und Informationsnetz zwischen den Kolonien.78 Hier sind auch die sog. Pfeilmünzen aus der zweiten Hälfte des 6. Jhs.v.Chr. zu nennen, die bisher nur aus dem Pontosgebiet bekannt sind und als eine Geldform gedeutet werden, die hauptsächlich dem Handel zwischen den Kolonien diente.79 Neben der Herstellung von Tonwaren läßt sich im 6. Jh.v.Chr. auch eine eigene Metall-produktion in den Apoikien belegen.80 Hier werden sowohl Gegenstände für den eigenen Ge-brauch als auch für den Export in die umliegenden nichtgriechischen Kulturbereiche her-gestellt. Manche, wie die aus Olbia stammenden Griffspiegel zeigen, daß man den Ge-schmack des Abnehmerkreises berücksichtigte, und den griechischen Spiegeltypus mit Motiven des skythischen Tierstils verzierte.81 Ähnlich wie es in der Münzprägung, Kleinkunst und Architektur zu lokalen Sonderformen kommt, bilden sich auch religiöse Eigenarten innerhalb der Schwarzmeerstädte heraus, die aber immer auf Vorstellungen aus dem Herkunftsgebiet beruhen. Das eindrucksvollste Bei-spiel im kultischen Bereich ist die Verehrung von Achill als Totengott, die ihren Mittelpunkt auf der Insel Leuke hatte, aber auch in pontischen Städten nachzuweisen ist.82 Die zuletzt genannten Beispiele sind nicht nur Anzeichen für die Verbreitung des mutter-ländischen Kulturgutes, sondern zeigen auch, wie die Unabhängigkeit der Kolonien vor allem
75 J.G. Vinogradov, Der Pontos Euxeinos als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Rapports et communications. 9e Congrès international d'épigraphie grecque et latine. (Trinovi 1987), 1986, 9ff.. 76 K. Zimmermann, Zu den Dachterrakotten griechischer Zeit aus Histria, in: Alexanrescu, P.; Schuller, W. (Hrsg.) Histria, Xenia 25, 1990, 155ff, hier 161. Auch in hellenistischer Zeit lassen sich diese Verbindungen belegen, Antefixe vom selben Typus mit einem behelmten Athenakopf sind sowohl in Mesembria als in Olbia gefunden worden: vgl. V. Velkov (Hrsg.), Nessebre 2, 1980126, Abb. 29 und E. Belin de Ballu, Olbia, 1972, 100, Taf. 15,3. 77 J.G. Vinogradov, Der Pontos Euxeinos als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Rapports et communications. 9e Congrès international d'épigraphie grecque et latine . Trinovi 1987, 9ff., hier 22. 78 Dazu ausführlich J.G. Vinogradov, Der Pontos Euxeinos als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Rapports et communications. 9e Congrès international d'épigraphie grecque et latine. Tri-novi 1987, 9ff. sowie A. Avram, Zu den Handelsbeziehungen zwischen Kallatis und dem taurischen Cher-sonnesos, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 7,2, 1988, 87ff. 79 Zur Erklärung der Pfeilmünzen wird einerseits auf Apoll als Bogenschütze hingewiesen, andererseits auf die Bedeutung von Pfeilspitzen als prämonetärer Wertgegenstände bei den Skythen. Dazu M. Alexandrescu Vianu, Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff., 59 f. mit weiteren Hinweisen. 80 In Olbia sind außer einem Schmelzofen auch Gußfomen gefunden worden, vgl. J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 76ff. 81 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 104 f.; Ausstellungskatalog, Gold der Skythen aus der Leningrader Eremitage, München 1984, 72 f. Ein frühes Beispiel, dessen Herstellungsort allerdings nicht bekannt ist, ist der Goldspiegel von Kelermes a.O. 50 f. Weitere Beispiele bei J. Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea area, 1990, 113ff. 82 H. Hommel, Der Gott Achilleus, SBHeidelberg Nr.1, 1980; Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983, 179 f.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
107
in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht im Verlauf des 6. Jhs.v.Chr. langsam zunimmt, auf vielen Gebieten aber Traditionen bestimmend bleiben, die sie an die Mutterstadt binden. Im Bereich der materiellen Kultur wird der Einfluß des Mutterlandes besonders auf dem hohen Niveau der Steinplastik deutlich, die in den Schwarzmeerstädten bisher allerdings nur in sehr geringer Zahl gefunden worden ist. Zunächst muß festgestellt werden, daß das Roh-material, meist feinkristalliner Marmor, nur importiert werden konnte. In den meisten Fällen wird es sich um Importe fertiger Skulpturen handeln.83 Vielleicht kamen die Handwerker bei größeren Bauvorhaben oder speziellen Aufträgen von auswärts, um vor Ort zu arbeiten. Dies ist im Falle der Schaffung einer neuen Apollonstatue für die Stadt Apollonia belegt, wo es sich die Stadt sogar leisten konnte, den berühmten Bildhauer Kalamis zu engagieren.84 Allerdings handelt es sich in diesem Fall wohl um eine große Bronzestatue und allein schon die Herstellung erforderte hier ein Können, das nur wenige Künstler beherrschten. Der Auftrag gibt einen Hinweis darauf, daß die Bürger über entsprechende Finanzmittel verfügten und zeigt, daß man sich auch in kultureller Hinsicht durchaus jeder anderen griechischen Polis gleichwertig fühlte. Die stilistischen Eigenschaften und die Ikonographie vieler uns erhaltener Kunstwerke läßt den Einfluß der ionischen Plastik erkennen, in einigen Fällen sogar speziell den der Mutterstadt Milet.85 Dies wird z.B. beim Vergleich einer marmornen Löwenstatue aus Milet im Louvre mit einer Löwenstatue aus Olbia deutlich.86 Obwohl nicht in allen Details so übereinstimmend wie es bei den aus einer Model gewonnenen Terrakotten der Fall ist, sind doch große Ähnlichkeiten festzustellen. Das betrifft schon allein den Typus, der nicht in allen Kunstlandschaften gleichmäßig vorkommt. Gerade in Milet und mit Milet verbundenen Orten ist eine Häufung von großplastischen Löwendarstellungen anzutreffen.87 Der Löwe hatte ja für Milet eine besondere Bedeutung, war er doch mit dem Hauptgott Apoll verbunden und blieb unverändert das Hoheitszeichen auf den Münzen der Stadt und vieler ihrer Apoikien. Auch in der anthropomorphen Großplastik sind deutliche Einflüsse der spätarchaischen ionischen Kunst erkennbar. Das Fragment eines Kouroskopfes aus Olbia in der Ermitage läßt sich gut in der Anlage des voluminösen, kugeligen Kopfes und hinsichtlich der langen Haarsträhnen sogar im Detail mit einem Kopf in Izmir vergleichen.88 Charakteristisch für den ionischen Siedlungsraum sind Mantelträger.89 Nicht die trainierten Körper der nackten Krieger und Athleten des griechischen Festlandes sind das Darstellungsideal, sondern mit kostbaren Stoffen bekleidete, fein frisierte Aristokraten. Die Gegenüberstellung einer solchen
83 Das ist angesichts der wenigen gefundenen Stücke und des Marmormangels wahrscheinlich, vgl. Hiller 1975, 46. 84 J. Dörig, Kalamis - Studien, JdI 80, 1965, 230ff. Auch für Athen schuf Kalamis eine Apollonstatue: Pausan. 3,3. 85 Einen Überblick über den Forschungsstand zur milesischen Plastik gibt V. v. Graeve, Archaische Plastik im Milet, MüJb 34 1983, 7ff und ders., Über verschiedene Richtungen der milesischen Skulptur in archaischer Zeit, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31 1986, 81ff. Vgl. auch K. Tuchelt, Die archaischen Skulpturen von Didyma, IstForsch 27, 1970. 86 V.M. Strocka, Neue archaische Löwen aus Anatolien, AA 1977, 481ff. 87 Zu archaischen Löwenskulpturen aus Histria vgl. V.M. Strocka, Neue archaische Löwen aus Anatolien, AA 1977, 481ff., 503, Abb. 42; Alexandrescu Vianu 1990, 182. 88 O. Waldhauer, Die antiken Skulpturen der Ermitage 2, 1928, Nr. 84 Abb. 3-4; H.P. Laubscher, Zwei neue Kouroi aus Kleinasien, IstMitt 13/14, 1963/64, 79 mit weiteren wichtigen Beobachtungen zur Einwirkung der milesischen Plastik auf die Kunst der Apoikien. Vgl. zur stilistischen Einordnung auch Alexandrescu Vianu 1990, 182. 89 Eine Zusammenstellung der bisher bekannten großplastischen Exemplare nach Herkunftsorten gibt B.A. Barletta., The Draped Kouros Type and the Workschop of the Syracuse Youth, AJA 91, 1987, 233ff.
Reinhard Senff
108
Mantelfigur aus Apollonia mit in Milet gefundenen Fragmenten zeigt nicht nur die gleiche Raffinesse in der Wiedergabe von Körperlichkeit und Stoffoberfläche, sondern auch, daß diese oberen Gesellschaftsschichten in den Kolonialstädten die Standeswerte ihrer Heimat hochhielten.90 Vielleicht haben wir es hier mit einem Angehörigen der Oberschicht zu tun, die an der Koloniegründung beteiligt war und noch lange danach die Macht in ihren Familien weitergab. Den Versuch einer eigenen künstlerischen Leistung zeigt das Fragment eines Kouros aus lokalem Kalkstein in Olbia.91 Oberkörper und Kopf sind erhalten, aber nur sehr grob und summarisch ausgeführt, so daß höchstens in der Fülle des langen Haares und einer gewissen Massigkeit ionische Züge zu erkennen sind. Er wurde später im Gymnasion der Stadt eingemauert und könnte von einer Statue stammen, die auf der Agora oder im nahe-gelegenen Temenos aufgestellt gewesen war, wie wir es aus dem griechischen Mutterland kennen. Die Grenzziehung zwischen einheimischer Bevölkerung und eingewanderten Griechen findet ihren deutlichsten Ausdruck in den Bestattungen. Den thrakischen, skythischen, sarmatischen oder mäotischen Stämmen mit mehr oder weniger seßhafter Lebensweise war die Bestattung - vornehmlich der Oberschicht - in großen Tumuli gemeinsam. Daß die Griechenstädte wie Magnete auf die einheimische Bevölkerung wirken, zeigt sich auch an den Begräbnissen. Rund um Histria hat sich eine riesige Nekropole erhalten, deren Bestattungen alle Formen der reinen "barbarischen" Tumulusform mit Menschen- und Tieropfern bis zu griechischen Bestattungsweisen zeigen.92 Das schrittweise Eindringen griechischer Kultur zeigt sich hier besonders in den Beigaben, im Tumulus Nr. 22 etwa in einer besonders großen Anzahl griechischer Amphoren.93 Diese Objekte werden allerdings als wertvolle Gegenstände frem-der Herkunft innerhalb des gewohnten Ritus verwendet, ohne die ursprünglichen Sitten zu verändern. Die Angehörigen der griechischen Oberschicht ließen sich wie in Griechenland mit über den Gräbern aufgestellten Stelen bestatten. Die Stele des Anaxandros, Sohn des Deines aus Apol-lonia, stellt ihn als mantelbekleideten Bürger im Spiel mit seinem Windhund dar, genau wie die Gestalt auf einem Relieffragment in Bodrum, das sich wiederum eng an ein milesisches Fragment anschließt.94 Eine Stele aus Olbia zeigt auf der Vorderseite Leoxos, Sohn des Molpagoras als griechischen Athleten, auf der Rückseite eine Gestalt in skythischer Tracht mit dem für die skythische Bewaffnung charakteristischen Goryt.95 Nach Ansicht von J.
90 Kouros aus Apollonia: Hiller 1975, 43, Taf. 27, 3-4; Frg. aus Milet: V. v. Graeve, Über verschiedene Rich-tungen der milesischen Skulptur in archaischer Zeit, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31 1986, 27 f. Taf. 7, 3-4; R. Senff, Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: V. v. Graeve, Milet 1991, IstMitt 42, 1992, 105ff., hier 107 f. Taf. 16. Zuletzt ausführlich zu diesem Typus L.D. Loukopoulou, Contribution a l`histoire de la Thrace Propontique durant la periode archaique, Meletemata 9, 1989, 161ff. Loukopoulou ver-sucht a.O. die zahlreichen in der Nähe des thrakischen Rhaidestos gefundenen marmornen Bildwerke auf Bild-hauerwerkstätten der Mutterstadt Samos zurückzuführen. Allerdings hebt sie auch deutliche Parallelen zu Skulpturen hervor, die in Milet und Didyma gefunden wurden, so daß man bis jetzt nur einen insgesamt süd-ionischen Einfluß sicher konstatieren kann. 91 J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 98 Abb. 95. 92 P. Alexandrescu, Necropola Tumulara, Histria 2, 1966, 133ff. 93 P. Alexandrescu, Necropola Tumulara, Histria 2, 1966, 133ff., 155ff.; 1990, 67 f. Dasselbe läßt sich an jüngeren Beispielen in Olbia erkennen, vgl. Belin de Ballu, Olbia, 1972, 83 f. 94 Hiller 1975, 152ff. Das Fragment der milesischen Stele ist noch unpubliziert. 95 Dazu ausführlich J. Vinogradov, Die Stele des Leoxos, Molpagores' Sohn, aus Olbia und die skythisch-griechischen Beziehungen im frühen 5. Jh.v.Chr., AA 1991, 499ff., s. auch J.G. Vinogradov, S. Kryzickij, Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, 1995, 99 f.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
109
Vinogradov markierte die Stele den Kenotaph des im Kampf mit den Skythen in der Steppe gefallenen Leoxos. Einen lebhaften Eindruck von der Anziehungskraft, die die städtische griechische Kultur auf die umwohnenden Nomadenstämme ausübte, gibt wieder Herodot in seinem Bericht über den Skythenkönig Skyles.96 Durch seine Mutter, eine Griechin aus Istros (Histria) war er grie-chisch erzogen worden. Er besaß einen Palast in Olbia, der von marmornen Sphingen und Greifen umstanden war.97 Wenn Skyles in der Stadt weilte, kleidete er sich wie ein Grieche und ging wie ein Grieche auf der Agora umher. In diesem Falle wirkte sich der kulturelle Kontakt also sogar prägend auf die ganze Lebensweise aus. Die festen städtischen Siedlungen, von denen aus die Griechen Handel trieben, blieben nicht ohne Auswirkungen auf das Hinterland. An den wichtigsten Verkehrswegen entstanden im 6. Jh. v.Chr. größere Siedlungen von "Barbaren" offenbar zum Zweck des Handels mit den Griechen. Die Verteilung der Siedlungen und Kurgane am Unterlauf des Bug beispielsweise läßt erkennen wie stark sie auf den besonders von den griechischen Händlern benutzten Wasserweg ausgerichtet sind.98 Hier hat man gleichsam die letzten Verästelungen des Handels- und Transportnetzes vor Augen, das in der Anlage von Apoikien durch Milet seinen Ausgang nahm. Ein gut erforschtes Beispiel ist die Siedlung von Elizavetovka am unteren Don, die nach den Ausgrabungsergebnissen hauptsächlich von Skythen bewohnt war und aus einem temporären Handelsplatz zu einer festen städtischen Niederlassung heranwuchs.99 Die riesigen Mengen von Fischabfällen zeigen, daß man in großem Stil Dörrfisch produzierte und ausführte um dagegen vor allem Wein, Öl und in geringerem Umfang auch die hier ge-fundene griechische Keramik zu tauschen. Auf lange Sicht führte dieser Kontakt mit der griechischen Welt zu einer Veränderung des skythischen Geschmacks, wie die Grabfunde zeigen; die Ansätze dafür sind schon im 6. Jh. v.Chr. entstanden.100 Die Epoche, in der wir mit einem unmittelbaren Einfluß Milets auf die Schwarzmeerregion rechnen können endet mit dem ionischen Aufstand und der Eroberung Milets durch die Perser im Jahr 494 v.Chr.101 Danach hat die zwar bald wiederbesiedelte Stadt zunächst unter persischer, dann athenischer Vorherrschaft lange keine überregionale Rolle mehr gespielt. Die Zerstörung des Handelsnetzes findet seinen Niederschlag in den Denkmälern. Schlagartig verschwindet die ostgriechische Keramik und wird ersetzt durch attische Ware, die sich im Verlaufe des 4. Jhs. v.Chr. diesen Markt so stark erobert, daß man eine bestimmte attische Gattung zunächst nach dem Hauptfundort als "Kertscher Vasen" bezeichnet hat. Auch in der 96 Herodot 4, 78ff. 97 Herodot 4, 79. Eine Vorstellung von diesen Statuen geben vielleicht die im sog. Temenos an den Heiligen Straße von Milet nach Didyma gefundenen Skulpturen, die hier auch im Zusammenhang adliger Repräsentation aufgestellt waren, vgl. K. Tuchelt, (Hrsg.), Ein Kultbezirk an der Heiligen Straße von Milet nach Didyma, Didyma 3,1, 1996, 146ff. 98 V.D. Blavatskij, Le rayonnement de la culture antique dans le pays de la Pontide Nord, in: Akten des 8. Int. Kongr. f. klass. Archäologie, Paris, 1963, 139ff; Marcenko; Vinogradov 1989, 809ff.; B. Böttger, Griechen am Don. Die Grabungen in Tanais, AA, 1995, 99ff. 99 I.B. Brashinskij, K.K. Marcenko, Elisavetovskoye: Skythische Stadt im Don – Delta, 1984; K. Marcenko, Die Siedlung von Elizavetovka - ein griechisch - barbarisches Emporion im Dondelta, Klio 68,1986, 377ff.. 100 V.D. Blavatskij, Le rayonnement de la culture antique dans le pays de la Pontide Nord, in: Akten des 8. Inter-nationalen Kongresses für klassische Archäologie, Paris, 1963, 139ff, 144ff. 101 Alexandrescu Vianu 1990, 184 vermutet mit Hiller 1975, 47 daß milesische Künstler aus diesem Grund ihre Heimat verlassen hätten und in die Kolonien geflohen sein könnten, was eine Erklärung für ionische Einflüsse in der Plastik des Strengen Stils aus diesen Gebieten wäre. Neuerungen wären dann im 5. Jh. nur von anderen Kunstzentren zu erwarten. Zur Geschichte des Schwarzmeerraumes im 5. Jh.v.Chr. vgl. J. Vinogradov, Die historische Entwicklung der Poleis des nördlichen Schwarzmeergebietes im 5. Jh.v.Chr., Chiron 10, 1980, 63ff.
Reinhard Senff
110
Plastik setzt sich attischer Einfluß von den nördlichen Küstenstädten bis nach Kolchis durch, wie eine hochklassische Grabstele aus Souchoumi und die kürzlich bei Jubilejnoje entdeckten spätklassischen Marmorreliefs zeigen.102 Milet hat mit der Gründung seines Netzes von Kolonien im Schwarzmeergebiet die Grundlagen für die Urbanisierung dieser Region gelegt und die Weichen für eine Hellenisierung gestellt, die sich in Kulten und politischen Institu-tionen in ihrer spezifisch südionischen Form dauerhaft erhalten hat. Wie es durch die Anlage autonomer Stadtgebilde aber eigentlich vorprogrammiert war, lockern sich die engen Bin-dungen an die Mutterstadt bereits im Verlaufe des 6. Jhs.v.Chr. und verschwinden im Bereich der materiellen Kultur nach der Zerstörung Milets. Die darstellende Kunst der umliegenden Völker unterscheidet sich darin von der griechi-schen, daß sie zunächst keine anthropomorphen Darstellungen, vor allem keine von Göttern in Menschengestalt kennt. Ein deutlicher Einfluß der griechischen Kunst läßt sich daher vor allem im Eindringen der griechischen Ikonographie erkennen und ist im skythischen Raum gelegentlich sogar schon im 7. Jh.v.Chr. zu fassen. Zurück nach Milet, von wo Kolonisation und Kulturtransfer ihren Ausgang nahmen. Mit den zuletzt gezeigten Monumenten befinden wir uns in der spätarchaischen Epoche und haben die Zeit der Anlage kleiner Handelsniederlassungen längst hinter uns gelassen. Sie sind Zeug-nisse vielschichtiger Gemeinwesen mit komplexen sozialen und politischen Strukturen. Auch die schon gezeigte Stele aus Olbia gehört hierher, denn der Name des Vaters des Ver-storbenen, Molpagoras verweist auf die Molpoi, eine in Milet durch eine berühmte Inschrift aus dem Delphinion bekannte religiöse Vereinigung. Besonders in der Sakralarchitektur begegnet man Einflüssen milesischer Schmuckformen. Konrad Zimmermann hat bei seiner Analyse der Dachterrakotten aus dem Temenos des Zeus und der Aphrodite darauf hingewiesen, daß hier wie in Olbia die nächsten Parallelen in einer Traufsima vom Kalabaktepe zu finden sind. Diese Epoche liegt aber jenseits der Periode, in der wir mit sicheren archäologischen Indizien auf ein kulturelles Netzwerk schließen können, in dessen Mittelpunkt die Stadt Milet steht. Diese endet nämlich abrupt mit der Eroberung und Zerstörung der Stadt durch die Perser. Auch die nun zu verzeichnenden städtebaulichen Neuerungen haben mit Milet nichts zu tun, so gern man hier vom hippodamischen System spricht. Zwar scheint es in Histria schon im 6. Jh.v.Chr. eine geradlinig verlaufende Hauptverkehrsachse zu geben, aber hier sind noch zu wenig Details für die Binnensiedlung bekannt. Das 421 v. Chr.gegründete Chersonnesos weist sowohl ein regelmäßiges Raster der Innenstadtbebauung auf als auch eine Zenturiation der Chora. Aber diese Verfahren sind bereits lange zuvor bei der Gründung unteritalischer Kolonien, etwa in Metapont angewandt worden und man könnte eher vermuten, daß das neu gegründete Milet diesen Erfahrungen seinen regelmäßigen Stadtplan verdankt. Ein ganz neues Erscheinungsbild der Städte konstituieren die jetzt aufkommenden Befesti-gungsanlagen, die auf Wachstum von Wohlstand und Einwohnerzahl und die zunehmenden Erpressungen der umwohnenden Stammesfürsten zurückzuführen sind. Sie tragen dem neuesten Stand der Poliorketik, der Stadtbelagerungstechnik Rechnung, aber diese Standards
102 Ch. Picard, La stele grecque de Soukhoumi en Colchide (Caucase), RA 48, 1956, 81ff. zur Stele von Sou-choumi, E. Savostina, Trouvaille de reliefs antiques dans un établissement agricole du Bosphore Cimmérien (Taman), RA 1987, 3ff. und U. Mrogenda, u.a., Zu zwei Neufunden spätklassischer Reliefs aus Südrußland, Boreas 11, 1988, 51ff. zu den Reliefs von Jubiljenoie. Zum Verhältnis von Athen und Milet im Schwarzmeer-handel des 6. Jhs. v.Chr. vgl. P Panitschek, Zur Entstehung des athenischen Handels mit dem Schwarzmeerraum im 6. Jh.v.Chr., Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 7,2, 1988, 27ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
111
sind so allgemein bekannt und durch theoretische Schriften verbreitet, daß man sie kaum an konkreten Vorbildern festmachen kann. Dafür stehen Äußerungen antiker Autoren zur Verfügung wie auch auf Stelen veröffentlichte Dekrete als Materialisationen der Beziehungen zwischen den Poleis. Kulte, Kalender, Eigen-namen, Beamten- und Priestertitel, hinter denen sich politische und religiöse Institutionen verbergen, Alphabet und sprachliche Dialektformen und was für den Archäologen natürlich von größter Wichtigkeit ist, Artefakte werden in die Neugründungen exportiert. In der Regel erfolgt die Beeinflussung im kulturellen Bereich von der Mutterstadt in Richtung der Kolonien, während von dort her in der Hauptsache Rohstoffe oder Lebensmittel zurück-flossen. In wenigen Fällen ist aber auch die umgekehrte Richtung zu erkennen, wenn z.B. Kulte aus den kolonisierten Gebieten in die Mutterstadt gelangen. Die kulturellen Ver-bindungslinien lassen sich archäologisch in den wichtigsten Kunstgattungen nachweisen; in der Hauptsache im Bereich von Vasenmalerei, Kleinkunst, Plastik und Architektur. Hier kann unterschieden werden zwischen Produkten, die unmittelbar in der Mutterstadt hergestellt und in die Kolonien transportiert worden sind (Keramik, Kleinkunst) und Gegenständen, die eher am Ort mit den stilistischen Eigenschaften der Kunst des Gründungsortes entstanden (Großplastik, Architektur). In den wenigsten Schwarzmeerkolonien sind ähnliche Häuser der archaischen Zeit aus-gegraben worden. Lediglich in Nymphaion und Pantikapaion scheint es zumindest niedrige Steinsockel für die Räume zu geben. Gleich daneben begegnen Bauten aus Holz oder Schilf, wie sie für die einheimische Architektur charakteristisch sind. Man hat versucht, darin unterschiedliche Wohnungen für Einheimische und Kolonisten in derselben Stadt zu er-kennen, aber das ist nicht so einfach. In Histria fehlen z.B. überhaupt solide Steinsockel bei den Wohnhäusern, trotz des deutlichen griechischen Charakters der religiösen Monumente, in der skythischen Donmetropole Elisavetovka scheinen dagegen auch Griechen in hölzernen Grubenhäusern gewohnt zu haben. Diese Bautechnik charakterisiert die meist steinarmen Uferzonen, in denen sich die Griechen niederließen, wie hier ein Beispiel aus Simagre in Kolchis im heutigen Georgien zeigt. Viel-leicht überstieg auch der nötige Aufwand die Arbeitskraft der wenigen Siedler, wir haben es hier ja wahrscheinlich nur mit kleinen Gruppen von ca. 100 Personen zu tun. Erst seit dem späten 4. Jh. v.Chr. finden wir solide Steinarchitektur in diesen Städten. Mit den zuletzt erörterten Funden haben wir auch schon das Feld der Handelsniederlassungen bereits überschritten, denn hier müssen seßhafte Handwerker für einen genau bekannten Markt gearbeitet haben. Auch viele der späteren in skythischen Kurganen gefundenen Kunst-gegenstände müssen von Griechen hergestellt worden sein. In der Forschung wird das Verhältnis Mutterstadt - Kolonie im Hinblick auf die Urbanistik unterschiedlich eingeschätzt. Hier sind mangels gut erforschter Städte noch viele Fragen offen. Diskutiert werden sollen die wichtigsten Aspekte: - Sowohl im Hinblick auf die Gesamtanlage der Stadt, als auch für die Bauformen
einzelner Häuser lassen sich Fälle größter Unabhängigkeit von der Mutterstadt zeigen (Grubenhäuser in milesischen Kolonien Südrußlands).
- Es gibt Beispiele für die Übernahme künstlerischer Detailformen aus der Mutterstadt (Dachterrakotten von Histria - Milet).
- Die veränderte Ausgangssituation bei Gründung einer Kolonie bei der Verteilung von Haus- und Landparzellen läßt regelmäßige Städte entstehen, die sich "fortschrittlich" neben den ungeplanten Altstädten der Gründer ausnehmen.
Reinhard Senff
112
- Möglicherweise wirken die Erfahrungen bei der Anlage der Koloniestädte zu einem späteren Zeitpunkt auf das griechische Mutterland zurück, wenn hier im 5. und 4. Jh. v.Chr. neue Zentren demokratischer Poleis mit regelmäßigem Stadtplan (und gleich-großen Grundstücken?) entstehen.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
113
Literaturverzeichnis Die Abkürzungen entsprechen den für die Publikationen des Deutschen Archäologischen Instituts geltenden Richtlinien, vgl. Archäologische Bibliographie 1992, IXff.
Akurgal, E., Alt - Smyrna 1, Wohnschichten und Athenatempel, o. O. 1983.
Alexandrescu Vianu, M., Die Steinskulptur von Histria, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990 179ff.
Alexandrescu, P., Necropola Tumulara, Histria 2, 1966, 133ff.
Alexandrescu, P., La céramique d`epoque archaique et classique, Histria 4, 1978.
Alexandrescu, P., Histria in archaischer Zeit, in: P. Alexandrescu, W. Schuller (Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990, 47ff.
Ausstellungskatalog, Gold der Skythen, Gold der Skythen, aus der Leningrader Eremitage, München 1984.
Avram, A., Zu den Handelsbeziehungen zwischen Kallatis und dem taurischen Chersonnesos, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 7,2, 1988, 87ff.
Avram, A., Das histrianische Territorium in griechisch - römischer Zeit, in: P. Alexandrescu, W. Schuller(Hrsg.), Histria, Xenia 25, 1990, 9ff.
Barletta. B.A., The Draped Kouros Type and the Workschop of the Syracuse Youth, AJA 91, 1987, 233ff.
Belin de Ballu, E., Olbia, 1972.
Betancourt, Ph., The Aeolic Style in Greek Architecture, 1977.
Blavatskij, V.D., Le rayonnement de la culture antique dans le pays de la Pontide Nord, in: Akten des 8. Int. Kongr. f. klass. Archäologie, Paris, 1963, 139ff.
Blavatskij, V.D., Pantikapeji, 1964.
Blümel, C., Die archaischen griechischen Skulpturen der Staatlichen Museen zu Berlin, 1963.
Boardman, J., Kolonien und Handel der Griechen. Vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr., 1981.
Boardman, J., The Material Culture of Archaic Greece, CAH 3,3, 2. Aufl. 1982, 442ff.
Boardman, J., Trade in Greek decorated Pottery, OJA 7,1, 1988, 27ff.
Boardman, J., The Trade Figures, OJA 7,3, 371ff., 1988.
Boldrini, S., Le Ceramiche Ioniche, Gravisca 4, 1994.
Böttger, B., Griechen am Don. Die Grabungen in Tanais, AA, 1995, 99ff.
Bouzek, J., Greek Pottery in the Black Sea area, 1990.
Brashinskij, I.B.; Marcenko, K.K., Elisavetovskoye: Skythische Stadt im Don-Delta, 1984.
Braun, T.F.R.G., The Greeks in Egypt, CAH 3,3, 2. Aufl. 1982.
Cahn, H.A., Die Löwen des Apoll, MusHelv 7, 1950, 185ff.
Reinhard Senff
114
Camp, J., The Athenian Agora, 1986.
Coja, M.; Dupont, P., Histria 5, Ateliers céramiques, 1979.
Coja, M., Les fortifications grecques dans les colonies de la côte ouest du Pont Euxin, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 95ff.
Coja, M., Greek colonists and native populations in Dobruja (Moesia inferior). The archaeological evidence. Greek colonists and native populations, 1990, 157ff.
Cook, R.M., Fikellura - Pottery, BSA 1933 - 34, 1936, 1ff.
Cook, R.M., Die Bedeutung der bemalten Keramik für den griechischen Handel, JdI 74, 1959, 114ff.
Cook, R.M., The Greeks in Ionia and the East, 1962.
Cook, R.M., Greek Painted Pottery, 1972.
Danov, C.M., Pontos Euxeinos, RE Suppl. 9, 1962, Sp. 866-1175.
Danov, C.M., Altthrakien, 1976.
Danov, C.M., Zur Geschichte der griechischen Kolonien an der ägäischen und propontischen Küste Altthrakiens. - Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von H. Vetters, 1985, 52ff.
Dentzer, J.M., La représentation du banquet couché, 1982.
Dimitriu, A.S., Cartierul de locuinte din zona de vest a cetatii în epoca arhaica, Histria 2, 1966, 21ff.
Dimitriu, A.S., Paläste und Hütten in der milesischen Kolonie Istros, in: D. Papenfuss, V.M. Strocka, (Hrsg.), Palast und Hütte, 1982, 309ff.
Dörig, J., Kalamis - Studien, JdI 80, 1965, 138ff.
Drerup, H., Griechische Baukunst in geometrischer Zeit, Archaologia Homerica 2, 1969.
Dunbabin, T.J., The Greeks and their Eastern Neighbours, 1957.
Dupont, P., Amphores commerciales archaiques de là Grèce de l`Est, PP 37, 1982, 193ff.
Dupont, P., Classification et détermination de provenance des céramiques grecques orientales archaiques d'Istros, Dacia 27, 1983, 19ff.
Dupont, P., Naturwissenschaftliche Bestimmung der archaischen Keramik Milets, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 57ff.
Ehrhardt, N., Milet und seine Kolonien, 1983.
Ehrhardt, N., Probleme der griechischen Kolonisation am Beispiel der milesischen Gründungen, Eos 73, 1985, 81ff.
Ehrhardt, N., Die politischen Beziehungen zwischen den griechischen Schwarzmeer-gründungen und ihren Mutterstädten. Ein Beitrag zur Bedeutung von Kolonialverhältnissen in Griechenland. - Rapports et communications. 9e Congrès international d'épigraphie grec-que et latine. (Trinovi 1987) 78ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
115
Favory, F., Propositions pour une modélisation des cadastres ruraux antiques, in: M. Clavel-Lévêque (Hrsg.), Cadastres et espace rural, 1983, 51ff.
Fehr, B., Orientalische und griechische Gelage, 1971.
Flinders Petrie, Naukratis 1, Third Memoir of the Egypt Exploration Fund, 1988.
Gajdukevich, V.E., Das bosporanische Reich, 1971.
Gardner, E.A, Naukratis 2, Sixth Memoir of the Egypt Exploration Fund, 1888.
Graham, A.J., The colonial expansion of Greece, 5, Hellespont, Propontis, Bosporus, CAH 3,3, 2. Aufl. 1982, 83ff.
Graham, A.J., Pre-Colonial Contacts: Questions and Problems, in: J.-P. Descoeudres (Hrsg.), Greek Colonists and Native Polpulations, 1990, 45ff.
Heinz, M.; Senff, R., Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: V. v.Graeve, Milet 1992 - 1993, AA 1995, 220ff.
Hiller, H., Ionische Grabreliefs aus der ersten Hälfte des 5. Jhs.v.Chr. 12. Beih. IstMitt, 1975.
Hoepfner, W.; Schwandner, E.L., Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Neubear-beitung, Wohnen in der klassischen Polis, Band 1, 1994.
Hommel, H., Der Gott Achilleus, SBHeidelberg Nr.1, 1980.
Jantzen, U., Ägyptische und orientalische Bronzen aus dem Heraion von Samos, 1972.
Kawerau, G.; Rehm, A., Das Delphinion, Milet 3, 1914.
Khudiak, M.M., Raskopii Svjatiliza Nimfeja, SovA 16, 1952, 232ff.
Kleiner, G., Die Ruinen von Milet, 1968.
Kochelenko, G.; Kouznetsov, V., La colonisation grecque du Bosphore cimmérien, in: O. Lordkipanidze, P. Leveque, (Hrsg.), Le Pont-Euxin vu par les Grecs, 1990, 67ff.
Königs, W., Reste archaischer Architektur in Milet, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 113ff.
Kryzickij, S.D., Zilye doma anticnych Severnogo Pricernomorja (VI v. do n.e.-IV v.n.e), 1982.
Kryzickij, S.D., Antike Stadtstaaten im nördlichen Schwarzmeergebiet, in: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hrsg.), Gold der Steppe, Archäologie der Ukraine, 1991, 187ff.
Lang, F., Archaische Siedlungen in Griechenland, Struktur und Entwicklung, 1996.
Laubscher, H.P., Zwei neue Kouroi aus Kleinasien, IstMitt 13/14, 1963/64, 73ff.
Lo Porto, F.G., Le importazioni della Grecia dell’Est in Puglia, in: Vallet (Hrsg.), Les céra-miques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978, 131ff.
Long, L.; Miro, J.; Volpe, G., Les épaves archaiques de la pointe Lequin, in: M. Bats, G. Ber-tucchi, G. Conges, H. Treziny, (Hrsg.), Marseille grecque et la Gaulle, Études Massaliètes 3, 1992, 199ff.
Lordkipanidze, O., Suchumskaja stela, SovA Nr. 1, 1968, 166ff.
Reinhard Senff
116
Lordkipanidze, O., La georgie et le monde grec, BCH 98, 1974, 897ff.
Lordkipanidze, O., Das alte Kolchis und seine Beziehungen zur griechischen Welt vom 6. zum 4. Jh.v.Chr. Xenia, Konstanzer Althistorische Vorträge und Forschungen , hrsg. von W. Schuller, 1985, 14.
Lordkipanidze, O., The Fortifications of Ancient Colchis, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 179ff.
Lordkipanidze, O., Archäologie in Georgien, 1991.
Loukopoulou, L.D., Contribution a l`histoire de la Thrace Propontique durant la periode archaique, Meletemata 9, 1989.
Marcenko, K., Die Siedlung von Elizavetovka - ein griechisch-barbarisches Emporion im Dondelta, Klio 68,1986, 377ff.
Marcenko, K., Vinogradov, Y., The Scythian Period in the northern Black Sea Region, (750-250 BC), Antiquity 63, 1989, 803ff.
Morris, S.P., LASANA, A contribution to the Ancient Greek Kitchen, Hesperia 54, 1985, 393ff.
Mrogenda, U. u.a., Zu zwei Neufunden spätklassischer Reliefs aus Südrußland, Boreas 11, 1988, 51ff.
Müller-Wiener, W., Bemerkungen zur Topographie des archaischen Milet, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 95ff.
Niemeyer, H.G. (Hrsg.), Phönizier im Westen, 1982.
Noonan, T.S., The Origin of the Greek Colony at Pantikopaeum, AJA 77, 1973, 77ff.
Panitschek, P., Zur Entstehung des athenischen Handels mit dem Schwarzmeerraum im 6. Jh. v.Chr., Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, 7,2, 1988, 27ff.
Picard, Ch., La stele grecque de Soukhoumi en Colchide (Caucase), RA 48, 1956, 81ff.
Pippidi, D.M., Greci nel basso Danubio, 1971.
Price, E.R., Pottery of Naucratis, JHS 44, 1924, 180ff.
Prinz, H., Funde aus Naukratis, Klio 7.Beih., 1906.
Pritchett, W.K., The Attic Stelai, Part 2, Hesperia 1956, 178ff.
Ramage, A., Lydian Houses and Architectural Terracottas, Archaeological Exploration of Sardis, Monograph 5, 1978.
Roebuck, C., The organization of Naucratis, ClPhil 44, 1951, 212ff.
Roebuck, C., Ionian Trade and Colonization, 1959.
Röhlig, J., Der Handel von Milet, 1933.
Rolle; R.; Murzin, V.J.; Sramko, B.A., Das Burgwallsystem von Bel’sk (Ukraine). Hamburger Beiträge zur Archäologie 18, 1991, 57ff.
Rusjaeva, A.S.; Vinogradov, J.G., Der "Brief des Priesters" aus Hylaia, in: R. Rolle, M. Müller-Wille, K. Schietzel (Hrsg.), Gold der Steppe, Archäologie der Ukraine, 1991, 201ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
117
Savostina, E., Trouvaille de reliefs antiques dans un établissement agricole du Bosphore Cimmérien (Taman), RA 1987, 3ff.
Seibert, J., Metropolis und Apoikie, 1963.
Senff, R., Die Grabung auf dem Zeytintepe, in: v.Graeve, V., Milet 1991, IstMitt 42, 1992, 105ff.
Senff, R., Die Grabung am Kalabaktepe, in: v.Graeve, V. Milet 1992-1993, AA 1995, 208ff.
Snodgrass, A.M., The Historical Significance of Fortifications in Archaic Greece, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 125ff.
Strocka, V.M., Neue archaische Löwen aus Anatolien, AA 1977, 481ff.
Tolstikov, V.P., L'apport de la fortification a l`histoire du Bosphore antique, in: P. Leriche, H. Tréziny (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 167ff.
Tolstikov, V.P., Archäologische Forschungen im Zentrum von Pantikapaion und einige Pro-bleme der Stadtplanung vom 6. bis zum 3. Jh.v.Chr., in: W. Schuller, W. Hoepfner, E.L. Schwandner, Demokratie und Architektur, Wohnen in der klassischen Polis 2, 1989, 69ff.
Treister, M.J.; Shelov - Kovedyaev, T.S., An Inscribed Clay Object from Hermonassa, Hesperia 58, 1986, 289ff.
Treister, M.J.; Vinogradov, Y.G., Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea, AJA 97, 1993, 521ff.
Tsetskhladze, G.; De Angelis, F. (Hrsg.), The Archaeology of Greek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, 1995.
Tsetskhladze, G., Greek Penetration of the Black Sea, in: G. Tsetskhladze, G.; De Angelis, F. (Hrsg.), The archaeology of Greek Colonisation, Essays dedicated to Sir John Boardman, 1995, 111ff.
Tuchelt, K. (Hrsg.), Ein Kultbezirk an der Heiligen Straße von Milet nach Didyma, Didyma 3,1, 1996.
Tuchelt, K., Die archaischen Skulpturen von Didyma, IstForsch 27, 1970
v.Gerkan, A., Der Poseidonaltar bei Kap Monodendri, Milet 1, 1915, 4.
v.Graeve, V.; Senff, R., Die Grabung am Südhang des Kalabaktepe, in: V. v.Graeve, Milet 1989, IstMitt. 40, 1990, 44ff.
v.Graeve, V., Archaische Plastik in Milet, MüJb 34, 1983, 7ff.
v.Graeve, V., Über verschiedene Richtungen der milesischen Skulptur in archaischer Zeit, in: W. Müller-Wiener (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 81ff.
v.Graeve, V., Der Schnitt auf dem Gipfelplateau des Kalabaktepe 1988, in: V. v.Graeve, Milet 1989, IstMitt.40, 1990, 39ff.
Vallet, G. (Hrsg.), Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en occident, Coll. Int. du CNRS N. 569, Neapel 1976, 1978.
Vallet, G.; Villard, F.; Auberson, P., Megara Hyblaea 1, Le Quartier de l`Agora Archaique, 1976.
Reinhard Senff
118
Velkov, V. (Hrsg.), Nessebre 2, 1980.
Velkow, V., Mesambria Pontica, in: W. Schuller (Hrsg.), Die bulgarische Schwarzmeerküste im Altertum, Xenia 16, 1985, 29ff.
Vinogradov, J., Die historische Entwicklung der Poleis des nördlichen Schwarzmeergebietes im 5. Jh.v.Chr., Chiron 10, 1980, 63ff.
Vinogradov, J.G., Olbia, Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer, Xenia, Konstanzer Althistorische Vorträge und Forschungen, hrsg. von W. Schuller 1981, 1.
Vinogradov, J.G., Der Pontos Euxeinos als politische, ökonomische und kulturelle Einheit und die Epigraphik, Rapports et communications. 9e Congrès international d'épigraphie grec-que et latine. Trinovi 1987, 9ff.
Vinogradov, J., Die Stele des Leoxos, Molpagores' Sohn, aus Olbia und die skythisch-griechischen Beziehungen im frühen 5. Jh.v.Chr., AA 1991, 499ff.
Vinogradov, J.G.; Kryzickij, S., Olbia, eine altgriechische Stadt im nordwestlichen Schwarz-meerraum, 1995.
Voigtländer, W., Zur archaischen Keramik Milets, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 35ff.
Waldhauer, O., Die antiken Skulpturen der Ermitage 2, 1928.
Walter, H.. Frühe Samische Gefäße, Samos 5, 1968.
Walter - Karydi, E., Samische Gefäße des 6. Jhs.v.Chr., Samos 6,1, 1973.
Walter - Karydi, E., Zur archaischen Keramik Ostioniens, in: Müller-Wiener, W. (Hrsg.), Milet 1899-1980, IstMitt Beih. 31, 1986, 73ff.
Wasowicz, A., Les ”fondations en terre” d'Olbia et d'Histria, ArcheologiaWarsz 20, 1969, 39ff.
Wasowicz, A., Olbia Pontique et son territoire, 1975.
Wasowicz, A., Urbanisation et organisation de la chora coloniale grecque autour de la mer Noire, in: Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Colloque de l'Ecole francaise de Rome 67 (Cortona 1981), 1983, 911ff.
Wasowicz, A., Le système de défense des citès grecques sur les côtes septentrionales de la mer noire, in: Leriche, P.; Tréziny, H. (Hrsg.), La fortification dans l'histoire du monde grec, 1986, 79ff.
Werner, Probleme der Rechtsbeziehungen zwischen Metropolis und Apoikie, Chiron 1971, 19ff.
Zimmermann, K., Zu den Dachterrakotten griechischer Zeit aus Histria, in: Alexandrescu, P.; Schuller, W. (Hrsg.) Histria, Xenia 25, 1990, 155ff.
"Milet - Stadt im Zentrum eines Handels- und Kulturnetzes"
119
Abbildungsnachweis Abb. 1: Verf., Abb. 2: Miletgrabung, Abb. 3a: nach Vinogradov; Kryzickij 1995 Abb. 8, Abb. 3b: nach Vinogradov; Kryzickij 1995 Abb. 9, Abb. 4a: nach Alexandrescu 1978 Taf. 7, Kat 65, Abb. 4b: nach Walter - Karydi 1973 Taf. 78, 598, Abb. 4c: Miletgrabung, Abb. 5a: Miletgrabung, Abb. 5b: nach Walter-Karydi 1973 Taf. Taf. 86, 627, Abb. 6a: Miletgrabung, Abb. 6b: nach Boldrini 1994 48 Nr. 26, Abb 6c: nach Lo Porto 1978 Taf. 70 Abb. 21, Abb. 6d): nach Alexandrescu 1978.
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
121
Hartmut Galsterer (Bonn)
ZENTRALE PLÄTZE IN ANTIKEN STÄDTEN -
ARCHITEKTUR UND POLITISCHE VERFASSUNG BEI FORUM ROMANUM UND AGORA
Daß Plätze sich in ihrer Form und Ausstattung ändern, wenn sich ihre Funktion ändert, aber auch wenn das soziale und ökonomische Umfeld sich ändert, ist unmittelbar einleuchtend; die im Moment bei uns geführte Diskussion über die Neugestaltung des Schloßplatzes in Berlin ist ein gutes Beispiel dafür.1 Das Ausmaß der Änderungen hängt dann von der Verfügbarkeit der einzusetzenden Mittel und meist auch von einem neuen Konzept ab. Solche Änderungen im ‘Konzept’, in der ‘Ideologie’ festzustellen, wenn es keine geschriebenen Quellen gibt, also allein aus den archäologischen Resten, ist sicher nicht einfach, und es wird sich in der Mehr-zahl der Fälle auch wohl nicht um einfache Alternativen handeln. Der bekannte Archäologe Paul Zanker stellte einmal "das 'demokratische' Erscheinungsbild der klassischen griechi-schen Polis" den „hierarchischen Strukturen in Rom“ gegenüber.2 Ziel dieses Vortrags ist es zu überprüfen, ob es bei den Hauptplätzen der beiden wichtigsten antiken Städte, Athen und Rom, so gravierende Unterschiede wirklich gibt. Im folgenden geht es zunächst um die Veränderungen am politischen und wirtschaftlichen Zentrum Roms, dem Forum, das erst in der Kaiserzeit zur Unterscheidung von den neuen anderen Foren der Stadt den Namen Forum Romanum erhielt. Ich beginne hiermit und stelle es in den Mittelpunkt meiner Darlegung, weil ja wohl schon die meisten einmal dort durch die Ausgrabungen gewandert sind, und weil die Ruinen des Forums einfach viel ein-drucksvoller sind als etwa die der Athener Agora, die ich in einem zweiten, kürzeren Teil behandeln werde. Ich bin natürlich nicht der erste, der sich mit dem Aussagewert von Platzarchitektur und -an-lagen für soziale und politische Zustände beschäftigt. Für die Athener Agora hat dies vor nicht langer Zeit in einem schönen Buch Camp getan3; von den vielen Hunderten, die sich mit dem römischen Forum beschäftigt haben, muß es genügen, auf Coarelli und Zanker hin-zuweisen. Was man heute vom Forum Romanum sieht - und was man auf dem Plan und der Rekon-struktion sieht (Abb. 1 und 2) - sollte man allerdings zunächst einmal schnell vergessen, nicht weil es falsch wäre, sondern weil es den Zustand ab der mittleren Kaiserzeit wiedergibt, der so erst nach dem Brand Roms unter Nero entstand. Rom und sein Zentrum, das Forum, entstehen am Schnittpunkt zweier wichtiger Straßen Mittelitaliens. Dies ist einerseits die von Nordwesten nach Südosten führende, parallel zur Küste verlaufende Längsstraße, die im Norden als die späteren viae Aurelia, Cassia und
1 Der Vortragsstil wurde für die Druckfassung weitgehend beibehalten, die Annotierung auf ein Minimum beschränkt. 2 P. Zanker, Pompeji. Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform, Trierer Winkelmanns-programm 9, 1987, 11; vgl. auch die Einleitung zu W. Hoepfner; G. Zimmer, Griechische Polisarchitektur und Politik, Tübingen 1993 3 J.M. Camp, Die Agora von Athen, Mainz 1989
Hartmut Galsterer
122
Flaminia auf die Tiberfurt an der milvischen Brücke hinführten, dann als via Lata (der Corso) zum Kapitol ging und an den Steinbrüchen des Kapitolshügels (als vicus Lautu-miarum) vorbei zur Forumsniederung kam. Diese durchquerte sie als - oder zumindest teil-weise als - via sacra und verließ sie entlang des Palatin in Richtung Meer und - als via Appia - in Richtung Campanien. Diese seit undenklichen Zeiten begangene Straße kreuzte sich am Fuß des Kapitols mit einer anderen, die von den Salinen nördlich Ostias als via Salaria (Salzstraße) den Viehhirten im Appennin das unentbehrliche Salz brachte. In der Stadt führte sie über den alten Tiberübergang an der Insel, am frühesten Tiberhafen und am Kapitol ent-lang (als vicus Iugarius) und als Argiletum weiter an den Ausläufern des Quirinal entlang nach Nordosten, zu den Latinern und den Sabinern. Das Forum liegt, ebenso wie das südlich anschließende Forum Boarium, in den Über-schwemmungsgebieten des Tibers und eines vom Quirinal herabkommenden Neben-flüßchens. Das Forum lag außerhalb der ersten Siedlungen auf dem Palatin und der Velia bzw. auf dem Quirinal, und auch sein Name scheint ja darauf hinzudeuten, daß es "außen", foris, lag. Auch die via sacra heißt via, wie sonst nur die außerstädtischen Straßen, und nicht vicus oder clivus, wie die innerstädtischen Verbindungen.
Abb. 1: Das Forum Romanum 1 Porticus Deorum Consentium 7 Tiberius-Bogen 13 Venus Cloacina
2 Umbilicus Urbis Romae 8 Phokas-Säule 14 Augustus-Bogen
3 Septimius Severus-Bogen 9 Marsyas, Feigen-, Ölbaum 15 Quelle der Juturna
4 Decennalienbasis 10 Lacus Curtius 16 Vesta-Tempel
5 Lapis Niger u.Weinstock 11 Reiterstandbild Domitians 17 Regia
6 Comitium 12 Reiterstandbild Konstantins 18 Romulus-Tempel
19 Titus-Bogen
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
123
Abb. 2: Der Triumphzug Kaiser Konstantins, Gemälde von Bühlmann und Wagner, München 1890
Nach der literarischen Überlieferung kämpften in diesem, zwischen ihren Gemeinden liegen-den flachen Gebiet die Römer vom Palatin und die Sabiner vom Quirinal - Ursache war der berühmte Raub der Sabinerinnen. An dieser Stelle schlossen, eben aufgrund der Intervention dieser Sabinerinnen, Romulus und der Sabinerkönig Titus Tatius Frieden und vereinigten die beiden Siedlungen mit dem Forumtal als Mittelpunkt. Nach der Tradition waren es dann besonders die Könige aus der etruskischen Dynastie der Tarquinier, die durch den Bau der Cloaca Maxima das Forumtal entwässerten und für den zivilen Gebrauch nutzbar machten. Unter ihnen entstanden die ersten Bauten am Comitium, dem politischen Zentrum der Stadt, und von ihnen wurden wohl schon die beiden großen Tempel am Forum geplant, der des Saturn und der der Dioskuren Castor und Pollux. Am Comitium wurde dann 450 v. Chr. das Zwölftafelgesetz, die erste - und für über tausend Jahre letzte - Gesetzeskodifikation der Römer, ausgehängt. Soweit die literarische Überlieferung, die bis vor wenigen Jahrzehnten auf großes Mißtrauen bei den Historikern stieß. Inzwischen wird aber durch die neueren Ausgrabungen die römische Frühzeit auch in ihren topographischen Einzelheiten immer glänzender bestätigt, vor allem was die Datierungen betrifft, natürlich nicht bunte Novellen wie die vom Raub der Sabinerinnen. Menschliche Aktivität zeigt sich im Forumtal zuerst durch Gräber ab dem 10. Jhdt., zunächst im Bereich des Augustusbogens und dann auch nördlich am Antoninus Pius-Tempel.4. Sie gehören mit einiger Sicherheit zu einer Siedlung auf Palatin und Velia, deren Westtor, die porta Mugonia, südlich vor der Konstantinsbasilika lag (Abb. 3). 4 Ich sehe ab von den mittel- und spätbronzezeitlichen Siedlungen auf dem Kapitol und bei S. Omobono, von denen anscheinend keine Kontinuität zu den unten genannten Siedlungen besteht. Vgl. C. Tagliamonte, in: E.M. Steinby, Lexicon topographicum Urbis Romae, Rom 1994ff., I 230
Hartmut Galsterer
124
Abb. 3: Die Siedlung auf Palatin und Velia Die Nekropole am Antoninus Pius-Tempel scheint um ca. 800 v. Chr. nach Norden auf den Esquilin ‘verlegt’ worden zu sein. In der Forumsnekropole gibt es später nur noch Kinder-bestattungen. Das Gebiet wird sichtlich in den Siedlungsbereich einbezogen: ab etwa 750 v. Chr. gibt es unter dem Augustusbogen und der Regia Holz- und Strohhütten, und diese West-ausdehnung der - nach der Tradition von Romulus 753 v. Chr. gegründeten - Palatinstadt ist die Voraussetzung für die Vereinigung der beiden Siedlungssysteme. Schon um 650 v. Chr. gab es eine erste Befestigung der via sacra, der wenig später eine Be-festigung der zentralen Forumsfläche mit Kies und Sand folgt. Um 620 v. Chr. kam es im Gefolge eines katastrophalen Tiberhochwassers, das eine 90cm dicke Ablagerungsschicht hinterließ, zu einer Neustrukturierung des Forums. Anstelle der Hütten im östlichen Teil des Forums wird die erste Regia gebaut, am westlichen Ende wird das Comitium befestigt und auf einem Steinfundament mit Ziegelmauerwerk das erste Senatsgebäude errichtet, die nach der Überlieferung vom dritten König, Tullus Hostilius, erbaute curia Hostilia. Zahlreiche Funde von griechischer Importkeramik aus dieser Zeit im Bereich des Forums passen in das Bild. Schließlich stammten die Tarquinier von einer aus Korinth verbannten Familie ab, die zu dem dort herrschenden Bacchiadenclan gehörte. Unter ihnen erhält das Forum nun die Struktur, die es bis in das 2.Jh v. Chr. beibehalten sollte. Die mit dem Bau des großen Hauptkanals, der cloaca maxima, beendete Drainage des Forummittelteils führte nun sichtlich zu einer rationalen Trennung von verschiedenen Funktionsbereichen. Im Osten befand sich wohl die Königsresidenz mit ihren Annexen. Wir kennen sie nur aus ihren republikanischen Nachfolgebauten, aber es ist kaum zweifelhaft, daß die Regia, die spätere Residenz des Pontifex Maximus, das anschließende Haus des rex sacrorum, der Tempel der Vesta und das Kloster, wenn man so sagen darf, der Vestalinnen ursprünglich zusammengehörten, wie ja auch alle diese Institutionen auf das ursprüngliche Königsamt hinweisen. Im Westen des Forums, am Schnittpunkt der beiden Straßen, entsteht hingegen ein politisches Zentrum für Adel und Volk. Es besteht zum einen aus dem Comitium, dem Versammlungs-platz der beiden ältesten Volksversammlungen, nämlich der nach Verwandschaftsgruppen eingeteilten Kurienversammlung und der nach regionalen Wahlbezirken zusammentretenden
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
125
Tribusversammlung.5 Das erste Comitium war rechteckig, und in seine Umfassung war eine Kultstätte mit dem lapis niger integriert, die seit jeher als das Grab des mythischen Stadt-gründers Romulus angesehen wurde. Wie in vielen griechischen Städten liegt somit auch hier in Rom das Heiligtum des vergöttlichten Gründers im politischen Zentrum. Der lapis niger selbst trägt die älteste Monumentalinschrift Roms, wohl eine Vorschrift für den Kult an dieser Stätte (lex arae), der vom König durchzuführen war. Seit dem Ende des 6. Jhs. wurde bei einer Neubefestigung der Comitiumfläche an ihrer südlichen Begrenzung eine erste Rednertribüne gebaut, an der dann später, um 338 v. Chr., die von den Antiaten erbeuteten Schiffsschnäbel angebracht wurden, von denen sie ihren Namen, Rostra, erhielt.6 Vielleicht ebenfalls in dieser Zeit entstand der Vorläufer der Graecostasis, der "Griechentribüne", von der aus fremde Gesandtschaften sich an das Volk und an den Senat wenden konnten. An der entgegengesetzten Seite des Comitium stand, wie schon gesagt, das erste Amtslokal des Senats, die curia Hostilia, die seit etwa 570 v. Chr. reich mit Terracottaplatten verziert war, ähnlich wie die Regia auf der anderen Seite des Forums. Westlich dieses Komplexes stand der Kerker, das Tullianum, dessen Name von König Ser-vius Tullius stammen soll, und hinter ihm ragte der tarpeische Fels hoch, von dem die zum Tode Verurteilten gestürzt wurden.7 Im massiven Fundament des benachbarten Saturntempels befanden sich die Staatskasse und das erste römische Archiv. Unmittelbar außerhalb der Stadtmauer am Hang des Kapitols lag die villa publica, wo in jedem fünften Jahre die Censoren die Zählung des Volkes und die Neuorganisation des Heeres vornahmen.8 Dem "königlichen" Bereich an der Osthälfte des Forums entsprach demnach ein ebenfalls schon in der Königszeit entstandener "politischer" Bereich im Westen. Verbunden wurden beide, nach der erfolgreichen Drainage des Forumsareals, durch die beiden Tempel, den des Saturn am Kapitolshang und den der Dioskuren am Fuß des Palatin, und die nach der Tradi-tion ebenfalls schon in die Königszeit zurückgehenden 'alten Buden', die tabernae veteres zwischen ihnen, Geschäftslokale in staatlichem Besitz, die bald ihr Pendant in tabernae novae an der Nordseite des Forumplatzes fanden. Hinter ihnen erstreckten sich die ‘besseren’ Wohnbezirke, in denen die Patrizier wohnten.9 Hinter den tabernae veteres, so erfahren wir zufällig, hatte im 3. Jh. Scipio Africanus, der Sieger über Hannibal, sein Haus, und die Grabungen Carandinis am Titusbogen zeigten, daß schon in der Königszeit die dort gele-genen Häuser des Patriziats keineswegs so schlicht waren, wie die späteren Römer, in ihrem
5 Nach Krause hätte das älteste comitium am Volcanal gelegen und wäre erst um 450 v. Chr. an den Platz vor der curia Hostilia verlegt worden, was eine Möglichkeit der Abhängigkeit eines solchen Versammlungsplatzes von dem nachkleisthenischen Athen ergäbe und mit der Tradition von Hermodor (s.u.) zusammenpaßte. C. Krause, Zur baulichen Gestalt des republikanischen Comitiums, Römische Mitteilungen 83, 1976, 38. In der neueren Literatur, d.h. vor allem bei Coarelli, wird jedoch das Volcanal direkt an den Rand des späteren Comitium gerückt. F. Coarelli, Il foro Romano I, II, Rom 1983, 1985 6 Die in ihrem Schatten versammelten und diskutierenden Stammtischstrategen und politischen Besserwisser heißen nach ihnen subrostrani. Vgl. Livius 44, 22 und Cicero fam. 8, 1, 4 7 Nach Krause ist das Tullianum bislang nicht vor das 3. Jh. zurückzudatieren. C. Krause, Zur baulichen Gestalt des republikanischen Comitiums, Römische Mitteilungen 83, 1976, 31-69, hier 41, Anm. 62 8 Die Lokalisierung innerhalb oder außerhalb der servianischen Mauer scheint bislang unklar, vgl. dazu F. Co-arelli, s.v. Atrium Libertatis, in: E.M Steinby, Lexicon topographicum, I 133 ff. und E.Tortorici, La „Terrazza domizianea“, l’aqua Marcia ed il taglio della sella tra Campidoglio e Quirinale, Bull. Com. 95,2, 1993, 7-24. Da aber der Census u.a. eine Neuaufstellung des römischen Heeres war, muß er außerhalb der militärfreien Zone des Pomeriums, d.h. außerhalb der Stadtmauer, abgehalten worden sein. 9 Unmittelbar hinter diesen wohl eher als vornehm zu bezeichnenden Vierteln lagen allerdings die sprich-wörtlich plebejischen Quartiere der Subura und des Velabrum.
Hartmut Galsterer
126
Glauben an die ursprüngliche Ärmlichkeit der Verhältnisse in ihrer Stadt, sich das vor-stellten.10 In dieser Form behielt das Forum Bestand bis in das Ende des 4. Jhs., als Rom bereits Vor-macht in Mittelitalien war und alle Neu- und Umbauten nun noch mehr unter griechischen Einfluß gerieten. Es ist nicht einfach, sich aus den wenigen Hinweisen in der antiken Literatur und den spärlichen Anhaltspunkten aus den Grabungen ein Bild zu machen, wie dieses älteste Forum ausgesehen haben könnte. Zu Hilfe kommt hier die mustergültige Ausgrabung und Publikation einer römischen Kolonie, Cosa, die 263 v. Chr. an der tos-kanischen Küste gegründet worden war.11 Ihr Forum, dessen Ausführung, bedingt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten während des ersten Punischen Krieges, sich über längere Zeit hinzog, ist sicher weitgehend nach stadtrömischem Vorbild konzipiert. Der Forumsplatz liegt, wie auch sonst bei römischen Kolonien, am Treffpunkt der beiden Hauptstraßen. An ihm werden vor allem anderen ein Comitium und eine Curia gebaut, neben denen dann auch bald ein als Gefängnis interpretierter Bau und ein Kultbezirk, der später zu einem regulären Tempel umgebaut wurde, entstanden.12 Ein Podium in diesem Bezirk war vielleicht eine Art Rostra. Nach einer Neuansiedlung von Kolonisten nach Beendigung des Hannibalkrieges wird dann endlich das Forum fertiggestellt. So werden an den drei restlichen Seiten des Forums acht fast identische Geschäftshäuser errichtet, die der Ausgräber Brown wohl zu Recht mit den tabernae am Forum Romanum vergleicht.13 Die Rekonstruktion dieses Forums mag einen Eindruck davon geben, wie der Mittelpunkt Roms im 5. Jh. aussah (Abb. 4).
Abb. 4: Das Forum von Cosa Am römischen Forum erhält im 4. Jh. das Comitium seine runde Form, die wir gerade schon in Cosa sahen, und wie es übrigens in der gleichzeitig mit Cosa gegründeten Kolonie in
10 Vgl. vorläufig A. Carandini, Le origini di Roma, Archeo 48 (Februar 1989), 48ff. 11 Vgl. die Zusammenfassung bei F.E. Brown, Cosa. The Making of a Roman Town, Ann Arbor 1980 12 Das Fassungsvermögen des Comitium wird auf ca. 600 Koloniebürger - von insgesamt wohl 2500 - geschätzt; vgl. ebd., 26. Dies würde bedeuten, daß man schon in relativ früher Zeit nicht mehr an eine Teilnahme aller Bürger an Abstimmungen glaubte. 13 Ebd., 35ff. Da Wohnquartiere in diesen Bauten fehlen, handle es sich um „adaptations of a typical atrium to public or commercial use“.
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
127
Paestum ebenfalls belegt ist. Ein griechischer Einfluß scheint hier ziemlich sicher zu sein.14 Auf den oberen Stufen spätestens dieses neuen Comitium, falls nicht schon bei dessen Vor-gänger, begegnen jetzt Ehrendenkmäler und Erinnerungsstücke in immer größerer Zahl. Eine sehr alte Statue wurde später als die des Hermodoros von Ephesus bezeichnet, der den Römern bei der Abfassung der Zwölf-Tafelgesetze geholfen haben sollte. Statuen des Alki-biades und des Pythagoras standen seit den Samnitenkriegen links und rechts der Kurie.15 Auch auf der Forumsfläche verbreiten sich nun, beginnend mit der columna Maenia für den Sieger von 338 v. Chr., Ehrendenkmäler, Säulen usw. Griechische Beispiele von ‘Stadt-möblierung’ sind zweifellos auch hier wirksam. Daß das Forum nicht nur ein Platz der Politik und für Geschäfte war, sondern daß dort auch seit frühen Zeiten Veranstaltungen der Unter-haltung wie Schauspiele und Gladiatorenkämpfe, Boxwettbewerbe und Tierhetzen statt-fanden, wird aus der Ausstattung der alten tabernae veteres et novae mit Portiken und vor allem mit maeniana, Balkonen, deutlich, von denen man diese Schauspiele besser verfolgen konnte. Umbauten größeren Stils beginnen am Forum allerdings erst am Ende des 3. Jhs., nach dem Krieg gegen Hannibal und vor allem im Gefolge der Siege im Osten des Mittelmeerraumes und der wachsenden Kenntnis griechischer Kultur und griechischer Lebensgewohnheiten. Noch im Jahr 210 v. Chr. gab es nach Livius am Forum keine Basilica.16 Dann entsteht hinter den tabernae novae die basilica Fulvia an der Stelle der späteren basilica Aemilia. 184 v. Chr. kauft der ältere Cato zwei Geschäftshäuser unmittelbar neben dem Senatsgebäude und errichtet dort die basilica Porcia und wenig später baut hinter den tabernae veteres der Vater der beiden Gracchen die basilica Sempronia.17 Diese Basiliken - trotz ihres griechischen Namens rein römische Mehrzweckbauten an den Märkten - erhalten aus der - meist östlichen - Beute ihrer Erbauer einen reichen Schmuck, das Forum wird repräsentativer.18 Hierzu könnte passen, daß die Geschäfte des unmittelbaren Lebensbedarfes, vor allem die mit Schmutz und Gestank verbundenen der Metzger und Fischhändler, langsam aus dem Forum verdrängt werden. An ihrer Stelle waren es jetzt mehr und mehr die tabernae argentariae, die Büros der Bankiers und Geldwechsler, die das wirtschaftliche Bild des Forums bestimmten - eine Entwicklung, die einen durchaus modernen Eindruck macht.19
Der erste der großen Machthaber am Ende der Republik, der dem Forum sein Bild auf-drückte, ohne es jedoch radikal zu verändern, war Sulla. Er baute die ehrwürdige curia Hostilia um und vergrößerte sie auf Kosten des Comitium, um den von ihm auf die doppelte Zahl von nunmehr 600 Senatoren vergrößerten Senat unterzubringen. Das Comitium hatte schon lange nicht mehr ausgereicht, um alle Bürger aufzunehmen. Daß ein Volkstribun des 2. Jhs. bei einer Rede auf den Rostra sich umdrehte und nicht mehr, wie üblich, in Richtung auf das Senatsgebäude, sondern auf die im Forumsareal versammelte Menge sprach, wurde ihm zwar als Buhlen um die Stimmen des Volkes und als Affront gegenüber dem Senat ausgelegt - in der Sache aber hatte er zweifellos recht, sich an die dort versammelte größere Zahl von
14 W. Hoepfner, Bauten der Demokratie, in: W. Hoepfner; G. Zimmer (Hrsg.), Die griechische Polisarchitektur, Tübingen 1993, 86-93, weist auf weitere Versammlungsbauten dieser Art in Metapont und Agrigent hin. 15 Plinius, nat. hist. 34,21 (Hermodor) und 34,26; letztere wurde erstaunlicherweise auf Geheiß des Apoll von Delphi aufgestellt. 16 Livius 26, 27. 17 Unklar bleibt weiterhin die von Steinby erschlossene Basilica an der Ostseite des Forums. E.M. Steinby, Il lato orientale del foro romano, Arctos 21, 1987, 139-184 18 Zur Entstehung der Basilika vgl. zuletzt F. Zevi, L’Atrium Regium, ArchCl 43, 1991, 475-487 19 Livius 26,27,2 argentariae (sc.tabernae) quae nunc novae appellantur
Hartmut Galsterer
128
Bürgern zu wenden.20 Nachdem nun aber im Gefolge des Bundesgenossenkrieges nahezu alle Bewohner Italiens das römische Bürgerrecht erhalten hatten, war der kleine Versammlungs-platz der Quiriten von einst vollends obsolet geworden. Es war ihm jedoch neben der neuen curia Cornelia, die übrigens die Orientierung der alten aufnahm, noch eine kurze Gnadenfrist gegönnt; er wurde vielleicht sogar geringfügig vergrößert. Auf dem Forumsareal ließ Sulla Gänge und andere Vorrichtungen einbauen, um dort aufwendige Spiele und Tierhetzen ver-anstalten zu können. Der Platz selbst wurde jetzt von der vergoldeten Reiterstatue des Dik-tators beherrscht, ebenso wie auf das Forum von oben das unter Sulla renovierte Kapitol mit dem noch heute teilweise erhaltenen Archivgebäude, dem Tabularium, herabblickte. Den großen Einschnitt in der Geschichte des Forums bringen dann die Umbauten Caesars und des Augustus. Unter ihnen verändert sich der Charakter des Forums radikal. Caesar er-baute statt der vom römischen Mob niedergebrannten sullanischen Kurie und dem Rest des Comitium seine eigene curia Iulia, die wir - als ältestes erhaltenes Gebäude - mehr oder weniger in ihrer caesarischen Form noch heute sehen. Der Rest des Comitium wurde planiert und in das Forum einbezogen. Bezeichnend ist aber noch nicht einmal so sehr die Non-chalance, mit der hier ein sog. 'popularer' Politiker den traditionellen Ort der römischen Volksversammlungen beseitigt, sondern die Ausrichtung des Senatsgebäudes: Es ist nämlich nicht mehr auf das Forum Romanum bezogen, sondern auf Caesars eigenes forum Iulium, das in den letzten Jahren des Diktators hinter der alten Kurie entsteht. Daß ihr Versammlungs-lokal nunmehr ein Annex dieses monarchischen Repräsentationsbaues war, dürfte als poli-tische Botschaft den Senatoren sehr deutlich geworden sein. Die Ermordung des Diktators an den Iden des März war auch hierauf eine Antwort. Die verschwundenen alten Rostra wurden durch neue, größere an der westlichen Schmalseite des Forumsareals ersetzt, aber sie ge-wannen keine Bedeutung mehr. Mit Augustus wird das Forum ein Platz dynastischer Repräsentation, verliert dabei aber noch mehr an politischer Bedeutung. Sein Stellenwert ist schon an dem Größenverhältnis zwischen dem alten Forum, das erst jetzt den Namen "Romanum" erhielt, und den nördlich davon im Lauf der nächsten 150 Jahre entstandenen "Kaiserforen" des Augustus und Vespasian, Nerva und Traian abzulesen (Abb. 5). Aber dennoch ist Augustus sicher derjenige, der auch am Forum Romanum am meisten baute. Als er starb, war das Forumsareal buchstäblich von Bauten umgeben, die er oder An-gehörige seiner Familie neu gebaut oder verschönert hatten. Die curia Iulia wurde nach langer Bauzeit von ihm schließlich geweiht. An sie schließt die basilica Aemilia an, in die ein Ehrenmonument für Caius und Lucius Caesar integriert war. Jenseits der sacra via erhob sich der Tempel des vergöttlichten Caesar und vor ihm - an der Stelle des Gerichtslokals der gradus Aureliae - eine weitere Rednertribüne. Den alten Tempel der Dioskuren baute Tiberius kurz nach Christi Geburt neu auf. Die basilica Iulia, der die tabernae veteres und die basilica Sempronia weichen mußten, wurde von Augustus selbst im Namen seiner Adoptiv-söhne Caius und Lucius Caesar geweiht. Die caesarischen Rostra schließlich wurden von Augustus durch die Verbindung mit dem neu errichteten umbilicus urbis, dem symbolischen Nabel der Stadt, und dem miliarium aureum, dem goldenen Meilenstein, von dem aus alle Entfernungen auf den Straßen ins Reich gemessen wurden, zu einer Art Zentrum des Reiches gemacht. Ein Triumphbogen des Augustus im Osten und ein solcher für Tiberius im Westen rahmten das Forumsareal ein.
20 Es handelte sich um C. Licinius Crassus, trib. pl. 145, vgl. Cicero, Lael. 96 und L.R. Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966, 41 und 130f., Anm. 28.
Hartmut Galsterer
130
Die Funktionen des Forums sind nun anders verteilt als in der Republik. Politische Bedeutung besitzt jetzt nur noch die Kurie als Sitz des Senats, obwohl alle wichtigen Entscheidungen nun auf dem Palatin im Kaiserpalast fallen. Meinungsäußerungen des Volks gibt es zwar noch, aber nun nicht mehr bei den zu einem Ritual erstarrten Komitien, sondern im Theater und vor allem im Circus, wo die Anonymität des einzelnen und die große Menge der An-wesenden solche Kritik relativ gefahrlos machen. Was am Forum bleibt, ist die Recht-sprechung. Ursprünglich war der Sitz des Praetors und dann beider Praetoren im westlichen Bereich des Comitium, in der Nähe von Carcer und tarpeischem Fels gewesen. Später ver-legten sie ihre Tätigkeit in die Osthälfte des Forums, wo ab spätestens 74 v. Chr. eine gradus Aureliae genannte Tagungsstätte der römischen Geschworenengerichte belegt ist, nach alter Sitte noch unter freiem Himmel.21 Aber schon bald verschwinden auch die "aurelischen Stu-fen" zugunsten der neuen Rostra vor dem Caesartempel, und die Rechtsprechung, zumindest die der Geschworenengerichte, findet nunmehr in den Basiliken statt. Im wirtschaftlichen Bereich schreitet die "Standortverbesserung" des Forums fort. War der Platz ursprünglich ein Markt im weitesten Sinn gewesen, wie es seine Lage an den beiden wichtigen Straßenverbindungen nahelegte, wurden dann, wie schon gesagt, die für das Pub-likum lästigsten Berufe an den Rand gedrängt. Für die Fleischer dürfte sich auf dem Forum Boarium, dem Rindermarkt zwischen Forum und Tiber, Platz gefunden haben, und für die Fisch- und die anderen Lebensmittelhändler wurde nördlich des Forums spätestens im 3. Jh. v. Chr. ein großer Zentralmarkt, das Macellum, gebaut.22 Auch dieses mußte dann nach dem neronischen Brand aber in ein volkstümlicheres Viertel am Esquilin ausweichen, und an seiner Stelle bauten die Flavier dann das Forum Pacis.23 Neben den Bankierbüros scheinen nun eher Luxuswarenhäuser wie die Horrea Agrippiana am vicus Tuscus unterhalb des Palatin oder die Porticus Margaritaria, nach dem Namen wohl ein auf Perlen und Schmuck spezialisiertes Geschäft, vor dem Hauptaufgang zum Kaiserpalast das Bild bestimmt zu haben. Wieweit das Forum noch dem Verkehr offenstand, ist unklar. Einerseits galten in Rom ja schon seit Caesar tagsüber gravierende Verkehrsbeschränkungen; andererseits dürften die Triumphbögen über den Forumseinfahrten für zusätzliche Beschränkungen gesorgt haben. Die via sacra an der Nordseite des Forums muß aber prinzipiell mindestens offen geblieben sein, denn dort verliefen noch lange in der Kaiserzeit die Triumphzüge. Mit dem Ausbau der Kaiserforen wurden viele staatliche Funktionen dorthin verlegt, so z.B. die Verwaltung, aber auch die Feste der römischen iuventus auf das Augustusforum. Zu er-innern ist auch an die beiden Bibliotheken des Trajansforums. Aber ganz ungenutzt blieb auch das Forum Romanum nicht: Als Nero 66 n. Chr. den armenischen König Tiridates unter großer Anteilnahme der römischen Bevölkerung empfing, geschah dies auf dem Forum. Die Gardekohorten waren vor den Tempeln angetreten und Nero saß als Triumphator auf den caesarischen Rostra.24
21 Zu den gradus Aureliae vgl. C. Krause, Zur baulichen Gestalt des republikanischen Comitiums, Römische Mitteilungen 83, 1976, 31-69, hier 63f. Noch 23 v. Chr. läßt Marcellus als Ädil das Forum mit vela über-spannen, damit die Menge der Prozessierenden keinen gesundheitlichen Schaden nehme. 22 Noch im 2. Jh. v. Chr. gab es allerdings Fleischerstände am Forum, und es wurde dort auch geschlachtet, wie aus der Anekdote bei Livius 44,16,10 hervorgeht. Zu den römischen Märkten vgl. jetzt J.M. Frayn, Markets and Fairs in Roman Italy, Oxford 1993 23 Die Läden wurden in gewissem Umfang in den neuen „Mercati di Traiano“ untergebracht, vgl. E. Tortorici, La “Terrazza domizianea”, l’aqua Marcia ed taglio della sella tra Campidoglio e Quirinale, Bull. Com. 95,2, 1993, 7-24, hier 13. 24 Sueton, Nero 13
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
131
Schauen wir uns nun zum Vergleich Athen an. Wie Rom - und wie im übrigen fast alle alten Großstädte der Antike - entstand die Stadt durch einen Synoikismos, d.h. durch Zusammen-wachsen oder Zusammenlegung mehrerer Dörfer. Die Agora, die dem römischen Forum ent-spricht, ist von der Bronzezeit bis in das 7. Jh. ein Friedhof; die Siedlung scheint unterhalb der Akropolis gelegen zu haben. Doch muß man hier dazu sagen, daß unsere archäologischen Kenntnisse über das mykenische Athen bislang recht begrenzt sind und wir die in der athenischen Überlieferung besonders unterstrichene Bedeutung der Stadt in dieser Zeit nicht gut kontrollieren können. Sitz der Könige war zu diesem Zeitpunkt sicher die Akropolis. Mit dem Ende der mykenischen Epoche beginnt in Athen, wie auch sonst in Griechenland, eine längere Zeit des Niedergangs und des demographischen Rückgangs, die erst im 10. Jh. endet. In dieser Zeit setzt auf der Agora eine bis ins 6. Jh. reichende Wohnbebauung ein, die meist nur durch die Brunnen dieser Häuser nachzuweisen ist. Wann der von der Tradition in die Zeit der mykenischen Könige datierte Synoikismos, der mit dem Namen des Theseus ver-bunden wird, und in welcher Form er stattfand, ist noch unklar - jedenfalls ist die Agora nicht vor dem 6. Jh. zum Zentrum Athens geworden.25 Um 600 v. Chr. scheint man den Entschluß gefaßt zu haben, die Agora einer neuen Bestim-mung zuzuführen (Abb. 6). Jedenfalls werden im Verlauf des 6. Jhs. die Brunnen verfüllt, und die Bestattungen hören auf. Ein Grund für die Wahl dieses Platzes lag sicher darin, daß er relativ eben war und daß über ihn die Straße verlief, auf der die Prozession beim großen Athenafest zu dem Tempel der Göttin auf der Akropolis zog, doch wissen wir nicht, ob auch weitere Motive für diesen Ort sprachen. Wohl in Zusammenhang mit der Evakuierung der bisherigen Nutzer beginnt am Anfang des Jahrhunderts an der Westseite des Platzes, am Fuße eines Hügels, die Bebauung mit öffentlichen Gebäuden. Das Datum liegt zu nahe an den Reformen, durch die Solon 594 v. Chr. dem athenischen Staat eine neue politisch-soziale Ordnung gab, als daß man nicht einen Zusammenhang an-nehmen möchte. Allerdings waren nach einer ernstzunehmenden spätantiken Quelle die Texte von Solons Gesetzen zunächst auf der Akropolis angebracht und wurden erst später in das Prytaneion auf der Agora verbracht, damit jedermann freien Zutritt zu ihnen hätte.26 Dies klingt so, als ob das politische Zentrum in dieser Zeit noch auf der Akropolis gewesen wäre. Den großen Wendepunkt in der Geschichte der Agora stellt, wie gleichzeitig auch für das Forum in Rom, das 6. Jh. dar.27 In Athen ist dies auf lange Strecken das Jahrhundert der Tyrannis der Familie der Peisistratiden, und vielleicht war ihre Tätigkeit für die Agora so wichtig wie die der Tarquinier für das Forum in Rom. Unter der späteren Tholos, dem "Kasino" für den diensttuenden Ratsausschuß (Prytanie), fanden sich Reste eines sehr ansehnlichen Wohnhauses (Gebäude F), das mit einiger Wahrscheinlichkeit als Residenz der Peisistratiden in Anspruch genommen wird.28 In seinem trapezförmigen Grundriß zeigt es sogar gewisse Ähnlichkeit mit der Regia in Rom, doch kann dies natürlich rein zufällig sein. Nördlich davon liegen unter dem späteren Bouleuterion, dem Äquivalent der Senatskurie in Rom, Reste von Gebäuden, die nicht nach Privathäusern aussehen. Falls nicht das Haus der Tyrannen in Athen, die übrigens keine Tyrannen im heutigen Sinn waren und die auch verfassungsmäßig nicht über die anderen adligen Athener herausgehoben waren, aus einer
25 Plutarch, Thes. 24. 26 Pollux 8,28 über Solons axones und kyrbeis. Die Einrichtung der Prytanie geht auf Kleisthenes am Ende des 6. Jhs. zurück; ein Gebäude für die Prytanen kann also nicht älter sein. 27 Dies ist auch der Zeitpunkt, mit dem Boersma seinen Katalog einsetzen läßt. Vgl. J.S. Boersma, Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C., Groningen 1970. 28 J.M. Camp, Die Agora von Athen, Mainz 1989, 51f.
Hartmut Galsterer
132
Abb. 6: Die Agora in der archaischen Zeit ganzen Gruppe von Gebäuden bestand, also auch der Bezirk des späteren Bouleuterion dazu-gehört haben könnte, ist zu überlegen, ob nicht schon im 6. Jh. hier der Sitz des Volksrates, damals also des Rates der 400, war. Ebenfalls in die Mitte des 6. Jhs. scheint der erste Bau der Stoa Basileios an der nordwest-lichen Ecke der Agora zu gehören, wo der panathenäische Prozessionsweg um den Markt-hügel bog und Kurs nach Südost auf die Akropolis nahm. Das Gebäude, das nach den Zer-störungen durch die Perser anscheinend mit dem früheren Material wieder aufgebaut wurde, war der Sitz des archon basileus, des 'Königs-Archon', der nach dem Ende der Monarchie die Aufgaben der früheren Könige in der Rechtsprechung und im Sakralwesen übernommen hatte. In der Hierarchie der athenischen Beamten stand er an zweiter Stelle hinter dem archon eponymos, der dem Jahr den Namen gab. Es fällt auf, daß auch hier - wie in Rom - das 'po-litische' Zentrum mit Ratsgebäude und Wohnung des Tyrannen um einiges von dem 'könig- lichen' Bezirk getrennt ist, wenngleich der König hier nur noch ein auf ein Jahr gewählter Amtsträger ist. Das Gebäude ist - soweit wir wissen - das erste eines Bautyps, der sich bald großer Beliebtheit erfreute und an den Plätzen nahezu aller Städte in der griechischen Welt zu finden war. In seiner einfachsten Form handelt es sich um eine Reihe nebeneinander liegender Kammern bzw. einen oder mehrere große Räume, die durch einen davor liegenden
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
133
Abb. 7: Die Agora in klassischer Zeit, etwa um 400 v. Chr. Säulengang verbunden waren. Der Säulengang bot Schatten, Schutz vor Wind und vor Regen, die abschließbaren Räume dienten der Verwaltung oder konnten vermietet werden. Amtsgebäude für einen Beamten wie hier für den archon basileus gab es in Rom nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ebenfalls aus der Mitte des 6. Jhs. stammt wohl die rechteckige Einfriedung an der Südseite der Agora, die als Sitz der Heliaia, des athenischen Geschworenengerichts, interpretiert wird. Etwas weiter nach Süden wurde ein Gebäude gefunden, das zumindest im 5. Jh. als Gefäng-nis diente. Wenn die zahlreichen dort gefundenen kleinen Medizinfläschchen der Aufnahme des berüchtigten Schierlingssaftes dienten, mit dem ja auch Sokrates hingerichtet wurde, hätten wir hier wieder die Zusammengehörigkeit von Gerichtsplatz, Gefängnis und Hin-richtungsstätte, die wir bereits in Rom konstatieren konnten. Ansonsten ist, mit Ausnahme einiger kleiner Heiligtümer zwischen Ratsgebäude und Königs-stoa, die Agora des 6. Jhs. mit Ausnahme einiger Altäre leer. Mindestens bis in das 4. Jh. fin-den hier auch Wettrennen und andere Sportereignisse statt. Insgesamt hat man den Eindruck, daß auch noch in der Peisistratidenzeit der Hauptplatz Athens, verglichen mit dem römischen in derselben Zeit, eher bescheiden aussah. Auch nach dem Sturz der Tyrannis und den demokratischen Reformen des Kleisthenes, nach den Siegen über die Perser, nach Marathon und Salamis, als das gestiegene Selbstwertgefühl der Athener und die aus dem Seebund nun
Hartmut Galsterer
134
reichlicher fließenden Mittel sich in einer großartigen baulichen Umgestaltung der Akropolis auswirkten, sind die Aktivitäten auf der Agora eher verhalten. Neben der Neuplanung der Akropolis und den Bauten im Piraeus ist die Serie von Baumaßnahmen auf dem Markt sicher nicht unbedeutend, aber keineswegs eine glänzende Selbstrepräsentation der nun unbestritten regierenden Demokratie. Nach den gut dokumentierten Zerstörungen von 480 v. Chr. durch die Perser an Königsstoa und dem oben als Residenz der Peisistratiden vermuteten Gebäude gab es zunächst wohl Re-paraturen. Zuerst wurde, aus ideologischen Gründen, die von den Persern geraubte Statuen-gruppe der Tyrannenmörder erneuert. Danach wurden die Königsstoa und das alte Rathaus wiedererrichtet. Neu hinzu kam in der ersten Jahrhunderthälfte eine weitere Stoa, die "be-malte" genannt nach einem berühmten Zyklus von Historienbildern, die darin ausgestellt waren. Ihre Lage direkt am Eingang der Agora und die Öffnung nach Südosten, abgewandt von den kalten Nordwinden, machten sie zu einem der frequentiertesten Gebäude der Agora und durch die dort ausgestellten Bilder und militärischen Erinnerungsstücke zugleich zu einer wahren Ruhmeshalle der athenischen Kriegsgeschichte. Es ist dies übrigens die Stoa, von der dann die philosophische Schule des Zenon im 3. Jh. ihren Namen erhielt. Ebenfalls in diese Zeit gehört die Tholos, der Aufenthaltsort für die 50 Ratsmitglieder, die für einen zivilen Monat (eine Prytanie) zu dauernder Anwesenheit beim Ratsgebäude verpflichtet waren. Über den Resten des sog. Peisistratidenbaus wird sie als Rundbau errichtet. Nach der Mitte des Jahrhunderts beginnt in Athen die große Zeit des Perikles. Auch weiterhin wird ein Großteil der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Akropolis und dort besonders auf den Neubau des Parthenon verwandt, doch ging auch die Umgestaltung der Agora weiter. Auf dem Markthügel hinter dem Rathaus entsteht der einzige Monumentaltempel am Markt, wohl der des Hephaistos. Interessanterweise wurden in seiner Umgebung große Pflanzkübel gefunden, die eine Grünanlage rings um das Heiligtum belegen (wie in Rom am Trajans-forum). Der Besucher antiker zentraler Plätze hatte also nicht nur die Möglichkeit, in Säulen-hallen und Basiliken sich vor den Unbilden des Wetters und vor allzu großer Sonne zu schüt-zen, sondern er konnte auch in Parks unter Bäumen und Sträuchern lustwandeln - ein Aspekt, der uns heute bei Ausgrabungen meist völlig entgeht. Erst nach einer längeren Unterbrechung gingen in den letzten Jahren des Jahrhunderts, also in der Endphase des peloponnesischen Krieges, die Bauarbeiten an der Agora weiter. Hinter dem alten Ratsgebäude wurde ein neues errichtet und das alte in ein Archiv des Rates ver-wandelt; etwas früher ist vielleicht das langgestreckte Denkmal der zehn Phylenheroen entstanden, das zwischen Ratsgebäude und der Heliaia stand und das der offizielle Publi-kationsort von Gesetzen und sonstigen Bekanntmachungen war. Die Gruppe von Säulen-hallen wurde ergänzt durch die des Zeus Eleutherios, südlich an die des Basileus an-schließend, sowie eine, die den Markt im Süden abschloß. Inschriften legen nahe, daß zu-mindest später hier die Metronomen ihr Büro hatten, d.h. die Beamten, die für die Normal-maße und -gewichte zuständig waren und deren Einhaltung durchzusetzen hatten, was uns daran erinnert, daß auch die Athener Agora selbstverständlich Marktfunktionen hatte. Ein großes Gebäude neben der Süd-Stoa wird als Münze gedeutet, wo die berühmten Athener Eulen hergestellt wurden, also auch hier ein Bezug zum wirtschaftlichen Leben. Die Nord- und die Ostseite des Marktes waren anscheinend im 5. Jh. noch weitgehend Privathäusern und Geschäften vorbehalten, doch entstand am Ende des Jahrhunderts in der nordöstlichen Ecke des Platzes ein Gebäude, das nach den Funden als ein weiterer Sitz - neben der Heliaia im Südwesten - eines der vielen attischen Schwurgerichtshöfe angesehen wird, die jeweils mit mindestens 201 Richtern besetzt waren (Abb. 7).
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
135
Blicken wir am Ende des 5. Jhs. noch einmal auf diesen „zentralen Bezirk“ Athens, dann sehen wir eine größere Streuung der Funktionen als in Rom. Am Markt tagt zwar der Rat, und an ihn, als das auch im demokratischen Athen wichtigste Organ, sind die Büros der aus-schlaggebenden Beamten, vor allem der Strategen, angegliedert. Sitzungsort der Volks-versammlung, der ekklesia, ist nicht die Agora, sondern der etwa einen halben Kilometer südwestlich gelegene Pnyx-Hügel, wo zunächst (unter Kleisthenes?) in den Berg ein theater-ähnlich ansteigender Teilnehmerraum für ca. 5.000 Teilnehmer eingehauen wurde, der später mit Sitzbänken versehen und in einer letzten Ausbaustufe (die allerdings nicht mehr vollendet wurde) sogar mit großen Säulenhallen als Zuflucht für die Bürger bei schlechtem Wetter ausgestattet wurde.29 Der Blick der in der Pnyx versammelten Athener ging nicht, wie im römischen Comitium, in Richtung auf das Ratsgebäude - oder auf den Markt überhaupt -, sondern nach Südwesten in Richtung auf die Stadtmauern. Zwischen dem Platz der Volksversammlung und dem Markt hatte ein weiterer wichtiger Rat seinen Tagungsort, der Areopag oder - offiziell - der Rat auf dem Areopag, in dem, wie im römischen Senat, ex officio alle ehemaligen Archonten saßen. Er galt gegenüber dem aus der Bürgerschaft erlosten Rat der 500 unten auf der Agora immer als etwas elitär und als Konkurrenz zu den demokratischen Institutionen. Deshalb hatte er in Zeiten ausgeprägt demokratischer Verfassung wie im 5. Jh. nur geringe Bedeutung. Unter eher oligarchischen Auspizien wie häufig im Hellenismus und unter den Römern war sein Gewicht erheblich. Nach dem Tod Alexanders war die politische Bedeutung Athens dahin; nur sein kulturelles Prestige machte es noch zum begehrten Partner hellenistischer Herrscher und zu einem Ort, an dem es den Ruf förderte, als Mäzen aufzutreten.30 Der pergamenische König Attalos II. erbaute die heute von den Amerikanern wieder errichtete und als Agora-Museum verwendete Attalos-Stoa an der Ostseite des Marktes. An seinem südlichen Rand entstand eine weitere große Stoa. Beide dienten nach Meinung der Archäologen hauptsächlich als Geschäftszentren und Einkaufspassagen. Das 1. Jh. v. Chr. war für Athen eine schwere Zeit. Die Regierung setzte mit bemerkenswerter Konstanz immer auf die Verlierer in den vielen Kriegen dieser Zeit. Erst mit Augustus kam es zu Ruhe und zu einem bescheidenen wirtschaftlichen Auf-schwung der Stadt, die nunmehr als beliebte Universitätsstadt und Touristenzentrum von der pax Romana profitierte. Schon Caesar hatte Gelder zur Verfügung gestellt, um etwa 100 m östlich der alten Agora einen neuen Markt zu errichten, den dann Augustus fertigstellte - man denkt dabei an das Caesar- und Augustusforum in Rom. Auch eine ähnliche Funktions-verlagerung wie dort ist anzunehmen, denn die Marktfläche der alten Agora wird jetzt immer mehr zugebaut (Abb. 8). Augustus' Schwiegersohn Agrippa baute an der Südseite sein riesiges Odeion, einen der größten Konzertsäle der damaligen Welt, und auf die Platzfläche werden, wohl aus anderen Teilen Attikas, ganze Tempel aus dem 5. Jh. verlagert. Athen wird somit mehr und mehr ein Museum. Nach dieser Neubauperiode ist dann erst wieder am Beginn des 2. Jhs. n. Chr., und nun zum letzten Mal, größere Bauaktivität zu bemerken. An der Straße von der Agora zur Akropolis hinauf läßt der reiche athenische Bürger Flavius Pantainos eine Philosophenschule mit Bibliothek, ein College, errichten und weiht sie Kaiser Trajan und der Stadt Athen. Hadrian, der Griechenfreund und Bürger Athens, stiftet der Stadt eine große Basilika an der Nordseite des Platzes und errichtet das zusammengefallene Odeion des Agrippa aufs neue. Da er zudem neben dem Augustusmarkt eine neue, große Bibliothek bauen ließ und den
29 H. Kourouniotes; H.A.Thompson, The Pnyx in Athens, Hesperia 1, 1932, 90-217. 30 Zu dieser Epoche jetzt Chr. Habicht, Athen. Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, München 1995.
Hartmut Galsterer
136
Tempel des olympischen Zeus nach 700 Jahren endlich fertigstellte, konnten die Athener ihn zu Recht als Neugründer der Stadt ehren. Er war aber auch der letzte römische Kaiser, der in großem Stil auf der Agora investierte - und eventuell noch vorhandener Bauwille in Athen ging mit dem wirtschaftlichen und militärischen Chaos des 3. Jhs. unter. Im 4. Jh. wird die Agora weitgehend aufgegeben. Vergleicht man die Entwicklung, so kommt einem der Unterschied zwischen dem 'demokra-tischen' Athen und dem 'hierarchischen' Rom, um Zankers oben zitierten Unterschied wieder aufzunehmen, gar nicht so groß vor. Man könnte fast behaupten, daß das republikanische Forum mit der starken Betonung des Comitium neben der curia einen demokratischeren Eindruck machte. Allerdings ist auffällig, daß das Comitium seit dem 6. Jh. nicht mehr ver-größert wurde, obwohl die Zahl der Bürger von den ersten, nur in der Größenordnung ver-trauenswürdigen Censuszahlen vom Beginn des 5. Jhs. bis zum Bundesgenossenkrieg min-destens um das Dreißigfache stieg. Auch in der Kolonie Cosa, von der oben die Rede war, bot das Comitium Platz vielleicht für ein Viertel der Bürgerschaft. Es kann wohl nicht Inten-tion gewesen sein, daß die außerhalb der Stadt wohnenden Bürger sich in größerem Umfang an den Wahlen beteiligten. Charakteristisch im Vergleich zu Rom ist das frühzeitige Aufkommen von speziellen Amts-häusern oder Verwaltungsgebäuden für Beamte.31 Neben dem 'Eichamt', von dem oben schon die Rede war, scheint es südlich der Ratsgebäude den Sitz der Strategen, das Strategeion, gegeben zu haben. Da die Strategen in der Verfassung des klassischen Athen das wichtigste Wahlamt waren, von dem aus sowohl die allgemeine Politik betrieben wie auch der Ober-befehl im Krieg geführt wurde, müßte man das Gebäude, von dem nur noch unscheinbare Reste erhalten sind, dementsprechend als Regierungssitz bezeichnen. Wir wissen nicht, was die Strategen dort machten, aber wir hören, daß gewissenhafte Generäle wie Nikias, der spätere Verlierer in der Schlacht von Syrakus, sich den ganzen Tag dort aufhielten.32 Die Be-fehlshaber der athenischen Kavallerie, die Hipparchen, scheinen hingegen in der Nordwest-ecke der Agora, dort, wo die Panathenäenstraße auf den Markt mündet, ihre Büros gehabt zu haben und dort, auf der freien Marktfläche, ihre Reiter auch trainiert und gemustert zu haben. Alle diese Identifikationen sind keineswegs sicher, aber Hinweise bei Aristoteles und in dem Reiseführer des Pausanias lassen sie zusammen mit Inschriften, die an oder bei den er-wähnten Gebäuden gefunden wurden, als halbwegs plausibel erscheinen. In Rom kennen wir nichts derartiges: Konsuln, Prätoren usw. hatten ihre Büros, falls man sie so nennen kann, zuhause, ebenso wie sie auf die Dienste privater Sklaven und Freigelassener zurückgriffen und nicht auf von der Bürgerschaft aus ihren eigenen Reihen gewähltes Subalternpersonal.33 Erst in der Kaiserzeit gibt es in Rom spezialisierte Verwaltungsbauten wie z.B. die Porticus Minucia als Hauptquartier der römischen Nahrungsmittelversorgung oder die statio aquarum als Sitz des Direktors der Wasserversorgung.
31 Pausanias 10,4,1 schreibt in einem oft zitierten Satz über das Städtchen Panopeus in Phokis: "wenn man den Namen Stadt auch einem solchen Ort geben darf, der weder Amtsgebäude noch Gymnasium, weder Theater noch Marktanlagen besitzt...". In römischen Städten sind sie nicht belegt; die immer wieder aufgenommene Identifikation der drei Gebäude an der Südseite des Forums von Pompeji mit Kurie und den Amtsgebäuden der Ädilen und Duovirn mag für die Kurie stimmen, ist für die beiden letzteren aber sicher unfundiert. 32 Plutarch, Nikias 5,1. 33 Vitruv erwähnt noch für die augusteische Zeit, daß Angehörige der oberen Klassen in ihren Häusern basilika-ähnliche Räume für staatliche Aufgaben haben sollten.
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
137
Interessant ist schließlich vielleicht auch noch die relative Lage der Bauwerke zueinander. Während in Athen die Volksversammlung relativ weit vom Rat entfernt tagte und so viel-leicht einfacher eine gewisse Unabhängigkeit bewahren konnte, lag das römische Comitium direkt am Eingang zum Ratsgebäude und wird deshalb häufig als vestibulum curiae, als Vorraum des Senats, bezeichnet.34 Ich kann nicht den Finger auf den einen oder anderen besonders charakteristischen Unter-schied zwischen Athen und Rom legen. Entweder ist also die oben zitierte Interpretation, das "demokratische Erscheinungsbild der klassischen griechischen Polis" und die "hierarchischen Strukturen in Rom" müßten sich auch in der Architekturplanung niedergeschlagen haben, falsch - oder vielleicht ist der Unterschied zwischen Athen und dem seiner Verfassung nach ja ebenfalls nicht so oligarchischen Rom der Republik doch nicht so groß wie häufig ver-mutet wird. Insofern würde sich das Ergebnis dieser historischen Interpretation archäolo-gischer Quellen gut mit neueren Untersuchungen etwa zu Polybios, unserer frühesten Quelle zur römischen Verfassung, decken.35
34 Livius 45,24,12: in comitio, in vestibulo curiae und ähnlich 6,23,3; 22,59,16 und 30,21,4. 35 F. Millar, The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C., JRS 74, 1984, 1-20, de-diziert Polybio nostro; vgl. Ders., Politics, Persuasion and the People before the Social War (150-90 B.C.), JRS 76, 1986, 1-11. Zuletzt beschäftigte sich mit dem Thema eine Sektion des Historikertages in Leipzig 1994, deren Vorträge nun gedruckt vorliegen: M. Jehne (Hrsg.), Demokratie in Rom. Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik, Historia-Einzelschriften 96, Stuttgart 1995.
Hartmut Galsterer
138
Literaturhinweise Boersma, J.S., Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C., Groningen 1970.
Brown, F.E., Cosa. The making of a Roman town, Ann Arbor 1980.
Camp, J.M., Die Agora von Athen, Mainz 1989.
Carandini, A., Le origini di Roma, Archeo 48, (Februar 1989), 48-60.
Coarelli, F., Il foro Romano I, II, Rom 1983, 1985.
Cornell, T.J., The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000 - 264 B.C.), London; New York 1995.
Frayn, I.M., Markets and Fairs in Roman Italy, Oxford 1993.
La grande Roma dei Tarquini (Ausstellungskatalog Rom 1990).
Habicht, Chr., Athen. Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, München 1995.
Hoepfner, W.; Zimmer, G. (Hrsg.), Die griechische Polisarchitektur und Politik, Tübingen 1993.
Jehne, M. (Hrsg.), Demokratie in Rom. Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Re-publik, Historia-Einzelschriften 96, Stuttgart 1995.
Kolb, F., Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike, München 1995.
Kourouniotes, H; Thompson, H.A., The Pnyx in Athens, Hesperia 1,1932, 90-217.
Krause, C., Zur baulichen Gestalt des republikanischen Comitiums, Römische Mitteilungen 83, 1976, 31-69.
Millar, F., The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C., JRS 74, 1984, 1-20.
Ders., Politics, Persuasion and the People before the Social War, JRS 76, 1986, 1-11.
Steinby, E.M., Il lato orientale del foro romano, Arctos 21, 1987, 139-184.
Ders. (Hrsg.), Lexicon topographicum Urbis Romae, Rom 1994ff.
Taylor, L.R., Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Cae-sar, Ann Arbor 1966.
Tortorici, E., La “Terrazza domizianea”, l’aqua Marcia ed taglio della sella tra Campidoglio e Quirinale, Bull. Com. 95,2, 1993, 7-24.
Zanker, P., Forum Romanum. Die Neugestaltung durch Augustus, Tübingen 1972
Ders., Pompeji. Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform, Trierer Winkelmannsprogramm 9, 1987.
Zevi, F., L’Atrium Regium, ArchCl 43, 1991, 475-487.
"Zentrale Plätze in antiken Städten"
139
Abbildungsnachweis: Abb.1: Curtius, L.; Nawrath, A., Das antike Rom, 4. Aufl. München 1963, Beilage, Abb.2: Das alte Rom mit dem Triumphzug Konstantins im Jahre 312 n. Chr. Rundgemälde von den Professoren J. Bühlmann und A. Wagner in München, München 1890, Abb.3: Coarelli, Foro Romano, I 50 Abb. 14, Abb.4: Brown, Cosa, Abb. 52, Abb.5: Curtius-Nawrath, antikes Rom, Abb.6: Camp, Agora, 43 Abb. 21, Abb.7: ebd., 101 Abb. 66.
"Refugiantennetze im 16. Jahrhundert"
141
Wolfgang Kaiser (Marseille)
"FREMDE IN ANDEREN LÄNDERN ODER FREMDEN GLEICH IN IHRER HEIMAT"
REFUGIANTENNETZE IM 16. JAHRHUNDERT Das 16. und 17. Jahrhundert waren durch Mobilität geprägt, zum großen Teil durch er-zwungene Mobilität. Sie waren wie das 20. Jahrhundert Jahrhunderte der Vertreibung. Die Wanderungen einzelner oder ganzer Bevölkerungsgruppen wurden zu einem nicht un-wesentlichen Teil durch den Religionskonflikt provoziert, den Konflikt zwischen Islam und Christentum und den Auseinandersetzungen zwischen den sich herausbildenden christlichen Konfessionen. Bekannt ist, wie Genf und Frankfurt als Drehscheiben bei der Weiterleitung und Aufteilung der hugenottischen Glaubensflüchtlinge insbesondere nach 1685 fungierten.1 Zu dieser Zeit existierte ein ausgebautes System kirchlicher und herrschaftlicher Insti-tutionen, die effizient ineinandergriffen und die Flüchtlingsströme lenken konnten. Im 16. Jahrhundert war die Situation für Glaubensflüchtlinge unwägbarer und unübersichtlicher. Worauf konnten sich die im weitesten Sinne evangelischen Refugianten, um die es im folgenden gehen soll, stützen? Auf die Städte, die Zuflucht und eine prekäre Überlebens-möglichkeit boten, und auf die Beziehungsdichte und überlegene Informationsökonomie des Städtenetzes. Nicht nur die - intensiv untersuchten - Beziehungen zwischen den reformato-rischen Zentren entschieden über den Weg, den Refugianten nahmen, ökonomische Ver-flechtungen innerhalb des Systems der Messen und Plätze, familiäre Verbindungen und politische Bündnisse (Städtebünde sowie Bündnisse zwischen evangelischen Städten und Fürsten) spielten gleichermaßen eine Rolle. Im folgenden sollen nicht die großen Gestalten der Reformation im Vordergrund stehen. Es wird vielmehr gleichsam ein Seiteneinstieg gewählt, um einen spezifischen Refugiantenblick auf die Stadt, ihre Ressourcen und Handlungsspielräume, und auf das Kommunikationsnetz zwischen den Städten zu skizzieren. 1. 1581 erschien in London eine Schrift mit dem Titel "Forma d'una Repubblica Catholica".2 Der nicht genannte Verfasser schlug darin als Heilmittel für die Verwirrungen, die man zur Zeit "nella religione et repubblica christiana" vorfinde, ein Universalkonzil vor, "un libero e santo concilio". Da indes die mächtigen Prälaten, die "non solo nella religione, ma anche nella repubblica" regierten, ein solches Konzil niemals zulassen würden, müsse man die "uomini di bene" zu einem "corpo di repubblica sano" zusammenfassen, einem imaginären republikanischen Körper, der sie über räumliche Entfernungen und die Unterschiede der Gesetze und Völker hinweg vereinen würde, ohne daß sie ihr Heimatland verlassen oder sich ihren Fürsten und Obrigkeiten entfremden müßten. Auf einen Grundbestand von Glaubens-überzeugungen gesundgeschrumpft und mit klaren moralischen Maßstäben operierend, würde dieser "corpo di repubblica sano" den verdorbenen Körper der Kirche von seinen Mißständen befreien. Die "repubblica catholica" oder "universale" sollte gebildet werden von "diversi col-
1 Michelle Magdelaine und Rudolf von Thadden (Hrsg.), Die Hugenotten, München 1985 (frz. Ausgabe: Le Refuge huguenot, Paris 1985). 2 Abgedruckt in: Cantimori/Feist (Hrsg.), Per la storia degli eretici italiani, Rom 1937, 169-209 [daraus die folgenden Zitate; Übers. von mir, W.K.].
Wolfgang Kaiser
142
legi d'uomini, i quali vivono forastieri per gli altrui paesi, o come forastieri in casa loro" [als Fremde in den anderen Ländern oder Fremden gleich in ihrer Heimat]. Das ist kurzgefaßt die Vision einer Republik der Refugianten und der in ihrer Heimat unter Ausnahmegesetz stehenden Häretiker, sprich: einer Geheimgesellschaft von Fremden. Die Grundeinheiten des ausschließlich aus (im Unterschied zum Klerus nicht korrumpierten) Laien gebildeten Ordens sollten die "colleghi" (mindestens zwei bis drei Personen) bilden, auch "academia, compagnia, fraternità" genannt, die sich einmal wöchentlich ["eher vor als nach dem Mittagessen"] versammeln sollten. Der Verkehr zwischen den verstreuten Collegien sollte über Briefwechsel geschehen, wofür ein "cancelliere" bestimmt werden mußte, der imstande sein sollte, "jene Allegorien und Chiffren" zu handhaben, die je nach Land oder Person am ge-eignetesten erschienen. Das vorgeschlagene Organigramm war geprägt durch die für Geheim-gesellschaften typische Mischung von Initiation und Mißtrauen. Als höchstes Gremium war eine "dieta generale" vorgesehen, der die "sopraintendenza e sovranità di tutta questa republica" zustehen sollte (zusammengesetzt aus Deputierten der Kollegien). Der Tagungsort sollte wechseln: entweder sollte sie auf der "terra di qualche gentilhuomo o signore", dem Gut eines befreundeten Herrn stattfinden, oder aber in einer großen Stadt mit einer europäischen Messe "come Francoforte, Lione, Parigi e simili". Unter dem Schutz der zur Messe strömenden Menschen könnten sich die Deputierten "senza sospetto o im-pedimento alcuno" [ungehindert und ohne Verdacht zu erregen] bewegen und versammeln. Deshalb sollten die Deputierten das Kleid von Kaufleuten oder ähnlich unverdächtigen Personen tragen. Besser noch sollte man wirkliche Kaufleute zu Deputierten wählen. Die Kodifikation nikodemitischer Praktiken ging noch weiter. Den "cittadini" (wie die Mit-glieder des Ordens bezeichnenderweise genannt werden) der "repubblica catholica" in Ländern wie Italien oder Spanien, in denen die Repression so hart war, daß eine Organisation in Kollegien unmöglich schien, empfahl der anonyme Autor den Gebrauch von Metaphern, Allegorien, Wortspielen, Ironien, die man zu jeder Zeit und an jedem Ort verwenden kann, "perchè fra quei che s'intendono basta un minimo cenno, onde potranno trattare di queste cose per i ridotti, per le botteghe, per le chiese, per le piazze, per le corti, e dovunque si adunano brigate: o finalmente alle tavole stesse." [denn unter denen, die sich verstehen, genügt die geringste Andeutung, deshalb können sie über diese Dinge an jedwedem Versammlungsort, in den Wirtshäusern, Kirchen, auf Plätzen oder Höfen oder überall dort sprechen, wo mehrere Menschen zusammenkommen, letztendlich einfach bei Tisch].3 Delio Cantimori hat bereits auf die Parallelen hingewiesen, die diese Geheimorganisation zu jener der italienischen Täufer aufweist. Augenfällig sind auch die Verbindungslinien zur Tra-dition der mehrdeutigen Sprache, die sich von Descartes' Vorstellung von der Denkfreiheit gebenden "List"4 über Graciáns Stil der Andeutungen und Beziehungen, der Beiworte,
3 Siehe Delio Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, übers. von Walter Kaegi, Basel 1949, 380-382. Frances A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London 1964, Ndr. Chicago 1978, 343-344, ordnet ihn in die hermetische Tradition ein, vor allem auf Grund seines Aufenthalts in Prag, als er mit Dee zusammenkommt und Visionen hat, in denen ihm der Erzengel Uriel erscheint und ihm aufträgt, nach Rom zu gehen. 4 Zur Notwendigkeit des verhehlenden Schreibens in Descartes Discours de la méthode (1637), Salvatore S. Nigro, "Liebe und Haß", Nachwort zu Torquato Accetto, Von der ehrenwerten Verhehlung, Berlin 1995, 93-100; ital. Della dissimulazione onesta (1641), Ndr. 2. Aufl. Genua 1990. Jean-Pierre Cavaillé, Descartes. La fable du monde, Paris 1991, Kap. VI: La liberté de feindre. Vgl. ebenfalls, zur Verteidigung der ehrenwerten Dissimulation durch Giordano Bruno, John Bossy, Giordano Bruno and the Embassy Affair, New Haven-London 1991, 125-126, 140-146 (dt. Übers.: Agent der Königin. Giordano Bruno und die Londoner Bot-schaftsaffäre 1583-1586, Stuttgart 1995).
"Refugiantennetze im 16. Jahrhundert"
143
Gleichnisse und doppelsinnigen Worte5 bis zur doppelten Begrifflichkeit Spinozas ziehen läßt.6 Verhehlendes Sprechen und Verhalten dienen indes bei Pucci nicht nur dem Über-wintern in einer feindseligen Umgebung, sondern verfolgen offensive Ziele, sind auf den Sieg des Geheimordens über die Kräfte der Verderbnis gerichtet. Hier sind weniger die immanenten Probleme der literarischen Gattung, die Traditionslinie protestantischer Utopien, oder die innere Dynamik der Geheimgesellschaften von Interesse. Gestellt werden soll zunächst die Frage nach dem Verfasser dieser "realistischen Utopie" und nach den Erfahrungen, die seinen Vorstellungen zugrunde gelegen haben.7 Der hier für eine "Refugianten-Republik" der Fremden plädierte, war selbst ein ruheloser Re-fugiant, der Florentiner Francesco Pucci. Durch die Forschungen insbesondere Delio Canti-moris und Luigi Firpos den Spezialisten wohlbekannt, steht er im Schatten nicht nur der großen Reformatoren, sondern auch der bedeutenden "häretischen" oder einfach heterodoxen Denker italienischer, englischer oder französischer Herkunft, mit denen er verkehrte.8 Fran-cesco Pucci (geboren 1541 – gestorben 1597) entstammte einer wohlhabenden Florentiner Familie, den Pucci di Dino, nicht den vornehmeren, Kardinäle in ihrer Familie zählenden Pucci di Pucci, die ihn später wegen Verwandtschaftsusurpation verklagten. Zunächst für das Ordensleben bestimmt, schickte ihn sein wohlhabender Onkel, ein römischer Juwelier, nach Lyon in eine Kaufmannslehre. Nach dessen Tod und der für ihn damit verbundenen Erbschaft entdeckte Pucci im Alter von 27 Jahren seine Berufung: daß er nicht fürs Kontor, sondern für theologische Studien geschaffen sei. Er schrieb sich an der Sorbonne ein und schloß sich unter dem Eindruck der Bartholomäusnacht den "oltramontane sètte" - italienischen refor-matorischen Gruppen - an.9 Ende 1572 ging er nach London und wurde dort Mitglied der reformierten italienischen Gemeinde. Als er auf der allgemeinen Priesterschaft und dem Mitspracherecht jedes Gemeindemitglieds in Glaubensdingen beharrte, geriet er in Konflikt mit den strengen kalvinistischen Pastoren, die meinten, diese Zeiten seien vorbei. Er schrieb sich an der theologischen Fakultät in Oxford ein und erhielt dort den akademischen Grad des B.A. Mit den Querelen seines Aufenthalts in England begann eine vierzehnjährige Wanderzeit für Francesco Pucci, der sich mit traumwandlerischer Sicherheit sogleich mit der jeweiligen vor Ort herrschenden Orthodoxie anlegte. Sein Weg führte nach Basel (1577-1578), wo er seine Schriften zur Verbrennung abgeben mußte, zurück nach London (1579-1581), dann nach
5 Balthasar Gracián, Das Handorakel [Oracúlo Manual, 1647], übers. von A. Schopenhauer, Stuttgart 1980, z.B. Maxime 25 (Winke zu verstehen wissen), Maxime 43 (Denken wie die wenigsten und reden wie die meisten). Werner Krauss, Graciáns Lebenslehre, Frankfurt a.M. 1947; Gerhart Schröder, Logos und List. Zur Entwicklung der Ästhetik in der frühen Neuzeit, Königstein/Ts., 1985, 93-150 (Kap.3: Der Text als List). 6 Yirmiyahu Yovel, Spinoza and Other Heretics. Vol. I: The Marrano of Reason. Vol. II: The Adventures of Im-manence, Princeton-Oxford 1989, dt. Übers.: Spinoza. Die Abenteuer der Immanenz, Göttingen 1994, Kap.5: Spinoza, die Menge und die mehrdeutige Sprache; Gabriel Albiac, La Sinagoga vacía, Madrid 1987, frz. Übers.: La Synagogue vide. Les sources marranes du spinozisme, Paris 1994. 7 Miriam Eliav-Feldon, "Secret Societies, Utopias, and Peace Plans: The Case of Francesco Pucci", in: The Journal of Medieval and Renaissance Studies 14 (1984), 139-58; Dies., Realistic Utopias: The Ideal Imaginary Societies of the Renaissance, Oxford 1982. 8 John Dee, Bernardino Ochino, Celio Secundo Curione, Lelio Sozzini, François Baudouin, Sebastian Castellio, Guillaume Postel; siehe Elie Barnavi und Miriam Eliav-Feldon, Le périple de Francesco Pucci. Utopie, hérésie et vérité religieuse dans la Renaissance tardive, Paris 1988. 9 Vgl. seine Lebensschilderung im Brief an Papst Clemens VIII. (Amsterdam, 5.8.1592), in: Francesco Pucci, Lettere, Documenti e testimonianze, a cura du Luigi Firpo e Renato Piattoli, Bd. 1, Florenz 1955, 139-149, hier 144.
Wolfgang Kaiser
144
Krakau, wo er seine Auffassungen, mit denen er überall Anstoß erregte,10 vor der Refu-giantengemeinde vertrat. 1585 schwur er in Prag vor dem päpstlichen Nuntius ab und kehrte in den Schoß der katholischen Kirche zurück - als weiterhin wenig orthodoxer Christ. Man dürfe doch, gab er Papst Clemens VIII. in einem Brief aus Amsterdam am 5. August 1592 zu bedenken, die "soldati di frontiera", die "corpo a corpo" im offenen oder versteckten Glau-benskampf stünden, nicht den gleichen "minuti leggi" [kleinlichen Gesetzen] unterwerfen wie die gewöhnlichen Gläubigen.11 Die Bittbriefe nutzten ihm letztlich wenig. Im April 1593 wurde er in Salzburg verhaftet und in Ketten nach Rom gebracht, wo er 1597 enthauptet und sein Körper auf dem Campo di Fiori verbrannt wurde. Francesco Pucci war weniger ein christlicher "Grenzsoldat" als vielmehr ein Grenzgänger zwischen den sich herausbildenden konfessionellen Orthodoxien. Sein bewegter Lebensweg macht ihn zu einer interessanten Gestalt. Er ist sicherlich nicht repräsentativ, wohl aber auf-schlußreich und signifikativ für jene Gruppe der "wandernden Christen", der er sich in einem Brief von 1584-1585 an Lelio Sozzini selbst zurechnet.12 Deren Grenzfall bildeten vielleicht die italienischen Refugianten in Krakau. Dort veröffentlichte Marcello Squarcialupi de Piombino 1588 in lateinischer Sprache ein Glaubensbekenntnis des nach Krakau geflüchteten Arztes Simone Simoni aus Lucca, der "zuerst Katholik, dann Kalvinist, anschließend Lutheraner, schließlich wiederum Katholik, aber immer Atheist" gewesen sei.13 2. Die beiden Versionen jener wahren christlichen Gesellschaft der "uomini di bene", die Franceso Pucci aus der Erfahrung seines unsteten Wanderlebens destilliert, definieren die "repubblica catholica" über einen Grundstock von Glaubensüberzeugungen, vor allem aber über Kommunikationsformen und Kommunikationsstrukturen, die Zusammenhalt und Konti-nuität des Collegiums gewährleisten sollten. Einmal durch eine doppelte Informations-ökonomie, die Verwendung des Geheimnisses als "einer soziologischen Technik, als einer Form des Handelns".14 Die Verwendung doppelsinniger Zeichen und Wörter soll eine untergründige Kommunikationsebene unter Eingeweihten schaffen, das Band zwischen ihnen fester knüpfen, einen inneren Wert der Zugehörigkeit und die Distinktion zu den anderen aufbauen. Der Kodex nikodemitischer Verhaltensweisen soll umgekehrt das Überleben der Geheimgesellschaft in feindseliger Umgebung sichern. Zweitens durch die wirksame Ausnutzung der städtischen Informations- und Verkehrsökonomie: über das Handels-, Post- und Botenwesen konnten die Angehörigen der Geheimgesellschaft verschlüsselt Verbindung miteinander halten, ohne selbst zu reisen. Die Verkehrsverbindungen zwischen den Städten ermöglichten den "wandernden Christen", bei Gefährdung oder sich andernorts bietenden Chancen rasch von einer zu einer anderen Stadt zu ziehen. Messen boten die Möglichkeit, unerkannt, verkleidet zusammenzukommen.
10 Kindliche Unschuld, Unsterblichkeit Adams vor dem Sündenfall, gegen kalvinistische Prädestination, natür-liche Güte des Menschen, Möglichkeit auch für Heiden, dank des lumen naturale zur Erkenntnis Gottes und zum Heil zu kommen. 11 Pucci, Lettere, op. cit., Bd.1, 148. 12 "Ex sessione XXXV concilii peregrinantium christianorum", Cantimori, Häretiker, op. cit., 369. 13 John Tedeschi, "Italian Reformers and the Diffusion of Renaissance Culture", in: Sixteenth Century Journal 5:2 (Okt. 1974), 79-94, 84; zitiert bei Barnavi/Eliav-Feldon, Le périple de Francesco Pucci, op. cit., 167. 14 Georg Simmel, "Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft, in: Ders., Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (1908), zitiert nach: Gesamtausgabe, Bd. 11, hrsg. von Oskar Rammstedt, Frankfurt a.M. 1992, 383-455, hier 407.
"Refugiantennetze im 16. Jahrhundert"
145
Die "Ecclesia Peregrinorum" und die "repubblica catholica" sind auf Kommunikation, Ver-kehr und den Commerce der Menschen gegründete, urbane Organisationsformen. Augen-fällig sind die Parallelen zu Vorstellungen von der christlichen Gemeinde, wie sie der während der reformierten Herrschaft in Lyon tätige Pierre Viret entwickelte. Neben der klassischen Körpermetapher, mit der er paulinisch die Amtskirche begründet, gebraucht er für die Kirchenzucht ein anderes Bild: "Die Disziplin der Kirche ist wie die Sehnen und Nerven in einem Leib. Ohne sie hast Du nur ein wirres Durcheinander von Lastern und liederlichen Menschen, eine Synagoge statt einer Kirche Gottes und einer heiligen Com-pagnie, die sich im Namen Jesu Christi versammelt."15 Die Gemeinde gleicht einem mensch-lichen Netzwerk der Kommunikation, beseelt durch Gottes Kraft - und freilich auch gelenkt durch den Pfarrer, der als Mund Gottes und als Mund der Gemeinde allein das Wort ergreift (hier würde Pucci Einspruch erheben - seine Geheimgesellschaft ist gleichsam die "église invisible terrestre"). Der Bezug auf die Stadt und das urbane Kommunikationsnetz unterscheidet Puccis Vorstellung beispielsweise von den klandestinen Täufergruppen, die sich am Oberrhein über Herrschaftsgrenzen hinweg zusammenschlossen, aber angesichts der Repression gezwungen waren, sich außerhalb der Städte zu versammeln, sich in Dörfern zwischen den größeren Zentren oder gar in unwegsamen Gegenden anzusiedeln. Sie nutzten nicht die Knotenpunkte, sondern die Maschen des Städtenetzes aus und bauten ein strukturell randständiges Verbindungsgeflecht auf. Eine gewisse Analogie ließe sich ziehen zur Herrschaftsgrenzen ausnutzenden räumlichen Organisation des Landjudentums im Elsaß und in der Markgraf-schaft Baden.16 Der Zusammenhang der urbanen Orientierung mit dem sozialen Erfahrungshintergrund der hier bislang betrachteten Refugianten, die in gesteigertem Maße Außenseiter waren, liegt auf der Hand. Für sie war die Stadt Bühne und Schauplatz der theologischen Dispute, der Diskussionsraum schlechthin. Das Städtenetz bildete einen diskursiven Raum, in dem sich die gebildeten Glaubensflüchtlinge bewegten und um Ämter oder Positionen als Korrektoren, Professoren usw. konkurrierten.17 Städte wie Basel und Straßburg, die Zentren des Buch-drucks waren und zugleich eine Universität oder zumindest eine Hohe Schule besaßen oder aufbauten, konzentrierten in ihren Mauern Möglichkeiten für gelehrte Refugianten, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und waren natürlich besondere Anziehungspunkte für sie. Auch die Häretiker und Querdenker gehörten zu jenen, die unter das (von ihnen gelehrt mißdeutete) Verdikt der radikalen reformatorischen Bewegungen fielen - zu den "Gelehrten, den Verkehrten".18 3. Die Möglichkeit, eine im städtischen Raum verborgen wirkende "Republik der Re-fugianten" zu imaginieren, ergab sich aus einem spezifischen historischen Kontext. Die 15 Paulusbrief: Epheser 4:15-16. Pierre Viret, Instruction chrestienne en la doctrine de la loy et de l'evangile, et en la vraye philosophie et theologie, 2 Bde., Genf 1564, Pkt. 2, 360-363, zitiert nach Natalie Zemon Davis, "Das Heilige und der gesellschaftliche Körper", in: Dies., Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit, Berlin 1986, 64-92, 154-157, hier 87. 16 Siehe die Berichte über die Täuferversammlungen, z.B. in Eckbolsheim westlich von Straßburg (in der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1545, in: Quellen zur Geschichte der Täufer, bearb. von Marc Lienhard, Stephen F. Nelson und Hans Georg Rott, Elsaß, IV. Teil, Stadt Straßburg 1543-1552, Gütersloh 1988, 143-145. 17 Erich Kleinschmidt, Stadt und Literatur in der Frühen Neuzeit. Voraussetzungen und Entfaltung im südwest-deutschen, elsässischen und schweizerischen Städteraum, Köln, Wien 1982. 18 Carlos Gilly, "Die Gelehrten, die Verkehrten", in: Antonio Rotondò (Hrsg.), Forme e destinazione del mes-saggio religioso. Aspetti della propaganda religiosa nel Cinquecento, Florenz 1991, 229-375.
Wolfgang Kaiser
146
Stationen von Puccis europäischen Peregrinationen waren keineswegs zufällig gewählt (Basel, London, Krakau, Amsterdam), es waren Orte einer relativen Toleranz. In Basel fanden beispielsweise viele der italienischen Dissidenten Zuflucht. Die Stadt befand sich in einer besonderen Zwischenstellung. Sie war seit 1501 verbündet mit den eidgenössischen Orten und deren Vermittlerin par excellence mit den süddeutschen Reichsstädten, insbesondere mit Straßburg, das Basel in Bündnisse einzubeziehen suchte.19 Die Städte hatten im oberrheinischen Raum auch in anderer Hinsicht eine wichtige Brokerposition: Straßburg und Basel waren 1525 drittständische Vermittler zwischen den Bauernhaufen und deren markgräflichen und österreichischen Herren. 1529 hatte Basel die Reformation offiziell eingeführt, ihr Glaubensbekenntnis von 1534 war jedoch so offen formuliert, daß sich die italienischen Glaubensflüchtlinge in Basel darauf berufen konnten. Es war eine Zwischen-phase (1540er-1570er Jahre), in der die Frontstellung der Italiener und Sébastien Castellios gegen Calvin in Basel geduldet, ja von dem lutherisierenden Münsterprediger Simon Sulzer vielleicht sogar nicht ungern gesehen wurde. In dieser vergleichsweise offenen Situation - oder wie der Calvinist François Hotman bei seinem Aufenthalt in Basel kritisch vermerkte, unter der laschen Kirchenzucht Sulzers - lag der Handlungsspielraum der italienischen Refugianten, die Möglichkeit, religiöse Fragen offen zu diskutieren. Dem aufmerksamen Beobachter Michel de Montaigne fiel dies 1580 bei seinem Aufenthalt in Basel sofort auf: "M. de Montaigne jugea qu'ils estoient mal d'accord de leur religion par les responses qu'il en receut: les uns se disans zinglens, les autres calvinistes, et les autres martinistes [Lutheraner]; et si fut averty que plusieurs couvoint encore la religion romene dans leur coeur."20 Diese Offenheit galt indes nur im kleinen Kreis der Elite: Thomas Platter beschäftigte Täufer auf seinem Landgut, mit einem vorsichtigen Brief schickte der Basler Rat dem Markgrafen Ernst Miguel Servets Traktat gegen die Trinitätslehre nach Rötteln. Der Täufer David Joris konnte unbehelligt "mit dem Gitzifell" leben, nach außen hin rechtgläubig in Basel als angesehener Bürger leben und in seinem Binniger Wasserschloß über seine Familie und Sekte herrschen.21 Bereits vor seiner Ankunft war er Gegenstand einer reichen Korres-pondenz zwischen Straßburg und Basel.22 Der Rat und die führenden Bürger - Amerbach, Sulzer, der Pfarrer Gast, Platter - wußten um sein Geheimnis. Auch das war eine Verwendung des Geheimnisses als soziologische Technik - als Herr-schaftstechnik für die Definition sozialer Grenzen. Innerhalb des kleinen Kreises der führen-den Bürger durften die der Bürgerschaft gesetzten Normen überschritten werden. Nach außen hin tat der Rat so, als sehe er nicht, was vor sich ging: er "sah durch die Finger", wie Sebastian Franck in seiner Sprichwörtersammlung das Verb "dissimulieren" in die Volks- 19 Thomas A. Brady Jr., Turning Swiss. Cities and Empire (1450-1550), Cambridge usw., 1985; Ders., Protestant Politics: Jacob Sturm (1489-1553), Atlantic Highlands, N.J., 1995 (dt. gekürzte und veränderte Ausgabe: Zwischen Gott und Mammon. Protestantische Politik und deutsche Reformation, Berlin 1996). 20 Michel de Montaigne, Journal de voyage en Italie, in: Ders., Oeuvres complètes, hrsg. von A. Thibaudet und M. Rat (Ed. Pléiade), Paris 1962, 1128-1129; dt. Übers.: Tagebuch einer Badereise, übers. von O. Flake, Frankfurt a.M. 1980, 54: "Der Herr von Montaigne fand, daß sie über ihre Religion sehr uneins waren, den Antworten nach zu urteilen, die er von ihnen hörte. Der eine nannte sich Zwinglianer, der andere Calvinist, der dritte Martinist, und so kam der Herr von Montaigne auf den Gedanken, daß verschiedene noch der römischen Religion in ihrem Herzen den Vorzug geben möchten." 21 D.h. sich mit dem Ziegenfell bedecken. um wie Jakob zu täuschen (Genesis 27). Vgl. Wolfgang Kaiser, "Vicini stranieri. L'uso dei confini nell'area di Basilea (XVI-XVII secolo)", in: Quaderni Storici 90: 3 (1995), 601-630. 22 Quellen zur Geschichte der Täufer, op. cit., Teil III, Stadt Straßburg 1536-1542, Gütersloh 1986, 156-231 (Gespräch von Joris mit den Straßburger Täufern, 1538); IV, 119-21 (Straßburg schickt Basel die Artikel der Joristischen Sekte, 1544), 122 (Straßburg warnt Basel vor den Joristen, 1544).
"Refugiantennetze im 16. Jahrhundert"
147
sprache übersetzte.23 Die offene Diskussion war unter der Voraussetzung sozialer Ab-schottung denkbar, Öffentlichkeit und Heimlichkeit bedingten einander: so löst sich der scheinbare Widerspruch zwischen dem Zwang zur Dissimulation und dem Wissen innerhalb der Elite um das Geheimnis der Refugianten. In die Politik der Städte hinsichtlich der Aufnahme von Refugianten gingen jedoch auch ganz andere als religiöse Fragen ein, die von den Glaubensflüchtlingen kaum zu beeinflussen waren. Ermöglichte die oligarchische Abschottung der Entscheidungsinstanzen in Genf eine großzügige Bürgeraufnahme von Refugianten (die angesichts der vielen geflohenen Alt-gläubigen für die Ankurbelung der Wirtschaft willkommen waren), so spielten in Straßburg und Basel Ansehen und Wohlstand der Refugianten eine wesentliche Rolle, Faktoren, die nur durch Spezialwissen kompensiert werden konnten, wenn überhaupt.24 Deutlich wird dies bei den englischen Glaubensflüchtlingen, die nach der Thronbesteigung Maria Tudors vorüber-gehend ihre Heimat verließen (1554-58). Sie wurden mit offenen Armen aufgenommen, weil ihr Aufenthalt von vornherein als temporärer geplant war. Das Exil der Geistlichen und Adligen in Straßburg, Frankfurt, Basel oder Genf wurde von englischen Bankiers gleichsam "gesponsert", von einem Konsortium mit dem Ziel finanziert, die Geschäftsbeziehungen mit diesen Städten zu verstärken.25 Das ökonomische Interesse an einer florierenden Buchproduktion, die europaweit die Nachfrage nach Kontroverstheologie und Polemik bediente, ließ den Basler Rat nicht das Instrument der Zensur flexibel handhaben, sondern geschicktes Spurenverwischen durch Angabe falscher Druckorte anregen.26 Er unterstützte auch offiziell durch briefliche Eingaben den Druck der ersten europäischen Ausgabe des Koran. Der Drucker Froben konnte sogar so weit gehen, daß er um seines Talmud-Druckes willen nach Rom schrieb und behauptete, er würde sofort nach Rom ziehen, und überhaupt sei er immer noch Katholik. Die Drucker waren bekanntermaßen zentrale Anlaufstellen und Mittelsmänner im Verbindungsgeflecht zwischen Glaubensflüchtlingen, sie bildeten eine Brücke zu anderen Milieus als den "intellektuellen Refugianten".27 Als der Basler Drucker Thomas Platter um 1544 die Leitung der Münsterschule übernahm, beschloß er, sich aus der gemeinsam mit Oporinus28 be- 23 Sebastian Franck, Erste namenlose Sprichwörtersammlung vom Jahre 1532, hrsg. von F. Lautendorf, Poesneck 1876, Ndr. Hildesheim-New York 1970 [die Zuschreibung an Sebastian Franck wird bestritten]. 24 Siehe zu Castellio Hans R. Guggisberg, Sebastian Castellio 1515-1563. Humanist und Verteidiger der religiösen Toleranz im konfessionellen Zeitalter, Göttingen 1996. 25 Christina Hallowell Garrett, The Marian Exiles. A Study in the Origins of Elizabethan Puritanism, Cambridge 1938, Ndr.1966, 7-8. Philippe Denis, Les Eglises d'étrangers en pays rhénans (1538-1564), Paris 1984, 83-86. 26 Siehe auch die Anfrage des Herrn de Falais beim Straßburger Rat: Straßburg wurde auf Anraten Bucers als Druckort seiner Apologie angegeben, er sei aber bereit, die Angabe streichen zu lassen, Quellen zur Geschichte der Täufer, op. cit., Elsaß, IV. Teil, 241 (29.1.1548 aus Basel). Jacques de Bourgogne, seigneur de Falais, Enkel eines natürlichen Sohns Philipps des Guten, war Rat Karls V. und aus Glaubensgründen aus den Niederlanden nach Straßburg, später nach Basel gereist. Die Apologie stammt aus der Feder Calvins: Jean Calvin, Excuse de noble seigneur, Jaques de Bourgoigne [...] pour se purger ver la M. Imperiale des calomnies à luy imposées, en matiere de sa Foy, dont il rend confession, Genf: Jean Gérard, 1547, Ndr. Paris 1896, Genf 1911 (ed. Alfred Cartier). 27 Vgl. Peter G. Bietenholz, "Der italienische Humanismus und die Blütezeit des Buchdruckes in Basel. Die Basler Drucke italienischer Autoren von 1530 bis zum Ende des 16. Jahrhunderts", in: BBG 73 (1959); Ders., Basle and France in the Sixteenth Century: The Basle Humanists and Printers in their contacts with francophone culture, Genf 1971; Carlos Gilly, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt, Basel 1985. 28 Johannes Herbster genannt Oporin; siehe etwa Max Geiger, Die Basler Kirche und Theologie im Zeitalter der Hochorthodoxie, Zürich 1952, 24 (sein Ausruf: "der tüffel hett uns mit dem nüwen basttum beschissen").
Wolfgang Kaiser
148
triebenen Druckerei zurückzuziehen. Einen Teil seiner Bücher verkaufte er auf der Frank-furter Messe und erhielt kaum den Papierpreis, "die ich aber zu Basell noch hatt, koufft mier Jacob de Puyß ab von Paryß. minen werchzüg aber zu der trukerey gab ich Petro Bernae wolfeill zu kouffen".29 Der zweite Käufer, Pietro Perna, wurde einer der bedeutendsten Basler Drucker der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Luccheser war mit der ersten Welle von Flüchtlingen nach Basel gekommen, hatte sich dort 1542 an der Universität immatrikulieren lassen und 1557 das Bürgerrecht und die Safranzunft erworben.30 Er nutzte seine Familien- und Handelsverbindungen, verschickte seine Bücher in Warenballen versteckt nach Italien und wurde postwendend bei einem Aufenthalt in Lucca 1548 verhaftet. 4. Damit wird auf andere Verbindungslinien hingewiesen, die in Francesco Puccis Vorstel-lungen nur angedeutet sind und die uns von den theologischen und kulturellen Höhen hinab-führen in das profanere Milieu des Kontors. Pucci hatte wie erwähnt in seiner Utopie angeregt, die Deputierten der Geheimgesellschaft sollten sich zur Messezeit in Frankfurt, Lyon oder Paris treffen, als Kaufleute verkleidet. Es folgte der merkwürdig anmutende Vorschlag, besser noch sollte man wirkliche Kaufleute zu Delegierten wählen. Der Geldschneider und notorische Lügner und Betrüger, der Kaufmann als Vertreter der "repubblica catholica" der wahren Christen! Für einen Augenblick wechselt Pucci hier von einer Außensicht der Ressourcen der Stadt zur Frage, wie die Refugianten sich stärker im sozialen Körper der Stadt verankern, in ihm teilweise aufgehen können. Er hatte während seiner Lehrzeit in Lyon (1563) zwar nicht mehr die Herrschaft der Reformierten erlebt, wohl aber gesehen, daß innerhalb der italienischen Nation eine reformierte Gemeinde, namentlich von Lucchesern, weiterexistierte, geschützt durch Fremdenprivileg und eine starke ökonomische Stellung. Einen tieferen Einblick in die Refugiantenexistenz des Kaufmanns bietet die Lebens-beschreibung des Luccheser Kaufmanns Pompeo Diodati, die er am Ende seines Lebens in Genf als calvinistische Rechtfertigungs- und Heilsgeschichte verfaßte. Er war nach eigener Aussage bereits von seiner evangelischen Mutter insgeheim im rechten Glauben erzogen worden - in Lucca, einer Hochburg des Protestantismus, das den Katholiken als die "città infetta" per excellence galt.31 Er kam im Zuge einer Geschäftsreise just in dem Augenblick nach Lyon, als die Hugenotten die Macht in der Stadt übernahmen, und wurde von den calvinistischen Geistlichen endgültig bekehrt. 1566 ging er nach Paris (und eine Kleinstadt in der Nähe), wo er in der italienischen Kaufmannskolonie Verwandte hatte. Seine Lebensschil-derung ist interessant, weil sie die besonderen Probleme des protestantischen Kaufmanns in einer Verfolgungssituation zeigen: das zeitweise Exil und die Rückkehr (nach dem zweiten und dritten Bürgerkrieg), den Kampf um die Rückgabe des beschlagnahmten Eigentums und um die Rückzahlung gewährter Darlehen usw. In seiner Rechtfertigungsgeschichte schreibt er 29 Thomas Platter, "Selbstbiographie" (1499), in: Thomas und Felix Platter, Zur Sittengeschichte des XVI. Jahr-hunderts, hrsg. von Heinrich Boos, Leipzig 1878, Ndr. Nördlingen 1989, 97. 30 Walter Bodmer, Der Einfluß der Refugianteneinwanderung von 1550-1700 auf die schweizerische Wirtschaft. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühkapitalismus und der Textilindustrie, Zürich 1946, 75, Anm. 101; Werner Kaegi, "Machiavelli in Basel", in: Ders., Historische Meditationen, Zürich 1942, 131; Antonio Rotondò, "Pietro Perna e la vita culturale e religiosa di Basilea fra il 1570 e il 1580", in: Ders., Studi e ricerche di storia ereticale italiana del Cinquecento, Turin 1970, 273-391; Simonetta Adorni-Braccesi, "Una città infettà". La repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento, Florenz 1994, 308 und Anm. 250 (mit weiterer Literatur). 31 "Discorso fatto al nome di Dio, da me Pompeo Diodati, cittadino di Lucca, di molte gracie che ho ricevuto da Dio, fatto a Aquisgrana addì 20 di febraro 1575", abgedruckt in: Vincenzo Burlamacchi, Libro di ricordi degnissimi delle nostre famiglie, a cura di Simonetta Adorni-Braccesi, Rom 1993, 137-160. Zu Lucca siehe Simonetta Adorni-Braccesi, "Una Città infetta", op. cit.
"Refugiantennetze im 16. Jahrhundert"
149
gegen zweierlei an: gegen die Lauheit und den Glaubenszweifel, der im Zögern zwischen der Bewahrung von Besitz und Stellung und dem offenen Eintreten für das Wort Gottes deutlich wird; und gegen den schwarzen Fleck in der Lebensgeschichte - die erzwungene Konversion oder zumindest das äußerliche Verleugnen des Glaubens in und nach der Bartholomäusnacht, der religiöse Stachel im Herzen der Nikodemiten. Pompeo Diodati geht 1575 endgültig nach Genf und gehört 1593 mit anderen Lucchesern - Turrettini, Cesare Balbani (zu denen auch Pucci Kontakt hat) - zu den Gründern der "Grande Boutique", der größten Seidenhandelsgesellschaft. Seine Nachlaßbilanz zeigt weitverzweigte Beteiligungen in Genf, Frankreich, der Schweiz, in Flandern und ein Depot beim ge-nuesischen Banco San Giorgio.32 Hier sind es die ökonomischen Beziehungen der starken Luccheser Kaufmannskolonien in Lyon, Antwerpen usw., die nach der gescheiterten republikanischen, gegen die Spanier gerichteten Verschwörung unter Führung Francesco Burlamachis (er wird 1541 in Mailand hingerichtet) den Exodus en bloc der Luccheser Protestanten erleichtern, der sie vor allem nach Genf, aber auch nach Basel führt (Pietro Perna gehört zu ihnen, der Piemonteser Curione war Hauslehrer der Burlamachi). In einer zweiten Welle verlassen protestantische Luccheser Kaufleute nach 1576 Antwerpen. Die "Lucca Connection" ist aufgrund ihres ökonomischen Potentials das augenfälligste Bei-spiel dafür, wie Glaubensflüchtlinge bestehende wirtschaftliche und familiäre Verbindungen ausnutzten. In ähnlicher Weise nutzten Marseiller protestantische Kaufleute wie Benoît Montchal und Valentin Holtzheuser ihre Geschäftsverbindungen mit Lyon und Genf. Ihre Position als Agenten beispielsweise des Handelshauses Georg Obrecht & Israël Minckel (Lyon und Straßburg) oder als Geschäftspartner der Genfer Kaufleute Nicolin Ferrat und François de Brumont machten sie umgekehrt in Marseille als - heimliche oder potentielle – Protestanten kenntlich, weil man geschäftliche Beziehungen als Indiz religiöser Überein-stimmung deutete.33 Die Geschäftsbeziehungen ermöglichten zum einen Risikostreuung, sie boten einen gewissen Schutz gegen den Verlust des Eigentums. Und sie ermöglichten Zwischenlösungen. Sie erleichterten nicht nur den endgültigen Weggang, sondern ein zeit-weiliges Exil und die Rückkehr, im Falle Marseilles das Pendeln im Dreieck Genf-Lyon-Marseille.34 Refugianten- und Bürgerexistenz verbanden sich in der gleichzeitigen Präsenz des Kaufmanns, selbst oder durch Faktoren oder Beteiligungen an mehreren Plätzen. 5. Puccis Vision der Refugiantenrepublik, deren Angehörige miteinander kommunizieren, ohne daß die "cittadini" reisen müssen, die sich am System der Messen und Plätze orientiert und deren beste Delegierte ehrliche Kaufleute sind, liegt am Schnittpunkt zweier Kommunikationsnetze und zweier sozialer Erfahrungsräume. Einerseits die Verbindungen zwischen den "frei-schwebenden" Gelehrten (die die Nähe zur Macht suchen müssen, um zu überleben), die als erste das Augenmerk auf sich ziehen. Andererseits die ökonomischen Verflechtungen, die Verbindungen des Kaufmanns (im Widerstreit zwischen Geschäft und Glauben), der oftmals als
32 Bodmer, Einfluß, op. cit., 47-48. 33 Wolfgang Kaiser, Marseille im Bürgerkrieg. Sozialgefüge, Religionskonflikt und Faktionskämpfe, 1559-1596, Göttingen 1992, 228-229; Ders., "Récits d'espace. Présence et parcours d'étrangers à Marseille au XVIème siècle", in: Jacques Bottin und Donatella Calabi (Hrsg.), La città e i luoghi degli stranieri. XII-XVIII secolo, Venedig, Paris, 1998; Liliane Mottu-Weber, Economie et Refuge à Genève au siècle de la Réforme: La draperie et la soierie (1540-1630), Genf 1987, 136. 34 Deutlich bei Robert Begue, der zwischen Genf und Marseille lange hin und her pendelt und mit den Brüdern Hermitte in geschäftlicher Verbindung bleibt, Lettres de négociants marseillais: Les Frères Hermitte, 1570-1612, ed. Micheline Baulant, Paris 1953.
Wolfgang Kaiser
150
fremder Resident ebenfalls als unsicherer Kantonist gilt. Diese geraten den Exulanten zumeist erst nach ihrer erfolgreichen Niederlassung in der Fremde ins Blickfeld. In der Praxis gibt es Überlagerungen und wechselseitige Verstärkungen: die Existenz als Kaufmannskolonie unter Fremdenprivileg erleichterte das Überwintern der italienischen Protestanten in Lyon, die Risiko-streuung über Geschäftsbeteiligungen und -vertretungen ermöglichte Zwischenlösungen. Das Bild von den "wandernden Christen" verweist auf die äußerliche Stellung des Re-fugianten gegenüber der Stadtgesellschaft: er nutzt die Ressourcen der Stadt, ohne in ihr Fuß zu fassen: er ist ein Gast, der nicht bleibt. Dagegen kommen die Exulanten-Kaufleute in der Absicht, mit ihren stadtübergreifenden Verbindungen Geschäfte zu machen und vielleicht Fuß zu fassen. Sie mobilisieren damit die latente Fremdenfeindlichkeit der Stadt, das Mißtrauen der Obrigkeit gegenüber jenen, die zugleich drinnen und draußen sind, über Verbindungen verfügen, die über den Mauerring hinausreichen, den Argwohn gegen Andersgläubige. Der praktische, in vielen Städten nur mühevoll erreichte Kompromiß von wirtschaftlicher und politischer Integration und religiöser Differenz ist die kontrollierte Duldung von Fremdengemeinden (in Basel erst in den 1570er Jahren).35 Gegenüber Puccis flexiblem Kommunikationsmodell stellt dies eine von Burgen und Zitadellen geprägte Landschaft dar. In der konfessionellen Landschaft der "Hochorthodoxie", wie man diese Phase für Basel ab etwa 1580 nennt, wurde für die unabhängigen Köpfe die Luft knapp, die Basler Druckerpresse des Pietro Perna stand still. Die Ambiguität der Utopie Francesco Puccis, in der sich die Refugiantenexistenzen des Ge-lehrten und des Kaufmanns überschneiden und die die Ressourcen der Stadt positiv wertet, kontrastiert mit dem Blick, den Calvin auf die Stadt richtet: seinen Kampf gegen die "Liber-tiner", welche die Stadtreformation auf höchste gefährden, gegen die Mode - "nostre Seigneur n'est point un tailleur de robbes" - und seine Orientierung am Refuge ("Salus"). Calvin ima-giniert eine Refugiantenrepublik, die strenger Zucht unterworfen ist und eine Organisation ausbildet, die es ihr ermöglicht, in einer feindlichen Welt der Herrscher und Staaten zu überleben.36 Die beiden hier skizzierten Stränge kommen in Pernas vergifteter Waren-lieferung - theologische Schriften in Stoffballen verborgen - sinnfällig zusammen. Die evan-gelische Botschaft und die Tuche werden über dieselben Kommunkationswege verschickt, um ganz Unterschiedliches zu transportieren. Wer hat langfristig mehr Erfolg, Buch oder Ballen? Bei Pietro Pernas Sendung nach Lucca der Ballen.
35 Wichtiger Förderer war der Kaufmann Marco Perez aus Antwerpen (wiederum die "Lucca Connection"); die Erlaubnis zum Hausgottesdienst erhielt die Gemeinde erst 1572, siehe Wolfgang Kaiser, "Les étranges fantaisies des Welsch". La communauté réformée de langue française à Bâle entre ressentiments xénophobes et solidarité religieuse (XVIe-XVIIe siècle)", in: Gabriel Audisio (Hrsg.), Religion et identité. Actes du colloque inter-national, Aix-en-Provence, octobre 1996, Aix-en-Provence 1998. Erster offiziell anerkannter Pfarrer der fran-zösischen Gemeinde wurde der in den 1560er Jahren aus Marseille geflüchtete Pastor Mathieu Virelle. 36 Heiko A.Oberman, "'Europa afflicta': The Reformation of the Refugees", in: Archiv für Reformations-geschichte 83 (1992), 91-111 [Calvin-Zitat: C.R. Calv.op. 49: 681 C (Sermon 8 über 1 Kor. 10: 19-24)].
"Stadtkultur im Industrierevier"
151
Eckart Pankoke (Essen)
STADTKULTUR IM INDUSTRIEREVIER.
LOKALE NÄHE UND REGIONALE NETZE 1. Soziale Räume, funktionale Zonen, kulturelle Felder In seiner "Soziologie des Raumes" weist Georg Simmel (1903) darauf hin, daß 'sozialer Raum' nicht nur geographisch zu vermessen und zu begrenzen ist, sondern immer auch als soziale Gestalt und Gestaltung soziologisch zu beobachten und zu beschreiben ist - also nicht nur als "eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern auch als eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt". Im industriellen Ballungsraum an Rhein und Ruhr aber verlieren die klassischen Grenzen bürgerlicher 'Stadtkultur' ihre Konturen. Raumbildend wurden eher die funktionalen Schienen und Zonen industrieller Systembildung. In dieser Industrielandschaft, wo nichts gewachsen scheint, sondern alles gemacht und ge-plant werden muß, gelten Machbarkeit und Künstlichkeit erst recht für die Kulturentwicklung sowohl im Blick auf die 'Skyline' der weithin ausstrahlenden Attraktionen, wie für die 'Szenen' kulturellen Alltags 'vor Ort'. Zugleich aber zeichnen sich gerade in der kulturellen Entwicklung neue Muster ab: In der Krise urbaner Kultur werden regionale Netzwerke zur Chance, kulturelle Profile neu zu entwickeln. Netzwerke und Lernprozesse sind nicht nur gefordert für die hochkulturelle 'Skyline' der überregional ausstrahlenden Attraktionen, son-dern auch für die soziokulturellen 'Szenen' des sub- und interkulturellen Alltags 'vor Ort'. Kulturelle Anbieter und Nachfrager müssen lernen, sich regional zu vernetzen. Das Ruhrgebiet gibt sich gerne in großen Formaten. Zum "starken Stück Deutschland" paßt dann die "starke Kultur" eines von schwerer Arbeit und großer Industrie geprägten "Wir"-Ge-fühls. Doch Solidarität lebt nicht nur aus einer Kultur der Stärke, sondern gründet zugleich auf sozialer Nähe, wo man sich noch 'mitten drin' ('milieu') erleben kann. Kulturelle Bürgernähe fand festen Grund in einer flächendeckend ausgebauten Infrastruktur kultureller Versorgung mit Stadtbüchereien, Musikschulen, Volkshochschulen, Stadtteil-zentren und Revier-Parks. "Wo Arbeit ist, muß Kultur hin" - so vor 70 Jahren Essens Bürgermeister Hans Luther, als er in schwerer Zeit das Folkwang-Museum für das Ruhrgebiet retten konnte. "Kultur und Arbeit", das blieb Schlüsselmotiv der Entwicklung des Industriereviers zur Kulturlandschaft. Nirgendwo sonst sind Kulturfragen so eng verbunden mit den Strukturfragen der industriellen Entwicklung. Zu erinnern ist an traditionelles Mäzenatentum der Ruhr-Industrie bis hin zum heutigen 'Initiativkreis Ruhr'. Initiative kam aber auch aus Bürgerschaft und Arbeiterbewegung. Legendär wurde der Auftakt der Ruhrfestspiele im Austausch von "Kunst gegen Kohle". Dies fand Ausdruck in dem am runden Tisch von Politik, Verwaltung und Wirtschaft entwickelten "Aktionsprogramm Ruhr" mit dem richtungweisenden Programmteil "Kulturel-les Leben im Ruhrgebiet". In der Strukturkrise wird kultureller Mangel spürbarer als sonst. Zugleich bedroht der Spar-zwang der kommunalen Haushaltskonsolidierung gerade die freien Felder kulturellen Engagements. Im Verteilungskampf wird dann deutlich, daß "Kultur" machtpolitisch nur
Eckart Pankoke
152
wenig Gewicht hat. Wo im "zur Permanenz erklärten Stammtisch" (so der Ruhrgebietsdichter und -kritiker Erik Reger um 1930) der Kommunalpolitiker das Maß der Mitte den Ton angibt, findet Kultur nur wenig Stimme. Dies nährt Vorurteile: Die repräsentative 'Skyline' der Bildungsbürger wirkt distanzierend elitär, aber auch alternative Szenen schüren in bürger-schreckender Exzentrik Berührungsängste. Ohnehin scheint der Stadthorizont für die Dynamik der regionalen Kulturentwicklung zu eng und zu starr geworden. Längst scheint das bildungsbürgerliche Stammpublikum des 'alten Reviers' und eine darauf fixierte traditionelle Arbeiterbildung auf- und abgelöst durch junge und wache kulturelle Öffentlichkeit, deren Suchbewegung nicht mehr an der eigenen Stadt-grenze halt macht, sondern die kulturellen Potentiale dieses weiten und dichten Kulturraumes zu aktivieren lernt. So wie die kulturell aktiven Szenen ihre kulturellen Anlaufstellen regional zu vernetzen wissen, könnte auch die kommunale Kulturpolitik neues Profil gewinnen, wenn sie für in-novative Lernprozesse und für regionale Netzwerke offener wird. Dazu ermutigen neue Wege und Netze: die Umstellung der Kulturverwaltung auf Eigenbetrieb und Selbststeuerung in Dortmund, die Pflege der durch das überkommunale Projekt "Kultur 90" angestoßenen Diskurs-Kultur, die produktive Spannung von bürgerlicher und alternativer Kulturpolitik, die engagierte Allianz von Kultur und Wirtschaft, die stadtübergreifenden Theater-Kooperationen. Institutionelle Rahmen für solche Lernprozesse regionaler Vernetzung bietet das städteverbindende "Sekretariat für gemeinsame Kulturpolitik", aber auch der tradi-tionsreiche "Kommunalverband Ruhr". Daß bei der kulturellen und ökologischen Erneuerung alter Industriereviere sich Innovation mit Partizipation verbinden kann, zeigt sich im Vorfeld der "Internationalen Bauausstellung Emscherpark" (IBA). So wie die kulturell aktiven Szenen sich regional zu vernetzen wissen, könnte auch kommunale Kulturpolitik neues Profil gewinnen, wenn sie für innovative Lernprozesse und für regionale Netzwerke offener würde. 2. 'Revierkultur' und 'Kulturregion' Im Modernisierungsprozeß vom 'alten Revier' zu neuer Regionalität erinnert der Begriff des 'Reviers' an die kleinräumig zergliederten Lebensräume der 'Colonien' und 'Quartiere', die weit unterhalb des Maßstabes der modernen Stadt zu orten sind. 'Region' steht dann für die Modernisierung mit der Ausbildung funktionaler Zonen und Zentren, die die Menschen zwang, sich funktional zu orientieren. Mobilität steuert sich nun durch die kalkulierte Erreichbarkeit solcher Funktionen. Die Raumforschung spricht hier von industrieller Ballung. Damit kommt zugleich zum Ausdruck, daß die Muster und Werte alteuropäischer Polis-Kultur sich verlieren könnten. Zumindest werden die funktionalen Schienen moderner Lebensführung kaum noch jenen Blick aufs Ganze freigeben, der dazu auffordert, sich auf kulturellen Feldern und in öffentlichen Räumen mit seiner Welt kritisch und konstruktiv auseinanderzusetzen. Die kritische Vogelperspektive eines die engen Grenzen durchbrechenden Überblicks oder Durchblicks riskierten im 'alten Revier' allenfalls 'freischwebende' Intellektuelle wie der Dichter Erik Reger, der 1931 seinen Roman "Union der festen Hand" veröffentlichte, dessen eigentlicher Held das Ruhrgebiet ist, wie es sich im inneren Monolog darstellt:
"Es war ein Land von gewaltiger Gegensätzlichkeit und Weitmaschigkeit, wo seit hundert Jahren alles ein Anfang war und in hundert Jahren nichts abgeschlossen sein konnte; ein Land nicht schön, nicht häßlich bloß nützlich [...].
"Stadtkultur im Industrierevier"
153
Es war jetzt noch ein planloses, achsenloses, zielloses Durcheinander, eine naive An-sammlung barbarischer Gegensätze, ein von hundert widerspruchsvollen Fluchtlinien-festsetzungen ineinander geschachteltes Straßendickicht, ein von hundert widerspruchs-vollen Ideologien überschwemmtes und von Heuschreckenschwärmen sogenannter Kulturträger heimgesuchtes Menschenmaterial. Nirgends sonst saßen die Menschen so dicht zusammen, nirgends sonst lagen so viele Städte von solcher Größe und Wichtigkeit und dabei doch so verschiedenen Antlitzes nebeneinander. Aber nirgendwo sonst waren die Menschen so isoliert in Gruppen, und nirgendwo sonst die Städte einer Provinz so weit entfernt von einer wirtschaft-lichen, kulturellen und verwaltungs- und verkehrstechnischen Einheit".1
Die Vision einer 'neuen Mitte' vermittelte jüngst der Gasometer auf dem verlassenen Hütten-gelände bei Oberhausen, der zusammen mit dem zugehörigen Hüttenwerk abgerissen werden sollte. Doch die Internationale Bauausstellung Emscherpark (IBA) verrechnete die dazu fälligen Abbruchkosten mit Fördermitteln der Landesplanung und Denkmalpflege. So ent-stand ein imposantes Denkmal für die Monumentalität großer Industrie, zugleich aber auch ein riesiger Resonanzkörper für museale und musikalische Installationen, in denen die Ge-schichte dieses Raumes sich spiegeln kann. Attraktiver für die Bevölkerung erscheint aber die Möglichkeit, aus schwindelndem Höhenblick das Revier als Landschaft zu erleben. Am Fuße des Gasometers weitete sich die industrielle Brache des mit dem Traditionsnamen "Gute-Hoffnungs-Hütte" auf vorindustrielle Gründung rückverweisenden Montankomplexes aus. Hoch oben auf dem Gasometer kann man ermessen, wie weit sich in der Montankrise die Industriebrache ausdehnte, während sich zugleich die Brachfläche als neuer Baugrund erweist, mitten in dichtester Besiedlung und verkehrsmäßig anschließbar an weiträumig mobilisierbare Kaufkraftströme. Die Zentrierung aller Wege auf die einstigen Produktionszentren bieten nun für beliebige Zwecke eine verkehrstechnisch perfekt erschlossene Zentralität allseitiger Erreich-barkeit. Was lag im industriell längst brachliegenden Emschertal bei Oberhausen dann näher als um-zuschalten und ein solches im Schnittpunkt der großen Verkehrsstraßen und Einzugs-schneisen liegendes industrielles Zentrum der Arbeitsgesellschaft nun als 'Centr-O' für die Kommerzialisierung einer post-industriellen Erlebnisgesellschaft zu nutzen. Zumindest ver-sprechen die externen Investoren sich davon Profit und gute Rendite, wobei gerade das fremde Kapital und die vielen Filialen multinationaler Anbieter doch schon an Globali-sierung, wenn nicht an Kolonisierung denken lassen. Im Ruhrgebiet wird solch exzentrische Zentralität bei aller versprochenen Beschäftigungs-wirksamkeit für den Standort allerdings eher mit Sorge betrachtet. Dies ist zum einen die Sorge der nun unter scharfe Konkurrenz kommenden Geschäftsleute der Nachbarstädte. Die Befürchtung scheint realistisch, daß die neu zentrierten Attraktivitäten des Mega-Konsums die regionalen und überregionalen Kaufkraftströme an allen anderen Anbietern vorbeiziehen werden. Die Politiker kommunaler Wirtschaftsförderung befürchten als Preis der neuen Prächtigkeit eine Verödung der benachbarten Innenstädte. Ernst zu nehmen ist aber auch die Sorge einiger Kulturpolitiker, daß die neue Attraktivität der "neuen Mitte" nicht nur Kaufkraft abschöpft, sondern auch das knappe Gut Aufmerksamkeit verbraucht. Kulturpolitische Zielgruppen, die bislang immer ansprechbar waren, wenn sie als Produzenten und auch als Konsumenten dem öffentlichen Raum ihrer Heimatstadt verbunden waren, verlieren nun im Sog des neuen Glanzes ihren soziokulturellen Raumbezug. Die sich 1 E. Reger, Union in fester Hand. Roman einer Entwicklung, Berlin 1931, Neuauflage 1946, 588f.
Eckart Pankoke
154
schon jetzt schärfer abzeichnende Amerikanisierung des Alltags wird zudem dadurch sym-bolisiert, daß sich im Centr-O werbewirksam all die Marken finden lassen, die weltweit den Amerikanismus symbolisieren: von Hollywood bis Dallas. Symbolische Ortsbezogenheit signalisiert auch die als Marktplatz inszenierte "Coca-Cola-Oase" als bunte Arena für schnellen Zugriff und Imbiß - die Kommunikation kommt von der Videowand vor einer leeren Mitte. Doch solch eine 'Konsum-Arena' wird kein 'Kultur-Forum' und bleibt als Plaza des industriellen Kommerzes weit entfernt von der klassischen Piazza einer urbanen Kultur, die übrigens - wie die großen Plätze am Mittelmeer demonstrieren - eigentlich frei bleibt vom kommerziellen Konsum und seinem Glamour. Doch die funktional 'ins Reine gesteigerten' funktionalen Zonen und Zentren können (und wollen) die Offenheit urbaner Öffentlichkeit nicht bieten. Die perfekte Konfektion 'urbaner' Illusionen blockiert jede freie Konstruktion urbanen Lebens. Vielleicht könnte der Einzelhandel der Nachbarstädte langfristig doch von den aktuellen Sorgen aufatmen, wenn er sich auf die Attraktivität der eigenen heimische Stadtkultur besinnt, deren kulturelles Potential eben von keiner Disneyland-Illusion zu kopieren ist. Vor diesem aktuellen Hintergrund ist die Frage nach der heute auch kulturell in Frage gestellten Identität dieser Industrielandschaft als Kulturlandschaft neu zu erörtern. Eine solche kulturgeschichtliche und kulturpolitische Selbstverständigung in der Spannung von "Revierkultur" und "Kulturregion" fordert die kritische Auseinandersetzung und die provo-kative wie produktive Begegnung mit der regionalen Geschichte und fördert die Ver-ständigung auf seine strukturellen Probleme und kulturellen Programme. Für unsere historisch-soziologische Reflexion von Entwicklungen dieser Industrielandschaft Rhein-Ruhr - die sich selbstbewußt immer auch als Kulturlandschaft darzustellen suchte - lassen sich drei Phasen konstruieren:
gestern: das 'alte Revier' in der Spannung von Altlast und Aufschwung; heute: die Grenzen und Krisen industrieller Modernität im Ballungsraum; morgen: neue Horizonte sozialer Vernetzung und kulturellen Lernens.
Wir können diese Zeitenfolge auch mit raumbezogenen Kategorien markieren:
1. Das 'alte Revier' läßt sich sozialräumlich charakterisieren durch die Fixierung fester 'Gren-zen'. Im 'alten Revier' waren nicht nur die Außengrenzen durch die unterirdisch vermessenen Kohlevorräte klar gezogen. 'Vor Ort': das lag 'unter Tage'. Auch die inneren Grenzen zwi-schen Arbeitswelt und Alltagswelt, zwischen Kneipe und Kirche, schwer-industriellem 'Grau' und kleingärtnerischem 'Grün' waren eng gesteckt. Letztlich schrumpfte der soziale Raum auf den Straßenraum im unmittelbaren Wohnumfeld der einstigen "Colonien". Planer markierten diesen kleinräumigen Maßstab des 'alten Reviers' zwischen Arbeit und Alltag im Horizont zwischen Kotten (also der Arbeitsstätte), Konsum, Kirche und Kneipe als "Pantoffel-Meile".
2. Die Zonen industrieller Ballung lassen sich bestimmen durch das Diktat funktionaler Zwänge. Der Lebensrahmen war nun weniger bestimmt durch soziale Räume der Begegnung von Arbeit, Alltag und Freizeit als durch funktionale Zonen und funktionale Zentren, in denen nicht nur die Produktion, sondern auch der Konsum durch Konzentration 'ins Reine' gesteigert war. Der unmittelbare Lebensraum schrumpfte zum beliebigen Drehpunkt einer funktionalen Mobilität. Entscheidend wurde die schnelle und billige Erreichbarkeit von funktionalen Zentren. Die reinen Wohngebiete und die reinen Industrieflächen gingen zu-einander auf Abstand, aber auch die Zentren für Konsum und Regeneration begannen sich auszudifferenzieren - ganz im Sinne der in der Charta von Athen 1933 von den Städteplanern
"Stadtkultur im Industrierevier"
155
programmierten Funktionstrennung. Das Ruhrgebiet war in diesem Sinne durch den schon 1920 als regionale Selbstverwaltung gegründeten Ruhrsiedlungsverband richtungsweisend geplant, indem Wohnflächen, Industrieflächen und Grünflächen planmäßig getrennt wurden. Doch mit der räumlich geordneten Funktionstrennung des modernen und mobilen Lebens verlieren soziale Räume und ortsbezogen orientierte kulturelle Felder ihre lebensweltliche Bedeutung. Kulturentwicklung treibt damit in das Dilemma, im Sinne der tradierten Revier-Kultur auf die kleinräumige Ortsbezogenheit eines Lebens "vor Ort" setzen zu wollen, zugleich aber auch im Sinne regionaler Funktionstrennung und Funktionssteigerung für die Kultur eher auf das 'große Format' der regionalen Reichweite setzen zu müssen.
3. Neue Horizonte regionaler Vernetzung lassen sich beschreiben mit Blick auf aktuelle Akti-vitäten und Initiativen kultureller Netzwerke und Lernprozesse. Beide Kategorien bieten in ihrer theoretischen Konstruktion die Möglichkeit, zwischen Lokalität und Funktionalität zu vermitteln. Bedeutet 'Revier' traditionell die Vorgegebenheit durch klare Grenzen und plan-gerechte Raster, so haben wir es heute mit Wirklichkeiten zu tun, die sich konstituieren durch kommunikative Verknüpfung und selbstorganisierte Vernetzung. Was sich zur "Region" entwickelt, entscheidet sich in der offenen Beziehung zwischen Akteuren, seien es kulturelle Produzenten oder die zu interessierenden und zu aktivierenden kulturellen Adressaten.
So entwickelten sich die innovativen Potentiale einer neuen Regionalkultur gerade aus den sich neu eröffnenden Möglichkeiten ihrer regionalen Vernetzung. Hier können sich kulturelle Ini-tiativen halten und weiter entwickeln, die jeweils vor Ort gewiß zu schwach wären, um sich behaupten zu können. 3. Regionale Identität: "Schwere Arbeit", "Große Organisation" und "Starke Kultur" Die Muster regionaler Identität, nicht nur der Stigmatisierung von außen, sondern auch in der Selbstverständigung regionaler Identifikation lassen sich auf den Dreiklang reduzieren: "Schwere Arbeit", "Große Organisation", "Starke Kultur". In diesen Formeln spiegelt sich das Selbstverständnis und Selbstbewußtsein des heute als "altindustriell" stigmatisierten und in ihren strukturellen kulturellen Altlasten problematisierten "rheinisch-westfälischen Industriegebietes", zumindest für dessen 'große Zeit' von der Kolo-nialisierungsphase um 1890 bis zu den Montankrisen seit 1970. Prägend wurde die in den 1920er Jahren vom damaligen "Ruhrsiedlungsverband" durchgesetzte Raumordnung mit west-östlich über den Hellweg und durchs Emscher-Tal geführten Trassen und Schienen, den damit süd-nördlich verstrebten Städteringen und dazwischen den von in-dustrieller Besiedlung durch verbandliche Planung freigelassenen Grüngürteln der "Verbands-grünstreifen". Diese 'Schaschlik'-Struktur des Ruhrgebiets gibt regionaler Planung bis heute den Rahmen. Zugleich spiegeln solche Konstruktionen die Künstlichkeit, Planbarkeit und Machbarkeit sozial-räumlicher Gestaltung. Machbar erscheint dann auch die Installation kultureller Infrastruktur. So sah es schon 1929 Erik Reger:
"Die Kultur wird, wie ehedem Fabriken, Häuser und Menschen, wahllos hineingestopft. Die Städte strengen sich an, geben für Kultur und Kulturreklame mehr Geld aus, als sie angesichts der sozialen Lage verantworten können. [...] Ein groß aufgezogener artisti-scher Apparat läuft leer, er ist unrentabel, weil er unproduktiv ist."
Eckart Pankoke
156
In den Aufbaujahren der Bundesrepublik nach 1945 bezog sich kulturelle Erinnerung und Er-neuerung zunächst auf die Pflege des kulturellen Erbes als (heile) 'Gegenwelt' zu einer durch Macht und Geld programmierten industriellen Wirklichkeit. Im politischen und gesellschaft-lichen Neubeginn setzte gerade die Kultur- und Bildungspolitik deutliche Zeichen "geistigen Aufbauwillens". Allerdings vollzog sich die kulturpolitische Neuorientierung weniger im Enthusiasmus des "Aufbruchs" als in bedächtigen Versuchen zu sichten und zu sichern, zu bewahren und zu erneuern, was als kulturelles Erbe und Vermächtnis im Bildersturm faschistischen Terrors zerstört und verfemt worden war. Über die Einrichtungen der Volks-bildung entwickelte sich damals ein starkes Feld flächendeckender kultureller Grund-versorgung, das uns heute schon so sehr zur Selbstverständlichkeit geworden ist, daß es in den Erfolgsbilanzen kommunaler Kulturpolitik gegenüber spektakulären Glanzbildern der kulturellen Skyline unverdient im Hintergrund bleibt. So bleibt zu würdigen, daß schon in den Aufbaujahren das Angebot einer flächendeckenden Grundversorgung mit kultureller Infrastruktur zu den großen kulturellen Leistungen der Revierstädte zählte. Hier konnten kulturpolitisch engagierte Pädagogen und Politiker weithin freien Gestaltungsraum finden. Zugleich verzichtete die britische Militärregierung auch bald auf eine direktive Regulierung kunstpolitischer Aktivitäten. Dies machte den Weg frei, die zerstörten stadtbürgerlichen Kulturinstitute (Theater, Museum) in städtischer Regie wiederaufzubauen. Es ging primär um die Erneuerung 'bürgerlicher', genauer 'bildungsbürgerlicher' Stadtkultur, um die Pflege eines kulturellen Erbes, das sich rechtfertigen konnte als 'Gegenwelt' zur Bar-barei der jüngsten Vergangenheit, aber auch als Gegenwelt zu den Banalitäten von Arbeit und Alltag. Auch die mit programmatischer Verklammerung von "Kultur und Arbeit" für die Kulturpolitik immer wieder neu beschworene Zielgruppe der Industriearbeiter wurde weniger angesprochen in ihrer "Kultur der Arbeit" als in dem aus der Tradition der Arbeiterbildungsbewegung neu aufgegriffenen Programm einer bürgerlich orientierten Bildungskultur. Es ging dem 'affluent worker', dem aufsteigenden Arbeiter, auch um die soziale Selbstbestätigung durch kulturellen Aufstieg ins Bildungsbürgertum und nicht um kulturelle Alternativen und Experimente. "Heile Welt" und "starke Kultur": Wenn wir den kulturellen Wiederaufbau im Ruhrgebiet charakterisieren wollen, bieten sich diese zwei schnellen Formeln an. Es war eine bürgerliche Repräsentationskultur der "heilen Welt", und zugleich war es im Blick auf die industrielle Or-ganisation der Arbeit eine "starke Kultur" der Repräsentation der Macht des Faktischen. "Heile Welt" steht ironisch für die Fragwürdigkeit einer Kultur, die abgehoben von den Zerrissenheiten gesellschaftlicher Problemfelder die ästhetische Einbildung des "Edlen, Wahren und Schönen" als Hochkultur abgekoppelt hat und als Harmonie zu zelebrieren sucht. Von "starker Kultur" sprechen wir dann, wenn in kultureller Kommunikation die Integration einer Organisation oder auch einer Region beschworen wird und durch das Gewicht einer solchen symbolischen Gewalt anders gelagerte Konflikte, Kontroversen und Diskurse kaum noch Gehör finden.2 "Heile Welt" steht für die praktische Unverbindlichkeit des Geistigen, "starke Kultur" für die Präsentation des Mächtigen, für die Einheitlichkeit und Geschlossenheit sozialer Wirklichkeit und die (Selbst-)Darstellung ihrer Repräsentanten. Doch "heile Welt" des Geistes und "starke Kultur" der Macht schaffen gerade nicht das Klima und den öffentlichen Raum, in dem sich Innovation und Emanzipation, Engagement und Autonomie entwickeln lassen.
2 Vgl. W. Bußkamp; E. Pankoke, Innovationsmanagement und Organisationskultur, Essen 1993.
"Stadtkultur im Industrierevier"
157
4. Modernisierung und Mobilisierung - vom Industrierevier zum Ballungsraum
Heute aber scheint die einst starke 'Kultur der Arbeit' auch an der Ruhr konturlos zu werden. "Wirklichkeit ist ins Funktionale gerutscht" - so formulierte es schon der junge Bert Brecht, als er die Abstraktheit industrieller Macht nicht mehr durch sozialen Realismus, sondern nur noch durch 'Verfremdung' aufzeigen konnte. "Ins Funktionale gerutscht" - das gilt auch für den in den 1960er Jahren beobachtbaren Form-wandel industrieller Räume. War das alte Industrierevier noch bis in die 1950er Jahre geprägt durch 'starke' Industriekultur, 'schwere' Arbeit und 'große' Organisation, aber auch durch immobil machende Dichte, Nähe und Enge, so weiteten die Modernisierungsschübe des Wirt-schaftswunders den Horizont ins Regionale. Erst jetzt sprach man von "Ballung" und meinte damit: die sozialräumlichen Folgen von Motorisierung und Mobilisierung im regionalen Verkehrsverbund, die massenmediale Überformung durch eine zwischen Ruhr und Emscher registrierte größte Fernsehdichte der Bundesrepublik, die ersten großen Trabantenstädte in Hochbau, die Kanalisierung von Kaufkraftströmen und Freizeitinteressen in funktionale Zonen und funktionale Zentren wie Industrie- und Gewerbeparks, Einkaufszentren und Freizeitzentren (Revierparks). Fixpunkte regionaler Orientierung wurden bald auch die neuen Hochschulen gleich am 'Ruhrschnellweg'. All diese Großprojekte regionaler Infrastruktur aber lagen kaum noch im Herzen der Städte, sondern zumeist dazwischen, im Niemandsland der "Verbands-grünstreifen", wo die funktionalen Schienen des Massenverkehrs sich kreuzen. Als Steuerungsinstanz regionaler Koordination wurde in den 1960er Jahren der damalige Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) zum Forum und Fokus kultureller Moderni-sierung. Hier gewann die Idee Gewicht, die Einheit und Schlagkraft dieses industriellen Ballungsraumes auch durch eine regionale Planung der schon damals beachtlichen kulturellen Ressourcen zu bündeln. Die kleinräumige Verschränktheit von Arbeits- und Lebenswelt im 'alten Revier' wurde auf-gebrochen durch funktionale Schienen einer Rationalisierung der Arbeit und einer gleichzeitigen Mobilisierung der Bedarfsdeckung über konsumtive und kulturelle Märkte. Die strukturelle Krise im Montanbereich wurde für die tradierte Revierkultur auch zur kul-turellen Krise. Dies gilt auch für die politische Kultur. Anfang der 70er Jahre setzte alles auf einen neuen "Maßstab Ruhr", der die Beschränktheiten des 'alten Reviers' in neu ge-schnittenen Großräumen aufheben sollte. So galt es, die wirtschaftliche Umstellung durch politisch-administrative Reformen zu flankieren. Sowohl die Territorialreform (der Ein-gemeindung zu städtischen Großräumen), wie die Funktionsreform der Neuordnung admini-strativer Kompetenzen gerade im Bereich der Raumordnung setzten auf die Rationali-sierungschancen der großen Formate. Dies verband sich - identitätspolitisch - mit dem demonstrativen Abschied vom 'alten Revier'. Ganz im Sinne des zynischen Optimismus der Schumpeter-Formel von der "schöpferischen Zerstörung" versprach man sich vom Abbau sog. "Altlasten" den Aufwind zu neuen Wegen. Innovationen versprach die Modernisierung der Infrastruktur, aber auch die Modernisierung der kulturellen Muster von Milieu und Mentalität. So kam das 'alte Revier' auch kulturell unter Modernisierungsdruck. Raumordnungspolitisch wurde die sich einspielende Balance von lokaler und regionaler Kultur korrigiert durch neue Koordinaten. Die Verwaltungsreformen der 1970er Jahren schwächten als Funktionalreform die kulturelle Gestaltungskompetenz einer regionalen Selbstverwaltung, zugleich wurde durch die Territorialreform einer die großen Städte begün-stigenden Eingemeindungspolitik die Konzentration auch der kulturellen Kräfte bestätigt und
Eckart Pankoke
158
in Richtung auf eine in den großen Stadtregionen Duisburg, Essen und Dortmund sich neu formierende Sub-Regionalität verstärkt und verschärft. Der sich so beschleunigende Modernisierungsschub spiegelte sich im kulturpolitischen Dis-kurs, für den mit der Maßstabsvergrößerung industrieller und urbaner Modernität nun die soziale Reichweite und Wirkungstiefe der kulturellen Infrastruktur zum Problem wurde. Gegenüber den Maßstabserweiterungen der Regionalplanung signalisierte in den 1970er Jahren die Programmformel "Bürgernähe" das Problembewußtsein einer sich verschärfenden Entfremdung zwischen politisch-administrativen Organen und ihrer sozialräumlichen Basis. Aktueller Hintergrund war die Sorge, daß mit der planungspolitisch gebotenen Ausweitung von Verwaltungs- und Steuerungskompetenz ins Regionale nicht nur die kommunale Sou-veränität vieler örtlicher Gemeinschaften verlorenging, sondern daß sich damit auch die politische Vertretung lokaler Interessen "ausdünnen" mußte. Die Distanz zum 'alten Revier' verband sich oft mit der programmatischen Beschwörung einer neuen Modernität. Theoretiker dieser auch das Ruhrgebiet in den Strudel reißenden industriellen wie urbanen Modernisierung faßten die sich unter Modernisierungsdruck neu herausbildenden Strukturen und Kulturen mit der Formel vom "industriellen Ballungsraum". Dies bedeutete zugleich, daß ein Weg-Modernisieren des 'alten Reviers' gerade nicht zur nachholenden Urbanisierung wurde. Vielmehr entstanden post-urbane Strukturen der Ballung und Streuung, die alles Städtische hinter sich ließen. Die Landesplanung NRW der 1970er Jahre versuchte, die anstehende Modernisierung des Ruhr-Reviers mit der anschwellenden Motorisierung zu koppeln. In neuer Rasterung sollte die Region durch ein enger gezogenes Gitterwerk neuer Schnellstraßen parzelliert werden. Ins Kreuz der Verkehrsschneisen sollten dann jeweils funktionale Zentren, insbesondere Einkaufszentren für die schnelle und komfortable Marktentnahme gelegt werden. Zwischen den Siedlungsschwerpunkten in den seit den 1920er Jahren durch die Freiraumplanung des damaligen Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk (SVR) unbebaut belassenen sog. "Verbandsgrünstreifen" sollten sog. "Revierparks" auch das Freizeit- und Grünangebot poly-zentral konzentrieren und so rationalisierbar machen.
"Ein Raster von regionalen Supermärkten und regionalen Freizeit- und Amüsierparks sollte die quartierbezogene Versorgung ergänzen, was unter Größen- und Preiskon-kurrenz hieß, sie mehr und mehr ruinieren. Ein 10x10 km Neutralraster von Auto-bahnen und Schnellstraßen sollte die Verkehrsmittelwahl ausweiten, was unter dem Ansturm der Modernisierung ermöglichte, die tägliche Arbeitsmigration und den Lastentransport zu erweitern und von der Schiene auf die Straße zu verlagern."3
Historisch-soziologische Rekonstruktionen des Modernisierungsprozesses machen deutlich, wie sich im Tempodruck von Mobilisierung und Motorisierung die Horizonte und Koordinaten der sozialen Lebensräume verändern. In der Zeitdimension verschärft sich Tempodruck, wenn die Wege weiter werden und ein aufwendiges 'Pendeln' zwischen den immer weiter auseinander-gezogenen funktionalen Zonen von 'Arbeit' und 'Leben' zwingend wird. Im Wandel von Raum und Zeit geraten die 'urbanen' Muster und Werte unter Spannung und in Bewegung. In der aktuellen Gleichzeitigkeit von Modernisierung und Post-Modernisierung verändern sich die räumlichen Grenzen von Stadt und Land, Privatheit und Öffentlichkeit, Heimat und Fremde, 'Systemzeit' und 'Eigenzeit'. Grenzen verschwimmen, Räume werden übersprungen, Distanzen schmelzen,- und doch wird bei aller Temposteigerung die Zeit nur knapper und kostbarer.
3 S. Müller, Der Niedergang der Stadt im Ruhrgebiet, in: H.G. Helms (Hrsg.), Die Stadt als Gabentisch, Leipzig 1992, 376.
"Stadtkultur im Industrierevier"
159
Doch eine Regionalpolitik der funktionalen Konzentration im Verbund mit einem Umbau aus der Fläche in die Höhe erwies sich mit den im Ruhrgebiet eingelebten Mustern nahräumlicher Orientierung als nicht kompatibel. Der Straßenbau verschlang bald die Kosten, die eigentlich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gefordert waren. Gravierender noch schienen die mit diesem Konzept der polyzentralen Konzentration verbundenen Sanierungsprobleme der Wohninfrastruktur. Die neue Wertigkeit von Immobilien in zentraler Verkehrslage für eine neue "Gentry" von Wohnungseigentümern mußte zugleich zur Verdrängung älterer Mietpopulationen führen. ("Gentrification") Während früher die modernen und mobilen Schichten die urbanen Verdichtungszentren eher meiden wollten und in weit abgelegener Streulage ihr grünes Glück suchten, wird es künftig eher umgekehrt sein: die explosiven Wohnkosten in den exklusiven Verdichtungskernen werden sich bald nur noch diejenigen leisten können, die hier ohne großen Verkehrsaufwand attraktive Wohn- und Arbeitsplätze zu verbinden verstehen. Verdrängt werden insbesondere die älteren Menschen, aber auch Familien mit Kindern, die nun in Billigregionen ausweichen, die weniger angebunden sind an die immer schnelleren Trassen fürs 'Tempo des Lebens'. Auch dies spiegelt und steigert die "Gesellschaftsspaltung" - nun auch in Mobile und Im-mobile. Ein Beispiel für die Mobilisierung kultureller Märkte sind die offensichtlich lukrativen Projekte, welche Kultur im Sinne kulturindustrieller Massenproduktion zu vermarkten suchen. Die Aktivitäten kommerzieller Kulturanbieter, die ihre Pläne dann auch eher über die städtische Wirtschaftsförderung als über die kommunale Kulturpolitik aushandeln, kal-kulieren damit, kulturelle Bedürfnisse in Unterhaltungsbedarf umzulenken und diesen dann massenhaft zu vermarkten. Hier sollte sich die Kulturpolitik nicht desinteressiert abwenden, sondern sich selbstkritisch fragen, ob von dieser weithin erfolgreichen Vermarktung von unterhaltsamem Kulturersatz nicht für die Vermittlung kultureller Angebote zu lernen ist. Zur kulturpolitischen Herausforderung wird aber auch die neue Prächtigkeit einer kulturellen 'Skyline', die offensichtlich hoch attraktiv wird für namhafte Sponsoren, ihren Namen über För-derung zu vergolden. Es gibt gerade hier im Revier mit seinem gewiß nicht berechtigten Minderwertigkeitskomplex ein Zauberwort, das heißt "Weltniveau". Dies zielt allerdings we-niger auf ein lokales Publikum als auf überregionale Sponsoren. 5. "Kulturregion" Rhein-Ruhr - Netzwerke und Lernprozesse In selbstkritscher Auseinandersetzung mit den kulturellen 'Altlasten' des 'alten Reviers' setzte schon Ende der 1960er Jahre eine unter Dietrich Springorum neu gefaßte Abteilung für regionale Öffentlichkeitsarbeit bewußt auf Innovation und ging damit auf Konfrontation zur 'heilen Welt' und 'starken Kultur' der eingesessenen Revier-Mentalität. "Laßt uns den Kohlen-pott umfunktionieren!" So hieß es dazu bereits 1969 im Titel eines Strategie-Papiers des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk:
"Das Ruhrgebiet ist eine artifizielle Landschaft. Nirgendwo sonst in Deutschland ist eine Industrielandschaft freilich so willkürlich und zweckgebunden artifiziell wie gerade im Ruhrgebiet. Wie wäre es, wenn sich das Ruhrgebiet anschickte, diese artifizielle Basis endlich bewußt zu machen, sie hat neben ihren Schauerseiten auch unstreitig starke Faszination. [...] Wie wäre es, sich Gedanken darüber zu machen,
Eckart Pankoke
160
diese Landschaft artifiziell zu überhöhen. Erst dann [...] hätte der Slogan 'Ruhrgebiet - Industrielandschaft der Zukunft' seine Berechtigung." 4
Auch Springorums Entwurf einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit, die sich bewußt versteht als Arbeit am Image und zugleich an der Identität dieses Raumes, war sich der Schwierigkeiten und Widerstände bewußt, die Identität und die Solidarität regionaler Zugehörigkeit öffentlich zu machen.5 Zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit zählten damals auch die in der Bürgerinitiativenbewegung neu entwickelten Formen einer direkteren Partizipation. "Mehr Demokratie wagen!" hieß es damals programmatisch. Dies war nun umzusetzen in neue Formen einer politischen Kultur der Selbststeuerung des öffentlichen und kulturellen Lebens. Allerdings blieb in den kommunalen Großräumen des Ruhrgebiets die komplizierte Vernetzung der hier greifenden Planungsprozesse einer Mitwirkung durch die betroffene Öffentlichkeit weitgehend verschlossen, Partizipation konnte sich allenfalls mediatisiert über Gemeinden, Verbände und Parteien vollziehen, zumal bei der öffentlichen Auslage der Pläne alle entscheidenden Weichen bereits gestellt waren. Damit stellte sich das Problem einer Erweiterung und Vertiefung der Planungslegitimation im Medium einer an regionalen Entwicklungsproblemen orientierten politischen Öffentlichkeit. Gerade für den Ballungsraum konnte festgestellt werden, daß die nicht eindeutig abgrenz-baren Überschneidungen von funktionsspezifischen Wirkungs- und Einflußbereichen und den örtlich gefaßten kommunalen Verfügungsräumen die öffentliche Identifizierung und Profi-lierung von ortsbezogener Kommunalpolitik erschwerten. Die im industriellen Ballungsraum ohnehin nur schwach entwickelte Tradition bürgerlich-liberaler Öffentlichkeit6 und die Unübersichtlichkeit und Unabsehbarkeit der die eigene Situation betreffenden überörtlichen Determinanten sind allerdings auch die Erklärung für das eher schwache Bild partizipativ aktiver Bürgerinitiativen.7 Stärker als lokale Gebundenheit und deren kulturelle Gestaltqualität einer "symbolischen Orts-bezogenheit" (Treinen) wirken hier die funktionalen Betroffenheiten durch die Systemzwänge der Arbeitswelt. Stärker als lokale Partizipation interessierte deshalb auch die auf die Welt der Arbeit bezogene Organisation sozialökonomischer Interessen. Dies gilt gerade auch für die kulturellen Interessen, die sich längst - im Unterschied zu den eher im Rathaushorizont befangenen Kommunalpolitikern - regional orientieren. Es ginge dann um die Frage, ob hier eine Horizonterweiterung ins Regionale nicht nur für eine regional ab-zustimmende Profilierung der Skyline, sondern vielleicht auch für die noch damals weniger aktive Szene soziokultureller Initiativen eine besondere Entwicklungschance bieten könnte. Gegen die ihre alte Zentralität verlierende industrielle Arbeitsgesellschaft stehen heute Er-wartungen und Forderungen nach einer jenseits der Modernität industrieller Ballung sich neu entwickelnden post-industriellen Kulturgesellschaft. Diese kann sich allerdings nicht mehr ver-stehen als fraglose Fortschreibung der stadtbürgerlichen Repräsentativ-Kultur, vielmehr haben wir ein buntes Spektrum von sich wechselseitig als 'Alternative' wahrnehmenden kulturellen Initiativen. Daß es zugleich zum Problem wurde, die "Einheit des Problemraums Ruhr" gegen alle zen-tralistischen wie zentrifugalen Tendenzen zu behaupten, zeigen gerade die Versuche, die Zu-kunft der Region in konzertierter Aktion in Verantwortung zu nehmen. Die Richtung weist 4 D. Springorum, Laßt uns den Kohlenpott umfunktionieren, in: Revier-Kultur 1986, Heft 2, 85-96, hier 94. 5 Ebd., 85. 6 K. Rohde, Vom Revier zum Ruhrgebiet. Parteien, Wahlen, Politik, Kultur, Essen 1986. 7 B. Borsdorf-Ruhl, Bürgerinitiativen im Ruhrgebiet, Essen 1973.
"Stadtkultur im Industrierevier"
161
das von der "Ruhrkonferenz" (8./9.5.1979 in Castrop-Rauxel) aller für das "Revier" ver-antwortlichen Interessen und Instanzen (der Landesregierung, dem Kommunalverband Ruhr, den großen Städten, den Kammern, Industrieverbänden, Gewerkschaften und Kirchen) ge-meinsam getragene "Aktionsprogramm Ruhr". Gegenüber der Zentralität der großen Formate begann das Umdenken und Gegensteuern mit der landesplanerischen Zielvorgabe: "Abbruch der regionalisierten Sicht und Stop der Flächensanierung. Lokale, städtische Raumentwicklung und Stärkung der sozialen Netze in Wohnquartieren". Der Ausbau der Schnellstraßen sollte ein Gegengewicht finden im quar-tiersbezogenen Verbund von Verkehrsberuhigung und Wohnumfeldverbesserung. "Straßen und Plätze sollten für Fußgänger, Radfahrer, Kinder und alte Menschen" zurückgewonnen werden, so die Forderungen eines ministeriellen Runderlasses für die behutsame Moderni-sierung einer "kleinteiligen, erhaltenden Stadterneuerung in Nordrhein-Westfalen".8 Strategien der gesellschaftspolitischen Entwicklungssteuerung im Zusammenspiel von POLIS und REGIO bewährten sich gerade auch für die im Aktionsprogramm als eigener Bereich ausgewiesene Entwicklung des "kulturellen Lebens" im Ruhrgebiet, wozu es im Schlußwort des Ministerpräsidenten programmatisch hieß: "Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern die Hefe im Teig dieser Gesellschaft."9 Der kulturpolitische Test für die Steuerungsfähigkeit einer regional orientierten Gesell-schaftspolitik und der Vermittelbarkeit von lokaler und regionaler Orientierung, wäre die Frage, ob sich in der Kulturlandschaft Ruhrgebiet die Attraktivität einer regionalen "Skyline" mit der Aktivität ihrer soziokulturellen "Szenen" verbinden ließe, ohne daß dabei die "Skyline" alles an Aufmerksamkeit und Zuwendung derart absorbiert, daß sich damit die "Szenen" noch weiter in Grauzonen und Schattenlagen abgedrängt sehen. In diesem als Standort industrieller Produktionsstätten verplanten polyzentrischen Städte-schwarm bietet der Ausfall bürgerlicher wie bürgerschaftlicher Urbanität aber auch besondere Chancen, hier komplexere und flexiblere Netzwerke entwickeln zu können als in den auf Zentralität fixierten Metropolen der klassischen Moderne. Ein Unterschied zwischen der für die klassischen Metropolen typischen Zentralität urbaner Verdichtung und der im industriellen Ballungsraum gegebenen Polyzentralität funktionaler Ver-netzung kann darin liegen, daß das Erleben und Beherrschen des urbanen Lebensraums sich 'territorial' orientiert, etwa an Kategorien urbaner 'Nähe' und 'Dichte', während industrielle Metropolen sich eher funktional organisieren, so daß sich die moderne Organisations-gesellschaft von jeder sozialräumlichen Bodenhaftung tendenziell 'abhebt'. Nicht mehr die räumliche Verdichtung urbaner Nähe, sondern die zeitgerechte Erreichbarkeit in regionalen Netzen wird zum Standortfaktor industrieller Zentren. Heute aber scheint nun auch diese Struktur industrieller Ballung in neuartigen sozialräum-lichen Konstellationen der globalen Kommunikationsgesellschaft aufgelöst. Im elektro-nischen 'internet' der 'digitalen Stadt' wird urbane Nähe durch eine globale Omnipräsenz überspielt. Die bisherigen Standortfaktoren urbaner oder industrieller Modernität scheinen entwertet.
8 S. Müller, Der Niedergang von Stadt im Ruhrgebiet, in: H.G. Helms (Hrsg.), Die Stadt als Gabentisch, Leipzig 1992, 268-281, hier 278. 9 Ministerpräsident Johannes Rau in: Landesregierung NRW 1979, 158.
Eckart Pankoke
162
6. Regionale Skyline und lokale Szenen "Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik", diese von Alfons Spielhoff vor Jahren ausgegebene Parole eines neuen kulturpolitischen Engagements (wie es dann auch mit Gründung der 'Kulturpolitischen Gesellschaft' programmatisch aufgegriffen wurde) fand ihr Bezugsproblem zunächst in der Frage der gesellschaftspolitischen Verantwortbarkeit der Allokationseffekte kultureller Infrastruktur. Wie waren bei knappen Mitteln kulturelle Investitionen und Institu-tionen nach Zielgruppen und Zielräumen auszurichten? Das infrastrukturelle Erscheinungs-bild der Kulturlandschaft Ruhr stellte sich dar als ein aufwendiger Strauß nebeneinander lebender, jeweils in sich abgeschlossener, selbstgenügsamer "Stadtkulturen". Doch durch dieses Nebeneinander kommunaler Rundum-Kulturen, die sich jeweils orien-tierten am Versorgungsauftrag provinzieller Zentren, lebten viele Kommunen kulturpolitisch über ihre Verhältnisse, indem die gerade für suburbane Zonen und soziokulturelle "Szenen" nötige Förderung durch die Bindung der Mittel an ambitionierte City-Kultur blockiert blieb. Städte wie Gelsenkirchen oder Oberhausen können es zwar in ihrer Größenordnung mit jeder Provinz-Hauptstadt aufnehmen, allerdings fehlt ihnen das provinzielle Hinterland, dem sie "Mitte" sein könnten. Doch gerade weil sie nicht als Mittelpunkt die Mittelschichten eines provinziellen Einzugsbereiches mit Mittelmaß zu versorgen haben, hätten solche Städte im Kontext regionaler Arbeitsteilung die große Chance, nicht nur für Gelsenkirchener und Ober-hausener, sondern für den großen Einzugsbereich dieses Ballungsraumes Profil statt Provinz zu bieten. Doch viel zu lange hemmte lokale 'Selbstgenügsamkeit' die Chance der Profilierung und Aktivierung einer regionalen 'Skyline'. Damit unterblieb es, die kulturellen Kräfte zu einer dem wirtschaftlichen Potential dieses Raumes adäquaten Metropol-Kultur zu profilieren. Die regionale 'Skyline' der weithin beachtenswerten kulturellen Höhenflüge und Höhepunkte, wie die lokalen 'Szenen' kulturellen Lebens 'vor Ort' könnten so gleichermaßen verfehlt werden. Dazu zeigten empirische Bilanzen, daß zwar die Kaufkraftströme der Konsumlandschaft regional orientiert und auch kanalisierbar waren, die Planung und Verwaltung der kulturellen Angebote jedoch im Rathaushorizont befangen blieb. In der Regel blieb das durch Vormiete-Ringe zusammengehaltene bildungsbürgerliche Stamm-Publikum als 'geschlossene Gesellschaft' unter sich. Auch wenn diese sich einem breiteren Publikum der arbeitenden Bevölkerung zu öffnen suchte, bestimmte - ganz in der Tradition klassischer Arbeiterbildung - die Pflege kulturellen Erbes das Programm. Dies fand in den früheren Ruhrfestspielen seine hochkulturelle Ausformung. Auf lokaler Ebene wurde aus der Öffnung für ein neues Publikum eher eine populistische Anbiederung an die leichte Muse gängiger Unterhaltung - Operette statt Oper, Boulevard statt Tragödie. Dagegen setzte als Dortmunder Kulturdezernent Alfons Spielhoff seine für die damalige Kulturpolitik ketzerische Frage, ob solche Produktionen wie die 'Operette vom Opernhaus' und 'Boulevardtheater vom Schauspielhaus' nicht überbesetzt seien und ob man solche durch Leichtgängigkeit zugkräftigen Produktionen nicht besser dem freien Spiel kultureller Märkte überlassen sollte, um so kulturpolitisch dort aktiv werden zu können, wo der Markt als Steuerungsmedium versage, also in der Förderung kultureller Avantgarden und Alternativen. Doch im Ruhrgebiet dominierte immer noch, wie schon Erik Reger mahnte, "ein Kultur-marsch der Stadtverwaltungen, der ein Auf-der-Stelle-Treten ist", solange städtische Kultur-institute eher aufs Kopieren kultureller Repräsentation setzen als auf ein auf regionale Pro-bleme antwortendes eigenes Profil:
"Stadtkultur im Industrierevier"
163
"All diese Institute stehen auf einer Insel, fern vom Leben; sie fungieren [...] in den Werbeprospekten der Verkehrsvereine; aber die Menschen, [...] klar sehende, ent-schlossene Jugend, Angestellte, Arbeiter gehen daran vorbei. [...] Es ist unmöglich, daß es in ihr Bewußtsein dringt, es gehört nicht zu ihnen, es entspricht nicht ihrem Lebensgefühl."
Profil statt Provinz, das muß keineswegs bedeuten, daß alle Ressourcen und Kompetenzen auf regionale Zentralität hochgezont werden - so die berechtigte Angst von Gelsenkirchen, als Essen neben dem guten alten Grillo-Theater (genannt nach dem Fabrikherrn, der seiner Stadt ein ganzes Theater schenkte) die große Aalto-Oper eröffnete. Doch kann, wie sich bald zeigte, regionale Orientierung auch zur Chance werden, daß kommunale Kulturpolitik für regionales Profil verantwortlich und so auch 'vor Ort' das kulturelle Leben interessanter und attraktiver wird. Die dabei bewußt werdende Frage, ob im industriellen Ballungsraum die räumliche Dimension und Definition sozialer Wirklichkeit an Bedeutung und Deutlichkeit verlieren könnte, stellt sich heute unter der Bedingung der Pluralisierung und der Individualisierung der Lebensstile gewiß schärfer. Unsere Fragen nach der räumlichen Wirkung des Sozialen und der sozialen Bedeutung des Räumlichen stellen sich im Blick auf die sich abzeichnende Post-Moderne einer post-industriellen und post-urbanen "Erlebnisgesellschaft" gewiß neu und anders. Vielleicht ist die derzeit beobachtbare Erosion der sozialräumlich verankerten sozial-moralischen Milieus und der strukturell wie kulturell erklärbare Individualisierungsschub ein Grund, sich nun im offenen Horizont "Kulturregion" aktiv zu orientieren. Vor allem die jüngere Generation fixiert sich weniger auf die heimatlichen Ligaturen, sondern orientiert sich eher an den Optionen weiträumiger Vernetzung. Vieles spricht dafür, daß sich auch in der Umstellung der kognitiven Kartierung ein Generationsbruch abzeichnet, von der Arbeits-gesellschaft zur "Erlebnisgesellschaft". Vielleicht bedeutet die Pluralisierung und die In-dividualisierung der Lebensstile auch ein anderes Verhältnis zum Raum, der nun bewußter in seinen Optionen akzeptiert und aktiviert werden kann. Nehmen wir die jüngere und mobilere Aktivbevölkerung in den Blick, so rückt ein neuer Typ ins Bild. Ein junges erlebnisrationales Konsumverhalten, das mit Fahrplan, Veranstaltungs-plan und Straßenkarte sich eine kognitive Kartierung bildet, in der die Region als polyzentral vernetzter Options- und Aktionsraum an Attraktivität gewinnt. In dieser Altersgruppe scheint der ältere Typ des sozialräumlich und soziokulturell eingebundenen Milieus allerdings längst abgelöst durch polyvalent vernetzte 'Szenen', deren Ortsbezug nicht mehr durch Tradition vorgegeben ist, sondern wo die Wirklichkeit des Sozialen bewußt konstituiert wird: als Programm und Projekt, Konstrukt und Kontrakt, Konsens und Konflikt. 7. Neue Horizonte - Vernetzung zur Kulturregion Die Beobachtung der neuen Reichweiten und Maßstäbe regionaler 'Märkte', und zwar sowohl für die Anbieter wie für die Nachfrager, bestätigt zunächst, daß mit den neuen Verkehrs- und Kommunikationstechniken weiträumiger Orientierung und Mobilisierung sich der Horizont der sozialräumlichen Orientierung ins 'Regionale' ('Überörtliche') gewandelt hat. Richtungs-weisend für eine neue Regionalität der Angebote und Nachfragen sind nicht nur die kleineren Städte am Ballungsrand, die gerade in ihren Spezialitäten neues Profil gewinnen, das in-
Eckart Pankoke
164
zwischen zur überregional ausstrahlenden Skyline zu zählen ist. Dies fordert den Mut zu neuer ortsübergreifender Kooperation und Kombinatorik, zu Konkurrenz und Kontrast. Im Bewußtsein der Dynamik struktureller wie kultureller Umbrüche, wie sie zu geschichts-theoretischen Etikettierungen wie 'Post-Moderne' verleiten, stellt sich die Kulturfrage heute neu. Über Kultur vermittelt sich nicht nur die Identität, Solidarität und Produktivität eines sozialen Raumes, sondern auch die Reflexivität modernen Bewußtseins. Dann gewinnt kul-turelles Leben die Entwicklungsdynamik von Lernprozessen. Die aus neuem Problembewußtsein ableitbaren programmatischen Konsequenzen, wie sie auch mit dem Forum "Kultur 90" angesagt waren, programmieren praktisch einen kultur-politischen Perspektiven- und Führungswechsel. Quer zur Selbstgenügsamkeit der sich etablierenden Stadtkulturen des Ruhrgebiets öffneten sich in den 70er Jahren neue Horizonte einer bewußten Profilierung durch Regionalisierung. Auch die sich gegenüber der großstädtischen Modernität neu formierenden Alternativen soziokultureller Felder sind bei allem programmatischen Ortsbezug nur denkbar in ortsüber-greifenden Koordinaten. Wirksames Potential der Vernetzung kultureller Felder entwickelte sich nun über ortsüber-greifende Sympathisantenfelder und Bündnisbereiche. Ein prominentes wie profiliertes Netz-werk bot gewiß Anfang der 70er Jahre die 'Kulturpolitische Gesellschaft'. Hier zeigte sich, daß gerade Zusammenschlüsse auf regionaler Ebene besondere Schubkraft entfalten konnten. So versuchte es auch die KuPoGe mit regionalen Untergliederungen, gerade im Ruhrgebiet. Ruhrgebietsspezifische Vernetzungen bildeten sich auch über den Zusammenschluß der Widerstandsgruppen gegen die Totalsanierung der alten Bergarbeitersiedlungen, über die Arbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren - oder auch über das neue "Netzwerk experi-mentelle Musik und neuer Jazz". Wem es gelingt, sein spezifisches Publikum regional zu interessieren und zu mobilisieren, der hat gute Aussichten, daß das künstlerische Risiko der radikalen Profilierung sich tragen wird. Die Ablösung von der kommunalen Ebene gewinnt heute prekäre Aktualität, da die kommunale Subventionierung immer weniger sicher ist. Dabei erweist sich soziokulturelle Selbststeuerung regionaler Synergie als Chance einer neuen Beweglichkeit. Aber es bleibt die Sorge, daß die Strategie der kulturellen Selbststeuerung, die zunächst gewählt wurde, um der radikalen Avantgarde freies Spiel zu erkämpfen, nun eher denen entgegenkommt, die sich aus lästig werdenden Bindungen und kostenwirksamen Verantwortungen auf billige Weise lösen wollen. Doch Selbststeuerung als Strategie regio-naler Kulturentwicklung bedeutet im Idealfall gerade nicht Abkoppelung, wohl aber die Auskuppelung von Eigendynamik und Autonomie. Auch ein "jenseits von Markt und Staat" sich neu konstituierender "Dritter Sektor" kultureller Eigendynamik ist gewiß auf öffentliche Mittel angewiesen und bleibt so bezogen auf öffent-liche Macht und öffentliche Meinung. Dennoch erweist sich gerade die institutionelle Auto-nomie situativer Selbststeuerung als wichtige Bedingung für eine unbürokratische Förderung der Entwicklung von kultureller Kreativität und solidarischem Engagement. Gerade in diesem 'freien Feld' von kultureller Initiative und sozialer Aktion könnte einer aktiven Kultur-politik kommunaler Selbstverwaltung die neue Funktion zukommen, als Mittler und Makler wirksam zu werden. Ein wichtiger Indikator für die Steuerungsfähigkeit kommunaler Politik, sich auf kulturelle Selbststeuerung einzulassen, ist die Bereitschaft, von Institutionenförderung auf Projekt-förderung umzustellen. Die Verwaltungswissenschaft beschreibt den damit gegebenen kultur-politischen Führungswechsel als Umschalten von direktiver zu non-direktiver, von regula-
"Stadtkultur im Industrierevier"
165
tiver zu kontextueller, von transitiver zu reflexiver Steuerung. Wir dürfen es uns jedoch nicht leicht machen, in der Umstellung auf kulturpolitische Selbststeuerung nur die Entlastung von fiskalischen und legitimatorischen Kosten zu sehen. Steuerung durch das Auskuppeln von Selbststeuerung fordert von Politik und Verwaltung eine anspruchsvolle kommunikative Sensibilität und strategische Kompetenz. Gefordert im komplexen Geflecht zwischen poli-tisch-administrativem System und kultureller Initiative ist eine hohe Kunst des Verwaltens und des Vermittelns. Hintergrund ist die kulturelle Dynamik des gesellschaftlichen Wertewandels, aber auch ein Gestaltwandel der urbanen und regionalen Kulturlandschaft. Ein wichtiger Faktor ist dabei ein neuer Typus kultureller Akteure und kultureller Unternehmer. Die immer noch akute Berufsnot im Bereich kultureller Professionalität hat viele dazu gezwungen, kulturelle Kompetenz zu selbstaktiven Feldern zu organisieren, die in ihrer 'Gemeinnützigkeit' und 'Zusätzlichkeit' die Kriterien von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfüllen. In der Regel tragen sich solche Felder durch ressortübergreifende 'Einmischungen' und entsprechende Mischfinanzierungen. So gehört es zur Kunst des Verwaltens, die dazu erforderlichen 'Ver-mittlungen' zu arrangieren und zu balancieren. Dieser Führungswechsel von regulativer Kulturstaatlichkeit zu einer aktiven kommunalen Politik gegenüber kulturellen Feldern bedeutet gewiß eine institutionelle Aufwertung des Kommunalen. Selbststeuerung bedeutet gerade nicht, daß sich öffentliche Kulturpolitik aus der Förderung, Steuerung und Verantwortung zurückzieht. Eher wird Steuerung komplexer, anspruchsvoller und professionell aufwendiger. Gefordert ist dichtere und weitere kommunikative Ver-netzung, wechselseitiges Wahrnehmen, Auseinandersetzen, Verhandeln, Verständigen. Steuerungstheoretisch ist darauf hinzuweisen, daß kommunale Kulturpolitik neben dem Steuerungsmuster PLAN längst auch Elemente von MARKT zu berücksichtigen sucht. Dies hat seinen Grund nicht nur darin, daß die Legitimierbarkeit 'wachsender Staatstätigkeit' auch im Kulturbereich an Grenzen stößt. Dann aber stellt sich die Frage, wie die Offenheit des Marktes verbunden werden kann mit einer Verbindlichkeit öffentlicher Kulturförderung, welche die Kunst wiederum vor den Zwängen des Marktes in Schutz nimmt. Neben der Selbstgenügsamkeit eines kulturpolitischen Lokalismus und der Selbstregulierung kultureller Märkte ist heute ein "dritter" Typus kultureller Steuerung zu beobachten: die "Selbststeuerung" kultureller Felder. Ein solcher sich "jenseits von Markt und Staat" kon-stituierender "Dritter Sektor" kultureller Eigendynamik bleibt dennoch angewiesen auf öffentliche Mittel und damit in produktiver Spannung zu öffentlicher Macht und öffentlicher Meinung. In subsidiärer Kooperation der Kommune mit freien Trägern und Initiativen wird die institutionelle Autonomie situativer Selbststeuerung zur Chance, Kreativität und Engage-ment spontan und unbürokratisch zu entwickeln. Heute scheint in den kulturellen Bereich Bewegung zu kommen: Kulturell ist das Ruhrgebiet eben nicht Provinz, sondern Region: Steht das Provinzielle für die Schranken selbst-genügsamer Geschlossenheit, so steht das Regionale für eine Öffnung der Horizonte, für den innovativen Sprung über die Schatten von Rathäusern, Kirchtürmen und Fabrikschloten. Was sich kulturell ereignet in Bottrop oder Herne bleibt längst nicht mehr lokal, sondern wird beobachtet und verhandelt in lokaler Öffentlichkeit und Offenheit. Der 'Blick über den Tellerrand', wie man hier sagt, und der unmittelbare Austausch mit Kollegen rundum schafft kooperative Netzwerke und damit professionellen Kontext, wie er sich kaum entfalten würde, wenn man selbstherrlich unter sich bliebe. Konkurrenz belebt das Geschäft, Kommunikation hebt das Niveau und Konflikt treibt auf neue Wege. Daß sich die Ruhrgebietspolitiker, auch
Eckart Pankoke
166
im Policy-Feld "Kultur", wechselseitig beobachten und untereinander kennen und treffen, wird dann zur Chance institutioneller Lernprozesse. Auch die Gegenseite, das freie Feld der 'autonomen' Initiativen und Alternativen, stellt sich im Horizont regionaler Vernetzung anders dar als im Alleingang der lokalen Arenen. Was für die Skyline gilt, die Ausstrahlung und Anziehung in weite Einzugsbereiche, gilt auch für Alternativen und Avantgarden. Auch hier sind Sympathisantenfelder und Bündnisbereiche weiter geschnitten als in den Solitärstädten der Provinz, wo kulturelle Experimente "allein auf weiter Flur" es offensichtlich schwerer haben, sich durchzusetzen, Zumindest für die kulturelle Entwicklung dürfen wir heute hoffen, daß die Region zu aktiver Öffentlichkeit zusammenwächst, wobei der 'Maßstab Ruhr' gewiß nicht mehr in den weit-gesteckten Grenzen des einstigen 'Ruhrkohlenbezirks' zu identifizieren ist, zeichnen sich doch gerade im Kulturbereich neue Konstellationen regionaler Zusammenarbeit ab, die bewußt kleinräumiger geschnitten sind als das alte Montanrevier, die aber gerade deshalb im überschaubaren Rahmen regionaler Nachbarschaft zu intensiverer Zusammenarbeit finden - wie der Aufbruch eines sich selbstbewußt entwickelnden "Kulturraums Niederrhein" oder die zur regionalen Abstimmung sich neu formierende Vernetzung der Teilregion Emscher-Lippe. Immer wenn im Ruhrgebiet neue Wege gesucht werden, bilden sich solche Kristalli-sationspunkte regionaler Öffnung. Dazu zeigen die Suchprozesse zur Internationalen Bau-ausstellung "Emscherpark", daß Kultur in der Region farbiger wird, wenn sich Horizonte öffnen und innere Vernetzung die Kombinatorik steigert. Entscheidend aber wird, daß im dicht besetzten Städteschwarm nicht alle einheitlich das Gleiche bieten, sondern die Möglichkeiten einer bewußt regionalen Steuerung von Nach-fragen und Angeboten zur Chance werden, das Besondere nicht nur zu erhalten, sondern in seiner Vielfarbigkeit zu steigern. Erst die Regionalisierung des kulturellen Lebens eröffnet neue Wege und Netze einer Dif-ferenzierung und Profilierung der Angebote. Dabei geht es gewiß auch um die verführerische Möglichkeit, das Kulturleben umzustellen von der Förderung durch Stadt und Staat auf das Steuerungsprinzip Markt. Dabei könnten die neuen telematischen Medien und Techniken einer "Stadt im Netz" auch der Vermarktung und Vermittlung kultureller Angebote neue Horizonte eröffnen. Doch sollte bewußt bleiben, daß der öffentliche Kulturauftrag sich nicht dadurch abwälzen läßt, daß man die Künste den Kräften des Marktes ausliefert. Zu lernen wäre deshalb eher von dem mobilen, flexiblen und reflexiven Such- und Wahlverhalten eines neuen Kulturpublikums, das sich bewußt regional zu orientieren und zu organisieren beginnt. So wie die kulturell aktiven Szenen ihre kulturellen Anlaufstellen regional zu vernetzen wissen, könnte kommunale Kulturentwicklung neues Profil gewinnen, wenn sie für in-novative Lernprozesse und für regionale Netzwerke offener wird. Schließlich wäre bei aller grenzübergreifenden Dynamik verkehrstechnischer Erschließung und telematischer Vernetzung im Ruhrgebiet daran zu erinnern, daß die Sozialkultur des 'alten Reviers' in einer 'starken Kultur' der sozialen Nähe gründete. Davon zeugt ein heute immer noch lebendiges Gemeinschaftsleben und Vereinswesen10 auf der Ebene der Wohn-siedlungen und Stadtteile. Diese Sozialformen bürgerschaftlichen Engagements gewinnen heute neues Interesse, nicht nur auf theoretischen Foren eines modisch gewordenen Kommunitarismus-Diskurses sondern auch in den praktischen Belangen als Gegengewicht zur Verknappung der öffentlichen Mittel 10 A. Zimmer, Public-Private Partnership. Staat und Dritter Sektor in den 1980er Jahren. Zusammenfassung der Ergebnisse der Policy-Analyse des deutschen Teilprojektes, Berlin 1995.
"Stadtkultur im Industrierevier"
167
und der Verengung kommunaler Spielräume. Im Sinne einer Sicherung und Weiter-entwicklung der soziokulturellen Infrastruktur könnten gerade die Lernprozesse einer regio-nalen Vermittlung und Vernetzung dazu beitragen, daß das ruhrgebietstypische Vereins-wesen, insbesondere die in lokale Nähe eingebundenen Bürgervereine, aus ihrer traditionellen 'Selbstgenügsamkeit' aufwachen. Bürgergesellschaftliches Engagement könnte sich dann entwickeln und vernetzen zu Aktivposten sozialer und kultureller Selbststeuerung in einer sich neu formierenden Kulturregion Rhein-Ruhr.
Eckart Pankoke
168
Literaturverzeichnis Berghahn, Volker, Die versunkene Welt der Bergassessoren, in: Revier-Kultur 3, 1986, 62-69.
Bigge, Matthias, Kulturpolitik im Ruhrgebiet, in: Rainer Bovermann u.a. (Hrsg.), Das Ruhr-gebiet - ein starkes Stück Nordrhein-Westfalen. Politik in der Region 1946-1996, Essen 1996, 499-532.
Borsdorf-Ruhl, Barbara, Bürgerinitiativen im Ruhrgebiet, Essen 1973.
Börstinghaus, Wolfgang, Kommunale Sozialpolitik und Stadtteilkultur. Lokale Kulturarbeit mit Vereinen, Dortmund 1986.
Bovermann, Rainer; Goch, Stefan; Priamus, Heinz-Jürgen (Hrsg.), Das Ruhrgebiet - ein starkes Stück Nordrhein-Westfalen. Politik in der Region 1946-1996, Essen 1996.
Bußkamp, Werner; Pankoke, Eckart, Innovationsmanagement und Organisationskultur. Chancen innovativer Industriekultur im Ruhrgebiet, Essen 1993.
Friedemann, Peter; Seebold, Gustav (Hrsg.), Struktureller Wandel und kulturelles Leben. Politische Kultur in Bochum 1860-1990, Essen 1992.
Fürst, Dietrich, Der Region auf die Sprünge helfen, in: PASSAGE 1/1993, 17-27.
Heinze, Rolf G.; Hilbert, Josef u.a., Strukturpolitik zwischen Tradition und Innovation. Nordrhein-Westfalen im Wandel, Opladen 1996.
Kilper, Heiderose; Latniak, Erich; Rehfeld, Dieter; Simonis, Georg, Das Ruhrgebiet im Um-bruch. Strategien regionaler Verflechtung, Opladen 1994.
Köllmann, W. u.a. (Hrsg.), Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter. Geschichte und Entwick-lung. 2 Bde., Düsseldorf 1990.
Kommunalverband Ruhrgebiet, Zeichen setzen. Zeichen geben. Ein neues Profil für die Kulturregion Ruhrgebiet, Essen 1996.
Lück, Volker; Nokielski, Hans; Pankoke, Eckart; Rohe, Karl, Industrieller Ballungsraum. Zur sozial- und politikwissenschaftlichen Problematisierung, in: Zeitschrift für Soziologie 5, 1976, 309-318.
Müller, Sebastian, Der Niedergang von Stadt im Ruhrgebiet. Mit Strukturpolitik hat er nicht aufgehört, in: H.G. Helms (Hrsg.), Die Stadt als Gabentisch, Leipzig 1992, 268-281.
Ökologie-Stiftung NRW / Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Stadt im Netz, Medien. Markt. Moral 2, 1996.
Pankoke, Eckart, Das Industrierevier als Kulturlandschaft. Zur kulturellen Dynamik des Ruhrgebiets nach 1945, in: Hans-Jürgen Priamus; Ralf Himmelmann (Hrsg.), Stadt und Region. Region und Stadt Essen, 1993, 105-142.
Ders., Altes Revier und neue Region. Das Ruhrgebiet als Kulturlandschaft, in: Lebens-verhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf, Frankfurt a.M.; New York 1993, 686-693.
"Stadtkultur im Industrierevier"
169
Ders., Regionalkultur? Muster und Werte regionaler Kultur im Ruhrgebiet, in: Informationen zur Raumentwicklung 11, 1993, "Regionalgeschichte", 759-768.
Ders., Öffentliche Verwaltung 1918-1975, in: W. Köllmann u.a. (Hrsg.), Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter. Geschichte und Entwicklung. Bd. 2, Düsseldorf 1990, 7-66.
Reger, Erik, Kulturpolitik an der Ruhr (zuerst in: Das Kunstblatt 13, 1929, 291-299), Neu-druck in: Revier-Kultur 1, 1986, 82-90.
Ders., Union der festen Hand. Roman einer Entwicklung, Berlin 1931, Neuauflage 1946.
Rohe, Karl, Vom Revier zum Ruhrgebiet. Parteien, Wahlen, Politische Kultur, Essen 1986.
Ders., Wie stark ist das 'starke Stück Deutschland'? Einladung zum Gespräch über Tradition und Perspektiven des Ruhrgebiets, in: Revier-Kultur 1, 1986, 18-32.
Rossmann, Andreas, Erst kommt die Arbeit, dann die Kultur. Dem Revier mangelt es nicht an Museen, Theatern und Orchestern, aber an überregionaler Strahlkraft, in: Frankfurter All-gemeine Zeitung vom 24.09.1996.
Schäfers, Bernhard; Wewer, Göttrik (Hrsg.), Die Stadt in Deutschland. Soziale, politische und kulturelle Lebenswelt, Opladen 1996.
Springorum, Dietrich, Laßt uns den Kohlenpott umfunktionieren (Informationsdienst Ruhr, Juli 1969). In: Revier-Kultur 2, 1986, 85-96.
Tenfelde, Klaus, Vom Ende der Arbeiterkultur, in: Revier-Kultur 3, 1986, 21-31.
Zimmer, Annette, Public-Private Partnership. Staat und Dritter Sektor in den 1980er Jahren. Zusammenfassung der Ergebnisse der Policy-Analyse des deutschen Teilprojektes, Berlin 1995.
Dies., Vereine - Basiselemente der Demokratie. Eine Analyse aus der Dritte-Sektor-Perspek-tive, Opladen 1996.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
171
Helmut Schneider (Düsseldorf)
SOZIALE NETZE UND STÄDTISCHE EXISTENZSICHERUNG
EIN VERGLEICH VON SEKUNDÄRZENTREN IN KENYA, THAILAND UND DEN PHILIPPINEN NACH AUSGEWÄHLTEN INDIKATOREN
1. Sozialräumliche Beziehungsnetze und Urbanisierung Die Anfänge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der sozialräumlichen Struktur von Städten, speziell von Großstädten, sowie den sozialen Beziehungsnetzen ihrer Bewohner standen in der Geographie wie auch in der Soziologie unter dem starkem Einfluß einer romantisierenden Gesellschaftskritik, die Städte und städtisches Leben als Antithese zu einem idealisierten Zustand vorindustrieller, ländlicher Gemeinschaften verstand. Die Einschätzung des Geographen Carl Ritter aus dem Jahr 1817, die Großstadt sei "das allerkünstlichste Gebilde, ein wahres Ungeheuer"1 kann als durchaus typisch für diese Haltung angesehen werden. Ein (groß)stadtkritischer Impuls prägte auch die späteren stadtökologischen Studien der Chicagoer Schule der Stadtsoziologie, die für die sozialgeographische Stadtforschung von außerordentlicher Bedeutung waren. Exemplarisch sei auf den klassischen Aufsatz von Luis Wirth "Urbanism as a way of life" (1938) verwiesen.2 Wirth thematisierte hier das Verhältnis der verschiedenen Dimensionen des Urbanisierungsprozesses, den Zusammenhang von demographischem und flächenhaftem Stadtwachstum mit einer spezifischen Form städtischen sozialen Lebens. Größe und Heterogenität städtischer Siedlungen führen danach zu An-onymität, Oberflächlichkeit und Ausdünnung sozialer Beziehungen unter den Bewohnern, informelle soziale Kontrollen nehmen zugunsten formeller ab, die soziale Integration schwin-det, die Tendenz zur Anomie3 wird zu einer ständigen Gefahr für die städtische Gesellschaft. Analyse und Interpretation von Mustern und Dynamik städtischer Sozialbeziehungen mußten vor diesem Hintergrund notwendig zur Darstellung einer Verfallsgeschichte geraten. Diese Form der (Groß)Stadtkritik kann heute sowohl mit Bezug auf entwickelte Industrie-gesellschaften wie auch auf die Gesellschaften der Dritten Welt als empirisch widerlegt gelten. Die soziale Organisation der städtischen Bevölkerung läßt sich nicht als "community lost" (im Sinne von Wirth, Park u.a.), aber auch nicht als "community saved" im Sinne innerstädtischer Viertelsbildung mit "hinübergerettetem", quasi-dörflichem Charakter inter-pretieren. Nicht zuletzt die Untersuchungen über innerstädtische ethnische Viertelsbildungen haben gezeigt, in welchem Ausmaß sich hinter scheinbar traditionellen Formen hochmoderne Inhalte verbergen können und ethnische Identitäten erst im städtischen Kontext virulent oder überhaupt neu "erfunden" oder konstruiert werden.4 Demgegenüber ist die Vorstellung von einer "community liberated", d.h. von individuellen Bindungen, die mit dem Übergang zu städtischen Lebensformen neu entstehen oder auch existierenden Bindungen, die einen Be- 1 Zitiert nach J. Friedrichs, Stadt-Soziologie, Opladen 1995, 153. 2 L. Wirth, Urbanism as a Way of Life, in: American Journal of Sociology 44, 1938, 1-24. 3 Wirth entlehnt diesen Ausdruck bei Dürkheim, der damit einen Zustand der Normenlosigkeit bezeichnet. Bei Wirth ist dagegen eher die Normenvielfalt koexistierender städtischer Subkulturen gemeint; vgl. J. Friedrichs, Stadt-Soziologie, Opladen 1995, 149. 4 F. Heckmann, Ethnische Minderheiten, Volk und Nation, Stuttgart 1992.
Helmut Schneider
172
deutungswandel erfahren, die sich über die Stadt, aber auch darüber hinaus erstrecken können, realistischer.5 Dem Bindungsverlust stehen so Wandel und Neuentstehung sozialer Bindungen gegenüber, dem Verlust von Sicherheit die Eröffnung neuer Chancen. Diese Ambivalenz städtischer Lebensformen prägt in hohem Maße die Bevölkerung in den schnell wachsenden Sekundärzentren in vielen Ländern der Dritten Welt, die sich zu einem großen Teil aus Land-Stadt-Migranten der ersten und zweiten Generation zusammensetzt. Nicht-marktförmige soziale Netze sind insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe elementare Bestandteile von Existenzsicherungsstrategien, von denen im Extremfall das Überleben von Individuen abhängen kann. Städtische soziale Netzwerke sind in hohem Maße von histo-rischen und kulturellen - z.B. ethnischen - Faktoren geprägt und tragen so zur je spezifischen Modifikation des Urbanisierungsprozesses bei. 2. Soziale Netze als Untersuchungsgegenstand Im Unterschied zu der mit Blick auf die städtischen Sozialbeziehungen pessimistischen Sicht der einflußreicheren stadtökologischen Richtung hat Georg Simmel bereits in seinem 1908 publizierten Aufsatz über die "Kreuzung sozialer Kreise", der vielfach als Ursprung der Netz-werkanalyse angesehen wird, auf die neuen Formen sozialer Bindungen von Stadtbewohnern und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten und Chancen hingewiesen.6 Soziale Netz-werke werden allgemein als Geflechte sozialer Beziehungen definiert, die sich auf sehr unter-schiedliche Inhalte und Analyseebenen (Individuum, Institutionen, Stadtviertel) beziehen können. Im folgenden werden nur soziale Netze von Individuen thematisiert, die im Kontext städtischer Existenzsicherungsstrategien stehen. Es geht also um mehr oder weniger lockere Kontakte und Beziehungen, die z.B. Familien, Haushalte oder Verwandtschaftsgruppen umfassen können, aber nicht darauf beschränkt sein müssen. Soziale Netze sind auch nicht auf eine bestimmte räumliche Ebene fixiert, sie können sich auf den engeren Wohnstandort (Straße, Viertel, Stadt) beschränken, aber auch bis auf die internationale Ebene reichen. Die Dichte sozialer Beziehungen nimmt jedoch in der Regel mit der Entfernung vom Wohn- und/oder Arbeitsstandort ab. Da die Untersuchung totaler Gesamtnetzwerke, die alle Arten von Beziehungen aller Mit-glieder einer Gruppe untereinander umfassen, gewöhnlich einen unvertretbar hohen Er-hebungsaufwand erfordert, werden in den meisten Studien wie auch in der folgenden Betrachtung nur partielle, egozentrierte Netze analysiert. Einbezogen werden dabei nur be-stimmte, ausgewählte Beziehungen, die eine Person (Ego) zu anderen Personen (Alteri) hat.7
3. Nicht marktförmige soziale Netze und Existenzsicherung Der Urbanisierungsprozeß in der Dritten Welt wird in starkem Maße durch Migrationen getragen, hauptsächlich in der Form von Land-Stadt-Migrationen. Dies gilt insbesondere für
5 Vgl. zu dieser Typologie B. Wellman; P.J. Carrington; A. Hall, Networks as Personal Communities, in: B. Wellman; S.D. Verkowitz (Eds), Social Structures, Cambridge 1988, 130-184. 6 G. Simmel, Die Kreuzung sozialer Kreise, in: O. Rammstedt (Hrsg.), Georg Simmel - Gesamtausgabe, Bd. 11, Frankfurt a.M. 1992, 456ff. 7 J.C. Mitchell, Social Networks, in: Annual Review of Anthropology 3, 1974, 279-299; T. Schweizer, Netz-werkanalyse als moderne Strukturanalyse, in: Ders. (Hrsg.), Netzwerkanalyse, Berlin 1989, 1-34; J. Wegmann, Soziale Netzwerke, in: B. Schäfers (Hrsg.), Grundbegriffe der Soziologie, 4. Aufl. Opladen 1995, 225-228; J. Friedrichs, Stadt-Sozologie, Opladen 1995, 153.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
173
die hier interessierenden Sekundärzentren, während in den in der Regel wesentlich größeren Metropolen oder Primatstädten das demographische Wachstum schon in höherem Maße auf natürlichem Zuwachs beruht. Quantitativ noch von geringerer Bedeutung, aber mit wach-sender Tendenz tragen jedoch auch bereits Stadt-Stadt-Migrationen zum demographischen Wachstum und zur Ausformung von Urbanität in städtischen Zentren auf den mittleren Ebenen der Siedlungshierarchie bei. Ein Beispiel dafür ist die im folgenden behandelte Zuwanderung von Bangkok nach Chiang Mai, teilweise schon durch agglomerationsbedingte Beeinträchtigungen der Lebensqualität in der thailändischen Hauptstadtmetropole ver-ursacht.8 Der Übergang von ländlichen zu städtischen Lebensformen impliziert für die meisten Men-schen eine Ausweitung der Lebensbereiche, die durch marktförmig regulierte Beziehungen geprägt sind. Unter dem Gesichtspunkt der Existenzsicherung stehen dabei die Wohnungs- und Arbeitsmärkte im Vordergrund. Zum Schutz vor den für den einzelnen oft existenz-bedrohenden Auswirkungen der nach dem Prinzip der Selbstregulation funktionierenden Märkte haben sich in dem Raum zwischen Markt und einem vor allem als Sozialstaat besonders schwachen Staat in der Dritten Welt nicht-marktförmige, soziale Netzwerke ent-wickelt. Sie stellen ein elementares System sozialer Sicherung dar, das an bereits existieren-den Formen der Subsistenzproduktion von Haushalten sowie der auf Reziprozität und Re-distribution beruhenden Beziehungen innerhalb von Familien- und Verwandtschaftsgruppen anknüpft, sie an die städtischen Lebensweisen anpaßt und um neue Elemente ergänzt. Aus der praktischen Notwendigkeit der Existenzsicherung mußten die neuen Städter in der Dritten Welt auf die Erfahrung reagieren, daß die aus ihren kulturellen, sozialen und politischen Einbettungen herausgelösten Märkte desaströse Folgen für den einzelnen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt haben können,9 eine Einsicht, die sich inzwischen auch bei neo-liberalen Entwicklungsstrategen langsam durchsetzt. "Solange die Akteure auf den Draht-seilen des Marktes agieren und stets mit dem möglichen Absturz konfrontiert sind, werden sie ohne solche Netze nicht auskommen."10 Solche Netzwerke sind insbesondere für Migranten in einer neuen, auch kulturell fremden Umgebung Mittel und Medium sozialer Verankerung und Interaktion, sie dienen der materiellen Unterstützung und zur Orientierung für indi-viduelles Verhalten. Die Anpassung an und die Bewältigung von neuen Lebenssituationen wird durch die Vermittlung von Informationen und konkreter Hilfe erleichtert. Eine zentrale Rolle spielen dabei Familienbeziehungen. Soziale Netzwerke können aber auch die "ex-perimentelle" Bindung an einen neuen soziokulturellen Kontext erschweren, indem sie die Bindung an die eigene Gruppe festigen, so übergreifende Kontakte erschweren und den Wunsch nach Rückkehr an den Herkunftsort stärken. "Too often the role of social networks is seen ideally supportive, while the other side of the coin, their restrictive nature, is over-looked."11 Ob Netzwerke auch eine solche integrationshemmende Funktion haben, wird im folgenden untersucht.
8 F. Kraas, Bangkok, in: Geographische Rundschau 48, 1996, 89-96. 9 K. Polanyi, The Great Transformation, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1990; S.C. Humphreys, Geschichte, Volks-wirtschaft und Anthropologie, in: K. Polanyi (Hrsg.), Ökonomie und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1979, 7-59. 10 Prokla-Red., Akteure beim Hochzeitsakt mit Netz. Ein Experiment, in: Prokla 97, 1994, 516. 11 A. Pohyola, Social Networks - Help or Hindrance for the Migrant?, in: International Migration 24, 1991, 435-443.
Helmut Schneider
174
4. Interkultureller Vergleich und Auswahl der Untersuchungsstädte Urbanisierungsprozesse - und als wesentlicher Bestandteil die Entfaltung sozialer Netzwerke - laufen in je spezifischen soziokulturellen und historischen Kontexten ab und werden ent-sprechend mehr oder weniger stark modifiziert. "Kultur" wird hier als dynamisches Konzept verstanden und bezieht sich auf die Bedeutungssysteme und Handlungsmuster sozialer Gruppen, die auf gemeinsamer Erfahrung und Geschichte beruhen, in alltagsweltlicher Praxis verankert sind und so durch menschliches Handeln laufend reproduziert, aber auch verändert und neuen Bedingungen angepaßt werden.12 Im folgenden wird deswegen von der These ausgegangen, daß ähnliche Ursachen im Sinne von Prozessen, Ereignissen oder Strukturzwängen je nach dem "cultural context" sehr unter-schiedliche empirische Resultate hervorbringen können. Der global wirksame Urbani-sierungsprozeß muß insofern entgegen der modernisierungstheoretischen Annahme keines-wegs zwangsläufig nach Nivellierung lediglich zeitversetzter Phasen in eine Konvergenz städtischer Formen und sozialräumlicher Muster münden. Die Einflüsse des mit der sozialen Struktur und der politischen Ordnung eng verwobenen und Handlungsspielräume sozialer Gruppen und Klassen einschließenden "cultural context" können die nivellierenden Wir-kungen des Modernisierungsprozesses oder die Durchsetzung der Weltmarktimperative mehr oder weniger stark modifizieren. Diese Vorstellung von "Kultur" als einer globale Prozesse modifizierenden Größe schließt zugleich einen extremen Kulturrelativismus aus.13 Zur Identifikation kulturspezifischer Modifikationen universeller Prozesse ist die Analyse der Urbanisierung innerhalb nur eines bestimmten Kulturzusammenhangs jedoch wenig geeignet. Einsichten verspricht hier vielmehr ein interkulturell vergleichender Ansatz. Damit geraten überhaupt erst unterschiedliche Resultate gleicher oder ähnlicher Prozesse ins Blickfeld und lassen sich hinsichtlich der modifizierenden Wirkung des "cultural context" untersuchen.14 Diese Überlegungen lagen der Auswahl der hier untersuchten Sekundärstädte zugrunde, die historisch und kulturell sehr unterschiedlich "eingebettet" sind: Während das thailändische Chiang Mai Produkt einer bis ins 13. Jahrhundert zurückgehenden autochthonen Stadt-entwicklung ist, die bis in die zwanziger Jahre weitgehend isoliert vom Kernraum des Landes verlief, handelt es sich bei Baguio City in den Philippinen und Nakuru in Kenya um koloniale Gründungen durch die Kolonialmächte USA bzw. Großbritannien, die erst kurz nach der Jahrhundertwende erfolgten.15 Nakuru war bis zur kenianischen Unabhängigkeit (1963) eine weitgehend "weiße" Stadt in einem von weißen, vorwiegend europäischen Siedlern erschlos-senen Raum ("white highlands"), der Zuzug afrikanischer Bevölkerungsgruppen wurde durch die britische Kolonialverwaltung strikt begrenzt und scharf kontrolliert. Baguio City wurde
12 J. Agnew; J. Mercer; D. Sopher, The City in Cultural Context. Introduction and Commentary, in: Dies. (Ed.), The City in Cultural Context, Boston 1984, 1-30, 277-280. 13 Ebd. 14 Ebd. 15 Vgl. ausführlicher zur Entwicklung von Chiang Mai, Baguio City und Nakuru H. Schneider, Zivilisations-prozeß, Macht und städtische Form in einer buddhistischen Kultur. Das Beispiel von Chiang Mai, Nordthailand, in: M. Jansen u.a. (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeits-gruppe Stadtkulturforschung 1, Aachen 1994, 195-217; Ders., Aspekte der Existenzsicherung städtischer Haus-halte in der kenianischen Mittelstadt Nakuru, in: A.M. Brandstetter u.a. (Hrsg.), Afrika hilft sich selbst. Prozesse und Institutionen der Selbstorganisation, Münster; Hamburg 1994, 356-370; Ders., Ethnizität und ethnische Viertelsbildung in philippinischen Sekundärstädten am Bsp. von Zamboanga City und Baguio City, in: M. Jansen u.a. (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkultur-forschung 2, Aachen 1997, 61-100.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
175
als koloniale "hill station", als Erholungszentrum für die koloniale und einheimische Elite sowie als Sommerresidenz für die amerikanische Kolonialverwaltung geplant. Zuzugs-beschränkungen für die einheimische Bevölkerung wie in Nakuru existierten hier nicht. Aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktionen für ein weiteres Umland, ihres demographischen Gewichts (1990: Nakuru: 164.000 E., Chiang Mai: 166.883 E., Baguio City: 183.146 E.) und ihrer Stellung in der nationalen Städtehierarchie können alle drei Städte als der Primatstadt des jeweiligen Landes nachgeordnete Sekundärzentren angesehen werden. 5. Demographisches Wachstum und Migration Die Zuwachsraten der demographischen Verstädterung liegen in der Dritten Welt mit Aus-nahme Lateinamerikas, das bereits einen hohen Verstädterungsgrad (= Anteil der städtischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung) aufweist, deutlich über dem globalen Durchschnitt und weit über den Vergleichszahlen für die entwickelten und bereits hochgradig verstädterten Länder Europas und Nordamerikas (Abb. 1). Die höchsten Zuwachsraten weist derzeit Afrika auf, wobei Ostafrika (mit dem Unter-suchungsraum Kenya) noch über dem kontinentalen Durchschnitt liegt.16 Dies gilt auf niedri-gerem Niveau auch für Südostasien (mit den Untersuchungsräumen Thailand und Philip-pinen). Längst sind nicht mehr nur die großen Metropolen oder Primatstädte betroffen, sondern auch die Städte auf nachgeordneten Stufen der Siedlungshierarchie. Gerade hier entfällt ein hoher Anteil des demographischen Stadtwachstums auf Zuwanderungen. Aller-dings ist bei länderübergreifenden Vergleichen zu berücksichtigen, daß die der UN (bzw. ihren Unterorganisationen) zur Verfügung stehenden Daten auf den amtlichen Zensus-ergebnissen der einzelnen Länder basieren. Dabei können die Definitionen, was jeweils unter städtischen Siedlungen zu verstehen ist, sowohl im Zeitverlauf wie auch zwischen den einzelnen Ländern beträchtlich variieren.17 Das demographische Wachstum der einbezogenen Städte wurde im Laufe der letzten 30 Jahre in unterschiedlich starkem Maße durch Migrationen bestimmt. Die Wachstumsraten der Bevölkerung lagen in Baguio City (Philippinen) im gesamten betrachteten Zeitraum über dem jeweiligen nationalen Durchschnitt, für Nakuru (Kenya) gilt dies erst für den Zeitraum 1969-1979, hier mit rund 7%, und für die folgende Phase (1979-1980) mit immer noch 5,8 % jedoch weit über dem Landesdurchschnitt. Lediglich das nordthailändische Sekundärzentrum Chiang Mai weist über den gesamten Betrachtungszeitraum gemessen am Bevölkerungs-wachstum auf nationaler Ebene leicht unterdurchschnittliche Zuwachsraten auf (Abb. 2). Da verläßliche statistische Angaben dazu nicht vorliegen, wird für eine Schätzung des Migrationsanteils am Bevölkerungswachstum der untersuchten Städte die Bevölkerungs-zunahme auf nationaler Ebene als Richtgröße für die natürliche Bevölkerungszunahme zugrunde gelegt. Dies läßt sich insofern rechtfertigen, als grenzüberschreitende Migrationen quantitativ unbedeutend sind und sich per Saldo zudem weitgehend aufheben. Mit dieser Schätzung dürfte die tatsächliche Bedeutung der Zuwanderungen leicht unter-, die der Ab-wanderungen dagegen etwas überbewertet sein, da die im Vergleich zu den Städten im ländlichen Raum höhere Rate der natürlichen Bevölkerungszunahme in den nationalen Durchschnittswert eingeht.18
16 Vgl. dazu auch W. Gaebe, Urbanisierung in Afrika, in: Geographische Rundschau 10 (46), 1994, 570-576. 17 Eine Übersicht enthält UN (Hrsg.), World Urbanization Prospects. The 1994 Revision, New York 1995, 33ff. 18 Grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen waren z.B. in den Philippinen 1990 mit einem Anteil von jeweils ca. 0,1% an der Gesamtbevölkerung nur geringfügig und per Saldo weitgehend ausgeglichen (vgl.
Helmut Schneider
176
Abb. 1: Zuwachsraten der Gesamtbevölkerung und der städtischen Bevölkerung 1990-1995 und Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung (1995) in ausgewählten Räumen
Quelle: UNFPA, Weltbevölkerungsberichte 1994 und 1995 In den betrachteten drei Ländern ist die Rate der natürlichen Bevölkerungszunahme ten-denziell rückläufig, liegt aber in allen Fällen noch deutlich über dem europäischen Wert (0,3%), für Kenya und die Philippinen auch noch über dem weltweiten Durchschnitt (1,7%). In der unterschiedlichen Höhe der nationalen demographischen Zuwachsraten kommt zum einen das unterschiedliche ökonomische Entwicklungsniveau der drei Länder zum Ausdruck. Einen ersten Eindruck davon vermittelt bereits der grobe Wohlstandsindikator "Brutto-sozialprodukt (BSP)/Kopf":19 Gemessen am durchschnittlichen BSP/Kopf für die Bundes-
NSO/P [National Statistics Office, Philippinen], 1990 Census of Population and Housing, Manila 1992), in Thailand lag der Anteil grenzüberschreitender Zuwanderungen im selben Jahr sogar nur bei 0,04% (vgl. NSO/T [National Statistics Office, Thailand], 1990 Population and Housing Census, Bangkok 1994), für Kenya lagen entsprechende Angaben nicht vor. - Kleinräumig differenzierte Daten über die natürlichen Bevölkerungs-veränderungen stehen nicht zur Verfügung, allerdings liegt in allen drei betrachteten Ländern die Fertilität in Städten deutlich niedriger als im ländlichen Raum. Das entsprechende Stadt-Land-Verhältnis betrug in Kenya 4,5/7,1 (1989), in Thailand 2,5/3,1 (1990) und auf den Philippinen 2,96/3,59 (1990) (vgl. NSO/P 1992; NSO/T 1994; C. Short, A Rural-Urban Demographic Model to Project the Population of Kenya 1990–2020, Nairobi 1992, 8f.). Als Indikator der Fertilität wird in den amtlichen Statistiken die durchschnittliche Zahl der Lebend-geburten pro Frau und Jahr für die Gruppe der verheirateten bzw. jemals verheirateten Frauen im gebärfähigen Alter (definiert als 15-49jährige Frauen) verwendet. Auch wenn man berücksichtigt, daß aufgrund defizitärer Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum dort auch die Sterblichkeit, insbesondere die Kindersterblichkeit höher liegt, ist aufgrund der großen Fertilitätsunterschiede - sehr stark ausgeprägt in Kenya - gleichwohl die An-nahme gerechtfertigt, daß das natürliche Bevölkerungswachstum in städtischen Räumen niedriger sein dürfte als auf dem Land. 19 Auf die Problematik dieses Indikators kann hier nicht weiter eingegangen werden, vgl. dazu D. Nohlen; F. Nuscheler, Indikatoren von Entwicklung und Unterentwicklung, in: Dies. (Hrsg.), Handbuch der Dritten Welt. Bd. 1: Grundprobleme, Theorien, Strategien, Bonn 1992, 76-108, hier 76ff.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
177
Abb. 2: Durchschnittliche jährliche Zuwachsraten der Bevölkerung 1960–1990
Quelle: CBS/K 1994, NSO/P 1992, NSO/T 1994; kenianische Zensustermine in Klammern
republik Deutschland (1993: 23.560 US-$) entfällt auf den entsprechenden Vergleichswert für Kenya ein Anteil von nur 1,15%, für die Philippinen von 3,61% und für Thailand immer-hin von 8,95%.20 Zum anderen spielen aber auch kulturspezifische Unterschiede wie etwa die kulturelle Bewertung von Kinderreichtum (Kenya), die religiös motivierte Ablehnung von Geburtenkontrolle (Philippinen) oder umgekehrt eine intensive staatliche Werbung für Maßnahmen zur Geburtenregelung (Thailand) eine Rolle. Das demographische Wachstum von Baguio City und Nakuru wurde nach dieser Schätzung, die auf zahlreichen einschränkenden Annahmen beruht und entsprechend vorsichtig bewertet werden muß, in der Dekade 1980 (1979) - 1990 (1989) mit schätzungsweise rund 50% ganz erheblich durch Zuwanderungen getragen. Demgegenüber war der Anteil der Migrationen am Gesamtwachstum in Baguio City im davorliegenden Zeitraum 1970 und 1980 mit knapp 24% relativ gering. Darin spiegelt sich die ökonomische Krise und politische Unsicherheit wider, die das Kriegsrechtsregime der Marcos-Regierung in den siebziger Jahren geprägt haben. Die negative Wanderungsbilanz für Nakuru in der ersten Dekade des Betrachtungszeitraumes hängt wiederum eng mit der kolonialen Geschichte der Stadt zusammen. Das ehemalige Zentrum des weißen Siedlergebietes im kenianischen Hochland ("white highlands") war in den Jahren vor und nach der Unabhängigkeit des Landes (1963) zunächst stark von der Ab-wanderung der weißen Bevölkerung betroffen. Dem folgte schließlich ein massiver Zustrom afrikanischer Bevölkerung, die während der britischen Kolonialzeit durch rigide Zuwan-derungsbeschränkungen weitgehend von dauerhafter städtischer Ansiedlung ausgeschlossen war. Dies kommt in den hohen Migrationsanteilen in den folgenden Dekaden zum Ausdruck. Das nordthailändische Chiang Mai weist demgegenüber jedoch für den gesamten betrach-teten Zeitraum entsprechend den statistischen Indikatoren eine negative Wanderungsbilanz auf. Zu berücksichtigen ist hier zwar, daß die vorgenommene Schätzung die Abwanderung
20 Vgl. Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1995, Bonn 1995, 188f.
Helmut Schneider
178
Tab.: Schätzung des Nettomigrationsanteils am demographischen Wachstum der Städte Nakuru, Chiang Mai und Baguio City 1960 (1962) - 1990 (1989)
absolute geschätzter Zunahme Migrationsanteil Baguio City/Philippinen 1960 – 1970 34102 47,6% 1970 – 1980 34471 23,7% 1980 – 1990 64133 51,4% Nakuru/Kenya 1962 – 1969 8970 -30,9% 1969 – 1979 45700 58,1% 1979 – 1989* 71131 48,3% Chiang Mai/Thailand 1960 – 1970 17993 -11,7% 1970 – 1980 17865 -29,6% (1983 – 1990)* 16384 -26,0% (1983 – 1990)** 16384 5,3%
Quellen: NSO/P 1992, NSO/T 1994, CBS/K 1994 *Die administrativen Grenzen der Städte Nakuru und Chiang Mai wurden in dem betrachteten Zeitraum erheblich erweitert, so daß ein Teil der demographischen Zunahme auf die räumliche Erweiterung des Stadtgebietes zurückzuführen ist. Dies fällt für Nakuru mit seinem relativ dünn besiedelten ländlichen Umland nicht wesentlich ins Gewicht. Gravierend ist dies allerdings für Chiang Mai; hier wuchs die städtische Bevölkerung durch die 1983 vorgenommene Erweiterung des administrativen Stadtraumes von 17,5 km² auf 40 km² um 44000 Einwohner, was einer Zunahme von rund 40% entspricht. Um den Ein-fluß dieses demographischen Sprungs auszuschalten, wurde zur Abschätzung des Verhältnisses von natürlicher und migrationsbedingter Bevölkerungsbewegung für Chiang Mai deswegen nur der Zeitraum 1983-1990 berücksichtigt.
** Nach einer hinsichtlich ihrer Ausgangsprämissen nicht überprüfbaren Schätzung betrug das natürliche Bevölkerungswachstum in der Provinz Chiang Mai in den achtziger Jahren durchschnittlich nur 0,7% p.a. Danach würde sich für den Zeitraum 1983-1990 eine leicht positive Wanderungsbilanz ergeben.21
überbewertet und die amtliche Statistik nur als eingeschränkt zuverlässig gelten kann. So wird z.B. für Chiang Mai angenommen, daß die tatsächlichen Bevölkerungszahlen um 25-30% über den amtlichen Angaben liegen, da viele Einwohner ihren Wohnstatus nur als tem-porär ansehen (z.B. Studenten und Schüler) und sich nicht offiziell registrieren lassen.22 Auch wenn von einer unter dem Landesdurchschnitt liegenden natürlichen Bevölkerungszunahme ausgegangen wird,23 ergibt sich nur ein relativ geringer Wanderungsgewinn. In diesen Wer-ten kommt zum Ausdruck, daß sich Thailands ökonomischer Aufschwung, der seit den acht-
21 Vgl. Louis-Berger-Intern. Inc., Initial Study Findings Report for Chiang Mai Planning Project, Chiang Mai 1991, VI-1. 22 Schätzung des Geographischen Instituts der University of Chiang Mai 1992 und Louis-Berger-Intern. Inc., Initial Study Findings Report for Chiang Mai Planning Project, Chiang Mai 1991, VI-3. 23 Schätzung: 0,7% für 1989, vgl. ebd., VI-1.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
179
ziger Jahren boomartige Züge aufweist und das Land zu einem Kandidaten für den Club der asiatischen "Tigerökonomien" gemacht hat,24 im wesentlichen auf den Großraum Bangkok und die angrenzenden Provinzen konzentriert, eine Folge der historisch begründeten starken Zentralisierung des Landes und der extremen "primacy" von Groß-Bangkok, dessen Ein-wohnerzahl um das 34-fache über der von Chiang Mai liegt. Die daraus resultierende, vor allem arbeitsmarktbedingte Wanderungsattraktivität von Bangkok und seinem weiteren Um-land bietet eine Erklärung für die negative oder bestenfalls ausgeglichene Wanderungsbilanz von Chiang Mai. Mit Ausnahme der Fremdenverkehrswirtschaft ist eine mit den Boom-regionen des Landes vergleichbare ökonomische Dynamik hier nicht zu verzeichnen. Bereits auf dieser Betrachtungsebene zeigt sich, in welchem Maß die demographische Ent-wicklung der ausgewählten Sekundärzentren von länder- und regionsspezifischen histo-rischen und soziokulturellen Faktoren mitbestimmt wird. Solche Unterschiede kommen auch in den Ergebnissen der 1991/92 durchgeführten Befragungen zum Ausdruck, die den folgen-den Ausführungen zugrunde liegen.25 In den ausgewählten Städten wurden jeweils ca. 1000 Personen direkt befragt (965 in Chiang Mai, 972 in Baguio City und 1018 in Nakuru), über die Angaben zu den übrigen Haushaltsmitgliedern wurden jeweils weitere 2000-3000 Personen in die Erhebung einbezogen. Der Anteil der Migranten an dem Sample (= Personen, die irgendwann vor dem Befragungszeitpunkt in die jeweilige Stadt zugewandert sind), lag in Nakuru mit knapp 77% am höchsten, dicht gefolgt von Baguio City mit knapp 76%. Aber auch in Chiang Mai machten Migranten an allen Befragten mit knapp 47% einen im Vergleich zwar deutlich niedrigeren, aber dennoch beachtlichen Anteil aus. Dies läßt sich als Indiz für die erwähnte hohe Wanderungsintensität trotz negativer oder einer höchstens leicht positiven Wanderungsbilanz interpretieren. 6. Migrationsmotive und soziale Netze Die Entscheidung von Individuen, Familien oder Haushalten, den Wohnstandort ganz oder teilweise - in Form gespaltener Haushalte -, nur temporär oder auf Dauer in die betrachteten Städte zu verlagern, ist in der überwiegenden Mehrzahl der analysierten Fälle Bestandteil von Strategien zur Existenzsicherung. Dies kommt einerseits in der Dominanz unmittelbar ökonomischer Migrationsmotive zum Ausdruck: In Nakuru nannten knapp 85% aller befragten Migranten ökonomische Gründe als wanderungsentscheidend, in Chiang Mai waren es mehr als 75% und in Baguio City knapp 60%. Zum anderen läßt sich aber auch die bildungsbezogene Migration mittel- und langfristig orientierten Strategien zur eigenen oder familiären Existenzsicherung zuordnen. Dies spielt insbesondere für Baguio City eine Rolle, dessen Funktion als schulisches und universitäres Bildungszentrum für ganz Nord-Luzon einen bedeutenden Pull-Faktor für die Zuwanderung darstellt.26 Für über 27% aller befragten Migranten waren hier bildungsbezogene Gründe migrationsentscheidend - Gründe, die für die Migranten in Chiang Mai deutlich geringer ausgeprägt (ca. 11%) und in Nakuru nahezu unbedeutend (3%) waren. Auf familiäre Wanderungsgründe entfielen in allen drei Städten annähernd gleich große Anteile zwischen 12% und 14%. Bei familienbedingten Migrationen, gewöhnlich in der Form 24 R.J. Muscat, The Fifth Tiger. A Study of Thai Development Policy, Armonk (N.J.); Tokyo 1994. 25 Diese Befragungen sind Teil eines umfassenderen, von der VW-Stiftung finanzierten Forschungsprojektes über Urbanisierungsprozesse in Sekundärzentren der Dritten Welt. 26 G.V. Manhan; E.F. Torres, Planning and Development in a Highland City. A Case Study of Baguio, The Philippines, in: Regional Development Dialogue 2 (12), 1991, 102-113.
Helmut Schneider
180
mitwandernder Familienangehöriger, kann für die Mehrzahl der Fälle aber ebenfalls ein ökonomisches Motiv bei den wanderungsentscheidenden Personen unterstellt werden. An-dere Wanderungsmotive wie z.B. die Anziehungskraft des "städtischen Lebens", Lösung aus der sozialen Kontrolle ländlicher Gemeinschaften usw. waren in allen drei Städten nahezu verschwindend gering; lediglich in Chiang Mai wurden entsprechende Nennungen etwas häufiger registriert. Dies läßt sich mit aller Vorsicht als ein Ausdruck des im Städtevergleich im Durchschnitt bereits höheren materiellen Wohlstands interpretieren.
Abb. 3: Zuwanderungsmotive von Migranten in Baguio City, Chiang Mai und Nakuru
Quelle: eigene Erhebung
Betrachtet man die Entwicklung der wanderungsentscheidenden Gründe im Zeitverlauf, so ist in allen drei Fällen der deutliche Rückgang familienbedingter Wanderungsentscheidungen zu konstatieren. Zugleich gewinnen die unmittelbar ökonomischen Motive an Bedeutung. Dieser Befund kann als Hinweis darauf interpretiert werden, daß unter den wandernden Personen eigene ökonomische Motive an Gewicht gewinnen - dies betrifft vorrangig weibliche und jüngere Migranten - und familien- oder verwandtschaftszentrierte Bindungen und soziale Netzwerke für die Wanderungsentscheidung offensichtlich an Gewicht verlieren. Inwieweit stärker zweck- und freundschaftsorientierte soziale Netze an diese Stelle treten, man also modernisierungstheoretisch von zunehmender "Modernität" sprechen könnte, kann hier nicht weiterverfolgt werden.27 Ein im Zeitverlauf allmählicher Anstieg bildungsbezogener Migra-tionen läßt sich für Baguio City und für Nakuru, hier allerdings nur auf sehr niedrigem Niveau, bestätigen (für Chiang Mai ist der empirische Befund aufgrund der geringen Grund-
27 Vgl. dazu ausführlicher H. Schneider, Ethnizität und ethnische Viertelsbildung in philippinischen Sekundär-städten am Beispiel von Zamboanga City und Baguio City, in: M. Jansen u.a. (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Ver-öffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 61-100.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
181
gesamtheiten für die einzelnen Zuwanderungszeiträume nicht genügend aussagekräftig). Dem allgemeinen Bild widerspricht jedoch der deutliche Rückgang bildungsbezogener Migrations-motive für die jüngste, zwischen 1986 und 1992 zugewanderte Migrantengruppe in Baguio City. Dies dürfte zum einen mit den Auswirkungen des starken Erdbebens zusammenhängen, das 1990 den Norden Luzons und hier insbesondere die Stadt Baguio City erschüttert hat.28 Verkehrswege, Wohnungen und auch die Gebäude vieler Bildungseinrichtungen wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, so daß die Attraktivität von Baguio City als Bildungs-zentrum zumindest vorübergehend beeinträchtigt wurde. Zum anderen sind aber auch viele potentielle Schüler und Studenten angesichts einer zunehmend polarisierten Sozialstruktur und vor dem Hintergrund gelockerter Familienbindungen zunächst gezwungen, ihren Lebens-unterhalt in der Stadt sicherzustellen, bevor an den Beginn einer Ausbildung gedacht werden kann. 7. Migrationsmuster und soziale Netze zwischen Quell- und Zielräumen der Migration Die Aufrechterhaltung von sozialen Bindungen mit den Herkunftsräumen stellt für Migran-ten, aber auch für die Herkunftsgemeinschaften ein wichtiges Element nicht-marktförmiger Existenzsicherungsstrategien dar. Solche Beziehungen fungieren als soziales Auffangnetz, sie ermöglichen den Transfer materieller Ressourcen und von Informationen in beide Rich-tungen, sie können den Übergang zu städtischen Lebensweisen erleichtern, aber auch blockieren, insofern sie den Migranten die emotionale Ablösung erschweren. Unter den soziale Netzen, die Bestandteil von Existenzsicherungsstrategien sind, greift jenes räumlich am weitesten aus, das durch die Beziehungen von Migranten zu ihren Herkunfts-orten bzw. -regionen aufgespannt wird. Allgemein wird davon ausgegangen, daß die auf Se-kundärzentren in der Dritten Welt gerichtete Migration im Unterschied zu den Metropolen oder Primatstädten nur aus wenigen, räumlich nahegelegenen Quellgebieten stammt. Ein Vergleich der drei betrachteten Städte nach der relativen Bedeutung der Quellgebiete der Migration bestätigt diese Einschätzung im wesentlichen, zeigt aber auch interpretations-bedürftige Abweichungen (vgl. Abb. 4a-c). Am nächsten kommt dem erwarteten Bild das Migrationsmuster der nordphilippinischen Stadt Baguio City. Über 78% der in der Befragung erfaßten Migranten stammt aus den an-grenzenden Provinzen Nord-Luzons, allein fast 43% kommen aus der Provinz Benguet, in der Baguio City liegt, sowie einer unmittelbar angrenzenden Provinz. Alle übrigen Herkunfts-räume fallen, abgesehen von dem Großraum Manila mit einem ebenfalls nur geringen Anteil von 4,2%, kaum ins Gewicht. Räumlich differenzierter ist das Muster für die kenianische Stadt Nakuru. Lediglich knapp 20% der Migranten stammen aus dem Nakuru District selber und aus unmittelbar angrenzenden Räumen. Die übrigen Quellgebiete konzentrieren sich auf weiter entfernte, aber dicht besiedelte Räume, zum einen im Westen des Landes am Victoria See sowie zum anderen auf den ebenfalls dicht besiedelten Kernraum des Landes nördlich von Nairobi. Die Hauptstadt selber ist jedoch mit einem Anteil von 2% nur schwach vertreten. Die räumlich weiter entfernten Küstendistrikte sowie der sehr dünn besiedelte Norden des Landes spielen als Quellgebiete der Migration nach Nakuru praktisch keine Rolle.
28 T.M. Santos, The Killer Earthquake of 1990. Lessons and Opportunities, in: Philippine Geographical Journal 2 (34), 1990, 67-70.
Helmut Schneider
182
Das Muster der Zuwanderungen für das nordthailändische Chiang Mai entspricht - allerdings mit einer wichtigen Ausnahme - wiederum weitgehend den Erwartungen: Rund 67% der erfaßten Migranten stammen aus der Provinz Chiang Mai selber sowie angrenzenden Räumen. Im Unterschied zu den beiden anderen betrachteten Städten spielt für Chiang Mai aber auch die Stadt-Stadt-Migration eine Rolle; besonderes Gewicht hat dabei die Zu-wanderung aus der Hauptstadtregion Bangkok mit einem Anteil von 17,6% an allen befragten Migranten. Eine räumliche Konzentration der Herkunft der übrigen Migranten ist nicht erkennbar. Während es sich in Nakuru und Baguio City überwiegend um eine direkte Land-Stadt-Wanderung handelt (87% bzw. 74%), nannte über die Hälfte der Migranten in Chiang Mai städtische Herkunftsorte. Neben der - bedeutenden - Zuwanderung aus Bangkok wurden jedoch mehrheitlich kleinstädtische Siedlungen genannt. Dies deutet auf stärker ausgeprägte Formen einer Step-wise-migration hin. Die Zuwanderung aus dem Ausland spielt für alle drei Städte keine nennenswerte Rolle. Während sich das hypothetisch zu erwartende Migrationsmuster im wesentlichen aus der Stellung der je-weiligen Stadt in der nationalen Städtehierarchie und der Reichweite ihrer zentralörtlichen Funktionen ableiten läßt, muß zur Erklärung der Abweichungen jedoch auf historische, kulturelle sowie regions- oder lokalspezifische Faktoren zurückgegriffen werden. In Kenya weisen die dichtbesiedelten Räume im Westen und im Zentrum des Landes, Hauptsiedlungsgebiete der zahlenmäßig dominierenden Ethnien der Luo und Luhya bzw. der Kikuyu aufgrund weitgehend erschlossener Landreserven und kleinräumiger Zersplitterung von Bodeneigentum oder Bodennutzungsrechten einen hohen Abwanderungsdruck auf, nicht zuletzt auch als Folge der kolonialen Bodenpolitik. Die im klimatisch gemäßigten Hochland gelegenen Agrarflächen der weißen Siedler im näheren Umland von Nakuru waren dem-gegenüber nach der Unabhängigkeit des Landes zum Teil Zielräume kleinbäuerlicher Auf-siedlungsprogramme, so daß hier nur ein reduzierter Abwanderungsdruck herrscht und in den Grenzräumen zu den viehhaltenden nomadischen und seminomadischen Ethnien (u.a. Masaii, Kalenjin) auch noch ungenutzte agrarische Potentiale vorhanden sind.29 Die großen, aber dünn besiedelten semi-ariden Räume im Norden Kenyas, aber auch die Räume entlang der Küste spielen als Quellgebiete der Migration keine bedeutende Rolle. Im Fall der Küsten-bevölkerung stellen klimatische und kulturelle Faktoren eine wesentliche Migrationsbarriere gegenüber dem Hochland dar.
Für Chiang Mai ist jedoch der hohe Anteil der Zuwanderung aus Bangkok erklärungs-bedürftig, wurde doch zuvor die ökonomische Attraktivität der Hauptstadt als Motiv für Abwanderungen aus Chiang Mai genannt. Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, daß es sich dabei um recht verschiedene soziale Gruppen handelt. Unter der abwandernden Bevölkerung dominieren junge, arbeitsuchende Menschen, die oft noch am Beginn ihrer Berufskarriere stehen und für die der große, differenzierte und dynamische Arbeitsmarkt und die erhofften Verdienstmöglichkeiten in Bangkok ein zentrales Wanderungsmotiv darstellen. Die aus Bangkok zuwandernden Gruppen bestehen dagegen zu einem großen Teil aus älteren, viel-
29 In diesen Grenzräumen ist es in den letzten Jahren jedoch wiederholt zu Konflikten zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen gekommen, die z.T. politisch gesteuert waren, aber inzwischen auch eine Eigendynamik entwickelt haben. Das in den nomadischen Gesellschaften gegenwärtig rasch vordringende private Grund-eigentum hat kommerziellen Interessen den Weg bereitet, denen die Kleinbauern (v.a. Kikuyu), die das Land oft ohne gültigen Rechtstitel als Squatter bewirtschaften, im Wege sind. Kommerzielle Inwertsetzung von Land bedeutet dann vielfach Vertreibung. Daraus könnte sich eine neue Quelle der Land-Stadt-Migration entwickeln, schon jetzt stellen ethnische Flüchtlinge einen zwar noch relativ kleinen, aber wachsenden Bevölkerungsanteil in Nakuru.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
183
Abb. 4a: Quellgebiete der Migration nach Baguio City 1991/92
Quelle: eigene Erhebung
Helmut Schneider
184
Abb. 4b: Quellgebiete der Migration nach Chiang Mai 1991/92
Quelle: eigene Erhebung
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
185
Abb. 4c: Quellgebiete der Migration nach Nakuru 1991/92
Quelle: eigene Erhebung
fach bereits aus dem Berufsleben ausgeschiedenen Personen, die oft im Familienverband nach Chiang Mai abwandern. Während der Großraum Bangkok als Zentrum des ökonomi-schen Booms zunehmend von Agglomerationsnachteilen gekennzeichnet ist (Überlastung der Infrastruktur, sinkende Umweltqualität, sinkende Wohnqualität), bietet Chiang Mai - noch - vergleichsweise angenehme städtische Lebensbedingungen. Die Stadt hat sich deswegen zu einem beliebten Alterssitz von aus Bangkok stammenden Rentnern und Pensionären ent-wickelt, die oft mit weiteren Familienmitgliedern übersiedeln. Eine weitere wichtige Gruppe von Migranten aus Bangkok stellen Staatsbeamte und -angestellte, die in das Zentrum der Nordregion versetzt werden oder sich selber um Versetzung dorthin bemüht haben. In dem stark zentralisierten thailändischen Staatswesen werden nach wie vor Stellen bis auf die unterste Ebene durch zentrale hauptstädtische Institutionen besetzt. Eine Karriere im Staats-
Helmut Schneider
186
apparat setzt andererseits oft eine Ausbildung, mindestens aber eine Zwischenstation in der Hauptstadt voraus. Die Staatsbürokratie hat sich nach der Abschaffung der absoluten Mon-archie seit den dreißiger Jahren zu einer wichtigen strategischen Gruppe entwickelt, deren Angehörige hohes Prestige genießen und für die nationale Identität der Thais eine wichtige Rolle gespielt haben und noch spielen.30 7.1 Bindungen an die Herkunftsräume: Haushaltsspaltung, Besuche, Rückkehrwunsch Migrationen implizieren eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß zwischen Herkunfts- und Ziel-räumen ein Netz sozialer Beziehungen entsteht. Dies kann über familiäre und verwandt-schaftliche Bindungen, über Freundschaften, aber auch über Rechtsansprüche vermittelt sein, deren Einlösung z.B. eine periodische Anwesenheit am Herkunftsort erfordert. Ob und in welchem Ausmaß sich tatsächlich soziale Netzwerke zwischen den Herkunftsräumen und jetzigen Wohnorten der Migranten entwickelt haben, wird im folgenden anhand der Indi-katoren "Haushaltsspaltung", "Besuche am Herkunftsort" und "Rückkehrwünsche" überprüft. 7.1.1 Gespaltene Haushalte "backward linkages"
Als besonders intensive Form der Bindung sind dabei gespaltene Haushalte anzusehen. In diesen Fällen definieren sich die Befragten als Mitglieder von zwei räumlich getrennten Haushalten. Es handelt sich dabei in der überwiegenden Mehrheit um Migranten, allerdings können sich auch bereits in den betrachteten Städten geborene Personen noch den Herkunfts-haushalten bzw. -familien der Eltern zugehörig fühlen. Personen, die sich zwei getrennten Haushalten in derselben Stadt zugehörig fühlen, meist als Folge des Auszugs jüngerer Personen aus überbelegten Wohnungen, machen in allen Städten nur einen verschwindend geringen Anteil aus. Die Dominanz der Migranten unter den Personen mit gespaltenen Haus-halten spiegelt sich auch in dem räumliche Verteilungsmuster der zweiten Haushalte wider, das weitgehend deckungsgleich mit den Quellgebieten der Migration ist. In Baguio City gaben 44,3% der Befragten an, einem zweiten Haushalt anzugehören, zu über 90% handelt es sich dabei um Migranten. Dieser relativ hohe Wert hängt damit zusammen, daß hier wie ausgeführt die bildungsbezogene Migration eine besondere Rolle spielt, Schüler und Studenten ihren Stadtaufenthalt oft als nur temporär betrachten, mehrheitlich auch noch keine eigenen Familien gegründet haben und sich insofern den elterlichen Herkunftshaus-halten noch stärker verbunden fühlen. In Nakuru definierten sich nur ca. 17% als Mitglieder zweier Haushalte, hier handelt es sich zu über 83% um Migranten. Die Bindung an die eige-nen oder elterlichen Herkunftsräume ist gemessen an diesem Indikator in Chiang Mai am geringsten ausgeprägt, nur rund 10% fühlten sich einem zweiten Haushalt zugehörig. Dabei handelt es sich zudem nur zu 56% um Migranten. Als Erklärung kann hier der Umstand herangezogen werden, daß Zuwanderungen in Chiang Mai im Städtevergleich eine geringere Rolle spielen, dagegen aber Migranten der zweiten Generation bereits stärker vertreten sind. Diese können sich den Herkunftsfamilien oder -haushalten der Eltern noch verbunden fühlen, obwohl sie selbst bereits in Chiang Mai geboren und oft auch aufgewachsen sind. Zu berücksichtigen ist hier aber auch die Schwierigkeit, mit der sich jeder kulturvergleichende
30 Vgl. zur Bedeutung der "Funktionärs- und Bildungsreisen" für die nationale Integration B. Anderson, Die Er-findung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt a.M.; New York 1993.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
187
Ansatz konfrontiert sieht: daß Bedeutungen je nach "cultural context" variieren können. Dies betrifft auch die Vorstellungen, die mit einer Mitgliedschaft in einem zweiten Haushalt assoziiert werden. Genügte z.B. den kenianischen Befragten gewöhnlich die Selbstzuschrei-bung oder die Fremdzuschreibung durch andere Haushaltsmitglieder, verbanden zahlreiche Interviewpartner in Chiang Mai mit einem zweiten Haushalt auch häufige und regelmäßige, mindestens monatliche Besuche. Insofern liegt den entsprechenden empirischen Befunden für Chiang Mai vermutlich ein strengerer Maßstab zugrunde. Wird die Gruppe der Migranten betrachtet, so unterhält mit Anteilen von 13% in Chiang Mai und 19% in Nakuru nur eine Minderheit über Haushaltsspaltungen engere Bindungen zum Herkunftsort; der hohe Anteil von 52% in Baguio City erklärt sich aus den Besonderheiten bildungsbezogener Migration. Allerdings gibt die Tatsache der Haushaltsspaltung allein noch keine hinreichende Information über den Stellenwert im Rahmen von Existenzsicherungs-strategien. Es kann aber angenommen werden, daß Haushaltsspaltungen, die auch die Tren-nung von Ehepartnern implizieren, in der Mehrzahl der Fälle Ausdruck von räumlich arbeits-teiligen Strategien zur Existenzsicherung sind. Die Befunde zeigen für die untersuchten Beispiele ein differenziertes Bild. Bei verheirateten Personen mit gespaltenem Haushalt implizierte dies in Chiang Mai nur bei 6% auch eine Trennung vom Ehepartner. Dem-gegenüber betrug dieser Anteil in Baguio City 27%, in Nakuru sogar über 51%. Neben kulturellen Variationen bezüglich der sozialen Akzeptanz von räumlich getrennt lebenden Ehepartnern spiegelt sich darin vor allem die mit dem ökonomischen Entwicklungsgefälle verbundene unterschiedliche Ausprägung materieller Zwänge. Für Kenya spielt darüber hin-aus auch die in der Kolonialzeit entstandene, kulturell eingebettete Form der Arbeitsteilung eine Rolle, die Frauen und Kindern die "Zuständigkeit" für die agrarische Subsistenz-produktion und die gelegentliche Vermarktung von Überschüssen im ländlichen Raum zuwies, während die Männer städtischem Lohnerwerb nachgingen.31 "foreward linkages"
In eine Betrachtung der durch Migration und Haushaltsspaltung aufgespannten sozialen Netze muß grundsätzlich auch die Bindung von Migranten einbezogen werden, für die Nakuru, Baguio City oder Chiang Mai Herkunftsorte und Ausgangspunkte der Migration sind. Die dazu erforderliche Erfassung von Migranten an verschiedenen Zielorten war im Rahmen der durchgeführten Untersuchung jedoch nicht möglich. Erfaßt wurden aber Per-sonen, die aufgrund der Zuschreibung durch die Befragten zum betreffenden städtischen Haushalt gehörten, zum Zeitpunkt der Befragung aber an einem anderen Ort lebten. Aufgrund der indirekten Erhebung ist dieses Merkmal sicher nur mit großer Vorsicht zu interpretieren. Haushaltszugehörige, aber temporär abwesende Personen wurden in Baguio City und Nakuru bei rund 4% aller Haushalte mit zwei und mehr Mitgliedern registriert, in Chiang Mai lag dieser Anteil nur bei 1%. Die im Vergleich zu "rückwärts" gerichteten Haushaltsspaltungen deutlich geringere Ausprägung hängt zum einen damit zusammen, daß Nakuru und Baguio City in weitaus stärkerem Maße Zielorte der Migration denn Abwanderungsräume sind. Dies gilt jedoch nicht für Chiang Mai, wo aufgrund der demographischen Daten auch von einer starken Abwanderung vorzugsweise nach Bangkok ausgegangen werden muß. Eine Er-klärung ist darin zu suchen, daß die Abwanderung aus den untersuchten städtischen Zentren
31 Vgl. H. Schneider, Aspekte der Existenzsicherung städtischer Haushalte in der kenianischen Mittelstadt Nakuru, in: A.M. Brandstetter u.a. (Hrsg.), Afrika hilft sich selbst. Prozesse und Institutionen der Selbst-organisation, Münster; Hamburg 1994, 356-370.
Helmut Schneider
188
vielfach bereits eine Etappe einer Step-wise-migration darstellt, Bindungen also eher zu den ursprünglichen ländlichen Herkunftsräumen bestehen. Eine Rolle dürfte aber auch spielen, daß städtische Sozialbeziehungen lockerer und damit auch die Bindungen an städtische Haushalte weniger intensiv sind. Dies gilt generell, insbesondere aber für die thailändische Gesellschaft, die aufgrund ihrer wenig rigiden, als "loosly structured" klassifizierten sozialen Organisation ethnologisch immer schon als "Problemfall" angesehen wurde, da verbindliche Beziehungsstrukturen nur schwer zu identifizieren waren.32 Die Erosion erweiterter Familien-strukturen (extended families) und damit verknüpfter Bindungen ist hier bereits weit, auch bis in den ländlichen Raum, fortgeschritten.33 Im Vergleich dazu kommt über die Kernfamilie hinausgehenden familiären und verwandtschaftlichen Beziehungen auf den Philippinen und in Kenya noch eine größere Verbindlichkeit zu.34 Für die temporär abwesenden Haushaltsmitglieder spielten ausländische Migrationsziele nur in Baguio City eine nennenswerte Rolle. Hier handelt es sich aber immerhin um zwei Drittel der betreffenden Haushalte, die auf diese Weise in die internationale Arbeitsmigration ein-gebunden sind. Die Philippinen sind schon seit längerem an der internationalen Arbeits-migration beteiligt; Hauptdestinationen sind die ölexportierenden Staaten, Australien und die USA, letztere mit einer bis in die Phase der amerikanischen Kolonialherrschaft zurück-reichenden Tradition. Die Möglichkeit, an Geldüberweisungen im Ausland beschäftigter Haushaltsmitglieder partizipieren zu können, stellt für die Existenzsicherung von Haushalten einen wichtigen Vorteil dar.35 7.1.2 Besuche am Herkunftsort Eine weniger intensive Bindung an den Herkunftsraum, die Herkunftsfamilie oder den Herkunftshaushalt stellen Besuche dar, die in der Regel mit Ressourcentransfers und Infor-mationsaustausch in beiden Richtungen verbunden sind. Entgegen der Annahme, weibliche Migranten seien ihren Herkunftsgemeinschaften noch stärker verbunden oder verpflichtet, was seinen Ausdruck in höheren Besuchshäufigkeiten finden müßte, zeigen die empirischen Befunde für die untersuchten Städte keine diesbezügliche geschlechtsspezifische Differen-zierung. Gefragt wurde in der durchgeführten Erhebung nach mindestens einem Besuch der Migranten am Herkunftsort im vorausgegangenen Jahr. Fast 90% der Migranten in Nakuru, aber auch ca. 73% in Chiang Mai machten entsprechende Angaben, mit einem "Besucher-anteil" von rund 60% für alle Migranten liegt Baguio City etwas darunter. Dies hängt damit zusammen, daß die Bildungsmigranten im Unterschied zu den Arbeitsmigranten vielfach von ihren Herkunftsfamilien noch alimentiert werden müssen und Besuchskosten, die z.B. auf-grund erwarteter Geschenke immer mehr umfassen als reine Transportkosten, bei schmalem Budget relativ stärker ins Gewicht fallen. Ein Beleg dafür ist der für alle Städte in der Tendenz ähnliche Befund, daß die Besuchshäufigkeit in den unteren Einkommensgruppen am schwächsten ausgeprägt ist.
32 Vgl. B.L. Foster, Family Structure and the Generation of Thai Social Exchange Networks, in: R. Mc Netting a.o. (Eds.), Households. Comparative and Historical Studies in the Domestic Group, Berkeley 1984, 84 -108, hier 85ff. 33 R.J. Muscat, The Fifth Tiger. A Study of Thai Development Policy, Armonk (N.J.); Tokyo 1994, 283. 34 Vgl. z.B. F.L. Jocano, Elements of Filipino Social Organization, in: Y. Kikuchi (Ed.), Philippine Kinship and Society, Quezon City 1989, 1-26; D. Berg-Schlosser, Tradition and Change in Kenya, Paderborn 1984. 35 Vgl. G. Gunatilleke (Ed.), The Impact of Labour Migration on Households. A Comparative Study of Seven Asian Countries, Tokyo 1992.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
189
Auffallend ist allerdings der im Vergleich hohe "Besucheranteil" in Nakuru. Anders als die nur durchschnittliche Häufigkeit von gespaltenen Haushalten verweist dieser Indikator auf eine besonders enge Bindung an die Herkunftsräume. Dies läßt sich jedoch nur mit den kul-turellen Besonderheiten der ethnisch definierten Herkunftsgemeinden in Kenya erklären. Gemeinschaftliches Bodeneigentum besteht trotz expandierender Formen des Privateigen-tums in vielen Gebieten noch, einzelnen Familien, Haushalten oder Personen werden ledig-lich Nutzungsrechte zugewiesen. Diese Nutzungsrechte, aber auch Erbansprüche bei Privat-besitz müssen immer wieder durch persönliche Anwesenheit bestätigt und bekräftigt werden. Berechtigt dazu sind in den patriarchalisch organisierten ethnischen Gemeinschaften in der Regel nur die Männer, auch wenn sie bereits längerfristig abwesend sind. So müssen z.B. bei einigen Ethnien die Söhne entsprechende Ansprüche für ihre Mütter geltend machen, wenn deren Männer abwesend oder verstorben sind (auf ethnienspezifische Differenzierungen kann hier nicht weiter eingegangen werden). 7.1.3 Rückkehrwünsche Als weiteres Indiz für fortbestehende Bindungen an die Herkunftsräume können die von Migranten geäußerten Rückkehrwünsche angesehen werden. Ob die darin zum Ausdruck kommenden Bindungen im Vergleich zu Haushaltsspaltungen und Besuchen schwächer oder gleich stark ausgeprägt sind, läßt sich allerdings nicht eindeutig beantworten. Trotz enger Verbundenheit können z.B. Besuche am Herkunftsort aufgrund großer Distanzen und/oder ökonomischer Schwierigkeiten für einen längeren Zeitraum unmöglich sein. Andererseits kann angenommen werden, daß zwischen der Häufigkeit geäußerter Rückkehrwünsche und sozioökonomischen Integrationsschwierigkeiten von neuangekommenen Migranten ein posi-tiver Zusammenhang besteht. Differenziert wurde in der durchgeführten Befragung zwischen konkret geplanter Rückkehr im bevorstehenden Jahr und zwar grundsätzlich bestehendem, aber zeitlich nicht konkretisierten Rückkehrwunsch. Eine konkret bevorstehende Rückkehr wurde in allen drei Fällen nur von einer kleinen Minderheit geplant. Dies läßt den Schluß zu, daß es sich bei dem allgemein geäußerten Wunsch nach Rückkehr an den Herkunftsort in vielen Fällen weniger um eine realistische Handlungsorientierung als vielmehr um eine psychische Anpassung handelt, um den schwierigen und verunsichernden Übergang zu einer längerfristigen oder dauerhaften Stadtexistenz bewältigen zu können. Für diese Einschätzung spricht auch der Befund, daß dieser Wunsch in allen drei Städten am häufigsten von jüngeren, noch nicht lange in der Stadt lebenden Personen mit geringem Einkommen geäußert wurde. Die Diskrepanz zwischen Erwartungen und städtischer Lebensrealität wird von dieser Gruppe am schmerzhaftesten erfahren. Ein allgemeiner Rückkehrwunsch ohne zeitliche Konkretisierung wurde von rund 24% der Migranten in Chiang Mai, von knapp 34% in Baguio City, jedoch von über 50% in Nakuru geäußert. Gegen die Vermutung, dies könne in dem kenianischen Fall Ausdruck noch fort-bestehender, in der Kolonialzeit wurzelnder zirkulärer Migration sein, bei der ein - zumeist männliches - Haushaltsmitglied temporär städtische Beschäftigungen ausübt, sprechen jedoch verschiedene bereits erwähnte Befunde: Auch unter den Migranten in Nakuru machten Per-sonen mit räumlich gespaltenem Haushalt nur eine Minderheit (19%) aus, und die in der Befragung erfaßten verheirateten Personen lebten in der überwiegenden Mehrheit (über 80%) mit dem Partner am Untersuchungsort zusammen. Darin kommt eher eine in Afrika stärker noch als in Südostasien ausgeprägte Orientierung zum Ausdruck, die sich als "life in a dual
Helmut Schneider
190
system" beschreiben läßt.36 Gemeint ist damit, daß ein bereits langfristig angelegter Stadt-aufenthalt ganzer Familien mit einer Rückkehroption - unabhängig davon wie realistisch diese ist - verbunden wird. Gewöhnlich wird eine Rückkehr an den Herkunftsort nach Beendigung des Arbeitslebens angestrebt. Solche Wünsche können auch dann noch bestehen, wenn die Lebensumstände der Befragten bereits erkennen lassen, daß eine Realisierung sehr unwahrscheinlich ist. Aufgrund des weitgehenden Ausschlusses von Frauen vom Zugang zu Grund und Boden ist diese Option zumindest für alleinstehende Frauen in Kenya weniger realistisch als für Männer. Dies spiegelt sich in dem Befund, daß die befragten weiblichen Migranten in Nakuru mit einem Anteil von 43% in deutlich geringerem Maße als die männlichen Befragten (55%) den Wunsch nach Rückkehr in die Herkunftsorte äußerten. Für Baguio City und Chiang Mai konnten demgegenüber keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den geäußerten Rückkehrwünschen festgestellt werden. 8. Bindung an die Herkunftsräume als Hemmnis der urbanen Integration? Soziale Netzwerke zwischen Quell- und Zielräumen der Migration haben vielfach die Funktion, den Übergang zu städtischen Lebensformen materiell und mental zu erleichtern, abzustützen und als soziales Auffangnetz gegen Risiken abzusichern. Diese für die Existenz-sicherung elementare Funktion stand bei den bisherigen Ausführungen im Vordergrund. Bindungen an die Herkunftsräume der Migranten können aber auch als Hemmnis wirken, durch das ein experimentelles "Sich-Einlassen" auf die städtische Lebensumwelt erschwert oder gar verhindert wird (vgl. die einführenden Bemerkungen in Kap. 3). Um abschätzen zu können, ob dies tatsächlich zutrifft, werden zunächst nur Personen betrachtet, die in gespaltenen Haushalten leben. Haushaltsspaltung wird dabei als Indikator besonders enger Bindungen betrachtet. In dieser Teilgruppe der Befragten sind in allen drei untersuchten Städten die Mitgliedschaften in städtischen Organisationen wie z.B. in Ver-einen, Gewerkschaften, Selbsthilfegruppen etc. nicht nur deutlich geringer als bei der in der Stadt geborenen Bevölkerung, sondern auch geringer als bei den übrigen Migranten aus-geprägt. Gleiches gilt für den Wohnort des besten Freundes als einem weiteren Indikator städtischer Sozialintegration. Bei Personen mit Haushaltsspaltung wohnte der beste Freund bzw. die beste Freundin deutlich seltener in der untersuchten Stadt als bei allen anderen Gruppen. Umgekehrt sind die Besuche des Herkunftsortes wie auch die geäußerten Rück-kehrwünsche deutlich überdurchschnittlich ausgeprägt. Letzteres gilt für Chiang Mai allerdings nur mit Einschränkungen, da hier die fortgeschrittene Erosion familiärer Sozial-bindungen dazu geführt hat, daß die jungen Migranten in der Stadt die Gründung eines eigenen Haushaltes anstreben und in weit geringerem Maße als auf den Philippinen oder in Kenya den Wunsch haben, in den elterlichen Haushalt zurückzukehren. Insgesamt scheinen diese Befunde zunächst die These zu bestätigen, daß intensive Bindungen an die Herkunfts-räume die städtische Sozialintegration erschweren. Wird in die Betrachtung allerdings auch die Wirkung einbezogen, die die Dauer des Stadtaufenthaltes auf die Bindung an die Herkunftsräume ausübt, so muß diese Schlußfolgerung jedoch stark relativiert werden. In allen drei untersuchten Sekundärstädten nimmt die Bindung an die Herkunftsräume deutlich mit der Dauer des Stadtaufenthaltes ab. Dies läßt sich an verschiedenen Indikatoren wie z.B.
36 Vgl. J. Gugler, Vier Phasen der Urbanisierung in Schwarzafrika, in: R. Henkel; W. Herden (Hrsg.), Stadt-forschung und Regionalplanung in Industrie- und Entwicklungsländern, Heidelberg 1989, 13-24.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
191
Haushaltsspaltungen, Besuchshäufigkeiten und geäußerten Rückkehrwünschen ablesen. Um-gekehrt ist eine klare Zunahme städtischer Sozialbindungen zu konstatieren, was z.B. durch Mitgliedschaften in städtischen Organisationen zum Ausdruck kommt. 9. Stadtbewohner - eine bindungsarme Spezies? Abschließend soll noch einmal die eingangs aufgeworfene Frage einer Abschwächung oder Ausdünnung sozialer Bindungen von Stadtbewohnern gegenüber einer ländlich-dörflichen Lebensweise aufgegriffen werden, wie sie in den klassischen Aussagen der Stadtökologie als Gefahr sozialer Anomie formuliert wurde. Als Indikator für soziale Bindungsarmut soll hier das quantitative Gewicht von Einpersonenhaushalten betrachtet werden. In Baguio City und in Chiang Mai betrug der Anteil dieser - nur bezogen auf die am Untersuchungsort bestehende Haushaltsform! - alleinlebenden Personengruppe an allen Befragten 11% bzw. 14%, in Nakuru lag dieser Anteil allerdings mit 28% deutlich über diesen Werten. Dies muß angesichts der hohen Wertschätzung von Familie, erweiterter Familie und ethnischer Gruppe in Kenya zunächst überraschen. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, daß sich der ange-sprochene Personenkreis in seiner großen Mehrheit keineswegs in das negative Bild des ent-wurzelten und bindungslosen Stadtbewohners einfügt. Zur Erklärung ist für Nakuru zunächst auf die Folgewirkungen der erst wenige Jahrzehnte zurückliegenden kolonialen Vergangenheit zu verweisen. Im Bemühen, eine dauerhafte Ansiedlung einheimischer Bevölkerung in den Städten nach Möglichkeit einzudämmen und zu begrenzen, wurden während der britischen Kolonialzeit für die benötigten Arbeitskräfte vorwiegend Ein-Zimmer-Wohneinheiten errichtet, die den Zuzug von Familienangehörigen weitgehend unmöglich machen sollten. Der afrikanischen Bevölkerung war lediglich der Status temporärer Stadtbewohner zugedacht, die Städte sollten der weißen Bevölkerung und den indischen Geschäftsleuten vorbehalten bleiben. Noch in den sechziger Jahren machten winzige Ein-Zimmer-Wohneinheiten ca. 90% des städtischen Wohnungsbestandes in Nakuru aus.37 Die heute die städtische Ökonomie bestimmenden Industriebetriebe haben diese Wohnungspolitik teilweise übernommen. Daraus ergibt sich ein aus der Struktur des Woh-nungsbestandes herrührender Zwang zu Einpersonenhaushalten, der die Häufigkeit dieser Haushaltsform in Nakuru mit erklärt, aber nur bedingt Schlüsse auf die Sozialbindungen der Bewohner zuläßt. Am Untersuchungsort alleinlebende Personen können sich aber auch einem anderen Haushalt zugehörig fühlen und insofern nicht umstandslos als bindungsarm angesehen werden. Berücksichtigt man nur die allein lebenden Personen, die sich nicht in Form von Haushalts-spaltungen zugleich auch einem anderen Haushalt zugehörig fühlen, so reduziert sich der entsprechende Anteil in Nakuru auf nur noch 10% der Befragten. Werden weitere "Bindungs-indikatoren" wie Mitgliedschaften, Freundschaften, Besuche des Herkunftsortes und Rück-kehrwünsche einbezogen, so bleibt nur eine sehr kleine Gruppe von lediglich 0,5% aller Befragten übrig, die nach den hier zugrunde gelegten Indikatoren als bindungsarm oder "anomisch" gelten muß. Dieser Befund läßt sich für die Städte Chiang Mai und Baguio City ebenfalls verifizieren. Eine Bestätigung der sozialökologischen Hypothese über Bindungs-armut und soziale Entwurzelung von Stadtbewohnern ist daraus schwerlich abzuleiten.
37 A. Wachtel, Towards a Model of Urbanism in an African City. The Dual Focus Career of Formal Sector Wor-kers in Nakuru, Kenya, Ann Arbor 1979.
Helmut Schneider
192
10. Schlußbemerkung Aus dem Vergleich von Art, Entfaltung und Umfang existenzsichernder sozialer Netze in den Sekundärzentren Baguio City (Philippinen), Chiang Mai (Thailand) und Nakuru (Kenya) lassen sich einige allgemeine Schlußfolgerungen ziehen.
1. Zwischen den untersuchten Sekundärzentren bestehen Ähnlichkeiten hinsichtlich der Stel-lung in der nationalen Siedlungshierarchie und der relativen Reichweite ihrer zentralörtlichen Funktionen. In allen drei Fällen wird das demographische Wachstum in erheblichem, aller-dings unterschiedlichem Maß durch Zuwanderungen, überwiegend durch Land-Stadt-Migrationen getragen. Damit stellt sich das Problem, wie die "neuen Städter" den Übergang zu städtischen Lebensweisen und die Integration in eine kulturell zumeist fremde und ökonomisch oft bedrohliche Lebensumwelt bewältigen.
2. Aus den Strukturähnlichkeiten der untersuchten Städte folgen soziale Reaktionsweisen, die einige allgemeine Gemeinsamkeiten aufweisen: Dies betrifft zum einen die räumlichen Mi-grationsmuster mit der Dominanz weniger, zumeist nahegelegener Quellgebiete, zum anderen aber auch die in allen drei Fällen feststellbare Aufrechterhaltung sozialer Bindungen von Migranten an ihre Herkunftsfamilien, -haushalte oder -gemeinschaften. Der Befund, daß die Intensität dieser Bindungen im Zeitverlauf in allen drei untersuchten Fällen abnimmt, ist ein Indiz für die mit der Dauer des Stadtaufenthaltes tendenziell abnehmenden Funktionen als materielle und mentale Sicherheitsnetze. Allerdings läßt sich dies nicht modernisierungs-theoretisch als lineare, bruchlose Entwicklung interpretieren. Aufgabe oder Aufrecht-erhaltung, Intensivierung oder gegebenenfalls auch Neubelebung sozialer Netze zwischen Migranten und ihren Herkunftsgemeinschaften sind vielmehr Varianten, die variabel ent-sprechend den Notwendigkeiten städtischer Existenzsicherung von Haushalten oder Indi-viduen eingesetzt werden. Dies betrifft auch noch bestehenden Formen von zirkulärer Migration oder des Festhaltens an einem "life in a dual system", die nicht als "Durch-gangsstadien" des Modernierungsprozesses mißverstanden werden dürfen.
3. Die zwischen den untersuchten Städten im einzelnen unterschiedlichen Migrationsmuster und die differierenden Ausprägungen von Sozialbindungen lassen sich nur unter Ein-beziehung historischer Faktoren sowie des jeweiligen "cultural context" erklären. Spezifische historische und kulturelle Faktoren sind aber nicht nur für den Vergleich zwischen Na-tionalstaaten, sondern auch für die Differenzierung von nationalstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene von Relevanz (z.B. Kenya als britische Kolonie, die "white highlands" als von weißen Siedlern erschlossener Raum und Nakuru als städtisches Zentrum dieses Raumes). In einer konkreten Lokalität überlagern und verflechten sich insofern verschiedene Funktions-räume und prägen auch die Ausbildung sozialer Netzwerke auf jeweils spezifische Weise.
4. Die vorgestellten Befunde lassen nicht den Schluß zu, bei der zum großen Teil aus Zuwanderern bestehenden Bevölkerung der schnell wachsenden Sekundärzentren handele es sich überwiegend um entwurzelte, bindungsarme Stadtbewohner. Zum einen werden soziale Bindungen an die Herkunftsgemeinschaften aufrechterhalten, zum anderen werden sie mit der Dauer des Stadtaufenthaltes aber zunehmend auch durch städtische Sozialbindungen ergänzt oder ersetzt. Dies trifft auch für das kenianische Beispiel zu, wo kulturspezifisch die Rückkehrwünsche der Migranten noch besonders ausgeprägt sind. Zahlreiche Indikatoren belegen jedoch auch hier, daß der Übergang zu städtischen Lebensformen mehrheitlich dauerhaft - wenn auch nicht linear-bruchlos - und nicht nur temporär ist, mit allen Folgen, die sich daraus für Stadtplanung und Kommunalpolitik ergeben.
"Soziale Netze und städtische Existenzsicherung"
193
Literaturverzeichnis Anderson, B.,Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt a.M.; New York 1993.
Agnew, J.; Mercer, J.; Sopher, D., The City in Cultural Context. Introduction and Commen-tary, in: Dies. (Eds.), The City in Cultural Context, Boston 1984,1-30, 277-288.
Berg-Schlosser, D., Tradition and Change in Kenya, Paderborn 1984.
CBS/K [Central Bureau of Statistics, Kenya], Kenya Population Census 1989, Vol. I, Nairobi 1994.
Foster, B.L., Family Structure and the Generation of Thai Social Exchange Networks, in: R. McNetting a.o. (Eds.), Households. Comparative and Historical Studies in the Domestic Group, Berkeley 1984, 84-108.
Friedrichs, J., Stadt-Soziologie, Opladen 1995.
Gaebe, W., Urbanisierung in Afrika, in: Geographische Rundschau 10 (46), 1994, 570-576.
Gunatilleke, G. (Ed.), The Impact of Labour Migration on Households. A Comparative Study of Seven Asian Countries, Tokyo 1992.
Humphreys, S.C., Geschichte, Volkswirtschaft und Anthropologie. Das Werk Karl Polanyis, in: Karl Polanyi, Ökonomie und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1979, 7-59.
Jocano, F.L., Elements of Filipino Social Organization, in: Y. Kikuchi (Ed.), Philippine Kinship and Society, Quezon City 1989, 1-26.
Kraas, F., Bangkok. Ungeplante Megastadtentwicklung durch Wirtschaftsboom und sozio-kulturelle Persistenzen, in: Geographische Rundschau 2 (48), 1996, 89-96.
Louis-Berger-Intern. Inc., Initial Study Findings Report for Chiang Mai Planning Project, Chiang Mai 1991.
Manhan, G.V.; Torres, E.F., Planning and Development in a Highland City. A Case Study of Baguio, The Philippines, in: Regional Development Dialogue 2 (12), 1991, 102-113.
Mitchell, J.C., Social Networks, in: Annual Review of Anthropology 3, 1974, 279-299.
Muscat, R.J., The Fifth Tiger. A Study of Thai Development Policy, Armonk (N.J.); Tokyo 1994.
Nohlen, D.; Nuscheler, F., Indikatoren von Entwicklung und Unterentwicklung, in: Dies. (Hrsg.), Handbuch der Dritten Welt. Bd. 1: Grundprobleme, Theorien, Strategien, Bonn 1992, 76-108.
NSO/P [National Statistics Office, Philippinen], 1990 Census of Population and Housing, Manila 1992.
NSO/T [National Statistics Office, Thailand], 1990 Population and Housing Census, Bangkok 1994.
Pohjola, A., Social Networks - Help or Hindrance for the Migrant?, in: International Mi-gration 3 (24), 1991, 435-443.
Helmut Schneider
194
Polanyi, K., The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesell-schaften und Wirtschaftssystemen, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1990 (zuerst 1944).
Santos, T.M., The Killer Earthquake of 1990. Lessons and Opportunities, in: Philippine Geographical Journal 2 (34), 1990, 67-70.
Schneider, H., Zivilisationsprozeß, Macht und städtische Form in einer buddhistischen Kultur. Das Beispiel von Chiang Mai, Nordthailand, in: M. Jansen u.a. (Hrsg.), Städtische Formen und Macht, Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkultur-forschung 1, Aachen 1994, 195-217.
Ders., Aspekte der Existenzsicherung städtischer Haushalte in der kenianischen Mittelstadt Nakuru, in: A.M. Brandstetter u.a. (Hrsg.), Afrika hilft sich selbst. Prozesse und Institutionen der Selbstorganisation, Münster; Hamburg 1994, 356-370.
Ders., Ethnizität und ethnische Viertelsbildung in philippinischen Sekundärstädten am Bsp. von Zamboanga City und Baguio City, in: M. Jansen u.a. (Hrsg.), Grenzen und Stadt, Ver-öffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung 2, Aachen 1997, 61-100.
Ders., Ethnische Konflikte ... droht eine Zukunft von Stammeskriegen? Die Aktualität von Ethnizität und Nationalismus - Überlegungen zu einigen neueren Ansätzen, in: Schriften der Hans-Böckler-Stiftung 1996.
Ders., Social Networks and Access to Employment and Accomodation in Third World Secondary Cities, in: H. Schneider; K. Vorlaufer (Eds.), Employment and Housing - Central Aspects of Urbanization in Secondary Cities. A Crosscultural Comparison, London 1996.
Schweizer, T., Netzwerkanalyse als moderne Strukturanalyse, in: Ders. (Hrsg.), Netzwerk-analyse - ethnologische Perspektiven, Berlin 1989, 1-34.
Short, C., A Rural-Urban Demographic Model to Project the Population of Kenya 1990–2020, Nairobi 1992.
Simmel, G., Die Kreuzung sozialer Kreise, in: O. Rammstedt (Hrsg.), Georg Simmel – Gesamtausgabe, Bd. 11: Soziologie - Untersuchungen über die Formen der Vergesell-schaftung, Frankfurt a.M. 1992 (zuerst 1908).
UN (Hrsg.), World Urbanization Prospects. The 1994 Revision, New York 1995.
UNFPA [Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen], Weltbevölkerungsberichte 1994 und 1995, Bonn o.J.
Wachtel, A., Towards a Model of Urbanism in an African City. The Dual Focus Career of Formal Sector Workers in Nakuru, Kenya, Ann Arbor 1979.
Wegmann, J., Soziales Netzwerk, in: B. Schäfers (Hrsg.), Grundbegriffe der Soziologie, 4. Aufl. Opladen 1995, 225-228.
Wellman, B.; Carrington, P.J.; Hall, A., Networks as Personal Communities, in: B. Wellman; S.D. Berkowitz (Eds.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge 1988, 130-184.
Weltbank (Hrsg.), Weltentwicklungsbericht 1995, Bonn 1995.
Wirth, L., Urbanism as a Way of Life, in: American Journal of Sociology 44, 1938, 1-24.
FdR – Publikationen "Freunde des Reiff " der Fakultät für Architektur an der RWTH-Aachen e.V. Stand: August 2004
Geschäftsstelle: Freunde des Reiff e.V., Schinkelstr. 1, 52062 Aachen; Publikationsbeauftragter: Dipl.-Ing. Karsten Ley Tel.: 0241/ 80-95073, Fax.: 0241/ 80-92073, email: [email protected] Bankverbindung: Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00), Kto.Nr. 2000 8264
Beiträge der 'Freunde des Reiff e.V.' an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. ISSN 1438-6658 Nr. 1 Nitsch, Walter Carl 1999: Das Quirinus Münster. Baubericht und Neue Sicht.
ISBN 3-936971-04-8, Ln, € 165,00 – SFr. 249,00
Wissenschaftliche Schriften an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. ISSN 1437-1774 Nr. 1 Weinand, Yves 1998: Sichtbare Spannungen.
ISBN 3-936971-02-1, Ln, € 65,00 – SFr. 99,00 Nr. 2 Döring, Wolfgang; Führer, Wilfried; Jansen, Michael (Hrsg.) 1999: Brückenschläge.
Festschrift zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Wilhelm Friedrich Führer. vergriffen
Nr. 3 Pieper, Jan; Naujokat, Anke und Kappler, Anke 2003: Jerusalemskirchen. Mittelalterliche Kleinarchitekturen nach dem Modell des Heiligen Grabes. Katalog zur Ausstellung. ISBN 3-936971-10-2, Brosch., € 8,00 – SFr. 15,00
Nr. 4 Jansen, Michael (Hrsg.) 2004: Archaeological Park al-Balid. Technical Report. ISBN 3-936971-11-0, Ln, € 369,00 – SFr. 549,00
Nr. 5 Jansen, Michael (Hrsg.) 2004: Archaeological Park al-Balid. Site Atlas. ISBN 3-936971-12-9, € 299,00 – SFr. 444,00 (A4: € 159,00 – SFr. 239,00)
Nr. 6 Jansen, Michael (Hrsg.) 2004: Archaeological Park al-Balid. Photo Documentation. ISBN 3-936971-13-7, € 179,00 – SFr. 269,00
Nr. 7 Jansen, Michael und Hoock, Jochen (Hrsg.) 2002: Stadtnetze. Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung IAS, Bd. 3 ISBN 3-936971-15-3, Ln, € 55,00 – SFr. 84,00
Nr. 8 Jansen, Michael und Roeck, Bernd (Hrsg.) 2002: Entstehung und Entwicklung von Met-ropolen. Veröffentlichungen der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Stadtkulturforschung IAS, Bd. 4 ISBN 3-936971-16-1, Ln, € 55,00 – SFr. 84,00
Dissertationen an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. I, Architektur und Planung. ISSN 1436-7904 Noch nicht vorhanden
Dissertationen an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. II, Ingenieurwissenschaften. ISSN 1436-2570 Nr. 1 Rottke, Evelyn 1998: ExTraCAD – Computerunterstützung des architektonischen Trag-
werkentwurfs. ISBN 3-936971-00-5, Ln, € 65,00 – SFr. 99,00
Nr. 2 Heyden, Johann-Wilhelm 2002: Räumliche Knotenstabtragwerke in Ausführung mit Kreuzbalken und Induo-Verbundankertechnik. ISBN 3-936971-07-2, Ln, € 95,00 – SFr. 144,00
Nr. 3 Eggemann; Holger 2003: Vereinfachte Bemessung von Verbundstützen im Hochbau. Entwicklung, historische Bemessung und Herleitung eines Näherungsverfahrens. ISBN 3-936971-09-9, Ln, € 40,00 – SFr. 59,00
Dissertationen an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. III, Geisteswissenschaften. ISSN 1436-7912 Nr. 1 Dams, Bernd H. 1998: Marly. Die Ursprünge des Königlichen Schlosses von Marly: Iko-
nologie und Architektur. ISBN 3-936971-01-3, Ln, € 85,00 – SFr. 129,00
Nr. 2 Janßen-Schnabel, Elke 1999: Planungsprogramme frühkolonialer englischer Städte in Nordamerika im Vergleich mit Konzepten französischer, niederländischer und spanischer Niederlassungen. ISBN 3-936971-03-X, Ln, € 55,00 – SFr. 84,00
Nr. 3 Hung, Chuan Hsiang 1999: Die Gestaltung und Veränderung der Stadt Tainan seit ihrer Gründung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Strukturanalyse der historischen Hauptstadt Taiwans. ISBN 3-936971-05-6, Ln, € 75,00 – SFr. 114,00
Nr. 4 Wijesundara, Kuliyapiti W. J. P. 2001: Urban conservation and the renewal of the his-toric city. A comprehensive study on the methods, means and strategies of urban con-servation between Germany and Sri Lanka with special reference to the conservation policy in the renewal process. ISBN 3-936971-06-4, Ln, € 105,00 – SFr. 159,00