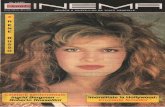Rudolf Ulrich: Österreicher in Hollywood (review)
Transcript of Rudolf Ulrich: Österreicher in Hollywood (review)
2/2004
zeit&medien
Thema:Kommunikations-
geschichte in neuen EU-Ländern II
Wandlungen der tschechischenMedienlandschaft
(1993-2003)
Wiener Werbung in Pressburg
1870-1918
Transformationsprozessein Ungarn
Kommunikations-wissenschaftlicheTransformations-
forschung, quo vadis?
Die erste tschechischsprachige
Zeitung Wiens
J a h r g a n g 1 9
Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart
ISSN 0259-7446€ 4,40
medien & zeit
2/2004
m&z 2/2004 Umschlag/v02 11.06.2004 17:32 Uhr Seite 1
ImpressumMedieninhaber.
Herausgeber und Verleger:Verein „Arbeitskreis für historische Kommunikationsforschung
(AHK)“, A-1180 Wien, Postfach 442http://muz.pub.univie.ac.at
WAP: http://muz.pub.univie.ac.at/wap/
© Die Rechte für die Beiträge in diesem Heft liegen beim„Arbeitskreis für historische Kommunikationsforschung (AHK)“
Vorstand des AHK:Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch (Obmann),
a.o. Univ.-Prof. Dr. Fritz Hausjell (Obmann-Stv.),Mag. Fritz Randl (Geschäftsführer),
Mag. Bernd Semrad (Geschäftsführer-Stv.),Mag. Claudia Spitznagel (Schriftführerin),
Christian Schwarzenegger (Schriftführer-Stv.),Mag. Wolfgang Monschein (Kassier),
Marion Linger (Kassier-Stv.)
Redaktion:Wolfgang Duchkowitsch, Bernd Semrad
Lektorat und Layout:Gaby Falböck, Bernd Semrad
Redaktion Buchbesprechungen:Gaby Falböck ([email protected])
Korrespondenten:Prof. Dr. Hans Bohrmann (Dortmund),
Univ.-Prof. Dr. Hermann Haarmann (Berlin),Univ.-Prof. Dr. Ed Mc Luskie (Boise, Idaho),
Univ.-Prof. Dr. Arnulf Kutsch (Leipzig),Dr. Markus Behmer (München),
Prof. Dr. Rudolf Stöber (Bamberg)
Druck:Buch- und Offsetdruckerei Fischer, 1010 Wien, Dominikanerbastei 10
Erscheinungsweise:Medien & Zeit erscheint vierteljährlich
Bezugsbedingungen:Einzelheft (exkl. Versand): € 4,40
Doppelheft (exkl. Versand): € 8,80
Jahresabonnement:Österreich (inkl. Versand): € 16,—
Ausland (inkl. Versand auf dem Landweg): € 21,80
StudentInnenjahresabonnement:Österreich (inkl. Versand): € 11,60
Ausland (inkl. Versand auf dem Landweg): € 17,40
Bestellung an:Medien & Zeit, A-1180 Wien, Postfach 442
oder über den gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel
ISSN 0259-7446
Wandlungen der tschechischen Medienlandschaft (1993-2003) 4
Jan Jirák / Barbara Köpplová
Wiener Werbung in Pressburg 1870 – 1918 10
Danusa Serafínová / Jozef Vatrál
„Ich bin kein Pessimist, obwohl...“Thomas Várkonyi im Gespräch mit Gábor
Kapitány über die Transformation des
ungarischen Mediensystems 17
KommunikationswissenschaftlicheTransformationsforschung, quo vadis?Eine theoretische und empirische Skizze 24
Stefan Jarolimek
„Ceské vídenské postovní noviny“Die erste tschechischsprachige Zeitung Wiens
(1761) 35
Wolfgang Duchkowitsch
Rezensionen 44
medienzeit&
Inhalt
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 1
m&z 2/2004
3
Editorial
Vor wenigen Wochen erweiterte sich die Europäi-sche Union von 15 auf 25 Mitgliedsstaaten. NeuePartner in der Gemeinschaft sind auch die Nach-barn Österreichs im ehemaligen „Osten“. Mitdem Beitritt dieser Staaten wurde nicht nur dieNachkriegsordnung Europas endgültig in die Ge-schichtsbücher verbannt, sondern auch ein Re-formprozess mit einer neuen Qualität versehen,der mit der „Wende“ 1989ff. begonnen wurde.Medien & Zeit setzt mit diesem Heft einen mitder Ausgabe 3/2003 gestarteten Schwerpunktfort, der sich mit Entwicklungen und Erkennt-nissen der Kommunikationsgeschichte in neuenEU-Ländern beschäftigt. Nachdem im VorjahrFormierung, Institutionalisierung und Entwick-lung des Fachs in diesen Ländern im Vorder-grund stand, waren die BeiträgerInnen diesmalaufgefordert, konkrete Forschungsbemühungenzu skizzieren und vorzustellen. Dabei kristallisier-te sich unabhängig voneinander ein starkerSchwerpunkt im Bereich der Transformationsfor-schung heraus – da sich dieses Erkennt-nisinteresse sehr stark auf vergangene Prozesseund Wandlungen im Mediensystem bezieht, lässtsich namentlich auch das Engagement von Kom-munikationshistorikerInnen erklären.
Eröffnet wird dieses Heft von den Prager Kom-munikationswissenschaftern Jan Jirák und Barba-ra Köpplová. Sie überblicken in ihrem Beitragden Wandel des tschechischen Mediensystemsseit 1993. Dass es sich dabei um eine zusammen-fassende Zwischenbilanz handelt, wird durch denUmfang der von den Transformationsprozessenbetroffenen Bereiche erklärbar. Für endgültigeErkenntnisse ist die Zeit noch nicht reif, derBedarf an Forschung noch nicht abschätzbar.Medienökonomie, politische Ökonomie, Rezep-tions- und Berufsfeldforschung sind (neben eini-gen anderen) gleichermaßen gefordert, um denTransformationsprozess hinlänglich erklären zukönnen.Ein ähnliches Bild zeichnet Gábor Kápitany,ungarischer Kulturanthropologe, im Gesprächmit Medien & Zeit. Er urteilt über die Transfor-mation des ungarischen Mediensystems, indem
er ihm Nivellierung und Homogenisierung atte-stiert. Da diese Prozesse in Ungarn schon früherals in anderen Reformstaaten einsetzten, ist derhistorisierende Blick bereits weniger getrübt.Von konkreten Forschungen berichten DanusaSerafínová und Jozef Vatrál. Der Beitrag fasstErgebnisse eines jüngst abgeschlossenen For-schungsprojekts zusammen: Untersucht wurdendie Annoncen und Inserate in der deutschspra-chigen Pressburger Presse im Zeitraum von 1870bis 1918, dem Zerfall der „Donaumonarchie“.Ein reich illustrierter Band ist im Erscheinen, hierwerden einige Detailergebnisse präsentiert.Stefan Jarolimek stellt anhand seines Dissertati-onsvorhabens theoretische und methodischeVorüberlegungen zur Transformationsforschungan. Dass er sich dabei auf weiten Strecken an derSystemtheorie orientiert, unterstreicht das vielge-staltige Erscheinungsbild des Erkenntnisobjekts„Transformation“ (des Mediensystems). Die Ent-sprechungen seiner Überlegungen korrespondie-ren augenfällig mit den epistemologischen Per-spektiven in den betroffenen Staaten, wie sie etwavon Jirák und Köpplová beschrieben werden.Der Beitrag von Wolfgang Duchkowitsch befasstsich schließlich mit der ersten tschechischsprachi-gen Zeitung in Wien, hier vor allem den Hinter-gründen ihrer Entstehung. Der Fokus ist dabeivor allem auf die Methodologie zu richten: DerBeitrag kann auch als Quellenkunde gelesen wer-den – die neue Ordnung Europas öffnet(e) auchfür die Kommunikationsgeschichte viele Quellenin Form von Archiven, Bibliotheken, Sammlun-gen etc. Als Ausblick auf kommende Forschungsbe-mühungen in einem neu formierten Europa seiabschließend auf die bereits angedeuteten trans-nationalen Kooperationen verwiesen. AuchMedien & Zeit wird seine Rolle als (ein) publizi-stisches Herzstück der Kommunikationsge-schichte über die neue Position innerhalb Euro-pas „erweitert“ definieren. Die grenzüberschrei-tende Zusammenarbeit wird fortgesetzt.
WOLFGANG DUCHKOWITSCH
BERND SEMRAD
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 3
1 Mit einem gewissen Maß an Vereinfachung wird derBegriff „Massenmedien“ in seiner traditionellenBedeutung angewendet, also zur Kennzeichnungderjenigen Institutionen, die imstande sind, für ihrverstreutes Publikum regelmäßig gesellschaftlich relevantebzw. interessante und zeitlich aktuelle Informationen zuproduzieren und anzubieten, und dies in gedruckter Form
oder als Sendesignal.Es handelt sich also um die Produktion von für die breiteÖffentlichkeit bestimmten Zeitungen und Zeitschriften(General Public) und Rundfunk- und Fernsehsendungen,gegebenenfalls um die im technologischen Milieu desInternets angebotenen Äquivalente dieser Medien.
Die Metapher „Medienlandschaft“ istverlockend und irreführend zugleich, in
einer Hinsicht jedoch bedeutsam – durch ihreVerwendung kann deutlich gemacht werden, dasses den Autoren um die Erfassung der prinzipiel-len (wenn man sich ans ursprüngliche Bild hält –landschaftsbildenden) Faktoren geht, dass sie sichauf dem Niveau einer gewissen Abstraktionbewegen und auf die Erfassung aller Spezifikader einzelnen Mikroklimas und Biotope verzich-ten, die in der beschriebenen Landschaft vor-kommen mögen. Und dies war das echte Anlie-gen der Autoren dieses Beitrags. Die Metapher„Medienlandschaft“ erlaubt es in unserem Inter-essenfeld ein gewichtiges Ziel anzupeilen – näm-lich zu versuchen, Massenmedien und Gesellschaft ingegenseitigen Wechselbeziehungen darzustellen bzw. dieMedien als untrennbares Element der Gesellschaft aufzu-zeigen, mitnichten als deren Funktion, als deren unterge-ordnetes Instrument, sondern als Institution, die über eineinnere, von politischen, ökonomischen und kulturellenFaktoren bestimmte Dynamik verfügt und die sich maß-geblich an der Prägung der Gesellschaft, aber auch ihrerselbst beteiligt.
In diesem Sinne stellt der anschließende Beitrageinen Versuch dar, die Entwicklung der tschechi-schen Medien vom Zeitpunkt der Entstehung derselbständigen Tschechischen Republik bis insJahr 2003 hinein zu illustrieren und die Hauptfak-toren aufzuzeigen, die diese ein Jahrzehnt langeEntwicklung bedingt haben und noch bedingenoder zumindest Einfluss auf deren Entwicklunggenommen haben.Der Text versucht vorerst, die charakteristischenMerkmale der Massenmedien1 darzustellen, mitdenen die selbständige Republik ins erste Jahrihrer Existenz eintrat, versucht anzudeuten, wiedie Massenmedien im „Input“, also vor demJahre 1992 ausgesehen haben. Im Weiteren geht
er dazu über, die Entwicklung seit dem Jahre1992 bis in die Gegenwart darzulegen und in die-ser Epoche Schlüsselfaktoren und maßgeblicheEreignisse aufzuspüren, welche die Entwicklungund die Rolle der Massenmedien am meistenbeeinflusst haben. Dabei werden drei Faktorenins Auge gefasst, die zum Begreifen der Rolle derMedien in der Gesellschaft von besondererBedeutung sind: die Entwicklung des medialenAngebots (also die eigentliche Medienprodukti-on), die Entwicklung der Eigentumsverhältnisseim Medienbereich und die Wechselwirkung zwi-schen den Medien, deren Konsumenten und(weiteren) gesellschaftlichen Institutionen (insbe-sondere der politischen Macht).
1. Zustand der tschechischenMedien vor Entstehung derTschechischen Republik und die Entwicklung des Medien-angebots nach dem Jahre 1992
In die neunziger Jahre traten die tschechischenMedien mit einer Struktur und einer dementspre-chenden Produktion ein, die weit mehr denErfordernissen des autoritären Staates angepasstwar als den tatsächlichen Bedürfnissen und derNachfrage des Publikums. Statistische Angabenaus dieser Zeit weisen relativ hohe Auflagen beiTageszeitungen und Zeitschriften aus (in man-cher Hinsicht überstiegen sie vergleichbare Zah-len aus anderen Ländern) sowie hohe Einschalt-zahlen bei den elektronischen Medien. So warzum Beispiel die Gesamtauflage der Tagespresseum ungefähr ein Drittel höher als zum jetzigenZeitpunkt – und diese Zahl ist ernst zu nehmen,auch wenn wir sie angesichts der Medienmanipu-lation (Zwangsabnahme) und entschieden niedri-gerer Druckflächen korrigieren müssen. Aber
m&z 2/2004
4
Wandlungen der tschechischen Medienlandschaft (1993-2003) Jan Jirák / Barbara Köpplová
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 4
auch weitere Kennziffern wiesen hohe Werte auf– so die Gesamtzahlen und die thematische Dif-ferenzierung der Zeitschriftenproduktion, dieCharakteristiken der Programmgestaltung derelektronischen Medien usw.
Ein typisches Merkmal der Medienlandschaft vordem Jahre 1990 war die konsequente Subordina-tion der Medien unter die autoritative/politischeSphäre, ihre inhaltliche Reglementierung (Zen-sur), die Gleichgültigkeit gegenüber wirtschaftli-chen Aspekten der Medienproduktion, aber auchdie fortschreitende Veralterung der technischenAusstattung und der sich daraus ergebenden Pro-duktionsbedingungen. Einerseits nahmen dieMedien wegen der ihr von der Machtsphäre ein-geräumten Bedeutung eine privilegierte Stellungein, andererseits waren sie unterdotiert und stan-den auf schwachen ökonomischen Beinen (zumgrößten Teil gehörten sie zur Sphäre, die ausgesellschaftlichen Ressourcen finanziert wurden).Markanteste „landschaftsbildende“ Merkmalewaren selbstverständlich die strikte, zum großenTeil auf persönlicher Verantwortung beruhende,Kontrolle, die durchdachte Informationsflussbe-hinderung und die Manipulierung der Inhalte.
Aus heutiger Sicht erhöhte die Einschränkungdes Informationsflusses paradoxerweise denWert der Informationen für das Publikum. WoInformationen Mangelware oder gar „verboteneFrucht“ sind, steigt die Nachfrage ins unermess-liche und das Zielpublikum war bereit, relativhohe Anstrengungen zu unternehmen, dochirgendwie an sie heranzukommen, ob nun durch„Filtern“ und „Destillation“ des Ballasts oderdurch relativ sophistische und freie Interpretationder „Andeutungen“, durch „Lesen zwischen denZeilen“. Das Zielpublikum war dabei wohl breiterals allgemein angenommen wird und schlosssoziale Gruppen mit ein, die den Medien unter„normalen“ Verhältnissen weit geringere Auf-merksamkeit widmen und sich eher für Infotain-ment interessieren.
Dieses auf der Reglementierung der Inhalte beru-hende System wurde so auf sicher ungewollte
und unbeabsichtigte Weise ihrem öffentlichdeklarierten „Aufklärungsparadigma“ gerecht –indem es sein Publikum nötigte, den Medien undderen Inhalten gebührende Aufmerksamkeit zuschenken und mit ihnen aktiv „zu arbeiten“.Genauso wie auf anderen ökonomischen Gebie-ten überstieg auch hier die Nachfrage meilenweitdas Angebot.
Der Beginn der neunziger Jahre, also die„Epoche des gemeinsamen Staates der
Tschechen und Slowaken“ nach dem Untergangder ČSSR, stand im Zeichen von Bemühungen,sich vom vorherigen Modell einer autoritärenGesellschaft zu befreien und eine offene Gesell-schaft aufzubauen, die von den Prinzipien derUnantastbarkeit privaten Eigentums, einer aufdemokratischen Entscheidungen beruhendenAusübung der Macht, sowie von kultureller,schöpferischer und Meinungspluralität2 geprägtsein sollte. Resultat für die Massenmedien war,dass zu dieser Zeit Privatgesellschaften, vomStaat ökonomisch unabhängige Medien für dasfortschrittlichste und ideale Modell gehalten wur-den. Also Medien, die ihre Aktivitäten den Bedin-gungen und Möglichkeiten des Markts unterord-nen, ihre Unabhängigkeit vor Versuchen politi-scher Druckausübung bewahren und das Rechtdarauf haben, Autorenstellungnahmen völlig freiund ohne Eingriffe von außen formulieren zudürfen. Die so genannte „Medienunabhängig-keit“ war eines der zentralen Themen der Nach-November-Diskussionen über die Stellung undRolle der Medien in der Gesellschaft. Der Nach-druck auf die Privatisierung (Verwestlichung) derMedien führte dazu, dass sich das vorher büro-kratisierte und zentral geleitete mediale System inden Jahren von 1990 bis 1992 schnell in ein ziem-lich liberales Milieu mit einem hohen Maß anKonkurrenz, einem bedeutenden Anteil an aus-ländischem Kapital und einer minimalen Mög-lichkeit der Einflussnahme politischer Kräfte indieses Milieu verwandelte.
Die Entstaatlichung der Medien hatte zweigrundsätzliche Formen – die Privatisierung und dieGründung öffentlich-rechtlicher Medien auf dem Sek-
m&z 2/2004
5
2 Die gesellschaftliche Metamorphose der tschecho-slowakischen Gesellschaft nach dem Jahre 1989 vollzogsich vor dem Hintergrund eines höchst zentralisierten,kontrollierten und durchplanten Mediensystems, in demökonomische Wettbewerbsprinzipien unter markt-wirtschaftlichen Bedingungen keine Rolle spielten undderen einziges „Vorzeichen“ in Bezug auf eine künftigeEntwicklung in der Akzeptanz des föderativen Staats-
gefüges bestand (also die sprachlich und mitunter auchinhaltlich-organisatorische Aufteilung in tschechische undslowakische Medien). Siehe auch Barbara Köpplová/JanJirák: Czech Print Media in Transition. In: Michael BruunAndersen: Media and Democracy. Oslo: University of Oslo1996 sowie Barbara Köpplová/Jan Jirák: Changes in theStructure of Czech Mass Media. In: Experience and ExpectationsFive Years After. Praha: Karolinum 1996.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 5
m&z 2/2004
6
tor der elektronischen Medien. Die Privatisierungoffenbarte sich sowohl in der Tagespresse, in derHerausgabe von Zeitschriften, als auch in denRundfunksendungen, wo sie faktisch Hand inHand mit der Umwandlung des staatlichen Rund-funks in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkging. (Hier werden neu entstehende regionaleRundfunkstationen zu einem wichtigen neuenMerkmal der medialen Struktur, die es bis zurJahreswende von 1989/1990 nicht gegeben hatte,wie zum Beispiel Radio 1 – 1990, Bonton – 1991,E2 – 1991, Kiss – 1992). Auf dem Gebiet derFernsehsender war der Prozess weniger radikal –sicher infolge der Tatsache, dass die Gründungeines neuen Fernsehsenders finanziell weitanspruchsvoller ist, aber wohl auch deswegen, dadie politische Elite über die reelle Neuordnungder Verhältnisse auf dem Sektor der Fernsehsen-der noch unschlüssig war (die erste bedeutendeprivate Fernsehanstalt nahm erst nach Gründungder selbständigen Tschechischen Republik ihrProgramm auf –das Fernsehen Pre-miera im Jahre1993). Diese gewis-se Ratlosigkeit, derGrund für die umeiniges komplizier-tere Entwicklungprivater Fernsehsender, wurde noch durch feh-lende Frequenzen zum Betreiben einer größerenAnzahl von Fernsehstationen verstärkt.
Ihre staatlich selbständige Existenz trat die tsche-chische Gesellschaft demzufolge mit einem imPrinzip schon transformierten und liberalisiertenMediensystem an, mit einer existierenden media-len Legislative (lediglich das so genannte Presse-gesetz wurde 1990 novelliert, aber auf ein neuesGesetz zur Definition der bei der Veröffentli-chung von Periodika auferlegten Pflichten undgleichzeitigen Regelung mancher Aspekte bei derAusübung der Journalistentätigkeit musste sichdie tschechische Gesellschaft bis zur Jahrhundert-wende gedulden), mit einer voll und ganz privati-sierten Presse, einem rechtlich und ökonomischabgeschlossenen Umwandlungsprozess der staat-lichen Rundfunk- und Fernsehsender in öffent-lich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten,einem sich konsolidierenden Markt auf dem
Gebiet des Rundfunks und einem eingeleitetenProzess zur Entstehung des Privatfernsehens.
2. Entwicklung der tschechischen Medien von 1992 bis in die Gegenwart
Wir gehen davon aus, dass sich die Massen-medien – im Sinne der Thesen Habermas’
über den Strukturwandel der Öffentlichkeit3 – ander Konsolidierung der Macht in der gegebenenGesellschaft beteiligen, dass sie die Öffentlichkeitzur Rolle mehr oder weniger passiver Beobachterverurteilen und selbst die Position eines Reprä-sentanten der öffentlichen Meinung in Anspruchnehmen. Die Massenmedien errichten demzufol-ge einen von ihnen selbst beherrschten und bean-spruchten öffentlichen Raum – und füllen ihn mitInhalten, die wichtig für die Herausgeber undSender sind (und dies in Bezug auf ihren eigenenMachtanspruch und ökonomische Gesichtspunk-
te), gegebenenfalls auch für derenökonomische und politische Partner– keineswegs aber für die Öffent-lichkeit als solche.Sie betreiben dieses Unterfangenjedoch in einem Milieu, das sichihrer diesbezüglichen Aktivitätennur schwerlich gewahr wird, da die
Öffentlichkeit träge auf ihrem Klischee über dieRolle der Medien in demokratischen Gesellschaf-ten beharrt – einem Klischee, das, wie James Cur-ran4 bemerkt, weitab der Realität in Bezug auf dieStellung der Medien in der Gesellschaft ist.
Wir gehen davon aus, dass ein maßgeblicher„organisatorischer“ Faktor der tschechischenMedienlandschaft vor allem die deutliche Ten-denz zur Kommerzialisierung der Medienprodukti-on und als Folge davon auch deren Eigentums-konzentration und die inhaltliche Homogenisierungsind.
Die ersten beiden Jahre der Existenz der selb-ständigen Tschechischen Republik sind aus derSicht der Wandlung der Medienlandschaft insbe-sondere wegen des Antritts der Medien mit deut-lichem Unterhaltungscharakter interessant –denn am 13. April wurde zum ersten Mal dasBoulevardblatt Blesk 5 herausgegeben, im gleichen
3 Siehe Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit.Praha: Filosofia 2000.
4 James Curran: Neue Auffassung von Massenmedien undDemokratie. In: Jan Jirák/Blanka Ríchová: Politische
Kommunikation und Medien. Praha: Karolinum 2000.5 Bis zu diesem Zeitpunkt kam nur die regionale Tages-
zeitung Expres heraus, die zwar verschiedene Ausgabenhatte, aber nie eine ganzflächige Verbreitung fand.
Der Aufschwung der Unter-haltungsmedien ist mit-bestimmend für die weitereEntwicklung der tschechi-schen Medienlandschaft.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 6
m&z 2/2004
7
Jahr nimmt das Regionalfernsehen Premiera (mitKapitalbeteiligung des Medienmagnaten SilvioBerlusconi) ihre Sendungen auf und im Februar1993 erhält die Gruppe CET 21 die Lizenz zumBetreiben eines landesweiten privaten Fernseh-senders, den die Zuschauer im Februar 1994unter dem Namen TV Nova kennen lernen. Anjenem Tag im Februar 1994, an dem TV Novaihre Programme auszusenden beginnt, hat derAntritt der Unterhaltungsmedien unserer Mei-nung nach seinen Höhepunkt erreicht. Dabeigeht es bei weitem nicht nur um diese Fernsehan-stalt, sondern um den rasanten Aufschwung vonMusiksendern und die Restrukturierung des Zeit-schriftenmarkts mit deutlicher Tendenz zumLifestyle-Sektor (dieser Trend kommt jedoch erstin den Jahren 1998/99 zu seinem Höhepunkt –durch den Antritt des Journals SPY ).
Der Aufschwung der Unterhaltungsmedien istunserer Meinung nach mitbestimmend für dieweitere Entwicklung der tschechischen Medien-landschaft. Der Antritt der Medien mit reinemUnterhaltungscharakter unterstrich die Konzepti-on der medialen Produktion als kommerzielleAktivität, deren charakteristisches Merkmal dieVermehrung der eingebrachten Investitionen ist. Diese Konzeption hat begreiflicherweise deutli-che Folgen, einerseits für den Charakter derMedienproduktionen und andererseits auch fürdie Eigentumsstrukturen der Medien. Die Kom-merzialisierung der tschechischen Medien hat ganz ein-deutig vor allem zu einer markanten Eigentums-konzentration geführt. Zu Beginn des Jahres 2004waren die folgenden Verlage auf dem Markt dertschechischen Tagespresse präsent: Vltava, LabePress (zu 80% im Besitz der Neuen Passauer Presse,20% Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft),Mafra (98% Rheinisch-Bergische Verlagsgesell-schaft + 2% Press Invest = 100% LN), Ringier ČR(Ringier AG), Economia (78% Handelsblatt + 11%ČTK / Tschechisches Pressebüro), Futura (Halónoviny), Region ČR (Region ČR) und Borgis (91%Zdenék Porybny + Kleinaktionäre) und Metro ČR(100% Metro International, Schweden).6
Diese Tendenz zur Konzentration zeichnet sichauch in anderen Mediensegmenten ab. 1993 ent-
stand die erste Kette privater Rundfunksender,der Zeitschriftenmarkt hat sich mit der Zeit sostark konzentriert, dass im Jahre 2003 unter denzehn laut Anzeigenumfang bedeutendsten Her-ausgebern ausschließlich ausländische Verlage zufinden sind: Sanoma, Hachette Filipacchi, Stra-tosféra-Hearst, Europress, Burda, Bertelsmann-Springer CZ, MediaCop, Axel Springer Praha,Ringier, Astrosat. Erwägungen über die Eigen-tumsverflechtung der beiden landesweiten Fern-sehanstalten TV Nova und Prima haben dieGrenzen der Spekulation bereits überschritten.
Die Kommerzialisierung der tschechischenMedien wird auch in deren Programminhal-
ten deutlich. Betrachtet man die Tagespresse, soist festzustellen, dass der tschechische Leser ohneein seriöses (politisches) Blatt auskommen muss,im Gegensatz dazu bewegen sich alle existieren-den Titel (mit Ausnahme des Handelsblatts Hos-podá ské noviny, das durch die thematische Orien-tierung und die Zusammensetzung seiner Leser-schaft in eine einigermaßen andere Richtung weist)auf dem Niveau hochauflagiger „Tabloids“, dieElemente der politischen Berichterstattung undKommentare mit Unterhaltungselementen derMassenpresse kombinieren. Endeffekt ist einhohes Maß an Homogenisierung der medialen Inhal-te und eine geringe (ja zurückgehende) Verschie-denartigkeit der einzelnen Medien. Proportionaldazu sank das Ausmaß des Medienkonsumssowohl in den gesellschaftlichen und wirtschaftli-chen Eliten, als auch in einer Reihe von gesell-schaftlichen Gruppierungen (Teenager, Gruppenvon niedrigerer gesellschaftlicher Position usw.).Die Trivialisierung des Inhalts – einschließlichdes Trends zur Trivialisierung sozialer und politi-scher Themen – schlägt sich in einer Flucht desPublikums in die Privatsphäre nieder, die anBedeutung zugenommen hat (Problemlösungoder Entfaltung eigener ökonomischer Interes-sen, wachsender Stellenwert individueller gesell-schaftlicher Probleme auf Kosten gesamtgesell-schaftlicher Probleme). Die Menschen lesenweniger, hören weniger zu und in letzter Zeitsehen sie auch weniger fern. Eine ganze Reihevon ihnen hat festgestellt, dass man auch ganz gutohne Medien leben kann – siehe der langfristige
6 Nach der Akquisition von Právo durch Ringier, die derzeitde facto abläuft, gibt es offenbar nur noch zwei reintschechische Verlage, wobei hinzuzufügen ist, dass diesedeutliche Minoritätstitel sind.
7 Die Spannung zwischen den Wünschen der politischenElite und den Vorstellungen der Medienprofis erreichtenin der so genannten „Weihnachtsfernsehkrise“ ihren
Höhepunkt, und dies im öffentlichen Protest derMitarbeiter des Tschechischen Fernsehens (ČT) an der Artund Weise der Besetzung der Funktion und an derkonkreten Person des Generaldirektors von ČT, der imHerbst 2000 vom damaligen Rat des TschechischenFernsehens ausgewählt worden war.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 7
Auflagenrückgang der Zeitschrift Respekt, dasDahinvegetieren von Kulturzeitschriften, erfolg-lose Versuche zur Expansion neuer „seriöser“Tagesblätter, sinkende Zahlen von Abos undLesern der Tagespresse, erfolglose Versucheneuer Boulevardblätter sowie das erschöpftePotenzial der Zuschauerattraktivität von TVNova.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Ent-wicklung der tschechischen Medienland-
schaft mitbestimmt, ist die Wechselwirkung zwi-schen den Medien und der politischen und öko-nomischen Sphäre. Die Medienproduktionenstellen einen der dynamischsten Sektoren dertschechischen Industrieproduktion dar. Trotzdem Auf und Ab in der Entwicklung der tsche-chischen Ökonomie in den neunziger Jahren undzu Beginn des neuen Jahrhunderts blieben größe-re Schwankungen im Umfang der zu Werbe-zwecken in die Medien fließenden Mittel aus. Während diese Mittel im Jahre 1993 3,5 Mrd.Kronen ausmachten, waren es 1996 schon 6 undim Jahre 2002 schon 14,5 Mrd. Kronen (zum Ver-gleich: das ist genauso viel wie das Landwirt-schaftsministerium und mehr als das Gesund-heitsministerium aus dem Staatssäckel bekommt– Quelle: Arbomedia und Finanzministerium derTschechischen Republik).
Die Medienproduktion wird somit zum bedeu-tenden Wirtschaftszweig, dessen Stabilität voneminenter Bedeutung für die tschechische Wirt-schaft ist. Gleichzeitig handelt es sich um einenZweig, der – wie schon betont – eine öffentlicheSphäre konstruiert und beherrscht, was ihn zueinem attraktiven (und lebenswichtigen) Mittelfür diejenigen macht, die nach einem Anteil ander politischen Macht streben und potenzielleWähler für sich gewinnen wollen. Diese beidenAspekte – die ökonomische und politischeBedeutung der Medien – macht aus dem media-len Sektor einen höchst interessanten Tummel-platz sowohl für die politische Elite als auch fürdie Kapitäne aus Wirtschaft und Ökonomie(wobei die Interessen dieser beiden Akteure oftaufeinander stoßen, sich überschneiden oderauch ergänzen).
Der ökonomische Stellenwert der Medien wurdein der tschechischen Medienlandschaft insbeson-dere in der Etappe des gestiegenen Interesses des
Bankensektors an einer Eigentumsbeteiligung anden Medien im Verlauf der ersten Hälfte derneunziger Jahre sichtbar. Dies gilt in abgewandel-ter Form bis heute. Die Fernsehgesellschaft TVNova gehört einer der größten Finanzgruppenüberhaupt – der PPF – an, zu der unter anderemauch die Unternehmen eBanka, Česká pojistovna,die Zeitschrift Euro, Mineralwasser Korunní oderdas Kosmetik-Unternehmen Dermacol gehören.Markantestes ökonomisches Merkmal der tsche-chischen Medien auf längere Sicht bleibt dereneigentumsrechtliche Verankerung in multinatio-nalen Strukturen, das heißt die faktische ökono-mische Globalisierung der tschechischen Medien. Die Wechselbeziehung zwischen politischerMacht und den Medien begleitet die Medienent-wicklung schon während der gesamten Existenzder selbständigen Republik, sie ist ein normalerBestandteil der tschechischen Medienlandschaftund hat unserem Urteil nach auf das Verhaltender Medien nur beschränkte Wirkung (was viel-leicht auch durch das faktische Herauslösen dertschechischen Medien aus allen tschechischenEigentumsbindungen verursacht wird). Vongrößerer Bedeutung ist aus dieser Sicht vor allemdie Beziehung zwischen den öffentlich-rechtli-chen Anstalten, insbesondere dem TschechischenFernsehen, und der Abgeordnetenkammer desParlaments der Tschechischen Republik.Die Bemühungen der politischen Elite zurSchwächung der öffentlich-rechtlichen Medien,gegebenenfalls zur weitgehenden Kontrolle überdas Tschechische Fernsehen (im TschechischenRundfunk ist diese Tendenz weit weniger deut-lich), stellt einen markanten Charakterzug derBewegungen in der tschechischen Medienland-schaft dar. Die Entwicklung bis 1996, als die ent-scheidende Macht von der rechtsorientierten(und vom Thatcherismus inspirierten) BürgerlichDemokratischen Partei (ODS) ausgeübt wurde,stand im Zeichen des Versuchs der Schwächungund Marginalisierung der öffentlich-rechtlichenMedien. Die Epoche nach 1998, unter dem Ein-fluss der sozialdemokratischen Partei (ČSSD),zeichnet sich im Gegensatz dazu durchBemühungen aus, einerseits die Rolle der öffent-lich-rechtlichen Medien eher zu stärken, aberandererseits auch deren Bindungen an die politi-sche Elite zu festigen und sich direkt oder indi-rekt in deren Gebaren einzumischen. Das Inter-esse der politischen Elite an den Medien und dasInteresse dieser Medien an der Festigung der
m&z 2/2004
8
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 8
m&z 2/2004
9
eigenen Position führt einerseits zu Auseinander-setzungen, andererseits jedoch auch zu Verhand-lungen, was sich besonders seit dem Jahre 2000als verstärkter Trend abzeichnet.7
In der tschechischen Medienlandschaft kommt esso zu einer wachsenden Spannung, denn einer-seits operieren hier Medien, die in der Beziehungzur politischen Macht ein hohes Maß an Autono-mie genießen. Dies macht sich natürlich auch aufpsychologischem Niveau bemerkbar, also in derMentalität derer, die für diese Medien arbeiten.Auf der anderen Seite gibt es hier jedoch auchöffentlich-rechtliche Medien, deren Verflechtungmit der politischen Macht nicht nur augenschein-lich ist, sondern sogar legislativ vorherbestimmtist. Menschen, die in diesen Medien beschäftigtsind, bewegen sich jedoch keinesfalls in einemprofessionellen Vakuum, sondern können sichvon den privaten Medien inspirieren lassen – undnicht nur von ihnen, sondern auch von der imtschechischen meta-medialen Diskurs vorherr-schenden Rhetorik.
Abschließend
Wenn man hier abrupt abschließen wollte,käme man zum Schluss, dass es die Tsche-
chische Republik nach einer vierzehnjährigen,mitunter ziemlich hektischen Entwicklunggeschafft hat, Europa wenigstens in der medialenSphäre einzuholen. Seltsamerweise ist dies fürviele kein Grund zu Jubelgesängen und zurZufriedenheit. Das hängt vom Blickwinkel ab.Auch anderswo sind die Leute mit dem Zustandder Medien nicht völlig zufrieden – es kommtimmer darauf an, wer und aus welcher Perspekti-
ve das Geschehen betrachtet. Die Druckmedienleben hart am Abgrund, die „öffentlich-rechtli-chen“ Medien wissen weder ein noch aus, denkommerziellen geht es – genauso wie allen – umden Gewinn. Wenn es um die Inhalte geht, gibt esso manches zu verbessern, der überstürzten undkopflosen Flucht zur Unterhaltung geht die Luftaus (wenn man sehr optimistisch ist, dann wohlwenigstens in der Tagespresse). Die Beziehungzur Parteienlandschaft und den politischen Elitenist ein komplizierter Prozess und widerspiegeltdie Atmosphäre in der Gesellschaft, aber auchanderswo hat man von Zeit zu Zeit seine„Affären“ und „Affärchen“.
Jan JIRÁKPhDr., Linguist, Assistenzprofessor (Dozent) an der Abteilung für Medienwissenschaftender Fakultät für Sozialwissenschaften der Karls-Universität Prag. Lektor für Medien-und Kommunikationstheorie und a.o. Professor an der New York University in Prag.Autor zahlreicher Artikel über tschechische Medien. Co-Autor von Einführung in Medi-enwissenschaft (2001, gem. m. Graeme Burton) und Medien und Gesellschaft (2003,gem. m. Barbara Köpplová); ehem. Vorsitzender des Tschechischen Fernsehrates.
Barbara KÖPPLOVÁPhDr., CSc., Medienhistorikerin, Assistenzprofessorin (Dozentin) und Leiterin an derAbteilung für Medienwissenschaften der Fakultät für Sozialwissenschaften der Karls-Universität Prag. Lektorin für Medien- und Journalismusgeschichte. Autorin zahlreicherArtikel über die Entwicklung der tschechischen Medien sowie der deutschsprachigentschechischen Medien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Publikationen u.a. DieGeschichte des Journalismus (1989, gem. m. Ladislav Köppl) und Medien und Gesell-schaft (2003, gem. m. Jan Jirák); ehem. Mitglied des Tschechischen Rundfunkrates.
Literatur:Curran, James: Novy pohled na masová média a
demokracii. In: Jan Jirák/Blanka Ríchová:Politická komunikace a média. Praha: Karoli-num 2000.
Habermas, Jürgen: Strukturální prem na verejnosti.Praha: Filosofia 2000.
Jakubowicz, Karol: The Genie is Out of the Bottle.In: After the Fall. Media Studies Journal, Fall1999, S. 52-59.
Barbara Köpplová/Jan Jirák: Czech Print Mediain Transition. In: Michael Bruun Andersen:Media and Democracy. Oslo: University ofOslo 1996.
Barbara Köpplová/Jan Jirák: Changes in theStructure of Czech Mass Media. In: Experienceand Expectations Five Years After. Praha:Karolinum 1996.
Sparks, Colin: Communism, Capitalism and theMass Media. London: Sage 1998.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 9
Kurz bevor es klar wurde, dass auch die Slo-wakei ihren Stern auf dem Himmel des ver-
einten Europas bekommt und Mitglied der ein-heitlichen Wirtschaftszone wird, haben wir unsentschlossen eine Hintertür zu öffnen, um nach-zusehen wie stark die Werbung Wiener bzw.österreichischer, deutscher und teilweise auchschweizerischer, dänischer und einheimischerInserenten in der Pressburger deutschsprachigenPresse vertreten war, und zwar in den Jahren 1870bis 1918. In diesen Jahren waren die beiden, heuteam wenigsten voneinander entfernten Hauptstäd-te zweier Staaten des erweiterten Europas, Wienund Bratislava (die Entfernung beträgt ungefähr60 Kilometer), Bestandteil eines durch geschickteHeiratspolitik der Habsburger vereinigten TeilsEuropas – der multinationalen und multikulturel-len Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Bra-tislava hieß damals Pressburg, Pozsony,Preśporok und war eine dreisprachige Provinz-stadt. In dieser Stadt voller Toleranz lebten injener Zeit Deutsche, Slowaken, Ungarn und diejüdische Kommune miteinander. Die Stadt Press-burg erlebte in den Jahren 1870 – 1914 einenraschen Aufschwung. Neue Betriebe wurdenerrichtet, neue Menschen kamen um hier zuarbeiten und mit ihren Familien in den für sieerbauten Wohnungen zu leben. Technische Neu-igkeiten fassten sehr schnell Fuß in Pressburg.Die Stadt hatte eine Telefonzentrale, wurde elek-trisch beleuchtet, besaß eine elektrische Stadt-bahn, in den Jahren 1911 bis 1914 wurde dieberühmte, aus den Erzählungen unserer Großel-tern bekannte, elektrische Lokalbahn zwischenWien und Bratislava erbaut, viele Kinos öffnetenihre Tore, Automobile ersetzten nach und nachdie Kutschen und es gab auch Taxis. Pressburgwurde immer schöner und seine relativ starkeMittelschicht stellte ein kaufkräftiges Publikumdar, das nicht nur die einheimischen Inserenteninteressierte.
Die Objekte unserer Recherche waren ausgewähl-te Jahrgänge der konservativen TageszeitungPreßburger Zeitung, gegründet im Jahre 1764, dieseit 1880 eine Morgenausgabe und eine Abend-ausgabe hatte und der bedeutenden PressburgerDruckerfamilie Angermayer gehörte, ihrer Kon-kurrentin, der liberalen Tageszeitung Westungari-
scher Grenzbote (gegründet 1872), der Tageszeitungjüngeren Datums Preßburger Tagblatt (gegründet1896). Weiters zwei Wochenzeitungen: die Preß-burger Presse (gegründet 1898 als Presseorgan fürkommunale und lokale Interessen) und die Reform(seit Mai 1902 Fortsetzung der WestungarischenVolkszeitung) und letztendlich der Almanach Preß-burger Wegweiser (gegründet 1842).
Das Resultat der Recherchen war verblüffend:Wiener, österreichische und deutsche Werbean-noncen – vor allem jedoch die Wiener Werbean-noncen – waren in der recherchierten Presse sehrzahlreich vertreten, oft standen auf einer Seitemehrere solche Annoncen nebeneinander. Wirhaben uns deshalb entschieden, die Resultateunserer Forschungen in einem Buch zusammen-zufassen, das dieser Tage in der Reihe Carpatho-Germanica unter dem Titel „Pressburger liebsteWaren & Dienste“, Untertitel „Wiener und weite-re Annoncen in der Pressburger deutschsprachi-gen Presse 1870 bis 1918“ erscheint und außerder einleitenden Studie 237 Abbildungen derhistorischen Werbung als auch ein Verzeichnisder Adressen der Inserenten in der Originalrecht-schreibung beinhaltet.
Im vorliegenden Beitrag geht es uns nicht um dieWerbung für unser Buch bzw. um seine Rezensi-on. Es geht darum zu zeigen und aufgrund derbeigefügten Beispiele Wiener kommerzieller Wer-bung auch zu belegen, dass die beiden MetropolenWien und Bratislava damals nicht nur geogra-phisch nah beieinander lagen, sondern dass es sichauch um eine geistige und kulturelle Nähe handel-te, deren Kontinuität später, besonders nach demJahre 1948, gewaltsam durch die Stacheldrähte ander Grenze unterbrochen wurde, worauf auchWolfgang R. Langenbucher und Bernd Semrad imVorwort zu unserem Buch hinweisen.
Was alles boten die Wiener Inserenten, die, wiealle andere, regelmäßig durch die Annoncen derRedaktionen zum Inserieren in der PressburgerPresse aufgefordert waren, den Pressburgern undallen anderen Lesern und Leserinnen der Press-burger deutschsprachigen Presse in jenen Jahrenan? Die Bandbreite der Insertionen wurde biszum Ausbruch des 1. Weltkrieges immer breiter
m&z 2/2004
10
Wiener Werbung in Pressburg 1870 – 1918Danusa Serafínová / Jozef Vatrál
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 10
m&z 2/2004
11
und ihre Gestaltung immer bunter. Ob es sichaber um schlichten Text, Versform, Text in ver-zierten Rahmen oder um die Kombination vonText und Bild mit oder ohne Schutzmarke han-delte, ob klein oder groß, direkt inseriert oderdurch Vertreter bzw. Zweigstellen angeboten,jedenfalls versprachen alle Inserenten schondamals den Kunden, dass ihre Waren und Dien-ste zwar den niedrigsten Preis, aber die besteQualität hätten. Das galt auch für das Angebotder Annoncen-Bureaus aus Wien, wie etwa dasBureau von A. Oppelik’s Nachfolger AntonOppelik (sesshaft in Wien I., Grünangergasse 12),der seinen Annoncen-Kalender anbot1 oder vonAnnoncen-Expeditionen wie etwa von H. Scha-lek aus Wien II., Wollzeile II, welcher betonte,dass ein Inserat gut verfasst, gut platziert und in
einer geeigneten Zeitung veröffentlicht, Erfolgbringt (Abb. 2)2.
Vertiefen wir uns in die vergilbten Seiten derPressburger deutschsprachigen Presse und
suchen nach etwas Wienerischem für des Press-burgers Leib und Seele von A bis Z. Zuerst sprin-gen uns die Annoncen der Apotheker ins Auge.Allen voran der Apotheker Franz Joh. Kwizdaaus Korneuburg bei Wien, der sich – wie vieleandere auch – lobt, k. & k. Hoflieferant zu seinund der nicht nur Produkte für die Menschen wieGicht-Fluid3, sondern auch Veterinär-Präparate4
anbot. Beim Anblick der sich zyklisch wiederhol-ten Annonce zur Bekämpfung des Bandwurmsvon Dr. Bloch aus Wien, Praterstrasse 52, imPressburger Wegweiser5 wird uns klar, welcheLast diese Plage für unsere Vorfahren bedeutete.Es folgen Blutreinigungspillen von J. Pserhofer’sApotheke „zum goldenen Reichsapfel“ in Wien,Singerstrasse Nr. 15, mit vielen Danksagungengeheilter Patienten6, Brady’sche MariazellerMagentropfen aus der Apotheke „zum Königvon Ungarn“ in Wien I., Fleischmarkt 1, derenSchutzmarke die Mariazeller Mutter Gottes war,sie sollten bei Magenverstimmung helfen (Abb.3)7. Dasselbe versprach auch der Apotheker Juli-us Schaumann aus Stockerau bei Wien mit seinemMagensalz8. Wiener Original-Spitzwegerich-Extrakt mit Kalk-Eisen erzeugt vom ApothekerV. v. Trnkoczy in Wien V., Hundsthurmerstrassebekämpfte Brust- und Lungenleiden9. WilhelmMaagers Lebertran mit der Fabrik in Wien III.,Heumarkt 310, und andere Arzneimittel bzw. viele
1 Preßburger Wegweiser, 1900, S. 101.2 Preßburger Tagblatt, 1905, Jg. 10, Nr. 3265, S. 12.3 Preßburger Wegweiser, 1882, S. 14.4 Preßburger Wegweiser, 1882, S. 206.5 Preßburger Wegweiser, 1880, o.S.
6 Preßburger Zeitung, 1888, Jg. 125, Nr. 53, S. 6.7 Westungarischer Grenzbote, 1900, Jg. 29, Nr. 9481, S. 11.8 Preßburger Wegweiser, 1914, S. 10.9 Westungarischer Grenzbote, 1900, Jg. 19, Nr. 5877, S. 9.10 Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr. 5877, S. 11.
Abb. 1: Eigeninserat der Pressburger Zeitungaus dem Jahr 1905
Abb. 2: Preßburger Tagblatt, 1905, Jg. 10, Nr. 3265, S. 12
Abb. 3: Westungarischer Grenzbote, 1900, Jg. 29, Nr. 9481, S. 11
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 11
12
m&z 2/2004
andere Wiener Produkte und Dienste waren nichtnur den Pressburger Kunden bekannt, sondernauch den Leserinnen und Lesern der damaligenslowakischen Presse, wo man diesen Insertionenregelmäßig begegnete. Ein weiterer Apotheker,Josef Weis aus der Mohren Apotheke in Wien,Tuchlauben Nr. 27, verband die pharmazeuti-schen Spezialitäten im Angebot mit Toiletten-und Parfümartikel11. Verweilen wir noch beimThema Gesundheit und zwar bei der sehr sensi-blen Zahnpflege. Wiener Zahnärzte und Zahn-techniker boten in der Pressburger deutschspra-chigen Presse regelmäßig ihre Dienste an, so wur-den zum Beispiel von Dr. Freivogel und vomZahntechniker Breitmann aus Wien I., Kärntner-strasse Nr. 29, die sogenannten Baltimore Zähne„ohne Kautschuk-Gaumen und ohne die Wur-zeln zu entfernen“ als epochale Neuheit vorge-stellt12. Neben dem Mundwasser Odol wurdeauch das Anantherin-Mundwasser J. G. Popps,k. & k. Hof-Zahnarzt aus Wien, empfohlen undvor deren Fälschungen wurde gewarnt13. Ob mansich aber heute in der Annonce auf Mundwasseroder Zahnpasta den Ausruf erlauben könnte„Ein Glück, dass es Zahnschmerzen gibt“14, imSinne von „Du kannst darüber froh sein, weil dirdann ein bestimmtes Mundwasser hilft“, ist frag-lich. Die verlorene Gesundheit wieder zu findenhalfen den Pressburgern auch die Aufenthalte inösterreichischen Kurorten und Sanatorien, wiedem Priessnitztal bei Mödling15 oder dem Sanato-rium Gutenbrunn in Baden bei Wien16. Nicht weitvon der Gesundheit entfernt sind Kosmetikaund Waschmittel. Wenn man von den verschie-denen Haarwuchsessenzen und Pomaden fürMänner und Frauen des Karl Polts absieht17,
waren die meisten kosmetischen Produkte ausWien für Frauen bestimmt. Unter dem Motto„Schönheit ist Reichtum, Schönheit ist Macht“bot ihre Produkte eine gewisse Rosa Schäffer ausWien an, die mit ihrem Kopf als Schutzmarke fürihre Produkte garantierte18. Klythia Puder vonGottlieb Taussig, k. & k. Hof- und Kammerliefe-rant aus Wien, I., Wollzeile 3 (Abb. 4)19, war denPressburger Frauen ebenso vertraut wie denenaus Wien. Im reichen Angebot an Waschmitteln,unter denen die Marke Schicht mit Hirsch oderSchlüssel dominierte, wurde neben den Markenwie Persil20 und Sunlight21, die noch heute existie-ren, der sparsamen Hausfrau auch Minka-Wasch-pulver der Minka-Waschpulverwerke in WienXIV/3, mit General-Depôt für Pressburg undUmgebung bei Tölössy István, Michaelergasse 5,empfohlen (Abb. 5)22. Interessant wendete sich
die Firma Karig an die Kunden. Die Firmabewarb Karig Raben Seifen und Vesta-Pulver,indem sie behauptete, bei ihr sei nur die Reklameweniger, die Qualität aber nicht23. Aus Wienstammten auch die ersten Annoncen für Wasch-maschinen, z. B. von S. Berger, der auch Auswin-demaschinen und Wäscherollen erzeugte24.
Verlassen wir diesen Themenkreis und gehenzum Essen und Trinken über. Mit Lebens-
mitteln wurden die Pressburger meistens von ein-heimischen Lebensmittelwerken versorgt, wie der
11 Preßburger Wegweiser, 1896, S. 272.12 Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 137, Nr. 61, S. 9.13 Preßburger Zeitung, 1879, Jg. 115, Nr. 38, S. 8.14 Preßburger Zeitung, 1896, Jg. 133, Nr. 101, S. 6.15 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 585, S. 4.16 Preßburger Zeitung, 1913, Jg. 150, Nr. 194, S. 15.17 Preßburger Zeitung, 1870, Jg. 107, Nr. 5, S. 6.
Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr. 5883, S. 11.
18 Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 180, S. 8.19 Preßburger Zeitung, 1910, Jg. 147, Nr. 22, S. 10.20 Preßburger Zeitung, 1913, Jg. 150, Nr. 303, S. 6.21 Westungarischer Grenzbote, 1910, Jg. 39, Nr. 13070, S. 8.22 Preßburger Zeitung, 1909, Jg. 146, Nr. 114, S. 11.23 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 583, S. 6.24 Preßburger Wegweiser, 1896, S. 252.
Abb. 4: Preßburger Zeitung, 1910, Jg. 147, Nr. 22, S. 10
Abb. 5: Preßburger Zeitung, 1909, Jg. 146, Nr. 114, S. 11
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 12
13
m&z 2/2004
bekannten Dampf-Wurst-Fabrik von JohannManderla, gegründet bereits im Jahre 1866 vonAndreas Manderla und die Pressburger Dampf-mühle von Gottfried Ludwig, erbaut im Jahre1870. Aber ebenso wie die Pressburger Spezia-lität, die Nuss- und Mohnbeugel, die auch kisten-weise versandt wurden, kamen aus Wien ver-schiedene Delikatessen in die Pressburger Delika-tessenläden, so zum Beispiel Tschinkelsche Scho-koladen der Firma Aug. Tschinkel Söhne mit demSitz in Wien, Schwarzenbergstrasse (Abb. 6)25 zuPeter Jaklitsch u. a., Kakao und Schokolade vonViktor Schmidt und Söhnen aus Wien IV., Allee-gasse 18,26 zu Jos. Wimmers Söhnen, OskarPischingers Stephanie Torte in die PressburgerKonditorei Mayer27 u.a. Freudensprünge bei jeder
Hausfrau aufgrund des gelungenen Kuchenserzielte durch ihre Produkte wie Backpulver undVanillezucker die Firma Oetker mit Sitz inBaden bei Wien und ihrem Stammhaus in Biele-feld (Abb. 7)28. Aus Wien XIV./2 lieferte manauch Pflanzenfett nach Pressburg, welches als„reinstes Speisefett von den Autoritäten aner-
kannt wurde“ und unter dem Namen Kunerolbekannt war29. Auch gesunde Kindernahrungwurde aus Wien angeboten und zwar das durchdie Autoritäten von Österreich-Ungarn undDeutschland als bestes anerkanntes Kufeke’sKindermehl30. Den Pressburgern duftete schondamals Julius Meinl’s Bohnenkaffee in der Nase
(Abb. 8)31. Von alkoholhaltigen Getränken wurdez. B. das Bier der Bierbrauerei-Actien-Gesell-schaft in Schellenhof bei Wien bei Peter Jaklitschin Pressburg, Michaelergasse Nr. 160, angebo-ten32, sowie das fürstl. Schwarzenberg-Witting-auer Lager-Bier im Hotel „zum rothen Ochsen“33.Zum Kaffee zündete man sich oft eine Zigarettean: Die Werbung für Tabak war damals nichtuntersagt. So inserierten in der Pressburgerdeutschsprachigen Presse auch die Fabrik zurHerstellung des Zigarettenpapiers Les dernièrescartouches aus Paris mit der Niederlassung inWien I., Schottenring 2534, und Jakobi, der Her-steller der Antinicotin-Zigaretten-Hülse ausWien, Piaristengasse35. Bei Wein und Sekt wurdenmeist einheimische Marken angeboten. Pressburgwar schon damals durch seinen guten Weißweinund Sekt der Marke Palugyai und Hubert36
bekannt. Der Pressburger Kellerverein inseriertein der Presse regelmäßig nicht nur Einladungenzu seinen Versammlungen, sondern auch seinevorzüglichen alten Weine37.
Ähnlich wie bei den Kosmetika überwog auchbei den Modewaren das Angebot für Frau-
en. Wiener Chic eroberte Pressburg. Im Angebot
25 Westungarischer Grenzbote, 1882, Jg. 11, Nr. 3345, S. 9.26 Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr. 5883, S. 10.27 Preßburger Zeitung, 1888, Jg. 125, Nr. 4, S. 5.28 Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 34, S. 6.29 Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 208, S. 13.30 Preßburger Zeitung; 1900, Jg. 137, Nr. 190, S. 6.31 Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 147, Nr. 355, S. 4.
32 Preßburger Wegweiser, 1874, o.S. 33 Preßburger Zeitung, 1888, Jg. 125, Nr. 54, S. 8.34 Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr.. 5877, S. 11.35 Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 179, S. 5.36 Preßburger Wegweiser, 1880, o.S.37 Preßburger Wegweiser, 1907, S. 39.
Abb. 6: Westungarischer Grenzbote, 1882, Jg. 11, Nr. 3345, S. 9
Abb. 7: Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 34, S. 6
Abb. 8: Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 147, Nr. 355, S. 4
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 13
standen Stoffe z. B. von Grand Magasin „Au PrixFix“ der Brüder Hirsch & Co., Wien I., GrabenNr. 1538, die Mieder „Perplex“ des Miederfabri-kanten und Patentinhabers Adolf Bachrich & Co.in Wien I., Biberstrasse 2439, elegante Krägen,Capes, Jaquets, Kleider usw. von J. A. Plank, WienII., Praterstrasse 36 (Abb. 9)40, Pelzwaren desKürschners W. Odwarka aus Wien VI., Mariahil-ferstrasse 4941, und Wiener Schnitte vom VerlagWiener Moden, Herausgeber der gleichnamigenZeitung42. Wiener Schuh zu Wiener Bekleidungbot den Pressburgern u. a. „Lager zum WienerSchuh“ in der Langen Gasse an43, weiter dieSchuhfabrik in Mödling, nicht weit von Wien, mit
dem Verkauf nur in der Deakgasse Nr. 9 in Pres-sburg44. Beste Absätze für die Schusterwerkstät-ten lieferte die Wiener Firma Sigmund Beer undSöhne mit Sitz in Wien VI./245. Elektro GoldUhren zu festlicher Bekleidung mit der kostenlo-sen Elektro Gold Uhrkette lobte die Firma Hein-rich Kertézs aus Wien I., Wollzeile 34/2746 inderen Angebot sich auch Plüschtiere wie Bärenund Äffchen befanden47.
Zum letzten Themenkreis der angebotenenWiener Waren von Gebrauchsartikeln
gehört die Ausstattung von Wohnungen. Hierkann man die Petroleumlampen48 und elektrischeBeleuchtungskörper der Firma R. Ditmar ausWien (Abb. 10)49 erwähnen, Möbel der Möbel-Fabrik Heinrich Back aus Wien, welche sie ohneVerpackungs- und Transportkosten zu berechnenlieferte50, Teppiche, Decken, Vorhänge undMöbelstoffe verkauft von S. Schein in den Loka-litäten Donaugasse 7, I. Stock51, Dauerbrandöfen
der k. & k. Hof-, Bau- und Kunsttischlerei von J.W. Müller aus Wien V./2, Einsiedlerplatz 3-452,schöne Pendeluhren mit Musik versandt durchdie erste und größte „Wiener Uhren Niederlage“von Max Böhnel in Wien IV., Margaretenstr.27/39 K53, das Stingl Piano aus Wien54, Platten-spieler von G. Stiasny, Wien IV., Kalvarienberg-gasse, Nr. 34 F55 usw.
Eine beliebte Freizeitbeschäftigung der Pressbur-ger und Pressburgerinnen war das Lesen. DieBücherinsertionen und die Zeitungen- undZeitschrifteninsertionen in der Pressburgerdeutschsprachigen Presse waren zahlreich. Hierübertraf jedoch das deutsche Angebot das öster-reichische. Nachschlagewerke wie Meyers Kon-
m&z 2/2004
14
38 Preßburger Zeitung, 1896, Jg. 133, Nr. 238, S. 7.39 Preßburger Zeitung, 1909, Jg. 146, Nr. 107, S. 9.40 Preßburger Zeitung, 1897, Jg. 134, Nr. 135, S. 23.41 Westungarischer Grenzbote, 1881, Jg. 10, Nr. 3021, S. 9.42 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 595, S. 5.43 Westungarischer Grenzbote, 1881, Jg. 10, Nr. 3021, S. 11.44 Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 137, Nr. 96, S. 8.45 Preßburger Zeitung, 1910, Jg. 147, Nr. 29, S. 9.46 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 549, S. 5.47 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 602, S. 6.
48 Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 137, Nr. 350, S. 10.49 Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 137, Nr. 356, S. 7.50 Preßburger Zeitung, Jg. 137, Nr. 356, S. 7.51 Preßburger Zeitung, 1888, Jg. 125, Nr. 29, S. 12.52 Preßburger Wegweiser, 1909, S. 31.53 Preßburger Wegweiser, 1900, S. 29.54 Preßburger Wegweiser, 1903, S. 120.55 Preßburger Wegweiser, 1910, S. 28.56 Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr. 5882, S. 9.57 Preßburger Zeitung, 1913, Jg. 150, Nr. 194, S. 5.
Abb. 9: Preßburger Zeitung, 1897, Jg. 134, Nr. 135, S. 23
Abb. 10: Preßburger Zeitung, 1900, Jg. 137, Nr. 356, S. 7
Abb. 11: Inserat des Wiener Zeitungs-Bureaus imPreßburger Wegweiser 1888
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 14
m&z 2/2004
15
versationslexikon, Fachbücher wie „Wie werdeich ein guter Kaufmann“ vom Verlag der Han-dels-Akademie Leipzig, Goethes sämtliche Werkewurden durch die Cotta’sche BuchhandlungNachfolger in Stuttgart angeboten u. a. Von dendeutschen Zeitungen erfreuten sich jahrelangbesonderer Aufmerksamkeit die humoristischenMeggendorfer Blätter. Aus Wien inserierte regel-mäßig Hartleben’s Verlag56. Von den Zeitschriftendie schon erwähnte Wiener Mode und Wiener Illu-strierte Zeitung57. Die Seele des Menschen konntesich auch am Hören von Musik erfreuen. Bei ver-schiedenen Veranstaltungen konzertierten oftWiener Künstler, z. B. bei den Frühlingsfestenvom 30. Mai bis 6. Juni 1909 in Pressburg-Enge-rau (geschrieben auch Pozsony-Ligetfalu, Anm.)war es die Wiener Schrammelmusik58. Zweigstel-len der Fabriken von Fahrrädern der Marke Mete-or, Dürkopp, Styria u. a. luden die Kunden zu
Ausflügen bis nach Paris ein (Abb. 12)59. ErstesWiener Reisebureau, Wien I., Kolowratring 9,organisierte Vergnügungsfahrten mit demDampfschiff von Pressburg nach Budapest undretour60. Auch der Reisende, der nähere Auskünf-te von der Hamburgisch-Amerikanischen Packet-fahrt Aktien Gesellschaft Express Postdampf-schiffahrt Hamburg-New York brauchte, konntesie in Wien IV., Weyringergasse 32, bei JosefGschirhakl bekommen61. Praktische Hilfe für Rei-sende nach Wien war die regelmäßige Veröffent-
lichung der Fahrpläne der Eisenbahn, sowie dieAnnoncen Wiener Hotels, z. B. des Hotels Bea-trix62 und des Hotels Ungarische Krone63, dieebenfalls in der Pressburger deutschsprachigenPresse ihre Dienste anboten. Ein speziellesHobby war in jenen Jahren die Jagd. Die hiesigenGeschäfte mit Jagdwaffen boten Jagdpatronenund Jagdrequisiten auch ausländischer Herkunftan64. Für Jagdhunde und Schutzhunde wurdeschon damals Fattinger „Hundekuchen“ angebo-ten65. Der Wildexporteur und TierschätzmeisterKarl Gudèra aus Wien VII/2, Zollergasse 31,bestellte wiederholt über Annoncen lebendesWild, besonders Fasane, Rebhühner und Hasen66.Unter den aus Wien am öftesten angebotenenDiensten standen die Angebote der Versiche-rungsgesellschaften wie Europa67, Austria68,Österreichischer Phönix und Providentia allenvoran. Versichert wurden Hab und Gut, Menschund Tier gegen verschiedenste Schäden. Nachdem Aufkommen moderner Transportmittel wieFahrrad und Auto versicherten einige von ihnenauch gegen Verkehrsunfälle, obwohl es uns jetztlächerlich vorkommt, wenn wir an die damaligeGeschwindigkeit der Automobile denken. Extraversichern konnte man damals auch die Spiegel-gläser. Die Erste Wiener Spiegelglas-Versiche-rungsgesellschaft wurde in Pressburg durch Jos.Wimmers Söhne vertreten69. Die Veröffentli-chung der Kurse der Wiener Börse war für diePreßburger Zeitung eine Selbstverständlichkeit.
Durch diese Aufzählung ist das Verzeichnisder aus Wien angebotenen Waren und
Dienste bei weitem nicht erschöpft. Wir könntenbei den Waren z. B. die Photoapparate aus Lech-ners Fabrik, Wien, Graben 31, Schwannhäusser’sBüroartikel der Shannon-Registratur-Unterneh-mung aus Wien I., Johannesgasse 2, I. Stock,praktische Geschenke der Firma gold. Pelikanund viele andere Waren erwähnen. Bei den Dien-sten könnten wir weiter in Details gehen und überdie Inserate der neuen Besitzer von Restaurants,Bierhallen u. a. berichten, die sich den Kundenempfahlen, wie z. B. Joseph Regenhart bei derÜbernahme des Restaurants am priv. österr.-ung.Staatsbahnhof in Wien im Mai 189770.
58 Preßburger Presse, 1909, Jg. 12, Nr. 590, S. 6.59 Westungarischer Grenzbote, 1900, Jg. 29, Nr.9543, S. 4.60 Preßburger Zeitung, 1888, Jg. 125, Nr. 85, S. 8.61 Westungarischer Grenzbote, 1890, Jg. 19, Nr. 5882, S. 7.62 Preßburger Zeitung, 1910, Jg. 147, Nr. 71, S. 13.63 Preßburger Zeitung, 1905, Jg. 142, Nr. 180, S. 7.64 Preßburger Wegweiser, 1909, S. 45.
65 Preßburger Zeitung, 1909, Jg. 146, Nr. 113, S. 8.66 Preßburger Wegweiser, 1903, S. 45.67 Preßburger Wegweiser, 1870, o.S.68 Preßburger Wegweiser, 1882, S. 175.69 Preßburger Wegweiser, 1914, S. 10.70 Preßburger Zeitung, 1897, Jg. 134, Nr. 114, S. 5.
Abb. 12: Westungarischer Grenzbote, 1900, Jg. 29, Nr.9543, S. 4
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 15
m&z 2/2004
16
All diesem Aufschwung machte der 1. Weltkriegein Ende. Die Redaktionen leerten sich, die Zahlder Seiten in den Zeitungen wurde reduziert unddie Zahl der Annoncen verringerte sich. DasAngebot wurde schmäler. Feste und Lotterienwurden selten organisiert, wenn überhaupt dannzu Wohltätigkeitszwecken. Bei den aus Wienangebotenen Waren überwogen Inserate für ver-schiedene Desinfektionsmittel sowie Einkochglä-ser und Einkochapparate, damit man sich selbstversorgen konnte. Mitteilungen über die Eröff-
nung von Niederlassungen Wiener Betriebe inPressburg kamen nur vereinzelt vor.
Das Ende des Krieges bedeutete nicht nurden Zerfall der Monarchie, sondern auch
den Zerfall einer gemeinsamen Kultur- und Wirt-schaftszone. Diese Unterbrechung der Konti-nuität bedeutete den ersten Schritt zur Entfrem-dung beider Metropolen, die mit dem Eintritt derSlowakei in die Europäische Union wieder ganzverschwindet, das ist unsere größte Hoffnung.
Danusa SERAFÍNOVÁDoz. PhDr., PhD. Dozentin für Journalismus am Lehrstuhl für Journalismus der Philoso-phischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Fachgebiet: Geschichte desJournalismus, Geschichte der Werbung. Hobbyfach: Slowakisch als Fremdsprache.Langjährige Lektorin an der Sommerschule der slowakischen Sprache Studia AcademicaSlovaca. Publikationen: Danusa Serafínová: Preßburger Zeitung – Nutz und Lust. Brati-slava/Pressburg 1999; Danusa Serafínová / Jozef Vatrál: Pressburger liebste Waren &Dienste. Bratislava/Pressburg 2004 u. a.
Jozef VATRÁL (1945)Doz. PhDr., PhD., Dozent für Journalismus, Leiter des Lehrstuhls für Journalismus derPhilosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Fachgebiet: Geschichtedes slowakischen Journalismus, Typographie und Design, Interaktive Medien. Vorsitzen-de der Vereinigung Mass Media Science, Chefredakteur der Fachzeitschrift „Otázky Zur-nalistiky“ [Fragen des Journalismus]. Publikationen: Danusa Serafínová / Jozef Vatrál:Pressburger liebste Waren & Dienste. Bratislava/Pressburg 2004 u. a.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 16
* Das Gespräch wurde übersetzt von Thomas Várkony.
m&z 2/2004
17
Thomas Várkonyi: „Wie hat sich aus Ihrer Sicht diemediale Situation in Ungarn, die ungarische Öffentlich-keit, die Mediennutzung und deren wissenschaftliche Ana-lyse auf historischem und/oder anthropologischem Gebietseit dem Systemwechsel 1989/90 entwickelt?“
Gábor Kapitány: „Die Mediensituation inUngarn hat sich vor dem Systemwechsel 1989wesentlich von dem unterschieden, was für West-europa bzw. andere Teile der Welt im allgemeinentypisch war. Das sozialistische Lager hatte eineeigene Medienstruktur, einen eigenen Stil, eineeigene Thematik, und obwohl innerhalb diesesLagers die ungarische die am ehesten offene undam ehesten den westlichen Medien vergleichbarewar, war sie doch vom Typus her ganz verschie-den. Nur um auf die evidentesten Unterschiedehinzuweisen: So wäre der vom ideologischenStandpunkt monolithische Charakter zu erwäh-nen; obwohl es in den 80er Jahren Diskussions-sendungen gab, die unterschiedliche Ansichten zuWort kommen ließen und in einigen Zeitungenvon der offiziellen Meinung divergierende Stand-punkte erscheinen durften, musste doch auch indiesen Medien die Hegemonie der sozialistischenIdeologie gesichert sein; und dann gab es nochweitere Abweichungen, die ziemlich lautstarkeRolle der Kultur oder die bedeutende Rolle derProduktionsereignisse in den Nachrichten. Daherbedeutete der Systemwechsel eine wesentlicheVeränderung im gesamten Themenkreis derMedien, in ihrem Stil, in der verwendeten Symbo-lik. Außer den erwähnten (das heißt neben derpolitisch-ideologischen Pluralisierung und derZurückdrängung der Kultursendungen und derProduktionsnachrichten) waren sehr augenfälligeVeränderungen zum Beispiel das Eindringen derdurch die Medien repräsentierten Öffentlichkeitin die Intimsphäre der Bevölkerung, die show-charakterliche Verschiebung der Inhalte, sowohlauf dem Gebiet der Kultur als auch auf demGebiet der Politik und das Auftreten des damiteinhergehenden grelleren Umgangstons. DerSystemwechsel bedeutete gleichzeitig auch einenGenerationenwechsel, auch auf dem Gebiet der
Medien, da die neue Generation bereits durchund auf die westlichen Medien hin sozialisiertworden ist und deren Vertretung übernommenhat. Eine wesentliche Veränderung ist auch dieModifikation der medialen Strukturen, in ersterLinie in Richtung eines marktwirtschaftlichenTypus. Es erschienen die kommerziellen Sender,die davor natürlich nicht präsent waren. Fernse-hen und Radio bestanden im Wesentlichen auszwei bis drei staatlichen Kanälen und nachdemdas Überleben dieser Sender vom VerhältnisAngebot und Nachfrage abhängig ist, muss mansie offensichtlich ganz anders betreiben als diefrüheren staatlichen Sender. Diese Veränderun-gen resultierten in der Ausformung einer derarti-gen Sendungsstruktur und eines derartigen Sen-dungsstils, dass daraufhin zumindest die zweigrößten kommerziellen Sender die staatlichenSender überholten, daher wurden diese dazugezwungen, ihren Stil zu verändern und immergrößere Zugeständnisse in Richtung des markt-wirtschaftlichen Typus zu machen. Es verstehtsich auch von selbst, dass, als das Land von demEinparteiensystem der so genannten weichenDiktatur in das Mehrparteiensystem der parla-mentarischen Demokratie gewechselt hat, sichdas Mediensystem pluralisiert hat und dort eben-falls die Vertreter der verschiedenen Parteien undRichtungen erschienen sind.“
Thomas Várkonyi: „In Österreich hat es auch media-le Veränderungen gegeben. Früher gab es zum Beispiel nurdas öffentlich-rechtliche Fernsehen, allerdings gab es nebenParteizeitungen auch unabhängige Zeitungen. Hier hat dieVeränderung einerseits durch ins Kabelnetz eingespeistePrivatsender, andererseits durch österreichische Werbefen-ster deutscher Kabelsender stattgefunden. Auch in Ungarnsind internationale Konzerne in die Medienlandschaft ein-gestiegen. Wie ist deren Auswirkung auf die Medienland-schaft, deren Einfluss auf die Öffentlichkeit und wie wirddiese Neuerung von der Bevölkerung akzeptiert?“
Gábor Kapitány: „Über den unmittelbaren Ein-fluss dieser Konzerne habe ich keinen Überblick,das ist in Wahrheit Wirtschaftssoziologie, da lau-
„Ich bin kein Pessimist, obwohl...“*
Thomas Várkonyi im Gespräch mit Gábor Kapitány über die Transformation des ungarischen Mediensystems
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 17
m&z 2/2004
18
fen recht interessante Forschungen über dieseFragen, zum Beispiel sind hervorragende Arbei-ten zu dieser Thematik von meiner Kollegin Erz-sébet Szalai erschienen. Als Zuschauer undMedienanalytiker kann man jedenfalls sehen, dassauch im ungarischen Fernsehen internationaleFirmen und Programme aufgetaucht sind. Es gibtimmer mehr solche Sendungen, welche eindeutigauf der Übernahme ausländischer Lizenzenbasieren und sich an diese anlehnen. Es ist auchbekannt, dass die Presse, inklusive der elektroni-schen Presse, zu einem großen Ausmaß insEigentum westlicher Konzerne übergegangen ist,dass heißt die Internationalisierung ist stark spür-bar. Die Rezeption dieser Entwicklung ist in derGesellschaft ambivalent. Einerseits ist in gewisserHinsicht die Präsenz einer kulturellen „Kolonisa-tion“ nicht zu negieren, da das einströmendeKapital offensichtlich die eigenen Interessen zurGeltung bringen will, und dies scheinbar leichtermit einer nach Franchise-Typus uniformenMedienstruktur und dumpingmäßig verabreich-ten Neuheiten erreichen kann, als wenn es auf diein der gegebenen Gesellschaft vorhandenen inne-ren Eigenschaften zurückgreifen müsste. Gleich-zeitig existiert die Auffassung, dass es keine Alter-native zu dieser Entwicklung gibt, da in einemwirtschaftlich und strukturell erst aufschließen-den Land das Hereinströmen von Kapital unum-gänglich ist, und eventuelle negative Effekte indie Kategorie „notwendige Übel“ fallen. Meinepersönliche Meinung ist, dass das Hereinströmenwestlichen Kapitals von größerem Ausmaß undgrößerer Wirkung war, als es optimal gewesenwäre und dass daher das Land mehr, als in dem inden vergangen zehn bis fünfzehn Jahren verwirk-lichten Ausmaß, danach trachten sollte, die eigeneKultur zu schützen. All das ist natürlich nicht nurein osteuropäisches Problem; die Amerikanisie-rung der Kultur, oder die Frage der kulturellenGlobalisierung ist in Frankreich, Italien undanderswo auch thematisiert worden, und wenn eseinerseits keinen Sinn ergibt, diese Entwicklungzu dämonisieren oder zu mystifizieren, glaube ichandererseits nicht, dass die Welt ausschließlichvor dieser Alternative steht.“
Thomas Várkonyi: „Ist es nicht so, dass eine Sen-dung, die in Ungarn nach einem ausländischen Konzeptübernommen wurde und in verschiedenen anderen Län-dern unter ähnlichem Namen läuft, doch eine eigenständi-ge ungarische Eigenart hat? Ein gutes Beispiel dafür wäredie Sendung „Heti Hetes“, die im deutschsprachigenRaum unter dem Namen „Sieben Tage, sieben Köpfe“präsent ist, allerdings mit einem komplett anderen Grund-
tenor. Während die deutsche Show größtenteils auf eherstumpfsinnigem Schenkelklopfhumor aufbaut und frei vonKritik, Politik und Provokation ist, ist die ungarischeVersion eine sich größtenteils mit politischen Themenbeschäftigende, polemisch gefärbte Unterhaltungssendungvon hohem Niveau. Das zeigt, dass eine Sendung inUngarn, obwohl sie auf einem internationalem Konzeptbasiert, eine eigene und einzigartige Ausprägung erhaltenkann. Das Gegenbeispiel wäre dann die Realityshow „BigBrother“.“
Gábor Kapitány: „Einerseits ist es wahr, dassjegliches übernommenes Format nationalen Cha-rakter annehmen kann. Die ungarische Kulturwar immer schon in großem Ausmaß für ihreOffenheit bekannt, es gab immer vielerlei Ein-flüsse aus Europa und die ungarische Kulturkonnte ihnen im Allgemeinen ihren eigen Stem-pel aufdrücken. Im Übrigen kann das sogar beidem vorher als schlechtes Beispiel erwähnten„Big Brother“ funktionieren, weil es nach einerfundierten Analyse der ungarischen Version auchdort die ungarischen Eigenheiten, beziehungs-weise zumindest Eigenheiten, die auf Charakteri-stika gewisser Segmente der ungarischen Gesell-schaft heute hinweisen, gibt. Aber davon wirddiese Sendung nicht Teil der ungarischen Kultur,wenn wir unter Kultur ein System der Werte, dergeistigen Errungenschaften, Schöpfungen, Ver-haltensmuster und Paradigmen verstehen, das imLaufe der Jahrhunderte natürlich ständigen Ver-änderungen ausgesetzt ist, aber auch im Gleich-gewicht mit den Existenzverhältnissen der gege-benen Bevölkerung ist. Im Fall einer Fernsehsen-dung ist in diesem Zusammenhang die entschei-dende Frage, was die gegebene Sendung zu dieserKultur beitragen kann. Die Sendung „Megasz-tár“, die ebenfalls auf einem westlichen Formatbasiert, ist zum Beispiel nicht nur populär underfreut sich guter Kritiken, sondern gerade weilsie auf niveauvolle Weise talentierten Jugendli-chen ein Forum bietet und dieses Talent sich ausder gegebenen Kultur speist, bietet sie der Kultureine Möglichkeit sich zu manifestieren, wennnatürlich auch nur in den Parametern des Unter-haltungsgenres. „Big Brother“ ist allerdings, egalin welchem Land wir es uns anschauen, hinsicht-lich der Auswirkungen auf die Sozialisation einenegative Sendung. Daran ändern auch die lokalenCharakteristika nichts, die „couleur locale“ unddie Kultur sind nicht austauschbare Begriffe. DieKultur jedes Landes folgt einer inneren Logik, diesich über die Jahrhunderte aufbaut. Das bedeutetnie, dass sie sich verschließt, im Gegenteil, dieäußeren Einflüsse „befruchten“ sie, aber sie hat
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 18
m&z 2/2004
19
ihre innere Logik, nach der die gegebenen Schrit-te aufeinander folgen. Diese Logik wird durchinternationale Ereignisse und Einwirkungenbedroht, da die Gefahr besteht, dass nicht das dasLeben und die Verhältnisse der hier LebendenAusdrückende, sondern ein nicht aus ihnen orga-nisch hervorgegangenes „kulturelles Muster“ denAufbau der nationalen Kultur prägt. Es ist näm-lich so, dass alles, was durch die Medien weltweitverbreitet wird, eine sehr eigene kulturelleKohärenz aufweist, aber in diesem Fall nicht indem mit positiven Assoziationen umschriebenenSinn von Kultur, sondern in einem neutralenSinn. Dies ist zwar auch eine Art von sehrkohärenter und konsistenter Kultur, allerdingsenthält sie zahlreiche solche negativen Elemente,die die Menschheit nicht in die allerbeste Rich-tung lenken. Mein größtes Problem damit, wofürauch die erwähnte Sendung „Big Brother“ eingutes, aber natürlich nicht das einzige Beispiel ist,ist, dass diese Kultur auf der moralischen Ebeneim Verhältnis zwischen Gut und Böse eine starkenegative Tendenz aufweist. Was an der heutigenWeltkultur das Hauptproblem zu sein scheint, hatschon vor einem halben Jahrhundert David Ries-man in seinem Werk „The Lonely Crowd“ sehrplastisch dargestellt. In dieser klassischen kultur-soziologischen Analyse unterscheidet Riesmandrei Verhaltenstypen: den von der Tradition gelei-teten Typus, den von innen geleiteten Typus undden von außen geleiteten Typus. Er zieht denSchluss, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-hunderts der von außen geleitete Mensch in denVordergrund rückt, was vollkommen richtig ist.Gleichzeitig könnte man die Attitüde, die er alsvon innen geleiteten Typus beschreibt, als Verhal-tensmuster als gefährdet bezeichnen. Das ist einesehr negative Tendenz. Diese Sendungen propa-gieren stark und verbreiten auch die Attitüde desvon außen geleiteten Menschen, was natürlich fürden Markt ideal ist, weil diese Attitüde die desguten Konsumenten ist; und die Attitüde ist auchideal für die Politik, denn der von außen geleiteteTypus ist ein leicht manipulierbarer Wähler. Aber von der Warte der Kultur der Mensch-heit aus betrachtet, die von innen geleitete,souveräne, moralische Menschen benötigenwürde, die den Unmenschlichkeiten, den Mani-pulationen, den Ungerechtigkeiten widerstehenkönnen, ist dies eine negative Entwicklung. Dasin den Medien dominante Weltbild propagiertallerdings, dass dies ein anachronistisches Idealwäre. Das ist natürlich nicht wahr, der Kampfzwischen Gut und Böse ist in jedem Zeitalterzeitgemäß.“
Thomas Várkonyi: „Dazu möchte ich erwähnen, dassman in der Fachliteratur viele Hinweise darauf findet,dass man die Menschen doch nicht so leicht steuern kannwie man dachte und wie es das ursprüngliche Ziel war.Der Mensch nimmt etwas aus dem Angebot an, aber nie-mand kann kontrollieren, was das Individuum damitanfängt. Daher kann man es nicht so steuern, wie manmöchte.“
Gábor Kapitány: „Ich stimme zu. Glücklicher-weise kann und wird die Menschheit nie homo-gen sein, aber es ist nicht egal, welche kulturellenNormen in einem gegebenen Zeitalter dominantsind. In einem Zeitalter, wie es zum Beispiel das19. Jahrhundert war, war dieser von innen geleite-te Typus als positive Norm und Vorbild in derKultur und auch in der Erziehung präsent. Daherist es, wenn man die manipulierbaren Menschenauch berücksichtigt, nicht egal, ob wir sie in Rich-tung freie Persönlichkeiten steuern oder in Rich-tung konsumierende Masse.“
Thomas Várkonyi: „Zwei Bücher möchte ich in die-sem Zusammenhang erwähnen. Das eine ist vom ungari-schen Soziologen Elemér Hankiss und heißt „Proletárreneszánsz“ (Die Renaissance der Proleten), in welchemes unter anderem um jenes Phänomen, um jenen Men-schentypus geht, der „politisch unkorrekt“ als „glatzköp-figer, bodybuildender, tätowierter Rausschmeißer“beschreibbar ist. Das heißt, es handelt von jenen, die imgegebenen Zeitalter aktuell kategorisierbare und einorden-bare Stilmerkmale tragen und wie sich diese in die erwähn-te, auch durch „Big Brother“ charakterisierte Kultur, ein-fügen. Das andere Buch ist von Neil Postman, es heißt„Wir amüsieren uns zu Tode“ und handelt davon, dassdie elektronischen Medien jene positiv empfundene Kulturzerstören, die auf der Schrift, auf dem Buchdruck, aufBüchern basiert. Postman selbst hat zum Beispiel nichteinmal einen Computer verwendet, er hat nur mit derFüllfeder geschrieben, er lehnte alle modernen Hilfsmittelab. Dieses Weltbild nennt man apokalyptisch. MeineFrage wäre, inwieweit nach all dem Gesagten Ihr Weltbildals apokalyptisch bezeichnet werden kann?“
Gábor Kapitány: „Zuerst einmal sind weder dieMedien noch sonst irgendwer Schuld an den Phä-nomenen, über die wir hier reden. Die Relationzwischen Gut und Böse in der Welt kommt ineiner wesentlich komplizierteren Art zur Geltung,als dass man diese in der Art von Ver-schwörungstheorien personifizieren könnte. DieKommerzialisierung der Medien und die Förde-rung ihrer Rezeptionsfähigkeit hat ebenso eineeigene Logik wie der Markt und der Kapitalismusauch und natürlich kommen all diese zur Geltung.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 19
m&z 2/2004
20
Ich glaube dem Fernsehstar, dass er nicht diekommenden Generationen verderben will, son-dern dass er ein Profi ist, das heißt, er will eineerfolgreiche Sendung produzieren. Gleichzeitigzeigt die Geschichte der Menschheit, dass durchverschiedene Partizipienten, die nach ihrer eige-nen Logik optimierte Handlungsweisen setzen,die spontan zur Geltung kommenden Prozessesich dergestalt addieren, dass sie entweder in eineBlütezeit führen oder in die Dekadenz. Darin binich sehr wohl mit vielen heutigen Autoren einerMeinung, dass sich die westliche Welt gegenwär-tig in einem dekadenten Zeitalter befindet undzwar in sehr vielen Belangen. Viele vergleichen siemit dem römischen Kaiserreich und dies nichtungerechtfertigt, denn die Realityshows sind ingewisser Hinsicht Zitate von Gladiatorenspielenund die Dominanz von zügellosem Sex ohneMoral ist ebenfalls mit dem spätrömischen Zeital-ter vergleichbar. Und es werden immer mehr, indieser Hinsicht negative, Phänomene erkennbar.Es ist allerdings auch nicht zu vergessen, dassman auch in jener Zeit auf das Ende der Weltgewartet hat, auf den totalen Zusammenbruch,doch führte all das zur Entstehung einer neuengesellschaftlichen Ordnung, deren Basis dasgegen den Geist des dekadenten Rom rebellieren-de Christentum bildete. Das wesentliche ist alsojetzt, dass, in Opposition zu einem gewissen, gro-ßen, seit Jahrhunderten andauernden und in jegli-cher Hinsicht ausgelaugten Paradigma sich jetztein solches neues Paradigma herauskristallisierenkann, welches sich dann über Jahrhunderte neuaufbauen kann und nicht in Dekadenz versinkt.“
Thomas Várkonyi: „Meiner Meinung nach kann sichdas deshalb so entwickeln, weil es in der heutigen Weltglücklicherweise eine offensichtlich größere Freiheit desIndividuums im Vergleich zu vergangenen Kulturen undGesellschaftsformen gibt. Die wichtige Frage in diesemZusammenhang ist, ob eine Bewegung gegen die absolutepersönliche Freiheit nicht in das gleiche Fahrwasser wie derradikale Islam gerät, da dieser auch genau die so genann-te Dekadenz der westlichen Welt zu bekämpfen vorgibt.“
Gábor Kapitány: „Ich denke der Islam ist keineAlternative, obwohl ich kein Sachverständiger binund niemanden in seinem Glauben verletzenmöchte. Aber der Islam ist ja doch eine einein-halbtausend Jahre alte Religion, die keine neueAlternative darstellt. Das heißt es ist nicht dieRede davon, dass für die heutige Zeit eine in dieZukunft weisende, eine Erneuerung beinhaltendeAntwort gegeben wird, sondern dass der Islam,genau wie auch der christliche Konservatismus,
auf Basis der eigenen Werte in Opposition zu die-sen Tendenzen steht. Dass die Popularität desIslam auch in einigen traditionell nichtislami-schen Gruppen wächst, entspricht jener Tendenz,nach der dekadente Zeiten nach Auswegensuchen und sehr oft, wenn es sich noch nichtabzeichnet, was das Neue ist, suchen sie diese injenen Dingen, die zwar alt, aber anders sind alsdie dominanten. Um bei dem Vergleich mit Romzu bleiben, finden wir dazu eine Analogie in derZuwendung zum Isis-, beziehungsweise zum Mit-hraskult, die natürlich keine wirklichen Verände-rungen bedeuteten, dazu musste etwas Neuesentstehen. Ich bin sicher, dass die Menschheitauch im 21. Jahrhundert aus dieser moralischenKrise herausfindet und in den dominanten Ten-denzen der heutigen Zeit sind sicher schon posi-tive Elemente der neuen Zeit enthalten. Was denzweiten Teil der Frage betrifft, so denke ich, dass,obwohl wir nicht wissen können, in welche Rich-tung sich die Menschheit entwickelt, nichts einepositive Alternative bedeuten kann, was die Ver-leugnung der persönlichen Freiheit bedeutet undnoch weniger etwas, das den Terror, dass heißtdie Missachtung des menschlichen Lebens, reprä-sentiert. Die erfolgreiche Erneuerung beinhaltetimmer einen Großteil von dem, was früher gutwar, hat allerdings immer auch neue Eigenschaf-ten. Die Humanität soll man nicht zurückneh-men, sondern steigern. Sie haben vorher auch darauf hingewiesen, dasses Leute gibt, die sich wegen der negativen Ten-denzen von allen Moden des Zeitalters abwen-den, keine neuen Technologien verwenden etc.Ich würde mich auch davor hüten, denn auch dietechnologische Entwicklung gehört nicht zu denSündenböcken. Jede Technologie kann man posi-tiv oder negativ verwenden, und wenn man vorihr flüchtet, führt das zu Nichts. Viel mehr mussman nicht einmal an der Verbreitung von Dingenminderwertiger Qualität zwangsläufig verzwei-feln, denn im besten Fall kann daraus noch etwasGutes entstehen. Ich bin kein Pessimist, obwohlich die heute dominanten Tendenzen nicht fürpositiv halte.“
Thomas Várkonyi: „Ungarn ist vor wenigen Wochender Europäischen Union beigetreten. Welchen Einflusskann dieses Ereignis auf die Politik und auf die Medienhaben, kann sich in Bezug darauf etwas ändern, dass inder Europäischen Union gewisse politische und medialeNormen existieren, wohingegen meiner Meinung nach derpolitische Diskurs und dessen mediale Aufbereitung imheutigen Ungarn nicht wirklich als EU-konform zubezeichnen sind?“
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 20
m&z 2/2004
21
Gábor Kapitány: „In Ungarn bin ich zuhause,die Länder der Europäischen Union kenne ichallerdings nur als Tourist und weil ich über siegelesen habe. Das heißt auf der Ebene des tiefe-ren Erlebens, die das Leben in der Kultur undGesellschaft eines Landes bedeutet, ist dieEuropäische Union für mich eine äußere Welt.Mit den Erwartungen im Zusammenhang mitdem Beitritt ist zumindest so viel sicher, dass es inOst- und Ostmitteleuropa in Bezug auf in gesell-schaftlichem Sinn verstandener Demokratieweniger Erfahrungen aus der Vergangenheitgegeben hat, dass heißt in diesem Sinn kann dieZusammenarbeit der Mitgliedsländer jedenfallseine positive Wirkung auf die ungarische Gesell-schaft haben. Die andere Seite der Sache ist aller-dings, dass ich kein Anhänger der Aufrechterhal-tung von ständigen Minderwertigkeitsgefühlenbin, der Verkündung der ZurückgebliebenheitUngarns, denn dazu, dass eine Kultur wirklichwirksam sein kann, muss eine Kultur Selbstbe-wusstsein haben. Das beweist von der französi-schen Kultur bis zur holländischen, von der ame-rikanischen bis zur finnischen, jede Nation, dieetwas erreicht hat in der Welt. Dieses einholende,verfolgende, lernende, zurückgebliebene Imageist keine gute Strategie, meiner Meinung nachbrauchen wir uns unserer eigenen Traditionennicht zu schämen. Diese sind natürlich andere alsdie westlichen, aber nicht geringere. Leider neigtauch die Union zeitweise dazu, neu beigetretenenLändern gegenüber eine Art „schulmeisterhaf-ten“ Verhaltens anzunehmen; mit Auflagen,Erwartungen, während sie gewisse Rechte undMöglichkeiten den beitretenden Ländern nichtgewährt, das heißt, dass zeitweise die Einstellungeine ziemlich einseitige ist. Ich bin ein Anhängerdessen, dass eine Kultur selbstbewusst sein soll,dass sie die Verantwortung dafür, dass sie in ver-gangenen Zeiten anders war, übernimmt, was sieschlecht gemacht hat, daraus soll sie lernen. Aller-dings haben die ungarische und die anderen ost-und ostmitteleuropäischen Kulturen Traditionen,von denen andere etwas lernen können. Dasheißt, einerseits müssen wir viel von den westli-chen, demokratischen Traditionen übernehmen,andererseits müssten wir allerdings die Repräsen-tation unserer eigenen Kultur steigern und unsdarauf konzentrieren, was wir von dem, was unseigen ist, der EU geben können.“
Thomas Várkonyi: „Wenn man die politischen Ver-hältnisse betrachtet, hat sich die Europäische Union bisjetzt nicht sehr in die ungarische Politik eingemischt, außerdass z.B. wirtschaftliche Mindeststandards für den Beitritt
verlangt wurden. Allerdings werden nach dem EU-Bei-tritt die in Ungarn leider schon als typisch bezeichenbarenSkandale, Verleumdungen, Geplänkel sicherlich einegrößere Aufmerksamkeit, vielleicht auch Einmischunghervorrufen. Wie ist die öffentliche Meinung dazu, dassdie Medien, nämlich sowohl die Fernsehstationen als auchdie Radiosender, Zeitungen und Zeitschriften, bekannter-maßen und allgegenwärtig zwischen „linken“ und „rech-ten“ Weltanschauungen gespalten sind?“
Gábor Kapitány: „In gewisser Hinsicht ist diesüberall auf der Welt der Fall, das ist keine ungari-sche Eigenheit. Es ist unzweifelhaft so, dass imZuge der letzten Wahlen im Jahr 2002, unter Mit-wirkung beider politischen Seiten, die Emotionensehr stark aufgewühlt worden sind, sodass siebereits in der Nähe der Polithysterie anzusiedelnsind. Aber einerseits kann man auch das nicht alsfür die Natur der ungarischen Gesellschafttypisch bezeichnen, andererseits wird das auchvon der Mehrheit der Bevölkerung nichtgeschätzt. Die Mehrheit ist zum Zeitpunkt dieserWahlen wirklich in diese Sackgasse gekommenund hat sich dem einen oder anderen Lager ange-schlossen, aber trotz allem hat die überwiegendeMehrheit der Menschen genug von dieser emo-tionalen Polarisation und ist im Allgemeinendafür nicht mehr zu haben. Es ist auch als unga-rische kulturelle Tradition bezeichenbar, dass dieungarische Gesellschaft nie extremen Positionenanhing, diese hatten immer nur kurzfristig einenNährboden, aber sobald sich die Aufregunggelegt hat, hat nie eine extreme Form die Mehr-heit bekommen. Die ungarische Gesellschaft undGeschichte hat im Übrigen, teils aus geopoliti-schen Gründen, teils als Folge der ungeschicktenungarischen Selbstdarstellung, eine schlechterePresse, als sich aus dem tatsächlichen Wissen her-leiten ließe. Außerdem verstärkt die politischePolarisation künstlich eine wirklich existierendekulturelle Polarisation. Diese kulturelle Polarisati-on hat, wie überall auf der Welt, gesellschafts-strukturelle Gründe. So wie sich zum Beispiel inEngland die Tory-Whig-, beziehungsweise späterTory-Labour-Spaltung, herausgebildet hat, exi-stieren auch in anderen Ländern Europas die Polekonservativ-christdemokratisch und sozialdemo-kratisch, die nicht nur Unterschiede in der politi-schen Anschauung, sondern in vielen Fällen auchunterschiedliche Paradigmen, Wertordnungenund Geschmacksrichtungen bedeuten. Und indiesen Ländern ist auch ziemlich gut voraus-sagbar, ob jemand sagen wir konservativ-bürger-liche oder radikal-linke Presseprodukte liest. Beiuns, und vielleicht kann man verallgemeinern,
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 21
m&z 2/2004
22
dass es im Osten Europas generell so ist, kommtallerdings zu den kulturellen Unterschieden, diedie Polarisation verursachen, noch ein weitererFaktor hinzu, der auch mit dem erwähnten West-europa-Anknüpfungskomplex zusammenhängt.Im 19. Jahrhundert erreichte die Modernisierungund Entwicklung des Bürgertums in zwei Wellendie ungarische Gesellschaft. Die erste Welle warder Versuch, auf der am Anfang des Jahrhundertsangekurbelten landwirtschaftlichen Konjunkturbasierend, den Adel und die Bauern zu verbür-gerlichen. In der ungarischen Geschichte heißtdiese Zeit das „Reformzeitalter“, da die adeligenLandtage mit Unterstützung der erwachendenbürgerlichen Presse und Literatur zahlreicheReformen in die Wege geleitet haben, mit derenHilfe sie die ungarische Gesellschaft an anderebürgerliche Gesellschaften der damaligen Zeitanzunähern versuchten. Diese Reformen ver-suchten auf die inneren Entwicklungen der unga-rischen Gesellschaft und auf die daraus organischerwachsenden Kapitalbildungen zu bauen, dieseTendenz wurde durch die Niederschlagung derRevolution und des Freiheitskampfes 1848/49gebrochen. Die zweite Welle fand Ende des 19.Jahrhunderts zu der auch in Ungarn so genannten„Gründerzeit“ durch das Hereinströmen interna-tionalen Industrie- und Bankkapitals statt. DieseModernisierungswelle hat als Basis ein sowohlvom internationalen Kapital als auch vom büro-kratischen Staatsapparat abhängiges, zu einemgroßen Teil nicht ursprünglich ungarisches, Bür-gertum. Diese zwei Modernisierungswellenbasierten also auf unterschiedlichen gesellschaft-lichen Gruppierungen, unterschiedlichen Strate-gien und Gesellschaftsbildern, man könnte sagen,dass sie unterschiedliche kulturelle Systeme umsich herum entstehen ließen. Obwohl im 20. Jahr-hundert die Entwicklung beider Wellen gebro-chen wurde, wirkten die im 19. Jahrhundert auf-geworfenen Alternativen weiter. Die erste dieserAlternativen, der Versuch, auf die organisch ausder ungarischen Wirtschaft erwachsene Moderni-sierung aufzubauen, war die „népi“ (in etwa:volklich, nicht völkisch; Anm.) Bewegung, dochwurden deren Möglichkeiten (in erster Linie diebeginnende Verbürgerlichung der Bauern) nachdem Zweiten Weltkrieg durch den Staatssozialis-mus liquidiert. Der Staatssozialismus hat sich auf-grund seiner antikapitalistischen Ausrichtungauch der anderen Alternative, der „urbanen“Bewegung, entgegengesetzt. Im letzten Abschnittseiner Geschichte entdeckte dieser „Sozialismus“allerdings die Werte der „Gründerzeit“, in den70er und 80er Jahren haben sowohl Wirtschafts-
fachleute als auch Historiker versucht, diesenWeg der Verbürgerlichung und Modernisierungals „goldenes Zeitalter“ zu rehabilitieren. Dies istnicht zu trennen von jenem Prozess, in dem sichein Teil der sozialistischen Elite, wie von Orwellvorausgesagt, dem Weg des „kapitalistisch Wer-dens“ nach dem Modell des ausgehenden 19.Jahrhunderts, das heißt auf internationalemKapital und bürokratischem Staatsapparat basie-rend, genähert hat. Nach dem Systemwechselschien es, als ob wieder zwei Wege der Verbür-gerlichung offenstünden. Ziemlich viele began-nen in Verbindung mit dem Staat, aber auch offenfür internationale Verbindungen, mit der Verbür-gerlichung, das heißt auf die für den Spätsozialis-mus charakteristische Art und Weise. Darin istauch die Affinität nicht nur politisch, sondernauch kulturell zu dem, in erster Linie von den sogenannten „linken“ Parteien repräsentierten Ver-bürgerlichungs-Modell zu sehen. Gleichzeitig mitder Privatisierung ergaben sich auch Möglichkei-ten der Kapitalanhäufung, die aus den innerenEntwicklungen der ungarischen Wirtschafterwuchsen und in dieser Hinsicht eher der erstenWelle glichen, der des „Reformzeitalters“. Diesmotivierte andererseits die „Renaissance“ des„Reformzeitalters“ und hauptsächlich jene kultu-relle Zweiteilung, die den einen Teil der Gesell-schaft in Richtung internationale Kapitalinteres-sen (die „urbanen“), den anderen in Richtung aufinnere wirtschaftliche Kraftquellen hoffend, demTypus des Reformzeitalters entsprechend, treibt.Und diese hängen auch der jeweiligen Logik, denWertesystemen, Paradigmen und politischen Prä-ferenzen der zwei Seiten an. Diese Teilung wirdheute von der Politik verstärkt, fallweise werdengewisse symbolische Streitpunkte hervorgehobenund um mit Emotionen und Erregungen aufge-heizte Fälle herum aktiviert. Wenn man allerdingsdas ganze Land betrachtet, wäre offensichtlichoptimal, wenn der politische Wechsel zwischenRepräsentanten dieser zwei Modelle möglichstreibungslos funktionieren würde. Diese zweialternativen Modelle werden jedenfalls miteinan-der in Konkurrenz und Widerstreit stehen, aberman könnte anstreben, dass die bei Regierungs-wechseln zeitweilig eintretenden Präferenzwech-sel nicht die Vernichtung der Ergebnisse des aufdem anderen Weg Erreichten mit sich bringt.“
Thomas Várkonyi: „Zum Abschluss stellt sich nochdie Frage, welche Gebiete aus dem Dreieck Kommunika-tionswissenschaft, Geschichte und Anthropologie IhrerMeinung nach in Zukunft in Ungarn näher erforscht undbearbeitet werden sollten?“
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 22
m&z 2/2004
23
Gábor Kapitány: „Aus dem bis jetzt Gesagtenfolgt schon, dass meines Erachtens ein wichtigerPunkt ist, dass wir uns viel mehr über den innerenAufbau der ungarischen Kultur, ihrem Erbe, ihrerLogik, im Klaren sein müssen und dem, was diesim anthropologisch-historischen Verhältnisbedeutet. Ich halte die Erforschung dessen fürsehr wichtig und natürlich den Geschichtsunter-richt auch. In der letzten Zeit, und ich denke, dassdies eine weltweite Tendenz ist, hat die Qualitätdes Geschichtsunterrichtes nachgelassen, genau-so wie das Prestige der Geschichte als Fach. Vieledenken, dass immer nur die neuesten Trendswichtig sind. Wer allerdings nicht weiß und nichtversteht, welche Rolle die Vergangenheit in derKonstruktion der Gegenwart spielt, der kannseine Gegenwart nicht in eine bessere Zukunftsteuern. Was nun die Medien betrifft, lässt sichsagen, dass, da die Medien die Massen mit ständigneuen Phänomenen bombardieren, es sehrwesentlich ist, diese jederzeit zu verfolgen und zuanalysieren und sich über ihre Bedeutung undihre Ursachen im Klaren zu sein. Offensichtlichhat der Kulturforscher auch jene Verantwortung,dass er den Menschen erklärt, womit sie konfron-tiert werden und da immer neue Formen erschei-nen, sind auch immer neue Erklärungen vonNöten. Es ist wichtig, dass die Rezipienten – undjede neue Generation, die durch die Mediensozialisiert wird – lernen, mit den Medien umzu-
gehen und zu erkennen, was ein neues Phänomenbedeutet, wie es manipuliert etc. Und man musssowohl die positiven als auch die negativen Seitendarlegen. Wenn wir nur die negativen Seiten her-vorheben, dann werden wir der immer komplexstrukturierten Realität und der immer komplexfunktionierenden Gesellschaft gegenüber nichtgerecht, und wir werden ähnlich weltfremd wiedie vorher erwähnten Apokalyptiker. Wenn wiraber jede neue Entwicklung, jedes neue Phäno-men mit der Einstellung annehmen, dass was neuist nur gut sein kann, oder dass was die Masse derBevölkerung will nicht wertlos sein kann, dannkönnen wir auch zu Apologeten ziemlich inhu-maner Entwicklungen werden. Um die beidenfehlerhaften Extreme zu vermeiden ist auch im21. Jahrhundert nicht auf eine moralische Grund-haltung zu verzichten. Als vielleicht wichtigstemoralische Frage unserer Zeit halte ich jene nachdem Schutz des von innen geleiteten, souveränenIndividuums und überhaupt die nach der Rele-vanz der Ethik. Und weiters das Aufzeigen, wiegesellschaftliche Prozesse, darunter die Wirkungder Medien, auf den Menschen und auf dieGestaltung der gesellschaftlichen Moral, wirken.Und unter Moral, das ist vielleicht aus dem bisherGesagten klar geworden, verstehe ich ganz undgar nicht eine moralisierende oder belehrendeGrundhaltung, sondern den Schutz der Kulturund der menschlichen Persönlichkeit.“
Gábor KAPITÁNY (1948)Abschlüsse an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität ELTE in Budapest1972 (Ungarische Sprache und Literatur) und 1973 (Psychologie). Tätigkeit am Buda-pester Institut für Bildungsforschung, nach dessen Auflösung 1992 am soziologischenForschungsinstitut der ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1973 Hochzeit mitÁgnes Kapitány, geb. Gál, mit der er seitdem gemeinsam forscht und publiziert. Ihrgemeinsames Gebiet ist erst die Wertesoziologie, dann die Kulturanthropologie. Seit1983 sind sie habilitiert. Sie haben sechzehn Bücher und mehr als hundert Artikel veröf-fentlicht, unter anderem zu folgenden Themenbereichen: Wertesysteme, Motivations-forschung, kulturelle Interaktionen, Symbole des alltäglichen Lebens, Gegenstandssym-bolik, Nationalsymbolik etc. Sie unterrichten und haben unterrichtet an folgenden Uni-versitäten: ELTE, BME, Universität Miskolc, Károli Gáspár reformierte Universität, Uni-versität für Industriekunst etc. Sie betreiben mehrere Forschungswerkstätten, seit Jah-ren nehmen sie auch an einem unter österreichischer Leitung stehenden Forschungs-projekt teil. Sie sind Mitglieder zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen, so auchdes Semiotikausschusses der Akademie der Wissenschaften. Gábor Kapitány ist seit derGründung der ungarischen Gesellschaft für Kulturanthropologie deren Vizepräsident.Außerdem betätigt er sich literarisch, 2002 ist ein umfangreicher Roman erschienen.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 23
24
m&z 2/2004
Nach mehr als fünfzehn Jahren der Transfor-mation und der Transformationsforschung
bieten die Staaten des ehemaligen Ostblocks einsehr unterschiedliches Bild. Die VorzeigestaatenPolen und Tschechien haben es fast geschafft undsind seit Mai Teil der Europäischen Union. Dasehemalige Machtzentrum, die Russische Födera-tion, kämpft noch immer mit seiner Größe, sei-nen Oligarchen und verfolgt weiterhin eine nachwestlichem Geschmack wenig demokratischePolitik der harten Hand. Andere Staaten, die inihren Transformationsbestrebungen nur schlep-pend vorankommen, darunter vor allem die mit-telasiatischen Staaten, gelten als „consolidatingauthoritarian rules“ oder „failed states“1. Die vorallem von Politologen geführten Untersuchungendieser Prozesse bestanden zunächst aus einerSammlung empirischer Daten, die in einer Artdichten Beschreibung zusammengefasst und ver-glichen wurden. Auf dieser ersten empirischen Basis versuchteman dann auch theoretische Annahmen zu for-mulieren. Dass sich so eine Vielzahl von Wissen-schaftlern dies zur Aufgabe machte, lag wohlauch wesentlich daran, dass die deutsche Wieder-vereinigung Teil der Transformationen jener Zeitwar. Eins jedoch kann direkt zu Beginn festge-stellt werden: Die Transformationstheorie gibt esnicht.Es wird daher im Folgenden darum gehen, dieDefizite und Perspektiven der Transformations-forschung im Allgemeinen und für die Kommu-nikations- und Medienwissenschaft im Speziellenherauszuarbeiten.2 Auf Basis der erkannten Defi-
zite sollen perspektivisch in einer Art theoreti-scher und empirischer Skizze Möglichkeiten zurumfassenden Untersuchung der Transforma-tionsprozesse aus kommunikationswissenschaft-licher Sicht erarbeitet, vor- und zur Diskussiongestellt werden.
Transformationsforschung
Um den Forschungsstand zur Transformation zuumreißen ist es unabdingbar, den Blick auf diePolitikwissenschaft und die Soziologie zu richten.Beide Disziplinen beschäftigten sich sehr frühmit dem Problem der Transformation und brach-ten sowohl theoretische als auch empirischeErgebnisse zum Vorschein.3 Die theoretischeDiskussion4 stützte sich einerseits auf vorhande-ne makrotheoretische Gesellschaftstheorien,etwa die Modernisierungstheorie Parsons oderdie Luhmann’sche Systemtheorie. Parsons Theo-rieentwurf erwies sich jedoch als zu starr für dievon Rückschlägen geprägten Transformations-prozesse. Nachbesserungen, wie sie maßgeblichvon Zapf mit der „weitergehenden Modernisie-rung“5 vorgenommen wurden, stellten diesbezüg-lich eine Verbesserung dar, konnten der Moderni-sierungstheorie jedoch nicht zum Durchbruchverhelfen. Die funktional-strukturelle System-theorie, wie sie maßgeblich Niklas Luhmannprägte, stellte sich als offener heraus. Das geneti-sche Erklärungsdefizit jedoch, dass sich wesent-lich durch die Unmöglichkeit der ganzheitlichenErfassung von Akteuren innerhalb der Theorieergibt, konnte mit ihrer Hilfe auch nicht gelöst
1 Introduction. In: Monroe E. Price/BeataRozumilowicz/Stefaan G. Verhulst (Hrsg.): Media Reform.Democratizing the media, democratizing the state. London &New York 2002, S. 1-7, hier S. 6.
2 Seit dem Sommersemester 2003 ist die Transformation der„Medien“ Thema eines Forschungscolloquiums amLehrstuhl für Historische und SystematischeKommunikationswissenschaft der Universität Leipzigunter der Leitung von Prof. Dr. Arnulf Kutsch. FürAnregungen, die aus dieser kritischen Auseinandersetzungmit bestehenden theoretischen und empirischenErgebnissen entstanden, danke ich allen Beteiligten.
3 Für die Politikwissenschaft vgl. etwa Klaus von Beyme:Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt/Main 1994. Oder:
Jakob Juchler: Osteuropa im Umbruch. Politische, wirtschaftlicheund gesellschaftliche Entwicklungen 1989-1993. Gesamtüberblickund Fallstudien. Zürich 1994. In der Soziologie etwa dieDiskussionen in den Ausgaben des Berliner Journals fürSoziologie 1993/1994.
4 Für einen ausgiebigen Überblick vorherrschenderTransformationstheorien vgl. Raj Kollmorgen: Suche nachTheorien der Transformation. In: Berliner Journal für Soziologie, 4.Jg. (1991), Nr. 3, S. 381-399.
5 Zur näheren Erläuterung und Diskussion vgl.: RolfReißig: Transformation – Theoretisch-konzeptionelle Ansätze,Erklärungen und Interpretationen. In: BISS public, 4. Jg. (1994),Nr. 15, S. 5-43, hier S. 16ff.
KommunikationswissenschaftlicheTransformationsforschung, quo vadis? Eine theoretische und empirische Skizze
Stefan Jarolimek
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 24
25
m&z 2/2004
werden. Damit soll nicht die „Vertreibung desMenschen aus dem Paradies der Systemtheorie“6
nachgebetet, sondern vielmehr dem UmstandRechnung getragen werden, dass Akteure in ein-zelne Rollen aufgeteilt und somit Verbindungen,die über diese Akteure und damit auch über Rol-lengrenzen hinweg funktionieren, nicht beobach-tet werden (können). Dieses Defizit stellten auch all jene heraus, dieinnerhalb der theoretischen Diskussionen für dieBevorzugung der Akteurs- und Handlungstheo-rien plädierten. Den Akteur als zentrales Unter-suchungskriterium benannten auch die US-ameri-kanischen Forscher, etwa um O’Donnell, Schmit-ter und Przeworski7, die sich bereits vor den Ent-wicklungen in Ost- und Mittelosteuropa mit denTransformationen in Lateinamerika beschäftig-ten. Die Betonung der Tatsache, dass die Verän-derungen in den betreffenden Staaten durchAkteure bzw. deren Handlung hervorgerufenwurden, klingt zunächst logisch, lässt jedoch weit-gehend offen, inwieweit diese dabei von Vorga-ben der Gesellschaft beeinflusst worden sind.
In diese konträr geführte Diskussion aufge-nommen wurden auch integrative Ansätze, wie
etwa von dem Kultursoziologen Jürgen Ger-hards8, der ausgehend von einem Vorschlag UweSchimanks9 dafür plädiert, die mikro- und makro-theoretischen Ansätze zu kombinieren. „Das Ver-bindungstheorem von System- und Akteurstheo-rie läßt sich dann folgendermaßen formulieren:Akteure wählen innerhalb der durch Systeme auf-gespannten ‚constraints‘, durch die abstrakteZiele substantiell vorgegeben und Mittel zurErreichung der Ziele definiert sind, diejenigenHandlungen, die ihre spezifischen Ziele mit demgeringsten Aufwand erreichbar machen.“10 Aufdiese Weise werden die jeweiligen Defizite derEinzeltheorien behoben. „Ohne eine solche
komplexe Theoriekombination läuft die soziolo-gische Analyse [...] an den Realitäten“11 vorbei.Sehr ausführlich diskutierte Raj Kollmorgen dieverschiedenen Theorieansätze innerhalb derSoziologie. In seiner Kritik betrachtet er nicht nurdie system-, akteurs- und handlungstheoretischenHerangehensweisen, sondern widmet sich dezi-diert den vielfältigen integrativen Theorieansät-zen. Auf die Frage nach der „richtigen“ Trans-formationstheorie gibt aber auch er keine Ant-wort, sondern konstatiert am Ende:
„Wie sich Gesellschaften reproduzieren und entwickeln(werden) ist nicht allein ein Problem des Postsozialis-mus ... und alles andere als akademische Taschenspie-lerei. Schöne Aussichten? Die praktischen und theore-tischen Gemengelagen verweigern einfach Antwor-ten.“ 12
Jedoch soll an dieser Stelle eine Einschätzung sei-ner Analyse transformationstheoretischer Über-legungen aufgegriffen werden. Er empfiehlt für„eine nähere Statuierung“13 die Vorschläge vonHans-Peter Müller und Michael Schmid14. Dieseplädieren innerhalb ihrer dreistufigen Erklärungs-logik des sozialen Wandels als letzten Schritt füreine „historisch-empirische Transformations-theorie“, die empirisch kontrolliert die Verände-rungen und Entwicklungen rekonstruieren soll.Und weiter: „[E]ine Transformationstheorie geht in der Regelvon einer (zumeist normativ) festgelegten Ent-wicklungsrichtung, von einer raum-zeitlichenSpezifizierung des Entwicklungsverlaufs und voneinem konkret identifizierbaren Ensemble vonInstitutionen, Akteuren und Umwelten aus. [...]Eine Transformationstheorie wird dabei nichtumhin können, sowohl die Bezugsgesellschaft alsauch den Untersuchungszeitraum exakt zu defi-nieren, um einesteils konkrete Wandlungsbarrie-
6 Helmut Willke: Fußnoten zur großen Konfusion. In: Ethik undSozialwissenschaften, 11. Jg. (2000), Nr. 2, S. 284-287, hier S.284.
7 vgl. etwa Guillermo O’Donnell/Philippe C.Schmitter/Laurence Whitehead (Hrsg.): Transitions fromAuthoritarian Rule. Comparative Perspectives. Baltimore &London 1991. Oder: Adam Przeworski: Spiel mit Einsatz.Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika, Osteuropa undanderswo. In: Transit, 1. Jg. (1990), Nr. 1, S. 190-211.
8 Jürgen Gerhards: Politische Öffentlichkeit. Ein system- undakteurstheoretischer Bestimmungsversuch. In: FriedhelmNeidhardt (Hrsg.): Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, sozialeBewegungen. Opladen 1994, S. 77-105.
9 Uwe Schimank: Der mangelnde Akteurbezug systemtheoretischerErklärungen gesellschaftlicher Differenzierung – EinDiskussionsvorschlag. In: Zeitschrift für Soziologie, 14. Jg. (1985),Nr. 6, S. 421-434.
10 Gerhards, Politische Öffentlichkeit, S. 81.
11 Uwe Schimank/J. Weyer: Der Untergang des Staatssozialismus:Vergangenheits- und zukunftsorientierte Herausforderungen an diesoziologische Gesellschaftstheorie. Referat auf dem 27. Kongreß derDeutschen Gesellschaft für Soziologie in Halle/Saale (Abstract).In: Sahner/ Schwendtner (Hrsg.): Gesellschaften im Umbruch.Abstract-Band des Kongresses, o.O. 1995, o.S., zit. nach RajKollmorgen: Schöne Aussichten? Eine Kritik integrativerTransformationstheorien. In: Raj Kollmorgen/RolfReißig/Johannes Weiß (Hrsg.): Sozialer Wandel und Akteurein Ostdeutschland. Empirische Befunde und theoretische Ansätze.Opladen 1996, S. 281-331, hier S. 299.
12 Kollmorgen, Schöne Aussichten?, S. 324.13 ebd., S. 286.14 Hans-Peter Müller/Michael Schmid: Paradigm Lost? Von der
Theorie sozialen Wandels zur Theorie dynamischer Systeme. In:Hans-Peter Müller/Michael Schmid (Hrsg.): SozialerWandel. Modellbildung und theoretische Ansätze.Frankfurt/Main 1995, S. 9-55.
>>
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 25
26
m&z 2/2004
15 ebd., S. 37ff.16 ebd., S. 39.17 Kollmorgen, Schöne Aussichten?, S. 287, Hervorhebung S.J.18 Wolfgang Merkel: Struktur oder Akteur; System oder Handlung:
Gibt es einen Königsweg in der sozialwissenschaftlichenTransformationsforschung? In: Wolfgang Merkel (Hrsg.):Systemwechsel 1. Theorie, Ansätze und Konzeptionen. Opladen
1994, S. 303-331, hier S. 325f, Hervorhebung im Original.19 Barbara Thomaß: Kommunikationswissenschaftliche Über-
legungen zur Rolle der Medien in Transformationsgesellschaften. In:Barbara Thomaß/Michaela Tzankoff (Hrsg.): Medien undTransformation in Osteuropa. Wiesbaden 2001, S. 39-64.
20 vgl. Thomaß/Tzankoff, Medien und Transformation inOsteuropa.
ren und Entwicklungshindernisse rechtzeitigerkennen zu können, andererseits aber auch ziel-dienliche Prozesse und Mechanismen zu identifi-zieren, wozu unausweichlich auf die vorgelager-ten Modelle und theoretischen Kenntnissezurückgegriffen werden muß. In diesem Zusam-menhang wird sie unterschiedliche Transformati-onsrythmen einzelner gesellschaftlicher Sektorenwie Wirtschaft, Politik und Kultur ebenso einbe-ziehen wie die vorhandene Konfiguration vonInstitutionen unddie Machtverhält-nisse zwischenden Akteuren.“15
Damit wird eineTransformations-theorie nicht mehrden möglicher-weise gewünschten Allgemeinheitsgrad und -anspruch besitzen, jedoch trotzdem auf dieModell- und Theoriebildung angewiesen sein.Denn es gelte auch für die aktuelle Transformati-onsforschung, dass „die untersuchte gesellschaft-liche Umgestaltung weder mit ähnlichen Vorgän-gen verglichen noch angemessen zeitdiagnostischbewertet werden kann“16. Kollmorgen resümiert:„Mir scheint diese Statuierung von ‚historisch-empi-rischen Transformationstheorien‘ auch für den postso-zialistischen Gegenstand nicht nur schlechthinangemessen, sondern darüber hinaus geeignet,eine ‚Meßlatte‘ für weitere Diskussionen transfor-mationstheoretischer Ansätze darzustellen.“17
Auch aus der kommunikationswissenschaftlichenSichtweise scheint der Einschlag dieser histo-risch-empirischen Betrachtung, die auch maßgeb-lich auf die Besonderheiten des jeweiligen Trans-formationsstaates eingeht, sinnvoll. Deshalb solldieser Gedanke in dem weiter unten skizziertenTheorieansatz und auch im Hinblick auf dieempirische Umsetzung bedacht werden. Und noch einmal die Frage: „Gibt es einenKönigsweg in der Transformationsforschung?Mit Sicherheit nicht den, der sich exklusiv an denAxiomen, Theoremen und Reduktionen einersoziologischen Großtheorie alleine orientiert. [...]Ein Ansatz zur Systemwechselforschung, derfunktionale Teilsystemlogiken, systemische Legi-
timationserfordernisse, Sozial- und Machtstruk-turen, Institutionen sowie den internationalenKontext als jeweils zu konkretisierende con-straints für das strategische Handeln politischerAkteure begreift, vermag die Logik und denAblauf von Systemwechseln angemessener zuentschlüsseln als Ansätze, die auf eine einzigeTheorie verpflichtet werden.“18
Der Hinweis auf die Kombination von soziologi-schen Großtheorien bzw. auf die Erarbeitung
integrativer Ansätze und die Erfas-sung der Strukturen, Institutionenetc. als constraints ist sicherlich nichtnur relevant und zweckmäßig für dieUntersuchung der politischen Akteu-re und der Transformation des politi-schen Systems. Deshalb wird im Wei-teren der Versuch unternommen,
diese Empfehlung auch für die kommunikations-wissenschaftliche Erforschung der Transforma-tionsprozesse weiterzudenken.
Kommunikations-wissenschaftliche Transformationsforschung
Diese Diskussion wurde auch in der Kommu-nikations- und Medienwissenschaft ver-
folgt. Hinsichtlich der Frage, welche Theorie oderob ein integrativer Ansatz zu befürworten sei,gelangt sie zum gleichen Ergebnis: „Ähnlich wiein der Transformationsforschung ist offenbar dieRolle der Medien auch aus kommunikationswis-senschaftlicher Sicht am ergiebigsten mit einerkombinierten Herangehensweise aus akteurs-und systemtheoretisch orientierter Betrachtungs-weise, die die Analyse struktureller Bedingungenberücksichtigt, zu bestimmen.“19
Innerhalb der Kommunikations- und Medienwis-senschaft liegen jedoch weit weniger Forschungs-ansätze zur Transformation vor als in denerwähnten Nachbardisziplinen. Um so erfreuli-cher ist daher der Versuch von Barbara Thomaßund Michaela Tzankoff, in einem Sammelbandnicht nur die theoretische Diskussion aufzuarbei-ten, sondern auch Fallstudien zu ausgewähltenLändern zu präsentieren.20 Anhand dieses Bandeswird aber auch deutlich, mit welchen Problemen
Eine Transformationstheoriewird nicht umhin können,sowohl die Bezugsgesellschaftals auch den Untersuchungs-zeitraum exakt zu definieren.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 26
27
m&z 2/2004
und Defiziten sich die kommunikationswissen-schaftliche Transformationsforschung konfron-tiert sieht. Zwar diskutiert Tzankoff ausführlichdie Forschungsbestrebungen der Nachbardiszi-plinen. Und Thomaß versucht, in ihren kommu-nikationswissenschaftlichen Überlegungen dieErgebnisse der vorangegangenen Diskussionenauf die Kommunikations- und Medienwissen-schaft zu übertragen, lässt bei diesem Unterfan-gen jedoch weitgehend offen, wie der Untersu-chungsgegenstand zu definieren sei und wie des-sen systematische und umfassende Untersuchungumzusetzen wäre. Thomaß und Tzankoff stellenam Ende des Bandes fest, dass „die Transforma-tionsprozesse in Osteuropa nicht ohne Medienvonstatten gegangen [sind], also auch nicht ohnesie zu erklären. Wie deren Rolle theoretisch zukonzipieren ist, dafür sollten in der Studie ersteHinweise gegeben werden. Sie auszuarbeiten undvor allem entsprechende empirische Untersu-chungen dazu anzuregen, wird die Aufgabe vonhoffentlich vielen nachfolgenden Forschungensein.“21 Die von den Autorinnen gehegten Hoff-nungen sollen nicht enttäuscht und daher ihrebemerkenswerte Vorarbeit kritisch begutachtetund fortgeführt werden.
Zum Gegenstand: Massenmedien, Publizistik?Öffentlichkeit!
Die von Thomaß aufgenommene Diskussionsystemtheoretischer Ansätze hinsichtlich
eines Systems Publizistik22, Massenmedien23
reflektiert leider nicht die neueren systemtheore-tischen Ansätze24. Diese erscheinen jedoch geradein Anbetracht der vorliegenden Defizite hilfreich.So stellen Alexander Görke und MatthiasKohring die Frage, was denn der Untersuchungs-gegenstand der Kommunikations- und Medien-wissenschaft25 ist und gelangen in ihren Theorie-entwürfen26 zu einem relativ einheitlichen Ergeb-nis. Beide konzipieren ein Funktionssystem
Öffentlichkeit, dessen wichtigstes Teilsystem derJournalismus sei. Gemeinsam wenden sie sich ineinem „Abschied ohne Tränen“27 demonstrativvon den Begriffen der (Massen-)Medien und(Massen-)Kommunikation ab und formulierenals These, dass das gesuchte System im „Span-nungsfeld von Journalismus- und Öffentlichkeits-forschung zu verorten“28 sei. Kohring kommt zudem Schluss, dass „in einer funktional ausdiffe-renzierten Gesellschaft die Beobachtungen vonEreignissen für die Ausbildung wechselseitigergesellschaftlicher Umwelterwartungen durch eineigenes Funktionssystem übernommen wird.Dieses Funktionssystem bezeichnen wir alsÖffentlichkeit.“29 Mit Hilfe dieser neueren Ansät-ze kann nicht nur der Untersuchungsgegenstandfür die kommunikationswissenschaftliche Trans-formationsforschung präzisiert werden, alsoÖffentlichkeit, öffentliche Kommunikation bzw.der Journalismus als Leistungssystem der Öffent-lichkeit, sondern es können auch weitere Fort-schritte in Richtung einer Definition für dieTransformation im „Medienbereich“ erwartetwerden.
Transformation von Öffentlichkeit: Beginn und Ziel?
Die Theorieentwürfe von Kohring und Görkebeziehen sich nicht auf Transformationsereignis-se, sondern bestimmen den Status der Öffent-lichkeit in einer ausdifferenzierten Gesellschaft.Wenn aber das (gleichwohl normative) Ziel derTransformation im politischen System in derAusbildung eines demokratischen Systems liegt,und in der Ökonomie in der Ausbildung einesWirtschaftssystems, das durch den Markt regu-liert wird, so kann man für den Medienbereichfesthalten: Das Ziel dieses Transformationspro-zesses ist die Ausdifferenzierung einer pluralisti-schen Öffentlichkeit. Dabei muss jedoch immerkritisch hinterfragt werden, wer diese idealisti-
21 Barbara Thomaß/Michaela Tzankoff: Medien undTransformation in den postkommunistischen Staaten Osteuropas.In: Thomaß/Tzankoff, Medien und Transformation inOsteuropa, S. 235-252, hier S. 251.
22 mit Bezug auf Frank Marcinkowski: Publizistik alsautopoietisches System. Politik, und Massenmedien. Einesystemtheoretische Analyse. Opladen 1993.
23 mit Bezug auf Niklas Luhmann: Die Realität derMassenmedien. 2., erweiterte Auflage, Opladen 1996.
24 Alexander Görke/Matthias Kohring: Unterschiede, dieUnterschiede machen: Neuere Theorieentwürfe zu Publizistik,Massenmedien und Journalismus. In: Publizistik, 41. Jg. (1996),Nr. 1, S. 15-31. Oder: Armin Scholl/Siegfried
Weischenberg (Hrsg.): Journalismus in der Gesellschaft. Theorie,Methodologie und Empirie. Opladen 1998, S. 63ff (Kap. 3).
25 Alexander Görke/Matthias Kohring: Worüber reden wir?Vom Nutzen systemtheoretischen Denkens für diePublizistikwissenschaft. In: Medien Journal, 21. Jg. (1997), Nr.1, S. 3-14.
26 Matthias Kohring: Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus.Ein systemtheoretischer Entwurf. Opladen 1997 bzw.Alexander Görke: Risikojournalismus und Risikogesellschaft.Sondierung und Theorieentwurf. Opladen & Wiesbaden 1999.
27 Görke/Kohring,Worüber reden wir?, S. 10.28 ebd., S. 13.29 Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 243.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 27
schen Ziele festlegt. Einerseits ist hier die „west-liche“ Sicht verwurzelt. Die ehemaligen Ost-blockstaaten sollen das Niveau der westlichenNachbarländer erreichen. Andererseits sind dieszweifelsohne die Ziele der aufkeimenden „CivilSociety“ zu Beginn des Transformationsprozes-ses. Ob die Transformationsländer diese in späte-ren Phasen immer noch verfolgen, ist fragwürdig. Als Anfangspunkt dieses Prozesses muss manwohl den gelenkten Journalismus begreifen, derals Subsystem des politischen Apparats fungierte.In welchen Phasen bzw. Stufen sich dieser Pro-zess vollzog, muss erst noch erforscht werden.Festhalten kann man jedoch, dass sich bei dieserTransformation von der kommunistischen zurpluralistischen Gesellschaftsform, die Codierungder Öffentlichkeit/des Journalismus von soziali-stisch vs. nicht-sozialistisch30 zu umweltrelevant vs. nicht-umweltrelevant bzw. mehrsystemzugehörig vs. nicht-mehrsystemzugehörig31 wandelte. Damit einher gehtauch die Veränderung des journalistischen Pro-gramms, also der Entscheidungskriterien für dieAuswahl der Ereignisse in der öffentlichen Dis-kussion. Diese Veränderungen verdienen jedocheine ausführlichere Erörterung, die an dieser Stel-le nicht gegeben werden kann.
Vorgehensweise: Defizite undVorschläge
Hinsichtlich der Berichterstattung muss kon-statiert werden, dass in den vorliegenden
Fallstudien kaum Bestrebungen zur Erforschungder Inhalte bestehen. Dies lenkt den Blick auf dieFrage, wie systematisch und umfassend dieTransformation eines wie auch immer geartetenMedienbereichs bislang untersucht wurde. InAnbetracht der vorliegenden Ergebnisse32 kannman übergreifend festhalten, dass bestimmte Ele-mente immer wiederkehren. So beinhalten fastalle Studien Informationen über die Veränderun-gen der medienrechtlichen Grundlagen und der
Medienökonomie. Auch die Lage der Journalistenwird vielfach bewertet. Andere Teilbereiche blei-ben jedoch außen vor. Die Methodik der Untersuchung bleibt weitge-hend unklar. Am Beispiel des von Tzankoff undThomaß herausgegebenen Sammelbandes lässtsich dies anschaulich zeigen. Einerseits werdendie theoretischen Erkenntnisse zur Transformati-on zusammengetragen, referiert, die Übertragungauf die Kommunikations- und Medienwissen-schaft versucht und die Perspektive einer sowohlmakro- als auch mikrotheoretischen Vorgehens-weise favorisiert. Andererseits kehren die system-und akteurstheoretischen Begrifflichkeiten in denFallstudien nicht wieder. Auch wird in vielen Fäl-len nicht deutlich, worauf der Schwerpunktgelegt wurde und warum welche Akteure ausge-wählt wurden. Mit viel gutem Willen kann mandie Beschreibung der rechtlichen und ökonomi-schen Rahmenbedingungen als makrotheoreti-sche und die Erfassung der Entscheidungen eini-ger Akteure als mikrotheoretische Sichtweise ver-buchen. Zu fragen bleibt dann jedoch: Wozubenötigt man die aufwändig geführte theoretischeDiskussion? Für die Umsetzung der theoretischen Grundlagewerden folglich Kriterien notwendig, die esermöglichen, die theoretischen Erkenntnissedanach auch als Variablen zu operationalisierenund empirisch zu überprüfen. Ganz wesentlicherscheint dabei der Hinweis Ulrich Sarcinellis, dervier Kriterien aufstellt, an denen sich die „Poli-tikvermittlung in der Demokratie auch heutemessen lassen muß“33. Da der Fokus der Trans-formationsforschung sehr stark auf den politi-schen Prozessen liegt, gelten diese Kriterien zwei-felsohne auch für die pluralistische Öffentlichkeitbzw. die journalistische Berichterstattung allge-mein. Als erstes Kriterium nennt er die Zugangs-pluralität und -offenheit. Dahinter verbirgt sich dieVorstellung, dass in einem demokratischenSystem der Zugang zu Informationen nicht
28
m&z 2/2004
30 Zur Konzeption von Öffentlichkeit im sozialistischenSystem vgl. Detlef Pollack: Das Ende einer Organisations-gesellschaft. Systemtheoretische Überlegungen zum gesellschaftlichenUmbruch in der DDR. In: Zeitschrift für Soziologie, 19. Jg.(1990), Nr. 4, S. 292-307. Und Ray Rühle: Die Entstehungpolitischer Öffentlichkeit in der DDR am Beispiel von Leipzig. In:Stefanie Averbeck/Klaus Beck/Arnulf Kutsch (Hrsg.):Großbothener Vorträge zur Kommunikationswissenschaft IV.Bremen 2003, S. 9-30.
31 Kohring plädiert für das generalisierte Kommunikations-medium Mehrsystemzugehörigkeit, während Hug andieser Stelle den Begriff der Umweltrelevanz festmacht. Ineiner gemeinsamen Publikation merken die Autorenjedoch an, dass es sich dabei lediglich um einen „relativunbedeutenden semantischen Unterschied“ handele. (vgl.
Matthias Kohring/Detlef M. Hug: Öffentlichkeit undJournalismus. Zur Notwendigkeit der Beobachtung gesellschaftlicherInterdependenz – Ein systemtheoretischer Entwurf. In: MedienJournal, 21. Jg. (1997), Nr. 1, S. 15-33, hier S. 22, Anm. 4.)Der Begriff der Mehrsystemzugehörigkeit ist jedoch m. E.zu favorisieren, da sowohl der Begriff der Relevanz beiHug als auch der der Aktualität bei Görke gleichzeitig auchTeile des journalistischen Programms bezeichnen.
32 vgl. etwa aus dem Sammelband von Thomaß/Tzankoff,Medien und Transformation in Osteuropa.
33 Ulrich Sarcinelli: Politikvermittlung und Demokratie: ZumWandel der politischen Kommunikationskultur. In: UlrichSarcinelli (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in derMediengesellschaft. Bonn 1998, S. 11-23, hier S. 12.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 28
exklusiv sein darf und sich diese auch aus einerVielzahl von Quellen speisen müssen. Als näch-stes führt Sarcinelli die Richtungspolitische Pluralitätan, worunter er eine Vielfalt politischerRichtungstendenzen versteht. Als drittes Kriteri-um benennt er die Pluralität von Komplexitätsgraden.Dadurch soll gewährleistet werden, dass durchverschiedene Komplexitätsgrade verschiedeneAdressatengruppen und Teilöffentlichkeitenerreicht werden können. Als letztes Kriteriumnennt Sarcinelli die Kommunikative Rückkopplung.In einem demokratischen System dürfe keine ein-seitig gerichtete Elite-Bürger-Kommunikationvorherrschen. Vielmehr müsse es auch für Inter-essengruppen möglich sein, ihre Belange zu kom-munizieren. Diese Basisrückkopplung ist nichtnur Zeichen für eine Gesellschaft mit unter-schiedlichen Interessen, sondern auch dafür, dassdie Bürger an der öffentlichen Kommunikationpartizipieren. Dieser normative Bezugsrahmenkann für die (zumindest politische) Berichterstat-tung angelegt werden. In einer späteren Opera-tionalisierung wird es notwendig sein, diese Kri-terien so einzugrenzen, dass eine Überprüfunganhand vorliegender medialer Angebote möglichist. So muss im Vorfeld einer Untersuchunggeklärt werden, wann beispielsweise Richtungs-politische Pluralität erreicht ist. Sind dazu zweiunterschiedliche Standpunkte etwa in zwei ver-schiedenen Zeitungen notwendig, oder dasAbwägen der Standpunkte innerhalb eines Arti-kels? Die Kriterien Sarcinellis sind sicherlich hilf-reich, um in Zukunft zu Dimensionen bzw. Eva-luationen zu gelangen, die Auskunft über die Plu-ralität des öffentlichen Systems geben. Wenn man, wie hier geschehen, die theoretischenVorüberlegungen von Thomaß weiterführt unddie neueren Theorieentwürfe der Kommunikati-ons- und Medienwissenschaft mit einbezieht undsich damit auf ein System Öffentlichkeit miteinem Subsystem Journalismus als Untersu-chungsgegenstand verständigt, könnte manzumindest für das Leistungssystem Journalismusein Modell bzw. eine weitere Systematik zu Rateziehen. Siegfried Weischenberg erfasst in seinenKontexten des Journalismus alle relevanten Aspektedes journalistischen Systems.34 In den äußerenSchalen erfasst es sowohl den Normen- als auchden Strukturkontext, also die rechtlichen Rahmen-bedingungen, ethische und moralische Standards
sowie rechtliche, politische, ökonomische undorganisatorische Imperative. Im Kern erfasst dasModell den Rollenkontext und somit die journali-stischen Akteure, ihr Selbstverständnis, Profes-sionalisierung etc. Dazwischen siedelt Wei-schenberg in seinem Modell den Funktionskontextan, worunter er vor allem die Berichterstattungsubsumiert. Diese Modell erfasst somit alle kom-munikationswissenschaftlich relevanten Aspekte,die zur Untersuchung des Journalismus vonNöten sind. Darüber hinaus lässt sich daraus eineSystematik ableiten, die durchaus zur Untersu-chung der Transformationsprozesse geeignet ist.Bei den Vorschlägen zur empirischen Umsetzungwird noch einmal dezidiert Bezug auf diesesModell genommen.
Im Weiteren wird hauptsächlich auf das Leis-tungssystem Journalismus Bezug genommen.
Natürlich existieren noch weitere Systeme inner-halb der Öffentlichkeit, etwa Public Relations.35
Mit Bezug auf die neueren theoretischen Ent-würfe und in Anbetracht der Veränderungenscheint der Journalismus am greifbarsten im Hin-blick auf eine empirische Umsetzung. Das Funk-tionssystem Öffentlichkeit soll dabei nicht ver-nachlässigt, sondern anhand eines Teilbereicheseine umfassende Untersuchung gewährleistetwerden. Als Zwischenresümee lässt sich Folgen-des festhalten: Die theoretische Auseinanderset-zung mit den Fragen des Transformationsprozes-ses orientiert sich bislang weitgehend an denErgebnissen der Politikwissenschaft und derSoziologie. Ähnlich wie in diesen Disziplinenwird auch in der Kommunikations- und Medien-wissenschaft eine Kombination von mikro- undmakrotheoretischer Sichtweise favorisiert. DerUntersuchungsgegenstand blieb dabei indiffe-rent. Mit Bezug auf neuere systemtheoretischeAnsätze kann man die Transformation des„Medienbereichs“ als den Wandel des Journalis-mus vom Subsystem eines vorherrschenden poli-tischen Systems zum Leistungssystem innerhalbeines ausdifferenzierten FunktionssystemsÖffentlichkeit bzw. als die Entstehung eineseigenständigen Systems Öffentlichkeit begreifen.Die Kriterien zur Vielfalt von Sarcinelli gebenweitere Hinweise darauf, welche Merkmale in derjournalistischen Berichterstattung als wichtigsteLeistung innerhalb der öffentlichen Kommunika-
29
m&z 2/2004
34 Siegfried Weischenberg: Journalistik. Theorie und Praxisaktueller Medienkommunikation. Band1: Mediensysteme, Medien-ethik, Medieninstitutionen. 2., überarbeitete und aktualisierteAuflage. Opladen & Wiesbaden 1998, S. 69-71.
35 vgl. etwa Stefan Jarolimek: Ist PR öffentliche Kommunikation?Eine systemtheoretischer Entwurf zum Verhältnis von PublicRelations und Journalismus. (unveröffentlichte Magisterarbeit)Jena 2001.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 29
30
m&z 2/2004
tion zu betrachten sind. Mit Hilfe der Kontextedes Journalismus von Weischenberg gelangen wirzu einer umfassenden Systematik der Untersu-chung der Transformationsprozesse innerhalbder Öffentlichkeit.
Neue Wege? Von der Theorie zu Empirie
Die empirische Erfassung der Transforma-tionsprozesse verlief bislang weitgehend
unsystematisch und nicht theoriegeleitet. Jedochmuss auch hier wieder darauf hingewiesen wer-den: „Theorieloses Beobachten ist wie Wäsche-klammernzählen – sinnlos.“36 Dabei werdensicherlich keine neuen Wege betreten, sondern eswird lediglich der Versuch unternommen, altbe-kannte Methoden sinnvoll innerhalb eines syste-matischen Zugangs zu kombinieren. Um eineoptimale Verbindung dieser Ebenen herzustellenund die Verquickung der einzelnen Akteure inihrem Umfeld aufzuzeigen und zu erklären, wärees sicherlich zweckdienlich, das statistische Ver-fahren der Mehrebenenanalyse37 anzustreben, dasbislang hauptsächlich in der Erziehungswissen-schaft Anwendung fand. Da es sich jedoch beider Untersuchung der Transformationsprozessenicht um einzelne Schulen, Schulklassen undSchüler handelt, sondern um Akteure, die in ver-schiedenen Organisationen gleichzeitig agierenkönnen, und es sich damit bei der Transformati-onsforschung um ein weitaus offeneres Feld han-delt, scheidet dieses Verfahren aus. Gleichwohlsoll aber ein Mehrmethodendesign angestrebtwerden, um die vielfältigen Entwicklungen undVeränderungen offen zu legen. Eine statistischeBerechnung der Zusammenhänge etwa vongesetzlichen Veränderungen, der Berichterstat-tung und der Professionalisierung der Journali-sten – soviel sei schon zuvor angemerkt – kanndamit nicht erreicht werden. Der Journalismus als vielleicht wichtigstes Leis-tungssystem der Öffentlichkeit soll stellvertre-tend für alle Formen öffentlicher Kommunikati-on untersucht werden, ohne jedoch andere Ele-mente der Öffentlichkeit gänzlich auszublenden.Mit Bezug auf das Modell der Kontexte des Jour-nalismus von Weischenberg können alle relevan-ten Aspekte des Medienbereichs im Transforma-
tionsprozess untersucht werden. Für die einzel-nen Schalen bzw. ihre Merkmale sollen Vorschlä-ge hinsichtlich der Methode und der Operationa-lisierung gemacht werden. Die äußerste Schalebezeichnet – wie oben schon erwähnt – den Nor-menkontext. Dieser umfasst die gesellschaftlichenRahmenbedingungen, die historischen und recht-lichen Grundlagen, die Kommunikationspolitiksowie professionelle und ethische Standards. Inder Untersuchung dieses Teilbereichs sollzunächst eine Überblick der Geschehnisse imTransformationsprozess grob umrissen werden,um auch spätere Ergebnisse einordnen zu kön-nen. Im Weiteren gilt es, vor allem die medien-rechtlichen Veränderungen nachzuvollziehen. Inder Dokumentenanalyse stehen dabei vor allemfolgende Fragen im Vordergrund: Ist die Mei-nungsfreiheit in der Verfassung verankert? Wel-che Rechte werden dabei jedem Bürger zugesi-chert? Wird der Zugang zu Informationen gere-gelt? Speziell auf den Bereich der Medien bezo-gen muss herausgearbeitet werden, ob eineMediengesetzgebung besteht und wie dieseinhaltlich zu evaluieren ist. Ebenfalls als Bestand-teile des Normenkontextes sind ethische und mora-lische Standards zu untersuchen. Existieren Jour-nalistenverbände in dem betreffenden Staat? Gibtes einen Moralkodex oder eine Berufsethik? Obund wie diese eingehalten werden und wie dieJournalisten damit umgehen, muss im Rahmender Untersuchung des Rollenkontextes erforschtwerden.Die nächste Ebene bezeichnet den Strukturkon-text. Mit diesem sind alle Zwänge, also politische,organisatorische und vor allem wirtschaftlicheRestriktionen gemeint, welche die tägliche Arbeitim journalistischen System beeinflussen. Da fürdie westlichen Mediensysteme vielfach von einer„Kommerzialisierung“38 gesprochen wird, sollauch hier die wirtschaftliche Komponente her-vorgehoben werden. Zu fragen ist nach der Orga-nisation der Medienbetriebe oder möglichenAbhängigkeitsverhältnissen der Redaktionen vomStaat bzw. staatsnahen Betrieben. Bei Staaten miteinem hohen Anteil ausländischer Investoren,beispielsweise Polen, Tschechien oder Bulgarien,gilt es, diese Verbindungen offen zu legen bzw.mögliche Folgen für die journalistischen Akteureund ihre Produkte auszuloten. Aber auch politi-
36 Beatrice Dernbach: Darf ’s noch ein bißchen Theorie sein? In:Public Relations Forum, 4. Jg. (1998), Nr. 4, S. 198-200, hierS. 198.
37 vgl. etwa Hartmut Ditton: Mehrebenenanalyse. Grundlagen undAnwendungen des Hierarchisch Linearen Modells. Weinheim &
München 1998.38 vgl. etwa Klaus-Dieter Altmeppen/Martin Löffelholz:
Zwischen Verlautbarungsorgan und „vierter Gewalt“. In:Sarcinelli, Politikvermittlung und Demokratie in derMediengesellschaft, S. 97-123, hier S. 115.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 30
31
m&z 2/2004
sche Imperative müssen in dieser Strukturanalyseberücksichtigt werden, um etwa die Einflussnah-me der Regierung auf Rundfunkräte oder Ein-griffe in die tägliche Redaktionsarbeit qua Dekretaufzuzeigen. Dabei werden die politischen Impe-rative „hier meist indirekt – in ökonomischenoder organisatorischen Zusammenhängen –wirksam“39. Alles in allem verfolgt die Betrach-tung des Normen- und Strukturkontextes kein quan-titatives Erhebungsverfahren. Das Modell Wei-schenbergs bietet in dieser Hinsicht eine Hilfe-stellung, um relevante Aspekte der Öffentlichkeitbzw. des Journalismus zu erfassen. Die Analysedieser beiden Ebenen soll einen Überblick überdie Rahmenbedingungen leisten. Systemtheore-tisch gesprochen geht es dabei vor allem um jenegesellschaftlichen Systeme, deren Kommunika-tionen nicht der Öffentlichkeit zugeordnet wer-den können, aber gleichwohl Ein-fluss auf die Öffentlichkeit neh-men. Kurz: Die Ergebnisse derAnalyse des Normen- und Struk-turkontextes bilden einen Großteilder Restriktionen, der constraints fürdie Akteure der Öffentlichkeit. In den beiden inneren Schalen, denRollen- und Funktionskontexten, geht es folglich umdie Akteure, die ihr Handeln (etwa die Berichter-stattung) an diesen Restriktionen ausrichten.Diese Ebenen sind in einer kommunikationswis-senschaftlichen Betrachtung maßgeblich für dieTransformationsprozesse. Der Funktionskontextumfasst die „Leistungen und Wirkungen desSystems Journalismus“40, also das Feld derMedienaussagen. Dieser Bereich wurde bislangweitgehend vernachlässigt. Doch gerade dieBerichterstattung informiert das Publikum überdas aktuelle Geschehen, und nur wenige könnentatsächlich an den politischen Verhandlungen,Gesetzesentscheidungen etc. partizipieren. Gera-de für die entstehende „Zivilgesellschaft“41 ist dieBerichterstattung unerlässlich. Um die Verände-rungen der Berichterstattung nachzuvollziehen,wird hier eine quantitative und qualitative Inhalts-analyse vorgeschlagen. Dass diese empirischeVorgehensweise bislang nicht häufiger realisiertwurde, verwundert umso mehr, denn die „Kom-munikationswissenschaft ist sozusagen die Wis-
senschaft, die Inhaltsanalysen kultiviert und auchweiterentwickelt hat“.42 Aber vielleicht ist dies nurein weiteres Indiz dafür, dass sich die kommuni-kationswissenschaftliche Transformationsfor-schung bislang zu stark am politologischen Vor-gehen orientiert.
Mit der Methode der Inhaltsanalyse kann ge-zeigt werden, wie sich die Berichterstattung
im Verlauf der Transformation veränderte. Kon-kret geht es darum, wie sich rechtliche, politischeoder wirtschaftliche Restriktionen und deren Ver-änderungen auf die Medieninhalte auswirktenbzw. die Kriterien der Vielfalt verwirklicht wur-den. Natürlich können bei einem Untersuchungs-zeitraum von etwa 15-18 Jahren, wenn man dieersten Proteste seit Mitte der achtziger Jahre desvergangenen Jahrhunderts mit berücksichtigt,
nicht alle journalisti-schen Produkteeiner Inhaltsanalyseunterzogen werden.Aus forschungsöko-nomischen Grün-den und aus Grün-den der Praktikabi-
lität muss daher eine zeitliche, thematische undproduktionstechnische Auswahl getroffen wer-den. Eine Vollerhebung scheidet aus heutigerSicht aus. Die produktionstechnische und zeitli-che Auswahl ist abhängig vom jeweiligen Staat,der untersucht werden soll. Das heißt, es gilt zuentscheiden, ob und welche publizistischenAngebote untersucht werden: Fernsehen, Radio,Presse oder Internet, bzw. welche Sender oderTitel erforscht werden.43 Bezüglich der zeitlichenAuswahl wird hier der Vorschlag unterbreitet,kleinere Zeiträume von Umbruchphasen zubetrachten. Um Veränderungen vor und nacheinem Bruch oder einem herausragenden Ereig-nis (etwa erste Präsidentschaftswahlen) messenzu können, sollten diese Zeiträume aber auchnicht zu kurz gewählt werden. Um die danachimmer noch riesige Menge an Material bewältigenzu können, empfiehlt es sich eine weitere zeitlicheAuswahl zu treffen, etwa mit Hilfe so genannterkünstlicher Wochen. Die thematische Stichprobeist im Gegensatz zu den beiden ersten nicht von
39 Weischenberg, Journalistik, S. 69.40 ebd.41 Die Bedeutung der so genannten „Zivilgesellschaft“ als
einer der wesentlichen Faktoren im Transformations-prozess wird allenthalben hervorgehoben, wenngleichbisher kaum definiert wurde, aus welchen Personen oderGruppen sich diese „Civil Society“ zusammensetzt.
42 Hans-Bernd Brosius/Friederike Koschel: Methoden derempirischen Kommunikationsforschung. Eine Einführung.Wiesbaden 2001, S. 156.
43 Bei dieser Auswahl sind auch publizistische Angebote zuberücksichtigen, die u. U. unregelmäßig oder nur ingeringer Auflage erscheinen, gleichwohl aber einen großenEinfluss auf die Transformationsprozesse haben können.
Mit der Methode der Inhalts-analyse kann gezeigt werden,wie sich die Berichterstattungim Verlauf der Transformationveränderte.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 31
32
m&z 2/2004
dem jeweiligen zu untersuchenden Staat, sondernvom kommunikationswissenschaftlichen For-schungsinteresse, abhängig. Dabei stehen zweigroße thematische Blöcke im Vordergrund. ZumEinen ist dies die politische Berichterstattung, dadie Entwicklung des Journalismus als Teil despolitischen Systems zum Leistungssystem derausdifferenzierten Öffentlichkeit nachgezeichnetwerden soll. Zum Anderen soll eine Art Selbstre-ferenz beobachtet werden. Denn es gehört zurCharakteristik eines ausdifferenzierten Öffent-lichkeitssystems, dass es sich auch selbst beob-achten kann bzw. beobachtet und über solcheEreignisse kommuniziert.
Die quantitative Analyse kann im Rahmenihrer Möglichkeiten zunächst einmal Ent-
wicklungen und Veränderungen des Umfangsund der journalistischen Genres innerhalb derBerichterstattung erfassen. Bei der Genreeintei-lung bleibt zu bemerken, dass die gängigen deut-schen Darstellungsformen nur bedingt auf diefremden Kulturkreise zu übertragen sind. Jedochlassen sich mit diesen ersten Ergebnissen Aussa-gen darüber treffen, wie sich der Umfang und dieArt etwa der politischen Berichterstattung verän-derte. Mit Hilfe so genannter semantischer Diffe-rentiale können erste Aussagen darüber getroffenwerden, wie kritisch, d. h. wie positiv oder nega-tiv, ein Ereignis bewertet wird. Diese ersten quan-titativen Ergebnisse sagen zunächst recht wenigüber die Qualität der Berichterstattung aus. Des-halb soll der quantitativen eine qualitative Inhalts-analyse folgen, die ausgewählte Artikel näheruntersucht. Dabei können beispielsweise Artikelzu ähnlichen politischen oder selbstreferentiellenEreignissen ausgewählt und verglichen werden.Diese Untersuchung muss sowohl zeitnahe Ver-gleiche innerhalb verschiedener Medienerzeug-nisse als auch die Veränderungen vor und nachUmbrüchen bzw. zwischen den Phasen beinhal-ten. Die Anzahl der untersuchten Artikel richtetsich dabei selbstredend nach der zur Verfügungstehenden Ressource Zeit. Eine kritische Mengeist noch zu bestimmen.Die unterste Ebene im Modell Weischenbergs bil-det der Rollenkontext. Folglich geht es hier umdie Medienakteure, ihre demographischen Merk-male, soziale und politische Einstellungen, dasRollenselbstverständnis und Publikumsimagesowie ihre Professionalisierung und Sozialisation.Hierzu drängt sich die Untersuchung mittelsInterviews auf. Da bislang kaum derart systemati-sche Studien zur Transformationsforschung undsomit Forschungsergebnisse vorliegen, empfiehlt
es sich, auf ein standardisiertes Verfahren zu ver-zichten. Statt dessen ist das qualitative Verfahrendes Leitfadeninterviews sinnvoll, um imGespräch auftauchende Fragestellungen mit ein-zubeziehen. Im Gegensatz zu bisherigen Unter-suchungen soll die Auswahl der Akteure begrün-det werden. Es ist für die Untersuchungsanlageund im Sinne einer umfassenden Herangehens-weise erstrebenswert, die Akteure systematischauszuwählen. Demnach sind also Vertreter vonverschiedenen journalistischen Redaktionen vonInteresse. Ebenso Politiker, die maßgeblich anVeränderungen etwa der Mediengesetzgebungbeteiligt waren/sind und Vertreter von NGOs(z.B. Internews) bzw. anderer einflussreicherOrganisationen (z.B. OSZE). Die Fragen kon-zentrieren sich neben den oben erwähnten per-sönlichen Daten weitgehend auf die Beurteilungder Situation der Medien im Land bzw. auf dieEinschätzung der Berichterstattung. Außerdemist es von Interesse, wie die verschiedenen SeitenRestriktionen beurteilen, um zu erfahren, wie sieihre tägliche Arbeit daran ausrichten und wie sieihr Selbstbild definieren. Mögliche Ergebnissekönnten beantworten, welche Akteure welcheInteressen vertreten, und wie sich ihr Handeln anden vorgegebenen Restriktionen orientiert. Eingenauer Fragenkatalog muss noch erarbeitet werden und sich auch an den historischen Ge-gebenheiten des entsprechenden Staates orien-tieren.
Fazit
Die hier unterbreiteten Vorschläge stellensicherlich nicht das non plus ultra der
zukünftigen Transformationsforschung dar undsind im Detail, dessen ist sich der Autor gewiss,auch recht vage. Mit dieser ersten Skizze solljedoch die Diskussion um eine historisch-syste-matische Auseinandersetzung mit den Prozessender Transformation vorangetrieben werden.Nach fünfzehn Jahren hat die Kommunikations-und Medienwissenschaft noch keine probatenund systematischen Mittel zur Erforschung diesesUntersuchungsgegenstandes vorlegen können, istsie sich doch bis dato sogar über den Untersu-chungsgegenstand selbst unklar. Mit den hier aus-geführten theoretischen Überlegungen wurdeversucht, einige der vorherrschenden Defiziteaufzuarbeiten und Vorschläge für die empirischeUntersuchung zu unterbreiten. Die wichtigstenErgebnisse und skizzierten Vorschläge finden inder folgenden Abbildung eine zusammenfassen-de Darstellung.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 32
33
m&z 2/2004
Öffentlichkeit, Schwerpunkt auf Journalismus
Übergang von Journalismus als Verlautbarungsorgan des „Supersystems“ Politik (vgl. Pollack bzw. Rühle [s. Anm. 30]) zum wichtigsten Leistungs-system des Funktionssystems Öffentlichkeit (vgl. Kohring bzw. Görke [s. Anm. 26]).
Untersuchungskontexte(in Anlehnung an Weischenberg,Journalistik, siehe Anm. 34)
Normenkontext
Strukturkontext
Funktionskontext
Rollenkontext
Abb. 1: Zusammenfassende Darstellung zur Untersuchung der Transformation des Journalismus.
Quellen
Gesetze, Dekrete,Ukase, Moralkodex
Politische Beschlüsse
Hilfeleistungen, etwavon ausländischenNGOs oder Regierungen (ExterneFaktoren)
Ökonomische Faktoren:Jahresberichte bzw.Ergebnisse vorhandenerUntersuchungen zurÖkonomie
Journalistische Berichterstattung (TV, Hörfunk, Presse,Internet)
Journalisten, Politiker,Vertreter von relevan-ten NGOs bzw. der„Civil Society“
Empirische Methode
Dokumentenanalyse
Dokumentenanalyse
Sekundäranalyse
Inhaltsanalyse (quanti-tativ und qualitativ)
Stichprobe: produk-tionstechnisch, zeitlich(länderbezogen) undthematisch (politischeund selbstreferentielleBerichterstattung)
Schwerpunkt: Verände-rung der Berichterstat-tung, vor allem hin-sichtlich der Kriteriender Vielfalt (vgl. Sarci-nelli, Politikvermittlungund Demokratie in derMediengesellschaft,siehe Anm. 33)
Interviews (qualitativ)
Theoretischer System- und Akteursbezug
Restriktionen, vor allemder Teilsysteme Politik,Recht und Wirtschaftfür die Akteure derÖffentlichkeit
Handeln der Akteure
Untersuchungs-gegenstand
Transformation als
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 33
m&z 2/2004
34
Ausblick
Die hier vorgestellte theoretische und empiri-sche Skizze verfolgt ein hochgestecktes
Ziel: eine theoriegeleitete, umfassende und syste-matische Erforschung der Transformationspro-zesse aus kommunikationswissenschaftlicherSicht. Die Umsetzung benötigt nicht nur vielZeit, sondern darüber hinaus Kenntnisse imUmgang mit komplexen Theorien, Methodenund eine weitreichende Sprachkompetenz, um
auch Bedeutungsnuancen etwa in der Berichter-stattung oder der Gesetzgebung einschätzen zukönnen. Doch nur auf diesem Wege und mit dendaraus gewonnenen Erkenntnissen wird es mög-lich sein, ein Modell der Transformation zu ent-wickeln, das diese Prozesse nicht nur deskriptiverfasst, sondern die Rolle der „Medien“ im Trans-formationsprozess erklärt. Kommunikationswis-senschaftliche Transformationsforschung, quovadis? Der vorliegende Beitrag skizziert einenWeg.
Stefan JAROLIMEKM.A., Studium der Medienwissenschaft, Ostslawistik und Interkulturellen Wirtschafts-kommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Studienaufenthalte an derStaatlichen Weißrussischen Universität Minsk. Er promoviert zum Thema „Öffentlichkeitim Wandel. Die Transformation des Journalismus in Belarus“ am Lehrstuhl fürHistorische und Systematische Kommunikationswissenschaft der Universität Leipzig.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 34
Während des 17. und 18. Jahrhunderts warenZeitungen, wie es Kurt Koszyk definiert,
im Wesentlichen staatlich kontrollierte und beein-flusste Nachrichtenblätter mit einer „zielgerichte-ten Informationsstruktur“ sowie „Objekte derStaatsräson“1. Daher weist Jürgen Habermas demInteresse der Obrigkeiten, die sich die Presse baldzu „Zwecken der Verwaltung nutzbar machten“,eine größere Bedeutung für die regelmäßige Her-ausgabe vorliegender Nachrichtenmaterialien zuals den geschäftlichen Interessen von Druckernoder Verlegern2. Dieses obrigkeitliche Interesse,das sich gleichlaufend mit dem rasch wachsendenEinfluss der durch Zeitungsmeldungen vermittel-ten Kenntnisse von Vorgängen der „großenWelt“3 auf die damalige Öffentlichkeit4 zur nuan-cierten absolutistischen Kommunikationspolitik5
erweiterte, stellte gerade in Wien, der kaiserlichenResidenzstadt, die wichtigste Prämisse aller Zei-tungsgründungen zwischen 1671 und 1757 dar6.Dabei waren die Motive, die der Etablierungneuer Zeitungsunternehmungen zugrunde lagen,stets innen- oder außenpolitischer, repressiver7
oder repräsentativer8 Natur.Dem Umstand äußerer, von politischen Sachla-gen und -zwängen abhängiger Voraussetzungenvon Zeitungsgründungen ist daher auch bei derAnalyse jener Faktoren Rechnung zu tragen, diefür die Herausgabe der ersten tschechischsprachi-gen Zeitung Wiens im Jahre 1761 maßgebendgewesen sein konnten, insbesondere der spezifi-schen Wirksamkeit aktueller Staatsräson. Dane-ben soll freilich der Tatbestand nicht außer Achtgelassen werden, dass um die Mitte des 18. Jahr-
35
m&z 2/2004
„Ceské vídenské postovní noviny“Die erste tschechischsprachige Zeitung Wiens (1761)*
Wolfgang Duchkowitsch
* Dieser Beitrag ist eine geänderte Fassung des 1980 in denÖsterreichischen Ostheften erschienenen Aufsatzes:Wolfgang Duchkowitsch: Die erste tschechischsprachigeZeitung Wiens (1761). In: Österreichische Osthefte, Jg. 22(1980), S. 118-130.
1 Kurt Koszyk: Die Zeitung. 17. Jahrhundert bis zurGegenwart. In: Handbuch der Publizistik. Bd. 3. Berlin1969, S. 78.
2 Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit.Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichenGesellschaft. (= Sammlung Luchterhand, 25). 5. Aufl.Neuwied u. Berlin 1971. S. 33-34.
3 Vgl. Emil Dovifat: Allgemeine Publizistik. Berlin 1968, S.28.
4 Vgl. hiezu auch die wichtigen Aussagen Klingensteins zurambivalenten Funktion der Publizierung politischerAngelegenheiten. Grete Klingenstein: Staatsverwaltungund kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. Das Problemder Zensur in der Theresianischen Reform 1970. S. 153 u.154.
5 Unter absolutistischer Kommunikationspolitik wird hier,die Begriffsbestimmung Otto B. Roegeles und jene imdtv-Wörterbuch zur Publizistik resümierend, dieGesamtheit aller nach vorbestimmten Regeln ablaufendenMaßnahmen der absolutistischen Herrschaft verstanden,die in der Absicht gesetzt waren, die Vorgänge deröffentlichen Kommunikation im Sinne eigenerWertvorstellungen gegenüber anderen lnteressen normativzu beeinflussen.– Otto B. Roegele: Kommunikationspolitik.In: Publizistik. (=Fischer-Lexikon, 9). Hg. v. ElisabethNoelle-Neumann u. Winfried Schulz. Frankfurt a. M.1971, S. 76 u. 77; Kurt Koszyk/Karl H. Pruys (Hg.): dtv-Wörterbuch zur Publizistik. 2. verb. Aufl. München 1970,S. 186 u. 188.
6 In Wien wurden in dieser Zeit folgende Blätter gegründet:Il corriere ordinuio und Cursor ordinarius (1671),Post=täglicher Mercurius und Wienerisches Diarium (1703),
eine titelmäßig unbekannte französischsprachige Zeitung(1743) und Gazette de Vienne (1757).
7 Die Gründung der Blätter Il corriere ordinario und Cursorordinarius wurde von der NiederösterreichischenRegierung gefördert, in dem vergeblichen Bemühen, dieFlut der nicht von der Zensurbehörde erfassbaren,handschriftlich vervielfältigten Zeitungen, dersogenannten „Geschriebenen Zeitungen“ einzudämmen.Helmut W. Lang: Die deutschsprachigen Wiener Zeitungendes 17. Jahrhunderts. Phil. Diss. Wien 1972, S. 54.
8 Ein öffentlich ausgegebenes Versprechen der Regierung zuBeginn des 18. Jahrhunderts, also in der schweren Zeit desSpanischen Erbfolgekrieges, neue Zeitungsunternehmenbesonders zu begünstigen, führte zur Gründung desPost=täglichcn Mercurius und des Wienerischen Diariums. –Vgl. Österreichs Zeitschriften für 1819. In: LiterarischerAnzeiger 2, 1819. 17. Sp. 133.Die kurzfristige Phase einer Entspannungspolitik inmittender Auseinandersetzung zwischen Österreich undFrankreich um die österreichische Erbfolge hatte dieHerausgabe einiger weniger Nummern einerfranzösischsprachigen Zeitung in Wien im Jahre 1743 zurFolge. Vgl. dazu die redaktionellen Mitteilungen imWienerischen Diarium vom 19. Dezember 1742 und vom12. Jänner 1743. Zur außenpolitischen Situation vgl. MaxBraubach: Versailles und Wien von Ludwig XIV. bisKaunitz. (=Bonner historische Forschungen, 2). Bonn1952, S. 360-361 sowie Eugen Guglia: Maria Theresia.Bd. 1. München/Berlin 1917, S. 196-197.Die Gründung der nächsten französischsprachigenZeitung Wiens, der Gazette de Vienne im Jahre 1757, warwiederum von einer außenpolitischen Konstellationabhängig; sie entsprach dem tiefgreifenden Wandel despolitischen Kräfteverhältnisses nach Abschluss des„Renversement des alliances“ und fand daher in Kaunitzeinen starken Befürworter. HHStA, ÄltereZeremonialakten, 1757, Januar. fol. 4r-5r.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 35
hunderts eine große Anzahl von Tschechen inWien ansässig war9, somit also auch die Möglich-keit eines entsprechenden Rezipientenkreisesgegeben war und überdies die Kontakte der Wie-ner Bevölkerung mit Tschechen damals bereitsüber eine lange Tradition verfügten. Von Akti-vitäten tschechischer Kaufleute in Wien, die inden Gasthöfen „Bey dem Schabenrüssel“ und„Beym Praunen“ abzusteigen pflegten, berichtetnämlich schon Wolfgang Lazius in seinem 1546herausgegebenen Werk „Viennae Austriae“10. DieHandelstätigkeit dieser Kaufleute erstreckte sichvornehmlich auf den Export von Wein und denImport von Fischen, sonstigem Fleisch, Tuchwa-ren und Bier. Zwei Jahre später hieß es dann im„Lobspruch der Hochlöblichen weitberühmbtenKhünnigklichen Stat Wienn“, dass am Lugeck„böhmische“ Händler anzutreffen seien und dieFischmärkte mit Viktualien aus Böhmen undMähren versorgt würden11.Für die Zuwanderung von Tschechen nach Wienblieb diese sozioökonomische Kontaktzone aberbedeutungslos. Entscheidend waren vielmehrzwei wichtige politische Ereignisse zu Beginn des17. Jahrhunderts: die endgültige Verlegung derArchive und Ämter von Prag nach Wien im Jahre1619, die für Prag einen empfindlichen Geltungs-verlust nach sich zog, und die Schlacht amWeißen Berg, die dem tschechischen Volk die gei-stige Führerschicht nahm12.Die in den folgenden Jahrzehnten des 17. Jahr-hunderts stattgefundene Immigration von Tsche-chen nach Wien erscheint allerdings herrschafts-strukturell bedingt und gelenkt, wahrscheinlicheingeleitet von der „Heranziehung des bescheide-nen und arbeitsamen Tschechen“, wie es AdolfMais auf eine doch sehr kurze Formel bringt, „alsArbeiter und Diener in die Stadtsitze der einzel-
nen Herrschaften“13.Fundiertere Aussagen zur sozialen Struktur derzugewanderten Tschechen nach Wien ermögli-chen die Feiern zu den sogenannten Nationsfe-sten, die sich gegen Ende des 17. Jahrhundertsaus der Idee der Gegenreformation heraus ent-wickelt hatten. Die böhmischen Landesgenossenbegingen das Fest zu Ehren des Hl. Wenzel – dasNationsfest – und die mährischen Landesgenos-sen feierten ihre beiden Landespatrone Cyrill undMethod in der Michaeliskirche, nachweislich seit172814. Die Predigten bei diesen Anlässen wurdenzur Gänze in deutscher Sprache gehalten, und derBegriff des Patrioten wurde allein mit der betref-fenden Landeszugehörigkeit in Verbindunggebracht; mit einem Volksbegriff hatte er nochnichts gemein. Daher sind die Tschechen im 18.Jahrhundert weniger als solche, sondern zumeist„im Verband mit den Randdeutschen ihresRaumes als territorial zusammengehörige Lands-mannschaft zu erkennen“15.Vom Aufkommen einer rein tschechischsprachi-gen Gruppe in Wien kann erst nach der Mitte des18. Jahrhunderts die Rede sein. Aus dieser Zeitwird bereits ein reges Leben der Tschechen –sowohl beim Adel als auch in der breiten Bevöl-kerung – bezeugt16. Signifikant erscheint die Wei-sung, wonach Verlautbarungen im Gebiete derheutigen Wiener Gemeindebezirke Landstraßeund Wieden, in die damals die erste tschechischeEinwanderung begonnen haben soll, sowohl indeutscher als auch in tschechischer Sprache zubringen waren. Dafür steht weiters die Tatsache,dass um 1760 im Palais des Fürsten Kaunitz„hanakische Operetten“ aufgeführt wurden,wobei der tschechische Adel, wie Mais erwähnt,„noch gerne in böhmische und mährische Trach-ten schlüpfte, um Theater zu spielen“17. Dafür
36
m&z 2/2004
9 Tschechen waren vor allem in Bereichen des Handwerksund des Kleingewerbes vertreten. Vgl. Adolf Mais: Dastschechische Erbe Wiens. In: Die Österreichische Nation 13,1961, 4, S. 60. Diese Angabe lässt sich allerdings nichtnäher quantifizieren, da aus jener Zeit keine Ergebnissevon Volkszählungen vorliegen. Vgl. dazu auch MonikaGlettler, die sich ausführlich mit der Frage derZuwanderung und der Zahl von Tschechen in Wienauseinandersetzt und angibt, dass man erst seit etwa 1851damit begonnen hatte, über die Zahl der WienerTschechen Statistiken zu veröffentlichen. Danach warenz.B. im Jahre 1900 in Wien insgesamt 102.974 Tschechenregistriert. Monika Glettler: Die Wiener Tschechen um1900. (=Veröffentlichungen des Collegium Carolinum.28). München/Wien 1972, S. 27 u. 47.
10 Wolfgang Lazius: Historische Beschreibung der …Hauptstadt Wienn in Österreich anjetzo in unser teutscheSprache vertirt, mit etlichen Annotationibus … auch
anderen schönen Historien gemehret durch HeinrichAbermann. Wien 1619, Bd. 2. S. 83 und Bd. 3, S. 101.
11 Wolfgang Schmeltzl: Ein Lobspruch der Hochlöblichenweltberümbten Khünigklichen Stat Wienn in Österreich …beschrieben im 1548 Jar, zu den 3. mal versehen undgebessert. Wien 1849. Z. 335 u. Z. 864-880.
12 Vgl. Joseph Dobrowsky: Geschichte der Böhmischen Spracheund Litteratur. Prag 1792, S. 193. „Die Schlacht amweißen Berge 1620 lähmte und entkräftigte die ganzeböhmische Nation an Leib und Seele.“
13 Adolf Mais: Die Tschechen in Wien. In: WienerGeschichtsblätter 12, 1957, 3, S. 58.
14 Ebd. sowie Walter Schamschula: Die Anfänge dertschechischen Erneuerung und das deutsche Geistesleben(1740-1800). München 1973, S. 145.
17 Mais, Die Tschechen in Wien, S. 59.16 Ebd.17 Ebd.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 36
scheint letztlich noch das Faktum wertbar, dass ineben diese Zeit die Gründung der ersten Wienertschechischsprachigen Zeitung fällt.Die erste Nummer dieses Blattes erschien am 1.April 1761, die letzte am 27. Juni desselben Jah-res. Damit ist dieser Nachrichtenträger das Blattmit der zweitkürzesten Erscheinungsdauer allerin Wien produzierten Zeitungen von den Anfän-gen der Wiener periodischen Presse, 1621, bis zurMassenherstellung von Gazetten während derjosephinischen Ära18.Dennoch dürften die Gründe, weshalb den Českévídenské poštovní noviny (Tschechische Wiener Post-Zeitung) in der einschlägigen Literatur nur ineinem bescheidenen Ausmaß Aufmerksamkeitgeschenkt worden ist, weniger auf einer beab-sichtigten Vernachlässigung eines derart spezifi-schen Mediums aufgrund dessen geringenBestandsdauer beruhen, sondern vielmehr darinzu finden sein, dass bisher kein Bestandsnachweisgelingen konnte19.Von Gottfried Johann Dlabacz, der im Jahre 1803seine Aufarbeitung der böhmischen Literatur undSprache mit dem Aufsatz „Nachricht von den inböhmischer Sprache verfaßten und herausgege-benen Zeitungen“ um ein wichtiges Untersu-chungsfeld erweitert hat20, stammt der erste wis-senschaftliche Hinweis auf die Bedeutung unddie Funktion dieses Blattes. Die hiefür erforder-lich gewesenen Daten hatte ihm der Wiener Uni-versitätsprofessor Josef Valentin Zlobický, eingebürtiger Mährer, geliefert. Zlobický scheintdemnach in der damaligen Fachwelt der einzigeGewährsmann gewesen zu sein, der noch übereine geschlossene Sammlung der České vídensképoštovní noviny verfügte und daher auch in der Lagewar, authentische Auskünfte zu geben. Diesenentsprechend soll es eine der Hauptintentionendes Wiener tschechischsprachigen Blattes gewe-sen sein, „sowohl den in Österreich lebenden
Böhmen sich gefällig zu machen als auch derböhmischen Sprache außer Böhmen nach Kräf-ten zu steuern“21.Die nächste Notiz zu diesem Pressephänomenfindet sich in der Arbeit Jungmanns über dieGeschichte der tschechischen Literatur. Jung-mann bietet in seiner diesbezüglichen Anmer-kung allerdings eine Titelfassung an, die der Rea-lität nicht entspricht, jedoch als tradierteumgangssprachliche Kurzform ausgedeutet wer-den kann22. Auch in der zweiten Auflage seinesWerkes lautet die betreffende Eintragung unver-ändert: Denník Vídenský 23. Die Angaben zurErscheinungsdauer und der Vermerk, dass einMangel an Abnehmern zur Einstellung diesesBlattes geführt hat, stellen freilich keine Bereiche-rung des damaligen Wissensstandes dar, da diesebereits seit der Arbeit Dlabacz’ bekannt waren.Eine umfassendere Darstellung zur Geschichtedes ersten Wiener Blattes in tschechischer Spra-che bringt erst Josef Volf in seinem 1926 publi-zierten Artikel „Počátek českého novinárství ve Vídni“(Die Anfänge des tschechischen Pressewesens inWien)24. Volf geht von der bereits erwähntenbrieflichen Benachrichtigung des Gelehrten Dla-bacz durch Zlobicky aus, als deren Verwahrungs-ort er das „Literární Archiv Národního Musea“ inPrag ausweist. Bemerkenswerterweise erwähnt erdie durch Dlabacz erfolgte Auswertung jedochnicht, sondern begnügt sich mit einem kurzenRückblick auf die Persönlichkeit Zlobickys, dersich sowohl als Inhaber des ersten Lehrstuhls fürtschechische Sprache und Literatur an der Uni-versität Wien als auch als Sammler alter tschechi-scher Schriftwerke einen Namen in Fachkreisengeschaffen hatte. Wohl weist Volf darauf hin, daßsämtliche Nachforschungen über einen Besitz-nachweis der České vídenské poštovní noviny erfolglosgeblieben waren, doch engt er seine Literaturbe-sprechung auf die Eintragungen Jungmanns25
37
m&z 2/2004
18 Die Erscheinungsdauer des Blättchens Der aufrichtigePostkläpperbothe etwa währte vom 17.12.1783 bis zum3.1.1784.
19 Negativ blieben auch die im Rahmen des internationalenBibliotheksleihverkehrs vorgenommenen Anfragen. Selbstdie Deutsche Presseforschung in Bremen, der an dieserStelle für ihre freundliche Unterstützung gedankt sei,konnte nicht weiterhelfen.
20 Gottfried Johann Dlabacz: Nachricht von den inböhmischer Sprache verfaßten und herausgegebenenZeitungen. (=Abhandlungen der Königl. Böhm. Ges. d.Wiss., 3, 1, 2). Prag 1803, S. 27.
21 Ebd.; ob Zlobicky diese Zeitung als geschlosseneSammlung erworben oder während ihrer Herausgabelaufend bezogen hatte, lässt sich nicht ermitteln.
22 Josef Jungmann: Historie literatury české (Geschichte dertschechischen Literatur). Prag 1825, S. 375.
23 Ebd., 2. Aufl. Prag 1848, S. 275.24 Josef Volf: Počátek českého novinárstvní ve Vídni (Die Anfänge
des tschechischen Pressewesens in Wien). In: Dunaj 3,1925/26, 4/5, S. 135-136. Eine Kurzfassung diesesAufsatzes ist unter dem Titel Die erste tschechische ZeitungWiens. Eine Veröffentlichung der bisher unbekanntenVoranzeige, in der Prager Presse vom 25. September 1925abgedruckt.
25 Volf kannte anscheinend nur die zweite Auflage dieserArbeit; sein Zitat ist überdies unkorrekt, da sich diediesbezüglichen Angaben nicht auf der S. 354, wie es imRegister fälschlich heißt, sondern auf der S. 175 befinden.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 37
und auf die pressehistorischen DarstellungenZenkers26 ein, in denen dieses Blatt mit keinemeinzigen Wort gewürdigt wird27. Als sein wichtigesVerdienst bleibt freilich die wortwörtliche Präsen-tation des zweisprachig abgefassten, doppelseitigbedruckten Avertissements, mit dem der WienerDrucker Johann Leopold Kaliwoda am 3. März1761 die Herausgabe eines vollständigen Zei-tungsbogens „zum Eingang nächstkünftigenMonats dis Jahrs“ angekündigt hatte28.Diese Voranzeige, von der noch gesondert zusprechen sein wird, trug folgende Aufschriften:„An sammentliche der böhmischen Sprache kün-dige Landesgenossenschaft und alle sich in selberüben wollende Liebhaber“ bzw. „Na společnéčeské reči povědomé vlastenstvo a všechny v ní secvičiti chtějící milovníky“. Zum Standpunkt derObrigkeit gegenüber dem Plan, ein politischesBlatt herauszubringen, das in einer Sprache abge-fasst werden sollte, die in Wien zu dieser Zeitnicht sehr geläufig war, sowie zur damaligen poli-tischen und geistigen Situation als Randbedin-gung dieser Zeitungsgründung und schließlich zuden Bedingungen, die an das erwünschte Privileggebunden waren, weiß Volf nur wenig an aufhel-lenden Reflexionen anzubieten.Wichtige Einblicke gewähren indes Dokumente,die im Niederösterreichischen Landesarchiv ver-wahrt werden. Aus diesen ist zu ersehen, dassKaliwoda das alleinige Vorrecht auf den Druckund die Herausgabe eines in „böhmischer Spra-che“ abgefassten „Zeitungs-Bogen“ am 13.Dezember 1760 erhalten hatte. „Wir geruheten“ ,so wird in der Privilegsurkunde von Maria The-resia vermerkt,
„ihme, um pro bono publico allwochentlich einen inBöhmischer Sprache gedruckten Zeitungs=Bogen ausseiner Presse ausgeben zu dürfen, ein Privilegiumimpressorium auf 10 nacheinander folgende Jahreallermildest zu ertheilen.“ 29
Für welchen Zeitpunkt der Buchdrucker Kaliwo-da das Ersterscheinen seiner „post-täglichen“ –zweimal in der Woche erscheinenden – Zeitunggeplant hat, geht aus der Bewilligung der Landes-mutter nicht hervor. Da Kaliwodas Ansuchenselbst nicht erhalten scheint, ist auch nicht zuersehen, ob kaufmännische Überlegungen beidem Wunsch nach der Realisierung eines derarti-gen Projektes eine große Rolle gespielt haben.Ebensowenig ist auf Grund der im Niederöster-reichischen Landesarchiv verwahrten Quellen zuentscheiden, ob Kaliwoda zu einer der beideneinander konkurrenzierenden Gemeinschaften inPrag Verbindungen gepflogen hatte, wovon einevon böhmischem Landespatriotismus erfüllt warund die andere dem österreichischen Patriotismushuldigte. Desgleichen lässt sich schließlich nichtfeststellen, ob es bloß intensive Kontakte Kaliwo-das zu den in Wien ansässigen bzw. im Umfelddes Wiener Hofes agierenden Tschechen gewesenwaren, die seinen Plan zur Zeitungsgründungbefördert haben.Da zudem der Bildungsgang des 1705 in Wiengeborenen Kaliwoda im Dunkeln liegt, hat esganz den Anschein, als grenzten sich alle Aussa-gen über denkbare Beeinflussungen aufgrundmöglicher sozialer Beziehungen zu einzelnen Per-sönlichkeiten oder Gruppen, auch derjenigen,welche die historiographische und philologischePhase der tschechischen Erneuerungen getragenhaben, als Randbedingung der Zeitungsgründungselbst im Bereich der Spekulation ein30. Dass Kali-woda tschechischer Abstammung war31, gibtjedenfalls noch kein hinreichendes Motiv für dieGründung der České vídenské poštovní noviny ab.Ein dominanter Faktor für die Beurteilung unddas Verständnis, weshalb sich Kaliwoda gerade zuEnde des Jahres 1760 um das Privileg für denDruck und die Herausgabe einer in „böhmischer
38
m&z 2/2004
26 Ernst Victor Zenker: Geschichte der Journalistik inÖsterreich. Verf. aus Anlass der Weltausstellung 1900. Miteinem Vorw. v. Ferd. Saar. Wien 1900 und: Geschichte derWiener Journalistik von den Anfängen bis zum Jahre 1848.Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Mit einembibliogr. Anhang. Wien u. Leipzig 1892. – In demzitierten Artikel in der Prager Presse (siehe Anm. 24)polemisiert Volf: „Zenker hat einmal etwas höhnisch, wieich glaube, behauptet, Wien hätte im 18. Jahrhundert allemöglichen Zeitungen gehabt, nur die Tschechen wärennicht dabei gewesen.“
27 Die Behauptung Stelovskys, dieses Blatt sei sechsmal inder Woche herausgekommen, blieb somitunwidersprochen. Josef Stelovsky: Cys. Krl. WídenskeNowiny. In: Vidensky národní kalendár. 1090. Ve Vídni
1908, S. 83.28 Volf, Počátek českého novinárstvní ve Vídni, S. 134.29 Niederösterreichisches Landesarchiv, Hofresoluta in
Publicis, 1760. Dez.30 Bis zum dreiunddreißigsten Lebensjahr Kaliwodas sind
nur drei Daten bekannt: der Ankauf der BuchdruckereiWolfgang Schwendimanns am 21. Juni 1734, dieImmatrikulation als Buchdrucker an der Universität Wienvom 17. September desselben Jahres und die Ernennungzum Reichshofbuchdrucker im Jahre 1738. – AntonMayer: Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482-1882. Bd. 2.Wien 1887, S. 25-26.
31 Volf bemerkte in dem oben zitierten Aufsatz in der PragerPresse (siehe Anm. 24), dass seine Vorfahren „jedenfallstschechischen Ursprungs“ sind.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 38
Sprache“ abgefassten Zeitung beworben hat unddafür auf ein großes Entgegenkommen seitensder Obrigkeit gestoßen ist, erscheint allerdingsaus der am 14. Dezember 1760 erfolgten Grün-dung des Staatsrates32 ableitbar. Denn mit derInstallierung dieser Behörde wurde im Annähe-rungsprozess in der Verwaltung der böhmischenund österreichischen Länder, der mit Beginn desDritten Schlesischen Krieges eine kurze Unter-brechung erlitten hatte, eine bedeutende Wende-marke erreicht33.Dieser Prozess fand seinen Abschluss in der Ver-einigung der böhmischen und österreichischenHofkanzlei, mit der die „große Kaiserin“, wieFriedrich Walter schreibt, „die hemmendenstaatsrechtlichen Grenzen zwischen den Ländernder Wenzelskrone und den österreichischenErbländern aufzuheben“34 vermochte.Die Zielsetzung, die mit der Schaffung diesesStaatsapparates verfolgt werden sollte, bestanddarin, durch eine bessere Einrichtung der Verwal-tung die sozioökonomische Position des kriegs-bedingt erschöpften Österreichs zu heben35 unddie deutschösterreichischen Erbländer durch einneues Band fester miteinander zu verknüpfen.Der Staatsrat sollte nach dem ausdrücklichenWunsche Maria Theresias die Teile mit demGanzen verbinden36. Diese Intention mündete imJahre 1763 in den Erlass folgenden Dekrets:
„Liebe Getreue! Demnach wir bishero wahrgenom-men, wie sowohl in unserem Erb=KönigreichBöheimb als in dem Markgrafentumb Mähren die beidem größten Teil ihrer Landes=Inwohner üblicheböheimbische Sprache dermaßen in Abgang gerate,dass die meisten Vorsteher und Beambten derselbenganz unkündig, ja selbst bei unseren dasigen Lan-des= und oberen Justiz=Stellen ingleichen bei denenstädtischen Magistraten sich an dieser Sprache fähigenSubjectis ein großer Abmangel äußeret, mithin zurBeförderung unseres Dienstes, dann Aufrechterhal-tung der Ordnung und Justiz ohnumbgänglich nötigsein will, diese soweit verfallene Sprache wiederumbemporzubringen:Als ergehet unser gnädigster Befehl an Euch im
Lande kundzumachen, daß fürohin die Eltern ihreSöhne fleißiger in der böhmischen Sprache unterrichtenlassen, die Studien=Kommission aber durch denDirectorem humaniorum besonders darauf inviligirensolle, damit die Jugend in den kleineren Schulen zuÜbersetzung böhmischer Argumenten angewiesen undverhalten, folgsam diese Sprach möglichster Dingenwiederumb in rechten Gang gebracht und erhalten ...werden möge, worauf Ihr auch Eures Ortes festeHand zu halten und zu denen erledigtenDienst=Stellen ... keine andere als solche Subjecta,welche bömisch reden und schreiben, in Vorschlag zubringen habet.“ 37
Neben der politischen und sozialen Veränderung,die mit der Gründung des Staatsrates einherging– Elvert spricht vom Anbeginn einer „neuen Zeit,die die bürgerlichen Elemente hervorbrachte“38 –,ist somit die besondere Berücksichtigung dertschechischen Sprache im Sinne einer Optimie-rung der Kommunikation zwischen den staatli-chen Instanzen und dem einfachen Bürger alseine äußere Bedingung zu erkennen, die demWunsch nach einer in „böhmischer Sprache“gedruckten Zeitung entgegenkam. Denn dasTschechische galt unter den in der Monarchiegesprochenen slawischen Sprachen als die amweitesten fortgeschrittene, mit deren Hilfe manglaubte, sich auch mit den anderen im Habsbur-gerreich lebenden Slawen verständigen zu kön-nen39. Diese spezielle Bedachtnahme hatte sichschon einige Jahre vor dem Ansuchen Kaliwodashauptsächlich auf dem Unterrichts- bzw. Ausbil-dungssektor manifestiert: 1752 wurde Tsche-chisch an der Militärakademie in Wien und zweiJahre später an der Wiener Ingenieurakademieobligatorisch40. „Daß an den neugegründetenKriegsschulen nebst anderen auch die tschechi-sche Sprache“ gelehrt wurde, stellt für Volf sogarden unmittelbaren Anlaß für die Gründung derČeské vídenské poštovní noviny dar, wobei er sich aufdie Präambel des bereits erwähnten Avertisse-ments vom 3. März 1761 beruft41.Die Funktion, die diesen beiden Schuleinrichtun-
39
m&z 2/2004
32 Der Obersthofmeister Graf Ulfeld war angewiesenworden, die Einrichtung dieser Behörde durch einUmlaufschreiben bekannt zu geben. Publiziert wurde dieNachricht von der ersten Session am 28. Jänner 1761. –Wienerisches Diarium. Num. 8, Beil.
33 Carl Frh. v. Hock/Hermann Ignaz Bidermann: Derösterreichische Staatsrat (1760-1848). Wien 1879, S. 7.
34 Friedrich Walter: Fürst und Staat im Zeitalter des Barock.In: Österreich in Geschichte und Literatur 3, 1959, 4, S.187.
35 Christian d’Elvert: Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte, mit besonderer Rücksicht auf die böhmische
Länder. Brünn 1880, S. 381.36 Codex Austriacus. 6. Wien 1777, S. 115.37 Abgedruckt in: Raimund Kaindl: Der Völkerkampf und
Sprachenstreit in Böhmen im Spiegel der zeitgenössischenQuellen. Wien 1927, S. 33-34.
38 Elvert, Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte, S.504.
39 Schamschula, Die Anfänge der tschechischen Erneuerung, S.147.
40 Bertold Bretholz: Geschichte Böhmens und Mährens. Bd. 3.Reichenberg 1924, S. 200.
41 Volf, Die erste tschechischsprachigc Zeitung Wiens.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 39
gen zukommen sollte, zeigt sich sehr deutlich inder Einleitung des „Deutsch-böhmischen Natio-nallexikons“, ediert von Karl Tham im Jahre1788:
„Daß ein Begüterter . . . mit seinen Unterthanensprechen könne, erfordert wohl sein eigener Vortheil,da es sich leicht einsehen läßt, daß, wenn man sich aufeinen Dolmetsch verlassen muß, man nicht nur oft derBetrogene seyn, sondern auch unwissend Irrthümerbegehen könne.... Nach der Aussage der erfahrensten Offiziere wer-den diejenigen von dem gemeinen Manne, die mit ihmseine Sprache reden können, als seine Landsleute sogeliebt, daß er gerne sein eigenes, um das Leben seinesLandsmannes zu retten, in die Schanze schlägt.“ 42
Die Tatsache, dass im Schutzbrief, den MariaTheresia am 13. Dezember 1760 dem DruckerKaliwoda ausgestellt hat, die Sprachkonzeptionder zu gründenden Wiener Zeitung unmittelbarnach der einleitenden Bewilligungsformel alsArgument für die Gewährung des erbetenen Pri-vilegs steht, erklärt sich ebenfalls im Kontext mitden Konsequenzen, die aus der Schaffung desStaatsrates erwartet wurden, bzw. aus dem vonder Obrigkeit initiierten Kurs zur Intensivierungder tschechischen Sprachkenntnisse. Denn eshieß:
„Wann wir nun nach dem von behörigen Orten einge-zogenen gutächtlichen Bericht, und Uns darob besche-henen gehorsamsten Vortrag allergnädigst erwogen,daß dieses allerunterthänigste Gesuch die Ausbreitungder böhmischen Sprache als ein sehr nützliches Vorha-ben zum Endzweck habe . . .“ 43
Die Verpflichtung, die Kaliwoda mit der Privi-legsverleihung „über oben gedachte BöhmischeZeitung auf Zehen nacheinander folgende Jahreohne Hindernuß, und anderwärtiger Beeinträch-tigung in allerhöchsten Gnaden“44, zu überneh-men hatte, bestand darin,
„daß sothanes Privilegium Unserem darauf privile-girten Prager Hof-Buchdrucker Kirchner unnachteilig,und er Kalivoda von ermeldten böhmischen Zeitungallwochentlich einige Exemplarien zu Unserem k:k:Directorio in Publicis et Cameralibus abzugebenschuldig und verbunden seyn solle.“ 45
Bemerkenswert erscheint also, dass diesem
Schutzbrief der übliche Hinweis fehlt, bei derHerausgabe des Privilegsobjektes stets Vorsichtzu üben und die jeweils konzipierte Nummer erstnach der offiziellen Genehmigung durch diezuständige Zensurbehörde in Druck zu geben.Anstelle dessen wurde Kaliwoda bloß dazu ver-pflichtet, dem Directorium in Publicis et Camera-libus, jener Behörde, der zu dieser Zeit die Zei-tungszensur obgelegen war46, eine nicht näherpräzisierte Anzahl von bereits gedruckten Exem-plaren wöchentlich abzuliefern. Als einzigeBesorgnis der Obrigkeit entpuppt sich vielmehrein ausgeprägtes Interesse an einer absolutenKonfliktlosigkeit zwischen Kaliwoda als Produ-zenten der tschechischsprachigen Zeitung inWien und dem Herausgeber der im Jahre 1719von Karl Franz Rosenmüller gegründeten Pražképoštovské noviny (Prager Post-Zeitung)47.Die Kaliwoda auferlegte Verbindlichkeit, dieRechte des Prager Zeitungsproduzenten in kein-erlei Hinsicht zu schmälern, lassen folgende Aus-deutung zu: Einerseits sollte jedweder Beschwer-de jenes älteren Privilegieninhabers auf die Her-ausgabe einer tschechischsprachigen Zeitung vonvornherein begegnet werden und andererseitssollte sich keine Konkurrenzierung zwischen die-sen beiden Privilegieninhabern anbahnen. Primärsollte jedoch vermutlich eine ruhige Entwicklungdieser neuen Wiener Zeitung gewährleistet wer-den, die den Interessen des Hofes als Trägerinoffizieller oder offiziöser Meldungen gegebenen-falls noch besser als das Prager Blatt entsprechenkonnte.An den Schluss der Privilegausfertigung wurdedie geläufige Gebots- und Verbotswendunggesetzt, die ihren Wirkungskreis auf alle Einwoh-ner und Untertanen, „was Würden, Standes,Amts oder Wesens die in Unseren Königl: Böhei-misch= und Oesterreichischen Erblande seynd“,erstreckt sah. Der Niederösterreichischen Regie-rung wurde dabei speziell mitgegeben,
„daß sie mehrgemeldten Leopold Johann Kalivoda beydiesem von Uns ihme über widerholte BoheimischeZeitung obverstandener massen auf zehen nacheinan-der folgende Jahre allergnädigst verliehenen Privilegiogebührend schützen, und handhaben, darwider selbstnicht thun, noch das andern zu thun verstatten, beyVermeidung Unserer schweren Straff, undUngnad.“48
40
m&z 2/2004
42 Karl Tham: Deutsch-böhmisches Nationallexikon.Prag/Wien 1788.
43 Niederösterreichisches Landesarchiv, Hofresoluta inPublicis, 1760, Dez.
44 Ebd.45 Ebd.
46 Ebd.47 Josef Volf: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und
Mähren bis 1848. Weimar 1928, S. 119 u. 122.48 Niederösterreichisches Landesarchiv, Hofresoluta in
Publicis, 1760, Dez.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 40
Ebenfalls hatte die Niederösterreichische Regie-rung die Benachrichtigung der vier Kreisämter,des Niederösterreichischen Kammerprokurators,der Universität Wien, sämtlicher Drucker, derPrivilegien- und Handwerkskommission sowieder Landeshauptmannschaft Österreich ob derEnns zu übernehmen. Dieser Verpflichtung ent-ledigte sich die Landesbehörde am 19. Dezember1760.Damit stand der Herausgabe einer Wiener tsche-chischsprachigen Zeitung nichts mehr im Wege.Dennoch vergingen knapp drei Monate, bis Kali-woda so weit war, den Erscheinungsbeginn diesesBlattes definitiv mit dem 1. April 1761 anzukün-digen:
„Allbereits vor einigen Jahren Se. Kayerl. Königl.Apostol. Maj. allergnädigst anzubefehlen geruhet, daßin denen durch Dero ruhmwürdigste Landes=Mütter-liche Sorgfältigkeit eingeführten Kriegs=Schulen, nebstanderen auch hauptsächlich die Böhmische Sprachegelehret werden solle, und seynd zu solchem Endenicht nur allein die tüchtigste Lehrer dieser Spracheangestellt, sondern auch viele Adels-Personen inBöheim und Mähren, durch diesen allerhuldreichstenVorgang, untereinstens ermuntert worden, sich fürihre Erbfolgere mit dergleichen Sprach-Lehrer zu ver-sehen.“ 49
Nach dieser Präliminarerklärung, die nicht nurdie allgemein zugenommene Bedeutung dertschechischen Sprache betonte, sondern insbe-sondere auf das sich neu entfaltete Selbstver-ständnis50 hinwies, erläuterte Kaliwoda die weite-ren Argumente, die ihn dazu bewogen hatten, mitdem Plan der Herausgabe einer derartigen Zei-tung an die Öffentlichkeit zu treten:
„Damit demnach die Academisten sowol, als anderesich in dieser Sprache üben wollende Jugend allerOrten, nach einmal erlernten Grundsätzen, desto füg-licher zu einen vollständigeren Begriff und Fertigkeitgelangen möge, scheinet wol vor allem das nothwendig-ste und beste Mittel zu seyn, sich mit Lesung Böhmi-scher Bücher und Verfassungen öfters zu beschäftigen;weilen also absonderlich die dermalige Kriegs=Läuff-ten uns so viele Vorfallenheiten mittheilen, daß allhier
in Wien wochentlich an den zweyen Post=Tägen,nemlich Mittwochs und Samstags, ein vollständigerZeitungs=Bogen in Böhmischer Sprache gar füglich andas Licht treten kan; so vertröstet man sich aller-dings, daß dergleichen Bemühung und Ausgabe denenLiebhabern der Sprache desto erwünschlicher seynwerde, als sie eben andurch auf die bequemlichsteWeise die Vollkommenheit derselben, als die Fruchtihrer Übung und Endzwecks, am ehesten werdenerreichen können.“ 51
Danach ließ Kaliwoda die Zusicherung folgen,bereits ein verlässliches Korrespondenznetz „zudesto genauerer Bedienung deren Liebhabern“eingerichtet zu haben. Die an dieses Versprechengekoppelte Anmerkung, dass „die Nachrichtenvon weit=entlegenen Landen, in der Kayserl.Königl. Residenz=Stadt Wien jederzeit gegenanderen Erbländischen Städten um etwelcheTäge ehender einzulauffen pflegen“, ist dabeiunschwer als Eigenreklame und Versuch einerpositiven, wenn auch nur teilweise berechtigten52
Abgrenzung gegenüber den an einem gewissenAktualitätsdefizit leidenden auswärtigen Medieninnerhalb der Erbländer zu erkennen.Interessenten, „welche die Ehre ihrer uraltenMutter=Sprache auch in andre entfernte Länderund Völker löblichst auszubreiten befliessen seynwollen“ sowie alle jene, „die sich zum Nutzen desgemeinen Weesens eines vollständigen Begrifsderselben theilhaftig zu machen verlangen“, wur-den
„zur geneigtesten Abnahm und Beförderung dieserBöhmischen Zeitungen nicht nur nach jedermansGebühr Dienst=freundlichst eingeladen, sondernzugleich erinneret . . ., daß sich wegen Bestallung undrichtiger Ablangung derselben entweder allhier in demKayserl. Obrist=Hof=Post=Amt, oder bey mir aufdem Dominicaner=Platz in meinem Buch=Gewölb,als den Verlags=Ort, nach Belieben könne angemel-det werden.“ 53
Trotz dieser Eigenwerbung und der intensivenBemühung um einen großen Abnehmerkreiskonnte Kaliwoda die Herausgabe der České vídens-ké poštovní noviny gerade nur bis zum Schluss desersten Quartals aufrecht halten. Als Argument für
41
m&z 2/2004
49 Diese zweisprachige Mitteilung wurde erstmals – freilichohne irgendeine Quellenangabe – von Volf vollständigvorgestellt. Volf, Počátek českého novinárstvní ve Vídni, S. 134-136. – Im Zuge dieser Arbeit konnte ein Exemplar diesesAnkündigungszettels als Anzeigenbeilage des WienerischenDiariums in der Österreichischen Nationalbibliothekaufgefunden werden. Dieses beidseitig bedruckte Blatt istnach der Num. 23 vom 21. März 1761 beigebunden.
50 Weizsäcker spricht von einer „lebhaften
landespatriotischen, ‘bohemistischen’ Einstellung“.Wilhelm Weizsäcker: Zur Geschichte des österreichischenStaatsgefühls. In: Ostdeutsche Wissenschaft. Bd. 2. München1955, S. 305.
51 wie Anm. 49.52 Beispielsweise langten die Nachrichten aus dem
nordeuropäischen Bereich in Prag früher als in Wien ein.53 wie Anm. 49.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 41
die Einstellung wurde, wie bereits vermerkt, derMangel einer ausreichenden Anzahl von Abneh-mern angegeben54.Diese Begründung für die Einstellung der Zei-tung sagt sehr viel aus. Sie weist darauf hin, dassdas Blatt Kaliwodas weder ein lebensfähiges Bin-deglied zwischen den Vorgängen in der damali-gen Welt und der tschechischsprachigen Bevölke-rung gewesen war, noch ein potentielles Mittelder tschechischen Erneuerung, die sich in dieserZeit sowohl auf kulturellem als auch auf politi-schem Bereich zu vollziehen angebahnt hatte,einer Erneuerung, die im Rahmen einer frischgeschaffenen nationalen Ideologie gegenüber derüberregionalen Ordnung der Habsburgermonar-chie bemüht war, den im Verlauf der Gescheh-nisse des 17. Jahrhunderts eingebüßten Kontaktder Tschechen mit den europäischen „Hochkul-turen“ wiederherzustellen. Überdies offenbartsie, dass weder die Aktivitäten des Wiener Kreisesvon Historikern und Bibliothekaren, dessen gei-stige Ausstrahlung auf die Wiedergeburt destschechischen Nationalbewusstseins von hoherIntensität war, noch die Besonderheit des Mitein-anderwirkens deutscher und slawischer Gelehrterin der übergeordneten Metropole der Donau-monarchie, eine Besonderheit, die zu jener Zeit inähnlicher Ausprägung ansonsten nur noch inPrag anzufinden war, sich positiv auf dieBestandsdauer der České vídenské poštovní novinyauswirkten.Wien war damals zwar der Ort, in dem die deut-sche und tschechische Sprache auf engem Raummiteinander lebten, in dem eine geistige Begeg-nung der beiden Kulturbereiche stattfand, aberdeshalb noch lange kein geeigneter Nährbodenfür die Herausgabe einer tschechischsprachigenZeitung. Denn es dauerte danach immerhin zwei-undfünfzig Jahre bis zur Gründung des nächstentschechischsprachigen Blattes, der Cís. král. vídens-ké noviny (k.k. Wiener Zeitung), eines Journalspolitisch-literarischen Inhalts mit einer Lebens-dauer von immerhin fünf Jahren, herausgebrachtvom bedeutenden Philologen Johann NepomukHromátko.Wie bereits angemerkt55, konnte die Zeitung Kali-wodas bisher in keiner einzigen Bibliothek nach-gewiesen werden. Da auch aus der Literatur nicht
eindeutig hervorgeht, wer das Erbe der Biblio-thek Zlobickys angetreten hat, dürfte ein derarti-ger Nachweis vermutlich auch nicht leicht gelin-gen. Wurzbach gibt an: „…was mit seiner …Bibliothek, für welche der Ankauf durch denStaat befürwortet wurde, geschehen ist, wissenwir nicht.“56 Christian d’Elvert hingegen führtaus, dass die Sammlungen Zlobickys „Graf Auer-sperg um 10.000 fl. Banknoten“ gekauft hat57.Einer diesbezüglichen Anfrage an das Auersper-gische Familienarchiv im Schloss Wald bei St.Pölten mit der Bitte, bei der Identifikation diesesnicht näher vorgestellten Grafen Auerspergbehilflich zu sein, war kein besonderer Erfolgbeschieden. Auch der von dieser Stelle gelieferteHinweis, es könnte sich bei diesem Grafen um einMitglied der krainischen Linie handeln, konntenichts zur Eruierung des Käufers der BibliothekZlobickys beitragen.Dagegen könnte allem Anschein nach eine bio-graphische Mitteilung Eduard Janotas aus demJahre 1863 über den Grafen Josef von Auersperg,den Besitzer des Schlosses Hartenberg in derNähe von Falkenau an der Eger, den Schlüsselzur Auffindung der ersten tschechischsprachigenZeitung Wiens enthalten. Janota berichtet näm-lich, dass sich Graf Josef von Auersperg imBesitze einet vorzüglichen Bibliothek befundenhatte, deren Schwerpunkt unter anderem dieSammlung böhmischer Gesetze und Landtagsbe-schlüsse sowie sonstiger Werke über Böhmendargestellt hatte, „auf welche Sammlungen er(Auersperg, Anm. des Verf.) große Kosten ver-wendete.“58
Die Frage, ob dieser Graf Auersperg, ein „Mannder Wissenschaft“, den Goethe, sooft er sich inBöhmen aufhielt, stets zu besuchen pflegte59,tatsächlich jener bibliophile Gelehrte war, der dieBibliothek Zlobickys erworben hatte, werdenvielleicht zukünftige Ermittlungen oder Hinweisebeantworten können. Selbst dann aber, wenn einsolcher Nachweis gelänge, wäre es erst recht eineKärrnerarbeit, dem Problem nachzugehen, werdie Nachfolge der Sammlungen dieser gräflichenFamilie angetreten hat. Da jedoch in jüngerer Zeitdamit begonnen wurde, die Geschichte derTschechen in Wien vom ausgehenden 19. Jahr-hundert an wissenschaftlich zu bearbeiten –
42
m&z 2/2004
54 Volf, Počátek českého novinárstvní ve Vídni, S. 133.55 vgl. Anm. 19.56 Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich. Bd. 60. Wien 1891, S. 203.57 Christian d’Elvert: Geschichte des Bücher- und Steindrucks,
des Buchhandels, der Bücher-Censur und der periodischen
Literatur. Brünn 1854, S. 300.58 Ed. Janota: Josef Graf von Auersperg. In: Mittheilungcn des
Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jg. 6, Prag1868, S. 163.
59 Ebd.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 42
m&z 2/2004
43
genannt sei hier etwa der Sammelband vonVales60 –, erscheint es vorstellbar, dass dieses neuentwickelte Forschungsbewusstsein auch zu einerweiter zurückreichenden, intensiven und syste-matischen Behandlung der politischen und kultu-rellen Entwicklung dieser nationalen Minderheit
in Wien führt. In dieser Verbindungslinie wäre esdaher auch durchaus denkbar, dass sich selbst zu der speziellen Frage einer detaillierterenBeleuchtung der ersten tschechischsprachigenZeitung Wiens neue Lösungsansätze anbietenwerden.
Wolfgang DUCHKOWITSCH (1942)Dr. phil., Univ. Prof. am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft derUniversität Wien; Leiter zahlreicher kommunikationshistorischer Projekte. Hauptarbeits-gebiete: Medien und Kommunikation zwischen Missbrauch und Aufklärung. Diversemedienhistorische Publikationen; Herausgeber zahlreicher Bücher, zuletzt Die öster-reichische NS-Presse 1918-1933. Wien 2001; Die Spirale des Schweigens. Zum Umgangmit der nationalsozialistischen Zeitungswissenschaft. (gem. m. Fritz Hausjell u. BerndSemrad). Münster 2004.
60 Vlasta Vales (Hg.): Doma v cizine. Cesi ve Vídni ve 20.století. [Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im
20. Jahrhundert]. Prag 2002.
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 43
44
m&z 2/2004
RUDOLF ULRICH: Österreicher in Hollywood.Wien: Filmarchiv Austria 2004, 623 Sei-ten.
Was haben Gustav Diessl und Peter Lorregemeinsam? Nun, beide kamen um die Jahrhun-dertwende in (Alt-)Österreich zur Welt – Diessl1899 in Wien, Lorre 1904 im mährisch-slowaki-schen Rosenberg –, beide übten den Beruf desSchauspieler aus – und beide waren in Hol-lywood. Diessl verbringt ein paar Wochen dort,um 1931 in den MGM-Studios „Menschen hin-ter Gittern“ zu drehen, die deutschsprachige Ver-sion des Gefängnisdramas „The Big House“;danach kehrt er nach Deutschland zurück undsetzt dort seine Filmkarriere, die Anfang derzwanziger Jahre begann, mit glänzendem Erfolgfort. 1941 beispielsweise tritt er im antiserbischenPropagandastreifen „Menschen im Sturm“ auf,der den Überfall auf Jugoslawien rechtfertigensoll; später in „Kolberg“ (1945), dem berüchtig-ten filmischen Durchhalteepos des „Dritten Rei-ches“. Lorre, mit Fritz Langs „M“ 1931 zum Stargeworden, flüchtet im Februar 1933 von Berlinnach Wien, noch im gleichen Jahr reist er weiternach Paris, dann nach London und erreicht imSommer 1934 die USA, wo er bis zu seinem Tod1964 lebt und arbeitet. In Ulrichs Buch sind diebeiden sozusagen friedlich miteinander vereint:der Dagebliebene, der sich arrangiert und bereit-willig in die Propagandamaschinerie der Natio-nalsozialisten einfügt – und der Vertriebene, derseine erfolgreiche Tätigkeit im deutschen Kinoaufgrund seiner jüdischen Herkunft jäh beendenund in der Fremde des Exils, abgeschnitten vonder Muttersprache, erst einen neuen Anlauf neh-men muss.
„Österreicher in Hollywood“, so der Buchtitel,sind sie halt beide. So wie die rund 400 anderenPersonen, die der Band mit biografischen Einträ-gen und umfangreichen Biografien vorstellt. DerBogen reicht dabei vom berühmten Bühnenbild-ner und Art Director Joseph Urban, der bereits1911/12 in die USA emigriert, bis zu ArnoldSchwarzenegger, von aus Nazideutschlandgeflüchteten Filmschaffenden wie Billy Wilderbis zu Digital Artists der Gegenwart, von verges-senen Vertriebenen wie der Schauspielerin LiliaSkala bis zu bekannten Darstellerinnen wie HedyLamarr.
„Den immensen Kulturleistungen österreichi-scher Filmkünstler im Zentrum der Weltkinema-tografie gewidmet“ (S. 7) sei sein Buch, meintUlrich im Vorwort. Da genügt schon ein Sprün-gerl, auf das man in Hollywood vorbeigeschauthat, um verzeichnet zu werden: Christiane Hör-biger etwa verbringt Anfang der neunziger Jahregerade einmal zwei Wochen für Dreharbeiten amin der Versenkung verschwundenen Streifen „ForParents Only“ in Los Angeles – „beim Filmgelang ihr die Realisierung eines Kindheits- undJugendtraums – der Sprung nach Hollywood“ (S.194), zitiert Ulrich ihren Mann Gerhard Töt-schinger aus dessen Buch über sie... Der Autorund Schauspieler Fritz Eckhardt wiederumschreibt am Sunset Boulevard „mehrere Wochenan der Geschichte des letztlich in Wiener Ateliersgedrehten Musikfilms ,The Waltz King‘“ (S. 111)– den immensen Einfluss seiner Arbeit spürt manin Hollywood heute noch.
„Hollywood muss man nicht beschreiben, Hol-lywood ist kein Ort – Hollywood ist einMythos.“ (S. 9) Diese von Ulrich seiner Einlei-tung vorangestellte Einschätzung stammt vomansonsten als Autor von Ratgebern wie „DenkenSie sich frei!“ und „Tourenski- und Tiefschnee-fahren abseits der Piste“ hervorgetretenen Hel-mut-Maria Glogger. „Österreich kann ohne Hol-lywood leben, Hollywood aber nicht ohne Öster-reich.“ (S. 15) Meinte 1989 der Exilant und vor-malige US-Botschafter in Österreich HenryGrunwald, ein weiteres „Leitmotiv“ des Bandes.Im Verein legen diese Zitate deutlich dar, wie hiermit (Film-)Geschichte verfahren wird: undiffe-renziert, oberflächlich und nicht zuletzt sehrpatriotisch – nach dem Motto: Egal, wer waswann wo wie und warum getan bzw. gedreht hat– Österreicher (die geschlechterneutrale Formexistiert im Buch nicht) sind sie alle, der öster-reichische Film ist, sei es auch und gerade in Hol-lywood, eine große Familie.
Zu dieser Familie gehört beispielsweise auch LuisTrenker. 1932/33 werden seine beiden Filme„Berge in Flammen“ und „Der Rebell“ unter sei-ner Mitwirkung in Hollywood in englischspra-chigen Versionen neu gedreht. Der biografischeEintrag endet freilich schon mit 1935 und demSatz: „Luis Trenkers Œuvre als Schauspieler,Autor und Produzent umfasst bis in die 80-erJahre 30 Filme und 50 Dokumentationen, dazu
Rezensionen
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 44
45
m&z 2/2004
fast zwei Dutzend Bücher.“ (S. 533) Es wäre jawirklich zu indezent gewesen, auf Trenkers Rolleim Nationalsozialismus hinzuweisen – oder gardas begeisterte Telegramm abzudrucken, das erzum „Anschluss“ nach Wien geschickt hatte.(Großzügig illustriert ist der Band ja allemal.)
Einer, der wirklich in Hollywood lebte – gezwun-germaßen, weil ins Exil getrieben –, und zwar alsrecht erfolgloser Drehbuchautor, war FriedrichTorberg. Über seine Remigration heißt es: „1951zurück in Wien, wurde er eine der zentralen Figu-ren des österreichischen Kulturlebens.“ (S. 530)Dann werden die „Tante Jolesch“ erwähnt undTorbergs Leistungen als Feuilletonist, Übersetzerund Redakteur des Forum – über seine Rolle alsmaßgeblicher Betreiber des Brecht-Boykotts keinWort.
Immerhin muss man Rudolf Ulrich zugute hal-ten, dass er in jahrelanger Kleinarbeit sehr vielMaterial zusammengetragen hat und zahlreicheFilmschaffende erst durch seine Recherchen (wie-der)entdeckt wurden – gerade auch etliche Exi-lantInnen, die in der Regel mit oftmals rarenAbbildungen vertreten sind. Zugleich wird an„Österreicher in Hollywood“ mehr als deutlich,wohin es führen kann, wenn ein begeisterterHobbyhistoriker und Sammler von Verlag undLektorat komplett im Stich gelassen wird.
Denn: In puncto lexikalisch angelegte Film-bücher steht der Band, was sprachliche Unge-reimtheiten, faktische und auch inhaltliche Fehleranbelangt, sicherlich einzigartig da.
Nehmen wir gleich den ersten Eintrag, „HerbAndress“, Schauspieler. „Sein Weg“, lesen wir da,„führte ihn nach Kalifornien, San Francisco, LasVegas und 1963 mit der damaligen GefährtinElena Williams in das magische Filmbabel.“ (S.27) Ein paar Zeilen weiter wird aus dem Regis-seur Sidney Lumet ein „Sydney“. Und genau dereine Part, mit dem sich Herb Andress einen blei-benden Platz in der Filmgeschichte gesichert hat,nämlich die Hauptrolle in Niklaus SchillingsNeuer-Deutscher-Film-Klassiker „Die Vertrei-bung aus dem Paradies“ (1977), findet bei Ulrichkeine Erwähnung (so wie auch mehrere kleineRollen für Fassbinder) – auch in der Filmografienicht, denn die verzeichnet, wie im ganzen Band,nur US-Filme, wodurch der Informationswerterheblich geschmälert wird.
Solcherart eingestimmt, blättern wir ein paar Sei-
ten weiter zu „Lenore Aubert“, Schauspielerin.Wir lesen, dass sie nach der Flucht in die USA einAngebot des La Jolla Playhouse in San Diegobekam und daraufhin mit dem Autobus von NewYork nach Kalifornien reiste. Dort wurde sie ineinem kleinen Theater in Los Angeles von einemFilmtalente-Scout entdeckt und debütierte 1943in der Agentenkomödie „They Got Me Cover-ed“. Das La Jolla Playhouse wurde freilich erst1947 gegründet... Auch die Filmografie der Dar-stellerin enthält mehrere Fehler, so wird aus demFilm „Passport to Destiny“ der nicht existierende„Password to Destiny“; und zum Drüberstreuenverliert der berühmte Schauspieler George San-ders in der Bildunterschrift am Kopf der Seite ein„e“ - und heißt nun „Georg“.
Sie glauben, das sind Ausnahmen? Zwei Seitenzurückgeblättert zu „Leon Askin“, Schauspieler,1933 nach Wien vertrieben, 1938 nach Frank-reich geflüchtet, 1940 in die USA. „Ab 1942“,heißt es da, „diente der Exilant bei der Air Forceim Army Showbusiness als Public Relations Offi-cer.“ (S. 31) Eine Stabsstelle „Air Force im ArmyShowbusiness“ – als wäre es eine Komödie vonWilder. Auf den drei Seiten des Askin-Eintragesfinden sich nicht weniger als 14 nachweislicheFehler: falsch geschriebene Film- und Fernsehti-tel, falsche Jahreszahlen und Genre-Zuordnun-gen, Auslassungen – und in einer Bildunterschriftder Name „Ralf Wolters“ – der hat den Buchsta-ben zuviel (das „s“), der womöglich anderswofehlt.
Manchmal kommt die Chronologie durcheinan-der, manchmal wird gar die Film- und Zeitge-schichte umgeschrieben. Im Eintrag „Paul Hen-reid“ erzählt Ulrich vom Flug liberal gesinnterHollywoodstars nach Washington, D.C. imHerbst 1947: Henreid, Danny Kaye, Gene Kelly,Humphrey Bogart, Lauren Bacall und anderewollten damit im Vorfeld der HUAC-Verhöre, zudenen eine Reihe „freundlicher“ und „unfreund-licher“ Zeugen aus der Filmbranche geladen wor-den war, ihren Protest gegen Gesinnungsschnüf-felei und die Einschränkung der bürgerlichenFreiheiten zum Ausdruck bringen. „Alle außerBogart“, so Ulrich, „kamen danach selbst auf dieso genannte Black List und erhielten Berufsver-bot.“ (S. 188) Berufsverbot für Bacall, Kaye undKelly? Blühender Unsinn.
Dass ein Autor nicht schreiben kann bzw. aus-schließlich im Stil der Boulevardpresse der fünfzi-ger oder sechziger Jahre; dass er dabei das Engli-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 45
m&z 2/2004
46
sche und Deutsche ständig „kreativ“ vermengt(„die Movie Town zeigte daraufhin Interesse“, S.36) bzw. offensichtlich wortwörtlich aus demEnglischen übersetzt („seine Laufbahn begann ander Dramatikschule des Deutschen Volksthea-ters“, S. 40); dass Eintrag für Eintrag stereotypdie gleichen Formulierungen („braune Machtha-ber“, „Nazi-Machthaber“, S. 182 bzw. S. 155)und blumigen Metaphern („als Hitlers Schattenlänger und bedrohlich wurde“, S. 191) auftau-chen – all das hätte ein Lektorat, das dieseBezeichnung nur im Mindesten verdient, leichtkorrigieren können.
Schwerer allerdings wiegt die Tatsache, dass sichdas Filmarchiv Austria mit „Österreicher in Hol-lywood“ auf die Seite jener schlägt, die sich gernemit den Leistungen von AuslandsösterreicherIn-nen, im Besonderen ExilantInnen, schmücken,ohne die zentralen Fragen von historischerSchuld und Verantwortung auch nur anzutönen.Was verbindet denn tatsächlich den jüdischenSchauspieler Paul Morgan, 1930/31 kurzzeitig inHollywood, 1933 von Berlin nach Wien vertrie-ben, 1938 von der Gestapo verhaftet, im gleichenJahr im Konzentrationslager Buchenwald umge-kommen, mit seinem Berufskollegen AntonPointner, zur gleichen Zeit wie Morgan in Ame-rika, später dann – „Der Beruf führte den Künst-ler fast um die ganze Welt“ (S. 373) – tatkräftigim Nazifilm aktiv, u.a. in Veit Harlans nationali-stischem Tendenzfilm „Der große König“(1942)? Oder mit den Computeranimateuren,Models, Kameraleuten etc., die seit einigen Jah-ren die „Movie World in Hollywood“ (S. 366)aufsuchen? Nichts – außer: Sie sind halt ausÖsterreich. „Das kleine Österreich“ ist für Ulricheben „nach wie vor eines der Talentreservoirs fürdie ,Traumfabrik‘“. (S. 14) Ein hohler patrioti-scher Reflex. „This Land is My Land“ heißt einFilm in einer Bildunterschrift zum SchauspielerWalter Slezak (S. 476) – „This Land is Mine“sollte es richtig lauten, ein Anti-Nazi-Film ausdem Jahre 1943, unter Beteiligung etlicher Exi-lanten entstanden in der Regie des Franzosen JeanRenoir.
Gerade die „sorgfältige“ Edition und Redaktiondes Bandes, der nicht endenwollende Strom anFehlern und Fauxpas, beraubt also darüber hinausdie Betroffenen noch Jahrzehnte nach dem Exil-schicksal ihrer Biografie und ihrer individuellenArbeiten und Leistungen.
Christian Cargnelli
RAY RÜHLE: Entstehung von politischerÖffentlichkeit in der DDR in den 1980erJahren am Beispiel von Leipzig. (= Kom-munikationsgeschichte 17). Münster-Hamburg-London: LIT Verlag 2003, 170Seiten.
Ray Rühle geht in diesem Buch der Frage nach,wie sich während der achtziger Jahre in der DDReine politische Öffentlichkeit außerhalb desbestehenden geschlossenen politischen Systemsherausbilden und weiters mit dessen Öffentlich-keit konkurrieren konnte. Rühles Grundideehierbei ist, dass das staatssozialistische System derDDR über keine politische bzw. rechtsstaatlichgesicherte Öffentlichkeit verfügte, stattdesseneine „simulierte“ Öffentlichkeit forcierte. Der Autor diskutiert zunächst unterschiedlichetheoretische Modelle, um Hypothesen für diepolitische Öffentlichkeit der DDR zu erstellenund zu überprüfen. Als Ausgangslage dient Rühledie „Theorie des kommunikativen Handelns“von Jürgen Habermas, obwohl ihm bewusst ist,dass diese nicht vollständig auf die politischenEntwicklungen der DDR übertragen werdenkann. Schließlich entstand diese Theorie im undbezogen auf den Kontext westeuropäischerDemokratien. Rühle begreift seinen Unter-suchungsgegenstand sozusagen mit Hilfe einerwesteuropäischen Theorie, indem er Parallelenzwischen sozialen Bewegungen in der BRD undin der DDR zieht und – aus eben dieser Sicht –auf fehlende Voraussetzungen für eine demokra-tische Öffentlichkeit im staatssozialistischenSystem hinweist. Seine theoretische Herange-hensweise an das Thema Öffentlichkeit erfolgtdabei weniger aus dem Forschungssubjekt herausals vielmehr entlang bestehender normativerBegrifflichkeiten. Das, obwohl Rühle erklärt,warum sowohl Habermas’ „Strukturwandel derÖffentlichkeit“ als auch Niklas LuhmannsSystemtheorie für das Verstehen von Öffentlich-keit in der DDR nicht ausreichen. Das Pri-vatrecht, das Habermas als Grundvoraussetzungvon politischer Öffentlichkeit postuliert, hat es inder DDR nicht gegeben. Die Systemtheorie igno-riert unterdessen die Rolle sozialer AkteurInnenund damit verbunden deren Kognitionen undMotivationen, die jedoch für die Analyse vonAusschlussmechanismen im Zusammenhang mitÖffentlichkeit unerlässlich sind. Das Öffentlich-keits-Modell von Jürgen Gerhards und FriedhelmNeidhardt hält der Autor für seinen Untersu-chungsgegenstand schon nützlicher, obwohl auchhier nicht alle normativen Charakteristika auf die
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 46
m&z 2/2004
47
politische Realität der DDR-Öffentlichkeitzutreffen. Wenngleich die genannten Theoriemo-delle offensichtlich den Wandel der politischenÖffentlichkeit in Leipzig nicht ausreichend fassenkönnen, bewegt sich die vorliegende Untersu-chung dennoch im Rahmen eben dieser.Ein wichtiges Moment des vorliegenden Buchesbildet das Konzept der Zivilgesellschaft (definiertauf S. 60), die einen „latenten Einfluss“ (S. 25)auf das ausschließende politische DDR-Systemausgeübt hat. Die Zivilgesellschaft formierte sich,aus der „zweiten“ bzw. regierungsunabhängigenÖffentlichkeit heraustretend, zu der – vonHabermas definierten – „Gegenöffentlichkeit“ (S.25), die auf die „simulierte“ staatliche Öffentlich-keit einwirken sollte. Im Zusammenhang mit dervorliegenden Untersuchung kann sicherlich voneiner Gegenöffentlichkeit gesprochen werden,weil Rühle jene aus der evangelischen Kirche ent-stehende Bewegung untersucht. Bei der Erfor-schung weiterer opponierender Gruppierungenmüsste wahrscheinlich von höchst heterogenenGegenöffentlichkeiten gesprochen werden.Die Untersuchung entstehender alternativer undfolglich gegenöffentlicher Sphären in der DDRerfordert eine Beleuchtung des Verhältnisses zwi-schen politischer Öffentlichkeit und Privatsphä-re. Rühle behauptet zu Recht, dass einzig in derprivaten Lebenswelt staatlich unabhängige Arti-kulationen zu politischen Themen möglichwaren, obwohl umgekehrt das DDR-Regimeauch die Privatsphäre zu vereinnahmen trachtete.Ein in der Zahl wachsendes Publikum führte zueiner Ausweitung dieses privaten Bereichs in denachtziger Jahren, während sich unter manchenGesellschaftsgruppen ein Wertewandel vollzog.Jene Prozesse, die in westlichen Demokratien seitAnfang der siebziger Jahre einsetzten, vermutetRühle auch bezogen auf die DDR während derachtziger Jahre. Im Gegensatz zu westlichenDemokratien führte dieser Wertewandel jedochzu keinen sozialen Bewegungen und einer daraufaufbauenden institutionalisierten alternativenÖffentlichkeit, sondern zu einer zweiten Öffent-lichkeit, die sich vom politischen System abgrenz-te. Die Kirche bot sich dabei als herrschaftsfreiesArtikulationsforum an, weil sie als einzige Ein-richtung außerhalb der „simulierten“ Öffentlich-keit neuen Lebenskonzepten und Kommunikati-onsbedürfnissen Raum gab. Die Kirche dabeibezüglich ihres „weitgehend ideologiefreienRaumes“ (S. 58) hervorzuheben, hätte – wie auchdie Lebenswelt der AkteurInnen innerhalb derLeipziger Kirchen – einer genaueren Erläuterungbedurft.
Umgekehrt beeindruckt die stringente Aufschlüs-selung jenes Prozesses, in dem sich allmählicheine regimekritische Öffentlichkeit formierte.Die „zweite Öffentlichkeit“ (S. 59) bildete sichAnfang der achtziger Jahre innerhalb der Kircheund in Abgrenzung zur staatlichen „simulierten“Öffentlichkeit heraus. Die Kirchenöffentlichkeitfungierte hierbei als Pufferzone zwischen zweiterund „simulierter“ Öffentlichkeit. Bald entwickel-te sich aus der zweiten Öffentlichkeit die„Gegenöffentlichkeit“ (S. 68), deren Ziel es war,in die „simulierte“ staatliche Öffentlichkeit hin-einzuwirken.Diesen Vorgang analysiert Rühle anhand derLeipziger Umweltschutzgruppe „ArbeitsgruppeUmweltschutz“ (als Teilöffentlichkeit der zweitenÖffentlichkeit) und der später aus ihr abgespalte-nen „Initiativgruppe Leben“ (IGL). Seine Wahlargumentiert der Autor damit, dass die AGU(Arbeitsgruppe Umweltschutz) zu den größtenund aktivsten Umweltschutzgruppen innerhalbder zweiten Öffentlichkeit gehörte. Mit ihrenPublikationen und gegenöffentlichen Aktionenversuchte die AGU, die öffentliche Meinung imSinne ihrer Forderungen zu mobilisieren unddaraufhin Druck auf das politische System auszu-üben, was ihr erst 1989 gelang. Mit dem Hinweisauf die Schwierigkeit, die öffentliche Meinungempirisch nachzuweisen, analysiert Rühle daherderen mobilisierende Faktoren.Die Wahl des Themas Umwelt/Umweltschutz alsAusgangspunkt politischer Öffentlichkeitbegründet der Autor Rühle mit dem Argument,dass Umwelt ein elementarer Teil der Lebensweltist und folglich im Sinne Habermas’ hohes Poten-zial besitzt, die öffentliche Meinung zu mobilisie-ren. Anhand dieser Thematik kann nämlich derProzess vom Aufzeigen einzelner Probleme imSinne einer Systemverbesserung hin zu einergrundsätzlichen Infragestellung des politischenSystems und damit verbunden eine Systemverän-derung nachgezeichnet werden.Im letzten Kapitel arbeitet Rühle schließlich jeneFaktoren heraus, die eine Mobilisierung deröffentlichen Meinung ermöglichten und folglichden Wandel der politischen Öffentlichkeitbewirkten. Nachdem die Kirchenöffentlichkeitals „Übungsfeld“ für das Herausbilden „politi-scher Kommunikationsfähigkeit“ (S. 134)gedient hatte, entstanden nun neue Parteien undBewegungen, die vermehrt Menschen anspra-chen. Das politische System kollabierte lautRühle aufgrund des Drucks der Straße im Herbst1989. Mobilisierende Faktoren waren dabei derverstärkte Einfluss von westdeutschen Massen-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 47
m&z 2/2004
48
medien und die Massenauswanderung überUngarn. Wünschenswert wäre trotzdem eine stär-kere Ausarbeitung des gesamtgesellschaftlichenKontextes, in welchem sich diese opponierendeumwelt-bezogene Öffentlichkeit herausbildete.Zwar verweist Rühle einerseits in Anlehnung anHabermas’ „Strukturwandel der Öffentlichkeit“auf die Bedeutung von Geheimdiensten instaatssozialistischen Gesellschaften (S. 27) undandererseits auf die innenpolitischen Entwicklun-gen in der Sowjetunion Ende der achtziger Jahre,vermisst wird dennoch eine genauere Analysewirtschaftlicher, sozialer, militärischer und inter-nationaler Einflüsse auf die Protestbereitschaft,die Straßendemonstrationen sowie auf den Wan-del der politischen Öffentlichkeit der DDR. Ins-gesamt erweist sich das vorliegende Buch alsäußerst interessante Lektüre, weil es anhand desUntersuchungsgegenstandes, der Umweltakti-vitäten rund um den Fluss Pleiße und der hierfürverwendeten Primärquellen, die Interaktionenzwischen systemerhaltenden und regimekriti-schen Kräften in Leipzig nachzeichnet.Zuletzt noch eine Anmerkung: Jürgen Habermashat im Vorwort zum 1990 neu aufgelegten„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ im Zusam-menhang mit dem Verhältnis von politischerÖffentlichkeit und Privatsphäre Folgendes festge-stellt: „Anders als der Ausschluss der unterprivile-gierten Männer hatte die Exklusion der Fraueneine strukturbildende Kraft.“ (S. 19)Mit diesen Worten reagiert Habermas auf die anihm geübte Kritik, dass er nämlich bei seinerAnalyse den Ausschluss von Frauen aus öffentli-chen Sphären unberücksichtigt ließ und diesesomit auf theoretischer Ebene zum zweiten Malausschloss. Dieses Problem zeigt sich übrigensauch im Mainstream der Transformationsfor-schung seit Anfang der neunziger Jahre, in derGeschlechterverhältnisse nicht einmal angedachtwerden. Nachdem Habermas selbst Mängel sei-nes in den sechziger Jahren verfassten „Struktur-wandels“ eingestanden hat, beschreitet Rühlevierzig Jahre später den selben Weg.Zu diskutieren wäre letztendlich, inwiefern jeneauf westeuropäische Wirklichkeiten konzipiertenTheoriemodelle überhaupt auf Tranformations-prozesse Osteuropas anwendbar sind, oder obnicht verstärkt induktive Vorgangsweisen bevor-zugt werden sollten.
Silvia Nadjivan
JÖRG REQUATE (HRSG.): EuropäischeÖffentlichkeit. Transnationale Kommu-nikation seit dem 18. Jahrhundert.Frankfurt/Main: Campus-Verlag 2002,328 Seiten.
Europa wächst zusammen. Mit dieser anlässlichder EU-Erweiterung vielfach strapazierten Fest-stellung öffnet der Klappentext dieses Buches,allerdings ohne in Verdacht zu geraten, sich in dielange Reihe jener einzugliedern, die sobald einStehsatz etabliert wurde, diesen eifrig und unre-flektiert anwenden. Diese Gefahr tut sich hiernicht auf, da das Buch mit Erscheinungsjahr2002 (und Ursprung in einer Tagung im Geistes-wissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kul-tur Ostmitteleuropas [GWZO] in Leipzig imJahr 1999) noch aus einer Zeit stammt, in der dieinflationäre Verwendung dieser Floskel keinThema war. Außerdem wird hier – und das istviel bedeutsamer – ein deutlicher Gegenentwurfzum unbedachten Gebrauch von Begrifflichkei-ten gemacht.Angeregt durch einen während des Bosnienkon-flikts 1995 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitungerschienenen Artikel, der angesichts der querdurch Europa feststellbaren Empörung über dieKriegsgräuel de facto die Formierung einereuropäischen Öffentlichkeit konstatierte, wirdversucht, den „konstruktiven und damit wandel-baren Charakter des Europabegriffs und die dar-aus folgende Offenheit des Begriffs der europäi-schen Öffentlichkeit“ (Requate/Schulze Wessel:Europäische Öffentlichkeit: Realität und Imagina-tion einer appellativen Instanz, S. 12) aus einerhistorischen Perspektive genauer zu bestimmen.Der Band greift nun im 18. Jahrhundert begin-nend unterschiedliche Situationen, Krisen undKonflikte, in denen Europa oder eine europäischeÖffentlichkeit Adressat von (politischen) Hilfs-und Unterstützungsappellen wurde, auf undblickt dabei auf die veränderlichen „Elemente derkommunikativen Herstellung Europas“ (S. 13).Dabei gliedert sich das Buch in zwei Teile: Einenersten, in welchem „Der Appell nationaler undreligiöser Gruppen“ und einen zweiten in dem„Europäische Öffentlichkeit in Kriegen und revo-lutionären Umbrüchen“ behandelt werden. Wasdabei vorweg festgestellt und später durch dieBeispiele bestätigt wird, ist der Zerfall „der“Öffentlichkeit in eine Vielzahl von Teilöffentlich-keiten. Diese werden abhängig von der Partei, dieden Appell entrichtet, von den direkten Adressa-ten – sprich auf welchen konkreten Europabegriffaus dem pluralen Fundus konkurrierender Euro-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 48
49
m&z 2/2004
pavorstellungen sich die appellierende Gruppebezieht und durch wen sie diesen Europabegriffvertreten sieht (vgl. S. 17ff.) – und von den Mit-teln, die zur Verbreitung des Appells eingesetztwerden, konstituiert. Gerade in den Aufsätzen, die sich mit in der zeit-lichen Abfolge früher angesiedelten Ereignissenbefassen, wie etwa jene von Francois Guesnet(Strukturwandel im Gebrauch der Öffentlichkeit:Zu einem Aspekt jüdischer politischer Praxis zwi-schen 1744 und 1881, S. 43-62) und MartinSchulze Wessel (Religiöse Intoleranz, grenzüber-schreitende Kommunikation und die politische Geo-graphie Ostmitteleuropas im 18. Jahrhundert, S.63-78) wird dabei deutlich, dass die Kommuni-kation, durch die Anliegen verbreitet werden soll-ten, vor allem auf persönlichen Netzwerken, Für-sprache und Korrespondenz mit ausgewähltenVertretern einer Adressinstanz fußte. Dadurchwird zweierlei deutlich: 1.) Die so geschaffeneÖffentlichkeit ist primär keine Öffentlichkeit, diesich auf disperse Massen stützt, sondern eine derExperten, der Einflussreichen und deren Einflü-sterer; die Öffentlichkeit ist kein zwingenderBegriff der Breite, sondern einer der Relevanzund der potenziellen Durchsetzungsmöglichkeit.Wobei natürlich gerade im Hinblick auf dieDurchsetzung von Interessen eine zusätzlicheMobilisierung von Solidarität und Zustimmunginnerhalb der Bevölkerung von Adressstaatenhilfreich war, um die Einsicht der politischenEntscheidungsträger in die Relevanz eines Anlie-gens bzw. in die Opportunität einer Reaktiondarauf zu unterstützen. In letzter Konsequenz waraber für den Handlungserfolg eines Appells an„Europa“ , nicht die Art oder gefundene Zustim-mung des Appells letztentscheidend, sondernmachtpolitische Eigeninteressen der Angespro-chenen, wie Schulze Wessel am Beispiel der „Pra-ger Juden“ und „Thorner Protestanten“ zeigt.Umso bedeutender wird es daher 2.) für denAppell in eigener Sache jenes „Europa“ bzw. jeneTeile Europas anzusprechen, die aufgrund ihrerEigeninteressen am ehesten für das Anliegen zugewinnen sein könnten; eine Strategie die sich biszur tumben Unterteilung in altes und neuesEuropa durchzieht.Ein weiteres in mehreren Aufsätzen wiederkeh-rendes Element im Bemühen um die Herstellungvon Öffentlichkeit, ist der Versuch durch „dieSchaffung von Versammlungsöffentlichkeiten“(S. 33), etwa durch die Abhaltung von Kongres-sen oder Gründung von Organisationen Nieder-schlag in der Presseberichterstattung zu finden,Kontakte zu Politikern herstellen zu können und
internationale Netzwerke zu anderen Gruppenaufzubauen. Einen besonders interessantenZugang zu dieser Art der Kongressöffentlichkeitfindet Michael Berkowitz in seinem Aufsatz überTheodor Herzl und den Baseler Konrgess von1897, den er als „Beispiel für die Schaffung einermassenmedial gestützten jüdischen Öffentlich-keit in Europa“ (S. 81) skizziert. Unter Bedacht-nahme auf den von Walter Benjamin geprägtenBegriff des „optischen Unbewussten“ (der mehr-fach angedeutet, aber nicht als strenger theoreti-scher Leitfaden durchgezogen wird) sucht er nachden „Mythen, Erinnerungen, Werten und Sym-bolen [...] des modernen Judentums“ (S. 80) diegeschaffen wurden um eine „neue jüdischeÖffentlichkeit herzustellen“(ebd.).Mit Mythen und Symbolen befasst sich auchThomas Scheffler ein Stück weit, wenn er zumFunktionswandel „orientalischer“ Gewalt ineuropäischen Öffentlichkeiten fragt, inwieweitder Orient zur Konstituierung europäischerÖffentlichkeit beitrug. Durch ein diffus verzerr-tes Bild des „Orient“ als ein ideell entgegenge-setztes pauschaliertes Bezugsmodell wurde esmöglich eine Einheit „Europa“ als kontradiktori-sches Konzept in einem Wort zu denken. Eine Veränderung dieser Gegenüberstellung setztwesentlich nach dem Zweiten Weltkrieg (vgl. S.227ff ) – in dem Europa als bestehende kulturelleEinheit vorerst auch als Vorstellung verunmög-licht wurde – ein, da sich die Trennlinien ver-schoben und die europäische (westliche) Polemiknun vor allem gegen die kommunistischen Regi-me gerichtet war. Nach der Ölkrise von 1973wurde es, durch wirtschaftliche Bindungen undAbhängigkeiten gefördert, notwendig einen vor-sichtigen Dialog an Stelle der prinzipiellen Kon-frontation zu setzen. Diese Schilderung, die anwandelbaren und wechselhaften realpolitischenKonstellationen festgemachte unterschiedlicheBewertung des Orient bzw. der „orientalischenGewalt“ in europäischen Öffentlichkeiten, mün-det dann auch in der Feststellung, dass hier „kei-neswegs kulturessentialistische Konstanten“ (S.230) sondern eben besagte politische Konstella-tionen ausschlaggebend sind.Insgesamt zeigt sich, in den besprochenen Bei-spielen wenig überraschend, dass „je weiter manin das 20. Jahrhundert vordringt, desto wichtigerwerden die Massenmedien für die Konstituierungvon Massenmedien“(S. 273), wie Michael A.Schmidtke seinen Aufsatz über 1968 und dieMassenmedien eröffnet. Belegt wird diese Theseauch durch Sören Brinkmanns Beispiel über denSpanischen Bürgerkrieg, in dem er zeigt, wie die-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 49
50
m&z 2/2004
ser Konflikt stärker als jemals zuvor in Bildernvermittelt und von den unterschiedlichen politi-schen Strömungen bzw. Blöcken genutzt wurde,um Öffentlichkeit im eigenen ideologischenSinne zu bestärken. Ergänzend dazu schreibtStefan Troebst über „nationalrevolutionäre Be-wegungen auf dem Balkan und die RessourceWeltöffentlichkeit“. Schmidtke selbst erschließtsich zunächst den Begriff „Gegenöffentlichkeit“um dann die „spezifische Logik der Medienbe-richterstattung [speziell unter Berücksichtigungdes Fernsehens] einerseits und den Aktionsstrate-gien der Protestbewegungen andererseits“ (S.275) herauszuarbeiten. Seine Erläuterungen zurKultur- und Medienkritik bringen gewohnteVokabeln aus der Frankfurter Schule bzw. der„Dialektik der Aufklärung“ ein. Diese werdenspäter dort relevant, wo erklärt wird, dass sichAusdrucksformen des studentischen Protestes oft-mals deshalb nicht direkt strategisch an die Mas-senmedien wandten, da sich der Protest an eineForm der Öffentlichkeit richten sollte, die sichden Hervorbringungen und manipulativenMechanismen der Kulturindustrie zu entziehenglaubte bzw. sich ihrer entziehen wollte. DieseZielöffentlichkeiten waren dabei – wenn es auchinternationale Konzentrationen gab – primärnationale Öffentlichkeiten. So musste auch dieStudentenschaft, wie zum Schluss des Aufsatzesam Beispiel Rudi Dutschkes in Prag festgehalten,erkennen, dass sich ihre Anliegen nicht unmittel-bar auf andere Länder übertragen ließen (vgl. S.294). Am Ende des Buches kehren Jörg Requateund Matthias Vollert unter dem Titel „Die Lie-ben und die Bösen“ quasi zum Ausgangspunktder Überlegungen zurück und äußern sich „ZurDiskussion um den Jugoslawienkonflikt inDeutschland und Frankreich (1990 bis 1996)“.Die Frage, ob es sich um eine europäische Debat-te oder lediglich um nationale Debatten zu einemeuropäischen Thema handelt, endet einmal mehrin einer Abkehr von der holistischen Vorstellungeines Europa, einer europäischen Öffentlichkeitund einer europäischen Debatte. Der Band mün-det so in einer Feststellung, die zuvor durch eineVielzahl an konkreten Beispielen nachhaltig illu-striert wurde. Was anzumerken bleibt, ist dasshier oft – allein aufgrund der wissenschaftlichenProvenienz der Autoren – eher Geschichte vonKommunikation als Kommunikationsgeschichtebetrieben wird, was durchaus mehr als einesemantische Spitzfindigkeit ist, aber nicht scha-det, sondern im Gegenteil interessante Ansatz-punkte für Diskussionen aufwirft. Requate undSchulz Wessel haben ein durchweg interessantes
(Lese-)Buch herausgegeben, an das zu denkensein wird, wann immer les- oder hörbar festge-stellt wird: Europa wächst zusammen.
Christian Schwarzenegger
MARIETTA BEARMAN / CHARMAIN BRINSON /RICHARD DOVE / ANTHONY GRENVILLE / JENNIFER
TAYLOR: Wien – London, hin und retour.Das Austrian Centre in London 1939 bis1947. Wien: Czernin Verlag 2004, 287Seiten.
„Da war Keiner und Keine, denen die neue Bar-barei nicht Lebenswichtiges geraubt hatte. Exi-stenz, Vermögen, Familienband. Kinder ohneEltern. Eltern ohne Kinder. Und mit einemLebenswillen und mit Heldenmut ohnegleichenschritten sie Alle an den Aufbau einer neuen Exi-stenz. (…) Und der Centre nahm sie alle in sei-nen Schoß.“ (S. 18) Korrespondierend zu denLebenserinnerungen des regelmäßigen BesuchersWilhelm Jerusalem betonte auch die Mitarbeite-rin Eva Kolmer in einem Schreiben an die Redak-tion des „Spektator“ die zutiefst menschlicheIntention der Institution „Austrian Centre“: Siespricht von einem ambitionierten Projekt „wohindie vielen Flüchtlinge, die in finsteren Quartierenoder in Unterkünften leben, die sie tagsüber zuräumen haben, kommen könnten, um zu lesen,zu schreiben, Unterricht zu nehmen und sichumschulen zu lassen, eines Ortes, wo sie musizie-ren und alle möglichen Kunstveranstaltungenorganisieren können.“ (S. 16) Egal mit welchemForschungsfokus man sich der österreichischenEmigration nach England in den Jahren 1934 bis1945 nähert, in der wissenschaftlichen Literaturbleibt eine Begegnung mit dem „Austrian Cent-re“ bzw. dessen Exponenten in Form der Exil-bühne „Laterndl“, der Zeitschriften „Zeitspiegel“,„Young Austria“ und „Austrian News“ sowie derpolitischen Organisationen „Young Austria“ und„Free Austrian Movement (FAM)“ nicht aus.Freilich krankte die diesbezügliche Auseinander-setzung bislang an einem von zwei Symptomen:So erlaubten basale Nachschlage- und Standard-werke wie etwa Helene Maimanns „Politik imWartesaal“ allein eine streifende, kursorische Dar-stellung des „Austrian Centre“ respektive seinesUmfelds. Dagegen bewegten sich zweifelsfreiwertvolle Detailstudien, entgegen dem wissen-schaftstheoretischen Paradigma der fächerüber-greifenden Vernetzung, allein in den innerdiszi-plinären Grenzen und spiegelten damit letztend-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 50
51
m&z 2/2004
lich allein einen schmalen Ausschnitt, einenMikrokosmos im Mikrokosmos der LondonerExilanten wider. Berechtigten Anlass zur Hoff-nung auf Überbrückung dieser interdisziplinärenKlüfte gab die Konstituierung einer „Österreichi-schen Gesellschaft für Exilforschung“ anno 2002.Angesichts eines auf ökonomische Verwertbarkeitabzielenden und damit für Historiographie genu-in forschungsfeindlichen Klimas droht diesesengagierte Projekt allerdings an finanziellen Hür-den zu scheitern. Wenig überraschend also, dassdie nun vorliegende, eine Gesamtsicht der Lei-stungen des „Austrian Centre“ bietende Publika-tion von einem fünfköpfigen Autorenteam ausEngland verfasst wurde. Die fünf Wissenschaft-lerinnen und Wissenschaftler arbeiten am „Rese-arch Centre for German and Austrian Exile Stu-dies“ an der Universität London und konntenbereits durch maßgebliche Publikationen zumösterreichischen Exil in England auf sich auf-merksam machen. Charmian Brinson, dessenwissenschaftliche Beschäftigung mit der politi-schen Arbeit des „Free Austrian Movement(FAM)“ bereits in deutscher und englischer Spra-che vorliegt, bewegt sich im vorliegenden Bandim Rahmen von vier Beiträgen auf dem gewohn-ten Terrain Politik. Dabei spannt er den Bogenvon den Anfängen des „Austrian Centre“, diebald von politischen Grabenkämpfen gekenn-zeichnet waren, bietet im zweiten Aufsatz einenÜberblick über die weltanschaulichen Publikatio-nen des FAM, skizziert sodann die Bemühungender „Austrian Centre“-Aktivisten um politischeAkzeptanz durch das Gastgeberland um im letz-ten Beitrag gemeinsam mit Marietta Bearman,den finalen Akt, die Schließung der Institutionnachzuzeichnen. Mag eine Beschäftigung Brin-sons mit dem neuen Thema Musik anfänglichverwundern, erschließt sich durch seine Aus-führungen der Konnex zur Politik bald unzwei-felhaft. Im Bemühen des „Austrian Centre“, derbritischen Gesellschaft das Bild eines eigenständi-gen Österreich und einer von Deutschland unab-hängigen Nation zu vermitteln, konnte wenigerder Weg der politischen Propaganda, denn derPfad der Kultur beschritten werden. Vor allemdas Medium Musik fand, durch sein ihm imma-nent innewohnendes Charakteristikum der Über-windung von Sprach- und Kulturbarrieren, vir-tuose Anwendung. Brinson verweist in diesemKontext ergänzend auf eine Studie, die bei derAuswahl der zur Aufführung kommendenMusikdarbietungen eine deutliche Fokussierungauf österreichische Komponisten (Haydn, Schu-bert, Mozart inklusive der Wahlösterreicher
Beethoven und Brahms) erkennen lässt. (S. 153) Der mittlerweile emeritierte Germanistikprofes-sor Richard Dove deckt in seinen Ausführungendie weiteren, vielfältigen kulturellen Aktivitätender Formationen rund um das „Austrian Centre“ab und lässt auch hier keinen Zweifel über diepolitische Dimension der Produktionen entste-hen. Egal ob in der Reihe „Free Austrian Books“damals aufstrebenden jungen Autoren wie ErichFried eine publizistische Plattform gebotenwurde, in der Bühne „Laterndl“ Jura Soyfers zeit-kritische Stücke zur Aufführung gelangten oderim Rahmen der Revue „Blinklichter“ Martin Mil-lers Hitlerparodie „Der Führer spricht“ nicht nurreges Publikumsinteresse, sondern auch eine Ein-ladung zur Präsentation via BBC-Radio zur Folgehatte – im Kern zielten sämtliche Bemühungendarauf ab, die künftige Unabhängigkeit Öster-reichs in den Köpfen des Publikums zu manife-stieren. Das beachtliche publizistische Spektrum des„Austrian Centre“ in Form von „Zeitspiegel“,„Young Austria“ und „Austrian News“ wird vonJennifer Taylor auf – vermutlich die Buchpro-duktion bedingenden – knappen 24 Seiten abge-handelt. Mag das eingangs von der Forschergrup-pe postulierte Ziel, die mangelnde „analytischeTiefe und historische Objektivität“ bisheriger,vielfach autobiografischer Veröffentlichungenzum „Austrian Centre“ zu überwinden (S. 10),durchaus Einverständnis und Interesse erzeugen,darf dennoch Rezeption und Berücksichtigungbestehender Veröffentlichungen erwartet werden.Im Falle von Jennifer Taylor drängen sich hin-sichtlich dieses Faktums mit einiger BerechtigungZweifel auf: „Heute lässt sich kaum mehr nach-vollziehen, ob die Herausgeberschaft des ,YoungAustria’ all die Jahre seines Erscheinens hindurchdieselbe blieb, doch gibt es Hinweise darauf, dassGeorg Breuer, 1942 erst sechzehn Jahre alt, bisKriegsende und darüber hinaus die Funktion desChefredakteurs ausübte.“ (S. 71) Ein Blick in die2003 erschienene Autobiografie Georg Breuers,vielmehr noch ein Gespräch mit dem via öster-reichischem Telefonbuch problemlos auffind-und kontaktierbaren Exiljournalisten hätte ver-mutlich Licht in diese dunkle Angelegenheitgebracht. Ein virtuelles Fragezeichen schwebtauch über der offensichtlichen Negation – derangesichts der heimischen Forschungsrealitätnicht unwesentlichen Größe – der grauen Litera-tur respektive der studentischen Abschlussarbei-ten. Selbst bei kontextrelevanten Titeln wie „VonKarl Ausch bis Stefan Wirlander. 34 Biografienösterreichischer Journalisten im Exil in Großbri-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 51
52
m&z 2/2004
tannien ab 1933“ oder „Österreichische Exilpu-blizistik in Großbritannien 1939 bis 1946. Der„Zeitspiegel“. Möglichkeiten und Grenzen rezi-pientenorientierter Ansätze in der Exilforschung“schien für die Beiträgerin eine Kenntnisnahmeoffensichtlich von geringem Interesse. Allein ausforschungsökonomischen Erwägungen über-rascht schließlich die vollständige Ausblendungeines von 1992 bis 1997 am Institut für Publizi-stik- und Kommunikationswissenschaft der Uni-versität Wien durchgeführten Forschungsprojek-tes. Resultat dieser Arbeit eines mehrköpfigenTeams war unter anderem eine Datenbank, dieeine formale und inhaltliche Erschließung aller in„Zeitspiegel“ und „Young Austria“ erschienenBeiträge beinhaltet. Vor dem Hintergrund derTatsache, dass vor allem die ersten beidenAbschnitte der vorliegenden Publikation in wei-ten Teilen mit Texten aus diesen Exilzeitschriftenbestritten werden, erzeugt der fehlende Verweisauf Projekt und via Internet zugänglicher Daten-bank Unverständnis. Eine wesentliche Erweiterung des bisherigen For-schungsspektrums stellen zweifelsfrei die Re-aktionen der britischen Presse auf die Aktivitätendes Centres, die Akzeptanz bzw. die Wahrneh-mung der Mehrheitsgesellschaft dar. So erhellenddie Perspektive der Außensicht im Falle Englandsist, so irritierend wirkt sie vereinzelt beim Blickauf die Situation in Österreich. „Das Unvermö-gen der Sozialdemokraten, den Angriffen desautoritären Dollfuß-Regimes im Februar 1934nachhaltig Widerstand zu leisten, und das folgen-de Verbot ihrer Organisationen hatte den Kom-munisten zwar die Stimme so manches desillusio-nierten Sozialdemokraten eingebracht.“ (S. 29)Die personelle Übermacht gepaart mit einerzweifelsfrei überlegenen Waffengewalt vonBundesheer und Heimwehr als „Unvermögen“des sozialistischen Schutzbundes zu titulieren,wird bei österreichischen Leserinnen und Lesernvermutlich wenig Einverständnis hervorrufen. ImHinblick auf weitere Studien wäre sicherlich auchein Zahlenbeleg für jene Feststellung, dass dieMehrheit der Exilösterreicher in Großbritannienblieb (S. 61), von wesentlichem Interesse.In Summe liegt hier ein Buch vor, das tatsächlicherstmals die vielschichtigen Vernetzungen des„Austrian Centre“ und seiner „Trabanten“ klar-legt. Vor dem Hintergrund der britischen Realitätund der Ziele der Organisation bietet die Lektü-re überaus klärende Einsichten und spannendeAnsichten. Dennoch verdeutlicht die Publikationeinmal mehr: Begegnung zweier verschiedenerKulturen – der Exilantinnen und Exilanten mit
der britischen Mehrheitsgesellschaft gestern, derbritischen und der österreichischen Exilfor-scherinnen und -forscher heute – kommen seltenohne kleinere Missverständnisse aus. So gilt es imBereich Exilforschung besonders, nicht nur dieinterdisziplinären, sondern auch die transnatio-nalen Grenzen der Forschung zu überwinden.
Gaby Falböck
VEDRAN DZIHIC: Intellektuelle in der jugos-lawischen Krise. Rolle und Wirken derpostjugoslawischen unabhängigen Intel-lektuellen in Wien. Frankfurt am Main:Peter Lang Verlag 2003, 213 Seiten.
Wie bereits der Titel verspricht, wird in dem vor-liegenden Buch die Rolle von Intellektuellenbezogen auf die jugoslawischen Kriege der neun-ziger Jahre untersucht. Bei dem Versuch denBegriff des/der „Intellektuellen“ zu definieren,kommt Vedran Dzihic bald zu dem Schluss, dasssich eine Theoretisierung und demzufolge eineOperationalisierung, obgleich etlicher Studiendazu, als schwierig gestalten. In diesem Zusam-menhang bespricht er Ansätze von Pierre Bour-dieu, Antonio Gramsci, Julien Benda, Jean-PaulSartre und Michel Foucault, entscheidet sichletztlich für die Intellektuellen-Definition vonEdward Said. Diesen Schritt argumentiert Dzihicdamit, dass Saids Begriffsbestimmung, in dem1997 veröffentlichten Werk „Götter, die keinesind“, „eine brauchbare Trennlinie zwischen denunabhängigen Intellektuellen und den nichtautonomen und im Dienst der Politik und derMachtstrukturen stehenden Intellektuellenschafft“ (S. 26). Dass sich Dzihic „der Akzentu-ierung der westlichen Literatur“ (S. 44) bei seinertheoretischen Ausarbeitung bewusst ist, macht erspätestens an der hier zitierten Stelle deutlich.Bevor der Autor auf Saids Einteilung von Intel-lektuellen näher eingeht, erläutert er den Bedeu-tungswandel von dieser gesellschaftlichen Gruppeim Kontext politischer Entwicklungen seit densiebziger Jahren in Westeuropa und verstärkt seitdem Ende des bipolaren Systems, insbesondereseit dem kriegerischen Zerfall des ehemaligenJugoslawien. Mehrere Stränge im Rahmen dieserEntwicklungen können laut Dzihic beobachtetwerden, so beispielsweise jene Dimension, die dieFrage nach der „Eingliederung in und Instrumen-talisierung durch die Machtstrukturen“ wie auchdie Frage nach der „Freiheit und Unabhängigkeitder Intellektuellen“ (S. 31) aufwirft. Im Folgen-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 52
m&z 2/2004
53
den beschäftigt sich der Autor mit Definitionenvon Macht und Unabhängigkeit und gelangt zurEinsicht Edward Saids, wonach es die völligeUnabhängigkeit von geistiger Kapazität nichtgeben kann. Unter diesem Aspekt vergleicht Dzi-hic die Position von Intellektuellen in West- undOsteuropa und erkennt, dass in realsozialistischenLändern regimekritische Intellektuelle nicht dieMöglichkeit hatten, die „öffentliche Meinung“(S. 41) zu beeinflussen. Die Ursache dafür orteter in der schwachen Ausprägung der „Öffentlich-keit“. Vermisst wird an dieser Stelle eine nähereDefinition und exaktere begriffliche Trennungvon „Öffentlichkeit“ und „öffentliche Meinung“.Als den nächsten wichtigen Unterschied zwischenwest- und osteuropäischen Intellektuellen mar-kiert der Politologe Dzihic „die Unterscheidungvon Intellektuellen und ‚Intelligencija’“ (S. 42),wobei die zweite Gruppe sinngemäß als Instru-mentarium der sozialistischen Herrschaftselitefungierte und regierungsunabhängige (kritische)Intellektuelle (die es der kommunistischen Ideo-logie nach nicht geben konnte) ersetzte.Nach seinen theoretischen Ausführungen zurBedeutung der besagten gesellschaftlichen Grup-pe in West- und Osteuropa lenkt Dzihic denBlick auf den Untersuchungsgegenstand des ehe-maligen Jugoslawien sowie dessen Nachfolgestaa-ten seit Anfang der neunziger Jahre. Unter demFokus „Krise“ und „Exil“ rollt der Autor dieTransformationsprozesse vor, während und nachden kriegerischen Konflikten (der neunzigerJahre) auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawi-en auf. Wie sich die Situation und der Einflussvon Intellektuellen im Tito-Jugoslawien gestalte-te, verdeutlicht der Autor anhand seiner tief grei-fenden gesamtgesellschaftlichen Analyse. JeneIntellektuelle, die im Zuge der jugoslawischenKrise die jeweiligen nationalistischen Republikse-liten ideologisch unterstützten, begreift Dzihic als„Vor-Denker“ (S. 98) der kriegerischen Konflikteder neunziger Jahre, wobei er sich vor allem aufEinschätzungen von WissenschafterInnen ausdem ehemaligen Jugoslawien bezieht. Mancheseiner InterviewpartnerInnen wie beispielsweiseBogdan Bogdanovic deklarieren „Staatsintellek-tuelle“ (Slavenka Drakulics Definition, s. S. 93)als „Halbintellektuelle“. Gegenüber gestellt wer-den diesen die „Nach-Denker“ (S. 109) des Krie-ges, jene Intellektuelle, die aufgrund ihrer oppo-sitionellen Tätigkeiten entweder ins innere oderäußere Exil getrieben wurden oder sich trotz derstaatlichen Repressionen gegen das Regime enga-gierten. Beispiele dazu führt Dzihic in Serbien,Kroatien und Bosnien-Herzegowina an.
Eine besondere Stellung räumt der Autor Wienals einem Ort postjugoslawischer Intellektuellerein. Anschließend an seine einfühlsamen Erläute-rungen zum Leben im Exil, die vor allem auf dieWerke der Anfang der neunziger Jahre emigrier-ten kroatischen Schriftstellerin Dubravka Ugresicbasieren, analysiert Dzihic die Situation undAktivitäten von (post)jugoslawischen DenkerIn-nen in ihrem historischen Zusammenhang. Erbeleuchtet letztendlich Vereine, Initiativen, Zeit-schriften und Buchhandlungen als Forum desAustauschs wie auch zum Teil des Versuchs man-cher Intellektueller, von außen auf die politischenEntwicklungen in den jugoslawischen Nachfolge-staaten Einfluss zu nehmen.Die vorliegende Studie liefert einen zugleich tie-fen wie auch berührenden Einblick in das Bezie-hungsgeflecht von politischer Krise, Intellektua-lität und Exil, wobei der Autor seinen normativenbzw. moralischen Anspruch an die Funktion vonIntellektuellen eindeutig erkennen lässt.
Silvia Nadjivan
RICHARD W. DILL: Neue Demokratien –neuer Rundfunk. Erfahrungen mit derMedientransformation in Osteuropa.(= MARkierungen. Beiträge des Münch-ner Arbeitskreises öffentlicher Rundfunk3) Münster: LIT Verlag 2003, 174 Seiten.
Der Band 3 der von Walter Hömberg herausge-gebenen Reihe MARkierungen – Beiträge desMünchner Arbeitskreises öffentlicher Rundfunkbietet einen Erfahrungsbericht des langjährigenAuslandskoordinators der ARD, Richard W. Dill.Dieser hat mehrfach, unter anderem im Auftragder Unesco, als Medienberater in Reformstaatengearbeitet. Zuletzt etwa im Kosovo, wo er amAufbau des public service broadcasters RTK inführender Rolle mitwirkte. Dieser Bericht stelltdie Erfahrungen im Aufbau dieses Rundfunksen-ders in den Mittelpunkt. Dill geht in seinenErläuterungen weitgehend chronologisch vor –von den ersten Schritten über den Sendestart biszu den unmittelbaren Erfahrungen danach. DerBericht tritt auf weiten Strecken als „leidenschaft-liches Plädoyer“ (Hömberg) für das Modell desPublic Broadcasting auf, changiert zwischenRückblicken auf Dills berufliche Erfahrungenund dessen politische Sozialisation sowie den im Erzählstil gehaltenen Erinnerungen an dieZeit im Kosovo. Ergänzt wird der Band durchgrundlegende Überlegungen zu Medienfrei-
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 53
54
m&z 2/2004
heit und Mediengesetzgebung (s. Anhang).Hömberg leitet den Band ein – den Anspruch derReihe MARkierungen stets zwischen den Zeilenmitgeschrieben – indem er die zentralen Merk-male von Transformationsprozessen in ost-europäischen Ländern nennt: Momente derDemokratisierung, Modernisierung und Heraus-bildung marktwirtschaftlicher Strukturen, diesich in Westeuropa im Laufe von Jahrzehntenentwickelten – „hier laufen sie gleichzeitig ab“(S. 5). In diesem „Dilemma der Gleichzeitig-keit“ (Ebd.) arbeitete auch der Autor diesesBandes.Dill berichtet aus der Praxis der Transformationvormals kommunistischer Mediensysteme. DerAnspruch des Bandes ist somit schon in der Anla-ge weitgehend geklärt: Erzählungen, Anekdotenund Anekdötchen reihen sich aneinander, dasBuch ist durchgängig flott geschrieben – im dop-pelten Wortsinn. Der Autor präsentiert einedurchaus lebendige Innensicht der Demokratisie-rungsprozesse in Reformländern, gespickt mit an-schaulichen Beispielen infrastruktureller Defizite(etwa des Computermangels) als auch elementa-ren Schwierigkeiten im Umgang mit der „Masse“.Jener „Masse“, die zu einer demokratischenGesellschaft und pluralistischen Öffentlichkeitgeformt werden soll. Oder besser: sich nichtzuletzt mit Hilfe des weder staatlichen noch kom-merziellen Rundfunksenders RTK selbst formensoll. Der doppelte Bezugsrahmen des (Rund-funk-)Journalismus als Subsystem der Öffent-lichkeit sowie als konstituierendes Element dieser schwingt in den Erzählungen vom Um-
gang mit „content“, Kapital und Personal stets mit.Der wissenschaftliche Gebrauchswert dieses Ban-des ist in der Zusammenschau der normativenAnsprüche Dills, der theoretischen Annahmender Transformationsprozesse und der konkret fas-sbaren Rahmenbedingungen („constraints“) zusehen. Die konkret fassbaren Transformationen,ihre Erfolge und Probleme lassen sich schnell ausden vielen Appetithäppchen herausschälen, dieDill anbietet. Dass in der praktischen Umsetzungoft der normative Anspruch verwässert wird, lässtsich etwa anhand des pragmatisch-praktizisti-schen Umgangs mit „Alltagsproblemen“ inReformstaaten erläutern. So berichtet Dill zwarvom Anspruch, „populären und nützlichen“Rundfunk machen zu wollen, Public Broadcastzwischen Kommerz und staatlichem Rundfunkansiedeln zu wollen (S. 10), macht aber kein Hehldaraus, dass der Weg dorthin ein steiniger ist.Den größten Nutzen entfaltet die 160-seitige,phasenweise an Memoiren gemahnende Erzäh-lung in ihrem Charakter als eine biographischeQuelle für die wissenschaftliche Analyse vonTransformationsprozessen. Diese auf die Akteurs-ebene fokussierte Quelle ist jedoch in eine Wech-selbeziehung mit Normen-, Struktur- und Hand-lungsebene zu stellen. Erst aus diesen Interdepen-denzen ist letztlich herauszulesen, ob und wie einMediensystem die Transformation zu einerdemokratisch und pluralistisch verfassten Einheitgeschafft hat.
Bernd Semrad
m&z 2/2004 Kern/v07 15.06.2004 7:06 Uhr Seite 54
Bei Unzustellbarkeitbitte zurück an:
A-1180 Wien, Postfach 442
P.b.b.,Erscheinungsort Wien,Verlagspostamt 1180 Wien,2. Aufgabepostamt 1010 Wien
ZN: 02Z033628 M
zeit&medienmedien & zeit
NEUERSCHEINUNG
Die Spirale des Schweigens. Zum Umgang mit der nationalsozialistischenZeitungswissenschaft.
Der Band will erhellen, wie nach 1945 mit demErbe der NS-Zeitungswissenschaft in Deutsch-land und Österreich umgegangen wurde. Wie inanderen wissenschaftlichen Disziplinen verdeck-ten Jahrzehnte des Schweigens folgenreich perso-nelle und inhaltliche Kontinuitäten, verhinder-ten die Remigration vertriebener ForscherInnenund behinderten die Modernisierung des Faches. Das noch junge Fach wurde durch die NS-Herr-schaft in seiner vielfältigen Entwicklung jähgebrochen, ab 1933 zunächst zu einer politi-schen Führungswissenschaft degradiert, danachzur Kriegswissenschaft. Willfährige Vollstrecker,junge Aufsteiger, angepasste Mitläufer und stillDuldende benötigte dieses System. Noch immer zeigen sich weiße Flecken in derErkundung der „braunen“ Vergangenheit.Renommierte AutorInnen aus Deutschland, derSchweiz und Österreich stellen sich in diesemBuch brennenden Fragen nach Wurzeln derheutigen Kommunikationswissenschaft.
m&z 2/2004 Umschlag/v02 11.06.2004 17:32 Uhr Seite 4


























































![[Mit Isabelle Vonlanthen and Ulrich Schmid], Nationale Gemeinschaftskonzepte. Der Dichter als Volkserzieher, in: Ulrich Schmid (Hg.), Schwert, Kreuz und Adler. Die Ästhetik des nationalistischen](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63177d347451843eec0ab0ee/mit-isabelle-vonlanthen-and-ulrich-schmid-nationale-gemeinschaftskonzepte-der.jpg)
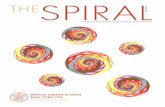







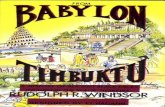
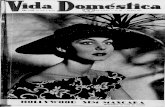
![EXHIBIT "A-1" [Hollywood Inventory] - Internet Archive](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63364472e687b37e4f0611b6/exhibit-a-1-hollywood-inventory-internet-archive.jpg)