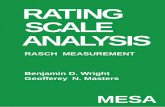Republikanischer Liberalismus. Benjamin Constants Staatsverständnis
-
Upload
ruhr-uni-bochum -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Republikanischer Liberalismus. Benjamin Constants Staatsverständnis
Lem
bcke
/Web
er (H
rsg.
) • R
epub
likan
isch
er L
iber
alis
mus
ST
AA
TS
VE
RS
TÄ
ND
NI
SS
E
Im Zentrum der Reihe Staatsverständnisse steht die Frage: Was lässt sich den Ideen früherer und heutiger Staatsdenker für ein zeitgemäßes Verständnis des Staates entnehmen?
Constant ist lange Zeit einseitig als Gewährsmann für die liberale Tradition politi-schen Denkens in Anspruch genommen worden. Diese Rezeptionslinie lässt sich von den Liberalen des Deutschen Vormärz, die sich in ihrer Kritik des monarchischen Prinzips auf Constants Version einer konstitutionellen Monarchie berufen, bis hin zu Isaiah Berlin ziehen, der Constant zum Ahnherren seiner Unterscheidung zwischen positiver und negativer Freiheit stilisiert.
Die Constant-Forschung hat dieses vorherrschende Interpretationsmuster durch einige bahnbrechende Arbeiten in den letzten dreißig Jahren in Frage gestellt. Sie hat gezeigt, dass Constants politisches Denken tiefe Wurzeln in der republikanischen Tradition besitzt und Freiheit nicht auf einen rechtlich garantierten privaten Verfü-gungsraum reduziert, sondern im Kontext der Sorge um den Erhalt des politischen Gemeinwesens betrachtet. Der Band dokumentiert Meilensteine dieses interna-tionalen Diskurses über Constant, die größtenteils zum ersten Mal in deutscher Sprache vorgelegt werden.
Herausgeber:
Oliver W. Lembcke hat zurzeit eine Professur für Politische Theorie und Ideen-geschichte an der Universität Leipzig inne.Florian Weber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Uni versität Jena.
59
ISBN 978-3-8329-5296-9
Republikanischer Liberalismus
Oliver W. Lembcke Florian Weber (Hrsg.)
Benjamin Constants Staatsverständnis
Nomos
BUC_Lembcke_5296-9.indd 1 16.10.13 09:25
Staatsverständnisse
Herausgegeben von Rüdiger Voigt Band 59
Wissenschaftlicher Beirat:
Virgilio Afonso da Silva, São Paulo Klaus von Beyme, HeidelbergWolfgang Kersting, KielHerfried Münkler, BerlinHenning Ottmann, MünchenWalter Pauly, JenaPier Paolo Portinaro, TorinoRyuichiro Usui, TokyoLoïc Wacquant, BerkeleyBarbara Zehnpfennig, Passau
BUT_Lembcke_5296-9.indd 2 21.10.13 09:22
Oliver W. Lembcke/Florian Weber (Hrsg.)
Republikanischer Liberalismus
Benjamin Constants Staatsverständnis
Nomos
ohne Titel!!!!
BUT_Lembcke_5296-9.indd 3 21.10.13 09:22
1. Auflage 2013© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8329-5296-9
Lektorat: Anja Borkam
BUT_Lembcke_5296-9.indd 4 21.10.13 09:22
5
Editorial
Das Staatsverständnis hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder grundlegend gewandelt. Wir sind Zeugen einer Entwicklung, an deren Ende die Auflösung der uns bekannten Form des territorial definierten Nationalstaates zu stehen scheint. Denn die Globalisierung führt nicht nur zu ökonomischen und technischen Verände-rungen, sondern sie hat vor allem auch Auswirkungen auf die Staatlichkeit. Ob die „Entgrenzung der Staatenwelt“ jemals zu einem Weltstaat führen wird, ist allerdings zweifelhaft. Umso interessanter sind die Theorien der Staatsdenker, deren Modelle und Theorien, aber auch Utopien, uns Einblick in den Prozess der Entstehung und des Wandels von Staatsverständnissen geben, einen Wandel, der nicht mit der Globalisierung begonnen hat und nicht mit ihr enden wird.
Auf die Staatsideen von Platon und Aristoteles, auf denen alle Überlegungen über den Staat basieren, wird unter dem Leitthema „Wiederaneignung der Klassiker“ immer wieder zurück zu kommen sein. Der Schwerpunkt der in der Reihe Staats-verständnisse veröffentlichten Arbeiten liegt allerdings auf den neuzeitlichen Ideen vom Staat. Dieses Spektrum reicht von dem Altmeister Niccolò Machiavelli, der wie kein Anderer den engen Zusammenhang zwischen Staatstheorie und Staatspraxis verkörpert, über Thomas Hobbes, den Vater des Leviathan, bis hin zu Karl Marx, den sicher einflussreichsten Staatsdenker der Neuzeit, und schließlich zu den Weimarer Staatstheoretikern Carl Schmitt, Hans Kelsen und Hermann Heller und weiter zu den zeitgenössischen Theoretikern.
Nicht nur die Verfälschung der Marxschen Ideen zu einer marxistischen Ideologie, die einen repressiven Staatsapparat rechtfertigen sollte, macht deutlich, dass Theorie und Praxis des Staates nicht auf Dauer von einander zu trennen sind. Auch die Verstrickungen Carl Schmitts in die nationalsozialistischen Machenschaften, die heute sein Bild als führender Staatsdenker seiner Epoche trüben, weisen in diese Richtung. Auf eine Analyse moderner Staatspraxis kann daher in diesem Zusam-menhang nicht verzichtet werden.
Was ergibt sich daraus für ein zeitgemäßes Verständnis des Staates im Sinne einer modernen Staatswissenschaft? Die Reihe Staatsverständnisse richtet sich mit dieser Fragestellung nicht nur an (politische) Philosophen, sondern vor allem auch an Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften. In den Beiträgen wird daher zum einen der Anschluss an den allgemeinen Diskurs hergestellt, zum anderen wer-den die wissenschaftlichen Erkenntnisse in klarer und aussagekräftiger Sprache – mit dem Mut zur Pointierung – vorgetragen. So wird auch der / die Studierende unmittelbar in die Problematik des Staatsdenkens eingeführt.
6
Mit dem Forum Staatsverständnisse wird Interessierten zudem ein Diskussions-forum auf der Website www.staatswissenschaft.de eröffnet, um sich mit eigenen Beiträgen an der Staatsdiskussion zu beteiligen. Hier können z.B. Fragen zu der Reihe Staatsverständnisse oder zu einzelnen Bänden der Reihe gestellt werden. Als Reihenherausgeber werde ich mich um die Beantwortung jeder Frage bemühen. Soweit sich dies anbietet, werde ich von Fall zu Fall bestimmte Fragen aber auch an die HerausgeberInnen der Einzelbände weiterleiten.
Prof. Dr. Rüdiger Voigt
7
Vorwort
„Ich glaube an die Revolution, weil ich an Sie glaube.“ – In einem Brief vom 9. Juli 1799 findet sich diese Geste der Ehrerbietung, gerichtet an Emmanuel Joseph Sieyès. Die Worte stammen von Benjamin Constant, der anders als Sieyès nicht zur ersten, sondern zur zweiten Generation der politischen Denker des Revolutionszeit-alters gehört. In ihnen spiegelt sich die Hoffnung wider, dass die Autorität von einst seinen wiedererstarkten Einfluss nutzen solle, um das Erbe der Französischen Revo-lution bewahren. Nur welches? Eine Kernthese unserer Arbeiten zum politischen Denken von Sieyès in den letzten Jahren zielte darauf, diesen als Vertreter einer französischen Variante des demokratischen Konstitutionalismus vorzustellen. Für eine solche These lassen sich in der Literatur nicht allzu viele Verbündete heran-ziehen. Einer der ältesten Waffenbrüder an der Seite und im Geiste von Sieyès ist Benjamin Constant – das hat ihn für uns zunächst interessant gemacht. Die ein-gehendere Beschäftigung mit diesem Denker hat jedoch bald schon ergeben, dass Constant zwar oft im Munde geführt, aber selten verstanden wird. Gerade im deut-schen Sprachraum hat er längst noch nicht die Aufmerksamkeit erfahren hat, die ihm als ein herausragender Vertreter des modernen demokratischen Verfassungsstaates zustehen sollte. Dem Ziel, ein breiteres Publikum mit seinem Werk bekannt zu machen, dient daher der vorliegende Band. Ein Rückgriff auf die Beiträge im nationalen Rahmen genügt dafür jedoch nicht; um die Rezeption des politischen Denken Constants angemessen zu rekonstruieren, bedarf es des Ausgriffs auf den internationalen Diskurs.
In diesem Sinne freut es uns, die folgende Melange an Constant-Forschern prä-sentieren zu können, die zugleich zu den namhaften Vertretern der politischen Theo-rie und der Ideengeschichte gehören – darunter: drei Amerikaner (Bryan Garsten, Stephen Holmes, Helena Rosenblatt), zwei Franzosen (Patrice Higonnet, Lucien Jaume), drei Deutsche (Lothar Gall, Karlfriedrich Herb, Daniel Schulz) sowie einen Luxemburger (Norbert Campagna) und eine „Kosmopolitin“, die offenbar in der italienischen, französischen und englischen Welt gleichermaßen zu Hause ist und ihren derzeitigen Sitz in der Schweiz hat (Biancamaria Fontana). Aus diesem Auto-renpool stammen die wesentlichen Beiträge der Constant-Forschung der letzten drei-ßig Jahre. Um den Zugang zu diesen Texten zu erleichtern, sind die Beiträge der ausländischen Wissenschaftler übersetzt worden. Bekanntlich ein mühevolles Ge-schäft, an dem sich dankenswerter Weise eine Reihe von Personen mit unterschied-lichen Aufgaben und Fertigkeiten, aber mit durchweg hohem Engagement beteiligt
8
haben: Wir danken herzlich Lukas Stewart (HSU Hamburg), Janek Löbel (FSU Je-na), Richard Nennstiel und Luisa K. Schmidt (Universität Leipzig) für ihre Bereit-schaft zur Mitarbeit. Und wir sind froh, auch bei diesem Band auf das bewährt gründliche Lektorat von Anja Borkam vertrauen zu dürfen. Unser Dank geht darüber an die verschiedenen Verlage, die uns die Erlaubnis für den Abdruck der verschie-denen Texte eingeräumt haben (siehe die Einzelnachweise am Ende des Bandes).
Übersetzungen sind nicht nur eine mühevolles Aufgabe; im universitären Alltag wird es schnell auch zu einem langwierigen Geschäft; wir danken daher in beson-derer Weise dem Reihenherausgeber Professor Dr. Rüdiger Voigt für die umsichtige Betreuung und die Geduld, die er gegenüber diesem Projekt aufgebracht hat.
Hamburg/Berlin im September 2013 Oliver W. Lembcke und Florian Weber
9
Inhaltsverzeichnis
Oliver W. Lembcke und Florian Weber Einleitung: Constants republikanischer Liberalismus 13
I. ALTE UND MODERNE FREIHEIT
Karlfriedrich Herb Triumph des Individuums – Ende des Bürgers? Constant über die Freiheit der Modernen 25
Bryan Garsten Religion als politisches Argument. Benjamin Constants vergessene Vorlesungen über die Geschichte der Religion 41
Lucien Jaume Constant und die „Freiheit der Modernen“ 73
Helena Rosenblatt Benjamin Constants Liberalismus in neuem Lichte: Industrialismus, Saint-Simonismus und die Restaurationszeit 115
II. PRINZIPIEN UND PRAXIS DER POLITIK
Norbert Campagna Zwischen Prinzipienlosigkeit und Prinzipientyrannei: Die Rolle der „principes intermédiaires“ in Moral, Politik und Recht 137
Biancamaria Fontana Grenzen des Fortschritts – Constants Wandlungen im Nachdenken über den geschichtlichen Wandel 157
Daniel Schulz Liberale Metamorphosen der Republik. Benjamin Constants Konstitutionalismus zwischen institutioneller Strategie und Bürgergeist 183
10
III. STAAT UND VERFASSUNG
Stephen Holmes Constants Prinzipien einer Verfassungsarchitektur 203
Patrice Higonnet Constant und der amerikanische Föderalismus 229
Lothar Gall Die Rolle des Monarchen im Verfassungsstaat: Constants Lehre vom „pouvoir neutre“ 245
Textnachweise 281
Autorenverzeichnis 283
13
Oliver W. Lembcke und Florian Weber
Einleitung: Constants republikanischer Liberalismus
Die Diskussion zwischen republikanischen und liberalen Ansätzen ist ein Dauer-thema der Politischen Theorie. Ob unter dem älteren Label „Gesellschaft versus Ge-meinschaft“ oder unter dem jüngeren „Liberalismus versus Kommunitarismus“ – in Auseinandersetzungen zwischen liberalen und republikanischen Ansätzen wird stets die zentrale Frage verhandelt, welche Stellung dem Politischen in der Moderne zu-kommt. Die beiden Traditionen geben auf diese Gretchenfrage der Politischen Theo-rie unterschiedliche Antworten: Während der Liberalismus von der Freiheit des Individuums ausgeht und der Politik die Aufgabe zuweist, die individuellen Frei-heitsräume durch Rechtssetzung und -durchsetzung zu schützen, ist Freiheit für den Republikanismus selbst eine politische Größe: Erst in einem freien Gemeinwesens – einer Republik – können die Bürger auch ihre individuellen Handlungsspielräume in einem bedeutungsvollen Sinn ausleben.
Einer der ersten, der diese Gretchenfrage der Politischen Theorie in unmissver-ständlicher Klarheit formuliert hat, ist Benjamin Constant. In seiner berühmten, 1819 gehaltenen Vorlesung mit dem Titel Die Freiheit der Alten im Vergleich zu der der Heutigen skizziert er in idealtypischer Weise ein liberales (Freiheit der Moder-nen) und ein republikanisches (Freiheit der Alten) Freiheitsverständnis. Constants plakative Zuweisung des republikanischen Freiheitsverständnisses zur vormodernen Denkweise und seine gegen die jakobinische Auslegung des Republikanismus ge-richtete Deutung, der revolutionäre Terror sei ein Resultat des unzeitgemäßen Versuchs, das klassische Tugendideal unter neuzeitlichen Bedingungen zu aktuali-sieren, haben in der politischen Ideengeschichte dazu geführt, ihn vorrangig als Bannerträger des Liberalismus und Kritiker des Republikanismus wahrzunehmen.
Maßgeblich verantwortlich für diese liberale Vereinnahmung Constants ist Isaiah Berlin1, der Constant als Gewährsmann für seine eigene Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit heranzieht.2 Bis heute prägt diese Zuordnung die
1 Berlin 1972. 2 Constants Unterscheidung zwischen alter und moderner Freiheit ist vielschichtiger als die
Berlins zwischen positiver und negativer Freiheit. Vgl. hierzu Weber 2004, S. 200 ff.
14
Rezeption von Constant, und zwar in beiden Lagern des politischen Diskurses: John Rawls ordnet in seinem Werk Political Liberalism Constant ebenso der liberalen Tradition zu3 wie Philip Pettit in seiner Studie Republicanism4. Bezeichnenderweise tituliert Pettit das liberale Freiheitsdenken als „Berlin-Constant framework“5: „Constant’s modern liberty is Berlin’s negative liberty, and his ancient liberty – the liberty of belonging to a democratically self-governing community – is the most prominent variety of Berlin’s positive conception.“6
In der Constant-Forschung ist diese plakative Sichtweise in den vergangenen dreißig Jahren zunehmend in Frage gestellt worden. Die an Pettits Einschätzung erinnernde These des Constant-Experten Guy Howard Dodges aus dem Jahre 1980 findet unter den zeitgenössischen Constant-Kennern kaum noch Zustimmung: „Constant’s distinction between ancient and modern liberty is the same as Sir Isaiah Berlin’s between positive and negative freedom.“7 Eine Abkehr von dieser bis in die frühen 1980er Jahre dominierenden abwehrrechtlich-liberalen Lesart bewirkte Stephen Holmes bahnbrechendes Werk Benjamin Constant and the Making of Modern Liberalism8, der auf die demokratietheoretische Fundierung von Constants Konstitutionalismus hinweist und den Fokus auf die Bedeutung politischer Freiheit für das Werk Constants lenkt. Bezüge zur republikanischen Tradition des politischen Denkens stellte Biancamaria Fontana, Herausgeberin der englischen Werkausgabe Constants9, in ihrer Monographie Benjamin Constant and the Post-Revolutionary Mind heraus10, indem sie auf die Bedeutung der Geschichtlichkeit11 für Constants politisches Denken verweist. Diese beiden Werke bereiteten für die zeitgenössische Constant-Forschung einen neuen Boden, auf dem das Denken Constants seine Kontur erst im Spannungsfeld liberalen und republikanischen Gedankenguts erhält.
Für diese Neuausrichtung lassen sich zwei Gründe anführen: Während ältere Arbeiten sich mit den publizierten Schriften Constants begnügt hatten – den Früh-schriften der thermidorianischen Phase und der Zeit des Direktoriums und seinen
3 Rawls 1993, S. 206, 299. 4 Pettit 1997, S. 18, 50. 5 Pettit 1997, S. 27. 6 Pettit 1997, S. 18. 7 Dodge 1980, S. 42. 8 Holmes 1984. 9 Constant 1988. 10 Fontana 1991. 11 Gegenüber der Transzendenz des Politischen in theologischen oder naturrechtlichen Theorien
betonen republikanische Ansätze die Immanenz des Politischen. Republikanismus setzt eine „Säkularisierung“ (Pocock) der historischen Zeit voraus. Vgl. Jainchill 2008, S. 32.
15
späten Schriften nach 1813 –, griffen Holmes und Fontana auf Archivmaterialien zurück, die Constants Arbeiten während der napoleonischen Ära umfassen. Diese Arbeiten bilden den Nukleus seiner späteren, meist hastig redigierten und aus aktuellen politischen Anlässen publizierten Schriften, sie umfassen aber darüber hinaus theoretische Grundlagenreflexionen, die tiefer in Constants Theoriearchi-tektur blicken lassen als seine veröffentlichten Werke. Mit der Publikation dieser Archivmaterialen durch Étienne Hofmanns Edition der Urform der Principes de politique12 und Henri Granges Edition der Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays13 hat sich die Quellenlage für die Constant-Forschung wesentlich verbessert.
Zum anderen hat der Republikanismus, sowohl als ideenhistorische Deutungs-folie14 als auch als systematisches Theorieangebot15 eine Renaissance erfahren. Zu einem guten Teil handelt es sich um ein Phänomen innerhalb des angelsächsischen politischen Kulturraums, in dem das lange Zeit hegemoniale liberale Deutungs-muster eine ideengeschichtliche Rebellion geradezu herausforderte. Zunehmend fragen angelsächsische Ideenhistoriker jedoch auch nach den republikanischen Wur-zeln des kontinentaleuropäischen Denkens der Revolutionsepoche.16 Sie haben auf die Verbreitung des klassisch-republikanischen Idioms unter oppositionellen Den-kern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die intensive Rezeption angel-sächsischer Klassiker hingewiesen, deren Werke in der vorrevolutionären Epoche bereits vielfach in französischer Übersetzung vorlagen.17 Vor allem die spätere Pha-se der Französischen Revolution nach dem Sturz Robespierres, die in der marxi-stisch dominierten Historiographie als eine Phase der Reaktion diffamiert wurde, hat vor diesem republikanischen ideengeschichtlichen Hintergrund interessante Neube-schreibungen erfahren.18 Von hier aus ergeben sich neue und weiterführende Per-spektiven auch auf das Werk Constants.19
Die von Bailyn und Pocock angestoßene Debatte, die anfangs politisch-ideolo-gisch aufgeladen war und zu Grabenkämpfen um die „richtige“ Deutung der US-amerikanischen Verfassungsgeschichte führte, hat sich inzwischen abgekühlt und
12 Constant 1980. 13 Constant 1991. 14 Bailyn 1967; Pocock 1975. 15 Michelman 1988; Sunstein 1993; Pettit 1997. 16 Hammersley 2005; Gröschner/Lembcke 2011. 17 Zum Überblick: Rochedieu 1948. 18 Livesey 2001; Jainchill 2008. 19 Zum Beispiel Vincent 2000; Weber 2004.
16
„verwissenschaftlicht“.20 Von einander widerstreitenden Paradigmen sind Republi-kanismus und Liberalismus mittlerweile zu Kristallisationspunkten eines heuristi-schen Spannungsfeldes geworden, in dem sich die beiden Denkansätze zu Hybrid-formen verschränken und sich dadurch weder der einen noch der anderen Seite ein-deutig zuordnen lassen.21 Eine solche offene Deutungsfolie erweist sich für die Re-konstruktion des Constantschen Denkens als besonders fruchtbar. Während für sein Verständnis des Politischen und der politischen Ordnung eine Nähe zum Republika-nismus kennzeichnend ist – ablesbar an seiner geschichtlichen Denkweise und seiner Präferenz für eine demokratische Organisation der Gesellschaft –, zeigt sich sein Li-beralismus insbesondere im Verhältnis des Staates zu den gesellschaftlichen Berei-chen der Religion und Ökonomie, die er gegenüber politischer Bevormundung abschirmt.
***
Die Mehrzahl der in diesem Band zusammengestellten Aufsätze wurde für die Publikation ins Deutsche übersetzt. Bei jenen Schriften Constants, deren Über-setzung in der Werkausgabe von Axel Blaeschke und Lothar Gall (Constant 1970-1972) vorliegt, wurde diese Übersetzung zur Grundlage genommen, sofern die Autoren nicht eigene Übersetzungen vorgelegt haben. Die Werkausgabe von Blaeschke und Gall findet sich daher nicht in den jeweiligen Bibliographien eigens aufgeführt, stattdessen sind die einzelnen Nachweise nach folgendem Muster ange-geben worden, nämlich: „Werke“ nebst Band- und Seitenzahl sowie – zur leichteren Einordnung der Fundstellen – die folgenden Kurztitel in Klammern:
• Über die Stärke = Über die Stärke der gegenwärtigen Regierung Frank-reichs und die Notwendigkeit, sich ihr anzuschließen (Orig. De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier), Werke, Bd. 3, S. 33-118.
• Politische Reaktion = Über politische Reaktion (Orig. Des réactions poli-tiques), Werke, Bd. 3, S. 119-202.
20 Vgl. Rodgers 1992. 21 Eine ganz ähnliche Perspektive bezogen auf den Kontext des amerikanischen Verfassungs-
diskurses 1788/89 (und mit einem entsprechend programmatischen Titel) findet sich im Sammelband Die hybride Republik (2010); ausführlich zur strategischen Hybridisierung der beiden Strömungen durch die Federalist Papers Lhotta 2010.
17
• Eroberung und Usurpation = Vom Geist der Eroberung und der Usurpa-tion in ihrem Verhältnis zur europäischen Zivilisation (Orig. De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation euro-pénne), Werke, Bd. 3, S. 231-406.
• Grundprinzipien der Politik = Grundprinzipien der Politik, die auf alle re-präsentativen Regierungssysteme und insbesondere auf die gegenwärtige Verfassung Frankreichs angewandt werden können (Orig. Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et parti-culièrement à la constitution actuelle de la France), Werke, Bd. 4, S. 9-244.
• Freiheit = Über die Freiheit der Alten im Vergleich zu der der Heutigen (Orig. De la liberté des Aciens comparée à celle des Modernes), Werke, Bd. 4, S. 363-396.
• Perfektibilität = Über die Perfektibilität des Menschengeschlechts (Orig. De la perfectibilité de l’espèce humaine), Werke, Bd. 4, S. 397-422.
***
Die hier versammelten Aufsätze lassen sich in drei thematische Gruppen einteilen. Eine erste Gruppe von Aufsätzen setzt sich mit dem Freiheitsbegriff Constants im Rahmen des Themenfeldes Alte und moderne Freiheit auseinander. Karlfriedrich Herb legt in seinem Beitrag Triumph des Individuums – Ende des Bürgers? Constant über die Freiheit der Modernen einerseits den liberalen Kern von Constants Frei-heitsverständnis frei, zeigt jedoch zugleich, wie dieser von Constant selbst relativiert wird: Das von allen Bürgerpflichten befreite Individuum tendiert dazu, die Grund-lagen seiner Freiheit zu erodieren. Der Glaube an die harmonische Entfaltung der individuellen Kräfte und der auf ihm beruhende Fortschrittsoptimismus ist Constant abhandengekommen – durch seinen normativen Individualismus geht ein skepti-scher Riss: Auf die Idee der individuellen Freiheit fällt ein Schatten durch die von ihr heraufbeschworene Gefahr der Dekadenz. Die Tugend der Alten kehrt als Kor-rektiv wieder, ohne von Constant wirklich integriert zu werden.
Bryan Garsten knüpft an diese Problemdiagnose an und zeigt in seinem Aufsatz Religion als politisches Argument. Benjamin Constants vergessene Vorlesungen über die Geschichte der Religion Möglichkeiten einer Verknüpfung von liberaler Freiheitsidee und republikanischem Gemeinsinn auf. Im Hinblick auf Religion ist Constant einerseits durch und durch liberal – jegliche Formen von Zivilreligiosität, wie sie der jakobinische Republikanismus dekretiert, lehnt er kategorisch ab. Zu-gleich lenkt er den Blick jedoch auf die gesellschaftliche Integrationsfunktion von Religion, die in der Moderne nur dann ausgefüllt wird, wenn Religiosität frei von
18
jeglicher staatlicher Bevormundung bleibt. Constant bleibt bei dem Gegensatz von Alt und Modern nicht stehen, sondern transzendiert diesen durch die prima facie paradox anmutende Einsicht, dass es in der Moderne der Blick der Alten und ihr Interesse an der gesellschaftlichen Funktion der Religion selbst ist, die zur liberalen Freilassung des Glaubens führt.
Den positiven Gehalt abwehrrechtlich geschützter moderner Freiheit, den Garsten mit dem Begriff der „Selbstvervollkommnung“ abstrakt umreißt, füllt Lucien Jaume in seinem Aufsatz Constant und die „Freiheit der Modernen“ mit konkretem Inhalt. Es ist das moralische und politische Urteilsvermögen des „liberalen Subjekts“, das dieses zugleich zum Bürger qualifiziert. Die urteilenden Bürger bilden eine kritische Öffentlichkeit, die wiederum ein Forum bietet, in dem die individuellen Einstel-lungen und Meinungen transformiert werden können. Die Bedeutung der öffentli-chen Sphäre lässt sich daher auch nicht durch die Feststellung individueller Präfe-renzen ersetzen, da diese sich erst in der Öffentlichkeit bilden. Dies ist Constants republikanisches Argument für die Legitimation der repräsentativen Demokratie, das auf einer Konzeption des öffentlichen Raums als Sphäre des gemeinsamen Urteilens, nicht jedoch auf antikisierenden Tugendvorstellungen beruht.
Helena Rosenblatt überträgt in ihrem Beitrag Benjamin Constants Liberalismus in neuem Lichte. Industrialismus, Saint-Simonismus und die Restaurationszeit die Un-terscheidung zwischen Alt und Modern auf die (im 19. Jahrhundert neu entstehende) Disziplin der politischen Ökonomie. Sie fragt, wo Constants Denken zwischen den Alternativen von naturrechtlichen und positivistisch-szientistischen Ordnungsvor-stellungen verortet werden kann. Einerseits ist für Constant das Faktum moderner arbeitsteiliger Gesellschaften unhintergehbar, wodurch der Rückgriff auf vormoder-ne Ordnungskonzepte verstellt ist. Andererseits wendet sich Constant gegen die mo-dernistischen Organisationstheorien des (frühsozialistischen) „Industrialismus“, der Fortschritt, Entwicklung und Modernisierung koordinieren und planen zu können vermeint. Wie auf dem Gebiet der Religion erweist Constant sich auch im Bereich der Wirtschaft als ein Liberaler, der an eine freiheitliche Selbstorganisation der Ge-sellschaft glaubt – ohne freilich die Politik auf eine bloße Garantiefunktion autono-mer gesellschaftlicher Regelungskreisläufe zu reduzieren (wie die Aufsätze des drit-ten Teils zeigen werden). Wie auch Herb und Jaume betonen, gebricht es Constant am Glauben an einen sich selbst entwickelnden Liberalismus. Die Perspektive der Alten wird für ihn zum kritischen Korrektiv, der Moderne den Spiegel vorzuhalten.
Die Aufsätze des zweiten Themenfeldes Prinzipien und Praxis der Politik lenken den Fokus auf Constants methodisch-theoretischen Zugriff auf Politik. Die zentrale These von Norbert Campagna hebt darauf ab, dass Constant aus prinzipiellen Gründen antidogmatisch argumentiert. In seinem Aufsatz Zwischen Prinzipienlosig-keit und Prinzipientyrannei. Constants „principes intermédiares“ rekonstruiert er
19
Constants Lehre der zwischen Theorie und Praxis vermittelnden Brückenprinzipien, mit der dieser in seiner berühmten Auseinandersetzung mit Kant sein Argument für ein Notrecht auf Lüge begründet. Constant wage den Spagat zwischen einem „extremen Rigorismus“, den er an Kant kritisiert, und einem „absoluten Opportunis-mus“, der die Praxis für nicht prinzipiell theoriefähig hält. Diese antidogmatische, gleichwohl am Ideal prinzipiengeleiteter Praxis festhaltende Zwischenposition manifestiert sich im staatsrechtlichen Zusammenhang in Constants Forderung eines „Gnadenrechts“, das nicht als passives Gnadenrecht – die Prärogative des Souveräns zu begnadigen –, sondern auch als aktives Recht des Bürgers, Begnadigung einzu-fordern, gedacht wird.
Biancamaria Fontana legt den antidogmatischen Zug Constants an seinem Ver-hältnis zur Historizität politischer Ordnungen frei. Sie betont in ihrem Aufsatz Grenzen des Fortschritts – Constants Wandlungen im Nachdenken über den ge-schichtlichen Wandel die historische Fundierung von Constants Denken, die sich in der Abkehr von naturrechtlich oder kontraktualistisch begründeten Ordnungsmodel-len manifestiert. Zugleich wahrt er jedoch Distanz gegenüber dem Traditionalismus Burkes, der Geschichtsphilosophie Condorcets und szientistischen Fortschrittstheo-rien à la Saint-Simon. Die wichtigen politischen Fragen hat die Geschichte entschie-den, ohne dass daraus eine Logik der Entwicklung deduziert werden könnte. Die Geschichtlichkeit politischer Ordnung bewahrt ein Moment der Kontingenz, den Raum des politisch Möglichen – ein zutiefst republikanisches Motiv.
Die Stellung der republikanischen Motivik bei Constant ist das Thema von Daniel Schulz’ Beitrag Liberale Metamorphosen der Republik. Benjamin Constants Konsti-tutionalismus zwischen institutioneller Strategie und Bürgergeist. Er versteht Con-stants Schriften als Teil eines (post-)revolutionären Diskurses, in dem das Erbe des klassischen Republikanismus erneuert wird. Die Transformation der klassischen Idee einer freiheitlichen Verfassung des Gemeinwesens besteht in der liberalen Er-weiterung des Verfassungsbegriffs, die nun auch im technischen Sinne als ein En-semble von Regeln verstanden die Freiheit institutionell garantieren. Schulz rekon-struiert Constants Verfassungsdenken als eine „liberal-republikanische Synthese“.
Im dritten Teil des Bandes geht es um Staat und Verfassung bei Constant. Gegen die klassisch-liberale Lesart gewendet, die dem Konstitutionalismus vorrangig die Funktion der Limitierung staatlicher Gewalt zuspricht, zeigt Stephen Holmes in seinem Aufsatz Constants Prinzipien einer Verfassungsarchitektur, dass Constant auch auf die Frage einer Legitimierung staatlicher Autorität Bedacht nimmt. Ähnlich wie Lucien Jaume hebt Holmes Constants Vertrauen in die rationalisierende Kraft parlamentarischer Debatten und deren Wiederhall in einer breiten Öffentlichkeit hervor; Constant konzipiere repräsentative Demokratie als „government by dis-cussion“. Wie die Federalists auf der anderen Seite des Atlantiks suche er die Bür-
20
ger durch kluge Verfassungsarchitektur von der moralischen Zumutung der Tugend-haftigkeit zu entlasten, setze jedoch zugleich auf die Ausbildung von Bürgergeist und Gemeinsinn durch eine lebendige politische (Diskussions-)Kultur.
Wie groß die von Holmes angerissene geistige Nähe Constants zu den Vätern der amerikanischen Verfassung tatsächlich ist, zeigt Patrice Higonnet in seinem Beitrag Constant und der amerikanische Föderalismus. Über Vermittlung Jacques Neckers, der die Rolle eines Multiplikators für angelsächsisches Gedankengut im französi-schen Politikdiskurs einnimmt, rezipiert Constant frühpluralistische Ideen und macht sich die Argumentation der Federalists zu eigen, eine föderale Staatsorganisation ermögliche die Ausweitung des Republikprinzips auf Flächenstaaten. Wirkungsge-schichtlich betrachtet ist Constant jedoch ein einsamer Rufer im Walde – seine plu-ralistischen Ideen verhallen im zentralistischen Frankreich ungehört.
Der abschließende Beitrag von Lothar Gall Die Rolle des Monarchen im Verfas-sungsstaat widmet sich dem wohl bekanntesten Aspekt von Constants Verfassungs-theorie – seiner Lehre des pouvoir neutre. Gall führt Constants Funktionsbeschrei-bung des Staatsoberhaupts auf seine intensive Auseinandersetzung mit der engli-schen Verfassungsgeschichte zurück und zeigt einmal mehr, wie sehr Constants Denken durch Anregungen aus der angelsächsischen politischen Ideengeschichte geprägt ist. Seine Idee eines neutralen, die Einheit des Staates symbolisch repräsen-tierenden Monarchen belässt der dem souveränen Zugriff entwachsenen plura-listischen bürgerlichen Gesellschaft ihre Freiheit, dämmt jedoch zugleich ihre zentri-fugalen Tendenzen ein. Der pouvoir neutre ist der Schlusstein von Constants Verfas-sungsarchitektur, der ihre beiden tragenden Säulen, die Sphäre pluralistisch-demo-kratischer Präferenz- und Willensbildung in der Gesellschaft und die Sphäre reprä-sentativ organisierter Präferenztransformation und Willensformung im Staat mitein-ander verbindet.
Der Beitrag von Lothar Gall stammt aus dem Jahr 1963 und wurde somit vor der oben skizzierten Renaissance der Constant-Forschung verfasst. Sein Werk über Constant und dessen Rezeption im deutschen Vormärz ist in seiner Gründlichkeit der verfassungshistorischen Analyse nach wie vor mustergültig, ein Auszug daraus darf in einem Sammelband nicht fehlen, der den Anspruch erhebt, einen reprä-sentativen Überblick über die Meilensteine der Constant-Forschung zu geben. Ihr gemeinsamer Nenner ist ein Sensus für die Besonderheit von Constants politischem Denken: die Fähigkeit, prinzipiengeleitete Theorie an sich wandelnde historische Lagen anzupassen, ohne dabei zum Opportunisten zu werden. Constant ist damit ein genuin politischer Denker, wenn man Politik versteht als Kunst, Ordnung dort zu ermöglichen, wo der „Ordnungsschwund“ (Blumenberg) der Neuzeit dies gesell-schaftlich erforderlich macht. In Zeiten revolutionären Aufruhrs bedeutet ein solches Denken, den Fokus auf die stabilisierenden Rahmenbedingungen demokratischer
21
Ordnung zu lenken (die nicht notwendig selbst demokratisch sein müssen)22, in Zeiten autoritärer Reaktion hingegen um Liberalisierung und Demokratisierung. Constant ging es stets darum, Antworten auf diese Herausforderungen in einem moderaten Geist auszubalancieren. Diese Einsicht herausgestellt zu haben, ist das Verdienst der hier versammelten Aufsätze.
Literatur
Bailyn, Bernard, 1967: The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge/Mass. Berlin, Isaiah, 1972: Two Concepts of Liberty. In: Laslett, Peter/Runciman, W. G./Skinner, Quentin
(Hrsg.): Philosophy, Politics and Society. Oxford, S. 118-172. Constant, Benjamin, 1980: Les „Principes de politique“ de Benjamin Constant. Hrsg. von Étienne
Hofmann. Genf. Constant, Benjamin, 1988: Political Writings. Hrsg. von Biancamaria Fontana. Cambridge. Constant, Benjamin, 1991: Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution
républicaine dans un grand pays. Hrsg. von Henri Grange. Paris. Dodge, Guy Howard, 1980: Benjamin Constant’s Philosophy of Liberalism. A Study in Politics and
Religion. Chapel Hill. Fontana, Biancamaria, 1991: Benjamin Constant and the Post-revolutionary Mind. New Haven/Conn. Gall, Lothar, 1963: Benjamin Constant. Seine politische Ideenwelt und der deutsche Vormärz.
Wiesbaden. Gröschner, Rolf/Lembcke, Oliver W., 2011: Freistaatlichkeit. Prinzipien eines europäischen
Republikanismus, Tübingen.
Hammersley, Rachel, 2005: French Revolutionaries and English Republicans: The Cordeliers Club, 1790-1794. Woodbridge.
Holmes, Stephen, 1984: Benjamin Constant and the Making of Modern Liberalism. New Haven/Conn.
Jainchill, Andrew, 2008: Reimagining Politics after the Terror: The Republican Origins of French Liberalism. Ithaca/London.
Lembcke, Oliver W./Weber, Florian, 2010: Revolution und Konstitution: Zur politischen Theorie von Sieyès. In: Emmanuel Joseph Sieyès: Was ist der Dritte Stand? Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Oliver W. Lembcke und Florian Weber. Berlin, S. 13-89.
22 Constants Beiträge stehen in der Tradition der Verfassungsgarantien, wie sie u.a. prominent
von Sieyès’ entworfen worden sind, man denken bspw. an seine „jury constitutionannaire“ oder seinen „grand électeur“, vgl. hierzu Sieyès 2010 und 2013; zu Sieyès weiterführend Lembcke/Weber 2010; zum Vergleich von Sieyès „jury constitutionnaire“ und Constants „pouvoir neutre“ Weber 2005. – In kritischer Auseinandersetzung hierzu ist auch der Beitrag Condorcets zu würdigen, der demgegenüber die politischer Kontrolle demokratischer Politik mit allein demokratischen Mitteln favorisiert. Für eine ausführliche Diskussion hierzu vgl. Urbinati 2006, Kap. 6, ebenso Schulz 2010, S. 41.
22
Lhotta, Roland 2010: Die Federalist Papers und die moderne Politikwissenschaft: Der republikanische Institutionalismus von Hamilton, Madison und Jay, in: ders. (Hrsg.): Die hybride Republik. Die Federalist Papers und die politische Moderne, Baden-Baden, S. 99-123.
Livesey, James, 2001: Making Democracy in the French Revolution. Cambridge/London. Michelman, Frank, 1988: Law’s Republic. In: The Yale Law Journal, H. 8, S. 1493-1537.
Pettit, Philip, 1997: Republicanism. A Theory of Freedom and Government. Oxford. Pocock, John, 1975: The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic
Republican Tradition. Princeton/NJ.
Rawls, John, 1993: Political Liberalism. New York. Rochedieu, Charles Alfred, 1948: Bibliography of French Translations of English Works. 1700-1800.
Chicago.
Rodgers, Daniel T., 1992: Republicanism: The Career of a Concept. In: Journal of American History, H. 79, S. 11-38.
Schulz, Daniel, 2010: Einleitung: Condorcet und die Theorie der repräsentativen Demokratie. In: ders. (Hrsg.): Freiheit, Revolution, Verfassung. Marquis de Condorcet. Kleine politische Schriften. Berlin, S. 11-50.
Sieyès, Emmanuel Joseph, 2010: Was ist der Dritte Stand? Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Oliver W. Lembcke und Florian Weber. Berlin.
Sieyès, Emmanuel Joseph, 2013: The Essential Political Writings. Hrsg. von Oliver W. Lembcke und Florian Weber. Leiden, i.E.
Sunstein, Cass R., 1993: The Enduring Legacy of Republicanism. In: Elkin, Stephen L./Soltan, Karol Edward (Hrsg.): A New Constitutionalism. Designing Political Institutions for a Good Society. Chicago/London, S. 174-206.
Urbinati, Nadia, 2006: Representative Democracy. Principles and Genealogy. Chicago/London. Vincent, K. Steven, 2000: Benjamin Constant, the French Revolution, and the Origins of French
Romantic Liberalism. In: French Historical Studies, H. 4, S. 607-637. Weber, Florian, 2004: Benjamin Constant und der liberale Verfassungsstaat. Politische Theorie nach der
Französischen Revolution. Wiesbaden. Weber, Florian 2005: Verfassungsschutz als Demokratiefürsorge? Zur Theorie eines Verfassungswächters
bei Fichte, Sieyès und Constant, in: Der Staat, H. 44, 112-137.