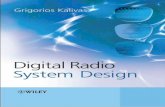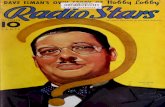Radio Chronik - Radiotechnik
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Radio Chronik - Radiotechnik
Telefunken T 5000, Baujahr 1950
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8. Kapitel — Die Radiogeschichte von 1950 bis 2000 +
Inhaltsverzeichnis
8.1 Der „Kopenhagener Wellenplan" zwingt Deutschland zu neuen Konzepten
8.2 Vorurteile in Deutschland
8.3 Armstrong wies den richtigen Weg
8.4 Deutschland bekommt die „Welle der Freude" — und ganz Europa wird neugierig
8.5 Mit den „Allglas-Serien" begann nicht nur das „UKW-Zeitalter" — auch das letzte Kapitel der „Röhrenradio-Geschichte"
8.6 Die „Goldenen Fünfziger"— UKW überrascht mit Spitzenleistungen
8.7 „HiFi" ist angesagt, und „3 D" Raumklang — Deutschland wird Radioexport-Weltmeister
8.8 Kurz, Mittel, Lang — nur auf den AM-Bereichen hörte man die Welt
8.9 Radios bestehen nicht nur aus Technik: Design in der Nachkriegszeit
8.10 Sollte man den „Transistor" wirklich ernst nehmen? Es gab da nämlich andere Probleme
8.11 Ernüchterung in der ganzen Branche — Überproduktion — die Japaner kommen
8.12 Schrumpfende Gewinne — der Handel im Umbruch — die Japaner wollen mehr
8.13 „Stereo-Rundfunk" und das Ende der kompakten Großgeräte
8.14 Die Radioröhre hat ausgedient — bei ihren Liebhabern lebt sie weiter
8.15 Abschied vom alten Radio — die neuen Bausteine sind durchweg mit Transistoren bestückt. Sollte man der abservierten Röhre nachweinen?
8.16 Hi-Fi-Quadrofonie — ein Stiefkind?
8.17 Integrierte Schaltungen. Drohende Gefahren — nicht nur aus Japan
8.18 Die Aussichten waren nicht rosig — die Betriebsergebnisse mager
8.19 Alle rechnen mit einer Erholungsphase — erhoffen höhere Renditen
8.20 Zwischen Hoffen und Bangen — doch das Ende war nicht aufzuhalten
1
Zuerst das Radio,
dann das eigene Auto,
auch wenn's nur
ein kleines ist...
Ludwig Erhard
sei's gedankt
Der einstige Schlager der Lloyd-Werke: Der »Leukoplastbomber« Lloyd LP 300.
2
6
5,9
7.3
2 5
0.4
4.9 -2.5
30 4 4
1971-80
‚2,8%
3,6 3.3
1951 53 55 57 59
Die Zeit des Aufschwungs, bald
Wirtschaftswunder genannt, beginnt.
Ludwig Erhards Ziel, Wohlstand für
alle, liegt zwar noch weit entfernt, der
Glaube daran wächst jedoch von
Jahr zu Jahr. Zunächst wirken sich
allerdings noch die Folgen des Kriegs
aus. Die Zahl der Arbeitskräfte steigt
1961 63 65 67 69
und damit die Zahl der Arbeitslosen.
Das bedeutet Konsumverzicht für
große Bevölkerungsteile. Das zuneh-
mende Warenangebot läßt zugleich
die Nachfrage steigen. Der Wirt-
schaftspolitik liegen die Prinzipien
der sozialen Marktwirtschaft zu-
grunde: Konsumfreiheit. Gewerbe-
1971 73 75 77 79 1980' • .;,,,,ese,
freiheit, Produktions- und Handels-
freiheit und Wettbewerbsfreiheit.
Das steile Wachstum nach 1951, das
heißt der Anstieg des Bruttosozial-
produkts, ist nicht von Dauer, wie die
Darstellung zeigt. In den späteren
Jahrzehnten flacht es mehr und mehr
ab.
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Schaubild zur Entwicklung der deutschen Industrie
in den Jahren von 1951 bis 1980
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8. Kapitel — Die Radiogeschichte von 1950 bis 2000 +
Zum Beginn der zweiten Jahrhundert-Hälfte waren die Fundamente gelegt — für ein friedlich prosperierendes Leben, das vom Streben nach Wohlstand erfüllt sein sollte. Überall wurde gebaut — es entstanden neue Fabri-ken — auch zur Produktion von Radiogeräten. Nur die Teilung Deutschlands blieb ein Stachel im Fleisch — noch vierzig Jahre mussten vergehen, bis auch dieses Unheil aus der Welt geschafft war.
8.1 Der „Kopenhagener Wellenplan" zwingt Deutschland zu neuen Konzepten
1950 hatten alle Radiofirmen, welche nicht durch die Währungsreform weggespült worden waren, die oft zitierte „Friedensqualität" erreicht. Der Anschluss an den Weltstandard war geschafft. Seit
1948 aber schwelte ein großes Problem in Deutschlands Rundfunkwesen: Im März 1950 würde der
„Kopenhagener Wellenplan" in Kraft treten, und der konnte fur den Mittelwellenempfang hierzulan-
de nur verheerende Folgen haben. Was denn hatten die „Kriegsverlierer" anderes zu erwarten, als
auch diese Bestrafung... Die internationale Fernmeldeunion beschloss 1948 auf ihrer Konferenz in Kopenhagen (auf der die
Deutschen draußen bleiben mussten), dass — ganz im Sinne des amerikanischen Morgenthau-Plans — das gesamtdeutsche Sendernetz zu Gunsten anderer Staaten rigoros ausgedünnt werden müsse.
Deutschland erhielt keine Exklusiv-Welle mehr. Den vier Besatzungszonen wurde ab 15. März 1950
jeweils nur noch eine Mittelwellenfrequenz zugestanden:
971 kHz — 309 m für die britische, 989 kHz — 303 m für die amerikanische,
1043 kHz — 288 m für die russische und 1196 kHz — 251 m für die französische Zone.
(Quelle: „Der Rundfunkhandel, Heft 1, Dezember 1948)
Nachdem all diese Wellen unter 310 m lagen, konnte man tagsüber keine großen Reichweiten erwar-
ten, und bei Nacht waren Empfangsstörungen vorprogrammiert, weil die gleichen Wellenlängen auch
von anderen europäischen Sendern mitbenutzt wurden. Darüber hinaus wurden den „viergeteilten Deutschen" noch vier weitere Wellenlängen unterhalb des
Bereichs der Mittelwelle zugeteilt. Zwischen 187 und 196 m angesiedelt, lagen die im so genannten
„Grenzwellenbereich", auf den zwar (außer in der Hochseeschifffahrt) niemand großen Wert legte (die meisten Radios konnten diese Wellenlängen gar nicht empfangen), der aber ebenfalls anderen
Sendern zur Verfügung stand.
Im November 1975 endlich, als die Wellenkonferenz in Genf tagte, „beeilten" sich die Teilnehmer,
das Diktat von 1948 zu revidieren, und mit Wirkung vom November 1978, also 30 Jahre nach der Kopenhagener Ausgrenzung, erhielt Deutschland wieder mehrere Mittelwellenfrequenzen. Da aber
registrierte man dieses „Wohlwollen" nurmehr am Rande — die Rundfunktechnik war längst von
„UKW" beherrscht — die Mittelwelle hatte von ihrer ursprünglichen Bedeutung sehr viel eingebüßt.
Zurück zur katastrophalen Situation im Jahr 1948. Noch strahlten in den drei Westzonen, die 1949
das Glück hatten, zur Bundesrepublik vereinigt zu werden, 18 zusätzliche Sender ihre Programme aus. Und weil der Mittelwellenbereich (200 ... 600 m) ohnehin total überbelegt war — auf den Plätzen
für 121 Sender tummelten sich deren 600 — konnte man in den Abendstunden eher Kauderwelsch als
ein einzelnes Rundfunkprogramm hören.
Noch Schlimmeres wurde fürs kommende Jahr , prognostiziert, wenn es ernst werden sollte —
SLa'S:rdir < 61, wenn das gefürchtete Diktat die meisten deut-
schen Sender zum Schweigen bringen würde.
Die „Funk-Technik" nahm's leichter und 7-11.4&,....cLesetd /It
schrieb in ihrem Leitartikel vom Mai 1949:
„Wie bereits in diesen Spalten mehrfach ausgeführt wurde, waren einflußreiche Tageszeitungen und
einige aktive Programmzeitschrifien überfüttert mit Berichten unter großen Schlagzeilen über die
„erschröcklichen" Auswirkungen des Kopenhagener Wellenplanes".
3
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Klar war zunächst nur dies: Es musste was getan werden. Also setzten sich die führenden Köpfe der Post, der Sendeanstalten und der Industrie zusammen und ersannen Abhilfe. Hochfrequenter Draht-funk sei die Lösung, das meinten die einen, der Gleichwellen-Rundfunk, realisierbar durch ein Netz schwacher Mittelwellensender wurde erwogen; auch der Kurzwellenrundfunk.
Für andersartig modulierte Sender in dem (für den Rundfunk zugelassenen) 3-m-Bereich plädierten die anderen. Angeführt wurden diese Verfechter der frequenz-modulierten Ultrakurzwelle von Prof. Dr. Werner Nestel, welcher — von Telefun-ken kommend — gerade zum richtigen Zeitpunkt technischer Direktor des NWDR (des Nord- West- Deutschen Rundfunks) geworden war.
Es wurde keine leichte Über- 1<- "1r J
zeugungsarbeit — die Skepti- Mr. I 1149 - IM41104PIG
ker hatten aus damaliger Sicht so unrecht nicht —
berichtete doch der „Radio-Händler" über UKW k Opesitraekruif 9111bA4401.?
8.2 Vorurteile in Deutschland
Schon Ende der Dreißiger war FM ein Diskussionsthema, in dem die kontroversen — vielleicht auch Amerika-feindlichen — Meinungen zu Tage traten. Was sich da vor und während des Zweiten Welt-kriegs abspielte, beschrieb Dr. A. Renardy sehr anschaulich in seinem Beitrag für die Fachzeitschrift „Das Radio-Magazin" vom März 1950:
„Die Möglichkeit, akustische Signale durch periodische Frequenzänderungen ebenso übertragen zu können wie durch Änderungen der Amplitudenhöhe war längst bekannt, als die Entwicklung Mitte der dreißiger Jahre durch das von E.A. Armstrong angemeldete amerikanische Patent 1 941 069 in Fluß kam. Im Gegensatz zu den daraufhin einsetzenden Veröffentlichungen vor allem in der Tagespresse Ameri-kas behauptete Armstrong nichts anderes, als daß Frequenzmodulation bei Ultrakurzwellen Vorteile böte, weil in diesen Frequenzbereichen atmosphärische und elektrische Störungen ihre entscheiden-de Bedeutung verloren hätten, so daß fast ausschließlich das Geräterauschen die Möglichkeiten der Verstärkung begrenze. Dieses aus Röhren-, Widerstands- und Kreisrauschen zusammengesetzte Ge-räterauschen sei in der Hauptsache amplitudenmoduliert, so daß es bei Frequenzmodulation und Demodulation mit einem auf Amplitudenmodulation nicht ansprechenden Detektor wesentlich unter-drückt werden könnte. Angesichts dieser Sachlage tauchte schon bald der Verdacht auf der Rummel um die Frequenzmodu-lation sei eine geschickt inszenierte [...] Angelegenheit interessierter Kreise. Dieser Verdacht ist in den letzten 15 Jahren immer wieder aufgetaucht und ausgesprochen, aber niemals durch Beweise erhärtet worden. Nach den Aufzeichnungen von Dr. F.C. Salg formulierte ihn ein führender Direktor einer deutschen Weltfirma zu Beginn des zweiten Weltkrieges wie folgt: ,Die Neuerfindung der Frequenzmodulation ist ja doch nicht viel anderes als eine rein geschäftlich gedachte Maßnahme, dazu bestimmt, dem Empfängerabsatz, der in den USA infolge Überproduktion ohne Zweifel stockt, neue Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben in Europa weder Zeit noch Lust noch Geld genug, um — im Hinblick auf unsere ganz anders gelagerten Marktverhältnisse — derartige vo-rübergehende Modetorheiten zu kopieren.' Damals liefen in den USA, vor allem in den dichtbesiedelten Gebieten an der Ostküste, über 100 FM-Sender, während man sich in Deutschland nur theoretisch mit Frequenzmodulation befaßte. Das än-derte sich, als Dr. F. C. Saig für die Luftwaffenforschung eingezogen wurde und Frequenzmodulation
4
YON Oß.1.4ü K 2E1MCM
in Amerika: „Das Wallstreet-Journal schreibt: Die Angelegenheit der Frequenzmodulation befindet sich bei uns in einem schlechten Zustand. Die Senderunternehmungen verlieren daran Geld. Die Hörer kaufen die Empfänger für diese Stationen nicht in der erwarteten Anzahl. Daher gehen überall fi-equenzmodulierte Sender wieder ein".
In Deutschland ist das anders — befand Werner Nestel — die Amerikaner haben nicht die Mittelwel-lenprobleme. Warum aber musste es Frequenzmodulation sein — warum nicht Amplitudenmodulation? Weil bei AM atmosphärische und sonstige Störungen den Empfang mitunter ungenießbar machten.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
selbst als Arbeitsgebiet wählen konnte. In Eindhoven wurde unter der Leitung von Prof Dr. v.d. Pohl ein Forschungsinstitut errichtet, dem eine Studiengesellschaft Hamburg unter Dr. E. Busse zugeord-net war. Korrespondierend waren mit dem Forschungsinstitut verbunden: das Forschungsinstitut der
AEG, Telefunken (Rothe, Roder), Lorenz (Dr. Rochow), das Heinrich-Hertz-Institut für Schwin-
gungsforschung. Es bestanden Abteilungen für Apparatebau und -entwicklung bei Lorenz, Telefun-
ken, Dietz & Ritter, Blaupunkt und Graetz, für Antennen beim Heinrich Hertz-Institut, bei Friesecke
und Höpfner, für Quarze bei Gibely, Prag, und schließlich für Mitarbeiter in Spezialfragen. An fol-
genden Orten sind bis März 1943 frequenzmodulierte Sender auf Kurz- und Ultrakurzwellen ständig
oder zeitweilig in Betrieb gewesen:
Eindhoven ,Sonnenblume UKW max. 6 kW; Hamburg KW und UKW, max. 160 W; Athen KW, max. 25 W; Berlin-Nord KW, 20 W; Syrakus KW, 20 W; Biarritz KW, 20 W [usw.]. Außerdem stand eine Ju 52 als fliegendes Behelfslaboratorium zur Verfügung, mit der in Höhen bis zu 5200 m gearbeitet worden ist.
Es würde zu weit führen, hier auf die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft einzugehen. Sie sind von Dr. Saig in einer aufschlußreichen Zusammenstellung festgehalten. Nachdem die Arbeitsgemein-
schaft im März 1943 ,Heldenklau zum Opfer gefallen war, sind ihre Ergebnisse durch die Kriegser-
eignisse, Bomben und Unverständnis verlorengegangen, zumindest aber in die Winde verstreut wor-
den. Es entbehrt nicht der Tragik, daß die Aufzeichnungen und umfangreiches Material von Dr. Saig im April 1943 zum Betrieb der Zentralheizung einer Villa benutzt worden sind."
Es war also mal wieder der Krieg, genauer: die vom Militär in Auftrag gegebenen Forschungen, wel-che die deutschen Techniker schlauer gemacht haben. Jetzt wurden die Vorbehalte gegen FM nicht mehr so lautstark vorgetragen — auch nicht von dem im Aufsatz von Dr. Renardy genannten „führen-den Direktor einer Weltfirma".* Und so konnte Dr. W. Nestel dem von ihm favorisierten Sendeverfahren zum Durchbruch verhelfen: Der FM-UKW-Rundfunk im Drei-Meter-Band wurde beschlossen. Wäre Professor Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker federführend gewesen, dann hätte man nach dessen Meinung weder den Rundfunk der neuen Art gebraucht, noch den alten. Der „Radio-Händler" nämlich berichtete in seinem Dezember-Heft 1950: „ Wußten Sie schon, daß Prof von Weizsäcker in
seinem „Göttinger Vortrag" die verderbliche Wirkung des Rundfunks noch über die der Atombombe stellte? Die vernichtende Kritik eines Wissenschaftlers an den Rundfunkprogrammen" — meinte der „Radio-Händler"...
* Telefunken versäumte nicht, sich die Armstrong-Schutzrechte für Deutschland zu sichern
8.3 Armstrong wies den richtigen Weg
Auch die Fachleute, welche sich schon in den Jahren zuvor mit UKW-Versuchssendungen befasst hatten, ahn-ten 1948/49 nicht entfernt, dass die Weichenstellung, welche dem UKW-Funk freie Fahrt signalisierte, nicht nur für Deutschland, sondern schließlich auch europa-weit zur Geburtsstunde einer geradezu revolutionären Änderung der Hörergewohnheiten werden sollte. Wie aber sah es mit der technischen Realisierung dieses neu-en Verfahrens aus? Recht gut, denn im Grunde war es so neu nicht.
Konnte man doch auf die Erfindungen des Herrn Arm-strong aus Amerika zurückgreifen, der als Wegbereiter des (amplitudenmodulierten) Überlagerungsprinzips ge-würdigt wurde, und auch schon mit der Pendelrückkopp-lung experimentierte.
Die Funkindustrie verdankt dem ameri-
kanischen Erfinder Edwin H. Armstrong epochale Neuerungen.
5
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Pendelrückkopplung alt, aber neu für Ultrakurzwelle Die Pendelrückkopplung — früher nach ihrem Erfinder oft Firm
ftrongfchaltung genannt ift to alt wie der Rundfunk. Die FUNK- SCHAU hat über diele unerhört leiRungsfähige Schaltung früher oft berichtet und auch Selbftbaugeräte, die mit diefer Schaltung arbeiten, befchrieben.
Aber lehr bewährt hat fich die Pendelrückkopplung nicht, fie war zu unftabil und verfchwand infolgedeffen völligaus dent Gefichtskreis. Nun kheint fie aber Ihre Tücken bei Ultrakurzwellen nicht im fchäd-lichen fiusmaß zu zeigen Sie wird uns alto vielleicht gerade bei den Wellen, die fich bis heute noch nicht hochfrequent verftärken laffen, wichtigfte Dienfte leiten.
PcluzIplibititigug tar dic Pendulrlidt-kupplung.
Einleitung zum Aufsatz von Dr. F. Bergtold aus der „Funkschau", Heft 44 vom 27. Oktober 1935. Schon in dieser Zeit schrieben führende Funktechniker über dieses Fachgebiet und sie hatten auch schon erkannt, dass sich der Pendler speziell für Ultrakurzwellen eignen würde.
Nun galt die Frequenzmodulation als solche im Grunde nicht als Armstrongs Erfindung (Fessenden hatte sich diese Möglichkeit schon 1902 ausgedacht), doch war er der Mann, der in den Dreißigern berufen schien, das Verfahren zur Praxisreife zu entwickeln. Und als er dies geschafft hatte, forderte er 1934 von der RCA (der mächtigen Radio Corporation of America), sie möge sein neues FM-Sys-tem anstelle des bisherigen AM-Rundfunks einfiihren.
Sicher ging Armstrongs Ansinnen etwas zu weit, wären doch sämtliche AM-Empfänger des Landes auf einen Schlag wertlos geworden. Armstrong wurde tief enttäuscht. Die RCA zögerte — lehnte ab, und auch die übrige amerikanische Radioindustrie zeigte vorerst wenig Interesse. Jedoch — aufgeben war nicht Sache des hartnäckigen Erfinders. Schließlich gelang es ihm, die Über-legenheit seines Systems so überzeugend zu demonstrieren, dass sich einige RCA-Konkurrenten ent-schlossen, FM einzufiihren. So begann etwa 1939 der Siegeszug der HiFi-Rundfunkübertragung, dann aber traten auch in Amerika kriegsbedingte Entwicklungen in den Vordergrund. Der Krieg ging zu Ende, Armstrong erhielt eine Verdienstmedaille, aber kein Geld. Seinem Land hatte er die FM-Patente kostenlos zur Verfiigung gestellt; zahlreiche Nachkriegs-Patentbenutzer wollten nicht mehr zahlen. Die RCA ging noch einen Schritt weiter und stellte seine Patentansprüche grundsätzlich in Frage. Mit Hilfe ihrer Ratio-Detektor-Entwicklung und anderer RCA-Patente reifte der Plan, Armstrong kaltzustellen. 1948 entschloss sich der Erfinder wieder mal zu einer Klage, ob-wohl ihn die Erfahrung hätte lehren müssen, was dabei herauskommen kann. Hatte ihn doch schon 1934 der erfolglose Prozess gegen Lee de Forest eine Million Dollar gekostet.
Wenn man die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bezeichnet, so muss man auch — und dies besonders — dort gefällte Gerichtsurteile einbeziehen; sie treiben mitunter (auch heute noch) seltsame Blüten. Über die Urteile zu den Prozessen Armstrong ./. de Forest und Armstrong ./. RCA mögen neutrale Beobachter nur ungläubig den Kopf schütteln — fir Armstrong selbst aber waren sie vernichtend. Erst nach seinem Tod — der Verzweifelte sprang 1954 vom 13. Stock eines New Yorker Hochhauses — revidierten die „Rechtsverdreher" ihre Meinung. Der Witwe wurde firs erste eine Million Dollar zu-gesprochen. Es folgten Lizenzeinnahmen (auch Telefunken erwarb die FM-Rechte), und so kam Armstrong posthum neben höchsten Ehrungen und Auszeichnungen schließlich zu einem Vermögen von ca. zehn Millionen Dollar.
C'est la vie, hätte der Franzose Lucien Levy gesagt, welcher sich 1917/18 von Armstrong und dem französischen Staat um seine Prioritätsansprüche auf den Überlagerer geprellt fihlte. Er aber war schon 15 Jahre zuvor (81-jährig) eines natürlichen Todes gestorben. Traurig aber wahr, es ist die Tragik auch unter den Großen der Technik: Viele, wenn nicht die meis-ten derselben hatten offensichtlich nichts Besseres zu tun, als sich unter Aufbietung unnütz vertaner Energie gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Die Anwälte waren stets die lachenden Dritten.
6
Frequenzmodulierter Rundfunk über den frequenzmodulierten Rund-
funk, für den der Bereich von 88 bis 108 MHz freSegeben ist. ein Urteil zu fällen, ist aus der Ferne unmöglich, zumal man sich an Ort und Stelle noch nicht dar-über einig ist, ob Vorteile gegenüber Am-plitudenmodulation auf ähnlich hohen Frequenzen gegeben sind. Die Tatsache, daß in den Staaten fast tausend frequenz-modulierte Sender laufen, besagt nicht viel in einem Lande, in dem es noch nie an technischen Argumenten gefehlt hat, wenn es die wirtschaftlichen Notwendig-keiten der Industrie erforderten.
Ursprünglich wurde für den UKW-FM-Rundfunk der Bereich 87,5 bis 100 MHz freigegeben, am 1.7.1987 = 87,5 bis 104 MHz, und am 1.1.1996 = 87,5 bis 108 MHz.
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.4 Deutschland bekommt die „Welle der Freude" —
und ganz Europa wird neugierig
„Die Tatsache, dass in den Staaten fast tausend fre-
quenzmodulierte Sender laufen, besagt nicht viel..."
— stand in einem Aufsatz unter dem Titel „Wo steht Amerika heute"; welchen „Das Radio-Magazin" im Heft 7/1949 veröffentlichte. In Amerika war UKW eben noch nicht notwendig. Im selben Jahr (1949) wurde die Ultrakurzwelle in Deutschland eingeführt, und dies mit erheblichem Werbeaufwand. Der Fach-buch-Autor, Erfinder und „HÖR ZU"-Mann Eduard Rhein kürte sie 1950 zur „Welle der Freude". Die Sende- und Empfangstechnik war in ihren Grundzügen bekannt, auf der Empfängerseite so-wohl der Pendel-Rückkoppler als auch das Super-hetprinzip. Noch glaubte man, dass UKW im Drei-Meter-Band in guter Qualität nur auf Sichtweite empfangen wer-den könnte. So wurden zahlreiche Regionalsender projektiert, die den Empfang wenigstens eines Programms gewährleisten sollten — störungsfrei bei Tag, und insbesondere in den Abendstunden.
Großer Wettbewerb für UKWoFM1Geriite!
Neben der Errichtung von zahlreichen Ultrakurzwellen.
Sendern ist die Schaffung von einfachen Ultrakurzwellen-
Empfängern und von Ultrakurzwellen-Vorsatzgeräten
Voraussetzung für die Erschließung dieses Wellenbereiches.
Die Rundfunkanstalten: Bayerischer Rundfunk, Hessischer
Rundfunk, Südwestfunk, Radio Stuttgart und der Nord-
westdeutsche Rundfunk wenden sich deshalb an die
Öffentlichkeit mit der Aufforderung, daß die technisch in-
teressierten Kreise (sowohl Fachleute als auch Amateure)
in einem Wettbewerb selbstgebaute Empfänger den Rund-
funkanstalten zur Begutachtung vorlegen. Im Hinblick
auf die Wichtigkeit der Lösung dieser Aufgabe sind hohe
Geldpreise ausgesetzt, und zwar je ein erster Preis in
Höhe von 10 000,— DM,
a) für ein Ultrakurzwellen-Vorsatzgerät, das zusammen mit einem vorhandenen Rundfunkempfänger der bisher üblichen Bauart den Empfang dieses neuen Wellen-bereiches im 3-rn-Band bei Frequenzmodulation er-möglicht:
b) ein vollständiges Gerät, das sowohl Mittelwellen-Rund-funkempfang mit Amplitudenmoduiation als auch Ultrakurzwellen-Empfang mit Frequenzmodulation im 3-m-Band ermöglicht.
Für jede der beiden Aufgaben stehen außerdem en
zweiter und ein dritter Preis in Höhe von je 4 000,— DM
und je 1 000,— DM zur Verfügung. Die ausführlichen
Wettbewerbsbestimmungen veröffentlichten wir bereits
im Heft 6 des „RADIO-MAGAZIN".
Bekanntmachung in „Das Radio-Magazin", Heft 7/1949
Nachdem schon Ende Februar / Anfang März 1949 Versuchssender in Mün-chen und Hannover in Betrieb gegan-gen waren, folgten bis Jahresende Hamburg, Berlin, Nürnberg, Frankfurt, Kassel und Stuttgart mit UKW-Sendern höherer Leistung. Jetzt aber fehlten noch die Empfänger.
Die Sendeanstalten erinnerten sich an die Kreativität der Amateure aus den Anfängen der Funktechnik — also er-munterten: der Bayerische Rundfunk, der Hessische, der Nordwestdeutsche, der Süddeutsche und der Südwestfunk im Frühjahr 1949 Konstrukteure, und alle, die sich zur Entwicklung brauch-barer und preiswerter UKW-Emp-fangsteile für befähigt hielten. Es wink-ten stattliche Preise. Die ersten Ergebnisse wurden von ei-nem Preisgericht im Oktober 1949 be-urteilt und prämiert.
Bei den Radioherstellern gab es bis 1949 nur die für amplitudenmodulierte Sendungen geeigneten Empfänger, de-ren Mittelwellenbereiche zum Teil bis 1605 Khz erweitert worden waren, dass auch die im damaligen „Grenz-wellenbereich" funkenden Sender (unterhalb 200 m) empfangen werden konnten.
7
SIEMENS
RUND
FUNK
GERATE
17i€1.nim taw
Selbstverständlich berücksichtigen die
Slemens-Rundfunkgeräte der laufenden
Fertigung die geplante Neuverteilung der
Senderfrequenzen sowie auch die Ein-
führung des Ultra-Kurzwellen-Rundfunks.
Der Mittelweltenoereich is! erweitert.
Neue Staten zum Austausch strict in
Voroere hung.
Der Anschtue tür UKW-Vorsätze octet
Elnbaugerate ist berücksichtigt
Bel den Siemens-Rundfunkgeräten älte-
rer Jahrgänge steht unser Technischer
Kundendienst für eine reibungs-
lose Umstellung zur Verfügung.
SIEMENS & HALSKE AktiENGLSELISCHAFT
Bild I. UKW-Vorsatzsuper von Blaupunkt Bild Z. L/KW-Vorsatzsuper der Fa. No7d-Mende Bild 3. Grundig-Vorsatzgerdt
Die dynamische Chronik
1950 kamen dann wenige Radios mit integriertem UKW-Teil
zum Empfang frequenzmodulierter Sender auf den Markt —
die meisten waren erst mal für UKW „vorbereitet". Dafür gab
es Einbau-Aggregate in verschiedenen Qualitäts- und Preis-
klassen. Zunächst bevorzugte man die Pendelrückkopplung,
von der man, wie zuvor vermerkt, schon seit Mitte der Dreißi-
ger wusste, dass sie für UKW geeignet sein würde.
Der „Radio-Händler" äußerte seine Zustimmung zum Pendler
in der November-Ausgabe 1949 wie folgt:
„ Wußten Sie... daß aller Voraussicht nach bei geeigneter Ab-
wandlung das Pendelrückkopplungsaudion die zweckmä ßigste
Lösung der Empfangs- und Demodulationsfrage bei UKW-
Empfang darstellen wird, da sich bisher kein günstigerer
Kompromiß zwischen Preis und Leistung finden ließ..."
8. Kapitel
Inserat aus der „Funkschau", Heft 6/1949
Der UKW-Pendler im Wega Fox zwo (links). Eng geht's her —
das Einbauteil mit der ECF 12 dürfte nicht größer sein.
Weil einfache Pendel-Rückkoppler ohne entsprechende Kunstschaltungen benachbarte Empfänger
stören konnten, wurden sie in der Regel durch Vorstufen ergänzt. Von den 46 im Modelljahr 1950/51 angebotenen UKW-Zusatzgeräten arbeiteten die Mehrzahl, nämlich 33 als Pendler und nur 13 als Superhet. Letztere gab es für Großgeräte; anfänglich wurde noch die multiplikative Mischung bevor-
zugt. Geräte der Mittelklasse (bei Phi-
lips z.B. der Jupiter MU) mussten sich
meist mit einem Pendler mit Flanken-gleichrichtung begnügen.
„Man stelle nicht auf die Sendermitte
(Maximum) ein, sondern etwas links
oder rechts davon" — stand in der Be-
dienungsanleitung. Das Magische Auge
war bei UKW-Empfangsteilen dieser
Art noch nicht in Funktion.
Zur Ergänzung von Empfängern, die nicht für den Einbau eines UKW-Teils vorbereitet waren, konn-
te man getrennt aufzustellende Zusatzgeräte kaufen, die über Tonabnehmerbuchsen an Radios jeder
Art, auch Vorkriegsmodelle, anzuschließen waren. Solche Provisorien verschwanden schnell wieder.
8
UKW SB Super-Vursatzgerlit
Preis: De 98,—
UKW 6A UKW-Spezial-Empfänger
Preis: DM 348,-
1 KW 4 C
Schaltung: Sperhet
spannungen: 125 u. 220 V
Wellenbereiche: 87 , 100 MHz
Besonderheiten: Einhat1-gerät. passend. für die Telefunkengeräte Opus 49,
UKW 5
Schaltung: Superh et
Netzspannungen: 110425, 1501220/240 V
UKW 6 A
Schaltung: Superhet
Stromart: Wechselstrom
Netzspannungen: 110/128/ 150, e0 240 V
Leistungsaufnahme: etwa 75 W
Wellenbereiche: 87.,100 MHz
Skalenlampe: 63 V, 0.3 A
Zahl der Kreise: 8 Kreise
Wellenbereiche; UKW
Schwundausgleich: nein
Lautsprecher; Permanent-dynamisch. 6-W-L5ut-sprecher, Ausgangs-leistung 4 W. 200 mm
Gehäuse: Prelistoff. 450x 300x218
Gewicht: netto etwa 10.7 kg, brutto etwa 14 kg
ECU 11
EF 14
EF 11
EA..% 11
EClf lt EF 14 EF 11 IlEAA 11
IAEG 250 IE 60
KUli 11
EF' 14
EF 14
fEAA 11
ECL 11
AZ 11
reheatra. Operette. yra, Caardas
e: Chassis
: 41 cm lang
net twa 1,75 kg, brutto etws 2.20 kg
Wellenbereiche: 87 . 100 1111z
Gehäuse: Holz. 480x230x110
Gewicht: 8.5 kg
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Schon 1951 wurde UKW zum Standard. So schlecht war in vielen Gebieten der abendliche Mittel-
wellenempfang, dass die ultrakurze Welle nicht mehr als zusätzlicher, sondern ggf. schon als Haupt-Empfangsbereich galt. Nur den Kleinen, den Zweit- und Küchenradios, sollte mit Rücksicht auf die
Kosten der technische Aufwand dear noch nicht zugestanden werden.
Telefunken offerierte 1950 UKW-Empfänger in drei Versio-nen. UKW 4 c hieß das mit ECH 11, 2 x EF 14 und EAA 11 bestückte Chassis zum nachträglichen Einbau in die Modelle Operette, Viola, Lyra und Csardas. Als Unterbaugerät mit eigenem Netzanschluss war's die Type UKW 5 B.
Das dritte Modell ist der hier abgebildete „UKW-Spezial-Empfänger UKW 6 A. In dem saßen neben den vier zuvor genannten Stahlröhren noch die ECL 11 und eine AZ 11.
Glaubte Telefunken wirklich, zum Preis von DM 348.- ein Gerät verkaufen zu können, mit dem 1950 in der Regel ge-rade mal ein Sender empfangen werden konnte? Kein Wun-der, dass die Erstauflage der auf den Markt gekommenen UKW 6 A zu Ladenhütern wurden. (Sammlung Dr. Windisch)
Thema „Bezirksempfang auf UKW" abhaken. Aber — weder die HF-
noch die zu erwartenden Vorteile der neuen NF-Frequenzbreite waren
Fürs erste konnte man das technischen Möglichkeiten, ausgeschöpft.
Nun war die Zeit gekom-
men, wo sich die Entwick-ler mit geeigneten Maßnah-
men zur Perfektionierung
der Empfangsgeräte ausei-
nandersetzen mussten. Da-
zu waren auch neue Funkti-
onsteile erforderlich — und
Röhren, welche nicht nur fir den Kurz-, Mittel- und
Langwellenempfang ge-
schaffen worden waren.
Kopie aus dem Rundfunk- Katalog 1950/51
Mit solchen Problemen befassten sich nun intensiv die rundfunktechnischen Entwicklungslabors der
bedeutenden Werke, deren Techniker sich im Klaren darüber waren, dass die Erfolg versprechenden
Arbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen konnten. Der Hörer, der zuvor auf dem Mittelwellen-
band keinen ungestörten Empfang mehr hatte, erwartete noch keine Klang-Wunder; er war von der
„Welle der Freude" von Anfang an begeistert. Und das Ausland, wo die Empfangsverhältnisse teils
auch nicht viel besser waren, schielte neugierig auf die neue deutsche Technik.
In Italien waren, wie die „Funkschau" im Heft 24/1950 zu berichten wusste, gegen Ende 1950 bereits
acht UKW-Sendestationen in Betrieb. Auch die Finnen — anscheinend schon damals besonders fort-schrittlich gesinnt — bekundeten großes Interesse. Sie baten Dr. Nestel nach Helsinki und ließen dort von Telefunken auch gleich einen UKW-Versuchssender installieren. „Die mit diesem Sender erziel-
ten Reichweiten und die Güte der Modulation haben allgemein überrascht", steht im 2. Februar-Heft der „Funkschau" Jahrgang 1951. Etwas später erhielt Schweden, wie der „Radio-Händler" im Juli
1951 berichtete, einen solchen Versuchssender und im Februar 1952 las man in „radio mentor": „Für die Einfuhr von Radiogeräten aus Deutschland nach Schweden wurde bisher die Hälfte des
Jahreskontingentes von 4 Millionen skr. freigegeben".
Für die deutsche Funkindustrie war das ein Aufbruchssignal!
9
UK851111,10111 EIN 9KREIS EINBAUSUPER FÜR GERÄTE ALLER FABRIKATE
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.5 Mit den „Allglas-Serien" begann nicht nur das „UKW-Zeitalter" — auch das letzte Kapitel der „Röhrenradio-Geschichte"
Die alten Vorkriegs-Röhrenserien, aber auch die ersten Rimlockröhren waren fir die hohen UKW-Frequenzen nicht eben geeignet, weshalb Telefunken 1949 und 50 noch einige UKW-tüchtige Stahl-
röhrentypen nachschob. Die aber wurden schließlich durch UKW-geeignete „Rimlocks" der 42er-Serie verdrängt, mit denen — wie bereits im Kapitel
7.10 gesagt — die Neuzeit der Röhrengeschichte be-
gonnen hatte. Den Rimlocks folgten unmittelbar die
Novalröhren der 80er-Serie mit den Typen ECC 81, EF 80, EABC 80.
Noch aber gab es in dieser Bauform keine Hoch-
leistungs-Endröhre — die EL 41 entsprach nur knapp
der Vorkriegstype EL 11, weshalb vereinzelt zwei
EL 41 in Gegentakt- oder Parallelschaltungen ver-wendet wurden (z.B. 1952 im Opta-Rheingold 3953, 1953 auch im Kiraco-Stradivari II). Erst nachdem sich die 1952/53 erschienene (in der Erstserie allzu heiße und zu thermischer Gitteremission neigende) 5,5 Watt-Endpentode EL 84 dauerhaft bewährte und
bedenkenlos mit ihren vorgegebenen Daten (12 Watt max. Anodenverlustleistung) betrieben werden konnte, verzichtete man schließlich auf die gute alte
Hochleistungstype EL 12 (mit 18 Watt max. Ano-denverlustleistung). Immerhin aber konnte diese
Vorkriegs-Röhrentype (auch das ist im Kapitel 7.10
zu lesen) als Ausnahmeerscheinung bis 1955/56 überleben.
Beliebt war 1952 der Graetz-UKW-Einbau-super UK 83 W/GW, bestückt mit ECC 81, 2 x EF 41, 2 x PL 205, und E 220 C 50.
Ein gutes Jahrzehnt hatten sich Telefunkens E- und U-Stahlröhren bewährt, 1951 schlug ihre letzte Stunde. Im Folgejahr fand man sie nur noch vereinzelt in wenigen (Vorjahres-) Modellen, die in Er-furt gefertigten Glasausfiihrungen in einigen ostdeutschen Geräten noch bis Mitte der Fünfziger.
Dass Telefunken so schnell nicht von ihren Eigenentwicklungen lassen wollte, ist kein Geheimnis.
1949/50 hinkte die „Deutsche Weltmarke" der Entwicklung hinterher. Ein Hauptgrund war sicher,
dass Telefunken (im Gegensatz zu Philips/Valvo) unter denkbar schlechten Nachkriegsbedingungen
zu leiden hatte, sowohl in fertigungstechnischer, wie auch in finanzieller Hinsicht. Das aber war nicht
der einzige Grund — es gab schließlich ERP-Kredite. Verschloss man denn die Augen vor den Reali-
täten? Hatte man etwa zu lange auf die Vorherrschaft auf dem deutschen Markt gebaut? Wollte man
sich nicht eingestehen, dass nach dem Auslauf der patentrechtlichen Möglichkeiten eine Kapitulation
vor dem internationalen Röhrenmarkt unumgänglich wurde — die Zeit der hochwertigen, aber zu teu-ren, nicht mehr im Trend liegenden Stahlröhren abgelaufen war?
Anscheinend lastete diese Erkenntnis schwer auf einer Generation, die sich zuvor unangreifbar wähn-
te — hierzulande die Führungsrolle innehatte... Warum haben die Manager nicht in ihr streng vertrau-liches Protokoll vom 28. März 1936 geschaut? Schon damals stellte doch Prof. Hans Rukop in der Delegiertensitzung fest:
„Jeder sei sich klar, daß die Metallröhre technisch kein Vorteil, dagegen aber die Glasröhre billiger
sei. Trotzdem wird Telefunken, wenn die Metallröhre Effekt hat und Anklang beim Publikum findet,
wieder den Vorwurf der Rückständigkeit auf sich ziehen, wenn sie diese Röhre nicht bringt".
Vielleicht war's nicht gerade glücklich formuliert, doch es wurde unverblümt eingeräumt, dass es
eben nicht der technische Fortschritt war, sondern der drohende Image-Verlust, welcher Telefunken
bewog, die „Stahl-Neuheit" einzufahren — freilich mit den damals zeitgemäßen, gegenüber der A-Serie wesentlich verbesserten Systemen.
10
II
Nur in diesem Telefunken-K-M-L-Autosuper D 51 M findet man zwei Stück ECL 113
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Doch die Entwicklung machte nicht halt und so bedarf es wohl keines Kommentars, warum man sich
wundert, dass in den Telefunken-Labors auch dann noch neue Stahlröhren entwickelt wurden, als
sich die Amerikaner schon von denselben verabschiedet hatten — solche Oktalröhren nur noch in Glas
fertigten bzw. auf die in der zweiten Hälfte der Vierziger verfügbaren Miniaturröhren in Allglas-
Ausführung umgestiegen waren. Die alten Amerika-Typen wurden zuletzt (auf Wunsch der Russen)
nur noch in Ostberlin (OSW) fabriziert; und in Stahlausführung nur in der Sowjetunion.
Indes — auch Telefunken konnte sich schließlich dieser weltweit Fuß fassenden neuen Röhren-
Generation nicht verweigern, zumal ihr (siehe: „Die Allgemeine Rundfunk-Technik" Heft 10/1950) für deren Entwicklung aus den Mitteln des „Marshall-Plans" eine Million DM gewährt wurde. Aber
noch immer meinten die „Stahlröhren-Fabrikanten", diese Winzlinge seien fur Heimradios unnötig;
nur für Kfz-Empfänger gestand man ihnen Vorteile zu.
Allstrom-Röhren (die noch in etwa der Hälfte
aller Geräte steckten) ließ die deutsche Welt-
marke deshalb links liegen und beschränkte ihr
1950 erschienenes „Pico-Röhren"-Programm
auf die fürs Autoradio erforderlichen Typen ECH 42, EAF 42, ECL 113 und EZ 40. Ursprünglich sollten sie alle „113" heißen
(ECH 113 usw.), man wollte der Konkurrenz nicht zugestehen, Vorreiter gewesen zu sein;
letztendlich jedoch siegte die Einsicht. Nur die Endröhre musste nicht zwingend „ECL 41" ge-
nannt werden, weil es dazu keine Konkurrenz-
type gab. Da hatte eben die Einsicht ihre Gren-zen...
Die Telefunken-Pico-Röhrenserie (aus „Funk-Technik" Heft 3/1950)
Biid 3. Die kleinen Abmessungen der Pico-Röhren gehen aus diesem Bild deutlich herror
Wenn man zwei ECL 113 im Gegentakt-AB-Betrieb arbeiten ließe, so meinten Ihre Schöpfer, könnte
man mühelos 4 Watt Sprechleistung erzielen. Und das sei genug — auch fürs Auto. Indes — das Kon-zept fiel wohl nicht auf fruchtbaren Boden; selbst Telefunken steckte — man mag es kaum glauben —
die durchaus sinnvolle ECL 113 in kein einziges ihrer Heimgeräte. 1950 fand man sie im kleinsten
Körting-Modell Neos 51 W, im Dira Zeitklang, im Jotha Export, 1950 bis 52 auch im billigen Jotha-Einkreiser Liliput und 1952 bis 53 in den letzten Grundig-Zweikreisern 810 /840.
Schließlich darf auch noch über die Röhrenbestückungen der Geräte aus der Saison 1955/56 gestaunt werden: Da steckte Grundig die ECL 113 letztmals in die Kleinsuperhets 80 U und 90 U, während Telefunken es vorzog, die eigenen Jubilate-Modelle dieser Art mit der EL 41 auszustatten. Man könnte glauben, die Telefunken-Geräteentwickler wollten ihre Röhren-Kollegen ärgern, und so ab-
wegig ist diese Vermutung nicht. Zeitzeugen berichten, dass die sich meist mit gemischten Gefühlen begegneten...
Noch weniger Glück hatte die ECL 113 mit den Autoradios, wear dieser Röhrensatz doch in erster
Linie gedacht war. Gerade mal ein Autosuper wurde in der Gegentakt-Endstufe mit zwei Stück die-
ses Typs ausgestattet, und das war der im „Funkschau"-
Heft 11/1951 beschriebene Telefunken II A 51 bzw. II D
51 von 1951. Im schlichteren I A 51 des gleichen Bau-jahrs glänzte die Gute durch Abwesenheit, weil sie für
den Eintakt-Betrieb zu schwach war. Die in der umfang-
reichen Rimlock-Reihe enthaltene EL 41 beherrschte den
Markt — saß doch sogar in Telefunkens Autosuper 1 A 51!
Auch mit der „Pico-Auto-Serie" wurde es also nichts.
Der Radio-Historiker erinnert sich: Schon in den Dreißi-
gern wollte Telefunken die damals neue E-Glasröhren-
Serie nur in Autoradios dulden — aber da gab's ja noch das Monopol...
11
( GRunoio) 216 B
Reisesuper für Batteriebetrieb, 5 Kreise, 5 Röhren, eingebaute Rahmen-antenne, grof3e Tagesempfangsleistung auf 2 Wellenbereichen, dyne-mischer Lautsprecher, stabiles, farbiges Prefgtoffgehriuse.
Gewicht: ca. 3 kg Röhren: 0F91, DK 91, DF 91, DAF 91, DI.. 92
Preis DM 216.-(betriebsfertig)
ERNSEHGERÄT F 5 Blicigrölle: 29 x 22 cm, 625 Zeilen, Emp-
fangsbereich: 1 Kano! (beliebig wählbar
18 Röhren, 9 Bild- u. 3 Tonkreise, Tonemp-
fang nach Intercarrierprinzip, Allstrom:
220V. Ausmaße: 447 mm hoch, 725 mm
breit, 455 mm tief. Eingebaute Antenne.
---------------
Schon in den 1953er „Funkschau"-Heften 1
und 3 offerierte Graetz Femseh-Tisch- und
Standgeräte.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
E-Stahlröhren konnte man — wie in den Heimempfängern — auch in den 1952er Autosuperhets nicht mehr finden. Und die 1940 far Batteriebetrieb geschaffenen D-Stahlröhren wurden schließlich von demselben Schicksal betroffen. Nur der etwas veraltete Nora-Reisesuper Noraphon 53 und die Batte-rie-Heimsuperhets 453 / 651 B von Brandt wurden 1952 noch mit ihnen bestückt; und 1953 bildete der aus dem 1950er Wega-Netzanschlussempfänger Fox hervorgegangene Batterie-Heimsuper Fox B
das Schlusslicht.
Das Jahr 1949 war noch nicht zu Ende, als Grundig die Fachpresse mit dem „Weltklang-Reisesuper" überraschte, welchen die Fürther mit der importier-ten Typenreihe: zwei 1 T 4 (DF 91), 1 R 5 (DK 91), 1 S 5 (DAF 91) und 3 Q 4 (DL 92) bestückten. Diese, 1939/40 in den USA entwickelten Miniatur-röhren steckten 1950 schon in acht deutschen Kof-fer-Modellen — 1951 (aus eigener Fertigung) auch im Telefunken Bajazzo 52. Sie machten letztend-lich auch der D-Stahlröhrenserie den Garaus.
8.6 Die „Goldenen Fünfziger" — UKW überrascht mit Spitzenleistungen
Mit dem Beginn der 50er-Jahre war die westdeutsche Wirtschaft wieder richtig in Schwung gekom-men. Die dunklen Wolken der in Quebec diskutierten Morgenthau-Direktive* hatten sich verzogen, Auflagen und Produktionsbeschränkungen wurden (schon vor dem NATO-Beitritt) nicht mehr be-achtet und die mit Hilfe des Marshall-Plans errichteten Betriebe trugen zum Abbau der Arbeitslosig-keit bei. Altbekannte und einige der neuen Radiohersteller, welche auch die beiden Krisenjahre nach der Währungsumstellung noch heil überstanden hatten, erahnten schon die Konjunkturwelle und ver-buchten beachtliche Produktionssteigerungen; nicht zuletzt dank ihrer teils unvorhersehbaren Export-erfolge. Und Neuheiten brachte die Unterhaltungsbranche: 1951 kam hierzulande die erste Langspielplatte mit 33 1/3 U/min. auf den Markt, Ende 1952 startete das erste deutsche Fernsehprogramm (in den USA begann die Ära des Farbfernsehens).
1953 begann zögerlich der Verkauf von S/W-Fernsehemp-fängern — über 1.000 Mark musste man dear bezahlen. Die Krönung der englischen Königin — man konnte sie schon auf dem Bildschirm verfolgen — hatte den ersten Kaufschub be-wirkt. Der Rundfunkindustrie bescherte das Fernseh-Geschäft in den Jahren ab 1955/56 beachtliche Umsatzzuwächse und eine Verbreiterung ihrer Basis. Hinzu kamen — dank besserer Schallplatten und anderer Tonträger — Radio-Phono-Geräte und große Tonmöbel. Zum Teil wurden die mit einer Haus-bar kombiniert, für deren Auskleidung Spiegel oder „Acella-Plastik" in Mode gekommen waren. Die Wortschöpfung „Musiktruhe" wurde zum Inbegriff des neuen Wohlstands. Dem Bundesbürger bedeutete offensicht-lich das Luxusgerät so viel, dass er es noch vor der Woh-nungseinrichtung haben wollte. 1953 gab es fast 40 Modelle solcher Truhen. Der Grundig-Konzertschrank 9040 W koste-te 3.450 DM, nur 750 Mark weniger als ein Volkswagen...
* Der vom US-Staatssekretär Henry Morgenthau vorgeschlagene so ge-nannte „Morgenthau-Plan" vom September 1944 sah vor, Deutschland in ein Agrarland zu verwandeln und die gesamten Industrieanlagen abzubau-en. Er wurde aber nur in sehr abgemilderter Form realisiert.
12
• TEIEF1)NKEN ROHREN - F 0 R ALLE RUNDFUNK HOREN •
z
5,5 W
bp.% 72,5
bei kleiner
folge holler
mole dieser neuen Relive
TELE
FUN
KEN
0
on
a
7
Wei apcmn u A.; 6,3V Gegentakt-A- Betrieb -A8 -Betrieb
He:strum 760 mA AnodensPonnong 250 250 V
Anociernponnunig 250 250 V Schimeteertponnung 250 250 V
0 Sclunnetersponnung 250 200 V Kothodenwidentonel pro Rohre 135 200 CI
Anode...atom pro Rohm 48 37 mA
z
G7tte,074:70.11111717.9 7,5 — 6 V
Kathodenwiderstand 140 160(1 Aubemeiderstand sen Anode zu Anode
Sptechlerstunq
7
12
7 1,0
12,5 W
7K
Anoderetrom 48 34 mA
Steilheit 11 10 rnAJV leinfolttor 6 7,5 1,4,
Innenwiderstond 50 55 0
Aufsemeiclentond 5,2 7 I'll
Sptechleistung 5,3 3.8W
• T E EFL) N KE N - it OH R E N - ALLE DIE RuNOPUNK HORE
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Einige Musikschänke der Luxusklasse wurden 1953 mit Fernseh-Empfängem ausgestattet — die
„Graetz-Fernseh-Luxus-Truhe F 14" 'nit Rundfunk-Empfangsteil zum Beispiel kostete 5.175.— DM.
Und was steckte drin — in den Radios und Musiktruhen aus Anfang der Fünfziger? Welche Röhren
wurden bevorzugt?
Die Entwicklung neuer Typen war 1950/51 noch im Fluss, man konnte — auch in den hochwertigen
Rundfunkempfängern — noch sehr unterschiedliche Röhrensysteme finden. Nur die „Stiftsockel-Röhren", welche noch in manchen Radios aus den Dreißigern zu finden waren, gehörten der Vergan-genheit an. Aber man verwendete noch andere Typen aus der Vorkriegs- und Kriegszeit, z.B. solche aus der abgewandelten „roten"-Philips-Serie mit Topfsockeln; und natürlich die Telefunken-Stahl-
röhren. Daneben die Lorenz-71 er-Reihe auf Loctalsockeln, und auch schon die 40er Rimlockröhren.
„Wußten Sie schon" — schrieb der „Radio-Händler" in seinem Heft 14/1951 — „ daß in Deutschland
im Jahre 1950 13.5 Millionen Röhren hergestellt worden sind? Und daß gegenwärtig 151 deutsche
Röhrentypen auf dem Markt sind.." Nun aber durfte man hoffen, dass langsam in das uneinheitliche
Sortiment etwas mehr Ordnung einkehren würde, obwohl noch immer neue Typen hinzukamen.
Telefunken war — wie schon in den Zwanzigern und Dreißigern — mit der Entwicklung ins Hintertref-fen geraten und hinkte auch den Rimlocks hinterher. Es tat weh, wieder mal zum Nachzügler abge-stempelt zu werden — so etwas sollte künftig nicht mehr passieren. Das Ulmer Röhrenlabor, dem Dr. Horst Rothe auch ein Applikationslabor angegliedert hatte, hing nun nicht mehr am „Altbewährten",
es widmete sich den neuesten Entwicklungen, vor allem im Hinblick auf das zu erwartende Geschäft
mit Fernsehgeräten.
Mit der 80er- Röhrenserie — 1951 waren bereits P-Typen,
z.B. die PCL 81 auf dem Markt, 1953 die EL 84 —
stand Telefunken wieder in der ersten Reihe. Auch Phi-
lips/Valvo fertigten solche
„Noval-Röhren" (EBF 80,
ECL 80 u.a.); es folgten Sie-mens und auch TeKaDe; und
so wurden die früheren Typen
nach und nach verdrängt.
Und wozu brauchte man eine „P-Serie"? Diese Röhren mit
300 mA-Serienheizung waren
fiir Fernsehgeräte gedacht,
um dort den schwergewichti-
gen Heiztrafo einzusparen.
Nur selten findet man sie in
Radios; zu den Ausnahmen
zählen z.B.: der 1952er Wega Bobby (Wechselstrom-Type 1009), der 1954er Kaiser UKW-Spezial W 1032 oder der 1955er Loewe Hellas 841
W, die enthalten neben der E-
80er-Serie die PCL 81.
Doch es waren nicht nur die
40er- und 80er-Serien, die das
Rennen machten.
Ganzseitiges Inserat aus:
„radio mentor" 4/53, S. 149
13
HIE WELT
&Vet(
I« CV RAT LJR - &WREN
75./ce
der international standardisierten Empfetn«
gerrehren,TypertzindMiniche-Röhren..lhre
Produktion umfaßte im vergangenen Jahr
200 Millionen Stück. Sie werden ‚berm für
die Entwicklung moderner Rundfunk- und
Fernseb-EmplOngez wie für kommerzielle
Genets auf der ganzen Welt bevorzugt.
Aude
IL«) Wit E eraid sie
IM itaHRENWERK ESSLINGEN
C. LORENZ AKTIENGESELLSCHAFT
STUTTGART BERLIN .HANNOVER
LANDSHUIT • ESSLINGEN PFORZHEIM
Inserat aus: „Radio-Magazin" Heft 9/1951
Die dynamische Chronik
In ihrem zweiten Septemberheft 1949 berichtete die „Funkschau" über die neuerdings bei Tungsram in der Schweiz erschienenen Miniaturröhren.
Neue Tungsram-Typen
In Ergänzung der bisher schon vorhandenen Batterie-röhren erscheinen nunmehr in der Schweiz Miniatur-röhren für Wechselstrom- und Allstrombetrieb, die von Tungsram, Zürich, herausgebracht werden und einen maximalen Durchmesser von 19 mm besitzen. Die Wechselstromtypen sind für 6,3 V bemessen, die All-stromausführungen haben einen Heizstrom von 150 mA.
Abbildung aus der „Funkschau" Heft 12/1949, S. 187
8. Kapitel
Bild 1. Die kleinen Abmessungen der Miniaturrieren geben aus diesem Bild deutlich betrat
1951 wurde im Juni-Heft des „Radio-Magazins" angekündigt: „Die C. Lorenz-AG beabsichtigt, im Sommer dieses Jahres die
international eingeführte Miniaturröhren-Serie auch für den
deutschen Markt zu liefern. Die Wechselstrom-Serie besteht
aus den bekannten Typen 6 BE 6 (Pentagrid-Converter),
6 AV 6 (Duodiode-Triode), 6 BA 6 (Regelpentode), 6 AQ 5
(Endpentode) und 6 AU 6 (Pentode). Eine entsprechende Mini-
aturröhren-Serie für Allstromempfänger befindet sich in Vorbe-
reitung".
Im Röhrenwerk Esslingen begann man auch sogleich mit der Großserienfertigung. Die meisten Lorenz- wie auch Schaub-Radios von 1951 wurden bereits mit Röhren dieser Serie be-stückt (siehe z.B.: Schaub Koralle 53 im Kapitel 9). 1952 ka-men die kleinen „Siebenpoligen" mit deutschen Typenbezeich-nungen als „90er-Serie" in die Kataloge. Weil diese Miniaturröhren eben nur sieben Anschlussstifte hat-ten, gab es (auch in der gleichartigen Batterieröhren-Serie) fiir die Oszillator-/Mischstufe nur Heptoden (Pentagrid-Converter), jedoch keine Oktoden und erst recht keine Trioden/Hexoden.
Nicht nur die Stahlröhren gehörten nun der Vergangenheit an, auch die Lorenz-Schlüsselröhren und ebenso die seit 1947 in größten Mengen fabrizierten Valvo-Röhren mit Außenkontakt-sockeln, welche letztmals in einigen Geräten der Saison 1951/52 saßen. Nur eine Vorkriegsröhre hielt sich hartnäckig bis 1955: die EL 12. Von dieser Ausnahme abgesehen war 1952 endlich das drei Jahre währende „Typendurcheinander" bereinigt. Nun hatten sich die Allglastypen der 40er-, 80er- und 90er-Serien in sämt-lichen Koffer- Auto- und Heimradios verwurzelt — die 80er und 90er behaupteten sich bis zum Ende der Röhren-Ära, wo sie schließlich durch Transistoren verdrängt wurden.
Diese Röhren der letzten Generation waren nicht nur billiger als die alten Systeme, sie eigneten sich auch viel besser zum Betrieb mit hohen Frequenzen, wozu das UKW-Band zählte. Und das durfte seit 1951 auch in den Mittelklasse-Superhets nicht mehr fehlen. Widerlegt waren Zweifler, wie z.B. Walter
Regelien, Herausgeber des „Empfänger-Vademecum", der 1949 noch meinte: „ es sei absurd, anzu-
nehmen, daß die jetzt vorhandenen Empfänger über lang oder kurz, oder gar über „ultrakurz" veral-
ten oder gar unbrauchbar werden könnten". Was Regelien nicht für möglich hielt, war eingetroffen. Und die beachtlichen Weiterentwicklungen, unterstützt durch neue Röhren, verbesserten die Qualität der Geräte Anfang der Fünfziger stetig.
14
• - , I '1
r *WI
KORTI NG SYNTEKTOR 54 W
Die sensationelle KörtIng.Synchro.Detektorschaltung mit der
extremen Trennschdrie von 1:5000, HöchstomPendlichkeit
u. optimalen Störbegrenzung für IJKW •WE IT KM P FA NO,
UKW.Rauschsperre Doppelt wirksame outornatIsche land-
breltenregeluno Kurzwellenlupe • Fer4t-Roter•Antenne - 2 Laut-
sprecher In Breltband-Raumklang.Komblnation.
KORTING RADIO -WERKE • OSWALD RITTER G.M.B.H.
GRASSAU-CHIEMGAU1OBERBAYERN • FROHER LEIPZIG
KORTING BAUT SEIT 1925 SPITZENERZEUGNISSE DER FUNKTECHNIK
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Im UKW-Empfangsteil verschwand der Pendler, welcher zumeist mit der dafiir entwickelten Stahl-röhre ECF 12 bestückt worden war. Zum Standard wurde 1951/52 die mit Rimlockröhren ausgestat-tete Superhet-Schaltung mit der additiven Mischung und dem Ratiodetektor zur Demodulation. Man hatte auch entdeckt, dass die Reichweite der Sender beim Empfang mit leistungsfähigen UKW-Geräten doch erheblich größer war als anfänglich angenommen. Musste das jetzt erst entdeckt werden? Aufgrund der Ergebnisse, die Abraham Esau schon 1925/26 mit seinem, auf dem 3-Meter-Band arbeitenden 100 Watt-Sender erzielen konnte und der um-fangreichen Untersuchungen, die in den Dreißigern zu entspre-chenden Erkenntnissen geführt hatten, war es doch vorauszuse-hen... Im August 1928 veröffentlichte „Der Deutsche Rund-funk" (auf den Seiten 2404/05) in Auszügen einen Vortrag, den Prof. Dr. Esau anlässlich der Bremer Funktagung gehalten hatte.
„Der Vortragende schloß seinen Vortrag damit, daß er erklärte, daß Deutschland auf dem Gebiete
der ultrakurzen Wellen ein gutes Stück voran sei in der Welt, und daß es zu hoffen ist, daß dieser
Vorsprung auch weiter erhalten bliebe" — schrieb der Redakteur abschließend. Wer aber sollte diese Einschätzung 25 Jahre später noch im Gedächtnis haben...
Unter dem Titel „UKW bei fehlender Sicht" schrieb Dr. K.H. Deutsch in der „Funk-Technik" Nr. 20/1950: „Bis in die jüngste Zeit hinein fanden sich in aller Welt viele Verfechter der Ansicht, dass
ein sicherer UKW-Betrieb — also mit Meterwellen — für den Funksprechdienst nur auf Strecken mit
optischer Sicht möglich wäre. Ihnen mag zugute gehalten werden, dass bislang ein ausreichender
Großversuch in Deutschland nicht vorgenommen wurde" (Diese Sichtweise war bereits überholt). Professor Dr. von Handel sagte in einem Werks-Vortrag „Über die Empfindlichkeit von UKW-Emp-fängern" (anlässlich des 25jährigen Bestehens der Körting-Radiowerke, ausgedruckt in: „Das Radio-Magazin" Heft 10/1950): „Es ist wichtig, diesen Zweck der hohen Empfindlichkeit solcher Geräte zu betonen, weil in weiten
Kreisen, z.T. auch in der Fachwelt, hierüber keine völlige Klarheit zu bestehen scheint".
Mit wissenschaftlichem Ernst hat sich den Wellen unter 5 in bisher eigentlich nur ein Mann gewidmet: Prof. A. Esau vom Physikalischen Institut in Jena. Seine Erfolge. auf diesem Gebiet sind allerdings nur aus verein-zelten Vorträgen, nicht aber aus Publikationen (von Patentschrif-ten abgesehen) zu entnehmen.
Inserat aus der „Funkschau" Heft 18/1953).
Nach und nach aber begann sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die ultrakurzen Wellen auch über manchen Hügel klettern konnten. Und die Möglichkeit, auf UKW mehrere Stationen zu empfangen — die örtlichen Sender gestalteten im April 1950 auch schon zweite Programme — er-weckte den Ehrgeiz in den Entwicklungslabors. Es kamen Spitzenerzeugnisse zustande.
Eine Aufsehen erregende Körting-Konstruktion erschien 1953: der Syntektor 54 mit der genialen Synchrodetektor-Schaltung, dessen UKW-Emp-fangsleistung kaum mehr zu überbieten war. Deshalb zählt er heute, wie auch der nachfolgen-de Royal-Syntektor zu den gesuchten Sammler-stücken. Nur dies sollte den Sammler bedenklich stimmen: Die nicht ganz unkomplizierte Schal-tungstechnik durchblicken außer ihrem Erfinder Dr. Moortgat-Pick nur noch wenige Spezialisten und Könner. Und wenn diese ihre Kenntnisse und Reparatur-Erfahrungen nicht vererben, wird es bald nicht mehr möglich sein, die Fernemp-fangsleistungen solcher Geräte in ihrer ursprüng-lichen Qualität zu demonstrieren.
Glaubte man den Inseraten, dann gab es eigentlich
nur Empfänger erster Wahl. In diesem Fall aber war
die Werbung nicht übertrieben
15
Die dynamische Chronik
Wie schon eingangs erwähnt, begann in den „Goldenen Fünfzigern" auch das Kapitel „Fernsehen", welches in dieser „Radiogeschichte" ausgespart bleiben muss. Den Rundfunkwerken indes verhalf es zu weiteren Höhen-flügen. Und den Fußballern. Zahlte doch 1953 der NWDR dem Deutschen Fußballbund für die Femseh-Übertragungsrechte des Endspiels sage und schreibe 2.500 Mark!!!
Notiz aus „radio mentor", Juli-Heft 1953
8. Kapitel
• 2500 DM zahlte der NWDR dem Deut-schen Fussballbund für die Genehmi-gung zur 'Übertragung des Fussball-Endspieles im Fernsehen. Der Rund-funkhandel vermietete für diesen Tag Fernseher an eine grössere Anzahl von Fussball-Vereinen, das kostete in Ham-burg mit Antennenanlage je etwa 75 DM.
8.7 „HiFi" ist gefragt und „3 D" Raumklang — Deutschland wird Radioexport- Weltmeister
Ist der Rundfunkempfänger „fertig"? — fragte Karl Tetzner in seinem Leitartikel im Heft 24
Ist der Rundfunkempfänger „fertig"? der ,Funkschau" vom Dezember 1953 — dazu nachstehender Ausschnitt.
Man darf daher behaupten, daß die Zeiten der technischen Überraschungen und auch der raschen Fortentwicklung vorbei sind, selbst wenn man an die nimmermüden Wissenschaftler in unseren Labors und Forschungsstätten denkt. Von dem Standpunkt aus betrachtet, daß umwälzende Neuheiten nicht zu erwarten sind, ist auch die jährliche Abhaltung einer Großen Deutschen Rundfunkausstellung nicht recht sinnvoll; ein zweijähriger Rhythmus dürfte richtig sein. Die Männer in den Konstruktionsbüros der Fabriken atmen auf. Endlich wird es ihnen ermöglicht, sich fertigungstechnischen Details zu widmen und Einzelheiten zu bear-beiten, die sie bisher aus Zeitmangel nicht in Angriff nehmen konnten.
Die Rundfunkgeräteindustrie kann natürlich auf die Dauer nicht ohne Neuheiten aus-kommen. Im Wettbewerb um das Geld des lieben Publikums steht das Rundfunkgerät nicht allein und muß daher anziehend bleiben, solange es noch nicht vom Fernsehen auf ein be-scheideneres Plätzchen verwiesen worden ist (fraglich, ob das in ferner Zukunft der Fall sein wird ...). Jedoch — was soll man tun, wenn die echten technischen Sensationen fehlen und die Werbeleute nach zugkräftigen Schlagern rufen?
Prof. Tetzner hatte nicht unrecht. Die UKW-Empfangsleistungen waren bis 1953 — innerhalb von nur drei Jahren also — exzellent gesteigert worden; mehr konnte man kaum erwarten. Dies allein aber ge-nügte den Technikern nicht. Die Tonqualität war noch verbesserungswürdig und deshalb wurde der Niederfrequenz-Seite besondere Beachtung geschenkt. „In der Luft" lag dies deshalb, weil die „Welle der Freude" mit ihrer Übertragungsbreite von bis zu 12...15 kHz ein neues Hörerlebnis ver-sprach, wenn man die Möglichkeiten zu nutzen verstand.
Schon gegen Ende der Dreißiger wurde versucht, das Klangspektrum bei Spitzengeräten durch den Einbau eines zusätzlichen Hochtonlautsprechers zu verbessern. Die Erfolge hielten sich in Grenzen, weil für die „Höhen" im AM-Bereich das „Ende der Fahnenstange" normalerweise schon bei 4 bis 6 kHz erreicht war. Auch jetzt begann der Fortschritt in Sachen Tonqualität wieder mit dem Hochtöner, der wie damals frontal in die Schallwand neben dem Hauptlautsprecher eingebaut wurde. Zunächst schien das elek-trostatische System den Forderungen am ehesten zu entsprechen. Grundig hatte es schon 1950 im großen 495 W. Körting entwickelte den „Formant"-Hochtöner für Frequenzen von 7000 bis 15000 Hz, der 1952 erstmals in das Spitzengerät Royal Selector 53 W
eingesetzt wurde. Die gewölbte Membran dieses Lautsprechers sorgte aufgrund ihrer Geometrie bereits für einen „Raumklang". Auch andere Firmen verwendeten den Formant zur Wiedergabe der Höhen.
Nach Wiederaufnahme der Lautsprecher-Entwicklung konnte Körting 1952 das erste Ergebnis dieser Arbeiten vorweisen. Es war der elektrostatische „Forrnant-Lautsprecher mit Weitwinkelabstrahlung. (Aus: „40 Jahre Körting-Radio")
16
1444,440yemie funkschau
hf»1111 rit',,,
Seha
ilung bein2131aup u n k t.„3-D-Rauet-ktangs ern", Die seittichen Lautsprecher er- geben e Annäherung an den IdeaLfatt der
„atmenden Kugel."
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Indes — die Freude darüber war nicht ungeteilt. Vor allem ältere Hörer wollten — vom AM-Empfang
her „verwöhnt" — an ihrer „warmen" Tonlage festhalten; die Bässe wurden von ihnen bevorzugt.
Deshalb drehten sie nun
die (meist noch mit der
Bandbreitenregelung
kombinierte) Tonblende
lieber auf „dunkel", um die unangenehm emp-
fundenen „störenden
Zischgeräusche" nicht
anhören zu müssen. Von der jüngeren Generation
hingegen wurden so-
wohl mehr — mitunter
übertriebene — Höhen erwartet, als auch größe-
re Lautstärke. Die Ent-wickler waren erneut
gefordert: die „Welle
der Freude" in „HiFi-Qualität" wurde zum
Ziel erklärt.
Zuschrift an die „Funkschau", Heft 9/1955.
Ob das schließlich erreichte Ziel allein den Leistungen der Spezialisten zugeschrieben werden konn-
te? Ob es nicht ein Geschenk des Himmels war, wenn man künftig auf der ultrakurzen Welle auch sagenhaft schönen Sphärenklängen lauschen durfte? Hatte doch Papst Pius XII. — wie das in der „Telefunken-Zeittafel" zu lesen ist — im Januar 1951 den Erzengel Gabriel zum himmlischen Patron des gesamten Nachrichtenwesens ernannt. Wenn das kein gutes Omen war...
NI* an die FUNKSCHAU-Redaktion
Volksempfänger klangsdiöner als UKW
Zu dieser Diskussion in der FUNKSCHAU 1955. Heft 3, Seite 43, möchte ich hinzufügen: Es gibt viele Hörer und ich glaube es sind die meisten, die eine natürliche Abneigung gegen hohe Töne haben. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, eine Miniaturstatistik auf-zustellen, und bin zu dem Ergebnis gelangt, daß von ca. 50 Besitzern von Rundfunkempfängein mehr als 40 ihre Tonblende oder ihren Höhenregler richtiggehend „zugeknallt" hatten, wenn ich einmal so sagen darf. Möge die Ursache nun tatsächlich auf Nervenbelastungen zurückzuführen sein, Tatsache ist jedoch, daß ein Gefallen an einer solchen Wiedergabe Selbstbetrug ist. Hingegen sind es die gleichen Leute, die den Standpunkt vertreten, eine Rundfunkdarbietung oder eine Schallplattenwiedergabe sei bei weitem kein Originalkonzert.
Natürlich ist das richtig, und unter den geschilderten Zuständen wird es nie anders sein. Jeder Ela-Techniker weiß, daß die Harmoni-schen und die Obertöne bestimmend für das Klangvolumen sind, und gerade um dessen willen werden Geräte mit Höhenanhebung ge-schaffen.
Ich sehe nun durchaus eine Möglichkeit, den Hörer zum Anhören breitbandiger Darbietungen zu erziehen! Diese Aufgabe könnten z. B. die Programmzeitschriften oder der Rundfunk selbst erfüllen. Es ist mir in vielen Fällen gelungen, einfach auf Grund technischer Erläu-terungen, wobei ich den Sinn und Zweck der Baß- und Höhenregler zum Thema gestellt habe, die Leute dazu zu bringen, versuchsweise eine Darbietung in vollem Frequenzumfange zu hören, und ,bereits nach kurzer Zeit gab es für diese Leute gar keine andere Tonein-stellung mehr! Das Thema „Volksempfänger klangschöner als UKW" geht also keineswegs nur die Industrie an, sondern vielmehr weite Kreise der Hörerschaft! Alfred Heckmann
Die Entwicklung machte nicht halt — dafür sorgte schon die Konkurrenz. Ab etwa 1952 erhielten die besseren
Modelle anstelle der einfachen Tonblende getrennte Regler für die Anhebung der Höhen und Tiefen. Und in der zweiten Hälfte der Fünfziger begann man, mit den
Lautsprechern (jetzt auch dynamischen Hochton-
Systemen) und den dazu nötigen Endstufen großzügiger
umzugehen. Vorerst aber sollte ein neues Hörerlebnis
Furore machen.
Skizze aus der „Funkschau", Heft 14/1954, Seite 279: Nach dem Vorbild der „atmenden Kugel", die schon Jahre zuvor von den Herren Harz und Köster (NWDR) entwickelt worden war, kreierte Blaupunkt „3 D"
„3 D" wurde es genannt, als „vollendeter Raumklang" apostrophiert, und mit großem Trara auf den
Markt gebracht. Ein ganz neuer „dreidimensionaler Klangeindruck" sei dies — als ob nicht schon der Trichterlautsprecher von 1924 den Raum mit seinen drei Dimensionen bis in den letzten Winkel be-
schallt hätte... Und schließlich waren die drei Lautsprecher nicht einmal dreidimensional ausgerichtet
— sie tönten nur in die zwei horizontalen Richtungen.
Die Firma Blaupunkt hatte den Stein mit ihren 1954er Modellen Florida und Riviera ins Rollen ge-bracht, aber Max Grundig war es schließlich, welcher der Branche mit dem „3-D-Rummel" erst rich-tig einheizte.
17
18
Bild 1. Prinzip des Raumktangsystems mit BiLd Z. Gelochter Streu- einem Lautsprecher und Tonkammer
reflektor vor der Laut-
sprecheröffnung
seitlicher Schallau.stritt
Lautsprecher Streu- System reflektor
8. Kapitel
Tr0m0e› •KONZERT-STRAHIER
DENKENDE TONBLENDE
TRIPLEX -ABSTIMMUNG
TELEFUNKEN
enge4Sir Fofnegebung und 3 0 •Klong
nneen °Omen !REAP« EN biehie win
Gera,. inn Hoengino0 an reideniecher
nd Auterottung. Die Libefteueenden
Es sind di* IdezzlgefEne Over Preitliteue fro define
Quediniz die Weenier** TFLEFUNKEN berpf
E nip fahlizn Sie 'Nan Kunden die Empgenge,
Jubilate • Jubilate • Jubilee mit Uhr
Openetle .Cratairtise • Opus und die brinahrten
FIZINS.THER der TI 10 Snit
denn Sie einch
EFUNKEN STEHEN HEISST S
Die dynamische Chronik
Das Argument, dass man nur mit
zwei seitlich angebrachten Lautspre-
chern den echten Raumton hören
könnte, war im Grunde recht ober-
flächlich; beim Publikum aber stieß
die von Grundigs Werbestrategen
erdachte „3 D-Kampagne" auf die
erhoffte Resonanz. Alle anderen
mussten, wenn auch widerwillig,
nachziehen und (wie dies Telefun-
ken elegant löste) wenigstens kleine-
re Hochtöner in die vorderseitigen
Ecken ihrer Geräte einfligen.
Raumidang mit nur einem Lautsprefier
The Tendenz, die Geräte zu volkstümlichen Preisen herauszubrin-gen, führten bei der Firma Emud nach gründlichen Versuchen zu einer neuen Raumklanganordr.un,g nut nur einem einzigen Laut-sprecher.
Emud war schon in der Vorkriegszeit als Hersteller einfacher und preisgünstiger Radios bekannt. Mit dieser Konstruktion aber konnten die Ulmer nicht überzeugen (Skizzen aus „Funkschau", Heft 6/1955).
Schon mit vier Lautsprechern war dieser SABA- Spitzensuper Freiburg-Automatik 3 DS von 1954 (ein Mono-Empfänger!) üppig ausgestattet, und nun gesellten sich zu ihnen — weil der Markt es ver-langte — zwei weitere für „3D".
Hermann Brunner-Schwer schrieb in „SABA, Bilanz einer Aufgabe":
„Grundigs Donnerschlag kam kurz
vor Beginn der Funkausstellung, zu
einem Zeitpunkt also, an dem die
Hersteller große Mengen neuer
Modelle für die Saison bereits vor-
fabriziert hatten. Was blieb also
anderes übrig, als die auf Lager
liegenden Apparate wieder auszu-
packen, die Chassis auszubauen,
alle mit echtem Nuß baumfurnier
geschmückten Holzgehäuse an den
Seitenwänden vorsichtig auszu-
schneiden und die aus Thermoplast
gespritzten Lautsprecherblenden
einzupassen, hinter denen dann
zwei kleine Lautsprecher einge-
schraubt und verdrahtet wurden."
Telefunken fand mit dem Einbau der zwei 3D-Hoch-ton-Lautsprecher in die vor-deren Ecken eine elegante Lösung.
Oiskant-sirahlet
Schaltbilder aus: „Funkschau, Heft 16/1954, S. 342. Der Grundig-Vor-stufensuper 5050 W/3D galt als Spitzengerät aus der Saison 1954/55
Ii0pF 50N2
AM F
EL 84
WNW
2,51iF
• Tiefton-lautsprecher
Seiten-lautsprecher
250F
Diskant-strahlet
Bitd 4. Gegentakt - Endstufe des Grundig 3- D -Kiang - Supers 5050 W I 3D mit
Klangweichen und fünf Lautsprechersystemen
EL84
Seitenlautsprecher
504F
4.4k2 bei co. 3k/Is
Tiefton-lootsprecher
Bitd 3. Schattung
der Endstufe beim Grundig
3-D-Klang- Super
5040 Wf3D
700k2 Höhen- reg/er
5K1
Oki
25nF
19
C.GRurumo
Musikgorkit 955 W
mit 3 -D-Elioki Die Schall-Austritts-öffnungen am Graetz-Modell Sinfonia 4R
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Die Geschäfte florierten. Ausgereifte UKW-Technik und „3 D-Klang" — das war für viele Grund ge-nug, sich nun ein „modernes" Rundfunkgerät anzuschaffen. Die Grundig-Werke — dies sei zu ihrer
Ehrenrettung vermerkt — waren auch wirklich bemüht, dem „Raumton" Vorteile abzugewinnen, das
beweisen die aufwendigen Schaltungen mittels spezieller „Klangweichen" in den Modellen 5040 W/
3D und 5050 W/3 D von 1954. Max Grundig wurde zum „3-D-König"; diese Führungsrolle konnte
ihm nicht mehr streitig gemacht werden.
Nur die billigeren Musikgeräte 955 W und 1055 W von 1955 konnten Grun-
digs Ansehen trüben. Die hatten zwar
seitliche Schallaustrittsöffnungen,
dahinter aber keine Lautsprecher.
Sollte man sie als „3 D-Effekt-Mogel-packungen" bezeichnen? Oder machte eine „Schallführung" die beiden
„3D"-Lautsprecher schon entbehrlich?
Auch andere Firmen setzten mit mehr
oder weniger technischem Aufwand auf Werbeeffekte.
Graetz wollte „3D" übertrumpfen. Was dabei herauskam, war schlimm. „UKW-Rundstrahl-Raumklang-Spitzensuper 4 R" — dieses Prädikat verliehen die Herren aus Altona ihrem Modell Sinfonia, nachzulesen in einem der 1954er Radiokataloge. Um eine vierseitig wirkende Rundstrahlcharakteristik sollte es sich handeln, aber was aus den schmalen Schlitzen hervor-quoll, war mehr als bescheiden. Nur die Wer-bung konnte den Absatz beflügeln — musste doch einfach besser sein als nur „3D"!
1-1-1—LLU _
Bild 2. Anordnung der Lautsprecher; die gestricheiten Pfeile deuten die seitliche
Schallabstrantung an
Die dynamische Chronik
Das „4 R"-Verfahren (Graetz) und der nach oben
strahlende Mittel-Hochtöner in Philips-Geräten (alle aus der Saison 1954/55) zählten hierzu.
Siemens meinte, ihre Schatullen
hätten den „Raumton" infolge
ihrer „Divergenzgitter"-Türen
auch ohne seitliche Lautsprecher.
1954 brachte Siemens neben den Geräten in Ein-heits-Gestaltungen wieder Schatullen-Modelle auf den
Markt. Bei geschlossenen Türen würden Reflektionen den „Raumton" bewirken — 3D-Lautsprecher seien bei ihren Geräten überflüssig, sagte Siemens...
8. Kapitel
SIEMENS
GE RATE
rriticr Klart4
reine Frrrede
MIT RAUMTON
Auch die Kaiser-Werke Kenzin-
gen machten sich Gedanken, wie
sie den Kaufinteressenten von der
in ihrem Hause erdachten 3D-
Realisierung überzeugen könn-
ten.
Die beiden Hochtöner des Mo-dells Kaiser-Walzer W 1145/3D
strahlten sowohl nach vorn, als auch „durch die innen ausgekehl-
ten Vorderholme den Klang nach
Art des 3D -Prinzips überkreuz
nach den Seiten" — so steht's ge-
schrieben in der „Funkschau" Heft 22/1954.
Wie beim Typ Kaiser-Walzer fügten die Kaiser-Werke auch bei diesem „Union"-Modell W 57/3D die elektrostatischen Hoch-töner links und rechts der Lautsprecherwand ins Gehäuse ein, wo sie gegeneinander schallten. Um den „3D-Hochgenuß" auszukosten, sollte der Hörer schon die Nase gegen die Lautsprecherwand drücken...
Weil der Wunsch nach immer besseren Raumklangverfahren zur Wiedergabe der UKW-Sendungen
nun mal geweckt war, mussten sich die Spezialisten des guten Tons noch etwas Feineres einfallen
lassen als nur die dreiseitige (nicht „dreidimensionale") Schallabstrahlung. Einen Schritt in die richtige Richtung taten die Entwicklungsingenieure bei Loewe, die 1954 anstelle
„3 D" den Begriff „Plastik" — für „plastische" Wiedergabe, z.B. im Hellas Plastik 552 P — bevorzug-
ten. Sie schufen 1955 das Spitzengerät Hellas 841 W mit zwei NF-Kanälen und einer Gegentakt-
Endstufe in „Ultralinear-Schaltung". Eine der End-
stufen wurden mit einer PCL 81 bestückt, die andere
mit 2 x EL 84.
Loewe-Hellas 2841 W Baujahr 1956. Stereo gab es noch nicht, (NF-seitig erst 1958/59 zur Wiedergabe der Mu-sik von Stereo-Schall-platten), aber dieses so genannte „Plastik-Ton"-Modell glänzt wie seine Vorgänger mit einem Zweikanal-Endverstär-kersystem: Für die Hö-hen eine 2-Watt-End-stufe, und für die Tiefen die 12 Watt-Gegentakt-Endstufe.
20
Neben den zwei Frontlautsprechern sind die seitlichen Tonkammersysteme zu erkennen.
U V 3,,A
UL 41
EL 8 Mid Ist
qlp.F
® 5'122
MO EL 84 560 k4
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Noch einen Schritt weiter — sicher zu weit — gingen 1955 die in Osterrode heimisch gewordenen
Continental-Werke. Sie bezeichneten ihre Modelle bedenkenlos als „Imperial Stereo". Im Folgejahr
war dann, wohl nach entsprechenden Protesten, das „Stereo" wieder verschwunden. Die Stereo-
Schallplatte kam doch erst drei Jahre später auf den Markt und den Stereo-Rundfunk — den gab's erst
nach 1963. Mit ausgereiften Empfängern dieser Art hatte sich die deutsche Radio-Industrie in wenigen Jahren an
die Weltspitze hochgearbeitet, und viele glaubten, das Ende der entwicklungstechnischen Möglich-
keiten sei langsam erreicht.
Die Philips-Entwickler indes schienen — den Röhren-
Aufwand betreffend — keine Grenzen zu kennen. Sie versahen 1955 ihr Elf-Röhren-Spitzenmodell Capella
753/4E/3D mit einem Zweikanal-Mono-Hi-Fi-Verstär-
ker. Die beiden „eisenlosen" 4-Watt Gegentakt-Endstu-
fen wurden mit vier Lautsprecherröhren bestückt.
Capella 753/4 E/3 D 8-(11-)Kreis-Wechselstromsuper
575,— DM FCC 85, ECU 81, EF 89, EBF 80, EABC 80, EC 92, EL 84, 17L 84, EL 84, UL 94, EM 80, B 250 C 150
Capella 753/4E/3 D
8 AM-(11 FM-)Kreise, 2 (2) ver-änderbar; 11 Rd Tgl
4 Wellenbereiche (UMEL), Ein-knopf-Abstimmung für AM/FM mit automat. Umschaltung; Motor-Abstimmung zur Ein-stellung von 3 UKW-, 2 MW-und 1 LW-Sender und Ab-stimmhilfe ; 6 AM-ZF-Kreise, Bandbreite regelbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf drei Stufen; 8 F.m..zF.. Kreise. FM-ZF 10,7 MHz
14 Drucktasten, 4 Wellenbereich. Ferri tan tenne. 3 UKW-. 2 NINV-, 1 LW-Sender, TA. 3 D, Aus
NF-Teil 4-W-Endstufe (Tiefton) und. 4-W-Endstufe (Hochton); An-schlüsse für TA, Magnetton (Diode). Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefen-regler. Höhenregler mit Band-breiteschalter gekuppelt
1 Sicherung, 1 A für 110, 125 V oder 0.5 A für 145, 220 V. 2 Skalenlampen. 7 V (0,3 A)
Ausführung und Gewicht Edelholz, dunkelbraun, 700 455 x 275 mm: Gewicht 18 kg
Die „eisenlose" Philips-Endsufe des Capella 753/4E/3D hat eine sonderbare (auch wieder geänderte) Röhrenbestückung. Nicht nur die Berücksichtigung der inneren Widerstände führten (im Wechselstromgerät 0 zur Wahl der UL 41 (bzw. im Kata-log der UL 84), es war auch die Katodenisolation, die ihren Einsatz in dieser Schaltung erforderlich machten.
Auch das 1956er-Nachfolgemodell Ca-pella 663 wurde wie-der mit „eisenlosen" Endstufen ausgestat-tet, jetzt jedoch mit vier der eigens dafür geschaffenen Laut-sprecherröhren EL 86.
Rechts abgebildet ist die Type 663 AS. Im Vorgriff auf die späte-ren Baustein-Systeme offerierte Philips die-sen Empfänger ohne eingebaute Lautspre-cher. Die seitlich an-gebrachten Gitter die-nen nur der Lüftung.
Die „eisenlose" Endstufe — ohne Ausgangstrafo — war zur besseren Wiedergabe der Höhen gedacht. Dazu aber mussten die Lautsprecher-Schwingspulen hochohmig sein. Die waren sehr teuer in der
Herstellung und führten vereinzelt auch zu Ausfällen, weshalb dieser Weg wieder verlassen wurde.
Nur der VEB Stern-Radio Sonneberg fand (erst 1960/61) noch Gefallen an dieser Technik und krei-erte den Mittelklassesuper Erfurt IV mit der eisenlosen Endstufe.
21
Graetz propagierte 1956 den „Schall-kompressor" und sprach von einer
„bahnbrechenden Neuheit".
Im selben Jahr schuf Grun-
Adig das „Wunschklang-
Register" — heute würde
I 2 man „Equalizer" sagen.
GRIMM
ICORTING c ic 830 4.1.<
MIT DYNAMIC-REGISTER
UND DYNAMIC -ANZEIGE
DM 478:
STEREODYN -RAUMAKUSTIK
EIN BAHNBRECHENDER ERFOLG MODERNER RUNDFUNKTECHNIK
FERNSEHEN•RLINPFUNU•M At NETTON KORTING
Inserat aus der „Funk-Technik", Heft 13/1957
Die dynamische Chronik
trett RAUMKLANG
mit
Ist die bohnbredsende Neuheit der Groeiz-Radto-Femseh-Werke, mit der des oberste Ziel der Rundfunktechnik erreide wurdei
Naturgetreue Tonwiedergabe.
8. Kapitel
Die It. Prospekt „bahnbrechende Neuheit" der Graetz-Werke: Der „Schallkompressor, bei dem anstelle der unzuverlässigen elektrostatischen Lautsprecher ein permanentdynamisches Druckkammersystem eingesetzt wurde, welches den Schall über Rohrleitungen nach den Seiten abstrahlte.
Grundig sprach nicht von einer „bahn-brechenden Neuheit", erzielte aber mit dem „Wunschklangregister einen Fort-schritt, dessen hörbare Wirkung nicht nur im Prospekt stand.
Mende (Nord-Mende) wertete
bereits seine Geräte des Modell-jahrs 1955/56 durch ein fünfteili-
ges Klangregister auf: "Baß,
Sprache, Orchester, Solo und
Jazz" konnte man jetzt über Tas-ten wählen. Körting brachte das
Raumakustik-Gerät Dynamic 830
W auf den Markt — mit der dort entwickelten Stereodyn- und Dy-
namik-Expander-Schaltung.
Pseudo-Stereofonie hat man zuvor
bewerkstelligt, indem die hohen und tiefen Frequenzen gefiltert
über getrennte NF-Kanäle ver-stärkt wurden, wobei die Hoch-
und Tiefton-Lautsprecher in ver-
schiedene Richtungen strahlten.
So konnte man auf dem einen Ohr
bevorzugt die Violinen etc. hören
und auf dem anderen mehr die
Bassinstrumente.
Diese Idee aber setzte sich nicht
durch — Körting hat es mit dem
1957 erschienenen 830 W, den es
im Folgejahr auch in der echten
Stereo-Ausführung gab, besser
gemacht.
Der Sammler zählt solch wertvolle Radios aus der „Raumklang-Zeit" zu seinen beliebten Exponaten
mit interessanten technischen Errungenschaften.
22
GERMANY
DIN 45500
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Vielleicht hätten sie damals, Mitte der Fünfziger, längerfristigere Beachtung gefunden, wenn nicht schon 1958 die Stereo-Schallplatte in Serie gegangen wäre. So verloren die akustischen Tricks beim Monosystem an Bedeutung. Man stattete nun alle großen Geräte mit zwei breitbandigen Stereo-NF-Kanälen, leistungsstarken Einfach- oder Gegentakt-Endstufen und insgesamt vier oder mehr Laut-sprechern aus. „HiFi" war zum Begriff geworden und der Hörer erlebte — zunächst die Schallplatten-wiedergabe — in einer wirklich neuen Dimension.
Und — „ Was ist HiFi?"... Mit dieser Frage beschäftigte sich 1956 auch Dr. A. Renardy im 2. April-Heft der „Funkschau" (8/1956). Schon in den Dreißigern hatten die Amerikaner den Begriff „High Fidelity" geprägt, der — frei übersetzt — „naturgetreue Wiedergabe" bedeuten sollte. Bei annähernd geradlinigem Frequenzgang wünschte man sich die verzerrungsfreie Übertragung von Tonfrequenzen im Bereich 40...15.000 Hz. So einfach sei das nicht, meinte W. Gruhle, und bekundete in der „Funkschau", Heft 24/1957 aus-fiihrlich seine Ansichten über dieses Thema.
Durch Gruhles Be-trachtungsweisen wurde HiFi zu ei-nem Problemfall, der sich bis auf Ge-biete der Psycholo-gie vorwagte.
Einleitung zum zweiseiti-gen Aufsatz W. Gruhle.
Jenseits von Hi Fi
Von W. Gruhle
Das Schlagwort Hi Fi stellt den Elektroakustiker vor eine neue Situation: er ist auf das Grenzgebiet zwischen Technik, Psychologie und Musik gelangt, wo sein bisheriges Wissen aufhört. Jeder Tonmeister, jeder Musiker, jeder Architekt steht diesen Problemen gegenüber. Es wird Zeit, daß auch der Elektroniker, der elektroakuetisch arbeitet, dieses Neuland kennen lernt. Begrenzung auf das eigene enge Fachgebiet hindert jeden Fortschritt, deshalb werden hier diese Gesichtspunkte einmal im Zueammenhang erörtert.
Jetzt geriet diese Angelegenheit erst mal ins Stocken. Man sprach zwar allenthalben von HiFi, aber es fehlte die Definition. Im September 1962 wurde das Thema wieder aufgegriffen. Ing. Otto Diciol berichtete in einem Leitartikel der „Funkschau" im Heft 18 über diesbezügliche Bemühungen in den zuständigen Gremien: dem Deutschen High-Fidelity-Institut (DHFI) und dem ZVEI, Sektion Phono.
High Fidelity - nur ein Schlagwort?
Als vor mehreren Jahren der Ausdruck High Fidelity — aus den USA kommend — auch in Deutschland seinen Einzug hielt, wurde es Mode, niederfrequente übertragungs-geräte mit dem Zusatz Hi Fi oder High Fidelity zu versehen.
Der Autor dieses Artikels erinnert sich in diesem Zusammenhang noch sehr gut an die Anfrage des Chefredakteurs einer bekannten Fachzeitschrift. Dieser interessierte sich dafür, ob die übertragungsdaten deutscher Verstärker, die mit dem Zusatz Hi Fi versehen waren, in etwa denen der amerikanischen Hi-Fi-Verstärker entsprächen. Da-mals mußte diese Frage — trotz erheblicher Fortschritte bei den übertragungseigen-schaften von Verstärkern — noch eindeutig verneint werden.
An dieser Stelle würde es zu weit führen, die von High-Fidelity-Geräten zu fordern-den strengen Qualitätspflichten im einzelnen aufzuzählen. Es soll hier lediglich eine kurze Begriffsdefinition gegeben werden. Bei elektroakustischen Geräten oder Anlagen sollte von Hi-Fi-Eigenschaften nur dann gesprochen werden, wenn folgende Grund-voraussetzungen erfüllt sind:
1. Die linearen und nichtlinearen Verzerrungen, die Tonhöhenschwankungen sowie die Störspannung sollen so klein sein, daß der spezifische Klangcharakter der Original-modulation auch in seinen Feinheiten nicht, oder nur mit Mühe hörbar, geändert wird.
2. Die Einsdiwingungsvorgänge bei impulsartiger Modulation sollen innerhalb des Crbertragungsbereidies von alien Geräten einer Anlagenkette möglichst verzerrungsarm verarbeitet werden.
3. Die Aussteuerungs- und Endleistungsreserve muß ausreichend sein, um auch kurz-zeitige Aussteuerungsspitzen unverzerrt wiedergeben zu können.
High Fidelity ist also zunächst eine Frage der elektrischen Eigenschaften aller in einer übertragungskette verwendeten Glieder. Für echte High-Fidelity-übertragungen sind daher Geräte erforderlich, deren übertragungseigenschaften wesentlich besser sein müssen als die der üblichen Standardgeräte gemäß DIN-Entwurf 45 567 vom November 1957.
Links: Das erste Drittel des Auf-satzes von Otto Diciol im Heft 18 der „Funkschau" Jg. 1962
Entsprechende Entwürfe wurden ausgearbeitet und auch wieder geändert. Es dauerte — dank „deut-scher Gründlichkeit" — rund ein Jahrzehnt, bis sich die Spezialisten des guten Tons schließlich im April 1966 auf die endgültige Fassung der HiFi-Norm DIN 45 500 einigen konnten.
23
1
J. /13- `
Jr"- Lotie-ine l-tuuerecheranordnung mit doppelt wirkender Membran der Schalldose.
Vergrößerter Bildausschnitt
Bild 5: Zwei Beispiele Rir die Schaltung des Hall.
systems van Grundig a) bei monauraler b) bei
stereofonischer Wiedergabe
NF-Einganst
0)
rechter Ka1421
linker Kenai
Direktschall
verzögerter Schaff (riachhatil
rechts
links
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Die (HiFi-) Stereo-Tonträgervviedergabe mittels getrennter NF-Stufen — das galt 1958/59 schon als
neues Hörerlebnis. Doch die Entwickler wollten sich auch damit noch nicht zufrieden geben. Der
„Raumton" von 1954 sollte durch den so genannten „Raumhall" überflügelt werden.
Neu war die Idee nicht — schon 1925 hatte der Berliner W. Lohmann einen Lautsprecher mit zwei
Trichtern konstruiert, welche beiderseits der Glimmer-Schallmembran angeordnet waren. Durch eine
Verlängerung der Schallftihrung des zweiten Trichters konnte ein räumlicher Eindruck der Wiederga-
be entstehen. „Der Radio-Amateur" schrieb 1925 zu den Skizzen im Heft 43:
„Der Zweck dieser Anordnung ist der, eine gewisse Phasenverschiebung der aus den beiden Trich-
tern herausgehenden Schallschwingungen zu erzielen. An sich wäre zur Erzielung einer gewissen
Raumwirkung eine Verzögerung des Schalls des einen Trichters gegenüber dem anderen von etwa
1/1000 Sekunde erforderlich. Dieses könnte durch die punktiert angedeutete Schallführung f er-
reicht werden... usw."
Abb. i. Kombination der beiden lrichter beim Lohmann-
Lautsprecher.
Der Klangeindruck war damals wohl nicht überwältigend — das Lohmann- System war nicht gefragt.
Gut zwanzig Jahre später bewirkte man diesen Effekt durch zeitverzögernde Spiralfedern, welche zwischen Schallgeber
(eingangsseitig) und Piezo-Mikrofone (ausgangsseitig) ein-gehängt wurden. Damit ließ sich ein unüberhörbarer Nach-
hall realisieren — Philips nannte das „Reverbeo".
Nachdem der UKW-Funk bzw. dessen brillante Wiedergabequalität auch in anderen Ländern Gehör
gefunden hatte und auch schnell die entsprechenden Sendernetze installiert werden konnten, bedurfte
es keiner großen Mühe, die hochwertigen Geräte aus deutscher Produktion in großen Mengen zu ex-
portieren. Die Rundfunkhersteller in aller Welt hatten wohl dieser Entwicklung keine Erfolgschancen
beigemessen und waren gegenüber deutschen Produkten um einige Jahre im Rückstand. So erlebten
die westdeutschen Radiowerke ihre goldenen Fünfziger und wurden schließlich Rundfunkgeräte-
Export-Weltmeister. Ob man wohl rückwirkend den Herren aus aller Welt danken sollte, welche 1948 am Konferenztisch
von Kopenhagen die deutschen Verlierer indirekt zu solchen Entwicklungsaktivitäten angespornt
haben?
24
Mit „Raumklang"
und „HiFi" waren
die Spitzengeräte
deutscher Rund-
funkwerke zu-
nehmend belieb-
ter geworden, und das nicht nur
im Inland.
Rechts: Chassis des 1953er Tele-funken Concertino mit der dreh-baren Ferritantenne.
gpoloifilp brachte für die deutsche Ind 9
den ersten Kleinstregler
1949 unter 20 mm Durchmesser
n den ersten kappenlosen Hochohmwide
195u mit axialen Anschlußdröhten
1952
195
1 den ersten hothkapazitiven
I Kondensator (Ultracond DK•4000) ;
den ersten Ferritantennenstab aus
Keraperm
Fe rrit-Sta b
Links: Inserat aus „radio mentor" Heft 7/1952, Bei Dralowid hieß der Fer-ritstab "Keraperm". Philips erfand schon 1947 den Werkstoff „Ferrocube".
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.8 Kurz, Mittel, Lang — nur auf den AM-Bereichen hörte man die Welt
Die „Welle der Freude" alleine hätte nicht den Aufschwung erklären können, den die westdeutsche
Radioindustrie in den Fünfzigern erleben durfte. Vor allem ausländische Abnehmer waren nicht we-
niger durch herausragende Empfangsleistungen in den amplitudenmodulierten Wellenbereichen zu
überzeugen. Und schließlich gab und gibt es auch hierzulande noch genügend Hörer, die sich nicht mit den örtlichen Sendungen begnügen wollen. Nicht zuletzt sind das heutzutage die „DXer" und „shortwave listener". Deshalb wurde auch über die konventionellen Empfangsbereiche nachgedacht.
Telefunken hatte bereits mit dem 1950er-Modell T 5000 ein Meisterwerk präsentiert, das schon einen
integrierten UKW-Bereich enthielt, vor allem aber noch mit seinen AM-Empfangsleistungen auf al-len Wellenlängen (auch gespreizten Kurzwellen-Bereichen) auftrumpfen konnte. Die Wettbewerber
folgten dem damaligen Marktführer dicht auf den Fersen und es gelang ihnen in den Folgejahren
auch, die (1951 noch mit Stahlröhren bestückten) Telefunken-Modelle zu übertreffen.
Der 23 kg schwere Siemens Spitzensuper 51 (SH 906 141 hat zwar keine HF-Vorstufe mehr, aber mit sieben Rim-lockröhren, EM 4, EL 12 in der Endstufe und AZ 12 für die Gleichrichtung zählt der zu den größten der Saison 1950/51. Was ihn besonders sammel-würdig macht: der Spulenre-volver für die Wellenbereiche Lang, Mittel und 3 x Kurz. Wer aber konnte sich das 1950 leisten: 650.- D-Mark — mehr als zwei Monatsgehälter — für solch einen Luxus... (Siehe auch Siemens, Kap. 9)
Nicht nur, um dem Rundfunkteilnehmer bei Mittel- und Langwellenempfang die Außenantenne zu
ersparen, setzte man in die besseren Heimgeräte eine drehbare Ferrit-Antenne ein.
Das war die Nachfolgerin der früheren Rahmenantenne und hatte wie diese eine Richtwirkung. Mit
ihr konnten unter Umständen zwei Sender getrennt werden, die aus verschiedenen Richtungen (mög-lichst ca. 90 Grad) auf etwa derselben Wellenlänge empfangen wurden. So nützte man alle Möglich-
keiten, um auf dem völlig überbelegten Mittelwellenband gegenseitige Störungen zu minimieren.
25
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Auch mit Resonanzkreisen wurde nicht gespart. Zahlreiche Acht-Kreis-Superhets kann man unter
den Fünfziger-Radios finden — vor dem Krieg waren nur Spitzensuper mit so vielen Kreisen ausge-
stattet.
Allerdings hinkt dieser Vergleich. Statt zwei wurden nun drei ZF-Filter eingebaut, das ergab schon
sechs Kreise. Solche Achtkreis-Superhets hatten weder eine HF-Vorstufe noch das Eingangs-Band-
filter. Aber auch damit ausgestattete Geräte kamen wieder auf den Markt. 1952 beispielsweise hatte
Nord-Mende seinen Typ 500-10 im Programm. Er war mit drei regelbaren und sieben fest abge-
stimmten Kreisen versehen. Zehn-Kreiser waren gar keine Seltenheit, doch wurden diese oft mit nur
einem Eingangskreis, dem Oszillator und schließlich acht ZF-Kreisen aufgebaut.
Deshalb schaut der Sammler bei Großgeräten aus dieser Zeit besonders tief in die Schaltbilder. Be-
vorzugt interessieren ihn die Vorstufensuper, wie etwa der Schaub-Transatlantic von 1954, welcher
außerdem noch durch drei KW-Bereiche aufgewertet worden war.
Unter den Spitzengerä-ten aus Mitte der Fünfzi-ger gab es nur noch wenige Superhets mit HF-Vorstufen. Aus dem Hause Schaub war es der Transatlantic 55.
Mit elf Röhren und zwei „Kristalldioden" wurde dieser 1954/55 gebaute Neu n-/Elf-Kreis-Vorstu-fensuper bestückt. Der zusätzliche Zwei-gang-Drehko (hinten) dient der Einstellung des Ortssenders auf die dafür vorgesehene Fest-sendertaste.
Kaum zu glauben, dass den Technikern auch der Zehn-Kreiser noch nicht genügte. Die Grundig-Großsuper 5050 und 5040 erhielten 1953 und 1954 elf AM-Kreise, der Loewe Hellas 552 ebenfalls,
und SABA präsentierte in den selben Jahren neue Freiburg-Modelle, denen tatsächlich zwölf AM-
Kreise einverleibt wurden (neun davon — mit der regelbaren MHG-Schaltung (dem Differentialfilter)
— in der ZF).
SABA
Saba — „Freiburg-Automatic"
14-Röhren-12 (m. UKW 25)-Kreis-Superhe
mit Drucktastenautomatik
Schaltung: 12 (UKW 13)-Kreis- Besonderheiten: Motorisch an- . Superhet getriebener, automatischer 1 Stromart: 110, 125, 150, 220, UKW-Spitzensuper mit UKW-
240 V Wechselstrom Gegentakteingang, abge- Leistungsautnahme: 100 W stimmter Vorstufe, hodtwirk- Sicherungen: 110-125V: 1,25 A samer Pentodenbegrenzung
220-240 V: 0,6 A u. Ratiodetektor, 2 getrennte Skalenlampen: 4 x 7 V / 0,3 A Skalenzeiger, 9-teilige Kla-Tostenlampen: 7 x 8,5 V/0,15 A viertastatur, davon 7 Leucht- Wellenberelche: tasten, von der Frontseite
UKW: 87 — 100 MHz mit großem Bedienungsknopf Kurz: 5,9 — 18,7 MHz beliebig einstellbare Orts- Mittel: 510 — 1610 kHz taste mit abgestimmten An- Lang: 145 — 350 kHz ' tennenkreis sowie optischer TA: Tonabnehmer Anzeige, höchste Trennschär-
Röhren: 14 mit 24 Funktionen for auf AM durch Verwen-ECC 81, EC 92, ECH 81, EF dung des Saba - Differential-89,
i EBF 80, 2 x EABC 80, : filters, 15 - Watt - Gegentakt-
ECC 83, EM 34, ECL 80, 2 x' endstufe. Weitere Einzelhei-EL 84. Selen B 250 C 140, ten siehe Saba „Meersburg
, 25 C 2 Automatic" unter Besonder- Schwundaosglekh: AM: 2stufig heiten. Lautsprecher: perm.-dyn., 2x je Gehäuse: Edelholz hochglanz-
260 mm Großlautspredier inft i 1 poliert, 720 x 460 x 330 mm Hochleistungsmagneten, u. 2 x HT. mit Raumstrahlwirkunü Gewicht: 22,1 kg netto
Preis: DM 699,—
Mehrpreis für Fernbedienung DM 50,—
Aus dem „Fachkatalog des Rundfunk-, Phono-, Fernseh-Handels" 1954/55. Im „Handbuch..." kostete der 3 DS 739.- DM
26
Motor-Duplex-Schaltung bei den Sa ba - ten Meersburg-Autornatik und Freiburg-Auto-matik. An der Frontplatte sitzt nur e in Knopf, das Urischatten von AM- dui FM- A bstimmung erfotgt durch die Schattgabet zwischen den bei-
den dunklen Kupp/ungsscheiben./M Eindrechts oben sieht man den Antriebsmotor
8. Kapitel
Aus: „Funkschau", Heft 14/1954
KORTING
Das Blockschaltbild (aus „40 Jahre Körting") zeigt nur die AM-Gruppe des Körting-Royal-Syntektor, der Schaltungsaufwand für den FM-Teil ist nicht geringer.
Mirth * Oszil /diorite&
EC 32
An
1. l-Rule Abstimni- anzeige
EM 85
,•••••41>
9egleng riirkwarts Pegelspann,- G/eichrichter
2. Diode
GA 80
Tag-karielo BS 604
- me Fes rgr-span
Phasen- ilnikehrstefe
Fri ade
14 81 80
«IF».
h#F-
di-Stole
118.9
/1/ -Verliefe eigeeerst.
EI 89
2 Zl-Stufe Penthode
E8F 80
if-Stuff Nome
ICH 81
1
tenodurrater 1. &ode
14,8180
Gegentakt-indstufe
Gegentakt - Endstufe
El eq
Neer-gleithriehter
AZ,,
Die dynamische Chronik
Von der hohen Kreiszahl des SABA- Automatic 3 DS wurde
1954 aber weniger Notiz genommen als von einer anderen
Spezialität, welche dieses Spitzengerät auszeichnete: Nur SA-
BA hatte ihn — den automatischen Sender-Suchlauf. Er war das
Ergebnis einer Weiterentwicklung des Konzeptes von 1937,
das damals noch nicht ausgereift war. Jetzt funktionierte es und
sollte noch viele Jahre eine SABA-Domäne bleiben. Mit zwölf
Röhren und sechs Lautsprechern versehen, kostete der — schon mit einer Kabel-Fernbedienung ausgestattete — 3 DS annähernd
800.- DM, etwa doppelt soviel wie der normale Achtkreis-
Superhet.
Mit diesem Gerät hatte der technische Aufwand far die Selek-
tion des AM-Empfangs den Höhepunkt erreicht. Der SABA
Freiburg 6-3 D von 1955/56 wurde wieder auf zehn Kreise
reduziert, der Freiburg 8 von 1957/58 musste sich gar mit acht
AM-Kreisen begnügen. UKW war nun zum bevorzugten Emp-
fangsbereich geworden. Deshalb wurde auch schon 1954/55 dem AM-Teil des Körting
Royal-Syntektor nicht die Beachtung geschenkt, welche dieser
hervorragende, mit 11(12) Kreisen, einer HF-Vorstufe, additi-
ver Triodenmischung und weiteren schaltungstechnischen Raf-
finessen ausgestattete Empfänger verdient hätte.
Um das Thema „AM-Empfang" abzurunden: Es gab natürlich nicht nur die Spitzengeräte, zu denen
sich der Sammler besonders hingezogen fühlt. Standard-Sechskreis-Superhets waren im Angebot
und auch noch Geradeaus-Empfänger. Mit seiner, schon im Absatz 7.11 wiedergegebenen Prognose:
„Die früher von der deutschen Industrie gepflegte Zweikreiserklasse erscheint im neuen Baujahr
nicht mehr. Einkreisempfänger werden nur von wenigen Fabriken für solche Interessenten herge-
stellt, die sich den preislich günstigen, aber für den schmalen Geldbeutel schon zu teuren Kleinsuper
nicht leisten können" — hatte der Kommentator 1949 (im „Funkschau"-Heft Nr. 14) den Geradeaus-
empfänger doch etwas zu früh tot gesagt. Anscheinend war's ein Scheintod — brachte doch die selbe Fachzeitschrift etwa ein Jahr später, in
ihrem ersten September-Heft von 1950, wieder eine dreiseitige Abhandlung über „Neuzeitliche Gera-
deausempfänger", in der die neuesten Einkreiser der Firmen: Apparatebau Backnang, Blaupunkt, Grundig, Jotha, Lorenz, Loewe-Opta, Lumophon, Emud, Schaub und Schmidt-Corten vorgestellt
wurden — einige davon hatten sogar einen UKW-Empfangsteil.
27
&Wei-
Kleinempftinger
trennsdiorf, große Leistung!
EDLY-RADIO BERLIN SW 61, Hagelbergerstr. 53
SCHAUB-LORENZ
Pirol 56 OW
1 AM-Kreis; 1 Ito ± 1 Tgl
2 Wellenbereiche (ML)
0.5-22-W-Endstufe
1 Lautsprecher perm,-dyn., 130 mm
St roinversorgung 110. 127, 220V. 28 W. 1 Si- cherung. 0.25 A. 1 Skalen-lampe, 18 V (0,1 A). Röhre
Ausführung und lie cht I'reßstoff, weinrot, 310 X 201 130 mm: Gewicht 2.3 kg
Pirol 56 (AV 1-K reis-Allstrom- Gcradeausempfänger
79,—
UEE 71, C 220 N tit E
... ging die Ära des Geradeausempfängers zu Ende - zumindest in der BRD.
Die dynamische Chronik
Vergessen wurde das Nora-Einkreisgerät Aida, ein Nachfol-ger des Junior, über den im „Radio-Händler" vom November 1949 geschrieben steht: „Wußten Sie schon... daß die Firma Nora mit ihrem Einkrei-
ser einen überraschend großen Markterfolg im ganzen Reich
erzielt hat, weil dieses Gerät die Eigenschaften der VEL 11 so
optimal ausnützt, wie dies bisher noch bei keinem industriel-
len Gerät möglich gewesen ist..."
Der „Radio-Händler" verschwieg, dass es mit anderer Röh-renbestückung bessere Einkreiser gab, als den Nora. Doch wenn man's genau nimmt: mit der 1949/50 schon etwas ange-staubten Telefunken-Spar-Röhre sicher keinen besseren als diesen Junior GW 152.
8. Kapitel
>NORA- JUNIOR< (3W 152
DER ERSTE DER NEUEN
Alistrom-Einkreiser mit der VEL 77 Gegenüber der alten DKE-Schaltung mit der Röhre VCL 11 besitzt ein mit der neuen Kombinationsröhre VEL 11 bestückter Einkreiser wesentlich höhere Empfindlichkeit und größere Ausgangsleistung.
G E RATE 1949
AvI,unfle Ober liatetMegke.",t.
eele-.!cre alte Norer.We,leswerl ,e ,vn,sn
1950 fand man die VEL 11 nur noch im Blaupunkt-Einkreiser E 79 U und im Thesing-Ara, welcher 1951 von Grundig als Gloria angeboten wurde. Den Voraussagen zum Trotz erwies er sich als zäher Bursche, der Einkreiser - ganz so schnell wollte er doch nicht das Feld räumen. Auch in den Folgejahren verblieb er in den Katalogen und im Grun-dig-Lieferprogramm von 1953 konnte man noch den Zweikreiser 840 W finden.
Sogar noch ein DKE-Nachfolger war 1953 auf dem Markt: der Edly-Kleinempfänger mit der nur noch für den Ersatzbedarf gefertigten VEL 11.
Fritz Rohde wollte nicht vom Kleinempfänger lassen. Noch in der „Funkschau" Heft 13/1953 offerierte er den Edly-Kleinempfänger, der aber auch — z.B. für Batteriebetrieb — mit Miniaturröhren be-stückt wurde.
Die aus der Vorkriegszeit für Geradeausempfänger bekannte Firma Emud fabrizierte für das Modell-jahr 1956/57 ihren letzten Einkreiser; mit 75.- DM war der Cherie das billigste Gerät im Katalog. Und es gab zum Preis von 79.- DM noch einen zweiten: den Pirol 56 GW von Schaub-Lorenz.
Über 30 Jahre zuvor hatten die drei - Emud, Schaub und Lorenz - ihre ersten Audions mit NF-Verstärkern gebaut. Mit ihren letzten Mo-dellen dieser Bauart...
Cherie •Kreis-Allstrom-Geradeous_
empfänger UF 11, UL 11. Tgl
EMUD-RADIO
Cherie
1 A31-Kreis; 2 Rö + 1 Tgl 2 Wellenbereiche (ML)
3-W-Endstufe Lautsprecher perm.-dyn., 130 mm
Stromversorgung 120, 220 V. 25 W. 1 Siche- rung, 0.3 A. 1 Skalenlampe. 18 V (0.1 A), Röhre
Ausführung und Gewicht Preßstoff. dunkelbraun. :e5 x 215 x 150 mm: Gewicht 2 kg
28
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.9 Radios bestehen nicht nur aus Technik: Design in der Nachkriegszeit
Nicht nur die Technik interessiert den Sammler, Radios haben auch ein Erscheinungsbild — die Ge-
häusegestaltung. Diese übte nicht nur Einfluss auf die Kaufentscheidung aus, sie war auch Spiegel-
bild der Mode, des aktuellen Stils und des Zeitgeistes. Im Kapitel 2, Abschn. 9 wurde dieses Thema aufgegriffen — es handelte sich um die Gehäuse-Archi-
tektur aus dem Zeitraum von 1930 bis 1935. Vergleichbar mit der späteren Kühlergrill-Veränderung
an Daimler-Benz-Automobilen entwickelten sich die Gerätegestaltungen schon Mitte der Dreißiger konsequent vom Hoch- zum Querformat. Das Höhe/Breite-Verhältnis war bei nebeneinander liegen-
den Ausschnitten für Skala und Lautsprecher etwa 1:2, bei Modellen mit Langfeld-Skalen näherten
sich die Maße denen des Goldenen Schnitts, also etwa 1:1,6.
Und nach dem Krieg? Zuerst kümmerte man sich um die Gestaltung recht wenig. Man prüfte das er-
forderliche Volumen und verglich es mit den Bemessungen der spärlichen Holzvorräte, welche für
die Gehäusefertigung verfügbar waren.
Natürlich dienten die Vorkriegsmodelle als Leitbild, doch es vergingen Jahre,
bis das einstige Niveau annähernd wie-
der erreicht wurde. Erst 1948, als es nach der „Währungs-
reform" wieder einen Wettbewerb gab,
mussten sich die Rundfunkwerke nach
den Wünschen der Käufer richten.
1945/46 entstanden die Gehäuse für die ersten Lorenz-„Notzeitradios" und Lautsprecher (links) aus Abfallbrettern unterschiedlicher Dicke.
1947/48 kam das rechts stehende — noch immer aus übrig ge-bliebenen Wehrmacht-Einzelteilen gefertigte — Modell S 48
bereits in einem professioneller hergestellten Sperrholzgehäuse auf den Markt. (Sammlung Dr. E. Windisch)
Der links abgebildete, 1947 in Köppelsdorf gefer-tigte EAK- Einkreiser 3/47 W stammt aus AEG-Hinterlassenschaften — das verraten die Telefun-ken-Drehknöpfe. Nur 34 x 20 x 23 cm misst das gefällige Kleinra-dio. Primitiv ist auch dieses Gehäuse, doch es wurde durch den Bakelit-Rahmen aufgewertet.
Ende der Vierziger experimentierten einige Kleinfirmen auch mit abartigen Gestaltungen. Neben den
Radios in Bar- und Bücherschrän-
ken gab es: Radio-Schachtische,
die in der „Funk-Technik" im Heft
1/1950 vorgestellte „Kaminfeuer-
Musiktruhe" (siehe: Thesing, Kap. 9), auch Lampenradios (Kap. 9: Bi-Funk, Tonolux, Uba) und
solche in Rund- bzw. Tongefäßen (Kap. 9: Gollnow, LTP). Ein besonders einfallsreicher „Fabrikant" (siehe Höfig im An-
hang B I, ) stellte auf der Leipziger Messe 1950 sogar ein
„Radio im Miniatur-Konzertflügel" vor.
Trotz aufwendiger Werbemaßnahmen: Das mit dem Innenleben von LTP kreierte Rondo-Urnenradio brachte im Ergebnis nur
rote Zahlen und trieb den Herrn Bürkle in den Konkurs.
29
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Über derartige Kreationen schrieb ein Redakteur der „Funk-Technik" unter dem Titel „Radio auf
neuen Wegen?" im Heft 19/1949: „Der Markt sagte bisher immer Nein! „Rundfunkgeräte im ungewöhnlichen Gehäuse sind stets eine
Frage an den Markt. Bisher hat dieser stets mehr oder weniger vernehmlich nein gesagt, worauf die
neuartigen und auffallenden Radiogeräte in allen Fällen genau so schnell gegangen sind wie sie ka-
men. Man muß als Fabrikant viel Mut aufbringen, dieses schon so oft mißglückte Experiment zu wie-
derholen, und man muß wirklich etwas Gutes bringen, etwas, was einleuchtet und erkennen läßt, daß
so etwas schon immer gefehlt hat...".
Diesen „Mut" brachten die in großen Serien fabrizierenden Unternehmen verständlicherweise nicht auf, sie beließen es bei den herkömmlichen Gestaltungen. Indes — von den abwechslungsreichen Stil-
richtungen aus den Dreißigern blieb nicht viel übrig. Die Links-Rechts-Aufteilung von Lautsprecher-ausschnitt und Skala und andere individuelle (Skalen-) Gestaltungen liefen Anfang der Fünfzi-ger zugunsten der lang gestreckten Skalen aus, die dann — mit wenigen Ausnahmen — an der un-teren Frontseite platziert wurden.
Frontgestaltungen wie beim Wobbe Syndikus konnte man noch bei manchen Geräten der Baujahre 1949 bis 51 finden, z.B. bei Mende oder Blaupunkt. Opta-Spezial gestaltete ihre Radios auch 1952 noch so.
Als Vorläufer des auf den Käufer zukommen-den Einheits-Stils hatte Telefunken 1949 den ersten Opus kreiert, bestehend aus zwei nuss-braun furnierten Seitenteilen und einem eben-solchen, vom Boden bis zur Oberfläche durch-gehenden Sperrholzteil. Tastenreihen unter der Skala gab es erst bei späteren Modellen.
Der Telefunken Opus 49 wurde zum Vorbild künftiger Gehäusegestaltungen. Später verlegte man die Bedienungs-knöpfe in die Skala.
Der Opus entspricht dem linken Gestaltungstypus in der nachfolgenden Abbildung. Beim davon ab-weichenden zweiten Modell verlief das dreiseitige Sperrholzteil von der linken Seite über die Front zur rechten Seite mit den sich daraus ergebenden Abrundungen an den Vertikalkanten (mittlerer Typ). Wenige Gehäuse bestanden auch aus einem vierseitig umlaufenden Sperrholzteil (Oberfläche, Seitenteile und Boden); die eingesetzte Vorderfront hatte abgerundete Ecken (rechter Typ).
Gefragt war die Einheitsgestaltung mit kleineren Variationen (Skizzen A. Kofink)
30
PTA)
hie /952/53
Klaviertasten-Groß-Super mit 8 Tasten
-UKW Superteil (Ratio Detektor)
mit Vorröhre
Störbegrenzer « Kurzwellenlupe
Großer 6 Watt Konzertlautsprecher
mit Nowi-Membrane
15 Kreise (9 UKW + 6 AM)
8 Röhren mit 11 Funktionen * 9 kHz Tonfilter
Hoch- und Tieftonregister durch Tastatur
Anschluß für Fernbedienung
Große ZF Verstörkung • Nußbaumgehause
Maßei 578 / 373 / 280 mm
Wechselstrom: 348,- DM mi,trom: 362,- DM
Klaviertasten-Groß-Super mit 8 Tosten
UKW Superteil (Ratio Detektor)
mit Vorröhre
Störbegrenzer • Kurzwellenlupe
Zwei Konzertlautsprecher mit Nowi-
Membrane • 17 Kreise (9 UKW + 8 AM)
8 Röhren mitll Funktionen • 9 kHz Tonfilter
Hoch- und Tieftonregister durch Tastatur
Anschluß fur Fernbedienung
Nußbaumgehause
Maße: 620 40u S 300 mm
Wechselstrom: 398,- DM
398.- DM
Klaviertasten-Luxus-Super mit 9 Tosten
Enorme UKW Leistung
Zwei große Konzertlautsprecher
19 Kreise (11 UKW 8 AM)
9 Röhren mit 12 Funktionen
18 Watt Endröhre (EL 12)
Hoch- und Tieftonregister durch Tastatur
Anschluß für Fernbedienung
Elegantes Nußbaumgehäuse
Maße: 6401400/340 mm
Wechselstrom: 448,- DM
348.- DM
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Als dann 1952 die elfenbeinfarbigen Bereichstasten aus Styrol-Copolymerisaten in Mode kamen,
wurde das Einheitsgesicht perfekt. Oben der bzw. die Lautsprecher, darunter die Skala und davor
eine Reihe Klaviertasten — alle machten dasselbe. Ein Grund dafür, dass diese, verächtlich als
„Gebiß-Radios" bezeichneten 50er-Modelle, von denen noch viel zu viele auf Floh- und Sammler-
märkten und auch beim Sperrmüll (im Regen) stehen, in Sammlerkreisen nicht besonders geschätzt
sind. Nur wenn sie technische Raffinessen zu bieten haben, erwacht das Interesse des Sammlers.
Man mag sich fragen, ob denn der Stil der Fünfziger-Möbel zur Ursache dieses Einheits-Designs ge-
worden war... Ganz und gar nicht.
31
ARKETreZt,',42'en,i'
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Nur vereinzelt findet man Radios, die mit den zeittypischen Elementen der Formgestaltung gebaut
bzw. ausgestattet wurden, z.B. mit den, der Mode entsprechenden schräg gestellten Füßchen, wie sie
an Sesseln und Tischen der Fünfziger üblich waren.
Der Schaub Goldsuper oder das Ton-
funk-Modell Violetta W 332 in der
„Lyra-Form" seien als Einzel-Beispiele
genannt. Bei Musikschränken bemühte
man sich eher um Anpassung, aber nur
der Loewe-Musiktisch Palette von
1955/56 entsprach direkt dem damali-
gen Möbelstil.
Aus einem Prospekt: Schaub-Lorenz-Goldsuper W42. 1956/57 hatten die Pforzheimer meh-rere solche „Goldsuper im Nähkäst-chen-Stil" in Ihrem Lieferprogramm. „Repräsentatives großes Edelholzge-häuse in schwingender Linie" stand im Prospekt.
Philips (Saturn, Uranus) verwirklichte
noch eigene Gestaltungs-Ideen, allge-
mein jedoch wirkte das Radio im Rah-
men der 50er-Jahre Möbel-Ensembles
eher wie ein Fremdkörper. Es hatte doch niemand polierte Nussbaummöbel...
Indes — der Kunde wollte es so — die
schlichteren, mit hellen und mattierten
Furnieren ausgestatteten Modelle waren kaum gefragt.
Bild links: Die schräg gestellten Füßchen des Tonfunk- Violetta W 332 passten sich den Tischen und Sesseln der Fünfziger an.
Rechts: Ganz im 50er-Stil: Der Loewe-Radio-tisch Palette 763 W von 1955. (Radio-Museum Hans Necker, Bad Laasphe)
32
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Das mussten auch die Grundig-Gestalter erfahren. Über ihre in Hannover ausgestellten Exponate schrieb Karl Tetzner in der „Funkschau" Nr. 11/1954 unter dem Titel „Experimente mit dem Gehäuse":
„Grundig hatte inmitten einer modernen Dekora-
tion einen neuen Musikschrank ausgestellt, der
sich von den bisherigen deutschen Möbeln dieser
Art wesentlich unterschied. Das helle Eschenholz
in streng geometrischer Form enthielt einen Spit-
zensuper und rechts unter der Haube entspre-
chend dem Auswechselprinzip wahlweise einen
Plattenspieler, einen Wechsler oder ein Tonband-
gerät. Die Besucher standen je nach ihrer Ein-
stellung begeistert oder kopfschüttelnd davor —
auf alle Fälle dürfte der beabsichtigte Zweck er-
reicht worden sein: Man wollte einem breiten
Publikum den Vertreter eines radikalen Stilwech-
sels zur Begutachtung vorstellen".
Grundig- Musikschrank 7080 W von 1955
Bis zum Ende der Fünfziger behauptete sich der Einheits-Stil. Zwar kamen die abgerundeten Gehäuse aus der Mode, man gestaltete sie etwas schlichter, aber auch an diesem Telefunken Opus 9 Hi-Fl von 1958 findet man noch eine (samt den Abrundungen unpassende) Gold-Zierleiste. Erst im folgenden Jahrzehnt war der 50er-Einheits-Stil passé.
Noch aber schien die Zeit dafür nicht reif — nur Braun konnte mit solchen Kreationen punkten. In den Sechzigern aber, als das geölte Teakholz in Mode kam, fand man es erfreulich, dass diesem Trend entsprechend auch etliche Gehäuse gestaltet wurden, die sich dann in das Teak-Mobiliar ein-fügten.
Wir sind aber noch in der Zeit Mitte der Fünfzi-ger, und heute möchte man glauben, dass es da-mals überhaupt keine Designer gab, so wenig be-eindrucken uns eben die phantasielosen, dem Konsumentengeschmack angepassten Edelholzge-häuse dieses Jahrzehntes. Bedauerlicherweise be-schädigt diese „50er-Langeweile" auch das Image der technisch hochwertigen Empfangsgeräte. In den Sechzigern wurden die Formen schlichter.
SIEMENS -Klangmeister
Aus einem Inserat in der „Funkschau", Heft 13/1962
Karree-Form —
Verkaufsargument
Nummer 1
Heute ist die hochentwickelte Technik bei
qualifizierten Radiogeräten schon selbst-
verständlich, Um so mehr ist die besondere
Form für den Kaufentschluß entscheidend.
Karree-Form - das charakteristische Ge-
sicht der neuen Siernens-Radiogeräte ist
Ihr bestes Verkaufsargument.
Karree-Form mit glatten Flächen, strengen
Konturen, ausgewogenen Proportionen, mit der harmonischen Kombination von
Holz und Stoff, von Glas und Eloxal. Ein
Siemens-Klangmeister beeindruckt, er
wirkt wertvoll, aber nicht aufdringlich - mit
seiner dezenten, wohnlichen Form paßt
er organisch in jeden Raum.
Siemens-
Radiogeräte
)Klangmeister(
33
edun
Rundfunk- und Fernsehgeräte im Stil unserer Zeit
von international bekannten Gestaltern entworfen,
fehlen niemals in Verkaufs- und Ausstellungsräumen sowie im Schau-
fenster des fortschrittlichen Rundfunk-Fachhändlers.
Der auf gute Auswahl bedachte Händler weiß warum
/.1
011101111.111111111.1111.11.11
PK-G, Baujahr 1955
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Am Beginn der Fünfziger wurden
einige Bakelitgehäuse noch etwas
phantasievoller geformt, z.B. für
die Blaupunkt-Modelle F 229 U
oder M 289 W. Deren Inhalt setzte
Blaupunkt auch noch in wohlges-
taltete Holzgehäuse.
1950/51 hatte Blaupunkt ihre nach Vor-kriegs-Vorbildern gestalteten Modelle im Lieferprogramm, wie z.B. diese Ty-pen F 229 U und F 266 U.
Ferner gab es die kleinformatigen Modelle (teils schon Zweit-
radios), welche anfänglich in Bakelit-, später auch in Ther-
moplast-Gehäuse eingebaut wurden. Sie ließen zwar etwas
mehr gestalterische Ideen erkennen, als außergewöhnliches
Designbeispiel könnte aber allenfalls der Telefunken 4347 GW
bzw. Tango 5449 GWK genannt werden.
Schon sein Vorgänger T 4347 GW von 1947 war so gestaltet worden — auch 1949 fand man ihn wieder schick — diesen kleinen Telefunken Tango 5449 GWK.
Mitte der Fünfziger erschien die Alternative zum Einheitsgewand. Dr. Fritz Eichler, der bei Braun fürs
Kreative zuständig war, konnte wohl 1954 das braune, mit Gold-
zierleisten umrandete Einheitsantlitz der Radios nicht mehr er-
tragen, kreierte zusammen mit Artur Braun den aufsehenerregen-
den Kleinsuper SK 1 und ging auf die Suche nach neuen Wegen.
Die Braun-Kleinsuperhets wurden von 1955 bis 61 in sie-ben annähernd gleichen Ausführungen gebaut — zuletzt als SK 25. Unterschiedlich war die technische Ausstattung. Der SK / empfing nur Ultrakurzwellen, die 2er-Typen dagegen UKW und Mittelwellen.
Sie führten ihn nach Ulm zur Hochschule für Gestaltung, wo er
mit Ot1 Aicher, Max Bill und Hans Gugelot zusammentraf. Guge-
lot erhielt den Gestaltungsauftrag für die Musiktruhe PK-G, die
dann 1955 auf den Markt kam. Die erste zukunftsweisende Kre-
ation stand im Rampenlicht.
1955 brachte Braun als Neuschöpfung das Gerät combi auf den Markt. Dessen Detailgestaltung — die Drehknopfanordnung — hat man sich beim Telefunken Tango (siehe oben) abgeschaut. Weil es sich aber um einen Entwurf von Prof. W. Wagenfeld handelte, fand dieses Modell unter den Design-Fans eine Wertschätzung, welche dem fünf Jahre früher erschienenen Tango nicht zugebilligt wurde.
34
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Dr. Eichler verließ sich nicht auf einen Experten (Hans Gugelot verstarb 1965 im 45ten Lebensjahr),
er schätzte auch die Gestaltungs-Ideen anderer kreativer Designer wie Prof. Herbert Hirche, Arne Ja-
kobsen, Prof. Herbert Lindinger und Prof. Wilhelm Wagenfeld.
So nebenbei wollte Eichler auch sein Büro neu gestalten und beauftragte verschiedene Experten mit
Entwürfen. Den aus dem Rahmen fallenden präsentierte ein Architekt mit wenig Berufserfahrung,
aber viel Gespür fürs Design. Es war Dieter Rams, den Eichler sogleich zur HfG Ulm brachte. Dort
begann seine Zusammenarbeit mit Gugelot: Der SK 4 („Schneewittchensarg") war das Ergebnis.
Von nun an fand Dieter Rams seinen festen Platz im
Hause Braun, wo er für das Design der meisten nach-
folgenden Geräte verantwortlich wurde. Es entstanden
die Atelier-Modelle, Weltempfänger und HiFi-Anla-
gen. Noch heute zählt der Erfolgreiche zur ersten De-
signergarnitur dieser Epoche. Die Exponate des hoch
dekorierten Professor Dr. h.c. Rams stehen in den be-
deutendsten Museen rund um den Erdball.
Das berühmte Braun-Gerät, das auch „Schneewittchensarg" genannt wird. 1956 in der Zusammenarbeit von Gugelot und
Rams entstanden, blieb es über einen Zeitraum von acht Jahren fast unverändert im Braun-Lieferprogramm. Nur die Technik änderte sich, schließlich kam die Stereo-Schallplatte auf den Markt. Mit dem SK 4 begann die Erfolgsserie, dies hier ist die Type SK 5 von 1958.
Hat es sich denn für Braun ausgezahlt? Wie stand es mit dem Geräteabsatz?
Für „Herrn Biedermann" war es sicher nicht das Richtige; er schüttelte den Kopf über die kühlen,
sachlich schlichten Gebilde. Die Architekten und avantgardistisch orientierte Individualisten aber
jubelten — zollten ihnen uneingeschränkte Anerkennung. Gab es doch endlich etwas, das zum Wohn-
stil der neuen Bungalow-Architektur paßte, sie an Kühnheit vielleicht noch übertraf.
So stießen die Frankfurter in eine Marktnische, die ihrer Produktionskapazität entsprach. Wären die Brüder Braun diesen Weg nicht gegangen, dann hätten sie im Kampf um den gesättigten Markt wahr-
scheinlich schon früher aufgegeben, und wie manch andere die Radioproduktion einstellen müssen. So aber konnte man Braun-Anlagen bis 1990 kaufen. Dies zu einem Zeitpunkt, zu dem renommierte
Firmen wie Körting, Mende, SABA und auch Telefunken längst ihre Produktion hatten aufgeben
müssen, vom Markt verschwunden waren, oder deren einst klangvolle Namen nur noch zum Kaufan-reiz an irgendwelchen Fremderzeugnissen zu finden waren. Gewinne warf die Fertigung jedoch nicht mehr ab, im Gegenteil: annähernd 10 Millionen DM Ver-luste mußte Braun 1989 schlucken, bzw. die amerikanische Mutterfirma Gillette, welche 1967 die
Mehrheit des Unternehmens erworben hatte (siehe auch: Braun-Firmengeschichte im Kapitel 9).
Eine ernsthafte Konkurrenz gab es für das Frankfurter Unternehmen in der zweiten Hälfte der Fünfzi-
ger kaum. Man konnte es
sich wohl leisten, im Ver-
trauen auf das zum Begriff Nachdem sich gewordene Braun-Design Wega wie zuvor Braun konse- eine Zeit lang eher billige quent auf die Komponenten einzubauen. Design-Linie festgelegt hatte, Erst in den Sechzigern trat erschien 1967 ein Konkurrent auf den unter anderem die von Hartmut Plan: die Firma Wega rea- Esslinger ges- lisierte das Design von taltete Kompakt Hartmut Esslinger und Ver--Anlage, beste- hend aus HiFi- ner Panton, brachte stilvol- Tuner, -Verstär- le Modelle auf den Markt, ker und Plattenspieler
Studio- blieb aber auf dem Sieger-
der, am schönsten war sie zweifelsfrei in der schlichten Weiß-Schleiflack-Ausführung.
35
(Dual 1015 HiFi). treppchen stets die Zweite. Es gab diese Wega 3200 HiFi auch in Nussbaum, Teak oder Palisan-
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Die hochwertige Wega-Stereobar 3300 HiFi wurde 1967 von Verner Panton entworfen
WEGA
Abbildung unten: 1978 war das Esslingers letzter Entwurf für ein Wega-Gerät. Die Kompaktanlage Conzept 51 K war in schwarz oder weiß lieferbar und es gab dazu auch das rechts abgebildete Unter-gestell. (Technikmuseum Mannheim)
Abgestimmt auf die Fomi der Wega Kompakulnlage Concept 51K wird ein Untergestell geliefert, das die Redienung aus einer bequemen Position hcraus ermöglicht. Die Ver. arbeitung erlaubt die Aufstellung der Anlage frei im Raum.
Farben: schwarz und hellgrau. Lieferung Anfang 1979.
Ein Modell in dieser außergewöhn-lichen Gestaltung brachte Sony 1969 auf den deutschen Markt. Telefunken fand daran anschei-nend Gefallen und kreierte einen gleichartigen Empfänger mit hoch-wertiger Ausstattung für das Mo-delljahr 1970/71. Das mit der Rundskala ausgestat-tete Steuergerät HiFi - compact 2000 ist bei Sammlern seines Designs wegen besonders beliebt.
Überraschend ist die brillante Wie-dergabequalität, welche man den kleinen Lautsprecher-Boxen TL 41 mit den Maßen 16,2 x 26,1 x 17 cm nicht zutraut.
36
Diese Prognose war aber so neu nicht — hatte man ähnliches doch bereits 1924 (!) vernommen, und auch in den
Dreißigern wurden manche Hoffnun-
gen auf den steuerbaren Kristalldetek-
tor geweckt...
,
zzeed.tlilitz
Die (berühmt gewordene) Skizze aus dem Laborbuch von Walter Brattain (Quelle: BTL bzw. CQDL 12/1 997 — aus dem Aufsatz von Prof. Dr. Dr. B. Bosch)
Die dynamische Chronik
In der hauseigenen Loewe-Design-Abteilung wur-de 1971 die „line 2001" entworfen. Verschiedene Receiver wurden nach dieser „line" gestaltet, u.a. 1974 auch das rechts abgebildete Modell Juwel sensotronic.
Der Blick über die Grenzen fällt auf die dänische
Firma Bang & Olufsen, zu der sich derzeit die
„Design-Bewussten" hingezogen fühlen.
8. Kapitel
8.10 Sollte man den „Transistor" wirklich ernst nehmen?
Es gab da nämlich andere Probleme
Aus den USA, genauer den „Bell Telephone Laboratories", kam 1947 die Kunde, man sei auf dem
Wege, aus der Germanium-Diode einen steuerbaren Halbleiter zu entwickeln. Ein „neuartiges
Kristall-Relais" wollte man auf die Beine steam; in bestimmten Bereichen könnte man damit aber
möglicherweise in absehbarer Zeit auch die Dreipol-Vakuumröhre ersetzen.
Kristalldetektor oder Röhre? Durch die Erfindungen von Amerikanern und des Russen
Lossev erwächst der Röhre in dem Kristalidetektor eine scharfe Konkurrenz. Es ist nämlich gelungen, durch besondere Schaltungen den Detektor zu all den gleichen Arbeiten heranzuziehen wie die Röhre. Man kann mit ihm jetzt auch Schwingungen erzeugen, so daß mit seiner Hilfe auch Rückkopplungsschaltungen angewendet werden können; auch soll mit ihm schon ein Sendea auf kurze Entfernung möglich gewesen sein. Wir wollen diese Nachricht un-seren Lesern nicht vorenthalten, aber nicht damit be-zwecken, daß allzu große Hoffnungen auf den Detektor ge-setzt werden. Bekanntlich liegt zwischen dein ersten ge-lungenen Laboratoriumsversuch, dem Erfinder und der Pra-xis noch ein weiter Weg. Wir brauchen noch lange nicht unsere Röhrenempfänger zum Gerümpel zu legen, erst wollen wir uns doch wenigstens eine Weile an den Spar-röhren erfreuen.
Notiz aus: „Jung-Deutschlands Funkwelt", Heft 19/1924
„Lasst mal die Amerikaner forschen", meinten die Experten,
die haben ja das Geld für solch teure und vage Experimente.
Zum Weihnachtsfest 1947 war es dann wirklich soweit. Wil-
liam Shockley, John Bardeen und Walter Brattain heißen die
(1956 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten) Väter des mit
großem Aufwand und Engagement entwickelten Transistors.
Auch das nahm man relativ gelassen zur Kenntnis. Dass der
Transistor im Bereich der Elektronik eine Revolution auslö-sen würde, erkannte niemand so recht. Und die Reaktion in
Europa? Wenn schon die Amerikaner selbst dieser Erfin-
dung keine größere Bedeutung beizumessen schienen (die
Presse, auch die Fachpresse, brachte darüber nur kurze Notizen), konnte man hierzulande getrost ab-warten. In der Tat war der Spitzentransistor eine — dem Detektor ähnliche — Wackelkontakt-
Konstruktion, die mit Röhren in punkto Funktionssicherheit überhaupt nicht konkurrieren konnte. Andererseits hatte das Ding entscheidende Vorteile: Es war sehr klein und beanspruchte minimale
Energie. So schlich sich der Transistor zuerst in Hörgeräte, wo er nach und nach die Subminiaturröh-
re verdrängte.
37
• Transistore werden in USA von 6 Firmen, Western Electric, General Electric, Ratheon, Sylvania, Westing-house und RCA hergestellt. Der Preis eines Transistors liegt mit ca. 15 Dol-lar gegenüber den amerikanischen Röh-renpreisen sehr hoch.
Aus „radio mentor" Heft 4/1952
p-n-p-Flächen-
Transistoren
Inserat aus der „Funkschau", Heft 15/1954
PF 9 PF 96. DK 96. DF 96. PF 96, OA 72. OA 72, 2 OA 72. OC 71, OC 71, 2 OC 72
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Im Dezember 1948 endlich meinte die „Funkschau":
„Vor kurzem haben die Bell Telephone Laboratories Mittei-
lung von einer Entdeckung gemacht, deren Tragweite noch
nicht übersehbar ist, der Eignung von Germanium-Kristal-
len als Verstärkertrioden". Und am Schluss der Betrachtung
steht: „Die Herstellungskosten sind heute noch höher als bei
gleichwertigen Röhren. Wenn man aber berücksichtigt, daß man mit der Herstellung von Transisto-
ren ganz im Anfang steht und daß die Röhrentechnik viele Jahre bis zum heutigen Stand gebraucht
hat, kann man eine erhebliche Kostensenkung mit Sicherheit erwarten. Die außerordentlich geringe
Große des Transistors, der Wegfall eines Vakuums und die Unabhängigkeit von Heizstrom quellen
würde ihm eine große Verbreitung sichern".
Diese „Verbreitung" sollte noch einige Jahre auf sich warten lassen. 1952 warden Germanium-Tran-
sistoren zwar bereits von sechs amerikanischen Unternehmen gefertigt, deren Umsätze aber waren
zunächst unbedeutend. Die Zuverlässigkeit des Spitzen-
transistors ließ zu wünschen übrig. Die über Hörgeräte hinausgehenden Anwendungsgebie-
te dieser nur für Tonfrequenzen geeigneten Transistoren
waren noch unklar — und schließlich lag der massenhaf-
te Einsatz im Computer wie auch in der Raumfahrt noch
in weiter Ferne.
Nach und nach jedoch ergänzten die Röh-
renfirmen ihr Produktionsprogramm
durch Germaniumtransistoren und auf
Initiative von Texas-Instruments brachte
Regency sechs Jahre nach der Erfindung
das erste Transistorradio auf den Markt —
das 1954er Regency TR 1 ist heute ein
begehrtes Sammlerstück. Im eigenen
Hause wurde dem TR 1 keine besondere
Beachtung geschenkt — man ließ die Fer-
tigung wieder auslaufen.
Weitsicht bewiesen dagegen die Japaner Akio Morita und Masaru Ibuka. Sie erwarben 1953 Ferti-
gungslizenzen, um — wie Morita im seinem Buch „Made in Japan" schreibt — mit einer intensiven
Forschungsarbeit zu beginnen. Die neue Dotierungstechnik der „Tokyo Telekommunikations Engi-
neering Company" f.ihrte schließlich zu einem hochfrequenztauglichen Flächentransistor, mit dem
1955 Moritas erstes volltransistorisiertes Radio TR 55 bestückt wurde („SONY" wurde erst zwei Jah-
re später zum Markenzeichen, 1958 auch zum Firmennamen). Ein Jahr war Morita zu spät gekom-
men — wäre er doch so gerne als erster Transistorradio-Hersteller der Welt in die Radiogeschichte
eingegangen...
Langsam wurden die spielzeugähnlichen Kleingeräte (1957 brachte SONY „das kleinste Taschenra-
dio der Welt" auf den Markt) auch bei der Jugend Europas populär. Eine Konkurrenz zum Röhrenra-
dio war aber noch nicht zu erkennen, noch rund zehn Jahre erfreute sich die Radioröhre ihres Lebens.
Zunächst wurde die Kontaktierung des Germanium-Transistors verbessert;
der Siegeszug des 1954 von der amerikanischen Philco angekündigten und
von Texas Instruments vorgestellten, viel stabileren, aber schwieriger herzu-
stellenden Silizium-Transistors folgte erst später (in Deutschland ca. 1957).
Inzwischen aber befassten sich auch die deutschen Radiowerke mit dem
Transistor, insbesondere die Koffer- und Autoradio herstellenden Betriebe. 1956 wurden im NF-Bereich zahlreicher Kofferempfänger anstelle der Röh-
ren DAF 96 und DL 94/96 erstmals Transistoren eingesetzt, (z.B. im Philips
Babette), welche oft von Philips (Valvo) kamen, aber auch schon bei Inter-
metall (ITT), Siemens, TeKaDe und Telefunken im Lieferprogramm waren.
38
IhlíJ . Gexamtathnitionli flee
/3•Tioe.p.iofiren-T...honSupers Tetuftinken TR 2
00602 OC602 OC602 OC602 00604
gia
VA LV 0
Type Eigenschaften und Verwendung
PUP- Flächentransistoren
OC 44 Transistor für Misch- und Oszillatorstufen
OC 45 Transistor für 2F-Verstärkerstufen
OC 65 Miniaturtransistor für Vorverstärkerstufen in Hörgeräten
OC 66 Miniaturtransistor für Vor- und Endverstärkerstufen in Hörgeräten
CC 70 Transistor für NF-Vorverstärkerstufen OC 71 Transistor für NF-Treiberstufen und Endstufen kleiner Leistung sowie fur
Gleichstromverstärker und Oszillatorschaltungen
CC 72 Transistor für NF-Endstufen höherer Leistung sowie für Gleichstromver-stärker und Oszillatorschaltungen
2-0C 72 Transistorpaar für NF, Gegentakt, Klasse-B-Endstufen mit Ausgangslei-stungen von etwa 300 mW
00 73 Allzwecktransistor mit engen Streugrenzen und 30 V Kollektorsnitzcn-spannung
OC 76 Transistor für Schalteranwendungen aller Art mit 250 mA Kollektor-spitzenstrom in beiden Richtungen und 125 mA mittlerem Kollektorstrom
Preis:DV
17.0
16,50
13.75
13,75
10.20
10,21
13.00
26,0
11.65
13,11
TELEFUNK EN
Type Eigenschaften und Verwendung
PUP - Flächentransistoren
OD 603 NF-Leistungstransistor, Verlustleistung 4 W
00 604 NF-Leistungstransistor, Verlustleistung 1.3 W
00 603 NF-Leistungstranststor, Verlustleistung 15 W
OC 601 NF-Transistor für Multivibrator- u. Sperrschwingerschaltungen
OC 602 NF-Transistor für Anfangsstufen DC 602 spez. Schalttransistor
OC 603 NF-Transistor für Anfangsstufen hodiwertiger NF-Verstäiker
OC 604 NF-Transistor für Endstufen, Verlustleistung 50 mW
OC 604 spez. NF-Transistor für Endstufen, Verlustleistung 100 mW
OC 612 Hochfrequenztransistor. Grenzfrequenz ca. 5 MHz
OC 613 Hochfrequenztransistor, Grenzfrequenz ca. 10 MHz
PUP -Subminiatur - Flöchentransistoren
OC 622 NF-Transistor mit mittlerem Stromverstärkungsfaktor
OC 623 NF-Transistor für Anfangsstufen hochwertiger Verstärker
OC 624 NF-Transistor mit hohem Stromverstärkungsfaktor
Preis/D11
21,50
10,20
10,20
12,11
13,10
10.21
13,1i
16,51
17,71
13,75
14.51
13,75
1 out Antrim
Die dynamische Chronik
Der erste Telefunken-Transistor-Super TR 1 von 1956. Eine ausführliche Be-schreibung des TR 1 enthält die „Funk-schau" Heft 5 vom März 1956.
8. Kapitel
Die Transistorhersteller selbst waren bei ihren eigenen Geräten
noch zurückhaltend, ließen den andern, z.B. Braun, Grundig und
Schaub-Lorenz den Vortritt. Untätig aber war auch Telefunken
nicht. Schon 1954 soll mit der Entwicklung des Volltransistor-Supers begonnen worden sein. 1956 wurde der mit 5 x OC 602 und 1 x OC 604 bestückte Telefunken TR 1 öffentlich vorgestellt.
Kaufen konnte man ihn nicht; nur an ausgewählte Testpersonen wurde der erste in Deutschland her-gestellte Taschensuper in Transistortechnik verteilt. In den Handel kam dann 1957 der Partner (mit OC 613, 2 x OC 612, 2 x OC 604 und OA 154). Da aber war er nicht mehr alleine — Akkord und Phi-lips hatten auch schon „Volltransistorisierte". Auch Graetz zählte zu den Pionier-Firmen: Professor Harmans experimentierte 1957 bereits an einem volltransistorisierten UKW-Empfänger, der aber nie fabriziert wurde.
Die Halbleiter-Typenbezeich-
nungen lehnten sich an die
der Röhren an. Deren erster
Buchstabe kennzeichnete die Heizung. Mit „O" begannen
alle Halbleiter, wohl deshalb,
weil sie „ohne Heizung" wa-ren. Als zweiten Buchstaben
erhielten Dioden (wie die
Röhren) ein „A", die Transis-
toren (Trioden) ein „C" und
die NF-Leistungstransistoren
ein „D".
Erste zaghafte Versuche im
Autoradio unternahm Blau-
punkt 1957 bei seinem Mo-dell Wiesbaden. Neben vier Röhren erhielt das Gerät 3
Transistoren (TF 80/30, TF
77. Es war wohl ein Testfall.
Bedenken waren nicht unbe-
rechtigt: bei Temperaturen,
wie sie sich in der Sommer-
hitze im KFZ ausbilden
können, war die Betriebssi-cherheit nicht immer ge-
währleistet.
39
+kttegriefte Schaltungen, Transistoren und Dioden für Geräte der modernen Elektronik. hergestellt in Nürnberg. Freiburg und Waldkirch bel
INTERMETALL
ITT-Inserat von 1972
Rechts: Reklame aus „radio-fernseh-händler" Febr. 1962. Das Telefunken-Lieferprogramm von 1962 mit neuen Typenbezeichnungen.
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
1958 gab es schon mehrere Kofferempfänger, die ausschließlich mit Transistoren bestückt waren.
Grundig (auch andere) hatte schon den Taschen-Transistor-Boy mit den Maßen 14,5 x 9 x 4,5 cm im
Programm. Obgleich einige Volltransistorisierte auch schon Ultra-Kurzwellen empfangen konnten,
waren die HF-Teile etlicher hochwertiger Koffergeräte bis 1959 noch mit D-90er-Röhren bestückt.
Jedoch — bei sämtlichen „Mobilen" war der Vormarsch des Transistors nicht mehr zu bremsen..
TELEFUNKEN pup-FLXCHENTRANSISTOREN
AF 165 1.17.T.entirtor für Ver., ett.- und ZF.Pufen MIMelwellerheetztet uttel 617, Tronsiver für 20,52,7te 10,7 2,741
00 602 N7.1tonsitlee mit Strenwerladritmelfekter
CC 614 6,47-trenutter Itür Y ei ee. u. Milgintufen
tm 020,0e66e7
00 41$ HT, 724 Ver, und Mirchteden 6.
AC Ill ?me...mitten. rer AC 117 Ver,NefSetetung 190 m'Af 6 V wed e Y
AC 117 EndetufentransWor für Geptettnif• 11Schdi24ngor, Vertuttleittvn, 433 mW,
6 V 4n0 I V
AC 122 te-Ventuhtettenattine rntt haher Stronweratdrkun, Ver,a04103, Itt
Ac 23 Trebertreneuer für AC 121 Verlüstlehhang 133 tme, 3 v Sdfrieb
AC 124 27027 7114,111720 für OnttdAtükf• ft...heltungar, VerlutiteiOung 400 nAv, 12 V Seine
217 TO H7,7renvetor für Sdnelndsturen kleinerdr ldiatung Kurswellnegebier Verlimleolung 1513 mW
652 tO Schairtremiger tür hob, Scheltpeedttutr. dteksiten, VerlePlegunit 20 mW
0172 30 SetelFirentittor für hotür Sitholteeccfwein• dlekeltün, Verb..21st...7 33 mw
00 403 tredieurentronsinevrireSer 1.431.Av (4.1
Wv tenden Inner, gern Drucktchriften Fitt FUNCON
genauen tecnnischen Doren. ItC6IIEN,VE4111113
U1,4•0074 AU
1960 gab es auch die ersten volltransistorisierten Autoradi-
os — vorerst aber nur fiir AM-Empfang, obwohl doch die
neuesten Halbleiter schon UKW-tauglich waren. Und nicht
der Transistor-Hersteller Philips ging voran und brachte
derartige Kfz-Geräte auf den Markt, sondern die Firmen
Wandel & Goltermann, Blaupunkt, Becker und sogar Emud.
Philips hatte 1960 noch den durchweg mit Röhren bestückten AM-Empfänger Paladin 382 in den
Katalogen; und den Paladin 484 von 1958, welcher nur NF-seitig mit Transistoren ausgestattet war,
HF-seitig aber mit Röhren. Durch eine spezielle Niedervolttechnik (mit den dafür geeigneten Röhren, z.B. ECH 83, EF 97 usw.)
konnte diese Type ohne Spannungswandler mit den Akku-Spannungen 6 oder 12 Volt betrieben wer-
den. Philips also bevorzugte noch Röhren, obwohl — wie die „Funk-Technik" im Januar-Heft 1959
berichtete — im eigenen Hause schon UKW-tüchtige Drift-Transistoren gefertigt wurden. Sowohl
Valvo wie auch Telefunken hatte diese „Neuen" bereits im Lieferprogramm. Und doch ersetzte Phi-
lips erst 1961 die Niedervolt-HF-Röhren in ihren Autoradios durch Transistoren — da dann aber auch
schon im FM-Teil.
Unter den Tischempfängern von 1960 waren
— mit Ausnahme des Kleinstsupers „Bobby"
vom VEB Stemradio Sonneberg — nur batte-
riebetriebene Modelle (wie der Kobold) mit
Transistoren bestückt. Die Röhre saß also
noch relativ stabil im Sockel, das netzbetrie-
bene Heimgerät sollte (noch) nicht auf sie
verzichten. Und kaum jemand in der deut-
schen Rundfunkindustrie dachte daran, dass
der Transistor bzw. die daraus weiterentwi-
ckelten Funktionsteile eines Tages dazu bei-
tragen könnten, ihr Lebenslicht auszublasen.
Loewe bezeichnete sein erstes, mit Transistoren bestücktes Batterie-Heimradio Kobold 5960 TR
als „schnurlosen Volltransistor-Tischempfänger".
40
Das geplatzte Kartell
ist die Überschrift eines Artikels im Tagesspiegel vom 7. 5. 1961, aus dem wir im folgenden einige Aus-züge veröffentlichen. „Kein ganzes Jahr hat das Rund-funkkartell gehalten, auch durch mühsame Flickarbeit war es nicht mehr zu retten. Der Austritt der Firma Grundig hat ihm den letz-ten Halt genommen. Zur Zeit ist der Markt mit etwa 400 000 unverkauften Fernsehemp-fängern überschwemmt, bis Juli werden es nach Meinung des Grundig-Generaldirektors Dr. Otto Sieweck ‚mindestens 700 000' sein.
Notiz aus: „radio und fernsehen" vom Juli 1961
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Philetta Alltransistor
Nicht überall hat man Netzanschluß, Denken Sie an den Wohnwagen,
an das Kajütboot oder an den Bungalow draußen im Grünen. Aber
überall karat man jetzt den ..Großsuper im Kleinformat' aufstellen,
weil es die PhiIona auch in Ailtransistor-Technik für Batteriebetrieb
gibt, Sie at niversehl verwendbar und besitzt die gleichen her-
vorragenden E;9enrichafien wie die millionenfach bewährte Philetta.
Wie aus dem Philips-Prospekt hervorgeht, war der Philetta Alltransistor- Empfänger aus
dem Modelljahr 1961/62 vorzugsweise für den Rundfunkempfang außer Haus vorgesehen.
8.11 Ernüchterung in der ganzen Branche — Überproduktion — die Japaner kommen
Die Sechziger hatten begonnen und noch war es nicht der Transistor, der den deutschen Managern Kopfschmerzen bereitete — die schwarzen Wolken kamen aus einer anderen Richtung. Es war einfach zuviel produziert worden — vor allem zuviel Fernsehgeräte.
Was auf Halde steht, muss weg", sagten sich die Produ-zenten und nahmen es nicht mehr so genau, wenn die Han-delswege den Pfad der Tugend verließen. Es bildete sich ein grauer Markt; Preisbrecher brüsteten sich damit, dem Verbraucher dank geringer Handelsspannen endlich Geräte zu volkstümlichen Preisen offerieren zu können. Der Ein-zelhandel fürchtete bereits eine Neuauflage der Verhältnis-se von 1932. Die Schuld wurde den Herstellern angelastet, welche nun in große Bedrängnis gerieten.
Die renommierte Firma Körting hatte schon Mitte der Fünfziger, als sie den Ruin auf sich zukommen sah, alles auf ein Karte gesetzt: ein Liefervertrag mit dem Versand-haus Neckermann garantierte ihr langfristige Abnahme. Der Schachzug des Firmenchefs Gerhard Böhme schien gelungen und ließ sogar bei manchem Wettbewerber ein wenig Neid aufkommen.
41
Die Uberproduktion
Dazu kam, daß die Industrie wesentlich mehr produ-ziert hat, als der Markt konsumieren konnte. Die Folge davon waren übervolle Lager, die zum Auslösen jenes gefährlichen Mechanismus führten, nach dem Ware von selbst auf den Markt drängt, wenn übergroße Vorräte vorhanden sind. In diesem Falle aber fehlt nun jede Kontrolle darüber, an wen — und zu welchen Bedingun-gen die Geräte geliefert werden. Hier setzen die dunklen Märkte ein. Jeder bekommt Ware, wenn er nur be-zahlt — und jeder bekommt den Höchstrabatt, sofern er es versteht, den Lieferanten richtig zu drücken. In sol-chen Zeiten vermehrt sich die Zahl der Zwischenhändler kaninchenhaft, so daß es unmöglich wird, nachzuprüfen, ob der Besteller einen Revers unterschrieben hat oder nicht, Denn die Angst, auf den Vorräten sitzenzublei-ben, überwindet die Moral. Daraus kann man folgern, das die Überproduktion die Hauptursache und das Grundübel des Aufblähens der grauen und schwarzen Märkte ist.
Notiz aus: „radio-fernseh-händler", Februar 1962
japanische
Transistoren-
Gräte
Wirsuchen in alten Städten der Bundesrepublik
bei Radiohändlern gut eingeführte Vertreter,
die hervorragende japanische Transistoren-
Gerate mit 6 oder 7 Transistoren verkaufen
wollen. Es handelt sich um tragbare Koffer-
geräte für Kurz- und Mittelwelle mit Batterie
und/oder Strornanschluß.
Wir sind eventuell bereit, den Alleinverkauf
in einzelnen Stödten an gut eingeführte Fach-
geschäfte zu übergeben.
Die Lieferung der Geräte erfolgt ab deutschem
Lager prompt oder kurzfristig.
Zuschriften erbeten an die Anzeigen-Abteilung
der Funkschau unter Nummer 7078 8 erbeten.
42
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Auch andere Versand- und Kaufhäuser wollten nicht zurückstehen und es gelang ihnen auch, zahlreiche, auf Lagerbeständen sitzende Rundfunkwerke umzustimmen. Die Fachhandelstreue bekam Risse.
Grundig belieferte große Kaufhaus-Ketten, legte jedoch — die Preisgestaltung und Ser-viceleistungen betreffend — strenge Maßstä-be an. Mende, Schaub-Lorenz, und insbe-sondere SABA hingegen wehrten sich vehe-ment gegen den Einzug ihrer Erzeugnisse in Kaufhäuser.
Neckermanns erstes Radiogerät wurde 1953 noch
im Apparatewerk Dachau gebaut. Die folgenden
Qualitätsgeräte kamen von Körting aus Grassau.
Dass es mit den Zuwachsraten so nicht weitergehen würde — daran musste man sich erst gewöhnen; zunächst einmal herrschte in vielen Vorstandsetagen der Rundfunkwerke Katzenjammer. Alle Hoff-nungen ruhten nun auf dem Stereo-Rundfunk und dem ersehnten zweiten Fernsehprogramm. Doch die Gewinne sprudelten nicht. Es wurde bereits vom Farbfernsehen gemunkelt — die Käufer übten sich in Zurückhaltung und begnügten sich vorab mit einem UHF-Converter.
Graetz in Altena war als erste der „Großen" schon An-fang der Sechziger in eine Krise geraten und konnte nur überleben, weil Hermann Abtmeyer glaubte, das ITT-Imperium noch weiter ausbauen zu müssen.
Aus der Industrie
Zusammenarbeit zwischen SEL und Graetz. Die Standard Elek-trik Lorenz AG (SEL) und die Graetz KG haben zwecks weit-gehender Rationalisierung eine enge Zusammenarbeit beschlossen, die der Marktbedeutung beider Gruppen gerecht wird. Es ist anzu-nehmen, daß Graetz neue finanzielle Mittel zugeführt bekommt und zugleich für die Röhren-, Halbleiter- und Bauelemente-Pro-duktion der SEL-Gruppe einen bedeutenden Kunden abgeben wird. Die SEL ist die deutsche Tochtergesellschaft der International Tele-phone & Telegraph Co. (ITT), New York, und beschäftigt im Bun-desgebiet und Berlin 25 000 Mitarbeiter in 17 Werken; Graetz be-treibt 9 Fabriken mit 7000 Mitarbeitern.
Notiz aus der „Funkschau", Heft 8/1961. Mit der finanziellen Unter-
stützung fing es im April an, bereits im Mai wurde Dr. Herriger aus
dem SEL-Vorstand in die Geschäftsleitung der Graetz-KG delegiert,
und im September 1961 entstand die neue Holding-Gesellschaft
Graetz GmbH mit der SEL-Geschäftsleitung.
Neben den vollen Lagern, welche erst langsam abgebaut werden konnten, droh-te neues Ungemach. 1958 wollte man solchen Inseraten, wie rechts abgebildet, noch keine Bedeutung beimessen. Es blieb aber nicht bei den kleinen billigen Transistorgerätchen, die Japaner waren dabei, ihre Position auf dem Weltmarkt kontinuierlich auszubau-en und begnügten sich in den Folgejah-ren nicht mehr mit einem Nischendasein.
Inserat aus der „Funkschau", Heft 11/1958.
Noch waren es kleine Importeure, welche
japanische Importwaren anboten.
Doe klutnata 6-rscussreloc-Getar. Etnpgangubctutet
555- OSOHu. Awit9cmileleiatun9 mw.
cr, 505 9, Grd0c 11 r,x cm. in dun Felton, wili49,
gaol: tadue kuratte, licht tratuutchad. Acehornpland.
Itch. .to tiortngor Grade voila/ Tan.
!Compton nut Batten*, tentuttaa-Ohrttenet Zudor-
talaglelaknquu 0tdii0chun0 ituttLiunetetutet :el/Callum
DM 179.- 12/0+11ta
NEUHEIT: 7-Tuinenu1
,141. KURZWELLE nal tand C oleeeUo Sit
BeTteitu- und Tutuan0chlu0. mit lne Tole-
ice und Ott.thenot Gebeuee xauctiartat*
Giro*edi ea. 1560 d. (70r*Itu 22 K10 010,5
Kemple* mu hetteate Land atathöret tc Vet/Omuta.
cau0 Lade: DM 279.• brTTT
Auslieferungslager und Generalverlsetung tar Deutschland:
Die Leica auf dem
Radio-Markt
Zenith Roya11000
8 Kurzwellen bandbereiche,
Sputnik welienlänge,
1 Matelwelle
9 Tronsistoren,
9 Taschenlampenbattenen
rr 300 Betriebsstunden.
E nzelhandelsverkaufspres
ca. DM 1300. -
Zenith Royal 200
Taschen-Kleinsuper
7 Transistoren
4 Taschenlampenbatter en
bis 100 Betriebsstunden
Einzelhandelsverkaufspres
ca. DM 280 -
ZENITH, CHICAGO USA
Importeur: Frankfurter Außenhandel GmbH.,
Frankfurt/MainW13, Tel. 77 74 54-56 -Telex 0411597
Verkauf nur über den führenden Fach-Emzelhandel
Mletelurnleskee
eltr.
TYP.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
1958 aber konnte man die Ver-
schiebung der Kräfteverhältnis-
se, welche die Japaner dann in den Sechzigern bewerkstellig-
ten, noch nicht voraussehen.
Es gab noch keinen Grund zur
Besorgnis — schrieb doch die „Funkschau" im Heft 8/1959:
Produktionsrekord der Rund-
funk- und Fernsehgeräteindu-
strie im Jahre 1958
„ ... stieg die Fertigung auf 5,345
Mio Stück gegenüber 4,658 Mio
Stück im Jahre 1957 (+ 14 %)".
COMEX, IMPORT DUSSELDORF - BERLINER ALLEC 41 -TELEF
Inserat aus der „Funkschau", Heft 12/1958
Des weiteren steht in der Funk-
schau: „ Wertmäfiig ist die Stei-
gerung wegen des Vordringens
der aufwendigeren Fernsehgerä-
te noch größer; von einem Pro-
duktionswert im Jahre 1957 in
Höhe von 1,243 Mrd. DM aus-
gehend wurden 1958 genau
1,615 Mrd. (+ 29 %) erreicht.
Unser Industriezweig steht damit
an der Spitze aller Produktions-
gruppen der Elektroindustrie ".
TR 610 - die Seekgati4K az4 deo,s Ractumsadd•
Einen Siefejzge,dnrdr die Wnlle der Sony SR 631
In IS Monahan wurden non detsem Gerdi 200000 Stück srericauft,
devon allein in Deütuidand und übrigen Europa 40000 Stud, -
Au. de* Erfahrungen des SR 63 entivickele ,ich, der
D 'rY T R 610
Er *0 dos bloinots flachste und lelehleite Radio. iViit seines 6 minds-
armenTransistoren. senem guten und lautstarken Raurnklong ist er
dos Gerre. dos olle begeistert,
Sony SR 610 hut eine elegant° handliche Farm und it in rot oder
schwarz mit Gold lieferbar.
Miniatur-Einzelteile Ide Selbstbau eon klelniten TescheirSurser.Getaten mit Transistoren
Sony-Inserat aus der „Funkschau", Heft 21/1958
In Anbetracht eines solch steilen Wirtschaftsauf-
schwungs wollte man die Produktion der billigen
Taschen- und Kofferempfänger getrost den Fern-
ostfirmen überlassen, auch wenn Sony 1958 in Eu-ropa schon gut 40.000 Stück davon verkauft hatte.
Importe aus Amerika waren noch weniger zu fürch-
ten. Diese Geräte konnten kaum billiger produziert
werden, und für die hochwertigen Kurzwellenemp-
fänger (in Deutschland gab es erst 1963 den Braun
T 1000) interessierten sich nur die „shortwave-
listener".
Die deutschen Rundfunkwerke wurden ständig ver-größert — die Produktionszahlen erhöht — offen-
sichtlich in dem Glauben, dass der Markt noch lan-
ge keine Sättigungs-Erscheinungen zeigen würde. Anfang der Sechziger aber wurde die Funkindustrie
davon „überrascht", und das wirkte wie ein Schock.
Zenith-Inserat aus der „Funkschau", Heft 23/1958
43
Ich bin
kein Einzelgänger auch wenn ich, der Funkberater des Funkberaterringes Stuttgart, in einer Stadt höchstens einmal vertreten bin. Es lohnt sich, mich aufzusuchen, denn ich arbeite mit Hundertenrühriger,ge-wissenhafter, sehr erfahrener Radio-Einzelhändler Hand in Hand, Ihnen Ihre Radiosorgen abzunehmen. Ach-ten Sie daher auf den mir geschützten Namen:
Ihr Funkberater Beliebt bei Kunden wie Lieferanten
Zur Jahreswende 1962/63 befindet sich unsere Branche noch timer Inmitten der Umstellung. Der Übergang von der durch Preis- und Rabatt-bindung in wesentlichen Punkten fixierten Ge-schäftstätigkeit zum ganz freien Markt vollzieht sich langsam, nicht ohne schmerzhafte Operati-onen und Irrtümer. Nur tastend finden Herstel-ler und Händler neue Formen ihrer Tätigkeit, manches wird erst in Umrissen erkennbar.
Die Lage ist unübersichtlich. Neben dem Dis-counter im schäbigen Ladenlokal mit abblät-ternder Farbe an den Wänden und unordentlich gestapelten Kartons, in dessen Auslagen schreiende Plakate den permanenten Ausver-kauf verkünden, existiert der seriöse, fast vor-nehm zu nennende Fachhändler in der besten Lage der Großstadt (nur hier kann er sich halten), in dessen Räumen das Feilschen um Rabatte nicht aufkommt. Es gibt direkt an den
Verbraucher verkaufende Grossisten, und es gibt vom Großhandel finanzierte Einzelhandels-geschäfte. Reparaturspezialisten gewinnen an Boden als Folge von Kartonpreisen ohne Service —, während der bisherige mittlere Fachhändler sein Sortiment ausweiten muß, weil er enders nicht mehr auf seine Kasten kommt. Filialbetriebe schränken die Zahl ihrer Zweigstellen aus Gründen der Rentabilität ein und Grossisten bereisen das Ausland, um nach neuen Lieferanten zu forschen. Dabei wird Japan zuerst angepeilt.
Aus: „Funkschau", Heft 1/1963 unter dem Titel: Blick in die Wirtschaft — Strukturänderung im Handel
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.12 Schrumpfende Gewinne — der Handel im Umbruch — die Japaner wollen mehr
Im März 1962 berichtete die „Funkschau" (Heft 5): „Nach bisher vorliegendem Zahlenmaterial wur-
den im abgelaufenen Jahr 1961 rund 446.000 Fernsehempfänger weniger hergestellt als im Jahre 1960". Auch die Exporte mussten einen Rückgang um 35 % hinnehmen. Bei den Rundfunkempfän-gern war es nicht viel besser: Vom Januar bis September 1962 wurden rund 1,22 Mio. gefertigt; im Jahr zuvor waren es noch rund 1,55 Millionen. Die gesamte Branche — Grundig ausgenommen — beklagte jetzt den kontinuierlichen Preisverfall, musste die oft schon in rote Zahlen fallenden Renditen durch Gewinne aus anderen Produktgruppen ausgleichen — so es welche gab.
Max Grundigs Geschäftspolitik, meinten die Konkurrenten, waren diese Preisentwicklungen zu ver-danken. Der inzwischen zum Branchenriesen aufgestiegene Konzern wollte sich nicht mit dem Zu-kauf einiger kleiner Firmen wie die schon 1951 erworbene Lumophon, AWB (1956), Tonfunk (1964) und Kaiser (1969) begnügen; vielmehr trachtete er bereits seit Anfang der Sechziger nach so renom-mierten Radiofabriken wie Mende und SABA, die durch Ertragsminderungen und zunehmende Pro-duktions- (Lohn-) kosten keine Gewinne mehr erzielen konnten und ums Überleben kämpften. Ohne Erfolg, wie sich später (bei SABA schon 1968, bei Mende in den Jahren der Sättigung — 1976 bis 78) zeigte. Sie mussten sich an Größere binden, wollten aber dem Konsul Grundig den Triumph nicht gönnen. Die Schuld an der prekären Lage allein auf den Fürther Marktführer abzuwälzen, würde je-doch der Situation nicht gerecht werden. Das Überangebot hätte auch ohne Grundigs Zutun far da-hinschwindende Endpreise gesorgt. In einem Aufsatz in der „Funkschau" vom Januar 1963 schrieb Max Grundig: „Die Bemühungen der
Industrie gehen heute im wesentlichen in zwei Richtungen. Auf der einen Seite gilt es, den hohen
Stand des Erreichten zu perfektionieren und so preisgünstig wie möglich herzustellen, auf der ande-
ren Seite zeichnen sich tiefgreifende Entwicklungstendenzen für die unmittelbare Zukunft ab".
Grundig hoffte — wie andere — auf den Stereo-Rundfunk, musste sich aber zunächst auf die „preis-günstige Produktion" beschränken, womit ihm auch der Einzug seiner Produkte in die Kaufhäuser erleichtert wurde. Gedrückte Preise und die daraus resultierenden Um-schichtungen im Handel bereiteten mit der Zeit beson-ders den alteingesessenen Fachhandelsfirmen Sorgen. Um auch ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, billige-re Markengeräte in ihr Angebot aufzunehmen, bediente
man sich des Zentraleinkaufs.
Schon 1935 war die Funkberater-Organisation ge-gründet worden.
Anfänglich sollte sie nur Werbe-zwecken dienen, um eine begrenz-te Anzahl aner-kannter Meister-betriebe mit Re-paraturabteilun-gen als: „Funkberater-
Fachgeschäfte"
zu kennzeichnen.
44
Man mißbraucht ihn!
Figur und Wort „Ihr Funkberator" sind
den Mitgliedern des Funkberaterriitges
Stuttgart 0, Werastraße 79, gesetzlich ge-
schützt. So verständlich es sein mag, daß
manch einer diesen erfolgreichen Namen unrechtmäßig für rich
ausnutzen möchte, so unnachsichtigwerdenwir dagegenvorgehen
--'30if-Funkberater beliebl bei Kunden und Lieleronlen
Funkberater GmbH
Sitz Stuttgart gegr. 1935 neu: 1948
Einkaufs-Zentralen für den Fachhandel
1969 vereinigt zur Interfunk e.G. Sitz Ditzingen
Ruefach GmbH 8. Co. KG.
Sitz Ulm gegr. 1974
2001 vereinigt zur
R.I.C. Electronic Communication Services GmbH Sitz Ditzingen
Handier-Logo. - MASTER'S
RED ZAC (1907)
Union-Ring e.V. Sitz Hamburg
gegr. 1953
71111:071— Spitzenerzeugnieee
Warum sind Union-Greats no gut und preitwerti
• Großeinkauf
won 80 fahrenden Pachgesdetten
O Getraut Kostenrechnung
zwischen Handel und Industrie
• Garantiert erstklassige Erzeugnisse
einer namhaften Rundfunkfabrik
Echte Schwarzwälder Qualitätsarbeit
Aus einem „Union"- Prospekt, den das Radio- Fachgeschäft Holzbach in Hamburg verteilte
Ein prächtigen Mbbelstäck
mit moderner tinienfährung,
ausgestattet mit dean Lusussuper W 593 D-S,
4-lounger 10-Plattenwechsler, Ba mourn beleuchtet
Ausfahrungi Hochgtanzpoliertes Tonmdbel
in hell und dunkel
Abmessung mit Fatten F7011210 x 475 mm.
W 5913 D Phone-Bar OM 698. -
45
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Auch nach der Neugründung im Jahr 1947 sah der Funkberaterring seine Aufgabe zunächst wieder in
der Werbung und Information, nach und nach aber insbesondere darin, die Einkaufsbedingungen für
den Kreis seiner Mitglieder günstiger zu gestalten. „radio mentor" schrieb im Heft 5/1949:
„Funkberater-Einkauf eGmbH, Stuttgart. Statut
vom 1.11.1948. Einkauf und Handel mit Radioge-
räten und verwandten Artikeln, sowie Förderung
des Absatzes dieser Artikel durch die Genossen,
insbesondere durch einheitliche Werbung und
durch Kreditgewährung".
Das „Funkberater-Schild an der Ladentür sollte für einen seriösen Meisterbetrieb bür-gen. In Städten mittlerer Größe wurde als Mitglied nur ein Fachgeschäft ausgewählt. Anscheinend aber nannten sich auch man-che Nicht-Mitglieder „Funkberater".
Parallel zur „Funkberater"-eGmbH wurde 1953 der „Union Ring" e.V. ins Leben gerufen, der sich
dann 1969 mit dem Funkberater zur „Interfunk" vereinigte.
Ilinzu kam eine weitere Fachhandels-Einkaufsgesell-schaft, die „Ruefach"; 1974 gegründet von Peter Diesel-
dorf, dem Inhaber der Ulmer Südschall-GmbH. 2001 wur-
de sie und die „Interfunk" mit je fünfzigprozentiger Betei-
ligung zur Ruefach-Interfunk-Cooperation „R.I.C." mit
Sitz in Ditzingen zusammengeschlossen.
Darüber hinaus gab es den „EDR" — Einkaufsring Deut-
scher Radio-Händler, der kaum Bedeutung erlangte, sowie
die Aera- und die Expert-Gruppe (Bild- und Ton- GmbH),
in der sich einige große Handelshäuser zusammenschlos-sen. Die Expert-Fachhandelskooperation war laut „rfe" Heft 4/2003 auch im Jahr 2002 wieder erfolgreich.
Die Einkaufsvereinigungen wollten ihren, gegen Mitte der Fünfziger zunehmend unter den neuen Versandhandels-und Großmärkten leidenden Fachhändlern besonders
preisgünstige Geräte zur Verfügung stellen — eigene Fach-handelsmarken sollten zum Pendant zu den Kaufhausmar-
ken werden. Entsprechende Modelle ließen sie auch bei
verschiedenen, unter Auftragsmangel leidenden mittel-
ständischen Radiowerken
produzieren, z.B. bei Emud,
Kaiser, Südfunk oder Ton-
funk; wie auch bei sonstigen,
auf dem Markt unbekannten Firmen. Solche meist unter
erheblichem Preisdruck ent-
standenen Funkberater- bzw.
Union-Radios zählten nicht
eben zu den besten.
Der Empfänger in der Phono-Bar W
59/3D entspricht genau dem Kaiser-6/10-Kreis-Super W 1645/3D, wel-cher mit dem Vermerk „Preis auf Anfrage" im Radiokatalog 1959/60 enthalten ist. (Archiv Roelof de Jong Posthumus)
Forschung macht den Unterschied . . .
Generalvertretung für Deutschland
C. blelchers 4k Co. Bremen Postfach 29 Telefon (0421) 31 02 11
Der erreichte, garantiert gleichbleibend hohe Leistungsstan-
dard veranlaßte K. Matsushita, die NATIONAL -Geräte jetzt auch dem deut-
schen Fachhandel und damit dem deutschen Käuferkreis vorzustellen.
Japans größter Hersteller für Fernseh Rundfunk- und Elektrogeräte
MATSUSHITA ELECTRIC JAPAN
Generalvertretung für Deutschland Fa. HERBERT HULS. Hamburg 1. Lindenstraße 15-19, Tel.: 241101
HEINRICH ALLES KG. Frankfurt/M., Mannheim, Siegen. Kassel • BERFIANG & CORNEHL Dortmund, Wuppertai-Elberfeld. Bielefeld • HERBERT HOLS, Hamburg. Lubeck KLEINE-ERFKAMP & CO, Köln, Dusseldorf, Aachen. LEHNER & KUCHENMEISTER KG, Stuttgart MUFAG GROSSHANDELS GMBH. Hannover. Braunschweig - WILH. NAGEL OHG, Karls-ruhe. Freiburg/Brsg., Mannheim • GEBRUDER SIE. Bremen • SCHNEIDER -OPEL, Berlin SW-61, Woltenbüttel, Marburg/Lahn • GEBRUDER WEILER, Nürnberg, Bamberg, Regens-
burg, Würzburg, Munchen. Augsburg. Landshut.
ELEKTRISCHE UM, ELEKTRO-
NISCHE QUALITATSPROOUKTE
Die dynamische Chronik
Rekordproduktion in Japan
Das vergangene Jahr schloß in Japan mit einer Fertigung von 13,75 Millionen Rundfunkempfängern ab, wovon die überwiegende Zahl transistorisierte Klein-, Taschen- und Spielzeugempfänger waren. Für 1962 wird die Gesamtproduktion auf 14,9 Millionen Geräte geschätzt. 4,56 Millionen Fernsehempfänger wurden im Vor-jahr hergestellt. Wie bereits gemeldet, dürfte diese Zahl in diesem Lahr um mindestens 100 000 unterschritten werden. Dagegen er-wartet die japanische Industrie für 1962 die Fertigung von 1,35 Mill. Tonbandgeräten; 1961 waren es erst 890 000.
Obwohl die Produktion stückzahlenmäßig erstaunlich hoch ist, liegen die Erlöse der Industrie niedrig; der Konkurrenzkampf ist hart und der Trend zum kleinen und billigen Gerät hält an.
1961 konnte die Bauelemente-Industrie in Japan folgende Fer-tigungsmengen verzeichnen (in Millionen Stück): Widerstände 1 000, Kondensatoren 1 200, Verstärkerröhren 164, Elektronen-strahlröhren aller Typen 4,6, Transistoren 181. Für 1962 wird eine weitere Steigerung vorhergesagt; sie wird die gefertigten Tran-sistoren auf 220 Mill. Stück erhöhen.
8. Kapitel
Der Preiskampf unter den inländi-
schen Erzeugern war schon
schlimm genug — nach und nach
jedoch drängten zu ihrem Unglück
immer mehr fernöstliche Erzeug-
nisse auf den deutschen Markt —
bevorzugt über den aufblühenden
Versandhandel. Aber auch die Ein-
kaufs-Genossenschaften ergänzten
ihre Angebote durch asiatische
Fabrikate — nicht grundlos hieß die
Funkberater-Gesellschaft ab 1969
„Interfunk".
Notiz aus der „Funkschau, Heft 18/1962
Rechts:
Inserat aus der „Funkschau", Heft 4/1963. Die
Japaner fertigten auch Netzanschluss-Röh-
rengeräte für MW-, KW- und UKW-Empfang,
und das zu Preisen von 50 — 80 Mark.
Was mit Taschen- und Kofferradios
begann, setzte sich mit Heimgeräten
und Fernsehapparaten fort.
Akio Morita (Sony) und Masaharu
Matsushita (in Europa = National, in
den USA = Panasonic) hatten sich
zum Ziel gesetzt, den Weltmarkt zu
erobern. Auch andere (Pioneer usf.)
wollten ein Stück vom Kuchen haben.
Neuer Japan-Import 2 Transistorradio 17.50 6 Transistorradio 39. -
bei 10 Stück 16.- bei 10 Stück 37. - bei 30 Stück 15.50 bei 20 Stück 36. - bei 50 StOck 14.75 bei 50 Stück 34. - bei 100 StOck 14.- bei 100 Stück 32.50
Japan 9 Transistorradio MW-UKW 109.- bei 10 Stack 100. - Japan Kleinsttonbanddiktiergerdt 75.- bei 10 Stück 68. - Japan 6 Transistorradio mit Uhr 69.50 bei 10 Stack 66, - Japan 6 Transistorradio MW-LW 58.50 bei 10 Stück 56. -
Japan Netzgerät 7 Röhren MW-UKW 80. - bei 10 Stück 77. - Japan Netzgerät 5 Röhren MW-KW 50. - bei 10 Stück 48. -
Japan Feldstecher 8 x 30 57.50 Alle Preise rein Japan Feldstecher 7 x 50 74.70 netto, netto per Japan Feldstecher 10 x 50 78. - Nachnahme
Japan Sprechfunkgerdte 27 Mc, 1 Paar komplett 30.5.
Bitte beachten Sie die postalischen Bedingungen über den Betrieb von Sendern I
PELO-OPTIK München 15, Bayerstraße 103, Fernsprecher 53 30 98
Und so sahen nicht nur die namhaften Markenfir-
men ihre ohnehin schon bedeutungslosen Gewinne
vollends dahinschwinden, auch dem Fachhändler
blieb die Erkenntnis nicht erspart: der Versand-
und Warenhausvertrieb nahm ihm die Butter vom
Brot.
Die Spatzen pfiffen's von den Dächern:
Die „Goldenen Fünfziger" sind endgültig vorbei.
Inserate
aus den
Funkschau-
Heften Nr.
7 und 21/63
46
Richtiges Stereo-Hören verlangt eine
gut durchdachte Aufstellung des
Konzertschrankes und des Stereo-
Raumklangstrahlers im Zimmer.
Nur in dem schraffierten Raum vor
den beiden Schallquellen I und II
erhalten Sie die richtige stereo-
phonische Wirkung!
CNORDMENDE Stereofibel .2
Die stereophonische Klangwiedergabe ist so wahrheitsgetreu, daß Sie glauben,
die Musik zu sehen und zu fühlen, Das Orchester breitet sich in einem weiten
Bogen vor Ihnen aus: Links Streicher und Holzbläser, rechts Bratschen und Bässe
und in der Mitte die Hörner und Schlagzeuge. Die räumliche Aufteilung des
Orchesters ist so eindrucksvoll und überwältigend gelöst, daß Sie praktisch
jedes Instrument aus dem Orchester heraushören.
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.13 „Stereo-Rundfunk" und das Ende der kompakten Großgeräte
Das Jahr 1963, in dem der Rundfunk (40jährig) ins „Schwabenalter" kam, gestaltete sich ereignis-
reich. Kennedys berühmter Ausspruch an der Mauer wird den Berlinern ewig im Gedächtnis bleiben,
noch im selben Jahr wurde der gefeierte Präsident in Dallas erschossen. Der 87jährige Konrad Ade-
nauer — damals schon fast Legende — trat zurück und Ludwig Erhard wurde sein Nachfolger.
Auch im Bereich des Rundfunks gab es Neues: Im April 1963 startete das Zweite Deutsche Fernse-
hen und Ende August begann das „stereophone Zeitalter" des Hörfunks, zunächst beim SFB auf der
Funkausstellung in Berlin. Die Industrie hätte die Sendeanstalten unfair bedrängt, meinten die Sende-
leute, aber die Industriellen fürchteten, Deutschland könnte seinen technischen Vorsprung einbüßen, wenn man die HF-Stereotechnik weiterhin vor sich her schob.
Deutschland ein unterentwickeltes (Rundfunk-) Land?
„Grünes Licht für Hf-Stereofonie" überschrieben wir hoffnungsfroh unseren Leit-artikel in Heft 14/1962, nachdem in Bad Kreuznadi die Entscheidung über die europäische Hf-Stereonorm gefallen war. Heute dürfen wir das Signallicht höchstens auf „Gelb" schalten, nachdem es Monate hindurch auf „Rot" gestanden hat.
Es gab einige Kontroversen. Die Rundfunkanstalten fühlten sich von der Radiogeräte-Industrie bedrängt, und zwar unzulässig, wie sie meinten. Auch legten sie ein Bündel Vorbehalte auf den Tisch: es sei kein Geld vorhanden, denn die Abgabe von 30 Prozent der Fernsehteilnelimergebühren an die neue Mainzer Fernsehanstalt, das kommende Dritte Fernsehprogramm und später das Farbfernsehen zehren bis auf weiteres auch den Einnahmezuwadis durch höhere Fernsehteilnehmerzahlen auf. Ferner sei noch längst nicht bewiesen, daß die breite Masse der Hörerschaft die Stereofonie günstig auf-nehmen würde — das Beispiel der Stereo-Schallplatte sei alles andere als ermutigend. Schließlich wird die angebliche Entwertung der großen Tonbandarchive mit Mono-Musik ins Treffen geführt, und einige Experten bezweifeln den Wert der Stereo fonie überhaupt, wie auch niemand wissen könne, ob Stereo für Hörspiele eine Bereicherung abgeben wird.
Auszug aus Karl Tetzners Leitartikel
in der „Funkschau" Heft 4/1963.
Stereo im Rundfunk — warum eigent-
lich? — fragte der Elektromeister H.
Engels im Heft 7, und im Heft 11/63
fand die Funkschau heraus, dass
die Stereo-Befürworter die Ablehner
um das Doppelte übertrafen.
So lange es gedauert hatte, bis
sich die Sendeanstalten grund-
sätzlich zu dieser neuen Tech-
nik bekannten, so lange währ-
te es nun, bis auch die letzten
Sender wenigstens stunden-
weise eines ihrer Programme in Stereo ausstrahlten.
Im Dezember 1965 (!) stand in
der „Funkschau", dass in Bay-
ern die Stereosender noch
nicht in Betrieb sind — aber
österreichische Stereopro-
gramme seien zu empfangen.
Aus der Betriebsanleitung eines Mende-Konzertschranks von 1958. Damals
gab's aber nur Stereo-Tonträger, meist in Form von Stereo-Schallplatten; und
deshalb waren nur die NF-Stufen mit Stereoverstärkern ausgerüstet.
47
Lautsp R
Die Mus absolut echt und naturgetreu. jetzt hören Si , genau e im Kanzertiol, aus echer Richtun der Klan er ein-zelnenjnstrumente kommt.
48
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Die Rundfunkwerke, welche mit der Zeit eher zu „Fernsehgerätewerken" warden (seit 1960 war auch
in den Katalogen das „Fernseh-Angebot" an die erste Stelle gerückt), erzielten nochmals gute Umsät-
ze mit ihren hoch entwickelten Hörfunk-Geräten in bester HiFi-Stereo-Qualität. Noch aber fehlte den
meisten der HF-Stereodecoder, der im ersten Stereo-Jahr ggf. als Nachrüst-Zusatz geliefert wurde.
Die Empfänger der ersten Klasse waren mehrheitlich noch mit Röhren — bis zu 16 Stück pro Gerät —
ausgestattet. In der zweiten Klasse dagegen hatte der Transistor Einzug gehalten. Unter den Autora-
dios fand man immer weniger Geräte, in denen neben Transistoren noch Röhren ihren Dienst taten;
in Koffer- bzw. Taschenradios waren sie bereits völlig vom Transistor verdrängt. Und nun konnte
man ihn auch schon in den HF-Stereodecodern der Großgeräte finden.
Die Stereo-Wiedergabe hatte nicht nur Veränderungen im Bereich der Technik zur Folge, die Einheit
des alten Radios wurde wieder in Frage gestellt.
In diesem, 1965 mit zwei Gegentakt-Endstufen (2 x ELL 80) ausgestatteten Philips Saturn Ste-
reo 641 (B 6 D 41 A) sitzen die Lautsprecher mit 21 cm Durchmesser beidseitig schräg im 73 cm breiten Edelholzgehäuse. Frontseitig ist die Schallwirkung eher bescheiden, und der Stereo-Eindruck ist weitgehend davon abhängig, wie der seitlich austretende Schall im Raum reflektiert wird. Deshalb kommt bei diesem Gerät dem Aufstel-lungsort besondere Bedeutung zu. Keinesfalls sollte er einseitig an einer (Schrank-) Wand ste-hen, vorteilhaft wäre die 45-Grad-Aufstellung in einem Winkel des Raumes.
War es bis Anfang der Dreißiger
noch üblich, Empfänger und
Lautsprecher (auch wegen des
geffirchteten „Röhrenklingens")
in getrennte Gehäuse einzubau-
en, machte nun, 30 Jahre später,
das Zweikanal-Stereo-Verfahren
Maßnahmen erforderlich, wel-
che letztendlich wieder zu die-
sem „Rückschritt" führten.
Die drei Positionen: „Lautspre-
cher — Hörer — Lautsprecher"
sollten möglichst ein gleichseiti-
ges Dreieck bilden, also zuein-
ander in einem Winkel von je-
Die großen SABA-Modelle Freiburg Vollau-tomatik 12 bis 15 Stereo (hier die Type 12 von 1962) werden noch heute vom Sammler geschätzt, obwohl doch die Lautsprecher-gruppen mit viel zu geringem Abstand im Gerät eingebaut wurden.
weils 60° aufgestellt sein. Dies war
natürlich nicht der Fall, wenn beide
Lautsprecher mit Abständen von
wenigen Dezimetern links und
rechts im Empfänger eingebaut wa-
ren. Wenigstens einer davon sollte
vom Gerät entfernt platziert werden.
Die von der Radioindustrie empfohlene Lautsprecher- und Sitzanordnung für den optimalen HF-Stereo-Genuss.
Die dynamische Chronik
Grundig war schon Mitte der Fünfziger (far die „3-D-Radios")
mit externen „HiFi-Klangstrahlern" auf den Markt gekommen.
Diese Gebilde in Form von Nachttisch- oder gar Stehlampen
konnte man an beliebigen Orten aufstellen oder auch aufhängen.
Elegante Lösungen waren das nicht.
8. Kapitel
Recht bieder sehen sie aus — der externe Grundig-Hochton- Lautsprecher in Form einer Nachttischlampe (aus der Sammlung R. Frit-zen) oder der mit einer Stehlampe kombinier-te. Die Grundig-Akustik-Spezialisten hatten aber schon um die Mitte der Fünfziger erkannt, dass nur die „Hochtöner" den so genannten „Raumklang" bewirken konnten.
Erst später begann sich diese Erkenntnis allgemein durchzusetzen — erst um die Jahr-tausendwende begnügte man sich mit nur einem „Subwoofer" und verteilte zwei oder mehrere kleine Diskant-Lautsprecher bzw. „Satelliten" im Raum.
Noch waren zahlreiche Stereo-Empfänger mit eingebauten Laut-
sprechern zu haben — bis Mitte der Sechziger wurden sie von
verschiedenen Firmen angeboten. Manche Empfänger hatten auch den zweiten Lautsprecher als
Anhängsel, das man abnehmen und wegstellen konnte. Auch
solche Modelle entpuppten sich als vorübergehende Erscheinun-gen.
1964 konnte man zum Preis von DM 668.-solch einen Loewe-
Stereo-Phonosu per kaufen.
Das Besondere an ihm ist der abtrennbare Lautsprecher zur Er-weiterung der Stereo-Basis.
Letztendlich gab es im Bereich der „HiFi-Stereofonie" nur eine sinnvolle Alternative: aus den Kom-
plettgeräten sämtliche Lautsprecher herauszunehmen.
Also begannen Studio-Komponenten, ergänzt durch zwei Lautsprecherboxen, den Markt zu erobern.
49
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
So stellte sich der Zeichner Anfang der Sechziger die zeitgemäß moder-ne Regalwand vor.
Sie sollte den Mu-sik- und Fernseh-schrank mit der darin eingebauten Hausbar ersetzen.
Die beiden Laut-sprecher — die sind viel zu hoch positi-oniert.
Abbildung aus: „radio und fernsehen", Heft 12/1960
Das Telefunken-Stereo-Steuergerät Opus 2550 mit zwei getrennten Lautsprecherboxen.
Wie im Bild oben gezeichnet, wurden sie im Abstand von zwei bis drei Meter in die Regal-wand eingestellt.
Dem Transistor war nun auch die neue HiFi-Generation nicht mehr heilig. Opus 2550 HiFi hieß das
Telefunken-Schlusslicht, welches noch ausschließlich mit Röhren bestückt war. 1964 kam es auf den
Markt — man findet es zuletzt im Katalog 1965/66. In den zwei Folgejahren erhielt das Opus-Studio
2650 eine Mischung aus Röhren und Transistoren und anschließend gab's nur noch transistorbe-
stückte.
Andere Firmen hatten vereinzelt noch bis 1968 Röh-
ren in ihren Geräten. Braun beispielsweise bestückte
den HiFi-Stereo-Verstärker CSV 60 mit zehn Röh-
ren, und zum Ausklang des letzten Röhren-
Jahrzehntes durfte sich das Studio 1000 an zwei
Stück dieser Spezies erfreuen. Unter den Tischemp-
fängern war es der Philips- Capella Reverbeo (12 RB
770), in dem 1969 die letzten Röhren steckten.
Für die meisten Radiosammler, wenn sie sich über-
haupt noch ftir spätere Nachkriegsgeräte interessie-
ren, endet das Sammeln bei den Empfängern aus
den Sechzigern — dem
„Ende der Röhren-Ära".
Das kleine Modell Jubilate 1651 mit verchromten Knöpfen und Drucktasten aus der Saison 1966/67 war das letzte Telefunken-Radio, welches noch durchweg mit Röhren bestückt wurde.
50
TELEFUNKEN Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
BERLIN SW11, HALLESCHES UFER 12
Empfänger- und Verstärkerröhren für den Rundfunk Durch Inlands- und Austundspatente geschützt
Pi.: 5d PE 11 ,92 Pf 8-0
Röhren mit Wolfram-Heizfäden
Stromsparende Röhren
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.14 Die Radioröhre hat ausgedient — bei ihren Liebhabern lebt sie weiter
Nun wäre er am Platze, der Abgesang auf die Röhre. Wann war das denn, Schon im Kapitel 1.2 wurde dieses Thema behandelt. Wir wollen es noch-mals aufgreifen, uns kurz fassen, und mit der Triode beginnen.
Zwei Erfinder meldeten 1906 und 1907 Röhren-Patente an: der Österreicher Robert v. Lieben und der Amerikaner Lee de Forest. Lieben wusste, was er mit seiner Erfindung bezwecken wollte — nämlich die Verstärkung — war aber mit seinem Steuersystem auf dem falschen Wege.
Lee de Forest, der im Grunde eine Dioden-Variante suchte, um berechtigte Schutzansprüche straflos ver-werten zu können, wollte mittels einer neuartigen, effektiveren Detektorröhre zum Ziel gelangen. Die Hauptsache: sie musste patentfähig sein. Eine Hilfselektrode einzufügen — das war seine Idee, die sich im Nachhinein als visionär erwies. Anfäng-lich jedoch tappte der Erfinder im Dunkeln.
als sie erfunden wurde?
Gasgefüllte Lieben-Röhre
Obgleich er bereits 1906 den Patentanspruch auf eine Röhre zur Verstärkung schwacher elektrischer Ströme postulierte, taugte auch das 1907 angemeldete „Gitter-Audion" vorerst nur zur HF-Gleichrichtung. Erst nach Jahren des Expe-rimentierens erkannte er, dass sich sein Dreielektrodensystem tatsächlich auch zum Zwecke der Verstärkung eignete.
So wurde de Forests „Audion" (die ursprüngliche Detektorröhre) schließlich auch zur praktisch anwendbaren Triode, mit der man jedoch erst ab etwa 1911/12 etwas anfangen konnte. Wichtig war letztendlich auch die Erkenntnis,
dass Gas zwar in Gleichrichterröhren (später in Thyratrons) vorteilhaft sein konnte, in der Verstärker-röhre aber zu unstabiler Arbeitsweise fiihrte. Zuverlässig wurden die Trioden, als Wissenschaftler der Western-Electric (D.Arnold) und General Electric (I. Langmuir) 1913 das notwendige Hochvakuum in den Griff bekamen und somit zuverlässig arbeitende Verstärkerröhren schufen.
51
De Forests Audion
De Forest-Triode (Audion)
Telefunken-Triode (E.V.N.)
RE bis RENS-Stiftröhren
Loewe-Mehrfachröhren
A- B- C- und K-Serien
V-Sparserie
E- und U-Stahlröhren •
0- Stahlröhren
Schlüsselröhren-Serien
(Philips 20er, Lorenz 70er)
E- und U-Valvo-
Topfsockelröhren -
40er (Rirnlock) 4•11.0.11110
Telefunken-Pico-Serie ......
80er (Nova!)
90er (Miniatur) ,
Radioröhren und
die Zeitabschnitte
der Erstbestückung.
Von 1945 bis
1948/49 wurden
in großen Mengen
auch Wehrmacht-
röhren verwendet,
vorzugsweise die
RV 12 P 2000.
Natürlich gab es die Röhren auch noch nach den aufgezeich-neten Zeiträumen. Man brauchte sie für Ersatzzwecke und einzelne Exportländer hatten Sonderwünsche
' EL 12 bis 1964155 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
201.' +200r
Pu'wirer
0,2n1A
iiiee Piesckaettide liille-12414ce
Die PHILIPS- Enneode EQ 80
Siebengitterrehre für FAI•Dernedulatlore une Itärbegrenzung
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Auch Lieben hatte seine noch immer mit Quecksilberdampf gefüllte Röhre 1910 mit Hilfe des Steu-
ergitters nach und nach funktionsfähig gemacht — 1912 wurde sie in Serie fabriziert, 1914 mit Hoch-vakuum. Von Liebens Patenten hatte vor allem die Telefunken-Gesell-
schaft den Nutzen, und zwar deshalb, weil sie hierzulande mit Hilfe der-
selben dem Ziel der Marktbeherrschung näher kam.
Bescheiden war die Verstärkung mit diesen ersten Röhren. Aber sie wur-
den weiterentwickelt. Ein halbes Jahrhundert später gab's die E 810 F mit
einer Steilheit von 50 mA/V. Anders ausgedrückt: der Verstärkungsfak-
tor stieg im Verlauf der 50jährigen Röhrenentwicklung vom zehnfachen
auf den gut tausendfachen Wert.
Drei Elektroden, davon ein Git-ter, hatten die ersten Audionröh-
ren. Schon in den Dreißigern er-
schienen Hexoden und Oktoden
zur multiplikativen Mischung,
und das Ende der Leiter signali-
sierte 1949/50 die „Nonode" oder
auch „Enneode" EQ 40 / 80, eine Neunelektroden-Röhre mit sieben
Gittern zur FM-Begrenzung und Demodulation.
Links: Notiz und Schaltbild aus den
„Funkschau"-Heften 6 und 12/1950
Würde man denn auch so etwas durch schlichte Zwei- oder Dreielektroden-
Halbleiter ersetzen können? Es ging. Schon in der Röhrenepoche zeichnete sich entsprechendes ab.
Rechts: Die erste Telefunkenröhre E.V.N. 94 sitzt auf dem Sockel
EZ 96. Am 23.8.1916 wurde sie geprüft.
Die Ausführung des Elektrodensystems erinnert eher an die Röhre
de Forests, als an die Lieben-Röhre. (Sammlung P. Kohmann)
52
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
In den Fünfzigern griff man für die additive Mischung wieder zur Triode und auch die EQ 80 war
schnell wieder aus der Mode gekommen (ihre Fertigung wurde schon 1951 wieder eingestellt). "Zurück zur Pentode und Triode" — so der Trend — teils wurde die Hexode schon aus der AM-Mischstufe verbannt. Somit stand dem Transistor auch im Bereich der hochwertigen Empfänger
nichts mehr im Wege — die ECH 81 beispielsweise konnte durch den MOS-FET ersetzt werden.
Eigentlich ist's kein Wunder, wenn wir die Röhre in unseren 1970er Radios vergeblich suchen —
doch es bedurfte der Gewöhnung. Rund 700 Millionen davon wurden 1963 noch weltweit gefertigt,
zehn Jahre später lief die Fertigung in den westdeutschen Werken aus. Sollte tatsächlich die Daseins-
berechtigung der Radioröhre schon 60 Jahre nach der Erfindung erloschen sein? Aus und vorbei?
Die Rundfunkgeräte betreffend — ja. Selbst die Abstimmanzeigeröhre, welche den Hörer einst als „Magisches Auge" so fasziniert hatte, die dann zum magischen Fächer, zum magischen Band und
schließlich (in Stereogeräten) zur magischen Waage wurde, hat man durch Leuchtdioden ersetzt. Den
Radiofreund erinnern sie an die Glimmröhren, welche in den Dreißigern anstelle von Schattenzeigern
u. dgl. zur Abstimmanzeige dienten. Würden jetzt sämtliche Vakuumröhren und ihre gasgefüllten Verwandten der Vergangenheit angehören?
Sicher nicht. Es bleiben bedeutsame Anwendungfälle, in denen auf spezielle Ausführungen der guten
alten Röhre auch heute noch nicht verzichtet werden kann. In den Endstufen leistungsstarker Kurz-
wellen- Sender (500 kW) beispielsweise tun sie „derzeit noch" ihren Dienst. Und dann gibt es ja auch noch die „Röhrenverstärker-Freaks", welche sich partout nicht davon abbringen lassen, dass der
„Röhren- Sound" durch keinen noch so aufpolierten Transistor zu erreichen sei.
Das ist kein moderner Kochherd — es ist ein hochwertiger T + A - Röhrenverstärker V 10 neuester Bauart
In Kreisen kompetenter Akustikspezialisten wurde diese Frage eingehend erörtert; dort räumte man
jedoch der Messtechnik einen höheren Stellenwert ein als dem Musikerohr. Also eine Glaubensfrage?
Möglich, aber die Theologen unserer Zeit ftihlen sich dafür nicht zuständig — heute nicht mehr.
Im 17. Jahrhundert war das noch anders. Damals bestand der Klerus darauf, in Sachen Wissenschaft ein Wörtchen mitzureden. 1633 zum Beispiel hielt es die katholische Inquisition für angebracht, Ga-
lilei wegen der Verkündung des kopernikanischen Weltsystems in den Kerker werfen zu lassen, ihn anschließend lebenslang unter Hausarrest zu stellen. Es vergingen fast zwei Jahrhunderte (!), bis die Wissenschaft in dieser Sache auch von den Kirchenmännern in Rom anerkannt wurde.
Scheibe oder Kugel? Siliziumscheibe oder Röhre? Ist das auch eine Weltanschauung? Wenigstens
drohen heute dem Verfechter des neuen Glaubens weder Folter noch Haft. Und die Freunde der alten
Technik können diese Frage getrost im Raume stehen lassen — sich weiterhin am Klang der ihnen ans
Herz gewachsenen Röhren-Radios und -Verstärker ergötzen.
Die Typenbezeichnungen der Vorkriegs-Radio-Röhren sind im Anhang A IV zu finden, die der Nachkriegs-Typen im Anhang B IV.
53
Mit Hochgenuil lauschte er dew Rundfunk
Anno 1924 glühten die Wolfram-Heizfäden in den
Röhren noch wie in kleinen Beleuchtungslampen
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.15 Abschied vom alten Radio — die neuen Bausteine sind durchweg
mit Transistoren bestückt. Sollte man der abservierten Röhre nachweinen?
1969 glühten im Radio die letzten Röhren. 1969 spazierte
auch der erste Mensch auf dem Mond. Ohne den Silizi-
umtransistor und Silicon Valley wäre das nicht möglich
gewesen. Sollte man der Radioröhre nachweinen?
Die Verfechter des Fortschritts betrachten sie heute als
eine zwischenzeitliche Notlösung. Warum wurde der De-
tektor nicht schon damals zum Verstärker gemacht, fragen
besonders Naive...
Zurückschauend ergibt sich folgendes Bild: Um die Jahr-
hundertwende, zu Professor Bra uns Zeiten (1850-1918),
wusste man über das Kristallgefüge und dessen elektri-
sche Eigenschaften noch recht wenig und musste sich auf
Experimentalerkenntnisse beschränken. Die wissenschaft-
lich-technischen Möglichkeiten waren noch sehr begrenzt;
es gab ja noch keine Elektronenmikroskope und hoch-
empfindliche Labormessgeräte, die doch erst mit Hilfe
von Röhrensystemen entstehen konnten. Und — wer hätte
solch zweifelhafte Experimente bezahlen sollen?
Würde man den Kostenaufwand ermitteln, der letztendlich den Amerikanern durch die Grundlagen-
forschungs- und Entwicklungsfinanzierung entstanden ist, dann ergäbe dies eine unvorstellbare Sum-
me. 1910 hätte derartiges auch dann nicht finanziert werden können, wenn der Wissensstand ein an-
derer gewesen wäre.
Es wäre absurd, wollte man den Herren aus der Funkensender-Epoche und danach vorhalten, mit der
Vakuum-Verstärkerröhre den falschen Weg beschritten zu haben. Es war schlicht unmöglich, vom
Halbleiter definierte Verstärkungseigenschaften zu verlangen, aber die Arbeiten zahlreicher Wissen-
schaftler aus den USA (Lilienfeld), aus Deutschland (Schottky, Hilsch, Pohl, Welker) und auch aus der
UdSSR (Losew), beweisen, dass es nicht an den Ideen dazu fehlte.
W. Büll beschrieb in der „Funkschau" Heft 15/1953 einen „Kristallverstärker aus dem Jahre 1926"
wie folgt: "Es ist allgemein bekannt, daß der Transistor ein Kind der neuesten Zeit darstellt. Weni-
ger bekannt sein dürfte aber, daß bereits im Jahre 1926 (.9 ein „Transistor** beschrieben worden ist.
Nicht nur aus historischem Interesse, sondern wegen der Tatsache, daß auch andere Stoffe als Ger-
manium verwendet werden können, sei dieser Kristallverstärker beschrieben".
Mit der nachfolgend skizzierten, in England patentierten Alaun-/Salpeter-Konstruktion sollte zwar
lautstarker Empfang möglich gewesen sein, technische Unvollkommenheiten verhinderten aber die
praktische Einfahrung dieses Kristallverstärkers.
Nur die Röhre erwies sich als zuverlässig, sie war und bleibt eine bahnbrechende Erfindung — der
damals einzig mögliche und richtige Weg. Ohne den Umweg über die Röhre hätte es nie einen ver-
lässlichen Transistor geben können. Sie hat mitgeholfen, ihren Konkurrenten zu erschaffen, der ihr
dann eines Tages das Lebenslicht ausblasen sollte.
Nun aber war der mit so großem Aufwand entwickelte Transistor geboren, hatte die Kinderkrankhei-
ten hinter sich gelassen und wurde voll funktionstüchtig. Im Vergleich mit der Röhre zeigt er ent-
scheidende Vorzüge: > er benötigt kein Vakuum und keine Heizung
> zum Betrieb sind nur Kleinspannungen erforderlich
> die Lebensdauer ist praktisch unbegrenzt
> die Maße und das Gewicht sind minimal
> die Wärmeentwicklung bleibt gering, ebenso der Energieverbrauch
> und er ist in „Chips" integrationsfähig.
54
0 0 0
,••••••••••••••••••
AC132 AD 150
AC 161 AC 126
(74 efihiall tnF
AC 126 AF 117
-1)* .....1.1•••••••••••»•
fietriebsorten - Mew 6egen - Bässe fiefpaß bzw. Lautstärke- Flochpail bzx Salance urnsclialter t stereo kopplung When Rauschfilter Einsteller flumpelfiller Einsteller
AC 161 AC 126 AC 161
Bild 3. Elockschattung des Nf-Veretdrkers AC 127 AO 150
,IMMIMI•1••••••MII
•
250 000 Stereo-Geräte sind nach den letzten Untersuchungen in der Bundesrepublik verkauft worden. Schon jetzt strahlt die Mehrzahl der deutschen Sendeanstalten ein festes Stereo-
Programm aus; bis Mitte dieses Jahres wird wahrscheinlich das gesamte Bundesgebiet ver-sorgt sein. Damit könnte es nach Meinung von
Sachverständigen dem Hörfunk gelingen, sich
wieder eine interessierte und anspruchsvolle
Hörerschaft zurückzugewinnen.
Notiz aus der „Funkschau", Heft 2/1965
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Transistorbestückte Geräte bieten nicht nur technische, sondern vor allem wirtschaftliche Vorteile — die außer Dienst gestellte Radioröhre musste das einsehen. Die bisher mit 14 bis 16 Röhren bestückten Großgeräte erhielten nun die viel billigeren Transistoren: 30, 50 oder noch mehr. Dazu noch Halbleiterdioden. Anfangs wurden sie alle namentlich aufgefiihrt. Nachdem die Stückzahlen weiter zunahmen, ging das nicht mehr. Über 100 dieser Halbleiter konnte man schon im SABA 8120 von 1970 finden und die Zahlen stiegen weiter. Aber diese Gebilde waren alle sehr klein, und deshalb konnten auch die Geräte kleiner und flacher werden. Man stelle sich vor, ein vergleichbarer technischer Aufwand hätte mit Röhren realisiert wer-den sollen... Von den Kosten abgesehen hätten die vielfach größeren und schwereren Geräte zur Ab-führung der darin entstehenden Wärme mit Kühlgebläsen ausgestattet werden müssen. Nur der Tran-sistor ermöglichte die reduzierten Ausmaße. Dies im Gegensatz zu den Katalogen: sie schwollen an, von 15 mm (1960) auf 20 mm (1970). Das Angebot der Unterhaltungsindustrie wurde immer größer. Die im Wohlstand aufwachsende Jugend war zu einer beachtlichen Käuferklientel geworden, wollte sich nicht mehr mit ausrangierten Geräten des elterlichen Haushalts begnügen, peilte vielmehr die lautstarke HiFi-Stereoanlage an, zuzüglich Plattenspieler und Tonband. Kaum gab es im Haus noch einen Raum ohne Radio, auch im Auto war es selbstverständlich, und für die Freizeit hatte man den Koffer oder einen Mini, der in jede Hosentasche passte. Indes — die wenigsten dieser Kleingeräte kamen aus deutscher Produktion. In der Ein-/Ausfuhr-Statistik im „Funkschau"-Heft 13/1965 wurden die gesamten Ausfuhren von Rundfunkempfängern im Jahr 1964 mit 1.456.559 Stück beziffert, die Einfuhren mit 1.736.505 — davon 1.382.284 allein aus Japan. Ausfuhren in dieses Land gab es so gut wie keine. Die Tendenz war steigend — Japan galt damals noch als Billiglohnland, während in Deutschland die Löhne stetig erhöht werden mussten. Wen wundert's, dass hierzulande die Produktionszahlen von Jahr zu Jahr abnahmen. Im April 1965 zum Beispiel wurden 50.300 Heimempfänger produziert — ein Jahr zuvor im gleichen Monat 72.045. Auf dem Fernseh-Sektor dagegen, auf dem die Fernost-Konkurrenz noch nicht spürbar war, ging es in diesem Zeitraum stets aufwärts.
Beim Kauf hochwertiger HiFi-Stereoanlagen vertrau-ten die Käufer zumeist den deutschen Markenfabrika-ten, weshalb die Umsatzrückgänge nicht so hoch wa-ren, wie die der Stückzahlen. „Made in Germany" wurde — trotz höherer Preise — auch im Ausland ge-schätzt.
Für den Wohnbereich stand ein breites Angebot zur Verfügung. Noch gab es die Kompaktanlage, jetzt flacher und breiter, um die Lautsprecherabstände zu vergrößern. Links und rechts der Skala saßen die Lautsprecher bei besonders flachen Modellen; der Philips Capella Reverbeo beispielsweise wurde derart gestaltet. Diesen Stereo-Empfänger hatten die Philips-Entwickler mit einer Nachhall-Einrichtung ausgestattet, wie sie damals bei den beliebten Dr. Böhm-Orgeln gebräuchlich waren.
Aus der „Funkschau", Heft 16/1966. Jetzt wurden bereits hochwertige Stereoverstärker durchweg mit Transistoren bestückt
55
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Wie schon im vorletzten Abschnitt gesagt, konnte aber der Stereoeffekt nur dann optimal zur Geltung kommen, wenn die Lautsprecher der einzelnen Kanäle in zwei bis drei Meter Entfernung aufgestellt waren. Beliebter wurden deshalb Anlagen, die sich aus Bau-steinen zusammensetzten. Philips hatte bereits 1958, noch fur Mono, die Bausteinkomponenten NG 5501 mit 5601 auf den Markt gebracht. Damals waren sie nicht gefragt, jetzt aber, mit „Stereo", war der richtige Zeitpunkt gekommen. Man platzierte die Steuergeräte nach Möglichkeit in Sitzmöbelnähe, weil es nur wenige Empfänger mit Ka-bel-Fernbedienungen gab und die drahtlose noch nicht da war. Die Lautsprecher fanden ihren Platz gegenüber in der Regalwand.
Dieses Emblem soll für den Hörfunk werben,
Auf der Deutschen Funkausstellung 1965 in Stutt-gart war es an den Hallenwänden angebracht.
man sah es als Thekenautsteller und als Strei-fenaufkleber an den Schaufensterscheiben der Fachgeschälte VieIleichl wird das hörende
Männchen — der Gegensatz zum gemütlich Sit-zenden der Aktion „Fernsehen müßte man hdben" — bald das Symbol einer neuen Gemein-schaftswerbung der Rundlunkgeräteindustrie. Sie ist für des kommende Frühjahr im Gespräch.
Und wie sah es bei den Rundfunk-Herstellern aus? Ging die Branche — nachdem die Lagerbestände aus der Überproduktion von 1960/61 hatten abgebaut werden können — besseren Zeiten entgegen? Es kam wieder Morgenstimmung auf, aber so sicher waren sich die Produzenten nicht
Rechts: Aus einem Bericht von K. Tetzner über die Funk-ausstellung 1965 in Stuttgart. Schon wieder wurde befürch-tet, dass die Industrie zuviel Fernsehgeräte herstellte. Von Hörfunk-Heimempfängern war nicht die Rede.
Zwar kein rosenroter Optimismus aber doch Zuversicht erfüllte die wirtschaftlich
Verantwortlichen der Industrie. Das Jahr 1965 hat sich bisher gut angelassen; die
Verkäufe ab Hersteller laufen bis auf kleine Schönheitsfehler zufriedenstellend, und im
Gespräch war zu erfahren, daß die zum Beginn einer jeden Saison nicht nur unver-meidlichen. sondern wegen der Saisonnachfrage letztlich notwendigen Lagerbestände
an Fernseh- und auch an Koffergeräten immer bei den anderen Firmen, niemals beim
Gesprächspartner, lagen. Einige Grossisten gestanden, daß ihre Läger gut gefüllt seien. und daß sie daher Sondereinkaufskonditionen seitens des einen oder anderen Her- stellers nicht reizvoll fänden. K. T.
Die folgenden Jahre gaben wenig Anlass zur Freude. Siemens teilte mit: „Der Abschluß des Ge-
schäftsjahres 1965/66 (bis 30.9.) zeigte die für die Elektroindustrie im Bundesgebiet charakteristi-
sche Tendenz: Etwas erhöhte Umsätze, vornehmlich durch vermehrten Export, zurückgehende Erträ-
ge und trotz fast unveränderter Mitarbeiterzahl weiterhin kräftig steigende Personalkosten" [usw]. Und die „Funkschau" resümierte (im Heft 5/1967): „Das Jahr 1966 wird in die Wirtschaftsgeschich-
te unserer Branche als ein schwieriger, teilweise verlustbringender Zeitabschnitt eingehen".
Was die Funk-schau nicht wis-sen konnte: es war nicht der letzte „verlustbringende
Zeitabschnitt"...
Mit der Zeit bekamen die transistorisierten Studiogeräte und die Lautsprecherboxen ein „neues Einheits-design". Hier im Bild: Braun regie 450 von 1975 — ein Stereo-Steuergerät, bei dem alle Anforderungen der HiFi-DIN-Norm 45500 deutlich über-schritten werden.
Eine drahtlose Fern-steuerung hatte der Braun-Receiver noch nicht — die gab's aber schon 1971 — erst-mals für den SABA-Telecommander K.
56
Heim-Studio-Anlage 3400 ELAC QUA DRO-SOUND
Diese Heim-Studio-Anlage vermittelt ein völlig neues
Klangbild — erweiterte Stereophonic. ELAC Quadro-
Sound. Die ELAC-Spezialisten stellen hier eine
Hi-Fi-Anlage vor, die es jetzt ermöglicht, die seit
langem angestrebte „Konzertsaal-Atmosphäre" auch
in kleinen Räumen erleben zu können.
Beim ELAC Quadro-Sound-Verfahren werden bei
Stereo-Programmen die fur den Höreindruck wichtigen
Reflektionen von den Wänden, die Echoanteile, wie
sie in großen Räumen (z. B. die verhallende Akustik der
Orgel in einem Kirchenschiff) entstehen, nachgebildet.
Diese werden durch 2 kleine Zusatzlautsprecher, die sich
seitlich oder hinter dem Zuhörer befinden, so
wirksam wieder abgestrahlt, daß dieses Verfahren den
Zuhörer unmittelbar in das Musikgeschehen einbezieht.
Der volltransistorisierte Receiver 3400 T enthält einen
leistungsfähigen UKW-Stereo-Empfangsteil mit zusätz-
lichen KW-, MW- und LW-Bereichen und einen
Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2 x 50 Watt Musikleistung.
Die zu dieser Heim-Studio-Anlage gehörenden 2 Laut-
sprecherpaare sind speziell auf die Belastbarkeit des
Receivers und den E LAC Quadro-Sound abgestimmt
L R
1 74 -v.
V II •
L RN
Bild 7. Quadrophone Wie- dergabe sus zwei Kanälen
Der Kunstkopf mit den 2 Neumann-
Mikrophonen
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Hi-Fi-Stereo — ein Höhepunkt der Audiotechnik — war langsam in Fahrt
gekommen. Der Empfänger wurde durch einen Stereo-Plattenspieler
ergänzt, und wer es sich leisten konnte, kaufte sich ein Tonbandgerät.
Diese bis zu 20 kg schweren und im Extremfall über 2.000 DM teuren
Maschinen waren Ende der Sechziger so begehrt, dass 15 Firmen sich
mit ihrer Herstellung befassten. Einschließlich der Kassettenrecorder
standen im 1969er Katalog 90 (!) verschiedene Tonband-Modelle.
Grundig hatte seine Geräte zunächst mit Niedrigpreisen auf den Markt
gebracht und wurde schließlich der Welt größter Tonbandgeräte-Her-
steller. 1955/56 hatte Grundig vier Tonbandgeräte im Lieferprogramm. Das preisgünstigste (TM 5) kostete 375.-DM, das teuerste: TK 920/3D — oben im Bild — 1.125.- DM.
„Etwas teurer' war 1965 die Braun-HiFi-Tonbandmaschine TG 60 — die kostete 1.980.— DM und wog 19,2 kg.
Im Bereich des Rundfunkempfangs wurde es langsam
schwer, noch mit Neuerungen aufzuwarten. Die Berli-
ner (RIAS) versuchten es 1973 mit der „Kunstkopf-Ste-
reophonie", der ein ähnlicher (Miss-) Erfolg beschieden
war, wie dem „Quadrosound-Verfahren", das über vier
Kanäle und Lautsprechergruppen eine besonders plasti-
sche Wiedergabe spezieller Schallplatten versprach.
Der schon gewohnte Wirrwar bei den Quadrofonie-Techniken, unentschieden wie eh und je, wurde durch das Erschei-nen der an sich schon seit Jahren be-kannten Kunstkopf-Stereofonie kräftig angeheizt. Wenn sich die Erwartungen
erfüllen, die man an die Lautsprecher-Version dieses Verfahrens knüpft, könnte sich technisch eine neue Situa-tion ergeben. Das wird aber zweifellos den Weltmarkt nicht erschüttern.
Links: aus der „Funkschau", Heft 21/1973, S. 789.
Ausführlichere Betrachtun-gen zum Thema „Quadro" enthält der folgende Ab-schnitt 8.16.
Die Skizze links und das ELAC-Inserat wurde dem „Funk-Technik"- Heft 17, Jg. 1971 entnommen.
Die „kopfbezogene Stereophonie" ging auf Überle-gungen von Wissenschaftlern des Heinrich Hertz-Institutes zurück, die das ausgezeichnete Orientie-rungsvermögen des menschlichen Gehörs unter die Lupe nahmen. Wenn man die Stereo-Mikro-phone in einen „Kunstkopf einsetzte, und die Wie-dergabe über Stereo-Kopfhörer erfolgte, musste doch das den idealen Hör-Eindruck vermitteln. Das war auch so. Weil aber die meisten Hörer Lautsprecher bevorzugten, konnten sich die Sen-deanstalten nur versuchsweise zu dieser speziel-len Aufnahmetechnik entschließen. Ausführliche Betrachtungen zu diesem Thema enthalten auch die Archiv-Blätter des DRM, Berlin. Die Mikrophone im Kunstkopf fertigte G. Neumann.
57
Gegen Ende
des Jahrzehn-
tes waren die-
se technisch
aufwendigen
Verfahren
schon wieder
vergessen.
FIld 5 Bausatz fur den Aril-Decoder von Blaupunkt zum Anschluß an handeisubhche
Autoradlos
umhalf-Elnriehtung .Phonomaicope
4
Manchen gefiel es aber doch nicht, wenn
zahlreiche Einzelteile herumstanden, und
deshalb kamen nochmals Geräte in
Mode, in denen wieder Empfänger, Plat-
tenspieler und später sogar HiFi-Stereo-
Cassettenrecorder vereinigt wurden.
HiFi-Studio, HiFi-Center oder auch
Kompaktanlagen hießen diese Modelle.
Sie wurden von oben bedient und waren
meist durch eine Plexihaube abgedeckt.
Telefunken- electronic center 6001 hifi, eine Rundfunk-Phono-Kombination in Sensortechnik, abgebildet im Heft „Telefunken-Sprecher" Nr. 67 vom September 1975. Telefunken schreibt: „Kompaktanlagen wie diese erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit und halten Einzug in großen und kleinen Wohnungen. Wahrscheinlich, well sie in der Handhabung prak-tischer angesehen werden als Anlagen, die sich aus Bausteinen zusammensetzen".
58
Die dynamische Chronik
Sehr gut hat sich eine Entwicklung bewährt, die schon 1971 als die
„Rundfunk-Technik von morgen" in der Junk-Technik" beschrieben,
und 1974 bei der ARD eingeführt wurde: das ARI = Auto-Radio-
Informationssystem. Die Fabriken für Kfz-Empfänger begrüßten es
und statteten ihre Geräte mit allen technischen Raffinessen aus.
Die Autohifi-Entwicklung in den 1970er Jahren stand
nicht nur im Zeichen der technischen Verfeinerung
wie etwa Rauschunterdrückung, Bandsortenwahl und
Stereoton bei Cassettengeräten, sondern auch von
einer Innovation ganz anderer Art: 1974 stellte Blaupunkt
den Verkehrsfunkdecoder ARI (Autofahrer-Rundfunk-
Information) als Zusatzgerät fürs Autoradio vor. Wo auch
immer jemand in Deutschland mit dem Auto unterwegs
war, konnte er mit ARI erfahren, auf welchen Autobahnen
sich Staus gebildet hatten..
8. Kapitel
Abbildung aus der „Funk-Technik", Heft 18/1971.
Auszug aus der Broschüre: „Magazin zur Bosch-
Geschichte" Sonderheft 2. Robert Bosch GmbH, his-torische Kommunikation.
Schwieriger war es, dem Interessenten far das Heimgerät noch etwas Neues zu bieten. Mit Baustei-
nen, welche schon im Zuge des Innenausbaus in die Wohnraummöbel integriert werden sollten, hatte Grundig 1962 keine größeren Erfolge verbuchen kön-
nen: Möbel konnten Jahrzehnte dieselben bleiben, das
Rundfunkgerät nur Jahre. Bevorzugt wurden Kompo-
nenten, die nicht fest installiert werden mussten.
• GRUNDIG Baustein-Serie
me das Programm für Individualisten
1978 erschienen auf dem Markt die ersten HiFi-Türme. Ein Turm setzte sich damals aus den Kom-ponenten HiFi-Empfangsteil, HiFi-Verstärker, HiFi-Plattenspieler und HiFi-Cassettendeck zu-sammen. Aus dem Turm wurde ein Rack, aus dem Empfän-ger ein Tuner, und aus dem Verstärker ein Ampli-fier (Tuner + Amplifier = Receiver), womit man dokumentierte, dass nun eine neue Technikepoche angebrochen war, in der das „Radio" nur noch als nostalgischer Begriff Geltung haben konnte.
Und noch etwas hatte sich grundlegend geändert: In den Radiofabriken der Fünfziger wurden noch hunderte fleißiger Frauenhände gebraucht, welche jedes Einzelteil mit großer Geschicklichkeit an den vorgesehenen Platz im Chassis einlöteten.
Anfang der Achtziger schätzte man Kombinationen wie diesen „Mini-Turm mit der Maxi-Leistung" von Körting. Er enthält den Tuner T 100, den Verstärker A 100 und das Cassettendeck C 100. Den oberen Abschluss bildet der Dual-Plattenspieler mit dem Ortofon-System.
(Werkfoto Körting)
Die Verbindungsdrähte, Widerstände und Kon-densatoren wurden — wenn möglich — direkt an die Ösen der Röhrenfassungen, Spulensätze, Wellenschalter usw. gelötet. Wo Stützpunkte er-forderlich waren, setzte man Lötösenleisten ein.
Ein Rückblick: So sah der Schaltungsaufbau eines Rund-funkempfängers aus, als es noch keine „gedruckten" gab. Ein Blick unter das Chassis des Körting-Saxonia von 1935.
59
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Eine Variante war das Hochformat-Studio. Bei Schneider hieß es Vertical Audio Line.
Mit einer Grundfläche von ca. 40 x 18 cm konnte es auch dort aufgestellt werden, wo die 60 bis 80 cm breiten und annähernd 40 cm tiefen Flachausführungen keinen Platz mehr fanden. Aber nicht nur Platz sparend war ein solches Modell, besonders attraktiv wirkte der ans alte Polyphon erinnernde senkrechte Plattenspieler mit dem Tangen-tial-Tonarm.
1984/85 fertigte Schneider die Vertical Audio Line VAL
1002, für den Sammler ist sie eine willkommene Abwechslung unter den üblichen Flachmodellen.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Bereits 1947 aber hatte die „Funk-Technik" (im Heft 24) über die „Starrverdrahtung" mittels ge-spritzter oder gedruckter Leitungen berichtet. In den USA wurden so auf kommerzieller Basis schon Baugruppen zusammengestellt; hierzulande war die Zeit dafür noch nicht reif. 1956 aber — noch in der „Röhren-Ära" — hatte Paul Metz die von Fritz Stahl produzierte „gedruckte Schaltung" in seine Geräte eingefügt (siehe „Ruwel" im Kapitel 9).
Telefunken brachte mit dem UKW-Super Caprice 1956 „ den ersten serienmäßig in Deutschland ge-
fertigten Rundfunkempfänger
auf den Markt, dessen Haupt-
chassis mit gedruckten Schal-
tungszügen und nach dem
Tauchlötverfahren hergestellt
wurde" (Zitat aus dem „Funk-schau"-Heft 24/1956).
Äußerlich gleicht der Telefunken-Typ Caprice (hier das Modell von 1957) den anderen Kleinsuperhets aus die-ser Zeit, aber ein Blick unter das Chassis offenbart die 1956 eingeführ-te „gedruckte Schaltung"
Die Bestückung mit Einzelteilen erfolgte zwar noch von Hand, aber die „Admiral Corp. in Chicago" hatte, wie die „Funk-schau" im April 1956 berichtete, schon eine maschinell mit Bau-elementen bestückte Leiterplatte in eines ihrer Fernsehgeräte eingesetzt. Und so war es nur eine Frage der Zeit, wann diese durch sinkende Weltmarktpreise erzwungene Automation auch in den andern Industrieländern nicht mehr zu umge-hen war. Nach und nach wurde auch hierzulande die Bestückung der neuen „Leiterplatten" den Automaten überlassen und das Tauchbad ersetzte die Löterinnen. Nur ungern verließen sie ihren Arbeitsplatz — viele fanden keine neue Stelle.
Noch ein Rückblick — in die Radiofabrikation um 1950 — aus einem Bildbe-richt über das Lembeck-Apparatewerk im „Funk-schau"-Heft 4/1950.
Lembeck in Braunschweig zählte zu den kleineren Radio-Herstellern, aber auch in den großen Betrie-ben sahen in den Fünfzi-gern deren Fertigungs-Straßen nicht viel anders aus. Tausende Arbeitskräf-te wurden damals beschäf-tigt — auch mit Lötarbeiten.
60
Die Hi-Fi-Normen DIN 45 500 suchten nicht nur eine
untere Qualitätsgrenze für ein Werbeprädikat festzu-
legen, sondern auch den unbegrenzten Abstieg unter
die Hörbarkeitsgrenze zu bremsen. Meßfanatikern ge-
nügen aber die sorgsam und nüchtern konzipierten
Forderungen schon lange nicht mehr. Weil sie mit
den Mitteln der modernen Halbleiterschaltungstech-
nik verhältnismäßig leicht zu erfüllen und in mancher
Hinsicht auch um Zehnerpotenzen noch zu überbieten
sind, wird die Verschärfung der Normen zugunsten
einer neuen Exklusivität gefordert, die nur noch am
Zertifikat und am Preis ablesbar, statt mit dem Ohr
zu hören ist.
Aus der „Funkschau", Heft 20/1972
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.16 Hi-Fi-Quadrofonie — ein Stiefkind?
In den Siebzigern konzentrierte sich das Interesse der Bürger bevorzugt auf das Farbfernsehen. Radio hörte man so nebenbei, aber der Abend gehörte der „Flimmerkiste". Deshalb beschränkten sich Neu-entwicklungen im Bereich Hörfunkgeräte speziell auf Hi-Fi-Anlagen — in vielfältigen Ausführungen.
„High-Fidelity — am Ende einer Illusion?"
— überschrieb Ernst Pfau seinen, 1972 im 2. Oktober-Heft der „Funkschau" erschienenen Aufsatz. Daraus der folgende Abschnitt: „Am Ende einer langen ebenso mühevollen
wie für den Verbraucher teuren Entwicklung
fällt es nicht schwer, wiederum den Triumph
einer Illusion zu entdecken. Auf den Parties
der Arrivierten gibt es Leute, die glauben,
etwa einen Unterschied zwischen 0,1 und
0,01 Prozent klirrender Verzerrungen mit
den Ohren feststellen zu können — selbst
wenn sich auf dem Plattenteller ein Muse-
umsstück dreht".
Hen Pfau schien die Hi-Fi-Enthusiasten zu verkennen. Das Ende des obigen Abschnitts aus seinem interessanten Fachaufsatz belegt doch, dass nicht erst die „Röhrenverstärker-Freaks" keine Kosten scheuten, wenn sie das „Perfekte" suchten...
In Long Island
setzt man auf die Quadrofonie
Long Island City, jenseits des East River, im Westen von der imponierenden Skyline
Manhattans gesäumt, liegt im geschäftigen New Yorker Stadtteil Queens. Hier hat Fisher
Radio seinen Verwaltungssitz, die Laboratorien und zugleich die regionale Auslieferung
für einige Ostgebiete der USA.
Die Amerikaner schworen auf „Quadro". Dear interessierte man sich natürlich auch in Deutsch-land, erkannte aber Hürden, die zu beseitigen nicht so einfach waren. Bei der Wie-dergabe über Tonbänder in Vierspurtechnik gab es na-türlich keinerlei Schwierig-keiten, die aber waren nicht bespielt.
Überschrift und Einleitung zum zweiseitigen bebilderten Aufsatz von Karl Tetzner in der „Funk-Technik", Heft 24/1970.
Ohne die Möglichkeit der Schallplattenwiedergabe hätte man das System doch vergessen können...
Drei Weltfirmen für die CD-4-Quadrofonie-
Platte: Drei bedeutende Weltfirmen — RCA
Corp., Matsushita Electric und die Victor Com-
pany of Japan (JVC Nivico) — haben in einer
gemeinsam in New York und Tokio heraus-
gegebenen Erklärung bekräftigt, daß sie die
von JVC Nivico vorgestellte Vierkanal-Schall-
platte nach dem CD-4-System (vgl. Heft 22./
1970, S. 790) für Quadrofonie-Aufnahmen als
„ideal in jeder Hinsicht" ansehen. Die RCA
Corp. hat sich mit diesem Verfahren unab-
hängig vom Erfinder befaßt und wesentliche
Entwicklungsarbeit geliefert.
Aus der „Funkschau", Heft 23/1971
Quadrophonie-Schallplatten, wie diese von EMI-Electrola sind hierzulande so selten wie die „echten" Quadrofonie-Verstärker.
In den Fünfzigern war es schon schwierig genug, in den Plattenrillen Stereo-Informationen nach den HiFi-Maßstäben zu separieren — wie viel problematischer musste das bei Quadro sein. Gelöst wurde diese Aufgabe unter Zuhilfenahme einer Trägerfrequenz von 30 kHz. „Ideal in jeder Hinsicht" sei das Ergebnis, aber nicht alle waren einer Meinung. Ein weiteres Risiko: Langzeit-Erfahrungen lagen eben noch nicht vor — und noch zu wenige Erkenntnisse über die Rentabilität bei entsprechenden Plattenproduktionen. Zum Quadro-Rundfunk existierten auch nur Theorien.
61
Blockschaltbild der Wieder- gabe-Anlage aus der „Funkschau", Heft 22/1970.
Elektronik macht so heiter
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Viel wurde über diese Quadro-Technik diskutiert. Tetzners Aufsatz folgte
in den Heften 12 und 13/1971 die 6-seitige Abhandlung von Wilfried
Hardt, und auch die „Funk-Technik" behandelte das Thema in ihren Heften 16 und 17/1971. Die Verfechter des von Fisher propagierten Systems saßen
vor allem in Amerika, und in Ja-
pan, wo lt. „Funkschau", Heft
6/1973 schon über 1,1 Mio. Vier-
kanal-Schallplatten verkauft wer-
den konnten.
Hierzulande versuchte man es mit der „Pseudo-Quadrofonie", wie
sie bereits im vorhergehenden Abschnitt 15 gestreift, und in ei-nem Aufsatz von Winfried Knob-
loch in der „Funkschau", Heft 18/1971 beschrieben wurde.
Aus dem Aufsatz: „Quadrofonie-Platten kritisch abgehört", veröffentlicht im „Funkschau"-Heft 20/1973
Damit waren die Quadro-Diskussionen lange noch nicht ab-geschlossen. Allein in der „Funkschau" erschienen in den
Jahren 1972 und 1973 zehn Abhandlungen zu diesem Thema.
Heft 3/1972: „4-D-Stereo-Raumklang — ein verfeinertes 4-Kanal-Matrixverfahren für Pseudo-Quadrofonie".
Heft 11/1972: „Quadrofonie zurückhaltend beurteilt".
Heft 13/1972: „Die sogenannten ,diskreten Systeme' für Quadrofonie haben in der deutschen Ela-Industrie wegen der fehlenden Kompatibilität wenig Sympathien".
Heft 7/1973: „Vorschlag für ein diskretes Vierkanal-Rundfunk-System".
Heft 14/1973: Eine Studie des Batelle-Instituts über alle technische und wirtschaftliche Aspekte der Quadrofonie.
Heft 17/1973: „Quadrofonie: Wohin führt der Weg ?".
Heft 18/1973: „Quadrofonie — Experiment oder technischer Fortschritt? "(ein vierseitiger Aufsatz von Dr. Moortgat-Pick, der alle Facetten des Verfahrens ausleuchtet).
Heft 21/1973: Amerikanische „diskrete CD-4-Quadro-Schallplatten".
Heft 21/1973: „Hatten Sie heute schon Ihr Quadro ? — Vierkanal-Konfusion auf der internationalen Funkausstellung Berlin".
Heft 24/1973: E. Pfau mokierte sich unter dem Titel „Quadro-Muffel" darüber, dass die Rundfunkanstalten Quadrofonie-Sendungen schlicht ablehnten.
1974 ging's weiter — mit Quadro und mit Kunstköpfen, welche lt. „Funkschau" Heft 7/1974 um die
4.000 DM kosteten; für den Amateur somit nicht erschwinglich waren. „Kunstkopf contra Quadro?"
— fragte die „Funkschau" im Heft 12/1974 — das Heft 18 berichtete über Entwicklungen in Amerika —
dieses Thema wurde zum Dauerbrenner. Zahlreiche Firmen fertigten um
die Mitte der Siebziger teure Geräte zum Abspielen der Quadrofonie-
Platten, welche in den USA einen Umsatzanteil von 5 % erringen konn-
ten. Erst Jahre später verliefen die Quadro-Diskussionen im Sande.
In Amerika nennen die Quadrofonie-Skeptiker die diversen Matrix-
Quadrofonie-Systeme „Baby Quad" und Vorführungen solcher Ge-
räte auch „Schizophonie".
Ein Menschenkenner hingegen sagte: Hierzu- lande „Wo Quad-Wirkung noch nicht vorhanden ist, wird die Werbung
schlief Quad-Bedürfnis und schließlich Quad-Bewußtsein wecken!"
das „Quad- Bewußtsein" —wollte sich nicht wecken lassen... (Fundstelle: „Funkschau", Heft 3/1972)
62
Als erste Schallplattenfirma brachte CBS Anfang 1972 Vierkanal-Sdiallplatten (SQ-System) heraus. Das Quadro-Reper-
toire dieser Firma ist inzwischen auf 41
LP angewachsen, die Platten, die aus Amerika importiert werden und zum
Preis von 28,— DM über CBS zu be-ziehen sind, sind Parallelveröffent-
lichungen zu den größtenteils in Deutsch-
land schon bekannten Stereo-Versionen. Einige Monate später kamen aus Japan die ersten CD-4-Platten von JVC Nivico. Das JVC-Repertoire — mit hierzulande
sonst nicht bekannten Einspielungen
vorwiegend japanischer Herkunft — um-
faßt mittlerweile 18 Platten, die Einzel-platte soll im Handel 17,50 DM kosten.
Rechts: Entwurf für das Quadrofonie-Zeichen
Integrierte Schaltung für UKW-Empfänger
Eine der interessantesten und die für die Zukunft der Rundfunkempfänger möglicher-weise bedeutendste Entwicklung stellte Standard Elektrik Lorenz (SEL) in Hanno-ver der Fachpresse vor: ein Hf- und Zf-Teil für UKW-Empfang, weitgehend in integrier-ter Schaltung aufgebaut.
Aus einem Bericht im „Funkschau", Heft 10/1966
Und es vergingen weitere Jahre, bis der IC nach und nach Wurzeln schlug. 1970 konnte man im Philips-Rundfunk-empfänger-Programm unter 26 Geräten nur ein Modell finden, in dem ein derartiger Schaltkreis eingebaut war: das Taschengerät Fanette IC 100.
Bei den sonstigen Fabrikaten des Modell-jahrs 1970/71 blieb der IC bzw. die IS (die „Integrierte Schaltung") ebenfalls noch die Ausnahme.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.17 Integrierte Schaltungen. Drohende Gefahren — nicht nur aus Japan
In den Sechzigern begegnete man nicht nur in den Vorstandsetagen deutscher Rundfunkwerke langen Gesichtern (siehe Kapitel 8.11), auch im Silicon Valley herrschte Krisenstimmung. Zu viele Firmen hatten sich vorgenommen, am Transistor zu verdienen, doch der Absatz ließ sich nicht unbegrenzt steigern, zumal die Japaner einen beachtlichen Marktanteil erobert hatten. Das altbekannte Spiel ver-schonte auch das Silicon Valley nicht: die durch rationelle Fertigungsmethoden erzeugten Überpro-duktionen drückten die Preise in den Keller. Der einfache Transistor — der die aufwändige Röhren-Triode ersetzen konnte — war zum billigen Massenartikel verkommen. Nicht besser erging es danach dem MOS-FET mit Tetrodenfunktion. Schon 1960 war man in Kreisen der japanischen Transistorproduzenten der Ansicht, „ daß die Konjunktur der Transistorindustrie ih-
ren Höhepunkt überschritten habe. Für dieses Jahr wird eine Gesamtproduktion von 150 Mio. Tran-
sistoren erwartet. Die in- und ausländische Nachfrage werde aber nur etwa 95 Mio. betragen. Au-
ßerdem hätten die Lagerbestände 14 Mio. Transistoren erreicht". (Quelle: „rfe" Heft 17/1960).
Neues musste ersonnen werden. Den Erfindern sollte es nicht vergönnt sein, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Und es wurde Neues geschaffen. Anstelle einer Transistorfunktion gelang es 1959 den Amerikanern Kilby und Noyce schließlich, deren mehrere — einschließlich passiver Bauteile — in ein gemeinsames Siliziumplättchen einzubetten. Das war der Beginn der integrierten Schalttechnik, die zunächst (speziell in der Raumfahrt) der digitalen Rechentechnik diente. Viele Jahre später kam die neue Technik auch ins Radio. SEL überraschte die Fachwelt 1966 auf der Hannover Messe mit ei-
nem Prototyp, welcher in der Fachpresse ausführlich be-schrieben wurde. Indes — nicht die SEL sondern Philips war schließlich die erste europäische Firma, welche 1967 das mit zwei integ-rierten Schaltkreisen bestückte Taschenradio IC 2000
(Durchmesser — 70 mm) hierzulande offerieren konnte.
1967 galt der Philips IC 2000 als Wunderwerk der Technik, und das Innenleben dieses kleinen Empfängers mit dem Durchmes-ser von rund sieben Zentimeter wird auch heute noch bestaunt.
63
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
„Integrierten" arbeiteten. Der Grundig RTV 1040 HiFi
(1974/75) gehörte dazu. Seine Bestückung: 185 Transisto-
ren und 97 Halbleiterdioden.
Modelle mit integrierten Schaltkreisen kamen mit weniger
Transistoren aus, aber die Bestückung des Elac HiFi-
Quadrophonie-Receivers 5000 T (er stammte, wie auch alle
anderen Elac-Geräte, aus dem Hause Körting) war auch
nicht gerade kleinlich: 155 Transistoren, 8 IS und 146
Halbleiter.
Die integrierte Schaltung TBA 570, eingebaut im Telefunken-Partner spezial 101 von 1973, ersetzt u.a. drei herkömmliche Röhren mit mehreren Verstärkerfunktionen (ECH 81, EF 89 und EABC 80). Er übernimmt die Aufgabe einer Oszillatorschaltung, einer Mischstufe, eines AM/FM-ZF-Verstärkers und einer AM-Demodulatorstufe. Der Baustein besteht aus 25 Transistoren, 5 Dioden, 31 Widerständen und 1 Keramik-Kondensator.
Um die Mitte der Siebziger gab es dann nur
noch wenige Geräte, welche durchweg ohne die
IC oder IS?
Leser Smans aus der Republik du Zaire ist mit uns unzufrieden, weil wir der Sprache Goethes zu viele englische Brok-ken beimischen (Heft 1/1972, S. 4) ... Le-ser L. Mandel aus Wuppertal kann nicht verstehen, daß wir anstelle von IC, wie die internationale gebräuchliche Abkürzung lautet, stets IS wählen. IC steht für integrated circuit, einwandfrei für einen englischen Begriff, hingegen ist IS das Kürzel für integrierte Schaltung. der deutschen Version also. Warum sollen wir nicht IS wählen? In der Regel versu-chen wir das unseren Lesern klar zu ma-chen. indem wir immer dann, wenn in einem Beitrag IS zum ersten Mal benutzt wird, dahinter in Klammern integrierte Schaltung vermerken. Oder wir sollten es tun. Gelegentlich wird es vergessen. Übrigens ist die deutsche Übersetzung "integrierte Schaltung" (nicht Schaltkreis!) in DIN 41857 — Mikroelektronik, Begriffe — festgelegt.
Das transistorisierte Stereo-Decoder-Einbauteil im SABA Freudenstadt 18 Baujahr 1966 misst circa 73 x 90 mm.
Zum Vergleich die oben abgebildete integrierte Schaltung
— die Größenverhältnisse stimmen natürlich nicht:
Im August 1971 veröffentlichte die „Funk-Technik" im Heft 15 einen Aufsatz über „Integrierte Schaltungen für Stereo-Deco-der mit der oben abgebildeten vergrößerten Aufsicht.
1,3 mm x 1,3 mm groß (klein) ist jetzt, nur fünf Jahre später, der Silizium-Chip mit der integrierten Schaltung ULN 2121 A.
64
1:23it_ Fe TLJDUJ cmcm
Das hochwertige Komp gerat nach DIN 45 500 mit HIFI- Stereo-Receiver und HiFi tenwechsler Zweimal 25 Watt Sinugerstung, 7 Sensoren, 4 Wellenbereiche und Quadrosound
Körting war (wegen der Inlands-Vertriebsbindung mit Neckermann) bis 1972 nicht in den Großhandelskatalo-gen, und versuchte, über den Namen der in Körting-Besitz befindlichen Fa. Görler, Brühl bei Mannheim, wie-der mit dem Handel ins Geschäft zu kommen. Das Studio 2002 wurde mit Transistoren und integrierten Schaltungen ausgestattet (Aus "Funkschau", Heft 20/72)
V Die japanische Konkurrenz auf dem amerikanischen Rund-funkempfängerrna rkt, insbeson-dere auf dem Gebiet der Transi-stor-Kleinsuper, hat einerseits dazu geführt, daß große ameri-kanische Firmen wie Motorola, Emerson, Columbia, General Electric — entweder fertige japa-nische Transistorgeräte verkau-fen oder japanische Transistoren und andere Bauelemente in ihre Empfänger einbauen. Anderer-seits versuchen andere Firmen — wie z. B. Admiral —, ihren Ab-satz durch patriotische Werbeslo-gans („in den USA mit amerika-nischen Bauteilen hergestellt") zu erhöhen. An dem gesamten Um-satz von Transistorgeräten in den USA hatte 1958 Japan einen Anteil von 309/0.
V Um eine mengenmäßige Aus-fuhrbeschränkung von Transi-storgeräten hat der Japan Machi-nery Exporters Association beim japanischen Wirtschaftsministe-rium nachgesucht, um die Be-schwerden der amerikanischen elektronischen Industrie zu ent-kräften, die beim US-Office of Civil Defense Mobilization Maß-nahmen gegen die überfiutung des amerikanischen Marktes mit Japanischen Transistorgeräten ge-fordert hat.
Nicht nur deutsche Firmen hatten unter der Konkurrenz aus Asien zu leiden, insbesondere amerikanische Unterneh-men kamen in Bedrängnis. Notizen aus: „radio und fernsehen" vom November 1959 (links) und vom Mai 1960 (oben).
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Der Loewe Quadrophonie-Receiver QR 320 (auch
1974/75) hatte „nur" 143 Transistoren und 92
Halbleiterdioden, weil er schon mit 14 IS ausges-
tattet war. Nicht verbürgen möchte sich der Autor dafür, ob diese Modelle hinsichtlich ihres Bestü-
ckungsaufwandes schon Grenzfälle darstellten.
In der zweiten Hälfte der Siebziger fanden es die
Katalogmacher langsam albern, die Bestückung
weiterhin aufzuführen. Das hatte ja auch wenig
Sinn, nachdem es unklar blieb, wie viele und wel-
che Funktionen in den einzelnen Schaltkreisen
enthalten waren. Letzten Endes war es wichtiger,
was das Gerät konnte, welche Eingangsempfind-lichkeit es hatte und welche andere technische Eigenschaften und Besonderheiten es aufwies. Den Radioentwicklern wurde mit dem Einbau der „Integrierten" manche Arbeit abgenommen. An-
fangs hatten sie das vielleicht begrüßt, später war-den sie nachdenklich. Die Spezialisten im Silicon Valley integrierten nämlich derart viel in den
Chip, dass die Receiver auch von Leuten zusam-
mengebaut werden konnten, die weder das Wis-sen, noch die Labor-Erfahrungen hatten, wie sie
in deutschen Radiowerken vorausgesetzt werden durften.
Asiaten interessierten sich zunehmend für die Entwicklungen im „Tal des Siliziums", weil sie die
wirtschaftliche Bedeutung der Halbleitertechnik rechtzeitig erkannt hatten. Zuerst durften sie für die
Amerikaner untergeordnete Arbeiten erledigen. Silizium-Halbfabrikate wurden zur Weiterbehand-lung in die Billiglohn-Länder Korea, Taiwan etc. versandt. Dort zerlegte man die Siliziumscheibe in Chips, welche dann einbaufertig montiert und abschließend geprüft wurden. Nach dieser arbeitsinten-
siven Herstellungsphase traten die Fertigteile wieder den Heimweg nach Amerika an.
Schon Mitte der Fünfziger aber hatte man in den Län-
dern der aufgehenden Son-
ne den Braten gerochen
und auch schon genügend
Fachkräfte herangebildet,
um an eigene Produktionen
denken zu können.
Was die Japaner nicht schon wussten, besorgten
sie sich zum Teil über ille-
gale Wege. Einerseits ver-standen sie sich auf das
Kopieren amerikanischer
Produkte, andererseits per-
fektionierten sie die Ver-fahrenstechniken und arbeiteten mit bewundernswerter Genauigkeit und Zuverlässigkeit. So konnten
sie die Amerikaner bezüglich der dort noch beträchtlichen Ausschussquoten schnell in den Schatten
stellen. Die asiatischen Produkte wurden demzufolge sogar für modernste amerikanische Waffensys-teme bevorzugt. Das tat weh, wo doch im Grunde Nippons Unternehmen — mit Förderung durch ihr „MITI" — das Ministerium für internationalen Handel und Industrie — die Früchte der Entwickler aus New Jersey (Bell) und California (Silicon Valley) ernteten. Und exakt damit wurden sie auf dem Weltmarkt die Nr. 1!
65
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
„Kristallene Krisen" lautet der Titel des Fachbuchs von Prof. Hans Queisser, in dem die Geschichte
der Mikroelektronik vorzüglich dargestellt ist. In diesem Werk ist auch nachzulesen, wie es den Japa-
nern schließlich gelang, ihre wirtschaftliche Vormacht-
stellung zu erringen bzw. zu fundamentieren. Die Amerikaner beklagten sich bitter — dort befand sich
schon 1970 die gesamte Elektronik-Industrie in einer Krise — in ihrem Heft 21/1970 berichtete die „Funk-
schau" von drastischen Umsatzrückgängen und massi-
vem Arbeitskräfte-Abbau. Notiz aus der „Funkschau",
Heft 9/1971
In Deutschland wurde die ‚japanische Gefahr" noch nicht ernst genommen. Was machte es schon
aus, wenn auch hierzulande der Markt mit diesen billigen importierten Taschengerätchen über-
schwemmt wurde...
„1969 war ein gutes Jahr" — schrieb die „Funkschau" in ihrem Heft 1/1970, und die Bundesregierung
glaubte sogar, konjunkturdämpfende Maßnahmen ergreifen zu müssen. Telefunken indes warnte vor der Sperrung von Haushaltmitteln far die Forschung (Quelle: „Funkschau", Heft 7/1970). Die deut-
sche Funkindustrie nämlich hinkte den neuesten japanischen Entwicklungen hinterher — dem sollte
abgeholfen werden. Im Verlauf vertraulich geführter Verhandlungen zwischen Telefunken und Hitachi konnten die Un-
terhändler 1970 einen umfassenden „Patentaustausch- und Know-how-Vertrag" abschließen, von
dem die „Funkschau" (siehe Heft 11/1972) erst zwei Jahre später Kenntnis erhielt. Die Grundlage eines solchen Vertrags ist stets ein „Geben und Nehmen". Das ganze Interesse der
Japaner galt dem PAL-Verfahren — nur das konnte Telefunken in die Waagschale werfen. Dieses aus
der Hand zu geben, war jedoch mehr als riskant. Man einigte sich deshalb dahingehend, dass nur
Fernsehgeräte mit kleinen Bildschirmen (max. 18 Zoll) gefertigt werden durften, welche in Europa
anfangs noch wenig gefragt waren. Nach und nach jedoch brachen die Dämme; auch Matsushita er-
hielt Lizenzen — andere fanden Wege zur Umgehung der Telefunken-Patente. Und von einem Ge-
bietsschutz, das Bundesgebiet betreffend (analog zum Hitachi-Vertrag), war nicht mehr die Rede.
Nun waren der fernöstlichen Konkurrenz Tor und Tür geöffnet, nun waren es nicht mehr die billigen
Taschenradios, welche anfangs kaum beachtet wurden. Jetzt, wo in Japan integrierte Schaltungen
nachgebaut und weiterentwickelt wurden, ging man dort an die Massenproduktion all der Geräte, welche mit IC's ausgerüstet werden konnten.
Dies allein hätte jedoch nicht ausgereicht, um die deutschen Rundfunkwerke erneut in eine Krise zu stürzen. Es waren die Billiglöhne, die schließlich dazu führten. Und zu den Niedrigpreisen kam noch
der neue Technik-Look, welcher breite Käuferschichten zum Kauf der Japan-Erzeugnisse bewog.
Zwar waren die deutschen Fabrikate den japanischen in den Siebzigern entwicklungstechnisch noch
überlegen, aber ein Ge-
häuse, furniert mit Plas-
tikfolien (Holz- Imita-
ten), das passte nicht
mehr in die Zeit.
Ein aktuelles Outfit
zum richtigen Zeitpunkt
wurde versäumt. Die
Japaner gewannen an
Boden — kontinuierlich ging die Produktion
deutscher Heimradios zurück.
Statistik aus der „Funkschau", Heft 23 vom Dezember 1971. Im September 1970 wurden
150.465 Heimempfänger produziert, im September des folgenden Jahres nur noch 89.625.
66
Fakten Die Preise für einfache Taschenempfänger
aus ostasiatischer Produktion sind erstaunlich
niedrig. Beispielsweise kostet ein 5-Transistor-
MW-Super (5 Transistoren, 1 Diode, 2 2f-Stu-
fen) mit Tragetasche ab Hongkong nur 1,52 Dol-
lar (= 5.85 DM) bei Mindestabnahme von 500
Stück. 6-Transistor-Geräte mit drei Zf-Stufen
sind ab 1,75 Dollar erhältlich.
Produktionszahlen der bundesdeutschen Radio- und Fernsehgeräteindustrie
Januar We August 1971
September 1971
Januar bis
August 1970
September
1970
Heim- Stück 817 396 89 625 912 454 150 465
empfänger Wert (Mill. DM) 220,9 25,0 234,1 38,0
Reise-, Auto- u. Stück 2 782 849 296 584 3 225 012 419 825
Taschenempfänger Wert (Mill. DM) 451,4 46,9 466,1 61,3
Phonosuper u. Stück 159 249 14 921 224 657 19 935 Musiktruhen Wert (MM. DM) 71,5 9,2 96,1 9,4
Fernsehempfänger Stück 522 008 71 346 585 545 82 768 Farbe Wert (Mill DM) 785,7 107,4 811,1 122,6
Fernsehempfänger Stück 1 014 266 144 339 1 302 911 188 351 Schwarzweiß Wert (Mill. DM) 407,8 57,9 546,6 79,4
Wie sagte doch Michail
Gorbatschow: „Wer zu
spät kommt..."
Thomson-Brandt
verlagert Elektronik
zu Thomson-CSF
Notizen und Inserat-Teil
(rechts) aus dem „Funk-
schau"-Heft 8, April 1970
THOMSON Ihr Partner für die Zukunft!
THOMSON, ein Weltunternehmen, zählt zu den
führenden und größten Konzernen Europas. Quali-
fizierte Wissenschaftler und eine Belegschafts-
stärke von mehr als 130 000 Mitarbeitern mag die
Größenordnung und die Möglichkeiten des Unter-
nehmens erkennen lassen.
THOMSON, durch die Firma TELCO Elektro GmbH,
Koblenz, In Deutschland vertreten, übernimmt den
Vertrieb von Rundfunk-, Phono-Fernsehgeräten
sowie elektrischen Haushaltsgeräten für die ge-
samte Bundesrepublik Deutschland einschließlich
West-Berlin.
Ein spezielles, in Technik und Form dem deut-
schen Markt angepaßtes Programm, wurde nach
sorgfältiger Vorbereitung entwickelt. Eine vom
ersten Tage an klare Vertriebskonzeption und
günstiger Preis garantiert Ihnen — heute und in
der Zukunft — ausreichende Gewinnspanne und
sichert Ihnen den gewünschten Erfolg.
Technische Kurzinformation:
61 cm Panorama-Bildröhre, 14 Transistoren, 2 inte-
grierte Schaltungen, 6 Röhren, 19 Dioden, elek-
tronische Programmwahl, Frontlautsprecher.
Erfragen Sie Ihren zuständigen THOMSON-Werks-
großhändler
THOMSON TELCO Elektro GmbH, 54 Koblenz
Franz-Wels-Straße 10, Postf. 2205, Tel. 0261/42086
1970 war Thomson noch kein bedeutender Konkurrent
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Auch andere Branchen, wie die optische Industrie (Foto), Büromaschinen- und Motorradindustrie
konnten mit den lohnadäquaten Preisen der Fernosterzeugnisse nicht mithalten und selbst die Auto-
mobilwerke bekamen es mit der Angst zu tun.
Noch aber machte man gute Geschäfte mit den
Farbfernsehgeräten, welche 1967/68 erst zaghaft
verkauft warden. 1969/70 lagen sie voll im
Trend, und die „Funkschau" berichtete in ihrem
Heft 22/1970 noch von „glänzender Umsatzent-
wicklung". Vorerst fielen ja nur die Preise für
Halbleiter in den Keller, und vereinzelte Kurzar-
beit in verschiedenen Betrieben vermochte dort
die Stimmung am Jahresende etwas trüben.
Aus der „Funkschau", Heft 14/1970
Indes — man hätte schon voraussehen können,
dass Europa über kurz oder lang ein ähnliches
Schicksal ereilen würde wie es die Amerikaner
beklagten.
Bildröhrenfertigung
um die Hälfte gedrosselt
Preisverfall bei
Halbleitern
Japaner werden
kritisiert
Die Flaute am
amerikanischen Elektronik-Markt
Und kaum beachtet wurde ein weißes Wölkchen
am Horizont, das sich in der zweiten Hälfte der
Siebziger zu einer tiefschwarzen Wolke entwi-ckeln sollte: die ersten Ankündigungen der fran-
zösischen Firma Thomson-Brandt, welche auf
dem deutschen Markt Fuß fassen wollte.
Die großen Fusionen in der französischen
Elektronikindustrie sind mit ideeller und
materieller Förderung durch den Staat
weit fortgeschritten.
Die großen Elektronik-Fusionen in Frankreich
1971 begann der Abstieg. Schon im Januar stürz-
ten die Preise für Farbfernsehgeräte um ein Vier-
tel ab, im Februar wurde von den Markenfirmen
Kurzarbeit angemeldet (siehe: „Funkschau", Heft
4/1971). Die Umsätze brachten kaum noch Ge-
winne — Max Grundig „ wäre froh gewesen, wenn
er 1970 den halben Jahresbetrag von 1969 hätte
erwirtschaften können". Telefunken sanierte sich
schon über den Verkauf von PAL-Lizenzen nach
Japan (s.: „Funkschau", Heft 7/1971)
67
Um knapp 13 90 erhöhte sich der Jahresum-
satz 1969 im Fernseh- und Rundfunk-Techni-
ker-Handwerk und erreichte damit die Stei-
gerungsrate des Rundfunk- und Femseh-Ein-
zelhandels. Dagegen setzte der Großhandel
unserer Branche im Vorjahr etwa 220/0 mehr
um, während die Produktion um 23,3 Vo stieg.
Das Zurückbleiben des Fachhandels und
Handwerks wird auf das Vordringen der
Groß-Detaillisten, vornehmlich der Waren-
und Versandhäuser sowie der Supermärkte,
zurückgeführt.
Neue billige SW-Fernsehgeräte von Grundig
Am 19. Mal gab die Grundig AG bekannt, daß sogleich nach Pfingsten die Auslieferung einer neuen Serie von Schwarzweiß-Fernsehgeräten beginnt, deren Preis vom Hersteller selbst als „Sensation" bezeichnet werden.
Die ersten Reaktionen der Mitbewerber lessen erwarten, daß die meisten Firmen dem Vor-
gehen von Grundig gezwungenermaßen fol-gen werden, und zwar rascher als im Februar, als die übrige Industrie In die neuen Grundig-
Preise für Farbempfänger erst mit wochen-langer Verzögerung eintraten. Daß diese
Preissenkung der Schwarzweißmodelle eine fühlbare Einengung der Rendite bedeutet, ist einleuchtend.
„Aus der Wirtschaft" überschrieb die „Funkschau" diesen Bericht im Heft 11/1972. Die Renditen wurden immer kleiner, dennoch stiegen die Lohnkosten — scheinbar unaufhaltsam...
Um 12,7/a lagen die Lohnkosten in der deut-schen Elektroindustrie im 3. Quartal 1971 über dem entsprechenden Vorjahresstand: da-gegen stieg der Preisindex für elektrotech-nische Erzeugnisse lediglich um 4,2%. Im Ex-portgeschäft konnten die Preise sogar nur um 1,8% angehoben werden. Der stagnierenden bzw. rückläufigen Produktion dieses Industrie-zweiges im 4. Quartal stehen weiter steigende Lohn- und Gehaltssummen gegenüber.
Die Industriebetriebe standen unter einem enormen Preisdruck. Im Inland konnten die Abgabepreise nur geringfügig angehoben werden, im Export fast gar nicht. Die Gewerkschaften aber kümmerte das nicht; ihre Lohnforderungen waren absolut kontraproduktiv.
Fakten
AEG-Telefunken, Inhaber der Pal-Patente, hat Lizenzen für die Fertigung von Farbfern-sehgeräten nach dem Pal-System bisher nur
an Fabriken in den Ländern gegeben, die das Pal-System eingeführt haben. Infolgedessen sind am europäischen Markt auch noch keine japanischen Farbgeräte aufgetaucht.
„1970 ging es uns ja noch gut" könnten die AEG-Telefunkenleute gesagt haben, als sie entgegen dieser Meldung (aus der „Funkschau", Heft 19/1970) nun doch Lizenzen nach Japan verkauften...
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Vorerst bereiteten vor allem Schwarzweiß-Typen Kummer. Die importierten Billig-Fernsehgeräte
waren an den teils ruinösen Verhältnissen in deutschen Rundfunkwerken nicht unschuldig. Die Fabri-
kation von Taschenempfängern konnte man auch
abschreiben. Wenn solche Modelle noch mit deut-
schen Markennamen in die Kataloge kamen, handel-
te es sich um Fernost-Fabrikate.
Durch Geschäftsberichte, Presseinformationen und auch durch persönliche Gespräche mit Repräsentan-ten unserer Industrie zieht sich wie ein roter Faden die Aussage: Die Importe nehmen beängstigend zu. Daraus folgert für die heimischen Hersteller von Ge-räten der Unterhaltungselektronik die ungenügende Ausnutzung ihrer Fertigungskapazitäten, was zur An-passung zwingt. Personelle Konsequenzen tun sich auf; die Belegschaft wird durch Nichtersatz der natür-
lichen Personalabgänge oder sogar durch Entlassun-gen reduziert.
Sind die Alarmrufe berechtigt? Wo liegen die Ur-sachen, wer ist verantwortlich — und ist Abhilfe mög-lich?
Nach Mitteilung der Telefunken Fernseh- und Rund-funk GmbH flossen 1971 für etwa 1 Milliarde DM') Ge-räte der Unterhaltungselektronik aus dem Ausland in die Bundesrepublik ein, das sind 28% des Markt-volumens. Nur der geringe Anteil teurer Farbfernseh-empfänger am Import hat verhindert, daß der Prozent-Satz noch wesentlich höher liegt.
Spontan meint man, daß als Lieferländer »eigentlich" nur Japan und andere fernöstliche Staaten in Frage kommen können. Das stimmt aber nicht; nur 40% wer-den von dort hereingenommen, der weitaus größere Rest stammt aus West- und Osteuropa.
Es sind zwei Arten von Einfuhren zu unterscheiden. Die eine nennt sich Handelsimporte und umfaßt alle Lieferungen ausländischer Hersteller auf deren Rech-nung und auch die Käufe, die deutsche Importhäuser draußen tätigen. Die andere Art heißt Eigenimporte. Das sind Geräte, die von deutschen Herstellern aus-ländischen Firmen in Auftrag gegeben werden. Sie kommen im Inland unter der Marke des Auftrag-gebers auf den Markt.
Aus einem Bericht von K. Tetzner in der „Funkschau" H. 5/1972
Siemens, die AEG und BBC forderten Staatsbeihil-
fen, „weil es der deutschen Industrie nicht mehr
möglich sei, aus eigenen Mitteln in der ganzen Breite
und Tiefe der Bauelementetechnik tätig zu sein"
steht in der „Funkschau" im Heft 10/1971. In der selben Ausgabe schrieb Karl Tetzner in seinem Be-richt von einer Pressekonferenz auf der Hannover
Messe: „ Wer seine Freude an ungehemmter Konkur-
renz hat, konnte zufrieden sein; wer hingegen an die
Krise der bundesdeutschen Unterhaltungselektronik
denkt, blickte besorgt in die bunte Runde. Der zum Teil weit fortgeschrittenen Verdrängung der deut-
schen Geräte vom Weltmarkt folgt nun die Kampfansage im eigenen Haus".
Freude kam allenfalls noch in Händlerkreisen auf. 500 Expert-Händler aus sechs europäischen Län-
dern trafen sich im mondänen Kurort Davos. Am Umsatz asiatischer Erzeugnisse wurde oft schon
mehr verdient, als an den deutschen Fabrikaten. Sony steigerte — wie die „Funkschau" im Heft
12/1971 berichtete — im japanischen Fiskal-Jahr 1971 seinen Europa-Export um 64 %.
68
Preiskrieg Schon vor der Ankündigung des Necker-mann-NEC-Farbportables für 1148 DM hatten sich führende Fachgeschäfte im Bundesgebiet Gedanken über die korrek-ten Preise für solche kleinen Empfänger gemacht. Als nun Neckermann ab 22. Februar eine zunächst sehr begrenzte Stückzahl dieser japanischen Geräte ver-kaufte — die Lizenzverhandlungen sind, wie an anderer Stelle dieses Heftes be-richtet wird, inzwischen positiv verlaufen — traten die in der Aera zusammengeschlos-senen Fachhändler sowie die Interfunk-Gruppe mit Gegenaktionen auf den Plan. Einige Aera-Händler, darunter Radio-Rim, München, boten das Sony-Trinitron-Por-table für 1095 DM an, und die Interfunk-Händler offerierten das gleiche Modell für 1148...1198 DM. Sicherlich sind 1095 DM für das genannte Modell ein einmaliger Tiefstpreis ohne nennenswerte Rendite,
jedoch wollte der Facheinzelhandel nicht tatenlos zusehen, wie der Versandhandel zumindest optisch das Rennen macht. — Dem Vernehmen nach soll das 33-cm-Trinitron-Portable in Japan zu (umgerech-net) 800 DM verkauft werden, so daß der neue Preis im Bundesgebiet in etwa er-klärbar wird. Von Matsushita ist zu hören, daß bis An-fang März der Preiskrieg keinen Einfluß auf den Absatz der gut beurteilten Natio-nal-Farbportbles hatte. Die Lage wird je-doch sofort anders, wenn noch mehr japa-nische Marken mit derart billigen Geräten herauskommen sollten. Auf alle Fälle ist zunächst einmal dieser Markt preislich verdorben; man vermag sich nicht vorzustellen, daß die deutsche Industrie besondere Lust verspürt, sich diesem ruinösen Wettbewerb bei den Farbportables zu stellen.
69
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Hohe Bestände an (deutschen) Farbfernsehgeräten, Export-Probleme und wachsende Einfuhren be-
klagte Karl Tetzner auch in seinem Bericht vom Juli 1971, und in einem Aufsatz unter dem Titel
„Die nackte Not — oder: mit dem Rücken an der Wand" beschrieb er die prekäre Situation der deut-
schen Industriebetriebe im „Funkschau"-Heft Nr. 18/1971.
Löhne und die Kosten für zahlreiche Gebrauchs-güter stiegen an, nur die Preise für Geräte der Unterhaltungselektronik stagnierten im Minus-Be-reich. (Grafik aus der „Funkschau", Heft 17/1972)
Nur die Einkaufsgenossenschaften verbuch-ten noch steigende Umsätze — die Inter-
funk-GmbH erzielte 50,9 % Zuwachs.
Gewinn-Halbierung bei Philips, Preisverfall
und ähnliche Hiobsbotschaften konnte man
in den Dezember-Ausgaben der Zeitschrif-
ten lesen. Die Siebziger begannen viel
schlimmer, als die Sechziger endeten ...
/u I I
für theater, Sportveranstaitungen
I Kino
60 Keen und
50 ./..'
40
30
''''...1"-Varcher, Zei' tungen, 20
00 ... ......._
— ""''''' Rundfunk-, Phonogeräte
.............,_
Fernseh- ohne Zubehör
und 90 00-
............._.....,
NI
1962
63
65
66
67
68
69
70
1971
Saba gab sich noch optimistisch. Diese Firma (mit einer Mehrheitsbeteiligung der amerikanischen GT & E) erhöhte nochmals das Stammkapital und erzielte im ersten Halbjahr 1972 mit ihren Farb-
fernsehgeräten eine Umsatzsteigerung von 20 % — die Gewinne betreffend hielt man sich vornehm
zurück. Ansonsten klangen die Aussichten für die kommenden Jahre nicht eben ermutigend — im
„Funkschau"-Heft 3 von 1972 steht: Nach Meinung von AEG-Telefunken wird der Anteil der Einfuh-
ren im Jahre 1975 betragen: bei Kofferempfängern 65 %, bei Heim-Monoempfängern 100 % und bei
Stereogeräten 30 %. Bei Schwarzweiß-Fernsehgeräten sieht man im gleichen Jahr einen Importabteil
von 85 % voraus, bei Farbgeräten von nur 17 %..."
Telefunken lag mit seinen Prognosen nicht falsch — am Ende verblieb in den deutschen Rundfunk-werken (die Kfz-Sparte ausgenommen) im wesentlichen noch die Farbfernsehgerätefabrikation
(PAL), während sie andere Geräte der Unterhaltungselektronik (auch Radios) großenteils von auslän-
dischen Herstellern in Billiglohn-Ländern fertigen ließen. Doch schon wurde (im „Funkschau"-Heft 18/1972) über die ersten japanischen Farb-Portables be-
richtet — fabriziert bei Sony und National — und bei Hitachi — „mit vollgültiger PAL-Lizenz"!
Der Telefunken-Deal wurde nun durch Umsatzverluste „belohnt". Waren doch die PAL-
Fernsehgeräte zuvor Deutschlands Stärke. Mit ihnen konnte der europäische Umsatz gegenüber dem
Vorjahr um 75 % gesteigert werden, was sich in den Bilanzen der deutschen Werke niederschlug.
Nun rückte das Ende des „PAL-Glücks" näher.
Artikel aus der „Funkschau", Heft 7/1973. Bisher waren es „nur" Rund-funkgeräte, Koffer- und Ta-schenradios sowie Schwarz-weiß-Fernsehgeräte — jetzt wurde von den Japanern die letzte Bastion angegriffen: die Farbfernseh-Sparte. Auch wenn es vorläufig „nur" Portables waren — die ver-kauften Lizenzen begannen sich schon zu rächen. AEG-Telefunken konnte sich insofern trösten, als ihre PAL-Lizenzeinnahmen einen zwei-stelligen Millionenbetrag er-reicht hatten (s.:"Funkschau", Heft 15/1973).
Jedoch: "Auf alle Fälle ist zunächst einmal dieser Markt preislich verdorben" — steht im „Funkschau"-Bericht links...
Nordmende hat sich entschlossen, nach Asien zu gehen, weil nur unter den dor-
tigen Verhältnissen eine Produktion auf-
gezogen werden kann, die den Japanern
und anderen asiatischen Konkurrenten ge-
wachsen ist. Niedrigpreisgeräte können
schwerlich im Bundesgebiet konkurrenz-
fähig hergestellt werden, selbst nicht unter
Einsatz vieler Gastarbeiter. Nordmende
entspricht überdies mit dem Aufbau einer
Produktion in Asien den Forderungen der Bundesregierung, mehr im Ausland zu
investieren, um die Zahl der Gastarbeiter
hierzulande nicht weiter ansteigen zu les-sen,
Aus der „Funkschau", Heft 15/1973 (Abschnitt)
Procluktionspolltik
Die In Japan regierungsseltIg angeordneten Exportbeschränkungen werden von der ein-heimischen Industrie immer mehr durch Ver-lagerung der Fertigung ins Ausland umgan-gen. Der Präsident der Sharp Corp., Akira
Saeki, gab eine entsprechende freimütige Erklärung kürzlich in Osaka ab: Sein Unter-nehmen wird die Produktion weitgehend in bestehende oder noch zu errichtende Werke in Südkorea, auf den Philippinen, Taiwan und
Indonesien verlegen und die dort hergestell-ten Farb- und Schwarzweiß-Empfänger, Ste-reoanlagen und auch “Weiße Ware" nach den USA. Europa, dem Mittleren und Nahen Osten mit Ausnahme von Japan exportieren.
Aus der „Funkschau", Heft 11/1973
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
8.18 Die Aussichten waren nicht rosig - die Betriebsergebnisse mager
Die Fachzeitschriften befassten sich — wie das ihre Aufgabe war — auch 1973/74 mit technischen Problemstellungen. Im Audio-Bereich wurde noch viel über „Quadrofonie" und sogar über die „Kunstkopf-Stereofonie" disku-tiert. Das besondere Interesse jedoch galt Anfang 1973 den Sorgen, teils Existenzängsten, welche sich in Industriekreisen, auch im Groß—und Einzelhandel breit machten.
Die deutschen Rundfunkwerke mussten Auswege fin-den, und es blieb ihnen anscheinend nichts anderes üb-rig, als wenigstens Teile ihrer Produktion in Billiglohn-Länder zu verlagern. „Nordmende baut in Malaysia" — lautete die Über-schrift im „Funkschau-Express", Heft 15/1973, und nicht die Bremer allein versuchten, dergestalt ihre Er-tragslage zu verbessern. Nur ein Lichtblick erschien am Horizont: auch Japaner konnten nicht mehr so billig fabrizieren. Um 500 % (!) seien in den letzten zehn Jahren die Lohnkosten gestie-gen, beklagte Akio Morita in der „Funkschau" im Heft 15/1973 — auch diese Insel-Fabrikanten, welche die Preisspirale nach unten in Gang gesetzt hatten, mussten sich jetzt nach anderen Produktionsorten umsehen.
Japaner bekamen nun die Konkurrenz aus benach-barten asiatischen Staaten zu spüren — mussten schon außerhalb Japans produzieren. Den Deut-schen indes nützte es wenig — die Fernost-Länder konnten ihren Export innerhalb eines Jahres um rund 50 % steigern.
Aus der „Funkschau", Heft 15/1973
Wären die Gewinne 1973 so gut gewesen, wie die Umsätze, dann hätte die Branche eigentlich zufrieden sein können. Aber das war der Schwachpunkt. Preis-erhöhungen müsste man durchsetzen können — war allenthalben zu hören, aber der Branchenführer Max Grundig ließ schon auf der Berliner Funkausstellung verlauten, „daß das Haus in Fürth die Preise kon-
stant halten wird" (s.:„Funkschau", Heft 21/1973).
Wenigstens hatte man — dank steigender Umsätze — die Verlustzeiten hinter sich gelassen, gab die AEG-Telefunken bekannt, und die großen Lagerbestände seien auch abgebaut werden. Bei einigen Artikeln kam es sogar zu Lieferfristen. Weil aber im Oktober 1973 die Ölpreise davonliefen, schrieb die „Funkschau" im Heft 24/1973: „Ob dieser Schröpfung der Haushaltkasse beschleicht Handel und Industrie eine gewisse Beklom-
menheit hinsichtlich des Weihnachtsgeschäftes..."
Sicher hegte auch Max Grundig entsprechende Befürchtungen und entschloss sich zum Eintritt in das Vermietgeschäft von Fernsehgeräten.
70
Das Geld sitzt nicht mehr so locker
Die Werkstattkosten laufen davon
Das Sony-Farbgerätewerk in San Diego/USA baut z. Z. ebenso viele Geräte wie die Sony-
Fabrik in Tokio. liegt allerdings im Ausstoß noch weit hinter der Sony-Hauptfabrik in No-
goy/Japan. Wie Sony-Präsident Akio Morita kürzlich in New York mitteilte, sind die Her-stellungskosten pro Einheit in Japan „heute noch" niedriger als in den USA. Immerhin stiegen die reinen Lohnkosten in Japan in den letzten zehn Jahren um 500 °4 (I): die Zu-
nahme im Jahr 1973 wird auf 24 (I/0 geschätzt.
Es bliebe dem Unternehmen nichts anderes
übrig, als Fabriken in alien großen Absatz-märkten zu errichten.
Dr. Wilhelm Schlemm
Kunstkopf-Stereofonie — eine Alternative zur Quadrofonie?
Nordmende ruird in der 1. Hälfte 1975 für Teile der Farbfernsehgeräte-produktion Kurzarbeit einführen müssen. Lagerbestände liefen auf
und verlangten Preiszugeständnisse.
Als Gründe für den Arger ruerden
auch das zusammengebrochene Eng-landgeschäft und die Importrestrik-
tionen Italiens genannt. — Telefunken hat für den gesamten Dezember im Berliner Werk für 600_800 Mitarbei-ter (non 2000) Kurzarbeit eingeführt; betroffen ist die Phono- und Ton-bandgerätefertigung.
Aus: „Funkschau", Heft 25/1974
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Alles wird teurer Post. Benzin, 01, Kraft-
gen Löhne und Gehälter. Facheinzel- und
Vorjahr fast vervierfacht — die deutschen Radiowerke pro- fahrzeugreparaturen, vor allem aber stei-
Im Oktober 1973 hatten sich die Ölpreise gegenüber dem
duzierten in der zweiten Hälfte der Siebziger fast nur noch -großhandel sind gleichermaßen betrof- rote Zahlen. fen; überall wird versucht, zu sparen und die Unkosten zu drosseln. Das alles muß auf dem Hintergrund einer etwas labilen Geschäftssituation gesehen werden. Zwar darf man die diesjährigen August-Umsätze dieser Branche, setzt man sie im Vergleich zum Monet August 1972 (Olympiaboom), asrs atypisch ansehen, abet September (-7 °la) und Oktober brachten auch kaum mehr als „durchwachsene" Ergebnisse. Auf alle Fälle steigt die Zahl der Test-
Aus der „Funk- firmen, die die Zukunft nicht mehr durch schau", und durch rosig ansehen. Heft 25/1973
Manche sehnten sich in die Sechziger Jahre zurück, die zwar mit einer Krise begannen, dann aber doch noch recht gut endeten. 1974 las man im „Funkschau"-Heft 21/1974: „Nach einem Bericht des ZVEI hat sich
die Elektrokonjunktur im 2. Vierteljahr 1974 merklich
abgekühlt...".
Hohe Lagerbestände zwangen wieder zu Kurzarbeit — die Konjunkturaussichten wurden eher pessi-mistisch eingeschätzt; auch die Radio-Sparte betreffend. Auf serienreife technische Weiterentwicklungen wartete man vergeblich, die Quadrofonie steckte in einer ebensol-chen Krise wie die Kunstkopf-Stereofonie.
Eine noch kleine Gemeinde schwört auf die kopfbezogene Stereofonie als das einzige echte räumliche übertragungsverfahren, und fast alle Rundfunk-anstalten experimentieren mit dem Kunstkopf, wenn auch überwiegend für
Hörspielzwecke. Die Meinungen in der Offentlichkeit sind gegensätzlich. Des-
halb bringen wir hier eine sachliche Argumentation, die unserer Meinung nach sehr zur Klarstellung beiträgt: Es wird keine Konkurrenz zwischen Stereo, Quadro und Kunstkopf-Stereo geben, sondern aus Vernunftgründen ein rein sachbezogenes Nebeneinander.
Dr. Schlemm meinte noch in der „Funkschau", Heft 20/1974, es könnte ein „Nebeneinander" von Stereo, Quadro und Kunstkopf geben. In Chicago wurden 80 HiFi-Anlagen mit SQ-Decodern ausge-stellt — von 32 Firmen — darunter auch Grundig und Nordmende. Dabei stritten die Experten doch noch über drei SQ-Verfahren zur Kanaltrennung... (Quelle: „Funkschau", Heft 22/1974).
Vom Fiasko der Quadrofonie Systemwirrwarr tötet alle Aktivität
Hohe Lagerbestände auch bei Stereogeräten
Der Versuch der System-„Entwirrung"
Hierzulande hatte man die Quadro- und Kunstkopftechnologien bereits abgeschrieben — man kon-zentrierte sich auf hochwertige Stereoanlagen. Nur die Fachzeitschriften wollten das Thema noch nicht begraben. Im Januar 1975 erschien in der „Funkschau" noch ein vierseitiger Aufsatz von Dr. Moortgat-Pick, dem noch weitere Beiträge in den Heften 2, 3, 5, 7, 8, 18, 22 und 24 folgten. Dies in einer Zeit, wo in Deutschland noch nicht überall Stereo empfangen werden konnte. „Stereo auf dem Vormarsch" — verkündete die „Funkschau" im Heft 13/1975, und teilte mit, dass Bayern 3 ab dem 4. Mai Stereosendungen ausstrahlt — am 10. Mai hatte der Rias Berlin Stereo-Premiere. Die Funkindust-rie träumte von großen HiFi-Stereo-Umsätzen, und tatsächlich wurden auch teure Geräte gekauft.
71
Die Konjunkturlage der deutschen Industrie für elektronische Bauelemente war noch nie so ernst wie in diesem Jahr, erklärte M. Schinle, Direktor des Erzeugungsbereiches „passive Bauelemente" von der ITT Bau-elemente-Gruppe Europa in Nürnberg. Im ersten Halbjahr 1975 ging die Produktion
um 20 0/a gegenüber dem gleichen Vor-jahrszeitraum zurück. Die Hauptabnehmer, nämlich Hersteller von Geräten der Unter-haltungselektronik, hatten im 1. Halbjahr durchweg kurzgearbeitet, so daß auch vom 3. Quartal 1975 keine Belebung zu erwarten Ist. Das 4. Quartal schließlich kann selbst bei einigermaßen günstigem Verlauf keinen Ausgleich für das schlechte Dreivierteljahr bringen.
Notiz aus der „Funkschau", Heft 22/1975.
Große Sorgen hatten 1975 auch die Hersteller von Einzel-
teilen zum Bau von Rundfunk- und Fernsehgeräten. Es gab
schon Firmenpleiten. Zum Beispiel stellte die Firma Dau
Co., Nagold, Spezialist für hochwertige Drehkondensatoren
Konkursantrag, der mangels Masse abgelehnt wurde.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Für solche „Hightech"-Geräte gab es trotz hoher Preise noch einen Käuferkreis, insgesamt aber konn-
ten die Umsätze auf dem Rundfunkgebiet keinesfalls befriedigen. Aus einer internen Marktanalyse
Produktionszahlen der bundesdeutschen Radio- und Fernsehgeräteindustrie
Januar bis April 1975
Mal 1975 Januar bis April 1974
Mai 1974
Heim- Stück 451 802 107 563 502 376 141 1691) empfänger Wert (Mio. DM) 154,6 34,8 184,8 50,9
Reise-, Auto- u. Stück 877 815 245 830 1 263 029 346 6742) Taschenempfänger Wert (Mio. DM) 190,3 52,9 244,4 69,0
Kombinationsgeräte und Stück 125 871 41 355 140 747 36 0023 ) Musiktruhen Wert (Mio. DM) 76,1 25,9 77,9 21,1
Fernsehempfänger Stück 713 300 172 639 798 875 219 0134) Farbe Wert (Mio. DM) 996,6 238,6 1104,4 308,1
Fernsehempfänger Stück 470 835 90 342 673 732 165 2145) Schwarzwei 8 Wert (Mio. DM) 187,6 34,3 259,9 65,4
der Grundig-Werke
(siehe „Funkschau"
Heft 3/1975) geht her-
vor, dass im Vorjahr
Absatzrückgänge bei Rundfunkempfängern
um 18 % zu verzeich-
nen waren. „Die Prei-se für SW- und Farb-fernsehgeräte sind weiter im Rutschen" — stand im Heft 11/1975.
Links aus: „Funkschau",
Heft 17/1975
Unter dem Thema „Die lange Durststrecke" schrieb Karl Tetzner im „Funkschau"-Heft 13/1975:
„Der Branche geht es nicht gut. Das erkennt man insbesondere an den Umsatzvergleichen zwischen dem I. Quartal 1975 und den glänzenden ersten drei Monaten 1974" [usw.]. „Der jüngste Konjunk-turbericht des Zentralverbandes der elektrotechnischen Industrie (ZVEI) lautet „besorgniserregend",
und die Produktionszahlen bestätigen das. Nur in der Sparte „Kombinationsgeräte" — das waren vor-wiegend hochwertige Stereoanlagen — zeigte die Umsatzkurve nach oben.
Prof. Tetzner machte sich in seiner Kolumne im „Funkschau"-Heft 24/1975 auch Gedanken darüber,
ob die neu vorgestellten Fernsehgeräte wirklich mit so viel „Schnickschnack" ausgestattet sein muss-ten und schrieb: „:4.hnliche Überlegungen wie für die Farbempfänger gelten abgewandelt für unsere HiFi-Anlagen. Was sie an Einstell-Luxus und Watt-Protzerei bieten (beides wird vom Käufer daheim nur zu einem geringen Teil ausgenutzt), grenzt häufig genug fast an Unfug, nur erklärbar aus dem Konkurrenzdenken und mit dem Appell an den Snobismus". Allein die HiFi-Produzenten hatten 1976 aufs richtige Pferd gesetzt. „Hi-Fi 76 — Das war ein Bom-benerfolg" — lesen wir in der „Funkschau", Heft 22/1976, und da stand auch schon die Befürchtung
im Raum, dass aufgrund des großen Erfolges alle möglichen Produzenten auf dem „HiFi-Goldesel" reiten wollten — auch unqualifizierte. Und so
kam es, dass man HiFi-Firmen entdecken konn-
te, von denen man zuvor nie etwas gehört hatte.
,,Das ist die Branche der Lemminge" sagte ein neu In die Unterhaltungselektronik ge-kommener Cheftechniker einer Gerätefabrik. Er meinte damit, daß hier ein unstillbarer Nachahmungstrieb herrscht, der die zur Gat-tung der Wühlmäuse gehörenden Lemminge (lemmus lemmus) bewegt, sich gelegentlich zu Hunderttausend auf eine Wanderschaft zu begeben, die unweigerlich an einem Fjord-ufer endet und damit den Tod aller bedeu-tet, die sich der Reise angeschlossen haben. Wir wollen hoffen, daß es wirklich nur beim Nachahmungstrieb ohne den schrecklichen Ausgang bleibt. Was dem Zitierten auffiel, war eben die Tatsache, daß immer einer mit irgend einem nützlichen oder unnützem Gag den Vorreiter spielt und alle, alle folgen.
Aus der „Funkschau", Heft 22/1976
72
Die dynamische Chronik
Alle klagten 1975 über schmerzhafte Umsatzrück-gänge — sogar die Japaner. Die aber wollten sich damit nicht abfinden. Im 1. Halbjahr 1976 expor-tierten sie, was das Zeug hielt, in die USA, und er-höhten so ihre Exportlieferungen gegenüber dem Vergleichszeitraum 1975 um das dreifache. „Sie essen uns lebendig cull' — sagte der Zenith-Präsident John Nevin (siehe nebenstehenden Bericht aus der „Funkschau", Heft 18/1976). Und: 65.000 Arbeitsplätze werden in den USA bedroht — jetzt soll der amerikanische Präsident ein Machtwort sprechen — das stand im „Funkschau"-Heft 22/1976.
So schlimm ging es den deutschen Rundfunkwerken noch nicht. Bei Blaupunkt, Philips und Telefunken gab es Ende 1975 kaum noch Lagerbestände; Blau-punkt konnte sogar 500 Neueinstellungen vorneh-men — Telefunken 137. Diese Firmen äußerten aller-dings ihre Zweifel an der Stabilität der momentanen Aufwärtsbewegung („Funkschau", Heft 4/1976).
8. Kapitel
Die Reaktion der amerikanischen Gerä-tehersteller äußert sich in Betroffenheit und in dem Wunsch zurückzuschlagen. Zenith und Sylvania bezichtigen die Ja-paner unfairer Verkaufspraktiken, also des Preisdumpings, ausgeführt von ei-nem sorgfältig abgeschirmten inneria-panischen Markt, „Sie essen uns leben-dig auf," sagte Zenith-Präsident John Nevin, „und die Regierung tut nichts, um uns zu schützen". Tatsächlich ist das Handelsministerium seltsam inaktiv, und die International Trade Commis-sion, eine Regierungsbehörde, hat zu-nächst einmal ellenlange Fragebogen an die einheimische Industrie verschickt, um deren „Status" zu ergründen und daraus den Grad der Gefährdung abzule-sen.
Die Blaupunkt-Werke in Hildesheim berich-
ten, daß sie im vierten Quartal 1975 den
Farbgeräteumsatz um nicht weniger als 52 90
gegenüber der Vorjahrszeit steigern konn-
ten, was etwa doppelt so hoch war wie der
Branchendurchschnitt. Sich selbst gliedert
das Unternehmen „irgendwo zwischen der
vierten und sechsten Stelle" im Reigen der
Konkurrenten ein, nennt aber keine absolu-
ten Zahlen.
Das hervorragende vierte Quartet reichte
nicht aus, um den Vorjahresumsatz von 825,5
Mio. DM zu halten; 1975 dürften rd. 5 %
Rückgang zu verbuchen sein. Wären die gu-
ten Umsätze bei Autoradios nicht gewesen,
so hätte das Ergebnis noch schlechter aus-
gesehen. 1974 machten die Blaupunkt-Werke,
mehrheitlich zur Bosch-Gruppe gehörend,
noch magere 0,5 Mio. Gewinn; 1975 dürfte
ein gerade ausgeglichenes Ergebnis wahr-
scheinlich sein.
Aus der „Funkschau", Heft 6/1976
Aus der „Funkschau", Heft 9/1976
Schließlich lagen die Produktionszahlen von 1975 um 14 % unter denen von 1974. „Alle Sparten mit Aus-
nahme der kombinierten Geräte waren vom Rück-
gang betroffen" — stand im „Funkschau"-Heft 6/1976. Und noch etwas löste — wie K. Tetzner im Leitartikel der „Funkschau", Heft 7/1976 schrieb — im Handel und Handwerk tiefe Beunruhigung aus: der unauf-haltsame Strukturwandel infolge „Modulisierung". „Der Berufsstand der Rundfunk— und Fernsehtechni-
ker sah sich in Frage gestellt. Der Begriff „Fachhan-
del mit erstklassigem Kundendienst" könnte an An-
ziehungskraft verlieren, wenn ‚dank' der Modulisie-
rung jeder Halbtechniker das ehedem so komplizierte
Farbgerät, Umsatzträger Nr. 1, wieder zum Spielen
bringen kann".
Den neu entstandenen Selbstbedienungsmärkten kam diese Entwicklung gerade recht — ihre Marktchancen wurden dadurch erheblich verbessert.
Wenn eines Tages große Farbbildröhren zu konkurrenzlos
günstigen Preisen aus dem Fernen Osten nach Europa
kommen und wenn sich der Strom der billigen Bauelemente
aus der gleichen Ecke verstärkt, kann es in der heimischen Geräteindustrie neue Überlegungen geben. Sagen wir es offen heraus: Bildröhren plus Komponenten kommen aus
dem Osten, warum, bitte sehr, nicht gleich das komplette
Farbgeräte-Chassis? Ihm kann man in Europa und im Bun-
desgebiet ein dem unsrigen Geschmack entsprechendes
Kleidchen schneidern kein Mensch würde merken, woher
das Gerät wirklich kommt. Bei einfachen Radiorecordem, Kassettengeräten und Rundfunkempfängern geschieht das schon seit Jahren. Der nächste Sektor industrieller Arbeitsplätze ginge flöten...
In seinem Leitartikel im „Funkschau"-Heft 16/1976 sprach Prof.
Tetzner das Ungeheuerliche aus. In Industriekreisen hörte man
nur von Hoffnungen, dass es so weit nicht kommen möge, es
unterblieb aber der erwartete Aufschrei des Entsetzens...
Feind Nr. 1: Die Märkte
Die wegen ihrer maßlosen Expansion neuer-
lich wieder ins Gerede gekommenen
Selbstbedienungsmärkte unterschiedlicher
Couleur — C +C, Alikauf, Metro usw. sind
für den Facheinzelhändler teils störend, teils
lebensbedrohend. Nachdem Lockvogelange-
bote (= Verkauf von Geräten unter Einkaufs-
preis) juristisch nur unter sehr schwierigen
Bedingungen verfolgt werden können, spü-
ren die Händler, wie immer häufiger Mar-
kenempfänger von diesen Gruppen „verhäm-
mert" werden. Mischkalkulation machts mög-
lich etwas, womit der Fachhändler kaum
dienen kann.
73
High Fidelity ist Standard
Gerade das Fehlen herausragender technischer Neuerungen auf der diesjäh-rigen Funkausstellung auf dem Gebiet der Hi-Fi-Technik war ein Beweis dafür, wie gut und qualitativ hochwertig die Geräte der Aussteller bereits sind. Tech-nologisch ist es heutzutage nicht mehr schwer, die Bedingungen der Hi-Fi-Norm 45 500 einzuhalten. Dies wird um so lieber gemacht, als das Aushänge-schild der DIN-Norm ein gewisses Renommee für die Qualität eines Produktes darstellt.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.19 Alle rechnen mit einer Erholungsphase — erhoffen höhere Renditen
Warum denn sind die letzten acht Seiten vornehmlich mit Wirtschaftsnachrichten angefüllt — mag
sich mancher Leser fragen — wo bleiben denn die Weiterentwicklungen in Sachen Radiotechnik? Und wo sind die Bilder von neuen Modellen?
In der Tat — es gab kaum Neuentwicklungen, welche dem Hörer mehr hätten bieten können, als die
ausgereiften Konstruktionen
aus früheren Jahren. Schon
1975 las man, dass HiFi nun
eben „Standard" sei.
Im Rahmen eines Messebe-
richts in der „Funkschau"-Heft 22/1975 wurden über
30 Modelle abgebildet, wo-von die meistem im neuen
„Einheitsstil" gestaltet worden waren. Oder sollte man zum wiederholten mal das leidige Thema
„Quadro" aufgreifen, worüber in der Funkschau 1976 im Heft 20 nochmals ein Aufsatz unter folgen-dem Titel erschien: „ Quadrofonie — scheintot oder mausetot, das ist die Frage" ... Die Redakteure waren sicher selbst nicht recht glücklich, wenn sie nichts über interessante Neuheiten zu berichten
wussten... Da musste man eben über neuartigen Bedienungskomfort schreiben, welchen sie zuvor selbst als „Schnickschnack" abgetan hatten.
Auch französische Kollegen hielten von derlei Dingen nicht viel — sie meinten, „ dass die Deutschen eine förmliche Sucht nach Neuem hätten, was doch zumeist überflüssige ,gatgets seien. Dieser ame-
rikanische Slangausdruck für Spielereien und nette Nichtigkeiten hat sich übrigens in der französi-
schen Sprache voll etabliert und aussprachemäßig integriert" („Funkschau", Heft 26/1976).
Das Quadrofoniegerät von Elac (Körting) protzte mit Tastenfel-dem und Instrumen-ten, welche an Regie-Steuerpulte erinnern.
Mancher Käufer legte halt Wert darauf, dass er nicht nur optimal hören, sondern auch mit vielen Knöpfchen und Reglern spielen konnte. Aus den USA kam die Nachricht, dass Hi-Fl beim jüngeren Publi-kum (vor dem Auto) bereits das Status-symbol Nr. 1 sei.
„Warum sind Hi-Fi-Anlagen so schlecht" — überschrieb Dr. J. Mantel seinen Aufsatz in der Funk-schau", Heft 20/1976 und füllte damit 5 Seiten. Ob daraufhin so mancher Hersteller das Büßerhemd
überzog? Einzelne Entwicklungen indes vermochten doch noch auffiorchen lassen. Der Synthesizer-Tuner (PLL-Quarz-Digital-Tuner) und die Senderidentifikation zählten hierzu.
Ermuntert durch steigende Absatz-Zahlen widmeten sich auch „die Großen" dem Hi-Fi-Markt — vor-
an die Grundig-Werke. Sie verzeichneten 1976 nicht nur ansteigende Farbfernsehgeräte-Umsätze,
Grundig erzielte auch auf dem Hi-Fi-Sektor 10 bis 12 % Umsatzsteigerung, und konnte in Deutsch-
land weit über 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Wie die Inlands- florierten auch die Exportumsätze,
nur die Schweizer blickten noch in die Röhre. Dort gab es — wie die Funkschau im Februar 1977 be-
richtete — zu dieser Zeit noch keine Stereo-Hörfunksendungen. Die Stereo-Hi-Fi-Freunde im Alpen-land mussten sich also mit der Schallplattenwiedergabe begnügen.
74
Das Großversandhaus Quelle, Fürth, will
in den Jahren 1977 und 1978 Farbfernseh-
geräte im Wert von rd. 70 Mio. Finnmark
(= rd. 43 Mio. DM) von der finnischen Firma
Oy Lohja AB „Finlux" beziehen. Das Unter-
nehmen, das stark exportorientiert ist, befin-
det sich in einer kräftigen Expansionsphase.
Notiz aus der „Funkschau", Heft 3/1977
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
In der zweiten Hälfte der Siebziger verlagerten sich die Schwerpunkte. Japan konzentrierte sich jetzt auf Entwicklungen und ließ — weil die Lohnkosten im eigenen Land zu hoch geworden waren — die Geräte in anderen asiatischen Ländern bauen. Wie nicht anders zu erwarten, wollten auch diese auf-
keimenden Industrie-staaten mehr vom Ku-chen haben, und rich-teten eigene Produkti-onen ein — warden also zu neuen Konkurren-ten.
Nach den USA dürfte Japan jenes Land sein, von dem die wichtigsten Impulse für die
elektronische Technik und Wirtschaft ausgehen. Es ist zugleich der mit Abstand größte
Exporteur von Farbfernsehgeräten und ein wichtiger Lieferant von elektronischen
Bauelementen. Taschenrechnern und anderen Erzeugnissen, obwohl die ausgespro-
chenen Billigprodukte nicht mehr aus Japan stammen, sondern eher in Hongkong,
Südkorea und auf Taiwan gefertigt werden.
Vorspann zu einem Bericht in der „Funkschau", Heft 3/1977
Aber auch in Osteuropa wurden jetzt Geräte der Un-terhaltungselektronik produziert, und sogar in Finn-land. Das hatte auch Rückwirkungen auf deutsche Produzenten. Im Schaub-Lorenz-Werk Rastatt zum Beispiel wurde wegen der ständig zunehmenden Im-porte und verschlechterter Absatzlage die Produktion im Februar 1977 vorerst mal fiir 14 Tage eingestellt.
Hauen und Stechen gefällig!?
1977 begann mit Paukenschlägen. Diese un-
sere Industrie ist wieder einmal dabei, sich
gegenseitig und sich selbst den Hals zuzu-drehen. Gemeint sind die Preissenkungs-
aktionen, die den Herstellern mit großer Si-cherheit alles oder last alles an Gewinn ko-sten werden, was in den letzten Monaten
des vergangenen Jahres sich abzeichnete,
vornehmlich bei Farbfernsehgeräten. Man kämpft verbissen um Marktanteile, wohl wis-send, daß nur ein gewisses Produktions-volumen die Gemeinkosten auffangen kann. Wer zu wenig baut und verkauft, marschiert Ins Minus.
Aus der „Funkschau", Heft 6/1977
Schlechte Nachrichten kamen auch von der Halbleiter-Front. „Europa fast hoffnungslos unterlegen" — lautete die Überschrift zu einem Aufsatz in der „Funkschau", Heft 5/1977. Die Amerikaner seien so erfolgreich, weil dort für die militärische Elektronik jährlich ein Volu-men von 30 Milliarden DM zur Verfügung stünde. Kaum jemand glaubte, dass man unter diesen Umstän-den in Europa jemals (wieder?) in die erste Reihe aufrü-cken könnte, zumal doch auch noch ein beachtlicher Vorsprung der Japaner aufzuholen wäre...
Weltweit befand sich die Elektronik-Industrie im Um-bruch. „Zenith — ein Warnsignal" überschrieb K. Tetz-ner den nebenstehenden Aufsatz in der „Funktechnik", Heft 23/1977. Alle Hoffnungen ruhten nun auf der kommenden Funk-ausstellung. Vielleicht würde ja der „Mikrocomputer im Hi-Fi-Gerät... aber der kam ja auch aus Japan...
75
Das Gesprächsthema in der amerikani-
schen Elektronlkindustrie war Im letzten
Monet der überraschend bekanntgegebene
Entschluß der Zenith Electric Co, Chi-
cago, Ihre Produktionspolitik völlig zu
ändern. Jahrelang hielt Zenith die Fahne
„Wir fertigen nur in den USA" hoch, wäh-
rend ringsherum die gesamte Konkurrenz
mehr und mehr vor den hohen inner-
amerikanischen Löhnen auswich und in
Niedriglohnländern wie Mexiko, Süd-Korea
und vor allem in Taiwan fertigen ließ. Im
kommenden Jahr wird nun auch Zenith
Frintplatten und Fernsehgeräte-Chassis im
großen Umfang in Mexiko und Taiwan
produzieren und gegen Ende 1978 auch
alle Stereo-Geräte von draußen herein-
nehmen. Das kostet zunächst 5000 der
20 000 Zen ith-Arbeiter den Job, 600 An-
gestellte werden ebenfalls entlassen. Da-
neben ist die Auflösung der Forschungsab-
teilung unter Robert Adler beschlossene
Sache: alle Entwicklungsarbeiten wer-
den daraufhin überprüft, ob sie einen un-
mittelbaren Bezug zu neuen Produkten
haben.
Die Ursache des Entschlusses ist nicht die
japanische Konkurrenz in den USA, son-
dern der rapide Preisverfall am Markt, der
zu rigorosen Kostensenkungen zwingt. Die
Konkurrenz, vornehmlich die RCA, auch
Sylvania, Admiral und General Electric,
lassen längst in Mexiko und in Fernost
bauen, womit sie beträchtliche Kostenvor-
teile einhandeln.
Prof Tetzner recherchierte, und veröffentlichte in der „Funkschau", Heft 13/1977 erschreckende Daten ei-ner Überproduktion: „ 500 000 Farbfernsehgeräte lie-gen auf Lager" — und der Industrie fiel nichts besseres ein, als Nachlässe und Sondervergünstigungen zu ge-währen.
fflu«MUß
• 4114111 • 1,00 • •••
Om
Newil
O•O• 60060 ----a---- • 0••• 6606• ••• I 0
ur.,,,,,,eiti.erreMemivrr (jaks .A4 n),$tmtextung der net Arthivit.Fseitidinovi7, riigetrriecht die Zdirretaideen ree.• Selte .ileern PmejrnreortuAl Orr each vothatutretr thennold ttlaisedi. Abetrtstmang
103 FUNKSCHAU 1977, Heft 23 1091
Die dynamische Chronik
21 Mikrocomputer
„Microcomputer steuert Hi-Fi-Gerät"— lautete die Überschrift zu dem Aufsatz, den die Inge-nieure Holighaus und Kanow in der „Funk-schau", Heft 23/1977 veröffentlichten. Aller-dings handelte es sich nur um ein Musterge-rät — „wann eine Serienproduktion erfolgt, ist noch nicht abzusehen" — stand im Vorspann des Aufsatzes.
8. Kapitel
Die Erwartungen auf der IFA 1977 wurden nicht enttäuscht — zumindest was die Hi-Fi-Anlagen
(Zuwachs 15 %) und Autoradios betraf. Die Rundfunkwerke (deren Rendite nur gut 1 % vom Um-
satz ausmachte), zeigten sich dennoch zufrieden. Auch die Schweizer interessierten sich vermehrt für
Hi-Fi-Stereoanlagen; im August 1977 wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass dort etwa 1978/79 die
Hälfte der Rundfunkteilnehmer Stereosendungen empfangen könnten. Mit gewinnbringenden Zuwachsraten rechneten nur noch unverbesserliche Optimisten, die Realisten erwogen Rationalisierungsmaßnahmen. Auch der Rundfunkhandel wurde davon nicht ausgenommen,
waren doch die Lohnkosten zwischen 1971 und 1975 um 50 % gestiegen — das stand in keinem Ver-
hältnis zur Umsatz- bzw. Ergebnis-Steigerung. Frei gewordene Stellen wurden nicht mehr besetzt. Auf die alten „Röhrenradio-Techniker" konnte man mit der Zeit verzichten. „ Wozu hängen Sie an
diesem veralteten Gerät" — meinte der Rundfunkhändler, wenn ihm ein Röhrenradio zur Reparatur
gebracht wurde — „ heute bekommen Sie ein neues zur Hälfte des Preises, welchen Sie für Ihr altes
Röhrengerät bezahlten, und sparen auch noch am geringen Stromverbrauch".
Den Radiofabrikanten eröffneten sich 1978 neue Möglichkeiten zur Einsparung von Löhnen, die: „Automatische Bestückung — den Japanern gleichwertig" — so verkündet in der „Funkschau", im Heft 25/1977. Das war ein Meilenstein, der schließlich zur Freistellung vieler Arbeitskräfte führen
musste. Nur durch „Gesundschrumpfung" konnte die Rundfunkindustrie überleben — 1977 war sie nochmals „mit einem blauen Auge" davongekommen. Nach den Aussichten für 1978 gefragt, übte
man sich in Zurückhaltung. Vielleicht gingen die Spar-
maßnahmen zu weit, als sich
die meisten deutschen Hi-Fi-
Fabrikanten entschlossen, auf
der „Hi-Fi 78" nicht mehr auszustellen. Erstmals näm-
lich waren deren Stückzahlen
im 1. Quartal 1978 rückläu-
fig — manche witterten schon
eine Marktsättigung. Nach
längerem Zögern wollte nur Telefunken zur „Hi-Fi 87"
kommen.
Aus der „Funkschau", Heft 15/1978
Produktionszahlen der bundesdeutschen Radio- und Fernsehgeräte-Industrie
Januar bis
März 1978
April
1978 Januar bis März 1977
April 1977
Heim- Stuck 168 290 55 201 199 590 61 239 empfänger Wert (Mio. DM) 77,4 24,8 78.4 22,7
Reise-, Auto- u. Stück 915 868 330 164 1 107 458 404 351 Taschenempfänger Wert (Mio. DM) 241,3 89,7 270.3 100.8
Kombinationsgeräte u. Stück 222 357 80 099 263 977 61 310 Musiktruhen Wert (Mio. DM) 193,6 68,6 168,0 49,7
Fernsehempfänger Stuck 1 050 665 325 055 891 739 277 379 Farbe Wert (Mio. DM) 1086,5 361,9 1080,6 345.6
Fernsehempfänger Stück 148 625 54 874 181 555 66 297 Schwarzweiß Wert (Mio. DM) 50,9 17,6 , 60.8 21,8
Hi-Fi-Geräte lagen noch im Trend, dagegen verloren Heim-Rundfunk- und Reiseempfänger aus deut-
scher Fabrikation stetig an Bedeutung, was sich auch in den Funkschau-Veröffentlichungen nieder-
schlug. Da fand man so gut wie nichts mehr über Radios, vielmehr schrieben die Redakteure über
elektronische Geräte aller Art; angefangen beim Treppenhaus-Schaltautomat über CB-Funk bis zum
Rechner bzw. Computer. Der Titel „Funkschau" war (die Amateurfunkberichte ausgenommen) nur
noch bedingt zutreffend, und der Franzis-Verlag hatte vorsorglich die weiteren Fachzeitschriften:
„ELEKTRONIK" und „ELO" gegründet, welche sich steigenden Zuspruchs erfreuten.
76
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Nachdem nun die „Hi-Fi-78" gelaufen war, verbreitete sich wieder Zuversicht. Die Besu-cherzahlen (155 000!) und die Pressekonferenz mit etwa 350 Journalisten ließen die Branche aufhorchen. Bedenklich war nur, dass die meisten Ausstel-ler aus dem Ausland kamen (Pioneer, Toshiba, Sony, Akai usw.). Von Ausnahmen abge-sehen, hatten die deutschen Hersteller diese Chance ver-passt. Im nächsten Jahr — sag-ten sie — werden wir bestimmt wieder dabei sein... (Quelle: „Funkschau". Heft 20/1987)
Hi-Fi heute
Immer noch steigende Um-
satzzahlen und die Flut all-
jährlich neu auf dem Markt
erscheinender Geräte lassen
nur die Deutung zu, daß von
einer Marktsättigung auf
dem Gebiet der High Fidelity
nicht die Rede sein kann.
Zwar ist nicht jedermann in
der Branche uneinge-
schränkt glücklich — dazu ist
die Konkurrenz bei manchen
Geräten gar zu dicht gesät —
dennoch hat wohl niemand
zum Wehklagen einen
Grund.
In den „Funkschau"-Heften 21 und 22/1978 standen Berichte über die auf der Hi-Fi-Messe ausgestellten Re-ceiver, Tuner, Verstärker, Plattenspieler, Kassettenre-corder, Kompaktanlagen, Spulentonbandgeräte, Laut-sprecher aller Art und Kopfhörer — diese Berichte er-streckten sich über insgesamt 45 Seiten! Es gab zwar konzeptionelle und stilistische Unterschiede, im Grunde aber waren die Geräte nahezu einheitlich aufgebaut. Der Umfang der Berichterstattung lässt erkennen, welch große Bedeutung doch der Hi-Fi-Branche beigemessen wurde. Das „High Fidelity-Jahrbuch 9" enthält weit mehr als 1 500 Geräte, für die deren Hersteller den Qualitäts-stand nach DIN 45 500 in Anspruch nahmen.
Ob sie sich ärgern?
Der sehr große Erfolg der Hi-Fr 78 mit 155 000
Besuchern und einem überraschend, fast
sensationell hohen Besuch aus Kreisen des Handels muß jene deutschen Hi-Fi-Produ-
zenten nachdenklich stimmen, die aus allerlei
Gründen nicht teilnahmen. Zweifellos ent-
stand optisch der Eindruck, Hi-Fi-Geräte stammen hierzulande im wesentlichen aus
dem Ausland, Japan an der Spitze. Dabei rü-
sten sich die großen Deutschen, wie wir sie
einmal nannten, mit Vehemenz für das kom-
mende Hi-Fi-Geschäft im Herbst und Winter,
Philips, beispielsweise, kündigte 59 Modelle
an — und keines war in Düsseldorf zu sehen. Grundig versucht mit seinen Hausmessen
überall im Bundesgebiet zu erreichen, was in
Düsseldorf hätte geschafft werden können,
wenn die Fürther dabei gewesen wären.
Doch nun zu einem anderen Thema. Kaum waren die Rationalisierungsmöglichkeiten durch die auto-matische Bestückung von Platinen bekannt geworden, sorgten neue Nachrichten unter den Beschäf-tigten der Unterhaltungsindustrie far helle Aufregung. Die „Funkschau" veröffentlichte im Heft 12/1978 eine Abhandlung von Dr. Lorenz, welcher eine provokante Überschrift vorausgestellt wurde.
Dr. Lorenz indes glaubte nicht an einen massiven Stellenabbau. Aus dem Original-text: „Eilfertig, so Dr. Lorenz, wird die
Mikroelektronik zum Schuldigen gemacht;
sie würde mehr Arbeitsplätze vernichten als neue schaffen. Seine vorgezogene Schlußfolgerung: Es
ist unwahr, daß durch die Mikroelektronik Millionen von Arbeitsplätzen bedroht sind Andererseits
aber steht uns eine Katastrophe bevor, wenn wir den Fortschritt behindern oder durch lenkende Bü-
rokratie behindern lassen — wenn wir uns vom Weltgeschehen abkapseln und die nötigen Innovati-
ons-Investitionen unterlassen". Ein brisantes und aktuelles Thema tat sich da auf — die Fachzeit-schriften mussten fortan darüber berichten.
„Wir werden dicker" — überschrieb sodann Herwig Feichtinger seinen Leitartikel im „Funkschau"-Heft 21/1978. „Nein nicht wir. Die Funkschau wird wieder einmal umfangreicher, nämlich um eine
neue Rubrik —‚ Mikrocomputer — die Sie in diesem Heft zum ersten Mal finden".
77
Steht uns eine Katastrophe bevor?
Der Mikroprozessor ein Job-Killer?
Produktionszahlen der bundesdeutschen Radio- und Fernsehgeriiteindustrle
Januar b. April Januar b. April
März 1979 1979 März 1978 1978
Heim- Stück 164 137 54 862 168 290 55 201 empfänger Wert (Mio. DM) 73,1 19,8 77,4 24,8
Reise- und Auto- Stück 839 274 302 880 915 868 330 164 empfänger Wert (Mio. DM) 234,0 82,8 240,8 89,7
Kombinationsgeräte u. Stück 144 407 40 058 222 357 80 099
Musiktruhen Wert (Mio. DM) 133,7 35,2 193,6 68,6
Fernsehempfänger Stück 880 097 323 547 1 050 665 325 055
Farbe Wert (Me. DM) 967,2 313,5 1086,5 361,9
Femsehempfänger Stück 91 538 26 781 148 625 54 874
Schwarzweiß Wert (Mio. DM) 33,7 9,6 50,9 17,6
Tabelle aus der „Funkschau", Heft 16/1979.
Aufgrund welcher Erhebungen der ZVEI einen Zuwachs in Hi-Fi-Geräten prognosti-
zierte, bleibt sein Geheimnis. Im ersten Quartal 1979 gingen die Kombinationsgerä-
te-Stückzahlen drastisch zurück - im April sogar um 50 %.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
8.20 Zwischen Hoffen und Bangen — doch das Ende war nicht aufzuhalten
„Die europäische Bauelemente-Industrie in der Krise — Stoppt Japan!" — so lautete die Überschrift zum Leitartikel in der „Funkschau", Heft 23/1978. Das war zwar nicht neu, musste aber in aller Deutlichkeit wieder mal gesagt werden, um auch die Politik in die Pflicht zu nehmen. Genützt jedoch hat es wenig. „Selbstbeschränkung ist besser als Einfuhrsperren" — meinten die Wirtschaftswissen-schaftler und verwiesen darauf, dass sich Deutschland als Export-Weltmeister so etwas nicht leisten könnte. Man müsse eben den Japanern, die freilich ihren eigenen Markt vor Einfuhren schützten, freiwillige Zugeständnisse abringen.
Die Rundfunkwerke hatten Anfang 1979 Sorgen in jeder Hinsicht — und nicht kleine. „Nachdem ins-
besondere die Lagerbestände bei Farbfernsehgeräten zum Jahresbeginn die 600 000 Stück-Marke
bei der deutschen Industrie überstiegen hatten, und auch der Absatz der übrigen braunen Ware nicht
den Erwartungen entsprach, haben die Produzenten zu dem bewährten flexiblen Instrument der
Kurzarbeit gegriffen" — stand im „Funkschau"-Heft 5/1979. Blaupunkt, Grundig, Schaub-Lorenz mit Graetz,. Loewe-Opta, Nordmende — alle beantragten Kurz-arbeit, und auch Telefunken. In Hannover wurde das Umsatzziel kräftig nach unten korrigiert, indes — nach 10 Mio. im Jahr 1977 betrugen die Verluste 1978 satte 20 Millionen DM. Und dies, obwohl Telefunken far PAL-Lizenzen noch 35 bis 40 Mio. kassieren konnte. Nachdem man wusste, dass der wesentliche Teil dieser PAL-Patente 1980 ausliefen, konnte man sich vorstellen, wie dann Telefun-kens Bilanzen aussehen würden.
Der Fachverband Unterhal-tungselektronik im ZVEI indes gab sich noch opti-mistisch. Die deutschen Farbfernsehgeräte seien attraktiv und nach Meinung ausländischer Experten weltweit Spitze. Auch bei Hi-Fi- und Kompaktanlagen seien noch Zuwachsraten zu erwarten. Allerdings verschwieg auch der Verband nicht, dass sich die Ertragslage weiter ver-schlechtert hat, während der Konkurrenzdruck zunahm.
Die Wolken werden düsterer Als ob die europäische Unterhaltungselek-
tronik nicht schon mit den Japanern und in de-ren Gefolge mit den anderen Anbietern aus Fernost genug Probleme am Halse hätte! Sich gegen diese mächtigen, geschickten und ge-duldigen Konkurrenten zu behaupten, ver-langt fast mehr als die Europäer aufbringen können. Und doch zeichnen sich noch düste-rere Wolken am Horizont ab. Man hört gele-gentlich von der Aufbauarbeit der Volksrepu-blik China auf dem Sektor der Unterhal-tungselektronik.
Aus der „Funkschau", Heft 18/1979.
„Beklommenheit beim
Kommerz, Zuversicht
bei der Technik" — so überschrieb Karl Tetz-ner seine Vorschau zur Funkausstellung 1979. Die Technik betreffend gab es allerdings nichts Spektaku-läres zu berichten — es waren nur kleine Schrittchen, meist zur Bedienungserleichterung. Unter dem Druck der Markt-sättigung bedurfte es verstärkten Ideenreichtums. „Diskussionspunkt bei Hi-Fi: Wie werden die Minis ab-
schneiden? Werden sie mehr als 10 % vom Gesamtumsatz
ausmachen? Hier erwirbt der Käufer wenig Volumen für
viel Geld — wird es ihm gefallen?
IFA'791.
Viol Licht, aber auch Schaffen
78
Eine ruhige Oase im Menschenge-
wimmel und Lautsprecherlärm der Funkausstellung bot die Sonderschau „Hörfunk im Zeitalter des Fernsehens"
im Untergeschoß des Rundfunlunu-scums am Funkturm. In kleinen Räu-
men werden Rundfunkgeräte aus der
Zeit von 1945 bis 1973 gezeigt sowie auf kurz und treffend formulierten Plakaten
Meldungen aus der Geschichte des Hör-
rundfunks wiedergegeben.
Um die leise Wehmut zu verstehen,
die in dieser Sonderschau mitschwingt. sei daran erinnert, daß der Hörfunk von seiner Entstehung an eine neue literari-
sche Kunstform entwickelt hat: das
Hörspiel. Diese Synthese aus Sprache. Musik und Geräuschen vermittelt nur über das Ohr den glaubwürdigen Ab-
lauf einer Handlung oder eines Büh-
nenstückes. Alfred Braun inszenierte
bereits 1924 ”Wallensteins Lager" für den Hörfunk. damals noch in theater-
mäßiger Ausstattung in Kostümen und mit Wehr und Waffen, um den Schau-spielern und den Hörern diese „Sende-
büh wirkungsvoller darzustellen.
Großer Beliebtheit erfreuten sich auch
die Empfänger „für Reise und Heim" —
Die dynamische Chronik
Die Fülle des Angebots war überwältigend — Philips sprach
Produkten. Viele lockten mit Sonderpreisen. Sieben Hi-
Fi-Spezialzeitschriften buhlten um Kunden...
Zwischendurch mal etwas „Nostalgisches" gefällig? Ein
Funkausstellungs-Berichterstatter besuchte auch mal das
(heute nicht mehr existierende) Deutsche Rundfunkmuse-
um unter dem Berliner Funkturm. Es war der bekannte Fachschriftsteller Otto Limann, der
dann für die „Funkschau", Heft 21/1979 einen Aufsatz
unter dem Titel: „Ist der Hörfunk museumsreif" ver-
fasste. Daraus nebenstehend ein kurzer Ausschnitt. Man kann es nachfiihlen, wie dem früheren Chefredakteur der
„Funkschau" zu Mute war... Am Schluss seiner Geschichte steht der erfreuliche Satz:
„Die Ausstellung beweist, dass auch im Zeitalter des
Fernsehens der Hörrundfunk durchaus nicht museums-
reif ist".
1978 zählten Uhrenradios zu den meistgekauften Rund-
funkempfängern einfacher Art, 1979 wurden auch Radio-Recorder beliebt — vor allem bei den Zeitgenossen, wel-
che sich die teure Hi-Fi-Anlage nicht leisten konnten.
Gute Hörspiele im Rundfunk jedoch schienen in späteren Jahrzehnten nicht mehr „in" zu sein. Erst mit den Hör-
spiel-Kassetten bzw. CD's erlebten sie eine Renaissance.
Für Reise und Heim - Taschen - und Weltempfänger,
Radiorecorder, Uhrenraclios
8. Kapitel
von 2.200 unterschiedlichen Hi-Fi-
Aus der „Funkschau", Heft 22/1979
Geräte, welche man früher
„Kofferradio" nannte. Die
konnte man auch zuhause be-
treiben — sowohl mit Batte-
Hi-Fl in einer gewissen Mindestgröße für den Musikgenuß, für alle anderen Zwecke
dagegen tragbar und möglichst klein diesen Trend auf dem Rundfunkempfängerge-
biet machte die Funkausstellung wieder einmal sehr deutlich. Es zeigte sich aber auch —begünstigt durch die fortschreitende Miniaturisierung—eine Tendenz zum Mehrfunk-
tionen-Gerät, z. B. als Taschenempfänger mit Quarz-Weckuhr und eingebautem
Rechner.
rien als auch am Stromnetz. Vom Taschen- bis zum Weltempfänger wurden vielfältige Modelle in allen Preisklassen angeboten.
Mit Hoffnungen hatte 1979 begonnen — es wurde ein weiteres Krisenjahr. Die Statistik weist zwar
bei den Heimempfängern (gegenüber 1978) eine Stückzahl-Zunahme aus, die Erlöse aber waren ge-
ringer — das dokumentiert den Preisverfall. Noch schlimmer sah es bei den „Kombinationsgerä-ten" (HiFi) aus, da be-
trug der Rückgang 50
%. Die Industrie stellte
sich auf ständig fallende
Umsätze ein, aber die
Produktionskosten fie-len nicht im gleichen
Verhältnis.
Nur nach außen hin trug man noch Optimismus
zur Schau — intern wur-
de die Lage schon als
trostlos, von manchen
gar als „hoffnungslos"
beurteilt...
79
Produktionszahlen der bundesdeutschen Radio- und Fernsehgeräteindustrie
, Januar 1980 Jahr 1979) Januar 1979 Jahr 1978
Heim- Stück 74 115 686 260 54 890 604 319
empfänger Wert (Mio. DM) 27,0 262,8 23,8 286,8
Reise- und Auto- Stück 215 080 3 302 413 282 068 3 257 545
empfänger Wert (Mio. DM) 52,7 934,1 72,4 895,4
Kombinationsgeräte u. Stück 16 093 374 374 46 627 785 435
Musiktruhen Wert (Mio. DM) 13,4 314,8 45,0 679,7
Femsehempfänger Stück 305 021 3 870 055 296 476 4 019 046
Farbe Wert (Mio. DM) 308,5 3921,6 329,0 4390,0
Femsehempfänger Stück 22 160 310 118 36 863 584 392
Schwarzweiß Wert (Mio. DM) 7,8 107,9 12,8 198,5
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Das VI ,<roco nputer-Jc nrzohnt
Die Elektronik der achtziger Jahre
wird vor allem vom breiten Ein-
satz der Mikroelektronik geprägt sein
-einer Technik, deren Bausteine
heute bereits zur Verfügung stehen,
die aber erst im kommenden Jahr-
zehnt eine wirklich breite Verwendung
finden wird, allem voran der Mikro-
computer.
Ein neues Jahrzehnt hatte begonnen — das erste Jahrzehnt des Computers. Den Rundfunkwerken nützte es nichts — außer Siemens befasste sich kein deutsches Unternehmen der Unterhaltungselektronik mit der Datentechnik. Nur Ak-kord versuchte den Einstieg, verkaufte dann aber an Bosch.
Von der Mikroelektronik profitierte auch ein — früher „Bastler" genannter — Personenkreis. 40 bis 50 000 Besu-cher zählte die „Hobby-tronic"- Messe in Dortmund.
Die nächsten zwei bis drei Jahre entscheiden über das Schicksal
der europäischen Unterhaltungselektronik
Der Rundfunkindustrie im gesamten europäischen Wirtschaftsgebiet ging es so schlecht, dass nun dringend Maßnahmen auf höherer Ebene zu ergreifen waren. Die „Funkschau" notierte im Heft 6/1980: „Frankreich ist jetzt von der EG-Kommission zum Einfuhrstopp von Fernsehgeräten aus
Japan und Taiwan und zum Einfuhrstopp von Rundfunkempfängern bestimmter Art aus Taiwan, Ja-
pan, Südkorea, Hongkong und Polen ermächtigt worden. Zeitraum: 1.1. bis 30.9. 1980".
Die Herren vom ZVEI setzten sich mit Vertretern der Industrie zusammen um Auswege aus der prekären Situation zu finden. Die fanden sie natürlich nicht. Aus dem Bericht im „Funkschau"- Heft 7/1980, (aus dem rechts ein kurzer Ausschnitt abgedruckt ist), geht her-vor, dass die Japaner ohne diplomatische Floskeln di-rekt in die deutsche Wunde griffen. Auf deutscher Sei-te konnte man nur betretene Gesichter erblicken. SABA war inzwischen (aus zweiter Hand) bei Thom-son-Brandt gelandet und Prof. Tetzner wollte weitere Übernahmen (Zusammenbrüche) nicht ausschließen.
Nachdem Saba voraussichtlich eine neue
Heimat gefunden hat, fragt man in der
Branche beklommen, ob das die letzte
Konzentrationsaktion war. Noch gibt es drei defizitäre Konzemtächter: Blaupunkt (Bosch). ITT Schaub-Lorenz/Graetz (ITT) und Telefun-ken (AEG-Telefunken). ganz zu schweigen von Loewe-Opta im Einflußbereich von Philips und von noch unabhängigen Paul Metz. Wohin werden sie gehen - werden sie bleiben?
K.T.
Aus einem Bericht unter dem Titel: „Thomson-Brandt
wird Saba kaufen",
erschienen in der „Funkschau", Heft 9/1980.
2. Der harte Wettbewerb auf dem bundes-
deutschen Markt für UE bescherte dem
Verbraucher, teils wegen der Einfuhren,
teils wegen des hausgemachten Verdrän-
gungskampfes von Industrie und Handel,
konkurrenzlos niedrige Preise. Daß dabei
die deutsche Industrie in die roten Zahlen
geriet, interessiert den Mann auf der Straße
immer erst dann, wenn wieder ein Werk
schließt und ein Verwandter arbeitslos
wird. Heute noch beschäftigt dieser Indu-
striezweig rd. 100000 Mitarbeiter...
Am 4. März
antworteten die Japaner:
Die Schwierigkeiten der bundesdeutschen
Unterhaltungselektronik-Industrie sind in
der Hauptsache nicht auf die japanische
Konkurrenz zurückzuführen. Der Haupt-
grund sei vielmehr, daß nicht genügend für
Forschung und Entwicklung getan wird,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.
In Grundig steckte schließlich auch schon eine Philips-Beteiligung (1979 erst 24,5 %), später wurde diese Beteiligung aufge-stockt. Dass es der ITT-Gruppe nicht gut ging, war kein Geheimnis, und die schon aussichtslose Lage bei Telefunken hatte sich auch schnell herumgespro-chen.
80
Man erzählte sich letzthin folgende Geschichte:
Im Januar gaben amerikanische Wissenschaftler eine grundlegend neue
Erfindung auf dem Elektronik-Sektor bekannt.
Im Februar erklärten die Russen, sie hätten diese Erfindung schon vor zehn
Jahren gemacht, und .
im März lieferten die Japaner die Neuentwicklung aus der Serienfertigung
in die USA.
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
„Hemmt der Ingenieurmangel den Fortschritt? — fragte K. Tetzner in der „Funkschau", im Heft
11/1980, und schrieb: „Die Bauelementeindustrie lebt weltweit von Innovationen; diese Innovations-
leistung aber hängt ganz entscheidend von den Mitarbeitern ab; der Nachschub von qualifizierten
Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern wird als lebensnotwendig erachtet. Hier hat die In-
dustrie begründete Sorgen... Man hörte Ungünstiges. In Studienfächern wie Informatik und System-
technik sind die verfügbaren Plätze z.T. nur zu 40 % besetzt". Man hätte — schon früher... doch jetzt
war's zu spät... Könnte Frankreich zum Rettungsanker werden? Könnte ein ge-
meinsames Vorgehen aus der Krise fahren? Jean-Pierre Souviron
versprach den Deutschen eine bessere Zukunft.
Die japanische Herausforderung ist in aller Munde und in aller Ge-hirne, Gesprächsthema Nummer Eins und ein Alptraum für man-che unsere Wirtschaftsmanager.
Nachdem die kleinen Männer aus dem Fernen Osten unsere Kameraindustrie (fast) eliminier-ten und sich anschicken, langfri-stig den Automobilmarkt aufzu-rollen, ist die Unterhaltungselek-tronik dieses Landes und dieses Kontinents geschockt. Schon
lange beherrschen die Japaner unseren Video- und Hi-Fi-Markt.
Wenn die Schutzfrist abläuft, die der deutschen Industrie für die Großbild-Farbempfänger dank Pal-Lizenzen bzw. deren Lizenz-vergabe-Modalitäten gewährt ist, dann steht einiges bevor.
Die Franzosen streben eine eu-ropäische Gruppe mit europäi-
schem Management in Vertrieb und Entwicklung an. Das klingt gut, aber es klingt nicht zusam-men mit der Entwicklung im Nordmende-Management, wo Dr. Vogt, Sprecher der Ge-schäftsführung, und Hermann L. Mende, der letzte Namensträger
aus der Gründerfamilie, gingen und zwei hierzulande unbe-kannte Franzosen nachrückten. Wird es bei Saba ähnlich kom-
men? Wenn ja, dann stimmt et-was nicht an Souvirons Worten von der „europäischen Gruppe".
In der Realität ist aber manches anders, als in schönen Theo-
rien. Und es wäre auch naiv,
anzunehmen, dass ein linter-
nehmen hohe Beträge inves-tiert, um dem Verkäufer einen Gefallen zu tun. Natürlich war
Gewinndenken die Triebfeder,
und vielleicht auch die Absicht, Konkurrenten auszuschalten.
Letzteres hätte den Franzosen ja auch gelingen können — nur
das mit den Gewinnen — das
funktionierte eben gar nicht...
Aus: „Funkschau", Heft 12/1980
Es sollte „kein Einmarsch in Deutschland" sein — sagte
Herr Souviron — „sondern eine europäische Antwort auf
die japanische Herausforderung". Na ja... die Manager westlich des Rheins konnten auch nur Arbeitsplätze ab-
bauen und Betriebsteile stilllegen. Und die Bundesregie-
rung zeigte keinerlei Bereitschaft, ihre Muskeln spielen
zu lassen. Dort erkannte man gar nicht, dass es bereits
„Fünf nach Zwölf' war. Die Branche stand im Regen.
Die Funkschau berichtete im Heft 15/1980: „Es hat den
Anschein, dass auch die Telefunken Fernseh- und Rund-
funk GmbH, Hannover, nicht darum herum kommen
wird, Teile der — oder die ganze — Fertigung von Hi-Fi-
Geräten nach Fernost zu verlagern".
Allein die teils neu erstandenen Elektronik-Märkte, wel-
che ihre Geräte gleich samt der Verpackung abgaben
(sich nicht nur die Vorführung, sondern auch das auspa-
cken ersparten), lachten sich ins Fäustchen — und die
Kunden bekamen hochwertige Geräte zu Schleuderprei-
sen. Der Fachgroßhandel indes sah sein Ende nahen — seine Aufgabe hatten weitgehend die Einkaufs-Zusam-
menschlüsse (Interfunk, Expert, Aera usf.) übernommen.
Eine klare Absage
Noch immer wird gelegentlich über die be-wegten Klagen der deutschen U-Elektronik-Industrie diskutiert, vorgebracht auf einer Pressekonferenz im März in Frankfurt/M. Wir berichteten ausführlich in Heft 7/80, S. 55. Welchen Mißerfolg dieser Appell an den Pro-tektionismus hatte, liegt inzwischen auf der Hand. Die Bundesregierung denkt nicht dar-an, gegen die japanische Konkurrenz mit Ein-fuhrrestriktionen oder anderen Mitteln einzu-schreiten. Das betonte zuletzt Staatssekretär Dr. Dieter von Würzen vom Bundeswirt-schaftsministerium auf der Video '80 in Berlin: Innovation, Wettbewerb und Markt müssen auch im Bereich der Kommunikationstechnik ihre legitimen Funktionen behalten, sie kön-nen nicht durch Handelsrestriktionen ge-schwächt werden. Zwar gestand er ein, daß es im Bereich der Unterhaltungselektronik im Bundesgebiet erhebliche Einbußen der indu-striellen Massenproduktion gab. Aber es müsse der Industrie gelingen., durch Innova-tionen zum richtigen Zeitpunkt wieder Tritt zu fassen.
Eine Großhandlung konnte man einfach schließen — die paar Angestellten fanden auch Unterschlupf
in den Elektronikabteilungen der Kaufhäuser oder bei den neuen Märkten. Eine Fabrik mit 1.000 und
mehr Beschäftigten zu schließen, das war nicht so einfach. Also weitermachen — vielleicht bis zum
Konkurs...
Als nächsten Hoffnungsschimmer peilten unsere Rundfunkwerke die „Hi-Fi 80" an, diese bedeuten-
de, von vielen Interessenten besuchte Messe, welche sie 1978 noch links liegen ließen.
81
............ ..........
1.11.1.11••
Die tragbare Stereo-kompaktanlage Ilin-Studio von Telefunkilti
Lautsprecher hili M80
Bild 4. Der Flächenstrahler von Grundig mit der
Bezeichnung ..Monolith" ist asymmetrisch aufge-
baut und bedingt für Stereo zwangsläufig eine
linke und eine rechte Ausführung
Aus: „Funkschau", Heft 22/1980
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Das unüberblickbare Angebot
Dr. Klaus-Dietrich Liehr, neuer Audiochef
bei Philips, hat es zusammengezählt: Hi-Fi-Bausteine werden hierzulande von 116 Firmen angeboten, Kassettenrecorder von 94, Plattenspieler von 82. Die Produkte aber sind zahlenmäßig noch schneller gewachsen.
1978 gab es in Deutschland „nur" 825 Hi-Fi-Bausteine im Angebot, 1 979 aber bereits 1522. Folglich gelingt es nur sehr wenigen An-bietern, Marktanteile von 4...8 % zu erreichen.
Bei einzelnen Marktsegmenten beträgt das ja-panische Angebot insgesamt mehr als 50 %. Philips fühlt sich zumindest in Europa als der Größte; 1979 verkaufte der Konzern dort 1,7 Mio. Hi-Fi-Geräte, was einen Marktanteil von 12 % ausmacht — europaweit, bitte.
Wer wohl hätte es anders erwartet — das Angebot auf der
„Hi-Fi 80" war nicht mehr überschaubar. Die Anbieter
überschlugen sich in Werbe-Slogans. Herr Neumayr war
belustigt und schrieb in der „Funkschau", Heft 17/1980:
„Mit Erstaunen konnte ich kürzlich in einer Hi-Fi-
Zeitschrift lesen, dass die Violinen in Verbindung mit dem
Vor-Vorverstärker der Firma YZ besser klingen als in der
Natur...!". Etwas später stand im selben Aufsatz: „ Sollen
wir uns verrückt machen lassen von Messwerten, die jen-
seits von Gut und Böse liegen — soll heißen, die von unse-
rem Ohr, das noch dazu von Mensch zu Mensch verschie-
den ist, sowieso nicht mehr wahrgenommen werden".
Nun war es also so weit — technisch waren die Geräte auf
einem so hohen Stand, dass nur noch Raffinessen, Bedie-
nungskomfort und andere Spielereien als „Neuheit" galten.
„Hi-Fi 80 — ein großer Erfolg für alle" — resümierte die „Funkschau" im Heft 21/1980. „Diese zum
5. Mal durchgeführte Hi-Fi-Spezialmesse für Geräte, die der DIN 45 500 entsprechen, übertraf die
Vorgängerveranstaltung in jeder Hinsicht — mehr Aussteller (denn die „Deutschen" waren diesmal
vollständig zur Stelle) auf mehr Quadratmetern in mehr Hallen und letztlich auch 35 000 mehr Besu-
cher". Nur 5 % der befragten Aussteller zeigten sich mit dem Verlauf der Messe unzufrieden, 80 %
hingegen erklärten das Gegenteil". Die „Funkschau" berichtete über die Messestände auf 18 Seiten.
Natürlich waren alle Geräte in Halbleitertechnik aufge-
baut, nur „Luxman" tanzte aus der Reihe — mit einem
Röhrenverstärker. War's ein Nachzügler oder ein Vorrei-
ter? Vereinzelte Hi-Fi-Freaks (mit gefüllter Geldbörse)
fingen an, auf den „Röhren-Sound" zu schwören.
Nicht nur die Geräte waren mit ihren Einstellreglern zur
Klang-Optimierung oder -Verfälschung überladen, auch
bei den Lautsprechern war Superlativismus keine Selten-
heit. In den Monolith von Grundig wurden 22 Lautspre-
cherchassis eingebaut — Stereo hörte man mit 44 Laut-
sprechern. Integrierte Endverstärker, Ionen-Hochtöner
und Subwoofer — jeder Hersteller wollte den andern über-
bieten. „Nur zwei" Boxen waren manchem zu wenig — es
wurden Vierergruppen offeriert.
Auch teure tragbare Geräte wurden zu „HiFi-Studios".
Das Kassettenteil war schon selbstverständlich — im Telefunken HiFi-Studio 1, Baujahr 1980. Mit 2 x 30 Watt Sinus-Nennleistung hörte man bei Netzbetrieb — bei Batteriebetrieb mit 2 x 3 Watt.
82
Abschied vom Wachstum? Mit der Weltwirtschaft steht es
nicht zum besten; dafür haben vor
allem die Herren des Ols gesorgt.
Seit Mitte 1980 gewannen die re-
zessiven Einflüsse immer mehr an Gewicht, die der erneute Olpreis-
schub ausgelöst hatte. Der Ab-
schwung setzte sich zuerst in den
USA und schließlich auch in West-
europa durch. Selbst in Japan hat die Konjunktur deutlich an Fahrt ver-
loren. Mit einem Anstieg ihrer ge-
samtwirtschaftlichen Produktion um voraussichtlich 3,5 Prozent werden
die Japaner aber deutlich besser
abschneiden als ihre Konkurrenten.
Die USA. Frankreich und die Bun-
desrepublik Deutschland können nur mit einem geringfügigen Plus
rechnen, In Italien steht sogar eine
Rezession bevor; auch in England
dürfte die Wirtschaftsleistung — wie
schon im Jahre 1980 — schrumpfen,
1979 1980 1981 ung
1980/81: Marsch ins
Konjunktur-Tal
Wirtschaftswachstum in%
08
Niederlande Schweiz Italien
— BR Deutschlan +2.3
USA
England
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
welches der Chronist keinesfalls übergehen möchte, weil es zu den eine Chronik erst aufgebaut werden kann. Das sind teils Firmenschriften
und Kataloge, auch persönliche Kontakte zu Zeitgenossen, vor allem aber die Berichte, welche man den Fachzeitschriften entneh-men kann. Und die Qualität einer Fachzeitschrift ist in erster Linie von ihrem Chefredakteur abhängig. Was wäre nicht alles der Vergessenheit anheim gefallen, wenn nicht Kapazitäten wie Otto Kappelmayer, Otto Limann und Karl Tetzner fir die Zeitgenossen berichtet, und ihr Wissen der Nach-welt überliefert hätten... Wir Chronisten wären arm dran...
Ein Jahrzehnt war zu Ende gegangen — das letzte, in dem die Rundfunktechnik in Deutschland noch Gewicht hatte —‚ und mit ihm die „Ära Tetzner". Seit 1953 war Karl Tetzner far die
„Funkschau" tätig, ab 1966 als Chefredakteur.
ft (.4
„27 Jahre dabei, 14 Jahre als Dirigent —, die
rechte Zeit um aufzuhören und die Jüngeren in die
Pflicht zu nehmen" — schrieb der 1976 zum Hono-rarprofessor an der Freien Universität Berlin ernannte Publizist. Beim Franzis-Verlag war er eine Institution — die Zeitschrift mit seiner persönlichen Note wurde auf diesem Sektor die Nr. 1. Leider ist sie in der Nachfolgezeit nicht nur unpersönlicher geworden — es war auch zu spüren, dass der Kontakt zu den Rundfunkfirmen nicht mehr der war, wie man ihn zu Karl Tetzners Zeiten fast selbst-verständlich erwartet hatte.
Natürlich hat der hervorragende Sachkenner seine Verbindungen zur Funktechnik und zu den Rund-funkfabriken nicht einschlafen lassen, nachdem er in München den Chefsessel verlassen hatte — auch im Alter von 90 Jahren ist er noch an allen Neuerungen interessiert und voll im Bilde. Viele Ehrun-gen durfte Prof. Tetzner entgegennehmen — auch in der Vereinigung „Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens" (GFGF) ist er Ehrenmitglied.
Und nun zu einem Thema, Grundlagen zählt, auf denen
Karl Tetzner
Die Achtziger wurden für die Rundfunk-industrie zu Schicksalsjahren. Wäre es nur ein Abschied vom Wachstum gewe-sen — das hätte man ja verschmerzen können. Eher aber war's der Weg in den Untergang.
Drei Dutzend Ruefach-Händler, an der Spitze ihr Geschäftsführer An-dreas Brandt, sind gegenwärtig da-bei, eine neue Gesellschaft zu grün-den. Die „Postenkauf GmbH" will (her-produktionen und Auslaufmodelle in der Industrie aufkaufen und sie dann inner-halb der Gesellschafter vermarkten. Man hat vor, auch Nichtmitglieder der Ruefach zu beliefern, wenn sie sich der neuen Gesellschaft anschließen.
Geräte aus deutscher Fertigung wurden schon zu Schleuderpreisen verkauft —
auf dem Weltmarkt tobte Taiwan startet mit ein Konkurrenzkampf —
eigener importierte Waren wur- Entwick- den immer billiger. lung
Aus: „Funkschau", Heft 4/1981
83
Schlechte Nachricht für ICs Die Integrated Circuit Engineering (IEC), eine in Ari-zona ansässige Beratungsfir-ma mit gutem Ruf auf dem Halbleitergebiet, prognostiziert der amerikanischen Halb-leiterindustrie für das laufende Jahr eine Fülle von negativen Einflüssen. Das Unternehmen rechnet mit Absatzrückgängen und spürbaren Entlassungen, hervorgerufen durch eine er-hebliche Überkapazität.
Sony produziert in China Ab 1984 will Sony entspre-chend einem Abkommen mit der Volksrepublik China Au- dio-Kassettenrecorder und Fernseh-Projektoren in China produzieren. Die Recorder sol-len nach Asien und Südameri-ka exportiert werden, die TV-Projektoren sind für den Be-darf in der Volksrepublik selbst gedacht. Die sehr sorgfältigen Vorbereitungen laufen im No-vember dieses Jahres an; sie nehmen Rücksicht auf die re-lativ rückständigen Produk-tionstechniken und die Qualifi-kation der chinesischen Arbei- ter. W. S.
Mit Milliwatt und Kilowatt
Aus der „Funkschau", Heft 16/1981
„Audio ist tot, es lebe Video!" Wer das geglaubt hat, hatte sich in Chicago gewaltig in den Finger geschnitten. HiFi ist noch immer ein ausgezeichnetes Geschäft, und alle, die eine gegenteilige Meinung äußern, sind auf dem fal-
schen Dampfer. Alle „Großen" am amerikanischen Markt - von Acoustic
Research bis Technics, von Aiwa bis Sony haben in den ersten Monaten deutlich mehr verkauft als im Vorjahr; JVC berichtete sogar von seinem besten Vierteljahresergebnis überhaupt. Bestimmte Produktgruppen, wie z.B. Kasset-
tendecks und Receiver, sind in einigen Preisgruppen sogar knapp am Markt.
Die Textausschnitte oben, links und rechts entstammen der „Funk-schau", Heft 8/1981
In dieser, von Pessimismus getrübten Zeit kam plötzlich eine
hierzulande überraschende Nachricht aus Amerika: „Hi-Fi ist
ein ausgezeichnetes Geschäft".
Micronn-System nennt Blaupu same Mtni-He-Fi-Anlage bestehend aus Tuner. Amplifier. Kassertend und zwei Boxen
84
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
In der „Funkschau" war das „Radio" schon Geschichte - Elektroakustik mit HiFi der neue Titel dieser Sparte hieß: „Elektroakustik mit HiFi.
Der Franzis-Verlag brachte die „MC" heraus; eine Mikrocomputer-Zeitschrift. Vielleicht aufgrund
der Erkenntnis, dass die „Funkschau" eines Tages gar nicht mehr gefragt sein würde.
Die Unterhaltungselektronik betreffend stand im Heft 7/1981: „Produktionsplus - aber Umsatzminus"
- das bedeutete nichts Gutes. Auf
der ganzen Welt wurden weitere Fer-
tigungskapazitäten installiert. Jeder meinte, nur mit Zuwachsraten über-
leben zu können - mögen doch die
Wettbewerber ins Gras beißen...
Was dabei an Gewinnen flöten ging,
sollte durch noch höhere Umsätze
ausgeglichen werden...
Telefunken wollte durch die Einfüh-
rung eines neuen Vertriebssystems
ein Minimum an Preisstabilität erzie-
len, aber das Bundeskartellamt war
dagegen.
Ein Silberstreif am Horizont? - far
die amerikanischen Händler viel-
leicht - weniger jedoch für die ein-
heimischen Hersteller. Fisher (seit
1974 Emerson, seit 1976 Sony) und
Harman Kardon waren selbstver-
Poker auf Zeit Daß das in Deutschland praktizierte
Vertriebssystem auf dem Gebiet der Un-terhaltungselektronik marode ist, wird wohl von niemandem ernsthaft bestritten werden. Zu undurchsichtig sind die Kon-ditionen geworden, zu einseitig wurden die _Großen" im Handel bevorzugt.
Daß ausgerechnet Telefunken nun-mehr einen Vorstoß zur Bereinigung der Situation unternimmt, kann man nur noch als „Flucht nach vorne- interpre-tieren. Zu lange ist vielerorts an den Sym-ptomen, nicht an der Ursache herumge-doktert worden: Mit Kitt-in-die-Fugen-schmieren konnte das brüchige Mauer-werk nicht mehr repariert werden.
ständlich auf der „CES" vertreten.
Indes - bei den von der Funkschau
gezeigten Hi-Fi-Anlagen handelte
es sich großenteils um japanische
Fabrikate, welche z. T. schon in
Amerika gefertigt wurden. Aiwa,
JVC, Marantz, Mitsubishi, Naka-
michi, Pioneer, Sansui, Sharp, So-
ny, Technics und Yamaha stellten
ihre Geräte aus; und Blaupunkt
wollte mit dem „Mikronic-60-
System" ins Geschäft kommen.
Marcel Siegenthaler
Mikrocomputer im Receiver Seit Anfang 1980 ist die Welt der hochwertigen Receiver verändert. Kleine schwarze Module haben die längst prophezeite „Black-Box"-Technik zur Tatsache gemacht. Ihre Konzeption macht sie vielseitig, so werden z. B. bereits heute Mikrocomputer in den unterschiedlichsten Geräten - vom Spielzeug über Waschmaschinen bis zum Navigations-rechner - eingesetzt. Der folgende Beitrag richtet sich an HiFi-Freunde und beabsichtigt, einen kleinen Einblick in die Mikrocomputer-Steuer-technik eines Receivers zu vermitteln.
Heiße Köpfe und kalte Füße Die „kleine Funkausstellung" in Düsseldorf, die sich in diesem Jahr
erstmalig mit dem Zusatzwort „Video" schmückte, war wie noch nie
zuvor eine „politische" Messe. Das wurde vielleicht vom Normalbesu-cher gar nicht so sehr wahrgenommen. In den Gesprächen aber auf den Ständen klang es anders: Preisverfall bei steigenden Kasten,
daraus resultierender erbarmungsloser Wettbewerb, schlechte Nach-richten vom Arbeitsmarkt, die Diskussionen um AEG-Telefunken - all
das belastete das Bild.
Die dynamische Chronik
Der Mikrocomputer setzte sich durch — wurde nach und nach in alle technische Geräte eingesetzt. Und die Digitaltech-nik begann, die analogen Systeme zu verdrängen. Im Bereich der Unterhal-tungselektronik machte die Compact Disk den Anfang. Sie war auch das Ta-gesgespräch auf der Funkausstellung 1981, auf der freilich noch Plattenspie-ler und Kassettendecks ausgestellt wur-den. „Solide Mittelklasse bevorzugt" — so die Überschrift zu den „Funkschau"-Messeberichten im Heft 23/1981.
8. Kapitel
Am Rande der Funkausstellung wurde (s. „Funkschau" H. 25-26/1981) schon über die Möglichkeit der Einführung des „digitalen Rundfunks" diskutiert. Das war noch Zukunftsmusik.
Neue Technologie, neuer Rundfunk? Am Rande der Funkausstellung hält die Technische Kommission ARDi ZDF ein Pressekolloquium ab, zu dem die in Berlin anwesenden Jour-nalisten nun schon traditionsgemäß geladen werden. In diesem Jahr hatte sich einiger Zündstoff angeboten - das fing bei der Digitalisie-rung an und hörte bei den sogenannten Neuen Technologien noch lange nicht auf. Der nachfolgende Beitrag gibt Auszüge aus den Statements der Referenten.
Aus einem Bericht der „Funkschau", Heft 25-26/1981
Real waren Fortschritte in der Ferti-gungstechnik — die wurde immer dif-fiziler. Durchkontaktierten Leiterplat-ten folgten „Hochlagige Multilayer" — die gesamte Schaltungstechnik wurde miniaturisiert, die Laufzeiten redu-ziert.
Deutsche U-Elektronik im Abwind. Nach den amtlichen Angaben wurden im Mai 1982 um 15 % weniger Farbfern-sehgeräte in der Bundesrepu-blik hergestellt (nicht abge-setzt!) als im Vorjahr. Auch die Produktion von Audiogeräten ging zurück und zwar um 11 %. Zulegen konnten nur die Autoradios (+8 %).
Die Technologie konnte sprunghafte Fortschritte vorweisen — deutsche Rundfunkwerke nur ansteigende Verlustzahlen. „Neue Berufsbilder
wären notwendig" — überschrieb Dietmar Benda seinen kritischen Aufsatz zur Elektronik-Berufsausbildung in der „Funkschau" im Heft 14/1982; doch — war es nicht schon viel zu spät?
„Unbestreitbar ist, dass die derzeitige Rezession stärkere Auswirkun-
gen hat, als die vorhergehenden" — äußerte der Nordmende-Presse-sprecher auf einer Presse-Informationstagung (siehe: „Funkschau" Heft 17/1982). So etwas sagen Pressesprecher nur ungern.
Dr. Max Grundig, dem auf der „HiFi-Video" 1982 der Eduard-Rhein-Ring verliehen wurde, geriet in Rage, als er auf die japanische Konkurrenz zu sprechen kam. Er wehrte sich dagegen, „ dass durch
eine günstigere Lohn- und Kosten-
struktur in Japan riesige Produktions-
kapazitäten aufgebaut werden, die
dann aufgrund der höheren Lohnni-
veaus in Deutschland vorhandene
Kaufkraft abschöpfen".
Dass dann auch noch ein fernöstlicher
Hersteller ein Grundig-Patent in aller
Unschuld in seine neuen Geräte in-
stallierte, mag vielleicht letzter Auslö-
ser für die Säbel-Attacke des energi-
schen Max Grundig gewesen sein,
der, wie er sagte, „sein Lebenswerk
nicht in Frage gestellt sehen will".
Aus der „Funkschau", Heft 21/1982
85
Bild 2. Attacke gegen Fernost: Max Grundig
(Foto: Kp.)
Konkurse und Ver-
gleichsverfahren in der Bundesrepublik
Deutschland
Jahr Insolvenzen
1972 4 574
1973 5 515
1974 7 722
1975 9195
1976 9362
1977 9562
1978 8722
1979 8319
1980 9140
1981 11 653
1982 15 876
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Konsul Grundig wusste, wovon er sprach — „ von einem Han-
delskrieg gigantischen Ausmaßes. Zwei verschiedene Welten
stehen sich gegenüber. Wir müssen handeln, wenn wir in Eu-
ropa nicht noch mehr Arbeitsplätze gefährden wollen".
„Heißen Gesprächsstoff gab es mithin genug — und genug
Leute, die dabei kalte Füße bekommen haben." — stand in der Funkschau.
In Spötterkreisen kursierte die folgende Geschichte:
Es rauchten schon die Köpfe — bei den Teilnehmern eines internati-onalen Manager-Seminars, als der Seminarleiter abschließend ger-ne hören wollte, wie's denn so mit der Allgemeinbildung stünde. Wer hat's wann gedichtet — fragte er und zitierte: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche..." Betretenes Schweigen — bis aus der hinteren Reihe ein kleiner Japaner ertönte: „Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Osterspaziergang, 1806". Die Teil-
nehmer staunen... Noch eine Frage: „Fest gemauert in der Erden..."— und wieder springt der kleine Japaner auf: „Friedrich
Schiller, Lied von der Glocke, 1799". Peinlich berührt zischt ein Teilnehmer aus der ersten Reihe: „Scheißjapaner"— und triumphierend ertönt
hinten die Antwort: „Max Grundig, CEBIT 1982"!
Gar keinen Spaß hatten die Manager an der Realität. Wie in der Grundig-Geschichte (Kapitel 9.49) ausführlich dargelegt, musste letztendlich auch Max Grundig das Handtuch werfen, nachdem sich seine Vision von einem europäischen „Philips-Grundig"-Unternehmen aufgrund des Widerstandes
der Kartellbehörde zerschlagen hatte. Philips stützte Grundig nur so lange, bis die Verluste schwindelerregende Größenordnungen annahmen, dagegen näm-lich fielen auch den Holländern keine Patentrezepte ein.
Von den einst bedeutenden deutschen Funkunternehmen konnte nur Loewe überleben, und Metz — beide mit Fernsehapparaten — Blaupunkt und Becker mit Kfz-Geräten. Telefunken kam 1983/84 (wie zuvor schon Nord-Mende und SABA) in die Hände von Thomson. Alle Werke (siehe Kapitel 9) wurden nach und nach stillgelegt. Braun wurde von Gillette erworben, Schaub/Lorenz/ Graetz am 1.1.1988 von Nokia. Die Neuerwerber lösten die Sparten Unterhal-tungselektronik auf. Am Ende dieses Jahrzehntes gab es auf dem Markt so gut wie kein Heimradio mehr, welches — in nennenswerten Serien — in Deutsch-land produziert wurde.
Ältere Radioliebhaber wollen es einfach nicht wahr haben, dass Firmen wie SABA, Körting und NordMende, die noch in ihren letzten Tagen hochwertige Empfänger produzierten, dem Untergang geweiht sein sollten — und auch das einstige „Flaggschiff Telefunken"... Der Radiohistoriker wird immer wieder gefragt, ob da nicht etwa ein Irrtum vorläge.
kOrtlflg NORDMIEIN'DIE
Marken wie Saba und auch Telefunken konnte man doch noch immer in den Werbeschriften entdecken. Und wenn Telefunken schon keine Rundfunk- und Fernsehgeräte mehr fertigte, wird sie doch zumindest im kommerziellen und militärischen Bereich mit dem Bau von Ortungs- und Nachrichtengeräten weiterhin existieren.
Das schlichte Design des RC 652 aus den Neunzigern zeugt
von gestalterischer Qualität — Philippe Starck hat den „don 0" entworfen. Telefunken steht drauf, aber wo nichts mehr ist, kann auch kein Radio entwickelt und gebaut werden. Thomson brachte dieses, mit Niedriglöhnen von Chinesen gefertigte Stereogerät mit Cassettenrecorder in den Neunzigern auf den Markt. Der gekaufte Markennamen diente als Kaufanreiz — man könnte auch sagen: zur Kundentäuschung...
86
von
von
TELEFUNKEN 36 cm Fernseher MA-135 • 34 cm sicidbore Dinonnie • Front -
AS igang • Scod • 1301xt 37,5 x 34 x 37 (rn • Ad Nu 396465
EZD 3-D-Itmesuldirinfi
Fer,osleuerettiq
CC
/27
Die dynamische Chronik
8. Kapitel
Schon im nationalen Interesse wäre es doch unverantwortlich, die Funktechnik in Deutschland ein-
fach zu liquidieren. Es ist aber so!
Telefunken-Reste wanderten von der AEG zur Aero-
space (DASA) und schließlich zur EADS. Trotz un- AUS HAND'
bestreitbarer technischer Leistungen endete Telefun-
ken dort in der Bedeutungslosigkeit.
Den Namen Telefunken (2003 hätte die „Die deut-
sche Weltmarke" das „100jährige" feiern können)
fand man nur noch — bzw. wieder — in der im Jahr
2000 neu gegründeten „Telefunken-Sender-Systeme
Berlin AG".
Auch noch im Jahr 2006 scheute sich ein Media-Markt nicht, das billige Fernsehgerät unter dem „einst" be-deutenden Markennamen „Telefunken" anzubieten...
Die wenigen in Deutschland noch produzierenden Rundfunkwerke fertigen auch in den Jahren nach
der Jahrtausendwende mit wechselnden Geschäftserfolgen noch Fernsehgeräte der höheren Preisklas-
se; und auf dem Hörfunk-Sektor konnten sich mit einem begrenzten Marktanteil hochwertige Autora- dios behaupten.
Zwar werden — für die
Käuferschicht mit beson-
ders gut gepolsterten
Geldbörsen — auch noch
wenige Heim-Musikanla-
gen gebaut, nennenswerte
Serien aber liefen zuletzt
1990 von den Bändern.
0
Berl
cD Schneider
50 JAHRE 1923-1973
Die Kriegsjahre ausgenommen, erlebte die deutsche Radioindustrie fünf erfolgreiche Jahrzehnte — danach ging's abwärts. „50 Jahre Deutscher Rundfunk" — das zu feiern hatten nur noch die Sendeanstalten Grund — die Ra-dio-Hersteller nicht mehr.
Lassen wir abschließend Hermann Brunner-
Schwer, den 1988 verstorbenen einstigen Chef
der inzwischen aufgelösten Schwarzwälder Ap-
paratebauanstalt, zu Wort kommen:
„An SABA erinnert heute nur noch eine Ver-
triebsgesellschaft. Auch die Produkte, die über
die Organisation angeboten werden, tragen
diesen Namen. Woher sie stammen, bleibt dem
Käufer verborgen. Nur das eine ist sicher: Aus
dem Schwarzwald kommen sie nicht..."
87
Die dynamische Chronik 8. Kapitel
Epilog
Zwar ist diese Chronik noch nicht zu Ende geschrieben — aber die Deutsche Radioge-
schichte ist zu Ende. Deshalb soll dem Epilog bereits hier — vor den zahlreichen Firmen-
geschichten, sonstigen Radiothemen und Registern — sein Platz eingeräumt werden. Am
Ende der Dokumentation würde derselbe seinen Bezug zur Deutschen Radiogeschichte
verlieren.
Zwei grundsätzliche Möglichkeiten gibt es, eine Weltherrschaft (die es total nie geben kann) anzustreben:
1. Einen Gegner — ein Land — einen Kontinent gar — mit kriegerischen Waffen dem Erdboden gleich machen
2. Eben diesen Gegner mit wirtschaftlichen Waffen in die Knie zu zwingen.
Ein Wirtschaftskrieg ist wesentlich humaner, führt aber (nur ohne die Vernichtung von Materie und Menschenleben) zum gleichen Ziel.
Die Voraussetzungen für beide Arten der Bezwingung sind: der wissenschaftlich-technische Vorsprung, Kapital und Kriegslist.
Früher hatten in wechselnden Weltregionen epochale Hochkulturen ihre Blütezei-ten — heute sind es die Giganten der Wirtschaft, die sich im Glanz ihrer Wirt-schaftsübermacht und ihres Reichtums auf der Siegerstraße sehen. Marktbeherr-schting = Weltbeherrschung — solange die kriegerischen Waffen schweigen. Dieser Kreislauf wäre ja „relativ" normal — von einem Jahrhundert zum anderen gingen solche „Krisenherde" um den Globus — schon immer gab es Vorherr-schaftskämpfe — das ist wohl ein Naturgesetz. Jetzt aber geht es an die Welt-Substanz. Vor 50 Jahren war Japan ein Billiglohnland. Nach einem steilen Lohnanstieg (500 %) ließen die Japaner in benachbarten Billiglohnländern fertigen. Bald aber machten sich jene von den scheinbaren Monopolisten unabhängig — wollten selbst die Gewinne einstreichen — verbrauchten immense Energien und Ressour-cen. Es wird nicht mehr lange währen, bis auch die neuen Senkrechtstarter nach weiteren Billiglohnländern Ausschau halten. Bevor aber das letzte Land der Erde in diesen Kreislauf einbezogen wird, hat die Natur schlapp gemacht. Die ins Uferlose expandierende Menschheit kann sich vor Katastrophen nicht mehr retten und verliert ihre Lebensgrundlagen.
Den Kollaps hat man doch schon im Jahr 2000 vorausgesehen, sagen dann die, die ihn verursacht haben. Was soll's — nach der Eiszeit ist schließlich auch wie-der neues Leben entstanden — wenn auch erst einige tausend Jahre später...
89