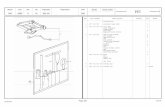Qairawāner Miszellaneen I: Fragmente aus der Bibliothek des Abū l-ʿArab at-Tamīmī...
Transcript of Qairawāner Miszellaneen I: Fragmente aus der Bibliothek des Abū l-ʿArab at-Tamīmī...
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi
(st. 333/944-45) in der Handschriftensammlung
von Qairawän
Qairawaner Miszellaneen I
Von Miklos Muranyi, Bonn
Privatbibliotheken haben ihren besonderen Reiz; insbesondere dann,
wenn sie berühmten Persönlichkeiten gehören und zugänglich sind.
Aber nur selten wird dem nach solchen Sammlungen Suchenden das
Glück zuteil, in Bestände privater Sammlungen aus dem dritten musli¬
mischen Jahrhundert Einblick zu gewinnen — auch wenn sie heute teil¬
weise fragmentarisch, zerstreut und ungeordnet vorliegen.
Die Manuskriptsammlung der ehemaligen Moscheebibliothek von
Qairawän beherbergt einige Privatsammlungen aus jener Zeit. Ihre
Besitzer, deren Namen wie Exlibris auf den Titelblättern erscheinen,
kennen wir heute jedoch kaum noch; viele von ihnen sind in den tabaqät-
Werken nicht einmal verzeichnet. Der Wert ihres Nachlasses mag uns
jedoch für den Mangel an biographischen Daten über die Sammler ent¬
schädigen. Die drei Handschriftenfragmente aus der Qairawaner
Sammlung, die ich hier erstmalig vorstelle, verdienen in zweierlei Hin¬
sicht besondere Beachtung: sie sind, zum einen, im Besitz des berühm¬
ten Qairawaner Gelehrten des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts
d.H. Abü l-'Arab al-Tamimi, Muhammad b. Ahmad b. Tamim (st. 333/
944-45) gewesen und tragen seinen Schriftzug'. Zum anderen stellen
zwei von ihnen die ältesten erhaltenen Schriften einer kaum erforschten
literarischen Gattung, des Hlm al-ri^äl aus dem frühen 3. Jhdt. d.H.,
dar. Das dritte Werkfragment gehört einem anderen literarischen
Genre an, ist aber mit dem 'ilm al-ri^äl eng verwandt; es ist ein Frag¬
ment aus der Hadit-hiteratur, speziell eine Sammlung von diversen
tumq zu einem Prophetendictum, die auf dessen Verbreitungsradius im
' Abü l-'Arab war selbstverständlich auch im Besitz anderer Schriften; einigeHefte aus dem Bereich des Fiqh habe ich in meinen Materialien zur mälikitischen
Rechtsliteratur. Wiesbaden 1984, S. 95-96, vorgestellt. — Über ihn siehe GAS. I,356-57; Tartib al-madärik (Rabat), 5/323-26; Ma'älim, 3/36-38.
Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 513
2. Jhdt. d.H. schließen lassen. Die in den hier vorgestellten Fragmen¬
ten präsentierten Wissenschaftsdisziplinen — Hadil-Liter&tuT und Hlm
al-ri^äl — sind Stiefkinder in der ansonsten regen Gelehrsamkeit von
Qairawän und des islamischen Westens im 3. und 4. Jhdt. d.H. gewe¬
sen. Daher zählen sie auch in dieser Hinsicht zu den seltenen Exempla¬
ren der /^arfj|-Wissenschaften in einer der wertvollsten, aber nur wenig
bekannten Manuskriptsammlungen Nordafrikas.
Ms. Nr. 1516
14 fol. 24 X 17 cm, etwa 33 Zeilen/Blatt; unregelmäßiges, etwas rissiges
Pergament (raqq), Titelblatt sehr beschädigt.
Titelblatt (fol. 1 recto):
jJU 0^ -^i J JWJ\ j^l I ^ ^l:^ *j
(sie) JjJI <jj iU-JI ^ S 1 ^ Cni^l o- LU' iiJJl <j Jj"^' -r-^^'
(sie) ,>jLI J-\, (sie)
JU J\ üi JaI olä [ U| .J<£ <jj
jJL> j;,, J_C JJ-1 J_J.l J\ JC- ,_JJ^ JJ-l iljj
o*. -y, -^.«.^
Das Heft endet auf fol. 13 recto wie folgt:
*jT, ^1 Jp <ui ,;J.Ui i.^ JJ xJ-\, JW üj^, j*i oüJ» ..jtf ^-
---^ ^ jltI ^ti" ^ <izS
Anschließend auf fol. 13 recto-14 verso folgen einige Hadite in der Ri¬
wäya von Furät b. Muhammad al-'Abdi, Abü Sahl (st. 292/904)^ die
ausnahmslos auf al-Mufaddal b. Fadäla, Abü Mu'äwiya al-Mi§ri (101/
719-181/797 oder 182/798)^ zurückgehen. Diese Nachträge sind ofTen¬
sichtlich während der Vorlesungen bei Furät b. Muhammad aufgezeich¬
net worden, an denen auch der Besitzer des Heftes, Abü l-'Arab teilge¬
nommen haben kaim; er ist als Schüler von Furät b. Muhammad aus¬
gewiesen und zitiert seinen Lehrer in seinem teöa^ä^-Buch mehrfach —
haddatani/sami'tu/qäla li Furät b. Muliammad — direkt. Diese Samm¬
lung endet mit: sami'tu ^ami'ahä min Furät; sie ist aber nicht von Abü 1-
'Arab selbst geschrieben worden. Da er jedoch als Besitzer des Heftes
auf dem Titelblatt erscheint, dürfte der Nachtrag aus derselben Zeit
^ stammen.
^ Über ihn: Aghlahides/TAL-Bi, 325; Ben Cheneb, 141 und ibidem. Index,280.
3 Über ihn: Tahdib, 10/273-75; Ibn Sa'd, VII/2.204; Kindi/GuEST, 377-83:
385-87; Futüh Misr/ToRREV, 244,16-20.
514 Miklos Muranyi
Inhalt des Heftes
fol. lb der Anfang fehlt. Die Liste beinhaltet die Generation der Tä¬
bi'ün, die in Basra gelebt haben,
fol. 3 a tasmiyat man nazala l-Ba^ra min al-sahäba
fol. 4 a tabaqät al-Bagdädiyyin
fol. 5b tabaqät al-Wäsitiyyin
fol. 7 b ohne neue Überschrift beginnt hier wohl das im Titel genannte
Kitäb tabaqät ahi al-Basra wa-ma'rifat al-ri^äl
fol. 9 b ashäb al-Hasan (al-Basri) wa-Ibn Sirin wa-man käna fi tabaqa-
tihim — wohl ein Untertitel im Kapitel von fol. 7 b
Es ist etwas ungewöhnlich, daß das Heft mit der Generation der Täbi'ün
und nicht mit der Namenliste der Sahäba beginnt.
Verfasser:
Ahmad b.'Abd Alläh b. §älih b. Muslim, Abü 1-Hasan al-Tgli (181/
797-261/975)*. Er lebte in Kufa und Bagdad, übersiedelte dann wäh¬
rend der Mihna nach Aträbulus in Nordafrika. Hier ist er als Hadit-K.en-
ner berühmt geworden. Das vorliegende Heft stellt einen Teil seines
Kitäb al-ta'rih wa-ma'rifat al-ri^äl al-tiqät dar, das Ibn Hagar al-'Asqa¬
läni unter diesem Titel, in der Riniäya. von Sälih b. Ahmad b.'Abd Alläh
al-'Igli erhielt' und in seinem Tahdib al-tahdib durchgehend zitiert. Auf
dieses Buch, das der Sohn erst in Aträbulus im Jahre 257/870 erhielt
{Bagdad, 9/214,7), weist noch al-Dahabi als ein nützliches Werk über
^arh wa-ta'dil (Tadkira, 560) hin.
Die Riwäya des Buches ist hier mit dem Namen des Ahmad b. Mu'tib
b. Abi 1-Azhar, Abü Öa'far (st. Dü 1-Qäda276 oder 277/Febr. 890-891 )*
verbunden, der in Nordafrika vor allem durch die Überlieferung der
Schriften des 'Igli bekannt geworden ist: sami'a min Abi l-Hasan al-Küfi
Qami'a mä 'indahu (Aghlabides/TAL,Bi 255). Wahrscheinlich während
seiner ausgedehnten Studienreise in den Osten und nach Medina kam er
mit al-'Igli in Aträbulus zusammen und brachte sein Werk nach Qaira¬
wän. Abü l-'Arab lobt ihn ausdrücklich als Kenner des Hadit und der
Traditionarier — ein in Qairawän nicht alltägliches Phänomen. Die
■» Über ihn siehe: GAS, I, 143; al-§afadi: al-Wäfi bil-wafayät. Bd. VII. Ed.Ihsän 'Abbäs. Wiesbaden 1969, S. 79-80.
' Siehe Ibn Hagar: Fihrist marwiyät Saihinä. . .Ibn Ha^ar al-'Asqaläni. Ms.Berlin 10213 (11272), fol. 86b-87a.
*■ Über ihn siehe: Aghlabides/T ai.bi, 255-60; Dibä^, 1/147; Ma'älim, 2/177-180; Ben Cheneb, 138-39; M. Talbi, &nirat 312 u. 317.
Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 515
Beschäftigung mit Hlm al-hadit und Hlm al-ri§äl hatte in der ansonsten
sehr regen Gelehrsamkeit in der Stadt wenig Platz; nur ein kleiner Kreis
scheint sich mit dieser Disziplin befaßt zu haben. Die Gelehrten Qaira-
wäns treten in jener Zeit vor allem als Fuqahä' in Erscheinung, die sich
um das Hadit nur wenig kümmerten, sich mit Isnaden nicht auseinan¬
dersetzen wollten, sondern — als praxisbezogene Juristen — eher das
Verständnis einer Rechtsfrage (mas'ala) förderten.
Der berühmte Rechtsgelehrte Muhammad b. Ibrähim b. 'Abdüs (202/
817-260/874 - GAS, I, 473-74) ist einer derjenigen Fuqahä' in Qaira¬
wän des 3. Jhdts. gewesen, der mehr Wert auf das Verständnis einer
aktuellen Rechtsfrage und ihre Beantwortung legte als auf die Kenntnis
der Namen von Prophetengefährten, den Vermittlern juristischer Nor¬
mativen. Sein Ratschlag an seine Schüler: ifliam hädihi l-mas'ala fa-
innahä anfa'u laka min ma'rifat ism Abi Huraira (wa-fi riwäyat 'anHam-
mäs) hädä ahabbu ilayya min ma'rifat ism Abi Sa'id al-Hudri\ zeigt ein¬
deutig, daß das Traditionsmaterial als Quelle der Rechtsfindung noch
damais keine unumstrittene Priorität genoß.
Diese Tendenz ist bereits in der Generation vor Mälik b. Anas im Kreis seiner
älteren Zeitgenossen in Medina zu beobachten. Ein altes Fragment aus demKitäb al-ha^§deti 'Abd al-'Aziz b.'Abd Alläh b. Abi Salama al-Mägiäün (st. 164/
780-81) ist kaum Aodi<-orientiert; seine Diktion entspricht weitgehend den spä¬teren ?;iMA?a^'ar-Werken des 3. Jahrhunderts d.H. Das Traditionsmaterial ist
schon hier entweder sekundär, oder aber erst in seinem Anfangsstadium vor¬handen. Deshalb die Kritik Mälik's am Werk al-Mägi§ün's: 'amila dälika kalä¬
man bi-gairi haditin wa-lau kuntu anä lladi 'amiltu la-bada'tu bil-ätärtumma Sadadtu dälika bil-kaläm (al-Tamhid, 1/86; Tartib al-madärik, 2/75). —
Zum Werk siehe: M. Muranyi: Ein altes Fragment medinensischer Jurisprudenzaus Qairawän. Wiesbaden 1985. (AKM).
Diese Einstellung zum Hadit und seinen Überlieferern beschränkte sich
sicherlich nicht nur auf Ibn 'Abdüs und seine Anhänger. Die Gelehrten
von Qairawän waren im allgemeinen keine muhadditün, die sich mit
Fragen der Überlieferungsmodalitäten auseinanderzusetzen pflegten.
Es gehörte wohl schon zu den Ausnahmen, wenn Qairawaner Gelehrte
sich dieser Wissenschaftsdisziplin widmeten. Einen Schüler des 'Igli
aus Qairawän, Mähk b.'Isä al-Qafsi, Abü 'Abd Alläh (st. 305/917) cha¬
rakterisiert der Lokalhistoriker al-Hu§ani (st. 361/971 - GAS, I, 363)
mit der beachtenswerten Bemerkung: lau 'äSa qalilan wa-imtadda bihi l-
' Aghlabides/TAL,m, 191; — überliefert durch seinen Schüler Luqmän b. Yüsuf(st. 319/931 — Ben Cheneb, 171), gekoppelt mit der Riwäya des Hammäs b.Marwän al-Qädi (st. S03/915 - Aghlabides/TALBi, 340-50). Vgl. M. Muranyi,Materialien, S. 68.
516 Miklos Muranyi
'wnru la-galaba 'alä ahli l-Qairawän 'ilmu l-hadif. Abü l-'Arab selbst
zählt ihn zu den 'ulamä' ashäb al-hadit bil-magrib {Bagdad, 4/214,6). Die
Mehrheit der Qairawaner Gelehrten waren eben an ra'y orientierte
Fuqahä', die in juristischen Fragen nur selten auf das Hadit zurückgrif-
fen'. Das Ergebnis dieser Haltung ist in den erhaltenen Fiqh-Büchern
aus jener Zeit gut attestiert'". Daher dürfte das Manuskript aus der
Bibliothek des Abü l-'Arab zu den seltenen Exemplaren dieser Litera¬
turgattung in Qairawän gezählt werden.
Die Eintragungen auf dem Titel- und Endblatt des Heftes lassen das
Alter der Kopie annähernd bestimmen; das Manuskript gehört zweifel¬
los zu den ältesten, gegenwärtig bekannten Schriften dieses Genres. Es
ist nach dem kitäb des Räwi Ibn Mu'tib, wahrscheinlich noch zu seinen
Lebzeiten, in der zweiten Hälfte des 3. Jhdt. d.H. in Qairawän angefer¬
tigt worden. Dieses im Kolophon genannte kitäb des Ibn Mu'tib ent¬
stand wahrscheinlich in Aträbulus, in der ersten Hälfte des 3. Jhdts.
d.H., nach der Flucht al-'Igli's vor der mihmi {um 218/833 — Bagdäd, 4/
215,6-7) nach Nordafrika. Die Begegnung zwischen Ibn Mu'tib und al-
'Igli kam also in dieser Zeit — bis 261/975 — zustande.
Es ist nicht bekannt, daß al-'Igli selbst in Qairawän gewesen ist; wir
wissen nur, daß Qairawaner Schüler bei ihm in Aträbulus studierten.
Die Entstehung des kitäb von Ibn Mu'tib und die Abschrift des vorlie¬
genden Manuskriptes liegen somit nicht weit auseinander; letzteres
steht in unmittelbarem Kontakt mit dem wahrscheinlich beim Verfasser
angefertigten Original. Wenn man bedenkt, daß wir nur noch eine späte
Bearbeitung von al-'Igli's Werk - u.d.T. al-Tiqät (GAS, I, 143) - aus
dem frühen 9. Jhdt. d. H. besitzen, ist dieses alte Heft aus Qairawän von
besonderer literarhistorischer und überlieferungsgeschichtlicher Be¬
deutung.
* Ben Cheneb, 174; Aghlabides/Yx-Lm, 397.
' Siehe z.B.: wa-käna l-aglab 'alaihi hafz ra'y AShab wa-fiqhihi: Tartib al-madärik (Bekir), 2/21 — über Sa'id b. Hassän al-§ä'ig (st. 236/850). —
käna. . .'äliman bil-ra'y mutafanninan hädiqan bil-kaläm fi masä'il: Tartib al-
madärik (Rabat), 4/456 — über Yahyä b. Ayyüb b. Hälid b. Hayyän (st. gegenEnde des 3. Jh. d. H.). Siehe auch meine Materialien, S. 97. — Daß nordafrika¬
nische Gelehrtenkreise mehr Interesse liir Fiqh als für das Hadit gezeigt haben,erwähnt noch al-Huäani in einem lehrreichen Bericht über den Traditionarier
Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (siehe unten Anm. 16): sami'tu ba'eja l-Suyüh wa-dukira fadlu l-tafaqquh 'alä katrati l-riwäya wa-^am'i l-ahbär (!) fa-qäla hädä l-
Samädihi 'alä katrati ^am'ihi wa-'adadi riwäyatihi (Ben Cheneb, 107).
Siehe hierzu meine Materialien zur mälikitischen Rechtsliteratur, S. 67-69 u.78-79.
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 517
Inhaltlich hietet das Manuskript allerdings kaum Neues; es ist eine
Sammlung von Namen bekannter und weniger bekannter muhadditün,
versehen mit den üblichen Prädikaten des ^arh wa-ta'dil als tiqa, da'if
al-hadit, salih, matrük, lä ba'sa bihi, teilweise mit dem Hinweis rawä 'an /
wa-yarwi 'anhu, kutiba 'anhu / yuktabu 'anhu usw., etwa in der Diktion
des Kitäb al-tänh wal-'ilal von Yahyä b. Ma'in (158/775 - 233/847 -
GAS, I, 106-7) in der Riwäya von Abü '1-Fadl al-'Abbäs b. Muhammad
al-Düri (st. 271/884)". In diesem Frühstadium der Traditionskritik
sind solche Listen nichts anderes als trockene Lektüre gewesen und
dienten überwiegend dem Zweck, Traditionarier mit einem der Qualifi¬
kationsmerkmale zu versehen. Über ihre Lebensumstände sagen diese
Sammlungen nichts, oder nur sehr wenig aus. Bei al-'Igli erfahren wirnicht einmal ihre Lebensdaten. Auch die innere Struktur dieser ersten
Schriften des ^arh wa-ta'dilist noch etwas lose; sowohl al-'Igli im vorlie¬
genden Heft als auch Ibn Ma'in in seinem oben genannten Werk ordnen
die Listen nach Ländern bzw. nach Städten an. Innerhalb dieser Anord¬
nung ist die Liste nicht alphabetisch zusammengestellt, was das Auffin¬den von bestimmten Traditionariern erheblich erschwert.
Parallelstellen zu den Belegen des Manuskriptes bei Ibn Hagar, der in
seinem Tahdib al-tahdib al-'Igli in extenso zitiert, koimten wider Erwar¬
ten nicht gefunden werden. Im Manuskript ist oft um einiges mehr
erhalten als bei Ibn Hagar, der — al-'Igli exzerptierend — nur die Prädi¬
kate des ^arh wa-ta'dil wiederholt. Es kommt auch vor, daß in der Vita
eines muhaddit bei Ibn Hagar jedweder Hinweis auf al-'Igli fehlt, obwohl
jener im Manuskript angeführt ist'^. Manchmal liegen sogar zwei ver¬
schiedene Nachrichten über denselben muhaddit vor; über Man§ür b.
Zädän al-Wäsiti sagt al-'Igli im Manuskript folgendes: wäsiti tiqasakana
l-Ba^ra sami'a min al-Hasan wa-Ibn Sirin wa-gairihim. (sie) wa-käna
" al-Dahabi erwähnt dieses ri^äl-Werk in der Überlieferung von al-Düri wie
folgt: wa-kitäbuhu fi l-ri§äl 'an Ibn Ma'in rnu^allad kabir näfi' yunabbi'u 'an basa-rihifi hädä l-Sa'n (Tadkira, 579). — Ibn Hagar benutzt das Werk in dieser Riwä¬ya, wenn er die Passagen mit wa-qäla l-Düri 'an Ibn Ma'in in seinem Tahdib al-
tahdib einleitet. Er hat das Bueh u. d. T. Ta'rih Yahyä b. Ma'in 'alä l-ri^äl in dieser
Riwäya erhalten; siehe sein Fihrist (vgl. Anm. 5) fol. 91 a. — Das Manuskript istin der Zähiri3'ya-Bibliothek, rnajniü' 112 erhalten (GAS, I, 107) und umfaßt die
muhadditün von Mekka (fol. 1 b) , Medina (fol. 25 b) , Kufa (42 b) , Syrien, Ägyptenund al-öazira (fol. 151b — Ende) in insg. elf a^zä'.
Siehe z. B. 'Iyäd b. Himär b. Abi ffimär: Tahdib, 8/200. Im Ms.: rawä 'anhuMutarrif riwäyatahu 'an al-nabiyy 'alaihi l-saläm haditain au taläta. Oder: Mälik
b. Dinär al-Sulami: Tahdib, 10/14-15. Im Ms. lesen wir: Mälik b. Dinär yuknä
Abä Yahyä wa-käna warräqan yaktubu l-masähif wa-käna zähidan 'äbidan qalil al-hadit tiqatan.
518 Miklos Muranyi
yahtimu l-qur'äna mä baina l-^uhr waL-'a^r wa-yahtimuhu mä baina l-a^r
wal-'iSä'. Bei Ibn Hagar lesen wir: wa-qäla l-I^li ratlun säli^un
muta'abbid Icäna tiqatan tabatan wa-lcäna sari'a l-qirä'a wa-käna yuliibbu
an yatarassala fa-lä yastafi'u^^, was mit dem ersteren Beleg nur teil¬
weise inhaltlich verwandt ist. Wichtiger als kleine inhaltliche Abwei¬
chungen zwischen dem Manuskriptbeleg und Ibn Hagar's Tahdib —
deren Ursache in den verschiedenen Riwäyät des Werkes begründet
sein dürfte — erscheint mir die unterschiedliche Klassifizierung eines
und desselben muhaddit durch al-'Igli. Über Huäaim b. Baäir, Abü
Mu'äwiya lesen wir im Manuskript: tiqatun katiru l-hadit tiqa käna min
huffä?i l-hadit käna yursilu. Dagegen lautet der Beleg bei Ibn Hagar: wa-
qäla l-'I^li HuAaim wäsifiyyun tiqa wa-käna yudallis^'*. Dies stimmt mit
den Meinungen anderer Traditionskritiker überein, die ihm tadlis, nieht
jedoch die Verbreitung von maräsil vorwerfen. Solche Differenzen sind
in der Traditionskritik nicht unerheblich und sollten bei der wünschens¬
werten Herausgabe dieses Heftes vermerkt werden.
" Tahdib al-tahdib. 10/306. - al-Maqdisi, 'Abd al-Ganiy b. 'Abd al-Wähid (st.
600/1203 - GAL. II. 356; Suppl. I. 605), auf dessen al-Kamälfiasmä' al-ri^älmder Bearbeitung von Abü 'l-Haggäg al-Mizzi (st. 742/1341 - GAL.II.64) u.d.T.
Tahdib al-kamäl sieh Ibn Hagar al-'Asqaläni in seinein Tahdib al-tahdib stützt,referiert den obigen Passus ebenfalls, allerdings nicht nach al-'Igli, sondern
nach Ibn Sa'd: käna tiqatan tabatan wa-käna sari'a l-qirä'a wa-käna yuridu yata-rassalu fa-lä yastafi'u. . .. Siehe al-Maqdisi, Ms. Berlin, 9925, fol. 129 a —so aueh
Ibn Sa'd, VII/2. 60, — in identischer gramm. Konstruktion, ohne die Partikel an.Es scheint, als ob der fragliehe Passus bei Ibn Hagar nicht dem tabaqät-Werk.des 'Igli, sondern dem des Ibn Sa'd entnommen worden wäre. Vielleicht irrt sich
Ibn Hagar in seiner Quellenangabe; denn bei al-Maqdisi, dessen Werk er aus¬
wertet, geht derselbe Beleg auf Ibn Sa'd zurück. Möglich wäre noeh die Über¬nahme des Abschnittes bei Ibn Sa'd durch al-'Igli; überlieferungsgeschichtlichkann dies jedoch nicht bestätigt werden.
Tahdib al-tahdib, 11/61. Siehe auch Mizän, 3/257-58. Siehe auch die
Bemerkung von al-'Igli über Muhammad b. Wäsi' b. öäbir in Tahdib, 9/499-
500: 'äbidun tiqatun wa-läkin buliya bi-ruwät sü'in im Vergleich zum Beleg imMs., wo sein Urteil wesentlich günstiger ausfällt: ra^l sälih zähid näsik minhiyäri l-näs wa-afädilihim wa-laisa bi-katiri l-hadit wa-huwa tiqa sähibu svnnatin
wa-hairin 'urida 'alaihi qadä' l-Basra wa-abä. al-Maqdisi, fol. 162 a (siehe Anm.
13) referiert nach al-'Igli ebenfalls tiqatun käna yudallisu, die wohl die ursprüng¬
liche Version des Urteils gewesen sein dürfte. Denn auch naeh al-Hatib al-Bag¬dädi heißt es an derselben Stelle bei al-Maqdisi: wa-qad dallasa Huiaim 'an öäbiral-öu'fi wa-gairihi min maSäyihihi ahädita katiratan (so auch: Bagdäd, 14/86-87). Möglicherweise ist die Variante yursilu auf einen Abschriftfehler im Qaira-
wäner Manuskript zurückzuführen, da alle anderen Belege eindeutig ein yudal¬lisu verzeichnen.
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 519
Wie wenig Ibn Hagar's Tahdib al-tahdib bei der Rekonstruktion der
von ihm benutzten Schriften verläßlich ist, zeigt die im Manuskript refe¬
rierte Passage über Sulaimän b. Tarhän al-Taimi (st. 143/760 — GAS, I,
285-86), wo es heißt: Sulaimän b. Tarhän yuknä Abä l-Mu'tamir wa-
käna rajulan sälihan tiqa tabat wa-käna yaqifu 'inda 'Ali tva-'Utmän wa-
käna Ayyüb al-Sahtiyäni munäfiran lahuß hädä wa-hä'ulä'i l-arba'a yaf-
haru bihim ahlu l-Ba$ra / wa-yunvä 'an Sufyän al-Tauri annahu qäla
ra'aytu bil-Basra arba'atan lam ara bil-Küfa mitlahum ya'ni Ayyüb al-
Sahtiyäni wa-Ibn 'Aun wa-Yünm b.'Ubaid wa-Sulaimän al-Taimi wa-
kulluhum mawäli laisa fihim min al-'arab ahadun.
Ibn Hagar referiert al-'Igli lediglich mit den Worten: täbi'i tiqa fa-
käna min hiyär ahli l-Ba^ra ( Tahdib, 4/202). Bei ihm ist der Passus nach
Sufyän al-Tauri stark gekürzt erhalten: qäla l-Tauri huffäz al-Ba^ra
taläta wa-dakarahu fihim. Diese drei — und nicht vier wie bei al-'Igli —
werden dann, ebenfalls nach al-Tauri in der Riwäya von Ibn al-Mubä¬
rak, bei Ibn Abi Hätim und ähnlich bei al-Dahabi namentlich angeführt.
Allerdings erscheint Sulaimän b.Tarhän in einer ganz anderen Gesell¬
schaft: qäla Ibn al-Mubärak 'an Sufyän qäla: huffäz al-Basriyyin taläta
Sulaimän al-Taimi wa-'Ä^im. al-Ahwal wa-Däwüd b. Abi Hind iva-'Ä^im
ahfazuhum (Tadkira, 151; vgl. al-öarh wal-ta'dil, 2/1, 124).
Neu ist bei al-'Igli femer der Hinweis, daß Sulaimän b Tarhän keine
Entscheidung über die Priorität von 'Ali bzw. 'Utmän fällen wollte — im
Gegensatz zur Nachricht bei Ibn Sa'd (VII/2. 18) und nach ihm bei Ibn
Hagar. Rückschlüsse auf die von Ibn Hagar benutzten Schriften von
al-'Igli sind angesichts inhaltlicher Differenzen, die den Kern des ^arh
wa-ta'dil berühren, nur sehr begrenzt, wenn überhaupt möglich.
Kontroverses ist selbstverständlich nicht nur beim Vergleich der PrimärqueUe
mit ihren Exzerpten bei Ibn flagar — etwa im Tahdib al-lahdib oder im Lisän al-mizän — festzustellen. Die 'ihn aZ-n^äi-Literatur liefert zahlreiche Beispiele für
sehr unterschiedliche Beurteilungen eines und desselben muhaddit, deren Ursa¬chen von Fall zu Fall aufzuklären sind. Welche Überlegungen bei der Qualifizie¬
rung von Traditionariern in der i/arfi/-Kritik die entscheidende Rolle gespielthaben, ist nur selten direkt erkennbar. Däwüd b. al-IJu§ain al-Umawi al-Madani
(st. 135/752) ist für die Hadit-Kr\t\k als Härigit, 'Ibädit bekannt, bei dem sein
Gesinnungsgenosse 'Ikrima Unterschlupf fand und ihm Hadite nach Ibn 'Abbäs
weitergab. Aber nur selten ist seine politische Gesinnung für seine Zuordnungauf der Wertungsskala des 'ilm al-ri^äl ausschlaggebend gewesen; während al-
Sägi ihn als munkar al-hadil muttaham hi-ra'y al-hawäri^ verurteilt (Ibn Hagar:
Hady al-säri. Ed. Muhibb al-DIn al-Uatib. Kairo, o.J., S. 401), Ihn al-öauziihn in seiner Sniiimlung der dii'afn' anführt (Ms. Azhar. hadit 148. fol. 61 b). giltüber ihn einschränkend auch : mä rawä 'an 'Ikrima Ja-munkar — so 'Ali b. al-
Madini bei Ihn Hagar (Tahdib, 3/181 — vgl. auch Taqrib al-tahddj 1/231: tiqa(sie! — M. M.) illä fi 'Ikrima. . .. Indifferent sind dagegen die Prädikate wie layyin(Abü Zur'a) , laisa bihi ba's (al-Nasä'i) und lä yahmadüna haditahu (al-öüzagäni —
520 Miklos Muranyi
siehe Ibn Hagar: Hady al-säri, S. 401; Tahdib, 3/181-82; Mizän, 1/317). Eine
interessante Belegstelle im Kitäb al-ta'rih wa-'l-'ilal (Ms. Zähiriyya, ma^mü'112, fol. 28 b) zeigt, daß Yaliyä b. Ma'in wesentlichen Anteil an seiner positivenBeurteilung als tiqa gehabt haben muß: qäla Yahyä iva-qad rawä Mälik 'an Dä¬
wüd b. Husain / qultu (d.i. Abü '1-Fadl al-Düri, Schüler und Räwi des Ibn Ma'in)lahu Däwüd mä. taqülu fihi? qäla (Ibn Ma'in) tiqatun / qäla Abü 'l-Fadl wa-qadkäna 'indi anna Däwüd da'if hattä qäla Yahyä tiqatun (vgl. gekürzt bei al-Dahabi,Mizän, 1/317). Die Begründung für seine Beförderung von da'if zu tiqa in der
Zeit von Ibn Ma'in liefert sein Nachfolger Abü Hätim: laisa bil-qawiyyi wa-lauläanna Mälikan rawä 'anhu la-turika hadituhu (Tahdib, 3/181). Und ähnlich, aber
sich jetzt nicht mehr auf Mälik allein beschränkend, heißt es nach Ibn 'Adi: ma¬libu l-hadit idä rawä 'anhu tiqatun. Damit erhält er von seinen unmittelbaren
Nachfolgern — wohl nieht nur von Mähk allein — Rückendeckung. Daß seine
Hadite allen Kriterien des §arh wa-ta'dil standgehalten haben sollen, bestätigendie Worte käna li-an yahurra min al-samä' ahabb ilaihi min an yakdiba fi l-hadit,die angeblich sc^hon Mälik selbst formuhert haben soll ( Tamhid, 2/310). Das von
Däwüd b. al-Hußain überlieferte Material soll nicht ohne jede Prüfung abgelehntwerden; hierbei hat die Traditionskritik darüber zu entscheiden, welches der
von ihm tradierten Hadite denen der tiqät und atbät entspricht: haddata 'an al-tiqät bimä lä yuSbihu hadita l-atbät yagibu mu^änabatu riwäyatihi — heißt es naeh
Ibn Hibbän (Ibn al-öauzi, a.a.O.), der die kompromißlose Ablehnung seiner Tra¬
ditionen mit der Begründung verurteilt, Däwüd b. al-Hu§ain sei kein engagierterHärigit gewesen: käna yadhabu madhaba l-Surät wa-käna man taraka haditahu'alä l-ipläq wahama li-annahu lam yakun bi-dä'iyatin {Tahdib, 3/182). Dies und
vor allem die Tatsache, daß spätere unumstrittene Größen der Traditionswis¬
senschaft nach ihm überlieferten, wird der Grund für seine Qualifizierung alstiqa — so Ibn Ma'in, Ibn Sa'd und al-'Igli — gewesen sein. Zweifellos hat diese
Entwicklung der Muwafta' des Mälik b. Anas positiv beeinflußt, in dem er als
Saih Mälik's mehrfach in Erscheinung tritt, allerdings kein einziges mal in dem
Isnäd Däwüd — 'Ikrima — Ibn 'Abbäs, welchen die Traditionskritik kompromi߬los verurteUt.
Das n^äi-Werk von al-'Igli hat auch in der tahaqät-hWßTatvLT des isla¬
mischen Westens Spuren hinterlassen. Dies zeigen einige Belege bei al-
Qädi 'Iyäd al-Yah$ubi, der al-'Igli's Meinungen über manche muhaddi¬
tün der Mälikiyya in seinem mälikitischen tabaqat-WeTk zitiert. In wel¬
cher Riwäya er auf al-'Igli zurückgreifen konnte, ist jedoch nicht fest¬
stellbar; in seinem mai?/aÄa-Werk, im Kitäb al-Gunya, in dem er diejeni¬
gen Werke aufzählt, die er bei seinen Lehrern gehört hatte, fehlt jeder
Hinweis auf die hadit-kritische Schrift von al-'Igli. Er referiert ihn unter
den inkonsequent angegebenen Namen als Ahmad b.'Abd Alläh al-Küfi,
Ahmad b. Sälih al-Küfi, Ahmad b.'Abd Alläh b. Sälih, oder einfach als
al-KüfiDiese Fragmente beziehen sich nur auf einige muhadditün von
Tartib al-madärik (ed. Rabat), 3/14, 17, 32, 134, 200, 202, 205, 220, 232,
282, 364, 373, 374; 4/18,39. Die Belege beziehen sich ausnahmslos auf muhad¬ditün des islamischen Ostens.
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 521
Medina. Basra, Syrien und Ägypten. Äußemngen von al-'Igli über die
Gelehrten seiner Wahlheimat Ifriqiyä im Sinne des ^arh wa-tädil sind
in den mir bekannten Quellen dagegen nicht erhalten; nur an einer
Stelle erwähnt er zwei Traditionarier — Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi
(st. 225/839) und 'Abbäs b. al-Walid al-Färisi (st. 218/833) - als die
einzigen muhadditün von Nordafrika. Der primäre Beleg ist bei Abü 1-
'Arab — nach Mälik b. 'Isä (siehe oben, S. 515) — al-'Igli — erhalten'* und
erscheint, allerdings ohne diese Quellenangabe, auch bei al-Qädi 'Iyäd
{Aghlabides/TAL,Bi, 142). Die überwiegende Mehrheit bilden hier die
Fuqahä', nicht die Traditionarier; und praxisbezogene Juristen werden
nicht nach den Kriterien des ^arh wa-ta'dil beurteilt.
Das zweite Fragment aus der Bibliothek des Abü l-'Arab ist ebenfalls
der literarischen Gattung des 'ilm al-ri^al zuzuordnen und stammt
ursprünglich aus Ägypten.
Ms. Nr. 1505
3 fol. 20 X 15 cm, etwa 25 Zeilen / Blatt, dünnes, stark beschädigtes
Pergament {raqq).
Erhalten ist unter dieser Nummer fol. 1 recto und vei'so, femer eine
Lage aus der Mitte einer kurräsa, auf beiden Seiten beschrieben.
Titelblatt (fol. 1 recto):
Auch dieses Fragment ist ein ri^äZ-Werk, dessen Titel allerdings nir¬
gends nachweisbar ist. Das Heft ist, wie dies aus dem Titel eindeutig
abgeleitet werden kann, von Habib b. Na^r b. Sahl, Abü Na§r al-Tamimi
(201/816-287/900), dem Verwalter des mazälim-Amtes unter Sah-
" Ben Cheneb, 107: wa-qäla li Mälik b. 'Isä qäla li Abü 'l-Hasan al-Küfi lam
yakun 'indakum bi-Ifriqiyä mvlpadditun illä Müsä b. Mu'äwiya wa-Abbäs b. al-Fä¬risi (vgl. ebd. 254).
Anfang (fol. 1 verso):
Jlj JU«— .y öy^^ ^Jüä« ._j»-Le ^^i.^t.'.n y ^r-y^ u^"**"
JIj jv.»-J\ j_t j, *U1 j: jLväi Ui J»-
iiJ Jj^ ^ j, M J_t j, M J_f
PI 522 Miklos Muranyi
nün's Richteramt in Qairawän, überhefert worden. Er selbst ist als Ver¬
fasser eines Kitab al-Aqdiya, in dem er seine an Sahnün gerichteten
Rechtsfragen und dessen Antworten zusammengefaßt hat, ausge¬
wiesen". Das vorliegende Fragment hat Abü l-'Arab direkt von ihmerhalten.
Der Anfang des Heftes (fol. 1 verso) verrät über den möglichen
Ursprung dieses n^äi-Werkes etwas mehr; Habib b. Na§r gibt seine
unmittelbare Quelle mit Muhammad b. 'Abd Alläh b. 'Abd al-Rahim an.
Die darauf folgende Liste von Traditionariern mit den kurzen Hinwei¬
sen und Prädikaten der Traditionskritik tiqa / da'if / laisa bihi ba's / lä
yuktabu hadituhu u. a. geht direkt auf ihn zurück. Sein vollständiger
Name lautet Muhammad b. 'Abd Alläh b.'Abd al-Rahim b. Abi Zur'a al-
Mi§ri, Abü 'Abd Alläh Ibn al-Barqi (st. 249/863), bekannt auch als Abü
Zur'a al-Barqi. Als Faqih verkehrte er im Kreis bedeutender Rechtsge¬
lehrter seiner Zeit in Ägypten, verfaßte einen Kommentar zum Muhta¬
sar al-sagir des Ibn 'Abd al-Hakam (st. 214/829 - GAS, I, 467) mit
ergänzenden Hinweisen auf regionalbedingte ihtiläf des madhab. Die
Titel seiner Schriften lassen auf sein Interesse für die tabaqät- bzw. 'ilm
al-ri^dl- Literatur schließen. Er ist als Verfasser eines Kitäb ß ri^dl al-
Muwatfa', eines Kitäb ß garib al-MuwaUa', eines Kitäb al-ta'rih und
eines Kitäb al-tabaqät ausgewiesen. Sowohl al-Dahabi als auch Ibn Nä-
9ir al-Din al-Qaisi (777/1375-842/1438 - GAL, II, 92 und Suppl. II, 83)
kennen ihn als sähib Kitäb al-du'afä'^*.
Das hier vorliegende Handschriftenfragment, an dessen Anfang ihn
^abib b. Na$r direkt zitiert, steht wohl mit seinem (abaqät- bzw. du'afä'-
Werk in Verbindung. Es gibt im Manuskript keine weiteren Vermerke,
die auf eine andere Autorschaft schließen ließen. Nicht nachweisbar ist
allerdings der direkte Kontakt zwischen Ibn al-Barqi und Habib b.
Na§r, der im einleitenden Isnad (fol. 1 verso) durch die Formulierung
" lahu kitäb ma'rüf fi masä'ilihi li-Sahnün sammähu bil-aqdiya: Aghlabides/
Talbi, 278; Dibä^, 1/336. Über ihn siehe: Aghlabides/TAi.Bi, 277-78; Dibä^, 1/336; Ma'älim, 2/198; Ben Cheneb, 141. Dieses Kitäb al-Aqdiyaistim Qairawa¬
ner Bestand erhalten: siehe J. Schacht in: Arabica 14 (1967) 248-49; M.Muranyi, Materialien, S. 80.
" Tadkira, 569; Sadarät, 2/120; — über Ibn Nä?ir al-Din siehe auch meine
Materialien, S. 113-115. Zu Ibn al-Barqi siehe: Tartib al-madärik (ed. Rabat), 4/180-81; Dibä^, 2/167; Tahdib al-tahdib, 9/263; Sam'äni, 2/172; Muntazam, 5/
71: sein K.al-ta'rih soll sein Bruder Ahmad (st. 270/883) vollendet haben;Zirikli, 7/92-93. Ibn al-Faradi hat wohl aus diesem Ta'rih einen Teil gekannt:
wa^adtu dälika fi kitäbin näwalani-hi Ahmad b.'Abd AUäh b.'Abd al-Rahim fihidikr quddti 'l-hulafä' bi-'l-AruMus (Ibn al-Faradi, Nr. 1607 — in der Vita des
Yazid b. Yahyä b. Suraib al-Tugibi).
i
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 523
qäla (d.i. Habib b. Na§r) haddatariä Muhammad b.'Abd Alläh b.'Abd al-
Rahim attestiert wird. Ob Habib b. Na^r selbst als Verfasser dieses Hef¬
tes überhaupt infrage kommt, erscheint mir zweifelhaft; in diesem Falle
wäre er als Kompilator einer Schrift über 'ilm al-ri^äl anzusehen, der
u. a. auch Ibn al-Barqi als eine seiner Quellen referiert. Als solcher oder
als Verfasser eines eigenständigen ri^äl-Werkes ist er in den Biogra¬
phien nicht erwähnt.
Während Bibliotheksarbeiten in Qairawän bin ich auf ein weiteres
Fragment dieses Heftes gestoßen, das gegenwärtig in einer bisher nicht
katalogisierten Sammlung diverser Manuskriptreste ( Watiqa 1/mahfaza
l/Heft 4) liegt. Auch hier handelt es sich aber nur um eine Lage von vier
beschriebenen Seiten im Duktus des Heftes Nr. 1505. Hier sind die
Namen 'Abd Alläh, 'Ubaid Alläh und 'Abd al-Rahmän erfaßt, auf Seite 4
endet das ganze Heft {tamma al-kitäb) mit dem Namen Giyät b. Ibrä¬
him. Anschließend folgt ein Hörerzertifikat, aufgezeichnet bei Habib b.
Na§r: sami'ahu min Habib b. Na^rAbü Bakr { ? ) — der Rest ist unle¬
serlich'*". Darauf folgt eine spätere, sekundäre Eintragung aus dem
Muhtalif al-hadit des Ibn Qutaiba (st. 276/889 - GAL, I, 124-127).
Beide Heftreste gehören zusammen. Das fragmentarische Hörerzerti¬
fikat im letzteren erlaubt sogar Rückschlüsse auf das Alter des Werkes;
es ist noch zu Lebzeiten des Habib b. Na§r, also vor 287/900 auf¬
geschrieben worden und steht — wie das Ms. Nr. 1516 von al-'Igli — dem
Original zeitlich sehr nahe. Zwischen ihm und der Kopie liegt nur sein
direkter Räwi. Das Manuskript beinhaltet ausschließlich Namen von
Traditionariern mit Angabe ihrer Qualifikationsmerkmale durch die
üblichen Termini des 'üm al-ri^äl. Im Gegensatz zum Werkfragment
des 'Igli sind die Namen hier — wenn auch nur annähernd — alphabe¬
tisch angeordnet.
Daß beide Werkfragmente aus dem Bereich des 'ilm al-ri^äl im Besitz
von Abü l-'Arab al-Tamimi gewesen sind, ist sicherlich kein Zufall. Als
Verfasser des Kitäb tabaqät 'ulamä' Ifriqiyä wa-Tünis, das gegenwärtig
als das einzige, erhaltene fabagät-Werk von ihm bekannt ist" galt sein
In dieser fahaqa kenne ich nur einen Gelehrten, der die kunya Abü Bakr
trägt und bei Habib b. Na§r gehört hat: Muhammad b. Muhammad b. Wiääh,bekannt als Abü Bakr b. al-Labbäd, ist einer der berühmtesten Fuqahä' jenerZeit in Qairawän und erscheint in mehreren Hörerzertifikaten Qairawaner
Manuskripte. Er starb wie Abü l-'Arab 333/944. Siehe GAS, I, 476; TaHib al-madärik, 5/286-95; weiteres über ihn: Muranyi, Materialien, S. 50-51 u. 95-97.
" Ben Cheneb in: JA (1906), 343-60. — Herausgegeben von M. Ben Che¬
neb. Alger 1920. (Pubhcations de la Faculty des Lettres d'Alger. T. 51.) Ein
)Lm^
524 Miklos Muranyi
Interesse überwiegend dieser literarischen Gattung, die in seiner Hei¬
matstadt Qairawän nicht gerade zu den eifrig betriebenen Wissen¬
schaftsdisziplinen gehörte. In seiner Zeit war Qairawän Zentrum der
Jurisprudenz vor allem mälikitischer Prägung; zugunsten des Fiqh blieb
die Wissenschaft über ^arh wa-tädil und die Traditionswissenschaft
schlechthin im Hintergrund. Abü l-'Arab selbst spricht in seinem taba-
gä<-Werk auch von einem Kitäb tabaqät al-ri^äl^° und von einem Kitäb
tiqät al-ri^äl wa-4i'äfihim^\ die er verfaßt hat. Seine Nachfolger heben
dementsprechend hervor, daß er sich auf das Hadit und seine Vermittler
konzentrierte (wa-galaba 'alaihi l-haditu wal-ri^äl)^^ — dies wohl im
weiteres Werk von Abü l-'Arab, sein Kitäb al-mihan hat M. J. Kister in der
Handschriftensammlung von Cambridge vor einiger Zeit identifiziert undbeschrieben: JSS 20 (1975), 210-218; hrsg. in Beirut 1978.
'° Ben Cheneb, 29.
^' Ben Cheneb, 33.
" Tartib al-madärik (ed. Rabat) , 5/324. — Im islamisehen Westen, in Andalus
ist die Pflege der //adi<-Wissenschaft und Traditionskritik offensichtlich mehr
verbreitet gewesen als in Qairawän, auf dem Umschlagplatz östlicher Gelehr¬
samkeit nach al-Magrib und Andalus. Die 'ilm ai-n'^äZ-Literatur hat dort neben
der Auswertung importierter Materialien aus dem Osten auch eigenständigeProdukte aus der Peder von Gelehrten andalusischer Provenienz. Hälid b. Sa'd
al-Qurtubi (st. 352/963) ist als Verfasser eines K fi ri^äl al-Andalus ausgewie¬sen; welehen Stellenwert sein Werk genossen hat, läßt eine Aussage des Emirs
al-Mustansir bi-'Uäh von Cordova erahnen: idäfäharanä ahlu 'l-maäriq bi-Yahyäb. Ma'in fähamähum bi-Hälid b. Sa'd (Ibn al-Faradi, Nr. 398). Selbst der Qaira-wäner Abü l-'Arab übernahm Materialien zum Hadit und zur Hadit-Kritik aus
Andalus: über Qäsim b. Mus'ida al-Bakri (st. 317/929) äußert er sieh, in der
Uberlieferung seines Sohnes Tamim b. Muhammad, wie folgt: ra'aytu 'indahu 'il¬
man bi-'l-hadit iva-tamyizan lil-ri^äl fa-ahadtu 'anhu (Ibn al-Faradi, Nr. 1063;vgl. Tartib al-madärik, 5/247). — Als Verfasser eines n'^äi-Werkes und als Ken¬ner der Ruwäl des Mälik b. Anas ist 'Abd Alläh b. Muhammad b. Hunain al-
Kiläbi al-Qurtubi dureh seine Monographie ta'lif fi ma'rifat al-ri^äl wa-'ilal al-
hadit wa-fl- 'l-asmi'a min Mälik bekannt geworden ( Tartib al-madärik, 5/211-12;vgl. Ihn al-Faradi, Nr. 671). - Hasan b.'Abd Alläh b. Madhag (st. 318/930) istzwar kein Kenner der .^/arfif-Literatur gewesen, doch zeichnete er sich als Über¬heferer von Büchern des ^arh wa-ta'dil aus: wa-lam, yakun lahu baßarun bi-'l-
hadit wa-ma'rifatun bi-turuqihi 'alä annahu qad käna aktara min riwäyat kutub al-ri^äl fi-'l-ta'dil wa-'l-tar^ih (Ibn al-Faradi, Nr. 340).
Den Gelehrten Ahmad b. Sa'id b. Hazm b. Yünus al-Sadafi al-Qurtubi (st.350/961), der Studienreisen nach Mekka, Ägjrpten und Qairawän unternahm,
lobt Ibn al-Faradi (Nr. 142) wie folgt: sannafa ta'rihan fi 'l-muhadditin balaga fihi'l-gäyata; dieses n^öZ-Werk studieite dann Halaf b. Ahmad, Ibn Abi Ga'far (st.
Ramadän 393/Juli 1003 - Ibn al-Faradi, Nr. 418) unter dem Titel: al-Tärih al-
kabir fi-'l-ta'dil wa-'l-tar^ih (al-Humaidi: öadwat al-muqtabas, Nr. 411. Kairo1966; vgl. auch Nr. 214).
Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 525
Gegensatz zu vielen seinen Zeitgenossen, die — wie kurz angedeutet —
sich vor allem der Jurisprudenz widmeten.
Diese von Abü l-'Arab genannten Schriften sind bisher nicht aufgefun¬
den worden; es ist allerdings möglich, daß sie — wenn auch nur fragmen¬
tarisch — in der großartigen Handschriftensammlung von Qairwän,
unter den zahlreichen ungeordneten Blättern verborgen liegen. Sein
Kitäb al-4u'afä' — wohl identisch mit dem oben erwähnten Kitäb tiqät al-
ri^äl wa-(}i'äßhim — zitiert noch Ibn Hagar al-'Asqaläni sowohl im Tah¬
dib al-tahdib als auch im Lisän al-mizän. Er unterscheidet sogar zwi¬
schen dem du'afä'-Werk und einem gewissen Ta'rih al-Qairawän^^ .
Vielleicht ist das letztere Buch mit seinem Kitäb al-ta'rih in zehn a^zä'
identisch, das in der Liste der Schriften des Abü l-'Arab mehrfach ange¬
führt wird und als Zusammenfassung seiner Schriften über 'ilm al-ri^äl
angesehen werden dürfte. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang
nur, daß sein Zeitgenosse al-Hu§aiü lediglich das Kitäb tabaqät ri^ällfri-
qiya^^ des Abü l-'Arab, lücht aber seine anderen n'^äZ-Werke nennt.
Die hier vorgestellten zwei Werkfragmente aus der Privatbibliothek
des Abü l-'Arab al-Tamimi bestätigen sein reges Interesse für die 'ilm al-
Das Kitab al-du'afä' wa- 'l-matrükin von Muhammad b. al-Nadr b.Salama b.al-öärüd (st. 291/904) gab Ahmad b.'Abd Alläh b.Muhammad Ibn al-Bägi (st. um400/1009) an seinen Schüler Ibn 'Abd al-Barr in Andalus weiter (al-Humaidi,
a.a.O. Nr. 223); sein Interesse flir diese Wissenschaftsdisziphn und fiir i^'i^Ä wird
andererorts auch bestätigt: käna yudäkiru bi- 'l-fiqh wa-yudäkiru bi- 'l-hadit wa-
'l-ri^äl (al-Pabbi: Bugyat al-multaniis. Nr. 423. Kairo 1967).
Als Importware sind die traditionskritischen Anmerkungen des Yahyä b.Ma'in (158/775-233/847 - GAS.1. 106-7) von Muhammad b. Ibrähim b. Sa'idIbn Abi 1-Qarämid überliefert und in einem Buch zusammengefaßt worden: lahu
ta'lifun ^ama'a fihi kalämaAbi Zakariyä' Yahyä b. Ma'in fi-lalätina ^z'an ahba-ranä bihi Abü 'Umar Ibn 'Abd al-Barr 'anhu (al-Humaidi, Nr. 17; al-Pabbi, Nr.
46).
Ebenfalls ein (Zw'a/ä'-Werk aus dem Osten, das Kitäb al-Lhi'afä' wa-'l-matrükin des Abü'l-Fath al-Azdi (st. um 367/977 - GAS.1. 199-200) überheferte
ein gewisser Ibrähim b. Hiikr nl-MiUisi|j in .Andalus (al-Huiiiiüdi. Nr. 268).Als //a<iii-Kenner, die sich auch mit 'ihn al-ri§äl beschäftigt haben, sind im
Westen des 4. Jh. d.H. mehr Gelehrte ausgewiesen als in Qairawän: Muham¬mad b.'Abd Ahäh al-Balawi al-Qurtubi (st. 370/980 - Ihn al-Faradi, Nr. 1327);'Abd AUäh b. Ismä'ü b. Harb al-Qurtubi (st. 380/990 - Ibn al-Faradi, Nr. 748);
Muhammad b. Ahmad, Ibn Mufarrig al-Qurtubi 315/927-380/990 - Ibn al-
Faradi, Nr. 1360) und Ismä'il b. Ishäq b.Ibrähim (305/917-384/994): käna'äli-
man bi-'l-ätär wa-'l-sunan häfi^an li-'l-hadit wa-asmä' al-ri^äl wa-ahbär al-muhadditin. . . (Ihn al-Faradi, Nr. 221).
Tahdib al-tahdib, 2/159: wa-dakarahu Abü l-'Arab fi l-du'afä' wa-dakara fita'rih al-Qairawän. . . Siehe auch Lisän, 1/127; 5/36; vgl. GAS. 1.357.
^■^ Ben Cheneb, 173.
36 ZDMG 136/3
526 Miklos Muranyi
n^äZ-Literatur. Sie sind vielleiciit in seinen bisiier unbekannten (.abaqät-
Werken, die dann auch die muhadditün des islamischen Ostens behan¬
delt haben können, verarbeitet worden.
Die Existenz einiger Fragmente aus dem Bereich des 'ilm al-ri^äl in
orientalischen Bibliotheken ist bekannt. Zwar sind sie im Vergleich zu
den hier vorgestellten Werkfragmenten aus Qairawän wesentlich jünge¬
ren Datums, doch würde ihre literarhistorische Einordnung und Struk¬
turanalyse unsere Kenntnisse über die Genesis dieser 'Hilfswissen¬
schaft' der ÄadiZ-Literatur grundlegend erweitem. Die kritische Edi¬
tion dieser Schriften^' mit gleichzeitiger Synopse entsprechender Paral¬
lelbelege bei Ibn Abi Hätim, Ibn Hibbän, al-Buhäri, vor allem aber bei
Ibn Hagar und al-Dahabi wäre nicht nur eine lohnende, sondern eine
unabdingbare Vorarbeit zur Untersuchung der 'ilm aZ-n^äZ-Literatur
des 2. und 3. muslimischen Jahrhunderts^'.
F. Sezgin hat in der GAS, I. eine Vielzahl solcher Manuskripte erstmaligbekanntgegeben, die bisher nicht herausgegeben worden sind. Hierzu gehörendie Schriften von Yahyä b. Ma'in (GAS, I, 107) von al-'Uqaih (ebd. I, 177), von
Ibn Qattän (ebd. I, 198-99), al-Däraqutni (ebd. I, 207-9), Abü l-Qäsim al-Balhi(ebd. I, 622-623) und andere. Das Kitäb al-ta'rih von Ibn Abi Haitama, Ms.
Qarawijryin, Fäs, Nr. 244 ist ebenfalls ein ri^äl-Werk auf insg. 199 Blättern undbehandelt die muhadditün von Mekka, Yamäma, al-Yaman, Medina und Kufa
(GAS, I, 320 ist zu berichtigen). Hier wird wiederum 'Ah b. al-Madini (st. 234/
849 - GAS, I, 108) mehrfach zitiert. Zum Ms. siehe auch RIMA 22 (1976) 217,Nr. 256.
In letzter Zeit hat G. H. A. Juynboll den Versuch unternommen, die Ent¬
stehung der //arfiZ-Kritik darzustellen: Muslim Tradition. Studies on chronology,provenance and authorship of early hadith. Cambridge 1983. Dort bes. S. 134ff
(dazu siehe meine Bemerkungen in WI 23/24 (1984), S. 516-19). Angesichtsdes reichhaltigen Manuskriptmaterials alter n^äZ-Werke erscheint mir seineFeststellung, diese anhand von Ibn Hagar's Tahdib al-tahdib rekonstruieren zu
können (siehe S. 136) als viel zu optimistisch, ja unrealistisch. Allein das hiervorgestehte kleine Fragment von al-'Igli (siehe oben S. 513-21) bietet inhaltlich
manchmal mehr, als die entspeeht^nden Parallelbelege bei Ibn IJagar; uneinge¬schränkt gilt dies aueh für die Schriften von Ibn Ma'in, al-'Uqaili usw. Langwie¬rige und mühsame Manuskriptstudien sind daher einer längst überfälligen, adä¬quaten Analyse dieser literarischen Gattung der /ferfö-Wissenschaft vor¬
zuschalten. Zurückzugreifen ist vor allem auf diejenigen biographischen Werke,
die als Vorarbeiten zu Ibn Hagar's Tahdib anzusehen sind; sie sind in hadit- kri¬tischen Untersuchungen bisher stets unbeachtet geblieben, obwohl ihr literarhi¬
storischer Wert mit Hinblick auf die Entwicklung des 'ilm al-ri^äl unumstritten
sein dürfte. Das bereits erwähnte Kamäl fi. asmä' al-ri^äl des 'Abd al-Ganiy b.'Abd al-Wähid b. Surür al-Maqdisi (st. 600/1203) und seine Bearbeitung durchal-Mizzi (st. 742/1341) u.d.T. Tahdib al-Kamäl (siehe oben, Anm. 13), nicht
zuletzt aber das Tahdib al-tahdib/Muhtaßar Tahdib al-Kamäl von al-Dahabi (st.748/1349), von denen uns zum Teil ein lückenloses Handschriftenmaterial zur
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 527
Das dritte Werkfragment aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-
Tamimi gehört dem Genre der Hadit-LiteT&tur an. Es ist unter den hier
vorgestellten Manuskripten das kleinste Bruchstück überhaupt; erhal¬ten ist nur das Titelblatt einer kurräsa.
Ms. Nr. 108
1 Blatt, 26,5 X 15,5 cm; 39 Zeilen (fol. 1 verso); Pergament {raqq); am
linken Rand stark beschädigt.
Titelblatt (fol. 1 recto)
^,<A^My M J^, JC JU, iljL- M Jl >J1 J ^ ,W L. V
^'^^\ öLjot j kJ^ -"-^ ^j} '-^.'L" J* jl —s-L Jju\z}\, ^Ut-ol
tj-T*^' rr" ty. ui -"-+^1
Anfang des Heftes (fol. 1 verso):
Jl >-ll J 4.U^i] JC, ^,<A^My *U1 UJ j^)\ <UI
^b., j -Uj«. 4UI j>-c \J\ JC j\ 2J j, jL^ j, .Uliis- Lu. JLj, JjLj
:Jli ^.sL-iaJl -Lyi^ t/^>* Lj-l»- Jli
Jlä Jb^JI M j y_yr ^ |.jU ^1 j,; ^ ^1 J_^l ^> \j^], U;
jjy IJi^ JUi Uli S_,*iJI Iji» jjy Ja jUi jjjl iU |*L., *UI |Jj> *UI Jyj] JLlt US^
t^' ui J;"-' y.j^ '-^'-^ tr-::* >>. u—^'^ L?.ip-j .ojj ^ j^UaT V ,Xj
../i ,.:>UI ^1 0* ,>JI 4UI xj; u^ fj^' lj; crrj ü.*
Anschließend werden die verschiedenen {uruq zu dieser Tradition ange¬
führt, die ausnahmslos bei Ismä'il b. Abi Hälid — Qais b. Abi Häzim —
öarir b. 'Abd Alläh zusammeiüaufen. Dann in Zeile 33 steht ein Nach¬
trag des zu Beginn des Heftes genannten Räwi's mit dem darauf folgen¬den zweiten Hadit;
|,::.Ji:..l jli cic 4LII J^ aUI Jyj JUi U-l- j^ jj., J ij. J jlj
u-^'' ^.J ' J '{'A^l*) Jt»! j~^^ Jj J* ^
XJ- Uj'.;?- Jli '<~s- ^j; jUi- L'jj- Jli ^ j^U ^'j^, Jt» ■tr'>* J^-» '^-JJr'J
j) :J,ij (Jl-, ■lill J.« -OJI Jyj vr.otu- Jyj ^^gitll ö^j J, SjL»£ i:uj.u- Jli _,_uC j iUJ.1
Jli i:—» ^ jLi- UJ J.^ Jli j J..U Lij I Jl»-, . l^, Jj, ,,r-»-^' ^ J-° j'-^'
•jUc y ß^, J} -JW j_jj1^ J:^^! Utj.^
Verfügung steht (zum letzteren siehe Mss. Berlin 9933-9936; zu den anderenvgl. GAL, Suppl. I. 606 — mit weiteren Angaben), sind zunächst auf die dortbenutzten frühen n^öZ-Werke des 3. Jahrhunderts d.H. zu überprüfen.
Es wäre sicherlich eine lohnende Aufgabe, das gegenwärtig bekannte Hand¬schriftenmaterial dieses Geiu-es auf die bisher unerforschten Tendenzen bei der
Klassifizierung von muhadditün durchzuarbeiten. Als Fallstudie siehe meine
kurze Darstehung: Ein altes Dokument üher Haditfabrikationen in der frühen medi¬nensischen Jurisprudenz. In: Jähiliyya and Islamic Studies in horwur of M. J. Kis¬ter. In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam — (im Druek).
36*
m
528 Miklos Muranyi
Verfasser:
Muhammad b. Waddäh b. Bazi', Abü 'Abd Alläh al-Qurtubi (199/815-
286/899). Über ihn siehe GAS, I, 474-75; Tartib al-madärik, 4/435-
440. Werkmeister, S. 263-67. Als mälikitischer Jurist und muhaddit
ist er über die Grenzen von Andalus hinaus berühmt gewesen. Er unter¬
nahm zwei Studienreisen in den islamischen Osten; die erste im Jahre
218/833, die zweite, die nicht datiert ist, trat er wohl einige Jahre spä¬
ter an, weil er noch bei Sahnün b. Sa'id in Qairawän — also bis 240/854
— studieren konnte, dessen Mudawwana er dann in Andalus
verbreitete^'. Denn nur seine zweite Reise diente dem Zweck der wis¬
senschaftlichen Bildung — heißt es in seiner Vita; eine Feststellung,
deren Wahrheitsgehalt allerdings kaum überprüfbar ist.
Auf jeden Fall sind seine Studienreisen im Osten sehr fruchtbar gewe¬
sen; es ist sein Verdienst, die /farfif Gelehrsamkeit in Andalus mit der
Jurisprudenz verbunden zu haben. Als Überlieferer mehrerer fiqh-
Bücher ist er in seiner Heimatstadt Cordova berühmt geworden; die in
seiner Biographie erwähnten o^Z/Vers. usül Ibn Waddäh^^ stellen wahr¬
scheinlich die Sammlung seiner Schriften dar, die seine Schüler in Cor¬
dova überlieferten. Zweifellos galt sein Interesse vor allem dem Hadit;
sein Kitäb al-Qut'än — wie der Titel vermuten läßt — behandelte Hadite
mit lückenhaften Isnaden, die er wahrscheinlich auch kommentierte^'.
Das hier vorliegende Werkfragment, in der Liste seiner eigenen Schrif¬
ten stets angeführt^", ist dagegen eine Sammlung von vollständigen
Isnaden zum Hadit mit dem im Titel angegebenen Inhalt. Es bestätigt
" Ihn 'Atiyya, 52, 68, 86, 96.
Lisän, 5/416; Ibn al-Fara(Ji, Nr. 1518; Dibä^, 2/350. Er ist als ÄäM>ifolgen-der Werke ausgewiesen: Muwatta' in der Rezension von Yaljyä b. Yahyä, die erkorrigiert hatte; Tajsir al-Muwatta' yonlhnMva.&m (st. 259/873 — GAS, I, 473),
erhalten in Qairawän, Nr. 1054; das Kitäb al-Siyar von Abü Ishäq al-Fazäri (st.gegen 188/804 — GAS, I, 292), ein Werk über ^ihäd 'm der Riwäyaxon khn Mar¬wän al-Ma§§i§i (st. 240/854), erhalten in der Qarawiyyin-Bibliothek von Fäs
(darüber siehe M. Muranyi in: Jerusalem Studies in Arabic and Islam 6 (1985)und andere); siehe auch Werkmeister, 264-66.
Siehe Werkmeister, 264.
F. Sezgin führt das Werk an zwei Stellen an: I, 357 als Abschrift durch
Abü l-'Arab und I, 475 unter den Schriften des Ibn Waddäh. Das vorliegendeManuskript war jedoch niemals im Privatbesitz von H. Husni 'Abdalwahhäb.
Als solches ist es zuerst von Zirikli, 6/224, Abb. 923 (Titelblatt des Heftes)
ausgegeben worden. H- HusNi 'Abdalwahhäb hat seinerzeit einige Fragmentein der Moscheebibliothek von Qairawän auf Mikrofilme aufgenommen und
davon diese Aufnahme des Titelblattes Zirikli zur Verfügung gestellt. (Aus¬kunft von Ibrähim SabbCth im April 1983).
Fragmente aus der Bibliothek des Abu l-'Arab al-Tamimi 529
eindeutig das Interesse des Verfassers für eine — wie wir sahen — in Ifri¬
qiyä und in Andalus^' nur halbherzig gepflegte Wissenschaftsdisziplin.
Riwäya und Inhalt des Fragmentes
Abü l-'Arab al-Tamimi, Kopist und Besitzer des Heftes, übemahm diese
Äadii-Sammlung von seinem Lehrer Sa'id b. Sa'bän b. Qurra al-Hauläni
(st. 295/907); er ist auch als Überlieferer des Wä4ih al-sunanvon 'Abd
al-Malik b. Habib — durch die Vermittlung seines Sohnes 'Ubaid Alläh
b. 'Abd al-Malik — in Qairawaner Fragmenten ausgewiesen^^ Die
Abschrift des Heftes erfolgte im ausgehenden 3. Jhdt. d.H. in Qaira¬
wän, wo Sa'id b. Sa'bän lebte und wo auch der Kontakt zwischen ihm
und dem Verfasser Ibn Waddäh wahrscheiiüich zu lokalisieren ist. Die
Begegnung zwischen beiden Gelehrten ist vielleicht noch zu Lebzeiten
von Sahnün erfolgt, als Ibn Waddäh die Überliefemngsrechte zur
Mudawwana erhielt, um sie dann in Cordova zu tradieren.
Das Bmchstück dieser i^ac^iZ-Sammlung, deren ursprünglicher
Umfang nicht festzustellen ist, beinhaltet nur zwei Prophetendicta mit
Angabe diverser {uruq zur Tradition. Ahnliche Sammlungen gab es
schon früher, die dem Verfasser Ibn Waddäh als Vorbild gegolten haben
können; einer seiner Lehrer im Osten, Yahyä b. Ma'in, den wir bereits
als Traditionskritiker kennengelemt haben, soll über zwanzig Isnade
zum Haditß ru'yati Iläh gekannt haben. Etwas später hat dann al-Dära¬
qutni (st. 385/995 — GAS, I, 206-9) die turuq zu diesen Traditionen
gesammelt und darüber eine Abhandlung u.d.T. Kitäb ru'yat Alläh 'azza
wa-^alla^^ verfaßt. In Qairawän selbst ist eine ähnliche HaditSaxnm-
lung schon früher nachweisbar; Yahyä b. 'Umar al-Kinäni (213/828-
289/902)'''' ist als Verfasser eines Kitäb al-na?ar ilä Iläh tabäraka wa-
ta'älä yauma l-qiyäma bei al-Huäani (Ben Cheneb, 135) erwähnt. Ob
^' Siehe Anm. 9 und Dibäg, 2/163: käna l-gälib 'alaihi al-fiqh wa-lam yakunlahu 'ilm bil-hadit—üher Muhammad b. Hälid al-MartanU (st. 220/835); ähnlich:
Dibä^, 2/19 über 'Abd al-Malik b. Hasan ( st. 232/846). - Die Charakterisierung
des Äßbag b. Halil al-Qurtubi (st. 273/886) spricht fiir sich: käna mu'ädiyan lil-ätär laisa lahu ma'rifa bil-hadit Sadid al-ta'assub li-ra'y Mälik wa-ashäbihi wa-li-Ibn al-Qäsim min bainihim (Tartib al-madärik, 4/251; vgl. Ihn al-Faradi, Nr.247).
Siehe meine Materialien, S. 20 und dort Anm. 39.
" Siehe die Bemerkung von Ibn Hagar, Fath al-bäri, 13/434. Das Werk, dasauch das hier überlieferte Hadit beinhalten dürfte, ist erhalten: Ms. Escorial
1445 (Derenbourg, III); GAS, I, 207.
" Über ihn siehe GAS, I, 475; M. Muranyi, Materialien, 92-97.
530 Miklos Muranyi
seine Schrift unter dem Einfluß der vorliegenden Sammlung des Ihn
Waddäh stand, wissen wir nicht. Auch er, Yahyä b. 'Umar, untemahm
eine ausgedehnte Studienreise in den Osten, auf der er .{fadiZe mit dieser
Thematik gesammelt haben dürfte.
Ibn Waddäh's Sammlung ist eindeutig von den muhadditün des isla¬
mischen Ostens beeinflußt worden, in deren Kreis er in der ersten
Hälfte des 3. Jhdts. d. H. studiert hatte. Er verzeichnet insgesamt acht¬
zehn Isnade zum ersten Dictum, die auf Ismä'il b. Abi Hälid als erstes
gemeinsames Glied der Kette zurücklaufen; von ihm aus verläuft der
Isnad über Qais b. Abi Uäzim — 'Abd Alläh b. öarir — Prophet geradli¬
nig. Die zusammengestellten fwmg der Tradition stellen sich — soweit
im Original les- bzw. rekonstmierbar — wie folgt dar:
Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (siehe oben S. 521) — Waki' b. al-öarräh
(129/746-197/812 - GAS, I, 96-7)
al-IJasan b. 'Isä (st. 239-40/853-54 - Tahdib, 2/313-15) - Öarir b.
'Abd al-Hamid (107/725-188/803 - Tahdib, 2/75-77; Azmi, Studies,
144)
al-Hasan b. 'Isä - 'Abd Alläh b. Idris al-Audi (110/728-192/807 - Tah¬
dib, 5/144-46)
Abü Haitama Mu§'ab (?) - 'Isä b. Yünus (st. um 191/806 - Tahdih, 8/
237-40)
Hämid b. Yahyä (st. 242/856 - Tahdib, 2/169/70) - Sufyän b. 'Uyaina
(107/725 - 196/811 - OAS, I, 96)
(?) - Waki' b. al-öarräh
Muhammad b. Qudäma b. A'yun (st. um 250/864 - Tahdib, 9/409-10)
— öarir b. 'Abd al-Hamid
Muhammad (b. Qudäma ?) — Waki' b. al-öarräh
Abü l-Hasan b. Sälih (?) - Muhammad b.'Ubaid (st. 205/820 - Tahdib,
9/327-29)
( ? ) - ( ? ) - unleseriiche Zeile.
'Abd Alläh b. Muhammad (b. Abi Saiba, st. 235/849 - Tahdib, 6/2-4;
oder: Abü 'Umar al-Yamäni, st. 236/850 - Tahdib, 6/21-22) - Waki'
b. al-öarräh
( ? ) — ( ? ) unleserliche Zeile.
( ? ) - Ya'lä b. 'Ubaid (st. 209/824 - Tahdib, 11/402-3)
Muhammad b. 'Abd Alläh b. Numair (st. 234/848 - Tahdib, 9/282-83)
- ( ? )
Ibn Numair — Waki' b. al-öarrah
Muhammad b. Mas'üd (st. 247/861 - Tahdib, 9/438) - Yahyä b. Sa'id
al-Qattän 120/737-198/813 - Tahdib, 11/216-20)
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 531
Ibn Abi Maryam, d.i. Abu Bakr b. 'Abd Allah b. Abi Maryam (st. 256)
869 - Tahdib, 12/28-30) - Usaid (b. Yazid ? - Mizän 1/120?) - 'Abda
b. Sulaimän (st. 188/803 - Tahdib, 6/458-59)
Ibn Abi Maryam — Usaid (?) — Sufyän b. 'Uyaina
Die Tradition ist in Ifriqiyä Importware und — vielleieht erstmalig —
von Muhammad b. Waddäh vorgestellt worden. Nur eine Variante, die
erste am Anfang des Heftes, übemahm er von einer nordafrikanischen
Hadit-Autontät. von Müsä b. Mu'äwiya al-Samädihi (st. 225/839 —
siehe oben, S. 521). Ein nochmaliger Rückgriff aufihn erfolgt in Zeile 33
des Ms.: zäda Müsäß haditihi marratanß ähirihi. . .fa-qäla rasülulläh
sallä Uähu 'alaihi wa-sallam fa-in istafa'tum allä tuglabü 'alä salätin. . .
mit anschließender Berichtigung des lafz im Koranzitat: wa-qäla Müsä:
qabla l-gurüb — anstelle der unrichtigen Wiedergabe von Sur. 50,39 im
Hadit mit qabla gurübihä. Schon Su'ba b. al-Haggäg (st. 160/776 —
GAS, I, 92) war im Zweifel darüber, ob der Nachsatz mit dem Koranzi¬
tat ursprünglicher Bestandteil des Dictums gewesen ist'^. Müsä b.
Mu'äwiya geht dagegen davon aus, daß der Koranvers wa-sabbih bi-
hamdi rahbika. . . (nicht: fa-sabbih — wie im Ms.) der Stu*. 50,39 und
nicht Sur. 20,130, wo wa-qabla gurübihä steht, entnommen wurde. In
den musannaf- und musnad-V^erken des 3. Jhdts. d.H. sind beide
Varianten überliefert'", die auf die Stmktur des Hadites keine wesent¬
liche Wirkung hatten. Kontroverse Ansichten gab es jedoch über die
Zuordnung des ganzen Koranzitates, beginnend mit: tumma qara'a. . ..
Mit Verweis auf die Variante bei Muslim macht Ibn Hagar im lafz bei al-
Buhäri auf idrä§ dieses Nachsatzes aufmerksam; bei Muslim wird dies
durch die eindeutige Formuliemng: tumma qara'a öarir: wa-sabbih bi-
hamdi rabbika. . . usw. vermieden^'. Parallelbelege, in denen der Koran¬
zitat fehlt, sind vielleicht auf die Vermeidung der umstrittenen Stelle
des idrä^ abgestellt''*.
^' Ibn Hanbai, Musnad, 4/360 unten.
" Siehe z.B. Buhäri/Fo<A al-bäri, 2/Nr. 554; 573; Abü Däwüd, 2/277; Ibn
Hanbai, Musnad, 4/360; 362; 365-66.
^' Muslim, I. Nr. 633 in der Riwäya von Zuhair b. Harb — Marwän b. Mu'ä¬
wiya al-Fazäri (st. 193/808 — Tahdib, 10/96-98) im Gegensatz zur Äiwäya vonWaki' b. al-Garräh (ebd. Nr. 633/212), der auch in unserem Manuskript mehr¬
fach erscheint. Siehe Fath al-bäri, 2/Seite 34. Zu erwähnen ist allerdings, daßMarwän b. Mu'äwiya auch bei al-Buhäri (Fath al-bäri, 2/Nr. 554) mit dem laf?des hadit mudra^ erscheint. Die Korrektur erfolgte daher wohl erst bei seinen
Nachfolgern, hier bei Zuhair b. Harb (st. 234/848 - GAS, I, 107).
" Buhäri/FaZÄ al-bäri, 13/Nr. 7434-35; al-Humaidi, Musnad, 2/Nr. 799.
532 Miklos Muranyi
In der Angabe der turuq des Dictums in unserem Manuskriptfragment
überwiegen die irakischen muhadditün, vor allem Waki' b. al-Öarräh als
Quelle zweiten Grades für Ibn Waddäh. Da letzterer als Überlieferer
des Musannaf von Waki' durch die Riwäya von Müsä b. Mu'äwiya al-
§amädihi in andalusischen Gelehrtenkreisen ausgewiesen ist^', dürfte
das hier referierte Dictum, neben anderen Riwäyät, demselben entnom¬
men worden sein. Einige seiner direkten Quellen — wie Muhammad
b.Qudäma b.A'yun, Hamid b. Yahyä und Muhammad b.Mas'üd, ferner
'Isä b. Yünus als Quelle zweiten Grades — sind ursprünglich in den
Grenzmarken, tugür al-Säm, beheimatet gewesen. Wir wissen aus
anderen Quellen und handschriftlich erhaltenen literarischen Produk¬
ten aus jener Zeit, daß Muhammad b. Waddäh während seiner Studien¬
reise sich auch in den tugür aufgehalten hat. al-Massisa und Tarsüs sind
die Stationen gewesen, wo er nicht nur die genannten Gelehrten getrof¬
fen hat"", sondem wo er die Riwäyät zu drei Werken mit ^iAörf-Thematik
— nämlich das Kitäb al-siyar von Abü Ishäq al-Fazäri, das Kitäb fadl al-
^ihäd von 'Abd Alläh b. al-Mubärak und das Kitäb al-siyar von al-Walid
b. Muslim nach al-Auzä'i — erhielt"'. Die im Titel angegebene Thematik
der Tradition — die Möglichkeit, Gott am Jüngsten Gericht erblicken zu
können — dürfte gerade im Kreis der murdbitün in den Grenzmarken,
sowohl in Syrien als auch in Ifriqiyä und Andalus, in der Heimat des Ibn
Waddäh, durchaus aktuell gewesen sein. Die Isnade einiger Varianten
bei Ibn Waddäh führen sicherlich nicht nur zufällig in die tugür al-Sä-
miyya, sondern sind als Ergebnis von Aktivitäten derjenigen muhaddi¬
tün zu werten, die zwecks Bildung und Erziehung der ^^Aät^-Kämpfersich in den Grenzmarken niederließen"^
In Nordafrika selbst, wo unser Manuskriptfragment in der Abschrift
des Abü l-'Arab beheimatet ist, haben wir hierfür eindeutige Parallele;
der bereits genannte Yahyä b. 'Umar verfaßte nicht nur eine Sammlung
" Ibn Hair al-läbiü, Fahrasa, 126-27; Ibn 'Atiyya, 64.
Mit Ausnahme von Muhammad b. Qudäma al-Ma^^i^i, den er in Mekka traf
{Tahdib, 9/410).
Siehe M. Muranyi: Das Kitäb al-siyar des Abv Ishäq al-Fazäri. In: Jerusa¬lem Studies in Arabic and Islam 6 (1985), S. 72-73.
" Vgl. EI^ II, 36b. Diese Gelehrten bilden bei Ibn Sa'd eine fabaqa für sieh:
Bd. VII/2. 185-188. Sie waren aber keineswegs nutzlose Theoretiker, sondernaktive Kämpfer. Abü Ishäq al-Fazäri, dessen Kitäb al-siyar Ibn Waddäh in
Andalus überlieferte (siehe oben, Anm. 28), nahm an einem Sommerfeldzug{ßä'ija) in der Gegend von Himä im Jahre 156/772 teil (siehe Abü Zakariyä' al-Azdi: Ta'rih Mavsil. Ed. 'AliHabiba. Kairo 1967, S. 225. — Siehe meine Bemer¬
kungen hierzu in: Jerusalem Studies in Arabie and Islam 6 (1985), S. 69-70.
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 533
ähnlichen Inhalts mit dem Titel Kitäb al-nazar ilä Iläh tabäraka wa-ta'ä-
lä yauma l-qiyäma (siehe oben, S. 529), sondern auch eine Abhandlung
über die Vorzüge von Monastir und des ribät: Kitäb fadä'il al-Munastir
wal-ribäf^. Er starb in Süsa als muräbit. Abü l-'Arab selbst, sein Schü¬
ler, zog mit seinen Gesinnungsgenossen aus Qairawän als ?nuräbi{ nach
Süsa und Monastir; allerdings nicht gegen den christlichen Westen,
sondem gegen die „Ketzer" in den eigenen Reihen: gegen die Si'a von
al-Mahdiyya.
Die zweite Tradition hängt mit der ersten thematisch zusammen und
ist mit den hier verzeichneten Isnaden bei Muslim erhalten"". Die im
Manuskript belegte Variante in der Riwäya des Sufyän b. 'Uyaina (st.
196/811 - GAS, I, 96) nach 'Abd al-Malik b.'Umair - 'Umära b.
Ru'ayba ist munqati', aber als solche bekannt"^ und von der Traditions -
kritik nicht verschont geblieben. Abü Hätim al-Räzi (st. 277/890 —
GAS, I, 153) verweist darauf, daß zwischen diesem 'Abd al-Malik b.
'Umair und dem sahäbi Ibn Ru'ayba ein Glied in der Überliefererkette
fehlt"'. Diese Schwachstelle korrigiert dann der Familienisnad Abü
Bakr b. 'Umära — Vater, der nicht nur in Verbindung mit 'Abd al-Malik
b.'Umair, sondern auch mit Ismä'il b. Abi Hälid — im Manuskript die
letzte, fragmentarisch erhaltene Variante — verwendet wird"'.
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
Abü Däwüd: Abü Däwüd al-Sigistäni: Sahih Sunan al-Mustafä. Kairo o.J. 2 Bde.Aghlahides/TAL,Bi: Tarägim Aglabiyya niustahra^a min Madärik al-Qädi 'Iyäd-
Ed. M. Talbi. Tunis 1968.
Aghlabides/VAUBi, 263.
Muslhn, L Nr. 634/213; 634/214.
^5 Ihn Hanbai, Musnad, 4/136 und 261; Abü Däwüd, 1/70.
'" Tahdib, 6/413: yadhulu bainahu wa-baina 'Umära b. Ru'ayba ra^ulun. —
'Umära b. Ru'ayba selbst war ein nur wenig bekannter sahäbi; Ibn Sa'd, VI.26,10-11 kennt ihn als Räwi des hier referierten Ifadites fi l-salät qabla gurübi l-Sams.
"' Im Juh 1985 hat mich Prof M. J. Kister (Jerusalem) auf die Existenz
eines weiteren Fragmentes von al-'Igli's n^äZ-Werk aufmerksam gemacht. Es istdies das Ms. Yahuda, Ar. 194 auf insg. 17 fol. Die Handschrift beginnt fragmen¬tarisch mit dem ersten Teil; auf fol. 4 a beginnt al-^uz' al-täni min al-la'rih fi ma'¬
rifat tiqät al-ri^äl wa-ma'rifat asmä'ihim wa-buldänihim min tasnif Abi MuslimSälih b. Ahmad b. 'Abd Alläh b. Sälih al-'Ißi al-Küfi und endet auf fol. 17b frag-
mentariseh. Das Manuskript ist undatiert ; es scheint eine spätere Abschrift zu
sein. Zu dieser Riwäya siehe oben, S. 514.
534 Miklos Muranyi
Bagdäd: al-Hatib al-Bagdädi: Ta'rih Bagdäd au madinat al-saläm. Kairo 193 1
Ben Cheneb: Classes des savants de ITJriqiya. Par Abü 'l-'Arab Mohammed benAhmed ben Tamim et Mohammed ben al-Härit ben Asad al-Hoäani. Ed. M.Ben Cheneb. Alger 1920.
ders. Notice surun manuscrit de Ve siicle de l'hegire intitule Kitäb Tabaqät Olamä'i Ifriqiyya par Abou 'l-'Arab. In: JA (1906), 343-60.
Buhä,n/Fath: Ihn Hagar al-'Asqaläni: Fath al-bäri bi-Sarh Sahih al-Buhäri. Ed.
'Abd AL-'Aziz b. 'Abd Alläh b. Bäz u.a. Kairo: al-Matba'a al-salafiyya1380 d.H.
Dibä^: Ibn Farhün: al-Dibä^ al-mudahhab fi ma'rifat 'ulamä' al-madhab. EdMuhammad Ahmadi Abij l-Nür. Kairo 1972.
Futüh Mi?r/ToRREY: 'Abd al-Rahmän b.'Abd Ahäh b.'Abd al-Hakam: FutühMisr wa-ahbäruhä. Ed. Ch. C. Torrey. New Haven 1922. (Yale OrientalSeries. Researches. 3.)
GAL: C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. 2. Aufl. i 2Suppl.-Bd. 1-3. Leiden 1937-49.
GAS.I.: f. Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. I. Leiden 1967.Humaidi: Abü Bakr 'Abd Alläh b. al-Zubair al-Humaidi: al-Musnad. Ed. Habib
al-Rahmän al-A'zami. Beirut 1380 H.
Ihn 'Atiyya: Fihris Ibn 'Atiyya. Ed. Muliammad Abü l-Aöfän und Muham¬mad al-Zähi. Beirut 1980.
Ibn al-Faradi: Ta'rih 'ulamä' al-Andalus. Kairo 1966. (al-Maktaba al-Andalu-siyya. 2.)
Ibn Hanbai: Musnad al-Imäm Ahmad b. Hanbai. Büläq. Nachdr. Beirut 1969.
Ibn Hair: Abü Bakr Muhammad b. Hair al-Iäbili: Fahrasa mä rawähu 'an Suyü-hihi Zaragossa 1893. Nachr. Beirut/Kairo 1963.
Ibn Sa'd: Ibn Sa'd: Kitäb al-tabaqät al-kubrä. Ed. E. Sachau u. a. Leiden 1904-40.
Kindi/GuEST: Muhammad b. Yüsuf al-Kindi: Kitäb al-wulät wa-kitäb al-qudät.Ed. Rh. Guest. Leiden 1912. (E. J. W. Gibb Memorial Series. 19.)
Ma'älim: al-Dabbäg: Ma'älim al-imän fi ma'rifat ahi al-Qairawän. Akmalahu wa-
'allaqa 'alaihi Abü 1-Fadl b. Nägi. Bd. III. Ed. Muhammad Mädür. Kairo/Tunis 1978.
Munta?.am: Ibn al-öauzi: al-Munta?amfi ta'rih al-mulük wal-umam. Haidaräbäd1357-62 H.
Muranyi, Materialien: M. Muranyi: Materialien zur mälikitischen Rechtslitera¬
tur. Wiesbaden 1984. (Studien zum islamischen Recht. Bd. 1.)
Muslim: Muslim b. al-Haggäg: Sahih. Ed. Muhammad Fu'äd 'Abd AL-BÄyi.Kairo 1955.
Sadarät: Ibn al-'Imäd: Sadarät al-dahab fi ahbär man dahab. Kairo 1350 H.Sam'äni: al-Sam'äni: Kitäb al-ansäb. Ed. 'Abd al-Rahmän b. Ya^yä al-
Mu 'allami al-Yamäni. Haidaräbäd 1962 -.
Schacht: J. Schacht: On some manuscripts in the libraries of Kairouan andTunis. In: Arabica 14 (1967), 225-258.
Tadkira: al-Dahabi: Tadkirat al-huffd?. Haidarabad 1955-58 (Nachdr. Beiruto.J.)
Tahdib al-tahdib: Ibn Hagar al-'Asqaläni: Tahdib al-tahdib. Haidarabad 1325-27 H.
Talbi, £mirat: Mohamed Talbi: L'^mirat Aghlabide. 184-296/800-909.Histoire politique. Paris 1966.
Fragmente aus der Bibliothek des Abü l-'Arab al-Tamimi 535
Tamhid: Ibn 'Abd al-Barr: al-Tamhid li-mä fi l-Muwaffa' min al-ma'äni wal-asä-
nid. Rabat 1967 — (unvollständig).
Tartib al-madärik: al-Qädi 'Iyäd: Tartib al-madärik fi tartib al-masälik li-ma'rifata'läm madhab Mälik. Rabat 1965 — (unvollständig). Ed. A. Bekir. Beirut1967.
Werkmeister: Walter Werkmeister: QueUenuntersuchungen zum Kitäb al-
'Iqd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/860-328/940). EinBeitrag zurarabischen Literaturgeschichte. Berlin 1983.
Zirikli: Zirikli: A'läm. Kairo 1954-59.
Theologen und Mystiker in Huräsän und Transoxanien
Von Bernd Radtke, Basel
Für Richard Grämlich zum sechzigsten Geburtstag
I. Die Fa<}äHl-i Balh
Neben Weltgeschichten wie Tabaris Ta'rih, Ibn al-Atirs Kämil, Ihn al-
öawzfs Muntazam, Dynastiengeschichten wie Ibn Wä^ils Mufarrig al-
kurüb, biografischen Lexika wie §afadis Wäß stellen Stadt- und Lokal¬
geschichten unsere Hauptinformanten der mittelalterlichen islami¬
schen Geschichte. Zu nennen wären etwa für Ägjrpten die Futüh Mi^r
des Ibn 'Abd al-Hakam, für Damaskus der monumentale Ta'rih DimaSq
des Ibn 'Asäkir, fur Bagdad der Ta'rih Bagdäd des Hatib al-Bagdädi. Es
gibt Geschichten der iranischen Landschaften Färs, öurgän, Sistän,
Stadtgeschichten von Naysäbür, Buhärä, Samarqand, Marw und Herat.
Und es existiert auch eine Stadtgeschichte für die bis zur Zerstörung
durch die Mongolen im Jahr 617/1220 große und blühende Stadt Balh:
Die Fadä'il-i Balh (Storey 1/2, 1296; Bregel' 2, 1053f ).
Die beiden topografischen Einleitungskapitel der Chronik wurden
bereits von Ch. Schefer in der Chrestomathie persane ediert (S. 65-103
Text, S. 56-94 Einleitung), das gesamte Werk jedoch erst 1972/1350 §
von 'ÄBD al-Hayy-i HabIbi in den IntiSärät-i bunyäd-i farhang-i Iran.
Es bietet neben den von Schefer veröffentlichten Kapiteln den Haupt¬
teil (S. 56-390) mit den Biografien von siebzig Persönlichkeiten, die in
Balh lebten, starben oder in irgendeiner Verbindung mit der Stadt stan¬
den. Der Aufbau der Fadä'il-i Balh entspricht somit demjenigen des
Ta'rih DimaSq und Ta'rih Bagdäd: nach einer topografischen Einleitung
folgen im Hauptteil Biografien. In unserem Werk sind die Biografien im
Unterschied zu den genannten Stadtchroniken von Bagdad und Damas¬
kus in zeitlicher Reihenfolge, nicht alphabetisch angeordnet.
Der Verfasser nennt sich (4,1) Abü Bakr 'Abdallah b. 'Umar b.
Muhammad b. Däwüd al-Wä'iz Sali ad-din al-Balhi. Er beendete das
Werk wenige Jahre vor der Zerstörung der Stadt im Ramadän 610/
1214, und zwar in arabischer Spreiche. Knapp siebzig Jahre später, im