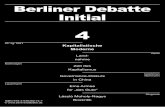The very model of a modern travel agency? : the Polytechnic Touring Association 1888-1962.
Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
Akademie Verlag
Nietzsche, Darwin und die Kritik der Politischen Theologie
Herausgegeben von Volker Gerhardt und Renate Reschke
ISBN: 978-3-05-004690-7
NietzscheforschungJahrbuch Band 17 der Nietzsche-Gesellschaft
Sonderdruck aus:
Inhaltsverzeichnis
Siglenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I.DerNietzsche-PreisUrsulaPiaJauchBeantwortungderFrage,obnunendlich‚allephilosophischeDogmatikindenletztenZügen‘liege?EinekleinerePhilippikaüberdenZustandderakademischenPhilosophiezuBeginndes21.Jahrhunderts,gefolgtvoneinergrößerenLaudatioaufLudgerLütkehaus,denheiterenPhilosophenundNietzsche-PreisträgerdesJahres2009 . . . . . . . . . . . . . 13
LudgerLütkehausDiegrausameWiederkehrdesDionysosFriedrichNietzscheliestEuripides–undantizipiertseineigenesGeschick . . 19
II.NietzscheundDarwinAndreasUrsSommerNietzschemitundgegenDarwinindenSchriftenvon1888 . . . . . . . 31
MichaelSkowronEvolutionundWiederkunftNietzscheundDarwinzwischenNaturundKultur. . . . . . . . . . 45
WernerStegmaier„ohneHegelkeinDarwin“KontextuelleInterpretationdesAphorismus357ausdemV.BuchderFröhlichen Wissenschaft . . . . . . . . . . . 65
6 Inhaltsverzeichnis
SörenReuter„DieserLehregegenüberistderDarwinismuseinePhilosophiefürFleischerburschen“GrundzügeeinermöglichenDarwin-RezeptionNietzsches . . . . . . . 83
JuttaGeorgDieKraftdesMittelmäßigenNietzsche,DarwinunddieEvolution . . . . . . . . . . . . . 105
AnetteC.HornNietzschesDécadence-BegriffundDarwinsEvolutionstheorie . . . . . . 119
MauriceErbEvolution,Genealogieund,Gegen-Anthropologie‘MichelFoucaultsfrüheAuseinandersetzungmitDarwinundNietzsche . . . 137
III.NietzscheunddieKritikderpolitischenTheologie17.Nietzsche-Werkstatt,Schulpforta9.–12.September2009(Leitung:SteffenDietzschundUdoTietz)
SteffenDietzschKenosisoderWiderdieLegendevonderErledigungjederPolitischenTheologie . . . . 151
MartinTrefzerExemplarischesScheiternNietzschealsgnostischerIntellektuellerinderPolitischenTheologieEricVoegelins . . . . . . . . . . . . . 159
ChristophSchweerNietzscheunddiePolitischeTheologie . . . . . . . . . . . . . 169
HannoBollerPolitischeTheologieunterBedingungenmodernerKulturen? . . . . . . 177
WolfgangBartuschatSpinozaalsKritikerderPolitischenTheologie–einVorgängerNietzsches? . . 191
DanielaTeodorescuWaskommtnachGottesTod? . . . . . . . . . . . . . . . 205
FrederikBeckNietzschesFortschrittskritik–ImplikationenfürpolitischeTheologie . . . . 215
7Inhaltsverzeichnis
IV.BeiträgeJensThiel„…daskommtdavon,wennmansichmitdenallerhöchstenHerrschaftenindenHöhenunseresGeisteslebenseinlässt“KarlSchlechtas‚rettendeNüchternheit‘unddieHistorisch-KritischeGesamtausgabederSchriftenFriedrichNietzschesim‚DrittenReich‘ . . . . 229
BenedettaZavattaDerKampfzwischenNotwendigkeitundfreiemWillenbeiEmersonundNietzsche . . . . . . . . . . . . . . . . 249
ChristianWollekPhilologiaabscondita–DielateinischenTextedesSchülersNietzsche. . . . 267
V.VermischtesEberhardPrauseMorgenandachtenmitNietzscheSechsAndachtenimDeutschlandfunkvom10.8.–15.8.2009 . . . . . . 285
HermannJosefSchmidtInkompetenzdemonstrationeneinessichalsKritikerinszenierendenBiographen?EineReplikzuKlausGoch . . . . . . . . . . . . . . . . 293
VI.RezensionenFriederikeFelicitasGünther,RhythmusbeimfrühenNietzsche(Manos Perrakis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301SilvioPfeuffer,DieEntgrenzungderVerantwortung.Nietzsche–Dostojewskij–Levinas(Paolo Stellino) . . . . . . . . . 304ManuelDries(Hg.),NietzscheonTimeandHistory(Enrico Müller) . . . . 306KlausVieweg(Hg.),FriedrichSchlegelundFriedrichNietzsche.TranszendentalpoesieoderDichtkunstmitBegriffen(Vivetta Vivarelli). . . . 309GiulianoCampioni,DerfranzösischeNietzsche(Angelika Schober) . . . . 312HeinerFeldhoff,NietzschesFreund.DieLebensgeschichtedesPaulDeussen(Klaus Goch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316DomenicoLosurdo,Nietzsche,deraristokratischeRebell.IntellektuelleBiographieundkritischeBilanz.BandI:DieKritikderRevolutionvondenjüdischenProphetenbiszumSozialismus.BandII:NietzscheunddieantidemokratischeReaktion.PolitikundtheoretischerÜberschuss(Christian Niemeyer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
8 Inhaltsverzeichnis
PeterAndréBlochetal.(Hg.),FriedrichNietzsche,Handschriften,ErstausgabenundWidmungsexemplare.DieSammlungRosenthal-LevyimNietzsche-HausinSilsMaria(Ralf Eichberg) . . . . . . . . . . . . . . . . 325SörenReuter,Ander„BegräbnisstättederAnschauung“(Christian Kassung) . 327Pietro Gori, Il meccanicismo metafisico (Mattia Riccardi) . . . . . . . 330JörgGleiter,DerphilosophischeFlaneur–NietzscheunddieArchitektur(Renate Reschke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Personenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
AndreAs Urs sommer
Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
Ein großes Individuum muss das, worüber es spricht, nicht aus eigener Anschauung kennen. Für Friedrich Nietzsche war der Darwinismus eine selbstverständliche Denkvoraussetzung – eine so selbstverständliche, dass er Charles Darwins Hauptwerke nicht im Original lesen musste, sondern sich auf die Darstellung in diversen sekundärliterarischen Quellen und kritischen Auseinandersetzungen verlassen konnte, aus denen er seine teilweise recht präzisen Kenntnisse schöpfte. Darwinismus galt Nietzsche als Epochenphänomen, als herrschende ‚Schule‘. Er zeigte kein Interesse an dem, was der Meister selbst gesagt hatte und verspürte kein Bedürfnis, ihn gegen seine Anhänger und Popularisierer in Schutz zu nehmen. Das Epochenphänomen Darwinismus erwies sich für Nietzsche als ideale Projektionsfläche, um sich selbst, sein eigenes Denken zu konturieren, beispielsweise mit eigenen Entwürfen, was die Natur oder was der alles Lebendige bestimmende Kampf sei. Am Beispiel des Darwinismus lässt sich Nietzsches intellektuelle Adaptionsbereitschaft und Adaptionskraft ad oculos demonstrieren. Zugleich lässt sich Nietzsches eigene Theorieselektion in den griffigen Begriffen des Darwinismus beschreiben: Welche Konzepte erweisen sich als die angemessensten, die ‚fittesten‘ für die Beschreibung der Wirklichkeit und für die Bestimmung unseres Handelns? Das alles sind Gründe, weswegen sich die NietzscheForschung bereits eingehend mit Nietzsches DarwinismusRezeption beschäftigt und an der Frage abgearbeitet hat, ob er denn ein Darwinist oder vielmehr ein AntiDarwinist gewesen sei.1 Allerdings zeigt sich Nietzsche am Darwinismus nur situativ interessiert, insofern er sich dagegen profilieren kann. Der Darwinismus dient ihm nicht als Gesamterklärung der Welt, sondern als Reibungsfläche; er muss dazu in kein Bekenntnisverhältnis treten, weder ‚dafür‘ noch ‚dagegen‘ sein. Bei der einschlägigen Forschung fällt auf, dass nicht selten eine Teleologie in Nietzsches langjährigen Umgang mit Darwinschen Überlegungen hineingelesen wird, die den Eindruck erweckt, er habe sich zu immer klareren Positionsbezügen im Darwinschen und antiDarwinschen Kräftefeld hochgearbeitet. Da aber gerade Darwin teleologische Betrachtungsweisen problematisiert, wird man aus methodischer
1 Von der Frage nach der Aktualisierbarkeit von Nietzsches DarwinRezeption lässt sich etwa Dieter Henke, Nietzsches Darwinkritik aus der Sicht gegenwärtiger Evolutionsforschung, in: Nietzsche-Studien 13, Berlin, New York 1984 bestimmen.
32 Andreas Urs Sommer
Zurückhaltung von solchen TeleologieProjektionen in Nietzsches eigene Denkentwicklung tunlich absehen. Die hier vorgetragenen Beobachtungen verschreiben sich diesem AbstandHalten und wollen der retrospektiven Teleologisierung dadurch entgegenwirken, dass sie Nietzsches späteste Äußerungen zum Thema, namentlich in der Götzen-Dämmerung, im Antichrist und im späten Nachlass, einer genauen Lektüre unterziehen, um damit das Verfahren zu adaptieren, das Nietzsche „Götzen aushorchen“ (KSA, GD, 6, 57) nennt, oder, weniger bombastisch formuliert, das Verfahren der Auskultation. Dabei geht es exemplarisch um die Frage, was Größe, große Individuen ausmacht. Rekapituliert man Nietzsches Äußerungen zu Darwin und Darwinismus, zu Selektion und Evolution in all seinen Aufzeichnungen, Werken und Briefen, so ergibt sich von seinen Jugend und Studententagen an ein buntes Panorama.2 Spätestens mit der ersten Lektüre von Friedrich Albert Langes Geschichte des Materialismus 1866 setzt eine kontinuierliche Beschäftigung mit Literatur ein, die den Darwinismus zum Gegenstand hat. Insbesondere die mittlere Werkphase ab Menschliches, Allzumenschliches wird, wohl auch unter dem Eindruck des darwinistischen Freundes Paul Rée, von einem positiven Darwin-Bild bestimmt. Das böse Wort von Darwins Lehren als einer „Philosophie für Fleischerburschen“ (KSA, NF, 8, 259) scheint vergessen. Im Spätwerk hingegen akzentuiert sich, gerade angesichts der als Konkurrenzmodell zum Darwinschen Naturverständnis entwickelten ‚Lehre‘ des ‚Willens zur Macht‘, der kritische Ton; der Darwinismus erscheint öfter als eine falsche, zeittypische Ideologie. Ohnehin ist Nietzsches Interesse nicht so sehr naturwissenschaftlichbiologisch orientiert, sondern auf den Menschen hin zentriert. Aber gehen wir in medias res. Der erste und weitaus längste Abschnitt beleuchtet einen Passus aus der Götzen-Dämmerung, der zweite zwei späte Nachlassnotate, der dritte schließlich Positionsbezüge im Antichrist. Der vierte und letzte Abschnitt resümiert.
I.
Der ‚Anti-Darwin‘ betitelte Abschnitt 14 in den Streifzügen eines Unzeitgemässen, dem zweitletzten Kapitel in der letzten von Nietzsche selbst zum Druck autorisierten Schrift, der Götzen-Dämmerung, ist häufig als Schlüsselstelle zur Erhellung von Nietzsches Denkhorizont herangezogen worden. So heißt es etwa in Heinrich Rickerts 1920 erschienener Abrechnung mit der Lebensphilosophie: „Dieser ‚Anti-Darwin‘ überschriebene Aphorismus gewährt klaren Einblick in die biologistischen Motive von Nietzsches Denken. In der Steigerung des Lebenswillens fand er als typischer Vertreter der neuesten Lebensphilosophie schließlich den Sinn des Lebens überhaupt. Dies ließ sich dann gut auch mit seiner früheren, an Schopenhauer und Richard Wagner orientierten ‚dionysischen‘ Weltanschauung vereinigen.“3 Rickerts Urteil ist symptomatisch für ein bei der Nietz2 Siehe die quellenkritisch akribische Rekapitulation bei Thomas H. Brobjer, Nietzsche and the „Eng-
lish“. The Influence of British and American Thinking on His Philosophy. Foreword by Kathleen Marie Higgins, Amherst NY 2008.
3 Heinrich Rickert, Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen Mode-strömungen unserer Zeit, Tübingen 1920, 97.
33Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
scheDeutung lange vorherrschendes Verfahren (das im übrigen seine spiegelbildliche Entsprechung in Nietzsches eigenem Umgang mit seinen Quellen hat), das Verfahren, aus einem beliebigen NietzschePassus einen markanten Gedanken hervorzuheben, den Kontext der Äusserung auszublenden und aus ihr stattdessen den ‚ganzen‘ Nietzsche systematisch zu extrahieren. Es ist nicht ganz klar, ob Rickert Nietzsche ‚biologistische Motive‘ unterstellt, bloss weil er sich mit Darwinschen Überlegungen beschäftigt und ihnen etwas Eigenes entgegenhält. Deutlich ist aber Rickerts Wille sichtbar, Nietzsche dem Schema ‚philosophischer Modeströmungen‘ gefügig zu machen, deren Kritik er sich widmet. Fraglich ist, ob sich die Götzen-Dämmerung (Streifzüge eines Unzeitgemässen, Aph.14) für eine solche Einpassung eignet. Wenden wir uns dem Kontext des fraglichen Abschnitts zu: ‚Anti-Darwin‘ ist innerhalb der Streifzüge eines Unzeitgemässen nur einer von zahlreichen Abgrenzungsversuchen Nietzsches gegen diverse prägende Figuren des zeitgenössischen intellektuellen Lebens: Ernest Renan, Charles-Augustin Sainte-Beuve, George Eliot, Thomas Carlyle und andere mehr. Der Abschnitt gegen Darwin schließt eine Reihe solcher scheinbar ganz personenbezogener Artikel ab und erhält als Abschluss eine herausgehobene Stellung. So unterschiedlich die Personen und ihre Werke sind, gegen die Nietzsche hier anschreibt, so deutlich ist doch, dass er überall Verwechslungsgefahr wittert: Renan könnte ihm in der Deutung Jesu und des frühen Christentums bedenklich nahe kommen, SainteBeuve mit seinem psychologischen Blick, George Eliot mit ihrer Christentumsferne. In Ecce homo (Warum ich so gute Bücher schreibe 1) heißt es über die Rezeption des Gedankens vom Übermenschen: „Andres gelehrtes Hornvieh hat mich seinethalben des Darwinismus verdächtigt; selbst der von mir so boshaft abgelehnte ‚Heroen-Cultus‘ jenes grossen Falschmünzers wider Wissen und Willen, Carlyle’s, ist darin wiedererkannt worden“ (KSA, EH, 6, 300). Im Falle von Carlyle und Darwin ist die Möglichkeit der Verwechslung nicht bloß latent, sondern wurde von Nietzsche bereits als Tatsache wahrgenommen. Entsprechend skandiert er sein eigenes Programm: „Hört mich! denn ich bin der und der. Verwechselt mich vor Allem nicht!“ (ebd., 257). Die Angst vor dem Verwechselt-Werden ist ein Leitmotiv in Nietzsches späten Schriften (vgl. ebd., 298). Daraus erklärt sich die Notwendigkeit, in den Streifzügen die direkte Konfrontation mit den unter sich sehr unterschiedlichen, prägenden Figuren der zeitgenössischen intellektuellen Debatten zu suchen. Freilich ist der Aph. 14 der einzige, in dem dem Gegner ein ‚Anti-‘ vorangestellt wird. Das griechische Präfix αντι ist für sich genommen amphibolisch: Es bedeutet nicht nicht nur ‚gegen‘, sondern auch ‚an Stelle von‘. Und tatsächlich ist ‚Anti-Darwin‘ ein Abschnitt, der nicht nur widerstrebende Auffassungen zurückweist, sondern etwas an ihre Stelle setzen will, nämlich eine alternative Auffassung von Evolution, ein alternatives Verständnis von Natur. Nietzsche setzt sich selbst an die Stelle der Metonymie ‚Darwin‘: „Was den berühmten ‚Kampf um’s Leben‘ betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme; der Gesammt-Aspekt des Lebens ist nicht die Nothlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichthum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung, – wo gekämpft wird, kämpft man um Macht“ (ebd., 120). Ausgangspunkt ist die darwinistische (nicht: Darwinsche) Formel des struggle for life, deren Bekanntschaft Nietzsche bei seinen Lesern ebenso selbstverständlich voraussetzt wie die in Darwins The Origin of Species explizierte Bedeutung einer Konkurrenz
34 Andreas Urs Sommer
um knappe Nahrungsmittelressourcen, aus der die an ihre Umgebung am besten angepassten Individuen siegreich, d. h. überlebend hervorgehen sollen. Nietzsches erster, wissenschaftsmethodisch nicht zu beanstandender Einwand dagegen lautet, es handle sich dabei um eine Behauptung, die bislang noch nicht bewiesen sei. Der Einwand besagt zunächst nur, dass für jede Tatsachenbehauptung auch Beweise beigebracht werden müssen und dass wir es bei Darwins struggle for life nicht mit einer Tatsache, sondern mit einer Hypothese zu tun haben. Der nächste Schritt impliziert freilich ein umfassendes Wissen über die Natur als solche: Der Schreibende formuliert keine Gegenhypothese, sondern verfügt über die Gewissheit, dass der fragliche Kampf nur als Ausnahme vorkomme und dass das Leben an sich nicht durch Mangel, sondern durch Überfülle charakterisiert sei, so dass es keinen Grund gibt, um Nahrungsmittel zu konkurrieren. Vielmehr kämpfe man um Macht – womit Nietzsche eine zentrale Kategorie, die er seinem Wirklichkeitsverständnis zugrundelegt, in die Diskussion bringt. Für dieses Wirklichkeitsverständnis und dafür, wie die Natur an sich ist, bedarf es anscheinend keiner Belege, geschweige denn der Beweise: ein Vorgehen, das alle Leser irritieren wird, die eingangs noch gern bereit waren, der Forderung zu folgen, Darwin und seine Anhänger müssten sich für ihr Wirklichkeitsverständnis rechtfertigen. Das billige Ansinnen, auch das sprechende Ich werde sein alternatives Wirklichkeitsverständnis rechtfertigen, wird stillschweigend übergangen. Freilich ist es keineswegs so, dass Nietzsche hier seine Kritik ganz einfach auf seine divinatorische Privateinsicht in das Wesen der Natur gründet. Vielmehr verlässt er sich, ohne das explizit zu machen, auf die naturwissenschaftlich abgesicherten Einwände, die William Henry Rolph in seinen von Nietzsche intensiv durchgearbeiteten Biologischen Problemen gegen Darwin vorgebracht hat.4 Bei Rolph hatte sich Nietzsche die folgende Stelle markiert und am Schluss am Rand mit der Notiz: „mehr Leben“ glossiert: „Dann aber spielt sich freilich der Daseinskampf nicht mehr um’s Dasein ab, er ist kein Kampf um Selbsterhaltung, kein Kampf um die ‚Erwerbung der unentbehrlichsten Lebensbe-dürfnisse‘, sondern ein Kampf um Mehrerwerb. Dann ist er auch nicht bedingt durch die Existenz von Umständen, die das Leben des Geschöpfes beeinträchtigen, sondern er ist constant, er ist ewig; er kann nie erlöschen, denn eine Anpassung an die Unersättlichkeit giebt es nicht, selbst nicht bei äusserster Abundanz. Dann ist ferner der Daseinskampf kein Vertheidigungskampf, sondern ein Angriffskrieg, der nur unter gewissen Umständen zu einem Vertheidigungskampfe umgewandelt werden kann. Wachsthum aber und Vermehrung und Vervollkomnung sind die Folgen jenes erfolgreichen Angriffskrieges, in keiner Weise aber der Zweck desselben oder gar einer in der Natur liegenden Tendenz. Während es also für den Darwinisten überall da keinen Daseinskampf giebt, wo die Existenz des Geschöpfes nicht bedroht ist, ist für mich der Lebenskampf ein allgegen
4 W[illiam] H[enry] Rolph, Biologische Probleme zugleich als Versuch zur Entwicklung einer ra-tionellen Ethik. Zweite, stark erweiterte Auflage, Leipzig 1884. Der Band ist in Nietzsches Bibliothek mit vielen Lesespuren erhalten: Giuliano Campioni, Paolo D’Iorio, Maria Cristina Fornari, Francesco Fronterotta, Andrea Orsucci (Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin, New York 2003, 504 f. Schon Heinrich Rickert, Die Philosophie des Lebens, 96 f. macht Rolph als Quelle für Streifzüge eines Unzeitgemässen, Aph. 14 namhaft, vgl. die genauen Nachweise: Greg Moore, Beiträge zur Quellenforschung, in: Nietzsche-Studien 27 (1998), 537 ff. Zur Interpretation auch Gregory Moore, Nietzsche, Biology and Metaphor, Cambridge 2002.
35Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
wärtiger: Er ist eben primär ein Lebenskampf, ein Kampf um Lebensmehrung, aber kein Kampf um’s Leben!“5
Nietzsche adaptiert Rolphs Vorlage6, indem er zum einen seinen eigenen Begriff von Macht und Machtsteigerung in sie einträgt7 und zum anderen das ausblendet, was Rolph eigentlich interessiert, nämlich die Frage der ‚Vervollkommnung‘, die Rolph in eine ethische Maxime ummünzt: „Unsere Lebensvorschrift an alle uns Nahestehende ist: Vorwärts! Strebe Dich zu verbessern!“8 Gerade die Vervollkommnung der Gattung als nicht intendiertes Produkt der Entwicklung weist Nietzsche im folgenden ab, indem er ausführt, dass in den Fällen, wo der Kampf ums Leben stattfinde, keineswegs die vollkommeneren, stärkeren Individuen, sondern vielmehr die Schwächeren obsiegen würden. Immer danach trachtend, nicht verwechselt zu werden, wendet sich Nietzsche also nicht nur gegen Darwin, sondern (nur für die Eingeweihten entzifferbar) auch gegen seinen eigenen antidarwinistischen Gewährsmann Rolph, um so noch in der Adaption von fremdem Gedankengut seine intellektuelle Souveränität zu beweisen. Angemerkt sei noch, dass Nietzsche auch Rolphs Überlegungen zum Altruismus nicht ohne Widerwort lässt. Wo Rolph schreibt: „Das Fortpflanzungsgeschäft ist also gar kein altruistischer Process“, notiert Nietzsche am Blattrand: „so wenig als das Pissen“.9
Interessant ist, dass Nietzsche nach der Exposition seines AbundanzNaturbegriffs nicht bei dessen weiterer Erläuterung bleibt, sondern auf den Ausnahmefall des Kampfes ums Leben eingeht, der tatsächlich vorkomme, aber umgekehrt als es sich „die Schule Darwin’s“ wünsche: Die ‚„Starken“, die „Bevorrechtigten“, die „glücklichen Ausnahmen“ seien nicht etwa die Nutznießer, sondern die Leidtragenden dieses Kampfes. Und dann wird, wie erwähnt, implizit gegen Rolph behauptet, die Gattungen wüchsen nicht in der Vollkommenheit, weil die Schwachen stets über die Starken Herr würden. Dafür nennt Nietzsche zwei Gründe, nämlich deren große Zahl und deren größere Klugheit. Halten wir kurz inne, bevor wir uns dem zweiten Teil des Abschnitts mit seinen Erörterungen des Geistbegriffs widmen: Nietzsche lehnt zunächst aus dem Interesse an theoretischer Selbstidentität heraus die Darwinsche Naturauffassung ab und postuliert einen Machtkampf bei Ressourcenüberfülle anstelle eines Lebenskampfes bei Ressourcenknappheit. Dann aber wird zugestanden, der „Kampf ums Leben“ komme vor, jedoch mit einem anderen Resultat als die Darwinisten annähmen, nämlich auf Kosten der Starken 5 William Henry Rolph, Biologische Probleme, 97. Die von Nietzsche unterstrichenen Stellen sind
kursiviert, seine Durchstreichung durchgestrichen dargestellt. Der ganze Passus ist mit Randstrichen und einem NB markiert.
6 Auch da, wo er behauptet: „Man soll nicht Malthus mit der Natur verwechseln“ (KSA 6, 120). Die Vorlage ist William Henry Rolph, Biologische Probleme, 86: Darwin „hat sich offenbar durch das Malthus’sche Gesetz etwas zu sehr bestechen lassen; und die Anwendung dieses Gesetzes bedeutet Mangel und immer wieder Mangel“. Thomas Robert Malthus hat bekanntlich die These zum Gesetz erklärt, ein geometrisches Wachstum der Bevölkerung stehe einem nur arithmetischen Wachstum der Nahrungsressourcen gegenüber, was notwendigerweise zu Hunger und Elend führen müsse. Rolph und Nietzsche gehen hingegen vom Überfluss der Ressourcen aus.
7 Zum Willen zur Macht im Darwin-Spencer-Nietzsche-Kontext: Daniel C. Dennett, Darwin’s Dan-gerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, New York, Toronto, London, Sidney 1995.
8 William Henry Rolph, Biologische Probleme, 120.9 Ders., ebd., 185. Kursiviertes von Nietzsche unterstrichen. Vgl. MarieLuise Haase, „Nietzsche und
…“, in: Nietzscheforschung, Bd. 10: Ästhetik und Ethik nach Nietzsche, Berlin 2003, 25.
36 Andreas Urs Sommer
und auf Kosten der Gattungsvervollkommnung. Dazu ist zunnächst zu sagen, dass in der Darwinschen Konzeption auch nicht behauptet wurde, dass die Stärksten überlebten, sondern (mit dem Begriff von Herbert Spencer, den Darwin dann in die fünfte Auflage von The Origin of Species (1869) übernehmen sollte) der survival of the fittest, das Überleben der am besten Angepassten. Und das sind mit Sicherheit die von Nietzsche als ‚Schwache‘ Gekennzeichneten. Es liegt also nur ein scheinbarer, ein rhetorisch inszenierter Gegensatz zur „Schule Darwin’s“ vor. Sodann ist es zumindest nicht unproblematisch, in Darwin selbst eine moralischgeschichtsteleologische Vervollkommnungsidee hineinzulesen, wo Darwin doch eher von optimaler Anpassung an die jeweiligen Umweltgegebenheiten spricht, die allenfalls situative Vervollkommnungen darstellen.10 Freilich ist der geschichtsphilosophische Fortschrittsglaube mit der Evolutionstheorie bei vielen Darwinisten des späteren 19. Jahrhunderts ein Bündnis eingegangen11, so dass die „Schule Darwin’s“ Nietzsches Vorwurf einer 10 Siehe Werner Stegmaier, Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution, in: Nietz-
sche-Studien 16 (1987), 281, sowie das Kapitel Darwin and Teleology in George J. Stack, Lange and Nietzsche, Berlin, New York 1983; Henning Ottmann, Philosophie und Politik bei Nietzsche. 2. verbesserte und erweiterte Auflage, Berlin, New York 1999, 267 hält den Darwinismus „in letzter Konsequenz“ für „optimistisch“, während hinter Nietzsches scheinbarem Optimismus ein „tragische[r] Pessimismus“ stehe.
11 So heißt es bei Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaft-liche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, Fünfte verbesserte Auflage, Berlin 1874, 249: „Im Großen und Ganzen beruht der Fortschritt selbst auf der Differenzirung und ist daher gleich dieser eine unmittelbare Folge der natürlichen Züchtung durch den Kampf um’s Dasein.“ Dezidiert das Fortschrittsdenken mit der Selektionstheorie in Einklang zu bringen, versuchte Ludwig Büchner in seiner mehrfach aufgelegten Darstellung Die Darwin’sche Theorie von der Entstehung und Umwandlung der Lebe-Welt. Ihre Anwendung auf den Menschen, ihr Verhältniß zur Lehre vom Fortschritt und ihr Zusam-menhang mit der materialistischen oder Einheits-Philosophie der Vergangenheit und Gegenwart. In sechs Vorlesungen allgemein-verständlich dargestellt, Vierte verbesserte und mit Hülfe der neuesten Forschungen ergänzte Auflage, Leipzig 1876, 245–300. Er findet kulturhistorische Belege dafür, dass man „die Idee von einem ewigen Fortschritt oder einem aufsteigenden EntwicklungsGang“ für einen „wohlwollende[n] Traum“ (ebd., 259) gehalten und geglaubt hat, „daß sich vielmehr Alles in einem ewigen Kreislaufe bewegt, der schließlich immer wieder in sich selbst zurückkehrt, ähnlich dem bekannten Bilde der Schlange, welche sich in ihren eigenen Schweif beißt“ (ebd., 259 f.). Büchner selbst sieht sich durch die Darwinsche Theorie demgegenüber in der Ansicht bestärkt, „daß diese Ansicht vom ewigen Stillstand oder, besser gesagt, von der ewigen Bewegung oder Verwandlung, vom ewigen Wechsel ohne Fortschritt falsch ist und falsch sein muß, und daß im Gegentheil die Thatsachen ebensowohl in der Natur wie in der Geschichte für einen ewigen, wenn auch nach menschlichen Begriffen und Berechnungen überaus langsamen Fortschritt sprechen“ (ebd., 264). Zur Kritik an solchen Positionen bei Nietzsche und Foucault: Philipp Sarasin, Darwin und Foucault. Genealogie und Geschichte im Zeitalter der Biologie, Frankfurt am Main 2009, 112. Zur deutschen Darwinismus-Rezeptionsgeschichte: Alfred Kelly, The Descent of Darwin. The Popularization of Darwinism in Germany, 1860–1914, Chapel Hill 1981 (darin spielt Nietzsche nur eine marginale Rolle); zur allgemeinen Information Franz M. Wuketits, Darwin und der Darwinismus, München 2005; Eva-Marie Engels (Hg.), Charles Darwin und seine Wirkung, Frankfurt am Main 2009 (Aufsatz von Kurt Bayertz, Sozialdarwinismus in Deutschland 1860–1900, zu Nietzsche 186–188) sowie Kurt Bayertz, Myriam Gerhard, Walter Jaeschke (Hg.), Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Bd. 2: Der Darwinismus-Streit, Hamburg 2007 (darin Dirk Solies, Evolution oder Entwicklung? Kritik und Rezeption eines Darwinistischen Grundbegriffs,
37Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
einschlägigen Wahrnehmungstrübung durchaus trifft.12 Interessant ist freilich, dass Nietzsche im fraglichen Abschnitt zwar keine Gegenthese zur Vervollkommnung formuliert, aber doch nahelegt, man habe die Evolution als eine Verfallsgeschichte zu verstehen, weil sich am Ende die ‚Schwachen‘ durchsetzen sollen. Deren Herrschaft zu beklagen wird Nietzsche im Spätwerk bekanntlich nicht müde. Der vermeintlich darwinistischen Evolutionsteleologie wird hier also kein nüchterner Evolutionsteleologieverzicht entgegengehalten, bei dem man sich sogar auf den ‚eigentlichen Darwin‘ berufen könnte, sondern eine Kritik an bestimmten natürlichen Gegebenheiten insinuiert: nämlich eine Kritik daran, dass die Starken à la longue den Schwachen unterlegen sind, also eine Teleologie des Niedergangs, der décadence. Götzen-Dämmerung (Streifzüge eines Unzeitgemässen 14) kündigt dem Glauben an den Gattungsperfektibilismus ebenso das Vertrauen auf wie der Hoffnung, der große Einzelne werde über die Masse Herr. In Streifzüge eines Unzeit-gemässen 44 (KSA, GD, 6, 145 f.) und 48 (ebd., 150 f.) scheint Nietzsche hingegen zu dieser Hoffnung zurückzufinden, so dass sich zwischen diesen Abschnitten und dem Anti-DarwinAbschnitt eine starke Spannung aufbaut. Daraus folgen für die Interpretation von ‚Anti-Darwin‘ erhebliche Probleme: Falls es sich beim „Kampf um’s Leben“ tatsächlich um eine biologische Gegebenheit handeln sollte (wenn auch nur um eine ‚Ausnahme‘), dann wird hier implizit ein moralisierender Vorbehalt gegen das Funktionieren der Natur selbst geltend gemacht: Die Natur selbst scheint Nietzsches eigenen Wertpräferenzen, die auf einen Triumph der Starken setzen, zu widersprechen. Diese Opposition gegen die Natur entspricht strukturell exakt jener Opposition gegen die Natur, die Nietzsche beim Christentum diagnostiziert, das die Natur verleugnen wolle. Ist das eine ironische Koketterie? Sodann fragt man sich, wie es denn um den Kampf um Macht bestellt sei, der in der Natur statt des „Kampfes um’s Leben“ doch den eigentlichen Normalfall darstelle. Geht es bei den ‚Schwachen‘ und den ‚Starken‘ wirklich um den Ausnahmefall des Lebenskampfes oder doch um den Normalfall des Machtkampfes? Der Bezug bei der Wendung „Gesetzt aber, es giebt diesen Kampf – und in der That, er kommt vor“ (ebd., 120) wird offenbar absichtlich verunklart, so dass manche Interpreten die beiden Kampfformen (im Anschluss an die Fröhliche Wissenschaft, KSA, FW, 3, 585 f.) beim späten Nietzsche
zu Nietzsche 210 ff., 218 ff. und Reinhard Mocek, Darwin und die Moral. Überlegungen zu einem Problemkern der Weltanschauungsdebatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ebd., zu Nietzsche 255–260).
12 Die Funktionsweise der Fortschrittsbehauptung diskutiert Nietzsche in KSA, NF 1887, 12, 449: „Zu jedem ‚Fortschritt‘ gehört eine Umdeutung der verstärkten Elemente ins ‚Gute‘.“ Nietzsches Einwände gegen den Fortschrittsbegriff im Nachlass problematisieren immer wieder den Versuch, die Menschheit oder überhaupt Gattung(en) zum Subjekt der Geschichte und damit des Fortschritts zu machen. Damit wird die zeitgenössische entwicklungsbiologische Diskussion im Anschluss an Darwin in die geschichtsphilosophische Fortschrittsbetrachtung einbezogen: „Daß die Gattungen einen Fortschritt darstellen, ist die unvernünftigste Behauptung von der Welt: einstweilen stellen sie ein Niveau dar, – daß die höheren Organismen aus den niederen sich entwickelt haben, ist durch keinen Fall bisher bezeugt“ (KSA, NF,13, 304). Dabei verzichtet er selbst nicht auf einen eigenen Fortschrittsbegriff (KSA, GD, 6, 150), während er in (KSA, GD, 6, 144) den „modernen ‚Fortschritt‘“ als das Weiterschreiten in der décadence charakterisiert und damit die Veränderungsmacht des Individuums auf geschichtliche Prozesse durchaus einschränkt.
38 Andreas Urs Sommer
schlicht identifiziert gefunden haben.13 Bei genauerem Hinsehen lebt Anti-Darwin gerade von solchen systematischen Verunklarungen, die den Autor trotz seines Willens, nicht verwechselt zu werden, nicht auf eine ganz klar bestimmte Position festzulegen erlauben. Es ist nicht klar, worum im zweiten Teil des Abschnittes gekämpft wird, ob um knappe Subsistenzressourcen oder um Macht. Verkompliziert wird die Angelegenheit schliesslich noch durch die bewusste Aussparung aller Hinweise, über welche Art von Lebewesen hier eigentlich gesprochen wird. Sind etwa nur Hominiden gemeint, redet Nietzsche über eine menschheitsgeschichtliche Entwicklung in der Terminologie biologischer Evolution, um sich in die zeitgenössische sozialdarwinistische Debatte einzuschreiben, nicht ohne sie zu modifizieren? Oder kommt diese Form des Kampfes einschließlich Triumph der Schwachen auch bei beliebigen anderen Lebewesen – bei Tannenbäumen, Einzellern, Schabrackentapiren und Papageien vor? Die Pointe des Abschnittes ist nun, dass Nietzsche „Geist“ nicht etwa den ‚Starken‘ zuordnet, die von einer tumben Masse majorisiert werden, sondern Klugheit, „Geist“ explizit den Schwachen vorbehält (KSA, GD, 6, 121). Darin folgt er seinen Überlegungen in der ersten Abhandlung der Genealogie der Moral, wo es heißt: „Die menschliche Geschichte wäre eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den Ohnmächtigen her in sie gekommen ist“ (KSA, GM, 5, 267). In den Streifzügen 14 gilt der Geist als ein Mittel, mit dem die Schwachen sich gegen die Starken durchsetzen – „[m]an muss Geist nöthig haben, um Geist zu bekommen“ (KSA, GD, 6, 121). „Geist“ wird, obwohl Darwin vorgeworfen wird, er habe ihn vergessen, ganz im Schema der Evolutionstheorie erklärt, nämlich als dasjenige, wodurch die physisch Unterlegenen sich an ihre zunächst von den physisch Überlegenen, den ‚Starken‘ bestimmten Umweltbedingungen optimal anpassen und damit schließlich obsiegen. Auch hier unterlässt Nietzsche es nicht, das Ganze in naturwissenschaftliche Terminologie zu kleiden: „Ich verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung, die grosse Selbstbeherrschung und Alles, was mimicry ist (zu letzterem gehört ein grosser Theil der sogenannten Tugend)“ (ebd., 121). – Geist als das Kampfmittel der ‚Schwachen‘ ist evolutionär offensichtlich hochgradig erfolgreich und gerade mit dem Begriff der „grossen Selbstbeherrschung“ nicht (wie vielleicht zu erwarten wäre) durchweg negativ belegt. Die Überlegung zur evolutionären Unerlässlichkeit des Geistes akzeptiert für die humane Entwicklung, um die es hier offensichtlich geht (ohne dass dies ausdrücklich gesagt würde), die in den Streifzügen 14 (ebd., 120) als allgemeine naturphilosophische These verworfene Malthusische Grundvoraussetzung der Darwinschen Evolutionstheorie: Die Voraussetzung für die Entwicklung des Geistes als Mittel der Selbstermächtigung der Schwachen ist gerade der Mangel. Der Mangel an Macht zwar diesmal, aber was bedeutet dieser Machtmangel anderes als Mangel an Ressourcenkontrolle? – Die innere Spannung in den Streifzügen 14 zeigt, wie stark experimentell und begrifflich wenig sedimentiert Nietzsches Überlegungen zu Evolution und Geist sind. Seine Explikation von „Geist“ ist wohl vor allem als Provokation des idealistischen Geistbegriffes gedacht und entsprechend physiologischevolutionär geerdet.14
13 So Werner Stegmaier, Darwin, Darwinismus, Nietzsche, 284.14 Der Begriff Mimikry kommt bei Nietzsche erstmals in der Morgenröthe (KSA, M, 3, 36) vor, eben
falls schon in Relation gesetzt zu menschlichem Verhalten, menschlicher Moral, als Verstellung
39Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
Betrachtet man Streifzüge 14 isoliert, so ist die Stärke der ‚Starken‘ rein physisch. Nietzsches wiederholte Versuche in den Schriften der Achtziger Jahre, den ‚Starken‘ wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, ließe sich dann als ein geistfeindliches Plädoyer für die Reinstallation der Herrschaft tumber Kraftprotze lesen. Das große Individuum, von dem Nietzsche zu schwärmen pflegt, wäre dann der hünenhafte, geistig minderbemittelte Barbar, der seine Konflikte mit Faust und Keule auszutragen gewohnt ist. Aber das ist nicht das Ende des Liedes. Schon Streifzüge 14 enthält einen bislang ausgesparten Passus, der eine solche Einengung verbietet: „Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes (– ‚lass fahren dahin! denkt man heute in Deutschland – das Reich muss uns doch bleiben‘)“ (ebd., 121). Dieses Zitat aus der vierten Strophe von Martin Luthers berühmtem, an Psalm 46 angelehntem Kirchenlied Eine feste Burg ist unser Gott (1529)15, bezieht sich zurück auf das Kapitel der Götzen-Dämmerung (Was den Deutschen abgeht) (ebd., 103 ff.) und kann als Beleg dafür gelesen werden, dass Nietzsche sich keineswegs schlankweg auf Seiten der ‚Starken‘ schlägt, hatte er dort die Deutschen doch gerade wegen ihrer Geistferne schroff kritisiert: Die Regression der Deutschen in Geistverachtung ist gerade nicht wünschbar, ganz abgesehen davon, dass „Geist“ die Voraussetzung und das Mittel des ganzen götzendämmerischen Unternehmens ist. Streifzüge 14 sprengt mit dieser ironischen Volte selbst bereits die darin scheinbar artikulierte Präferenz für geistlose Kraftprotze. Auf der Suche nach dem großen Individuum unter der Präambel des Darwinismus wird man sich im Spätwerk weiter umsehen müssen.
und Verhehlung der eigentlichen Absichten. Die biologischen Informationen, die er darin gibt, sind direkte, teilweise wörtliche Adaptionen aus Karl Semper, Die natürlichen Existenzbedingungen der Thiere, Leipzig 1880, Theil 1, 111 f. und 264 sowie Theil 2, 232 ff. und 251 ff. Die exakte Übertragung auf das menschliche Verhalten ist hingegen Nietzsches Innovation. In KSA, M, 3, 36 werden die „Praktiken, welche in der verfeinerten Gesellschaft gefordert werden“ auf tierische Mimikry zurückgeführt, um am Ende „das ganze moralische Phänomen als thierhaft zu bezeichnen“ (KSA 3, 37). Die Genealogie der Moral (KSA, GM, 5, 329) engt Mimikry auf das Verhalten der Schwachen, „Sklaven und HörigenBevölkerungen“ ein, was sich schon in KSA, NF 10, 493 und KSA, NF 11, 111 abgezeichnet hatte. Die Götzen-Dämmerung (Streifzüge eines Unzeitgemässen, Aph. 14) knüpft hingegen wieder an den umfassenderen, durchaus nicht abwertenden Sinn in der Morgenröthe an. Zugrunde liegt wiederum Sempers funktionale Definition: „Die Mimicry oder die Nachahmung eines Thieres durch ein anderes. Bates und Wallace gaben den obigen Namen allen jenen Fällen von schützenden Aehnlichkeiten, in welchen ein sonst schutzloses Thier die Form und Färbung eines andern, auf besondere Weise geschützten nachahmt und dadurch höchst wahrscheinlich den Nachstellungen seiner Feinde leichter entgeht, als es ohne diese Verkleidung zu thun vermöchte. Auch hier wieder kann der so durch die Maskerade gewährte Schutz sowol dem Verfolger als auch dem Verfolgten zugute kommen; jenem, indem er ihn den wachsamen Augen seiner Beute verbirgt, diesem, indem er das vertheidigungslose Thier schützt, welches sich unter die gut vertheidigten Formen mengt, denen es die Kleidung abborgte“ (Karl Semper, Die natürlichen Existenzbedingungen, Theil 2, 233 f.).
15 „Das Wort sie sollen lassen stahn und kein’ Dank dazu haben; / er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. / Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: / laß fahren dahin, sie haben’s kein’ Gewinn, / das Reich muß uns doch bleiben.“ Nietzsche hat unter ausdrücklicher Nennung Luthers das Thema des prädominanten Machtinteresses mit Hilfe des Kirchenliedes schon einmal in der Morgenröthe (KSA, M, 3, 209) durchgespielt.
40 Andreas Urs Sommer
II.
Zunächst ist auf zwei Nachlassaufzeichnungen vom Frühjahr 1888 hinzuweisen, die beide ebenfalls den Titel „Anti-Darwin“ tragen. Die erste dieser Aufzeichnungen (KSA, NF, 13, 303 ff.) stellt zunächst heraus, dass die in Streifzüge 14 gegen Darwin und seine Anhänger gemachte Feststellung, nicht die Stärksten, sondern die „mittleren, selbst […] un-termittleren Typen“ (ebd., 303) setzten sich durch, explizit auf die Menschen bezogen sei. Daraus wird eine allgemeine naturphilosophische Schlussfolgerung gezogen: „Gesetzt, daß man uns nicht den Grund aufzeigt, warum der Mensch die Ausnahme unter den Creaturen ist, neige ich zum Vorurtheil, daß die Schule Darwins sich überall getäuscht hat“ (ebd.). Direkt folgen moralisch-immoralistische Konsequenzen: „Mein Gesammtaspekt der Welt der Werthe zeigt, daß in den obersten Werthen, die über der Menschheit heute aufgehängt sind, nicht die Glücksfälle, die Selektions-Typen, die Oberhand ‹haben›: vielmehr die Typen der décadence – vielleicht giebt es nichts Interessanteres in der Welt als dies unerwünschte Schauspiel … So seltsam es klingt: man hat die Starken immer zu bewaffnen gegen die Schwachen; die Glücklichen gegen die Mißglückten; die Gesunden gegen die Verkommenden und Erblich-Belasteten. Will man die Realität zur Moral formuliren: so lautet diese Moral: die Mittleren sind mehr werth als die Ausnahmen, die Decadenz-Gebilde mehr als die Mittleren, der Wille zum Nichts hat die Oberhand über den Willen zum Leben – und das Gesammtziel ist nun, christlich, buddhistisch, schopenhauerisch ausgedrückt: besser nicht sein als sein Gegen die Formulirung der Realität zur Moral empöre ich mich: deshalb perhorrescire ich das Christenthum mit einem tödtlichen Haß, weil es die sublimen Worte und Gebärden schuf, um einer schauderhaften Wirklichkeit den Mantel des Rechts der Tugend, der Göttlichkeit zu geben“ (ebd., 303 f.). Nietzsche trägt die Überlegungen zum Darwinismus hier explizit in seine décadenceAnalysen ein und bezichtigt die herrschende, christlich kontaminierte Moral eines naturalistischen Fehlschlusses, nämlich aus dem Funktionieren von Selektion unter Menschen, aus einem Faktum etwas Normatives abzuleiten, aus einem Sein ein Sollen. Es ist freilich auffällig, dass Nietzsche diese Überlegungen in keinem seiner späten Werke explizit anstellte, denn das wiederum hätte unweigerlich Einwände gegen die normativen Grundlagen seines eigenen Sprechens provoziert: Aus der Opposition gegen die Natur eine normative Grundlage abzuleiten, hätte ihn selbst in den Geruch idealistischer Metaphysik gebracht, die abzulehnen er sonst nicht müde wird. Die Kontamination von décadenceAnalyse und DarwinismusKritik bleibt so in den Streifzügen eines Unzeit-gemässen subkutan. Während Streifzüge eines Unzeitgemässen 14 sich nach dem ersten Eindruck auf eine vermeintlich naturwissenschaftliche Beschreibung eines Sachverhalts beschränkt, wird freilich in späteren Abschnitten, besonders Streifzüge eines Unzeitge-mässen 33–36 (KSA, GD, 6, 131 ff.), der Eindruck erweckt, man habe sich der physisch Schwachen zu entledigen. Die Frage ist freilich, ob die Schwachen von Streifzüge eines Unzeitgemässen 14 tatsächlich mit den décadents und Lebensverneinern dieser späteren Abschnitte identisch sind, wie es KSA, NF, 13, 303 f. nahelegt. Was wäre aus einem wissenschaftlichen Sachverhalt oder einer besseren, antiDarwinschen Theorie der Evolution zu gewinnen? Doch offenbar gerade nicht der Ratschlag, sich auf Seiten der ‚Starken‘ zu schlagen (worin immer ihre Stärke bestehen mag, sind sie doch gerade nicht stärker als die ‚Schwachen‘, die sie besiegen), wenn es doch dem natürlichen Verlauf der Dinge
41Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
entspricht, dass die Schwachen obsiegen. Dass sie décadents seien, ist vorerst nur ein unbewiesenes Werturteil, sind sie augenscheinlich den evolutionären Erfordernissen, ihren Umweltbedingungen besser angepasst als die Starken. Das zweite „Anti-Darwin“-Notat (ebd., 14 [133] 315 ff.), ergänzt das Argument, die Darwinisten imaginierten fälschlich eine Vervollkommnung der Gattung noch mit einer Breitseite gegen die „Domestikation des Menschen“ (ebd., 315): ein Thema, das Nietzsche beispielsweise in der Götzen-Dämmerung (Die ‚Verbesserer‘ der Menschheit) (KSA, GD, 6, 98 ff.) religionsgeschichtlich exemplifiziert. Die Nachlass-Aufzeichnung hebt hervor, dass es zwischen den Starken und den Schwachen „keine Übergangsformen“ gebe (KSA, NF, 13, 316), dass mithin keine Vervollkommnung vom einen „Typus“ zum anderen stattfinde: „Man behauptet die wachsende Entwicklung der Wesen. Es fehlt jedes Fundament. Jeder Typus hat seine Grenze: über diese hinaus giebt es keine Entwicklung“ (ebd.) Mit dieser Behauptung hat Nietzsche die Grundvoraussetzung des Darwinismus kassiert, nämlich die Evolution verschiedener Lebensformen auseinander. Daraus müsste in letzter Konsequenz die Leugnung des Werdens selbst folgen – eine Konsequenz, die Nietzsche in den von ihm veröffentlichten oder zur Veröffentlichung präparierten Werke scheut. Es gehört vielmehr zu seinen Hauptvorwürfen an die Adresse der bisherigen Philosophen, das Werden zugunsten eines imaginären Seins geleugnet zu haben (KSA, GD, 6, 74 f.). Zu den ‚Consequenzen‘, die Nietzsche in 14 [133] explizit zieht (KSA, NF, 13, 315), gehört es denn auch nicht, das Werden zu leugnen, sondern nur die Höherentwicklung. So macht er mit der Antiteleologie ernst, die bei Darwin eigentlich angelegt war: „der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich zu irgend einem anderen Thier dar. Die gesammte Thier- und Pflanzenwelt entwickelt sich nicht vom Niederen zum Höheren … Sondern Alles zugleich, und übereinander und durcheinander und gegeneinander“ (ebd., 316 f.). Entscheidend ist nun, dass der ‚höhere Typus‘ nunmehr keineswegs mit dem physisch Starken, dem geistlosen Kraftprotz identifiziert wird: „Die reichsten und complexesten Formen – denn mehr besagt das Wort ‚höherer Typus‘ nicht – gehen leichter zu Grunde: nur die niedrigsten halten eine scheinbare Unvergänglichkeit fest. Erstere werden selten erreicht und halten sich mit Noth oben: letztere haben eine comprimittirende Fruchtbarkeit für sich. – Auch in der Menschheit gehen unter wechselnder Gunst und Ungunst die höheren Typen, die Glücksfälle der Entwicklung, am leichtesten zu Grunde. Sie sind jeder Art von décadence ausgesetzt: sie sind extrem, und damit selbst beinahe schon décadents … Die kurze Dauer der Schönheit, des Genies, des Caesar, ist sui generis: dergleichen vererbt sich nicht. Der Typus vererbt sich; ein Typus ist nichts Extremes, kein ‚Glücksfall‘ … Das liegt an keinem besonderen Verhängniß und ‚bösen Willen‘ der Natur, sondern einfach am Begriff ‚höherer Typus‘: der höhere Typus stellt eine unvergleichlich größere Complexität, – eine größere Summe coordinirter Elemente dar: damit wird auch die Disgregation unvergleichlich wahrscheinlicher. Das ‚Genie‘ ist die sublimste Maschine, die es giebt, – folglich die zerbrechlichste“ (ebd., 317). Komplexitätsreichtum, Vielfalt ist jetzt statt Muskelkraft das Kriterium zur Unterscheidung des Mittelmasses vom großen Individuum. Nicht länger die Schwachen gelten als dekadenzbedroht, vielmehr die großen Individuen selbst. Sie hören auf den altbackenen Namen ‚Genies‘ – und haben offensichtlich von Seiten der Mittelmäßigen nur mehr wenig zu befürchten.
42 Andreas Urs Sommer
III.
Eine letzte Verarbeitungsstufe der darwinisch-antidarwinischen Überlegungen findet sich im Antichrist, der ‚Umwerthung aller Werthe‘. Da werden insbesondere die Differenzierungen aus dem Notat 14[133] (ebd.) aufgegriffen. Wie selbstverständlich wird im Anti-christ (Abschnitt 5) Geistigkeit mit Stärke assoziiert – eine Verbindung, die Streifzüge 14 gerade noch auszuschließen schien. Aber Gefährdung droht dem überkomplexen, starken Individuum nun nicht so sehr aus seiner eigenen Überkomplexität, sondern von aussen: „Das Christenthum hat die Partei alles Schwachen, Niedrigen, Missrathnen genommen, es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die ErhaltungsInstinkte des starken Lebens gemacht; es hat die Vernunft selbst der geistig-stärksten Naturen verdorben, indem es die obersten Werthe der Geistigkeit als sündhaft, als irreführend, als Versuchungen empfinden lehrte“ (KSA, AC, 6, 171). In Nachlass 14[133] und im Antichrist Abschnitte 3 bis 5 nimmt Nietzsche anstelle von Rolph einen anderen Kritiker des Darwinismus auf (natürlich wieder, ohne ihn zu nennen) nämlich Carl von Nägeli mit seiner Mechanisch-physiologischen Theorie der Abstammungslehre (1884). Dort markiert sich Nietzsche den folgenden Passus: „nach Darwin ist die Veränderung das treibende Moment, die Selection das richtende und ordnende; nach meiner Ansicht ist die Veränderung zugleich das treibende und richtende Moment. Nach Darwin ist die Selection nothwendig; ohne sie könnte eine Vervollkommnung nicht stattfinden und würden die Sippen in dem nämlichen Zustande beharren, in welchem sie sich einmal befinden. Nach meiner Ansicht beseitigt die Concurrenz bloss das weniger Existenzfähige; aber sie ist gänzlich ohne Einfluss auf das Zustandekommen alles Vollkommneren und besser Angepassten.“16
Im Antichrist wird dem Menschen das Privileg aberkannt, „Krone der Schöpfung“ zu sein: „jedes Wesen ist, neben ihm, auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit“(KSA, AC, 6, 180). Auch das erinnert stark an Nägeli: Es „entspricht der Grad der Vollkommenheit, zu dem sich jedes Sinneswerkzeug [beim Menschen] ausgebildet hat, genau dem Bedürfnisse, und es giebt keines, in welchem der menschliche Organismus nicht von irgend einer Thierspecies sich weit übertroffen sähe.“17
„Nicht, was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist das Problem“ (ebd., 170). Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, zu denen namentlich der ‚Übermensch‘ im Zarathustra Anlass gegeben hatte, wird klargestellt, die Evolution des Menschen zu einer neuen Gattung sei nicht intendiert. Eine Vorarbeit zum Antichrist 3 ist noch expliziter: „Was für ein Typus die Menschheit einmal ablösen wird? Aber das ist blosse Darwinisten-Ideologie. Als ob je Gattung abgelöst wurde! Was mich angeht, das ist das Problem der Rangordnung innerhalb der Gattung Mensch“ (KSA, NF, 13, 481). Obwohl der ‚Geist‘ durchaus präsent bleibt, leitet Nietzsche „den Menschen nicht mehr vom ‚Geist‘, von der ‚Gottheit‘ ab, wir haben ihn unter die Thiere zurückgestellt. Er gilt uns als das stärkste Thier, weil er das listigste ist: eine Folge davon ist seine Gei16 Carl von Nägeli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Mit einem Anhang:
1. Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntniss, 2. Kräfte und Gestaltungen im mole-cularen Gebiet, München/ Leipzig 1884, 285. Nietzsche hat den zweiten Satz am Rand markiert; Kursivierungen entsprechen seinen Unterstreichungen.
17 Ders., ebd., 567.
43Nietzsche mit und gegen Darwin in den Schriften von 1888
stigkeit. Wir wehren uns anderseits gegen eine Eitelkeit, die auch hier wieder laut werden möchte: wie als ob der Mensch die grosse Hinterabsicht der thierischen Entwicklung gewesen sei“ (KSA, AC, 6, 180).18
IV.
Zwei Darwinismus-Kritiker und -Modifikatoren, die sich nicht ohne weiteres unter einen Hut bringen lassen, Rolph und Nägeli, spielen bei Nietzsches später Auseinandersetzung mit dem Darwinismus eine bestimmende Rolle. Nietzsche adaptiert deren Ansätze. Er kritisiert zum einen im Antichrist nach Nägeli die darwinistische Vervollkommnungsrhetorik und will den „höherwerthigeren“ „Typus“ (ebd., 170) nicht als bloßes, womöglich notwendiges Produkt einer menschheitsgeschichtlichen Entwicklung verstanden wissen. Vielmehr postuliert er jetzt, man müsse einen solchen Typus „züchten“ – wobei die Frage, wie eine solche Züchtung konkret beschaffen sein soll, unterbelichtet bleibt. Bei diesem großen Individuum handelt es sich ersichtlich nicht mehr um den tumben ‚Starken‘ aus den Streifzügen 14, sondern um eine überkomplexe Persönlichkeit, deren Größe gerade in der Fähigkeit besteht, die Komplexität zu synthetisieren, zu einer nichtdekadenten Einheit zu bringen. Zum anderen gründet die DarwinismusKritik in der Götzen-Dämmerung wesentlich auf Rolph und wendet sich dort gegen die Identifikation von Natur mit Mangel – stattdessen sei Natur als Abundanz zu begreifen. Hier passt Nietzsche wiederum seine dominanten Macht- oder Wille-zur-Macht-Gedanken dem vorgegebenen Schema an und betreibt zugleich eine starke Relativierung des philosophischerseits gemeinhin hoch gehängten Geist-Begriffs. Diese Relativierung kehrt mit weiteren Spezifikationen in Antichrist 14 wieder. Dennoch lässt sich Nietzsche nicht einfach auf einen dogmatischen Materialismus festlegen – schon in den Streifzügen 14 beharrt er darauf, dass man den Geist in die Betrachtung dessen, was Evolution ausmacht, wesentlich mit einbeziehen müsse. Freilich ist es ein metaphysisch radikal ausgenüchterter Geist. Wesentlich zum Verständnis von Nietzsches Verfahren ist die Einsicht in seinen Gestus der Überbietung: Er übernimmt nicht einfach Rolphs oder Nägelis Reflexionen, sondern reichert sie mit eigenen Überlegungen an, die mitunter in eine zu den Quellen ganz konträre Richtung laufen. Dabei bleiben interne Spannungen bestehen. So oszilliert sein Begriff des Starken und des großen Individuums zwischen geistlosem Kraftprotz und 18 Dass der Mensch keinen Sonderstatus im Gesamtgefüge der Welt beanspruchen könne, ist im Zuge
des Darwinismus eine zu Nietzsches Zeit bereits weit verbreitete Ansicht, vgl. die von Nietzsche gern benutzte Culturgeschichte Friedrich von Hellwalds: „Wie aus dieser Darstellung erhellt, kann der Mensch in keiner Weise von den übrigen Wesen der belebten Schöpfung getrennt werden. Er steht mitten inne gleichwie jedes andere Geschöpf. Es ist daher auch vergebliches Beginnen für ihn eine Sonderstellung zu beanspruchen“ (Friedrich von Hellwald, Culturgeschichte in ihrer natürli-chen Entwicklung bis zur Gegenwart. Zweite neu bearbeitete und sehr vermehrte Auflage, Bd. 1, Augsburg 1876, 6). Von einer dualistischen Naturkonzeption hat man sich nach Hellwald in Richtung eines Monismus verabschiedet. „Ebenso haltlos, ja weniger noch zu begründen, ist der Unterschied zwischen Thier und Mensch. […] Schon ist in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass zwischen den geistigen Fähigkeiten des Menschen und des Thieres kein qualitativer, sondern nur ein quantitativer Unterschied bestehe“ (ebd., 7).
44 Andreas Urs Sommer
überkomplexem Genie. Diese Spannungen abzubauen, zeigt Nietzsche wenig Interesse. Es ist wohl auch nicht die Aufgabe seiner Interpreten, sie nachträglich zu glätten. Nietzsches später Umgang mit dem DarwinismusKomplex ist ein Schulbeispiel für seinen produktiven, oft räuberischen Umgang mit den Vorlagen. Immerhin ist festzuhalten, dass Darwin und der Darwinismus in seinen diversen rezeptionsgeschichtlichen Brechungen für Nietzsche eine anhaltende Inspirationsquelle darstellten. Dabei ist die Frage, ob er nun als Darwinist oder als AntiDarwinist gelten soll, letztlich irrelevant – würde sie doch einerseits voraussetzen, dass Nietzsche sich definitiv auf eine Position festgelegt hätte, und andererseits, dass man eine genaue Definition davon hätte, welche Form von Entwicklungsdenken als ‚darwinistisch‘ gelten darf und welche nicht. Beide Voraussetzungen sind jedoch nicht erfüllt. Nietzsches anhaltende Auseinandersetzung mit Darwinschen Themen und Thesen rührt daher, dass Darwin sowohl zu einem radikal historischen Denken anhält (alles, was ist, ist geworden), als auch zu einer radikalen Naturalisierung scheinbarer Übernatürlichkeiten. Der Geist, um noch einmal das Beispiel zu nehmen, ist, so viel Darwinismus herrscht auch bei Nietzsche, einerseits ein natürliches Phänomen, andererseits ein historisches Phänomen. Gleiches gilt für den Menschen, egal, ob im Mittelmaß oder in einsamer Größe. Diese Größe wiederum will Nietzsche für sich selbst in Anspruch nehmen, und zwar nicht, wie wir wissen, als geistloser Muskelprotz, sondern als überkomplexes, nicht auf einen Nenner reduzierbares Genie. Die Anerkennung seiner Größe will er erreichen durch Unterscheidung, durch Nicht-Identifikation mit dem schon Gesagten und Gedachten. Der große Mensch ist groß, weil er anders ist als alle anderen, weil er nicht in der Gattung, im Einerlei aufgeht. In der Einebnung der individuellen Differenz, im Aufgehen des Individuums im Gattungseinerlei besteht denn auch eine, wenn nicht die wesentliche Provokation des Darwinismus für Nietzsche. Er will vor allem nicht verwechselt werden. Und dazu sind alle Mittel recht.