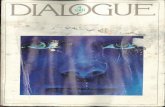Keyser 1981 Aufbau der Tastsinnesorgane in den Schalen von Ostracoden
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Keyser 1981 Aufbau der Tastsinnesorgane in den Schalen von Ostracoden
Beitr. elektronenmikroskop. Direktabb. Oberfl. 14 (1981)
Dietmar Keyser
Aufbau der Tastsinnesorgane in den Schalen von Ostracoden (Crustacea)
603
Angemeldet zum 14. KOlloquium des Arbeitskreises für Elektronenmikroskopische Direktabbildung und Analyse von Oberflächen (EDO)
(23. bis 27. August 1981 in Innsbruck)
Abstract: STRUCTURE OF MECHANORECEPTORS IN THE CARAPACE OF OSTRACODS (CRUSTACEA) The ultrastructure of sensory bristles on the shell of 9 podocopid Ostracoda has been investigated. The nervous elements consist of a thecogen, a trichogen and a tormogen cell, which enclose as enveloping cells a liquor space with 4 receptor cilies. Two of them reach near to the tip of the bristle, the other only to the joint of the bristle. Just before moulting a special auxiliary structure, the sieve plate, together with the sensory bristle are al ready fully developed. It is assumed, that besides the function as mechanoreceptors an additional function, e. g.temperatur sensing, is present. Kurzfassung: 9 Arten von podocopiden Ostracoden werden h1nsichtlich der Ultrastruktur ihrer Schalenborsten untersucht. Der typische Bau eines Arthropodensensillums mit thecogener, trichogener und tormogener Zelle wird festgestellt. Es sind vier Receptorcilien vorhanden, von denen zwei bis zum Borstenende, zwei dagegen nur bis zum Borstengelenk reichen. Die Borste, ebenso wie eine spezielle Hilfsstruktur, die Siebplatte, sind schon vor dem Abwerfen der alten Schale bei der Häutung komplett ausgebildet. Es wird für die Borste eire doppelte Funktion angenommen, außer der mechanorezeptiven, möglicherweise eine temperaturperzipierende.
Einleitung: Ostracoden sind niedere Krebse mit einem, den gesamten Körper umschließenden Carapax. Sie bilden neben den fünf Mundgliedmaßen nur noch 2 Thoracopoden aus. Ihre Größe beträgt zwischen 0,1-20 mm, wobei die häufigste Größenklasse zwischen 0,5 und 1 mm liegt. Die Hautduplikatur des Kopfes besteht aus einer chitinösen Kutikula, die von der darunterliegenden Epidermis abgeschieden wird. Die Innenwand dieser Carapaxfalte bleibt dünnhäutig, während in die Außenwand sehr stark CalzitKristalle eingelagert werden. Diese durch Kalk verfestigte äußere Wand der Carapaxfalte bildet häufig sehr bizarre Ornamente aus, die oft genetisch kontrolliert werden (Fig.1) (LIEBAU 1969, Dr.Dletmar Keyser,Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Martin-Luther-King-Platz 3 2000 Hamburg 13
604
BENSON 1975, SYLVESTER-BRADLEY & BENSON 1971). Bei der Häutung, die Ostracoden häuten sich bis zu 8 mal vom Nauplius bis zum adulten Tier, wird diese Kalkschale abgeworfen. Sie bleibt sehr oft fossil erhalten. Diese Mikrofossilien ermöglichen palökologische und phylogenetische Aussagen. Da vor allem die Schalen und nur im begrenzten Umfang Extremitäten (siehe K.J.MÜLLER 1979) den Geologen zur Verfügung stehen, ist es vordringlich, die Funktion der relevanten Strukturen der Schale an lebenden Tieren zu klären. Die verkalkte Schale der Ostracoden ist von Poren durchbrochen, durch die Borsten auf der Oberfläche versorgt werden. Diese Borsten können verschiedene Gestalt und Anordnung haben (KEYSER 1980). Bei einigen Familien der Cytheracea sind die Borsten von einer Siebplatte umgeben (Fig.2). Der Ausbau der Borsten soll nach ROME(1947) dem eines Insekten-Scolopidiums entsprechen. Die Sensillen der Crustacea sind bereits in einigen Untersuchungen bearbeitet worden (MEAD et al.1976, RISLER 1977, 1978). Besonders die Malakostraken wurden hier untersucht, während nur wenige Arbeiten sich mit den niederen Krebsen beschäftigen (HEIMANN 1979, RIEDER & SPANIOL 1980). Wie ANDERSSON (1975) schon feststellte, sind gerade die Ostracoden besonders interessant, weil sie phylogenetisch eine alte Gruppe sind und sich die Phylogenie anhand der fossilen Funde gut rekonstruieren läßt. Die vorliegende Untersuchung stellt den Aufbau der Schalenborsten bei mehreren Ostracoden dar.
Fig.1 Hirschmannia viridis: linke verkalkte Schale/left calcified shell. - Fig.2 Hirschmannia viridis: Ornament und Siebpore auf der Schale, zu beachten die noch vorhandenen Häutungshaare/ Ornamentation and sieveplate on the shell, note the still present moulting hairs. - Fig.3 Schnitt durch das Sensillum in Höhe der Versteifungen der kutikulären Scheide/Section through the sensillum in the plane of the fortifications of the dendritic sheat. - Fig.4 Schnitt in Höhe des Ansatzes der kutikulären Scheide an der thecogenen Zelle/Section in the region of the end of the thecogen cello - Fig.5 Schnitt in der Region des Rezeptorlymphraumes/Section in the region of the receptor lymph cavity. -Fig.6 Schnitt durch die Spitze der Dendriteninnenglieder;Section through the upper inner dendritic segments. - Fig.7 Schnitt durch die Dendriteninnenglieder/Section through the inner dendritic segments.
AbkürzungentAbbreviations: ~: Borste/bristle,-~: Rezeptorcilie/ receptorcil~e7-cz: kutikulärer ~apfen/cuticular peg,-es: Häutungsspalt/ecdysal space,-id: Dendriteninnenglied/inner dendritic segment,-n: Zellkern;nucleüS,-rl: Rezeptorlymphraum/receptor lymph cavIty,-s: SChale/shell,-sh: kutikuläre Scheide/dendritic sheat,-~: Sieopore/sieve yore,=th: thecogene Zelle/thecogen cell,-to: tormogene Zellejtormogen cell,-tr: trichogene Zelle/ trichogen cello --
Ma8stab/scale:1fm außer anders gekennzeichnet/1rm unless otherwise indicated.
606
Material und Methode: Die Untersuchungen wurden an 9 Arten der Podocopa durchgeführt: Xestoleberis aurantia, Cytherura sella, Cyprideis torosa, Eucytheridea bairdii, Leptocythere lacertosa, Hirschmannia viridis, Candona compressa, Cyclocypris laevis, Cypridopsis vidua. Verschiedene Häutungsstadien wurden vor allem bei Hirschmannia viridis bearbeitet.
Die Tiere wurden lebend in 2,5% Glutaraldehyd fixiert, in Sörensen-Phosphat oder Cacodylat-Puffer gewaschen, mit 2% Osmiumtetraoxyd-Lösung in Puffer nachfixiert, entkalkt in 10% Essigsäure, in aufsteigender Acetonreihe entwässert und in SPURR's Medium eingebettet. Die Blöcke wurden mit einem REICHERT Ultramikrotom Om/U2 geschnitten, mit Uranylacetat und Bleicitrat kontrastiert und in einem ZEISS EM 9S-2 photographiert.
Die Präparation für die REM-Untersuchung beschränkte sich auf die Ablösung der Schalen von Tieren in 70% Alkohol, dem Aufbringen der Klappen auf einen Objektträger und einer Goldbesputterung. Die Aufnahmen wurden in einem CAMBRIDGE S4 REM *) gemacht.
Ergebnisse: Alle untersuchten Ostracodenarten besitzen einfache unverzweigte Borsten, nur Cyprideis torosa, Eucytheridea bairdii, sowie Cytherura sella weisen daneben auch verzweigte Borsten auf (KEYSER 1980). Die Länge der Borsten ist unterschiedlich. Sie beträgt bei Cyprideis bis zu 50/um bei Cytherura dagegen nur 15/um. Mehrere Arten (Cyprideis, Eutytheridea, Xestoleberis und Hi~schmannia) bilden um die Borste ein Siebporenfeld aus (Fig.2), welches Leptocythere sekundär nach innen verlagert hat. Cytherura. Candona, Cyclocypris,und Cypridopsis besitzen kein Sieb. Trotz dieser unterschiedlichen äußeren Strukturen ist der Aufbau der Borstennerven und der Begleitzellen identisch.
Es sind jeweils 4 Rezeptorcilien mit einer 9 + 0 Anordnung von Mikrotubuli vorhanden (Fig.4). Nur in zwei Fällen wurden Sensillen mit zwei Cilien beobachtet. Diese Rezeptorcilien verlaufen in einem Lymphraum, der von einer kutikulären Scheide umgeben ist. Zwei der Rezeptorcilien verschmelzen im distalen Teil der Borste mit dieser Scheide (Fig.11). Die beiden anderen Cilien ziehen nur ein kurzes Stück in die Borste und enden vor dem Borstengelenk. Die kutikuläre Scheide weist hier 8 längsverlaufende Versteifungssepten nach außen auf (Fig.3). Im Bereich der Epidermis gehen die Rezeptorcilien in vier Sinneszellen,den Dendriten-Innensegmenten,über (Fig.6,7). Die beiden Ebenen der Rezeptorcilien, einmal der weit in die Borste hineinziehenden sowie die andere der kurz endenden, stehen senkrecht aufeinander (Fig.4,5).
Die Basis der Ci lien umgibt die sogenannte thecogene Zelle kurz bevor sie in die Dendriten-Innensegmente übergehen. Die thecogene Zelle bildet die kutikuläre Scheide, In diesem Bereich spaltet sich die, im distalen Bereich ringförmige, Scheide auf und umgibt die Cilien sowie den sich sehr erweiternden Lymphraum nur noch halbmondförmig (Fig.5) und verschwindet in Höhe des Übertritts von Dendriten~Innensegment und -Außensegment (Rezeptorcilien) völlig (Fig.6). Die thecogene Zelle umschließt noch den distalen Bereich der Dendriten-Innensegmente (Fig.8).
*) Dieses Gerat 1st eine Leihgabe der DFG.
607
Die Scheide sowie der distale Bereich der thecogenen Zelle wird ihrerseits von einer weiteren Zelle, der trichogenen Zelle umgeben, die als Bildungszelle für die Borste dient (Fig.8). Diese Hüllzelle zieht in die Borste hinein und endet in Höhe des Borstengelenks. Eine weitere Hüllzelle, die tormogene Zelle, umschließt den ganzen Sensillenkomplex innerhalb der Epidermis und bildet die Gelenkhaut und den die Borstenöffnung umgebenden Kragen (Fig.8). Die daran anschließenden Epidermiszellen zeigen keine besonderen Veränderungen. Während der Häutung, die besonders bei Hirschmannia untersucht wurde, liegt die neugeformte Borste im Häutungsspalt (Fig.9). Sie ist nur von der Epikutikula umgeben und zeigt im Querschnitt eine Hüllzelle (trichogene Zelle) sowie die kutikuläre Scheide und zwei Rezeptorcilien (Fig.10). Der Innenraum der trichogenen Zelle erscheint knapp nach der Bildung der Epikutikula leer, mit nur wenigen Mikrotubuli angefüllt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Auflösung der alten Endokutikula abgeschlossen ist, ist dieser gesamte Bereich mit einer chitinösen Masse ausgefüllt (Fig.11). Über die chemische Natur dieses Stoffes ist noch nichts bekannt. In die gleiche Phase fällt die Bildung der bei einigen Arten auftretenden Siebporen. Sie entstehen in der tormogenen Zelle aus Vakuolen, die sich in den Häutungsspalt öffnen und dann ebenfalls mit einer Epikutikula überzogen werden (Fig.9,12). Zu diesem Zeitpunkt haben die Siebporen bereits ihre definitive Länge und Form. Während des Verkalkungsvorganges wird die tormogene Zelle aus dem Bereich der Siebporen hinausgedrängt, so daß das Sieb schließlich nur noch als Schalenstruktur den Borstenkanal umgibt, während die tormogene Zelle im Verband der Epidermis bleibt (Fig.13). Neben den Siebporen bildet die tormogene Zelle noch weitere Strukturen am Rand der Siebporen oder um den Borstenkanal herum aus. Die Borste lieat während des gesamten Häutungsvorganges frei im Häutungsspalt fFig.12), nur das Gelenk mit den ringförmigen Verstärkun~sleisten ist, wie später auch beim gehäuteten Tier (Fig.13), eingesenkt.
Diskussion: Die lateralen Sinnesorgane auf der Schale der untersuchten Ostracoden entsprechen weitgehend dem allgemeinen Schema von Arthropodensensillen (ALTNER 1977). Es sind drei verschiedene Hüllzellen mit spezifischen Aufgaben an der Bildung der Sensillen beteiligt (Fi~.8). Die thecogene Zelle bildet allein die kutikuläre Scheide (KEIL 1978), die trichogene Zelle die Borste (KEIL 1978)(Fig.10,11), während die tormogene Zelle den kutikulären Kragen (GNATZY & ROMER 1980) sowie in manchen Fällen die Siebplatte ausbildet (Fig.10,12). Die Bildung einer Siebplatte muß als besonderes Merkmal gelten, da bisher eine ähnliche Hilfsstruktur bei Arthropoden noch nicht beschrieben ist. Die Funktion dieser Struktur ist noch unklar, aber sie könnte eine Art von Schutzsubstanz für die ungeschützt im Häutungsspalt liegenden Teile der Nerven ausschütten, wie von GUSE (1980) gefordert. Wie dieser Schutz allerdings bei den Familien ohne Siebpore bewerkstelligt wird, muß dann noch untersucht werden.
608
fiber die Funktion der Borsten auf der Schale kann bisher ebenfalls noch nichts genaues gesagt werden. Die weitaus meisten der untersuchten Sensillen besaßen 4 Rezeptorcilien, allerdings wurden auch welche mit zwei gefunden (Fig.8). Die Anordnung dieser Cilien in zwei senkrecht aufeinanderstehenden Ebenen ist recht ungewöhnlich. Bisher ist man davon ausge~angen, daß es sich allein um Mechanorezeptoren handeln müsse (ROME 1947, HART MANN 1967). Der für Arthropoden tYFische Tubularkörper fehlt hier allerdings. Auch RISLER (1977) bestädigt das Fehlen eines Tubularkörpers in den Chordotonalorganen der Krebse. Die unterschiedliche Länge der Cilien sowie der enge Verlauf der beiden langen Cilien in engem Kontakt mit der kutikulären Scheide in der Borste (Fig.11) ist vergleichbar im Aufbau mit den von ALTNER et al. (1981) beschriebenen "np-sensilla", einer kurzen, an der Spitze blasig erweiterten Borste. Die Funktion dieser Borste wurde mit Hygro-und Temperaturperzeption festgestellt. Bei Ostracoden scheidet die Hygroperzeption wohl aus, da es sich um wasserlebende Tiere handelt. Eine Temperaturabhängigkeit könnte jedoch möglich sein. Die spezielle Ausformung des Borstengelenkes, besonders die nach innen gerichteten kutikulären Zapfen, weist allerdings eher auf eine mechanorezeptive Funktion hin (Fig.12,13). Diese Sensillen dürften also nicht nur einen gerichteten Reiz aufnehmen, wie GNATZY & TAUTZ (1980) bei Gryllus beschrieben haben, sondern mechanische Reize von allen Seiten perzipieren. Ob die beiden im Gelenkbereich endenden Cilien diesen Reiz aufnehmen, kann noch nicht gesagt werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß ein äuSerer Rezeptorlymphraum nicht vorhanden ist. Es muS demnach angenommen werden, daß die Sensillen auf der Schale der Ostracoden verschiedene Reize aufnehmen können. Zu klären ist, ob die Sensillen mit nur zwei Rezeptorcilien andere Aufgaben wahrnehmen als die mit 4 Rezeptorcilien.
Danksagung: Für die Hilfe bei der Präparation möchte ich Frau S.Belßner, für die überarbeitung des Manuskriptes und wertvollen Diskussionen Herrn Prof.Dr.G.Hartmann, beide Hamburg, danken,
Literatur: lltner, H., 1977: Insektensensillen: Bau-und Funktionsprinzipien, Verh.Dtsch.Zool.Ges. 70: 139-153.
Fig.8 Schnitt durch das gesamte Sensillum in Höhe der hier nur 2 Dendriteninnenglieder/Section of the whole sensillum in the region of in this case only two inner dendritic segments.-Fig.9 Längsschnitt durch die Schale und die äußere Epidermis eines sich gerade häutenden Tieres mit Siebplatte/Section through the shell and outer epidermal layer of an animal just prior to ecdysis which possess a sieve-plate.-Fig.10 Schnitt durch die Borste im Häutungsspalt vor der Chitinisierung/Section through the non chitinous bristle in the ecdysal space.-Fig.11 Schnitt durch die Borste im Häutungsspalt nach erfolgter Chitinisierung/ Section through the fully chitinous bristle in the ecdysal space. Fig.12 Hirschmannia viridis: Neugebildete Borste im Häutungsspalt/Newly formed bristle in the ecdysal space.-Fig.13 Xe stoleberis aurantia: Borstenlängsschnitt/Section through bristle.
610
Altner, H., Ch.Routil, R.Loftus, 1981: The structure of bimodal Chemo-, Thermo- and Hygroreceptive sensilla on the antenna of Locusta migratoria, Cell Tissue Res.215: 289-308. Andersson, A., 1975: The ultrastructure of a presumed chemoreceptor aestetasc "Y" of a cypridid ostracod, Zool.Scripta !: 151-158. Benson, R.H., 1975: Morphologie stability in Ostracoda, Bull. amer.Paleont.65: 13-45. Gnatzy, W. & J:Romer, 1980: Morphogenesis of mechanoreceptor and epidermal cells of Crickets during the last instar, and its relation to molting-hormone level, Cell Tissue Res.213: 369-391. Gnatzy, W. & J.Tautz, 1980: Ultrastructure and mechanical properties of an insect mechanoreceptor: Stimulus-transmitting structures and sensory apparatus of the cercal filiform hairs of Gryllus, Ce II Tissue Res.213: 441-463. Guse, G.W., 1980a: Fine structure of sensilla during moulting in Neomysis integer (LEACH) (Crustacea, Mysidacea), Experientia ~: 1382-1384. Guse, G.W., 1980: Develo~ment of antennal sensilla during moulting in Neomysis integer (LEACH) (Crustacea, Mysidacea), Protoplasma 105: 53-67. Hartmann-;-G., 1967: BRONN's Klassen und Ordnungen des Tierreichs: Ostracoda 1,2: 1-408. Akadem.Verlag, Geest und Portig KG, Leipzig. Heimann, P., 1979: Fine structure of sensory tubes on the antennule of Conchoecia spinirostris (Ostracoda, Crustacea), Cell Tissue Res.202: 461-477. Keil, T., 1~: Die Makrochaeten auf dem Thorax von Calliphora viaina Robineau-Desvoidy (Calliphoridae, Diptera) Feinstruktur und Morphogenese eines epidermalen Insekten-Mechanorezeptors, Zoomorphologie 90: 151-180. Keyser, D., 1980: Auftreten und Konstanz von Poren und Borsten auf der Schale von Podocopa (Ostracoda, Crustacea), Verh.naturwiss.Ver.Hamburg (NF) 23: 175-193. Liebau, A., 1969: HomoIOgisierende Korrelationen von Trachyleberididen-Ornamenten (Ostracoda, Cytheracea), N.Jb.Geol.Paläont. Mh. 1969 (7): 390-402. Mead, F., D.Gabouriaut, G.Corbiere-Tichane, 1976: Struature de l'organe sensoriel apical de l'antenne chez l'Isopode terrestre Metoponorthus sexfasciatus BUDDE-LUND (Crustacea, Isopoda), Zoomorphologie 83: 253-269. MÜller, K.J., 1~9: Body appendages of paleozoic Ostracodes, Proc.of VII International Symp.of Ostracodes, Serbian Geol.Soc. 1979 Belgrad: 5-9. Rieder, N. & H.Spaniol, 1980: Die Rezeptoren an den ersten Antennen von Leptestheria dahalacensis RÜFFEL (Crustacea, Conchestraca), Zoomorphologie 95: 169-179. Risler, H., 197~ Die Sinnesorgane der Antennula von Ligidium hypnorum (CUVIER) (Isopoda, Crustacea), Zool.Jb.Anat.100: 514-541. Risler, H., 1977: Die Sinnesorgane der Antennula von Porcellio scaber LATR. (Crustacea, Isopoda), Zool.Jb.Anat.98: 29-52. Rome, D.R., 1947: Herpetocypris reptans (Ostracoae), ~tude morphologique et histologique. I. Morphologi~ externe et syst~me nerveux, La Cellule 51: 49-152. Sylvester-Bradley, P:C. & Benson, R.H., 1971: Terminology for surfaae feature in ornate Ostracodes, Lethaia !: 249-286.