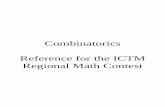Jähnichen, Gisa (2004). Einheit durch Differenz – oder: Wozu noch Musikethnologie? . Berichte aus...
Transcript of Jähnichen, Gisa (2004). Einheit durch Differenz – oder: Wozu noch Musikethnologie? . Berichte aus...
- 205-
Gisa J ÄHNICHEN
EINHEIT DURCH DIFFERENZODER:
wozu NOCH MusiKETHNOLOGIE?
Zu Beginn des 21. Jahrhundert sollte die Frage nach dem zukünftigen Sinn von Musikethnologie nicht als längst überfällig beklatscht werden, sondern doch eher verwundern . Erweiterungsfähige Konzeptionen einer ganzheitlichen Musikwissenschaft können gewiss nützliche Orientierungshilfen sein, wenn sie von übergreifendem Verständnis geprägt sind. Im Zeitalter rasant zunehmender methodologischer Differenzierungen und Spezialisierungen in ausnahmslos allen Bereichen der Wissenschaft und Forschung sollten sie jedoch keinesfalls als Horizontausblendungen herhalten.
Die wiederentdeckte Forderung nach einer einheitlich verstandenen "Wissenschaft über Musik", wie siez. B. kürzlich von Martin Greve formuliert wurde (Writing against Europe - Vom notwendigen Verschwinden der " Musikethnologie ", in: Die Musikforschung, Jg. 55, Heft 3, Bärenreiter-Verlag, Kassel 2002, ähnlich angelegt in seinem späteren Abschlussvortrag zum Habilitationsverfahren an der TU Berlin) , macht sich allerdings zum Anwalt der etablierten "Über"musikwissenschaftler, die nun nachdenken, ob es in Zukunft noch Sinn hat, sich den einen oder anderen Hof-Musikethnologen zu halten. Man muss schließlich auch verzichten können in Zeiten der Not.
Damit ist die Richtung der so gemeinten Einheitlichkeit in der Musikwissenschaft bereits klar ausgedrückt: Zum einen wisse man das meiste sowieso schon oder könne es bei Bedarf kurzfristig am Rande der Weltmetropolen beschaffen. Der Berg vielfältiger Kulturprodukte sei ja durch Migrationsbewegungen bereits beim Propheten angelangt. So erübrige sich doch wohl die anstrengende und kostspielige Spezialisierung. Zum anderen lohne es sich kaum noch, das wenige, was man nicht wisse, noch irgendwie zu erforschen, weil die globalisierte Zivilisation längst für dessen Aussterben sorge. Und überhaupt, man habe schon genug über "Andere" geschrieben, sowohl übermäßig wohlwollend, beinahe nestbeschmutzend, als auch unredlich, weil fern
- 206-
jeder kulturinternen Kritikmöglichkeit Inzwischen könnten die "Anderen" doch wohl selbst über sich schreiben. Dies dürfe ja dann einfließen in eine stiloffene, geschichtsoffene und weltoffene Konkurrenz.
Wozu also Musikethnologie?
Die Not muss tatsächlich groß sein; und ich frage mich, wie unsicher man sich seiner selbst sein muss, um dieser Argumentation bereitwillig zu folgen.
Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte und einige erkenntnistheoretische Überlegungen sollen helfen, zunächst einen wesentlichen Unterschied zwischen der verunsicherten Historischen Musikwissenschaft europäischer Ausprägung und der fehlinterpretierten Musikethnologie zu verdeutlichen.
In beiden Teilgebieten werden möglichst detaillierte Kenntnisse über die Beschaffenheit "musikalischer Produkte" angestrebt. Doch während dies in der Historischen Musikwissenschaft bereits das erklärte Ziel ist, ist es in der Musikethnologie nur eine von mehreren Voraussetzungen, Untersuchungen anzustellen. Hier geht es um etwas anderes: um möglichst detaillierte Kenntnisse musikalischer Produktionsweisen, die als solche nicht von den Akteuren, von ihren zeiträumlichen Dimensionen und konkreten ethnisch-sozialen Einbettungen getrennt werden können. "Musik" als lapidar bezeichneter Gegenstand eines jeden musikwissenschaftliehen Teilgebietes ist eben vielerlei und dies ist auch der Grund zahlreicher terminologischer Probleme nicht nur im Vergleich verschiedener Kulturen, sondern auch innerhalb ein und derselben Kultur.
Musik kann sowohl ein Produkt als auch eine Handlung, ein Ereignis, ein Geschehen bezeichnen. Der erste Aspekt ist Gegenstand der Historischen Musikwissenschaft und ihrer angegliederten, diesen Aspekt untermauernden Teilgebiete, der zweite ist der der Musikethnologie. Der eigentliche Vorzug der Historischen Musikwissenschaft europäischer Prägung besteht darin, dass Intrakulturalität, soziales Grundwissen und Kenntnis grundsätzlicher musikalischer Produktionsprinzipien vorausgesetzt werden, wenn musikalische Werke der Vergangenheit und Gegenwart europäischer Musikkultur
- 207-
und ihrer Derivate, zumeist in verschriftlichter Form, im Mittelpunkt stehen.
Diese Vorbedingungen mussten in der Musikethnologie erst erarbeitet werden und es bedurfte vieler Anstrengungen, sie überzeugend durchzusetzen. Schon die damit notwendige interdisziplinäre Ausrichtung macht deutlich, dass es sich nicht nur primär um unterschiedliche "Untersuchungsobjekte" handelt, sondern um eindeutig verschiedene wissenschaftliche Betrachtungsweisen. Doch das war nicht das einzige Problem.
Die handlungsorientierte Musikethnologie konnte wissenschaftsgeschichtlich erst dann sinnvoll betrieben werden, als es möglich war, deutlich verschiedenartiges musikalisches Produzieren beobachtbar zu machen, sei es durch direkte Anschauung, durch Ton- und später durch Filmaufnahmen. Sie war also an eine bestimmte kommunikative und technische Entwicklung gebunden, die erst Ende des 19. Jahrhunderts einsetzte. Eine direkte musikpraktische Beobachtungsmöglichkeit gab es zwar schon immer an den Schnittstellen verschiedener Kulturen und spielte bei der Herausbildung regionaler und lokaler Stile und Repertoires unbestritten eine wesentliche Rolle. Dies ging jedoch in der Historischen Musikwissenschaft europäischer Prägung durch die stete Orientierung auf das Endprodukt, das gemessen wurde an bereits Bekanntem, eher marginal in den Erkenntnisgewinn ein. Musikalische Volks- und Völkerkunde galten ihr lediglich als illustrative Anhängsel, als Abarten ihrer selbst auf lokal und qualitativ beschränktem Niveau. Die Systematische Musikwissenschaft als abstrahierendes Instrument der Analyse war ein ebenso enger Blick nach innen, der Produktqualitäten auf unterschiedliche Art und Weise zu vermessen hatte und der folgerichtig mit der Intention zur produktiven Draufsicht einer sich entwickelnden Musikethnologie kollidierte. Es nimmt daher kein Wunder, dass wichtige, auch streitbare Impulse aus der Tonpsychologie und der Organologie kamen, dass es vornehmlich außereuropäische und/oder oral tradierte Musik war, die "herausforderte", denn es fehlte die Selbstverständlichkeit der Intrakulturalität, des sozialen Grundwissens und der Kenntnis musikalischer Produktionsprinzipien. Damit schränkte sich die Möglichkeit einer produktorientierten, bewertenden bzw. einer Verwertung zuführbaren wissenschaftlichen Untersuchung stark ein.
-208-
Insofern war es zunächst die Historische Musikwissenschaft, die der Musikethnologie ihren äußerlichen Aktionsradius vorschrieb, nämlich jene soweit nicht verwertbaren "exotischen" Artikulationen musikalischer Kreativität, die mit außereuropäisch, oral tradiert, nicht-westlich usw. beschrieben sein sollten. Die implizierten ethnischen Zuordnungen als Grenzmarkierung des Verantwortungsbereiches stellten sich ebenfalls vornehmlich aus dieser Perspektive ein und wirken heute fort in der Annahme, man könne Musikethnologie in regionale Zuständigkeiten aufteilen. Kulturkreislehre, Authentizismus und Typisierungen stellen sich mithin als vermittelnder Behelf der Historischen Musikwissenschaft dar. Doch dies ist keineswegs identisch mit den Zielen der Musikethnologie, in der es mitnichten um das Verwerten musikalischer Produkte verschiedener Ethnien geht. Musikethnologie ist eben nicht Expansion der Historischen Musikwissenschaft, auch wenn Quellenstudium, Notationskunde, Ikonographie, Archäologie und viele andere Forschungsgebiete, in denen dauerhaft vergegenständlichte Objekte betrachtet werden, eine erhebliche Rolle spielen. Umgekehrt ist auch die Untersuchung von individuellen Schaffensprozessen, ihren sich wandelnden sozialen Hintergünden und Rezeptionsbedingungen in der Historischen Musikwissenschaft von Belang, doch es geschieht mit definitiver Rücksicht auf die musikalische Produktqualität, die zu beurteilen sie sich befähigt sieht.
Der Musikethnologie geht es im weitesten Sinne um die Untersuchung musikkultureller Lebensstrategien, bei denen das dabei entstehende "Produkt" nur ein zeitlich sehr befristeter und kein absoluter "Durchgangspunkt" ist. Beurteilungen sind, wenn überhaupt, nur in sehr engen raumzeitlichen Zusammenhängen möglich und in sich äußerst relativ.
Feldforschungen sind gerade deshalb unersetzbar. Teilnehmende Beobachtung- wo immer sie auch geschieht- ist dabei eine der effektivsten Methoden zur Kenntnisgewinnung, denn sie integriert die Untersuchenden in jene musikalischen Prozesse, die den wesentlichen Sinn ihrer Wissenschaft ausmachen. Der Toleranzbereich normativen Randelos hängt "in Echtzeit" von diesen Kontexten ab. Wir studieren die Beziehungen der Akteure, der Rezipienten und der Produzenten, zu ihren musikalischen Handlungen, wir studieren die Technologien und Denkweisen, derer sie sich bedienen, wir unternehmen gar
- 209-
Selbstversuche, um bestimmten "Logiken" in ihren individuellen Handlungsweisen auf die Spur zu kommen. Daher ist die Definition des Feldes dabei keineswegs an vorgefertigte Muster gebunden. Aus der zwangsweise eindimensionalen Sicht der Produktbezogenheit hingegen machen sich gerade in transkulturellen Zusammenhängen westlicher Metropolen Klischees stark, die Nationalität auf Abstammung zurückführen, die weder die individuelle Identität noch die zeiträumliche Dimension ihrer Ausprägung berücksichtigen ganz entgegen ihres "historischen Anspruchs" - und damit lediglich ein weiteres Produktattribut liefern: "arabischer" Mozart, "kalifornische" ChinaOper. Interkulturalität ist in diesem Kontext nur ein anderer Begriff für freie ProduktwahL
Gerade das macht Musikethnologie als diskursives Regulativ unentbehrlich. Aus ihrer Handlungsperspektive gibt es z. B. kein "Original", denn erst ein Produkt kann originale Eigenschaften aufweisen. Erst ein Produkt kann kopiert werden, sogenannte Typizität oder Exotik repräsentieren und getrennt von seiner zeiträumlichen und individuellen Dimension auch komplette Sinnentleerung erfahren. "Weltmusik" als Teil aktueller "Popularmusik" lebt im Grunde von medialer Verdinghebung und sinnentleerender Abstraktion. Anders könnte sie schwerlich funktionieren . Aus der Sicht der Musikethnologie ist der Prozess dieser Abstraktion durchaus interessant, als Produkt hingegen reiht sie sich ein in eine lange Geschichte von zeitlich sehr befristeten Erscheinungen. Ihr verhältnismäßig geringer ökonomischer Erfolg hat damit eher weniger zu tun als mit der Monopolisierung des Musikmarktes und der damit einhergehenden Uniformierung von "Verbraucherverbal ten".
Ein anderer Gesichtspunkt beginnt hier eine Rolle zu spielen: die häufige Verquickung der historischen Betrachtung von Musik als Produkt und dessen Sein als Ware. Warenwirtschaftlich ist die Konzentration auf musikalische Produktqualitäten Marktforschung im gehobenen Stil. Je erfolgreicher sie betrieben wird, umso mächtiger sind ihre Protagonisten. Musikethnologie schließt sich durch ihren anderen wissenschaftlichen Ansatz von diesem Vorgang gewissermaßen aus. Das einzige, was sie zu Markte tragen kann, ist angehäuftes Wissen über verschiedene musikkulturelle Lebensstrategien und Kenntnisse über verschiedene musikalische Produktionsweisen, die erst dann interes-
- 210-
sant im Sinne von warenwirtschaftlich verwertbar werden, wenn sie als Produkte behandelt werden, etwa im musiktherapeutischen Zusammenhang, im internationalen oder transkulturellen Kulturmanagement, als "Performance" oder als auf Ton- und Bildträger gebannte "Zeitdokumente". Doch auch in der wahrhaft globalen Warenwirtschaft gibt es überlebenswichtige Regulative, die niemals käuflich sein können: Würde, Selbstachtung, Verständnisbereitschaft, Vertrauen. Je perfekter jedwede Wissenschaft in warenwirtschaftliche Zusammenhänge eingreift oder einzugreifen gezwungen ist, desto wichtiger werden diese Regulative. Das gilt auch für Musikkulturen, wie sehr stilistisch offen oder geschichtlich offen sie auch immer betrachtet werden. Hier kann nun endlich von Gemeinsamkeiten der Historischen Musikwissenschaft und der Musikethnologie die Rede sein, ein Anspruch der ihnen in ihrer wissensvermittelnden Funktion Einheit verschafft. In diesem Sinne gibt es nur eine Musikwissenschaft, so unterschiedlich die wissenschaftlichen Betrachtungsweisen ihrer Teilgebiete beschaffen sein mögen.
Die von Martin Greve geforderte Einheit der Musikwissenschaft und die von nicht wenigen Musikhistorikern dieses Landes der weltoffenen, toleranten und friedliebenden Menschen frohlockend interpretierte Argumentation zur Abschaffung der Musikethnologie war allerdings weit davon entfernt.
Der Musikkritiker Klaus Peter Richter schrieb einst in der FAZ unter dem Titel "Warum es um die Musikethnologie still geworden ist I Provinz Europa: Von wohltönenden Diskursen verschluckt" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. Januar 2003, SeiteN 3), freizügig und bisweilen wenig korrekt von Martin Greves Text ab. Er noch mehr als Martin Greve selbst macht die ganze Tragik transparent: Man muss wirklich nicht viel verstehen, weder von Musik noch von Ethnologie, um dennoch gedruckt zu werden, wenn es nur fachpolitisch zweckdienlich ist. Mir bleibt nur zu hoffen, dass es "lediglich" die Not der Sparzwänge und nicht etwa tatsächliches Unverständnis der Situation ist, die dazu führten. Es wäre nicht nur schade um die Musikethnologie, sondern schade um die Musikwissenschaft.