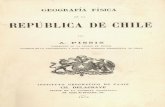Bauhaus en Chile, revista “de arquitectura“ n°28, FAU U. Chile julio 2015
Hybride Erinnerung. Geschichtspolitik in Chile
Transcript of Hybride Erinnerung. Geschichtspolitik in Chile
Hybride Erinnerung
Geschichtspolitik in Chile
von Stephan Ruderer
Abstract: This article analyses the “struggle for memory” in Chile after the Pinochetdictatorship. Drawing on theories seeking to combine the concept of “collectivememory” with methods of oral history, the main focus will be on the “emblematicmemories”. After the end of the dictatorship, the twomost influential narratives of thepast came from the democratic government of theConcertaciûn and from themilitary,in alliance with the oppositional parties of the right-wing. The article traces back howpreviously antagonistic versions of the past, held by the government and the militaryrespectively, have evolved into a hybrid leading narrative that still maintains the twoadversary versions in a disconnectedmanner. This hybridmemory leaves the strugglefor a moral consensus a task for current memory politics.
I. Einleitung
„I have been through this before.“ – In den Tagen nach den Anschlägen auf dasWorld Trade Center am 11. September 2001 beschrieb der chilenischeSchriftsteller Ariel Dorfman seine Erinnerungen an den „anderen“ 11. Sep-tember. An diesem Tag im Jahr 1973 putschte das chilenischeMilitär gegen diedemokratisch gewählte Regierung des Sozialisten Salvador Allende undDorfman erinnerte sich angesichts der Ereignisse in New York daran, dass der11. September schon seit 28 Jahren ein Tag der Trauer und des Todes fürMillionenvon Chilenenwar.1Diese Art der Erinnerung fand allerdings in Chilewährend der fast 17 Jahre dauernden Militärdiktatur unter Augusto Pinochetkaum eine Ausdrucksmöglichkeit. Erst seit der Rückkehr zur Demokratie imJahr 1990 kann sich die Erinnerung an die Opfer des „anderen“ 11. Septembersartikulieren und dem Siegergedächtnis des chilenischen Militärs eine andereVersion der Geschichte entgegensetzen. Im Folgenden soll der „Kampf um dieGeschichte“ in der chilenischen Demokratie analysiert werden, wobei ingrober Anlehnung an das Konzept von Nestor Garc�a Canclini die Heraus-bildung einer hybriden Form der Erinnerung konstatiert wird.2
1 Ariel Dorfman, The Last September 11, in: Pilar Aguilera u. Ricardo Fredes (Hg.), Chile.The Other September 11. An Anthology of Reflections on the 1973 Coup, Melbourne2006, S. 1–3, hier S. 1.
2 Nestor Garc�a Canclini, Hybrid Cultures. Strategies for Entering and LeavingModernity,Minneapolis 1995.
Geschichte und Gesellschaft 36. 2010, S. 129 – 156Ð Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2010ISSN 0340-613X
In Demokratisierungsprozessen spielt die Geschichtspolitik eine zentraleRolle, denn im Prozess des politischen Umbruchs steht das Geschichtsbildeiner Nation auf dem Prüfstand. „Systemwechsel sind auch als Geschichts-bildwechsel zu konzipieren“,3wobei einschränkend hinzugefügt werdenmuss,dass der reibungslose Übergang von einem oktroyierten Geschichtsbild derDiktatur hin zu einer pluralistisch ausgehandelten nationalen Leiterzählung inder Demokratie eine Illusion ist. Tatsächlich sind es immer wieder die Kon-flikte um die Deutung der Vergangenheit, die die Bemühungen um Aufarbei-tung im Prozess der Demokratisierung beeinflussen.4 Im Umkehrschluss be-einträchtigt auch die Art undWeise, wie mit der Vergangenheit einer Diktaturumgegangen wird, die Form des nationalen Erinnerns an eben diese Vergan-genheit. Dabei lassen sich die beiden Felder Vergangenheitspolitik und Ge-schichtspolitik definitorischplausibel voneinander abgrenzen:Während unterVergangenheitspolitik in erster Linie praktisch-politische Maßnahmen ver-standen werden, die sich auf die konkrete Aufarbeitung der Diktaturfolgenbeziehen,5 so ist Geschichtspolitik durch öffentlich-symbolisches Handelncharakterisiert, welches auf die Konstruktion von Geschichts- und Identi-tätsbildern abzielt und nicht unbedingt in zeitlicher Nähe zu seinem Bezugs-gegenstand stehen muss.6
3 Harald Schmid, Systemwechsel und Geschichtsbild. Zur Debatte um die „doppelteVergangenheitsbewältigung“ von NS- und SED-Vergangenheit, in: Deutschland Archiv38. 2005, S. 290–297, hier S. 292.
4 So schon Peter Steinbach, Vergangenheitsbewältigung in vergleichender Perspektive.Politische Säuberung, Wiedergutmachung, Integration (= Informationen der Histori-schen Kommission zu Berlin, Beiheft 18), Berlin 1993, S. 8.
5 Der Begriff Vergangenheitspolitik wurde zuerst von Claus Offe, Der Tunnel am Ende desLichts. Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten, Frankfurt 1994,in die akademische Debatte eingebracht. Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die An-fänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996, etablierte ihndann mit seinem Standardwerk zum Umgang mit den Tätern der Nazizeit in denfünfziger Jahren. Mittlerweile hat sich die Konzeption des Begriffes wesentlich weiter-entwickelt, vgl. u. a. Helmut König, Von der Diktatur zur Demokratie oder Was istVergangenheitsbewältigung, in: ders. u. a. (Hg.), Vergangenheitsbewältigung am Endedes zwanzigsten Jahrhunderts, Opladen 1998, S. 371–392; Jon Elster, Coming to Termswith the Past. A Framework for the Study of Justice in the Transition to Democracy, in:Archives Europ¤ennes de Sociologie 39. 1998, S. 7–48; Petra Bock, Vergangenheits-politik im Systemwechsel. Die Politik der Aufklärung, Strafverfolgung, Disqualifizie-rung und Wiedergutmachung im letzten Jahr der DDR, Berlin 2000 und Ruth Fuchs u.Detlef Nolte, Politikfeld Vergangenheitspolitik. Zur Analyse der Aufarbeitung vonMenschenrechtsverletzungen in Lateinamerika, in: Lateinamerika-Analysen 9. 2004,S. 59–92.
6 Vgl. Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Wegzur bundesrepublikanischen Erinnerung, 1948–1990, Darmstadt 1999, S. 32.
130 Stephan Ruderer
Die Aufgabe der Geschichtspolitik, zu Prozessen der politischen Bewusst-seinsbildung beziehungsweise zur nationalen Identitätskonstruktion in derBevölkerung beizutragen, ist gerade in Demokratisierungsprozessen funda-mental. In der Erinnerung an die Vergangenheit geht es nicht nur um dieEtablierung einer „offiziellen“ historischenWahrheit, sondern immer auchumpolitisch geprägte Interpretationen und Deutungen. Geschichte kann so zueinem „Kampffeld der Vergangenheitsinterpretationen und der Zukunftser-wartungen“7 werden; sie dient eben auch der Legitimierung der aktuellenpolitischen Situation. Im Systemwechsel kommt der Formierung eines na-tionalenGedächtnisses besondere Bedeutung zu, da sich dieDemokratie in deröffentlichen historischen Interpretation deutlich von der vorausgegangenenDiktatur absetzen muss, um im Bewusstsein ihrer Bürger eine eigenständigeIdentität zu erhalten. Die neue demokratische Regierung muss sich dieserAufgabe annehmen, um imKampf umdieDeutungshoheit über die Geschichteeinen staatlich autorisierten Gedächtnisrahmen abzustecken.8 Es geht also – jenach Art und Weise des Regimeübergangs – nicht nur darum, den Verdrän-gungsmechanismen der Diktatur, die ihre Verbrechen vergessen machenmöchte, die Erinnerung entgegenzusetzen. Sondern es geht um einen tat-sächlichen „Kampf der Erinnerungen“, bei der eine positive Erzählung überdas alte Regime mit einer „negativen Erinnerung“9 kontrastiert werden muss,die aber gleichzeitig als positives Identifikationsangebot für die neue Demo-kratie dienen kann.Schon Maurice Halbwachs hat darauf hingewiesen, dass sich das individuelleErinnern nur innerhalb kollektiver Bezugsrahmen abspielt.10 Die in Anleh-nung an ihn entwickelten Konzepte des „kollektiven Gedächtnisses“ von Janund Aleida Assmann lassen sich zur Analyse der Erinnerungskonflikte inÜbergangsgesellschaften durchaus verwenden.11 Gerade die von Aleida Ass-
7 Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik, S. 17.8 Vgl. Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur undGeschichtspolitik, München 2006, S. 149 f.
9 Reinhart Koselleck, Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses, in: VolkhardKnigge u. Norbert Frei (Hg.), Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mitHolocaust und Völkermord, München 2002, S. 21–32.
10 Vgl. Maurice Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1985,S. 201.
11 Vgl. u. a. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politischeIdentität in frühen Hochkulturen, München 20055 ; Aleida Assmann u. Ute Frevert,Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Ver-gangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999; Aleida Assmann, Der lange Schatten der Ver-gangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, sowie denGründervater der französischen Erinnerungsgeschichte Pierre Nora, Wie lässt sichheute eine Geschichte Frankreichs schreiben?, in: ders. (Hg.), ErinnerungsorteFrankreichs, München 2005.
Geschichtspolitik in Chile 131
mann für das nationale oder politische Gedächtnis vorgenommene Differen-zierung zwischen Sieger- und Verlierer- beziehungsweise Täter- und Opfer-gedächtnis, welche sich durch eine hohe symbolische Intensität und einestarke Affektivität auszeichnen und dadurch – sich meist unversöhnlich ge-genüberstehend – das Zusammenleben einer Gesellschaft mitprägen können,12
erhält in Demokratisierungsprozessen Relevanz. Um diese Prozesse ange-messen einordnen zu können, sollte der Historiker also auch die Dynamikenbei der Herausbildung eines kollektiven nationalen Gedächtnisrahmens in denBlick nehmen. Ebenso gilt es, die Entstehung von „Erinnerungsorten“ zuuntersuchen, bei denen es sich in denWorten von FranÅois Etienne undHagenSchulze um „langlebige, Generationen überdauernde Kristallisationspunktekollektiver Erinnerung und Identität [handelt], die in gesellschaftliche, kul-turelle und politische Üblichkeiten eingebunden sind und die sich in demMaße verändern, in dem sich die Weise ihrer Wahrnehmung, Aneignung,Anwendung und Übertragung verändert“.13
Dabei muss man sich der Problematik des immer medial vermittelten „kollek-tiven Gedächtnisses“ bewusst sein, denn die individuelle Erinnerung der Be-troffenen geht darin nur unzureichend auf, wie jüngst Christof Dejung in seinemPlädoyer für die Verwendung der Oral History wieder deutlich gemacht hat.14
Eine überzeugende Verbindung zwischen der nur individuelle Erfahrungenwahrnehmenden Oral History und der generalisierenden Analyse der kollekti-ven Erinnerung hat der Historiker Steve Stern am Beispiel der chilenischenGesellschaft vorgenommen, indem er unter Verwendung von Oral Historymehrere Gruppen so genannter „emblematischer Erinnerungen“ herausgear-beitet hat, die den Kampf um die Geschichte in Chile prägen.15 Stern sprichtdabei von „Erinnerungsknoten“, die dem sozialen Körper eingebunden sind,und deren Artikulation von bestimmten sozialen Trägerakteuren, wie zumBeispiel Menschenrechtsgruppen oder Militäreliten, abhängig ist. Einen ähnli-chen Ansatz verfolgt Michael Lazzara, der ebenfalls am Beispiel Chiles denTerminus „lenses of memory“ prägt, durch die auch die subjektive Sicht auf die
12 Vgl. Assmann, Der lange Schatten, S. 60.13 FranÅois Etienne u. Hagen Schulze, Einleitung, in: dies. (Hg.): Deutsche Erinnerung-
sorte, Bd. 1, München 2001, S. 18.14 Vgl. Christof Dejung, Oral History und kollektives Gedächtnis. Für eine sozialhistori-
sche Erweiterung der Erinnerungsgeschichte, in: GG 34. 2008, S. 96–115. Zur Kritik andem Begriff „kollektives Gedächtnis“ vgl. u. a. auch Reinhart Koselleck, Der 8. Maizwischen Erinnerung und Geschichte, in: Rudolf Thadden u. Steffen Kaudelka (Hg.),Erinnerung und Geschichte. 60 Jahre nach dem 8. Mai 1945, Göttingen 2006, S. 13–22,hier S. 20.
15 Vgl. Steve Stern, Remembering Pinochet’s Chile. On the Eve of London 1998, Durham20062, S. 4.
132 Stephan Ruderer
Vergangenheit berücksichtigt wird.16 Diese Konzeptionen, die den starren Be-griff des kollektiven Gedächtnisses aufbrechen, ohne sich in der Vielfalt derindividuellen Erinnerungen zu verlieren, sollen auch der folgenden Analyse derGeschichts- beziehungsweise Erinnerungspolitik in Chile als Leitlinie dienen.Der Fokus liegt dabei im Sinne der oben dargelegten Aufgabe der Geschichts-politik auf dem Kampf um das nationale Gedächtnis beziehungsweise auf derEtablierung eines staatlich autorisierten Gedächtnisrahmens.Die lateinamerikanischen Übergangsprozesse stellen ein ergiebiges Untersu-chungsfeld für die Art der Erinnerungspolitik dar, bei der „emblematische Er-innerungen“ konträr aufeinandertreffen, und die Durchsetzung eines „negati-ven Gedächtnisses“ als positive Bezugsfolie für die neu entstehende Demokratiedaher besondere Priorität erhält. Häufig trifft man auf dem Kontinent auf aus-gehandelte Übergänge von der Diktatur zur Demokratie, bei denen die altenMachthaber noch einen großen Teil der Macht konservieren konnten, und eineoffizielle und öffentliche Verurteilung der Diktatur nicht stattgefunden hat. Vordiesem Hintergrund soll im Folgenden die Entwicklung der erinnerungspoliti-schen Debatten in Chile analysiert werden, wobei im Mittelpunkt der Unter-suchung offizielle erinnerungspolitische Akte der Regierung sowie die Presse-diskurse über die Vergangenheit stehen.17 Um die geschichtspolitischen De-batten in Chile einordnen zu können, wird in einem ersten Schritt der vergan-genheitspolitischeVerlauf der chilenischenTransition, innerhalb dessen sich dieKonflikte um die Erinnerung abspielten, referiert.
II. Verlauf der chilenischen Vergangenheitspolitik
NachdemderDiktatorAugusto Pinochet schonEnde 1988 ein von derDiktaturvorgesehenes Plebiszit über seinen Verbleib an der Macht verloren hatte,übernahm am 11. März 1990 der demokratisch gewählte ChristdemokratPatricio Aylwin, der dem Parteienbündnis der Concertaciûn vorstand, dieRegierung in Chile. Damit endete die brutale Militärdiktatur, die mit demPutsch gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salva-dor Allende am 11. September 1973 begonnen hatte.18 Nachdem schon das„sozialistische Experiment“ von Allende von derWeltöffentlichkeit mit großerAufmerksamkeit verfolgt worden war, wandelte sich das anschließende
16 Vgl. Michael Lazzara, Chile in Transition. The Poetics and Politics of Memory, Gai-nesville 2006, S. 13.
17 Dabei wurden im Rahmen meiner Dissertation über „Vergangenheitspolitik und De-mokratisierung in Chile 1990–2006“ die größeren Tageszeitungen in Chile (besondersEl Mercurio und La Tercera, aber auch Zeitungen mit niedrigeren Auflagen) systema-tisch durchgesehen.
18 Zur Militärdiktatur vgl. Carlos Huneeus, The Pinochet Regime, Colorado 2007 undStefan Rinke, Kleine Geschichte Chiles, München 2007, S. 144 ff.
Geschichtspolitik in Chile 133
Pinochetregime schnell zum Sinnbild einer grausamen lateinamerikanischenMilitärdiktatur.19 Die Anklage der Menschenrechtsverletzungen wurde nichtnur international sondern auch innerhalb Chiles zu einem einigenden Faktorder Oppositionsbewegung gegen Pinochet. Es ist somit nicht verwunderlich,dass das Thema „Menschenrechte“ und damit auch die Aufarbeitung derVerbrechen der Vergangenheit zu einer zentralen Forderung der neuen de-mokratischen Regierung gehörte. Die Möglichkeiten zur Umsetzung dieserForderung waren jedoch durch die Art und Weise der chilenischen Transitionkonditioniert.20
Die politische Ausgangskonstellation des ausgehandelten Übergangs in Chilewar komplex und im Sinne des Handlungsspielraums der demokratischenMachthaber ziemlich restriktiv. Pinochet blieb als ehemaliger Diktator auchüber 1990 hinaus noch weitere acht Jahre Oberbefehlshaber des Heeres undsollte in dieser Funktion großen politischen Einfluss behalten. Daneben ver-suchte das Militär, sich durch eine Reihe von so genannten Fesselgesetzen, dieim letzten Jahr des Regimes erlassen worden waren, gegen juristische Straf-verfolgung abzusichern. So konnte der Diktator massiv in die Besetzung desObersten Gerichtshofes und des Verfassungsgerichts eingreifen, dem neuenParlament verbieten, Handlungen der politischenAdministration des Regimeszu untersuchen und die Akten des Geheimdienstes in die Archive des Heeresüberführen. Komplettiert wurden diese Maßnahmen durch das weiterhingültige Amnestiegesetz aus dem Jahre 1978, welches sämtliche Menschen-rechtsverletzungen aus den ersten Jahren der Diktatur unter Amnestie stellte.Gleichzeitig garantierten neun designierte Senatoren und ein binominalesWahlsystem, welches grundsätzlich den zweitstärksten Wahlblock – in Chilemeist die konservativen rechten Parteien – bevorteilt,21 den politischen Ver-bündeten des Militärregimes eine Vetoposition in der neuen Demokratie, von
19 Zur exemplarischen Rolle Chiles vgl. Laurence Whitehead, Democratization. Theoryand Experience, Oxford 2002, S. 213.
20 Dies trifft nicht nur für den chilenischen Fall zu, sondern gilt allgemein für Transi-tionsprozesse, vgl. die klassische Studie von Guillermo O’Donnell u. Philippe Schmitter,Transition from Authoritarian Rule. Bd. 4: Tentative Conclusions about UncertainDemocracies, Baltimore 1991.
21 Dabei stehen in jedem Distrikt zwei Sitze zur Wahl, wobei ein Wahlbündnis nur dannbeide Sitze gewinnen kann, wenn es doppelt so viele Stimmen wie das zweitstärksteBündnis erzielt. Da dies selten eintrifft, teilen sich die beiden großen Parteienbündnisseaus Concertaciûn und rechter Opposition trotz unterschiedlicher Stimmenzahl meistdie Sitze eines Distrikts. Das System favorisiert auf diese Weise die rechte Opposition,die im Kongress im Verhältnis zu ihren Wählerstimmen überproportional vertreten ist,schließt kleinere Parteien (besonders die Kommunistische Partei) von der parlamen-tarischen Repräsentation aus und verlagert denWahlkampf in die einzelnen Bündnisse.Zum binominalen Wahlsystem vgl. die Artikel in dem Band von Carlos Huneeus (Hg.),La reforma al sistema binominal. Una contribuciûn al debate, Santiago 2006.
134 Stephan Ruderer
der aus sie zahlreiche vergangenheits- und erinnerungspolitischeMaßnahmenblockieren konnten.22 Für das Feld der Geschichtspolitik besonders relevantwar die Subventionierung auf Staatskosten der beiden größten chilenischenTageszeitungen, die beide in deutlicher ideologischer Nähe zur Diktaturstanden und aufgrund der finanziellen Hilfen im letzten Jahr des Regimes eineMonopolstellung in der Medienlandschaft der neuen Demokratie einnehmensollten.23 Die neuen demokratisch legitimierten Machthaber sahen sich an-gesichts dieser Situation zu einer „Konsenspolitik“ veranlasst, die der altenElite große Zugeständnisse machte.Trotz dieser „extremely constrained transition“24 übernahm die Regierungunter Patricio Aylwin im ersten Jahr die Initiative auf dem Feld der Vergan-genheitsaufarbeitung. Das herausragende Ereignis stellte dabei der Bericht derNationalen Kommission für Wahrheit und Versöhnung dar, der im März 19912.296 Tote oder „Verschwundene“ der Diktatur aufzählte.25 Dieses nach demVorsitzenden der Kommission Raffll Rettig auch Rettigbericht genannte Do-kument legte erstmals offiziell die Dimensionen der schlimmsten Menschen-rechtsverbrechen in Chile fest, stieß jedoch beim Militär auf harschen Wi-derstand, so dass sich die Regierung im Anschluss an den Bericht daraufverlegte, das Thema der Vergangenheitspolitik von der öffentlichen und po-litischen Agenda zu verdrängen. Maßnahmen zur Aufarbeitung der Vergan-genheit spielten sich lange Zeit nur noch hinter den Kulissen ab; der Öffent-lichkeit sollte eine erfolgreiche Transition und eine versöhnte chilenischeGesellschaft präsentiert werden. Diese Fassade einer „smiling mask“26 wurdejedoch immer wieder von „Erinnerungseinbrüchen“ der Vergangenheitdurchbrochen, die sich entweder in den Versuchen, auch legislativ einenSchlusspunkt unter das Thema Vergangenheit zu setzen, oder durch aufse-henerregende Entscheidungen der Justiz, äußerten.27
Die zahlreichen Schlusspunktversuche scheiterten jeweils an demWiderstandderMenschenrechtsgruppen imVerbundmit den an der Regierung beteiligten
22 Zur restriktiven Ausgangssituation vgl. u. a. Huneeus, Pinochet Regime, S. 431 ff. undSimon Collier u. William Sater, A History of Chile, 1808–1994, Cambridge 1996,S. 359 ff.
23 Vgl. Walter Krohne, Las dos caras de la libertad de expresiûn en Chile, 1990–2005,Santiago 2005, S. 11 ff.
24 Juan Linz u. Alfred Stepan, Problems of Democratic Consolidation. Southern Europe,South America, and Post-Communist Europe, Baltimore 1996, S. 206.
25 Ein überarbeiteter Bericht kommt auf insgesamt 3.195 Tote oder „Verschwundene“.Siehe zum Rettigbericht ausführlich Guido Klumpp, Vergangenheitsbewältigung durchWahrheitskommissionen. Das Beispiel Chile, Berlin 2001.
26 Marta Lagos, Latin America’s Smiling Mask, in: Journal of Democracy 8. 1997,S. 125–138, hier S. 126.
27 Vgl. Alex Wilde, Irruptions of Memory. Expressive Politics in Chile’s Transition toDemocracy, in: Journal of Latin American Studies 31. 1999, S. 473–500.
Geschichtspolitik in Chile 135
sozialistischen Parteien, während die Menschenrechtsprozesse der Justiz re-gelmäßig auf die Fragilität der chilenischen Konsenspolitik verwiesen, da siezu öffentlich ausgetragenenKonflikten zwischen den zivilenMachthabern unddem Militär führten.28 Im bedeutendsten Fall vor der Verhaftung Pinochets inLondon wurde der ehemalige Chef des chilenischen Geheimdienstes, ManuelContreras, im Jahr 1995 für ein Attentat auf einen chilenischen Exilpolitikerauf US-amerikanischem Boden zu einer Haftstrafe verurteilt.29 Auchwenn daschilenische Militär das Urteil letztlich akzeptierte, demonstrierte es gleich-zeitig seine Machtposition, indem sich Contreras über fünf Monate mit mili-tärischer Hilfe seiner Verhaftung entzog und erst nach langwierigen Ver-handlungen mit der Regierung in die Gefangenschaft überführt werdenkonnte.Tatsächlich wurde die Vergangenheit von der chilenischen Politik und Ge-sellschaft aber erst mit der Verhaftung Pinochets in London am 16. Oktober1998 dauerhaft „wiederentdeckt“. Für den Verlauf der Vergangenheitspolitikkam diesem Ereignis „katalytische Wirkung“ zu, in dessen Folge alte Wundengeöffnet sowie neue Debatten und Maßnahmen angestoßen wurden.30 DerDiktator selbst entzog sich zwar nach seinem 503 Tage währenden Zwangs-aufenthalt in London einer Verurteilung in dem in Chile gegen ihn geführtenProzess, doch die vergangenheitspolitische Entwicklung gewann neue Dyna-mik. So trafen sich im Anschluss an die Verhaftung Pinochets erstmals Ver-treter des Militärs, der Regierung und der Menschenrechtsszene gemeinsaman einem Runden Tisch, um die Lösung des Problems der „verschwundenen“Opfer zu diskutieren. Die Aktivitäten der Justiz im Hinblick auf die Men-schenrechtsprozesse nahmen seit dem Jahr 1999 beständig zu und auch diedemokratische Regierung sah sich angesichts des 30. Jahrestages des Putschesim Jahr 2003 veranlasst, einen neuen vergangenheitspolitischen Vorschlag zupublizieren, der unter anderem die Entschädigungsleistungen der Opfer ver-besserte. Daneben wurde auf Initiative der Menschenrechtsgruppen einezweite Wahrheitskommission einberufen, die ebenfalls nach ihrem Vorsit-zenden benannte Valechkommission, welche im November 2004 ihren Berichtveröffentlichte, in dem sie insgesamt 27.255 Folteropfer der Diktatur doku-
28 Vgl. Tom�s Moulian, Chile actual. Anatomia de un mito, Santiago 1997, S. 31 ff.29 Auf Druck der USA war diese Tat explizit aus dem Amnestiegesetz von 1978 ausge-
nommen, vgl. Rainer Huhle, Ein Schritt vorwärts – und zwei zurück? Der „Fall Letelier“im Prozeß der Rückgewinnung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Chile, in:Detlef Nolte (Hg.), Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Hamburg 1996,S. 182–203.
30 Diese Interpretation folgt der These von David Pion-Berlin, The Pinochet Case andHuman Rights Progress in Chile. Was Europe a Catalyst, Cause or Inconsequential?, in:Journal of Latin American Studies 36. 2004, S. 479–505. Zum Fall Pinochet vgl.Madeleine Davis (Hg.), The Pinochet Case. Origins, Progress and Implications, London2003.
136 Stephan Ruderer
mentiert.31 Die im gleichen Jahr erfolgten Enthüllungen über die Geheim-konten Pinochets bei der US-amerikanischen Riggs-Bank, auf denen derDiktator unter falschem Namen mehrere Millionen Dollar angehäuft hatte,führten zu einer weiteren Degradierung der öffentlichen Figur Pinochet. DerSkandal im April 2006 um die falsche Identifizierung von Diktaturopfern, dieAnfang der neunziger Jahre im Patio 29, einem Massengrab auf dem chileni-schen Zentralfriedhof, gefundenwordenwaren, und die Ereignisse umdenTodPinochets im Dezember 2006, markierten das erste Jahr der neuen RegierungBachelet. Die beiden Situationen führten der chilenischen Gesellschaft vorAugen, dass auch 16 Jahre nach dem Ende der Diktatur die Vergangenheitkeineswegs abgeschlossen war und die Debatten um die Deutung der Diktaturweiterhin eine zentrale Rolle in der chilenischen Demokratie einnahmen.Vor dem Hintergrund des hier kurz skizzierten Verlaufs der chilenischenVergangenheitspolitik spielten sich die geschichtspolitischen Debatten ab, aufdie im Folgenden näher eingegangen werden soll.
III. Die Akteure
Zu Beginn der chilenischen Demokratie standen sich zwei große politischeBlöcke gegenüber, denen eine sehr unterschiedliche Interpretation der Ge-schichte sowie eine divergierende Zukunftsvision zu eigen waren. Die Regie-rung der Concertaciûn musste bei ihrer Arbeit mit dem Widerstand des Mi-litärs, der rechten Parteien und des Großunternehmertums rechnen, die sichals „Erben“ der Militärregierung verstanden und die Aufarbeitung der Men-schenrechtsverletzungen als „Anklage“ gegen die Institution des Militärs an-sahen.32 Die Concertaciûn basierte in erster Linie auf einer Koalition derchristdemokratischen und der sozialistischen Partei, die sich im Parlamenteiner Allianz der beiden diktaturnahen Parteien UDI (Uniûn de Democr�tas
31 Diese Zahl wurde in einem Zusatzbericht bis Juni 2005 noch auf 28.459 erhöht, vgl. diedeutsche Ausgabe des Berichts: Nationale Kommission zur Untersuchung von politi-scher Haft und Folter, „Es gibt kein Morgen ohne Gestern“. Vergangenheitsbewältigungin Chile, Hamburg 2008, und Veit Straßner, Die Comisiûn Nacional sobre PrisiûnPol�tica y Tortura. Ein neues Kapitel in der Aufarbeitung des Staatsterrorismus in Chile,in: Lateinamerika-Analysen 12. 2005, S. 37–62.
32 Vgl. Claudio Fuentes u. FranciscoRojas, Transiciûn, coaliciûny gran estrategia, Santiago1997, S. 7 ff. Die Autoren beschreiben den Block aus rechten Parteien und Militär als„korporative Koalition“, der es um das Andenken der Militärregierung und die Inter-essen ihrer Institutionen gehe. Dem stellen sie die Concertaciûn als „demokratisch-modernisierende Koalition“ gegenüber, die auf eine Überwindung der diktatorischenVergangenheit und eine demokratische Modernisierung des Staates ziele.
Geschichtspolitik in Chile 137
Independientes) und RN (Renovaciûn Nacional) gegenüber sah.33 Trotz derdeutlich unterscheidbaren Positionen dieser beiden politischen Blöcke ist zuberücksichtigen, dass innerhalb der einzelnen Gruppen keine Homogenitätherrschte, sondern auch auf dem Feld der Erinnerungspolitik interne Dyna-miken und Konflikte existierten. Innerhalb der Concertaciûn verhinderte diesozialistische Partei, die über personelle Verbindungen eine große Nähe zurMenschenrechtsszene aufwies, mehrere Versuche, die vergangenheitspoliti-schen Bemühungen in Chile zu beenden, zu denen die Exekutive und dieChristdemokraten zu gewissen Zeiten durchaus bereit gewesen wären.34 AufSeiten der Opposition existierte in den ersten Jahren der Demokratie eine engeVerbindung zwischen politischen Parteien und Militär, in der Pinochet selbstdie herausragende und tonangebende Rolle – auch für die politische Positio-nierung der Parteien zur Vergangenheit – spielte. Der chilenische SoziologeTom�s Moulian sieht in der effizienten Arbeit dieser Koalition sogar eine Art„militärische Partei“, da das Heer unter der Leitung Pinochets aufgrund derguten Kontakte zu den rechten Parteien und der Justiz regelrechte Lobbyarbeitfür seine Interessen betrieb.35 Die politische Entwicklung führte jedoch spä-testens nach der Verhaftung Pinochets in London zu einer Distanzierungzwischen den Parteien und dem Militär innerhalb dieser Koalition.36 DieOpposition ging 1999 – wahlkampfbedingt – auf Distanz zum ehemaligenDiktator, während sich das Militär mit der Teilnahme am Runden Tisch erst-mals des Themas der Menschenrechtsverletzungen annahm. Die politischenParteien verlegten sich seit diesem Zeitpunkt auf eine Verteidigung des„Werkes“ der Militärdiktatur – wobei darunter vor allem der wirtschaftlicheAufschwung verstanden wurde –, so dass die Figur des Diktators selbst in denHintergrund rückte. Spätestens nach seiner öffentlichen Degradierung durch
33 Zur Concertaciûn gehörten daneben noch die Partei für die Demokratie (PPD, Partidopor la Democracia) und die kleinere Radikale Partei (PR, Partido Radical). Die Kom-munistische Partei (PC, Partido Comunista) zählte nicht dazu. In der Opposition nahmdie UDI die intransigente Verteidigungsposition der Diktatur ein, während die RN alsmoderate, wirtschaftlich liberale Partei eher zu demokratischen Zugeständnissen bereitwar.
34 Vgl. zu diesen unterschiedlichen Positionierungen die Werke des PS-Politikers CamiloEscalona, Una transiciûn de dos caras. Crûnica cr�tica y autocr�tica, Santiago 1999, unddes DC-Politikers Edgardo Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gober-nabilidad, Barcelona 1997.
35 Vgl. Tom�s Moulian, Chile. Las condiciones de la democracia, in: Nueva Sociedad 140.1995, S. 4–10, hier S. 7 f. , und Moulian, Chile actual, 1997, S. 51.
36 Vgl. Felipe Agüero, Democratizaciûn y militares. Breve balance de diecisiete aÇos desdela transiciûn, in: Manuel Alc�ntara S�ez u. Leticia Ruiz Rodr�guez (Hg.), Chile. Pol�tica ymodernizaciûn democr�tica, Barcelona 2006, S. 313–335, hier S. 331, und ClaudioFuentes, La transiciûn de los militares. Relaciones civiles-militares en Chile 1990–2006,Santiago 2006, S. 94.
138 Stephan Ruderer
den „Fall Riggs“ im Jahr 2004 kam der revisionistischen Haltung Pinochetskaum mehr politischer Einfluss zu.Neben diesen beiden politisch wichtigsten „Akteuren“ fiel den Menschen-rechts- und Opfergruppierungen dank des moralischen Gewichts ihrer For-derungen große Bedeutung auf dem Gebiet der Vergangenheits- und Erinne-rungspolitik zu. Aufgrund des gemeinsamen Ursprungs imWiderstand gegendie Diktatur glichen zu Beginn der Demokratie die Positionen dieser Gruppenden Versprechen der Regierung, während die Menschenrechtsakteure imLaufe der Zeit immer mehr zu Trägern einer kritischen „Gegen-Erinnerung“werden sollten.37 Gerade in der Menschenrechtsszene wurde eine „tragische“Erinnerung an Putsch und Diktatur auch in die Zeit der Demokratie als„emblematische Erinnerung“ im Sinne Sterns übertragen.38 Diese „Gegen-Erinnerung“ – für die auch der eingangs zitierte Artikel von Dorfman steht –erreichte aber nicht die gleiche öffentliche Wirkungsmacht wie die beiden insZentrum der vorliegenden Analyse gerückten „Gedächtnisse“ der großenpolitischen Blöcke. Dies lag, und liegt auch in der Gegenwart, zu einem be-trächtlichen Teil an einem weiteren wichtigen Akteur auf dem Feld der Erin-nerungspolitik in demokratischen Übergangsprozessen: den Medien.Auch wenn die Wirkung der Medien auf das Publikum als komplexer und nurschwer tatsächlich messbarer Prozess erscheint, bei dem neben der Qualitätund Quantität der Berichterstattung auch die Prädispositionen und das Wer-tesystem der Rezipienten zu berücksichtigen sind,39 so ist sich die Forschungdoch einig, dass die „Medien bei der Beschaffung demokratischer Legitimitäteine zentrale Rolle spielen.“40 Von daher kommt der Presse gerade im Demo-kratisierungsprozess besondere Bedeutung zu,41 denn Zeitungen als mei-nungskonstituierende Medien bringen gewisse Themen erst in die Öffent-
37 Zu den chilenischen Menschenrechtsgruppen vgl. Veit Straßner, Die offenen WundenLateinamerikas. Vergangenheitspolitik im postautoritären Argentinien, Uruguay undChile, Wiesbaden 2007, S. 234 ff.
38 Vgl. Stern, Remembering 20062, S. 215 ff.39 Vgl. Hans Mathias Kepplinger u. Elisabeth Noelle-Neumann, Wirkung der Massen-
medien, in: Elisabeth Noelle-Neumann u.a. (Hg.), Das Fischer-Lexikon Publizistik.Massenkommunikation, Frankfurt 2002, S. 597–647, hier S. 644 ff.
40 Andreas Beierwaltes, Demokratie und Medien. Der Begriff derÖffentlichkeit und seineBedeutung für dieDemokratie in Europa, Baden-Baden 2000, S. 213; vgl. hierzu auch dieAusführungen von Gerd Strohmeier, Politik und Massenmedien. Eine Einführung,Baden-Baden 2004, S. 75 ff. zur politischen und demokratiestützenden Funktion vonMassenmedien.
41 Das Medium Fernsehen besitzt sicherlich aufgrund des Film- und damit Beweischa-rakters eine noch höhere Glaubwürdigkeit, doch sind Zeitungen im Feld der Politik-information den bewegten Bildern zumindest gleichbedeutend, so Beierwaltes, De-mokratie, S. 11.
Geschichtspolitik in Chile 139
lichkeit ein, wobei im Übergangsprozess das vorhandene Pressesystem alsGanzes betrachtet werden muss.42
In Chile wird der Markt der Tageszeitungen von zwei großen Unternehmenbeherrscht, der Mercurio-Gruppe und dem Aktienkonsortium COPESA,welche zusammen knapp 88 Prozent der Auflagen43 und circa 80 Prozent derWerbeeinnahmen44 aller Tageszeitungen auf ihre Produkte konzentrieren. Dieführende Tageszeitung des gleichnamigen Unternehmens ist El Mercurio,während COPESA die Publikation La Tercera herausgibt.45 Außerhalb dieses„Duopols“46 existiert nur noch eine von einer ausländischen Gesellschaft fi-nanzierte kostenlose Metrozeitung, welche an den Ausgängen der U-Bahnverteilt wird, und die zumGroßteil imBesitz des Staates befindliche LaNaciûn,deren Marktanteil aber minimal ausfällt. Neben den überregionalen Tages-zeitungen gibt es noch 46 regionale Publikationen, die größtenteils zur Mer-curio-Gruppe gehören.47 Da die beiden großen Medienunternehmen derneoliberalen, konservativen Rechten zuzuordnen sind, kann man in Chile voneinem ideologisch monopolisierten Pressesystem sprechen, welches großeMängel hinsichtlich einer demokratisch-pluralistischen Meinungsfreiheitaufweist.48
42 Vgl. Carlos Filgueira u. Dieter Nohlen, La prensa en los procesos de transiciûn en Europay Am¤rica Latina, in: dies. (Hg.), Prensa y transiciûn demûcratica. Experiencias reci-entes en Europa y Am¤rica Latina, Frankfurt 1994, S. 10–40, hier S. 10.
43 Diese Zahl aus dem Jahre 2003 ist so bei Krohne, Las dos caras, S. 336 entnommen.44 Ermittelt aus der Aufstellung aus dem Jahr 2003 bei Osvaldo Corrales Jorquera u. Juan
Sandoval Moya, Concentraciûn del mercado de los medios, pluralismo y libertad deexpresiûn, Santiago 2005, S. 9. Beide Zahlen gelten ähnlich für den gesamten Zeitraumvon 1990 bis heute.
45 Zur Mercurio-Gruppe gehören daneben noch die auf Sensationsjournalismus ausge-richtete Tageszeitung Las ltimas Noticias und die Abendzeitung La Segunda. COPESAbringt noch die Boulevardzeitung La Cuarta heraus und ist beteiligt an der kostenlosenMetrozeitung La Hora, vgl. Falvio Cort¤s, Modernizaciûn y concentraciûn. Los mediosde comunicaciûn en Chile, in: Cristi�n Toloza u. Eugenio Lahera (Hg.), Chile en losnoventa, Santiago 1998, S. 557–611, hier S. 563 ff. Zur genauen Besitzstruktur derbeiden Unternehmen, vgl. Guillermo Sunkel u. Esteban Geoffroy, Concentraciûneconûmica de los medios de comunicaciûn, Santiago 2001, S. 36 ff. und Walter Krohne,La libertad de expresiûn en Chile bajo la atenta mirada de la critica: un balance de losaÇos 1990–2000, Santiago 2002, S. 60 f.
46 Krohne, Las dos caras.47 Vgl. zur Presselandschaft in Chile die Statistiken unter : http://www.anp.cl.48 Vgl. Krohne, Las dos caras, S. 11 ff. ; Corrales Jorquerau. SandovalMoya, Concentraciûn
del mercado, S. 20; Sunkel u. Geoffroy, Concentraciûn econûmica, S. 115 und HumanRights Watch, Los l�mites de la tolerancia. Libertad de expresiûn y debate pfflblico enChile, New York 1998, S. 12. Nur im Bereich der Monatszeitschriften existieren Aus-nahmen von der ideologischen Monopolisierung, so besonders die seit 1998 existie-
140 Stephan Ruderer
Dies ist mit zu bedenken, wenn im Folgenden für die Analyse vor allem Aus-sagen aus den beiden großen Tageszeitungen herangezogen werden. Dieideologische Ausrichtung der Presselandschaft sorgte und sorgt dafür, dass dieVergangenheitsnarrative der diktaturnahen Koalition eine hegemoniale Posi-tion in der öffentlichen Auseinandersetzung einnehmen können. Dies be-deutet nicht, dass es in den Reihen der Parteien, Gewerkschaften und Men-schenrechtsgruppen nicht Erinnerungen gibt, die den hier referierten zweiVersionen beziehungsweise der mittlerweile konstatierten hybriden Leit-erzählung entgegenstehen. Nur ihr Einfluss auf das öffentlich sanktioniertenationale Gedächtnis – und um den Kampf um dieses geht es in der chileni-schen Erinnerungspolitik – ist nicht von vergleichbarer Relevanz. Diese Aus-sage gilt imÜbrigen – aus anderen Gründen – auch für die katholische Kirche,die noch während der Diktatur aufgrund ihres Eintretens für die Menschen-rechte eine bedeutende politische Rolle eingenommen hatte.49 ImGegensatz zudem Einsatz während der Diktatur war der Einfluss der katholischen Kircheauf den Demokratisierungsprozess nach 1990 jedoch „modest and at timesobstructive“,50 so dass ihre Stimme auch in der erinnerungspolitischen Kon-stituierung des nationalen Gedächtnisrahmens nur von untergeordneter Be-deutung war.
IV. Geschichtspolitik in Chile
1. Die Ausgangslage: zwei VersionenIn Chile existierten zu Beginn der Demokratie 1990 unterschiedliche „em-blematische Erinnerungen“, doch kam besonders den antagonistischen Nar-rativen des Militärs mit seinen politischen Verbündeten und der neuen de-mokratischen Regierung öffentlichkeitswirksame Funktion zu, da sich inihnen auch ein Großteil der subjektiven Erinnerungen der jeweiligen Seitespiegeln konnte. Für die Anhänger der Diktatur galt Pinochet „als großerWegbereiter der neuentstehenden Demokratie“.51 Dies wurde der Öffentlich-keit auch deutlich vermittelt : So titelte die einflussreichste TageszeitungEl Mercurio amTag der Regierungsübergabe: „Präsident Pinochet übergibt dieFührung der Nation an Aylwin [in dem Moment,] in dem der Prozess der
rende Zeitschrift The Clinic, die politische Positionen in der Nähe der Concertaciûnvertritt.
49 Vgl. Brian Smith, The Church and Politics in Chile. Challenges to Modern Catholicism,Princeton 1982; Pamela Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile,1973–90, Basingstoke 1996 und Maria Angel�ca Cruz, Iglesia, represiûn y memoria. Elcaso chileno, Madrid 2004.
50 Michael Fleet u. Brian Smith, The Catholic Church and Democracy in Chile and Peru,Notre Dame 1997, S. 159.
51 So ein führender Politiker der UDI in: La Tercera, 11. 3. 1990, Cuerpo B, S. 6.
Geschichtspolitik in Chile 141
demokratischen Wiederherstellung, den die Streitkräfte und die Polizei am11. September 1973 begonnen hatten, zu Ende geht“.52 Die Junta-Generäleüberreichten sich in den letzten Tagen ihrer Amtszeit gegenseitig einen Ordender „erfüllten Mission“, der öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck bringensollte, dass die Demokratie als vollständig etabliert gelte und der Auftrag derMilitärregierung erfolgreich zu Ende gebracht sei.53 Forderungen nach Auf-klärung über dieMenschenrechtsverbrechen begegnetemanmit demHinweis,dass eine Desinformationskampagne gegenüber der Militärregierung existie-re, welche aus Gründen der Rache verfolgt werde und nur die Stabilität derGesellschaft untergraben würde. Die „Wahrheit“ läge in der stabilen Ordnung,die Pinochet hinterlassen hätte, welche durch terroristische Akte, angestacheltdurch eine übermäßige Betonung des Menschenrechtsthemas, gefährdetwäre.54
Für die Regierung hingegen stand fest : „Es gibt keine Demokratie ab demheutigen 11. März 1990“.55 Solche Aussagen wurden meist mit dem Verspre-chen begleitet, eine Politik durchzuführen, „die die Wege öffnet, damit einevollständigeDemokratie in vier Jahren erreicht werden kann“.56Dabei kamderAufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen zentrale Bedeutung zu, denn, soder Präsident Aylwin: „Wir wollen, dass die Menschenrechtsverbrechen auf-geklärt werden und dass, im Rahmen des Möglichen, Gerechtigkeit geschaffenwird“.57
In diesen Aussagen tauchen die beiden großen Themenkomplexe der erin-nerungspolitischen Debatten in Chile auf: Demokratie und Menschenrechts-verbrechen. Für die neue Regierung ging es darum, die Demokratie historischzu legitimieren, wobei die Aufgabe auch darin bestand, den in der konserva-tiven Presse Chiles vorherrschenden Diskurs der Diktaturanhänger zu bre-chen. Man musste also vermitteln, dass von der Diktatur keine positivenEinflüsse auf die Demokratie ausgegangen seien, diese nicht gar von Pinochet„zurückgebracht“ worden sei. Der Erinnerung an die Menschenrechtsver-brechen kam ähnliche Bedeutung zu. Durch die Betonung des repressivenCharakters der Militärregierung konnte die positive Erzählung über die un-mittelbare Vergangenheit durchbrochen werden, die Demokratie könnte sichso normativ von der Diktatur absetzen.
52 El Mercurio, 11. 3. 1990, S. A1.53 Vgl. La Tercera, 2. 3. 1990, S. 7 u. 6. 3. 1990.54 Vgl. u. a. El Mercurio, 18. –24.3.1990; La Tercera, 25. 3. 1990, S. 4 und La Naciûn,
25.3. 1990, S. 6.55 So Andr¤s Zald�var, Politiker der DC in: La Tercera, 11. 3. 1990, Cuerpo B, S. 3.56 Interview mit dem damaligen Außenminister Enrique Silva Cimma, El Mercurio,
11. 3. 1990, S. D13.57 La Tercera, 5. 3. 1990, S. 4, vgl. auch Las ltimas Noticias, 5. 3. 1990, S. 5 und La Tercera,
8. 3. 1990, S. 6.
142 Stephan Ruderer
2. Moralische Zeichensetzung und Konsolidierung der zwei VersionenPräsident Aylwin nutzte zu Beginn seiner Regierungszeit die moralische Au-torität, die ihm als demokratisch gewähltem Staatsoberhaupt zukam, um insymbolischen Zeremonien der neuen Demokratie historische Legitimität zuverleihen. Schon am 12. März 1990 feierte Chile die neue Demokratie mit eineröffentlichen Inaugural-Zeremonie im Nationalstadion, welches in den erstenMonaten derDiktatur als Konzentrationslager und Folterzentrummissbrauchtwordenwar. Dieser „rito positivo“58 diente der symbolischen Legitimation derDemokratie und der öffentlichen „Reinigung“ der Wunden der diktatorischenVergangenheit. Den Menschenrechtsverbrechen wurde sowohl performativ –durch den einsamen Tanz der Frauen von „Verschwundenen“ – als auch ex-plizit durch die Rede Aylwins gedacht; die Feier fungierte als kathartischerAkt, mit dem symbolisch die moralischen Differenzlinien zwischen der neuenDemokratie und der vergangenen Diktatur gezogen wurden. In ähnlicherWeise diente das offizielle Staatsbegräbnis für Salvador Allende am 4. Sep-tember 1990 als erinnerungspolitischer Versuch, die demokratische TraditionChiles zu betonen und als symbolischer, zukunftsgerichteter Akt der Ver-söhnung. Die Präsenz Aylwins und internationaler Staatsgäste sowie der of-fizielle Charakter der Trauerfeier platzierten Allende explizit innerhalb derdemokratischen Tradition des Landes. Für Aylwin war dies „eine Zeremonieder Wiedergutmachung, der Wiederbegegnung und des Friedens“,59 mit derdie politischenDivergenzen der Vergangenheit zwischenAylwin undAllende –die der Präsident in seinem Diskurs auch betonte60 – durch die offizielle Re-habilitation des ehemaligen politischen Gegners überwunden wurden. Sym-bolisch wurden somit die demokratische Tradition und Legitimität Chilesbetont, wobei der Staatsakt für einen politischen – aber eben demokratischen –Widersacher zur Absetzung von der Diktatur und zur Autorisierung der po-litischen Position der aktuellen Regierung diente.61
Einen ersten Höhepunkt in der erinnerungspolitischen Auseinandersetzungstellte dann der Rettigbericht im Jahr 1991 dar. Für die Regierung dokumen-tierte der Bericht eineWahrheit, die „von allen akzeptiert werden“62müsse unddie als Ausgangspunkt für die Versöhnung und für Gesten der Reue auf Seitendes Militärs dienen sollte. Gleichzeitig wollte man jedoch „in die Zukunftschauen“ und die Debatte um die Vergangenheit so schnell wie möglich be-
58 Alfredo Joignant, El gesto y la palabra. Ritos pol�ticos y representaciones sociales de laconstrucciûn democratica en Chile, Santiago 1998, S. 158.
59 Patricio Aylwin, La Transiciûn chilena. Discursos escogidosMarzo 1990–1992, Santiago1992, S. 85.
60 Patricio Aylwin war zur Zeit der Allende-Regierung Präsident der Christdemokrati-schen Partei, die sich unter seiner Führung von einem unterstützenden Faktor Allendeshin zur stärksten Oppositionskraft entwickelt hatte.
61 Vgl. Joignant, El gesto, S. 179.62 Aylwin, La Transiciûn, S. 137.
Geschichtspolitik in Chile 143
enden. Das Militär nahm jedoch die Aufforderung zur Entschuldigung nichtan, sondern sprach ganz imGegenteil dem Bericht jeglichen „historischen undjuristischen Wert“63 ab und verwies auf die alleinige Schuld der Allende-regierung an der Gewalt. Man hätte in der damaligen Situation als „moralischeReserve des Landes“ eingreifen müssen, und selbst wenn es dabei eventuell zuExzessen Einzelner gekommen sei, so käme es jetzt nicht in Frage, „vor denAugen der Bevölkerung auf die Anklagebank gesetzt zu werden“.64 Die Faktendes Berichts wurden zwar nicht geleugnet, in den Worten des damaligenVorsitzenden der rechten Oppositionspartei RN ließ sich das Vorgefallene„zwar nicht rechtfertigen, jedoch erklären“65 – und zwar mit der Schuld derAllenderegierung.Dem Bericht kam trotz dieser intransigenten Haltung der „militärischenPartei“ große Bedeutung für den erinnerungspolitischen Verlauf zu. Er lösteerstmals eine mehrwöchige intensive Debatte um die Vergangenheit aus, inderen Folge die Verbrechen der Diktatur nicht mehr geleugnet werdenkonnten. Aufgrund der Haltung des Militärs, dessen Diskurs die konservativePresse dominierte, standen sich jedoch imErgebnis zwei Erzählungen über dieVergangenheit gegenüber : Auf der einen Seite die Wahrheit der Regierung,welche die Menschenrechtsverbrechen der Diktatur in den Mittelpunkt derErinnerung stellen wollte, auf der anderen Seite die Version der Diktatur-anhänger, die die Gewaltexzesse erklären konnten, die Schuld bei den Mar-xisten situierten und eine positive Deutung der Militärregierung – die politi-sche Ordnung gebracht hätte – aufrecht erhalten konnten. Durch den deutli-chen Willen der Regierung, die konfliktreiche Debatte schnell zu beenden,wurden die Fakten des Rettigberichts letztlich nicht ausreichend genutzt, umder Erzählung der Rechten angemessen zu widersprechen. Die Scheu vor einerkonfliktreichen öffentlichen Debatte, welche die angestrebte erfolgreicheTransition demaskiert hätte und die – angesichts der Ausgangslage nicht un-begründete – Angst vor einer Machtdemonstration des Militärs, die den De-mokratisierungsprozess gefährdet hätte, führten die Regierung dazu, die ge-schichtspolitischen Debatten zu diesem Zeitpunkt zu vernachlässigen. Diezwei Versionen über die Vergangenheit blieben unversöhnlich und immernoch mindestens ebenbürtig in der Öffentlichkeit nebeneinander bestehen.
3. Wirkungsmacht der „positiven“ Erinnerung an die DiktaturIn der Folgezeit des Rettigberichts überwog in Chile der Versuch, das ThemaVergangenheit für beendet zu erklären, und die Regierung verlor die Initiativeauf dem erinnerungspolitischen Feld. Bezeichnend dafür ist die Einweihung
63 El Mercurio, 28. 3. 1991, S. A1.64 Ej¤rcito de Chile. El Ej¤rcito, la verdad y la reconciliaciûn, in: Estudios Pfflblicos 41. 1991,
S. 449–472, hier S. 471.65 La Tercera, 8. 3. 1991, S. 3.
144 Stephan Ruderer
des Monuments für die „Verschwundenen“ auf dem Zentralfriedhof inSantiago im Februar 1994. An der für die Opfererinnerung wichtigen Zere-monie nahm – im Gegensatz zu den symbolischen Akten zu Beginn der De-mokratie – weder ein hoher Regierungsvertreter teil, noch wurde die Errich-tung des Denkmals in den großen Tageszeitungen thematisiert.66 Die Erinne-rung an die Verbrechen gelangte nur noch über den Umweg der Justiz auf dieöffentliche Agenda, besonders im Fall des Prozesses gegen den ehemaligenGeheimdienstchef der Diktatur Manuel Contreras. Die Verurteilung diesesGenerals im Jahr 1995 bedeutete zwar auch einen erinnerungspolitischen Er-folg, da die verbrecherischen Elemente des Regimes von Pinochet deutlichwurden. Die Resistenz des Militärs gegen das Urteil und die Konflikte mitPinochet in Folge des Prozesses verstärkten jedoch auf Regierungsebene denWillen, das Thema Vergangenheit endgültig zu beenden, ohne zu einer – vondenMilitärs abgelehnten – Verurteilung der Diktatur zu kommen. Gleichzeitigkonnte Pinochet die Ereignisse nutzen, um seine Definition der Versöhnung inErinnerung zu rufen: „Man muss vergessen, die einzige Sache, die uns bleibt,meineHerren, ist zu vergessen! Undmanvergisst, nichtmit einemProzess, derwieder aufgenommen wird, der erneut aufgenommen wird, indem man Leuteins Gefängnis steckt. Ver-ges-sen, das ist dasWort“.67Deutlich wird aber auch,dass sich das Vergessen nur auf eine Seite der Vergangenheit bezog, nämlichauf die der Menschenrechtsverbrechen, deren Täter man nicht noch ins Ge-fängnis stecken sollte. Den Leistungen seines Regimes galt dieser Aufruf nicht,ganz im Gegenteil betonte Pinochet regelmäßig, dass „ich immer Demokratwar“ und dass „das, was wir gemacht haben, dazu da war, die Demokratiewiederzubringen“.68
So konnte in den Jahren bis 1998 das in der konservativen Presse Chiles ver-mittelte positive Bild über dieMilitärregierung und die Person Pinochets seineWirkung entfalten. Dabei leistete die demokratische Regierung nicht nurkeinen Widerspruch, sondern trug aufgrund ihrer Vorstellung von Konsens-politik noch selbst maßgeblich zu dem positiven Bild Pinochets bei. So ver-teidigte Aylwin den General 1994 mit dem Ausspruch, „Pinochet garantiertedie Transition“,69während der Verteidigungsminister Chiles Pinochet 1997 als„Beispiel der Verantwortung für diejenigen, die den öffentlichen Dienst wäh-len“,70 lobte. In diesem Sinne stieß der Wandel Pinochets vom Oberbefehls-haber zum Senator auf Lebenszeiten Anfang des Jahres 1998 zwar bei Politi-kern der Concertaciûn auf Widerstand, wurde von der Regierung aber
66 Vgl. Wilde, Irruptions, S. 485.67 Rede Pinochets im Club de la Uniûn am 13.9. 1995, in: La Ãpoca, 14. 9. 1995, S. 14
[Silbenbetonung im Original].68 Interview mit Pinochet, in: Cosas, 26. 9. 1997, S. 11–16.69 El Mercurio, 30. 4. 1994, S. C3.70 El Mercurio, 31. 10. 1997, S. D2.
Geschichtspolitik in Chile 145
gleichzeitig als „Erfolg der paktierten chilenischen Transition“71 verteidigt.Der erinnerungspolitische Diskurs der Rechten, die Pinochet in der Rolle des„Demokratie-Bringers“ sah, erhielt so Legitimität und Wirkungsmacht durchdie demokratische Regierung.Als Höhepunkt dieses „Erinnerungskonsenses“ fungierte die Umwandlungdes Feiertags am 11. September – Tag des Putsches – in einen „Tag der na-tionalen Einheit“. Der 11. September 1973 als „ein Datum des politischen,sozialen undWertestreits unserer Erinnerung“72 symbolisierte den Kampf umdie Geschichte. Während er für die meisten Mitglieder der Concertaciûn „dentragischsten Tag der Geschichte des Landes“73 darstellte, feierte die Oppositionam 11. September „die Befreiung Chiles“.74 In einem Pakt zwischen dem Se-nator Pinochet und der christdemokratischen Regierungspartei einigte mansich im September 1998 darauf, den Feiertag als „Geste der Versöhnung“ ab-zuschaffen, auch wenn man von einem tatsächlichen Konsens über die histo-rische Bedeutung dieses Tages immer noch weit entfernt war.75 Dabei ging esPinochet vor allem um eine Aufbesserung seiner Reputation als Politiker. Sohatte er noch amTag vor der Einigung die Aberkennung des Feiertags mit demVerweis auf seine historische Bedeutung deutlich abgelehnt: „Weit davonentfernt zu einer wahrhaften Versöhnung der Chilenen beizutragen, wird dieAberkennung dieses entscheidenden nationalen Feiertags die Bresche zurVerdunkelung der historischen Wahrheit vertiefen“.76 Der plötzliche Mei-nungsumschwung entsprach politischem Kalkül. Durch die freiwillige Auf-gabe „seines“ 11. Septembers konnte sich Pinochet als konzilianter Politikerinszenieren, der durch eine große Versöhnungsgeste die Einigung der oppo-sitionellen politischen Blöcke möglich gemacht hatte. So nützte diese politischund gesellschaftlich wirkungslose Initiative – der „Tag der nationalen Einheit“wurde im Jahr 2002 wieder abgeschafft – nur Pinochet selbst, der sich alsmoderater Politiker der Versöhnung und als elder statesman präsentieren
71 So der damalige Staatsminister Juan Villarzffl in: La Tercera, 17. 2. 1998, S. 4.72 AzunCandina Polomer, El d�a interminable. Memoria e instalaciûn del 11 de septiembre
de 1973 en Chile, 1974–1999, in: Elizabeth Jelin, Las conmemoraciones. Las disputas enlas fechas „in-felices“, Madrid 2002, S. 9–50, hier S. 11.
73 So der Senator der sozialistischen Partei JaimeGazmuri, in: Chile, Senado 19, 29. 7. 1997,S. 2497, unter http://www.senado.cl.
74 So Pinochet im Senat, Chile, Senado 22, 18. 8. 1998, S. 2397, unter http://www.senado.cl.Zu den unterschiedlichen Erinnerungen um den 11. September 1973 und die „Instal-lation“ dieser in der Öffentlichkeit vgl. Candina Polomer, El d�a interminable, S. 9 ff. ;Alfredo Joignant, Un d�a distinto.Memorias festivas y batallas conmemorativas en tornoal 11 de septiembre en Chile, 1974–2006, Santiago 2007, S. 29 ff. und Stefan Rinke, Der11. September als komplexer Erinnerungsort 2008, in: Jahrbuch Lateinamerika32. 2008, S. 76–87.
75 Vgl. Joignant, Un d�a distinto, S. 29.76 Chile, Senado 22, 18. 8. 1998, S. 2397, unter http://www.senado.cl.
146 Stephan Ruderer
konnte. Im September 1998 schien also die bedeutende Rolle von Pinochet undseinem Regime für die Demokratie in der erinnerungspolitischen DebatteChiles gefestigt. Die Menschenrechtsverbrechen waren zwar erwähnt worden,aufgrund der staatsmännischen Leistungen Pinochets in Vergangenheit undGegenwart erschienen sie in der öffentlichen Erinnerung jedoch nur noch amRande.
4. „Erinnerungseinbrüche“: Beginn des Kampfes der ErinnerungenDiese erinnerungspolitische Situation sollte erst durch die Verhaftung Pino-chets im Oktober 1998 in London aufbrechen. Da die vielfältigen und kom-plexen Einwirkungen der Verhaftung Pinochets auf die chilenische Transitionan dieser Stelle nicht geschildert werden können, soll nur grob die Entwick-lung der öffentlichen Debatte um Pinochet dargestellt werden. Der „FallPinochet“ wurde zu Beginn von Militär, Opposition und der Regierung zumStaatsproblem Nummer Eins erklärt. Die Verteidigung des Generals besaßoberste staatliche Priorität, denn es ging in den Worten der Regierung auchdarum „unsere Art der Transition“77 zu verteidigen – und dabei spielte, wiedargelegt, die Figur Pinochets mittlerweile eine zentrale Rolle. Die Konsens-mechanismen der chilenischen Vergangenheits- und Geschichtspolitik griffenjedoch in London nicht. Der Prozess der englischen Richter führte der chile-nischen Gesellschaft schlagartig die einhellige Ablehnung Pinochets durch dieWeltöffentlichkeit vor Augen. Eine Rückkehr des Generals war nur zu errei-chen, wenn den transnationalen Forderungen nach Vergangenheitsaufarbei-tung zumindest teilweise nachgekommen würde. Dies setzte allerdings einenWandel in den geschichtspolitischen Positionierungen im Land voraus.So feierte Pinochets Rückkehr nach Chile im März 2000 nur noch die Oppo-sition als „historischen Moment“ und „siegreichen Tag für den General“.78DieRegierung dagegen drängte mittlerweile auf einen Prozess gegen den Diktatorund wandte sich, angesichts der – durch den „Fall Pinochet“ deutlich gewor-denen – „ungelösten Probleme der Transition“ wieder verstärkt dem Themader Menschenrechtsverbrechen zu.79 Dieser öffentlich vermittelte Sinnes-wandel verweist auf die erinnerungspolitischen Konsequenzen des „Falls Pi-nochet“. Besonders die in Chile breit rezipierte globale Verurteilung desDiktators führte dazu, dass die negativen Seiten der Diktatur auch im Landverstärkt in den Fokus der Erinnerung rückten; der historische Verteidi-gungsdiskurs der Rechten traf in der Öffentlichkeit auf deutlicheren Wider-spruch. Auch von akademischer Seite wurde jetzt erstmals in die Debatteeingegriffen. In einem „Manifest der Historiker“, das gegen den Versuch, „dieöffentliche Wahrheit über das letzte halbe Jahrhundert der chilenischen Ge-
77 So der damalige Außenminister Jos¤ Miguel Insulza in: La Hora, 23. 10. 1998, S. 7.78 El Mercurio, 4. 3. 2000, S. A1 und La Tercera, 4. 3. 2000, S. 4.79 El Mercurio, 10. 3. 2000, S. A1, und La Tercera, 10. 3. 2000, S. 4.
Geschichtspolitik in Chile 147
schichte zu manipulieren und zurechtzurücken“,80 gerichtet war, verwehrteman sich dagegen, dass Pinochet die Verantwortung für „in der chilenischenGeschichte unvergleichbare Menschenrechtsverbrechen“ negierte, und rücktedie Frage der Volkssouveränität und der Menschenrechte ins Zentrum derhistorischen Analyse.81Der apologetische Diskurs der Diktaturanhänger bliebab jetzt zumindest nicht mehr unbeantwortet.Daneben ereignete sich auch in der offiziellen Wertung der Vergangenheit einneuer Qualitätsschritt, der mit der Veröffentlichung des Rettigberichts ver-gleichbar ist. Der Prozess gegen Pinochet in London verdeutlichte, dass wederdie chilenische Regierung noch das Militär das Thema der Menschenrechts-verbrechenweiter ignorieren konnten. Aus diesemGrund berief die Regierungeinen Runden Tisch ein, an dem erstmals Menschenrechtsanwälte, Vertreterder Regierung und des Militärs zusammenkamen, um eine Lösung für dasProblem der „Verschwundenen“ zu finden. Das Mitte 2000 veröffentlichteDokument des Dialogforums zeigte Fortschritte und Grenzen der Erinnerungan die Diktatur zehn Jahre nach deren Ende auf. Die Einigung dokumentierteerstmals offiziell die Anerkennung durch das Militär von „schweren Men-schenrechtsverbrechen, in die Mitarbeiter der Staatsorganisationen währendder Militärregierung verwickelt waren“.82 Dieses erstmalige Zugeständnis vonSeiten der Täter legte die Reaktionen des Militärs auf den Rettigbericht ad actaund spiegelte die Annäherung an eine gemeinsame nationale Leiterzählung, inder die „negativen“Aspekte derDiktatur integriert waren. Gleichzeitig wurdenaber die unterschiedlichen historischen Interpretationen über die Schuld ander Gewalt und die Rolle der Militärregierung in dem Dokument aufrechterhalten, das heißt die positive Interpretation des Putsches und der Diktaturblieb bestehen. Im Militär war man nicht bereit, eine systematische Repres-sionspolitik zuzugestehen.83 Nicht umsonst betonte der damalige Oberbe-fehlshaber Izurieta auch nach demAbkommen in internen Ansprachen immerwieder „das fundamentale Werk [der Militärregierung] seit dem historischen
80 „Manifiesto de Historiadores“, in: La Segunda, 2. 2. 1999, La Naciûn, 4. u. 5. 2. 1999, ElSiglo, 5. –11.2. 1999 und Punto Final, 5. –18.2. 1999, sowie in Sergio Grez u. GabrielSalazar (Hg.), Manifiesto de Historiadores, Santiago 1999, S. 7–26.
81 Vgl. ebd., zitierte Aussage auf S. 16. Das Manifest richtete sich nicht nur gegen dieInterpretation Pinochets, sondern auch gegen die „akademischere Version“ dieser Ge-schichtsauffassung, die vom Historiker, Erziehungsminister des Militärregimes undMitglied der Rettigkommission Gonzalo Vial in Beiträgen in La Segunda verbreitetwurde.
82 Zitat aus der Declaraciûn de la Mesa de Di�logo sobre Derechos Humanos, 13. 6. 2000,unter : http://www.ddhh.gov.cl/mesa_dialogo.html.
83 Vgl. Juan Carlos Salgado (Brigadier), La Participaciûn del Ej¤rcito de Chile en laMesa deDi�logo sobre los Derechos Humanos, in: FLACSO-Chile (Hg.), Chile 1999–2000;Nuevo Gobierno, Desaf�os de la reconciliaciûn, Santiago 2000, S. 193–201, der die Po-sition des Heeres nochmals zusammenfasst.
148 Stephan Ruderer
11. September 1973“.84 Die Menschenrechtsverbrechen wurden also an-erkannt, ohne daraus Konsequenzen für das historische Bild der Diktaturabzuleiten.Immerhin zeigte sich in Folge des Runden Tisches ein kurzzeitiger Prioritä-tenwandel in der öffentlichen Debatte um die Vergangenheit. Zu Beginn desJahres 2001 stand zumindest für einige Monate das Thema der „Verschwun-denen“ im Fokus des öffentlichen Interesses. Nicht mehr Pinochet, sondernseine Opfer erschienen in dieser Zeit als Staatsproblem, dessen Lösung wichtigfür das Zusammenleben der chilenischen Gesellschaft sei. Doch auch jetzthoffte die neue Regierung unter Ricardo Lagos mit dem Abschlussdokumentdes Runden Tisches und mit dem Ende des Prozesses gegen Pinochet in Chileim Jahr 2001 auf eine Beendigung der erinnerungspolitischen Debatte. DieStraflosigkeit Pinochets, der aufgrund von „moderater Demenz“ von denchilenischen Richtern für prozessunfähig erklärt wurde, blieb dabei als sym-bolisches Signal der fehlenden Vergangenheitsaufarbeitung bestehen.Erst im Jahr 2003 nahm die Regierung den „Kampf um die Erinnerung“ be-wusst an, wobei die Initiative durch den 30. Jahrestag des Putsches ausgelöstund durch Forderungen der Menschenrechtsgruppen angeregt und vorberei-tet worden war. Nachdem Präsident Lagos schon im August des Jahres einenumfangreichen Menschenrechtsvorschlag vorgelegt hatte, gab er durch einesymbolische Zeremonie dem 30. Jahrestag des Putsches eine besondere Be-deutung für die historische Erinnerung. Die zentrale symbolische Geste derZeremonie bestand in der Öffnung einer Seitentür des Regierungspalastes LaMoneda durch Lagos, durch die traditionell die demokratischen PräsidentenChiles das Gebäude betreten hatten und die vom Militärregime geschlossenwurde, nachdemman am11. September 1973 den toten Körper Allendes durchdiese Tür hinausgetragen hatte. Die Erinnerung an Allende stand im Mittel-punkt des Aktes. Lagos betonte in seiner Rede den „Märtyrertod“Allendes „inErfüllung seiner Pflicht aufgrund des legitimen Amtes, das er innehatte“.85DieZeremonie unterstrich – ähnlich wie auf dem Staatsbegräbnis Allendes 1990 –die demokratische Legitimität des Präsidenten, dessen Selbstmord als Opferan die republikanische Tradition Chiles interpretiert wurde. Aufgrund derbewussten Situierung Allendes innerhalb der demokratischen Legitimitätkonnte dem Jahrestag eine positive Konnotation beigegeben werden, welche
84 Ricardo Izurieta, Proposiciûn del Discurso del Comandante en Jefe del Ej¤rcito […] conmotivo del homenaje del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las FF. AA.,Santiago, 31. 10. 2000, S. 2 f. Vgl. auch die Grußansprache von ders., Saludo en el D�a delas Glorias del Ej¤rcito, Santiago, 19.9.2000. Beide Dokumente sind einsehbar in derBibliothek des Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) in Santiago,unter http://www.cesim.cl.
85 Vgl. die Regierungsbroschüre zu dem Festakt, in der auch die Rede Lagos’ abgedrucktist: Gobierno de Chile, 30 aÇos. 11 de septiembre de 1973–11 de septiembre de 2003.Acto conmemorativo, Santiago 2003, S. 45.
Geschichtspolitik in Chile 149
die tragische Erinnerung an den Putsch abschwächte.86 Durch die live imFernsehen übertragene Zeremonie konstituierte der 30. Jahrestag einenWendepunkt in der geschichtspolitischen Position der Regierung. Die bishe-rige Enthaltung im „Kampf der Erinnerungen“ wurde ersetzt durch eine of-fizielle Position, die den Militärputsch als Bruch mit der demokratischenTradition Chiles verurteilte und die republikanische Legitimität der von derRechten geschmähten Figur Allendes hervorhob. Der 11. September konnte als„Erinnerungsort“ im kulturellen Gedächtnis der Chilenen verankert werden,die Regierung nahm sich der öffentlichen Auseinandersetzung um die Ver-gangenheit an.87
Diese offizielle Positionierung wurde von der Rechten in den Tagen um den 30.Jahrestag mit einer regelrechtenmedialen Offensive beantwortet. Dabei wurdein eigens geschalteten Anzeigen vor der „Geschichtsfälschung“ durch die Re-gierung gewarnt, deren Erinnerung an Allende man die „wahre Geschichte“gegenüberstellen müsse.88 Die Verantwortung für den Zusammenbruch derDemokratie wurde weiterhin ausschließlich bei der Linken verortet, derenGewaltbereitschaft mit historischen Reportagen über die Zeit vor September1973, in denen hauptsächlich Mitarbeiter der Diktatur zu Wort kamen, un-terstrichen wurde.89 Das militärische Eingreifen konnte so als Rettung desLandes vor dem Kommunismus, die Diktatur als Periode des wirtschaftlichenAufschwungs und Weg zur Demokratie dargestellt werden. Die Menschen-rechtsverletzungen, die man auch in den Reihen der Opposition durchgehendablehnte, wurden angesichts der historischen Leistungen der Diktatur relati-viert.Diesem in der öffentlichen Debatte weiterhin dominanten Diskurs stand je-doch durch die Zeremonie erstmals die öffentliche und offizielle Haltung derRegierung gegenüber, die zumindest symbolisch auf die Bedeutung der Auf-arbeitung der Vergangenheit für die Zukunft des Landes aufmerksam gemachthatte. Der 30. Jahrestag widersprach deutlich den Aufrufen, die Vergangenheitzu vergessen – die sich immer nur auf die „negativen“ Seiten der Diktaturbezogen –, und brach endgültig mit der „schweigenden Erinnerung“ derChilenen.90 13 Jahre nach dem Ende der Diktatur begann der „Kampf um dieErinnerung“ an Bedeutung zu gewinnen.
86 Vgl. Joignant, Un d�a distinto, S. 99.87 Vgl. Ingrid Wehr, Chile 30 Jahre nach dem Militärputsch. Der 11. September als kon-
fliktträchtiger Gedächtnisort, in: Lateinamerika-Analysen 6. 2003, S. 114–141, hierS. 120.
88 Vgl. El Mercurio, 11. 9. 2003, S. C5, La Tercera, 28. 8. 2003, S. 4 und La Segunda,10.11. 2003, S. 13 u. S. 15.
89 Vgl. El Mercurio, 10. 8. 2003, S. D10, 16. 8. 2003, S. A3 u. 24. 8. 2003, S. D11-D12 sowieLa Segunda, 9. 11. 2003, S. 9 u. 16. 9. 2003, S. 9.
90 Vgl. Carlos Huneeus, Chile. Un pa�s dividido. La actualidad del pasado, Santiago 2003,S. 249 ff. , der ausführlich auf die Bedeutung der Fernsehprogramme und Presseberichte
150 Stephan Ruderer
5. Hybride Erinnerung: eine Erzählung, zwei VersionenEinen weiteren Schritt hin zu einer gemeinsamen Leiterzählung über die un-mittelbare Vergangenheit stellte die Veröffentlichung des Valechberichts imNovember 2004 dar, mit der die Menschenrechtsverbrechen wieder in denMittelpunkt der Debatten rückten. Dieser Bericht, der die Folteropfer derDiktatur dokumentierte, führte erstmals zu einem umfassenden Schuldein-geständnis des chilenischen Heeres. In Reaktion auf den Bericht sagte derdamalige Oberbefehlshaber des Heeres Cheyre, dass „das chilenische Heer dieharte aber unumgängliche Entscheidung getroffen hat, die Verantwortung zuübernehmen, die es, als Institution, für alle strafbaren und moralisch nicht zuakzeptierenden Taten der Vergangenheit hat.“91 Der Valechbericht führte alsozu der Anerkennung der während des Runden Tisches noch geleugneten in-stitutionellen Schuld des Militärs. Der repressive Charakter der Diktatur wardamit endgültig in die nationale Erinnerung über die Zeit des Pinochetregimeseingegangen. Dies zeigte sich auch daran, dass die Regierung zwar – wie nachallen bisherigen vergangenheitspolitischen Maßnahmen – darauf hoffte, dasThema nun endgültig abschließen und den Blick in die Zukunft richten zukönnen, dabei aber betonte, – und das war neu – dass die Vergangenheithinsichtlich ihrer Verbrechen nicht vergessen werden dürfe, um die nationaleRekonstruktion zu vollenden.Auch auf Seiten der rechten Parteien folgte eine Umwertung des historischenUrteils, wobei die wichtigen Elemente des revisionistischen Diskurses aberaufrecht erhalten wurden. So wurden die Verbrechen zwar verurteilt, einEingeständnis der Mitschuld der zivilen Mitarbeiter der Diktatur wurde aberabgelehnt, da diese entweder nichts davon gewusst oder aber Schlimmeresverhindert hätten.92 DerÖffentlichkeit wurde von den ehemaligen politischenMitarbeitern der Diktatur nun eine künstliche Trennlinie zwischen dem mi-litärischen Repressionsapparat und der politischen Verantwortung im Mili-tärregime vermittelt, welche den aktuellen Politikern eine Aufarbeitung ihrerVerantwortung in der Diktatur ersparen sollte. Die Schuld lag nach dieserInterpretation ausschließlich bei Mitarbeitern der Streitkräfte, so dass die
um den 30. Jahrestag des Putsches eingeht. Zu dem Konzept der Erinnerung alsSchweigen, vgl. Norbert Lechner u. Pedro Güell, Soziale Konstruktion der Erinnerungund geschichtliche Aufarbeitung der Diktatur, in: Peter Imbusch u. a. (Hg.), Chile heute.Politik, Wirtschaft, Kultur, Frankfurt 2004, S. 295–307, hier S. 300.
91 Emilio Cheyre, El fin de una visiûn, in: La Tercera, 5. 11. 2004, S. 6 [HervorhebungenS. R.].
92 Vgl. El Mercurio, 12. 11. 2004, S. C4, 21. 11. 2004, S. C3, 28. 11. 2004, S. C5, 30. 11. 2004,S. C5 u. 3. 12. 2004, S. C6 sowie La Tercera, 29. 11. 2004, S. 6 u. 30. 11. 2004, S. 5. ImKontrast zu dieser Ablehnung von Verantwortungsübernahme standen vereinzelte öf-fentliche Geständnisse von direkt an den Verbrechen beteiligten Militärs, vgl. El Mer-curio, 21. 11. 2004, S. D12-D13, die aber den Eindruck einer rein militärischen Schuldnur verstärkten.
Geschichtspolitik in Chile 151
Erinnerung an die positiven Seiten des Pinochetregimes aufrecht erhaltenwerden konnte. Die Trägergruppe der positiven Erinnerung an die Diktaturbrach also auseinander : Während die durch die fortgesetzten Aufarbeitungs-maßnahmen etablierte Faktenlage das Militär dazu zwang, sich mit der eige-nen Tätergeschichte auseinanderzusetzen, konnten die zivilenMitarbeiter undUnterstützer des Regimes die Verdrängung der eigenen negativen Erinnerungfortsetzen. Dieses Interpretationsmuster sollte sich – weniger defensiv als inden Tagen nach dem Valechbericht – auch nach dem Tod Pinochets wieder-holen.Zuvor jedoch trat eine erneut extern initiierte Situation ein, welche die Re-putation Pinochets und damit das von ihm vermittelte Geschichtsbild starkbeschädigen sollte. Eine Untersuchung der US-Behörden, die nach den An-schlägen auf das World Trade Center die Finanzquellen der ausländischenTerroristen in den Blick nahmen, deckte auch die Geheimkonten des chileni-schen Generals bei der Riggs-Bank auf. Hatte der Diktator noch im Jahr 2003behauptet: „Ich habe mich niemals bereichert. Alle wissen, dass sogar meinLohn gespendet wurde“,93 so fiel das Bild des „ehrlichen Maklers“ in Folge derRiggs-Affäre endgültig in sich zusammen. Die Tatsache der geheimen Aus-landskonten löste in Chile sowohl eine heftige öffentliche Debatte als auchjuristische Aktionen gegen Pinochet aus. Beides provozierte einen bedeuten-den Reputationsverlust und eine weitere Isolation des ehemaligen Diktators.Besonders für seine Anhänger, für die der General den Retter des Vaterlandesvor dem Kommunismus verkörperte, dessen ökonomische Leistungen weitüber den „Exzessen“ der Menschenrechtsverbrechen standen, zerbrach dasBild des selbstlosen Staatsmannes, der seine ganzen Anstrengungen in denDienst Chiles gestellt hatte. Durch den Fall Riggs erwies sich Pinochet alskorrupter Diktator, der seine Stellung skrupellos zur persönlichen Bereiche-rung ausgenutzt hatte. So überließen die Oppositionspolitiker – trotz einergewissen Vorsicht bei Schuldzuweisungen – Pinochet ganz den Ermittlungender Justiz, während man im Militär die Enttäuschung über die Korruptionnicht verbergen konnte. Auch die Umfragewerte wiesen einen deutlichen Re-putationsverlust Pinochets im Laufe des Jahres 2005 auf, der in Zusammen-hang mit den Berichten über den Fall Riggs zu erklären ist.94 Insgesamt führte
93 La Tercera, 25. 11. 2003, S. 6.94 So sank der positive Eindruck des Pinochetregimes in der Bevölkerung zwischen De-
zember 2004 undOktober 2005 um 7 Prozent, während sich der Anteil der Bevölkerung,der im Pinochetregime nur Schlechtes sah, im gleichen Zeitraum um 12 Prozent erhöhthatte. Zwischen 2004 undOktober 2005 sank auch die Zahl der Personen, die in Pinocheteinen der besten Herrscher des Landes sahen, um 9 Prozent, während die BewertungPinochets als Diktator um 9 Prozent anstieg, vgl. Centro de Estudios de la RealidadContempor�nea (CERC), Barûmetro CERC, Oktober 2005, unter http://www.cerc.cl. Dieim historischen Verlauf der Umfragen seit 1990 erstmals feststellbare größere Verän-
152 Stephan Ruderer
die Entwicklung in den Jahren nach der Verhaftung in London dazu, dass dieFigur Pinochet in den geschichtspolitischen Debatten immer mehr in denHintergrund rückte. Der Diktator selbst erfuhr eine öffentliche Degradierung,die aber von der erinnerungspolitischen Einordnung seines Regimes – zu-mindest auf Seiten seiner ehemaligen Verbündeten – strikt getrennt wurde.Diese Tatsache führte in den Jahren nach seinem Tod zu einem paradoxenRollentausch in der erinnerungspolitischen Positionierung, da jetzt aus demengsten Familien- und Freundeskreis Aufrufe gegen das Vergessen der per-sönlichen Leistungen Pinochets erfolgten, die sich explizit auch an die ehe-maligen politischen Verbündeten richteten.95
Durchbrochen wurde die öffentliche Marginalisierung der Figur des Diktatorsnoch einmal indenTagennach seinemTod am10. Dezember 2006, in denen sichder „Kampf der Erinnerungen“ in Chile eindrucksvoll manifestierte. Die Re-gierung setzte dabei einAusrufezeichen, indem sie Pinochet ein Staatsbegräbnisin seiner Eigenschaft als ehemaliger Präsident versagte.96 Für die geschichts-politische Legitimation stellte diese offizielle Absage ein bedeutendes Signal dar:Die Selbstdarstellung als Präsident, Staatsmann und „Demokratie-Bringer“hatte in den 16 Jahren vergangenheitspolitischer Entwicklung an Wirkungs-macht verloren, die offizielle Staatshaltung sprach Pinochet die demokratischeLegitimität ab. So wurde der General vom damaligen Innenminister denn auchüberraschend deutlich als „klassischer Diktator der Rechten“97 bezeichnet.ImGegensatz dazuwurde die Begräbniszeremonie zum letzten großen Auftrittdes Pinochetismus, welcher dem Toten einen genuinen Platz in den Ge-schichtsbüchern der Nation zuwies. Die einhellige Glorifizierung Pinochetsvon Rednern aus dem Militär, der Rechten und des Unternehmertums erhieltbesondere Legitimation durch denAuftritt des Kardinals von Santiago, der „alldas Gute“, das Pinochet für das Vaterland geleistet habe, unterstrich, ohne dieRepressionspolitik auch nur zu erwähnen.98 In konsequenter Fortsetzung desbisherigen Diskurses über das Militärregime dankte auch die politische Op-positionspartei UDI dem General für die „Wiederherstellung der Demokra-
derung dieserWerte für das Jahr 2005 bestätigt die enormeBedeutung des Falls Riggs fürdie Reputation Pinochets.
95 Vgl. La Tercera, 10. 12. 2007, S. 4 u. 10. 12. 2008, S. 6. Das deutliche Eintreten Pinochetsfür das Vergessen einige Jahre zuvor schien dabei schon wieder vergessen zu sein.
96 Als Begründung wurde dabei auf die nicht demokratisch legitimierte RegierungszeitPinochets und die zahlreichen Menschenrechtsprozesse verwiesen, vgl. La Naciûn,online, 10. 12. 2006, unter http://www.lanacion.cl. Dort ist auch die offizielle Stellung-nahme der Regierung zum Tode Pinochets abgedruckt.
97 Vgl. La Naciûn, 11.12. 2006, unter http://www.lanacion.cl.98 Vgl. El Mercurio, 12. 12. 2006, S. C3. Dieser Auftritt stand im Gegensatz zur Haltung der
katholischen Kirche während der Diktatur, in der sie sich als moralische Oppositionzum Regime profilierte, siehe Anm. 49.
Geschichtspolitik in Chile 153
tie“.99 Durch diese Danksagungen – die durch ganzseitige Anzeigen von Pri-vatleuten in den großen Tageszeitungen verstärkt wurden – konnte der Toposvon Pinochet als „Bringer der Demokratie“ auch gegen die Haltung der Re-gierung aufrecht gehalten werden. Die Unterschiede zwischen Diktatur undDemokratie wurden so in der öffentlichen Debatte verwischt.In besonderemMaße spielte sich der „Kampf der Erinnerungen“ in denMedienab. Hier dominierte eine Interpretation, die zwei große HinterlassenschaftenPinochets ausmachte: Die Menschenrechtsverletzungen wurden in einemNullsummenspiel mit den wirtschaftlichen Leistungen aufgerechnet. Nebendem verurteilenswerten konnte so auch das positive Erbe der Diktatur hervor-gehoben werden.100 Dabei erhielten die Anhänger des Generals auch Unter-stützung von Vertretern der Regierung, welche die wirtschaftlichen Leistungender Diktatur besonders hervorhoben. Die Menschenrechtsverbrechen der Dik-tatur konnten zwar auch von den Verteidigern Pinochets nicht mehr unerwähntbleiben, durch die Hinweise auf seine wirtschaftlichen und staatsmännischenLeistungen konnten sie jedoch als kleineres Übel dargestellt werden.Während sich die zwei Versionen über die Vergangenheit zu Beginn der De-mokratie unversöhnlich gegenüberstanden, machte die Erwähnung von zu-mindest zwei Hinterlassenschaften Pinochets – die alle politischen Lagerdurchzog – die hybride erinnerungspolitische Annäherung deutlich: Mittler-weile existierte unter großen Teilen der Regierungs- und Oppositionspolitikereine Leiterzählung, die aber die beiden Versionen nahezu unverändert be-inhaltete. Der mediale Einfluss der Sympathisanten Pinochets und der Ver-teidiger des „Werkes“ der Diktatur noch heute verweist dabei auf die Mög-lichkeit, dass in der historischen Erinnerung Chiles die „Staatsleistungen“Pinochets die grausamen Facetten seiner Regierung übertünchen könnten.101
Zumindest existiert innerhalb der chilenischenGesellschaft eine hybride Formder Erinnerung an das Pinochetregime, in der die guten und schlechten Seitender Diktatur in der historischen Darstellung unverbunden nebeneinandergestellt werden, sich im nationalen Gedächtnis aber zu einem Bild vermischen,
99 Vgl. die offizielle Stellungnahme der UDI, unter: http://www.udi.cl/?pagina=leer_mas&id=137. Die Partei kritisierte auch die Verweigerung eines Staatsbegräbnisses als Präsidentdurch die Regierung, in der sie „Größe und Großzügigkeit“ vermisste, vgl. ebd.
100 Besonders deutlichwird diese Interpretation in den Sonderausgaben der beiden größtenZeitungen El Mercurio und La Tercera zum Tod Pinochets, vgl. El Mercurio, EspecialAugusto Pinochet Ugarte, 11. 12. 2006, und La Tercera, Augusto Pinochet Ugarte,1915–2006, 11. 12. 2006.
101 Vgl. Cristûbal Rovira Kaltwasser, Pinochets Tod und die schweigende Zustimmung zuseinemRegime, in: Lateinamerika-Analysen 16. 2007, S. 253–264, hier S. 258 f. , der voneiner „schweigenden Zustimmung“ zu Pinochet innerhalb der chilenischen Gesellschaftspricht. Das „Schweigen“wurde dabei durch die Begräbnisfeier unterbrochen, währendder sich die Affinität zu dem Diktator nochmals ungehindert äußerte.
154 Stephan Ruderer
in dem die Diktatur „sowohl gut als auch schlecht“ war.102 Die erinnerungs-politisch notwendige moralische Absetzung der Demokratie von der Diktaturlässt sich so nur schwer erreichen.103
V. Fazit
Zum Zeitpunkt des Todes Pinochets lässt sich in Chile von einer hybridenForm der Erinnerung sprechen, da sich die beiden öffentlich einflussreichstenGedächtnisträger einem Diskurs angenähert haben, der zwei Versionen inte-griert. Sowohl in der Narration der Regierung als auch der Opposition werdenmittlerweile Bestandteile des Opfer- und des Tätergedächtnisses berücksich-tigt. So sind die Menschenrechtsverbrechen zwar ein zentrales Thema dernationalen Leiterzählung über die Diktatur ; der chilenische Gedächtnisrah-men lässt aber auch ausreichend Platz für die Betonung der wirtschaftlichenund staatsmännischen Leistungen der Militärregierung, ohne allerdings diehistorische Verbindung zwischen Repression und wirtschaftlichen Reformenzu erwähnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass damit die offizielle „lense ofmemory“ feststeht und der nationale Erinnerungsrahmen endgültig konsti-tuiert ist. Außerhalb dieser hybriden Form existieren weitere „Erinnerungs-knoten“, wobei in erster Linie dezidierte Opfer- oder Tätererinnerungen vonkollektiven Gedächtnisträgern artikuliert werden. Die Umfragen zur Bewer-tung von Pinochet und dem Putsch zeigen, dass der tragischen Erinnerung derMenschenrechtsgruppen größere Bedeutung zukommt als der heroischenErinnerung von Verbänden ehemaliger Militärs.104
102 Für diese Antwort optierten auch im August 2006 noch 52 Prozent der Chilenen auf dieFrage, ob das Regime Pinochets nur Gutes, nur Schlechtes oder eben Gutes undSchlechtes hatte, vgl. CERC, Barûmetro CERC, August 2006, unter http://www.cerc.cl.
103 Diese Tatsache zeigt sich auch in Umfragen zur Unterstützung der Demokratie in Chile.Für die Einstellung der Bevölkerung in den Jahren seit 1990 ist die Umfrage vom Oktober2005 symptomatisch, bei der 53 Prozent der Chilenen die Demokratie jeder anderenRegierungsform vorziehen würden, während 11 Prozent ein autoritäres Regime befür-worten und für 29 Prozent die Regierungsform keinen Unterschied ausmacht, vgl. CERC,Barûmetro CERC, August 2006, unter http://www.cerc.cl. Besonders die hohe Zahl anpolitischer Indifferenz ist auch im internationalenVergleichbesorgniserregend, vgl. DetlefNolte, Demokratie und Marktwirtschaft in Lateinamerika. Politische Institutionen undwirtschaftliche Reformen in der Wahrnehmung der Bürger, in: Peter Birle u.a. (Hg.),Demokratie und Entwicklung in Lateinamerika, Frankfurt 2006, S. 123–157. Diese Zahlenlassen sich nicht monokausal mit der erinnerungspolitischen Debatte in Chile erklären,der hier dargestellten Entwicklung kommt aber Einfluss auf die Einstellung zur Demo-kratie zu.
104 Während in den Jahren von 1990bis 2004 immer zwischen 30und 35 Prozent derChilenenim 11. September 1973 eine „Befreiung vom Marxismus“ sahen und knapp über 50 Pro-zent den Tag als „Zerstörung der Demokratie“ erinnerten, so änderten sich diese Werte
Geschichtspolitik in Chile 155
Trotzdem erhält die Erinnerung, die von der Regierung, also von offiziellerstaatlicher Seite, mitgetragen wird, besondere Relevanz, denn es geht im De-mokratisierungsprozess – wie oben dargelegt – erst einmal darum, einen de-mokratisch legitimierten Gedächtnisrahmen abzustecken. Vor diesem Hinter-grund weisen die lateinamerikanischen Transitionsprozesse andere Vorausset-zungen auf als die, die sich für die Bundesrepublik nach dem ZweitenWeltkriegergaben – und verlangen damit auch eine andere analytische Bewertung. MitBlick auf die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland konsta-tierte Hermann Lübbe, „daß die öffentliche Anerkennung der politischen undmoralischen Niederlage der nationalsozialistischen Herrschaft zu den zentralenlegitimatorischen Elementen dieser Republik gehörte“; und nur im Schutzdieser „wiederhergestellte[n] normative[n] Normalität“ konnte das Schweigenüber die Vergangenheit seine integrative Funktion erfüllen.105 In Chile existiertezu Beginn der Demokratie diese „normative Normalität“ nicht, so dass wederdas Verschweigen der Vergangenheit noch die widerspruchslose Akzeptanz derhegemonialen Tätererinnerung einen erinnerungspolitisch gangbaren Weg fürdie demokratische Regierung darstellen konnte. Um die demokratische Kon-solidierung und Integration der Gesellschaft zu erreichen, musste sie erst einenGedächtnisrahmen schaffen, der sich an Kriterien orientierte, welche die mo-ralischeVerankerung der Demokratie befestigten.106VordiesemHintergrund istauch die angeklungene Kritik an der Rolle der chilenischen Regierung bei derHerausbildung der hybriden Form der Erinnerung zu verstehen, da diese häufigdem in der Presse hegemonialen Diskurs der Diktaturanhänger nicht ent-schieden genug widersprochen hat, um zu einer demokratischen nationalenIdentitätsbildung beizutragen. Dieser Widerspruch ließe sich auch realisieren,ohne die notwendige pluralistische Meinungsvielfalt in der Öffentlichkeit ein-zuschränken.
Dr. des. Stephan Ruderer, Westfälische Wilhelms-Universität, Exzellenzcluster212, Domplatz 20–22, 48143 MünsterE-Mail: [email protected]
nach dem Fall Riggs nochmals verstärkt, so dass im August 2006 nur noch 19 Prozent imPutsch eine „Befreiung vom Marxismus“ erkannten und 68 Prozent in dem Tag die„Zerstörung der Demokratie“ sahen. Einen ähnlichenVerlauf nahmen dieWerte über denEindruck vom General Pinochet, von dem im August 2006 immerhin 82 Prozent derBevölkerung dachte, dass er „als Diktator“ in die Geschichte eingehenwerde, während nurnoch 12 Prozent in ihm einen „der besten Herrscher, die Chile im 20. Jahrhundert hatte“sahen, vgl. CERC, Barûmetro CERC, August 2006, unter http://www.cerc.cl.
105 Vgl. Hermann Lübbe, Der Nationalsozialismus im politischen Bewusstsein der Ge-genwart, in:Martin Broszat u.a. (Hg.), DeutschlandsWeg in die Diktatur. InternationaleKonferenz zur nationalsozialistischen Machtübernahme, Berlin 1983, S. 333.
106 Wolfrum, Geschichtspolitik, S. 31 postuliert dies nicht umsonst als voraussetzenden„Grundkonsens“ für geschichtspolitische Debatten in der Demokratie.
156 Stephan Ruderer