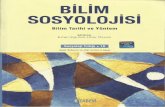Heckl, Raik: Mose als Schreiber. Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs, Zeitschrift...
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Heckl, Raik: Mose als Schreiber. Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs, Zeitschrift...
ZAR 19, 2013
Mose als Schreiber Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs
Raik Heckl (Leipzig)
1. Einführung
Seit mehr als 300 Jahren streitet die alttestamentliche Wissenschaft mit der traditionellen Bibelrezeption um die Verfasserschaft des Pentateuchs, der aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht von Mose abgefasst worden sein kann,1 traditionell aber auf ihn zurück-geführt wird. Diese Sicht hängt wahrscheinlich mit einer Reihe von Bibelstellen zusam-men,2 in denen Mose als Schreiber fungiert.3 Mose ist Hauptfigur der Bücher Exodus –Deuteronomium, auf Gottes Befehl hin ist er im Deuteronomium4 Ich-Erzähler und Spre-cher der Gebote. Wenn Mose schreibt – und dies in einer Reihe von Stellen ebenfalls auf Jhwhs Befehl hin –, dann ist das Schreiben literarisches und theologisches Thema.
Sowohl mit der Figur des Mose als auch mit dem Schreiben sind ganz bestimmte Vorstellungen verbunden. Beides gehörte für die intendierten Adressaten offenbar zum kulturellen Hintergrundwissen, das für die Rezeption des Textes erforderlich war. Daher muss zunächst in mehreren traditionsgeschichtlichen Durchgängen diesem Hintergrund-wissen nachgegangen werden, bevor die Stellen, an denen Mose schreibend erwähnt wird, analysiert werden können.
Dabei können in dieser Arbeit nicht alle Aspekte, die Mose als Figur betreffen,5 diskutiert werden. In der Untersuchung steht im Vordergrund, wie Mose mit autoritativen Texten in Verbindung gebracht wird.
1 Erstmals wurde von dem Reformator Karlstadt Zweifel darüber geäußert, dass Mose in Dtn 34 über
seinen eigenen Tod berichtet haben könne. Vgl. Kraus, Geschichte, 29f. Baruch Spinoza führte eine ganze Reihe von stilistischen und inhaltlichen Argumenten an und äußerte die Vermutung, dass Esra für den Pentateuch verantwortlich sein könnte. Vgl. Nadler, Baruch de Spinoza, 829f.; Kraus, Geschichte, 61f. Als Übersicht über die Entwicklung des Konzeptes der mosaischen Autorschaft in Judentum und Christentum und seine Kritik vgl. Houtman, Pentateuch, 7ff.
2 Es finden sich nur im Pentateuch Stellen, an denen Mose konkret schreibend vorgestellt ist. Dies hängt damit zusammen, dass Mose nur dort als Figur handelnd dargestellt ist, während außerhalb des Penta-teuchs auf ihn und auf die von ihm angeblich verfassten Texte lediglich zurückgeblickt wird. Das geschieht allerdings oft mit Formeln, die bereits erkennen lassen, dass man auf eine mehr oder weniger autoritative Form des Pentateuchs oder von Teilen des Pentateuchs zurückgreift, die direkt mit Mose verbunden werden. Vgl. z.B. Jos 8,31–35 und dazu Heckl, Kultstätte, 95f.
3 Nach Otto, Gesetz des Mose, 99, hat die Vorstellung der mosaischen Verfasserschaft des Pentateuchs, die s.E. im 1. Jh. aufkommt, Ex 17,14 und Num 33,2 rezipiert.
4 Siehe Dtn 1,3. 5 Für einen breiteren Zugang zu den Aspekten, die mit Mose verbunden sind, vgl. die Übersichten bei
Schmidt, Exodus, Sinai und Mose; Otto, Mose; Dohmen, Mann.
Raik Heckl 180
Beim Thema Schreiben ist ein Zugang vom Allgemeinen zum Spezielleren möglich. Entsprechend wird die Schriftkultur im Alten Israel zunächst unabhängig von den Texten der Bibel in den Blick genommen. Danach wird in zwei Durchgängen den im Pentateuch erkennbaren Vorstellungen vom Schreiben und von bestimmten Texten und ihrer Ent-stehung nachgegangen.
2. Schreiben als literarisches Thema im Pentateuch
2.1 Grundlegung: das Schreiben nach den epigraphischen Zeugnissen Wir besitzen eine Reihe von Textfunden aus Palästina. Anhand orthographischer Kriterien lässt sich erkennen, dass das Hebräische unter Rückgriff auf das phönizische Zeichen-system eine eigene Schriftsprache entwickelt hat.6 Die Zahl der Belege nimmt im Verlaufe der Eisenzeit erheblich zu. Die Mehrheit der althebräischen Textzeugnisse stammt aus dem 8. und 7. Jh. v. Chr., doch sprechen die frühen Zeugnisse7 für die Existenz einer Schrift-kultur bereits im 10. Jh. Drei Inschriften stammen aus Samaria bzw. Galiläa, eine aus Beth Shemesh. Insbesondere der Gezer-Kalender – eine wiederbeschriebene Kalktafel und daher wohl eine Schreiberübung – zeigt, dass das Schreiben in dieser frühen Zeit eine regelrechte Schriftkultur voraussetzt.8 Weitere in den letzten Jahren entdeckte Inschriften vervollstän-digen das Bild. Die spannendste darunter ist das Ostrakon aus Khirbet Qeiyafa, das mehrere Zeilen Text erkennen lässt und offenbar Formulierungen enthält, die traditionsgeschichtlich mit biblischen Gesetzestexten zusammenhängen.9 Unlängst wurde außerdem eine Inschrift an einem Tongefäß mit proto-kanaanäischen Zeichen in Jerusalem gefunden, das aufgrund der Paläographie zwischen dem 11. und 10. Jh. v. Chr. datiert.10
Die noch vereinzelten Zeugnisse in früher Zeit lassen vermuten, dass das Schreiben zu-nächst nur von einer schmalen Elite praktiziert wurde. J. Renz hat dabei auf der Basis einer genauen Analyse der Schriftformen der Region herausgearbeitet, dass anders als bei den umliegenden Nachbarn die Schriftformen des Nord- und Südreichs sehr eng miteinander verwandt waren. Eine eigenständige hebräische Schrift lässt sich s.E. erst im Anschluss an eine Nutzung der phönizischen Schrift im 10. Jh. im Nord- und im 9. Jh. v. Chr. im Süd-reich nachweisen, „so daß von vornherein eine kulturelle Beziehung zwischen den Schrei-berschulen der beiden Staaten anzunehmen ist“.11 Diese kulturelle Nähe im Bereich der Schriftsprache sieht Renz auch noch nach dem Ende des Nordreiches als gegeben, als die
6 Vgl. Renz, Text und Kommentar, 38f.; Knauf, Umwelt, 119; Rollston, Scribal Education, 67f. Rollston,
ebd., 65, weist auf orthographische Unterschiede zwischen judäischen und samaritanischen Texten hin, die s.E. für die Existenz zweier Dialekte sprechen. Die Verwendung der phönizischen Schrift in Israel sei ein übergreifendes Phänomen in der Region. Vgl. Rollston, ebd., 27–42., bes. 37: „Israel’s use of the Phoenician script was definitely part of a broader phenomenon.“
7 Vgl. Renz, Text und Kommentar, 29–39. 8 Rollston, Writing, 30, sieht den Gezer-Kalender als phönizischen Text an. 9 Vgl. Achenbach, Personae miserae, 125. Da der Text weder als Urkunde noch als Brief erkennbar ist,
wird vorgeschlagen, dass es sich ebenfalls um eine Schreiberübung handelt. Zur Diskussion vgl. ebd., 95.
10 Vgl. Mazar/Ben-Shlomo/Ahituv, Pithos from the Ophel, 39. 11 Renz, Schrift, 51.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 181
Innovationen des Schriftsystems des Nordreiches sich im Südreich durchsetzten bzw. mit jenen des Südreiches mischten.12
Ob dieser regionale kulturelle Kontext auch bereits in früher Zeit literarische Texte hervorgebracht hat, ist unsicher, doch sollte man aufgrund der Undatierbarkeit der Anfänge der biblischen Texte und der Seltenheit13 von literarischen Texten unter den epigraphischen Funden, nicht vorschnell die Anfänge der literarischen Produktion des Alten Israel in die späte Königszeit datieren.14 Die Existenz vereinzelter Schriftzeugnisse auf Gebrauchs-gegenständen und die beiden Schultexte, (Gezer-Kalender und Khirbet Qeiyafa-Ostrakon) aus der frühen Zeit sprechen am ehesten dafür, dass man in der Schriftkundigkeit eingeübt wurde, bevor man sie praktizierte.15 Beides setzt im Alten Orient die Ausbildung voraus und dies wiederum – soweit wir anhand der Analogie Ägyptens und Mesopotamiens zu-rückschließen können – die Existenz literarischer Texte.16
Die Ostraka vom 7. und 6. Jh. v. Chr. lassen bereits erkennen, dass die Schrift-kundigkeit sich in der späten Königszeit relativ stark verbreitete17 und dass die Schrift-sprache der Kommunikation in ganz unterschiedlichen Kontexten diente. Besonders auf-schlussreich ist das Lachisch-Ostrakon Nr. 3. Darin verteidigt sich ein Offizier gegen den Vorwurf seines Vorgesetzten, nicht lesen zu können.18 Das Ostrakon, das um 600 v. Chr.
12 Vgl. ebd. 13 Obwohl es sich bei ihr um nichtisralitische Inschriften handeln dürfte, beweisen die Texte von Tell Deir
Alla die Existenz von literarischen Texten in Israel. Denn zweifellos muss Bileam entsprechend als literarische Figur in Israel bekannt gewesen sein. Parker, Stories, 13ff., vergleicht auch den Bittbrief aus Mesad Hashavyahu und die Siloam-Inschrift mit Erzählungen in der Hebräischen Bibel.
14 Vgl. Rollston, Writing, 134: „It would be most difficult to argue that a culture capable of developing and employing a distinct national script with a developed scribal culture did not have the capacity to write texts of various sorts.“
15 Als Schülerübungen sind z.B. auch die aus dem 8. Jh. aus Lachisch stammenden Texte Lak(8) 13, Lak(8) 17 und Arad(8) 99 erkennbar. Siehe Renz, Text und Kommentar, 74–76.119f.
16 Vgl. dazu die Überlegungen von Carr, Writing, 163f. Er hält ausdrücklich gegen die Skepsis von Schniedewind, Bible, 56f. fest, dass „a small-scale writing-education system does not preclude the creation of longer works“ (Carr, ebd., 163). D. Carr ist grundsätzlich Recht zu geben, dass genau so, wie das auch in der Assyriologie gesehen wird, auch eine schmale Basis von hebräischen Schriftfunden erstens die Schreiberausbildung und dieses die Existenz eines literarischen Curriculums in Israel voraussetzen dürfte.
17 Rollston, Writing, 133, nimmt an, dass die Zunahme im 7. und 6. Jh. „to the growth of the administrative apparatus“ zuzuschreiben ist. Schaper, Tora als Text, 57, spricht von einer „explosionsartige[n] Zunahme in der Benutzung von Schreibmedien“ zwischen dem 8. und 6. Jh. v. Chr. Jamieson-Drake, Scribes, 148 schließt daraus, dass alle Orte, an denen Textfunde gemacht wurden, in irgendeiner Weise administrativ mit Jerusalem in Verbindung standen, „that professional administrators were trained in Jerusalem, and only in Jerusalem“.
18 Vgl. den Text bei Schniedewind, Reflections, 158: „לא ידעתה קרא ספר‚ you do not know (how) to read a letter.‘“ Als alternative Interpretation hält Schniedewind auch „‚Did you not understand? Then call a scribe!‘“ für möglich. Schaper, Tora als Text, 57 sieht den Brief ebenfalls als Beispiel für eine „vergleichsweise weitverbreitete Lese- und Schreibfähigkeit“. Er verweist außerdem auf das Ostrakon von Mesad Hashavyahu, wobei das allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem professionellen Schreiber im Auftrag des Landarbeiters, der sich über die ungerechte Behandlung beschweren will, nach Diktat verfasst ist. Siehe dazu Renz, Text und Kommentar, 323. Spannend ist dieser Text aber, weil er in der späten Königszeit die Verantwortung von Offizieren für Rechtsangelegenheiten erkennen lässt (so Conrad, Ostrakon von Jabne-Yam, 250), wie dies vom Deuteronomium vorausgesetzt wird.
Raik Heckl 182
datiert wird,19 zeigt, dass es in der späten Königszeit in bestimmten militärischen Rängen selbstverständlich war, lesen und ansatzweise20 schreiben zu können.21 Zudem zeigt die Reaktion des Offiziers gegenüber seinem Dienstherrn, dass der Vorwurf, nicht lesen zu können, eine schwere Beleidigung darstellte. Dies wiederum setzt eine hohe Bewertung der Schriftkundigkeit in der späten Königszeit voraus.
Man kann festhalten, dass wir zwar nichts über die Schulen wissen, in denen israe-litische und judäische Beamte im Gebrauch der Schrift trainiert wurden, doch spricht die Existenz einer nationalen Schriftsprache für eine regelrechte Ausbildung in der Schriftkun-digkeit, die u.a. die Beamten durchlaufen haben. Die Situation ist im gesamten syrisch-palästinischen Kulturraum im Prinzip vergleichbar. Ausgehend vom regionalen wirtschaft-lichen Zentrum in den phönizischen Mutterstädten, die ihrerseits kulturell eine direkte Fortsetzung der spätbronzezeitlichen Kultur bildeten, entwickelten sich in den entstehenden Stammes- und Nationalstaaten Palästinas seit dem Anfang des ersten vorchristlichen Jahrtausends jeweils eigenständige Schriftsprachen. Doch so wenig Klarheit wir über die Anfänge der israelitischen Literatur haben, so wenig wissen wir über die Literatur der Nachbarn. Das gilt selbst für die Phönizier. Nach Ausweis der mythischen Überlieferung und wohl auch de facto haben die Griechen die Schriftkundigkeit erst von den Phöniziern übernommen.22 Dies geschah in der Zeit, in der in Griechenland die ersten literarischen Texte entstanden.23 Trotz des offenkundig weitreichenden kulturellen Einflusses der Phönizier, trotz beeindruckender architektonischer Bauten und einer Erwähnung in anderen Literaturen im Mittelmeerraum und in Mesopotamien ist – abgesehen von einigen längeren Inschriften und einigen Exzerpten in späterer Literatur24 – nichts von der Literatur der Phönizier erhalten geblieben. Dass wir die Ergebnisse einer literarischen Geschichte des Alten Israel in den Büchern der biblischen Traditionsliteratur besitzen, ist demgegenüber geradezu ein Glücksfall. Obwohl man heute sehr viel vorsichtiger mit der Datierung der
19 Vgl. Renz, Text und Kommentar, 405. 20 Schniedewind, Reflections, 161, sieht den Text als verfasst von einem „writer with rudimentary scribal
training“. 21 Schniedewind, Reflections, 163: „This letter of the literate soldier is powerful evidence pointing to
seminal changes in the social fabric of society during the late Judaean monarchy – even if the level of this soldier’s literacy was quite basic and needed a scribe to help him.“
22 Hekataios von Milet wendet sich gegen die Annahme einer authochtonen Entstehung der Kultur. Nach Powell, Homer, 6 schlussfolgert Hekataios: „Culture comes from the East; Danaos came from Egypt; therefore Danaos brought the alphabet.“ Herodot führt die Überlieferungen über Kadmos’ Ursprung aus Tyros an (Hist. V 58,1.) und sucht dies anhand von alten Weihinschriften im Apollo-Tempel in Theben zu beweisen (Hist. V 59–61,1). Seinen Versuch einer Fundierung der Übernahme der Schrift im Mythos muss man als Ätiologie ansehen, die aber auf dem Faktum der auch inschriftlich nachweisbaren Entwicklung der griechischen Schrift aus der phönizischen basiert. Vgl. dazu Powell, Homer, 10.
23 Man vermutet in der Regel den Übergang vom 9. zum 8. Jh. v. Chr. als Zeit der Entstehung der griechischen Schrift. Vgl. Steymans/Staubli, Schriften, 118. Powell, Homer, 187 geht in seiner Ein-schätzung sehr viel weiter: „If about 800 B.C. the adapter was inspired by an individual poet to make his invention, and if tradition has preserved the poet’s name and works, that poet must have been either Homer or Hesiod.“
24 Bei Eusebius in der Praeparatio evangelica I 9–10 sind mehrere Exzerpte der phönizischen Geschichte des Philo von Byblos enthalten. Vgl. Bonnet/Niehr, Phönizier, 28–30. Der Text weist unter anderem auffällige Berührungen mit der biblischen Urgeschichte auf. Siehe dazu die Auflistung der Bezüge zwischen Gen 1 und Philo bei Müller, Philon und Ebach, Weltentstehung.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 183
ältesten Schichten der biblischen Texte ist, dürfte die Geschichte der Produktion von literarischen Texten im Alten Israel ebenfalls deutlich weiter zurückreichen.25
2.2. Schreiben und Geschriebenes Das Schreiben ist bei den Texten der biblischen Traditionsliteratur bereits deswegen präsent, weil wir in ihren Texten das Ergebnis eines literarischen Prozesses vor uns haben, der in einer Schriftkultur fußt. Das Schreiben oder Geschriebenes begegnet aber auch als Thema in den Texten. Dies geschieht mitunter nur beiläufig, mitunter aber wird das Schrei-ben bzw. das Geschriebene auch explizit behandelt.
Es ist umstritten, wie weit man die biblischen Texte als Zeugnis der Geschichte auswerten kann.26 Das Gleiche gilt auch für kulturgeschichtliche Fragestellungen wie die Frage nach der Bedeutung des Schreibens im Alten Israel. Einen Ausweg könnte der Vorschlag von Chr. Hardmeier aufzeigen, der die biblischen Texte zumindest als Primär-zeugen ihrer Entstehungszeit ansieht.27 Die Existenz literarischer Texte zeigt nicht nur, dass man geschrieben hat, sondern auch, dass Texte gelesen und tradiert wurden. Die Thema-tisierung des Schreibens in den Texten weist dieses explizit als wichtiges Kulturgut aus. Allerdings sind die Abfassungszeit der biblischen Texte und deren Diachronie in der Regel unsicher. An diesem Punkt hilft jedoch der Charakter der biblischen Texte weiter. Da die biblischen Texte nicht fiktionale Literatur sind, sondern „adressatenbezogene Mitteilungs-literatur“,28 lässt die kommunikative Funktion der Texte die Annahme zu, dass bei den intendierten Adressaten eine Akzeptanz zumindest der kulturellen und geschichtlichen Informationen eines Textes vorausgesetzt ist.29 Dieser Ansatz hilft bei der Evaluation der biblischen Notizen über das Schreiben, da diese zeigen, welche Vorstellungen über die Schriftkultur und über das Schreiben z.T. längst vergangener Epochen bei den intendierten Adressaten akzeptiert waren.
Im Folgenden geht es zunächst allgemein um Kontexte, an denen die Tätigkeit des Schreibens erwähnt wird. Danach werden eine Reihe von Stellen durchgegangen, an denen Texte behandelt werden, zunächst solche, deren Kenntnis bei den intendierten Adressaten vorausgesetzt ist, über deren Ursprung aber nichts gesagt wird, dann Texte, deren Ursprung thematisiert wird. Schließlich werden Texte / Textteile behandelt, die mit Jhwh oder Mose verbunden werden.
2.2.1. Schreiben im Pentateuch Es gibt eine Reihe von Stellen im Pentateuch, wo die selbstverständliche Existenz von schriftlichen Aufzeichnungen belegt ist. Die Stellen sind besonders aufschlussreich, da an ihnen zugleich verschiedene sekundäre Funktionen von Schriftlichkeit begegnen.30
25 Vgl. Parker, Stories, 11. 26 Willi, Chronik als Auslegung, 215 unterscheidet beispielsweise die Chronik als tertiärer von den
Samuelis-/Königebüchern als sekundärer Geschichtsschreibung. 27 Vgl. Hardmeier, Prophetie, 32. 28 Blum, Historiographie, 68. 29 Nach Blum, Historiographie, 73 handelt es sich um einen „‚unmittelbaren‘ Geltungsanspruch“ des
Textes, der „elementar auf Identifikation, Einverständnis etc. ausgerichtet ist.“ Ähnlich sah das bereits Amit, Narratives, 94, die feststellt, dass „the biblical author wants to be believed by the public.“
30 „In ihrer primären Funktion ist die geschriebene Sprachform Medium und Instrument der
Raik Heckl 184
Ex 28,36 // 39,30 Zu nennen ist das Diadem des Hohepriesters, das nach Ex 28,36 und 39,30 mit der Inschrift versehen war, „die die Zugehörigkeit zu Jhwh dokumentierte“,31 was aber קדש ליהוהentweder auf den Träger32 oder auf die kultischen Bezüge bezogen gewesen sein kann.33 Wie auch immer man die Inschrift zu deuten hat, so ist doch klar, dass durch sie eine exemplarische Zueignung von Person, Gegenstand oder Gaben zu Jhwh realisiert wird. Die Inschrift hatte also eine performative Funktion34 in den kultischen Bezügen.
Num 17,17f. Eine ähnliche Funktion hat die Aufzeichnung der Namen der Stammesführer auf die Stäbe in Num 17,17f.35 An der besonderen Funktion vom Stab des Stammes Levi, auf den der Name Aarons geschrieben wird, ist erkennbar, dass die Stäbe nicht nur den Träger, sondern auch den zugehörigen Stamm repräsentieren. Das Blühen von Levis Stab, der durch die Aufschrift Aaron zugewiesen wird, symbolisiert die besondere Erwählung des Stammes unter der Führung Aarons.36
Num 11,16ff.37 In diesem Kontext zeigt sich eine besondere performative Funktion einer Aufzeichnung. Es werden 70 Männer aus den Ältesten ausgewählt, auf die ein Anteil am prophetischen Geist des Mose übertragen wird. In 11,26 werden zwei Personen thematisiert, die nicht mit zur Stiftshütte gegangen waren. Über sie heißt es lapidar, sie seien unter den Aufge-schriebenen gewesen (µybwtkb hmhw). Bei der Auswahl von Personen ist also an einen regelrechten ‚Verwaltungsakt‘ gedacht, bei dem Namen aufgezeichnet werden.38 Spannend ist, dass auf die beiden Männer, die nicht bei dem Akt an der Stiftshütte anwesend waren, dennoch der Geist kommt (jwrh µhyl[ jntw). Das Aufzeichnen von Namen repräsentiert
Repräsentation von sprachlichen Zeichen, in sekundären Funktionen wird sie zu Konstruktionsmaterial für andere Zeichensysteme“ (Glück, Schrift und Schriftlichkeit, 204).
31 Otto, Deuteronomium 1–11, 810. 32 Houtman, Exodus III, 516f. sieht den Hohepriester als Repräsentanten Israels. 33 Nach Jacob, Exodus, 1023 bezieht sich der Ausdruck auf die heiligen Gaben, die Jhwh gehören. 34 Als performativ ist dies zu verstehen, da mit der Aufschrift die besondere Beziehung zur Gottheit
ausgedrückt und zugleich zugewiesen wird. Das entspricht der Definition, die Assmann, Verschriftung, 62 aufstellt, wonach „mit den Mitteln der Schrift eine sprachliche Handlung vollzogen wird“. In diesem Fall handelt es sich um die Zuweisung der Sache, Handlung oder Person zur Gottheit, die durch die Inschrift als vollzogen gilt.
35 Zur Diskussion der Diachronie vgl. Schmidt, Numeri, 74f. 36 „Da aber dieser Stab ‚für das Haus Levi‘ sprosste, hatte Jahwe nicht nur Aaron, sondern auch den
Stamm Levi erwählt“ (Schmidt, Numeri, 75). 37 Eine vergleichbare Vorstellung findet sich in Jos 18,9. Dort soll das Land vermessen werden, die
Landesteile sollen aufgeschrieben und danach unter den Stämmen verlost werden. 38 Nach Noth, Numeri, 80, symbolisiert die 70 eine große Anzahl. Er vermutet, dass die beiden Personen
sekundär zugefügt seien, um die 72 zu erreichen. Doch selbst, wenn es sich um einen Zusatz handeln sollte, so nimmt µybtk in V. 26 doch die an Mose gerichtete Aufforderung auf, siebzig Männer aus den Ältesten zu sammeln (wyrfçw µ[h ynqz µh yk t[dy rça larçy ynqzm çya µy[ybç yl hpsa, V. 16), so dass nicht an 72 gedacht sein kann. Wie dem auch sei, aus der Perspektive von V. 26 muss bei dem ‚Sammeln‘ (V. 16) an eine Auswahl von Personen ohne persönliche Anwesenheit gedacht sein.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 185
bereits die Auswahl von Personen für eine bestimmte Funktion, die von Mose (11,29) be-stätigt wird.
Num 5,12ff. Ein performativer Gebrauch von Schriftlichkeit begegnet beim sog. Eifersuchtsordal in Num 5,12ff. Nach einer Beschwörung der des Ehebruchs verdächtigten Frau, werden die Flüche aufgeschrieben und danach wieder abgewaschen. Die Frau muss diese Flüssigkeit trinken, und nach einem Opfer kommt der Fluch über sie, wenn „sie sich verunreinigt hat-te“ (hamfn ayhw). Das Aufschreiben und Auswaschen des Fluches und seine orale Verinner-lichung durch die Frau steht mit seiner Wirkung in einem direkten Zusammenhang.
Dtn 24,1ff. Die schriftliche Aufzeichnung bestimmt die Wirksamkeit einer juristischen Entscheidung in Dtn 24,1ff. Hier geht es um einen Spezialfall bei der Auflösung einer Ehe, nämlich um eine Frau, die zweimal geschieden wird. Dieser wird eine Rückkehr zum ersten Mann verwehrt. Für die Frage der Funktion des Schreibens ist wichtig, dass in beiden Fällen die Auflösung der Ehe mit wtybm hjlçw bezeichnet wird. Dem geht aber jeweils die Abfassung eines ttyrk rps und dessen Aushändigung voraus (hdyb ˆtnw ttyrk rps hl btkw). Der Rechtsakt der Trennung gehört unmittelbar mit der Abfassung des Dokumentes zusammen. Aus dem Satz darf man allerdings nicht folgern, dass jeder angesprochene Israelit, für den die וכתב להVorschrift gilt, potentiell schriftkundig ist. Der Rechtsakt selbst erfordert keine weiteren Personen. Der Ehemann musste zwar für ein Schreiben sorgen, konnte es aber sicher auch von einem Schreiber anfertigen lassen. Das Schreiben ist als selbstverständlicher Bestand-teil des Rechtsaktes erkennbar.
Resümee Beim Durchgang durch die genannten Stellen ist deutlich geworden, dass das Schreiben sowohl in dtn/dtr als auch in priesterlichen Texten des Pentateuchs eine wesentliche Rolle spielt. Diese geht über den Aspekt der Schrift als Kommunikationsmittel hinaus. Die Schrift erhält aufgrund des Aktes des Schreibens zusätzliche Bedeutungsaspekte, so dass von einer performativen Form von Schriftlichkeit gesprochen werden kann.39 Sie scheint
39 Assmann, Fluchinschriften, 244ff. stellt das anhand von schriftlichen Fluchformeln vor. Diese sind
performativ: „Sie ‚beziehen‘ sich nicht ‚auf‘ einen Sachverhalt, sondern stellen ihn her“ (ebd., 243). Vgl. auch Assmann, Verschriftung, 62. Hierbei handelt es sich um eine besondere Form von Pragmatik. Während Assmanns Schlussfolgerungen für die Flüche des Deuteronomiums deren besondere Pragmatik treffen, gehen sie beim Charakter des Deuteronomiums insgesamt zu weit. Die Benutzung von Fluchformeln wie anderen paränetischen Mitteln im Deuteronomium zeigt, dass man die intendierten Adressaten zu überzeugen versucht, sich am Deuteronomium als religiösem Entwurf auszurichten. Assmanns Schlussfolgerung „Das Gesetz etabliert einen Nexus einerseits zwischen Norm und Sanktion und andererseits zwischen Tat und Folge“ (ders. Fluchformeln, 236) ist nicht nur falsch, weil Tora „Weisung“ (nicht „Gesetz“ [!]) bereits begrifflich den paränetischen Aspekt enthält, sondern weil dem Text des Deuteronomiums mit dem Ursprung in der literarischen Figur des Mose Autorität zugeschrieben werden soll, die er sonst nicht hätte. Mose als prophetischer Vermittler weist auch erst den Flüchen ihre Bedeutung zu. Diese Pragmatik des Deuteronomiums lässt sich nur damit erklären, dass seine Inhalte ursprünglich gerade nicht unumstritten waren. Vgl. dazu unten, 200ff.
Raik Heckl 186
bestimmte kultische und juristische Akte bzw. den Besitz oder die Zugehörigkeit zu manifestieren. Durch die schriftliche Ausfertigung eines Dokumentes wird ein juristischer Akt erst vollzogen. Die Einschreibung in eine Liste repräsentiert die Zuweisung der Auf-gabe, die an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Situation erfolgt.
Literarisch umgesetzt werden offenbar juristische und religiöse Funktionen des Schreibens, die bei den intendierten Adressaten als bekannt vorausgesetzt waren. Insbe-sondere die Aufzeichnung eines Namens auf einen Gegenstand als Besitzangabe ist auch archäologisch belegt.40 Mit der Inschrift auf dem Diadem des Hohepriesters lassen sich letztlich die çdq-Inschriften vergleichen.41
Es handelt es sich bei den aufgeführten Stellen jeweils um Rückprojektionen aus der kultischen und juristischen Praxis der Abfassungszeit in die Zeit der Wüstenwanderung. Dies zeigt, dass das Schreiben in den betreffenden Kontexten eine akzeptierte und auch für die erreichbare Vergangenheit der intendierten Adressaten selbstverständliche Angelegen-heit war. Keinesfalls war das Schreiben eine Innovation der späten Königszeit. Aus der Perspektive der dtn/dtr und priesterlichen Texte wird vielmehr deutlich, dass Schrift-kundigkeit zur kulturellen Normalität der Königszeit gehört haben muss.
2.2.2. Konkrete Texte im Pentateuch mit anonymem Ursprung Im Folgenden werden einige Texte diskutiert, die im Pentateuch Erwähnung finden bzw. zitiert werden.42
1. Grundsätzlich ist in dem umfänglichen Werk des Pentateuchs, das als Tradi-tionsliteratur erkennbar ist und nachweislich eine lange literarische Geschichte aufweist, damit zu rechnen, dass die Vorstufen bei den intendierten Adressaten zumindest zum Teil als bekannt vorausgesetzt waren.43 Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn man nicht mit einem rein redaktionsgeschichtlichen Modell der Textreproduktion rechnet, da Ände-rungen des Stils und Kohärenzprobleme darauf hindeuten, dass zumindest Textteile über-nommen worden sind. Die folgenden Beispiele können nur eine Annäherung an das Phäno-men darstellen:
Als literarische Vorstufen des Pentateuchs sind u.a. die Gesetzeskorpora erkennbar.44
40 Dies ist für Alltagsgegenstände (vgl. z.B. die Tongefäße Arad[8] 92, Arad[8] 93, Renz, Text und
Kommentar, 117f. und Wasserkanne Or[8] 1, ebd., 132f.) ebenso bezeugt wie für Wertgegenstände wie die Elfenbeinverzierung Nim(8) 3, ebd., 131.
41 Besonders interessant ist die Inschrift aus dem Heiligtum in Arad(8) 104, Renz, Text und Kommentar, 159f. Vgl. z.B. auch BMir(8) 7, ebd., 171f. Auch der Granatapfel aus Elfenbein Jer(8) 33, ebd., 193, ist vergleichbar, doch ist die Echtheit der Inschrift umstritten. Vgl. dazu zuletzt Lemaire, Re-examination, 174, der aufgrund der Epigraphie allerdings wieder für die Echtheit plädiert.
42 Zu dieser Kategorie könnte u.U. auch die Aufschrift auf dem Diadem des Hohepriesters gerechnet wer-den. Da es sich bei ihr aber entweder um eine Eigentumsbeschriftung handelt oder mit ihr eine be-stimmte kultische Funktion im Blick ist, wurde der Kurztext קדש ליהוה nicht in die konkreten Texte eingeordnet.
43 Spannend ist an diesem Punkt das Faktum, dass selbst den Rabbinen des 5. Jh. n. Chr. in bBB 14b zumindest noch eine eigenständige Entstehung der Bileamgeschichte bewusst war.
44 Beim dtn Gesetz und dem Heiligkeitsgesetz ist umstritten, ob diese ursprünglich unabhängige Gesetzes-korpora waren. Siehe zum Dtn die These von Kratz, Komposition, 136. S.E. wurde „es von vornherein oder recht bald in den älteren Erzählfaden eingesetzt“. Zum Heiligkeitsgesetz vgl. Gertz, Grund-information, 232f.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 187
Dass es auch vorpriesterliche literarische Vorstufen der Erzählzusammenhänge des Penta-teuchs gegeben haben muss, ist Konsens, auch wenn über deren Zusammengehörigkeit und deren Umfang unterschiedliche Thesen miteinander konkurrieren. An manchen Stellen lässt sich erkennen, dass größere Blöcke in den vorliegenden Text integriert worden sind. Dies ist beispielsweise in der Formulierung ≈rah µymçh twdlwt hla am Übergang zwischen der priesterlichen und nichtpriesterlichen Schöpfungsgeschichte der Fall und in Gen 37,2, wo bq[y twlwt hla den Übergang von der Jakobs- zur Josefsgeschichte markiert. Auch bei eingefügten poetischen Texten lässt sich eine eigenständige Existenz und Funktion vermuten. Im Pentateuch ist in dieser Hinsicht das Mirjamlied unbestritten, außerhalb sieht man das Deboralied als älteren poetischen Text an. Umstritten ist aber bspw. die unab-hängige Existenz des Schilfmeerliedes.45
Eine Reihe von Textabschnitten in Num 21 gehört ebenfalls in diese Kategorie. Über deren Ursprung erfahren wir nichts außer den Referenzangaben. In Num 21, 14a wird darin auf ein Werk mit dem Titel hwhy twmjlm rps verwiesen. In Num 21, 27a heißt es µylçmh wrmay ˆk l[, was m.E. am ehesten auf eine anonyme Herkunft eines poetischen Textes schließen lässt. Der erste Abschnitt (Num 21,14bf.), der aus dem „Buch der Kriege Jhwhs“ stammen soll, enthält nahezu ausschließlich Ortsangaben. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt, der in seinem Kontext dazu dient, die Aussagen über den Grenzverlauf zwischen den Moabitern und den Amoritern zu belegen.46 Der Rückgriff auf die Quelle erfolgt mit ˆk l[. Unmittelbar mit diesem Zitat hängen m.E. zwei andere Abschnitte des Kapitels zusammen. Es handelt sich um das sog. Brunnenlied, das in Num 21,17f. wiedergegeben wird, und um das Heschbonlied, das in Num 21,27–29 folgt. Ersteres dient dazu, einen Inhalt zu belegen, der nur knapp in Vers 16 erwähnt wird. Insbesondere die Referenz auf das Lied und die Metaphorik der Beschreibung des Brunnenbaus zeigt, dass Inhalte aus einer anderen Quelle im Hintergrund stehen. Die Parallelismen und die Aufforderung zum Singen weisen auf einen poetischen Zusammenhang hin. Beim letzten Zitat, dem Heschbonlied, wird als Urheberschaft auf sog. µylçm, Dichter, verwiesen. Bei diesem Lied ist die poetische Struktur unverkennbar. Wieder wird das Lied als Beleg für die Eroberung des ostjordanischen Gebietes und offenbar als Begründung für den späteren Grenzverlauf zwischen den Moabi-tern und Israel angeführt. Weil alle drei Zitate im gleichen Kontext vorkommen und eine ganz ähnliche Funktion haben, legt sich die Herkunft aus derselben Quelle nahe. Das Buch der Kriege Jhwhs wird offenbar als poetische Quelle und Grundlage für den Erzähltext von Wüstenwanderung und Landnahme des Ostjordanlandes verwendet.47 Erkennbar ist eine gewisse Autorität des poetischen Textes, die im Gebrauch des Textes oder besser in der
45 Houtman, Exodus II, 243 nimmt an, dass es für den Kontext komponiert worden sei. Er meint, man
habe auf die Psalmtraditionen zurückgegriffen, aber „the song in the form in which it occurs in Exodus was never an independent song and that it makes no sense to search for the ‚Sitz im Leben‘.“ Doch auch die Einschränkung, die mit „the form in which it occurs in Exodus“ gemacht wird, lässt die Möglichkeit eines Rückgriffs auf Vorlagen offen.
46 Aufgrund der Tatsache, dass auch die Vorlage einen Grenzverlauf dargestellt haben muss, kann es sich bei את und ואת in V. 14b nicht um Akkusativzeichen handeln, sondern nur um die Präposition את. Die Grenze verläuft bei den genannten Ortslagen. Vgl. dazu Heckl, Song of Heshbon.
47 In Heckl, Song of Heshbon habe ich die Vermutung geäußert, dass möglicherweise weitere Kämpfe zu dem poetischen Werk über den Ursprung Israels Jhwhs gehörten.
Raik Heckl 188
Tatsache, dass er bei den intendierten Adressaten des Numeribuches (noch) als bekannt vorausgesetzt wird, begründet ist.
Ähnlich scheint es sich mit einigen Verweisen auf den Text des Deuteronomiums zu verhalten, die wir vor allem in den hinteren Rahmenkapiteln finden. Dort wird bereits mehrfach die Existenz eines 48,ספר zu dem die Kontexte der Stellen auch gehören, vorausgesetzt.49 So sprechen Dtn 28,58; 29,19.26 von den Worten / Reden, die „in diesem Buch“ hzh rpsb geschrieben sind. Dtn 28,61 verweist in ähnlicher Weise auf „das Buch dieser Weisung“ (tazh hrwth rps), während Dtn 29,20 und Dtn 30,10 „dieses Buch der Weisung“ (hzh hrwth rps) nennen. Alle diese Referenzen setzen voraus, dass die Abschnitte im direkten Kontext der Phrasen Teil des den Lesern vorliegenden Buches sind. Die Belege im hinteren Teil des Rahmens laufen auf die Abfassung eines Textes durch Mose (Dtn 31) zu, weswegen sie später noch einmal zu behandeln sind. Mit diesem Text dürfte auch Dtn 17,18 zusammenhängen, da dort die Szenerie von Dtn 31 aufgerufen wird.50
2. An drei Stellen des Buches Deuteronomium werden die Adressaten der Moserede auf der Ebene der Moserede dazu aufgefordert, sich einen Text als religiösen Gebrauchstext anzufertigen: a) In Dtn 6,9 und 11,20 ist vom Aufschreiben der Moserede die Rede. Die Worte bzw. Reden des Mose ˚wxm ykna rça hlah µyrbdh µwyh (Dtn 6,6), yrbd (Dtn 11,18) sollen nach dem Befehl des Sprechers des Buches auf die Türpfosten der Häuser und Stadttore geschrieben werden. Die beiden zum liturgischen Textbestand der Verlesung des Schema‘ Israel ([mç tayrq) gehörenden Kontexte fordern aber darüber hinaus zum Aus-wendiglernen bzw. zur Verinnerlichung der Moserede(n) und zu ihrem Gebrauch in Amulettform auf.51 Kaum praktikabel erscheint es, dass in den beiden Stellen zur Auf-zeichnung des gesamten Deuteronomiums aufgefordert wird. Es dürfte von vornherein – wie in der späteren jüdischen Tradition der Mezuzot und Tefillin – pars pro toto an den Gebrauch von Abschnitten, die den Gesamttext repräsentieren, gedacht sein.52 b) Einen
48 Da es sich pragmatisch auf den vorliegenden Text bezieht, kann man ספר durchaus mit „Buch“
wiedergeben, wobei man sich freilich klar sein muss, dass ספר eine große Bedeutungsspanne hat. 49 Sonnet, Book within, Zitat: 261 hat ausführlich über die Natur dieser Bemerkungen nachgedacht und
sieht eine indirekte Verweisfunktion auf das Buch, das den intendierten Adressaten vorliegt: „Deuteronomy is the surrogate of another ‚book‘, disclosing the content of the latter while not assuming its formal identity. But Deuteronomy does so in being a surrogate book. The reader comes to know the Torah as spoken by Moses, but Moses’s spoken word is, from the outset, a written word within the book of Deuteronomy. If irony is to be found in Deuteronomy, it is that irony of the unavoidable character of the written form. Deuteronomy makes a powerful virtue of such an ironical necessity.“ Zur Kritik an Sonnet und vergleichbaren Modellen vgl. schon Heckl, Präsentation, 235f. M.E. basiert Sonnets Konzept auf einem postmodernen Verständnis von literarischer Fiktionalität, dem die bib-lischen Texte nicht entsprechen. Die Studie wird weitere Argumente gegen solche Annahmen und für ein alternatives und der altorientalischen Kultur adäquates Modell aufzeigen.
50 Der Text muss unten, 189f. weiter behandelt werden, da er von der Anfertigung des ספר durch den König spricht.
51 Als Übersicht über diese Textsorte siehe Berlejung, Zeichen, 133–140. Erstmals in diese Richtung hat Keel, Zeichen, 193ff. die Stelle von einer Fülle ikonographischer Hinweise her interpretiert. Berlejung, Zeichen, 151 sieht konkret Dtn 6,6–9 als Referenz auf ein Textamulett. Vgl. weiter Otto, Deute-ronomium 1–11, 808–810.
52 E. Otto denkt an einen klar umrissenen Kontext: „In Dtn 6,9 ordnet Mose an, dass »diese Worte«, die in Dtn 6,6 genannt werden und Schema‘ Israel und Horebdekalog umfassen, an die Türpfosten mezûzot des Hauses und an das Tor ša‘ar anzuschreiben seien“ (Otto, Deuteronomium 1–11, 811). Freilich ist
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 189
umfassenden Text des Deuteronomiums scheint Dtn 27,2ff. im Blick zu haben. Dort fordert Mose dazu auf, seine Reden nach der Landnahme auf Stelen zu schreiben. Dabei handelt es sich um eine Ätiologie der Reden des Mose als eines schriftlichen Textes. Es ist zwar möglich, dass die beiden Gesetzesstelen mit einer Aufzeichnung des Deuteronomiums an Vorstellungen von Textmonumenten anknüpfen,53 doch dürfte der ätiologische Aspekt im Vordergrund stehen.54 Dtn 27 erklärt, wie die Mosereden in ihre schriftliche Form gekommen sind, obwohl Mose nicht mit in das Land westlich des Jordans ziehen konnte.
Doch bereits in Dtn 17,18 haben wir einen etwas anderen Verweis auf das ab-geschlossene Buch vor uns. Dort wird letztlich von den Adressaten der Moserede gefordert, dass der von diesen eingesetzte König (Dtn 17,14f.) sich eine Abschrift „dieser Tora“ anfertigen soll. Auch dies verweist auf das den intendierten Adressaten vorliegende Buch. Die Aufforderung dürfte unmittelbar mit der Königskritik der dtr Geschichtsbücher zusam-menhängen, denn über keinen König wird entsprechend berichtet, dass er sich eine Ab-schrift der Tora anfertigen ließ. Vielmehr wird in der ‚Auffindungsgeschichte‘ in 2Kön 22,8.10 offenbar ein vergessenes Buch gefunden, das bis dahin keine Rolle gespielt hat.55
das abhängig von den literarkritischen Entscheidungen innerhalb von Dtn 6,4ff. M.E. spricht der doch eher offene Umfang der Texte der Tefillin und Mezuzot in der Antike dafür, dass die Hinzusetzung des Dekalogs nur eine mögliche Interpretation von Dtn 6,9 gewesen ist. Im Übrigen ist zu beachten, dass bei den drei Texten, die bis heute bei der Rezitation des Schema‘ gelesen werden, jeweils von der konkreten Handlung der Anfertigung der Texte, bzw. der Gedächtnisfäden (Num 15,38f.) die Rede ist. Dies dürfte mit der performativen Bedeutung des Schreibens in der Antike zusammenhängen. Mit dem Aufschreiben und Tragen der Verse, die vom Aufschreiben und Tragen sprechen, wird in besonderer Weise die Einhaltung dieses Gebotes unterstrichen.
53 Nielsen, Deuteronomium, 247, sieht einen Zusammenhang mit einer entsprechenden Praxis in Ägypten. Freilich zeigen die Tell Deir ‘Alla Inschriften, dass diese Praxis auch in Palästina gang und gäbe war.
54 Vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 363f. Eine vergleichbare Konzeption findet sich auch in der Tafel I des Gilgameschepos, wo der den Lesern / Hörern zugängliche Inhalt des Epos mit der Figur des Gilgamesch in Verbindung gebracht wird.
55 Die Nichtbenutzung des Buches über nahezu die ganze Geschichte dürfte im Übrigen bereits bei der Auffindungsgeschichte in 2Kön 22,8 der entscheidende Punkt sein. Bereits Hardmeier, König, 93, hat die „Geschichtslücke der seit Josua bis Joschija nie mehr erfolgten Tora-Vorlesung“ gesehen, doch überlegte er, wie es dazu gekommen sein kann, dass es in Vergessenheit geriet. S.E. soll das Auffinden eines für die intendierten Adressaten bekannten Buches dessen Bedeutung hervorheben (vgl. ebd., 104) und der erste Teil der Geschichte sei „von der überraschenden Zufälligkeit, mit der das Buch bekannt wurde“ (ebd., 105), geprägt. Demgegenüber erklärt der Zusammenhang zwischen Dtn 31 und 2Kön 22, warum trotz Auffindungsbericht und Reform unter Josia das Unheil im dtr Königebuch nicht aufzuhalten ist. Deshalb wird in 2Kön 22,8 auch mit der Determination von ספר התורה die Kenntnis des gefundenen Buches auch als bekannt vorausgesetzt. Anders Willi-Plein, Wort, 85, die an die Verschrif-tung einer bekannten mündlichen Verkündigung denkt: „Da Unterweisung und Belehrung wesentlich ein mündlicher Vorgang ist, handelt es sich also auch hier – wie bei der Rolle des Jeremia – um die Archivierung des Mündlichen, die Toraakten sozusagen.“ Doch ist es eine Frage der Pragmatik. Die Determination ist vor allem ein Signal für die intendierten Adressaten. Es ist entsprechend auch kein Hinweis darauf, dass es nur eine Kopie des Buches gab, wie van der Toorn, Scribal Culture, 147 schlussfolgert. Das Thema der Buchauffindung wird also erst nachträglich in einen Reformbericht eingebunden. Mit der Reform erhält es seine Autorität, denn die Auffindung bezeugt, dass Mose es bei der Bundeslade abgelegt hat. Zugleich wird das Exil erklärt, da das Buch nur in negativer Weise als Zeuge gegen Israel (לעד בך, Dtn 31,26) wirken konnte. Zur Josianischen Reform vgl. zuletzt Pietsch, Kultreform. Nach Pietsch, ebd., 334 liegt lediglich ein „ideengeschichtlicher Zusammenhang zwischen der Religionspolitik Josias und dem Tradentenkreis des Deuteronomium“ vor, und beides sei literarisch
Raik Heckl 190
Was an den ersten vier Stellen an die Zuhörer des Mose adressiert ist, ist pragmatisch auf den Gebrauch des Deuteronomiums als religiöses Buch gerichtet. Es geht in Dtn 6,9; 11,20 und 27,2ff. um dessen Existenz und um seinen Gebrauch in der persönlichen Religiosität. In Dtn 17,18 wird faktisch der Realität der Königszeit das vom Dtn propagierte Ideal der persönlichen Religiosität entgegengestellt. Da der Gebrauch der Tora durch den König in Dtn 17,20 mit einer Heilszusage nicht nur für den König, sondern auch für seine Söhne, also offenbar die davidische Dynastie, verbunden ist, dient dieser Text letztlich als Ätiologie des Untergangs des Königtums in Juda.
Ein Gebrauch von biblischen Texten, wie er in Dtn 6,9; 11,20 gefordert wird, ist vergleichsweise früh belegt. Er ist schon unter den Qumrantexten56 und zuvor durch die Ketef Hinom-Amulette mit Varianten des Priestersegens57 und dem Papyrus Nash nach-weisbar. Dtn 6 und 11 könnten darauf weisen, dass das Deuteronomium oder Teile seiner Vorstufen bereits während seiner Literargeschichte entsprechend in Verwendung waren.58 Zumindest Dtn 6,9 gehört unmittelbar in den Zusammenhang des dtn/dtr Deuteronomiums. Für die Entstehung des Deuteronomiums bedeutet dies, dass es relativ zeitig in seiner literarischen Geschichte mit einer bestimmten Form der persönlichen Religiosität in einer Beziehung stand und auf sie wirken sollte. Um das zu erreichen, nutzte man die bereits akzeptierte Autorität des Mose, der nun dazu auffordert, Kopien oder Teilkopien des Buches anzufertigen und zu verwenden.
Resümee Der Blick auf im Pentateuch vorausgesetzte Texte zeigt, dass dieser auf literarische Traditionen aufbaut und bereits akzeptierte literarische Texte als argumentative Grundlage nutzt. Innerhalb des Pentateuchs wird auf die Existenz besonders des Deuteronomiums als abgeschlossener Text mit der Phrase hrwth rps verwiesen. Konkrete Entstehungsszenarien finden sich ebenfalls im Deuteronomium. Dort wird den impliziten Adressaten die Abfassung der Mosereden an mehreren Stellen aufgetragen, was man faktisch als Ätiologien der Existenz des Buches (Dtn 6,6; 11,18; 27,2ff.) einerseits und seines Gebrauchs in der persönlichen Religiosität andererseits ansehen muss. In ähnlicher Funktion – allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen – hat man die Aufforderung in Dtn 17,18 an den König zu sehen, die das Königtum an ein späteres vom Deuteronomium geprägtes Ideal der persönlichen Religiosität bindet und zugleich den Untergang des Königtums erklärt.
unabhängig voneinander (vgl. ebd., 482). Während 2Kön 22f. kaum historisch zuverlässige Informa-tionen über eine Reform Josias entnommen werden können (gegen Pietsch, Kultreform, 471), basiert die exilische und nachexilische Verbindung von Deuteronomium und Reform auf dem Wissen des vorexilischen Ursprungs des Deuteronomiums und darauf, dass man von der besonderen Bedeutung der Jhwh-Verehrung unter Josia wusste. Die Verbindung von Deuteronomium und Kultreform ist für die dtr Theologie konstitutiv.
56 Siehe Milik, Tefillin, 33–85. 57 Vgl. dazu Berlejung, Der gesegnete Mensch. 58 Vgl. Veijola, Moses Erben, 88; ders., Deuteronomium, 181; Otto, Deuteronomium 1–11, 811.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 191
2.2.3. Konkrete Texte im Pentateuch mit Ursprung bei Jhwh In Ex 32,32f. ist ein Buch erwähnt, auf das im Pentateuch nicht wieder zurückgekommen wird. V. 32 ist Teil von Moses Fürbitte für das Volk nach dem Bundesbruch in Ex 32,1–6. In V. 32b schließt diese damit, dass Mose Jhwh auffordert, im Falle einer Verweigerung der Vergebung (ˆya µaw) ihn, Mose, aus dem Buch zu tilgen, das Jhwh geschrieben habe (tbtk rça ˚rpsm an ynjm).59 Es handelt sich bei der Aufforderung und bei Jhwhs Reaktion darauf um eine Metapher, die auf den Tod des Mose zielt.60 Sein Tod als Figur des Buches würde letztlich sein Verschwinden aus der Erzählung des Pentateuchs bewirken. Das Buch, das Jhwh geschrieben hat, steht daher zumindest mittelbar in einem Zusammenhang mit der Existenz des Textes, in dem Mose eine der wichtigsten Figuren ist.
Es ist daher zu schließen, dass der Pentateuch mit einem göttlichen Text in einen Zu-sammenhang gebracht wird. Bezieht man ein, dass das Schreiben repräsentative und performative Funktionen haben kann, legt es sich für Ex 32,32 nahe, dass ähnlich wie bei den Bezügen auf ein ספר im Deuteronomium pragmatisch der den intendierten Adressaten vorliegende Text gemeint ist. Mose wirft sein Leben mit dem Verweis auf seine Existenz in dem Buch in die Waagschale, in dem er für die intendierten Adressaten entsprechend auch nicht weiter angetroffen werden könnte.
Was auf der einen Seite als Rhetorik zu verstehen ist, da auf der Erzählebene weder das Volk noch Mose in der Handlung des Pentateuchs verzichtbar sind, wirft auf der anderen ein Licht auf den Kontext. Dieser gilt offenbar als göttlicher Text, eine Vorstellung, die wir außerhalb des Pentateuchs u.a. in Jos 24,26 antreffen, wo davon die Rede ist, dass Josua das Buch der Tora Gottes mit einem Zusatz versieht. Was auch immer dort konkret mit תורת bezeichnet ist,61 der Text hält fest, dass Josua mindestens die Bundesschlussszenerie האלהים(Jos 24) in sie eingetragen hat.
Der einzige Text, der im Pentateuch im Wortlaut zitiert und auf Gott zurückgeführt wird, ist der Dekalog. Von dem Text wird behauptet, dass Jhwh ein erstes und ein zweites Exemplar angefertigt hat. Allerdings ist davon im direkten Kontext des Dekalogs nur im Deuteronomium die Rede. In Dtn 5,22 wird auf die vorangehende Gebotsreihe zurück-verwiesen und erwähnt, dass Gott sie auf zwei Tafeln geschrieben und Mose ausgehändigt habe. Die Anfertigung der Tafeln durch Gott wird außerdem im späten62 vierten Kapitel direkt vor dem Dekalog (Dtn 4,13) erwähnt. Dort heißt es, dass Jhwh dem Volk am Horeb seinen Bund mündlich verkündigt habe. Dieser wird zunächst mit dem Begriff עשרת הדברים „zehn Worte“ bezeichnet. Danach heißt es auch dort, dass Jhwh diese Worte auf zwei steinerne Tafeln aufgezeichnet habe. Im dritten Rückblick auf die Ereignisse am Horeb wird in Dtn 9,10 wiederum berichtet, dass Gott Mose die beiden steinernen Tafeln
59 Diese Stelle wird abschließend noch einmal in dem Übersichtskapitel „Jhwh als Schreiber“ (unten, 198)
behandelt. 60 Vgl. Aurelius, Fürbitter Israels, 89. 61 Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 220, sieht in dem Vers eine „Verschriftungstheorie des
Hexateuch“. Knauf, Josua, 198: „Indem Josua ‚sein Buch‘ der Tora hinzufügt, versteht sich das kanonische Josuabuch als deren Supplement.“ Letzteres lässt sich leider nicht beweisen. Es ist wahrscheinlicher, dass der Text behauptet, mit hlah µyrbdh würden Worte / Reden von Josua in den engeren Kontext eingefügt.
62 Der Text setzt priesterliche Texte des Tetrateuchs als bekannt voraus. Siehe dazu und zur Diskussion Otto, Deuteronomium 1–11, 532ff.
Raik Heckl 192
ausgehändigt habe. Der Vers fasst zusammen, was auf den Tafeln aufgezeichnet war. Auch hier wird das, was Jhwh dem Volk gegenüber gesprochen hat, als Inhalt der Tafeln genannt. Auffällig ist allerdings, dass anders als an den vorangehenden Stellen in Dtn 9,10 nicht direkt davon die Rede ist, dass Jhwh den Text geschrieben habe: µyhla [bxab µybtk µynbah tjwl ynç ta yla hwhy ˆtyw. Hier werden die Tafeln charakterisiert und als mit dem Finger Gottes geschrieben bezeichnet, was eine Differenz zu den klaren Aussagen, Gott habe geschrieben, darstellt.63
In Dtn 10,2 stellt Jhwh (ebenfalls im Rückblick) nach der Zerstörung der ersten Tafeln die Anfertigung von neuen Tafeln in Aussicht. Die Identität der zweiten und der ersten Tafeln wird betont und in Dtn 10,4 heißt es noch einmal, dass Jhwh die gleiche Inschrift, bezeichnet auch hier als zehn Worte, angefertigt und Mose ausgehändigt habe. Alle diese Erwähnungen sind summarischer Natur. Auffällig ist mithin die Charakterisierung der Tafeln als geschrieben von einem Finger Gottes.
Gegenüber den direkt im Kontext des Dekalogs im Deuteronomium anzutreffenden Verschriftungsnotizen ist es im Exodusbuch auffällig, dass erstmals in Ex 24,12 davon die Rede ist, dass Gott die steinernen Tafeln geschrieben habe. Doch werden diese zusammen mit weiteren von Gott geschriebenen Texten erwähnt, die Mose erhalten soll. Ebenfalls auffällig ist im inhaltlichen Ablauf der Sinaiperikope, dass Mose dem Volk zunächst mündlich die Worte Jhwhs mitgeteilt hat (Ex 24,3a), dann erst selbst davon eine Auf-zeichnung angefertigt und diese noch einmal verlesen hat (Ex 24,4). Erst in 31,18 gelangt Mose in den Besitz der Tafeln, die wie in Dtn 9,10 als כתבים באצבע אלהים bezeichnet werden. Mose und Jhwh konkurrieren scheinbar als Urheber auch der Inhalte des Dekalogs, wenn Mose offenbar zunächst die Worte Jhwhs einschließlich des Dekalogs aufschreibt, er danach aber noch von Gott die Tafeln mit den zehn Worten erhält, die er in Ex 32,15 nur dafür bekommen hat, um sie in 32,19 zu zerstören, als er das im Tanz um das Götterbild be-griffene Volk antrifft. In Ex 34,1 soll Mose neue Tafeln anfertigen, die erst in 34,28 (wohl von Gott) wieder beschrieben werden.
Weil im Deuteronomium die Vorstellungen des schriftlich von Gott mitgeteilten Textes und von Moses Mittlerschaft ineinander übergehen und auf Mose das Hauptgewicht im Deuteronomium liegt, kann die Idee vom göttlichen Ursprung der Tafeln nicht aus dem Deuteronomium stammen. Eher könnte man überlegen, ob ein göttlicher Ursprung von Texten bzw. eine Zuschreibung von Texten zu Jhwh, wie in Ex 32,32f. und Jos 24,26 vorausgesetzt, ursprünglich mehr Inhalte umfasst hat.64 Eine damit zusammenhängende Vorstufe könnte an den beiden Stellen, an denen davon die Rede ist, dass sie mit dem Finger Gottes geschrieben sind, greifbar sein.65
Alle diese Probleme und die offensichtlich bei den intendierten Adressaten voraus-gesetzte besondere Bedeutung des Dekalogs lassen sich damit erklären, dass dieser bereits außerhalb der beiden Stellen im Pentateuch im religiösen Gebrauch war. Der Dekalog ist im Deuteronomium ganz eng mit dem Schema Israel, seiner ursprünglichen Eröffnung, verbunden. In Dtn 5,1 wird dem Dekalog die Überschrift aus Dtn 6,1 mit dem Ruf um
63 Vgl. zur Traditionsgeschichte des Motivs Maier, Finger. 64 Vgl. dazu auch die traditionsgeschichtlichen Bezüge nach Ägypten unten, 196ff. 65 Die Vorstellung des Fingers Gottes könnte nach Maier, Finger, 240 „im Sinne übertragener Rede
aufgefasst“ werden, was er anhand von Ex 8,15; Ps 8,4 entfaltet.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 193
Aufmerksamkeit larcy [mç vorangestellt. Und auch der direkte Übergang vom Dekalog zum Schema Israel spricht dafür, dass beide Texte in der persönlichen Religiosität wichtig waren. Denn Dtn 5,31 behauptet ja, dass Jhwh Mose direkt im Anschluss an den Dekalog das Deuteronomium (ta ˚yla hrbdaw µdmlt rça µyfpçmh µyqjhw hwxmh lk) mitgeteilt habe (siehe Dtn 6,1: µyqjh hwxmh tazw µkta dmll µkyhla hwhy hwx rça µyfpçmh). Und bezeich-nenderweise findet sich der Gebrauch des Dekalogs in Inschriften sowohl bei Samari-tanern66 als auch im Judentum.67 Aus Qumran sind mehrere Texte aus Tefillin und Mezuzot bekannt, die den Dekalog enthalten.68 Das wahrscheinlich älteste Zeugnis der Zusammen-stellung der beiden Texte ist der Papyrus Nash, der aus dem 2. bzw. 1. Jahrhundert v. Chr. stammt.69 Spannend sind diese Zeugnisse auch deswegen, weil das Judentum sich später gegen den Gebrauch des Dekalogs in der Liturgie entschieden hat,70 was beweist, dass es eine Tradition des besonderen Dekaloggebrauchs gegeben haben muss. Der Dekalog als Textbestandteil fand im Dtn seinen Platz, weil er aufgrund seiner Herkunft mit ganz beson-derer Autorität verbunden war. Ob er immer schon als der konkrete Text bekannt war, der auf Gott direkt zurückgeht, muss man aufgrund des Vergleichs von Dtn mit Exodus in Zweifel ziehen, und sicher hatte er ursprünglich auch nicht die im Deuteronomium gege-bene Form. Denn der Kontext macht den Eindruck, als wolle man den Wortlaut ‚kanoni-sieren‘.71
Man hat sehr viel über den Ursprung des Dekalogs spekuliert und einen Zusam-menhang mit der Verkündigung Hoseas gesehen.72 Hos 8,12 spricht von einer „Fülle von Weisungen“,73 die Gott aufschreiben könnte, das Volk würde es dennoch als Fremdes ansehen (wbçjn rz wmk ytrwt wbr wl btka74). Dies dürfte auf eine existierende schriftliche Form von Geboten abzielen.75 Da Hos 4,2 oft in einen Zusammenhang mit dem Dekalog gebracht wird, ist in Hos 8,12 ein Bezug zu derselben Tradition nicht unwahrscheinlich. Wie die Beziehung des Dekalogs zu der in Hosea erkennbaren Tradition auch zu bestimmen ist, ein von Gott verfasster Text ist als besondere Autorität im Blick.76
Mit einer Anpassung des Dekalogs an dessen Wortlaut im Dtn hätte man später auch das Konzept der göttlichen Abfassung aus der vageren Vorstellung eines göttlichen Ur-sprungs eines oder mehrerer göttlicher Texte entwickelt, wenn man annimmt, dass das Dtn sich auf einen Text in einer Vorstufe der Sinaiperikope bezieht.77
66 Vgl. Dexinger, Garizimgebot. 67 Vgl. Stemberger, Dekalog, 94–99. 68 Vgl. die Auflistung bei Stemberger, Dekalog, 96. 69 Vgl. Fischer, Text, 13. 70 Der Sachverhalt wird in yBer 1,5,3c diskutiert. Vgl. dazu Stemberger, Dekalog, 100. 71 Dies ist in Dtn 5,22 abgesehen von mehreren Autoritätsverweisen an der Kanonformel erkennbar. 72 Vgl. dazu Neef, Heilstraditionen, 175–178. 73 Plural nach LXX. 74 Zu den textuellen Problemen siehe Wolff, Hosea, 170 75 Wolff, Hosea, 186: „Hosea kennt schon eine Vielzahl von schriftlich überlieferten Weisungen. Damit
ist für die Mitte des 8. Jh. schriftliche Tradition des alten Bundesrechts bezeugt.“ Aufgrund des Kontextes wird auch überlegt, ob die Formulierung sich auf „Priesterweisungen“ (so Jeremias, Hosea, 111) bezieht.
76 Vgl. dazu auch Wolff, Hosea, 186. 77 Kratz, Dekalog, 235, hält fest, dass der Dekalog in Dtn aus Ex 20 „– und zwar in der vorliegenden, im
Zuge der Aufnahme überarbeiteten Fassung – ‚zitiert‘“ wurde. Vgl. Kratz, Höre Israel, 80.
Raik Heckl 194
Ein weiterer Verweis auf göttliches Schreiben wurde bereits erwähnt. In Ex 24,12 sind neben den steinernen Tafeln noch zwei weitere Texte (hwxmh hrwth) erwähnt, die Jhwh geschrieben haben soll: Mindestens die Aufzählung in dem Vers ist sehr spät, da bereits umfangreiche Textkorpora in den Blick genommen werden.78 Es ist wahrscheinlich, dass dieser Vers Vorstellungen wie jene in Ex 32,32 und den göttlichen Ursprung des Dekalogs integriert hat. Spannend ist daran, dass Gott zwar als deren Verfasser erwähnt wird, dass aber Mose, der in dem Vers angesprochen ist, nie in den Besitz von anderen Texten als dem Dekalog kommt.79
Resümee Jhwh wird ganz selbstverständlich als Schreiber mit Texten in Verbindung gebracht. Es wird weder erklärt noch vermittelt, dass Gott sich des Schreibens als Kommu-nikationsmittel bedient. Diese Selbstverständlichkeit wird zuerst bei der Abfassung der Tafeln des Dekalogs deutlich. Dies ist der einzige Text, dessen exakter Wortlaut und materiale Existenz auf Gott selbst zurückgeführt wird. Auffällig ist freilich, dass dies nur im Deuteronomium im direkten Kontext des Dekalogs geschieht. Seine Stellung im Kon-text des Schema Israel, zu dem vom Dekalog übergeleitet wird, war Anlass zu der Vermu-tung, dass der Dekalog wie das Schema Israel eine wichtige Rolle in der persönlichen Religiosität gespielt hat und dass beide Texte vielleicht auch schon zusammen verwendet wurden. Zwei weitere Stellen setzen Jhwh als Schreiber von Texten voraus, die nicht konkret auf existierende Texte bezogen sind, allerdings wahrscheinlich in Relation zum Pentateuch bzw. zu seinen Vorstufen gestellt sind.
2.2.4. Konkrete Texte bzw. Textteile im Pentateuch mit Ursprung bei Mose Als letzter Punkt sind im Überblick bereits die Stellen zu besprechen, an denen Mose als Schreiber erscheint. Dies dient dazu, die weitergehende Fragestellung für die Analyse der Einzelstellen zu schärfen. Es handelt sich um Ex 17; 24; 34; Num 33 und Dtn 31.
In Ex 17,14 soll Mose etwas rpsb „in das Buch“ (MT) schreiben (a). Während es noch genauerer Analyse bedarf, worum es sich dabei handelt, schreibt Mose in Ex 24,4 die Reden Jhwhs auf (b) und verliest anschließend den tyrbh rps. An dieser Stelle liegt ein Verweis auf den direkt vorangehenden Gesetzeskorpus vor, der daher in der wissen-schaftlichen Terminologie auch diesen Namen trägt. In Ex 34,27 wird Mose im Kontext der Anfertigung der zweiten Gesetzestafeln und im direkten Anschluss an den sog. kultischen Dekalog von Gott aufgefordert, „diese Worte“ µyrbdh hlah aufzuschreiben (c), was sich wohl auf die vorangehende Gebotsreihe bezieht. Als Begründung wird angeführt, dass sie die Grundlage für den erneuerten Bundesschluss sein soll. In Num 33,2a (d) heißt es, dass Mose die Stationen auf einen Befehl Jhwhs hin aufgeschrieben habe (hwhy yp l[ µhy[sml µhyaxwm ta hçm btkyw). Dann folgt nach einer Überschrift 33,2b das große Stationen-
78 Vgl. dazu bereits Heckl, Augenzeugenschaft, 370f. 79 In dem Beitrag Heckl, Augenzeugenschaft, 371 habe ich die These aufgestellt, dass die Stelle mit dem
Konzept einer Abfassung der Tora insgesamt durch Mose in einem Zusammenhang steht. Die Tora des Mose und die von Gott geschriebene Tora stehen sich gegenüber. Zusammenfassend dazu siehe unten, 225.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 195
verzeichnis (Num 33,3–49), das einen Bogen vom Auszug bis zur Ankunft im Jordantal schlägt. Zwei Texte schreibt Mose in Dtn 31. In Dtn 31,9 schreibt Mose offenbar den den intendierten Adressaten vorliegenden Text (e) – daher tazh hrwth – und händigt ihn den levitischen Priestern und den Ältesten aus. Danach (f) heißt es in Dtn 31,22, dass Mose das nachfolgende Lied (Dtn 32) aufschrieb.80 Überraschend wird schließlich in Dtn 31,24 resümiert, dass Mose nun fertig ist, „die Reden dieser Tora“ tazh hrwth yrbd vollständig (µmt d[) aufzuzeichnen, was sich möglicherweise auf die beiden vorangehenden Verschrif-tungsnotizen Dtn 31,9.22 zurückbezieht.
Der kurze Überblick lässt ebenso wie an anderen Zusammenhängen des Pentateuchs, wo das Schreiben thematisiert wird, erkennen, dass auch mit Mose das Kommunika-tionsmittel „Schreiben“ ganz selbstverständlich verbunden wird. Offenbar wird Mose von den intendierten Adressaten ganz selbstverständlich im Besitz der Schriftkundigkeit ge-sehen. Dass sich dadurch die eigentlichen Schreiber selbst ein „Denkmal im Pentateuch gesetzt“81 haben, ist unverkennbar.82
Die Verschriftungsnotizen mit Mose beziehen sich abgesehen von Dtn 31,9.24 immer auf Einzelstellen bzw. Abschnitte. In Dtn 31,9 wird mit התורה הזה ein Bezug zu anderen Stellen im Buch Deuteronomium hergestellt. Daher nimmt man üblicherweise an, dass sich Dtn 31,9 auf die Abfassung des Deuteronomiums bezieht.83 Alle Stellen unterscheiden sich jeweils voneinander. Es handelt sich in der Tat um sechs unterschiedliche Texte. In den Texten wird auf sechs unterschiedliche Verschriftungsakte rekurriert, wobei Dtn 31,9 und 31,22 durch Dtn 31,24 in einen Zusammenhang gebracht werden. Aufgrund dieser disparaten Situation stellt sich die Frage nach der Funktion des Motivs im jeweiligen Kontext. Was bewirkt die Behauptung der Verschriftlichung für das Verständnis des jewei-ligen Textes? Ist die Intention des Textes, den Mose schreibt, mit dem Motiv verbunden, hängt sein Gebrauch womöglich direkt mit der Intention des jeweiligen Abschnittes zusam-men?
Es stellt sich die Frage, ob wir sechs bzw. fünf – wenn man Dtn 31,9.22.24 zusam-mennimmt – unterschiedliche Konzepte vom Schreiben durch Mose vor uns haben, oder ob sich an den genannten Stellen ein übergreifendes Konzept nachweisen lässt. Wenn dies der Fall wäre, könnte man Entwicklungen im Motivgebrauch nachgehen und versuchen, eine traditionsgeschichtliche Entwicklung des Konzeptes „Mose als Schreiber“ nachzuzeichnen.
Bei der Anfertigung der Dekalogtafeln wird im Kontext des Dtn betont, dass der den intendierten Adressaten vorliegende Text mit demjenigen auf den Tafeln und dieser wie-derum mit dem Inhalt der Gottesrede am Horeb identisch gewesen sei. Bei allen Stellen, an denen Mose schreibt, fehlt eine solche explizite Aussage. Zu klären ist, wie sich der von Mose verfasste Text zu dem den intendierten Adressaten vorliegenden Text verhält.
80 Vgl. dazu Heckl, Präsentation, 231–236. 81 Otto, Tora als Buch, 582. Ähnlich auch van der Toorn, Scribal Culture, 166f., der annimmt, dass Mose
als eine Art Modell für die Schreiber gedient hat. 82 Ähnliches vollzieht sich interessanterweise auch in Ägypten und Mesopotamien, wo Thot und Nabû das
Patronat über die Schreiberschaft innehaben, worin sich das Selbstbewusstsein dieses ‚Standes‘ widerspiegelt. Vgl. Millard, Nabû, 608; Vos, Thot, 863.
83 Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 207, geht mit der Annahme, dass sich Dtn 31 auf Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium bezieht, bereits darüber hinaus. M.E. handelt es sich um eine Abfassungsnotiz des gesamten Pentateuchzusammenhangs. Vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 371f.
Raik Heckl 196
Der Vergleich mit der Abfassung der Dekalogtafeln zeigt ein weiteres Problem: Im Pentateuch existiert eine eigentümliche Konkurrenzsituation. Mose schreibt immer wieder, aber auch Gott schreibt, und Mose selbst kommt mit den Texten Gottes in Berührung. Dass Mose zudem offenbar in Ex 32,32 in einem von Gott geschriebenen Buch vorkommt, er aber mit dem Dekalog selbst einen von Gott geschriebenen Text in der Hand hält, ist eine eigentümliche Verschachtelung, der weiter nachzugehen ist.
3. Jhwh als Schreiber und Schreibergötter in der Umwelt Israels
Die Rede vom Dekalog als von Gott selbst verfasster Text steht nicht allein. Sie gehört zu der Rede von weiteren ‚göttlichen‘ Büchern in Israel. Diese Vorstellung ist im Pentateuch und darüber hinaus (vgl. Jos 24,26; Hos 8,12) anzutreffen, wobei es sich um ein religiöses Konzept handelt, das Israel mit der Umwelt verbindet. Denn bei den Nachbarkulturen wird bestimmten Göttern des Pantheons eine Schreibertätigkeit zugewiesen. An erster Stelle sind die beiden Gottheiten Nabû und Thot zu nennen. Nabû in Mesopotamien und Thot in Ägypten waren göttliche Schreiber und Sekretäre.84 Diese beiden Gottheiten übten über ihre religiöse Heimat hinaus sehr viel Einfluss aus und waren möglicherweise im Alten Israel bekannt.85 In der direkten Nachbarschaft Israels bei den Phöniziern wurde Thot in das lokale Pantheon integriert, was mit den engen Beziehungen zwischen Phönizien und Ägypten zusammenhängt.86
Thot wurde als Schreiber des Re, als Erfinder der Schrift und auch als Urheber religiöser Texte angesehen.87 Er wird beispielsweise im Sargtext CT III, 240b „als Schrei-ber der Gottesworte“ bezeichnet.88 Diese Vorstellung ist mindestens seit dem Mittleren Reich belegt.89 Man sieht den Gott später als Verfasser von Teilen des Totenbuches.90 Obwohl er über weite Teile des Buches angesprochen wird und auch über ihn gesprochen
84 In Ägypten hatte auch die Göttin Seschat in bestimmten Kontexten die Funktion der Schreiberin. Sie
handelt mitunter auch gemeinsam mit Thot (vgl. Stadler, Weiser, 15) und kann als seine Schwester angesehen werden. Vgl. Kurth, Thot, 520.
85 Nabû scheint als נבו sicher in Jes 46,1 zusammen mit בל gemeint zu sein. Möglich ist, dass der Ortsname נבו (Num 32,3; Dtn 32,38; 34,1 u.ö.) etwas damit zu tun hat. Es ist überlegt worden, ob die Formulierung דרך יהוה לעשות צדקה (Gen 18,19) auf die Rolle Thots anspielt. Vgl. Vos, Thot, 863. Albright, Yahweh, 245f. sah in Hi 38,36 einen Bezug zu dem ägyptischen Gott. Freilich fragt man sich an der Stelle, ob nicht eher ein Ptz. Pl. der Wurzel בטח „vertrauen“ vorliegt. Sicher ist, dass Nabû von den Schreibern in Ugarit verehrt wurde. Vgl. Millard, Nabû, 607. Er wurde in transformierter Form noch von den altsyrischen Kirchenvätern mit der Schreibkunst in Verbindung gebracht. Vgl. Pomponio, Nabû, 22.
86 Dafür spricht, dass nach Philo von Byblos dem Gott Thot durch El als Herrschaftsbereich das Land Ägypten zugeteilt worden sei. Weiterhin kommt es ja zu einer Identifikation zwischen Thot und Hermes im Hellenismus, die sicher auch von den Phöniziern vermittelt worden ist. Vgl. dazu Mussies, Interpretatio Judaica, 92f. Bei Philo von Alexandria werden zudem Thot und Mose einander angenähert.
87 Vgl. Vos, Thot, 863. 88 Vgl. Kurth, Thot, 507. 89 Vgl. Schott, Thot als Verfasser, 20. 90 Vgl. Bertholet, Macht der Schrift, 9; Stadler, Weiser, 25f.76f.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 197
wird, bildet sich in der Spätzeit allmählich die Vorstellung heraus, dass er Verfasser des ganzen Totenbuches und weiterer Texte gewesen ist.91 Abhängig ist dies möglicherweise davon, dass Thot insgesamt im Totenbuch eine prominente Rolle spielt. So wird das Toten-buch mit einer Selbstvorstellung Thots an Osiris eröffnet. Zudem wird Thot in einigen Totenbuchkapiteln ausdrücklich als Verfasser erwähnt.
Als Beispiel sei auf Spruch 182 verwiesen.92 Dort heißt es zunächst: „Schriftrolle, Osiris dauern (zu lassen), dem ‚Herzensmatten‘ Atem zu geben mit Hilfe des Thot und die Feinde des Osiris zu vertreiben, wenn er dorthin (ins Jenseits) gelangt ist in seinen Erschei-nungsformen. Schutz, Hilfe und Unterstützung (zu geben) im Totenreich. Thot selber hat (das Buch) angefertigt, damit das Sonnenlicht auf ihm (Thot) ruhe, Tag für Tag.“93 Danach stellt sich freilich der Verstorbene als Thot94 vor: „Ich bin Thot, der tüchtige Schreiber mit reinen Händen, Herr des Doppelhornes, der Böses (ablehnt) und (nur) Maat schreibt, dessen Abscheu Unrecht ist, dessen Schreibbinse den Allherrn schützt, ein Herr der Gesetze, der (so) spricht, daß seine Worte die Beiden Ufer in Ordnung bringen.“95 Thot wird offenbar genutzt, um die besondere Wirksamkeit und Autorität insbesondere bei der Identifikation des Verstorbenen mit der Gottheit zu unterstreichen.96
Eine wichtige Rolle spielte die inhaltliche Kompetenz Thots im Totengericht, die die Zuschreibungen unterstützt hat.97 Er kann aber auch quasi als Sekretär Urheber von Texten sein, für die er nicht inhaltlich verantwortlich ist, wenn er „z.B. einen Schöpfungsbericht entsprechend der Schöpferworte aufschreibt und so die Inhalte nicht selbst determiniert, sondern reproduziert.“98 Dabei wird die Schriftlichkeit besonders betont, und so kommt Thot, dem Schreiber, eine wichtige Rolle bei der Realisierung der Schöpfung zu: „Die Schöpfungslehre von Memphis betont die Schriftförmigkeit der Welt. Sie deutet die Welt als einen Text, den Ptah im Herzen erdacht und vermittelst der Zunge ausgesprochen hat, woraufhin er sich in der sichtbaren Wirklichkeit in Gestalt der Dinge realisiert hat, die den Hieroglyphen entsprechen.“99 Spannend im Vergleich mit den Vorstellungen des Penta-teuchs ist, dass bei besonderen Texten betont wird, dass Thot sie mit seinen eigenen Fingern verfasst habe, obwohl in diesen Texten selbst keine Zuweisung erkennbar ist.100
91 Vgl. Schott, Thot als Verfasser, 24. 92 Weitere Beispiele: Stadler, Weiser, 77. 93 Hornung, Totenbuch, 390. 94 Vgl. dazu Hornung, Totenbuch, 414. 95 Hornung, Totenbuch, 390. 96 Vgl. Stadler, Weiser, 76. 97 Vgl. Stadler, Weiser, 77. 98 Stadler, Weiser, 79. 99 Assmann, Theologie und Weisheit, 30. 100 Vgl. Schott, Thot als Verfasser, 24. Die Vorstellung ist auch in anderen magischen Zusammenhängen
anzutreffen wie bspw. in Totenbuch 16 und 115. Vgl. Hornung, Totenbuch, 65. Dadurch ergibt sich nochmals eine verstärkte Beziehung zum biblischen Gebrauch der Formulierung. Denn vom µyhla [bxa ist beispielsweise auch in Ex 8,15 in Bezug auf die Plage an den Ägyptern die Rede. Zur biblischen Vorstellung vgl. Maier, Finger, 240. Signifikanterweise sind es in Ex 8,15 die ägyptischen Magier, die den Begriff im Munde führen, während es der Finger Jhwhs ist, der in Ps 8,4 den Himmel und die Gestirne geschaffen hat.
Raik Heckl 198
Für den möglichen kulturübergreifenden Zusammenhang der Fragestellung ist Philo von Byblos wichtig. Nach diesem hat Sanchuniathon, auf dessen Werk er für seine Geschichte Ägyptens zurückgreift, die Schriften des Thot, des Erfinders der Schrift, verwendet.101
Obwohl dieses phönizische Vermittlungskonzept an das Konzept der mosaischen Vermittlung der Tora erinnert und ein Einfluss der ägyptischen Religion in diesem Punkt auf Israel naheliegt, findet sich kein eindeutiger Hinweis auf eine besondere Schreiber-gottheit in Israel.102 Jhwh als „Nationalgottheit“ und später allein verehrter Gott hat die Funktion des Schreibers selbst übernommen.
Seit einer Arbeit von L. Koep zur „altchristlichen Bildersprache“ vom „himmlischen Buch“, das eine religionsgeschichtliche Einführung zum Thema im Alten Testament ent-hält, unterscheidet man in der Bibel die Vorstellung eines Schicksalsbuches (Ps 139,16), eines Buches der Werke (Mal 3,16) sowie eines Buches des Lebens (Ex 32,32).103 Koep verband die ersten beiden Konzepte mit Mesopotamien und Ägypten104 und sah im „Buch des Lebens“ eine eigene israelitische Entwicklung.105
In die Reflexion bezog Koep allerdings die konkreten Texte, die mehr oder minder göttlichen Ursprungs sein sollen, bewusst nicht mit ein. Er beschränkte seine Untersuchung auf „Metaphern in dem strengeren Sinne“ und bearbeitete in ihr nicht die Vorstellung des heiligen Buches, „das zwar im Himmel entstanden, von göttlicher Hand geschrieben sein will, aber dann doch als religiöse Urkunde und Lehrinstrument in die Hand der Menschen gelangt“.106 Die Behandlung des Themas nur als Metapher, losgelöst von den ganz kon-kreten Vorstellungen von göttlichen Schriften im Alten Israel verzerrt aber das Bild.107 Da in der Hebräischen Bibel nicht nur der Dekalog auf Gott zurückgeführt wird, sondern bspw. auch in Hos 8,12 ein damit verwandtes Konzept vorliegt und in Ex 32,32 der Pentateuch oder seine Vorstufen mit einem von Gott verfassten Text in Verbindung gebracht wird, kann man das Thema „Gott als Schreiber“ nicht losgelöst von den konkreten Textbezügen betrachten. Es ist stattdessen davon auszugehen, dass wie in Ägypten eine Wechsel-beziehung zwischen der Vorstellung Gottes als Schreiber und der Beurteilung religiöser Texte existiert hat.108 Auch die Zuschreibungen von Teilen des Totenbuches in Ägypten, der Verweis des Philo von Byblos auf die Verwendung der Schriften des Thot bei der
101 Siehe Eusebius PE 1.9.24. Vgl. dazu Attridge / Oden, Philo, 3f. Text von PE 1.9.24 ebd., 28f. 102 In Mal 3,16 ist von einem Buch der Werke die Rede, das vor Gott geschrieben wird. Möglicherweise
ist mit dieser Formulierung an eine Gestalt im himmlischen Thronrat gedacht, die das Schreiben über- nimmt. Der Thronrat legt sich nahe, da ja in Mal 3,1 vom מלאך הברית die Rede ist. Außerdem wird im Buch das Ephiteton צבאות verwendet.
103 Vgl. Lange, Weisheit, 70f., der dabei Koep, Buch, 37f. rezipiert. 104 Vgl. Koep, Buch, 37. Er überlegt, ob „der Schicksalsbuch-Gedanke im babylonischen Neujahrsritus“
(ebd.) die Rezeption der Vorstellung im AT und im Judentum beeinflusst hat. 105 Vgl. ebd., 38f. 106 Koep, Buch, 1f. 107 Ähnlich verfährt Koep, Buch, 37 auch mit den altorientalischen und ägyptischen Parallelen. So zieht
er für den Zusammenhang mit der Einschreibung der Toten durch den Gott Thot nicht die besondere Beziehung Thots zum Totenbuch heran.
108 Nach Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 125 haben erst die dtr Redaktoren, die den Dekalog einfügten, das Konzept geschaffen. Dies ist m.E. traditionsgeschichtlich dahingehend zu korrigieren, dass sie suchten, das traditionelle Konzept Jhwhs als eines Schreibers auf den Dekalog zu beschränken und es sich für den eigenen Text sc. das dtr Deuteronomium zunutze zu machen.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 199
Abfassung des Werkes des Sanchuniathon lassen komplexe hermeneutische Prozesse erkennen, die den göttlichen Ursprung klassischer religiöser Texte betreffen. Solchen Pro-zessen muss entsprechend auch die Analyse der entsprechenden Texte des Pentateuchs nachgehen.
4. Mose als Mittler des Gotteswillens
4.1. Mose als Übermittler von Weisungen in priesterlichen Texten In den priesterlichen Texten des Pentateuchs fungiert Mose über weite Strecken ganz schematisch als Mittler des Gotteswillens an die Priesterschaft und an das Volk. Es ist ein Grundcharakteristikum priesterlicher Texte in den Büchern Exodus bis Numeri, dass Jhwh von Mose die Weitergabe von Handlungsanweisungen oder Vorschriften fordert. Die ent-sprechende Formulierung hçm la hwhy rbdyw mit der anschließenden an Mose109 gerichteten Aufforderung, eine Rede bzw. einen Befehl weiterzugeben (larçy ynb la rbd), findet sich zwischen Ex 14,1f. und dem Ende des Numeribuches,110 besonders häufig im Levitikus- und Numeribuch. Während diese Redeeinleitung von J. C. Gertz im Exodusbuch als „typisch für priesterschriftlichen Sprachgebrauch“111 angesehen wird und damit als eines der sprachlichen Anhaltspunkte für die Priestergrundschrift gilt, hält R. Achenbach sie für ein Mittel „zur Strukturierung und Abgrenzung der Perikopen in der Sinaierzählung“112 und damit für ein spätes redaktionelles Element. Dieses in priesterschriftlichen Texten und nachpriesterlichen Redaktionen vorkommende Element ist nicht notwendig ein Problem für die Annahme einer eigenständigen Priestergrundschrift.113 Der breite Gebrauch der Formel zeigt aber, dass in der persischen Zeit übergreifend in priesterlich geprägten Texten eine ganz bestimmte mit Mose verbundene Hermeneutik entwickelt und genutzt wurde, um die Texte der Bücher Exodus bis Numeri zu strukturieren und Inhalte zu vermitteln.
M.E. spricht einiges dafür, dass die in Ex 4,13ff. ausformulierte Rolle des Mose mit der signifikanten Redeeinleitung im Zusammenhang steht.114 Die Formulierung µyhlal wl hyht htaw hpl ˚l hyhy awh hyhw wurde entsprechend auf die Vermittlung bezogen. Mose wird an dieser Stelle als Gott für Aaron bezeichnet, womit er offenbar als Ursprung der Inhalte gedacht ist, während Aaron eine sekundäre Rolle zugewiesen wird. Die Konzeption mag auf der einen Seite in der vorpriesterlichen Berufung des Mose gegründet sein, doch kann sie auch nicht unabhängig von den ebenfalls vorpriesterlichen Vermittlungskonzepten des Deuteronomiums gesehen werden. Ein prophetischer Einfluss ist in dem priesterlichen
109 Mitunter ist sie auch an Mose und Aaron gerichtet. So bereits Ex 6,13 und danach Lev 11,1; 13,1;
14,33 u.ö. 110 Die ersten verwandten Formulierungen finden sich schon in Ex 6,10.13.29; 13,1. 111 Gertz, Tradition, 65. 112 Achenbach, Vollendung, 463. 113 Allerdings finden sich parallel zum Schematismus der Ortsangaben ähnlich stereotype
Datums- und Altersangaben. Die formalen Übereinstimmungen in den Büchern Ex–Num sprechen m.E. am ehesten dafür, dass die priesterliche Bearbeitung zwar sukzessive, aber grundsätzlich nach denselben Prinzipien geschehen ist.
114 Ex 4,13ff. dürfte ihrerseits das nichtpriesterliche Berufungskonzept ausformuliert haben. Vgl. Blum, Studien, 362.
Raik Heckl 200
Konzept, wie es im Deuteronomium vorhanden ist, greifbar, wo Mose implizit in seinen Reden und explizit in seiner Figuration als Prophet erkennbar ist.115 Da schon das Deutero-nomium die Prophetie deutlich von der Gestalt des Mose her interpretiert und ihr Beschrän-kungen auferlegt,116 dürfte in den priesterlichen Texten eine bestimmte Sicht der prophe-tischen Traditionen der deuteronomistischen Geschichtsbücher vorliegen.
Das priesterliche Vermittlungskonzept, das ausgehend von Ex 4,15 die Bücher Exodus bis Numeri prägt, spiegelt das Selbstverständnis der Priesterschaft am Zweiten Tempel wider. Das erklärt, dass eine ganze Reihe von Vorschriften im Levitikus- und Numeribuch über Mose direkt an Aaron bzw. später an Eleasar gerichtet sind (vgl. z.B. Lev 16,1f.; 22,17f.; Num 6,22f.; 17,1f.). E. Otto hat entsprechend den Ursprung einer mündlichen Tradition der Sinaitora gesehen, die „mündlich in der priesterlichen Sukzession tradiert“117 wurde. In der Konzeption des abgeschlossenen Pentateuchs ist das Deuteronomium eine erste verschriftlichte Form der Auslegung der Sinaitora.118 Als Auslegung wird damit der vorläufige Charakter des Deuteronomiums unterstrichen und nach Otto zugleich pragma-tisch den „protorabbinischen Schriftgelehrten der nachexilischen Zeit […] ein ein-drückliches Denkmal gesetzt“.119
4.2. Die Rolle von Mose im Deuteronomium Nach J. Schaper ist das Deuteronomium Ursprung und Zeugnis einer neuen Form der Kommunikation religiöser Inhalte: „Offenbarung war nun ohne eine schriftliche Niederlegung derselben nicht mehr möglich – vgl. Dtn 5–26! – und ist später gar nicht mehr ohne ihre ‚Publikation‘ als Buch und öffentliche Inschrift denkbar; vgl. Dtn 31,24 und 27,3.8.“120 Nach Schaper steht im Hintergrund eine radikale Veränderung in der theologischen Kultur durch das Deuteronomium und die Josianische Reform: „Im Deutero-nomium wird dem Schreiben zentrale Bedeutung zugesprochen; in der Kommunikation zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre hat es eine Schlüsselstellung inne – es ist im eigentlichsten Sinne des Wortes ein Medium zwischen Gott und Mensch.“121 „Der Zusammenhang von Schreiben und Reform ist unauflöslich.“122 Schaper geht allerdings noch weiter und spricht in Anschluss und partieller Kritik einer These von Assmann123 im
115 Schmitt, Geschichtsverständnis, 217 nimmt an, dass sich die priesterliche Schicht „als Wahrerin
prophetischer Tradition verstand“. Dies macht er an der Beobachtung in Ex 14 fest, dass sowohl der priesterliche als auch der nachpriesterliche Text mit Mose prophetische Vorstellungen verbindet. Vgl. Schmitt, Geschichtsverständnis, 212. Davon ausgehend sieht er übergreifende Themen in Tetrateuch und DtrG, die besonders prophetisch geprägt gewesen seien und nimmt an, dass der Pentateuch mit den vorderen Propheten „kanonischen Charakter erhalten“ (Schmitt, Geschichtswerk, 293) habe.
116 Siehe Dtn 34,10 und dazu Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 229f. 117 Otto, Gesetz des Mose, 72. In dem Abschnitt sind die Thesen zusammengefasst. Zur Frage des münd-
lichen Charakters siehe unten, 212 mit Anm. 180 und die Zusammenfassung. 118 Siehe dazu zuletzt Otto, Deuteronomium 1–11, 203. 119 Otto, Deuteronomium 1–11, 204. 120 Schaper, Tora als Text, 58. 121 Schaper, Scriptural turn, 285. 122 Ebd. 123 Nach J. Assmann geht mit dem Übergang von der primären zur sekundären Religion eine „Wende
vom Ritual zum Text“ (Assmann, Mosaische Unterscheidung, 145) einher. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Ikonoklamus und der Herausbildung bei der Entstehung des
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 201
Deuteronomium von „einer Textualisierung des Offenbarungsgeschehens im antiken Juda“.124 S. E. „steht das Deuteronomium am Anfang jener Entwicklung hin zur ‚Buchre-ligion‘, die mit der Durchsetzung des Monotheismus Hand in Hand ging.“125
Aus mehreren Gründen ist bei diesem Sachverhalt Vorsicht geboten: 1. Der Verweis aus dem Buch selbst auf dessen Verschriftlichung, der Verweis auf das
den intendierten Adressaten vorliegende Buch, spricht gerade nicht dafür, dass „Offenbarung […] ohne eine schriftliche Niederlegung derselben nicht mehr möglich“ war. Zunächst einmal spricht das Faktum des existierenden Textes für dessen Bedeutung selbst. Mit anderen Worten ist nicht nur im Deuteronomium, sondern in allen Bereichen der Traditionsliteratur eine besondere Bedeutung des Schreibens vorausgesetzt. Die Abfassung des Deuteronomiums ist fest eingebunden in eine Jahrhunderte alte Geschichte der Schriftkultur. Schriftlichkeit gehörte sicher wie in den Nachbarkulturen ganz selbstverständlich zu verschiedenen Bereichen der Religion. Zudem setzt das Deuteronomium wie nahezu alle anderen atl. Texte die Existenz literarischer Vorstufen voraus.126 Beim Gesetzeskorpus ist man sich einig, dass es auf dem Bundesbuch fußt.127 Es kann also in den von Schaper angeführten Stellen gar nicht darum gehen, dass Offenbarung seit dem Deuteronomium nur noch schriftlich gedacht werden konnte. Vielmehr wird auf
Monotheismus: „Dem prophetischen Monotheismus mangelt es an natürlicher Evidenz; er wandelt, wie Paulus sagt, nicht in der Schau, sondern im Glauben. Der Glaube stützt sich auf die Schrift, auf den verbrieften Bund und das Gesetz. Der Kult stützt sich auf den Akt, den Vollzug, die Schau. Die Schrift führte zu einer Entritualisierung und Enttheatralisierung der Religion“ (ebd., 152). Schaper, Scriptural turn, 289 sieht zwar demgegenüber lediglich einen Einfluss der wachsenden Bedeutung des Schreibens auf die Theologie: „Von einem ‚scriptural turn‘ im Sinne Assmanns, also einem direkten Zusammenhang zwischen der zunehmenden Bedeutung des Schreibens und dem Durchbruch des Monotheismus, kann also sicherlich keine Rede sein. Wohl aber hatten die wachsende gesell- schaftliche Bedeutung des Schreibens, der (Materialität der) Schrift und der Schreibertätigkeit sowie der Zusammenhang zwischen Schreiben und Reform einen bemerkenswerten Einfluss auf die Ent- wicklung des Gottesbildes in der JHWH-Religion.“ Schaper scheint dabei Assmanns Unterscheidung von depositiver und performativer Funktion von Schriftlichkeit (vgl. Assmann, Verschriftung, 62) zu rezipieren. Für Assmann ist das Deuteronomium und die Tora im zweiten Sinne eine Art perfor- mativer Rechtsinschrift, die wie im antiken Griechenland uneingeschränkte Gültigkeit aufgrund der Form schriftlicher Veröffentlichung trägt: „Es handelt sich [bei den biblischen Gesetztestexten, R.H.] nicht um Wissensliteratur, die das Gedächtnis der Rechtspfleger entlasten soll, sondern ganz ein- deutig um performative Schriftlichkeit, die als absolut verbindliche Grundlage aller künftigen Rechts- praxis gedacht ist“ (ebd., 65), vgl. ders., Kanon, 16f, wo Assmann den Sachverhalt mit der Reform des Josia verbindet. Die Pragmatik der auch von Assmann reflektierten Vermittlungssituation (vgl. Assmann, Verschriftung, 75), widerspricht aber diesen Schlussfolgerungen. Denn der Befehl des Mose, seine Worte aufzuzeichnen soll dem Text offenbar Autorität zuweisen, die er ohne die Ver- mittlung durch Mose als Sprecher / Schreiber nicht gehabt hätte.
124 Schaper, Scriptural turn, 291. An anderer Stelle formuliert Schaper: „What does all this tell us about Deuteronomy’s concept of God? First and foremost, Deuteronomy depicts God as a scribe.“ (Schaper, Theology of Writing, 110) Doch ist der einzige Text, den Gott im Deuteronomium schreibt, eben der Dekalog. Das Konzept seiner Herkunft direkt von Gott wird vom Deuteronomium nur auf- gegriffen und genutzt, um die Autorität des Mose und der von ihm vermittelten Inhalte (vgl. Dtn 5,31) zu unterstreichen.
125 Schaper, Scriptural turn, 291. 126 Dafür spricht bereits der Gebrauch der Kanonformel in Dtn 4,2; 13,1. 127 Vgl. dazu im Einzelnen Otto, Das Deuteronomium, 250ff.
Raik Heckl 202
das vorliegende Buch verwiesen und seine Abfassung betont, um seine Bedeutung insbesondere im Vergleich zu anderen Texten hervorzuheben. Da das Deuteronomium eine ausgeprägte Literargeschichte hat, hat man mit den Referenzen die Autorität der neuen Fassung des Buches gegenüber jener der Vorstufen und weiterer Literatur hervorgehoben.
2. Ebenfalls zu bezweifeln ist der enge Zusammenhang zwischen der Josianischen Reform und dem Schreiben, den Schaper in Anschluss an Assmann128 sieht. Es handelt sich m.E. um einen Zirkelschluss, wenn man beides ursächlich verbindet. Der Zusammenhang zwischen Dtn 31 und 2Kön 22 trägt ätiologischen Charakter, indem er die Notwendigkeit des Exils erklärt. In jedem Fall sind die Anfertigung und Ablage des Buches bei der Bundeslade (Dtn 31,9.24) und dessen Auffindung literarisch aufeinander bezogen. Die Auf-findungsgeschichte lässt das Deuteronomium erst als altes Buch erscheinen. Beides unter-streicht seine besondere Autorität im exilisch / nachexilischen Israel. Ob es von Anfang an einen Zusammenhang zwischen Reform und Deuteronomium gegeben hat und wie dieser ausgesehen hat, darüber sagt das Gegenüber von Dtn 31 und 2Kön 22 nichts.
Unbestreitbar ist allerdings, dass das dtr Deuteronomium wohl der erste autoritative Text des entstehenden Judentums war.129 Seine literarische Geschichte unterstreicht seine Bedeutung ebenso wie die Verwendung der sog. Kanonformel, die seinen Wortlaut zu sichern sucht.130 Als Text, der verinnerlicht werden und gelesen werden sollte,131 war es ge-richtet auf Akzeptanz und Identifikation bei seinen intendierten Adressaten. Es stellt sich die Frage, worin seine Autorität eigentlich begründet liegt. Die materielle Existenz des Deuteronomiums als Buch wird nur in relativ wenigen und primär späten Abschnitten des Rahmens132 thematisiert. Demgegenüber wird die Autorität der Inhalte des Buches Deutero-nomium durchgängig mit der Gestalt des Mose begründet.133 Mose ist Erzähler und Verkünder von Gesetzen. Und selbst in den wenigen unpersönlich formulierten Erzählab-schnitten verweist man auf das Buch als Zusammenstellung der „Reden, die Mose rede-te“.134 Die Zwischenüberschriften führen jeden Teil wiederum als Moserede ein, oder sie leiten auf der Ebene des sprechenden Mose zu einem weiteren Abschnitt seiner Rede über.
Die allenthalben anzutreffende Paränese dient ebenso wie die Formulierung als Moserede an das Volk dazu, den intendierten Adressaten die Inhalte nahe zu bringen, die sich von dem abheben, was rezipiert wird, seien es der Gesetzestext des Bundesbuches oder
128 Assmann, Mosaische Unterscheidung, 51 bringt die Entstehung der Tora mit der Reform des Josia in
Verbindung. Auf sie führt er auch die Entwicklung ihrer Kanonizität zurück. Vgl. Assmann, Kanon, 16.
129 Vgl. Veijola, Deuteronomium, 5f. Als solches wirkte das Deuteronomium von seinen vorexilischen Vorstufen ausgehend vor allem im Exil. Vgl. dazu Otto, Deuteronomium 1–11, 238ff.
130 So Otto, Deuteronomium 1–11, 539; vgl. auch Schaper, Tora als Text, 59; van der Toorn, Scribal Culture, 145.
131 Vgl. oben, 188. 132 Dort wo vom ספר die Rede ist, befinden wir uns in der Regel in spätdeuteronomistischen Ab-
schnitten. Anders verhält es sich in den Paränesen Dtn 6 und 11, in denen Mose die Verinnerlichung seiner Reden fordert. Doch wie auch die Ätiologie in Dtn 27 vermeiden diese Stellen den Anachro- nismus einer Rede vom Buch noch.
133 Dies habe ich im ersten Teil meines Beitrages Heckl, Augenzeugenschaft, 360–362 dargestellt. 134 Zur Begründung der Wiedergabe vgl. Heckl, Moses Vermächtnis, 50. Otto, Deuteronomium 1–11,
311, verweist darauf, dass schon Buber in Anschluss an die jüdische Auslegung darunter „eine Sammlung von Mosereden“ verstand.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 203
die Erzähltexte.135 Das Buch lebt also von der Fiktion der Mündlichkeit, wovon auch noch die älteren Referenzen auf den Bestand des Deuteronomiums in Dtn 6; 11 und 27 für seine ‚Verinnerlichung‘ zeugen, da zunächst mit einer mündlichen Vermittlung gerechnet wird und der Text allenthalben als Gedächtnisstütze dient.
Die Figur des sprechenden Mose soll also den Inhalten des Buches Autorität verleihen. Deshalb wird die Autorität des Mose immer wieder mit Verweisen auf den Aufenthalt des Volkes am Horeb begründet. So rückt in Dtn 1–3 beispielsweise Mose erst in die Vermitt-lerrolle, weil aufgrund des Ungehorsams des Volkes die direkte Kommunikation zwischen Volk und Gott abreißt,136 während Dtn 5,24f. und das Prophetengesetz in Dtn 18,16 darauf verweisen, dass das Volk nach der Verkündigung des Dekalogs Mose am Horeb erst zu seiner Rolle gedrängt hat.137 Diese Stellen begründen die prophetische Vermittlerrolle des Mose. Und so atmet das Buch – explizit entfaltet in Dtn 18,18 und 34,10 – aufgrund seines durchgehenden Charakters als Moserede von Anfang an und bereits in seinen ältesten Schichten138 den Geist eines prophetischen Buches.
Demgegenüber ist das Schreiben im Deuteronomium nur am Rande und in den Rahmenteilen präsent. Außerdem ist es eine deutlich zusätzliche und spätere Vorstellung, die ihren Kern in Dtn 31 hat, einem der Texte, die vom Schreiben des Mose sprechen, der aber gerade nicht mehr zum eigentlichen Kern des Deuteronomiums gehört und weder dem dtn noch dem dtr Bestand des Buches zugeschrieben werden kann.139
Von einer Theologie des Schreibens ist im Deuteronomium daher eher nicht zu sprechen, und auch das Gottesbild hat sich nicht mittelbar durch das Schreiben verändert. Als grundlegendes Kulturgut spielte es in der Religion spätestens seit der ersten Entstehung von religiösen Texten und deren Gebrauch eine Rolle.140 Zudem ist zu beachten, dass Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Antike aufeinander bezogen waren.141 Die Religion
135 Vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 360–362. Ähnlich auch Arnold, Ipsissima Vox, 68f.: „Along these
lines, Deuteronomy’s use of the speech of Moses, presented as his valedictory addresses, gives ‚voice‘ to the revising and updating of previous legal tradition.“
136 Vgl. Heckl, Moses Vermächtnis, 362f. 137 Dtn 4,15 begründet das von Mose vorgetragene Bilderverbot mit der Tatsache, dass das Volk am
Horeb keine תמונה gesehen hat. In Dtn 9,8ff. wird auf den Horeb verwiesen, um Moses Rolle als Fürbitter zu begründen (Dtn 9,18f.).
138 Nach Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 193–196 ist es das nachexilische Deuteronomium, das in Blick auf die Prophetenbücher diesen Aspekt entworfen hat. M.E. haben die letzten Autoren am Deuteronomium diesen Aspekt nur verstärkt. Es war im Buch ab der literarischen Stufe, auf der Mose als Sprecher erscheint, gegeben. Reuter, Konzepte, legt noch einmal umfassend dar, dass „für den autoritativen Sprecher der Frühzeit [im Urdeuteronomium] [...] nur Mose“ (ebd., 79) infrage kommt. Vgl. auch Chapman, Law, 146f.: „Deut 34:10–12 functions primarily to describe Moses as a prophet, and thus complete the book of Deuteronomy and the Torah.“
139 Chapman, Law, 165 sieht die Kapitel als nachdtr und nur wenig älter oder gleichzeitig mit dem Abschluss des Pentateuch an. Vgl. weiter Heckl, Augenzeugenschaft, 364–367.371f., und unten, 219ff.
140 M.E. ist eher die Tendenz erkennbar, die Schriftlichkeit der direkten Gottesoffenbarung auf das Minimum des Dekalogs zu begrenzen. Durch Mose im Pentateuch und durch andere Propheten in den Prophetenbüchern ist vermittelte mündliche Offenbarung in der Hebräischen Bibel bestimmend. Das „Konzept des Schriftverständnisses in der Hebräischen Bibel, das auf der Tora fußt, [ist] prophetisch geprägt“ (Heckl, Schriftverständnis, 219).
141 Siehe zusammenfassend Carr, Mündlich-schriftliche Bildung, und die Übersicht über die
Raik Heckl 204
des Buches entsteht erst dadurch, dass sich allmählich bestimmte Texte als autoritativ durchsetzten und später den kanonischen Bestand der jüdischen religiösen Literatur bildeten. Das Deuteronomium wurde als solches zwar zuerst akzeptiert, was man an den literarischen Querbeziehungen mit den dtr Geschichtsbüchern sehen kann, doch hing dies von der Autorität des prophetischen Mose ab.
5. Mose als Schreiber des Gottes Israels
An vier der betreffenden Textstellen (Ex 17,14; Ex 34,27; Num 33,2; Dtn 31,22) schreibt Mose auf Jhwhs Befehl hin bzw. soll er schreiben. Dies zeigt, dass Mose quasi institutionell als Schreiber des Gottes Israels gedacht ist. Dies ist er auch außerhalb des Pentateuchs an den Stellen, an denen vom Buch des Mose oder der Tora des Mose die Rede ist (vgl. z.B. Jos 23,6; 2Kön 23,25; Mal 3,2; Neh 13,1; 2 Chr 25,4; 35,12). Das Judentum der Zeit des Zweiten Tempels142 wie des Urchristentums sah Mose als Vermittler und Verfasser des Pentateuchs.143 Seit dem rabbinischen Judentum sieht man ihn außerdem als den Ursprung der mündlichen Tora, von Halacha und Aggada an. Trotz dieser breiten Wirkungs-geschichte erscheint er im Pentateuch nur sporadisch als Schreiber, wobei ihm auffälliger Weise anders als beispielsweise Esra nicht die Berufs- und Ehrenbezeichnung eines Schreibers (vgl. Esr 7,6.12.21; Neh 8,1 u.ö.) beigelegt wird. Um diese Textstellen und um ihre jeweiligen Kontexte geht es im Folgenden.
5.1. Ex 17,14 [wçwhy ynzab µyçw rpsb ˆwrkz taz btk hçm la hwhy rmayw
.µymçh tjtm qlm[ tkz ta hjma hjm yk Da sprach Jhwh zu Mose: „Schreib dies als Erinnerungszeichen in ein Buch. Und präge Josua ein,144 dass ich das Andenken Amaleks austilgen will unter dem Himmel. –
a Die masoretische Vokalisation spricht determiniert von „dem Buch“, während die LXX eine
indeterminierte Lesung bezeugt. Die Determination macht deutlich, dass es sich um ein ganz bestimmtes Buch handelt, in das Mose schreibt. Diese Vorstellung dürfte im Zusammenhang eines Midrasch stehen,145 so dass der von der LXX bezeugten Lesetradition der Vorzug zu gewähren ist. Das Nomen rps kann verschiedene Textformen bezeichnen. Die Wiedergabe mit „Buch“ hat
Forschung bei Schniedewind, Orality.
142 Nach Otto, Gesetz des Mose, 99 kam es dazu erst im 1. Jh. v. Chr. 143 Dies ist in rabbinischer Zeit bereits ein status confessionis, wenn die Sicht, Mose habe nur die
Zehn Gebote von Gott bekommen, in yBer 1,5,3c abgewiesen wird. Vgl. dazu Stemberger, Dekalog, 99–101. Die bekannte Traditionskette mit Ausgangspunkt bei Mose in mAb 1,1 zeigt dies ebenso. Anders als die christliche Tradition machten sich die Rabbinen allerdings Gedanken darüber, wie Mose realistischerweise Verfasser gewesen sein kann. Und so sehen sie in bBB 14b in den letzten Versen des Buches Deuteronomium einen Nachtrag von Josua und verstanden die Bileamperikope (Num 22–24) als eigenständigen Text des Mose.
144 Wörtlich: „lege in die Ohren Josuas“. 145 bMeg 7a setzt voraus, dass Mose den Abschnitt in seine Tora schreiben soll: hm – taz btk hrwt hnçmb
ˆak.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 205
tentativen Charakter. Die Pragmatik (s.u.) weist aber darauf, dass der den intendierten Adressaten vorliegende Text gemeint ist.146
Der Vers gehört zu dem größeren Kontext Ex 17,8–16. Er wird in der Regel für
sekundär gehalten.147 Enthalten sind eine an Mose gerichtete Jhwh-Rede mit zwei Aufforderungen (V. 14aβ.γ) und ein yk-Satz (V. 14b). Die erste Aufforderung betrifft das Aufschreiben: Der von Mose aufzuzeichnende Text soll als Erinnerungszeichens dienen.148 Er hat also eine vergleichbare Funktion wie Gegenstände und Handlungen im Exodusbuch, die ebenfalls als ˆwrkz bezeichnet werden.149 Das Demonstrativpronomen repräsentiert den Inhalt, der zum Gedächtnis aufgezeichnet werden soll. Es kann sich rein formal auf den vorangehenden oder nachfolgenden Kontext beziehen. Die zweite Aufforderung [wçwhy ynzab µycw enthält kein Objekt.150 Daher ist V. 14b dazu Objektsatz.
Houtman zieht die beiden Aufforderungen inhaltlich zusammen: „YHWH speaks to Moses, and instructs him to transmit the episode and YHWH’s assurance that Amalek will be annihilated root and branch to following generations, both in writing and orally, so that they will not fall into oblivion.“151 Houtman nimmt also an, dass taz in der ersten Aufforderung sich sowohl auf die Episode zurückbezieht, der Objektsatz aber mit Jhwhs Zusage nicht nur mündlich an Josua vermittelt werden soll, sondern ebenfalls zu der Aufzeichnung gehört.152 Syntaktisch wäre dies aber ungewöhnlich, da sich an ˆwrkz taz als Objekt des Satzes eigentlich höchstens ein Attributsatz mit rça anschließen könnte.153 Es ist also grammatisch wahrscheinlicher, dass taz sich (mit der zugehörigen Apposition ˆwrkz) zurückbezieht auf die vorangehende Geschichte,154 während Josua lediglich Jhwhs Zusage der Auslöschung der Erinnerung an Amalek mündlich mitgeteilt werden soll.
Was ist mit dem rps gemeint, in den Mose die Geschichte vom Kampf gegen Amalek schreiben soll? Der ˆrwkz-Begriff macht deutlich, dass es sich bei der Aufzeichnung in den rps um eine für die intendierten Adressaten wichtige Größe handelt. Wenn dem so ist, muss es sich auch um eine den Adressaten zugängliche Größe handeln. Es ist alternativ kaum vorstellbar, dass der antike Autor hier mit der Existenz eines fiktiven rps, in den von Mose geschrieben worden ist, oder auch mit der unabhängigen Existenz der Geschichte argumen-tiert.155 Ähnlich wie bei den Zuschreibungsnotizen im Totenbuch, die sich problemlos auf
146 Hier und bei den folgenden Textabschnitten können nur für die Analyse notwendige textkritische
Probleme erörtert werden. 147 Vgl. Schmitt, Sieg, 158f. (dort Literatur). Schmitt, ebd., 159 überlegt im Anschluss an Zenger, ob der
Pentateuchredaktor in größerem Umfang tätig gewesen ist. Vgl. auch Levin, Jahwist, 358. Berner, Exoduserzählung, 132, sieht die Geschichte insgesamt als sehr spät und als Reaktion auf Num 20 an.
148 Die Verbindung zu Est 6,1 und Mal 3,16 und die von Ges18, 302, entsprechend vorge- schlagene Wiedergabe mit „Bericht“ rückt den Gedächtnischarakter in den Hintergrund.
149 Vgl. Ex 28,12 (// 39,7); 28,29; Lev 23,24 u.ö. 150 Der כי-Satz holt als Objektsatz die Leerstelle des Satzes nach. 151 Houtman, Exodus II, 371. 152 So auch zuletzt MacDonald, Anticipations, 16. 153 Vgl. dazu Gesenius / Kautzsch, Grammatik, §§ 155.157, 508–512.514f. 154 So interpretiert auch die jüdische Tradition das Demonstrativpronomen זאת. Vgl. dazu Jacob, Exodus,
497. 155 Ein solches Konzept hat Sonnet, Book within für das Dtn entwickelt. Zur Kritik vgl. oben Anm. 49.
Ähnlich unterscheidet auch Dohmen, Ursprung, 261: „Das Buch ist formal natürlich nicht die Tora,
Raik Heckl 206
Textstellen beziehen, an denen der Gott Thot selbst handelt, repräsentiert das Buch, welches von den intendierten Adressaten gelesen wird, jenes Buch, in das Mose einen Abschnitt einschreibt. Aufgrund dieser Überlegungen kann man die Abfassungsnotiz in V. 14aβ nicht nur mit den Verschriftungsnotizen im ägyptischen Totenbuch, sondern auch mit den Abfassungsnotizen pseudepigrapher Schriften vergleichen, mit dem Unterschied, dass in Ex 17 nicht ein Gesamttext auf Mose zurückgeführt wird, sondern lediglich ein Passus daraus. Welchen Charakter und Ursprung der rps, also der Gesamttext wohl des Buches Exodus oder seiner Vorstufen, hat, darüber ist der Verschriftungsnotiz in Ex 17,14 nichts zu entnehmen.
Daraus resultiert, dass es sich um zwei Aufforderungen handelt: die Aufforderung, die Erzählung über die Auseinandersetzung mit Amalek aufzuschreiben und die Aufforderung, Josua über die Absicht Jhwhs zu belehren. Schriftlich aufzuzeichnender Inhalt und münd-lich weiterzugebender Inhalt stehen im Kontrast zueinander. Der schriftliche Inhalt betrifft das vergangene Geschehen der Erzählung, während die Zusage sich in V. 14aγb auf künftiges Geschehen richtet.156
Bei diesem Gegenüber stellt sich die Frage, was mit der Aufforderung in Blick genommen wird. Josua und die Amalekiter haben im Pentateuch nichts mehr miteinander zu tun. Jenes Volk wird in der Kundschaftergeschichte in Num 13,29 und in den Bileam-sprüchen Num 24,20 erwähnt. An der zuletzt genannten Stelle wird noch einmal dessen Vernichtung angekündigt. Und auch im Josuabuch sucht man die Amalekiter nach dem an Josua gerichteten Befehl (Ex 17,14) vergeblich.
Sie tauchen allerdings in Dtn 25,17–19 mit Bezug auf dasselbe Ereignis wie Ex 17,8ff. auf. Der Abschnitt enthält erstens die Aufforderung, zu erinnern, dass die Amalekiter Israel auf dem Weg aus Ägypten hinterrücks überfielen (Dtn 25,17f.), und zweitens den Befehl, später nach der Landnahme die Erinnerung an die Amalekiter auszulöschen (Dtn 25,19). Die Entsprechungen der Phraseologie zwischen rwkz (Dtn 27,17), µymçh tjtm qlm[ rkz ta hjmt (Dtn 25,19a) und ta hjma hjm µymçh tjtm qlm[ rkz (Ex 17,14b) zeigen, dass dies eine intendierte literarische Querbeziehung ist.157
Entsprechend sind die Differenzen besonders zu beachten. Erstens fällt auf, dass nach Ex 17,14 Jhwh zwar das Andenken an Amalek austilgen will, während das Deuteronomium in Dtn 25,19 dies von den Israeliten nach der Landnahme fordert.158 Der Unterschied liegt auf einer Ebene mit der Zusage Jhwhs, die Landbevölkerung zu vertreiben und der an die Israeliten gerichteten Aufforderung, dies zu tun.159 Die Willenskundgabe Jhwhs kann daher auf eine Aufforderung im Sinne von Dtn 25,19 zielen. Zweitens wird Mose in Ex 17,14aβb befohlen, Josua den Inhalt einzuprägen. Allerdings richtet sich Dtn 25,19 nicht aus-schließlich an Josua, sondern an das Volk insgesamt. Da sich Dtn 25,19 auf 1Sam 14f.
aber intentional ist mit diesem Buch nichts anders als die Tora gemeint.“ M.E. unterscheiden die Autoren der Stelle nicht zwischen „formal“ und „intentional“.
156 Gegen Houtman, Exodus II, 386, der annimmt, es gehe beide Male um Jhwhs Ankündigung „transmitted in written form as well as orally“.
157 So auch van Seters, Life of Moses, 203. 158 Dies ist offensichtlich auf die Zusammenhänge in 1Sam 15 bezogen. 159 Als Paradebeispiel kann man auf Dtn 7,1f. verweisen. Dort wird in V. 1 angekündigt, dass Jhwh die
Völker des Landes schlagen wird, in V. 2 aber vorausgesetzt, dass das Volk diese Aufgabe selbst vollziehen muss.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 207
beziehen wird,160 ist die Aufforderung an Josua in Ex 17,14 erklärungsbedürftig. Man kann dies also damit erklären, dass Josua in Ex 17,14 stellvertretend für das Volk steht. Ähn-liches vollzieht sich in dem midraschartigen Nachtrag Jos 8,30–35. Dort wird von Josua berichtet, dass er einen Altar auf dem Ebal errichtet, was Mose in Dtn 27,4ff. dem Volk befohlen hatte.161
Die Aufforderung, Josua die Vernichtungsabsicht Jhwhs einzuprägen, kann nur auf den bereits im dtn Gesetz existierenden Passus hin geschrieben sein. Josuas Rolle bei der Land-nahme ist in Ex 17 noch nicht geklärt; dass er Nachfolger des Mose bei der Landnahme wird und das Volk repräsentieren kann, ist nur im Blick auf das Dtn erkennbar. Auch Jhwhs Willensbekundung zur Auslöschung der Erinnerung an Amalek und die Aufforderung in Dtn 25,19 kann man sich am ehesten so vorstellen, dass die Autoren in Ex 17,14 sich auf den bereits existierenden Passus in Dtn 25 theologisch systematisierend bezogen. Es liegt also wahrscheinlich ein Vorverweis auf Dtn 25 vor.
Während sich das Gegenüber Josua (Ex 17) – Volk (Dtn 25) und Jhwhs Auslö-schungsabsicht (Ex 17) – Auslöschungsbefehl (Dtn 25) von einer späteren systema-tisierenden Absicht von Ex 17 erklärt, fallen inhaltliche Diskrepanzen der Auseinan-dersetzung mit den Amalekitern stärker ins Gewicht. In Dtn 25,17f. ist ausschließlich davon die Rede, dass die Amalekiter die Israeliten auf dem Wege aus Ägypten überfallen hätten. Dtn 25 scheint also eine Erinnerung an ein Unheil zu sein und eine Niederlage der Israeliten im Blick zu haben. Dass in Ex 17 eine vergleichbare Situation im Hintergrund steht, lässt der eröffnende Vers Ex 17,8 erkennen, in dem allerdings nur allgemein erwähnt wird, dass die Amalekiter kamen und gegen Israel kämpften. Von einem hinterhältigen Angriff ist nicht expressis verbis die Rede. Stattdessen berichten die V. 9–13 von einem Kampf des Volkes unter Führung Josuas, der von Mose (unterstützt von Aaron und Hur) durch Hoch-halten seines Stabes begleitet wird. Am Ende kommt es bei dieser Konstellation zu einer entscheidenden Schwächung162 der Amalekiter.
Ex 17,8ff. berichtet also von einer eher siegreichen militärischen Auseinandersetzung, während Dtn 25 eine Niederlage erwähnt. Da offensichtlich in Ex 17,14 eine literarische Beziehung zu Dtn 25 hergestellt wird, ist diese Differenz der beiden Texte nicht nur dem Verfasser von Ex 17,14 bewusst gewesen. Der Verweis in Ex 17,14 signalisiert den inten-dierten Adressaten die Diskrepanz zwischen den beiden Kontexten geradezu.
Da Ex 17 wahrscheinlich auf die schon existierende Passage in Dtn 25 ausgerichtet wurde, zielt dieses Kapitel insgesamt darauf, die Informationen in Dtn 25 zu kontrastieren.
160 Siehe 1Sam 15,2f. 161 Vgl. zu dieser Verschiebung des Gewichts auf Josua Heckl, Kultstätte, 84. 162 Mit Jacob, Exodus, 495. Nach Ges18, 362; HAL, 311 unterscheidet man aufgrund des Akkadischen
zwei Wurzeln und schlägt für חלש I die Bedeutung „besiegen“ vor. Die nur in Hi 14,10 vorkommende .II habe die Bedeutung „kraftlos sein“. Der Unterschied wird letztlich am transitiven bzw חלש intransitiven Gebrauch festgemacht. Zu beachten ist, dass das Hebräische ja auch das Adj. çlj kennt (Jo 4,10). Die LXX sieht offensichtlich keine unterschiedlichen Verben. Sie gibt das intransitiv gebrauchte חלש in Hi 14,10 mit pi÷ptein wider, das transitive in Ex 17,13 mit tre÷pein. Die weiter geforderte Vergeltung in Ex 17,14b lässt letztlich keine andere Semantik zu als „schwächen, überwinden“. Im Blick ist offenbar gerade nicht ein regelrechter Sieg. Nach Jacob, Exodus, 497 liegt zudem ein Wortspiel mit נחשלים אחריך כל in Dtn 25,18 vor. Der transitive Gebrauch könnte also aufgrund der Intertextualität gewählt worden sein.
Raik Heckl 208
Doch dies geschieht, ohne einen direkten Widerspruch zu erzeugen. Denn es ist darin davon die Rede, dass die Amalekiter den Krieg eröffnen und angreifen (Ex 17,8) und es unter Gebrauch von çlj (Qal) nicht von einem vollständigen Sieg über die Amalekiter, sondern nur von einer Schwächung die Rede ist, so dass die auf 1Sam 8 bezogene Aufforderung in Dtn 25 nicht ihren Sinn verliert. Dennoch wird so eine schreckliche Niederlage während der Wüstenwanderung zumindest partiell in einen wunderbaren Sieg verwandelt.
Man kann schlussfolgern, dass die Stelle Ex 17,14 dazu dient, den intendierten Adres-saten zwischen zwei unterschiedlichen Darstellungen ein und desselben Geschehens zu vermitteln. Dies geschieht, indem ein Unterschied zwischen dem, was Mose schriftlich aufzeichnen soll und dem, was er im Dtn mündlich weitergibt, gemacht wird. Die Betonung des Schreibens ist so unvermittelt, und der Unterschied zu Dtn 25, wo das „Einprägen“ geschieht, so signifikant, dass man das Nebeneinander von Schreiben und Einprägen nicht einfach nur als Betonung eines Inhaltes ansehen kann.163
Vielmehr wird von Ex 17,14 der Eindruck erweckt, als habe Mose im Dtn als Sprecher (durchaus auf Befehl Jhwhs hin) nur Teilinformationen wiedergegeben. Das Dtn hatte of-fenbar bereits eine autoritative Bedeutung, so dass man ein solches hermeneutisches Verfahren entwickeln musste. Die Aufforderung an Mose, den vorangehenden Text aufzuschreiben, stellt diesen über das, was Mose in Dtn 25 sagt. Aufgrund des Schreibens wird Ex 17,8–13 eine höhere Autorität zugewiesen. Faktisch wird Mose hier von Jhwh zum Chronisten eines Geschehens während der Wüstenwanderung gemacht. Das auf Veran-lassung Jhwhs geschriebene Wort dient dazu, die Autorität des gesprochenen Wortes im Deuteronomium zu relativieren, ohne es zu nivellieren. Die Schriftlichkeit des Textab-schnittes in Ex 17,8–13 soll die Mündlichkeit des Deuteronomiums überbieten und zugleich die Unterschiede zwischen den beiden Stellen vor dem Leser des Gesamttexts recht-fertigen.164
Der offenbar veränderte Horizont des Amalekitergeschehens während der Wüsten-wanderung ergibt einen guten Sinn, wenn man davon ausgeht, dass eine Vermittlung zwischen Texten des Exodusbuches und des Deuteronomiums zu den letzten priesterlichen Kompositions- bzw. Redaktionselementen des Pentateuchs in der persischen Zeit gehört. Während das (wohl dtr) Deuteronomium auf die von Saul geführte Auseinandersetzung mit den Amalekitern zielt, was bereits an der Querverbindung zwischen 1Sam 15,2 und Dtn 25,17, aber auch an der Thematisierung der nicht vollständigen Bannung in 1Sam 15,20ff. erkennbar ist, hat der entsprechend Ex 17,14 als Erinnerung aufzuzeichnende Abschnitt (Ex 17,8ff.) die Funktion, über die Geschichte der Königszeit hinweg die Erinnerung an die auf wunderbare Weise durch den erhobenen Stab des Mose gewonnene Schlacht gegen die Amalekiter wachzuhalten. Es sind Hur als ein Judäer165 und Aaron der Stammvater und
163 Gegen Houtman, Exodus II, 371 siehe auch Zitat oben, Anm. 151. 164 Eine späte Kommentierung verschiedener weiter auseinander liegender Inhalte sieht MacDonald,
Anticipations, 18; er vermutet in der Handerhebung des Mose eine Vorwegnahme seines Fürbittens in Ex 32,9ff.
165 Vgl. Ex 31,2. Vgl. zur Wahl schon Jacob, Exodus, 496. Nach Berner, Wasserwunder, 209 ist Hur „Repräsentant des Stammes Juda“. Allerdings ist es kaum möglich, darin „die spät-nachexilische Vorstellung eines idealen Israel [...], das nur dann obsiegt, wenn die mosaische Tora vom König und vom Priestertum gestützt wird“ (ebd.) zu sehen. Den priesterlichen Autoren wäre es ein Leichtes gewesen, beispielsweise durch den Namen Amminadab einen Hinweis auf David einzufügen (vgl.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 209
Repräsentant der Priesterschaft, die hier erstmals166 zusammen auftreten und Mose stützen und somit das Wunder ermöglichen, das erinnert werden soll. Könnte es sein, dass an dieser Konstellation sowohl die Autoritäten der Provinz Jehud (Statthalter und Hohepriester) als auch deren religiöser Hintergrund (Tora) im Blick sind?167 Zugleich mag es bereits am Ende der Perserzeit Identifikationen der Amalekiter mit aktuellen Feinden gegeben haben, wie dies später bei Josephus der Fall ist,168 so dass man in der Vergangenheit siegreiche Auseinandersetzungen mit aktuellen Gegnern vorweggenommen sieht.
Über den ספר, in den Mose schreibt, ist zwar nichts gesagt, doch handelt es sich möglicherweise um die Supplementation eines größeren Zusammenhanges. Eine Beziehung zu einer Vorstellung wie in Ex 32,32 und Jos 24,26 könnte bestehen,169 ohne dass in Ex 17 Klarheit zu gewinnen ist.
5.2. Ex 24,3–8 µyfpçmh lk taw hwhy yrbd lk ta µ[l rpsyw hçm abyw 3
.hç[n hwhy tbdArça µyrbdh lk wrmayw dja lwq µ[hAlk ˆ[yw hwhy yrbd lk ta hvm btkyw 4
rhh tjt jbzm ˆbyw rqbb µkçyw .larçy yfbç rç[ µynçl hbxm hrc[ µytçw
tl[ wl[yw larçy ynb yr[nAta jlçyw 5 .µyrp hwhyl µymlç µyjbz wjbzyw
.jbzmh l[ qrz µdh yxjw tngab µçyw µdh yxj hçm jqyw 6 µ[h ynzab arqyw tyrbh rps jqyw 7
.[mçnw hç[n hwhy rbdArça lk wrmayw µ[hAl[ qrzyw µdhAta hçm jqyw
.hlah µyrbdh lk l[ µkm[ hwhy trk rça tyrbhAµd hnh rmayw
3 Und Mose kam und gaba dem Volk alle Worte Jhwhs und die Rechte wieder. Da antwortete das Volk mit einer Stimme, und sie sprachen: „Alles was Jhwh gesagt hat, werden wir tunb.“ 4 Und Mose schrieb die Worte/Reden Jhwhs auf und stand früh am Morgen auf, baute einen Altar unterhalb des Berges und zwölf Mazebenc für die zwölf Stämme Israels. 5 Und er sandte die Jungen der Israeliten, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Stiere als Gemeinschaftsopfer für Jhwh. 6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in eine Schale, und die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar.
die Genealogie 2Chr 2), was aber gerade nicht geschieht.
166 Vgl. Ex 24,14. 167 Das würde insgesamt dafür sprechen, dass der ganze Zusammenhang auf der Grundlage einer älteren
Tradition, auf der auch Dtn 25 beruht, als neuer Text geschaffen wurde. Das entspricht der Sicht von van Seters, Life of Moses, 203.
168 Die Verheißung in Num 24,20 wird eine wichtige Quelle für entsprechende Vorstellungen in der Apokalyptik gewesen sein. Vgl. zu Amalek in Qumran und der jüdischen Literatur der Zeit des Zweiten Tempels Maier, Amalek, 224f. Josephus identifiziert die Amalekiter mit den Arabern. Vgl. ebd., 235.
169 Vgl. dazu oben, 191.
Raik Heckl 210
7 Da nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Augen des Volkes vor. Und sie sprachen: „Alles was Jhwh gesagt hat, wollen wir tun und hören.“ 8 Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: „Siehe, das ist das Blut des Bundes, den Jhwh mit euch über allen diesen Redend geschlossen hat.“
a rps (Pi.) hat die Hauptbedeutung „zählen, aufzählen“ und wird von daher für das Wiedergeben von Inhalten im Sinne von „erzählen“ verwendet. Hier liegt der Schwerpunkt auf der vollständigen Wiedergabe der Jhwh-Reden, was an der Phrase lk taw hwhy yrbd lk µyfpçmh erkennbar ist. b Der Samaritanus bezeugt aufgrund von Homoioarkton dieselbe Phrase wie in V. 7b. c Im Samaritanus und der LXX ist die Rede von „zwölf Steinen“. Dabei kann es sich nur um eine ideologische Korrektur handeln. Im Hintergrund könnte ein Verbot wie Dtn 16,22 stehen. Für eine umgekehrte Ersetzung von µynba durch hbxm lässt sich aus sachlichen und formalen Gründen (warum sollte der Plural אבנים durch den Singular hbxm ersetzt worden sein) kein textkritisches Szenario wahrscheinlich machen. d Ein Fragment der Kairoer Geniza liest µyfpçm. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen sekundären interpretativen Einfluss, denn Mose liest den tarb rps und über dem Gesetzeskorpus steht außerdem µyfpçmh. Innerhalb dieses Abschnitts findet sich das Motiv „Mose als Schreiber“ zweimal. In V. 4 ist vom Schreiben des Mose die Rede und danach liest er den tyrbh rps, wobei es sich offenbar um den angefertigten Text handelt. In der Regel wird angenommen, dass das Kapitel die Kompilation mehrerer Erzählfäden ist.170 In der vorliegenden Analyse steht zwar der Aspekt von Moses Schreiben im Vordergrund, doch ist zu beachten, dass es sich um eine zweigeteilte Bundesschlussszenerie handelt, was unschwer an der zweimaligen Zusicherung von Gehorsam durch das Volk erkennbar ist. Innerhalb dieser Bundesschluss-szenerie stehen sich ein mündlicher Vortrag der Reden Jhwhs und ihre Verlesung gegenüber. Die beiden Selbstverpflichtungen des Volkes beziehen sich auf diese beiden Akte, auf den mündlichen Vortrag der Jhwh-Reden durch Mose und ihr Aufschreiben und die nachfolgende Verlesung. Auffällig ist dabei, dass dem Volk zweimal der gleiche Text präsentiert wird.171
Mit µyfpçmh lk taw hwhy yrbd lk wird auf das verwiesen, was Mose dem Volk mitteilt. Es kann sich synchron an dieser Stelle nur um vorangehende Textabschnitte mit Gottesreden handeln. Es kommen der Dekalog (Ex 20,1–17), das Altargesetz (Ex 20,22–26) und das Bundesbuch (Ex 21,1–23,33) in Frage.172 Da die Angabe lk µyfpçmh auf das Bundesbuch
170 Vgl. dazu zusammenfassend Dohmen, Exodus 19–40, 198f. Nach Dohmen, ebd. sind V. 3–8
„notwendig für den Fortgang“. Vgl. die Analyse des gesamten Textes durch Schniedewind, Textualization, 155ff.
171 Dies könnte der Grund für die Textänderung im Genizafragment sein. Vgl. die Textkritik zu V. 8. 172 Man könnte noch überlegen, ob es theoretisch möglich wäre, dass Mose den Dekalog nicht mitteilt,
da das Volk diesen ja selbst gehört hat und eine eigene Schriftgrundlage hat. So Houtman, Exodus III, 391 (alternative Positionen dort). Doch כל דברי יהוה sowohl in V. 3 als auch in V. 4 lässt auf einen Gesamtzusammenhang schließen. Die Beziehung zwischen dem vorliegenden Text und der Verschriftungsnotiz lässt Houtman offen. W. M. Schniedewind weist auf den Abschlusscharakter von 24,4.7 hin, doch geht er nicht dazu über, die Funktion der Verschriftungsnotiz zu bestimmen. „It casually notes that Moses had written down the words of God“ (Schniedewind, Textualization, 157).
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 211
mit seiner Überschrift in 21,1 zu beziehen ist, kann mit der pluralischen Formulierung hwhy yrbd lk nur Dekalog und Altargesetz gemeint sein.
Das Volk akzeptiert die von Mose vorgelegten Jhwh-Reden. Die mündliche Wei-tergabe (24,3a) beinhaltet Ex 20,18–21, wo Mose als Mittler zur Weitergabe der Reden Jhwhs an das Volk eingeführt wird, sowie die Aufforderung aus der Überschrift Ex 21,1b (µhynpl µyçt rça). Bei der sich anschließenden Abfassungsnotiz (24,4a) könnte man zunächst den Eindruck gewinnen, dass nur Dekalog und Altargesetz von Mose aufge-zeichnet worden seien, da nur hwhy yrbd lk, nicht aber die µyfpçm genannt werden. Doch da die Reden später als „Bundesbuch“ bezeichnet werden und das Tun betont ist, wird die Verschriftungsnotiz Ex 20–23 insgesamt umfassen, der damit als von Mose verfasster Text charakterisiert wird.173
Die Notiz macht den Eindruck einer Art pseudepigraphischer Zuweisung,174 die dem Wortlaut des vorangehenden Abschnittes besondere Autorität verleihen soll. Über den Kontext, in dem Mose als schreibend und lesend erscheint, sagt der Abschnitt nichts. Der Text spekuliert nicht darüber, wie der Abschnitt in den den intendierten Adressaten vorlie-genden Gesamttext gekommen ist, doch wird zumindest für den Abschnitt Ex 20,1–23,33 eine Identität vorausgesetzt.
Nach der kultischen Feier und dem Blutritus am Altar wird auf den von Mose geschriebenen Text zurückgekommen. Das Buch des Bundes wird das zweite Mal nun „in die Ohren des Volkes“ mitgeteilt, woraufhin das Volk auch ein zweites Mal akklamiert: „Alles was Jhwh gesagt hat, wollen wir tun und hören.“ Die Verbindung des anschlie-ßenden Blutrituals mit den vorangehenden Jhwh-Reden µyrbd lk l[ hlah macht deutlich, dass es sich bei der Verlesung um die vorher bereits von Mose weitergegebenen Reden handelt. Die Bezeichnung als tyrbh rps könnte vermuten lassen, dass der Abschnitt als eigenständiger Text angesehen wird.
Das Nebeneinander von mündlicher Weitergabe, Abfassung und nochmaliger Verlesung im Rahmen der Bundeszeremonie mutet eigenartig an. Es dient in dem Kontext aber offenbar dazu, den intendierten Adressaten des Textes letztlich zu versichern, dass es sich tatsächlich bei dem Text in Ex 20–23 um die Grundlage des Bundesschlusses handelt, dass also der den Hörern oder Lesern des Buches Exodus vorliegende Text mit dem identisch ist, was Mose gehört, weitergegeben und anschließend geschrieben hat. Die Zuhörer des Mose bestätigen damit den impliziten Adressaten des Buches, dass der Text, den diese in ihren Händen halten, nicht nur mit demjenigen identisch ist, den Mose geschrieben hat, sondern auch mit dem, was Jhwh gesprochen hat.
Welchen Grund gibt es, dass das an dieser Stelle so betont wird? Im Hintergrund steht m.E. wiederum ein Bezug zum Deuteronomium. Im dtr Deuteronomium wird betont,175
Schiedewind, ebd., 158, sieht wegen der Erwähnung des ספר הברית einen Zusammenhang mit 2Kön 23 und an beiden Stellen eine gemeinsame dtr Redaktion („deuteronomists’ hands“) am Werke.
173 Nach Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 182 wird an der Stelle entsprechend der Konzeption der Pentateuchredaktion nur das Bundesbuch verschriftet.
174 Vgl. zum Konzept Zimmermann, Pseudepigraphie, 1786ff., der die allmähliche Zuschreibung des Pentateuchs zu Mose mit dem Phänomen in einen Zusammenhang bringt (vgl. ebd., 1787).
175 Vgl. vor allem Dtn 5,2–5, aber auch Dtn 4,2.
Raik Heckl 212
dass der Dekalog und nur jener176 der Text des Bundesschlusses am Horeb ist. Dtn 5,31 behauptet sogar, dass Mose im Anschluss an den Dekalog das Deuteronomium von Gott bekommen hat.177
Überhaupt stellt sich im Kontext des Dekalogs in Dtn 5 der Sinai- bzw. Horeb-aufenthalt signifikant anders dar als in Ex 20ff. Abgesehen davon, dass im Dtn behauptet wird, dass nur der zitierte Dekalog der Bundesschlusstext ist,178 ist dort auch nur von diesem als von Gott selbst geschriebenem Text die Rede, nicht aber von einem durch Mose geschriebenen Text. Dies macht es wahrscheinlich, dass Mose als Schreiber erst ein im Gegenüber von Dtn 5 entwickeltes Konzept ist. Besonders in Dtn 5,22 hat man außerdem den Eindruck, als wollten die dtr Autoren den Wortlaut des Dekalogs ein für allemal mit der Autorität des Mose und seiner Zuhörerschaft definieren.179
Das, was Mose dem Volk nach dem Deuteronomium mitteilt, unterscheidet sich also stark von dem, was er entsprechend Ex 24,3 in schriftlicher und mündlicher Form weiter-gibt. Hätten wir nur die Mitteilung, dass Mose dem Volk die Mosereden in Ex 20–23 mündlich weitergegeben hat und würde nichts von einem Aufschreiben und einer Verlesung in Ex 24 stehen, dann müsste man das Konzept von Dtn 5f. für authentisch halten, da Mose als Augenzeuge und das ihm gegenüberstehende Volk die Korrektheit des Deuteronomiums bezeugen. Der Leser würde Mose aufgrund dessen Autorität ‚glauben‘, dass jener nach dem Dekalog am Horeb von Jhwh das Deuteronomium empfangen hatte. Durch die Notiz in Ex 24,4 aber, dass Mose die Reden aufgeschrieben hat, wird deren Wortlaut nun gegen das Zeugnis des Deuteronomiums gesichert. Die Verlesung des Buches sichert den „tatsächlichen“ Wortlaut der ursprünglichen Bundesschlussszenerie und der zugrunde liegenden Texte gegen die Behauptung von Dtn 5,2–5.22, dass nur der Dekalog Grundlage des Bundes am Horeb gewesen sei. Das Deuteronomium selbst mit seiner Behauptung des Horeb-Ursprungs (Dtn 5,31) wird damit faktisch zu einer zusätzlichen Mitteilung Jhwhs an Mose bzw. aufgrund des langen Zeitabstandes von den Horeb-geschehnissen zu einer perspektivischen Auslegung des „Bundesbuches“ vom Sinai.180 In
176 Siehe Dtn 5,22. 177 So schon Seitz, Studien, 48. 178 Gegen die These von Hossfeld, Dekalog, 262, dass der Dekalog zwar auf eine Gebotsreihe fuße, aber
in Dtn 5 erst zum Dekalog geworden ist, wobei „das Privilegrecht, das Bundesbuch und das dtn Gesetz“ sein „Horizont“ war, betont Kratz, Höre Israel, 80, zu Recht den Zitatcharakter: „Das Zitat hat die Funktion, in der Rekapitulation der Sinaiperikope die Rolle des Dekalogs neu zu definieren […]. Das Hersagen des Dekalogs ist also wirkliches Zitat, so, wie auch die folgenden Gesetze des Deuteronomiums das am Sinai offenbarte Bundesbuch (auslegend) zitieren.“ So auch schon Kratz, Dekalog, 236. Allerdings muss man dann auch wie beim Verhältnis von Bundesbuch und Deute- ronomium davon ausgehen, dass der Dekalog auch nicht unverändert, sondern aktualisiert „zitiert“ worden ist. Vgl. Köckert, Gesetz, 176.
179 Die Formel ולא יסף als „Vorform der Kanonformel“ (Veijola, Deuteronomium, 140) lässt erkennen, dass das Dtn sich kritisch auf die Tradition bezieht, und hier nun den klar abgegrenzten Text mit der Autorität des Augenzeugen als authentischen Wortlaut präsentiert. Könnte es sein, dass diese Eingrenzung (vgl. Hossfeld, Dekalog, 228) möglicherweise auch gegen ein ursprünglich anderes Ende des Dekalogs oder konkret gegen den sich anschließenden Text des Altargesetzes gerichtet war? Dass der Dekalog am Ende offen war, zeigt die Einfügung des zusätzlichen Altargebotes in der Version des samaritanischen Pentateuchs.
180 An dieser Stelle bestätigt sich bereits die Beobachtung von E. Otto, der auch im Rahmen des
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 213
jedem Fall wird seine Autorität gegenüber Ex 20–23 reduziert.181 Als Text, den Mose schreibt, ist pragmatisch der den intendierten Adressaten vorliegende Text gemeint. Die Bezugnahme auf das Deuteronomium und seine Hermeneutik zeigt, dass er faktisch als Teil des Gesamttextes des Pentateuchs oder seiner Vorform gedacht ist.
5.4. Ex 34,27f. hlah µyrbdh ta ˚l btk hçmAla hwhy rmayw 27
.larçy taw tyrb ˚ta ytrk hlah µyrbdh yp l[ yk htç al µymw lka al µjl hlyl µy[braw µwyy µy[bra hwhy µ[ yhyw 28
.µyrbdh trç[ tyrbh yrbd ta tjlhAl[ btkyw
27 Da sprach Jhwh zu Mose: „Schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir einen Bund geschlossen und mit Israel.“ 28 Und era war dort beib Jhwh vierzig Tage und vierzig Nächte. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Er schrieb aber auf die Tafeln die Worte des Bundes als die zehn Worte. a LXX fügt hier noch einmal Mose als Subjekt ein. Es handelt sich um eine scheinbare stilistische Verbesserung im griechischen Text, die aber die Intention des Gesamttextes nicht beachtet. Der stellt in 34,1 in Aussicht, dass Jhwh selbst auf die Tafeln das aufschreiben will, was vorher darauf stand. b Die Ersetzung von ta durch ynpl in Samaritanus (und nach LXX) gestaltet den Text zu einer audienzartigen Szene um. hwhy ynpl lässt die Hierarchie deutlicher werden.182 Wie daraus ta geworden sein kann, lässt sich nicht erkennen. Die an Mose gerichtete Aufforderung, einen Text aufzuschreiben, schließt den vor-angehenden sogenannten kultischen Dekalog Ex 34,11–26 ab.183 Mit dem Demons-trativpronomen אלה, das auf das Naheliegende verweist, kann es sich nur auf die vorangehende Jhwh-Rede beziehen, die in 34,10 eröffnet wird.184 Mose soll also die Gebotsreihe aufschreiben, wobei nichts darüber mitgeteilt wird, wohin Mose den Text schreiben soll. Da intendiert ist, dass Mose die direkt vorangehenden Worte niederschreibt, dürfte auch an dieser Stelle der den intendierten Adressaten vorliegende Text gemeint sein.
Deuteronomiums festgestellt hat, dass dieses in der letzten Phase des Buches zur „Auslegung der Sinai-Tora“ wird. Vgl. Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 167. Allerdings deutet sich im Kontext von Ex 24,3–8 bereits an, dass nicht eine mündlich gedachte Sinai-Tora kommentiert wird. Vielmehr handelt es sich um zwei Formen von Schriftlichkeit. Das Deuteronomium trägt als verschriftlichte Rede den Charakter des perspektivischen Textes, des Kommentars, und soll damit möglicherweise auch etwas wie ein Konzept von Auslegung sein, was sich mit Sicherheit in der späteren rabbinischen Vorstellung der mündlichen Tora widerspiegelt.
181 Die dtr Autoren haben bereits ähnlich gegen die ältere Sinaitradition argumentiert. Vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 360–362. Hier schlägt das Pendel faktisch zurück.
182 Vgl. zur Formulierung in Ex 6,12 Houtman, Exodus II, 506. 183 Vgl. Houtman, Exodus III, 715. 184 Es handelt sich um „den Abschluss des ‚Rechtskorpus‘“ (Dohmen, Exodus 19–40, 372).
Raik Heckl 214
Wieder geht es in der Passage um einen Bundesschluss, hier nach dem Bundesbruch in Ex 32. Auch der Dekalog spielt eine Rolle. Diesen will Gott nach Ex 34,1 wieder schreiben, und Mose soll ihn ein zweites Mal bekommen.
Das Thema tyrb kehrt in V. 28 in dem erzählerischen Resümee der Abfassung noch einmal wieder. Bei V. 28b wird überlegt, ob das Subjekt wechselt und nun davon die Rede ist, dass Jhwh auf die Tafeln schreibt.185 Eigentlich würde man im engeren Kontext eher annehmen, dass Mose die Worte neben oder über den von Gott geschriebenen Dekalog auf-zeichnet.186 Doch ist entscheidend, dass die tyrbh yrbd mit der Apposition µyrbdh trç[ versehen sind. Letzteres ist in Dtn 4,13 und 10,4 der terminus technicus für den Dekalog. Er wird in Ex 24,28b bereits als bekannte Größe determiniert gebraucht und kann sich also nur auf das Aufschreiben des Dekalogs auf die erneuerten Tafeln beziehen. Ein direkter Anschluss an 34,1 liegt also vor, so dass Jhwh die Tafeln schreibt.
Wenn Mose aber die vorangehenden Worte nicht auf die Tafeln schreibt, wo soll er sie hinschreiben? M.E. handelt es sich um nichts anderes als um eine Notiz über die Abfassung des Kontextes der Stelle und somit um den Versuch, den genauen Wortlaut dieses Textes mit der Autorität des Mose zu versehen. Als Begründung der Abfassung heißt es in V. 28b, dass diese Worte die Grundlage des neuerlichen Bundes seien.
Der Inhalt der vorangehenden Jhwh-Rede scheint dem zunächst nicht zu entsprechen. Dort ist in V. 10 von einem zukünftigen Bund mit dem Volk die Rede, der im Lande ge-schlossen werden soll, und es werden in diesem Zusammenhang Wunder angekündigt, die die Präsenz Jhwhs in seinem Volk erweisen. Beim Übergang zur Gebotsreihe in 34,11a wird allerdings die Bewahrung der Gebote, die Mose auf dem Sinai mitgeteilt werden ( אשר eingeschärft. Die Schriftlichkeit dient also der Überbrückung der Zeit zwischen ,(מצוך היוםder Vermittlungssituation, in der Mose die Gebote am Sinai bekommen hat und ihrer späteren Einhaltung im Land. Denn erst nach der Landnahme und dann ohne die Ver-mittlung des Mose werden die Worte, die dennoch auf Mose bezogen sind (V. 10: ˚m[ hç[ rça; V. 27 ˚ta ytrk), ihre Bedeutung haben.
Bereits V. 11a erinnert aufgrund der Phraseologie an das Deuteronomium, wobei anders als dort Jhwh selbst der Sprecher ist. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass der Text von Ex 34,10ff. etwas mit dem Deuteronomium zu tun hat. Nach der Analyse des Festkalenders durch S. Gesundheit kann man den Text am ehesten als Teil einer Redaktion ansehen, die die Traditionen von Dtn und Bundesbuch mit Aspekten der priesterlichen Tradition verbunden hat.187 Der Abfassungsbefehl Ex 34,27 vermittelt offenbar zwischen diesem
185 So schon Ramban mit Verweis auf Ex 34,1. Die Midraschim verweisen auf die Identität der Tafeln,
von der in Dtn 10,4 die Rede ist. Houtman, Exodus III, 714: „YHWH again writes the ten ordinances, the decalogue, on stone tablets“. Mit Dohmen, Exodus II, 373 sprechen „die Objektnennung und die vorausgehende Leserlenkung dafür, JHWH als Subjekt von V 28b anzusetzen“.
186 V. 28a bezieht sich mit der 3. Sing. mask. auf Mose. Der Wechsel des Subjekts ist nicht angezeigt. Dohmen, Exodus II, 373 sieht mit dem Fasten des Mose einen Hinweis auf Ex 24, was klarstelle, dass Jhwh hier wie in 24,11f. schreibe: „Damit wird der Leser deutlich auf Ex 24 verwiesen, so dass er von dort auch das ‚Schreiben Gottes‘ einzuspielen vermag.“ Das ist m.E. sehr weit hergeholt. Mit einem redaktionell entstandenen Problem rechnet Wilms, Bundesbuch, 180; so auch Konkel, Sünde, 131.
187 Nach Gesundheit, Intertextualität, 205, handelt es sich dabei bei Ex 34,18–26 um eine „Umgestaltung und Erweiterung von I [Ex 23,14–19 – R.H.] unter Einbeziehung von II [Dtn 16 – R.H.] und
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 215
neuen Text und den anderen Texten. Wiederum dürfte besonders das Dtn im Blick sein. Denn in Dtn 10,4 ist nur davon die Rede, dass Gott erneut die Tafeln mit den µyrbdh trc[ beschreibt und sie Mose überreicht. Danach wechselt der Dtn-Text in die Paränese mit Verweis auf das Deuteronomium.188 Insgesamt ist in Dtn 9f. nach dem Bundesbruch von der Zerstörung der Tafeln, der Fürbitte des Mose und von der Herstellung der neuen Tafeln die Rede, nicht aber von einem Bundesschluss und auch nicht von einem zusätzlichen Text. Demgegenüber behauptet Ex 34,27f., dass erst nach der Verkündung der Gebotsreihe 34,10–26, nach dem Befehl zum Aufschreiben (V. 27) und nach dem Fasten des Mose Jhwh die Tafeln neu beschrieben hat und dass der Bundesschluss mit diesem neuen Text verbunden ist.
Es mag bei dem Abfassungsbefehl in Ex 34,27 auch eine Rolle gespielt haben, dass nach Ex 24 ein gewisser Systemzwang bestand und eine schriftliche Abfassung des Bun-destextes notwendig war, doch wie schon dort handelt es sich in Ex 34 um eine gegenüber dem Text des Deuteronomiums veränderte Vorstellung vom Bundesschluss. Gegenüber dem Deuteronomium und seiner Betonung des Dekalogs wird in Ex 34,27 der sog. kulti-sche Dekalog nach Bundesbruch und vor der Erneuerung der Tafeln zusätzlich zur Grund-lage des Bundes gemacht. Umgekehrt wird der Eindruck erweckt, als habe Mose im Deute-ronomium mündlich nicht alles mitgeteilt, was sich am Sinai zugetragen hat, ein Eindruck, der durch die teilweise dtn geprägten Inhalte von Ex 34,11–26 unterstrichen wird. Die Betonung der Abfassung von Ex 34 durch Mose dient dazu, die Autorität der mündlich durch Mose vermittelten Texte im Deuteronomium zu überbieten. 189
Zwar wird nichts darüber ausgesagt, wohin Mose den Text auf Befehl Jhwhs schreiben soll, aber wiederum dürfte intendiert sein, dass es sich um den Text handelt, der den in-tendierten Adressaten vorliegt, in dem eben die Gebotsreihe Ex 34,11–26 in direktem Kontext des Verschriftungsbefehls steht. Die Formulierung sichert damit die Autorität eines späten redaktionellen Eingriffs in den Pentateuch und dies wiederum gegen das Zeugnis des Deuteronomiums.
5.4. Num 33,1f .ˆrhaw hçm dyb µtabxl µyrxm ≈ram waxy rva larçy ynb y[sm hla 1 .µhyaxwml µhy[sm hlaw hwhy yp l[ µhy[sml µhyaxwm ta hçm btkyw 2
1 Dies sind die Wegea der Israeliten, auf denen sie aus Ägypten auszogen entsprechend ihrer Heerscharen unter Mose und Aaron.
priesterlichen Traditionen“; ders. (= Bar On), Calendars, 192: „Since, as I have shown, both Deuteronomic and Priestly elements can be detected, I have thought it best to attempt to deal with the manner in which the copying, revision and redaction has been carried out and to speak of the writer- reviser who has accomplished this task without affixing to him one of the conventional labels.“ Oswald, Staatstheorie, 129 rezipiert dies teilweise, indem er den Abschnitt als dtr geprägt ansieht.
188 Dtn 10,12 spielt auf den ursprünglichen Anfang des Deuteronomiums an. 189 Nach Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 181f. handelt es sich bei Ex 34,27 um eine ältere vordtr
Vorstellung vom Schreiben Jhwhs, die von der Pentateuchredaktion aufgegriffen worden sei. Der literarische Charakter der Gebotsreihe und die Tatsache, dass das Deuteronomium in Dtn 10,3–5 offenbar noch nichts von Moses Schreiben weiß, spricht dafür, dass auch in Ex 34,27 die letzten Veränderungen am Text des Exodusbuches auf diesem Wege mit Autorität versehen werden.
Raik Heckl 216
2 Und Mose schrieb bdie Lagerplätzea ihrer Wegeab nach dem Befehl Jhwhs auf. Und dies sind cdie Wegea zu ihren Lagerplätzenac. a Ein Problem in Num 33,1f. ist, wie die beiden Begriffe מוצא und מסע zu interpretieren sind. Mit Milgrom, Numbers, 278f.; Schmidt, Numeri, 202; Ges18, 705, bezeichnet מסע als Verbalnomen von ,.sind die Zwischenziele, „Ausgangsorte“ im Blick (siehe Milgrom, ebd מוצאים den Weg. Mit נסעSchmidt ebd., Ges18, 646). Anders als in einer Reihe von Übersetzungen angenommen wird, meint nicht מסע, sondern מוצא so etwas wie den Lagerplatz, von dem man aufbrach. Aufgrund des Nebeneinanders von Zwischenzielen und Wegen, würde die Übersetzung von מסע mit „Station“ zu einer Vermengung der Terminologie führen. b מוצאיהם למסעיהם wörtlich: „ihre Ausgangsorten, die zu ihren Wegen (gehörten)“. c Die parallele Formulierung, wörtlich wohl „ihre Wegen, die zu ihren Ausgangsorten gehören“, bezeichnet den Weg zum nächsten Ausgangsort. Nach der Verschriftungsnotiz vor dem großen Itinerar der Wüstenwanderung190 hat Mose entsprechend dem Befehl Jhwhs (hwhy yp l[) geschrieben. Anders als bei den bisher disku-tierten Stellen scheint sich die Notiz nicht zurückzubeziehen, sondern auf die nachfolgende Aufzählung der Stationen.191
Die für Über- und Unterschriften typische Formulierung findet sich zwar zweimal in Num 33,1–2 (V. 1 und V. 2b). Die Abfassungsnotiz ist aber mit keinem der beiden Nomi-nalsätze direkt verbunden. Vielmehr steht sie als eigenständiger Hauptsatz zwischen den beiden Nominalsätzen, als würde wiederum durch das Verschriften ein Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten hergestellt. Dieser inhaltliche Zusammenhang wird an der Textoberfläche durch die Substitution von ynb larçy durch Suffix 3. Pl. mask., durch waw-Impf. in V. 2a und durch waw-Kopulativum bei V. 2b realisiert.
Wie bereits beim Lesen auffällt, wiederholen sich die Verweise auf die מסעים „Wege“ und µyaxwm „Ausgangsorte“, wobei in der Verschriftungsnotiz und in der nachfolgenden Überschrift (33,2) die Phrase in invertierter Ordnung wiederholt wird.192 Dies kann m.E. kein Zufall sein, sondern weist darauf, dass der von Mose verschriftete Text nicht mit dem in 33,2 überschriebenen Itinerar als identisch gedacht ist. Mose schreibt nach 33,2a die Lagerplätze ihrer Wege, doch nach 33,2b folgen die Wege zu den Lagerplätzen.
190 Für die Herkunft des Itinerars werden verschiedene Thesen vertreten. Nach Noth, Wallfahrtsweg, 74
handelt es sich zum Teil um einen alten Text; so zuletzt noch Milgrom, Numbers, 498: „an ancient itinerary of the wilderness trek – the master list from which the individual itineraries in the narratives were drawn“. Schmidt, Numeri, 203 nimmt als Ursprung die Pentateuchredaktion an. Zur Kritik von M. Noths These vgl. ebd., 204.
191 So z.B. Schmidt, Numeri, 205; Seebaß, Numeri III, 367. 192 Seebaß, Numeri III, 378, stellt fest: „2 formuliert kurios, indem 2b den Anfang von 2a chiastisch
aufnimmt: Ausgangsorte nach Stationen – Stationen nach ihren Ausgangsorten. Der Chiasmus umkreist das für den Platz von 1–49 in Numeri einzig Wichtige: Jahwe gab Mose den Befehl zur Aufzeichnung.“ Von einem Chiasmus spricht auch Milgrom, Numbers, 278. Eine solche Beschreibung begründet die Inversion nicht, doch ist deutlich, dass mitnichten eine zufällige durch eine Redaktion zustande gekommene Formulierung vorliegt, wie dies Noth, Numeri, 210; Schmidt, Numeri, 205 annehmen; so auch schon Gray, Numbers, 444.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 217
Ebenfalls auffällig im Vergleich zu der parallelen Terminologie in V. 2a und 2b ist, dass in Num 33,1 nur von den מסעים die Rede ist, auf denen die Israeliten auszogen. Während 33,2b beschränkend ausdrückt, dass die Wanderungen zu den Ausgangsorten / Lagerplätzen folgen, verweist Num 33,1 ganz offen auf die Wege der Israeliten. Die Formulierung steht mit Notizen, die nicht den konkreten Weg von Lagerplatz zu Lagerplatz im Blick haben, in einem formalen Zusammenhang.193 Signifikant ist, dass Num 33,1 ein Pendant in Num 10,28 hat: Num 10,28: waxyw µtabxl larçy ynb y[sm hla Num 33,1: ˆrhaw hçmAdyb µtabxl µyrxm ≈ram waxy rça larçy ynb y[sm hla Num 10,28 leitet von der Liste des Aufbruchs zu den Erzählungen von der Wüsten-wanderung über, was an dem nachgestellten ויסעו erkennbar ist. Grundsätzlich bezieht sich die Notiz aber zurück auf den Aufbruchsabschnitt, der in Num 10,12 beginnt. Num 33,1 ist ganz parallel aufgebaut. Das macht es wahrscheinlich, dass wie an anderen Stellen (Lev 26,46; 27,34; Num 30,17; 36,13) auch in Num 33,1 eine Unterschrift vorliegt. Der Relativ-satz weist zurück auf den Auszug aus Ägypten, der unter der Führung Moses und Aarons erfolgte. Daher ist Num 33,1 parallel zu Num 10,28 eine Unterschrift unter den voran-gehenden Textzusammenhang. Doch dieser reicht jetzt sehr viel weiter zurück als die Unterschrift in Num 10,28, nämlich bis zum Exodus.194 Die Unterschrift markiert damit das Ende der Wüstenwanderung formal, und tatsächlich folgen in Num 34–36 nur noch einige Vorschriften. Die Israeliten sind am Ziel angekommen. Die Überquerung des Jordans steht unmittelbar bevor.195
Num 33,1–2 markiert mit der Unterschrift das Ende der Wüstenwanderung und leitet zu dem in 33,2b mit einer eigenen Überschrift ausgestatteten Itinerar der Wanderung über.196 Für die Sicht des Pentateuchs sind bereits dieser Abschluss der Wüstenwanderung und die Beifügung des Itinerars von großer Bedeutung. Denn aus Sicht der Autoren, die diese Überleitung verfasst haben,197 entspricht der Erzähltext, der das Volk von Ägypten bis in die Steppengebiete Moabs führt, also Ex 14–Num 32, dem Itinerar Num 33,3ff., das als fulminanter Abschluss von Exodus und Wüstenwanderung erscheint.
Wie verhält sich nun dazu die Behauptung, dass Mose geschrieben hat? Und was konkret hatte man als von Mose nach Num 33,2a geschriebenen Text im Blick?
Der Zusammenhang, der durch den Übergang Num 33,1f. zwischen Erzähltext und Itinerar hergestellt wird, ist durch eine terminologische (ˆm w[syw + Ortsname) und über weite Strecken auch sachliche Entsprechung der Ortsnamen198 sowie der inhaltlichen Nebenbemerkungen199 im Itinerar gegeben. Es drängt sich der Eindruck auf, dass man mit dem Itinerar noch einmal mit letzter Exaktheit den Weg durch die Wüste festhalten wollte.
193 Vgl. 17,1; Ex 40,36; Num 10,12. 194 Die Anfangszeile des Itinerars in Num 33,3 zeigt, wieweit die Überschrift konkret zurückreicht. Denn
dort nimmt die Formulierung hmr dyb larçy ynb waxy konkret Bezug auf hmr dyb µyaxy larçy ynbw in Ex 14,8.
195 Den Ort des Itinerars als Schlüsselstelle im Pentaeuchs sieht auch Dozeman, Numbers, 250. 196 Der Übergangsabschnitt ist formal dem Übergang von Num 36,13 nach Dtn 1,1 ähnlich. 197 Dabei muss es sich mit Sicherheit um eine mit dem Endtext zusammenhängende Stufe der
Literaturwerdung des Numeribuches handeln. 198 Vgl. die Gegenüberstellung der Ortsnamen bei Milgrom, Numbers, 499. 199 Vgl. Schmidt, Numeri, 204.
Raik Heckl 218
Eine Korrektur von Ex 12–Num 32 ist also eher nicht beabsichtigt. Vielmehr will man diesen großen Zusammenhang sozusagen als letzten Akt vervollständigen.
Die Betonung der Mosaizität des Itinerars dürfte daher nicht allein auf die Aufzählung der Stationen bezogen sein. Vielmehr bestätigt es die Authentizität der Wüstenwande-rungstexte insgesamt. Wenn man annimmt, dass sich die Verschriftungsnotiz auf das Itinerar bezieht, würde die Autorität der in Ex 12–Num 32 dargestellten Inhalte durch das Schreiben des Mose bestätigt.
Allerdings wäre die dezidierte Bestätigung des Itinerars durch die Abfassungsnotiz nicht nötig, wenn dessen Autorität nicht in irgendeiner Weise in Frage gestanden hätte. Die Zuhilfenahme des schreibenden Mose weist m.E. wiederum in Richtung des Deutero-nomiums. Denn dort findet sich im dtr Dtn 1–3 für den Weg vom Horeb ins Land Moab eine einfachere geographische Konzeption und außerdem enthält Dtn 10,6f. in einer Glosse einen verwandten, aber abweichenden itinerarischen Abschnitt.200 Daher kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass Mose als Schreiber wiederum als Autorität gegen den im Deuteronomium sprechenden Mose genutzt wird. Dessen mündlicher Rückblick im Dtn auf die Wanderung vom Horeb in das Land Moab soll durch ihn als Schreiber als perspektivisch, ungenau, partiell oder u.U. auch als schlecht „erinnert“ relativiert werden.
Doch wie verhalten sich dazu die entsprechenden Texte des Tetrateuchs? Reicht die Zuweisung eines Itinerars dazu aus, die doch massiven Abweichungen im Ablauf und im Inhalt zwischen dem Deuteronomium und dem Tetrateuch zu erklären? M.E. muss man an dieser Stelle noch einmal das Gegenüber der Verschriftungsnotiz und der sich an-schließenden Überschrift ernst nehmen (Num 33,2a.b). Die invertierte Bezeichnung der Inhalte spricht für eine Entsprechung dessen, was Mose geschrieben hat und des Itinerars, aber eher nicht dafür, dass sich beides auf das Gleiche bezieht. Wenn dem so ist, wäre Mose nicht als Schreiber des Itinerars tätig vorgestellt, sondern er wäre nach Num 33,2a im vorangehenden Text der Wüstenwanderung am Werke gewesen. Es sind ja gerade die priesterlichen Texte, die die Wüstenwanderung u.a. mit ihren gleichförmigen itinerarischen Notizen durchziehen und so als Gesamtkonzept erscheinen lassen. Die Verschriftungsnotiz würde sich damit auf die priesterliche Komposition der Bücher Exodus bis Numeri beziehen, der durch den Verweis auf die Abfassung durch Mose höchste Autorität zuge-schrieben wird. Dadurch wird den intendierten Adressaten der priesterlich abgeschlossene Text von Ex 14–Num 32 gegenüber dem Deuteronomium und vor allem auch gegenüber den von den priesterlichen Autoren verarbeiteten Vorlagen als authentisch erwiesen.201 Ihm
200 Das kleinere Itinerar in Dtn 10,6f. enthält zwar eine Reihe von Ortsangaben, die auch in Num 33,30–
34 vorkommen. Die Übereinstimmungen könnten dafür sprechen, dass die Glosse zwar noch nicht das fertige Itinerar, also noch nicht den fertigen Pentateuch, wohl aber die in Num 33 verarbeiteten Informationen voraussetzt. Die Ansicht von Schmidt, Numeri, 207 dass Dtn 10,6f. „ein sehr spätes Stück“ ist, kann nicht bedeuten, dass es später als Num 33 verfasst ist, da die Autoren doch sonst hätten auf den Wortlaut in Num 33 zurückgreifen können.
201 L. Hänsel hat die Vermutung geäußert, dass in der Argumentation in Esra / Nehemia noch die Existenz konkurrierender Texte erkennbar sei. Er spricht von „einer Situation, in der mehrere Tora- Bücher nebeneinander existieren, die eine gewisse Autorität für sich beanspruchen. Der Pentateuch, insbesondere auch dessen im ‚masoretischen‘ Text vorhandene Fassung, ist in dieser Zeit nur einer dieser Texte“ (Hänsel, Studien, 166). Dasselbe wird im Pentateuch durch den Gebrauch der mosaischen Autoriät als Schreiber deutlich.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 219
wird dadurch außerdem höchste Autorität zugeschrieben. Dass man dies an dieser Stelle entsprechend in den Text einschreibt, auch angesichts der Tatsache, dass noch weitere Vor-schriften im Numeribuch folgen, weist darauf, dass der priesterliche Abschluss des Penta-teuchs sukzessive vonstattengegangen sein muss.202
5.5. Dtn 31,9.22.24 In Dtn 31 liegen zwei Verschriftungsnotizen vor (Dtn 31,9.22), die danach noch einmal zusammengefasst zu werden scheinen (Dtn 31,24). Das Kapitel liegt formal und inhaltlich nicht mehr auf der Ebene des von den Mosereden bestimmten Deuteronomiums, sondern auf der Ebene des Pentateuchs.203 Dass sich gerade in diesem Kapitel die Verschrif-tungsnotizen häufen, hängt sicher mit seinem literarisch gegenüber dem dtn und dtr Deuteronomium späten Charakter zusammen.204 In dem Kapitel suchen die (wohl) priesterlichen Autoren das dtn Konzept der Augenzeugenschaft Moses, von der das Buch auch in seiner Endgestalt als Abfolge mehrerer Mosereden an dessen Todestag überwie-gend geprägt ist, in ein neues umfassenderes Konzept zu integrieren.205 Mose als Schreiber legitimiert in Dtn 31,9 einen Text, der sich zunächst im Umfang von dem Text massiv unterscheidet, der als eine Folge von Mosereden dem Volk mündlich mit in das Land gegeben wird, wo es ihn entsprechend Dtn 27 auf Stelen abfassen soll.206 Zu dem umfassenderen Text (tazh hrwth) gehören anders als zu den Mosereden (hrwth yrbd) auch die erzählerischen Rahmenverse. Zu ihm gehört auch der Eröffnungszusammenhang, der in Dtn 1,3 das Deuteronomium in die priesterliche Jahreszählung seit dem Auszug integriert und Dtn 4, in dem nicht nur Verweise zu Texten des Numeribuches nachgetragen werden, die in Dtn 1–3 noch fehlen, sondern auch die Kenntnis des priesterlichen Schöpfungs-berichtes vorausgesetzt ist.207 Aus diesen Gründen hatte ich bereits in meinem Beitrag „Augenzeugenschaft und Verfasserschaft“ vermutet, dass es in Dtn 31,9 nicht mehr nur um die Abfassung des Deuteronomiums geht, sondern um das Deuteronomium als Teil des Pentateuchs. Dieses Kapitel macht den Pentateuch m.E. zu einem von Mose verfassten Text.
Dies geht einher mit einer veränderten Geschichtstheologie, die nun auf den direkten Kontext des Deuteronomiums bezogen ist. Die sich an die Verschriftungsnotiz in Dtn 31,9 anschließenden Verse Dtn 31,10–13 entwerfen ein Konzept, nach dem der von Mose verfasste Text für das Volk von grundlegender Bedeutung ist. Es soll im Prinzip direkt im Anschluss an die Landnahme dem ganzen Volk durch eine regelmäßige Verlesung zu-gänglich gemacht werden. Den von Mose verschrifteten Text zu hören „und so die Gottes-furcht zu lernen, ermöglicht es, den Geboten des Deuteronomiums entsprechend zu leben,
202 Das trifft sich sowohl mit der Annahme, dass das Numeribuch als letzter Komplex geschaffen worden
ist wie auch mit der inzwischen breit akzeptierten These, dass die Priesterschrift nur bis an das Ende des Exodusbuches oder nach Lev 16 reicht. Vgl. dazu Römer, Urkunden, 15–20.
203 Vgl. Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 175ff.; Heckl, Präsentation, 227. 204 Angesichts des ebenfalls späten Charakters aller anderen Stellen, an denen Mose als
Schreiber auftauchte, ist die Häufung des Motivs in Dtn 31 zu beachten. 205 Vgl. dazu Heckl, Augenzeugenschaft, 371f. 206 Vgl. dazu Heckl, Augenzeugenschaft, 360–362; s. auch oben, 188f. 207 Vgl. dazu Otto, Deuteronomium 4, 218f.; Heckl, Augenzeugenschaft, 366.
Raik Heckl 220
was die Gottesnähe und das Heil in Zukunft sichert“.208 Auffällig ist, dass die Verschriftung hier wieder wie in Ex 20 mit einer Verlesung Hand in Hand geht.
Was pragmatisch auf den Gebrauch und die intendierte Bedeutung des abgeschlossenen Pentateuchs in der persischen Zeit abzielt,209 erklärt aber zugleich auch das Exil. Denn in Dtn 31 wird mit der Einlagerung des von Mose geschriebenen Buches bei der Bundeslade ein Zusammenhang zur Auffindungslegende in 2Kön 22 hergestellt. Wie der Anhang an das Königsgesetz, der den Königen einen permanenten Gebrauch der Tora vorschrieb, primär dazu dient, den Untergang zu begründen, so dient der Nichtgebrauch des abgeschlossenen von Mose geschriebenen Buches dazu, das Exil zu erklären, zugleich aber für die intendierten Adressaten ein neuerliches Exil zu vermeiden.
Eingebunden in Dtn 31 ist die Abfassungsnotiz des Moseliedes, was von Jhwh zuvor in Dtn 31,19 befohlen wird. Bei diesem handelt es sich zwar nicht um einen deutero-nomischen Text. Doch wichtig ist, dass das Lied, das Mose in Dtn 31,22 aufschreibt, „mit dem in Kap. 32 zitierten Lied als identisch gedacht ist“.210 Die Verschriftung des Liedes durch Mose dient dazu, den Text – sicherlich mit seinen sehr späten Ergänzungen – gegen-über älteren Versionen als authentische Form erscheinen zu lassen.211
Dennoch spielt die Einfügung des Liedes als eines zusätzlichen Verschriftungsaktes auf Befehl Jhwhs hin eine entscheidende Rolle, denn in Dtn 31,24 wird noch einmal zusam-menfassend auf die Verschriftungsakte des Mose zurückgeblickt:
.µmt d[ rps l[ tazh hrwth yrbd ta btkl hçm twlkk yhyw 24
.rmal hwhy tyrb ˆwar yaçn µywlhAta hçm wxyw 25 .d[l ˚b µç hyhw µkyhla hwhy tyrb ˆwra dxm wta µtmçw hzh htwth rps ta jql 26
24 Und es geschah, als Mose fertig war, die Reden dieser Tora auf die Buchrolle bis zum Ende zu schreiben. 25 Da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes Jhwhs tragen: 26 „Nehmt dieses Buch der Tora und legt es an die Seite der Lade des Bundes Jhwhs, eures Gottes, damit es dort Zeuge sei gegen dich.“
Wenn die Phrase hrwth yrbd das ursprüngliche Deuteronomium bezeichnet, während hzh
hrwth rps oder tazh hrwth die umfassende Größe bezeichnet, dann muss man die Abschlussnotiz in Dtn 31,24 so verstehen, dass Mose mit der Aufzeichnung des Liedes das Deuteronomium abschließt. Die Verschriftungsnotiz leitet mit der Formulierung d[l ˚b zu
208 Heckl, Präsentation, 243. 209 Dies ist in der Verlesung der Tora durch Esra in Neh 8 erkennbar, wobei es sich sicher auch um eine
spätere Konzeption handelt. Dennoch bezeugt der Text, dass man die Tora und ihren Gebrauch für die Perserzeit für maßgeblich hielt. Ein weiterer Zeuge allerdings auch indirekter Natur ist Hekataios von Abdera, der in seinem Abschnitt über die Juden in FgrH 264 F 6 (5f.), Folgendes mitteilt: „Er (Hekataios) sagt, dass dieser (der Hohepriester) während der Versammlungen und anderer Zusammenkünfte die Anordnungen vortrage, wobei bei diesem Akt die Juden so folgsam würden, dass sie sich unverzüglich auf die Erde werfen und den Hohepriester, der ihnen (das) vermittelt, anbeten.“ (Übersetzung: Heckl, Abschluss, 191). Vgl. dazu, ders., Esra als Hohepriester, 76.
210 Heckl, Präsentation, 235. 211 Vgl. insgesamt zum Lied Heckl, Präsentation, 231–236.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 221
den V. 27–30 über, die bereits den späteren Ungehorsam des Volkes gegen die von Mose vermittelten Gebote thematisieren, woran sich das Lied anschließt, das dieselbe Funktion hat.
Die Eröffnung von V. 24 mit btkl hçm twlkk yhyw stellt nicht nur einen Zusammenhang zur Abfassung des Liedes, sondern auch zur Abfassung der Tora in Dtn 31,9 her. Die Aufzeichnung des Liedes, das sich für die intendierten Adressaten erst anschließt, gehört zu einem kontinuierlichen Abfassungsgang des Mose hinzu, der sich faktisch parallel zu der Handlung in Dtn 31 vollzieht. Es mag für moderne Leser ein Problem darstellen, dass Mose in dem angeblich von ihm verfassten Text in der dritten Person schreibt, für den antiken Leser dürfte es eine selbstverständliche Zuweisung des Textes zu Mose sein. Diese dient dazu, dem vorliegenden Text eine besondere Dignität zu verleihen, und dies auch und gera-de im Gegensatz zu mindestens einer weiteren noch existierenden abweichenden, kürzeren Fassung des Deuteronomiums.212 Dass der Text danach in Dtn 31,26 wieder vom hzh hrwth rps spricht, den Mose bei der Bundeslade ablegen lässt, zeigt, dass das Deuteronomium hier letztlich tatsächlich nur als Teil eines umfassenden Textes gedacht ist. Es ist in Dtn 31 wie in den spätpersischen bzw. frühhellenistischen Büchern Chronik und Esra/Neh der vorliegende Endtext des gesamten Pentateuchs als Tora des Mose im Blick.
6. Die Hermeneutik im Hintergrund von Moses Schreiben – Synthese
1. An sieben Stellen (Ex 17; 24; 34; Num 33; Dtn 31 [3x]) begegnet uns das literarische Konzept, dass Mose schreibt bzw. auf Befehl Jhwhs schreiben soll. Die Stellen beziehen sich in Exodus bis Numeri jeweils auf bestimmte Passagen des Pentateuchs und behaupten, dass Mose für deren Wortlaut bzw. in Dtn 31 für den Gesamttext verantwortlich ist. Den jeweiligen Kontexten wird mit der Behauptung einer mosaischen Abfassung besondere Autorität zugeschrieben.
2. Eine Zuweisung von Texten und Textabschnitten zu bestimmten Figuren ist nicht auf den Pentateuch beschränkt. So findet sich eine Vielzahl von Psalmen, für die behauptet wird, sie gingen auf bestimmte Figuren der Frühgeschichte und Geschichte Israels zurück.213 In Bezug auf David wird das bspw. in den Zuweisungen von Liedern in den Erzähltexten deutlich (2Sam 22,1; 23,1), in 2Chr 7,6 wird es reflektiert.214 Sodann gibt es eine entsprechende Zuweisung an Salomo über dem Buch der Sprüche, was in 1Kön 5,11–13 erzählerisch entfaltet wird.215 Durchaus solchen Vorstellungen entsprechend muss man
212 Bereits Wellhausen hat eine entsprechende Sicht zur Rezeption des Deuteronomiums vertreten: „Das
Deuteronomium war das alte heilige Buch und genoß das größte Ansehen, es ließ sich nicht durch das neue verdrängen, sondern mußte damit vereinigt werden“ (Wellhausen, Prolegomena, 407f.).
213 Nach Wilson, Editing, 156f. handelt es sich um eine literarische Zuschreibung von Autorschaft, die übergreifenden kompositionellen Zwecken dienen.
214 Die Rabbinen in bBB 14b haben sich bei den Psalmen eine Art Traditionsgeschichte vorgestellt und David als denjenigen gesehen, der die Psalmen als letztes Glied einer Traditionskette verschriftet hat: „David schrieb die Psalmen nach zehn Greisen: Adam, den ersten Menschen, Melchizedek, Abraham, Moseh, Heman, Jeduthun, Asaph, und die drei Söhne Korachs.“
215 Eine ähnliche Vorstellung könnte den Prophetenbüchern zugrunde liegen. Denn in vielen gibt es erzählerische Verse, mit denen die Propheten eingeführt werden. Auch gibt es in den
Raik Heckl 222
die Passagen, in denen Mose schreibt, verstehen. Mose taucht im Kontext der Stellen in Ex–Num nicht nur immer wieder auf, sondern er ist über weite Strecken die Hauptfigur des Pentateuchs und engster Kommunikationspartner Jhwhs.
Wenn von einem Teil des Textes, in dem Mose immer wieder vorkommt, behauptet wird, er sei von ihm verfasst, dann wird die Figur in eine Beziehung zum Gesamtkontext gebracht. Dies zeigte sich bereits in Ex 32,32, wo Mose als literarische Figur seine Existenz thematisiert. Indem an den anderen Stellen behauptet wird, dass Mose in dem Buch, das den intendierten Adressaten vorliegt, selbst schreibt, wird dieses zur Schrift des Mose. Es handelt sich dabei um eine Form symbolischer Repräsentation.216 Die Pragmatik solcher Zuweisungen wird den antiken Adressaten bewusst gewesen sein. Denn sie entspricht dem, was die Thematisierung von Schriftlichkeit auch in anderen Bereichen des Pentateuchs erkennen lässt.
Dass zwischen Mose und den intendierten Adressaten eine Vielzahl von Schreibern steht, dürfte der Realität der Abfassung von Dokumenten in der Antike entsprechen, die im Namen von Personen verfasst sind, die u.U. nicht schriftkundig waren. Sehr aufschlussreich ist in dieser Hinsicht die bekannte Bemerkung über „den Lügengriffel der Schriftgelehrten“ (Jer 8,8). Vor welchen konkreten Auseinandersetzungen Jeremia bzw. seine Rezipienten mit dieser Formulierung auch stehen mögen,217 so ist doch deutlich, dass der Vers es als selbstverständlich voraussetzt, dass reale Schreiber an der Tora arbeiten. Mehr noch, die Kritik ergibt nur Sinn, wenn diese Schreiber nicht im eigenen Namen tätig waren.
3. Das Konzept der späten Verschriftungsnotizen schließt sich unmittelbar an das priesterliche Vermittlungskonzept an, das die priesterlichen Texte zwischen Exodus und Numeri durchzieht,218 nur dass man Mose nun nicht mehr nur im Anschluss an das Deuteronomium als sprechenden Übermittler des Gotteswillens an die Israeliten oder an die Priesterschaft, sondern als schreibenden Übermittler in den Blick nimmt.
4. Die direkte Zuschreibung von Textabschnitten zu Mose muss im Zusammenhang mit einer älteren Vorstellung von einem göttlichen Ursprung der Grundlagen des Pentateuchs stehen. Wie Thot „als Schreiber der Gottesworte“ Urheber religiöser Bücher in Ägypten war, wurden religiöse Texte im Alten Israel direkt mit Jhwh in Verbindung gebracht.
Es ist in erster Linie der Dekalog, von dem in der Hebräischen Bibel ein göttlicher Ursprung behauptet wird. Allerdings geht die Einfügung des Dekalogs in das Deuteronomium bereits mit dem Versuch einher, seinen Umfang, Wortlaut und theo-logische Bedeutung mit der Autorität des Mose zu umgrenzen. Die Formulierung des Dekalogs als „geschrieben mit dem Finger Gottes“ könnte nach J. Maier Metapher für einen ursprünglich eher vagen Zusammenhang des Textes mit der Gottheit sprechen.219
Prophetenbüchern oft erzählerische Passagen, die den Propheten selbst reflektieren. Dennoch wird der Inhalt dieser Bücher ganz unter den Namen des jeweiligen Propheten gestellt. Man vergleiche z.B. das Jeremiabuch, das, obwohl es mit דברי ירמיהו eröffnet wird, bereits in Jer 1,11 Jeremia im Erzähltext erwähnt.
216 Eine solche sah schon Bertholet, Macht der Schrift, 9 bei den auf Thot zurückgeführten Schriften in Ägypten.
217 Otto, Mose, 78, sieht „zahlreiche Aufhebungen der mosaischen Tora des Pentateuch“ in Jer 30f. mit der Bemerkung in einem Zusammenhang.
218 Vgl. dazu oben 199ff. 219 Vgl. oben Anm. 65.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 223
Denn auch in Ägypten kann der Verweis auf den Finger eines Gottes im übertragenen Sinne eine göttliche Beteiligung bezeichnen. Die Vorstellung vom göttlichen Ursprung des Dekalogs hängt also mit einer entsprechenden Bewertung von Teilen der dem Pentateuch zugrundeliegenden Literatur zusammen, was sich noch in Ex 32,32; Jos 24,26, aber auch in Erwähnungen der Weisung Gottes bzw. Jhwhs wie in Hos 4,6; Am 2,4 oder Ps 1,2; 37,31 u.ö. zeigt.
Wichtig für das Verständnis des Pentateuchs ist Ex 32,32. Dort kommt Mose als ‚Gegenstand‘ eines von Gott geschriebenen Buches vor, womit auf den Text angespielt wird, der den intendierten Adressaten vorliegt. Diese und die genannten Stellen außerhalb des Pentateuchs sprechen für die Existenz einer älteren mythisch geprägten Vorstellung von einem göttlichen Ursprung der religiösen Literatur in Israel, die von den späten Verschriftungsnotizen mit Mose abgelöst wurde.220
5. Angesichts der Traditionsgeschichte sollten wir die Erkenntnisse der Exegese über den historischen Ursprung des Pentateuchs nicht von vornherein mit der Intention des Buches verbinden, wie es seit der Aufklärung221 geschieht: „Will man […] den Pentateuch als Ganzes auf Mose als den einzigen Verfasser zurückführen, dann steht man [neben dem disparaten Charakter des Werkes, R.H.] vor einem nicht minder großen Problem, nämlich der schon als klassisch zu bezeichnenden Frage, wie denn Mose (der in der Tradition zum Verfasser dieses Werkes geworden ist) über seinen eigenen Tod hätte berichten können.“222 Mose kann nicht der Verfasser des Pentateuchs gewesen sein, und dennoch existieren darin Zuschreibungen an ihn. Mit ihnen wollte man den Pentateuch als Moses Schrift ausweisen.223 Auch im Alten Ägypten hat man sich nicht an der Zuschreibung von Text-teilen zu Thot gestoßen, obwohl dieser darin als Figur erwähnt war. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei den Zuschreibungen zu Mose um eine symbolische Repräsentation. In den späten priesterlich geprägten Abschlusstexten des Pentateuchs wird bewusst dieses Konzept entwickelt und dem Pentateuch damit ein mosaischer Charakter verliehen. Der Zusammenhang mit dem in der Umwelt und im Alten Israel anzutreffenden Konzept des göttlichen Textes zeigt, dass Mose als menschlicher prophetischer Schreiber des Penta-teuchs ein Konzept ist, das eine mythenkritische Historisierung auf dem Boden des ent-stehenden Monotheismus beinhaltet.224
6. Die Stellen, an denen Mose schreibt, sind auf Inhalte des Deuteronomiums gerichtet. Offenbar besaßen jene in den Kreisen, die man auch mit den Texten in Exodus–Numeri erreichen wollte, eine besondere Bedeutung. Für alle behandelten Stellen existieren im Deuteronomium abweichende Versionen oder Aussagen. Die Behauptung der mosaischen
220 Dieses Verfahren liegt auf einer Ebene mit dem priesterlichen Umgang mit den mythischen
Überlieferungen bei der Formulierung des priesterlichen Schöpfungsberichtes. „Mythische Tradition und die Anfänge einer als naturkundlich-technisch zu bezeichnenden Weltsicht [werden] zu einem Weltbild verbunden [...], das gleichermaßen mythologisch wie naturkundlich ‚exakt‘ ist“ (Gertz, Antibabylonische Polemik, 153).
221 Siehe den Überblick oben, Anm. 1. 222 Dohmen / Oeming, Biblischer Kanon, 54f. 223 Schon Bertholet, Macht der Schrift, 33 vermutete nach einer Diskussion von Zuschreibungen
in anderen Religionen auch für den Pentateuch etwas Vergleichbares. 224 Als eine Historisierung sieht auch Reuter, Konzepte, 71f. die wachsende Zuweisung von
Überlieferungen zu Mose an.
Raik Heckl 224
Verfasserschaft im Tetrateuch wird damit den mündlich im Deuteronomium von Mose vorgetragenen Inhalten gegenübergestellt. Da Mose als fiktiver Sprecher im Deutero-nomium schon die Inhalte mit einer hohen Autorität vorträgt, greift man auf seine Autorität als Schreiber zurück. Dies hat auch mit der festgestellten außerordentlich hohen Bedeutung des Schreibens in administrativen, rechtlichen und religiös/kultischen Zusammenhängen zu tun. So wird es gegenüber dem Deuteronomium möglich, einen kritischen Akzent zu setzen, um seine Inhalte (trotz seiner bereits akzeptierten Autorität) zu korrigieren.
Bei den Stellen im Deuteronomium, die durch Ex 17; 24; 34; Num 33 in den Blick kommen, handelt es sich jeweils um Rückverweise auf Zusammenhänge, die vermutlich in einer früheren Fassung bereits ihren Platz in der Pentateuchüberlieferung hatten. Die wichtigste Beziehung ist sicher jene zum Bundesbuch, das vom Deuteronomium rezipiert und zugleich zurückgedrängt wurde, dem nun aber als von Mose geschriebener Text zusammen mit den anderen Texten der vorderen Sinaiperikope wieder zu einer literarischen Bedeutung verholfen wird. Mose als Schreiber zeugt gegen Mose als Sprecher. Sein eigenes Reden im Deuteronomium wird durch die angeblich von ihm vorher aufge-zeichneten Inhalte als perspektivische, rudimentäre Präsentation in der Situation am Tage seines Todes unmittelbar vor der Landnahme erwiesen. Ältere vom Dtn kritisierte oder außer Acht gelassene Traditionen konnten so in ein Gesamtkonzept des Ursprungs Israels und seiner Gottesbeziehung integriert werden – im priesterlichen Konzept eines inklusiven Monotheismus, wobei diese Texte sicher nicht unverändert geblieben sind.225
7. Die Entwicklung des Konzeptes einer höheren Autorität der von Mose geschriebenen Texte226 hat nicht nur auf das Deuteronomium, das mit einem ‚prophetischen Mose‘, der die Authentizität der Texte des Deuteronomiums bezeugt, zurückgegriffen.227 In Aus-einandersetzung mit dem Deuteronomium haben die priesterlichen Autoren ein grund-legendes Konzept entwickelt. Dieses ist über die Verschriftungsnotizen hinaus in den vielen priesterlichen Texteröffnungen erkennbar, in denen Mose als konkreter Vermittler von Gesetzen zu Volk und Priesterschaft vorgestellt wird, Mose als alleiniger Vermittler zwi-schen Jhwh und Israel.
8. Deutlich ist, dass das Motiv „Mose als Schreibender“ ausgeweitet worden ist. In Ex 17 handelt es sich lediglich um einige Verse. In ihnen wird eine in Dtn 25 erwähnte Niederlage nahezu in einen Sieg umgemünzt, ohne dass man die Aussagen in Dtn 25 als unzutreffend ansehen muss. Ex 24 hat das Konzept des Bundesschlusses im Blick und revidiert das Konzept von Dtn 5 von der Tradition der Sinaiperikope her, wobei jedoch zugleich auch der dtr Dekalog rezipiert und aktualisiert wurde. Das Gleiche gilt in Ex 34, wo eine regelrechte Bundeserneuerungsszene mit einer sowohl an das Deuteronomium als auch an das Bundesbuch angelehnten späteren Gebotsreihe dem Dekalog als Bundes-dokument an die Seite gestellt wird. In Num 33 dient „Mose als Schreiber“ nicht mehr nur als Autorität für eine einzelne Textpassage. Mit einem dem priesterlich abgeschlossenen Aufriss von Ex 12–Num 32 entsprechenden Itinerar wird den Büchern Exodus bis Numeri indirekt die Autorität der mosaischen Verfasserschaft zugewiesen. Es scheint sogar so, als bringe man die priesterliche, systematisierende Redaktion an den Büchern Exodus Numeri
225 Vgl. dazu weiter Heckl, Exposition, 30. 226 Siehe oben, 204–216. 227 Siehe dazu oben, 200.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 225
mit Mose in einen Zusammenhang. Eine Art von Supplementation, ein herausgeberischer Akt, der neue und alte Texte zusammengefügt und nach einem Itinerar angeordnet hat, wird mit dem Erzpropheten Mose verbunden. In jedem Fall wird an dieser Stelle mit Mose als Autor zwischen den priesterlich abgeschlossenen Wüstenwanderungstexten und dem dtr Deuteronomium mit seinen völlig anders gearteten Geschichtsrückblicken vermittelt.228
Dtn 31 stellt demgegenüber den letzten und auch für die Wirkungsgeschichte ent-scheidenden Schritt dar. Dies ist bereits daran erkennbar, dass in dem Kapitel mehrere Ver-schriftungsnotizen zu finden sind. Spätestens in Dtn 31,24 wird Mose nicht mehr nur für das Abfassen von Teiltexten, sondern für einen Gesamttext verantwortlich gemacht. Unter Rückgriff auf eine ältere Ätiologie des dtr Deuteronomiums wird nun behauptet, dass Mose einen umfänglicheren Text selbst hergestellt hat, was den priesterlich abgeschlossenen Text gegenüber seinen Vorstufen mit der Autorität Moses als Verfasser versieht. M.E. bezieht sich die Verschriftungsnotiz in Dtn 31, die wohl zu den letzten Texten des Pentateuchs in der spätpersischen Zeit gehört, nicht mehr nur auf das Buch Deuteronomium. Vielmehr behaupten die priesterlichen Autoren, die das Deuteronomium in den Gesamttext des Penta-teuchs integrierten, dass Mose es ursprünglich als Teil eines größeren Ganzen geschaffen hat.
9. Offenbar haben die priesterlichen Autoren am Endtext des Pentateuchs allmählich ein umfassendes hermeneutisches Konzept entwickelt. Das Konzept der mosaischen Ver-fasserschaft von Teilen des Pentateuchs – und in Dtn 31 für den Gesamttext – soll zwischen einer älteren Zuschreibung der religiösen Vorlagen des Pentateuchs zu Jhwh und einer im Zuge der Entstehung des Monotheismus aufkommenden Mythenkritik vermitteln. Auffällig ist ja, dass trotz der hohen Bewertung des Dekalogs im Deuteronomium dieser dort ausschließlich über die Vermittlung des Mose in seiner im Deuteronomium definierten Gestalt zu den intendierten Adressaten gelangt.229 Dabei wird das ältere Konzept eines gött-lichen Ursprungs der religiösen Literatur – nach Ps 1,2 und Jos 24,26 der Tora Gottes – nicht einfach nur ersetzt, sondern in das neue Konzept überführt. Der sicherlich in seiner jetzigen Form späte Vers Ex 24,12 zeugt davon, dass Jhwh die Übergabe des Gottestextes an Mose in Aussicht stellt.230 Doch kommt es – wohl aufgrund der Sünde des Volkes in Ex 32 – nicht zu einer Übergabe und so ist der Text, der mit Mose verbunden wird, als Substitut eines Textes gedacht, in dessen Besitz Israel nicht kommt.
10. Das priesterliche Konzept integrierte am Ende auch das Deuteronomium in den abgeschlossenen Pentateuch. Es wird Teil der von Mose geschriebenen Tora. Wie ist es nun
228 Schon diese nachvollziebare Entwicklung innerhalb von Exodus-Numeri zeigt, dass die Einschätzung
von Schniedewind, Textualization, 154: „While P obviously comes to be a written text, P is not conspicuous about its own textuality. This latter point is particularly noteworthy when we consider the prominent place of the written Torah in Ezra-Nehemiah (and Chronicles), that is, in the post-exilic priestly literature.“ nicht stimmt. Im Gegenteil: Offensichtlich ist in den priesterlichen Texten bereits dasselbe Konzept wie in Esra / Nehemia enthalten.
229 Zu den unterschiedlichen Fassungen und dem Vermittlungskonzept der priesterlichen Autoren vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 370f.
230 Utzschneider, Heiligtum, 114.f. hat überlegt, ob dem Vers die Vorstellung zugrunde liegt, dass in der Bundeslade nicht nur die Dekalogtafeln, sondern auch andere religiöse Texte lagen. Die Existenz einer solchen Vorstellung könnte zusätzlich erklären, warum das Deuteronomium darauf insistiert, dass nur der Dekalog von Gott stammt.
Raik Heckl 226
aber verstanden, angesichts dessen, dass man immer wieder seine Aussagen relativiert und zwischen ihnen und priesterlich ergänzten Aussagen in Exodus–Numeri vermittelt? M.E. gibt der Eröffnungsvers der ersten Moserede des Deuteronomiums (Dtn 1,5) Aufschluss. Der Vers liegt nicht nur im Übergangsbereich zwischen dem Numeribuch und dem Deu-teronomium, zu dem mit Dtn 1,3f. deutlich priesterlich geprägte Formulierungen gehören, die das Deuteronomium inhaltlich mit der Chronologie von Exodus–Numeri verbinden. Dtn 1,5 hat also in jedem Fall eine Bedeutung auf der letzten kompositorischen Ebene des Buches, auch wenn der Vers möglicherweise auf eine ältere Formulierung zurückgehen mag.231
Mit Eckart Otto ist zunächst daran festzuhalten, dass Moses Handlung „Erklärung, Erläuterung“ ist.232 Objekt seines Handelns – das, was Mose erklärt – und dessen Ergebnis müssen unterschieden werden. Nach allen Regeln von Kohärenz und Grammatik muss die Erklärung, der Kommentar, mit der Moserede beginnen. Das Objekt kann entsprechend nichts sein, das erst viel später etwa in Dtn 5,1 folgt.233 Auch aus logischen Gesichtspunk-ten ist es nicht möglich, dass 4,44 mit tazh hrwth dieselbe Größe bezeichnet, denn dort wird eingeschränkt und von der Tora geredet, die Mose den Israeliten vorgelegt hat. Diese Tora (tazh hrwth) in 1,5 wird von einer Tora, die Mose den Israeliten nach 4,44 vorgelegt hat, unterschieden. Für E. Otto legte es sich zunächst aufgrund der großen Bedeutung der Horeb-Geschehnisse nahe, dass mit tazh hwrth die Gesetzeskorpora am Sinai bzw. die am Sinai mündlich geäußerten Gesetze gemeint sind. Doch liegen jene sehr weit entfernt und das tazh suggeriert, dass diese Tora für die intendierten Adressaten direkt im Kontext greifbar ist. Von daher ist anzunehmen, dass entsprechend dem Konzept der Schriftlichkeit auf den den intendierten Adressaten bis Num 36,13 vorliegenden Text verwiesen ist. Letzt-lich deckt sich die hier vorgelegte These mit Ottos Sicht. Denn in Ex – Num kommt den
231 Nach Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 173 gehört der Vers zur Pentateuchredaktion. Ich bin
nach wie vor der Überzeugung, dass die Formulierung התורה הזאת sich in der dtr Eröffnung des Deuteronomiums mit dem Rückblick Dtn 1–3 ursprünglich auf die nachfolgende Gottestora (Dtn 1,6– 8) gerichtet haben könnte, die von Mose mit seiner Erzählung Dtn 1,6–3,29 erklärt wird. Denn die Geschichte begründet synchron das erste Mal im Deuteronomium, wie Mose in seine Ver- mittlungsrolle gekommen ist. Vgl. Heckl, Moses Vermächtnis, zusammenfassend: 443f. Ohne Dtn 1,5 oder eine äquivalente Formulierung fehlt der ersten Moserede eine Redeeinleitung. Vgl. ebd., 69.73.
232 Mit Otto, Schriftgelehrte, 482–486; vgl. Heckl, Moses Vermächtnis, 63f. Der Vorschlag von Braulik/ Lohfink, Rechtskraft, 246f. die Semantik von באר in Anschluss an das Akkadische mit „Rechtskraft verleihen“ wiederzugeben, sucht die Zurückweisung einer älteren These, באר bezeichne das Schreiben (Mittmann, Deuteronomium, 14f.), zu umgehen. Vgl. auch Schaper, Publication, 229f.; Finsterbusch, Deuteronomium, 53f. Die These beachtet aber nicht Syntax und Funktion von Dtn 1,5. anschließende Text stellt das לאמר als Objekt bezeichnet, und der sich an את ist mit התורה הזאת Ergebnis der mit באר bezeichneten Handlung des Auslegens dar (mit Otto).
233 In Anschluss an Braulik / Lohfink, Rechtskraft, 247 formuliert Schaper, Publication, 229: „Deut 1:5 cannot refer back to Numbers and Leviticus but must refer to the ‚Torah‘ that follows. It is best understood as cataphorically referring to the Torah of Deuteronomy 5–28 […].“ Er sieht einen Zusammenhang von Dtn 1,5; 27,8 mit Dtn 4,44, das auf den Korpus des Dtn verweise. Doch gerade in Dtn 1,5 ist wie in Dtn 4,44 die Nahdeixis verwendet. Daher bezieht sich der Wortlaut von 4,44 זאת in תורה הזאת zwar auf den direkt nachfolgenden Text voraus, doch התורה אשר שם משה לפני בני ישראל Dtn 1,5 kann gerade nicht dieselbe Größe bezeichnen.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 227
bereits in ihrem direkten Kontext als schriftlich ausgewiesenen Texten der Sinaitora besondere Bedeutung zu.234
Das Deuteronomium an der Schnittstelle zwischen Num 36,13 und Dtn 1,1 wird als perspektivische Auslegung des Mose erwiesen. Zusammen mit den restlichen Schriften des Pentateuch schriftlich von Mose niedergelegt, ist es als mosaische Auslegung zugleich doch Teil der Tora. Als schriftliche Form der mündlichen Auslegung der schriftlich nieder-gelegten Tora wird das Deuteronomium, wenn man so will, zu deren Schlussstein.
11. Der Blick auf den Ursprung der jüdischen Hermeneutik der Tora und ihre Hintergründe macht deutlich, dass nicht erst die Stellen, an denen Mose schreibt, die Ursache für die Sicht sind, dass der Pentateuch traditionell (innerbiblisch bereits in Esra / Nehemia und Chronik235) auf Mose zurückgeführt wird. Diese Stellen sind bereits eine Reaktion auf die Zuweisung der Texte zu Jhwh und auch auf die bereits existierende besondere Rolle des Mose. Wahrscheinlich war auch die Zuschreibung von Texten zu Mose ausgehend vom Deuteronomium bereits im Gange, was ältere Vorstellungen eines gött-lichen Ursprungs der religiösen Texte ablöste.236
Das dtr Deuteronomium griff nur auf das Motiv „Gott als Schreiber“ zurück.237 Bereits sein exilischer Bestand stellte eine literarische Stufe dar, auf der mythische Vorstellungen vom Schreiben der Gottheit abgelöst und in das prophetische Konzept des sprechenden Mose integriert wurden. Auch von einer speziellen Theologie des Schreibens ist im Deute-ronomium und im Pentateuch eher nicht zu sprechen,238 sondern allenfalls von einer Inanspruchnahme des Schreibens für die Auseinandersetzungen in der Theologie und für eine umfassende Zusammenstellung der religiösen Traditionen des Alten Israels.239 Dies geschah allerdings in einer Weise, die der hohen Bedeutung der Schriftlichkeit in Israel bis zur spätpersischen Zeit Rechnung trug.240
234 An anderer Stelle (Otto, Deuteronomium im Pentateuch, 183) stellt Otto fest, dass „in der Welt des
Mose […] der hr:/Th rp,se (Dtn 28,58.61; 29,19.20.26; 30,10) das von Mose verschriftete Bundesbuch [ist]“. Allerdings wird dort (noch) nicht der Begriff Tora verwendet, was zeigt, dass sich das priesterliche Konzept des Abschlusses der Tora in Ex 24,4 noch im Werden befindet.
235 Vgl. Heckl, Augenzeugenschaft, 355–357 und summarisch Moenikes, Tora ohne Mose, 195: „Während in der nachexilischen chronistischen Geschichtsschreibung (wie zuvor bereits im Talmud und in der Griechischen Bibel) unter der Mose-Tora der Pentateuch verstanden wird, schreiben die in ihrem Grundbestand vorexilischen Bücher Josua und Könige wie auch einige Stellen des Deutero- nomiums der Mose-Tora nur das Buch Deuteronomium (in welchem entstehungsgeschichtlichen Stadium auch immer) zu.“
236 Die bei Philo von Byblos anzutreffende Sicht, dass Sanchuniathon die Schriften des Thot verarbeitet hat, dürfte auf einen vergleichbaren Prozess in der phönizischen Literatur hindeuten. Vgl. dazu oben, 198.
237 Es steht nicht im Vordergrund des Deuteronomiums. Anders Schaper, Theology of Writing, 110, vgl. dazu oben, Anm. 124 und 200ff.
238 Schaper, Theology of Writing, 115 vermutet, dass die priesterlichen Autoren am Deuteronomium den schriftlichen Charakter der Offenbarung zu unterstreichen suchten: „They [the priestly circles, R.H.] were, of course, aware of the primacy of the oral word. But they missed no opportunity to underline their status as guardians of the written word, of the textualized revelation, by depicting not just Moses and Joshua but indeed YHWH himself as engaged in scribal activity.“
239 Siehe zur Diskussion der Thesen von J. Schaper und J. Assmann oben, 200f. und Anm. 123. 240 Dafür spricht, dass das Schreiben mehrfach als integraler Bestandteil von verschiedenen Handlungen
angesehen wird. Siehe dazu oben, 183ff.
Raik Heckl 228
12. Methodisch zeigt der Weg, der in den biblischen Texten zu dem übergreifenden hermeneutischen Konzept führt, dass es bei der Erfassung der Literargeschichte darauf ankommt, die in den Texten enthaltenen Vermittlungskonzepte aufzudecken. Denn die Autoren wollten den intendierten Adressaten ihren neuen Text gegenüber seinen literarischen Vorstufen plausibilisieren.241 Auf der synchronen Ebene werden so die pragmatischen Aspekte der Diachronie der Texte deutlich.242
241 Zumindest auf den letzten Stufen des Pentateuchs lässt sich also ausschließen, dass sich literarische
Arbeit nur innerhalb der Schreiberstuben vollzogen hat, ohne dass die Texte ‚hinausdrangen‘, wie van der Toorn, Scribal Culture, 128 annimmt: „Such editing should not be confused with publishing; textual revisions and expansions performed in the course of a new edition usually remained within the confines of the scribal elite.“ Eher ist dem Konzept von Carr, Writing, 159 zu folgen, „that successive generations of master Israelite scribes revised and augmented this education-enculturation curriculum as conditions changed“.
242 Darauf hat Otto, Rechtshermeneutik, 75 erstmals aufmerksam gemacht: „Widersprüche und Spannungen im Pentateuch sollten […] als gezielt für den Leser stehen gelassene oder in der Mehrzahl sogar bewusst eingefügte Marker begriffen werden, die den Leser in die Lage versetzen sollen zu erkennen, dass die Erzählungen nicht in der erzählten Zeit allein ihren Horizont haben, sondern eine hermeneutische Strategie der Applikabilität auf die Erzählzeit als die des Lesers verfolgen, also ein tua res agitur zum Ausdruck bringen wollen, wenn sie von der Mosezeit erzählen.“
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 229
6. Literatur Achenbach, R.: The Protection of Personae miserae in Ancient Israelite Law and Wisdom and in the
Ostracon from Khirbet Qeiyafa, Sem. 54, 2012, 93–125. — Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des Numeribuches im Kontext von
Hexateuch und Pentateuch (BZAR 3), Wiesbaden 2003. Albright, W. F.: Yahweh and the Gods of Canaan. A Historical Analysis of two Contrasting Faiths,
Winona Lake (IN) 1968. Amit, Y.: Reading Biblical Narratives. Literary Criticism and the Hebrew Bible, Minneapolis (MN)
2001. Arnold, B. T.: Deuteronomy as the Ipsissima Vox of Moses, Journal of Theological Interpretation 4,
2010, 53–74. Assmann, J.: Altorientalische Fluchinschriften und das Problem performativer Schriftlichkeit. Vertrag
und Monument als Allegorien des Lesens, in: Gumbrecht, H. U. / Pfeiffer, K. L. (Hg.): Schrift (Materialität der Zeichen A 12), München 1993, 233–255.
— Fünf Stufen auf dem Wege zum Kanon. Tradition und Schriftkultur im frühen Judentum und seiner Umwelt, Münster 1999.
— Die mosaische Unterscheidung. oder der Preis des Monotheismus (Edition Akzente), München 2003.
— Theologie und Weisheit im alten Ägypten, Paderborn 2005. — Zur Verschriftung rechtlicher und sozialer Normen im Alten Ägypten, in: Gehrke, H.-J. (Hg.):
Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich (ScriptOralia 66 Reihe A, Altertumswissenschaftliche Reihe 15), Tübingen 1994, 61–85.
Attridge, H. W. / Oden, R. A.: Philo of Byblos. The Phoenician History. Introduction, Critical Text, Translation, Notes (CBQ.MS 9), Washington D.C 1981.
Aurelius, E.: Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament (CB.OT 27), Stockholm 1988.
Berlejung, A.: Der gesegnete Mensch. Text und Kontext von Num 6,22–27 und den Silberamuletten von Ketef Hinnom, in: Berlejung, A. / Heckl, R. (Hg.): Mensch und König. Studien zur Anthropologie des Alten Testaments. FS R. Lux (HBS 53), Freiburg im Breisgau 2008, 37–62.
— Zeichen der Verbundenheit und Medien der Erinnerung. Zur Religionsgeschichte und Theologie von Dtn 6,6–9 und verwandten Texten, in: Berlejung, A. / Heckl, R. (Hg.): Ex oriente lux. Studien zur Theologie des Alten Testaments. FS R. Lux (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 39), Leipzig 2012, 131–165.
Berner, C.: Die Exoduserzählung. Das literarische Werden einer Ursprungslegende Israels (FAT 73), Tübingen 2010.
— Das Wasserwunder von Rephidim (Ex 17,1–7) als Schlüsseltext eines nachpriesterschriftlichen Mosebildes, VT 63, 2013, 193–209.
Bertholet, A.: Die Macht der Schrift in Glauben und Aberglauben (ADAW.PH), Berlin 1948/1. Blum, E.: Historiographie oder Dichtung? Zur Eigenart alttestamentlicher Geschichtsüberlieferung,
in: Blum, E. / Johnstone, W. / Markschies, C. / Hardmeier, C. (Hg.): Das Alte Testament – ein Geschichtsbuch? Beiträge des Symposiums „Das Alte Testament und die Kultur der Moderne“ anlässlich des 100. Geburtstags Gerhard von Rads (1901–1971), Heidelberg, 18.–21. Oktober 2001 (atm 10), Münster 2005, 65–86.
— Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin u.a. 1990. Bonnet, C. / Niehr, H.: Phönizier, Punier, Aramäer (KStTh 4,2), Stuttgart 2010. Braulik, G. / Lohfink, N.: Deuteronomium 1,5 tazh hrwth ta rab „er verlieh dieser Tora Rechtskraft“,
in: Lohfink, N.: Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur V (SBAB 38), Stuttgart 2005, 233–251.
Raik Heckl 230
Carr, D. M.: Mündlich-schriftliche Bildung und die Ursprünge antiker Literaturen, in: Utzschneider, H. / Blum, E. (Hg.): Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006, 183–198.
— Writing on the Tablet of the Heart. Origins of Scripture and Literature, Oxford u.a. 2005. Chapman, S. B.: The Law and the Prophets. A Study in Old Testament Canon Formation (FAT 27),
Tübingen 2000. Conrad, D.: Ostrakon von Jabne-Yam, TUAT I, 249–250. Dexinger, F.: Das Garizimgebot im Dekalog der Samaritaner, in: Braulik, G. (Hg.): Studien zum
Pentateuch. FS W. Kornfeld, Wien 1977, 111–133. Dohmen, C.: Exodus 19–40 (HThKAT), Freiburg im Breisgau u.a. 2004. — Mose. Der Mann, der zum Buch wurde (Biblische Gestalten 24), Leipzig 2011. — „Mose schrieb diese Tora auf“ (Dtn 31,9). Auf der Suche nach dem biblischen Ursprung der
Vorstellung von der mosaischen Verfasserschaft des Pentateuch, in: Achenbach, R. / Arneth, M. (Hg.): „Gerechtigkeit und Recht zu üben“ (Gen 18,19). Studien zur altorientalischen und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israels und zur Religionssoziologie. FS E. Otto (BZAR 13), Wiesbaden 2009, 256–265.
— / Oeming, M.: Biblischer Kanon, warum und wozu? Eine Kanontheologie (QD 137), Freiburg im Breisgau u.a. 1992.
Dozeman, T. B.: The Book of Numbers, The New Interpreter’s Bible XII, Nashville 1998, 1–268. Ebach, J.: Weltentstehung und Kulturentwicklung bei Philo von Byblos. Ein Beitrag zur
Überlieferung der biblischen Urgeschichte im Rahmen des altorientalischen und antiken Schöpfungsglaubens (BWANT 108), Stuttgart u.a. 1979.
Finsterbusch, K.: Deuteronomium. Eine Einführung (UTB 3626), Göttingen 2012. Fischer, A. A.: Der Text des Alten Testaments. Neubearbeitung der Einführung in die Biblia Hebraica
von Ernst Würthwein, Stuttgart 2009. Gertz, J. C.: Antibabylonische Polemik im priesterlichen Schöpfungsbericht?, ZThK 106, 2009, 137–
155. — Tradition und Redaktion in der Exoduserzählung. Untersuchungen zur Endredaktion des
Pentateuch (FRLANT 186), Göttingen 2000. — u.a.: Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte
des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen 32009. Gesenius, W. / Kautzsch, E.: Hebräische Grammatik, Leipzig 281909. Gesundheit, S.: The Festival Calendars in Exodus XXIII 14–19 and XXXIV 18–26, VT 48, 1998,
161–195. — Intertextualität und literarhistorische Analyse der Festkalender in Exodus und im Deuteronomium,
in: Blum, E. / Lux, R. (Hg.): Festtraditionen in Israel und im Alten Orient (VWGTh 28), Gütersloh 2006, 190–220.
Glück, H.: Schrift und Schriftlichkeit. Eine sprach- und kulturwissenschaftliche Studie, Stuttgart 1987.
Gray, G. B.: Numbers (ICC), Edinbourgh 21912. Hänsel, L.: Studien zu „Tora“ in Esra-Nehemia und Chronik. Erwägungen zur Bezugnahme auf ,תורה
.in Esra-Nehemia und Chronik im Horizont frühjüdischer Texte, Leipzig 1999 משפט, דבר, מצוה, חוקHardmeier, C.: König Joschija in der Klimax des DtrG (2Reg 22f.) und das vordtr Dokument einer
Kultreform am Residenzort (23,4–15*), in: Lux, R. (Hg.): Erzählte Geschichte. Beiträge zur narrativen Kultur im alten Israel (BThS 40), Neukirchen-Vluyn 2000, 81–145.
— Prophetie im Streit vor dem Untergang Judas. Erzählkommunikative Studien der Jesaja- und Jeremiaerzählungen in II Reg 18–20 und Jer 37–40 (BZAW 187), Berlin u.a. 1990.
Heckl, R.: Augenzeugenschaft und Verfasserschaft des Mose als zwei hermeneutische Konzepte der Rezeption und Präsentation literarischer Traditionen beim Abschluss des Pentateuchs, ZAW 122, 2010, 353–373.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 231
— Die Exposition des Pentateuchs. Überlegungen zum literarischen und theologischen Konzept von Genesis 1–3, in: Berlejung, A. / Heckl, R. (Hg.): Ex oriente lux. Studien zur Theologie des Alten Testaments. FS R. Lux (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 39), Leipzig 2012, 3–37.
— Eine Kultstätte auf dem Ebal? Josua 8,30–35 und der Streit mit Samaria um die Auslegung der Tora, ZDPV 129, 2013, 79–98.
— Moses Vermächtnis. Kohärenz, literarische Intention und Funktion von Dtn 1–3 (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 9), Leipzig 2004.
— Die Präsentation tradierter Texte in Dtn 31 zur Revision der dtr Geschichtstheologie, in: Fischer, G. / Markl, D. / Paganini, S. (Hg.): Deuteronomium – Tora für eine neue Generation (BZAR 17), Wiesbaden 2011, 227–246.
— The Song of Heshbon (Num 21:27–30). Its Context and its Original Place in the Ancient Literature of Israel, in: Human, D. (Hg.): Psalmody and Suffering, in Druck.
— Überlegungen zum Schriftverständnis aus alttestamentlicher Perspektive, in: Bolín, N. (Hg.): Im Klang der Wirklichkeit. Musik und Theologie. FS M. Petzoldt, Leipzig 2011, 213–225.
— Wann ist mit dem Abschluss des Pentateuchs zu rechnen? Zur Bedeutung von Hekataios von Abdera für die Literargeschichte Israels, WdO 39, 2009, 184–204.
Herodot: Herodot Historien. Griechisch-deutsch, hg. von J. Feix, München 1968. Hornung, E.: Das Totenbuch der Ägypter (BAW.AO), Zürich 1979. Hossfeld, F.-L.: Der Dekalog. Seine späten Fassungen, die originale Komposition und seine
Vorstufen (OBO 45), Freiburg (Schweiz) u.a. 1982. Houtman, C.: Exodus I–IV (Historical Commentary on the Old Testament), Leuven 1993–2002. Houtman, C.: Der Pentateuch. Die Geschichte seiner Erforschung neben einer Auswertung
(Contributions to Biblical Exegesis and Theology 9), Kampen 1994. Jacob, B.: Das Buch Exodus, Stuttgart 1997. Jamieson-Drake, D. W.: Scribes and Schools in Monarchic Judah. A Socio-Archeological Approach
(JSOT.S 109), Sheffield 1991. Jeremias, J.: Der Prophet Hosea (ATD 24,1), Göttingen 1983. Keel, O.: Zeichen der Verbundenheit. Zur Vorgeschichte und Bedeutung der Forderungen von Dtn
6,8f. und par, in: Casetti, P. / Keel, O. / Schenker, A. (Hg.): Mélanges Dominique Barthélemy (OBO 38), Freiburg (Schweiz) u.a. 1981, 159–240.
Knauf, E. A.: Josua (ZBK 6), Zürich 2008. — Die Umwelt des Alten Testaments (NSK.AT 29), Stuttgart 1994. Köckert, M.: Wie kam das Gesetz an den Sinai?, in: Köckert, M.: Leben in Gottes Gegenwart.
Studien zum Verständnis des Gesetzes im Alten Testament (FAT 43), Tübingen 2004, 167–181. Koep, L.: Das himmlische Buch in Antike und Christentum. Eine religionsgeschichtliche
Untersuchung zur altchristlichen Bildersprache (Theoph. 8), Bonn 1952. Konkel, M.: Sünde und Vergebung. Eine Rekonstruktion der Redaktionsgeschichte der hinteren
Sinaiperikope (Exodus 32–34) vor dem Hintergrund aktueller Pentateuchmodelle (FAT 58), Tübingen 2008.
Kratz, R. G.: Der Dekalog im Exodusbuch, VT 44, 1994, 205–238. — „Höre Israel“ und Dekalog, in: Dohmen, C. / u.a. (Hg.): Die Zehn Worte. Der Dekalog als Testfall
der Pentateuchkritik (QD 212), Freiburg im Breisgau 2005, 77–86. — Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments. Grundwissen der Bibelkritik
(UTB 2157), Göttingen 2000. Kraus, H.-J.: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-
Vluyn 31982. Kurth, D.: Thot, LÄ 6, 1986, 497–523. Lange, A.: Weisheit und Prädestination. Weisheitliche Urordnung und Prädestination in den
Textfunden von Qumran (StTDJ 18), Leiden 1995. Lemaire, A.: A Re-examination of the Inscribed Pomegranate. A Rejoinder, IEJ 56, 2006, 167–177.
Raik Heckl 232
Levin, C.: Der Jahwist (FRLANT 157), Göttingen 1993. MacDonald, N.: Anticipations of Horeb. Exodus 17 as Inner-Biblical Commentary, in: Khan, G. /
Lipton, D. (Hg.): Studies on the Text and Versions of the Hebrew Bible. FS Robert Gordon (VT.S 149), Leiden u.a. 2012, 7–19.
Maier, J.: Amalek in the Writings of Josephus, in: Maier, J.: Studien zur jüdischen Bibel und ihrer Geschichte (SJ 28), Berlin 2004, 219–236.
— Der Finger Gottes und der Dekalog. Ein exegetisch-theologisches Problem im mittelalterlichen Judentum, in: Maier, J.: Studien zur jüdischen Bibel und ihrer Geschichte (SJ 28), Berlin 2004, 237–252.
Mazar, E. / Ben-Shlomo, D. / Ahituv, S.: An Inscribed Pithos from the Ophel, Jerusalem, IEJ 63, 2013, 39–49.
Milgrom, J.: במדבר Numbers. The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation, Philadelphia u.a. 1990.
Milik, J. T.: Tefillin, Mezuzot et Targums, DJD 6, 1977, 33–91. Millard, A. R.: Nabû, DDD, 1999, 607–610. Mittmann, S.: Deuteronomium 1:1–6:3 literarkritisch und traditionsgeschichtlich untersucht (BZAW
139), Berlin u.a. 1975. Moenikes, A.: Tora ohne Mose. Zur Vorgeschichte der Mose-Tora (BBB 149), Berlin 2004. Müller, H.-P.: Der Welt- und Kulturentstehungsmythos des Philon Byblios und die biblische
Urgeschichte, ZAW 112, 2000, 161–179. Mussies, G.: The Interpretatio Judaica of Thot-Hermes, in: van Voss, M. (Hg.): Studies in Egyptian
Religion. FS J. Zandee, Leiden 1982, 89–120. Nadler, S.: The Bible Hermeneutics of Baruch de Spinoza, in: Sæbø, M. (Hg.): Hebrew Bible, Old
Testament. The History of its Interpretation. II From the Renaissance to the Enlightenment, Göttingen 2008, 827–836.
Neef, H.-D.: Die Heilstraditionen Israels in der Verkündigung des Propheten Hosea (BZAW 169), Berlin, New York 1987.
Nielsen, E.: Deuteronomium (HAT 6), Tubingen 1995. Noth, M.: Das vierte Buch Mose. Numeri (ATD 7), Göttingen 1966. — Der Wallfahrtsweg zum Sinai (Nu 33), in: Noth, M.: Archäologische, exegetische und
topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels (Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde 1), Neukirchen-Vluyn 1971, 55–74.
Oswald, W.: Staatstheorie im Alten Israel. Der politische Diskurs im Pentateuch und in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, Stuttgart 2009.
Otto, E.: Deuteronomium 1–11, (HThKAT), Freiburg, Basel, Wien 2012. — Deuteronomium 4. Die Pentateuchredaktion im Deuteronomiumsrahmen, in: Veijola, T. (Hg.):
Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen (SESJ 62), Göttingen, Helsinki 1996, 208–237. — Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch. Studien zur Literaturgeschichte von
Pentateuch und Hexateuch im Lichte des Deuteronomiumrahmens (FAT 30), Tübingen 2000. — Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien (BZAW 284),
Berlin u.a. 1999. — Mose, der erste Schriftgelehrte. Deuteronomium 1,5 in der Fabel des Pentateuch, in: Böhler, D.
(Hg.): L' écrit et l'Esprit. Études d'histoire du texte et de théologie biblique en hommage à Adrian Schenker (OBO 214), Freiburg (Schweiz) 2005.
— Mose. Geschichte und Legende (Wissen 2400), München 2006. — Das Gesetz des Mose, Darmstadt 2007. — Die Rechtshermeneutik im Pentateuch und in der Tempelrolle, in: Achenbach, R. / Arneth, M. /
Otto, E. (Hg.): Tora in der Hebräischen Bibel. Studien zur Redaktionsgeschichte und synchronen Logik diachroner Transformationen (BZAR 7), Wiesbaden 2007, 72–121.
Mose als Schreiber: Am Ursprung der jüdischen Hermeneutik des Pentateuchs 233
— Die Tora als Buch. Ein Schlüssel zum Schriftverständnis der Hebräischen Bibel, in: Ders.: Die Tora. Studien zum Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAR 9), Wiesbaden 2009, 568–586.
Parker, S. B.: Stories in Scripture and Inscriptions. Comparative Studies on Narratives in Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible, New York 1997.
Pietsch, M.: Die Kultreform Josias. Studien zur Religionsgeschichte Israels in der späten Königszeit (FAT 86), Tübingen 2013.
Pomponio, F.: Nabû. A. Philologisch, RA 9, 1978, 17–24. Powell, B. B.: Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge, New York 1991. Renz, J.: Text und Kommentar (Handbuch der althebräischen Epigraphik / Johannes Renz, Wolfgang
Röllig 1), [S.l.] op. 1995. — Schrift und Schreibertradition. Eine paläographische Studie zum kulturgeschichtlichen Verhältnis
von israelitischem Nordreich und Südreich (ADPV 23), Wiesbaden 1997. Reuter, E.: Konzepte von Autorität. Gestalten und Funktionen der Mosefiktion, in: Fischer, G. /
Markl, D. / Paganini, S. (Hg.): Deuteronomium – Tora für eine neue Generation (BZAR 17), Wiesbaden 2011, 69–81.
Rollston, C. A.: Scribal Education in Ancient Israel. The Old Hebrew Epigraphic Evidence, BASOR 344, 2006, 47–74.
— Writing and Literacy in the World of Ancient Israel. Epigraphic Evidence from the Iron Age (ABSt 11), Atlanta 2010.
Römer, T.: Zwischen Urkunden, Fragmenten und Ergänzungen. Zum Stand der Pentateuchforschung, ZAW 125, 2013, 2–24.
Schaper, J.: The „Publication“ of Legal Texts in Ancient Israel, in: Knoppers, G. N. / Levinson, B. M. (Hg.): The Pentateuch as Torah. New Models for Understanding its Promulgation and Acceptance, Winona Lake (IN) 2007, 225–236.
— „Scriptural turn“ und Monotheismus. Überlegungen zu einer (nicht ganz) neuen These, in: Schaper, J. (Hg.): Die Textualisierung der Religion, Tübingen 2009, 275–291.
— (Hg.): Die Textualisierung der Religion, Tübingen 2009. — A Theology of Writing. The Oral and the Written, God as Scribe, and the Book of Deuteronomy,
in: Lawrence, L. J. / Aguilar, M. I. (Hg.): Anthropology and Biblical Studies. Avenues of Approach, Leiden 2004, 97–119.
— Tora als Text im Deuteronomium, in: Morenz, L. D. / Schorch, S. (Hg.): Was ist ein Text? Alttestamentliche, ägyptologische und altorientalistische Perspektiven (BZAW 362), Berlin u.a. 2007, 49–63.
Schmidt, L.: Das vierte Buch Mose. Numeri 10,11–36,13 (ATD 7/2), Göttingen 2004. Schmidt, W. H.: Exodus, Sinai und Mose. Erwägungen zu Ex 1–19 und 24 (EdF 191), Darmstadt
1983. Schmitt, H.-C.: Die Geschichte vom Sieg über die Amalekiter Ex 17,8–16 als theologische
Lehrerzählung, in: Schmitt, H.-C.: Theologie in Prophetie und Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAW 310), Berlin u.a. 2001, 155–164.
— „Priesterliches“ und „prophetisches“ Geschichtsverständnis in der Meerwundererzählung Ex 13,17–14,31. Beobachtungen zur Endredaktion des Pentateuch, in: Schmitt, H.-C.: Theologie in Prophetie und Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAW 310), Berlin u.a. 2001, 203–219.
— Das spätdeuteronomistische Geschichtswerk Genesis I – 2 Regum XXV und seine theologische Intention, in: Schmitt, H.-C.: Theologie in Prophetie und Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAW 310), Berlin u.a. 2001, 277–294.
Schniedewind, W. M.: How the Bible Became a Book. The Textualization of Ancient Israel, Cambridge u.a. 2004.
— Orality and Literacy in Ancient Israel, RStR 26, 2000, 327–332. — Sociolinguistic Reflections on the Letter of a ‚Literate‘ Soldier (Lachish 3), ZAH 13, 2000, 157–
167.
Raik Heckl 234
— The Textualization of Torah in the Deuteronomic Tradition, in: Otto, E. / Achenbach, R. (Hg.): Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und deuteronomistischem Geschichtswerk (FRLANT 206), Göttingen 2004, 153–167.
Schott, S.: Thot als Verfasser heiliger Schriften, ZAeS 99, 1972, 20–25. Seebaß, H.: Numeri. III. Teilband Numeri 22,2–36,13, Neukirchen-Vluyn 2007. Seitz, G.: Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium (BWANT 93), Stuttgart 1971. Sonnet, J.-P.: The Book within the Book. Writing in Deuteronomy (Biblical Interpretation Series 14),
Leiden u.a. 1997. Stadler, M. A.: Weiser und Wesir. Studien zu Vorkommen, Rolle und Wesen des Gottes Thot im
ägyptischen Totenbuch (Orientalische Religionen in der Antike / Oriental Religions in Antiquity 1), Tübingen 2009.
Stemberger, G.: Der Dekalog im frühen Judentum, JBTh 4, 1989, 91–103. Steymans, H. U. / Staubli, T. (Hg.): Von den Schriften zur (Heiligen) Schrift. Keilschrift,
Hieroglyphen, Alphabete und Tora, Freiburg (Schweiz) 2012. Utzschneider, H.: Das Heiligtum und das Gesetz. Studien zur Bedeutung der sinaitischen
Heiligtumstexte (Ex 25-40; Lev 8-9) (OBO 77), Freiburg (Schweiz) u.a. 1988. van der Toorn, K.: Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge (MA) 2009. van Seters, J.: The Life of Moses. The Yahwist as Historian in Exodus–Numbers (Contributions to
Biblical Exegesis and Theology 10), Kampen 1994. Veijola, T.: Das fünfte Buch Mose – Deuteronomium. Kapitel 1,1–16,17 (ATD 8,1), Göttingen 2004. — Moses Erben. Studien zum Dekalog, zum Deuteronomismus und zum Schriftgelehrtentum
(BWANT 149), Stuttgart 2000. Vos, R.: Thot, DDD, 1999, 861–864. Wellhausen, J.: Prolegomena zur Geschichte Israels. Nachdruck der 6. Ausgabe von 1927 mit einem
Stellenregister, Berlin u.a. 2001. Willi, T.: Die Chronik als Auslegung. Untersuchungen zur literarischen Gestaltung der historischen
Überlieferung Israels (FRLANT 106), Göttingen 1972. Willi-Plein, I.: Spuren der Unterscheidung von mündlichem und schriftlichem Wort im Alten
Testament, in: Sellin, G. / Vouga, F. (Hg.): Logos und Buchstabe. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Judentum und Christentum der Antike (TANZ 20), Tübingen 1997, 77–89.
Wilms, F.E.: Das jahwistische Bundesbuch in Exodus 34 (StANT 32), München 1973. Wilson, G. H.: The Editing of the Hebrew Psalter (SBL.DS 76), Chico (CA) 1985. Wolff, H. W.: Dodekapropheton I. Hosea (BK 14,1), Neukirchen-Vluyn 1990. Zimmermann, R.: Pseudepigraphie/Pseudonymität, RGG4 6, 2003, 1786–1788.