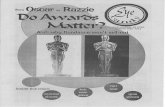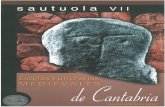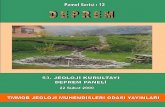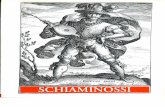Hany, E. A. (2000). Förderung der Kreativität. In K. J. Klauer (Hrsg.), Kognitives Training
-
Upload
uni-erfurt -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Hany, E. A. (2000). Förderung der Kreativität. In K. J. Klauer (Hrsg.), Kognitives Training
Hany, E. A. (2000). Förderung der Kreativität. In K. J. Klauer (Hrsg.), Kognitives Training
(2. Aufl., S. 262-292). Göttingen: Hogrefe - Verlag für Psychologie.
------------------------------------------------------------------------------------
Förderung der Kreativität
Ernst A. Hany
Die Präzision von Vorhersagen über die Entwicklung von Wissenschaftszweigen liegt
manchmal deutlich unter der Treffsicherheit von Wettervorhersagen auf der Grundlage über-
lieferter Bauernregeln. Zumindest gilt diese Einsicht für meine eigene Einschätzung zur Ent-
wicklung von Trainingsprogrammen für die Kreativitätsförderung, die ich am Schluss meines
Beitrages zur ersten Auflage dieses Bandes gewagt hatte (Hany, 1993). Dort hatte ich darge-
legt, wie sich Begabungs- und Expertiseforschung gegenseitig zu befruchten begännen, und
prognostiziert, dass die vorliegenden Erkenntnisse zur Bedeutung der Gedächtnis- und Wis-
sensorganisation für flexible Denkprozesse mit innovativen Resultaten rasch zur erfolgreichen
Konstruktion kreativitätsförderlicher Instruktionsmodelle führen würden.
Eine nüchterne Betrachtung der jüngsten Veröffentlichungen in Handbüchern, wissenschaftli-
chen Zeitschriften und populärpsychologischen Werken muss jedoch zum Ergebnis kommen,
dass die vielversprechende Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse ausblieb und statt des-
sen die 50 Jahre alten Techniken zur Erhöhung der Ideenquantität immer wieder fröhliche
Urständ feiern – und nicht einmal als Verlegenheitslösung vorgeschoben werden (z. B. Früh-
wacht & Haenschke, 1994).
Dieser Beitrag kann daher nicht – wie andere dieses Bandes – ein besonders gelungen kon-
struiertes und empirisch validiertes Trainingsprogramm darstellen oder gar empfehlen. Viel-
mehr ist es beim gegenwärtigen Stand von Forschung und Praxis aussagekräftiger, einen
Überblick über allgemeine Entwicklungen zu geben und dabei gefeierte Trends, Phasen des
Stillstands, gern frequentierte Sackgassen und Lichtblicke in offene Pfade herauszuarbeiten.
Insgesamt hat die gegenwärtige Kreativitätsforschung das von ihr untersuchte Innovationspo-
tential bei sich selbst am wenigsten angewandt. Bei der großen Zahl ungelöster Fragen – die
- 2 -
in diesem Beitrag dargestellt werden sollen – ist diese Aporie jedoch nicht weiter verwunder-
lich. Nach wie vor umstritten sind die Definitionsansätze von Kreativität und die Kriterien für
kreative Leistungen (Abschnitt 1), die notwendigen und hinreichenden Bedingungen auf Sei-
ten des Individuums, die nötig sind, um kreative Verhaltensweisen zu zeigen und innovative
Leistungen zu erbringen (Abschnitt 2), die Frage der Beeinflussbarkeit dieser individuumspe-
zifischen Faktoren (Abschnitte 3 und 4) und letztlich die Befunde zur Wirksamkeit der För-
dermaßnahmen, zu denen auch standardisierte Trainingsprogramme zählen (Abschnitt 5).
Die Klärung dieser Fragen wird dadurch erschwert, dass theoretische Konzeptionen zur Krea-
tivität (z. B. Sternberg & Lubart, 1999; Westmeyer, 1997) und biographische Studien an krea-
tiven Individuen (z. B. Czikszentmihalyi, 1997) wenig Bezug zu den praktischen Versuchen
der Kreativitätsförderung, die ihrerseits die akademische Kreativitätsforschung mitunter be-
wusst ignorieren, aufweisen. Diese gegenseitige „splendid isolation“ von explanativer For-
schung und technologischer Praxisgestaltung unterdrückt aber jene dynamische Spannung, die
zur wissenschaftlichen Fortentwicklung des Feldes nötig wäre, und lässt solchen selbster-
nannten Experten zu viel Raum zur öffentlichen Selbstdarstellung, die entweder empirieferne
theoretische Skizzen oder aber Trainingsprogramme von ungeklärter Wirksamkeit, in denen
nur alte Kreativitätstechniken recycelt werden, als neueste Errungenschaft anpreisen. Es ist
deshalb erforderlich, systematisch zu klären, welche Ideen und Techniken entwickelt wurden,
welche sich bewährt haben und in welchen noch ungenutztes Potential schlummert.
ZUR BEGRIFFSBESTIMMUNG VON KREATIVITÄT
Im Rahmen der Psychologie als Wissenschaft vom Menschen konzentriert sich auch die Krea-
tivitätsforschung auf Verhaltensweisen und Persönlichkeitseigenschaften des Individuums zur
Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Veränderung von Kreativität. Der Ursprung kreati-
ver Leistungen wird im Individuum angesiedelt. Dabei konzentriert sich der allgemeinpsycho-
logische Ansatz auf Problemlöseprozesse, Gedächtnisstrategien, Motivationssysteme etc.,
während der differentialpsychologische Ansatz eher Fähigkeitsunterschiede, individuelle
kognitive Stile, Lernbiographien etc. ins Auge fasst. Als Aussenkriterium zur Bestimmung
des kreativen Potentials einer Person dient in jedem Fall die kreative Leistung, die verschie-
dene Ansprüche erfüllen muss, um als kreativ zu gelten. Diese Ansprüche sind erstaunlich
vage, nämlich als Merkmale der Bewertung durch eine relevante soziale Gruppe, definiert
(vgl. Amabile, 1983; Lubart, 1999), so dass manche Forscher die Auffassung vertreten, man
- 3 -
könne Kreativität gar nicht an sich untersuchen, sondern nur als Inhalt derjenigen sozialen
Prozesse, die zur Einschätzung einer Person oder Leistung als kreativ führen (Weinert, 1983;
Westmeyer, 1998).
Betrachten wir dazu die üblicherweise (z. B. Jackson & Messick, 1967; Mumford & Gustaf-
son, 1988; Simonton, 1988) genannten Kriterien für eine kreative Leistung: Sie muss neu und
ungewöhnlich sein, den Betrachter verblüffen und ihn dazu bringen, Elemente in einem bisher
nicht wahrgenommenen Zusammenhang zu sehen, sie muss für ein bekanntes Problem oder
für eine neu erkannte Problemstellung eine angemessene und nutzbringende Lösung darstel-
len, sie soll zu einer geistigen Umstrukturierung eines Wissensgebietes führen und sie soll
sich allgemein durchsetzen und bewähren. Der Aspekt der praktischen Umsetzung und
Durchsetzung wird allerdings häufig von der geistig-kreativen Leistung getrennt und als Ab-
schlussphase in einem komplexeren Innovationsprozess betrachtet (Bollinger & Greif, 1983).
Die genannten Kriterien für eine kreative Leistung sind tückischer als der erste Eindruck ver-
muten lässt. So kann man den Begriff der Neuartigkeit in mehrerer Hinsicht problematisieren.
Boden (1992) fragt, ob in unserer physikalischen Welt mit festgelegten Stoff- und Energie-
mengen überhaupt etwas neu geschaffen werden kann, da immer bereits vorhandene Materia-
lien benutzt werden. Weisberg (1989) und Simonton (1980) versuchen zu zeigen, dass beein-
druckende wissenschaftliche und künstlerische Leistungen als kumulatives Produkt in vielen
kleinen Schritten entstehen und nur in unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Traditionen
und Diskussionen der jeweiligen Zeit ihre Form erhalten. V. Pierer (1999) belegt an markan-
ten Beispielen aus der Technikgeschichte, dass manche zündende Idee ohne lange Jahre an-
schließender Kleinarbeit und zähen Ringens um praktische Lösungen nie zu der heute bewun-
derten Innovation gereift wäre. Insofern muss man das Entstehen neuer Ideen und Produkte
eher als evolutionären denn als revolutionären Prozess konzipieren.
Umstritten ist auch die Rolle der sozialen Bewertung. Kann man Peter Mitterhofer, der 1864
die erste mechanische Schreibmaschine erfand, als kreativ ansehen oder nicht? Die Gelehrten
der kaiserlichen Akademie in Österreich lehnten seine Erfindung als unnütz ab. Erst als sein
Modell in den Archiven zufällig entdeckt und in den USA zur Serienreife entwickelt wurde,
begann der Siegeszug der Schreibmaschine (Breuer, 1998). Die Vorstellung, dass erst die so-
ziale Anerkennung ein Produkt als kreativ erscheinen lässt, mag man noch hinnehmen. Aber
die Annahme, dass diese Anerkennung einen Menschen erst kreativ macht, ist zumindest der
- 4 -
psychometrischen Tradition der Kreativitätsforschung zuwider, die stabile Personmerkmale
als unverzichtbare Grundlage kreativer Leistungen unterstellt (Weinert, 1999). Demnach
müsste eine Person als kreativ gelten können oder nicht, unabhängig davon, wie sich ihre
Ideen und Produkte „verkaufen“ lassen.
Das Grundmodell der psychologischen Analyse kreativer Tätigkeit stammt wohl von Jackson
und Messick (1965) und ist bis heute noch gültig. Zunächst zeigen die Autoren, dass eine Idee
oder ein Produkt dann als kreativ gilt, wenn sie beim Beurteiler gewisse ästhetische Reaktio-
nen auslöst, die ihrerseits bestimmt werden durch objektivierbare Merkmale des Produkts und
deren Vergleich mit gewissen Standards. Auf der einen Seite des kreativen Prozesses steht
also der Betrachter, der gegenüber einem Produkt dauerhafte Reaktionen (der Überraschung,
Befriedigung, Angeregtheit und des Genießens) zeigt. Auf der anderen Seite steht die Person,
die das Produkt geschaffen hat, und die dazu gewisser stabiler persönlicher Voraussetzungen
bedarf, vor allem, wenn sie kontinuierlich kreative Leistungen zeigt. Jackson und Messick
nennen hierfür persönliche Qualitäten (Originalität, Sensibilität, Flexibilität und Poesie), die
ein Mensch entwickeln muss, und weiterhin vier Bündel von Personmerkmalen, die notwen-
dig sind, um jeweils eine dieser Qualitäten auszubilden. Der dauerhaften Reaktion des Beob-
achters als „Konsumenten“ des Produkts stehen also spiegelbildlich dauerhafte Merkmale des
„Produzenten“ gegenüber – und dieser versucht die Psychologie habhaft zu werden. An die
Stelle der analytischen Vermutungen bei Jackson und Messick sind empirische Untersuchun-
gen an Kontrastgruppen getreten, um die Kennzeichen kreativer Persönlichkeiten zu ermit-
teln. Diese sollen nicht nur zur Erklärung kreativer Leistungen dienen, sondern auch den An-
satz zur gezielten Veränderung im Rahmen von Trainingsprogrammen bilden.
Schließlich gehen alle Versuche und Ansätze, Kreativität zu trainieren, davon aus, dass Per-
sonmerkmale die wichtigsten Voraussetzungen für kreative Leistungen sind. Diese Merkmale
– so wird unterstellt – sind zwar (durch Training) beeinflussbar, weisen aber auch eine gewis-
se Stabilität (nach dem Training) auf, so dass Trainingseffekte zumindest mittelfristig erhalten
bleiben. Aus psychologischer Sicht im allgemeinen und aus Sicht der Trainingsforschung im
besonderen sind demnach Persönlichkeitsmerkmale und ihre Beteiligung an kreativen Leis-
tungen von größtem Interesse. Diesen Merkmalen wenden wir uns im folgenden zu. Sie um-
fassen nicht nur Fähigkeiten und personale traits, sondern ebenso habituelle Denkstile, regel-
mäßig verwendete Problemlösestrategien, Reflexionsgewohnheiten, Arbeitsrhythmen, Routi-
- 5 -
nen der Selbstbewertung, Strategien des Einsatzes kognitiver Ressourcen u. ä., soweit diese
trait-analoge Merkmale aufweisen.
INDIVIDUELLE VORAUSSETZUNGEN VON KREATIVITÄT
Sternberg und Lubart (1999) unterteilen die neueren Forschungsansätze zur Kreativität in (a)
psychodynamische, (b) psychometrische, (c) kognitive und (d) persönlichkeitsumfassende
Modelle. Jeder dieser Ansätze stellt andere Personmerkmale in den Mittelpunkt. Eine Aus-
wahl der am eingehendsten untersuchten Merkmale soll näher dargestellt werden.
Personmerkmale aus psychodynamischer Sicht
Die Annahme, gesellschaftlich anerkannte Leistungen seien sublimierte Ausdrucksformen
sexueller Energie, geht auf Freud und sein Konzept der Abwehrmechanismen zurück
(Bloomberg, 1973). In diesem theoretischen Rahmen kann sowohl das Auftreten kreativer
Leistungen – als Subliminierung – als auch deren Unterbleiben – als Zensierung lustvoller
Impulse – erklärt werden. Die Befassung mit dem Unbewussten und den individuellen Trieb-
schicksalen kann somit sowohl zur Erklärung als auch zur Förderung von Kreativität beitra-
gen. So haben manche Psychoanalytiker anhand biographischer Analysen berühmter Persön-
lichkeiten versucht, die Größe von deren Leistung durch die Schwere ihres inneren Konflikts
zu erklären (z. B. Erikson, 1964, bei Martin Luther). Solche Beschreibungen wurden häufig in
Empfehlungen der Art umgemünzt, dass man durch Reduktion des rationalen Kalküls und der
unmittelbaren Bewertung dafür sorgen solle, dass das Unbewusste seine kreativen Assoziati-
onen voll entfalten könne.
Psychoanalytischem Gedankengut entstammt auch die Modellierung des Phasenverlaufs für
den schöpferischen Einfall, wie ihn zahlreiche Forscher entdeckt zu haben glauben (vgl. Prei-
ser, 1976, für einen Überblick). Meist werden vier Phasen unterschieden, beginnend mit der
Präparationsphase, in der das Problem erkannt wird und alle nötigen Informationen gesam-
melt werden. Dieser folgt die Inkubationsphase, in der das Problem auf unbewusster Ebene
bearbeitet wird. Manche kreativen Erfinder oder Entdecker berichten, sie hätten Urlaub ge-
nommen, ganz andere Dinge gemacht, sich entspannt und so der kreativen Idee Gelegenheit
gegeben, sich zu entwickeln. Meist unerwartet sei dann die Phase der Illumination eingetre-
ten, in der die entscheidende Idee wie eine Erleuchtung über sie gekommen sei. Diese Idee
- 6 -
muss dann in der Verifikationsphase noch auf Tauglichkeit geprüft und in die Tat umgesetzt
werden. Als entscheidend gilt jedoch die Inkubationsphase, in der das kindliche, assoziative
und phantasievolle Denken vorherrscht, das Sigmund Freud primärprozesshaftes Denken ge-
nannt hat (Russ, 1988).
Nach der sorgfältigen Untersuchung von Weisberg (1993) muss jedoch bezweifelt werden,
dass jede kreative Idee einen Mehrphasenprozess voraussetzt und eine unbewusste Verarbei-
tung die notwendige Bedingung für einen kreativen Einfall darstellt. Weisberg versucht statt-
dessen nachzuweisen, dass Forscher ihren eigenen Schaffensprozess nur unzureichend be-
schreiben können und Selbstauskünfte deshalb keine geeignete Basis für eine theoretische
Modellbildung darstellen. Wenngleich die Evidenz für das Auftreten unbewusster Prozesse
bei kreativen Leistungen bescheiden ist, kann man doch davon ausgehen, dass Vorgänge, die
nicht der bewussten Wahrnehmung unterliegen, bei kreativen Denkprozessen eine wichtige
Rolle spielen. Spontane Assoziationen (Koestler, 1964), Kombinationen (Simonton, 1988)
und Analogiebildungen (Finke, Ward & Smith, 1992) sind auch in kognitionspsychologischen
Modellen vorgesehen. Der tiefenpsychologische Theorierahmen ist demnach nicht erforder-
lich, wenn man kreative Denkprozesse modelliert (siehe unten).
Daran ändert auch die Vermutung nichts, Kreativität und Psychopathologie seien eng ver-
wandt und deshalb müsse man beiden Phänomenen mit psychodynamischen Modellen zu
Leibe rücken. In Deutschland war es vor allem Lange-Eichbaums Buch "Genie, Irrsinn und
Ruhm" (Lange-Eichbaum, 1932), das eine solche Auffassung vertrat. Man verweist dabei auf
Künstler wie Ernest Hemingway und Virginia Woolf, die Selbstmord verübten. Oder man
nennt Kant, Hölderlin, Kafka, Rousseau oder Tennyson, die alle depressiv gewesen sein sol-
len (Claridge, 1992). Neuere Untersuchungen, wie die von Ludwig (1992, 1995) an 2000 be-
rühmten Männern und Frauen, zeigen jedoch, dass der Zusammenhang zwischen Kreativität
und Psychopathologie erstens nur schwach ausgeprägt und zweitens die Kausalrichtung des
Einflusses nicht eindeutig festzustellen ist. Die überwiegende Mehrzahl kreativer Persönlich-
keiten, die Ludwig untersucht hat, wies jedenfalls keine Anzeichen einer psychischen Störung
auf. Somit muss die These als widerlegt gelten, dass eine gewisse Neigung zum Psychotizis-
mus die notwendige Voraussetzung für kreative Leistungen sei. Die Befunde der retrospekti-
ven Studie von Ludwig werden durch die Ergebnisse der Studie von Csikszentmihalyi (1996)
an zeitgenössischen produktiven und erfolgreichen Personen bestätigt.
- 7 -
Personmerkmale aus psychometrischer Sicht
Die psychometrische Perspektive unterstellt, dass die Persönlichkeit aus einem Bündel von
quantitativ variierenden Eigenschaften bestehe. Jedes Individuum lasse sich durch einen Vek-
tor im n-dimensionalen Merkmalsraum beschreiben. Somit sei „Kreativität“ ebenfalls ein
kontinuierlich variierendes Phänomen, von dem jede Person eine größere oder geringere
Quantität aufweise.
Von der Annahme, extrem hohe allgemeine Intelligenz würde ausreichen, um im Leben er-
folgreich zu werden (Cox, 1926; Galton, 1892) ist man aufgrund gegenläufiger empirischer
Belege (Oden, 1968) abgerückt. Allenfalls mag ein Schwellenmodell gelten, dem zufolge
unterhalb eines gewissen (mittleren) Intelligenzniveaus auch kreative Leistungen beeinträch-
tigt seien (Feldhusen, 1993). Dennoch wird seit den Forschungsarbeiten von Guilford (1950)
die Existenz spezifischer kreativer Fähigkeiten angenommen, die unabhängig von Intelligenz-
faktoren sind. Guilford selbst brachte 1950 mehrere Fähigkeitsfaktoren ins Spiel, die er aus
seiner Vorstellung von bestimmten Typen schöpferischer Menschen auf analytische Weise
ableitete. Er nannte Problemsensitivität, Flüssigkeit der Ideenproduktion, Originalität und
Neuheit der Ideen, geistige Flexibilität im Wechsel von Ordnungssystemen, Synthetisieren
und Analysieren, Reorganisieren und Bewerten als Merkmale kreativ denkender Menschen.
Aus seinen empirischen Arbeiten zur Struktur der Intelligenz schälte sich dann allein das di-
vergente Denken als zentraler Denkprozess für produktive Leistungen heraus (Guilford,
1967). Dennoch überlebte sein ursprüngliche Fähigkeitskatalog, weil Torrance zu einigen
dieser Fähigkeiten Tests entwickelte (Torrance, 1974), die weite Verbreitung erfuhren. Die
Beliebtheit dieser Verfahren rührt daher, dass Torrance einerseits ihre langfristige prädiktive
Validität für kreative Berufsleistungen pries (Torrance, 1972b) und andererseits demonstrier-
te, dass sich die Testergebnisse mit geringem Trainingsaufwand steigern ließen (Torrance,
1972a). Sollte man hier den entscheidenden Hebel gefunden haben, um die Kreativität aller
Menschen mühelos zu steigern? Wir kommen darauf zurück.
Personmerkmale aus kognitionspsychologischer Sicht
Neue Ideen entstehen im Kopf. Deshalb schenkt die psychologische Forschung seit vielen
Jahren den Denkprozessen bei der Ideenproduktion besondere Aufmerksamkeit. Zum einen
will man dysfunktionale Denkabläufe und -gewohnheiten identifizieren (und abbauen), zum
- 8 -
anderen versucht man, kreativitätsförderliche Denkstrategien und Formen der Wissensaktivie-
rung zu ermitteln, die man durch Trainingsmaßnahmen dann als neue Gewohnheiten erwer-
ben kann. Im Hintergrund steht die Annahme, die geistigen Werkzeuge des logischen Den-
kens und der Aktivierung früherer Erfahrungen würden keinesfalls zu neuen Ideen oder Ein-
sichten führen. Man müsse deshalb entweder Informationen oder Erfahrungen sammeln, die
für das Individuum neu sind, oder die vorhandenen Daten neu kombinieren, damit daraus
neue Ideen entstehen. Im Hintergrund dieses Vorgehens steht wohl die Philosophie des Empi-
rismus, wie wir an einem Zitat von John Locke erkennen können (Locke, 1913, S. 182):
Wenn wir das Fortschreiten unseres Geistes beobachten und aufmerksam verfolgen, wie er
seine aus Sensation oder Reflexion stammenden einfachen Ideen wiederholt, nebeneinan-
derstellt und verknüpft, so wird uns das weiter führen, als wir anfangs vielleicht glaubten. Ja
ich meine, wenn wir sorgfältig auf den Ursprung unserer Begriffe achten, werden wir finden,
daß auch die v e r w i c k e l t s t e n I d e e n , so wenig sie scheinbar auch mit der Sinn-
lichkeit oder mit irgendwelchen Fähigkeiten unseres Geistes zu tun haben, doch ausschließ-
lich zu jenen gehören, die der Geist sich bildet, indem er Ideen wiederholt und verknüpft, die
er entweder durch sinnliche Objekte, oder durch seine eigene auf die letzteren bezügliche Tä-
tigkeit erworben hat (...).
Wie verknüpfen sich bekannte Elemente zu neuen Ideen? Dazu gibt es verschiedene Modelle.
Das einfachste, schon von Poincaré (1914) formulierte Modell nimmt an, unser Denksystem
würde – häufig unterhalb der bewussten Ebene – in blinder Wahl zahlreiche Kombinationen
ausprobieren und viele denkbaren Assoziationen durchspielen. Campbell (1960), Mednick
(1962) und Simonton (1989) sind neuere Vertreter dieses Ansatzes, die jedoch nicht erklären
können, wie solche endlosen Kombinationsversuche ablaufen können, ohne Aufmerksam-
keitskapazität zu erfordern. Dass dieser Prozess wesentlich strukturierter abläuft, wird dage-
gen sowohl von Gestaltpsychologie als auch von der modernen Kognitionspsychologie be-
hauptet. Wertheimer (1964) beschrieb Ordnungsleistungen, die von inhärenten Strukturie-
rungstendenzen der Problemelemente selbst ausgingen. Johnson-Laird (1989) versuchte hin-
gegen darzulegen, dass die Person aktiv Analogien zwischen zwei Wissensgebieten suchen
muss, um Problemlösungen von einem Gebiet auf das andere zu übertragen. Dass solche Ana-
logien nicht automatisch hergestellt werden, ist nach den Befunden von Gick und Holyoak
(1983) offensichtlich.
- 9 -
Deshalb genügt es wohl nicht, auf die Vielfalt automatisch gebildeter Assoziationen zu ver-
trauen. Wissensdomänen müssen aktiv durchforstet, verglichen und kombiniert werden, damit
sich neue Einsichten ergeben (Davidson, 1986). Das Auffinden von Analogien und Einfach-
strukturen ist – solchen Modellbildungen zufolge – ein mühsamer Prozess, dem sich Indivi-
duen nur dann aussetzen, wenn sie schrittweise angeleitet werden.
Auch das Lösen von Problemen besteht nach kognitionspsychologischen Erkenntnissen aus
einer Abfolge von Denkschritten, die mit der allgemeinen Natur von Problemen korrespondie-
ren (Dörner, 1974; Newell & Simon, 1972). Bransford und Stein (1984) haben zu Lehrzwe-
cken den Problemlöseprozess in fünf Schritte unterteilt: Zuerst muss das Problem korrekt
identifiziert werden. Als nächstes gilt es, das Problem einzugrenzen und in eine handhabbare
Fragestellung zu übersetzen. Anschließend müssen Möglichkeiten und Wege, das Problem zu
lösen, gesammelt und erkundet werden. Hat man eine aussichtsreiche Lösung gefunden, muss
man sie als nächstes probieren und schließlich den damit erreichten Zustand bewerten, im
Hinblick auf die Frage, ob das Problem damit wirklich gelöst wurde. Gut strukturierte Prob-
leme lassen sich mit solchen Allzweckalgorithmen lösen, so dass selbst Computerprogramme
chemische und astronomische Entdeckungen vollziehen können (Langley, Simon, Bradshaw
& Zytkow, 1987). Viele Probleme sind jedoch schlecht strukturiert, so dass man keine Algo-
rithmen, sondern allenfalls Heuristiken einsetzen kann, um der Lösung näher zu kommen
(Dörner, 1982). Während Experten solche „Faustregeln“ intuitiv einsetzen, scheitern Laien
häufig daran, wenn sie versuchen, komplexe, schlecht strukturierte Probleme strategisch zu
lösen (Langley, 1985).
Allgemeine, bereichsunspezifische Strategien taugen in der Regel auch nur zur Lösung einfa-
cher Probleme. Anspruchsvolle Probleme in komplexen Inhaltsbereichen erfordern vor allem
ein reichhaltiges Wissen über das Problemumfeld. Es gilt, die Tiefenstruktur von Problemstel-
lungen zu erkennen, Beobachtungen mit typischen Mustern von Hinweisreizen (Syndromen)
zu vergleichen, um die Hintergründe eines Problems rasch zu erkennen (Patel & Groen,
1986), und neben routinisierten algorithmischen Problemlösungen ein umfangreiches Reser-
voir an Ausweichstrategien und Sonderfallregelungen parat zu haben (Johnson, 1988) oder
aus tieferliegenden Kausalmodellen ad hoc abzuleiten (Patel, Arocha & Kaufman, 1994).
Aus diesen kognitionspsychologischen Erkenntnissen wird die plausible Folgerung abgeleitet,
dass kreative Problemlösungen auf anspruchsvollem Gebiet vor allem vom fundierten Wissen
über den jeweiligen Gegenstandsbereich abhängen (Ericsson, 1998). Die Geister scheiden
- 10 -
sich jedoch bei der Frage, ob für den Erwerb des fraglichen Wissens alltägliche, jeder Person
verfügbare Lernformen ausreichen (Weisberg, 1993) oder ob der Erwerb dieses Wissens die
besondere Präsentation und Aufbereitung des Lernstoffs verlangt, nämlich in Form verschie-
denartiger Problemstellungen und Musterfälle, mit der die kognitive Vernetzung unterschied-
licher Anwendungsperspektiven ermöglicht wird (Weinert, 1990).
Offen diskutiert wird auch die Frage, ob ein hoher Grad an Expertenwissen an und für sich
auch schädlich für kreative Entwicklungen sein könne, da zumindest prozedurales, aber auch
diagnostisches Wissen sich in automatisierten Denk- und Handlungsroutinen niederschlage,
die als Konventionen und Gewohnheiten jede neue Perspektive behinderten (Frensch &
Sternberg, 1989). Somit erweist sich der tägliche Kampf gegen die eigenen Denk- und Ar-
beitsgewohnheiten – in Form des „deliberate practice“ (Ericsson & Charness, 1994) – als
Königsweg zur Leistungsexzellenz. Ob die daraus abgeleiteten trivialen Ratschläge zur Erhö-
hung der persönlichen Allzweckkreativität („Tun Sie jeden Tag etwas Neues!“, „Entwickeln
Sie Ihre vernachlässigten Seiten!“ usw.), die uns aus vielen Ratgebern entgegenschlagen
(Csikszentmihalyi, 1997), ihre Wirkung tun, mag dahin gestellt sein, lohnt aber nicht der wis-
senschaftlichen Untersuchung.
Personmerkmale aus persönlichkeitspsychologischer Sicht
Denkfähigkeiten, Lernstrategien und Problemlöseprozesse beschreiben die kognitive Seite der
kreativen Person. Dass diese Sichtweise durch affektive und motivationale Komponenten er-
gänzt werden muss, wusste bereits Guilford (1973, S. 25f.): „Ob ein Mensch, der die erforder-
lichen Fähigkeiten besitzt, tatsächlich Ergebnisse kreativer Art hervorbringt oder nicht, hängt
von seinen motivationalen und temperamentsmäßigen Eigenschaften ab“. Den Versuch einer
Ordnung kreativitätsrelevanter Personmerkmale hat in jüngster Zeit Amabile (1996) unter-
nommen. Sie unterscheidet (a) bereichsspezifische Fertigkeiten (wie Wissen und technisches
Können), die von angeborenen Fähigkeiten abhängen, (b) kreativitätsrelevante Fertigkeiten
(wie kognitive Stile und Heuristiken zur Ideenfindung), die überwiegend von Übung und Er-
fahrung abhängen, und (c) Aufgabenmotivation, die von inneren wie äußeren Faktoren ab-
hängt. Die Aufgabenmotivation hat Amabile empirisch ausführlich untersucht. Dabei hat sie
aufgedeckt, dass alle äußeren Bedingungen, die dem Individuum externe Bewertungsmaßstä-
be signalisieren, kreativitätshemmend wirken. Belohnungen können hemmend wirken, wenn
sie als Kontrollfunktion eingesetzt werden, nicht jedoch, wenn sie das Individuum als Aner-
- 11 -
kennung der eigenen Bemühung erlebt. Frühere Vermutungen, wonach jede von außen ge-
setzte Belohnung die intrinsische Motivation und damit auch kreatives Schaffen unterminie-
ren würde, gelten als widerlegt (Eisenberger, Armeli & Pretz, 1998).
Die intrinsische Motivation als zentrale Voraussetzung kreativen Handelns steht auch im Mit-
telpunkt der Arbeiten von Csikszentmihalyi (1985). Mit flow beschreibt er jenes Gefühl des
völligen Aufgehens in ihrer Tätigkeit, das Menschen bei bestimmten Arbeits- und Freizeitbe-
schäftigungen erleben und das sie zu kreativen Leistungen befähigt. In der Tätigkeit selbst
liegende Voraussetzungen für das flow-Erleben sind u. a.: Es gibt klare Ziele für jeden
Schritt; für jede Handlung erfolgt unmittelbare Rückmeldung; Herausforderungen und Fähig-
keiten befinden sind im Gleichgewicht; Fehlschläge bereiten keine Sorgen; man denkt nicht
mehr an sich, sondern geht in der Tätigkeit auf.
In jüngster Zeit hat Csikszentmihalyi (1997) zeitgenössische produktive Menschen aus vielen
Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftssparten interviewt. Bei der Suche nach charakteristi-
schen Persönlichkeitsmerkmalen entdeckte er eine dynamische Ambivalenz oder Gegensätz-
lichkeit in den Verhaltensäußerungen: So seien hochkreative Menschen manchmal verspielt,
manchmal diszipliniert; manchmal träumerisch, manchmal nüchtern; einerseits konservativ,
andererseits rebellisch usw. Ob sich in diesen Gegensatzpaaren nur die mangelnde Definier-
barkeit der kreativen Persönlichkeit ausdrückt oder eine gewisse produktive Flexibilität der
Verhaltensmuster, muss offen bleiben. Jedenfalls scheinen einfache Listen von Persönlich-
keitsmerkmalen kreativer Personen (Barron & Harrington, 1981) der Komplexität des Phä-
nomens nicht gerecht zu werden, wie schon Weisberg (1989) zeigte.
Unbestritten scheint allenfalls zu sein, dass nur diejenige Person kreativ sein kann, die das
eigene schöpferische Tun als wertvoll ansieht. Menschen, die Angst vor den eigenen Fähig-
keiten haben, denen bei Veränderungen, Unsicherheit und Unberechenbarkeit unbehaglich
wird und die fest an geistige und moralische Autoritäten glauben, werden kaum den Mut zu
kreativen Neuschöpfungen aufbringen. Wer Neues schafft, stellt Altes in Frage und zerstört es
unter Umständen. Deshalb zählen Selbstbewusstsein, Risikobereitschaft, Durchsetzungsfä-
higkeit und wohl auch eine gewisse Aggressivität zu den notwendigen Eigenschaften erfolg-
reicher kreativer Menschen (Perkins, 1988). In empirischen Studien lassen sich gewisse,
wenngleich relativ schwache Belege für diese Behauptungen finden (Bollinger & Greif,
1983).
- 12 -
Die genannten Persönlichkeitsmerkmale, vor allem motivationale Einstellungen und Prozesse,
werden durch die Umwelt stark beeinflusst. Die wenigen empirischen Untersuchungen zu den
spezifischen Sozialisationsbedingungen kreativer Individuen befassten sich mit dem Einfluss
der Familie (Albert & Runco, 1986), der Schule (Torrance, 1972a), des Arbeitsumfeldes
(Kohn & Schooler, 1978) und historischer Ereignisse (Simonton, 1997). In jedem Feld lassen
sich gewisse Einflussfaktoren nachweisen, die man zusammenfassend als Verfügbarkeit und
Nutzung von Handlungs- und Gestaltungsspielräumen bei komplexen Aufgabenstellungen,
als Freiheit von Rollenzwängen und elementaren Bedürfnissen, als Erleben persönlicher
Wirksamkeit und Autonomie bei der Verfolgung eigener Anliegen, als Klima nicht-
evaluativer, intensiver Kommunikation sowie als Anregung durch kreative Vorbilder be-
schreiben kann. Aufmerksamkeit erregt hat die Studie von Zuckerman (1992; original 1977),
der zufolge die Wahrscheinlichkeit, einen Nobelpreis zu erhalten, enorm steigt, wenn man im
Labor eines Nobelpreisträgers arbeitet und dort seine Doktorarbeit anfertigt. Wenngleich die-
ser einfache, in seinem Kausalgefüge aber vermutlich komplexe Befund zu zahlreichen glei-
chermaßen plausiblen Erklärungsmöglichkeiten verlockt, so verrät gerade die offenkundige
Beliebigkeit der individuell präferierten Erklärung die Dürftigkeit des gesicherten Wissens:
„Angesichts der schmalen empirischen Evidenz ist die Organisationspsychologie bisher auf
wissenschaftlich kaum abgesicherte theoretische Spekulationen zur Erklärung und Prognose
innovativen Verhaltens in Organisationen angewiesen“ (Bollinger & Greif, 1983, S. 432).
ÜBERBLICK ÜBER MASSNAHMEN ZUR KREATIVITÄTSFÖRDERUNG
Wenn man die Person- und Umweltmerkmale, von denen im vorangehenden Text die Rede
war, näher betrachtet, so wird offenkundig, daß zahlreiche Möglichkeiten der Einflußnahme
bestehen. Unzählige Faktoren der familiären Sozialisation, der schulischen Förderung, der
therapeutischen Intervention etc. sind geeignet, Veränderungen, auch positive, bei Fähigkei-
ten, Persönlichkeitsmerkmalen und aktueller Motivationslage herbeizuführen. In diesem Bei-
trag geht es jedoch nicht um plausible oder nachgewiesene Effekten von natürlichen Unter-
schieden in den individuellen Entwicklungskonstellationen, sondern um die Beschreibung und
Bewertung gezielt herbeigeführter Interventionen. Wir werden unseren Blickwinkel noch wei-
ter einschränken, um beispielsweise Vorgehensweisen, die Amabile (1996) beschreibt – wenn
etwa Eltern darauf verzichten, mehr als ein Kind zu haben, um dieses eine möglichst optimal
fördern zu können –, ausschließen zu können. Wir werden im folgenden nur Trainingspro-
- 13 -
gramme betrachten, die als kurzfristige, systematische und standardisierte Interventionen
konzipiert sind, mit dem Ziel, eine unmittelbare und stabile Erhöhung der kreativen Produkti-
on herbeizuführen. Diese Programme setzen an unterschiedlichen individuellen Leistungsvor-
aussetzungen an, bedienen sich unterschiedlicher Methoden und Vorgehensweisen und kön-
nen im Hinblick auf verschiedene Kriterien bewertet werden. Im folgenden werden – nach
einer allgemeinen Überlegung – diejenigen Schritte des kreativen Problemlöseprozesses zur
Ordnung der Trainingsansätze herangezogen, die Amabile (1996) anführt, um zu zeigen, wie
ihre kreativitätsrelevanten Persönlichkeitsmerkmale den kreativen Denkprozeß steuern.
Möglichkeiten der Beeinflussung individueller Merkmale durch Training
Das letzte Ziel von Maßnahmen zur Kreativitätsförderung ist die dauerhafte Steigerung krea-
tiver Leistungen. Dieses Ziel hat mit zwei Problemen zu kämpfen. Auf der einen Seite sind
kreative Leistungen nicht eindeutig definiert und auch nicht leicht zu operationalisieren. Auf
der anderen Seite ist Leistung das Ergebnis eines Arbeitsprozesses, bei dem ein Individuum
die eigenen Ressourcen mobilisiert, um einer Aufgabenstellung und dem damit verbundenen
Leistungsmaßstab gerecht zu werden. Wenn Leistung sowohl von stabilen als auch von aktu-
ell wirkenden Personfaktoren abhängt, müssen Trainingsprogramme genau diese Faktoren
ansprechen und weiterentwickeln.
Aber welche Personmerkmale sind der schnellen und gezielten Beeinflussung zugänglich?
Amabile (1996) argumentiert, daß Fähigkeiten und grundlegende Persönlichkeitseigenschaf-
ten aufgrund ihrer theoretisches Konzeption durch ein kurzfristiges Training nicht dauerhaft
verändert werden können. Wohl aber akzeptiert sie, daß motivationale Einstellungen zu beein-
flussen seien, die dann im positiven Fall zu gesteigerter Lernbereitschaft führen und auf die-
sem Weg mittelfristig den Erwerb kreativitätsrelevanter Fertigkeiten und domänspezifischen
Wissens fördern. Andere Autoren halten hingegen selbst kognitive Fähigkeiten für kurzfristig
formbar (Klauer, 1991) und zwar nicht nur bei Kindern, sondern auch bei älteren Erwachse-
nen (Willis & Nesselroade, 1990). Es ist schwer zu entscheiden, ob im Bereich des fluiden
Denkens Basiskapazitäten trainiert werden können oder ob alle Leistungssteigerungen auf den
Erwerb von Denkstrategien bzw. von Wissen über Aufgabenstrukturen und auf die Automati-
sierung von Inferenzprozessen zurückzuführen sind. Auch im Bereich des kreativen Denkens
muß beim gegenwärtigen Stand der Forschung offen bleiben, ob durch Trainingsprogramme
- 14 -
neue Denkkapazitäten aufgebaut, vorhandene besser genutzt oder diese durch Lernen besser
„verschaltet“ werden.
Einstellung und Motivation
Kreative Einstellungen und Haltungen lassen sich nicht einfach vermitteln. In manchen Per-
sönlichkeitstheorien gilt die kreative Persönlichkeit als schwer zu erreichendes Endziel der
individuellen Entwicklung (Rogers, 1961). Bei ungünstigen Kindheitserfahrungen dürfte
demnach eine psychotherapeutische Behandlung nötig sein, um kreative Potentiale freizuset-
zen (Adams, 1974; Stein, 1974). Aber selbst Personen ohne Entwicklungsstörung können von
Therapietechniken profitieren, wie Meichenbaum (1975) gezeigt hat. Er setzte mit gutem Er-
folg Selbstverbalisationen („Be creative, be unique.“) ein, in denen sich Personen selbst zu
kreativen Handlungen ermutigten. Wir sehen daraus, dass die motivationale Seite des kreati-
ven Prozesses am leichtesten anzuregen ist, wie auch Amabile (1996) zeigen konnte. Ver-
schiedene Trainingsprogramme konzentrieren sich deshalb darauf, kreatives Arbeiten als an-
genehme, befriedigende und lohnenswerte Tätigkeit darzustellen und den Teilnehmern des
Gefühl zu vermitteln, selbst ohne große Mühe kreativ sein zu können. Ein klassisches und
nach den Regeln der Kunst gestaltetes Förderprogramm mit spezieller Betonung der affekti-
ven Prozesse stellt das Purdue Creative Thinking Program (Feldhusen, Treffinger & Bahlke,
1970) dar, das für ältere Grundschüler und Sekundarstufenschüler konzipiert wurde. Es be-
steht aus 28 Lerneinheiten, in denen jeweils Tondarbietungen und Arbeitshefte verwendet
werden. Jede Tonaufnahme besteht aus der drei- bis vierminütigen Darstellung verschiedener
Formen und Strategien kreativen Verhaltens und ermutigenden Ausführungen an die Zuhörer,
ihre eigene Kreativität zu erproben. Anschließend wird in Form eines acht- bis zehnminütigen
Hörspiels die Biographie eines berühmten amerikanischen „Pioniers“ (eines Präsidenten, For-
schers oder Entdeckers) präsentiert, wobei die Darstellungsform die Zuhörer zu eigenem Ent-
decken und Gestalten motivieren soll. Die Aufgabenhefte enthalten dann Produktivitätsübun-
gen, die um die präsentierte Person kreisen (z. B. „Stell Dir vor, Henry Ford hätte keinen Au-
tomotor erfunden und wir hätten bis heute keine Fahrzeuge. Was könnten wir ohne Autos
alles nicht machen?“). Anfänglich wurden die Tonaufzeichnungen dieses Trainingspro-
gramms über einen lokalen Radiosender ausgestrahlt; später konnte man die Materialien als
Multimediaset erwerben. Dieses Programm wurde in zahlreichen Studien evaluiert (z. B. Shi-
vely, Feldhusen & Treffinger, 1972; Treffinger, Speedie & Brunner, 1974; Feldhusen & Clin-
kenbeard, 1987), die dem Programm eine gewisse positive Wirkung bestätigen konnten.
- 15 -
Problemwahrnehmung
Um ein Problem als solches zu identifizieren, ist eine besondere Sensitivität gegenüber Wi-
dersprüchen und offenen Fragen vonnöten, d. h. Aufmerksamkeit sich selbst und der Umwelt
gegenüber. Es existiert kein Kreativitätstraining, das sich ausschließlich auf diese Fertigkeit
konzentriert. In den 60er Jahren wurde jedoch mit verschiedenen Methoden der Bewusst-
seinserweiterung experimentiert, die mit sensorischer Stimulation und Deprivation (Houston,
1973; Taylor, 1970), mit Drogen, Hypnose oder Trance (Gowan, 1975) erreicht werden sollte.
Die Effekte solcher Studien reichen über subjektive Evidenzerlebnisse kaum hinaus. Weitere,
ebenfalls unspezifische Methoden der Kreativitätsförderung umfassen Rollenspiel und Sozi-
odrama, mit denen ein besseres Verständnis seiner selbst sowie die Betrachtung eines Prob-
lems aus verschiedenen Perspektiven geübt werden sollte (Eberle, 1974; Torrance, 1975).
Sicherlich bieten die genannten Techniken einschließlich Hypnose (Stein, 1974) und systema-
tischer Entspannung (Krampen, 1997) neue Erfahrungen und fördern das Durchbrechen von
Denk- und Lebensgewohnheiten. Als Folge sind aber defensive Reaktionen genauso möglich
wie echtes Wachstum, so dass Wirksamkeit und Effizienz solcher bewusstseinsverändernder
Maßnahmen schwer zu beurteilen sind. Ähnlich verhält es sich mit Imaginationstechniken,
die empirisch erst ansatzweise untersucht sind (Ainsworth-Land, 1982), obgleich sie als Ve-
hikel für den kreativen Denkfortschritt besonders in den Naturwissenschaften gelten (Miller,
1996).
Generierung von Lösungsvorschlägen
Die Produktion möglichst vieler Ideen und Lösungsvorschläge stellt in der Tradition von
Guilford und Torrance ein charakteristisches Merkmal kreativen Schaffens dar. Zahlreiche
Trainingsprogramme enthalten Elemente zur Förderung divergenter Produktion. Sorgfältig
entwickelt und elaboriert wurde das Productive Thinking Program (Olton, 1969; Covington,
Crutchfield, Davies & Olton, 1974), das sich an 11-12jährige Schüler wendet. 15 Arbeitshefte
werden individuell oder in angeleiteten Gruppen bearbeitet. Empfohlen wird die Verteilung
der Übungen auf ein Schulhalbjahr, so dass ein Heft pro Woche bearbeitet wird. Die Hefte
enthalten comicartige Geschichten von Lila und Jim, die unter Betreuung ihres Onkels John
ein Problem nach dem anderen erleben, wobei verschiedene Problemlösefertigkeiten de-
monstriert und anschließend eingeübt werden. Herzstück des Programms stellen 16 Regeln
- 16 -
für produktives Denken dar (Polson & Jeffries, 1985), von denen einige wiedergegeben wer-
den sollen:
- Lass Deinen Verstand offen. Springe nicht über Schlussfolgerungen zur Antwort eines Prob-
lems.
- Lass Dir viele Ideen zur Problemlösung einfallen. Gib Dich nicht mit wenigen zufrieden.
- Versuche, Dir ungewöhnliche Ideen auszudenken.
- Um Ideen zu bekommen, nimm Dir alle wichtigen Dinge und Personen aus dem Problem
einzeln vor und denke sorgfältig darüber nach.
- Denke zunächst an verschiedene allgemeine Lösungsmöglichkeiten und erarbeite dann viele
spezielle Ideen für jede der Möglichkeiten.
- Wenn Du nach Ideen suchst, lass Deinen Verstand alles um Dich herum erforschen. Beinahe
jeder Gegenstand bietet Ideen für die Lösung.
Diese Regeln liegen den einzelnen Übungen des Programms zugrunde. Studien zur Pro-
grammevaluation zeigen, dass bei programmnahem Material gute Trainingsgewinne zu erzie-
len sind, während die Effekte bei erforderlichem Trainingstransfer nicht eindeutig sind (Tref-
finger & Ripple, 1971; Feldhusen & Clinkenbeard, 1987; Mansfield, Busse & Krepelka,
1978). Eine Anwendung des Programms in deutschen Hauptschulen erbrachte keine Förderef-
fekte (Lissmann & Mainberger, 1977).
Übungen zur Förderung des divergenten Denkens sind in zahlreichen anderen Trainingspro-
grammen enthalten, die wegen ihrer thematisch umfassenden Ausrichtungen hier nicht be-
sprochen werden sollen. Das bekannteste davon ist das Cognitive Research Trust (CoRT)-
Programm von de Bono (1973), von dessen sieben Trainingsmodulen eines Übungen zur Kre-
ativität enthält. Knappe Übersichtsdarstellungen des Programms finden sich bei Polson und
Jeffries (1985) sowie bei de Bono (1985).
Speziell auf divergentes Denken ausgerichtet ist die Technik des Brainstorming, die in der
Regel in Problemlösegruppen eingesetzt wird. Osborn (1963) nannte sein dreiphasiges Ver-
fahren, das Problemdefinition, Lösungsproduktion und Lösungsauswahl umschließt, Brain-
storming, da mit Hilfe des Gehirns ein Sturm von Ideen ausgelöst werden solle (Stein, 1975).
Das Training besteht zunächst in der Vermittlung der beiden Grundprinzipien: Bewertung
wird aufgeschoben; Quantität fördert Qualität. Diese Prinzipien werden in Form von vier Re-
geln für die Gruppendiskussion (oder die Einzelarbeit) vermittelt:
- 17 -
1. Kritik ist nicht erlaubt.
2. "Wildes" Assoziieren ist gern gesehen.
3. Quantität ist willkommen: je mehr Ideen, desto besser.
4. Kombination dieser Ideen und Verbesserungsvorschläge sind gefragt.
Die Gruppensitzung wird am besten von zwei Personen geleitet, ferner benötigt man eine
Schreibkraft, um die Ideen zu protokollieren. Zu Beginn der Sitzung werden die Regeln für
die Gesprächsführung dargestellt. Das zu besprechende Problem wird den Beteiligten am bes-
ten einige Zeit vor dem Treffen mitgeteilt. Zumindest einige Teilnehmer sollten Experten auf
ihrem Gebiet sein, damit auch anspruchsvolle Lösungen zustande kommen. Das ursprüngliche
Modell sieht vor, dass Teilnehmer, die einen Lösungsvorschlag haben, sich melden und ihre
Idee (aber nur eine einzelne) vortragen. Sie wird weder diskutiert noch bewertet, man kann
aber Modifikationen als eigene Idee vortragen. Eine Brainstorming-Sitzung ist oft nach 15
Minuten bereits zu einer ausreichenden Anzahl an Lösungsvorschlägen gelangt. Die Bewer-
tung der Lösungen wird entweder in einem separaten Abschnitt der Sitzung oder von einer
neuen Teilnehmerrunde vorgenommen.
Brainstorming gilt zunächst als Technik des Problemfindens, die ohne großes Training einge-
setzt werden kann. Sie wurde eingehend untersucht und es liegen sowohl experimentelle (z.
B. Bouchard, 1971, 1972) als auch Feldstudien dazu vor (vgl. den sehr detaillierten Überblick
von Stein, 1975). Demzufolge kann mit Brainstorming die Quantität der Ideenproduktion in
Gruppen deutlich gesteigert werden, sie liegt aber in der Regel unterhalb der Produktivität,
wenn man alle Gruppenmitglieder einzeln Ideen generieren lässt. Die durchschnittliche Quali-
tät der Gruppenlösungen liegt jedoch vielfach über der Qualität der zusammengefassten Ein-
zellösungen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass qualitativ hochwertige Problemlö-
sungen nicht immer den Umweg gesteigerter Quantität benötigen. Stratton und Brown (1972)
zeigten, dass ein Training in der Beurteilung von Problemlösungen zu verringerter Produktivi-
tät, aber erhöhter Lösungsqualität führen kann.
Maltzman (1960) versuchte Brainstorming regelrecht zu trainieren. Dabei zeigten sich die
auch von anderen Verfahren bekannten Transferprobleme, so dass es anscheinend wenig loh-
nenswert ist, ein allgemeines Brainstorming-Training zu absolvieren, zumal die Technik
selbst ohne große Mühe anzuwenden ist.
- 18 -
Wissensaktivierung
Die Aktivierung des gespeicherten Wissens ist für die soeben dargestellte Lösungsproduktion
von grundlegender Bedeutung. Bei der Suche nach kreativen Ideen ist es erforderlich, sich
geistig von den bekannten Problemaspekten zu entfernen und auch fernliegende Eigenschaf-
ten und Beziehungen zu untersuchen. Gründlich geübt wird die Veränderung der „kognitiven
Distanz“ in Synectics, einer von Gordon (1961) entwickelten und von Prince (1970) weiterge-
führten Problemlösemethode. Trainingsteilnehmer werden vor allem in die Konstruktion von
Analogien eingeführt. Dabei werden vier Arten unterschieden:
- Persönliche Analogie meint die Identifikation mit einem Objekt, das eine wichtige Rolle in
der vorliegenden Problemstellung aufweist, z. B. mit einem technischen Bauteil. Die persön-
liche Identifikation führt zu einer Personifikation des Objekts und zu einer „Innensichtweise“
der Objektmerkmale und Beziehungen.
- Direkte Analogie bezeichnet die üblichen bereichsverknüpfenden Analogien, z. B. wenn
Problemlösungen aus der Biologie in das Gebiet der Technik übertragen werden.
- Symbolische Analogie besteht darin, für ein Problem eine ästhetisch anregende verbale Be-
zeichnung zu finden, ähnlich einem Buchtitel, in dem sich das Kernproblem als begriffliches
Paradox ausdrückt. Diese Analogiebildung kann zu vielfältigen Assoziationen und Lösungs-
vorschlägen anregen.
- Die Phantasie-Analogie schließt ungewöhnliche Vergleiche genauso ein wie eigentlich un-
mögliche oder unrealistische Vorschläge. Wunschvorstellungen und Ich-Regression führen
aber unter Umständen zur Entdeckung nichtberücksichtigter Eigenschaften oder Beziehungen
der Problembestandteile untereinander.
Stein (1975), der diese Trainingsmerkmale ausführlich darstellt und darüber hinaus viele In-
formationen zum Sitzungsablauf, zur Theorie des Problemlöseprozesses aus der Sicht von
Synectics usw. bietet, resümiert, dass sich diese Form kreativen Arbeitens eigentlich aus ein-
fachen Methoden zusammensetzt und deshalb kreatives Schaffen nicht einfacher macht, son-
dern nur die Teilnehmer dazu bringt, härter als sonst zu arbeiten. Deshalb würden Synectics-
Sitzungen häufig zur Erschöpfung der Teilnehmer führen. Da Synectics als kommerziell ar-
beitendes Institut Trainingskurse oder besser Trainerstunden verkauft, sind wenig Evaluati-
onsstudien durchgeführt und publiziert wurden. Wenngleich unbestritten ist, dass sich mit der
hier beschriebenen Methoden Probleme lösen lassen und die Teilnehmer auch zu persönli-
- 19 -
chem Wachstum angeregt werden, ist nicht geklärt, inwieweit dauerhafte Veränderungen der
Problemlösekompetenz bei den Teilnehmern angestrebt oder erzielt werden.
Khatena (1975) konstruierte ein damit verwandtes Trainingsprogramm, das zur häufigeren
Anwendung der zitierten Analogiearten und somit zu kreativerer Problemlösung führen sollte.
Seine Anwendung (vier mal 50 Minuten) bei College-Studenten förderte zwar deren Origina-
lität in den Posttests, schien sich jedoch nicht auf den Gebrauch der anspruchsvolleren Analo-
gien auszuwirken, so dass die Trainingseffekte letztlich ungeklärt blieben (Khatena, 1982).
Kombination von Problemaspekten
Offene Probleme, die zahlreiche Lösungen zulassen, werden häufig nicht systematisch genug
exploriert. Einige einfache Techniken wurden für diesen Zweck entwickelt, ohne dass dafür
systematisches Training erforderlich wäre. Aus diesem Grund gibt es dazu auch keine syste-
matischen Evaluationsstudien. Dennoch sollen diese Techniken – der Vollständigkeit halber –
exemplarisch angeführt werden.
Eigenschaften Auflisten (Crawford, 1978) bezeichnet die Methode, z. B. alle Eigenschaften
eines zu verbessernden Gegenstandes aufzulisten und sich für jede möglichst viele Variatio-
nen zu überlegen. Die Kombination aller Ausprägungen der identifizierten Eigenschaften ist
dann Kennzeichen der morphologischen Methode (Zwicky, 1957; Allen, 1962), die durch
geeignete Gruppierungstechniken zu einer erweiterten, aber noch überschaubaren Zahl an
Merkmalskombinationen als mögliche Problemlösungen führt.
Weniger in Richtung einer systematischen Variation, dafür zu vielfältigen Kombinationsarten
führt die Verwendung von Checklisten, in denen abstrakte Vorschläge für Denkoperationen
geboten werden. Osborn (1963) fertigte eine Liste mit 73 Fragen an, die sich auf beliebige
Probleme und Denkinhalte (Objekte, Personen) anwenden lassen. Man wird durch diese Fra-
gen dazu angeregt, mit dem Problemgegenstand vielfältige kognitive Transformationen vor-
zunehmen. Beispiels solcher Fragen sind „Ersetzen?“, „Was oder wen als Ersatz?“, „Andere
Zutaten?“, „Anderes Material?“, „Anderen Prozeß?“ usw.
Das Kombinieren von Wissenselementen wurde systematischer von Taba (1966; zit. n. Tan-
nenbaum, 1983) in ein sozialkundliches Curriculum integriert. Die Schüler sollten neben den
- 20 -
Unterrichtsinhalten lernen, (a) Konzepte systematisch zu entwickeln, (b) Schlussfolgerungen
und Verallgemeinerungen vorzunehmen und (c) Verallgemeinerungen anzuwenden. Konkret
wird geübt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Objekten zu erkennen, differenzier-
te Beobachtungen vorzunehmen, Objekte zu gruppieren, zu klassifizieren usw. und damit
Wissensbestände systematisch anzulegen und erweitern. Lernprogramme dieser Art beziehen
sich jedoch auf logisches und systematisches Denken allgemein und gehen über den Rahmen
dieses Beitrags hinaus.
Steuerung des Problemlöseprozesses
Ein komplettes Modell des kreativen Problemlösens, das neben spezifischen Fertigkeiten ge-
rade auch die Selbststeuerung kreativer Prozesse vermitteln will, wurde von Sidney Parnes in
den 60er Jahren in Buffalo aus einem eklektischen Ansatz entwickelt (Parnes & Noller,
1972). Darin stellt das von Osborn (1963) entwickelte Brainstorming eine wichtige Kompo-
nente dar. Das mit Creative Problem Solving betitelte Programm wurde mehrfach überarbeitet
(Parnes, Noller & Biondi, 1977) und später als Arbeitsbuch für das Selbststudium neu publi-
ziert (Isaksen & Treffinger, 1985). Es wird immer noch rege verwendet (Cramond, Martin &
Shaw, 1991). In diesem Programm lernen die Teilnehmer, kreatives Problemlösen als feste
Abfolge einzelner Schritte vorzunehmen:
1. Aufspüren von Unklarheiten oder einer verwirrenden Situation (mess-finding).
2. Informationssuche (fact-finding) als Situationsanalyse.
3. Problemdefinition (problem-finding) als Eingrenzung und Präzisierung des zentralen Prob-
lems.
4. Produktion von Lösungsvorschlägen (idea-finding).
5. Auswahl einer Lösung (solution-finding) durch Berücksichtigung und Anwendung multip-
ler Bewertungskriterien.
6. Ausführungsplanung (acceptance-finding) und Umsetzung.
Das zuletzt veröffentlichte Arbeitsbuch enthält zahlreiche Übungsaufgaben und Arbeitsblätter
und versucht mit Hilfe von Checklisten, Tipps und Strukturierungshilfen den Erwerb ver-
schiedener Techniken und Fertigkeiten für die sechs Problemlösephasen zu fördern. Zur Pro-
grammdurchführung liegen zahlreiche Evaluationsstudien für Schüler bzw. Erwachsene vor
(Überblick bei Feldhusen & Clinkenbeard, 1987; Mansfield, Busse & Krepelka, 1978). In den
70er Jahren wurde dieses Programm bevorzugt als Gruppentraining mit hohem Zeitaufwand
- 21 -
durchgeführt (mindestens 16 Sitzungen; Stein, 1975) durchgeführt, beispielsweise über einen
Zeitraum von zwei Jahren bei Collegestudenten (Reese, Parnes, Treffinger & Kaltsounis,
1976). Der hohe Aufwand begünstigte positive Effekte, die methodischen Prüfungen durchaus
standhalten (Rose & Lin, 1984). Planungs- und Kontrollkompetenzen hinsichtlich sequenzar-
tiger Problemlöseprozesse werden jedoch häufiger im Problemlösetraining als in Kreativitäts-
programmen vermittelt (Bransford, Sherwood & Sturdevant, 1987).
Im deutschen Sprachraum erschien kürzlich ein inzwischen bereits wieder vergriffenes Krea-
tivitätstraining von Preiser und Buchholz (1991), das ähnlich wie das Creative Problem Sol-
ving einen mehrphasigen Problemlöseprozeß vermittelt. Aus den sechs werden hier sieben
Phasen. Dabei wird am Anfang eine Phase der allgemeinen Weltoffenheit hinzugefügt, und
statt einer eigenen Phase der Problemdefinition wird hier ein Abschnitt eingefügt, der eine
gewisse Distanz zum Problem herstellen soll und konkret aus Entspannungs- und Analogie-
übungen besteht. Eingeleitet wird die Programmpräsentation mit einem Überblick über die
psychologische Kreativitätsforschung, ohne daß dabei jedoch Probleme der Forschung oder
Kreativitätsförderung angesprochen werden.
ZUR EFFEKTIVITÄT DER KREATIVITÄTSFÖRDERUNG
Grundlegende Probleme
Interne Validität: Sind die Trainingsinhalte für Trainingserfolg verantwortlich?
Was führt zur Leistungssteigerung am Trainingsende?
Gibt es eine spezifische Trainingswirkung jenseits von Placeboeffekten (und Übungs-
/Coachingeffekten)? – nur mit Placebo-Kontrollgruppe zu ermitteln. #### Rose & Lin???
Externe Validität: Führt Trainingserfolg zu besseren kreativen Leistungen?
Wie stabil, generell sind Trainingseffekte?
Problematisch, wenn Torrance-Tests zur Effektmessung eingesetzt werden. Fähigkeits- und
trait-Status????
Wenn ja, dann dürften Veränderungen nicht so einfach möglich sein.
Wenn nein, ist Stabilität der Effekte unklar.
- 22 -
Dass die meisten Studien die von ihm entwickelten Torrance Tests of Creative Thinking als
Kriterium verwendeten und gleichzeitig ähnliche Trainingsinhalte aufwiesen, was manchmal
als „teaching to the test“ gebrandmarkt wurde (Perkins, 1990; Wallach, 1985), stellt für Tor-
rance kein substantielles Argument dar, da er selbst in zahlreichen längsschnittlich angelegten
Studien den Nachweis führen konnte, dass spätere Lebensleistungen durch Meßwerte seiner
Tests gut prognostiziert werden konnten (Torrance, 1972b). Aus diesem Grund werden die
Torrance-Tests selbst in testkritischen Arbeiten als relativ brauchbar eingeschätzt (Cooper,
1991; Wallach, 1985). Dass in manchen der Längsschnittstudien (z.B. Torrance, 1969) ernste
methodische Probleme aufscheinen (mangelnde Reliabilität des Kriteriums, 30% Stichpro-
benmortalität, nach Intelligenz hochselegierte Stichprobe), wurde bislang zu wenig beachtet.
Torrance (1988) selbst gibt nämlich einen Überblick über 36 Studien, in denen signifikante
Veränderungen der Testleistungen allein durch Instruktionsvariation erreicht wurden. Zahlrei-
che Studien zeigten, dass einzig die Aufforderung, möglichst originelle Antworten zu geben,
die Testleistung deutlich erhöhte. Raina (1968) setzte beispielsweise kleine Geldbeträge als
Belohnung für die meisten Lösungen in einem Verwendungstest (Guilford, 1967) aus, wo-
durch die durchschnittliche Leistung in der Experimentalklasse im Vergleich zu einer Kon-
trollgruppe so stark anstieg, dass sich eine Effektstärke von 1,77 für Flüssigkeit und 1,88 für
Flexibilität berechnen ließ. Manske und Davis (1968) konnten zeigen, dass allein die Sugges-
tion, eine kreative Person zu sein, die Testleistungen signifikant ansteigen ließ, und Turner
und Rains (1965) demonstrierten, dass Instruktionseffekte sowohl bei hochkreativen als auch
bei wenig kreativen Probanden in gleicher Weise erzielbar sind. Da somit als gesichert gelten
kann, dass divergente Testleistungen von situativen Bedingungen stark beeinflussbar sind,
verbietet sich ihr Einsatz zur Beurteilung von Trainingseffekten eigentlich von selbst - weil
positive Effekte sowohl „simuliert“ als auch unterdrückt (Anstrengungsreduktion durch Fä-
higkeitsattribution als Trainingskonsequenz) werden können. Torrance (1986) erkennt zwar
an, dass durch Leistungsanreize und speziell gestaltete Durchführungsbedingungen der Krite-
riumstests befristete Kreativitätssteigerungen möglich sind; in den von ihm analysierten Stu-
dien hätten solche Maßnahmen jedoch nur in 60-70% der Fälle Erfolg gezeigt, während die
besten Trainingsprogramme immerhin bis zu 90% Erfolg verbuchen konnten.
- 23 -
Allgemeine Erkenntnisse
Tabelle X
Durchschnittliche Effektstärken von Kreativitätsfördermaßnahmen (Lipsey & Wilson, 1993)
Autoren Unabhängige Variable Abhängige Variable ES N
Cohn (1985) Kreativitätstechniken kreative Leistung 0,57 106
Rose & Lin (1984) Trainingsprogramme
zum kreativen Denken
Torrance-Tests 0,47 46
Kardash & Wright
(1987)
Kreatives Drama Schulleistung 0,67 16
Adair, Sharpe & Huynh
(1990)
Placebo-Effekte bei
Kontrollgruppen
alle Effekte 0,62 57
Alle Metaanalysen 0,50 302
Legende: ES = Effektstärke; N = Anzahl der Einzelstudien (In der letzten Zeile: Anzahl der Metaanalysen)
Die Diskussion um die Trainingssensibilität und -spezifität der Torrance-Tests soll noch um
einige Hinweise bereichert werden. Rose und Lin (1984) führten eine Metaanalyse von Stu-
dien zur Effektivitätsmessung von Trainingsprogrammen durch. Sie beschränkten sich dabei
auf Studien, in denen Torrance-Tests zur Veränderungsmessung eingesetzt und längere Trai-
ningsphasen (nicht nur eine Experimentalsitzung) angewandt wurden. Aus 46 Studien konn-
ten sie 370 Messungen der Effektstärke (McGaw & Glass, 1980) ermitteln, woraus sich eine
über alle Studien und alle Testdimensionen gemittelte durchschnittliche Effektstärke von
0,468 ergab. Die besten Effektwerte (im Durchschnitt 1,21) konnten für das Creative Problem
Solving-Programm hinsichtlich verbaler Flüssigkeit ermittelt werden. So positiv diese Ergeb-
nisse ausfallen, so wenig verraten sie über die Trainingswirkung.
Wie erfüllt die Trainingsforschung zur Kreativitätsförderung die an sie gestellten Anforde-
rungen? - Zunächst ist festzuhalten, daß außer anekdotischem Material keine Untersuchungen
zum individuellen oder gesellschaftlichen Bedarf nach Kreativitätsförderung vorliegen. Statt-
dessen wird unterstellt, daß Kreativität für jeden Menschen wertvoll sein kann und daß
- 24 -
gleichzeitig jeder Mensch durch ein Kreativitätstraining profitieren dürfte. Selbst wenn man
diese globalen Annahmen nicht anzweifelt, so fehlen doch Bemühungen um Trainingsindika-
tionen (d. h. um Regeln für die Zuordnung bestimmter Personen zu bestimmten Program-
men).Die Instruktionsmethodik für Trainingsprogramme ist ebensowenig ausreichend er-
forscht. Zwar wurden zahlreiche Studien zur Ermittlung differentieller Trainingseffekte
durchgeführt: Beispielweise fanden Shively et al. (1972) komplexe und inkonsistente Interak-
tionen zwischen Trainingsprogramm (Purdue oder Covington), Lernform (individuell versus
mit Anleitung durch eine Lehrkraft) und Kriteriumsmessbereich (verbale versus figurale Kre-
ativität) hinsichtlich der Trainingseffekte; Huber et al. (1979) fanden komplexe Interaktionen
zwischen Trainingsmaterial, Klassenstufe und Begabungsniveau der Teilnehmer hinsichtlich
der Programmeffekte; Bouchard (1972) fand komplexe Interaktionen zwischen Trainingser-
fahrung, Belohnung und dem Niveau interpersonaler Effektivität hinsichtlich der Effekte ei-
nes Brainstorming-Versuchs; usw. Diese Effektstudien wurden aber bislang nicht hinsichtlich
der optimalen Trainingsgestaltung - in Abhängigkeit von den Instruktionszielen und den Teil-
nehmervoraussetzungen - ausgewertet, so dass bislang die kognitiven Grundlagen weder der
vermittelten Kreativitätstechniken noch der dazu initiierten Lehr-Lern-Prozesse hinreichend
geklärt sind (Polson & Jeffries, 1985). Sternbergs (1983) Postulat Nr. 1 (s. o.) wurde demnach
bislang nicht eingelöst.
Einzelbefunde zu speziellen Trainingsprogrammen
Mit der Untersuchung von Trainingseffekten beschäftigen sich mehrere Autoren. Feldhusen
und Clinkenbeard (1987) stellen die Ergebnisse von Evaluationsstudien zum Purdue Creative
Thinking Program, zum Productive Thinking Program, zum Creative Problem-Solving sowie
zu anderen Programmen zusammenfassend dar. Die Autoren kommen zu dem positiven Er-
gebnis, “that it is possible, through direct instructional efforts, to effect significant gains in
students' creative thinking and problem-solving abilities (...)” (Feldhusen & Clinkenbeard,
1987, S. 177). Ähnlich positiv hatte sich zuvor bereits Torrance (1972a###) geäußert, der
nach einem Überblick über 142 Studien zur Kreativitätsförderung immerhin 72% der Arbei-
ten als Erfolgsbestätigungen interpretierte. Am erfolgreichsten seien seiner Meinung nach
Programme, die kognitive und affektive Ziele verfolgten, zur Strukturierung anregten und
- 25 -
Motivation vermittelten, und gleichzeitig Möglichkeiten zur Mitarbeit, praktischen Übung
und Interaktion mit Lehrkräften und anderen Teilnehmern böten.
Bedeutend kritischer als die bisherigen Arbeiten fällt die Übersicht von Mansfield, Busse und
Krepelka (1978) aus, die ebenfalls die genannten Programme sowie einige weitere untersuch-
ten. Die Autoren konnten zwar bestätigen, dass die Absolventen vieler Programme gesteigerte
Leistungen in Tests zum divergenten Denken zeigten. Dem Productive Training Program
wurde sogar bescheinigt, komplexes konvergentes Denken anzuregen. Starke Zweifel werden
jedoch dahingehend geäußert, ob divergentes Denken wirklich verbessert wurde (als alternati-
ve Erklärungen werden Coaching-Effekte und erhöhte Testmotivation diskutiert) und ob di-
vergentes Denken bedeutsam für kreative Lebensleistungen sei. Die Autoren konstatieren
auch, dass Transfereffekte des Kreativitätstrainings kaum nachgewiesen werden konnten.
Einige wenige Studien kann man finden, die Transferaufgaben oder Produktivitätsindikatoren
außerhalb des Trainingssettings als Evaluationskriterien heranziehen. Cramond, Martin und
Shaw (1990) verglichen die reguläre Anwendung des Creative Problem Solving mit einer
modifizierten, d.h. durch Transferelemente angereicherten Version sowie mit einer Placebo-
gruppe hinsichtlich ihrer Transferleistungen. Die Schlußfolgerung der Autoren, „there was a
higher degree of transfer of problem-solving strategies“ (Cramond et al., 1990, S. 141) für die
modifizierte Programmversion, wird durch die völlig unzureichende Datenauswertung nicht
gestützt. Basadur, Graen und Green (1982) trainierten Ingenieure und Techniker in einem
Treatment-/Placebo-/Non-Treatment-Design innerhalb von zwei Tagen, mehr Wert auf die
Produktion als auf die Bewertung von Ideen zu legen. Die eingesetzte Batterie an Meßverfah-
ren bestand aus Selbst- und Fremdratings, Produktionsaufgaben und „on the job“-
Verhaltensbeurteilungen zwei Wochen nach dem Training. Zahlreiche signifikante Änderun-
gen konnten zugunsten der Treatment-Gruppe verbucht werden, wenngleich der Wert der
Ergebnisse dadurch geschmälert wird, dass kein Prätest-Posttest-Design, keine objektiven
Transfermessungen und keine Effektstärkeberechnungen eingesetzt wurden und subjektive
Attribuierungen der Treatmentgruppe nicht kontrolliert wurden. Aufgrund der unzureichen-
den Reliabilität der meisten Messwerte sind die vielen positiven Befunde jedoch erstaunlich.
- 26 -
Die zuletzt zitierte Studie zeigt, dass auch anspruchsvolle Trainingsstudien durchführbar sind.
Diese sind freilich im Bereich der Kreativitätsförderung, zumal in der beruflichen Anwen-
dung, rar. Burke und Day (1986) konnten in ihre Metaanalyse von 70 Trainingsstudien für
Manager keine einzige zur Kreativität einbeziehen. Zumindest konnten drei Studien zum
Training des Problemlösens hinsichtlich objektiver Lernkriterien ausgewertet werden. Die
mittlere Effektstärke des Problemlösetrainings rangierte mit 0,16 am Schluss aller Trainings-
formen. Es scheint einfacher zu sein, zwischenmenschliche Beziehungen, arbeitsbezogene
Motivation oder allgemeine Managementkompetenz zu trainieren als Problemlösen und Krea-
tivität.
Welche Gründe auch immer vorliegen mögen, es gibt derzeit weder in der schulischen Aus-
bildung (Cropley, 1990) noch in der beruflichen Fortbildung (Latham, 1988) breiteres Interes-
se an der Entwicklung eines Kreativitätstrainings oder koordinierte Ansätze dafür.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Determiniertheit und Vorhersagbarkeit kreativer Leistungen
Was kann man modifizieren, wie weit gehen die Effekte?
Selektion oder Modifikation?
Veränderung der Person oder der Umwelt?
Empfehlungen
langfristig-kurzfristige Förderung
unspezifisch/generell versus spezifisch
Kriterium – Vorhersagbarkeit im allgemeinen?
Begrenztheit des personspezifischen Ansatzes
Offenheit/freies, entspanntes Kombinieren versus anstrengende Suche nach Kombinationen
komplexe Programme – was wirkt eigentlich?
LITERATUR
- 27 -
Adair, J. G., Sharpe, D. & Huynh, C. L. (1990). The placebo control group: An analysis of its
effectiveness in educational research. Journal of Experimental Education, 59, 67-86,
Adams, J. L. (1974). Conceptual blockbusting. A guide to better ideas. San Francisco: W.H.
Freeman.
Ainsworth-Land, V. (1982). Imaging and creativity. Journal of Creative Behavior, 16, 5-28.
Albert, R. S. & Runco, M. A. (1986). The achievement of eminence: a model based on a lon-
gitudinal study of exceptionally gifted boys and their families. In R. J. Sternberg & J.
E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 332-357). Cambridge: Cambridge
University Press.
Alexander, P. A. & Judy, J. E. (1988). The interaction of domain-specific and strategic
knowledge in academic performance. Review of Educational Research, 58, 375-404.
Allen, S. M. (1962). Morphological creativity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Amabile, T. (1996). Creativity in context. Update to The social psychology of creativity.
Boulder, CO: WestView.
Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualiza-
tion. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357-376.
Barron, F. (1988). Putting creativity to work. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity.
Contemporary psychological perspectives (pp. 76-98). Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Barron, F. & Harrington, D. M. (1981). Creativity, intelligence, and personality. Annual Re-
view of Psychology, 32, 439-476.
Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1989). Intentional learning as a goal of instruction. In L. B.
Resnick (Ed.), Knowing, learning, and instruction. Essays in honor of Robert Glaser
(pp. 361-392). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Boden, M. A. (1992). Die Flügel des Geistes. Kreativität und Künstliche Intelligenz. Mün-
chen: Artemis & Winkler.
Bollinger, G. & Greif, S. (1983). Innovationsprozesse. Fördernde und hemmende Einflüsse
auf kreatives Verhalten. In M. Irle (Hrsg.), Methoden und Anwendungen in der Markt-
psychologie. Enzyklopädie für Psychologie, Band D III 5 (S. 396-482). Göttingen:
Hogrefe.
Bouchard, T. J. (1971). Whatever happened to Brainstorming? Journal of Creative Behavior,
5, 182-189.
- 28 -
Bouchard, T.J. (1972). Training, motivation, and personality as determinants of the effective-
ness of brainstorming groups and individuals. Journal of Applied Psychology, 56, 324-
331.
Bransford, J. D. & Stein, B. S. (1984). The IDEAL Problem Solver. A guide for improving
thinking, learning, and creativity. New York: W. H. Freeman.
Bransford, J. D. & Stein, B. S. (1984). The Ideal Problem Solver. A guide for improving
thinking, learning, and creativity. New York: W.H. Freeman.
Bransford, J. D., Sherwood, R. D. & Sturdevant, T. (1987). Teaching thinking and problem
solving. In J. B. Baron & R. J. Sternberg (Eds.), Teaching thinking skills: Theory and
practice (pp.162-181). New York: W.H. Freeman.
Breuer, R. (1998). Genieblitz ohne Widerhall. bild der Wissenschaft special: Mehr Zeit! (S.
34-37). Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Briskman, L. (1980). Creative product and creative process in science and art. Inquiry, 23, 83-
106.
Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacogni-
tion. In R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology, Vol. 1 (pp. 77-165).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Brown, R.T. (1989). Creativity: What are we to measure? In J. A. Glover, R.R. Ronning & C.
R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity (pp. 3-32). New York: Plenum Press.
Burke, M.J. & Day, R.R. (1986). A cumulative study of the effectiveness of managerial train-
ing. Journal of Applied Psychology, 71, 232-245.
Bussmann, H. & Heymann, W. (1983). Kreativität. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft,
Band 8 (pp. 490-494). Stuttgart: Klett-Cotta.
Campbell, D. T. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other
knowledge processes. Psychological Review, 67, 380-400.
Cannon-Bowers, J. A., Tannenbaum, S .I., Salas, E. & Converse, S. A.(1991). Toward an in-
tegration of training theory and technique. Human Factors, 33, 281-292.
Chi, M. T. H., Glaser, R. & Rees, E. (1982). Expertise in problem solving. In R .J. Sternberg
(Ed.), Advances in the psychology of intelligence (Vol. 1, pp. 7-76). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Claridge, G. (1992). Great wits and madness. In R. S. Albert (Ed.), Genius and eminence (pp.
329-350). Oxford, UK: Pergamon.
- 29 -
Cohn, C. M. G. (1984). Creativity training effectiveness: A research synthesis (Doctoral dis-
sertation, Arizona State University, 1984). Dissertation Abstracts International, 45,
2501 A.
Cole, H. P. & Parsons, D. E. (1974). The Williams Total Creativity Program. Journal of Crea-
tive Behavior, 8, 187-207.
Cooper, E. (1991). A critique of six measures for assessing creativity. Journal of Creative
Behavior, 25, 194-204.
Covington, M. V., Crutchfield, R. S., Davies, L. & Olton, R.M.(1972). The Productive Think-
ing Program. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.
Cox, C. (1926). The early mental traits of three hundred geniuses. Stanford: University Press.
Cramond, B., Martin, C. E. & Shaw, E. L. (1990). Generalizability of creative problem solv-
ing procedures to real-life problems. Journal for the Education of the Gifted, 13, 141-
155.
Crawford, R. P. (1950). How to get ideas. Lincoln, Nebraska: University Associates.
Cropley, A. J. (1990). Kreativität im Alltag: Über Grundsätze kreativitätsorientierten Lehrens
und Lernens. International Review of Education, 36, 329-344.
Cropley, A.J. (1990). Kreativität im Alltag: Über Grundsätze kreativitätsorientierten Lehrens
und Lernens. International Review of Education, 36, 329-344.
Csikszentmihalyi, M. (1985). Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Lageweile: im Tun
aufgehen. Stuttgart: Clett-Cotta.
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention.
New York, NY: HarperCollins.
Csikszentmihalyi, M. (1997). Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen
überwinden. Stuttgart: Klett-Cotta.
Csikszentmihalyi, M. (1997). Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen
überwinden. 2. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta.
Davidson, J. E. & Sternberg, R. J. (1984). The role of insight in intellectual giftedness. Gifted
Child Quarterly, 28, 58-64.
Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R.J.Sternberg & J. E. Davidson
(Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 201-222). Cambridge: Cambridge University
Press.
Davis, G. A. (1991). Teaching creative thinking. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.),
Handbook of gifted education (pp. 236- 244). Boston: Allyn & Bacon.
de Bono, E. (1973). CoRT thinking materials. London: Direct Education Services.
- 30 -
de Bono, E. (1985). The CoRT Thinking Program. In J. W. Segal, S. F. Chipman & R. Glaser
(Eds.), Thinking and learning skills: Relating instruction to research. Vol. 1 (pp. 363-
388). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
deBono, E. (1973). CoRT thinking. Blandford, Dorset, England: Direct Education.
Dörner, D. (1982). Wie man viele Probleme zugleich löst - oder auch nicht! Sprache und
Kognition, 1, 55-66.
Eberle, R. (1974). Does Creative Dramatics really square with research evidence? Journal of
Creative Behavior, 8, 177-182.
Eisenberger, R., Armeli, S. & Pretz, J. (1998). Can the promise of reward increase creativity?
Journal of Personality and Social Psychology, 74, 704-714.
Ericsson, K. A. & Charness, N. (1994). Expert performance: Its structure and acquisition.
American Psychologist, 49, 725-747.
Ericsson, K. A. (1996). The acquisition of expert performance: An introduction to some of the
issues. In K.A.Ericsson (Ed.), The road to excellence. The acquisition of expert per-
formance in the arts and sciences, sports, and games (pp. 1-50). Mahwah, NJ: Erl-
baum.
Ericsson, K. A. (1998). The scientific study of expert levels of performance: general implica-
tions for optimal learning and creativity. High Ability Studies, 9, 75-100.
Ericsson, K. A. (1998). The scientific study of expert levels of performance: General implica-
tions for optimal learning and creativity. High Ability Studies, 9, 75-100.
Erikson, E. H. (1964). Der junge Mann Luther. Eine psychoanalytische und historische Stu-
die. München: Szczesny.
Eysenck, H. J. (1993). Creativity and personality: Suggestions for a theory. Psychological
Inquiry, 4, 147-178.
Federico, P. & Landis, D. B. (1984). Cognitive styles, abilities, and aptitudes: Are they de-
pendent or independent? Contemporary Educational Psychology, 9, 146-161.
Feldhusen, J. F. & Clinkenbeard, P. R. (1987). Creativity instructional materials: A review of
research. Journal of Creative Behavior, 20, 153-182.
Feldhusen, J. F. & Clinkenbeard, P. R. (1987). Creativity instructional materials: a review of
research. Journal of Creative Behavior, 20, 153-182.
Feldhusen, J. F. (1993). A conception of creative thinking and creativity training. In S. G.
Isaksen, M. C. Murdock, R. L. Firestien & D. J. Treffinger (Eds.), Nurturing and de-
veloping creativity: The emergence of a discipline (pp. 31-50). Norwood, NJ: Ablex.
- 31 -
Feldhusen, J. F., Treffinger, D. J. & Bahlke, S. J. (1970).Developing creative thinking: The
Purdue Creativity Program. Journal of Creative Behavior, 4, 85-90.
Findlay, C. S. & Lumsden, C. J. (1988). The creative mind. Journal of Social and Biological
Structures, 11, 3-56.
Finke, R. (1990). Creative imagery. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Finke, R. A., Ward, T. B. & Smith, S. M. (1992). Creative cognition: Theory, research, and
applications. Cambridge: MIT Press.
Frederiksen, N. (1984). Implications of cognitive theory for instruction in problem solving.
Review of Educational Research, 54, 363-407.
Frensch, P. A. & Sternberg, R. J. (1989). Expertise and intelligent thinking: When is it worse
to know better? In R.J.Sternberg (Ed.), Advaces in the psychology of human intelli-
gence, Vol. 5 (pp. 157-188). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Frühwacht, M. & Haenschke, B. (1994). Ideenfindung/Kreativitätstechniken. In F. J. Heeg &
P. Meyer-Dohm (Hrsg.), Methoden der Organisationsgestaltung und Personalentwick-
lung (S. 548-578). München: Hanser.
Gallini, J.K. (1989). Schema-based strategies and implications for instructional design in
strategy training. In C. B. McCormick, G. Miller & M. Pressley (Eds.), Cognitive
strategy research: From basic research to educational applications (pp. 239-268). Ber-
lin: Springer.
Galton, F. (1892). Hereditary genius: An enquiry into its laws and consequences. London:
Macmillan.
Gardner, H. (1983). Frames of mind. The theory of multiple intelligences. New York: Basic
Books.
Gardner, H. (1996). So genial wie Einstein. Schlüssel zum kreativen Denken. Stuttgart: Klett-
Cotta.
Geschwind, N. & Galaburda, A. M. (1987). Cerebral lateralization. Biological mechanisms,
associations, and pathology. Cambridge, MA: The MIT-Press.
Getzels, J. W. & Czikszentmihalyi, M. (1976). The creative vision: A longitudinal study of
problem-finding in art. New York: Wiley-Interscience.
Getzels, J. W. & Jackson, P. W. (1963). The highly intelligent and the highly creative adoles-
cents. In C. W. Taylor & F. Baron (Eds.), Scientific creativity (pp. 161-172). New
York: J. Wiley.
Gick, M. L. & Holyoak, K. J. (1983). Schema induction and analogical transfer. Cognitive
Psychology, 15, 1-38.
- 32 -
Gick, M. L. & Holyoak, K. J. (1987). The cognitive basis of knowledge transfer. In S.M.
Cormier & J. D. Hagen (Eds.),Transfer of learning. Contemporary research and appli-
cations (pp. 9-47). San Diego: Academic Press.
Gick, M. L. (1989). Transfer in insight problems: The effects of different types of similarity.
In K. J. Gilhooly, M. T. G. Keane, R. H. Logie & G. Erdos (Eds.), Lines of thinking:
Reflections on the psychology of thought, Vol. 1: Representation, reasoning, analogy
and decision making (pp.251-266). Chichester: J. Wiley & Sons.
Glaser, R. & Bassok, M. (1989). Learning theory and the study of instruction. Annual Review
of Psychology, 40, 631-666.
Glaser, R. (1990). The reemergence of learning theory within instructional research. Ameri-
can Psychologist, 45, 29-39.
Goldstein, I.L. & Buxton, V.M. (1982). Training and human performance. In M. D. Dunnette
& E. A. Fleishman (Eds.), Human performance and productivity: Human capability
assessment. (Vol. 1, pp. 135-178). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Goldstein, I.L. (1980). Training in work organizations. Annual Review of Psychology, 31,
229-272.
Goleman, D. (1996). Emotionale Intelligenz. München: Carl Hanser.
Gordon, W. J. J. (1961). Synectics. New York: Harper.
Gowan, J. C. (1975). Trance, art, and creativity. Journal of Creative Behavior, 9, 1-11.
Gruber, H. & Mandl, H. (1992). Begabung und Expertise. In E. A. Hany & H. Nickel (Hrsg.),
Begabung und Hochbegabung. Theoretische Konzepte, empirische Befunde, prakti-
sche Konsequenzen (S. 59-74). Bern: Huber.
Gruber, H. E. & Davis, S. N. (1988). Inching our way up Mount Olympus: the evolving-
systems approach to creative thinking. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of creativ-
ity. Contemporary psychological perspectives (pp. 243-270).Cambridge: Cambridge
University Press.
Gruber, H. E. (1981). Darwin on man: a psychological study of scientific creativity (2nd ed.).
Chicago: University of Chicago Press.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.
Guilford, J. P. (1973). Kreativität. In G. Ulman (Hrsg.), Kreativitätsforschung (S. 25-43).
Köln: Kiepenheuer & Witsch. [Übersetzung des Artikels von 1950 im American Psy-
- 33 -
chologist; übernommen aus G. Mühle & C. Schell (Hrsg.), Kreativität und Schule (S.
13-36). München: ####.]
Hadamard, J. (1945). The psychology of invention in the mathematical field. Princeton:
Princeton University Press.
Haensly, P., Reynolds, C. R. & Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, con-
flict, and commitment. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of gift-
edness (pp. 128-148). Cambridge: Cambridge University Press.
Halpern, D. F. (1987). Analogies as a critical thinking skill. In D. E. Berger, K. Pezdek & W.
P. Banks (Eds.), Applications of cognitive psychology: Problem solving, education,
and computing (pp. 75-86). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hany, E. A. (1993). Kreativitätstraining: Positionen, Probleme, Perspektiven. In K. J. Klauer
(Hrsg.), Kognitives Training (S. 189-216). Göttingen: Hogrefe.
Hayes, J. R. (1989). The Complete Problem Solver (2nd ed.).Hillsdale, NJ: Lawrence Erl-
baum.
Hennessey, B. A. & Amabile, T. M. (1988). The conditions of creativity. In R. J. Sternberg
(Ed.), The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives (pp. 11- 38).
Cambridge: Cambridge University Press.
Hofstadter, ...
Höhler, G. (1994). Kreativität in Schule und Gesellschaft. In G. Höhler, C. Hoerburger, H.
Hubert, R. Seitz & H. J. Serve (Hrsg.), Kreativität in Schule und Gesellschaft (S. 62-
99). Donauwörth: Auer.
Höhler, G. (1994). Kreativität in Schule und Gesellschaft. In G. Höhler, C. Hoerburger, H.
Hubert, R. Seitz & H. J. Serve (Hrsg.), Kreativität in Schule und Gesellschaft (S. 62-
99). Donauwörth: Auer.
Höhler, G. (1994). Kreativität in Schule und Gesellschaft. In G. Höhler, C. Hoerburger, H.
Huber, R. Seitz & H. J. Serve (Hrsg.), Kreativität in Schule und Gesellschaft (S. 62-
99). Donauwörth: Ludwig Auer.
Holland, J. H, Holyoak, K. J., Nisbett, R.E. & Thagard, P. R.(1986). Induction. Processes of
inference, learning, and discovery. Cambridge, MA: MIT Press.
Holyoak, K. J. & Koh, K. (1987). Surface and structural similarity in analogical transfer.
Memory and Cognition, 15, 332-340.
Houston, J. (1973). The Psychenaut Program: An exploration into some human potentials.
Journal of Creative Behavior, 7, 253- 278.
- 34 -
Howe, M. J. A., Davidson, J. W., & Sloboda, J. A. (1998). Innate talents: Reality or myth?
Behavioral and Brain Sciences, 21, 399-442.
Huber, J., Treffinger, D., Tracy, D. & Rand, D. (1979). Self- instructional use of programmed
creativity training materials with gifted and regular students. Journal of Educational
Psychology, 71, 303-309.
Isaksen, S. G. & Treffinger, D. J. (1985). Creative Problem Solving: The basic course. Buf-
falo, NY: Bearly Limited.
Jackson, P. W. & Messick, S. (1965). The person, the product, and the response: Conceptual
problems in the assessment of creativity. Journal of Personality, 33, 309-329.
Jackson, P. W. & Messick, S. (1967). The person, the product, and the response: conceptual
problems in the assessment of creativity. In J. Kagan (Hrsg.), Creativity and learning.
Boston: Houghton Mifflin.
Johnson, E. J. (1988). Expertise and decision under uncertainty: Performance and process. In
M.T.H.Chi, R. Glaser, & M. J. Farr (Eds.), The nature of expertise (pp. 209-228).
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Johnson-Laird, P. N. (1989). Analogy and the exercise of creativity. In S. Vosniadou & A.
Ortony (Eds.), Similarity and analogical reasoning (pp. 313-331). Cambridge: Uni-
versity press.
Kardash, C. A. M. & Wright, L. (1987). Does creative drama benefit elementary school stu-
dents? A meta-analysis. Youth Theatre Journal, 1(3), 11-18.
Khatena, J. (1975). Creative imagination imagery and analogy. Gifted Child Quarterly, 19,
149-160.Khatena, J. (1982). Educational psychology of the gifted. New York: J.
Wiley.
Klauer, K. J. (1991). Erziehung zum induktiven Denken: Neue Ansätze der Denkerziehung.
Unterrichtswissenschaft, 19, 135-151.
Klix, F. (1983). Begabungsforschung - ein neuer Weg in der kognitiven Intelligenzdiagnos-
tik? Zeitschrift für Psychologie, 191, 360-387.
Koestler, A. (1964). The act of creation. New York: Macmillan.
Koestler, A. (1964). The act of creation. New York: Macmillan.
Koestler, A. (1964). The act of creation. New York: Macmillan.
Kohn, M. L. & Schooler, C. (1978). The reciprocal effects of the substantive complexity of
work on intellectual flexibility: A longitudinal assessment. American Journal of Soci-
ology, 84, 24-52.
- 35 -
Krampen, G. (1997). Promotion of creativity (divergent productions) and convergent produc-
tions by systematic-relaxation exercises: empirical evidence from five experimental
studies with children, young adults, and elderly. European Journal of Personality, 11,
83-99.
Kuhl, J. (1987). Action control: The maintenance of motivational states. In F. Halisch & J.
Kuhl (Eds.), Motivation,intention, and volition (pp. 279-292). Berlin: Springer.
Lange-Eichbaum, W. (1932). The problem of genius. New York: Macmillan.
Langley, P. (1985). Learning to search: From weak methods to domain-specific heuristics.
Cognitive Science, 9, 217-260.
Langley, P., Simon, H. A., Bradshaw, G. L. & Zytkow, J. M. (1987). Scientific discovery.
Computational explorations of the creative processes. Cambridge, MA: MIT Press.
Larkin, J. H., McDermott, J., Simon, D. P. & Simon, H. A. (1980).Models of competence in
solving physics problems. Cognitive Science, 4, 317-345.
Latham, G. P. (1988). Human resource training and development. Annual Review of Psy-
chology, 39, 545-582.
Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (1993). The efficacy of psychological, educational, and be-
havioural treatment. Confirmation from meta-analysis. American Psychologist, 48,
1181-1209.
Lißmann, U. & Mainberger, U. (1977). Experimentelle Untersuchung der Effektivität eines
Kreativitätstrainingsprogramms. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 24, 326-
334.
Locke, J. (1913). Versuch über den menschlichen Verstand. Erster Band (Buch I und II).
Leipzig: Felix Meiner.
Londner, L. (1991). Connection-making processes during creative task activity. The Journal
of Creative Behavior, 25, 20-26.
Lubart, T. I. & Sternberg, R. J. (1995). An investment approach to creativity: Theory and
data. In S. M. Smith & T. B. Ward (Eds.), The creative cognition approach (pp. 271-
302). Cambridge, MA: MIT Press.
Ludwig, A. M. (1992). Creative achievement and psychopathology: Comparisons among pro-
fessions. American Journal of Psychotherapy, XLVI, 330-354.
Ludwig, A. M. (1995). The price of greatness. Resolving the creativity and madness contro-
versy. New York: Guilford.
Maltzman, I. (1960). On the training on originality. Psychological Review, 67, 229-242.
- 36 -
Mandl, H., Gruber, H. & Renkl, A. (1991). Kontextualisierung von Expertise. Forschungsbe-
richt Nr. 2. München: Ludwig- Maximilians-Universität, Institut für Empirische Päda-
gogik und Pädagogische Psychologie.
Mansfield, R. D., Busse, T. V. & Krepelka, E. J. (1978). The effectiveness of creativity train-
ing. Review of Educational Research, 48, 517-536.
Mansfield, T. V. & Busse, R. S. (1980). Theories of the creative process: A review and a per-
spective. Journal of Creative Behavior, 14, 91-103, 132.
Markus, H. R. & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emo-
tion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
Martindale, C. (1989). Personality, situation, and creativity. In J. A. Glover, R. R. Ronning &
C. R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity (pp. 211-232). New York: Plenum
Press.
McGaw, B. & Glass, G. V. (1980). Choice of the metric of effect size in meta-analysis.
American Educational Research Journal, 17, 325-337.
Mednick, S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Psychological Review,
69, 202-232.
Meichenbaum, D. (1975). Enhancing creativity by modifying what subjects say to them-
selves. American Educational Research Journal, 12, 129-145.
Mendelsohn, G.A. (1976). Associative and attentional processes in creative performance.
Journal of Personality, 44, 341-369.
Miller, A. I. (1996). Insights of genius. Imagery and creativity in science and art. New York:
Copernicus.
Miller, A. I. (1996). Insights of genius. Imagery and creativity in science and art. New York:
Copernicus.
Morris, N. M. & Rouse, W. B. (1985). Review and evaluation of empirical research in trou-
bleshooting. Human Factors, 27,503-530.
Mumford, M. D. & Gustafson, S. B. (1988). Creativity syndrome: Integration, application,
and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43.
Mumford, M. D. & Gustafson, S. B. (1988). Creativity syndrome: Integration, application,
and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43.
Mumford, M. D. & Gustafson, S. B. (1988). Creativity syndrome: Integration, application,
and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43.
Newell, A. & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall.
- 37 -
Nickerson, R. S. (1999). Enhancing creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativ-
ity (pp. 392-430). Cambridge: Cambridge University Press.
Oden, M. H. (1968). The fulfillment of promise: 40-year follow-up of the Terman gifted
groups. Genetic Psychological Monographs, 77, 3-93.
Ohlsson, S. (1984). Restructuring revisited. I. Summary and critique of the Gestalt theory of
problem solving. Scandinavian Journal of Psychology, 25, 65-78.
Olton, R.M. (1969). A self-instructional program for developing productive thinking skills in
fifth- and sixth-grade children. Journal of Creative Behavior, 3, 16-25.
Ornstein, R. E. (1972). The psychology of consciousness. Middlesex: Penguin.
Ornstein, R. E. (1989). Multimind. Ein neues Modell des menschlichen Geistes. Paderborn:
Junfermann.
Osborn, A. F. (1963). Applied imagination (3rd edition). New York: Scribner's.
Parnes, S. J. & Noller, R. B. (1972). Applied Creativity: The Creative Studies Project, Part II:
Results of the Two Years Program. Journal of Creative Behavior, 6, 164-186.
Parnes, S. J., Noller, R. B. & Biondi, A. M. (1977). Guide to creative action. New York:
Charles Scribner's Sons.
Patel, V. L. & Groen, G. J. (1986). Knowledge-based solution strategies in medical reasoning.
Cognitive Science, 10, 91-110.
Patel, V. L., Arocha, J. F., & Kaufman, D. R. (1994). Diagnostic reasoning and medical ex-
pertise. In D.L.Medin (Ed.), The psychology of learning and motivation (pp. 187-252).
San Diego, CA: Academic Press.
Perkins, D. N. (1988). Creativity and the quest for mechanism. In R. J. Sternberg & E. E.
Smith (Eds.), The psychology of human thought (pp. 309-337). Cambridge: Cambridge
University Press.
Perkins, D. N. (1990). The nature and nurture of creativity. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.),
Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp. 415-443). Hillsdale, NJ: Erl-
baum.
Perkins, D. N. (1990). The nature and nurture of creativity. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.),
Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp. 415-443). Hillsdale, NJ: Law-
rence Erlbaum.
Pettigrew, T. (1982). Cognitive style and social behavior: A review of category width. In L.
Wheeler (Ed.), Review of personality and social psychology (Vol. 3, pp. 199-224).
Beverly Hills: Sage.
- 38 -
Pintrich, P. R., Cross, D. R., Kozma, R. B. & McKeachie, W. J.(1986). Instructional Psychol-
ogy. Annual Review of Psychology, 37, 611-651.
Polson, P. G. & Jeffries, R. (1985). Instruction in general problem-solving skills: An analysis
of four approaches. In J. W. Segal, S. F. Chipman & R. Glaser (Eds.), Thinking and
learning skills: Relating instruction to research. Vol. 1(pp. 417-455). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Poze, T. (1983). Analogical connections - the essence of creativity. Journal of Creative Be-
havior, 17, 240-258.
Prawat, R. S. (1989). Promoting access to knowledge, strategy, and disposition in students: A
research synthesis. Review of Educational Research, 59, 1-41.
Preiser, S. (1976). Kreativitätsforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Preiser, S. & Buchholz, N. (1997). Kreativitätstraining. Das 7-Stufen-Programm für Alltag,
Studium und Beruf. Augsburg: Augustus.
Prince, G. M. (1970). The practice of creativity. New York:Harper.
Putnam, R. (1989). Mathematics knowledge for understanding and problem solving. Interna-
tional Journal of Educational Research, 11, 687-705.
Reese, H. W., Parnes, S. J., Treffinger, D. J. & Kaltsounis, G. (1976). Effects of a creative
studies program on structure-of-intellect factors. Journal of Educational Psychology,
68, 401-410.
Rips, L. J. (1989). Similarity, typicality, and categorization. In S. Vosniadou & A. Ortony
(Eds.), Similarity and analogical reasoning (pp. 21-59). Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Rogers, C. (1961). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. London:
Constable.
Rose, L. H. & Lin, H.-T. (1984). A meta-analysis of long-term creativity training programs.
Journal of Creative Behavior, 18, 11-22.
Runco, M. A. (Ed.). (1996). Creativity from childhood through adulthood: The developmental
issues. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Russ, S. (1988). Primary process thinking on the Rorschach, divergent thinking, and coping in
children. Journal of Personality Assessment, 52, 539-548.
Scarr, S. (1997). Behavior genetic and socialization theories of intelligence: Truce and recon-
ciliation. In R. J. Sternberg & E. L. Grigorenko (Eds.), Intelligence: Heredity and en-
vironment (pp. 3-41). New York: Cambridge University Press.
- 39 -
Schmidt, J. (1985). Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philo-
sophie und Politik 1750-1945. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Schott, F. (1991). Instruktionsdesign, Instruktionstheorie und Wissensdesign: Aufgabenstel-
lung, gegenwärtiger Stand und zukünftige Herausforderungen. Unterrichtswissen-
schaft, 19, 195-217.
Shively, J. E., Feldhusen, J. F. & Treffinger, D. J. (1972).Developing creativity and related
attitudes. Journal of Experimental Education, 41, 63-69.
Silver, H. K. (1983). Scientific achievement and the concept of risk. The British Journal of
Sociology, 34, 39-43.
Simon, H. (1976). Identifying basic abilities underlying intelligent performance of complex
tasks. In L. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp. 65-98). Hillsdale, NJ: Erl-
baum.
Simonton, D. K. (1975). Sociocultural context of individual creativity: A transhistorical time-
series analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 1119-1133.
Simonton, D. K. (1975). Sociocultural context of individual creativity: A transhistorical time-
series analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 1119-1133.
Simonton, D. K. (1988). Scientific genius. A psychology of science. Cambridge: Cambridge
University Press.
Simonton, D. K. (1988). Scientific genius: A psychology of science. Cambridge: Cambridge
University Press.
Simonton, D. K. (1989). Chance-configuration theory of scientific creativity. In B. Gholson,
W. R. Shadish, R. A. Neimeyer & A. C. Houts (Eds.), Psychology of science (pp. 170-
213). Cambridge: Cambridge University Press.
Simonton, D. K. (1997). Genius and creativity: Selected papers. Greenwich, CN: Ablex.
Simonton, D.K. (1988). Scientific genius: A psychology of science. Cambridge: Cambridge
University Press.
Spektrum der Wissenschaft. Spezialheft „Intelligenz“. Juli 1999.
Springer, S. P. & Deutsch, G. (1995). Linkes - rechtes Gehirn. 3. Auflage. Heidelberg: Spekt-
rum.
Stein, M. I. (1974). Stimulating creativity. Volume 1: Individual procedures. New York: Aca-
demic Press.
Stein, M. I. (1974). Stimulating creativity. Volume l: Individual procedures. New York: Aca-
demic Press.
- 40 -
Stein, M. I. (1975). Stimulating creativity. Volume 2: Group procedures. New York: Aca-
demic Press.
Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In
R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 3-15). Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Sternberg, R. J. (1983). Criteria for intellectual skills training. Educational Researcher, 12, 6-
12.
Sternberg, R. J. (1988). A three-facet model of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature
of creativity. Contemporary psychological perspectives (pp. 125-147). Cambridge:
Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (1996). Costs of expertise. In K.A.Ericsson (Ed.), The road to excellence. The
acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games (pp. 347-
354). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Sternberg, R. J. (1998). Erfolgsintelligenz. Warum wir mehr brauchen als EQ+IQ. München:
Lichtenberg.
Stratton, R. P. & Brown, R. (1972). Improving creative thinking by training in the production
and/or judgment of solutions. Journal of Educational Psychology, 63, 390-397.
Taba, H. (1966). Teaching strategies and cognitive functioning in elementary school children.
Washington, D.C.: U.S. Office of Education.
Tannenbaum, A. J. (1983). Gifted children: Psychological and educational perspectives. New
York: Macmillan.
Taylor, I. A. (1970). Creative production in gifted young (almost) adults through simultane-
ous sensory stimulation. Gifted Child Quarterly, 14, 46-55.
Terman, L. M. & Oden, M. H. (1959). The gifted group of mid-life. Stanford: Stanford Uni-
versity Press.
Torrance, E. P. & Presbury, J. (1984). The criteria of success used in 242 recent experimental
studies of creativity. Creative Child and Adult Quarterly, 9, 238-243.
Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Torrance, E. P. (1972). Can we teach children to think creatively? Journal of Creative Behav-
ior, 6, 114-141. (a)
Torrance, E. P. (1972). Predictive validity of the Torrance Tests of Creative Thinking. Jour-
nal of Creative Behavior, 6, 236-252. (b)
- 41 -
Torrance, E. P. (1972). Predictive validity of the Torrance Tests of Creative Thinking. Jour-
nal of Creative Behavior, 6, 114-141.
Torrance, E. P. (1972). Predictive validity of the Torrance Tests of Creative Thinking. Journal
of Creative Behavior, 6, 236- 252. (b)
Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking. Technical-norms manual.
Bensenville, IL: Scholastic Testing Service.
Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking. Technical-norms manual.
Bensenville, IL: Scholastic Testing Service.
Torrance, E. P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Norms – technical manual. Lex-
ington, MA: Ginn.
Torrance, E. P. (1975). Sociodrama as a creative problem-solving approach to studying the
future. Journal of Creative Behavior, 9, 182-195.
Torrance, E. P. (1986). Teaching creative and gifted learners. In M.C. Wittrock (Ed.), Hand-
book of research on teaching (3rded., pp. 630-647). New York: Macmillan.
Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg
(Ed.), The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives (pp. 43-75).
Cambridge: Cambridge University Press.
Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg
(Ed.), The nature of creativity. Contemporary psychological perspectives (pp. 43-75).
Cambridge: Cambridge University Press.
Treffinger, D .J. & Ripple, R. E. (1971). Programmed instruction in creative problem-solving.
Educational Leadership, 28, 667- 675.
Treffinger, D. J., Speedie, S. M. & Brunner, W. D. (1974). Improving children's creative
problem solving ability: The Purdue creativity project. Journal of Creative Behavior,
8, 20-30.
Tucker, P. H. & Warr, P. (1996). Intelligence, elementary cognitive components, and cogni-
tive styles as predictors of complex task performance. Personality and Individual Dif-
ferences, 21, 91-102.
Urban, K.K. (1992). Neuere Aspekte der Kreativitätsforschung. Universität Hannover: Manu-
skript.
v. Pierer, H. (1997). Erfinden, entwickeln, unternehmerisch umsetzen – Von der Idee zum
Markterfolg. In H. v. Pierer & B. v. Oetinger (Hrsg.), Wie kommt das Neue in die
Welt? (S. 133-146). München: Hanser.
- 42 -
Van Patten, J., Chao, C.-I & Reigeluth, C. M. (1986). A review of strategies for sequencing
and synthesizing instruction. Review of Educational Research, 56, 437-471.
Vosniadou, S. (1989). Analogical reasoning as a mechanism in knowledge acquisition: a de-
velopmental perspective. In S. Vosniadou & A. Ortony (Eds.), Similarity and analogi-
cal reasoning (pp. 413-469). Cambridge: Cambridge University Press.
Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt Brace.
Weinert, F. E. (1990). Der aktuelle Stand der psychologischen Kreativitätsforschung und ei-
nige daraus ableitbare Schlußfolgerungen für die Lösung praktischer Probleme. In P.
H. Hofschneider & K. U. Mayer (Eds.), Generationsdynamik und Innovation in der
Grundlagenforschung (pp. 21-44). München: Max-Planck-Gesellschaft.
Weinert, F. E. (1993). Wissenschaftliche Kreativität: Mythen, Fakten und Perspektiven. Pa-
derborn: Universität Paderborn.
Weinert, F. E. (1997). Das Individuum. In H. v. Pierer & B. v. Oetinger (Hrsg.), Wie kommt
das Neue in die Welt? (S. 201-208). München: Hanser.
Weinert, F. E. (1990). Der aktuelle Stand der psychologischen Kreativitätsforschung und ei-
nige daraus ableitbare Schlußfolgerungen für die Lösung praktischer Probleme. In P.
H. Hofschneider & K. U. Mayer (Hrsg.), Generationsdynamik und Innovation in der
Grundlagenforschung (S. 21-44). München: Max-Planck-Gesellschaft.
Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wit-
trock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 315-327). New York:
Macmillan.
Weisberg, R. (1989). Kreativität und Begabung. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft.
Weisberg, R. (1989). Kreativität und Begabung. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft.
Weisberg, R. W. (1986). Creativity, genius and other myths. What you, Mozart, Einstein &
Picasso have in common. New York: W. H. Freeman.
Weisberg, R. W. (1986). Creativity, genius and other myths. What you, Mozart, Einstein &
Picasso have in common. New York: W. H. Freeman.
Weisberg, R. W. (1993). Creativity. Beyond the myth of genius. New York: W. H. Freeman.
Wertheimer, M. (1964). Produktives Denken. Frankfurt: Kramer.
Westmeyer, H. (1998). The social construction and psychological assessment of creativity.
High Ability Studies, 9, 11-21.
Westmeyer, H. (1998). The social construction and psychological assessment of creativity.
High Ability Studies, 9, 11-21.
- 43 -
Williams, F. E. (1972). A Total Creativity Program for individualizing and humanizing the
learning process. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Press.
Willis, S. L. & Nesselroade, C. S. (1990). Long-term effects of fluid ability training in old-old
age. Developmental Psychology, 26, 905-910.
Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities. New York: Basic Books.
Zuckerman, H. (1992). The scientific elite: Nobel Laureates' mutual influences. In R. S. Al-
bert (Ed.), Genius and eminence (pp. 157-169). Oxford, UK: Pergamon (orig. 1977).
Zwicky, F. (1957). Morphological astronomy. Berlin: Springer.