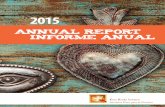Grenzfälle des Sprechens im Kino des New Hollywood
Transcript of Grenzfälle des Sprechens im Kino des New Hollywood
1
Grenzfälle des Sprechens im Kino des New Hollywood
Dieser Aufsatz befasst sich mit einigen Charakteristika der Inszenierung des Sprechens in einer spezifischen Periode des Hollywood-Kinos, die als New Hollywood bekannt ist und etwa von 1967 bis 1980 datiert werden kann. Ich werde zunächst ein Beispiel näher erläutern und daraus einige Schlussfolgerungen ziehen, die ich im folgenden auf eine ganze Reihe anderer Beispiele beziehen werde. Auf diese Weise lässt sich – so die Hoffnung – sowohl eine wenig untersuchte Facette dieses speziellen Kinos näher beleuchten als auch historisch informierter Aufschluss über das Spannungsfeld gewinnen, in welchem sich die Stimme im Film immer schon befindet.1 Ein Beispiel: Was bedeutet es, wenn ein Affe zu sprechen beginnt? Am Ende von ESCAPE FROM THE PLANET OF THE APES (Regie: Don Taylor, USA 1971), dem dritten Teil der PLANET OF THE APES-Reihe, sind die beiden Protagonisten, die sprechenden und intelligenten Affen Zira und Cornelius, aus der Zukunft in die Gegenwart der 1970er Jahre gereist, tot: ermordet von Menschen. Zira allerdings hat im Laufe der Handlung ein Baby zur Welt gebracht und es durch Vertauschung mit einem anderen Affenkind vor dem Schicksal seiner Eltern zu bewahren vermocht. Wie dem Zuschauer wohl bewusst ist, ist also mit dem Ende der Protagonisten nicht alles vorbei. Und wirklich kehrt der Film für die letzte Szene zu diesem letzten Überlebenden zurück, welcher die Zukunft der Menschheit und die Zukunft der Filmreihe auf seinen Schultern trägt. Die letzte Einstellung des Films isoliert ihn schließlich durch eine Heranfahrt der Kamera von allen anderen Figuren, und zum ersten Mal scheint der kleine Schimpanse Laute zu bilden. Zunächst scheinen die Geräusche dem engen Raum zwischen Zunge und Gaumen zu entspringen, ähnlich einem leichten Würgen oder einem voluminöseren Hühnergackern, um dann mehr Raum zu gewinnen und schnell immer klarer artikuliert zu werden: mit einer seltsamen, zwischen Tier und Mensch nicht eindeutig einzuordnenden, hohen und gequetschten Stimme, der es an Resonanzraum zu mangeln scheint, aber klar und deutlich und schließlich stetig dringlicher wiederholt der Affe bis über die finale Schwarzblende hinaus immer wieder das eine Wort: „Mama. Mama. Mama! Maama! Maama! …“
Diese Szene lässt sich in gleich mehrfachem Sinne als eine affektive Figur der Grenzüberschreitung, als eine liminale Figur verstehen – in Anlehnung an Raymond Bellour ließe sich hier von einer symbolischen, einer dispositiven und einer intensiven Dimension der Emotion sprechen:2 auf der Ebene des
1 „A film’s aural elements are not received as an autonomous unit. They are immediately analyzed and distributed in the spectator’s perceptual apparatus according to the relation each bears to what the spectator sees at the time.“ Chion 1999, 3. 2 Vgl. Bellour 2005, 64f.: „Die Emotion ist zunächst einmal immer intensiv (oder affektiv): Das ist die erste fundamentale Ebene der Emotion im Kino. Das reinste Beispiel dafür ist der [durch eine unvorhergesehene Bewegung ausgelöste] Schock [...].“ Auf eine zweite, die textuelle Ebene, die ich hier überspringe, folgt die „dritte Ebene der Emotion, die ich symbolisch nennen werde. Am besten können wir diesen [...] Begriff fassen, wenn wir uns an das erinnern, was Barthes in S/Z über den Code oder das symbolische Feld mit seinen drei Eingängen, dem rhetorischen, dem ökonomischen und dem psychoanalytischen, sagt und
2
Symbolischen handelt es sich bei diesem Affen nicht um irgendeinen, sondern um denjenigen, dessen Nachfahren die Menschen als Krone der Schöpfung ablösen und versklaven werden – ein Konflikt, der erst mit der totalen Vernichtung des Planeten Erde sein Ende finden wird, wie es die beiden Vorgängerfilme PLANET OF THE APES (Franklin J. Schaffner, USA 1968) und BENEATH THE PLANET OF THE APES (Ted Post, USA 1970) zeigen, die vom dritten Teil aus gesehen in der Zukunft spielen. Nicht zufällig wird daher der Name dieses ominösen Affen im folgenden Film, CONQUEST OF THE PLANET
OF THE APES (J. Lee Thompson, USA 1972), in Caesar geändert werden: denn was in dieser Szene geschieht, kommt dem Überschreiten des Rubikon gleich, dem Überschreiten einer Grenze, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Das Überschreiten des Rubikon bedeutet Krieg, und die emotionale Aufladung, aus welcher sich die gewaltsame Auseinandersetzung speisen wird, ist im Kern schon in dieser Szene und in der Tatsache enthalten, dass die so dringlich herbeigerufene Mutter des kleinen Affen ihn nicht hören kann und nicht zu ihm kommen wird, weil sie von Menschen erschossen wurde. Das Zur-Sprache-Finden ist damit unter das Zeichen des Verlusts gestellt: der Ruf nach der Mutter entsteht aus dem Alleingelassensein des Kindes, aus einer Diskrepanz zwischen Wunsch und Erfüllung, die nach Ausgleich verlangt.
Der Mechanismus, zwischen der Etablierung eines Bedürfnisses und dessen Erfüllung eine Lücke einzuführen, ist aus der Dramaturgie der melodramatischen Seifenoper als Cliffhanger bekannt. Wie schon aus der Beschreibung der narrativen Ebene ersichtlich, speist sich ein Gutteil des affektiven Potentials der in Rede stehenden Szene aus der Tatsache, dass es sich bei den PLANET OF THE APES-Filmen um eine Filmreihe handelt, und besonders aus dem Umstand, dass auf ESCAPE der CONQUEST, also die Eroberung (und auf diese wiederum der BATTLE) folgen würde. Damit ist neben einer narrativen nun eine ökonomische, bzw. produktionshistorische Dimension angesprochen. Die APES-Filme stellen eine der ersten sogenannten Franchises des postklassischen Hollywood-Kinos dar, noch dazu eine sehr erfolgreiche.3 Sie sind damit von geradezu paradigmatischer Bedeutung für eine Entwicklung, die zentral ist für das Kino des New Hollywood: die Konvergenz der Charakteristika von A- und B-Produktionen.4
Filmreihen oder Filmserien sind ganz und gar nicht ungewöhnlich im Hollywood-Kino. Bis in die 1960er Jahre hinein waren sie jedoch beschränkt auf die weniger prestigeträchtige Produktion von B-Filmen (z.B. die MR. MOTO-Serie mit Peter Lorre in den späten 1930er Jahren). Und im Unterschied zu den
damit mehr oder weniger die Idee einer kulturellen Ordnung beschreibt. [...] Und schliesslich verdankt sich das Kino oftmals den Effekten des Dispositivs. Damit sind zunächst all jene Effekte gemeint, mit denen sich die Kino-Maschine in den Rahmen der Visionen einschreibt, die sie selbst inspiriert.“ 3 In jüngerer Zeit gab es zwei Versuche, die Marke wiederzubeleben: PLANET OF THE APES (Tim Burton, USA 2001) sowie RISE OF THE PLANET OF THE APES (Rupert Wyatt, USA 2011). Während dem ersteren weder kritisches noch kommerzielles Glück beschieden war, scheint der Erfolg des letzteren auf beiden Feldern gegenwärtig einem Reboot den Boden zu bereiten, welcher das Material der ursprünglichen Serie neu arrangieren wird. Zum Begriff des Reboot vgl. Proctor 2012. 4 Vgl. Cook 2000, 3f., für einen ersten diesbezüglichen Überblick.
3
klassischen Beispielen sowie zu den meist lose und episodisch aufeinander folgenden Filmen etwa der James Bond-Reihe erheben die APES-Filme den Anspruch, so etwas wie eine zusammenhängende Narration zu erstellen, auch wenn sich zwischen den verschiedenen Filmen erhebliche logische Widersprüche auftun. Diese scheinen häufig aus der Spannung zu resultieren, die sich zwischen den dramaturgischen Notwendigkeiten eines abendfüllenden Spielfilms und dem Versuch ergeben, über den Verlauf von fünf einzelnen Filmen hinweg nicht nur kausallogisch konsistent, sondern auch interessant zu erzählen. So war ursprünglich keine Fortsetzung des ersten Films geplant (und auch in der Folge scheinen die Produzenten eine Fortsetzung jeweils vom kommerziellen Abschneiden des vorigen Films abhängig gemacht zu haben); dieser Gedanke kam erst durch den unvorhergesehenen kommerziellen Erfolg auf. Der Star dieses ersten Films, Charlton Heston, erklärte sich zu einer Mitwirkung in einer Nebenrolle offenbar nur unter der Bedingung bereit, dass der Film mit der Zerstörung der Erde enden müsse (möglicherweise mit dem Hintergedanken, weitere Fortsetzungen zu vermeiden). Damit war die Narration am Ende des zweiten Teils scheinbar in einer Sackgasse gelandet. Der einzige Ausweg bestand in der Umkehrung der ursprünglichen Prämisse: an die Stelle der in die Zukunft reisenden Menschen treten nun Affen, die in die Vergangenheit reisen. Diese auf einen Zirkelschluss angelegte Konstruktion ist natürlich sehr dazu angetan, zahlreiche Paradoxien zu provozieren, von denen eine wesentliche die oben beschriebene Konstellation (das von seiner Mutter verlassene Kind) betrifft: dieses Kind wird zur zentralen Figur eigentlich erst in der Deutung der Geschehnisse durch den folgenden, vierten Teil der Reihe.
Auf dieser Meta-Ebene des Dispositivs (nach Bellour) wird die symbolische Dimension – die narrativen, tendentiell kulturspezifischen Effekte von Verlust, Trauer und Einsamkeit, die hier u.a. an das westliche Konzept der Kleinfamilie gebunden sind – ergänzt durch einen Mechanismus der Neugier, der sich schnell verbindet mit kognitiven Operationen, die sich zum Beispiel auf jenes Gewirr von Paradoxien beziehen können, das ich hier nicht weiter ausbreiten möchte. Die beiden Dimensionen verbinden sich, wirft man einen Blick auf die Inszenierung des erstmaligen Sprechens in den APES-Filmen insgesamt; hierbei drängt sich besonders die lange Verfolgungsjagd in PLANET
OF THE APES auf, an deren Ende der schließlich eingefangene Taylor (Charlton Heston) den Affen hasserfüllt und mit brechender Stimme entgegenschleudert: „Take your stinking paws off me, you damn dirty apes!“ Ein anderes Beispiel liefert der Beginn von ESCAPE, wenn die zuvor vermeintlich stumme Zira indigniert erklärt, warum sie die angebotene Banane verschmäht: „Because I loathe bananas!“ Die verschiedenen Figurationen des markierten Sprechens lassen so über den Verlauf der fünf Filme ein Netz an Bezügen entstehen, welches das Verhältnis von Affen und Menschen als permanenten Austausch von Kontrastierungen, wechselseitigen Entsprechungen, Tradierungen und Abgrenzungsbemühungen beschreibt – stets inszeniert als Überwindung einer erzwungenen, bzw. körperlich bedingten, oder selbstauferlegten Sprachlosigkeit. Das Zur-Sprache-Finden ist hier also eine Frage der poetischen Logik der Filme und damit letztlich anschlussfähig für kulturhistorische Diskurse: sowohl zur
4
Rolle des Sprechens im Spielfilm als auch zur Stellung der Sprache bezüglich des Nachdenkens über das Verhältnis von Mensch und Tier.
Am anderen Ende des Spektrums – in der (zeitlichen) Konstituierung des Wahrnehmungsvorgangs weder privilegiert noch benachteiligt, sondern durchaus gleichauf5 – lässt sich noch eine dritte Ebene ausmachen, auf der das Thema der Grenzüberschreitung durchgespielt wird, nämlich die Ebene der konkreten Inszenierung, der Art und Weise, wie der kleine Affe und sein Zur-Sprache-Finden ins Bild gesetzt sind. Hier ist der Ort, wo die übergeordnete Frage der poetischen Logik an die Konkretion einzelner Szenen und Einstellungen zurückgebunden wird. Nach Bellour ist hiermit die intensive Dimension der Emotion angesprochen. In diesem Fall wäre also zu reden vom Bewegungsgestus der Kamera in ihrer Heranfahrt, die den kleinen Affen bildräumlich zentriert und isoliert; von der resultierenden halbnahen Einstellung, die das Gesicht exakt in der Bildmitte plaziert; sowie etwa von der Farbgebung der Mise en Scène, in welcher das metallische Blau der Gitterstäbe pointiert gegen die Braun- und Graustufen des Käfigstrohs und des Affenkörpers abgesetzt ist (vgl. Abb. 1).
Abb. 1: Zwischen Mensch und Affe, Käfig und Freiheit, Filmende und
Filmanfang. Dieser über die Anordnung der Gitterstäbe graphisch auf den Bildraum bezogene Kontrast führt eine Spannung ein, die noch durch das Festhalten der Stäbe durch den Affen verstärkt wird: eine weitere, oder vielleicht sogar die entscheidende Grenze, die es zu überschreiten gilt (auch das graphische Element der Gitterstäbe, bzw. des Fangnetzes, ist ein wiederkehrendes Motiv in den APES-Filmen). Und gewissermaßen geschieht genau das in der Schwarzblende, die nurmehr die nach der Mutter rufende Stimme übriglässt,
5 „Die Narration und die Erzählung sind genausowenig Folgewirkungen der Bilder wie sie Ergebnisse der Aussagen und der diesen Aussagen zugrunde liegenden sprachlichen Prozesse sind. [...] Die filmische Erzählung ebenso wie die Bilder und die Aussagen, aus denen sie besteht, sind das Ergebnis narrativer bzw. bilderzeugender Prozesse.“ André Parente: Narrativité et non-narrativité filmique, zit. nach: Bellour 2005, 95. Es geht also nicht darum, einen Primat ,reiner‘ Affektivität gegenüber den komplexeren Prozessen auf der symbolischen Ebene zu behaupten. Bellour selbst fügt hinzu: „Wichtig ist hier jedoch, dass beide Aspekte [...] in ihrem tiefsten Grund auf immer verbunden bleiben werden [...].“ Ebd., 98.
5
jedes visuelle Hindernis jedoch auslöscht: die Stimme als das, was hinüberreicht, sowohl aus der Enge des Bildraums als auch in die narrative Zukunft, als auch in den folgenden, noch nicht existenten Film hinein. Indem die Grenze so als Teil eines Vorgangs, nämlich des Vorgangs der Grenzüberschreitung, gedacht wird, avanciert sie von einer rein räumlichen oder gedanklich-abstrakten Einrichtung zu einem Faktor der spezifischen Zeitlichkeit des Films. Das Bild selbst – nicht das, was auf ihm dargestellt ist – wird so zu einer liminalen Figur, zu einer Form, welche auf allen Ebenen den Übergang denkt. Affizierung, Grenzen und die filmische Form Zu Beginn dieses Textes habe ich die Figur der Grenzüberschreitung als eine affektive Figur bezeichnet und dabei das Moment der Affizierung zunächst mehr oder weniger vorausgesetzt. – lediglich verschiedene Ebenen der Emotion wurden mit Bellour ausdifferenziert. Die Verbindung von liminaler Figur und affektiver Dimension ist jedoch keineswegs zufällig oder willkürlich, sondern formal höchst folgerichtig, insofern nicht nur die Sprache, sondern auch die Emotion einen genuinen Bezug zum Problem der Grenze aufweist. So ist der Vorgang der Grenzüberschreitung ein zentraler Gedanke in den Überlegungen Sergej Eisensteins zum filmischen Pathos. Pathos ist bei Eisenstein zunächst streng als wirkungsästhetische Kategorie zu verstehen, die sich erst im Rückschluss auf die filmische Form beziehen lässt – wobei Form und Zuschauergefühl homologe Strukturen ausbilden:
Pathos ist alles das, was den Zuschauer „außer sich geraten“ lässt. Mit etwas gewählteren Worten könnte man sagen, die Wirkung des Pathos eines Werkes besteht darin, daß der Zuschauer in Ekstase versetzt wird. [...] εκ-στασις („Herausgekommen aus einem Zustand“) bedeutet wörtlich das gleiche wie „außer sich geraten“ oder „aus dem gewöhnlichen Zustand gekommen“. [...] Das „Außersichkommen“ ist kein „Herauskommen ins Nichts“, sondern es ist unweigerlich ein Übergang in etwas anderes, in etwas qualitativ anderes, in etwas dem Ausgangszustand Entgegengesetztes (das Unbewegliche geht ins Bewegliche, das Lautlose ins Tönende und so weiter).6
Der Zuschauer vollzieht mithin in seiner Wahrnehmungstätigkeit die pathetische Konstruktion des Werkes exakt nach, oder genauer, wie Hermann Kappelhoff schreibt:
So ist mit dem montierten Bewegungsbild einerseits ein Parcours physiologischer Reize, Wirkungen und Effekte entworfen, der von den Zuschauern durchlaufen wird. Andererseits ist dieses Bild die Matrix eines Prozesses permanenter Rückkopplungen, in der eben diese Wirkungen und Effekte als Ausdrucksfigur aufgenommen und als Zuschaueremotion verwirklicht werden.7
Pathos ist also gerade nicht nur ein Konstruktionsprinzip, sondern beschreibt zuallererst ein Wirkungsverhältnis zwischen Film und Zuschauer, welches über den Reduktionismus eines einfachen Sender-Empfänger-Modells hinausgeht.
6 Eisenstein 2005, 224f. 7 Kappelhoff 2008, 30f.
6
Wenn Eisenstein schreibt: „Ekstase formuliert sich [...] als Teilnahme am Moment des ,Werdens‘, wie ihn die Dialektik versteht: als Moment des Übergangs von Quantität in Qualität, als Moment des Entstehens (der Empfindung) der Einheit in der Vielfalt, als Moment des Vollzugs der Einheit der Gegensätze.“,8 dann ist klar, dass der „Vollzug der Einheit“ nur vom Zuschauer selbst geleistet werden kann.
Ein weiterer Aspekt ist schließlich zu erwähnen, der besonders hervorsticht und zugleich besonders relevant zu sein scheint, wenn dieses Filmbeispiel als charakteristisch für die filmhistorische Periode gelten kann, aus der es stammt, nämlich für das Kino des New Hollywood. Dazu ist vorab zu bemerken, dass es ja keineswegs selbstverständlich ist, dass es sich bei dem kleinen Affen im Käfig offensichtlich um einen echten Affen handelt, und weder um eine Puppe noch um einen Schauspieler im Affenkostüm. Aus dieser Tatsache ergibt sich nun eine Reihe von Fragen: wie lässt sich das Verhältnis zwischen Affendarstellern und schauspielernden Affen ästhetisch beschreiben? Was bedeutet es, ex negativo, für die poetische Logik der Filme, wenn sie den Konflikt zwischen Menschen und Affen hauptsächlich mit Hilfe offensichtlich kostümierter Menschen inszenieren? Welche Funktion haben in diesem Zusammenhang die (nicht nur im Marketing der Filme, sondern auch in den Filmen selbst) ostentativ ausgestellten Bemühungen um eine realistische Anmutung wenigstens der wichtigsten (von Menschen gespielten) Affenfiguren? Und welche Funktion hat in diesem Zusammenhang die Verwendung eines echten Affen für den entscheidenden Moment der Grenzüberschreitung an dieser Stelle?
Nicht alle diese Fragen können und sollen hier behandelt werden; vielmehr möchte ich mich, wie gesagt, auf einen Aspekt konzentrieren, der u.a. die Frage des Schauspiels berührt: wie beschrieben, wiederholt sich das Wort „Mama“ mehrfach auf der Tonspur, synchron begleitet von einer Mundbewegung des Affen, in welche sich der Sound gewissermaßen hineinfindet – gemäß der These von Rick Altman, dass sich der Sound im Filmbild stets auf der Suche nach einer Quelle befindet, ähnlich der Laute eines Bauchredners, die vom Zuschauer unwillkürlich auf die Bewegungen der Bauchredner-Puppe bezogen werden.9 So weit, so trivial. Weniger trivial ist die Tatsache, dass dieser kurze Moment einer ,passenden‘ Mundbewegung im Laufe der Einstellung (die daher im strengen Sinne nicht eine einzige Einstellung ist) mehrfach exakt wiederholt wird: nicht der Affe bewegt sich mehrfach, sondern das Filmbild selbst gelangt in eine Schleife, einen Loop. Dies fällt besonders dadurch auf, dass die Bewegung des Affen mit einer leichten Abwärtsbewegung der Kamera, offenbar einer Ausschnittkorrektur, einhergeht, die sich nun ebenfalls mehrfach wiederholt. Was auf der Tonebene als Dramaturgie ansteigender Erregung inszeniert ist – die zunehmende Dringlichkeit des Rufens nach der Mutter – findet seinen Widerpart auf der Bildebene als vierfache Wiederholung desselben Moments, die in die Schwarzblende mündet.10 Die Poetik der Grenzüberschreitung bringt
8 Eisenstein 1998, 657. 9 Vgl. Altman 1980. 10 Der Genauigkeit zuliebe ist festzuhalten, dass erst die letzten Rufe, die aufgrund der Schwarzblende nicht mehr ans Bild gebunden sind, das Prinzip der Steigerung vollends
7
gewissermaßen die Materialität des Bildes selbst an eine ganze eigene Grenze. Daraus resultiert eine merkwürdige Inkongruenz, die an die Verwendung kürzester Loops in bestimmten Musikvideos erinnert, die nach dem Prinzip arbeiten, den Rhythmus des Visuellen gänzlich dem des Auditiven anzupassen. Was uns jedoch an dieser Stelle interessiert, ist die Frage, wie sich dieses Spannungsverhältnis zwischen Ton und Bild auf eine filmische Poetik der Grenze, bzw. der Grenzüberschreitung, beziehen lässt. Stimme, Bild und Körper In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Bild und Ton ja nicht nur in der wiederholten Diskontinuität des visuellen Loops als einer abstrakten Figur zusammenkommen, sondern ebenso und im gleichen Moment im Bild eines Körpers, das sich unter anderem aus diesem Loop herleitet. Der Loop ist allerdings in dieser Beziehung nur eines unter vielen Elementen einer audiovisuellen Figur in ihrer ganzen Konkretion. Was für das Kino im allgemeinen gültig ist, wird an diesem Beispiel deutlich: dieser Körper ist nicht einfach der abgefilmte Körper eines real vorhandenen Schimpansen, sondern es handelt sich um ein synthetisches Phänomen. Soll heißen: Ton und Bild wirken zusammen, um einen Körper zu produzieren. Diesen Aspekt der Produktion oder Figuration betont etwa Adrian Martin:
[…] bodies are not a ,given‘ thing in cinema; contrary to common sense, bodies are not just standing or sitting or lying there or walking around, waiting to be photographed. […] Dynamically, in the process of being rendered from shot to shot and scene to scene, they proceed from a line to shape to a volume to a character, and at any point they can be abstracted, enhanced or obliterated.11
Die Konstruktion von Körpern gleicht in dieser Perspektive einem zeichnerischen Vorgang, wobei das Grundmaterial nicht von Punkt und Linie gebildet wird, sondern durch das Filmkorn, die in stetiger Bewegtheit befindlichen Silberkristalle in der auf das Trägermaterial aufgetragenen Gelatine-Schicht, dem eigentlichen ,Film‘. So schreibt Deleuze: „Das Kino reproduziert keine Körper, es produziert sie mit Körnern, die Zeitkörner sind.“12
Es scheint mehr als ein Zufall zu sein, wenn der Begriff des Korns an einer anderen, für uns relevanten Stelle ebenfalls auftaucht, nämlich in Roland Barthes’ Konzept vom „Korn“ der Stimme.13 Wenn auch Barthes und Deleuze hier nicht einfach dasselbe Prinzip beschreiben, so lassen sich doch genügend Übereinstimmungen ausmachen, um die beiden Konzepte aufeinander zu beziehen. So definiert Barthes das Korn als den „Körper in der singenden
entfalten. Solange das Bild zu sehen ist, bleibt die Bandbreite der Interpretationsmöglichkeiten des Bildes durch den Ton vergleichsweise eng begrenzt. 11 Martin 2000. 12 Deleuze 2005, 277. 13 Vgl. Barthes 1990. Die deutsche Übersetzung von Barthes’ „grain“ mit „Rauheit“ kann nur als äußerst unglücklich bezeichnet werden, ganz besonders angesichts der Tatsache, dass Barthes sich in diesem Aufsatz mit Verve gegen die Verwendung von Adjektiven zur Beschreibung stimmlicher Qualität ausspricht.
8
Stimme, in der schreibenden Hand, im ausführenden Körperteil“.14 Barthes grenzt das Korn explizit von einem verengten Begriff des Ausdrucks ab, in dem dieser als eineindeutige Relation von Signifikant und Signifikat gedacht ist: „[...] es ist die Spitze (oder der Grund) der Erzeugung, wo die Melodie tatsächlich die Sprache bearbeitet – nicht, was diese sagt, sondern die Wollust ihrer Laut-Signifikanten, ihrer Buchstaben [...]. Es ist, mit einem sehr einfachen, aber ernst zu nehmenden Wort: die Diktion der Sprache.“15 Die hier angesprochene affektive Dimension des Körperlichen denkt Barthes durchaus im Anschluss an Deleuze, insofern sich die Wahrnehmung des Korns ihm zufolge nicht auf ein zu bestätigendes „psychologische[s] ,Subjekt‘“ bezieht, sondern vielmehr daran arbeitet, „jenseits des Subjekts den ganzen Wert [zu] entfalten, der hinter dem ,ich liebe‘ oder ,ich liebe nicht‘ steckt“.16
Diese Idee ist bei Deleuze ausformuliert und konzeptuell radikalisiert, wenn er das Verhältnis von Figur und Körper als eines der Einwirkung von Kraft beschreibt: „Der ganze Körper wird von einer intensiven Bewegung durchlaufen. Einer [...] Bewegung, die in jedem Augenblick das reale Bild auf den Körper überträgt, um die Figur zu bilden.“17 Die deformierende, affizierende Kraft dieser Bewegung ist die Sensation. Die Sensation bezieht sich sowohl auf den ,Bildkörper‘ des Films als auch auf das ,Körperbild‘ des Zuschauers (d.h. dessen Wahrnehmung seines eigenen Körpers und seiner Empfindungen im Sinne von Kappelhoffs Ausdrucksbegriff) und verbindet beide miteinander:
Die Sensation ist mit einer Seite zum Subjekt hin gewendet [...], mit einer anderen zum Objekt [...]. Oder besser: sie hat überhaupt keine Seiten, sie ist unauflösbar beides zugleich, sie ist Auf-der-Welt-Sein, wie die Phänomenologen sagen: Ich werde in der Sensation, und zugleich geschieht etwas durch die Sensation, das eine durch das andere, das eine im anderen.18
Dieses Werden ist nicht zu denken ohne den Faktor Zeit: die wechselseitige Bezugnahme von Bildkörper und Körperbild vollzieht sich ausschließlich in der konkreten Dauer des Wahrnehmungsvorgangs. In der Sensation lässt sich so das Prinzip der Grenzüberschreitung wiedererkennen: „Ich als Zuschauer erfahre die Sensation nur, indem ich ins Gemälde hineintrete, indem ich in die Einheit von Empfindendem und Empfundenem gelange.“19 Dies bringt uns, bei bemerkenswerter Ähnlichkeit der Formulierung, zurück zu Eisensteins Konzeption der Ekstase, bzw. des Pathos. Damit wären nicht nur Emotion und
14 Barthes 1990, 277. 15 Barthes 1990, 272. Der in dem vorliegenden Aufsatz verwendete Begriff des Ausdrucks leitet sich im Gegensatz dazu von Überlegungen in der philosophischen Anthropologie (Georg Simmel, Helmuth Plessner) und der Phänomenologie (Maurice Merleau-Ponty) her, wo Ausdruck mit einem starken Akzent auf dem Faktor der Bewegung als Entfaltung von Sinnhaftigkeit verstanden wird, die nicht auf zeichenhafte Bedeutungskonstitution reduzierbar ist. Vgl. zur Relevanz dieses Ausdrucksbegriffs für die Filmtheorie Kappelhoff 2004. 16 Barthes 1990, 277. 17 Deleuze 1995, 18. 18 Deleuze 1995, 27. 19 Deleuze 1995, 27.
9
Transgression zusammengedacht, sondern beide zudem auf die spezifische Situation audiovisueller Wahrnehmung im Kino hin perspektiviert – und ganz besonders auf das Problem des filmischen Sprechens, insofern dieses stets die Frage nach dem Körper aufwirft. Das „Korn“ im Kino des New Hollywood So öffnet der doppelte Gedanke eines filmischen Korns sowie eines Korns der Stimme die Perspektive auf das „Werden eines ,unbekannten Körpers‘“,20 insofern beide in der Wahrnehmung des Zuschauers spannungsvoll aufeinander bezogen werden. Dabei herrscht nicht etwa eine apriorische Symmetrie zwischen den diversen Elementen; vielmehr verhält es sich (wie von Rick Altman ausgeführt) so, dass der Sound danach strebt, sich ins Bild einzufinden, nach einem „Wo?“ zu fragen, während das Bild dazu tendiert, mit einem „Da!“ zu antworten. Wie wir bereits gesehen haben, impliziert dieses Verhältnis keineswegs eine Unterordnung des Sounds – im Gegenteil scheint der Sound oft dahingehend zu operieren, dass er das Bild in Bewegung versetzt (in der Suche nach dem Ursprung des Sounds) oder sich die Bewegung des Bildes unterwirft (sei es bezüglich des Rhythmus oder bezüglich der Tonalität).
Der entscheidende Gesichtspunkt im Gedanken des Korns steckt für unseren Zusammenhang jedoch in dem Umstand, dass sich für das Kino des New Hollywood eine gewisse Verfeinerung der Körnigkeit nachweisen lässt, eine Ausdifferenzierung der expressiven Register. Für die Dimension des Sounds hat Michel Chion diese Entwicklung höchst anschaulich beschrieben, anhand einer Szene aus INVASION OF THE BODY SNATCHERS (Philip Kaufman, USA 1978):
This sound [...] of an unwrinkling, an unfolding of organs, of membranes detaching themselves from one another, and of a sucking, all at once, this sound, real and precise, clear and sharp in the high registers, tactile, you heard it as if you were touching it, like the touch of the skin of a peach, which gives some people the shivers. […] And since the minor denizens of the high registers have entered films (even in standard mono versions), along with them has come another materiality, another rendering of life. I am not talking particularly of the spatial effects of stereo, or Dolby thunder, but of a micro-rendering of the hum of the world, which locates the film in the ultra-present indicative, declines it in the ultra-concrete. Something has shifted, and, like the substitutions narrated by the film, a change deriving from the sound, and not registered anywhere, has taken place and changed the status of the image: a quiet revolution.21
Die Betonung der Nuance ist in dieser Beschreibung direkt mit der Funktion der Affizierung des Zuschauers zusammengebunden: der Sound gewinnt eine taktile Anmutung, die sich dem Zuschauer als körperliche Erfahrung vermittelt, Bildkörper und Körperbild treten über das Filmkorn miteinander in Kontakt. Und auch für die Dimension des Bildes lässt sich eine Entwicklung hin zu einer neuen Materialität feststellen, unter anderem zurückzuführen auf den
20 Deleuze 1997, 259. 21 Chion 1991, 69f.
10
vermehrten Einsatz von natürlichem Licht (bedingt durch den Übergang vom Studio zur Location als Drehort), die Verwendung von Diffusionsfiltern, stärkere Differenzierung in der Helligkeit des Bildes sowie eine radikal erhöhte Dynamik in der Beweglichkeit der Bildebenen und Bildgrenzen durch den Einsatz von Zooms, Fokusverschiebungen und wesentlich mobileren Kameras.22 Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang weiterhin das Aufkommen der Zeitlupe sowie die Tendenz zu sehr langen Einstellungen auf der einen und extrem kurzen Einstellungen auf der anderen Seite. Pascal Bonitzer bringt diesen letzten Punkt auf folgende Formel: „Es [das moderne Kino] hat die organischen Emotionen aufgelöst, um subtilere Einstellungen hervorzubringen, es hat das Kino für größere und kleinere Dimensionen geöffnet.“23
Wenn also das Kino des New Hollywood als ein Kino der Grenzüberschreitung gelten kann, dann gilt dies nicht nur im Sinne seiner Poetik des Schocks und des Tabubruchs,24 sondern – und dieser zweite Sinn steht mit dem ersten in direkter Beziehung – im Sinne der Erschließung eines ganz neuen Bereichs der Uneindeutigkeiten, Nuancierungen, Zweifelhaftigkeiten und Unschärfen. Man denke noch einmal an diese schwer bestimmbare Qualität der Stimme des Affenbabys am Ende von ESCAPE FROM THE PLANET OF THE
APES: diese seltsame Stimme trifft auf den sichtbaren Körper eines realen Affen, verankert sich in dessen Bewegungen, um einen Körper zu modellieren, für den es kein Vorbild mehr gibt – weder in der Natur noch in den Genres des klassischen Hollywoodkinos. Alfred Hitchcock beschreibt diese Verschiebung von der Abstraktion in die Konkretion für seine Arbeit am Sound zu THE
BIRDS (USA 1964): „Wir schauen uns den Film Rolle für Rolle an, und ich diktiere, was ich jeweils hören möchte. Bisher ging es dabei immer um natürliche Geräusche. Aber jetzt, mit den elektronischen Geräuschen, muß ich nicht nur die Töne angeben, die ich haben möchte, sondern ihre Art und ihren Stil bis ins Kleinste beschreiben.“25 Damit ist letztlich ein Paradox formuliert: Das „Organische“, das „Natürliche“ stehen ein für ein System der abstrakten Entsprechungen, für eine diskrete, generische Typologie. Demgegenüber ermöglicht das „Rendering“, die synthetische Zusammenstellung, einen neuen Realitätseffekt, indem es eine haptische Dimension des Bildes erschließt, die letztlich einer Wirkungsästhetik verpflichtet ist – einer Ästhetik, die den Zuschauer in seiner leiblichen Anwesenheit im Kinosessel zum Zielpunkt hat. Die Grenze wird nach ,innen‘, ins Zwischen verlegt: an die Stelle einer kategorialen Ordnung tritt eine Aktivität des Auffaltens und Entfaltens, die das Körperbild des Zuschauers und den Bildkörper des Films miteinander in Berührung bringt. Ich möchte im folgenden anhand einer Reihe von Beispielen einige Schlaglichter auf bestimmte Tendenzen dieser Aktivität werfen.
22 Zu all diesen Punkten eine erste Übersicht bei Cook 2000, 355-383. 23 Pascal Bonitzer, zit. nach: Bellour 2005, 71. 24 Vgl. Kappelhoff 2008, 152-196. 25 Truffaut 1973, 289.
11
Grenzfälle des Sprechens
I: Eine neue Ordnung des Raums Die Privilegierung der Stimme und ihrer Verständlichkeit, die noch für das klassische Kino kennzeichnend ist,26 ist für das New Hollywood nicht mehr ohne weiteres gegeben. Man denke etwa an das Durcheinander der Stimmen in der Eröffnungsszene von MCCABE & MRS. MILLER (Robert Altman, USA 1971), welches koinzidiert mit der ,demokratischen‘ Lichtsetzung, die keine Figur hervorhebt und den Raum nur näherungsweise strukturiert. Man denke auch an die Rolle des Lärms in vielen Filmen, besonders pointiert am Beginn von JUNIOR BONNER (Sam Peckinpah, USA 1972), wo der Lärm der Baumaschinen die Frage des Protagonisten nach seinem Vater unter sich begräbt. Auch hier verliert das menschliche Individuum, der menschliche Körper seine strukturierende Funktion für die Erschließung des Bildraums. Koexistieren bei Altman stets mehrere Ebenen simultan und näherungsweise gleichberechtigt, so entsteht bei Peckinpah ein fragmentierter Raum, den die menschliche Wahrnehmung nicht mehr zu ordnen vermag.
II: Eine neue Materialität Dort, wo die Stimme ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, wird auch sie zum Träger der angesprochenen neuen Materialität. Dies lässt sich etwa an der Vergewaltigungsszene in DELIVERANCE (John Boorman, USA 1972) nachvollziehen, in welcher einer der Kanu-Touristen von seinem Vergewaltiger gezwungen wird, wie ein Schwein zu quieken. Die Szene bezieht ihren Schrecken aus ihrer Detailgenauigkeit: ebenso wie sich jedes Stück Erde, jedes Blatt von der weichen, schwitzenden Haut des erschöpften Städters absetzt, ebenso teilt sich in diesem Quieken seine Kurzatmigkeit, seine durch die Panik hervorgerufene Hyperventilation mit, sein erlahmender, in nackte Angst übergehender Widerstand. All dies stellt sich nicht repräsentativ her, sondern als körperlicher Nachvollzug der taktilen Dimension des Sounds. Der Übergang von menschlichen zu tierischen Lauten ist hier insofern logisch, als der Akt der Vergewaltigung für den Film die ultimative Grenzverletzung markiert, die alle folgenden Übertritte erzwingt – mit derselben Kraft, welche als Strömung des Flusses die Kanus mitreißt. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Quieken lediglich den Auftakt zur eigentlichen Vergewaltigung bildet, als furchterregende Ankündigung der Reduzierung des menschlichen Körpers auf das bloße Fleisch. Der Gewaltakt selbst macht sich als schmerzliche Erfahrung erst dann voll geltend, wenn das gespielte Quieken anderen Lauten weicht, Lauten, die insofern direkt auf menschliche Pein verweisen, als sie keinen Platz mehr für symbolische Assoziationen lassen. Das Ächzen und Stöhnen des Penetrierten verdrängt jedes noch so grausame Spiel und ist nur bei sich selbst.
Doch Schmerz ist nicht nur im Hier und Jetzt. In MARATHON MAN (John Schlesinger, USA 1976) ist der Sprechakt des Protagonisten (gespielt von Dustin Hoffman) eingebunden in einen affektdramaturgischen Zusammenhang, der ganz wesentlich auf der innerfilmischen Erinnerung des Zuschauers basiert.
26 Vgl. Chion 1999, 6.
12
Hoffmans Figur wird in der eindrücklichsten Szene des Films von einem Zahnarzt gefoltert und so schwer an den Zähnen verletzt, dass man ihm dies beim Sprechen bis zum Ende des Films deutlich anhört. Zusätzlich begleitet ein sirrend hoher Ton die Szene der Folterung, der später wieder eingesetzt wird, um den stechenden Schmerz dieses Moments wieder aufzurufen. Das vermehrte Schlucken und Saugen, das ,Herumsprechen‘ um bestimmte empfindliche Stellen im Mund herum, die zuweilen undeutliche Artikulation, das Lallen – all dies ist Teil eines Sound Designs, welches an die Stelle des absoluten Bösen (die Bösen in diesem Film, das sind die alten Nazis) einen extrem lebhaft ausgestalteten, konkreten Vorgang setzt, der zudem bei den meisten Zuschauern eigene Erfahrungen und Vorstellungen wachzurufen bestrebt ist. In letzter Konsequenz geht es dabei um ein Bild der Geschichte am eigenen Körper.
III: Eine neue Ordnung der Zeit Die Sprechakte der Figuren in den Filmen von John Cassavetes haben diverse Funktionen. Eine wesentliche ist es, die Dramaturgie der Filme mitzubestimmen. Sprechen, das heißt vor allem der andauernde Redefluss, ist hier genuiner Teil der körperlichen Verhaltensweisen, welche die Dynamik vieler Cassavetes-Filme steuern, die Länge ihrer Einstellungen, den Rhythmus der Kamerabewegungen – das schlagendste Beispiele hierfür ist sicherlich FACES (USA 1968). Die sich aufschaukelnden Rededuelle der Figuren werden bis an die Grenzen der Erschöpfung und darüber hinaus geführt – sowohl der Erschöpfung des Zuschauers als auch der Erschöpfung der Form (im Unterschied etwa zum Redefluss in den Filmen Woody Allens, der strikt in das Regime der Pointe eingebunden ist – auch wenn das unaufhörliche Reden selbst natürlich zum Teil dieser Pointe avanciert). Das Sprechen rhythmisiert die Einstellung im vollen Sinne des Worts: es ist eine auf die Einstellung und auf den Zuschauer wirkende, deformierende Kraft im Sinne von Deleuzes Begriff der Sensation und begründet in diesem Sinne eine eigene Zeitlichkeit. Ein Vergleich mit den Filmen des sogenannten Blaxploitation-Kinos, allen voran SWEET SWEETBACK’S BAADASSSSS SONG (Melvin Van Peebles, USA 1971), verdeutlicht diese Funktion: auch hier ist das Sprechen Grundlage eines spezifischen filmischen Rhythmus, nur ist die Musikalität der Sprache sehr viel stärker ausgestellt (während ihre denotative Funktion zuweilen in den Hintergrund rückt) – bis zu dem Punkt, dass ein im Off des Bildes befindlicher Chor das Geschehen kommentiert und dabei beständig zwischen Singen und Sprechen oszilliert: ein Sprechgesang.
IV: Das Werden eines unbekannten Körpers
Geht man davon aus, dass die Filme des New Hollywood dem synthetischen Charakter des filmischen Körpers in besonderer Weise Rechnung tragen, dann überrascht es nicht, dass in vielen Horrorfilmen der Periode (oder denen, die dem Horror nahestehen) ein problematisches Verhältnis zwischen dem sichtbaren und dem hörbaren Körper thematisch wird. Ein deutliches Beispiel liefert THE EXORCIST (William Friedkin, USA 1973), welcher den Zustand dämonischer Besessenheit als auf den Körper wirkende Kraft inszeniert – eine Kraft, die nicht nur das Gesicht des Mädchens zur Fratze verzerrt, sondern auch
13
seine Stimme in alle möglichen Richtungen deformiert: hin zu einem Grollen, das nicht mehr auf ein stimmliches Organ, sondern eher auf die Welt des Anorganischen zu verweisen scheint; hin zum Tier, zum Hecheln und Knurren eines wütenden Hundes; hin zu einer kalten, krächzenden Tonlosigkeit; hin zur Stimme der verstorbenen Mutter des Priesters; schließlich hin zu einem wilden Durcheinander heulender, fiepsender, singender, einander antwortender Stimmen, zu einem multiplen Körper. Ein solcher multipler Körper wird auch in BLACK CHRISTMAS (Bob Clark, Kanada 1974) figuriert, einem Vorläufer der Slasher-Filme der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Hier gibt es zwei Besonderheiten: zum einen spielt die technische Vermittlung der Stimme durch das Telefon eine wesentliche Rolle; zum anderen ist der Sprechakt, der immer wieder unvermittelt und effektiv von einer Stimme / Persönlichkeit / Körperlichkeit in die andere fällt, Teil einer Figuration aus bewegten Kameraeinstellungen, die die Subjektive (Point of View oder POV) des Anrufers / Mörders darstellen. Während die Anrufe stets an den Ort des Telefons gebunden sind, durchziehen diese POVs das ganze Haus, in dem der Mörder sein Unwesen treibt. Die Vielheit des stimmlichen und die Unschärfe des visuellen Körpers in seiner ominösen Dynamik des allsehenden Auges wirken zusammen, um das Haus in den klaustrophobischen Zustand einer Anwesenheit einzuhüllen, die wiederum als Deformation auftritt: Deformation der Stimme ebenso wie des durch den POV wahrgenommenen Raumes.
Schließlich gibt es Momente, in denen die Verortung der Stimme im Körper gleichzeitig behauptet und unmöglich gemacht wird. So ein Moment ist das Ende des bereits erwähnten INVASION OF THE BODY SNATCHERS: die Invasion der Außerirdischen scheint vollkommen, lediglich der von Donald Sutherland gespielte Protagonist scheint davongekommen zu sein. Ohne Aufsehen zu erregen, bewegt er sich durch die verlassene Stadt, als ihn plötzlich jemand anspricht: in dem Glauben, einen gleichfalls Überlebenden entdeckt zu haben, kommt seine Mitstreiterin vom Vortag auf ihn zu. Der Protagonist dreht sich um, deutet auf sie und stößt einen grauenhaften Schrei aus, den der Zuschauer als Erkennungszeichen der Aliens kennengelernt hat. Das Entscheidende ist nun aber, dass dieser Schrei emphatisch keine Verankerung im Körper findet: alles, was man als Artikulation bezeichnen könnte, scheint abwesend, nichts in diesem Laut verweist auf ein lauterzeugendes Organ, auf einen körperräumlichen Zusammenhang. Jede Idee eines Individuums scheint hier ausgelöscht. Wenn die Kamera dann in der letzten Einstellung auf den Mund des Protagonisten zoomt, dann fokussiert sie eben nicht die Quelle des Tons, wie es einer klassischen Poetik entspräche. Sie fällt vielmehr in ein schwarzes Loch, das keinem Organismus mehr angehört, sondern einem unbekannten Körper.
V: Was jenseits des Sprechens liegt Das Kino des New Hollywood ist auch eine Periode der schweigsamen Figuren; etwa Chato (Charles Bronson) in CHATO’S LAND (USA 1972, Michael Winner), der gerade mal zwei Sätze auf Englisch von sich gibt, oder viele der Figuren in den Filmen Monte Hellmans, z.B. in THE SHOOTING (USA 1967) oder TWO-LANE BLACKTOP (USA 1971). In COCKFIGHTER (USA 1974, Monte Hellman)
14
rückt die Sprachlosigkeit in den Mittelpunkt der Inszenierung: der Protagonist des Films, gespielt von Warren Oates, verdient seinen Lebensunterhalt mit Hahnenkämpfen. Nach einem verlorenen Kampf hat er einen Schweige-Eid geleistet, den er erst mit dem Gewinn eines großen Turniers beenden will. Obwohl (oder gerade weil) er auf dem Voice Over durchaus spricht, baut sich das Schweigen wie eine Hemmung auf und erzeugt eine Spannung, die im Verlauf des Films eine ganze Reihe von Registern durchläuft: mal hat es komischen Effekt, mal vermittelt es große Entschlossenheit, mal wirkt es wie eine körperlich spürbare Blockade. Immer jedoch bezieht es seine Kraft aus der Dauer, in der es sich ausdehnt. Eine zusätzliche Dimension gewinnt das Schweigen dadurch, dass es explizit mit den bis auf den Tod miteinander kämpfenden Hähnen assoziiert wird, die während des Kampfes keinen Laut äußern. Mit Bezug auf diesen brutalen Sport heißt es gleich zu Beginn des Films: „This is something you don’t conquer. Anything that can fight to the death and not utter a sound… well….“ Damit annonciert sich eine ganz eigene liminale Dimension: die stoische Ruhe des brutalen Hahnenkampfes führt eine Grenze ein, angesichts derer nichts mehr zu sagen bleibt. Der Film inszeniert diese Grenze wieder und wieder in den Hahnenkämpfen selbst und verwirklicht dabei eine Ästhetik der sachlichen Aufmerksamkeit, die jeder Psychologie entkleidet ist und alle Energie in die Entfaltung eines komplexen Bewegungsablaufs investiert – Vorschnellen, Ausweichen, Angreifen, Sich Verkeilen, Zurückprallen, Zustoßen. Die Kämpfe werden bis zum Zustand der totalen Erschöpfung geführt, und diese Erschöpfung ist das Erschlaffen jeder Spannung: der Tod eines der Kontrahenten. Wenn aber am Ende von COCKFIGHTER der Protagonist seine ersten Worte spricht, dann geschieht dies ganz ohne Mühe, ohne jedes Anzeichen einer zu bewältigenden Schwierigkeit – eher aus einer Fülle heraus. Der Film wechselt nochmals das emotionale Register, indem der Protagonist eine neue dramaturgische Funktion übernimmt: die von ihm gesprochenen Worte werden zur Pointe der Szene, sie lösen die aufgebaute Spannung auf. Das Schweigen als deformierende Kraft weicht dem Sprechen mit Leichtigkeit. Doch steckt auch in dieser Leichtigkeit ein Sterben, schreibt doch das Ende des Films die Trennung der Geschlechter fest, wenn die Freundin des Protagonisten ihn angesichts der Grausamkeit des von ihm betriebenen Sports verlässt. Die Gewalt des Hahnenkampfes setzt sich damit auf einer neuen Ebene fort, und so bleibt vielleicht auch die Spannung auf einer subtileren Ebene erhalten.
VI: Poetiken der Nuance Die Subtilität der Verschiebungen: darauf läuft vieles von dem hinaus, was hier angeführt worden ist. Eine paradigmatische Formulierung dieses Prinzips, wie auch eine Aussicht auf seine weitreichenden Konsequenzen, findet sich zu guter Letzt in Francis Ford Coppolas THE CONVERSATION (USA 1974). Der Protagonist des Films, gespielt von Gene Hackman, ist ein Abhörspezialist, der das titelgebende Gespräch aufnimmt. Der ganze Plot des Films, die Frage: „Wer verschwört sich gegen wen?“, hängt schließlich, rückblickend, an einer minimalen Verschiebung in der Betonung eines Satzes, von einem Wort aufs
15
Nachbarwort: Aus „He’d kill us if he got the chance“ wird „He’d kill us if he got the chance“.
In dieser Verschiebung liegt der ganze Reichtum paranoischer Imagination. Die Affektpoetik der Paranoia wiederum kennzeichnet das Kino des New Hollywood nicht erst seit Watergate; vielmehr wird hier ersichtlich, dass diese Poetik nicht einfach nach dem Schema eines Abbildverhältnisses zwischen Wirklichkeit und Kino zu begreifen ist. Die Unsicherheit darüber, was man selbst gesehen und gehört haben mag, greift erst dann mit voller Konsequenz um sich, wenn der organische Zusammenhang der klassischen Formen zugunsten solcher Formen aufgelöst ist, die sich aus der minimalen Differenz entfalten. Die Differenz, um die es dem Film geht, entspringt ja gerade nicht einem organischen Zusammenhang, sondern ist das Ergebnis der höchst künstlichen Konstruktion einer kohärenten Unterhaltung mit den Mitteln der Überwachungselektronik. Paranoia hat als poetische Ordnung von Wahrnehmung zunächst nichts mit der Inszenierung einer tatsächlichen Verschwörung zu tun, jedoch sehr viel mit einer bestimmten Art und Weise, Verbindungen und Zusammenhänge zu schaffen. Die Eingangssequenz von THE CONVERSATION demonstriert das: die Kamera folgt einer bestimmten Figur (dem Pantomimen), diese führt sie zu einer weiteren (dem Protagonisten), an der sie schließlich hängenbleibt. Diese zweite Figur wiederum hängt an weiteren Figuren, dem belauschten Paar, welches die titelgebende Unterhaltung führt. So deutet eine Verschiebung auf die nächste, ohne dass ein Ende, eine Letztbegründung dieser Aktivität des Verweisens jemals in Sicht käme. Am Ende von THE CONVERSATION sitzt der Protagonist in seiner Wohnung, umzingelt von unsichtbaren, ihn überwachenden Mächten. Die Idee der Grenzüberschreitung erweist sich hier schließlich als ein Trugbild; denn jenseits der Grenze warten nur neue Oberflächen darauf, ungeahnte Tiefen zu enthüllen.
Das bedeutet freilich nicht, dass diese Idee ihre emotionale Ansteckungskraft verloren hätte. Denn selbst noch im vergeblichen Anrennen gegen unsichtbare Mauern vermag sich eine Dauer einzunisten. Wenn etwa ein Film wie TWO-LANE BLACKTOP gänzlich in der Immanenz der Straße verbleibt,27 dann öffnet sich dadurch, dass die Grenze nach innen verlegt wird, der Blick auf etwas Neues: „[...] it quietly steers towards a level of abstraction, a documentary minimalism […]. Released from the strong fable and from the need to engineer the narrative into didactic shape, the images develop an energy that charges representation with something other than symbolic overtones or metaphoric substitutes.“28 Es gälte also nicht, auf die Grenzüberschreitung zu verzichten, sondern vielmehr, den Ort der Grenze sorgsam zu bestimmen. Das „Außersichkommen“ des Zuschauers wäre dann vielleicht nicht mehr ein Sprung, sondern eher (und bescheidener) eine kleine Verschiebung.
So beschreiben die Grenzfälle des Sprechens im Kino des New Hollywood einerseits ein breites Panorama, andererseits umkreisen sie alle, auf die ein oder andere Weise, den Kern des Problems – eine Bewegung, die sich entweder
27 Vgl. Robnik 2007, 112. 28 Elsaesser 2004, 291.
16
theoretisch oder historisch auflösen lässt. Wenn, theoretisch betrachtet, die Stimme und das Sprechen schon immer die Frage nach dem Körper und seinen Grenzen aufwerfen, dann verschärft das Kino diese Frage, oder genauer: es deckt die Unsicherheit auf, aus welcher diese Frage sich speist. Dies tut es vor allem dadurch, dass es mit der Dissoziierung ernstmacht, welche latent im Verhältnis von Körper und Stimme nistet. Das emotionale Wirkungsspektrum solcher Dissoziierung, welches von Komik (bei Altman) bis zum Schrecken (bei Friedkin) reicht, habe ich weiter oben andeutungsweise skizziert. Die Ausdifferenzierung dieses Spektrums wiederum bezeichnet die historische Perspektive der Analyse. Das Kino des New Hollywood verbindet in dieser Hinsicht zwei Verfahren der Grenzüberschreitung: zum einen verschreibt es sich dem schockhaften Tabubruch, zum anderen der Entfaltung eines Zwischenreichs des Materiellen, auf dessen Grundlage der Tabubruch erst zur vollen Geltung kommt – nämlich insoweit, wie die Filme vor den Schock die Einbeziehung des Zuschauers in dieses Zwischenreich setzen. Es wären somit die kleinen, subtilen Verschiebungen und Mobilisierungen der Zuschauerposition, welche der spektakulären Transgression den Boden bereiten. Abbildungsverzeichnis
• Abb. 1: ESCAPE FROM THE PLANET OF THE APES, USA 1971. DVD Capture, 20th Century Fox 2005.
Literaturverzeichnis
• Altman, Rick: Moving Lips. Cinema as Ventriloquism, in: Yale French
Studies, Nr. 60 (1980), 67-79. • Barthes, Roland: Die Rauheit der Stimme [1972], in: ders.: Der
entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays III, Frankfurt a.M. 1990, 269-278.
• Bellour, Raymond: Das Entfalten der Emotionen, in: Matthias Brütsch u.a. (Hg.): Kinogefühle. Emotionalität und Film, Marburg 2005, 51-101.
• Chion, Michel: Quiet Revolution… and Rigid Stagnation [1987], in: October, Jg. 58 (Herbst 1991), 69-80.
• Chion, Michel: The Voice in Cinema [1982], New York 1999. • Cook, David A.: Lost Illusions. American Cinema in the Shadow of
Watergate and Vietnam, 1970-1979, New York 2000.
17
• Deleuze, Gilles: Das Gehirn ist die Leinwand [1986], in: ders.: Schizophrenie und Gesellschaft. Texte und Gespräche von 1975 bis 1995, hg. von Daniel Lapoujade, Frankfurt a.M. 2005, 269-277.
• Deleuze, Gilles: Das Zeit-Bild. Kino 2 [1985], Frankfurt a.M. 1997. • Deleuze, Gilles: Francis Bacon – Logik der Sensation [1984], 2 Bände,
München 1995. • Eisenstein, Sergej: Das Organische und das Pathos [1939], in: ders.:
Jenseits der Einstellung. Schriften zur Filmtheorie, hg. von Lenz, Felix und Diederichs, Helmut H., Frankfurt a.M. 2005, 202-237.
• Eisenstein, Sergej: Monsieur, madame et bébé, in: ders.: Yo, ich selbst. Memoiren, Band 2, hg. von Klejman, Naum, Berlin 1998, 640-663.
• Elsaesser, Thomas: The Pathos of Failure: American Films in the 1970s. Notes on the Unmotivated Hero [1975], in: ders./Horwath, Alexander/King, Noel (Hg.): The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s, Amsterdam 2004, 279-292.
• Kappelhoff, Hermann: Matrix der Gefühle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit, Berlin 2004.
• Kappelhoff, Hermann: Realismus. Das Kino und die Politik des Ästhetischen, Berlin 2008.
• Martin, Adrian: The Body has no Head. Corporeal Figuration in Aldrich, in: Screening the Past, Nr. 10 (2000), Quelle: http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fr0600/amfr10b.htm, Zugriff am 6. 3. 2012.
• Proctor, William: Regeneration & Rebirth. Anatomy of the Franchise Reboot, in: Scope, Nr. 22 (Februar 2012), Quelle: http://www.scope.nottingham.ac.uk/February_2012/proctor.pdf, Zugriff am 3. 4. 2012.
• Robnik, Drehli: New Hollywood Road Movies als Wissensbiotop und Medium prekärer Erfahrung, in: Pauleit, Winfried u.a. (Hg.): Traveling Shots. Film als Kaleidoskop von Reiseerfahrungen, Berlin 2007, 104-117.
• Truffaut, François: Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?, München 1973.