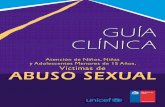Drei archaische Gefäßattaschen aus Didyma, in: A. Giumlia-Mair - C. C. Mattusch (Hrsg.),...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Drei archaische Gefäßattaschen aus Didyma, in: A. Giumlia-Mair - C. C. Mattusch (Hrsg.),...
Monographies Instrumentum 5/
PROCEEDINGS OF THE XVIIth INTERNATIONALCONGRESS ON ANCIENT BRONZES,
- IZMIR -
textes réunis par: Alessandra GIUMLIA-MAIR et Carol C. MATTUSCH
2
éditions mergoilem
ISSN 1278-3846
dépôt légal septembre 2016 ISBN 978-2-35518-059-0
55 € TTC
éditions mergoil
L e XVIIème Congrès international sur les Bronzes Anciens a eu lieu au Centre culturel de
Sabanci à l’Université Eylül Dokuz, à Izmir, en mai 2011. Le thème général du congrès était «Bronzes de la Méditerranée orientale.»Les 29 articles publiés ici représentent le matériel qui a été présenté en 2011, regroupés en quatre catégories :
- Les ustensiles de cuisine, les pièces associées à la vaisselle et les lampes - Les ornements, pendants de harnais, décorations de meubles, objets militaires- Les statuettes et autres représentations- La statuaire à grande échelle
The XVII International Congress on Ancient Bronzes was held at the Sabanci Cultural
represent the material that was presented in 2011, grouped into four categories:
- Vessels, vessel attachments, and lamps
- Statuettes and other images- Large-scale statuary
Center and Dokuz Eylül University in Izmir in May, 2011. �e general subject ofthe congress was «Bronzes from the eastern Mediterranean.» �e 29 papers published here
- Adornments, harness, furniture, military and naval e�ects
ARCHÉOLOGIE DES PLANTES ET DES ANIMAUX .
ARCHÉOLOGIE DU PAYSAGE
ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE ROMAINE
BIBLIOGRAPHIES THÉMATIQUES EN ARCHÉOLOGIE
CAHIERS DU PATRIMOINE, Montagnac
EUROPE MÉDIÉVALE
FORSCHUNGEN ZUM DÜNSBERG
HORS-COLLECTION
MÉMOIRE DE PLANTES
MONOGRAPHIES INSTRUMENTUM
PRÉHISTOIRES
PROTOHISTOIRE EUROPÉENNE
TEMPS MODERNES
Les collections des éditions: Alessandra GIUMLIA-MAIR :
archaeologist and archaeometallurgist, is the vice-president of the International Standing Committee for Bronze Congresses
Carol C. MATTUSCH :
archaeologist and art historian specializing in the production of bronze statuary, is the president of the International Standing Committee for Bronze Congresses.
MI52
em
PROC
EED
ING
S OF
TH
E XV
IIth
INTE
RNAT
ION
AL C
ONG
RESS
ON
AN
CIEN
T BR
ONZE
S, I
ZMIR
A. G
IUM
LIA-
MAI
R C.
C. M
ATTU
SCH
C
M
J
CM
MJ
CJ
CMJ
N
MI-52_Couverture.pdf 1 22/07/2016 14:24:51
Proceedings of the XVIIth International Congress on Ancient Bronzes, Izmir
MI_52_pages_1_4.indd 1 18/07/2016 12:18
Monographie Instrumentum52
Collection dirigée parMichel Feugère
MI_52_pages_1_4.indd 3 18/07/2016 12:18
Éditions MergoilAutun2016
Alessandra Giumlia-Mair and Carol C. Mattusch
Proceedings of the XVIIth International Congress on Ancient Bronzes, Izmir
avec les contributions de
Hélène Aurigny, Beryl Barr-Sharrar, David Bartus, Fede Berti, Leonardo Bigi, Margherita Bolla, Yorgos Brokalakis, Marina Castoldi, Mario Cygielman, klara De Decker,
Ekkehard Diemann, Exhlale Dobruna-Salihu, Zeina Fani, Patrizia Framarin, Norbert Franken, Alessandra Giumlia-Mair, Nadezda Gulyaeva, Ata Hasanpour, Seán Hemingway, Despina Ignatiadou,
Nino Kalandadze, Fulvia Lo Schiavo, Maximilian Lubos, Jeffrey P. Maish, Mehrdad Malekzadeh, Angelalea Malgieri, Carol C. Mattusch, Valeria Meirano, Sergio Meriani, Marcello Miccio, Niccolò Mugnai, Omid Oudbashi, Olga
Palagia, Paolo Pecchioli, Matteo Perotti, John Pollini, David Saunders, Heather F. Sharpe, Chiara Tarditi, Mikhail Treister, Marc Walton, Leonid Yablonsky, Gerhard Zimmer.
Préface de Alessandra Giumlia-Mair et Carol C. Mattusch
MI_52_pages_1_4.indd 5 18/07/2016 12:18
Tous droits réservés© 2016
Diffusion, vente par correspondance :
Editions Mergoil37 Rue du Faubourg Talus
F - 71140 Autun
Tél : 0345440444e-mail : [email protected]
ISBN : 978-2-35518-059-0ISSN : 1278-3846
Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduitesous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner ou autre)
sans l’autorisation expresse des Editions Mergoil.
Texte : auteursSaisie, illustrations : idem
Mise en pages : Alessandra Giumlia-Mair et Editions Mergoil Couverture : Editions Mergoil
Photo : (Minerva) ©Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Quatrième de couverture : (panther) ©Chiara TarditiDépôt légal Septembre 2016
MI_52_pages_1_4.indd 6 18/07/2016 12:18
The International Bronze Congress is recognized as the leading forum for scholars whose research enhances our knowledge of the art, culture, and technology of bronzes in the Classical world. Since 1970, there have been 20 successful Congresses, most recently in Izmir (2011), Zurich (2013), and Los Angeles (2015). Each congress attracts hundreds of participants from Europe, the United States, and Asia. The presentations have covered a broad range of topics in the fields of archaeology, ancient technology, history of art, and conservation, and have introduced many new discoveries and new ideas. The next International Bronze Congress will be held at the University of Tübingen in 2018.
International Standing Committee for Bronze Congresses
Members:
Carol C. Mattusch (president) Alessandra Giumlia-Mair (vice-president) Sophie Descamps-LequimeEckhard Deschler-Erb Norbert FrankenNadezda Gulyaeva Despina IgnatiadouAnnemarie Kaufmann-HeinimannSusan Stock
MI_52_pages_1_4.indd 9 18/07/2016 12:18
Previous bronze congresses and publications:
1. Nijmegen, 1970.Tagung über römische Bronzegefäße im Rijksmuseum G. M. Kam in Nijmegen von 20. biseinschließlich 23. April 1970.Hektogr. Niederschrift 1970.
2. Mainz, 1972.Bericht über die Tagung ‘Römische Toreutik’ vom 23. - 26. Mai 1972 in Mainz.ed. Heinz Menzel, Jb. RGZM 20 (1973), 258-282.
3. Brussels-Mariemont, 1974.Actes des IIIes journées internationales consacrées à l’étude des bronzes romains Bruxelles-Marie-mont 27. - 29. mai 1974. Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire 46, 1974 (1977), 5-217.
4. Lyon, 1976.Actes du IVe Colloque International sur les bronzes antiques (17. - 21. mai 1976).Annales de l’Université Jean Moulin, Lyon 1977, 5-236.
5. Lausanne, 1978.Bronzes Hellénistiques et Romains. Tradition et Renouveau. Actes du Ve Colloque international surles bronzes antiques Lausanne, 8. - 13. mai 1978.Cahiers d’Archéologie Romande 17 (1979).
6. Berlin, 1980.Toreutik und figürliche Bronzen. Akten der 6. Tagung über Antike Bronzen 13. - 17. Mai 1980 inBerlin. Berlin, Antikenmuseum, 1984.
7. Székesfehérvár, 1982.Bronzes Romains figurés et appliqués et leur problème techniques. Actes du VIIe Colloque interna-tional sur les Bronzes antiques, Székesfehérvár, 1982.Alba Regia 21, 1984, 5-136.
8. Stara Zagora, 1984.Unpublished.Exhibition catalog: Ancient Bronzes, Stara Zagora: District Historical Museum, 1984.
9. Vienna, 1986.Griechische und römische Statuetten und Großbronzen. Akten der 9. Tagung über antike Bronzenin Wien, 21. - 25. April 1986,ed. Kurt Gschwantler und Alfred Bernhard-Walcher. Vienna: Kunsthistorisches Museum, 1988.Exhibition catalogue: Guß + Form: Bronzen aus der Antikensammlung,ed. Kurt Gschwantler et al., Vienna: Kunsthistorisches Museum, 1986.
10. Freiburg, 1988.Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen. Forschungen und Berichte zur Vor- undFrühgeschichte in Baden-Württemberg, 45 (1994)Exhibition catalogue: Hans Ulrich Nuber, Antike Bronzen aus Baden-Württemberg, Schriften des
MI_52_pages_1_4.indd 11 18/07/2016 12:18
Limesmuseums Aalen 40, 1988.
11. Madrid, 1990.Bronces y Religion Romana. Actas del XI. Congreso Internacional de Bronces Antiquos,ed. J. Arce and F. Burkhalter. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993.Exhibition catalogue: Los Bronces Romanos en España, Madrid: Ministerio de Cultura 1990.
12. Nijmegen, 1992.Acta of the 12th International Congress on Ancient Bronzes, Nijmegen, 1-4 June 1992,eds. S. T. A. M. Mols, A. M. Gerhartl-Witteveen, H. Kars, A. Koster, W. J. Th. Peters, and W. J. H.Willems, Nederlandse Archeologische Rapporten 18 (Nijmegen 1995).
13. Cambridge Mass., 1996.From the Parts to the Whole: Acta of the 13th International Congress on Ancient Bronzes,eds. C. Mattusch, A. Brauer, and S. Knudsen, JRA supplement 39, 2 vols., 2000, 2002.Exhibition catalogue: The Fire of Hephaistos: Large Classical Bronzes from North American Col-lections, ed. C. Mattusch, Cambridge, Mass.: Harvard University Art Museums, 1996.
14. Cologne, 1999.Antike Bronzen, Werkstattkreise:Figuren und Geräte, Cologne, 2000.
15. Aquileia, Grado and Trieste, 2001.I Bronzi Antichi: Produzione e tecnologia,ed. A. Giumlia-Mair, 2002, Éditions M. Mergoil, Montagnac.
16. Bucharest, 2003.The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity,ed. C. Museteanu, Bucharest 2004.
17. Izmir, 2011.Proceedings of the 17th Bronze Congress, Izmireds. A. Giumlia-Mair and C. Mattusch, Éditions Mergoil, Montagnac, 2016.
18. Zurich, 2013.New Research on Ancient Bronzes,eds. E. Deschler-Erb and P. Della Casa, Zurich Studies in Archaeology 10, 2015.
19. Los Angeles, 2015.Electronic publication in progress.Exhibition catalogue: Power and Pathos: Bronze Sculpture of the Hellenistic World,eds. J. M. Daehner and K. Lapatin, Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2015.
MI_52_pages_1_4.indd 12 18/07/2016 12:18
13
15
17
29
39
49
59
65
71
79
87
93
95
103
111
119
127
Table of conTenTs
Preface
Vessels, Vessel attachments, and lamps
Omid Oudbashi, Ata Hasanpour, Mehrdad Malekzadeh The luristan bronzes in sangtarashan: bronze Technology in Western Iran in the first Millennium bc
Hélène Aurigny anatolian bronzes from Delphi in the archaic Period
Klara De Decker and Ekkehard Diemann Reconstruction of the fabrication of the “Rhodian” oinochoai
Chiara Tarditi athenian archaic bronze vessel production: new evidence from old excavations
Norbert Franken Dr arei chaische Gefäßattaschen aus Didyma
Nadezda Gulyaeva bronze lamps of Ionian Type in the Hermitage Museum
Mikhail Treister and Leonid Yablonsky bronze lamp in form of reclining zebu bull from filippovka
Valeria Meirano bronze phialai mesomphaloi in context: some recent and revisited case studies
Beryl Barr-Sharrar approaches to the study of Hellenistic Metalwork: a Preliminary Introduction
adornments, harness, furniture, military and naVal effects
Despina Ignatiadou aThe enea mirrora. Re-examination
Jeffrey P. Maish, Marc Walton, David Saunders, and Nino Kalandadze Technical study of the bronze Kline legs from Vani
Niccolò Mugnai, Leonardo Bigi, Matteo Perotti copper alloy items from the Roman military site of Thamusida (sidi ali ben ahmed, Morocco)
Patrizia Framarin Objects of enameled bronze with millefiori glass insertion from Augusta Praetoria Salassorum (Aosta, Italy)
Yorgos Brokalakis The use of bronze on Roman ships and the shipwreck of agia Galini
MI_52_pages_1_4.indd 13 22/07/2016 09:58
statuettes and other images 141
Heather F. Sharpe 143observations on the casting, Mounting and Display of archaic Greek bronze statuettes
Fede Berti and Angelalea Malgieri 151bronzi da Iasos: ritrovamenti e testimonianze di età Imperiale
David Bartus 163Two Roman bronze heads with cirrus from brigetio
Marina Castoldi 169bronze Trees
Seán Hemingway 175an early Imperial bronze sphinx support in the Metropolitan Museum of art, new York
Margherita Bolla 183eastern bronzes in northern Italy
Exhlale Dobruna-Salihu 197Roman small bronze sculpture in the central part of Dardania (Kosovo)
Zeina Fani 209les bronzes de Rimat
large-scale statuary 217
John Pollini 219 The God from cape artemision: Zeus or Poseidon? an old Question, a new approach
Gerhard Zimmer 231searching for the Goddess
Olga Palagia 237Towards a publication of the Piraeus bronzes: the apollo
Fulvia Lo Schiavo, Mario Cygielman, Marcello Miccio, Paolo Pecchioli, and Alessandra Giumlia-Mair 245The Restoration of the Minerva of arezzo
Alessandra Giumlia-Mair and Sergio Meriani 253a Roman bronze portrait: composition and technology in the 1st century a.D.
Carol C. Mattusch 263Why bronze? The Tastes and attitudes of Roman collectors
Maximilian Lubos 265boubon bronzes – new Perspectives
abstracts / résumés 275
MI_52_pages_1_4.indd 14 22/07/2016 09:58
Drei archaische Gefäßattaschen aus Didyma
NORBERT FRANKEN Rheinsberger Str. 2, D-10115 Berlin. [email protected]
Bei den zwischen 1905 und 1913 von den Königlichen Museen zu Berlin unter der Leitung von Theodor Wiegand (1864 – 1936) und Hubert Knackfuß (1866 – 1948) durchgeführten Ausgrabungen kamen im Bereich des Apollon-Heiligtums von Didyma über 100 mehrheitlich archaische Bronzen zutage. Von diesen gelangten vor Inkrafttreten des 1907 vom Osmanischen Reich erlassenen Antikengesetzes ca. 20 Objekte im Rahmen der Fundteilung in das Antiquarium der Berliner Museen (heute: Antikensammlung – Staatliche Museen zu Berlin). Der von den Ausgräbern in Didyma zurückgelassene Teil der Bronzen hingegen ist seit der Zerstörung des deutschen Grabungshauses durch englische Marine und Luftwaffe im Sommer 1916 verschollen (Karo 1919, 169; Wiegand 1919, 189; Tuchelt 1970, 40). Da durch die kriegerischen Ereignisse auch sämtliche in Didyma verbliebenen Glasnegative vernichtet wurden und darüber hinaus Fotos und Zeichnungen der älteren didymäischen Bronzefunde fast vollständig fehlen, läßt sich über die jetzt fehlenden Stücke nur soviel sagen, wie den wenigen und überaus knappen Beschreibungen im Fundbuch und kursorischen Erwähnungen in den erhaltenen Grabungstagebüchern zu entnehmen ist (Antikensammlung – SMB Archiv Nr. Didy 8). Die Handschrift ist die des Grabungsleiters H. Knackfuß. Aufgrund der unzureichenden Dokumentation kam es so im Laufe der Zeit innerhalb der Berliner Bestände gelegentlich zu Verwechslungen von Bronzen aus Didyma und Milet mit den sehr viel zahlreicher erhaltenen Fundbronzen aus dem Hera-Heiligtum von Samos (dazu auch Bumke 2002). Nach Abschluß der zwischen 2004 und 2011 vom Berichterstatter unternommenen Erschließung der meisten bis 1945 erworbenen Bronze-, Blei- und Eisen- objekte der Berliner Antikensammlung läßt sich nun noch rund ein Dutzend Objekte mit verschiedener Sicherheit als aus Didyma stammend identifizieren (Franken 2011).
Zusammen mit anderen Beständen der Berliner Museen waren auch einige der Bronzen aus Didyma von einem verheerenden Brand im Leitturm des Flakbunkers Berlin-Friedrichshain be-troffen, bei dem im Mai 1945 ein großer Teil der ausgelagerten Kunstschätze verbrannte. Seit der im Jahre 2005 aus Anlaß des 60. Jahrestages des Kriegsendes in Moskau gezeigten Ausstellung „Archäologie des Krieges – Rückkehr aus dem
Nichts“ hat sich das Wissen über Art und Umfang der nach 1945 von der Roten Armee aus dem Flakbunker Friedrichshain und den übrigen Verlagerungsorten der Berliner Museen geborgenen, danach in die Sowjetunion verbrachten, jedoch im Jahre 1958 nicht an die DDR restituierten Kunstwerke kontinuierlich vermehrt. Vor allem dank des Entgegenkommens der damaligen Museumsdirektorin Irina Antonova und der sich daraus ergebenden Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern Vladimir Tolstikov und Ludmilla Akimova war es dem Verfasser möglich, im April 2009 und im September 2010 den in einem Spezialdepot des Staatlichen Museums der Bildenden Künste A. S. Puschkin (kurz: Puschkin-Museum) aufbewahrten Teil der Objekte aus Bronze und Eisen zu sichten. Von ca. 1000 Metallobjekten und -fragmenten in Moskau konnten – nicht zuletzt dank der durch den Fotografen Konstantin Korganov angefertigten Digitalaufnahmen – so bis heute etwas mehr als 700 wieder ihrer alten Inventarnummer zugeordnet werden.
Abb. 1: Skizze aus dem Tagebuch der Didymagrabung vom 2.-7. 12. 1907
Unter den seit 1945 kriegsbedingt nach Moskau verlagerten Bronzen fanden sich auch zwei nachweislich bzw. höchstwahrscheinlich aus Didyma stammende archaische Gefäßattaschen, die so ungewöhnlich und ohne Vergleiche sind, daß sie eine ausführliche Bekanntmachung verdienen. Da die beiden Attaschen, wie fast alle heute in Moskau befindlichen Bronzen, beim Brand des Flakbunkers ihre alte Aufschrift mit Angabe der Inven-tarnummer verloren haben, bedarf es zum
Bronze Congress Izmir
59
Nachweis ihrer Herkunft aus Didyma aber zunächst einer längeren Beweisführung. Das oben bereits erwähnte Fundbuch von Didyma nennt unter Nr. 7 (= Didyma 7) einen großen bronzenen Wulsthenkel mit drei Knäufen, der zwischen dem 2. und dem 7. Dezember 1907 wie die vorhergehende Nummer bei „dem archaischen Rundbau vor der Ostfront des Tempels“ gefunden wurde.
Bestätigung findet die Angabe beim Blick ins Grabungstagebuch (Antikensammlung – SMB Archiv Nr. Didy 1), wo man liest: „... Vor der Mitte des Tempels, in etwa 6 m Abstand von der untersten Stufe, kommt man auf eine tiefe Schicht, die keine Marmorsplitter mehr enthält, sondern wie verwitterter Brandschutt aussieht, in mehreren Lagen. Hier finden sich eine größere Anzahl von archaischen Bronzeblechen in sehr brüchigen Fragmenten, die sorgfältigst gesammelt wurden, ferner ein grösserer Gefäßhenkel aus Bronze und ein sehr gut erhaltener Greifenkopf von seltener Form ...“ Gleich bei der Erwähnung des Henkels findet sich eine weniger als fingernagelgroße Skizze (Abb. 1) eines seltsam halbrund vorgewölbten Gebildes, das auf seiner Vorderseite drei senkrechte Rippen aufweist, die nach unten jeweils in einer kugeligen Verdickung auslaufen. Ohne genauere Maßangaben und eine ergänzende Beschreibung wäre es aussichtslos, den vermißten Gegenstand allein anhand der Skizze wiederfinden zu wollen.
Abb. 2: Henkelring Berlin, Antikensammlung – SMB Inv. Didyma 8
Doch enthält die nachfolgend genannte Nr. 8 (= Didyma 8) einen wichtigen Hinweis, indem dort ein „zu einem Nr. 7 gleichen oder vielleicht zu Nr. 7 selbst gehöriger Henkelring“ verzeichnet ist. Dieser „Henkelring“ (= Didyma 8), der laut Fundbuch rund einen Monat vor Nr. 7, in der Woche vom 4. bis 9. November 1907, nicht weit entfernt „nahe der nördlichen Peribolostreppe vor der Ostfront des Tempels“ gefunden wurde, hat
sich glücklicherweise im Bronzemagazin der Antikensammlung vorgefunden. (Abb. 2) Er ist insgesamt 16,6 cm breit und besaß, soweit es die stark korrodierte Oberfläche erkennen läßt, keinerlei Ornament. Aus der von Knackfuß für möglich gehaltenen Zusammengehörigkeit des „Wulsthenkels“ Didyma 7 und des „Henkelrings“ Didyma 8 läßt sich nun schließen, daß der ungefähr 9 cm messende innere Abstand zwischen den beiden Spitzen der beweglichen Handhabe (Didyma 8) der zu fordernden Gesamtbreite der vermißten Attasche (Didyma 7) entsprochen haben dürfte. Tatsächlich fand sich unter den bis dahin nicht identifizierbaren Objekten in Moskau eine mit 9,5 cm Breite ausreichend große archaische Attasche (Abb. 3 a - c), die nach Maß und Beschreibung zweifellos mit dem vermißten „Wulsthenkel mit drei Knäufen“ (Didyma 7) identisch sein dürfte. Bei genauer Überprüfung am Objekt ließ sich allerdings feststellen, daß die drei kugeligen Verdickungen sicher nicht – wie vom Zeichner angenommen – hängend, sondern nur stehend ausgerichtet gewesen sein können. Im Profil ist nämlich deutlich eine zurückspringende Kante zu erkennen, die ehemals in horizontaler Ausrichtung auf dem Rand des Gefäßes gesessen haben dürfte. Bevor wir jedoch der Frage der Rekonstruktion näher nachgehen, seien noch zwei kleinere Attaschen desselben Typs erwähnt, die ebenso aus den Ausgrabungen in Didyma stammen. Ohne genauere Maßangabe verzeichnet das Fundbuch unter Nr. 52 einen am 20. Februar 1910 in der Südwestgrabung, also unweit der südwestlichen Ecke des späteren Apollontempels gefundenen kleinen Wulsthenkel mit drei Knäufen und dem Vermerk „ähnlich Nr. 7“. Während dieser Henkel Nr. 52, von dem nicht zu vermuten ist, daß er nach Berlin gelangte, wahrscheinlich 1916 in Didyma zerstört wurde oder in der folgenden Zeit verloren ging, fand sich unter den zunächst unidentifizierbaren Objekten in Moskau ganz unerwartet eine dritte Henkelattasche derselben Form (Abb. 4 a - c). Mit einer Breite von 5,2 cm ist sie nur wenig mehr als halb so groß wie die Attasche Didyma 7. Außerdem unterscheidet sie sich von dieser dadurch, daß ihr einer der drei Knäufe fehlt. Angesichts dessen dürfte es sich bei ihr sehr wahrscheinlich um die ohne Angabe der Maße, des Fundorts und des Funddatums als Nr. 66 in das Fundbuch von Didyma eingetragene Attasche (= Didyma 66) handeln, die dort als „mittelgroßer eigenartig profilierter Wulsthenkel mit drei Knäufen (einer fehlt)“ beschrieben ist. Anders als die größere Attasche (Didyma 7) zeigt die kleinere Attasche (Didyma 66) in der Seitenansicht keinen Rücksprung, mit dem sie ursprünglich auf dem Rand eines Gefäßes aufgesessen haben könnte, doch ragen die drei Knäufe soweit vor, dass sie in hängender Anordnung keinen Platz vor der Gefäßwand gefunden hätten.
Bronze Congress Izmir
60
Abb. 3 a - c: Henkelattasche ehem. Berlin, ANT, Inv. Didyma 7 (z. Zt. Moskau, Puschkin-Museum)
Abb. 4 a - c: Henkelattasche ehem. Berlin, ANT, Inv. Didyma 66 (z. Zt. Moskau, Puschkin-Museum)
Bei diesen Attaschen müssen die Knäufe also ohne Zweifel ursprünglich nach oben ausgerichtet gewesen sein. Zusätzliche Bestätigung findet diese Annahme durch den Vergleich mit einigen wohl in der Mehrzahl aus Kleinasien stammenden flachen Schalen phrygischen Typs, die an ihrem äußeren Rand neben so genannten ‚Spulenbändern’ auch zwei walzen- oder spulenförmige Attaschen mit einer beweglichen Handhabe aufweisen. Exemplarisch zu nennen sind mehrere Schalen und wenigstens eine zugehörige Attasche aus Gordion (Young 1981, 126 – 130 Taf. 66 f.; Kohler 1995, Taf. 37 A) sowie je eine Schale aus Magnesia am Sipylos (Manisa) im Archäologischen Museum von Izmir (Akurgal 1955, 81 Taf. 60 a), aus dem Tumulus an der Baumschule in Ankara im dortigen Museum (Akurgal 1955, 81 Taf. 57 a; 59) und aus Bayındır/Elmalı (Tumulus C) im Archäologischen
Bronze Congress Izmir
61
Museum von Antalya (Özgen – Özgen 1988, 37 Abb. 40).
Gudrun Klebinder-Gauss, die sich zuletzt mit dieser Materialgruppe auseinander gesetzt hat, fand Belege für ein Vorkommen dieses Gefäßtypus vom dritten Viertel des 8. Jahrhunderts bis kurz nach 600 v. Chr. (Klebinder-Gauß 2007, 140 – 143) Bei einer gründlicheren Materialsammlung, als sie dem Verfasser bei Vorbereitung dieses Beitrags möglich war, wird sich die Zahl der bislang veröffentlichten Bronzeschalen des phrygischen Typs sicherlich noch erheblich erweitern lassen. Wie weit verbreitet vor allem die hier interessierenden Bronzeschalen mit Spulenband ehemals waren, könnte darüber hinaus eine auf größtmögliche Vollständigkeit zielende Erschließung aller nachweisbarer Frag-mente (Attaschen, Handhaben, Spulenbänder etc.) zeigen. Hier soll neben der Erwähnung von drei jüngst veröffentlichten Spulenbändern aus dem Artemision von Ephesos, die G. Klebinder-Gauss für westanatolische Nachahmungen phrygischer Produkte hielt (Klebinder-Gauss 2007, 268 Kat. 826 – 828 Taf. 66-67.), der Hinweis genügen, daß auch die Berliner Antikensammlung ehemals zwei isolierte Spulenbänder aus Dodona, mit zwei Spulen (ehem. Berlin, Antikensammlung Inv. Misc. 10594; L 17,5 cm. Unveröffentlicht), und aus Olympia, mit einer Spule (ehem. Berlin, Antikensammlung Inv. Ol. 7612; L ca. 10,8 cm. Furtwängler 1890, 136 zu Nr. 852), besaß. Beide Stücke waren seit Ende des Zweiten Weltkriegs vermißt und sind erst jüngst im Moskauer Puschkin-Museum wieder aufgetaucht (Vgl. dazu Franken 2011).
Während die Zahl der ‚Spulen’ bei den oben genannten Schalen zwischen vier und acht schwankt, besitzt eine besonders reich dekorierte Schale aus dem so genannten ‚Lydian Treasure’ sogar zehn ‚Spulen’ (Özgen – Öztürk 1996, 235 Nr. 225 mit Abb. und weiterer Lit.). Gleiches gilt für eine aus Zypern stammende Schale der ehemaligen Cesnola Collection im Metropolitan Museum New York (Richter 1915, 203 f. Nr. 538 Abb.). Die zuletzt genannte Schale ist jedoch aus einem anderen Grund von Interesse. Anders als die vorher genannten Henkelattaschen weist sie nämlich nicht nur einen Knopf, sondern jeweils zwei Knöpfe auf den Henkelattaschen auf. In der Anzahl der Knöpfe kommt sie den Attaschen aus Didyma daher am nächsten. Bronzene Kessel bzw. Schalen phrygischen Typs oder auch nur einzelne Henkelattaschen mit drei Knäufen sind dem Verfasser trotz intensiver Recherche nicht bekannt geworden. Auch unter den bisher veröffentlichten Bronzegefäßattaschen archaischer Zeit aus Milet und Didyma (Tuchelt 1971, 83 f. Taf. 18; Heinz – Senff 1995, 223 f. Abb. 24; Donder 2002, 6 Abb. 3) finden sich keine Beispiele dieses Typs. Gerade aufgrund des Fehlens unmittelbarer Vergleiche
stellen die seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin vermißten und nun durch glückliche Umstände in Moskau wieder aufgetauchten Attaschen aus Didyma, die wir als Produkte einer oder mehrerer bisher nicht näher lokalisierbarer westkleinasiatischer Bronzewerkstätten des 7. Jahrhunderts v. Chr. ansehen, eine besonders wertvolle Bereicherung unserer Denkmälerkenntnis dar.
Anmerkung Abweichend von dem in Izmir gehaltenen Referat erscheint hier der Text eines Vortrags, den der Verfasser im November 2010 anlässlich des von H. Donder organisierten Kolloquiums über „Ionische und phrygische Bronzewerkstätten“ in der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts (KAAK) in Bonn gehalten hat.
Danksagungen
Für die Leitung der beiden DFG-Projekte ist W.-D. Heilmeyer und A. Scholl zu danken.
Bibliographie
Akurgal, E. 1955. Phrygische Kunst. Ankara, Archäologisches Institut der Universität Ankara.
Bumke, H. 2002. Eine Bes-Statuette aus dem Apollonheiligtum von Didyma. Istanbuler Mitteilungen 52: 209 – 219.
Donder, H. 2002. Funde aus Milet XI. Die Metallfunde. Archäologischer Anzeiger H 1: 1 – 8.
Franken, N. 2011. Bilddatenbank Antike Bronzen in Berlin: http://www.smb.museum/antikebronzenberlin/index .htm
Furtwängler, A. 1890. Die Bronzen und die übrigen kleineren Funde von Olympia. Olympia IV. A. Asher & Co., Berlin.
Heinz, M. – Senff, R. 1995. „Die Grabung auf dem Zeytintepe,“ Archäologischer Anzeiger: 220 – 224.
Karo, G. 1919. „Deutsche Denkmalpflege im westlichen Kleinasien 1917/18“, Clemen, P.(Hrsg.), Kunstschutz im Kriege. A. Seemann, Leipzig.
Klebinder-Gauß, G. 2007. Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos. Verlag der
Bronze Congress Izmir
62
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.
Kohler, E. L. 1995. The Gordion Excavations Final Reports II: The Lesser Phrygian Tumuli - The Inhumation. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Özgen, E. – Özgen, I. (Hrsg.) 1988. Antalya Museum. Ankara, Ministry of Culture and Tourism, Head Quarters Office of the Revolving Capital Administration.
Özgen, I. – Öztürk, J. 1996. The Lydian Treasure. Turkey, U. Okman (ed.), Republic of Turkey, Ministry of Culture, General Directorate of Monuments and Museums.
Richter, G. M. A. 1915. Greek, Etruscan and Roman Bronzes. New York: The Metropolitan Museum of Art.
Tuchelt, K. 1970. Die archaischen Skulpturen von Didyma. Istanbuler Forschungen 27.
Tuchelt, K. 1971. Didyma 1969/70, Istanbuler Mitteilungen 21.
Wiegand, Th. 1919. Deutsche Denk-malpflege im westlichen Kleinasien 1917/18. In Clemen, P. (Hrsg.), Kunstschutz im Kriege. A. Seemann, Leipzig.
Young, R. S. 1981. The Gordion Excavations, Final Reports I. Three Great Early Tumuli. Philadelphia, University Museum, University of Pennsylvania.
Abbildungsnachweis: Abb. 1: Repro nach Tagebuch der Didymagrabung (Archiv ANT – SMB, Didy 1); Abb. 3 a – c. 4 a: Foto Konstantin Korganov, Staatliches Museum der Bildenden Künste A. S. Puschkin, Moskau; Abb. 2. 4 b – c: Foto Verfasser.
Bronze Congress Izmir
63