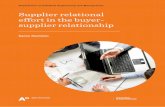Dominicus Gundissalinus's Theory of Science (my German doctoral dissertation from 2003)
Transcript of Dominicus Gundissalinus's Theory of Science (my German doctoral dissertation from 2003)
Alexander Fidora
Die Wissenschaftstheorie des Dominicus Gundissalinus
Voraussetzungen und Konsequenzen des zweiten Anfangs der
aristotelischen Philosophie im 12. Jahrhundert
2003
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ............................................................................................................................. 7 1. Einführung: Stellung und Bedeutung des Gundissalinus .............................................. 9 2. Die lateinisch-christliche und arabische Tradition als
Voraussetzungen der wissens- und wissenschaftstheoretischen Aristoteles-Rezeption bei Gundissalinus ....................................................................... 23
2.1. Gundissalinus und die Heilige Schrift:
Christliche versus weltliche Wissenschaft? ............................................................ 23
2.2. Gundissalinus und Boethius: Wissens- und Wissenschaftstheorie ........................................................................ 37
2.2.1. Vorbemerkung .............................................................................................. 37
2.2.2. Die boethianische Einteilung der
Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen ................................................. 37 2.2.3. Die boethianische Einteilung der
Wissenschaften gemäß ihren Methoden ....................................................... 48 2.2.4. Die boethianische Axiomatik der Wissenschaften ........................................ 56
2.2.5. Die boethianischen didaskalika, und die
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften ................... 65
2.3. Gundissalinus und Isidor von Sevilla: Die neuen (?) Wissenschaften ................................................................................ 77
2.4. Zwischenbilanz und Plädoyer
für einen avicennisierenden Boethianismus ............................................................ 89 3. Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
für die Wissens- und Wissenschaftstheorie bei Gundissalinus ...................................... 97
3.1. Problemstand .......................................................................................................... 97
6 Inhaltsverzeichnis
3.2. Die aristotelische Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen ......................................................... 103
3.3. Die aristotelische e[xij-Lehre und die Bestimmung
der Methoden der Wissenschaften als Seelenvermögen ....................................... 115 3.4. Die aristotelische Axiomatik der Wissenschaften.................................................. 129 3.5. Die aristotelische Subordination und
Binnendifferenzierung der Wissenschaften ........................................................... 145
3.6. Die aristotelische Tripartition der praktischen Philosophie .................................. 167 4. Schluß: Gundissalinus und der
‚zweite Anfang‘ der aristotelischen Philosophie .......................................................... 181 Bibliographie ................................................................................................................... 195 Register ............................................................................................................................ 217
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist am DFG-Forschungskolleg „Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel“ der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main entstanden und wurde im Som-mersemester 2002 als Dissertation am dortigen Fachbereich Philosophie und Geschichtswis-senschaften eingereicht. Ich danke dem DFG-Forschungskolleg für die Aufnahme dieses Bandes in seine Reihe sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses. Ferner gilt mein Dank ganz besonders meinen Gutachtern Matthias Lutz-Bachmann (Frank-furt), Thomas M. Schmidt (Frankfurt) und Ludger Honnefelder (Bonn) für die Begleitung der Arbeit und ihre kritischen Anregungen. Aus dem Frankfurter Arbeitszusammenhang sind daneben noch zu nennen Anna Akasoy, Hans Daiber, Andreas Niederberger und Dorothée Werner, denen ich ebenfalls großen Dank schulde. So haben mich Anna Akasoy und Hans Daiber in arabistischen Fragen unterstützt und viel Zeit aufgewandt. Letzteres gilt auch für Andreas Niederberger, mit dem ich diese Arbeit Kapitel für Kapitel diskutieren durfte. Er und Dorothée Werner haben schließlich auch das gesamte Manuskript noch einmal gegen-gelesen.
Darüber hinaus haben zahlreiche internationale Gelehrte zum Gelingen dieser Arbeit bei-getragen: Charles Burnett (London) gab mir die Möglichkeit, erste Ergebnisse meiner For-schungen im Dezember 2000 am Warburg Institute vorzustellen; Ramón Gonzálvez (Toledo) öffnete mir den Zugang zur Biblioteca Capitular der Kathedrale von Toledo und hat mich seither mit dem nötigen handschriftlichen Material versorgt; mit María Jesús Soto (Pam-plona) und ihren Kollegen habe ich an der Universidad de Navarra mehrfach über Gundissa-linus diskutieren können; und auch Serafín Vegas (Alcalá de Henares) stand mir in den ver-gangenen Jahren stets mit seinem freundschaftlichen Rat zur Seite. Ihnen allen gebührt mein aufrichtiger Dank.
Schließlich möchte ich auch meiner Familie und Anna Méndez für ihre Geduld danken. Ihnen und ganz besonders dem Andenken an meine Großväter Heinrich Fidora und Josep Maria Riera sei diese Monographie gewidmet.
Frankfurt am Main, Mai 2003 Alexander Fidora
1. Einführung: Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
Seit Charles Homer Haskins provokanter These einer ‚Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert‘, so der Titel seines 1927 erschienenen Werkes,1 hat die Geschichtswissen-schaft ein immer klareres Bild von der historischen Bedeutung der Schulen und Bildungsin-stitutionen, von der gesellschaftlichen Relevanz des Wandels im Selbstverständnis der Kün-ste, Disziplinen und Wissenschaften sowie von der Herausbildung der ‚scholastischen Me-thode‘ im Kontext der Revolution der Wissenskultur für nahezu alle Bereiche des gesell-schaftlichen und politischen Lebens gezeichnet.2 Aber auch in der Philosophiegeschichts-schreibung im engeren Sinne liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor, die neben der Ent-stehung einer selbständigen Sphäre der Intellektualität3 auch die systematischen Einzelbei-träge verschiedener Schulzusammenhänge und Autoren für das 12. Jahrhundert betrachten, wobei insbesondere die wissens- und wissenschaftstheoretischen Diskussionen des Pariser und Chartreser Umfeldes und ihr Einfluß auf die Ausbildung einer differenzierten Wissen-schaftskonzeption gewürdigt wurden.4 So ist unterdessen nicht nur auf die Entstehung einer selbständigen Naturphilosophie verwiesen worden,5 sondern auch auf den ‚éveil métaphy-sique‘6 des 12. Jahrhunderts und die damit einhergehende Unterscheidung von Philosophie und Theologie. Für die Geschichte der Philosophie bedeutet dies, daß der in Thomas von Aquin kulminierende Übergang von einem an Platon orientierten Einheitskonzept der Wis-senschaft zur aristotelisch gefaßten Pluralität derselben mit der Ausdifferenzierung der Wis-____________________________________________________________________________________________
1 Vgl. Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge (Mass.) 1927, Ndr. New York 1957. Siehe zum Begriff einer ‚Renaissance im 12. Jahrhundert‘ auch Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, „Der Streit um die Renaissance im 12. Jahrhundert – Eine Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen Humanismus, Wissenschaft und Religiosität“, in: Convenit Selecta 3 (2000), S. 7-26. 2 Vgl. etwa Peter Weimar (Hrsg.), Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert, Zürich 1981; Robert L. Benson u. Giles Constable (Hrsg.), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford 1982; sowie Richard W. Southern, Scholastic Humanism and the Unification of Europe – Vol. I: Foundations, Oxford 1995, sowie id., Scholastic Humanism and the Unification of Europe – Vol. II: The Heroic Age, Ox-ford 2001. 3 Siehe hierzu v.a. Jacques LeGoff, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris 1957. 4 Siehe etwa den von Peter Dronke herausgegebenen Sammelband A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, mit bedeutenden Beiträgen zu Peter Abaelard, Wilhelm von Conches, Gilbert von Poitiers, Thierry von Chartres u.a., sowie die dort verzeichnete Literatur. 5 So v.a. von Andreas Speer, Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer ‚scientia naturalis‘ im 12. Jahrhundert, Leiden u.a. 1995. Sowie neuerdings id., „Agendo physice ratione – Von der Entdeckung der Natur zur Wissenschaft von der Natur im 12. Jahrhundert“, in: Rainer Berndt u.a. (Hrsg.), ‚Scientia‘ und ‚Disciplina‘. Wissenstheorie und Wissenschaftspraxis im 12. und 13. Jahrhundert, Berlin 2002, S. 157-174. 6 Vgl. das vierzehnte Kapitel von Marie-Dominique Chenu, La théologie au XIIe siècle, Paris 1957, S. 308-322. Siehe ferner auch den diesem Komplex gewidmeten Aktenband von Matthias Lutz-Bachmann u.a. (Hrsg.), Metaphysics in the Twelfth Century – The Relationship Among Philosophy, Science and Theology, Turnhout 2003 (im Druck).
Einführung
10
senschaften im 12. Jahrhundert zumindest vorbereitet, wenn nicht in Teilen sogar schon voll-zogen wird. Tatsächlich ist längst bekannt, daß diese epistemologischen Reflexionen auch und in besonderer Weise mit der Rezeption neuer Texte, dem Timaios und auch der arabi-schen Philosophie, sowie der über sie im 12. Jahrhundert allmählich einsetzenden Rezeption der aristotelischen Gedanken zusammenhängen.7 Dabei wäre es freilich unterbestimmt, die Rezeption dieser neuen Texte als exogenen und alleinigen Auslöser der epistemologischen Entwicklungen anzunehmen; vielmehr scheint es so, daß diese Entwicklungen und die Re-zeption der neuen Quellen sich gegenseitig bedingen.
Um die zentrale Frage nach dem genauen Ablauf und der Beschaffenheit jener gegensei-tigen Bedingtheit von Reflexion und Rezeption im Prozeß des Übergangs vom platonischen Einheitskonzept der Wissenschaften zum aristotelischen Pluralismus derselben angemessen in den Blick zu nehmen, kann neben Paris und Chartres ein bestimmter Ort als privilegierter Zugang angesehen werden: Toledo. Während sich jedoch die Untersuchungen zu den epi-stemologischen Voraussetzungen der ‚intellektuellen Revolution‘8 des 12. Jahrhunderts bis-lang in erster Linie auf den Raum des heutigen Frankreich konzentriert haben,9 stellt die Bearbeitung dieser Frage für die Iberische Halbinsel eine eklatante Lücke in der gegenwär-tigen Forschungsliteratur dar.10 Dabei verspricht gerade die Untersuchung des philosophi-schen Umfeldes des im Jahre 1085 von Alfons dem VI. aus islamischer Herrschaft zurück-eroberten Toledo interessanteste Aufschlüsse, die in mancherlei Hinsicht weiter tragen als jene zur Île de France und den benachbarten Zentren: Denn zum einen arbeiteten in der spa-nischen Metropolis unter dem Mäzenat des Erzbischofs Johannes von Toledo in der soge-nannten ‚Übersetzerschule von Toledo‘ ab der Mitte des 12. Jahrhunderts zahlreiche christ-liche und jüdische Gelehrte an Übersetzungen wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen sowie später an der Übersetzung des Corpus aristotelicum arabum,11 womit Toledo gleich-sam eine der ersten Schnittstellen des lateinischen Westens mit der arabischen und aristoteli-schen Wissens- und Wissenschaftstheorie darstellt und von daher in besonderer Weise ge-eignet scheint, die Rezeptionsbedingungen derselben zu untersuchen. In Bezug auf die Aus-sagekraft dieser Übersetzungen ist in den letzten Jahren allerdings wiederholt darauf hinge-wiesen worden, daß die Übertragungen der aristotelisch geprägten Werke aus dem Arabi-schen ebenso wie die Übersetzung des Corpus aristotelicum arabum noch keine Erklärung für den Übergang von einer platonischen zu einer aristotelischen Wissenschaftskonzeption
____________________________________________________________________________________________
7 Vgl. etwa Charles Burnett, „Scientific Speculations“, in: Peter Dronke (Hrsg.), op. cit., S. 151-176. 8 Vgl. zu diesem Begriff Richard W. Southern, Scholastic Humanism and the Unification of Europe – Vol. I: Foundations, op. cit., S. 31. 9 Dies bestätigt auch ein kurzer Blick in den bereits erwähnten Sammelband von Peter Dronke (Hrsg.), op. cit., in dem Autoren der Iberischen Halbinsel nur am Rande behandelt werden. 10 Die bislang zu Toledo vorliegenden Arbeiten haben in der Regel stark prosopographischen Charakter und vernachlässigen darüber den systematischen Beitrag dieses Zentrums zu den philosophischen Debatten der Zeit. Siehe zur Prosopographie zum Beispiel die herausragende Arbeit von Ramón Gonzálvez, Hombres y Li-bros de Toledo (1086-1300), Madrid 1997. 11 Die Existenz eines institutionalisierten Schulzusammenhangs für Toledo ist immer wieder bestritten wor-den, so zuletzt von Serafín Vegas, La Escuela de Traductores de Toledo en la historia del pensamiento, Toledo 1998, S. 11-25, der zugleich einen guten und reich dokumentierten Gesamtüberblick über die in To-ledo entfaltete Übersetzungstätigkeit bietet. Hier und im folgenden soll der Begriff einer ‚Schule‘ daher in seinem weiteren Sinne verstanden werden, so wie etwa auch im Fall der Schule von Chartres.
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
11
darstellten.12 Dem ist gewiß zuzustimmen, sofern man unter Übersetzung nur die Bereitstel-lung von Texten verstehen will. In diesem Sinne erklären die Übersetzungen selbst tatsäch-lich nichts, wohl aber die Präferenzen der Übersetzer, ihre impliziten Auswahlkriterien und ihr Umgang mit den jeweiligen Texten. Wie bedeutsam und aufschlußreich die Erforschung dieser Elemente ist, hat Thomas Ricklin mit seiner Doppelstudie zur lateinischen Rezeption der aristotelischen Physica und zur Übersetzung des Liber de causis13 durch Gerhard von Cremona († 1187) – auch er ein Toledaner Übersetzer – gezeigt. „Nach den Motiven Ger-hards [für seine Übersetzungen] zu fragen“, so Ricklin, „heißt zuallererst anzuerkennen, daß eine Übersetzung selbst im Horizont der Geschichte der Philosophie mehr ist als das bloße Zurverfügungstellen eines Textes [...] Die Übersetzungsbewegung ist, und das wird nur zu gerne übersehen, auch der Ausdruck des Bewußtseins eines Mangels, das Eingeständnis der eigenen intellektuellen Inferiorität.“14 Gerade das Bewußtsein dieses Mangels, der die Übersetzung der arabischen, aristotelisch geprägten Werke motiviert, scheint für die Beant-wortung der Frage nach dem Übergang von Platon zu Aristoteles ein wichtiger Schlüssel zu sein. Zum anderen, und dies ist für die folgende Untersuchung von großer Bedeutung, ent-stehen in Toledo parallel zu den Übersetzungen auch eigenständige Werke zur Wissens- und Wissenschaftstheorie, allen voran jene des hier zu behandelnden Dominicus Gundissalinus, die deutlich an die zeitgleichen ‚französischen‘ Beiträge, aber auch und v.a. an aristotelische Konzepte der Epistemologie anschließen15 und dabei die Verwendung und das Interesse der in Toledo angefertigten Übersetzungen gleichsam in statu nascendi dokumentieren. Damit zeichnet sich in Toledo sowohl durch die Übersetzungen als auch die eigenständigen Arbei-ten in ganz besonderer Weise der komplexe – in der Auseinandersetzung mit den zeitgenös-sischen lateinisch-christlichen Debatten und der Rezeption der arabischen Quellen sich voll-ziehende – Übergang von platonischer zu aristotelischer Wissenschaftstheorie ab, der jedoch bislang für diesen Raum nicht hinreichend untersucht wurde. Diese Lücke in der gegenwärti-gen Forschung, wenn auch nicht zu schließen, so doch zu verringern und damit einen Beitrag zur Klärung der epistemologischen Grundlagen der Renaissance des 12. Jahrhunderts zu
____________________________________________________________________________________________
12 Vgl. z.B. Georg Wieland, „Platon oder Aristoteles? – Überlegungen zur Aristoteles-Rezeption des lateini-schen Mittelalters“, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (1985), S. 605-630, hier S. 609: „Sollte wirklich die Übersetzung der aristotelischen Werke aus dem Griechischen und Arabischen die eigentliche Ursache für die Neuorientierung des Denkens gewesen sein? Damit wäre doch wenig erklärt. Die bloße Zugänglichkeit von Texten erklärt nicht deren Einfluß.“ 13 Vgl. zum Liber de causis und seiner Geschichte auch Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, Von Bagdad nach Toledo – Das ‚Buch der Ursachen‘ und seine Rezeption im Mittelalter (lateinisch-deutsch), Mainz 2001. 14 Vgl. Thomas Ricklin, Die ‚Physica‘ und der ‚Liber de causis‘ im 12. Jahrhundert: Zwei Studien, Freiburg i. Üe. 1995, S. 69-70. Auch Ruedi Imbach insistiert in seinem Vorwort zu Ricklins Arbeit auf der Bedeutung der Übersetzungen für das Verständnis der Weiterentwicklung der Philosophie im 12. Jahrhundert. 15 Wie wenig gründlich die Wissens- und Wissenschaftstheorie des Gundissalinus in der Vergangenheit untersucht wurde, verdeutlicht bereits die Tatsache, daß Gundissalinus einigen als echter Aristoteliker gilt, während andere ihn zum Platoniker stempeln. Vgl. für den Aristotelismus u.a. Fernand van Steenberghen, „L’organisation des études au Moyen Âge et ses répercussions sur le mouvement philosophique“, in: Revue philosophique de Louvain 52 (1954), S. 572-592, hier S. 588; für den Platonismus siehe etwa James A. Weisheipl, „Classification of the Sciences in Medieval Thought“, in: Mediaeval Studies 27 (1965), S. 54-90, hier S. 72. Die schiere Unhaltbarkeit der Apostrophierung des Gundissalinus als Platoniker wird sich in der folgenden Untersuchung, zumindest für seine Wissens- und Wissenschaftstheorie, hinlänglich erweisen.
Einführung
12
leisten, ist das Ziel der folgenden Untersuchung zur Wissens- und Wissenschaftstheorie des Dominicus Gundissalinus und ihrem Zusammenhang mit der Aristoteles-Rezeption.
Zu Person, Werk und Bedeutung des Gundissalinus für die Fragestellung Der Archidiakon von Cuéllar Dominicus Gundissalinus (ca. 1110-1190), spanisch Domingo Gundisalvo, darf gewiß als systematisch relevantester Vertreter der ‚Schule von Toledo‘ bezeichnet werden, wo er ab ca. 1140 gewirkt hat und – so zumindest das Bild der bisherigen Forschung – nicht nur an der Übersetzungsarbeit beteiligt war, sondern auch eigenständige philosophische Arbeiten verfaßte.16
So übertrug Gundissalinus zunächst gemeinsam mit Avendauth (Ibn DÁwÙd), dessen Identität noch immer strittig ist,17 und anderen ab den 1140er Jahren an die zwanzig Werke aus dem Arabischen, die von diesen zunächst ins Spanische, vom Archidiakon daraufhin ins Lateinische übertragen wurden.18 Unter diesen Übersetzungen befinden sich so bedeutende Schriften wie al-KindÐs De intellectu; al-FÁrÁbÐs unter dem Titel De scientiis stark überar-beiteter Traktat KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm; Avicennas Schrift De convenientia et differentia subiectorum ebenso wie sein Liber de anima seu sextus de naturalibus und sein Liber de philosophia prima sive scientia divina, kurz Metaphysica, alle drei aus seiner großen, auf Aristoteles fußenden philosophischen Summe, dem KitÁb aš-šifÁÞ; Ibn Gabirols Fons vitae;
sowie die Summa theoricae philosophiae, d.h. al-ÇazzÁlÐs MaqÁÒid al-falÁsifa, u.v.m.19 Darüber hinaus ist Gundissalinus der Verfasser von fünf selbständigen Abhandlungen,
deren Chronologie noch nicht abschließend ermittelt werden konnte. Es sind dies zum einen der stark an Avicenna bzw. Aristoteles angelehnte Traktat De anima, dessen erklärtes Ziel es ist, zu sicheren Aussagen über die Seele und ihr Schicksal nicht nur aus der Perspektive des Glaubens, sondern gerade aus jener der Philosophie zu gelangen. Zweitens die thematisch hieran anschließende, vermutlich von Wilhelm von Auvergne (ca. 1180-1249) plagiierte ____________________________________________________________________________________________
16 Die wenigen Neuigkeiten über das Leben des Archidiakons beschränken sich auf Nennungen seiner Per-son in verschiedenen Urkunden, so zuletzt im Jahre 1190. Siehe Demetrio Mansilla, „La documentación pontificia del Archivo de la Catedral de Burgos“, in: Hispania Sacra 1 (1948), S. 141-163, hier S. 159-161, no. 40. – Vgl. zur mageren ‚Biographie‘ des spanischen Archidiakons auch Juan Francisco Rivera, „Nuevos datos sobre los traductores Gundisalvo y Juan Hispano“, in: Al-Andalus 31 (1966), S. 267-280. 17 Siehe zur Person Avendauths und seiner möglichen Identität mit dem bedeutenden jüdischen Gelehrten Abraham Ibn DÁwÙd die Bemerkungen weiter unten in Kapitel 3.1., wo die entsprechende Literatur angege-ben wird. 18 So zumindest der berühmte Prolog zur De anima-Übersetzung von Avendauth und Gundissalinus, in dem es heißt: „Habetis ergo librum, nobis praecipiente et singula verba vulgariter proferente, et Dominico Archi-diacono singula in latinum convertente, ex arabico translatum.“ Siehe Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1968 u. 1972, hier Bd. I, S. 4. – Allerdings dürfte Gundissalinus in späteren Jahren auch gänzlich selbständige Übersetzungen angefertigt haben. Vgl. zu dieser Frage die Ausführungen ebenfalls weiter unten Kapitel 3.1. 19 Für die Zuschreibung der z.T. in Bezug auf den Übersetzer anonym überlieferten Übersetzungen sind nach wie vor die Arbeiten von Manuel Alonso maßgeblich; vgl. insbesondere Manuel Alonso, „Traducciones del arcediano Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 12 (1947), S. 295-338. Siehe für eine vollständige, an Alon-sos Ergebnissen orientierte Auflistung der Übersetzungen des Dominicus Gundissalinus (sowohl der eigen-ständigen als auch der in Kooperation entstandenen) das entsprechende Verzeichnis in der Bibliographie am Ende dieser Arbeit.
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
13
Abhandlung De immortalitate animae, deren Zuschreibung zu Gundissalinus allerdings mittlerweile zugunsten Wilhelms bestritten wird;20 auch hier bemüht sich der Verfasser um eine philosophische Argumentation, die nicht nach äußerlichen Gründen für die Unsterb-lichkeit der Seele fragt – so die Kritik an der Tradition –, sondern nach Gründen „ex pro-priis“, womit der Verfasser zugleich einen neuen, letztlich aristotelischen Standard von Wis-senschaftlichkeit reklamiert. Drittens der lange Zeit dem Boethius zugeschriebene Kurztrak-tat De unitate, in dem Gundissalinus im Rahmen einer an Ibn Gabirol orientierten Einheits-metaphysik seine spezifische Lösung des Form-Materie-Problems entwickelt; eine Reihe von markanten Formulierungen der kurzen Schrift wurde später zu philosophischen Grund- und Lehrsätzen des Mittelalters (z.B.: „Qudiquid est, ideo est, quia unum est.“). Viertens die kosmologische Schrift De processione mundi – Gundissalinus’ Metaphysik –, die auch bibli-sche Quellen bemüht, um über eine zunächst epistemologische Untersuchung zu einer On-tologie und schließlich zu Gott als der ersten Ursache aufzusteigen.
Nicht zuletzt sei die wirkungsmächtigste Schrift des Gundissalinus genannt, die den Titel De divisione philosophiae trägt. Durch sie wurde eine Vielzahl neuer Wissenschaften in die lateinische Philosophie des Mittelalters eingeführt,21 etwa Optik (‚De aspectibus‘) und Statik (‚De ponderibus‘), aber auch die Metaphysik, die bis zu Gundissalinus dem Namen nach unbekannt war, auch wenn ihre spezifischen Fragestellungen freilich unter dem Titel der göttlichen Wissenschaft verhandelt wurden. Darüber hinaus bestimmte die Divisio mit ihrem Verständnis des Status der einzelnen Wissenschaften, der Beschreibung ihres Verhältnisses zueinander und der auf Aristoteles zurückweisenden Fundamentaleinteilung derselben in praktische und theoretische Wissenschaften das Wissenschaftsverständnis der Zeit nicht nur seinem Inhalt, sondern auch seiner Form nach neu. Dabei bilden auch hier arabisch-jüdische Quellen den Hintergrund, v.a. Avicenna, al-FÁrÁbÐ und al-ÇazzÁlÐ, die mit den maßgeblichen Quellen der eigenen Tradition zusammengebracht werden. Die Schrift wurde zur Vorlage nicht nur für Michael Scotus’ († vor 1235) gleichnamiges Werk, sondern auch für Robert Kilwardbys († 1279) De ortu scientiarum – das Standardwerk der Einteilung der Wissen-schaften im Mittelalter.22
So das Gundissalinus-Bild, das auf die Editionsarbeit seiner Werke im Rahmen der Bei-träge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie insbesondere auf die hieran anknüpfenden Forschungen Manuel Alonsos aus den 40er Jahren desselben Jahrhunderts zurückgeht. Die seither aus verschiedenen Archiven erschlossenen neuen Dokumente23 sowie weitere in den letzten Jahren aufgefundene, bislang unbekannte ____________________________________________________________________________________________
20 Vgl. Baudoin C. Allard, „Note sur le De immortalitate animae de Guillaume d’Auvergne“, in: Bulletin de philosophie médiévale 18 (1976), S. 68-72. Allerdings kann Allard die Autorschaft Wilhelms letztlich nicht nachweisen. 21 Eine gute Beschreibung der von Gundissalinus hier vorgelegten Einteilung der Wissenschaften auf der phänomenalen Ebene gibt Friedrich Dechant, Die theologische Rezeption der ‚Artes liberales‘ und die Ent-wicklung des Philosophiebegriffs in theologischen Programmschriften des Mittelalters von Alkuin bis Bona-ventura, St. Ottilien 1993, S. 140-180; im folgenden soll es jedoch nicht um diesen ordo scientiarum selbst gehen, sondern vielmehr um die dahinterstehende Wissens- und Wissenschaftstheorie. 22 Einen immer noch lesenswerten Überblick in deutscher Sprache über Gundissalinus’ philosophische Werke gibt Clemens Baeumker, „Dominicus Gundissalinus als philosophischer Schriftsteller“, in: BGPhMA XXV, 1-2, Münster 1927, S. 255-275. Siehe ferner auch zu den eigenständigen Werken des Dominicus Gun-dissalinus die am Ende der Arbeit verzeichnete Bibliographie. 23 Vgl. v.a. Francisco J. Hernández, Los Cartularios de Toledo. Catálogo documental, Madrid 1985.
Einführung
14
Handschriften24 der Werke des Gundissalinus haben allerdings eine Überprüfung dieses Bil-des erforderlich gemacht, um mehr über den Archidiakon in Erfahrung zu bringen. Zu Recht ist unlängst darauf hingewiesen worden, daß zwar die Forschungen zum Werk des Gun-dissalinus Fortschritte gemacht hätten, die Geschichte seines Lebens jedoch voller Fragezei-chen bleibe.25 In dieser Hinsicht hat Adeline Rucquoi mit ihrer jüngsten Arbeit26 zur Identität des Gundissalinus ein wichtiges Desiderat der Forschung aufgegriffen und mit großer Sorg-falt die zur Verfügung stehenden Dokumente zu Gundissalinus’ Leben zusammengetragen. Dabei kommt sie zu dem überraschenden Ergebnis, daß Gundissalinus letztlich gar nicht eine Person, sondern in Wahrheit zwei Personen gewesen sei: die eine, der Übersetzer der Werke Avicennas und anderer; die andere, der Verfasser von philosophischen Schriften, allen voran von De divisione philosophiae.
Diese Zweiteilung wird nach Rucquoi dadurch bestätigt, daß a) unser Autor unter minde-stens zwei Namen bekannt ist: einerseits ‚Dominicus Gundisalvi‘ (zuweilen auch nur ‚Domi-nicus‘), wobei der zweite Name im Genitiv steht und damit auf die Filiation hinweise, sowie andererseits ‚D. Gundisalvus‘, wobei ‚D.‘ einzig den Titel dominus bedeuten könne.27 Beide Gestalten sind als Archidiakone im Raum Toledo bekannt und werden dementsprechend auch in den Handschriften so apostrophiert. Rucquoi zufolge entsprechen dieser Unterschei-dung die Namen des Archidiakons von Cuéllar, ‚Dominicus Gundisalvi‘, sowie des Archi-diakons von Talavera, ‚Gundisalvus‘, die beide, dies ist unstrittig, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Kathedrale von Toledo angehörten. b) Darüber hinausgehend führt eine Untersuchung der incipits und explicits in den erhaltenen Manuskripten der Übersetzungen und Werke, die bislang ein und demselben Autor zugeschrieben wurden, Rucquoi zu der Behauptung, daß die Übersetzungen eindeutig mit dem Namen ‚Dominicus Gundisalvi‘ in Verbindung stünden, während die philosophischen Werke aus der Feder des ‚Gundisalvus‘ stammten. Damit wäre also der Übersetzer der Werke Avicennas und anderer ‚Dominicus Gundisalvi‘, Archidiakon von Cuéllar, wohingegen der Name des Philosophen, des Verfas-sers zahlreicher Traktate, ‚Dominus Gundisalvus‘ lauten würde – c) eine Unterscheidung, die die mittelalterlichen Autoren, die sich auf die Übersetzungen und Werke der beiden bezie-hen, wie selbstverständlich gemacht hätten.
Trotz der Suggestivität dieser Argumentation scheint die Sache sich jedoch anders zu verhalten, denn die gemachte Unterscheidung zwischen beiden Namen gilt letztlich weder ____________________________________________________________________________________________
24 Siehe z.B. Édouard-Bernard Abeloos, „Un cinquième manuscrit du Tractatus de anima de Dominique Gundissalinus“, in: Bulletin de philosophie médiévale 14 (1972), S. 72-85; Harrison Thomson, „Eine ältere und vollständigere Hs. von Gundissalinus’ De divisione scientiarum“, in: Scholastik 8 (1933), S. 240-242; sowie Lynn Thorndike, „Unnoticed Manuscripts of Gundissalinus’ De divisione philosophiae“, in: The English Historical Review 38 (1923), S. 243-244. 25 Juan Tomás Pastor García, „Domingo Gundisalvo, el arcediano segoviano“, in: M. Fartos Martínez u. L. Velázquez Campo (Hrsg.), La filosofía española en Castilla y León. De los orígenes al siglo de oro, Valla-dolid 1997, S. 39-55, hier S. 39: „Se ha avanzado mucho en el conocimiento de su obra, aunque [...] no su-cede lo mismo con su biografía, donde permanecen muchos interrogantes a pesar de que últimamente se han hecho notables aportaciones.“ 26 Siehe Adeline Rucquoi, „Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?“, in: Bulletin de philosophie médiévale 41 (1999), S. 85-106. 27 Die beiden Namensformen ‚Gundisalvi‘ / ‚Gundisalvus‘ entsprechen ‚Gundissalini‘ und ‚Gundissalinus‘, die sich im deutschsprachigen Raum für unseren Archidiakon eingebürgert haben. Obwohl die Formen ‚Gun-disalvi‘ / ‚Gundisalvus‘ den Dokumenten nach älter sind, folge ich im weiteren der Konvention.
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
15
für die Toledaner Dokumente des 12. Jahrhunderts noch für die incipits und explicits der Manuskripte und auch nicht für die mittelalterlichen Autoren nach Gundissalinus:
a) Zunächst muß ein von Alonso zitiertes Dokument von 1178 erwähnt werden, das eine der ältesten Quellen zum Leben des Gundissalinus darstellt.28 Es handelt sich um ein in arabi-scher Schrift abgefaßtes Dokument, das einen von Gundissalinus getätigten Verkauf bezeugt. In lateinische Buchstaben zurückübersetzt, besagt das Dokument wörtlich, daß der genannte Verkauf vom „arcediano don Domingo Gonzalbo“29 getätigt wurde, welcher der gängigen Meinung zufolge, der auch Rucquoi sich anschließt, kein anderer als der Archidiakon von Cuéllar ist. Das erste Dokument, das den vollständigen Namen des Gundissalinus gibt, be-zeugt ihn also als ‚Domingo Gonzalbo‘, eine Namensform, die sich wörtlich in einem Do-kument aus dem Jahre 1181 wiederfindet, das von einem weiteren von ‚Domingo Gonzalbo‘ getätigten Verkauf eines seiner Felder in Zalencas (oder Chalencas)30 handelt. Dabei ist zu beachten, daß die volkssprachliche Form ‚Gonzalbo‘ mit den lateinischen Formen ‚Gonzal-vus‘ oder ‚Gundisalvus‘ korrespondiert (während volkssprachlich ‚Gonzál[v]ez‘ lateinisch ‚Gundisalvi‘ entspricht). Nun findet sich ein weiteres Dokument aus dem Jahre 1214, in dem eine gewisse Frau Jimena der Kirche von Toledo ihr Erbteil von Zalencas übereignet, das zuvor dem Archidiakon ‚Dominicus Gundisalvi‘31 gehört habe. Zweifellos ist hier vom sel-ben Archidiakon und von derselben Besitzung die Rede, von denen das zuvor erwähnte Do-kument handelt, nur daß der Besitzer im einen Dokument ‚Domingo Gonzalbo‘ (= ‚Domini-cus Gundisalvus‘, im Nominativ), im anderen aber ‚Dominicus Gundisalvi‘, im Genitiv, heißt. Ferner findet sich bereits 1190 ein gewisser ‚Dominicus Gonsalvi‘ als Unterzeichneter in einem in Palencia ausgefertigten Dokument, das einen Rechtsstreit zwischen den Bischö-fen von Palencia und Segovia schlichtet und gerade die Kirche Santa María von Cuéllar be-trifft,32 was die Vermutung nahelegt, daß dieser ‚Dominicus Gonsalvi‘ eben unser Archidia-kon von Cuéllar ist.
Gesteht man zu, daß in diesen vier Dokumenten stets von derselben Person die Rede ist, muß auch konstatiert werden, daß bereits zu Gundissalinus’ Zeiten eine relative Unent-schlossenheit bezüglich der verschiedenen Formen seines Namens bestand. Denn derselbe Archidiakon von Cuéllar erscheint mal als ‚Dominicus Gundisalvi‘, mal als ‚Dominicus Gundisalvus‘.
b) Und auch hinsichtlich der vermeintlichen Entsprechung der Form ‚Dominicus Gundi-salvi‘ mit den Übersetzungen sowie der Form ‚Dominus Gundisalvus‘ mit den philosophi-schen Werken müssen einige Vorbehalte formuliert werden: ____________________________________________________________________________________________
28 Vgl. Manuel Alonso, „Notas sobre los traductores toledanos Domingo Gundisalvo y Juan Hispano“, in: Al-Andalus 8 (1943), S. 155-188, hier S. 158. 29 Zwar kennt das Arabische bekanntermaßen keine Vokale, doch ist es bei der Schreibung nicht-arabischer Namen üblich, diese durch Stellvertreter anzudeuten (um Mißverständnissen vorzubeugen), so daß der Aus-laut von ‚Gonzalb-‘ sich – trotz der nicht strikt determinierten Wertigkeit des hier eingesetzten Stellvertreters – als ‚o‘ und die Namensform damit als ‚Gonzalbo‘ identifizieren läßt, zumal der Stellvertreter im Auslaut von ‚Gonzalb-‘ mit jenem im Auslaut von ‚Doming-‘ identisch ist. 30 Vgl. Manuel Alonso, „Notas sobre los traductores toledanos Domingo Gundisalvo y Juan Hispano“, art. cit., S. 161-162. 31 Es handelt sich um das Dokument no. 348, zusammengefaßt und teilweise ediert von Francisco J. Her-nández, op. cit., S. 313. 32 Siehe Demetrio Mansilla, art. cit., hier no. 40, S. 159-162.
Einführung
16
• Nach Ludwig Baur, dem Herausgeber von De divisione philosophiae, endet das Manuskript Oxford, Corpus Christi College 86, fol. 217vb, folgendermaßen: „Explicit hoc opus a Domin’o Gundisalino.“33 Aber ‚Domin’o‘ ist zwangsläufig ‚Dominico‘ (auf keinen Fall kann es für ‚Domino‘ stehen), so daß der Philosoph ‚Dominicus Gun-disalinus‘ (= ‚Dominicus Gundisalvus‘) heißen würde. Nach Rucquoi wäre jedoch der Verfasser des De divisione ‚Dominus Gundisalvus‘, ‚Dominicus‘ hingegen der Über-setzer.
• Rucquoi selbst zitiert auf der S. 92 ihres Artikels folgendes incipit des De divi-sione philosophiae aus dem Manuskript London, British Museum, Sloane 2946, fol. 216: „Explicit hoc opus a domino Gundissalini apud Tholetum editum.“ Doch wenn der Philosoph tatsächlich ‚Gundissalinus‘ oder ‚Gundisalvus‘ hieße, wie Rucquoi be-hauptet, wieso heißt es dann hier ‚Gundissalini‘ im invariablen Genitiv und nicht ‚Gundissalino‘? Der invariable Genitiv ist ein klares Zeichen dafür, daß unser Autor auch als ‚Gundisalvi‘ bekannt war.
Dasselbe gilt für das Manuskript von De divisione philosophiae aus Oxford, Bodleian Li-brary, ms. Bodl. 679 (2. Hälfte des 13. Jh.). Ursprünglich fand sich im Text keine Zuschrei-bung, doch Clemens von Canterbury fügte ihm um 1475-1500 hinzu:34 „Hic incipit Gun-dessalvi de divisione philosophie (fol. 1r) [...] Explicit liber de divisione philosophie. editus a domino gundissalvi apud tholetum (fol. 19r).“ Es läßt sich hier dieselbe Inkongruenz beobachten, die, wie erwähnt, dafür spricht, daß auch der Philosoph und nicht nur der Über-setzer in den Handschriften als ‚Gundisalvi‘ bekannt war. Hinzu kommt, daß Clemens in dem Index, den er dem Band voranstellt, folgendes schreibt: „Gundessalvus de divisione philosophie folio primo (fol. ii).“ Während Clemens also im vorangegangenen Zitat unseren Autor ‚Gundisalvi‘ nannte, heißt ihm dieser nun ‚Gundisalvus‘, womit vollends deutlich wird, daß er beide Formen für austauschbar hielt.
Es ist folglich offenkundig, daß auch der Philosoph in den Handschriften ‚Dominicus‘ (und nicht nur ‚Dominus‘) genannt wird, während er (und nicht bloß der Übersetzer) in die-sen zugleich ‚Gundisalvi‘ heißt. Nimmt man beides zusammen, so ergibt dies einen Philo-sophen namens ‚Dominicus Gundisalvi‘, was nach Rucquoi jedoch gerade der Name des Übersetzers wäre. Damit ist zumindest erwiesen, daß es in der handschriftlichen Tradition keine so eindeutige Zuschreibung der Übersetzungen und Werke zu ‚Dominicus Gundisalvi‘ einerseits und ‚Dominus Gundisalvus‘ andererseits gibt, wie Rucquoi behauptet. Im Gegen-teil, entweder finden sich Mischformen beider Namen oder aber die Schreiber benutzen, wie im Falle des Clemens, beide Namen unterschiedslos. Dabei sitzen sie nicht etwa einem Miß-verständnis auf, vielmehr gilt, daß, wie bereits für die Toledaner Dokumente gezeigt wurde, offenbar kein Unterschied zwischen den beiden Namen bestand, und zwar weder in Toledo noch in der späteren handschriftlichen Tradition. Auch die incipits und explicits können da-
____________________________________________________________________________________________
33 Siehe Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. Ludwig Baur, in: BGPhMA IV, 2-3, Münster 1903, S. 161. 34 Die Informationen zu diesem Manuskript, das für die Edition von Baur nicht kollationiert wurde, verdanke ich Bruce Barker-Benfield von der Bodleian Library (Oxford).
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
17
mit nicht als Beweis für die Unterscheidung zweier ‚Gundissalini‘ in Anschlag gebracht werden.
c) Der Fall des Clemens von Canterbury führt direkt zum nächsten Punkt: Stimmt es tat-sächlich, daß die mittelalterlichen Autoren sauber zwischen ‚Dominicus Gundisalvi‘ und ‚Dominus Gundisalvus‘ unterschieden, zwischen dem Übersetzer und dem Philosophen also? Auch dies ist nicht zutreffend, wie man an der Zuschreibung der gundissalinischen Überset-zung des Werkes De coelo et mundo durch Vinzenz von Beauvais an ‚Gundissalinus‘ (und nicht ‚Gundissalini‘!) in seinem Speculum naturale erkennen kann – ein Werk, das Rucquoi selbst auf S. 90 ihres Artikels erwähnt, obwohl sie dieses hier ohne weitere Erklärung als ‚Traktat‘ und nicht als Übersetzung klassifiziert. Im gleichen Sinne setzt sie auch in ihrer Übertragung eines Satzes von Nicolás Antonio aus dem 17. Jahrhundert, in dem dieser von der ‚Gundisalvus‘ zugeschriebenen Übersetzung des Werkes De coelo et mundo („libros de Coelo et mundo ex arabico in latinum transtulisse“) handelt, das Wort ‚traduction‘ in Anfüh-rungszeichen. Für diese Relativierung der Aussagen des Vinzenz von Beauvais und des Ni-colás Antonio seitens der Autorin ist kein Grund erkennbar, außer daß Rucquoi, um die Kon-sistenz ihrer Zuschreibungen zu wahren, hierin lieber ein eigenes Werk des Gundissalinus sehen möchte als eine Übersetzung. Vielleicht identifiziert Rucquoi die Schrift De coelo et mundo mit De processione mundi, d.h. mit einem philosophischen Werk des Gundissalinus, das in mindestens zwei Handschriften einen ähnlichen Titel trägt.35 Gleichwohl ist offenkun-dig, daß die beiden Gelehrten sich auf den Avicenna zugeschriebenen Traktat De coelo et mundo beziehen, der in Wahrheit eine Übersetzung eines Werkes von Íunain Ibn IsÎÁq (ca. 809-873) durch Gundissalinus ist, wie Alonso gezeigt hat.36 Zu Zeiten des Vinzenz von Beauvais und des Nicolás Antonio rangierten die Übersetzungen also gemeinsam mit den philosophischen Werken unter einem Namen, gleichviel ob dieser nun ‚Gundisalvi‘ oder ‚Gundisalvus‘ lautete.
Damit ist auf drei der entscheidenden Schritte in Rucquois Argumentation geantwortet worden: Sowohl im Toledaner Milieu selbst als auch in der handschriftlichen Tradition und bei den mittelalterlichen Autoren gibt es keine Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, ‚Gundisalvi‘ und ‚Gundisalvus‘ zu zwei Personen zu erklären. Zwar ist damit noch nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, daß tatsächlich mehrere Autoren unter dem Namen ‚Gundi-salvi/Gundisalvus‘ firmieren, und erst recht ist nicht positiv gezeigt worden, daß, im Gegen-teil, die vermeintlich zu unterscheidenden Autoren ein und dieselbe Person waren. Um diese Identität positiv nachzuweisen, lassen sich allein die frappierenden textuellen und inhaltli-chen Parallelen zwischen den Übersetzungen und den philosophischen Werken in Anschlag bringen, die in der folgenden Untersuchung deutlich werden mögen. Hier galt es zunächst nur zu zeigen, daß das neu erschlossene und von Rucquoi sorgfältig versammelte historische Material nicht zwingend die Annahme zweier ‚Gundissalini‘ erfordert. Vielmehr gilt es, getreu des weisen Grundsatzes des entia non sunt multiplicanda sine necessitate die von
____________________________________________________________________________________________
35 Gleichwohl lautet dieser Titel, der sich im incipit des Manuskripts Laon, n. 412, fol. 16r, sowie des Manu-skripts Cambridge, Gonville and Caius 504, fol. 169v, findet, De creatione coeli et mundi und nicht bloß De coelo et mundo. 36 Vgl. Manuel Alonso, „Íunayn traducido al latín por Ibn DÁwÙd y Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 16 (1951), S. 37-47, sowie neuerdings Oliver Gutman, „On the Fringes of the Corpus aristotelicum: The Pseudo-Avicenna Liber celi et mundi“, in: Early Science and Medicine 2 (1997), S. 109-128.
Einführung
18
Rucquoi entwickelte Hypothese zweier ‚Gundissalini‘ bis auf weiteres zugunsten des zuvor beschriebenen herkömmlichen Gundissalinus-Bildes zurückzustellen.
Gegenüber Gerhard von Cremona und anderen Autoren stellt Dominicus Gundissalinus damit in gewisser Weise einen ‚Glücksfall‘ dar, insofern als er nicht nur Übersetzer ist, wie der Cremonese, sondern zugleich der Verfasser der genannten Traktate.37 Denn mehr noch als aus den Übersetzungen wird sich aus diesen Traktaten, die viele Elemente der von Gun-dissalinus übersetzten Werke produktiv integrieren, das von Ricklin weiter oben angeführte Bewußtsein eines Mangels herausschälen lassen. Was sich aus den Übersetzungen nur an-deutungsweise und indirekt als Tendenz ergibt, wird hier in den Schwerpunktsetzungen und Formulierungen des Autors selbst unmittelbar greifbar.
Entsprechend gilt es in dieser Untersuchung, die fünf eigenen Werke des Gundissalinus unter dieser Rücksicht zu analysieren. Um das den Übersetzer und v.a. den Philosophen Gundissalinus leitende Interesse ausfindig zu machen, scheint es dabei von größter Wichtig-keit, die Rezeption der lateinisch-christlichen Tradition in Gundissalinus’ selbständigen Werken zu betrachten. Denn die Rezeption arabischer und aristotelischer Schriften selbst geschieht nicht im luftleeren Raum, vielmehr werden diese Texte aus bestimmten Problem-lagen heraus rezipiert. Das von Ricklin in Anschlag gebrachte ‚Bewußtsein eines Mangels‘ bzw. das ‚Eingeständnis der eigenen intellektuellen Inferiorität‘ kann ja nur dort entstehen, wo die Lösungen der eigenen Tradition bewußt an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ge-führt werden. In den immanenten Schwierigkeiten und Fragestellungen der eigenen Tradi-tion, so daher eine der Kernthesen des ersten Teils dieser Arbeit, wird die Antwort auf Se-lektion und Umgang mit den übersetzten Texten zu suchen sein und damit ein wichtiger Hinweis auf die Gründe für den Übergang von einem Wissenschaftskonzept zum anderen. Das Hauptaugenmerk bei der Untersuchung der Werke des Gundissalinus lag jedoch bislang auf einer nicht selten einseitigen Rekonstruktion der durch ihn geleisteten Aufnahme der arabisch-jüdischen Philosophie, die in seine Werke eingegangen ist. Überhaupt scheint Gun-dissalinus auf mehr Zuspruch von Seiten der Arabistik als von Seiten der Erforschung der Philosophie des lateinischen Mittelalters gestoßen zu sein.38 So sind zwar die Quellen der lateinisch-christlichen Tradition ebenso wie die Bibelstellen, auf die Gundissalinus zurück-greift, durch die einzelnen Nachweise in den entsprechenden kritischen Editionen zu einem Großteil bekannt, es fehlen jedoch nähere Untersuchungen zu Gundissalinus’ genauerem Umgang mit diesen Quellen. Dabei ist es einerseits verständlich, daß sich die Forschung zunächst auf das ‚Neue‘ an Gundissalinus stürzte, namentlich die Aufnahme arabisch-jüdi-scher Motive in sein Denken – und es ist unbestritten, daß genau dies sein philosophiege-schichtliches Verdienst ist. Doch ist damit der zweite Schritt vor dem ersten getan: Will man
____________________________________________________________________________________________
37 Der historisch gewiß bedeutsame Unterschied, ob es sich bei Übersetzer und Autor um dieselbe Person handelt oder nicht, ist für die systematische Zielsetzung dieser Arbeit allerdings letztlich nicht ausschlagge-bend. Entscheidend ist vielmehr, daß in jedem Falle, wie Adeline Rucquoi in ihrem Artikel selbst bemerkt, der Autor die Übersetzungen der vermeintlich anderen Gestalt bestens kannte, womit Übersetzung und ei-genständige Rezeption hier Hand in Hand gehen. Ob dies historisch gleichsam in Personalunion geschieht oder nicht, ist dabei zunächst zweitrangig. 38 Ein Blick auf die im Anhang angeführte Forschungsbibliographie wird dies bestätigen. Die umfassendsten Studien zu Gundissalinus haben der Arabist Manuel Alonso und die ebenfalls aus der Arabistik stammende Marie-Thérèse d’Alverny vorgelegt. Dabei stehen fast ausnahmslos die arabisch-jüdischen Quellen des Gun-dissalinus im Vordergrund.
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
19
nämlich diese Aufnahme der arabischen Wissens- und Wissenschaftstheorie und in ihrem Gefolge der aristotelischen Philosophie adäquat verstehen, so wird man zunächst danach fragen müssen, wie sich diese Integration des ‚Fremden‘ ins ‚Eigene‘ im einzelnen vollzog. Sicherlich ist es dafür wesentlich, die Rezeption arabischer Quellen bei Gundissalinus im engeren Sinne zu untersuchen, mindestens genauso wesentlich in diesem Zusammenhang ist es aber, zu klären, wie die lateinisch-christliche Tradition bei Gundissalinus rezipiert wurde, um überhaupt erst zu verstehen, auf welche Herausforderungen seine Aufnahme der arabi-schen sowie, in einem weiteren Schritt dann, der aristotelischen Philosophie selbst reagiert, d.h. also nach den Voraussetzungen für das ‚Neue‘ im ‚Eigenen‘ zu fragen ebenso wie auch nach den Wechselwirkungen zwischen beiden. Zum Aufbau der Untersuchung Entsprechend der vorangehenden Überlegungen ist der erste Teil der vorliegenden Ar-beit (2.) der Rezeption lateinisch-christlicher Autoren bzw. Texte im Lichte der arabischen Philosophie sowie den so gewonnenen wissens- und wissenschaftstheoretischen Ausgangs-voraussetzungen bei Gundissalinus gewidmet. Dabei gilt es zu zeigen, wie diese Ausgangs-punkte von Gundissalinus entwickelt und in z.T. erstaunlicher Nähe zu den zeitgleichen Entwicklungen in Chartres und Paris an den Rand ihrer Erklärungsmöglichkeiten gebracht werden. Anders als für die ‚französischen‘ Autoren ist es für Gundissalinus jedoch möglich, dort wo die lateinisch-christlichen Texte systematisch gleichsam ausgereizt sind und teil-weise in theoretische Sackgassen zu führen scheinen, über diese hinauszugehen, und zwar mit den ihm zur Verfügung stehenden aristotelisierenden arabischen Autoren, wie al-FÁrÁbÐ, al-ÇazzÁlÐ und Avicenna. Dazu soll in diesem ersten Teil zunächst (2.1.) auf der Grundlage von Gundissalinus’ Bibel-Rezeption seine Verhältnisbestimmung von Theologie und Philo-sophie in den Blick genommen werden, die den Raum für seine Wissens- und Wissen-schaftstheorie und die Rezeption nicht-christlicher Elemente überhaupt erst eröffnet. Vor diesem Hintergrund soll daraufhin (2.2.) der Versuch unternommen werden, zu zeigen, wie allen voran die boethianische Epistemologie von Gundissalinus übernommen, bis an ihre Grenzen entfaltet und sodann mit Hilfe der aristotelisierenden arabischen Autoren weiterge-dacht wird. Im Mittelpunkt stehen dabei – nach einer Vorbemerkung (2.2.1.) – die klassi-schen, auch von den Chartreser Autoren diskutierten Fragen der Differenzierung der Wis-senschaften erstens nach Gegenständen (2.2.2.) und zweitens nach Methoden (2.2.3.) sowie drittens die Axiomatik der Wissenschaften (2.2.4.) und viertens die Frage nach der Subordi-nation und Binnendifferenzierung derselben (2.2.5.). Alle vier Komplexe werden bei Gun-dissalinus intensiv bearbeitet und im Lichte seiner aristotelisierenden arabischen Quellen über die Chartreser Diskussionen hinaus weitergedacht. Abgerundet wird dieser Teil durch eine Untersuchung (2.3.) der Einflüsse Isidors von Sevilla auf Gundissalinus, mit der gezeigt wird, wie nicht nur arabische Quellen zum weiterführenden Interpretationsparadigma für lateinisch-christliche Gedanken werden. Vielmehr wird umgekehrt auch die arabische Philo-sophie, hier die arabische Enzyklopädie mit ihrem reichhaltigen einzelwissenschaftlichen Material, im Lichte der eigenen lateinisch-christlichen Tradition interpretiert. Dieser erste Teil der Arbeit erfüllt seinen Zweck genau dann, wenn es ihm gelingt, aufzuzeigen (2.4.), welche Interessen, immanenten Anknüpfungspunkte und Schwierigkeiten die eigene Tradi-
Einführung
20
tion für Dominicus Gundissalinus bot, an die er sodann die ‚fremde‘, d.h. arabische Philoso-phie gleichsam als Antwort anschließen konnte und vice versa. Diese Schnittstellenanalyse zwischen eigener und fremder Tradition, die sich gleichermaßen auf die eigenständigen Werke des Gundissalinus und seine Übersetzungen stützt, versteht sich als Beitrag zur Klä-rung der lateinisch-christlichen Voraussetzungen und ihrer arabischen Interpretamente für die Aristoteles-Rezeption des 12. Jahrhunderts. Denn wie sich zeigen wird, entfaltet Gun-dissalinus auf der Grundlage der lateinisch-christlichen Philosophie und ihrer Weiterent-wicklung durch arabisches Gedankengut eine Wissens- und Wissenschaftstheorie, die bereits die wesentlichen Themen der genuin aristotelischen Epistemologie bedenkt und damit zu-gleich den Hintergrund seiner Rezeption des Aristoteles selbst bildet.
Letztere, d.h. die wissens- und wissenschaftstheoretische Rezeption des Aristoteles selbst, ist Gegenstand des zweiten Teils (3.) dieser Arbeit. Dabei stellen sich ähnliche Pro-bleme wie für den ersten Teil. Wenn nämlich weiter oben darauf hingewiesen wurde, daß die bisherige Forschung zu Gundissalinus v.a. auf seinen Umgang mit arabischen Autoren bezo-gen war, so ist dies im strengen Sinne zu verstehen. Denn es fehlten bislang nicht nur Unter-suchungen zu den lateinisch-christlichen Quellen seiner Wissens- und Wissenschaftstheorie, ebenso wurde auch eine genauere Betrachtung seiner Kenntnisse des Aristoteles vernachläs-sigt. Zwar ist immer wieder auf den aristotelischen Einfluß auf Gundissalinus durch die ara-bischen Autoren hingewiesen worden – und dies zu Recht –, doch sind die bedeutenden Zi-tate, die Gundissalinus direkt Aristoteles zuschreibt und die sich nicht ohne weiteres aus seinen arabisch-jüdischen Bezugsautoren herleiten lassen, bislang nicht näher analysiert worden. Ja es herrscht nicht nur Unklarheit darüber, ob Gundissalinus direkten Zugang zu aristotelischen Originaltexten besaß, sondern auch im affirmativen Fall stehen sich die bis-lang nicht überprüften und meist auch nur am Rande aufgestellten Behauptungen unvermit-telt gegenüber, Gundissalinus habe entweder aus dem Aristoteles graeco-latinus oder aus dem Aristoteles arabus geschöpft. Die Beantwortung dieser eher philologischen, aber sowohl historisch als auch systematisch höchst relevanten Frage, kann in diesem zweiten Teil nur ansatzweise erfolgen. Was hingegen ausführlich gezeigt werden soll, ist die Tatsache, daß Gundissalinus mit den einschlägigen wissens- und wissenschaftstheoretischen Aussagen des Stagiriten durchaus vertraut war und somit als eine der frühesten Rezeptionsgestalten genuin aristotelischer Epistemologie gelten kann. Dabei ist es das Ziel dieses zweiten Teils, darzu-tun, wie sich diese Rezeption des Aristoteles strikt auf der Grundlage der Auseinanderset-zung mit Boethius’ Epistemologie und seiner arabisch vermittelten Fortentwicklung aus dem ersten Teil der Arbeit vollzieht. Streng parallel zu diesem ersten Teil läßt sich so – nach einer Skizze des Problemstandes (3.1.) – eine Aufnahme explizit aristotelischer Theoreme zur Einteilung der Wissenschaften nach Gegenständen (3.2.) und Methoden (3.3.), zur Frage ihres axiomatischen Aufbaus (3.4.) sowie zu ihrer Subordination und Binnendifferenzie-rung (3.5.) beobachten. Zu diesen vier Abschnitten tritt schließlich ein weiterer Abschnitt zur Rezeption der aristotelischen Einteilung der praktischen Philosophie (3.6.) hinzu. Der zweite Teil der Arbeit dokumentiert damit, wie die lateinisch-christlichen und arabischen Voraus-setzungen im Werk des Archidiakons letztlich in eine auch explizite Aristoteles-Rezeption münden, wobei zugleich deren Konsequenzen in ihrer Tragweite beleuchtet werden sollen. So zeichnet sich bei Gundissalinus die Gestalt eines neuen, primär an erkenntnis- und wis-senschaftstheoretischen Fragen interessierten und seinem Selbstverständnis nach von der Theologie emanzipierten Konzepts von Philosophie im originär aristotelischen Sinne ab.
Stellung und Bedeutung des Gundissalinus
21
Auf der Grundlage der gewonnenen Einsichten in die Voraussetzungen und Konsequen-zen der Aristoteles-Rezeption bei Dominicus Gundissalinus wird daraufhin (4.) versucht, diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungen des 12. und 13. Jahr-hunderts für ein besseres Verständnis jenes Prozesses, den man die intellektuelle Revolution des 12. Jahrhunderts genannt hat, sowie seiner Konsequenzen fruchtbar zu machen.
2. Lateinisch-christliche und arabische Tradition als Voraussetzungen der wissens- und wissenschaftstheoretischen Aristoteles-Rezeption bei Gundissalinus
2.1. Gundissalinus und die Heilige Schrift: Christliche versus weltliche Wissenschaft?
Die lateinisch-christliche Quelle des Gundissalinus par excellence ist gewiß die Heilige Schrift. Denn anders als man annehmen könnte, verwies die ‚Entdeckung‘ der arabischen Philosophie und Wissenschaft in Toledo das Studium der Bibel nicht etwa in den Hinter-grund: Mit Ausnahme der Schrift De immortalitate animae zeigt der Archidiakon in allen seinen Werken ein reges Interesse sowohl für das Alte als auch für das Neue Testament, die wiederholt, teils wörtlich, teils sinngemäß, zitiert werden.
Gleichwohl darf diese scheinbar harmonische Koexistenz arabischer und biblischer Texte im Werk des Gundissalinus nicht täuschen: Bekanntlich stellt die Rezeption der arabischen Philosophie die doctrina christiana – verstanden als Bibelstudium – vor eine große Heraus-forderung, indem sie letzten Endes den Status derselben als Wissenschaft in Frage stellt.1 Die Lösungsvorschläge hierzu von späteren Autoren, etwa Thomas von Aquin, sind geläufig;2 doch bereits bei Gundissalinus finden sich Bemühungen – wenn auch gewiß bescheidenerer Art –, das Verhältnis zwischen biblischem und philosophischem Wissen zu bestimmen. Tat-sächlich wird die erwähnte Harmonie zwischen beiden Wissensbereichen im Werk des Gun-dissalinus erst als Ergebnis einer Reflexion über die Geltungsansprüche beider Wissens-quellen möglich, die es ihm zugleich erlaubt, die arabische Philosophie in einen christlichen Kontext zu integrieren. Die Rezeption der Bibel bei Gundissalinus und die Reflexion über ihre Geltungsansprüche ist damit unvermeidlich auch eine Voraussetzung für die Rezeption der nicht-christlichen Philosophie. In diesem Kapitel soll es daher nach einigen Bemerkun-gen zu dem von Gundissalinus benutzten Bibeltext jeweils um den argumentativen Wert der Heiligen Schrift und ihren Status gegenüber der arabischen falsafa innerhalb seiner erklär-termaßen philosophischen Werke gehen.
Gundissalinus’ Bibel
Nur wenig ist zur Rolle der Bibel zur Zeit der Reconquista Toledos bekannt, wenn man von den Einzeluntersuchungen zur Reform der spanischen Liturgie oder jenen zur Entwicklung der westgotischen Schrift absieht, für die Toledo ein notorisch bedeutsamer Referenzpunkt
____________________________________________________________________________________________
1 Siehe hierzu die eingangs erwähnte Studie von Georg Wieland, „Platon oder Aristoteles? – Überlegungen zur Aristoteles-Rezeption des lateinischen Mittelalters“, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (1985), S. 605-630. 2 Vgl. etwa Thomas’ überzeugende Diskussion zum Verhältnis von Theologie und Metaphysik in seiner Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden 1955, q. V, art. 4, resp., S. 192-195.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
24
ist.3 Um so mehr ist es zu danken, daß Klaus Reinhardt in einem kurzen, aber kenntnisrei-chen Artikel einiges Licht in die Angelegenheit gebracht hat, indem er das Fortleben der Bibelstudien unter den Toledaner Mozarabern des 12. Jahrhunderts untersucht.4 Reinhardt weist dabei zunächst auf die Bedeutung der biblischen Codices aus Toledo hin: die soge-nannte Biblia Hispalense aus dem 10. Jahrhundert, die den vollständigen Text der Heiligen Schrift enthält und gegenwärtig in der Biblioteca Nacional in Madrid mit der Signatur Vitr. 13-1 verwahrt wird, sowie den Codex Biblioteca Capitular de Toledo, 2-2, aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, der nur die alttestamentlichen Bücher Joshua bis zum Psalter enthält und ursprünglich Teil einer fünf- oder sechsbändigen Bibel gewesen sein muß.5 Obwohl nun diese Codices aus dem 10. oder 11. Jahrhundert datieren, muß man die arabischen Rand-glossen in ihnen, so Reinhardt, einer Hand des 12. Jahrhunderts zuschreiben, womit die ge-nannten Codices die Kontinuität der Bibelstudien in Toledo sowohl für die Zeit vor als auch nach der Reconquista dokumentieren.
Gleichwohl scheint dies nicht die Linie zu sein, in der Gundissalinus zu verorten ist, da ein genauerer Blick auf den von ihm zitierten Bibeltext deutlich macht, daß seine Bibel nicht die westgotische Bibel der Mozaraber ist, die u.a. durch die beiden genannten Codices ver-treten wird. Die Bibelstudien des Gundissalinus speisen sich folglich aus einer anderen Quelle als jene seiner mozarabischen Mitbürger. Dies läßt sich v.a. an den Zitaten aus dem Psalter erkennen; zu Beginn von De divisione philosophiae etwa zitiert Gundissalinus Psalm 13, 1: „corrupti sunt et abominabiles facti sunt in studiis suis [...]“,6 wofür das Psalterium visigothicum-mozarabicum gibt: „corrupti sunt et abominabiles facti sunt studiose [...]“.7 Ähnliches gilt für die Psalme aus Gundissalinus’ Tractatus de anima: Während er Psalm 16, 15 zitiert als: „satiabor cum apparuerit gloria tua“,8 heißt es im Psalterium visigothicum-mozarabicum: „satiabor dum manifestabitur gloria tua“. Und Psalm 33, 9, der im Psalterium visigothicum-mozarabicum lautet: „Gustate et videte quam suavis est dominus“, erscheint bei Gundissalinus in der Form: „Gustate et videte quoniam suavis est dominus.“9 All diese geringfügigen textuellen Abweichungen besäßen nicht die geringste Bedeutung, wenn sie nicht wortwörtlich die charakteristischen Lesarten des sogenannten Gallikanischen Psalters
____________________________________________________________________________________________
3 Vgl. zu diesen zwei Aspekten jeweils Juan Francisco Rivera, La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), 2 Bde., Toledo 1966 u. 1976, v.a. Bd. II, S. 313-326, sowie Anscari M. Mundó, „La datación de los códices litúrgicos visigóticos toledanos“, in: Hispania Sacra 13 (1965), S. 1-25. 4 Klaus Reinhardt, „Bible et culture à l’époque de la reconquête de Tolède“, in: Jacques Huré (Hrsg.), Tolède (1085-1985). Des traductions médiévales au mythe littéraire, Paris 1985, S. 135-145. 5 Siehe für eine detaillierte Beschreibung dieser Codices Teófilo Ayuso Marazuela, La Vetus latina hispana, Bd. I, Madrid 1953, S. 352 u. S. 357, sowie Agustín Millares Carlo, „Manuscritos visigóticos. Notas biblio-gráficas“, in: Hispania Sacra 14 (1961), S. 337-444, hier S. 340 u. S. 373-374. Die jüngste katalographische Erfassung findet sich in Klaus Reinhardt u. Ramón Gonzálvez, Catálogo de los códices bíblicos de la Cate-dral de Toledo, Madrid 1990, S. 81-84 u. S. 395-398. 6 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 4. 7 Dieser und die folgenden Psalme werden zitiert nach der Biblia polyglotta matritensia. Series VII. Vetus latina. L. 21. Psalterium visigothicum-mozarabicum, editio critica curante Mons. Dr. Theophilo Ayuso Mara-zuela, Matriti 1957. – Meine Hervorhebungen. 8 Dominicus Gundissalinus, Tractatus de anima, ed. Joseph Thomas Muckle, in: Mediaeval Studies 2 (1940), S. 23-103, hier S. 100. 9 Ibid.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
25
reproduzieren würden, also jenes offiziellen Psalters, der sich bis heute zusammen mit der Übersetzung aus dem Hebräischen durch Hieronymos in der Vulgata wiederfindet.10
Der Einfluß des Gallikanischen Psalters auf Gundissalinus ist leicht zu erklären: Be-kanntermaßen erreichten die Auseinandersetzungen um den mozarabischen Ritus und die westgotische Tradition im allgemeinen ihren Höhepunkt unter Gregor VII. kurz vor der Re-conquista Toledos.11 Und so war es nicht ohne Grund, daß der erste Erzbischof der neuen Metropolis ein ‚Franzose‘ aus Cluny wurde, Bernhard von Sauvetat,12 womit der römische Ritus auf der Iberischen Halbinsel eingeführt und gefestigt werden sollte.13 Von diesem Augenblick an sollte der ‚französische‘ Einfluß auf die Kirche von Toledo für Jahre bestim-mend bleiben, stammten doch fast alle Nachfolger Bernhards aus der Francia. Urteilt man nach Gundissalinus’ Bibeltext (dem Gallikanischen Psalter), so scheint es, daß Gundissalinus in diesem Konflikt für die ‚innovativen‘ und ‚modernen‘ Kräfte Partei ergriff, die sich an der ‚französischen‘ Bibel und damit auch an den Bibelstudien der Francia orientierten, die ge-rade im 12. Jahrhundert ihr floruit erlebten.14
Die Unterscheidung von Heiliger Schrift und Philosophie: De divisione philosophiae Es ist ohne Zweifel der Prolog zu De divisione philosophiae – seiner einflußreichsten Schrift, die von der Organisation der Wissenschaften handelt – jene Stelle in seinem Opus, an der Gundissalinus mit größter Klarheit und Systematizität das Problem des Verhältnisses von Heiliger Schrift und Philosophie aufgreift, indem er die fundamentale Unterscheidung von menschlicher und göttlicher Wissenschaft vornimmt.15 Erstere definiert er folgendermaßen:
____________________________________________________________________________________________
10 Vgl. zur Geschichte der verschiedenen Psalter die Edition von Robert Weber, Le Psautier Romain et les autres anciens Psautiers latins, Rom 1953, v.a. die Einführung S. VIII-XXIII. 11 Siehe zu diesem Konflikt u.a. José Orlandis, Estudios de historia eclesiástica visigoda, Pamplona 1998, bes. S. 218-263. 12 Diese große Gestalt ist mit viel Sorgfalt porträtiert worden von Juan Francisco Rivera, El arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-1124), Rom 1962, auch in: id., La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), op. cit., Bd. I, S. 127-196. 13 Von Bedeutung sind in dieser Hinsicht auch die Überlegungen zum Erzbischof von Ramón Gonzálvez, Hombres y Libros de Toledo (1086-1300), Madrid 1997, S. 77-84, wo sein Bemühen hervorgehoben wird, die Toledaner Kanoniker mit Büchern aus der Francia zu versorgen. Gonzálvez geht davon aus, daß Bernhard einen umfangreichen Plan zum Abschreiben von Büchern für seine Kirche im Sinn hatte (S. 81), zu dem möglicherweise auch die Abschrift des Gallikanischen Psalters gehörte. 14 Für eine Überblicksdarstellung der Bibelstudien im Raum des heutigen Frankreich zur Zeit des Gundissalinus vgl. Jean Châtillon, „La Bible dans les écoles du XIIe siècle“, in: Pierre Riché u. Guy Lobri-chon (Hrsg.), Le Moyen Âge et la Bible, Paris 1984, S. 163-197. – Auf die gegenseitige Abhängigkeit von einigen ‚französischen‘ Theologen und Philosophen und von Gundissalinus hat bereits Richard McKeon, „Rhetoric in the Middle Ages“, in: Speculum 17 (1942), S. 1-32, hier S. 17, hingewiesen, ebenso Nikolaus M. Häring, „Thierry of Chartres and Dominicus Gundissalinus“, in: Mediaeval Studies 26 (1964), S. 271-286. 15 Dieselbe Unterscheidung findet sich wörtlich auch zu Beginn des De ortu scientiarum von Robert Kil-wardby, der als der einflußreichste Divulgator des Gundissalinus gelten kann, welcher so bis zu Thomas von Aquin gelangte. Siehe Robert Kilwardby, De ortu scientiarum, ed. Albert G. Judy, Toronto 1976, S. 9.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
26
Humana vero scientia apellatur, quae humanis rationibus adinventa esse probatur, ut om-nes artes quae liberales dicuntur.16
Die menschliche Wissenschaft – und nur diese ist Gegenstand seiner folgenden Ausführun-gen – ist somit dadurch bestimmt, daß sie das Resultat rationaler Begriffsarbeit („rationes“) ist. Die göttliche Wissenschaft dagegen wird folgendermaßen definiert:
Divina scientia dicitur, quae deo auctore hominibus tradita esse cognoscitur, ut vetus testamentum et novum. Unde in veteri testamento ubique legitur: ‚locutus est dominus‘, et in novo: ‚dixit Iesus discipulis suis‘.17
Aus dem hier Gesagten geht hervor, daß der Gegenstand der göttlichen Wissenschaft im geoffenbarten Wort besteht und ihre Aufgabe somit sein Studium ist, d.h. das Studium des Alten und Neuen Testaments, und der in ihnen enthaltenen Geheimnisse des christlichen Glaubens, wie der Trinität und der Inkarnation. Von dieser Fundamentaleinteilung wird in den verbleibenden Kapiteln des Werkes keine Rede mehr sein.
Gleichwohl wird die mit ihr vorgenommene Unterscheidung späterhin innerhalb der Darlegung der philosophischen Wissenschaften selbst erneut thematisch, denn auch hier kommt der Archidiakon auf die göttliche Wissenschaft zu sprechen, doch nicht mehr in dem vorgenannten Sinne; vielmehr versteht er nunmehr den Begriff als Synonym für „prima phi-losophia“ und „metaphysica“.18 Mit dem Traktat De divisione philosophiae ist der Ursprung der Metaphysik als Bezeichnung einer Wissenschaft gegeben, denn als solche findet sie sich weder in der griechischen Tradition, wo meta. ta. fusika, (hinter der Physik) lediglich einen Ort angibt, noch in der arabischen falsafa, welche den griechischen Begriff als mÁ baÝd aÔ-ÔabÐÝa (was nach der Physik ist) à la lettre übernimmt. Es ist das (unbewußte) Verdienst des Archidiakons, diesen Begriff so ins Lateinische übersetzt zu haben, daß er zu einem weibli-chen Substantiv wird, womit er sich den Bezeichnungen der übrigen Wissenschaften, wie Physik (physica) oder Mathematik (mathematica) annähert.19 Daß diese Wissenschaft von Gundissalinus ebenso wie die Theologie noch als göttliche Wissenschaft bezeichnet wird, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß beide Arten der göttlichen Wissenschaft für Gun-dissalinus kategorial verschieden sind.20 Zwar handelt nach Gundissalinus auch die Metaphy-sik von Gott, ja sie beweist sogar seine Existenz, doch ist er gerade deshalb nicht ihre ei-gentliche Materie, da die Gegenstände einer Wissenschaft – wie bereits Aristoteles wußte,
____________________________________________________________________________________________
16 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 5. 17 Ibid. 18 Ibid., S. 38. 19 Vgl. zur Genealogie des Begriffs der Metaphysik die leider noch zu wenig bekannten Arbeiten von Isacio Pérez Fernández, „Verbización y nocionización de la metafísica en la tradición siro-árabe, in: Pensamiento 31 (1975), S. 245-271; id., „Verbización y nocionización de la metafísica en la tradición latina“, in: Estudios filosóficos 24 (1975), S. 161-222; sowie zusammenfassend id., „Influjo del árabe en el nacimiento del término latino-medieval ‚metaphysica‘“, in: Jorge M. Ayala (Hrsg.), Actas del V Congreso Internacional de Filosofía Medieval, 2 Bde., Madrid 1979, hier Bd. II, S. 1099-1107. 20 Gundissalinus selbst erklärt, daß die Metaphysik nur „a digniori parte“, also nicht absolute, sondern nur relative als „göttliche Wissenschaft“ zu bezeichnen sei; vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philo-sophiae, ed. cit., S. 38. – Vgl. zur unterschiedlichen Nomenklatur der Metaphysik auch nach Gundissalinus, etwa noch bei Thomas von Aquin, Wladyslaw Strózewski, „Metaphysics as a Science“, in: Monika Asztalos u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy, Bd. I, Helsinki 1990, S. 128-157.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
27
auf den sich Gundissalinus hier beruft –, nicht noch einmal durch dieselbe Wissenschaft bewiesen werden können.21 Vielmehr sind sie entweder selbstevident, oder aber sie werden in einer anderen Wissenschaft bewiesen. Welche Wissenschaft aber sollte die Prinzipien der Metaphysik beweisen, wenn diese doch die allgemeinste Wissenschaft von allen ist, ja ihre Aufgabe nach Gundissalinus gerade darin besteht, allen anderen Wissenschaften die Prinzi-pien zu sichern?22 Die Metaphysik muß also von dem ausgehen, was durch sich selbst evi-dent ist: und dies ist das Seiende, womit Gundissalinus mit beiden Füßen in der aristoteli-schen Metaphysik-Tradition steht. Doch gerade indem sie dieses und seine Ursachen unter-sucht, gelangt sie zur ersten Ursache selbst, nämlich Gott:
Deinde ostendit, quod illud tantum, quod est istarum proprietatum, debet credi quod sit deus cuius gloria sublimis. [...] Postea destruit errores quorundam de deo et operationibus eius opinantium infinitatem et diminutionem in eo et in operationibus eius et in essentiis quas creavit.23
Offensichtlich handelt also auch die Metaphysik von Gott, jedoch nicht vom Gott Abrahams, sondern vom Gott der Philosophen. Und tatsächlich findet sich im gesamten Metaphysik-Kapitel von De divisione nicht die geringste Reminiszenz an den christlichen Gott. Ganz im Gegenteil sind alle Stellen, die in diesem Kapitel von Gott handeln, von al-FÁrÁbÐ, also einem arabischen Philosophen hergenommen.24
Damit ergeben sich zwei Wissenschaften, die von Gott handeln: eine göttliche, die im Studium der Bibel besteht, und eine menschliche, die auch als „philosophia prima“ und „metaphysica“ bezeichnet wird. Beide genießen eine wechselseitige Unabhängigkeit: So wie Gundissalinus die Theologie nicht der Philosophie unterordnet, so scheint er auch nicht um-gekehrt eine Philosophie als ‚ancilla theologiae‘ im Sinne zu haben. Es ist das Verdienst Fernand van Steenberghens, diese deutliche Unterscheidung beider Wissenschaften zum ersten Mal auf den Punkt gebracht zu haben:
On voit très nettement dans le système des sciences proposé par Gundisalvi, comment il a résolu les problèmes qui se posaient aux penseurs chrétiens de son temps: [...] il accepte l’idée d’une ‚sapientia‘, d’une sagesse humaine ou rationelle distincte de la ‚sapientia
____________________________________________________________________________________________
21 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 36-37: „Teste enim Aristotele nulla scientia inquirit materiam suam; sed in hac scientia inquiritur an sit deus. Ergo deus non est materia eius“ –Siehe dazu Aristoteles, Analytica posteriora I, 1, 71a 1-17, wo festgestellt wird, daß alles Wissen auf Vor-aussetzungen aufruht. Dieser Grundsatz war auch durch Avicenna bekannt, der ihn u.a. im vierten Teil seiner Enzyklopädie KitÁb aš-šifÁÞ aufgreift, der von Gundissalinus unter dem Titel Prima philosophia übersetzt wurde: „Nulla enim scientiarum debet stabilire esse suum subiectum.“ (Avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1977 u. 1980, hier Bd. I, S. 5) 22 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 38: „Officium autem huius artis est certificare principia omnium scientiarum.“ 23 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 41. 24 Das ganze Kapitel verdankt viele Gedanken den entsprechenden Seiten des Traktats KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm von al-FÁrÁbÐ, der von Gundissalinus unter dem Titel De scientiis übersetzt und z.T. stark überarbeitet wurde. Siehe Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. Manuel Alonso, Madrid u. Granada 1954, S. 127-131.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
28
christiana‘; enfin il combine assez heureusement le système des arts libéraux avec la divi-sion aristotélicienne de la philosophie.25
Diese Unterscheidung des biblischen und philosophischen Wissens wird auch durch den Aufbau von De divisione reflektiert, in dem die biblischen Verweise und Zitate nicht als autoritative Argumente in den philosophischen Fortgang des Werkes eingeführt werden. Die Funktion der Verweise auf die Bibel ist deutlich anders: Recht eigentlich betrachtet rekurriert Gundissalinus in De divisione auf die Bibel als auf einen literarischen Text, mit dem er seine Ausführungen in den Kapiteln zu den Sprachkünsten illustriert, namentlich Grammatik und Poetik. So erklärt er beispielsweise im Kapitel über die Grammatik, daß diese ihren Namen dem griechischen „gramaton“ (sic), Buchstabe, verdankt, und daß obwohl der Buchstabe nur einen Teil der Grammatik ausmache, diese dennoch pars pro toto „grammatica“ genannt werde, so wie das Buch Genesis zwar nicht ausschließlich von der „generatio“ handle, aber trotzdem seinen Namen von dieser her erhalten habe.26 In ähnlicher Weise greift er etwas später, im Kapitel über Poetik, erneut auf die Evangelien als literarische Texte zurück, um den Unterschied zwischen „argumentum“ und „fabula“ zu erhellen: „Res autem ficta alia est, quae fieri potuit et dicitur argumentum ut parabolae evangelii, alia est, quae fieri non potuit et dicitur fabula.“27 Hierauf folgt eine Diskussion der literarischen Gattungen:28 Drama, Erzählung und Mischformen, die Gundissalinus mit je einem Buch der Heiligen Schrift ver-anschaulicht.29 Damit wird deutlich, daß die Bezüge zur Bibel in diesem Traktat die philosophische Argumentation nicht bestimmen, vielmehr ist ihre Funktion v.a. illustrativ, womit die programmatische Unterscheidung beider Wissenssphären bestätigt wird. Es ist somit zu beobachten, daß Gundissalinus in De divisione philosophiae von Anfang an eine klare Abgrenzung von philosophischem und theologischem Wissen etabliert, die sich auch in der Argumentation des Traktates niederschlägt und letztlich in der Unterscheidung der bei-den genannten Arten göttlicher Wissenschaft, nämlich der Metaphysik und der Theologie, kulminiert, die durch ihre Gegenstandsbereiche klar voneinander abgegrenzt werden. Wenn nun aber Gundissalinus in einem ersten Schritt gleichsam negativ konstatiert, daß beide Wis-sensarten verschieden sind, so scheint es dennoch gerechtfertigt, weiter nach ihrem positiven Verhältnis zu fragen, insofern beide auch von Gott handeln. Doch gibt De divisione keine Antwort darauf, wie das Verhältnis von Heiliger Schrift und Philosophie positiv zu verstehen ist, was Friedrich Dechant dazu geführt hat, von einem „unverbundenen Nebeneinander von
____________________________________________________________________________________________
25 Fernand van Steenberghen, „L’organisation des études au Moyen Âge et ses répercussions sur le mouve-ment philosophique“, in: Revue philosophique de Louvain 52 (1954), S. 572-592, hier S. 588. – Meine Her-vorhebung. 26 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 52-53. 27 Ibid., S. 55. 28 Ibid., S. 56. 29 Hierin folgt Gundissalinus wörtlich Beda Venerabilis, der als einer der ersten die Kategorien der Rhetorik auf die Bibel anwandte, um auf diese Weise ihre Vollkommenheit auch als literarischer Text zu erweisen. Siehe Beda Venerabilis, Libri II De Arte Metrica et De Schematibus et Tropis – The Art of Poetry and Rhe-toric, ed. Calvin B. Kendall, Saarbrücken 1991, S. 164. Vgl. zu Beda Venerabilis und zur christlichen Rheto-rik-Tradition Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen u. Ba-sel 111993, S. 55-58.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
29
Philosophie und Theologie“ zu reden, das er mit der Position Sigers von Brabant vergleicht.30 Allerdings scheint dieses Urteil übertrieben und vorschnell, da Gundissalinus nicht glaubt, daß die Wahrheit einer der beiden Wissenschaften jener der anderen widersprechen könnte, wie sich zeigen wird.
Die „consonantia“ von Heiliger Schrift und Philosophie: De processione mundi In De processione mundi bedient sich der Archidiakon der Bibel als Ausgangspunkt seiner Überlegungen über die Schöpfung der Welt, womit sich bereits eine interessante Parallele zwischen ihm und der sogenannten Schule von Chartres andeutet, in der naturphilosophische Reinterpretationen von Genesis im Lichte des platonischen Timaios entstanden.31 So führt Gundissalinus gleich zu Beginn von De processione mundi dreimal die Autorität der Bibel an:
‚Invisibilia dei per ea, quae facta sunt, a creatura mundi intellecta conspiciuntur.‘ [Rom. 1, 20] [...] Unde in libro Sapientiae scriptum est: ‚per magnitudinem creaturae et speciem potest intelligibiliter creator videri‘. [Sap. 13, 5] [...] Unde de Sapientia scriptum est: ‚in viis ostendit se hilariter et in omni providentia ocurrit illis‘. [Sap. 6, 17]32
Obwohl diese drei Zitate letzten Endes auf die Erkenntnis Gottes abzielen, eröffnet sich mit ihnen zugleich die Möglichkeit einer Wissenschaft, die nicht von der geoffenbarten Wahrheit abhängt, sondern die, im Gegenteil, aus der rationalen Betrachtung der Natur zu Gott ge-langt. Diesen letzten Aspekt, die Rationalität der philosophia naturalis, entwickelt Gun-dissalinus anhand einer Untersuchung der Methodologie der Wissenschaften des Boethius, der der göttlichen Wissenschaft die intellektuelle, der Mathematik die disziplinengerechte und der Naturphilosophie die rationale Methode zuweist.33 Jede Wissenschaft hat damit ihre eigene Methode und folglich auch eine gewisse Selbständigkeit gegenüber den anderen Wis-senschaften. Am Ende dieser Untersuchung greift Gundissalinus den zitierten Vers aus dem Römerbrief auf und fügt hinzu, daß „[...] per ea, quae facta sunt, invisibilia dei intellecta creatura mundi conspicit, cum ratio ad compositionem accedit hoc modo“.34 Die biblischen ____________________________________________________________________________________________
30 Siehe Friedrich Dechant, Die theologische Rezeption der ‚Artes liberales‘ und die Entwicklung des Philosophiebegriffs in theologischen Programmschriften des Mittelalters von Alkuin bis Bonaventura, St. Ottilien 1993, S. 177. 31 Es sei verwiesen auf Thierry von Chartres und seinen Genesis-Kommentar sowie auf die Werke seines Zeitgenossen Wilhelm von Conches. Zu ersterem und seinem Tractatus de sex dierum operibus vgl. Peter Dronke, „Thierry of Chartres“, in: id. (Hrsg.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, S. 358-385, zu letzterem und seinem kosmologischen Denken siehe Dorothy Elford, „William of Con-ches“, ibid., S. 308-327. Zum Verhältnis von Thierry und Gundissalinus siehe weiter oben Anm. 14 dieses Kapitels. 32 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. u. span. Übers. María Jesús Soto Bruna u. Concep-ción Alonso del Real, Pamplona 1999, hier S. 120. – Vgl. zu den Vorzügen dieser Edition gegenüber den Ausgaben von Menéndez Pelayo und Georg Bülow meine Rezension in: Estudios eclesiásticos 76 (2001), S. 664-666. 33 Boethius entwickelt die Methodenlehre der Wissenschaften in seinem Traktat De Trinitate. Siehe Boethius, Die theologischen Traktate, übers., eingel. u. mit Anm. versehen von Michael Elsässer, Hamburg 1988, S. 8/9. – Vgl. zur Interpretation dieser Passage durch Gundissalinus weiter unten 2.2.3. 34 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
30
Zitate zu Beginn von De processione mundi dienen dem Archidiakon von Cuéllar mithin gerade zur Begrenzung des Geltungsbereichs des in der Heiligen Schrift Ausgesagten, der-gegenüber Gundissalinus mit der rationalen Methode der philosophia naturalis eine Autorität sui generis etabliert.35 Gundissalinus bekräftigt mithin die Unabhängigkeit eines rein philoso-phischen Wissens in Abhebung von der Bibel, wie sie bereits im letzten Abschnitt zutage trat.
Im Verlauf der folgenden Spekulationen in De processione hält der Archidiakon die Un-abhängigkeit der Naturphilosophie mit aller Konsequenz durch: Zunächst zeigt er, daß das Sein der ersten Ursache nicht nur möglich, sondern notwendig sein muß, daraufhin argu-mentiert er zugunsten der Einheit und Unbeweglichkeit der ersten Ursache und identifiziert diese letztendlich mit Gott. Schließlich charakterisiert er die beiden ursprünglichen Kompo-nenten der Realität, die durch die erste Ursache vereint werden: Materie und Form. Diese beiden und ihre Zusammensetzung sind nach Gundissalinus der Gegenstand der creatio ex nihilo. Soweit in verkürzter Form die kosmologische Doktrin aus De processione mundi, die von Gundissalinus zwar eingangs unter den Titel der Naturphilosophie gestellt wird, deren Inhalte jedoch auch und gerade metaphysischer Art sind. Tatsächlich ist die Verschränkung von Metaphysik und Naturphilosophie als Prinzipientheorie ja bis weit ins 13. Jahrhundert hinein eine gängige Konstruktion.36 M.ª Jesús Soto Bruna, die Mitherausgeberin von De pro-cessione mundi, spricht daher in Bezug auf dieses Werk mit Recht immer wieder von Gun-dissalinus’ Metaphysik.37 Von besonderem Belang für die vorliegenden Ausführungen ist dabei, daß Gundissalinus bis zu diesem Punkt (d.h. von der zweiten Seite bis zum zweiten Drittel des Traktates) die Heilige Schrift nicht wieder benutzt, sondern seine Positionen aus-gehend von strikt philosophischen Argumenten entwickelt, von denen einige, wie etwa der universelle Hylemorphismus, den Gundissalinus behauptet, auf Ibn Gabirols Fons vitae zu-rückgehen.38 Nun aber, nachdem er seine eigene kosmologische Position entwickelt hat, die eine große Emphase auf die Simultaneität der Schöpfung von Form und Materie legt, kon-frontiert Gundissalinus diese mit der Interpretation von Genesis, welche die, so wörtlich, „Theologen“ vorlegen. Der Abschnitt, der mit den Worten „dicunt tamen theologi“ anhebt, beschreibt eine kosmologische Konzeption, die davon ausgeht, daß die Schöpfung mit einem Chaos der Elemente beginnt, die noch ununterschieden und ‚uninformiert‘ sind. Die Theolo-
____________________________________________________________________________________________
35 Die Autonomie der philosophia naturalis ist ein weiteres Element, das Gundissalinus mit den Autoren der Schule von Chartres verbindet, v.a. mit Wilhelm von Conches. Siehe hierzu Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, „Philosophie und Physik zwischen notwendigem und hypothetischem Wissen. Zur wissens-theoretischen Bestimmung der Physik in der Philosophia des Wilhelm von Conches“, in: Early Science and Medicine 6 (2001), S. 22-34. 36 Bereits in De divisione philosophiae, ed. cit., S. 39, weist Gundissalinus auf den engen Zusammenhang zwischen Naturphilosophie und Metaphysik hin: „Sed [metaphysica] post naturales ideo [legatur], quia multa de hiis, quae conceduntur in ista, sunt de illis, quae iam probata sunt in naturali, sicut generatio et corruptio et alteritas et locus et tempus et ‚quod omne quod movetur ab alio movetur‘ et quae sunt ea quae moventur a primo motore et cetera.“ 37 Siehe ihre Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 19-79. 38 Dieses Werk ist von Gundissalinus und einem gewissen Magister Johannes übersetzt worden und wurde von Clemens Baeumker herausgegeben. Siehe Ibn Gabirol, Fons vitae, ed. Clemens Baeumker, in: BGPhMA I, 2-4, Münster 1892 u. 1895.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
31
gen, gemeint ist hier aller Wahrscheinlichkeit nach Hugo von Sankt Viktor (ca. 1096-1141),39 die diese Schöpfungstheorie vertreten, heißt es weiter, behaupten, daß diese von der Heiligen Schrift selbst bezeugt wird („testatur“). Damit wird zugleich deutlich, daß Gundissalinus mit der Bezeichnung „theologi“ bzw. „theologia“ durchaus eine klar definierte Wissenschaft meint und den Begriff nicht in seiner im 12. Jahrhundert wenigstens bis Abaelard noch un-scharfen Weise gebraucht.40 Denn Gundissalinus führt einen Begriff der Theologie ein, der gegenüber seiner traditionellen Semantik einen deutlichen Schritt zu einer Präzisierung des-selben in Richtung auf seine im 13. Jahrhundert dann entfaltete und immer noch gültige Be-deutung darstellt: Theologen sind ihm jene Denker, die das Zeugnis („testatur“) der Heiligen Schrift zum Gegenstand ihrer Überlegungen machen. Entsprechend dieser Gegenstandsbe-stimmung der Theologie führt Gundissalinus ihren Bezugstext aus Genesis für die zur Dis-kussion stehende Frage an und erklärt, wie dieser von den Theologen verstanden wird:
Ubi cum Moyses dicit: ‚In principio creavit deus caelum et terram‘ [Gen. 1, 1], per caelum et terram omnium caelestium terrestriumque materiam hoc loco voluit intelligi, de qua consequenter postea per formam distincta sunt, quae in ipsa prius per essentiam simul creata sunt.41
Gemäß der Deutung der erwähnten Theologen – Hugo von Sankt Viktor – sowie einiger Dichter bedeuteten die Worte Mose also die vorgängige Schöpfung der Materie, die das Chaos ausmachen würde, auf das im Nachhinein die Formen zur Anwendung kämen. Der Schöpfungsprozeß hätte mithin zwei Phasen: die Schöpfung der Materie und die Informie-rung des Chaos. Doch ist nach Gundissalinus die Vorgehensweise der Theologen nicht lege artis, da sie die „descriptiones“ des Schöpfungsvorgangs aus der Heiligen Schrift ihren ei-genen Modellen anpassen und nicht umgekehrt, wie es ihre Wissenschaft zu erfordern scheint, letztere aus ersteren gewinnen.42 Gundissalinus widersetzt sich denn auch dieser Interpretation energisch, indem er seine Widerlegung derselben mit den Worten „sed secun-dum philosophos“, namentlich Ibn Gabirol, einleitet, womit die deutliche Unterscheidung von Theologie und Philosophie zum Vorschein kommt.43 In seiner darauf folgenden philoso-
____________________________________________________________________________________________
39 Manuel Alonso hat zeigen können, daß die hier von Gundissalinus inkriminierte Lehre wörtlich auf eine Passage aus De sacramentis christianae fidei (PL 176, Sp. 190) von Hugo von Sankt Viktor zurückgeht. Siehe Manuel Alonso, „Hugo de San Víctor, refutado por Domingo Gundisalvo hacia el 1170“, in: Estudios eclesiásticos 21 (1947), S. 209-216. Es ist der Erwähnung wert, daß auch der bereits genannte Wilhelm von Conches Hugos Lehre vom Chaos attackiert. So heißt es in seinen Glosae super Boetium: „Dicunt quidam fluitantem esse materiam quattuor elementa in chao, id est in confusione [...] Qui michi videntur ex verbis Platonis et aliorum philosophorum errare et contra divinam bonitatem haeresim inserere.“ (Wilhelm von Conches, Glosae super Boetium, ed. Lodi Nauta [CCCM CLVIII], Turnhout 1999, S. 153) 40 Zur Begriffsgeschichte der Theologie von ihren Anfängen bis in die Spätantike vgl. Ferdinand Katten-busch, „Die Entstehung einer christlichen Theologie. Zur Geschichte der Ausdrücke qeologi,a, qeologei/n, qeolo,goj“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 38 (1930), S. 161-205. Einer der ersten, wenn nicht der erste, der den Begriff der Theologie in einer systematisch reflektierten Form gebraucht, ist Peter Abaelard; siehe Horacio Santiago-Otero, „El término ‚teología‘ en Pedro Abelardo“, in: Revista española de teología 36 (1976), S. 251-259. 41 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 188. 42 Vgl. ibid.: „Deinde quod dicit: ‚Et tenebrae erant super faciem abyssi‘ [Gen. 1, 2] et cetera, quae sequun-tur, [theologi] adaptant descriptiones praedictae descriptioni.“ 43 Die explizite Unterscheidung von Theologie einerseits und Philosophie andererseits als zweier Wissen-schaften, wie sie Gundissalinus hier vornimmt, ist für seine Zeit höchst ungewöhnlich und etabliert sich recht
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
32
phischen Argumentation, die hier nicht in all ihren Einzelheiten nachgezeichnet werden kann, versucht Gundissalinus zu zeigen, daß der Begriff des Chaos selbst bereits die Zusam-mensetzung aus Form und Materie voraussetzt. Denn wenn unter Chaos die Vermischung der Elemente („permixtio elementorum“) verstanden wird, würde dies zugleich seine Bestim-mung durch die Formen bedeuten, da die Elemente bereits aus Form und Materie zusam-mengesetzt seien.44 Daraus schließt er, daß es kein Chaos sensu stricto gibt, wie von den erwähnten Theologen behauptet, sondern daß Form und Materie gleichzeitig geschaffen wurden.
Doch präjudiziert diese Widerlegung keineswegs die Gültigkeit des biblischen Schöp-fungsberichtes, vielmehr ist sie auf eine kritische Untersuchung der Deutung desselben durch die Theologen beschränkt. Denn für den Archidiakon behaupten die in Frage stehenden Verse aus Genesis keineswegs die sukzessive Schöpfung von Materie und Form, auch wenn dies prima facie so scheinen könne. Nach Gundissalinus handelt es sich lediglich um ein Problem der Sprache, die es nicht gestattet, die Gleichzeitigkeit auszudrücken:
Quamvis ergo Moyses prius nominavit caelum et terram, deinde lucem [...], ordo tamen, quo creata narrantur, in creando non intelligatur. Quae enim simul sine tempore ad esse prodierunt, simul dici sine tempore non potuerunt. Omnis syllaba tempus habet.45
Der alttestamentliche Schöpfungsbericht widerspricht mithin nicht der kosmologischen Kon-zeption einer gleichzeitigen Schöpfung von Materie und Form, wie Gundissalinus sie im Laufe von De processione mundi entwickelt, vielmehr befinden sich beide in Einklang, was Gundissalinus mit dem folgenden Vers 18, 1 aus Jesus Sirach unterstreicht: „Cui consonat Divina Scriptura, quae dicit: ‚Qui vivit in aeternum, creavit omnia simul.‘“46
Dieses letzte Zitat bestätigt nicht nur die kosmologische Position des Archidiakons; be-deutsamer für den gegenwärtigen Kontext ist, daß es eine Präzisierung des Verständnisses der Beziehung von philosophischer Argumentation und biblischer Autorität erlaubt. Diese Beziehung wird mit der anmutigen Metapher einer „Konsonanz“ („consonat“) beschrieben: So wie sich die Stimmen zweier Sänger in einem einzigen Gesang vereinigen, so gelangen auch Philosophie und Bibelstudium, obwohl sie sich aus verschiedenen Quellen speisen, zu denselben Ergebnissen. Eine Metapher, die sich im übrigen hundert Jahre später wörtlich im
____________________________________________________________________________________________
eigentlich erst im 13. Jahrhundert, auch wenn sich bereits im 12. Jahrhundert erste Anzeichen für diese Aus-differenzierung beibringen lassen. Vgl. in diesem Sinne die Beiträge in Matthias Lutz-Bachmann u.a. (Hrsg.), Metaphysics in the Twelfth Century – The Relationship Among Philosophy, Science and Theology, Turnhout 2003 (im Druck). 44 Auch in der Elementen-Diskussion läßt sich ein interessanter Parallelismus mit der Schule von Chartres ausmachen, und wiederum v.a. mit Wilhelm von Conches: Sowohl dieser als auch Gundissalinus verwenden neben dem Begriff ‚elementum‘ auch den Term ‚elementatum‘, womit sie den aus Elementen zusammenge-setzten Körper bezeichnen. Dieser letztgenannte Begriff scheint zeitgleich in Chartres und Toledo aufzu-kommen, ohne daß bislang die genaue Abhängigkeit geklärt werden konnte. Vgl. Theodore Silverstein, „‚Elementatum‘: Its Appearence Among the Twelfth-Century Cosmogonists“, in: Mediaeval Studies 16 (1954), S. 156-162. 45 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 212. 46 Ibid.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
33
De Trinitate-Kommentar des Thomas von Aquin wiederfinden wird, in dem die Unterschei-dung von Theologie und Philosophie zentrales Thema ist.47
Es gilt somit festzuhalten, daß die Unterscheidung von biblischem und philosophischem Wissen, wie sie aus De divisione und dem Anfang von De processione spricht, nur eine Seite des Problems ist: der komplementäre Aspekt ist die „Konsonanz“ beider, womit der argu-mentative Wert der Heiligen Schrift nicht bloß illustrativer Natur ist, sondern dieser zugleich eine bestätigende Funktion zukommt.
Die Bibelzitate im Tractatus de anima und De unitate Die in der bisherigen Untersuchung von De divsione philosophiae und De processione mundi hervorgetretene Dialektik von Unterscheidung und Übereinstimmung von Philosophie und Theologie wird auch durch die Verwendung von Bibelzitaten im Tractatus de anima und in De unitate gestützt, die daher kurz skizziert werden soll. Der erstgenannte Traktat bemüht sich, die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen, wobei er deutlich von Avicenna inspiriert ist, dem er zahlreiche Passagen verbatim entlehnt.48 Seinen Ausgang nimmt der Traktat mit zwei Bibelzitaten aus Job und dem Psalter:
Unde in tantam dementiam delapsi sunt ut etiam Deum non esse dicerent; aut sicut illi qui in Iob dicunt: ‚Quid sit Deus, ut serviamus ei‘ [Iob 21, 15]; aut sicut illud David: ‚Dixit in-sipiens in corde suo: Non est Deus‘ [Ps. 13, 1]. Quapropter rationes quibus philosophi ani-mam esse deprehenderunt apponere necessarium duxi.49
Wie in De processione mundi, so geht Gundissalinus auch hier von einer biblischen Aussage aus, um die Notwendigkeit einer philosophischen Untersuchung zu legitimieren, die nach Vernunftgründen („rationes“) vorgehen soll. Erneut dient ihm die Bibel damit dazu, einen von ihr verschiedenen Wissensbereich zu eröffnen, wobei sie ihm sogar Gelegenheit bietet, die Übersetzung und Integration arabischer Philosophie zu rechtfertigen:
Quapropter quicquid de anima apud philosophos rationabiliter dictum inveni, simul in unum colligere curavi. Opus siquidem latinis hactenus incognitum utpote in archivis grae-cae et arabicae tantum linguae reconditum [...] ad notitiam latinorum est deductum ut fi-deles, qui pro anima tam studiose laborant, quid de ipsa sentire debeant, non iam fide tan-tum, sed etiam ratione comprehendant.50
____________________________________________________________________________________________
47 Vgl. Thomas von Aquin, op. cit., q. 1, art. 1, resp., S. 60: „Sed quia verba Philosophi in III De anima magis videntur sonare quod intellectus agens sit potentia animae et huic etiam auctoritas Sacrae scripturae consonat [...]“ – Meine Hervorhebung. 48 Vgl. etwa das zehnte Kapitel von Gundissalinus’ Tractatus de anima, ed. cit., S. 84-103, wo Avicennas Vermögenslehre ausführlich zitiert wird. Dennoch ist Gundissalinus’ Traktat durchaus originell und keine bloße Kompilation. Für eine in diesem Sinne ausgewogene Einschätzung des Verhältnisses von Gundissali-nus’ Traktat und Avicennas Schrift sei verwiesen auf Dag Nikolaus Hasse, Avicenna’s ‚De anima‘ in the Latin West. The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-1300, London u. Turin 2000, S. 13-18. 49 Dominicus Gundissalinus, Tractatus de anima, ed. cit., S. 32. 50 Ibid., S. 31.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
34
Folgerichtig vermeidet Gundissalinus im folgenden alle Bezüge auf die Bibel, bis er zum Ende seines Traktates gelangt.51 Allein hier, auf den letzten Seiten des zehnten Kapitels, verstattet er sich Rekurse auf die Bibel, die er mit Formeln wie „iuxta illud“, „unde propheta“ oder „apostulus testatur“ einleitet,52 um eben die „Konsonanz“ all dessen, was er zuvor aus einer avicennischen und mithin philosophischen Perspektive heraus dargelegt hat, mit der Heiligen Schrift zu bestätigen.53 Niemals indessen benutzt Gundissalinus die Bibel als Prämisse seiner Argumente.
Nach dem bisher Gesagten dürfte es kaum wundernehmen, daß sich in dem Opuskulum De unitate sämtliche Verweise auf die Bibel gegen Ende der Schrift konzentrieren. So be-schließt der Autor, nachdem er in seiner z.T. neoplatonischen Argumentation verschiedene Formen von Einheit gegeneinander abgehoben hat, seine Ausführungen folgendermaßen:
Alia dicuntur unum ratione [...], vel ratione unius sacramenti, ut ‚spiritus aqua et sanguis‘ [1 Ioh. 5, 8] dicuntur unum [...] Alia dicuntur unum more [...] vel secundum consensum virtutis [...], ut: ‚Multitudinis credentium erat cor unum et anima una‘ [Acta 4, 32], vel se-cundum consensum eiusdem vitiis plures homines dicuntur unum, ut: ‚Qui adhaeret mere-trici, unum corpus efficitur‘ [1 Cor. 6, 16].54
Diese Sätze erinnern zunächst an die illustrative Funktion der Bibelzitate in De divisione: Wie dort, so bedient sich Gundissalinus auch hier der Bibel als eines sprachlichen Reperto-riums, mit dem er die semantische Richtigkeit seiner Begriffe, hier die Verwendung des Be-griffs ‚unum‘, überprüft.55 Zugleich aber stellt dies erneut einen Versuch des Gundissalinus dar, die „Konsonanz“ seiner Überlegungen mit der Heiligen Schrift zu erweisen: Die ver-schiedenen Bedeutungen, die der Autor zuvor voneinander abgegrenzt hat, entsprechen je-weils einem Satz der Bibel.
Beide Werke verdeutlichen mithin, was sich bereits aus der Untersuchung von De pro-cessione mundi ergab: Obwohl vorausgesetzt wird, daß Heilige Schrift und Philosophie zwei klar geschiedenen Wissensbereichen zugehören, so besteht dennoch zwischen ihren Resul-taten eine Entsprechung.
____________________________________________________________________________________________
51 Es sei auf eine Ausnahme hingewiesen: auf den Seiten 58 und 59 zitiert Gundissalinus zweimal die Bibel. Allerdings stellt das hier diskutierte Thema einen kosmologischen Exkurs dar, der keinen unmittelbaren Einfluß auf die Hauptargumentation, nämlich den Erweis der Unsterblichkeit der Seele, hat. 52 Ibid., S. 100. 53 Dieses letzte Kapitel des Tractatus de anima hat Étienne Gilson dazu veranlaßt, in Bezug auf Gundissali-nus von einem ‚augustinisme avicennisant‘ zu sprechen. Vgl. Étienne Gilson, „Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929-1930), S. 5-149, hier S. 85. Siehe für eine nähere Darlegung seiner Gründe weiter unten 2.2.3. sowie für eine Kritik dieser Bezeichnung Kapitel 2.4. 54 Dominicus Gundissalinus, De unitate, ed. Manuel Alonso, in: Pensamiento 12 (1956), S. 65-78, hier S. 76. 55 Es ist kein Zufall, daß mit Alanus ab Insulis gerade ein Meister dessen, was man die Sprachphilosophie des 12. Jahrhunderts nennen könnte, durch Gundissalinus’ biblische Beispiele inspiriert wird, die er in seinem Liber in distinctionibus dictionum theologicalium (PL 210) – einem Wörterbuch theologischer Grundbegriffe – s.v. ‚unum‘ referiert.
Gundissalinus und die Heilige Schrift
35
Das Verhältnis von Philosophie und Theologie bei Gundissalinus Als Ergebnis dieses Durchgangs durch die Werke des Gundissalinus im Hinblick auf das Verhältnis von Heiliger Schrift und Philosophie und ihre Geltungsansprüche gilt es zunächst die beiden folgenden Elemente festzuhalten: Erstens, daß der Archidiakon bereits in De divi-sione eine klare Unterscheidung dessen vornimmt, was Gegenstand der Philosophie bzw. Metaphysik ist, und dessen, was Gegenstand der Theologie ist, womit er der Philosophie und insbesondere der Metaphysik, die er als erster namentlich als Wissenschaft einführt, einen autonomen Status zuerkennt. Aus dieser Perspektive kann der argumentative Wert der Heili-gen Schrift in Gundissalinus’ Werken innerhalb der philosophischen Argumentationskette lediglich illustrativ sein, insofern diese hier als Gegenstand der philosophischen Sprachkün-ste verhandelt wird, wie ihre Verwendung in den Grammatik- und Poetik-Kapiteln aus De divisione zeigt. Zweitens muß man jedoch betonen, daß diese Autonomie der Philosophie bzw. der Metaphysik einerseits und der Theologie andererseits, die aus ihren differenten Ge-genstandsbereichen und Methoden resultiert, nicht zu einer absoluten Unverbundenheit bei-der Wissenssphären führt, wie Friedrich Dechant insinuiert, vielmehr scheinen beide in ihren Fluchtlinien in eins zu fallen, oder, um Gundissalinus’ Formulierung aufzugreifen, es besteht „Konsonanz“ zwischen ihnen. Deshalb kann der argumentative Wert der Heiligen Schrift als Gegenstand der Theologie auch für die Philosophie mehr als illustrativ sein, denn jene ist zugleich im Hinblick auf die Ergebnisse der philosophischen Argumentation konfirmativ bzw. korrektiv im Sinne einer norma negativa, so wie es umgekehrt die Ergebnisse der Phi-losophie für jene der Theologie sein können. Doch ist die Heilige Schrift als Gegenstand der Theologie in Gundissalinus’ Schriften niemals Teil der philosophischen Argumentation, dies ist sie nur als Gegenstand der philosophischen Sprachkünste. Ihre konfirmative und korrek-tive Funktion hingegen bleibt beschränkt auf einen Vergleich der in den jeweiligen Wissen-schaften gewonnenen Ergebnisse.
Es ist richtig, daß für Gundissalinus alle Ergebnisse der Philosophie letztlich mit den Re-sultaten einer gründlichen theologischen Lektüre der Heiligen Schrift übereinstimmen müs-sen und umgekehrt. Gleichwohl ist diese Übereinstimmung der Heiligen Schrift nicht die Bedingung der Wahrheit für die Theoreme der Philosophie, denn wenn soeben behauptet wurde, daß diese mit jener übereinstimmen „müssen“, so müssen sie dies nicht etwa, um wahr zu sein, sondern umgekehrt gerade weil sie wahr sind. Für die Rezeption der arabischen Philosophie und der durch diese vermittelten aristotelischen Gedanken bedeutet dies, daß die Autorität der Heiligen Schrift an sich kein Hindernis darstellt, im Gegenteil, in dem Maße, in dem die falsafa wahr ist, wird sie mit der Heiligen Schrift übereinstimmen, wie Gundissali-nus für die avicennischen Argumente des Tractatus und die neoplatonischen Elemente aus De unitate zu zeigen versucht; mehr noch, es kann sogar zu einem Fall wie dem von Ibn Gabirol und Hugo von Sankt Viktor in De processione kommen, wo ein heidnischer Autor, hier ein Jude, gegenüber einem Christen Recht erhält. Damit lassen sich bereits bei Gun-dissalinus die zentralen Motive einer säkularen Gestalt von Philosophie finden, die im nachthomasischen Denken die Dialektik von Theologie und Philosophie so dauerhaft prägen sollte, daß sich die Geschichte dieser beiden Disziplinen bis heute in den Begriffen von Un-terscheidung und Übereinstimmung bewegt.
2.2. Gundissalinus und Boethius: Wissens- und Wissenschaftstheorie 2.2.1. Vorbemerkung Boethius ist für Gundissalinus neben der Heiligen Schrift eine der wichtigsten lateinisch-christlichen Quellen. In allen seinen Abhandlungen finden sich Zitate oder Anlehnungen aus zahlreichen Werken des Boethius, etwa aus De consolatione philosophiae, De institutione arithmetica, De institutione musica, De differentiis topicis, In Ciceronis topica, De Trinitate, De hebdomadibus u.a.m.1 Allein die Fülle des Materials legt es nahe, daß Gundissalinus über die Werke des Boethius im Original verfügte. Dies bestätigt im übrigen auch das Manuskript 10109 (olim Tol. 13-6) der Biblioteca Nacional in Madrid, das aus dem Toledo des 12. Jahr-hunderts stammt und neben einigen Werken des Laktanz die Consolatio philosophiae des Boethius enthält.2
Dieser gewichtige Einfluß, der allenthalben bis in die Terminologie des Gundissalinus hinein greifbar ist,3 soll im folgenden an vier Komplexen untersucht werden, die zugleich das deutlich wissens- und wissenschaftstheoretische Interesse des Gundissalinus an Boethius dokumentieren, das im Zentrum dieser Arbeit steht. Es sind dies die Fragen nach der Ein-teilung der Wissenschaften erstens gemäß ihren Gegenständen und zweitens gemäß ihren Methoden sowie drittens nach dem axiomatischen Charakter der Wissenschaften und vier-tens nach der Subordinationstheorie und der Binnendifferenzierung der Wissenschaften. Dabei wird jeweils zunächst kurz die Ausgangsproblematik in den Texten des Boethius be-schrieben, dieser werden sodann die Lösungen aus den Chartreser Boethius-Kommentaren entgegengestellt, um daraufhin das Spezifikum der gundissalinischen Boethius-Rezeption in ihrer Verschränkung mit den neuen, aristotelisierenden arabischen Quellen um so schärfer bestimmen zu können. 2.2.2. Die boethianische Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
Der für die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen einschlägige Text des Boethius aus dem zweiten Abschnitt seines Traktates Quomodo Trinitas unus Dei ac non tres Dii, kurz De Trinitate genannt, wird mindestens viermal in De divisione philosophiae4 und ____________________________________________________________________________________________
1 Eine vollständige Zusammenstellung der Boethius-Zitate bei Gundissalinus hat Manuel Alonso vorgelegt, allerdings ohne eine weitergehende Interpretation derselben. Vgl. Manuel Alonso, „Influencia de Severino Boecio en las obras y traducciones de Gundisalvo“, in: id., Temas filosóficos medievales (Ibn DÁwÙd y Gun-disalvo), Comillas 1959, S. 369-396, hier S. 369-377. 2 Vgl. zu diesem Manuskript Lisardo Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos existen-tes en España, Madrid 1984. Leider war es mir bisher nicht möglich, weitere boethianische Manuskripte, insbesondere der Opuscula sacra, ausfindig zu machen, die Dominicus Gundissalinus hätten zugänglich sein können. Die folgenden Ausführungen der Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3. stehen mithin unter dem Vorbehalt, zukünftigen Manuskript-Funden und ihrer Auswertung nicht zu widersprechen. 3 Dies hat Manuel Alonso, „Influencia de Severino Boecio en las obras y traducciones de Gundisalvo“, art. cit., S. 377-396, eindrucksvoll nachweisen können. 4 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15, 27, 36 u. 113.
38 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
einmal in De processione mundi5 zitiert, wobei Gundissalinus ausdrücklich auf Boethius als Quelle hinweist. So heißt es gleich im Prolog der Divisio philosophiae, in dem Gundissalinus verschiedene Grundeinteilungen6 der Philosophie vorführt:
Et ob hoc dicit Boethius, quod physica est inabstracta et cum motu, mathematica abstracta et cum motu, theologia vero abstracta et sine motu.7
Um dieses scheinbar harmlose Boethius-Referat des Gundissalinus in seiner ganzen Trag-weite zu erfassen, ist ein Blick auf die Einteilung der Philosophie des Boethius und ihr Fort-leben bis zu Gundissalinus angebracht. Der entsprechende Passus aus dem bereits erwähnten zweiten Abschnitt von De Trinitate lautet folgendermaßen:
Nam cum tres sint speculativae partes, naturalis, in motu inabstracta avnupexai,retoj (con-siderat enim corporum formas cum materia, quae a corporibus actu separari non possunt [...]), mathematica, sine motu inabstracta (haec enim formas corporum speculatur sine materia ac per hoc sine motu, quae formae cum in materia sint, ab his separari non pos-sunt), theologica, sine motu abstracta atque separabilis (nam dei substantia et materia et motu caret) [...]8
Boethius entwirft hier in engem Anschluß an das 6. Buch der Metaphysik des Aristoteles eine Tripartition der theoretischen Philosophie in Naturphilosophie, Mathematik und Theologie,9 deren Kriterien er mit Hilfe von Abstraktheit und Bewegung angibt.10 So ist die Natur-philosophie oder Physik durch Inabstraktheit und Bewegung ihrer Gegenstände bestimmt, die Mathematik durch Inabstraktheit und Bewegungslosigkeit und die göttliche Wissenschaft durch Abstraktheit und Bewegungslosigkeit. Die Schwierigkeit dieser Bestimmung wird insbesondere in der Definition der Mathematik als inabstracta sichtbar. Denn wie kann ge-rade die Mathematik, die abstrakte bzw. abstraktive Wissenschaft par excellence, von
____________________________________________________________________________________________
5 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122. 6 Neben der im folgenden zitierten boethianischen Klassifikation finden sich Bestimmungen der Philosophie von Isidor von Sevilla und Isaak Israeli. Vgl. dazu Anton-Hermann Chroust, „The Definitions of Philosophy in the De divisione philosophiae of Dominicus Gundissalinus“, in: New Scholasticism 25 (1951), S. 253-281. 7 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15. 8 Boethius, Die theologischen Traktate, übers., eingel. u. mit Anm. versehen von Michael Elsässer, Hamburg 1988, S. 6-9. 9 Es verbietet sich, den hier aus der aristotelischen und boethianischen Tradition kommenden Begriff der Theologie oder göttlichen Wissenschaft mit jenem Konzept von Theologie gleichzusetzen, von dem im vor-hergehenden Abschnitt die Rede war. Die aristotelische und boethianische Theologie ist, durch und durch philosophische Theologie, letztlich Metaphysik. 10 Bei Aristoteles heißt es hierzu in der Metaphysik VI, 1, 1026a 13-16: „Denn die Physik handelt von abtrennbaren (selbständigen), aber nicht unbeweglichen Dingen, einiges zur Mathematik Gehörige betrifft Unbewegliches, das aber nicht abtrennbar (ouv cwrista,) ist, sondern als an einem Stoff befindlich; die erste Philosophie aber handelt von sowohl abtrennbaren (selbständigen) als auch unbeweglichen Dingen.“ (Ari-stoteles, Metaphysik I-VI, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31989, S. 252/253) Sämtliche Codices geben für die Bestimmung der Physik avcw,rista. Die Lesart cwrista, geht auf eine Konjektur Albert Schweglers in seinem Kommentar zur Metaphysik, Tübingen 1847, Ndr. Frankfurt am Main 1968, S. 16, zurück. Zu Recht hat Klaus Jacobi, „Natürliches Sprechen – Theoriesprache – Theologi-sche Rede. Die Wissenschaftslehre des Gilbert von Poitiers (ca. 1085-1154)“, in: Zeitschrift für philosophi-sche Forschung 49 (1995) S. 511-528, hier S. 514, Bedenken gegen diese Korrektur des aristotelischen Tex-tes angemeldet, der auch ohne sie einen guten, ja sogar besseren Sinn gibt.
Gundissalinus und Boethius 39
Boethius als inabstracta bezeichnet werden?11 Will man die Konsistenz der boethianischen Einteilung garantieren, so wird man von einem aus heutiger Sicht kontra-intuitiven Gebrauch der Qualifikation inabstracta ausgehen müssen. Diese dient Boethius gerade nicht zur Be-zeichnung einer Leistung des Geistes, durch welche die Gegenstände der Mathematik aus der Materie herausgelöst würden, sondern ist eine Beschreibung des ontologischen Status der Gegenstände der Mathematik. Diese sind ihrem Sein nach von der Materie nicht abtrennbar und insofern inabstracta, avcw,rista, wie es bei Aristoteles heißt. Entsprechend wird die Qualifikation inabstracta auch von Boethius selbst erklärt. Im Falle der Physik etwa mit dem Zusatz: „formae cum materia, quae a corporibus actu separari non possunt.“ Das heißt, die Physik betrachtet diejenigen Formen zusammen mit ihrer Materie, die ihrem Sein nach, actu, nicht abgetrennt werden können. Wenn dies aber die Erläuterung des Boethius zu inabstracta ist, so bewegt sich dieser Begriff eindeutig auf einer ontologischen Ebene. Eine epistemolo-gische Komponente hingegen gelangt in die Einteilung des Boethius erst mit dem Bewe-gungskriterium. So heißt es in der zitierten Definition der Mathematik: „mathematica [...] speculatur sine materia ac per hoc sine motu.“ Der Art der Betrachtung ohne Materie ent-spricht also die Betrachtung ohne Bewegung, wohlgemerkt nicht die Seinsweise – genau das also, was mit Abstraktion im heutigen Sprachgebrauch als einer Leistung des Geistes be-zeichnet wird. Die Qualifikation sine bzw. in motu verweist somit bei Boethius implizit auf den epistemologischen Status der Gegenstände der Erkenntnis.
Festzuhalten ist also, daß der Abstraktionsbegriff des Boethius primär ontisch konnotiert ist, daher auch die Möglichkeit, die Mathematik als inabstracta zu bezeichnen. Ein noeti-scher Abstraktionsbegriff, wie Boethius ihn bei Aristoteles hätte finden können,12 wird zwar mit dem Kriterium der Bewegung vorbereitet, ist jedoch insgesamt nur sehr zaghaft und ansatzweise formuliert.13
____________________________________________________________________________________________
11 In diesem Sinne definiert denn auch Isidor von Sevilla die Mathematik als Wissenschaft vom Abstrakten: „Mathematica latine dicitur doctrinalis scientia, quae abstractam considerat quantitatem. Abstracta enim quantitas est, quam intellectu a materia separantes [...] in sola ratiocinatione tractamus.“ (Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, ed. Wallace M. Lindsay, 2 Bde., Oxford 1911, Bd. I, lib. III, praef.) 12 So charakterisiert zwar auch Aristoteles die Gegenstände der Mathematik als avcw,rista, dies gilt jedoch nur für ihr Sein; denn in der Betrachtung sind sie für Aristoteles ta. evx avfaire,sewj, d.h. das Resultat eines gedanklichen Prozesses, womit der Stagirite bereits über einen klaren Abstraktionsbegriff verfügt, den er von der ontologischen Ebene deutlich unterscheidet; siehe Metaphysik XIII, 2, 1077b 9-14: „Daraus ist denn offenbar, daß weder das durch Abstraktion Entstandene (to. evx avfaire,sewj) früher, noch das durch Hinzufü-gung Entstandene später entstanden ist [...] Daß also die Gegenstände der Mathematik nicht in höherem Sinne Wesen sind als die sinnlichen Körper, noch dem Sein nach früher als das Sinnliche, sondern bloß dem Begriff nach, noch endlich irgendwo abgetrennt sein können, ist hiermit genügend erklärt.“ (Aristoteles, Metaphysik VII-XIV, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31991, S. 282/283) 13 Bereits Konrad Bruder, Die philosophischen Elemente der ‚Opuscula sacra‘ des Boethius. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der Philosophie der Scholastik, Leipzig 1928, S. 30, erkannte die hier dargelegte Eigenart des boethianischen Abstraktionsbegriffs, als er feststellte: „[...] so deckt sich dieser Begriff der Abstraktion nicht völlig mit dem der Abstraktion im gewöhnlichen Sinne.“ Auf den Punkt gebracht hat die rein ontische Auslegung von abstracta allerdings erst Siegfried Neumann, Gegenstand und Methode der theoretischen Wissenschaften nach Thomas von Aquin aufgrund der ‚Expositio super librum Boethii De Trinitate‘, in: BGPhMA XLI, 2, Münster 1965, S. 36-48.
40 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Zum Problemstand im 12. Jahrhundert Dieser ontische Abstraktionsbegriff des Boethius ist nicht nur aus heutiger Sicht als kontra-intuitiv zu bezeichnen. Bereits die Boethius-Kommentatoren des 12. Jahrhunderts hatten ihre liebe Not mit ihm. Zu nennen sind hier v.a. Thierry von Chartres († nach 1156), Gilbert von Poitiers († ca. 1154) und Clarembald von Arras († ca. 1187) aus dem Umkreis der Schule von Chartres. Sie alle erkennen die Schwierigkeit des boethianischen Textes und bemühen sich darum, die Möglichkeit von Abstraktion innerhalb der Mathematik mit ihrer Qualifika-tion als inabstracta in Einklang zu bringen. Thierry von Chartres z.B., Kanzler der Kathe-dralschule von Chartres, schreibt:
Unde ‚sine motu‘ dicitur quia res abstracte et immutabiliter considerat. ‚Inabstracta‘ vero dicitur mathematica eo quod ‚formas‘ considerat quae non possunt esse ‚sine materia‘.14
Diese Erklärung läuft auf einen zweifachen Gebrauch von abstracte bzw. inabstracta hinaus: Abstracte wird hier zunächst adverbial als epistemologischer Begriff gebraucht, der die Art der Betrachtung der Gegenstände der Mathematik näher bestimmt, andererseits jedoch wird im Hinblick auf den ontologischen Status derselben von inabstracta gesprochen.15
In eine nachgerade paradoxe Formulierung mündet die Schwierigkeit mit dem boethiani-schen Abstraktionsbegriff beim Bischof von Poitiers Gilbert. Hier heißt es in seinem Kom-mentar zu De Trinitate im Hinblick auf die Mathematik:16
‚Inabstracta‘ [vocatur] quidem eo quod inseparabilia sunt quae nisi separatim non perspi-cit.17
Damit wird der zweifache Gebrauch von abstracte und inabstracta bei Thierry auf ein ande-res, für Gilbert synonymes Begriffsfeld verlagert, nämlich das der separatio, um hier jedoch wieder in der gleichen Zweideutigkeit zu enden. Die Gegenstände der Mathematik sind zwar inseparabilia, können aber nur separatim betrachtet werden.
Entschiedener als seine beiden Chartreser Kollegen thematisiert Clarembald von Arras – ein Schüler des Thierry – die Schwierigkeiten der boethianischen Klassifikation der Mathe-matik:
Mirum autem quod mathematicam dixit ‚inabstractam‘ cum propter formarum abstracta-rum speculationem eam esse censuit ‚sine motu‘. Sed ut doceret formas mente abstracti-
____________________________________________________________________________________________
14 Thierry von Chartres, Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and His School, ed. Nikolaus M. Häring, Toronto 1971, S. 162, no. 23. 15 Siehe zu Thierry und seinen Boethius-Kommentaren u.a. Peter Dronke, „Thierry of Chartres“, in: id. (Hrsg.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, S. 358-385. Allerdings kon-zentriert sich Dronke sehr stark auf Thierrys Rezeption der boethianischen Methodologie der Wissenschaften, die uns im nächsten Abschnitt beschäftigen wird, so daß seine Rezeption der boethianischen Bestimmung der Gegenstandsbereiche der Wissenschaften kaum diskutiert wird. 16 Klaus Jacobi hat versucht, diesen Widerspruch aufzulösen, indem er Gilbert (das gleiche ließe sich entsprechend auch für Thierry behaupten) eine bewußte Unterscheidung zwischen dem Gebrauch des Wortes ‚abstractus‘ bzw. ‚separatus‘ als Objekt zu Verben des Erkennens einerseits und als Adverb zu solchen Ver-ben andererseits unterstellt. Siehe Klaus Jacobi, art. cit., S. 517. 17 Gilbert von Poitiers, The Commentaries on Boethius by Gilbert of Poitiers, ed. Nikolaus M. Häring, To-ronto 1966, S. 85, no. 31.
Gundissalinus und Boethius 41
biles naturae actu materiae inhaerere non est veritus dicere ‚inabstractam‘ simulque quod ‚mathematica‘ aliter a theologica non differret.18
Zum ersten Mal wird hier explizit ein Unverständnis bezüglich der boethianischen Einteilung artikuliert.19 Damit scheint sich bei Clarembald bereits ein noetischer Abstraktionsbegriff gegenüber einem ontischen durchzusetzen. Doch wird dieser Übergang noch nicht konse-quent vollzogen, denn letztlich stimmt Clarembald Boethius wieder zu, wenn er den Ab-straktionsbegriff auch für die ontologische Ebene gelten läßt, wo er ohne Bedenken („non est veritus“) angewandt werden kann. Entscheidender als dieses Motiv ist für Clarembald jedoch vermutlich die Überlegung, daß durch eine Korrektur des boethianischen inabstracta zu abstracta die Distinktheit von Mathematik und göttlicher Wissenschaft bzw. Metaphysik bedroht wäre, die dann beide als abstracta und sine motu beschrieben werden müßten.
Insgesamt läßt sich beobachten, daß die zitierten Autoren das Problem einer fehlenden Differenzierung des Abstraktionsbegriffs erkannt haben, dennoch halten sie trotz der Schwie-rigkeiten bei der Interpretation des boethianischen Textes an dessen Einteilung fest, womit sie einen äquivoken Abstraktionsbegriff in Kauf nehmen, der sowohl epistemologisch als auch ontologisch gewendet werden kann und der zugleich eine nicht geringe begriffliche Unschärfe in ihre Ausführungen bringt.
Gundissalinus’ Lösung des Dilemmas Anders verhält es sich nun bei Gundissalinus, der Boethius im bereits angeführten Prolog seiner Divisio philosophiae mit den Worten „mathematica abstracta et cum motu“ zitiert und damit stillschweigend die Schwierigkeit in Boethius’ Text glättet.20 Dabei ist diese Korrektur des boethianischen inabstracta zu abstracta und des sine motu zu cum motu keineswegs nur punktuell, vielmehr durchzieht sie die gesamte Divisio philosophiae als deren Hintergrund, und wird gegen Ende der Schrift noch einmal explizit mit folgenden Worten bekräftigt:
____________________________________________________________________________________________
18 Clarembald von Arras, Life and Works of Clarembald of Arras. A Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. Nikolaus M. Häring, Toronto 1965, S. 112, no. 15. 19 Auch Wilhem Jansen, der vormalige Herausgeber der Kommentare des Clarembald, schließt sich dessen Unverständnis an, wenn er in seinem Vorwort erklärt: „Sonderbarerweise hat Boethius sie [= die Gegen-stände der Mathematik] inabstracta genannt [...]“ (Clarembald von Arras, Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius ‚De Trinitate‘. Ein Werk aus der Schule von Chartres im 12. Jahrhundert, ed. Wilhelm Jansen, Breslau 1926, S. 39) 20 Da bislang Gundissalinus’ Textvorlage der Opuscula sacra, wie bereits angemerkt, nicht ausfindig ge-macht werden konnte, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, ob es sich tatsächlich um eine Kor-rektur des Gundissalinus handelt oder lediglich um eine Textvariante. Einige Varianten (zumeist von Manu-skripten aus dem deutschen Sprachraum) bietet die Edition von Rudolf Peiper, die allen neueren Ausgaben zugrunde liegt: Boethius, Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae consolationis libri quinque accedunt eiusdem atque incertorum Opuscula sacra, Lipsiae 1871. Weitere Varianten gibt jetzt zudem die jüngste Ausgabe der Opuscula sacra: Boethius, De consolatione philosophiae – Opuscula theologica, ed. Claudio Moreschini, Monachii et Lipsiae 2000. Allerdings findet sich in der Boethius-Ausgabe von Peiper, S. 152, keine vergleichbar starke Variante. Nur ein Manuskript, Gothanus, n. 103 et 104, ändert ‚inabstracta‘ zu ‚in abstracta‘, läßt allerdings das Bewegungskriterium unberührt. Auch die Ausgabe von Moreschini, S. 169, bietet nur ein weiteres Manuskript, nämlich London, British Library, Harl. 3095, das ‚inabstracta‘ gibt, ohne aber das Bewegungskriterium darum zu ändern.
42 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Ex quibus necessario tres species philosophiae theoricae proveniunt: aut est enim abstracta et sine motu ut theologia, aut inabstracta et cum motu ut naturalis, aut abstracta et cum motu ut mathematica, quae est media inter utramque.21
Der Physik, genauer ihren Gegenständen, ist es also eigen, inabstrakt und in Bewegung zu sein, der Mathematik abstrakt und in Bewegung und der göttlichen Wissenschaft bzw. Me-taphysik abstrakt und ohne Bewegung. Daß hier aus dem boethianischen inabstracta ein abstracta und aus seinem sine motu ein cum motu geworden ist, wurde lange Zeit überlesen. So erwähnt Ludwig Baur in der kritischen Edition der Divisio philosophiae von 1903 in sei-nem Hinweis auf die dem Boethius-Referat zugrundeliegende Stelle mit keinem Wort die von Gundissalinus vorgenommene Veränderung.22 Auch Manuel Alonso beschränkt sich in seinem 1959 veröffentlichten Artikel über den Einfluß des Boethius auf Gundissalinus23 darauf, das zitierte Boethius-Referat des Gundissalinus auf Boethius’ De Trinitate zurückzu-führen, ohne auf die signifikanten Veränderungen aufmerksam zu machen. Es ist Philip Merlans Verdienst, in seinem 1953 erschienenen Buch From Platonism to Neoplatonism24 auf die Inversion der boethianischen Definition der Mathematik bei Gundissalinus hinge-wiesen zu haben, auch wenn er dieser insgesamt nur wenig Aufmerksamkeit schenkt. Erst 1984 hat Henri Hugonnard-Roche den Versuch einer Klärung dieser Modifikation der boethianischen Einteilung bei Gundissalinus unternommen, indem er auf die Bedeutung Avicennas in diesem Prozeß aufmerksam macht.25
Und tatsächlich geht der Korrektur der boethianischen Definition in der Divisio philo-sophiae eine längere Avicenna-Paraphrase unmittelbar voraus, die an eine Passage aus der Logica – dem Buch zur Isagoge aus dem ersten Teil des KitÁb aš-šifÁÞ – angelehnt ist, die möglicherweise von dem bereits erwähnten Avendauth gemeinsam mit Gundissalinus über-setzt wurde.26 So heißt es bei Gundissalinus:
[...] scilicet aut speculatio de hiis, quae non sunt separata a suis materiis nec in esse nec in intellectu; aut est speculatio de hiis, quae sunt separata a materia in intellectu, non in esse; aut speculatio de hiis, quae sunt separata a materia in esse et in intellectu.27
____________________________________________________________________________________________
21 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 103. 22 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15. 23 Vgl. Manuel Alonso, „Influencia de Severino Boecio en las obras y traducciones de Gundisalvo“, art. cit., S. 370. 24 Vgl. Philip Merlan, From Platonism to Neoplatonism, Den Haag 1953, S. 74: „He [= Dominicus Gundissalinus] claims to quote our Boethius passage but he certainly quotes it in a most peculiar way. [...] As we see, Gundissalinus instead of quoting, quietly corrects Boethius in two ways. Whatever the resaon, he describes mathematicals as moved and perceiving that it is difficult to designate both physicals and mathe-maticals by any one and the same term (e.g. either as abstracta or as inabstracta) corrects Boethius for a second time.“ Im folgenden tendiere ich allerdings zu der umgekehrten Reihenfolge der Korrekturen. 25 Vgl. Henri Hugonnard-Roche, „La classification des sciences de Gundissalinus et l’influence d’Avicenne“, in: Jean Jolivet u. Roshdi Rashed (Hrsg.), Études sur Avicenne, Paris 1984, S. 41-75, hier v.a. S. 46-47. 26 Vgl. hierzu Manuel Alonso „Traducciones del árabe al latín de Juan Hispano (Ibn DÁwÙd)“, in: Al-Anda-lus 17 (1952), S. 129-151, hier bes. S. 143-145. 27 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 14-15. – Vgl. damit Avicenna, Logica, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1961, fol. 2rb: „Partes ergo scientiarum sunt aut speculatio de conci-piendo ea quae sunt cum hoc quod habent in motu esse et existentiam et pendent ex materiis propriarum specierum, aut speculatio secundum quod sunt separata ab his in intellectu tantum, aut secundum quod sunt
Gundissalinus und Boethius 43
In Übereinstimmung mit Avicenna teilt Gundissalinus hier die spekulativen Wissenschaften in solche, deren Gegenstände weder dem Sein noch dem Erkennen nach abgetrennt sind, in solche, deren Gegenstände zwar dem Sein nach nicht abgetrennt sind, aber dem Erkennen nach, sowie in solche, deren Gegenstände dem Sein nach und dem Erkennen nach gleicher-maßen abgetrennt sind. Diesen drei spekulativen Wissenschaften werden sodann in der an-geführten Reihenfolge die Namen scientia physica sive naturalis, scientia mathematica und theologia sive scientia prima zugeordnet. Die Physik betrachtet mithin jene Gegenstände, die sowohl ontisch als auch noetisch unabgetrennt vorliegen, die Mathematik jene, die zwar ontisch nicht abgetrennt sind, aber noetisch abgetrennt werden können, und die göttliche Wissenschaft verstanden als Metaphysik jene, die ontisch und noetisch abgetrennt sind. Der Sache nach unterscheidet sich diese Einteilung nicht von der rechtverstandenen Klassifika-tion des Boethius, wohl aber begrifflich. So ist zu beachten, daß Gundissalinus in dem hier vorgestellten Zusammenhang nicht von abstracta und inabstracta spricht, sondern von se-parata. Das separari taucht zwar bereits in Boethius’ Einteilung auf, allerdings ist seine Be-deutung bei diesem noch synonym zu abstracta zu verstehen. Bei Gundissalinus scheint hingegen eine klare Festlegung dieses Begriffs gerade in Abhebung vom Begriff abstracta vorgenommen zu werden: separata ist zunächst eine ontologische Qualifizierung, die freilich auch epistemologisch relevant wird, insofern als das seinsmäßig Getrennte zwangsläufig auch getrennt erkannt wird. Dies wird etwa bei der gundissalinischen Abgrenzung von Ma-thematik und göttlicher Wissenschaft bzw. Metaphysik deutlich. Beide sind nach seiner Ein-teilung als abstracta zu bezeichnen, doch ist dies nur ein Teilaspekt der Bestimmung der göttlichen Wissenschaft:
Utraque igitur abstracta dicitur, quia de rebus prout extra materiam sunt utraque loquitur. Sed mathematica agit de abstractis a materia per intellectum, theologia de separatis a ma-teria per effectum. Illa enim habent esse in materia, sed intelliguntur absque materia, haec vero simul habent esse et intelligi extra materiam.28
Die Abstraktion ist also eine Leistung des Intellekts, die Separation eine im Sein vorfindbare Bestimmung „per effectum“. Was dem Sein nach abgetrennt ist („separatus“), wird auch abgetrennt erkannt („abstractus“), insofern lassen sich beide Wissenschaften nach Gundissa-linus als abstracta bezeichnen. Umgekehrt jedoch, und auch dies läßt sich anhand der zitier-ten Passage erkennen, sagt das abstracta seinerseits nichts über den ontologischen, sondern lediglich über den epistemologischen Status des Erkannten aus. Das Erkannte kann unter Abstrahierung von der Materie erkannt werden, ohne daß es darum per effectum, also seins-mäßig, von dieser getrennt wäre. Eben dies ist der Fall der Mathematik. Gundissalinus’ Abstraktionsbegriff Wie sich diese im Gegensatz zu Boethius rein epistemologische Abstraktion vollzieht, be-schreibt Gundissalinus abermals im Rückgriff auf Avicenna, diesmal auf den ebenfalls von
____________________________________________________________________________________________
separata ab his in esse et intellectu. Prima autem pars divisionis est scientia naturalis. Secunda est discipli-nalis [...] Pars vero tertia est scientia divina.“ 28 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 42.
44 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
ihm und Avendauth aus dem zweiten Teil des KitÁb aš-šifÁÞ übersetzten Traktat De anima, folgendermaßen:
Zunächst definiert er die Abstraktion als eine bestimmte Apprehension der Form eines Gegenstandes, wobei er vier verschiedene Stufen der Abstraktion unterscheidet. Nämlich jene, die durch die Sinne, allen voran den Gesichtssinn (visus), geschieht; jene, die durch die Vorstellungskraft (imaginatio) geleistet wird; eine andere, die der Schätzung (aestimatio) eignet; und wieder eine andere, die der Vernunft (intellectus) zukommt. Durch die Abstrak-tion der Sinne wird eine unvollkommene Abstraktion geleistet, bei der die Dinge nur in Ver-bindung mit der Materie und einer Reihe akzidenteller Bestimmungen erfaßt werden. Auch die durch die Vorstellungskraft geleistete Abstraktion ist imperfekt, insofern als auch sie nur das einzelne, akzidentell Bestimmte erfassen kann. Erst die Schätzung bzw. aestimatio „transzendiert“, wie Gundissalinus sagt, das einzelne, indem sie zu den „intentiones immate-riales“ der Dinge vorstößt, wie etwa Gestalt, Farbe und Lage, die zwar allesamt nur in Ver-bindung mit der Materie sein können, die in der aestimatio jedoch ohne diese erfaßt werden. Diese Abstraktionsform ist nach Gundissalinus reiner als die beiden vorangestellten. Doch gibt es über sie hinausgehend noch eine vierte und letzte, die der Vernunft, die sowohl die Formen betrachtet, die bereits ihrem Sein nach als abgetrennt und damit ohne Materie vor-liegen, als auch jene, die zwar in der Materie vorgefunden werden, die aber offenbar nicht zwangsläufig als ihrem Sein nach von dieser unabtrennbar gedacht werden, wie etwa die Gattungs- und Artbegriffe.29
Mit diesen Überlegungen legt Gundissalinus ein komplexes Abstraktionsmodell noeti-scher Prägung vor, das sich seinerseits auf die drei spekulativen Wissenschaften zurückbe-ziehen läßt. So wären nach diesem Modell die beiden unvollständigen Abstraktionsformen, die durch die Sinne und die Vorstellungskraft stets auf das einzelne gehen, der Physik zuzu-ordnen. Diese ist dann insofern als inabstrakt zu bezeichnen, als die in ihr geleistete Ab-straktion eine in hohem Maße defiziente ist. Die Abstraktionsform der Schätzung oder aesti-matio kommt der Mathematik zu, die jene Dinge zu betrachten hat, die zwar ihrem Sein nach in der Materie sind, jedoch noetisch von dieser abtrennbar sind. Insofern als die aestimatio in Gundissalinus’ Darstellung bereits eine reinere Form der Abstraktion bezeichnet, ist die Mathematik als abstracta zu fassen. Die Abstraktionsform des intellectus hingegen, die zum einen die von der Materie bereits seinsmäßig abgetrennten Formen betrachtet sowie zum anderen jene Formen, die zwar in den Dingen vorgefunden werden, die jedoch nicht zwangsläufig in ihrem Sein an die Materie gebunden sind, eignet der göttlichen Wissenschaft bzw. Metaphysik, die darum als abstracta klassifiziert wird. Daraus wird deutlich, wie Gun-dissalinus zu seiner Bestimmung der Mathematik als abstracta gelangt, oder, wie er zuwei-len präziser formuliert, als „scientia abstractiva“,30 womit der prozessuale Vorgang der noeti-schen Abstraktion eingeholt wird.
Offen bleibt dabei zunächst noch die Frage, wieso die Mathematik, wiederum in deutli-chem Gegensatz zu Boethius, bei Gundissalinus als cum motu bestimmt wird. Man könnte zunächst annehmen, daß es sich hier um einen äußerlichen Systemzwang handelt, denn
____________________________________________________________________________________________
29 Siehe zur hier resümierten Abstraktionslehre Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 28-30. – Vgl. damit Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1968 u. 1972, hier Bd. I, pars 2, cap. 2, S. 114-121. 30 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 28.
Gundissalinus und Boethius 45
bliebe die Qualifizierung der Mathematik des Boethius als sine motu unter gleichzeitigem Hinzukommen des gundissalinischen abstracta für das boethianische inabstracta erhalten, so wären damit die Grenzen zwischen Mathematik und göttlicher oder metaphysischer Wis-senschaft aufgehoben. Beide würden dann als abstracta et sine motu bestimmt werden. Dies war auch die Sorge des Clarembald von Arras, wie bereits gezeigt wurde. Gleichwohl scheint diese Veränderung einen tieferliegenden, sachlichen Grund zu haben: Denn nachdem Gun-dissalinus den Abstraktionsbegriff als epistemologisches Kriterium der Einteilung der Wis-senschaften festgelegt hat, führt er nun dieselbe Festsetzung auf Seiten des Bewegungskrite-riums durch, das als Indikator der ontologischen Verfaßtheit der Gegenstände der spekulati-ven Wissenschaften fungiert. Wenn Boethius in seiner Einteilung die Gegenstände der Phy-sik als cum motu bezeichnet, die der Mathematik jedoch als sine motu bestimmt, so hebt er damit eben nicht auf ihren ontologischen Status ab, sondern auf ihren Platz in der Ordnung der Erkenntnis, wie bereits oben ausgeführt. Wenn dagegen bei Gundissalinus die Gegen-stände der Mathematik als in Bewegung befindlich beschrieben werden, so steckt dahinter die Überzeugung, daß diese ebenso wie die Gegenstände der Physik nicht für sich bestehen, sondern nur in Verbindung mit der Materie; dagegen sind die Gegenstände der göttlichen Wissenschaft als sine motu zu qualifizieren, da sie nicht nur im Erkennen, sondern auch im Sein für sich existieren können. So wie die Bestimmung der Abstraktion von Gundissalinus als epistemologisches Kriterium unter Rückgriff auf Avicenna erfolgt ist, so steht auch bei der nun vorgenommenen Festlegung der Bewegung als ontologisches Kriterium eine arabi-sche Quelle im Hintergrund. Diesmal ist es ein in der Divisio philosophiae ebenfalls kurz vor dem Boethius-Zitat bei Gundissalinus paraphrasierter Abschnitt aus al-ÇazzÁlÐs MaqÁÒid al-falÁsifa. Auch diese wurden von Gundissalinus unter dem Titel Summa theoricae philo-sophiae übersetzt. Die entsprechende Stelle in der Divisio philosophiae lautet:
Omnia quae intelliguntur aut omnino sunt extra materiam et motum, nec coherent corpori-bus convertibilibus et mobilibus, ut deus et angelus [...] aut omnia sunt in materia et motu, ut figura et humanitas.31
Aus der Parallelisierung von esse bzw. non esse in materia mit esse bzw. non esse in motu, die übrigens nicht von al-ÇazzÁlÐ stammt, sondern einen Zusatz des Gundissalinus innerhalb des ansonsten fast wörtlichen Zitates darstellt, läßt sich klar ersehen, daß Gundissalinus das Bewegungskriterium als rein ontologisches Kriterium versteht, während es bei Boethius epistemologisch verstanden wurde. Dort stand zu lesen: „mathematica [...] speculatur sine materia et per hoc sine motu“, wobei der Akzent hier auf „speculatur“, also auf die Betrach-tung zu legen ist. Die Qualifizierung der Mathematik als cum motu bei Gundissalinus ist mithin nicht etwa eine lästige Konzession in der Folge der Korrektur des inabstracta zu ab-stracta, die rein äußerlich die Distinktheit der einzelnen Wissenschaften gewährleisten soll, vielmehr bildet sie das sachliche Pendant zu der von Avicenna herkommenden noetischen Abstraktion, das von Gundissalinus in Anlehnung an al-ÇazzÁlÐ entwickelt wird. ____________________________________________________________________________________________
31 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 14. – Vgl. damit al-ÇazzÁlÐ, Algazel’s Metaphysics. A Mediaeval Translation, ed. Joseph Thomas Muckle, Toronto 1933, S. 3: „[...] omnia quae in-telliguntur, vel sunt omnino extra materiam nec coherent corporibus convertibilibus et mobilibus, ut est ipse deus altissimus et angelus [...]“
46 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Schwierigkeiten in Gundissalinus’ Interpretation An die Grenzen seiner Korrektur des Boethius – dies soll nicht verschwiegen werden – ge-langt Gundissalinus bei der genaueren Untersuchung der Arithmetik, die für ihn nicht nur irgendeinen Teil der Mathematik repräsentiert, sondern ihren bedeutendsten. So wird die Arithmetik von ihm folgendermaßen definiert:
Genus eius est, quod ipsa est prima omnium matheseos disciplinarum, quae inabstracta considerat et sine motu.32
Die Brisanz dieser Definition liegt auf der Hand, denn gerade in dieser Weise hatte Boethius die Mathematik bestimmt, bevor er von Gundissalinus korrigiert wurde.
Man hat hierfür zwei Erklärungen gegeben: Die erste bemüht sich erst gar nicht um ein angemessenes Verständnis der Problematik, sondern begnügt sich mit der Feststellung, Gun-dissalinus, der ohnehin kein besonders sorgfältiger Denker gewesen sei, habe an dieser Stelle Boethius einfach abgeschrieben und dabei vergessen, ihn zu korrigieren. Diese Explikation besäße eine gewisse Plausibilität, wenn sich nachweisen ließe, daß zwischen der Korrektur der boethianischen Definition im Zusammenhang mit der Mathematik und ihrer unkorrigier-ten Wiederaufnahme anläßlich der Arithmetik eine längere Zeitspanne nicht nur im Textsub-strat, sondern auch im Leben des Archidiakons läge. Doch schon der weitere Fortgang des Textes straft diese Hypothese Lügen, denn nur wenige Seiten nach der Behandlung der Arithmetik untersucht Gundissalinus die Geometrie, also einen weiteren Teil der Mathema-tik, und dieser wird von ihm als abstracta et cum motu beschrieben, womit er seine Korrek-tur an Boethius wieder aufgreift.
Die zweite Erklärung weist darauf hin, daß bei Avicenna oder zumindest in Gundissali-nus’ Lesart des Avicenna die Zahl, numerus, als bewegungslos, die geometrischen Figuren hingegen als bewegt gedacht werden.33 Dies könnte Gundissalinus dazu veranlaßt haben, die Gegenstände der Arithmetik, anders als die der Geometrie, ihrem Sein nach als von der Ma-terie getrennt, d.h. bewegungslos, zu qualifizieren. Offen bleibt dann jedoch, wieso die Arithmetik darüber hinaus auch noch inabstrakt sein soll. Es sei denn, man nimmt an, daß diese Bestimmung selbst nicht auf sachliche Gründe zurückgeht, sondern einzig die Di-stinktheit der Arithmetik gegenüber der Metaphysik zum Ausdruck bringen soll.34
Doch scheint die Quelle für Gundissalinus’ Überlegungen an dieser Stelle nicht Avicenna zu sein, sondern der kurz vor der Bestimmung der Arithmetik als inabstracta et sine motu zitierte al-FÁrÁbÐ mit seinem von Gundissalinus unter dem Titel De scientiis übersetzten und massiv überarbeiteten KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm. Gundissalinus gibt diesen in der Divisio folgen-dermaßen wieder:
Numerus ergo de hiis est, quae utroque modo considerantur, in se scilicet et in materia, cum motu et sine motu.35
____________________________________________________________________________________________
32 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 92. 33 Vgl. Avicenna, Logica, ed. cit., fol. 2ra. 34 Siehe zu den beiden hier vorgestellten Erklärungsansätzen Henri Hugonnard-Roche, „La classification des sciences de Gundissalinus et l’influence d’Avicenne“, art. cit., S. 52-54. 35 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 90-91. – In Gundissalinus’ Adaptation von al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm heißt es: „Arithmetica est scientia de numero. Numerus vero duobus
Gundissalinus und Boethius 47
Offenbar hängt die Schwierigkeit bei der Bestimmung der Arithmetik mit eben dieser Zwit-tergestalt der Zahl zusammen, die auf zweierlei Weise betrachtet werden kann: einmal so, wie sie in sich ist („in se“), nämlich sine motu, also ihrem Sein nach von der Materie abge-trennt; ein andermal zusammen mit der Materie, in Bewegung. Zusammen mit der Materie wird die Zahl nach Gundissalinus betrachtet, sofern man nach dem Zählenden und dem Ge-zählten fragt, dies geschieht in den Rechenkünsten, dem praktischen Teil der Arithmetik; getrennt von der Materie wird die Zahl dagegen betrachtet, wenn man nach ihren Eigen-schaften fragt, etwa danach, ob sie gerade oder ungerade ist, und dies ist der theoretische Teil der Arithmetik.36 Der praktische Teil wäre damit als inabstracta et cum motu zu bestimmen; der theoretische als abstracta et sine motu. Der gundissalinische Vorschlag, die Mathematik als „media inter utramque“ zu beschreiben, d.h. als Mittleres zwischen Physik und göttlicher bzw. metaphysischer Wissenschaft,37 ist offenbar in Bezug auf die Arithmetik so zu verste-hen, daß sich die Arithmetik von diesen beiden genannten Wissenschaften nicht im Hinblick auf die Kombination des Abstraktions- und des Bewegungskriteriums unterscheidet, sondern alle vier diesbezüglich denkbaren Ausprägungen in sich vereinigt. Vor diesem Hintergrund ist die Bestimmung der Arithmetik als inabstracta et sine motu in gewisser Weise ungenü-gend, da sich in ihr jeweils nur eine Bestimmung des praktischen und eine des theoretischen Teils der Arithmetik wiederfinden lassen. Andererseits jedoch wird die Definition der Arithmetik durch diese Verschränkung der Kriterien selbst zu einer Chiffre für die von Gun-dissalinus eingeführte Zwittergestalt des Wesens der Zahl.
Bei alledem gilt es jedoch zu beachten, daß Gundissalinus seine Boethius-Korrektur kei-neswegs zurücknimmt, vielmehr stellt sich ihm hier ein neues, viel weiterreichendes Pro-blem, nämlich die Frage nach dem Wesen der Zahl und damit zugleich nach dem Verhältnis von Arithmetik und Physik einerseits sowie von Arithmetik und Metaphysik andererseits. Denn daß unter Abstraktion auch an dieser Stelle eine noetische Leistung zu verstehen ist und unter dem Bewegungskriterium ein ontologisches Argument, scheint unzweifelhaft.
Insgesamt zeigt sich damit eine nicht uninteressante terminologische Entwicklung des Abstraktionsbegriffs: Bei Boethius noch durch und durch ontisch konnotiert, bei seinen spä-teren Kommentatoren aus dem Umkreis der Schule von Chartres bereits äquivok in ontischer und noetischer Hinsicht gebraucht, wird der Begriff der Abstraktion bei Gundissalinus zu einem rein epistemologischen Konzept. Damit antizipiert Gundissalinus in gewisser Weise die von Thomas von Aquin eingeführte Distinktion von noetischer Abstraktion und ontischer Separation, die dieser in seinem Kommentar zu Boethius’ De Trinitate vornimmt.38 Hinter diesem terminologischen Wechsel läßt sich womöglich ein noch bedeutenderer Wandel kon-
____________________________________________________________________________________________
modis consideratur: in se et in materia. Ideo arithmetica alia est practica, alia est theorica.“ (Dominicus Gun-dissalinus, De scientiis, ed. cit, S. 85) 36 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 90: „Numerus enim in se consideratur, cum eius essentia et proprietas tantum attenditur, sicut quando accipitur abstractus ab omni sensato [...] In materia consideratur, cum attenditur ut aliquid eo numeretur, quemadmodum utentur eo in commerciis et in negotiationibus saecularibus. [...] Illa vero consideratio, qua numerus in se attenditur, dicitur theorica vel speculativa. Qua vero consideratur in materia, dicitur practica vel activa.“ 37 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 103. 38 Vgl. hierzu neben Siegfried Neumann, op. cit., S. 79-96, Louis-Bertrand Geiger, „Abstraction et sépara-tion d’après S. Thomas In De Trinitate, q. 5, a. 3“, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 31 (1947), S. 3-40.
48 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
statieren: Denn indiziert dieser terminologische Wechsel nicht zugleich den Übergang von einem primär ontologisch orientierten Denken zu einem stärker epistemologisch ausgerich-teten Paradigma?
Doch sollen diese Fäden hier nicht weitergesponnen werden; statt dessen soll auf das ur-sprüngliche Anliegen zurückgekommen werden, nämlich die Bedeutung der Rezeption der eigenen Tradition für die Integration des Neuen zu verstehen. Im Falle der Rezeption der boethianischen Gegenstandsbestimmung der Wissenschaften stießen die Chartreser Kom-mentatoren auf zahlreiche Schwierigkeiten, die sie allerdings angesichts eines fehlenden eindeutig bestimmten noetischen Abstraktionsbegriffs nicht klar fassen und lösen konnten. Ein solcher scheint jedoch mit Avicennas Abstraktionstheorie und der klaren Unterscheidung von ‚noetisch abstrahierbar‘ und ‚ontisch separierbar‘ gefunden zu sein, mit der letztlich die aristotelische Unterscheidung von ta. avcw,rista und ta. evx avfaire,sewj wiedergewonnen ist. Ergänzt wird diese Abstraktionstheorie ihrerseits durch die an al-ÇazzÁlÐ anknüpfende und zugleich über ihn hinausgehende ontologische Bestimmung der Gegenstände der Wissen-schaften anhand des Bewegungskriteriums. In beiden Fällen, und dies ist entscheidend, er-kennt Gundissalinus das in der arabischen Tradition vorhandene Potential sowie dessen Re-levanz für den boethianischen Ansatz, den er eben darum nicht nur rezipiert, sondern revi-diert. 2.2.3. Die boethianische Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Methoden Den zur soeben dargestellten Gegenstandsbestimmung der Wissenschaften komplementären Zug der boethianischen Wissenschaftsklassifikation, nämlich die Methodologie der Wissen-schaften, erörtert Dominicus Gundissalinus in einem seiner späteren Werke, seiner Kosmo-logie De processione mundi. Nachdem er in dieser zu Beginn zunächst den bekannten Vers 1, 20 des paulinischen Römerbriefs zitiert, demzufolge es von den geschaffenen und sicht-baren Dingen zu den unsichtbaren Dingen, d.h. letztlich zu Gott, aufzusteigen gilt,39 bringt er mit diesem Aufstiegsgedanken in einem zweiten Schritt die boethianische Methodendiskus-sion in Verbindung, die er folgendermaßen zitiert:
Unde dicitur, quod in naturalibus rationaliter, in mathematicis disciplinaliter, in theologi-cis intelligentialiter versari oportet.40
Der locus classicus für die boethianische Methodologie der Wissenschaften, auf den Gun-dissalinus hier abzielt, ist erneut der Traktat De Trinitate. Auch diesem Zitat des Gundissa-linus soll zunächst die boethianische Originalfassung gegenübergestellt sein; so unterscheidet Boethius in unmittelbarem Anschluß an die soeben besprochene gegenstandsorientierte Ein-teilung der Wissenschaften in scientia naturalis, mathematica und theologica dieselben nach ihren Methoden – auch dies ein Gedanke, der bei Aristoteles grundgelegt ist:41 ____________________________________________________________________________________________
39 Zur Auslegung dieses Verses bei einigen von Gundissalinus’ Zeitgenossen, insbesondere bei Peter Abae-lard vgl. Alexander Fidora, „Die Verse Römerbrief 1, 19ff. im Verständnis Abaelards“, in: Patristica et Me-diaevalia 21 (2000), S. 76-88. 40 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122. 41 Bereits Aristoteles, Metaphysik II, 3, 995a 12-17, fordert die Adäquanz von Gegenstand und Methode. So ist nach ihm nicht jede Methode auf jeden Gegenstand anwendbar. „Daher muß man dazu schon gebildet
Gundissalinus und Boethius 49
In naturalibus igitur rationabiliter, in mathematicis disciplinaliter, in divinis intellectualiter versari oportebit.42
Damit ist programmatisch in nur einem Satz die boethianische Methodologie der Wissen-schaften formuliert. Gerade der lakonische Charakter dieser Ausführungen ist es aber, der für die Interpretation dieser Passage zur Herausforderung wird.43 Während sich nämlich die rationale Methode der Physik sowie die intellektuelle Methode der göttlichen Wissenschaft bzw. Metaphysik mit Hilfe der entsprechenden Ausführungen des Boethius selbst, etwa aus der Consolatio, erklären lassen, steht der Leser mit der Charakterisierung der mathemati-schen Methode als „disciplinaliter“ vor einer deutlichen Schwierigkeit. Denn wiewohl der Ausdruck „disciplina“ ein zu Boethius’ Zeiten geläufiger Terminus ist, scheint das Adjektiv „disciplinalis“ bzw. das Adverb „disciplinaliter“ im Zusammenhang mit der Mathematik erstmals in De Trinitate aufzutreten und ist auch sonst in Boethius’ Opus nicht belegt, so daß hierzu von Boethius selbst keine Erläuterung zu gewinnen ist.
Eine Klärung des Terminus hat Siegfried Neumann versucht, der darauf hinweist, daß bei Boethius, ebenso wie zuvor bei Martianus Capella, der Begriff „disciplina“ gebraucht wird, um die Künste des Quadrivium von jenen des Trivium abzuheben, die als „artes“ im eigentli-chen Sinne bezeichnet werden, so daß ein Begriff aus der artes-Tradition auf die aristoteli-sche Philosophieeinteilung übertragen wird. Dabei, so Neumann, soll mit „disciplinaliter“ ein Vorgehen gemeint sein, das sich auf der Grundlage von Vernunft und Einbildungskraft voll-zieht. Diese Interpretation stützt sich allerdings nicht mehr auf eine Begriffsanalyse, sondern auf allgemeine Überlegungen zum Wesen der Mathematik. Das Problem der mathematischen Methode bei Boethius selbst, das hier jedoch nicht diskutiert werden soll, scheint damit wei-terhin offen, zumal Neumanns Interpretation ihrerseits Abgrenzungsfragen bezüglich der Mathematik und der göttlichen oder metaphysischen Wissenschaft aufwirft.44 Die Chartreser Interpretation der boethianischen Methodologie
Genau diese Fragen, d.h. jene nach der spezifischen Gestalt der mathematischen Methode sowie jene nach ihrem Verhältnis zur göttlichen Wissenschaft, waren es denn auch, welche die Kommentatoren des Aniciers im 12. Jahrhundert fesselten. Der erste unter ihnen, der Bischof von Poitiers Gilbert, kommentiert den in Frage stehenden Passus folgendermaßen:
Ac per hoc ‚in naturalibus‘ quae sicut sunt percipi debent, scilicet concreta et inabstracta, ‚oportebit‘ philosophum ‚versari rationaliter‘ [...] ‚In mathematicis‘ vero ubi inabstracta aliter quam sint i.e. abstractim attenduntur, oportebit eum versari ‚disciplinaliter‘ [...] ‚In
____________________________________________________________________________________________
sein, welche Weise man bei jedem Gegenstande zu fordern hat; denn unstatthaft ist es, zugleich die Wissen-schaft und die Weise ihrer Behandlung zu suchen, da jedes von diesen beiden für sich zu finden nicht leicht ist. Die genaue Schärfe der Mathematik aber darf man nicht für alle Gegenstände fordern, sondern nur für die stofflosen. Darum paßt diese Weise nicht für die Wissenschaft der Natur, denn alle Natur ist wohl mit Stoff behaftet.“ (Aristoteles, Metaphysik I-VI, ed. cit., S. 80/81) 42 Boethius, Die theologischen Traktate, ed. cit., S. 8/9. 43 Nicht ohne Grund bittet Boethius in seinem Traktat De hebdomadibus den Leser um Nachsicht für die „obscuritates brevitatis“ – ein Ausdruck, der gewiß auch auf den vorliegenden Passus zutrifft. Vgl. Boethius, Die theologischen Traktate, ed. cit., S. 34/35. 44 Vgl. zur skizzierten Interpretation Siegfried Neumann, op. cit., S. 48-57.
50 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
divinis‘ quoque quae non modo disciplina verum etiam re ipsa abstracta sunt ‚intellectua-liter‘ versari oportebit [...]45
Die Erklärung der Methodologie der Wissenschaften, die Gilbert hier vorschlägt, ist eine Rückanwendung eines der Kriterien, mit denen Boethius die Objektbereiche der Wissen-schaften bestimmt, nämlich der Abstraktion, auf deren Methoden. Damit scheint die Metho-dologie der Wissenschaften sich letztlich auf die Unterscheidung ihrer Objekte zu reduzie-ren.46
Weitaus differenzierter ist in dieser Hinsicht der Vorschlag Thierrys von Chartres in sei-nem Kommentar zu De Trinitate:
Et sciendum quod diversis animae viribus et comprehensionibus in physica, mathematica, theologia utendum est ad comprehendendum universitatem ut subiecta est his tribus spe-culativae partibus. Nam in theologia utendum est intellectibilitate sive intelligentia: in mathematica vero intellectu qui est disciplina: in physica ratione, sensu et imaginatione quae circa materiam comprehendunt quicquid comprehendunt.47
Für Thierry hängt die boethianische Methodologie der Wissenschaften mit den Vermögen der Seele, den „vires animae“ (und nicht etwa den Objekten), zusammen, womit sich ihm das folgende Problem stellt: Während die Methode der Physik („rationabiliter“) ebenso wie jene der göttlichen Wissenschaft oder Metaphysik („intellectualiter“) jeweils einem Seelenver-mögen entsprechen, nämlich der „ratio“ und dem „intellectus“, scheint es, daß sich die Ma-thematik, die „disciplinaliter“ verfährt, nicht auf ein Seelenvermögen, sondern auf den Lern-prozeß bezieht. Thierry versucht diese Schwierigkeit zu lösen, indem er der Mathematik das intellektuelle Vermögen und damit den „intellectus“ („intellectu qui est disciplina“) zuord-net, während er das Vermögen der göttlichen Wissenschaft mit einem Neologismus als „in-tellectibilitas“48 bestimmt, die er ihrerseits mit der „intelligentia“ identifiziert.49 Damit ergibt sich eine klare Zuordnung von Seelenvermögen und Methoden der Wissenschaften: Die Physik verfährt vermittels der „ratio“ „rationabiliter“, die Mathematik vermittels des „intellectus“ „disciplinaliter“ und die göttliche Wissenschaft vermittels der „intellectibilitas“ „intellectualiter“. Ein entscheidender Mangel dieser Zuordnung liegt jedoch darin, daß sich das Adverb „intellectualiter“, das nach Boethius die Methode der göttlichen Wissenschaft
____________________________________________________________________________________________
45 Gilbert von Poitiers, op. cit., S. 86-87, nos. 38, 39 u. 41. 46 Für weitere Einzelheiten zu Gilbert und seiner Kommentierung der hier vorgestellten Passagen aus De Trinitate siehe auch Klaus Jacobi, art. cit., S. 511-528. 47 Thierry von Chartres, Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and His School, ed. cit., S. 164, no. 30. 48 Was das Substantiv ‚intellectibilitas‘ betrifft, so handelt es sich um einen der Schule von Chartres eigentümlichen Neologismus. Vgl. Jacqueline Hamesse, „Un nouveau glossaire des néologismes du latin philosophique“, in: ead. (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latini-tas‘, Louvain 1997, S. 237-254, hier S. 249-251. Boethius kennt allein das Substantiv ‚intellectibilia‘ und das entsprechende Adjektiv ‚intellectibilis‘, wie die folgende Passage aus seinem Kommentar zur Isagoge des Porphyrios belegt: „Intellectibile, quod unum atque idem per se in propria semper divinitate consistens, nulli unquam sensibus, sed sola tantum mente intellectuque capitur. [...] secunda vero est pars intellegibilis quae primam intellectibilem cogitatione atque intelligentia comprehendit [...]“ (Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta, ed. Samuel Brandt [CSEL XLVIII], Lipsiae 1906, Ia ed., lib. I, cap. 3, S. 8) 49 Für eine Analyse der Beziehung zwischen ‚intellectus‘, ‚intellectibilitas‘ und ‚intelligentia‘ bei Thierry siehe Peter Dronke, art. cit., bes. S. 365-367.
Gundissalinus und Boethius 51
bestimmt, von „intellectus“ herleitet, womit sich der „intellectus“ eher zur Beschreibung der göttlichen als der mathematischen Wissenschaft anzubieten scheint.
Virulent wird dieser scheinbar folgenlose Mangel im De Trinitate-Kommentar von Thierrys Schüler, dem Archidiakon Clarembald:
Vel ‚rationabiliter in naturalibus versari‘ oportet i.e. rationabiles causas inquirendo cur hoc tantum sit vel tale [...] ‚In mathematicis vero disciplinaliter‘ i.e. abstractive et intellectibi-liter philosopho versandum est [...] ‚In divinis‘ autem ‚intellectualiter‘ hoc est intellectibi-liter theologum ‚versari oportebit‘ [...]50
Clarembald folgt seinem Lehrer in der Erläuterung der Methode der göttlichen Wissenschaft als „intellectualiter“ mit Hilfe des Begriffs der „intellectibilitas“, der sich hier in der Form „intellectibiliter“ findet. Das Problem, das sich bei Clarembald ergibt, besteht jedoch darin, daß die Methode „intellectibiliter“ an der zitierten Stelle auch die Mathematik definiert. So-wohl die göttliche oder metaphysische Wissenschaft als auch die Mathematik verfahren „in-tellectibiliter“.51 Damit mündet der von Thierry und seinem Schüler Clarembald unternom-mene Versuch einer Klärung und Systematisierung der boethianischen Methodologie in einer Nivellierung derselben, in deren Folge die distinkten Methoden der einzelnen Wissenschaf-ten ineinander überzugehen drohen. Zusammenfassend läßt sich daraus der Schluß ziehen, daß die Methodologie der Wissenschaften des Boethius die Chartreser Kommentatoren des 12. Jahrhunderts vor eine Schwierigkeit stellt, die diese letzten Endes nicht zufriedenstellend lösen können.
Wie Gundissalinus Boethius ‚korrigiert‘
Doch wie verhält es sich nun mit Gundissalinus? Scheint es nicht so, daß für ihn letztlich dieselben Grenzen des Boethius-Ansatzes bezüglich der Zuordnung von Methoden und See-lenvermögen gelten, wenn er mit dem Anicier behauptet:
Unde dicitur, quod in naturalibus rationaliter, in mathematicis disciplinaliter, in theologi-cis intelligentialiter versari oportet.52
Doch was prima facie als ein wörtliches Boethius-Zitat erscheinen könnte – und so weisen es auch die Herausgeberinnen des De processione mundi ebenso wie Manuel Alonso aus –,53 ist in Wahrheit viel mehr als dies: In dieser Passage zitiert Gundissalinus Boethius nicht bloß,
____________________________________________________________________________________________
50 Clarembald von Arras, Life and Works of Clarembald of Arras. A Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. cit., S. 113-114, nos. 17-19. 51 Dementsprechend stimme ich nicht mit Wilhelm Jansen überein, der in seiner Thierry-Interpretation kategorisch ‚intellectibilitas‘ und Mathematik voneinander trennt: „Sie steht im Dienste der Theologen und bedarf keines Organes. Eine mira singularitas vor den übrigen Seelenkräften. An Subtilität übertrifft diese Erkenntniskraft in ihren Erwägungen die abstrakte mathematica consideratio.“ (Clarembald von Arras, Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius ‚De Trinitate‘, ed. cit., S. 55) 52 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122. 53 Vgl. ibid., S. 227 des Appendix, sowie Manuel Alonso, „Influencia de Severino Boecio en las obras y traducciones de Gundisalvo“, art. cit., S. 370.
52 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
sondern ‚korrigiert‘ ihn abermals, indem er das „intellectualiter“, das die göttliche Wissen-schaft bzw. Metaphysik kennzeichnet, in „intelligentialiter“ verwandelt.54
Nach dieser kleinen ‚Korrektur‘ kann Gundissalinus mit einer Paraphrase des Boethius fortfahren, diesmal der Consolatio V, pr. 4, ohne auf die Schwierigkeiten seiner Chartreser Kollegen zu stoßen:
Et rationi quidem sufficit possibilitas, demonstrationi vero necessitas, intelligentiae vero simplex et mera quaedam conceptio. Ad intelligentiam autem per intellectum sive per de-monstrationem, ad intellectum per rationem, ad rationem vero per imaginationem, et ad imaginationem vero per sensum ascenditur.55
Damit ist eine vollständige Auflistung der Seelenvermögen gegeben, die mit dem höchsten unter ihnen, nämlich der „intelligentia“ beginnt, auf welche der „intellectus“ folgt, auf diesen die „ratio“ sowie schließlich „imaginatio“ und „sensus“.56 Die ersten drei dieser Vermögen stimmen dabei dank der von Gundissalinus im Text des Boethius vorgenommenen Modifi-kation exakt mit den Methoden der Wissenschaften überein: die „intelligentia“ mit „intelli-gentialiter“, der „intellectus“ mit „disciplinaliter“ und die „ratio“ mit „rationaliter“. Indem Gundissalinus das boethianische „intellectualiter“ durch „intelligentialiter“ ersetzt – ein weiterer Neologismus im übrigen, der aus der Interpretation von De Trinitate hervorgeht –, gelingt es ihm, eben jene von Thierry und Clarembald angestrebte Korrespondenz von Wis-senschaften und Seelenvermögen zu etablieren, allerdings ohne auf die gleichen Probleme zu stoßen wie diese: Die Physik gründet in der „ratio“, die Mathematik im „intellectus“ und die göttliche Wissenschaft in der „intelligentia“.
Bis zu diesem Punkt mag Gundissalinus’ Unterscheidung der Seelenvermögen als bloß begriffliche erscheinen, doch beeilt er sich, diese neuen Begriffe mit Inhalt zu füllen:
[...] ratio formas sensibiles praeter materiam, intellectus formas intelligibiles tantum, in-telligentia vero unam simplicem formam utcunque, sed similiter apprehendit.57
Im Verlauf des Traktates wird er nun jedoch die beiden letztgenannten Vermögen beiseite lassen, da bei seinen kosmologischen Überlegungen die „ratio“ hinreicht, um vom Sichtbaren zu Gott, dem ersten Prinzip des Kosmos, aufzusteigen:
____________________________________________________________________________________________
54 Wie bereits das letzte Unterkapitel gezeigt hat, erweist sich bei genauerer Lektüre, daß Gundissalinus seine Referenzautoren nicht nur zitiert, sondern kreativ modifiziert. Auch hier ist allerdings darauf hinzuwei-sen, daß Gundissalinus’ Text von De Trinitate nicht vorliegt. Die Ausgabe von Peiper, ed. cit., S. 152, liefert jedoch keine Hinweise auf das Bestehen einer solchen Textvariante in der Überlieferung von De Trinitate. Gleiches gilt für die Ausgabe von Moreschini, ed. cit., S. 169. Umgekehrt läßt sich sagen, daß von den vier kollationierten De processione-Manuskripten nur ein einziges den ursprünglichen Boethius-Text wiedergibt, nämlich Oxford, Coll. Oriel n. 7. Es liegt nahe, zu vermuten, daß ein Schreiber Gundissalinus’ Korrektur hier rückgängig gemacht hat. 55 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122. 56 Gegenüber der im letzten Unterkapitel im Rahmen der Abstraktionstheorie vorgestellten Vermögenslehre, die nur vier Vermögen nennt, ist dies eine komplexere Anordnung, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, daß die Divisionsschrift im Frühwerk des Archidiakons anzusiedeln ist, De processione dagegen in späteren Jahren entstand. 57 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122.
Gundissalinus und Boethius 53
Unde per ea, quae facta sunt, invisibilia dei intellecta creatura mundi conspicit, cum ratio ad compositionem accedit hoc modo.58
Damit bleiben vorläufig verschiedene Fragen offen: Wie erkennt die „intelligentia“ die „una simplex forma“? Und welche ist die Differenz zwischen dem „intellectus“, der die „formae intelligibiles“ erfaßt, und der „intelligentia“, die lediglich die „una simplex forma“ erkennt? Beide erfassen die reinen Formen ohne Materie – steht Gundissalinus damit nicht erneut vor Clarembalds Dilemma?
Eine weiterführende Klärung der Unterscheidung zwischen „intelligentia“ und „intellec-tus“ findet sich in Gundissalinus’ Tractatus de anima, in dem er beide unter erneuter Beru-fung auf Boethius folgendermaßen voneinander abhebt:59
Sicut autem per intellectum scientia sic sapientia per intelligentiam acquiritur, quae secun-dum Boethium paucorum admodum hominum est et solius dei. Intelligentia enim est altior oculus animae quo se vel deum et aeterna contemplando speculatur.60
Die „intelligentia“ übersteigt den Bereich der Wissenschaften sensu stricto, also die Physik und die Mathematik, um zur „sapientia“, zur Weisheit, zu werden, womit sie sich Gott nä-hert: Nur wenige Menschen gibt es, die diese Stufe des Wissens erreichen, das letztendlich Gott allein eignet. Und so wie das körperliche Auge des Lichtes bedarf, um zu sehen, so muß auch die „intelligentia“, das Auge der Seele, erleuchtet werden, um ihren Gegenstand wahr-zunehmen:
Cum enim hic oculus animae qui est intelligentia in contemplationem creatoris intendit, quoniam deus est lux, ipsa intelligentia tanta claritate divini luminis perfunditur ut in ipsa intelligentia sic irradiata lux inaccessibilis tamquam forma in speculo resultare videatur.61
Dies ist also die Weise, in der die „intelligentia” die „una simplex forma“ erkennt: Sie muß von Gott, dem Vater der Lichter, erleuchtet werden, damit in ihr, wie in einem Spiegel, der Reflex der einen und einfachen Form widerscheine. Die „intelligentia“ ist folglich kein blo-ßer Akt des Menschen, vielmehr ist Gott selbst an ihr beteiligt: ja die Intelligenz ist göttlich.
Die beiden soeben kommentierten Passagen weisen große Ähnlichkeit mit zwei Formu-lierungen des Boethius aus seiner Consolatio auf. Die erste antizipiert das Motiv der „in-telligentia“ als Auge, das die einfache Form erkennt:
____________________________________________________________________________________________
58 Ibid. 59 Die folgenden Worte „paucorum admodum hominum“ lassen sich in Boethius’ Werken nicht nachweisen. Gleichwohl gibt es weitere Textzeugen, die diese Wendung mit Boethius verbinden, z.B. der Alcher von Clairvaux zugeschriebene Liber de spiritu et anima, PL 40, Sp. 808, sowie Peter Abaelard in seiner Logica ingredientibus, ed. Bernhard Geyer, in: BGPhMA XXI, 1-3, Münster 1919-1927, S. 330-331. Treffender dagegen bringt Wilhelm von Conches, Glosae super Platonem, ed. Édouard Jeauneau, Paris 1965, S. 102, diese Formulierung mit Calcidius’ Übersetzung des Timaios 51e in Verbindung; ebenso Clarembald von Arras in seinem Kommentar zu Boethius’ De Trinitate, ed. cit., S. 109, no. 8. Vgl. die entsprechende Stelle in Plato, Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. J. H. Waszink, Londoni et Leidae 1962, S. 50: „Intellectus vero dei proprius et paucorum admodum lectorum hominum.“ – Ein Passus, der zwar nicht dem Wortlaut, aber doch immerhin dem Sinn nach von Boethius in seiner Consolatio, V, pr. 5, aufgegriffen wird. 60 Dominicus Gundissalinus, Tractatus de anima, ed. cit., S. 99. 61 Ibid.
54 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Ratio vero hanc quoque transcendit speciemque ipsam quae singularibus inest universali consideratione perpendit. Intelligentiae vero celsior oculus existit; supergressa namque universitatis ambitum ipsam illam simplicem formam pura mentis acie contuetur.62
Die zweite Formulierung identifiziert die „intelligentia“ mit dem göttlichen Geist und hält den Leser dazu an, die Vereinigung mit ihr anzustreben:
Si igitur uti rationis participes sumus ita divinae iudicium mentis habere possemus, sicut imaginationem sensumque rationi cedere oportere iudicavimus, sic divinae sese menti humanam summittere rationem iustissimum censeremus. Quare in illius summae intelli-gentiae cacumen si possumus erigamur.63
Insgesamt läßt sich damit in Bezug auf die boethianische Methodendiskussion und ihre Auf-nahme bei Gundissalinus festhalten, daß die durch den Wechsel von „intellectualiter“ zu „intelligentialiter“ eingeführte ‚Korrektur‘ nicht bloß begrifflich bleibt, sondern der Aus-druck – und vermutlich auch der Ausgangspunkt – einer rigorosen Restrukturierung der boethianischen Erkenntnistheorie ist. Nach ihrer Behandlung durch Gundissalinus stellt sich Boethius’ Methodenlehre, die für Chartreser Autoren wie Thierry und Clarembald in ver-schiedener Hinsicht problematisch war, auf systematische und konsistente Weise dar: Jede einzelne der Methoden der Wissenschaften gründet in einem der Seelenvermögen, welche ihrerseits klar voneinander geschieden sind. Die von Aristoteles geforderte Gegen-standsadäquanz der wissenschaftlichen Methoden wird damit zumindest vermögenstheo-retisch eingeholt. „Intellectus“ und „intelligentia“ in den Übersetzungen des Gundissalinus Bislang ist das Problem der boethianischen Methodologie der Wissenschaften und ihrer Re-zeption bei Gundissalinus erörtert worden; zum Abschluß dieses Unterkapitels sollen nun die Verzahnungen dieser Rezeption bei der Übernahme und Integration der arabischen Philoso-phie untersucht werden. Es wurde in der Einführung bereits darauf hingewiesen, daß Gun-dissalinus gemeinsam mit Avendauth u.a. an die zwanzig Werke arabisch-jüdischer Denker ins Lateinische übersetzte, von denen ein Großteil erkenntnistheoretischen Fragen gewidmet ist, deren Komplexität den lateinischen Autoren fremd war.64 So gilt es, in den er-kenntnistheoretischen Schriften des Alexander von Aphrodisias (ins Arabische übersetzt), des al-KindÐ, des al-FÁrÁbÐ und des Avicenna eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen des Wortes Ýaql, das den griechischen nou/j übersetzt, auseinanderzuhalten, die durch ent-sprechende Zusätze gekennzeichnet werden: der verwirklichte Intellekt, der mögliche Intel-lekt, der erworbene Intellekt, der materiale Intellekt und der tätige Intellekt, der in der latei-
____________________________________________________________________________________________
62 Boethius, Consolatio philosophiae, ed. Ludovicus Bieler (CCSL XCIV), Turnhout 1957, lib. V, pr. 4, S. 97. 63 Ibid., pr. 5, S. 100. 64 So etwa: Alexander von Aphrodisias, De intellectu et intellecto, ed. Gabriel Théry, in: id., Autour du décret de 1210: II. Alexandre d’Aphrodise, Kain 1926, S. 68-83; al-KindÐ, De intellectu, ed. Albino Nagy, in: BGPhMA II, 5, Münster 1897, S. 1-11; al-FÁrÁbÐ, De intellectu et intellecto, ed. Étienne Gilson, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929), S. 115-141; Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. cit.
Gundissalinus und Boethius 55
nischen Welt noch besondere Aufmerksamkeit erfahren sollte. Während sich die vier ersten dieser Begriffe auf die menschliche Seele beziehen, wird der tätige Intellekt als vom Men-schen losgelöst betrachtet, insofern als er allererst die Bedingung für den Übergang des möglichen zum verwirklichten Intellekt (des Menschen) darstellt. Zugleich ist der tätige Intellekt für die arabischen Autoren, wie z.B. Avicenna, bezeichnenderweise von Gott un-terschieden.65 Trotz dieser großen Bedeutungsunterschiede sind alle Intellekte unter dem einen Konzept des Ýaql begriffen.66
In den von Gundissalinus angefertigten lateinischen Übersetzungen läßt sich dagegen eine Aufspaltung dieses Begriffs beobachten, so z.B. in dem folgenden Passus aus Gundissa-linus’ gemeinsam mit Avendauth angefertigter Übertragung des Seelenbuches aus dem zweiten Teil von Avicennas KitÁb aš-šifÁÞ, bekannt als Liber de anima seu sextus de natura-libus:
[...] anima rationalis cum coniungitur formis aliquo modo coniunctionis, aptatur ut contin-gant in ea ex luce intelligentiae agentis ipsae formae nudae ab omni permixtione. Primum autem quod percipit de eis humanus intellectus est id quod de eis est essentiale et acci-dentale.67
In diesem Abschnitt wird der tätige Intellekt, al-Ýaql al-faÝÝÁl, mit „intelligentia“ wiederge-geben, womit seinem Vorrang den anderen Intellekten gegenüber, die als „intellectus“ über-setzt werden, Rechenschaft getragen wird. Wie Jean Jolivet bemerkt hat, handelt es sich dabei jedoch nicht um eine reine Zufälligkeit, vielmehr gilt:
Cette traduction [...] utilise les mots ‚intelligence‘ et ‚intellect‘ d’une façon parfaitement régulière et précise. Le premier désigne toujours l’agent de la connaissance intellectuelle [...] Quant au mot intellect, la traduction latine l’emploie quand il est question de ce qui est intellectuel dans l’âme humaine.68
Damit ist die Unterscheidung von „intelligentia“ und „intellectus“, die Gundissalinus ausge-hend vom boethianischen Text entwickelt, bei Avicenna gleichsam wiedergefunden. Für die Rezeption der arabischen Philosophie bedeutet dies, daß einer ihrer charakteristischsten Züge verlorengeht: Während diese eine klare Unterscheidung von tätigem Intellekt und Gott be-hauptet, identifiziert Gundissalinus beide durch seine Übersetzung des tätigen Intellekts als „intelligentia“, insofern nämlich als für ihn, wie gezeigt wurde, die „intelligentia“ göttlich ist. Diese Modifikation der Lehre Avicennas hat Étienne Gilson dazu veranlaßt, mit Blick auf Gundissalinus von einem ‚augustinisme avicennisant‘69 zu sprechen – eine äußerst strittige ____________________________________________________________________________________________
65 Siehe zur arabischen Intellekttheorie z.B. Rafael Ramón Guerrero, „¿Qué es filosofía en la cultura árabe?“, in: Jan A. Aertsen u. Andreas Speer (Hrsg.), Was ist Philosophie im Mittelalter? (Miscellanea Me-diaevalia 26), Berlin u. New York 1998, S. 257-270, hier v.a. S. 267-268. 66 Ich folge Henri Hugonnard-Roche, „La tradition syro-arabe et la formation du vocabulaire philosophique latin“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), op. cit., S. 59-80, hier S. 76-77. 67 Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. cit., Bd. I, S. 128. 68 Vgl. Jean Jolivets für diese Erörterungen grundlegenden Artikel „Intellect et intelligence. Note sur la tradition arabo-latine des XIIe et XIIIe siècles“, in: S. Hossein Nasr (Hrsg.), Mélanges offerts a Henry Cor-bin, Teheran 1977, S. 681-702, hier S. 689. Sowie ferner id., „Étapes dans l’histoire de l’intellect agent“, in: Ahmad Hasnawi u.a. (Hrsg.), Perspectives arabes et médiévales sur la tradition scientifique et philosophique grecque, Louvain u. Paris 1997, S. 569-582. 69 Vgl. Étienne Gilson, „Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929-1930), S. 5-149, hier v.a. S. 85.
56 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Charakterisierung, die zum Schluß dieses Teils noch einmal überdacht werden soll,70 von der sich aber bereits jetzt sagen läßt, daß sie sich nicht zwingend mit den vermögenstheoreti-schen Reflexionen des Gundissalinus belegen läßt. Denn die von Gilson als alleiniger Beleg für seine These angeführte Identifizierung von Gott und tätigem Intellekt – so haben die voranstehenden Ausführungen gezeigt – ist unmittelbar boethianisch basiert und nicht etwa durch Augustinus vermittelt.
Wie eingangs erwähnt, sind die Boethius-Zitate in Gundissalinus’ Werk allgegenwärtig; doch imprägniert und formt die Beschäftigung des Archidiakons mit Boethius nicht nur sein Vokabular, vielmehr zeigt sich erneut, daß ihm die Konfrontation mit den Problemen der eigenen Tradition, hier der boethianischen Methodendiskussion, die Entwicklung eigener Positionen abverlangt. Diese Position, die strenge Trennung von „intelligentia“ und „in-tellectus“, wirkt ihrerseits auf den Übersetzungs- und Transmissionsprozeß ein, so daß die Rezeption und Integration der ‚neuen‘ und bis dahin ‚unbekannten‘ arabischen Philosophie letztlich in entscheidendem Maße auch durch die eigene christlich-lateinische Tradition und ihre immanenten Probleme konditioniert wird. Gleichzeitig plausibilisiert aber die so gele-sene arabische Intellektlehre eine originär lateinisch-christliche Position, indem diese in den Kontext einer äußerst elaborierten Erkenntnistheorie eingebettet wird. Die Konsequenzen dieser Konditionierung lassen sich noch bei Thomas von Aquin ausmachen, der sich – nicht ohne eine gewisse Irritation – auf folgende Weise zum Unterschied von „intelligentia“ und „intellectus“ äußert:
In quibusdam tamen libris de arabico translatis, substantiae separatae, quas nos angelos di-cimus, ‚intelligentiae‘ vocantur; forte propter hoc, quod huiusmodi substantiae semper actu intelligunt. In libris tamen de graeco translatis, dicuntur ‚intellectus‘ seu ‚mentes‘.71
Daß es sich jedoch nicht nur, wie der heilige Thomas zu suggerieren scheint, um ein rein terminologisches Übersetzungsproblem handelt, sondern weitergehende Reflexionen zur Erkenntnistheorie hier in die Übersetzungen mit eingegangen sind, dürfte deutlich geworden sein. 2.2.4. Die boethianische Axiomatik der Wissenschaften Neben den in den beiden vorangegangenen Abschnitten behandelten Fragen der Wissen-schaftseinteilung aus De Trinitate kann ein weiterer Problemkomplex aus Boethius’ Werk als zentral für seine Wissens- und Wissenschaftstheorie ausgemacht werden: Es handelt sich um die sogenannte Axiomatik der Wissenschaften,72 die in seinem kurzen, aber einflußreichen Traktat De hebdomadibus,73 auch Axiomenschrift genannt, grundgelegt ist. Boethius be-
____________________________________________________________________________________________
70 Siehe hierzu weiter unten 2.4. 71 Thomas von Aquin, Summa theologiae, iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, in: Opera omnia IV-XII, Romae 1889-1906, hier Ia, q. LXXIX, art. 10, resp., Bd. V, S. 277. 72 Siehe zur axiomatischen Methode und ihrer Geschichte die einschlägige Monographie von Mechthild Dreyer, More mathematicorum. Rezeption und Transformation der antiken Gestalten wissenschaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert, in: BGPhMA, N.F. 47, Münster 1996. 73 Vgl. zu dem nach wie vor rätselhaften Titel der Abhandlung Sarah Pessin, „Hebdomads: Boethius Meets the Neopythagoreans“, in: Journal of the History of Philosophy 37 (1999), S. 29-48, die einen Zusammen-
Gundissalinus und Boethius 57
stimmt hier in einem methodologischen Vorlauf zur eigentlichen Untersuchung, welche die Frage nach dem Gutsein der Substanzen behandelt, zunächst die wissens- und wissen-schaftstheoretischen Grundlagen derselben. Dabei postuliert er als Grundlage jeder Wissen-schaft communes animi conceptiones, d.h. dem Denken aller Menschen gemeinsame Begrif-fe, die als selbstevidente Prinzipien das unhintergehbare Fundament einer jeden Wissen-schaft ausmachen sollen, das seinerseits keines Beweises mehr fähig ist.74 Den Hintergrund dieser Auffassung bilden die Ausführungen des Aristoteles zum apodeiktischen Wissen aus den Analytica posteriora I, das für den Stagiriten in dem Wissen um die Notwendigkeit eines Sachverhaltes und seiner Ursachen besteht, womit letztlich alles Wissen auf zumindest in der jeweiligen Wissenschaft nicht weiter beweisbare Prinzipien, hier Axiome und Thesen ge-nannt,75 zurückgeht.76 Diese sind nach Aristoteles nicht nur die Anfangsgründe des epistemi-schen Wissens, sondern der apodeiktischen Wissenschaften überhaupt. Als paradigmatische Realisierung dieses bei Aristoteles entwickelten, aber nicht vollständig durchgeführten An-satzes gelten gemeinhin die Elemente des Euklid, auch wenn diese – wie sich später in Ka-pitel 3.4. zeigen wird – ein ganz bestimmtes Konzept von Axiomatik favorisieren, das nicht einfachhin identisch ist mit dem aristotelischen.77 Euklid konzipierte seine Elemente kurz nach Aristoteles um 300 v. Chr. im Museion von Alexandrien als Lehrbuch für den dortigen Unterricht, woraufhin sie in kurzer Zeit zu dem Lehrbuch der Mathematik schlechthin wer-den sollten. Charakteristisch für das Werk ist seine streng deduktive Vorgehensweise, mit deren Hilfe aus ersten, unbeweisbaren Prinzipien, die der Untersuchung vorangestellt wer-den, die Lehrsätze der Mathematik entwickelt werden.
Auch wenn diese ersten Prinzipien bei Euklid nicht Axiome, sondern gemeinsame Begriffe, koinai. e;nnoiai, genannt werden, ist die Übereinstimmung mit Aristoteles’ Ausfüh-
____________________________________________________________________________________________
hang zwischen Boethius und Nikomachos von Gerasa herstellt, dessen pythagoreischer Hintergrund Boethius hinsichtlich der Bedeutung der Zahl Sieben beeinflußt haben könnte. 74 Vgl. hierzu sowie zum Traktat insgesamt Gangolf Schrimpf, Die Axiomenschrift des Boethius (‚De hebdo-madibus‘) als philosophisches Lehrbuch des Mittelalters, Leiden 1966, der eine überzeugende Interpretation der Schrift vorlegt, auch wenn seine darauf folgende Behandlung ihrer Wirkungsgeschichte Dominicus Gun-dissalinus ausklammert. 75 Siehe zur genaueren Bestimmung dieser beiden Begriffe, von denen erstere sich auf die allen Wissenschaften gemeinsamen Regeln beziehen, während letztere die jeder einzelnen Wissenschaft spezifi-schen Voraussetzungen ihres Gegenstandes und seiner eigentümlichen Eigenschaften bezeichnen, weiter unten das Kapitel 3.4. 76 So heißt es in den Analytica posteriora I, 2, 71b 19-72a 17: „Wenn nun das Wissen die behauptete Beschaffenheit hat, so muß auch die apodeiktische, auf dem Beweis beruhende Wissenschaft aus Prämissen entspringen, die wahr sind, die ersten und unvermittelt sind und bekannter und früher sind als der Schlußsatz und Ursache von ihm. [...] Von den unvermittelten Prinzipien eines Schlusses nenne ich ‚Thesen‘ diejenigen, die man nicht beweisen kann und nicht jeder schon inne zu haben braucht, der irgend etwas lernen will, da-gegen nenne ich die Prinzipien, die jeder, der lernen will, inne haben muß, ‚Axiome‘.“ (Aristoteles, Philo-sophische Schriften I, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995, S. 3-5) 77 Auf wesentliche Unterschiede zwischen aristotelischer und euklidischer Axiomatik weist auch Miklós Maróth, Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden u.a. 1994, S. 135-138, hin.
58 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
rungen unverkennbar.78 Beide Texte waren Boethius vertraut,79 als er seiner Axiomenschrift die folgende wissenstheoretische Überlegung voranstellte:
Communis animi conceptio est enuntiatio quam quisque probat auditam. Harum duplex modus est. Nam una ita communis est, ut omnium sit hominum, veluti si hanc proponas: ‚Si duobus aequalibus aequalia auferas, quae relinquantur aequalia esse‘, nullus id intelli-gens neget. Alia vero est doctorum tantum, quae tamen ex talibus communibus animi con-ceptionibus venit, ut est: ‚Quae incorporalia sunt, in loco non esse‘, et cetera; quae non vulgus sed docti comprobant.80
Boethius unterscheidet damit zwei Arten selbstevidenter Prinzipien: jene, die allen Menschen gleichermaßen zukommen, sowie jene, die nur den Gelehrten zugänglich sind. Vor dem Hintergrund der Elemente ist dies durchaus erklärbar, wie sich zeigen wird; für die Philoso-phen des 12. Jahrhunderts allerdings, bei denen sich die Kenntnis dieses Textes erst allmäh-lich durchsetzt,81 bedeutet diese eigentümliche Dichotomie eine deutliche Interpre-tationsherausforderung. Denn wie ist es zu erklären, daß selbstevidente Prinzipien, die allen gemein sein sollen, nur bestimmten Menschen zuteil werden? Erste Annäherungen: Thierry, Gilbert und Clarembald Einen ersten Versuch, dieses scheinbare Paradox nicht-allgemeiner allgemeiner Prinzipien zu lösen, unternimmt Thierry von Chartres in seinem Fragment gebliebenen De hebdomadibus-Kommentar, der mit der Besprechung des ersten boethianischen Axioms abbricht. Zur Dopplung der ersten Prinzipien in solche, die allen Menschen gleichermaßen zugänglich sind, und jene, die den Gelehrten vorbehalten bleiben, äußert er sich folgendermaßen:
‚Harum duplex modus est‘ quasi dicat: per se notum aliud est per se notum absolute, aliud inter doctos. Et hoc est: ‚ut omnium sit hominum‘ i.e. ut omni homini per se sit illa ‚enuntiatio‘ nota. ‚Alia vero doctorum‘ ut solis scilicet sit nota sapientibus. ‚Quae tamen‘
____________________________________________________________________________________________
78 Spätere Autoren jedoch beziehen sich auf diese ‚gemeinsamen Begriffe‘ des Euklid stets unter dem Titel ‚Axiome‘. So etwa Proklos in seinem Kommentar zu Euklids Elementen. Vgl. Proklos, A Commentary on the First Book of Euclid’s ‚Elements‘, trans. with an introd. and notes by Glenn R. Morrow, Princeton 1970, S. 62: „When a proposition that is to be accepted into the rank of first principles is something both known to the learner and credible in itself, such a proposition is an axiom.“ 79 Von den Elementen ist eine auf Boethius zurückgehende partielle Übersetzung erhalten. Siehe Menso Fol-kerts, ‚Boethius‘ Geometrie II, ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters, Wiesbaden 1970. Hier findet sich auch der Ursprung der lateinischen Formulierung der communis animi conceptio, so heißt es S. 117: „Communes igitur animi conceptiones sunt, quae a Graecis cenas ethnias [= koinai. e;nnoiai] vocantur.“ Vermutlich existierte sogar eine lateinische Übersetzung der Analytica posteriora von Boethius, die aller-dings früh verlorenging. So Lorenzo Minio-Paluello im Vorwort zur Edition der Analytica posteriora-Über-setzungen in Aristoteles latinus IV, 1/4, 2 fasc., Brügge u. Paris 1968, hier fasc. I, S. XII-XV. 80 Boethius, Die theologischen Traktate, ed. cit., S. 34-37. 81 Die fragmentarische Übersetzung der Elemente durch Boethius kann für die gegenwärtige Untersuchung als vernachlässigbare Größe gelten, da ihr Einfluß auf die Philosophie verschwindend gering war. Erst die vollständigen Übersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische im 12. Jahrhundert verhelfen den Ele-menten zum Durchbruch als philosophischer Texte. Vgl. John E. Murdoch, „The Medieval Euclid: Salient Aspects of the Translations of the Elements by Adelard of Bath and Campanus of Novara“, in: Revue de synthèse 89 (1968), S. 67-94, hier S. 68.
Gundissalinus und Boethius 59
et cetera. Ac si dicat: quamvis tantum constet inter doctos ‚tamen‘ ex per se notis absolute descendit i.e. si opus fuerit per illa poterint tantummodo quae inter doctores constant comprobari.82
Die Pointe dieser Interpretation liegt im Deduktionsverhältnis, das zwischen den beiden Klassen von Prinzipien etabliert wird.83 So sind die nur den Gelehrten zugänglichen Prinzi-pien für Thierry bei Bedarf direkt aus den unbedingt selbstevidenten Prinzipien ableitbar („descendit“). Der Unterschied zwischen dem vulgus und den doctores liegt demnach in der Fähigkeit, eine derartige Ableitung durchzuführen. Diese Interpretation fügt den boethiani-schen Ausführungen allerdings nur wenig hinzu, denn ungeklärt bleibt die Frage, wie eine solche Ableitung vorzustellen ist.84
Auch Gilbert von Poitiers geht in seinem Kommentar zur Axiomenschrift zunächst von einem solchen Ableitungszusammenhang aus, den er jedoch über Thierry hinausgehend mit disziplinentheoretischen Überlegungen verknüpft:
‚Alia vero‘ ita communis animi est quod non omnium hominum sed ‚doctorum tantum‘ modum ‚est‘. ‚Quae tamen venit ex talibus conceptionibus‘ quae, qualiter praedictum est, ‚communis‘ sunt ‚animi ut est haec: Quae incorporalia sunt, in loco non esse‘. Haec enim non quidem eius, quae dicitur „logicae rationis“, universalitate locus est sed – ex logicae loco veniens – naturalis.85
Mit dem letzten der hier zitierten Sätze wird die zweite Gruppe der Prinzipien dahingehend bestimmt, daß ihre Universalität nicht so zu verstehen ist, daß sie logisch begründet sei, vielmehr gehören sie der Naturphilosophie an. Damit wäre die Universalität der ersten Prin-zipien eine Frage der Logik: Die Nichtexistenz dieser Prinzipien ließe sich nicht denken, ohne in einen Widerspruch zu geraten. Die den doctores vorbehaltenen Prinzipien hingegen wären nicht logischer Natur, sondern naturphilosophischen Charakters, auch wenn sie letzt-lich aus den logischen Prinzipien herstammen („veniens“).86 Mit der Unterscheidung von
____________________________________________________________________________________________
82 Thierry von Chartres, Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and His School, ed. cit., S. 120, no. 7. 83 Nach Mechthild Dreyer, „Die literarische Gattung der Theoremata als Residuum einer Wissenschaft more geometrico“, in: Maarten J. F. M. Hoenen u.a. (Hrsg.), Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages, Leiden u.a. 1995, S. 123-135, hier S. 128, soll sich Thierry von Gilbert und Clarembald gerade dadurch unterscheiden, daß für ihn „kein Zusammenhang zwischen den als Beweisgründen dienenden Sätzen“ be-steht. Dem widerspricht jedoch der zitierte Passus, der einen eindeutigen Begründungszusammenhang zwi-schen ersten und zweiten Prinzipien annimmt. 84 Demgegenüber hebt allerdings Gangolf Schrimpf, op. cit., S. 62, die terminologische Eigenständigkeit des Kommentars hervor: „Thierry hat bereits eine fest ausgeprägte und sicher gebrauchte eigene Begriffssprache. Sie unterscheidet sich durchaus von der des Boethius.“ Bedauerlicherweise geht Schrimpf hier nicht auf Thierrys Diskussion der boethianischen Dopplung der Prinzipien ein. 85 Gilbert von Poitiers, op. cit., S. 191, no. 17. 86 Mechthild Dreyer, More mathematicorum. Rezeption und Transformation der antiken Gestalten wissen-schaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert, op. cit., interpretiert den in Frage stehenden Satz gerade anders herum, was jedoch vom Textbefund her nicht gerechtfertigt erscheint. So schreibt sie S. 120: „Im Kommentar zu De hebdomadibus folgt sodann die Unterscheidung zweier Arten von Axiomen. Axiome der ersten Gruppe seien – so führt Gilbert aus – naturhaft bekannt, insofern jeder, auch unabhängig von der Disziplin der Logik, sie als wahr erkenne. Zur zweiten Gruppe hingegen gehören solche, die abgeleitet aus der ersten – nur die Gelehrten als Axiome kennen würden.“ Irritierend ist dabei die Übersetzung von „naturalis“ als „na-
60 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
logischen und naturphilosophischen Prinzipien nähert sich Gilbert der ihm noch unbekannten aristotelischen Einteilung in allgemeine Prinzipien (Axiome) einerseits und den jeweiligen Wissenschaften eigentümliche Grundlagen (Thesen) andererseits, wie sie in den Analytica posteriora I ihren Niederschlag findet.87 Zusammengenommen mit der boethianischen Vorstellung der Ableitbarkeit dieser Prinzipien auseinander wird diese ansonsten erstaunli-che, disziplinentheoretische Interpretation Gilberts jedoch problematisch. Denn es stellt sich damit zunächst in verschärfter Weise die Frage nach dem Wesen der geforderten Ableitung sowie zudem jene nach der Selbständigkeit der Disziplinen, hier der Logik und der Natur-philosophie: Wie sollen aus Prinzipien der Logik solche der Naturphilosophie hervorgehen, und hat nicht vielmehr die Naturphilosophie ihre unhintergehbaren Grundlagen, die ihrerseits nicht aus der Logik gewonnen werden können?
Der erste Chartreser Autor, der Boethius’ communis animi conceptio unmittelbar mit Ari-stoteles in Zusammenhang bringt, ist Clarembald. So erläutert er diese im Prolog zu seinem De hebdomadibus-Kommentar mit Hilfe eines Zitates aus den Topica.88 Dieses ist zwar für das Verständnis der Axiome nicht unmittelbar einschlägig, es verweist jedoch darauf, daß Clarembald die Herkunft der boethianischen Überlegungen erahnt. Unberührt von dieser Rückführung auf Aristoteles bleibt allerdings seine anschließende Kommentierung der Dopplung der Prinzipien. Von dieser heißt es zunächst:
Duo autem omnium sunt genera per se notorum: unum quidem scholasticum et commune; aliud vero doctissimorum tantum, quod paene intellectibilitatis requirit capacitatem.89
Sowie etwas später: Duo proponit per se notorum genera: unum quidem absolute per se notorum, alterum ve-rum secundum quid.90
Mit der letzten Unterscheidung führt Clarembald den bereits bei Thierry angedeuteten Ge-danken absoluter und relativer erster Prinzipien aus („absolute descendit“, schreibt Thierry). Und auch das erstgenannte Zitat liegt in der Linie seines Lehrers, denn selbst wenn dieser in seinem De hebdomadibus-Kommentar nicht von „intellectibilitas“ spricht, so haben die Aus-führungen des letzten Unterkapitels deutlich gemacht, daß dieser Begriff von ihm herkommt. ____________________________________________________________________________________________
turhaft bekannt“, statt „naturphilosophisch“, mit der Dreyer zudem die Umkehrung des Ableitungsverhältnis-ses verbindet. 87 Vgl. Analytica posteriora I, 10, 76a 37-41: „Es sind aber von den Prinzipien, die man in den beweisenden Wissenschaften verwendet, die einen der jeweiligen Wissenschaft eigentümlich, die anderen allgemein [...] Zu den eigentümlichen Prinzipien gehört z.B., daß die Linie oder das Gerade die und die Wesensbeschaffen-heit hat, zu den allgemeinen Prinzipien der Satz, daß Gleiches, von Gleichem abgezogen, Gleiches läßt.“ (Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., S. 21) 88 Clarembald von Arras, Life and Works of Clarembald of Arras. A Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. cit., S. 189, no. 1: „Prima autem et vera per se nota illa sunt quae aliena probatione non egent. De cuiusmodi Aristoteles: ‚Non oportere, inquit, in disciplinalibus principiis inquirere propter quid sed unumquodque principiorum ipsum esse fidem.‘“ Es handelt sich um den letzten Satz des ersten Kapitels aus dem ersten Buch der Topica. – Clarembalds Herausgeber weist an dieser Stelle im Apparat darauf hin, daß auch in Gundissalinus’ De divisione philosophiae die allen zugänglichen Prinzipien als „prima“ bezeichnet werden; allerdings scheint diese Parallele zu schwach, um auf Abhängigkeiten zu schließen. 89 Vgl. Clarembald von Arras, Life and Works of Clarembald of Arras. A Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. cit., S. 190, no. 3. 90 Ibid., S. 198, no. 16.
Gundissalinus und Boethius 61
Anders als Gilbert versucht Clarembald mithin, die Dopplung der Prinzipien nicht über ein disziplinentheoretisches Argument zu lösen, sondern mit vermögenstheoretischen Reflexi-onen. Welche Schwierigkeiten diese jedoch in sich bergen, wurde bereits dargelegt.
Wie im Falle der Wissenschaftseinteilung und ihrer Methodologie läßt sich damit be-obachten, daß die Chartreser Autoren zentrale Probleme der boethianischen Konzeption er-kennen und einer Lösung zuführen wollen. Dabei gehen ihre Ansätze wesentlich über Boethius hinaus und weisen insbesondere im Falle Gilberts deutliche Parallelen mit Aristo-teles’ Systematisierungen auf, obgleich letztlich nicht hinreichend klar wird, wie das Ablei-tungsverfahren zwischen den Prinzipien der ersten und jenen der zweiten Klasse zu verste-hen ist.91 Um die aufgeworfene Frage sowie den axiomatischen Ansatz insgesamt besser zu verstehen, fehlt den Chartreser Autoren (neben den Analytica posteriora) ein wichtiger Be-zugstext: eben die Elemente des Euklid.92 Gundissalinus’ Verständnis der communes animi conceptiones Anders als im lateinischen Westen waren Euklids Elemente im arabischen Kulturkreis das ganze Mittelalter hindurch in Adaptationen und Übersetzungen verfügbar.93 Bereits ab dem frühen 9. Jahrhundert lassen sich mindestens zwei vollständige Übersetzungen der Elemente ins Arabische ausmachen: zum einen die Übertragung von al-ÍaÊÊÁÊ (8./9. Jahrhundert), zum anderen jene von IsÎÁq Ibn Íunain (†910); daneben existierten schon früh etliche Kommentare und Paraphrasen, etwa von an-NairÐzÐ (ca. 865-922) und Avicenna. Beide Übersetzungen sollten zum Ausgangspunkt auch der lateinischen Euklid-Tradition werden. So haben die drei Übersetzungen der Elemente, die mit Adelard von Bath in Verbindung gebracht wurden,94 ihren Ursprung in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in al-ÍaÊÊÁÊs Fassung, während jene des Gerhard von Cremona, die aus der zweiten Hälfte des 12. Jahr-hunderts stammt, auf die Version des IsÎÁq Ibn Íunain zurückgeht.95 Zeitlich zwischen die-sen beiden lateinischen Übersetzungen dürfte die Übertragung Hermanns von Carinthia an-____________________________________________________________________________________________
91 Der Vollständigkeit halber sei noch auf Alanus ab Insulis hingewiesen, ein dem Chartreser Kreis nahe-stehender Autor aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, der sich in seinen Regulae caelestis iuris auf die boethianische Unterscheidung zweier Arten von Prinzipien beruft: „Theologicarum autem maximarum aliae veniunt in notitiam multorum ut haec: unum esse principium rerum, aliae in notitiam paucorum i.e. sapien-tium ut haec: omne simplex esse suum et id quod est unum habet. De his quae vix veniunt in notitiam pauco-rum agendum.“ Vgl. Alanus ab Insulis, Regulae caelestis iuris, ed. Nikolaus M. Häring, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 48 (1982), S. 97-226, hier S. 123. Zur Verhältnisbestimmung beider Klassen finden sich jedoch bei Alanus keine Gedanken. 92 Zu Recht unterscheidet Gillian R. Evans daher zwischen einer rein boethianischen Axiomatik, der die Chartreser Autoren zuzurechnen sind, und einer euklidischen Axiomatik, welche sie für systematisch an-spruchsvoller hält, aber erst eine Generation später mit Nikolaus von Amiens beginnen sieht. Vgl. dazu ihren Aufsatz „Boethian and Euclidean Axiomatic Method in the Twelfth Century“, in: Archives internationales de l’histoire des sciences 30 (1980), S. 36-52. 93 Vgl. zur Geschichte des arabischen und lateinischen Euklid allgemein John E. Murdoch, „Euclid: Transmission of the Elements“, in: Dictionary of Scientific Biography IV (1971), S. 437-459. 94 Vgl. für eine Edition der ersten der adelardschen Übersetzungen H. L. L. Busard, The First Latin Transla-tion of Euclid’s ‚Elements‘ Commonly Ascribed to Adelard of Bath, Toronto 1983. 95 Gerhards Übersetzung wurde ediert von H. L. L. Busard, The Latin Translation of the Arabic Version of Euclid’s ‚Elements‘ Commonly Ascribed to Gerard of Cremona, Leiden u.a. 1984.
62 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
zusiedeln sein, die um die Mitte des Jahrhunderts entstanden ist.96 Mit den Übertragungen Hermanns und Gerhards zeigt sich bereits, daß gerade im Toledo des 12. Jahrhunderts ein großes Interesse an Euklids Elementen bestand. Es ist daher kaum verwunderlich, daß auch Gundissalinus diese Schrift kannte und verwendete:97
In jenem Kapitel seiner Divisionsschrift, das Gundissalinus der Mathematik widmet, be-handelt er ausführlich die demonstratio, die er als das Instrument der Mathematik auszeich-net. Gleichbedeutend mit demonstratio ist für ihn dabei der Begriff des Syllogismus, dessen Grundlagen er als „propositiones primae“ und „verae“ bestimmt. Interessant ist dabei zu-nächst, daß solche Propositionen für ihn sowohl sinnlicher (sensibilia) als auch intelligibler (intelligibilia) Art sein können. Zur Gruppe der ersten Propositionen gehören Erfahrungs-sätze wie die folgenden: „Feuer wärmt“, „Schnee ist weiß“, usw. Unter die Propositionen der zweiten Art zählt er den (analytischen) Satz: „Das Ganze ist größer als ein Teil von ihm.“ Letztere, d.h. die intelligiblen Propositionen, wiederum unterscheidet er nach zwei Klassen, deren erste er folgendermaßen definiert:
Prima sunt, quae cum primo audiuntur, statim conceduntur. Prima sunt, quae syllogismo-rum conclusiones esse non possunt, nulla enim sunt notiora eis, et ideo dicuntur per se nota, quia non possunt fieri nota per alia; unde apellantur communes animi conceptiones, quas quisque cum audit approbat.98
Damit wird klar, daß jene Propositionen, die Gundissalinus zuvor als intelligibilia bezeichnet hat, mit den communes animi conceptiones in Verbindung zu bringen sind, deren boethia-nische Definition hier wörtlich zitiert wird. Erläutert werden diese, übereinstimmend mit den Kommentaren der Chartreser Autoren, über ihre Selbstevidenz („per se nota“) und ihre dar-aus folgende Unbeweisbarkeit. Auffällig ist dabei bereits, daß das von Boethius bemühte Beispiel: Gleiches von Gleichem weggenommen, ergibt Gleiches, nicht erwähnt wird, son-dern dafür der oben angeführte Satz: Das Ganze ist größer als ein Teil von ihm. Boethius’ Beispielsatz findet sich sowohl in den Analytica posteriora I, 10 als auch in Euklids Ele-menten, wo er als drittes Axiom firmiert.99 Der von Gundissalinus bemühte Satz hingegen stellt das achte bzw. neunte Axiom der Elemente dar; diese Ersetzung ist nur möglich, weil Gundissalinus offenbar den Zusammenhang zwischen Boethius’ communes animi conceptio-nes und Euklids koinai. e;nnoiai erkennt.100 H. K. Kohlenberger sieht in eben dieser Ersetzung ____________________________________________________________________________________________
96 Hermanns Übertragung wurde ebenfalls herausgegeben von H. L. L. Busard, „The Translation of the Elements of Euclid From the Arabic Into Latin by Hermann of Carinthia (?)“, in: Janus 54 (1967), S. 1-140. 97 Wie Manuel Alonso gezeigt hat, war Gundissalinus zumindest mit den Werken von Ibn Íunains Vater vertraut; vgl. Manuel Alonso, „Íunayn traducido al latín por Ibn DÁwÙd y Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 16 (1951), S. 37-47. Es ist daher zu vermuten, daß er auch seine arabische Übersetzung der Elemente kannte, zumal er sich, wie ebenfalls Alonso zeigen konnte, in seiner Überarbeitung von al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm, d.h. in De scientiis, explizit inhaltlich auf Euklids Elemente bezieht und damit über al-FÁrÁbÐ hinausgeht. Vgl. Manuel Alonso in seiner Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 31-32. 98 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 32. 99 Vgl. Euklid, Die Elemente, übers. u. hrsg. von Clemens Thaer, Frankfurt am Main 1997, S. 3. 100 Die Identifizierung der communes animi conceptiones mit Euklids koinai. e;nnoiai ist – wiewohl begriffsgeschichtlich stringent – keinesfalls selbstverständlich. So sucht man in Version I der Adelard-Über-setzung sowie der Übertragung Hermanns von Carinthia vergeblich nach ihr. Adelard von Bath bezeichnet in Version I die euklidischen Axiome noch als scientia communis oder scientia universaliter communis, Her-mann transliteriert einfachhin den arabischen Ausdruck seiner Vorlage. Erst in den beiden späteren Versionen
Gundissalinus und Boethius 63
des dritten durch das achte bzw. neunte Axiom, die er erstmalig bei Thomas von Aquin, De potentia, q. V, art. 4, beobachten will, einen Beleg für die Wiederentdeckung des ursprüngli-chen aristotelischen Sinnes von ‚Axiom‘. Diese Sichtweise ist freilich nicht unproblematisch, folgt man ihr jedoch, so ist jedenfalls der aristotelische Sinn von ‚Axiom‘ nicht erst bei Thomas, sondern bereits mit Gundissalinus zurückgewonnen, der eben jene Ersetzung vor-nimmt.101 Sicher gilt hingegen, daß sich mit dieser Ersetzung gegenüber den Chartreser Auto-ren bei Gundissalinus der Versuch abzeichnet, die boethianische Axiomatik mit Hilfe der euklidischen Elemente zu deuten, womit die rein boethianische Axiomatik überwunden wird.102
Dieses Interpretationsparadigma nun erlaubt es Gundissalinus, zu einem wesentlich neuen Verständnis der zweiten Klasse der intelligiblen Prinzipien zu gelangen, die ebenfalls im Rückgriff auf Euklid folgendermaßen erläutert wird:
Secunda vero intelligibilia sunt, quae in demonstrationibus concluduntur, qualia sunt theo-remata Euclidis, quae postquam probantur per prima, in demonstratione assumentur, et ideo non sunt per se nota, quia non fiunt nota per se, sed per alia.103
Die hier vorgenommene Gleichsetzung der zweiten Klasse der Prinzipien, die laut Boethius nicht allen zugänglich sind, mit den euklidischen Theoremata104 offeriert ein vertieftes Ver-ständnis des Zusammenhangs beider Klassen von Prinzipien, der sich nun eben als der Zu-sammenhang der euklidischen Axiome und Theoreme darstellt. In diesem Licht ist die Dif-ferenz beider Klassen weder disziplinen- noch vermögenstheoretisch begründet, sondern erfolgt über die bei den Chartreser Autoren vermißte nähere Bestimmung des Ableitungszu-sammenhanges. Für die Elemente besteht dieser Ableitungszusammenhang in der syntheti-schen Verknüpfung der Axiome zu Theoremata, im Unterschied zur analytischen Entwick-lung, wie Gundissalinus selbst mit den Begriffen der resolutio und der compositio deutlich macht:
____________________________________________________________________________________________
Adelards sowie bei Gerhard findet sich ausdrücklich die in Frage stehende Gleichsetzung. Vgl. dazu Charles Burnett, „The Latin and Arabic Influences on the Vocabulary Concerning Demonstrative Argument in the Versions of Euclid’s Elements associated with Adelard of Bath“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), op. cit., S. 117-135, hier v.a. S. 122. 101 H. K. Kohlenberger, „Communes conceptiones“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie I (1971), Sp. 1024: „Mit der Aristotelesrezeption des Thomas ist der aristotelische Sinn von ‚Axiom‘ wiedererlangt. Dies kann auch den entsprechenden mathematischen Beispielen entnommen werden, so dem 8. euklidischen Axiom: ‚Das Ganze ist größer als der Teil.‘“ – Doch findet sich ja bereits bei Boethius mit dem Satz: „Glei-ches von Gleichem weggenommen, ergibt Gleiches“, ein mathematisches Beispiel, auch wenn der Heraus-geber des Boethius, Michael Elsässer, vorschlägt, diesen Satz in ein angeblich populäres Verständnis zu überführen: „Wenn man von Sand Sand wegnimmt, bleibt Sand übrig.“ Vgl. Boethius, Die theologischen Traktate, ed. cit., S. 122-123. 102 Damit wäre nicht etwa Nikolaus von Amiens als erster Repräsentant der euklidischen Axiomatik zu bezeichnen, wie es Gillian R. Evans, art. cit., tut, sondern bereits Dominicus Gundissalinus, auch wenn Ni-kolaus die erste umfangreichere Ausarbeitung dieses Gedankens vorlegen wird. 103 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 33. 104 Nach Proklos, op. cit., S. 63, versteht man hierunter die unmittelbar aus den Axiomen hervorgehenden Sätze; es ist bemerkenswert, daß Gundissalinus wie später Nikolaus von Amiens den Begriff bereits in die-sem Sinne verwendet. Hermann von Carinthia dagegen setzt ihn in seiner Übersetzung der Elemente, ed. cit., S. 11, mit den Axiomen gleich. Entsprechend wird der Begriff in der Schule von Chartres und auch noch bei Alanus ab Insulis als synonym zu demjenigen des Axioms verwandt.
64 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
[...] consideratio fit duobus modis: uno resolutionis et alio compositionis [...] Sed Euclidis in libro suo non incessit, nisi secundum viam compositionis. Qui enim a simplicioribus in-cipit, ut ad compositiora perveniat, quasi componendo ascendit, ut quod ex simplicibus compositum est ostendat. Sic Euclides cum a puncto incipit et deinde ad lineam, deinde ad superficiem et postea ad corpus pervenit, modo compositionis usus fuit [...]105
Rückbezogen auf Boethius bedeutet dies, daß die zweiten Prinzipien das Resultat einer syn-thetischen Verknüpfung der ersten Prinzipien wären. Damit eröffnet Gundissalinus eine ori-ginelle Perspektive auf das Verhältnis erster und zweiter Prinzipien in Boethius’ De heb-domadibus, die nicht durch analytische Entwicklung auseinander hervorgehen, sondern durch synthetische Verknüpfung gewonnen werden. Inwieweit diese Bestimmungen den aristotelischen Ansatz insgesamt sowie das für diesen charakteristische Verhältnis von Axiomen und Thesen im besonderen angemessen wiedergeben, kann in diesem Teil zunächst nicht weiter verfolgt werden, sondern erst in Kapitel 3.4.; entscheidend ist vielmehr, daß Gundissalinus mit ihnen einen weiteren Beitrag zum Verständnis der axiomatischen Methode liefert, der mit dem Gedanken der Synthese zumindest ein zentrales Motiv der aristotelischen Konzeption aufnimmt.106
Eingebettet ist die soeben diskutierte Distinktion der intelligibilia bei Gundissalinus in die bereits erwähnte Makrounterscheidung zwischen diesen und den sensibilia. Mit ihr geht der Archidiakon deutlich über den durch die boethianische Dopplung der Prinzipien abge-steckten Rahmen hinaus, die sich in diesem Licht als eine Binnenunterscheidung der intelli-gibilia erweist. Die Quelle für die Erweiterung des boethianischen Ansatzes scheint der von Gundissalinus übersetzte pseudo-al-kindÐsche107 Liber introductorius in artem logicae de-monstrationis zu sein, der im Rahmen seiner Diskussion der Elemente zu folgendem Schluß kommt:
Scias enim quod haec nota, quae vocantur prima intellecta, non adquiruntur in animabus intelligentium nisi per inductionem rerum sensibilium.108
____________________________________________________________________________________________
105 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 111. – Auf eine Parallelstelle hierzu in der Schrift De eodem et diverso des Adelard von Bath weist Charles Burnett, „The Latin and Arabic Influences on the Vocabulary Concerning Demonstrative Argument in the Versions of Euclid’s Elements associated with Adelard of Bath“, art. cit., S. 127, hin. Ich vermute eine gemeinsame arabische Quelle, etwa den von Gundissalinus übersetzten Pseudo-al-KindÐ, Liber introductorius in artem logicae demonstrationis, ed. Albino Nagy, in: BGPhMA II, 5, Münster 1897, S. 41-64, hier S. 53. 106 Insgesamt scheint es, daß Gundissalinus mit seiner synthetischen Deutung zwar einen wesentlichen Aspekt der Apodeixis zum Ausdruck bringt, daß er jedoch nicht das Ganze des aristotelischen Entwurfes erfaßt, der sich vielmehr gleichermaßen auf Analyse und Synthese stützt. Zum Verhältnis von Analyse und Synthese schreibt Wolfgang Detel in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Analytica posteriora, 2 Bde., Darmstadt 1993, Bd. I, S. 303: „In der Zweiten Analytik spielt natürlich die Analyse im Sinne des Verdich-tungsverfahrens nach I, 23 eine entscheidende Rolle. Sie ist methodisch eine bottom-up-Prozedur, die abge-schlossen sein muß, bevor die eigentliche Deduktion als ‚Synthese‘ oder top-down-Prozedur konstruiert werden kann.“ Man wird Gundissalinus damit eine gewisse Einseitigkeit vorwerfen können, insofern er sich ausschließlich auf die „eigentliche Deduktion“ konzentriert. 107 Als Verfasser dieser Schrift ist AbÙ SulaimÁn MuÎammad Ibn Ma’šar al-BustÐ al-MaqdisÐ vorgeschlagen worden. Vgl. Susanne Diwald, Arabische Philosophie und Wissenschaft in der Enzyklopädie ‚KitÁb IÌwÁn aÒ-ÑafÁ‘ (III), Wiesbaden 1975, S. 11. 108 Pseudo-al-KindÐ, Liber introductorius in artem logicae demonstrationis, ed. cit., hier S. 52. Die pseudo-al-kindÐschen Ausführungen nehmen in der arabischen Tradition eine Sonderstellung ein, da diese in der
Gundissalinus und Boethius 65
Philosophiehistorisch und systematisch bedeutsam ist diese Makrounterscheidung, weil mit ihr der komplementäre Aspekt zur aristotelischen Apodeixis, der die intelligibilia (oder „prima intellecta“) entsprechen, eingeführt wird, nämlich die Epagoge, die es mit sensibilia zu tun hat. So gehören nach Aristoteles zu den Prinzipien jeder Wissenschaft notwendiger-weise auch solche, die durch die Sinne und im Wege der Induktion gewonnen werden.109 Mit der Aufnahme dieser Unterscheidung macht sich Gundissalinus den starken Erfahrungsbezug zu eigen, der das aristotelische Wissenschaftskonzept von platonischen Konstruktionen un-terscheidet. Allerdings, und dies unterscheidet Gundissalinus vom Autor des Liber intro-ductorius, stellen die intelligibilia für ihn eine eigenständige Klasse dar, die sich nicht auf die sensibilia zurückführen läßt.
Die boethianische Axiomatik wird damit bei Gundissalinus in zweierlei Hinsicht präzi-siert: Zum einen wird der deduktive Zusammenhang der selbstevidenten Prinzipien über die synthetische Verknüpfung abgehoben von einer analytischen Entwicklung derselben, womit ein wesentlicher Beitrag zu seinem besseren Verständnis geleistet wird. Gundissalinus for-muliert so auf dem Hintergrund neu erschlossener Texte, hier der Elemente Euklids, eine Antwort auf ein Problem, das sich bei der Betrachtung der Chartreser Autoren als noch un-zureichend interpretiert erweist. Zum anderen wird über die bei Boethius und seinen Kom-mentatoren vorliegende Fragestellung hinaus, im Anschluß an die Interpretation der Motive aus dem Liber introductorius, das apodeiktische Verfahren selbst noch einmal als Ganzes in den Blick genommen und durch die Epagoge, also eine induktive Komponente ergänzt. Der Erfahrungsbegriff wird so zu einem konstitutiven Bestandteil der Prinzipientheorie.
Den Ausgangspunkt dieser Entwicklungen bilden dabei einmal mehr die systematischen Ausführungen zur Theorie des Wissens und der Wissenschaften bei Boethius, die Gundissa-linus die Anschlußfigur neu übersetzter Texte, hier der Elemente und des Liber introducto-rius, an die eigene Tradition bieten – das Resultat dieses Anschlusses ist ein in Bezug auf die Komplementarität von Deduktion und Induktion deutlich aristotelisch gefärbtes Verständnis von Axiomatik, das bereits die thomasische Interpretation desselben wenn nicht vorweg-nimmt, so doch zumindest vorbereitet. 2.2.5. Die boethianischen didaskalika, und die Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften Als viertes und letztes Charakteristikum der boethianischen Wissens- und Wissenschafts-theorie sind schließlich die sogenannten didaskalika, oder auch kefa,laia zu betrachten, das sind Fragen, die in der Tradition der spätantiken Aristoteles-Kommentare die Darstellung der einzelnen Wissenschaften strukturieren und auch von Gundissalinus in seiner Divisions-____________________________________________________________________________________________
Regel die Epagoge nicht im Sinne der Analytica posteriora versteht, sondern ausgehend von den Analytica priora als ein der Syllogistik und dem Beweis untergeordnetes Verfahren. Siehe hierzu Miklós Maróth, op. cit., S. 182-195. 109 Vgl. insbesondere Analytica posteriora II, 19, 99b 15 - 100b 5, wo es heißt: „Von dem Schluß und dem Beweis wissen wir nun, was beides ist und wie es zustande kommt, und ebenso von der beweisenden Wis-senschaft. Denn sie ist dasselbe. Von den Prinzipien aber wollen wir jetzt hören, wie man sie erkennt [...] Man sieht also, daß wir die ersten Prinzipien durch Induktion kennen lernen müssen. Denn so bildet auch die Wahrnehmung uns das Allgemeine ein.“ (Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., S. 104-107)
66 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
schrift herangezogen werden. Eine erste Auflistung dieser gleichsam pädagogischen Fragen gibt Boethius in Antwort auf seinen Gesprächspartner Fabius in der ersten Edition seiner In Isagogen Porphyrii commenta, wo es heißt, daß folgende sechs Punkte jeder Erörterung („omnis expositio“) eines Werkes vorauszuschicken seien: operis intentio; utilitas; ordo; si eius cuius esse opus dicitur, germanus propriusque liber est; operis inscriptio; ad quam partem philosophiae cuiuscumque libri ducatur intentio.110 Bereits Samuel Brandt, der Editor der In Isagogen Porphyrii commenta, weist in seinem Vorwort immer wieder auf die starke Dependenz des boethianischen Werkes von alexandrinischen Aristoteles-Kommentaren hin, und auch im Falle der didaskalika, kann als sicher gelten, daß Boethius diese aus der er-wähnten Tradition der spätantiken Aristoteles-Kommentare übernimmt, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach von Ammonios Hermeiou, in dessen Schule Boethius womöglich studierte.111 So finden sich denn auch in Ammonios’ Kommentar zur Isagoge die folgenden kefa,laia wieder: skopo,j (= intentio), crh,simon (= utilitas), gnh,sion (= germanus proprius-que liber est / Herkunft des Autors), ta,xij (= ordo), evpigrafh, (= inscriptio), u`po. poi/on me,roj (= ad quam partem),112 die allerdings nicht nur für Ammonios, sondern cum grano salis für die gesamte Tradition der spätantiken Aristoteles-Kommentare kennzeichnend sind.113
Diese noch sehr bibliographische und rezeptionsorientierte Aufstellung wird in Boethius’ späterer Schrift114 De topicis differentiis dahingehend erweitert und v.a. verallgemeinert, daß sie nicht nur die Lektüre eines bestimmten Textes anleiten soll, sondern zum Strukturmerk-mal der artes schlechthin wird. Hier heißt es nun, daß zunächst folgende Fragen zu behan-deln seien:
De cuius quidem rei traditione nihil ab antiquis praeceptoribus accepimus. [...] Quam par-tem doctrinae vacuam, ut possumus, aggrediamur. Dicemus itaque de generis artis, spe-ciebus, et materia, et partibus, et instrumento, instrumentique partibus, opere etiam offi-cioque actoris et finis.115
Die didaskalika, dienen hier nicht mehr der Erschließung eines bestimmten Werkes, sondern erfüllen in bewußter Abgrenzung von der Kommentar-Tradition („nihil ab antiquis prae-ceptoribus accepimus“) die Aufgabe einer Strukturierung des Gegenstandes selbst und nicht nur der über ihn vorhandenen Literatur. Boethius vollzieht damit eine entscheidende Wen-dung von der Kommentierung hin zur systematischen Ausarbeitung wissens- und wissen-schaftstheoretischer Fragestellungen, wenn auch diese Wende keinen direkten und unüber-windbaren Bruch mit der spätantiken Kommentar-Tradition darstellt. Denn insofern diese im Corpus aristotelicum den Kanon der Wissenschaften überliefert sieht, führt auch die Struktu-rierung der aristotelischen Bücher in letzter Konsequenz zu einer Strukturierung der Wissen-schaften selbst. Boethius steht damit gewiß weiterhin in der Tradition der spätantiken Ari-____________________________________________________________________________________________
110 Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta, ed. cit., Ia ed., lib. I, cap. 1, S. 4-5. 111 Es ist nach wie vor umstritten, ob Boethius in Alexandrien oder in Athen studierte, oder gar beides. Vgl. dazu u.a. Cornelia de Vogel, „Boethiana I“, in: Vivarium 9 (1971), S. 59-66. 112 Ammonios Hermeiou, In Porphyrii Isagogen sive V voces, ed. Adolf Busse (CAG IV, 3), Berlin 1891, S. 21. 113 Eine tabellarische Übersicht der kefa,laia bei den einschlägigen spätantiken Autoren gibt Edwin A. Quain, „The Medieval accessus ad auctores“, in: Traditio 3 (1945), S. 215-264, hier S. 250. 114 Siehe zur Chronologie der logischen Schriften des Boethius Lambertus Marie de Rijk, „On the Chrono-logy of Boethius’ Works on Logic“, in: Vivarium 2 (1964), S. 1-49 u. S. 125-162. 115 Boethius, De topicis differentiis, PL 64, Sp. 1207.
Gundissalinus und Boethius 67
stoteles-Kommentatoren, zugleich geht er jedoch gleichsam mit ihnen über sie hinaus. Un-mittelbares Vorbild dieser zweiten Fassung der didaskalika, bei Boethius sind denn auch nicht die griechischen Aristoteles-Kommentare, vielmehr scheint für diese Fassung Ciceros De inventione Pate gestanden zu haben, auch wenn der Anicier über die fünf dort genannten Fragen, nämlich genus, officium, finis, materia und partes, hinausgeht:
Sed antequam de praeceptis oratoriis dicimus, videtur dicendum de genere ipsius artis, de officio, de fine, de materia, de partibus. Nam his rebus cognitis facilius et expeditius ani-mus unius cuiusque ipsam rationem ac viam artis considerare poterit.116
Aus welchen Quellen Cicero selbst schöpft, ist unklar. Es scheint jedoch gewiß, daß die zweite Formulierung der didaskalika, im Gegensatz zur ersten nicht unmittelbar auf Vorla-gen der griechischen Spätantike zurückgreifen kann, und damit womöglich erst im latei-nischsprachigen Raum entsteht. Inhaltlich ist sie mit den Kategorien des genus, der materia, der partes und – bei Boethius – des instrumentum in jedem Fall dem aristotelischen Modell der Wissenschaften verpflichtet.
Ferner läßt sich feststellen, daß die erste Formulierung vom frühen Mittelalter bis zum 12. Jahrhundert gegenüber der zweiten deutlich dominiert. So sind die sogenannten accessus ad auctores – das lateinische Pendant der kefa,laia – des Sedulius Scottus und des Remigius von Auxerre, auf deren Grundlage der Rhetorik-Unterricht in den Schulen ab dem 9. Jahr-hundert abgehalten wurde, eindeutig an der ersten Fassung ausgerichtet, die diesen Autoren neben Boethius v.a. über den spätantiken Grammatiklehrer Servius bekannt war. Nur ver-einzelt greifen sie auf Elemente der zweiten Formulierung zurück, etwa im Fall von materia und utilitas; diese werden dann allerdings in den Kontext der Kommentierung zurückver-setzt, so daß das in ihnen vorhandene, von Cicero und Boethius intendierte strukturierende Moment für die Wissenschaften im Frühmittelalter abhanden kommt.117
Die Schule von Chartres und der accessus Gerade diese zweite Fassung der didaskalika, sollte jedoch im 12. Jahrhundert ein erneuertes Gewicht erhalten, und zwar zunächst und v.a. im Umkreis der Schule von Chartres. Dabei sind es diesmal nicht die Boethius-Kommentare, in denen sich das Interesse an den boethia-nischen didaskalika, kristallisiert, sondern vorwiegend die den Triviums-Wissenschaften gewidmeten Chartreser Glossen, etwa zu Cicero und Priscian. So findet sich die wahrschein-lich erste Bezeugung des von der zweiten boethianischen Fassung der didaskalika, beein-flußten accessus in den Glosule super Priscianum des Wilhelm von Conches (ca. 1080-1154), die um 1120 entstanden sein dürften. Entsprechend heißt es hier:
____________________________________________________________________________________________
116 Cicero, De inventione, hrsg. u. übers. von Theodor Nüßlein, Düsseldorf u. Zürich 1998, lib. I, 5, S. 18. 117 Siehe zu Sedulius und Remigius H. Silvestre, „Le schéma ‚moderne‘ des accessus“, in: Latomus 16 (1957), S. 684-689, der eine Zusammenstellung verschiedener accessus bietet, die angesichts der schlechten Editionslage, insbesondere der Werke des Remigius, von großem Wert ist.
68 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
In principio huius artis haec sunt consideranda: quid sit ipsa ars, quod nomen artis, quae causa nominis, quod genus, quod officium, quis finis, quae materia, quae partes, quis arti-fex, quae intentio auctoris.118
In diesem accessus zeigt sich bereits sehr deutlich, daß trotz einiger Reminiszenzen an die erste Fassung der didaskalika, (intentio auctoris) die Elemente aus der zweiten Fassung überwiegen (genus, officium, finis, materia, partes, artifex [= auctor]). Zwar fehlen schein-bar die beiden Fragen nach instrumentum und species, die Boethius noch nennt, doch dies nicht ohne Grund, denn Wilhelm selbst verweist unmittelbar nach dem zitierten Passus dar-auf, daß die Grammatik weder instrumentum noch species besitze. Insgesamt zielt der ac-cessus damit in erster Linie nicht auf eine bio-bibliographische Einführung in das zu kom-mentierende Werk, die Institutiones grammaticae des Priscian, vielmehr geht es Wilhelm mit Boethius um die Bestimmung des Status und der Struktur der in Frage stehenden Wissen-schaft, nämlich der Grammatik.
Ausführlicher noch spiegelt sich die zweite Fassung der didaskalika, in dem in den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts entstandenen Kommentar des Petrus Helias († ca. 1166) zu Cice-ros De inventione. Hier nennt Petrus Helias, der dem Chartreser Kreis nahe steht, gleich zu Beginn, im incipit der Schrift, der Reihe nach folgende Fragen:
Sicut ordo nostrae doctrinae exigit, ita quoque circa artem rhetoricam consideranda sunt haec: Primo quid sit rhetorica, deinde quod genus rhetoricae, quae materia, quod officium, quis finis, quae partes, quae species, quod instrumentum, quis artifex, quare rhetorica vo-cetur, quo ordine docenda sit et discenda.119
Damit finden sich sämtliche Fragen aus der zweiten Fassung der didaskalika, des Boethius, wobei diese noch um die Frage nach dem ordo aus der ersten Fassung erweitert werden. Bezeichnend ist, daß Petrus Helias neben dieser Version der didaskalika, auch jene erste Fassung kennt, die er aber getrennt verhandelt. Nachdem er in dem zitierten Passus circa artem fragt, bringt er so später auch Fragen circa librum: quae auctoris intentio, utilitas ope-ris, titulus, utrum ad philosophiam pertineat, welche die erste Fassung der didaskalika, auf-greifen. Damit nimmt er eine klare Unterscheidung zwischen beiden accessus-Schemata vor, welche die Fragen ausdrücklich auf die Wissenschaft selbst oder aber auf das Werk bezieht.
In seinem später, um die Mitte des Jahrhunderts verfaßten Kommentar Summa super Priscianum verzichtet Petrus Helias dann gänzlich auf die Fragen circa librum und behandelt allein jene circa artem:
Ad maiorem artis grammaticae cognitionem primo videndum est quid sit grammatica, quod genus eius, quae materia, quod officium, quis finis, quae partes, quae species, quod
____________________________________________________________________________________________
118 Wilhelm von Conches, Glose super Priscianum, Florenz, Bibl. Med.-Laur., ms. San Marco 310, fol. 1ra., zitiert nach Karin M. Fredborg in ihrer Einleitung zu Thierry von Chartres, The Latin Rhetorical Commenta-ries by Thierry of Chartres, Toronto 1988, S. 15, Anm. 66. – Siehe zu Wilhelms Glosse auch Édouard Jeau-neau, „Deux rédactions des gloses de Guillaume de Conches sur Priscien“, in: Recherches de théologie an-cienne et médiévale 27 (1960), S. 212-247. 119 Petrus Helias, [In Ciceronis De inventione], Vatikan, Fondo Ottobon., lat. 2993. Zitiert nach Karin M. Fredborg, „Petrus Helias on Rhetoric“, in: Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge grec et latin 13 (1974), S. 31-41, hier S. 32.
Gundissalinus und Boethius 69
instrumentum, quis artifex, quare grammatica dicatur, quo ordine etiam docenda sit et dis-cenda.120
Diese sind sowohl inhaltlich als auch in ihrer Reihenfolge identisch mit den Fragen aus sei-nem Cicero-Kommentar, so daß es scheint, der accessus des Petrus Helias habe sich bewährt und konsolidiert.
Zuletzt ist schließlich noch der vielleicht bekannteste Chartreser accessus zu nennen, der aus der Feder Thierrys von Chartres stammt und sich in seinem Kommentar zu Ciceros De inventione findet. Hier heißt es gleich zu Beginn:
Circa artem rhetoricam decem consideranda sunt: quid sit genus ipsius artis, quid ipsa ars sit, quae eius materia, quod officium, quis finis, quae partes, quae species, quod instru-mentum, quis artifex, quare rhetorica vocetur.121
Dieser accessus, so die nahezu einhellige Meinung der bisherigen neueren Forschung,122 sei auch das Vorbild für Gundissalinus’ im nächsten Abschnitt zu besprechendes accessus-Schema gewesen. Doch sind berechtigte Bedenken gegen diese Meinung vorgetragen wor-den, so zunächst von Nikolaus M. Häring,123 der darauf verweist, daß Thierry in seinem Kommentar als gesetzter Lehrer auftritt, der bereits die Höhen und Tiefen des Schulbetriebs durchlaufen habe. Anders als Richard W. Hunts Datierung, der Thierrys Kommentar als ein Jugendwerk ausgibt, handele es sich damit um ein Spätwerk, so daß dieser durchaus von Gundissalinus’ um 1150 niedergeschriebener Divisio beeinflußt sein könnte und nicht um-gekehrt. Ferner macht Häring die teilweise konfuse Anordnung der Fragen bei Thierry gel-tend; insbesondere die Vertauschung der Fragen nach dem quid sit und dem genus wirkt unbeholfen. Diese Bedenken sind durch die kritische Edition der Summa super Priscianum von Leo Reilly 1993 noch verstärkt worden. So ist nach Reilly davon auszugehen, daß Gun-dissalinus zwar durchaus den Chartreser accessus adaptiert, jedoch nicht von Thierry, son-dern aus Petrus Helias’ frühem Cicero-Kommentar.124 Petrus Helias’ Priscian-Kommentar reagiert nach Reilly seinerseits auf Gundissalinus’ De divisione und korrigiert eine von Gun-dissalinus aus Petrus Helias’ Cicero-Kommentar falsch wiedergegebene Ansicht.125 Beide Werke, d.h. De divisione und die Summa super Priscianum, bilden dann den Anknüpfungs-punkt für Thierrys Kommentar.
____________________________________________________________________________________________
120 Petrus Helias, Summa super Priscianum, ed. Leo Reilly, 2 Bde., Toronto 1993, hier Bd. I, S. 60. 121 Thierry von Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, ed. cit., S. 49. 122 Vgl. hierzu v.a. Richard W. Hunt, „The Introductions to the Artes in the Twelfth Century“, in: Studia Mediaevalia in Honor of R. J. Martin, Brügge 1948, S. 85-112; Karin M. Fredborg in ihrer Einleitung zu Thierry von Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, ed. cit., S. 15-20; sowie Charles Burnett, „A New Source for Dominicus Gundissalinus’s Account of the Science of the Stars?“, in: Annals of Science 47 (1990), S. 361-374, hier S. 361-362.. 123 Vgl. Nikolaus M. Häring, „Thierry of Chartres and Dominicus Gundissalinus“, in: Mediaeval Studies 26 (1964), S. 271-286. 124 So Leo Reilly in seiner Einleitung zu Petrus Helias, Summa super Priscianum, ed. cit., Bd. I, S. 30-32. 125 Reillys für diese Abhängigkeit ins Feld geführte Argumente lassen sich noch um einen weiteren Punkt ergänzen. So findet sich bei Petrus Helias im Priscian-Kommentar die kuriose Etymologie von „titulus“ aus „Titan“ gleich „sol“, verbunden mit der Erklärung, der Titel erleuchte wie eine Sonne das ganze Werk. Leo Reilly bemerkt in seiner Edition, daß er die Quelle hierfür nicht finden kann. Vgl. Petrus Helias, Summa super Priscianum, ed. cit., Bd. I, S. 349. Bezeichnenderweise findet sich dieselbe Erklärung auch in Domini-cus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 114.
70 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Wie immer auch diese Frage zu entscheiden ist, so kann doch als unstrittig gelten, daß in der Schule von Chartres die zweite Fassung der boethianischen didaskalika, wiederentdeckt wird und daß Gundissalinus über Chartreser Autoren, sei es Petrus Helias, sei es Thierry von Chartres, mit ihr in Berührung kommt. Unhaltbar ist dagegen Ludwig Baurs Ansicht: „Es dürfte wohl kaum einem ernstlichen Zweifel begegnen, wenn wir die Behauptung aufstellen, Gundissalinus habe seine kefa,laia zum großen Teil aus diesen, durch die arabischen Über-setzungen der Kommentare zu den Aristotelesschriften ihm wohl zugänglichen kefa,laia entnommen.“126 Denn für die von Ludwig Baur in Anschlag gebrachte arabische Tradition gilt hingegen, daß die didaskalika, hier stets im Sinne der ersten Fassung verstanden werden, d.h. als literarische Topoi innerhalb der Kommentarliteratur zur aristotelischen Logik, so etwa in den Kommentaren zur Isagoge oder zur Kategorienschrift.127 Im KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm etwa, einer enzyklopädischen Darstellung aller Wissenschaften, die von Gundissalinus und später Gerhard von Cremona übersetzt wurde und von ersterem in seiner Divisionsschrift allenthalben herangezogen wird, nennt al-FÁrÁbÐ anläßlich der Behandlung der Logik im arabischen Original folgende kefa,laia: Nutzen; Gegenstände, von denen gehandelt wird; Bedeutung des Titels; Aufzählung der Teile und ihrer Inhalte.128 Bezeichnenderweise wird nur die Logik nach dieser Art behandelt, was damit zu erklären ist, daß es sich hier eben um Topoi im Rahmen der Behandlung der Schultradition der Logik handelt. Ebenfalls erwäh-nenswert scheint mir, daß diese didaskalika, sowohl in Gundissalinus’ als auch in Gerhards Übersetzung des Traktates, der unter dem lateinischen Namen De scientiis bekannt wurde, fehlen.129 Schon deshalb kommt al-FÁrÁbÐ nicht als Inspirationsquelle für Gundissalinus in Frage.
Species und partes: Subordinationstheorie und Binnendifferenzierung bei Gundissalinus Zugleich, und unbeschadet der Chartreser Verdienste, muß nach diesem Durchgang jedoch auch festgehalten werden, daß der Chartreser Gebrauch der didaskalika, zwar bereits deut-lich zeigt, daß diese im Sinne von Strukturmomenten der Wissenschaften verstanden werden, doch bleibt ihr Anwendungskontext immer noch in die Kommentierung eingebunden, sei es des Cicero oder des Priscian.
Anders verhält es sich bei Gundissalinus: In seiner Schrift De divisione philosophiae be-gegnet die zweite Fassung der boethianischen didaskalika, gänzlich losgelöst vom Kom-mentar-Kontext; mehr noch, sie dient nicht mehr nur zur Beschreibung des Status und der Struktur einer bestimmten Wissenschaft, der Rhetorik oder der Grammatik, sondern wird in
____________________________________________________________________________________________
126 Siehe Ludwig Baur in seiner Studie zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 205. – Meine Hervorhebung. 127 Vgl. hierzu insbesondere Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungsliteratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 385-387. 128 Siehe al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. Ángel González Palencia, Madrid 21953, S. 13 der spani-schen Übersetzung. 129 Siehe für Gerhards Übersetzung, ibid., S. 91, für Gundissalinus’, id., De scientiis, ed. cit., S. 67.
Gundissalinus und Boethius 71
der Darstellung des Gundissalinus zum Leitfaden der Analyse nahezu aller vorgestellten Wissenschaften.130 So beginnt die Divisionsschrift mit der programmatischen Ankündigung:
Circa unamquamque autem earum [= partium philosophiae] haec inquirenda sunt scilicet: quid ipsa sit, quod genus est, quae materia, quae partes, quae species, quod officium, quis finis, quod instrumentum, quis artifex, quare sic vocetur, quo ordine legenda sit.131
In Bezug auf jede Wissenschaft soll also der Fragenkatalog, der in der Tat große Ähn-lichkeit mit jenem des Petrus Helias hat, durchlaufen werden, um so zu einer vollständigen Darstellung der Wissenschaften auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien zu gelangen. Wohl unterschieden von diesem Fragenkatalog, und in erneuter Übereinstimmung mit Petrus Helias, findet sich dann am Ende der Schrift eine zweite Aufstellung, welche die kefa,laia circa librum vereinigt: „intentio auctoris, quae utilitas operis, nomen etiam auctoris, titulus operis, ordo quoque legendi et ad quam partem philosophiae spectet et de distinctione libri in partes et capitula.“132 Wie Petrus Helias unterscheidet Gundissalinus damit deutlich die zwei Fassungen der boethianischen didaskalika,, wobei die erste Fassung gleichsam nur als Ap-pendix zu seiner Schrift fungiert, während die zweite Fassung die Systematik der gesamten Schrift vorgibt, und dies losgelöst von aller Kommentararbeit. Damit gewinnt die zweite Fassung der boethianischen didaskalika, ihren vollen Sinn zurück.
Diese eigenständige Weiterentwicklung des accessus-Schemas in Richtung auf eine Wis-sens- und Wissenschaftstheorie bei Gundissalinus zeigt sich u.a. in einer folgenreichen Ver-schiebung des Schwerpunktes innerhalb der zweiten Fassung der boethianischen didaskalika,. Diese Verschiebung soll die folgende tabellarische Auflistung der Fragen der verschiedenen accessus des Gundissalinus, des Cicero, des Boethius und der Chartreser Au-toren verdeutlichen:
D. G. Cicero In Isag. De top. W. v . C. P. H. Th . v. C. Quid Quid (1) Quid (1) Quid (2)
Genus Genus (1) Genus (1) Genus (4) Genus (2) Genus (1) Materia Materia (4) Materia (3) Materia (7) Materia (3) Materia (3) Partes Partes (5) Partes (4) Partes (8) Partes (6) Partes (6)
Species Species (2) Species (7) Species (7) Offic. Offic. (2) Offic. (7) Offic. (5) Offic. (4) Offic. (4) Finis Finis (3) Finis (8) Finis (6) Finis (5) Finis (5) Instr. Instr. (5) Instr. (8) Instr. (8)
Artifex Actor (6) Artifex (9) Artifex (9) Artifex (9) Quare Nomen (2/3) Quare (10) Quare (10) Ordo Ordo (3) Ordo (11)
____________________________________________________________________________________________
130 Ausnahmen sind die Kapitel ‚De aspectibus‘, ‚De ponderibus‘, ‚De ingeniis‘ und die praktische Philoso-phie, die nicht am Leitfaden der Fragen diskutiert werden. 131 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 19. 132 Vgl. ibid., S. 140. – Auch hier sieht der Editor, Ludwig Baur, arabische Vorlagen am Werk; siehe ibid., S. 313-314. Doch ist nach all dem bisher Gesagten viel wahrscheinlicher, daß auch an dieser Stelle Chartreser Einflüsse vorliegen; dies legt insbesondere die formelhafte Einführung der zwei Fassungen der didaskalika, durch circa artem und circa librum nahe, die sich wörtlich sowohl bei Gundissalinus als auch bei Petrus Helias findet.
72 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Zunächst führt diese Tabelle noch einmal die klare Übereinstimmung der Schemata des Gundissalinus und des Petrus Helias vor Augen. Zugleich werden jedoch auch Unterschiede deutlich, und zwar insbesondere mit Blick auf die Abfolge der Fragen, die durch die Zahlen in runden Klammern angegeben wird. Alle drei Chartreser accessus behandeln partes und species nach officium und finis, womit sie der ciceronianischen Reihenfolge folgen. Anders die Abfolge bei Gundissalinus, der – wie bemerkenswerterweise auch Boethius in De topicis differentiis – die Behandlung von partes und species vorzieht. Diese geänderte Abfolge hält Gundissalinus in sämtlichen Kapiteln durch, so daß sie nicht bloß einer flüchtigen Vertau-schung geschuldet zu sein scheint, sondern vermutlich von systematischer Relevanz ist.133 Und tatsächlich ist es durchaus erklärbar, warum Gundissalinus diese Änderung vornimmt, wenn man sein Interesse an einer strukturierten Darstellung des Ganzen der Wissenschaften bedenkt. Denn mit diesem kommt der Frage nach der Subordination bestimmter Wissen-schaften sowie nach der Beziehung der Binnenteile der einzelnen Wissenschaften eine aus-gezeichnete Bedeutung zu, zumal Gundissalinus sich in der Situation befindet, zahlreiche bislang nicht qualifizierte und in den tradierten ordo scientiarum zu integrierende ‚neue‘ Wissenschaften gleichsam unterbringen zu müssen. Die Subordination und Binneneinteilung der Wissenschaften wird damit zu einer der zentralen Herausforderungen der Wissens- und Wissenschaftstheorie, auf die Gundissalinus mit Hilfe der didaskalika, species und partes reagiert.
So nennt Gundissalinus etwa im Falle der Physik folgende acht species, von denen es heißt, daß sie unter der Physik enthalten seien („sub ea continentur“): „[...] scientia de medi-cina, scientia de indiciis [leg. iudiciis], scientia de nigromantia secundum physicam, scientia de imaginibus, scientia de agricultura, scientia de navigatione, scientia de speculis, scientia de alquimia.“134 Daneben zählt er als partes der Physik folgende Teile auf: Liber caeli et mundi, De generatione et corruptione, De vegetabilibus usw., also verschiedene naturphilo-sophische Schriften des Aristoteles.135 Für die Mathematik hinwiederum nennt er folgende sieben species, die unter ihr enthalten sind: „[...] arithmetica, geometria, musica et astrologia, scientia de aspectibus, scientia de ponderibus, scientia de ingeniis“; ihre partes sind mit den ersten vier species identisch.136 Im Metaphysik-Kapitel, um nur die drei prominentesten Wissenschaften zu nennen, werden die species als „consequentia entis, in quae scilicet divi-
____________________________________________________________________________________________
133 Mir ist lediglich ein weiterer accessus bekannt, der wie Gundissalinus species und partes vorzieht; es handelt sich um einen anonymen Text, der vermutlich Mitte des 12. Jahrhunderts in England verfaßt wurde und den Charles Burnett zugänglich gemacht hat. Siehe Charles Burnett, „Innovations in the Classification of the Sciences in the Twelfth Century“, in: Simo Knuuttila u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Me-dieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy, Bd. II, Hel-sinki 1990, S. 25-42, hier S. 33. 134 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20. Ludwig Baurs „scientia de indiciis“ scheint ein Lesefehler für „scientia de iudiciis“, also die astrologische Wissenschaft, zu sein. – Diese Reihung übernimmt Gundissalinus aus dem vermutlich von ihm übersetzten Traktat De ortu scientiarum, der al-FÁrÁbÐ zugeschrieben wird (das arabische Original ist indes verloren); vgl. al-FÁrÁbÐ, De ortu scientiarum, ed. Clemens Baeumker, in: BGPhMA XIX, 3, Münster 1916, hier S. 20: „[...] scientia de iudiciis, scientia de medicina, scientia de nigromantia secundum physicam, scientia de imaginibus, scientia de agricultura, scien-tia de navigando, scientia de alquimia quae est scientia de conversione rerum in alias species, scientia de speculis.“ 135 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20-23. 136 Vgl. ibid., S. 31-32.
Gundissalinus und Boethius 73
ditur ens“, angegeben: „substantia“, „accidens“, „universale“, „particulare“, „causa“, „cau-satum“, „potentia“ und „actus“; die partes der Metaphysik schließlich richten sich nach der Art der Unabhängigkeit des betrachteten Gegenstandes von der Materie.137
Was es mit der unterscheidenden Rede von den species und partes genauerhin auf sich hat, deutet Gundissalinus im Arithmetik-Kapitel an. Nachdem er hier das Prädikament oder die Kategorie der Quantität als die der Mathematik eigentümliche Materie, d.h. als ihren Gegenstand, definiert hat, etabliert er folgenden Zusammenhang zwischen dieser und den species der Mathematik:
Constat igitur, quod totum praedicamentum quantitatis materia est mathematicae faculta-tis, quando quidem singulae species istius materia sunt singularum specierum illius; qua-propter singulae materiae specierum partes erunt generis earum.138
Die jeweiligen species einer Wissenschaft korrelieren demnach mit den species der Materie bzw. des Gegenstandes der entsprechenden Wissenschaft, im Falle der Mathematik also mit den species der Quantität. Allerdings ist dies nur eine sehr andeutungsweise Erklärung.
Den Schlüssel zum Verständnis des von Gundissalinus hier Gemeinten scheint die Summa Avicennae de convenientia et differentia subiectorum zu liefern – das von Gundissa-linus übersetzte und in seine Divisionsschrift unter Verweis auf seine Herkunft integrierte achte Kapitel des zweiten Teils des fünften Buches von KitÁb aš-šifÁÞ,139 das den Analytica posteriora entspricht.140 In diesem konstatiert Avicenna, und mit ihm sein Übersetzer Gundissalinus, zunächst, daß die Unterscheidung auch zusammenhängender Wissenschaften über ihren Gegenstand erfolge, selbst dann wenn dieser in bestimmter Hinsicht identisch sei.141 So kann zwischen zwei Wissenschaften, die sich letztlich auf denselben Gegenstand beziehen, eine „communicatio ut generis ad accidens speciei“142 bestehen, d.h. die species oder pars bezieht sich auf bestimmte Akzidenzien („accidens“) eines Teils bzw. einer Unter-art („species“) der Subjektgattung („genus“) des gemeinsamen Gegenstandes. Diese Fest-stellung wird von Avicenna in seiner Summe im Hinblick auf die hier leitende Frage der species und partes noch weiter differenziert:
Et hoc membrum dividitur in duo, quorum unum ponit minus commune de universitate communioris et in causa [leg. scientia] eius ita, ut speculatio eius sit pars speculationis communioris; alterum vero assolat minus commune a communiore et speculationem eius non ponit partem speculationis magis communis, sed ponit eam scientiam sub eo.143
Innerhalb des zuvor beschriebenen Verhältnisses sind mithin noch einmal zwei Phänomene zu unterscheiden, d.h. die Akzidenzien eines bestimmten Teils oder einer bestimmten Unter-
____________________________________________________________________________________________
137 Vgl. ibid., S. 37. 138 Ibid., S. 32. 139 Ibid., S. 124-133. 140 Es ist das Verdienst Henri Hugonnard-Roches, den Zusammenhang der Unterscheidung von species und partes in Gundissalinus De divisione mit der Übersetzung von Avicennas Summe herausgestellt zu haben. Die folgenden Bemerkungen sind angelehnt an seinen Artikel „La classification des sciences de Gundissali-nus et l’influence d’Avicenne“, art. cit., S. 54-57. 141 So besteht nach Avicenna die Möglichkeit einer „diversitas unius subiecti“. Vgl. Dominicus Gundissali-nus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 124. 142 Ibid., S. 125. 143 Ibid., „causa“ ist ein Lese- oder Übersetzungsfehler für „Wissenschaft“ aus Avicennas arabischem Text.
74 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
art der Subjektgattung des gemeinsamen Gegenstandes lassen sich selbst auf zwei Weisen betrachten, deren erste mit dem Begriff der partes („ponit partem“) in Verbindung gebracht wird, während die zweite als Unterordnung („ponit sub eam“) charakterisiert wird. Diese Zweiteilung von Unterordnung und Teilsein entspricht dabei genau der gundissalinischen Unterscheidung von species und partes, insofern die species als untergeordnete oder subor-dinierte Wissenschaften verstanden werden, während die partes konstitutive Bestandteile der Wissenschaften sind. Was nun den genauen Unterschied dieser beiden Betrachtungsweisen ausmacht, tritt deutlicher an folgendem Beispiel aus der Summe zutage, das Avicenna und Gundissalinus bemühen:
Unus [modus] est cum id, per quod res fit minus communis, est aliquid de accidentibus es-sentialibus signatum et tunc considerantur accidentia, consequentia quae consequuntur subiectum appropriatum secundum quod adiungitur ei illud accidens tantum, sicut medi-cina quae est sub scientia naturali. Medicina enim speculatur corpus hominis; pars etiam quaedam scientiae naturalis speculatur corpus hominis. Sed pars scientiae naturalis quae speculatur corpus hominis considerat illud absolute et inquirit de accidentibus eius essen-tialibus absolute, quae accidunt ei secundum quod est homo, non secundum conditionem, quae adiungatur. Medicina vero considerat illud secundum quod infirmatur vel sanatur tantum et inquirit de accidentibus eius, quae sunt ex hoc modo.144
Die Unterscheidung zwischen species und partes beruht demnach darauf, daß letztere die Akzidenzien der Teile bzw. Unterarten der Subjektgattung des gemeinsamen Gegenstandes, hier des Körpers, „absolute“ betrachten, während erstere sie in besonderer Rücksicht unter-suchen. Daher sind die species kein Teil der entsprechenden Wissenschaft, hier der Physik, sondern dieser untergeordnete Wissenschaften. So behandelt etwa eine pars der Naturphilo-sophie einen bestimmten Teil bzw. eine bestimmte Unterart des Körpers (das ist die Sub-jektgattung der Naturphilosophie), nämlich den menschlichen Körper, „absolute“; die Medi-zin hingegen, als der Naturphilosophie subordinierte species, behandelt den Körper des Men-schen nur unter besonderer Rücksicht („secundum quod“) – ein Beispiel, das auch Thomas von Aquin bemühen wird, um die für ihn, genau wie für Gundissalinus, zentrale Unterschei-dung zwischen den einer bestimmten Wissenschaft subalternierten Wissenschaften einerseits und den Teilen einer Wissenschaft andererseits zu veranschaulichen.145 Avicennas gegenstandsorientierte Unterscheidung auch gegenstandsgleicher Wissenschaften ist damit in letzter Konsequenz eine solche der Hinsichten. Indem Gundissalinus diese Überlegungen in sein Werk integriert, liefert er eine theoretische Antwort auf die sich durch die Neu-entdeckung der Natur- und anderer Wissenschaften vermittelt über die arabische Philosophie stellende Herausforderung einer wissenschaftstheoretischen Einordnung derselben. So er-möglichen es ihm die Begriffe pars und species nicht nur, verschiedene Teile der Wissen-schaften zu identifizieren, sondern zugleich erlaubt es ihm dieses Instrumentarium, die neu entdeckten Wissenschaften in ein hierarchisches Ordnungsschema innerhalb des tradierten ordo scientiarum zu bringen.
Gundissalinus gelingt damit in der Verbindung des boethianischen accessus-Schemas aus De topicis differentiis mit Gedanken des Avicenna, die ihrerseits an Aristoteles’ Analytica
____________________________________________________________________________________________
144 Ibid., S. 126-127 145 Vgl. Thomas von Aquin, Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden 1955, q. V, art. 1, ad 5, S. 170-171. – Siehe hierzu auch weiter unten das Kapitel 3.5. a).
Gundissalinus und Boethius 75
posteriora I anknüpfen,146 eine wissens- und wissenschaftstheoretisch äußerst bedeutsame Neu-Interpretation der beiden didaskalika, species und partes, die mit ihrem Verständnis der species die Frage der Subordination der Wissenschaften in angemessener Weise in den Blick bekommt und in bestimmter Weise beantwortet, während sie zugleich mit ihrem Verständnis der partes zu einer Klärung der Binnenstruktur der einzelnen Wissenschaften beiträgt. Das von Gundissalinus vorgestellte accessus-Schema weist damit nicht nur in seinem universel-len, weil auf die Totalität der Wissenschaften ausgreifenden Anspruch über die Chartreser Entwürfe hinaus und auf seinen boethianischen Ursprung zurück, sondern auch inhaltlich wird es zu einem wissens- und wissenschaftstheoretisch höchst relevanten Element und zeigt erneut die fruchtbare Verknüpfung von boethianischen und avicennischen Theorieelementen bei Gundissalinus.
Die in diesem und in den vorangegangenen drei Unterkapiteln dargestellte Rezeption oder besser Revision der lateinisch-christlichen, letztlich boethianisch fundierten Wissens- und Wissenschaftstheorie im Lichte der arabischen Philosophie liefert ein anschauliches Bei-spiel dafür, wie sich die Integration des ‚Neuen‘ gerade auf der Grundlage der eigenen Tra-dition und ihrer immanenten Probleme und Fragestellungen vollzieht. Dominicus Gundissa-linus gibt sich, was seine Behandlung der boethianischen Wissens- und Wissenschaftstheorie anbelangt, nicht etwa als der mediokre Kompilator, für den er gern gehalten wird, der ohne Rücksicht auf die Kompatibilität der exzerpierten Texte diese hintereinanderreiht. Vielmehr erweist sich der Archidiakon von Cuéllar als durchaus eigenständiger und mutiger Denker, der die Schwierigkeiten der eigenen Tradition ebenso wie das Potential des fremden Denkens realistisch einzuschätzen und zu nutzen weiß und sich auf dem Hintergrund der arabischen Texte neue, richtungweisende Lösungsperspektiven für Probleme der lateinisch-christlichen Tradition erschließt. Die Rezeption der arabischen Philosophie, insbesondere des Avicenna, aber auch des arabischen Euklid und des Pseudo-al-KindÐ verschränkt sich dabei mit der eigenen lateinisch-christlichen Tradition und v.a. den Chartreser Boethius-Diskussionen, die Gundissalinus offensichtlich gut kannte,147 zu einem komplexen Netz gegenseitiger Konditio-nierung und Ergänzung.
Vor diesem Hintergrund entwickelt Gundissalinus zum einen anhand einer komplexen noetischen Abstraktionstheorie eine deutlich aristotelische Wissenschaftseinteilung, deren Distinktheit in der Verschiedenheit ihrer Objektbereiche gründet. Zum anderen entwirft er eine letztlich ebenfalls aristotelische methoden- und vermögenstheoretische Differenzierung der Wissenschaften, die sich jeweils durch eigene Methoden voneinander abheben. Als drit-tes erarbeitet er sich ein erstes Verständnis der für das aristotelische Wissenschaftskonzept charakteristischen axiomatischen Wissenschaft, die er zugleich durch einen starken Erfah-rungsbezug auszeichnet. Schließlich entwirft er, wie soeben dargestellt, im Anschluß an
____________________________________________________________________________________________
146 In Aristoteles’ Analytica posteriora I, 13 wird die Frage der Subordination allerdings, wie weiter unten in Kapitel 3.5. a) ausführlich dargelegt wird, mit anderer Akzentsetzung gelöst. 147 Nicht ohne Grund vermutet Charles Burnett daher, daß Gundissalinus in ‚Frankreich‘ ausgebildet wurde. Siehe hierfür Charles Burnett, „Filosofía natural, secretos y magia“, in: Luis García Ballester (Hrsg.), Histo-ria de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla I: Edad media, León 2002, S. 95-144, hier S. 103 – eine These, die auch die Übereinstimmungen von Gundissalinus’ Fragestellungen mit jenen der Chartreser Boethius-Kommentierung nahelegen.
76 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Boethius und unter Rekurs auf Avicenna Positionen zur Subordination und Binnendifferen-zierung der Wissenschaften, mit denen er ebenfalls ein aristotelisches Anliegen wieder auf-greift, das ihm die Integration der ‚neuen‘ Wissenschaften ermöglicht.
2.3. Gundissalinus und Isidor von Sevilla: Die neuen (?) Wissenschaften
Die isidorianische Tradition in Toledo reicht zurück in die Zeit Isidors von Sevilla selbst, der noch 633, also nur drei Jahre vor seinem Tod, den Vorsitz über das IV. Konzil von Toledo führte. Und auch für die nachfolgenden Toledaner Konzile VI (638), XI (675) und XVI (693) ist sein Einfluß deutlich herausgestellt worden.1 Es bestehen darüber hinaus zahlreiche Untersuchungen über eine ganze Reihe Toledaner Autoren, die durch Isidor beeinflußt sind, unter denen u.a. zu nennen sind König Sisebut von Toledo mit seiner Carmen de luna, der heilige Ildefons von Toledo mit seinem De viris illustribus und der heilige Julian von Toledo mit seinem Antikeimenon.2 Nur wenig hingegen ist über das Fortleben des isidorianischen Einflusses nach der Invasion der Araber bekannt.3 Die isidorianische Tradition in Toledo nach der Reconquista
Doch auch wenn für diese Zeit große Namen aus der Geschichte der Philosophie und Theo-logie fehlen, mit denen Isidor in Verbindung gebracht werden könnte, so lassen die Hand-schriftenbefunde keinen Zweifel an der Bedeutung, die Isidor auch in mozarabischen Kreisen noch besaß. Hierfür können insbesondere die vier Handschriften der Etymologiae4 des hei-ligen Isidor aus der Biblioteca Capitular von Toledo als Belege in Anschlag gebracht wer-den, von denen die älteste kurz vor dem Einmarsch der Araber datiert.5 Diese Handschrift weist eine große Vielfalt von Anmerkungen späterer Hände auf, einige in arabischer, andere in lateinischer Schrift. Sowohl die Menge der isidorianischen Codices als auch die Spuren ____________________________________________________________________________________________
1 Vgl. zum IV. Konzil von Toledo José Madoz, „Le symbole du IVe Concile de Tolède“, in: Revue d’histoire ecclésiastique 34 (1938), S. 5-20; für das VI. Konzil id., „El símbolo del VI Concilio de Toledo (a. 638) en su centenario XIIIo“, in: Gregorianum 19 (1938), S. 161-193; für das XI. Konzil id., Le symbole du XIe Concile de Tolède, Louvain 1938, bes. S. 112-113; sowie für das XVI. Konzil id., El símbolo del Concilio XVI de Toledo, Madrid 1946, bes. S. 120. Ferner J. de J. Pérez, La cristología en los símbolos toledanos IV, VI y XI, Rom 1939, bes. S. 10-15, 17, 19, 28, 37-38, 45, 47-48 u. 50. 2 Siehe etwa Walter Stach, „Bemerkungen zu den Gedichten des Westgotenkönigs Sisebut“, in: Corona quernea. Festgabe K. Strecker zum 80. Geburtstage dargebracht, Leipzig 1941, S. 75-96; Jacques Fontaine, „El De viris illustribus de San Ildefonso de Toledo: Tradición y originalidad“, in: Anales toledanos 3 (1971), S. 59-96; und Arturo Veiga Valiña, La doctrina escatológica de San Julián de Toledo, Lugo 1940, S. 150. 3 Vgl. die entsprechende Lücke im bibliographischen Abriß zu Isidor von Sevilla von Jocelyn N. Hillgarth, „The Position of Isidorian Studies: A Critical Review of the Literature 1936-1975“, in: Studi medievali, 3a serie, 24 (1983), S. 817-896, fortgeführt durch id., „Isidorian Studies“, in: Studi medievali, 3a serie, 31 (1990), S. 925-973. Hingegen gibt es Belege für Isidors fortbestehenden Einfluß in Córdoba, León und Ka-talonien. 4 Für eine moderne Edition des Werkes sei verwiesen auf die Ausgabe von Wallace M. Lindsay: Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, 2 Bde., Oxford 1911. Eine kritische und zwei-sprachige (lateinisch-französisch/englisch) Edition erscheint seit 1981 in Einzelausgaben unter der Leitung von Jacques Fontaine und Yves Lefèvre in Paris, Les Belles Lettres. 5 Es handelt sich um die Codices Tol. 15-8, 15-9, 15-10 und 15-11. Der älteste dieser Codices ist als Faksi-mile erschienen: Isidori Etymologiae Codex Toletanus (nunc Matritensis) 15, 8, codices graeci et latini pho-tographice depicti duce Scatone de Vries, Lugduni 1909. Er befindet sich gegenwärtig in der Biblioteca Na-cional in Madrid.
78 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
ihres intensiven Gebrauchs lassen auf die anhaltende Bedeutung Isidors auch nach der Er-oberung durch die Araber schließen. Um das allgemeine Interesse der damaligen Leserschaft auszumachen und damit zugleich das besondere Interesse des Gundissalinus vorzubereiten, ist ein genauerer Blick auf die Anmerkungen des erwähnten Codex Tol. 15-8 hilfreich. Die lateinischen Anmerkungen des Codex (die nahezu immer mit den arabischen Anmerkungen zusammenfallen) verteilen sich wie folgt: fol. 2r, 11r, 34r, 34v, 36v, 38r, 70v, 79v, 82r, 83v, 86v, 87r, 88r, 93r, 106v, 108v, 120r, 129v, 130r, 131ra, 134r, 134v, 135r, 135v, 139v, 142v, 143r, 145r. Deutlich ersichtlich ist aus dieser Anführung eine Anhäufung der Anmerkungen auf den Folios 34r-38r, 70v-93r und 129v-145r. Diese Anhäufungen wiederum entsprechen den folgenden Büchern der Etymologiae: die erste Anhäufung deckt das Buch ‚De medicina‘ (= fol. 33r-36v), die zweite das Buch ‚Vocum certarum alphabetum‘ (= fol. 75r-93r) und die dritte das Buch ‚De lapidus et metallis‘ (= fol. 131r-139r). Damit lassen sich drei klare Inter-essensschwerpunkte der zeitgenössischen Leser unterscheiden: Zunächst die Medizin, was verwundern mag, wenn man bedenkt, daß Isidor kein herausragender Medizin-Theoretiker war, wie die Medizinhistoriker des vergangenen Jahrhunderts immer wieder betont haben.6 An zweiter Stelle steht die Methode der Etymologiae selbst, die Isidor im ‚Liber X‘ erläutert. Dies ist hingegen weniger verwunderlich, insofern als die etymologische Methode gleichsam die große Leistung des Isidor darstellt. An dritter Stelle schließlich steht ein Traktat, der die Eigenschaften der Steine und Metalle diskutiert und sich damit als Ausgangspunkt der al-chimistischen Spekulation anbietet. Auch das Interesse an diesem Teil der Etymologiae ist nicht verwunderlich, da doch scheinbar die alchimistischen und nigromantischen Wissen-schaften im mittelalterlichen Toledo besonders gepflegt wurden.7
Um diese Darstellung der Anmerkungen des Codex abzurunden, sei zuletzt noch auf eine Anmerkung auf Folio 36u hingewiesen, die unter dem Titel ‚Nota de Musis‘ bekannt ist. Von allen Anmerkungen, die zumeist bloße Wortglossen sind, ist diese die längste und erstreckt sich über eine ganze Kolumne. Der Text, der nach dem Ursprung des Namens der Musik und der Musen fragt, ist von Paul Ewald und Gustav Löwe vollständig transkribiert worden.8
Als vorläufiges Ergebnis der vorangegangenen Überlegungen zum Toledaner Codex der Etymologiae gilt es mithin festzuhalten, daß auch nach der Eroberung Toledos durch die Araber ein deutliches Interesse am Werk des heiligen Isidor besteht, und zwar mit deutlicher Akzentuierung der Medizin, der etymologischen Methode und der Alchimie.
____________________________________________________________________________________________
6 Die medizinischen Kenntnisse des heiligen Isidor sind allgemein als ausgesprochen oberflächlich eingestuft worden. Siehe die Beiträge zu dieser Frage von Otto Probst, „Isidors Schrift De medicina (= Etymol. lib. IV)“, in: Archiv für Geschichte der Medizin 8 (1915), S. 25-38, sowie Karl Sudhoff, „Die Verse Isidors von Sevilla auf dem Schrank der medizinischen Werke seiner Bibliothek“, in: Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 15 (1916), S. 200-204. 7 Der Ruhm Toledos als Metropole der Nigromantie hat seinen vielleicht schönsten literarischen Ausdruck im ‚Exemplo XI‘ des Conde Lucanor von Don Juan Manuel gefunden. Siehe hierzu auch die angeführten Texte bei Reinaldo Ayerbe-Chaux, El Conde Lucanor: Materia tradicional y originalidad creadora, Madrid 1975, S. 243ff. Gleichwohl ist die historische Bedeutung der Nigromantie in den intellektuellen Kreisen Toledos in Frage gestellt worden, etwa von Jaime Ferreiro Alemparte, „La escuela de nigromancia de To-ledo“, in: Anuario de estudios medievales 13 (1983), S. 205-268. 8 Siehe Exempla Scripturae Visigoticae XL Tabulis Expressa, ediderunt Paulus Ewald et Gustavus Loewe, Heidelbergiae 1883, S. 10.
Gundissalinus und Isidor von Sevilla 79
De divisione philosophiae und die Etymologiae Es ist höchst wahrscheinlich, daß Gundissalinus, als er um 1150 sein enzyklopädisches Werk De divisione philosophiae schrieb, eine der vier Handschriften der Etymologiae aus der Bi-blioteca Capitular von Toledo zur Hand hatte, möglicherweise sogar den Codex Tol. 15-8, der soeben vorgestellt wurde. Was seine Benutzung der isidorianischen Enzyklopädie anbe-langt, die neben der Heiligen Schrift und Boethius als weitere lateinisch-christliche Haupt-quelle der Divisionsschrift gelten muß, ist folgendes hervorzuheben:
Bereits im Prolog von De divisione philosophiae finden sich drei Zitate von Isidor, wel-che die Philosophie bestimmen. Es handelt sich um die klassischen Definitionen der Philo-sophie als „rerum humanarum divinarumque cognitio cum studio bene vivendi coniuncta“9 und, nur eine Zeile weiter, als „ars artium et disciplina disciplinarum“.10 Diese zwei Definitionen werden durch die etymologische Erklärung des Wortes ‚Philosophie‘ als „amor sapientiae“11 ergänzt. Neben den beiden erwähnten Definitionen der Philosophie finden sich vier weitere Definitionen, die aus dem Liber de definitionibus12 des Isaak Israeli stammen, d.h. aus der arabisch-jüdischen Tradition, und denen bereits reichlich Aufmerksamkeit zuteil wurde.13 Demgegenüber ist es jedoch wichtig, zu bemerken, daß Gundissalinus mit den drei genannten Isidor-Zitaten bereits zu Beginn des Werkes seine Einteilung der Philosophie programmatisch auch im Kontext der lateinisch-christlichen Tradition verortet, selbst wenn er diese tiefgreifend verändert.
Bei diesen drei Zitaten, so wie in den meisten Fällen, benennt Gundissalinus seine Quelle nicht. Allein an zwei Stellen offenbart er Isidor als seinen Bezugsautor, so im Kontext der Kapitel ‚De astrologia‘ und ‚De astronomia‘.14 Die für Gundissalinus ungewöhnliche expli-zite Nennung seiner Quelle läßt vermuten, daß diesem Zitat eine besondere Bedeutung für seine Argumentation zukommt. Wenn man andererseits die Kapitel von De divisione unter quantitativen Gesichtspunkten betrachtet, ergibt sich, daß eines der Kapitel, in denen Gun-dissalinus gemessen an der Länge desselben den intensivsten Gebrauch von den Etymologiae des heiligen Isidor macht, ausgerechnet ‚De medicina‘15 ist. Diese Kapitel aber – Astrologie / Astronomie und Medizin – spiegeln in gewissem Maße gerade auch jene Interessenslage wieder, die bereits als charakteristisch für die Leserschaft des Codex Tol. 15-8 ausgewiesen wurde. Und was noch wichtiger ist, sie koinzidieren gerade mit den arabischen Wissen-schaften par excellence, die den nachhaltigsten Einfluß auf die westliche Welt ausüben soll-ten. So befand sich die ‚europäische‘ Medizin vor dem Eindringen der arabischen Texte in einem deplorablen Zustand, während die Araber über ein ausgebildetes Gesundheitswesen verfügten, so wie auch die Astronomie als Wissenschaft im Okzident erst zu dieser Zeit zu
____________________________________________________________________________________________
9 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 7 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 1). 10 Ibid. (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 9). 11 Ibid. (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 3). 12 Vgl. Isaak Israeli, Liber de definitionibus, ed. Joseph Thomas Muckle, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 12-13 (1937-1938), S. 300-328 u. S. 328-340. 13 Siehe z.B. Anton-Hermann Chroust, „The Definitions of Philosophy in the De divisione philosophiae of Dominicus Gundissalinus“, in: New Scholasticism 25 (1951), S. 253-281. 14 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 115-121. 15 Ibid., S. 83-89.
80 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
florieren begann.16 Bekannt ist der Fall des Philosophen Daniel von Morley (ca. 1140-1210), der von Paris in Richtung Toledo aufbrach, um dort die bis dahin in den intellektuellen Zen-tren der Francia vergleichsweise stiefmütterlich behandelten Naturwissenschaften zu studie-ren.17 Gleiches gilt für Gerhard von Cremona, der aus Italien nach Toledo kam, um den Almagest zu studieren, und dann zu einem der produktivsten Übersetzer der Schule von To-ledo wurde, indem er v.a. auch astronomische und medizinische Texte ins Lateinische über-setzte.18 Doch welche ist die genauere Funktion der Isidor-Zitate in den erwähnten Kapiteln, dem ‚De astrologia‘ / ‚De astronomia‘ und dem ‚De medicina‘? Gundissalinus und die Astronomie bzw. Astrologie Zu Beginn des Kapitels ‚De astrologia‘ zitiert Gundissalinus die isidorianische Definition der Astrologie: „Astrologia est scientia mobilis magnitudinis, quae cursus siderum et figuras et habitudines stellarum circa se et circa terram indagabili ratione perquirit.“19
Das zweite Isidor-Zitat des Kapitels betrifft die Geschichte der fraglichen Wissenschaft, die Isidor mit den Chaldäern beginnen und mit Ptolemaios enden läßt:
Astrologiam Caldaei primi docuerunt. Abraham instituisse Aegyptios astrologiam Iosip-pus auctor asseverat. Graeci autem dicunt hanc artem ab Athlantae prius excogitam, ideo-que sustinuisse caelum dictus est. [...] Cum autem multi de astrologia scripserint, inter eos tamen Ptolemaeus rex Alexandriae apud Graecos praecipuus fuit.20
In diesem Zusammenhang muß auf eine Besonderheit des Gundissalinus hingewiesen wer-den: Während Originaltext der hier zitierten Definitionen des Isidor von ‚astronomia‘ die Rede ist, verändert der Archidiakon dies zu ‚astrologia‘, womit er dem – für unsere Begriffe
____________________________________________________________________________________________
16 Vgl. für einen allgemeinen Überblick hierzu W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh 1972, und zwar v.a. S. 63-65 u. S. 65-68, wo ‚europäische‘ und arabische Astronomie bzw. Medizin verglichen werden. Detailliertere Darstellungen der Situation dieser beiden Wissenschaften in Toledo finden sich jeweils in Paul Kunitzsch, Von Alexandria über Bagdad nach Toledo. Ein Kapitel aus der Geschichte der Astronomie (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1 [1991]), München 1991, sowie Heinrich Schipperges, „Zur Rezeption und Assimilation arabischer Medizin im frühen Toledo“, in: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin 39 (1955), S. 277-283. 17 Vgl. seine von Gregor Maurach edierte Philosophia, in: Mittellateinisches Jahrbuch 14 (1979), S. 204-255, wo es S. 212 heißt: „Sed quoniam doctrinam Arabum, quae in quadruvio fere tota existit, maxime his diebus apud Tholetum celebratur, illuc, ut sapientiores mundi philosophos audirem, festinanter properavi. Vocatus vero tandem ab amicis et invitatus, ut ab Hyspania redirem, cum pretiosa multitudine librorum in Angliam veni.“ 18 Unter diesen stechen hervor der Almagest des Ptolemaios für die Astronomie und Galens Tegni gemein-sam mit Avicennas Canon medicinae für die Medizin. Eine kurze Biographie des Gerhard mitsamt Überset-zungsregister findet sich im Nekrolog seiner Schüler, der Gerhards letzter Übersetzung beigegeben wurde. Der Nekrolog wurde mehrfach ediert, etwa in Ferdinand Wüstenfeld, Die Übersetzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 22/2-3 [1877]), Göttingen 1877, S. 57ff. 19 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 115 (Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 15 u. lib. III, 15, 1). 20 Ibid., S. 118-119 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. III, 25, 1).
Gundissalinus und Isidor von Sevilla 81
– invertierten Gebrauch der beiden Terme auch in seinen anderen Schriften folgt.21 Gundissalinus spricht also an dieser Stelle eigentlich von der Astronomie.
Er selbst thematisiert den Unterschied beider im nächsten Kapitel, das er der ‚astronomia‘ (also unserer Astronomie) widmet, die er als eine Wissenschaft definiert „de proposita quaestione [...] iudicandi secundum planetarum et signorum positionem“.22 Diese ist im Kon-text weiterer Wissenschaften angesiedelt, die es erlauben, „über eine vorgesetzte Frage zu urteilen“, „ut geomantia, quae est divinatio in terra, idromantia in aqua, aeromantia in aere, pirromantia in igne, ciromantia in manu et multae aliae, ut scientia augurandi in volatu [...]“.23 In diesem Kapitel nun zitiert er erneut den heiligen Isidor, und zwar gerade um den Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie zu bestimmen:
Secundum vero Isidorum in hoc differunt, quod astrologia caeli conversionem, ortus, obi-tus, motusque siderum continet, vel ex qua causa ita vocentur. Astronomia vero partim naturalis, partim superstitiosa est: naturalis, dum exequitur solis et lunae cursus vel stella-rum certas temporum stationes; superstitiosa vero est illa, quam mathematici sequuntur, qui in stellis augurantur, quique etiam duodecim signa per singula animae vel corporis membra disponunt, siderumque cursu nativitates hominum et mores praeiudicare conan-tur.24
Wie aus diesem Zitat hervorgeht, ist die Haltung des heiligen Isidor der Astrologie im heuti-gen Sinne gegenüber ambig. Offensichtlich erachtet er eine astrologische Wissenschaft als möglich und wünschenswert, wenn auch in einem stark eingeschränkten Sinne. Auf jeden Fall verwirft er sie nicht rundweg, wie Augustin vor ihm und auch zahlreiche Generationen nach dem Bischof von Hippo.25
In einer geistigen Atmosphäre, in der die Nigromantie (zusammen mit anderen ‚okkulten‘ Wissenschaften, wie der Astrologie) anscheinend einen bedeutenden Stellenwert einnahm, mußten die Ausführungen des heiligen Isidor besonders attraktiv erscheinen, indem sie in gewissem Umfang den Vorstoß und die Konsolidierung der astrologischen Wissenschaft legitimieren. Es sei nur am Rande darauf verwiesen, daß gerade zu Gundissalinus’ Zeit die wichtigste Schrift zur Astrologie dieser Epoche von Johannes von Sevilla, der lange Zeit auch mit Gundissalinus in Verbindung gebracht wurde, ins Lateinische übersetzt wird, näm-lich AbÙ MaÝšars Introductorium maius (zugleich einer der wichtigsten Texte für die
____________________________________________________________________________________________
21 Siehe hierzu die erhellende Anmerkung von Manuel Alonso in seiner Edition von Dominicus Gundissali-nus, De scientiis, ed. cit., S. 171-172. 22 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 119. 23 Ibid., S. 119-120. 24 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 121 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. III, 27, 1). 25 Vgl. zur komplexen Haltung Isidors bezüglich der Astrologie Jacques Fontaine, „Isidore de Séville et l’astrologie“, in: Revue des études latines 31 (1954), S. 271-300, sowie von demselben in seiner umfangrei-chen Isidor-Monographie, Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, Bd. II, Paris 1959, S. 453-589. Wenig treffend hingegen scheint die Einschätzung von Olaf Pedersen, demzufolge eines der Verdienste der Etymologiae des heiligen Isidor gerade „the clear distinction between astronomy and astrology and his unambiguous rejection of the later“ sei; ganz im Gegenteil scheint diese Zurückweisung jedoch alles andere als unambig. Siehe Olaf Pedersen, „Astronomy“, in: David C. Lindberg (Hrsg.), Science in the Middle Ages, Chicago 1978, S. 303-337, hier S. 306.
82 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Verbreitung des aristotelischen Denkens).26 Mit dieser und weiteren thematisch verwandten Übersetzungen eröffnete sich Gundissalinus und seinen Zeitgenossen ein neuer, nahezu un-bekannter Erkenntnisbereich. Und dankbar ergreift Gundissalinus die Gelegenheit, die ihm Isidor bietet, indem er diesen seinen Bedürfnissen anpaßt. Denn während der heilige Isidor seine Billigung der Astrologie einschränkt, indem er zwischen einer natürlichen und einer abergläubischen Astrologie unterscheidet, gilt dies nicht für Gundissalinus, für den die Astrologie per definitionem eine „scientia iudicandi“ oder „augurandi“ ist, die Isidor gerade als abergläubisch qualifiziert. Gundissalinus folgt hierin al-FÁrÁbÐs Traktat KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm, den er ausführlich im vorliegenden Kapitel zitiert, sowie zahlreichen arabischen Au-toren, die der Astrologie als „scientia iudicandi“ eine herausragende Rolle zusprechen.27
Was jedoch hier von Interesse ist, ist die Tatsache, daß das explizite Isidor-Zitat in die-sem Kapitel – auf die Seltenheit expliziter Zitate bei Gundissalinus ist bereits hingewiesen worden – eine besondere Funktion erfüllt: Mit dem Isidor-Zitat rekurriert Gundissalinus auf eine Instanz innerhalb seiner eigenen Tradition, die ihn dazu autorisiert, neue Elemente in diese Tradition zu integrieren – Elemente, die aus der arabischen Welt herkommen und die zu rechtfertigen er sich gegenüber der westlichen Welt genötigt sieht.28 Gundissalinus und die Medizin
Für das Kapitel ‚De medicina‘ gilt ähnliches: Bereits zu Beginn des Kapitels bedient sich Gundissalinus des heiligen Isidor, um eine Definition der Medizin vorzulegen: „Medicina est, quae corporis humani vel tuetur vel restaurat salutem.“29 Später dann zitiert er ihn, um die Teile der Medizin einzuführen und zu erklären: „pharmatica“, „cirurgia“ und „dieta“:
____________________________________________________________________________________________
26 Vgl. zur systematischen Bedeutung dieses Werkes für die Philosophie des Mittelalters v.a. Richard Le-may, AbÙ MaÝshar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century – The Recovery of Aristotle’s Natural Philosophy Through Arabic Astronomy, Beirut 1962. Lemay selbst war es, der später versuchte, in „De la scolastique à l’histoire par le truchment de la philologie: itinéraire d’un médiéviste entre Europe et Islam“, in: Biancamaria Scarcia Amoretti (Hrsg.), La diffusione delle scienze islamiche nel medio evo europeo, Rom 1987, S. 399-535, bes. S. 408-427, Johannes von Sevilla in recht diffuser Argumentation mit Johannes Hispanus und diesen mit Avendauth, also Gundissalinus’ Mitarbeitern, zu identifizieren. 27 Eine ausführlichere Behandlung der Rolle der Astrologie in De divisione philosophiae findet sich bei Lynn Thorndike, A History of Magic and Experimental Science During the First Thirteen Centuries of Our Era, Bd. II, New York 1929, S. 78-81. 28 Neben Isidor könnte noch eine zweite lateinisch-christliche Quelle auf Gundissalinus’ Konzeption der Astronomie gewirkt haben. Es handelt sich um die beiden bereits erwähnten und von Charles Burnett ent-deckten Chartreser accessus zur Wissenschaft von den Sternen. Vgl. Charles Burnett, „A New Source for Dominicus Gundissalinus’s Account of the Science of the Stars?“, in: Annals of Science 47 (1990), S. 361-374. Allerdings muß gesagt werden, daß zwar beide Traktate in Handschriften von Chartreser Provenienz überliefert sind, doch läßt Burnett außer acht, daß sie dort gerade mit zahlreichen von der Iberischen Halbin-sel stammenden Schriften zusammenstehen. Damit ist offen, ob hier tatsächlich Chartreser Gedanken auf Gundissalinus wirken oder nicht vielmehr eine umgekehrte Beeinflussung anzunehmen ist, d.h. daß hier womöglich Texte hispanischer Provenienz rezipiert werden. In jedem Fall bezeugen diese Texte jedoch ein-mal mehr den regen Austausch zwischen Chartres und Toledo. 29 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 83 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. IV, 1, 1).
Gundissalinus und Isidor von Sevilla 83
Pharmatica graece latine dicitur medicamentum, cirurgia manus operatio, dieta dicitur re-gula. Pharmacia igitur est medicamentorum curatio, cirurgia ferramentorum incisio, dieta est legis ac vitae observatio. Hiis tribus modis fit omnis curatio morbi.30
An einer weiteren Stelle zitiert Gundissalinus Isidor, um den Ursprung der Bezeichnung der Medizin zu erläutern:
Medicina a modo i.e. temperamento dicitur, ut non statim, sed paulatim adhibeatur. Nam multo natura contristatur et mediocritate gaudet. Unde, qui pigmenta et antidota satis vel assidue biberint vexantur. Immoderatio enim non salutem homini sed periculum affert.31
Diese drei Zitate sind allesamt Definitionen oder Erklärungen von (z.T. griechischen) termini technici. Für die Rezeption der arabischen Medizin bedeutet dies, daß obwohl der europäi-schen Philosophie der Zeit eine klare Vorstellung vom Wesen der Medizin als Wissenschaft abgeht, gleichwohl durch Isidor die terminologischen Kategorien überliefert sind, die es erlauben, den Inhalt dieser Wissenschaft zu erfassen.
Während die bisherigen Isidor-Zitate des Medizin-Kapitels, wie gezeigt, more etymolo-gico vorgehen, folgt nun ein systematisch äußerst bedeutsames Zitat:
Quaeritur a quibusdam cur inter ceteras liberales disciplinas medicinae ars non connume-ratur. Ad quod respondetur: propterea quia illae singulares continent causas, ista vero om-nium. Nam et grammaticam medicus scire iubetur, ut intelligere vel exponere possit, quae legit; similiter et rhetoricam, ut veracibus argumentis valeat deffinire ea, quae tractat [es folgen die weiteren artes liberales, die hier übersprungen werden]. Nam sicut ait quidam medicorum cum ipsorum qualitatibus et nostra corpora commutantur: hinc est, quod medi-cina secunda philosophia dicitur. Vera enim disciplina totum hominem sibi vendicat. Nam sicut per illam anima, ita per hanc corpus curatur. 32
Es folgen noch zwei weitere lange Isidor-Zitate aus den Etymologiae, welche die Geschichte der medizinischen Disziplin nachzeichnen, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden brauchen, zumal für den gegenwärtigen Kontext das eben erwähnte Zitat von vorrangiger Bedeutung ist. Denn mit ihm versucht Gundissalinus, die Integration der Medizin in den traditionellen ordo scientiarum zu rechtfertigen: die septem artes liberales. So scheint die Medizin, die Gundissalinus als Wissenschaft aus arabischen Quellen schöpft – insbesondere aus dem Canon medicinae des Avicenna, der von dem bereits mehrfach erwähnten Gerhard von Cremona übersetzt wurde und der von Gundissalinus im Verlauf des vorliegenden Ka-pitels immer wieder zitiert wird –33 weder im Rahmen des Quadrivium (arithmetica, geome-tria, musica, astronomia) noch des Trivium (grammatica, rhetorica, dialectica) einen Platz zu finden. Es muß daher ein Platz für sie innerhalb der eigenen Tradition gesucht werden, und diesen Platz scheint Gundissalinus in den Worten Isidors zu finden, der behauptet, daß die Medizin, insofern als sie aller anderen philosophischen Disziplinen bedarf, in gewisser Weise eine zweite Philosophie ist. Damit verfügt Gundissalinus über ein starkes Argument
____________________________________________________________________________________________
30 Ibid., S. 85 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. IV, 9, 2). 31 Ibid., S. 86 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. IV, 2, 1). 32 Ibid., S. 87-88 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. IV, 13, 1-5). 33 Vgl. zu diesem Werk und seinem Einfluß auf die abendländische Medizin Danielle Jacquart, „La méde-cine arabe et l’occident“, in: Louis Cardaillac (Hrsg.), Tolède XII-XIII. Musulmans, chrétiens et juifs: le savoir et la tolérance, Paris 1992, S. 192-199.
84 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
aus der eigenen Tradition, daß es ihm erlaubt, die Medizin in sein philosophisches System zu integrieren.
Die Etymologiae des heiligen Isidor können somit verstanden werden als die hermeneuti-schen Bedingungen, die es den westlichen Philosophen erlauben, den medizinischen Diskurs der Araber zu verstehen. Und dies in einem doppelten Sinn: nämlich sowohl material, inso-fern Isidor ihnen die Begrifflichkeiten zur Verfügung stellt, mit denen sie den Inhalt der neuen Wissenschaft fassen können, als auch formal, insofern er ihnen den Ort dieser Wis-senschaft mit Bezug auf die anderen Wissenschaften vorgibt.
Wenn zuvor gesagt wurde, daß die Aufmerksamkeit erstaunen könnte, welche die Leser des Codex Tol. 15-8 dem Kapitel ‚De medicina‘ trotz der Oberflächlichkeit der medizini-schen Kenntnisse des heiligen Isidor schenken, so ist nun verständlich, warum dies so ist: Die Leser interessierte gerade die Oberfläche, d.h. der Ort der Medizin in Bezug auf die an-deren Wissenschaften sowie ihre Begrifflichkeit; die Inhalte der Medizin hingegen schöpften sie aus den arabischen Texten. Wie im Falle der Astrologie geht es also auch hier darum, dem ‚Neuen‘ gleichsam einen Ort innerhalb des ‚Bekannten‘ zuzuweisen. Robert Kilwardby: De ortu scientiarum
Die herausgehobene Stellung Isidors im Prolog und in den Kapiteln über Astronomie / Astrologie und Medizin in De divisione philosophiae wird in gewisser Weise bestätigt durch den englischen Dominikaner Robert Kilwardby, einen Zeitgenossen des Thomas von Aquin. Sein Werk De ortu scientiarum kann als eine der gelungensten und zugleich als letzte der großen Synthesen des mittelalterlichen Wissenschaftskosmos gelten, womit sie direkt an-knüpft an die Tradition der isidorianischen Etymologiae und des De divisione philosophiae von Gundissalinus. Und tatsächlich ist ein Großteil des De ortu scientiarum, wie bereits mehrfach herausgestellt wurde, durch De divisione philosophiae inspiriert,34 wodurch Robert Kilwardby zum bedeutendsten Vermittler des Gundissalinus wurde. So dürfte die Kenntnis, die Thomas von Aquin von Gundissalinus besaß, vermutlich in weiten Teilen von Robert Kilwardby stammen.
Bemerkenswert für die hier angestellten Überlegungen ist nun, daß sich zwar insgesamt in De ortu scientiarum im Vergleich mit De divisione philosophiae ein deutlicher Rückgang des Interesses an Isidor konstatieren läßt, daß dies jedoch in keiner Weise die soeben analy-sierten Passagen betrifft.35 Ganz im Gegenteil bietet Kilwardby bereits im zweiten Kapitel seines Werkes, ‚De definitione et ortu philosophiae in generali‘,36 zwei isidorianische Defini-tionen der Philosophie an. Zum einen jene, die schon bei Gundissalinus begegnete: „Philo-____________________________________________________________________________________________
34 Bereits Ludwig Baur erkannte diese Abhängigkeit. Siehe S. 368-380 der Studie, die seine Edition von Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., begleitet. Seither ist dieser Einfluß in nahezu allen Lexikonartikeln zu Gundissalinus unablässig wiederholt worden; doch scheint keine eingehendere Untersuchung zum Thema vorzuliegen. 35 Der Einfluß des heiligen Isidor auf Robert Kilwardby ist gleichsam en passant zuerst (und meines Wis-sens auch zuletzt) kommentiert worden von Daniel A. Callus, „The Tabulae super Originalia Patrum of Robert Kilwardby, O.P.“, in: Studia Mediaevalia in Honor of R. J. Martin, Brügge 1948, S. 243-270, und hier S. 268ff. 36 Robert Kilwardby, De ortu scientiarum, ed. Albert G. Judy, Toronto 1976, hier S. 10.
Gundissalinus und Isidor von Sevilla 85
sophia est rerum divinarum humanarumque cognitio cum studio bene vivendi coniuncta“,37 sowie eine neue, die an die Stelle der Definition der Philosophie als „ars artium et disciplina disciplinarum“ tritt, nämlich: „Philosophia est divinarum humanarumque rerum, in quantum homini possibile est, probabilis scientia.“38 Robert Kilwardby verzichtet auf die isidoriani-sche Erklärung des Namens der Philosophie, die Gundissalinus zitiert. Gleichwohl lassen die genannten Zitate keinen Zweifel daran, daß es für Kilwardby ebenso wie für Gundissalinus wichtig ist, seine Einteilung der Philosophie in einen traditionellen lateinisch-christlichen Rahmen einzubetten, der ihm durch Isidor vorgegeben wird.
Die zweite Stelle innerhalb des Werkes, die eine deutliche Verdichtung von Isidor-Zita-ten aufweist, ist das zwölfte Kapitel XII ‚De ortu astronomiae et astrologiae et earum diffe-rentia, subiectis, finibus et definitionibus‘,39 d.h. der Kontext der Astronomie und Astrologie. So wird Isidor zitiert, um die Astronomie zu definieren als „astrorum lex quae cursus side-rum et figuras et habitudines stellarum inter se et circa terram indagabili ratione percurrit“.40 Aber auch um den Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie herauszustellen, rekur-riert Kilwardby auf Isidor, indem er letztgenannte mittels der Kategorien „naturalis“ und „superstitiosa“ differenziert:
Quaedam autem pars naturalis est, scilicet quae ex virtute stellarum satagit reddere causas eventuum naturalium, qui contingunt in hoc inferiori mundo [...] Quaedam autem est quasi naturalis, sed non est vere naturalis sed mendax et superstitiosa [...] Ista [...] in unum col-lecta dicitur astrologia secundum Isidorum in eodem libro et capitulo [...]41
Dies ist derselbe Passus, der auch von Gundissalinus herangezogen wird und der es beiden Philosophen erlaubt, der Astrologie im traditionellen Curriculum der Philosophie einen Platz zuzuweisen und sie gegen ablehnende Haltungen wie jene Augustins in Schutz zu nehmen.
Noch aufschlußreicher ist jedoch die dritte Stelle, an der sich Isidor-Zitate häufen: das vierunddreißigste Kapitel ‚De divisione et speciebus mechanicae secundum Hugonem de Sancto Victore‘,42 in dem, wie der Titel bereits andeutet, die septem artes mechanicae verhandelt werden, von denen eine die Medizin ist. Zu Recht hat man diese durch Hugo von Sankt Viktor vorgenommene Restrukturierung des Einteilungsschemas der Philosophie mit Gundissalinus’ Leistungen verglichen: Denn beide weisen ein großes Bemühen um die As-similation der neuen (arabischen) Gedanken auf.43 Interessant ist nun, daß Kilwardby am Ende der Diskussion über lanificium, armatura, navigatio, agricultura, venatio, medicina und theatrica, denen er je einen Abschnitt widmet, einen weiteren Abschnitt hinzufügt, der folgendermaßen beginnt: „Et notandum quod de his quae ad has artes spectant, multa tractat Isidorus in libro Etymologiarum.“44 Hierauf folgt eine ausführliche Verzeichnung von ____________________________________________________________________________________________
37 Ibid. (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 1). 38 Ibid. (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. II, 24, 9). 39 Ibid., S. 32-35. 40 Ibid., S. 34 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. III, 24, 1). 41 Ibid., S. 32-33 (= Isidor von Sevilla, Etymologiae, lib. III, 27, 1). 42 Ibid., S. 129-130. 43 Siehe zu einem Vergleich beider Lucia Miccoli, „Le ‚arti meccaniche‘ nelle classificazione delle scienze di Ugo di San Vittore e Domenico Gundisalvi“, in: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia Bari 24 (1981), S. 73-101; vgl. ferner auch Manuel Alonso, „Hugo de San Víctor, refutado por Domingo Gundisalvo hacia el 1170“, in: Estudios eclesiásticos 21 (1947), S. 209-216. 44 Robert Kilwardby, ed. cit., S. 130.
86 Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
Konkordanzen, mit deren Hilfe der Leser die jeder einzelnen ars mechanica entsprechende Darstellung in Isidors Enzyklopädie finden soll (unter Einschluß des Kapitels ‚De medi-cina‘). Diese Konkordanzliste begründet Robert Kilwardby folgendermaßen:
Haec adiunxi non quia Isidorus dictas artes mechanicas componat et digerat in modum ar-tis [dies ist das Verdienst des Hugo], sed quia ea quae sunt his artibus materiae multa ver-batim exponit et similiter effectus earum multos ad quae qui pro tempore indiguerit faci-lius per dicta recurret.45
Damit ist eine explizite Aussage getroffen über die Absicht, die Kilwardby mit den Isidor-Zitaten verfolgt: Isidor scheint ihm eine besonders reiche Beschreibung („verbatim exponit“) der neuerlich durch Gundissalinus und Hugo in das philosophische Curriculum eingeführten Wissenschaften zu geben. Isidors Rolle für die Rezeption der arabischen Philosophie In seiner Geschichte des mittelalterlichen Denkens kommt der Philosophiehistoriker Kurt Flasch zu folgendem Urteil über den heiligen Isidor:
Er [= Isidor] wollte die vorhandenen heidnischen Nachschlagewerke ablösen im Interesse einer Klerikerausbildung, die den Wissensstand von 600 konserviert. Wenn im Mittelalter eine eingehendere philosophische Reflexion einsetzen sollte, mußte man nach anderen Texten Ausschau halten. Dies erklärt, warum man seit etwa 1200 mit Eifer die arabischen und griechischen Autoren übersetzte.46
Doch wie verträgt sich dies mit der Tatsache, daß sich die Schrift De divisione philosophiae bereits in ihrem Prolog programmatisch als ein Werk isidorianischer Tradition versteht? Und wie könnte dies erklären, daß Gundissalinus Isidor gerade in den gleichsam ‚arabischsten‘ Kapiteln der Divisionsschrift ausgiebig anbringt: Astronomie / Astrologie und Medizin? Es scheint, daß diese Bemerkung Flaschs nach dem Gesagten modifiziert oder doch zumindest nuanciert werden muß, und zwar in dem Sinne, daß die Philosophen im 12. Jahrhundert zwar damit beginnen, sich an anderen Texten zu orientieren, doch tun sie dies nicht in Abwendung von Isidor von Sevilla, sondern gerade indem sie ihn zum Ausgangspunkt wählen. Denn der kaum zu überbietende konzeptuelle Reichtum der isidorianischen Enzyklopädie, auf den Robert Kilwardby ausdrücklich hinweist, macht aus diesem Werk einen Vermittler antiker Wissensbestände, womit Isidor die hermeneutischen Grundvoraussetzungen sowohl mate-rialer als auch formaler Art für das Verständnis und die Integration der neuen Gedanken bereitstellt, die sich ihrerseits aus dem antiken Wissen der großen griechischen Astronomen
____________________________________________________________________________________________
45 Ibid., S. 131. 46 Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart 1986, S. 82. – Differenzierter argumentiert in dieser Hinsicht Jacques Verger, „Isidore de Séville dans les universi-tés médiévales“, in: Jacques Fontaine u. Christine Pellistrandi (Hrsg.), L’Europe héritière de l’Espagne wisi-gothique, Madrid 1992, S. 259-267, der nach dem Hinweis auf das abnehmende Gewicht Isidors für die Autoren des 13. Jahrhunderts darauf insistiert, daß die zentrale Frage weiterhin lautet, warum trotz der Ent-deckung neuer Texte Isidors Werk nicht gänzlich aus dem geistigen Panorama der Zeit verschwindet. Die vorhergehende Untersuchung von Robert Kilwardbys De ortu scientiarum gibt zumindest einige Hinweise zur Beantwortung dieser Frage.
Gundissalinus und Isidor von Sevilla 87
und Ärzte speisen. In dieser Rolle wird Isidor zu einer bedeutsamen Bezugsgestalt des sich Bahn brechenden aristotelischen Wissenschaftspluralismus der Zeit, der gerade nicht mit einem Substitutions- oder Verdrängungsprozeß einhergeht, wie Flaschs Äußerungen sugge-rieren könnten, sondern in einem Anschluß- und Verkettungsprozeß verschiedener Gedan-ken, ja letztlich verschiedener Traditionen vollzogen wird, wie Gundissalinus’ Isidor-Rezep-tion noch einmal deutlich macht.47
____________________________________________________________________________________________
47 Diese Brückenfunktion des Isidor zwischen arabischer und christlicher Kultur gilt übrigens auch in umge-kehrter Richtung, d.h., daß Isidor nicht nur zur Rezeptionsbedingung arabischer Kultur durch christliche Denker wird, sondern auch den Anknüpfungspunkt für arabische Denker an die lateinisch-christliche Welt liefert. So sind Teile des Chronicon maior des Isidor von Sevilla zusammen mit Orosius’ Historiae adversus paganos bereits im 10. Jahrhundert ins Arabische übersetzt worden – diese Übersetzung ist die einzige wis-senschaftliche Übersetzung aus dem Lateinischen ins Arabische zu dieser Zeit! Vgl. dazu Hans Daiber, „Oro-sius’ Historiae adversus paganos in arabischer Überlieferung“, in: J. W. van Henten u.a. (Hrsg.), Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Culture. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram, Leiden u.a. 1986, S. 202-249.
2.4. Zwischenbilanz und Plädoyer für einen avicennisierenden Boethianismus Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, welche Bedeutung der lateinisch-christlichen Tradition und ihrer Bearbeitung im Lichte der arabischen Philosophie für die Entwicklung der gundissalinischen Wissens- und Wissen-schaftstheorie zukommt. Dominicus Gundissalinus erscheint dabei nicht etwa als naiver Eklektiker, der gleichsam unbewußt und ohne Kenntnis der philosophischen Implikationen seines Tuns von hie und da exzerpierte Texte zu einem inkonsistenten ‚Schein‘-Ganzen fügt. Ganz im Gegenteil entpuppt sich der Archidiakon von Cuéllar nicht nur im Falle der boethia-nischen Wissens- und Wissenschaftstheorie und ihrer arabisch vermittelten Fortentwicklung, sondern auch in Bezug auf das Verhältnis von Theologie und Philosophie sowie die ‚neuen‘ Wissenschaften als durchaus eigenständiger und überlegter Denker, der die Schwierigkeiten der eigenen Tradition ebenso wie ihr Potential erkennt und mit dem ‚fremden‘ Denken zu einer echten Synthese bringt. Um diese Synthese in ihrer ganzen Eigenart zu verstehen, sol-len im folgenden die einzelnen Schritte und Ergebnisse der bisherigen Überlegungen zu-sammengefaßt werden:
a) Zunächst wurde in Kapitel 2.1. die Rezeption der Heiligen Schrift bei Gundissalinus und ihr Verhältnis zur Philosophie untersucht. Dabei ergab sich erstens, daß der Archidiakon bereits in De divisione philosophiae eine klare Unterscheidung zwischen biblischem und philosophischem bzw. metaphysischem Wissen trifft, womit er der Philosophie einen von der Offenbarung autonomen Status zubilligt. Zweitens wurde herausgearbeitet, daß diese Auto-nomie der Philosophie nicht zu einer absoluten Unverbundenheit beider Wissenssphären führt, vielmehr scheinen beide in ihren Fluchtlinien in eins zu fallen, oder um mit Gundissa-linus zu reden, es besteht „Konsonanz“ zwischen Metaphysik und Offenbarungstheologie, wie auch Thomas von Aquin ein Jahrhundert später mit den gleichen Worten formulieren wird. Dies, so wurde gezeigt, bedeutet für die Bearbeitung der arabischen Philosophie, daß die Autorität der Heiligen Schrift ipso facto keine Beschränkung darstellt, denn die Wahr-heitsbedingung der falsafa ist nicht ihr Zusammenfallen mit der Heiligen Schrift, vielmehr ist dieses selbst, dort wo es geschieht, das Resultat der Wahrheit beider. Die Philosophie und v.a. die Metaphysik, die bei Gundissalinus erstmals im lateinischen Westen namentlich in Erscheinung tritt, etablieren sich damit als autonome und säkulare Disziplinen gegenüber der Offenbarungstheologie.
b) Es folgte unter 2.2. die Untersuchung der Rezeption boethianischer Elemente bei Gun-dissalinus, wobei sich insbesondere vier Themenkreise der Wissens- und Wissenschaftslehre in ihrer Anschlußfähigkeit an arabische Theorieelemente als signifikant erwiesen. Zum einen wurde die boethianische Klassifikation der Wissenschaften nach ihren Gegenständen (De Trinitate) bei Gundissalinus aufgezeigt und in ihrer Eigenart beleuchtet. Dabei ergab sich, daß immanente Schwierigkeiten dieser Einteilung, die bereits von den Chartreser Autoren thematisiert werden, bei Gundissalinus durch die Hinzunahme arabischer Quellen, v.a. Avi-cenna, und die darauf aufbauende Entwicklung einer komplexen noetischen Abstraktions-theorie zu einer Reformulierung der boethianischen Einteilung führen, die eine konsistentere Konzeption der Wissenschaftsklassifikation erlaubt. Zum anderen konnte der Einfluß der boethianischen Methodenlehre der Wissenschaften (ebenfalls De Trinitate) auf Gundissali-nus belegt werden, wobei sich auch hier zeigte, daß immanente Probleme dieses Ansatzes,
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
90
die von Chartreser Autoren aufgeworfen werden, bei Gundissalinus im Horizont der arabi-schen Philosophie, hier insbesondere der avicennischen Intellekttheorie, zu einer produktiven Revision der boethianischen Vermögenslehre führen. Als drittes Moment der Boethius-Re-zeption bei Gundissalinus wurde die Aufnahme der axiomatischen Methode aus De hebdo-madibus durch den Archidiakon analysiert, die bei diesem durch eine Rekonstruktion dersel-ben in euklidischen Termini aus der arabischen Tradierung Euklids den Rahmen der Chartre-ser Debatten um dieselbe transzendiert und zudem mit Pseudo-al-KindÐ um den Erfahrungs-begriff ergänzt. Als letztes Element der Boethius-Rezeption wurde schließlich die von Avi-cenna geleitete Aufnahme des boethianischen accessus im Hinblick auf die Ordnung der Wissenschaften, ihre Subordination und Binnenstruktur untersucht – ein Problem, das sich Gundissalinus nicht zuletzt aufgrund der Neuentdeckung zahlreicher Wissenschaften stellte, wobei auch hier die Erklärungsansätze Avicennas deutliche Spuren hinterlassen haben. In allen vier Aspekten zeigte sich, daß Gundissalinus spezifisch aristotelische Elemente aus Boethius’ Wissens- und Wissenschaftstheorie herausarbeitet, die zwar auch und gerade die Chartreser Autoren beschäftigten, die bei Gundissalinus jedoch zur Anschlußfigur arabischer Philosophie und damit neuer Lösungsstrategien werden.
c) Als dritte lateinisch-christliche Integrationsgestalt neben der Bibel und Boethius wurde in Kapitel 2.3. die Präsenz und Funktion des Isidor von Sevilla im Werk des Gundissalinus untersucht. Dabei ergab sich, daß dieser in den nachgerade ‚arabischsten‘ Kapiteln von De divisione philosophiae am gegenwärtigsten ist, nämlich in jenen der Astronomie, der Astro-logie und der Medizin. Erklärt wurde diese prima facie erstaunliche Konzentration durch die Tatsache, daß Isidor in seinen Etymologiae zumindest begrifflich das aktual nicht mehr vor-handene Gesamt des antiken Wissensbestandes in lateinischer Sprache konserviert und so gleichsam die materialen und formalen hermeneutischen Voraussetzungen für die Erfassung der durch die arabische Philosophie vermittelten Wissenschaften liefert. So wie die arabische Philosophie im Falle der Boethius-Rezeption für Gundissalinus zu einer differenzierten Be-trachtung der in der eigenen Kultur tradierten wissens- und wissenschaftstheoretischen Mo-mente führt, so gilt also umgekehrt im Falle Isidors, daß dieser die Perspektiven auf die fremde Kultur eröffnet.
Gundissalinus erarbeitet sich damit aufs Ganze gesehen ausgehend von seiner lateinisch-christlichen Tradition ein a) säkulares, b) formal höchst ausdifferenziertes und c) auch mate-rial plurales Wissens- und Wissenschaftsverständnis, dessen Eigenart in der Synthese latei-nisch-christlicher und arabischer Elemente besteht.
Was nun diese Synthese anbelangt, so hat Étienne Gilson bereits 1930 den Versuch un-ternommen, sie näher zu bestimmen, indem er den bereits erwähnten Begriff des ‚augusti-nisme avicennisant‘ prägte,1 der alsbald seinen Weg in die Geschichtsschreibung der Philosophie finden sollte, um nicht nur die Philosophie des Gundissalinus zu beschreiben, sondern zum Kennzeichen einer weiterreichenden, allgemeinen Tendenz in der mittelalterli-chen Philosophie zu werden. Doch blieb dieser Begriff nicht unwidersprochen, und dies zu ____________________________________________________________________________________________
1 Vgl. Étienne Gilson, „Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929-1930), S. 4-149, hier v.a. S. 85: „En réalité, il suffit de le suivre jusqu’au bout pour constater que, dans sa pensée, l’illumination de l’âme par l’Intelligence agente d’Avicenne fait place a l’illumination de l’âme par Dieu. C’est pourquoi, conservant jusqu’à la lettre même de son modèle, il n’a pas un seul instant l’impression de s’engager dans une voie scabreuse, et c’est avec une étrange inconscience qu’il devient l’initiateur de l’augustinisme avicennisant.“
Zwischenbilanz und Plädoyer
91
Recht, wie die vorliegenden Überlegungen insbesondere zur Identifizierung von Gott und Intelligenz – Gilsons einzigem Argument – zeigen (vgl. oben Abschnitt 2.2.3.). Dabei waren es zunächst v.a. Arabisten, die sich an dieser Namensgebung stießen, so etwa Jacob Teicher, demzufolge die Identifizierung von Gott und Intelligenz in keiner Weise augustinisch inspi-riert sei, sondern auf Tendenzen in der arabisch-jüdischen Philosophie selbst zurückgehe. Letztlich sei Gundissalinus’ Position jene des al-ÇazzÁlÐ, der Avicennisches mit der Mystik des Sufismus verbinde – originär Augustinisches hingegen sei nicht zu belegen.2 Was den letzten Punkt anbelangt, so wird man Teicher sicherlich Recht geben müssen, denn Augusti-nus findet sich in der Tat kaum in den Werken des Gundissalinus, und auch an der von Gil-son als Beleg seiner These herangezogenen Stelle aus dem Tractatus de anima lassen sich Augustinus-Zitate nicht ausmachen. Was jedoch die Identifizierung von Gundissalinus’ Po-sition mit al-ÇazzÁlÐs Philosophie betrifft, so ist diese übereilt. Denn die grundsätzliche In-tuition Gilsons von einer Vermittlungsleistung des Gundissalinus, die er in den Begriff des ‚augustinisme avicennisant‘ kleidet, scheint nicht so schnell von der Hand zu weisen zu sein. So haben andere Kritiker der Formulierung Gilsons in Entsprechung zum ‚lateinischen Aver-roismus‘ von einem ‚lateinischen Avicennismus‘ sprechen wollen, um eben dieser Vermitt-lung Rechnung zu tragen.3 Diese Terminologie ist zwar in ihrer Offenheit gewiß angemesse-ner als jene Verengung, die Gilson vorschlägt, doch bleibt sie in Bezug auf Gundissalinus sehr generisch. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich der scheinbar präzisere Begriff des ‚augustinisme avicennisant‘ hartnäckig gehalten hat. So tritt er z.B. noch in dem ansonsten vorbildlichen Vorwort der Neu-Edition von De processione mundi in Erscheinung; und dies paradoxerweise obwohl die Autorin den Tractatus de anima – der Gilsons einziger Belegtext für seine Klassifizierung ist – Gundissalinus nicht mehr zuschreiben will.4
Die beiden vorgeführten traditionellen Bezeichnungen der Philosophie des Gundissalinus erweisen sich damit als letztlich ungenügend oder zumindest zu ungenau. Es ist dies freilich nicht der Ort, um einen Gemeinplatz durch den nächsten zu ersetzen, will man jedoch einen präzisen und brauchbaren Titel finden, um in wenigen Worten die Philosophie des Domini-cus Gundissalinus zu beschreiben, so scheint die Rede von einem ‚avicennisierenden ____________________________________________________________________________________________
2 Siehe Jacob Teicher, „Gundissalino e l’agostinismo avicennizzante“, in: Rivista di filosofia neo-scolastica 26 (1934), S. 252-258, der S. 258 mit aller Vehemenz gegen Gilson schließt: „[...] possiamo quindi conclu-dere che pure la fonte di inspirazione del misticismo di Gundissalino è d’origine musulmana anziechè cristiana e che pertanto, anche per questo rispetto, la construzione di Gilson circa la epurazione della psico-logia avicenniana con la concezione cristiana mistica iniziata da Gundissalino, e che avrebbe dato origine al movimento dell’agostinismo avicennizzante, non poggia su alcun fundamento.“ 3 Zu nennen ist hier v.a Roland de Vaux, der diesen Begriff prägte, und zwar wiederum mit besonderer Rück-sicht auf Gundissalinus. Vgl. seine Notes et textes sur l’avicennisme aux confins des XIIe-XIIIe siècles, Paris 1934, in deren Anhang sich eine auszugsweise Edition des Tractatus de anima von Gundissalinus findet. – Auch dieser Begriff ist im übrigen diskutiert worden, so etwa von Ermenegildo Bertola, „È esistito un Avi-cennismo latino nel Medioevo?“, in: Sophia 39 (1971), S. 318-334, der nach einer sehr differenzierten Be-trachtung sowohl des ‚augustinisme avicennisant‘ als auch des ‚lateinischen Avicennismus‘ zu dem allzu konzilianten Ergebnis kommt, daß beide cum grano salis brauchbar seien. 4 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 25 u. 28, sowie dazu meine Besprechung in: Estudios eclesiásticos 76 (2001), S. 664-666. – Was die Autorschaft des Tractatus anbelangt, so folgen die Herausgeberinnen einer Vermutung Alonsos, der Avendauth zum Verfasser dieser Schrift machen möchte. Siehe Manuel Alonso, „Gundisalvo y el Tractatus de anima“, in: Pensamiento 4 (1948), S. 71-77. Vom Handschriftenbefund her ist diese These nur schwerlich haltbar, denn hier finden sich eindeutige Zu-schreibungen zu Gundissalinus, und nicht zu Avendauth.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
92
Boethianismus‘ weitaus angemessener. Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, von welcher Tragweite und Nachhaltigkeit der Einfluß des Boethius auf Gundissalinus’ wissens- und wissenschaftstheoretische Systembildung ist und wie er eben jene Vermittlung leisten kann, die Gilson bei seiner Begriffsprägung vor Augen hatte. Zwar hat sich dabei auch die nicht zu unterschätzende Bedeutung der Heiligen Schrift und der Etymologiae des Isidor von Sevilla gezeigt, doch scheint das Herzstück der gundissalinischen Philosophie überhaupt, nämlich seine Theorie des Wissens und der Wissenschaften, durch und durch boethianisch fundiert zu sein. Und letztlich stimmt dem auch Gilson zu, wenn er in seinem einschlägigen Artikel – bezeichnenderweise allerdings nur in einer Anmerkung zum Haupttext – schreibt:
En dehors de ces rapprochements qui ne prouvent aucune filiation réelle, la seule source certaine de Gundissalinus en ce qui concerne sa théorie de l’intelligentia est celle à la-quelle lui-même nous renvoie [...]: Boèce. [...] Saint Augustin n’a laissé sur ce point qu’une terminologie imprécise.5
Warum dann noch am ‚augustinisme avicennisant‘ festhalten, wenn die entsprechenden Phä-nomene sich mindestens ebensogut mit dem Einfluß des Boethius deuten lassen, der zugleich Erklärungspotential für weitere spezifische Verschränkungen lateinisch-christlicher und ara-bischer Denkfiguren bei Gundissalinus bietet? Letzteres ist für die Klassifikation der Objekt-bereiche und Methoden, die Axiomatik sowie für die Subordinationstheorie und die Binnen-differenzierung der Wissenschaften bei Gundissalinus gezeigt worden. Es scheint mithin keine triftigen Gründe für die Rede von einem ‚augustinisme avicennisant‘ zu geben,6 wohl aber läßt sich ein deutlicher Einfluß des Boethius auf Gundissalinus belegen, der mit der Rezeption Avicennas und der arabischen Philosophie überhaupt Hand in Hand geht, was die Bezeichnung eines ‚avicennisierenden Boethianismus‘ sinnvoll erscheinen läßt.7
Mit der Ersetzung des Augustinus durch Boethius soll jedoch nicht nur quellenorientiert eine lateinisch-christliche Autorität durch eine andere ausgetauscht werden, vielmehr ver-bindet sich damit zugleich der Versuch, zu einem besseren Verständnis der Verbindungsli-nien und Kontinuitäten zwischen lateinisch-christlicher und arabischer Tradition zu gelan-gen. Miguel Cruz Hernández, ebenfalls ein Kritiker der Begriffsprägung Gilsons, bemerkt im Hinblick auf diese, daß sie einen Augustinismus sensu stricto voraussetzt, der zu einer Avi-cennisierung strebt. Doch wie soll dieses Streben verstanden werden, fragt er. Wird hier Avicennisches im klassischen Gewand des Augustinus in die lateinische Welt geschmuggelt? Oder soll die avicennische Dialektik zu einer Generalüberholung der Scholastik beitragen?8
____________________________________________________________________________________________
5 Sie Étienne Gilson, art. cit., S. 86, Anm. 1. 6 Siehe in diesem Sinne neuerdings auch Dag Nikolaus Hasse, Avicenna’s ‚De anima‘ in the Latin West. The Formation of a Peripatetic Philosophy of the Soul 1160-1300, London u. Turin 2000, der sich S. 208-209 entschieden gegen die Subsumtion des Archidiakons unter diesen Titel ausspricht. Allerdings scheint Hasse zu weit zu gehen, wenn er Gundissalinus’ Identifizierung von Gott und aktivem Intellekt, die im Abschnitt 2.2.3. dargestellt wurde, gänzlich bestreitet. 7 Daß die arabischen Wissenschaften bei Gundissalinus vielmehr gerade gegen Augustinus rezipiert werden, ist in den Ausführungen zur Astronomie/Astrologie im letzten Kapitel deutlich geworden. 8 Vgl. das Vorwort von Miguel Cruz Hernández zu Noboru Kinoshita, El pensamiento filosófico de Domingo Gundisalvo, S. 16: „[Der ‚avicennisierende Augustinismus‘] supone la existencia de un agustinismo sensu stricto desde mediado el siglo XII hasta el primer tercio del XIII que tendía hacia una avecenización. ¿Cómo?, ¿introduciendo la mercancía avicenista bajo el clásico ropaje agustiniano?, o por el contrario, ¿uti-
Zwischenbilanz und Plädoyer
93
Die Formulierungen sind bewußt polemisch, doch machen sie auf ein wichtiges Problem aufmerksam: denn wie soll der Zusammenhang und Übergang zwischen Augustinismus und Avicennismus erklärt werden, ohne dabei rein äußerlich zu bleiben? Das Konzept des ‚avi-cennisierenden Boethianismus‘ bietet dagegen eine Erklärung des intrinsischen Zusammen-hangs zwischen Boethius und Avicenna. Die Verbindung von Boethius und Avicenna zielt nicht auf die Christianisierung des letzteren, sondern nimmt ihren Ausgang bei systemati-schen Fragestellungen, die innerhalb der eigenen Tradition als aporetisch erscheinen – so bei den Chartreser Autoren –, die jedoch durch Zuhilfenahme der arabischen Philosophie neue Zugänge erlauben, wie die untersuchten Bereiche der Wissenschaftsklassifikation nach Ge-genständen und Methoden sowie der Axiomatik und der Subordination bzw. Binnendifferen-zierung der Wissenschaften gezeigt haben. Dabei ist der Garant dieses Zusammenhangs ganz offensichtlich der aristotelische Hintergrund des Boethius wie des Avicenna: Weil beide Autoren sich letztlich aus derselben Quelle speisen, führt die Synopse ihrer Ansätze zu ei-nem neuen und vertieften Verständnis aristotelischer Motive. In dieser Weise ergänzen sich Boethius und Avicenna zu einem letztlich aristotelischen Gesamtentwurf von Wissens- und Wissenschaftstheorie.
Damit ist zugleich ein weiterer gewichtiger Komplex der Auseinandersetzung um den ‚augustinisme avicennisant‘ angeschnitten. Denn dieser verfehlt nicht nur die tatsächliche Quellenlage des Gundissalinus, vielmehr suggeriert er darüber hinaus ein platonisches Grundkonzept, das mit dazu beigetragen hat, Gundissalinus dem Platonismus als dem Ari-stotelismus scheinbar diametral entgegengesetzter Position zuzurechnen. So hat etwa James Weisheipl den fundamental aristotelischen Charakter der gundissalinischen Wissenschafts-klassifikation zugunsten einer platonischen Konzeption bestritten.9 Auch wenn bereits in den vorangegangenen Ausführungen immer wieder auf die aristotelischen Wurzeln der gundissa-linischen Philosophie hingewiesen wurde, sollen deshalb das platonische und das aristoteli-sche Modell der Wissens- und Wissenschaftstheorie noch einmal als Ganze nebeneinander gestellt werden, um das aristotelische Erbe des Gundissalinus kenntlich zu machen: In er-kenntnistheoretischer Hinsicht steht der Platonismus im Anschluß an das sogenannte Lini-engleichnis aus Platons Politeia für die Auffassung, daß der Erkennende, der seine Erkennt-nisvermögen kontinuierlich gebraucht, von der sinnlichen Wahrnehmung über das Erkennen der Gegenstände der Mathematik bis zur reinen Ideenschau gelangt. Parallel dazu werden auch die Wissenschaften als in einer strikten Hierarchie befindliche verstanden: Bereits im Aufstieg von der Naturwissenschaft zur Mathematik umfaßt letztere alles wesentliche der ersten, wie denn auch die Wissenschaft von den Ideen alle anderen Wissenschaften ein-schließt. In der Dialektik, so Platons Name für die höchste Disziplin, vereinen sich die ver-schiedenen Wissenschaften in einer einzigen, weshalb dieses Paradigma als Einheitswissen-schaft bezeichnet werden kann. Der Aristotelismus nun repräsentiert Positionen, in denen erkenntnistheoretisch die sensitiven und intellektuellen Vermögen nicht bloß notwendige Stufen auf dem Weg zu einer höchsten Einsicht bzw. Idee sind, sondern in dem, was sie ____________________________________________________________________________________________
lizando la estupenda armadura dialéctica de Avicena para dearrollar y mettre à la page al pensamiento es-colástico latino de raíces agustinianas y pámpanos erigenistas, anselmianos, victorinos, etc.?“ 9 Siehe James A. Weisheipl, „Classification of the Sciences in Medieval Thought“, in: Mediaeval Studies 27 (1965), S. 54-90, hier S. 72: „Far from being fundamentally Aristotelian, this conception is neo-Platonic in foundation.“ In dieser Linie stehen auch die Ausführungen von Martin Anton Schmidt, „Scholastik“, in: Die Kirche in ihrer Geschichte II (1969), G 69-181, hier G 103.
Lateinisch-christliche und arabische Voraussetzungen
94
spezifisch erkennen, ihre jeweilige Berechtigung und Selbständigkeit finden, womit auch die sinnliche Erfahrung zu einer authentischen Erkenntnisquelle wird. So ist beispielsweise die Singularität eines Gegenstandes allein in der Wahrnehmung gegeben, wogegen derselbe Gegenstand mit den vermeintlich höheren Vermögen nur als Vertreter einer Art oder Gattung erkannt werden kann. In wissenstheoretischer Hinsicht hat dies die u.a. in Aristoteles’ Meta-physik entwickelte Konsequenz, daß jede Wissenschaft über die ihrem Gegenstandsbereich angemessenen Methoden verfügen muß, so daß sich die Wissenschaften nicht aufeinander zurückführen lassen, womit anders als bei Platon ein plurales Wissenschaftsverständnis vor-liegt. Entsprechend sind die Wissenschaften in einem bestimmten Sinn axiomatisch struktu-riert, d.h. jede Wissenschaft beruht auf einer Reihe von je eigenen Prämissen, aus deren An-wendung sie zu Resultaten gelangt, die sie aber selbst nicht begründen kann.10
Daß Gundissalinus der aristotelischen Tradition zuzurechnen ist und nicht dem platoni-schen Einheitskonzept, stand bereits für eine Vielzahl von Philosophiehistorikern außer Frage und wird durch die vorliegenden Ausführungen noch einmal in aller Deutlichkeit be-stätigt:11 Sein a) säkulares, b) formal komplexes, weil u.a. nach Gegenständen und Methoden differenziertes und c) auch material plurales Wissens- und Wissenschaftsverständnis nimmt die wesentlichen Grundzüge des Aristotelismus auf. Hinzu kommen Gundissalinus’ Ver-ständnis der Axiomatik sowie seine Verknüpfung prinzipientheoretischer Überlegungen mit dem Erfahrungsbegriff, die ebenfalls genuin aristotelisch sind. Wenn sich Gundissalinus dabei auf zwei Neoplatoniker beruft, namentlich Boethius und Avicenna, so tut dies seinem Aristotelismus keinen Abbruch. Denn der Neoplatonismus als eine selbst komplexe Tradition darf nicht einfachhin im Gegensatz zum Aristotelismus gesehen werden. So stehen gerade Boethius und Avicenna für eine distinkte Form des Neoplatonismus, die in deutlicher Orien-tierung an Aristoteles dessen Grundgedanken, insbesondere für die Wissens- und Wissen-schaftstheorie, mit Momenten aus der platonischen Ontologie zu verbinden trachtet. Über-haupt ist der Neoplatonismus seit alters her kein Gegenprogramm zum Aristotelismus, son-dern gerade in seinem Methodenbewußtsein streng an Aristoteles geschult – nicht von unge-fähr entstehen die bedeutendsten Aristoteles-Kommentare der Spätantike in den Schulen des Neoplatonismus. Gundissalinus steht damit gewiß in der Linie des Neoplatonismus, doch eben eines genuin aristotelischen Neoplatonismus, der mit dem platonischen Konzept der Wissenschaften nichts gemein hat. Die Kurzformel eines ‚avicennisierenden Boethianismus‘ stellt den Versuch dar, die aufgedeckten lateinisch-christlichen Voraussetzungen und ihre Verknüpfung mit Gundissalinus’ Rezeptions- und Assimilationsleistungen arabischer Philo-sophie im Bereich seiner Epistemologie auf einen Punkt zu bringen, der zugleich ihre aristo-telische Grundtendenz deutlich zum Ausdruck bringt. Der ‚avicennisierende Augustinismus‘ läuft hingegen Gefahr, mit Augustinus den gundissalinischen Ansatz im Sinne einer rein platonischen Wissenschaftskonzeption mißzuverstehen.
____________________________________________________________________________________________
10 Vgl. zu dieser keinesfalls erschöpfenden, aber für die vorliegende Arbeit ausreichenden Charakterisierung von platonischen und aristotelischen Wissens- und Wissenschaftsmodellen auch Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, „Von Toledo nach Paris – Wege der Wissenschaft und der Wissenstheorie im 12. Jahrhundert“, in: Forschung Frankfurt 19/1 (2001), S. 31-39, hier S. 35. 11 So z.B. Fernand van Steenberghen, „L’organisation des études au Moyen Âge et ses répercussions sur le mouvement philosophique“, in: Revue philosophique de Louvain 52 (1954), S. 572-592, hier S. 588, weiter oben zitiert in Kapitel 2.1.
Zwischenbilanz und Plädoyer
95
Das Anliegen der bislang präsentierten Überlegungen war es, wie in der Einführung dar-gelegt wurde, über die Frage solcher Klassifikationen hinausgehend einen neuen Beitrag zum besseren und vertieften Verständnis der einsetzenden Rezeptionsbewegung der aristoteli-schen Philosophie im Horizont der intellektuellen Revolution des 12. Jahrhunderts zu liefern: In dieser Hinsicht muß zunächst festgehalten werden, daß auch Gundissalinus ein Kind der von Marie-Dominique Chenu so genannten aetas boetiana ist,12 ein Begriff, der v.a. mit Blick auf die Chartreser Autoren geprägt wurde, der aber gleichermaßen das geistige Klima im Toledo des 12. Jahrhunderts trifft. Denn ganz offensichtlich nimmt Gundissalinus aktiven Anteil an den Chartreser Diskussionen zur Wissens- und Wissenschaftstheorie, wie die er-wähnten Beispiele zeigen.13 Indem der Archidiakon aber ebenso wie die Chartreser die boethianischen Ansätze zur Wissens- und Wissenschaftstheorie bis an ihre Grenzen voran-treibt, die sich so ergebenden Probleme dann aber mit der arabischen Philosophie verbindet, zeichnen sich bei Gundissalinus, wie gezeigt wurde, bereits die wesentlichen Theorieele-mente der aristotelischen Epistemologie vor. Beide, d.h. die Probleme der eigenen Tradition ebenso wie die diesbezüglichen Lösungsstrategien der arabischen Philosophie, verquicken sich bei Gundissalinus so zu einem impliziten Aristotelismus, der maßgeblich von der Aus-einandersetzung mit der boethianischen und avicennischen Wissens- und Wissenschaftstheo-rie angeleitet wird. Ja diese sind, wie im folgenden deutlich werden wird, die Voraussetzun-gen für eine auch explizite Aufnahme der aristotelischen Epistemologie durch Gundissalinus, die sich mithin gleichsam in einem Dreischritt rekonstruieren läßt: immanente Schwierig-keiten der lateinisch-christlichen Epistemologie – Lösungsangebote der arabischen Philoso-phie – Rezeption des Aristoteles. Die bisher in dem Begriff des ‚avicennisierenden Boethia-nismus‘ kondensierte Bewegung beschreibt die ersten beiden Stationen dieser Entwicklung. Konsequent soll nun vor diesem Hintergrund im nächsten Teil der Arbeit der dritte Schritt verhandelt werden, nämlich die explizite Aufnahme der aristotelischen Wissens- und Wis-senschaftstheorie.
____________________________________________________________________________________________
12 Vgl. das sechste Kapitel von Marie-Dominique Chenu, La théologie au XIIe siècle, Paris 1957, S. 143-158. 13 Auf die Berührungspunkte zwischen Gundissalinus und den Chartreser Autoren ist sowohl im Zusammen-hang der gundissalinischen Bibelrezeption als auch seiner Boethius-Interpretationen und seiner Aufnahme der Astronomie/Astrologie im Gefolge des heiligen Isidor immer wieder hingewiesen worden. Die großen Ähnlichkeiten lassen es durchaus als wahrscheinlich erscheinen, daß Gundissalinus, wie bereits in Abschnitt 2.2.5., Anm. 147 angedeutet, in Chartres oder Paris studierte. Doch läßt sich der ‚französische‘ Einfluß frei-lich ebenso über die Einsetzung ‚französischer‘ Bischöfe in Toledo nach der Reconquista erklären. Ferner ist aber auch von einer Beeinflussung der Zentren in der Francia, allen voran Chartres, durch Gundissalinus auszugehen, wie z.T. ebenfalls angezeigt wurde.
3. Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption für die Wissens- und Wissenschaftstheorie bei Gundissalinus
3.1. Problemstand
Der in der Zwischenbilanz des letzten Teils für Gundissalinus’ Wissens- und Wissen-schaftstheorie deutlich herausgestellte implizite Aristotelismus ist in der Geschichtsschrei-bung der Philosophie trotz z.T. gegenteiliger Meinungen, wie bereits erwähnt, nicht unbe-merkt geblieben. Im Gegenteil, zahlreiche Autoren sehen in Gundissalinus nicht nur den Vertreter eines impliziten, sondern sogar eines expliziten Aristotelismus; so schreibt etwa Ludwig Baur, der Editor von De divisione, die Schrift selbst stehe „auf ganz ausgesprochen aristotelischem Boden“.1 Anton-Hermann Chroust entfaltet dieses Urteil ein halbes Jahrhun-dert später folgendermaßen:
Throughout his De divisione Gundissalinus makes use not only of the whole of Aristotle’s Organon, but also of the so-called disciplinae novae such as metaphysics, physics, poli-tics, ethics, and economics, including Aristotle’s De coelo et mundo, De generatione et corruptione, De animalibus, De anima, the Libri de naturalibus (or, Parva naturalia), etc. Thus for the first time in the history of mediaeval education the majority of the Aristote-lian writings is referred to and relied upon in a ‚program‘ devised to furnish a general and basic introduction to all training in philosophy and theology.2
Damit wird Gundissalinus für Chroust zum ersten Rezipienten des lateinischen Mittelalters nicht nur aristotelischer Theoreme, sondern seiner Schriften selbst. Und tatsächlich bezieht sich Gundissalinus immer wieder auch explizit auf Aristoteles, der in seinen Werken allent-halben auch unter Erwähnung seines Namens zitiert wird. Mehr noch, in De immortalitate animae3 formuliert Gundissalinus selbst programmatisch seinen expliziten Aristotelismus, den er in einen scharfen Gegensatz zu Platon setzt:
Et haec quidem fere omnia a philosophis accepimus, ab Aristotele scilicet et sequacibus eius. Radices autem et probationes Platonis praeterimus, quoniam nec fidem intelligenti-bus de immortalitate animarum nostrarum faciunt, et omnibus animarum speciebus com-munes sunt, ita ut etiam animam brutalem et vegetabilem extendantur, de quibus mani-festum, quod earum esse post corpora et extra corpora otiosum est et omnino inutile.
____________________________________________________________________________________________
1 Ludwig Baur in Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 314. 2 Anton-Hermann Chroust, „The Definitions of Philosophy in the De divisione philosophiae of Dominicus Gundissalinus“, in: New Scholasticism 25 (1951), S. 253-281, hier S. 254. 3 Siehe zur bestrittenen gundissalinischen Autorschaft dieser Schrift den in der Einführung erwähnten Artikel von Baudoin C. Allard, „Note sur le De immortalitate animae de Guillaume d’Auvergne“, in: Bulletin de philosophie médiévale 18 (1976), S. 68-72. Wie bereits in der Einführung bemerkt, kann Allard allerdings letztlich nicht überzeugend dartun, daß Wilhelm von Auvergne der Autor dieser Schrift ist.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
98
Omne autem otiosum et inutile non solum inutiliter quaeritur, sed etiam dispendiose, quo-niam cum dispendio et iactura temporis, quo res utiles quaerendae sunt.4
Trotz dieses emphatischen Bekenntnisses des Gundissalinus zu Aristoteles und seiner be-wußten Distanzierung von Platon besteht bislang noch keine Klarheit darüber, woher der spanische Archidiakon seine Kenntnisse der aristotelischen Werke tatsächlich bezog. Drei mögliche Quellen kommen hierfür in Frage: entweder Gundissalinus ist mit dem Werk des Aristoteles allein aus zweiter Hand bekannt, namentlich durch die von ihm gemeinsam mit seinen z.T. jüdischen Kollegen übersetzten arabischen Autoren, oder er schöpft direkt aus den Schriften des Stagiriten. Im zweiten Fall stellt sich sodann die Frage, ob er dabei auf den Aristoteles arabus oder den Aristoteles graeco-latinus zurückgreift.
Der erste Fall läßt sich zwar nicht gänzlich ausschließen, doch sind die Aristoteles-Zitate des Gundissalinus allein auf der Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Übersetzungen des Archidiakons und seiner Kollegen nicht zu erklären. Vielmehr konnte Manuel Alonso sogar umgekehrt nachweisen, daß Gundissalinus bei seiner Überarbeitung von al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm in De scientiis dessen Text, dort wo Zuschreibungen bestimmter Theo-rieelemente zu Euklid und Aristoteles fehlen, um eben diese Zuschreibungen ergänzt.5 Die gundissalinische Kenntnis des Aristoteles und anderer antiker Autoren geht mithin deutlich über die in den arabischen Vorlagen seiner Übersetzungen vorfindbaren Elemente hinaus, so daß eine unmittelbare Kenntnis der aristotelischen Schriften anzunehmen ist. Doch auf wel-chem Wege konnte sich Gundissalinus diese Werke aneignen?
Diese Frage rührt unmittelbar an eines der meist diskutierten Probleme, das in Bezug auf Gundissalinus und seine Übersetzungen gestellt wurde, nämlich ob der Archidiakon in der Lage war, selbständig arabische Texte, also auch den Aristoteles arabus, zu lesen, oder ob er allein mit Hilfe seiner Mitarbeiter seine Übersetzungen verfaßte. Unumstritten ist, daß sich Gundissalinus zumindest am Beginn seiner Tätigkeit in Toledo verschiedener arabistisch geschulter Mitarbeiter bediente, die ihn bei seiner Arbeit unterstützten (oder umgekehrt). Einer von ihnen, genannt „Avendauth, israelita philosophus“ (der mit großer Wahrschein-lichkeit mit dem einflußreichen jüdischen Gelehrten Abraham Ibn DÁwÙd zu identifizieren ist),6 berichtet im Prolog seiner Übersetzung von Avicennas De anima, daß er Wort für Wort in die Vulgärsprache brachte („singula verba vulgariter proferente“), woraufhin der Latinist Gundissalinus sie ins Lateinische übersetzte („in latinum convertente“).7 Die Interpretation dieses Passus in dem Sinne, daß die beiden Männer sich über die Vernakularsprache, ver-
____________________________________________________________________________________________
4 Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. Georg Bülow, in: BGPhMA II, 3, Münster 1897, hier S. 11-12. 5 Vgl. Manuel Alonso in seiner Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 31-32. 6 Siehe zur Frage der Identifikation die Diskussion zwischen Marie-Thérèse d’Alverny, „Avendauth?“, in: Homenaje a Millás-Vallicrosa, Bd. I, Barcelona 1954, S. 19-43, und Manuel Alonso, „El traductor y prolo-guista del Sextus naturalium“, in: Al-Andalus 26 (1961), S. 1-35, sowie neuerdings Alexander Fidora, „Ein philosophischer Dialog der Religionen im Toledo des 12. Jahrhunderts: Abraham Ibn DÁwÙd und Dominicus Gundissalinus“, in: Yossef Schwartz (Hrsg.), Religiöse Apologetik, philosophische Argumentation, Tübingen 2003 (im Druck). 7 Siehe erneut die bereits in der Einführung erwähnte Stelle aus Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1968 u. 1972, hier Bd. I, S. 4: „Habetis ergo librum, nobis praecipiente et singula verba vulgariter proferente, et Dominico Archidiacono singula in lati-num convertente, ex arabico translatum.“
Problemstand
99
standen als das Kastilische, verständigten, hat in der Forschung zu der Ansicht geführt, daß keiner von beiden die Sprache des anderen hinreichend gut beherrschte. Während Manuel Alonso dagegen stets daran festhielt, daß Gundissalinus sehr wohl genügend Kenntnis des Arabischen besaß, um auch auf eigene Faust Übersetzungen anzufertigen,8 war es v.a. Marie-Thérèse d’Alverny, welche die Zweifel hieran schürte9 und wiederum andere zu so kategori-schen Urteilen wie dem folgenden führte: „[Ibn DÁwÙd] conocía el árabe y la lengua ro-mance, pero desconocía el latín. Su compañero Domingo Gundisalvo conocía la lengua ro-mance y el latín, pero desconocía el árabe.“10 Darüber noch hinausgehend behauptete schließlich der berühmte Arabist Mario Grignaschi, daß „nous [d.h. er...] ne croyons pas qu’il [= Gundissalinus] ait connu suffisamment l’arabe pour lire directement les ouvrages écrits dans cette langue et choisir les passages qui faisaient à son cas. Il a toujours cité Aristote d’après les traductions latines faites du grec.“11
Auch Grignaschi geht damit vorderhand davon aus, daß Gundissalinus durchaus unmit-telbaren Zugang zum aristotelischen Opus besaß, allerdings in der Form des Aristoteles graeco-latinus. Wäre diese letzte Bemerkung zum Aristoteles-Text des Gundissalinus tat-sächlich stichhaltig, so würde sie nicht nur die Hypothese stützen, daß Gundissalinus gar kein Arabisch konnte, vielmehr wäre dann auch die Geschichte der Aristoteles-Rezeption zumindest in Teilen neu zu schreiben. Denn, sofern Grignaschis Überlegungen zuträfen, wäre Toledo nicht der Ort gewesen, an dem Aristoteles in das lateinische Denken gelangte, zumindest nicht in jenem prominenten Sinne; vielmehr wäre der Erstkontakt auch der Tole-daner Gelehrten mit Aristoteles in den graeco-lateinischen Übersetzungen Jakobs von Ve-nedig (floruit erste Hälfte des 12. Jahrhunderts) zu suchen und nicht in den arabischen Ari-stoteles-Beständen in al-Andalus. Die Frage nach Gundissalinus’ Aristoteles-Text ist somit nicht nur eine Frage von unbezweifelbarem philologischen Interesse, sondern zugleich auch eine solche von höchster Relevanz für das Verständnis der Aristoteles-Rezeption und damit der Philosophiegeschichte insgesamt. Gleichwohl muß auf der Grundlage der Forschungen Alonsos als erwiesen gelten, daß Gundissalinus sehr wohl den Aristoteles arabus kannte. Erneut dient dabei die Schrift De scientiis als Beleg: In ihr findet sich eine Hinzufügung des Gundissalinus zu al-FÁrÁbÐs Text aus Aristoteles’ Meteorologica, die aus dem Arabischen übersetzt ist.12 Und auch die Untersuchungen in dieser Arbeit bestätigen dies.
____________________________________________________________________________________________
8 Vgl. die bereits in der Einführung angegebenen Arbeiten von Manuel Alonso, „Traducciones del arcediano Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 12 (1947), S. 295-338, bes. S. 333 u. S. 336, sowie id., „Las fuentes literarias de Domingo Gundisalvo: El De processione mundi de Gundisalvo y el K. al-ÝqÐda al-rafÐÝa de IbrÁhÐm Ibn David“, in: Al-Andalus 11 (1946), S. 159-173, hier S. 161. 9 Siehe Marie-Thérèse d’Alverny, „Notes sur les traductions médiévales des œuvres philosophiques d’Avicenne“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 19 (1952), S. 337-358, bes. S. 344-345. 10 Mariano Brasa Díez, „Métodos y cuestiones filosóficas en la Escuela de Traductores de Toledo“, in: Revista española de filosofía medieval 3 (1996), S. 35-49, hier S. 43. 11 Mario Grignaschi, „Le De divisione philosophiae de Dominicus Gundissalinus et les Quaestiones II-V in Sextum Metaphysicorum de Jean de Jandun“, in: Simo Knuuttila u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy, Bd. II, Helsinki 1990, S. 53-61, hier S. 58. 12 Vgl. Manuel Alonso in seinem Anhang zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 176, sowie weiter unten Kapitel 3.5. unter b).
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
100
Die folgenden Ausführungen wollen allerdings nur mittelbar einen Beitrag zur Klärung dieser Fragen liefern. Zwar soll die Quellenfrage des Gundissalinus stets mitbedacht werden, doch ist das Hauptanliegen dieses zweiten Teils in erster Linie ein systematisches: Nämlich die Frage, wie (und dabei kann die Frage nach dem Woher selbstverständlich nicht ausge-blendet werden) Gundissalinus die aristotelische Epistemologie im Anschluß an seinen ‚avi-cennisierenden Boethianismus‘ explizit rezipiert. Dieser Zusammenhang zwischen ‚avicen-nisierendem Boethianismus‘ und expliziter Aristoteles-Rezeption wird schon durch die enge Parallele der von Gundissalinus auf Aristoteles zurückgeführten epistemologischen Theorie-stücke mit den im letzten Teil behandelten Motiven spürbar. So entspricht die im folgenden zu verhandelnde genuin aristotelische Epistemologie bei Gundissalinus Punkt für Punkt den Unterkapiteln aus 2.2. In diesem Sinne wird zunächst, wie in der Einführung bereits vorweg-genommen, die Gegenstandsbereichslehre des Aristoteles bei Gundissalinus untersucht (3.2.), sodann die gundissalinische Aufnahme der aristotelischen Methodenlehre (3.3.) sowie die Rezeption der aristotelischen Axiomatik (3.4.) und schließlich die Bearbeitung der ari-stotelischen Subordinationstheorie und der Binnendifferenzierung der Wissenschaften (3.5.). Hinzu kommt die Behandlung der aristotelischen Einteilung der praktischen Philosophie (3.6.). Dabei wird jeweils zu untersuchen sein, woher Gundissalinus diese Theorieelemente bezieht und wie diese bei Aristoteles verstanden werden, um dann zu zeigen, wie sie bei Gundissalinus im Anschluß an die im ersten Teil entwickelten Positionen des ‚avicennisie-renden Boethianismus‘ interpretiert werden. Denn Gundissalinus ist kein passiver Rezipient der aristotelischen Texte, sondern rezipiert die z.T. sehr komplexen Stellen eben vor dem im letzten Teil dargestellten Hintergrund und gelangt so zu interessanten Interpretationen, in denen sich die Verzahnung seines ‚avicennisierenden Boethianismus‘ mit den neuen Aristo-teles-Quellen eindrucksvoll spiegelt. Von daher erhält der ‚avicennisierende Boethianismus‘ auch, wie sich erweisen wird, seine Bedeutung als Voraussetzung nicht nur eines impliziten, sondern expliziten Aristotelismus. Denn er führt Gundissalinus nicht nur zu aristotelischen Grundpositionen in seiner Wissens- und Wissenschaftstheorie, wie im letzten Teil dargetan wurde, sondern eröffnet ihm zugleich den Zugang für die Rezeption der aristotelischen Texte selbst. Nicht verschwiegen werden sollen dabei die durch diesen Zugang immer schon ge-setzten Grenzen der gundissalinischen Aristoteles-Rezeption. Denn mit dem ‚avicennisieren-den Boethianismus‘ ist Gundissalinus bereits eine bestimmte Optik auf Aristoteles mitgege-ben, die letztlich auch neoplatonisch geprägt ist.13 Allerdings ist dies nicht gleichbedeutend mit ‚platonisch‘ im Sinne einer Einheitswissenschaft, wie im letzten Kapitel angezeigt wurde. Im übrigen ist diese Optik eine, die sich bis weit ins 13. Jahrhundert hineinzieht und auch bei Thomas von Aquin z.T. noch zu beobachten ist14 – auch hierauf wird im folgenden
____________________________________________________________________________________________
13 Mit einigem Recht tituliert Georg Bülow Gundissalinus daher als ersten Repräsentanten eines „neuplato-nisch gefärbten Aristotelismus“. Vgl. sein Vorwort zu Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. Georg Bülow, in: BGPhMA XXIV, 3, Münster 1925, S. VII. 14 Vgl. zum neoplatonischen Einfluß auf Thomas Werner Beierwaltes, „Der Kommentar zum Liber de causis als neuplatonisches Element in der Philosophie des Thomas von Aquin“, in: Philosophische Rundschau 11 (1964), S. 192-215, hier bes. S. 202, wo Beierwaltes entschieden Stellung bezieht gegen allzu einseitige, rein aristotelische Auslegungen der thomasischen Philosophie. Sowie umfassender Robert J. Henle, Saint Thomas and Platonism. A Study of ‚Plato‘ and ‚Platonici‘ Texts in the Writings of St. Thomas, Den Haag 1956, der S. 304 und passim den differenzierten Umgang des Aquinaten mit neoplatonischen Begründungsfiguren und Positionen herausarbeitet.
Problemstand
101
verwiesen. Dieser zweite Teil beleuchtet damit auf der Grundlage des ersten Teils die Kon-sequenzen der Aristoteles-Rezeption für das neue Verständnis von Wissen und Wissenschaft, das die intellektuelle Revolution des 12. Jahrhunderts trägt. Auch wenn sich vor dem Hinter-grund dieser Ausführungen zeigen wird, daß Grignaschis These einer Rezeption des Aristo-teles graeco-latinus für Gundissalinus unhaltbar ist, so bestätigt die darzustellende Verzah-nung von ‚avicennisierendem Boethianismus‘ und Aristoteles-Rezeption anderseits doch eine Intuition, die den italienischen Gelehrten bei seiner Vermutung angeleitet haben mag. Nämlich die Tatsache, daß Gundissalinus’ Rezeption der aristotelischen Schriften nicht un-abhängig von den zentraleuropäischen Debatten seiner Zeit ist. Zwar kann nicht behauptet werden, daß er dieselben Aristoteles-Texte zur Hand hatte, wie sie einige Zeit später im heu-tigen Frankreich benutzt wurden, wohl aber rezipierte er den Aristoteles arabus vor einem ganz ähnlichen Hintergrund: namentlich Boethius und den zeitgenössischen Diskussionen um seine Opuscula sacra (allerdings ergänzt um die Auseinandersetzung mit Avicenna u.a.). Damit wird auch das Konkurrenzverhältnis hinfällig, das von einigen in Bezug auf die Über-setzungen der Werke des Aristoteles aus dem Arabischen und dem Griechischen suggeriert wird,15 denn beide erscheinen letztlich als Antworten auf dieselben Herausforderungen.
Dieser Teil dokumentiert so aufs Ganze gesehen anhand ausgewählter Beispiele die zwar bekannte, aber lange vernachlässigte Bedeutung, die Gundissalinus als vielleicht tatsächlich erstem Rezipienten und Interpreten des Stagiriten zukommt. „Die gewöhnliche Tradition in den historischen Darstellungen“, schreibt Clemens Baeumker, „bezeichnet als solchen neben Alexander von Hales den Bischof von Paris, Wilhelm von Auvergne. Aber lange vor diesen zwei hatte jenen Versuch ein anderer Gelehrter unternommen, der zwar unter den Überset-zern philosophischer Werke einen gewissen, wenngleich bestrittenen Ruhm genoß, dessen Name als philosophischer Schriftsteller dagegen fast ganz in Vergessenheit geraten war. Es ist der Archidiakonus von Segovia, Dominicus Gundisalvi [...]“16 Trotz dieses Memento hat sich in den historischen Darstellungen bislang wenig geändert; vielmehr wird Gundissalinus’ Rolle für die Aristoteles-Rezeption nach wie vor durch seinen zweifelhaften Ruf als Kompi-lator verdunkelt – doch zu Unrecht, wie sich im folgenden zeigen wird.
____________________________________________________________________________________________
15 So auch von Lorenzo Minio-Paluello, „Aristotele dal mondo arabo a quello latino“, in: id., Opuscula. The Latin Aristotle, Amsterdam 1972, S. 501-535, der v.a. S. 503-511 die Bedeutung der arabisch-lateinischen Aristoteles-Übersetzungen zu den „idola“ der Philosophiegeschichte deklariert, um dann minutiös graeco-lateinische Übersetzungen gegen arabisch-lateinische aufzurechnen. 16 Clemens Baeumker, „Dominicus Gundissalinus als philosophischer Schriftsteller“, in: BGPhMA XXV, 1-2, Münster 1927, S. 255-275, hier S. 256.
3.2. Die aristotelische Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
Zu Beginn seines einflußreichsten Werkes, De divisione philosophiae, präsentiert Gundissa-linus verschiedene Klassifikationen der Wissenschaften nach Gegenstandsbereichen, so die bereits ausführlich besprochene Einteilung aus Boethius’ Traktat De Trinitate.1 Wie im vorangehenden Teil dieser Arbeit gezeigt wurde, unterscheidet Boethius hier Physik, Ma-thematik und göttliche Wissenschaft bzw. Metaphysik nach dem Grad der Abstraktheit und Bewegung ihrer Objekte, womit er auf die von Aristoteles in seiner Metaphysik VI, 1, 1026a 13-16 vorgelegten Unterscheidungen rekurriert. Eine Einteilung, die Gundissalinus in der von uns dargelegten Weise aufgreift und als Reaktion auf die Chartreser Diskussionen unter dem Einfluß der arabischen Philosophie modifiziert wiedergibt als:
Et ob hoc dicit Boethius, quod physica est inabstracta et cum motu, mathematica abstracta et cum motu, theologia vero abstracta et sine motu.2
Die Anleihe, die Boethius anläßlich dieser Einteilung bei Aristoteles macht, ist nicht erst von der zeitgenössischen Forschung gesehen worden,3 vielmehr erkennt bereits Gundissalinus diese Ähnlichkeiten, wenn er nur wenige Zeilen nach der soeben zitierten Erwähnung der boethianischen Einteilung auf Aristoteles hinweist, den er folgendermaßen zitiert:
Unde Aristoteles: ideo scientiarum sunt species tres, quoniam una speculatur quod move-tur et corrumpitur ut naturalis, et secunda quod movetur et non corrumpitur ut disciplina-lis, tertia considerat quod nec movetur nec corrumpitur ut divina.4
Man dankt es Gundissalinus, daß er hier, entgegen seiner Gewohnheit, explizit auf seine Quelle hinweist, nämlich Aristoteles. Und um so mehr verwundert es, daß der Herausgeber von De divisione philosophiae, Ludwig Baur, der im allgemeinen mit großer Akribie die Belege der gundissalinischen Quellen versammelt, keine genaue Quelle für dieses Zitat im Apparat anzugeben vermag. Nach dem über die aristotelische Inspirationsquelle der boethia-nischen Einteilung Gesagten liegt es vorderhand nahe, auch Gundissalinus’ Referenz auf das 6. Buch der Metaphysik zu beziehen.5 Gleichwohl ergibt diese Zuordnung gewisse Schwierigkeiten, denn wenigstens eines der beiden von Gundissalinus zur Differenzierung
____________________________________________________________________________________________
1 Siehe Unterkapitel 2.2.2. dieser Arbeit. 2 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15. 3 Etwa von Michael Elsässer in den Anmerkungen zu Boethius, Die theologischen Traktate, übers., eingel. u. mit Anm. versehen von Michael Elsässer, Hamburg 1988, S. 118 (auch wenn hier nicht das 6., sondern eine weniger einschlägige Stelle aus dem 12. Buch der Metaphysik herangezogen wird), sowie von Klaus Jacobi, „Natürliches Sprechen – Theoriesprache – Theologische Rede. Die Wissenschaftslehre des Gilbert von Poitiers (ca. 1085-1154)“, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 49 (1995), S. 511-528, hier S. 514, der ausdrücklich das 6. Buch der Metaphysik nennt. 4 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15. 5 Auch hat Manuel Alonso in anderem Zusammenhang eine mögliche Beeinflussung des Gundissalinus durch Aristoteles’ Metaphysik feststellen können. Vgl. sein Vorwort und seine Anmerkung zu Dominicus Gundissalinus, De unitate, ed. cit., S. 67 sowie Anm. S. 76 zu Z. 145.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
104
der Wissenschaften verwandten Kriterien, nämlich die Vergänglichkeit, hat kein Pendant in Aristoteles’ Text, und umgekehrt fehlt in Gundissalinus’ Zitat dessen Abstraktionskriterium.6
Doch kommt ein anderer Text des Aristoteles als Quelle in Frage, nämlich das 2. Buch der Physik, wenn auch nicht in der griechischen Originalfassung, sondern in ihrer arabischen Tradierung, wie sich zeigen wird. Die entsprechende Passage, Physik II, 7, 198a 29-31, lautet in der griechischen Textüberlieferung:
Entsprechend sind es drei Aufgabenfelder (pragmatei/ai): Eines ist (befaßt) mit dem Un-veränderlichen (avkinh,twn), das andere mit dem zwar Veränderlichen (kinoume,nwn), aber Unvergänglichen (avfqa,rtwn), das dritte mit dem Vergänglichen (fqarta,).7
Drei Aufgabenfelder (pragmatei/ai) des wissenschaftlichen Arbeitens werden hier genannt, deren Gegenstände ihrerseits mit Hilfe der Kriterien der Bewegung (kinhto,n) und der Ver-gänglichkeit (fqarto,n) klassifiziert werden, also genau mit jenen Kriterien, die auch in dem von Gundissalinus angeführten Text erscheinen, weshalb kaum ein Zweifel möglich ist, daß genau diese Stelle aus der Physik Gundissalinus als Vorbild diente.8 Gleichwohl gilt es, ei-nige nicht unbedeutende Unterschiede im Blick zu behalten: a) In Aristoteles’ Text ist nicht von Wissenschaft (evpisth,mh) die Rede, sondern lediglich von „Aufgabenfeldern“ (pragmatei/ai) des wissenschaftlichen Arbeitens. b) Es ist zu beobachten, daß nicht alle Auf-gabenfelder mit Hilfe der beiden erwähnten Kriterien klassifiziert werden, wie dies bei Gun-dissalinus der Fall ist. c) Es fehlt ein griechisches Pendant zum Verb „speculari“ oder „con-siderare“, das bei Gundissalinus steht. d) Die Reihenfolge, in der die Aufgabenfelder aufge-zählt werden, verhält sich umgekehrt zu jener des Gundissalinus, bei dem die Reihung vom Vergänglichen zum Ewigen aufsteigt. e) Ferner muß festgestellt werden, daß – obwohl in dem zitierten Passus aus Aristoteles’ Physik die drei Aufgabenfelder nicht unmittelbar mit bestimmten Wissenschaften identifiziert werden – der Kontext des Kapitels eine klare Zu-ordnung erkennen läßt: So entsprechen die drei Aufgabenfelder der Metaphysik (deren Ge-genstände unbewegt sind), der Astronomie (deren Gegenstände zwar bewegt sind, aber nicht vergänglich, da ewig) und der Physik (deren Gegenstände vergänglich sind). Damit besetzt aber die Astronomie den Platz der Mathematik, die in Gundissalinus’ Aristoteles-Zitat fir-miert („disciplinalis“).
Unstrittig ist, daß Gundissalinus dieses Zitat keinesfalls direkt aus dem griechischen Text der Physik des Aristoteles entnehmen konnte, den wir bisher zugrunde gelegt haben. Viel-mehr muß er ihn entweder aus der graeco-lateinischen Übersetzung derselben bezogen ha-____________________________________________________________________________________________
6 So heißt es bei Aristoteles in Metaphysik VI, 1, 1026a 13-16: „Denn die Physik handelt von abtrennbaren (selbständigen) [leg. unabtrennbaren], aber nicht unbeweglichen Dingen, einiges zur Mathematik Gehörige betrifft Unbewegliches, das aber nicht abtrennbar (ouv cwrista,,) ist, sondern als an einem Stoff befindlich; die erste Philosophie aber handelt von sowohl abtrennbaren (selbständigen) als auch unbeweglichen Din-gen.“ (Aristoteles, Metaphysik I-VI, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Ham-burg 31989, S. 252/253) – Zur korrigierten Lesung mit „untrennbar“ siehe Kapitel 2.2., Anm. 10. 7 Aristoteles, Physik I-IV, übers. u. eingel. von Hans Günter Zekl, Hamburg 1987, S. 84/85. 8 Daß Gundissalinus die Physik wenigstens dem Namen nach kannte, ist offensichtlich, zumal er sie unter ihrem im Mittelalter geläufigen Titel De naturali auditu im Physik-Kapitel von De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20, ausdrücklich nennt. Zudem hat Charles Burnett auf weitere Parallelen zwischen diesem Ka-pitel und der aristotelischen Physik hingewiesen; vgl. Charles Burnett, „Filosofía natural, secretos y magia“, in: Luis García Ballester (Hrsg.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla I: Edad media, León 2002, S. 95-144, hier S. 109, Anm. 61.
Die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
105
ben, wie Grignaschi behauptet, oder aus der arabischen Texttradition. Was die graeco-latei-nische Übersetzung anbelangt, so ist bekannt, daß Jakob von Venedig bereits um 1140 eine lateinische Übersetzung der Physik, die sogenannte Physica vetus, anfertigte, die in über 100 Handschriften auf uns gekommen ist.9 Ferner ist eine weitere, anonyme Übersetzung, die sogenannte Physica vaticana, überliefert, die um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden zu sein scheint, die jedoch nur Fragmente der Physik enthält (Bücher I-II, 2) und nicht unse-ren Passus betrifft.10 In Jakobs Übersetzung aber heißt es zu unserer Stelle:
Unde tria negotia sunt, haec quidem circa immobile, alia vero circa mobile quidem incor-ruptibile autem, quaedam autem circa corruptibilia.11
Es ist festzustellen, daß Jakob in allen fünf Punkten, in denen sich Gundissalinus vom grie-chischen Text entfernt, größte Treue mit dem Original hält: a) Jakob spricht nicht von „scientiae“, sondern von „negotia“, womit pragmatei/ai durchaus treffend wiedergegeben wird. b) Er verteilt die Kriterien der Bewegung und der Vergänglichkeit bei der Beschrei-bung der Wissenschaften bzw. ihrer Gegenstände genau so wie der griechische Originaltext und bringt nur in Bezug auf die Astronomie beide zugleich zur Anwendung. c) Der Satz ist ohne ein zweites Prädikat. d) Die drei Aufgabenfelder werden in derselben Reihenfolge wie im Griechischen angeführt. e) Die Aufgabenfelder werden nicht mit den drei Wissenschaf-ten: Metaphysik, Mathematik und Physik identifiziert, wie sich ja auch der griechische Text nicht explizit hierzu äußert. Damit ist deutlich, daß die graeco-lateinische Übersetzung der Physik nichts zum Verständnis der charakteristischen Eigenheiten des von Gundissalinus verwandten Physik-Textes beiträgt. Der arabische Text der Physik Es liegt von daher nahe, den arabischen Text der Physik diesbezüglich zu befragen: Obwohl Belege für arabische Übersetzungen der Physik auch durch QusÔÁ Ibn LÙqÁ († 912) und ad-DimašqÐ († 900) vorliegen,12 stammt die einzig erhaltene Übersetzung von dem im Ab-
____________________________________________________________________________________________
9 Diese anonym überlieferte Physik-Übersetzung konnte Jakob erst aufgrund eines Sprachvergleichs von Lorenzo Minio-Paluello, „Jacobus Veneticus Graecus. Canonist and Translator of Aristotle“, in: Traditio 8 (1952), S. 265-304, hier S. 282-291, zugeordnet werden. Vgl. ferner zur Datierung der Übersetzung in das Jahr 1140 Fernand Bossier und Jozef Brams in ihrer Einleitung zu Aristoteles latinus, Physica – Translatio vetus, ed. Fernand Bossier u. Jozef Brams (Aristoteles latinus VII, 1/1-2), 2 fasc., Leiden u. New York 1990, hier fasc. I, S. XII u. S. XXI-XXII. Die vergleichsweise frühe graeco-lateinische Übersetzung der Physik steht im Kontrast zur nur sehr zögerlich einsetzenden Rezeption derselben. Vgl. dazu Thomas Ricklins Stu-die, die für die Gelehrten des 12. Jahrhunderts, und insbesondere die Chartreser, ein eklatantes Maß an „Un-kenntnis“ und „Desinteresse“ an Jakobs Übertragung nachgewiesen hat. Siehe Thomas Ricklin, Die ‚Phy-sica‘ und der ‚Liber de causis‘ im 12. Jahrhundert: Zwei Studien, Freiburg i. Üe. 1995, S. 11-19. 10 Auch sonst hat diese fragmentarische Übersetzung, die nur in einem einzigen Manuskript überliefert ist, wenig Wirkung gehabt. Vgl. in diesem Sinne Augustin Mansion in der Praefatio zu seiner Edition derselben in Aristoteles latinus, Physica – Translatio vaticana, ed. Augustinus Mansion (Aristoteles latinus VII, 2), Brügge u. Paris 1957, S. VII. 11 Aristoteles latinus, Physica – Translatio vetus, ed. cit., fasc. II, S. 80. 12 Siehe hierzu die Einleitung zu Aristoteles semitico-latinus, Aristotle’s ‚Physics‘ and Its Reception in the Arabic World, ed. Paul Lettinck (Aristoteles semitico-latinus VII), Leiden u.a. 1994, S. 1-4. Weitere Über-
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
106
schnitt 2.2.4. bereits erwähnten IsÎÁq Ibn Íunain, von dessen Vater Gundissalinus De coelo et mundo übersetzte.13 Der allein in einem Manuskript, Leiden, Universiteitsbibliotheek, Warner 583,14 erhaltene Text wurde von ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ ediert und bietet für den hier in Frage stehenden Passus folgende Lesart:
Und so gibt es also drei Arten der Wissenschaft (funÙnu ‘l-Ýilmi ×alÁ×atan): Die erste be-trachtet (yanÛuru) das, was unbewegt ist, die zweite betrachtet (yanÛuru) das, was bewegt, aber nicht vergänglich ist, die dritte betrachtet (yanÛuru) das, was vergänglich ist.15
Die Version von Ibn Íunain, wie sie im Leidener Manuskript, dem bislang einzigen Text-zeugen, erhalten ist, wahrt ebenfalls große Treue mit dem griechischen Original in der Mehr-zahl der Punkte. Gleichwohl weicht sie in zwei Punkten, nämlich a) und c), von diesem ab, da sie a) pragmatei/ai mit funÙnu ‘l-Ýilmi ×alÁ×atan, d.h. „Arten der Wissenschaft“ übersetzt, und c) dem Text das Prädikat yanÛuru hinzufügt, das exakt mit dem lateinischen „speculatur“ korrespondiert. Es scheint somit, daß sich in der arabischen Tradition zumindest einige Ele-mente finden lassen, die Gundissalinus’ Abweichungen vom griechischen Original erklären, was darauf hinweist, daß der Archidiakon sich eben dieser Texttradition und nicht des Aristoteles graeco-latinus bedient. Bedauerlicherweise stehen die anderen erwähnten arabi-schen Übersetzungen der Physik ebensowenig wie weitere Textzeugen von Ibn Íunains Übersetzung nicht zur Verfügung, mit deren Hilfe sich womöglich Aufschluß über die in Umlauf befindlichen Lesarten für die weiteren Punkte b), d) und e) gewinnen lassen könnte. Doch lassen sich zur Erhärtung der Hypothese, daß Gundissalinus sein Zitat dem Aristoteles arabus entnimmt, die beiden etwas späteren Übersetzungen der Physik von Gerhard von Cremona und Michael Scotus heranziehen, die beide unbestreitbar aus dem Arabischen ange-fertigt wurden16 und damit die Varianten dieser Texttradition widerspiegeln.
Der erste der beiden, Gerhard, kann, wie bereits in Kapitel 2.3. erwähnt, als der produk-tivste Übersetzer der Schule von Toledo gelten und übersetzte v.a. naturphilosophische Werke übersetzte.17 Freilich konnte bei dieser Ausrichtung eine Übersetzung der Physik des Aristoteles unter seinen Werken nicht fehlen. In dieser heißt es zu unserer Stelle:18 ____________________________________________________________________________________________
setzer werden von Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einlei-tungsliteratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 288, angeführt. 13 Vgl. den bereits genannten Artikel von Manuel Alonso, „Íunayn traducido al latín por Ibn DÁwÙd y Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 16 (1951), S. 37-47. 14 Eine erste Beschreibung und Auswertung der Handschrift, in der sich auch ein Kommentar von IsÎÁqs Schüler Ibn as-SamÎ zur Physik findet, gab S. M. Stern, „Ibn al-SamΓ, in: Journal of the Royal Arabic So-ciety of Great Britain and Ireland o. Jg. (1956), S. 31-44. 15 ArisÔÙÔÁlÐs, AÔ-ÔabÐÝa, tarÊamat IsÎÁq Ibn Íunain, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, 2 Bde., Kairo 1384/1964 u. 1385/1965, hier Bd. I, S. 138. 16 Vgl. etwa Augustin Mansion, „Étude critique sur le texte de la Physique d’Aristote (L. I-IV). Utilisation de la version arabe-latine jointe au commentaire d’Averroès“, in: Revue de philologie, de littérature et d’histoire ancienne 47 (1932), S. 5-41, sowie id., „Note sur les traductions arabo-latines de la Physique d’Aristote dans la tradition manuscrite“, in: Revue néo-scolastique de philosophie 37 (1934), S. 202-218. 17 Siehe zur Person des Cremonesen neben der in Kapitel 2.3. angegebenen Werkliste auch die Zusammenstellung in Serafín Vegas, La Escuela de Traductores de Toledo en la historia del pensamiento, Toledo 1998, S. 65-74. 18 Ich verdanke die Informationen zu den beiden Übersetzungen, die im folgenden herangezogen werden, nämlich jene des Gerhard und des Michael, der freundlichen Unterstützung von Aafke van Oppenraay (Gra-venhage/Niederlande).
Die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
107
Et ideo modi scientiae sunt tres. Unus enim consideratio de eo quod movetur, sed est cor-ruptibile. Secundus autem considerat de eo quod movetur, sed non est corruptibile. Tertius autem considerat de eo quod non corrumpitur neque movetur.19
Die Varianten der arabischen Version Ibn Íunains bezüglich der Punkte a) und c) werden von Gerhard eindeutig reproduziert: So ist von den Arten der Wissenschaft („modi scien-tiae“) die Rede, welche bestimmte Gegenstände betrachten („considerare“). Darüber hinaus wird aber jeder dieser Gegenstände immer mit zwei Kriterien beschrieben, nämlich Bewe-gung und Vergänglichkeit – eine Eigenheit, die weiter oben als Abweichung b) des gun-dissalinischen Textes hinsichtlich des griechischen Textes ausgemacht wurde. Doch findet sich noch mehr in diesem Zitat, denn auch die Reihenfolge in der Aufzählung der Wissen-schaften hat sich geändert, so daß diese nun in absoluter Übereinstimmung mit Gundissalinus vom Vergänglichen zum Ewigen aufsteigt; damit ist auch die Abweichung d) bei Gerhard zu beobachten. Was allerdings auch bei Gerhard fehlt, ist e) die Identifizierung der drei Wissen-schaften mit Physik, Mathematik und Metaphysik.
Ebenfalls in Toledo, wenn auch 50 Jahre später, übersetzte Michael Scotus, im Rahmen seines Übersetzungsvorhabens der Averroes-Kommentare, erneut die Physik aus dem Arabi-schen ins Lateinische.20 Sein Text weist dieselben Eigentümlichkeiten auf wie jene Texte des Gundissalinus und des Gerhard:
Et propter illud sunt species scientiae tres. Quarum una speculatur in eo quod movetur, sed est corruptibile, et secunda considerat in eo quod movetur, verumtamen est incorruptibile, et tertia contemplatur in eo quod non corrumpitur neque movetur.21
Auch hier finden sich die Abweichungen a) bis d) des Gundissalinus hinsichtlich des grie-chischen Originals. Allein es fehlt wie bei Gerhard e) die Identifikation der drei Wissen-schaften mit Physik, Mathematik und Metaphysik. Doch ist dieser Punkt vielleicht weniger auf eine mögliche Variante in der arabischen Texttradition zurückzuführen, als vielmehr auf einen interpretatorischen Einschub des Gundissalinus selbst – ein Einschub, der durch die Gestalt des Textes in der arabischen Tradition, namentlich die Rede von drei Wissenschaf-ten, durchaus nahegelegt wird. So kann man dieselbe Ergänzung auch in der Handschrift Wien, Nationalbibliothek, 234, fol. 76ra, beobachten, wo Gerhards Übersetzung an der frag-lichen Stelle mit den Worten „naturalis“, „mathematica“ und „metaphysica“ glossiert wird.
Als Ergebnis gilt es festzuhalten, daß Gundissalinus mit seinem Aristoteles-Zitat wörtlich die charakteristischen Eigenheiten der arabischen Physik-Tradition übernimmt, und zwar mit ____________________________________________________________________________________________
19 Aristoteles, Physica, lat. Übersetzung des Gerhard von Cremona, Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 16141, fol. 41rb. Dieses Manuskript gibt in parallelen Kolumnen die Übersetzungen Gerhards, Michaels und Jakobs. 20 Die Zuschreibung dieser Übersetzung zu Michael ist nicht unbestritten, zumal in den Handschriften eindeutige Angaben fehlen. Erste Zweifel äußerte bereits Roland de Vaux, „La première entrée d’Averroës chez les latins“, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 22 (1933), S. 193-243, hier S. 221. Siehe ferner auch die jüngste Stellungnahme zum Problem der Zuschreibung der Übersetzung des Commen-tarius magnus zur Physica sowie zur möglichen Rolle Hermanns des Deutschen von Horst Schmieja, „Se-cundum aliam translationem – Ein Beitrag zur arabisch-lateinischen Übersetzung des Großen Physikkom-mentars von Averroes“, in: Gerhard Endress u. Jan A. Aertsen (Hrsg.), Averroes and the Aristotelian Tradi-tion, Leiden u.a. 1999, S. 316-336. 21 Aristoteles, Physica, lat. Übersetzung des Michael Scotus, Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 16141, fol. 41rc.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
108
den spezifischen Varianten, die vermutlich sowohl er als auch nach ihm Gerhard und Mi-chael in einem der Toledaner Manuskripte vorfanden (und die nicht zur Gänze im Leidener Manuskript erhalten sind). Zum Verständnis der Aristoteles-Stelle Worin genau liegt nun aber die Bedeutung und Reichweite von Gundissalinus’ systemati-schem Beitrag zur Aristoteles-Rezeption hinsichtlich seiner Interpretation der vorliegenden Passage aus Aristoteles’ Physik im Sinne der e) Zuordnung der drei theoretischen Wissen-schaften Physik, Mathematik und Metaphysik?
Um dies herauszuarbeiten, gilt es zunächst zu untersuchen, welche Zuordnung Aristoteles selbst intendiert, denn tatsächlich ist die Passage aus der Physik ein äußerst interessantes Lehrstück des Stagiriten, mit dem er sich von Platons, aber z.T. auch von seiner in der Me-taphysik dargestellten Wissenschaftseinteilung in signifikanter Weise abgrenzt. Während nämlich bei Platon die Gegenstandsbereiche der Physik, Mathematik und Metaphysik durch-gehend als ouvsi,ai, also Substanzen mit eigenem ontologischen Status, vorgestellt werden, scheint diese Ansicht in der Physik hinsichtlich der Mathematik durchbrochen zu werden. Denn, wie bereits vorweggenommen wurde, wird hier die Mathematik bei der Darstellung der ontologischen Gegenstandsbereiche nicht (bzw. nicht als ganze) zugeordnet. Vielmehr ergibt sich aus dem weiteren Kontext der zitierten Stelle Physik II, 7, 198a 26-31 eine andere Zuordnung, die auch durch den größeren Zusammenhang bestätigt wird:
Es ist ein Mensch, der einen Menschen zeugt, und überhaupt alles, was Veränderung in Gang setzt und dabei selbst der Veränderung unterliegt – Gegenstände, bei denen das nicht so ist, gehören nicht mehr zur Aufgabe der Naturbetrachtung (fusikh,) […] entsprechend sind es drei Aufgabenfelder: Eines ist befaßt mit dem Unveränderlichen, das andere mit dem zwar Veränderlichen, aber Unvergänglichen, das dritte mit dem Vergänglichen.22
Das erste Aufgabenfeld ist damit von der fusikh, ausgeschlossen, insofern es unveränderlich ist; es ist, wie Aristoteles nur wenig später sagt, „das ganz und gar Unveränderliche und Er-ste von allem“ (Physik II, 7, 198b 2-3),23 und d.h. der Gegenstand der Metaphysik. Die bei-den anderen Aufgabenfelder gehören jedoch zur Physik, zumindest im weiteren Sinne, wenn man der Astronomie, die ja das Veränderliche, aber Unvergängliche betrachtet, eine Mittel-stellung zwischen Physik und Mathematik konzediert.24 Entscheidend ist dabei, daß der Objektbereich der Mathematik zumindest nicht in toto mit einem ontologisch konnotierten Gegenstandsbereich versehen wird. Vielmehr behält Aristoteles den Objekten der Mathe-____________________________________________________________________________________________
22 Aristoteles, Physik I-IV, ed. cit., S. 84/85. 23 Ibid. 24 Damit ergibt sich gegenüber den Ausführungen der Metaphysik die deutliche Spannung, daß dort, etwa XII, 8, 1073b 3-8, einerseits die Astronomie mit der Tradition unter die Mathematik subsumiert wird, hier die Astronomie jedoch der Physik zugeordnet wird. (Aristoteles, Metaphysik VIII-XIV, in der Übers. von Her-mann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31991, S. 260/261) – Diese Spannung zieht sich bis in die gegenwärtigen Aristoteles-Darstellungen; Ottfried Höffe etwa schreibt in seiner Aristoteles-Monographie Aristoteles, München 21999, S. 34: „Die Mathematik [besteht als angewandte] aus Astronomie, Mechanik, Nautik, Optik und Harmonik. Die Physik [...] behandelt den Gesamtbereich dessen, was in der bewegten Welt überhaupt vorhanden ist: die Gestirne [...]“ Letztere sind jedoch gerade der Gegenstand der Astronomie.
Die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
109
matik hier einen anderen, rein epistemischen Status vor, weshalb die Tripartition der Wis-senschaften nach ontischen Kriterien nurmehr umfaßt: Physik, Astronomie und Metaphy-sik.25 Eine nicht zu verheimlichende Schwierigkeit im Verständnis dieser Passage liegt frei-lich darin, daß Aristoteles diesen Ansatz letztlich nicht ganz konsequent verficht. So hält der Stagirite andernorts, etwa in der Metaphysik, z.B. VI, 1, 1026a 13-16 – jene Stelle, die für Boethius’ Einteilung maßgeblich ist –, scheinbar weiterhin auch an der überkommenen onti-schen Dreiteilung der Wissenschaften in Physik, Mathematik und Metaphysik fest:
Denn die Physik handelt von abtrennbaren (selbständigen) [leg. unabtrennbaren], aber nicht unbeweglichen Dingen, einiges zur Mathematik Gehörige betrifft Unbewegliches, das aber nicht abtrennbar (ouv cwrista,,) ist, sondern als an einem Stoff befindlich; die erste Philosophie aber handelt von sowohl abtrennbaren (selbständigen) als auch unbewegli-chen Dingen.26
Gleichwohl finden sich auch in der Metaphysik bereits Ansätze, die auf eine Entontologisie-rung der Mathematik hinweisen. So schreibt Aristoteles etwa in Metaphysik XII, 1, 1069a 30-36, hinsichtlich des Verhältnisses der mathematischen Objekte und der ouvsi,ai kritisch:
Der Wesen (ouvsi,ai) sind drei; erstens das sinnlich wahrnehmbare; von diesem ist das eine ewig, das andere vergänglich, das alle anerkennen, z.B. die Pflanzen [...] Zweitens das un-bewegliche (Wesen). Dieses behaupten einige als existierend (ei=nai cwristh,n), und teils scheiden sie dieses in zwei Bereiche von Wesen, teils setzen sie die Ideen und die mathe-matischen Dinge als ein Wesen (fu,sij), teils nehmen sie von diesen auch nur die mathe-matischen Dinge als unbewegliche Wesen an.27
Die sich hier ergebende Einteilung der Wissenschaften anhand der zugrundeliegenden Sub-stanzen klammert damit die Mathematik aus und macht den Bereich des sinnlich Wahr-nehmbaren zum Gegenstand der physikalischen, und d.h. hier auch der astronomischen Be-trachtung, während der zweite Bereich einer anderen Wissenschaft, nämlich der Metaphysik vorbehalten werden soll. Diese soll es aber weder mit den platonischen Ideen noch mit den Objekten der Mathematik als Substanzen zu tun – beide Konzeptionen lehnt Aristoteles be-kanntlich ab. Die Invektive gegen die platonische Position könnte nicht deutlicher sein: Die gesamte Tendenz des Absatzes zielt darauf, den ontologischen Status der mathematischen Objekte als Substanzen, die dann gleichsam als platonische Ideen verstanden würden, zu bestreiten.28
Doch wie verhält es sich dann mit den Objekten der Mathematik – eine Frage, die sich nicht nur in Bezug auf die Metaphysik, sondern auch im Anschluß an die Physik-Passage
____________________________________________________________________________________________
25 Die Interpretation der vorliegenden Physik-Stelle in diesem Sinne gilt in der gegenwärtigen Literatur als Konsens. Vgl. dazu u.a. Philip Merlan, From Platonism to Neoplatonism, Den Haag 1953, S. 54-55, sowie Hans Happ, „Kosmologie und Metaphysik bei Aristoteles. Ein Beitrag zum Transzendenzproblem”, in: Kurt Flasch (Hrsg.), Parusia. Studien zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Platonismus – Festgabe für Johannes Hirschberger, Frankfurt am Main 1965, S. 155-187, hier v.a. S. 170-173. 26 Aristoteles, Metaphysik I-VI, ed. cit., S. 252/253. Zur korrigierten Lesung mit „untrennbar“ (gegen Schweglers unnötige Konjektur) siehe Kapitel 2.2., Anm. 10. 27 Aristoteles, Metaphysik VII-XIV, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31991, S. 234/235. 28 Siehe zur Interpretation dieser Passage auch Gilles-Gaston Granger, La théorie aristotélicienne de la science, Paris 1976, S. 255-256.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
110
aufdrängt? Gegenüber einer substantialistischen Lesart derselben schlägt Aristoteles im 13. Buch der Metaphysik vor, sie als ta. evx avfaire,sewj, d.h. als Resultat eines gedanklichen Pro-zesses zu begreifen, so daß sie nicht als an sich abgetrennte bestehen; so in Metaphysik XIII, 2, 1077b 9-14:
Daraus ist denn offenbar, daß weder das durch Abstraktion Entstandene (to. evx avfaire,sewj) früher, noch das durch Hinzufügung Entstandene später entstanden ist [...] Daß also die Gegenstände der Mathematik nicht in höherem Sinne Wesen sind als die sinnlichen Körper, noch dem Sein nach früher als das Sinnliche, sondern bloß dem Begriff nach, noch endlich irgendwo abgetrennt sein können, ist hiermit genügend erklärt.29
Deutlich warnt Aristoteles hier davor, den epistemischen Primat der Gegenstände der Ma-thematik im Sinne des platonischen Liniengleichnisses aus der Politeia ontologisch zu miß-deuten. Vielmehr sind diese eben nur ta. evx avfaire,sewj. Auch in der Metaphysik ist damit trotz Beibehaltung der tradierten Tripartition im 6. Buch und der sich daraus ergebenden Spannungen das Problem des ontologischen Status der Mathematik nicht einfach ausgeblen-det, sondern wird von Aristoteles durch einen starken noetischen Abstraktionsbegriff einer Lösung zugeführt.30 Genau diese Lösungsstrategie aber veranlaßt Aristoteles in seiner Physik dazu, die überkommene Tripartition der theoretischen Philosophie in Physik, Mathematik und Metaphysik aufzugeben. Denn hier will er keine vollständige Aufzählung der Wissen-schaften als solcher liefern, sondern ausgehend von einer vollständigen Beschreibung der ontologischen Verhältnisse die diesen zugeordneten Wissenschaften erörtern. Gerade weil aber die Mathematik kein ontologisches Pendant hat, gehört sie nicht in diese Beschreibung hinein, was nicht heißt, daß sie nicht Bestandteil einer – hier von Aristoteles allerdings nicht intendierten – vollständigen Aufzählung der Wissenschaften ist. Gundissalinus’ Interpretation der Passage Wenden wir uns nun Gundissalinus zu: Boethius, auf den Gundissalinus sich unmittelbar vor seinem Aristoteles-Zitat bezieht, war, wie im Abschnitt 2.2.2. gezeigt, mit seiner Wissen-schaftseinteilung nach Gegenstandsbereichen gerade durch das Fehlen eines noetischen Ab-straktionsbegriffs in gewisser Weise hinter die von Aristoteles aufgezeigten Möglichkeiten zurückgefallen.31 Die Gegenstände der Mathematik galten ihm als inabstracta et sine motu. Gundissalinus nun transformierte, wie im ersten Teil dieser Arbeit ebenfalls dargestellt wurde, diese Definition der Mathematik unter Zuhilfenahme eines aus der arabischen Tradi-____________________________________________________________________________________________
29 Aristoteles, Metaphysik VII-XIV, ed. cit., S. 282/283. 30 Vgl. zur zentralen Bedeutung des Abstraktionsbegriffs bei der unterschiedlichen wissenschaftstheoreti-schen Behandlung von Mathematik und Physik die grundlegende Monographie von Augustin Mansion, In-troduction à la ‚Physique‘ aristotélicienne, Louvain u. Paris 21945, S. 123-195. Anders als Philip Merlan und Hans Happ erkennt Augustin Mansion allerdings noch nicht in vollem Umfang, welche Konsequenzen sich mit der Abstraktionstheorie für eine an ontischen Objektbereichen orientierte Wissenschaftseinteilung erge-ben, namentlich die hier untersuchte Transformation der überkommenen Tripartition in Physik, Mathematik und Metaphysik. 31 Vgl. Boethius, Die theologischen Traktate, ed. cit., S. 6-9: „[...] mathematica, sine motu inabstracta (haec enim formas corporum speculatur sine materia ac per hoc sine motu, quae formae cum in materia sint, ab his separari non possunt) [...]“
Die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
111
tion, namentlich von Avicenna hergenommenen starken noetischen Abstraktionsbegriffs zu abstracta et cum motu. Während Gundissalinus damit deutlich über Boethius hinaus und auf Aristoteles zuging, gelingt ihm diese Annäherung an Aristoteles mit seiner Interpretation des entsprechenden Passus aus der Physik jedoch nur teilweise. Zunächst erkennt Gundissalinus durchaus treffend, daß es Aristoteles an dieser Stelle nicht in erster Linie um eine Aufzäh-lung der Wissenschaften selbst geht, sondern vielmehr um eine Beschreibung der ontolo-gisch faßbaren Gegenstandsbereiche. Dies erhellt aus dem zwischen dem Boethius- und dem Aristoteles-Zitat von Gundissalinus gesetzten Verbindungssatz:
Et hae tres tantum scientiae sunt partes philosophiae theoricae eo quod non possunt esse plura genera rerum quam haec tria, de quibus possit fieri speculatio. Unde Aristoteles [...]32
Mit diesem Verbindungssatz wird das nun folgende Aristoteles-Zitat in den Zusammenhang der vollständigen Beschreibung der „genera rerum“ gerückt, nicht der Wissenschaften als solcher. Hierin wird man gewiß das systematische Verdienst der Aristoteles-Rezeption des Archidiakons an dieser Stelle sehen dürfen, denn mit dieser Interpretation expliziert Gun-dissalinus einen der wichtigsten Aspekte der aristotelischen Wissenschaftseinteilung, na-mentlich ihre Fundierung in der Differenzierung der Gegenstandsbereiche. Diese Auslegung der Passage ließe zunächst, ganz im Sinne des Aristoteles, die Möglichkeit offen, daß neben den genera rerum auch noch entia rationis wie die der Mathematik bestehen – eine auch für Gundissalinus im Prinzip durchaus attraktive Möglichkeit, böte sie ihm doch die Gelegen-heit, die Mathematik im Sinne seines starken Abstraktionsbegriffs gänzlich zu entontologi-sieren (die Gegenstände der Mathematik als ta. evx avfaire,sewj).
Doch mit dem Zusatz, daß die vollständige Beschreibung der „genera rerum“ mit der vollständigen Beschreibung der Wissenschaften selbst identisch sei („tres tantum scientiae“), verbaut sich Gundissalinus diese Perspektive des aristotelischen Textes sogleich wieder. Wie Boethius, schöpft auch Gundissalinus, zumindest an dieser Stelle, die bei Aristoteles ange-legten Möglichkeiten damit nicht aus: Statt dessen nimmt er mit seiner in das folgende Ari-stoteles-Zitat eingeschobenen Zuordnung der drei theoretischen Wissenschaften die über-kommene Einteilung, wie sie ihm bei Boethius begegnet, wieder auf und setzt die Wissen-schaft, deren Gegenstände veränderlich, aber unvergänglich sind, kurzerhand mit der Ma-thematik gleich. Damit aber attestiert er ihren Objekten mit Platon und gegen Aristoteles einen eindeutigen auch ontologischen Status – diese sind ihm eben keine reinen entia ratio-nis, wie bei Aristoteles angedeutet wird. Obwohl ihm also zuvor die Mathematik bei seiner Auseinandersetzung mit Boethius zum Problem geworden war, und zwar gerade hinsichtlich des ontologischen Status ihrer Objekte, erkennt der Archidiakon nicht das von Aristoteles in dieser Frage offerierte Lösungspotential. Allerdings ist festzustellen, daß diese Identifizie-rung nach Gundissalinus’ ‚Korrektur‘ des boethianischen inabstracta et sine motu zu ab-stracta et cum motu nicht inkonsistent ist. Ja es scheint sogar, daß seine Boethius-Rezeption und seine Aristoteles-Aufnahme sich an dieser Stelle gegenseitig konditionieren: Denn zum einen bietet ihm Boethius mit seiner Dreiteilung der Wissenschaften und ihren Kriterien, die zumindest in Bezug auf die Bewegung (Veränderlichkeit) Ähnlichkeit mit der Physik-Stelle besitzen, ein Interpretationsparadigma für die aristotelische Einteilung – auch wenn dieses
____________________________________________________________________________________________
32 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 15.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
112
sozusagen gerade den ursprünglichen Sinn verfehlt. Zum anderen bestätigt das so, d.h. im Sinne der traditionellen Tripartition, gelesene Aristoteles-Zitat Gundissalinus’ an al-ÇazzÁlÐ orientierte und auf die Chartreser Diskussionen reagierende ‚Korrektur‘ des boethianischen sine motu zu cum motu hinsichtlich der Beschreibung der Mathematik. Denn Gundissalinus’ so korrigiertes Boethius-Zitat und die Aristoteles-Stelle decken sich in diesem Punkt. Die Boethius-Rezeption des Gundissalinus ist damit ganz klar auch der Ausgangspunkt seiner Aristoteles-Rezeption, die erst durch Boethius möglich wird, aber durch ihn auch an ihre Grenzen stößt. Die im vorangegangenen immer wieder betonten lateinisch-christlichen Vor-aussetzungen der gundissalinischen Aristoteles-Rezeption markieren hier zugleich ihre Grenzen.
Ferner wird man die Grenzen der gundissalinischen Aristoteles-Interpretation aber auch in der ebenfalls immer wieder geltend gemachten arabischen Tradition suchen müssen: Denn die Rede von „drei Arten der Wissenschaft“, wie sie im Aristoteles arabus begegnet, anstelle der „drei Aufgabenfelder“, legt durchaus nahe, daß es sich um die drei theoretischen Wissen-schaften im traditionellen Sinne handelt und nicht allein bzw. in erster Linie um genera re-rum. Man darf bei der Beurteilung des Archidiakons und seiner Interpretationsleistung nicht außer acht lassen, daß der in den arabischen Quellen vorgefundene Aristoteles nicht der ‚reine‘ Aristoteles ist: Er präsentiert sich hier und auch und gerade in unserem Beispiel als neoplatonischer Aristoteles. Und so ist es kaum verwunderlich, daß Gundissalinus das zweite Aufgabenfeld mit der Mathematik (anstelle der Astronomie) identifiziert und den Gegen-ständen dieser Wissenschaft, die eigentlich abstrakte Gedankendinge sind, ganz im Sinne der platonischen Tradition einen ontologischen Status zubilligt.
Diese Interpretation des Passus findet sich denn auch in der arabischen Tradition bei Averroes, der die Stelle folgendermaßen auslegt:
Unus namque modorum trium scientiae est scientia, quae considerat de rebus mobilibus, et est scientia naturalis. Secundus est, qui considerat de rebus immobilibus, sed sunt in mo-bilibus, et est scientia mathematica [...]33
Doch sieht der Cordobese zugleich die Schwierigkeiten dieser Auslegung, insofern als nach Aristoteles die – in der Reihenfolge des Averroes – ersten beiden Wissenschaften beide zur fusikh, gehören sollen. Entsprechend erklärt er:
Mobilia autem corruptibila et mobilia incorruptibilia sunt unius scientiae. Et ideo forte hic non intendit dicere modos artium speculativarum, sed dicere modos entium diversorum [...]34
Damit erkennt er richtig, daß es Aristoteles gar nicht um eine vollständige Aufzählung der Wissenschaften geht, sondern um die ouvsi,ai und damit um eine rein ontologische Beschrei-bung der Gegenstandsbereiche, der „entia diversa“ (oder „genera rerum“, wie es bei Gun-dissalinus heißt). In der arabischen Tradition ist die Auslegung des Gundissalinus also durch-aus geläufig.
Im Lichte dieses Durchgangs ist mithin in Bezug auf Gundissalinus und seine Aristote-les-Interpretation folgendes gewonnen: Positiv gilt es zunächst zu konstatieren, daß die aus-____________________________________________________________________________________________
33 Averroes, Aristotelis De physico auditu libri octo cum Averrois Cordubensis variis in eosdem commenta-riis, Venetiis 1562, Ndr. Frankfurt am Main 1962 (= Bd. IV), fol. 74rb. 34 Ibid.
Die Einteilung der Wissenschaften gemäß ihren Gegenständen
113
drückliche Interpretation der Passage im Hinblick auf das Kriterium der Gegenstandsberei-che für die Einteilung der Wissenschaften als bedeutende eigenständige Leistung gewertet werden muß; diese expliziert eine wichtige aristotelische Einsicht. Allerdings gerät diese Leistung gerade durch die sie ermöglichenden Bedingungen, nämlich die Boethius-Rezep-tion und die arabische Tradition, an ihre Grenzen. Gundissalinus’ Deutung geht bei der Zu-ordnung der Wissenschaften zu den Gegenstandsbereichen aufgrund seiner boethianischen Vorgabe und der arabischen Textlage zu schnell vor und identifiziert die drei Aufgabenfelder einfachhin mit den drei theoretischen Wissenschaften: Physik, Mathematik und Metaphysik, obwohl er zuvor gerade in der Auseinandersetzung mit Boethius und der arabischen Tradi-tion einen ersten, nicht unbedeutenden Vorstoß hin auf eine Entontologisierung der Mathe-matik unternommen hatte. Die aristotelische Tripartition in Physik, Astronomie und Meta-physik wäre mit diesem Abstraktionsbegriff durchaus kompatibel. Freilich ist Gundissalinus’ konservative Deutung der Physik-Stelle nicht nur auf Boethius und die arabische Tradition zurückzuführen, sondern auch der Tatsache geschuldet, daß Aristoteles selbst zwischen bei-den Tripartitionen wechselt, so daß beide Strategien durchweg berechtigte Interpretamente des aristotelischen Denkens darstellen, das hier z.T. selbst (neo)platonische Züge trägt. Gun-dissalinus steht damit am Anfang einer allgemeinen Debatte um die rechte Auslegung des Aristoteles.
So finden sich auch bei Thomas von Aquin beide Interpretationen gleichberechtigt (?) nebeneinander. In seinem Kommentar zu Boethius’ De Trinitate etwa schreibt der Aquinate:
Praeterea, Philosophus in II Physicorum dicit tria esse negotia. Primum est de mobili et corruptibili, secundum de mobili et incorruptibili, tertium, de immobili et incorruptibili. Primum autem est naturale, tertium divinum, secundum mathematicum [...]35
Interessant ist, daß Thomas diese Auslegung, ebenso wie Gundissalinus, im Kontext seiner Boethius-Kommentierung bringt, während er nur wenig später, nach 1261, in seinem Kom-mentar zur Physik die entsprechende Stelle ganz anders, und zwar näher an Aristoteles in-terpretiert:
Et primum quidem negotium pertinet ad metaphysicam, alia vero duo ad scientiam natura-lem, cuius est determinare de omnibus mobilibus, tam corruptibilibus quam incorruptibili-bus.36
Tatsächlich zieht sich die Frage nach der rechten Bestimmung des Status der Mathematik bei Aristoteles bis in die neuzeitlichen Diskussionen hinein.37
Wenn soeben gesagt wurde, daß Gundissalinus am Anfang dieser Auseinandersetzung um das rechte Verständnis des Aristoteles steht, so ist dies keine bloße façon de parler, son-dern gilt sowohl in historisch-philologischer als auch systematischer Perspektive. Denn die Ausführungen der ersten beiden Abschnitte dieses Kapitels haben deutlich gezeigt, daß Gri-gnaschis These historisch-philologisch unhaltbar ist. Der Aristoteles-Text der Physik bei ____________________________________________________________________________________________
35 Thomas von Aquin, Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden 1955, q. V, art. 3, contra 8, S. 181. 36 Thomas von Aquin, In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, ed. P. M. Maggiolo, Turin 1954, lib. II, lect. XI, S. 118. 37 Noch Albert Schwegler etwa versuchte, der Mathematik nohtai. ouvsi,ai zum Gegenstand zu geben, sie also zu ontologisieren. Vgl. seinen Kommentar zur Metaphysik, Tübingen 1847, Ndr. Frankfurt am Main 1968, S. 115.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
114
Gundissalinus entspricht exakt dem Aristoteles arabus. Es ist daher offensichtlich, daß der Archidiakon Aristoteles nicht nach der graeco-lateinischen Übersetzung zitiert, sondern nach dem arabischen Text; und da das in Frage stehende Zitat auch in keiner der von Gundissali-nus und seinen Mitarbeitern übersetzten Schriften enthalten ist, auch nicht in Avicenna, wird man sogar schließen müssen, daß Gundissalinus selbst ohne äußere Hilfe zur Zeit der Abfas-sung von De divisione, also um 1150, in der Lage war, einen Text in arabischer Sprache zu lesen, der zu diesem Zeitpunkt, wenn auch noch unübersetzt, so doch mit großer Wahr-scheinlichkeit bereits in Toledo vorlag.
Mehr noch, und dies macht Gundissalinus’ systematischen Zugang aus: Gundissalinus ist nicht nur in der Lage, diesen Text zu lesen. Vielmehr gelingt es ihm, auch wenn er sich da-durch mögliche Interpretationsperspektiven verschließt, eine Transferleistung zwischen die-sem Text und der ihm gewiß besser vertrauten lateinisch-christlichen Tradition, namentlich Boethius, aber auch den arabischen Quellen zu vollziehen. Wenn im ersten Teil dieser Arbeit immer wieder die gegenseitige Explikationskraft zwischen Texten der lateinisch-christlichen Tradition und solchen der arabischen Tradition betont wurde, so kann nun gesagt werden, daß diese beiden zusammengenommen ihrerseits wiederum Interpretations- und Integra-tionsansätze für Gundissalinus’ explizite Aristoteles-Rezeption bieten und den aristotelischen Text selbst in wissens- und wissenschaftstheoretischer Perspektive fruchtbar machen. Denn erst im Licht der Lektüre des Boethius-Zitates aus De Trinitate und seiner an al-ÇazzÁlÐ und den Chartreser Diskussionen ausgerichteten ‚Korrektur‘ der Gegenstandsbestimmung der Mathematik von sine motu zu cum motu gelingt es dem Archidiakon, seine Interpretation der Physik-Stelle des Aristoteles bezüglich der Gegenstandsbereiche der Wissenschaften konsi-stent zu formulieren, deren Sinn sich im übrigen ohne Kenntnis der Tradition nicht leicht erschließt.
3.3. Die aristotelische e[xij-Lehre und die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften als Seelenvermögen
Nicht weniger Rätsel als das soeben verhandelte Aristoteles-Zitat aus der Physik gibt zu-nächst eine weitere wissens- und wissenschaftstheoretisch einschlägige Bezugnahme des Gundissalinus auf den Stagiriten auf. So schreibt der Archidiakon, ebenfalls in De divisione philosophiae, genauerhin im Grammatik-Kapitel, anläßlich der Aufzählung der verschiede-nen Begriffe, die zur Bezeichnung der Wissenschaft als solcher verwandt werden, folgendes:
Notandum autem, quia una et eadem res est ars et scientia, doctrina et disciplina et facul-tas. ‚Ars‘ et ‚doctrina‘ dicitur quantum ad doctorem, qui regulis et praeceptis suis nos constringit et artat ad operandum secundum artem. Unde et ars dicitur ab artando et doc-trina a docendo. Disciplina vero dicitur respectu discipuli, quia discitur, sed scientia, cum iam in anima retinetur; nam dicente Aristotele omnis scientia in anima est. Sed quia omnis scientia prius est in dispositione et postea in habitu, ideo cum scientia sit habitus mentis, apellatur facultas, quia dat homini facultatem operandi secundum artem.1
Auch wenn der erste Teil dieses Zitates nicht von Isidor stammt, verrät er einmal mehr Gun-dissalinus’ Schulung am Bischof von Sevilla.2 Denn hier werden more etymologico die ver-schiedenen Bezeichnungen der Wissenschaft durch eine semantische Analyse dargestellt, wobei die Art und Weise des Erwerbs der Wissenschaften zur leitenden Hinsicht ihrer Be-nennung wird. Für den vorliegenden Zusammenhang ist diese für sich genommen bereits bedeutende Begriffsanalyse des Archidiakons (oder ggf. seiner Vorlage) um so interessanter, als sie in einem zweiten Schritt die Frage des Wissenschaftserwerbs mit Aristoteles ver-knüpft: „nam dicente Aristotele omnis scientia in anima est.“ Anders als im Fall der Physik-Stelle hat Ludwig Baur hier durchaus vermeintliche Bezugstexte bei Aristoteles ausmachen können, die Gundissalinus „probabiliter“, wie der Herausgeber redlicherweise schreibt,3 als Vorlage dienen konnten. Derer gibt er im Apparat zur fraglichen Passage gleich zwei, was womöglich als Ausdruck seiner – wie sich zeigen wird – nicht unbegründeten Zweifel be-züglich ihrer tatsächlichen Einschlägigkeit für diese Stelle gewertet werden darf: De gene-ratione animalium I, 22, 730b 15ff. und/oder De anima III, 4, 429a 27-28.
Zunächst zu De anima: Daß Gundissalinus diese Schrift insgesamt zumindest dem Na-men nach kannte, steht außer Frage, zumal er selbst sie in seinem Physik-Kapitel4 erwähnt. So liegt De anima schon sehr früh sowohl in arabischer als auch lateinischer Übersetzung ____________________________________________________________________________________________
1 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 45. 2 Eine Quelle für diesen ersten Teil konnte der Editor, Ludwig Baur, nicht ermitteln. Sollte dieser erste Teil nicht gar von Gundissalinus selbst stammen, so kann jedenfalls aufgrund der in ihm angestellten begriffsge-schichtlichen Überlegungen mit Gewißheit gesagt werden, daß es sich um eine lateinische Quelle handeln muß. – Im Kontrast zur Vagheit ihrer Herkunft steht das prominente Nachwirken dieser Bestimmung, die Vinzenz von Beauvais – allerdings unter Zuschreibung zu Isaak Israeli (von dem sie jedoch nicht stammt und auch nicht stammen kann, da sie ja einen lateinischsprachigen Verfasser voraussetzt) – in sein Speculum doctrinale, Argentorati 1474, Ndr. Frankfurt am Main 1965, 1, 13, Sp. 4, aufnimmt. Bezeichnenderweise fehlt in Vinzenz’ ansonsten wörtlicher Übernahme gerade der uns im folgenden interessierende Mittelteil, d.h. das Aristoteles-Referat. Dieses ist also in jedem Fall eine Hinzufügung unseres Archidiakons, gleich nun ob der Rest der Passage auch von ihm stammt oder nicht. 3 Vgl. seine Anmerkungen zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 45. 4 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 23.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
116
vor. Die einzig vollständige arabische Übersetzung, die in der Handschrift IsÎÁq Ibn Íunain zugeschrieben wird, stammt vermutlich nicht von diesem, sondern wurde rund hundert Jahre früher von ÝAbdalmasÐÎ Ibn NÁÝima angefertigt.5 Die lateinische Übersetzung geht auf Jakob von Venedig zurück und entstand zwischen 1125 und 1140.6 Jedoch ist die von Ludwig Baur angeführte Stelle aus De anima nur sehr bedingt als Anknüpfungspunkt geeignet. So heißt es bei Aristoteles De anima III, 4, 429a 27-28 lediglich: „Und treffend äußern sich diejenigen, die sagen, die Seele sei der Ort der Formen (to,poj eivdw/n).“7 Die Rede vom Ort der Formen oder Bilder findet sich wörtlich in der arabischen und der lateinischen Übersetzung als makÁn li’Ò-Òuwar bzw. locus specierum.8 Von Wissenschaft im gundissalinischen Sinne als scientia ist hier jedoch nicht die Rede, weshalb diese Stelle aus De anima kaum als Vorlage in Frage kommt.
Näher an Gundissalinus’ Diktion ist – zumindest dem Wortlaut nach – die Passage aus De generatione animalium. Auch diese Schrift bzw. die Tierbücher insgesamt kannte der Archidiakon zumindest dem Namen nach, wie sich ebenfalls aus seinem Physik-Kapitel9 ergibt. So kursieren bereits sehr früh in der arabischen Tradition verschiedene Kompendien und Übersetzungen zu den Tierbüchern, und insbesondere zu De generatione animalium, von YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq (8./9. Jahrhundert), IsÎÁq Ibn Íunain und später Maimonides, welche die weite Verbreitung dieses Werkes dokumentieren, so daß möglicherweise auch für Gundissa-linus der Text in einer dieser Fassungen zugänglich war.10 Die ersten lateinischen Übersetzungen dieses Werkes hingegen entstehen erst im 13. Jahrhundert (von Michael Scotus, Wilhelm von Moerbeke sowie eine anonyme Übersetzung).11 Zwangsläufig konnte Gundissalinus sein Zitat also nur aus der arabischen Tradition entnehmen. Doch auch wenn die grundsätzliche Möglichkeit aufgezeigt ist, daß Gundissalinus hier aus De generatione animalium zitiert, ist damit noch nicht gesagt, daß das in Frage stehende Zitat tatsächlich aus den Tierbüchern stammt. Zwar heißt es hier nämlich – zumindest im arabischen Text von De generatione animalium I, 22, 730b 15-16 – von der Seele, daß in ihr die „Formen und die
____________________________________________________________________________________________
5 Der Text ist ediert als ArisÔÙÔÁlÐs, FÐ’n-nafs, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kairo 1954; siehe zur Frage der arabischen Tradition von Aristoteles’ De anima im allgemeinen sowie zur Autorschaft der Übersetzung im besonderen Helmut Gätje, Studien zur Überlieferung der aristotelischen Psychologie im Islam, Heidelberg 1971. 6 Vgl. Bernard G. Dod, „Aristoteles latinus“, in: Norman Kretzmann u.a. (Hrsg.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100-1600, Cambridge 1982, S. 45-79, hier S. 76. 7 Aristoteles, Über die Seele, mit. Einl., Übers. u. Komm. hrsg. von Horst Seidl, Hamburg 1995, S. 166/167. 8 Vgl. zum arabischen Text ArisÔÙÔÁlÐs, FБn-nafs, ed. cit., S. 72, sowie zum lateinischen den im De anima-Kommentar des lateinischen Averroes abgedruckten Text (eine Edition von De anima im Aristoteles latinus steht noch aus), Averroes, Aristotelis De anima libri tres cum Averrois commentariis et antiqua translatione suae integritati restituta, Venetiis 1562, Ndr. Frankfurt am Main 1962 (Suppl. II), fol. 153v. 9 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 23. 10 Die YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq zugeschriebene Übersetzung ist ediert als Aristoteles, Generation of Animals, the Arabic Translation Commonly Ascribed to YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq, ed. J. Brugmann u. H. J. Drossaart Lulofs, Leiden 1971. Vgl. zu Ibn al-BiÔrÐq und seinen Übersetzungen ferner Douglas M. Dunlop, „The Translations of al-BiÔrÐq and YayÎÁ (YuÎannÁ) b. al-BiÔrÐq“, in: Journal of the Royal Asiatic Society o. Jg. (1959), S. 140-150. 11 Vgl. Bernard G. Dod, „Aristoteles latinus“, art. cit., hier S. 77.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
117
Wissenschaft“ seien,12 doch ist der allgemeine Kontext, in dem es um die Zeugung und die Wirkung der Spermien im Mutterleib geht, für eine wissens- und wissenschaftstheoretische Interpretation denkbar ungeeignet.
Die Einbettung des Zitates bei Gundissalinus weist dagegen klar auf einen solchen wis-sens- und wissenschaftstheoretischen Zusammenhang hin, wie auch Ludwig Baur zu erken-nen scheint, wenn er den auf das explizite Aristoteles-Zitat folgenden Satz, in dem Gun-dissalinus die habitus-Lehre einführt („scientia prius est in dispositione et postea in habitu“), ebenfalls auf Aristoteles zurückführt, diesmal auf die vermeintlich aristotelische Schrift Ma-gna moralia II, 10, 1208a 33-34.13 Damit macht der Herausgeber ein zentrales aristotelisches Lehrstück in den Ausführungen des Gundissalinus aus, das in der Tat eine genuin aristoteli-sche Quelle vermuten läßt. Denn wie Martin Bauer zu Recht schreibt, gilt: „Da die Theorie des Habitus bei Aristoteles, nicht aber im Neoplatonismus bzw. Platonismus entwickelt wor-den ist, spielt sie im frühen Mittelalter keine Rolle. Das ändert sich nach der Übersetzung der Schriften des Aristoteles und der Rezeption seiner Philosophie.“14 So kommt die habitus-Lehre jedenfalls im Bereich der Wissenstheorie historisch tatsächlich erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf, etwa bei Wilhelm von Auvergne in seiner Schrift De anima,15 um dann beim Aquinaten voll entfaltet zu werden.16 Wissenstheoretische Bezugnahmen bei lateinisch-christlichen Autoren vor Gundissalinus sind hingegen nicht bekannt,17 womit der Zusammen-
____________________________________________________________________________________________
12 Aristoteles, Generation of Animals, the Arabic Translation Commonly Ascribed to YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq, ed. cit., S. 47: „[...] wa’n-nafs hiya allatÐ fÐhÁ aÒ-ÒÙra wa’l-Ýilm [und die Seele ist diejenige, in welcher sich das Bild und das Wissen/die Wissenschaft befindet].“ Diese Lesart des aristotelischen Textes bietet auch Michael Scotus in seiner Übersetzung aus dem Arabischen, siehe Aristoteles semitico-latinus, De animalibus. Michael Scot’s Arabic Translation – Part Three: Books XV-XIX: Generation of Animals, ed. Aafke van Oppenraay (Aristoteles semitico-latinus V), Leiden u.a. 1992, S. 53: „In anima autem est forma et scientia.“ Im griechi-schen Original jedoch finden sich Seele und Wissenschaft nicht in einem Enthaltungsverhältnis, sondern durch eine sowohl-als-auch Konstruktion auf gleicher Ebene angesiedelt: „Kai. h` me.n yuch. evn h|- to. ei=doj kai. h` evpisth,mh [...]“ Vgl. auch die Übersetzung in Aristoteles, Generation of Animals, with an Engl. trans. by A. L. Peck, London 1953, S. 121. 13 Vgl. seine Anmerkungen zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 45. 14 Martin Bauer, „Habitus“, in: Lexikon des Mittelalters IV (1989), Sp. 1813-1815, hier Sp. 1814. Siehe allerdings dagegen Cary J. Nederman, „Nature, Ethics and the Doctrine of habitus: Aristotelian Moral Psy-chology in the 12th Century“, in: Traditio 45 (1989-1990), S. 87-110, wo versucht wird, bereits für das 12. Jahrhundert frühe Verwendungen von habitus nachzuweisen. 15 Die herausragende wissenstheoretische Bedeutung der habitus-Lehre bei Wilhelm wird von Jean-Baptiste Brenet im Vorwort zu seiner französischen Teilübersetzung von De anima herausgearbeitet; vgl. Wilhelm von Auvergne, De l’âme, introd., trad. et notes par Jean-Baptiste Brenet, Paris 1998, v.a. S. 28-31. 16 Vgl. zur habitus-Lehre in der Wissenstheorie des Thomas neben seinem Kommentar zum sechsten Buch der Nikomachischen Ethik (Thomas von Aquin, Sententia libri Ethicorum IV-X, iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, in: Opera omnia XLVII, Romae 1969, lib. VI, cap. 3, S. 339-343) insbesondere auch fol-gende Stelle in seinem De Trinitate-Kommentar: Thomas von Aquin, Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden 1955, q. V, art. 1, contra 1, S. 169: „Partes enim speculativae sunt illi habitus qui partem contemplativam animae perficiunt. Sed [...]“ 17 Der Begriff habitus begegnet zwar bei Gundissalinus’ lateinisch-christlichen Hauptquellen Boethius und Isidor von Sevilla u.a., doch ist er hier deutlich anders konnotiert. So tritt er bei Boethius in der Verwendung als eine der Kategorien auf, namentlich in seinem Kommentar In Categorias Aristotelis, PL 64, lib. II, Sp. 218; diese Bedeutung von habitus im Zusammenhang mit den Kategorien wird von Aristoteles selbst jedoch von der uns hier beschäftigenden Bedeutung von habitus innerhalb der Wissens- und Wissenschafts-theorie klar abgegrenzt, wie sich weiter unten im Text zeigen wird. Bei Isidor wiederum erscheint der Begriff
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
118
hang des Aufkommens der habitus-Lehre beim Archidiakon mit der arabischen Philosophie und insbesondere den aristotelischen Schriften geradezu zwingend erscheint. Was nun jedoch die von Ludwig Baur ausgemachte Quelle, die Magna moralia, betrifft, deren Authentizität umstritten ist, so gilt es zu beachten, daß diese zu Lebzeiten des spanischen Gelehrten weder in arabischer noch in lateinischer Übersetzung verfügbar war. Eine arabische Übersetzung hat vermutlich nie bestanden;18 die lateinische Übertragung entstand erst zwischen 1255 und 1268 durch Bartholomäus von Messina.19 Damit kommen die Magna moralia als Vorlage für Gundissalinus nicht in Frage.
Ein möglicher Schlüssel zur Erklärung des expliziten Aristoteles-Zitates und des von Baur zu Recht auf Aristoteles zurückgeführten habitus-Motivs liegt womöglich darin, nicht nur nach einem passenden Text des expliziten Aristoteles-Zitates zu suchen, sondern in diese Suche die aristotelische habitus-Lehre mit einzubeziehen. Hält man in der Konsequenz die-ser Überlegung nach einer anderen aristotelischen Quelle des Zitates Ausschau, wobei nicht unbedingt ein wörtliches Zitat aus Aristoteles erwartet werden muß (auch im Falle von De generatione animalium ist dies ja nicht der Fall), sondern vielmehr die allgemeine wissens- und wissenschaftstheoretische Einbettung zu berücksichtigen ist, so findet sich ein möglicher Bezugstext mit dem 6. Buch der Nikomachischen Ethik des Aristoteles. Die Nikomachische Ethik als möglicher Anknüpfungspunkt des Gundissalinus Gundissalinus’ zitierter Passus weist insofern große Verwandtschaft mit dem 6. Buch der Nikomachischen Ethik auf, als in diesem der rationale Teil der Seele von Aristoteles dahin-gehend bestimmt wird, daß sich in ihm nicht nur die te,cnh, die fro,nhsij, die sofi,a und der nou/j befinden, sondern auch die evpisth,mh, die Wissenschaft also.20 Unmittelbar danach wird die evpisth,mh von Aristoteles weiter als e[xij avpodeiktikh, bestimmt, also als Habitus der Apo-deixis.21 Damit ist in aller Kürze – in einer im nächsten Abschnitt im Detail darzustellenden Weise – dargetan, daß für Aristoteles Wissenschaft grundsätzlich in der Seele ist, und zwar als Habitus derselben. Diese Stelle trägt damit sowohl dem expliziten Zitat des Archidiakons aus Aristoteles Rechnung, daß alle Wissenschaft in der Seele sei, als sie auch diese Überle-gungen mit dem habitus-Motiv in Verbindung bringt. Systematisch ist damit sicherlich der aristotelische Zusammenhang bezeichnet, in den Gundissalinus’ Ausführungen zurückwei-sen.
____________________________________________________________________________________________
in einer dritten, nicht-aristotelischen Verwendung, nämlich in der für die lateinische Welt traditionellen Be-deutung von Habit als Gewand. Siehe dazu Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, ed. Wallace M. Lindsay, 2 Bde., Oxford 1911, hier z.B. Bd. II, lib. XIX, 22, 3, unter ‚De diversitate et nominibus vestimentorum‘. Darüber hinausgehende frühe Verwendungsweisen, wie sie von Cary J. Neder-man, art. cit., angeführt werden, sind rein ethisch, niemals wissenstheoretisch konnotiert. 18 So Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungsliteratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 323. 19 Vgl. Bernard G. Dod, art. cit., hier bes. S. 62 u. S. 78. 20 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, hrsg. u. übers. von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main 1998, 3, 1139b 16-17, S. 28/29. 21 Ibid., 31-32, S. 30/31.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
119
Doch wie verhält es sich mit der Kenntnis, die Gundissalinus von der Nikomachischen Ethik tatsächlich haben konnte? Daß es im arabischen Raum schon sehr früh eine oder meh-rere Übersetzungen der Nikomachischen Ethik gab, war lange Zeit durch entsprechende Er-wähnungen mittelalterlicher arabischer Bibliographien (etwa dem Fihrist des Ibn an-NadÐm aus dem 10. Jahrhundert) und anderer Quellen bekannt, in denen immer wieder von Aristo-teles’ KitÁb al-aÌlÁq (Buch der Sitten) die Rede ist. Dieses ist offensichtlich identisch mit der Nikomachischen Ethik, die allem Anschein nach als einzige ethische Schrift des Aristoteles ins Arabische übersetzt wurde.22 Doch fehlten bislang Textzeugen dieser Tradition; erst durch die Handschriftenfunde von Arthur J. Arberry und Douglas M. Dunlop in der Mitte des letzten Jahrhunderts konnten entsprechende Manuskripte ausgemacht werden, von denen eines die Bücher I-VI, das andere die Bücher VII-X beinhaltet (es handelt sich um die zwei Hälften ursprünglich eines Manuskriptes).23 Beide Handschriften repräsentieren offensicht-lich verschiedene Teile derselben Übersetzung, die vermutlich auf Íunain Ibn IsÎÁq oder seinen bereits mehrfach genannten Sohn IsÎÁq Ibn Íunain zurückgeht und damit erheblich älter ist als das in der Handschrift genannte Datum ihrer Abschrift, nämlich 1222. Von be-sonderer Bedeutung für den gegenwärtigen Kontext ist, daß die beiden heute in Fes, Makta-bat al-QarawÐyÐn, 2508/80 und 3043/80, befindlichen Handschriften aller Wahrscheinlichkeit nach aus al-Andalus stammen, wie sich an der Schrift erkennen läßt und wie auch ein Be-sitzhinweis nahelegt.24 Als eindeutiger Hinweis auf die Verfügbarkeit der Ethik in Toledo selbst muß auch die fragmentarische Übersetzung derselben aus dem Arabischen durch Her-mann den Deutschen in der Mitte des 13. Jahrhunderts gewertet werden.25 Ob zudem die Zuschreibung einer Ethik-Übersetzung zu Michael Scotus als früherer Hinweis auf das Vor-liegen der Nikomachischen Ethik in Toledo gelten kann, ist indes zweifelhaft.26 Nichtsdesto-trotz ist damit aber aufs Ganze gesehen eine arabische Ethik-Tradition bezeugt, die Gun-dissalinus durchaus als Vorlage hätte dienen können.
Die lateinischen Übersetzungen sind hingegen alle deutlich später zu datieren. Die viel-leicht früheste unter ihnen, die anonyme Ethica antiquissima vom Ende des 12. Jahrhunderts, umfaßt zudem nur die Bücher II und III, also nicht unser 6. Buch. Erst vom Anfang des 13. Jahrhunderts dürfte die Ethica antiquiore stammen (möglicherweise von Michael Scotus übersetzt), die ebenfalls nur fragmentarisch überliefert ist. Die erste vollständig erhaltene
____________________________________________________________________________________________
22 Siehe Christel Hein, op. cit., S. 323. 23 Vgl. zu diesen Handschriftenfunden Arthur J. Arberry, „The Nicomachean Ethics in Arabic“, in: Bulletin of the School of Oriental and African Studies 17 (1955), S. 1-9, sowie Douglas M. Dunlop, „The Nicoma-chean Ethics in Arabic, Books I-VI“, in: Oriens 15 (1962), S. 18-34. 24 Vgl. Arthur J. Arberry, art. cit., S. 1, und Douglas M. Dunlop, art. cit., S. 19. 25 Vgl. zu Hermanns Fragmenten Anna Akasoy u. Alexander Fidora, „Eine Untersuchung zum arabischen Ursprung der alia translatio der Nikomachischen Ethik“, in: Bulletin de philosophie médiévale 45 (2003), (im Druck). 26 Es gibt Hinweise in mindestens einer Handschrift, die dafür sprechen, Michael Scotus die Ethica anti-quiore genannte lateinische Übersetzung der Nikomachischen Ethik zuzuschreiben. Doch scheint er diese dann direkt aus dem Griechischen, und zwar in Bologna, übertragen zu haben. Dagegen hat Fernand Bossier Argumente für die Autorschaft dieser Übersetzung seitens Burgundios von Pisa vorgelegt. Siehe Fernand Bossier, „L’élaboration du vocabulaire philosophique chez Burgundio de Pise“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latinitas‘, Louvain 1997, S. 81-116.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
120
lateinische Übersetzung erfolgte deutlich später, 1246-1247, durch Robert Grosseteste.27 Damit scheidet die lateinische Aristoteles-Überlieferung als Quelle für Gundissalinus bereits aus chronologischen Gründen aus.
Wie jedoch im letzten Kapitel gezeigt wurde, ist durchaus davon auszugehen, daß der Archidiakon entgegen der These von Grignaschi über die Fähigkeiten verfügte, Aristoteles’ Werke auch im Arabischen zu lesen. Daß die Nikomachische Ethik in al-Andalus vorlag, kann jedoch nach dem Gesagten als sicher gelten. Da das 6. Buch im arabischen Text aller-dings nur äußerst unvollständig erhalten ist – vielleicht ein Hinweis auf dessen starke Bear-beitung in der Handschrift – kann dieser bedauerlicherweise hier nicht zu einem Vergleich mit Gundissalinus’ Passage herangezogen werden.28 Im übrigen scheint Gundissalinus jedoch im vorliegenden Fall nicht wörtlich Aristoteles zu zitieren, vielmehr stellt sich sein Zitat als Paraphrase des 3. Kapitels aus dem 6. Buch der Nikomachischen Ethik dar, was durchaus mit seiner Arbeitsweise zu vereinbaren ist. Zwar läßt sich vor diesem Hintergrund Gundissali-nus’ Benutzung des Aristoteles-Textes nicht mit letzter Sicherheit belegen; andererseits ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die habitus-Lehre in der Wissenstheorie der Araber keine Rolle zu spielen scheint, so daß eine Vermittlung der habitus-Lehre über andere Quellen schwierig ist. So taucht der Begriff des habitus (arab. malaka) in den von Gundissalinus aus dem Arabischen übersetzten Werken kein einziges Mal in rein wissenstheoretischer Verwen-dung auf, sondern ist in der Regel, wie etwa in Gundissalinus’ Übersetzung des Metaphysik-Teils aus Avicennas KitÁb aš-šifÁÞ, auf den Bereich des ethischen Handelns begrenzt.29 Damit wird jedoch nur ein Sonderfall der aristotelischen habitus-Lehre thematisiert, während ihre grundsätzliche wissenstheoretische Dimension außer Betracht gelassen wird. Dies liegt ge-wiß auch daran, daß in der arabischen Tradition an die Stelle der aristotelischen habitus-Lehre eine differenzierte Intellektlehre neoplatonischer Prägung tritt.30 Wenn die habitus-Lehre Gundissalinus aber, wie zuvor gezeigt, weder durch die lateinisch-christliche Tradition noch durch die arabische Philosophie vermittelt wird, so liegt es mehr als nahe, ihren Ur-sprung in den aristotelischen Schriften selbst zu sehen.
Daß die Nikomachische Ethik Gundissalinus im übrigen ihrem Titel nach bekannt ist, geht klar aus ihrer Erwähnung im Schlußkapitel von De divisione zur praktischen Philoso-
____________________________________________________________________________________________
27 Siehe zu diesen Zusammenhängen die ausführliche Darstellung von René Antoine Gauthier in der Praefa-tio zu seiner Ausgabe von Aristoteles latinus, Ethica Nicomachea, ed. Renatus Antonius Gauthier (Aristoteles latinus XXVI, 1-3), 5 fasc., Leiden u. Brüssel 1974, hier fasc. I. 28 Die von ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ vorgelegte Edition des arabischen Textes der Nikomachischen Ethik (ArisÔÙÔÁlÐs, KitÁb al-aÌlÁq, tarÊamat IsÎÁq Ibn Íunain, Kuwait 1979) ist philologisch überdies nicht ver-läßlich, da sie den Text des Manuskripts an seinen lacunae stillschweigend aus dem Griechischen ergänzt. Eine Neuedition der arabischen Nikomachischen Ethik mitsamt englischer Übersetzung von Douglas M. Dunlop wird von Anna Akasoy und Alexander Fidora gegenwärtig für den Aristoteles semitico-latinus vor-bereitet. 29 Vgl. etwa Avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Lou-vain u. Leiden 1977 u. 1980, hier Bd. I, S. 213: „[...] et malum non est malum per potentiam mali, sed per habitum malitiae.“ 30 Vgl. in diesem Sinne die von Gundissalinus übertragenen und, wie in 2.2.3. gezeigt, im Hinblick auf ihre Intellektlehre rezipierten Werke von Alexander von Aphrodisias, De intellectu et intellecto, ed. Gabriel Théry, in: id., Autour du décret de 1210: II. Alexandre d’Aphrodise, Kain 1926, S. 68-83; al-KindÐ, De in-tellectu, ed. Albino Nagy, in: BGPhMA II, 5, Münster 1897, S. 1-11; al-FÁrÁbÐ, De intellectu et intellecto, ed. Étienne Gilson, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929), S. 115-141.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
121
phie hervor, wo er von der Politica als Teil der Ethica spricht und jene dem Aristoteles zu-schreibt,31 womit er sich von al-FÁrÁbÐ unterscheidet, der ihm hier als Vorlage dient und der die Ethik gar nicht nennt (vgl. hierzu weiter unten Kapitel 3.6.). Ja im Schlußkapitel (aber auch schon im Prolog) von De divisione finden sich, wie später ebenfalls in Kapitel 3.6. zu zeigen sein wird, sogar Anklänge gerade an das 6. Buch der Nikomachischen Ethik und die dort angeführte Tripartition der praktischen Philosophie. Damit weist De divisione philo-sophiae gleich mehrere Passagen auf, die eine Benutzung der Nikomachischen Ethik durch Gundissalinus plausibel erscheinen lassen. Bezeichnenderweise deuten alle Stellen, obwohl thematisch gänzlich verschieden, auf das 6. Buch der Nikomachischen Ethik hin. Dies muß als weiterer Anhaltspunkt dafür gelten, daß sich Gundissalinus tatsächlich in eigener Lektüre den aristotelischen Text erschließt und nicht aus anderen arabischen Quellen schöpft, in de-nen beide Stellen kaum in einem thematischen Zusammenhang behandelt worden sein dürf-ten. Wie immer auch diese historisch-philologische Frage letztlich zu beantworten sein wird, so muß doch nach vorläufigem Ausschluß anderer Quellen für die habitus-Lehre als äußerst wahrscheinlich angesehen werden, daß die Nikomachische Ethik in ihrer arabischen Tradie-rung, im weiten Sinne zumindest, nicht nur systematisch, sondern auch material die Koordi-naten für das Verständnis des gundissalinischen Zitates liefert. Zur Interpretation der Aristoteles-Passage Die zu Beginn des letzten Abschnittes resümierte Stelle aus der Nikomachischen Ethik, ge-nauerhin aus dem 3. Kapitel des 6. Buches, bildet gleichsam eine wissens- und wissen-schaftstheoretische Weitung der Perspektive dieses Werkes, welche die e[xij als Schlüssel-begriff der Ethik in eine allgemeine e[xij-Lehre einbettet. Der Begriff der e[xij selbst wird von Aristoteles auch andernorts entwickelt, so etwa in Metaphysik V, 20, 1022b 4-11, wo Ari-stoteles zwei e[xij-Begriffe voneinander abhebt:
Haltung (e[xij) nennt man (1.) in der einen Bedeutung z.B. eine Tätigkeit (Wirklichkeit [evne,rgeia]) des Haltenden und Gehaltenen als eine Art von Handlung oder Bewegung [...] (2.) In einem anderen Sinne aber nennt man Haltung (e[xij) die Disposition (dia,qesij), nach welcher das sich in einem bestimmten Zustand Befindliche sich gut oder schlecht befin-det.32
Während der erste dieser beiden e[xij-Begriffe auf die in den Kategorien entwickelte Katego-rie des e;cein verweist,33 ist mit dem zweiten Begriff eine qualitative Bestimmtheit gemeint. Es ist dieser zweite Sinn von e[xij, den Aristoteles in der Nikomachischen Ethik zur Beschrei-bung des Zustandes eines Vermögens an einem Träger bemüht. Damit sind zwei wesentliche, im Begriff des Habitus implizierte Bestandteile benannt: Der Habitus bezieht sich stets auf ein Vermögen, das seinerseits an einen Träger zurückgebunden ist.
____________________________________________________________________________________________
31 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 136: „Et haec quidem scientia continetur in libro Aristotelis, qui Politica dicitur, et est pars Ethicae.“ 32 Aristoteles, Metaphysik I-VI, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31989, S. 232/234. 33 Siehe Aristoteles, Kategorien – Hermeneutik oder vom sprachlichen Ausdruck, hrsg., übers., mit Einl. u. Anm. versehen von Hans Günter Zekl, Hamburg 1998, 4, 1b 27, S. 6/7.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
122
Der Träger des wissenschaftlichen Habitus ist für Aristoteles die Seele, und zwar genau-erhin ihr rationaler Teil, den er im 2. Kapitel der Nikomachischen Ethik in folgende Verhal-ten unterteilt:
Wir haben früher gesagt, die Seele habe zwei Seiten, eine vernünftige und eine nicht-ver-nünftige; jetzt müssen wir ebenso die vernünftige Seite derselben weiter einteilen. Wir setzen also voraus, daß an der vernünftigen Seite der Seele nochmal zwei Teile zu unter-scheiden sind [...] Wir möchten den einen dieser Teile als „auf Wissen beruhend“ (evpisthmoniko,n) und den anderen „auf Überlegung beruhend“ (logistiko,n) bezeichnen. [...] Diese Fähigkeit zu überlegen, ist somit der eine Teil der vernünftigen Seite der Seele. Nun ist es zu bestimmen, welche Verfassung (e[xij) in jedem dieser beiden Teile die beste ist.34
Die dem wissenschaftlichen Habitus korrespondierenden Verhalten sind also evpisthmoniko,n und logistiko,n – eine Unterscheidung, die auf die berühmte Einteilung des Aristoteles in theoretische und praktische Vernunft vorausweist,35 die später von ihm als Funktionen ein und desselben Vermögens vorgestellt werden und deren Unterscheidungskriterium einzig in ihren verschiedenen Zielrichtungen besteht, nämlich Wissen und Handlung.36 In diesem Sinne führt Albert Zimmermann in seinen konzisen Ausführungen zur aristotelischen e[xij-Lehre beide Verhalten auf das Verstandesvermögen als dasjenige Vermögen zurück, das auf Wahrheit geht.37 Dieses ist damit als das Vermögen der wissenschaftlichen Habitus ausge-zeichnet, die von Aristoteles in dem uns nun besonders interessierenden 3. Kapitel des 6. Buches der Nikomachischen Ethik folgendermaßen benannt werden:
Wir müssen nun, um die Erörterung derselben [d.h. der Tugenden] fortzusetzen, etwas weiter ausholen. Die Wege, auf denen die Seele bejahend oder verneinend die Wahrheit trifft, mögen fünf sein: Sachkundigkeit (te,cnh), Wissenschaftlichkeit (evpisth,mh), Ver-nünftigkeit (fro,nhsij), Weisheit (sofi,a), Vernunft (nou/j). Durch bloßes Vermuten und bloßes Meinen dagegen kann man auch im Irrtum sein.38
Von diesen fünf wissenschaftlichen Habitus,39 die Aristoteles hier als in der Seele befindlich nennt und auf ihr wahrheitsfähiges Verstandesvermögen bezieht, interessiert ihn in der Folge insbesondere jenes der Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft (evpisth,mh), das gewiß dem Verhalten des evpisthmoniko,n des Verstandesvermögens entspricht. Unmittelbar im Anschluß an die Aufzählung der einzelnen wissenschaftlichen Habitus präzisiert Aristoteles daher, was er unter ‚Wissenschaft‘ versteht:
____________________________________________________________________________________________
34 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, ed. cit., 2, 1139a 3-16, S. 24-27. 35 Vgl. zur Parallele der Unterscheidung evpisthmoniko,n/logistiko,n und theoretische/praktische Vernunft auch den Kommentar von René Antoine Gauthier zu dieser Stelle in Aristoteles, Éthique à Nicomaque, in-trod., trad. et comm. par René Antoine Gauthier, 3 Bde., Louvain u. Paris 1958 u. 1959, hier Bd. II, S. 442. 36 So etwa Aristoteles, Über die Seele, ed. cit., III, 9, 432b 27, S. 190/191. 37 Vgl. Albert Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Leiden u. Köln 1965, S. 92-95, dem wir auch in der weiteren Ar-gumentation folgen. 38 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, ed. cit., 3, 1139b 14-18, S. 28/29. 39 Siehe zur Frage der Vollständigkeit der wissenschaftlichen Habitus bei Aristoteles G. Kalinowski, „La théorie aristotélicienne des habitus intellectuels“, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 43 (1959), S. 248-260.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
123
Was nun ‚Wissenschaft‘ (evpisth,mh) sei, ergibt sich, wenn wir die Worte genau nehmen und uns nicht durch bloße Ähnlichkeit leiten lassen [...] Jede Wissenschaft scheint lehrbar und jeder Gegenstand lernbar. Jede Lehre aber knüpft an schon Bekanntes an, wie wir in unserer Analytik gezeigt haben, und vollzieht sich teils durch Induktion (evpagwgh,) teils durch Schlußverfahren (sullogismo,j). Die Induktion ist der Ausgangspunkt für das All-gemeine, das Schlußverfahren dagegen geht von dem Allgemeinen aus. Mithin gibt es Ausgangspunkte, aus denen Schlüsse abgeleitet werden, von denen sich aber kein Schluß ergibt. Dafür tritt dann die Induktion ein. Daraus folgt, daß Wissenschaftlichkeit eine auf Beweis gestützte Grundhaltung (e[xij avpodeiktikh,) ist mit den Eigenschaften, die wir in der Analytik ausgeführt haben [...]40
Damit wird Wissenschaft von Aristoteles als Habitus, d.h. als lehr- und erlernbare Grund-haltung, näher bestimmt, die sich der Apodeixis oder des Beweises bedient. Dieser aber ist, wie aus dem Abschnitt bereits hervorgeht und wie Aristoteles ausführlich in den Analytica posteriora I zeigt – auf die er sich auch hier bezieht –, identisch mit einer Ableitung aus (ersten) Prinzipien, die stets notwendiger sein müssen als das zu Beweisende. Entsprechend lautet die einschlägige Definition für ideales Wissen aus den Analytica posteriora:
Wir glauben aber etwas zu wissen (evpi,stasqai), schlechthin, nicht nach der sophistischen, akzidentellen Weise, wenn wir sowohl die Ursache, durch die es ist, als solche zu erken-nen glauben, wie auch die Einsicht uns zuschreiben, daß es sich unmöglich anders verhal-ten kann.41
Komplementär zur deduktiven Methode verhält sich die ebenfalls im Zitat aus der Nikoma-chischen Ethik erwähnte Induktion oder evpagwgh,, die in den Bereich der Auffindung der den Beweis oder Syllogismus tragenden Prinzipien gehört, wie bereits im Abschnitt 2.2.4. antizi-piert wurde. Insgesamt kann vor diesem Hintergrund gesagt werden, daß die e[xij-Lehre des Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik in erster Linie eine Methodenlehre für die Wis-senschaften ist, denen in enger Anlehnung an die Beweise der Mathematik ein deduktives Beweisverfahren zugrunde liegt.42 Diese Vorbildlichkeit des mathematischen Beweises darf jedoch nicht dahingehend mißverstanden werden, daß Aristoteles über ein kaum differen-ziertes Methodenbewußtsein verfügte. Zwar hat Siegfried Neumann durchaus Recht, wenn er schreibt: „Eine Zuordnung von Methoden, wie sie Boethius für die theoretischen Wissen-schaften durchführt, ist bei Aristoteles nicht anzutreffen. Für ihn sind die Induktion und De-duktion und hier vor allem die Beweisarten und Schlüsse methodisch von Bedeutung, und
____________________________________________________________________________________________
40 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, ed. cit., 3, 1139b 18-33, S. 30/31. 41 Aristoteles, Philosophische Schriften I, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995, I, 2, 71b 9-12, S. 3. Vgl. ferner für den griechischen Text die zweisprachige Ausgabe Aristoteles, Erste Analytik – Zweite Analytik, hrsg., übers., mit Einl. u. Anm. versehen von Hans Günter Zekl, Hamburg 1998, S. 314. Für die deutschen Zitate folgen wir jedoch wie bisher der Ausgabe von Eugen Rolfes, da die Verdeutschungen vieler aristoteli-scher termini technici in Hans Günter Zekls Übertragung das Verständnis des Textes insgesamt über Gebühr erschweren. 42 Vgl. zur Rolle der mathematischen Methode Mechthild Dreyer, More mathematicorum. Rezeption und Transformation der antiken Gestalten wissenschaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert, in: BGPhMA, N.F. 47, Münster 1996, S. 59-60: „Indem die Apodeixis (avpo,deixij) der Mathematik als Methode [...] in den Vor-dergrund tritt [...], wird Wissenschaft von Aristoteles mathematisch organisiert.“
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
124
zwar für alle Wissenschaften.“43 Es gibt jedoch neben der Metaphysik44 auch und gerade im 6. Buch der Nikomachischen Ethik Motive, die erkennen lassen, daß Aristoteles ein Bewußt-sein um die von jeder Wissenschaft verlangten spezifischen Methoden hatte. In der Nikoma-chischen Ethik wird dies insbesondere für die Metaphysik entwickelt: Wie Albert Zimmer-mann treffend beobachtet,45 wird diese von Aristoteles zuweilen, etwa Metaphysik I, 1, 982a 1-6, auch als sofi,a und damit scheinbar als weiterer Habitus neben der evpisth,mh bezeichnet. Dies scheint zunächst ihre Wissenschaftlichkeit in Frage zu stellen. Eine mögliche Erklärung hierfür gibt Aristoteles im 7. Kapitel des 6. Buches der Nikomachischen Ethik, wo es über den Habitus der Weisheit heißt:
Somit ist offenbar, daß die Weisheit (sofi,a) die vollkommenste in allen Wissenschaften sein muß. Der Weise wird also nicht bloß mit dem aus den Ausgangspunkten, aus den Prinzipien Abgeleiteten Bescheid wissen, sondern auch mit den Ausgangspunkten, den Prinzipien selbst. Weisheit ist also beides, Vernunft (nou/j) und Wissen (evpisth,mh), und stellt gleichsam die höchste Spitze der obersten Wissensgebiete dar.46
Auch sofi,a, d.h. die Metaphysik, ist damit evpisth,mh; die allgemeinen methodischen Erfor-dernisse der Wissenschaft muß auch sie erfüllen. Doch gelten daneben für sie, und dies ist für den vorliegenden Zusammenhang entscheidend, noch besondere methodische Auflagen: Das spezifische Surplus der Methode der Metaphysik ist gerade darin zu suchen, daß sie nicht nur aus Prinzipien ableitet, sondern über den nou/j unmittelbare Einsicht in die Prinzi-pien, und zwar in die allerersten, hat.
Die rein formale Methodenbestimmung der Wissenschaften bei Aristoteles ist damit durchaus für alle Wissenschaften eine: die Apodeixis; insofern ist Siegfried Neumann zuzu-stimmen. Material ergeben sich jedoch anhand des Status der in diese Apodeixis eingehen-den Prinzipien und ihrer jeweiligen Begründungsverhältnisse deutliche methodische Unter-schiede zwischen den verschiedenen Wissenschaften. Zwar werden diese nicht über ver-schiedene Vermögen begründet, wie bei Boethius, wohl aber über ein Wechselspiel ver-schiedener Habitus des einen Verstandesvermögens.
Insgesamt kann damit konstatiert werden, daß Aristoteles in unserem Passus nicht nur die Seele als Träger der Wissenschaft auszeichnet, sondern mit seiner e[xij-Lehre auch über deutliche Ansätze einer Methodendifferenzierung der Wissenschaften verfügt, so daß seine Ausführungen zur e[xij keinesfalls im Sinne einer Einheitsmethode verstanden werden dür-fen, sondern durchaus komplexere Gestalt besitzen.
____________________________________________________________________________________________
43 Siegfried Neumann, Gegenstand und Methode der theoretischen Wissenschaften nach Thomas von Aquin aufgrund der ‚Expositio super librum Boethii De Trinitate‘, in: BGPhMA XLI, 2, Münster 1965, S. 36. 44 Siehe Aristoteles, Metaphysik II, 3, 995a 12-17: „Daher muß man dazu schon gebildet sein, welche Weise man bei jedem Gegenstande zu fordern hat; denn unstatthaft ist es, zugleich die Wissenschaft und die Weise ihrer Behandlung zu suchen, da jedes von diesen beiden für sich zu finden nicht leicht ist. Die genaue Schärfe der Mathematik aber darf man nicht für alle Gegenstände fordern, sondern nur für die stofflosen. Darum paßt diese Weise nicht für die Wissenschaft der Natur, denn alle Natur ist wohl mit Stoff behaftet.“ (Aristoteles, Metaphysik I-VI, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl, Hamburg 31989, S. 80/81) 45 Siehe zum folgenden Zusammenhang erneut Albert Zimmermann, op. cit., S. 95. 46 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, ed. cit., 7, 1141a 16-20, S. 38/39.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
125
Gundissalinus’ Aufnahme der aristotelischen habitus-Lehre Gundissalinus schließt unmittelbar an zahlreiche der dargestellten Motive der aristotelischen habitus-Lehre an, wobei er zugleich eigene Akzente setzt, so etwa mit der Einbettung der-selben in den Kontext des Wissenserwerbs, der bei Aristoteles mit dem Begriffspaar „lehr-bar“/„erlernbar“ nur apostrophiert wird. Somit ergibt sich beim Archidiakon ein interessantes Geflecht aus Rezeption und Interpretation, das nun darzustellen ist:
Zunächst folgt Gundissalinus Aristoteles eindeutig mit seiner Verortung der Wissenschaft in der Seele („nam dicente Aristotele omnis scientia in anima est“). Wie Aristoteles gilt da-mit auch ihm die Seele als Träger des Habitus der Wissenschaft. Diese Bestimmung findet sich auch an weiteren Stellen von De divisione wieder, so etwa im Schlußkapitel, wo die Philosophie als „ordo animae“ beschrieben wird.47 Bei der darauf folgenden näheren Bestim-mung des habitus der Wissenschaft weicht Gundissalinus jedoch scheinbar deutlich von seinem Vorbild ab; denn anders als Aristoteles bestimmt er in dem zu Beginn dieses Kapitels zitierten Passus den Habitus der Wissenschaft nicht mit Hilfe der Apodeixis weiter, sondern führt eine neue Vokabel ein. So heißt es nun von der Wissenschaft: „scientia sit habitus mentis“, womit aber zumindest die aristotelische Definitionsstruktur aufgenommen wird, in der die Wissenschaft zunächst als Habitus bestimmt und dieser dann seinerseits weiter präzi-siert wird. Die hier zu beobachtende Ersetzung der Apodeixis durch mens scheint zunächst hinter Aristoteles zurückzufallen, ja es drängt sich geradezu der Verdacht auf, daß diese Er-klärung gegenüber der vorangehenden Bestimmung der Wissenschaft als in der Seele be-findlicher nichts Neues bringt. Gleichwohl ist diese Ersetzung nicht Ausdruck unüberlegter Redundanz, denn der bei Gundissalinus keinesfalls häufige Begriff der mens ist terminolo-gisch durchaus von Bedeutung. So weist dieser Begriff unmittelbar in den Kontext der in De processione mundi dargestellten Methodenlehre des Boethius aus Unterkapitel 2.2.3. zurück.
In einem ersten Schritt resümierte und modifizierte der Archidiakon, wie im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich dargetan wurde, Boethius’ Methodenlehre folgendermaßen:
Unde dicitur, quod in naturalibus rationaliter, in mathematicis disciplinaliter, in theologi-cis intelligentialiter versari oportet.48
In einem zweiten Schritt parallelisierte er diese Methoden in der ebenfalls bereits gezeigten Weise mit den drei Seelenvermögen ratio, intellectus und intelligentia:
Et rationi quidem sufficit possibilitas, demonstrationi vero necessitas, intelligentiae vero simplex et mera quaedam conceptio. Ad intelligentiam autem per intellectum sive per de-monstrationem, ad intellectum per rationem, ad rationem vero per imaginationem, et ad imaginationem vero per sensum ascenditur.49
Wenige Zeilen später nun – und dies ist für den gegenwärtigen Zusammenhang von zentraler Bedeutung – schließt er seine vermögenstheoretischen Betrachtungen zur boethianischen Methodenlehre mit folgenden Worten:
____________________________________________________________________________________________
47 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 142. 48 Dominicus Gundissalinus, De processione mundi, ed. cit., S. 122. 49 Ibid.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
126
His igitur gradibus ad Deum mens humana contemplando ascendit et ad hominem divina bonitas descendit.50
Neben dieser Stelle findet sich in De processione mundi nur eine einzige Passage, in der mens erneut auftaucht und die nahezu wörtlich die hier angestellten Überlegungen wieder-holt.51 Der Begriff der mens ist damit gleichsam das Vermögen, in das sich ratio, intellectus und intelligentia als Teilvermögen oder -verhalten desselben einreihen. Gegenüber dem Be-griff der Seele (anima) ist mens terminologisch also enger zu verstehen, nämlich als jener Seelenteil, in dem sich die rationalen Verhaltensweisen der Seele befinden. Wie Aristoteles suggeriert Gundissalinus damit eine Einteilung der Seele in irrationale und rationale Seele (mens) und macht mit seiner Identifizierung der Wissenschaft mit dem habitus mentis letz-tere als Verstandesvermögen zum Vermögen der Wissenschaft schlechthin. Behält man diese Herkunft des mens-Begriffs aus dem vermögenstheoretischen Kontext der boethianischen Methodendiskussion im Blick, so wird deutlich, daß Gundissalinus keinesfalls redundant argumentiert: So bestimmt er zunächst die Seele als Ort der Wissenschaft, um sodann in einem zweiten Schritt das spezifische Vermögen derselben auszuzeichnen, das der Wissen-schaft korrespondiert. Damit aber hat er, erneut unter Rekurs auf Boethius und dessen Me-thodenlehre, zwei wesentliche Elemente der aristotelischen habitus-Lehre benannt: den Trä-ger und das Vermögen des Habitus.
Offen bleibt an dieser Stelle allerdings, wie Gundissalinus den Habitus der Wissenschaft selbst in Abgrenzung von anderen (theoretischen) Habitus versteht, die sich auf denselben Träger und dasselbe Vermögen beziehen können. Für Aristoteles ist diese Präzisierung mit der Apodeixis gegeben, die jedoch bei Gundissalinus an dieser Stelle zugunsten der mens weichen muß. Aufschluß hierüber gibt die Reformulierung der Methoden der Wissenschaf-ten, die Gundissalinus in den Kapiteln der Physik, der Mathematik und der Metaphysik aus De divisione unter dem boethianischen didaskaliko,n instrumentum vornimmt. So heißt es zum instrumentum der Physik, dieses sei der „syllogismus dialecticus, qui constat ex veris et probabilibus. Unde Boethius: ‚in naturalibus rationaliter versari oportet‘“.52 Zur Methode der Mathematik heißt es, diese sei die demonstratio, welche „est syllogismus constans ex primis et veris propositionibus“.53 Und bei der Diskussion der Methode der Metaphysik steht zu lesen, diese sei tout court die demonstratio.54 Ganz in der Linie der aristotelischen Bestim-mung der Wissenschaft als Habitus der Apodeixis, d.h. des Beweises oder Syllogismus, wer-den hier von Gundissalinus die drei theoretischen Wissenschaften als auf Beweis bzw. Syllo-gismus gestützte charakterisiert. Formal besitzen damit alle drei dieselbe Methode, nämlich die des wissenschaftlichen Beweises. Material unterscheidet Gundissalinus jedoch ihre Vor-gehensweisen anhand ihrer Prinzipien. Diese werden zumindest in Bezug auf Physik und Mathematik noch einmal nach ihrer Unmittelbarkeit befragt, wobei sich dem Archidiakon ergibt, daß zwar beide Prinzipienreihen, also jene der Physik ebenso wie jene der Mathema-tik, grundsätzlich aus wahren („verus“) Prinzipien hervorgehen müssen, daß diese jedoch im
____________________________________________________________________________________________
50 Ibid. 51 Ibid., S. 218: „Ascendit enim mens humana, et descendit bonitas divina; et ista ascendit contemplatione, illa descendit revelatione.“ 52 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 27. 53 Ibid., S. 32. 54 Ibid., S. 38.
Die Bestimmung der Methoden der Wissenschaften
127
Falle der Physik nur „probabilis“ seien. Mit dieser Ambivalenz der Prinzipien als zugleich wahrer und doch nur wahrscheinlicher scheint gemeint zu sein, daß sie ihre Evidenz als wahre Prinzipien nicht aus sich selbst beziehen, sondern in bestimmter Weise abgeleitete Prinzipien darstellen. Die Mathematik dagegen hat es nach Gundissalinus mit sogenannten Erstprinzipien („primus“) zu tun, die entsprechend keiner Herleitung mehr bedürfen. Die Prinzipien der Metaphysik dagegen werden von Gundissalinus gar nicht beschrieben, viel-mehr wird die Metaphysik als jene Wissenschaft bezeichnet, der die demonstratio, d.h. die Apodeixis, schlechthin eignet. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daß Gundissalinus die Metaphysik, ähnlich wie Aristoteles in dem weiter oben dargelegten Sinn, als unmittelbares Wissen von ihren Prinzipien versteht, ja diese mit dem Wissen um ihre Prinzipien letztlich identisch ist. Mit dieser Beschreibung der formal einen Methode des wissenschaftlichen Beweises und seiner material verschiedenen Arten greift Gundissalinus, wenn auch vermut-lich nicht direkt, so doch in eindeutiger Weise die aristotelischen Überlegungen zur e[xij avpodeiktikh, der Wissenschaften auf. So verfügt der spanische Gelehrte nicht nur über einen Begriff des Trägers des Habitus der Wissenschaft sowie über dessen Vermögen, sondern auch über jenes Kriterium, das den Habitus der Wissenschaft von anderen Habitus abhebt: die Apodeixis.
Besonders interessant ist dabei auch, daß die boethianische Methoden- und Vermögens-lehre aus Abschnitt 2.2.3. hier ausdrücklich mit dem Syllogismus der Physik in Verbindung gebracht wird, wobei Gundissalinus in der Unterscheidung von dialektischem Syllogismus und demonstratio neue, letztlich ebenfalls aristotelische Motive aufgreift, die auch in den Pariser Dialektik-Diskussionen der Zeit eine bedeutende Rolle spielen: „syllogismus dialec-ticus, qui constat ex veris et probabilibus. Unde Boethius: ‚in naturalibus rationaliter versari oportet.‘“55 Nicht nur mit der Rückbindung des mens-Begriffs in die boethianische Methodendiskussion, die Gundissalinus mit Avicenna fortführt, sondern auch im Zusam-menhang mit der habitus-Lehre und ihrem Bezug zum Beweis greift Gundissalinus somit auf Boethius und seine avicennisierende Lektüre desselben zurück. Damit werden die explizit aristotelischen Theoreme nicht nur kontextualisiert, sondern mindestens ebensosehr auch plausibilisiert. Erst im Lichte der Methodendiskussion aus Unterkapitel 2.2.3. entfaltet Gun-dissalinus’ Aufnahme der aristotelischen habitus-Lehre so ihre volle Bedeutung; auch hier bleibt Boethius, selbst wenn Gundissalinus einmal mehr deutlich über ihn hinausgeht, indem er die Apodeixis mit Aristoteles als formale Standardmethode der Wissenschaft wiederent-deckt, ein zentrales Interpretament der neuen Theorieelemente, das Gundissalinus zugleich davor bewahrt, die Methoden der Wissenschaften im Sinne des Primats der Mathematik zu nivellieren – eine Interpretation, für die Aristoteles, wenn auch zu Unrecht, anfällig ist.56
____________________________________________________________________________________________
55 Ibid., S. 27. 56 Bereits Thomas von Aquin warnt vor einer solchen engführenden Interpretation, so u.a. in seiner Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. cit., q. VI, art. 2, resp., S. 217: „[...] peccant qui uniformiter in his tribus speculativae partibus [= naturalis, mathematica, theologia/metaphysica] procedere nituntur.“
3.4. Die aristotelische Axiomatik der Wissenschaften
Die für Gundissalinus allein schon aufgrund der Häufigkeit ihrer Erwähnung mit Abstand wichtigste Lehre der Wissens- und Wissenschaftstheorie des Aristoteles stammt jedoch we-der aus der Physik noch aus der Nikomachischen Ethik – den beiden bisher behandelten Schriften – sondern, wie kaum anders zu erwarten, aus dessen Analytiken. Auf eine erste Bezugnahme des Gundissalinus auf diese Schrift des Aristoteles wurde bereits anläßlich der Behandlung der Frage nach der Materie der Metaphysik in Kapitel 2.1. hingewiesen. So schreibt Gundissalinus im Metaphysik-Kapitel seiner Divisionsschrift zum didaskaliko,n ‚Materie‘ folgendes:
Alii vero materiam huius artis dixerunt esse deum. Qui omnes decepti sunt. Teste enim Aristotele nulla scientia inquirit materiam suam; sed in hac scientia inquiritur an sit deus. Ergo deus non est materia eius.1
Der Gedanke, daß in der Metaphysik Gottes Existenz bewiesen wird, eine Wissenschaft je-doch niemals ihre Materie beweisen kann und Gott folglich nicht Materie der Metaphysik ist, findet sich bereits bei Avicenna formuliert. In diesem Sinne heißt es in seiner von Gundissa-linus übersetzten Prima philosophia aus dem KitÁb aš-šifÁÞ:
Postquam inquiritur in hac scientia [= philosophia prima] an [deus] sit, tunc non potest esse subiectum huius scientiae. Nulla enim scientiarum debet stabilire esse suum subiec-tum.2
Die unleugbare inhaltliche und formale Nähe der gundissalinischen Konzeption zu Avicenna wird noch deutlicher im Arithmetik-Kapitel aus De divisione, wo Gundissalinus erneut unter Zuschreibung zu Aristoteles den Grundsatz aufgreift, daß eine Wissenschaft ihre Materie (bzw. ihr subiectum) nicht aufstellen kann. Vielmehr gilt, daß die Zahl die Materie der Arithmetik abgibt, eben weil sie in dieser nicht bewiesen, sondern zugrunde gelegt wird:
Materia eius [= arithmeticae] est numerus, quia de accidentibus eius tractat. Quamvis enim arithmetica dicatur esse scientia de numero, ipsa tamen non tractat de ipsa essentia numeri. Nullius enim scientiae est stabilire materiam suam, ut ait Aristoteles, sed ipsa assignat proprietates eius et ea quae accidunt ei.3
Die Formulierung der in Anschlag gebrachten Lehre erinnert mit dem „stabilire“ deutlich an Gundissalinus’ zitierte Avicenna-Übersetzung, so daß es zunächst durchaus angemessen erscheint, Gundissalinus’ Kenntnisse des aristotelischen Grundsatzes mit seiner Avicenna-Lektüre in Verbindung zu bringen.
Gleichwohl scheint Gundissalinus’ Aufnahme dieses Grundsatzes sich nicht ausschließ-lich auf Avicenna zurückführen zu lassen. Denn mit keinem Wort erwähnt der persische Philosoph hier die Herkunft seiner Überlegungen von Aristoteles, was Gundissalinus jedoch wiederholt tut. Mehr noch, Gundissalinus zitiert den wissens- und wissenschaftstheoretischen Grundsatz von der Unbeweisbarkeit der Materie einer jeden Wissenschaft noch einmal, im
____________________________________________________________________________________________
1 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 36-37. 2 Avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1977 u. 1980, hier Bd. I, S. 5. 3 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 92.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
130
Logik-Kapitel aus De divisione, und diesmal nicht nur unter Zuschreibung zu Aristoteles, sondern mit einer weiteren aufschlußreichen Präzisierung:
Non est autem thesis materiam huius artis [= logicae], sicut quidam putant. Dicente enim Aristotele in Analyticis nulla scientia probat materiam suam. Sed logica probat omnem thesim.4
Gundissalinus führt den Grundsatz damit nicht nur auf Aristoteles zurück, sondern gibt – anders als im Falle der Physik und der Nikomachischen Ethik aus den beiden vorangegange-nen Kapiteln – hier unmittelbar den Ort dieser Lehre im aristotelischen Opus an: nämlich die Analytica. So wie sich jedoch in der Prima philosophia des Avicenna keine Erwähnung des Aristoteles findet, fehlt in dieser auch der Hinweis auf die Analytiken. Bei aller Nähe zu Avi-cenna scheint Gundissalinus daher doch mit seinem Zitat hinter Avicenna zurück- und damit zugleich über diesen hinauszugehen in Richtung auf eine ursprünglichere Rezeption der Analytica. Dabei ist die Zurückführung des avicennischen Grundsatzes auf Aristoteles bereits eine bedeutende Leistung, insofern nämlich als jener Grundsatz selbst eine Interpretation der aristotelischen Lehre darstellt. Den Hintergrund für Avicenna, auf den auch Gundissalinus anspielt, scheint der Anfang aus den Analytica posteriora I zu bieten, wo es heißt:
Alles vernünftige Lehren und Lernen geschieht aus einer vorangehenden Erkenntnis. [...] Jene vorangehende Erkenntnis (proginw,skein) muß aber auf zweierlei Weise gewonnen werden: denn bei dem einen muß man vorwegnehmen, daß es ist (o[ti e;sti), bei dem ande-ren muß man verstehen, was das durch den Namen Bezeichnete ist (ti, to. lego,meno,n evsti), bei noch anderem muß beides sein.5
Die sich bereits in diesen Anfangssätzen abzeichnende und von Aristoteles im Verlauf seiner Schrift – wie später zu zeigen sein wird – noch weiter präzisierte Wissenschaftskonzeption bildet offensichtlich den Hintergrund für die Zuschreibung des in Frage stehenden Grundsat-zes zu Aristoteles, wie auch der Editor, Ludwig Baur, ausweist.6 Denn was Aristoteles hier als Voraussetzung jeder Erkenntnis und letztlich jeder Wissenschaft fordert, ist gerade die vorgängige, nicht intern zu beweisende Kenntnis, die im Hinblick auf die Ausgangspunkte jeder Wissenschaft und damit gerade auch im Hinblick auf ihr Subjekt oder ihre Materie bestehen muß. Genau dies aber bringt auch Gundissalinus in den zitierten Beispielen mit Aristoteles in Anschlag.
Daß Gundissalinus mit den Analytica posteriora und ihrem Wissenschaftskonzept ver-traut war, geht im übrigen aus einer weiteren Stelle aus dem Werk De immortalitate animae hervor.7 Ganz im Sinne seiner zu Beginn dieses zweiten Teils der Arbeit ausführlich zitierten
____________________________________________________________________________________________
4 Ibid., S. 71. 5 Aristoteles, Philosophische Schriften I, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995, I, 1, 71a 1-13, S. 1. 6 Vgl. seine Anmerkungen zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 36, S. 71 u. S. 92. 7 Auf die Frage der Autorschaft dieses Werkes wurde bereits in einigen Anmerkungen hingewiesen. Unstrit-tig ist, daß es zwei verschiedene Fassungen dieser Schrift gibt, deren ausführlichere Version von Wilhelm von Auvergne stammt. Baudoin C. Allard, „Note sur le De immortalitate animae de Guillaume d’Auvergne“, in: Bulletin de philosophie médiévale 18 (1976), S. 68-72, möchte jedoch auch die erste Fassung Wilhelm zuschreiben. Diese Ansicht wird auch in der jüngeren Literatur zu Wilhelm übernommen. Nach wie vor sind jedoch die Gründe, die Georg Bülow in seiner Edition des Werkes, De immortalitate, ed. cit., S. 84-107, für die Zuschreibung zu Gundissalinus anführt, überzeugend. So ist v.a. darauf zu verweisen, daß die frühere
Die Axiomatik der Wissenschaften
131
programmatischen Ankündigung, die Argumente Platons beiseite zu lassen, um sich statt dessen Aristoteles und seinen Gefolgsleuten anzuschließen,8 schreibt er hier:
Et iam nosti ex doctrina logices, quod syllogismus non est demonstratio, nisi cum fuerit ex propriis. Transcendentia enim et extranea cum aptata fuerint conclusioni, cuius certitudo nobis quaeritur, aptata inquam complexione et ordinatione syllogistica, non facient nobis scientiam demonstrativam.9
Für demonstratives oder apodeiktisches Wissen bzw. für die demonstrative oder apodeikti-sche Wissenschaft, die Gundissalinus hier im Auge hat, ist es nach diesen Sätzen unbedingt erforderlich, daß sie aus den Eigentümlichkeiten („ex propriis“) des Subjekts oder der Mate-rie hervorgehen. Zwar scheint Gundissalinus hier mit „ex doctrina logices“ weniger auf ein bestimmtes Buch, etwa die Analytiken, anzuspielen10 als auf den Logik-Unterricht im allgemeinen, doch ist das genannte Lehrstück, wie auch der Herausgeber der Schrift, Georg Bülow, anmerkt,11 eindeutig auf die Analytica posteriora I rückführbar. So hält Aristoteles in deren siebtem Kapitel fest, daß es nicht angeht „in der Art zu beweisen, daß man von einer Gattung zu einer anderen übergeht (metaba,nta)“.12 Anstelle eines solchen Übergehens bzw. einer solchen Transzendenz, wie Gundissalinus schreibt, gilt für den Beweis vielmehr, daß „die Außen- und Mittelbegriffe [...] derselben Gattung angehören [müssen], weil die Prädi-kate, wenn sie ihren Subjekten nicht an sich zukommen, ihnen zufällig zukommen müs-sen“.13 So läßt sich etwa in der Geometrie, wie Aristoteles weiterhin im siebten Kapitel aus-führt, durch diejenigen Eigenschaften, die nur nebenbei für die Linie zutreffend sind, etwa Schönheit, die aber nicht ihre eigentümlichen Prinzipien sind (evk tw/n avrcw/n tw/n ivdi,wn), kein wissenschaftlicher Schluß ziehen.14 Es muß also für den wissenschaftlichen Schluß, ja für jede Wissenschaft überhaupt evk tw/n avrcw/n tw/n ivdi,wn oder eben, wie Gundissalinus sagt, ex propriis geschlossen werden. Gundissalinus greift damit aus der in Aristoteles’ Analytica posteriora I entworfenen Wissenschaftskonzeption mindestens zwei Elemente heraus: Mit der Unbeweisbarkeit der Materie einer jeden Wissenschaft fordert er eine Kennt-nis des Subjekts der Wissenschaft, mit den jetzt dargestellten Argumenten ex propriis dar-über hinaus auch eine Kenntnis der ausgesagten Eigentümlichkeit.
____________________________________________________________________________________________
Fassung in dem Manuskript Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 16613, die eindeutige Zuschreibung zu Gun-dissalinus trägt und dort auch mit weiteren Schriften desselben Autors zusammensteht. Bülow zufolge ist die Schrift in ihrer ersten Fassung damit dem Gundissalinus zuzuschreiben und wurde dann von Wilhelm überar-beitet. Im übrigen bringt Allard letztlich keine beweiskräftigen Argumente vor, sondern versteht seine kurze Note lediglich als Anfrage; die Wilhelm-Literatur hat hier die Anfrage sogleich in den Stand der Antwort erhoben, ein freilich streitbares Verfahren. Wir gehen daher mit Bülow bis auf weiteres von der Autorschaft des Gundissalinus aus. 8 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit., S. 11-12, sowie weiter oben in dieser Arbeit unter 3.1. 9 Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit., S. 2. 10 Amable Jourdain äußerte aufgrund dieser Formulierung sogar die Vermutung, Gundissalinus selbst habe ein Werk zur Logik geschrieben, doch scheint dies vom Text her nicht gedeckt zu sein. Vgl. Amable Jour-dain, Recherches historiques sur l’âge et l’origine des traductions latines d’Aristote, Paris 1843, S. 113. 11 Vgl. seine Anmerkungen in Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit, S. 109-110. 12 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 7, 75a 38, S. 17. 13 Ibid., I, 7, 75b 10-12, S. 17. 14 Ibid., 17-19, S. 18.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
132
Der Archidiakon nennt damit also zwei entscheidende Momente aus der aristotelischen Wissenschaftstheorie, wie sie in Analytica posteriora I ihren Niederschlag gefunden hat. Und auch wenn er diese nicht exakt zitiert, so ist doch im ersten Fall durch die explizite Zuwei-sung an Aristoteles sowie im zweiten Fall durch die große terminologische Nähe zum Stagi-riten eine eigene Lektüre der Analytiken durch Gundissalinus durchaus anzunehmen. Die arabische und lateinische Tradition der Analytica posteriora Sowohl in der arabischen als auch in der lateinischen Tradition liegen die Analytica poste-riora schon sehr früh in Übersetzungen vor. So gibt es für die graeco-lateinische Tradition Hinweise auf eine frühe, teilweise Übersetzung der Analytica posteriora durch Boethius, die allerdings nicht erhalten ist und die späterhin zu Unrecht mit der ab dem 12. Jahrhundert kursierenden translatio communis in eins gesetzt wurde. Daß diese, auf uns gekommene ‚gemeine‘ Übersetzung jedoch nicht jene des Boethius sein kann, hat Lorenzo Minio-Paluello hinlänglich bewiesen, so wie er auch zeigen konnte, daß sie vielmehr Jakob von Venedig zuzuschreiben ist, der sie in den Jahren 1125-1150 angefertigt haben dürfte.15 Diese Übersetzung wurde ihrerseits nur wenige Jahre später zum Anlaß einer Neuübersetzung aus dem Griechischen, die ein gewisser Johannes veranstaltete. Dieser begründet sein Vorhaben folgendermaßen: „Nam translatio Boethii apud nos non integer invenitur. Translationem vero Iacobi obscuritatis tenebris involvi silentio suo perhibent Franciae magistri.“16 Offensichtlich war in den Augen des unbekannten Johannes die Dunkelheit der jakobschen Übersetzung ein wesentlicher Grund für ihre nur sehr zögerlich einsetzende Rezeption. Immerhin werden beide Übersetzungen bereits zur Mitte des 12. Jahrhunderts in der Francia von Johannes von Salisbury rezipiert.17
Doch scheinen diese graeco-lateinischen Übersetzungen kaum für Gundissalinus’ Auf-nahme des siebten Kapitels aus den Analytica posteriora I in Frage zu kommen (Parallelen zu seiner Aufnahme des ersten Kapitels lassen sich kaum sinnvoll rekonstruieren, da diese Aufnahme ja mehr als ein Zitat eine Rückführung avicennischer Aussagen auf Aristoteles ist). So ist in der translatio communis des Jakob zwar durchaus wie bei Gundissalinus von einem Beweis „ex principiis propriis“ die Rede, doch nicht von der „transcendentia“ und den „extranea“, die Gundissalinus diesen gegenüberstellt. Vielmehr heißt es bei Jakob:
Non ergo est ex alio genere descendentem demonstrare, ut geometricum in arithmetica [...] Neque si aliquid inest lineis non secundum quod lineae sunt et non inquantum ex princi-piis propriis sunt, ut si pulcherrima linearum recta est [...]18
____________________________________________________________________________________________
15 Vgl. Lorenzo Minio-Paluello, „Jacobus Veneticus Graecus. Canonist and Translator of Aristotle“, in: Traditio 8 (1952), S. 265-304, hier S. 281-291, sowie id. in der Einführung zur Edition der Analytica poste-riora-Übersetzungen in Aristoteles latinus IV, 1/4, 2 fasc., Brügge u. Paris 1968, hier fasc. I, S. XVII-XIX. 16 Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Translatio anonyma, ed. Laurentius Minio-Paluello (Aristoteles latinus IV, 2), Brügge u. Paris 1953, S. 1. 17 Vgl. Johannes von Salisbury, Metalogicon, ed. C. C. J. Webb, Oxford 1929, S. 111-112 u. S. 170-172, wo beide Übersetzungen erwähnt werden. 18 Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Translatio Iacobi, ed. Laurentius Minio-Paluello (Aristoteles latinus IV, 1/4), Brügge u. Paris 1968, hier fasc. IV, S. 19-20.
Die Axiomatik der Wissenschaften
133
Statt mit „transcendere“ wird bei Jakob also das griechische metaba,nta mit „descendere“ wiedergegeben, womit Gundissalinus von Jakob abweicht und dabei viel enger mit dem ur-sprünglichen aristotelischen Wortsinn von metaba,nta übereinstimmt. Der Archidiakon über-setzt hier also eindeutig besser als Jakob, dessen „descendere“ den aristotelischen Gedanken eher verzerrend wiedergibt, weshalb kaum von einer Abhängigkeit des Archidiakons von Jakobs Übersetzung ausgegangen werden kann. Im übrigen fehlt auch der gundissalinische Zusatz des „extranea“. In dieser Hinsicht weitaus näher an Gundissalinus’ Diktion ist dage-gen Johannes in seiner Übersetzung. So spricht dieser nicht nur vom Beweis „ex principiis propriis“, wie Gundissalinus und auch Jakob, sondern übersetzt darüber hinaus metaba,nta mit „transeuntem“:
Non ergo est ex alio genere transeuntem monstrare, sicut geometricum arithmetica. [...] Neque si aliquid inest lineis non secundum quod lineae et secundum quod ex principiis propriis, sicut pulcherrimam esse linearum rectam [...]19
Mit „transeuntem“ verbessert Johannes deutlich die jakobsche Übersetzung im Sinne seiner Intention, dessen Dunkelheiten aufzulösen. Ja es scheint ihm hier eine sehr exakte Überset-zung des aristotelischen metaba,nta gelungen zu sein. So wie jedoch Jakobs Übersetzung als Vorlage für Gundissalinus aufgrund ihrer Unterlegenheit dessen Lösung gegenüber aus-scheidet, so muß hier gerade das Gegenteil festgestellt werden. Denn wieso sollte Gundissa-linus diese sehr exakte Übersetzung des griechischen metaba,nta bei Johannes, so dieser seine Vorlage gewesen wäre, gegen die viel unpräzisere und letztlich auch mißverständliche Über-setzung durch „transcendentia“ ausgetauscht haben? Daneben fehlen auch bei Johannes die gundissalinischen „extranea“. Die graeco-lateinische Tradition scheint damit insgesamt nicht als Vorlage für Gundissalinus in Betracht zu kommen, was erneut gegen Mario Grignaschis These von einer rein graeco-lateinischen Aristoteles-Rezeption bei Gundissalinus spricht. Erst später, bei Thomas von Aquin, ergeben sich weitere Berührungspunkte des Gundissali-nus mit der lateinischen Auslegungstradition der Analytica posteriora, wenn ersterer in sei-nem Kommentar zum siebten Kapitel derselben schreibt: „[...] quod demonstratio est ex principiis propriis non extraneis.“20 Damit geht er deutlich über die ihm vorliegende Überset-zung Jakobs hinaus, und zwar interessanterweise in Richtung auf Gundissalinus und dessen „extranea“.
Neben der graeco-lateinischen Tradition ist auch die arabisch-lateinische Tradition der Analytica posteriora kurz zu betrachten, auch wenn diese bereits aus chronologischen Grün-den kaum die Quelle des Gundissalinus gewesen sein kann. So übersetzte Gerhard von Cre-mona erst im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts die Analytica posteriora aus dem Ara-bischen ins Lateinische, also deutlich nach der Abfassung von De divisione. Dabei spricht er jedoch nicht von Beweisen „ex propriis“, sondern fordert terminologisch unschärfer, daß der Ausgangspunkt des Beweises im Hinblick auf die Subjekte „sit proprium eis“. Auch finden sich bei ihm nicht das gundissalinische „transcendere“ bzw. die „extranea“, sondern statt dessen die weit entfernte Formulierung des „permutari“: „[...] impossibile est ut permutetur
____________________________________________________________________________________________
19 Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Translatio anonyma, ed. cit., S. 18. 20 Thomas von Aquin, In libros Posteriorum analyticorum, in: Opera omnia XVIII, Parmae 1865, lib. I, lect. XV, S. 110.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
134
demonstratio ex genere ad genus aliud.“21 Aber auch wenn diese Übersetzung Gerhards kei-nen unmittelbaren Ertrag für die Quellen des Gundissalinus liefert, so ist sie doch ein Beweis dafür, daß im 12. Jahrhundert die Analytica posteriora in Toledo in arabischen Manuskripten vorlagen und gelesen wurden. Daß sie zudem mit einem gewissen Interesse gelesen wurden, mag die Tatsache verdeutlichen, daß Gerhard nicht nur die aristotelische Schrift selbst, son-dern darüber hinaus auch den Kommentar des Themistius zur selben übertrug.22
Auch ist das Toledaner Interesse an dieser Schrift des Aristoteles kaum verwunderlich, wenn man die Rolle bedenkt, die den Analytica posteriora in der arabischen Tradition zu-kam. So hatte bereits IsÎÁq Ibn Íunain vermutlich in Fortführung der Arbeit seines Vaters im 9. Jahrhundert eine syrische Version des Werkes vorgelegt, die dann von AbÙ Bišr MattÁ († ca. 940) ins Arabische übertragen und noch im 10. Jahrhundert durch al-Íasan Ibn SuwÁr verbreitet wurde.23 Zugleich ist AbÙ Bišr MattÁ auch der Übersetzer von Themistius’ Kom-mentar. Neben dieser Übertragungstradition findet sich noch eine zweite, allerdings in den Manuskripten selbst nicht mehr erhaltene, anonyme Übersetzung der Analytica posteriora ins Arabische, die Gerhards Vorlage gewesen sein dürfte. Spuren dieser Übersetzung finden sich noch im Großen Kommentar des Averroes.24 Die Bedeutung dieses Werkes des Aristote-les für die arabische Wissens- und Wissenschaftstheorie kann kaum überschätzt werden; es ist bei al-KindÐ, al-FÁrÁbÐ und Avicenna allenthalben gegenwärtig.25 In Avicennas KitÁb aš-šifÁÞ etwa findet sich mit dem fünften Buch des ersten Teils eine umfangreiche Bearbeitung der Analytica posteriora, auf die auch Gundissalinus zurückgreift, indem er das achte Kapitel desselben übersetzt und unter dem Titel Summa Avicennae – wie im Abschnitt 2.2.5 dieser Arbeit gezeigt – als zentralen Teil in seine Divisionsschrift integriert.
Daß Gundissalinus so häufig und auch ausdrücklich auf die Analytica posteriora rekur-riert, dürfte mithin an der unbestreitbaren Prominenz dieser Schrift innerhalb der arabischen Tradition liegen. Denn sämtliche der vom Archidiakon benutzten und übersetzten Autoren speisen sich aus dieser Schrift, so daß es für Gundissalinus gewiß nahe lag, ihren teils expli-ziten, teils impliziten Bezügen im aristotelischen Opus selbst nachzugehen. Ein deutliches Beispiel hierfür ist gerade die Rückführung des avicennischen Grundsatzes der Unbeweis-barkeit der Materie einer jeden Wissenschaft auf den Anfang von Analytica posteriora I. Diese Rückführung vollzieht Gundissalinus jedoch anscheinend nicht auf der Grundlage der graeco-lateinischen Tradition sowie auch nicht mit Hilfe von Gerhards arabisch-lateinischer ____________________________________________________________________________________________
21 Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Gerardo Cremonensi interprete, ed. Laurentius Minio-Paluello (Aristoteles latinus IV, 3), Brügge u. Paris 1954, S. 18. 22 Gerhards lateinische Übersetzung dieses Werkes ist ediert als Themistius, Commentum super Librum posteriorum, ed. J. Reginald O’Donnell, in: Mediaeval Studies 20 (1958), S. 239-315. – Gundissalinus scheint diesen Kommentar jedoch nicht für seine Überlegungen zu verwenden. 23 Diese Übersetzung ist im arabischen Organon ediert als ArisÔÙÔÁlÐs, KitÁb al-burhÁn, in: ManÔiq ArisÔÙ, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, 3 Bde., Kairo 1948-1952, Bd. II, S. 307-406. 24 Vgl. zu diesen beiden Traditionen die Bemerkungen von Henri Hugonnard-Roche, „Averroès et la tradi-tion des Seconds analytiques“, in: Gerhard Endress u. Jan A. Aertsen (Hrsg.), Averroes and the Aristotelian Tradition, Leiden u.a. 1999, S. 172-187, bes. S. 173-174. 25 Vgl. für einschlägige Belegstellen Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungsliteratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 368-369, sowie zur systematischen Bedeutung der Analytica posteriora bei den Arabern Miklós Maróth, Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden u.a. 1994, hier insbes. das Kapitel „Die Rolle der Analytika deutera in den arabischen Wissenschaften“, S. 73-128.
Die Axiomatik der Wissenschaften
135
Übersetzung, denn diese sind kaum in der Lage, seine Rezeption des siebten Kapitels aus den Analytica posteriora I zu erklären. Vielmehr scheint auch im Falle der Analytica posteriora, die – wie sich an Gerhards Übersetzung derselben erkennen läßt – im 12. Jahrhundert in arabischer Fassung in Toledo bereits zur Verfügung standen, Gundissalinus’ Zugang zu die-ser Schrift eben über die Lektüre des Aristoteles arabus vermittelt zu sein. Die aristotelische Axiomatik im weiteren Sinne Um den Zusammenhang der dargelegten Elemente in ihrer Rezeption bei Gundissalinus an-gemessen beschreiben zu können, ist zunächst ein Blick auf ihre Rolle innerhalb des Wis-senschaftsverständnisses der Analytica posteriora selbst erforderlich, das gemeinhin mit dem Leitbegriff der axiomatischen Methode charakterisiert wird. Diese Klassifizierung ist gewiß eine vereinfachende und z.T. unterkomplexe Darstellung der hier von Aristoteles grundge-legten Wissenschaftskonzeption, so daß insbesondere in den letzten Jahren berechtigte Kritik an der bislang gängigen, sogenannten AFE-Interpretation (axiomatisch-fundamentalistisch-essentialistische Interpretation) der Analytica posteriora geäußert wurde.26 Diese kann hier zwar hier nicht Gegenstand der Untersuchung sein; gleichwohl versucht die folgende Zu-sammenfassung der aristotelischen Konzeption, einige dieser Kritikpunkte zu berücksichti-gen.
Zunächst ist festzustellen, daß der Begriff der Axiome bei Aristoteles in einem differen-zierten Zusammenhang mit weiteren Erstprinzipien auftritt, die ebenfalls das zu Beginn von Analytica posteriora I geforderte Vorwissen in Bezug auf jedes epistemische Wissen betref-fen. Es sind dies die Thesen, die vom Stagiriten ihrerseits in Hypothesen und Definitionen geschieden werden. Aristoteles beschreibt diesen Zusammenhang in Analytica posteriora I, 2, 72a 14-24 als Dreiteilung:
Von den unvermittelten Prinzipien eines Schlusses nenne ich ‚Thesen‘ diejenigen, die man nicht beweisen kann und nicht jeder schon inne zu haben braucht, der irgend etwas lernen will, dagegen nenne ich die Prinzipien, die jeder, der lernen will, inne haben muß, ‚Axiome‘. Von den Thesen sind diejenigen, die einen von den beiden Teilen der Aussage annehmen – ich meine nämlich, daß etwas ist oder daß etwas nicht ist –, ‚Hypothesen‘, diejenigen, die das nicht tun, ‚Definitionen‘. Denn die Definition ist zwar eine Thesis (Setzung) – denn der Arithmetiker setzt, daß Einheit das quantitativ Unteilbare ist –, aber keine Hypothesis. Denn es ist nicht dasselbe, zu sagen, was Einheit ist und daß Einheit ist [...]27
Die Axiome selbst, die für Aristoteles unhintergehbare und damit unbeweisbare Grundlagen des wissenschaftlichen Erkennens bilden, beschränken sich dabei auf ein sehr reduziertes Set von übergreifenden Prinzipien, die für alle wissenschaftlichen Disziplinen Geltung besitzen, wie etwa der uns bereits bei Boethius begegnete Gleichheitssatz28 oder aber der Wider-
____________________________________________________________________________________________
26 Für eine präzise Darstellung und Kritik des AFE-Modells siehe Wolfgang Detel in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Analytica posteriora, 2 Bde., Darmstadt 1993, Bd. I, S. 263-334. 27 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., S. 5. 28 Vgl. ibid., 10, 76a 40-41, S. 21. „[...] zu den allgemeinen Prinzipien [gehört] der Satz, daß Gleiches, von Gleichem abgezogen, Gleiches läßt.“
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
136
spruchssatz und andere logische Sätze.29 Sie sind damit rein formale Prinzipien, die, wie Aristoteles etwas später ausführt, allen Wissenschaften gemeinsam (koina,) sind.30
Anders verhält es sich mit den uns hier v.a. interessierenden Thesen bzw. den unter diese subsumierten Hypothesen und Definitionen, die von Aristoteles als für jede Wissenschaft spezifische (i;dia) verstanden werden.31 So steht die Hypothese im aristotelischen Verständnis für die Existenzannahme des spezifischen Subjekts eines bestimmten Schlusses bzw. für die Materie – wie Gundissalinus sagen würde – einer bestimmten Wissenschaft. Denn jede Wis-senschaft muß von der Existenz des ihr Zugrundeliegenden ausgehen, die selbst nicht mehr durch sie dargetan werden kann. So muß in der Arithmetik die Existenz von Einheiten, in der Geometrie jene von räumlichen Größen, in der Biologie jene von Lebewesen vorausgesetzt werden usw. Darüber hinaus, und dies ist die Aufgabe der Definitionen, muß – gundissali-nisch gesprochen – die spezifische Materie eines jeden Schlusses bzw. einer jeden Wissen-schaft zumindest vorläufig auch in ihrem Was bestimmt sein, um überhaupt sinnvoll voraus-gesetzt werden zu können.
Die in dem angeführten Zitat von Aristoteles zur Kennzeichnung des Vorwissens einge-führten Hypothesen und Definitionen betreffen jedoch nicht nur die spezifische Materie eines jeden wissenschaftlichen Schlusses, sondern auch das, was ihr zugeschrieben werden soll. In diesem Sinne wird in jeder Wissenschaft nicht nur das Daß und das Was ihres Subjekts vor-ausgesetzt, vielmehr gilt daneben auch noch folgendes:
Was demnach sowohl das Erste als auch das aus ihm Abgeleitete bedeutet, nimmt man an. Daß es aber ist (gilt), muß man von den Prinzipien annehmen, von dem anderen aber be-weisen. So z.B., was Einheit oder was das Gerade und das Dreieck (bedeutet). Daß aber die Einheit und (räumliche) Größe ist, muß man annehmen, das andere aber beweisen.32
In Bezug auf das „Erste“ oder das zugrundeliegende Prinzip jeder Wissenschaft, ihre spezi-fische Materie, wird also zweierlei vorausgesetzt, nämlich ihre Existenz und ihre Washeit. So gilt es beispielsweise vom Subjekt der Arithmetik, nämlich der Einheit oder der Zahl, ebenso wie vom Subjekt der Geometrie, also der räumlichen Größe, sowohl ihr Daß als auch ihr Was vorherzukennen. Dies greift die Überlegungen zum jeweiligen Subjekt der Wissen-schaften noch einmal auf. Doch setzt der Stagirite diesem Vorwissen noch ein weiteres Vor-wissen zur Seite: Denn auch mit Rücksicht auf die aus dem Subjekt abgeleiteten Eigen-schaften („das aus ihm Abgeleitete“), d.h. die ihm zuzusprechenden Eigenschaften, in der Arithmetik etwa die Eigenschaften ‚gerade/ungerade‘ usw., ist ein Vorwissen ihrer Washeit zu postulieren. Allerdings ist dies nicht ein Vorwissen ihres Daß. Ja vielmehr gilt, daß ihre Existenzfeststellung letztlich Resultat des Beweises bzw. der Wissenschaft selbst ist.33 Von ____________________________________________________________________________________________
29 Siehe hierzu auch die Darstellung von Otfried Höffe, Aristoteles, München 21999, S. 87-91. 30 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 10, 76a 38, S. 21, sowie I, 76b 14, S. 22, wo ausdrück-lich von den koina. lego,mena avxiw,mata die Rede ist. 31 Der Ausdruck i;dia dient dabei der Abgrenzung der Thesen von den eigentlichen Axiomen, die ja als koina, bezeichnet werden. Vgl. zu dieser Entgegensetzung etwa Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 10, 76a 37-38, S. 21: „Es sind aber von den Prinzipien, die man in den beweisenden Wissenschaften verwen-det, die einen der jeweiligen Wissenschaft eigentümlich (i;dia), die anderen allgemein (koina,).“ 32 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 10, 76a 31-36, S. 20-21. 33 Ich folge hier der Interpretation dieser Stelle durch Albert Zimmermann, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Leiden u. Köln 1965, S. 96, sowie Otfried Höffe, op. cit., S. 87, die unter dem „Abgeleiteten“ die zuzusprechenden Eigenschaften ver-
Die Axiomatik der Wissenschaften
137
den Eigenschaften, die hinsichtlich eines bestimmten Wissenschaftssubjekts prädiziert wer-den sollen, muß also immer dies vorausgesetzt sein, daß ihr jeweiliges Was bekannt ist. Denn nur bei Kenntnis der Washeit des Subjekts und gleichzeitiger Kenntnis der Washeit seiner Eigenschaften ist eine Vermittlung über den terminus medius möglich, die zu der Aussage führt, daß die Eigenschaft in oder am entsprechenden Subjekt existiert bzw. ist. Die Axiome im engeren Sinn gewährleisten dabei allein die formale Richtigkeit des Schlusses. Aristoteles selbst faßt dies noch einmal folgendermaßen zusammen:
Von den Eigenschaften aber, die diesen Objekten an sich zukommen, setzt man voraus, was sie je und je bedeuten, setzt z.B. die Arithmetik voraus, was ungerade oder gerade Zahl ist, Quadrat- oder Kubikzahl, und die Geometrie, was irrational, d.h. inkommensura-bel, gebogen oder konvergierend ist. Daß sie aber sind, beweist man aus den allgemeinen Prinzipien und aus dem schon Bewiesenen.34
Unter Aufnahme und Fortführung des Gedankens, daß die Thesen, d.h. Hypothesen und Definitionen, jeweils spezifische (i;dia) sein sollen, präzisiert Aristoteles zudem, daß auch die zuzusprechenden Eigenschaften, deren Washeit vorausgesetzt werden muß, dem Subjekt des Schlusses bzw. der Wissenschaft eigentümliche sein sollen. Denn es ist „nicht möglich, in der Art zu beweisen, daß man von einer Gattung zu einer anderen übergeht“.35 So gilt:
[Es] ist kein Beweis möglich, wenn den Linien etwas zukommt, nicht sofern sie Linien sind und sofern es aus ihren eigentümlichen Prinzipien folgt (evk tw/n avrcw/n tw/n ivdi,wn), wie etwa, daß die gerade Linie die schönste ist und daß sie sich zur Kreislinie konträr ver-hält.36
Die Eigenschaften, die in jedem Beweis und jeder Wissenschaft vorausgesetzt werden müs-sen, sind also nicht beliebige, sondern vielmehr die Eigentümlichkeiten des jeweiligen Sub-jekts bzw. – in Gundissalinus’ Terminologie – die propria. Als Akzidenzien nämlich, die dem Subjekt nur zufällig zukommen, wäre kein notwendiger Schluß aus ihnen möglich: „Denn die Außen- und Mittelbegriffe müssen derselben Gattung angehören, weil die Prädi-kate, wenn sie ihren Subjekten nicht an sich zukommen, ihnen zufällig zukommen müs-sen.“37 Spezifisch sind die zuzuschreibenden Eigenschaften mithin nicht nur ad extra, inso-fern sie jeweils nur einer Wissenschaft zukommen, vielmehr ergibt sich ihre Spezifität auch und gerade ad intra aus ihrer Gattungszugehörigkeit zum ebenfalls spezifischen Subjekt einer Wissenschaft. Die Lehre von den Thesen, und insbesondere den Eigenschaften, als i;dia ist damit zentral für das aristotelische Wissenschaftsverständnis, denn in ihr gründet letztlich
____________________________________________________________________________________________
stehen. Andere Interpreten, wie Richard McKirahan, Principles and Proofs – Aristotle’s Theory of De-monstrative Science, Princeton 1992, S. 40-41, verstehen „das Abgeleitete“ als sekundäres Subjekt der Wis-senschaft. Der Unterschied scheint jedoch eher terminologischer als sachlicher Natur zu sein, denn auch in McKirahans Interpretation ergibt sich das Daß dieses sekundären Subjekts erst als Ergebnis des Beweises, so wie das Daß der Eigenschaft. 34 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 10, 76b 6-11, S. 21. 35 Ibid., 6, 75a 38-39, S. 17. 36 Ibid., 7, 75b 17-19, S. 18. – Die Interpretation dieser Stelle ist umstritten. Im Kommentar zu seiner Übersetzung Aristoteles, Posterior Analytics, Oxford 1975, S. 129, besteht Jonathan Barnes etwa darauf, daß es sich hier keinesfalls um eine „illustration of kind-crossing“ handeln kann. Doch ist sein Erklärungsversuch nicht plausibler als die hier vertretene Interpretation als kind-crossing. 37 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 7, 75b 10-12, S. 17.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
138
die Differenzierung der einzelnen Wissenschaften bei Aristoteles, der eben keinen planen Reduktionismus allein auf allgemeine Prinzipien vornimmt.
Vielmehr führt die so mit den Begriffen der allgemeinen Axiome im engeren Sinne sowie der spezifischen Hypothesen und Definitionen gewonnene aristotelische Wissenschaftskon-zeption damit zu einem erweiterten Typ von Axiomatik, den Aristoteles in folgender Weise zusammenfaßt:
Denn jede beweisende Wissenschaft hat es mit drei Dingen zu tun, deren Sein sie voraus-setzt. Diese sind die Gattung, deren an sich ihr zukommende Eigenschaften sie betrachtet, die sogenannten allgemeinen Axiome, aus denen als ersten sie beweist, und drittens die Eigenschaften, deren jeweilige Bedeutung sie voraussetzt.38
Oder, um es mit den treffenden, im vorangegangenen bereits angeklungenen Worten Albert Zimmermanns auszudrücken:
[Zum Beweis sind erforderlich:] Eine Kenntnis des Subjekts des Schlußsatzes, eine Kenntnis der ausgesagten Eigentümlichkeit und eine Kenntnis des Prinzips, welches den Beweis ermöglicht, selbst aber unbeweisbar ist.39
Aufs Ganze gesehen kann damit festgestellt werden, daß Gundissalinus mit den von ihm rezipierten Elementen der Unbeweisbarkeit der spezifischen Materie einer Wissenschaft einerseits sowie der Forderung, daß diese ein spezifisches Wissen um die propria voraus-setzt, andererseits zwei in Aristoteles’ Wissenschaftstheorie engstens verknüpfte Theorie-stücke aufgreift: namentlich die Hypothesen und die Definitionen, die ihrerseits das Herz-stück seiner im weiteren Sinne axiomatischen Methode darzustellen scheinen.
Hinsichtlich der berechtigten Kritik an einem allzu deduktiven AFE-Modell ist nämlich festzustellen, daß der im weiteren Sinne axiomatische Charakter der aristotelischen Wissen-schaftstheorie letztlich gar nicht primär von den titelgebenden Axiomen bestimmt ist, son-dern in erster Linie von den Hypothesen und Definitionen geprägt wird, mit denen das Wis-sen um die Existenz und Washeit des zugrundeliegenden spezifischen Subjekts (sowie um die Washeit seiner möglichen Eigenschaften) vorausgesetzt wird. Von axiomatischer Me-thode ist bei Aristoteles daher allein im weiteren Sinne gleichsam metonymisch zu sprechen, insofern nämlich als seine Axiomatik sich eher aus den Voraussetzungen in Form von Exi-stenz-Hypothesen und Wesens-Definitionen als aus dem schmalen Set der Axiome im enge-ren Sinne ergibt. Was nun die Hypothesen und Definitionen anbelangt, so deuten Aristoteles’ eigene Worte in dem zu Beginn dieses Abschnittes zitierten Passus aus Analytica posteriora I, 2, 72a 15-16 darauf hin, daß diese Voraussetzungen nicht axiomatisch-fundamentalistisch in dem Sinne mißzuverstehen sind, daß sie gänzlich selbstevidente und letztbegründende Prinzipien seien, über die der menschliche Geist je schon verfügt und aus denen dann rein deduktiv Wissen(schaft) hervorgeht. Denn anders als die Axiome – für die Aristoteles in der Tat Selbstevidenz und Letztbegründungskraft reklamiert – müssen die spezifischen Thesen, d.h. Hypothesen und Definitionen, nicht immer schon gewußt werden, sondern sind offenbar erwerbbar.40 Dies aber öffnet, wie auch die Kritiker am AFE-Modell geltend machen, die
____________________________________________________________________________________________
38 Ibid., 10, 76b 11-16, S. 21-22. 39 Albert Zimmermann, op. cit., S. 96. 40 Vgl. auch hierzu noch einmal die weiter oben in Kapitel 3.3. diskutierte Stelle aus Aristoteles, Nikomachi-sche Ethik VI, hrsg. u. übers. von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main 1998, 3, 1139b 18-33, S. 30/31.
Die Axiomatik der Wissenschaften
139
aristotelische Axiomatik für die evpagwgh,, d.h. für eine bestimmte Form von Induktion, die Aristoteles am Ende von Analytica posteriora II auch explizit formuliert.41 Ein Blick zurück auf die boethianische Axiomatik und ihre Aufnahme bei Gundissalinus Vor diesem Hintergrund ergeben sich einige erhellende Einblicke in die mit Boethius anhe-bende und von den Autoren der Francia fortgeführte Diskussion zur Axiomatik der Wissen-schaften, an die – wie im Unterkapitel 2.2.4 gezeigt – Gundissalinus zunächst anknüpft. So scheint das AFE-Modell nicht erst eine moderne Auslegung des aristotelischen Wissen-schaftskonzepts darzustellen, sondern ist gerade durch die mittelalterliche Philosophie, ins-besondere Boethius und das 12. Jahrhundert vorgeformt: Bereits hier läßt sich nämlich fest-stellen, daß die jeder Wissenschaft eigenen Thesen des Aristoteles, die letztlich einen nicht strikt axiomatischen Begriff von Vorwissen reklamieren, sondern auch auf induktive Kom-ponenten setzen, zugunsten einer vollständigen Axiomatisierung eingeklammert bzw. aus-gelassen werden. So spricht Boethius in De hebdomadibus zwar noch von „termini regu-laeque“, die er seiner Untersuchung voransetzten will;42 tatsächlich bringt er daraufhin je-doch nur axiomatische Regeln, von denen einige für alle Geltung besitzen, während andere nur den doctores und damit bestimmten Wissenschaften vorbehalten sind. Die „termini“, die an die aristotelischen Definitionen erinnern (ein Terminus ist ein definierter Ausdruck), blei-ben hingegen unberücksichtigt. Damit ergibt sich bereits bei Boethius eine signifikante Ver-schiebung der Axiomatik im weiteren Sinne gegenüber Aristoteles: Denn die spezifischen Grundlagen einer jeden Wissenschaft, die Thesen, werden hier nicht mehr als induktiv moti-vierte Daß- und Was-Aussagen verstanden, sondern der gesamte Bereich der spezifischen Voraussetzungen einer jeden Wissenschaft wird nach dem Modell der allgemeinen Axiome (bei Aristoteles die einzig möglichen Axiome) gedacht, so daß die spezifischen Grundlagen selbst zu Regeln oder Axiomen werden, dann aber in der paradoxen Gestalt allgemeiner nicht-allgemeiner, weil für jede Wissenschaft spezifischer Voraussetzungen. Dies ist gewiß ein über Aristoteles weit hinausgehender Schritt hin auf eine vollständige Axiomatisierung der Wissenschaften, die nicht nur in ihren allgemeinen logischen Grundlagen auf Axiome rekurrieren, sondern eben auch für ihre jeweils spezifischen Ausgangsvoraussetzungen auf Axiome bauen.43 Allerdings führt dieser Versuch einer vollständigen, fundamentalistischen
____________________________________________________________________________________________
41 In diesem Sinne findet sich in Analytica posteriora II, 19, 100b 3-4 die interessante Aussage: „Man sieht also, daß wir die ersten Prinzipien durch Induktion kennen lernen müssen.“ (Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., S. 107) Otfried Höffe, op. cit., S. 92, weist darauf hin, daß unter diesen Prinzipien nicht die Axiome im engeren Sinne, sondern die Hypothesen und Definitionen zu verstehen sind. Ferner gilt es zu beachten, daß der Begriff der Induktion bei Aristoteles noch weiter zu qualifizieren ist, was hier jedoch nicht zum Gegenstand der Untersuchung werden kann (vgl. hierzu erneut zusammenfassend Otfried Höffe, op. cit., S. 91-96). 42 Boethius, Die theologischen Traktate, übers., eingel. u. mit Anm. versehen von Michael Elsässer, Ham-burg 1988, S. 34/35. 43 In besonders radikaler Form findet sich dieser Ansatz im 12. Jahrhundert bei Alanus ab Insulis, der expli-zit davon spricht, daß alle Wissenschaften „proprias habent regulas“. Vgl. Alanus ab Insulis, Regulae cae-lestis iuris, ed. Nikolaus M. Häring, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 48 (1982), S. 97-226, hier S. 121.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
140
Axiomatisierung, wie er im AFE-Modell noch deutlich nachklingt,44 zumindest für die Auto-ren des 12. Jahrhunderts zu den im Abschnitt 2.2.4. behandelten Schwierigkeiten, namentlich der Herleitung der allgemeinen nicht-allgemeinen, weil wissenschaftsspezifischen Axiome. Denn wenn diese nach Art der gänzlich allgemeinen aristotelischen Axiome gedacht werden, kommen sie für eine induktive Herleitung, wie Aristoteles sie für die spezifischen Thesen allem Anschein nach ansetzt, nicht in Frage. Wie im Abschnitt 2.2.4. gezeigt wurde, ist auch für Gundissalinus diese boethianische Form von Axiomatik durchaus maßgeblich, deren Schwierigkeiten er mit der Entwicklung eines an Euklid angelehnten synthetischen Verknüp-fungskonzepts der allgemeinen Axiome zu begegnen versucht. Tatsächlich ist es gut mög-lich, daß auch bei Boethius selbst Euklid den Hintergrund für seine Umdeutung der aristote-lischen Konzeption abgibt.
Zugleich wurde jedoch im Unterkapitel 2.2.4. darauf verwiesen, daß Gundissalinus sich darüber hinausgehend noch einen anderen Ansatz im Rahmen der Axiomatik zu eigen macht, namentlich die Überlegungen zur Induktion von Erstprinzipien („propositiones primae et verae“)45 aus dem von ihm übersetzten pseudo-al-kindÐschen Liber introductorius in artem logicae demonstrationis. So schreibt Pseudo-al-KindÐ folgendermaßen:
Scias autem quod argumentatio in qua non cadit error nec fallacia est illa in cuius compo-sitione et usu servantur conditiones quas praecepit Aristoteles discipulis suis, quae sunt haec: scilicet, ut in omni scientia et disciplina argumentabilia accipias duas intentiones notas, quae sunt prima intelligibilia, scilicet an est et quid est. Haec autem non praecepit Aristoteles nisi cum non est possibile sciri ignotum per ignotum [...]46
„Anitas“, d.h. das Ob- bzw. Daß-Wissen (aristotelisch gesprochen die Hypothese), ebenso wie die „quidditas“, d.h. das Was-Wissen (aristotelisch die Definition),47 sind mithin nach Pseudo-al-KindÐ die ersten Voraussetzungen eines jeden Schlusses und einer jeden Wissen-schaft. Woraufhin er nur wenig später hinzufügt:
Scias enim quod haec nota, quae vocantur prima intellecta, non adquiruntur in animabus intelligentium nisi per inductionem rerum sensibilium.48
Damit betont Pseudo-al-KindÐ unter explizitem Hinweis auf Aristoteles die induktive Kom-ponente des Voraussetzungswissens, das über die „inductio“ aus den „sensibilia“ gewonnen wird. Genau diese Überlegungen greift Gundissalinus in der im Abschnitt 2.2.4. bereits dar-gestellten Weise in seinem Mathematik-Kapitel aus der Divisionsschrift auf. Allerdings mit einer wesentlichen Modifikation, auf die ebenfalls bereits hingewiesen wurde: denn für Pseudo-al-KindÐ sind alle Erstprinzipien auf induktivem Weg durch die sensibilia zu erwer-ben. Gundissalinus hingegen setzt intelligibilia und sensibilia als zwei differente Klassen
____________________________________________________________________________________________
44 Wolfgang Detel, op. cit., Bd. I, S. 266, weist zu Recht darauf hin, daß sich die Grundzüge des AFE-Mo-dells bereits bei Autoren der frühen Neuzeit nachweisen lassen. Wie die vorangehenden und folgenden Überlegungen deutlich machen, kann man die Genese dieses Modells jedoch sogar bis in das frühe Mittelalter zurückverfolgen. 45 Siehe für diesen Begriff Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 32. 46 Pseudo-al-KindÐ, Liber introductorius in artem logicae demonstrationis, ed. Albino Nagy, in: BGPhMA II, 5, Münster 1897, S. 50. 47 Beide Ausdrücke kommen auch in substantivierter Form in Pseudo-al-KindÐs Liber introductorius vor; siehe ibid., S. 53. 48 Ibid., S. 52.
Die Axiomatik der Wissenschaften
141
von Erstprinzipien („propositiones primae“) an, deren erste rein axiomatisch im Sinne selbst-evidenter Prinzipien des Geistes verstanden wird, wohingegen die zweite im Anschluß an den Liber introductorius als induktiv gewonnen betrachtet wird. Bereits in der Interpretation der boethianischen Axiomatik nimmt Gundissalinus somit zwei entscheidende Korrekturen seiner beiden Vorbilder Boethius und Pseudo-al-KindÐ ganz im Sinne der genuin aristoteli-schen Konzeption vor: Zum einen ergänzt er den Ansatz der boethianischen Axiomatik mit Hilfe der induktiven Komponente aus Pseudo-al-KindÐ, zum anderen jedoch begradigt er den zu starken Induktionsbegriff des Pseudo-al-KindÐ, der sich auf sämtliche Erstprinzipien, also auch die allgemeinen aristotelischen Axiome zu beziehen scheint, gerade mit Hilfe der boethianischen Konzeption der Axiome als unableitbarer. Damit findet er einen überzeugen-den Mittelweg zwischen reiner Deduktion und reiner Induktion, der sich eng an Aristoteles’ Analytica posteriora hält.
Während die allgemeinen Axiome im Anschluß an die Boethius-Diskussion im Mathe-matik-Kapitel näher bestimmt werden können, bleibt in demselben jedoch noch dunkel, wie die induktiv gewonnenen Erstprinzipien im Hinblick auf ihre wissens- und wissenschaftsbe-gründende Funktion genauer zu verstehen sind. Gundissalinus und die Wiederentdeckung der aristotelischen Axiomatik im weiteren Sinne Mit der im vorliegenden Kapitel dieser Arbeit behandelten Aufnahme der Unbeweisbarkeit der Materie einer jeden Wissenschaft in Bezug auf dieselbe sowie der Kenntnis der von die-ser Materie ausgesagten Eigentümlichkeiten eröffnet sich nun jedoch eine mögliche Per-spektive für die genauere Bestimmung der induktiv gewonnenen Erstprinzipien. Denn auch wenn Gundissalinus diesen Transfer nicht explizit vollzieht, so scheinen sich die von ihm aus den Analytica posteriora I rezipierten aristotelischen Hypothesen und Definitionen hinsicht-lich der Materie und der Eigentümlichkeiten einer jeden Wissenschaft systematisch genau an die induktiv gewonnenen Erstprinzipien des Pseudo-al-KindÐ anschließen zu lassen.49
Zunächst gilt es hier jedoch, vor dem Hintergrund der Darlegungen zu den aristotelischen Hypothesen und Definitionen die eingangs zitierten Passagen zur Bestimmung des didaskaliko,n materia zumindest in Teilen schärfer in den Blick zu bekommen. So lautete die Bestimmung zur Materie der Metaphysik:
Alii vero materiam huius artis dixerunt esse deum. Qui omnes decepti sunt. Teste enim Aristotele nulla scientia inquirit materiam suam; sed in hac scientia inquiritur an sit deus. Ergo deus non est materia eius.50
Weil die Existenz Gottes also in der Metaphysik nicht vorausgesetzt wird, es aber zum Sub-jekt einer Wissenschaft gehört, zu deren Voraussetzungswissen zu zählen, kann Gott nicht das Subjekt der Metaphysik sein.51 Vielmehr gilt nach Gundissalinus von diesem: ____________________________________________________________________________________________
49 Unstrittig ist bei Gundissalinus, daß die Materie einer jeden Wissenschaften terminologisch als ‚Erstprin-zip‘ derselben zu fassen ist: „Sed materia est unum de principiis eius, quare nulla ars probat materiam suam.“ (Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 71) 50 Ibid., S. 36-37. 51 Es ist durchaus interessant, daß Gundissalinus hier verschiedene Positionen zur Frage nach dem Subjekt der Metaphysik referiert. Jene, die Gott zum Subjekt der Metaphysik macht, erinnert klar an Averroes, einen
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
142
Ideo necessario materia huius scientiae est id quod communius et evidentius omnibus est, scilicet ens, quod siquidem non oportet quaeri an sit, vel quid sit [...]52
Damit präzisiert Gundissalinus deutlich, daß er in Übereinstimmung mit Aristoteles’ Analy-tica posteriora I unter dem Voraussetzungswissen in Bezug auf das Subjekt einer Wissen-schaft Existenz-Hypothesen („an sit“) und Was-Definitionen („quod sit“) versteht. Dabei stellt die Metaphysik jedoch insoweit einen Sonderfall dar, als ihre Voraussetzungen nicht nur in ihr selbst unbeweisbar sein müssen, sondern auch durch andere Wissenschaften nicht bewiesen werden können, da die Metaphysik die höchste Wissenschaft ist. Dies impliziert zugleich die interessante (ebenfalls aristotelische) Folgerung, daß für Gundissalinus die Erst-prinzipien anderer Wissenschaften nicht nur durch unmittelbare Induktion erwerbbar sind, wie es in seinen im Anschluß an Pseudo-al-KindÐ angestellten Überlegungen scheinen könnte, sondern eben auch durch die Resultate anderer Wissenschaften.
Einen weiteren wichtigen Aspekt zur Präzisierung der gundissalinischen Position liefert die genauere Lektüre seiner Materie-Bestimmung für die Arithmetik:
Materia eius [= arithmeticae] est numerus, quia de accidentibus eius tractat. Quamvis enim arithmetica dicatur esse scientia de numero, ipsa tamen non tractat de ipsa essentia numeri. Nullius enim scientiae est stabilire materiam suam, ut ait Aristoteles, sed ipsa assignat proprietates eius et ea quae accidunt ei.53
Das Voraussetzungswissen der Arithmetik wird hier mit dem schillernden Begriff der „es-sentia“ bestimmt, der sich gleichermaßen auf die Existenz und die Washeit des Subjekts ‚Zahl‘ und damit auf Hypothese und Definition beziehen läßt. Entscheidend ist in diesem Zitat nicht nur, daß Gundissalinus hier die aristotelische Bestimmung des Subjekts der Arithmetik als Zahl aus den Analytica posteriora I aufgreift,54 sondern zudem die „proprieta-tes“ ins Spiel bringt. Der wissenschaftliche Schluß besteht demnach – so wie weiter oben für Aristoteles dargetan wurde – darin, daß einem in seiner Existenz und Washeit vorausgesetz-ten Wissenschaftssubjekt Prädikate zugesprochen werden, die ihrerseits den Status von „pro-prietates“ oder (gattungsmäßig) Zu-fallendem („ea quae accidunt“) haben. Wie auch Aristo-teles, nennt Gundissalinus hierfür folgendes Beispiel: „Prima est consideratio de hiis, quae accidunt numero ex sua essentia sicut hoc, quod alius est par, alius est impar et similia.“55
____________________________________________________________________________________________
Zeitgenossen des Gundissalinus. Gegen Avicenna ist für ihn die Existenz der abgetrennten Substanzen, das sind Gott und die Engel, nicht das Beweisziel der Metaphysik, sondern vielmehr ihr vorausgesetztes Subjekt: „Qui dicit, quod prima philosophia nititur declarare entia separabilia esse, peccat. Haec enim entia sunt subiecta primae philosophiae.“ (Averroes, Aristotelis De physico auditu libri octo cum Averrois Cordubensis variis in eosdem commentariis, Venetiis 1562, Ndr. Frankfurt am Main 1962 [Bd. IV], fol. 47va) – Wie später Thomas von Aquin, so schließt sich jedoch auch Gundissalinus der avicennisch-aristotelischen Ge-genposition an. 52 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 37. 53 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 92. 54 Aristoteles definiert das Subjekt der Mathematik genauerhin als Einheit, d.h. aber nichts anderes als Zahl: „[...] der Arithmetiker setzt, daß Einheit das quantitativ Unteilbare ist [...]“ (Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 2, 72a 21-22, S. 5) 55 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 92. – Bei Aristoteles hieß es, wie auch weiter oben schon angeführt: „Von den Eigenschaften aber, die diesen Objekten an sich zukommen, setzt man voraus, was sie je und je bedeuten, setzt z.B. die Arithmetik voraus, was ungerade oder gerade Zahl ist [...]“ (Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 10, 76b 6-8, S. 21)
Die Axiomatik der Wissenschaften
143
Damit ist implizit auch die aristotelische Forderung nach dem Voraussetzungswissen hin-sichtlich der Definition der Prädikate gegeben, die als propria zunächst in ihrer Washeit erkannt werden müssen. Allerdings wird diese Überlegung von Gundissalinus in De divisio-ne nicht weiter ausgeführt.
Dagegen erscheint sie in der zu Beginn erwähnten Schrift De immortalitate animae, wo sie unter dem Vorzeichen der Gültigkeit von Schlüssen behandelt wird. So lehnt Gundissali-nus in dieser Schrift die über die Gerechtigkeit Gottes argumentierenden Positionen zur Un-sterblichkeit der Seele ab und fordert dagegen, daß diese „ex propriis“ zu entwickeln seien. Den Schlüssel für seine darauf folgende Argumentation liefern ihm hierbei die „operationes propriae“ der Vernunftseele in ihrer Unzeitlichkeit, die ihm Rückschlüsse auf die Substanz derselben erlauben. Wichtiger als die Durchführung der Argumentation im einzelnen ist hierin jedoch, daß Gundissalinus als Prämissen eines Schlusses, hier mit dem Beweisziel der Unsterblichkeit der Seele, gut aristotelisch nur jene Prädikate zulassen will, die zuvor in ihrer Washeit als dem Subjekt (gattungsmäßig) eigentümlich erkannt wurden.56 Bemerkenswert ist dabei, daß diese Prädikate und die Bestimmung ihrer Washeit von Gundissalinus, wie auch schon der Herausgeber der Schrift, Georg Bülow, bemerkte, größtenteils induktiv durch Er-fahrungswissen gewonnen werden.57 So ist der Traktat De immortalitate animae ein hervorragendes Beispiel früher empirischer Physiologie und Psychologie. Damit erfüllt Gun-dissalinus nicht nur eine wichtige Forderung des Aristoteles hinsichtlich des vorausgesetzten Definitionswissens bezüglich der Prädikate aus den Analytica posteriora, vielmehr demon-striert er zugleich, ebenfalls im Sinne des Aristoteles, auf den er sich ja zu Beginn der Schrift auch mit Nachdruck beruft,58 wie dieses Voraussetzungswissen erworben werden kann – eine Diskussion, die nach Gundissalinus auch Thomas von Aquin im Anschluß an Aristoteles führen wird.59
Gundissalinus geht mit seiner Aufnahme der aristotelischen Hypothesen und Definitionen mithin deutlich über Boethius’ verengtes, weil zu strenges Konzept von Axiomatik hinaus, indem er, wie sich auch schon mit seiner Rezeption von Pseudo-al-KindÐ abzeichnete, dem streng axiomatischen Wissen ein weiteres Voraussetzungswissen zur Seite stellt. Die Ver-bindung zwischen der induktiven Komponente im Anschluß an Pseudo-al-KindÐ und diesem Voraussetzungswissen thematisiert er zwar nicht reflexiv, doch ist sie der Sache nach vor-handen. So verrät die Argumentationsweise von De immortalitate, wie soeben festgestellt wurde, einen stark naturwissenschaftlichen Aspekt von Induktion, der zum Aufweis der De-finitionen der jeweiligen Eigentümlichkeiten der Seele herangezogen wird. Neben die bei Boethius leitende avpo,deixij tritt so die aristotelische evpagwgh, als Bestandteil der axiomati-schen Methode im weiteren Sinne. Trotz dieser Innovationen bleibt der Anicier allerdings
____________________________________________________________________________________________
56 Dieser wissens- und wissenschaftstheoretische Gedanke des Gundissalinus ist im 12. Jahrhundert alles andere als selbstverständlich. Entsprechend groß sollte seine Nachwirkung sein, die J. A. Endres von Johan-nes von Rupella bis hin zu Albertus Magnus verfolgt. Vgl. J. A. Endres, „Die Nachwirkung von Gundissali-nus’ De immortalitate animae“, in: Philosophisches Jahrbuch 12 (1899), S. 382-392. 57 Siehe dazu seine Bemerkungen in Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit., z.B. S. 142. 58 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit., S. 11-12, sowie weiter oben in dieser Arbeit unter 3.1. 59 Vgl. hierzu Thomas von Aquin, In libros Posteriorum analyticorum, ed. cit., lib. II, lect. XX, S. 222-225, wo sich der Aquinate den aristotelischen Induktionsbegriff zu eigen macht.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
144
interessanterweise weiterhin bestimmend für Gundissalinus’ Interpretation auch dieser neuen Form von Axiomatik, was sich besonders im Fall der Materie einer jeden Wissenschaft nachweisen läßt. So ist die Behandlung der Hypothesen und Definitionen unter dem didaskaliko,n materia, das, wie im Unterkapitel 2.2.5. gezeigt, auf Boethius zurückgeht, ein deutlicher Indikator dafür, daß hier wiederum die aristotelischen Konzepte in einen boethia-nischen Rahmen eingearbeitet werden. Zugleich unterstreicht dies noch einmal die wissens- und wissenschaftstheoretische Stoßrichtung, die Gundissalinus den didaskalika, in Abhe-bung von den Chartreser Autoren gibt.
In ihrer Gesamtheit erschließt Gundissalinus’ Position zur Unbeweisbarkeit der jeweili-gen Materie einer Wissenschaft und ihren eigentümlichen Prädikaten damit ein Konzept von Axiomatik, das deutlich über die mit Boethius initiierte, über das 12. Jahrhundert bis zum gegenwärtigen AFE-Modell reichende Engführung hinausgeht. So öffnet Gundissalinus die Axiomatik durch eine pädagogisch-induktive Komponente, die er mit Pseudo-al-KindÐ be-reits in der Auseinandersetzung um Boethius entwickelt hat, auch für andere Formen des Voraussetzungswissens, namentlich für das Daß- und Was-Wissen, und integriert mit diesen in die tradierte Axiomatik zwei wesentliche Momente aus den Analytica posteriora. Wie weit diese Leistungen auf eine direkte Lektüre derselben zurückgehen, kann dabei nicht ein-deutig ermittelt werden, zumal die Analytica posteriora in der arabischen Literatur allge-genwärtig sind, so etwa bei den erwähnten Autoren (Pseudo-)al-KindÐ, al-FÁrÁbÐ und Avi-cenna. Die Tatsache jedoch, daß Gundissalinus zumindest teilweise über diese Autoren hinausgeht, wie zu Beginn gezeigt, deutet auf eine eigene Lektüre der Analytica posteriora hin, deren Resultate sich dann allerdings wahrscheinlich mit den von Gundissalinus rezi-pierten arabischen Autoren vermischen. Aber auch wenn die Quellenlage nicht eindeutig ist, so wird doch als unzweifelhaft gelten können, daß Gundissalinus den ursprünglichen und weiteren Sinn der aristotelischen Axiomatik aus den Analytica posteriora für die lateinische Philosophie mit seinen Reflexionen zumindest teilweise wiederentdeckt. Gleichzeitig darf bei aller innovativen Kraft des Gundissalinus nicht übersehen werden, daß auch die Abwen-dung von der boethianischen Axiomatik keine völlige Abkehr vom Anicier darstellt. So kon-serviert der Archidiakon den Begriff der allgemeinen Axiome des Boethius, und auch in Bezug auf die Hypothesen und Thesen gilt es zu beachten, daß diese über die boethianischen didaskalika, vermittelt bleiben.
3.5. Die aristotelische Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
Wie bereits bei der Behandlung der boethianischen didaskalika, im Abschnitt 2.2.5. festge-stellt wurde, ergeben sich auch im Anschluß an diese interessante Verbindungen, aber auch Unterschiede zwischen Gundissalinus und Aristoteles. Diese betreffen sowohl die Subordi-nationstheorie der Wissenschaften (species) als auch die Binnendifferenzierung einer jeden Wissenschaft (partes), die Gundissalinus den Rahmen für eine explizite Aufnahme der ari-stotelischen Werke bzw. ihrer Titel liefert. Diese beiden Themenkomplexe sollen im fol-genden in zwei geschlossenen Blöcken unter a) und b) nacheinander diskutiert werden. a) Die Subordinationstheorie der Wissenschaften
Zunächst zur Subordinationstheorie, die Gundissalinus, wie im Abschnitt 2.2.5. gezeigt, im Anschluß an Avicenna entwickelt. Bereits die Tatsache, daß Avicenna seine Reflexionen hierzu im ersten Teil seiner Enzyklopädie KitÁb aš-šifÁÞ in genau jenem Buch, das den Ana-lytica posteriora entspricht, vorlegt, deutet klar auf Aristoteles als seine Inspirationsquelle hin. So wird die Subordinationstheorie der Wissenschaften von Aristoteles tatsächlich in den Analytica posteriora an verschiedenen Stellen behandelt; als locus classicus derselben gilt dabei im allgemeinen das dreizehnte Kapitel des ersten Buches. Um nun Gundissalinus’ Position zur Subordination angemessen würdigen zu können, gilt es daher im folgenden, die Subordinationstheorie in ihrem Ursprungskontext der Analytica posteriora aufzusuchen und vorzustellen. Die Subordinationstheorie in den Analytica posteriora Vor einer Untersuchung der Stellungnahmen des Aristoteles in dem zentralen dreizehnten Kapitel aus Analytica posteriora I ist dabei zuerst auf den größeren Zusammenhang zu ver-weisen, in dem der Stagirite seine Subordinationstheorie ursprünglich situiert, nämlich die im vorangegangenen Kapitel dieser Arbeit erörterte Frage nach der je eigenen Materie und den je eigenen Prädikaten einer jeden Wissenschaft. Die Frage nach den subordinierten Wissen-schaften steht bei Aristoteles so von Anfang an im Spannungsfeld zweier Pole: Zum einen sollen die Materien und Prädikate jeder Wissenschaft eigentümliche sein und zu einer einzi-gen und gleichsam exklusiven Gattung gehören, zum anderen ist aber gerade für die überge-ordneten und subordinierten Wissenschaften zu beobachten, daß bei diesen die Beweise von einer Wissenschaft in die andere übergehen können (müssen), so wie etwa die Optik zum Teil geometrische Beweise benutzt. Nimmt man nun aber an, daß beide Wissenschaften – über- und untergeordnete – ihre Materien und Prädikate aus verschiedenen Gattungen bezie-hen und dennoch ihre Beweise ineinandergreifen, so liegt genau jener von Aristoteles – wie im letzten Kapitel dargestellt – kategorisch abgelehnte Fall der meta,basij vor, also der Über-
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
146
gang des Beweises aus einer Gattung in eine andere.1 Es ist mithin in diesem Zusammenhang für Aristoteles erforderlich, die Frage nach der Identität der zugrundeliegenden Gattungen, in welche die jeweiligen Materien und Prädikate der über- und untergeordneten Wissenschaft fallen, zu stellen. In einer frühen Überlegung aus dem siebten Kapitel der Analytica poste-riora I heißt es dazu:
So muß denn die Gattung entweder schlechthin (a`plw/j) oder, wenn der Beweis in eine an-dere Gattung übergehen soll, doch in gewisser Beziehung (h' ph/|) dieselbe sein.2
Damit wird eine interessante Differenzierung im Hinblick auf die Identität der Materie- und Prädikatsgattungen vorgenommen. So ist es hier für Aristoteles durchaus denkbar, daß zwei Wissenschaften dieselbe Gattung teilen und trotzdem distinkt sind, sofern die jeweilige Ma-terie und die jeweiligen Prädikate der einen Gattung nämlich in verschiedenen Hinsichten betrachtet werden. Damit wird die Identität der zugrundeliegenden Gattungen von Aristoteles in einer Weise qualifiziert, die ihm die Möglichkeit eröffnet, zwischen unter- und übergeord-neten Wissenschaften zu unterscheiden, ohne darum von Anfang an unter dem Vorwurf der meta,basij zu stehen.
Doch ist diese erste Stellungnahme des Aristoteles nur unter Vorbehalt zu lesen. Denn im folgenden geht der Stagirite selbst einerseits hinter seine hier vertretene Position zurück, andererseits erarbeitet er sich mit den Begriffen des Warum- und Daß-Wissens eine schein-bar andere Lösungsperspektive für die Frage der Subordination. So heißt es im neunten Ka-pitel in Bezug auf die Unterordnung der Harmonik unter die Arithmetik hinsichtlich der Gattungsfrage plötzlich:
Das Daß (o[ti) fällt unter eine andere Wissenschaft – denn die zugrundeliegende Gattung ist eine andere – das Warum (dio,ti) aber fällt unter die höhere Wissenschaft, zu deren Zu-ständigkeit die fraglichen Bestimmungen an sich (kaqV au`ta,) gehören. Man sieht also auch hieraus, daß sich etwas schlechthin nur aus seinen jeweiligen eigentümlichen Prinzipien beweisen läßt.3
Während das vorangegangene Zitat die Gattungsfrage zwischen den beiden Polen der je eigenen Gattung und der geteilten Gattung durch eine qualifizierte Identität der Gattungen gleichsam zu schlichten versucht, bezieht Aristoteles mit dieser Stelle entschieden Position für eine strikte Trennung der Gattungen (die dann allerdings das Problem der meta,basij er-neut virulent werden läßt, wenn die Beweise der übergeordneten Wissenschaft weiterhin auch in der untergeordneten Wissenschaft Anwendung finden sollen). Immerhin tauchen mit dem Begriff des „an sich“ (in der lateinischen Übersetzung bei Gerhard von Cremona ab-solute)4 noch Anklänge an die zuvor gemachte Differenzierung auf. Gleichwohl kann dies nicht über den Widerspruch zwischen den beiden Stellen hinwegtäuschen, den auch Richard McKirahan vermerkt.5 ____________________________________________________________________________________________
1 Vgl. hierzu die Ausführungen des letzten Kapitels sowie die entsprechende Passage der Analytica poste-riora in Aristoteles, Philosophische Schriften I, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995, I, 7, 75a 38, S. 17. 2 Ibid., 75b 8-9, S. 17. 3 Ibid., 9, 76a 11-15, S. 19-20. 4 Vgl. Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Gerardo Cremonensi interprete, ed. Laurentius Minio-Paluello (Aristoteles latinus IV, 3), Brügge u. Paris 1954, S. 21. 5 Vgl. hierzu Richard McKirahan, Principles and Proofs – Aristotle’s Theory of Demonstrative Science, Princeton 1992, S. 65.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
147
Überhaupt scheint es, daß Aristoteles mit dem letzten Zitat gar nicht um Konsistenz mit seiner früheren Äußerung bemüht ist, vielmehr will er hier in erster Linie einen neuen Ge-danken zur Klärung der Subordination einführen, nämlich das Begriffspaar o[ti/dio,ti, das sodann für ihn und auch für seine späteren Interpreten zum dominierenden Argument für die Subordinationsfrage wird, wie die zentrale Diskussion des dreizehnten Kapitels der Analytica posteriora I dokumentiert. Hier steht der bereits angekündigte locus classicus der traditio-nellen Subordinationstheorie des Aristoteles zu lesen, der folgendermaßen lautet:
In anderer Weise ist das Daß (o[ti) und das Warum (dio,ti) darin unterschieden, daß man jedes von beiden durch eine andere Wissenschaft erforscht. Von dieser Art sind die Wis-senschaften, die zu anderen in dem Verhältnis der Unterordnung stehen (qa,teron u`po. qa,teron), wie die Optik zur Geometrie, die Mechanik zur Stereometrie, die Harmonik zur Arithmetik und die Lehre der Erscheinungen am sublunarischen Himmel zur Astronomie. [...] So heißt Astronomie sowohl die nautische wie die mathematische Astronomie und Harmonik sowohl die mathematische wie die auf dem bloßen Gehör beruhende Harmonik. Hier nämlich ist es die Sache des Wahrnehmenden das Daß und Sache der Mathematiker das Warum zu wissen. Denn diese besitzen die Beweise aus den Gründen und wissen oft das Daß nicht. [...] Wie sich aber die Optik zur Geometrie verhält, so verhält sich eine an-dere Wissenschaft, etwa die des Regenbogens, auch zur Optik. Denn in ihr ist das Wissen des Daß Sache des Physikers, das des Warum Sache des Optikers [...]6
Demnach ist eine übergeordnete Wissenschaft für Aristoteles dadurch ausgezeichnet, daß sie in der Lage ist, das Warum eines Sachverhaltes anzugeben, der zwar auch in einer anderen Wissenschaft behandelt wird, von dem dort jedoch nur sein Daß bekannt ist. Dies scheint für Aristoteles nun das zentrale Unterscheidungskriterium zu sein, das die vorangegangenen Überlegungen, wenn auch vielleicht nicht aufheben, so doch überholen will.
Für eine angemessene Aristoteles-Interpretation stellt sich damit die Frage, wie diese Unterscheidung überhaupt noch mit den Ausgangsüberlegungen zur (durch die jeweilige Hinsicht) qualifizierten Identität der jeweiligen Materie- und Prädikatsgattung aus Kapitel 7 zusammenpaßt. In diesem Zusammenhang hat nun Richard McKirahan7 vorgeschlagen, in den Analytica posteriora mindestens zwei Typen von Subordination zu unterscheiden, die sich an dem von Aristoteles im dreizehnten Kapitel eingeführten Subordinationstripel: Arithmetik, mathematische Harmonik und akustische, d.h. rein auf Gehör beruhende Har-monik, orientieren. Das Verhältnis von Arithmetik und mathematischer Harmonik – die Sub-ordination im eigentlichen Sinne – sieht McKirahan adäquat über die jeweilige Hinsicht auf dieselbe Materie- und Prädikatsgattung beschrieben – also genau so, wie Aristoteles es im siebten Kapitel tut. Das 13. Kapitel hingegen bezieht sich mit seiner Unterscheidung des Daß- und Warum-Wissens nach McKirahan auf das Verhältnis von mathematischer Harmo-nik zu rein auf Gehör beruhender akustischer Harmonik. So weiß der Musiker etwa, daß diese oder jene Tonfolge diese oder jene Wirkung ergibt, aber er weiß mitunter nicht, warum dies so ist. Im Lichte dieser sehr erhellenden differenzierten Lesart gilt aber, daß „Posterior Analytics I, 13 can be read as precisely that – additional points which Aristotle might have
____________________________________________________________________________________________
6 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 13, 78b 34 - 79a 12, S. 30-31. 7 Vgl. die bislang ausführlichste Untersuchung zur Subordinationstheorie bei Aristoteles von Richard McKirahan, „Aristotle’s Subordinate Sciences“, in: The British Journal for the History of Science 11 (1978), S. 197-220, hier bes. S. 211-217.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
148
preferred to abandon than to see used as levers to pry the notion of subalternation away from the primary application he had in mind“.8 Genau diese letztgenannte, ‚unliebsame‘ Wende sollte jedoch die Interpretation der Subordinationstheorie nehmen: So wird Aristoteles’ Sub-ordinationstheorie gemeinhin in der Unterscheidung von Daß- und Warum-Wissen gesehen9 – und tatsächlich scheint dies nicht erst ein Zug der Aristoteles-Interpreten zu sein, sondern an der aristotelischen Position selbst zu liegen, die die von McKirahan zu Recht eingefor-derten Unterscheidungen in dieser Weise nicht vornimmt. Gundissalinus’ Subordination zwischen Avicenna und Thomas Vor dem Hintergrund der vorausgehenden Darstellung der Position aus Analytica posteriora I ist in Bezug auf Avicenna und Gundissalinus festzustellen, daß diese nur den ersten Teil der aristotelischen Überlegungen mitgehen, nämlich die Überlegung aus dem siebten Kapitel von Analytica posteriora I bezüglich der Unterscheidung einer schlechthinnigen und einer (durch die jeweilige Hinsicht) qualifizierten Identität der Materie- und Prädikatsgattung. Hier hieß es bei Aristoteles, um die Stelle noch einmal vor Augen zu führen:
So muß denn die Gattung entweder schlechthin (a`plw/j) oder, wenn der Beweis in eine an-dere Gattung übergehen soll, doch in gewisser Beziehung (h' ph/|) dieselbe sein.10
Richard McKirahan erläutert diesen Passus bei Aristoteles folgendermaßen: Another way of expressing this connexion is to say that the subordinate science takes its subject over from the superior science, but adds a further element to it. The optician stu-dies lines in sight, the musician numbers in sound [...] Geometrical premisses hold for li-nes, angels, etc. qua lines, angels, etc.11
Während also die schlechthinnige Betrachtung der Linien und all dessen, was ihnen als sol-chen zukommt, Gegenstand der Geometrie ist, obliegt es der ihr subordinierten Optik, von demselben Gegenstand und dem ihm Zukommenden unter bestimmter Hinsicht zu handeln. In ganz ähnlicher Weise aber ergab sich im Unterkapitel 2.2.5. im Hinblick auf die Subordi-nationstheorie des Gundissalinus und des Avicenna in De divisione philosophiae, daß diese die Möglichkeit annehmen, daß zwei Wissenschaften denselben Gegenstand einer Subjekt-gattung teilen, sich dabei jedoch in ihrer Hinsicht auf diesen dergestalt unterscheiden, daß die eine den jeweiligen Gegenstand und seine Akzidenzien absolut, die andere hingegen relativ betrachtet. So war es hier z.B. Sache eines bestimmten Teils der Physik, den menschlichen Körper – als Teil oder Unterart der Subjektgattung der Physik (‚beweglicher Körper‘) – „ab-solute“, d.h. als solchen zu betrachten, während es Gegenstand der der Physik als species untergeordneten Medizin war, denselben menschlichen Körper unter bestimmter Rücksicht („secundum quod“) zu betrachten. Diese konzeptuellen Übereinstimmungen zwischen Ari-stoteles einerseits und Gundissalinus und Avicenna andererseits treten noch deutlicher zu-
____________________________________________________________________________________________
8 Ibid., S. 215. – Seine Kursivierung. 9 So z.B. Jonathan Barnes im Kommentar zu seiner Übersetzung Aristoteles, Posterior Analytics, Oxford 1975, S. 148-155. 10 Aristoteles, Philosophische Schriften I, ed. cit., I, 7, 75b 8-10, S. 17. 11 Richard McKirahan, art. cit., S. 202. – Seine Kursivierung.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
149
tage, wenn man Gerhards von Cremona lateinische Übersetzung der entsprechenden Stelle der Analytica posteriora und ihre sprachlichen Lösungen heranzieht: „Et hoc est secundum duos modos, aut absolute aut secundum partem aliquam.“12 Das „absolute“ und das „secun-dum partem“ erinnern zweifelsohne an Gundissalinus’ Terminologie. Freilich reicht diese Parallele nicht hin, um in der entsprechenden Aristoteles-Passage den direkten Anknüp-fungspunkt für Gundissalinus zu erkennen, obwohl diesem, wie im letzten Kapitel dargetan, die arabische Fassung der Analytica posteriora zur Verfügung gestanden haben dürfte. Doch folgt Gundissalinus hier nur allzu eindeutig Avicenna, wie auch der weitere Verlauf der dar-gestellten Argumentation bei Aristoteles deutlich macht, von der sich Avicennas und Gun-dissalinus’ Überlegungen zunehmend unterscheiden.
So fehlt denn sowohl bei Avicenna als auch bei Gundissalinus die zweite Seite der ari-stotelischen Subordinationstheorie, die für die Aristoteles-Interpreten (und vermutlich auch schon für Aristoteles selbst) das Hauptstück seiner Subordinationstheorie darstellt, nämlich die Unterscheidung von o[ti- und dio,ti-Wissen. Nimmt man jedoch McKirahans Anmerkun-gen zu dieser zweiten Seite des aristotelischen Subordinationskonzepts ernst, so wird man sagen müssen, daß das Fehlen dieses Theoriestücks bei Avicenna und Gundissalinus keinen substantiellen Mangel in ihrer Subordinationstheorie darstellt. Daß beide nicht mit Aristo-teles weitergehen bis zur Unterscheidung von o[ti- und dio,ti-Wissen, bedeutet nicht, daß sie hinter ihm zurückbleiben, vielmehr deutet alles umgekehrt darauf hin, daß sie mit ihren Überlegungen einen aristotelischen Weg zu Ende gehen, den dieser selbst in eine andere Richtung gleichsam auf einer Nebenstrecke verlassen hat. Tatsächlich scheint es also, daß Avicenna und mit ihm Gundissalinus, ausgehend von der referierten Aristoteles-Stelle aus dem siebten Kapitel von Analytica posteriora I, ihre eigene Subordinationstheorie ent-wickeln, die mit Aristoteles zugleich über diesen hinausgeht. So ist etwa die Differenzierung von untergeordneten Wissenschaften im Gegensatz zu Teilen der Wissenschaft ein Moment, das bei Aristoteles gar nicht in den Blick kommt.13 Allerdings, und dies ist für Gundissalinus’ eigene Leistung in diesem Prozeß entscheidend, folgt der Archidiakon hierin lediglich Avi-cenna.
Im Falle der Subordinationstheorie ist mithin trotz des aristotelischen Grundanliegens und der letztlich ebenfalls aristotelischen Lösung desselben eindeutig festzuhalten, daß Gun-dissalinus zwar erneut Boethius und Avicenna in interessanter Weise kombiniert, wie im Abschnitt 2.2.5. dargestellt, daß diese Kombination ihn jedoch nicht zur direkten Rezeption darüber hinausgehender aristotelischer Philosopheme bringt. Denn alles, was Gundissalinus hier tut, ist, ausgehend von Boethius’ Unterscheidung von species und partes Avicenna zu rezipieren. Eine eigene Lektüre der entsprechenden Passagen aus den Analytica posteriora – mit all ihren Schwierigkeiten und Widersprüchen – ist dagegen nicht zu erkennen. Vielleicht aber auch gerade deshalb nicht, weil Avicennas Ausführungen hier den Analytica posteriora letztlich überlegen sind, insofern sie die Gattungsdiskussion nicht mit der Diskussion des
____________________________________________________________________________________________
12 Vgl. Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Gerardo Cremonensi interprete, ed. cit., S. 19. 13 Nicht zuletzt deshalb erweist sich Avicennas und mit ihm Gundissalinus’ im Abschnitt 2.2.5. dargelegte Position zur Subordination letztlich als komplexer. Während nämlich Aristoteles lediglich verschiedene Hinsichten auf die Subjektgattung einer Wissenschaft zu unterstellen scheint, differenzieren Avicenna und Gundissalinus diesen Punkt stärker, indem sie zunächst das Verhältnis der Subjektgattung zu ihren Teilen und Unterarten thematisieren und erst dann die Frage nach den Hinsichten auf diese Unterarten anschließen.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
150
Daß- und Warum-Wissens vermengen.14 Ganz gleich, wie diese Frage letztlich zu entschei-den ist, gilt es festzuhalten, daß Gundissalinus hier nicht über seine lateinisch-christlichen und arabischen Vorlagen hinausgeht.
Daß aber auch die Aufnahme dieses wissens- und wissenschaftstheoretischen Theorie-stücks im Anschluß an Boethius und Avicenna durchaus das Potential für eine vermeintlich authentischere aristotelische Position zur Subordination bietet, zeigt das Beispiel des Thomas von Aquin. Denn mit den folgenden Reflexionen aus seinem Kommentar zu Boethius’ De Trinitate scheint der Aquinate die von Gundissalinus im Rahmen der boethianischen Unter-scheidung von species und partes vorgelegte Avicenna-Adaptation ganz im Sinne des Ari-stoteles in Analytica posteriora I, 13 zu überdenken:
[...] Alia scientia continetur sub alia dupliciter, uno modo ut pars ipsius, quia scilicet subiectum eius est pars aliqua subiecti illius, sicut planta est quaedam pars corporis natu-ralis; unde et scientia de plantis continetur sub scientia naturali ut pars. Alio modo conti-netur una scientia sub alia ut ei subalternata, quando scilicet in superiori scientia assigna-tur propter quid eorum, de quibus scitur in scientia inferiori solum quia, sicut musica po-nitur sub arithmetica. Medicina ergo non ponitur sub physica ut pars. Subiectum enim me-dicinae non est pars subiecti scientiae naturalis secundum illam rationem, quae est subiectum medicinae. Quamvis enim corpus sanabile sit corpus naturale, non tamen est subiectum medicinae prout est sanabile a natura, sed prout est sanabile ab arte. [...] Et propter hoc medicina subalternatur physicae, et eadem ratione alchimia et scientia de agri-cultura et omnia huiusmodi.15
Bruno Decker, der Editor, gibt für diese Stelle keine Quelle des heiligen Thomas an, obwohl er unmittelbar zuvor auf parallele Stellen bei Avicenna und Gundissalinus verweist.16 Aber auch diese Stelle scheint eindeutig an Gundissalinus und die nur in seiner Divisionsschrift enthaltene lateinische Fassung von Avicennas Summe anzuknüpfen. Dies gilt sowohl syste-matisch, was die Distinktion von Teilsein und Unterordnung gerade am Beispiel der Medizin anbelangt,17 als auch terminologisch, wie etwa die Rede von den partes sowie ferner die Nennungen der alquimia und der agricultura als zweier subalternierter Wissenschaften der Physik belegen.18 Interessanterweise verknüpft Thomas nun diese Überlegungen mit den Begriffen des „quia“ und „propter quid“, d.h. der aristotelischen Unterscheidung von o[ti/dio,ti.19 Die Kommentierung des Boethius wird für Thomas so, wie so oft auch für Gun-
____________________________________________________________________________________________
14 Vgl. zu Avicennas Subordinationstheorie, die hier nicht als Ganze, sondern nur mit Blick auf Gundissali-nus vorgestellt werden konnte, Miklós Maróth, Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden u.a. 1994, S. 156-159. 15 Thomas von Aquin, Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden 1955, q. V, art. 1, ad 5, S. 170-171. 16 Vgl. ibid., S. 170, Anm. 1. 17 Vgl. hierzu das im Unterkapitel 2.2.5. angeführte Zitat aus der Summa Avicennae de convenientia et differentia subiectorum. 18 Diese beiden Wissenschaften werden auch in Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20, der Naturphilosophie subordiniert. 19 Weitergehende Einlassungen des heiligen Thomas zur Begründungsfunktion der Unterscheidung von Daß- und Warum-Wissen für die Subordinationstheorie finden sich in seinem Kommentar zu Analytica posteriora I, 13. Vgl. Thomas von Aquin, In libros Posteriorum analyticorum, in: Opera omnia XVIII, Par-mae 1865, lib. I, lect. XXV, S. 128-130.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
151
dissalinus, zur Gelegenheit, Boethianisches und Avicennisches zu genuin Aristotelischem, hier der Unterscheidung von propter quid- und quia-Beweisen, zu verweben.
Die Bemerkung von Henri Hugonnard-Roche in Bezug auf Gundissalinus’ Subordina-tionstheorie, daß „le remplacement [seiner Theorie] par le langage qui caractérise les scien-ces à l’aide de l’opposition entre démonstration quia et démonstration propter quid manifeste à coup sûr l’abandon de la conception qui était celle de Gundissalinus“,20 ist vor diesem Hintergrund gewiß nicht falsch, aber doch mit einigen Einschränkungen zu lesen. Denn wenn die aufgezeigte Parallele zwischen Thomas und Gundissalinus standhält, so wird man diesen Prozeß eher als Weiterentwicklung, denn als einfache Ersetzung beschreiben müssen. Ob diese Weiterentwicklung tatsächlich auch in allen ihren Konsequenzen eine systematisch fruchtbare Fortentwicklung der Subordinationstheorie des Gundissalinus ist, muß nach den Ausführungen zu Aristoteles im Anschluß an McKirahan freilich bezweifelt werden. Dies soll keineswegs die Bedeutung der so wiedergewonnenen Konzepte von demonstratio prop-ter quid und quia für die Wissens- und Wissenschaftstheorie insgesamt in Frage stellen, son-dern betrifft lediglich ihre Leistungsfähigkeit im Hinblick auf das Subordinationsproblem selbst bei Aristoteles. Tatsächlich sind die Ausführungen bei Aristoteles jedoch in ihrer Kürze auch nicht mehr als ein Anknüpfungspunkt für die im Mittelalter, etwa von Thomas, entwickelte komplexe(re) Subordinationstheorie, die ausgehend von den aristotelischen Texten durchaus eigenständige und getrennt zu verhandelnde Lösungen erarbeitet, für die Gundissalinus aber in jedem Fall mit seiner Aufnahme Avicennas eine wichtige Scharnier-funktion erfüllt. b) Die Binnendifferenzierung der Wissenschaften Explizitere Spuren des aristotelischen Einflusses lassen sich in Gundissalinus’ Darstellung der konstitutiven partes einer jeden Wissenschaft in De divisione philosophiae ausmachen. So wurde schon im Unterkapitel 2.2.5. sowie auch zu Beginn des vorliegenden Kapitels auf das bemerkenswerte Phänomen hingewiesen, daß Gundissalinus zur Binnendifferenzierung der Wissenschaften, insbesondere der Naturphilosophie, das Corpus aristotelicum heran-zieht. Dies läßt sich aber auch für die Logik beobachten, die hier zunächst vor der Natur-philosophie und ihren Teilen betrachtet werden soll. Da, wie soeben gesehen, Aristoteles im Rahmen seiner Subordinationstheorie – anders als Avicenna und Gundissalinus – nicht auf die Frage der Teile der Wissenschaften zu sprechen kommt und auch sonst keine allgemein gültige Theorie zur Binnendifferenzierung derselben aufstellt, muß hier auf eine Darlegung der originär aristotelischen Position zunächst verzichtet werden.21 Für die Naturphilosophie wird sich allerdings zeigen, daß Aristoteles faktisch eine solche Einteilung sehr wohl vor-nimmt. ____________________________________________________________________________________________
20 Henri Hugonnard-Roche, „La classification des sciences de Gundissalinus et l’influence d’Avicenne“, in: Jean Jolivet u. Roshdi Rashed (Hrsg.), Études sur Avicenne, Paris 1984, S. 41-75, hier S. 60. 21 Das Fehlen einer solchen Theorie macht sich insbesondere im Hinblick auf die Metaphysik bemerkbar, die sich bei Aristoteles bekanntlich in Ontologie, Prinzipientheorie und philosophische Theologie teilt, ohne daß jedoch letztlich ihr genauer Zusammenhang bestimmt wird. Vgl. zu diesem Problem und seiner Aufnahme im Mittelalter etwa Matthias Lutz-Bachmann (Hrsg.), Ontologie und Theologie – Beiträge zum Problem der Metaphysik bei Aristoteles und Thomas von Aquin, Frankfurt am Main u.a. 1988.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
152
Das Organon des Aristoteles und die partes der Logik bei Gundissalinus Die partes der Logik zählt Gundissalinus in seinem Logik-Kapitel in De divisione folgen-dermaßen auf:
Secundum Alfarabium octo sunt partes logicae: Categoriae, Perihermeneias, Analytica priora, Analytica posteriora, Topica, Sophistica, Rhetorica, Poetica. Nomina autem libro-rum ponuntur pro nominibus scientiarum, quae continentur in illis.22
Dieses Zitat signalisiert vorderhand, daß der spanische Archidiakon an dieser Stelle gar nicht direkt aus dem aristotelischen Opus schöpft, sondern scheinbar wiederum lediglich einem arabischen Vorbild folgt, hier al-FÁrÁbÐ und seinem von Gundissalinus unter dem Titel De scientiis adaptierten, bereits mehrfach erwähnten KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm.23 Eine sich enger am arabischen Original haltende lateinische Übersetzung dieser Schrift, die nachweislich Gun-dissalinus’ Adaptation benutzt, liefert etwas später Gerhard von Cremona.24 Tatsächlich zeigt nun zunächst ein Vergleich mit dem betreffenden Kapitel aus De scientiis, daß Gundissalinus in seinem Logik-Kapitel aus De divisione dieser Schrift exakt folgt. So heißt es in De scien-tiis:
Octo sunt partes logicae: Categoriae, Perihermeneias, Analytica priora, Analytica poste-riora, Topica, Sophistica, Rhetorica, Poetica. Nomina autem librorum proponuntur pro nominibus scientiarum, quae continentur in eis.25
Diese Parallele zwischen De divisione und De scientiis notiert bereits Ludwig Baur im Ap-parat zur entsprechenden Stelle der Divisionsschrift.26 Allerdings – und dies macht einen entscheidenden Unterschied – ist ihm noch nicht bewußt, daß De scientiis al-FÁrÁbÐs Schrift nicht einfachhin übersetzt, sondern adaptiert und paraphrasiert. Dies gilt auch für den vor-liegenden Fall. So lautet die uns hier interessierende Stelle in der wörtlicheren Übersetzung Gerhards: „Fiunt ergo partes dialecticae necessario octo, quarum unaquaque pars est in li-bro.“27 Diese Übersetzung Gerhards entspricht genau dem arabischen Text von al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm.28 An der entsprechenden Stelle findet sich bei al-FÁrÁbÐ also zunächst nur die Achtzahl der partes der Logik. Die Identifizierung derselben mit den entsprechenden aristotelischen Büchern erfolgt bei al-FÁrÁbÐ erst im Anschluß hieran in einer längeren Aus-führung, die jedes der acht von Gundissalinus genannten Bücher anführt und in seinem je-weiligen Inhalt bestimmt, ohne dabei allerdings auf ihren Zusammenhang untereinander näher einzugehen.29 ____________________________________________________________________________________________
22 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 71. 23 Der arabische Text ist mit spanischer Übersetzung ediert in al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. Ángel González Palencia, Madrid 21953. 24 Ediert ibid. – Die Abhängigkeit der gerhardschen von der gundissalinischen Fassung ist mehrfach von Manuel Alonso aufgezeigt worden; am ausführlichsten in seiner Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 13-32. 25 Ibid., S. 79-80. 26 Siehe Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 71. 27 Gerhards Übersetzung in al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 141. 28 Die spanische Übersetzung der entsprechenden Stelle des arabischen Textes lautet: „Infiérese de aquí que las partes de la lógica han de ser necesariamente ocho, cada una de las cuales se contiene en un libro espe-cial.“ Vgl. ibid., S. 32. 29 Vgl. ibid., S. 32-35 der spanischen Übersetzung.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
153
Diese sich an die Festlegung der Achtzahl der logischen Teilwissenschaften bei al-FÁrÁbÐ anschließenden mehrseitigen Darlegungen werden von Gundissalinus in seinem De scientiis bezeichnenderweise ausgelassen. Dafür stellt der Toledaner Gelehrte seiner Bestimmung der acht Teile der Logik im Sinne der acht genannten Bücher eine wichtige Passage voran, die hinwiederum in der arabischen Urfassung keine Entsprechung hat und folgendermaßen lau-tet:
Sed, quia veritatis certa cognitio non habetur, nisi per demonstrationem, ideo necessarium fuit librum componi, qui doceret qualiter et ex quibus demonstratio fieret. Et ob hoc com-positus est liber qui Posteriora analytica, sive Liber demonstrationis, dicitur. – Sed, quia demonstratio non fit nisi per syllogismum, syllogismus vero constat ex propositionibus, idcirco fuit necessarius liber in quo doceretur ex quot et qualibus propositionibus, et qua-liter secundum modos et figuras, syllogismus contexeretur. Et propter hoc facta sunt Ana-lytica priora. – Sed, quia propositiones syllogismum componere non possunt nisi ipse prius a suis terminis componantur, idcirco necessarius fuit liber qui doceret ex quibus et ex quot terminis propositio consisteret. Quod quidem plene docetur in libro qui dicitur Peri-hermeneias. – Sed, quia propositio ex terminis numquam bene componitur, nisi prius si-gnificatio cuiusque termini cognoscatur, ideo institutus est Liber categoriarum ad docen-dum quot sunt genera terminorum et quae sit significatio cuiusque eorum. Octo sunt partes logicae: Categoriae, Perihermeneias, Analytica priora, Analytica poste-riora, Topica, Sophistica, Rhetorica, Poetica. Nomina autem librorum proponuntur pro nominibus scientiarum, quae continentur in eis.30
Diese Überlegung, die bei Gundissalinus unmittelbar in die Bestimmung der acht Teile der logischen Wissenschaft im Sinne der aristotelischen Bücher führt und sich weder im arabi-schen Original der Schrift des al-FÁrÁbÐ noch in Gerhards Übersetzung findet, ist nun für die Frage nach den partes der Wissenschaften von großer Bedeutung. Denn anders als dies in al-FÁrÁbÐs Original der Fall ist, erklärt Gundissalinus auf diese Weise explizit, welcher der ganzheitliche Zusammenhang ist, in dem die Teile des Organon eben qua Teile stehen, näm-lich die Erlangung der „veritatis certa cognitio“, die mit den Analytica posteriora erreicht wird. Diese Vorrangstellung der Analytica posteriora bezieht Gundissalinus dabei zwei-felsohne aus den diesbezüglichen Bemerkungen al-FÁrÁbÐs, der die anderen Teile der logi-schen Wissenschaft auf diese ausgerichtet sein läßt.31 Das Wie dieser Ausrichtung, d.h. der genaue Zusammenhang zwischen den partes, findet sich allerdings im KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm nicht näher bestimmt, sondern ist hier eindeutig Gundissalinus’ Dreingabe. So geht Gun-dissalinus in De scientiis deutlich über seine Vorlage hinaus, indem er eine organische Sy-steminterpretation der logischen Schriften des Aristoteles entwickelt, die sich nahtlos an die Interpretation des Organon als Begriffslogik (Perihermeneias), Satzlogik (Categoriae), Schlußlogik (Analytica priora) und Beweis- oder Argumentationslogik (Analytica poste-riora) anschließen läßt, wie sie sich auch später z.B. bei Thomas von Aquin finden wird. Ganz in dieser Linie unterscheidet der Aquinate etwa in seinem Kommentar zu Periherme-neias das Organon gemäß drei verschiedenen, aufeinander hingeordneten Tätigkeiten des Intellekts wie folgt:
____________________________________________________________________________________________
30 Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 77-80. – Bereits der Editor, Manuel Alonso, merkt an, daß dieser Teil im Arabischen nicht vorhanden ist. 31 Siehe al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 35 der spanischen Übersetzung.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
154
De his igitur, quae pertinent ad primam operationem intellectus, idest de his, quae simplici intellectu concipiuntur, determinat Aristoteles in libro Praedicamentorum. De his vero, quae pertinent ad secundam operationem, scilicet de enuntiatione affirmativa et negativa, determinat Philosophus in libro Perihermeneias. De his vero, quae pertinent ad tertiam operationem, determinat Aristoteles in libro Priorum et in consequentibus, in quibus agitur de syllogismo simpliciter et de diversis syllogismorum et argumentationum speciebus, quibus ratio de uno procedit ad aliud.32
Diese Unterscheidung von Begriffs-, Satz-, Beweis- und Argumentationslogik ist identisch mit jener des Gundissalinus und bleibt bis in die Logique de Port Royal präsent.33
Letztlich nicht zu beantworten ist bei dieser für die lateinische Tradition wegweisenden Interpretation des Gundissalinus die Frage, mit welcher Quelle er hier über al-FÁrÁbÐ hinaus-geht. Denkbar ist zum einen eine weitere arabische Quelle. So ist die Einteilung der Wissen-schaften anhand der aristotelischen Schriften in der arabischen Literatur im allgemeinen und nicht nur bei al-FÁrÁbÐ weit verbreitet.34 Allerdings kommt hierfür keine der von Gundissali-nus sonst verwandten Schriften in Frage. Es ist daher durchaus plausibel, anzunehmen, daß Gundissalinus hier eine eigene Interpretation vorlegt, die sich an seiner Lektüre der von ihm angeführten aristotelischen Schriften selbst orientiert. So stehen einige der genannten Schriften des Aristoteles – etwa Categoriae, Perihermeneias – z.T. bereits seit längerem in lateinischer Fassung, der sogenannten logica vetus, zur Verfügung, während Gundissalinus die Analytiken, wie in 3.4. gezeigt, in ihrer arabischen Tradierung kennen konnte. Sollte sich Gundissalinus tatsächlich an den aristotelischen Schriften selbst orientiert haben, so liegt hier eine äußerst eigenständige Interpretationsleistung ihres Zusammenhangs vor. Denn der Sta-girite gibt im Organon keine Hinweise auf den Zusammenhang der Schriften untereinander. Entsprechend ist auch die gegenwärtige Forschung mittlerweile dazu übergegangen, die un-ter dem Titel ‚Organon‘ zusammengefaßten Schriften als autarke Abhandlungen zu interpre-tieren.35
Die vorangegangenen Überlegungen zu Gundissalinus’ interpretierenden Einschüben in seine Adaptation von al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm betreffen nun in gleicher Weise die Einteilung der partes der Logik in seiner Divisionsschrift, von der hier ausgegangen wurde. Denn in dieser referiert er nicht nur die weiter oben zitierte Passage zur Achtzahl der partes der Logik im Sinne des Corpus aristotelicum, sondern übernimmt auch wörtlich die von ihm in De scientiis eingefügten Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Analytica poste-riora, Analytica priora, Categoriae und Perihermeneias als Beweis-, Schluß-, Satz- und Begriffslogik, die soeben untersucht wurden.36 Auch diese Ausführungen weist der Editor, Ludwig Baur, als von al-FÁrÁbÐ übernommen aus, da er die Eingriffe des Gundissalinus aus De scientiis in den arabischen Urtext nicht (er)kennt.37 Gegen diese Zuweisung muß nach
____________________________________________________________________________________________
32 Thomas von Aquin, Commentaria in Aristotelis libros Peri hermeneias et Posteriorum analyticorum, iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, in: Opera omnia I, Romae 1882, prol., S. 7. 33 Vgl. hierzu u.a. Otfried Höffe, Aristoteles, München 21999, S. 38. 34 Nach wie vor grundlegend für die arabische Einteilung der Wissenschaften nach dem Corpus aristoteli-cum ist Martin Klamroth, „Über die Auszüge aus griechischen Schriftstellern bei al-JaÝqÙbГ, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 41 (1887), S. 415-442. 35 Vgl. zu dieser Diskussion Otfried Höffe, op. cit., S. 37-40. 36 Siehe Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 74-75. 37 Siehe ibid., im Apparat.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
155
dem Gesagten jedoch entschieden festgehalten werden, daß Gundissalinus im Rahmen der Diskussion der Binnendifferenzierung der Logik in De divisione eine Interpretation des logi-schen Korpus des Aristoteles versucht, die deutlich über seine Vorlage hinaus- und mögli-cherweise direkt auf seine eigene Lektüre der aristotelischen Werke zurückgeht. Dabei soll nicht verschwiegen werden, daß sich bei der Integration dieser Überlegungen in De divisione auch deutliche Schwierigkeiten abzeichnen. Denn letztlich muß gesagt werden, daß es Gun-dissalinus im Falle der Logik nicht gelingt, überzeugend darzutun, wie deren Einteilung mit den avicennischen Bestimmungen aus Abschnitt 2.2.5. zu den partes der Wissenschaften – verstanden als auf die Unterarten der gemeinsamen Subjektgattung bezogene Teile derselben Wissenschaft – zusammenstimmt.38 So definiert Gundissalinus zwar im Logik-Kapitel von De divisione verschiedene Unterarten der gemeinsamen Materie der Logik (d.i. die „univer-salitas, quae accidit rebus intellectis“), namentlich „genus“, „species“, „differentia“, „pro-prium“ und „commune“, doch bleibt gänzlich unbestimmt, wie diese sich zu ihren Teilen der Begriffs-, Satz-, Schluß- und Beweislogik verhalten bzw. wie sie diese Einteilung fundieren sollen. In jedem Fall aber expliziert der Archidiakon gegenüber al-FÁrÁbÐ einen organischen Teil-Ganzes-Zusammenhang der logischen Schriften des Aristoteles, der trotz seiner unleug-baren inhärenten Schwierigkeiten bis in die Neuzeit hinein für die Aristoteles-Interpretation leitend bleibt und, wie bemerkt, erst von der jüngeren Forschung in Frage gestellt wird. Die libri naturales des Aristoteles als partes der Naturphilosophie bei Gundissalinus Auch für die Aufzählung der aristotelischen Schriften, die Gundissalinus in De divisione unter dem Lemma der partes der Naturphilosophie gibt, ist ein Vergleich mit den entspre-chenden Ausführungen in Gundissalinus’ Adaptation De scientiis und al-FÁrÁbÐs arabischem Original dieser Schrift hilfreich. Denn auch wenn Gundissalinus hier nicht ausdrücklich auf al-FÁrÁbÐ hinweist, so ist dieser zweifelsfrei erneuter Ausgangspunkt der Binnendifferenzie-rung. So wird die Naturphilosophie von Gundissalinus zunächst ebenfalls in acht Teile un-tergliedert, die allesamt – der Bestimmung der partes aus Abschnitt 2.2.5. folgend – die Sub-jektgattung ‚beweglicher Körper‘ in ihren verschiedenen Teilen bzw. Unterarten zum Ge-genstand haben.39 Der erste Teil der Naturphilosophie wird folgendermaßen bestimmt:
Partes autem huius scientiae naturalis sunt octo. Quarum prima est inquisitio de eo, in quo communicant omnis corpora naturalia sive simplicia, sive composita: scilicet in principiis et accidentibus consequentibus illa principia; et hoc docetur in libro, qui dicitur: De natu-rali auditu.40
____________________________________________________________________________________________
38 Vgl. ibid., S. 70. 39 Gundissalinus selbst definiert im Anschluß an Avicenna die Materie bzw. die Subjektgattung der Naturphilosophie als „corpus [...] secundum quod subiectum est motui et quieti et permutationi.“ Siehe Do-minicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20, sowie dazu Avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1977 u. 1980, hier Bd. I, S. 9. 40 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
156
Diese Überlegung findet sich wörtlich auch in De scientiis sowie im KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm.41 Der erste Teil der Naturphilosophie soll mithin die beweglichen Körper mit Blick auf das ihnen allen Gemeinsame untersuchen und wird mit der Physik gleichgesetzt, die nach ihrem griechischen Titel Fusikh. avkro,asij sowohl in der arabischen als auch in der lateinischen Tradition unter dem Namen ‚Physikalisches Anhören‘ im Sinne von ‚Physik-Vorlesung‘ überliefert ist. Der lateinische Titel De naturali auditu übersetzt das arabische As-samÁÝ aÔ-ÔabÐÝÐ. Näheres über die arabische und lateinische Tradierung der Physik sowie ihre Überset-zung durch Gerhard von Cremona wurde bereits weiter oben in Kapitel 3.2. gesagt. Vom zweiten Teil der Naturphilosophie heißt es:
Secunda pars est inquisitio de corporibus simplicibus an sint; et si sint, tunc quae corpora sunt et quantus est eorum numerus [...] et haec consideratio est de mundo [...] et de caelo [...] et hoc docetur in prima parte primi libri eius, qui dicitur: Libri caeli et mundi. – Deinde sequitur inquisitio de elementis corporum compositorum an sint in istis simplici-bus [...] et haec inquisitio est usque ad finem primae partis primi libri eius, qui dicitur: Caeli et mundi. – Deinde sequitur consideratio de eo, in quo communicant omnia simpli-cia, quorum alia sunt elementa [...] et alia quae non sunt ipsis elementa [...] et haec inqui-sitio est de caelo et partibus eius et docetur in principio secundae partis eius libri, qui di-citur: Liber caeli et mundi et durat circiter usque duas tertias eius. – Deinde sequitur con-sideratio de eo, quod est proprium eorum, quae sunt elementa et eorum quae non sunt elementa [...] et hoc docetur in fine partis secundae et tertiae et quartae eius libri, qui dici-tur: Liber caeli et mundi.42
Auch diese Passage ist mit De scientiis und dem arabischen Original identisch.43 Der zweite Teil der Naturphilosophie gliedert sich entsprechend noch einmal in vier Unterteile, deren erster die einfachen Körper wie Himmel und Welt betrachtet, der zweite Teil die einfachen Elemente der zusammengesetzten Körper, der dritte Teil betrachtet die einfachen Körper, die keine Elemente sind, ebenso wie jene, die Elemente sind, im Hinblick auf ihre Gemeinsam-keiten, und der vierte Teil schließlich betrachtet dieselben im Hinblick auf ihre Eigentüm-lichkeiten. Die Bezeichnung der für diese Wissenschaft stehenden Schrift als Liber caeli et mundi ist die Übersetzung des in der arabischen Tradition üblichen Titels As-samÁÞ wa’l-ÝÁlam für Aristoteles’ De caelo.44 Der bereits im 9. Jahrhundert von YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq ins Arabische übertragene Text45 wurde erstmalig von Gerhard von Cremona ins Lateinische gebracht,46 später vermutlich auch von Michael Scotus.47
____________________________________________________________________________________________
41 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 120, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 60 der spanischen Übersetzung. 42 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 21-22. 43 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 121-123, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las cien-cias, ed. cit., S. 60-61 der spanischen Übersetzung. 44 Siehe zur Frage des Titels Gerhard Endress, Die arabischen Übersetzungen von Aristoteles’ Schrift ‚De caelo‘, Frankfurt am Main 1966, S. 58 u. S. 88, der hierin eine (legitime) Interpretation des entsprechenden Inhalts der aristotelischen Schrift sieht. 45 Der arabische Text ist ediert als ArisÔÙÔÁlÐs, FÐ’s-samÁÞ wa’l-Á×Ár al-ÝulwÐya, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kairo 1961. 46 Eine aufschlußreiche terminologische Untersuchung dieser noch unveröffentlichten Übersetzung Gerhards bietet Ilona Opelt, „Zur Übersetzungstechnik des Gerhard von Cremona“, in: Glotta 38 (1960), S. 135-170.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
157
Vom dritten Teil heißt es: Tertia pars est inquisitio de permixtione et corruptione corporum naturalium [...] et qualia alia ex aliis generantur [...] et hoc docetur in libro, qui dicitur: De generatione et corrup-tione.48
Auch dies stimmt gänzlich mit De scientiis und dem arabischen Original überein.49 Dieser Teil der Naturphilosophie handelt also von der Vermischung und dem Vergehen der natürli-chen Körper sowie vom Übergang der Körper untereinander. Die aristotelische Schrift De generatione et corruptione, die hierfür herangezogen wird, scheint im Kontext der Schule Íunain Ibn IsÎÁqs übersetzt worden zu sein, auch wenn bislang keine arabische Handschrift derselben aufgefunden werden konnte.50 Die frühe lateinische Tradition kennt eine Übertra-gung dieses Werkes aus dem Arabischen durch Gerhard von Cremona51 sowie eine anonyme Übersetzung aus dem Griechischen, die vermutlich ebenfalls ins 12. Jahrhundert zu datieren ist und von Burgundio von Pisa stammen könnte.52 Vom vierten Teil wird gesagt:
Quarta vero pars est inquisitio de principiis actionum et passionum quae propria sunt ele-mentis tantum et compositis ab eis; et hoc continetur in primis tribus partibus libri, qui di-citur De impressionibus superioribus.53
Auch dieser Punkt findet sich wörtlich in De scientiis und auch – mit einer geringfügigen Abweichung – in der arabischen Urfassung des Werkes.54 Dieser Teil der Naturphilosophie handelt mithin von den Wirkungen und Leidenschaften der Elemente, wobei der für diesen Teil stehende aristotelische Titel De impressionibus superioribus auf den arabischen Titel Al- Á×Ár al-ÝulwÐya für die Meteorologica des Stagiriten verweist. In der arabischen Welt ist diese Schrift ab dem frühen 9. Jahrhundert durch die Übersetzung des YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq be-kannt.55 Eine frühe graeco-lateinische Fassung, die allerdings nur das vierte Buch der ____________________________________________________________________________________________
47 Vgl. Bernard G. Dod, „Aristoteles latinus“, in: Norman Kretzmann u.a. (Hrsg.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100-1600, Cambridge 1982, S. 45-79, hier S. 76. 48 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 22. 49 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 123, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 61 der spanischen Übersetzung. 50 Siehe dazu Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungsliteratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 290. 51 Bislang unediert. Vgl. z.B. die Manuskripte Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 2318, sowie ibid., lat. 6506. 52 Ediert in Aristoteles latinus, De generatione et corruptione, ed. Johanna Judycka (Aristoteles latinus IX, 1), Leiden 1985. 53 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 22. 54 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 123-124, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las cien-cias, ed. cit., S. 61 der spanischen Übersetzung. – Gundissalinus’ „et compositis ab eis“ scheint ein Lese- oder Übersetzungsfehler zu sein. Im arabischen Original und auch in Gerhards Übersetzung werden die zu-sammengesetzten Körper gerade von der Betrachtung ausgeschlossen („con exclusión de los compuestos“ übersetzt Ángel González Palencia, ibid., S. 61, „sine compositis“ Gerhard, ibid., S. 162). Diese Lesart scheint zwingend, da sonst der Unterschied des vierten Teils der Naturphilosophie zum folgenden nicht er-kennbar ist. 55 Vgl. zur arabischen Tradition der Meteorologica neben der älteren Edition in ArisÔÙÔÁlÐs, FÐ’s-samÁÞ wa’l-Á×Ár al-ÝulwÐya, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kairo 1961, jene von Casimir Petraitis, The Arabic Version of Aristotle’s ‚Meteorology‘, Beirut 1967. Sowie jetzt auch Aristoteles semitico-latinus, Aristotle’s ‚Meteoro-
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
158
Meteorologica wiedergibt, verfertigte Henricus Aristippus vor 1162, seinem Todesjahr.56 Offensichtlich kannte Gerhard von Cremona diese Übersetzung bereits,57 als er die ersten drei (und nur die ersten drei) Bücher aus dem Arabischen übertrug.58 Vom fünften Teil gilt:
Quinta vero pars est consideratio de corporibus compositis ab elementis. [...] Et hoc conti-netur in quarto libro De impressionibus superiorum.59
Auch dies geht wörtlich auf De scientiis und den arabischen Text des KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm zurück.60 Deutlich erkennen schon die arabischen Autoren den in den Meteorologica mit dem vierten Buch vorliegenden Bruch, indem sie dieses einem anderen Teil der Naturphilosophie zuordnen, nämlich der Behandlung von Körpern, insofern sie aus Elementen zusammenge-setzt sind. Aristoteles selbst kündigt gegen Ende des dritten Buches einen Traktat über Mine-ralogie und Metallurgie an, doch läßt sich das vierte Buch nicht in diesem Sinne lesen, son-dern weist eher Parallelen mit De generatione et corruptione auf. Dies hat in der modernen Aristoteles-Literatur zur hier nicht weiter zu verhandelnden Frage nach der Authentizität des vierten Buches geführt.61 Auf die Bedeutung der Meteorologica insgesamt für Gundissalinus’ Binnendifferenzierung der Naturphilosophie wird weiter unten noch genauer einzugehen sein. Weiterhin gilt vom sechsten Teil der Naturphilosophie:
Sexta vero pars est consideratio de eo, in quo communicant corpora composita similium partium, quae non sunt partes compositi diversarum partium. Et haec sunt corpora minera-lia [...] Et hoc docetur in libro qui intitulatur: De mineris.62
Dies findet sich gleichfalls sowohl in De scientiis als auch in al-FÁrÁbÐs arabischem Text.63 Unter dem Titel De mineris, arabisch Al-maÝÁdin, sollen demnach in diesem Teil der Natur-
____________________________________________________________________________________________
logy‘ in the Arabico-Latin Tradition, ed. Pieter L. Schoonheim (Aristoteles semitico-latinus XII), Leiden u.a. 2000, die Gerhards Übersetzung beigibt (die Übersetzung des Henricus Aristippus wird dabei bedauerli-cherweise gänzlich beiseite gelassen). 56 Vgl. Bernard G. Dod, art. cit., S. 76. 57 Dies wird auch in der Werkliste des Gerhard berichtet, die seine Schüler nach seinem Tode zusammenstel-len. Die Werkliste ist mehrfach abgedruckt, u.a. in Ferdinand Wüstenfeld, Die Übersetzung arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert (Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 22/2-3 [1877]), Göttingen 1877, hier S. 67, no. 38: „Liber Aristotelis Meteororum tractatus III, quartum autem non transtulit eo quod sane invenit eum translatum.“ 58 Der im Mittelalter kursierende lateinische Text der Meteorologica war entsprechend eine Zusammenset-zung dieser beiden Übersetzungen, bis endlich Wilhelm von Moerbeke im 13. Jahrhundert eine Übersetzung gleichsam aus einem Guß vorlegen sollte. 59 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 22. 60 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 124-125, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las cien-cias, ed. cit., S. 61-62 der spanischen Übersetzung. 61 Aristoteles’ Autorschaft bestreiten u.a. Ingeborg Hammer-Jensen, „Das sogenannte VI. Buch der Meteorologie des Aristoteles“, in: Hermes 50 (1915), S. 113-136, sowie H. B. Gottschalk, „The Authorship of Meteorologica, Book IV“, in: Classical Quarterly 11 (1961), S. 67-79. Siehe dagegen Ingemar Düring in der Einleitung seiner Monographie Aristotle’s Chemical Treatise, ‚Meteorologica‘ Book IV, Göteborg 1944, S. 18-20. 62 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 22-23.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
159
philosophie homogene zusammengesetzte Körper untersucht werden. Der Titel selbst scheint Aristoteles’ soeben erwähnte Ankündigung im dritten Buch der Meteorologica 6, 378a 15-17 aufzugreifen, ein Buch zur Gesteins- und Metallkunde zu verfassen.64 Allerdings scheint der Stagirite eine solche Schrift nie geschrieben zu haben. Schon früh dürfte dieses Desiderat in der arabischen Tradition der libri naturales durch pseudo-aristotelische Schriften ausgefüllt worden sein, etwa durch Auszüge aus Theophrasts De lapidibus.65 Spätestens gegen Ende des 12. Jahrhunderts ist jedoch bereits ein anderer Text unter diesem Titel in Umlauf, näm-lich der avicennische Traktat zur Gesteinskunde aus dem KitÁb aš-šifÁÞ,66 der von Alfred von Sarashell vermutlich in Toledo unter dem Titel De mineralibus als Aristoteles’ Fortsetzung der Meteorologica übersetzt wurde.67 Ferner heißt es vom siebten Teil der Naturphilosophie:
Septima est consideratio de eo, in quo communicant species vegetabilium [...], et hoc do-cetur in libro De vegetabilibus.68
Auch dieser Teil befindet sich in wörtlicher Übereinstimmung mit De scientiis und al-FÁrÁbÐs Original.69 Er ist offensichtlich den Pflanzen gewidmet und bezieht sich auf eine entsprechende botanische Schrift des Aristoteles. Ob Aristoteles eine solche Schrift jemals verfaßt hat, ist unklar.70 In der arabischen Tradition wurde die entsprechende Lücke im Kor-pus der naturphilosophischen Schriften des Aristoteles, wie im Falle der Gesteins- und Me-tallkunde, zunächst durch Übersetzungen von Theophrasts Arbeiten gefüllt; später trat ein Traktat des Nikolaus Damascenus in Übersetzung durch IsÎÁq Ibn Íunain in den Vorder-grund.71 Dieses Werk wurde dann zur Grundlage der lateinischen Übersetzungen von De vegetabilibus bzw. De plantis durch Alfred von Sarashell, vermutlich ebenfalls in Toledo.72 Über den achten und letzten Teil sagt Gundissalinus:
____________________________________________________________________________________________
63 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 125, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 62 der spanischen Übersetzung. 64 Aristoteles, Meteorologie / Über die Welt, übers. von Hans Strohm, Berlin 21979, S. 89. 65 Siehe hierzu Christel Hein, op. cit., S. 291. 66 Der Text ist ediert als Avicenna, De congelatione et conglutinatione lapidum, Latin and Arabic texts ed. with an Engl. trans. and notes by E. J. Holymard and D. C. Mandeville, Paris 1927. Eine Diskussion der Autorschaft mit besonderer Rücksicht auf Aristoteles findet sich auf den S. 1-4. 67 Vgl. hierzu James K. Otte, „The Life and Writings of Alfredus Anglicus“, in: Viator 3 (1972), S. 275-291, hier bes. S. 283-285, sowie insbesondere José Antonio García-Junceda, „Los Meteorologica de Aristóteles y el De mineralibus de Avicena“, in: ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ u.a. (Hrsg.), Milenario de Avicena, Madrid 1981, S. 37-63. 68 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophaie, ed. cit., S. 23. 69 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 126, sowie al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 62 der spanischen Übersetzung. 70 Gustav Senn, „Hat Aristoteles eine selbständige Schrift über Pflanzen verfaßt?“, in: Philologus 85 (1929-1930), S. 113-140, beantwortet die Frage negativ. Siehe dagegen bereits Otto Regenbogen, „Eine Polemik Theophrasts gegen Aristoteles“, in: Hermes 72 (1937), S. 469-475, sowie später Ingemar Düring, Aristoteles – Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966, S. 514. 71 Siehe hierzu Christel Hein, op. cit., S. 291-292. 72 Vgl. neben James K. Otte, art. cit., S. 283-285, auch Aristoteles semitico-latinus, Nicolaus Damascenus, De plantis. Five Translations, ed. H. J. Drossaart Lulofs u. E. L. J. Poortman (Aristoteles semitico-latinus IV), Amsterdam 1989.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
160
Octava est consideratio de eo, in quo communicant species animalium, et de eo, quod est proprium unicuique eorum [...] et hoc docetur in libro qui intitulatur De animalibus et in libro De anima et in eis, quae sunt usque ad ultimum librorum De naturalibus.73
In diesem Teil schließlich soll es also um die beseelten Körper gehen, womit die Aufzählung der Unterarten von beweglichen Körpern, welche die Subjektgattung der Physik ausmachen und nach Unterkapitel 2.2.5. der Grund für deren Einteilung in konstitutive partes sind, zu einem Ende kommt. Wie alle bisher referierten Bestimmungen findet sich auch diese letzte Stelle wörtlich in De scientiis.74 Ludwig Baur weist daher die gesamte Liste als auf al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm beruhend aus in dem Glauben, daß De scientiis eine treue Übersetzung desselben biete.75 Gegenüber al-FÁrÁbÐs Original gibt es nun jedoch gerade in Bezug auf diesen letzten Teil der Naturphilosophie eine signifikante Abweichung, auf die Alonso in seiner Edition von De scientiis bereits hinweist.76 Denn bei al-FÁrÁbÐ fehlt der Hinweis auf die weiteren Bücher De naturalibus,77 mit denen die Parva naturalia des Aristoteles gemeint sein müssen.78 Die Kenntnis der hier außerdem genannten Schriften De anima sowie der Tierbücher in der arabischen und lateinischen Tradition wurde bereits in 3.3. dargelegt. Was nun die interessante Hinzufügung der Parva naturalia betrifft, so ist festzustellen, daß diese Schriften zumindest in der früheren arabischen Literatur einschließlich al-FÁrÁbÐs wahr-scheinlich noch unbekannt waren, da noch nicht übersetzt. Entsprechend konnte al-FÁrÁbÐ sie auch nicht in seiner Darlegung anführen, so daß es sich hier zwangsläufig um einen Zusatz des Gundissalinus handelt. Erst ab dem 11. Jahrhundert gibt es Hinweise auf das Einsetzen einer Rezeption dieser Werke in der arabischen Welt.79 Allerdings sind keine arabischen Übersetzungen in Handschriften überliefert. Ihre deutlichsten Spuren haben die Parva natu-ralia bei Averroes hinterlassen, der sie exzerpierte,80 womit deutlich ist, daß diese Texte zu Gundissalinus’ Zeiten auf der Iberischen Halbinsel präsent waren. Doch konnte Gundissali-nus die Parva naturalia durchaus auch aus der graeco-lateinischen Tradition kennen, da der Großteil dieser Schriften noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Jakob von Vene-dig übertragen wurde.81 Dies erklärt vielleicht auch, warum anders als bei den vorangegange-____________________________________________________________________________________________
73 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 23. 74 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 126. 75 Vgl. die Quellenangaben im Apparat zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 20-23. 76 Vgl. die Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 24-25 u. S. 32. 77 Vgl. al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 62 der spanischen Übersetzung. 78 Der Titel Parva naturalia taucht erst später in der lateinischen Tradition auf; Aegidius Romanus verwen-det ihn als einer der ersten. Siehe hierzu u.a. die Einleitung von David Ross in Aristoteles, Parva naturalia, a revised text with introd. and comm. by David Ross, Oxford 1955, S. 1. – Friedrich Dechant, Die theologische Rezeption der ‚Artes liberales‘ und die Entwicklung des Philosophiebegriffs in theologischen Programm-schriften des Mittelalters von Alkuin bis Bonaventura, St. Ottilien 1993, S. 159, Anm. 82, moniert hinsicht-lich der gundissalinischen Bezeichnung De naturalibus die unscharfe Terminologie, in der er ein Zeichen für Gundissalinus’ Unkenntnis dieser Schriften erkennen will. Dies ist jedoch höchst anachronistisch gedacht. 79 Siehe hierzu Moritz Steinschneider, „Die Parva naturalia des Aristoteles bei den Arabern“, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 37 (1883), S. 477-492, der S. 490 zu dem Ergebnis kommt, daß die Schriften im 10. Jahrhundert vermutlich noch gar nicht in arabischer Übersetzung vorlagen. 80 Vgl. Helmut Gätje, Die Epitome der ‚Parva naturalia‘ des Averroes I, Wiesbaden 1961. 81 Vgl. Bernard G. Dod, art. cit., S. 76-77. – Daß hier möglicherweise die lateinische Tradition Gundissali-nus bekannt ist, liegt um so näher, als die Parva naturalia in ihrer arabischen Überlieferung ab dem 12. Jahr-hundert gemeinsam unter dem (aristotelischen) Titel KitÁb al-Îiss wa’l-maÎsÙs, also Von der Wahrnehmung
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
161
nen Schriften keine Toledaner Übersetzungen derselben angefertigt wurden. Denn wie Charles Burnett mehrfach betont hat, besitzt die hier von Gundissalinus im Anschluß an al-FÁrÁbÐ vorgelegte Liste der libri naturales für die Toledaner Übersetzer allem Anschein nach einen nachgerade kanonbildenden Charakter.82 So ist höchst auffällig, daß fast sämtliche der hier von Gundissalinus genannten Schriften in Toledo übersetzt wurden. Die einzige Aus-nahme stellen dabei jene Schriften dar, die bereits in früheren lateinischen Ausgaben vorlie-gen, nämlich das vierte Buch der Meteorologica sowie die Parva naturalia.83 Wichtiger als diese Funktion der vorgelegten Liste als Leitfaden für die Erstübersetzung zahlreicher Werke des Aristoteles ist jedoch für den gegenwärtigen Kontext der partes, daß Gundissalinus mit der Hinzufügung der Parva naturalia erneut in den Text al-FÁrÁbÐs eingreift, so wie auch schon im Falle der partes der Logik. Damit verrät er auch hier, wie bereits Alonso zu Recht festgestellt hat, eine Kenntnis der aristotelischen Werke, die eindeutig über die von ihm be-nutzte Vorlage hinausgeht. Gundissalinus und die aristotelische Einteilung der Naturphilosophie in den Meteorologica Diesem kleinen, aber doch im Hinblick auf Gundissalinus’ Kenntnis des aristotelischen Kor-pus bedeutenden Eingriff läßt sich ein weiterer Zusatz des Gundissalinus im Physik-Kapitel aus De scientiis hinzugesellen, der nahelegt, daß Gundissalinus neben den Parva naturalia auch die weiter oben erwähnten Meteorologica gekannt haben muß. So schreibt er kurz vor seiner Aufzählung der partes der Naturphilosophie in De scientiis, al-FÁrÁbÐ übersetzend:
Nam unumquodque eorum non est nisi ad intentionem et finem aliquem, ut in quarto Me-teororum.84
Nun ist bei al-FÁrÁbÐ zwar tatsächlich dieses Zitat zu finden; es fehlt jedoch – worauf Alonso als erster aufmerksam gemacht hat –85 in den beiden uns heute bekannten arabischen Hand-schriften ebenso wie in Gerhards Übersetzung86 die Zuschreibung zum vierten Buch der
____________________________________________________________________________________________
und vom Wahrgenommenen (De sensu et sensato), dem ersten der Traktate, firmieren. Vgl. Moritz Stein-schneider, art. cit., S. 478 (sowie zur aristotelischen Wurzel dieser Nomenklatur weiter unten in diesem Ka-pitel in Anm. 94). Gundissalinus benutzt diesen arabischen Titel im Prolog zu seiner mit Ibn DÁwÙd angefer-tigten Übersetzung von Avicennas De anima; vgl. Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1968 u. 1972, hier Bd. I, S. 4. In De scientiis und De divisione verwendet er allerdings die allgemeinere, nicht durch die arabischen Quellen tradierte Bezeichnung De natu-ralibus. 82 Siehe u.a. Charles Burnett, „Vincent of Beauvais, Michael Scot and the ‚New Aristotle‘“, in: Serge Lusi-gnan u. Monique Paulmier-Foucart (Hrsg.), Lector et Compilator – Vincent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIIe siècle, Grâne 1997, S. 189-213, hier S. 192. 83 Nur die Physik ist eine Doppelübersetzung. Anders als Thomas Ricklin, Die ‚Physica‘ und der ‚Liber de causis‘ im 12. Jahrhundert: Zwei Studien, Freiburg i. Üe. 1995, S. 92, Anm. 97, der das Warum dieser Dop-pelübersetzung für unerklärbar hält, scheint dieses mir durch die Bedeutsamkeit der Schrift verhältnismäßig leicht erklärbar. 84 Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 117. 85 Vgl. Manuel Alonso im Anhang zu seiner Edition ibid., S. 176. 86 Siehe Gerhards Übersetzung in al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 159.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
162
Meteorologica, wo eine durchaus ähnliche Stelle sich tatsächlich 12, 390a 10-11 findet.87 Daß diese Zuschreibung ferner von einer anderen Hand als jener des al-FÁrÁbÐ stammen muß, legt auch der Wechsel im Titel der Schrift nahe, die sonst, wie im vorangegangenen, als De impressionibus superiorum von Gundissalinus ins Lateinische übersetzt wird. Im übrigen hat Alonso, wie bereits in Kapitel 3.1. erwähnt wurde, auch weitere Stellen in De scientiis auf-weisen können, an denen Gundissalinus bibliographische Angaben ergänzt.88 Offensichtlich kannte also Gundissalinus die Meteorologica unabhängig von al-FÁrÁbÐ, und dies nicht nur oberflächlich, wie die durchaus plausible Zuschreibung belegt. Dabei muß seine Kenntnis, wie Alonso ebenfalls zeigen konnte, auf den arabischen Text des Werkes zurückgehen.89 Denn in der graeco-lateinischen Übersetzung des Henricus Aristippus, die ja zugleich die einzige lateinische Übersetzung des vierten Buches im 12. Jahrhundert ist, lautet die Passage lapidar: „Horum quodcumque est gratia huius.“90 Es ist nur schwer vorstellbar, daß Gundissalinus aufgrund dieser Übersetzung eine Identifizierung des oben zitierten Textes mit den Meteorologica vornehmen konnte, womit erneut gegen Mario Grignaschis These von der rein graeco-lateinischen Aristoteleskenntnis des Gundissalinus Stellung bezogen werden muß.
Wenn Gundissalinus nun aber tatsächlich die Meteorologica so gut kannte, wie es diese Zuschreibung erfordert, so war ihm gewiß auch ihr Anfang, I, 1, 338a 20 - 339a 8, mehr als vertraut. Hier aber heißt es gerade in Bezug auf die partes der Naturphilosophie:
Die ersten Ursachen der Natur, die gesamte natürliche Bewegung, ferner die Ordnung der am Himmel kreisenden Gestirne, dazu Zahl und Art der Elementarkörper sowie ihr Über-gang ineinander, auch das allgemeine Werden und Vergehen sind also früher dargestellt. Nun ist von diesem Lehrgang noch das restliche Teilstück zu betrachten, das alle Früheren ‚Meteorologie‘ nannten. Es umfaßt alle Geschehnisse, die sich auf natürliche Weise, dabei jedoch im Vergleich mit dem ersten Elementarkörper unregelmäßiger vollziehen, und zwar besonders in dem der Gestirnsphäre benachbarten Raum [...] Sodann noch im Hin-blick auf die Erde ihre Teile, ihre Arten und die Eigenschaften dieser Teile. [...] Nach der Darstellung dieses Sachgebiets wollen wir untersuchen, ob sich auf der gegebenen metho-dologischen Grundlage ein Bericht über Tiere und Pflanzen, allgemein und speziell, geben läßt.91
Mit den zitierten Sätzen aus den Meteorologica werden sämtliche Teile der Naturphilosophie von der Physik, über De caelo, De generatione et corruptione, Meteorologica, De mineris, De anima, De animalibus und De vegetabilibus in der auch bei al-FÁrÁbÐ referierten Reihen-folge ihrem Inhalt nach aufgezählt.92 Ferner treten als letzter Teil der Naturphilosophie in den Meteorologica I, 3, 341a 12-14 die bei al-FÁrÁbÐ fehlenden Parva naturalia hinzu:
____________________________________________________________________________________________
87 Aristoteles, Meteorologie / Über die Welt, ed. cit., S. 116: „Alle Dinge sind bestimmt durch ihre Funktion (e;rgon).“ 88 Siehe hierfür Manuel Alonso in seiner Einleitung zu Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 31-32. 89 Vgl. Manuel Alonso im Anhang zu seiner Edition ibid., S. 176. 90 Zitiert nach Manuel Alonso, ibid. 91 Aristoteles, Meteorologie / Über die Welt, ed. cit., S. 9. 92 Auf die einzigartige Bedeutung der Meteorologica für ein adäquates Verständnis der aristotelischen Einteilung der libri naturales macht José Antonio García-Junceda, art. cit., S. 37-43, aufmerksam.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
163
Was aber das Entstehen der Wärme betrifft, die die Sonne spendet, so ist eine gesonderte, genaue Behandlung eher in der Vorlesung über Sinneswahrnehmung (evn toi/j peri. aivsqh,sewj) am Platze.93
Die Bezeichnung ‚Vorlesung(en) über Sinneswahrnehmung‘ ist bei Aristoteles nicht nur der Titel des ersten Traktates der Parva naturalia, sondern wird hier metonymisch, wie auch in der arabischen Tradition, als Kollektivtitel für seine naturphilosophischen Opuskel insgesamt verwandt.94
Obschon Aristoteles also, wie bereits erwähnt, keine allgemein gültige Theorie zur Ein-teilung einer Wissenschaft in partes entwickelt, so nimmt er diese Binnendifferenzierung zumindest hinsichtlich der Naturphilosophie in den Meteorologica faktisch doch vor, wie die zitierten Passagen deutlich erkennen lassen. Anders als im Falle der Logik liegt Gundissali-nus damit eine aristotelische Grundlage für die al-fÁrÁbÐsche Binnendifferenzierung der Na-turphilosophie vor, die zudem gegen al-FÁrÁbÐ (und mit Gundissalinus) auch die Parva natu-ralia berücksichtigt. Wenn Ludwig Baur daher in seinem Kommentar zu Gundissalinus’ – auf al-FÁrÁbÐ und De scientiis fußender – Einteilung der Physik in De divisione behauptet, diese sei rein äußerlich an Aristoteles herangetragen,95 so ist dies nicht zutreffend. Denn gerade im Falle der Physik, im Unterschied zur Logik, gibt Aristoteles mit den Bemerkungen in den Meteorologica selbst den Schlüssel zur Binnendifferenzierung der libri naturales an die Hand.
Gundissalinus macht sich hier folglich mit al-FÁrÁbÐ eine auch sachgemäße Einteilung der partes der Naturphilosophie zu eigen, die letztlich auf Aristoteles zurückgeht und womöglich eben dort von Gundissalinus selbst gelesen wurde. Dies könnte auch erklären, warum Gun-dissalinus in diesem Kapitel von De divisione auf den Hinweis verzichtet, den er bei der Einteilung der Logik gibt, nämlich daß diese Einteilung „secundum Alfarabium“ sei. Denn im Falle der Physik ist diese Einschränkung überflüssig, da hier die entsprechende Einteilung in den referierten Schriften des Aristoteles selbst, namentlich den Meteorologica, vorge-nommen wird.
Wie auch immer die Frage der direkten Beeinflussung des Gundissalinus durch Aristote-les an dieser Stelle entschieden wird, fest steht, daß Gundissalinus im Physik-Kapitel von De divisione einen genuin aristotelischen Vorschlag zur Binnendifferenzierung der Naturphilo-sophie aufgreift, der in Verbindung mit Avicennas partes-Lehre aus Abschnitt 2.2.5. ein bei Aristoteles fehlendes theoretisches Fundament erhält. Es dürfte daher kaum verwundern, daß auch diese von Gundissalinus vorgelegte Einteilung bis zu Thomas von Aquin fortgewirkt hat. Hier heißt es im Prolog zu seinem Physik-Kommentar:
Sed quia ea, quae consequuntur aliquod commune, prius et seorsum determinanda sunt, ne oporteat ea multoties pertractando omnes partes illius communis repetere, necessarium fuit, quod praemitteretur in scientia naturali unus liber, in quo tractaretur de iis [...] Hic autem est liber Physicorum, qui etiam dicitur De physico sive Naturali auditu [...] Se-
____________________________________________________________________________________________
93 Aristoteles, Meteorologie / Über die Welt, ed. cit., S. 14. 94 Auf die metonymische Verwendung des Titels ‚Vorlesung(en) über Sinneswahrnehmung‘ bei Aristoteles für die Parva naturalia insgesamt weist auch Jorge A. Serrano in der Einleitung zu seiner spanischen Über-setzung von Aristoteles, Parva naturalia, Madrid 1993, S. 15, hin. 95 Vgl. Ludwig Baur in der Studie zu seiner Edition von Dominicus Gundissalinus, De divisione philo-sophiae, ed. cit., S. 209.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
164
quuntur autem ad hunc librum alii libri scientiae naturalis, in quibus tractatur de speciebus mobilium: puta in libro De caelo de mobili secundum motum localem, qui est prima spe-cies motus; in libro autem De generatione de motu ad formam et primis mobilibus, scilicet elementis, quantum ad transmutationes eorum in communi; quantum vero ad speciales eo-rum transmutationes, in libro Meteororum; de mobilibus vero mixtis inanimatis, in libro De mineralibus; de animatis vero, in libro De anima et consequentibus ad ipsum.96
Es findet sich hier nahezu dieselbe Abfolge des naturwissenschaftlichen Korpus des Aristo-teles, die wie bei Avicenna und Gundissalinus ausdrücklich über die Unterarten der geteilten Subjektgattung ‚beweglicher Körper‘ begründet wird. Diese Aufnahme des gundissalini-schen Anliegens bei Thomas macht auf ein interessantes Motiv in der Rezeptionsgeschichte des gundissalinischen Divisionsmodells aufmerksam. Denn obschon die Einleitungsliteratur im 13. Jahrhundert deutlich zurückgeht – als letzter großer Versuch in diesem Sinne kann Robert Kilwardbys in Kapitel 2.3. behandelter Traktat De ortu scientiarum gelten –, so wer-den gleichwohl charakteristische Anliegen derselben aufgegriffen. Dies gilt auch und in be-sonderer Weise für die Diskussion der partes der Wissenschaften, die zum zentralen Thema der Prologe in den großen Aristoteles-Kommentaren avancieren.97
Das boethianische didaskaliko,n der partes aus Abschnitt 2.2.5. wird damit zunächst für Gundissalinus, aber dann auch für weite Teile der lateinischen Tradition, in seiner Verbin-dung mit der über die arabische Philosophie, hier al-FÁrÁbÐ, vermittelten Einteilung der Phi-losophie am Leitfaden der aristotelischen Schriften zu einem festen Bestandteil der Wissens- und Wissenschaftstheorie. Species und partes und Gundissalinus’ expliziter Aristotelismus Insgesamt entwickelt Gundissalinus so mit den boethianischen Termini species und partes unter Aufnahme avicennischer und al-fÁrÁbÐscher Motive zwei wesentliche Bausteine der mittelalterlichen Wissens- und Wissenschaftstheorie. Dabei ist als Ergebnis festzuhalten, daß Gundissalinus im Falle der Subordinationstheorie Aristoteles letztlich nicht in allen Teilen folgt, sondern hier neben Boethius seinem persischen Gewährsmann Avicenna die Treue hält, über den er – aus guten Gründen, möchte man sagen – nicht mit Aristoteles hinausgeht. Denn auch Avicenna ist in seiner Subordinationstheorie, wie gezeigt, implizit aristotelisch, ja vielleicht ist seine Subordinationstheorie letzten Endes sogar konsequenter aristotelisch als die von Aristoteles in Analytica posteriora I vorgelegte Theorie selbst.98 Nicht ohne Grund hat die von Gundissalinus in der Aufnahme Avicennas entwickelte Subordinationstheorie denn auch nachweislich bis zu Thomas gewirkt, wo sie mit der vermeintlich aristotelischeren
____________________________________________________________________________________________
96 Thomas von Aquin, In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, ed. P. M. Maggiolo, Turin 1954, lib. I, lect. I, S. 3-4. 97 Auf diesen interessanten Prozeß weisen u.a. auch Francis Cheneval und Ruedi Imbach hin im Vorwort zu ihrer Ausgabe von Thomas von Aquin, Prologe zu den Aristoteles-Kommentaren, hrsg., übers. und eingel. von Francis Cheneval u. Ruedi Imbach, Frankfurt am Main 1993, S. LXVI. 98 Dies scheint zumindest zu folgen, wenn man Richard McKirahan, art. cit., S. 202, mit seiner weiter oben referierten These ernst nimmt, daß Aristoteles zunächst in der Unterscheidung von o[ti/dio,ti möglicherweise nur einen Nebenstrang seiner Argumentation sah, der seinen Nachfolgern, wenn nicht schon ihm selbst, dann jedoch zusehends zum Hauptstrang derselben wurde.
Subordination und Binnendifferenzierung der Wissenschaften
165
Position verquickt wird. Damit bleibt Gundissalinus also in Bezug auf seine Subordina-tionstheorie innerhalb eines impliziten Aristotelismus, der jedoch gleichsam aristotelischer zu sein scheint als die entsprechenden Ausführungen der Analytica posteriora.
Ganz und gar explizit aristotelisch ist dagegen Gundissalinus’ Binnendifferenzierung des Organon und der libri naturales, mit der, wie Anton-Hermann Chroust zu Recht bemerkt,99 erstmals in der Geschichte des lateinischen Westens ein genuin aristotelisches Wissen-schaftsprogramm erarbeitet wird.
Dabei läßt sich im Falle des Organon gewiß darüber streiten, ob Gundissalinus’ systema-tische Lesart desselben angemessen ist, doch steht außer Frage, daß Gundissalinus mit dieser Lesart über seine Quelle al-FÁrÁbÐ hinausgeht. So stellt diese Lesart bereits eine komplexe Rezeptionsgestalt aristotelischer Gedanken dar, die einen intrinsischen Zusammenhang zwi-schen den verschiedenen Teilen der Logik aufstellt, der das Aristoteles-Bild trotz seiner in-ternen Probleme über Thomas von Aquin bis an die Schwelle der Neuzeit prägen sollte. Auch im Falle der libri naturales gibt der Archidiakon von Cuéllar eine Interpretation des Zusammenhangs derselben, die durch die Erwähnung der Parva naturalia über die arabische Vermittlung durch al-FÁrÁbÐ hinausreicht. Dabei gelingt es ihm hier sogar, die aristotelische Position selbst aus den Meteorologica abzubilden. Zugleich gewinnt diese aristotelische Einteilung durch die avicennische Bestimmung der partes aus Unterkapitel 2.2.5. als Be-trachtung der verschiedenen Teile der gemeinsamen Subjektgattung eine solide theoretische Grundlage, die sich noch bei Thomas findet.
Im Falle der Binnendifferenzierung der Wissenschaften zeigt sich einmal mehr, wie das Zusammendenken der lateinisch-christlichen Tradition, namentlich Boethius’ und seiner didaskalika,, mit der arabischen Tradition, hier al-FÁrÁbÐ und Avicenna, zum Ausgangspunkt für die Integration explizit aristotelischer Elemente in die Wissens- und Wissenschaftstheorie wird. So deutet hier erneut einiges auf eine eigene Kenntnis des aristotelischen Opus in sei-ner arabischen Überlieferung durch Gundissalinus hin.
____________________________________________________________________________________________
99 Vgl. Anton-Hermann Chroust, „The Definitions of Philosophy in the De divisione philosophiae of Dominicus Gundissalinus“, in: New Scholasticism 25 (1951), S. 253-281, hier S. 254, weiter oben zitiert in Kapitel 3.1.
3.6. Die aristotelische Tripartition der praktischen Philosophie
Die im letzten Kapitel eröffnete Vergleichsperspektive zwischen Gundissalinus’ De divisione philosophiae, seinem Traktat De scientiis und dem diesem zugrundeliegenden KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm des al-FÁrÁbÐ erlaubt es schließlich, noch eine weitere, im ersten Teil (2.) dieser Arbeit nicht diskutierte Frage im Hinblick auf Gundissalinus’ expliziten Aristotelismus aufzugrei-fen, nämlich jene nach seiner Behandlung der praktischen Philosophie.
Die praktische Philosophie umschließt gleichsam wie eine Klammer die gesamte Divi-sionsschrift, indem sie gleich zu Beginn derselben zunächst im Prolog in Erscheinung tritt, um dann v.a. am Ende des Werkes, direkt im Anschluß an die Übersetzung der avicenni-schen Subordinationstheorie, genauer untersucht zu werden. Dabei nimmt Gundissalinus bereits im Prolog wesentliche Differenzierungen vor, wie etwa jene ihrem Kern nach ari-stotelische Fundamentalunterscheidung von praktischer und theoretischer Philosophie: „Par-tes igitur, in quas primum philosophia dividitur, hae sunt: scilicet theorica et practica.“1 Von diesen beiden reicht nach Gundissalinus erstere, also die theoretische Philosophie, nicht hin, vielmehr ist ihre Ergänzung, ja gleichsam Überbietung durch die praktische Philosophie geboten:
Sed quia ad consequendam futuram felicitatem non sufficit sola scientia intelligendi quid-quid est, nisi sequatur etiam scientia agendi quod bonum est: ideo post theoricam sequitur practica, quae similiter dividitur in tres partes.2
Mit diesem Zitat, das die Bedeutung der praktischen Philosophie für die Erreichung der (zu-künftig-jenseitigen) Glückseligkeit betont, leitet Gundissalinus zu einem weiteren, für die folgenden Darlegungen leitenden Theorieelement aus der aristotelischen Tradition über, nämlich der Tripartition der praktischen Philosophie (er selbst spricht von einer „tripartita scientia practica“).3 Diese beschreibt er im Prolog der Divisionsschrift folgendermaßen:
Quarum una est scientia disponendi conversationem suam cum omnibus hominibus [...] et haec dicitur politica scientia et a Tullio ‚civilis ratio‘ vocatur. – Secunda est scientia disponendi domum et familiam propriam; per quam cognoscitur qualiter vivendum sit homini cum uxore et filiis et servis et cum omnibus domesticis suis et haec scientia voca-tur ordinatio familiaris. – Tertia est scientia, qua cognoscit homo ordinare modum pro-prium sui ipsius secundum honestatem [...] et haec scientia dicitur ethica sive moralis.4
Mit dieser Tripartition macht sich der spanische Archidiakon eine Einteilung der praktischen Philosophie zu eigen, die – wie bereits vorweggenommen wurde – in der aristotelischen Tradition verortet wird und sogar – in einer noch zu präzisierenden Weise – als eines der zentralen Lehrstücke des Stagiriten zur praktischen Philosophie gelten kann.
____________________________________________________________________________________________
1 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 12. – Siehe für die entsprechende Unter-scheidung beim Stagiriten z.B. Aristoteles, Über die Seele, mit. Einl., Übers. u. Komm. hrsg. von Horst Seidl, Hamburg 1995, III, 9, 432b 27 - 433a 1, S. 190/191. 2 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 16. – Hier verkehrt sich allerdings bereits, vermutlich unter dem Einfluß christlicher Motive, die aristotelische Bewertung aus dem zehnten Buch der Nikomachischen Ethik von bi,oj qewrhtiko,j einerseits und bi,oj politiko,j andererseits. 3 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 17. 4 Ibid., S. 16.
Die Tripartition der praktischen Philosophie
168
Es ist nun genau diese Tripartition, die Gundissalinus am Ende seines Werkes erneut auf-greifen und dort mit dem Namen des Aristoteles selbst in Verbindung bringen wird. Bevor die Untersuchung jedoch zu diesem letzten Kapitel der Divisionsschrift voranschreitet, das sich zu weiten Teilen aus al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm bzw. dem Traktat De scientiis speist, gilt es zunächst, der Tripartition der praktischen Philosophie bei Aristoteles und in der mittelalterlichen Tradition kurz nachzuspüren. Die Tripartition der praktischen Philosophie bei Aristoteles Tatsächlich scheint die Tripartition der praktischen Philosophie älter zu sein als Aristoteles. So finden sich bereits in Platons Protagoras 318e-319a mit der Unterscheidung von oivkei,a, oivki,a und po,lij deutliche Spuren eines solchen Konzepts.5 Aristoteles kann also kaum als Vater dieser Unterscheidung gelten, ja diese findet sich noch nicht einmal in der wün-schenswerten Ausdrücklichkeit bei ihm. Die einzige mehr oder weniger explizite Belegstelle für die Tripartition im ganzen Opus des Aristoteles bietet neben einer Bemerkung in der Eudemischen Ethik6 das sechste Buch der Nikomachischen Ethik – das Gundissalinus ja, wie in 3.3. gezeigt, zu kennen scheint –, wo es heißt: „Indessen kann es vielleicht ein eigenes Bestes (to. autou/ eu=) für niemanden ohne Haushaltskunst (oivkonomi,a) und Staatskunst (politei,a) geben.“7
Doch auch wenn Aristoteles nicht der Begründer der tripartiten praktischen Philosophie zu sein scheint und seine Ausführungen zur Tripartition selbst eher sparsam sind, so kommt ihm dennoch innerhalb der Geschichte der tripartiten praktischen Philosophie eine herausra-gende Stellung zu, insofern nämlich als er den ersten Versuch einer integrativen Systemati-sierung ihrer drei Bestandteile: Ethik, Ökonomik und Politik, vornimmt. So ist für den Leser der Nikomachischen Ethik bereits ab den ersten Seiten klar, daß diese in engstem systemati-schem Bezug zur Politik (und auch Ökonomik) steht. Entsprechend heißt es hier:
Allem Anschein nach gehört es [d.h. das Thema der Ethik] der maßgebendsten und im höchsten Sinne leitenden (avrcitektonikh,) Wissenschaft an, und das ist offenbar die Staatskunst (politikh,). Sie bestimmt, welche Wissenschaften oder Künste und Gewerbe in den Staaten vorhanden sind [...] Auch sehen wir, daß die geschätztesten Vermögen: die Strategik, die Ökonomik (oivkonomikh,), die Rhetorik, ihr untergeordnet sind. Da sie also die übrigen praktischen Wissenschaften in den Dienst ihrer Zwecke nimmt, auch autoritativ vorschreibt, was man zu tun und was man zu lassen hat, so dürfte ihr Ziel (te,loj) die Ziele der anderen als das höhere umfassen, und dieses ihr Ziel wäre demnach das höchste
____________________________________________________________________________________________
5 In Schleiermachers Übersetzung lautet die entsprechende Stelle: „Diese Kenntnis aber ist die Klugheit in seinen eigenen Angelegenheiten (oivkei,a), wie er sein Hauswesen (oivki,a) am besten verwalten, und dann auch in den Angelegenheiten des Staats (po,lij), wie er am geschicktesten sein wird, diese sowohl zu führen als auch darüber zu reden.“ (Platon, Werke I, gr.-dt. hrsg. von Gunther Eigler, Darmstadt 1977, S. 111) 6 Vgl. die Eudemische Ethik I, 8, 1218b 13-14: „Das aber ist das Ziel, welches in den Bereich jener Wissen-schaft gehört, die autoritativ über allen (anderen) steht. Und zwar bedeutet dies (dreierlei): Wissenschaft des Staatsmanns (politikh,,), der Hauswirtschaft (oivkonomikh,) und der praktischen Einsicht (fro,nhsij).“ (Aristo-teles, Eudemische Ethik, übers. u. komm. von Franz Dirlmeier, Berlin 1979, S. 17) 7 Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, hrsg. u. übers. von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main 1998, 9, 1142a 9-10, S. 42/43.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
169
menschliche Gut (avgaqo,n). Denn wenn dasselbe auch für den einzelnen und für das Ge-meinwesen das gleiche ist, so muß es doch größer und vollkommener sein, das Wohl des Gemeinwesens zu begründen und zu erhalten. Man darf freilich schon sehr zufrieden sein, wenn man auch nur einem Menschen zum wahren Wohle verhilft, aber schöner und göttli-cher ist es doch, wenn dies bei einem Volke oder Staate geschieht. Darauf also zielt die gegenwärtige Disziplin ab, die ein Teil der Staatslehre ist (politikh, tij ou=sa).8
Mit diesen Sätzen relationiert Aristoteles Ethik, Ökonomik und Politik dergestalt, daß letz-tere zum einheitsstiftenden Moment der verschiedenen Teile der praktischen Philosophie wird. Diese Integrationsgestalt der Politik wird in der Nikomachischen Ethik auch im weite-ren, etwa I, 2, 1095a 14-17, wiederholt gefestigt und mündet in der Schlußperspektive des letzten Buches derselben in die Feststellung, daß als Weiterführung der bis dahin vorgelegten Überlegungen nun die Ausarbeitung einer Schrift zur Politik erforderlich sei, um die, wie es X, 10, 1181b 15-16 heißt, „Philosophie von den menschlichen Dingen“ (h` peri. ta. avnqrw,pina filosofi,a) abzuschließen. Trotz der z.T. sehr starken Formulierung des Aristo-teles ist Otfried Höffe zuzustimmen, wenn er angesichts dieser Integrationsfunktion der Po-litik betont, daß Aristoteles mit ihr nicht einen absoluten Primat der Politik gegenüber der Ethik im Auge hat, wie Eugen Rolfes’ Übersetzung von politikh, tij ou=sa als „Teil der Staatslehre“ zu suggerieren vermag, sondern weiterhin an einem differenzierten Wissen-schaftsmodell auch für die praktische Philosophie festhält.9 So ist die Sonderstellung der Politik bei Aristoteles keinesfalls dahingehend zu verstehen, daß Ethik und Ökonomik ge-genüber der Politik rein untergeordnete Phänomene sind, die sich gleichsam, wie dies etwa im platonischen Modell der Politeia geschieht, in diese hinein auflösen.10 Ganz im Gegenteil besitzt die Ethik durchweg Grundlagencharakter auch und gerade für die Politik, indem sie die geteilten normativen Grundkonzepte entwickelt. So ist die Integrationsfunktion der Poli-tik für die praktische Philosophie weniger als Hierarchisierung oder gar Subordination zu verstehen, sondern als Ausdruck der engen Verklammerung beider sowie der Ökonomik in Bezug auf das alle drei umfassende Ziel (te,loj): das höchste Gut (avgaqo,n), wie es in dem zitierten Passus heißt, d.h. die Eudämonie. Die Explizierung genau dieser – teleologischen – Verklammerung der drei Disziplinen als selbständiger und doch aufeinander bezogener ist im Hinblick auf frühere, aber auch spätere Positionen das spezifisch aristotelische Verdienst innerhalb der Entwicklung der Tripartition der praktischen Philosophie, die damit allererst systematischen Charakter für die Wissens- und Wissenschaftstheorie gewinnt.11 ____________________________________________________________________________________________
8 Aristoteles, Philosophische Schriften III, nach der Übers. von Eugen Rolfes, bearb. von Günther Bien, Hamburg 1995, I, 1, 1094a 26 - 1094b 11, S. 2. 9 Vgl. die Einführung in Otfried Höffe (Hrsg.), Aristoteles’ ‚Politik‘, Berlin 2001, S. 5-19, hier bes. S. 17-19. 10 Die relative Selbständigkeit der in Ethik, Ökonomik und Politik betrachteten Sachverhalte betont Aristote-les gleich zu Beginn der Politik I, 1, 1252a 7-10: „Die nun meinen, daß zwischen dem Leiter eines Freistaates oder eines Königreichs, einem Hausvater und einem Herrn kein wesentlicher Unterschied bestehe, haben Unrecht. Sie glauben nämlich, diese verschiedenen Inhaber verschiedener Gewalten unterschieden sich je nach der großen oder kleinen Zahl, aber nicht der Art (ei=doj) nach [...]“ (Aristoteles, Philosophische Schriften IV, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995, S. 1) – Vgl. gegen die Interpretation des Verhältnisses von Ethik und Politik bei Aristoteles im Sinne eines Auflösungsmodells der Ethik in die Politik auch die Stel-lungnahme von Hellmut Flashar, „Ethik und Politik in der Philosophie des Aristoteles“, in: Gymnasium 78 (1971), S. 278-293. 11 So auch Francisco Bertelloni, „Les schèmes de la philosophia practica antérieurs à 1265: Leur vocabu-laire concernant la Politique et leur rôle dans la réception de la Politique d’Aristote“, in: Jacqueline Hamesse
Die Tripartition der praktischen Philosophie
170
Genau diese Systematisierungsleistung des Aristoteles sollte jedoch in der Tradierung der Dreiteilung der praktischen Philosophie wieder verlorengehen. So taucht die Dreiteilung auch noch nach Aristoteles etwa in der Kommentar-Tradition des Ammonios u.a. auf, und zwar auch und gerade unter Zuschreibung zum Stagiriten,12 doch nirgends ist der Versuch erkennbar, die drei verschiedenen Teile aufeinander zu beziehen und so ihren systematischen Zusammenhang herauszustellen.13 Die lateinische und arabische Tradierung der Tripartition bei Gundissalinus Die Überlieferung der Tripartition der praktischen Philosophie im Kontext der Kommenta-torenschule v.a. des Ammonios ist ihrerseits der Anknüpfungspunkt für die lateinische und arabische Geschichte der Dreiteilung. Sowohl in der lateinischen als auch in der arabischen Tradition ist die aristotelische Tripartition der praktischen Philosophie damit in einer be-stimmten Lesart, die allerdings die für Aristoteles charakteristische Frage nach dem syste-matischen Zusammenhang der drei Disziplinen ausblendet, schon vor und mehr oder weniger unabhängig von der Rezeption der aristotelischen libri morales gegenwärtig.
Für die lateinische Tradition sind es besonders Boethius, Cassiodor und Isidor von Se-villa, die das Tripartitionsschema des Ammonios in der im folgenden kurz zu skizzierenden Weise weiterreichen. So schreibt zunächst Boethius in seinem Porphyrius-Kommentar – also genau jener Literargattung, in der auch die Tripartitionen des Ammonios und des Elias er-scheinen:14
Practicae vero philosophiae [...] triplex est divisio. Est enim prima, quae sui curam gerens cunctis sese erigit, exornat augetque virtutibus [...] Secunda vero est, quae rei publicae cu-ram suscipiens cunctorum saluti suae providentiae sollertia et iustitiae libra et fortitudinis stabilitate et temperantiae patientia medetur; tertia vero, quae familiaris rei officium me-diocri componens dispositione distribuit.15
Bei Boethius tritt damit der auch von Gundissalinus verwandte Terminus der „practica phi-losophia“ als Oberbegriff dreier Disziplinen auf, die allerdings vom Anicier nicht weiter benannt werden. Die entsprechenden Erklärungen lassen jedoch keinen Zweifel daran, daß es sich hier um Ethik, Politik und Ökonomik handelt. Dies ist aber genau die uns interessie-rende aristotelische Tripartition, auch wenn man hier die für Aristoteles typische Reflexion auf den Zusammenhang der drei Disziplinen vergeblich sucht.
____________________________________________________________________________________________
u. Carlos Steel (Hrsg.), L’élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge, Turnhout 2000, S. 171-202, hier bes. S. 176-179. 12 Siehe etwa Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers. u. hrsg. von Otto Apelt, bearb. von Hans Günther Seidl, Hamburg 21967, V, 28, S. 257. 13 Vgl. die beiden Aristoteles-Kommentatoren Ammonios Hermeiou, In Porphyrii Isagogen sive V voces, ed. Adolf Busse (CAG IV, 3), Berlin 1891, S. 15, und Elias, In Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias commentaria, ed. Adolf Busse (CAG XVIII, 1), Berlin 1900, S. 31. 14 Auf die Bedeutung des Ammonios Hermeiou für Boethius ist bereits in 2.2.5. hingewiesen worden. 15 Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta, ed. Samuel Brandt (CSEL XLVIII), Lipsiae 1906, Ia ed., lib. I, cap. 3, S. 9.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
171
Deutlicher und für die lateinische Tradition wirkungsmächtiger sind die Äußerungen Cassiodors, der den drei praktischen Wissenschaften ihre jeweiligen Bezeichnungen zuord-net:
Moralis dicitur, per quam mos vivendi honestus appetitur, et instituta ad virtutem tendentia praeparantur. Dispensitiva dicitur, domesticarum rerum sapienter ordo dispositus. Civilis dicitur, per quam totius civitatis administratur utilitas.16
Mit dieser Begrifflichkeit: „moralis“, „dispensitiva“ und „civilis“, die sich auch bei Gun-dissalinus in den Bemerkungen zur Dreiteilung aus dem Prolog findet, sollte Cassiodor die Gestalt der Tripartition für das lateinische Mittelalter dauerhaft prägen. Der Einfluß dieser Formulierung läßt sich u.a. auch daran ermessen, daß sie von Isidor später in seinen Etymo-logiae, lib. II, 24, 16, wörtlich aufgegriffen werden sollte. Allerdings fehlt auch in dieser entwickelteren Formulierung jeder Hinweis auf den Zusammenhang der drei praktischen Wissenschaften, diese werden nur en passant hintereinandergereiht.
Über diese drei bedeutenden Vermittlungsgestalten bleibt die aristotelische Tripartition zumindest als Juxtaposition dreier Namen bis in Gundissalinus’ Zeit hinein wach. Dies ver-deutlicht auch das Beispiel des Wilhelm von Conches, in Bezug auf den in den Kapiteln 2.1. und 2.2.5. dieser Arbeit bereits auf Berührungspunkte mit Gundissalinus hingewiesen wurde. Dieser schreibt im accessus zu seiner Timaios-Glosse:
Practicae vero sunt tres species: ethica de instructione morum – ethis enim est mos –, echonomia id est dispensativa – unde echonomus id est dispensator –, haec docet qualiter unusquisque propriam familiam debeat dispensare, politica id est civilis – polis enim est civitas –, haec docet qualiter res publica tractetur.17
Damit trägt Wilhelm zugleich in interessanter Weise den griechischen Ursprüngen dieser Einteilung Rechnung und dokumentiert einen impliziten Aristotelismus, der bis ins 12. Jahr-hundert und damit unmittelbar bis an die Schwelle der lateinischen Aristoteles-Rezeption heranreicht.
Trotz dieser eindeutigen Präsenz der Tripartition in der lateinisch-christlichen Tradition läßt schon ein flüchtiger Vergleich zwischen Gundissalinus und diesen Autoren erkennen, daß der spanische Archidiakon sich zumindest für die inhaltliche Füllung der drei Wissen-schaften nicht an diesen Autoren orientiert, die sonst – wie im ersten Teil (2.) dieser Arbeit gezeigt – zu seinen Hauptquellen gehören. Begrifflich steht er ihnen freilich nahe, wie die Verwendung der Bezeichnungen „philosophia practica“: „moralis“, „dispensativa“ und „scientia civilis“ zeigt, die er signifikanterweise gegenüber den lateinischen Autoren in ihrer Reihenfolge verkehrt. Daß er die lateinische Tradition der Tripartition kennt, geht im übrigen unzweifelhaft aus seinem Hinweis auf Cicero bei der Bestimmung der Politik hervor.18
____________________________________________________________________________________________
16 Cassiodor, De artibus et disciplinis liberalium litterarum, PL 70, cap. III, Sp. 1169. 17 Vgl. Wilhelm von Conches, Glosae super Platonem, ed. Édouard Jeauneau, Paris 1965, S. 60. 18 So hieß es in dem eingangs angeführten Zitat aus Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 16: „[...] et haec dicitur politica scientia et a Tullio ‚civilis ratio‘ vocatur.“ – Der Herausgeber gibt keine Quelle an; prinzipiell kommen zwei Stellen aus Ciceros Werk in Frage, nämlich zum einen Cicero, De inventione, hrsg. u. übers. von Theodor Nüßlein, Düsseldorf u. Zürich 1998, lib. I, 5, S. 18: „civilis quaedam ratio est, quae multis et magnis ex rebus constat“, zum anderen interessanterweise eine Stelle in dem nur sehr fragmentarisch überlieferten Traktat Cicero, De re publica, hrsg. u. übers. von Karl Büchner, Düsseldorf u.
Die Tripartition der praktischen Philosophie
172
Doch schließt sich Gundissalinus zumindest bei seiner Beschreibung der tripartiten prak-tischen Philosophie aus dem Prolog nicht unmittelbar diesen Autoren an, sondern folgt arabi-schen Vorbildern. So findet sich die Tripartition der praktischen Philosophie in der arabi-schen Welt bei zahlreichen Autoren, so z.B. neben Avicenna19 bei al-ÇazzÁlÐ in dessen von Gundissalinus und Magister Johannes unter dem Titel Summa theoricae philosophiae über-setztem Werk MaqÁÒid al-falÁsifa. Dieses Werk liefert denn auch, wie Ludwig Baur zeigen konnte, die Vorlage für nahezu die gesamte Beschreibung der drei praktischen Disziplinen in Gundissalinus’ Prolog. So heißt es in Gundissalinus’ Übersetzung des arabischen Philoso-phen und Theologen, die Gundissalinus in der Divisionsschrift fast wörtlich kopiert:
[Scientia] activa enim dividitur in tria; quorum unum est scientia disponendi conversatio-nem suam cum omnibus hominibus [...] Secundum est scientia disponendi domum pro-priam, per quam cognoscitur qualiter sibi vivendum sit cum uxore, et filiis, et servis, et cum omnibus domesticis suis. Tertium est scientia moralis qua cognoscitur qualis in se debeat esse homo.20
Wie ein kurzer Blick auf die eingangs zitierten Sätze aus De divisione hinreichend erkennen läßt, geht Gundissalinus zumindest im Prolog dieses Werkes systematisch kaum über seine arabische Vorlage hinaus, auch wenn er die Namen der einzelnen Wissenschaften ergänzt. Denn so wie in der arabischen und auch lateinisch-christlichen Tradition insgesamt fehlt zumindest an dieser Stelle auch bei Gundissalinus ein weiterführendes systematisches In-teresse an der Verzahnung der drei Disziplinen der Ethik, Ökonomik und Politik untereinan-der, das aber, wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, gerade das Spezifikum der aristotelischen Tripartition ausmacht. Mit Blick auf den Prolog hat Georg Wieland von daher gewiß Recht, wenn er beklagt, daß in Gundissalinus’ Divisionsschrift „genauere Angaben über das Verhältnis dieser Disziplinen zueinander, insbesondere über deren relative Einheit in der Politik entsprechend der aristotelischen Konzeption [fehlen]“, was ihn letztlich zu der Feststellung führt, daß das „Resultat seiner [= des Gundissalinus] eigenen Bemühungen ent-sprechend dürftig [aus]fällt“.21 Gundissalinus’ Berufung auf den aristotelischen Zusammenhang von Ethik und Politik Mit den im vorangegangenen skizzierten Entwicklungen situiert sich Gundissalinus zunächst in dem nur wenig interessanten, aber für die arabische und lateinische Welt dominanten Feld, das durch die nominelle Aufrechterhaltung der aristotelischen Tripartition bei gleichzeitiger Aufgabe ihrer systematischen Implikationen gekennzeichnet ist. Eine deutlich andere Seite der gundissalinischen Konzeption von praktischer Philosophie läßt sich allerdings aus sei-____________________________________________________________________________________________
Zürich 1993, lib. III, 4, S. 170: „minime quidem contemnenda, ratio civilis et disciplina populorum“. Isidor von Sevilla ist diese Schrift noch voll zugänglich, was ihre Präsenz auf der Iberischen Halbinsel belegt. 19 In diesem Zusammenhang weist Ludwig Baur in seiner Studie zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 346, auf den Tractatus de divisionibus scientiarum, Venetiis 1546, hin, den Gun-dissalinus, wie Baur anmerkt, jedoch nicht gekannt haben dürfte. 20 Al-ÇazzÁlÐ, Algazel’s Metaphysics. A Mediaeval Translation, ed. Joseph Thomas Muckle, Toronto 1933, S. 2. 21 Georg Wieland, ‚Ethica‘ – ‚Scientia practica‘. Die Anfänge der philosophischen Ethik im 13. Jahrhun-dert, in: BGPhMA, N.F. 21, Münster 1981, S. 26 u. S. 27.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
173
nem Schlußkapitel der Divisionsschrift ersehen, zumal wenn man dieses mit dem ihm zugrundeliegenden KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm des al-FÁrÁbÐ vergleicht.
Was die Struktur dieses Kapitels in De divisione im Vergleich zur Schrift des al-FÁrÁbÐ anbelangt, so ist zunächst bereits bemerkenswert, daß Gundissalinus zwar zu weiten Teilen al-FÁrÁbÐ bzw. seine Adaptation desselben aus De scientiis heranzieht, daß indessen die Tri-partition der Wissenschaften, die dieses Kapitel gliedert, nicht von al-FÁrÁbÐ herkommt, son-dern von Gundissalinus an diesen gleichsam angelegt wird. So beginnt das Kapitel bei Gun-dissalinus folgendermaßen:
De partibus practicae philosophiae. Quarum prima scientia est gubernandi civitatem, quae dicitur politica sive civilis ratio. Civilis enim scientia inquirit de speciebus actionum et consuetudinum voluntariarum et de habitibus et moribus et gestibus, a quibus procedunt illae actiones consuetudines.22
Die ersten zwei Sätze dieses Zitates sind des Gundissalinus’ eigene Zutat. Erst mit dem drit-ten Satz beginnt ein langes Zitat aus De scientiis bzw. al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm, das der Bestimmung der Politik gewidmet ist. Schon innerhalb dieser Bestimmung der Politik, die den Hauptteil des Kapitels ausmacht, finden sich dann aber auch längere, nicht von al-FÁrÁbÐ übernommene Ausführungen, deren Quelle bislang unbekannt ist. Unter anderem geht es hier um die Einrichtung von öffentlichen Verwahrungsanstalten für krankheitsbedingt nicht inte-grationsfähige Mitglieder der Gesellschaft; Gundissalinus opponiert dabei vehement gegen die Tötung dieser Personen und führt ins Feld, daß deren Unterhalt der Gemeinschaft kaum Kosten verursache, da ihre Verwandten, sofern vorhanden, für die Unterbringung aufkom-men müßten.23
Ebenfalls nicht aus al-FÁrÁbÐ stammt die folgende, im Anschluß an die Erklärungen zur Politik gegebene Bestimmung der Ökonomik, des zweiten Teils der Tripartition also:
Secunda est scientia regendi familiam propriam [yconomica, add. ms. Cambridge, H.h. 4, 13], quae tribus modis regitur, videlicet: [...] disciplina a vitiis corrigendo, sollicitudo eo-rum necessitatibus subveniendo, doctrina vero eos honestis artibus instruendo, alios siqui-dem liberalibus, alios fabrilibus prout quemque docet.24
Hier nutzt Gundissalinus die Gelegenheit, in einer weiteren Passage auch die mechanischen Künste genauer einzuführen. Dieser Teil ist allerdings gegenüber der Politik um ein Vielfa-ches kürzer.
Dies gilt in noch stärkerem Maße für die äußerst knappen Anmerkungen zur Ethik, den dritten Teil der Tripartition, der ebenfalls über al-FÁrÁbÐ hinausgeht:
Tertia est gubernatio sui ipsius [ethica, add. ms. Cambridge, H.h. 4, 13]. Cui tria sunt ne-cessaria, scilicet: fuga vitiorum, exercitium virtutum et exempla meliorum.25
Damit ist die Aufzählung der Bestandteile der Tripartition komplett. In Bezug auf Ökonomik und Ethik sind die inhaltlichen Ausführungen des Gundissalinus dabei insgesamt, wie auch Georg Wieland und andere feststellen, gewiß sehr mager und gehen letztlich kaum über die
____________________________________________________________________________________________
22 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 134. 23 Vgl. ibid., S. 137. 24 Ibid., S. 139. 25 Ibid., S. 140.
Die Tripartition der praktischen Philosophie
174
in der lateinischen Welt auch bei anderen Autoren bekannten Grundlagen hinaus.26 Aller-dings hat Francisco Bertelloni darauf aufmerksam gemacht, daß Gundissalinus hier erstmals in der lateinischen Tradition zur Beschreibung der drei praktischen Disziplinen auf den ihnen jeweils eigentümlichen ‚Unterwerfungszusammenhang‘ rekurriert, indem er die Politik als „scientia gubernandi civitatem“, die Ökonomik als „scientia regendi familiam“ und die Ethik als „gubernatio sui ipsius“ (meine Hervorhebungen) charakterisiert,27 womit Gundissalinus systematisch die Anfangsüberlegungen aus der aristotelischen Politik aufgreift.28 Für den vorliegenden Zusammenhang von größerer Bedeutung ist jedoch, daß Gundissalinus mit diesen Bemerkungen zur Ökonomik und Ethik gegen seine Vorlage al-FÁrÁbÐ, der allein die Politik behandelt, die Tripartition durchsetzt,29 die er zuvor im Anschluß an al-ÇazzÁlÐ vorge-bracht hat und aller Wahrscheinlichkeit nach, wie eingangs bemerkt, auch aus dem sechsten Buch der Nikomachischen Ethik kennt. Denn damit nimmt Gundissalinus eine Umformung seiner Vorlage ganz im Geiste der aristotelischen Einteilung vor, die belegt, daß die Politik für ihn in engstem Zusammenhang mit den übrigen praktischen Wissenschaften steht und anders als bei al-FÁrÁbÐ nicht unabhängig von diesen behandelt werden kann.
Daß Gundissalinus der aristotelischen Ethik für die vorliegende Strukturierung des Kapi-tels zur praktischen Philosophie tatsächlich eine bedeutende Rolle zudenkt, die deutlich über al-FÁrÁbÐ hinausweist, ergibt sich auch aus einer weiteren, für den gegenwärtigen Zusam-menhang zentralen Stelle des Kapitels, die Gundissalinus’ Konzeption des Zusammenhangs von Ethik und Politik offenbart. So heißt es innerhalb der von al-FÁrÁbÐ übernommenen Be-stimmung zur Politik bei Gundissalinus:
Et haec quidem scientia continetur in libro Aristotelis, qui Politica dicitur, et est pars Ethicae.30
Diese Stelle ist philosophiehistorisch höchst bedeutsam, da hier zum ersten Mal in der latei-nischen Tradition31 überhaupt von der Politik des Aristoteles die Rede ist.32 Was nun ihre auch systematische Bedeutung anbelangt, so will Wieland, dem sich weitere Kritiker, wie ____________________________________________________________________________________________
26 Siehe Georg Wieland, op. cit., S. 26, sowie Francisco Bertelloni, „Presupuestos de la recepción de la Politica de Aristóteles“, in: Fernando Domínguez u.a. (Hrsg.), Aristotelica et lulliana, magistro Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, Steenbrügge 1995, S. 34-54, hier S. 45-46. 27 Vgl. Francisco Bertelloni, „Presupuestos de la recepción de la Politica de Aristóteles“, art. cit., S. 47, sowie id., „Les schèmes de la philosophia practica antérieurs à 1265: Leur vocabulaire concernant la Politi-que et leur rôle dans la réception de la Politique d’Aristote“, art. cit., S. 185. 28 Vgl. die weiter oben in diesem Kapitel in Anm. 10 zitierte Passage aus Aristoteles’ Politik I, 1, 1252a 7-10. 29 Darauf verweist auch Alessandro Levi, „La partizione della filosofia pratica in un trattato medioevale“, in: Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 67/2 (1907-1908), S. 1225-1250, hier S. 1236. – Die-ser Artikel bietet sonst gegenüber der Studie von Ludwig Baur und seinen Beobachtungen zur praktischen Philosophie in Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 308-313 und passim aller-dings kaum Neues. 30 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 136. 31 Die erste lateinische Übersetzung der Politik legt Wilhelm von Moerbeke um 1260 vor. Siehe für die Erstfassung derselben Aristoteles latinus, Politica (Libri I-II, 11), ed. Petrus Michaud-Quantin (Aristoteles latinus XXIX, 1), Brügge u. Paris 1961. 32 James Schmidt, „A Raven with a Halo: The Translation of Aristotle’s Politics“, in: History of Political Thought 7 (1986), S. 295-319, hat daher Unrecht, wenn er S. 298 kategorisch behauptet, es gebe vom 5. bis zum 13. Jahrhundert keine ausdrücklichen Bezugnahmen in der lateinischen Literatur auf die Politik.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
175
Bertelloni, angeschlossen haben, in diesem Passus jedoch nurmehr einen weiteren Beweis der Dürftigkeit der gundissalinischen Konzeption sehen.33 Denn hatte zuvor im Prolog jeder Hinweis auf einen Zusammenhang von Politik und Ethik gefehlt, so sei dieser nun zwar ge-geben, doch so, „daß die aristotelische Intention gerade umgekehrt wird“.34 Bevor dies im folgenden genauer bewertet werden kann, gilt es zunächst, einen Blick auf dieselbe Stelle in Gundissalinus’ De scientiis und al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm sowie Gerhards Übersetzung desselben zu tun. Denn anders als noch Ludwig Baur glaubte, handelt es sich bei dem soeben angeführten Text nicht einfachhin um ein Zitat aus al-FÁrÁbÐ.35 Gundissalinus’ Rede von der Politik als Teil der Ethik und das aristotelische Konzept Die drei mit De divisione zu vergleichenden Texte lauten nebeneinander gestellt wie folgt:
a) Gundissalinus’ De scien-tiis:
Et haec quidem scientia continetur in libro qui Poli-tica dicitur. Et est pars Ethicae.36
b) al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm:
All dies ist enthalten im Buch der Politik, d.h. im Buch der Regierung des Ari-stoteles und im Buch der Regierung Platons sowie in weiteren Büchern Platons und anderer Autoren.37
c) Gerhards Übersetzung:
Et hoc quidem est in libro qui Politica dicitur, et est liber Ethicae Aristotelis. Et est iterum in libro Ethicae Platonis, et in libris Platonis et aliorum.38
a) Zuerst zum Traktat De scientiis; dieser befindet sich in relativer Übereinstimmung mit De divisione. Allein es fehlt – aus Gründen, die sich nicht rekonstruieren lassen – in nahezu allen Handschriften bis auf eine (Erfurt, Amplon., Q. 295) die Zuschreibung der Politik zu Aristoteles. Gleichwohl ist die Filiation zwischen De divisione und De scientiis hier eindeu-tig.
b) Gleich mehrere signifikante Abweichungen sind dagegen zu beobachten, wenn man diesen beiden Texten al-FÁrÁbÐs Original gegenüberstellt: Zum einen spricht al-FÁrÁbÐ über-haupt nicht von Aristoteles’ Ethik wie Gundissalinus, vielmehr gibt er mit dem zweiten Halbsatz explikativ an, daß es sich bei dem griechischen Titel Politik um das Buch der Re-gierung (KitÁb as-siyÁsa) handelt. Dieses, und nicht der Titel aus dem ersten Halbsatz, wird dann Aristoteles zugeschrieben (was bei al-FÁrÁbÐ keine Konsequenzen hat, da beide iden-tisch sind, wohl aber bei Gundissalinus). Entsprechend ist bei al-FÁrÁbÐ auch nicht von Teil-
____________________________________________________________________________________________
33 Vgl. Francisco Bertelloni, „Presupuestos de la recepción de la Politica de Aristóteles“, art. cit., S. 46. 34 Georg Wieland, op. cit., S. 26. 35 Siehe seine entsprechenden Anmerkungen im Apparat zu Dominicus Gundissalinus, De divisione philo-sophiae, ed. cit., S. 136. 36 Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 138. 37 Al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. Ángel González Palencia, Madrid 21953, S. 70 der spanischen Übersetzung. 38 Gerhards Übersetzung in al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 170.
Die Tripartition der praktischen Philosophie
176
verhältnissen die Rede. Die zitierte Erwähnung der Ethik sowie ihre Relationierung mit der Politik ist also ganz Gundissalinus’ eigene Leistung und unterstreicht noch einmal die Be-deutung, welche die Nikomachische Ethik offensichtlich für Gundissalinus bereits besitzt. Zum anderen setzt al-FÁrÁbÐ Aristoteles’ Schrift die platonische Politeia zur Seite. Dies ist damit zu erklären, daß die aristotelische Politik vermutlich niemals in arabischer Sprache vorlag, so daß ihre Stelle im aristotelischen Korpus faktisch von der Politeia Platons besetzt wurde.39 Noch Averroes schreibt auf den ersten Seiten seines Kommentars zu Platons Poli-teia, daß er diese Schrift kommentiert, da er der aristotelischen Politik nicht habhaft werden konnte (entsprechend liegt uns kein Kommentar des Cordobesen zu Aristoteles’ Politik vor).40 Diesen Hinweis auf Platon unterdrückt Gundissalinus. Der Archidiakon nimmt damit al-FÁrÁbÐ gegenüber bereits in De scientiis und dann in De divisione zwei entscheidende Eingriffe in den Text vor, deren erster, d.h. die Relationierung von Politik und Ethik, even-tuell noch durch eine irrige Übersetzung erklärt werden kann (aber selbst dann stellt dies natürlich immer noch eine bemerkenswerte Interpretationsleistung dar); der zweite Eingriff scheint dagegen eine gewollte Entscheidung des Archidiakons gegen Platons Schriften wie-derzugeben. So stand ja bereits in De immortalitate programmatisch zu lesen, daß die Ar-gumente Platons übergangen werden sollten:41 hier nun macht Gundissalinus seine ‚Dro-hung‘ offensichtlich wahr. Die politische Theorie stellt er so exklusiv in den Kontext der aristotelischen Philosophie, womit er zugleich deutlich über die arabische Tradition hinaus-geht, ja sich von dieser abwendet, insofern diese in all ihren Kommentaren zur politischen Theorie stets Platons Politeia verpflichtet blieb, wie nicht zuletzt das Beispiel des Averroes deutlich macht.
c) Daß der Passus des al-FÁrÁbÐ zu Platon auch Gundissalinus in seiner arabischen Hand-schrift des KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm vorlag, kann kaum bezweifelt werden, zumal dies für Ger-hard, der das Werk nur wenig später ebenfalls in Toledo übersetzte, offensichtlich der Fall ist. Einerseits gibt Gerhard al-FÁrÁbÐ vollständig wieder und akzeptiert – gegen Gundissali-nus – auch Platon als Autorität in der praktischen Philosophie. Andererseits folgt er dann doch Gundissalinus’ idiosynkratischer Lesart von „Ethik“ für „Politik“, wobei er allerdings in gewisser Weise hinter Gundissalinus zurückbleibt, indem er dessen Rede von der Politik als pars der Ethik aufgibt und statt dessen mit al-FÁrÁbÐ den Satz explikativ konstruiert, so daß Politik und Ethik hier zu Synonymen werden.
Demgegenüber ist Gundissalinus’ Übersetzung in Bezug auf die von Georg Wieland kri-tisierte Stelle zur Politik als Teil der Ethik systematisch deutlich raffinierter. Es ist durchaus möglich, daß Gundissalinus’ und Gerhards Lesart zunächst auf eine Fehlübersetzung von KitÁb as-siyÁsa zurückgeht und die „Regierung“ im Sinne von jener „gubernatio“ versteht, die in der Ethik als Selbstregierung („gubernatio sui ipsius“) das Leib-Seele-Verhältnis be-stimmt. Diese ‚Fehlübersetzung‘ ist sogar mehr als wahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß ____________________________________________________________________________________________
39 Vgl. hierzu Christel Hein, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungslite-ratur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985, S. 325-326. Hier finden sich auch Literatur-hinweise zu jüngst aufgefundenen Bruchstücken, die eventuell doch auf arabische Übersetzungen aus der Politik hinweisen. 40 Siehe Averroes, Exposición de la ‚República‘ de Platón, estudio, trad. y notas de Miguel Cruz Hernández, Madrid 1986, S. 5. 41 Vgl. Dominicus Gundissalinus, De immortalitate animae, ed. cit., S. 11-12, zitiert weiter oben unter Kapi-tel 3.1.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
177
dem spanischen Archidiakon und seinem Kollegen das Buch der Regierung (KitÁb as-siyÁsa), das bei al-FÁrÁbÐ den griechischen Titel Politik erläutern soll, nicht bekannt ist (und auch nicht sein kann, da es in der arabischen Tradition, wie bemerkt, offenbar material nicht existiert und erst von Wilhelm von Moerbeke ins Lateinische übertragen wird). Die aristote-lische Schrift zur Ethik hingegen scheint zumindest Gundissalinus sehr wohl zu kennen (vgl. auch Kapitel 3.3.), so daß es für ihn naheliegt, unter dem KitÁb as-siyÁsa zunächst diese zu verstehen, um mit ihrer Hilfe den Titel Politik einzuordnen. So ist letztlich die Explikation der Politik durch die Ethik selbst ein weiterer, unverkennbarer Hinweis darauf, daß Gun-dissalinus diese Schrift bereits kannte. Bei alledem ist Gundissalinus jedoch – im Gegensatz zu Gerhard – sofort klar, daß es sich bei Politik und Ethik nicht einfachhin um dieselbe Wis-senschaft handeln kann, sondern daß beide trotz einer gegenseitigen Explikationskraft als selbständig zu betrachten sind. Anders als Gerhard hütet er sich daher davor, beide zu identi-fizieren („Politica [...] est liber Ethicae“), und setzt diese statt dessen in ein pars-Verhältnis („Politica [...] est pars Ethicae“).
Nach diesem Vergleich der drei Versionen von al-FÁrÁbÐs Text muß also festgehalten werden, daß Gundissalinus’ Version an dieser Stelle eine ausgesprochen komplexe Rezep-tions- und Transformationsfigur desselben darstellt, die den bei al-FÁrÁbÐ angelegten Ari-stotelismus durch die Relationierung von Politik und Ethik tiefgreifend und durchaus sinn-voll restrukturiert, während sie ihn zugleich mit der Elimination Platons programmatisch radikalisiert.
Aber hat nun Georg Wieland nicht trotz allem doch Recht, wenn er Gundissalinus vor-wirft, die ursprüngliche aristotelische Intention zu verkehren? Hinter diesem Vorwurf scheint die Ansicht zu stehen, daß die Ethik aristotelisch gesehen der Politik unterzuordnen sei, daß Gundissalinus aber der Ethik die Politik einverleibe und mithin genau das Gegenteil tue. Dieser Schluß ist jedoch im Hinblick auf die Phänomene zu grob und vorschnell. So gilt es demgegenüber zwei wesentliche Präzisierungen vorzunehmen: Erstens hinsichtlich der ur-sprünglichen aristotelischen Intention; diese ist bereits in jenem Abschnitt dieses Kapitels untersucht worden, der Aristoteles gewidmet ist. Der dort vorgeschlagenen Interpretation zufolge ist es nun gerade nicht Aristoteles’ Intention, die Ethik der Politik unterzuordnen, vielmehr handelt es sich um die – teleologische – Verklammerung zweier nichtsdestotrotz selbständiger Wissenschaften. Die zweite Präzisierung betrifft die Bedeutung des Terminus pars bei Gundissalinus. Dieser ist nämlich, wie in den Kapiteln 2.2.5. und 3.5. b) gezeigt wurde, für Gundissalinus kein beliebiger, sondern ein durch und durch technischer Begriff, der in Abhebung von species zu lesen ist. Wenn Gundissalinus daher die Politik als pars der Ethik bezeichnet, so ist damit keinesfalls eine Unterordnung derselben unter die Ethik sug-geriert. Denn Ethik, Ökonomik und Politik sind bei Gundissalinus letztlich als partes der praktischen Philosophie gleichermaßen konstitutive Bestandteile derselben, was zugleich einschließt, daß sie untereinander in einem bestimmten arbeitsteiligen Verhältnis stehen (so wie auch die partes der Logik und jene der Physik im vorangegangenen Kapitel). Eben die-ses Verhältnis ist es aber, das Gundissalinus mit der Rede von der Politik als pars der Ethik im Sinne der Verklammerung beider anspricht; hier geht es ihm nicht um eine Unterordnung, sondern darum, daß die verschiedenen Teile der praktischen Philosophie ihren Zusammen-hang nicht erst äußerlich über den Oberbegriff der praktischen Philosophie erhalten, sondern ihr intrinsischer Zusammenhang gerade darin besteht, daß sie sich auch und gerade unterein-ander in bestimmter Weise verhalten. Genau dies scheint aber Aristoteles mit seiner Zuord-
Die Tripartition der praktischen Philosophie
178
nung von Ethik und Ökonomik zur Politik im Auge zu haben. Die möglichen Differenzen zwischen der Beschreibung dieses Zusammenhangs bei Aristoteles und Gundissalinus sind dabei nicht in erster Linie sachlicher Natur, sondern eher solche der Akzentuierung, die sich aus der jeweiligen Perspektive ergeben, in der man diesen Zusammenhang beschreibt (bei Aristoteles teleologisch, bei Gundissalinus pädagogisch, im Sinne der Abfolge des Lektüre-kanons). Daß Gundissalinus mit der Rede von der Politik als pars der Ethik im übrigen weit entfernt ist von einer Unterordnung derselben unter letztere, belegt allein schon die Reihen-folge, in der er die drei praktischen Disziplinen behandelt sowie die Aufmerksamkeit, die er dabei der Politik gerade im Gegensatz zur Ethik (fünf Seiten zur Politik stehen hier fünf Zeilen zur Ethik gegenüber) zukommen läßt und die genau ihrer Rolle als Integrationsfigur der praktischen Disziplinen bei Aristoteles zu entsprechen scheint.
Die so von Gundissalinus entwickelte Verklammerung von Politik und Ethik zeigt sich jedoch nicht nur in ihrer wissens- und wissenschaftstheoretischen Zuordnung mit Hilfe des didaskaliko,n pars, sondern auch in den entsprechenden inhaltlichen Ausführungen zur Po-litik. So schreibt Gundissalinus bei der Behandlung der Frage des Zusammenhangs von poli-tischer Ordnung und individueller Moralität in De divisione:
Ostendit etiam [politica], quod bone consuetudines subiectorum proveniunt ex iusta domi-natione praelatorum. Actio vero huius virtutis qua sic vivitur ethica vocatur.42
Auch dieser Satz ist aus De scientiis übernommen, wo er sich dem Wortlaut nach findet.43 Gegenüber dessen arabischer Vorlage, dem KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm des al-FÁrÁbÐ, hat Gundissa-linus hier allerdings erneut eine Veränderung vorgenommen, denn beim arabischen Philoso-phen ist wiederum nicht von Ethik die Rede, sondern von Politik: „Die Politik ist der Effekt dieser Kraft“, heißt es bei al-FÁrÁbÐ.44 Während bei al-FÁrÁbÐ damit politische und ethische Sphäre säuberlich voneinander geschieden bleiben, zeigt Gundissalinus hier erneut, wie beide ineinander greifen, d.h. wie politische und moralische Sphäre und damit Politik und Ethik zusammenspielen.
Gundissalinus’ Rede von der Politik als Teil der Ethik ist mithin ein durchaus ernstzu-nehmender Beitrag zur Frage nach dem Verhältnis der tripartiten praktischen Wissenschaften und mithin zu einem der wesentlichsten Momente der praktischen Philosophie des Aristote-les in wissens- und wissenschaftstheoretischer Hinsicht. In jedweder Hinsicht greift es zu kurz, seinen Ansatz als gänzlich irrige Verkehrung der aristotelischen Grundintention abzu-tun. Es ist richtig, daß möglicherweise eine ‚Fehlübersetzung‘ den Anstoß für seine Inter-pretation gibt, doch schmälert dies keinesfalls seine systematischen Bemühungen, das ari-stotelische Korpus der libri morales in einen vernünftigen Zusammenhang zu bringen (an-ders als Gerhard mit seiner ‚Fehlübersetzung‘), der allein bei oberflächlicher Betrachtung in einem offenen Widerspruch zu Aristoteles zu stehen scheint. Ganz im Gegenteil dazu ist es jedoch, wie gezeigt, für Gundissalinus’ Selbstverständnis geradezu entscheidend, auch im Falle der praktischen Philosophie allein Aristoteles, und nicht etwa anderen Autoritäten wie
____________________________________________________________________________________________
42 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 134. 43 Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 135: „Ostendit etiam [politica] quod bonae consuetudi-nes subditorum proveniunt ex iusta dominatione praelatorum. Actio vero huius virtutis qua sic vivitur, ethica vocatur.“ 44 Al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. cit., S. 68 der spanischen Übersetzung.
Die Konsequenzen der expliziten Aristoteles-Rezeption
179
Platon, zu folgen. Entsprechend hat Cary J. Nederman den gundissalinischen Ansatz in Ab-hebung von Wieland deutlich positiv gewürdigt:
Gundisalvi’s reference to the Politics suggests that his treatment of political science as distinct from and superior to ethics and economics represented an attempt to reproduce what he regarded as Aristotle’s own position. With Gundisalvi, one might say, the ‚under-ground tradition‘ of Aristotelian political science begins to surface, to acknowledge expli-citly its debt to Aristotle.45
Mit Nederman wird man nach diesem Durchgang in der Tat festhalten müssen, daß Gun-dissalinus zumindest im Schlußkapitel der Divisionsschrift deutlich über die eingangs kurz skizzierten traditionellen Positionen zur Tripartition sowohl der lateinisch-christlichen Auto-ren als auch der arabischen Denker hinausgeht – und an diesen muß man ihn messen –, um im Anschluß an die aristotelischen Überlegungen aus der Nikomachischen Ethik, insbeson-dere aus ihrem ersten und letzten Buch, einen Nexus zwischen Politik und Ethik zu etablie-ren. Damit wird zumindest tentativ eine der wesentlichen Forderungen der genuin aristoteli-schen Einteilung der praktischen Philosophie erstmals wieder aufgegriffen, und dies mit explizitem und zugleich – im Hinblick auf Platon – exklusivem Bezug auf den Stagiriten und seine Schriften.
____________________________________________________________________________________________
45 Cary J. Nederman, „Aristotelianism and the Origins of ‚Political Science‘ in the 12th Century“, in: Jour-nal of the History of Ideas 52 (1991), S. 179-194, hier S. 190.
4. Schluß: Gundissalinus und der ‚zweite Anfang‘ der aristotelischen Philosophie
Mit dem vorausgegangenen zweiten Teil (3.) dieser Arbeit ist deutlich geworden, daß Gun-dissalinus im Rahmen seiner Wissens- und Wissenschaftstheorie nicht nur implizit, sondern auch explizit auf Aristoteles, und zwar den Aristoteles arabus, und seine Schriften rekur-riert.1
Dabei gibt es mannigfache Einzelhinweise auf eine direkte Lektüre der aristotelischen Schriften durch Gundissalinus, die sich noch um eine allgemeine Überlegung erweitern las-sen: Denn auch wenn Gundissalinus selbst keine Schrift des Aristoteles übersetzte, so scheint er sich doch offensichtlich der Verehrung der arabischen Autoren, denen er folgt, für Aristo-teles bedingungslos anzuschließen, wie nicht zuletzt aus seinen nachdrücklichen Berufungen auf den Stagiriten hervorgeht. Gesteht man dem Archidiakon auch nur ein Minimum an theo-retischer Neugierde und intellektueller Redlichkeit zu, wird man kaum glauben können, daß dieser sich mit den Versicherungen begnügte, die ihm die arabischen Autoren und Kom-mentatoren hierzu abgaben, vielmehr wird man annehmen müssen, daß er, geradezu aufge-stachelt durch deren Lektüre, selbst ad fontes strebte und die Werke des Aristoteles zumin-dest in Auszügen las. Ja wenn al-FÁrÁbÐ die Analytica posteriora und die übrigen Schriften des Aristoteles in allen nur erdenklichen Tönen preist, wen sollte es da noch wundernehmen, daß Gundissalinus nach Kräften versuchte, dieser Schrift (und anderer) habhaft zu werden? Und wenn Gundissalinus selbst diese Schriften in De divisione zum schlechthinnigen Kanon der Philosophie macht, muß man dann nicht geradezu fordern, daß er alles daran setzte, diese Schriften einzusehen? Daß die entsprechenden Texte aber in Toledo vorlagen oder zumindest wenige Jahre nach Gundissalinus dort vorlagen, belegt die aristotelische Übersetzungsarbeit Gerhards von Cremona. Vor diesem Hintergrund scheint es mehr als plausibel, daß sich bei Gundissalinus eine erste Lektüre nicht nur al-FÁrÁbÐs, Avicennas, Ibn Gabirols u.a. abzeich-net, sondern auch bereits der aristotelischen Texte selbst. Hierauf deuten schließlich auch die Zitate aus Aristoteles in Gundissalinus’ Schriften hin,2 allen voran das wörtliche Physik-Zitat aus Kapitel 3.2. Gleichwohl ist letztlich trotz allem nicht auszuschließen, daß der Archidia-
____________________________________________________________________________________________
1 Mario Grignaschis wiederholt erwähnte These, daß Gundissalinus ausschließlich aus der graeco-lateini-schen Übersetzung des Aristoteles schöpft, ist vor dem Hintergrund der philologischen Befunde, etwa zum Physik-Zitat aus Kapitel 3.2., aber auch in Bezug auf die Meteorologica aus Kapitel 3.5. b), unhaltbar und soll hier nicht noch einmal eigens besprochen werden. 2 Neben den in den vorangegangenen Kapiteln angeführten Aristoteles-Referenzen bei Gundissalinus sind weitere Zitate, etwa aus den Topica, zu verzeichnen. So wird die Stelle Topica I, 3, 101b 8-10 in Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 67 u. S. 85, gleich zweimal explizit zitiert, und dies sogar in verschiedenen Fassungen, von denen erstere die boethianische Topik-Übersetzung wiedergibt, wäh-rend die zweite nicht der graeco-lateinischen Tradition zu entstammen scheint. Deutliche Anklänge an Topica I, 14, 105b 19-21 finden sich ferner ibid., S. 75: „[...] sunt tria genera quaestionum. Morale, videlicet, natu-rale et rationale.“ Auch hier greift Gundissalinus nicht auf die bestehenden graeco-lateinischen Übersetzun-gen der Topica zurück.
Schluß
182
kon seine Aristoteleskenntnisse aus arabischen Zwischenquellen schöpfte. Diese müßten dann allerdings z.T. wörtlich die aristotelischen Originaltexte reproduzieren und sind nicht mit den uns bekannten, von Gundissalinus u.a. übersetzten Werken identisch.
Für den größeren Zusammenhang, in dem sich diese Arbeit versteht, nämlich die Frage nach den epistemologischen Grundlagen der Renaissance des 12. Jahrhunderts, ist dieses philologisch und historisch freilich höchst bedeutsame Problem allerdings in letzter Konse-quenz nicht von entscheidendem Gewicht. Entscheidend ist vielmehr in systematischer Hin-sicht, in welcher Art und Weise Gundissalinus hier bewußt und ausdrücklich – gleichviel ob auf direkter oder vermittelter textueller Grundlage – an genuin aristotelische Positionen zur Wissens- und Wissenschaftstheorie anschließt.
Dies konnte zumindest für fünf zentrale Themen nachgezeichnet werden: a) die Bestim-mung der Gegenstandsbereiche aus der aristotelischen Physik; b) die aristotelische Bestim-mung der Wissenschaft als e[xij aus der Nikomachischen Ethik; c) die erweiterte Axiomatik im Sinne der Überlegungen aus den Analytica posteriora; d) die Subordination sowie die Binnendifferenzierung, insbesondere der Naturphilosophie, im Anschluß an die Meteorolo-gica; e) die Tripartition der praktischen Philosophie und der Zusammenhang von Politik und Ethik aus der Nikomachischen Ethik. Dabei spricht die Art und Weise, mit der Gundissalinus an den Stagiriten anschließt und die zugleich zur Beantwortung der Ausgangsfrage dieser Arbeit nach den Voraussetzungen und Konsequenzen der Aristoteles-Rezeption beiträgt, eindeutig gegen einen rhapsodischen, rein eklektischen Aristotelismus. Gundissalinus’ mo-dus operandi in dieser Frage dürfte im Verlauf der Arbeit hinlänglich klar geworden sein: Zunächst (2.1.) eröffnet sich der Archidiakon eine selbständige Sphäre philosophischen Denkens, die bei aller sapientialen Überformung gegenüber der Theologie deutlich autonom ist,3 indem sie ihren eigenen Regeln folgt. Erst vor dem Hintergrund dieses säkularen Philosophieverständnisses kann dann die eigentliche wissens- und wissenschaftstheoretische Diskussion, die das Herzstück der gundissalinischen Philosophie bildet, unvoreingenommen in Angriff genommen werden. Diese, und mit ihr die Aristoteles-Rezeption des Gundissali-nus, vollzieht sich stets in einem problemorientierten Dreischritt, der von den einschlägigen Boethius-Passagen und ihrer Chartreser Interpretation über die arabischen Lösungsangebote bis zu Aristoteles selbst voranschreitet. So stehen zumindest die Punkte a) bis d) aus dem zweiten Teil (3.) dieser Arbeit in einem eindeutigen systematischen Zusammenhang mit den unter 2.2. referierten boethianischen Positionen zur Wissens- und Wissenschaftstheorie und ihrer arabischen Transformation bei Gundissalinus. In diesem Sinne knüpfte Gundissalinus mit a) der Bestimmung der Gegenstandsbereiche aus Aristoteles’ Physik eindeutig an seine Lektüre von Boethius’ De Trinitate an. Die hier vorgefundenen Aussagen zur Gegenstands-bestimmung der Wissenschaften reformulierte Gundissalinus zunächst – vor dem Hinter-grund der Chartreser Problemhorizonte – in Orientierung an al-ÇazzÁlÐ, womit sie mit der ____________________________________________________________________________________________
3 Jean Jolivet hat treffend auf diese Dialektik von autonomer Philosophie und sapientialer Überformung hingewiesen, die sich in letzter Instanz für die Autonomie der Philosophie entscheidet: „In fact it would seem as though he [= Gundissalinus] sought to replace the theology of the saints by a theology according to the philosophers, from which he is free to dissociate himself if need be, but which in its totality provides the broad conceptual framework in which can be inserted documents provided by the Scriptures, the saints and the mystics. Under the apparent unity of his text we can trace a marked movement away from traditional wisdom.“ (Jean Jolivet, „The Arabic Inheritance“, in: Peter Dronke [Hrsg.], A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, S. 113-148, hier S. 144)
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
183
darauf folgenden aristotelischen Position kompatibel wurden. Die in dieser Weise interpre-tierte Boethius-Stelle und das Aristoteles-Zitat aus der Physik zur Gegenstandsbereichsbe-stimmung folgten dabei nicht nur im Textsubstrat der Divisio dicht aufeinander, sondern wurden von Gundissalinus ausdrücklich zur gegenseitigen Erklärung angeführt. So wird die deutlich neoplatonische Interpretation der Physik-Stelle durch Gundissalinus nicht nur vom arabischen Physik-Text suggeriert, sondern auch noch einmal von Boethius’ Überlegungen getragen. Die Gegenstandsdifferenzierung als Kriterium der Unterscheidung der Wissen-schaften entwickelt Gundissalinus damit ausgehend von Boethius, unter Ergänzung arabi-scher Zwischenquellen, namentlich Avicenna und al-ÇazzÁlÐ, konsequent bis zu Aristoteles selbst. b) Auch die e[xij-Lehre des Aristoteles verband Gundissalinus mit boethianischen Überlegungen. Dabei war es die Methodenreflexion des Boethius aus De Trinitate, die zu-nächst ausgehend von Chartreser Fragestellungen und unter Zuhilfenahme avicennischer Elemente nach Art einer Theorie der Seelenvermögen interpretiert wurde. An diese Vermö-genstheorie wurde sodann der aristotelische Habitus der Apodeixis aus der Nikomachischen Ethik als Habitus des Geistes angeschlossen. Zugleich bewahrte Gundissalinus jedoch hier auch im Sinne des Aristoteles die Bedeutung der Apodeixis, die er als gemeinsames Instru-ment der verschiedenen Wissenschaften, z.T. ebenfalls in Anknüpfung an Boethius, beibe-hielt. Die habitus-Lehre wurde so mit der neoplatonischen Lehre von den Seelenvermögen in origineller Weise zusammengedacht. Damit macht sich Gundissalinus mit Hilfe lateinisch-christlicher Quellen und arabischer Zwischenschritte ein Motiv aristotelischen Denkens zu eigen, das in der Wissens- und Wissenschaftstheorie des 12. Jahrhunderts bis dahin noch völlig unbekannt ist. c) Die erweiterte Axiomatik wurde vor dem Hintergrund der communes animi conceptiones aus Boethius’ De hebdomadibus und ihrer Auslegung im Lichte Pseudo-al-KindÐs entwickelt. So ging Gundissalinus zunächst von dem engen Axiom-Begriff des Boethius aus und arbeitete sich an den diesbezüglichen Chartreser Problemkontexten ab, um mit Pseudo-al-KindÐ neue Lösungsperspektiven zu erschließen. In einem zweiten Schritt ließ er dann jedoch diese Diskussionen hinter sich, um den ursprünglichen aristotelischen Sinn der Axiomatik, nicht zuletzt ausgehend von Avicenna (aber weiterhin auch Boethius) wie-derzufinden. Entsprechend entwickelt Gundissalinus hier die genuin aristotelischen Konzepte des Voraussetzungswissens als Daß- und Was-Wissen, so wie er zugleich die induktive Komponente dieser beiden gegenüber den Axiomen im strikten Sinne geltend macht. Dabei zeigt die gundissalinische Perspektive zugleich, in welche Verengungen die Diskussion um die Axiomatik im Mittelalter mit und nach Boethius geraten war und wie diese letztlich bis heute teilweise noch bestehen. d) Die Subordination der Wissenschaften und ihre Binnendif-ferenzierung fand Gundissalinus in den boethianischen didaskalika, vorbereitet. In der Frage der Subordination greift der Archidiakon zwar vermittelt über Avicenna ein zentrales Mo-ment der aristotelischen Theorie auf, das er mit Boethius verbindet, dabei geht er jedoch, wie gezeigt, aus guten Gründen nicht weiter über den persischen Philosophen hinaus. Dagegen bot die Binnendifferenzierung der Wissenschaften Gundissalinus erneut Gelegenheit, das Corpus aristotelicum explizit heranzuziehen; so wurden das Organon und die libri naturales des Aristoteles nach dem Modell der partes des Boethius und im Lichte ihrer systematischen Interpretation im Anschluß an Avicenna und al-FÁrÁbÐ behandelt. Auch hier entwickelt Gun-dissalinus, immer ausgehend von Boethius und der arabischen Philosophie, wissens- und wissenschaftstheoretische Implikationen der aristotelischen Philosophie, die in der Folge nachhaltigen Einfluß auf die Geschichte der Philosophie ausüben sollten. e) In Bezug auf die
Schluß
184
Einteilung der praktischen Philosophie wurden ebenfalls zumindest terminologische Anlei-hen bei Boethius und der lateinisch-christlichen Tradition herausgestellt; allerdings scheint diese hier nicht in gleicher Weise für Gundissalinus’ Position maßgeblich zu sein.
Die so bei Gundissalinus im Anschluß an Boethius und seine Weiterentwicklung im Lichte arabischer Quellen rezipierten Elemente sind wohlgemerkt keine beliebigen, rhapso-disch versammelten Theoriestücke des Aristoteles, sondern gehören zu den Kernaussagen der aristotelischen Epistemologie. Des Gundissalinus’ Wissens- und Wissenschaftstheorie ist somit durch und durch aristotelisch4 – und sie will es auch ausdrücklich sein, wie die wieder-holten emphatischen Bezugnahmen auf Aristoteles deutlich machen, auch wenn ihr in eini-gen Fällen eine neoplatonische Lesart des Stagiriten zugrunde liegen mag. Gundissalinus legt so eine sowohl der Sache als auch ihrem Selbstverständnis nach aristotelische Wissens- und Wissenschaftstheorie vor. Ja mehr noch, die hier aufgegriffenen Positionen sind die sich durchhaltenden Themen in der Wissens- und Wissenschaftstheorie des Mittelalters, wie ihre dargestellte Pervivenz bis zu Thomas von Aquin deutlich macht – und nicht nur für das Mit-telalter, so gilt es hinzuzufügen. Die bereits in der Einführung gestreifte und in Kapitel 2.4. ausführlicher traktierte Frage, ob Gundissalinus eher als platonischer5 denn als aristotelischer Denker zu bezeichnen sei, ist damit jedenfalls im Hinblick auf seine Wissens- und Wissen-schaftstheorie eindeutig zugunsten des Aristoteles zu beantworten, auch wenn sich freilich immer wieder neoplatonische Einflüsse ausmachen lassen.6 Denn hier bringt Gundissalinus sowohl inhaltlich als auch ihrem Anspruch nach genuin aristotelische Positionen der Episte-mologie z.T. erstmals im lateinischen Westen zur Sprache. Will man nun annehmen, Gun-dissalinus habe diese Theoriestücke hie und da bei arabischen Autoren zusammengeklaubt, so tut dies dem Verdienst des Archidiakons keinen Abbruch, im Gegenteil. Denn dann hätte Gundissalinus mit großer Treffsicherheit die zentralen Theoreme der aristotelischen Episte-mologie aus verschiedenen Werken zusammengetragen und geschickt an seine eigenen sy-stematischen Problemstellungen und Überlegungen angeschlossen. Diese Hypothese scheint im übrigen noch aufwendiger und voraussetzungsreicher als die Annahme einer direkten Lektüre des Corpus aristotelicum. Ganz gleich jedoch, wie man sich in dieser Frage ent-scheidet: Daß Gundissalinus mit seiner Rezeption der aristotelischen Wissens- und Wissen-schaftstheorie wesentliche epistemologische Grundlagen der Renaissance des 12. Jahrhun-
____________________________________________________________________________________________
4 Dies mag in Bezug auf andere Teile seiner Philosophie, z.B. die Ontologie, anders beurteilt werden; so etwa Wolfgang Kluxen, „Abendländischer Aristotelismus V/1; Mittelalter“, in: Theologische Realenzyklo-pädie III (1978), S. 782-789, hier S. 783-784. Aber auch in Gundissalinus’ Ontologie, die in der Tat stärker platonisch gefärbt ist, dominieren aristotelische Konzepte. Vgl. hierzu den Kommentar zu Gundissalinus’ De unitate in Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, Vom Einen zum Vielen – Der neue Aufbruch der Me-taphysik im 12. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002, S. 136-144. 5 Wie etwa von James A. Weisheipl, „Classification of the Sciences in Medieval Thought“, in: Mediaeval Studies 27 (1965), S. 54-90, hier S. 72, und Martin Anton Schmidt, „Scholastik“, in: Die Kirche in ihrer Geschichte II (1969), G 69-181, hier G 103, behauptet wurde. 6 Daß der Neoplatonismus nicht einfachhin als Anti-Aristotelismus zu werten ist, sondern in vielem ein durch Aristoteles hindurchgegangener Platonismus ist, wurde bereits in Kapitel 2.4. betont. Der Neoplatonismus spielt daher für die Aristoteles-Rezeption eine entscheidende Rolle. Dies verdeutlicht eindrucksvoll die Re-zeptionsgeschichte des Liber de causis, eines neoplatonischen Werkes, das lange Zeit als 15. Buch der Meta-physik des Aristoteles galt. Vgl. zu diesem Text und seiner Geschichte die Bemerkungen weiter unten sowie Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, Von Bagdad nach Toledo – Das ‚Buch der Ursachen‘ und seine Rezeption im Mittelalter (lateinisch-deutsch), Mainz 2001, bes. S. 205-247.
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
185
derts expliziert, die in den zeitgleichen Positionen der Schule von Chartres und der Pariser Autoren nur der Tendenz nach vorhanden sind, kann kaum bestritten werden.
Was bedeuten die Fallstudien a) bis e) nun aber tatsächlich für die weiter gefaßte, hier im Mittelpunkt stehende Frage nach den Voraussetzungen und Konsequenzen der Aristoteles-Rezeption des 12. Jahrhunderts? Zunächst ist festzuhalten, daß es in all diesen ‚Einzelfällen‘ boethianische und arabische Anknüpfungspunkte sind, die in ihrer Verbindung überhaupt erst die Perspektive auf die aristotelischen Positionen eröffnen, was in Kapitel 2.4. mit dem Schlagwort des ‚avicennisierenden Boethianismus‘ und seiner Bedeutung für die Aristoteles-Rezeption angedeutet wurde. Dieser ist somit nicht nur die Voraussetzung für einen implizi-ten Aristotelismus, wie er in den Chartreser Auseinandersetzungen z.T. aufscheint und auch für Gundissalinus unter 2.2. aufgezeigt wurde, vielmehr haben die Ergebnisse des letzten Teils gezeigt, daß und wie gerade dieser spezifische Boethianismus bei Gundissalinus sogar in einen expliziten Aristotelismus mündet. Dies macht aber darauf aufmerksam, daß die Dis-kussionen um Boethius, wie sie in Paris und Chartres zu Gundissalinus’ Zeit geführt werden, die Aristoteles-Rezeption mit ihrer Differenzierung der Wissenschaften nicht nur präludie-ren, wie auch die Untersuchungen zur Metaphysik und Naturphilosophie des 12. Jahrhun-derts für den Raum des heutigen Frankreich nahelegen,7 sondern als solche für das geistige Klima, das sodann zur expliziten Rezeption der Wissens- und Wissenschaftstheorie des Sta-giriten führt, unmittelbar ausschlaggebend sind. Die explizite Rezeption der aristotelischen Epistemologie ist vor diesem Hintergrund nicht über eine reine theoretische Neugierde eini-ger Gelehrter an den Peripherien der lateinischen Zivilisation zu erklären, und noch viel we-niger über die bloße Bereitstellung neuer Quellen. Vielmehr ist die wissens- und wissen-schaftstheoretische Aristoteles-Rezeption das konsequente Zuendedenken von bereits in der eigenen Tradition vorhandenen und ein ums andere Mal gewendeten Sachfragen, wie dies in den Boethius-Kommentaren der Fall ist, deren eigene Lösungspotentiale zur Mitte des 12. Jahrhunderts mehr als ausgereizt sind (entsprechend versiegt die Tradition der Boethius-Kommentare – bis auf Thomas – nach dem Aufkommen des Aristoteles nahezu gänzlich).8 Die Pariser und Chartreser Autoren können diesem Zuendedenken über Boethius hinaus nur die Richtung weisen, doch vermögen sie es nicht, den entscheidenden Schritt über diesen hinaus zu tun. Hier zeigt sich das „Bewußtsein eines Mangels“, von dem in der Einführung die Rede war. Auch und gerade Gundissalinus erfährt diesen Mangel, ja möglicherweise hat er selbst, wie bereits mehrfach anklang, in Chartres studiert. Doch kann er ihn beheben und zunächst mit Hilfe der arabischen Philosophie über Boethius hinausgehen, um sodann die Brücke zu den originär aristotelischen Lösungsvorschlägen zu schlagen.
Das Verdienst des Gundissalinus in wissens- und wissenschaftstheoretischer Hinsicht ist dabei mindestens zweifach: So nimmt der Archidiakon zum einen auf der phänomenalen Ebene v.a. in De divisione durch die Integration zahlreicher bislang im überlieferten ordo ____________________________________________________________________________________________
7 Vgl. zu diesen beiden Aspekten etwa die bereits in der Einführung genannten Arbeiten von Marie-Dominique Chenu, La théologie au XIIe siècle, Paris 1957, S. 308-322, sowie von Andreas Speer, Die ent-deckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer ‚scientia naturalis‘ im 12. Jahrhundert, Lei-den u.a. 1995. 8 Vgl. zu diesem interessanten Phänomen auch Gillian R. Evans, „The Discussions of the Scientific Status of Theology in the Second Half of the 12th Century“, in: Matthias Lutz-Bachmann u.a. (Hrsg.), Metaphysics in the Twelfth Century – The Relationship Among Philosophy, Science and Theology, Turnhout 2003 (im Druck).
Schluß
186
scientiarum fehlender Wissenschaften eine tiefgreifende Reorganisation und Restrukturie-rung des Wissenschaftskosmos vor, die einer immer stärker differenzierten epistemischen Praxis gerecht werden will, wie bereits andere Untersuchungen hinreichend herausgestellt haben.9 Für diesen Prozeß spielen auf theoretischer Seite neben den arabischen Quellen auch, wie in Kapitel 2.3. gezeigt, die Etymologiae Isidors von Sevilla eine bedeutende Rolle, die ein deutlich plurales Wissenschaftsverständnis tradieren. Zugleich, und dies ist bislang nur zu gern übersehen oder unterbewertet worden, bemüht sich Gundissalinus jedoch, durch eine allgemein gültige, kohärente Wissens- und Wissenschaftstheorie, die er von Aristoteles be-zieht, diese Pluralität denkend noch einmal einzuholen. Die faktische Ausdifferenzierung und Professionalisierung der Wissenschaften, die im 12. Jahrhundert einsetzt, wird damit angemessen zu reflektieren versucht. So sind die Differenzen der Wissenschaften für Gun-dissalinus nicht kontingent, sondern werden von ihm einer theoretischen Rechtfertigung unterzogen, die sich an der zentralen aristotelischen Unterscheidung von Gegenstandsberei-chen und Methoden ausrichtet. Andererseits wird auch der Zusammenhang der in der dar-gelegten Weise distinkten und autonomen Wissenschaften bedacht, so etwa in der aristoteli-schen Axiomatik, welche die gemeinsamen Standards für Wissenschaftlichkeit formuliert, aber auch in den Theorien der Subordination und der Binnendifferenzierung, welche die Einheit in der Unterschiedenheit suchen. Auch wenn Gundissalinus’ Wissens- und Wissen-schaftstheorie daher zuweilen wie ein Flickenteppich anmuten mag, darf nicht vergessen werden, daß der Archidiakon in die kaum mehr bearbeitbare Materialfülle, die ihm begegnet, eine bemerkenswerte Ordnung bringt.10 Dies ist aber, wie hinreichend betont wurde, keine andere als die aristotelische Ordnung, die Gundissalinus immer wieder explizit für sich re-klamiert, um in ihrer Konsequenz ein neues, von der Theologie emanzipiertes und zugleich auf sie bezogenes primär epistemologisches Gesamtkonzept von Philosophie vorzulegen.
Bezogen auf die Theologie bleibt dieses Konzept von Philosophie in doppelter Weise, nämlich zum einen in seinem Fluchtpunkt, der in Kapitel 2.1. mit dem Begriff der Konso-nanz zwischen Theologie und Philosophie ausgewiesen wurde, zum anderen jedoch auch in einer weiteren Perspektive, die in Kapitel 2.1. nur angedeutet werden konnte und daher hier zumindest in Umrissen noch behandelt werden soll: es handelt sich dabei um die Stellung des neuen Konzepts von Philosophie nicht nur zur christlichen Theologie, sondern zu den Religionen im Plural. Denn wenn Gundissalinus’ Konzept von Philosophie sich im Span-nungsfeld von lateinisch-christlicher Tradition einerseits und arabisch-jüdischem Denken andererseits vollzieht, so sind damit nicht nur verschiedene Kulturkreise an der Genese die-ses Philosophiebegriffs beteiligt, sondern v.a. auch verschiedene Religionen. Das aristoteli-sche, streng rationale Programm von Philosophie, das der spanische Archidiakon sich erar-
____________________________________________________________________________________________
9 Die mit Gundissalinus einsetzende Differenzierung der Wissenschaften ist immer wieder herausgestellt worden. So etwa von Friedrich Dechant, der seine Überlegungen zu Gundissalinus charakteristischerweise unter das Schlagwort ‚Trennung‘ stellt. Siehe Friedrich Dechant, Die theologische Rezeption der ‚Artes libe-rales‘ und die Entwicklung des Philosophiebegriffs in theologischen Programmschriften des Mittelalters von Alkuin bis Bonaventura, St. Ottilien 1993, S. 140. 10 Daß Gundissalinus selbst sich von der Flut neuen Materials gleichsam überfordert sah, macht folgende Bemerkung aus De divisione deutlich, mit der er rechtfertigt, warum er nicht alle species der Naturphiloso-phie (scientia de iudiciis, scientia de nigromantia usw.) behandelt, sondern nur die Medizin: „De ceteris autem supradictis speciebus naturalis scientiae ideo aliquid dicere praetermittimus, quoniam ad cognitionem earum nondum pervenimus.“ (Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 89)
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
187
beitet, ist somit Teil eines Gesprächs zwischen den Religionen. Dies mag vorderhand er-staunen, denn während in Frankreich Peter Abaelard seinen Religionsdialog verfaßt und Petrus Venerabilis Übersetzungen des Korans gerade bei spanischen Gelehrten in Auftrag gibt, ist in Toledo, also genau dort, wo Abaelards literarische Gestalten sich tatsächlich auch in Fleisch und Blut begegnen, scheinbar keine intellektuelle Auseinandersetzung zwischen den Religionen zu beobachten. Die Erklärung hierfür ist darin zu suchen, daß der Dialog der Religionen in Toledo nicht unvermittelt zwischen den Vertretern der einzelnen Religionen in Form von Disputationen stattfindet, vielmehr ereignet er sich im Raum der Philosophie, ge-nauerhin des neu entwickelten Konzepts von Philosophie. Besonders gut läßt sich dies am Leitfaden der in Toledo von Gundissalinus und seinen jüdischen Mitarbeitern angefertigten Übersetzungen rekonstruieren. Auf die gemeinsame Übersetzung von Avicennas Schrift De anima durch Avendauth, also Ibn DÁwÙd, und Gundissalinus wurde bereits mehrfach hin-gewiesen, und auch die Frage nach der Identität dieses Ibn DÁwÙd mit Abraham Ibn DÁwÙd wurde dabei erwähnt. Diese gemeinsame Übersetzung von De anima, die hier als Beitrag zum Toledaner Religionsdialog präsentiert werden soll, stellt ihrerseits nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtvorhaben Avendauths dar. Dieser hatte zuvor bereits den Prolog von ÉuzÊÁnÐ zu Avicennas KitÁb aš-šifÁÞ vermutlich für den allerdings nicht genannten Erzbi-schof von Toledo ins Lateinische übersetzt und dabei in seinem Widmungsprolog die Über-setzung dieses Teils noch einmal in den größeren Zusammenhang seines, d.h. Avendauths, Ansinnens einer Gesamtübersetzung der Enzyklopädie des Avicenna gestellt:
Verba Avendauth israelitae: Studiosam animam vostram ad appetitum translationis libri Avicennae, quem Asschife id est Sufficientiam nuncupuit, invitare cupiens, quaedam ca-pitula intentionum universalium, quae logico negotio praeposuit in principio istius libri, dominationi vestrae curavi in latinum eloquium ex arabico transmutare.11
Aus diesem Projekt gehen hervor Avendauths Übersetzung der Isagoge des Avicenna,12 möglicherweise die anonyme Übersetzung des dritten Buches seiner Libri naturales13 sowie das uns hier interessierende sechste Buch seiner Libri naturales: De anima, das er gemein-sam mit Gundissalinus überträgt. Doch was beabsichtigt Avendauth, ein jüdischer Philosoph, mit diesem Projekt? In dem Widmungsprolog zur letztgenannten Übersetzung an den hier nunmehr namentlich erwähnten Erzbischof Johann von Toledo zeichnen Avendauth und Gundissalinus zunächst ein düsteres Bild ihrer Zeit, in der die Menschen sich ganz der sinn-lichen Erkenntnis verschrieben hätten und ihre Seele und damit sich selbst nicht mehr erken-nen würden, so daß sie letztlich auch Gott nicht mehr liebten. Die Konsequenz ist folgende:
Unde homines sensibus dediti, aut animam nihil esse credunt, aut si forte ex motum corpo-ris eam esse coniiciunt, quid vel qualis sit plerique fide tenent, sed pauci ratione convin-cunt. [...] Quapropter iussum vestrum, domine, de transferendo libro Avicennae philosophi de anima, effectui mancipare curavi, ut vestro munere et meo labore, latinis fieret certum,
____________________________________________________________________________________________
11 Dieser Prolog ist ediert in Alexander Birkenmajer, „Avicenna und Roger Bacon“, in: Revue néo-scolasti-que 36 (1934), S. 308-320, hier S. 314. 12 Dieses Werk ist z.B. in der römischen Handschrift Vat. lat. 4428 erhalten, wo es überschrieben ist mit: „Capitulum de universalibus translatum ab Avendeuth de libro Avicennae de Logico.“ 13 So zumindest Manuel Alonso, „Traducciones del árabe al latín de Juan Hispano (Ibn DÁwÙd)“, in: Al-Andalus 17 (1952), S. 129-151, hier S. 150-151.
Schluß
188
quod hactenus existit incognitum, scilicet an sit anima, et quid et qualis sit secundum es-sentiam et effectum, rationibus verissimis comprobatum.14
Die z.T. wörtliche Parallele zu den einleitenden Worten aus Gundissalinus’ Tractatus de anima, die bereits in Kapitel 2.1. zitiert wurden, ist offenkundig:
Quapropter quicquid de anima apud philosophos rationabiliter dictum inveni, simul in unum colligere curavi. Opus siquidem latinis hactenus incognitum utpote in archivis grae-cae et arabicae tantum linguae reconditum [...] ad notitiam latinorum est deductum ut fi-deles, qui pro anima tam studiose laborant, quid de ipsa sentire debeant, non iam fide tan-tum, sed etiam ratione comprehendant.15
Gundissalinus knüpft unmittelbar an den Widmungsprolog an. Aber erst aus dem Mund eines jüdischen Gelehrten zeigt diese Aufforderung der rationalen Durchdringung der Glaubensin-halte, die eben nicht bloß geglaubt, sondern auch gewußt werden sollen, ihre ganze Trag-weite. Könnte es einem jüdischen Gelehrten nicht letztlich gleichgültig sein, ob die Christen ihren Glauben nur glauben oder auch wissen? Ja, wieso sollte ein jüdischer Gelehrter den christlichen Glauben gar noch mit Argumenten zu seiner Festigung beliefern? Dies sind die Fragen, die sich auch Manuel Alonso stellte, und die ihn – gegen jede historische Evidenz – zu dem Schluß führten, der Übersetzer Ibn DÁwÙd (der sich in dem oben angeführten Zitat selbst als „israelita“ bezeichnet) könne nur ein zum Christentum konvertierter Jude sein.16 Doch ist diese scheinbare Paradoxie in Wirklichkeit nur die konsequente Folge aus dem zu-vor bereits Dargelegten, und zwar in dem Sinne, daß diese gemeinsamen Übersetzungen eines jüdischen Philosophen und eines christlichen Archidiakons aus dem Arabischen einen Beitrag zu einem philosophischen Diskurs der Religionen darstellen wollen. Der Islam hatte seine Rationalisierung bereits mit den Schriften al-KindÐs bis zu Avicenna erfahren, Abra-ham Ibn DÁwÙd legt für den jüdischen Glauben ein ähnliches Programm mit seinem ha-Emunah ha-Ramah vor,17 und er und Gundissalinus versuchen nunmehr mit den Übersetzun-gen aus dem Arabischen ins Lateinische diesen Weg auch für das Christentum zu beschrei-ten. Allein so kann das Christentum aus der Sicht der beiden Gelehrten überhaupt erst in einen Diskurs mit den anderen Religionen eintreten.18 Die Revindikation einer bestimmten Gestalt von Philosophie, die auf dem durch Avicenna vermittelten Aristoteles fußt, erwächst so zumindest in Teilen auch aus der Notwendigkeit, eine gemeinsame Sprache in der Begeg-nung der Religionen zu finden. Und dies nicht nur in dem äußerlichen Sinne, daß hier lingui-stische Barrieren überwunden werden und Gelehrte unterschiedlicher religiöser Provenienz zusammen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Entscheidend ist vielmehr, daß diese transkonfessionelle Übersetzungsarbeit nicht irgendwelche Texte zum Gegenstand hat, son-____________________________________________________________________________________________
14 Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u. Leiden 1968 u. 1972, hier Bd. I, S. 3-4. 15 Dominicus Gundissalinus, Tractatus de anima, ed. cit., S. 31. 16 Vgl. Manuel Alonso, „El traductor y prologuista del Sextus naturalium“, in: Al-Andalus 26 (1961), S. 1-35, hier bes. S. 26-35. 17 Die deutsche Übersetzung dieses Textes ist Abraham Ibn DÁwÙd, Das Buch Emunah Ramah oder: Der erhabene Glaube, übers. und hrsg. von Simson Weil, Berlin 1919. 18 Eine hervorragende Interpretation des Widmungsprologes im Sinne eines Rationalisierungsversuches der christlichen Kultur, wenn auch ohne direkten Bezug auf den Beitrag desselben zum Dialog der Religionen, gibt Serafín Vegas, „La transmisión de la filosofía en el medievo cristiano: el prólogo de Avendeuth“, in: Revista española de filosofía medieval 7 (2000), S. 115-125.
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
189
dern daß die Übersetzer ihre Arbeit als einen Beitrag zur Klärung der Grundlagen der Reli-gionen verstehen, der sie über alle Unterschiede in ihren jeweiligen Bekenntnissen hinweg verbindet in dem gemeinsamen Projekt einer kritisch prüfenden Vernunft. Die philosophi-sche Übersetzungsarbeit, und insbesondere das Vorhaben einer Gesamtübertragung von Avi-cennas philosophischer Summe, ist damit jener Ort, an dem der Dialog der Religionen in Toledo beginnt, und zwar nicht als Dialog der Autoritäten und Traditionen, wie von anderen Apologien bekannt, sondern als dezidiert philosophischer Diskurs.19 Dieser Typ eines impliziten philosophischen Religionsgesprächs wird auch durch die Überlegungen aus Ka-pitel 2.1. zu Gundissalinus’ Debatte um das angemessene Verständnis der Schöpfung im Anschluß an Ibn Gabirol und Hugo von Sankt Viktor bestätigt. Gundissalinus entwickelte hier einen Philosophiebegriff, der offenbar einen Außenstandpunkt im Verhältnis zu diesen Diskussionen reklamiert, von dem aus diese einer rationalen Prüfung unterzogen werden können. Dabei zeigte sich, daß durchaus der Position eines jüdischen Philosophen vor jener eines christlichen Denkers der Vorzug gegeben werden kann. Das Spezifische des sich so abzeichnenden Gesprächs zwischen den Religionen besteht demnach im bewußten Rekurs auf die philosophische Vernunft als Grundlage des gemeinsamen Gesprächs. Damit bahnt sich bei Gundissalinus und Ibn DÁwÙd ein Verständnis von Philosophie und von einem über sie vermittelten Religionsdiskurs an, das bis heute nichts an Gültigkeit eingebüßt hat: Das sich mit Gundissalinus und Ibn DÁwÙd an der Übersetzerschule von Toledo konkretisierende Projekt eines rationalen Diskurses der Religionen am Leitfaden einer die Wahrheitsansprü-che der Religionen prüfenden kritischen Vernunft – d.h. hier letztlich einer auf Aristoteles gegründeten philosophischen Theologie – bleibt auch für die heutigen Diskussionen um die konkurrierenden Ansprüche von Wahrheitseinsicht einerseits und Pluralismus bzw. Toleranz andererseits richtungweisend.20
Mit diesem wissens- und wissenschaftstheoretisch ausdifferenzierten und in seinem spe-zifischen Bezug auf die Theologie und die Religionen zugleich emanzipierten Modell von Philosophie ist Gundissalinus seinen ‚französischen‘ Kollegen zeitlich und auch sachlich gewiß voraus; doch sind seine Ausgangsanliegen über weite Strecken identisch mit den phi-losophischen Fragestellungen, die in der Francia, etwa bei den Chartresern und – in reli-gionsphilosophischer Absicht – bei Abaelard, entwickelt werden. Und auch Gundissalinus’ Antworten auf diese Fragestellungen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die – allerdings zeitlich um einiges später – in Paris und andernorts etwa von Thomas von Aquin angeboten werden; denn es sind hier wie dort die aristotelischen Antworten, nur daß diese in Paris länger auf sich warten lassen. Denn zunächst folgt auf die Generation der Chartreser Zeitgenossen des Gundissalinus, die sich an Boethius abarbeiten und an ihm die leitenden Fragestellungen für die folgenden Jahrzehnte entwickeln, eine Phase der Aneignung der arabischen Philosophie: Allen voran wird hier der auch Gundissalinus bekannte Liber de causis rezipiert, und zwar in mehrfacher Hinsicht. So entwickelt etwa Alanus ab Insulis (ca. ____________________________________________________________________________________________
19 Vgl. zu diesen Überlegungen auch meinen ausführlicheren Aufsatz „Ein philosophischer Dialog der Religionen im Toledo des 12. Jahrhunderts: Abraham Ibn DÁwÙd und Dominicus Gundissalinus“, in: Yossef Schwartz (Hrsg.), Religiöse Apologetik, philosophische Argumentation, Tübingen 2003 (im Druck). 20 Vgl. zur gegenwärtigen Debatte etwa Matthias Lutz-Bachmann, „Der eine Gott und die vielen Götter: Monotheistischer Wahrheitsanspruch versus ‚postmoderne Toleranz‘“, in: Matthias Lutz-Bachmann u. Andreas Hölscher (Hrsg.), Gottesnamen: Gott im Bekenntnis der Christen, Berlin 1992, S. 193-205, hier bes. S. 203.
Schluß
190
1120-1202) ausgehend von diesem Werk ein axiomatisches Wissenschaftskonzept, das z.T. Einsichten aus den Analytica posteriora vorwegnimmt. Ausgangspunkt ist dabei auch für den Magister aus Lille Boethius, genauerhin sein Traktat De hebdomadibus.21 Zugleich bietet der Liber de causis zusammen mit De hebdomadibus interessante Anknüpfungspunkte auch für die Metaphysik des Aristoteles. Es ist kaum übertrieben, zu sagen, daß die Erfolgsge-schichte der aristotelischen Metaphysik sich wesentlich dem Liber de causis verdankt, der den mittelalterlichen Autoren gleichsam den Schlüssel zum Verständnis dieser Schrift an die Hand gab.22 Parallel hierzu setzt auch die Rezeption von Avicennas De anima ein, in der Übersetzung des Ibn DÁwÙd und des Gundissalinus. Auch dieser Text sollte zu einem der bedeutenden Schritte auf dem Weg der Rezeption von Aristoteles’ Schriften, namentlich De anima, werden, wie etwa John Blunds († 1248) Tractatus de anima und die Schrift De anima seines Zeitgenossen, des Bischofs von Paris Wilhelm von Auvergne, bezeugen.23 Hier zeigt sich, wie ausgehend von Avicennas De anima wesentliche Grundlehren des Stagiriten, auch und gerade wissens- und wissenschaftstheoretischer Natur, vorbereitet und z.T. schon expli-zit mitvollzogen werden. Es ließen sich noch weitere Beispiele für die Bedeutung neuer Quellen nennen, die zwischen den Chartreser Diskussionen und der expliziten Rezeption des aristotelischen Opus vermitteln, wie dies auch bei Gundissalinus zu beobachten ist. Ent-scheidend ist dabei, daß es erst mit dieser allmählichen Aneignung des arabisch-jüdischen Denkens und ihrem zum Großteil noch unartikulierten, impliziten Aristotelismus im 13. Jahrhundert endlich zur expliziten Aristoteles-Rezeption kommt, die sodann nahezu alle Bereiche der Philosophie erfaßt und sich exemplarisch mit den Namen Alberts des Großen und Thomas’ von Aquin verbindet. Freilich übertrifft die theoretische Höhe der Antworten des 13. Jahrhunderts zumindest teilweise Gundissalinus’ erste, in gewissem Sinne noch ten-tative Versuche; doch sind die Positionen des 13. Jahrhunderts jenen des Gundissalinus in vielerlei Hinsicht verpflichtet. Zum Teil sogar nimmt Gundissalinus, wie in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, einige zentrale aristotelische wissens- und wissenschaftstheoretische Interpretamente (und auch ihre religionsphilosophischen Konsequenzen) bei Thomas von Aquin vorweg, dessen Aristotelismus im übrigen nicht selten ebenfalls neoplatonisch gefärbt ist, wie jener des Gundissalinus.24
Überschaut man rückblickend diese Entwicklungen aus der Vogelperspektive, so ist un-schwer zu erkennen, daß nicht nur die explizite wissens- und wissenschaftstheoretische Ari-stoteles-Rezeption des Gundissalinus und das sich damit durchsetzende neue Konzept von Philosophie, sondern auch die Aristoteles-Rezeption des 12. und 13. Jahrhunderts überhaupt ganz klar in einem Dreischritt von Boethius und anderen lateinischen Autoren, wie Isidor, ____________________________________________________________________________________________
21 Vgl. hierzu Andreas Niederberger, „Zwischen De hebdomadibus und Liber de causis – Einige Bemerkun-gen zu Form und Argumentation der Regulae theologiae des Alanus ab Insulis“, in: Convenit Selecta 5 (2000), S. 47-52. 22 Vgl. hierzu erneut die Ausführungen zur Wirkungsgeschichte des Liber de causis in Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, Von Bagdad nach Toledo – Das ‚Buch der Ursachen‘ und seine Rezeption im Mittel-alter (lateinisch-deutsch), op. cit., S. 205-247, hier bes. S. 224-226. 23 Vgl. für eine Gesamtdarstellung dieses Aneignungsprozesses von Avicennas De anima die Monographie von Dag Nikolaus Hasse, Avicenna’s ‚De anima‘ in the Latin West. The Formation of a Peripatetic Philo-sophy of the Soul 1160-1300, London u. Turin 2000. 24 Vgl. für eine angemessene Würdigung der neoplatonischen Elemente im Denken des Thomas Werner Beierwaltes, „Der Kommentar zum Liber de causis als neuplatonisches Element in der Philosophie des Tho-mas von Aquin“, in: Philosophische Rundschau 11 (1964), S. 192-215, hier bes. S. 202.
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
191
über die Begegnung mit arabisch-jüdischen Denkern und ihren jeweiligen religiösen Tradi-tionen bis zu Aristoteles selbst erfolgt. Tradierte Probleme verbinden sich hierbei mit inno-vativen Einsichten und erlauben die Integration des ‚Neuen‘ ins ‚Eigene‘. Bei Gundissalinus findet sich dieser Dreischritt gleichsam in geraffter Form; aber er trifft nicht nur auf diesen zu, sondern gilt gleichermaßen auch übergreifend für die Entwicklungen des 12. und 13. Jahrhunderts insgesamt. So lassen sich auch die großen philosophiegeschichtlichen Ent-wicklungslinien genau nach dem hier vorgeschlagenen Modell eines ‚avicennisierenden Boethianismus‘ und seines latenten Aristotelismus beschreiben: Das 12. Jahrhundert setzt mit einer starken Boethius-Rezeption ein, es folgt die Aufnahme arabischer und jüdischer Quellen (Liber de causis, Avicenna usw.), die auf bestimmte Fragestellungen aus eben dieser Tradition antworten – in eins damit kommt es zur verstärkten Auseinandersetzung mit dem Phänomen der ‚anderen‘ religiösen Traditionen –, woraufhin es erst in einem dritten Schritt zur eigentlichen Aristoteles-Rezeption kommt. Der Übergang von einem platonischen zu einem aristotelisch orientierten Wissenschaftskonzept und das Auftreten der Metaphysik als Wissenschaft sind damit nicht erst im 13. Jahrhundert und dann gleichsam als exogen indu-zierter Bruch mit der eigenen Tradition zu verorten, sondern sie sind bereits ein wesentliches Moment der intellektuellen Renaissance des 12. Jahrhunderts. Ja diese Renaissance selbst ist nicht auf das 12. Jahrhundert beschränkt, sondern beschreibt den Anfangspunkt einer konti-nuierlichen Entwicklung, die bei Gundissalinus – zumindest teilweise – noch im 12. Jahr-hundert in ihr Ziel gelangt, während sie in Zentraleuropa erst im 13. Jahrhundert zur Vollen-dung kommt.
Zu Recht zählt daher Ludger Honnefelder auch Gundissalinus – gleichsam als Avant-garde – zum Zusammenhang jener Autoren, den er zum Ausgangspunkt des „zweiten An-fangs der Metaphysik“ im 13. und 14. Jahrhundert erklärt, namentlich Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus.25 Denn auch wenn der spanische Archidiakon zeitlich deutlich früher liegt, so sind doch die wesentlichen Elemente eines neuen, ent-theologisierten philo-sophischen Metaphysikbegriffs26 bereits bei Gundissalinus faßbar. Aber mehr noch, mit Gun-dissalinus, so gilt es festzustellen, kommt nicht nur die aristotelische Metaphysik erneut und erstmalig im lateinischen Mittelalter ausdrücklich zur Sprache, vielmehr treten hier auch weitere, ja letztlich die entscheidenden Domänen der aristotelischen Philosophie in einer auch für die nachfolgenden Jahrhunderte bestimmenden Weise in Erscheinung: denn aus dem Blickwinkel der Wissens- und Wissenschaftstheorie führt Gundissalinus die theoreti-sche und praktische Philosophie des Stagiriten in ihrer Gesamtheit vor. Mit Gundissalinus kommt es so nicht nur zu einem ‚zweiten Anfang der Metaphysik‘, sondern sogar zu einem, wenn man so will, ‚zweiten Anfang‘ der aristotelischen Philosophie überhaupt. Die systema-tischen Konsequenzen dieses zweiten Anfangs sind in ihrer ganzen Tragweite nur schwer zu fassen: Denn dieser zweite Anfang gibt nicht nur spezifische Interpretationen aristotelischer Theorieelemente vor, vielmehr lenkt er zugleich auch die Aufmerksamkeit auf ausgewählte ____________________________________________________________________________________________
25 Vgl. Ludger Honnefelder, „Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert“, in: Jan P. Beckmann u.a. (Hrsg.), Philosophie im Mittelalter. Entwicklungen und Paradigmen, Hamburg ²1996, S. 165-186, zu Gundissalinus S. 167. 26 Nach Ludger Honnefelder, ibid., S. 185, ist der ‚zweite Anfang der Metaphysik‘ ja gerade dadurch charakterisiert, daß „die Entwicklung in der Rezeption des aristotelischen Programms von einer theologi-schen zu einer ontologischen Deutung, von der ersten Philosophie als Weisheit zur ersten Philosophie als Wissenschaft [führt].“
Schluß
192
Zusammenhänge, die nicht nur für die Aristoteles-Rezeption der unmittelbar folgenden Jahr-hunderte leitend sind, sondern vermittelt über diese auch den Rahmen für gegenwärtige Dis-kussionen um das rechte, nicht nur philologische, sondern auch systematische Verständnis der aristotelischen Philosophie darstellen. So lassen sich gegenwärtige Konzepte von Meta-physik und ihrer Kritik, wie Honnefelder immer wieder betont hat,27 nicht allein von den aristotelischen Quellen her, sondern allererst im Horizont der mit Gundissalinus anbrechen-den mittelalterlichen Reflexionen und ihrer arabisch-jüdischen ebenso wie neoplatonischen Quellen adäquat diskutieren. Gleiches läßt sich für die wissens- und wissenschaftstheoreti-schen Fragen auch der Gegenwart behaupten. Wer etwa Diskussionen zu Gegenstand, Me-thode, Axiomatik der Wissenschaften, ihrer Subordination und Binnendifferenzierung allein aus Aristoteles heraus führen will, wird nur allzuschnell die Grenzen gewahren, die sich dabei einstellen. Diese Konzepte auch der gegenwärtigen wissens- und wissenschaftstheore-tischen Debatten lassen sich aus Aristoteles allein nicht zufriedenstellend interpretieren. Ja oftmals sind die mit diesen Konzepten verbundenen Probleme gar nicht aristotelischer Her-kunft, sondern entfalten ihre Bedeutung erst in ihrem genuinen Entstehungskontext: den philosophischen Reflexionen des Mittelalters, wie dies etwa für die Diskussion um die Axiomatik im engeren Sinne der Fall ist, die sich bei Aristoteles gar nicht findet. Gundissali-nus’ zweiter Anfang der aristotelischen Philosophie ist somit auch für die systematischen Kontroversen der Gegenwart ein wesentlicher Bezugspunkt, ja diese können konsequent größtenteils erst im Lichte der mittelalterlichen Aristoteles-Rezeption ausgetragen werden. Denn die gegenwärtige Wissens- und Wissenschaftstheorie, ja Philosophie insgesamt, knüpft selbst da, wo sie sich genuin aristotelisch glaubt, zumeist nicht unmittelbar an die aristoteli-schen Vorlagen an, sondern gewinnt ihre Argumente erst aus der unleugbaren historischen Distanz zu diesen. Bei deren Überbrückung fließen jedoch die mittelalterlichen Rezipienten des Aristoteles und ihre in der Auseinandersetzung mit der arabisch-jüdischen Philosophie und dem Neoplatonismus gewonnenen Interpretationen, gleichviel ob bewußt oder unbe-wußt, stets ein. Auch der Deutsch-Aristotelismus des 17. Jahrhunderts, allen voran Christian Wolff, und selbst die durchaus berechtigten historisch-kritischen Bemühungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts um den ‚ursprünglichen‘ Aristoteles sind hiervon nicht ausgeschlos-sen.28 Dort wo aber dessenungeachtet der Versuch einer Purifizierung der aristotelischen Philosophie aus rein historisch-philologischer Perspektive absolut gesetzt wird, schneidet man sich von wichtigen Quellen und Traditionen auch des Denkens der Gegenwart ab und läuft Gefahr, einen Aristoteles zu präparieren, der für die systematische Interpretation der Gegenwart letztlich bei weitem nicht so interessant ist wie jener Aristoteles, der den ver-meintlichen Ballast der Diskussionen des Mittelalters und anderer Epochen mit sich trägt.29
____________________________________________________________________________________________
27 Vgl. v.a. Ludger Honnefelder, ‚Scientia transcendens‘. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Reali-tät in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus – Suárez – Wolff – Kant – Peirce), Ham-burg 1987. 28 Vgl. in diesem Sinne etwa die in den Kapiteln 2.2.2. und 3.2. diskutierten vermeintlichen Emendationen von Albert Schwegler. Diese sind ohne Kenntnis der mittelalterlichen Diskussionen um den Abstraktions-begriff bei Boethius und Aristoteles nur unzureichend versteh- und kritisierbar. 29 In dieser Hinsicht kommt auch der Erschließung des Aristoteles semitico-latinus, der seit 1975 in rascher Folge in der gleichnamigen Reihe unter der Leitung von Hans Daiber u.a. erscheint, ein kaum zu überschät-zender Wert nicht nur für die historisch-philologische Aristoteles-Kritik, sondern auch für die systematische Aufarbeitung seiner Philosophie zu.
Gundissalinus und der ‚zweite Anfang’ der aristotelischen Philosophie
193
Bei allem Bemühen um ein ursprüngliches Verstehen des aristotelischen Werkes darf näm-lich, wie Otfried Höffe mit Recht feststellt, dies nicht außer acht gelassen werden: „Eine philosophische Auseinandersetzung beabsichtigt nicht die Rettung oder Apologie eines Wer-kes, vielmehr ein besseres Verstehen der Natur und des Menschen. Infolgedessen kommt es nicht so sehr auf ein Wiederentdecken des Aristoteles an als auf die Fähigkeit, durch seine produktive Rezeption das Denken weiterzubringen.“30 Genau in diesem Prozeß einer produktiven Rezeption stellt Gundissalinus jedoch einen wesentlichen Schritt dar, hinter den nicht einfach zurückgegangen werden kann, ohne dabei die eigene Optik auf das aristoteli-sche Werk zu verleugnen.
In Gundissalinus verdichten sich somit wesentliche Momente der Renaissance des 12. und 13. Jahrhunderts in einem ‚zweiten Anfang‘ der Philosophie des Aristoteles, der zumin-dest in Teilen auch der Ausgangspunkt der gegenwärtigen Fragestellungen ist oder sein sollte. Und der Archidiakon ist sich dieses zweiten Anfangs der Philosophie durchaus be-wußt: Hierzu soll nun am Ende dieses Epilogs noch einmal Gundissalinus selbst zu Wort kommen, und zwar mit zwei Passagen aus den Prologen zu De scientiis und De divisione, mit denen er sich in aller Deutlichkeit als Kind einer Renaissance des 12. Jahrhunderts aus-weist: einer Wiedergeburt also, oder eines ‚zweiten Anfangs‘ der Philosophie eben. Beide Passagen gehören zum literarisch Anmutigsten, was Gundissalinus in seinem sonst sehr spröden Latein verfaßt hat. So schreibt er zu Beginn von De scientiis, in einem Passus, der nicht auf al-FÁrÁbÐs KitÁb iÎÒÁÞ al-ÝulÙm zurückgeht:
Cum plures essent olim philosophi, inter omnes tamen ille solus simpliciter sapiens dice-batur, qui omnium rerum scientiam certa cognitione comprehendisse credebatur. Nunc autem, mundo senescente, non dico sapiens, sed, quod minus est, philosophus nemo dici meretur.31
Die schmerzliche Erinnerung an vergangene Zeiten, da die Philosophie in ihrer Blüte stand, und es nicht nur Philosophen, sondern gar noch Weise gab, scheint somit die vis motrix des gesamten bis hierher wenigstens in Ausschnitten vorgestellten gundissalinischen Unterneh-mens zu sein. Dieses entsteht gleichsam aus dem Bedürfnis heraus, etwas von der einstigen Pracht für die als dürftig empfundene Gegenwart zurückzugewinnen, und zwar im Falle von De scientiis durch die Übersetzung und Bearbeitung arabischer Werke, die den griechischen Wissenschaftskosmos, den Gundissalinus hier ganz offensichtlich als Modell vor Augen hat, tradieren. Deutlicher noch wird dies im Prolog zu De divisione:
Felix prior aetas, quae tot sapientes protulit, quibus velut stellis mundi tenebras irradiavit. Quot enim ipsi scientias ediderunt, quasi tot faculas nobis ad illuminandum nostrae mentis ignorantiam reliquerunt. Sed quia nunc terrenis curis inserviunt, alii circa eloquentiae stu-dium occupantur, alii temporalis dignitatis ambitione inardescunt. Ideo paene omnes circa sapientiae studium languescunt et praesens lumen quasi caeci non attendunt. Unde propter istos opere pretium duximus, quid sit sapientia et quas partes habeat, breviter ostendere [...]32
____________________________________________________________________________________________
30 Otfried Höffe, Aristoteles, München 21999, S. 304. 31 Dominicus Gundissalinus, De scientiis, ed. cit., S. 55. 32 Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae, ed. cit., S. 3.
Schluß
194
Aus den Anfangsworten von De divisione spricht in kaum zu überbietender Klarheit die Sehnsucht nach glücklicheren Tagen, ja nach einer Renaissance dieser Tage, die mit der emphatischen Licht-Metaphorik fast schon an die ‚Aufklärung‘ erinnert. Gundissalinus ver-steht sein Werk mithin in bewußter Opposition zur historischen Situation der Philosophie seiner Tage gleichsam als Gegenprojekt, das sich an der antiken Philosophie, jenem „glück-lichen Zeitalter“ der Griechen, orientieren soll, ja dieses erneuern möchte. Aber mehr noch, diese Rückbesinnung verrät selbst noch einmal ihre Herkunft: „Felix prior aetas“ – dies sind nicht des Gundissalinus’ eigene Worte, es ist erneut Boethius, der hier spricht.33 Der ‚zweite Anfang‘ der Philosophie zeigt sich auch hier unauflöslich mit dem Namen des Aniciers ver-knüpft, der Gundissalinus – und mit ihm dem 12. und 13. Jahrhundert insgesamt – gemein-sam mit den arabischen Quellen den Weg zurück zu Aristoteles und seiner Wissens- und Wissenschaftstheorie weist, welche, wie angedeutet wurde, die epistemologischen Grundla-gen nicht nur für die intellektuelle Revolution des 12. Jahrhunderts bereitstellt.
____________________________________________________________________________________________
33 Siehe Boethius, Consolatio philosophiae, ed. Ludovicus Bieler (CCSL XCIV), Turnhout 1957, lib. II, cap. 5, S. 28.
Bibliographie
Werke des Domincus Gundissalinus
De anima, ed. Joseph Thomas Muckle, in: Mediaeval Studies 2 (1940), 23-103. De divisione philosophiae, ed. Ludwig Baur, in: BGPhMA IV, 2-3, Münster 1903. (Teilw.
Übers. ins Engl. in: Edward Grant [Hrsg.], A Source Book in Medieval Science, Cam-bridge [Mass.] 1974, 59-76.)
De immortalitate animae, ed. Georg Bülow, in: BGPhMA II, 3, Münster 1897. (Übers. ins Span. in: Noboru Kinoshita, El pensamiento filosófico de Domingo Gundisalvo, Sala-manca 1988, 129-149; Übers. ins Engl. in: Wilhelm von Auvergne, The Immortality of the Soul, transl. by Roland R. Teske, Milwaukee 1991.)
De processione mundi, ed. u. übers. ins Span. María Jesús Soto Bruna u. Concepción Alonso del Real, Pamplona 1999. (Davor ed. Georg Bülow, in: BGPhMA XXIV, 3, Münster 1925; davor ed. Marcelino Menéndez y Pelayo, in: Historia de los heterodoxos españo-les, Bd. I, Madrid 1880, 691-711; Übers. ins Engl. in: Dominicus Gundissalinus, The Procession of the World, transl. by John A. Laumakis, Milwaukee 2002.)
De scientiis, ed. Manuel Alonso, Madrid u. Granada 1954. De unitate, ed. Manuel Alonso, in: Pensamiento 12 (1956), 65-78. (Davor ed. Paul Correns,
in: BGPhMA I, 1, Münster 1891; Übers. ins Span. in: Noboru Kinoshita, El pensamiento filosófico de Domingo Gundisalvo, Salamanca 1988, 123-128; Übers. ins Deutsche in: Alexander Fidora u. Andreas Niederberger, Vom Einen zum Vielen – Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002, 66-79.)
Übersetzungen des D.G.
Alexander von Aphrodisias, De intellectu et intellecto, ed. Gabriel Théry, in: id., Autour du
décret de 1210: II. Alexandre d’Aphrodise, Kain 1926, 68-83. Avicenna, De convenientia et differentia subiectorum, ed. Ludwig Baur, in: BGPhMA IV, 2-
3, Münster 1903, 124-133. Avicenna, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. Simone van Riet, 2 Bde.,
Louvain u. Leiden 1977 u. 1980. al-FÁrÁbÐ, Liber excitationis ad viam felicitatis, ed. Marie-Thérèse d’Alverny, in: Archives
d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 24 (1949), 241-242. al-FÁrÁbÐ, Fontes quaestionum, ed. J. Bignami-Odier, in: Archives d’histoire doctrinale et
littéraire du Moyen Âge 12-13 (1937-1938), 154-155. al-FÁrÁbÐ, De intellectu et intellecto, ed. Étienne Gilson, in: Archives d’histoire doctrinale et
littéraire du Moyen Âge 4 (1929), 115-141.
Bibliographie
196
al-FÁrÁbÐ, De ortu scientiarum, ed. Clemens Baeumker, in: BGPhMA XIX, 3, Münster 1916. al-ÇazzÁlÐ, Algazel’s Metaphysics. A Mediaeval Translation, ed. Joseph Thomas Muckle,
Toronto 1933. al-ÇazzÁlÐ, Logica, ed. Charles Lohr, in: Traditio 21 (1965), 223-290. Isaak Israeli, Liber de definitionibus, ed. Joseph Thomas Muckle, in: Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge 12-13 (1937-1938), 300-328 u. 328-340. al-KindÐ, De intellectu, ed. Albino Nagy, in: BGPhMA II, 5, Münster 1897, 1-11. Pseudo-al-KindÐ, Liber introductorius in artem logicae demonstrationis, ed. Albino Nagy, in:
BGPhMA II, 5, Münster 1897, 41-64.
Übersetzungen unter Beteiligung von D.G.
Avicenna, Liber de anima seu sextus de naturalibus, ed. Simone van Riet, 2 Bde., Louvain u.
Leiden 1968 u. 1972. Avicenna, Logica, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1961. Avicenna, Prologus discipuli et capitula, ed. Alexander Birkenmajer, in: Revue néo-sco-
lastique de philosophie 36 (1934), 308-320. Avicenna, De speciebus cordium, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1962. Avicenna, Sufficientia physicorum, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1962. Avicenna, De universalibus, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1962. Avicenna, Liber de vegetabilibus, Venetiis 1508, Ndr. Frankfurt am Main 1962. Ibn Gabirol, Fons vitae, ed. Clemens Baeumker, in: BGPhMA I, 2-4, Münster 1892 u. 1895. IsÎÁq Ibn Íunain, De coelo et mundo, Venetiis 1508. QusÔÁ Ibn LÙqÁ, De differentia animae et spiritus, ed. C. S. Barach, Innsbruck 1878.
Weitere Quellentexte
Abraham Ibn DÁwÙd, Das Buch Emunah Ramah oder: Der erhabene Glaube, übers. und
hrsg. von Simson Weil, Berlin 1919. Alanus ab Insulis, Liber in distinctionibus dictionum theologicalium, PL 210, Sp. 687-1012. Alanus ab Insulis, Regulae caelestis iuris, ed. Nikolaus M. Häring, in: Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge 48 (1982), 97-226. Alcher von Clairvaux, Liber de spiritu et anima, PL 40, Sp. 779-832. Ammonios Hermeiou, In Porphyrii Isagogen sive V voces, ed. Adolf Busse (CAG IV, 3),
Berlin 1891. Aristoteles, Analytica posteriora, übers. u. erläutert von Wolfgang Detel, 2 Bde., Darmstadt
1993.
Bibliographie
197
Aristoteles, Erste Analytik – Zweite Analytik, hrsg., übers., mit Einl. u. Anm. versehen von Hans Günter Zekl, Hamburg 1998.
Aristoteles, Éthique à Nicomaque, introd., trad. et comm. par René Antoine Gauthier, 3 Bde., Louvain u. Paris 1958 u.1959.
Aristoteles, Eudemische Ethik, übers. und komm. von Franz Dirlmeier, Berlin 1979. Aristoteles, Generation of Animals, with an Engl. trans. by A. L. Peck, London 1953. Aristoteles, Generation of Animals, the Arabic Translation Commonly Ascribed to YayÎÁ Ibn
al-BiÔrÐq, ed. J. Brugmann u. H. J. Drossaart Lulofs, Leiden 1971. Aristoteles, Kategorien – Hermeneutik oder vom sprachlichen Ausdruck, hrsg., übers., mit
Einl. u. Anm. versehen von Hans Günter Zekl, Hamburg 1998. Aristoteles, Metaphysik I-VI, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst Seidl,
Hamburg 31989. Aristoteles, Metaphysik VII-XIV, in der Übers. von Hermann Bonitz, neu bearb. von Horst
Seidl, Hamburg 31991. Aristoteles, Meteorologie / Über die Welt, übers. von Hans Strohm, Berlin 21979. Aristoteles, Nikomachische Ethik VI, hrsg. u. übers. von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am
Main 1998. Aristoteles, Parva naturalia, a revised text with introd. and comm. by David Ross, Oxford
1955. Aristoteles, Parva naturalia, trad., introd. y notas de Jorge A. Serrano, Madrid 1993. Aristoteles, Posterior Analytics, trans. with notes by Jonathan Barnes, Oxford 1975. Aristoteles, Philosophische Schriften I, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995. Aristoteles, Philosophische Schriften III, nach der Übers. von Eugen Rolfes, bearb. von
Günther Bien, Hamburg 1995. Aristoteles, Philosophische Schriften IV, übers. von Eugen Rolfes, Hamburg 1995. Aristoteles, Physik I-IV, übers. u. eingel. von Hans Günter Zekl, Hamburg 1987. Aristoteles, Über die Seele, mit. Einl., Übers. u. Komm. hrsg. von Horst Seidl, Hamburg
1995. Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Translatio anonyma, ed. Laurentius Minio-
Paluello (Aristoteles latinus IV, 2), Brügge u. Paris 1953. Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Gerardo Cremonensi interprete, ed. Laurentius
Minio-Paluello (Aristoteles latinus IV, 3), Brügge u. Paris 1954. Aristoteles latinus, Analytica posteriora – Translatio Iacobi, ed. Laurentius Minio-Paluello
(Aristoteles latinus IV, 1/4), 2 fasc., Brügge u. Paris 1968. Aristoteles latinus, Ethica Nicomachea, ed. Renatus Antonius Gauthier (Aristoteles latinus
XXVI, 1-3), 5 fasc., Leiden u. Brüssel 1972-1974. Aristoteles latinus, De generatione et corruptione, ed. Johanna Judycka (Aristoteles latinus
IX, 1), Leiden 1985.
Bibliographie
198
Aristoteles latinus, Physica – Translatio vaticana, ed. Augustinus Mansion (Aristoteles lati-nus VII, 2), Brügge u. Paris 1957.
Aristoteles latinus, Physica – Translatio vetus, ed. Fernand Bossier u. Jozef Brams (Aristo-teles latinus VII, 1/1-2), 2 fasc., Leiden u. New York 1990.
Aristoteles latinus, Politica (Libri I-II, 11), ed. Petrus Michaud-Quantin (Aristoteles latinus XXIX, 1), Brügge u. Paris 1961.
Aristoteles semitico-latinus, De animalibus. Michael Scot’s Arabic Translation – Part Three: Books XV-XIX: Generation of Animals, ed. Aafke van Oppenraay (Aristoteles semitico-latinus V), Leiden u.a. 1992.
Aristoteles semitico-latinus, Aristotle’s ‚Meteorology‘ in the Arabico-Latin Tradition, ed. Pieter L. Schoonheim (Aristoteles semitico-latinus XII), Leiden u.a. 2000.
Aristoteles semitico-latinus, Aristotle’s ‚Physics‘ and Its Reception in the Arabic World, ed. Paul Lettinck (Aristoteles semitico-latinus VII), Leiden u.a. 1994.
Aristoteles semitico-latinus, Nicolaus Damascenus, De plantis. Five Translations, ed. H. J. Drossaart Lulofs u. E. L. J. Poortman (Aristoteles semitico-latinus IV), Amsterdam 1989.
ArisÔÙÔÁlÐs, FÐ’n-nafs, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kairo 1954. ArisÔÙÔÁlÐs, FÐ’s-samÁÞ wa’l-Á×Ár al-ÝulwÐya, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kairo 1961. ArisÔÙÔÁlÐs, KitÁb al-aÌlÁq, tarÊamat IsÎÁq Ibn Íunain, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, Kuwait
1979. ArisÔÙÔÁlÐs, KitÁb al-burhÁn, in: ManÔiq ArisÔÙ, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, 3 Bde., Kairo
1948 u.1952, Bd. II, 307-406. ArisÔÙÔÁlÐs, AÔ-ÔabÐÝa, tarÊamat IsÎÁq Ibn Íunain, ed. ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ, 2 Bde., Kairo
1384/1964-1385/1965. Averroes, Aristotelis De anima libri tres cum Averrois commentariis et antiqua translatione
suae integritati restituta, Venetiis 1562, Ndr. Frankfurt am Main 1962 (= Suppl. II). Averroes, Aristotelis De physico auditu libri octo cum Averrois Cordubensis variis in eos-
dem commentariis, Venetiis 1562, Ndr. Frankfurt am Main 1962 (= Bd. IV). Averroes, Exposición de la ‚República‘ de Platón, estudio, trad. y notas de Miguel Cruz
Hernández, Madrid 1986. Avicenna, De congelatione et conglutinatione lapidum, Latin and Arabic texts ed. with an
Engl. trans. and notes by E. J. Holymard and D. C. Mandeville, Paris 1927. Avicenna, Tractatus de divisionibus scientiarum, Venetiis 1546. Beda Venerabilis, Libri II De Arte Metrica et De Schematibus et Tropis – The Art of Poetry
and Rhetoric, ed. Calvin B. Kendall, Saarbrücken 1991. Biblia polyglotta matritensia. Series VII. Vetus latina. L. 21. Psalterium visigothicum-
mozarabicum, editio critica curante Mons. Dr. Theophilo Ayuso Marazuela, Matriti 1957.
Boethius, In Categorias Aristotelis, PL 64, Sp. 159-294.
Bibliographie
199
Boethius, Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae consolationis libri quinque accedunt eiusdem atque incertorum Opuscula sacra, ed. Rudolf Peiper, Lipsiae 1871.
Boethius, Consolatio philosophiae, ed. Ludovicus Bieler (CCSL XCIV), Turnhout 1957. Boethius, De consolatione philosophiae – Opuscula theologica, ed. Claudio Moreschini,
Monachii et Lipsiae 2000. Boethius, In Isagogen Porphyrii commenta, ed. Samuel Brandt (CSEL XLVIII), Lipsiae
1906. Boethius, Die theologischen Traktate, übers., eingel. u. mit Anm. versehen von Michael
Elsässer, Hamburg 1988. Boethius, De topicis differentiis, PL 64, Sp. 1174-1216. Cassiodor, De artibus et disciplinis liberalium litterarum, PL 70, Sp. 1149-1220. Cicero, De inventione, hrsg. u. übers. von Theodor Nüßlein, Düsseldorf u. Zürich 1998. Cicero, De re publica, hrsg. u. übers. von Karl Büchner, Düsseldorf u. Zürich 1993. Clarembald von Arras, Der Kommentar des Clarenbaldus von Arras zu Boethius ‚De Trini-
tate‘. Ein Werk aus der Schule von Chartres im 12. Jahrhundert, ed. Wilhelm Jansen, Breslau 1926.
Clarembald von Arras, Life and Works of Clarembald of Arras. A Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. Nikolaus M. Häring, Toronto 1965.
Daniel von Morley, Philosophia, ed. Gregor Maurach, in: Mittellateinisches Jahrbuch 14 (1979), 204-255.
Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers. u. hrsg. von Otto Apelt, bearb. von Hans Günter Zekl, Hamburg 21967.
Elias, In Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias commentaria, ed. Adolf Busse (CAG XVIII, 1), Berlin 1900.
Euklid, Die Elemente, übers. u. hrsg. von Clemens Thaer, Frankfurt am Main 1997. Exempla Scripturae Visigoticae XL Tabulis Expressa, ediderunt Paulus Ewald et Gustavus
Loewe, Heidelbergiae 1883. al-FÁrÁbÐ, Catálogo de las ciencias, ed. Ángel González Palencia, Madrid 21953. Gilbert von Poitiers, The Commentaries on Boethius by Gilbert of Poitiers, ed. Nikolaus M.
Häring, Toronto 1966. Hugo von Sankt Viktor, De sacramentis christianae fidei, PL 176, Sp. 173-618. Isidori Etymologiae Codex Toletanus (nunc Matritensis) 15, 8, codices graeci et latini pho-
tographice depicti duce Scatone de Vries, Lugduni 1909. Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, ed. Wallace M. Lindsay,
2 Bde., Oxford 1911. Johannes von Salisbury, Metalogicon, ed. C. C. J. Webb, Oxford 1929. Michael Scotus, De divisione philosophiae, ed. Ludwig Baur, in: BGPhMA IV, 2-3, Münster
1903, 398-400.
Bibliographie
200
Peter Abaelard, Logica ingredientibus, ed. Bernhard Geyer, in: BGPhMA XXI, 1-3, Münster 1919-1927.
Petrus Helias, Summa super Priscianum, ed. Leo Reilly, 2 Bde., Toronto 1993. Plato, Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus, ed. J. H. Waszink, Londoni
et Leidae 1962. Platon, Werke I, gr.-dt. hrsg. von Gunther Eigler, Darmstadt 1977. Proklos, A Commentary on the First Book of Euclid’s ‚Elements‘, trans. with an introd. and
notes by Glenn R. Morrow, Princeton 1970. Robert Kilwardby, De ortu scientiarum, ed. Albert G. Judy, Toronto 1976. Themistius, Commentum super Librum posteriorum, ed. J. Reginald O’Donnell, in: Medi-
aeval Studies 20 (1958), 239-315. Thierry von Chartres, Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and His School, ed.
Nikolaus M. Häring, Toronto 1971. Thierry von Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, ed. Karin
M. Fredborg, Toronto 1988. Thomas von Aquin, Commentaria in Aristotelis libros Peri hermeneias et Posteriorum ana-
lyticorum, iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, in: Opera omnia I, Romae 1882. Thomas von Aquin, Expositio super librum Boethii ‚De Trinitate‘, ed. Bruno Decker, Leiden
1955. Thomas von Aquin, In libros Posteriorum analyticorum, in: Opera omnia XVIII, Parmae
1865. Thomas von Aquin, In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, ed. P. M. Maggiolo,
Turin 1954. Thomas von Aquin, Prologe zu den Aristoteles-Kommentaren, hrsg., übers. und eingel. von
Francis Cheneval u. Ruedi Imbach, Frankfurt am Main 1993. Thomas von Aquin, Sententia libri Ethicorum IV-X, iussu impensaque Leonis XIII P. M.
edita, in: Opera omnia XLVII, Romae 1969. Thomas von Aquin, Summa theologiae, iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, in: Opera
omnia IV-XII, Romae 1889-1906. Vinzenz von Beauvais, Speculum doctrinale, Argentorati 1474, Ndr. Frankfurt am Main
1965. Wilhelm von Auvergne, De l’âme, introd., trad. et notes par Jean-Baptiste Brenet, Paris
1998. Wilhelm von Conches, Glosae super Boetium, ed. Lodi Nauta (CCCM CLVIII), Turnhout
1999. Wilhelm von Conches, Glosae super Platonem, ed. Édouard Jeauneau, Paris 1965.
Bibliographie
201
Sekundärliteratur
Abeloos, Édouard-Bernard, „Un cinquième manuscrit du Tractatus de anima de Dominique
Gundissalinus“, in: Bulletin de philosophie médiévale 14 (1972), 72-85. Akasoy, Anna u. Fidora, Alexander, „Eine Untersuchung zum arabischen Ursprung der alia
translatio der Nikomachischen Ethik“, in: Bulletin de philosophie médiévale 45 (2003), (im Druck).
Allard, Baudoin C., „Note sur le De immortalitate animae de Guillaume d’Auvergne“, in: Bulletin de philosophie médiévale 18 (1976), 68-72.
Alonso, Manuel, „Notas sobre los traductores toledanos Domingo Gundisalvo y Juan Hispano“, in: Al-Andalus 8 (1943), 155-188.
Alonso, Manuel, „El autor de De ortu scientiarum“, in: Pensamiento 2 (1946), 333-340. Alonso, Manuel, „Las fuentes literarias de Domingo Gundisalvo: El De processione mundi
de Gundisalvo y el K. al-ÝqÐda al-rafÐÝa de IbrÁhÐm Ibn David“, in: Al-Andalus 11 (1946), 159-173.
Alonso, Manuel, „Domingo Gundisalvo y el De causis primis et secundis“, in: Estudios ecle-siásticos 21 (1947), 367-380.
Alonso, Manuel, „Hugo de San Víctor, refutado por Domingo Gundisalvo hacia el 1170“, in: Estudios eclesiásticos 21 (1947), 209-216.
Alonso, Manuel, „Traducciones del arcediano Domingo Gundisalvo“, in: Al-Andalus 12 (1947), 295-338.
Alonso, Manuel, „Gundisalvo y el Tractatus de anima“, in: Pensamiento 4 (1948), 71-77. Alonso, Manuel, „Íunayn traducido al latín por Ibn DÁwÙd y Domingo Gundisalvo“, in: Al-
Andalus 16 (1951), 37-47. Alonso, Manuel, „Traducciones del árabe al latín de Juan Hispano (Ibn DÁwÙd)“, in: Al-An-
dalus 17 (1952), 129-151. Alonso, Manuel, „Coincidencias verbales típicas en las obras y traducciones de Gundisalvo“,
in: Al-Andalus 20 (1955), 129-152 u. 345-379. Alonso, Manuel, „El Liber de unitate et uno“, in: Pensamiento 12 (1956) u. 13 (1957), 65-
78, 179-202, 431-472 u. 159-202. Alonso, Manuel, „‚Al-qiwÁm‘ y ‚al-anniyya‘ en las traducciones de Gundisalvo“, in: Al-An-
dalus 22 (1957), 377-405. Alonso, Manuel, Temas filosóficos medievales (Ibn DÁwÙd y Gundisalvo), Comillas 1959. Alonso, Manuel, „El traductor y prologuista del Sextus naturalium“, in: Al-Andalus 26
(1961), 1-35. Alonso del Real, Concepción, „De processione mundi de D. Gundisalvo. Texto del Codex
Oxoniensis Coll. Oriel n. 7“, in: Cuadernos de filología clásica – Estudios latinos 21 (2001), 95-114.
Bibliographie
202
d’Alverny, Marie-Thérèse, „Notes sur les traductions médiévales des œuvres philosophiques d’Avicenne“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 19 (1952), 337-358.
d’Alverny, Marie-Thérèse, „Avendauth?“, in: Homenaje a Millás Vallicrosa, Bd. I, Barce-lona 1954, 19-43.
d’Alverny, Marie-Thérèse, „Les traductions d’Avicenne (Moyen Âge et Renaissance)“, in: Accademia dei Lincei 40 (1957), 71-90.
d’Alverny, Marie-Thérèse, „Translations and Translators“, in: Robert L. Benson u. Giles Constable (Hrsg.), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford 1982, 421-462.
d’Alverny, Marie-Thérèse, „Les traductions à deux interprètes, d’arabe en langue vernacu-laire et de langue vernaculaire en latin“, in: Colloques internationaux du CNRS, Paris 1989, 193-206.
Arberry, Arthur J., „The Nicomachean Ethics in Arabic“, in: Bulletin of the School of Ori-ental and African Studies 17 (1955), 1-9.
Ayerbe-Chaux, Reinaldo, El Conde Lucanor: Materia tradicional y originalidad creadora, Madrid 1975.
Ayuso Marazuela, Teófilo, La Vetus latina hispana, Bd. I, Madrid 1953. Baeumker, Clemens, „Dominicus Gundissalinus als philosophischer Schriftsteller“, in:
BGPhMA XXV, 1-2, Münster 1927, 255-275. (Davor frz. in Clemens Baeumker, „Les écrits philosophiques de Dominicus Gundissalinus“, in: Revue Thomiste 5 (1897), 723-745.)
Bauer, Martin, „Habitus“, in: Lexikon des Mittelalters IV (1989), Sp. 1813-1815. Bédoret, H., „Les premières traductions tolédanes de philosophie. Œuvres d’Alfarabi“, in:
Revue néo-scolastique de philosophie 41 (1938), 80-97. Bédoret, H., „Les premières traductions tolédanes de philosophie. Œuvres d’Avicenne“, in:
Revue néo-scolastique de philosophie 41 (1938), 374-400. Benson, Robert L. u. Constable, Giles (Hrsg.), Renaissance and Renewal in the Twelfth
Century, Oxford 1982. Berndt, Rainer u.a. (Hrsg.), ‚Scientia‘ und ‚Disciplina‘. Wissenstheorie und Wissenschafts-
praxis im 12. und 13. Jahrhundert, Berlin 2002. Bertelloni, Francisco, „Presupuestos de la recepción de la Politica de Aristóteles“, in: Fer-
nando Domínguez u.a. (Hrsg.), Aristotelica et lulliana, magistro Charles H. Lohr sep-tuagesimum annum feliciter agenti dedicata, Steenbrügge 1995, 34-54.
Bertelloni, Francisco, „Les schèmes de la philosophia practica antérieurs à 1265: Leur vo-cabulaire concernant la Politique et leur rôle dans la réception de la Politique d’Aristote“, in: Jacqueline Hamesse u. Carlos Steel (Hrsg.), L’élaboration du vocabu-laire philosophique au Moyen Âge, Turnhout 2000, 171-202.
Bertola, Ermenegildo, „È esistito un Avicennismo latino nel Medioevo?“, in: Sophia 39 (1971), 318-334.
Bibliographie
203
Birkenmajer, Alexander, „Avicenna und Roger Bacon“, in: Revue néo-scolastique de philo-sophie 36 (1934), 308-320.
Bonilla y San Martín, Adolfo, Historia de la filosofía española (desde los tiempos primitivos hasta el siglo XII), Bd. I, Madrid 1908, 309-388.
Bossier, Fernand, „L’élaboration du vocabulaire philosophique chez Burgundio de Pise“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latinitas‘, Louvain 1997, 81-116.
Bouyges, Maurice, „Notes sur les philosophes arabes connus des latins au Moyen Âge: VII. Sur le De scientiis d’Alfarabi récemment édité en arabe à Saïda, et sur le De divisione philosophiae de Gundissalinus“, in: Mélanges de l’Université Saint Joseph de Beyrouth 9 (1923-1924), 49-70.
Brasa Díez, Mariano, „Traducciones y traductores toledanos“, in: Estudios filosóficos 23 (1974), 129-137.
Brasa Díez, Mariano, „Las traducciones toledanas como encuentro de culturas“, in: Jorge M. Ayala (Hrsg.), Actas del V Congreso Internacional de Filosofía Medieval, 2 Bde., Ma-drid 1979, Bd. I, 589-596.
Brasa Díez, Mariano, „Métodos y cuestiones filosóficas en la Escuela de Traductores de Toledo“, in: Revista española de filosofía medieval 3 (1996), 35-49.
Bruder, Konrad, Die philosophischen Elemente der ‚Opuscula sacra‘ des Boethius. Ein Bei-trag zur Quellengeschichte der Philosophie der Scholastik, Leipzig 1928.
Burnett, Charles, „Scientific Speculations“, in: Peter Dronke (Hrsg.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, 151-176.
Burnett, Charles, „Innovations in the Classification of the Sciences in the Twelfth Century“, in: Simo Knuuttila u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy, Bd. II, Hel-sinki 1990, 25-42.
Burnett, Charles, „A New Source for Dominicus Gundissalinus’s Account of the Science of the Stars?“, in: Annals of Science 47 (1990), 361-374.
Burnett, Charles, „The Latin and Arabic Influences on the Vocabulary Concerning De-monstrative Argument in the Versions of Euclid’s Elements associated with Adelard of Bath“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latinitas‘, Louvain 1997, 117-135.
Burnett, Charles, „Vincent of Beauvais, Michael Scot and the ‚New Aristotle‘“, in: Serge Lusignan u. Monique Paulmier-Foucart (Hrsg.), Lector et Compilator – Vincent de Beauvais, frère prêcheur. Un intellectuel et son milieu au XIIe siècle, Grâne 1997, 189-213.
Burnett, Charles, „Filosofía natural, secretos y magia“, in: Luis García Ballester (Hrsg.), Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla I: Edad media, León 2002, 95-144.
Busard, H. L. L., „The Translation of the Elements of Euclid From the Arabic Into Latin by Hermann of Carinthia (?)“, in: Janus 54 (1967), 1-140.
Bibliographie
204
Busard, H. L. L., The First Latin Translation of Euclid’s ‚Elements‘ Commonly Ascribed to Adelard of Bath, Toronto 1983.
Busard, H. L. L., The Latin Translation of the Arabic Version of Euclid’s ‚Elements‘ Com-monly Ascribed to Gerard of Cremona, Leiden u.a. 1984.
Callus, Daniel A., „Gundissalinus’ De anima and the Problem of Substantial Form“, in: New Scholasticism 13 (1939), 338-355.
Callus, Daniel A., „The Tabulae super Originalia Patrum of Robert Kilwardby, O.P.“, in: Studia Mediaevalia in Honor of R. J. Martin, Brügge 1948, 243-270.
Cardaillac, Louis (Hrsg.), Tolède XIIe-XIIIe: Musulmans, chrétiens et juifs – Le savoir et la tolérance, Paris 1992.
Châtillon, Jean, „La Bible dans les écoles du XIIe siècle“, in: Pierre Riché u. Guy Lobrichon (Hrsg.), Le Moyen Âge et la Bible, Paris 1984, 163-197.
Chenu, Marie-Dominique, La théologie au XIIe siècle, Paris 1957. Chroust, Anton-Hermann, „The Definitions of Philosophy in the De divisione philosophiae
of Dominicus Gundissalinus“, in: New Scholasticism 25 (1951), 253-281. Curtius, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Tübingen u. Basel
111993. Daiber, Hans, „Orosius’ Historiae adversus paganos in arabischer Überlieferung“, in: J. W.
van Henten u.a. (Hrsg.), Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Early Christian Culture. Essays in Honour of Jürgen C. H. Lebram, Leiden u.a. 1986, 202-249.
Daiber, Hans, „Lateinische Übersetzungen arabischer Texte zur Philosophie und ihre Be-deutung für die Scholastik des Mittelalters“, in: Jacqueline Hamesse u. Marta Fattori (Hrsg.), Traductions et traducteurs de l’antiquité tardive au XIVe siècle, Louvain u. Cassino 1990, 203-250.
Dechant, Friedrich, Die theologische Rezeption der ‚Artes liberales‘ und die Entwicklung des Philosophiebegriffs in theologischen Programmschriften des Mittelalters von Alkuin bis Bonaventura, St. Ottilien 1993, 140-181.
Detel, Wolfgang, „Einleitung“, in: Aristoteles, Analytica posteriora, übers. u. erläutert von Wolfgang Detel, 2 Bde., Darmstadt 1993, Bd. I, 103-334.
Diwald, Susanne, Arabische Philosophie und Wissenschaft in der Enzyklopädie ‚KitÁb IÌwÁn aÒ-ÑafÁ‘ (III), Wiesbaden 1975.
Dod, Bernard G., „Aristoteles latinus“, in: Norman Kretzmann u.a. (Hrsg.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disinte-gration of Scholasticism 1100-1600, Cambridge 1982, 45-79.
Dreyer, Mechthild, „Die literarische Gattung der Theoremata als Residuum einer Wissen-schaft more geometrico“, in: Maarten J. F. M. Hoenen u.a. (Hrsg.), Philosophy and Learning. Universities in the Middle Ages, Leiden u.a. 1995, 123-135.
Dreyer, Mechthild, More mathematicorum. Rezeption und Transformation der antiken Ge-stalten wissenschaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert, in: BGPhMA, N.F. 47, Münster 1996.
Dronke, Peter, A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988.
Bibliographie
205
Dronke, Peter, „Thierry of Chartres“, in: id. (Hrsg.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, 358-385.
Duhem, Pierre, Le système du monde, Bd. III, Paris 1958, 177-184. Dunlop, Douglas M., „The Translations of al-BiÔrÐq and YayÎÁ (YuÎannÁ) b. al-BiÔrÐq“, in:
Journal of the Royal Asiatic Society o. Jg. (1959), 140-150. Dunlop, Douglas M., „The Work of Translation at Toledo“, in: Babel 6 (1960), 55-59. Dunlop, Douglas M., „The Nicomachean Ethics in Arabic, Books I-VI“, in: Oriens 15
(1962), 18-34. Düring, Ingemar, Aristotle’s Chemical Treatise, ‚Meteorologica‘ Book IV, Göteborg 1944. Düring, Ingemar, Aristoteles – Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg
1966. Elford, Dorothy, „William of Conches“, in: Peter Dronke (Hrsg.), A History of Twelfth-Cen-
tury Western Philosophy, Cambridge 1988, 308-327. Endres, J. A., „Die Nachwirkung von Gundissalinus’ De immortalitate animae“, in: Philo-
sophisches Jahrbuch 12 (1899), 382-392. Endress, Gerhard, Die arabischen Übersetzungen von Aristoteles’ Schrift ‚De caelo‘, Frank-
furt am Main 1966. Evans, Gillian R., „Boethian and Euclidean Axiomatic Method in the Twelfth Century“, in:
Archives internationales de l’histoire des sciences 30 (1980), 36-52. Evans, Gillian R., „The Discussions of the Scientific Status of Theology in the Second Half
of the 12th Century“, in: Matthias Lutz-Bachmann u.a. (Hrsg.), Metaphysics in the Twelfth Century – The Relationship Among Philosophy, Science and Theology, Turnhout 2003 (im Druck).
Ferreiro Alemparte, Jaime, „La escuela de nigromancia de Toledo“, in: Anuario de estudios medievales 13 (1983), 205-268.
Fidora, Alexander, „Dominicus Gundissalinus“, in: Biographisch-bibliographisches Kir-chenlexikon XVII (2000), Sp. 281-286.
Fidora, Alexander, „La metodología de las ciencias según Boecio: su recepción en las obras y traducciones de Domingo Gundisalvo“, in: Revista española de filosofía medieval 7 (2000), 127-136.
Fidora, Alexander, „La recepción de San Isidoro de Sevilla por Domingo Gundisalvo: Astro-nomía, astrología y medicina“, in: Estudios eclesiásticos 75 (2000), 663-677.
Fidora, Alexander, „Die Verse Römerbrief 1, 19ff. im Verständnis Abaelards“, in: Patristica et mediaevalia 21 (2000), 76-88.
Fidora, Alexander, „Domingo Gundisalvo y la Sagrada Escritura“, in: Estudios eclesiásticos 76 (2001), 243-258.
Fidora, Alexander, „M.ª Jesús Soto Bruna y Concepción Alonso del Real (eds.), De pro-cessione mundi. Estudio y edición crítica del tratado de Domingo Gundisalvo, Ediciones Universidad de Navarra (Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, n.o 7),
Bibliographie
206
Pamplona 1999, 262 pp., ISBN 84-313-1715-9“, in: Estudios eclesiásticos 76 (2001), 664-666.
Fidora, Alexander, „Nota sobre Domingo Gundisalvo y el Aristoteles arabus“, in: Al-QanÔara 23 (2002), 201-208.
Fidora, Alexander, „Ein philosophischer Dialog der Religionen im Toledo des 12. Jahrhun-derts: Abraham Ibn DÁwÙd und Dominicus Gundissalinus“, in: Yossef Schwartz (Hrsg.), Religiöse Apologetik, philosophische Argumentation, Tübingen 2003 (im Druck).
Fidora, Alexander u. Niederberger, Andreas, „Der Streit um die Renaissance im 12. Jahr-hundert – Eine Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen Humanismus, Wissenschaft und Religiosität“, in: Convenit Selecta 3 (2000), 7-26.
Fidora, Alexander u. Niederberger, Andreas, Von Bagdad nach Toledo – Das ‚Buch der Ur-sachen‘ und seine Rezeption im Mittelalter (lateinisch-deutsch), Mainz 2001.
Fidora, Alexander u. Niederberger, Andreas, „Philosophie und Physik zwischen notwendi-gem und hypothetischem Wissen. Zur wissenstheoretischen Bestimmung der Physik in der Philosophia des Wilhelm von Conches“, in: Early Science and Medicine 6 (2001), 22-34.
Fidora, Alexander u. Niederberger, Andreas, „Von Toledo nach Paris – Wege der Wissen-schaft und der Wissenstheorie im 12. Jahrhundert“, in: Forschung Frankfurt 19/1 (2001), 31-39.
Fidora, Alexander u. Niederberger, Andreas, Vom Einen zum Vielen – Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002.
Fidora, Alexander u. Soto Bruna, M.ª Jesús, „‚Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?‘ – Algunas observaciones sobre un reciente artículo de Adeline Rucquoi“, in: Estudios eclesiásticos 76 (2001), 467-473.
Flasch, Kurt, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stutt-gart 1986.
Flashar, Hellmut, „Ethik und Politik in der Philosophie des Aristoteles“, in: Gymnasium 78 (1971), 278-293.
Folkerts, Menso, ‚Boethius‘ Geometrie II, ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters, Wiesbaden 1970.
Fontaine, Jacques, „Isidore de Séville et l’astrologie“, in: Revue des études latines 31 (1954), 271-300.
Fontaine, Jacques, Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, Bd. II, Paris 1959.
Fontaine, Jacques, „El De viris illustribus de San Ildefonso de Toledo: Tradición y origina-lidad“, in: Anales toledanos 3 (1971), 59-96.
Fredborg, Karin M., „Petrus Helias on Rhetoric“, in: Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge grec et latin 13 (1974), 31-41.
Fried, Johannes, Aufstieg aus dem Untergang – Apokalyptisches Denken und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft im Mittelalter, München 2001.
Bibliographie
207
García Fayos, L., „El Colegio de Traductores de Toledo y Domingo Gundisalvo“, in: Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid 19 (1932), 109-123.
García-Junceda, José Antonio, „Los Meteorologica de Aristóteles y el De mineralibus de Avicena“, in: ÝAbdarraÎmÁn BadawÐ u.a. (Hrsg.), Milenario de Avicena, Madrid 1981, 37-63.
Gätje, Helmut, Die Epitome der ‚Parva naturalia‘ des Averroes I, Wiesbaden 1961. Gätje, Helmut, Studien zur Überlieferung der aristotelischen Psychologie im Islam, Heidel-
berg 1971. Geiger, Louis-Bertrand, „Abstraction et séparation d’après S. Thomas In De Trinitate, q. 5,
a. 3“, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 31 (1947), 3-40. Gil, José S., La Escuela de Traductores de Toledo y sus colaboradores judíos, Toledo 1985. Gil, José S., „The Translators of the Period of D. Raymond: Their Personalities and Trans-
lations (1125-1187)“, in: Jacqueline Hamesse u. Marta Fattori (Hrsg.), Traductions et traducteurs de l’antiquité tardive au XIVe siècle, Louvain u. Cassino 1990, 109-119.
Gilson, Étienne, „Les sources gréco-arabes de l’augustinisme avicennisant“, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 4 (1929-1930), 4-149.
Goichon, Amélie-Marie, La philosophie d’Avicenne et son influence en Europe médiévale, Paris 1951, 93-99.
González Palencia, Ángel, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Bd. I, Madrid 1926.
González Palencia, Ángel, El arzobispo don Raimundo y la Escuela de Traductores de To-ledo, Barcelona 1942.
Gonzálvez, Ramón, Hombres y Libros de Toledo (1086-1300), Madrid 1997. Gottschalk, H. B., „The Authorship of Meteorologica, Book IV“, in: Classical Quarterly 11
(1961), 67-79. Granger, Gilles-Gaston, La théorie aristotélicienne de la science, Paris 1976. Grignaschi, Mario, „Le De divisione philosophiae de Dominicus Gundissalinus et les
Quaestiones II-V in Sextum Metaphysicorum de Jean de Jandun“, in: Simo Knuuttila u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy, Bd. II, Helsinki 1990, 53-61.
Gutman, Oliver, „On the Fringes of the Corpus aristotelicum: The Pseudo-Avicenna Liber celi et mundi“, in: Early Science and Medicine 2 (1997), 109-128.
Hamesse, Jacqueline, „Un nouveau glossaire des néologismes du latin philosophique“, in: ead. (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latini-tas‘, Louvain 1997, 237-254.
Hammer-Jensen, Ingeborg, „Das sogenannte VI. Buch der Meteorologie des Aristoteles“, in: Hermes 50 (1915), 113-136.
Happ, Hans, „Kosmologie und Metaphysik bei Aristoteles. Ein Beitrag zum Transzendenz-problem”, in: Kurt Flasch (Hrsg.), Parusia. Studien zur Philosophie Platons und zur
Bibliographie
208
Problemgeschichte des Platonismus – Festgabe für Johannes Hirschberger, Frankfurt am Main 1965, 155-187.
Häring, Nikolaus M., „Thierry of Chartres and Dominicus Gundissalinus“, in: Mediaeval Studies 26 (1964), 271-286.
Haskins, Charles Homer, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge (Mass.) 1927, Ndr. New York 1957.
Hasse, Dag Nikolaus, Avicenna’s ‚De anima‘ in the Latin West. The Formation of a Peri-patetic Philosophy of the Soul 1160-1300, London u. Turin 2000.
Hasse, Dag Nikolaus, „Griechisches Denken, muslimische und christliche Interessen – Kul-turtransfer im Mittelalter“, in: Neue Zürcher Zeitung 18./19. August 2001, 52.
Hein, Christel, Definition und Einteilung der Philosophie. Von der spätantiken Einleitungs-literatur zur arabischen Enzyklopädie, Frankfurt am Main 1985.
Henle, Robert J., Saint Thomas and Platonism. A Study of ‚Plato‘ and ‚Platonici‘ Texts in the Writings of St. Thomas, Den Haag 1956.
Hernández, Francisco J., Los Cartularios de Toledo. Catálogo documental, Madrid 1985. Hillgarth, Jocelyn N., „The Position of Isidorian Studies: A Critical Review of the Literature
1936-1975“, in: Studi medievali, 3a serie, 24 (1983), 817-896. Hillgarth, Jocelyn N., „Isidorian Studies“, in: Studi medievali, 3a serie, 31 (1990), 925-973. Höffe, Otfried, Aristoteles, München 21999. Höffe, Otfried (Hrsg.), Aristoteles’ ‚Politik‘, Berlin 2001. Honnefelder, Ludger, ‚Scientia transcendens‘. Die formale Bestimmung der Seiendheit und
Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus – Suárez – Wolff – Kant – Peirce), Hamburg 1987.
Honnefelder, Ludger, „Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert“, in: Jan P. Beckmann u.a. (Hrsg.), Philosophie im Mittelalter. Entwicklungen und Paradigmen, Hamburg ²1996, 165-186.
Hugonnard-Roche, Henri, „La classification des sciences de Gundissalinus et l’influence d’Avicenne“, in: Jean Jolivet u. Roshdi Rashed (Hrsg.), Études sur Avicenne, Paris 1984, 41-75.
Hugonnard-Roche, Henri, „La tradition syro-arabe et la formation du vocabulaire philo-sophique latin“, in: Jacqueline Hamesse (Hrsg.), Aux origines du lexique philosophique européen. L’influence de la ‚latinitas‘, Louvain 1997, 59-80.
Hugonnard-Roche, Henri, „Averroès et la tradition des Seconds analytiques“, in: Gerhard Endress u. Jan A. Aertsen (Hrsg.), Averroes and the Aristotelian Tradition, Leiden u.a. 1999, 172-187.
Hunt, Richard W., „The Introductions to the ‚Artes‘ in the Twelfth Century“, in: Studia Me-diaevalia in Honor of R. J. Martin, Brügge 1948, 85-112.
Huré, Jacques (Hrsg.), Tolède (1085-1985): Des traductions médiévales au mythe littéraire, Paris 1989.
Bibliographie
209
Jacobi, Klaus, „Natürliches Sprechen – Theoriesprache – Theologische Rede. Die Wissen-schaftslehre des Gilbert von Poitiers (ca. 1085-1154)“, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 49 (1995), 511-528.
Jacquart, Danielle, „La médecine arabe et l’occident“, in: Louis Cardaillac (Hrsg.), Tolède XII-XIII. Musulmans, chrétiens et juifs: le savoir et la tolérance, Paris 1992, 192-199.
Jeauneau, Édouard, „Deux rédactions des gloses de Guillaume de Conches sur Priscien“, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 27 (1960), 212-247.
Jolivet, Jean, „Intellect et intelligence. Note sur la tradition arabo-latine des XIIe et XIIIe siècles“, in: S. Hossein Nasr (Hrsg.), Mélanges offerts a Henry Corbin, Teheran 1977, 681-702.
Jolivet, Jean, „The Arabic Inheritance“, in: Peter Dronke (Hrsg.), A History of Twelfth-Cen-tury Western Philosophy, Cambridge 1988, 113-148.
Jolivet, Jean, „Étapes dans l’histoire de l’intellect agent“, in: Ahmad Hasnawi u.a. (Hrsg.), Perspectives arabes et médiévales sur la tradition scientifique et philosophique grecque, Louvain u. Paris 1997, 569-582.
Jourdain, Amable, Recherches historiques sur l’âge et l’origine des traductions latines d’Aristote, Paris 1843.
Kalinowski, G., „La théorie aristotélicienne des habitus intellectuels“, in: Revue des sciences philosophiques et théologiques 43 (1059), 248-260.
Kattenbusch, Ferdinand, „Die Entstehung einer christlichen Theologie. Zur Geschichte der Ausdrücke qeologi,a, qeologei/n, qeolo,goj“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 38 (1930), 161-205.
Kinoshita, Noboru, El pensamiento filosófico de Domingo Gundisalvo, Salamanca 1988. Klamroth, Martin, „Über die Auszüge aus griechischen Schriftstellern bei al-JaÝqÙbГ, in:
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 41 (1887), 415-442. Kluxen, Wolfgang, „Abendländischer Aristotelismus V/1; Mittelalter“, in: Theologische
Realenzyklopädie III (1978), 782-789. Kohlenberger, H. K., „Communes conceptiones“, in: Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie I (1971), Sp. 1024. Kunitzsch, Paul, Von Alexandria über Bagdad nach Toledo. Ein Kapitel aus der Geschichte
der Astronomie (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1 [1991]), München 1991.
LeGoff, Jacques, Les intellectuels au Moyen Âge, Paris 1957. Leibowicz, Max, „Le choc des traductions arabo-latines du XIIe siècle et ses conséquences
dans la spécialisation sémantique d’astrologia et astronomia: Dominicus Gundissalinus et la scientia iudicandi“, in: Transfert de vocabulaire dans les sciences, Paris 1988, 213-275.
Lemay, Richard, AbÙ MaÝshar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century – The Reco-very of Aristotle’s Natural Philosophy Through Arabic Astronomy, Beirut 1962.
Bibliographie
210
Lemay, Richard, „De la scolastique à l’histoire par le truchment de la philologie: itinéraire d’un médiéviste entre Europe et Islam“, in: Biancamaria Scarcia Amoretti (Hrsg.), La diffusione delle scienze islamiche nel medio evo europeo, Rom 1987, 399-535.
Levi, Alessandro, „La partizione della filosofia pratica in un trattato medioevale“, in: Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 67/2 (1907-1908), 1225-1250.
Lohr, Charles H., „The Medieval Interpretation of Aristotle“, in: Norman Kretzmann u.a. (Hrsg.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100-1600, Cambridge 1982, 80-98.
Löwenthal, Albert, Pseudo-Aristoteles über die Seele. Eine psychologische Schrift des 11. Jahrhunderts und ihre Beziehung zu Salomo ibn Gabirol (Avicebron), Berlin 1891.
Lutz-Bachmann, Matthias, Das Verhältnis von Philosophie und Theologie in den ‚Opuscula sacra‘ des A. M. S. Boethius. Eine Studie zur Entwicklung der nachchalcedonischen Theologie, Münster 1984.
Lutz-Bachmann, Matthias (Hrsg.), Ontologie und Theologie – Beiträge zum Problem der Metaphysik bei Aristoteles und Thomas von Aquin, Frankfurt am Main u.a. 1988.
Lutz-Bachmann, Matthias, „Der eine Gott und die vielen Götter: Monotheistischer Wahr-heitsanspruch versus ‚postmoderne Toleranz‘“, in: Matthias Lutz-Bachmann u. Andreas Hölscher (Hrsg.), Gottesnamen: Gott im Bekenntnis der Christen, Berlin 1992, 193-205.
Lutz-Bachmann, Matthias u.a. (Hrsg.), Metaphysics in the Twelfth Century – The Rela-tionship Among Philosophy, Science and Theology, Turnhout 2003 (im Druck).
Madoz, José, „Le symbole du IVe Concile de Tolède“, in: Revue d’histoire ecclésiastique 34 (1938), 5-20.
Madoz, José, „El símbolo del VI Concilio de Toledo (a. 638) en su centenario XIIIo“, in: Gregorianum 19 (1938), 161-193.
Madoz, José, Le symbole du XIe Concile de Tolède, Louvain 1938. Madoz, José, El símbolo del Concilio XVI de Toledo, Madrid 1946. Mansilla, Demetrio, „La documentación pontificia del Archivo de la Catedral de Burgos“, in:
Hispania Sacra 1 (1948), 141-163. Mansion, Augustin, „Étude critique sur le texte de la Physique d’Aristote (L. I-IV). Utilisa-
tion de la version arabe-latine jointe au commentaire d’Averroès“, in: Revue de philolo-gie, de littérature et d’histoire ancienne 47 (1932), 5-41.
Mansion, Augustin, „Note sur les traductions arabo-latines de la Physique d’Aristote dans la tradition manuscrite“, in: Revue néo-scolastique de philosophie 37 (1934), 202-218.
Mansion, Augustin, Introduction à la ‚Physique‘ aristotélicienne, Louvain u. Paris 21945. Maróth, Miklós, Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, Leiden u.a. 1994. McKeon, Richard, „Rhetoric in the Middle Ages“, in: Speculum 17 (1942), 1-32. McKirahan, Richard, „Aristotle’s Subordinate Sciences“, in: The British Journal for the
History of Science 11 (1978), 197-220. McKirahan, Richard, Principles and Proofs – Aristotle’s Theory of Demonstrative Science,
Princeton 1992.
Bibliographie
211
Merlan, Philip, From Platonism to Neoplatonism, Den Haag 1953. Miccoli, Lucia, „Le ‚arte meccaniche‘ nella classificazione delle scienze di Ugo di San
Vittore e Domenico Gundisalvi“, in: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 24 (1981), 73-101.
Millares Carlo, Agustín, „Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas“, in: Hispania Sacra 14 (1961), 337-444.
Millás Vallicrosa, José M., Las traducciones orientales en los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo, Madrid 1942.
Minio-Paluello, Lorenzo, „Jacobus Veneticus Graecus. Canonist and Translator of Aristotle“, in: Traditio 8 (1952), 265-304.
Minio-Paluello, Lorenzo, „Aristotele dal mondo arabo a quello latino“, in: id., Opuscula. The Latin Aristotle, Amsterdam 1972, 501-535.
Mundó, Anscari M., „La datación de los códices litúrgicos visigóticos toledanos“, in: Hispa-nia Sacra 13 (1965), 1-25.
Murdoch, John E., „The Medieval Euclid: Salient Aspects of the Translations of the Ele-ments by Adelard of Bath and Campanus of Novara“, in: Revue de synthèse 89 (1968), 67-94.
Murdoch, John E., „Euclid: Transmission of the Elements“, in: Dictionary of Scientific Bio-graphy IV (1971), 437-459.
Nederman, Cary J., „Nature, Ethics and the Doctrine of habitus: Aristotelian Moral Psycho-logy in the 12th Century“, in: Traditio 45 (1989-1990), 87-110.
Nederman, Cary J., „Aristotelianism and the Origins of ‚Political Science‘ in the 12th Cen-tury“, in: Journal of the History of Ideas 52 (1991), 179-194.
Neumann, Siegfried, Gegenstand und Methode der theoretischen Wissenschaften nach Tho-mas von Aquin aufgrund der ‚Expositio super librum Boethii De Trinitate‘, in: BGPhMA XLI, 2, Münster 1965.
Niederberger, Andreas, „Zwischen De hebdomadibus und Liber de causis – Einige Bemer-kungen zu Form und Argumentation der Regulae theologiae des Alanus ab Insulis“, in: Convenit Selecta 5 (2000), 47-52.
Opelt, Ilona, „Zur Übersetzungstechnik des Gerhard von Cremona“, in: Glotta 38 (1960), 135-170.
Orlandis, José, Estudios de historia eclesiástica visigoda, Pamplona 1998. Otte, James K., „The Life and Writings of Alfredus Anglicus“, in: Viator 3 (1972), 275-291. Pastor García, Juan Tomás, „Domingo Gundisalvo, el arcediano segoviano“, in: M. Fartos
Martínez u. L. Velázquez Campo (Hrsg.), La filosofía española en Castilla y León. De los orígenes al siglo de oro, Valladolid 1997, 39-55.
Pedersen, Olaf, „Astronomy“, in: David C. Lindberg (Hrsg.), Science in the Middle Ages, Chicago 1978, 303-337.
de J. Pérez, J., La cristología en los símbolos toledanos IV, VI y XI, Rom 1939.
Bibliographie
212
Pérez Fernández, Isacio, „Influjo del árabe en el nacimiento del término latino-medieval ‚metaphysica‘“, in: Jorge M. Ayala (Hrsg.), Actas del V Congreso Internacional de Filo-sofía Medieval, 2 Bde., Madrid 1979, Bd. II, 1099-1107.
Pessin, Sarah, „Hebdomads: Boethius Meets the Neopythagoreans“, in: Journal of the Histo-ry of Philosophy 37 (1999), 29-48.
Petraitis, Casimir, The Arabic Version of Aristotle’s ‚Meteorology‘, Beirut 1967. Probst, Otto, „Isidors Schrift De medicina (= Etymol. lib. IV)“, in: Archiv für Geschichte der
Medizin 8 (1915), 25-38. Quain, Edwin A., „The Medieval accessus ad auctores“, in: Traditio 3 (1945), 215-264. Ramón Guerrero, Rafael, „¿Qué es filosofía en la cultura árabe?“, in: Jan A. Aertsen u.
Andreas Speer (Hrsg.), Was ist Philosophie im Mittelalter? (Miscellanea Mediaevalia 26), Berlin u. New York 1998, 257-270.
Regenbogen, Otto, „Eine Polemik Theophrasts gegen Aristoteles“, in: Hermes 72 (1937), 469-475.
Reinhardt, Klaus, „Bible et culture à l’époque de la reconquête de Tolède“, in: Jacques Huré (Hrsg.), Tolède (1085-1985). Des traductions médiévales au mythe littéraire, Paris 1985, 135-145.
Reinhardt, Klaus u. Gonzálvez, Ramón, Catálogo de los códices bíblicos de la Catedral de Toledo, Madrid 1990.
Ricklin, Thomas, Die ‚Physica‘ und der ‚Liber de causis‘ im 12. Jahrhundert: Zwei Studien, Freiburg i. Üe. 1995.
de Rijk, Lambertus Marie, „On the Chronology of Boethius‘ Works on Logic“, in: Vivarium 2 (1964), 1-49 u. 125-162.
Rivera, Juan Francisco, „Nuevos datos sobre los traductores Gundisalvo y Juan Hispano“, in: Al-Andalus 31 (1966), 267-280.
Rivera, Juan Francisco, El arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-1124), Rom 1962.
Rivera, Juan Francisco, La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), 2 Bde., Toledo 1966 u. 1976.
Rose, Valentin, „Ptolemaeus und die Schule von Toledo“, in: Hermes 8 (1874), 327-349. Rubio Fernández, Lisardo, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos existentes en
España, Madrid 1984. Rucquoi, Adeline, „Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?“, in: Bulletin de philosophie
médiévale 41 (1999), 85-106. Santiago-Otero, Horacio, „El término ‚teología‘ en Pedro Abelardo“, in: Revista española de
teología 36 (1976), 251-259. Sarton, George, Introduction to the History of Science, Bd. II, Washington 1927, 172-173. Schipperges, Heinrich, „Die frühen Übersetzer der arabischen Medizin in chronologischer
Sicht“, in: Sudhoffs Archiv 39 (1955), 53-93.
Bibliographie
213
Schipperges, Heinrich, „Zur Rezeption und Assimilation arabischer Medizin im frühen To-ledo“, in: Sudhoffs Archiv 39 (1955), 261-283.
Schipperges, Heinrich, „Das griechisch-arabische Erbe Toledos und sein Auftrag für die abendländische Heilkunde“, in: Sudhoffs Archiv 41 (1957), 113-142.
Schipperges, Heinrich, „Die Rezeption arabisch-griechischer Medizin und ihr Einfluß auf die abendländische Heilkunde“, in: Peter Weimar (Hrsg.), Die Renaissance der Wissen-schaften im 12. Jahrhundert, Zürich u. München 1981, 173-196.
Schmidt, James, „A Raven with a Halo: The Translation of Aristotle’s Politics“, in: History of Political Thought 7 (1986), 295-319,
Schmidt, Martin Anton, „Scholastik“, in: Die Kirche in ihrer Geschichte II (1969), G 69-181.
Schmieja, Horst, „Secundum aliam translationem – Ein Beitrag zur arabisch-lateinischen Übersetzung des Großen Physikkommentars von Averroes“, in: Gerhard Endress u. Jan A. Aertsen (Hrsg.), Averroes and the Aristotelian Tradition, Leiden u.a. 1999, 316-336.
Schrimpf, Gangolf, Die Axiomenschrift des Boethius (‚De hebdomadibus‘) als philosophi-sches Lehrbuch des Mittelalters, Leiden 1966.
Schwegler, Albert, Kommentar zur Metaphysik, Tübingen 1847, Ndr. Frankfurt am Main 1968.
Senn, Gustav, „Hat Aristoteles eine selbständige Schrift über Pflanzen verfaßt?“, in: Philo-logus 85 (1929-1930), 113-140.
Silverstein, Theodore, „‚Elementatum‘: Its Appearence Among the Twelfth-Century Cos-mogonists“, in: Mediaeval Studies 16 (1954), 156-162.
Silvestre, H., „Le schéma ‚moderne‘ des accessus“, in: Latomus 16 (1957), 684-689. Southern, Richard W., Scholastic Humanism and the Unification of Europe – Vol. I: Foun-
dations, Oxford 1995. Southern, Richard W., Scholastic Humanism and the Unification of Europe – Vol. II: The
Heroic Age, Oxford 2001. Speer, Andreas, Die entdeckte Natur. Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer
‚scientia naturalis‘ im 12. Jahrhundert, Leiden u.a. 1995. Speer, Andreas, „Agendo physice ratione – Von der Entdeckung der Natur zur Wissenschaft
von der Natur im 12. Jahrhundert“, in: Rainer Berndt u.a. (Hrsg.), ‚Scientia‘ und ‚Disci-plina‘. Wissenstheorie und Wissenschaftspraxis im 12. und 13. Jahrhundert, Berlin 2002, 157-174.
Stach, Walter, „Bemerkungen zu den Gedichten des Westgotenkönigs Sisebut“, in: Corona quernea. Festgabe K. Strecker zum 80. Geburtstage dargebracht, Leipzig 1941, 75-96.
Steenberghen, Fernand van, „L’organisation des études au Moyen Âge et ses répercussions sur le mouvement philosophique“, in: Revue philosophique de Louvain 52 (1954), 572-592.
Steinschneider, Moritz, „Die Parva naturalia des Aristoteles bei den Arabern“, in: Zeitschrift der Deutschen Morgendländischen Gesellschaft 37 (1883), 477-492.
Bibliographie
214
Steinschneider, Moritz, „Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts“, in: Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 149 (1904), 32-33 u. 40-50.
Stern, S. M., „Ibn al-SamΓ, in: Journal of the Royal Arabic Society of Great Britain and Ireland o. Jg. (1956), 31-44.
Strózewski, Wladyslaw, „Metaphysics as a Science“, in: Monika Asztalos u.a. (Hrsg.), Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth Inter-national Congress of Medieval Philosophy, Bd. I, Helsinki 1990, 128-157.
Sudhoff, Karl, „Die Verse Isidors von Sevilla auf dem Schrank der medizinischen Werke seiner Bibliothek“, in: Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissen-schaften 15 (1916), 200-204.
Sudhoff, Karl, „Toledo!“, in: Sudhoffs Archiv 23 (1930), 1-6. Teicher, Jacob, „Geršon ben Šel½m½h e Gundissalino“, in: Accademia Nazionale dei Lincei 9
(1933), 5-25. Teicher, Jacob, „Gundissalino e l’agostinismo avicennizzante“, in: Rivista di filosofia neo-
scolastica 26 (1934), 252-258. Teicher, Jacob, „The Latin-Hebrew School of Translators in Spain in the Twelfth Century“,
in: Homenaje a Millás Vallicrosa, Bd. II, Barcelona 1956, 401-443. Théry, Gabriel, Tolède, grande ville de la renaissance médiévale, Oran 1944. Thomson, Harrison, „Eine ältere und vollständigere Hs. von Gundissalinus’ De divisione
scientiarum“, in: Scholastik 8 (1933), 240-242. Thorndike, Lynn, A History of Magic and Experimental Science, Bd. II, New York 1923, 78-
82. Thorndike, Lynn, „Unnoticed Manuscripts of Gundissalinus’ De divisione philosophiae“, in:
The English Historical Review 38 (1923), 243-244. Tummers, Paul M. J. E., „Some notes on the Geometry Chapter of Dominicus Gundissali-
nus“, in: Archives internationales d’histoire des sciences 34 (1984), 19-24. de Vaux, Roland, „La première entrée d’Averroës chez les latins“, in: Revue des sciences
philosophiques et théologiques 22 (1933), 193-243. de Vaux, Roland, Notes et textes sur l’avicennisme aux confins des XIIe-XIIIe siècles, Paris
1934. Vegas, Serafín, La Escuela de Traductores de Toledo en la historia del pensamiento, Toledo
1998. Vegas, Serafín, „La transmisión de la filosofía en el medievo cristiano: el prólogo de Aven-
deuth“, in: Revista española de filosofía medieval 7 (2000), 115-125. Veiga Valiña, Arturo, La doctrina escatológica de San Julián de Toledo, Lugo 1940. Verger, Jacques, „Isidore de Séville dans les universités médiévales“, in: Jacques Fontaine u.
Christine Pellistrandi (Hrsg.), L’Europe héritière de l’Espagne wisigothique, Madrid 1992, 259-267.
de Vogel, Cornelia, „Boethiana I“, in: Vivarium 9 (1971), 59-66.
Bibliographie
215
Watt, W. Montgomery, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh 1972. Weber, Robert, Le Psautier Romain et les autres anciens Psautiers latins, Rom 1953. Weimar, Peter (Hrsg.), Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert, Zürich
1981. Weisheipl, James A., „Classification of the Sciences in Medieval Thought“, in: Mediaeval
Studies 27 (1965), 54-90. Wieland, Georg, ‚Ethica‘ – ‚Scientia practica‘. Die Anfänge der philosophischen Ethik im
13. Jahrhundert, in: BGPhMA, N.F. 21, Münster 1981. Wieland, Georg, „Platon oder Aristoteles? – Überlegungen zur Aristoteles-Rezeption des
lateinischen Mittelalters“, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (1985), 605-630. Wüstenfeld, Ferdinand, Die Übersetzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI.
Jahrhundert (Abhandlungen der königlichen Gesellschaft zu Göttingen 22/2-3 [1877]), Göttingen 1877.
Zimmermann, Albert, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert, Leiden u. Köln 1965.
Register antiker und mittelalterlicher Autoren A
ÝAbdalmasÐÎ Ibn NÁÝima 116 AbÙ Bišr MattÁ 134 AbÙ MaÝšar 81 AbÙ SulaimÁn MuÎammad Ibn Ma’šar al-
BustÐ al-MaqdisÐ 64 Adelard von Bath 61-64 Aegidius Romanus 160 Alanus ab Insulis 34, 61, 63, 139, 189 Albertus Magnus 143, 190 Alcher von Clairvaux 53 Alexander von Aphrodisias 54, 120 Alexander von Hales 101 Alfons VI. 10 Alfred von Sarashell 159 Ammonios Hermeiou 66, 170 Aristoteles passim Augustinus 56, 81, 85, 90-94, 97 Avendauth 12, 42, 44, 54f., 82, 91, 98f.,
161, 187-190 Averroes 91, 107, 112, 116, 134, 141f.,
160, 176 Avicenna 12-14, 17, 19, 27, 33-35, 42-46,
48, 54f., 61, 73-76, 83, 89-95, 98, 100f., 111, 114, 120, 127, 129f., 132, 134, 142, 144f., 148-151, 155, 159, 161, 163-165, 167, 172, 181, 183, 185, 187-191
B
Bartholomäus von Messina 118 Beda Venerabilis 28 Bernhard von Sauvetat 25 Boethius 13, 19f., 37-76, 79, 89f., 92-95,
100f., 103, 110-114, 117, 123-127, 132, 135, 139-141, 143f., 149-151, 164f., 170, 181-185, 190f., 194
Burgundio von Pisa 119, 157
C
Calcidius 53 Cassiodor 170f. Cicero 67, 69-72, 171 Clarembald von Arras 40f., 45, 51-54, 58-
61 Clemens von Canterbury 16f. D
Daniel von Morley 80 ad-DimašqÐ 104 Diogenes Laertius 170 Dominicus Gundissalinus passim E
Elias 170 Euklid 57f., 61-65, 75, 90, 98, 140 F
al-FÁrÁbÐ 12f., 19, 27, 46, 54, 62, 70, 72, 82, 98f., 121, 134, 144, 152-165, 167f., 173-178, 181, 183
G
Galen 80 al-ÇazzÁlÐ 12f., 19, 45, 48, 91, 112, 114,
172, 174 Gerhard von Cremona 11, 18, 61, 63, 70,
80, 83, 106-108, 133f., 146, 149, 152f., 156-158, 161, 175-178, 181
Gilbert von Poitiers 9, 40, 49, 58-61 Gregor VII. 25 ÉuzÊÁnÐ 187 H
al-ÍaÊÊÁÊ 61 al-Íasan Ibn SuwÁr 134 Henricus Aristippus 158, 162
Register
218
Hermann von Carinthia 61-63 Hermann der Deutsche 107, 119 Hugo von Sankt Viktor 31, 35, 85f., 189 Íunain Ibn IsÎÁq 17, 119, 157 I
Ibn DÁwÙd, siehe Avendauth Ibn Gabirol 12f., 30f., 35, 181, 189 Ibn an-NadÐm 119 Ibn Rušd, siehe Averroes Ibn as-SamÎ 106 Ibn SÐnÁ, siehe Avicenna Ildefons von Toledo 77 Isaak Israeli 38, 79, 115 IsÎÁq Ibn Íunain 61f., 106f., 116, 119,
134, 159 Isidor von Sevilla 19, 38f., 77-87, 90, 92,
115, 117f., 170f., 186, 190
J
Jakob von Venedig 99, 105, 116, 132f., 160
Johann von Toledo 187 Johannes 132f. Johannes Duns Scotus 191 Johannes Hispanus, siehe Magister Jo-
hannes Johannes von Rupella 143 Johannes von Salisbury 132 Johannes von Sevilla 81f. Johannes von Toledo 10 John Blund 190 Juan Manuel, Don 78 Julian von Toledo 77 K
al-KindÐ 12, 54, 134, 144, 188 L
Laktanz 37 M
Magister Johannes 30, 82, 172
Martianus Capella 49 Michael Scotus 13, 106-108, 116, 119,
156 Moses Maimonides 116 N
an-NairÐzÐ 61 Nikolaus von Amiens 61, 63 Nikolaus Damascenus 159 Nikomachos von Gerasa 57 O
Orosius 87 P
Peter Abaelard 9, 31, 48, 53, 187, 189 Petrus Helias 68-72 Petrus Venerabilis 187 Platon 9-11, 31, 53, 65, 93f., 97f., 100,
108-112, 117, 131, 168f., 176f., 179, 184, 191
Porphyrius 170 Priscian 67-70 Proklos 58, 63 Pseudo-al-KindÐ 64, 75, 90, 140-144, 183 Ptolemaios 80 Q
QusÔÁ Ibn LÙqÁ 104 R
Remigius von Auxerre 67 Robert Kilwardby 13, 25, 84-87, 164 Robert Grosseteste 120 S
Sedulius Scottus 67 Servius 67 Siger von Brabant 29 Sisebut von Toledo 77
Register
219
T
Themistius 134 Theophrast 159 Thierry von Chartres 9, 29, 40, 50-52, 54,
58-60, 69-71 Thomas von Aquin 9, 23, 25f., 33, 47, 56,
63, 65, 74, 84, 89, 100, 113, 117, 127, 133, 142f., 148, 150f., 153f., 163-165, 184f., 189-191
V
Vinzenz von Beauvais 17, 115 W
Wilhelm von Auvergne 12f., 97, 101, 117, 130f., 190
Wilhelm von Conches 9, 29f., 32, 67f., 71f., 171
Wilhelm von Moerbeke 116, 158, 174, 177
Y
YayÎÁ Ibn al-BiÔrÐq 116, 156f.