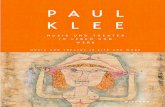Dicherlesung im medientechnischen Zeitalter. Thomas Klings intermediale Poetik der...
Transcript of Dicherlesung im medientechnischen Zeitalter. Thomas Klings intermediale Poetik der...
1
In: Harun Maye, Cornelius Reiber, Nikolaus Wegmann (Hg.): Original / Ton. Zur Mediengeschichte des O-
Tons. Mit Hörbeispielen auf CD. (Kommunkation audiovisuell Bd. 34). Konstanz: uvk 2007, S. 191-216.
Matthias Bickenbach
Von der Dichterlesung im medientechnischen Zeitalter
Thomas Klings intermediale Poetik der Sprachinstallation
ah, ah, denne!
(Thomas Kling)
Welche Stellung nimmt die Dichterlesung in der Mediengeschichte des O-Tons ein? O-Ton
gibt es erst, seitdem Töne technisch gespeichert werden. Die Dichterlesung dagegen ist eine
uralte Institution der Aufführung literarischer Werke. Sie ist keineswegs ausgestorben,
sondern im aktuellen Literaturbetrieb als Lesereise der AutorInnen fest installiert. Der
Dichterlesung haftet etwas von der Aura des Authentischen an, das die gesprochenen Worte
nah an den Originalitätsbegriff des Textes rücken lässt. Auch im Zeitalter professionellen
Literaturmanagements ist die Autorenlesung mehr als eine Informationsveranstaltung. Neben
der Bekanntschaft mit dem Inhalt, ist die Bekanntschaft mit dem Autor ausschlaggebend. Wie
gut sie oder er liest ist zweitrangig, man darf aber davon ausgehen, dass Autoren sehr gut
lesen, weil sie ihren Text besser als jeder andere kennen und weil sie ihn schon oft gelesen
haben.
Dennoch ist das Verhältnis der Autorschaft zum Text ein ganz anderes als das zum Vortrag.
Die tonale Übertragung von der Schrift zum Vortrag spielt nicht zwischen zwei Medien,
sondern zwischen drei Stadien des Werks. Das Verhältnis des fertiggestellten, des gedruckten
Textes zu seiner lauten Lektüre ist für den Autor nicht nur eine Aufführung objektiv
materialisierter Zeichen, sondern ebenso eine ständige Resonanz zwischen dem einst zu
Schreibenden, dem tatsächlich Geschriebenen und seinem gedruckten Zustand, der nach Paul
Valérys Einsicht selbst schon „mit lauterer und festerer Stimme spricht“.1 Dabei wird die
Lesung für den Autor zum „genauesten und erbarmungslosesten Prüfstand“ für die
„Tauglichkeit“ seines Buches: „Erst wenn ich Abend für Abend, wochenlang, dieselben
1 Paul Valéry: Die beiden Dinge, die den Wert eines Buches ausmachen, in: ders.: Über Kunst. Essays.
Frankfurt/M. 1965, S. 15-22, hier S. 15f. „Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Hervorbringung der
elementaren Tätigkeiten unseres Gehirns, die auf die Reize der Schrift mit eingebildeten oder wirklichen Tönen,
mit Bedeutung antwortet.“
2
Stellen vorgetragen habe, ohne den Text und damit mich am Ende zu hassen, halte ich einen
Roman, als Legende um den eigenen Körper, für einigermaßen gelungen.“2
Handelt es sich bei einer Dichterlesung um O-Ton oder um Sounddesign der Texte? Welchen
Status beansprucht die Lesung: den einer authentischen „Verwirklichung“ dessen, was
geschrieben steht oder den einer spontanen oder inszenierten Variation des Mediums Schrift
in einem anderen, die andere Seiten zur Geltung bringt, ohne zugleich privilegierter Zugang
zu Sinn und Bedeutung zu sein? Ist das Medium der Stimme des Dichters eine Aufführung im
Sinne von Performance oder eine Erweckung des originalen Textes aus den „toten
Buchstaben“ in das „lebendige Wort“?
Der Medienwechsel vom Text zum Ton erscheint als besonders mühelos. Während die
Umsetzung von Literatur in Bilder - sei es als Illustration, als auktorial kalkulierter Iconotext
oder als Literaturverfilmung – stets problematisch bleibt, funktionieren Lesungen als
Direktübersetzung scheinbar ohne Reibungsverluste. Der Erfolg von Hörbüchern gründet
offensichtlich in der Ersetzung von Lektüre durch Hören. Die Anstrengungen der Umsetzung
gedruckter Buchstaben in Sinneinheiten entfällt. Die Entbindung vom Auge ermöglicht
andere Aktivitäten und löst die Bindung zum Buch, die ja die imobile Lesehaltung
einschließt: Literatur lässt sich nebenbei rezipieren. Vor allem aber ersetzt das Hörbuch eine
„dividenda animi“, eine Teilung des Geistes oder der Aufmerksamkeit. Quintilian hat im
Kontext seiner Rhetorik als erster auf die Notwendigkeit der Lektüre, unterschiedliche
Medien, Auge und Ohr, zu koordinieren, hingewiesen. Das lesende Auge einerseits, die
Übersetzung der Buchstaben in Sinneinheiten und Bedeutung und deren laute Ausprache sind
in der Kunst des Lesens nicht gleichgeschaltet, sondern zeitversetzt. Die Augen müssen dem
Lautieren laufend vorausgreifen, um der treffenden Formulierung die Zeit zu geben, während
die Augenbewegung beim Sprechen schon die nächsten Phoneme, Lexeme und Morpheme
anspringen. Deshalb erfordert Lesen eine eigenständige Form der Aufmerksamkeit, die fast
alles andere ausschließt und lautes Lesen ein hohes Maß an Konzentration und Koordination.
Lesungen, im Radio oder als Erfolgsmedium des Hörbuchs, entlasten von diesem
Rezeptionsrahmen, den Lektüre fordert.
Als ob eine fremde Stimme (und sei es die des Autors) die Töne hervorbringen könnte, die
man selbst läse – selbstgelesene Akustik eines literarischen Textes – funktioniert der Erfolg
von Hörbüchern durch diesen Tausch der eigenen mit der fremden Stimme. Die fremde
Stimme avanciert zum O-Ton. Und welcher Ton könnte näher am Original stehen, als die
Stimme des Dichters, der seine Werke liest?
2 Bodo Kirchhoff: Legenden um den eigenen Körper. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt/M. 1995, S. 159.
3
Die These dass es sich dabei nicht um dasselbe handelt erscheint weniger plausibel als die
Vorstellung, zwischen Gelesenem und Geschriebenem bestehe kein wesentlicher Unterschied.
Diese scheinbar problemlose oder reibungslose Übersetzung gründet in dem uralten Privileg
der Stimme, das Jacques Derrida bekanntlich als „Phonozentrismus“ des westlichen
Abendlandes hervorgehoben und ausführlich in seinen philosophischen und
zeichentheoretischen Voraussetzungen kritisiert hat.
Der Punkt, an dem sich Ton und Literatur treffen und an dem sie immer schon zueinander
gefunden haben verdankt sich dem intermedialen Umstand eines phonetischen Alphabets. Die
Kreuzung von phoné, Laut, Stimme und litterae, Buchstaben, begründet eine implizite
Hierarchie der Zeichen. Die Stimme als gleichsam natürlich Einheit des Sinns verbürgt die
Übertragung der Bedeutung auch im Medium der Buchstaben. Sie wird so gleichermaßen zum
Vorbild der Kommunikation wie zu einer weit reichenden Vorstellung von Präsenz oder
Anwesenheit. Schriftliche Kommunikation gilt demnach als nur defizitäre Stufe des
gesprochenen Wortes. Denn nach Aristoteles ist "das in der Stimme Verlautende [das]
Zeichen für die in der Seele hervorgerufenen Zustände und das Geschriebene Zeichen für das
in der Stimme Verlautende".3
Gemäß dieses Privilegs der Stimme, den Zuständen der Seele näher zu stehen, gilt es in der
Lektüre von Literatur den Ton als originales Bedeutungsmedium der Schrift, zurückzuholen.
Noch Hans Georg Gadamers Hermeneutik Wahrheit und Methode notiert zur Lektüre und als
Aufgabe der Kunst des Verstehens:
"Alles Schriftliche ist […] eine Art entfremdete Rede und bedarf der Rückverwandlung der
Zeichen in Rede und in Sinn. Weil durch die Schriftlichkeit dem Sinn eine Art von Selbstent-
fremdung widerfahren ist, stellt sich diese Rückverwandlung als die eigentliche hermeneuti-
sche Aufgabe."4
In der Dichterlesung fielen damit Ursprungsmythos der Sprache als O-Ton wie originaler
Sinn und authentische Verlebendigung durch die Stimme des Autors zusammen. Liest der
Dichter live, lebt die Dichtung. Insbesondere für Lyrik als Format lauter Lesung gilt die
Definition von Literatur als Ort einer „Naturgeschichte des Reims“ bis heute fort.5
3 Aristoteles: De interpretatione. I, 16 a3. Zitiert nach Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt a. M. 1974, S.
24ff. 4 Hans Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. 5. Aufl. Tübingen 1986, S. 397.
5 Vgl. Peter Rühmkorf: agar agar – zaurzaurim. Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen
Anklangsnerven. Frankfurt/M. 1985. Rühmkorf führt Lyrik auf die anthropologische Disposition, an Reimen
gefallen zu haben, zurück.
4
Weniger durch die dekonstruktive Kritik, als durch kultur- und mediengeschichtliche
Forschungen ist jedoch deutlich geworden, dass auch die Stimme eine Geschichte hat.6 Auch
die Stimme ist, anders gesagt, ein kulturelles Medium und daher in historischen
Konstellationen zu beobachten, statt als Originalton eines unveränderlichen natürlichen
Zeichens. Das laute Lesen in der oralen Tradition der Antike ist durchaus ein anderes als das
des Mittelalters oder der Goethezeit.7 Zwischen der Auffassung von Poesie als oratio ligata
des Barock und dem Selbstverständnis der Lyrik seit Klopstock herrschen gewaltige kulturelle
Unterschiede, die auch die Funktion des Vortrags entscheidend verändern.8
Erst unter dieser Perspektive einer Vielfalt von Stimm- und Soundtechniken in der Kultur-
und Mediengeschichte kann auch wieder ins Bewußtsein rücken, dass schon die antike
rhetorische Tradition, namentlich Cicero, auf einem geradezu medientheoretisch reflektierten
Niveau Techniken der Stimme etablierte, die auf ihre subversive Wirkung unbemerkter
Vereinnahmung zielt. Darauf ist zurückzukommen.
O-Töne gibt es erst, seitdem sie speicherbar sind. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die
Mediengeschichte des O-Tons in der Chronik technischer Erfindungen seit Edinsons
Phonographen aufgeht. Vielmehr zeigt sich hier, dass Medientechniken kulturspezifische
Formationen darstellen. Ihre Verwendung und Bewertung, ihre Erfindung und
Funktionsfindung, ihre Entstehung und Stabilisierung als Medium decken sich nicht mit ihren
technischen Funktionen. Denn ob ein Medium erfolgreich wird oder nicht, darüber
entscheiden kulturelle Annahmebedingungen. Inwiefern der O-Ton ein kulturspezifisches
Medium ist, zeigt sich als Name der Funktion. Das technisch Speicherbare von Tönen erlangt
einen Status und eine Verwendung zugleich. Aber die Auszeichnung als dokumentarischer
Wert ist eine kulturelle Konvention, die Gespeichertes in bestimmter Form verwendet. Mit
dieser Erfindung stellt sich eine Unterscheidung in der Ordnung von Tönen und Klängen ein,
die weitere kulturelle Unterscheidungen schafft. Sie münden in die Formate der Medien,
„Live“ oder „O-Ton“. Die Dichterlesung, ebenso beides wie ein Drittes, ist ebenfalls eines.
Als O-Ton gilt keineswegs das sprichwörtlich flüchtige gesprochene Wort selbst, der flatus
vocis oder gar das eine Situation umgebende Rauschen. Weder alltägliche Kommunikation
noch die Sounds, die unsere Ohren füllen und filtern, sind als O-Ton ausgezeichnet, so
original sie sind. Allein der medial aufbereiteten „Ton-Konserve“ gilt die kulturelle
Begriffsbestimmung. Erst die Speicherung macht den Ton, der längst vergangen ist, zum O-
Ton. Erst in der späteren Wiederholung wird er zum Original einer dokumentarisches 6 Nicht erst seit der Zäsur technischer Medien. Vgl. Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme. München 2001.
7 Vgl. Matthias Bickenbach: Von den Möglichkeiten einer ‚inneren‘ Geschichte des Lesens. Tübingen 1999. 8 Zu Klopstock und der lauten gemeinsamen Lektüre als Vereinigung der Herzen vgl. den Beitrag von Harun
Maye in diesem Band.
5
Funktion. Es ist dabei kein Zufall, dass der Begriff zunächst auf gesprochene Worte und die
Stimme von Zeitzeugen gemünzt ist und erst in der weiteren Verwendung auf alle
aufgezeichneten Töne Verwendung findet.9 Die konstitutive Wiederholung und ihre
Möglichkeit, sich immer wieder zu ereignen, entspricht damit gerade nicht dem traditionellen
Begriff der Kunst vom Original, sondern einem vordergründig pragmatischen, in der Sache
aber dekonstruktiven und am Medium der Schrift orientierten Originalitätsbegriff, der darauf
insistiert, dass original nur sein kann, was sich wiederholen lässt.10
Dass O-Töne ein kulturelles Sounddesign darstellen, dessen Wert in der zeitversetzten
Wiederholung gründet, zeigt auch der medientechnische Begriff „live“. Die Liveschaltung –
gleichwohl technisch minimal zeitversetzt („Totzeit“) – reserviert die Direktübertragung und
besetzt die Lücke, die der O-Ton als institutionalisiert zeitversetzter Mitschnitt lässt.
Offensichtlich unterscheidet unsere Kultur also zwischen Tönen, die aktuell statt haben, O-
Tönen, die live übertragen werden und O-Tönen, die unter diesem Namen anerkannt und in
den Massenmedien eingesetzt werden. Der O-Ton ist ein stets schon historisches Dokument,
das begründet seinen Wert und seine Pragmatik.
Der Name, eine Sprachregelung, verbürgt die Authentizität dessen, was die technische
Speicherbarkeit erst hervorbringt.11
Zugleich ist O-Ton aber durchaus Sounddesign. Er ist
nicht nur bearbeitet, geschnitten und von störenden Geräuschen, Räuspern und Stockungen
bereinigt. Aber das macht keinen Unterschied für seinen kulturellen Status als
Originaldokument. Auch wenn gerade das geschnitten wird, was womöglich das Einmalige
der Situation kennzeichnet, die spontane stimmliche Aufführung, der Versprecher,
beeinträchtigt dieses Wissen um die Aufbereitung des O-Tons seinen kulturellen Wert nicht.
Sounddesign aber ist O-Ton schon als Institution selbst, als Auswahl und als Teil der ihn
umgebenden, hervorbringenden Formate, innerhalb derer er als Funktion erscheint. Dass
dieses Sounddesign als dokumentarische Funktion in den Massenmedien erfolgreich ist,
9 Die Definition von O-Ton gibt ein Stück Literatur. Salomo Friedlaenders Kurzgeschichte „Goethe spricht in
den Phonographen“ (1916) fingiert einen auf Goethes Stimmfrequenzen abgestimmten Apparat, mit dem seine
Stimme zunächst simuliert werden kann. Dies sei jedoch, „noch nicht die wirkliche Wiederholung wirklich von
ihm gesprochener Worte“. Erst im Arbeitszimmers Goethes in Weimar „empfängt“ der Erfinder den O-Ton des
Dichters. Die Kurzgeschichte ist abgedruckt in Friedrich Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. Berlin 1987, S. 93-107, hier S. 97. Drei Jahre später wird Rainer Maria Rilke das „Urgeräusch“ gänzlich von menschlichen
Stimmen ablösen Zum Kontext des Diskurs- und Medienwechsels vgl. ebd., S. 61ff., vgl. auch Kittler:
Aufschreibesysteme 1800 1900. München. 2. Aufl. 1987, S. 321ff. 10 Das Original ist damit ein – kultureller – Zeichenzusammenhang oder – mit Foucault - eine Regel des
Diskurses. Vgl. zur notwendigen Wiederholungsstruktur des Zeichens und dem Zusammenhang zum
Schriftbegriff vgl. Jacques Derrida: Ereignis Signatur Kontext, in ders.: Randgänge der Philosophie. Wien 1988,
S. 291-314. 11 „Aber um Rauschen und Nachrichten überhaupt zu unterscheiden, muß Reales über technische Kanäle laufen
können. Das Medium Buch kennt Druckfehler, aber kein Ur-Geräusch.“ Kittler: Aufschreibesysteme, S. 323.
6
beruht auf seiner memorialen Funktion: Der Wert des O-Tons ist sein auditives kulturelles
Gedächtnis.
Vor diesem grob skizzierten Hintergrund einer allgemeinen Mediengeschichte des O-Tons
interessiert im folgenden die Geschichte der Dichterlesung im späteren 20. Jahrhundert. Ist
der Mythos des ‚lebendigen Wortes‘, des „pfingstlich puren O-Tons“ (Kling) im Zeitalter der
elektronischen Speicher- und Übertragungsmedien ungebrochen wirksam oder schon ganz
vergessen und überholt? Wie positioniert sich die Dichterlesung in einer Umwelt der
Literatur, die mulitmedial, genauer gesagt, intermedial strukturiert ist?
Eine Geschichte der Dichterlesung, zumal der neueren seit 1950, liegt nicht vor und so ist es
ein glücklicher Umstand, dass ein Dichter, dass Thomas Kling sie in Auszügen gibt. Seine
poetologischen Ausführungen geben zweierlei zu entdecken: Eine Wiederentdeckung des
lauten Lesens jenseits des phonozentrischen Mythos sowie einen Einblick in die intermediale
Poetik seiner Lyrik selbst.
Die Geschichte der Dichterlesung, die Kling autobiographisch und das heißt lückenhaft
erzählt (Ernst Jandls Auftritt in der Royal Albert Hall oder das Leseritual der Gruppe 47 als
Vorbild des Ingeborg-Bachmann Preises spielen keine Rolle) ist untergründig eine Geschichte
der Desillusion. Zwei Erfahrungen, eine historisch und eine biographische, bewirken eine
„Neuformulierung“ der Dichterlesung, die eine Re-Orientierung an alternativen Traditionen
des Dichters ebenso einschließt wie unter dem Titel „Sprachinstallation“ die immanente
Poetik der Texte vor ihrer Aufführung. Thomas Kling konnte seine Poetik der
Sprachinstallation als Konzept „mundraum – sendeflächen“ des steirischen herbst 1999 mit
anderen LyrikerInnen öffentlichkeitswirksam vorstellen. Neben seinen Lyrikbänden liegen
zwei Bände poetologischer Schriften vor (Itinerar,1997 und Botenstoffe, 2000) sowie eine
von ihm herausgegebene Lyrikanthologie mit Gedichten vom 8. bis zum 20. Jahrhundert
(Sprachspeicher, 2001). Die Texte führen auf eine Genealogie des lesenden Dichters, die sich
vor allem an Aspekten der Performanz durch den Vortrag orientiert.
Reisestationen der Dichterlesung seit 1950
Itinerar eröffnet mit einer polemischen literaturgeschichtlichen Ordnung jüngerer
deutschsprachiger Lyrik, die sich an ihrer Dichterlesung orientiert. Es ist der Auftakt zu einer
Reise durch einige ihrer Stationen, in deren Verlauf Kling die Herkunft dessen, was er
„Sprachinstallation“ nennt, erzählt.12
Er gibt damit einen Einblick in verschiedene Formen
von Dichterlesung in denen sich Stimme, Sound und Medien in den letzten fünf Jahrzehnten
12 Thomas Kling: Itinerar. Frankfurt/M. 1997. „Itinerar“ bedeutet Reisestation ebenso wie Reisetagebuch.
7
unterschiedlich formiert haben. Gegen die Auffassung, die Dichterlesung sei immer gleich, im
Grunde wenigstens nur jetzt mit Mikrophon, setzt Kling verschiedene Traditionen, die ihn,
wie man sagt, beeinflusst haben, die aber, so die Pointe, allesamt etwas vergessen haben: Das
Lesen selbst als Performanz der Texte.
Der erste Satz des Textes mit dem Titel Sprachinstallation I lautet: „Die Dichterlesungen der
80er Jahre müssen denen der 70er geähnelt haben. In den 80ern jedenfalls waren sie piepsig
und verdruckst, vor allem aber von peinigender Langeweile.“13
Darüber in den 90er Jahren
Konsens zu erzielen, sei, so Kling, eine „der leichteren Übungen“. Sein Statement ist überaus
selbstbewußt. Der Lyrik dieser Jahrzehnte wird unterstellt, sie sei so wie ihre Vorlesung,
nämlich größtenteils „ausgesprochen nichtssagend“ und mehr noch: „der Sprache gegenüber
eine Frechheit.“14
Da spricht einer von einer festen Position aus, einer, der kulturell wie
intellektuell seine Position gefunden hat.15
Es ist jedoch nicht die Frage, ob einer sich das
leisten kann, so zu sprechen oder ob dies in die Rolle junger Poet, poète maudit, angry young
man, fällt. Die Frage ist, mit welchen Argumenten, mit welchen Reisegepäck, einer kommt.
Die Polemik des jüngeren Dichters über seine vorangegangene Generation, die es auch aus-
führlicher gibt, steht unter dem Titel Sprachinstallation I und deutet damit schon an, dass am
Ende der 90er Jahre ein zugleich technischerer, aber auch kreativerer Umgang mit Sprache,
Lyrik und deren Lesung eingefordert wird, als piepsig (Mikrophon) und verdruckst,
(technikverdrossen) über das Manuskript gebeugt vorzulesen.
Kling weiß allerdings sehr gut, dass es nicht einfach seine biographische Reisestationen sind,
welche die Epoche der Performance als Dichtunglesung prägt. Sie geht ihm voraus. Er selbst
stößt „79“ auf sie, in Wien. Spät also, viel zu spät, um am Ursprung zu partizipieren. Es ist
vielmehr eine Wiederentdeckung:
„Dort hatte sich seit den frühen 50er Jahren die Autoren der Wiener Gruppe, mit Ausnahme
H.C. Artmanns […], vor allem für den theoretischen Aspekt des Gedichts interessiert; es
waren Versuchsanordnungen, die Konsequenzen hatten.“16
13 Kling: Itinerar, S. 9. 14 Der Blick in die Literaturgeschichte der Lyrik lässt ahnen, dass Kling so unrecht nicht hat. Vgl. Michael
Braun: Lyrik, in: Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Gegenwartsliteratur seit 1968, hier S. 430
zur „lyrische[n] Schreibweise in den siebziger Jahren“ in der alltägliche Gedanken, Gefühle und Erfahrungen,
Stimmungen und Innerlichkeit zur Thematik des ‚lyrischen Ichs‘ wurden sowie zu den Labeln von „Neuer
Sensibilität“, „Neuer Subjektivität“ oder „Alltagslyrik“. 15
Thomas Kling gilt dem Times Literary Supplement als „einer der herausfordensten und komplexesten Dichter
der deutschen Gegenwartsdichtung“, der Neuen Zürcher Zeitung gar als „bedeutende[r] Lyriker des 20.
Jahrhunderts“, so tun es die Klappentexte seiner Bücher kund. 16 Kling: Itinerar, S. 9.
8
Diesen Konsequenzen ist im folgenden nachzugehen. Sie bilden eine Fallgeschichte der
Dichterlesung, in der über die Stadien „Aktion“, „Performance“ und „Sprachinstallation“,
eine reflektierte Wiederkehr des Lesens statt hat.
Die Wiener Gruppe war mit ihrer Programmatik auf den Text gekommen, auf „reine
Wortarbeit“, lies Schriftarbeit. Konkrete Poesie und Schreibmaschine, möchte man
zusammenfassen. Die erste Konsequenz, die diese Reorientierung der Lyrik am Medium der
Schrift hatte, waren Fragen der Textpräsentation jenseits des Gedruckten. In gewisser Weise
wurde der Ton verwiesen. Die „sogenannte Dichterlesung“ wurde abgelehnt.17
Das erste
öffentliche Auftreten der Gruppe 1957 war jedoch, so Kling, geradezu „konventionell – die
Dichter in einer Reihe auf dem Podium, jedem sein Pult“.18
Erst in den beiden darauf
folgenden Jahren wurden die „verschütteten Spuren der Avantgarden des frühen 20.
Jahrhunderts“ wiederentdeckt, konkret das Caberet Voltaire in Zürich als Wiege des
Dadaismus. Parallel zum Fluxus-Happening wurde so 1958/59 mit dem, was die Wiener
Gruppe „Aktion“ nannte die Dichterlesung zur „Performance“. Dies bedeutete eine
Veränderung der Aufführungssituation, aber nicht unbedingt die Veränderung des Lesens im
Vortrag. Die Stimme des Dichters wurde der Medienkonkurrenz anderer Übertragungs- und
O-Ton-Medien ausgeliefert:
„Der Vortrag von Dichtung trat deutlich hinter den breit angelegten Einsatz anderer, zum Teil
Simulation eingesetzter Kommunikationsprothesen (Film, Tapes..., ,- Multimedia at it‘s best!)
zurück“19
Man stellt ein Radio vor das Publikum auf die Bühne, auf einen zufälligen Sender gestellt,
und zieht sich zurück. Man zertrümmert medienwirksam das Klavier. An die Stelle der
Stimme tritt der Originalton als theatralische Sendung im Liveact. Die „Aktionen“
verabschiedeten gezielt das gehobene Klima der Dichterlesung. Das Publikum sollte
keineswegs als reaktionsfähiges Rezeptorium behandelt, sondern, so die Regel der Wiener
Aktionen, als „Gegenstand“. In der Performance der Dichterlesung wurde ein „vorderhand ein
literaturfernes Eingangsklima geschaffen: fünfundvierzigminütige Beschallung des Publikums
mit Bohrinselsounds vom Band“.20
Orignalton Lärm trifft den Orignalton Stimme. Obwohl diese Aktionen nicht nur als Skandal,
sondern, zur Irritation der Dichter, vom Publikum auch als Unterhaltung goutiert wurden,
17
Vgl. ebd., S. 10. 18 Ebd. 19 Ebd., S. 12. 20 Kling: Itinerar, S. 12.
9
gehören diese Station der Dichterlesung der Geschichte an. Kling notiert seinen eigenen
Eintritt am Endpunkt dieser historischen Etappe:
„Das, was die Wiener Gruppe 1958/59 anstelle von Lesungen zeigte, sie nannten es Aktionen,
war Performance; ein Begriff, der in die 70er gehört und für mich Anfang der 80er, als ich
aufzutreten, zu lesen, begann, schon nicht mehr verwendbar war. Performance: das war völlig
ausgefranst, vollkommen vernutzt, hat es auch inzwischen, staunenswerte Geschwindigkeit,
bis in den Duden geschafft“.21
Die Genealogie, in die Kling sich stellt, wird als historisch vergangene distanziert. Er selbst
fängt an zu lesen und dieses „zu lesen“ ist im Zitat kursiv gesetzt. Die schriftliche
Hervorhebung markiert nichts anderes, als den Verlust der Lesung in der Performance. Auch
deshalb mag Kling sich am Begriff der Performance nicht zufrieden geben, ist er für ihn
„nicht mehr verwendbar“.22
Wurde in den Aktionen der 1960er Jahre der „medienkritische Aspekt“ keineswegs
vernachlässigt,23
so rückte doch die Apparatur an die Stelle der Lesung oder integrierte diese
ohne sie zu verändern. Die Performanz der Lesung selbst wurde in der Performance ebenso
vergessen wie im Mainstream der Dichterlesungen der 1970er und 1980er Jahre. Eine erste
biographische Reisestation markiert die Absetzung Klings von diesen Dispositionen. 1983
gerät er aus Zufall („hast du was zu lesen dabei, klar“) selbst in eine Lesung im Kontext der
Performancepraxis:
„Wir betraten dann die Bühne, altes Wiener Gruppen-Konzept, […] als beträten wir ein
Kaffeehaus, behandelten die Zuschauer im überfüllten Saal als Gegenstand, ich […] hängte
meine Jacke an einem imaginären Garderobenhaken auf, die knallte hübsch auf die Bretter
[…] die Leute waren schier begeistert, jetzt schon – dann las ich vom Standmikro aus.“24
Damit endet der Text Sprachinstallation I: „- dann las ich vom Standmikro aus“. Der latent
kritische Unterton Klings, die Desillusion, zehrt hier ganz vom Unausgesprochenen, von der
lautlosen Markierung der Schrift, konkret von den oben erwähnten Kursiva in „zu lesen“ wie
hier vom parenthetischen Bindestrich, dem Zögern oder Stocken, der Störung zwischen
„begeistert, jetzt schon“ und „- dann las ich“.
21 Ebd., S. 11. 22 Vgl. Kling: Itinerar, S. 18. Das Wort Performanz, das im aktuellen kulturwissenschaftlichen Diskurs wieder
auf breiter Front zu Ehren kommt, ist gleichwohl als linguistischer Begriff zur Beschreibung der Lyrik Klings
zutreffend. Er selbst geht der Etymologie des Wortes nach und betont die aktiven Elemente der Aufführung und
schlägt den Begriff „Performer“ vor, ohne allerdings auf die linguistische Unterscheidung von konstativen
Sprechakten, die etwas benennen und performativen Sprechakten, die etwas ausführen, näher einzugehen. Als
Label ist Performance historisch, als Erinnerung an eine Wirkungsqualität der Sprache nicht. 23 Ebd., S. 11. 24 Ebd., S. 13.
10
Diese Erfahrung korrespondiert einer historischen, die exakt in jenem Vorbild der Wiener
Aktionen zu sehen ist.
Wie Hugo Ball zur Eröffnung des Cabaret Voltaire wie des Dadaismus 1916 in Zürich in
futuristischem Kostüm Dada las, gilt Kling als „eines der aufschlußreichsten Beispiele“25
für
das Schicksal der Lesung im Kontext der Performance. Hugo Ball tritt ins abstrakte
Bühnenbild und liest „Die Karawane“. Aber er selbst merkt während der Lesung:
„Da bemerkte ich, daß meine Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb, die uralte Kadenz
der priesterlichen Lamentation annahm, jenen Stil des Meßgesangs […]. Ich weiß nicht, was
mir diese Musik eingab. Aber ich begann meine Vokalreihen rezitativartig im Kichenstile zu
singen.“26
Kling resümiert:
„Das für alle Seiten Überraschende: zum Schluß ist der gute alte Priesterdichter wieder
installiert. Die Differenz zur nornenhaften Séance Georgeschen Zuschnitts, der
Fratzenhaftigkeit der Dichterlesung an sich, wird ausgesprochen minimal. […] Der singende
romantische Automat! Der pfingstlich-pure O-Ton!“27
Es geht um eine minimale Differenz, die den Unterschied macht. Die eigene Erfahrung am
Standmikrophon und die historische Hugo Balls ist für Kling Grund genug, die Dichterlesung
neu zu definieren. Was als „Sprachinstallation“ einen Unterschied zum Mainstreamwort
Performance markiert, ist seitdem selbst zum Label geworden, für „literal-multimediale mit
live gesprochener dichterischer Sprache gekoppelte events“.28
Die Sprachinstallation Klings ist weder Performance und auch etwas anderes als „slam
poetry“ oder andere Formen der Dichterlesung, die den Originalton des Sprechens in den
letzten Jahrzehnten wiederentdeckt haben. Kling grenzt sich ab:
„Seit etwa Mitte der 80er Jahre können wir ein erhöhtes Interesse in der sprachkritisch-
avancierten deutschen Lyrik an oralen Traditionen feststellen. Ich spreche hier weder vom
trostlos-vergrübelten Alltagsgedicht […] noch soll die Rede sein vom in den 90ern zu beob-
achtenden Beatnik-Revival, das unter der trademark ‚spoken word‘ einer neuen alten Unbe-
kümmertheit das Wort redet. […] Diskreditiert ist der Popbegriff […] seit längerem […].Ich
für meinen Teil habe spätestens seit 1983 mich für eine Neuformulierung der Dichterlesung
eingesetzt“.29
25 Kling: Itinerar, S. 38. 26
Hugo Ball zitiert von Kling, ebd., S. 37f. 27 Ebd., S 38. 28 Ebd., S. 19. 29 Ebd., S. 17.
11
Für seine Form der Lesung hat Kling das Wort „Sprachinstallation“ ausgewählt. Was ist der
Unterschied? Der Begriff bedeutet zunächst die Einrichtung von technischen Geräten in
einem Raum. Doch die Poetik der Sprachinstallation setzt weniger auf den
Aufführungskontext der Lesung, als auf die Sprache als einer Installation eines kulturellen
Gedächtnis selbst. Die Sprachinstallation ist nicht die technische Installation der Sprache in
der Lesung, sondern eine im Text des Gedichtes als Sprachfügung bereits installierte, die
Kling als einen übergreifenden intermedialen historischen Sprachraum konzipiert.
Die Intermedialität, in der der Text und sein Vortrag als differente Medien stehen, ist in
Thomas Klings Poetik ein Programm bis in die Strukturen und Themen seiner Lyrik hinein.
Seine Gedichte inszenieren den Wechsel von Medien aller Art. Sie mischen historische und
aktuelle Sendungen, seien sie Sprachformen, Briefe, Fotos oder fiktive Live-Reportagen,
bedienen sich der Sprache filmischer und elektronischer Bild- und Tonregie. Die Lesung als
Vortrag steht daher in engem Kontext mit der Intermedialität seiner Texte selbst.30
Intermedialität als Theorie der nicht nur technischen, sondern auch historischen und
kulturellen Verhältnisse zwischen Medien, findet in Thomas Klings Poetik ein komplexes
Beispiel für das Gedicht als Sprachkunstwerk, das sich aller Medien bedient.31
Das Mischpult der Sprache. Intermediale Poetik der Botenstoffe
Intermedialität als Lage der Dichterlesung bedeutet nicht nur äußere technische Bedingungen,
nicht nur die Apparate ihrer Aufführung, Mikrophon und Lautsprecher, Hörkassette, CD,
Lightshow, Videoshow - was auch immer zum Einsatz kommt. Es ist nicht der Gebrauch
technischer Medien, der in einer Performance gemacht wird. Konsequent ist – und das ist
Thomas Kling Poetik – die Öffnung der Lyrik selbst als Intermedium, als Speicher und
30 „Diese für alle Medien charakteristische Tatsache bedeutet, daß der ‘Inhalt’ eines Mediums immer ein anderes
Medium ist.“ Marshall McLuhan: Das Medium ist die Botschaft. In: ders.: Die magischen Kanäle.
Understanding Media. Frankfurt/M. 1970, S. 17-30, hier S. 17. McLuhan, auf den Intermedialität als
Grundstruktur aller Medien zurückgeführt werden kann, hebt das „Prinzip der Kreuzung als Methode zur
schöpferischen Entdeckung“ für den modernen Künstler emphatisch hervor: „Der Bastard oder die Verbindung
zweier Medien ist ein Moment der Wahrheit und Erkenntnis aus dem neue Form entsteht. Denn die Parallele
zwischen zwei Medien läßt uns an der Grenze zwischen Formen verweilen, die uns plötzlich aus der
narzißtischen Narkose herausreißen. Der Augenblick der Verbindung von Medien ist ein Augenblick des
Freiseins und der Erlösung vom üblichen Trancezustand und der Betäubung, die sie sonst unseren Sinnen
aufzwingen.“ Ebd., S. 63. 31 Zur Diskussion der Rolle von Intermedialität als historischer Dimension von Medien am Beispiel der
Fotografie vgl. Matthias Bickenbach: Die Intermedialität des Photographischen, in: Jürgen Fohrmann, Erhart
Schüttpelz: Die Kommunikation der Medien. Tübingen 2003, S. 126-166. Zur Theorie der Intermedialität, die
sich selbst auf intertextuelle oder systemtheoretische Theoriegrundlagen rückbezieht vgl. Jörg Helbig (Hg.):
Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets. Berlin 1998. Thomas Eicher, Ulf
Bleckmann (Hg.): Intermedialität. Vom Bild zum Text. Bielefeld: Aisthesis 1994. Peter V. Zima (Hg.):
Literatur Intermedial. Musik-Malerei-Photographie-Film. Darmstadt 1995. Jürgen E. Müller:Intermedialität.
Formen moderner kultureller Kommunikation. München 1996. Yvonne Spielmann: Intermedialität. Das System
Peter Greenaway. München: Fink 1998.
12
Wirkung intermedialer, also tonaler, textueller wie visueller Evokationen oder Memoria. Eine
Definition von „Gedicht“ führt vor, wie Kling vom Ton der Sprache zur Mixtur vieler Medien
übergeht - mit überraschenden Folgerung für das Hören von Gedichten:
„Gedichte sind hochkomplexe (‚vielzüngige‘, polylinguale) Sprachsysteme. Kommunikabel
und unkommunikabel zugleich: Hermes als Hüter der Türen und Tore, in diesen
Eigenschaften des Doorman, Schleusenwärters und Botenstoffbeförderers tritt er in
Erscheinung, ein Wirklichkeitsmixer, Reaktionsfähigkeit ist gefragt. Er hat darüber hinaus
Zutritt zur Totenwelt: zu (elektronischen) Bibliotheken. Das Gedicht baut auf Fähigkeiten der
Leser/Hörer, die denen des Surfens verwandt zu sein scheinen, Lesen und Hören – Wellenritt
in riffreicher Zone.“32
Surfen als Form der akustischen Gedichtrezeption ist eine kühne Metapher, die weniger an
beschauliche Einstimmung in hohes Kulturgut als an ebenso vergnügliche wie gefährliche
Assoziationsakrobatik gemahnt. Verschiedene Sprachsysteme sind im Zitat selbst am Werk.
Die Stelle tut, auch ohne Gedicht zu sein, was sie besagt: Sie mischt. Die Definition von
Gedicht bedient sich der wissenschaftlichen Sprache, hier Begrifflichkeiten der
Systemtheorie, zu der die Begriffe der Kommunikation, der Komplexität und natürlich des
Systems gehören. Hermes dagegen ist eine komplexe mythologische Figur, die als Schriftgott
und Götterbote, als Hüter, Dieb und trickreicher Geselle jedoch nicht den Musen-Ursprung
der Literatur voranstellt, sondern ihre medialen Grundlagen. Kling weist dem vielgestaltigen
Götterboten die Position eines Wächters oder Filters zu, der bestimmt, was aufgenommen
wird und was nicht. Ist Hermes ein Ohr? Ist der Bote nicht Aufnehmender und Sendender
zugleich? Also die Sendung selbst? Das Ohr ist ein hybrider Ort, eine Mischung aus
rezeptiver, passiver und sendender, aktiver Schnittstelle. Es unterscheidet sich darin vom
Auge. Die Differenz der Medien, Sinne und Künste ist immer schon Thema der Mythologie
gewesen, die sich später als Paragone oder Widerstreit der Künste fortsetzte. Hermes besiegt
mit dem Klang der eigens für diesen Kampf erfundenen Panflöte den Panoptes, das
kugelrunde Wesen mit seinen allsehenden Argusaugen. Der Ton siegt in der antiken
Mythologie über den Augensinn. Michel Serres hat in seiner synästhetischen „Philosophie der
Gemenge und Gemische“ Die fünf Sinne die mythologische Szene als Ursprung der
Herrschaft des Wortes bezeichnet und die mediale Differenz von Auge und Ohr
herausgestellt:
„Klangereignisse haben keine Ort, erfüllen aber dennoch den Raum. […] Der Blick liefert
etwas Gegenwärtiges, der Ton nicht. […] Hermes kennt den Träger, der keine hermetischen
32 Kling: Itinerar, S. 55.
13
Wände kennt. Der Blick ist lokal, das Hören global. […] Die Optik ist singulär, die Akustik
total. Hermes […] macht sich zum Musiker, denn der Schall kennt keine Hindernisse. Damit
beginnt die totale Herrschaft des Wortes. […] Der Klang siegt über den Blick.“33
Der Ton findet sein Rezeptorium in der überaus komplexen und paradoxen Haut-Mischung
des Ohrs:
„das Trommelfell präsentiert sich nach außen als glatte Haut, nach innen als Schleimhaut, als
harte und weiche Haut […]; die akustische Stoßwelle verwandelt sich in ein chemisches
Signal, das eine elektrische Information ins Zentrum überträgt. In welches Zentrum?
Empfängt die Box, oder sendet sie? Hören heißt schwingen, aber Schwingen bedeutet
senden.“34
Die „Reaktionsfähigkeit“, die auf Seiten der Leser/Hörer gefragt ist, ist demnach nicht eine
der Wahrnehmung oder einer besonderen Leistung derselben als Aufmerksamkeit, sondern
vielmehr körperliche und neurologische Grundlage des Lesers. Hermes jedenfalls, das können
wir der Definition des Gedichts Klings entnehmen, wählt aus und mischt, was wirkt. Aus dem
Boten wird ein „Botenstoffbeförderer“ – und Botenstoffe heißt Klings anderes poetlogisches
Buch.35
Hermes wirkt subkutan, dringt unter die Haut, ist ein gleichsam mikrobiologischer
Bote.
Es handelt sich hier nicht um singuläre Formulierungen, um modische Metaphern, sondern
die Gedichtdefinition in Itinerar steht im Kontext einer Summe von systematischen
Zuschreibungen und Genealogien, denen Thomas Kling seine Lyrik unterstellt.
Geschmacksverstärker oder Erprobung herzstärkender Mittel heißen frühere Lyrikbände
Thomas Klings. Der Bezug zur Sprache als etwas, das wie ein Botenstoff jenseits der
bewußten Wahrnehmung wirkt, unterscheidet Klings Gedichtdefinition von traditionellen
Vorstellungen. Mit ihm verändert sich auch die Rolle des lauten Lesens. Statt privilegiertem
Zugang zur Lyrik wird der Vortrag zum Medium der Infiltration mit historischen
Sprachmaterial.
Botenstoff ist für Kling die Lyrik selbst, das Gedicht. „Wir lesen Gedichte wieder gerne“,
heißt es in der Lyrik-Anthologie deutscher Dichtung vom 8. bis zum 20. Jahrhundert im
Kapitel zur eigenen Epoche: „Wir lesen Gedichte wieder gerne, diese alten und stets
verjüngbaren Botenstoffe“ und - während dieser Verjüngungskur durch Gerne-Lesen 33 Michel Serres: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische. Frankfurt/M. 1993, S. 54f. 34 Michel Serres, ebd., S. 189. Die Komplexität des Ohrs, Hammer, Amboß, Tympanon, vor allem aber die
Schrägstellung des Trommelfells lässt Jacques Derrida zu einem Modell der schrägen oder „geschrägten“
Lektüre kommen, die philosophische Diskurse von der Seite her anschneidet, um „[I]hr das Trommelfell zu
gerben – der Philosophie“. Vgl. Derrida: Tympanon, in: ders.: Randgänge der Philosophie. Wien 1988, S. 13-
28. 35 Thomas Kling: Botenstoffe. Köln 2001.
14
erscheint Hermes oder die Kommunikation selbst: „und Hermes-Merkur, der vielgestaltige
Kommunikationsgott zieht vorüber.“36
Fast eine Idylle. Lyrik wird gelesen und der Gott
erscheint, die Kommunikation erscheint höchstpersönlich. Das Gedicht erscheint als
Apotheose aller Kommunikation, als Kompaktkommunikation. Gelesen wird natürlich laut.
Das alles klingt wie ein traditionelles humanistisches Lob der – vergessenen – Qualitäten
lyrischer Bildung durch deren tonale Qualität. Auch das „Verlebendigen“ durch lautes Lesen
notiert Kling. Aber es gibt eine minimale Differenz. Die Schrift, das ABC, ist mit von der
Partie. Die LeserInnen der Lyrik-Anthologie sollen sich
„trauen, die Gedichte laut zu lesen: sie sprechend zu entziffern. Bei Quirinus Kuhlmann
taucht das schöne Worte ‚abecedieren‘ auf. Also bitte, verlebendigen sie die Gedichte, indem
Sie sie ‚abecedieren‘! Sprechen Sie das Gedicht mit – Sie werden sich wundern...“37
Das „abecedieren“ führt die Schrift auf ihre Materialität zurück, die der Phonozentrismus
übersteigt oder dissimuliert und bemüht dennoch dessen Wirkung, das Wundern über die
gesprochene Sprache, die das Gedicht anders erscheinen lässt als in stiller Lektüre. Doch
Klings Diktion der Wirkstoffe und intermedialen Mischung fasst das Wunder
medientechnisch: „Dichtung ist gesteuerter Datenstrom und löst einen solchen im Leser aus.“
Von „Sprachpolaroids“ ist die Rede und von „Ohrbelichtung“, nicht nur wenn der Text zur
Stimme wird. Das heißt: Alle Medien sind gefragt. Die Stimme erscheint nicht mehr als
Anwalt eines verbürgten Sinns, sondern als Medium unter Medien, die Datenströme oder
Assoziationen im Leser auslösen. Text wie Stimme sind unterschiedliche Formen einer
Programmierung, die sich in andere Programme einmischen. Klings Medienmetaphorik ist
keine modernistische Spielerei, sondern sie führt konsequent alle Medien auf eine Funktion
des Erinnerns, auf die Differenz zwischen Speicher, Gedächtnis und Erinnerung zurück.
Als Filter des historischen Sprachrraums, als Sprachspeicher – so der Titel der
Lyrikanthologie – ist das Gedicht „was es immer war: ein Mundraum“.38
Aber auch dieser
Raum ist nicht dem Authentischen und dem Originalton hörig, jedenfalls nicht in einfacher
Weise, sondern ebenfalls einer intermedialen Schnittmenge aller Medien. Der Mundraum ist
nicht der Ort autoritativer Diktion, sondern ein Ort der Verwandlung, der Performanz von
Sinn.
36
Sprachspeicher. 200 Gedichte auf deutsch vom achten bis zum zwanzigsten Jahrhundert. Eingelagert und
moderiert von Thomas Kling. Köln 2001, hier S. 311. 37 Vgl. Kling: Sprachspeicher. S. 330. 38 Kling: Sprachspeicher, S. 329.
15
„Hermes, der Trickster. Die Distanz zum Hörerleser, zum Leserhörer. Schnellzüngigst, mit
Stentorstimme, wie im Flüsterton. Immer inszeniert, immer inszeniert spontan. Immer präzis
auf den Punkt mit der Stimme, mit der Schrift; immer Rhythmus und Bild hübsch, in getimten
Klimawechseln, abstürzen lassen, um die Maschine, Sprach- und Sprechmaschine, wieder
hochzuziehen. Recherche, Regie, Dramaturgie, Bildtechnik, Schnitt, Schnittüberwachung,
Script, Archiv, Maske, die ganze verwackelte Kameraführung (Experimentalfilm! Under-
ground!), der vom Näseln in Knacklaute übergehende, gern als irritierend empfundene Ton
der Sprachinstallation: das Gedicht, paradoxes Instrument der Distanzüberwindung wie –
gewinnung.“39
Die Sprachinstallation als Neuformulierung der Dichterlesung gerät zur Medienpoetik. Denn
es handelt sich hier nicht um eine Beschreibung Klings seiner Art, zu lesen, sondern um eine
Beschreibung der Form seiner Lyrik, die in ihren Texten mediale Figuren und Operationen
aller Art aufnimmt. Wie installiert Thomas Kling Sprache vor der Sprachinstallation?
Die Medienpoetik der Sprachinstallation und die Genealogie lesender Dichter
Sprachinstallation 2 setzt mit einem Fund ein, einer Lesefrucht. Sie führt vor, wie die Lektüre
vor der Lesung und vor dem Gedicht hochkomplexe Zusammenhänge entwirft.
Kling liest bei Jean Paul ein Exzerpt: „Mit dem letzten Athemzuge gehen die vorher geschlos-
senen Augen und Mund wieder auf. Autenrieth.“ Das ist der Arzt Friedrich Hölderlins, der
Tobsüchtige mit einer Gesichtsmaske behandelte und Hölderlin „herzstärkende Mittel“
verchrieb. Wieder eine Kursive im gedruckten Text. Sie veweist auf Klings Lyrikband
Erprobung herzstärkender Mittel und damit auf einen Zusammenhang von Hölderlins
attestierten Wahnsinn und einer Medizintechnologie, die den Körper des Dichters zum
Experimentierfeld macht. Der Titel positioniert den Körper des Dichters in ein soziales
Stimulationsfeld.
Die Lektüre überquert historische, literaturgeschichtliche und aktuelle Konstellationen. Sie
mischt nicht nur Worte, sondern auch deren historischen Kontexte, um wieder andere Worte
hevorzubringen. Dass bei einem Toten Augen und Mund mit dem letztem Atemzug wieder
auf gehen, gilt nicht als interessante medizinische Information, die möglicherweise Jean Paul
angeht. Kling liest das Fundstück nicht als Aussage, sondern als Performativ, als Aufforde-
rung: „Ich lese das Notat des Psychiaters als Aufforderung zum Weiterhinsehen.“40
Doch der
imaginäre Blick gilt nicht den jetzt wieder sichtbaren toten Augen, sondern Worten. Die
Fundstelle wird zur:
39 Kling: Itinerar, S. 54. 40 Kling: Itinerar, S. 15.
16
„Aufforderung zum Weiterhinsehen, zur weiteren Sprachenfindung; zum Fortsetzen
dichterischer Traditionlinien im Rückgriff auf teils weit zurückreichende Rhizomanordnungen
und als Aufruf zu exzessiven Recherchen philologischer wie journalistischer Art, die vor jeder
Niederschrift, vor dem Schreibakt stehen – seien sie nun literal oder oral bestimmt. Die Ein-
beziehung aller existierenden Medien ist gefragt.“41
Dass das „aller“ aller Medien kursiv gesetzt ist, versteht sich. Alle Medien heißt nicht nur
Apparate, der technische Stand der Dinge, sondern auch jene alteingesessen und naturalisier-
ten Medien. Von der Lektüre eines Zitats kommt Kling auf einen Ethos dichterischer Arbeit,
der mit einer universalen Integration aller Medien endet. Kling begreift „Dichten“ nicht nur
als Akt des Schreibens, sondern als Akte der Rezeption mit allen Sinnen, ohne hier den Primat
des „gelebten Lebens“ (wie in der sog. Pop-Literatur) einzuführen. Augen und Mund auf, das
heißt auch reden, nachfragen, Recherchen anstellen und dies wiederum bedeutet „Lebensläufe
auch von Worten, ‚Soziolekten‘ einzuholen“.42
Kling bezieht nicht nur die jüngere Geschichte der Dichterlesung ein, sondern er zieht seine
Herkunft aus den Tiefen der Kulturgeschichte der Aufführung von Stimmen. Entscheidend ist,
gut literaturwissenschaftlich gesagt, eine Veränderung in der Rolle des Dichters.43
Er wird
nach der Programmatik des „Sprachspeichers“ als Person zu einem kollektiven Sprachraum.
Das Gedicht ist ein „Mundraum“, aber ein kollektiver, der im Körper des Dichters versammelt
und neu gemischt zur Aufführung kommen soll. Der Dichter wird zum Philologen und zum
„Memorizer“. Kling liest den Dichter sozio-ethnologisch:
„Ich pflege von jeher eine Etymologiebegeisterung, die der des 19. Jahrhunderts […] in keiner
Weise nachsteht. In der Ethnologie werden solche Leute als Memorizer bezeichnet, sie sind
die Gedächtnisverantwortlichen unter den Clanmitgliedern. Kapazitäten der Sprachwirklich-
keit.“44
„Solche Leute“ zeichnen sich nicht durch ihr Gedächtnis aus, sondern durch die Art und
Weise, wie sie das Gedächtnis im Vortrag zurückbringen. Diese selbstgewählte Herkunftsbe-
stimmung schlägt sich notwendig in einer Verwandlung der Dichterlesung nieder: „Ich für
meinen Teil habe spätestens seit 1983 mich für eine Neuformulierung der Dichterlesung ein-
41 Ebd. 42
Ebd., S. 16. 43 Zum Spektrum vgl. etwa Gunter E. Grimm (Hg.): Metamorphosen des Dichters. Das Rollenverständnis
deutscher Schriftsteller vom Barock bis zur Gegenwart. Frankfurt/M. 1992. 44 Kling: Itinerar, S. 16.
17
gesetzt.“45
In einem eigeständigen Text namens Memorizer führt Kling seinen Einsatz
genauer aus:
„Ziemlich genau 1985 begann ich meine Auftritte als Sprachinstallationen zu bezeichnen. Das
geschah zunächst, um eine Grenze zur Performance und zum Label Performance zu ziehen.
Dabei verzichtete ich nicht auf ein bißchen Mixed Media […] und wurde ein histrionischer
Dichter.“46
1983 also die Erfahrung konventienell ins Mikro zu lesen, während einer Performance. 1985
Sprachinstallationen, die in Düsseldorf, in Köln und anderswo, z.B. in Finnland,
Aufmerksamkeit erregten. Was war anders? Kling las u.a. mit dem „Performer“ Frank
Köllges und dessen kongenialer Schlagzeugbegleitung. Ein bißchen Mixed Media, aber sehr
reduziert. Nur was ist ein „histrionischer Dichter“?
Das Lexikon gibt Aufschluss, dass der Histrione ein Schauspieler im alten Rom war, auch
pantomimischer Tänzer und Gaukler. Es geht gezielt um Performanz und Performance, nicht
in der Form des Labels, sondern in einer personalen Form, in der die Performanz
gesprochener Sprache durch den Klangkörper des Vortragenden in Gestik, Mimik und Ton
inszeniert wird. Kling führt weitere, ganz verschiedene Vertreter wie Volksprediger, den
singenden Oswald von Wolkenstein oder auch Prediger-Dichter barocker Zeiten an. Er hätte
sich auch auf den mittelalterlichen Troubadour als Dichter-Sänger beziehen können und tut
dies auch an anderer Stelle.47
Allen „histrionischen Dichtern“ ist gemeinsam, dass der Körper
des Lyrikers zum Aufführungsort wird. Was die Sprachinstallation reformuliert ist, wie Kling
in einem kurzen Statement 1992 veröffentlicht, der „Dichter als Live-Act. Drei Sätze zur
Sprachinstallation.“
Wieso aber Sprachinstallation? Es gibt eine Definition von Sprachinstallation, die zeigt, dass
der Ton hier nicht im Sinne der romantischen Tradition als Erweckung des Wortes und
Ursprung der Dichtung interessiert, sondern als Medium unter Medien, deren wirksame
Gestaltung Aufgabe der Dichterlesung ist. Die Differenz zum Phonozentrismus ist minimal,
aber lesbar: „Sprach-Räume mit der Stimme gestalten, Sprache mit der Stimme der Schrift
gestalten: Sprachinstallation.“48
45 Ebd., S. 18. 46 Ebd., S. 59. 47 Vgl. Sprachspeicher, S. 20. „Im 12. Und 13. Jahrhundert treten mit Minnesang im deutschprachigen Raum
Berufsdichter auf den Plan, deren berühmtester Walter von der Vogelweide geblieben ist. [...] erst hört der
Dichter, dann sieht er […]. […] Vermittelt wird die Trobador-Dichtung wie auch die Lyrik des Minnesangs
mündlich, über die Stimme, im Live-Auftritt. Das heißt auch, durch die performative Sprache des
Köpereinsatzes, die dem Publikum den Text in Mimik und Gestik des Dichters nahebringt.“ 48 Kling: Itinerar, S. 59.
18
Die Metapher einer „Stimme der Schrift“ überkreuzt deren Lesung. Nicht ist es so, dass der
Ton als Original der Schrift vorausgeht und wieder zum Leben erweckt werden müsste, nicht
so, dass er sich erst mit der Lesung als Aufführung „lebe“, sondern die Schrift scheint eine
„Stimme“ jenseits der Stimme zu haben. Die poetologische Gestaltung der Sprache zeigt sich
als als ständige Überkreuzung schriftlicher, tonaler und visueller Effekte, die zu neuen
schriftlichen, tonalen und visuellen Effekten verdichtet werden. „Sprache mit der Stimme der
Schrift gestalten“ ist eine poetologische Weisung, die in der Verdopplung der phonetischen
Metapher diese dekonstruiert. Wäre die „Stimme der Schrift“ dasselbe wie ihr sprachliche
Intonation, dann wäre die Dopplung schlicht tautologisch. Es besteht hier eine minimale
Differenz zwischen der Stimme der Schrift und der Sprache als Stimme der Schrift. Die
Stimme der Schrift impliziert vielmehr Medien der Schrift, Medien, die unhörbar gestalten,
die graphischen Zeichen und Satzzeichen. So sehr Kling für eine Sprachaufführung seiner
Lyrik plädiert, so wenig verzichtet diese auf Interpunktion. Nicht nur wird Slang und Mundart
bei Kling phonetisch geschrieben oder transkribiert, sondern alle möglichen diakritischen
Textgestaltungen, inklusive des aktiven Einsatzes von Zeilenumbruch und Leerzeilen, finden
in der Lyrik Klings Anwendung in einem Maß, dass seine Gedichte zunächst als primär
textzentrierte Kunst erscheinen. Ein Kling-Gedicht philologisch genau zu zitierten, erfordert
die Nachstellung seines Layouts, erfordert eine intermediale Umsetzung als Textbild. Unter
dem Titel „Bildprogramme“ notiert das Gedicht „1 Zwischenbericht“:
„gegnüber. Eingelassene plattn; pro-
tzigste heraldik. weißestn marmors
parade: di superfette SPRACH-
INSTALLATION.49
Intarsien und Heraldik als Sprachinstallation. Die Nummer „2 Mitschnitt Calvenschlacht“, in
der Willibald Pirkheimer live „am Sattel, AM HU- / MANISTISCHEN
SATTELITTENTELEFON:“ berichtet („inzwischn: 1499“) klingt aus mit einem Fading der
Leitungen:
KAISER MAXIMILIAN SOLL GEWEINT
HABN ALS / FADING / DI KINDER ESSENZ /
BROTKLEE VON DEN WIESN DA BR-
icht
di leitun‘ zamm, damundherrn, in weißm rau-
schn, klappt zusamm das bilderwelt in riesen OH- 49 Thomas Kling: Fernhandel. Köln 1999, S 38 (erster Absatz).
19
NELÖSCHLÖSCH. Romantisch di bandnwerbun‘
Gottes, tonlos di engel vorm himml. Jerusalem, wei-
ße bänder, spruchbänder in händn. ohne text.50
Jeder Strich ist kalkuliert, die phonetisierende Schreibweise, hier auch selbst Ansprache,
bricht sich selbst in textuellen Störungen, die von der Trennung zur Unzeit angefangen bis
zum falschen grammatikalischen Geschlecht reicht – und historisch vom Fading
elektroakustischer Stimmen zurück zur Stimme ohne Text im Bild mittelalterlicher
Spruchbänder. Das Zusammenbrechen der Leitung oder Tradition, das Wort „BR-icht“ wird
selbst gebrochen inszeniert, aufgespalten in Kanal und Materialität des Mediums, Wortklang
oder phoné auf der einen, Buchstaben oder ABC auf der anderen Seite. Schon Klings erster
Gedichtband, 1986 wunderschön in der Eremiten-Presse, Düsseldorf gesetzt, kommt mit
dieser Trennung und Konfrontation zwischen Schrift und Stimme des Textes auf dem Titel
daher. Das Wort „Gedicht“ wird auf dem Titel in die Zeilen „KLING / GEDIC / HTE“
getrennt. „HTE“ ist Bestandteil des Wortes „Gedichte“ und diese Fügung der Buchstaben ist
bereits eine Sprachinstallation.
Thomas Kling setzt also nicht nur auf phonetisierende Schreibweise, auf kleinschreiben und
kleinschneiden von Sätzen und Worten, sondern er setzt die Materialität der Schrift auch dort
als Material der Lyrik ein, wo sie über ihre dienende Funktionen zur Aussprache hinausgeht
und eigene Räume schafft. So wird das Gedicht zu einem „Konstrukt“ und zur „Evokation“
zugleich, unter Einbeziehung des bereits „installierten“ kulturellen Gedächtnis wie der
Reaktionsfähigkeit der Leser/Hörer. In diesem Sinne gilt: „Das Gedicht als literales Ereignis
ist die Sprachinstallation vor der Sprachinstallation.“51
Im Wort der Sprachinstallation verschränken sich also die poetologischen und die
performativen Figurationen der Lyrik Klings. Seine Genealogie bezieht auch die – von ihm
zitierte – poetologische Forderung des Horaz, ein Dichter solle seiner Zeit gemäß dichten,
aktiv ein, doch er setzt nicht mehr auf aufwendige technische Installationen. Er bezieht sich
vielmehr zurück auf ethnologische wie kulturelle Formen der Sprachaufführung durch den
Körper des Lesenden als einem besonderem Medium.
Der Unterschied, den Kling macht, liegt nicht im Wort, sondern in einer Rückkehr zur Lesung
als Aufführung der Worte, die als „Sprachpartitur“ zuvor recherchiert, geschnitten, gemischt
und kalkuliert werden, um aus dem „Mundraum“ einen Gedächtnisraum werden zu lassen: 50
Ebd., S. 39f., hier S. 40 (letzter Absatz). 51 Ebd., S. 20: „Gedicht ist immer Evokation; und: Gedächtnis, spätestens seit Baudelaire, Mallarmé, George
[…] Konstrukt. ‚Poetische Rede ist konstruierte Rede‘ hat Sklovskij in seiner fundamentalen Studie ‚Kunst als
Verfahren‘ (1916) festgestellt.“
20
„Gedicht ist Gedächtniskunst und steht als Schrift naturgemäß vor der Performance des
Textes, der in vorklassischer Epoche bereits aus dem rhetorischen Kanon ausgeschalteten
actio; ist schon Rhetorik, die prononciert memoria miteinschließt“.52
Achtung Rhetorik, Memoria steht kursiv. In den vielen Positionen der selbstgewählten
Herkünfte spielt also auch die Verbindung zur Rhetorik eine Rolle und zwar in doppelter
Weise. Nicht nur als historisches Wissen über die Redeteile der Rhetorik, in denen die actio
und pronuntatio als Aufführung der Rede nur ein letztes Glied in ihrem Arrangement ist,
sondern vielmehr als Verführung durch die Stimme. Kling zitiert Nietzsche über Horaz –
Memoria und Sprachmacht, Rhetorik und Poetik mischen sich. Zwischen der Einstellung der
Memorizer und „Nietzsches Ahnenverehrung im Falle von Horaz“, gebe es, so Kling „keine
wesentliche Differenz“.
„Ich zitiere die berühmte Stelle: ‚Dies Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort,
als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft ausströmt, dies
Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum in der Energie der
Zeichen‘“53
Ende Zitat Nietzsche. Kling: „Eine für mich akzeptable Charakteristik von Moderne
überhaupt!“
Nietzsches Lob Horazens Sprachkraft, die er selbst für seine Lyrik des Dithyrambus und des
„großen Stils“ im Zarathustra neu erfinden wird, steht unter dem Titel: „Was ich den Alten
verdanke“. Es ist eine Sprachmacht, die den technischen Prinzipien der Moderne, mit
Minimalia Maximalia zu erzielen – Botenstoffe – in nichts nachsteht, sondern ihr als
vergessenes Exemplum vorausgeht. Diese Effektivität der Sprachfügung geht in der Antike,
wie der Philologe Nietzsche sehr gut weiß, mit einer „Kunst des Lesens“ einher, die den
Klang der Worte noch zu schmecken wußte: „Mit lauter Stimme: das will sagen, mit all den
Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und Wechseln des Tempos an denen die
antike öffentliche Welt ihre Freude hatte.54
52 Ebd.. 53 Friedrich Nietzsche zitiert nach Kling: Itinerar, S. 16. 54 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, Nr. 247, in: ders.: Werke in drei Bänden, hg. v. Karl
Schlechta. München 1965ff., Bd. II, S. 714. Zum Kontext vgl. Matthias Bickenbach: Wiederkäuen ist nicht
einfach zweimal lesen: Friedrich Nietzsche zur Methode lauten Lesens, in: ders.: Von den Möglichkeiten einer
‚inneren‘ Geschichte des Lesens, S. 40-54. Zu Nietzsche als Philologe grundlegend: Nikolaus Wegmann: Was
heißt einen 'klassischen Text' lesen? Philologische Selbstreflexion zwischen Wissenschaft und Bildung, in:
Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Hg. v. J. Fohrmann und W. Voßkamp. Stuttgart
1994, S. 334-444.
21
Wichtig ist hier jedoch nicht die Kritik Nietzsches am Verlust dieser öffentlichen Klangsphäre
und Kunst des lauten Lesens, sondern ein Punkt in seiner komplexen Sprachtheorie, die
aussagt: „es giebt gar keine unrhetorische ‚Natürlichkeit‘ in der Sprache an die man appelliren
könnte“55
Dies gilt nicht nur für die Zeichentheorie, d.h. die Relation von Wort und Sache,
sondern auch für die Relation von Ton und Sprache. Die antike rhetorische Tradition wußte
schon sehr gut, dass die Stimme, zumal des berühmten Dichters oder Redners, nicht Medium
der Natur, sondern Medium des Kalküls tonaler Subversion ist. Cicero hat in seiner Rhetorik
festgehalten, dass die Tonalität der Stimme am geeignetsten ist, die Hörerschaft zu
überzeugen, weil sie durch Klang und Rhythmus unbemerkt, also subversiv einnimmt. Denn,
"die Ohren erwarten, daß der gedankliche Gehalt eines Satzes durch die Wörter zusam-
mengefaßt wird."56
Aber der Rhythmus der Worte, Satzschlüsse und Perioden verleiht dem
gesprochenen Text eine Wirkung jenseits seiner inhaltlichen Bedeutung:
„Denn die Hörer richten ihre Aufmerksamkeit auf eben diese zwei und finden an ihnen
ihr Vergnügen - ich meine die Wörter und die Gedanken. Während sie diese
aufmerksamen Sinnes und voll Bewunderung in sich aufnehmen, entgeht ihnen der
Rhythmus und fliegt unbemerkt vorbei.57
“
Jacques Derrida hat die Geschwindigkeit der Übertragung von Wort zu Worten, von einem
Wort in einem Buch zu einem anderen in ihm oder in einem anderen Buch, kurz die
semantischen, lexikalischen und hermeneutischen Bedeutungsassoziationen, die sich lesend-
hörend automatisch einstellen, als eine unmessbare schnelle Datenübertragung der
Langsamkeit der Computers gegenübergestellt. Neben ihr nehme sich die „heutige
Technologie unserer Computer“ wie „Bastelei“ oder „prähistorisches Kinderspielzeug“ aus.
„Ein Spielzeug vor allem, dessen Funktionsabläufe dahinschleichen. Ihre Langsamkeit ist
inkommensurabel mit der quasi unendlichen Schnelligkeit der Bewegungen auf der
joyceschen Verkabelung. Und wie könnte man ein Werk dieser Art simulieren? Wenn diese
Fragen so furchterregend sind, dann weil sie nicht zunächst die Geschwindigkeit der mentalen
Operationen eines Subjekts (Autor oder Leser) betreffen.“58
55 Vgl. Nietzsche: Gesammelte Werke. München 1922 (Musarionausgabe), Bd. 5, S. 297ff. 56 Cicero: Orator. Lateinisch und deutsch. Hg. v. B. Kytzler. Zürich und München 1988. XLIV, St. 168. Zum
Kontext Ciceros vgl. Matthias Bickenbach: Von den Möglichkeiten einer ‚inneren‘ Geschichte des Lesens, S.
56ff., hier S. 60f. 57
Cicero, ebd., St. 197. Cicero stellt hier erstmals einen systematischen Bezug zwischen Prosatexten und
Artikulation her. Vgl. Karl-Heinz Göttert: Einführung in die Rhetorik. Grundbegriffe - Geschichte - Rezeption.
München 1991, S. 116 ff. 58 Jacques Derrida: Zwei Deut für Joyce, in: ders: Ulysses Grammophon. Berlin 1988, S. 16.
22
Die Sprachinstallation ist immer schon, jenseits der bewußt rezipierten Bedeutung, am Werk.
Die Stimme ist nur eine Simulation dieser komplexen Bewegungen der Bedeutung selbst, die
das Bewußtsein von Lesern und Hörern unterläuft. Als das vereindeutigende Medium des
Textes hat sie darin ihren Vorteil. „Immer wieder kam der Satz, den ich aus den 80er Jahren
kenne: Jetzt, wo ich sie gehört habe, verstehe ich ihre Gedichte viel besser.“59
Schon seit 1991 hat sich Kling seine Lesung auf CD vorgestellt. Der Suhrkamp Verlag
mochte das nicht machen. Erst nach dem Verlagswechsel zu DuMont kam der Lyrikband
Fernhandel 1999 „mit einer CD“ heraus, die Kling in Botenstoffe als „gebrannte
Performance“ bezeichnet.60
Sie enthält als dreifache Sprachinstallation von Gedicht, Lesung
und Speichermedium nichts anderes als die Stimme Thomas Klings. Unter dem Titel „Der
erste Weltkrieg“ versammeln die Gedicht eine historische Live-Übertragung, dessen
sprachinstallierter Sender „CNN Verdun“ heißt.61
Nichts als die Stimme ‚erscheint‘ auf der CD als „gebrannter Performance“. Der ehemalige
Chorschüler Kling, also mit Stimmausbildung, liest sehr gut. Fällt seine Stimme in die
Geschichte des Phonozentrismus zuletzt hinein und zurück? Es ist wahr, der Satz findet sich
auch bei Thomas Kling: „Es handelt sich um nichts weniger als um den Geist der
geschriebenen Sprache.“62
Doch dieser Geist ist ein multipler und gemischter. Es sind
Geister-Stimmen, Gespenster, Hermes oder Botenstoffe historischer Sendungen, die zur
Wirkung und zur Sprache kommen. Die Sprachinstallation Klings als „Lippe der Tradition“
ist so phonozentrisch wie ein Radiokanal. Statt einer Zentrierung des Sinns auf phoné
präsentiert sich vielmehr eine Medienpoetik der Mischung, die nichts weniger als die
Medienabhängigkeit aller Nachrichten reflektiert und damit auch die Nachricht der Stimme
dekonstruiert.
Die Sprachinstallation sei, als Live-Act oder als CD, „keine Ergänzung“, sondern ein
alternativer Zugang zum Gedicht: „es sind zwei literarische Produkte.“63
Folgerichtig kommt
es dann auch keineswegs auf die eine Stimme des Autors selbst an: „Wer nicht ‚vorlesen‘
kann, oder zu faul zum Üben ist – der soll den Mund halten, Schauspieler engagieren.“64
Es geht in der intermedialen Poetik der Sprachinstallation nicht um Verlebendigung von
Schrift oder Geist, sondern um Verwandlung, um die „proteushaften“ Qualitäten von Lyrik.
59 Kling: Botenstoffe, Interview mit Hans Jürgen Balmes (Januar 2000), S. 230. 60 Kling: Botenstoffe, S. 102f. 61 Die diesem Band beiliegende CD speichert mit freundlicher Genehmigung des DuMont Verlags den O-Ton
Klings Stimme und Gedicht „diese Photographie, dieses Foto“ aus dem Zyklus „Der erste Weltkrieg“ des
Bandes Thomas Kling: Fernhandel. Köln 1999. 62 Kling: Botenstoffe, S. 102. 63 Ebd., S. 230. 64 Ebd., S. 102.
23
Das Gedicht das „mehrfach gelesen“ werden will Ort seiner ständigen Verwandlung. „Es
ändert sich bei jedem Lesen“, heißt es deutlich. Das Gedicht, so lautet Klings poetisches
Credo der Sprachinstallation, muss die Fähigkeit zur „Wandelbarkeit“ haben. Erst dann wird
es aktiv - als das, „was es immer schon war: ein Mundraum, ein Wahrnehmungsinstrument“.65
65 Ebd., S. 329.