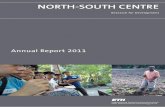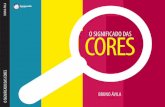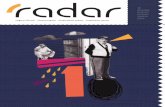Das Letzigrundstadion in Zürich
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Das Letzigrundstadion in Zürich
391© Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · Stahlbau 77 (2008), Heft 6
Im August 2007 wurde nach einer Rekordbauzeit von ca. 1 1/2Jahren das Letzigrundstadion in Zürich fertiggestellt. Eine dergroßen Veranstaltungen, die in diesem Stadion stattfinden wer-den, ist die Fußballeuropameisterschaft Euro 08. Allerdings istdas Letzigrund kein reines Fußball- sondern ein Mehrzweck-stadion, in dem auch das jährliche Leichtathletikmeeting „Welt-klasse Zürich“ und Konzerte stattfinden werden. Anders als vieleStadionneubauten wurde es nicht außerhalb der Stadt, sondernmitten in einer Wohngegend gebaut. Eine Intention des Architek-ten war es deshalb, das Stadion sehr offen zu gestalten, wasauch sehr hohe Anforderungen an die Ingenieure bei der Umset-zung der Dachkonstruktion stellte.
The Letzigrund stadium in Zurich. After a record constructiontime of approx. 1 1/2 years the Letzigrund stadium in Zurich wascompleted in August 2007. One of the great events taking place inthis stadium is the European Soccer Championship Euro 08. TheLetzigrund is however not a pure soccer stadium but a multifunc-tional stadium in which the annual athletics meeting „WeltklasseZürich“ and concerts will take place. In contrast to many othernew sites it was not built at the peripherals of the city but in themidst of a residential area. Consequently, it was one of the inten-tions of the architect to create the stadium very open which demanded very high engineering standards in the realisation of the construction of the roof.
1 Einleitung
Nach der Blockade des Neubaus des Hardturmstadions inZürich durch Einsprachen aus derAnwohnerschaft (Bild 1)wurde als Ausweichspielstätte für die Fußballeuropamei-sterschaft 2008 der Neubau des Leichtathletikstadions Let-zigrund vorgezogen. In der Rekordbauzeit von ca. 1 1/2Jahren wurde der alte Letzigrund (Bild 2) abgerissen unddurch einen Neubau ersetzt. Der Entwurf des Stadionneu-baus der Architekten Bétrix & Consolascio zeichnet sichneben dem um 8 m tiefer gelegten Niveau der Spielflächevor allem durch die Stahlkonstruktion des Daches aus.
Die hier vorliegende Veröffentlichung stellt die Inge-nieur- und Ausführungsplanung, die Fertigung und dieMontage des Stahldaches des Stadions vor.
2 Konstruktion
Die Geometrie des Daches wird durch die Anordnung derLichtmasten bestimmt (Bild 3), die alle den gleichen Ab-
Das Letzigrundstadion in Zürich
Carlo GalmariniMartin SchollmayerMartin Mensinger
Fachthemen
DOI: 10.1002/stab.200810052
Bild 1. Durch Einsprachen blockiertes Stadionprojekt„Hardturm” in ZürichFig. 1. Stadium project „Hardturm“ in Zurich blockedthrough objections
Quelle: www.stadion-Zuerich.ch
Bild 2. Blick in das alte Letzigrund-StadionFig. 2. View into the old Letzigrund stadium
stand zueinander besitzen. Aufgrund der unterschiedli-chen Abmessungen von innerem und äußerem Oval undder unterschiedlichen Tiefe der Haupt- und Gegentribüneergab sich die in Bild 4 dargestellte Lage der Hauptträger,welche dem Stadiondach eine gewisse Dynamik verleihen.
Haupttragelemente des neuen Stahldaches sind 31Vollwandbinder, die jeweils auf einem Stützenpaar auflie-gen und von dort ins Stadioninnere auskragen (Bild 4).Während die Auskragung über der Haupttribüne 32 m be-trägt, sind es an der gegenüberliegenden Seite knapp über20 m. Die Träger haben eine variable Höhe zwischen110 cm und 345 cm, bei einer Länge zwischen 29 m und43 m. Auf jeder der 31 Dachbinderspitzen ist außerdemjeweils ein ca. 20 m hoher, ca. 20° geneigter Lichtmast zurBeleuchtung des Stadioninnenraums montiert.
2.1 Lastannahmen und statische Berechnung
Die Lasten des Daches wurden an einem dreidimensiona-len Stabwerkmodell ermittelt. Insgesamt wurden über3000 Stäbe modelliert. Die auf das Dach einwirkendenWindkräfte wurden in Windkanalversuchen am Labora-toire de Mécanique des Fluides environnementale(EFLUM) der EPFL in Lausanne ermittelt. Neben dendirekten Windeinwirkungen auf das Dach wurden auchdie Auswirkungen des Windes auf die Schneeablagerun-gen untersucht: Es musste geklärt werden, ob von derDachaußenseite der Schnee an die Dachinnenseite trans-portiert werden und so zu einer ungünstigeren Belastungs-situation führen kann. Verlagerungen des Schnees von deräußeren auf die ungünstigere Innenseite sind gemäßWindkanalversuch möglich, allerdings in sehr begrenztemMaße (Bilder 5 und 6).
392
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
2.2 Ausbildung und Fertigung der Stützen
Die so genannten „tanzenden Stützen“ des Stadiondacheswurden als Verbundstützen ausgeführt. Sie besitzen einenüber ihre Länge veränderlichen Grundriss, der durch einRechteck am Fuß und ein weiteres am Kopfpunkt derStütze definiert wird. Das obere Rechteck besitzt anderegeometrische Abmessungen als das untere und ist zudemgegenüber diesem um einen definierten Winkel verdreht.Durch ein geradliniges Verbinden der Eckpunkte dieserRechtecke wird die Form der Stütze bestimmt. Die geradli-
Bild 3. Die Lichtmasten an den Trägerenden sind eines derherausragenden architektonischen Merkmale des neuen Sta-dions Fig. 3. The lamp posts at the tails of the beams are one ofthe outstanding architectural characteristics of the new sta-dium
Bild 4. Tragwerk Fig. 4. Structure
Bild 5. WindkanalmodellFig. 5. Wind tunnel design model
Bild 6. Schneeverlagerungen im WindkanalmodellFig. 6. Snow in the wind tunnel design model
Bild 7. Blick von oben auf eine Stütze: Ein reine Verdrillungdes Querschnittes hätte zu gekrümmten Außenkanten ge-führt. Taillierte Seitenbleche ermöglichten die ebenfalls dar-gestellten geraden KantenFig. 7. Top view onto a pillar: A pure torque of the cross sec-tion would have led to bent outer edges. Waisted side panelsmake possible the also represented straight angles
393
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
nigen Kanten führen – im Gegensatz zu einem Verdrillen –dazu, dass die Seitenflächen nicht aus trapezförmigen,sondern aus, in Abhängigkeit des Verdrehwinkels derRechtecke, mehr oder weniger taillierten Blechen zusam-mengesetzt sind (Bild 7).
Die Verdrehung der Stützenköpfe zu deren -füßen be-ruht auf der folgenden geometrischen Regel (Bild 8): DieStützenfüße stehen auf Linien, welche radial zur Tribü-nenkurve bzw. orthogonal zur Laufbahngeraden stehen.Da die Binderspitzen mit den aufmontierten Lichtmastenam Dachrand jedoch einen konstanten Abstand haben,können diese nicht radial bzw. orthogonal zum Dachrandverlaufen, sondern sind über den Stützenpaaren verdreht.
Der Winkel dieser Verdrehung bestimmt auch die Verdre-hung des jeweiligen Stützenquerschnitts und beträgt imMaximum 19°. Aufgrund der Neigung des Daches – es istüber der Haupttribüne höher als auf der Gegenseite – ha-ben die Stützen unterschiedliche Längen. Daraus folgt,dass jede Stütze ihre eigene Geometrie hat, was sowohlfür die Berechnung als auch für die Ausführungsplanungeinen großen Aufwand bedeutete.
Die Mantelbleche der Druck- und Zugstützen sindaus unbehandeltem wetterfestem Stahl und haben dahereine durch den Rostprozess entstandene rötlich-brauneFarbe. Da die Mantelflächen bei der Herstellung um denentsprechenden Winkel verdreht werden mussten, wurdederen Materialdicke begrenzt, damit die zur Verdrillungerforderlichen Kräfte nicht zu groß waren. Wie sich beider Herstellung herausstellte, war die gewählte Blechdickevon maximal 20 mm bezüglich der Verdrehbarkeit nichtzu dick gewählt, aber schon recht nahe an der Grenze desMachbaren. Aufgrund der geometrischen Gegebenheitensind auch die Belastungen auf die einzelnen Stützen sehrunterschiedlich.
Die Druckstützen haben am Fuß eine Kantenlängevon 100 cm und am Kopf 60 cm. Sie sind mit jeweils20 Längseisen mit Durchmessern bis zu 50 mm bewehrt.Zusätzlich verläuft ein Rundeisen mit bis zu 180 mmDurchmesser von der Kopfplatte der Stütze schräg in dieuntere Ecke, in der die größten Druckspannungen auftre-ten. Kopfbolzendübel an den Mantelblechen tragen zurVerbundwirkung bei und verhindern das Ausbeulen desStützenmantels. Im Inneren der Druckstützen musstenaußerdem bis zu vier Rohre für Elektroleitungen und dieAbführung des Dachwassers untergebracht werden. In derAuflagerwand der Stützen verlaufen in Verlängerung derStützenmantelbleche weitere Längseisen (siehe Bild 9).
Die 100 mm dicken Kopfplatten der Druckstützenverschwinden unsichtbar hinter dem überstehenden Cor-tenstahlmantel und sind mit diesem über Schlitznähte ver-bunden. Auf diesen Kopfplatten befinden sich bombierteAuflagerplatten, die mit nur 2 mm Spiel in eine gefrästeAussparung des Auflagerpunktes des Hauptbinders passt(Bilder 9a und 20).
Die Zugstützen haben am Fuß eine Kantenlänge von70 cm und verjüngen sich auf 41-cm am Kopf. Der Zug-stützenkern besteht im Querschnitt aus vier 50-mm-Ble-chen und einem 60-mm-Blech, welche H-förmig angeord-net sind. Die Dicken der Kernbleche mussten gemäßDAST-Richtlinie 009 begrenzt werden, um die Anfälligkeitauf Sprödbruch zu vermeiden, daher der zusammenge-setzte Querschnitt des Stützenkerns. Außerdem wurde einStahl mit einer hohen Zähigkeit gewählt (S355 K2G3).Die Zugkräfte werden über Kopfbolzendübel in den Betonder Auflagerwand eingeleitet. Weiterhin befinden sich umden Stützenkern herum zwölf Längseisen mit bis zu50 mm Durchmesser. Wie auch bei den Druckstützenwerden die im Stützenmantel wirkenden Normalkräfteüber Bewehrungseisen in die Auflagerkräfte eingeleitet.
Die Zugkräfte im Stützenkern werden über annä-hernd 200 Kopfbolzendübel in die Auflagerwand eingelei-tet. Am Stützenkopf schließen in Verlängerung des Kernsdoppelte Augenstäbe an, mit denen über eine Bolzenkon-struktion (650 kg schwerer Doppelbolzen) die Zugstützemit dem Dach verbunden ist. Die Bleche des Stützenkerns
Bild 8. „Tanzende Stützen“ im ausgeführten ZustandFig. 8. Completed „dancing pillars“
Bild 9. Schnitt durch ein Stützenpaar; a) Druckstützenquer-schnitt; b) ZugstützenquerschnittFig. 9. Cross-section of a pair of columns; a) cross-section ofcompression columns; b) cross-section of a diagonal tie
a) b)
und der Augenstäbe sind sowohl über voll durchge-schweißte Stumpfstöße als auch über Längsnähte mitein-ander verbunden, was durch die sich überlappende Anord-nung der Bleche ermöglicht wird. Da die Binder im Ge-gensatz zu den Stützen senkrecht stehen, sind dieAugenlaschen beim eigentlichen Eintritt in die Stützeleicht geknickt. Zusätzlich sind die Zuglaschen am Stüt-zenkopf über Knaggen und Schlitzschweißungen mit demäußeren Cortenstahlmantel verbunden.
Die Augenstäbe sind aus je zwei 50-mm-Blechen auszähem Stahl (S355 K2G3) zusammengesetzt. Auch hierwurde die Blechdicke begrenzt, um Sprödbruch bei tiefenTemperaturen zu vermeiden. Um zu hohe Spannungsspit-zen in den Ecken derAussparungen in den Augenstäben zuvermeiden, mussten diese entsprechend ausgerundet wer-den. Die endgültige Form der Augenstäbe wurde mit eineraufwendigen Finite-Elemente-Parameterstudie ermittelt,siehe Bild 11. Die Formgebung der Augenstäbe war maß-geblich von der Voraussetzung beeinflusst, dass an dieserStelle das Dach in seine endgültige Position einnivelliert
394
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
wird. Das bedeutet, dass zwischen Bolzen und Augenstab jenach Bedarf ein dickeres oder dünneres Futterblech einge-legt wird, um so die Binderspitze in seine entsprechend ge-wünschte Position zu richten. Dafür ist zwischen Bolzenund Augenstab eine gewisse Auflagerfläche erforderlich,welche die rechteckige Querschnittsform des Bolzens vor-aussetzt. Außerdem ist bei dieser Konstruktion gewährlei-stet, dass der Binder bzw. auch die dazugehörige Zugstützeum ein gewisses Maß aus der vorgesehenen Achse abwei-chen können. Insofern ist eine gewisse Verdrehbarkeit in-folge Montageungenauigkeiten sichergestellt.
Beim Eintritt der Stützen in den Beton sind Armie-rungsstäbe mit bis zu 63 mm Durchmesser mit dem Corten-stahlmantel verschweißt. Da die oberhalb der Betonober-kante schräg stehenden Stützen in der Regel gerade in denBeton geführt werden mussten, haben die Stützen an dieserStelle einen leichten Knick von einigen wenigen Grad.
Die Komplexität der Planungsaufgabe der Stützenzeigt sich auch an der Tatsache, dass für insgesamt62 Stützen über 10000 unterschiedliche Armierungsposi-tionen benötigt wurden.
Da die Stützen vollplastisch bemessen wurden undaußer den ungewöhnlich hohen Normalkräften (maximal18 MN Druck bzw. 15 MN Zug) auch große Biegemomenteum zwei Achsen aufnehmen müssen, war bei der Fertigungäußerste Perfektion gefragt. Die Fertigung der Stützen er-folgte mit Hilfe von Schablonen nach einem ausgeklügeltenKonzept für den Zusammenbau je zur Hälfte in den Werk-stätten der Baltensperger AG und der H. Wetter AG(Bild 12). Danach wurden die Stützen zum Betonierplatztransportiert und auf dem Kopf stehend ausbetoniert. ZumZeitpunkt der Montage betrug das zu montierende Stützen-gewicht bis zu 18 t, die praktisch vollständig in der oberenStützenhälfte konzentriert waren, während die untereHälfte praktisch nur aus einem Bündel zwar dicker, aberschubweicherArmierungsstähle bestand.
An die Montage der Stützen waren sehr hohe Anforde-rungen zu stellen, da aufgrund des Hebelarmverhältnissesjede Abweichung bei der Stützenmontage zu einer 10-fachgrößeren Abweichung beim Innenrand des Stadiondachsführte. Die Stützen wurden deshalb mit Hilfsstützen undvorgefertigten Schablonen montiert, die die gewünschteGenauigkeit der Montage ermöglichten (Bild 13). Dies warumso wichtiger, da nach dem Einbetonieren der Stützen insFundament kein Richten mehr möglich war.
Bild 11. Spannungsbild eines AugenstabesFig. 11. Picture of tension of an eyebar
Bild 12. Augenstäbe der Zugstützen während der FertigungFig. 12. Eyebars of the diagonal ties during fabrication
Bild 10. Fertigung der Druckstützen mit Hilfe von Schablo-nen: Deutlich erkennbar sind der schräge Verlauf des Voll-stahlkerns, die Stützenverdrehung und der Knick beim Ein-tritt in das Fundament.Fig. 10. Fabrication of the compression columns by meansof templates: The diagonal characteristics of the steel core,the pillar torsion and the buckling when entering the funda-ment are clearly visible
395
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
2.3 Ausbildung und Fertigung der Hauptträger
Haupttragelemente des neuen Stahldaches sind, wie be-reits erwähnt, 31 Vollwandbinder mit bis zu 32 m Auskra-gung, die jeweils auf einem Stützenpaar mit einer Sprei-zung von unter 3 m aufliegen (Bild 14). Die Trägerhöhenimmt von der Spitze zur Druckstütze hin von 110 cm auf345 cm zu. Die maximale Trägerlänge beträgt 43 m, dieFlanschdicken variieren zwischen 20 mm und 100 mm,die Stege zwischen 20 mm und bis zu 60 mm im Schub-feld zwischen Druck- und Zugstütze. Das maximale Trä-gergewicht beträgt 52 t.
Die Binder wurden wie die Stützen vorverformt ge-fertigt, damit sie unter Eigengewicht ihre gewünschteForm erhalten. Die Überhöhung an der Spitze des Bin-ders mit der größten Auskragung beträgt 340 mm, vgl.Bilder 15 und 16. Auf jeder der 31 Dachbinderspitzen istaußerdem jeweils ein ca. 20 m hoher Lichtmast zur Be-leuchtung des Stadioninnenraums montiert. Aufgrundder unterschiedlichen Trägerlängen ergaben sich für be-nachbarte Träger unterschiedliche Überhöhungen, sodass die einzelnen Dachfelder in der Planung nicht eben,sondern windschief waren. Die Trägerüberhöhungensetzten sich in horizontalen und vertikalen Vorverfor-mungen der Stützen, die ebenfalls in der Planungberücksichtigt wurden, fort. Die damit hochkomplexeGeometrie, welche dem Betrachter des fertiggestelltenStadions nicht ohne weiteres ersichtlich sein wird, wurdemit einem 3D-Stahlbau-CAD-Programm in einem einzi-gen Modell dargestellt. Das ehrgeizige Terminprogrammerforderte die simultane Bearbeitung des Gesamtmodellsdurch mehrere Konstrukteure, was die Konstruktions-aufgabe weiter verkomplizierte.
Als besonders komplexe Details erwiesen sich dieAusbildung der Mastfüße an den Trägerspitzen (1), dieVerankerung der doppelten Zuglaschen der Stützen in denTrägern (2) sowie die Ausbildung des Auflagers des Trägersauf den Druckstützen (3) (siehe Bild 17).
Da die Neigung der Lichtmasten nicht in Träger-achse, sondern zum Träger verdreht ausgeführt wurde,ergaben sich bei jedem Mastfuß unterschiedliche Loch-stellungen der Flansche (Bild 18). Dies führte zu Kolli-sionen mit der übrigen Anschlussgeometrie, so dassdetaillierte Konstruktionsregeln notwendig wurden, umeine statisch einwandfreie Detaillierung sicherzustel-len.
Auch bei dem Doppellaschenanschluss der Zugstüt-zen musste die detaillierte Planung von Träger zu Trägerangepasst werden (Bild 19). Im Bereich der Doppella-schen weist der untere Flansch eine Verbreiterung undzwei Schlitze auf, durch die die Laschen eingeführt wer-den. Die Verbindung zwischen Augenstäben und Trägerwird durch einen Doppelbolzen sichergestellt, der auf-grund seiner Scheibenwirkung eine gleichmäßige Bela-stung des inneren Stegbleches und der zwei seitlichenAuflagerbleche der Bolzen sicherstellt.
Bild 13. Montageabstützung der tanzenden StützenFig. 13. Assembly support of the dancing pillars
Bild 14. Stahldach im BauzustandFig. 14. Steel roof during construction
Bild 15. BindervorverformungFig. 15. Roof frame pre-deformation
Das Druckstück der Träger beim Auflager auf dieDruckstütze zeichnet sich durch seinen zweiaxialen Span-nungszustand aus. Es erfährt aus der Belastung des unte-ren Binderflansches eine Druckkraft von maximal ca.15 MN und aus der Druckstütze eine Belastung von maxi-mal ca. 18 MN. Die Geometrie des Druckstücks variiertewiederum von Träger zu Träger, dies zum einen aus derTrägergeometrie selbst, zum anderen aber aufgrund derTatsache dass alle Installationsleitungen und die Sogsi-cherung der Binder durch diese Druckstücke geführt wer-den mussten. Außerdem mussten die Druckstücke zurQuerkraftübertragung einen millimetergenauen Auflager-ring zum Druckstützenkopf aufweisen. Die Druckstückewurden daher nicht als Gussteile, sondern als Frästeileaus 400 mm dickem Blech hergestellt.
Die Produktion der Träger erfolgte aufgrund ihrer Ab-messungen in zwei eigens dafür eingerichteten tem-porären Werkstätten. Die Träger wurden in jeweils drei
396
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
Bild 18. MastfußdetailFig. 18. Detail of a foot of a lamp post
Bild 19. Anschlussdetail Zugstütze an BinderFig. 19. Detail of a connector diagonal tie at roof frame
Bild 17. TrägerübersichtFig. 17. Beam overview
Bild 16. Dachverformungen nach der MontageFig. 16. Roof deformations after assembly
Bild 20. Druckstücke der Binder im Bereich des Druckstüt-zenauflagersFig. 20. Thrust members of the roof frames in the range of apressure column bearing
397
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
Segmenten vorgefertigt und erst vor dem Aufbringen derendgültigen Beschichtung zusammengebaut und abge-schweißt. Insbesondere beim Anschlussdetail der Zug-stütze an den Binder (Bild 21) waren im Bereich der80 mm dicken seitlichen Bolzenauflagerbleche schwierigeSchweißdetails zu lösen, da im Inneren der Zuglaschen-kammern selbst Dichtnähte kaum schweißbar waren.
Der Transport (ca. 30 km, davon ca. 20 km Auto-bahn) erfolgte in der Nacht. Um die Träger überhaupttransportieren zu können, war die Entwicklung einer Auf-lagerkonstruktion für die Zugmaschine und den Nachläu-fer notwendig, welche an die jeweilige Trägergeometrie an-gepasst werden konnte (Bild 22).
Die Montage der Träger erfolgte mit Hilfe eines Rau-penkrans. Dazu wurden die Bolzen auf einer seitlich amTräger befestigten Hilfskonstruktion vormontiert, so dassdiese beim Einbau nur noch mit einer Handwinde einge-schoben werden mussten (Bild 24). Das Gehänge desKrans war mit einer Hydraulik versehen, welche eine Nei-gungskorrektur der Träger in ihrer Längsachse erlaubt(Bild 23). Dieses Montagekonzept hat sich derart be-währt, dass kürzeste Montagezeiten von deutlich unterzwei Stunden für die Träger erzielt wurden und die stren-gen Toleranzanforderungen problemlos erfüllt werdenkonnten.
2.4 Pfetten und Dilatationen
Die Felder zwischen den Dachbindern werden von insge-samt 341 Pfetten überspannt (Bild 25). Die Pfetten wirkenals Durchlaufträger mit Spannweiten bis zu 24 m. Die Trä-gerhöhe der Pfetten ist, bis auf die der innersten Pfette,konstant 600 mm; je nach Spannweite kommt ein IPE-,HEA- oder HEM-Profil zum Einsatz. Den Dachabschlussam Innenrand bildet ein HEA 700-Profil, das über denStadionkurven um die schwache Achse gebogen ist undsich so dem Grundriss der darunterliegenden Laufbahnanpasst. In jedem dritten Dachfeld sind Dilatationsfugenin den Pfetten angeordnet, die Bewegungen des Dachesinfolge von Temperatureinflüssen zulassen. Die Dilatati-onsfugen liegen im Momentennullpunkt der Pfetten. Dereinseitig realisierte Langlochanschluss ermöglicht Bewe-gungen von ca. 40 mm.
Zusammenfassung
Im August 2006, einen Tag nach dem Leichtathletik-Mee-ting „Weltklasse Zürich“, begann der Abriss des alten Let-zigrund-Stadions. Am 23.09.2007 wurde das neue Letzi-
Bild 21. Anschlussdetail aus Bild 18 in der FertigungFig. 21. Connection detail from fig. 18 during fabrication
Bild 22. Bindertransport mit (umgebauter) Zugmaschineund NachläuferFig. 22. Truss transport with (rebuilt) tractor and rear car-riage
Bild 23. Montage des ersten BindersFig. 23. Assembly of the first truss
Bild 24. Einschubvorrichtung für die ca. 650 kg schwerenDoppelbolzenFig. 24. Slide-in unit for the approx. 650 kg twin bolt
grund eingeweiht. Das Stadion wurde von den Leichtath-leten mit Begeisterung angenommen, und auch das ersteDerby zwischen den beiden Zürcher Fußballclubs FCZund Grasshoppers hat bereits stattgefunden. Das offene,freundliche Stadion stellt einen sympathischen Kontra-punkt zu den Kesseln der modernen Fussballarenen dar(Bilder 26 und 27).
Dieser Bericht beschränkt sich auf die Beschreibungdes Stahldachs des Stadions. Viele weitere Besonderhei-ten aus baulicher Sicht, wie z.B. die extrem schlanke fu-genlose Spannbetonrampe, die Aushublogistik zum Tiefer-legen der Stadionebene, die Aufbereitung des Aushubsund seine direkte Wiederverwendung als Zuschlagstoff fürden Beton auf der Baustelle, die Holzuntersicht des Da-ches und viele weitere interessante Details wurden nichtdargestellt.
398
C. Galmarini/M. Schollmayer/M. Mensinger · Das Letzigrundstadion in Zürich
Stahlbau 77 (2008), Heft 6
Die extrem kurze Bauzeit und der hohe Komple-xitätsgrad der Konstruktion und der notwendigen Bau-stellenorganisation stellten für alle Beteiligten einegroße Herausforderung dar. Dass letztendlich das Sta-dion termingerecht realisiert werden konnte, ist sicherauch auf das gute Zusammenspiel der Beteiligtenzurückzuführen.
Am Bau Beteiligte:
Bauherr: Stadt ZürichArchitekt: Bétrix & Consolacio, ErlenbachIngenieur: Walt + Galmarini, ZürichGU: Implenia AGStahlbau: ARGE Stahlbau Stadiondach
Baltensperger AG, HöriH. Wetter AG, Stetten
Literatur
[1] Mensinger, M.: Das Stahldach des Stadions Letzigrund inZürich. der bauingenieur, Nr. 3/2007.
[2] Galmarini, C., Schollmayer, M., Mensinger, M.: Das Stadionin Letzigrund in Zürich – Bauten für die EM 2008 in derSchweiz. Münchener Stahlbautage 2007.
Autoren dieses Beitrages:Dipl. Bauing. ETH Carlo Galmarini, Dipl. Bauing. TU Martin SchollmayerEnglischviertelstraße 24, CH-8032 ZürichUniv.-Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. (NDS) Martin MensingerTU München, Lehrstuhl für MetallbauArcisstraße 21, 80333 München
Bild 25. DachgrundrissFig. 25. Plan view of the roof
Bild 26. Fertiggestelltes Stadion aus Sicht der WebcamFig. 26. Completed stadium from a webcam point of view
Bild 27. Deckenuntersicht mit Holzverkleidung. Fig. 27. Ceiling bottom view with weather boarding