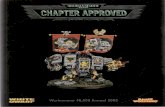Das Iatromathematische Hausbuch des Codex ÖNB, 3085 (fol ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Das Iatromathematische Hausbuch des Codex ÖNB, 3085 (fol ...
Das Iatromathematische Hausbuch des Codex ÖNB, 3085 (fol. 1r–39v)
Stoffgeschichtliche Einordnung, dynamisch-mehrstufige Edition und Glossar
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Art (MA)
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Astrid Böhm
am Institut für Germanistik
Begutachterin: Priv.-Doz. Mag. Dr. Andrea Hofmeister-Winter
Graz, 2014
2
Inhalt
1 Einleitung ..................................................................................................................................... 5
2 Forschungsgegenstand ................................................................................................................ 7
3 Stand der Forschung................................................................................................................. 10
4 Überblick über iatromathematische Hausbücher.................................................................. 13
5 Medizinische Fachliteratur des Mittelalters ........................................................................... 15
6 Iatromathematische Kompendien/Volkskalender ................................................................. 18
7 Inhaltliche Zusammensetzung des Iatromathematischen Hausbuchs ÖNB, Cod. 3085 .... 20
7.1 Kalendarium ........................................................................................................................... 20
7.1.1 Mittelalterliche Zeitrechnung .......................................................................................... 20
7.1.2 Tafelwerk und Kalenderwerk des Kodex Schürstab ....................................................... 22
7.2 Kalendertafeln im Cod. 3085 ................................................................................................. 23
7.3 Monatsregeln .......................................................................................................................... 25
7.4 Verworfene Tage (fol. 12v) .................................................................................................... 26
7.5 Tierkreiszeichen (fol. 12v–18v) ............................................................................................. 26
7.6 Mondwahrsagung ................................................................................................................... 27
7.6.1 Allgemeines ..................................................................................................................... 27
7.6.2 Überlieferung .................................................................................................................. 28
7.7 Planetenlehre (fol. 18v–27r) ................................................................................................... 29
7.7.1 Aufbau im Cod. 3085 ...................................................................................................... 29
7.7.2 Überlieferung .................................................................................................................. 30
7.8 Komplexionslehre (fol. 28r–29v) ........................................................................................... 30
7.8.1 Traditionslinien ............................................................................................................... 31
7.8.2 Überlieferung .................................................................................................................. 32
7.9 Aderlasslehre/Bade- und Schröpf-Traktate (fol. 30r–36r) ..................................................... 33
7.9.1 Das Oberdeutsche Aderlaßbüchel ................................................................................... 33
7.9.2 Regel der Gesundheit von Konrad von Eichstätt ............................................................ 34
7.9.3 24-Paragraphen-Text ...................................................................................................... 35
7.9.4 Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland ........................................................................... 36
8 Editionsgeschichte des Cod. 3085, fol. 1r–39v ........................................................................ 37
9 Kodikologische Beschreibung des Codex 3085 ...................................................................... 42
10 Beschreibung des Iatromathematischen Hausbuchs ÖNB‚ Cod. 3085, fol. 1r–39v ........... 44
10.1 Paläografische Beschreibung ................................................................................................. 44
10.1.1 Schriftart .......................................................................................................................... 44
10.1.2 Zahlzeichen ..................................................................................................................... 45
10.1.3 Auszeichnungen/Verzierungen ....................................................................................... 45
3
10.1.4 Rubrizierungen ................................................................................................................ 46
10.1.5 Zierinitialen ..................................................................................................................... 47
10.1.6 Linierung ......................................................................................................................... 47
10.1.7 Foliozählung .................................................................................................................... 47
10.1.8 Problemzonen der verwendeten Schriftart ...................................................................... 48
10.1.8.1 Minuskel versus Majuskel ................................................................................................................... 48
10.1.8.2 Schaft-s versus f ...................................................................................................................................... 48
10.1.8.3 Verbindung <ct> mit nachfolgendem Graph ............................................................................... 48
10.1.9 Schaft-s und rundes s ...................................................................................................... 49
10.1.10 Ligaturen ......................................................................................................................... 49
10.1.11 Super- und Subskripte ..................................................................................................... 49
10.1.11.1 Diakritika ................................................................................................................................................... 50
10.1.11.2 Abbreviaturen .......................................................................................................................................... 50
10.1.12 Interpunktion ................................................................................................................... 51
10.1.13 Sonstige Besonderheiten ................................................................................................. 52
10.2 Inhalt....................................................................................................................................... 52
11 Editionskonzept der ‚dynamischen Edition‘ .......................................................................... 60
12 Codierung .................................................................................................................................. 62
12.1 Prinzipien der Codierung ....................................................................................................... 62
12.2 Untersuchung der Superskripte .............................................................................................. 62
12.2.1 Analyse Tilde <#~> ........................................................................................................ 63
12.2.2 Analyse des Wortes gang bzw. der Wortverbindung Aufgang in Verbindung mit den Superskript-Varianten <#-> und <#~> über <n> ............................................... 64
12.2.3 Analyse des Wortes Zeichen bezüglich des finalen <n> ................................................. 64
12.2.4 Analyse des Wortes Monat in Verbindung mit den Superskript-Varianten <#-> <#~> und <#:> ...................................................... 65
12.3 Conclusio zur Untersuchung der Superskripte ....................................................................... 65
13 Editionskriterien Basistransliteration ..................................................................................... 68
14 Editionskriterien Lesefassung.................................................................................................. 70
15 Alphabetisches Graphinventar ................................................................................................ 72
15.1 Majuskeln, Minuskeln, Zierformen ........................................................................................ 72
15.2 Lombarden/Initialen ............................................................................................................... 83
15.3 Zahlzeichen ............................................................................................................................ 86
16 Graphinventar Sonderzeichen ................................................................................................. 88
16.1 Super- und Subskripte, Abbreviaturen, Symbole ................................................................... 88
16.2 Interpunktionszeichen und Symbole ...................................................................................... 91
16.3 Ligaturen ................................................................................................................................ 92
17 Edition Basistransliteration des Cod. 3085, fol. 1r–39v ....................................................... 95
18 Edition Lesefassung ................................................................................................................ 261
19 Glossar ..................................................................................................................................... 339
4
19.1 Namensverzeichnis............................................................................................................... 350
19.2 Lateinische Namen der Sternzeichen ................................................................................... 350
20 Terminologisches Glossar ...................................................................................................... 352
21 Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 355
21.1 Primärquellen ....................................................................................................................... 355
21.2 Sekundärquellen ................................................................................................................... 355
21.3 Wörterbücher/Nachschlagewerke ........................................................................................ 358
5
1 Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit bietet die Erstedition des Iatromathematischen Hausbuchs aus dem
Codex 3085 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, das sich auf fol. 1r–39v befindet, sowie
eine stoffgeschichtliche Einordnung des Hausbuchs. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile:
Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen dargelegt, die zur Verortung der Text-
sorte iatromathematischer Hausbücher im Allgemeinen bzw. zur Verortung des Hausbuchs des Cod.
3085 im Speziellen nötig sind. Da es sich bei iatromathematischen Hausbüchern um Kompilationen
bekannter bzw. verbreiteter Versatzstücke handelt, die als kurze bis mittlere Traktate inhaltlich
unverändert aneinandergesetzt wurden, wobei sich Auswahl und Anordnung der einzelnen Teile
variabel gestalten wird in der vorliegenden Arbeit der Fokus nicht nur auf der gesamten Kompi-
lation liegen, sondern auch auf ‚Einzeltexten‘, die das Iatromathematische Hausbuch beinhaltet.
In den Kapiteln 1–7 wird die Problematik der Begrifflichkeiten erörtert, sodann werden die
unterschiedlichen Titelgebungen für diesen Überlieferungstyp innerhalb der Wissenschaft diskutiert
sowie der Stand der Forschung reflektiert. Anschließend werden die verschiedenen Traktate, aus
denen sich das Iatromathematische Hausbuch des Cod. 3085 zusammensetzt, vorgestellt und im
speziellen Überlieferungskontext betrachtet.
In Kapitel 9 findet sich die kodikologische Beschreibung des gesamten Codex, gefolgt von
der kodikologischen und inhaltlichen Beschreibung des Abschnitts fol. 1r–39v, in dem sich das
Iatromathematische Hausbuch befindet (Kap. 10). Da sich im Zuge der Arbeit gezeigt hat, wie
divergierend einzelne Termini in den unterschiedlichen Disziplinen verwendet werden, ist dieser
Arbeit am Ende ein terminologisches Glossar beigefügt, das die von mir gebrauchten Fachaus-
drücke samt Definitionen verzeichnet (Kap. 20).
Die eigentliche Edition des Iatromathematischen Hausbuchs des Cod. 3085 findet sich im zweiten
Teil der Arbeit:
Ziel war es, eine Edition zu bieten, die nicht nur für literaturwissenschaftliche bzw. realien-
kundlich-historische, sondern auch für paläografische sowie linguistische Forschungsanliegen ver-
wertbar ist. Zu diesem Zweck wurde die Edition auf der Grundlage des von Andrea Hofmeister-
Winter entwickelten Konzepts der ‚dynamischen Edition‘ erstellt. Die Mehrstufigkeit dieses
Editionsverfahrens ermöglicht es einerseits, in einer quellennahen Basistransliteration eine Fülle an
paläografischen und linguistischen Details wiederzugeben, andererseits wird eine benutzerfreund-
liche Lesefassung geboten, die das Textverständnis erleichtern soll, ohne dass dabei der Lesefluss
durch ein Übermaß an Informationen der grafischen Ebene gebremst wird.
6
Die methodologische Beschreibung der ‚dynamischen Edition‘ sowie die Codierungsprinzipien und
die Editionsprinzipien der Basistransliteration wie auch der Lesefassung sind in den Kapiteln 11–14
beschrieben. Daran anschließend liegt der Arbeit ein Graphinventar bei, das sämtliche im Text
vorhandenen Graphtypen und Zeichen auflistet und beschreibt (Kap. 15 und 16). Kap. 17
präsentiert sodann die Basistransliteration in Synopse mit den Abbildungen der Handschrift, Kap.
18 die grafisch leicht normalisierte Lesefassung.
Um zukünftigen Lesern eine Hilfestellung beim Verstehen der Texte zu bieten, wurde der
Arbeit ein Ausgabenglossar beigefügt, das zahlreiche frühneuhochdeutsche, oft dialektal gefärbte
Begriffe erläutert, die eventuell Verständnisschwierigkeiten bereiten können (Kap. 19).
Auf der CD-ROM, die der gedruckten Arbeit beiliegt, befinden sich das komplette Digitalisat
des Iatromathematischen Hausbuchs ÖNB, Cod. 3085 (fol. 1r–39v) sowie beide Editionsstufen
(Basistransliteration und Lesefassung inkl. Glossar).
7
2 Forschungsgegenstand
Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist das auf fol. 1r–39v des Codex 3085 der Österreichischen
Nationalbibliothek Wien überlieferte Corpus des sogenannten Iatromathematischen Hausbuchs.
Dieses bildet den ersten Teil einer Sammelhandschrift, die auf das Jahr 1475 datiert wird. In der
Forschungsliteratur wird diese Textzusammenstellung unterschiedlich abgegrenzt und benannt:
Den Begriff des ‚Iatromathematischen Hausbuchs‘ für die fol. 1r–39v führen der Katalog
der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters1 sowie der Handschrif-
tencensus2.
Fallersleben3 hatte in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts fol. 1a–45b (also mehr als den
fraglichen Abschnitt) unter dem Begriff Calendarium zusammengefasst, während Men-
hardt4 diesen erweiterten Bereich fol. 1r–45v in drei Teile gegliedert sah:
1) „Kalender mit Lebensregeln in Versen (fol. 1r–12v)“
2) „Die Zeichen des Tierkreises und ihre Kraft (fol. 12v–27r)“
3) „Lehre von den 4 Komplexionen, vom Aderlassen, Baden, Stuhlgang, vom Einfluss
der Winde, von den zufallenden Gedanken, des Tobias, Aristoteles, der Bibel und
Seneca (fol. 28r–45v)“
Menhardt hält sich bei dieser Einteilung an Saxl5, der die betreffenden Folia noch deutlich
genauer unterteilt.
Ebenfalls als ein zusammengehöriger Bereich werden fol. 1a–45b im Katalog Tabulae
codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindo-
bonensi asservatorum6 geführt.
1 Vgl. Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Begonnen von Hella Frühmorgen-
Voss. Fortgeführt von Norbert H. Ott zusammen mit Ulrike Bodemann und Gisela Fischer-Heetfeld. Bd. 2, Lfg. 1/2. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag Beck 1993, S. 81. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/?xdbdtdn!%22hsk%200619a%22&dmode=doc#|4 [09.09.2014].
2 Vgl. Handschriftencensus: ‚Codex 3085‘. URL: http://www.handschriftencensus.de/6584 [09.09.2014]. 3 Vgl. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. k. Hofbiblio-
thek zu Wien. Leipzig: Weidmann 1841, S. 323. URL: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10800306.html [09.09.2014].
4 Vgl. Hermann Menhardt: Verzeichniss der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen National-bibliothek. Bd. 2. Berlin: Akademie Verlag 1961. (= Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffent-lichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. 13.) S. 872–874. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0750b.htm [09.09.2014].
5 Vgl. Fritz Saxl: Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters II: Die Handschriften in der Nationalbibliothek in Wien. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 1925/26, 16/2. Heidelberg: Winter 1927, S. 117–125. URL: https://archive.org/details/verzeichnisastro00saxl [27.08.2014]. [Online-Ansicht beginnend mit: https://archive.org/stream/verzeichnisastro00saxl#page/117/mode/1up]
8
Auf fol. 39v Mitte beginnt die Tobiaslehre (39v–45v), die sich nach neueren Forschungen7
thematisch nicht in den Komplex der vorherigen Aufzeichnungen einfügt. Die Abgrenzung des
vorangehenden Textes erfolgt durch eine ‚Schlussmarke‘, mit welcher der Schreiber das Ende des
Textes auf fol. 39v markiert. Danach folgt eine Lücke von ca. Seite, auf der eine Illustration Platz
finden sollte, bevor die Tobiaslehre beginnt, gefolgt von weiteren phiosophischen und religiösen
Texten. Thematisch lassen sich also nur fol. 1r–39v Mitte plausibel zu einer Einheit zusammen-
fassen, für die in der vorliegenden Arbeit die Bezeichnung Iatromathematisches Hausbuch verwen-
det wird.
Die Definition des Kompilationstyps ‚Iatromathematisches Hausbuch‘ ist in der Forschung nicht
eindeutig, jedoch u. a. durch den im Verfasserlexikon angegebenen Titel Iatromathematisches
Hausbuch8 für astromedizinische Kompendien eines bestimmten Kollektionstyps mit einer spe-
ziellen Textkombination eingeführt. Repräsentativ und der am besten untersuchte Vertreter dieser
Gattung ist der Nürnberger Kodex Schürstab (Zürich, MS C54). Für dieses Kompendium inklusive
seiner Paralellüberlieferungen wird der Terminus ‚Iatromathematisches Hausbuch‘ verwendet.
Ortrun Riha weist auf die „unglückliche Bennenungspraxis“9 hin: „der Kodex [gemeint ist der Ko-
dex Schürstab] ist nicht das, sondern nur ein iatromathematisches Hausbuch […].“10 „Man müsste
[…] das Etikett ‚Iatromathematisches Hausbuch‘ als Terminus für alle […] Kodizes einführen“11,
die einem Ordnungsprinzip folgen, das „regelhaft auftretende Kombinationen flexibler und variab-
ler Traktate“12 [im Kontext von astromedizinischen Texten] zeigt „und es nicht denen vorbehalten,
die genauso aufgebaut sind wie Z2“13 [Kodex Schürstab]. Häufig begegnet man in der Literatur
dem Begriff ‚Volkskalender‘, der jedoch genauso wenig scharf abgegrenzt ist und teilweise als Gat-
tungsbezeichnung dient, teilweise jedoch nur für die Schürstab-Parallelen genutzt wird.14 Werktitel
bzw. nachträgliche Titelgebungen stellen ein generelles Problem in der Forschung dar. So ist etwa
unter dem 24-Paragraphen-Text (einem Textbausteins dieses Kompendiums) einerseits der auf
6 Vgl. Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asser-
vatorum. Ed.Academia Caesarea Vindobonensis. Vol. II: Cod. 2001-3500. Wien: Gerold 1868, S. 193. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0751b.htm [09.09.2014].
7 Vgl. Anm. 2 und 3. 8 Friedrich Lenhardt/Gundolf Keil: ‚Iatromathematisches Hausbuch‘. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Hrsg. von Kurt Ruh [u. a.]. Bd. 4. Berlin, New York: de Gruyter 1983, Sp. 347–351. [Das Verfasserlexikon wird in weiterer Folge zitiert als: 2VL, Bd.-Nr., Jahr, Sp.]. Die im Artikel des VL angegebene Textgliederung passt zwar zum Kodex Schürstab, gilt aber nur bedingt bei anderen Texten dieser Art, die ebenfalls im Artikel erwähnt werden.
9 Ortrun Riha: Wissensorganisation in medizinischen Sammelhandschriften. Klassifikationsprinzipien bei Texten ohne Werkcharakter. Wiesbaden: Reichert 1992. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 9.) S. 157.
10 Ebda. 11 Ebda, S. 159. 12 Ebda, S. 157. 13 Ebda, S. 159. 14 Vgl. Ebda, S. 157.
9
Avicenna zurückgehende Text aus dessen Werk De phlebotomia zu verstehen, andererseits werden
unter diesem ‚Titel‘ aber auch andere Texte geführt, die ähnliche Strukturen und ähnlichen Inhalt
aufweisen. Auch der Titel Oberdeutsches Aderlaßbüchel ist kein Werktitel im eigentlichen Sinn,
sondern stellt einen „Notnamen“ dar, der eine „Sonderform des Laßtraktates“15 bezeichnet. Es
herrschen divergierende Meinungen, aus welchen speziellen Teilen sich dieses Kompilat
zusammensetzt. Trotz der unterschiedlichen Definitionen, haben sich diese Notbehelfe bezüglich
der Titelgebung in der Forschung durchgesetzt und werden daher auch von mir als solche
verwendet.
Für die in dieser Arbeit verwendete Bezeichnung des Kompilationstyps ‚Iatromathematisches Haus-
buch‘ werden folgende Kriterien herangezogen: Bei iatromathematischen Hausbüchern handelt es
sich um Sammlungen von Texten astrologisch-astronomischer Natur, die mit dem ärztlichen
Wissen der Humoralpathologie verknüpft sind. Dabei werden vorsokratische Naturerklärungen, die
späthippokratische Säftelehre, pythagoreische Gegensatzpaare und die babylonische Astrologie auf
antike Diätetik abgestimmt. Es kommt zu einer stimmigen Verschränkung von Dreier-, Vierer-, Sie-
bener- und Zwölfer-Schemata, auch wenn einzelne Teilaspekte einander durchaus widersprechen.
Das Organisationsprinzip solcher Art von Fachliteratur zeigt regelhaft auftretende Kombinationen
flexibler Traktate, die inhaltlich nur geringe Schwankungen aufweisen und – bedingt durch die
Zwölf- bzw. Siebenteiligkeit bei Tierkreiszeichen bzw. Planeten-Traktaten – auch strukturell nur
wenig voneinander abweichen. Aufgrund der astronomisch-astrologischen Ausrichtung der Texte
finden sich in iatromathematischen Hausbüchern meist Kalendarien, die der Berechnung der ver-
schiedenen Sternenkonstellationen dienen.
15 Friedrich Lenhardt: ‚Oberdeutsches Aderlaßbüchel‘. In: 2VL, Bd. 6, 1987, Sp. 1274.
10
3 Stand der Forschung
Wer sich über die deutschsprachige Medizinliteratur des Mittelalters informieren und bei-spielsweise wissen will, welche Texte aus den verschiedenen Jahrhunderten überliefert sind, welcher Gattung sie angehören, in welcher Tradition sie stehen, von wem und für wen diese Texte verfaßt und abgeschrieben wurden, steht vor einem Problem.16
In der Medizingeschichte findet deutschsprachige Medizinliteratur des Mittelalters genauso wenig
Niederschlag wie in der germanistischen Mediävistik. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende
Vorurteil, die Wissenschaftssprache des Mittelalters sei ausschließlich das Lateinische gewesen und
in der Volkssprache verfasste Texte „bestenfalls eine Popularisierung des lateinischen Wissens“17,
hält sich bis in die Gegenwart und hat zu einer ‚stiefmütterlichen‘ Behandlung deutschsprachiger
Medizintexte geführt. In den Anfängen des Fachs der Medizingeschichte18 finden sich zahlreiche
Publikationen von Karl Sudhoff, der mittelalterliche Texte in lateinischer sowie deutscher Sprache
abdrucken ließ. Eine erste Zusammenstellung aller bis 1910 publizierten deutschsprachigen medizi-
nischen Texte, insgesamt 50 Texte aus dem ober-, mittel- und niederdeutschen Sprachraum, stammt
von ihm. „Er wollte ‚ein zuverlässiges Verzeichnis aller erreichbaren mittelalterlichen Handschrif-
ten, sowohl in lateinischer wie in romanischer, germanischer und slowenischer Sprache‘[…] erstel-
len“19. Dieses Ziel ist bis heute nicht erreicht. Nach Sudhoff haben sich nur Gundolf Keil und seine
Schüler der Materie angenommen. Jedoch ist auch Keil, der laut Schnell „die Autorität auf diesem
Gebiet“20 darstellt, bis dato keine umfassende Darstellung der Materie gelungen.
Ähnlich vernachlässigt wurden die deutschsprachigen medizinischen Texte des Mittelalters in
der Germanistik. Schnell formulierte es folgendermaßen: „Im Tempel der deutschen Literatur des
Mittelalters nimmt die Medizinliteratur höchstens einen Nischenplatz in der Vorhalle ein.“21
Im 19. sowie zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die heilkundliche Fachliteratur durchaus
noch Untersuchungsgegenstand des Fachs. Mit der Entwicklung hin zur ‚schönen Literatur‘ fiel die
Beschäftigung mit mittelalterlicher Gebrauchsliteratur jedoch immer geringer aus. Gerhard Eis wid-
mete sich im Grunde als Einziger der Fachliteratur und beschäftigte sich am Rande auch mit medi-
zinischen Texten. Der Umschwung in der Sichtweise des Forschungsgegenstandes des Fachs hin zu
16 Bernhardt Schnell: Die deutschsprachige Medizinliteratur des Mittelalters. Stand der Forschung – Aufgaben für die
Zukunft. In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 12 (2000), S. 397 f. 17 Ebda, S. 398. 18 Als Fach etablierte sich die Medizingeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts an den medizinischen Fakultäten.
Unter Karl Sudhoff wurde 1906 das erste medizinhistorische Institut an der Universität Leipzig eröffnet. Vgl.: Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Zuletzt geändert am 15.04.2014. URL: http://karl-sudhoff.uni-leipzig.de/karlsudhoff.site,postext,geschichte.html?PHPSESSID=ntpok2gid2kit8m2pqhibe7o47 [27.08.2014].
19 Karl Sudhoff: Die gedruckten mittelalterlichen medizinischen Texte in germanischer Sprache. Eine literarische Studie. In: Sudhoffs Archiv 3 (1910), S. 273. Zitiert nach Schnell, Medizinliteratur, S. 398.
20 Schnell, Medizinliteratur, S. 398. 21 Ebda.
11
einem erweiterten Literaturbegriff führte in den letzten Jahrzehnten zu einer vermehrten Beschäfti-
gung mit der Gebrauchsliteratur, was sich u. a. in den Artikeln der 2., völlig neu bearbeiteten Auf-
lage des Verfasserlexikons zeigt. Mittlerweile findet sich dort eine Vielzahl an Einträgen, die medi-
zinische Texte zum Gegenstand haben.22
Ein Kritikpunkt, den Schnell bezüglich der im Verfasserlexikon angeführten Literaturhinwei-
se anführt, sei hier kurz aufgegriffen, da er sich auch in den für diese Arbeit wichtigen Artikeln
bestätigt gefunden hat: Die Autoren scheinen bemüht zu sein, möglichst viele weiterführende Lite-
raturhinweise anzugeben, die sich bei näherer Sichtung jedoch als wenig zweckdienlich erweisen.
Ein Mehrgewinn an Informationen ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Zudem sind die Anga-
ben zur Überlieferung vielfach unübersichtlich bzw. irritierend. Unter dem Lemma ‚Iatromathema-
tisches Hausbuch‘23 finden sich diverse Überlieferungen, die von verschiedenen ForscherInnen teils
in Editionen, teils in Fachartikeln etc. bearbeitet wurden, eine komplette Zusammenschau zeigen je-
doch weder die Autoren, auf die im Verfasserlexikon hingewiesen wird, noch die Autoren des Arti-
kels selbst.24
Das Problem der fehlenden Gesamtübersicht und einer generell mangelnden Beschäftigung
mit der medizinischen Fachliteratur, insbesondere mit den ‚Volkskalendern‘ – unter diesem Begriff
versteht sich auch das in dieser Arbeit behandelte Iatromathematische Hausbuch25 –, wird auch von
Brévart thematisiert:
The few investigations that are available are restricted to the analysis of but one element of work – the Kalendarium, the labors of the months, the seven planets, the four temperaments, the sign of the zodiac, phlebotomy, or the unlucky days – or they study the Volkskalender or its components solely from an art-historical viewpoint. Furthermore, these studies treat single versions of Volkskalender in isolation, and they rely for their material on only a few manuscripts. Consequently their results have little value for an understanding of the genre as a whole.26
Erschwert wird die Beschäftigung mit dieser Art der Fachliteratur zusätzlich mit der unterschied-
lichen Benennung der astrologisch-astronomischen medizinischen Literatur. Wie schon eingangs
erwähnt, existiert keine einheitliche Begriffsdefinition dieser Texte. Vielmehr werden für ‚relativ’
ähnliche Texte verschiedene Namen gewählt, ohne dass die Kriterien, die zu einer unterschied-
lichen Einteilung führen, explizit und somit nachvollziehbar gemacht würden.
22 Zu den Problemen der Lemmatisierung und kritischen Anmerkungen bezüglich der ausgewählten Texte des Ver-
fasserlexikons siehe ebda, S. 399 f. 23 Lenhardt/Keil, ‚Iatromathematisches Hausbuch‘, 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 347–351. 24 Schnell zeigt am Beispiel des Eintrags ‚Bartholomäus‘ eine ähnliche Problematik auf. Vgl. Schnell, Medizinlitera-
tur, S. 404 f. 25 Die Kriterien, die in dieser Arbeit zur Eingruppierung von Texten in die Gattung der iatromathematischen Haus-
bücher führen, sind auf Seite 9 beschrieben. 26 Francis B. Brévart: The German Volkskalender of the Fifteenth Century. In: Speculum: a journal of medieval
studies 63 (1988), S. 313.
12
Die meisten Studien, die sich der Thematik widmen, fokussieren einzelne Teile der Überlieferung,
ohne diese mit vergleichbaren Texten in Verbindung zu bringen, oder sind Editionen eines
bestimmten Textes, der zumeist nicht im Zusammenhang mit verwandten Überlieferungen darge-
stellt wird.27
So beschäftigt sich beispielsweise Ute Müller mit Mondwahrsage-Texten28 des Spätmittel-
alters und stellt die diesbezüglichen Teile des Cod. 3085 zum einen in eine bestimmte Traditions-
linie29, zum anderen wird der Cod. 3085 in den von ihr ausgewerteten Texten unter „Spezialtext“30
geführt, ohne zu erläutern, was genau sie zu einer Kategorisierung als Spezialtext bewogen hat.
Als Exempel soll hier noch der Heidelberger Codex Cpg 575 angeführt werden, der sich u. a.
auch unter den von Müller ausgewerteten Texten findet. Mit diesem Codex beschäftigte sich auch
Schönfeldt, jedoch ‚nur‘ im Zusammenhang mit der Temperamentenlehre. Beide ForscherInnen
stellen ihre Erkenntnisse über die spezifischen Teile des Codex in Zusammenhänge mit ähnlichen
Texten der jeweiligen Art. Eine Gesamtdarstellung der Kompilate, ihre Verbreitung und möglichen
Traditionslinien bleiben aufgrund der unterschiedlichen Forschungsfragen jedoch aus.
Auf diese Art von Schwierigkeit stößt man bei der Beschäftigung mit der Gattung der iatro-
mathematischen Hausbücher allerorten. Speziell bei Manuskripten, zu denen bisher wenig geforscht
wurde, wie im Fall des Cod. 3085, stellt sich die Frage der ‚Vergleichbarkeit‘. Während der Kodex
Schürstab in der Forschung mittlerweile recht gut bekannt ist und von verschiedenen Autoren
entweder solitär31 behandelt wurde oder zumindest Teile der Zürcher Handschrift in Zusammen-
hang mit anderen vergleichbaren Codices32 analysiert wurden, steht eine solche Untersuchung beim
Cod. 3085 noch aus. Die vorliegende Arbeit kann eine eigentlich notwendige großflächige Studie,
in welcher der Codex mit anderen ähnlichen Texten verglichen würde und wo auf Parallelen bzw.
Unterschiede eingegangen werden könnte, aufgrund des Arbeitsumfangs nicht leisten. Viele der in
der Literatur beschriebenen Handschriften, die eventuell mit dem Wiener Manuskript vergleichbar
wären, liegen nicht in edierter Form vor oder sind noch nicht einmal als Faksimile zugänglich. Ein
Besuch der Bibliotheken und Archive, in denen die einzelnen Manuskripte aufbewahrt werden, um
diese sinnvoll miteinander zu vergleichen, würde den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem sprengen,
obwohl dies sicherlich ein lohnenswerter Forschungsansatz auf dem Gebiet der medizinisch-astro-
logischen Fachliteratur wäre.
27 Vgl. ebda, S. 313 f. 28 Müller wertet 21 Handschriften vorwiegend aus dem 14., teils aus dem 15. Jahrhundert aus. Vgl. Ute Müller: Deut-
sche Mondwahrsagetexte aus dem Spätmittelalter. Berlin, Univ., Diss. 1971. 29 Näheres siehe Kap. 7.6 ‚Mondwahrsagung‘. 30 Vgl. Müller, Mondwahrsagetexte, S. 103. 31 Vom Einfluss der Gestirne auf die Gesundheit und den Charakter des Menschen. Hrsg. von Gundolf Keil unter
Mitarbeit von Friedrich Lenhardt und Christoph Weißer mit einem Vorwort von Huldrych M. Koelbing. Bd. 1: Faksimile, Bd. 2: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe des Manuskripts C 54 der Zentralbibliothek Zürich (Nürnber-ger Kodex Schürstab). Luzern: Faksimile-Verlag 1981–1983.
32 Vgl. Brévart, German Volkskalender.
13
4 Überblick über iatromathematische Hausbücher
Eine Sichtung der Forschungsliteratur33 ergab folgende Liste von Handschriften, die entweder unter
dem Begriff ‚Iatromathematisches Hausbuch‘geführt werden oder die inhaltlich größtenteils mit
iatromathematischen Hausbüchern übereinstimmen, auch wenn sie unter anderem Titel überliefert
sind.
1. Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbibl., Cod. 494
2. Einsiedeln, Stiftsbibl., Hs. 297
3. Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 291
4. Heidelberg, Universitätsbibl., Cpg 557
5. Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Ettenheimmünster 37
6. London, British Libr., Ms Add. 17987
7. London, University College, Ms Germ. 1
8. München, Staatsbibl., Cgm 28
9. München, Staatsbibl., Cgm 303
10. München, Staatsbibl., Cgm 328
11. München, Staatsbibl., Cgm 349
12. München, Staatsbibl., Cgm 727
13. München, Staatsbibl., Cgm 730
14. München, Staatsbibl., Cgm 736
15. München, Universitätsbibl., 2° Cod. ms. 578
16. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 795
17. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 16007
18. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 18792
19. Nürnberg, Staatsarchiv, Rep. 52a (Reichsstadt Nürnberg), Hs. Nr. 426
20. Saint Louis (Missouri), Concordia Seminary Library, rare book collection, ohne Sign.
21. Salzburg, Stiftsbibl. St. Peter, Cod. a VI 17
22. St. Gallen, Stiftsbibl., Cod. 760
23. Solothurn, Zentralbibl., Cod. S 386
33 Vgl. hierzu: Handschriftencensus, ‚Iatromathematisches Hausbuch‘ URL:
http://www.handschriftencensus.de/werke/2939 [09.09.2014]. – Lenhardt/Keil: ‚Iatromathematisches Hausbuch‘, Sp. 347–351. – Lorenz Welker: ‚Iatromathematisches Corpus‘. In: 2VL, Bd. 11, 2004, Sp. 707. – Keil/Lenhardt/ Weißer, Vom Einfluss der Gestirne, Bd. 2. – André Parent: Das ‚Iatromathematische Hausbuch‘ in seiner bisher ältesten Fassung. Die Buchauer Redaktion Heinrich Stegmüllers von 1443. Montreal, Univ., Diss. 1988. Zitiert nach Johannes Gottfried Mayer: Das ‚Arzneibuch‘ Ortolfs von Baierland in medizinischen Kompendien des 15. Jahrhunderts. Beobachtungen und Überlegungen zur Werktypologie medizinischer Kompendien und Kompi-lationen. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Reichert 1993. (= Ortolf-Studien. 1. Wissensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 46–49. – Riha, Wissensorganisation, S. 157.
14
24. Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 3085
25. Würzburg, Universitätsbibl., M. p. med. f. 5
26. Zürich, Zentralbibl., Cod. C 54 (Kodex Schürstab)
27. Privatbesitz Antiquariat Dr. Jörn Günther, Hamburg, Nr. 1997/24
28. Privatbesitz Lawrence J. Schoenberg, LJS 463
Für diese Arbeit konnte ein Vergleich des Iatromathematischen Hausbuchs des Cod. 3085 mit der
Handschrift C 54 der Zürcher Zentralbibliothek (Kodex Schürstab) vorgenommen werden. Es zeig-
ten sich dabei Abweichungen, die meist dialektal bedingt scheinen bzw. sprachliche Varianten dar-
stellen:34
Cod. 3085: In dem dritten herbst monat schreibt (fol. 10r)
Kodex Schürstab: In dem wintermon spricht (fol. 16r/S. 41)
Cod. 3085: An traum soltú dich nit keren Mit arbait solt dú dich neren (fol. 5r)
Kodex Schürstab: An traeume soltu dich nit keren kauffen sol man meren (fol. 11r/S. 31)
Zum Teil finden sich infolge fehlender oder hinzugefügter Wörter jedoch konträre Sachverhalte.
Cod. 3085: Dw macht aúch woll den part abschern (fol. 2r)
Kodex Schürstab: du solt auch nit den part scheren (fol. 8r/S. 25)
Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Werke vor allem durch einige in Cod. 3085 fehlende Ka-
lendertafeln, die fehlenden Tabellen zur Berechnung der Gestirne sowie einige fehlende Rezepte,
die im Kodex Schürstab überliefert sind. Außerdem verfügt der Kodex Schürstab über einen ein-
leitenden Teil, während der Cod. 3085 direkt mit dem Februarblatt beginnt, das Januarblatt ist nicht
überliefert worden. Die größten Unterschiede zeigen sich in der Gegenüberstellung des Aderlass-
Traktates. Hier sind in den beiden Handschriften differierende Texte zu finden bzw. eine andere
Anordnung der analogen Versatzstücke, während der Aufbau der restlichen Handschrift ident ist.
34 Die Folio- und Seitenangaben beziehen sich auf die Edition des Kodex Schürstab: Keil/Lenhardt/Weißer, Vom
Einfluss der Gestirne.
15
5 Medizinische Fachliteratur des Mittelalters
Beim Überblick über das heilkundliche Schrifttum des Mittelalters müssen wir uns über eines vorweg im klaren sein: dass wir es mit einem Literaturkomplex zu tun haben, der größer ist als alles, was wir als Literaturhistoriker vom mittelalterlich-fiktionalen Schrifttum je kennengelernt haben […]. Die medizinische Literatur des Mittelalters ist derart riesig dimensioniert, dass die mediävale Dichtung mit vergleichsweise zwergenhaften Proposi-tionen geradezu neben ihr verschwindet.35
Mit dieser Aussage hat Gundolf Keil die Situation dieser speziellen Fachliteratur eindrucksvoll um-
rissen. Die Fülle der Textzeugnisse ist bisher von der Wissenschaft nur ansatzweise gesichtet und
untersucht worden. Schon die Abgrenzung zu anderen Fachgebieten innerhalb der Medizinliteratur
gestaltet sich äußerst schwierig, sei es die Grenzziehung zu Veterinärschriften, alchemistischen
Schriften, mantisch-prognostischen Schriften oder dem astrologischen Schrifttum. Irgendwo zwi-
schen bzw. in diesen Gattungen ließen sich die iatromathematischen Texte, die sich im Cod. 3085
finden, am ehesten einordnen.
Betrachtet man die Materie innerhalb der heilkundlichen Schriften, so zeigt sich ein inhaltlich
breites Spektrum. Im therapeutischen Bereich finden sich eine Vielzahl an Texten über operatives
sowie konservatives Heilen, weiters ausführliche Schriften, die im diätetischen Bereich und der
gesunden Lebensführung anzusiedeln sind. Überliefert sind ferner Traktate, die sich auf den anato-
misch-physiologischen und funktionalen Aspekt der humanbiologischen Umstände konzentrieren.
Spezialtraktate gehen auf einzelne Phasen des Lebens ein, wie etwa Zeugung, Schwangerschaft,
Geburt, Kindheit oder Alter. Es finden sich diagnostische Leitfäden zur Pulsbeurteilung und zur
Harn-, Blut-, Stuhl oder Lepraschau. Einen breiten Raum nehmen auch konkrete Rezepte und Hin-
weise zur Arzneimittelherstellung ein, ebenso wie Abhandlungen zur Organo-, Phyto- und Litho-
therapie. Hinzu kommt noch die seuchenbezogene Literatur, die sich in zahlreichen Traktaten zur
Pest, der Syphilis oder dem Aussatz im Allgemeinen zeigt. Diese Aufzählung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich einen groben Überblick über die Teilbereiche
geben, um die Themenvielfalt zu demonstrieren, mit denen sich heilkundliche Schriften beschäf-
tigen.36
Wenn in diesem Kapitel von medizinischen Texten des Mittelalters die Rede ist, so unterliegt
dieser Begriff nicht nur thematischen Bedingungen, sondern auch zeitlichen und räumlichen
Einschränkungen. Die für diese Arbeit entscheidende räumliche Eingrenzung richtet den Blick auf
das westliche Abendland und lässt die byzantinische und die arabische Entwicklung der Medizin-
35 Gundolf Keil: Die Medizinische Literatur des Mittelalters. In: Artes mechanicae en Europe médiévale: Actes du
colloque du 15 octobre 1987. Hrsg. von Ria Jansen-Sieben. Brussel:Archives et bibliothèques de Belgique 1989. (= Archives et bibliothèques de Belgique. 34.) S. 73.
36 Vgl. ebda, S. 76–83.
16
literatur aus. Die Texte, die im europäischen Kontext entstanden sind, wurden – mit Ausnahme der
griechischen Tradition Italiens und Spaniens – in lateinischer bzw., oftmals darauf basierend, in der
Volkssprache verfasst.37
Die Absteckung des zeitlichen Rahmens des Medium Aevum richtet sich grob nach der all-
gemein wissenschaftsgeschichtlichen Einteilung und bewegt sich von etwa 500 bis 1500 n. Chr.,
wobei sich eine weitere Unterteilung in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter bewährt hat, da sich in
diesen Perioden deutliche Unterschiede ausmachen lassen, seien es wirtschaftliche, soziale oder
mentalitätsgeschichtliche.38
Folgt man der Epocheneinteilung der Geschichtswissenschaft, zeigt sich im Frühmittelalter
eine andere Wissensvermittlung als in späteren Epochen. Die Weitergabe von heilkundlichem
Wissen in schriftlicher Form wird ausschließlich von den Klöstern und Domschulen getragen. Die
Quellen sind größtenteils byzantinischen Ursprungs, zeigen jedoch durch oftmals mangelhafte
Übersetzungen starke Zersetzungen und sind meist nur mehr in Form von Exzerpten überliefert. Die
Medizinliteratur des Frühmittelalters macht einen eher kargen Eindruck, betrachtet man die Über-
lieferungen späterer Zeiten.39
Ein entscheidender Wendepunkt tritt mit der Entwicklung der Schule von Salerno ein, deren
Blütezeit zwischen 1000 und 1250 angesetzt wird. Die Impulse der Medizinschule prägten die
abendländische Heilkunde des Hochmittelalters entscheidend. In diesem Prototyp der späteren Uni-
versitäten wird dem Abendland das praxisbezogene Grundwissen der antiken Heilkunde aus arabi-
schen Vorlagen bereitgestellt. Die medizinische Wissensvermittlung wird im Rahmen dieser Ein-
richtung zur textorientierten akademischen Wissenschaft, die u. a. die Spaltung in Schulmedizin
und handwerkliche Chirurgie zur Folge hat. Im Zuge dessen verändern bzw. bilden sich die ‚Be-
rufsbilder‘ des Wund- und Laienarztes, des Apothekers oder des Baders aus.
Durch den Umschwung weg von der frühmittelalterlichen Mönchsmedizin hin zu einer Medi-
zin, die nun auch außerhalb der klerikalen Welt vermittelt wurde, kam es zu einer Ausweitung des
landessprachlichen medizinischen Schrifttums im Spätmittelalter. Die nötigen Voraussetzungen,
nämlich eine steigende Alphabetisierung, eine geeignete Infrastruktur (Städteausbau, Universitäts-
gründungen etc.) und technische Errungenschaften, wie die Papierherstellung und das Gutenber-
gische Druckverfahren, waren in dieser Epoche nun vorhanden. Der Interessentenkreis für diese Art
der Gebrauchsliteratur erweiterte sich beträchtlich. Patrizierschichten, Hebammen, Wund- und Lai-
enärzte, aber auch Branntweinbrenner und Apotheker gehören zu den Konsumenten der medizi-
nischen Fachliteratur.40 Kommerzielle Schreibstuben nehmen zu und das alte Auftragsprinzip wird
37 Vgl. ebda, S. 86. 38 Vgl. ebda, S. 84. 39 Vgl. ebda, S. 87. 40 Vgl. ebda, S. 88–91.
17
mehr und mehr durch die Vorratsproduktion abgelöst.41 Es hat sich gezeigt, dass eine grundlegende
Eigenschaft spätmittelalterlicher Textproduktion und -rezeption die Verbindung und Wechselwir-
kung zwischen Volkssprache und Latein ist. Die Annahme Karl Sudhoffs, dass alle volkssprachli-
chen Texte, die vor dem 15. Jahrhundert entstanden sind, lediglich Übersetzungen aus dem Lateini-
schen darstellen, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Vielmehr geht die Forschung heute von einer
sich gegenseitig befruchtenden Koexistenz aus. Deutschsprachige Werke wurden ebenso ins Latei-
nische übersetzt wie lateinische Texte ins Deutsche.42 Als Beispiel wäre hier der Bartholomäus zu
nennen. Das Werk gilt als das erste umfangreiche Werk der Medizinliteratur in deutscher Sprache.
Die Überlieferung setzt bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts im bairisch-österreichischen Raum
ein. Die Frage, ob der Verfasser seinen Text aus verschiedenen lateinischen Vorlagen bezog oder
ob das Werk aus ursprünglich selbstständigen Einzeltexten kompiliert wurde, ist nicht eindeutig ge-
klärt.43
41 Erste Bücheranzeigen sind 1450 von Diebolt Lauber geschaltet worden, in dessen Handschriftenmanufaktur 20
Spezialisten diverse, oftmals illustrierte Texte produzierten, deren Spektrum von religiösen, erbaulichen, natur-kundlichen, historischen bis zu fiktionalen Texten früherer Jahrhunderte reichte. – Vgl. Sebastian Seyferth: „Du solt wissen das gesunde Leüt nit sülen lassen noch kein Tranck nehmen […].“ Medizinisch-astrologische Wissens-präsentationsformen und deren Textsyntax in einem Iatromathematischen Hausbuch von 1487. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 61 (2006), S. 251.
42 Vgl. Seyferth, „Du solt wissen …“, S. 252 und Gundolf Keil: Der medizinische Kurztraktat in der deutschen Literatur des Mittelalters. In: Beiträge zur Überlieferung und Beschreibung deutscher Texte des Mittelalters. Referate der 8. Arbeitstagung österreichischer Handschriften-Bearbeiter von 25.-28. 11. 1981 in Rief bei Salzburg. Hrsg. von Ingo Reiffenstein. Göppingen: Kümmerle 1983. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 402.) S. 62.
43 Vgl. Schnell, Medizinliteratur, S. 404.
18
6 Iatromathematische Kompendien/Volkskalender
Im Gegensatz zu früheren Sammelhandschriften, in denen medizinische Stoffe sehr heterogen prä-
sentiert wurden, entstehen im 15. Jahrhundert vermehrt Handschriften, die sich im astrologischen
Kontext einer ganzheitlichen Gesundheitsthematik widmen. Eine der ersten Schriften dieser Art
stellt eine Augsburger Handschrift dar, die auf das frühe 15. Jahrhundert datiert und Johannes Wiss-
bier von Gmünd zugeordnet wird. Der Text beinhaltet ein Kalendarium (Handbuch mit chronolo-
gischen Berechnungen) und Abhandlungen zur aristotelischen Kosmologie, dem Zodiak und den
sieben Planeten. Johannes Wissbier, ein Schüler von Johannes Münzinger, welcher als Rektor der
lateinischen Schule eine Zeitrechnung verfasste, kopierte und erweiterte 1405 das lateinische Ka-
lendarium seines Lehrers. Von diesem erweiterten Volkskalender stammen mehr als 30 Hand-
schriften ab, vorwiegend aus dem 15. Jahrhundert. Diese Textgruppe wird von Brévart44 als Version
A des Volkskalenders45 bezeichnet.
Im Laufe des ersten Drittels des 15. Jahrhunderts entstand noch eine völlig andere Art der
Volkskalender. Zusätzlich zu Wissbiers Abhandlungen fanden unterschiedliche Themen in dieser
neuen Art der Volkskalender ihren Niederschlag: Es fließen Texte zur Temperamentenlehre, Bade-
regeln, Aderlass-Traktate, Monatsregeln oder Ausführungen zu den verworfenen Tagen ein. Diese
erweiterte Version des Volkskalenders legte ihren Fokus mehr auf die Vermittlung praktischer In-
formationen. Mehr als 20 Handschriften dieser Art sind überliefert und werden in der Forschung als
Version B des Volkskalenders geführt. Zu dieser Fassung gehört auch der Kodex Schürstab. Der
Vergleich des Iatromathematischen Hausbuchs des Cod. 3085 mit der Zürcher Handschrift zeigte
weitgehende Übereinstimmungen und lässt sich daher ebenfalls in die Tradition der Version B
stellen.
Beide Varianten des Volkskalenders waren weit verbreitet und stellten eine der wichtigsten
Arten der Gebrauchsliteratur dar, enthielten sie doch nützliche Hinweise und Ratschläge für eine
Vielzahl alltäglicher Problemstellungen. Mit Einführung des Buchdrucks sind zahlreiche weitere
Kalenderversionen entstanden, von denen sich der ‚Teutsch Kalender‘ größter Beliebtheit erfreute.
Das Werk ist erstmals 148146 von Johann Blaubire in Augsburg gedruckt worden und enthält im
Wesentlichen die Texte der Version B des Volkskalenders sowie einige zusätzliche Passagen an-
derer Handschriften.47 Zur Popularisierung der gedruckten Kalender und ihrer Weiterentwicklung
hin zum einjährigen Kalender trugen die beigegebenen „Practica“ – darunter sind die Gesundheits-
44 Vgl. Brévart, German Volkskalender, S. 312 ff. 45 Überliefert z. B. im Cod. III.1. 4° 1, Augsburg, Universitätsbibliothek. 46 Eine zweite Ausgabe von Blaubire erschien 1483, auf dieser aufbauend gab es zahlreiche weitere Veröffentlichun-
gen, wie beispielsweise von Johannes Schäffler in Ulm 1498. 47 Vgl. Brévart, German Volkskalender, S. 314.
19
hinweise, Prophezeiungen und ‚Bauernregeln‘ im Sinne des Iatromathematischen Hausbuchs zu
verstehen – maßgeblich bei.48 Aus dieser Art der Kalenderliteratur entwickelte sich die in der Frü-
hen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert beliebte Gattung des Almanachs heraus, wobei die astrologisch-
astronomischen Inhalte im Laufe der Zeit völlig daraus verschwanden.49
48 Vgl. Peter Johannes Schuler: ‚Kalender/Kalendarium‘. In: LexMa, Bd. 5, Sp. 866. 49 Vgl. William Crossgrove: Die deutsche Sachliteratur des Mittelalters. Bern [u. a.]: Lang 1994. (= Germanistische
Lehrbuchsammlung. 63.) S. 127.
20
7 Inhaltliche Zusammensetzung des
Iatromathematischen Hausbuchs ÖNB, Cod. 3085
Ziel dieses Kapitels ist es, die Vielzahl der kleineren Texteinheiten, aus denen sich das Iatromathe-
matische Hausbuch zusammensetzt, zu erläutern und wo immer möglich auf Herkunft und Über-
lieferungszusammenhänge der einzelnen ‚Textbausteine‘ hinzuweisen.
7.1 Kalendarium
7.1.1 Mittelalterliche Zeitrechnung
Die Zeitrechnung des Mittelalters ist vielfältig und kannte diverse Methoden, die sich je nach Re-
gion und Jahrhundert unterscheiden. Es soll hier, ohne auf die spezifischen Merkmale der Zeitein-
teilung näher einzugehen, der Versuch unternommen werden, die für das Iatromathematische
Hausbuch des Cod. 3085 wichtigsten Begriffe zu erläutern, um den ersten Teil des Hausbuchs, das
Kalendarium verständlich zu machen.
Die mittelalterliche Zeitrechnung beruht auf dem Sonnenjahr (anus solaris). Das ist der Zeit-
raum, den die Erde benötigt um die Sonne einmal zu umrunden. Das hiernach benannte tropische
Jahr hat durchschnittlich eine Länge von 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Ein
Tag ist in dieser Berechnung die Zeitspanne, die eine Umdrehung der Erde um ihre eigene Achse
ausmacht.
Der Julianische Kalender, der nach der Neuordnung des römischen Kalenders durch Julius
Cäsar eingeführt wurde, setzt ein Sonnenjahr mit 365 Tagen fest. Die verbleibende Zeit, die auf 6
Stunden berechnet wurde, versuchte man durch den Einschub eines Schalttages alle 4 Jahre auszu-
gleichen.
Diesen Julianischen Kalender brachte man zum Zwecke der christlichen Festrechnung mit
dem Mondumlauf in Verbindung. Ein Mondmonat beträgt im Schnitt 29 Tage, 12 Stunden, 44
Minuten und 3 Sekunden. Um die Mondmonate mit den julianischen Jahren zu synchronisieren,
wechselten die Tage der Monate zwischen 30 und 29 Tagen. Aufgerechnet auf 19 Julianische Jahre
inklusive der Schalttage und abzüglich des Schlusstages, konnte der Zweck der Zeitrechnung erfüllt
werden. Nach Ablauf des 19-jährigen Mondzyklus traten die Mondphasen wieder an denselben
Monatsdaten ein. Damit wurde auch eine Berechnung des Festkalenders möglich.
21
Die kalendarische Entsprechung für die Jahre des Mondzyklus ist die Goldene Zahl (nu-
merus aureus). In wiederkehrender Reihenfolge von 1 bis 19 durchläuft sie die Jahre der christ-
lichen Zeitrechnung, beginnend im Jahr 1 v. Chr.
Der Sonnenzyklus durchläuft in 28-jähriger Wiederholung die ganze Zeitrechnung. In Jahren,
die die gleiche Zahl (1–28) aufweisen, sollen die Wochentage auf dieselben Monatsdaten fallen.
Die Berechnungen des Zyklus setzen das Jahr 9 v. Chr. als ein mit einem Montag beginnendes
Schaltjahr an. Aufgrund dieser Festlegung ließen sich Jahresangaben auch im Sonnenzyklus tätigen.
Um die Wochentage für alle 28 Jahre zu bestimmen, wurden die 365 Tage des Jahrs mit den 7
Buchstaben A–G bezeichnet (Tagesbuchstaben), beginnend am 1. Januar mit A. Den Buchstaben
im einzelnen Jahr, auf den der erste Sonntag fällt, bezeichnet man als Sonntagsbuchstaben. Daraus
ergibt sich, dass alle Tage, die diesen Buchstaben im betreffenden Jahr tragen, Sonntage sind.
Lunarbuchstaben dienten (als älteres Hilfsmittel) der Berechnung der Mondphasen. Die
Buchstaben A–U/V bzw. A–T durchliefen wiederkehrend das Jahr und dienten zur Bestimmung der
zyklischen Mondphase.50
Für die Zeitrechnung des christlichen Mittelalters war die Bestimmung der Festtage aus-
schlaggebend. Nach dem Festkalender erfolgte sozusagen die Zeiteinteilung. Der Frühlingsanfang
wurde mit dem 21. März angesetzt, das Osterfest wurde bzw. wird in der christlichen Zeitrechnung
am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond begangen. D. h., der Sonntag, der dem ersten
Vollmond nach dieser Datumsgrenze folgt, stellt den Termin für das Osterfest dar.51 Um zu diesen
Daten zu gelangen, braucht es die Sonne, um den Wochentag zu berechnen, und den Mond, um den
Vollmond zu berechnen. Der Osterzyklus ist daher die Vereinigung der Berechnungen aus Sonnen-
und Mondzyklus.52
Häufige Verwendung fanden in mittelalterlichen Datierungen und Kalendern neben der Gol-
denen Zahl, den Tages- und Sonntagsbuchstaben noch Tagesbezeichnungen nach römischer Datie-
rung sowie die Bezeichnung durch Fest- oder Heiligentage, die je nach Diözesankalender unter-
schiedliche Lokalheilige verzeichnen.53
Um den vermutlichen Entstehungsort des hier behandelten Codex zu verifizieren, wurde eine Ana-
lyse der Fest- und Heiligennamen vorgenommen, die im Kalendarium des Cod. 3085 vermerkt sind.
Dabei bestätigte sich der bairisch-österreichische Raum. Enger ließ sich der Entstehungsort auf-
grund der vorliegenden Informationen nicht einschränken.
50 Vgl. Hermann Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 13. Aufl.
Hannover: Hahn 1991, S. 1–4. 51 Falls der 21. März ein Sonntag und gleichzeitig Vollmond ist, stellt dieses Datum den frühestmöglichen Termin für
das Osterfest dar. 52 Vgl. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, S. 5 f. 53 Vgl. ebda, S. 6.
22
In der Tabelle angeführt werden Diözesen, in denen zwei oder mehr der nicht überall gefeierten
Lokalheiligen verzeichnet sind, die im Codex 3085 Erwähnung finden.54
Diözese
Pas
sau
Bri
xen
Reg
ensb
urg
Sal
zbur
g
Fre
isin
g
Tri
ent
Pra
g
Aqu
ilei
ja
Eic
hste
dt
Bre
slau
Kon
stan
z
Kra
kau
Lokalheiliger
Castuli m. (26. Mär.)55
x x x x x x x
Ruperti ep. Salisburgen despositio (17. Mär.)56
x x x x x x
Georgii militis (24. Apr.)57
x x x x x x x x x x
Helene regine (22. Mai)58
x x x x x
Achacii et soc. m. (22. Jun.)59
x x x x x x x
Margareta v. (12. Jul.)60
x x x x x
Ruperti ep. Salisburgen Translatio (24. Sep.)61
x x x x x x x
Virgilii ep. Salisburgen. cf. (27. Nov.)62
x x x x x x
Abkürzungen: cf. = confessoris ep. = episcopi m. = martiris, martirum soc. = sociorum v. = virginis, virginum
7.1.2 Tafelwerk und Kalenderwerk des Kodex Schürstab
In anderen vergleichbaren Kalendern sind Tafelwerke zur Berechnung der Gestirne sowie Einfüh-
rungen zur Kalenderbenutzung mitüberliefert. Diese entscheidenden Teile fehlen im Cod. 3085. Der
Kalenderteil beginnt mit dem Februarblatt und setzt sich dann bis zum Dezember fort. Es ist also
54 Für die Recherche der Fest- und Heiligennamen wurde die HTML-Version von Grotefends Zeitrechnung
herangezogen. – Hermann Grotefend: Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 2 Bde. Hannover: 1891–1898. HTML-Version von Horst Ruth. 2004. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm [27.08.2014]. Um zu einzelnen Einträgen zu gelangen, muss im Heiligenverzeichnis der jeweilige Anfangsbuchstabe ausgewählt werden. In weiterer Folge wird der entsprechende URL zum betreffenden Buchstaben angegeben.
55 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_ck.htm [09.09.2014]. 56 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_r.htm [09.09.2014]. 57 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_g.htm [09.09.2014]. 58 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_h.htm [09.09.2014]. 59 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_a.htm [09.09.2014]. 60 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_m.htm [09.09.2014]. 61 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_r.htm [09.09.2014]. 62 Vgl. ebda, URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/h_v.htm [09.09.2014].
23
davon auszugehen, dass gemeinsam mit dem Kalenderblatt für den Januar eventuell auch die ‚Be-
nutzungsanweisungen‘ verloren gegangen sind. Als Anhaltspunkt, was sich möglicherweise noch
im Manuskript befand, wird der Kodex Schürstab herangezogen und die in ihm befindlichen Kalen-
derteile, welche im Cod. 3085 fehlen.
Das Tafelwerk63 des Kodex Schürstab umfasst zunächst eine Tabelle zur Bestimmung des mittleren
Mondstandes für jeden Tag des Jahrs (in diesem Fall die Jahre 1459–1491), dann zwei Kreissche-
mata zur Berechnung der Goldenen Zahl und der Sonntagsbuchstaben sowie eine Tafel zur Bestim-
mung des Mondstandes in den Tierkreiszeichen. Danach folgt, wie auch im Cod. 3085, der eigent-
liche Kalender mit den jedem Monat zugeordneten Tafeln der Neu- und Vollmonde. Am Ende der
Handschrift finden sich Tafeln, die zur Berechnung des Osterfestes und der davon abhängigen be-
weglichen Feste zur Bestimmung der Zeit zwischen Weihnachten und dem Fastnachtssonntag, der
Zeit zwischen Lichtmess und dem ersten Fastensonntag sowie verschiedener beweglicher Feste
nötig sind, und schließlich eine Tabelle zur Feststellung der Stundenregentschaft der sieben Plane-
ten. Einleitend wird in lateinischer Sprache die Benutzung des Tafelwerks erklärt und ebenfalls in
lateinischer Sprache erfolgt eine ausführliche Anleitung zum Gebrauch der Tabellen im eigent-
lichen Kalenderteil. Dieser mit Abstand jüngste tradierte Text stammt aus der Feder von Johannes
von Gmunden, „der als ‚Begründer der Himmelskunde‘ in Deutschland gilt“64.
Außer der Tafel zur Bestimmung des Mondstandes im Tierkreiszeichen65 (fol. 11v), der Tabu-
la pro Intervallo für die Jahre 1469–1499 (fol. 12r) und der Tabelle zur Stundenregentschaft der
sieben Planeten (fol. 19r) ist kein weiteres Tafelwerk im Cod. 3085 überliefert. Anweisungen zur
Verwendung der Tafeln und Tabellen sind nicht tradiert.
7.2 Kalendertafeln im Cod. 3085
Der Aufbau und die Ausführlichkeit der einzelnen Tabellen des Cod. 3085 unterscheiden sich von
denen des Kodex Schürstab, daher lassen sich die Erklärungen von Weißer bezüglich des Kalenda-
riums nur bedingt auf die vorliegende Handschrift übertragen. Es gibt beispielsweise keine Be-
schriftung, die eine Bestimmung der einzelnen Zahlen-Kolumnen erleichtern würde. Die folgende
Erklärung der Kolumnen beruht daher zum Teil auf Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten.66
63 Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. Chrisoph Weißer: Wie benutzt man einen mittelalterlichen Kaldender?
Ein Blick in die alte Zeitrechnung anhand der Beispiele aus dem ‚Kodex Schürstab‘. In: Keil/Lenhardt/Weißer, Vom Einfluss der Gestirne, Bd. 2, S. 147 ff.
64 Gundolf Keil: Anmerkungen zu den Quellen. In: Keil/Lenhardt/Weißer, Vom Einfluss der Gestirne, Bd. 2, S. 137. 65 Saxl bezeichnet diese Tafel als „Tabelle zum Aderlaß“. – Vgl. Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer
illustrierter Handschriften, S. 118. 66 Genauere Beschreibung der Kalendertafeln siehe Kap. 10.2 ‚Inhalt‘.
24
Kopfzeile: Monatsnamen und Anzahl der Tage
Sp. 1 Goldene Zahl
Sp. 2 vermutlich Stunden des Neu- oder Vollmondes
Sp. 3 vermutlich Minuten des Neu- oder Vollmondes
Sp. 4 Kolumne mit Buchstaben (a–v)
Sp. 5 Sonntagsbuchstabe
Sp. 6 römische Datierung
Sp. 7 leer
Sp. 8 Tagesheilige
Sp. 9 Lunarbuchstabe
Sp.10 fortlaufende Tageszählung mit Hinweis auf das eintretende Sternzeichen
Vergleiche mit anderen Kalendarien zeigen zum Teil Übereinstimmungen, die eine nähere Bestim-
mung der Rubriken des Cod. 3085 gestatteten. Einige Rubriken ließen sich jedoch nicht klären. Es
folgt eine kurze Aufstellung der Vergleichshandschriften und Kalendertafelrubriken:
Tübingen Md 2
18 Rubriken: Zahl der Tage, Goldene Zahl, Stunden, Minuten, Silben des Cisiojanus (Abkürzung
der Namen des Tagesheiligen), Sonntagsbuchstaben, Name des Tagesheiligen, Lunarbuchstaben,
Lasstage, römische Kalendereinteilung, Zahlzeichen für die 12 Tierkreiszeichen, Zahlzeichen zur
Graduierung, Zahlzeichen Stunden, Zahlzeichen Minuten.67
Zürich Zentralbibl. C 102b (Schüpfheimer Codex)
8 Rubriken: der Tag, Goldene Zahl, 2 Spalten Dauer des Neumondes, Sonntagsbuchstaben, röm.
Monatseinteilung, Tagesheilige und Lunarbuchstaben. Abschließend 4 Tafeln, die sich mit der
Goldener Zahl, den Lunarbuchstaben, den Tierkreiszeichen und der Ermittlung des
Sonntagsbuchstabens beschäftigen.68
67 Vgl. Helga Lengenfelder: Verzeichnis der Federzeichnungen, Rubriken und Initien der Abschnitte. In: Iatromathe-
matisches Kalenderbuch. Die Kunst der Astronomie und Geomantie. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Tü-bingen, Universitätsbibliothek, Md 2. Beschreibung der Hs. von Gerd Brinkhus. Introd. to the astrological-divina-tory ms. by David Juste. Verzeichnis der Federzeichnungen, Rubriken und Initien der Abschnitte und Anmerkun-gen zu den Texten und Bildern von Helga Lengenfelder. München: Ed. Lengenfelder 2000. (= Codieces illuninati medii aevi. 63.) S. 21.
68 Vgl. Bernhard Schnell. In: Heinrich Laufenberg: Regimen der Gesundheit. Iatromathematisches Hausbuch. Michael Puff: Von den ausgebrannten Wässern. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Zürich, Zentralbibliothek, Ms C 102 b. Einführung zu dem astromedizinischen Hausbuch von Bernhard Schnell. Beschreibung der Handschrift von Marlis Stähli. München: Ed. Lengenfelder 1998. (= Codices illuminati medii aevi. 41.) S. 15.
25
Zürich C54 (Nürnberger Kodex Schürstab)
13 Spalten: fortlaufende Tageszählung, 8 Zahlenkolumnen zur Neu- und Vollmondberechnung,
Sonntagsbuchstaben, Tagesheilige, Lunarbuchstaben, Silben des Cisiojanus.69
7.3 Monatsregeln
Durch den Verlust des Blattes für den Monat Januar beginnt der Kalenderteil des Cod. 3085 mit den
sogenannten ‚Monatsregeln‘ zum Februar.
Bei den Monatsregeln handelt es sich um Texte, die für jeden Monat des Jahrs medizinische
und astrologische Anweisungen bezüglich gesundheitserhaltender Maßnahmen, Ernährungsge-
wohnheiten und geeigneter Aktivitäten im Jahreslauf enthalten. Überliefert sind solche Regeln
schon aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert, allerdings stammen die meisten aus dem 15. Jahr-
hundert.
Der Text des Cod. 3085 ist bezüglich der Monatsregeln gleichlautend mit dem des Kodex
Schürstab, daher kann auch im Falle der verloren gegangenen Seiten von einem identischen Text
ausgegangen werden. Bei diesen Monatsregeln handelt es sich um Almansors Monatsregeln, be-
nannt nach der ersten Autorität, die als Zeuge der Wirksamkeit und ‚Echtheit‘ des Geschriebenen
aufgerufen wird. In jedem Monat kommt ein Meister zu Wort, aus dessen Mund der Leser/die
Leserin die entsprechenden Ratschläge und Anweisungen erfährt, die es in dieser Zeit zu beachten
gilt. Dabei handelt es sich um diätetische Ratschläge, wann welche Art von Medizin einzunehmen
ist, wer in dieser Zeit zur Ader gelassen werden soll, Baderegeln oder Hinweise zu Einläufen und
Schröpfbehandlungen. Weiters bieten die Texte Hinweise auf die Stellung des Mondes und die da-
mit verbundenen Aktivitäten im Jahreslauf. Auf diese Tätigkeiten beziehen sich auch die Illustratio-
nen, mit denen die Handschrift ausgestattet ist. So zeigt das Märzbild (fol. 2r) beispielsweise
mehrere bäuerliche Figuren, die mit Pflügen und Säen beschäftigt sind.
Neben dem deutschsprachigen Prosatext findet sich stets eine kurze Passage in lateinischer
Sprache, die Bezug nimmt auf das diesen Monat regierende Sternzeichen. Es werden die Primär-
qualitäten des Zeichens genannt sowie die Körperregionen, die diesem Zeichen zugeordnet sind.
Dementsprechend folgen Hinweise, die der Gesundheitserhaltung dienen bzw. bei Krankheit zu
einer Verbesserung der Beschwerden führen sollen.
Zusätzlich zum Prosatext sind noch kurze gereimte Monatsregeln zu finden, in denen die
wichtigsten Ratschläge komprimiert und in leicht memorierbarer Form vorliegen.70 Hier spricht der
69 Vgl. Weißer, Wie benutzt man einen mittelalterlichen Kalender?, S. 152–153. 70 Zu Reimformen in medizinischer Literatur siehe Gundolf Keil: Prosa und gebundene Rede im medizinischen Kurz-
traktat des Hoch- und Spätmittelalters: In: Poesie und Gebrauchsliteratur im deutschen Mittelalter: Würzburger Colloquium 1978. Hrsg. von Volker Honemann. Tübingen: Niemeyer 1979, S. 77–94.
26
personifizierte Monat den Lesenden an, stellt sich diesem kurz vor und gibt relevante Informationen
weiter.
7.4 Verworfene Tage (fol. 12v)
Bei den sogenannten ‚verworfenen Tagen‘ handelt es sich um bestimmte Tage im Jahresablauf,
denen ungünstige Eigenschaften zugeschrieben werden. Geschäftliche, aber auch private Unterneh-
mungen oder medizinische Eingriffe, wie der Aderlass, sollten an diesen Tagen unterlassen werden,
da die vorherrschende Sternenkonstellation das Ergebnis negativ beeinflussenkönnte. Es lassen sich
zwei verschiedene Arten der Bestimmung dieser Tage unterscheiden:
Die erste Methode ist die der astronomischen Berechnung. Durch den Wandel planetarischer
Stellungen kommt es zu sich jährlich ändernden Tagen, die als gefährlich gelten und somit für be-
stimmte Vorhaben zu meiden sind.
Die zweite und weitaus häufiger praktizierte Methode beruht nicht auf mathematischen Be-
rechnungen, sondern basiert auf traditioneller Überlieferung. Die Zahl der verworfenen Tage sowie
ihre Stellung im Kalender sind festgelegt und haben nichts mehr mit tatsächlichen astronomischen
Gegebenheiten zu tun. Die Tradition solch festgelegter Tage lässt sich bis ins alte Ägypten des 13.
Jahrhunderts v. Chr. zurückverfolgen. Ab dem 4. Jahrhundert n. Chr. finden sich die sogenannten
dies Aegyptici im römischen Kalender wieder. Während sich die Zahl der dies Aegyptici auf 24
beläuft, ist in Berufung auf die Griechen in einigen Handschriften eine Anzahl von 40 Tagen, in an-
deren Manuskripten von 58 Tagen genannt, wobei hier auf die arabische Tradition zurückgegriffen
wurde.71
Im Iatromathematischen Hausbuch des Cod. 3085 werden insgesamt 21 Tage aufgezählt, an
diesen soll man weder lassen chauffen noch verchaúffen vnd aúch chainerlay ertzney thún. Genannt
werden die einzelnen Tage nicht über uns heute geläufige Datumsangaben, sondern wie im Mittel-
alter üblich durch die Benennung von Heiligentagen, anhand derer man sich im Jahresablauf orien-
tierte.
7.5 Tierkreiszeichen (fol. 12v–18v)
Die Ursprünge der Lehre von den Tierkreiszeichen, des Zodiak, gehen auf die babylonische Astro-
nomie und Astrologie zurück. Es zeigen sich hier Einflüsse der altägyptischen Dekansternbilder.
Die Vorläufer der heutigen Form sind seit dem 3. Jahrhundert auszumachen, in welchen die Lehre
71 Vgl. Gundolf Keil: Die verworfenen Tage. In: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissen-
schaften 41 (1957), S. 27.
27
mit der griechischen Philosophie und Naturwissenschaft kombiniert wurde. Eine weite Verbreitung
erfuhr das System durch seine gute Vereinbarkeit mit dem philosophischen Weltbild des Aristo-
teles. Neue Ansichten kamen im Laufe der Zeit hinzu. So erfolgte die Zuteilung von Körper-
regionen und Gliedmaßen des Menschen zu einzelnen Sternzeichen. Es entwickelte sich eine Ge-
burtsastrologie, die bestimmend wurde für die charakterlichen und typbedingten Eigenschaften des
Menschen. Durch die Rezeption der griechisch-arabischen Wissenschaften gewann die Astrologie
ab dem 12. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung, wie sich anhand der vielfach überlieferten Text-
zeugnisse zeigen lässt. Ab dem 14. Jahrhundert finden sich auch in der deutschen Literatur erste
Texte dieser Art. In der Regel handelt es sich dabei um kleinere Traktate, die oftmals in der Umge-
bung medizinisch-astrologischer Kompendien auftauchen. Die enge Verbindung und teilweise Ver-
schmelzung der einzelnen Themen macht eine klare Eingruppierung72 in Tierkreiszeichenlehre, Pla-
neten-Traktate, Temperamentenlehre, Lunare, Mondwahrsage-Texte oder Monatsregeln fast un-
möglich.73 Meist folgen nach oftmals gleichem Texteingang unterschiedliche Zusammenstellungen
von kurzen Aussagen zu den einzelnen Zeichen des Zodiaks.
7.6 Mondwahrsagung
7.6.1 Allgemeines
Mondwahrsage-Bücher, sogenannte ‚Lunare‘, stellten astrologische Prognostiken anhand des
Mondlaufs an. Diese Lunare boten Vorhersagen zu jedem der 30 Tage des Mondmonats. Von die-
sen detaillierten und speziell auf einzelne Tage bezogenen Prognostiken setzten sich die übrigen
Mondwahrsage-Texte74 ab, die in zahlreichen Handschriften überliefert wurden. Die größte Gruppe
solcher Texte findet sich in Verbindung mit dem Mondstand in einem der zwölf Tierkreiszeichen.
Die Wirkung des Mondes wird durch andere Planeten, die sich im gleichen Zeichen befinden,
entweder gestärkt oder verringert. Ebenso ist die positiv besetzte Erhöhung bzw. die negativ be-
setzte Erniedrigung der Planetenstände zu beachten.
72 Eine Einteilung in 7 Prosatextgruppen nehmen Mayer und Keil im Verfasserlexikon vor. – Vgl. Johannes Gottfried
Mayer/Gundolf Keil, ‚Tierkreiszeichenlehre‘. In: 2VL, Bd. 9, 1995, Sp. 925 ff. 73 Vgl. Mayer/Keil, ‚Tierkreiszeichenlehre‘, Sp. 923 ff. – Hinzu kommt das Problem, dass die deutschsprachigen
Texte zum Zodiak bisher kaum untersucht worden sind. Editionen stehen nur in wenigen Fällen zur Verfügung und die Einteilung durch Zinner hat sich als nicht haltbar erwiesen. – Vgl. Ernst Zinner: Verzeichnis der astrono-mischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes. München: Beck 1925, S. 363–367.
74 Müller sowie Haage/Wegner unterscheiden zwischen Lunaren und Mondwahrsage-Texten, wobei Mondwahrsage-Texte alle Voraussagen betreffen, „die in irgendeiner Form mit den Eigenschaften, der Stellung oder dem Alter des Mondes verknüpft sind“, Lunare nur solche, die Angaben zu einem Mondtag liefern. – Müller, Mondwahrsagetexte, S. 41. – Vgl. Bernhard Dietrich Haage/Wolfgang Wegner: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit. Unter Mitarbeit von Gundolf Keil und Helga Haage-Naber. Berlin: Schmidt 2007. (= Grundlagen der Germanistik. 43.) S. 287 f.
28
Generell ist bei dieser Form der Mondwahrsage-Texte der Mond nur von indirekter Bedeu-
tung, indem er als Zeitmesser fungiert und durch seine jeweilige Position festlegt, welches der
Sternbilder zu welchem Zeitpunkt Einfluss auf den Menschen und seine Umwelt besitzt. Der tat-
sächliche astronomisch beobachtbare Mondstand spielte meist keine Rolle. Die Texte beinhalten
Tabellen, die zur Bestimmung der Mondkonstellation herangezogen wurden, somit war es dem
Nutzer möglich, schnell und einfach den Mondstand und das entsprechende Tierkreiszeichen im
Jahreslauf zu erkennen.75
Im weiteren Sinn müssen auch die Mondprognosen der Planeten- und Planetenkinder-
Traktate, in denen die einzelnen Planeten als Stunden-, Tages-, Wochen- oder Jahresregenten auf-
treten, als Mondwahrsage-Texte aufgefasst werden. Hierbei spielen die Eigenschaften des Mondes,
der in diesem Zusammenhang in seiner Funktion als bestimmender Planet fungiert, die entschei-
dende Rolle. So hätten beispielsweise unter ihm geborene Kinder ein bleiches und rundes Ange-
sicht, wären oftmals stolz und in Berufen anzutreffen, die im weitesten Sinne mit Wasser zu tun
haben.
7.6.2 Überlieferung
Müller stellt den Mondwahrsage-Text des Cod. 3085 in die von ihr so benannte Gruppe der ABC-
Tradition. Hierbei handelt es sich um die Handschriften:
A: Clm 5640, München, Bayerische Staatsbibliothek, 14. Jh. (fol. 84r–86v)
B: Cod. Berol. germ. 2°.1174, Berlin, Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz, 15. Jh. (fol. 19v–24v)
C: Cgm 7962, München, Bayerische Staatsbibliothek, 14. Jh. (fol. 53v–65v)
Das zodiakale Mondbuch der ABC-Gruppe stimmt nahezu wörtlich mit dem lunaren Orakel des
Cod. 3085 (fol. 12v–18r) überein.
Weiters findet sich die gereimte Version des Mondwahrsage-Textes (fol. 25v–26r) in folgenden
Codices:
Cod. Berol. germ. 4°.1022 (15. Jh.) Berlin, Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz
Cod. Vind. 2976, Wien, Österreichische Nationalbibliothek76
75 Vgl. Müller, Mondwahrsagetexte, S. 44 f. 76 Vgl. ebda, S. 200.
29
7.7 Planetenlehre (fol. 18v–27r)
Bei den sogenannten ‚Planeten-Traktaten‘ handelt es sich um parawissenschaftliche Texte – meist
in Prosaform vorliegend –, die über die Eigenschaften der sieben Planeten sowie über deren Ein-
fluss auf den Menschen berichten. Die Ausführlichkeit und die inhaltlichen Komponenten sind in
den einzelnen Überlieferungen unterschiedlich, allerdings lassen sich aufgrund ihres Gliederungs-
prinzips Gemeinsamkeiten erkennen. Die zuletzt von Ptolemäus festgelegte Planetenfolge ergibt das
Grundgerüst, dem der Aufbau dieser Texte folgt. Beginnend mit Saturn, dem erdfernsten Planeten,
werden die Planeten Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond vorgestellt.77
7.7.1 Aufbau im Cod. 3085
Die jeweilige Beschreibung wird im Codex 3085 durch eine vierzeilige paargereimte Strophe einge-
leitet, die Auskunft über die Primärqualitäten und die unmittelbaren Einflüsse des Planeten auf
seine Kinder gibt, also auf die Menschen, die unter diesem Planeten geboren sind. Darauf folgen
Erläuterungen über Macht und Wirkung des Planeten in den einzelnen Tierkreiszeichen. Hierbei
wird erklärt, welches Tierkreiszeichen welchem Planeten zugeordnet ist, wann die ‚Erhöhung‘ (die
Stelle im Zodiak, an der der Planet den größten Einfluss ausübt) stattfindet und wann die ‚Erniedri-
gung‘ erfolgt (die der Erhöhung gegenüberliegende Stellung, in der der Planet den geringsten Ein-
fluss aufweist). Auf diesen Angaben fußen auch Prognosen hinsichtlich günstiger oder ungünstiger
Zeitpunkte, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Es gilt die Stundenregenten des Tages zu be-
achten, also den Planeten, der im Tagesablauf über eine bestimmte Stunde des Tages herrscht.
Weiters finden sich astronomische Angaben, wie beispielsweise Umlaufzeiten der einzelnen Him-
melskörper.
Den Planeten-Traktaten angeschlossen sind sogenannte ‚Planetenkinder-Texte‘. Der Planet,
der im Augenblick der Empfängnis bzw. Geburt eines Kindes als Stundenregent herrscht, prägt mit
seinen Eigenschaften diesen Menschen ein Leben lang. Diese Merkmale beziehen sich auf die
Physis, den Charakter, den Stand oder auch auf den Beruf der Planetenkinder. Die Texte erläutern
die spezifischen Charakteristika eines jeden Planetenkindes und geben so Hinweise zur Konstitu-
tion, Berufswahl oder zu speziellen Befindlichkeiten.
Abschließend finden sich zwei zwölfzeilige Planetenkinder-Gedichte. Hierbei spricht, wie
auch schon im einleitenden Text, der personifizierte Wandelstern zum Leser. Er stellt sich und seine
Kinder in der direkten Rede vor.
77 Vgl. Francis B. Brévart/Gundolf Keil: ‚Planetentraktate‘. In: 2VL, Bd. 7, 1989, Sp. 715 f. – Seltener auch in umge-
kehrter Reihenfolge überliefert oder beginnend mit der mittelständigen Sonne.
30
7.7.2 Überlieferung
Die Planeten-Traktate sind in unterschiedlichen Kontexten überliefert. Nachgewiesen sind sie in
folgenden Fassungen:78
1. im Iatromathematischen Corpus (Astronomisch-astrologisches Lehrbüchlein A =
Volkskalender, Fassung A)
2. im Iatromathematischen Hausbuch (Astrologisch-medizinisches Hausbuch B =
Volkskalender Fassung B)
3. im Teutschen Kalender (Volkskalenderdruckfassung)
4. im Großen Planetenbuch
5. im Regimen sanitatis des Heinrich von Laufenberg
6. in Johannes Hartliebs dt. Bearbeitung der Secreta mulierum
7. in der anonymen obd. Secreta mulierum-Übersetzung
8. in vier dem Mönch von Salzburg bzw. Johannes von Gmunden zugeordneten
Planetengedichten
9. in Oswalds von Wolkenstein Lied Des grossen herren wunder (Kl. 22)
10. in Konrad Keysers Bellifortis
11. in weiteren noch nicht näher untersuchten Hausbüchern
7.8 Komplexionslehre (fol. 28r–29v)
Die mittelalterliche Komplexions- oder Temperamentenlehre geht auf die antike Humoralpatholo-
gie zurück. Sie basiert auf der Vorstellung der vier Grundelemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde),
denen jeweils zwei der vier Primärqualitäten (trocken, feucht, heiß und kalt) zugeschrieben werden.
Dieses Vierer-Schema wird mit den vier Säften (Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle)
des menschlichen Körpers kombiniert. Ausgehend von den Qualitäten-Zuordnungen des Polybios
bzw. Aristoteles wurde das von Galen entwickelte Modell der Humoralpathologie maßgebend für
das medizinische Grundverständnis des Mittelalters. Demnach beruhen Krankheiten auf einem pa-
thologischen Verhältnis in der Säftemischung des Menschen. Auf dieser Grundlage entstand ein
System der Zuordnung von Farben, Organen, Jahreszeiten, Lebensaltern, Nahrungsmitteln, Heil-
pflanzen usw. zu den vier Elementen bzw. Säften und den von diesen ausgedrückten Primärquali-
täten. Das jeweilige Säfteverhältnis bestimmte nicht nur Gesundheit oder Krankheit eines Men-
schen, sondern hatte auch Einfluss auf die Charaktereigenschaften und das Äußere des Individu-
ums. Diese Überlegungen führten zur Ausbildung der vier Temperamente (Melancholiker, Sangu-
78 Vgl. ebda, Sp. 719–721.
31
iniker, Phlegmatiker und Choleriker), die die Konstitution des Menschen maßgeblich beeinflussen.
Das System verschiedener Vierer-Schemata wurde darüber hinaus in Beziehung zum Zodiak und zu
den Planeten gesetzt. Daraus ergibt sich ein überaus komplexes Gefüge, in dem sich Mikro- und
Makrokosmos vereinen und einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen erlauben.79
In der Heilkunde war die Therapie darauf ausgerichtet, krankheitsauslösende Störungen der
Säftemischung zu beseitigen (beispielsweise durch Aderlässe). Gleichzeitig versuchte man mit
Maßnahmen der Diätetik, die Lebensführung so zu steuern, dass die gesunde Säftemischung erhal-
ten blieb. Der Einfluss von Jahreszeiten, Sternenkonstellation, Mondphasen etc. wurde dabei mit-
einbezogen, um eine möglichst vorteilhafte Ausgangssituation für den Patienten, aber auch für die
Erhaltung der Gesundheit zu schaffen.
7.8.1 Traditionslinien
Texte, die sich mit der Temperamentenlehre beschäftigen, finden sich in der medizinischen Fach-
literatur des 15. Jahrhunderts vor allem in zwei Formen. Zum einen handelt es sich um gesonderte
Traktate, die meist zwei Seiten umfassen und im Titel schon auf den zu erwartenden Inhalt hin-
weisen: Von den vier Komplexionen, Hie nach ist gesagt von den vier Temperamenten oder auch De
complexionibus. Die Texte teilen sich klar in vier Teile auf, die fallweise mit den Namen der vier
Temperamente überschrieben sind. Die überlieferten Texte weichen kaum voneinander ab und sind
in zahlreichen Handschriften tradiert worden.80
Die zweite Form der Überlieferung bilden Texte, die sich nicht rein mit der Temperamen-
tenlehre befassen, sondern diese in andere Lehren, beispielsweise die Planentenlehre, einfließen
lassen. Häufig findet sich diese Form in medizinisch-astrologischen Schriften wieder – zu diesen
zählen in diesem Sinne auch die ‚Volkskalendarien‘ –, in denen das Wissen um die Temperamente
mit den Beobachtungen zu den Tierkreiszeichen und Planeten kombiniert ist. Die Verzahnung der
diversen Schemata (4 Primärqualitäten, 4 Elemente, 4 Säfte, 4 Temperamente, 7 Planeten, 12 Tier-
kreiszeichen) erweitert die Temperamentenlehre beträchtlich. Der Leser, dem das Wissen um die
Komplexionen vertraut war, konnte beispielsweise anhand der Qualitäten eines bestimmten Plane-
ten leicht zum entsprechenden Temperament geführt werden, ohne dass das entsprechende Tempe-
rament explizit im Text genannt wurde. Genauso verhält es sich mit den Zodiak-Traktaten. Die
Tierkreiszeichen üben Einfluss auf den Monat ihres Erscheinens aus und verleihen ihm somit be-
stimmte Qualitäten. Diese Qualitäten prägen den Menschen, der unter diesem Sternzeichen geboren
wird. Die Verbindung zwischen Tierkreiszeichen und Planeten erfolgt wiederum durch Angaben,
welcher Planet welches Tierkreiszeichen regiert. Oftmals erfolgen diese Hinweise auch auf bild-
79 Vgl. Klaus Bergdolt: ‚Temperamentenlehre‘. In: LexMa, Bd. 8, Sp. 682 f. 80 Vgl. Zinner, Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes.
32
licher Ebene. Illustrationen von personifizierten Planeten sind mit Bildern der diesem Planeten zu-
gehörigen Tierkreiszeichen kombiniert und geben dem Rezipienten so schnell die Möglichkeit einer
ersten Übersicht.
Implizit ist die Temperamentenlehre auch in Traktaten zu den vier Elementen zu finden sowie
in medizinischen Texten, die sich mit der Harnschau beschäftigen. Bei Letzteren ging man davon
aus, dass sich nicht nur Krankheitsdiagnosen durch die Harnschau stellen ließen, sondern dass die
Farbe des Harns auch Rückschlüsse auf das Temperament der betreffenden Person erlaubte.
Zu den bisher besprochenen Prosatexten kommt noch eine – in Relation zu den Prosatexten
gesehen – relativ kleine Anzahl von Temperamenten-Gedichten, in denen die Komplexionslehre
tradiert wird.
Im Laufe der Zeit lassen sich starke Veränderungen an der ursprünglichen Temperamenten-
lehre von Galen ausmachen. Während ältere Texte sich noch in starker Zurückhaltung bezüglich der
Kombination von Temperament und beispielsweise Lebensalter üben, so zeigen die Texte des
späten Mittelalters einen wesentlich größeren ‚Kombinationswillen‘. Diese Entwicklung kommt be-
sonders in der Verschmelzung mit der Astrologie zur Geltung, die in der Antike nicht gegeben war.
Vor allem die Volkskalender tragen zur Verbreitung dieser Zusammenstellungen bei. Hier finden
sich meist nicht die ‚reinen‘ Temperament-Traktate, sondern Konglomerate des spätmittelalter-
lichen Weltwissens. Charakterliche Eigenschaften stehen neben Aussagen über den Körperbau oder
empfehlenswerten ‚Berufsprognosen‘.81
7.8.2 Überlieferung
In der hier behandelten Handschrift finden sich zwei der oben erwähnten Überlieferungsformen:
zum einen kommen in den Planeten- und Tierkreiszeichen-Texten (fol. 18v–27r) Elemente der
Temperamentenlehre vor, zum anderen ist auch ein reiner Temperamenten-Traktat auf fol. 28r–29v
überliefert. Mit nur leichten, meist dialektal bedingten Abwandlungen findet sich dieser Traktat
auch in den von Schönfeldt82 edierten Teilen der folgenden Handschriften:
München, Bayerische Landesbibliothek, Cgm 349
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 291
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 557
München, Bayerische Landesbibliothek, Cgm 28
München, Bayerische Landesbibliothek, Cgm 730
München, Bayerische Landesbibliothek, Cgm 328
81 Vgl. Klaus Schönfeldt: Die Temperamentenlehre in deutschsprachigen Handschriften des 15. Jahrhunderts. Heidel-
berg, Univ., Diss. 1962, S. 20 ff. 82 Schönfeldt, Temperamentenlehre.
33
7.9 Aderlasslehre/Bade- und Schröpf-Traktate (fol. 30r–36r)
Die Humoralpathologie basiert auf der Annahme, dass unabhängig vom Temperament in jedem
gesunden Menschen eine ausgewogene Säftemischung vorherrscht. Eine Störung des Säfteverhält-
nisses führt zu Störungen im Organismus, die sich dann in diversen Krankheitsbildern manifestie-
ren. Um die gesunde Balance wiederherzustellen, muss der Arzt die übermäßigen oder schädlichen
Säfte reduzieren. Dies war auf verschiedene Weisen möglich. Die am häufigsten verwendete Me-
thode war der Aderlass. Zu dieser minimal-invasiven Therapie zählt im weitesten Sinne auch das
Schröpfen sowie das Anlegen von Blutegeln. All diese Verfahren haben eine Reduktion der schäd-
lichen Körpersäfte zum Ziel. Die Therapie wurde sowohl prophylaktisch als auch bei bereits er-
krankten Personen eingesetzt.
Um eine erfolgreiche Behandlung durch einen Aderlass zu gewährleisten, galt es, vielfältige
Umstände zu beachten. Der richtige Zeitpunkt spielte in der mittelalterlichen Medizin eine bedeu-
tende Rolle. Nur wenn die richtige Sternenkonstellation vorlag, konnte ein Aderlass Heilung brin-
gen. Vom Lassen an verworfenen Tagen wurde zum Beispiel dringend abgeraten. Das Tempera-
ment und die Allgemeinkonstitution des Patienten mussten ebenso einbezogen werden, wie etwa
sein Alter oder das Sternzeichen, unter dem er geboren war. Auch die Lass-Stelle musste mit beson-
derer Sorgfalt gewählt und wiederum mit anderen beeinflussenden Faktoren in Einklang gebracht
werden, drohte doch dem Kranken ansonsten eine Verschlechterung seines Zustandes oder sogar
der Tod. Des Weiteren finden sich ausführliche Darlegungen zur Nützlichkeit des Aderlasses im
Allgemeinen sowie Anweisungen für den Umgang mit Schwellungen, die im Zuge der Behandlung
auftreten konnten, und für einen Bluttest anhand des Aussehens, Geruchs und Geschmacks des
Bluts. Die Quellen für dieses Wissen gehen auf eine Vielzahl von Überlieferungen zurück, sei es
Petrus Hispanus’ Traktat laus phlebotomiae oder der 24-Paragraphen-Text aus Avicennas Canon
medicinae.83 Einige Texte, deren sich der Kompilator des Codex 3085 bediente hat, konnten be-
stimmt werden und sollen im Folgenden genauer beschrieben werden. Es handelt sich dabei um das
Oberdeutsche Aderlaßbüchel, die Regel der Gesundheit des Konrad von Eichstätt, der 24-
Paragraphen-Text sowie das Arzneibuch Ortolfs von Baierland.
7.9.1 Das Oberdeutsche Aderlaßbüchel
Nach dem Kalendarium und Ausführungen astrologischer Natur folgen im Iatromathematischen
Hausbuch ÖNB, Cod. 3085 auf fol. 30r–39r Texte, die sich mit dem Aderlass beschäftigen, Anwei-
sungen zur Blutschau enthalten, Badevorschriften und Regeln für den guten Stuhlgang aufzählen,
83 Vgl. Brévart, German Volkskalender, S. 326.
34
Angaben zu den Qualitäten der Luft sowie der Winde geben und Betrachtungen über die Gemüts-
bewegungen zum Inhalt haben.
Diese Zusammenstellung wird als das Oberdeutsche Aderlaßbüchel bezeichnet und stellt eine
Sonderform des Aderlass-Traktates dar, der in der Antike wurzelt und uns im Frühmittelalter als
Phlebotomia Hippocratis bzw. in weiter ausgebauter Form im Hoch- und Spätmittelalter als Phle-
botomia des Salernitaner Arztes Maurus begegnet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts fand der Trak-
tat nach Reduktion, Verflachung und Schematisierung breiten Einlass in die volkssprachige Ge-
brauchsliteratur. Etwa ab 1450 erscheint der Traktat in standardisierter Zusammensetzung. In der
Forschung wird diese unter dem Titel Oberdeutsches Aderlaßbüchel geführt.84
7.9.2 Regel der Gesundheit von Konrad von Eichstätt
Ein Teil der v. a. die medizinischen und gesundheitsvorsorglichen Maßnahmen betreffenden Texte
des Cod. 3085 konnte der Regel der Gesundheit von Konrad Eichstätt zugeordnet werden.
Konrad von Eichstätt war bedeutender Arzt und Schriftsteller des angehenden 14. Jahrhun-
derts. Seine diätetischen Schriften gehören zu den erfolgreichsten Regimina sanitates des späten
Mittelalters. Seine Regel der Gesundheit ist zeitlich für das 14. Jahrhundert anzusetzen, die Über-
lieferung ist jedoch erst ab 1421 greifbar. Es handelt sich hierbei um eine Kompilation, die haupt-
sächlich aus Versatzstücken aus Konrads Schriften Urregimen und De qualitatibus ciborum besteht.
Daneben fanden Texte aus dem Gesundheitsregiment des Arztes Gregorius und Fassungen des Blut-
schaukatalogs B Eingang. Die verzweigte Streuüberlieferung im Umkreis astromedizinischer Kom-
pendien ist noch nicht hinlänglich erfasst, deutet aber mit Berücksichtigung der Tradition von mehr
oder weniger ausgeprägten Versionen der Regel der Gesundheit darauf hin, dass es sich hierbei um
einen der wirkungsmächtigsten Texte des Konrad von Eichstätt-Komplexes handelt.85
Folgende Kapitel aus der Regel der Gesundheit sind in den Aderlass-Traktat des Cod. 3085 voll-
ständig eingearbeitet worden:86
Regel der Gesundheit Kap. 2:
Nv get eyn ander Capitel an von tzufallen dez synnes vnd dez mutes etc.
84 Vgl. Lenhardt, ‚Oberdeutsches Aderlaßbüchel‘, VL, Sp. 1274–1276. 85 Vgl. Manfred Peter Koch/Gundolf Keil: ‚Konrad von Eichstätt‘. In: 2VL, Bd. 2, 1985, Sp. 162–169. 86 Vgl. Christine Boot: an aderlaszen ligt grosz gesuntheit. Zur Repräsentanz von Ortolfs Phlebotomie in deutsch-
sprachigen Aderlaßtexten. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Reichert 1993. (= Ortolf-Studien. 1. Wissensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 135 f.
35
→ Cod. 3085 (fol. 39r):
Merck hie von den zu vallenden des Synnes gedencken wie dy vnsern synn vn auch
gemuet oder vernufft verwandelnn
Regel der Gesundheit Kap. 13:
Von dem stulgang, von dem waßergang
→ Cod. 3085 (fol. 37r):
Merck hie wie sich der mensch gesúnt schúll halten mit dem stúelgang
Regel der Gesundheit Kap. 19:
Vom cristiren ein Capitel
→ Cod. 3085 (fol. 37r):
Nw merck hie vonn dem kristyrenn
Regel der Gesundheit Kap. 22:
Ein Kapitel von baden
→ Cod. 3085 (fol. 34v–35r):
Nw merck furbas von dem padenn wie das swais pad guet seý vnd auch wasserpad
Regel der Gesundheit Kap. 23:
Das ander Capitel von baden
→ Cod. 3085 (fol. 35r–36v):
Es spricht Auicena
Regel der Gesundheit Kap. 84:
Nu get ein ander Capitel an daz saget alle die adern, dy man leßet an dem menschen vnd
wofür sy gut sint (24- Paragraphen-Text)
→ Cod. 3085 (fol. 32r–34r):
Jtem von dem nútz der láß merck hin nách
Nur versatzstückweise wurden in den Aderlass-Abschnitt eingearbeitet:
Regel der Gesundheit Kap. 71:
Von Galyan ein Capitel
→ Cod. 3085 (fol. 32r):
ES ist zw wissen von dem nútz der láss
7.9.3 24-Paragraphen-Text
Der 24-Paragraphen-Text stellt einen Teil des Oberdeutschen Aderlaßbüchels dar. In diesem Kurz-
traktat sind die Venen des menschlichen Körpers verzeichnet, die sich zum Aderlass eignen. Durch
das Lassen an bestimmten Venen können spezifische Beschwerden gelindert bzw. geheilt werden.
36
Der Text geht auf Avincennas De phlebotomia zurück und findet sich seit dem 14. Jahrhundert in
landessprachlichen Bearbeitungen. Häufig gibt es in den Schriften auch eine Aderlass-Grafik, die
das sogenannte Lassmännlein zeigt.
Die Überlieferungen des Textes sind vielfältig und weichen erheblich voneinander ab.87 Un-
terschiede sind sowohl im Wortlaut als auch in der Anzahl der Paragraphen gegeben. Im Cod. 3085
werden 36 Lass-Stellen verzeichnet, wohingegen in einer Münchner Handschrift88 53 Lass-Stellen
genannt werden.
7.9.4 Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland
Im Cod. 3085 finden sich Teile des Arzneibuchs Ortolfs von Baierland. Das Kapitel 16 und der An-
fang des Kapitels 73 sind in der Wiener Handschrift überliefert, allerdings nicht wortgetreu. Kapitel
16 wird vom Kompilator – im Gegensatz zu den meisten anderen Handschriften, die diesen Traktat
übernommen haben – Galen zugeschrieben und nicht Almansor, der ansonsten als Autorität genannt
wird.89 fol. 30v gibt das Kapitel 16 des Arzneibuchs fast wortgetreu wieder, während das Kapitel 73
nur unvollständig übernommen wurde. Es fehlen hier die Paragraphen 13b, 14, 18b sowie 19 aus
Ortolfs Arzneibuch.90
87 Vgl. Gundolf Keil: ‚Vierundzwanzig-Paragraphen-Text‘. In: 2VL, Bd. 10, 1999, Sp. 334–339. 88 München, Bayrische Staatsbibliothek, Cgm 5499. 89 Vgl. Boot, Ortolfs Phlebotomie, S. 152. 90 Vgl. ebda, S. 122.
37
8 Editionsgeschichte des Cod. 3085, fol. 1r–39v
Die Forschung hat sich bislang wenig mit dem Iatromathematischen Hausbuch des Cod. 3085 be-
schäftigt. Auszüge des Hausbuchs wurden in folgenden Arbeiten veröffentlicht:
Planeten-Traktate (fol. 19v–24v): Stegemann91, HWA, Bd. 7, Sp.113–114, 137–138, 169–
170, 185–186, 212–214, 249–250.
Merkur-Verse (fol. 24v–25r): Stegemann, HWA, Bd. 7, Sp. 289.
Prosatext Mond (fol. 25v): Stegemann, HWA, Bd. 7, Sp. 263.
Mond-Verse (fol. 25v–26r): Müller, Mondwahrsagetexte, S. 271.
Die Illustrationen des Iatromathematischen Hausbuchs des Cod. 3085 sind in folgenden Arbeiten
abgedruckt:
Planeten-Bild/Planetenkinder-Bild (Venus) (fol. 24r) Schwarz-Weiß-Druck: Müller, Mond-
wahrsagetexte, S. 272.
Aderlassdarstellung (fol. 30r): Gross92, Illustrationen, S. 332.
Badender Mann (fol. 34v): Gross, Illustrationen, S. 340.
Planeten-Bild/Planetenkinder-Bild (Merkur) (fol. 25r): Gross, Illustrationen, S. 344.
Meisterbild/Tierkreiszeichen/Monatsbild (September) (fol. 8r): Gross, Illustrationen, S. 345.
Ein Problem, mit dem sich der Leser/die Leserin der Stegemann’schen Teiledition konfrontiert
sieht, ist, dass Stegemann sein Editionsprinzip nicht darlegt. Infolgedessen muss der Benutzer/die
Benutzerin die verschiedenen Superskripte, die in der Teiledition verwendet werden, selbst zu ei-
nem Codierungssystem zusammenstellen. Da das Faksimile in synoptischer Darstellung fehlt, sind
die LeserInnen völlig auf Stegemanns Transkription angewiesen. Diese ist jedoch, wie schon er-
wähnt, in ihrer Systematik nicht offengelegt.
Bei der Durchsicht des abgedruckten Textes zeigt sich ein sehr ‚konfuses‘ Bild. Prinzipiell lag
dem Editor wohl an einer möglichst konkreten Codierung, die jedoch nicht konsequent durchge-
führt wurde. Das typografische Inventar, dessen er sich zur Wiedergabe bedient, reicht vom geraden 91 Viktor Stegemann: ‚Planeten‘. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. von Hanns Bächtold-Stäub-
li, unter Mitwirkung von Eduard Hoffamnn-Krayer. Bd. 7. Berlin, Leipzig: de Gruyter 1935/1936, Sp. 36–294. [Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens wird in weiterer Folge zitiert als: HWA, Bd.-Nr., Sp.].
92 Hilde-Marie Gross: Illustrationen in medizinischen Sammelhandschriften. Eine Auswahl anhand von Kodizes der Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte des ‚Arzneibuchs‘ Ortolfs von Baierland. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrgs. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Reichert 1993. (= Ortolf-Studien. 1. Wissensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 172–348.
38
Strich über Buchstaben (Titulus planus), Trema, Tilde, Zirkumflex, einzelnen hochgestellten Punk-
ten, umgekehrten Breven bis zu hochgestellten Kommata, um die Superskripte der Handschrift dar-
zustellen. Weiters werden als Mittel der Interpunktion Schrägstriche, Kommata und Satzendpunkte
verwendet. Eine Kennzeichnung der Rubrizierungen (gestrichelte Majuskeln) oder der Initialen er-
folgt nicht. Die Groß-/Kleinschreibung der Handschrift wird nicht überall beibehalten. Graphvari-
anten werden nicht verzeichnet. Die Darstellung der Superskripte ist äußerst inkonsequent, ebenso
die von Stegemann normalisierte Interpunktion. Nur bei fol. 19v werden die Zeilenenden mit
Schrägstrich angezeigt, in weiterer Folge nicht mehr. Dafür folgt eine eingeführte Interpunktion auf
fol. 20v mit Satzendpunkten und Kommata, die dann ab fol. 21v kommentarlos wieder aufgegeben
wird. Widersprüchlich ist auch die Worttrennung bzw. Wortzusammenschreibung, die teils erfolgt,
teils nicht. Tremata und andere Superskripte, u/v-Ausgleich und Abbreviaturen bzw. deren Auflö-
sungen sind nach einem nicht nachvollziehbaren System nur teilweise gesetzt.
Zur Verdeutlichung werden in der nachfolgenden Übersicht einige Beispiele angeführt. Dabei steht
Stegmanns Transkription an erster Stelle (recte), die Transkription der vorliegenden Edition in der
Basisstufe, sofern sich Abweichungen ergeben, an zweiter Stelle (kursiv):93
Inkonsequente Übernahme von Tremata:
19v01 vnsawber – vn#-§aw#:ber
20v06 dy – dy#:, aber 21v06 leẅt, 19v10 dӱ
19v06 gut – gu#:t, aber 19v03 vntügent
19v03 planet – pla#:net, hert – he#:rt
19v17 nat(ur) – na#:t#“
Inkonsequente Übernahme von Superskripten:
20v06 manen – ma#-nen, aber 19v09 mānen
20v05 den – de#-, aber 19v10 dē
21v06 zornig‘, aber 21v18 gar – gar2#+
21v06 geren , aber 21v10 den – den#-
u/v-Ausgleich:
19v08 untügenthaffter – vntu#:gen#-thaffter#‘
20v04 Jupiter – IVp#~i#·ter#+
93 Codierungstabelle siehe unter Kap. 15 ‚Alphabetisches Graphinventar‘ und Kap. 16 ‚Graphinventar
Sonderzeichen‘. Näheres zur Basistransliteration siehe Kap. 11 ‚Editionskonzept der ‚dynamischen Edition‘‘ und Kap. 13 ‚Editionskriterien Basistransliteration‘.
39
Worttrennung/Zusammenschreibung:
19v15 vnkeusch – vn keusch
Unmarkierte Auflösungen:
19v20 staynpock – §tay#-pock, aber 19v16 frauē
20v15 waz – wz; 22v26 das – dz
22v06 natürlichen – natu#:r2li#·chn#-, aber19v12 swärtzm
22v30 natur – nat#“, aber 19v17 nat(ur) – na#:t#“
24v03 Mercurius – M!Er2cu#°i#9
24v06 von – vn#-, aber 19v14 vn
24v07 gar – ga#°
Allgemeine Transkriptionsabweichungen bzw. Lesefehler:
19v11 am – an#-
20v18 fisch – vi#·§ch
21v11 wedent – wedeut
21v13+21v15+21v17 Dan –!Ban
21v20–21 meloncolia – meloncoli#·ci#·
21v21 stile –§ti#·ll
21v22 au –an#-
21v22 jars – i#·ars
21v25 Wan – !Ban
21v27 na – ma#-
21v32 vnstchauig – vn§chani#·g
21v33 vn sabrkait –vn#:§alikai#·t
22v08 leittn – leu#:ttn#-
22v21 werde n t – wer#‘dn#-t
22v23 herd – he2r2#‘
22v29 zaichen – zai#·chn#-
23v18 aüß – au#:§s
23v21 senffmütig – senfft mu#:ti2g
23v23 tan tzen – tan#-tzn#-
24v03 seinet – §ei#·ner#°
24v04 aynem – aynnem
40
24v05 pöß – po#:§s
24v08 weiß – wei#·§s
24v13 Dey – !Dy#:e
24v14 grösz end – gr2o#:s zend
25v06 richtet – vi#·chtet
25v05 Dan – !Ban
25v08 wan – !Ban
25v10 Da omb – !Dar2#+ v#-b
25v14 anderer – andern#-
25v24 gemyncklich – gemayn#-ckli#·ch
Die edierten Passagen von Stegemann finden sich eingebunden in den Lexikonartikel ‚Planeten‘des
Handwörterbuchs des deutschen Aberglaubens94. Die Intention für einen Textabdruck kommt also
nicht aus paläografischen oder literaturwissenschaftlichen Bestrebungen heraus, sondern hat andere
Hintergründe. Umso verwirrender ist die widersprüchliche Transkription. Wäre es Stegemann um
die rein inhaltlichen Aspekte des Textes gegangen, so hätte er viele der paläografischen Informa-
tionen getrost unterschlagen können, da diese zum Textverständnis nur bedingt nötig wären. Da
jedoch die Editionsprinzipien nicht bekannt sind, lassen sich auch keine weiteren Aussagen zur Sys-
tematik seiner Transkription machen. Was dieses Beispiel einer nicht-transparenten Transkription
jedoch verdeutlicht, sind die enormen Vorzüge, die das Konzept der ‚dynamischen Edition‘ bietet.95
Bei Müller findet sich ein Abdruck des gereimten Mond-Textes (fol. 25v–26r). Ihre Transkription
„erfolgt nach den Richtlinien für Editionen innerhalb der Reihe ‚Deutsche Texte des Mittelalters‘
unter Ausschaltung des Paragraphen 2, nach dem orthographische Eigentümlichkeiten sachgemäß
gemildert werden sollen.“96 Es handelt sich also um eine buchstabengetreue Wiedergabe, die diakri-
tische Zeichen sowie unveränderte Groß- und Kleinschreibung aufweist. Abkürzungen wurden auf-
gelöst, deutlich erkennbare Fehler ausgebessert. Moderne Interpunktion wurde nur dort, wo der
Sinnzusammenhang leichter durchschaubar werden sollte, mittels Semikolon, Doppelpunkt und
Satzendpunkt eingeführt. Weiters legt Müller ihre Editionskriterien bezüglich mehrerer Quellen
offen, beschreibt ihr Vorgehen bei Absätzen, Lücken, Umstellungen etc.
94 Stegemann, ‚Planeten‘, Sp. 36–294. 95 Zum Editionskonzept der ‚dynamischen Edition‘ siehe Kap. 11. 96 Müller, Mondwahrsagetexte, S. 174. Es handelt sich hierbei um die Editionsrichtlinien der Reihe Deutsche Texte
des Mittelalters, von Arthur Hübner aktualisiert in Bd. 38. – Johannes Rothe: Das Lob der Keuschheit. Nach C. A. Schmids Kopie einer verschollenen Lüneburger Handschrift. Hrsg. von Johannes Rothe/Hans Neumann. Berlin: Weidmann 1934. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 38.) S. V–IX.
41
Im konkreten Fall der edierten Mond-Verse werden die Nasalkürzungen aufgelöst, der r-Ha-
ken wird wiedergegeben. Superskripte, wie beispielsweise Tilden, die vermutlich keine lautverän-
dernde Funktion besitzen, sind abgedruckt. Tremata über Graphen sind ebenfalls als solche abge-
druckt. Graphvarianten, Strichelungen oder Initialen sind nicht berücksichtigt bzw. als solche mar-
kiert.
Transkriptionsabweichungen bzw. Lesefehler, die bei der Qualitätsprüfung zu Tage traten:
25v35 samt – §ei#·n
25v39 zwelff – zw#:elff
26r03 ründ – r2o#:t
26r03 graẅ sainn – gr2aw#:§am#-
Anhand der beschriebenen Editionskriterien lässt sich die Transkription gut nachvollziehen und
wirft nur wenige Fragen auf.
42
9 Kodikologische Beschreibung des Codex 3085
Die Beschreibung des Codex folgt den Richtlinien zur Handschriftenkatalogisierung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft.97
Zur Beschreibung des Codex wird in erster Linie der Online-Katalog manuscripta.at – Mittel-
alterliche Handschriften in Österreich herangezogen.98 Ergänzungen bzw. Abweichungen, die sich
in anderen Verzeichnissen finden, sowie eigene Beobachtungen werden in den Fußnoten
kommentiert.
Aufbewahrungsort, Signatur Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3085
Sachtitel Sammelhandschrift mit verschiedenartigen Texten (deutsch)
Beschreibstoff/Blattzahl/Format Papier III, 221, III* Bl. 265×195
Datierung 1475: fol. 127r Anno 1475 etc.; fol. 218r Anno domini etc. 1475
Lagen
Lagen: 3III + (VI-3) 9 + 9.VI117 + V127 + III133 (?) + V143 + 2145 (?) + 2.VI169 + 1170 (?) + IV178 (?) + 3181 (?) + VI193 + V203 + VI215 + 6221 + 3III*. Die Lagenformel ist wegen der Neubindung und Restaurierung mit starkem Beschnitt des Buchblocks im 19. Jh. de facto mit einiger Sicherheit nur mithilfe der Wasserzeichenverteilung zu erstellen; die Zuordnung der Einzelblätter zu bestimmten Lagen ist nicht möglich.
Schäden Blatt 1–6 weisen Löcher auf; Blatt 9 Riss im oberen Drittel; mindestens die ersten vier Blätter fehlen99
Einband Halbpergamentband100, Bibliothekseinband des 19. Jh.s, 265×195101
Schriftraum schwankend 195/235×135/160
Zeilenzahl wechselnd102 32/50 Langzeilen
Schrift Eine Hand mit bisweilen stärker variierendem Duktus und wechselnder Schriftgröße, Bastarda103
97 Richtlinien Handschriftenkatalogisierung. Hrsg. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Unterausschuß für
Handschriftenkatalogisierung. 5. erw. Aufl. Neustadt an der Aisch: Schmidt 1992. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSKRICH.htm [02.09.2014].
98 Wien, ÖNB Cod. 3085 in: manuscripta.at – Mittelalterliche Handschriften in Österreich. [Online-Katalog]. Institut für Mittelalterforschung, Abteilung Schrift- und Buchwesen, vormals Kommission für Schrift und Buchwesen des Mittelalters. Zuletzt aktualisiert: 20.08.2012. URL: http://manuscripta.at/m1/hs_detail.php?ID=6007 [26.09.2014].
99 Siehe auch ‚Paläografische Beschreibung‘, Kap. 10.1.13 ‚Sonstige Besonderheiten‘. 100 Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften, S. 117. 101 Die genauen Maßangaben schwanken: 264×191 mm in: Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer
illustrierter Handschriften, S. 117, ebenso in: Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, S. 81. – 260×195 mm in: Handschriftencensus, ‚Codex 3085‘. – 264×194 mm in: Franz Unterkircher: Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1451 bis 1500 (= Katalog der datierten Handschriften in Österreich. 3.) Wien: VÖAW 1974, S. 62. URL: http://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=CMDA3&ms_code=AT8500-3085 [09.09.2014].
102 33–44 Zeilen in: Handschriftencensus, ‚Codex 3085‘. – 41 Zeilen in: Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften, S. 81.
43
Mundart bairisch-österreichisch104
Tinte, Rubrizierungen
Der Text ist mit schwarzer Tinte geschrieben. Hervorhebungen, Überschriften, Schlusszeichen, einfache Lombarden, Fleuronné-Initialen, Strichelung vor Anfangsbuchstaben sind in roter bzw. blauer Tinte getätigt.
Miniaturen 158 kolorierte Federzeichnungen105
Inhalt fol. 1r–39v Iatromathematisches Hausbuch fol. 39v–45v Johannes von Indersdorf Tobiaslehre fol. 46r–127r Biblia pauperum (Armenbibel) fol. 128r–130v Sinnsprüche in Prosa und Versen fol. 131r–133v leer fol. 134r–144v Irmhart Öser: Epistel des Rabbi Samuel an Rabbi
Isaac fol. 145r–v leer fol. 146r–218r Jacobus de Theramo Belial fol. 218v–219r leer fol. 219v–220r Geistliche Rätsel fol. 220v leer106
Orientierungshilfen Die einzelnen Blätter sind nummeriert. Auf der Recto-Seite befindet sich in der oberen rechten Ecke die Folio-Nummer 1, 2 etc. Eine Wiederholung der Folierung findet sich in der linken unteren Ecke der Verso-Seite mit der Ergänzung verso 1v, 2v, etc. Die fortlaufende Zählung ist von zwei unterschiedlichen Bearbeitern vorgenommen worden und stammt nicht vom ursprünglichen Schreiber der Handschrift.
103 Ebda. 104 Ebda. 105 Handschriftencensus, ‚Codex 3085‘: 158 Federzeichnungen. 106 Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften, S. 117–125.
44
10 Beschreibung des Iatromathematischen
Hausbuchs ÖNB‚ Cod. 3085, fol. 1r–39v
10.1 Paläografische Beschreibung107
10.1.1 Schriftart
Die verwendete Schriftart des Codex konnte als Bastarda identifiziert werden. Diese Bestimmung
deckt sich mit der Datierung der Handschrift (es finden sich zwei Jahresangaben des Schreibers auf
fol. 127r Anno 1475 etc. und fol. 218r Anno domini etc. 1475). Die für die gesteigerte Handschrif-
tenproduktion des 15. Jahrhunderts bestimmende Bastarda stellt eine Verbindung aus der Textualis
und der zügigen, schnelleren Schreibweise der Kursive dar. Ihre wichtigsten Merkmale sind:108
verlängerte Schäfte von f und Schaft-s
einstöckiges a
teilweise durchgezogene kursive Schleife an den Oberschäften von b, h, l, k und d
m, n und r können, die aus einzelnen Federzügen zusammengesetzte Form der Textualis
enthalten
teilweise einfache Brechung von Rundungen
brezelförmiges Schluss-s
teilweise Unterscheidung von druckstarken Schäften und feinen Haarstrichen
mögliche Verzierung durch feine Striche oder Häkchen
Die Handschrift weist in den Tabellen ein ‚höheres‘ kalligrafisches Niveau auf. Einzelbuchstaben
(z. B. Lunarbuchstaben) sind in der Textura ausgeführt. Brechungen sowie Haar- und Schatten-
striche sind deutlich erkennbar. Typische Graphenformen, wie das zweistöckige <a> oder Majus-
kelformen, sind der Textura zuzuordnen.
12v08 05v12 01v20 14v08
107 Zu den verwendeten Fachtermini siehe Kap. 20 ‚Terminologisches Glossar‘. 108 Vgl. Karin Schneider: Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung. Tübingen: Nie-
meyer 1999. (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte: B. Ergänzungsreihe. 8.) S. 65 f.
45
10.1.2 Zahlzeichen
Als Zahlzeichen werden im Fließtext römische Ziffern verwendet, während sich im Tabellenteil des
Kalenders indisch-arabische Ziffern finden. Die heutige Form der arabischen Ziffern bildet sich erst
um 1500 aus, daher weichen v. a. die Ziffern 4, 5, und 7 von der heutigen modernen Schreibweise
ab.109 Zusätzlich zu den natürlichen Zahlen 0–9 ist ein Zeichen zu finden, das normalerweise als
Schriftsymbol für den Zahlenwert ‚½‘ steht.110 Es handelt sich um ein j-förmiges Zeichen ohne
Superskript und mit durchgestrichener Unterlänge (in kursiver Form als Schleife).
Zur funktionalen Abgrenzung und leichteren Unterscheidung von römischen Zahlzeichen und
Buchstaben sind in manchen Passagen rote Punkte vor und nach bzw. zwischen den einzelnen Zahl-
zeichen eingetragen.
33v36 01v13
10.1.3 Auszeichnungen/Verzierungen
Der Schreiber verziert häufig Buchstaben der ersten bzw. letzten Zeile einer Seite. Diese Zeilen
sind von den übrigen räumlich abgegrenzt, bieten mehr Schriftraum und stellen meist Überschriften
für das nächste Kapitel dar. Auffällig sind vor allem die übergroß ausgeführten Majuskeln (Zier-
majuskeln, meist in initialer Stellung) sowie eine gesteigerte Schleifenbildung und eine stark ge-
schwungene Form der Superskripte. Eine sprachliche Funktion weisen die so ausgeschmückten
Graphe nicht auf. Es handelt sich (insofern nicht als Initiale zu betrachten) um rein ästhetische
Merkmale, die in der Basistransliteration111 nicht im Einzelnen berücksichtigt werden, sondern nur
mit dem Hinweis auf eine ausgeschmückte oder vergrößerte Form versehen werden.
13v33
26v01
109 Vgl. Bernhard Bischoff: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin:
Schmidt 1979. (= Grundlagen der Germanistik. 24.) S. 224. 110 Überlegungen zur Bedeutung des Zahlzeichens ‚½‘ siehe Kap. 10.2 ‚Inhalt‘: ‚1r–11r Verso‘. 111 Näheres zur Basistransliteration siehe Kap. 13 ‚Editionskriterien Basistransliteration‘.
46
Verzierungen treten an einzelnen Graphen häufig in Form von Haarstrichen in der Ober-, meist je-
doch in der Unterlänge und hier in finaler Stellung auf. Neben den Initialmajuskeln finden sich
rubrizierte Buchstaben, die mit einem senkrechten roten Strich versehen sind (Satzmajuskeln),
oftmals in Kombination mit einer vergrößerten Schreibweise. Weitere Zierelemente stehen häufig
hinter Rubriken-Benennungen und bilden einen ‚ästhetischen‘ Abschluss, es handelt sich also um
Terminatoren.
11v17
10.1.4 Rubrizierungen
Insofern die Grundschriftfarbe schwarz ist, sind neben den Satzmajuskeln, die meist eine rote Stri-
chelung aufweisen, auch die et cetera-Abbreviaturen rubriziert.
13r23 13r35
Rote Tinte wird weiters für die Trennpunkte zwischen römischen Ziffern verwendet sowie für
Überschriften und die dazugehörigen Zeilen-Anschlusszeichen, falls die Überschrift in die nächste
Zeile hineinragt.
28v06–10
Eine Ausnahme bildet fol. 39v11–12: Hier ist der letzte Satz des Iatromathematischen Hausbuchs
durch einen roten Zierhaken gekennzeichnet – der Text selbst ist in schwarzer Farbe ausgeführt.
Dieser Haken soll wohl das Textende markieren. Nach einem freigelassenen Raum von gut des
Schriftspiegels, wo vielleicht eine Abbildung Platz finden sollte, beginnt auf derselben Seite die
Tobiaslehre (vgl. S. 8).
39v11–12
Im tabellarischen Kalenderteil werden ganze Rubriken durch rote Farbgebung hervorgehoben (teils
wohl aus Layoutgründen, siehe fol. 12r) sowie einzelne Eintragungen (besonders bei Heiligen-
namen zu beobachten).
47
10.1.5 Zierinitialen
Kapitelanfänge und Abschnitte werden mit Zierinitialen eingeleitet. Abhängig vom Gliederungs-
prinzip finden sich bei Kapitelanfängen meist Fleuronné-Initialen, während kürzere Abschnitte häu-
fig eine einfachere Form von Zierinitialen aufweisen. Im Kalenderteil wechselt die Farbgestaltung
der Lombarden regelmäßig ab, ebenso wie die Farbgebung der Versalien bei Aufzählungen. Die
Fleuronné-Initialen kommen mit und ohne Umrandung vor und variieren in der Gestaltung des
Außenmotivs bzw. des Binnenfeldes.
32v20–24 13r01 27r32 02v03–10
10.1.6 Linierung
Die Blätter der Handschrift sind horizontal und vertikal liniert bzw. gerahmt. Auf jeder Seite zu
finden ist die äußere Umrahmung des Schriftraums mit einer doppelten Linienführung, die an den
Schnittpunkten weitergeführt wird. Je nach Blatt wird der Schriftraum nochmals durch Linierungen
in kleinere Einheiten unterteilt. Die Illustrationen sind meist doppelt gerahmt und weisen eine ein-
heitliche Größe und Ausführung auf (Gelehrtenporträts, Tierkreiszeichen mit Medaillon-Umfassung
etc.). Das Raster der Tabellen ist mit einfachen und doppelten Strichen durchgeführt. Im Fließtext
selbst findet sich keine Zeilenlinierung.
10.1.7 Foliozählung
Es finden sich eine bzw. zwei fortlaufende Nummerierungen der Blätter, die von zwei unterschied-
lichen Händen, die nicht dem Schreiber des Textes zuzuordnen werden konnten, stammen. Außer-
halb des gekennzeichneten Schriftraums, in der oberen rechten Ecke der Vorderseite jedes Blattes,
sind arabische Ziffern zu finden, während die Rückseite durch eine Nummerierung an der linken
unteren Ecke mit arabischen Ziffern und der Verso-Angabe gekennzeichnet ist. Auf fol. 2r ist im
letzten Drittel des rechten Blattrands wohl versehentlich von anderer Hand 2v notiert.
48
10.1.8 Problemzonen der verwendeten Schriftart
10.1.8.1 Minuskel versus Majuskel
Problematisch stellt sich die Unterscheidung zwischen Minuskeln und Majuskeln dar, besonders in
Fällen, in denen keine eigene Majuskelform zur Verfügung steht. Dies betrifft vor allem die Buch-
staben <l/L>, <v/V> und <z/Z>. Diese Graphe sind häufig weder anhand ihrer Größe noch anhand
ihrer Stellung im Satzgefüge als eindeutige Majuskeln zu erkennen, sofern sie nicht vom Schreiber
rubriziert wurden.
Während die Unterscheidung <d/D> aufgrund des zweimaligen Ansetzens der Feder getroffen
werden konnte (daraus ergibt sich beim Majuskel-d eine Überlappung der Strichführung, sodass im
Bauch der Auslauf zu sehen ist (rechtes Beispiel 28v07), fehlt insbesondere bei <v/V> und <z/Z>
ein solcher Anhaltspunkt.
28r32 28v07
10.1.8.2 Schaft-s versus f
Zwischen Schaft-s und f besteht immer dann eine grafische Konvergenz, wenn die Graphenfolge
<ft> vorliegt. In diesem Fall wird der allfällige Querstrich im Schaft des f nicht oder nur unzureich-
end gesetzt. Hingegen ist bei der Graphenfolge <fft> der Querstrich stets deutlich durch beide f-
Schäfte gezogen.
14r31 lufti#·g 27r22 luft
22v17 li#·§ti#·g
14r12 lufftes
10.1.8.3 Verbindung <ct> mit nachfolgendem Graph
Nicht immer eindeutig konnte allein anhand des grafischen Erscheinungsbildes die Unterscheidung
zwischen <c> und <t> getroffen werden. Wenn der Schreiber die Verbindung des nachfolgenden
Graphen ‚zu hoch‘ bzw. ‚zu tief‘ ansetzt, ist eine Differenzierung kaum möglich. Die Zweifelsfälle
konnten meist durch den Kontext (auf der semantischen Ebene) geklärt werden.
10rc1 chumen 02ra19 chalt 15r24 thu#:t
49
10.1.9 Schaft-s und rundes s
Bis auf eine Ausnahme ist die Verwendung von Schaft-s und rundem s umgebungsabhängig.
Schaft-s findet sich am Wortanfang sowie im Wortinneren, während rundes s in finaler Stellung
steht.
39r04
Im Kalenderteil treten beide s-Varianten auf. Hier sind sie funktional im Rahmen der Gliederung
bzw. Zählung.
10.1.10 Ligaturen
Bedingt durch den kursiven Schrifttyp finden sich zahlreiche Ligaturen, die nicht gesondert codiert
werden, sondern hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgelistet sind – Abbildungen dazu fin-
den sich im Graphinventar112: <be>, <ch>, <ck>, <cz>, <de>, <do>, <ff>, <fl>, <ft>, <ge>, <pp>,
<sch>, <st>, <sz>, <th>, <tl>, <tt> und <tz>.
10.1.11 Super- und Subskripte
In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Superskript‘ im ursprünglichen lateinischen Sinn der Wortbildung
verwendet (lat. superscribere ‚darüber schreiben‘). D. h., alle formal isolierbaren, unselbstständigen
Schriftelemente, die sich über einem Basisgraph befinden, zählen zur Kategorie der Superskripte,
unabhängig davon, welche Funktion ihnen zukommt.
Unter diese Definition können Diakritika fallen – also Schriftelemente, die lautlich-phonemi-
sche Unterschiede wiedergeben (der i-Punkt wird mit zu den diakritischen Zeichen gezählt, obwohl
ihm keine lautdifferenzierende Funktion zukommt) –, sofern sie sich über einem Basisgraph be-
finden. Genauso werden Abbreviaturen, die über einem Basisgraph stehen, auf der grafischen Ebe-
ne als Superskripte bezeichnet, analog Abbreviaturen unterhalb eines Basisgraphs als Subskript (lat.
subscribere ‚darunter schreiben‘).
Formal können Abbreviaturen und diakritische Zeichen zusammenfallen, wie beispielsweise
das tildenförmige Superskript, welches z. B. über <a> als Signal für Vokalabtönung auftritt, jedoch
auch als Kürzungszeichen für Konsonanten eingesetzt wird. In den folgenden Kapiteln werden die
einzelnen Phänomene zum einen in ihrer grafischen Realisation beschrieben und zum anderen nach
ihrer funktionalen Natur besprochen.113
112 Siehe ‚Graphinventar Sonderzeichen‘, Kap. 16.3 ‚Ligaturen‘. 113 Näheres zur Problematik der Superskripte wird in Kap. 12.2 ‚Untersuchung der Superskripte‘ erläutert.
50
10.1.11.1 Diakritika
Unter ‚Diakritika‘ verstehen sich unselbstständige Schriftelemente, die nur in Kombination mit
einem primären Schriftzeichen auftreten. Das Diakritikum steht nicht für den Sprachlaut, sondern
ist in Kombination mit dem Basisgraph ein phonologisches Merkmal des Sprachlauts oder zeigt
einen besonderen Akzent an. Die diakritischen Zeichen können unter, über oder an einzelnen
Graphen angebracht sein und punkt-, strich-, häkchen- oder kringelförmige Gestalt haben. Im Iatro-
mathematischen Hausbuch finden sich nur Diakritika, die über den Basisgraphen stehen.
Der i-Punkt ist vom Schreiber nicht konsequent eingesetzt, sondern findet sich etwa in 92 % der
Fälle. Ähnlich verhält es sich mit dem Punkt über <j>.114 Er ist – wie gesagt – kein lautdiffer-
enzierendes Element, sondern wurde seit dem 14. Jahrhundert allmählich zur grafischen Unter-
scheidung des <i> von anderen ähnlich gebauten Buchstaben <c, n, m…> eingeführt.115
Tremata finden sich über den Vokalen <a>, <e>, <o>, <u/v/w> sowie über dem <y>. Statt der
punktförmigen Ausführung gibt es in wenigen Ausnahmen auch eine strichförmige Variante. Diese
Abweichungen werden in der Basistransliteration gesondert codiert. Ebenfalls eigens codiert ist die
Variante der Superskripte, die aus der ursprünglichen Überschreibung eines Vokals durch ein e
hervorgegangen ist.
13r15 13r20 24v09
Eine weitere Form der Superskripte über Vokalen ist ein tildenförmiges Zeichen, das hauptsächlich
über <a> zu finden ist, jedoch auch über <e> und <o> sowie vereinzelt über <u>.
01ra07 14v17
10.1.11.2 Abbreviaturen
Das gleich ausgeführte Tildenzeichen findet sich auch über Konsonanten. Weiters tritt ein Zeichen-
bestand aus bogenförmigen (umgekehrtes Breve) sowie strichförmigen Superskripten auf, die teil-
weise einfache Nasalkürzungen kennzeichnen, und der r-Haken, der als redundant zu betrachten ist.
Die vom Schreiber verwendeten Abbreviaturen stellen teils Suspensionen, teils Kontraktionen
dar und reichen von den schon beschriebenen Strichformen über Schlaufenbildung am Wortende,
s-, c- oder Ω-förmige Haken, enge leicht gebrochene Tilden, z-förmige End- und Silbenkürzungen, 114 Die lautliche Realisierung der Grapheme <i> und <j> in mittelhochdeutschen Texten, ähnlich wie die lautliche
Realisierung der Grapheme <u, f, v, w>, war häufig vom Kontext abhängig. So können <i> und <j> wechselweise sowohl ein /i/ als auch ein /j/ repräsentieren. Vgl. Hilkert Weddige. Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. 6. Aufl. München: Beck 2004, S. 11.
115 Vgl. Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde, S. 49.
51
doppelte gerade Striche bis hin zu Kürzungen (per/pro) durch Subskripte in Form von Querstrichen
in der Unterlänge bzw. bei <pp> durch schrägen Abstrich.
01ra11 kalt(er) 02ra22 pesund(er)lich 06v08 m(a)r(t)er
28r28 p(ro)phet 04rb04 ap(er)cio 03rb03 s(ed)
In der vorliegenden Handschrift wurden einige gängige Kürzungszeichen des lateinischen Schrift-
wesens übernommen.116 So finden sich die häufig verwendeten Zeichen für die Vorsilben per, prae,
pro (p mit durchgestrichener Unterlänge) und die Nachsilben -ur und -us (z-förmiges Kürzungshäk-
chen), die auch auf die entsprechenden Nachsilben in deutschen bzw. eingedeutschten Wörtern
übertragen wurden. In gekürzter Form wird das häufig verwendete Wort ‚und‘ (analog zum gleich-
lautenden, aber selbstverständlich nicht bedeutungsgleichen lateinischen unde) oft mit Nasalkür-
zung als n geschrieben, daneben aber auch in der ungekürzten Form. Ebenfalls in gekürzter und
ungekürzter Form nebeneinander sind die Wörter ‚das‘ (dz) und ‚was‘ (wz) anzutreffen – eine
Schreibung die im 15. Jahrhundert üblich war.117
10.1.12 Interpunktion
Die Handschrift weist fast keine Interpunktion auf. Es finden sich nur vereinzelt Virgeln (insgesamt
sechsmal, wobei zweimal statt des einfachen Haarstrichs ein doppelter Haarstrich steht), die teils
Versgrenzen anzeigen, in einem Fall das Zeilenende markieren und teilweise zur Abgrenzung von
Sinneinheiten dienen könnten. Dabei könnte es sich jedoch auch um reine Zierelemente handeln,
die der Schreiber verwendet hat. Andere Satzschlusszeichen finden sich nicht. Falls vereinzelt
Punkte auftauchen, so sind diese sicher nicht als funktionale Elemente zu sehen, sondern aufgrund
falschen Ansetzens entstanden. Eine Worttrennung wurde vom Schreiber nur neunmal durchgeführt
(zwei parallel verlaufende Querstriche am Zeilenende) und richtet sich nicht nach Silbengrenzen.
Andere Interpunktionssymbole treten nicht auf.
116 In diesen Fällen stützt sich die Auflösung vornehmlich auf Adriano Cappelli: Lexicon Abbreviaturarum. Wörter-
buch lateinischer und italienischer Abkürzungen wie sie in Urkunden und Handschriften besonders des Mittelalters gebräuchlich sind, dargestellt in über 14000 Holzschnittzeichen. 2. verb. Aufl. Leipzig: Weber 1928. URL: http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html [27.08.2014].
117 Vgl. Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde, S. 88 f.
52
10.1.13 Sonstige Besonderheiten
Fol. 1r weist in Zeile 1rc05–06 eine Tilgung auf, die vermutlich vom Schreiber selbst vorgenom-
men wurde. Dieser Vers – Ber frauen dan mynet !Der wedorff das im gelinget – ist mit schwarzer
Tinte ausgestrichen. In der Parallelüberlieferung des Kodex Schürstab (fol. 7r/S. 23) heißt es an
dieser Stelle: Wer frauen denn ny:met daz kint dy vallent sucht gewinnet. Warum der Schreiber den
Vers getilgt hat, bleibt unklar.
Auf fol. 31r, 32r, 33r befinden sich am rechten Blattrand, auf fol. 33v am linken Blattrand und
auf fol. 32v am oberen Blattrand Marginalien, die aufgrund des Schrifttyps offensichtlich nicht aus
der Entstehungszeit der Handschrift stammen. Da die Handschrift offenbar stark beschnitten wurde,
lassen sich diese Marginalen nur mehr zum Teil auflösen. Insofern dies möglich war, findet sich ein
Hinweis in der Basistransliteration.
32v 32r
Die ersten 6 Blätter der Handschrift befinden sich in schlechterem Zustand als das restliche Manus-
kript. Es finden sich kleine Löcher, die sich durch mehrere Seiten ziehen. Schäden auf fol. 1r und 6r
sind im Zuge von Restaurierungsarbeiten durch Papierstreifen ausgebessert. Außerdem wurde der
Bund wegen des brüchigen Falzrandes auf fol. 3v, 4r und 9r durch Einfügen eines Papierstreifens
verstärkt. Blatt 9 weist einen Riss in der oberen linken Hälfte auf, der ebenfalls ausgebessert wurde.
Am Falz lässt sich erkennen, das mindestens 4 Blätter der ersten Lage fehlen.
10.2 Inhalt
fol. 1r–11r Kalender
Je zwei Seiten der Handschrift widmen sich einem Monat nach folgendem Schema:
Recto-Seite
Der Schriftraum der Vorderseite ist dreigeteilt: Eine Querlinie teilt ihn in zwei Hälften, wobei die
obere Hälfte durch eine senkrechte Linie nochmals in zwei gleichgroße Rechtecke unterteilt ist. In
jedem der drei Bereiche finden sich ein Textblock und eine Illustration. Die drei Bereiche werden
im Folgenden mit den Buchstaben a (linker oberer Bereich), b (rechter oberer Bereich) und c (unte-
rer Bereich) bezeichnet.
53
a. Dictum eines Meisters, wie man sich im betreffenden Monat verhalten soll, was zu tun und
was zu lassen ist.
b. Kurzer, in lateinischer Sprache gehaltener Text über die Natur des Tierkreiszeichens, in dem
der beschriebene Monat steht.
c. Monatsverse in teils gereimter Form.
In jedem der Textblöcke finden sich Illustrationen passend zur Thematik:
a. Bild eines Meisters (obere linke Ecke, quadratische Umrandung, ca. 11 Zeilen hoch,
½ Schriftraumbreite einnehmend)
b. Bild des Tierkreiszeichens (Tierkreiszeichen-Medaillons in quadratischer Umrandung, ca.
11 Zeilen hoch)
c. Monatsbild ( des Schriftraums einnehmend)
Verso-Seite
Auf der Rückseite des Blattes befindet sich ein tabellarisch angelegter Kalender mit jeweils 10
Spalten und 31 bzw. 32 Zeilen zuzüglich einer Kopfzeile, die den Namen des betreffenden Monats
nennt, sowie die Tagesanzahl.
Die überlieferten Blätter beginnen mit dem Februartext, die Beschreibung des Januars sowie
die Kalenderseiten zu Januar und Februar sind nicht überliefert. Der Vergleich mit anderen Kalen-
darien legt nahe, dass sich auf den verlorenen Folios auch eine Beschreibung befunden haben
könnte, die dem Leser/der Leserin eine Erklärung zur Benutzung des Kalenders bot.118
Die Tabellen des Kalenderteils folgen einem regelmäßigen Aufbau:
Kopfzeile: Monatsname und Anzahl der Tage (rubriziert)
Sp. 1: Goldene Zahl (Zahlen 1–19 rubriziert)
Sp. 2: Vermutlich Stunden des Neu- oder Vollmondes (Zahlen 0–23): Die zwei Ausnahmen
in dieser Spalte (Mai 27 und August 33) deuten auf Verschreibungen bzw. Abschreibfehler
hin.
Sp. 3: Vermutlich Minuten des Neu- oder Vollmondes (Zahlen 1–59)
Sp. 4: Buchstaben (a–v): Spalte 4 ist nur für den März, April, Mai und Juni ausgefüllt. Die
Buchstabenanzahl wechselt zwischen 19, 16, 19 bzw. 20 Buchstaben. Der März (1v) beginnt
mit dem Buchstaben b und endet in der Aufzählung im April (2v) mit dem Buchstaben v (19
118 Es finden sich in den meisten Handschriften, die Kalendarien entnhalten, auch Erläuterungen, wie diese zu be-
nutzen sind, oftmals in Kombination mit dem Tafelwerk, das zur Berechnung bestimmter Gestirnkonstellationen benötigt wurde. So z. B. in den Handschriften: Zürich, Zentralbibliothek, C 54 – München, Bayrische Staats-bibliothek 4 Inc.c.a. 494m – Tübingen, Universitätsbibliothek, Md 2.
54
Buchstaben rubriziert). Anschließend beginnt eine neue Aufzählung mit den Buchstaben A
bis q (16 Buchstaben). Es folgen 5 Leerstellen auf fol. 2v. Auf fol. 3v beginnt die Buchsta-
benreihe nach 9 Leerstellen mit den Buchstaben b–v (19 Buchstaben rubriziert) und endet
nach neuerlichem Anfang mit A beim Buchstaben c. Die Reihe wird auf fol. 4v weiter-
geführt und beinhaltet dort die Buchstaben d–v (17 Buchstaben, insgesamt 20 Buchstaben).
Die verbleibenden 13 Stellen der Kolumne bleiben leer. Hier enden die Eintragungen in der
Spalte 4 für die gesamte Handschrift.
Worum es sich bei dieser Buchstabenfolge handelt, konnte aufgrund der unvollständigen
Quellenlage nicht erschlossen werden. Das Ordnungssystem, das der Schreiber hier anführt,
ist entweder obsolet, da die folgenden Monate nicht mehr über diese Informationen verfü-
gen, oder die Handschrift konnte eventuell nicht fertiggestellt werden. Falls es sich um eine
Abschrift handelt, besteht auch die Möglichkeit, dass schon die Vorlage nicht vollständig
war und der Schreiber folglich nur die in dieser Handschrift überlieferten Informationen
abschreiben konnte.
Sp. 5: Sonntagsbuchstabe (A–g): Das A ist jeweils als Majuskel dargestellt und abwechselnd
in roter bzw. blauer Tinte geschrieben.
Sp. 6: Römische Datierung (Zahlen 1–17 bzw. 19 rubriziert), mit Einträgen der Nonen und
Iden sowie in der ersten Zeile, ähnlich einer Überschrift für diese Kolumne, der lateinische
Monatsname
Sp. 7: leer: Die Kolumne ist sorgfältig gezeichnet, was ein Hinweis darauf darstellen könnte,
dass hier noch zusätzliche Informationen eingetragen werden sollten.
Sp. 8: Tagesheilige bzw. Festtage (teils rubriziert)
Sp. 9: Lunarbuchstaben (A–z), mit Doppelungen und unterschiedlichen Schreibweisen z. B.
rundes s und Schaft-s, 27–28 Einträge
Sp. 10: fortlaufende Tageszählung mit Hinweis auf das eintretende Sternzeichen (Zahlen 1–
30, mit Einträgen der Sternzeichen 30–31 Einträge). Bei den Monaten März, Juli und Sep-
tember ist zwischen dem Eintrag des Sternzeichens und dem Eintrag der Zahl 1 ein j-förm-
iges Zeichen ohne Trema und mit durchgestrichener Unterlänge (in kursiver Form als
Schleife) zu sehen, das normalerweise als ‚½‘ zu lesen ist. Es dient augenscheinlich als zu-
sätzliche Zahl in der Zahlenreihe. Da es sich nicht bei den Monaten Mai, August, Oktober
und Dezember befindet, ist nicht davon auszugehen, dass es sich um eine Kennzeichnung
von Monaten mit 31 Tagen handelt. Was dieses Zeichen im Speziellen in der fortlaufenden
Zählung bedeuten soll, bleibt unklar.
55
fol. 11v
Tabelle119 mit 21Spalten × 28 Zeilen, zuzüglich Kopfzeile
Kopfzeile: Überschrift (Aureus numerus), danach folgen die Zahlen 1–19.
Sp. 1: Beschriftung mit den Tierkreiszeichen.
Sp. 2–20: fortlaufende Reihung mit Lunarbuchstaben (insgesamt je 28 Einträge).
Sp. 21: Informationen zu günstigen oder ungünstigen Zeitpunkten (gut, böse, mittel).
Die Beschriftungen und einzelnen Spalten sind abwechselnd mit roter bzw. schwarzer Tinte
geschrieben.
fol. 12r
Tabula pro Intervallo für die Jahre 1469–1499, 9 Spalten × 33 Zeilen, zuzüglich Kopfzeile und in
Zeile 33 Beschriftungen für die einzelnen Kolumnen.
Kopfzeile: Überschrift (Tabula pro Intervallo)
Zeile 33: Beschriftungen der einzelnen Kolumnen (da der Blattrand hier beschnitten ist,
lassen sich Teile nur rekonstruieren)
Sp. 1: Anno domini: Jahresangabe in römischen Ziffern
Sp. 2: Die iarr zall: Jahresangabe in römischen Ziffern
Sp. 3: Anno domini: Jahresangabe in römischen Ziffern
Sp. 4: Sumtag pu […]: Die Sonntagsbuchstaben g–A in Reihenfolge, wobei 6 der 7 Buch-
staben in Sp. 4 zu finden sind. Ein Buchstabe immer in Sp. 5.
Sp. 5: Schalck iar: Arabische Ziffern 1–3 in Reihenfolge, an der Stelle der Ziffer 4 steht der
entsprechende Sonntagsbuchstabe der Sp. 4
Sp. 6: Dy wochen z[all]: römische Ziffern 5–9 ohne Reihenfolge
Sp. 7: Die ubrigen t[…]: römische Ziffern 0–6 ohne Reihenfolge
Sp. 8: Die gulden z[all]: arabische Ziffern der Goldenen Zahl 1–19 in Reihenfolge
Sp. 9: Schlussel: Buchstaben ohne Reihenfolge
Die Beschriftung der Tabelle ist abwechselnd in roter und schwarzer Tinte ausgeführt. Ebenso
wechselt die Schriftfarbe der einzelnen Kolumnen regelmäßig ab, mit Ausnahme der Sp. 5 und Sp.
9. Die Ziffern der Sp. 5 sind rot geschrieben, während die aus Sp. 4 eingefügten Sonntagsbuchsta-
ben in schwarz gestaltet sind. In Sp. 9 sind die Buchstaben ebenfalls in zwei Farben ausgeführt. Es
119 Laut Saxl dient die Tabelle zum Aderlass. Vgl. Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter
Handschriften, S. 118.
56
ergibt sich keine regelmäßige Anordnung, daher kennzeichnet der Farbwechsel wohl besondere
Hervorhebungen einzelner Buchstaben.
fol. 12v Kurztraktat zu den verworfenen Tagen
Ca. das erste Drittel des Schriftraums einnehmende Aufzählung von 21 Tagen, die als ‚verworfene
Tage‘ überliefert sind. Die Datumsangabe erfolgt durch die Benennung der Heiligentage.
fol. 12v–18v Zeichen des Tierkreises und ihre Kraft
Es folgen die Beschreibungen der einzelnen Tierkreiszeichen und ihr Einfluss auf die menschliche
Natur. Bis auf fol. 18r und 18v ist jedem Tierkreiszeichen eine Seite gewidmet. In der jeweils obe-
ren linken Ecke des Blattes befindet sich je ein Tierkreiszeichen-Medaillon in quadratischer Um-
randung, 17–18 Zeilen hoch, jeweils das erste Sechstel des Seitenspiegels einer Seite ausfüllend. Zu
sehen sind darauf die entsprechenden Tierkreiszeichen (13r Widder, 13v Stier, 14r Zwilling, 14v
Krebs, 15r Löwe, 15v Jungfrau, 16r Waage, 16v Skorpion, 17r Schütze, 17v Steinbock, 18r Wasser-
mann, 18v Fische).
Fol. 18r beginnt mit der Erläuterung zum Wassermann, gefolgt von der Ausführung über das
Zeichen der Fische, die erst auf fol. 18v endet.
fol. 18v–27r Planeten-Traktat/Planetenkinder
Mitte des Blattes 18v beginnt der Planeten-Traktat. Vorgestellt werden die sieben Planeten, ihr Lauf
durch das Sonnenjahr, die zugehörigen Planetenkinder und die Stundenregentschaft.
fol. 19r
Tabelle zur Stundenregentschaft, 8 Spalten à 13 Zeilen (Tages- und Nachtstunden)
Auf fol. 19r befinden sich eine zweigeteilte Tabelle, die Auskunft über die Stundenregentschaft der
einzelnen Sternzeichen gibt. Der obere Teil (Sp. 1–8/Zeile 1–13) beginnt mit einer Kopfzeile, wel-
che die Kolumnenbeschriftungen enthält.
Zeile 1 – Kopfzeile: Stunden des Tages, darauf folgen die Wochentage beginnend mit
Sonntag
Sp. 1: arabische Ziffern 1–12 in Reihenfolge
Sp. 2–8: jeweils das regierende Sternzeichen des Wochentages zur angegebenen Stunde
Zeile 14 – Kopfzeile: Stunden der Nacht, darauf folgen die Wochentage beginnend mit
Sonntag
Sp. 15–26: jeweils das regierende Sternzeichen des Wochentages zur angegebenen Stunde
57
Mit Ausnahme der ersten Kolumne, die durchgehend mit roter Tinte gestaltet wurde, wechseln rote
und schwarze Farbe regelmäßig ab, sodass ein Schachbrettmuster entsteht.
fol. 19v–26r
Jeweils zwei Seiten widmen sich einer Planetenbeschreibung.
Auf der Vorderseite des Blattes befindet sich eine Abhandlung in Fließtext, auf der Rückseite
finden sich Planeten-Bilder und Planetenkinder-Bilder. Die Dreiteilung des Schriftraums von oben
nach unten erfolgt im Verhältnis 2/5 : 1/5 : 2/5. Der erste Bereich wird jeweils vom Planeten-Bild
ausgefüllt. Die nackten Figuren sind mit einem Gestirn über der Scham und den jeweiligen
Attributen versehen. Das zugehörige Sternzeichen ist in einem Medaillon in der unteren linken
Ecke zu sehen. Den mittleren Bereich füllt ein gereimter Planetenkinder-Text, der über die Eigen-
schaften des unter dem jeweiligen Planeten geborenen Menschen Auskunft gibt. Im unteren Seiten-
bereich befinden sich Bilder, die den Planetenkindern gewidmet sind, welche in den für sie typi-
schen Tätigkeiten dargestellt werden.
Aufteilung: fol. 19v–20r Saturn mit Steinbock und Wassermann, fol. 20v–21r Jupiter mit
Schütze und Fische, fol. 21v–22r Mars mit Widder und Skorpion, fol. 22v–23r Sonne mit Löwe,
fol. 23v–24r Venus mit Stier und Waage, fol. 24v–25r Merkur mit Jungfrau und Zwilling, fol. 25v–
26r Mond mit Krebs.
fol. 26v
Vom Planetenlauf und ihrer Natur. Vom Sonnenlauf durch die zwölf Tierkreiszeichen des Jahres.
fol. 27r
Wetterprognostik anhand der Planetenlehre.
Vom Sonnenlauf durch die zwölf Tierkreiszeichen des Jahres.
fol. 27v
Leer.
fol. 28r–29v Komplexionslehre
Dieser Abschnitt widmet sich der Komplexionslehre. Jeweils eine Seite behandelt eines der vier
Temperamente. In der linken oberen Ecke der Seite (15–17 Zeilen hoch, jeweils das erste Sechstel
des Schriftraums einnehmend) befindet sich ein Komplexionen-Medaillon (28r Melancholiker, 28v
Phlegmatiker, 29r Sanguiniker, 29v Choleriker). Die Figuren sind mit ihnen zugehörigen Attributen
dargestellt.
58
fol. 30r–34r Aderlass-Traktat
Die folgenden Seiten behandeln ausführlich den Aderlass. Auf fol. 30r ist in der linken oberen Ecke
(19 Zeilen hoch, erstes Sechstel des Schriftraumes ausfüllend, im Medaillon mit umgebendem Qua-
drat) eine Aderlass-Szene zu sehen.
fol. 31v Tierkreiszeichenmann
Fol. 31v zeigt eine ganzseitige Illustration des sogenannten Tierkreiszeichenmanns. In die Figur in-
tegriert sind die Tierkreiszeichen, die passend zur jeweiligen Körperregion, die sie beeinflussen, an-
geordnet sind: am Kopf beginnend Widder, im Halsbereich Stier, auf den Armen sitzend Zwilling,
im Brustbereich Krebs, im Sternumbereich Löwe, im Bauchbereich Jungfrau, auf der Scham Skor-
pion, zwischen den Oberschenkeln Schütze, zwischen den Knien Steinbock, zwischen den Unter-
schenkeln Wassermann und unter den Füßen Fisch.
fol. 32v–34r
Aufzählung von insgesamt 36 Aderlass-Stellen inklusiver ihrer Indikationen.
fol. 34v–35v Baderegeln
Eingeleitet wird der Bade-Traktat mit einer die oberen 2/5 des Schriftraumes einnehmenden Bade-
szene. Eine Figur sitzt im Badezuber, während die zweite Figur Getränke anreicht. Anschließend
folgt eine ausführliche Abhandlung zum Badewesen.
fol. 35v–36r Schröpflehre
Im letzten Viertel des fol. 35v beginnt eine Erläuterung zur Schröpflehre, die auf fol. 36r endet.
fol. 36v
Leer.
fol. 37r–39v allgemeine Gesundheitsregeln
Fol. 37r zeigt als Einleitungszeichnung (obere 2/5 des Schriftraumes) ein Ordinationszimmer, in
dem ein Patient und ein Arzt bei der Harnschau zu sehen sind. Der Text behandelt die Verdauung
und den Einsatz von Klistieren zur Genesung bzw. Erhaltung der Gesundheit. Anschließend findet
sich auf fol. 37v eine kurze allgemeine Arzneimittellehre sowie ein Kurztraktat zu den Einflüssen
der Luft und des Atems auf die Gesundheit. Unterbrochen wird der Traktat durch eine ganzseitige
Illustration auf fol. 38r. In einem mittleren Kreis ist eine männliche Figur mit Stock und Rosen-
59
kranz zu sehen. Kreisförmig um ihn herum angeordnet die sieben Planetennamen sowie die vier
Winde, symbolisiert durch vier männliche Köpfe in den Blattecken. Auf fol. 38v beginnt die dazu-
gehörige Windlehre. Fol. 39r zeigt in der Titelillustration (obere 2/5 des Schriftraumes) einen
sitzenden Mann, der von zwei Musikern mit Saiteninstrumenten unterhalten wird. Der Text
behandelt die zufälligen Gedanken.
fol. 39v
Auf der letzten Seite des Iatromathematischen Hausbuchs findet sich ein Ausspruch Avicennas über
den Wert der Gesundheit.120 Den Textabschluss bilden die Worte: Vnd da mit ain ende Got der her
vns in sein reich sende Amen. Nach einer halbseitigen Lücke beginnt die Tobiaslehre des Johannes
von Indersdorf.
120 Vgl. Saxl, Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften, S. 123.
60
11 Editionskonzept der ‚dynamischen Edition‘ Die vorliegende Edition folgt dem von Andrea Hofmeister-Winter entwickelten Konzept der dyna-
mischen Edition121 und soll nicht nur für literaturwissenschaftliche bzw. realienkundlich-histori-
sche, sondern auch für paläografische sowie linguistische Forschungsanliegen verwertbar sein.
Ältere Editionen sind oftmals durch Normalisierungen gekennzeichnet, die zwar das Textver-
ständnis erleichtern, dies jedoch mit dem Verlust von wertvollen paläografischen und linguistischen
Informationen bezahlen. Hier setzt das Konzept der ‚dynamischen Edition‘ an, das sich mehrerer
Editionsstufen bedient, um so viele Informationen wie möglich zu erhalten, die im Laufe der edito-
rischen Arbeit aus der Handschrift gewonnen werden konnten.
Die Grundstufe der mehrstufigen Edition ist die Basistransliteration. Im Idealfall besitzt diese
erste Ebene einen maximalen Informationsgehalt und stellt die Grundlage für die weitere
Bearbeitung dar. In den nächsten Schritten erfolgt eine systematische Reduktion der originalen An-
gaben, wobei die einzelnen Reduzierungen transparent, d. h. für die Nutzer nachvollziehbar, fest-
gehalten werden. Damit wird nicht nur die editorische Arbeit sichtbar und somit die getroffenen
Entscheidungen verständlicher gemacht, sondern es ergibt sich gleichzeitig eine Kontrollinstanz für
den Benutzer/die Benutzerin, um bestimmte Maßnahmen des Editors/der Editorin nach eigenem Er-
messen nachzuprüfen.
Bestandteile der dynamischen Edition122:
Faksimile: Grundlage einer jeden dynamischen Edition ist ein technisch hochwertiges
Vollfaksimile, entweder in Buchform oder in digitalisierter Form. Die letzte Form bietet alle
technischen Annehmlichkeiten (Zoom, Filter etc.), die ein optimales Arbeiten ermöglichen.
Das Faksimile ‚erspart‘ nicht das In-Augenschein-Nehmen der Quelle, sondern erleichtert
die Arbeit des Editors/der Editorin und trägt zur Schonung des Originals bei. Zusätzlich ist
es als Begleitung und Ergänzung der Basistransliteration – zu der es am besten parallel
dargeboten wird – essenzieller Bestandteil der Dokumentation und oberste Kontrollinstanz
für die Benutzer.
Deskriptive Transliteration/Basistransliteration: Als erste Stufe der editorischen Bear-
beitung bietet die deskriptive Transliteration eine möglichst genaue Dokumentation des
handschriftlichen Befunds, mit möglichst wenigen Analysen und Interpretationen im Vor-
121 Vgl. Andrea Hofmeister-Winter: Das Konzept einer ‚Dynamischen Edition‘ dargestellt an der Erstausgabe des
„Brixner Dommesnerbuches“ von Veit Feichter (Mitte 16. Jh.). Theorie und praktische Umsetzung. Göppingen: Kümmerle 2003. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 706.)
122 Vgl. ebda, S. 100–109.
61
feld, die nicht hundertprozentig ausbleiben können, jedoch auf ein Minimum reduziert wer-
den sollten. „Die deskriptive Methode setzt genaues Beobachten der Phänomenologie und
der Struktur der Handschrift voraus, noch nicht jedoch eine Analyse derselben.“123 Den
maximalen Informationsgehalt, der in der deskriptiven Transliteration erreicht wird, gilt es
für die digitale Recherche möglichst leicht zugänglich zu machen. D. h., auf eine Verwen-
dung von nicht-suchbaren Sonderzeichen wird möglichst verzichtet, auch wenn diese die
Graphe in manchen Fällen besser darzustellen vermögen. Die Verwendung von abstrakten
Zeichen des modernen Druckschriftsystems ermöglicht es, das Faksimile genau zu doku-
mentieren. Durch den Codierungsschlüssel in Form des Grahpinventars ist die Transkription
für den Anwender/die Anwenderin nachvollziehbar.
Typografisch standardisierte Lesefassung: Als letzte Stufe der dynamischen Edition ist
eine Lesefassung vorgesehen, in der der Benutzer/die Benutzerin einen normalisierten Text
vorfindet, der sich dem Leser/der Leserin ‚leicht‘ erschließt. Der Grad der Normalisierung
ist nicht für jede Edition gleich, sondern hängt von den Umständen und der Intention des
Editors/der Editorin ab. Aufgrund der vorhergegangenen Editionsstufen, die den hand-
schriftlichen Befund genauestens dokumentieren, lassen sich tiefgreifende Vereinheitli-
chungen der Graphie vornehmen, die den Textzugang erleichtern, ohne einen Informations-
verlust darzustellen.
Die Grundlage der vorliegenden Edition bietet das Faksimile des Cod. 3085, das als technisch hoch-
wertiges Volldigitalisat der Österreichischen Nationalbibliothek Wien zur Verfügung steht.124 Eine
finale Durchsicht am Original konnte etwaige Zweifelsfälle der Transkription aufklären. Die dieser
Arbeit beigelegte CD-ROM umfasst neben dem Digitalisat der Handschrift sowohl die deskriptive
Basistransliteration als auch die benutzerfreundliche Lesefassung inklusive des Glossars.
123 Ebda, S. 101. 124 Codex 3085. 15. Jh./1475/1475. [Volldigitalisat.] Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Handschriften und
Nachlässe. URL: http://archiv.onb.ac.at:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2945848.xml&dvs=1409123188308~253&locale=de&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=1&usePid1=true&usePid2=true [25.08.2014].
62
12 Codierung
12.1 Prinzipien der Codierung
Grundsätzlich können zwei Möglichkeiten der typografischen Umsetzung der Handschrift genutzt
werden: konkrete (ikonische) oder abstrakte (symbolische) Codierung. Beide Varianten bieten Vor-
und Nachteile. Eine durchgehend konkrete Codierung bietet den Vorteil, die Rezeption durch die
Assoziationsstiftung erheblich zu erleichtern. Mit den Problemen, die sich aufgrund der mangeln-
den Kongruenz zwischen historischen Schriftsystemen und der modernen Druckschrift ergeben,
sind dieser Vorgehensweise jedoch Grenzen gesetzt, v. a. wenn die Edition auf Sonderzeichen
verzichten will, die sich zwar visuell eine Nähe zum Original herstellen, jedoch aufgrund der tech-
nischen Voraussetzungen nur über mühsame Suchfunktionen (in der elektronischen Fassung) aufzu-
finden sind. Eine vollständig abstrakte Codierung ist hingegen nur mehr mit Hilfe eines Codie-
rungsschlüssels übersetzbar, eignet sich aber hervorragend zur maschinellen Weiterverarbeitung.
Für die vorliegende Edition wurden beide Systeme miteinander kombiniert. In Bereichen, in
denen es zum handschriftlichen System eine Entsprechung in der modernen Druckschrift gibt,
wurden diese ‚typografischen Imitationen‘ gewählt, bei mehreren Graphvarianten zusätzlich ein
Nummerncode angefügt. Handschriftliche Zeichen, zu denen keine druckschriftlichen Entsprechun-
gen vorliegen (Nasalstrich, Abbreviatur-Zeichen etc.), wurden mit abstrakten Druckschriftsymbolen
versehen, die nicht oder nur bedingt auf typografischen Ähnlichkeiten basieren.
12.2 Untersuchung der Superskripte
Ein Problem bei der Transkription und der darauf aufbauenden Lesefassung stellen die Super- und
Subskripte dar, die der Schreiber verwendet. Um zu klären, welchen Super- und Subskripten gram-
matikalische oder semantische Bedeutung zufällt, wurden in der Basistransliteration die Haarstriche
der beiden r-Varianten mit aufgenommen und analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass es sich hierbei
um reine Zierelemente handelt, denen keine weitere Bedeutung zukommt. In Folge dieser Fest-
stellung habe ich mich entschlossen, die Haarstriche anderer Graphe nicht zu transkribieren, son-
dern diese Formvariante lediglich exemplarisch ins Graphinventar aufzunehmen.
Zum Teil herrscht Unklarheit über die Funktion der Superskripte, die der Schreiber in großer
Zahl eingesetzt hat. Es finden sich unterschiedliche Varianten von Superskripten, unabhängig von
ihrer Umgebung. Ein Strich über einem Buchstaben kann gerade ausgeführt sein, eine leichte
63
Krümmung nach oben oder nach unten aufweisen, Tildenform annehmen und über mehrere Buch-
staben reichen. Gerade in Passagen, in denen dem Schreiber mehr Platz zur Verfügung stand, oder
bei besonders gestalteten Abschnitten, wie beispielsweise Überschriften, sind die Übergänge zwi-
schen bedeutungstragendem Zeichen und Verzierung fließend. Der handschriftliche Text weist
allein bei den tilden- und strich- bzw. bogenförmigen Varianten über 3200 Exemplare auf. Die
Frage nach einer systematischen Verwendung der verschiedenen Zeichen konnte nur teilweise
beantwortet werden, da eine vollständige Analyse aller Superskripte in all ihren Formen in dieser
Arbeit nicht geleistet werden kann. Um ein mögliches Prinzip im Gebrauch des Zeicheninventars
feststellen zu können, wurden verschiedene exemplarische Untersuchungen vorgenommen.
12.2.1 Analyse Tilde <#~>
Graph Beleg- stellen
Kommentar
a 56 15× da#~s; 4× na#~ch; nur in 3 Fällen mit nachfolgendem Nasal (pla#~net; 2×kra#~nck)
n 26 10× nach bzw. vor <a> (3× plan#~et; kran#~ck; na#~ch); 3× in Verbindung über doppeltem Nasal <nn> (ge§chriebenn#~; !Sinn#~es); 3× bei mon#~ad (insgesamt 4× nach <o> evtl. Hinweis auf verrutschtes Sup.); 2× finale Stellung; 1× anlautend (n#~ach);
o 22 8× Z/zwo#~;
5× nachfolgend Nasal (davon 3× mo#~nad); 2× vermutlich abtönend (ho#~ch§te; gewo#~nlich)
e 16 1× nachfolgend Nasal (ne#~nt); 1× nachfolgend lateraler Aproximant (e#~lpogen)
m 14 4× flegm#~atico; 2× anlautend (mai§ter, miltz); 2× finale Stellung
u 7 4× Diphthong (au#~f; lau#~ffet; leu#~t); 2× nachfolgender Nasale
l 5 4× vol#~get (ohne Superskript 6× volget)
w 5 4× konsonantischer Gebrauch (zw#~eifellhaftig; zw#~ellf; yetw#~eder#‘; zw#~o); 1× halb-vokalischer Gebrauch(lingw#~e)
i 2 nachfolgend Plosive
t 2 1× macht#~;1× mi#˙tt#~er#° g 2 1× !Sa#-g#~wi#˙neus; 1× reg#~ni#˙r2endt z 1 §ytz#~e
p 1 I!Vp#~i#˙ter#+
Gesamt 159
Über Vokal 104
Über Konsonant 55
64
Die Analyse der tildenförmigen Superskripte zeigt, dass 104× die Verbindung mit einem Vokal
gegeben ist (65 %). In 10 Fällen folgt danach ein Nasal, auf den sich das Superskript ebenfalls be-
ziehen könnte. In den 55 belegten Stellungen über Konsonanten konnte keine Tendenz ausgemacht
werden, dass es sich in diesem Fall um eine beabsichtigte Konsonantendopplung handelt.
12.2.2 Analyse des Wortes gang bzw. der Wortverbindung Aufgang
in Verbindung mit den Superskript-Varianten <#-> und <#~> über <n>
Schreibweise Beleg
gang 14
gan#-g 9
gan#~g 3
Gesamt 36
Es ist kein signifikanter Unterschied zwischen der Schreibweise mit einfachem <n> und einer
Schreibweise mit <n> plus Superskript auszumachen. Ob die beiden Superskriptvarianten generell
als Nasalkürzung zu sehen sind, bleibt daher offen.
12.2.3 Analyse des Wortes Zeichen bezüglich des finalen <n>
Schreibweise Beleg
c/zaichen /zaichn (1×) 33
c/zaichen#- 31
c/zaichenn#- 6
c/zaichenn 1
Gesamt 71
Bei einer Analyse der finalen n-Schreibung lässt sich ein leichter Überhang bei der Nasaldoppel-
schreibung erkennen. Die Verdreifachung des finalen <n> ist aufgrund dieser Statistik sicher als
redundant zu betrachten. Damit ist 7× die Doppelung ausgeschrieben, 31× eine Doppelung durch
Nasalstrich gekennzeichnet und 33× die einfache Variante zu finden. Das Verhältnis von nicht-aus-
geschriebener und ausgeschriebener Doppelung zu einfacher Variante beträgt somit 52 % zu 48 %.
Eine definitive Aussage zur Norm-Variante lässt sich aufgrund dieses Ergebnisses nicht treffen.
65
12.2.4 Analyse des Wortes Monat in Verbindung mit den Superskript-Varianten <#->
<#~> und <#:>
Da es bei dieser Analyse um die Verwendung und Verteilung der Superskripte geht, werden die
verschiedenen Schreibvarianten bezüglich <d/t> nicht berücksichtigt, sondern in einer Kategorie
zusammengefasst. Ebenso unberücksichtigt bleiben Kasusendungen oder Zusammensetzungen.
Schreibweise Beleg
(-)monat(-)/monad/(-)monadt 13
mo#:nad 7
mon#:adt 2
mo#~nad 4
mon#~ad 3
mon#-ad 2
Brach-/Hey-/Bintermon 3
Brachmo#- 1
Gesamt 35
Insgesamt konnten 35 Belege in der Handschrift gefunden werden. 13× findet sich das Wort aus-
geschrieben ohne zusätzliche Superskripte (37 %). Von den verbleibenden 22 Belegstellen findet
sich 7× ein Trema über dem <o>, 2× ein Trema über dem <n> (hierbei könnte es sich auch um eine
unabsichtliche Verschiebung nach rechts handeln). 3× findet sich das Wort ‚unvollständig‘ ohne
markierte Kürzung (Brach-, Hey-, Bintermon), wobei sich in diesen Fällen nur spekulieren lässt, ob
die ausgeschriebene Form auf nhd. ‚-monat‘ oder ‚-mond‘ endet, da beide Varianten überliefert
sind. Zusätzlich mit Superskript markiert sind 10 Fälle, davon 5 mit Superskripten über dem <n>
(Variante #- 2× und #~ 3×) und 4× #~ über dem <o>. Ein Beleg zeigt ein Superskript über <o> in
finaler Stellung, hier kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Nasalkürzung handelt.
Auch in diesem Fall lässt sich anhand der Analyse nicht schlussfolgern, wann die ver-
wendeten Superskripte eine Konsonantendoppelung bzw. Ausfall kennzeichnen, wann sie eine laut-
verändernde Funktion besitzen oder ob sie vielleicht nur als Zierelement auftreten.
12.3 Conclusio zur Untersuchung der Superskripte
Die Form der Superskripte an sich lässt keine sichere Aussage über ihre Funktion zu. Der Schreiber
setzt formgleiche Zeichen über Vokale wie über Konsonanten. In einigen Fällen lässt sich mit Ge-
wissheit von einer Nasalkürzung ausgehen – nämlich dann, wenn der Nasal nicht ausgeschrieben
wurde –, in anderen Fällen bleibt es mehr als fraglich, ob der Schreiber tatsächlich eine doppelte
Konsonantenschreibung beabsichtigte und sich nach dem Ökonomie-Prinzip durch das Superskript
einen Buchstaben erspart hat. Gerade die Analyse bezüglich der Superskripte über <n> zeigt deut-
66
lich, dass sich noch nicht einmal eine Tendenz ablesen lässt, welche Schreibweise dem Schreiber
als Norm galt. Die Kürzungen können einen, aber auch mehrere Buchstaben betreffen. Bei
Passagen, in denen mehr Platz vorhanden ist, sind die Superskripte häufig vergrößert und ‚schwe-
ben‘ über den Wörtern, sodass sich nicht mit Sicherheit bestimmen lässt, zu welchen Graphen sie
gehören. Nur in wenigen Fällen lässt sich ein bestimmtes Zeichen einer bestimmten Kürzung zu-
ordnen, wie etwa die lateinische us-Abbreviatur, und auch hier gibt es Ausnahmen (06v02 Au-
g(ust)). Es gibt Abschnitte, in denen generell ein etwas ‚unsauberes‘ Schriftbild herrscht. Bedingt
ist diese Flüchtigkeit vermutlich durch ein erhöhtes Schreibtempo oder schlichte Ermüdung. In
diesen Bereichen fallen auch die Superskripte ‚verwaschener‘ aus oder sind in einigen – im
Vergleich zur Gesamtzahl – wenigen Fällen deutlich erkennbar ‚verrutscht‘ und befinden sich daher
versehentlich über dem linken oder rechten Nachbarbuchstaben. Oftmals lässt der Sichtbefund aber
mehr als eine Interpretation zu. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Formen sind fließend
und lassen die Transkription in die eine oder andere Formvariante häufig zum Ermessen des
Betrachters werden.
Meiner Einschätzung zufolge hat der Schreiber bei der Superskriptverwendung, wenn
überhaupt, dann nur ein sehr ‚offenes’ System zugrunde gelegt. Außer der Feststellung, dass Super-
skripte so gut wie nie in initialer Stellung über Konsonanten auftauchen125, sondern nur im Wort-
inneren und in finaler Stellung zur Anwendung kommen, lässt sich so gut wie nichts mit Sicherheit
aussagen.
Die Vielfalt an Schreibvarianten ist meines Erachtens einerseits durch die Tatsache bestimmt,
dass es sich um eine Handschrift mit einem individuellen Schreibduktus handelt, der unterschied-
lichsten Faktoren unterliegt – diese können ein erhöhtes Schreibtempo, Ermüdung, mehr oder weni-
ger Schriftraum, die individuelle Verfassung des Schreibers oder schlichte Freude am ‚Gestalten‘
sein. Anderseits spielt vermutlich auch „die unsinnige Konsonantenverdopplung, die im 15. Jahr-
hundert als modische Schreibattitüde auftaucht“126, eine Rolle.
Bei allem Bemühen um Objektivität bei der Transkription sind jedem Editor/jeder Editorin Grenzen
gesetzt, denn auch die sorgfältigste Transkription verlangt Entscheidungen, die auf Interpretation
beruhen.
Insofern jede Art der Darstellung eines handschriftlichen Befundes im Druck immer schon ‚gedeuteter Befund‘ ist, sind die ‚deskriptiven Informationen […] zwar nicht interpretations-frei [aber] doch wesentlich interpretationsärmer als sie interpretierenden Informationen‘. Da
125 Es fanden sich nur in fünf Belegen zur initialen Superskriptstellung über Konsonanten, wobei es sich in allen fünf
Fällen auch um eine unabsichtliche Verschiebung nach links handeln könnte (15r26 n#~ebell – 21v10 m#~ai#˙§ter#‘ – 33r15 m#~i#˙ltz – 32r34 m#-ai#˙§ter#‘ – 38v09 n#~ach).
126 Müller, Mondwahrsagetexte, S. 200. – Zum Gebrauch von Abkürzungen und der „vorhandenen Neigung zur Kon-sonantenhäufung“ in deutschsprachigen Handschriften siehe auch Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Kap. III.1: Abkürzungen.
67
also absolute Objektivität nicht erreichbar ist, soll der Grundsatz realistisch lauten: ‚so doku-mentarisch wie möglich, so interpretativ wie notwendig‘.127
Das heißt, angesichts der oftmals geringen Unterschiede in der Federführung, aber v. a. hinsichtlich
der fließenden Übergänge mussten editorische Entscheidungen getroffen werden, die sicherlich in
vielen Fällen diskussionswürdig sind. Im Falle der ‚schwebenden‘ Superskripte wurden diese einem
Basisgraph eindeutig zugeordnet. Ebenso wurde eine eindeutige Entscheidung getroffen bezüglich
der Superskriptformen. Durch die synoptische Darstellung von Basistransliteration und Faksimile
kann jedoch jeder Benutzer/jede Benutzerin das Ergebnis der Transkription mit dem Ausgangs-
punkt vergleichen, meine Entscheidungen überprüfen und gegebenenfalls zu einer anderslautenden
Einschätzung kommen.128 Die hier vorliegende Edition bemüht sich, die Fülle an paläografischen
Informationen wiederzugeben, welche die Handschrift beinhaltet, kann aber nicht allen Phänome-
nen absolut gerecht werden. „Der Befund kann den Informationsgehalt der Textvorlage niemals
hundertprozentig erreichen.“129 Den herkömmlichen Editionsmitteln sind Grenzen gesetzt, die sich
erst durch die Beschreitung neuer Wege in den Editionswissenschaften erweitern werden.
127 Hofmeister-Winter, Dynamische Edition, S. 102. 128 Siehe hierzu ebenfalls: Hofmeister-Winter, Dynamische Edition, Kap. 4.5 ‚Theoretische Überlegungen zur Doku-
mentation des Befundes‘ und Kap. 6.3.2 ‚Deskriptive Transliteration als Basisstufe der Edition‘. 129 Ebda, S. 48.
68
13 Editionskriterien Basistransliteration
Die Prinzipien, denen die Basistransliteration folgt, finden sich in der folgenden Auflistung:
Alle Schriftsymbole der Handschrift, die ein Äquivalent im Druckschriftsystem besitzen,
sind mit diesem dargestellt.
Graphe, die in mehreren Varianten auftreten, werden zusätzlich mit einem Nummerncode
versehen.130
Alle Superskripte, egal ob diakritische Zeichen, Abbreviaturen oder redundanter r-Haken,
werden mit <#> sowie einem spezifischen Zeichen dargestellt und erhalten bei mehreren
Varianten zusätzlich einen Nummerncode.131
i ohne i-Punkt wird als <i> codiert. i mit i-Punkt wird als Zusammensetzung zweier Schrift-
symbole betrachtet. Da der i-Punkt ein diakritisches Zeichen darstellt, wird er auch als
solches behandelt. Die Darstellung erfolgt durch <#·>. Mit dem Punkt über j wird gleich
verfahren.
Abbreviaturen, die unabhängig von Morphogrammen existieren, wird ein eigenes Symbol
zugewiesen (beispielsweise <@> für et cetera-Abbreviatur).132
Minuskeln werden als solche dargestellt.
Majuskeln werden als solche dargestellt.
Rubrizierte Satz- und Initialmajuskeln, die eine Strichelung aufweisen, werden durch vor-
angestelltes <!> gekennzeichnet.
Schriftsymbolen, die der Textura zugeordnet werden können, ist <&> vorangestellt.
Fleuronné-Initialen, Versalien und Lombarden werden mit vorangestelltem <£> gekenn-
zeichnet und fett gedruckt abgebildet; in den Endnoten findet sich eine relative Größen-
angabe. Initialmajuskeln werden mit vorangestelltem <£> gekennzeichnet und fett gedruckt.
Die in der Handschrift verwendete Interpunktion (Virgeln, Punkte zwischen Zahlzeichen,
Worttrennungszeichen, Zeilen-Anschlusszeichen) wird als Slash </>, Punkt <.>, Gleich-
heitszeichen <=> bzw. gerader Strich <|> wiedergegeben.
Spezifische Ziersymbole erhalten eigene Codierungen.133
Durchstreichungen des Schreibers und Verschreibungen werden als solche gekennzeichnet
(Durchstreichungen in eckigen Klammern <[]>) bzw. in den Endnoten näher beschrieben.
130 Näheres siehe ‚Alphabetisches Graphinventar‘ Kap. 15.1 ‚Majuskeln, Minuskeln, Zierformen‘. 131 Näheres siehe ‚Graphinventar Sonderzeichen‘, Kap. 16.1 ‚Super- und Subskripte, Abbreviaturen, Symbole‘. 132 Näheres siehe Kap. 16 ‚Graphinventar Sonderzeichen‘. 133 Näheres siehe ‚Graphinventar Sonderzeichen‘, Kap. 16.2 ‚Interpunktionszeichen und Symbole‘.
69
Illustrationen werden mit geschweiften Klammern {} markiert und in den Endnoten be-
schrieben.
Rubrizierungen werden durch Fettdruck gekennzeichnet.
Indisch-arabische Zahlzeichen im tabellarischen Teil werden durch arabische Ziffern wie-
dergegeben.
Römische Zahlzeichen (in der Handschrift mit Hilfe von Minuskelbuchstaben dargestellt)
werden mit Minuskelbuchstaben dargestellt.
Die Zeilendarstellung bzw. Zeilenumbrüche erfolgen dem Original entsprechend.
Die Folio-Zählung steht jeweils zu Beginn der Seite in eckigen [] Klammern.
Die Zeilenzählung wird jeweils am linken Rand jeder Zeile angegeben (Folio- + Zeilenzahl)
Die Marginalien von einer späteren Hand werden in den Endnoten – wenn möglich – trans-
literiert bzw. beschrieben.
70
14 Editionskriterien Lesefassung
Zugunsten der leichteren Lesbarkeit und maschinellen Durchsuchbarkeit des Textes wurden in der
Lesefassung folgende typografische Standardisierungen vorgenommen:
Graphvarianten werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme bildet das Schaft-s. Im Fließtext
wird es als <s> (rundes s) dargestellt, da sich hier aus den beiden Varianten kein
Bedeutungsunterschied ergibt. Nur im tabellarischen Teil wird es weiterhin mit <§> wieder-
gegeben, da die beiden s-Varianten zum Gliederungsprinzip des Textes gehören.
i mit und ohne Punkt wird einheitlich als <i> dargestellt.
j mit und ohne Punkt wird einheitlich als <j> dargestellt.
Die Unterscheidung von Bastarda bzw. Textura wird aufgegeben, die Darstellung beider
Schriftarten erfolgt einheitlich.
Die Getrennt- und Zusammenschreibung wird im Zweifelsfall nach neuhochdeutscher Ge-
wohnheit unkommentiert vereinheitlicht. Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu ermög-
lichen, werden Worttrennungen am Zeilenende durch <=> dargestellt.
Die Interpunktion ist nach syntaktischen Gesichtspunkten behutsam angepasst worden, um
Sinneinheiten leichter erfassbar zu machen. Da die originalen Gliederungsprinzipien des
Textes Satzeinheiten nicht zuverlässig anzeigen, musste hier mehr oder weniger
interpretierend vorgegangen werden.
Am Satzanfang wird Großschreibung eingeführt und dieser Eingriff gegebenenfalls durch
Kursive markiert. Ebenso wird eingeführte Kleinschreibung durch Kursive markiert.
Abbreviaturen werden aufgelöst und durch Kursivdruck markiert.
Alle Superskripte, die offensichtlich keine Abbreviatur darstellen (also diakritische Zei-
chen), werden einheitlich durch Akzent < > über dem Basisgraph dargestellt.
Redundante Kürzungen werden unkommentiert weggelassen.134
Rubrizierungen werden durch Fettdruck gekennzeichnet.
Fleuronné-Initialen, Versalien und Lombarden werden fett und vergrößert dargestellt,
jedoch nicht näher kommentiert. Initialmajuskeln werden fett dargestellt.
Illustrationen werden durch geschweifte Klammern {} gekennzeichnet.
Indisch-arabische Zahlzeichen im tabellarischen Teil werden durch arabische Ziffern wie-
dergegeben.
134 Näheres siehe Kap. 10.1.11 ‚Super- und Subskripte‘.
71
Römische Zahlzeichen im Fließtext werden nach heutigen Gewohnheiten mit Großbuch-
staben dargestellt.
Dittographien werden unkommentiert getilgt.
Schreiberkorrekturen werden unkommentiert umgesetzt.
Offensichtliche Irrtümer werden unkommentiert getilgt bzw. korrigiert. Die Korrektur ist
durch Kursivdruck gekennzeichnet.
Die Folio- bzw. Zeilenangaben finden sich am linken Rand des Textes (Folioangabe in ecki-
ger Klammer [], Zeilenangabe in Fünferschritten).
Hinweise, die in der Basistransliteration Schäden, Marginalen, Tintenkleckse, Zeilen-An-
schlusszeichen usw. betreffen, werden nicht mehr angeführt, sie sind in der Basistranslitera-
tion dokumentiert.
Zierelemente, Rubrizierung einzelner Majuskelbuchstaben (Satzmajuskeln), Schlusszeichen
und Haarstriche bei <r> und <r2> werden nicht mehr wiedergegeben.
Bei den Auflösungen der Nasalkürzungen konnte keine für alle Belege generell gültige
Lösung getroffen werden. Hier wurde im Einzelfall nach dem Prinzip der leichteren Les-
barkeit entschieden.
72
15 Alphabetisches Graphinventar
In den Kopfzeilen des Graphinventars werden folgende Abkürzungen verwendet:
BT = Basistransliteration
LF = Lesefassung
In der Basistransliteration wird Schriftsymbolen, die der Textura zugeordnet werden können, <&> vorangestellt; die Kommentierung der Zierformen
(ausschließlich Majuskeln) erfolgt in den Fußnoten.
15.1 Majuskeln, Minuskeln, Zierformen
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
a 13r09
33r15
11v27
a
A 04rc02
05v12
02v01
A
!A 13r19
04v22
17v01
A
73
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
b 13r04
01v07
b
B 06rc20
04v01
10v01
B
!B 13r15
14v10
B
c 13r20
01v26
c
C 28r03
C
!C 14v15
C
d 13r09
01v09
d
d2 28v04
d
D 02rc02
03v01
D
74
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
!D 13r23
32v01
D
D2 37r08
25v01
D
!D2 35v30
D
e 01rc07
01v03
e
E 13r01
E
!E 29v17
E
f 03ra08
04v04
01v11
f
F 19r14
19r01
F
75
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
!F 06v31
F
g 13r02
02v25
g
G 02v10
G
!G 15r13
G
h 13r01
01v04
h
H 05rc01
05v01
H
!H 24r03
H
i#˙ 13r01
i mit Punkt über Basisgraph i
76
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
i 11rc14
i ohne Punkt über Basisgraph i
I
01rc04
relativ gerader Schaft, kein ausgeprägter An- oder Ab-strich
I
!I
18v28
I
I2
25v33
keine Bogenbildung, gerader Anstrich mit schrägem Ab-strich – mit und ohne Quer-strich
I
!I2
26r03
I
j#˙ 12r04
mit Punkt über Basisgraph
j 12r15
ohne Punkt über Basisgraph
J
12v01
15r32
An- und Abstrich geschwun-gen mit und ohne Querstrich
20v01
J
77
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
!J
02v10
14r26
05rb03
15v01
J
k 13r32
13v03
01v06
12r17
k
K 09v26
K
!K
05v09
K
l 13r02
01v07
l
L
06v11
33v25
singuläre Variante
07v15
Bei <l/L> keine eindeutige Grenzziehung zwischen Minuskel und Majuskel anhand von Form und Größe möglich
L
!L
02v20
L
78
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
m 13r01
01v08
m
M 01v26
01v01
39r01
M
!M 13v16
22v35
M
n 13r02
33r05
01v09
n
N 19v28
33r36
23v01
32v10
N
!N 14v33
N
o 13r21
01v10
o
O 30r13
O
!O 16r14
O
79
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
p 13r11
01v11
p
P 18v16
P
!P 02v23
P
q 31r31
01v12
q
!Q 04rb05
Q
r 13r01
r
r2 13r01
01v13
r
R 05rc01
R
!R 26v27
R
80
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
s 13r01
33r22
01v15
s
§ 13r13
01v14
§
nur in Tabellen
S 25v26
14v08
07v02
19v01
S
!S 13r13
18v26
14v18
S
t 13r04
01v16
t
T 07rc02
T
!T
13r10
T
u 01ra05
01v18 u
81
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
v 13r03
01v17
Bei <v/V> keine eindeutige Grenzziehung zwischen Mi-nuskel und Majuskel anhand von Form und Größe möglich
v
!v 19v27
singuläres Phänomen V
V 08rc01
18r31
26v01
V
!V 13r06
13r33
V
w 13r01
w
W 27r08
W
!W 20v14
W
x
22v30
23v19 22v30
x
82
BT faksimilierte Beispiele
Bastarda
faksimilierte Beispiele Textura
Beschreibung/ Kommentare
Zierformen LF
y 14r08
01v20
y
Y 08rb02
Y
z 13r06
07rc04
06v05
z
Z
15r09
05v11 Z
!Z 25r05
Z
83
15.2 Lombarden/Initialen
BT Faksimilierte Beispiele LF
£A
22v01
01v13
01v06
03rc01
A
£B
26v26
B
£C
17v01
C
£D
12v05
13r01
15v01
37v25
D
84
BT Faksimilierte Beispiele LF
£E
02ra01
28r01
E
£G
25r01
G
£H
27r32
H
£I
20v04
I
£K
04v01
K
£L
16r01
06rb01
08rb01
04v01
L
85
BT Faksimilierte Beispiele LF
£N
37v32
N
£M
18v26
M
£P
01rb01
P
£R
06ra01
R
£S
19v03
19v22
S
£T
03rb01
T
£U
15v01
U
86
BT Faksimilierte Beispiele LF
£W 24r01
W
£Z
21r01
Z
15.3 Zahlzeichen
BT Faksimilierte Beispiele Kommentare LF
o 01v05
0
ɤ 01v13
ungeklärte Bedeutung135 ɤ
1 19r02
1
2 19r03
2
3 19r04
3
4
4
135 Näheres siehe Kap. 10.2 ‚Inhalt‘ und 10.1.2 ‚Zahlzeichen‘.
87
BT Faksimilierte Beispiele Kommentare LF
19r05
5 19r06
5
6 19r07
6
7 19r08
7
8 19r09
8
9 19r10
9
i/i#·/j/j#·/v/x/l/c/m136
33v36
12r01
12r01
I/V/X/L/C/M
Wiedergabe ohne Trennpunkte und Kasusendungen
136 Falls vorhanden werden Trennpunkte durch <.> und hochgestelltes o (Endung der lateinischen Ordnungszahlen) durch <#o> dargestellt.
88
16 Graphinventar Sonderzeichen
16.1 Super- und Subskripte, Abbreviaturen, Symbole
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/ Kommentar
LF
#: 28r13
15v29
10r16
Trema über a, e, o, u/v, w, y
´ über Basisgraph
#:2 33r33
32r05
08ra06
singuläre Variante
37r16
17r31
singuläre Variante
einfach oder paarig auftre-tendes strichförmiges Super-skript über a, u, w, y
´ über Basisgraph
#:3 31r01
24v09
aus e reduziertes Superskript, bestehend aus einem liegenden Bogen und einem darüberge-setzten Punkt
´ über Basisgraph
#~ 01ra07
14v17
14v36
tildenförmiges Superskript
´ über Basisgraph bzw. Auf-
lösung kursiv
#˙ 13r01
Punkt über i und j i bzw. j
89
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/ Kommentar
LF
#-
11ra15 vn(d)
01ra06 warm
11rc03
Daru(m)b
31r08
abweichende Variante
32v17
abweichende Variante
bogenförmig bis gerader Strich, unspezifisches Kürzungszeichen
Auflösung kursiv
#+ 01ra14
03rc03
18v26
Ercú(r)i(us)
leicht bis stark gebogenes Superskript über r, mit und ohne Anbindung zum Basisgraph, bei fast geschlossener Kreisbildung kein Ausläufer nach links wie bei der Ω-Form
Auflösung kursiv
#° 25v08 vber
26v12 d(e)r
01ra11 kalt(er)
02ra22
s- oder Ω-förmiger Haken mit Öffnung nach links oder rechts
Auflösung kursiv
#‘ 28r22
28r42
redundanter r-Haken; Haarstrich
[entfällt]
#“ 16v28 nat(ur)
ur-Abbreviatur; z-förmiges Zeichen über Graph bzw. hochgestellt hinter Graph
ur
#9 18v26
Ercú(r)i(us)
us-Abbreviatur; 9-förmiges Zeichen
us
90
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/ Kommentar
LF
? 02rb08
(est)
03rb03 s(ed)
03rb04 q(uia)
04rb06
pl(ur)im(um)
05v13
Jungf(rau)
unspezifischer Kürzung; z-förmiger Haken am Wortende, hochgestellt oder als eigenständiges Zeichen
Auflösung kursiv
#* 11v01
nu(meru)s
04v22
m(a)r(tr)er
02rb09
con(tra)dicit
unspezifische Kürzung; enge gebrochene Tilde, teils mit zusätzlicher Schleife (nur bei ‚martrer‘)
Auflösung kursiv
#o 12r01
12r01
hochgestelltes o, als Endung der lateinischen Ordnungszahl
[entfällt]
ϼ
02rb02 corp(or)e
11rb04
p(ro)semia(=)
28r28
p(ro)phet
09rb07
p(er)mittat(ur)
pro/per-Abbreviatur; strich- oder hakenförmiges Subskript
pro/per
#= 04rb04
existente-Abbreviatur; strichförmiges Superkript, paarig ausgeführt
existente
dz 28r30
daz-Abbreviatur daz
wz 38r06
waz-Abbreviatur waz
91
16.2 Interpunktionszeichen und Symbole
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/ Kommentar
LF
= 10ra16–17 mach(=)est
Worttrennung; doppelte waagerechte Striche
[entfällt]
@ 13r35
et cetera-Kürzung; Schlusszeichen [entfällt]
$ 11v21
Ziersymbol; schlaufenförmiges Zier-element
[entfällt]
/ 35r30
Virgel; einfach oder doppelt ausge-führter Schrägstrich
[entfällt]
| 30v22
Zeilen-Anschlusszeichen [entfällt]
%
16v14
03v05
03v04
23v25
10ra10
03v09
14r18
02v20
z-förmiges Zierelement vor <f/F>, <h/H>, <k/K>, <l/L>
[entfällt]
£ 22v01
Lombarden/Initialen Basisgraph
fett gedruckt
92
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/ Kommentar
LF
{}
11r
Abbildung, mit kurzer Beschreibung {}
[] 01rc06
[gangen]
Schreiberkorrekturen, wie Streichungen und Überschreibungen, sind in den Fuß-noten der BT näher beschrieben. In der LF werden die Korrekturen unkommen-tiert übernommen.
[entfällt]
16.3 Ligaturen
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/Kommentar LF
be 13r21
be; Ligatur be
ch 13r13
20v24
ch; Ligatur ch
ck 01rc12
ck; Ligatur ck
cz
cz; Ligatur cz
93
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/Kommentar LF
02rc04
de 14v09
de; Ligatur de
do 01rc01
do; Ligatur do
ff 14v12
ff; Ligatur ff
fl 22v05
fl; Ligatur fl
fft 12v16
fft; Ligatur fft
ge 14v03
ge; Ligatur ge
pp
32r21
pp; Ligatur pp
§ch
13r02
sch; Ligatur sch
§t 14v26
st; Ligatur st
94
BT Faksimilierte Beispiele Beschreibung/Kommentar LF
ß
15v25
28v24
Schaft-sz; Ligatur ß
th 12v10
th; Ligatur th
tl 22v07
tl; Ligatur tl
tt 15r02
tt; Ligatur tt
tz 22v07
tz; Ligatur tz
97
[01r]
01ra01 {Abb. Gelehrtenporträt1} £E!S2 §pricht
01ra02 ypocr2#‘as 01ra03 der mai#˙ 01ra04 §ter !Man
01ra05 §chull §ich i#˙n de#-
01ra06 hornung warm#-
01ra07 halten#- !Da#~s mo#-
01ra08 ni#˙t r2i#˙ti#˙g werd ky
01ra09 tzen flei#˙§ch §oltu
01ra10 ni#˙t e§§en !Huet di#˙ 01ra11 ch vor2 aller kalt#°
01ra12 §pei#˙s !Dei#˙n getr2anck §oll §ei#˙n ab agr2om
01ra13 oni#˙en vnd epi#˙ch §a#:men#- !Vnd ve#:be dei#˙ne#-
01ra14 lei#˙b ern#-§tlichen#- hu#:et di#˙ch au#:ch vor#+ vb
01ra15 er e§§en#- vn#-d vor2#+ aller#‘ tr2u#-cken#-hai#˙t !Au#:ff
01ra16 der hant vnd au#:ff dem#- da#-umen#- i#˙§t gu
01ra17 et la§§en !Vnd zw#: dem hau#:bt @
{Abb. Sternzeichen3}
01rb01 £P!J§ti#˙s4 e§t §ignum fr2i#˙gi#˙dum et hu
01rb02 mi#˙dum aquati#˙cum !Jndi#˙fferens
01rb03 plantas pedum r2e§pi#˙ci#˙ens !Et va
01rb04 let propoci#˙oni#˙bus le§i#˙oni#˙ pedu#:m con#-tr2a
01rb05 di#˙ci#˙t !Podagr2e et om#-i#˙bus pedu#:m vi#˙cy#:s
01rb06 medelam#- negabi#˙t @
{Abb. Alltagsszene5}
01rc01 £HOr2nung6 pi#˙n i#˙ch genant DarIn wedorff man §o#:ck vnd r2auchs gewant
01rc02 Dw §olt auch r2echt erkennen mi#˙ch Ge§tu nackot es ger2eut di#˙ch Jn 01rc03 di#˙§em monad i#˙§t gu#:t la§§en Js vnd tr2i#˙nck au#:ch zw#: ma§§en @ 01rc04 !Di#˙e fuezz ni#˙t §alb no#:ch entwi#˙§ch7 !Ban der mon#- §chei#˙net i#˙n dem vi#˙§ch
01rc05 !Guet tr2anck §oltu nemen !Di#˙e §tr2#‘a§s mag di#˙ch ni#˙t gelemen#- [!Ber fr2auen dan
01rc06 myn#-et !Der#‘ wedorff das i#˙m geli#˙nget @]8 9
99
[01v]10
01v01 £K11 £L12 £Marci#˙us1314 hat xxxi#˙ tag
01v02 &d Mar2ci#˙#9 &f 20
01v03 8 4 24 &e 6 &g 21
01v04 &f 5 !Kunegund ai#˙n !Jungkfr2aw &h 22
01v05 16 0 33 &g 4 i 23
01v06 5 13 14 £A15 3 &k 24
01v07 13 1 55 &b 2 &l 25
01v08 2 22 4 &c Nonas !Per2petua vnd felici#˙tas &m 26
01v09 &d 8 &n 27
01v10 10 10 45 &e 7 &o 28
01v11 &f 6 &p 29
01v12 18 6 54 &g 5 &q &Ar2i#˙es
01v13 7 19 35 £A16 4 !Gr2egori#˙us ai#˙n pab§t &r ɤ17
01v14 &b 3 &§ 1
01v15 15 15 44 &c 2 &s 2
01v16 &d J&dus &t 3
01v17 4 4 25 &e 17 !Ci#˙r2i#˙acy ai#˙n mar2tr2er#‘ &v 4
01v18 12 17 56 &f 16 !Gedr2aut !Jungkfr2aw#: &u 5
01v19 &g 15 &x 6
01v20 1 13 16 £A18 14 &y 7
01v21 9 1 56 &b 13 &z 8
01v22 17 22 6 &c 12 !Benedictus ai#˙n !Abt &z 9
01v23 &b &d 11 &Z 10
01v24 6 19 47 &c &e 10 &A 11
01v25 14 23 28 &d &f 9 &b 12
01v26 &e &g 8 Verkundu#-g Mar2i#˙e &c 13
01v27 3 19 37 &f £A19 7 !Ca§tulus ai#˙n martr2er#‘ &d 14
01v28 &g &b 6 !Ruprecht ai#˙n pi§cholff &e 15
01v29 11 8 18 &h &c 5 &f 16
01v30 i &d 4 &g 17
01v31 19 4 27 &k &e 3 &h 18
01v32 8 17 8 &l &f 2 i 19
101
[02r]
2ra01 {Abb. Gelehrtenporträt20}£E!&S21 §pri#˙cht
2ra02 der mai#˙ 2ra03 §ter#‘ !Ga 2ra04 li#˙enus man#- §ch
2ra05 ull §ue§§e di#˙ng i#˙n
2ra06 dem !Mertzn#- ezz
2ra07 en#- vnd me#:t §oll
2ra08 man#- nu#:chtern#-
2ra09 tr2i#˙ncken#- !Chu#:el
2ra10 gechochet §oltu#:
2ra11 e§§en#- !Honi#˙g wei#˙#-
2ra12 vnd e§§i#˙ch mi#˙§ch ze§amen vnd leg darei#˙n#-
2ra13 r2a#:ti#˙ch !Vnd fr2ue nu#:chtern#- §o i#˙zz §ei#˙n ge
2ra14 nu#:g darauff §o tr2i#˙nck labes wa§§er ay#-
2ra15 nen gu#:etn tr2unck !Ob dw#: zw voll pi#˙§t
2ra16 §o tu#:nck ai#˙n feder#‘en i#˙n ai#˙n o#:ll vnd §tr2ei#˙ 2ra17 ch dy#: an den r2achen !Gut §pecerey §oltu
2ra18 darauff ny#:ezzen kai#˙n#- tr2#‘ei#˙bent tr2#‘anckny#:#-
2ra19 ni#˙t !Ban das ma#:cht di#˙ch chalt dei#˙n ge
2ra20 tr2#‘anck §ey#: ab r2au#:ttn vnd polayen vi#˙ll §ol/22
2ra21 tu#: paden aber#‘ ni#˙t zw#: hai#˙s !Dw#: §olt ni#˙t 2ra22 lazzn#- vnd pe§und#°lich an dem dau#:men @
{Abb. Sternzeichen23}
2rb01 £A!Ri#˙es24 e§t §i#˙gnu#:m cali#˙du#:m et §i#˙ccu#:m
2rb02 i#˙gneum bonu#- habens decorϼe ca 2rb03 put et partes ei#˙us !Et luna i#˙n eo
2rb04 exi#˙§tente e§t valen#-s mi#˙nu#:co#- i#˙n25 om#-i#˙ par#‘te 2rb05 corpori#˙s pr2#‘eter#‘ i#˙n capi#˙te !Nam#- gener#‘ali#˙t#°
2rb06 om#-i#˙ le§i#˙oni#˙ capi#˙ti#˙s e§t noci#˙uu#- vento§e i#˙n
2rb07 collo !Jn men#-te vel i#˙n auri#˙bu#:s non §unt po
2rb08 nende i#˙n gr2edi#˙ balnea vti#˙le ? !&Sed r2a§i#˙oni#˙ 2rb09 con#*di#˙ci#˙t @
{Abb. Alltagsszene26}
02rc01 £ICh27 pi#˙n gehai§§en der mertz Den pflueg i#˙ch auff §tertz Jn di#˙sem monadt
02rc02 lazz chai#˙n plut Doch i#˙§t §wai#˙s paden gu#:t @ 02rc03 !Des haubtz §oll man §cho#:nen !Ban i#˙n dem wi#˙der §chei#˙nt der man#-en !Ni#˙t zw
02rc04 ader la§§en aber paden !J§t guet an allen §chaden !Dy#: or2en Ir2czen#- §oll ma#-
02rc05 enperen !Dw macht au#:ch woll den part ab§chern#- @
103
[02v]28
02v01 £K29 £L30 £Apri#˙ll31 hat xxx tag
02v02 &m &g &Apri#˙&l&l i 20
02v03 16 13 17 &n £A32 4 &k 21
02v04 &o &b 3 &l 22
02v05 5 1 58 &p &c 2 !Ambr2o§i#˙us ai#˙n pi#˙§cholff &m 23
02v06 13 14 39 &q &d Nonas &n 24
02v07 2 10 48 &r &e 8 &o 25
02v08 10 23 29 &§ &f 7 &p 26
02v09 &t &g 6 &q 27
02v10 18 19 38 &v £A33 5 !Mar2i#˙e Inegippen#- &r 28
02v11 &A &b 4 &§ 29
02v12 7 8 19 &b &c 3 &s Thaur2us
02v13 &c &d 2 &t 1
02v14 15 4 28 &d &e J&dus !Ewfemi#˙a !Jungkfr2aw &v 2
02v15 4 17 9 &e &f 18 !Ti#˙burcy#: et valeri#˙ani#˙ &u 3
02v16 &f &g 17 &x 4
02v17 12 5 50 &g £A34 16 &y 5
02v18 &h &b 15 &z 6
02v19 1 1 19 i &c 14 &z 7
02v20 9 14 41 &k &d 13 %!Leo ai#˙n pab§t &Z 8
02v21 17 10 50 &l &e 12 &A 9
02v22 6 23 31 &m &f 11 &b 10
02v23 &n &g 10 !Vi#˙ctor ai#˙n !Pab§t &c 11
02v24 14 12 12 &o £A35 9 &d 12
02v25 &p &b 8 &Sand Gorg ai#˙n r2i#˙tter#‘ &e 13
02v26 3 8 21 &q &c 7 !Marcus ai#˙n !Ewangeli#˙§t &f 14
02v27 11 21 2 &d 6 &g 15
02v28 &e 5 &h 16
02v29 19 17 11 &f 4 !Vi#˙tali#˙s ai#˙n mar#‘tr2er#‘ i 17
02v30 &g 3 &k 18
02v31 8 5 52 £A36 2 &l 19
105
[03r]
03ra01 {Abb. Gelehrtenporträt37} £M!&Ai#˙§ter#‘38
03ra02 i#˙ohann
03ra03 es §pri#˙ 03ra04 cht ma#-
03ra05 §chull i#˙n dem#- a
03ra06 pri#˙ll tr2anck ne
03ra07 men !Das di#˙ch
03ra08 tr2#‘ei#˙be fr2i#˙§ch fle
03ra09 i#˙§ch §oltu#: e§§en#-
03ra10 !Bu#:rtzn#- §oltw#:
03ra11 e§§en#- als r2a#:ti#˙ 03ra12 ch vnd ku#:mpo§t !Ban#- das gepi#˙rt den#- po#:
03ra13 §§en#- fluß §cherffen#- vnd wi#˙nttu§en#- i#˙§t gu#:t
03ra14 vnd ge§unt !Dei#˙n getr2anck §oll §ei#˙n ab
03ra15 beta#:ni#˙en vnd r2au#:ttn#- oder wermu#:t !Vn#-
03ra16 pi#˙bnellen zw der2 medi#˙an i#˙§t ni#˙t gu#:t
03ra17 la§§enn @
{Abb. Sternzeichen39}
03rb01 £T!Haurus40 e§t §i#˙gnu#:m fr2i#˙gi#˙dum et §i#˙ccu#~
03rb02 terr2eum malum r2e§pi#˙ci#˙e#~s collum
03rb03 et gu#:ttu#:r !Et vi#˙tetur fleu#:botami#˙a §?
03rb04 plantaci#˙o arboru#:m et vi#˙nearu#- e§t valen#~s q?
03rb05 ci#˙to cr2e§cunt !Et augmentari#˙ fe§ti#˙na#~t et pa
03rb06 §§i#˙oni#˙bus colli#˙ et gu#:ttu#:ri#˙s et li#˙ngw#~e mede
03rb07 lam negant @
{Abb. Alltagsszene41}
03rc01 £ABr2i#˙ll42 pi#˙n i#˙ch genant Pau#:m peltzen vnd r2eben pe§chnei#˙d i#˙ch durch das la 03rc02 ndt Jn di#˙§em monad ny#:m di#˙ch ni#˙t an#-la§§en#- zw der median @ 03rc03 !Ban der man i#˙§t i#˙n dem §ti#˙er !So peltz paum das r2at i#˙ch di#˙r2#+ !Hew§er#+
03rc04 paw#:en i#˙§t guet !Sa#:men §a#:en au#:ch nu#:tz thuet %la§s di#˙ch chai#˙nen artz
03rc05 wei#˙§§en !Den#- hals haillen mi#˙t ey#:§§enn#- @
107
[03v]43 44
03v01 £K45 £L46 £Der47 May#: hat xxxi#˙ tag
03v02 &b May Phi#˙li#˙pp vnd Jakob xi#˙j #˙potn#- &m 19
03v03 16 2 1 &c 6 !Si#˙gmund ai#˙n kunig &n 20
03v04 5 14 41 &d 5 %hei#˙li#˙gn#- kr2eutz vi#˙ndu#-g &o 21
03v05 13 3 23 &e 4 %!Flor2i#˙an ai#˙n martr2#‘er#‘ &p 22
03v06 2 23 32 &f 3 !Gothar2t ai#˙n pi#˙§cholff &q 23
03v07 &g 2 &r 24
03v08 10 12 1 £A48 Nonas &§ 25
03v09 &b 8 &s 26
03v10 18 8 22 &c 7 &t 27
03v11 7 27 3 &b &d 6 &v 28
03v12 &c &e 5 &u 29
03v13 15 17 12 &d &f 4 !Pangr2atz ai#˙n martr2er#‘ &x !Gem#-i#˙ 03v14 &e &g 3 !Gangolff ai#˙n pi#˙§cholff &y 1
03v15 4 5 53 &f £A49 2 &z 2
03v16 12 18 34 &g &b Jdus !Sophi#˙a ai#˙n !Jungkfr2aw#: &z 3
03v17 &h &c 17 &Z 4
03v18 1 14 44 i &d 16 &A 5
03v19 9 3 24 &k &e 15 &b 6
03v20 17 23 34 &l &f 14 !Potenci#˙ana !Jungkfr2aw#: &c 7
03v21 &m &g 13 &d 8
03v22 6 12 14 &n £A50 12 &e 9
03v23 &o &b 11 %!Helena ai#˙n kuni#˙gi#˙n &f 10
03v24 14 0 56 &p &c 10 &g 11
03v25 3 21 5 &q &d 9 &h 12
03v26 &r &e 8 !Vrban ai#˙n !Pab§t i 13
03v27 11 9 46 &§ &f 7 &k 14
03v28 &t &g 6 &l 15
03v29 19 5 55 &v £A51 5 &m 16
03v30 8 18 36 &A &b 4 &n 17
03v31 &b &c 3 &o 18
03v32 16 14 45 &c &d 2 !Petr2onella !Jungkfr2aw#: &o52 19
109
[04r]53
04ra01 {Abb. Gelehrtenporträt54} £E!S55 §pri#˙cht
04ra02 auicenna
04ra03 man#- §chul
04ra04 i#˙n dem M
04ra05 ayen ni#˙t zw der le
04ra06 bern#- la§§en#- tr2an
04ra07 ck das da li#˙ndet
04ra08 §oltu#: ne#:men !Barm#-
04ra09 paden hab li#˙eb ch
04ra10 ai#˙nes thi#˙ers no#:ch
04ra11 vi#˙§ches haubt i#˙s
04ra12 ni#˙t noch fues !Barme §pei#˙s §oll §ei#˙n dei#˙n k
04ra13 r2e§en vnd des gelei#˙chn !Ban dauo#- wi#˙r2t
04ra14 das pluet erfr2i#˙§chet may#:en#- §ma#:ltz i#˙s nu#:
04ra15 chter !Dau#:on wi#˙r2t ma#- geli#˙ndr#°t dei#˙n ge
04ra16 tr2anck §oll §ei#˙n abwermu#:t vnd venchell
04ra17 §a#:men das §tos woll gewa§chn#- vnd mi#˙ 04ra18 §ch da#:s mi#˙t gai#˙s mi#˙li#˙ch !Vnd las das vb
04ra19 er nacht §te#-n vnd wan es lau#:ttr#+ wi#˙r2t §o
04ra20 tr2i#˙nck es dr#‘2ey#: tag nu#:chtern#- @
{Abb. Sternzeichen56}
04rb01 £G!Emi#˙ni#˙57 e§t §i#˙gnum cali#˙dum et hui#˙#~
04rb02 dum terr2eum malu#:m r2e§pi#˙ci#˙ens
04rb03 br2#‘achi#˙a manus et humeros !Et
04rb04 luna i#˙n#- eo exn#=te prohi#˙bet#“ aϼci#˙o vene bra
04rb05 chy#: !Qui#˙a aut §angwi#˙s egr2edi#˙no#- p#-t aut
04rb06 morbu#:m i#˙n cur2#‘r2it noci#˙un#- aut vt pli#˙m?58 i#˙ct#9
04rb07 §olet i#˙terari#˙ !Mala e§t vn#-gwi#˙u#- pr2#‘eci#˙o§io et
04rb08 vni#˙u#-§ali#˙ter#‘ a§tapuli#˙s v§q? admanus long
04rb09 i#˙tu#:di#˙ne#- no#- e§t faci#˙enda medela @
{Abb. Alltagsszene59}
04rc01 £HJe60 chum i#˙ch §toltzr2#° may#: Mi#˙t chluegn#- pluemen mangerlay Jn di#˙§em monad 04rc02 man warm paden §oll Auch tantzen vnd §pri#˙ngn vnd leben#- woll @ 04rc03 !So der man i#˙§t i#˙n der zwi#˙falti#˙gen §tr2#‘a§§en#- !So §oltu#: ni#˙t an d2en armen lazzn#-
04rc04 !Dei#˙n negell vnd dei#˙n hent !Mi#˙t ey#:§§en ni#˙t anwent !Vnd das di#˙r2 wi#˙r2t
04rc05 ver2hai#˙§§en !Dar2#‘nach wi#˙r§tu#: r2ay#:§enn @
111
[04v]61
04v01 £K62 £L63 £Brachmon hat xxx tag
04v02 &d &e Juni#˙us !Ni#˙comedi#˙s ai#˙n martrer &p 19
04v03 5 3 26 &e &f 4 &q 20
04v04 13 16 7 &f &g 3 !Er2a§mus ai#˙n pi#˙§cholff &r 21
04v05 2 12 16 &g £A64 2 &§ 22
04v06 &h &b Nonas &s 23
04v07 10 0 56 i &c 8 !Boni#˙faci#˙us vnd §ein ge§ell#-n &t 24
04v08 18 21 57 &k &d 7 &v 25
04v09 &l &e 6 &u 26
04v10 7 9 47 &m &f 5 !Pri#˙mus vnd feli#˙ci#˙anus &x 27
04v11 &n &g 4 &y 28
04v12 15 5 50 &o £A65 3 !Bar2naba ai#˙n zwelffpot &z 29
04v13 4 18 37 &p &b 2 &z 30
04v14 &q &c Jdus &Z Cancer
04v15 12 7 19 &r &d 18 &A 1
04v16 &§ &e 17 Vi#˙tus Mode§tus cr2e§ten &b 2
04v17 1 3 28 &t &f 16 &c 3
04v18 9 16 9 &v &g 15 &d 4
04v19 17 12 18 £A66 14 &e 5
04v20 &b 13 &f 6
04v21 6 0 59 &c 12 &g 7
04v22 14 13 40 &d 11 !&Albanus ai#˙n mr#*$er &h 8
04v23 &e 10 !Achaci#˙us vnd §ei#˙n ge§ell#-n i 9
04v24 3 9 49 &f 9 &k 10
04v25 11 22 30 &g 8 Johannes der tauffer &l 11
04v26 £A67 7 &m 12
04v27 19 18 39 &b 6 Johans vnd pauls mr#*$er &n 13
04v28 &c 5 !Di#˙e §i#˙ben §laffer &o 14
04v29 8 7 20 &d 4 …!Pan va§t…68 &p 15
04v30 &e 3 Peter vnd pauls &q 16
04v31 16 3 29 &f 2 Dy gedachtnus pauli &v 17
113
[05r]
05ra01 {Abb. Gelehrtenporträt69} £A!Ver2r2oi#˙s70
05ra02 der mai#˙§t
05ra03 er §pri#˙cht
05ra04 man sull
05ra05 i#˙n dem !Br2achmo#-
05ra06 alle tag nu#:chter
05ra07 prun wa§§er tr2i#˙n
05ra08 cken#- lactuck mi#˙t 05ra09 e§§i#˙ch §oltu#: e§§enn#-
05ra10 !Schlaff ni#˙t zw#: vi#˙l 05ra11 vi#˙§ch her2#‘te ay#:er#‘ 05ra12 §wei#˙nen flei#˙§ch her2t ka#:ß vnd alles ge#~pr#‘ate#-
05ra13 flei#˙§ch i#˙§t ni#˙t ge§unt !Dei#˙n#- getr2#‘anck §ey#: 05ra14 ab §alua plueme#- vnd r2au#:tten#- ho#:lerplu#:e
05ra15 §oltu nu#:chter e§§en#- @
{Abb. Sternzeichen71}
05rb01 £C!Ancer72 e§t §i#˙gnumfr2i#˙gi#˙dum et hu
05rb02 mi#˙dum aquati#˙cum !Jndi#˙fferens
05rb03 pectus r2e§pi#˙ci#˙ens !Iecor#‘ cu#:m pul 05rb04 mone !Et valet ϼpoci#˙oni#˙bus §u#:mendi#˙s
05rb05 lax#‘ati#˙ni#˙s tamen medi#˙came#- pector#‘i#˙s !Et ci#˙r 05rb06 ca pectus exi#˙§tenti#˙vm permi#˙tti#˙t non#- ad hibe
05rb07 ri#˙ @
{Abb. Alltagsszene73}
05rc01 £BRachmonad74 pi#˙n i#˙ch genant Hawen vnd ger§ten ny#:m i#˙ch i#˙n dy hant Jn di#˙§em 05rc02 monad §oll man nyemant ze ader lan Es §oll auch dy zei#˙t nyemant mu#:2 05rc03 §§i#˙g gan @ !Jn dem kr2ebs la§§en i#˙§t gr2#‘o§§e ver#‘lu§t75 !Czw der lungen lebe
05rc04 r2en vnd zw der#‘ pru#:§t !Tr2anck nemen i#˙§t guet !Dw#: pi#˙§t auch auff
05rc05 der §tr2as pehuet !An tr2#‘aum §oltu#: di#˙ch ni#˙t ker2#‘en !Mi#˙t arbai#˙t §olt du#: di#˙ch ner#‘ 05rc06 en @
115
[05v]76
05v01 £K77 £L78 £Heymon79 hat xxxi#˙ tag
05v02 5 16 10 &g Ju&li#˙us &§ 17
05v03 £A80 6 !Vn§er fr2auen we§chawu#-g &s 18
05v04 13 14 11 &b 5 &t 19
05v05 2 1 0 &c 4 Vlr2i#˙ch ai#˙n Bi#˙§cholff &v 20
05v06 10 13 41 &d 3 &u 21
05v07 &e 2 &x 22
05v08 18 9 50 &f Nonas !Bi#˙li#˙baldus ai#˙n pi#˙§cholff &y 23
05v09 7 22 31 &g 8 %!Ki#˙li#˙anus vnd §ei#˙n ge§elln#- &z 24
05v10 £A81 7 &z 25
05v11 15 18 40 &b 6 &Z 26
05v12 &c 5 &A 27
05v13 4 7 22 &d 4 Margaretha ai#˙n Jungf#?82 &b 28
05v14 12 20 3 &e 3 !Hai#˙nri#˙ch ai#˙n kay#:§§er &c 29
05v15 &f 2 &d %leo
05v16 1 16 12 &g J&dus !Czertai#˙lu#-g der zwelfpote#- &e ɤ
05v17 £A83 17 &f 1
05v18 9 4 53 &b 16 !&Alexi#˙us ai#˙n pei#˙chti#˙gr#+ &g 2
05v19 17 1 2 &c 15 &h 3
05v20 6 13 43 &d 14 i 4
05v21 &e 13 &k 5
05v22 14 2 24 &f 12 &l 6
05v23 3 22 33 &g 11 Mari#˙a Magdalena &m 7
05v24 £A84 10 &n 8
05v25 11 11 14 &b 9 !Cri#˙§ti#˙na ei#˙n !Jungkrfr2aw &o 9
05v26 &c 8 Jakob ai#˙n zwelffpot &p 10
05v27 19 7 23 &d 7 !Anna dy mu#:3ter Mari#˙e &q 11
05v28 8 20 4 &e 6 &r 12
05v29 &f 5 !Panthaleon ai#˙n mr#*er &§ 13
05v30 16 16 13 &g 4 &s 14
05v31 £A85 3 !Abdon vnd !Sennen &t 15
05v32 5 4 54 &b 2 &v 16
117
[06r]
06ra01 {Abb. Gelehrtenporträt86} £R!&A§us87 der2#°
06ra02 mai#˙§ter sp
06ra03 r2i#˙cht man
06ra04 §chull i#˙n de#-
06ra05 !Heymonad kai#˙n tr
06ra06 anck nemen das
06ra07 di#˙ch li#˙nder#‘t vor2#‘ 06ra08 vnlau#:tr2i#˙kai#˙t hu#:
06ra09 et di#˙ch !Des pe§te#-
06ra10 wei#˙ns tr2i#˙nck nu#:
06ra11 chter her#‘te §pei#˙s
06ra12 vnd gepr2aten flei#˙§ch i#˙zz ni#˙t !Das du ni#˙t 06ra13 zw engi#˙g wer2de§t ni#˙t §laff zw vi#˙ll wz
06ra14 von mi#˙lch i#˙§t das i#˙§t ge§unt !Dei#˙n getr2
06ra15 anck §ey ab§alua r2auten wermu#:t vn#-
06ra16 epi#˙ch §ame#- !Dw#: §olt ni#˙t la§§en#- noch kay#-
06ra17 tr2#‘anck nemen von#- xv kolendas augu
06ra18 §ti#˙ dz i#˙§t der §echst tag nach §and mar#‘ 06ra19 gar2#‘ethen#- tag dan#- vachen §ich an#- dy#:
06ra20 hu#:ndi#˙§chn#- tag !Vnd wer#‘en#- auff §and Ba#°
06ra21 tholomey#: tag @
{Abb. Sternzeichen88}
06rb01 £L!Eo89 e§t §i#˙gnum calidu#-et §i#˙ccu#:2m Ig
06rb02 neum malu#:m §tamachu#- et cor#‘ r2e 06rb03 §pi#˙ci#˙ens !Et luna i#˙n eo exi#˙§tente no#-
06rb04 valet mi#˙nu#:ci#˙o §an#-gbi#˙nisnec cau#:§are fo
06rb05 mi#˙tu#- !Et etci#˙am tunc nulla medela pro
06rb06 §tamacho cor2de et parti#˙bus adi#˙acenti#˙ 06rb07 bus ? faci#˙enda @
{Abb. Alltagsszene90}
06rc01 £BElcher91 ochß ger2en zeucht den pflueg Dem wi#˙ll i#˙ch geben hewes ge
06rc02 nu#:eg Auch wi#˙ll i#˙ch di#˙r2 mi#˙t tr2eu#:en §agen %huet di#˙ch vor den hundi#˙ 06rc03 §chen tagenn @ !Der leo meret den §mer#‘tzen#- !Der#‘ lu#:ngen vnd dem her#‘ 06rc04 tzen !Ni#˙t leg an#- ai#˙n new#:es klai#˙d oder#‘ gewan#-t !Pi#˙§tu geladen dw wi#˙r§tge§ch
06rc05 ant !Dw §olt chai#˙n erzeney92 nye§§en !Di#˙ch §oll auch §pey#:en#- §er2#‘e v#°dr2i#˙e§§enn @93
119
[06v]94
06v01 £K95 £L96 £Aug§t97 hat xxxi#˙ tag
06v02 13 17 35 &c &Aug#9 Peter ketn#-feyr#‘ &v 17
06v03 2 13 44 &d 4 !Steffan ai#˙n pab§t &x 18
06v04 &e 3 &y 19
06v05 10 2 25 &f 2 &z 20
06v06 18 22 34 &g Nonas !O§wolt ai#˙n kuni#˙g &z 21
06v07 £A98 8 !Si#˙xtus ai#˙n pabst &Z 22
06v08 7 11 15 &b 7 !Affr2a vnd i#˙r2 ge§ell§chafft &A 23
06v09 &c 6 !Ci#˙r2iacus vnd §ei#˙n ge§elln#~ &b 24
06v10 15 7 25 &d 5 &c 25
06v11 4 20 6 &e 4 Laur2enci#˙us mr#*$er &d 26
06v12 &f 3 !Ti#˙bur2ci#˙us martr2er#‘ &e 27
06v13 12 8 47 &g 2 &f 28
06v14 £A99 Jdus !Jpoli#˙tus vnd §ei#˙n ge§ellen &g 29
06v15 1 4 56 &b 19 &h 30
06v16 9 17 38 &c 18 Vn§er fr2awn §chi#˙edu#-g i Vi#˙r2go
06v17 17 13 46 &d 17 &k 1
06v18 &e 16 &l 2
06v19 6 2 25 &f 15 !Agapi#˙tus ai#˙n mr#*$er &m 3
06v20 14 15 8 &g 14 &n 4
06v21 £A100 13 !Ber#+nhart ai#˙n !Abt &o 5
06v22 3 11 17 &b 12 &p 6
06v23 11 33 58 &c 11 &q 7
06v24 &d 10 !Pan va§t &r 8
06v25 19 20 7 &e 9 Bar#‘tholomeus xi#˙i#˙pot &§ 9
06v26 &f 8 &s 10
06v27 8 8 48 &g 7 &t 11
06v28 £A101 6 &v 12
06v29 16 4 57 &b 5 &Augu§ti#˙nus pi#˙§cholff &u 13
06v30 5 17 38 &c 4 &x 14
06v31 &d 3 %!Feli#˙ci#˙s vnd adaucti#˙ mr#*$er#‘ &y 15
06v32 13 6 19 &e 2 16
121
[07r]
07ra01 {Abb. Gelehrtenporträt102} £I!N103 dem aug
07ra02 §t §pri#˙cht
07ra03 !Seneca da#-
07ra04 §o nym chai#˙n ertz
07ra05 ney von nyemant
07ra06 !Ban#- es dy hun
07ra07 di#˙§chenn#- tag §ei#˙n
07ra08 hut di#˙ch auch vo#-
07ra09 mi#˙lch !Chai#˙n §u
07ra10 e§§e §pei#˙s i#˙zz ni#˙t 07ra11 §under2#+ dy#: da pi#˙tt#°
07ra12 §ey#: !Tr2i#˙nck ni#˙t zw vi#˙ll wei#˙ns vor2#‘ vn#-l
07ra13 autr2#‘i#˙kai#˙t huet di#˙ch au#:ch hu#:et di#˙ch
07ra14 vor2#‘ aller#‘ hi#˙tz !Pi#˙er vnd met tr2i#˙nck ni#˙t 07ra15 es §ey dan fr2i#˙§ch dei#˙n getr2an#-ck §ey ab
07ra16 epi#˙ch pluemen vnd ab pelay#:en#- vnd ab
07ra17 wermuet @
{Abb. Sternzeichen104}
07rb01 £U!Jr2go105 e§t §ignu#:m fr2igidum106 et §ic=
07rb02 cum terr2eu#:m#- malum#- ventr2em
07rb03 et i#˙pi#˙u#-s i#˙nte§ti#˙na r2e§pi#˙ci#˙ens
07rb04 !Et valet pr2#‘o§emi#˙naci#˙oni#˙b? et agr#‘i#˙ 07rb05 cultur#‘i#˙s i#˙n te§ti#˙ni#˙s au#-t et i#˙§ti#˙s parti#˙ 07rb06 bus que adi#˙acent neg#-ant medela?
07rb07 fieri#˙ @
{Abb. Alltagsszene107}
07rc01 £BOll108 auff mi#˙t mi#˙r2 all i#˙n dy e#:er2en Dye da §chnei#˙den wellen ger2en Sie
07rc02 ch auch eben auff das pr2et Tr2i#˙nck weder#‘ pi#˙er wei#˙n noch mett 07rc03 !Nyema#-nt mi#˙t der#‘ ee#: wei#˙aget !So dermon i#˙§t i#˙n der#‘ maget !Dei#˙n ade
07rc04 r2en vnd dei#˙n r2i#˙pp !Mi#˙t ey§§en#- ny#:emant gr2i#˙pp !Czw §neiden guet zu#:
07rc05 ver2§icht !Chaynnem §cheff ver#‘tr2aw#: ni#˙cht @
123
[07v]109
07v01 £K110 £L111 £Der112 er§t herb§t hat xxx tag
07v02 2 2 58 &f Septe#- Gi#˙lg ai#˙n abt &z 17
07v03 10 15 19 &g 4 &z 18
07v04 £A113 3 &Z 19
07v05 18 11 18 &b 2 &A 20
07v06 &c Nonas &b 21
07v07 7 0 0 &d 8 !Magnus ai#˙n pei#˙chti#˙g#°r &c 22
07v08 15 20 9 &e 7 &d 23
07v09 &f 6 Gepur2d vn§er frauen &e 24
07v10 4 8 50 &g 5 &f 25
07v11 12 21 30 £A114 4 &g 26
07v12 &b 3 !Prothi#˙ vnd !Jaci#˙ncti#˙ &h 27
07v13 1 17 40 &c 2 i 28
07v14 &d Jdus &k 29
07v15 9 6 40 &e 18 !Hei#˙li#˙gen kr2eutzhebung &l Li#˙&br#‘a
07v16 17 2 30 &f 17 &m ɤ
07v17 6 15 11 &g 16 &n 1
07v18 £A115 15 %!Lampertus ai#˙n pi#˙§cholff &o 2
07v19 14 3 52 &b 14 &p 3
07v20 &c 13 &q 4
07v21 3 0 1 &d 12 !Pan va§t &r 5
07v22 11 12 41 &e 11 Matheus ai#˙n xi#˙i#˙pot &§ 6
07v23 &f 10 !Maur2i#˙ci#˙us vnd §ei#˙n ge§elln#- &s 7116
07v24 19 8 51 &g 9 &t 8
07v25 8 21 32 £A117 8 Ruprecht pi#˙§cholff &v 9
07v26 &b 7 &v 10
07v27 16 17 32 &c 6 &x 11
07v28 &d 5 !Co§mas vnd domi#˙anus &y 12
07v29 5 6 42 &e 4 &z 13
07v30 13 19 3 &f 3 Mi#˙chaell ai#˙n ertzengell &z 14
07v31 2 15 12 &g 2 !Jer#‘oni#˙mus ai#˙n pri#˙e§ter &Z 15
125
[08r]
08ra01 {Abb. Gelehrtenporträt118} £I!Sayas119 der
08ra02 mai#˙§ter#‘ §p 08ra03 r2i#˙cht das
08ra04 man#- §chull i#˙n dem#-
08ra05 her#‘b§t monadt pr 08ra06 ot aus gay#:2ß120 vnd
08ra07 !Schaff mi#˙lch nu#:ch
08ra08 tern#- e§§en#- vnd al
08ra09 le di#˙ng §ei#˙n guet
08ra10 zw#: nye§§en !Man §ol
08ra11 auch lazzen dw macht au#:ch all wur#‘tz 08ra12 en nutzen !Vnd macht auch all zei#˙ti#˙g
08ra13 fr2ucht e§§en vnd §emlich di#˙ng von obs
{Abb. Sternzeichen121}
08rb01 £L!Jbr2a122 e§t §i#˙gnu#:m cali#˙dum et humi#˙du#~
08rb02 aereum bonu#- Yli#˙a dor§um r2enes
08rb03 et achos !Re§pi#˙ci#˙ens negans mede
08rb04 lam om#-i#˙bus §ti#˙ati#˙ci#˙s r2eni#˙bus !Et i#˙n ei#˙s
08rb05 paci#˙enti#˙bus valet tn#- pr2#‘omi#˙nuco#-e §ang
08rb06 wi#˙ni#˙s §peci#˙aliter luna i#˙n pri#˙ma medi#˙eta
08rb07 te ex#=nte i#˙p§i#˙us @
{Abb. Alltagsszene123}
08rc01 £GVetes124 mo§tes hab ich vi#˙ll !Bem ich §ei#˙n geren geben wi#˙ll Jn di#˙§em monat
08rc02 §oltu ni#˙t gan vnd zw der lebern ader lan @ 08rc03 !Jn der wag huet der#‘ gema#:cht !Ny#:eren vnd ar§packen dem#- wi#˙rt r2echt
08rc04 !Bi#˙ld dw vi#˙ll lauffen vber veld !Dw chu#:mb§t vmb dei#˙n gluck !Vnd vmb deyn
08rc05 geldt @
127
[08v]125
08v01 £K126 £L127 £Der#‘128 ander herb§t hat xxxi#˙
08v02 £A129 Octo&b#° !Remi#˙gi#˙us ai#˙n pi#˙§cholff &A 16
08v03 10 3 53 &b 6 &b 17
08v04 &c 5 &c 18
08v05 18 0 3 &d 4 %!Fr2anci#˙§cus pei#˙chti#˙gr#° &d 19
08v06 7 12 44 &e 3 &e 20
08v07 &f 2 &f 21
08v08 15 8 53 &g Nonas !Marcus ai#˙n pab§t &g 22
08v09 4 21 34 £A130 8 &h 23
08v10 &b 7 Di#˙oni#˙§i#˙us vnd §ei#˙n ge§elln#- i 24
08v11 12 6 15 &c 6 &k 25
08v12 &d 5 &l 26
08v13 1 6 34 &e 4 &m 27
08v14 9 19 5 &f 3 !Kolman#-us mr#*er &n 28
08v15 17 14 14 &g 2 &o 29
08v16 £A131 J&dus &p Scorpi#˙o
08v17 6 3 55 &b 17 !Gallus pei#˙chti#˙gr#° &q 1
08v18 14 16 36 &c 16 &r 2
08v19 &d 15 %!Lucas !Ewangeli#˙§t &§ 3
08v20 3 13 45 &e 14 &s 4
08v21 &f 13 &t 5
08v22 11 1 26 &g 12 !Der xj#˙ tau§ent mai#˙d &v 6
08v23 19 21 37 £A132 11 &v 7
08v24 &b 10 &x 8
08v25 8 10 16 &c 9 &y 9
08v26 &d 8 !Cr2i#˙§pi#˙ni#˙ vnd cri#˙§pi#˙ni#˙ani#˙ &z 10
08v27 16 6 21 &e 7 &z 11
08v28 5 19 6 &f 6 !Pan va§t &Z 12
08v29 &g 5 Si#˙mon vnd Judas xi#˙i#˙potn#- &A 13
08v30 13 7 47 £A 4 &b 14
08v31 2 3 56 &b 3 !Pan va§t &c 15
08v32 10 16 37 &c 2 !Bolffgangus Bi#˙§cholff &d 16
129
[09r]133
09ra01 {Abb. Gelehrtenporträt134} £C!An§tanti#˙nus135
09ra02 der mai#˙§ter
09ra03 §chr2ei#˙bt ma#-
09ra04 §chull i#˙n dem#- ande
09ra05 r2en her2b§t136 mo#:nad
09ra06 !Swei#˙nen flei#˙§ch ge
09ra07 §otten e§§en vnd wey#-
09ra08 most tr2i#˙ncken !Ban
09ra09 das r2ei#˙ni#˙get137 den
09ra10 lei#˙b vnd macht di#˙ 09ra11 ch ge§unt !Geflugell gai#˙§§en vnd §cha
09ra12 ffen mi#˙li#˙ch i#˙§t ge§unt zwe§§en#- vnd zwe
09ra13 tr2i#˙ncken !Dei#˙n getr2#‘anck §ey#: ab pfeffer#‘r2
09ra14 vnd naglei#˙n du §olt lazzen vnd au#:ch
09ra15 getr2anck nemen @
{Abb. Sternzeichen138}
09rb01 £S!Corpi#˙o139 e§t §ignum fr2igi#˙dum et hu
09rb02 mi#˙du#:m aquati#˙cum !Jndi#˙fferens
09rb03 anum et ve§i#˙cam#- et totum locu#-
09rb04 li#˙bi#˙di#˙ni#˙s r2e§pi#˙ci#˙t !Balnei#˙s ob§tat wlne
09rb05 r2ati#˙s nocet? et pudendi#˙s nu#:llu#- wlt fi#˙ei#˙#°
09rb06 r2emedi#˙u#:2m !Tn#- luna i#˙n §cda#- i#˙pi#˙u#-s ex#=nte
09rb07 ϼmi#˙ttat#“ mi#˙nu#:2ci#˙o §angbi#˙ni#˙s fi#˙eri#˙ @
{Abb. Alltagsszene140}
09rc01 £IN141 gottes namen §ae#: i#˙ch mei#˙nen §amen Jch pi#˙t di#˙ch hr2r2#° §and galle Dz
09rc02 er2 mi#˙r2#‘ woll ge alle @ 09rc03 !Der scor#‘pi#˙an hat vber2#+ dy#: §cham#- gewalt %far2#° §cho#:n wi#˙ldu werden alt
09rc04 !Auch far2 ni#˙cht zw#: §cheff no#:ch142 vber#‘ veldt !Der vall gei#˙t todlich wi#˙der#‘ gelt@
131
[09v]143
09v01 £K144 £L145 £Der146 dri#˙t herb§t hat xxx tag
09v02 &d Nouem Aller hei#˙li#˙gn#- tag147 &e 17
09v03 18 12 47 &e 4 !Aller §eln tag148 &f 18
09v04 &f 3 &g 19
09v05 7 1 28 &g 2 &h 20
09v06 15 21 37 £A149 Nonas i 21
09v07 &b 8 !Leonhardt ai#˙n pei#˙chti#˙g#° &k 22
09v08 4 10 18 &c 7 &l 23
09v09 12 22 59 &d 6 &m 24
09v10 &e 5 !Theodorus martr2er#° &n 25
09v11 1 19 8 &f 4 &o 26
09v12 &g 3 Marti#˙nus Pi#˙§cholff &p 27
09v13 9 7 49 £A150 2 &q 28
09v14 17 3 58 &b Jdus !Br2i#˙cci#˙us !Pi#˙§cholff &r 29
09v15 6 16 39 &c 18 &§ 1 Sagi#˙tari#˙#9
09v16 &d 17 &s 2
09v17 14 5 20 &e 16 !Othmarus ai#˙n abt &t 3
09v18 &f 15 &v 4
09v19 3 1 29 &g 14 &v 5
09v20 11 14 10 £A151 13 El§pet Bi#˙ti#˙b &x 6
09v21 &b 12 &y 7
09v22 19 10 19 &c 11 &z 8
09v23 8 23 0 &d 10 !Ceci#˙lia !Jungkfr2aw#: &z 9
09v24 &e 9 !Clemens !Pab§t &Z 10
09v25 16 19 9 &f 8 &A 11
09v26 &g 7 Katheri#˙na Jungkfr2aw &b 12
09v27 5 7 50 £A152 6 &c 13
09v28 13 20 21 &b 5 Vi#˙r2gi#˙li#˙us Pi#˙§cholff &d 14
09v29 2 16 42 &c 4 &e 15
09v30 &d 3 !Pan va§t &f 16
09v31 10 5 22 &e 2 Andr2eas zwelffpot 17
133
[10r]
10ra01 {Abb. Gelehrtenporträt153} £I!N154 dem dri#˙ 10ra02 tten herb
10ra03 §t monat
10ra04 §chr2ei#˙bt der mai#˙ 10ra05 §ter#‘ !Me§te das 10ra06 man#- §ull chai#˙n
10ra07 §ways155 pad habe#-
10ra08 !Das dei#˙n pluet
10ra09 oder varb ni#˙t ver
10ra10 §ert werde %kayn
10ra11 haubt §oltu#: ezze#-
10ra12 Vor2 vnlautr2i#˙kai#˙t huet di#˙ch !Alles war
10ra13 mes di#˙ng hab li#˙eb vnd was di#˙ch ly#:nd2e
10ra14 mach !Seni#˙ff pfeffer knoffli#˙ch agr2i#˙mo
10ra15 ni#˙en vnd zwi#˙ffell i#˙s i#˙n di#˙§em monad2t
10ra16 dei#˙nen lei#˙b §oltu#: v#:ben !Getr2anck mach=
10ra17 e§t du nemen zw der lebere#- lazz vnd
10ra18 zw der#‘ plater#‘en @
{Abb. Sternzeichen156}
10rb01 £S!Agi#˙tari#˙us157 e§t §i#˙gnum calidum et
10rb02 §iccu#- bonu#- fenor2#‘a et cr#‘u#:r2#‘a r2#‘e§pi#˙ 10rb03 ci#˙ens !Et luna i#˙n eo exi#˙§tente e§t
10rb04 valens flew#:botami#˙a walnea i#˙n gr2#‘edi#˙ 10rb05 gaudet q? der2#‘a§i#˙one capi#˙ti#˙s !Et vngbi#˙ 10rb06 um pr2#‘eci#˙§ione §ed cr2u#:r2i#˙bus et toxi#˙s ne
10rb07 gant fi#˙eri#˙ medi#˙ci#˙nam @
{Abb. Alltagsszene158}
10rc01 £ICh159 wi#˙ll §chei#˙tter hawen vi#˙ll Sei#˙nt der wi#˙nter chumen wi#˙ll Mi#˙t §ei#˙ner#‘ ke 10rc02 lten al§o §er2e Das i#˙ch mi#˙ch vor2 dem fr2o§t er2nere @ 10rc03 !Der §chutz §cha#:det der#‘ hu#:aff !Ban#- der#‘ man §chey#-net dar#‘auff %las an
10rc04 dem#- ar2m#- §chi#˙er#‘ das hau#:bt !Paden i#˙§t di#˙r2 au#:ch erlaubt !Dw#: §olt har2#° vnd
10rc05 nagell we§chney#:den#- !So#: ma#:cht du#: vnr2u#:e ver2#‘mey#:den @
135
[10v]160
10v01 £K161 £L162 £Bi#˙ntermon163 hat xxxi#˙ tag
10v02 &f Decem&b#+ &g 18
10v03 18 1 31 &g 4 &h 19
10v04 7 14 12 £A164 3 i 20
10v05 &b 2 Bar2#‘bar#‘a ungkfr2#‘aw &k 21
10v06 15 10 21 &c Nonas &l 22
10v07 4 23 22 &d 8 Ni#˙colaus Pi#˙§cholff &m 23
10v08 &e 7 &n 24
10v09 12 11 43 &f 6 !Enphachnus mari#˙e &o 25
10v10 &g 5 &p 26
10v11 1 7 50 £A165 4 &q 27
10v12 9 20 33 &b 3 &r 28
10v13 17 16 42 &c 2 &§ 29
10v14 &d Jdus %Luci#˙a vnd oti#˙li#˙a
!Jungkfr2au#-
&s Cap#+corn#9
10v15 6 5 23 &e 19 &t 1
10v16 14 18 4 &f 18 &v 2
10v17 &g 17 &v 3
10v18 3 14 13 £A166 16 &x 4
10v19 &b 15 &y 5
10v20 11 2 54 &c 14 &z 6
10v21 19 23 3 &d 13 !Pan va§t &z 7
10v22 &e 12 Thomas zwelffpot &Z 8
10v23 8 11 44 &f 11 &A 9
10v24 &g 10 &b 10
10v25 16 7 53 £A167 9 !Pan va§t &c 11
10v26 5 20 34 &b 8 Gepur2d i#˙hu#- xpri#˙§ti#˙ &d 12
10v27 &c 7 Steffan martr2er &e 13
10v28 13 9 15 &d 6 Johannes zwelffpot &f 14
10v29 2 5 25 &e 5 Der ki#˙ndlei#˙n tag &g 15
10v30 10 18 6 &f 4 !Thomon ai#˙n pi#˙§cholff &h 16
10v31 &g 3 i 17
10v32 18 14 15 £A168 2 !Si#˙lue§ter ai#˙n pab§t &k 18
137
[11r]
11ra01 {Abb. Gelehrtenporträt169} £P!Lato170 §chr
11ra02 ei#˙bt i#˙n §e
11ra03 y#:nnem ca
11ra04 pi#˙tell das
11ra05 man i#˙n dem wi#˙n
11ra06 ter monad alle#°
11ra07 di#˙ng e§§en vnd
11ra08 tr2i#˙ncken §chul vn#-
11ra09 !Dei#˙n wei#˙n vnd de
11ra10 yn wa§§er#‘ §oll ni#˙t 11ra11 zw#: chalt §ei#˙n ge
11ra12 tr2anck macht dw nemen#- !Dei#˙n#- hau#:bt
11ra13 vnd dei#˙n fuezz §oltu warm#- halten ku#:m
11ra14 po#:§t vnd alle !Chalte §pei#˙s i§t vngesu#-t
11ra15 zw der leber2en vnd zw dem#- haubt vn#-
11ra16 zwallen#- aderen gemai#˙nckli#˙ch i#˙§t gu#:t
11ra17 la§§en !Vnd ob du wi#˙ld agr2omoni#˙en
11ra18 §oltu §mecken vnd e§§en das i#˙§t ge§u#-t
11ra19 dem hi#˙r2#‘en#- du §olt dei#˙nen mu#:nd wa§ch
11ra20 en#- vnd r2ai#˙n wehalten#- @
{Abb. Sternzeichen171}
11rb01 £C!Apri#˙cornus172 e§t §i#˙gnum fr2i#˙gi#˙dum et
11rb02 §iccu#- aereu#- malum#- ty#:bi#˙as et ge#:
11rb03 nua r2e§pi#˙ci#˙ens !Et lu#:2na i#˙n eo ex
11rb04 i#˙§tente vitetur flewbo tomi#˙a §ed ϼ§emi#˙#-a
11rb05 ci#˙oni#˙bus et agr2i#˙cultur2i#˙s valet et ge
11rb06 nu#:bus non debet fi#˙eri#˙ medi#˙camen @
{Abb. Alltagsszene173}
11rc01 £MJt174 wur2§ten vnd mi#˙t pr2aten /175wi#˙ll i#˙ch mei#˙n haws peraten Al§o hat das i#˙ar
11rc02 ai#˙n endt Got vns §ei#˙n gnad §endt @ 11rc03 Der §tai#˙npock §chadet dem kny#:en !Daru#+b §o huet i#˙r2#‘ mi#˙t tr2euen#- !Der#‘ §i#˙ech
11rc04 wir2t der2 mag woll gene§en !Dw macht zw §cheff ni#˙t §chi#˙er we§en !Bas
11rc05 dw pau#:e§t das velt %kai#˙n di#˙ng §i#˙ch §ta#:ti#˙gli#˙ch §telt @
139
[11v]176
11v01 1 £Au&reus177 nu#*s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11v02 &y
&n
&c
&v
&l
&Z
&§
&h
&z
&p
&e
&v
&m
&a
&s
i &z
&q
&f
11v03 !Bi#˙&der#‘ $ &z
&o
&d
&v
&m
&a
&s
i &z
&q
&f
&x
&n
&b
&t
&k
&Z
&r
&g
!Guet $
11v04 &z
&p
&e
&x
&n
&b
&t
&k
&Z
&r
&g
&y
&o
&c
&v
&l
&a
&§
&h
11v05 &Z
&q
&f
&y
&o
&c
&v
&l
&a
&§
&h
&z
&p
&d
&v
&m
&b
&s
i
11v06 Sti#˙e&r $ &A
&r
&g
&z
&p
&d
&v
&m
&b
&s
i &z
&q
&e
&x
&n
&c
&t
&k
Po#:§s $
11v07 &b
&§
&h
&z
&q
&e
&x
&n
&c
& t
&k
&Z
&r
&f
&y
&o
&d
&v
&l
11v08 !Zwi#˙&li#˙n&g $ &c
&s
i &Z
&r
&f
&y
&o
&d
&v
&l
&a
&§
&g
&z
&p
&e
&v
&m
!Po#:§s $
11v09 &d
&t
&k
&a
&§
&g
&z
&p
&e
&v
&m
&b
&s
&h
&z
&q
&f
&x
&n
11v10 Cre&bs $ &e
&v
&l
&b
&s
&h
&z
&q
&f
&x
&n
&c
&t
i &Z
&r
&g
&y
&o
mi#˙te&l&l $
11v11 &f
&v
&m
&c
&t
i &Z
&r
&g
&y
&o
&d
&v
&k
&a
&§
&h
&z
&p
11v12 !&le&be $ &g
&x
&n
&d
&v
&k
&a
&§
&h
&z
&p
&e
&v
&l
&b
&s
i &z
&q
!&po#:§s $
11v13 &h
&y
&o
&e
&v
&l
&b
&s
i &z
&q
&f
&x
&m
&c
&t
&k
&Z
&r
11v14 i &z
&p
&f
&x
&m
&c
&t
&k
&Z
&r
&g
&y
&n
&d
&v
&l
&a
&§
11v15 Jungkf&raw &k
&z
&q
&g
&y
&n
&d
&v
&l
&a
&§
&h
&z
&o
&e
&v
&m
&b
&s
Mi#˙tte&l&l $
11v16 &l
&Z
&r
&h
&z
&o
&e
&v
&m
&b
&s
i &z
&p
&f
&x
&n
&c
&t
11v17 !Wa&g $ &m
&a
&§
i &z
&p
&f
&x
&n
&c
&t
&k
&Z
&q
&g
&y
&o
&d
&v
!Guet $
11v18 &n
&b
&s
&k
&Z
&q
&g
&y
&o
&d
&v
&l
&a
&r
&h
&z
&p
&e
&v
11v19 Sco&r&p &o
&c
&t
&l
&a
&r
&h
&z
&p
&e
&v
&m
&b
&§
i &z
&q
&f
&x
mi#˙tte&l&l $
11v20 &p
&d
&v
&m
&b
&§
i &z
&q
& f
&x
&n
&c
&s
&k
&Z
&r
&g
&y
11v21 &q
&e
&v
&n
&c
&s
&k
&Z
&r
&g
&y
&o
&d
&t
&l
&a
&§
&h
&z
11v22 !Sc&hut&z $ &r
&f
&x
&o
&d
&t
&l
&a
&§
&h
&z
&p
&e
&v
&m
&b
&s
i &z
!Guet $
11v23 &§
&g
&y
&p
&e
&v
&m
&b
&s
i &z
&q
&f
&v
&n
&c
&t
&k
&Z
11v24 Stai#˙n&pock &s
&h
&z
&q
&f
&v
&n
&c
&t
&k
&Z
&r
&g
&x
&o
&d
&v
&l
&a
Po#:§s $
11v25 &t
i &z
&r
&g
&x
&o
&d
&v
& l
&a
&§
&h
&y
&p
&e
&v
&m
&b
11v26 !Wa§§e&r#‘man $ &v
&k
&Z
&§
&h
&y
&p
&e
&v
&m
&b
&s
i &z
&q
&f
&x
&n
c !gu#:tt $
11v27 &v
&l
&a
&s
i &z
&q
&f
&x
&n
&c
&t
&k
&z
&r
&g
&y
&o
&d
11v28 Vi#˙§c&h $ &x
&m
&b
&t
&k
&z
&r
&g
&y
&o
&d
&v
&l
&Z
&§
&h
&z
&p
&e
Mi#˙tte&l&l $
11v29 &y
&n
&c
&v
&l
&Z
&§
&h
&z
&p
&e
&v
&m
&a
&s
i &z
&q
&f
141
[12r]178
12r01 £Tabula179 &ϼ nteruallo
12r02 M#o180 !Cccc#o lxix#o &A &g vij o 7 &n
12r03 M#o !Cccc#o lxx#o &g 2 ix vj 8 &n
12r04 M#o !Cccc#o lxxj#˙#o &f 3 viij v 9 &e
12r05 M#o !Cccc#o lxxi#˙j#˙#o &e &d vj iiij 1o &k
12r06 M#o !Cccc#o lxxi#˙i#˙j#˙#o &c 1 ix ij 11 i#˙
12r07 M#o !Cccc#o lxxiiij#o &b 3 viij i 12 a
12r08 M#o !Cccc#o lxxv#o &a 3 vj o 13 &f
12r09 M#o !Cccc#o lxxvj#o &g &f viij vj 14 &f
12r10 M#o !Cccc#o lxxvij#o &e 1 vij iiij 15 r2
12r11 M#o !Cccc#o lxxviij#o &d 2 v iij 16 &b
12r12 M#o !Cccc#o lxxix#o &c 3 viij ij 17 &b
12r13 M#o !Cccc#o lxxx#o &b &a vij i 18 o
12r14 M#o !Cccc#o lxxxj#o &g 1 ix vj 19 &n
12r15 M#o !Cccc#o lxxxij#o &f 2 vij v 1 &l
12r16 M#o !Cccc#o lxxxiij#o &e 3 vj iiij 2 &k
12r17 M#o !Cccc#o lxxxiiij#o &d &c ix iij 3 &k
12r18 M#o !Cccc#o lxxxv#o &b 1 vij i 4 o
12r19 M#o !Cccc#o lxxxvj#o &a 2 vj o 5 &f
12r20 M#o !Cccc#o lxxxvij#o &g 3 viij vj 6 &e
12r21 M#o !Cccc#o lxxxviij#o &f &e vj v 7 l
12r22 M#o !Cccc#o lxxxix#o &d 1 ix iij 8 &k
12r23 M#o !Cccc#o lxxxx#o &c 2 viij ij 9 &b
12r24 M#o !Cccc#o lxxxxj#o &b 3 vij i 1o o
12r25 M#o !Cccc#o lxxxxij#o &a &g ix o 11 o
12r26 M#o !Cccc#o lxxxxiij#o &f 1 vij v 12 &§
12r27 M#o !Cccc#o lxxxxiiij#o &e 2 vj iiij 13 &k
12r28 M#o !Cccc#o lxxxxv#o &d 3 ix iij 14 &k
12r29 M#o !Cccc#o lxxxxvj#o &c &b vij ij 15 &p
12r30 M#o !Cccc#o lxxxxvij#o &a 1 vj o 16 &f
12r31 M#o !Cccc#o lxxxxviij#o &g 2 viij vj 17 &f
12r32 M#o !Cccc#o lxxxxix#o &f 3 vj v 18 &l
12r33 &An
no &
dom
i#˙ni#˙
!Di#˙&
e i#˙ar &za&
l&l
&A
nn
o &d
omi#˙[n
i#˙]
!Sum
ta&g &
pu[§tab]
Sc&
ha&
lck i#˙a&
r
!Dy#: w
oc&hn#- &
z[all]
Di#˙&
e u&
bri#˙&
gn#- t[ag]
Di#˙&
e &gu
&ld
en [zall]
&S
c&h
&lu
§§e&l 181
143
[12v]
12v01 £Das182 §ei#˙n po#:ß nd er#‘worffen ta#:g §o §y i#˙n dem Jar chumen#- an den §oll man weder#°
12v02 la§§en chauffen noch er#‘chau#:ffen#- vnd au#:ch chai#˙nerlay#: ertzney thu#:n i#˙n den na 12v03 ch ge§chri#˙ben tagen#- Vnd dau#:on i#˙§t no#:t das man#- i#˙r2 eben#- war nem vnd mi#˙t 12v04 vlei#˙s merck @ 12v05 £D!Er2183 er§t tag i#˙§t das ei#˙n gent i#˙ar der#‘ ander tag nach li#˙echtmes der dri#˙t 12v06 tag nach matheys tag !Der erst i#˙n dem mertzen der vi#˙erd nach vn§er
12v07 fr2awen#- tag i#˙n dem#- mertzen#- !Der zechn#-t tag i#˙n dem apri#˙ll der2 vi#˙e
12v08 r2d tag vor gr2egor2#‘y#: der2 dr2i#˙t ta#:g i#˙n dem#- may#:en#- !Der §ibent tag
12v09 wan der may will au§s gen der2 new#:nt tag vor2 !Johan#-es wapti#˙§ta der §ech§t
12v10 tag vor2#‘ mar#‘gar2ethe an §and mari#˙a magdalena tag der erst tag i#˙n dem aug
12v11 u§t !Der2 dr2i#˙t tag nach augusti#˙ni#˙ der#+ §ech§t tag vor2 vn§er fr2auen tag zw
12v12 herb§t an §and matheus tag !Der funfft tag nach mi#˙chaheli#˙s der §ech
12v13 §t tag vor2 marti#˙ni#˙ der2#+ dr2i#˙t tag nach kather2i#˙ne !Der#‘ ander tag vor2 ni#˙co
12v14 lay#: der2 ander2 tag vor2 thome des hei#˙li#˙gen zwelffboten#- @
12v15 £Hi#˙e184 hebt §i#˙ch an#- zw §chr2ei#˙benn#- von#- den#- zwelff zai#˙chen#- des gesti#˙ern#-s vnd
12v16 auch von i#˙r2 kr2afft das §ei#˙n dy zwelff §tra§§en an dem hi#˙mell dy#: vn§eren 12v17 lei#˙b en#-twegent vnd gebalt dar vber2 haben vnd hebt §ich das er§t an 12v18 von#- dem#- zai#˙chen des wi#˙ders @
145
[13r]
13r01 {Abb. Sternzeichen185} £D!Er2 186wi#˙der#° hat an des men
13r02 §chen gelideren das haubt
13r03 vnd alle dy#: geli#˙der dy#: dem
13r04 haubt zw gehor2ent an
13r05 den hals haubt mu#-d na§en#- o#:r2en
13r06 lep§en zend !Vnd zu#:ngen vnd dy#: ge
13r07 lider dy#:e dem#- hau#:bt zw gehor2ent
13r08 ob wendi#˙g des lei#˙bs !Vnd hat auch
13r09 all i#˙r2 §iechtagen di#˙e den#- §elbi#˙gen
13r10 geli#˙deren#- ge§chaden#- mu#:gen#- das i#˙§t
13r11 als vi#˙ll ge§prochen#- !Ban#- ari#˙es zw
13r12 §i#˙echtagen §tet das er §i#˙echtagen
13r13 machen §oll !So ma#:chet er#‘ chay#:nr#° 13r14 lay §i#˙echtagen#- mer#‘ dan an dem#- ha
13r15 u#:bt vnd an §ei#˙nen geli#˙deren !Ban
13r16 er2 an den andern#- geli#˙deren#- chayne#-
13r17 gewalt hat !Vnd das §elb thuent
13r18 dy#: zai#˙chen alle §am#-pt den#- §elbi#˙gn#-
13r19 gelider2en dar2uber §y dan gebalt habent !Ari#˙es i#˙st ai#˙n ei#˙n tr2uckent zai#˙ch
13r20 en der2 da vi#˙er2e §ei#˙n ar2i#˙es thau#:2rus cap#°cor2nu#:s leo vnd §agi#˙ttar2i#˙us vnd
13r21 wan der2 mon i#˙§t i#˙n ar2i#˙es !So i#˙st po#:§s er2tzney#: zw geben vnd tr#‘2anck zw ne#:m 13r22 en wan es alles ver2leu§et vnd das §elbi#˙g §oll man#- wi#˙§§en zw weha#:lten
13r23 an allen#- an der2en#- ei#˙ntr2uckenden zai#˙chen#- !Das man#- chay#:n er2tzney tr#‘2e 13r24 yben#- §choll vnd was vndew#:t da#:s §choll man#- auch pehalten#- §o das au§s
13r25 get !Ban der men#-§ch en#-pfi#˙eng gr2#‘o§§en#- §cha#:den#- vnder §ei#˙nem au§gangk
13r26 di#˙tz zai#˙chen wan#- es au#:§get von or2i#˙ent §o gei#˙t es tr2#‘uckens vnd war2#‘bs we 13r27 ter als vi#˙ll vnd es an#- i#˙m i#˙§t !Ber#‘ auch i#˙n der2#+ zei#˙t gepo#:r2#‘en wi#˙r2t nach ari#˙ 13r28 §totelis r2ed der2 gewi#˙nt aynnen kr2u#-pen#- lei#˙b vnd ainen chlay#:nnen hals
13r29 vnd ai#˙n lan#-gs antli#˙tz gr2o#:§§e augen vnd klaynne o#:r2en !Vnd ay#:nnen hals
13r30 genu#:g zw r2eden#- ai#˙nen klay#-nen#- par2#‘t §y §ei#˙n auch ger2en#- pr2#‘awn#- als §y
13r31 an der2 §unnen §ei#˙n ver2#+pr2ant !Sy#: §ei#˙n auch gere#-n vnfr2i#˙d§am §y ma#:chen
13r32 auch viell kr2i#˙eg vnd §uchn#- zwi#˙§chen der me#-n§chen vr2leng vnd kr2i#˙eg
13r33 !Vnd r2o#:tte kor2ner als dy §ew#:r2en haben#- §y vnder dem#- antli#˙tz vnd haben au
13r34 ch ai#˙nen ge§to§§en kr2umpen lei#˙b vnd i#˙§t zw genai#˙gt dem manen mi#˙t 13r35 §ei#˙ner natur2 @
13r36 £Hernach187 volget vonn#- dem czai#˙chenn#- des !Sti#˙ers ge§chri#˙benn#- @
147
[13v]
13v01 {Abb. Sternzeichen188} £D!Er2189 §ti#˙er hat an des men
13v02 §chen geli#˙deren den hals
13v03 vnd dy kelen pi#˙s an dye
13v04 ach§eln !Vnd was denn
13v05 §elbigen#- geli#˙deren an §iechtagen
13v06 wi#˙der2 fert !Als dr2u#:s vnd ge§were#-
13v07 wi#˙e die ver2§teen#- §ol§t i#˙§t vorma
13v08 ls ge§ai#˙t !Das zay#:chen hat au#:ch
13v09 den gepr2#‘e§ten der da hai#˙§§et der#‘ 13v10 chr2#‘ebs von dem zai#˙chen !Thau
13v11 r2o §oll man#- ai#˙n r2egell ver§teenn
13v12 !Ban der man#- !J§t190 i#˙n dem#- thaur2o d#+
13v13 gewalt ha#:t vber2#+ meri#˙di#˙em#- od#°
13v14 vber2#‘ da#:s tai#˙ll der2 welt !Sundr#°
13v15 vnd §ta#:tes Zai#˙chen i#˙§t von#- er2#‘de 13v16 vnd von#- !Meloncolicen#- natur2e
13v17 i§t wan es i#˙§t chalt vnd tr2u#:ck
13v18 en vnd fr2auen ge§chlacht !Dan §o i#˙§t gu#:et garten zw#: §een#- a#:cker vn#-
13v19 wei#˙ngar#+tn#- zw pauen vnd pau#:m peltzen#- wan#- §y wach§§en pa#:ld
13v20 !Vnd wer#‘dent lan#-g !Dan §o i#˙§t auch gu#:et hewser#+ pur2#‘ge vnd §tet 13v21 an#- zw#: va#:chen zepau#:en#- vnd i#˙§t dan#- guet alles das an#- zevachen dz
13v22 man#- wi#˙ll das lang weri#˙g sey#: !Es i#˙§t auch po#:§s ertzneyen an dem#- h=
13v23 als vnd dy#: kelen mi#˙t ey§§en#- wer2ur2en es i#˙§t au#:ch po#:§s vr2#‘leu#:g an 13v24 zw fachen#- !Vnd au§far2en zw vechten#- das zai#˙chen wan der mann#-
13v25 new#: i#˙§t §o machet es chalt vnd tr2u#:cken#- zei#˙t vnd wi#˙r2t dan pey#: der
13v26 erden#- nebell das §elbi#˙g thuet es au#:ch an sei#˙nem au#:ff gang §o es auf
13v27 get al§o vi#˙ll vnd an i#˙m i#˙§t vnd §tet !Ber#‘ au#:ch zw di§er zei#˙t gepor2e#-
13v28 wi#˙r2#‘t der2 hat ai#˙n wei#˙tte pr2ai#˙te lan#-ge na#:§en#- vnd wei#˙tte na§locher#‘ 13v29 !Vnd gr#‘o§§e au#:gen#- vnd §chon#~s kr2au#:s har2#‘ ay#-nen#- gr2o#:§§en#- hals er i#˙§t
13v30 auch ge§chami#˙g vnd wan er#‘ get §o §i#˙echt er2#‘ vn#-der2 §i#˙ch au#:ff dy#: erde#-
13v31 di#˙tz zaichen gelei#˙cht §i#˙ch mi#˙t §ei#˙ner natur2 dem#- planeten191 !Ven#9
13v32 !Vnd au#:ch dem meloncoli#˙cu#:s !Vnd reg#~ni#˙r2endt gelei#˙ch @
13v33 £Her#+nach192 vol#~get vonn#- dem#- czai#˙ch des zwi#˙li#˙ngs ge§chri#˙benn#- @
149
[14r]
14r01 {Abb. Sternzeichen193} £D!Er194 zwi#˙li#˙ng i#˙§t warm#- vnd fe
14r02 ucht vnd hat dy#:e czai#˙chen
14r03 an des men#-§chn#- gelidern#-
14r04 !Ach§ell arm#- hen#-t vnd §ch
14r05 ulterplat vnd dy#: §i#˙echtagn#- dy#: an
14r06 i#˙m ge§chechn#- !Oder2 ge§chechn#- §chu
14r07 llen wan der#+ man#- new#: i#˙§t i#˙m zwi#˙ 14r08 li#˙ng der gewalt hat vber dy tai#˙l 14r09 der2 welt !Da#:s da hai#˙§§et occi#˙dent
14r10 oder2 we§ten#- da#~s au#:ch ai#˙n gemay#-
14r11 zaichen#- od#+ zwi#˙falti#˙g zai#˙chn#- i#˙§t
14r12 vnd lufftes natur#‘ !Ban es i#˙§t wa#°
14r13 me vnd feucht vnd au#:ch wan es
14r14 chalt i#˙§t §o i#˙§t dan gut fr2eunt §ch
14r15 afft zw §a#:men !Cr2i#˙eg wer#‘den#- v#+
14r16 §onet es i#˙§t au#:ch dan#- gu#:t vr2#‘leu#:g
14r17 an zw heben#- vnd au§svar2en zw
14r18 vechten % la§§en i#˙§t po#:§s vnd we§und#° an#- den#- hen#-ten vnd an den#- ar2#‘me#-
14r19 es i#˙§t po#:§s dy#: ader2en#- mi#˙t ey#:§§en#- per2u#:r2#‘en vnd we§under#‘ zw la§§en#-n
14r20 wan man mu§t zwi#˙er2ent §chlachen#- !Ban#- das gut pluet get gar2#+
14r21 chaw#:m#- oder zemall ni#˙t der2#‘ ar2#‘m#~ wi#˙r2#‘t au#:ch siech oder#+ ge§wollen#-n
14r22 vnd vnder2#+ wei#˙llen#- §terben#- dy#: lew#:t !Da#:s i#˙§t war2#+ §o der man §o gar2#‘ vn 14r23 gluckhaffti#˙g i#˙§t an dem#- hi#˙mell dan#- i#˙§t ni#˙t gu#:t an#- zw heben chay#-ne#-
14r24 weg !Ban es mo#:cht cho#:me#- da#:s ai#˙n#- men#-§ch zw der#‘ §elbi#˙gn#- zei#˙t §tur2#‘b
14r25 i#˙n ai#˙nem hau§s es §tu#:nd ni#˙t lang dar2#‘nach es §tu#:r2ben mer leut i#˙n dem#-
14r26 selbi#˙gn#- hau§s wu#:r2d ai#˙n §i#˙echer ge§unt !Jn der2 selben#- stu#:nd er wedor#‘ft 14r27 woll glu#:cks das er2#‘ hi#˙n cha#:m das es ni#˙t wi#˙deru#-b §tur#‘b wurd195 ai#˙n
14r28 gefanger2#+ ledi#˙g an der#‘wei#˙ll er wedor2#‘fft woll glucks da#:s er#‘ hi#˙n ka#:m
14r29 vnd nit an der §tu#:nd gefangn#- wur2#‘d !Doch i#˙§t gut dy ertzney#: zw ne
14r30 men#- da#~s zai#˙chn#- wan#- der2#‘ mon#- dar2#‘In#- i#˙§t §o gei#˙t es guete zei#˙t wan es
14r31 i#˙§t war2m#- vnd lufti#˙g !Vnd da#:s thu#:et es i#˙n §ei#˙nem#- au#:ff gang wer au#:
14r32 ch196 vnder#‘ dem#- zai#˙chn#- dan#- gepor2en#- wi#˙r2#‘t der2 gewi#˙nt ai#˙n gewai#˙nete197
14r33 ge§talt weder2#‘ zelan#-ck noch zechur2#‘tz !Ni#˙t zw gr2o§s noch ze klai#˙n
14r34 mi#˙t ay#:nr2#+ wei#˙tten#- pr2u#:st es wi#˙r2t auch ai#˙n erli#˙ch per2#‘son vnd wi#˙rt 14r35 getr2ew#: §ta#:t vnd mi#˙lt !Vnd i#˙§t zw#: gen#~ai#˙gt dem#- plan#-etn#- mer#‘cur2i#˙o vn#-
14r36 meloncoli#˙co mi#˙t !Jr2en natur2#‘en @
14r37 £Her#‘nach198 volget vonn#- dem#- zai#˙chenn#- des kr2eb§s ge§chr2i#˙benn#- @
151
[14v]
14v01 {Abb. Sternzeichen199} £D!Er#‘200 kr2ebs i#˙§t feucht vnd cha
14v02 lter natur vnd hat an des
14v03 men#-§chn#- geli#˙dern#- !Di#˙e pru#:
14v04 §t vnd dy#: lungn#- vnd vnd201
14v05 das ober2tai#˙ll des magens !Vnd
14v06 der2 r2y#:ppn vnd das mi#˙ltz wan d#+
14v07 man i#˙§t i#˙m kr2ebs !Der#‘ gewalt hat 14v08 vber2#‘ das tai#˙l der#‘ welt &Septem 14v09 br2i#˙on#- !Vnd nor#‘ders das au#:ch ai#˙n
14v10 wandelpar2#‘s zai#˙chn#- i#˙§t !Ban#- §i#˙ch
14v11 dy §u#:n wan#-delt vnd wo dan i#˙r2
14v12 auff gang i#˙§t da get sy wi#˙der#‘ 14v13 ab !Ban#- §y#: ni#˙t hocher#‘ chu#:men#-
14v14 ma#~g es i#˙§t au#:ch ai#˙n wasser2i#˙gs
14v15 zai#˙chn#- vnd flegmati#˙cy#: natur2 fe
14v16 ucht vnd chalt !Es i#˙§t dan#- gu#:t
14v17 an czw vachen vnd var2en gegen dem#- tai#˙ll der2#+ we#~lt da#:s hai#˙§§et
14v18 &!Septembr2i#˙on oder nor2der2s es i#˙§t au#:ch gu#:t alle di#˙ng gu#:t zetu#:n
14v19 dy man#- mi#˙t wa§§er2#+ volbr2i#˙ngen §oll vnd mu#:e§s !Es §ey#: mi#˙t 14v20 mu#:len vi#˙§chn#- oder2#+ auff dem#- wa§§er2#+ zw var2#‘en es i#˙§t au#:ch gu#:t
14v21 dan#- er2#‘tzney#: zetr2#‘ei#˙ben#- !Vnd tr2#‘anck zw ne#:me#- vnd al§o §oll man#-
14v22 dan#- fr2ew#:d haben i#˙n dem hau§s wan es ge#:hor2t dar2zw#: !Es i#˙§t
14v23 au#:ch gu#:et alles da#:s an zw heben das man#- §nell enden#- §oll es i#˙§t
14v24 au#:ch po#:§s dy#: pr2u#:§t er2#‘tznen#- !Vnd auch hew#:§er2 pau#:en vnd von
14v25 ay#:nnem hau#:§s i#˙n das ander2#‘ zw zi#˙echn#- Vnd von#- ay#:nem gu#:t au#:f
14v26 das ander2#‘ !Es i#˙§st au#:ch po#:§s an heben was man wi#˙ll mi#˙t feur2#+
14v27 wur2#‘cken es i#˙§t po#:§s eli#˙ch leu#:t ma#:chn#- !Di#˙tz zai#˙chn#- gei#˙t chalt vn#-
14v28 feu#:cht §o der2 man dar2#‘In i#˙§t das §elb thu#:t es auch an#- §ei#˙ne#- an
14v29 fang !Ber2 i#˙n der2#‘ zei#˙t ge#:por2en#- wi#˙r2t der2 gewi#˙nt ay#:nne#- gr2#‘o 14v30 §§en#- lei#˙b vnd ay#:n di#˙cke hau#:t er2 wi#˙r2t ober2#‘thalben#- der2 gur2#‘tell 14v31 chlay#:nner2#‘ vnd vnder2thalbn#- gr2#‘o§§er2#‘ !Er2#‘ gwi#˙nt au#:ch gr2u#:en
14v32 zend vnd §ti#˙lt ger2#‘en#- !Vnd ai#˙n au#:g i#˙§t i#˙m gr2o#~§§er#‘ dan#- da#~s an#-d#+
14v33 !Vnd §ei#˙n auch ger2#‘n#- lau#:ffer#‘ vnd landfar2#‘er#‘ vnd potn#- das i#˙§t ge
14v34 §pr2o#:chn#- von#- dem kr2ebs vnd i#˙§t zw#: genai#˙gt dem#- ma#:nen#- mi#˙t 14v35 sei#˙ner2 natur2#‘ vnd lauff !Auch dem flegm#~ati#˙co @
14v36 £Hern#-ach202 vol#~get vonn#- dem zai#˙chenn#- des leo ge§chri#˙benn#- @
153
[15r]
15r01 {Abb. Sternzeichen203} £D!Er2204 leo hat an des men§chenn#-
15r02 geli#˙der#‘n das vntter#‘ tai#˙l des
15r03 her2#‘tzen !Vnd au#:ch der lebe 15r04 r2en#- vnd dy#: ader2n#- dy#: daru#-b
15r05 §ein !Vnd dy#: §ei#˙ttn#- vnd den ru#:ckenn#-
15r06 vnd dy#: §i#˙echtagn#- dy#: an#- i#˙m ge§chech
15r07 en !Ban der2#‘ man#- i#˙n dem#- zai#˙chn#- des
15r08 leo i#˙§t das i#˙§t ai#˙n zai#˙chn#- von or2i#˙ent
15r09 vnd ai#˙n ve§tes Zai#˙chn#- i#˙§t feur2es
15r10 vnd co#:ler#‘a vnd mannes natu#:r2#+ i#˙§t
15r11 !So i#˙§t gu#:t wandeln vnd zw#: r2#‘e 15r12 den mi#˙t gu#:etn#- leu#:tten als mi#˙t kay#:
15r13 ser2n#- kunign#- herczogen !Grau#:en
15r14 vnd pr2#‘elatn#- es i#˙§t au#:ch gu#:etan
15r15 zw vachen !Vnd wur2#‘ckn alle#~s 15r16 das205 man mi#˙t feur2#+ wur2cken#- §ol
15r17 vnd da#~s man wi#˙ll das lang be
15r18 r2i#˙g §ey#: !Es i#˙§t auch dan po#:§s er2tzney#:n#- den#- ma#~gen#- dem#- i#˙n geway#:
15r19 de dem#- gedar2#‘me der2 leber2#‘en vnd der2#+ lu#:ng !Vnd dar2 vmb was ma#-
15r20 thun oder2 la§§en §oll §o der#+ man#- i#˙n dem leo#: i#˙§t da#:s §oll man §chier#‘ 15r21 thu#:n !So der2#‘ leo au#:ff get vnd §oll man#- auch wi#˙§§en#- von#- allen#- zay#:
15r22 chen#- wa#~s gu#:et oder2#‘ po#:§s i#˙§t §o der2#‘ man#- i#˙§t i#˙n dem zai#˙chn#- das i#˙§t au
15r23 ch gu#:t vnd §chad wan es auff ga#:t !Su#:nder#‘ wa#:r#‘ dau#:on §pri#˙cht ma#-
15r24 zw hi#˙n der2i#˙§t i#˙n dem#- zai#˙chn#- vnd thu#:t es dan#- an §ei#˙ne#- auff gan#-g
15r25 !Der2 leo gei#˙t auch206 tr2u#:ckne vnd hai#˙§§e zei#˙t etwe#-n gei#˙t er2#+ auch r2egn#-
15r26 vnd n#~ebell aber2 da#:s i#˙§t ni#˙t von#- i#˙m §elber#‘ !Ber#‘ vnder#‘ dem#- zai#˙chn#- ge
15r27 po#:r2en wi#˙r2#‘t der2#+ ha#:t ober2#‘t halben#- ai#˙nen#- gr2o#:§§en lei#˙b vnd vndertha
15r28 lben ay#:nnen claynnen lei#˙b !Er2 hat au#:ch ay#:nnen wei#˙tten mu#:nd vnd kl
15r29 ayn#-es har2#‘ vnd §chno#:des ay#-nnen gr2#‘o§§en#- pau#:ch gr2o#:§§e pai#˙n !Di#˙§es za
15r30 y#:chn#- i#˙§t zw#: genai#˙gt mi#˙t sei#˙nr2#+ natur2#‘ dem#- planeten §atu#:r2no vn#-
15r31 dem#- flegmati#˙cu#:s @
15r32 £Her#-nach207 vol#~get vonn#- dem#- zai#˙chen#-n der#‘ unckfr2#‘auen#-n ge§chri#˙benn#~ @
155
[15v]
15v01 {Abb. Sternzeichen208} £UJr2go209 das zai#˙chen hat an
15v02 des men§chn#- geli#˙der2n#- den
15v03 nabell vnd auch den#- pau#:
15v04 ch !Jner2#‘thalben#- des nabels
15v05 vnd was da enmi#˙ttn#- i#˙§t von hay#:
15v06 mli#˙chn#- vnd i#˙n wendi#˙gn#- geli#˙der2en#-
15v07 !Als das i#˙n gewai#˙d vnd dy#: gema#:
15v08 chte vnd i#˙r2en §i#˙echtagen wan der
15v09 man#- i#˙§t i#˙n dem#- zai#˙chn#- !Vi#˙r2#‘go dz
15v10 ai#˙n gemai#˙n zai#˙chen i#˙§t das au
15v11 ch gewalt hat vber#‘ den#- tai#˙ll d#°
15v12 welt !Mer2i#˙di#˙es oder2 §under#‘ vnd
15v13 das der erden meloncoli#˙cen#- vnd
15v14 fr2auen natur2 i#˙§t !Ban es chalt
15v15 vnd tr2u#:cken i#˙§t §o i#˙§t dan gu#:t
15v16 §een gar2ten vnd a#:cker#‘ vnd i#˙§t al
15v17 les gu#:et zetun !Das von erden
15v18 Wer2den210 §oll vnd mag wan i#˙n allen zwi#˙falti#˙gen#- Za#~i#˙chen#- als dan#-
15v19 §ei#˙n !Sagi#˙ttari#˙us pi#˙§ci#˙s dy#: da#: gemai#˙n §ey#:n#- §o i#˙§t gu#:t zw#: thu#:n wz
15v20 man#- ger2en#- zwi#˙falti#˙g hat !Es i#˙§t dan gut hau§fr2aw#:n zw#: nem#-en
15v21 vnd wi#˙ti#˙ben vnd ni#˙t i#˙u#:ngkfr2au#:en wan#- sy vnfr2uchper#‘ werden#- oder#‘ 15v22 geper2#‘en#- §y §o geper2en#- §y do#:ch ni#˙t vi#˙ll !Es i§t auch gu#:t an zw he
15v23 ben weg zw machen#- vnd na#:ch chau#:ffma#-n §cha#:tz zw var2#‘en#- ge#:gen#-
15v24 dem tai#˙ll der2#‘ welt !Das da#: i#˙§t mer2i#˙di#˙es es i#˙§t au#:ch gu#:t zw wu#:r
15v25 cken#-211 wa#:s man#- mi#˙t feu#:r2#‘ wurcken §oll vnd i#˙§t po#:ß ertzney#:en#- an#- den#-
15v26 geli#˙dern#- des lei#˙bs dar2#+ vber2#‘ das zai#˙chn#- gewalt hat !Vnd i#˙§t au#:ch
15v27 po#:§s dy#: fues ertzney#:en#- da#:s zai#˙chn#- gei#˙t tr2u#:ckne vnd chalte zey#:t
15v28 !Vnd wi#˙nt pey#: der2#‘ er2den#- vnd wolckn i#˙n den#- lufften an#- r2e#:ge#-n §o es
15v29 dan#- ai#˙n weni#˙g r2e#:gnet das tuet es an §ei#˙nen#- auffgang wer#‘ vnder 15v30 dem#- zai#˙chn#- gepor2en wir2t !Der#‘ gewi#˙nt ai#˙n pr2ai#˙t antlitz vnd ai#˙n
15v31 erbergser2#‘ wi#˙r2t au#:ch gu#:ti#˙g vnd man#-haffti#˙g er#‘ hat au#:ch ai#˙n wey#:
15v32 tten#- mu#:nd vn#-d §ei#˙n i#˙m dy#: leb§§en#- ni#˙t zw di#˙ck no#:ch zw du#:n vnd hat
15v33 ai#˙n gemi#˙§chte var2#‘b !Ni#˙cht zw §wartz noch zw wei#˙§s vnd i#˙§t zw ge
15v34 nai#˙gt dem planet#-n !Jupi#˙ter#‘ mi#˙t sei#˙ner#‘ natur2 vnd melon#-colico @
15v35 £Her#‘nach212 volget von#- dem#- zai#˙chn#- der#‘ wa#~g ge§chri#˙benn#- @
157
[16r]
16r01 {Abb. Sternzeichen213} £L!Jbr2a214 das Zai#˙chen hat an de#-
16r02 men§chn#- !Iner2#‘thalben des na 16r03 bels her2ab gegen#- dem ge
16r04 macht !Dy#:e ny#:er2en dy#:e g
16r05 li#˙der2 vnd dy#: gr2#‘o§§en#- dar2#‘me dy#: ny#: 16r06 er2en vnd das gemacht dy#: hu#:ff
16r07 vnd i#˙r2en#- §i#˙chtu#:mb !Ban#- der man#-
16r08 i#˙§t i#˙n#- dem#- zai#˙chn#- d#° wag das
16r09 auch lufftes pluetes vnd mannes
16r10 natur2 i#˙§t !Ban es warm vnd feu
16r11 cht i#˙§t §o i#˙§t gu#:t weg an zw hebe#-
16r12 vnd auch nach chau#:ffma#- §cha#:tz ze
16r13 var2n#- gegen#- dem taill d#° welt dz
16r14 da hai#˙§§et !Occi#˙dens oder#‘ we§ten vn#-
16r15 i#˙§t auch gu#:t ader la§§en vnd au
16r16 ch gu#:t an zw heben vnd zw tu#:n
16r17 was der2#‘ erden zw#: gehor#‘t !Vnd
16r18 was von erden chu#:mt als acker pau#:en §ee#:n vnd §emli#˙ch di#˙ng vnd wz
16r19 da langber2i#˙g §ei#˙n §oll !Das zai#˙chen gei#˙t feu#:cht vnd war2me zey#:tt
16r20 vnd auch vnder#‘ wei#˙llen#- r2e#:gn#- es gei#˙t au#:ch §ti#˙llen wi#˙nt wan der2 man
16r21 dar2In i#˙§t dar2u#-b i#˙§t dan#- gut auff dem wa§§er#‘ zw#: var2en !Vnd das th 16r22 ut es au#:ch zw sei#˙ne#- au#:ff gang wer2 vnder dem zai#˙chn#- gepor2en wi#˙rt 16r23 !Der2#+ gewi#˙nt ai#˙n gelei#˙chs antli#˙tz vnd ai#˙n mi#˙ttelge§talt vnd wi#˙r2t
16r24 er2#+ ai#˙n man §o wi#˙r2t er2 fr2auen#- li#˙eb vnd i#˙§t es ai#˙n fr2aw §o wir2t §y de#-
16r25 manne#- li#˙eb §y §ei#˙n au#:ch ger2n#- §i#˙nger2#+ §pri#˙ng#° §ai#˙tten §pi#˙ler#‘ vnd liebh 16r26 aber2 §y#: §ei#˙n auch ger2en#- §pi#˙ler2#‘ vnd des §pi#˙ls mai#˙§ter !Vnd i#˙r2 mu#:twi#˙l 16r27 vnd gelu§t §ei#˙n vi#˙ll an#- §ai#˙ttn#- §pi#˙ll vnd an#- gebant §y#: §ei#˙n auch i#˙n §e
16r28 lber2 wai#˙ch !Vnd dy#: vnder2#‘ dem zai#˙chn#- gepor2#‘en wer#‘den#- da#:s §ei#˙n
16r29 gar2 §chon men§chn#- vnd r2o#:t vnder#‘ den#- au#:gen vnd haben ai#˙n payn gr2o
16r30 §§er2 dan da#:s ander#‘ vnd §ei#˙n auch vi#˙ll chu#~ndi#˙g !Das zai#˙chn#- i#˙§t zw#:
16r31 genai#˙gt dem#- plane#:ten venu#:s mi#˙t §ei#˙nr2 natur2#‘ vnd kr2afft vnd gele 16r32 i#˙cht §ich dem !Sa#-gwi#˙neus @
16r33 £Her2#‘nach215 vonn#- dem zai#˙chenn#- des !Scorpi#˙an ge§chri#˙benn#- @
159
[16v]
16v01 {Abb. Sternzeichen216} £D!Er2217 Scor2pi#˙an hat an des
16v02 men§chen gli#˙dern#- dy#: §cha#-
16v03 an fr2awen vnd an#- mann#-e
16v04 vnd auch !Bas zw der2 §ch
16v05 a#:m gehor2#‘t vnd den#- au#:ffgan#~g
16v06 vnd den §i#˙chtu#:mb di#˙e darczw#: ge
16v07 hor2#‘ent !Den §tai#˙n i#˙n den augen vn#-
16v08 dy#: augen tr2u#:b vnd das gr2i#˙e§s dz
16v09 i#˙n der2 plater#‘ lei#˙t !Ban der2 man#-
16v10 i#˙§t i#˙n dem §cor#‘2pi#˙an das ai#˙n ve§tes
16v11 zai#˙chn#- i#˙§t vnd §ta#:t vnd hat gew
16v12 alt vber#‘ den#- tai#˙ll der welt das
16v13 da hai#˙§§et §eptemtr2i#˙o vnd nor
16v14 der2s das wa§§er2#‘ %fflegmati#˙ca#-
16v15 vnd fr2au#:en natu#:r2 i#˙§t wan#- es
16v16 chalt vnd feu#:cht i#˙§t !Ban der2 ma#-
16v17 i#˙n dem §cor2pi#˙an i#˙§t §o i#˙§t es vnge
16v18 luckhaffti#˙g an §ei#˙nem valle !Vnd i#˙§t dan#- ni#˙t gu#:t la§§en vnd er2tzney
16v19 nemen i#˙§t dan#- gut vnd ander2s ni#˙chtz ni#˙t es i#˙§t auch dan#- gu#:t vber2#‘ 16v20 velde zw gen pau#:en oder pu#:r2#‘g auff zw#: heben#- !Oder#‘ zw#: we§tei#˙gn#-
16v21 auch i#˙n §cheff zw#: gen#- au#:ch i#˙§t po#:§s zw der zei#˙t ertzney#:en dy#: gli#˙d#°
16v22 !Da es gewalt vber2#‘ ha#~t das §elb §oll ma#- wi#˙§§en#- wan es auff get
16v23 als wan der2 man#- dar2In i#˙§t !Ber2#‘ vnder#+ dem#- zai#˙chen#- gepor2#‘en wi#˙rt 16v24 der2 i#˙§t clai#˙ns218 vnd mager2s lei#˙bs vnd vn#-der#‘ wei#˙llen#- wei#˙§s es hat
16v25 auch ai#˙n clai#˙ns §pi#˙tzi#˙gs antli#˙tz !Vnd klai#˙ne au#:ge#- vnd lange pai#˙n
16v26 clay#:n fu#:e§s §y#: §ei#˙n219 auch ve§tes mu#:3tes vnd weni#˙gs lei#˙bs geluckha
16v27 ffti#˙g §chalckhaffti#˙g vnkeu§ch vnd zor2#+ni#˙gs mu#:ets !Das zai#˙chen
16v28 i#˙§t zw genai#˙gt dem#- planetn#- lu#:na mi#˙t §ei#˙nr2#+ nat#“ vnd dem flegm 16v29 ati#˙cus mi#˙t §ei#˙ner ar2t @
16v30 £Her2nach220 volget vonn#- dem#- zai#˙chen des §chutzn#- ge§chri#˙benn#- @
161
[17r]
17r01 {Abb. Sternzeichen221} £D!Er2222 §chutz hat an des me
17r02 n§chen gli#˙dern#- dy#: vbri#˙g
17r03 en gelider#‘ !Als ma#- offt
17r04 §i#˙cht ai#˙nen men#-§chen
17r05 der2 da hat §ech§s vi#˙nger an ayn#-
17r06 er2 han#-t !Vnd an der2 andern au
17r07 ch §ech§s vi#˙nger es hat auch dy#:
17r08 vnnatur2#‘li#˙chen gr2o§§e der geli#˙d#+
17r09 als da ay#:nner ai#˙nes vi#˙ngers
17r10 oder2 ay#:nner han#-t ze weni#˙g hat
17r11 !Von gepur2#‘d oder2#‘ von ge§chi#˙ck
17r12 er2 hat au#:ch den#- gepr2e§ten der#‘ 17r13 da von chu#:mbt !Als da ayn#- hu#-t
17r14 oder2ai#˙n wolff oder ai#˙n ander2
17r15 thi#˙er2#‘ !Ai#˙nem ai#˙n gli#˙d ab pi#˙§s
17r16 er2 hat au#:ch dy#: vnnatu#:r2lichn#-
17r17 gewach§s !Als da §i#˙nd wartzn#-
17r18 oder2 vber2pay#:n vnd §emli#˙chen §i#˙echtumb es hat auch den gepr2e
17r19 §ten#- als der2 gli#˙der#‘ dy#: da#:von#- ei#˙n ander#‘ ge§to#:§§en §ei#˙n vnd wi#˙der ze§a
17r20 men gewach§en §ey#:n !Oder2 pey#: ei#˙n ander2 §chullen §ei#˙n vnd von ey#:n an
17r21 der2#‘ gewach§en#- §ei#˙n wan#- der2 man#- i#˙§t i#˙n dem §agi#˙ttar2i#˙o das der zwi#˙ 17r22 falti#˙gen Zai#˙chen#- ay#:ns i#˙§t vnd gewa#:lt hat vber das tail der#‘ welt 17r23 das da hai#˙§§et or2i#˙ent !Das feur2es vnd mann#-es natur2 i#˙§t wan#-
17r24 es hai#˙§s vnd tr2#‘u#:cken#- i#˙§t §o i#˙§t dan#- gu#:t zwi#˙§chn#- den leutten fr2eu#-t
17r25 §chafft zw machen#- vnd §uchn#- !Es i#˙§t au#:ch dan gu#:t zw#: der#‘ adern
17r26 la§§en vnd gu#:t zw#: paden vnd ge#:gen#- dem#- tai#˙ll der2#+ welt da#:s da h
17r27 ai§§et !Or2i#˙ent weg an#- zw#: heben vnd na#:ch chauffman §chatz zw
17r28 var2en#- es i#˙§t au#:ch gu#:t wech§elen vnd wa#~s man#- wech§eln wi#˙ll vn#-
17r29 vr2leu#:g an#- zw vachn#- !Vnd was man#- mi#˙t feur2#‘ wur2cken wi#˙ll vnd
17r30 volpr2i#˙ngn#- §oll wa#:s zw §chi#˙ffu#:ng ge#:hor2#‘t als vi#˙§chen#- vnd a#:cker2#+
17r31 pauen vnd §em#~lich di#˙ng !Auch i#˙§t po#:§s dem vi#˙echer2tzney zw#:2e223
17r32 geben#- wan#- es vber2#‘ dy#: thi#˙er2#‘ gewalt ha#:t das zai#˙chen#- gei#˙t hai#˙ 17r33 §§e vnd tr2uckne zei#˙t §o der2 ma#-n dar#‘In i#˙§t !Das i#˙§t au#:ch zw#: wi#˙§§en
17r34 an §ei#˙ne#- au#:ffgan#-g we#:r auch vnder dem#- zai#˙chen#- gepor2en#- wir2t
17r35 !Der i#˙§t au#~§s wezai#˙chne#:t mi#˙t den#- zai#˙chen dy#: da vor genant §ey#-
17r36 dar2#+ zw i#˙§t er#‘ r2o#:§lat r2o#:t vnd vngetr2#‘ew vnd hat dy#: vaderen zb
17r37 en zend pr2ai#˙tter#‘ i#˙n dem mu#-d dan dy#: andern#- !Das zai#˙chen#- i#˙§t zu
17r38 genai#˙gt mi#˙t §ei#˙ner nat#“ mercur2i#˙o vnd gelei#˙cht §i#˙ch auch dem
17r39 coleri#˙cus @
17r40 £Hernach224 volget vonn#- dem#- zai#˙chen des §tai#˙npocks ge§chri#˙ben @
163
[17v]
17v01 {Abb. Sternzeichen225} £C!Apri#˙cornus226 das zai#˙chen
17v02 hat an#- des men§chen ge
17v03 li#˙der dy#: kny#:e vnd i#˙r2 ader
17v04 vnd i#˙r2en#- §i#˙chtumb !Bann
17v05 der2 man i§t i#˙n dem §tay#:npo#:ck der#‘ 17v06 da gewalt hat vber Meri#˙di#˙es od#+
17v07 §under2 das auch ai#˙n#- wa#:ndelbar#‘s 17v08 zai#˙chen i#˙§t !Vnd auch melon#-coli#˙ce#-
17v09 vnd er2den nat#“ i#˙§t vnd auch fr2a
17v10 uen#- natur2#‘ i#˙§t wan#- es chalt vn#-
17v11 tr2u#:cken i#˙§t !So i#˙§t gu#:t acker garte#-
17v12 vnd wei#˙ngar2#‘ten pau#:en vnd alle
17v13 di#˙ng zw thu#:n vnd an#- zw hebe#-
17v14 dy#: man#- mi#˙t er#‘den volpri#˙ngn#- wi#˙l 17v15 !Vnd mu#:es es i#˙§t au#:ch gu#:t weg
17v16 an zw#: heben vnd nach chauffma#-
17v17 §chatz zw var2en gegen dem
17v18 mi#˙tten tag !Es i#˙§t au#:ch gu#:t zetu#:en vnd alles das an zw gr2ei#˙ff 17v19 en das man §chnell volpri#˙ngen wi#˙ll an dy#:e di#˙ng di#˙e man mi#˙t 17v20 gedi#˙ng oder mi#˙t na#:men au#:§s ny#:mbt !Es i§t po#:§s weg an zw he
17v21 ben#- vnd !Va#:r2en#- ge#~gen#- dem tai#˙ll der#‘ we#~lt §eptentr2i#˙o oder !Nor#‘ders 17v22 es i#˙§t auch po#:§s vr2leuch pegi#˙nnen vnd was man#- mi#˙t feur2 wu#:
17v23 r2cken#- §oll vnd thu#:n §oll !Auch i#˙§t ni#˙t gu#:3t la§§en no#:ch ertzney#: tr2ei#˙ 17v24 ben vnd i#˙§t po#:§s i#˙n der2 zei#˙t dy#: chny#:e er2#‘tzney#:en das zaichenn
17v25 gey#:t chalt vnd tr2u#:cken zei#˙t !So der man#- dari#˙n i#˙§t §o gei#˙t es wy#:
17v26 ndt pey#: der2 er2den vnd wolcken !Jn den#- lufften#- ai#˙n wa§§er vn#-d
17v27 vnder#‘bei#˙llen#- ne#:bell da#:s §elb thu#:t es au#:ch an#- §ei#˙ne#- au#:ff gan#~g
17v28 !Ber2 auch vnder2 dem#- zai#˙chn#- gepo#:r2n#- wi#˙r2t der2#+ gewi#˙nt ay#-ne#-
17v29 clugn#- lei#˙b vnd wi#˙r2t doch r2ai#˙n vmb §i#˙ch vnd gewi#˙nt vi#˙ll har2s
17v30 vnd pr2ai#˙ts antli#˙tz vnd clay#:nne pay#:n vnd r2edet ger2n#- mi#˙t i#˙m §elb#°
17v31 das zai#˙chn#- i#˙§t genai#˙gt der §u#:nnen mi#˙t i#˙r2er2 nat#“ !Vnd dem me 17v32 loncoli#˙cus @
17v33 £Hernach227 vol#~get vonn#- dem#- zai#˙chenn#- des wa§§er#+mans ge§chri#˙be#-
165
[18r]
18r01 {Abb. Sternzeichen228} £D!Er229 wa§§erman#- hat an
18r02 des men#-§chen#- geli#˙dern#-
18r03 dy#: pai#˙n ab vnd ab pi#˙s 18r04 auff dy#: knoden !Vnd dy#:
18r05 ader2n der payn vnd i#˙r2 §i#˙echtu#:mb
18r06 !Ban#- der2 man i#˙§t i#˙n dem#- wa§§er
18r07 man#- das ai#˙n §enfftes zai#˙chen
18r08 i#˙§t vnd das gewalt hat !Vber
18r09 den tai#˙ll der welt das da ha
18r10 y§§et occi#˙dent !Oder#‘ we§ten
18r11 das auch lufftes plu#:etes vn#-
18r12 ma#:nnes natur2 i#˙§t !Ban#- es hai#˙s
18r13 und feucht i#˙§t §o i#˙§t gu#:t i#˙n he
18r14 w#:§§er2 Ze pawen vnd hau#:§fr2a
18r15 wen Zw#: ne#:men %lechen vnd
18r16 ander2 gr2o#:§s di#˙ng enpfachen#-
18r17 !Auch i#˙§t gut zw der2 ader2 ze la§§en !Vn#~d i#˙§t au#:ch guet alle di#˙ng
18r18 an zw#: vachn dy man wer2i#˙g wi#˙ll ma#:chen !Es i#˙§t au#:ch dan po#:ß
18r19 dy pai#˙n er2tzneyen vnd ver2r2 weg an zw heben#- vnd alles dz
18r20 an czw gr2ei#˙ffen !Das ma#- pald vollenden#- wo#:lle das zai#˙chenn
18r21 wan der2 man darIn i#˙§t §o gei#˙t es war2m vnd feu#:cht vnd gu#:tn#-
18r22 wi#˙nt vnd i#˙§t dan au#:ch auff dem wa§§er zw#: var2en !Ber2 auch
18r23 vnder2 dem#- zai#˙chen gepor2#‘en wi#˙r2t der2 wi#˙r2t hoffer#‘ti#˙g vnd ho
18r24 chmu#:eti#˙g vnd !Ay#:ns hochen#- §y#:nnes vnd mu#:tes vnd lernet au
18r25 ch ger2en vnd i#˙§t genai#˙gt zw#: hocher#‘ chu#:n§t !Vnd i#˙§t auch we§ch
18r26 ai#˙den vnd gu#:t zw vnder wei#˙§§en §o §ei#˙n auch dy#:e dy#: vnder2 de#-
18r27 czai#˙chen gepor2en wer2#‘den §cho#:n lew#:t vnd r2o#:t vnder#‘ dem#- antli#˙tz
18r28 !Vnd haben ay#:n pai#˙n gr2o#:§§er !Dan das ander#‘ vnd §ei#˙n auch vi#˙l 18r29 chundi#˙g di#˙tz zai#˙chn i#˙§t au#:ch zw genai#˙gt dem planetn#- !Jup
18r30 i#˙ter2#‘ mi#˙t §ei#˙ner nat#“ vnd au#:ch dem#- !Sa#-gwi#˙neu#:s @
18r31 £Von230 dem zai#˙chenn#- des vi#˙§ch volget her2#+nach ge§chri#˙ben#- @ 18r32 £D!Er231 vi#˙§ch hat an dem men§chen#- gar hi#˙n ab dy#: fu#:es vnd
18r33 i#˙r2en §i#˙echtumb wan der2 man dar2In das auch gewa#:lt
18r34 hat vber2 den tai#˙ll der#‘ welt !Septem#-tr2i#˙o oder nor#‘der2s 18r35 das auch wa§§er flegma vnd fr2awen#- natur i#˙§t wan
18r36 es chalt vnd feucht i#˙§t §o i#˙§t gu#:t hau§fr2aue#- vnd fr2ew#:nt§chafft
18r37 zwi#˙§chen den lewten machen#- !Vnd new#:e mu#-tz slachen !Si#˙lber vnd
18r38 gold wech§eln#- vnd i#˙§t alles das gu#:3t zw#: tu#:en das da czw wa§§er
18r39 gehor#‘t !Oder2#‘ da#:s da#: mi#˙t wa#:§§er2#‘ §oll volpr2acht als vi#˙§chenn#-
18r40 oder2 mu#:ll ma#:chn#- oder auff dem wa§§er2 var2#‘en vnd §under#‘lichn#-
18r41 gegen dem#- tai#˙ll das da hai#˙§§et !Norders es i#˙§t auch gu#:t er2tzney
18r42 en vnd chau#:ffma#- §cha#:tz zw tr2ei#˙ben#- In#- der czei#˙t i#˙§t po#:§s dy#: fue§s
18r43 er2tzn#-ey#:en vber2#‘all !Vnd i#˙§t au#:ch po#:ß wa#:s man mi#˙t feur wur2ck
18r44 en §oll oder2 mu#:es das czai#˙chen wan#- der2 man#- dar2Innen i#˙§t
167
[18v]
18v01 {Abb. Sternzeichen232}§o gei#˙t es chalte vnd feuchte zei#˙t 18v02 oder2#‘ r2e#:gen#- !Das §elbi#˙g vnd das
18v03 vodr2e§t thu#:et es i#˙n §ei#˙ne#- au#:ff
18v04 gan#-g !Ber2 au#:ch vnder de#- zai#˙ch
18v05 en gepo#:r2en wi#˙r2t der2 hat ay#-n
18v06 en getr2uckten#- lei#˙b !Vnd i#˙§t wei#˙t 18v07 vmb dy#: pru#:§t vnd wi#˙r2t ku#:en vn#-
18v08 fr2ai#˙di#˙g vnd vbermu#:tig !Vnd er
18v09 hat auch ai#˙n clay#:n haubt vn#-
18v10 wi#˙r2bet ger2n#- vmb guet vnd es
18v11 get !Jm wo#:ll zw#: hant di#˙tz za
18v12 ychen i#˙§t zw genai#˙gt dem pl
18v13 aneten#- mar2s mi#˙t §ei#˙ner natur
18v14 !Vnd i#˙§t au#:ch flegmati#˙cus mi#˙t 18v15 §ey#:nnen wandell @ Hye nach
18v16 §aget der mai#˙§ter Partholomeu#:s 18v17 von den §i#˙ben#- planete#- wi#˙e di#˙e i#˙r2e#- lauff dur2ch dy zwelff zaichenn 18v18 der2 Su#:nnen haben Vnd auch von i#˙r2en natu#:r2en vnd welichs ki#˙nd 18v19 vnder2 in ge por2en wi#˙r2t vnd was nat#“ das enphachet nd i#˙n we 18v20 lcher2 §tund yetli#˙ch#+ planet r2egni#˙rt @
18v21 £D!Je233 §i#˙ben planetn#- haben i#˙r2en lau#:ff vnd gan#~g hi#˙nd#+ §i#˙ch al#~s
18v22 dy haydni#˙§chen mai#˙§ter §prechent !Das dye planeten reng
18v23 ny#:r2en all tag vnd §tund nach ei#˙n ander#‘ vnd nement dar 18v24 vmb aynen yetli#˙chn#- ta#:g !Jn der#‘ wo#:chn#- d#+ planetn#- nach der#‘ dann#-
18v25 regni#˙r2t @
18v26 £M!Er2cu#:i#+#9234 hebt §i#˙ch an#- auff den#- §am#~tztag zw na#~cht an der2#°
18v27 er#‘§ten §tund dy#: ander2 luna dy#: dr2i#˙t !Sat#“nu#:s !Dy vi#˙erd
18v28 !Iupi#˙ter dy#: funfft !Mars dye §ech§t dy !Su#:n dy §i#˙bent !Ve
18v29 nus dy acht mercur2i#˙#9 dy#: newtte luna !Dy zechent §aturn#9 dy
18v30 ayndlefft Iupiter dy zwelfft mar#‘s @
18v31 £D!Arnach235 §o chu#:mbt des §umtags anhebu#-g als dy#: §u#:n auff
18v32 get !Soll venu#:s mercu#:i#+#9 luna !Sat#“nus !Iupiter mar#‘s §ol 18v33 !Venus mercu#:ri#˙us luna §atu#:rn#9 !Das §ei#˙n auch xi#˙j#˙ §tu#:nden#- al§o
18v34 vi#˙nde§tu dy §iben planeten i#˙n den §iben tagn#- vnd nachten i#˙n der
18v35 wochen#- !Auch i#˙§t zw wi#˙§§en der2 tag §ey langk oder#‘ chur#‘tz von
18v36 der2 §un#-en auff gang pis zw der2 §unnen nyder2gang !So r2echet
18v37 man ni#˙t mer#‘ oder2#+ mynder#‘ wan zwelff §tu#:nd !Vnd auch i#˙n der2#+
18v38 nacht zwelff §tunde @
169
[19r]236
19r01 Stun
d d
es tags
!Sum
tag
Mon
tag
!Er2#‘chtag
Mi#˙tw
och
n#-
!Pfi#˙
ntzt
ag
Fr2
ey#:
ttag
!Sam
tzta
g
19r02 1 Su#:nn !Mann Mars !Mercuri#˙#9 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus 19r03 2 !Venus Sat#“nus !Sunn Mann !Mars Mercuri#˙#9 !Jupi#˙ter
19r04 3 Mercuri#˙#9 !Jupi#˙ter Venus !Sat#“nu#:s Su#:nn !Mann Mars
19r05 4 !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9
Jupiter !Venus Sat#“nus !Su#:nn
19r06 5 Sat#“nus !Su#:nn Mann !Mars Mercu#°i#˙#9 !Jupi#˙ter Venus
19r07 6 !Jupi#˙ter Venus !Sat#“nus Sunn !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9
19r08 7 Mars Mercu#°i#˙#9 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus !Su#:nn Mann
19r09 8 !Su#:nn Mann !Mars Mercuri#˙#9 !Jupi#˙ter Venus !Sat#“nus 19r10 9 Venus !Sat#“nus Sunn !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9 Jupi#˙ter
19r11 10 !Mercu#°i#˙#9 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus !Sunn Mann !Mars
19r12 11 Mann !Mars Mercu#°i#˙#9 !Jupi#˙ter Venus !Sat#“nus Sunn
19r13 12 !Sat#“nus Sunn !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9 Jupi#˙ter !Venu#:s237
19r14 Stu#-d
des nacht 238 !S
umta
g
Mon
tag
!Er2
chta
g
Mi#˙tb
och
en
!Pfi#˙
ntzt
ag
%fr
2ei#˙ta
g
!Sam
tzta
g
19r15 1 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus !Sunn Mann !Mar#‘s Mercu#°i#9
19r16 2 !Mars Mercu#°i#˙us !Jupiter Venus !Sat#“nus Sunn !Mann
19r17 3 Su#:nn !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus 19r18 4 !Venus Sat#“nus !Sunn Mann !Mars Mercu#°i#˙#9 !Jupi#˙ter#‘ 19r19 5 Mercu#°i#˙#9 !Jupiter Venus !Sat#“nus Su#:nn !Mann Mars
19r20 6 !Mann Mars !Merc#“i#9 Jupiter !Venus Saturn#9 !Sunn
19r21 7 Sat#“nus !Sunn Mann !Mars Mercu#°i#9 !Jupiter Venus
19r22 8 !Jupi#˙ter Venus !Saturn#9 Sunn !Mann Mars !Mercu#°i#9
19r23 9 Mars !Mercu#°i#˙#9
Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus !Su#:nn Mann
19r24 10 !Sunn Mann !Mars Mercu#°i#˙#9 !Jupiter Venus !Sat#“nus 19r25 11 Venus !Sat#“nus Sunn !Mann Mars !Mercu#°i#˙#9 Jupiter
19r26 12 !Mercu#°i##9 Jupi#˙ter !Venus Sat#“nus !Sunn Mann !Mars
171
[19v]
19v01 £Satu#:3r#‘nus239 alt vnd kalt hi#˙tzi#˙g vnd vnrayn#- nei#˙d vnd2 ha#:§s i#˙ch auch also §ey#-
19v02 alle mei#˙ne chi#˙nd dye da nder#‘ mi#˙r2 gepor2en §i#˙nd @ 19v03 £S!Atur2nus240 i#˙§t der obr2i#˙§t pla#:net vnd der2 gr2o#:§t vnd der#+ vntu#:gen#-t
19v04 haffti#˙ges vnd i#˙§t chalt vnd tr2ucken §aturnus vnder den pla
19v05 neten vnd §ei#˙ne chi#˙nder !Dy#: vnder2 i#˙m geporn#- werden §ei#˙n gewo#-
19v06 li#˙ch r2auber vnd morder2#‘ vnd wan er2 r2egni#˙rt §o i#˙§t gu#:t r2eden mi#˙t vbeln
19v07 leutten !Der2 planet i#˙§t vn§er2 natur2 vei#˙nt albeg vnd §tet gen !Or2i#˙ent
19v08 vnd i#˙§t ai#˙n planet po#:§er lewt vnd vntu#:gen#-thaffter#‘ dy#: mager §wartz
19v09 vnd dur2#‘ §ei#˙n vn#-d i#˙§t ai#˙n pla#:net der#+ ma#-nen dy#: ni#˙t par#+t haben#- vnd we
19v10 y§§e har#+ !Vnd dy#: i#˙r2e clay#:der2#+ vn#-§aw#:ber tr2#:agen241 !Dy#: chi#˙nder dy#: vnder de#-
19v11 §aturno werden gepor2en dy#: werden#- pr2aw#-n an#- dem lei#˙b vnd §wartz
19v12 mi#˙t §wa#:rtzm#- har !Vnd haben her2#:t242 part au#:ff dem hawbt vnd weni#˙g
19v13 har an dem#- part mi#˙t ayn#-er#‘ §malen#- pr2u#:§t vnd wi#˙r2t ha§§ig vnd vn
19v14 tu#:gen#-thafft vnd auch tr2auri#˙g !Vnd hor2t ger2#‘n#- alle vnr2ayne di#˙ng vn#-
19v15 tr2#:egt243 lieber2 vn§aubr2e clay#:der dan §cho#:ne vnd er#+ i#˙§t au#:ch ni#˙t vn keu§ch
19v16 vnd mag ni#˙t wo#:ll mi#˙t fr2aue#- wandeln !Vnd churtz bei#˙ll tr2ei#˙ben#- vnd
19v17 hat auch von#- na#:t#“ alle po#:§§e di#˙ng an#- i#˙m §atur2nus er2fullet §ei#˙nen
19v18 lauff i#˙n dr2ey#:§§i#˙g i#˙ar2en !Vnd i#˙n etli#˙chen monadtn#- vnd von#- §ei#˙ner ho#:
19v19 che wegen mag ma#- i#˙n gar2 §elten §echen#- vnd §ei#˙n auch §eynner nat#“
19v20 zai#˙chen des §aturnus der2#+ §tay#-pock vnd der2 wa§§erman dy §ei#˙n chalt
19v21 vnd tr2u#:cken vnd an#- i#˙r2er natu#:r2 !Vnd glei#˙cht §i#˙ch au#:ch dem#-244 melon
19v22 coli#˙cus mi#˙t §ei#˙ner natur2#‘ @
19v23 £S!Atur2245 ai#˙n §ter2en#- pi#˙n i#˙ch genan#-t !Der2#+ ho#~ch§te planet gar2#° wo#:l
19v24 er2kant !Natur2li#˙ch pi#˙n i#˙ch tr2u#:cken vnd chalt !Mi#˙t mey#:nen246
19v25 wer2#‘cken mani#˙gfalt !So i#˙ch i#˙n mei#˙nen hew§ern §tan !Jn dem
19v26 §taynpock vnd wa§§er2man !So chu#:m i#˙ch zw §chaden der welt !Mi#˙t 19v27 wa§§er2 vnd gr2o#:§§er !vbr2i#˙ger2 kelt !Mei#˙n er2hochu#-g i#˙n der wag i#˙§t247
19v28 !Jm wi#˙der vall i#˙ch zw#: der fr2i#˙§t !Vnd mag dy zwelff zai#˙chen
19v29 Nachent i#˙n dr2ey#:§§i#˙g !Iar2e#:n er2r2ai#˙chen @
173
[20r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen248}
20r01 £M!Ei#˙ne249 chi#˙nd §ei#˙n dur2r2 plai#˙ch vnd kalt !Gr2ob tr2a#:g po#:ß neydi#˙g vnd
20r02 alt !Dy#:ebig gi#˙eri#˙g gefangn lam vnd chalt !Tyeffe wang ir ha
20r03 wt i#˙§t her2#:t250 kai#˙nen pa#:rt !Gr2o§s leb§§en#- vnd vnge§chaffen#- gewant !Bu
20r04 e§te ty#:er §ei#˙n i#˙n woll erkan#-t !Da#:s er2tr2i#˙ch §y#: dur2ch gr2aben ger2#+ne !Vel
20r05 de pauens §y auch ni#˙t enper2ne !Vnd wi#˙e man#- i#˙n not mi#˙t arbai#˙t §oll
20r06 leben !Das i§t §aturnus chi#˙nder gegeben !Dy#:e anders i#˙r2 natu#:r2e han#-
20r07 Allai#˙n von §atur2#+no §oll man#- ver2§tan @
{Abb. Planetenkinder251}
175
[20v]
20v01 £Jupi#˙ter252 tu#~genthafft vnd gueter#+ §i#˙tten Pi#˙n i#˙ch das wi#˙§§et all gemay#-ntli#˙ch
20v02 Mei#˙ne chi#˙nder dy ku#:nnen §chr2#‘ey#:ben nd le§en woll nd mani#˙ger chun§t 20v03 §ei#˙n §y ger2en alczei#˙t voll @
20v04 £I!Vp#~i#˙ter#+253 der2#+ ander#° plan#~et der2#+ i#˙§t gluckhaffti#˙g tugenthafft wa
20v05 r2me vnd fr2i#˙§ch vnd etwen#- tr2a#:g an §ei#˙nem lauff vnd gehor2t de#-
20v06 zw dy#: da tugenthaffti#˙g §ei#˙n !Vnd her2#+li#˙chn ma#-nen dy#: da gr
20v07 o§s di#˙ck par2thaben vnd wer#‘den ni#˙t kall vnd wan er r2egni#˙rt 20v08 §o get es fr2auen woll dy#: mi#˙t knabe#-n gen#-t !Vnd i#˙§t dan gu#:t vor2 fur
20v09 §ten fr2i#˙d vnd r2echt §uchen dy§er2 planet haltet au#:ch §ei#˙nen lauff mi#˙t 20v10 den#- dy#: da hai#˙§§ent !Coleri#˙ci#˙ dy#: helffent au#:ch den#- lew#:ten#- vnd den#-
20v11 i#˙r2en#- vnd thu#:n do#:ch dem ni#˙t gelei#˙ch vnd thu#:n i#˙r2#+ hi#˙lff hai#˙m#-li#˙ch vn#-
20v12 vnuer2por2#+gen#- lich gegen den leu#:tn#- vnd aller2 mani#˙gli#˙ch vnd §ei#˙n
20v13 auch va§t getr2ew fr2ew#:nt vnd ni#˙t offenlich !Das chi#˙nd das vnder
20v14 dem#- planeten#- gebor2n#- wi#˙r2#+t da#~s !Wi#˙r2t gu#:etma#~§§ig vnd wi#˙r2t ere
20v15 vnd r2echt li#˙eb haben#- vnd hat au#:ch ger2en#- §chone klay#:der#+ vnd wz
20v16 !Da woll §me#:ckt vnd r2ay#:n i#˙§t das hat es ger2en#- !Es wi#˙r2t auch ni#˙t 20v17 par2m#-her#‘tzi#˙g vnd fr2olich vnd hat dy#: zai#˙chen#- der#‘ §u#:nnen#- den §chu#:
20v18 tzn#- vnd den vi#˙§ch !Jupi#˙ter er2fullet §ei#˙nen lau#:ff i#˙n zwelff !Iar2en#- @
20v19 £I!Vpi#˙ter254 §oll i#˙ch nenne#- mi#˙ch !Der ander#+ pla#~net tugen#-tli#˙ch
20v20 war2m#- vnd feucht pi#˙n i#˙ch gar !Jn mei#˙ner natur nw#: nemet
20v21 war2 !Czway zai#˙chen#- §ei#˙n dy hew§er mei#˙n !Der vi#˙§ch der
20v22 §chutz mi#˙t gu#:etm#- §chei#˙n#- !So#: ma#- mi#˙ch dar#+In#- §i#˙echt !Nyem
20v23 ant §chaden dauon ge§chi#˙cht !Jm !Cr#‘e2bs wi#˙r2d i#˙ch erhochet §ere
20v24 !Jm#- §tai#˙npock i#˙ch abher2 cher2e !Mei#˙n vmb lau#:ff dur2ch dy#: zwelff
20v25 czai#˙chen#- i#˙§t !Jn xi#˙j#˙ i#˙ar2en zw aller#+ fr2i#˙§t @
177
[21r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen255}
21r01 £ZVchti#˙g256 tugenthafft vnd §lecht !Bey§e fr2i#˙dli#˙ch vnd ger2echt !Geluck
21r02 haffti#˙g woll geclai#˙det adeli#˙ch !Scho#:n ver2nemi#˙g vnd ku#:nstr2i#˙ch
21r03 !Ai#˙n §cho#:n r2o#:§lat an#-ge§i#˙cht !Als ob es war#+ zw#: lachen#- geri#˙cht
21r04 !Pfa#+r2te valcken vnd ve#:der §pi#˙ll !Ja#:gen#- mi#˙t hun#-dn#- wi#˙ldes vi#˙ll !Ri#˙ch
21r05 ter2 §chi#˙e§§er2 vnd §tudi#˙r2er %legi#˙§ten decr2e#:ti#˙§te#-n vnd hoffi#˙r2er !Czw#: di#˙§en#-
21r06 di#˙ngn#- genai#˙gt §i#˙nd !Dy#:e da §ei#˙n gan#-tz !Jupi#˙ter#‘s ki#˙nd
{Abb. Planetenkinder257}
179
[21v]
21v01 £Mars258 zw §trei#˙t vnd zw vn§alikai#˙t Pi#˙n i#˙ch albegn gern#- perait Als euch
21v02 das er2czai#˙gt mei#˙n klai#˙d Mei#˙ne chi#˙n machen#- mangen#- haß Sy#: enwi#˙§§en 21v03 ni#˙t war2u#-b wi#˙e o#:der#+ vmb was @
21v04 £M!Ar2s 259 i#˙§t der2 dr2i#˙t planet vnd der2 i#˙§t hai#˙s vnd tr2u#:cken#- vnd ge
21v05 luckha#:ffti#˙g po#:§§e do#:ch mi#˙ttelma#:§§ig i#˙n#- §ei#˙ne#- lau#:ff vnd i#˙§t
21v06 ai#˙n planet zor2ni#˙g#+ lew#:t !Vnd dy da ger2en#- kr2i#˙egn vnd to#:be#-
21v07 vnd kall §ei#˙n vnd dy#: kr2au#:s har2 haben vnd weni#˙g vn#-der2 dem pla
21v08 neten i#˙§t gu#:t i#˙n §tr2ei#˙t zw gen#- !Vnd §telen#- r2au#:ben vnd pr2e#-nen#-
21v09 !Vnd wuntten#- dy#: lew#:t Ma#:r2s i#˙§t ai#˙n#- po#:ß planet vnd dar2u#-b wan#-
21v10 er2 r2e#:gni#˙rt vnder2#‘ den#- §iben#- pla#:netn#- !So §pr2e#:chen#-t dy#: m#~ai#˙§ter#‘ das 21v11 ma#- i#˙n §ech ob der2 !Su#:nne#- §o wedeut er2 gr2o#:s ny#:derlegu#-g vnd#+ dem#-
21v12 adell al§o das dy#: her2n#- r2i#˙tter#+ vn#-d kne#:cht de#:s §elbi#˙gn#- !Ia#:r2es ni#˙t 21v13 §chullen kr2i#˙egen#- !Ban §y ligent dar#+ny#:der#+ aber2 des §elben#- !Iars ha
21v14 ben dy paur2e#-n gu#:t kr2i#˙egen#-260 wan#- als di#˙ng ge#:t va#:§tna#:ch Jr2m#- wi#˙ll 21v15 en vnd dar2u#-b dy men#-§chn#- dy#: da en#-pfangen#- werden#-t !Ban#- mar#‘s 21v16 r2egni#˙r2#‘t dy#: wer#+den#-t gar2#+ §te#+ytper2#‘ vnd als vo#+r2ma#:ln ge§pro#:chn#- i#˙§t
21v17 !Ban#- ma#-n i#˙n §i#˙echt ob der §u#:nnen#- §o ha#:t er2 etli#˙ch na#:tur mi#˙t de#- dy#:
21v18 hai#˙§§en#-t §angwi#˙ney wan dy#: §ei#˙n gar2#+ §tr2ei#˙tpe#+r vnd verli#˙r2ent do
21v19 ch vi#˙ll vnd di#˙ck an#- i#˙r2en kr2i#˙egn#- !Ban#- man#- i#˙n aber §i#˙echt vnder d#+
21v20 §u#:nnen §o#: hat er2#+ etli#˙ch natu#:r2 mi#˙t den dy#: da hai#˙§§ent melonco
21v21 lici#˙ !Dy §ei#˙n §ti#˙ll vnd §wei#˙gen#-t vnd §tr2ei#˙tn#- vnd gely#:ngt i#˙n wol
21v22 an#- i#˙r2n#- kr2i#˙egn vn#-d §trei#˙tn#- vn#- des i#˙ar2s wan mar2s r2egni#˙rt §o
21v23 r2egni#˙rt gewo#:nlich ai#˙n#- §tern#- hai#˙§t !Cometa vnd i#˙n welchem lan#-d
21v24 dan#- der2 §tern#- wi#˙r2t ge§echn#- i#˙n de#- §elben land wi#˙r2t an#- zwei#˙ffell gr2o#:s
21v25 tewru#-g vnd hu#:ng#+ !Ban man#- mag i#˙n ni#˙t i#˙n allen lande#- ge§echn#- wa#-
21v26 er i#˙§t ny#:d#+ an#- dem hi#˙mell vn#- na#:het pey#: dem#- ma#-nen#- al§o des ma#:ne#-
21v27 §chaden i#˙n vmb gei#˙t dz ma#- i#˙n ni#˙t woll mag ge§echen vnd wann
21v28 dy#: §un i#˙§t i#˙n dem zai#˙chen !Cancer oder leo vnd welchs Iars er r2e
21v29 gni#˙rt §o i#˙§t ger2n#- der2#+ ma#-n vn#-d dy §u#:n pre#:chenhaffti#˙g !Der vnd#+
21v30 dem planeten gepor#-n wi#˙r2t der2#+ wi#˙r2t r2ot mi#˙t etli#˙chr#‘ vi#˙n§ternu#:s
21v31 !Als dy a#-nder2 §un pr2au#:#- wer2den nach dem#- dz chi#˙nd wi#˙r2t vntuge#-t
21v32 hafft vnd vn§chani#˙g !Es wi#˙r2t hoffer2ti#˙g vnd macht albeg kr2i#˙g
21v33 vn#- vn#:§alikai#˙t261 vn#-der#+ de#- leu#:te#- vn#-d ha#:t vnder den#- zwelff zai#˙chen
21v34 den#- wi#˙der#+ vn#- den#- §cor#+pi#˙an#- !Vn#- i#˙r2 co#-plexn#- vnd i#˙r2 nat#“ vnd !Mars 21v35 er2fullet §ei#˙nen lauff i#˙n fu#:nff hu#:nder2t vnd dr2ey#:§§ig ta#:gen @
21v36 £M!Ar2s262 der2 dr2i#˙t planet vn#-d §ter2#+ne !Pi#˙n i#˙ch gena#-t vn#- zur2n#- ge#-ne
21v37 hai#˙s vnd tr2u#:cken pi#˙n i#˙ch gar2 vi#˙l !Mi#˙t mei#˙n#° kr2afft medi#˙an
21v38 man wi#˙ll Zway zai#˙chn#- §ei#˙n mi#˙r2 vnd#+tan#- !Der2 wi#˙der2 vnd auch
21v39 der2 §corpi#˙an !So i#˙ch mi#˙t chr2a#:fft wi#˙r2d dari#˙n §ei#˙n !Cr2i#˙g wi#˙r2t vnd
21v40 wi#˙der2berti#˙ge pei#˙n#- !Mei#˙n er2ho#:chu#-g i#˙m §tay#-po#:ck i#˙§t Im !Cr2ebs v#+ fur2 i#˙ch
21v41 mei#˙n#° chr2a#:fft li#˙§t !Dy#:e zwelff zai#˙chn#- i#˙ch dur2#+ch var2#+ !Jn zwa#:yenn#-
21v42 !Jar2#‘en#- ga#-ntz vnd gar @
181
[22r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen263}
22r01 £Alle264 mei#˙ne gepor2ne chi#˙nd !Czor2ni#˙g mager2 gei#˙ti#˙g §i#˙nd !Ha§§i#˙g kr2i#˙egi#˙g
22r02 tr2aur2i#˙g mi#˙§§eli#˙ng !Stelen rau#:ben liegen#- di#˙ck !Stechn §lachn#- lern#-
22r03 kr2i#˙egen !Pr2enn#-en mo#-r#‘den#- alczei#˙t tr2i#˙ege#-n#- !Jr2 an#-tli#˙tz i#˙§t pr2aw#- r2o#:t
22r04 vnd §pi#˙tzi#˙g !Ei#˙n §char2ff ge§i#˙cht mi#˙t po#:§er2 wi#˙tz !Clay#:n zend vnd ay#-
22r05 nen#- clay#-nne#- pa#+r2t !Jr2#‘ lei#˙b i#˙§t lan#-g i#˙r2 hent §ei#˙n her2t !Vnd was mi#˙t 22r06 few#:r2 §oll ge§chechn#- !Da#:s mu#:e§§en me#:i#˙ne chi#˙nd#° verJechenn @
{Abb. Planetenkinder265}
183
[22v]
22v01 £Sol266 i#˙ch §ag euch mi#˙t churtzr2#° fr2i#˙§t Mei#˙n §chei#˙n vber2 all planeten i#˙§t
22v02 mei#˙n auffgang gei#˙t des tages §chei#˙n Mei#˙n vnder2gan#-g er2czai#˙get 22v03 dy#: §ter2en vei#˙n @
22v04 £D!Je267 §u#:nn i#˙§t der2#+ vi#˙er#+de plan#~et der2#+ i#˙§t hai#˙§s vn#-d tr2u#:cken#- vnd i#˙§t
22v05 lu§tli#˙ch vnd i#˙§t ai#˙n eynfli#˙e§§ends liecht vnd ay#:n leben allen den#-
22v06 dy da lebent vnd i#˙n#- allen natu#:r2li#˙chn#- di#˙n#-gen#- !Er2#+ i#˙§t ai#˙n pla
22v07 net §chon vnd lu§tli#˙chn#- leu#:chten#- der2#+ lewt an#-tli#˙tz vnd au#:ch
22v08 den leu#:ttn#- !Dye mi#˙t allen#- er2ber2n#- geden#-cken vmb gen#-t vnd mi#˙t er2#+ber2n#-
22v09 lew#:ttn#- di#˙e §u#:nn i#˙§t ai#˙n chuni#˙gli#˙cher §tern#- ai#˙n liecht vn#- ay#:n#- aug der
22v10 we#:lt i#˙§t §y genant vnd §chei#˙net dur2#‘ch §y §elber !Vnd er2leu#:chtet dy#: 22v11 ander2n#- §ter2n#- vnd i#˙§t au#:ch vnder2 den#- §iben plan#:etn#-268 der2#+ mi#˙lte§t vn#-d
22v12 zer2tai#˙lt dy#: zei#˙t !Vnd er2fult §ei#˙nen lau#:ff i#˙n ai#˙ne#- ga#-tzn#- Iar2#‘ Vnd dy#: 22v13 !Su#:n ma#:cht den#- me#-§chen zw#: lei#˙b vo#:ll vnd §ei#˙n an#-tli#˙tz ma#:chet §y i#˙m
22v14 gar2#+ §cho#:n vnd wo#:llge§chaffen#- mi#˙t gr2o#:§§en#- au#:gen#- vnd mi#˙t ay#-nem#-
22v15 gr2o#:§§en#- pa#:r#‘t vnd mi#˙t lan#-ge#- har2#° !Vnd ma#:chet den#- me#-§chn#- na#:ch der#+
22v16 §ele na#:ch i#˙m gelei#˙ch vnd machet In na#:ch andern#- §achen au#:ch wey#:s
22v17 vnd das ma#- i#˙n gar2#+ lieb hat !Vnd ma#:chti#˙n#- ku#:n§tr2ei#˙ch vnd li#˙§ti#˙g i#˙n
22v18 allen di#˙ngn#- vn#-d na#:ch dem#- plan#:etn#-269 §ei#˙n gena#-t dy#: §an#-gwi#˙ney#: wann#-
22v19 dy#: §elbi#˙gen#- leut §ei#˙n gar2#+ wegr2i#˙ffen i#˙n allen#- kun§ten#- !Vnd §ein270 aber
22v20 an gotli#˙chen#- di#˙ngen#- vnd ar2#+ticklen zw#~ei#˙ffelhaffti#˙g vnd §ein au#:ch
22v21 !Vnkeu#:§ch lew#:t vnd wer#‘dn#-t ga#:r2 lei#˙cht er#+czu#:r2n#-t vnd ny#-pt do#~ch gar2#+
22v22 pald ab an y#-n da#~s chi#˙nd da#~s da#+r2 vn#-der gepo#:r2e#-n wi#˙r2t des Iar2s vn#-
22v23 dy#: §u#:nn her2r2#‘ i#˙§t das wi#˙r2#‘t flei#˙§cholt !Vnd gewi#˙nt ay#-n §cho#:n an#-tli#˙tz
22v24 vnd gr2o#:§§e au#:gen#- !Vn#- ay#:n wei#˙§§e va#:rb mi#˙t aynem#- weni#˙g r2o#:ttes ge
22v25 mi#˙§cht !Vnd mi#˙t vi#˙ll par#‘tes vnd ha#:r2es nach der2#+ §u#:nnen#- gelei#˙chnu#:s
22v26 vn#- §chei#˙net au#:§wen#-di#˙g ga#:r2#° guet vnd §ei#˙n leut nach !Ir2m#- hau#:bt dz
22v27 §pr2echen#-t etli#˙ch mai#˙§ter !So §pr2#:echent271 auch dy#: ander2n#- dy#: vnder2 der
22v28 §u#:n gepo#:r2en#- we#+r2den#- §ei#˙n#- gar2#+ wei#˙s vnd fr2#:olich272 vnd haben#- gu#:et
22v29 lew#:t li#˙eb vnd ha#:§§en#- dy#: po#:§en#- !Vnd hat vnder#+ den#- zwelff zai#˙chn#-
22v30 den#- leo#: mi#˙t §ei#˙ner nat#“ vnd au#:ch mi#˙t sei#˙ner !Complexi#˙on @
22v31 £D!Je273 Su#:nn#- man#- mi#˙ch hai#˙§§e#-n §oll !Der2#° mi#˙lte§t plan#~et pyn#-
22v32 i#˙ch woll !Bar2m#- vnd tr2ucken chan#- i#˙ch §ei#˙n !Naturli#˙ch gantz
22v33 mi#˙t mei#˙nem#- §chei#˙n !Der2#+ leo hat mey#-nes hau§s kr2ai#˙s !Dar
22v34 In pi#˙n i#˙ch va§t tr2ucken vnd hai#˙§s !Doch i#˙§t §atu#:r2#+nus §tati#˙gli#˙ch
22v35 !Mi#˙t §ei#˙ner chelten#- wi#˙der2#+ mi#˙ch !Er2ho#:chet wi#˙r2d i#˙ch i#˙m#- wi#˙der#‘ !Jnd#° 22v36 wag vall i#˙ch her2 ny#:der2 !Jn dr2#‘ewn hundert vnd lxv tagn#- !Mag
22v37 i#˙ch mi#˙ch du#:r2ch dy#: zw#:elff zai#˙chen#- tr2a#:genn @
185
[23r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen274}
23r01 £I!Ch275 pi#˙n gluckhaffti#˙g edell vnd vei#˙n !Al§o §ei#˙n auch dy chi#˙nder me
23r02 yn !Rot wei#˙s gemengt §cho#:n ange§i#˙cht !Bolgewor2t wey#:§s chla
23r03 yn har2 ge§li#˙cht !Aynn#-e vai#˙§ten lei#˙b mi#˙t §charffen#- wo#+rten !Mi#˙ttl#-
23r04 augen ayn gr2o§§e §ty#-me !Sai#˙tten#- §pi#˙ll vnd §i#˙ngen von mu#:nde !Boll ezz
23r05 en vnd gr2o§§en her2r2n#- chu#-de !Vor2 mi#˙tten#- tag dy#:enen §y got voll !Dar
23r06 na#~ch §y leben wi#˙e man#- wi#˙ll !Stai#˙n §to§§en §chi#˙r2me#- r2i#˙ngen !Jn gewa
23r07 lt §y geluckes vi#˙ll gewy#-nnenn @
{Abb. Planetenkinder}276
187
[23v]
23v01 £Venus277 mei#˙n pi#˙ldnu§s i#˙§t fr2o#:li#˙ch Nach nei#˙d vnd2 haß §tell i#˙ch Mei#˙ne kin
23v02 der §ei#˙n genaygt zw vnlautr2i#˙kai#˙t Vnd §i#˙nge#-nt fr2oli#˙ch ane lai#˙d @
23v03 £U!Enus278 d2er2#‘ planet !J§t chalt vnd feucht vnd volpri#˙ngt §ei#˙nen#-
23v04 lauff i#˙n dr2ew#:n#- hunder2t vnd xli#˙i#˙j#˙ ta#:gen vnd er i#˙§t auch ge
23v05 luckhaffti#˙g !Venu#:s i#˙§t ai#˙n gueter vnd gemay#:nn#-er#+ §tern#- vnd
23v06 tem#-per2i#˙r2t mar2s po#:§hai#˙t vnd hat ai#˙n wol§chei#˙ne#-nde va#:rb vn#-
23v07 §chei#˙nt vnder dem#- ge§ti#˙r2n#- gar2#+ mi#˙lt§ami#˙gli#˙ch !Vnd i#˙§t als der §u#:nn#-en
23v08 an §chei#˙n i#˙§t an Iu#:ngen leu#:ten#- vnd §ei#˙n gelb lew#:t vnd vnkeu§ch vnd
23v09 dy#: ger2en#- pey#: fr2auen wo#:nen !Vnd au#:ch geren#- fr2au#:en arbai#˙t thuen#-
23v10 wan#- venus r2egni#˙rt §o i#˙§t gu#:et new#:e clay#:der2 chau#:ffen#- vnd an lege#-
23v11 £!Jtem#-279 wan#- venu#:s vor2#+ der2 §u#:nn#-e get §o hai#˙§§et §y luci#˙fer2 vnd wa#-n §y
23v12 dan#- na#:ch get §o hai#˙§§et §y ve§per#‘ vnd venus macht den#- me#-§chen#- ay#-
23v13 ner §cho#:nen per2§on !Vnd mi#˙t va#:§t gr2o#:§§en au#:gen#- vnd au#:g pr2a#:gen
23v14 als dan#- der2#+ §u#:n#-en#- an#- §chei#˙n i#˙§t vnd ma#:cht den#- men#-§chen#- mi#˙t der2 §e
23v15 le wei#˙t§chaffen#- vnd au#:ch na#:ch gei#˙§tli#˙chen#- di#˙ngen#- gi#˙eri#˙g vnd §ei#˙n
23v16 dy#:e dy#: da hai#˙§§en !Coler2i#˙ci#˙ dy#: haben#- §y#:nne dy da zwi#˙felti#˙g §i#˙nd
23v17 vn#- welei#˙ben#-t do#~ch ni#˙t au#:ff i#˙r2em#- zwei#˙ffell vor2#+ dem#- en#-de vnd da
23v18 von#- §ei#˙n §y#: au#:§s ge§chai#˙den von#- den §an#-gwi#˙ney !Dy#: pelei#˙ben#-t
23v19 zwi#˙falti#˙g pi#˙s an i#˙r2 en#-dt wer2 dar2 vnd#+ gebor2en#- wi#˙r2t der2 wax
23v20 et ni#˙t zw lan#-gk !Mi#˙ttelma#~§§i#˙g vnd mi#˙t gr2o§§en augen vnd au#:g
23v21 pr2#‘au#:en#- na#:ch der2 §u#:nnen als dan#- vor2#+ §tet vnd wi#˙r2t §enfft mu#:tig
23v22 vnd woll r2eden#-t vnd zu#:chti#˙g !Vnd zeu#:cht §i#˙ch au#:ch r2ay#-ni#˙gli#˙ch
23v23 vnd hor2#+t ge#:r2en#- §ai#˙ten#-§pi#˙ll vnd tan#-tzn#- der2 pla#:net ha#:t vnder2#° i#˙m
23v24 den och§§en vnd dy#: wag mi#˙t !Ir2er2#‘ natur2 @
23v25 £U!Enus280 der2 funfft plan#-et vei#˙n % !Hai#˙ß i#˙ch pi#˙n vnd der2#‘ my#-nen#-
23v26 §chei#˙n %feucht vnd kalt pi#˙n i#˙ch mi#˙t chrafft !Naturli#˙ch di#˙ck
23v27 mit maye§tat !Czway hew§er2 §ei#˙n mi#˙r2 vnder2tan#- !Der2 §tier2 dy#:e
23v28 wag dar2In i#˙ch han %!fr2oli#˙chs leben#- vnd lu#:§tes vi#˙ll !So ma#:r2s
23v29 mi#˙t mi#˙r2 ni#˙t kr2i#˙egen#- wi#˙ll !Jn dem vi#˙§ch er2#‘hoch i#˙ch mi#˙ch !Jn der2#° ma
23v30 gt vall ich §icher2lich !Jndr2ew#:n hu#:ndert tagn#- vnd funff vnd §ech
23v31 zi#˙ck !Du#:r2ch lauff i#˙ch dy zw#~elff zai#˙chen di#˙ck @
189
[24r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen281}
24r01 £W!As282 chi#˙nder2 vnder2 mi#˙r2 gepor2en wer2en !Dy#: §ei#˙n fr2oli#˙ch vnd §i#˙ngen ge
24r02 r2en#- !Ai#˙n zei#˙t ar2m#- dy#: ander2n r2ei#˙ch !An mi#˙lti#˙kai#˙t i#˙§t i#˙n ny#:eman#-t
24r03 gelei#˙ch !Har#‘pffen#- lau#:tten#- vnd alles §ai#˙tten §pi#˙ll !Hor2en §y ger2en#- vnd
24r04 chu#:nnen §ei#˙n vill !Arglen pfei#˙ffen#- vnd pu§aune#- !Tantzn ku§§en#- hal
24r05 §en#- r2aw#:nen !Jr2#+ lei#˙b i#˙§t hubsch ai#˙n#- hu#:b§schen#- mu#-d !An#- gewi#˙n gefu#:eg
24r06 ir2 antli#˙tz r2o#:t !Vnkeu§ch vnd dy#: my#-ne pfle#:gn#- !Sei#˙n#- venu#:s chi#˙nder#‘ 24r07 albegen @
{Abb. Planetenkinder283}
191
[24v]
24v01 £Mer2curi#˙us284 feu#:r2#‘r2en#-285 i#˙§t mei#˙n natur Als dan weczai#˙chent mei#˙n#- fi#˙gur Mey#-
24v02 ne chi#˙nder §ei#˙n#- gar §cho#:n Sy thuenen#- das §chnell vnd kuenn @ 24v03 £M!Er2cu#°i#9286 der2 planet !J§t getem#-per2i#˙r2t mi#˙t §ei#˙ner#° nat#“ !Al§o kum 24v04 pt er2 zw ai#˙nem gueten §o i#˙§t er2 gu#:t kumpt er2 zw#: aynnem po#:
24v05 §en §o i#˙§t er2 po#:§s !Mer2cur2i#˙us machet den me#-§chen#- en#-phenck
24v06 li#˙ch an §ei#˙nem lei#˙b vn#- ay#-ner#+ §tar#‘cken#- vnd herli#˙chen#- per§on#- vnd ma
24v07 cht den#- men#-§chen#- §cho#:n mi#˙t lutzell hars vnd ma#:cht !Jn na#:ch der2#+ §ell ga#°
24v08 wei#˙§s vnd §ubti#˙ll vnd das er2 wei#˙§hai#˙t gar#+ li#˙eb hat vnd aynnes gute#-
24v09 §iten !Vnd ay#:nner#+ gu#:3ten#- r2ed !Also das er2 wo#:ll §pre#:che#-nt wi#˙r2t vn#-
24v10 doch ni#˙t vi#˙ll r2e#:det vnd gewi#˙nt vi#˙ll fr2ew#:de vnd wi#˙r2t gu#:tz r2a#:tz
24v11 vnd na#:ch287 der2 ler2e der2 wey#:§en#- mai#˙§ter vnd §tern#- §echer#° !So get mercui#˙#+#9
24v12 der2 !Su#:n nach vnd hat ayn#-e#- §chei#˙n denn#- man#- §elten#- §i#˙echt da#+r2u#-b
24v13 er2#+ der2#+ §u#:nnen al§o nahent i#˙§t !Dy#:e vnd#+ dem#- planeten mercu#:ri#˙o
24v14 gepo#:r2en#- wer2#‘den dy#: gewy#-nen#- gr2o#:s zen#-d vnd wer2de#- r2ed §prachi#˙g
24v15 vnd wei#˙s vnd lei#˙cht pey#: den lewten#- vnd plai#˙ch an#- der2 varb vnd
24v16 §tudi#˙r2en#- ger2en#- !Vnd §ei#˙n §ti#˙ll vnd §ubti#˙ll vnd wi#˙r2t vi#˙ll an i#˙n §ten#- vn#-
24v17 §ei#˙n gu#:tz r2ats vnd haben#- do#:ch ni#˙t vi#˙ll gelucks vnd haben doch ni#˙t 24v18 po#:§hai#˙t i#˙n In §elber2 mercur2i#˙us er2fullet §ei#˙n#-e lau#:ff !Jn dr2ewn hu#-
24v19 der2t vnd i#˙n acht vnd dr2ei#˙§§i#˙g tage#- vnd dy#: meloncoli#˙cj#˙ §ei#˙n gar2#°
24v20 getur2§ti#˙g !Vnd ai#˙nes gu#:eten r2a#:tz vnd ger2e#:cht an i#˙n §elber#° vnd dy#:
24v21 lutzell r2eden vnd auch alle di#˙ng hay#:mlich volpri#˙n#-gn#- vnd reg#-ni#˙rt 24v22 vnder2#+ den#- zwe#:lff zai#˙chen mi#˙t der2 !Jun#-ckfr2au#:en vnd mi#˙t dem#- zwi#˙ 24v23 li#˙ng vnd mi#˙t i#˙r2en natur2enn @
24v24 £M!Er2#+cur2i#˙us288 der2 §ech§t planet !Hai§s i#˙ch vn#-d macht#~ wi#˙n#-t he
24v25 r2t !Bar2m#- pi#˙n#- i#˙ch pey#: ai#˙nem war2men §tern#- !Vnd chalt
24v26 pey#: ai#˙ne#- chalten#- ge#:r2en#- !Dy#: zwi#˙li#˙ng vnd dy#: magt vei#˙n
24v27 !Sei#˙n gehai#˙§§en dy hew#:§er2 mei#˙n#- !Dar2In gan i#˙ch gan i#˙ch289 gar#+ tuge#-
24v28 li#˙ch !So Iupiter ni#˙t i#˙r2r2et mi#˙ch !Mei#˙n#- er2#+hochu#-g i#˙§t i#˙n d#+ magt !Jn de#-
24v29 vi#˙§ch wi#˙r2t i#˙ch v#+zagt !Dur2ch dy#: zwelff zai#˙chen#- i#˙ch lauff Iage#-
24v30 !Jn dr2ew#:n#- hu#:nder2t vnd vi#˙er vnd §echzig tagen @
193
[25r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen290}
25r01 £G!Etr2ew291 wehent i#˙ch ger2en leren !Mei#˙ne chi#˙nder §i#˙ch zw hub§chait ke
25r02 r2en#- !Boll zw er2en vnd darczw wei#˙§§e %!fr2ewde chun§t §ubti#˙ll mi#˙t 25r03 pr2ey#:§§e !Jr2 ange§i#˙cht das i#˙§t r2ot voll vnd plai#˙ch !Ai#˙n hoch§tern#-
25r04 geluar2 har2 wai#˙ch !Sy §ei#˙n wo#:ll geler2t vn#-d gu#:t §chr2ei#˙ber !Golt §chm
25r05 id maler2 vnd pi#˙ld§ni#˙tzer2#+ !Orgeln machen vnd orgeln au#:ch vei#˙n !Zw
25r06 mani#˙ger han#-t §y li§ti#˙g §ei#˙n !Jr2 fr2e#:wnt i#˙n hilffi#˙g §i#˙nd !Arbai#˙t§am#- §eyn
25r07 mercur2i#˙us ki#˙nd @
{Abb. Planetenkinder292}
195
[25v]
25v01 £Der2293 man mei#˙n fi#˙gur Ny#-met aller2 planete#-n natur Bi#˙§§et auch das alle mey#-
25v02 ne ki#˙nd2 Ny#:emant ger2en#- vnder tani#˙g §i#˙nd2 @
25v03 £D!Er294 man i#˙§t der ni#˙dr2#‘e§t pla#:net er2#‘ i#˙§t feu#:cht vnd chalt vnd2
25v04 tugenthafft vnd i#˙§t her2r2 aller feu#:chten#- di#˙ng vnd i#˙§t au#:ch
25v05 aller2#‘ §chnelle§t an §ei#˙nem#- lau#:ff !Ban#- er lau#:fft i#˙n ay#:nne#-m
25v06 mo#:nad als vi#˙ll als dy !Su#:n i#˙n ai#˙nem#- Iar er2 vi#˙chtet au#:ch
25v07 !An295 alle chalte lewt dy#: da flu§§i#˙g §ei#˙n vnd auch ge§i#˙echt haben#- vnd
25v08 churtzli#˙ch alle dy#:e dy#: da po#:§§e feuchti#˙kai#˙t an#- i#˙n haben !Ban#- er2 vber#°
25v09 alle feu#:chti#˙kai#˙t r2egni#˙rt vn#-d aller mai#˙§t des me#-§chen#- !Von §ei#˙ne#- plu#:et
25v10 !Dar2#+ vm#-b §o i#˙§t es nu#:tz da#:s wi#˙r2 §ei#˙ne#- lau#:ff mer wi#˙§§en#- vnd i#˙n welch
25v11 em zai#˙chen er2 gan#-g wan#- es i#˙§t ga#+r §orckli#˙ch das man §ei#˙ns lau#:ffs ni#˙t 25v12 wa#:r2 ny#:mpt wan#- er2#+ der2#+ ny#:dr2e§t pla#:net i#˙§t !Es i#˙§t er2 au#:ch als ai#˙n r2i#˙ 25v13 chter2 vnd aller2#+ pla#:netn#- nat#“ an §i#˙ch zeu#:cht ai#˙n tai#˙ll vnd daru#-b mu#:e
25v14 §§en#- wi#˙r2 §ei#˙nen#- lau#:ff mer2#+ wi#˙§§en#- dan#- der#+ andern#- pla#:neten#- wan#- er vb#°
25v15 alles das r2egni#˙rt das i#˙n#- vn#-s i#˙§t !De#+r2 man#- macht den#- me#-§chen#- wei#˙t§ch
25v16 afft vnd al§o das er2 ni#˙t ma#:g pelei#˙ben#- an ay#-ner §tat vnd macht auch
25v17 den#- men#-§chen#- vn#-der2#+ wei#˙llen fr2#‘oli#˙ch vn#-d vnder wei#˙llen tr2au#:r2i#˙g !Vnd
25v18 do#:ch des mer2er2n#- tai#˙ls fr2oli#˙ch vn#- ma#:cht dem#- men#-§chen#- ai#˙n kr2u#:mpe
25v19 na§en#- mi#˙t krumpen na§lochern#- !Vnd gar#+ feu#:chter natur vnd hay#:§§en
25v20 dy#: §elben#- men#-§chen#- flegma#:ti#˙cj#˙ vnd §ei#˙n ga#+r2 tr2a#:g vnd der2 §elbi#˙g men§ch
25v21 hat albe#:g vngeleiche au#:gen#- !Al§o das i#˙m ay#:ns gr2o#:§§er#° i#˙§t dan#- das
25v22 ander2#° vnd e#+r2fu#:lt §ei#˙ne#- lau#:ff alle mo#~nad vnd er2leu#:cht dy#: na#:cht
25v23 vnd entlehet §ei#˙n li#˙echt von de#:r2 !Su#:nnen vnd mert §ich vnd my#-n
25v24 er2t §i#˙ch vnd dy chi#˙nd dy#: er2#+ ma#:chet vnd gepi#˙r2t das werden#- gema
25v25 yn#-ckli#˙ch kna#:ben#- !Vnd gar2 vi#˙ll gemayn#-§chafft mi#˙t den#- men#-§chen
25v26 vmb dy nachte §o der2 man#- hat wo#: vnd mi#˙t der2#° Su#:nne#- vnd wan#-
25v27 der2#+ man#- r2egni#˙r#‘t §o i#˙§t ni#˙t gu#:3t an#- zw#: heben#- no#:ch an#- zw#: vachen#- wed#+
25v28 pau#:en#- no#:ch kay#-nerlay#: §achen !Ban#- es i#˙§t vn§tat vnd vnbelei#˙bli#˙ch
25v29 vnd der2#+ man#- macht auch plai#˙ch vnder2#+ dem an#-tli#˙tz !Vnd mi#˙t fle
25v30 cken#- gemi#˙§cht vn#- macht i#˙n gar vn§ynni#˙g296 al§o das er2 gar#+ po#:ß
25v31 vnd czor2#+ni#˙g wi#˙r2t !Vnd d2as i§t vo#- i#˙r2s wandels we#:gen es i#˙§t zw#:e
25v32 wi#˙§§en das der2#+ man i#˙§t i#˙n ay#-nem#- y#:ettli#˙chen#- zai#˙chen#- ay#:n mo#:
25v33 nad vnd hat vnder2#+ I2m den !Cr2ebs mi#˙t §ei#˙ner nat#“ @
25v34 £D!Er2man#-297 der2#+ letzt pla#:net na#~§§e %!Hay#:§s i#˙ch vnd wur2ch di#˙ng
25v35 §ei#˙n la#:§§e !Chalt vnd feu#:cht mei#˙n wurcken i#˙§t !Natu#:r2#+li#˙ch
25v36 vn§tat zw aller2#+ fr2i#˙§t !Der2 kr2ebs mei#˙n hau§s we§e§§en hat !So
25v37 mei#˙n fi#˙gur dar2#+Innen §ta#:t !Vnd Iupiter2#+ mi#˙ch §chau#:t an !Chayn
25v38 !Vbels ich gewu#:r2cken#- chan#- !Er2#+ ho#:chet wi#˙r2d i#˙ch i#˙m#- §ty#:er2 !I2m §co
25v39 r2pi#˙an#- vall i#˙ch her2#+ ni#˙der2 §chi#˙er2 !Dye zw#:elff zai#˙chen i#˙ch du#:r2ch
25v40 gang !I2n §iben#- vnd zway#-nczi#˙g tagen#- lan#-g @
197
[26r]
{Abb. Planeten und Sternzeichen298}
26r01 £D!Er2299 §ter2en wurcken get durch mi#˙ch !Jch pi#˙n vn§tat vnd wu#:nder2li#˙ 26r02 ch !Mei#˙ner2 chi#˙nder man#- kayns geczemen chan#- !Nyema#-t §ei#˙n §y#: ger2e#-
26r03 vnder2#+ tan#- !I2r2 an#-ge§icht i#˙§t plai#˙ch vnd r2o#:t !Gr2uen#- vnd gr2aw#:§am#-
26r04 Zend ai#˙n dicken#- mu#:nd !Vber2#+§i#˙chti#˙g §chelch ai#˙nen engen ganck !Ger2enn
26r05 hoffer2ti#˙g tr2ag der2 lei#˙b ni#˙t langk %!lauffer2#‘ vi#˙§ch#+ §cheffleut gauckler#°
26r06 !Var2e#-nt§chu#:ler2#+ vo#:gler2 mu#:ller2 pa#:der2 !Vnd was mi#˙t wa§§er §i#˙ch er
26r07 ner2et !Den i#˙§t des ma#-nen#- §chei#˙n peker2et @
{Abb. Planetenkinder300}
199
[26v]
26v01 £Von301 der planeten#- lauff vnd2 auch vonn I2r2enn#- natur2enn#- merck her2nach @
26v02 £E!S302 i#˙§t zw wi#˙§§en von#- den §i#˙ben planeten#- das es got al§o geor
26v03 dnet hat der2 ob dem#- ge§ti#˙r2e#-n i#˙§t !Also welcher planet ay#:ne#-
26v04 §te#:r2en#- aller2#+ na#:g§t get von dem §elbi#˙gen#- §tern#- enphachet er
26v05 §chei#˙n !Soli#˙ch §tern#- §ei#˙n chalte#+r nat#“ etli#˙cher na#:§§er etli#˙ch
26v06 er2 etli#˙cher2303 tr2u#:ckner2#+ etli#˙cher2 hai#˙§§er#° dy#:e §elben#- natu#:r2en#- zeu#:cht den#-
26v07 men§chen von#- dem#- ge§ti#˙r2en#- !Etli#˙cher2 men§ch i#˙§t cha#:lt vnd tr2u#:cker#°
26v08 natu#:r#° der2#+ §wei#˙gt ger2en#- vnd i#˙§t ai#˙n vngetr2#~ewe#+r men#-§ch !Semlich §ei#˙n ka
26v09 lter vn#-d na§§er natu#:r2 dy#:e r2eden#- vi#˙ll vn#- §ei#˙n lan#-g r2a#:chi#˙g vnd vnver2
26v10 tr2a#:genli#˙ch !Etli#˙ch me#-§chen#- §ei#˙n hay#:§s vnd au#:ch tr2u#:ckner#+ natu#:r2 dy#:e
26v11 §ei#˙n ga#:chmu#:3ti#˙g vnd ku#:en#- vnd haben#- ger#-n vi#˙ll gewer#‘be vnd §ei#˙n doch
26v12 an#- der2#‘ li#˙eb vn§ta#:t304 welcher2 hay#:§§er vnd na#:§§er natu#:r#+ i#˙§t !Der#+ i#˙§t dr#°
26v13 pe§ten#- natur2 vnd i#˙§t ger2en#- mi#˙lt vnd er2e#-n geyti#˙g vn#- hat va#:§t li#˙eb
26v14 dy#: fr2aue#-n !Vnd i#˙§t au#:ch §ta#:t an#- der li#˙eb da von#- §prechent dy#: pu#:chr#°
26v15 das an#- dem#- §teren der2#+ da#: hai#˙§§e#-tt305 !Mar#‘s da#:s der2 vr2lewg phlege wa#-
26v16 er2 hay#:§§er vnd kalter vnd tr2u#:ckner nat#“ i#˙§t dy#:e natur2en chome#- der#+
26v17 vnlauter2n#- phli#˙cht !Der2 man i#˙§t der aller2 my#-§t vn#-der#+ den#- §iben#- pla
26v18 neten#- er2lauffet au#:ch a#:ller#+ nydr2e#:§t pey#: der2#+ erden#- dauo#- §o r2i#˙chtet
26v19 §i#˙ch dy#: welt alle nach dem#- man#- !Com#~eta i#˙§t ai#˙n#- §tern#- der2#‘ §elber#+
26v20 er2§chei#˙net ny#-mer#° wan#- §o §i#˙ch da#:s r2ei#˙ch ver2#+wandelen#- wi#˙ll §o er#‘ 26v21 §chei#˙net er2#+ !Den#- §tern#- §oll man#- kr2e§en#- oder2 an§echen das er2 von#-
26v22 dem#- §chei#˙n der2 von#- i#˙m §chei#˙net als der man#- §chei#˙nt der2#° §ter2n#- lau#:
26v23 ffet ni#˙t vn#-der2#+ an#-d2er2n#- §teren#- !Dy#:e pu#:cher wellen#-t da#:s es ai#˙n li#˙echt
26v24 §ey das go#:t mi#˙t gewalt en#-czu#-det hat i#˙n den#- lufften zw webey#:
26v25 §§en#- kunffti#˙g di#˙ng der2 welt @
26v26 £Von#-306 der#+ Sunn#-en lauff d2ur2ch d2y#:e zwelff zai#˙chen i#˙n d2em#- gantzen I2ar @
26v27 £B!Er2#‘307 well den#- lau#:ff des mor#‘gen#-s !Recht wi#˙§§en#- wi#˙e dy#:e
26v28 !Su#:nn du#:r2ch dy#: zwelff zai#˙chen#- i#˙n dem#- Iar2 lauffet I2n
26v29 ay#-em i#˙ar2#+ dur2ch alle czai#˙chen#- !Vnd pelei#˙bt i#˙n ay#-nem
26v30 y#:edli#˙chen#- czai#˙chen#- xxx tag §o §ei#˙n auch zwelff zai#˙che#-
26v31 !Ar2i#˙es thaur2us ge#-ini#˙ @ vnd dur2#‘ch di#˙§e der2#+ man#- i#˙n ay#-nem mo
26v32 nadt vnd du#:r2ch lau#~ffet au#:ch alle zai#˙chen#- i#˙n .xxx. tagen vnd2
26v33 pelei#˙bt i#˙n ay#-nem y#:edli#˙chn#- zai#˙chen dr2i#˙tthalben tag vnd mi#˙t d2e#-
26v34 d2u#:r2ch lau#:ffen#- d2i#˙§er2 zai#˙chen#- !So ku#:mpt d2an#- d2er2#+ ma#-n zw dem#- zay#:
26v35 chen#- d2a dy#: §u#:nn#- Inn#-e i#˙§t vnd mi#˙t d2em#- ver2ay#-net er2#+ §ich §o wi#˙r2t
26v36 dan#- der2#+ man#- i#˙n pru#-§ti#˙g !Ban#- d2a#: end2et er#‘ §ei#˙ne#- lau#:ff wan#- aber#°
26v37 der2#+ man#- §i#˙ch §chai#˙det von#- d2er#° §u#:nne#- xi#˙j#˙ gr2#‘adu#:s das gepu#+rt an
26v38 den#- hi#˙mell lvj#˙ mey#:ln !So vahet er2#+ an czw#: lei#˙chten#- vnd wi#˙r2t da#-n
26v39 ge§echen#- von#- den#- men#-§chen#- vnd2 ny#:#-mpt au#:ch §ei#˙n liecht von#- d2er2#°
26v40 !Sunn#-enn @
201
[27r]
27r01 £Hi#˙e308 hi#˙n nach §tet ge§chri#˙benn#- vonn#- d2en Si#˙benn planetenn#- wi#˙e §y r2egni#˙r2en#~t
nach d2es 27r02 Mann#-en §chei#˙n vnd wan §y#: §chon#-n feu#:cht oder na#:ß weter geben#-n 27r03 £B!Jldw#:309 wi#˙§§en alle zei#˙t r2egen oder §cho#:n des i#˙ars §o wart eben#- i#˙n we
27r04 lcher §tu#:nd der2 man#- new an#- dem#- hi#˙mell §ey#: !Jn welcher §tu#:nd ta#:gs
27r05 oder2#+ nachts als dan#- dar#+ vor#+ ge#:§chri#˙ben §tet §o wart auch welch
27r06 er2 planet r2egni#˙rt vn#-der den#- §i#˙ben pla#:neten @ Di#˙e Sunn @
27r07 £!J§t310 es das dy §u#:nn r2egni#˙rt vn#-der2 den#- §iben planetn#- !So wi#˙s das dz mon#~ad2t
27r08 wi#˙r2t hai#˙ß vnd au#:ch du#:r2r2#‘ nach den vi#˙er zei#˙tten des !Iars Wan des plane
27r09 ten fur2er2 i#˙§t der leo vnd §ei#˙n natur @ Der mann @
27r10 £!Bi#˙r2t311 das new i#˙n dem#- planeten#- luna !So wi#˙r2#+t der#+ mon#-adt wi#˙ntti#˙g vn#-d
27r11 dur2r2#‘ vnd auch ai#˙ns tai#˙ls r2egen wan §ei#˙n fur2er i#˙§t der !Cr2ebs der i#˙§t
27r12 chalt vnd feucht als das wa§§er @ Saturnus @
27r13 £!Bi#˙r2t312 aber2 das new#: i#˙n dem#- planeten#- !Satu#:r#‘nus §o wi#˙r2#‘t der#+ mon#-ad hai#˙s
27r14 oder2 chalt nach dem#- i#˙ar vnd halbs r2egen#- wan §ei#˙n fur2er i#˙§t der §tai#˙n pock
27r15 der i#˙§t gena#:tur#‘t als das few#:r !Vnd der wa§§er#+ man#- als der lu#:fft vnd Iu#:p
27r16 i#˙ter gemi#˙§cht auff pai#˙d §eyttenn @ Mars @
27r17 £!Bi#˙r2t313 das new#: i#˙n dem#- planeten#- mar#‘s !So wi#˙r2#‘t aber#° ai#˙n#- tai#˙ll r2egen#- vnd
27r18 ai#˙n tai#˙ll du#:r2r2 wan §ei#˙n fur2er i#˙§t der wi#˙der vnd der §corpi#˙an !Ban der wi#˙=
27r19 der2#+ i#˙§t als dz fewr vnd der scor2pi#˙an#- als dz wa§§er @ Mercuri#˙us @
27r20 £!Bi#˙rt314 da#:s i#˙n dem planeten mercuri#˙us !So wi#˙r2t der mo#:nad vi#˙ll r2e#:ge#-nn
27r21 wan#- §ei#˙n fur2er i#˙§t dy i#˙ungkfr2aw vnd der zwi#˙li#˙ng wan der zwi#˙li#˙ng i#˙§t
27r22 als der luft vnd dy !Ju#:ngfr2aw#: als dy#: erdenn @ Jupi#˙ter @
27r23 £!Bi#˙r2t315 das new#: i#˙n dem plan#:eten#-316 !Jupi#˙ter !So wi#˙r2t der2 mon#~ad halber#° tr2u#:
27r24 cken als das feu#:r2 vnd halber gemi#˙§cht mi#˙t wi#˙nt vnd mi#˙t r2egen#- Ban#-
27r25 §ei#˙n fu#:r2er2#+ i#˙§t der2#+ §chu#:tz vnd der2 vi#˙§ch wan der §chutz i#˙§t als das feur
27r26 vnd der2#+ vi#˙§ch i#˙§t als das wa#:§§er#+ @ Venus @
27r27 £!Bi#˙r2t das new#: i#˙n dem#- planeten Venus !So wi#˙r2#‘t der#+ mon#~ad §er#° hai#˙s vn#-
27r28 dur2r2 oder2 chalt vnd du#:r2r2 vnd au#:ch das vi#˙ertai#˙ll des i#˙ars albey r2ege#-
27r29 wan#- §ei#˙n fur2er2 i#˙§t der ochß vnd dy#: wag !Ban#- der2 wa#:g natur i#˙§t als
27r30 der2#+ wi#˙nt vnd der2 o#:chß als dy#: erden#- al§o i#˙st der mo#:na#:d gemi#˙§cht von de#-
27r31 payden von dem wi#˙nt vnd von#- dem wa§§er @
27r32 £Vo#-n317 der Su#-nnen lauff durch dy zwelff zai#˙chen i#˙n dem#- gantzenn I2ar2#‘ @ 27r33 £H!Je318 wi#˙ll d2er#‘ mai#˙§ter#° wei#˙§§en !Bi#˙e d2y#:e §u#:nne lauffet i#˙nd2en mo#~nad#-n
27r34 i#˙n dem I2enner i#˙§t dy#: §u#:nne i#˙n dem#- zai#˙chen#- des wa§§er mans !Jn de#-
27r35 hornu#-g i#˙§t §y i#˙n dem#- za#~i#˙chen#- des vi#˙§ch Jn#- dem#- mertzen#- i#˙§t §y i#˙n
27r36 dem#- czai#˙chen des wi#˙ders !Jn dem#- apri#˙ll i#˙§t sy#: i#˙n dem#- zaychenn#-
27r37 des §ty#:ers !Jn dem may#:en laufft §y i#˙n dem#- zai#˙chen#- de#:s zwi#˙li#˙ngs !Jn de#-
27r38 !Br2achmo#~nad i#˙§t dy#: §u#:nne i#˙m kr2ebs !Jn dem#- hewmo#:nad i#˙§t §y i#˙n dem leo
27r39 !In de#-m au#:g§ten#- i#˙§t §y#: i#˙n der Iu#:nckfr2au#:en#- !Jn dem#- ersten herbst mo#:nat
27r40 i#˙§t §y#: i#˙n der2 wa#:g !Jn dem#- an#-dern#- her#‘bst i#˙§t §y i#˙n dem#- §cor#‘pi#˙an !Jn d2em#-
27r41 dr2i#˙tte#- her#‘bst mon#:adt319 i#˙§t dy#: !Su#:n#- i#˙n dem#- §chu#:tzen !Jndem wi#˙nter#‘mo#: 27r42 nadt i#˙§t §y i#˙n dem#- !Stai#˙npo#:ck @
205
[28r]
28r01 {Abb. Temperamente320} £Hi#˙e321 hi#˙n nach §tet ge§chri#˙ben#- von d2enn
28r02 vi#˙er com#-plexi#˙on vnd von Ir2en natur2enn 28r03 das §ey der meloncolicus Coleri#˙cus ffle 28r04 gmaticu#:s vnd §angwi#˙neus Vn§er com 28r05 plexian i#˙§t von er2tr2ei#˙ch darumb 28r06 wi#˙r2#‘ §ei#˙n §warmu#:ti#˙kai#˙t gelei#˙ch @ 28r07 £E!S322 §ei#˙n vi#˙er handen natur2en#-
28r08 vnd complexian di#˙e der me
28r09 n§ch hat !Etli#˙cher men#-§ch
28r10 hat zwo etli#˙cher dr2ey#: et
28r11 licher2#‘ vi#˙er !Doch §o ny#-pt ai#˙ns dy#:e
28r12 ober2en#- han#-t das i#˙§t dy#:e der men
28r13 §ch aller ma#:i#˙§t hat !Vnd chai#˙n#- me#-
28r14 §ch hat allai#˙n ay#:nne do#:ch zw#:e
28r15 hant von#- dem#- er§ten#- !So §chrei#˙bt
28r16 man#- vnd li#˙§t von#- dem#- melon#-co
28r17 li#˙cus !Da#~s der2 wi#˙r2t gelei#˙chet
28r18 dem er2tr2ich vm#-b §ach waru#:mb wan#- das ertr2i#˙ch i#˙§t chalt vnd tr2u#:ckenn#-
28r19 als dy zai#˙chen der2 och§s vnd dy#: !I2u#:ngfr2aw#: vnd der2 §tay#:npock vnd
28r20 i#˙§t zw genai#˙gt mi#˙t allen#- §achen aber2 dy#: kelten vnd dy tr2ucken dy#:e
28r21 vber2 tr2effen#-t i#˙n i#˙m#- !Er2#+ wi#˙r2t au#:ch zw#: gelei#˙cht dem her2b§t wan#-323 der
28r22 i#˙§t chalt vn#- tr2u#:cken#- wan#- dy#: czei#˙t des herb§tz i#˙§t chalt !Dar#‘ vm#-b
28r23 das dy#: §u#:nn zw#: der2 §elben#- zei#˙t an#- dem#- hi#˙n#-egang324 an dem#- hi#˙mell vo#-
28r24 vns get i#˙n dy wi#˙ntr2#˙igen#-325 zai#˙chen !Es i#˙§t au#:ch tr2ucken dy zei#˙t vonn#-
28r25 §ach wegen#- der2#+ tr2u#:ckenhai#˙t du#:r2ch den §u#:mer v#+ ga#:ngn#- vnd das
28r26 dar2In gebor2en#- wi#˙rt !Er2 wi#˙r2t au#:ch zw gelei#˙cht dem#- altar wan §o
28r27 der2 men§ch alt wi#˙r2t pey#: lxx Iaren §o vachet §ich an §ei#˙n arbai#˙t §ei#˙nr#+
28r28 §i#˙echtagen vn#- daru#-b §o §pr2i#˙cht der2#+ ϼphet !Daui#˙d i#˙§t der men#-§ch do
28r29 ch wolmu#:ge#-t wan#- er i#˙§t .l.x.x. Iar2#+ alt §o mu#:es er doch arbai#˙t vnd
28r30 §mertzen#- ley#:den#- !Czw#: dem#- an#-dern#- ma#:ll §o merck vn#-d ny#:m#- wa#:r dz
28r31 der2 melon#-colicu#:s i#˙§t vorcht§am#- vnd ni#˙t getu#:r#+§ti#˙g wan#- er ma#-gelt
28r32 der2 §ach der2 getur2§ti#˙kai#˙t !Das i#˙§t offenbar an#- den#- hai#˙§§en#- ty#:ern als
28r33 an dem#- leo das gar2#+ ai#˙n tur#+§ti#˙g ty#:er i§t von#- der hitz wegn#- !Czw#: dem#-
28r34 dr2i#˙tten#- mall §o i§t der2#+ meloncoli#˙cus tr2a#:g vnd ai#˙nes tr2a#:ge#- lau#:ffs
28r35 !Daru#-b wan#- er2 i#˙§t ai#˙ner2 klaglichen vnd kalten#- nat#“ di#˙e i#˙m dy#: ge
28r36 li#˙der2 §wa#:r2 macht vn#- §terckt i#˙m dy#: gly#:der2#+ al§o das §y wer2#+den vn
28r37 gelai#˙ti#˙g zw#: gen#- !Des gelei#˙chen#- macht dy#: wi#˙r2m#- dy#: gli#˙der2 r2i#˙ng
28r38 an dem#- men#-§chen#- czw#: lau#:ffen#- vn#-d zw gen#- !Czw#: dem vi#˙er2den mal
28r39 §o i#˙§t der2 meloncolic#9 von#- der2#+ ai#˙ge#-§chafft wegen der2 kelten#- ha#:
28r40 §§ig vnd tr2au#:r2i#˙g vnd ver2ge§§en !Czw#: dem#- funfften#- ma#:ll §o i#˙§t er
28r41 von der2#+ ay#:gen#- §cha#:fft we#:genn der2#+ chelten#- weni#˙g pe#:gern#- er2 pegert
28r42 lutzell vnd mag weni#˙g !Er2#‘ peger2t weni#˙g von §ei#˙ner tr2#‘au#:r2igka 28r43 y#:tt we#:gen#- dy#: er2 an#- i#˙m ha#:t er2#+ ma#:g au#:ch lu#:czell vn#- weni#˙g von
207
[28v]
28v01 £!Sei#˙ner326 kelten wegen dy#: er2 i#˙n !Im hat nu#: ny#:m war als vi#˙ll ai#˙ne#- men§chn#- de#+
28v02 ay#:gen§chafft gepri#˙§t dy#: zw#: ay#:nner2#+ yedli#˙chen#- na#:tur gehort §o er ye my#-
28v03 ner der2#+ na#~tu#:r hat vn#- §o er2 y#:ee mer2#+ der2#+ ay#:gen#-§chafft hat der an#-dern#-
28v04 na#:tu#:r2en#- §o der2#+ man#- i#˙n i#˙m#- i#˙§t !Vnd re#:gni#˙r2et au#:ch mi#˙t mars vnd2 mi#˙t 28v05 der2 §u#:nnen#- i#˙n !Ir2#‘em#- la#:uff @
28v06 {Abb. Temperament327} %fflegmati#˙cus un§er complexi#˙on J§t328
28v07 mi#˙t wa§§er mer getan Darumb wi#˙r2#° 28v08 §ubti#˙likai#˙t vn#-d hub§chait ni#˙t mu#:gen |lan329
28v09 £D!Itz330 hi#˙e nach i#˙§t ge
28v10 §chri#˙ben#- von#- den#- dy#: da#~ ha
28v11 y§§en#- %flegm#:ati#˙ci#˙331 vn#- au
28v12 ch al§o ny#:m#- war i#˙n di#˙§em#- pu#:3ch dz
28v13 der2 %fflegm#:ati#˙cu#:s332 wi#˙r2t zw#: ge#:lei#˙ 28v14 cht dem#- wa#:§§er#‘ wan#- das wa§§er
28v15 da#:s i#˙§t feu#:cht !Vn#-d2 au#:ch333 kalt
28v16 al§o der2 flegm#~ati#˙#~cu#:s der#‘ gelei#˙ch
28v17 et §i#˙ch auch dem#- zai#˙chen#- mi#˙t §ei#˙n
28v18 er2 natu#:r#‘ !Das i#˙§t dem#- zwi#˙li#˙ng der#+
28v19 wa#:ge vn#-d au#:ch dem#- wa#:§§er#‘man#-
28v20 vnd dem#- vi#˙§ch !Czw#: dem#- an#-der#-n
28v21 mall nempt wa#:r2 der2#+ ai#˙gen#-§chafft des flegm#:aticus334 das dy#:e §ei#˙n §e
28v22 nfftes §y#:nnes vnd §chlaffet vi#˙ll !Vnd §ei#˙n auch va§t gr2o#:b mi#˙t i#˙r2en#-n
28v23 §ynnen vnd §ei#˙n tr2ag und §pey#:ben#- vi#˙ll vn#-d §ei#˙n vai#˙§t leu#:t vnd we
28v24 y§ß vnder2#+ dem#- an#-tlitz !Vnd tr2ei#˙ben#- au#:ch ger2en#- §ai#˙tten#- §pi#˙ll vnd ge
28v25 lei#˙chet §i#˙ch au#:ch den#- plane#:ten#- dem#- !Man vnd dem#- venu#:s mi#˙t i#˙r2e#-
28v26 na#:tur2en vn#-d mi#˙t §ei#˙ner#‘ com#-plexnn @
209
[29r]
29r01 {Abb. Temperament335} £San#-gwi#˙neus336 vn§er com#-plexi#˙an Seyn
29r02 von lufftes vi#˙ll Dar#‘ mb wi#˙r2 ho#:chmu#: 29r03 ti#˙g §ei#˙n an alle zi#˙ll @
29r04 £D!Je337 dr2i#˙tten das §ei#˙n dy#: §ang
29r05 wi#˙ney#: es i#˙§t zw#: wi#˙§§en#- das
29r06 der2 §angwi#˙neus i#˙§t mi#˙lt !Da#+
29r07 vmb wan er2 i#˙§t hi#˙tzi#˙g vnd feu#:cht
29r08 von#- der2 ai#˙gen#-§cha#:fft der2#‘ hi#˙tzi#˙gkai#˙t 29r09 !Da#~s §y#: doch albey §ei#˙n#- §ter#‘cker vn#-
29r10 dar2#‘ vmb §ei#˙n all lewt va§t kr2an
29r11 ck wan#- §y §ei#˙n va§t chalt von#- der2#+
29r12 ai#˙ge#-§chafft wegen#- der2#+ kelten#- dy#: §y
29r13 zw i#˙r2 zeuchet !Czw#: dem#- an#-de#:r2en
29r14 mall §o wi#˙r2t der2#‘ §an#-gwi#˙neu#:s zw#:
29r15 gelei#˙cht dem#- !Glentzen#- wan#- dye
29r16 czei#˙t i#˙§t chalt vnd feucht vnd dar2umb §o i#˙§t zw#: wi#˙§§en#- da#:s dy#:e §an#-
29r17 gwi#˙ney !Com#-plexian#- i#˙§t an#- allen#- lebli#˙chen#- §te#~ten#- vnd la#:ng wer2e#-
29r18 den wan#- das leben#- i#˙§t i#˙n dem#- her2#‘tzen#- !Vnd i#˙n den#- feu#:chten#- zw#: dem#-
29r19 dr2i#˙tten#- mall §o i#˙§t der2 §an#-gwi#˙n#-eus mer2#° gen#-ai#˙gt zw#: §pi#˙len#- vnd zw d#+
29r20 pu#:eber2ey#: !Ban#- der2#‘ melon#-coli#˙cu#:s oder2#‘ der2#+ flegmati#˙cu#:s vnd gena#:
29r21 y#:gt gewon#-li#˙ch zw#: der2 ler2#:e338 vn#-d i#˙§t §a#:ch war2#‘ vm#-b wan#- der#‘ §an#-g
29r22 wi#˙neus ma#:§li#˙chen#- hi#˙tz hat vn#-d feu#:cht vn#-d §ei#˙n#- gai#˙§t §ei#˙n#- §ubti#˙ll al
29r23 §o was man#- i#˙n fur2 ley#:tt !Das §y das gar2#+ §chi#˙r2 vnd gar2#+ pa#~ld pegr2ei#˙ 29r24 ffen#- vnd §ei#˙n au#:ch von#- ni#˙chte wei#˙§§er2 wan#- dy#: melon#-colici#˙ ode#+r2 dy#:
29r25 %flegm#~atici#˙ wan#- dy#: §an#-gwi#˙ney#: §ei#˙n aller2#+ mai#˙st pew#:egt vnd vn#-
29r26 §tati#˙g vn#-d ligen#- den di#˙ngen#- er2#‘en§tlich o#:b !Aber2 dy#: melon#-coli#˙ci#˙ vn#-
29r27 dy#: flegma#~ti#˙ci#˙ dy#: §ei#˙n vn#-pebegen#-li#˙ch vnd §ei#˙n §tat an#- i#˙n §elber#° vn#-
29r28 li#˙gent der2#+ ler2#+ §tati#˙gli#˙ch ob vnd §ei#˙n au#:ch wei#˙§s !Au#:ch §ei#˙n §y#: mi#˙t 29r29 li#˙ebeha#:ber2#‘ vnd li#˙ebhaber2In vn#- §ei#˙n fr2#‘oli#˙ch vn#-d lachent ger2#‘enn#-
29r30 £!Vnd339 §ei#˙n r2o#:tt vn#-der2#‘ dem#- an#-tli#˙tz vn#- §i#˙ngen#-t ger2en vnd §ei#˙n etzwa#:s
29r31 ku#:en vn#- haben#- vi#˙ll flei#˙§ch an#- i#˙n vn#- §ei#˙n fr2e#:ch vn#- vn#-tugenthafft vn#-
29r32 §ei#˙n#- zw#: genai#˙gt dem#- plan#:eten340 !Jupi#˙ter mi#˙t §ei#˙ner2 natur vnd
29r33 !Complexiann @
211
[29v]
29v01 {Abb. Temperament341} £!Coleri#˙cus342 vn§er complexian J§t von fe
29v02 wr2 kr2i#˙ege#-n czu#:rnen#- §chlachen#- J§t albeg 29v03 vn§er an vechti#˙gung @ 29v04 £D!Je343 vi#˙erden hai#˙§§en#- dy#: co#~leri#˙ci#˙V
29v05 nd i#˙§t zw#: wi§§en das der2#+
29v06 coler2i#˙cus i#˙§t mi#˙lt !Ban dy#:
29v07 feuchtikait enczu#:ndet Im da#:s plu#:t
29v08 !Vnd das hertz vnd machet i#˙n au#:ch
29v09 gelb vn#-der2 dem#- antli#˙tz vn#-d dar2#‘ v#-b
29v10 §ei#˙n dy#: coler2i#˙ci#˙ ga#:r2#‘ getur§ti#˙g !Von
29v11 der2#‘ hi#˙tz wegen#- pey#: dem#- hertzen#- vn#-
29v12 vm#-b da#:s hertz !Czw#: dem ander#-nn
29v13 ma#:ll §o wi#˙r2t der2 coler2#‘i#˙cu#:s zw#: ge
29v14 leichet dem#- Su#:mer wan#- der2 hai#˙s
29v15 vn#- au#:ch tr2u#:cken#- !I§t al§o i#˙§t auch
29v16 der2 coler2i#˙cu#:s hais vnd tr2ucken#-
29v17 !Er2 wi#˙r2t auch gelei#˙cht de#~r2#‘ vn#-tugent zw dem dr2i#˙tten mall §o
29v18 wi#˙§s das dy complexi#˙an#- !Coler2a i#˙§t dr2i#˙ualti#˙g dy#: er2§t di#˙e i#˙§t hi#˙ 29v19 tzi#˙g vnd dy leut344 haben#- ai#˙n plai#˙chs antli#˙tz vnd §ei#˙n va§t getur
29v20 §ti#˙g vn#-d mu#:tig !Vnd wan#- §y tr2u#:ncken#- §ei#˙n §o er2§chr2e#:cken §y#: dy#:e
29v21 lewt vnd dy#: men#-§chen gar2#‘ lei#˙chti#˙glich !Dy#:e ander2n#- §ei#˙n gemi#˙ 29v22 §cht vnd dy#: leu#:t habe#-n ai#˙n#- r2o#:t antli#˙tz gemi#˙§cht mi#˙t der2 gelb
29v23 vnd dy#: §ei#˙n ku#:ndi#˙g !Vn#- au#:ch va#:§t zorni#˙g vn#- §wa#-ng#° an#- dem#- lei#˙b
29v24 vn#-d vmb#- §i#˙ch ni#˙t va#:§t gr2o#:ß vn#- §ei#˙n du#:r2r2 vnd du#:r2ch r2o#:tt vn#-der
29v25 dem#- antli#˙tz vn#- an#- den#- pa#:cken#- !Vnd §ei#˙n#- au#:ch gewo#~nli#˙ch praw#:n
29v26 an dem#- leib vn#- an#:der2#‘§wo345 vnd do#:ch ni#˙t alle der2#‘ co#:leri#˙cu#:s gelei#˙ch
29v27 et §i#˙ch dem#- pla#:netn#- !Mercu#:r2i#˙o mi#˙t §ei#˙ner natur vnd au#:ch !Satu#:r
29v28 no vnd au#:ch i#˙r2#‘en zai#˙chen#- das i#˙§t der2 wi#˙der2 der2 leo vnd der2#°
29v29 !Schutz vn#- di#˙§es §ey#: ge§ai#˙tt von#- den vi#˙er !Complexiann @
213
[30r]
30r01 {Abb. Aderlass346} £Hernach347 volget wi#˙e man mi#˙t fr2
30r02 ewde vnd auch mi#˙t wolmu#:t la§§en 30r03 §chull zw#: der adern#- @
30r04 £E!S348 chu#:mpt di#˙ck vn#-d
30r05 offt al§o da#:s ai#˙n §ch
30r06 ad alt i§t An dem#- lei#˙b
30r07 oder2#+ au#:ff ai#˙ner#‘ §ei#˙ttn#-
30r08 !So §oll man la§§en au#:ff der#‘ §e 30r09 lben §ei#˙tten §o dy §u#:cht new#: i#˙§t
30r10 oder2 ai#˙n#- ander2#‘ gepr#‘echen#- oder
30r11 §chm#~er#‘tzen#- !Ban es dan wa#:r
30r12 i#˙n der2 len#-cken §ei#˙tten#- §o §oll ma#-
30r13 la§§en an der2 r2echte#- §ei#˙tten#- Od#+
30r14 wideru#-b auch chu#:2mpt es offt
30r15 von gewon#-hai#˙t !Das etli#˙cher
30r16 men#-§ch §wi#˙ndelt vnd i#˙n#- ama#:
30r17 cht vallet !So#: er#‘ la§§et dem#- §ol
30r18 man vor#‘ gu#:ete wu#:rtzell geben
30r19 ee das er2 la§§et als !Gali#˙e
30r20 nu#:s §pri#˙cht es §pri#˙cht au#:ch !Con#~§tan#-ti#˙nu#:s das alt lew#:t albe#:g §u#:ll
30r21 en#- la§§en#- wan#- §y ge§§ent vnd dy Ju#:ngen vnd dy#: §tar#‘cken vor2#‘ e§§ens 30r22 !Etli#˙ch haben#- auch di#˙ck vnd als §tarcks pluet §o man#- dy#: adern#- au#:ff
30r23 thu#:t das es ni#˙t gen#- wi#˙ll von#- der2 di#˙ck we#:gen#- !Dy#: §elben §chu#:llen auch
30r24 vor2 paden#- vn#- wan#-dern#- ee dan#- da#:s §y#: la§§en#- ga#:li#˙enus §pricht wer da
30r25 hat ai#˙n chalten ma#:gen#+ !Der §choll ni#˙t vi#˙ll la§§en#- an#- den ar#‘me#- no#:ch an#-
30r26 den#- fu#:e§§en der2#+ ader2n#- an#- den#- ar#‘me#- der2 §ei#˙n fu#:nff zwo#: medi#˙an dy#: leber
30r27 ader2 dy mi#˙ltz a#:der vn#-d dy#: hau#:bt ader Man §choll au#:ch me#~r#‘cken vi#˙err2#°
30r28 di#˙ng an#- dem#- la§§en#- gewo#:nhai#˙t da#:s alter vnd dy#: chr2a#:fft de#:s leibs
30r29 vnd de#:s men#-§chen !Vnd zw#: welcher zei#˙t man#- la§§en §chu#:ll §o dy zei#˙tt 30r30 vber#‘ hai#˙§s i#˙§t vn#-d vber2#‘cha#:lt i§t §o §oll ma#- ni#˙t la#:§§en#- ma#- §oll au#:ch ni#˙t 30r31 la§§en wan der2#‘ ma#- zw Iungk i#˙§t !Er2#‘ §oll au#:ch vber fu#:nff ta#:g alt §ei#˙n
30r32 vnd wan#- er2 au#:ch chu#:mpt vber#‘ funfft vn#-d zw#~ai#˙nczig ta#:g §o §oll man#-
30r33 !Auch ni#˙t la§§en#- man#- §oll au#:ch an#- §echen dy gewo#:nhai#˙t wan#- ay#:ns chu#:
30r34 mpt i#˙n das alter#‘ vn#- hat §i#˙ch ni#˙t gebe#:ntt des la#:§§en#- §o §oll es au#:ch ni#˙t 30r35 an heben an#- dem#- alter#‘ !Dye §i#˙ch aber#‘ ni#˙t gewe#~nt haben vnd §ei#˙n §tar#‘ck
30r36 dy#: mu#:gen#- la§§en au#:ch §oll man#- aller mai#˙st an#-§echen dy#: chr2a#:fft des me#-
30r37 §chen#- !J§t er2#‘ alt vnd ama#:chti#˙g §o §oll ma#-n weni#˙g vnd §eltten#- la§§en#-n
30r38 £!Jtem#-349 i#˙§t da#:s plut an dem#- men§chen#- de#:s er§ten §war#‘tz §o laß mann es 30r39 gen#- pi#˙s es r2ott var2#‘b werd !I§t es aber di#˙ck §o la§s man es gen#- pi#˙s dz
30r40 es du#:nn#- wer#‘d do#:ch ni#˙t als lan#-g das dem men§chen#- chai#˙n#- kr2an#~ck
30r41 hai#˙t dau#:on cho#:m @ Jtem wi#˙e man das pluet ver2§uchenn#- §chull @
30r42 £M!An#~350 §oll das pluet ver2§uchn#- a#:uff der2 czung I§t das pluet §u#:e§s §o
30r43 i#˙§t es ai#˙n czai#˙chen#- das es woll gedew#:t i#˙§t !J§t es aber pi#˙tter als
30r44 ain gall !Vnd2 §war#‘tz das i#˙§t ai#˙n po#:§§es plu#:et man §choll es au#:ch
215
[30v]
30v01 !Ver2#° §uchen wan es ge§ta#:t mi#˙t dem ge§ma#~ck !Smeckt es vbell §o i#˙§t es ai#˙n
30v02 zai#˙chen#- das dz pluet vnr2ai#˙n i#˙§t hat es aber#‘ ai#˙nen#- gu#:ten#- ge§ma#:ck !So
30v03 §pri#˙cht !Galienus das der2#‘ men§ch ge§u#:nt §ey#: @ Jtem von#- la§§en#- welcher#‘ 30v04 men§ch das thu#:n §oll vnd welcher ni#˙t vnd i#˙m ver2po#:ten §ey @ 30v05 £H!Er2#+351 mai#˙§ter gali#˙enus §pri#˙cht das von la§§en chu#-met gr2o#:§§err2#°
30v06 §cha#:d vnd vnfr2u#-met §er2e dem#- lei#˙b !Der2#+ es ni#˙t zw r2echter zei#˙tt 30v07 thu#:t vnd wan#- es i#˙m no#:t i#˙§t §o pr2i#˙ngt es i#˙m gr2#‘o§§en#- fr2u#:men#- i#˙§t
30v08 !Aber2 di#˙r2#+ §ei#˙n not das §oltu al§o erkennen dey#-ne gli#˙der §ei#˙n di#˙r2 §wa#:r vber2#°
30v09 allen dei#˙nen#- lei#˙b ha§tu#: hi#˙tz vn#-d der har2#+m i#˙§t di#˙r2 r2o#:tt vnd dick vn#- dey#-
30v10 pu#:l§s i#˙§t §nel vnd gr2o§s !Vnd i#˙§t di#˙r2#+ vor2n#- an#- der §ty#:r2en#- wee i#˙§t es aber#+
30v11 das §ei#˙n ai#˙n#- me#-n§ch ni#˙t pedor#‘ff vnd i#˙§t ma#:#~ger#‘ §o i#˙§t es i#˙m#- §cha#:d2 vnd
30v12 velt davon#- i#˙n#- gr2o§§e §u#:cht Vn#- §o#:lt au#:ch wi#˙§§en#- !Vor#‘ allen#- di#˙ngn#- wi#˙rt 30v13 ai#˙n men#-§ch kr2anck von#- la§§en#- §o §oll ma#- i#˙m#- ni#˙t la§§en#- Wan#- es ha#:t des
30v14 plu#:tes ze weni#˙g !Bi#˙r2t es aber#‘ §ter#‘cker#‘ von#- dem#- la§§en#- §o §oll ma#- y#:m
30v15 offt la§§en#- wan#- es hat des pluetes zw#: vi#˙ll !Dw#: §olt auch wi#˙§§en#- das
30v16 man#- ni#˙t la§s ay#:nnem#- ki#˙nd das pey#: zechen#- Iar2#-en §ey vnd aynne#- alte#-
30v17 man#- !Der von#- na#:t#“ cha#:lt i#˙§t de#+r2 ni#˙t plu#:et ha#:t !Hat er2 §i#˙ch aber gew=
30v18 e#:ntt vnd i#˙§t kr2a#-ck an#- dem#- lei#˙b §o §oll man#- i#˙m mi#˙t kopffen#- la§§en#- ma#-
30v19 §oll au#:ch ni#˙t la§§en !Ban#- es zw hai#˙s i#˙§t wan#- §o §wi#˙tzt der2#° me#-n
30v20 §ch ger2#‘en vn#-d ny#:mpt ma#- i#˙m das plu#:et §o wi#˙r2t der2#‘ me#-§ch kr2#‘a#~nck
30v21 davonn#- @ Von#- ge§untten#- lew#:tten#- vn#-d andern#- wan#- dy#: la§§en §ullen oderr2 |ni#˙cht $352 30v22 £M!Ai#˙§ter353 aui#˙cenna §pri#˙cht vnd §chrei#˙bt zwo zei#˙t In
30v23 dem Iar das i#˙§t i#˙n dem#- !Glentzen#- vn#-d i#˙n dem herb§t vnd §ey#:n#-354
30v24 au§gen#:ome#-n von#- an#-dern#- zeittn#- zw#: la§§en#- !Ge§u#:nttn#- leu#:tte#-
30v25 §oll man#- la§§en an#- ay#-nem#- liechtn#- tag zw#: der#‘ tertz zei#˙t pi#˙s §i#˙ch der lei#˙b
30v26 ger2ai#˙ni#˙gt von#- den#- §pai#˙cheln des mu#:nds vnd der na#:§en#- es ver2pew#:t
30v27 der2 mai#˙§ter !Alma#-§or2 da#~s ma#- ni#˙t §chu#:ll la§§en i#˙n ga#:r2#‘ hai#˙§§er#‘ zei#˙tt 30v28 no#:ch i#˙n gar2#‘ chalter zei#˙tt dw#: §olt wi#˙§§en wer gefallen#- oder ge§lagn#-
30v29 wi#˙r2t der2#+ §choll zw#: han#-t la§§en#- !Das das pluet ni#˙t pey#: i#˙m §ter#‘be 30v30 !Iun#-g leut §chullen#- la§§en wan#- der2 man#- new i#˙§t vn#- zw#: ny#:mpt ma#-
30v31 §oll wi#˙§§en an welchem#- tai#˙ll d#+ gepr2#‘echen#- i#˙§t dar2#‘an §oll ma#- ni#˙cht
30v32 la§§en#-n !Dw#: §olt au#:ch da#:s wi§§en wer da#~s aderla§§en#- vber#° gett
30v33 !Vnd da#:s po#:s plu#:et pey i#˙m pelei#˙bt der#‘ gewi#˙nt da#:s gi#˙cht oder2 den#-
30v34 r2i#˙tten#- o#:der2#+ er2#‘ ge#~wi#˙nt fle#:ck !An dem#- an#-tli#˙tz o#:der2#‘ er#‘ wi#˙r2t au#:§§etzi#˙g
30v35 dar2u#-b i#˙§t la§§en#- gu#:et der#‘ es zw#: r2e#:chter#‘Zei#˙t thu#:et @
30v36 Hi#˙e na#~ch §tet ge§chri#˙ben i#˙n welchem zay#:chen es we§underlich gu#:t la§§en#- i#˙§t 30v37 vnd czw welchen gli#˙dern man ni#˙t la§§en §chu#:ll das dan das §elbig zay |chen pedewt355 30v38 £M!An356 dw la§§en wi#˙ld czw#: der adern#- §o §oltu#: mer#‘ck 30v39 en das da §ei#˙n#- vi#˙er zai#˙chen#- !Di#˙e da gu#:et §ei#˙n zw la§§en#- das
30v40 !Ist der2 !Bi#˙der#‘ di#˙e wa#~g der#‘ §chu#:tz vn#-d der#‘ wa§§erman#- !Auch §ey#:nn
217
[31r]
31r01 £!Vi#˙er357 gemay#-ne Zai#˙chen#- dye §ei#˙n weder guet noch po#:3s der2 !Cr2ebs dy Iungkfr2a#~w
31r02 der2 §tai#˙npock vnd dy#:e vi#˙§ch vnd §ei#˙n auch vi#˙er zai#˙chen#- dy#:e §ei#˙n po#:s das i#˙§t
31r03 der2 !O#:chs der2#+ §cor2#‘pi#˙an#- dye zwi#˙li#˙ng vn#-d der2#+ leo i#˙n di#˙§en#- zai#˙chen#- es zw#:e
31r04 ma#:ll po#:s i#˙§t zw la§§en#- !Auch huet di#˙ch das dw#: ni#˙t la§§e§t zw#: dem#- gli#˙d
31r05 das dz §elb zai#˙chen pedewt wan#- dy#: mai#˙§ter §prechent da#~s e#:s gar2#°
31r06 §orglich §ey#: der2#+ wi#˙der2 pedewt das hau#:bt der2#‘ ochs den#- ha#:ls vnd dy kelen#-
31r07 der2 zwi#˙li#˙ng dy#: ar2m#- vnd dy#: hen#-t vnd dy#: §chu#:ltern der2#+ !Cr2#‘ebs dy#:e pru#:§t 31r08 den mage#-n vnd dy#: r2i#˙ppen#- dy#: ny#:eren#- vnd auch da#:s mi#˙ltz vn#-d au#:ch dy#:e lu#-358
31r09 ngell !Der2 leo der2 hat das hertz vn#- dy#: §ei#˙ttn#- vnd au#:ch den#- r2u#:cken#- dy#:e
31r10 Iungkfr2aw den pau#:ch vnd das i#˙n gewai#˙d !Di#˙e wag dy#: len#-tt vnd au#:
31r11 ch den nabell der2 §cor2pi#˙an#- dy#: §cham der2 §chutz dy#: di#˙echer der §tai#˙n#-po
31r12 ck dy#: kny#:e !Der2 wa§§erman dy#: §chi#˙npai#˙n dye vi#˙§ch dy fu#:es als da#-
31r13 i#˙n di#˙§er2 figu#:r her#+nach gema#:lt §tet !Dw#: §olt au#:ch merckn#- i#˙n we#:lch
31r14 em#- czai#˙chen#- de#+r2 man#- lauffet vn#- i#˙n welchem#- mon#:ad359 wan des me#-§chen
31r15 lei#˙b i#˙§t getai#˙llet !J§t das dw#: an dem#- tai#˙ll i#˙cht la§§e§t wan da von ku#:
31r16 mpt gr2o§§er#‘ §chaden ay#:ntweder2s gr2o§§er lan#-gberi#˙g #°§cha#:d !Oder der
31r17 gach tod dw#: §olt war2#‘ten#- das dw#: ni#˙t wu#:nt wer2#+de§t i#˙n#- dem#- §elben#- tail
31r18 !Oder2 zw#: der2 §elben zei#˙t §o der man dar i#˙n lau#:ffet !Item#- hu#:2et di#˙ch dz
31r19 dw ni#˙cht la§§e§t wan#- §ich der2#‘ man#- new#: enzundet an dem#- hi#˙m#~ell od#+
31r20 wan der2 man i§t funff tag vor2#+ oder na#:ch !Es §ey#: dan#- gar#‘ §ere not 31r21 §o ma#~g§tu#: la§§en czw#: aller Zei#˙t i#˙n dem#- !Iarr2#‘ @ Hy#:e hi#˙n nach §agett es
31r22 Von vi#˙er la§§en i#˙n dem#- i#˙ar#‘ an den pe§underlich gu#:et la§§en#- i#˙§t als dy nat#“ 31r23 lichen mai§ter §chrei#˙ben der2 §oll man woll eben wa#:r nemen @
31r24 £E!S360 i#˙§t zw wi#˙§§en#- das vi#˙er la#:§§en#- i#˙§t oder#‘ §ei#˙n i#˙n dem#- i#˙ar#° an#- den#- es361
31r25 pe§under#‘lich guet i§t zw la§§en der2 er§t tag an §and !Bla=362
31r26 §y ta#:g !Der2 ander2 auff §and phi#˙li#˙pp vnd §and Iacobes
31r27 ta#:g i#˙n dem#- ma#~y#:en#- der2#‘ dr2i#˙t tag nach §and !Bartholom#~e#9
31r28 ta#:g !Der2 vierd an §and mar2#‘ta#-ns ta#:g auch tu#:en ai#˙n tai#˙ll mai#˙§ter
31r29 dar2czw#: §and valentei#˙ns ta#:g !Vnd auch §and §teffan#-s ta#:g i#˙n denn
31r30 wei#˙nachten#- vnd al§o wer2en der2#‘ la§s tag §echs !Dar2 zw §o §chreibt 31r31 vns de#+r2 mai#˙§ter#‘ !Bar#‘tholomeu#:s i#˙n dem#- pu#:3ch !Cen#-tiloqui#˙o da#:s
31r32 ai#˙n y#:eder2 men#-§ch der2#‘ vber2#+ zwai#˙nzi#˙g i#˙ar2 i#˙§t alt der2#‘ §oll la§§en#-
31r33 i#˙n den na#:ch ge§chr2i#˙ben#- ta#:gn#- !Der2#‘ er2st de#+r2 §echcze#:chent tag i#˙n
31r34 dem#- me#~rtzen an dem#- r2e#:chten#- arm#- von#- des geho#:r2en#- wegen#- !Der an#-
31r35 der2#‘ i#˙§t der2 ai#˙nlifft ta#:g i#˙m apri#˙ll an#- dem#- len#-cken#- arm#- von#- de#:s ge
31r36 §i#˙chtz wegen#- !Der2#+ dr2i#˙t ta#:g i#˙§t der2#+ fu#:nfft oder der §ech§t de#:s may#:
31r37 en an ay#-nem#- yedli#˙chen#- ar2#+m vm#-b de#:s %febr2e#:s wegen auch huet
31r38 di#˙ch ze la§§en#- au#:ff den#- .x.x.v#:. ta#~g des mertzn#- vnd au#2ff den er§te#-
31r39 tag des Au#:g§ten#-363 !Vnd au#:2ff den#- dr2i#˙#~tte#- her2#+b§t mo#~nad an#- dem#- le
31r40 §ten ta#:g i#˙n di#˙§en#- dr2ey#:nn#- tagen#- !Soll ma#- weder#‘ men#-§chen#- noch
221
[32r]
32r01 £!Vi#˙echla§§en#-365 auch §oltu wi#˙§§en das all adern#- dy#: da gend zw dem haubt dy#:e
32r02 mag man la§§en na#:ch e§§ens vnd au#:ch all ader2n#- der2 pai#˙n vnd der fues
32r03 §oll man#- na#:ch e§§ens §lachen#- !Aber2#+ all ader#‘ der ar2#‘men §ol man nucht#°
32r04 la§§en @ Jtem#-366 von#- dem nu#:tz der2#+ la#:ß mer2#+ck hi#˙n na#:ch @ 32r05 £E!S367 i#˙§t zw wi#˙§§en von dem#- nu#:tz der la#:§s J§t dy#: la#:s ai#˙n my#:2nderu#-g
32r06 po#:§es pluets das da ny#:mbt alle po#:§§e vber flu§§ikai#˙t po#:§er368
32r07 feuchtikai#˙t i#˙n dem#- men§chen !Dauon §choll yeder men#-§ch zw der
32r08 ader2en#- la§§enn#- ai#˙ntweders von#- der2 vo#:lle we#:gen des plu#:ts
32r09 !Oder2 von der2 po§hait wegen der feu#:2chtikai#˙t Vnd §oll ma#- da#:s zw#:
32r10 zwai#˙n zei#˙tten#- thuen i#˙n dem#- i#˙ar2 !Dar2 vmb das ma#- pey#: ge§unthai#˙tt 32r11 pelei#˙b vnd ni#˙t mer2#+ oder2#+ §ei#˙n vor2i#˙ger2 pr2e#:chen#- mag vber2 werden#- das
32r12 £!J§t369 i#˙n dem#- glentzen#- vnd i#˙n dem#- herb§t i#˙n den#- zwai#˙#-n zeitten#- dy#: men#-§chn
32r13 aller2 mai#˙§t werden §i#˙ech vnd au#:2ch i#˙n dem#- !Glentzn#- vmb dy o§tern#- §o nympt
32r14 das pluet zw#:e §o §oll man#- la§§en fur2#‘ dy#: vberflu§§ikai#˙t des plu#:ets !An de#-
32r15 herb§t §oll man la§§enn#- fur2 dy#: po#:§en feuchti#˙kai#˙t des leibs
32r16 £Jtem#-370 von dem#- nu#:2tz der la#:s was pr2echens der men§ch da von ledi#˙g wi#˙r2t merck hi#˙n
na#~ch 32r17 £I!Tem#-371 dy la§s i#˙§t ai#˙n anfanck der ge§unthait vnd kumpt di#˙ck das der
32r18 men§ch gr2o§§er kr2a#:nckhai#˙t ab chumt von#- la§§ens wegen#- !Es macht
32r19 i#˙m auch guete gedachtnus vnd auch guet §y#:nne vnd temperi#˙r2t ai#˙ne#-
32r20 das hi#˙r2en !Vnd ma#:cht i#˙m#- warm#- das ma#:rck i#˙n den pai#˙nen Wa#:r2en
32r21 auch ainem dy o#:r2en ver2§choppt da#:s thuet es i#˙m au#:ff vnd r2ai#˙ni#˙gt ay#:nnem#-
32r22 den mage#-n vnd ver2#‘tr2ei#˙bt i#˙m dy#: tr2a#:ckhai#˙t !Vnd r2ai#˙ni#˙gt i#˙m dy#: platern#- vn#-
32r23 ma#:cht i#˙n#- wo#:ll dew#:en#- vnd ma#:cht372 i#˙m ai#˙n §enffte r2ed vnd §terckt i#˙m §ei#˙n §yn
32r24 !Vnd mynder2t i#˙m §ei#˙n tr2awm vnd lengert i#˙m §ei#˙n lebenn#- @
32r25 £Jtem#-373 zw welcher zei#˙tt dy#: la§s er2#‘potenn §ey @ 32r26 £D!As374 i#˙§t auch gar woll zw wi#˙§§en#- das dy#: mai#˙§ter#‘ §chr2ei#˙benn#- das dy#:e375
32r27 la§s zw aller zei#˙t ver2po#:ten i§t !Das i§t wan der2 man i#˙§t funff
32r28 tag vnd zechen#- tag vnd xv tag vnd xx tag vnd .x.x.v. tag !An di#˙§en
32r29 tagen !So#:ll man pey ni#˙chte la§§en wan#- dy#: mai#˙§ter haben dy#: ta#:g gehai#˙§n
32r30 dy#: §i#˙echen tag vnd als vi#˙ll dy mai#˙§ter §chrei#˙ben#-t §o §ei#˙n etli#˙ch men#-§chn#-
32r31 ge§tor2#‘benn dauon das §y zw vn#-r2echter2 zei#˙t vnd lauff des !Ma#:nne#- zw#:
32r32 der2 ader2#+ haben#-t gela#:§§enn @ Jtem wi#˙e ma#-n fur2 ai#˙n yedlichen#- gepr2e§ten#- zw
32r33 der2 ader la§§en §chull @ 32r34 £D!Er2376 m#-ai#˙§ter#‘ !Alma#-n§or §pri#˙cht da#~s di#˙e men#-§chen#- dy#: da gr2os adern#-
32r35 haben vnd r2o#:tt lewt §ei#˙n dy#: §ullen#- la§§en zw der#‘ ader#‘ wan#- §y
32r36 habenn#- pluetes ze vi#˙ll !Vnd vi#˙ll feu#:chti#˙gkai#˙t wer den atenn vn
32r37 §anfft zeucht der2#+ §oll la§§en#- an#- dem#- len#-cken ar2m#- zw#: der2#‘ men#-g adere#-nn
32r38 £!J§t di#˙r2 an der2 r2e#:chten#- §eitten#- wee oder#‘ an dem#- lei#˙b §o §oltu la§§en an#- de#°377
32r39 leber2en#- ader2 an#- dem#- r2echten#- arm#- !J§t di#˙r2 we#:e an dem#- r2ucken §o la§s an
32r40 der2 r2u#:ck adern#- ober2#‘thalben#- der#‘ len#-den dw#: §oltt au#:ch wi#˙§§en das dz la§s
32r41 ey#:§§en#- gr2o#:§§er §oll §ei#˙n i#˙n dem#- wi#˙ntter dan#- i#˙n dem#- !Su#:2mer dw §olt wi#˙§§en
223
[32v]378
32v01 £!Das379 man soll la§§enn#- i#˙n d2em Su#:2mer an d2em r2echten arm#- vnd i#˙n dem wi#˙ntter an d2em
32v02 len#-cken# ar2m#- mer#‘ck au#:ch wan#- dw#: zw#: der2 adern wi#˙ld la§§en#- !So §chnei#˙d galgan#-t
32v03 i#˙n den#- mu#:2nd vnd §chli#˙nd dy#: §pai#˙cheln i#˙n di#˙ch da#:s we#:haltet di#˙r2 das gu#:t pluett
32v04 !Vnd das po#:ß pluet das get von di#˙r2 !Vnd dar#‘nach §o dw#: gela§§en ha§t §o huet 32v05 di#˙ch vor2#+ vbr2i#˙ger2 hi#˙tz vnd vor2 hai#˙§§en#- §tu#:ben#- !Vnd auch vor vbri#˙gem e§§en#- vnd
32v06 tr2i#˙ncken#- dw#: §olt auch vbr2i#˙gs liecht ver#‘mei#˙den#- vnd den lufft vnd an der §u#:n=
32v07 nen zw#: gen Wan#- es §we#:chert dy au#:gen vnd plen#-det §ere vnd darnach §oll
32v08 ma#-n zi#˙mliche fr2ew#:de haben#- vnd fr2olickai#˙t das we§terckt den lei#˙b vnd all
32v09 lebli#˙ch gei#˙§t dy#: der2#+ men#-§ch ha#~t i#˙n dem lei#˙b @ !Aui#˙cenna @ 32v10 £Nw380 merck hernach ge§chri#˙ben#- wi#˙e ma#- ai#˙n yedli#˙che adern#- la§§en §chuld vnd wa#~r2
zw#:e 32v11 es nu#:tz vnd gu#:t §ey#: das vi#˙nde§tu auch i#˙n ge§chri#˙fft hi#˙e vnd an yetweder ader §un 32v12 derli#˙chn#- vnd wo dw la§§en#- wi#˙ld das §uech nach der zall di#˙§er ge§chri#˙fft @ 32v13 £D!Ie381 erst ader2en#- an#- der2#‘ §ty#:er2en i#˙§t gu#:et fur ai#˙nen#- §war2en §chmertzenn#-
32v14 des haubtz gela#:§§en#- vnd fur2 a#:macht !Vnd der ai#˙n to#:bi#˙g hi#˙r2en#- hatt
32v15 vnd dem#- das haw#:pt alle zei#˙t we#:e thu#:et vnd au#:ch ni#˙cht woll
32v16 ge§chla#:ffen#- ma#~g @
32v17 £D!Ie382 ander ader#° Nw petr2a#:cht vnd mer#‘ck Zwo#~ ad2er#°n di#˙e gen#~d von#- dem#-
32v18 §chlaff von#- pai#˙den §ei#˙tten des haubtz !Di#˙e §oll man la§§en#- fur2 dy ge§u#:cht
32v19 der2o#:r2en vnd fur2#+ den#- flu§s derau#:gen @
32v20 £D!Ie383 dr2i#˙t ader2#° Item#- zw#:o ader#-n an d2em#- hy#:ndernn#- hau#:bt dy#: §oll ma#- la§§e#-
32v21 dem das hi#˙r2en#- ge§paltenn#- i#˙§t !Vnd fur2 das flo#:s des hi#˙r2ens vnd fur2
32v22 all ge§u#:cht des hauptes @
32v23 £D!Ie384 vi#˙er2d adern#- Zwo ader#° vnder#° der2#‘ zu#:ng dy#:e §oltu#: fr2u#:e la§§en#- fur2#° das
32v24 flo#:s des hauptz vnd auch gepre§ten der zend !Vnd ge§wern#- des hi#˙r2n#-s
32v25 vnd der2 kelen vnd fur2 dy hue§ten !Vnd au#:ch fur2 den ge§ma#:ck des mu#:nds
32v26 £D!Ie385 fu#:nfft ader !Jtem#- ai#˙n ader vnder#‘ d2em#- kynne dy#: i#˙§t guet gela§§en#- fur2#°
32v27 dy ge§chbul§t der wan#-g !Vnd dem#- dy#: pru#:§t ge§wollen#- §ei#˙n vnd fur2#+
32v28 den flus der2 na#:§en vnd au#:ch fu#:r2 dy#: r2ew#:denn @
32v29 £D!Ie386 §ech§t ader#‘ !Item#- Zwo#~ ader#° vnder dem#- hals dy#: §cho#~ll man#- la§§en#- fur2#°
32v30 dy ge§wu#:l§t der2 kynpa#:cken !Vnd fur2#+ vbr2i#˙ges r2o#:tzen#- vnd auch fur
32v31 den#- gepr2e§ten des hertzn#- @
32v32 £D!Ie387 §ibent ader2#‘ !Item#- zwo#~ ad2er#° vnder dem#- gu#:emen#- §ei#˙n#- gu#:2et gela§§en#-
32v33 fur2 dy#:e pew#:len des antli#˙tz vnd fur2#° den#- gr2i#˙nt @
32v34 £D!Ie388 acht adern dy#: ader2 auff dem daw#:men §oll man#- la§§en#- fur2 d2as ge
32v35 §u#:cht des haubtz !Vnd fur2#+ den#- pluet ganck vnd fur2 dy pewllen vn#-
32v36 ander2 pr2e§ten#- de#:s haubtz
32v37 £D!Ie389 new#:nt ader#‘ !Item#- dy#: mi#˙tt#~er#° ader#° an#- paid2enn#- ar#‘men#- dy §oltu la#~§§en#-
32v38 zw dem#- her#‘tzen#- vnd zw#: der lu#:ngell !Vnd zw#: dem mi#˙ltz vnd zw
32v39 den ny#:er2en#- vnd zw#: dem#- a#:tem @
32v40 £D!Ie390 zechent ader#° !Item#- zw#:o haubt ader#°n au#~ff yedli#˙chm#- arm#- vnd2 ha
32v41 y§§ent !Epali#˙ca391 vnd haben den namen von dem haubt vnd ley#:t
225
[33r]
33r01 !Obnen#- i#˙n dem arm#- vnd wi#˙r2t sy r2echt ge§chlagen#- das i#˙§t guet fur2#° dy fau#:lnus
33r02 des haupts vnd zw#: dem#- hertzen#- vnd fur#+ dy#: zacher#‘ der au#:gen !Vnd fur2 allen §ch 33r03 mer#‘tze#-n der pr2u#:§t !Vnd dy §oll man#- §la#:chen auff §and ambr2o§y tag @
33r04 £D!Ie392 ai#˙ndlefft ader2#‘ zwo mi#˙ttell ader hai§§ent zw latei#˙n dy#: medi#˙an vnd li#˙gen#-t
33r05 enmi#˙ttell vber2 dy ar2m#- !Ber2 §y r2echt §lachen#- kan §o macht §y dy wuntten
33r06 hai#˙ll vnd i#˙§t auch gu#:t fur2 das hertzn#- lai#˙d !Vnd pri#˙ngt den men§chen#- zw
33r07 vi#˙ll chlu#:2eghai#˙t vnd i#˙§t au#:ch gut fur2 allen#- §me#:rtzn#- der#‘ glider#‘ vnd des mag 33r08 ens !Vnd der2 r2i#˙ppen#- vnd der#‘ §ei#˙tten dy#: §oll ma#- la§§en#- an#- §and lar2#‘en#-tzn#- ta#:g
33r09 £D!Ie393 zwelfft ader2#‘ !Item#- zw#:o ader2#‘ an#- y#:etwed2er §ei#˙tten#- des arms vnd hai#˙§t
33r10 !Epati#˙ca vnd wer#‘ §y r2e#:cht §la#:chen chan#- §o i§t §y guet fur2 all faulnus394
33r11 vnd §mertzn#- der2 leber2n vnd der r2i#˙ppen#- !Vnd auch des ma#:gens vnd des
33r12 mi#˙ltz vnd fur2#+ das fli#˙e§§ent plu#:et au#:s der#‘ na#:§en#- vnd fur2 allen#- gepr#‘e§ten
33r13 der2 na§en !Vnd §technus i#˙n der §ei#˙tten dy#: §oll ma#- la§§en#- i#˙n dem#- may#:en an#-
33r14 des hei#˙lgen#- !Cr2eutz ta#:g @
33r15 £D!Ie395 dr2#‘ey#:cze#:chent ader#‘ !Di#˙e m#~i#˙ltz ader#‘ hat den#- d2o#:n von#- dem#- mi#˙ltz vnd396
33r16 von#- der lungell dy las fur2 dy feule !Vnd fur2 das hertzn#- §techen vn#-
33r17 fur2 dy po§en fewchti#˙kai#˙t vnd fur2#‘ dy §wa#:re des atems dy#: man#- §lachenn
33r18 mag wan man wi#˙ll @
33r19 £D!Ie397 vi#˙erzechent ader !Jtem#- zwo#~ ader#‘ vber#‘ dy#: lenden#- §ei#˙n gu#:t gela§§enn#-398
33r20 fur2 allen gepr2e§ten des gemachtz vnd des §tai#˙ns i#˙n der plater#‘n
33r21 vnd gai#˙len i#˙n den nyer2en !Vnd fur2 dy#: pewlen#- vnd wa§§er§ucht vnd fur
33r22 das ge§u#:cht des r2ucken @
33r23 £D!Ie399 funffczechent ader#‘ !Jtem#- ai#˙n ader#‘ auff dem#- na#~bell i#˙§t gu#:3t gela
33r24 §§en fur2 das flo#:s des pau#:chs !Vnd fur2 dy ge§wu#:l§t der gema#:cht
33r25 vnd fur2 das gi#˙cht vnd fur2 den gr2i#˙mmen#- vnd den#- harm#- §taynn @
33r26 £D!Ie400 §e#:chczechent ader#‘ !Jtem#- ay#:n#- ader#‘ vor2n#- au#:ff dem#- Zagell dy#: §oll
33r27 man la§§en fur2 das par2adei#˙s vnd fur2 den r2ey§§en#-den §tai#˙n#- !Vnd fur#°
33r28 den zwan#-g der2#+ gema#:cht vn#-d fur2 dy#: wa§§er§ucht @
33r29 £D!Ie401 si#˙benczechent ader#‘ !An dem#- Za#:gell vnden#- i#˙§t ai#˙n#- ader#‘ dy#: §ol ma#-
33r30 la§§en fur2 den gr2i#˙mmen#- vnd fur2 dy#: ge§wul§t der#‘ gema#:cht vnd 33r31 fur2 dy wa§§er§ucht @
33r32 £D!Ie402 achczechent ader#‘ !Jtem#- zw#:o ader#‘ an#- yetw#~eder#‘ §ei#˙ttn#- d#° §chi#˙npai#˙n
33r33 §ei#˙n guet gela§§en fur2 dy#: wa#:§§echt ob §y#: von#- der pla#:2terenn#-
33r34 !I§t vnd fur2 dy zer2tem#-rung der ader#‘ !Vnd fur2 dy ma#:§el§u#:cht da#: von#- der#‘ 33r35 men§ch §ei#˙n var2#:b403 ver2#+leu§t dy#: wi#˙r2t i#˙m wi#˙der#‘ @ 33r36 £D!Ie404 New#:nzechent ader#‘ !Jtem#- zwo#~ ader#‘ vnder#‘ den kny#:en an#- pai#˙den#- pa
33r37 ynnen#- dy#: §oll man la§§en#- fur2 das wee der#‘ derme#-n vnd gr2ymme#-
33r38 des pau#:chs vnd fur2#+ dy#: ge§wul§t der#‘ pay#:nn @
227
[33v]
33v01 £D!Je405 zwai#˙nczi#˙ge§t ader#‘ !Jtem#- zwo adern#- obnen#- an d2en#- knoden#- auff pai#˙d
33v02 en pai#˙nen dy soltu la§§en au#:ff pai#˙den paynnen %fur2 dy platern vn#-
33v03 fur2 dy r2au#:den der2 pai#˙nnen#- @
33v04 £D!Ie406 .x.x.i#˙. ader#‘ !Jtem#- zwo ader#‘ i#˙n wendi#˙g dem#- wa#:dell dy#: §ei#˙n gu#:t gela§§en#-
33v05 fur2#‘ das ge#~§u#:cht !Vnd fur2#‘ an#-der#‘ gepr2e#:chn#- de#:s lei#˙bes@
33v06 £D!Ie407 .x.x.i#˙i#˙. ader#+ !Jtem#- zwo#: adern#- an pai#˙den enckeln §ei#˙n gu#:et gela§§n#-
33v07 fur2 den §andt i#˙n der platern#- der2 von den lenden#- chumpt !Vnd §o#:n
33v08 der2lichen#- fr2#‘au#:en#- i#˙§t e#:s gu#:3t dy#: ni#˙t ger2#‘ai#˙ni#˙get §ei#˙n#- !Na#:ch der#‘ gepur2t 33v09 vnd den dy i#˙r2 zei#˙t ni#˙t en#-han#- @
33v10 £D!Ie408 .x.x.i#˙i#˙j#˙. ader !Jtem#- zw#:o adern#- pey#: den#- knodenn#° au#:§wend2i#˙g an pai#˙d2en pa
33v11 ynnen#- §ei#˙n gu#:t gela§§en#- fur2 dy#: ge§u#:cht des r2ucken !Der lend2en
33v12 der2 ny#:er2en#- de#:s i#˙n gewai#˙des vnd fu#:r2 ge§we#~llen#- vnd fur2 der vn natur
33v13 li#˙chen#- gelider !An fr2au#:en vnd an#- ma#-nnen !Vnd fur2 hi#˙nd2ernu#:s d2es
33v14 har2ms vnd §oll man da de§ter di#˙cker la§§en#- vnd ni#˙t vi#˙ll @
33v15 £D!Ie409 .x.x.i#˙i#˙i#˙j#˙. ader#‘ !Jtem#- ai#˙n ader au#:ff der gr2#‘o§§en#- zechen#- dy#: §oll man#-
33v16 la§§en#- fur2 das flos der au#:gen vnd der au#:g§wern#- !Vnd flecken
33v17 vnd §wer2en#- pey#: den paynnen vnd fur2 den#- §tai#˙n vnd fur2 dy fi#˙§teln#-
33v18 an#- den#- §chi#˙n#~pai#˙n !Vnd2 wo#: ai#˙n#- fr2aw#: i#˙r2 zei#˙t ni#˙t ha#:t @
33v19 410£D!Ie411 funff vnd .x.x. ader#‘ !Jtem#- zw#:o ader#‘ dy#: hai#˙§§ent !Sab§aka dy#:e
33v20 §oll ma#- ni#˙cht §lachen#- wa#:n#- wer2 §y §lecht dem#- get dy#: §eel lache#-t au#:s
33v21 £D!Ie412 .x.x.vj#˙. ader#‘ !Jtem#- zwo#~ ader2 an yetweder#‘ §ei#˙ttn#- an der#‘ klay#:nne#-
33v22 zechen#- §ei#˙n gut gela§§en fur2 das ge§ucht der lend2en der plater#°
33v23 Vnd der2#+ mu#:eter#‘ !Vnd fur2 das par2#‘adei#˙s vnd an#-der poß flu#:s @
33v24 £D!Ie413 .x.x.vi#˙j#˙. ader !Ai#˙n ader#‘ an#- dem#- ende d2es r2u#:cken dy §oll man#- la§§e#-
33v25 fur2 das ge§u#:cht der2 Lenden !Vnd §tercket au#:ch @
33v26 £D!Ie414 .x.x.vi#˙i#˙j#˙. ader#‘ !Jtem#- zwo#~ r2u#:ck adern#- zwi#˙§chn#- den#- clay#:n#- vi#˙ng#°n
33v27 an pai#˙den#- henden §ei#˙n gu#:t gela§§en fur2 ai#˙n §choppen d#+ pru#:§t
33v28 Vnd da fur2 wan ai#˙ns ni#˙t lu§tet zw e§§enn#- !Vnd fur2 dy ge§ucht
33v29 vnd fur2#+ alle po§e di#˙ng des mi#˙ltzs @
33v30 £D!Ie415 .x.x.i#˙.x. ader !Jtem#- ai#˙n ader#‘ au#:ff dem#- e#~lpogen#- auff pai#˙den#- ar#‘ 33v31 men#- dy#: §oltu#: la§§en#- fur2 alles ge§ucht des haubtz !Vnd fur2#+
33v32 das flos der2 au#:gen#- !Vnd fur2 das ge§u#:cht der2 o#:r2en @
33v33 £D!Ie416 .x.x.x. ader#‘ !Jtem#- ai#˙n#- adern#- an dem#- re#:chtn#- ar2m#- hai#˙§§et pu#:l
33v34 mati#˙ca dy#: §oltu la§§en fur2 dy#: hu#:e§ten#- !Vnd fur2 als wee des hertz
33v35 en vnd auch der2#‘ leber2n#- @
33v36 £D!Ie417 .x.x.x.j#˙. ader#‘ !Jtem#- zw#:o adern#- an#- paidenn#- ar#‘men#- hai#˙§§et d2y ai#˙n
33v37 dy lebern#- ader2#‘ vnd dy ander#‘ dy mi#˙ltz ader#‘ !Dy §ei#˙n gu#:t gela
33v38 §§enn fur2 das zi#˙ttern !Vnd au#:ch des mi#˙ltz vnd fur2 den vberlauff
229
[34r]
34r01 £!Der418 gallen auff dy leber vnd fur2 dy galle der#‘ ga#~llen vnd fur2 das ge§u#:cht 34r02 des r2ucken Vnd der r2i#˙ppen vnd der §ei#˙tten#- !Vnd aller glider vnd auch fur2 vbe
34r03 r2i#˙g pluettn#- d2er2 na§enn vnd fur2 den r2i#˙ttn#- vnd fur#‘ als zi#˙ttern#- §oll man#- §y la
34r04 §§en !Jn dem may#:en#- vnd §ei#˙n au#:ch alczei#˙t gu#:t gela§§en i#˙n d2em#- !Iar2#‘@ 34r05 £D!Ie419 xxxi#˙i#˙ ader#‘ !Jtem#- zwo ader#‘ an d2en#- wangen dy §oll man#- la§§enn fur#°
34r06 dy r2au#:den#-420 vnd den gr2i#˙nt !Vnd fur2 §chebi#˙g d2es antli#˙tz vnd fur2#°
34r07 das weyeln der au#:gen @ 34r08 £D!Ie421 xxxi#˙i#˙i#˙ ader#‘ !Jtem zwo#~ ader i#˙n d2er kr2u#:mppe der#° o#:r2en §ol man#- la§§en#-
34r09 fur das wei#˙blen#- vnd i#˙§t au#:ch gu#:t fur2 das §chu#:2ttn#- des hau#:pts @ 34r10 £D!Ie422 xxxi#˙i#˙i#˙i#˙ ader zw#~o adern#- hi#˙n der#‘ den#- o#:r2en#- §oll man#- la§§en#- fur2#° dy pl
34r11 ater2en des antli#˙tz !Vnd fur2 das ge§ucht der zend vnd fur2 des
34r12 mundes gebr2e§tenn#- @ 34r13 £D!Ie423 xxxv ader2 !Jtem#- dye ader#‘ auff der na#~§en#- dye §oltu#: la#~§§enn#- fur2#°
34r14 das flo#:s des haubtz vnd au#:ch der na§en vnd d#° au#:gen#- @ 34r15 £D!Ie424 xxxvj#˙ ader2#‘ !Jtem#- Zwo ader i#˙n den#- wi#˙nckeln#- der augn#- neben#- d2er
34r16 na§enn dy §oltu la§§en#- fur2 den nebell der#‘ au#:gen !Vnd2 au#:ch fur2 das 34r17 flo#:§s der2 augenn @
231
[34v]
{Abb. Badehaus425}
34v01 £Nw426 merck furbas von d2em padenn wi#˙e das §wai#˙s pad guet §ey#: vnd auch wa§§er
34v02 pad vnd wi#˙e man §ich halten §chull Ee das man#- i#˙n d2as pad gett Oder auch 34v03 i#˙n dem pad vnd2 auch na#:ch dem#- pad @
34v04 £E!S427 §chr2ei#˙bt vns der mai#˙§ter aquar#‘o al§o So man#- pad2enn#- wi#˙ll od2er#°
34v05 §cher2pffen#- §o §oll der man#- §ei#˙n i#˙n dem abne#:men#- dw §olt di#˙ch auch hu
34v06 etten das dw#: chai#˙n gli#˙d per2u#:r2§t Mi#˙t chai#˙ne#- ey§§en zw la§§en
34v07 noch zw §cherffen §o der man i#˙§t i#˙n dem#- zai#˙chn#- das dan#- d2em
34v08 §elben#- gli#˙d zw gehort !Ber paden#- will der#° §oll paden#- wan#- d2er man#-
34v09 i§t i#˙n d2em wi#˙der#+ oder#° i#˙m §cor2pi#˙an#- oder i#˙m vi#˙§ch !Oder#° i#˙m §chu#:tzn#-
34v10 oder2 i#˙m §ty#:er oder2 i#˙n der#° Wag od2er2 i#˙m !Cr2ebs Hali#˙ der mai#˙§ter#° §pri#˙cht
34v11 !Man#- §chull i#˙n ka#:y#:nn#-e hai#˙§§en#- zai#˙chen#- i#˙n dy#: pad §tuben#- gen#- als i#˙n d2em#- leo
34v12 i#˙n der2 Iungfr2auen#- i#˙n dem zwili#˙ng !Vnd i#˙n dem#- §tai#˙npock !Es §pr2i#˙cht
34v13 auch aui#˙cenna Vnd galien#9 das nyema#-t i#˙n dy pad §tuben §chu#:ll gen#-
34v14 !Oder2 i#˙n chai#˙n wa§§er2pad §o er2 ge e§§en hat zw#: hant dy §peys §ey dan#-
34v15 vor2 verdewt als vmb dy ve§per#° !Oder fr2u#:e nach d#+ pr2ey#:m zei#˙t ee da#:s
34v16 dy vn#-gedew#:t §pei#˙s lauff i#˙n dy#: glider#° vmb vnd vmb !Auer2r2oi#˙s d2er mai#˙ 34v17 §ter2#+ §pr2i#˙cht es chomen#- gr2o#:s §i#˙echta#:gn#- davon#- au#:ch §oll der#° men#-§ch
34v18 vor2#+ zw#: §tu#:ell gen !Ee das er2 i#˙n das pad2 get es §pr2i#˙cht auch ga
34v19 li#˙enu#:s das dy po#:§en ma#:ter2i#˙e r2e#:ochent i#˙n dy glid#+ von d2em pad
34v20 vnd wi#˙r2#‘t her2t i#˙n dem#- men#-§chen#- !Vnd ma#:cht den me#-§chn#- fau#:l i#˙n d2e#-
34v21 lei#˙b vnd fau#:lt dy gli#˙der#+ auch §oltu#: ai#˙n weni#˙g d2i#˙ch er2 gen#- ee das du
34v22 pa#~de§t !Es §pr2i#˙cht aui#˙cenna d2as aynn#- yedlicher me#-§ch ma#:§lichn#-
233
[35r]
35r01 £!Soll428 paden#- das ni#˙cht zw hai#˙s noch zw#: lang §ey#: Wan dy#: zway#: wekr2enckn#- vnd
35r02 hi#˙tzi#˙gen#-t zw §er2e vnd wer ma§li#˙chn padet dem pri#˙ngt d2as pa#:d natu#:rli#˙chen#-
35r03 hi#˙tz vnd gu#:ete feuchtikai#˙t !Chai#˙n men§ch §oll chalten#- wei#˙n no#:ch py#:er2 noch
35r04 wa§§er#‘ oder2#+ ander#+ das chalt §ey tr2i#˙ncken i#˙n dem#- pa#:d !Ban d2as wekr2enckt
35r05 dy#: gli#˙der §chedli#˙chen#- !Es §pr2i#˙cht Aui#˙ce#-na es §chu#:ll nyemant nach d2em#- pad
35r06 pfeffer#‘ oder2#+ zwi#˙fell oder#° knoffla#:ch oder#+ was da §er2e hi#˙tzi#˙get Wan es pr
35r07 i#˙ngt dieti#˙cam#- !Das i#˙§t dz abneme#- an#- dem#- lei#˙b nyema#-t §oll au#:ch na#:ch d2em
35r08 pad e§§en#- gr2o#:be §pei#˙s als r2i#˙ntflei#˙§ch oder#° §wei#˙nen#- flei#˙§ch no#:ch gesaltzen#-n
35r09 flei#˙§ch oder zw han#-t an#- d2en#- lufft gen#- !Da#:s der lei#˙b ni#˙t zw#: kalt werde
35r10 dw §olt di#˙ch warm#- halten nach dem#- pa#:d vnd wan#- d2w i#˙n dy pa#:d§tu
35r11 ben#- ge#:§t !So §oltu#: ni#˙t an#- d2em#- er§ten#- gr2o#:§§e hi#˙tz lei#˙den#- da#- y#:e warm#- vnd
35r12 yee wer2#‘mer#‘ §oltu#: paden#- vnd doch ny#-mr2#° zw hai#˙s vnd §olt dei#˙nen#- lei#˙b ze
35r13 dem er#‘§ten#- wandw#: ger2a#:§te§t er2wer#‘men kr2a#:tzn#- !Vnd2 ni#˙t vi#˙ll r2ed2en#- no
35r14 ch §chr2eyen#- Vnd wandw zw d2em#- er§ten#- §wi#˙tze§t vnd di#˙ch ger2ei#˙be§t
35r15 !So §oltu#: di#˙ch pe#:gi#˙e§§en#- mi#˙t wa#:§§er da#:s no#:ch kelter2#+ i#˙§t wan#- es §pri#˙cht
35r16 aui#˙ce#:nna da#:s dw nach d2em#- chalten#- wa#:§§er#‘ Nach dem#- pa#:d d2as ni#˙t zw
35r17 kalt sey das dw#: auff di#˙ch §chu#:te§t dei#˙ne gli#˙der zi#˙mli#˙chn#- erkulet vn#-
35r18 wi#˙r2t des lei#˙be§ chr2a#:fft ge§terckt !Vnd welei#˙bt dy naturli#˙ch hi#˙tz i#˙n d2e#-
35r19 lei#˙b vnd ma#:cht da#:s der §wai#˙s der2 von d2em hertzn#- was au#:s gangn#-
35r20 £!Vnd429 der2 vnder der hau#:2t lag vnd ni#˙t her2#+ au#:s mo#:cht das d2er her2#‘aus 35r21 gen mu#:es dar2 nach an dem petth vnd wan#- dw#: di#˙ch wegew§§e§t vn#-d
35r22 aus dem#- pad wi#˙ld gen !So §oltu dei#˙nen lei#˙b mi#˙t ay#-nem wai#˙chen#-
35r23 tu#:ech tr2u#:cken#- machen vnd das §elb vm#-b di#˙ch §la#:chen#- vnd2 di#˙ch warm
35r24 pedecken#- vnd pe§chai#˙denli#˙ch vnd dar2#+nach warm halten#- !Es §pri#˙cht au#:2i#˙ 35r25 cenna vnd alman#-§or das dz pa#:d wan man ordenli#˙ch padet als dan#-
35r26 hi#˙n na#:ch ge§chr2i#˙ben §tet pr2i#˙ngt dem#- lei#˙b guete feuchtikait vnd thuet
35r27 dy#: gli#˙der nutzli#˙chen#- au#:ff !Vnd r2a#~i#˙ni#˙gt den#- lei#˙b au§wen#-di#˙g vnd ver2§went
35r28 ai#˙n tai#˙ll der2 §pei#˙s vn#-d der#‘ po#:§en#- ma#:teri#˙en#- der2 du zw#: vi#˙ll430 ha§t vnd ver
35r29 tr2ei#˙bt dy wi#˙nt i#˙n dem#- lei#˙b vnd ma#:cht §chlaffen#- Auch li#˙§t man#- d2as dz
35r30 pad ma#:chet den#- mage#-n de§ter#‘ pa#:ß nu#:tzen#- dy §pei#˙s vn#-d vertr2ei#˙bt wee //431
35r31 £!Vnd432 ma#:cht ve§t i#˙n dem#- lei#˙b das dw#: nit zw vill §chei#˙§§e§t aber pade§tu
35r32 anders als dan hi#˙e vor2#‘ ge§chr2i#˙ben §tet !So wenympt es di#˙r2 d2ei#˙n hertz
35r33 vnd al§o enczu#:ndet da#:s dw#: vnder wei#˙llen i#˙n am#:acht433 valle§t vnd au#:ch
35r34 mani#˙gem#- me#-§chen#- §ei#˙n leben#- chur2#+tzet vnd ma#:cht gr2o#:b feu#:chti#˙kai#˙t 35r35 £!Jn434 di#˙r2 gen#- an#- dy §ta#:t da es zw#: §chaden#- chu#:m#-pt kayn men§ch §choll pa
35r36 den#- der2#‘ dy §u#:cht hat !Oder2 chai#˙n hi#˙tzi#˙gen#- pr2e§ten#- da von#- §pri#˙cht der
35r37 mai#˙§ter aui#˙cen#-a dy#:e me#-§chn#- dy#: vber2#‘laden#- §ei#˙n#- mi#˙t vbr2i#˙g#° feuchtikait
35r38 das es i#˙m#- dy#: hau#:t ve#+r2§per#‘ vnd ver2#‘§cho#:pp !Da#:s chai#˙n §wai#˙s dar2#+ aus
35r39 ni#˙t cho#:men#- mag vnd lau#:fft au#:s aynnem#- gli#˙d i#˙n das ander vnd dar2
35r40 vmb §o i#˙§t ni#˙t gu#:et padenn Mi#˙t vollem lei#˙b wan dy §pei#˙s pelei#˙bett
235
[35v]
35v01 £!Vngedew#:t435 vnd tai#˙lt §i#˙ch i#˙n dy glider#° dauon#- §i#˙echtagn#- chomen#-t der2#° mai#˙ster#°
35v02 galienus §pri#˙cht das man paden §chull nach dem vnd der lei#˙b ger2ai#˙ni#˙ 35v03 get i#˙§t wor2den#- als der2#+ me#-§ch zw#: §tu#:ell be#:gett Vnd2 geha#:rmet hat dz
35v04 d2er2 po#:s ta#:mpff vnd wi#˙nt dauon gan#-g !Ban welib der2 i#˙n d2em#- lei#˙b §o
35v05 cho#:m der2#‘ men§ch i#˙n gezwan#-g i#˙n d2em#- lei#˙b vn#-d dar2#‘u#-b wer2 ve§t we#~ll
35v06 wer2#‘den#- i#˙n#- d2em#- lei#˙b !Der2 ma#:g na#:ch e§§en#-s i#˙n da#:s pad gen#- vnd lan#-g
35v07 dar2i#˙n#- li#˙gen#-/436 i#˙§t da#:s er ai#˙n#- melon#-coli#˙c#9 oder2 ai#˙n#- fleg#:mati#˙cu#:2s437 i#˙§t
o#~der2
35v08 i#˙§t er2#‘ aber2 ai#˙n#- !Coler2i#˙cus o#:der2#‘ ai#˙n !Sa#-g#~wi#˙neus §o ma#:g er2 chuel
35v09 paden#- an#- gr2o#:s hi#˙tz wi#˙ll er2#+ aber2 va#:§t §wi#˙tzn#- §o §oll er2#+ me#:t tr2i#˙ncken#-
35v10 vor2#+ dem#- pa#:d Auch §pr2i#˙cht aui#˙ce#-na wer2 padet an §tr2ei#˙chn#- da#:s d#+
35v11 de§ter2#+ ge§u#:ntter#+ §ey#: dauo#- §oll man §i#˙ch hu#:ettn#- vor2 vbr2i#˙g#+ hi#˙tz vnd §o#:l
35v12 ni#˙t lang i#˙n dem#- pa#:d li#˙gn#- !Es §ey dan da#~s er2#+ ai#˙n#- vai#˙§ter me#-§ch §eye
35v13 wan#- di#˙§e di#˙ng ma#:chent ai#˙n#- men#-§chen#- chr2a#:nck vnd hi#˙tzi#˙g man §oll
35v14 au#:ch ni#˙t vi#˙ll chaltz tr2a#:nck i#˙n dem#- pad nemen#- !Dau#:on der2 mai#˙§ter#+ //438
35v15 aui#˙cenna §pr2i#˙cht Das na#:ch d2er2#‘ hi#˙tz §tee dy hau#:tt offen d2a der2 §w
35v16 ai#˙s au#:s chu#:mpt !Ban#- da get dy cheltn#- wi#˙der#‘ ei#˙n#- von#- d2em#- tr2a#:nck
35v17 vnd tr2ei#˙bt i#˙r2 chr2afft au#:s den#- glidern#- i#˙n d2a#:s hi#˙r2en#- wan#- d2as hi#˙r2en#-
35v18 gei#˙t allen an#-der2n#- gli#˙der2n#- ver2#+§tantnu#:s !Ban d2y fu#:nff §ynne dar2In
35v19 li#˙gen#- das her2#‘tz gei#˙t allen gli#˙dern#- hi#˙tz vnd er2 ner2t dy §eell vnd au
35v20 ch das leben !Dye leber2n#- gei#˙t allen#- gli#˙dern#- feu#:chti#˙kai#˙t zetr2i#˙nckenn#-
35v21 Wan#- §y zeu#:cht alles getr2an#-ck au#:s dem ma#:gen#- an §i#˙ch dy#: ny#:er2n#- ge
35v22 ben#-t dy#: gepu#:r2t wa#:n#- d2er2 §am#~e von#- allen#- glider2n#- i#˙n §y chu#:mt vn#- ku
35v23 met dan an#- dy#: §ta#:t das fr2ucht da#:uo#- chu#:mp#-t !Czway#: lo#:cher2#+ §ei#˙n
35v24 i#˙n dem#- mu#:nd i#˙n das ai#˙n get dy §pei#˙s vnd das getr2anck i#˙n d2en ma#:
35v25 gen#- !Jn da#:s an#-der2#+ gett d2er2 lufft vnd der2 atem#- zw der2 lu#:2ngen wan#-
35v26 §y#: als ai#˙n pla#:§palck i#˙§t ob dem her2tzen#- das §y den#- chaltn#- lu#:fft an#-
35v27 §i#˙ch zeu#:cht vnd dy#: hi#˙tz mi#˙t dem#- atenn wi#˙der#‘ aus zeu#:cht !Vnd das 35v28 loch hat ai#˙n vber2#‘lid vnd als man#- da#:s e§§en#- vnd das tr2anck an#- §i#˙ch
35v29 zeucht !So thu#:t §i#˙ch das li#˙dlen#- wi#˙der#+ zw#: vnd wan#- man d2en aten
35v30 Wi#˙der2 a#:u§s zeu#:cht §o thu#:et §i#˙ch da#:s lid wi#˙der au#:ff !D2as der2 me
35v31 n§ch ni#˙t er2#‘ §ti#˙ck der2#+ magen#- i#˙§t als ai#˙n haffen#- das §i#˙ch dy §pei#˙s §ew#:t
35v32 vnd dew#:t dar2#+In vnd i#˙§t als ai#˙n#- ko#:ch vnd ai#˙n#- kne#:cht wan#- er2#° all
35v33 en gli#˙dern#- dy#: §pei#˙s vor2#+ per2#‘ai#˙t !Vnd2 r2ai#˙chet aber2 d2y#: feuchti#˙kai#˙t 35v34 hat er2 von dem tr2i#˙ncken dy hi#˙tz vnd das feur2 hat er2#‘ von d2em#-
35v35 her2#‘tzen#- !Vn#-d au#:ch von d2er2#‘ leber2n @ 35v36 £Jtem#-439 von#- d2em#- la§§enn#- mi#˙t d2enn#- ko#:pp henn#- i#˙n d2em#- pad d2a#~s man#- au#:ch
ne#~nt |§cherphenn440 @ 35v37 £Alles441 das la§§enn das man thuet au§wend2i#˙g an d2em
35v38 lei#˙b mi#˙t den kopffen#- !D2as i#˙§t guet wan man#- wi#˙rt dauon ni#˙t 35v39 !Als kra#~nck a#:ls ma#- von#- ader2#‘n la§§enn#- thu#:2et !Man#- §oll mer#‘ckn da#:s
35v40 vi#˙ll §tett §ei#˙n an d2em#- lei#˙b da man dy#: ko#:pff oder2 dy ho#:r2ner hi#˙nn
237
[36r]
36r01 £!Setzen#-442 §oll als an dy §ti#˙r2enn#- fur2 d2en gepr2e§ten d2er2#° augen#- vnd fur2 d2en §wi#˙nd2el
36r02 vnd fur2 dy §wa#:r2e vnd kr2a#:nckhai#˙t des haupts !Man §etzt §y au#:ch vnd#+ das
36r03 kynne fur2 dy ge§wul§t des mu#:nds vnd des zand flei#˙§ch vnd fur2 den#- §ch
36r04 mertzn#- der zend !Man §etzt au#:ch dy#: kopff auff dy pr2u#:§t vm#-b des atens
36r05 wi#˙llen ma#- §etzt §y au#:ch an dy §tat der2#‘ leber#+ das dy leber2 ni#˙t v#+pr2i#˙nne vn#-
36r06 er2§ti#˙ck vnd du#:r2 wer#‘de ma#- §e#:tzt §y#: au#:ch an dy#: §ta#:t des ma#:gen#-s !Vnd wer#‘ 36r07 met i#˙n#- vnd zeu#:cht dy#: vn#- rai#˙ni#˙gkai#˙t von#- i#˙m man §etzt §y au#:ch auff dy
36r08 !Ri#˙§te vnd au#:ff dy hant fur2#+ allen gepr2e#:§ten#- des haubtz vnd der#‘ augenn443
36r09 vnd der2#+ o#:r2en !Man#- §etzt §y#: au#:ch enmi#˙tten an#- den#- r2ucken fur2 allen pre§tn#-
36r10 des r2ucken#- Vnd der2#+ au#:gen man#- §e#:tzt §y au#:ch au#:ff dy lenden#- vnd auff
36r11 dy ar2§packn fur2 dy ge§we#:r2e !Vnd fur2 dy r2au#:di#˙gkai#˙t vnd fur2 dy po#:§en
36r12 plater2n#- vnd fur2#+ dy vbr2i#˙gen#- vnlau#:tr2i#˙kai#˙t dye dy ny#:er2en kr2encken
36r13 !Man#- §etzt §y#: au#:ch an#- dy#: diecher pey dem#- gemacht fur2 allen#- gepr2e§tn#-
36r14 des har2m#-s man#- §etzt §y au#:ch an dy#: en#-ckeln der#‘ fues fur2 dy pewlen#- vn#-
36r15 fur2 das §wi#˙ndeln des hau#:bts vnd fur2 das ven#-§ter2n#- der2#° augen das da
36r16 di#˙ck pluet zi#˙echet !Man#- §etzt §y au#:ch vnder den#- na#:bel fur2 den gep
36r17 r2e§tendes §techens vn#-d der2 per2mueter man §oll auch wi#˙§§en ee man#-
36r18 dy ko#:pff §etzt §o §oll man den lei#˙b r2ai#˙ni#˙gen#- i#˙n dem#- pad vnd du#:n ma#:ch
36r19 en#- vnd dy#:e fues pi#˙s an#- dy kny#:e !Jn war2men wa§§er paden das ma#:cht
36r20 das pluet §ubti#˙ll vnd du#:nn @
241
[37r]
{Abb. Harnschau444}
37r01 £Mer2ck445 hie wi#˙e §i#˙ch d2er men#-§ch ge§u#:2nt §chu#:2ll halten#- mi#˙t d2em#- §tu#:2elgan#-g 37r02 £E!S446 §pr2i#˙cht !Aui#˙cenna d2er2 mai#˙§ter wer2 §i#˙ch ge§unt well halten
37r03 mi#˙t dem §tuelgang der2 §oll dye di#˙ng nutzen dy i#˙n zw §tu#:elle
37r04 machen#-t gen#- vnd va#:§t §ai#˙chen#- !Vnd di#˙e i#˙m §wai#˙s pr2i#˙ngen vn#-
37r05 ni#˙t di#˙e di#˙ng dy i#˙m#- §che#:dli#˙ch §ei#˙n al§o das er2#‘ den#- lei#˙b albeg r2ai#˙ni#˙g
37r06 en §cho#:ll !Czw#: r2e#:chter2 zei#˙t vnd welche di#˙ng da#:s §ei#˙n da#:s fr2ag ay
37r07 nen wei#˙§§en ar2#‘tzt der2 dei#˙n natur2#+ vnd dei#˙nen gepr2e#:chn#- woll er2ke
37r08 nn#-e vnd dar2u#-b ped2o#:r2ff der2#+ me#-§ch D2a#:s er2#‘ etwan pade da#:s er2#° 37r09 §wi#˙tzen wer2d §o get von i#˙m vi#˙ll feuchtikai#˙t als i#˙ch dan hi#˙n nach
37r10 wi#˙ll §agen#- vnd weder2#‘ff vnder2 wei#˙llen#- wo#:ll la§§ens vnd wan#- gu#:t
37r11 §ey#: zw la§§en#- oder2#‘ §cha#:d !Da#:s wi#˙ll i#˙ch hi#˙n#- na#:ch auch §agen#- es §pri#˙cht
37r12 aui#˙cenn#-a da#:s d2er2 me#-§ch chai#˙n vber2flu§§ige po#:§e nat#“ pey i#˙m §chull la
37r13 §§en#- pelei#˙ben wan#- wer2 das wa§§er lang pey i#˙m tr2e#:gt !Vnd ni#˙t von#-
37r14 i#˙m la#:t gen#- dem#- wi#˙r2t der2 §tai#˙n i#˙n d2er2 pla#:tern#- wer2#° aber#‘ ma#:cht 37r15 zw §tu#:ell gen#- !Vnd es ni#˙t thuet dem#- chom#:en#-t447 d2y §iechtagen#- d2auon#-
37r16 das er2#+ chaw#:2m zw §tu#:ell ma#:g gen#- vnd wer2#‘dn#- i#˙m wi#˙nt i#˙n d2em#- lei#˙b
37r17 vnd po#:§e vber2#‘galle vnd wi#˙r2t vn#-lu§ti#˙g zw e§§enn#- !Vnd2 dar2#+ vm#-b wa#-
37r18 dw ni#˙cht macht zw#: §tuell gen#- §o §oltu etzwas nem#:en448 da#:s d2i#˙ch lei#˙ch
37r19 ti#˙gli#˙ch zw §tu#:eltr2ei#˙b !An allen §chaden mi#˙t ai#˙nes wei#˙§§en artz r2a#:tt
37r20 £Nw449 merck hi#˙e vonn d2em#- kr2i#˙§ty#:2r2en#-n 37r21 £E!S450 §pr2icht Alman§or2 d2er2 mai#˙ster#° das !Cr2i#˙§tyr2en#- ai#˙n edle er2tzney#:
37r22 §ey#: !Vnd tr2ei#˙bt vi#˙ll von#- d2em#- me#-§chen#- po#:§er#‘ ma#:teri#˙en vnd §pr2echn#-
243
[37v]
37v01 £!Auch451 ander#° men§chen#- das es r2ai#˙ni#˙ge dy nyern#- vnd dy platern#- von d2em
37v02 magen vnd dy ober2n#- glider vnd ver2tr2ei#˙bt !Coler2a#- das i#˙§t dy#: vber ga#:ll
37v03 es §pr2i#˙cht !Alman§or2 der2 mai#˙§ter#‘ §o ai#˙n men§ch dy#: §pei#˙s new§§et dy i#˙n
37v04 zw#: §tu#:ell ma#:cht gen#- na#:ch ayns wei#˙§§en artztes r2at dy dan#- gu#:et dar2
37v05 zw#: i#˙§t vnd zw r2echter2#° zei#˙t !Das da#:s dy obr2i#˙§t ertzney#: i#˙§t vnd §y ai#˙ne#-
37v06 men§chen zw ge§unt pey ge§unthai#˙t wehalten das §ei#˙n aber2#+ dye lew#:t
37v07 dye des wedur2ffen mer dan#- ander lew#:t dye dan#- gr2os vnd vai#˙§t §ei#˙n vn#-
37v08 dy da §er2e vi#˙ll §peis vnd obs e§§en#- !Vnd dy#: we#:ni#˙g lauffen#- vnd ar2#‘bai#˙ 37v09 ten /452 !Es §pr2i#˙cht aui#˙cenna das der2 lufft di#˙r2 nu#:tz vnd guet i#˙§t der2 da
37v10 ni#˙t ver2mi#˙§cht i#˙§t mi#˙t chai#˙nem tam#-pff oder2#+ pr2un§t der2 da von#- po#:§em
37v11 oder2 von vill wa§§er2#+s auff get !Von lacken#- oder2#‘ §u#:2n§t ver2#+mi#˙§cht i#˙§t
37v12 mi#˙t rau#:2ch o#:der2#+ mi#˙t po#:§em ge§ma#:ck Vnd der2#+ da ni#˙t en#-plo§§et i#˙§t mi#˙t=
37v13 ten#- oder2 zwi#˙§chen#- per2g vnd mau#:r !J§t aber2 da#:s dw d2en ni#˙t geha
37v14 ben ma#:cht §o §oltu i#˙n machen mi#˙t gu#:2eten kr2eu#:ter2n i#˙n d2ei#˙nem haws
37v15 dy#: woll §mecken !Vnd dye der2r2n#- vn#- pr2enne#- vnd gutn#- wei#˙n ma§lich tr2i#˙n
37v16 cken#- der2 da guet i§t fur2 dy nebell vnd fur2#‘ po#:§en#- lufft Vnd auch wa#-
37v17 der2 lufft dick i#˙§t vnd wan es r2egnet !Oder2 dy wa§§er2 tempfent vnd
37v18 i#˙§t au#:ch gu#:et das ai#˙n men§ch new§§et i#˙n §pei#˙s vnd i#˙n getr2anck ai#˙n
37v19 weni#˙g e§§ei#˙chs !Vnd we§under2 wa#-n der2#+ lufft v#+gi#˙fft i#˙§t In453 ai#˙nem ge
37v20 ma#-yne#-n §ter2ben#- i#˙§t nutz den lewten#- dy da hai#˙s vnd dur2#+ §ei#˙n das
37v21 dy tr2i#˙ncken#- ger2#‘§ten wa#:§§er vnd §u#:n§ten#- wa§§er !Bi#˙§§et da#:s po#:§er2 vn#-
37v22 di#˙cker lufft spr2i#˙cht aui#˙cen#-na vnd gr2o#:bes wa§§er2 des me#-§chen §pei#˙s
37v23 £!Jn454 d2em#- lei#˙b ver2#‘der2bt vnd au#:ch d2em men#-§chen an §ei#˙ne#- lei#˙b vn#- an §e
37v24 ynnem gemu#:et §chadet @ Jtem ai#˙n andr2ee ler2 von ertzney @ 37v25 £D!V455 §cholt auch mer2#‘cken das etli#˙ch men#~§chen#- er2tzney#: §er2#‘e fur#‘ch 37v26 tenn al§o das §y i#˙r2 ni#˙t nemen#- getur2r2en !D2en §oll ma#- §y ge
37v27 ben haym#-li#˙ch i#˙n ai#˙nem mu#:2es oder2 i#˙n wa§§er2 oder2#° i#˙n weu#:
37v28 es §ey#: !Es §ei#˙n au#:ch etli#˙ch me#-§chen#- di#˙e dy#: er2#‘tzney zw hant verli#˙e§ent
37v29 den §oll man pa#:tzpr2ot fur2 d2en mu#:nd2 haben#- !Vnd i#˙n zu#:e r2e#:den#- i#˙n mani#˙ 37v30 ger2lay han#-t wei#˙§s hi#˙ntz das §y dy er2tzney wehaltenn @ 37v31 £Merck456 hi#˙n nach von d2em lufft wi#˙e der2 n§er2 natur2#‘ nd kr2afft auff enthaltet n#- |auch
we§tercket457 37v32 £N!Vn458 mer2#‘ck das vnder2#‘ allen den di#˙ngen#- dy vn
37v33 §er2en lei#˙b ner2ten#- das nutze§t i#˙§t !Vnd das §chedli#˙che§t §ey vnd
37v34 ee vnn§er2#‘ na#:tur2#° ver2#‘wan#-d2elt dan#- der2 lufft wa#-n wi#˙r2 den lufft §tati#˙ 37v35 gli#˙ch !Mi#˙t dem#- mu#~nd vn#-d mi#˙t den#- na#:§locher2n#- zi#˙echen#- i#˙n dy#: lungell
37v36 vnd i#˙n das her2#‘tz vn#- i#˙n dy#: ader2n#- dy dar2Inne gend !Vnd wi#˙r2t der2 lufft
37v37 mi#˙t den#- lebli#˙chen#- gei#˙§ten#- de#:s plu#:ets i#˙n gemi#˙§chet wan#- war2 vmb
37v38 £!J§t459 der2#‘ lufft gu#:et §o er2fr2ew#:et er2#‘ dy#: natur2#° I§t er2 aber2#° po#:§s §o ma#:cht 37v39 er2#‘ §y §wa#:r2e vnd2 tr2au#:r2i#˙g !Der#° gu#:2et lu#:fft i#˙§t au#:2ch d2en#- §y#:nnen#- gu#:2et
245
[38r]
{Abb. Winde460}
Soll Venus Mercur2i#˙us % lu#:2na Satur2nus Jupi#˙ter Mars
Au§tner Be§ter Norter O§tner
247
[38v]
38v01 £!Ban461 alles das wer2ch vn§er2#° §yn#- was §ich al§o zw wegr2ei#˙ffen#- zeuchet vnd
38v02 auch zw fr2o#:likai#˙t das wi#˙r2t ee vnd volchomen#-licher2 volbr2a#:cht i#˙n guetem §ch
38v03 o#:nen lufft dan i#˙n tr2ueben#- §war2#:en462 lufft !Nw#: mer#‘ck das !Gali#˙enu#:s §pri#˙cht
38v04 es i#˙§t ni#˙t allai#˙n offen#-war2 von natur2#+li#˙cher#‘ le#:r2e der2#° mai#˙ster#° wi#˙r2 §echen es von#-
38v05 tagli#˙cher2#° er2wei#˙§ung !Das da tr2uebung vnd2 gr2obi#˙kai#˙t §wa#:r2es lufftes vn§ern#-
38v06 §ynn vnd vn§er2en muet we§wer2#‘ent Vnd vn§er#° fr2olickait wetr2uebet vnd wz
38v07 das men§ch thuen §choll das i#˙m das ni#˙t als wo#:ll zw#: §ynn#-en i#˙§t !Jn tr2uebem
38v08 vnd §war2en lufft als §a#:m wa#:r2 d2er2#+ lufft §cho#:n vnd2 lautter#‘ @ 38v09 £Jtem#-463 me#~r2ck hi#˙e hi#˙n n#~ach von#- d2en#- vi#˙er2#+ wi#˙ntten#- vnd auch von#- i#˙r2er#°
chr2a#:fft wi#˙e 38v10 §y vn§er2 natur2 vnd leben auff enthalten In di#˙§er2 gegen bur2ti#˙gen zei#˙t @ 38v11 £N!Vn464 mer2ck von#- der2 natu#:2r2 d2er2 wi#˙nt !Al§o d2er2 er2§t wi#˙nt d2er2 hai#˙§§et o#:§tner#°
38v12 wi#˙nt der2 chumbt von#- or2i#˙ent d2a d2i#˙e Su#:nn au#:ff gett vnd2 i#˙§t hai#˙s
38v13 vnd tr2ucken !Vnd2 i#˙§t ger2en#- §cho#:n vnd2 i#˙§t d2ur2ch chalt der2 §elb ha#:t
38v14 zw#: yettbed2er2 §eitten ai#˙nen wi#˙nt !Dy §elben wi#˙nt §ei#˙n ge§unt vnd guet
38v15 vnd ver2ender2n#- vn§er2en lei#˙b ni#˙t d2auon i#˙chtz zw#:2 achten i#˙§t od2er2 sey#: D2er2
38v16 ander2 wi#˙nt hai#˙§§et !Au§tner2 der2 wi#˙nt i#˙§t chalt vn#-d feucht vnd get du#:r2ch
38v17 di#˙e wue§ten Ramoney#: vnd dur2ch dy lant dy da war2m#- vnd feucht §ei#˙n
38v18 !D2er2 wi#˙nt thuet vn§er2#° na#:tur2 §er2e wee wan#- er2#+ ma#:cht vi#˙ll §wai#˙s vnd2 tu#:et
38v19 d2em haupt wee vnd ma#:cht §wi#˙nd2ell i#˙n d2em#- haubt !Vnd thuet §i#˙echen me#-
38v20 §chen wee vnd wa#:s an vn§er2em lei#˙b i#˙§t das ver2wi#˙r2r2et er2 vnd2 thuet ka=
38v21 ynn gu#:2et wan er2 ma#:chet zw §tuell gan !Der2 dr2i#˙tt wi#˙nt hai#˙§§et we§ter
38v22 der2 chu#:mpt da#: her2 von d2annen#- d2y §u#:nn ny#:der2#+ get der2 ha#:t auch ze yettbe
38v23 der2#° §ei#˙tten ai#˙nen wi#˙nt der2 i#˙§t hais vnd2 feucht von#- §ei#˙ner#° vnd2 i#˙§t d2och
38v24 albeg pey#: vn#-s warm !Das maynt er ni#˙cht an#-ders wan das er2 d2u#:2r2ch warms
38v25 land gett vnd2 thu#:2et au#:ch vn§er2 natu#:r2 ni#˙cht we#:e dau#:on i#˙chtz zw achte#-
38v26 i#˙§t !Der2#‘ vi#˙er2d2 wi#˙nd2t hai#˙§§ett Nor2twi#˙nt der2#+ chu#:mpt von#- no#:r2tbegn#- land2 d2er
38v27 I§t chalt vnd2 tr2u#:cken der2 hat auch zw#: yettweder2 §ei#˙tten#- ai#˙nen wi#˙nt dy#:e
38v28 chomen#- au§s chalten#- vnd dur2ch chalte land !Vnd du#:r2ch gepi#˙r2gi#˙§che land2
38v29 vnd thu#:n vi#˙ll gutz vnd vbels er2 thuet gu#:et wan er §tar2ck machet all
38v30 vn§er2 lebli#˙che chr2a#:fft !Er2 tuet auch vbell wan#- er#‘ macht dy#: hue§ten#- vn#-
38v31 das flo#:§s vnd thuet alten#- leu#:ten#- wee vnd ma#:chet eng vmb dy pru#:§t
38v32 vnd al§o wan dy wi#˙nt cho#:ment !D2er2 mag §ich d2ar#‘nach halten war2m#-
38v33 wan#- es i#˙§t nu#:tz das man#- §y er2kenne vnd §i#˙ch dar2n#:ach465 r2egi#˙r2 vn#- halte @
249
[39r]
{Abb. Alltagsszene466}
39r01 £Merck467 hi#˙e von d2en zu vallenden d2es Synnes gedencken wi#˙e dy vn§ern §ynn vn#-
39r02 auch gemuet oder2 ver2nufft ver2 wandelnn @ 39r03 £N!Vn468 ge#~t ai#˙n#- !Capi#˙ttel an von d2enn zu#:uallend2en#- ged2en#~cken d2es gemu#:tz
39r04 vnd2 auch d2es §ynn#~es d2a mai#˙nt er2 vnn#~ser ver2nu#:fft vnd2 wi#˙ll §agen
39r05 wi#˙e vns zor2#:en469 vn#-d2 lei#˙d2en#- d2e#:s !Si#˙nn#~es §er2#‘e hi#˙nd2er2t vnd2 enti#˙r2r2et vn#-
39r06 !Auch zw feuchten#- pr2i#˙nget vnd2 hi#˙nd2er2t d2y wer#‘ch d2es §y#:nn#-es !Vnd2 d2ar2u#-b
39r07 was §chadpa#:r i#˙§t als zo#:r2en vnd2 tr2#‘aur2ikai#˙t !Da#:s §ol man#- mei#˙d2enn#- mi#˙t 39r08 vley#:s wan#- war2u#-b zor2en vber2 hi#˙tzi#˙get alle gli#˙d2er#° d2es lei#˙bs von#- d2er2#+ hi#˙tzi#˙g
39r09 ung vnd2 pebegung d2es hertzen#- !Vnd2 §chend2et alle wer#:ch470 d2er2#‘ pe§schai#˙d2enhat
39r10 !Vnd2 dar2u#-b wa#:s von#- §y#:nnen#- ed2ell i#˙§t da#~s soll §i#˙ch huetten vor2 allen#- §achn
39r11 dy#: zo#:r2en vnd2 tr2aur2igkait pr2i#˙ngen !Es §ey dan#- das man#- von#- r2e#:chtkai#˙t 39r12 zur2nen mues als §am wan#- ma#-n v#:nr2echt d2i#˙ng §i#˙echt od2er2#+ ho#:r2t !Es i#˙§t au#:
39r13 ch zw#: wi#˙§§en wa#:s tr2au#:r2i#˙kai#˙t thu#:et od2er2#‘ §chaffet Tr2au#:2r2ikai#˙t vnd2 vnmu#:
39r14 ett d2er2#‘r2#‘et d2en#- lei#˙b vnd2 kelten#-t yn#- vnd2 d2ar2u#-b ma#:cht es ma#:ger#° vnd2 d2er2r2et
39r15 von#- kalter2 §ach we#:gen#- !Vnd2 zwi#˙n#~gt d2a#:s her#‘tz ze§am#:en#-471 vnd2 vi#˙n§ter#‘t vnd2
39r16 ma#:cht es §wa#:r2e vnd2 d2y lebli#˙chn#- gei#˙§t i#˙n d2em plut vnd2 i#˙n d2er2#‘ nat#“ !Vnd2
39r17 ma#:chet dy §ynne gr2o#:b vnd ma#:chet d2en men§chen ver2cza#:gt vnd2 vnbe
39r18 §u#:2nnen !Guet d2i#˙ng zw volbri#˙ngn#- vnd2 zw pegr2ei#˙ffen vnd2 dar2#‘ vm#-b i§t
39r19 tr2au#:r2en#- zw ver2 meid2en als ver2r2 man#- es von wi#˙d2er2barti#˙kai#˙t gela§§enn
39r20 mag we#:r2#° aber2#° mi#˙t vi#˙ll §or#‘gen#- !Vnd2 we#:ku#:mer#‘nu#:s vnd2erczo#:gen i#˙§t d2er2#‘ §ol 39r21 d2i#˙ck fr2ew#:2 den vnd tr2o#:§t §uchen d2a#:s es d2y#: na#:t#“ er2#‘lei#˙d2en#- mu#:g al§o d2as ma#-
39r22 £!Mi#˙t472 er2ber2#‘n#- vnd2 fr2o#:lichen d2i#˙ngn#- vnd2 tr2o§tnus d2y chr2a#:fft vnd2 d2y#: §ynne
39r23 mu#:g wi#˙d2er2#‘ pr2i#˙ngen#- auch mer2ck mi#˙t allem#- vlei#˙s !So man#- gee§§en ha#:t dz
39r24 Man#- ni#˙t §ytz#~e gegen#- kr2effti#˙gem#- feu#:r2r2e od2er2#° i#˙n vbri#˙gen hai#˙§§enn §tu#:benn
251
[39v]
39v01 £!Ban473 kr2anck leu#~t wer2d2en#- pald i#˙r2er2 kr2e#:fft per2aubt von#- gr2#‘o§§er#° hi#˙tz vnd2 werd
39v02 ent d2auon#- ama#:chti#˙g ai#˙n mer#‘ckli#˙chs r2edli#˙chs wor2#‘t §pr2i#˙cht !Aui#˙cenna d2a#:s
39v03 ni#˙chtz §ey i#˙n d2er2#+ welt das als §er2e gebu#:n§cht werd2 als ge§u#:nthai#˙t vn#-
39v04 peger2t wer2d2 von#- d2en d2y#: i#˙n d2er2#° welt §ei#˙n !Ban wen#- wi#˙r2 d2y ge§u#:nthai#˙t ni#˙t 39v05 haben §o fr2eu#:t vn#-s wed2er2#+ gu#:et no#:ch ku#:n§t no#:ch fr2e#:wnt noch kai#˙ner#°lay
39v06 wollu§t !Der2 welt vnd2 wan man#- ge§u#:nt i#˙§t §o ged2enckt man kayns
39v07 di#˙ngs my#:nd2er2#° wan#- wi#˙e ma#- d2i#˙§e gegenbur2#‘ti#˙ge ge§u#:nthai#˙t ver2tr2i#˙be !Al§o
39v08 das ny#:ema#-t §ei#˙nen#- mu#:etwi#˙llen ni#˙t la#:§§et d2ur2ch ge§u#:nthai#˙t wi#˙llen#- vnd2
39v09 wa#:r2 d2o#:ch pe§§er#+ !Da#:s ma#- d2i#˙§e gegenbur2ti#˙ge ge§unthai#˙t we#:hi#˙elt Wan#-
39v10 man#- chan#- dy ver2#‘lor2en#- ge§unthai#˙t !Jn lang#° zei#˙t ni#˙t wi#˙d2er#‘ pr2i#˙nge#- d2y#:e
39v11 i#˙n v#:ppi#˙kai#˙t ver2tr2i#˙ben i#˙§t Vnd2 d2a mi#˙t ai#˙n end2e !Go#:t d2er2 her2#° vn#-s i#˙n §ei#˙n
39v12 |r2ei#˙ch §end2e !Amenn474 @
252
Endnoten zur Basistransliteration
1 Männliche Figur, Hippokrates. 2 Blaue Lombarde, vier Zeilen hoch. 3 Fische. 4 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 5 Vier männliche Figuren, die sich am Feuer wärmen. 6 Blaue Lombarde, 4 Zeilen hoch. 7 Kodex Schürstab (fol. 7r/S. 23): ensalbe. 8 Spruch wurde komplett getilgt. In der Schürstab-Überlieferung (fol. 7r/S. 23): Wer frauen denn ny#:met daz kint dy
vallent sucht gewinnet. 9 Restaurierung des Blattes am unteren Rand erkennbar, ca. 2×3 cm breiter Papierstreifen aufgeklebt. 10 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Verkundu#-g Mar2i#˙e Z26. 11 Rote Lombarde. 12 Blaue Lombarde. 13 Verzierte und vergrößerte Initiale. 14 Martius = lat. März 15 Rote Lombarde. 16 Blaue Lombarde. 17 j-förmiges Zeichen ohne Trema, mit durchgestrichener Unterlänge. 18 Rote Lombarde. 19 Blaue Lombarde. 20 Männliche Figur, Galenus. 21 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 22 Schräger Haarstriche (Virgel) hinter sol. Markiert vermutlich das Zeilenende, da der Text über den vorgezeichneten
Schriftraum hinausragt. Möglicherweise jedoch nur Zierelement. 23 Widder. 24 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 25 Versehentlich zwei Punkte über dem i. 26 Vier Figuren mit Pferden, beim Pflügen und Säen. 27 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 28 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8, Z25: Sand Gorg ai#˙n r2i#˙tter#‘ . 29 Rote Lombarde. 30 Blaue Lombarde. 31 Verzierte und vergrößerte Initiale. 32 Blaue Lombarde. 33 Rote Lombarde. 34 Blaue Lombarde. 35 Rote Lombarde. 36 Blaue Lombarde. 37 Männliche Figur, Johannes. 38 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 39 Stier. 40 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 41 Vier Figuren beim Pflanzen, Schneiden, Veredeln, Pfropfen von Bäumen. 42 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 43 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Phi#˙li#˙pp vnd Jakob xi#˙j#˙
potn#- Z2, %hei#˙li#˙gn#- kreutz vi#˙ndug#- Z4. 44 Restaurierungsarbeiten am Bund. Brüchige Falzkante durch Einfügen eines Papierstreifens verstärkt. 45 Rote Lombarde. 46 Blaue Lombarde. 47 Verzierte und vergrößerte Initiale. 48 Rote Lombarde. 49 Blaue Lombarde. 50 Rote Lombarde. 51 Blaue Lombarde. 52 Die sonst übliche Reihenfolge der Lunarbuchstaben wird hier durch den zweifachen Eintrag von o unterbrochen.
Möglicherweise eine Verschreibung. 53 Restaurierungsarbeiten am Bund. Brüchige Falzkante durch Einfügen eines Papierstreifens verstärkt. 54 Männliche Figur, Avicenna. 55 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch.
253
56 Zwilling. 57 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 58 Unspezifisches Kürzungszeichen über m . 59 Drei Pärchen beim Baden, Tanzen, Flanieren; ein Musiker mit Instrument. 60 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 61 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Vi#˙tus Mode§tus cr2e§ten Z16,
Johannes der tauffer Z25, Johans vnd pauls mr#*$er Z27, Peter vnd pauls Z30, Dy gedachtnus pauli Z31. 62 Rote Lombarde. 63 Blaue Lombarde. 64 Rote Lombarde. 65 Blaue Lombarde. 66 Rote Lombarde. 67 Blaue Lombarde. 68 Vor und nach !Pan va§t jeweils drei rote Punkte. 69 Männliche Figur, Averroes. 70 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 71 Krebs. 72 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 73 Fünf Figuren beim Pflanzen, Umgraben, Gartenarbeit. 74 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 75 Versehentlich Punkt über e. 76 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Vlr2i#˙ch ai#˙n Bi#˙§cholff Z5,
Margaretha ai#˙n Jungfr#? Z13, Jakob ai#˙n zwelffpot Z26. 77 Rote Lombarde. 78 Blaue Lombarde. 79 Verzierte und vergrößerte Initiale. 80 Blaue Lombarde. 81 Rote Lombarde. 82 Suspensionskürzung, kleiner Hacken ähnlich r mit anschließender nach oben ausgeführter Schleife. 83 Blaue Lombarde. 84 Rote Lombarde. 85 Blaue Lombarde. 86 Männliche Figur, Rasus. 87 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 88 Löwe. 89 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 90 Drei Figuren (zwei Männer, eine Frau) bei der Erntearbeit. 91 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 92 z undeutlich, weil über Verschreibung n. n undeutlich, weil über Verschreibung y: erzey> erzeney. 93 Restaurierung des Blattes am unteren Rand erkennbar, ca. 2×3 cm breiter Papierstreifen aufgeklebt. 94 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Peter ketn#-feyr#‘ Z2,
Laur2enti#˙us mr#*$er Z11, Vn§er fr2awn §chi#˙edu#-g Z16, Bartholomeus xi#˙i#˙pot Z 25, &Augu§ti#˙nus pi#˙§cholff Z 29.
95 Rote Lombarde. 96 Blaue Lombarde. 97 Verzierte und vergrößerte Initiale. 98 Rote Lombarde. 99 Blaue Lombarde. 100 Rote Lombarde. 101 Blaue Lombarde. 102 Männliche Figur, Seneca. 103 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 104 Jungfrau. 105 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 106 g über Verschreibung d. 107 Drei Figuren (zwei Männer, eine Frau) bei der Getreideernte. 108 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 109 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Gi#˙lg ai#˙n abt Z2, Gepur2d vn§er
frauen Z9, Matheus ai#˙n xi#˙i#˙pot Z22, Ruprecht pi#˙§cholff Z25, Mi#˙chaell ai#˙n ertzengell Z30. 110 Rote Lombarde. 111 Blaue Lombarde. 112 Verzierte und vergrößerte Initiale.
254
113 Rote Lombarde. 114 Blaue Lombarde. 115 Rote Lombarde. 116 Notiz von anderer Hand außerhalb der Tabelle: ‚Emerami‘ (Hl. Emmeram 22. Sept.). 117 Blaue Lombarde. 118 Männliche Figur, Jesaja. 119 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 120 y mit nur einem Strich, singuläre Variante zu y mit zwei Strichen. 121 Waage. 122 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 123 Drei männliche Figuren bei der Weinlese und an der Weinpresse. 124 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 125 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Di#˙oni#˙§i#˙us vnd §ei#˙n
ge§elln#- Z10, Si#˙mon vnd Jdas xi#˙i#˙potn#- Z29, !Bolffgangus Bi#˙§cholff Z32 126 Rote Lombarde. 127 Blaue Lombarde. 128 Verzierte und vergrößerte Initiale. 129 Rote Lombarde. 130 Blaue Lombarde. 131 Rote Lombarde. 132 Blaue Lombarde. 133 Im Blatt befindet sich ein Riss, der sich durch die obere linke Hälfte zieht. Restaurierungsarbeiten am Bund. Brü-
chige Falzkante durch Einfügen eines Papierstreifens verstärkt. 134 Männliche Figur, Constantinus. 135 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 136 Seite beschädigt, Tinte stark ausgeblichen. 137 Seite beschädigt. 138 Skorpion. 139 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 140 Zwei Figuren mit Pferd beim Säen. 141 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 142 o mit einem Strich, singuläre Variante zu o mit Trema. 143 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Aller hei#˙li#˙gn#- tag Z3,
Marti#˙nus Pi#˙§cholff Z12, El§pet !Bi#˙ti#˙b Z20, Katheri#˙na Jungkfr2aw Z26, Vi#˙r2gi#˙li#˙us Pi#˙§cholff Z28, Andr2eas zwelffpot Z31.
144 Rote Lombarde. 145 Blaue Lombarde. 146 Verzierte und vergrößerte Initiale. 147 Seite beschädigt. 148 Seite beschädigt. 149 Blaue Lombarde. 150 Rote Lombarde. 151 Blaue Lombarde. 152 Rote Lombarde. 153 Männliche Figur, Meste. 154 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 155 Korrektur: y über i. 156 Schütze. 157 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 158 Zwei Figuren bei der Holzarbeit (Holzhacken), Wagen mit Pferd (Holztransport). 159 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 160 In roter Schrift ausgeführt: Überschrift, Rubrik 1, 6 und 10. Sowie in Rubrik 8: Bar2#‘bar#‘a Jungkfr2#‘aw Z5,
Ni#˙colaus Pi#˙§cholff Z7, Thomas zwelffpot Z22, Gepur2d i#˙hu#- xpri#˙§ti#˙ Z26, Steffan martr2er Z27, Johannes zwelffpot Z28, Der ki#˙ndlei#˙n tag Z29, !Thomon ai#˙n pi#˙§cholff Z30.
161 Rote Lombarde. 162 Blaue Lombarde. 163 Verzierte und vergrößerte Initiale. 164 Blaue Lombarde. 165 Rote Lombarde. 166 Blaue Lombarde. 167 Rote Lombarde. 168 Blaue Lombarde.
255
169 Männliche Figur, Plato. 170 Rote Lombarde, vier Zeilen hoch. 171 Steinbock. 172 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 173 Drei Figuren mit Schwein bei der Fleischverarbeitung bzw. beim Schlachten. 174 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 175 Leicht schräg geneigter Haarstrich, zeigt Versgrenze an. 176 Die Farbgebung mit den Rubrikenbezeichnungen wechselt schwarz-rot ab. Zeile 1 mit der Goldenen Zahl ist
durchgängig in rot gestaltet, die übrigen Rubriken wechseln schwarz-rot ab (Spalte 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 rot).
177 Verzierte und vergrößerte Initiale. 178 Die Farbgebung mit den Rubrikenbezeichnungen wechselt mit Ausnahme der goldenen Zahl (rot) regelmäßig
schwarz-rot ab. Die Überschrift sowie die Spalten 1, 3, 6 und 8 sind durchgängig in rot geschrieben. In Spalte 5 sind die Zahlzeichen rot hervorgehoben. In Spalte 9 sind einzelne Buchstaben rot hervorgehoben, deren Bedeutung ungeklärt ist.
179 Verzierte und vergrößerte Initiale. 180 Hier handelt es sich um den hochgestellten Buchstaben o als Flexionsendung für die lat. Ordnungszahlen. 181 Zeile 33: Alle Rubriken-Bezeichnungen quer geschrieben, Blatt beschnitten, Text daher nur rekonstruierbar. 182 Initialmajuskel. 183 Blaue Fleuronné-Initiale, vier Zeilen hoch. 184 Initialmajuskel. 185 Widder. 186 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 187 Initialmajuskel. 188 Stier. 189 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 190 Nicht normkonformes J, eventuell aus Verschreibung. 191 Ausbesserung in der Hs., das erste n aus Verschreibung t. 192 Initialmajuskel. 193 Zwilling. 194 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 195 r durch durchgedrückte Tinte der verso-Seite undeutlich. 196 Am Zeilenanfang einzelner roter Punkt, vermutlich Versehen. 197 Vermutlich Verschreibung (verhört oder verlesen): w statt m. Paralleltext Kodex Schürstab (fol. 20r/S. 49) gemeine
gestalt. 198 Initialmajuskel. 199 Krebs. 200 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 201 vnd Dittographie. 202 Initialmajuskel. 203 Löwe. 204 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 205 s- durch Tintenklecks undeutlich. 206 Einzelner Punkt über u. 207 Initialmajuskel. 208 Jungfrau. 209 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 210 Majuskel W in diesem Fall rein ästhetischer Natur. 211 Roter Klecks über n, vermutlich Versehen. 212 Initialmajuskel. 213 Waage. 214 Rote Fleuronné-Initiale (L) mit blauer Rahmung , vier Zeilen hoch. Ziermajuskel (J). 215 Initialmajuskel. 216 Löwe. 217 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 218 i-Punkt um einen Buchstaben zu weit links. 219 i-Punkt in der Unterlänge des darüberliegenden p von spitzigs. 220 Initialmajuskel. 221 Schütze. 222 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 223 w mit nur einem Strich, singuläre Variante zu w mit zwei Strichen. 224 Initialmajuskel.
256
225 Steinbock. 226 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. Untypische Ziermajuskel (A), siehe Graphinventar. 227 Initialmajuskel. 228 Wassermann. 229 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 230 Initialmajuskel. 231 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 232 Fische. 233 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 234 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, drei Zeilen hoch. 235 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, zwei Zeilen hoch. 236 Die Farbgebung der Tabelleneintragungen, mit Ausnahme der ersten Spalte (durchgehend rot) wechselt regelmäßig
schwarz-rot ab (Schachbrettmuster). Die Überschriften sowie Wochentage in Zeile 1 und 14 sind nicht horizontal, sondern vertikal geschrieben.
237 Korrektur n zu ü#:. 238 Korrektur: nacht mit schwarzer Tinte über rote Schrift geschrieben. Ursprüngliche Eintragung nicht mehr entziffer-
bar, vermutlich ‚tags‘. 239 Initialmajuskel. 240 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 241 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 242 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 243 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 244 Kleiner roter Farbklecks bei m, vermutlich Versehen. 245 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, drei Zeilen hoch. 246 Einzelner Punkt über m. Versehen oder Sofortkorrektur möglich: in zu m umgedeutet und linear weitergeschrieben. 247 Tintenfleck nach t. 248 Männliche Figur (Saturn), links unten Steinbock, rechts unten Wassermann. 249 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, zwei Zeilen hoch. 250 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 251 Fünf Figuren: Zwei Männer graben in der Erde, eine Figur faulenzt, eine Person ist hinter Gittern eingesperrt, eine
Figur begeht einen Diebstahl. 252 Initialmajuskel. 253 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 254 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 255 Männliche Figur (Jupiter), links unten Schütze, rechts unten Fische. 256 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 257 Sieben Figuren: Jagdszene mit Hund und Falken, eine Figur zu Pferd, zwei mal zwei Figuren im Gespräch. 258 Initialmajuskel. 259 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 260 Tinte über n stark verschmiert. 261 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 262 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 263 Männliche Figur (Mars), links unten Widder, rechts unten Skorpion. 264 Rote Lombarde, drei Zeilen hoch. 265 Zehn Figuren: Kampfszene, Brandschatzen, Mord, Diebstahl. 266 Initialmajuskel. 267 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 268 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 269 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 270 Einzelner Punkt über e, vermutlich Versehen. 271 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 272 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 273 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. Ziermajuskel (J). 274 Männliche Figur (Sonne), unten links Löwe. 275 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 276 Elf Figuren: Betender, Schwertkampfszene, zwei Figuren singen, zwei Figuren beim ‚Kugelstoßen‘, zwei Figuren
ringen miteinander. 277 Initialmajuskel. 278 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 279 Initialmajuskel. 280 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, zwei Zeilen hoch. Ziermajuskel (E). 281 Weibliche Figur (Venus), unten links Stier, unten rechts Waage.
257
282 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 283 Elf Figuren: tanzende Pärchen, Musikanten mit Saiten-, Blas- und Tasteninstrumenten. 284 Initialmajuskel. 285 Nicht normkonformes u. 286 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 287 Zweiter Trema-Punkt im Stamm des darüberliegenden i von nit. 288 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 289 gan i#˙ch Dittographie. 290 Männliche Figur (Merkur), unten links Jungfrau, unten rechts Zwilling. 291 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 292 Vier Figuren: Maler, Schreiber, Bildhauer, eine Figur bei der Metallverarbeitung. 293 Initialmajuskel. 294 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 295 Initialmajuskel. 296 Einzelner Punkt über y. Korrektur von i zu y. 297 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, zwei Zeilen hoch. 298 Weibliche Figur (Mond), unten links Krebs. 299 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 300 Acht Figuren: Fischer, Vogelfänger, Müller, Schiffsleute, Bader oder Barbier mit Kunde. 301 Initialmajuskel. 302 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 303 etli#˙cher Dittographie. 304 Zweiter Trema-Punkt strichförmig verschmiert. 305 Korrektur von n zu tt. 306 Initialmajuskel. 307 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 308 Initialmajuskel. 309 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 310 Initialmajuskel. 311 Initialmajuskel. 312 Initialmajuskel. 313 Initialmajuskel. 314 Initialmajuskel. 315 Initialmajuskel. 316 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 317 Initialmajuskel. 318 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Umrandung, drei Zeilen hoch. Ziermajuskel (J). 319 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 320 Melancholiker. 321 Initialmajuskel. 322 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 323 Roter Punkt zwischen w und a, vermutlich Irrtum. 324 Korrektur: e über n. 325 i-Punkt des zweiten i um einen Buchstaben zu weit links. 326 Initialmajuskel. 327 Phlegmatiker. 328 Hinter I§t befindet sich ein Punkt, dessen Funktion unklar ist. Eventuell soll das Zeilenende markiert werden, das
wäre allerdings eine sonst nicht angewendete Methode. Denkbar ist aber auch eine Verschreibung. 329 lan steht in Zeile 9 mit Zeilen-Anschlusszeichen. Nach lan steht ein Punkt bzw. das nicht ganz musterkonform
ausgeführte Zierelement $, das das Ende der Überschrift markiert. 330 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 331 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 332 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 333 a nicht ganz musterkonform, geht offenbar aus einer Verschreibung hervor. 334 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 335 Sanguiniker. 336 Initialmajuskel. 337 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 338 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 339 Initialmajuskel. 340 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 341 Choleriker.
258
342 Initialmajuskel. 343 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 344 Über u einzelner Punkt. 345 Trema um einen Buchstaben zu weit rechts. 346 Zwei Figuren: Arzt mit sitzendem Patienten beim Aderlass. 347 Initialmajuskel. 348 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 349 Initialmajuskel. 350 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, zwei Zeilen hoch. 351 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, drei Zeilen hoch. 352 ni#˙cht steht in Zeile 22 mit Zeilen-Anschlusszeichen. Nach ni#˙cht steht ein Punkt bzw. das nicht ganz muster-
konform ausgeführte Zierelement $, das das Ende der Überschrift markiert. 353 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Umrandung, drei Zeilen hoch. 354 Superskript um einen Buchstaben zu weit links. 355 chen pedewt steht in Zeile 38 mit Zeilen-Anschlusszeichen. 356 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, zwei Zeilen hoch. Offenbar Irrtum: M statt W. 357 Initialmajuskel. 358 Abweichende Form der Nasalkürzung (hakenförmig, s. Grapheninventar). 359 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 360 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 361 Notiz von anderer Hand, erstreckt sich über 3 Zeilen: ‚an Sun / en ta#:g / g t‘. 362 = gehört eventuell zur Notiz von anderer Hand. 363 Undeutliches u, ähnelt n. 364 Nackte männliche Figur mit über den Körper verteilten Sternzeichen. 365 Initialmajuskel. 366 Initialmajuskel. 367 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 368 Notiz von anderer Hand, erstreckt sich über 3 Zeilen. Wegen nachträglicher Beschneidung der Blätter nicht mehr zu
verstehen: ‚vnd / z e‘. 369 Initialmajuskel. 370 Initialmajuskel. 371 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, vier Zeilen hoch. 372 Trema-Punkte durch hohes Schreibtempo fast strichförmig. 373 Initialmajuskel. 374 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 375 Notiz von anderer Hand, erstreckt sich über 2 Zeilen: ‚verp[otten] / tag‘ 376 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Rahmung, drei Zeilen hoch. 377 Notiz von anderer Hand, erstreckt sich über 3 Zeilen: ‚Leber / am rec[hten] / Arm‘ 378 Notiz von anderer Hand am oberen Blattrand, über die komplette Breite des Schriftraums. Wegen Beschneidung
des Blattes nur mehr ‚arm‘ zu entziffern. 379 Initialmajuskel. 380 Initialmajuskel. 381 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 382 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 383 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 384 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 385 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 386 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 387 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 388 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 389 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 390 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 391 E statt C, vermutlich verhört oder verschrieben. Gemeint ist vena cephalica (Vene am Oberarm). 392 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 393 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 394 Notiz von anderer Hand, zwischen Zeile 9 und 10. Wegen Beschneidung des Blattes nur mehr Teile zu entziffern:
‚Lebe[r]‘. 395 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 396 Notiz von anderer Hand: ‚Milcz[t]‘. 397 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 398 Notiz von anderer Hand: ‚Fir we[]‘. 399 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch.
259
400 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 401 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 402 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 403 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 404 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 405 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. Ziermajuskel (J). 406 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 407 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 408 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 409 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 410 Notiz von anderer Hand, erstreckt sich über 2 Zeilen: ‚nicht laßen‘. 411 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 412 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 413 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 414 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 415 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 416 Rote Lombarde, eine Zeile hoch. 417 Blaue Lombarde, zwei Zeilen hoch. 418 Initialmajuskel. 419 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 420 Trema bei u teilweise durch d verdeckt. 421 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 422 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 423 Blaue Lombarde, eine Zeile hoch. 424 Rote Lombarde, eine Zeile hoch. 425 Zwei Figuren: Badehausszene. 426 Initialmajuskel 427 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, vier Zeilen hoch. 428 Initialmajuskel. 429 Initialmajuskel. 430 i-Punkt in der Unterlänge des darüberliegenden g auswendig. 431 Zwei schräge Haarstriche (Virgel) hinter wee. Möglicherweise Mittel zur syntaktischen Gliederung, evtl. jedoch nur
Zierelement. 432 Initialmajuskel. 433 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 434 Initialmajuskel. 435 Initialmajuskel. 436 Schräger Haarstrich (Virgel) hinter li#˙gen#-. Möglicherweise Mittel zur syntaktischen Gliederung, evtl. jedoch nur
Zierelement. 437 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 438 Zwei schräge Haarstriche (Virgel) hinter mai#˙§ter#+. Möglicherweise Mittel zur syntaktischen Gliederung, evtl.
jedoch nur Zierelement. 439 Initialmajuskel. 440 §cherphenn steht in Zeile 37 mit Zeilen-Anschlusszeichen. Nach §cherphenn steht das stark verkleinerte Zierele-
ment @. 441 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 442 Initialmajuskel. 443 e undeutlich, weil aus Verschreibung heraus entstanden. 444 Zwei Figuren: Arzt oder Apotheker mit Patienten bei der Harnschau. 445 Initialmajuskel. 446 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Rahmung, drei Zeilen hoch. 447 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 448 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 449 Initialmajuskel. 450 Rote Lombarde, zwei Zeilen hoch. 451 Initialmajuskel. 452 Schräger Haarstrich (Virgel) hinter ten. Möglicherweise Mittel zur syntaktischen Gliederung, evtl. jedoch nur Zier-
element. 453 Punkt über I, vermutlich I aus i entstanden. 454 Initialmajuskel. 455 Blaue Lombarde, drei Zeilen hoch. 456 Initialmajuskel.
260
457 auch we§tercket steht in Zeile 32 mit Zeilen-Anschlusszeichen. Nach auch we§tercket findet sich ein Mittelpunkt,
der die Überschrift abschließt. 458 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Umrandung, zwei Zeilen hoch. 459 Initialmajuskel. 460 Kreisschema: Figur mit Stock und Rosenkranz im Zentrum, eingefasst im Kreis der Planeten (beschriftet) und den
vier Himmelsrichtungen = Winde (beschriftet), symbolisiert durch Gesichter. 461 Initialmajuskel. 462 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 463 Initialmajuskel. 464 Blaue Fleuronné-Initiale mit roter Umrandung, drei Zeilen hoch. 465 Superskript um einen Buchstaben zu weit linls. 466 Drei Figuren: Eine Figur mit Bart auf einer Bank sitzend, die von zwei Musikanten mit Saiteninstrumenten unter-
halten wird. 467 Initialmajuskel. 468 Rote Fleuronné-Initiale mit blauer Umrandung, drei Zeilen hoch. 469 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 470 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 471 Superskript um einen Buchstaben zu weit rechts. 472 Initialmajuskel. 473 Initialmajuskel. 474 i#˙n §ei#˙n r2ei#˙ch §ende Amenn @ mit Unterstreichung hervorgehoben. #˙
262
[01ra] {Abb. Gelehrtenporträt137}
ES spricht
ypocras
der mai=
ster, man
5 schull sich in dem
hornung warm
halten, dás mo
nit ritig werd. Ky=
tzen fleisch soltu
10 nit essen. Huet di=
ch vor aller kalter
speis. Dein getranck soll sein ab agrom=
onien vnd epich sámen vnd vébe deinen
leib ernstlichen. Húet dich aúch vor vb=
15 er essen vnd vor aller trunckenhait. Aúff
der hant vnd aúff dem daumen ist gu=
et lassen vnd z dem ha bt. [01rb] {Abb. Sternzeichen138} Piscis est signum frigidum et hu=
midum aquaticum Jndifferens
plantas pedum respiciens Et va=
let propocionibus lesioni pedúm contra=
5 dicit Podagre et omnibus pedúm vicýs
medelam negabit
{Abb. Alltagsszene139} [01rc] HOrnung pin ich genant / DarIn wedorff man sóck vnd rauchs gewant /
Dw solt auch recht erkennen mich / Gestu nackot es, gereut dich / Jn
disem monad ist g t lassen s nd trinck a ch z massen Die fuezz nit salb nóch entwisch, ban der mond scheinet in dem visch.
5 Guet tranck soltu nemen. Die strass mag dich nit gelemen.
137 Männliche Figur, Hippokrates. 138 Fische. 139 Vier männliche Figuren, die sich am Feuer wärmen.
263
[01v]
K L Marcius hat XXXI tag
d Marcius f 20 8 4 24 e 6 g 21 f 5 Kunegund ain Jungkfraw h 22 5 16 0 33 g 4 i 23 5 13 14 A 3 k 24 13 1 55 b 2 l 25 2 22 4 c Nonas Perpetua vnd felicitas m 26 d 8 n 27 10 10 10 45 e 7 o 28 f 6 p 29 18 6 54 g 5 q Aries 7 19 35 A 4 Gregorius ain pabst r ɤ140 b 3 § 1 15 15 15 44 c 2 s 2 d Jdus t 3 4 4 25 e 17 Ciriacy ain martrer v 4 12 17 56 f 16 Gedraut Jungkfra u 5 g 15 x 6 20 1 13 16 A 14 y 7 9 1 56 b 13 z 8 17 22 6 c 12 Benedictus ain Abt z 9 b d 11 Z 10 6 19 47 c e 10 A 11 25 14 23 28 d f 9 b 12 e g 8 Verkundung Marie c 13 3 19 37 f A 7 Castulus ain martrer d 14 g b 6 Ruprecht ain pischolff e 15 11 8 18 h c 5 f 16 30 i d 4 g 17 19 4 27 k e 3 h 18 8 17 8 l f 2 i 19
140 j-förmiges Zeichen ohne Trema, mit durchgestrichener Unterlänge.
264
[02ra] {Abb. Gelehrtenporträt141}
ES spricht
der mai=
ster Ga=
lienus, man sch=
5 ull suesse ding in
dem Mertzn ezz=
en vnd mét soll
man núchtern
trincken. Chúel
10 gechochet soltú
essen. Honig wein
vnd essich misch zesamen vnd leg darein
rátich. Vnd frue núchtern so izz sein ge=
núg. Darauff so trinck labes wasser ay=
15 nen g etn trunck. Ob d zw voll pist, so túnck ain federen in ain óll vnd strei=
ch dý an den rachen. Gut specerey soltu
darauff nýezzen, kain treibent tranck ným
nit, ban das mácht dich chalt. Dein ge=
20 tranck seý ab raúttn vnd polayen. Vill sol=
t paden, aber nit z hais. D solt nit lazzn vnd pesunderlich an dem daúmen.
[02rb] {Abb. Sternzeichen142}
ARies est signúm calidúm et siccúm
igneum bonum habens de corpore ca=
put et partes eius Et luna in eo
existente est valens minúto in omni parte
5 corporis preter in capite Nam generaliter
omni lesioni capitis est nociuum ventose in
collo Jn mente vel in auribús non sunt po=
nende ingredi balnea vtile est Sed rasioni
contradicit
{Abb. Alltagsszene143}
141 Männliche Figur, Galenus. 142 Widder. 143 Vier Figuren mit Pferden, beim Pflügen und Säen.
265
[02rc] ICh pin gehaissen der mertz / Den pflueg ich auff stertz / Jn disem monadt
lazz chain plut / Doch ist swais paden gút
Des haubtz soll man schónen, ban in dem wider scheint der mannen. Nit zw
ader lassen, aber paden ist guet an allen schaden. Dý oren irczen soll man
enperen. Dw macht aúch woll den part abschern.
266
[02v]
K L Aprill hat XXX tag
m g Aprill i 20 16 13 17 n A 4 k 21 o b 3 l 22 5 5 1 58 p c 2 Ambrosius ain pischolff m 23 13 14 39 q d Nonas n 24 2 10 48 r e 8 o 25 10 23 29 § f 7 p 26 t g 6 q 27 10 18 19 38 v A 5 Marie Inegippen r 28 A b 4 § 29 7 8 19 b c 3 s Thaurus c d 2 t 1 15 4 28 d e Jdus Ewfemia Jungkfraw v 2 15 4 17 9 e f 18 Tiburcý et valeriani u 3 f g 17 x 4 12 5 50 g A 16 y 5 h b 15 z 6 1 1 19 i c 14 z 7 20 9 14 41 k d 13 Leo ain pabst Z 8 17 10 50 l e 12 A 9 6 23 31 m f 11 b 10 n g 10 Victor ain Pabst c 11 14 12 12 o A 9 d 12 25 p b 8 Sand Gorg ain ritter e 13 3 8 21 q c 7 Marcus ain Ewangelist f 14 11 21 2 d 6 g 15 e 5 h 16 19 17 11 f 4 Vitalis ain martrer i 17 30 g 3 k 18 8 5 52 A 2 l 19
267
[03ra] {Abb. Gelehrtenporträt144} MAister
iohann=
es spri=
cht, man
5 schull in dem a=
prill tranck ne=
men, das dich
treibe. Frisch fle=
isch soltú essen.
10 Búrtzen solt
essen als ráti=
ch vnd kúmpost, bann das gepirt den pó=
ssen fluß. Scherffen vnd winttusen ist gút
vnd gesunt. Dein getranck soll sein ab
15 betánien vnd raútten oder wermút vnd
pibnellen. Zw der median ist nit gút
lassenn.
[03rb] {Abb. Sternzeichen145} THaurus est signúm frigidum et siccum
terreum malum respiciens collum
et gúttúr Et vitetur fleúbotamia sed
plantacio arborúm et vinearum est valens quia
5 cito crescunt Et augmentari festinant et pa=
ssionibus colli et gúttúris et ling e mede
lam negant
{Abb. Alltagsszene146} [03rc] ABrill pin ich genant / Paúm peltzen vnd reben peschneid ich durch das la=
ndt / Jn disem monad ným dich nit an / lassen zw der median
Ban der man ist in dem stier, so peltz paum, das rat ich dir. Hewser
pa en ist guet. S men s en a ch n tz thuet. Lass dich chainen artz
5 weissen, den hals haillen mit eýssenn.
144 Männliche Figur, Johannes. 145 Stier. 146 Vier Figuren beim Pflanzen, Schneiden, Veredeln, Pfropfen von Bäumen.
268
[03v]
K L Der Maý hat XXXI tag
b May Philipp vnd Jakob xijpoten m 19 16 2 1 c 6 Sigmund ain kunig n 20 5 14 41 d 5 heiligen kreutz vindung o 21 5 13 3 23 e 4 Florian ain martrer p 22 2 23 32 f 3 Gothart ain pischolff q 23 g 2 r 24 10 12 1 A Nonas § 25 b 8 s 26 10 18 8 22 c 7 t 27 7 27 3 b d 6 v 28 c e 5 u 29 15 17 12 d f 4 Pangratz ain martrer x Gemini e g 3 Gangolff ain pischolff y 1 15 4 5 53 f A 2 z 2 12 18 34 g b Jdus Sophia ain Jungkfra z 3 h c 17 Z 4 1 14 44 i d 16 A 5 9 3 24 k e 15 b 6 20 17 23 34 l f 14 Potenciana Jungkfra c 7 m g 13 d 8 6 12 14 n A 12 e 9 o b 11 Helena ain kunigin f 10 14 0 56 p c 10 g 11 25 3 21 5 q d 9 h 12 r e 8 Vrban ain Pabst i 13 11 9 46 § f 7 k 14 t g 6 l 15 19 5 55 v A 5 m 16 30 8 18 36 A b 4 n 17 b c 3 o 18 16 14 45 c d 2 Petronella Jungkfra o147 19
147 Die sonst übliche Reihenfolge der Lunarbuchstaben wird hier durch den zweifachen Eintrag von o unterbrochen.
Möglicherweise eine Verschreibung.
269
[04ra] {Abb. Gelehrtenporträt148}
ES spricht
auicenna,
man schul
in dem M=
5 ayen nit zw der le=
bern lassen. Tran=
ck, das da lindet,
soltú némen. Barm
paden hab lieb, ch=
10 aines thiers nóch
visches haubt is
nit noch fues. Barme speis soll sein dein k=
resen vnd des geleichn, ban dauon wirt
das pluet erfrischet. Maýensmáltz is nú=
15 chter. Daúon wirt man gelindert. Dein ge=
tranck soll sein ab wermút vnd venchell
sámen, das stos woll gewaschen vnd mi=
sch dás mit gais milich vnd las das vb=
er nacht stehen. Vnd wan es laútter wirt, so
20 trinck es dreý tag núchtern.
[04rb] {Abb. Sternzeichen149} GEmini est signum calidum et humi=
dum terreum malúm respiciens
brachia manus et humeros Et
luna in eo existente prohibetur apercio vene bra=
5 chý Quia aut sangwis egredinon potest aut
morbúm incurrit nocivum aut vt plurimum ictus
solet iterari Mala est vngwium preciosio et
vniuersaliter ascapulis vsqe ad manus long=
itúdinem non est facienda medela
{Abb. Alltagsszene150}
148 Männliche Figur, Avicenna. 149 Zwilling. 150 Drei Pärchen beim Baden, Tanzen, Flanieren; ein Musiker mit Instrument.
270
[04rc] HJe chum ich stoltzer maý / Mit chluegen pluemen mangerlay / Jn disem monad
man warm paden soll / Auch tantzen vnd springn vnd leben woll
So der man ist in der zwifaltigen strassen, so soltú nit an den armen lazzen.
Dein negell vnd dein hent mit eýssen nit anwent. Vnd das dir wirt
5 verhaissen, darnach wirstú raýsenn.
271
[04v]
K L Brachmon hat XXX tag
d e Junius Nicomedis ain martrer p 19 5 3 26 e f 4 q 20 13 16 7 f g 3 Erasmus ain pischolff r 21 5 2 12 16 g A 2 § 22 h b Nonas s 23 10 0 56 i c 8 Bonifacius vnd sein gesellen t 24 18 21 57 k d 7 v 25 l e 6 u 26 10 7 9 47 m f 5 Primus vnd felicianus x 27 n g 4 y 28 15 5 50 o A 3 Barnaba ain zwelffpot z 29 4 18 37 p b 2 z 30 q c Jdus Z Cancer 15 12 7 19 r d 18 A 1 § e 17 Vitus Modestus cresten b 2 1 3 28 t f 16 c 3 9 16 9 v g 15 d 4 17 12 18 A 14 e 5 20 b 13 f 6 6 0 59 c 12 g 7 14 13 40 d 11 Albanus ain martrer h 8 e 10 Achacius vnd sein gesellen i 9 3 9 49 f 9 k 10 25 11 22 30 g 8 Johannes der tauffer l 11 A 7 m 12 19 18 39 b 6 Johans vnd pauls martrer n 13 c 5 Die siben slaffer o 14 8 7 20 d 4 Pan vast p 15 30 e 3 Peter vnd pauls q 16 16 3 29 f 2 Dy gedachtnus pauli v 17
272
[05ra] {Abb. Gelehrtenporträt151} AVerrois
der maist=
er spricht,
man sull
5 in dem Brachmon
alle tag núchter
prunwasser trin=
cken, Lactuck mit
essich soltú essenn.
10 Schlaff nit z vil. Visch, herte aýer,
sweinen fleisch, hert káß vnd alles gépraten
fleisch ist nit gesunt. Dein getranck seý
ab salua pluemen vnd raútten. Hólerplúe
15 soltu núchter essen.
[05rb] {Abb. Sternzeichen152} CAncer est signum frigidum et hu=
midum aquaticum Jndifferens
pectus respiciens Iecor cúm pul=
mone Et valet propocionibus súmendis
5 laxatinis tamen medicamen pectoris Et cir=
ca pectus existentivm permittit non adhibe=
ri
{Abb. Alltagsszene153} [05rc] BRachmonad pin ich genant / Hawen vnd gersten ným ich in dy hant / Jn disem
monad soll man nyemant ze ader lan / Es soll auch dy zeit nyemant mú=
ssig gan / Jn dem krebs lassen ist grosse verlust, czw der lungen, lebe=
ren vnd zw der prúst. Tranck nemen ist guet. D pist auch auff 5 der stras pehuet. An traum soltú dich nit keren. Mit arbait solt dú dich ner=
en.
151 Männliche Figur, Averroes. 152 Krebs. 153 Fünf Figuren beim Pflanzen, Umgraben, Gartenarbeit.
273
[05v]
K L Heymon hat XXXI tag
5 16 10 g Julius § 17 A 6 Vnser frauen weschawung s 18 13 14 11 b 5 t 19 5 2 1 0 c 4 Vlrich ain Bischolff v 20 10 13 41 d 3 u 21 e 2 x 22 18 9 50 f Nonas Bilibaldus ain pischolff y 23 7 22 31 g 8 Kilianus vnd sein gesellen z 24 10 A 7 z 25 15 18 40 b 6 Z 26 c 5 A 27 4 7 22 d 4 Margaretha ain Jungfrau b 28 12 20 3 e 3 Hainrich ain kaýsser c 29 15 f 2 d leo 1 16 12 g Jdus Czertailung der zwelfpoten e ɤ A 17 f 1 9 4 53 b 16 Alexius ain peichtiger g 2 17 1 2 c 15 h 3 20 6 13 43 d 14 i 4 e 13 k 5 14 2 24 f 12 l 6 3 22 33 g 11 Maria Magdalena m 7 A 10 n 8 25 11 11 14 b 9 Cristina ein Jungkrfraw o 9 c 8 Jakob ain zwelffpot p 10 19 7 23 d 7 Anna dy múter Marie q 11 8 20 4 e 6 r 12 f 5 Panthaleon ain martrer § 13 30 16 16 13 g 4 s 14 A 3 Abdon vnd Sennen t 15 5 4 54 b 2 v 16
274
[06ra] {Abb. Gelehrtenporträt154}
RAsus der
maister sp=
richt, man
schull in dem
5 Heymonad kain tr=
anck nemen, das
dich lindert. Vor
vnlaútrikait hú=
et dich. Des pesten
10 weins trinck nú=
chter, herte speis
vnd gepraten fleisch izz nit, das du nit
zw engig werdest. Nit slaff zw vill. Waz
von milch ist, das ist gesunt. Dein getr=
15 anck sey ab salua, rauten, wermút vnd
epich samen. D solt nit lassen noch kayn
tranck nemen von XV kolendas augu=
sti, daz ist der sechst tag nach sand mar=
garethen tag. Dann vachen sich an dý
20 húndischen tag vnd weren auff sand Bar=
tholomeý tag.
[06rb] {Abb. Sternzeichen155} LEo est signum calidum et siccúm Ig=
neum malúm stamachum et cor re=
spiciens Et luna in eo existente non
valet minúcio sangbinis nec caúsare fo=
5 mitum Et etciam tunc nulla medela pro
stamacho corde et partibus adiacenti=
bus est facienda
{Abb. Alltagsszene156}
154 Männliche Figur, Rasis. 155 Löwe. 156 Drei Figuren (zwei Männer, eine Frau) bei der Erntearbeit.
275
[06rc] BElcher ochß geren zeucht den pflueg / Dem will ich geben hewes ge=
núeg / Auch will ich dir mit treúen sagen / huet dich vor den hundi=
schen tagenn / Der leo meret den smertzen, der lúngen vnd dem her=
tzen. Nit leg an ain ne es klaid oder gewant. Pistu geladen, dw wirst gesch=
5 ant. Dw solt chain erzeney nyessen. Dich soll auch speýen sere verdriessenn.
276
[06v]
K L Augst hat XXXI tag
13 17 35 c August Peter ketenfeyr v 17 2 13 44 d 4 Steffan ain pabst x 18 e 3 y 19 5 10 2 25 f 2 z 20 18 22 34 g Nonas Oswolt ain kunig z 21 A 8 Sixtus ain pabst Z 22 7 11 15 b 7 Affra vnd ir gesellschafft A 23 c 6 Ciriacus vnd sein gesellen b 24 10 15 7 25 d 5 c 25 4 20 6 e 4 Laurencius martrer d 26 f 3 Tiburcius martrer e 27 12 8 47 g 2 f 28 A Jdus Jpolitus vnd sein gesellen g 29 15 1 4 56 b 19 h 30 9 17 38 c 18 Vnser frawn schiedung i Virgo 17 13 46 d 17 k 1 e 16 l 2 6 2 25 f 15 Agapitus ain martrer m 3 20 14 15 8 g 14 n 4 A 13 Bernhart ain Abt o 5 3 11 17 b 12 p 6 11 33 58 c 11 q 7 d 10 Pan vast r 8 25 19 20 7 e 9 Bartholomeus XIIpot § 9 f 8 s 10 8 8 48 g 7 t 11 A 6 v 12 16 4 57 b 5 Augustinus pischolff u 13 30 5 17 38 c 4 x 14 d 3 Felicis vnd adaucti martrer y 15 13 6 19 e 2 16
277
[07ra] {Abb. Gelehrtenporträt157}
IN dem aug=
st spricht
Seneca, da
so nym chain ertz=
5 ney von nyemant,
bann es dy hun=
dischenn tag sein.
Hut dich auch vor
milch. Chain su=
10 esse speis izz nit,
sunder dý da pitter
seý. Trinck nit zw vill weins, vor vnl=
autrikait huet dich, aúch húet dich
vor aller hitz. Pier vnd met trinck nit,
15 es sey dan frisch. Dein getranck sey ab
epich pluemen vnd ab pelaýen vnd ab
wermuet.
[07rb] {Abb. Sternzeichen158} UJrgo est signúm frigidum et sic=
cum terreúm malum ventrem
et ipsius in testina respiciens
Et valet pro seminacionibus et agri=
5 culturis in testinis aut et istis parti=
bus que adiacent negant medelam
fieri
{Abb. Alltagsszene159} [07rc] BOll auff mit mir all in dy éeren / Dye da schneiden wellen geren / Sie=
ch auch eben auff das pret / Trinck weder pier, wein noch mett
Nyemant mit der eé weiaget, so der mon ist in der maget. Dein ade=
ren vnd dein ripp mit eyssen nýemant gripp. Czw sneiden guet zú=
5 versicht. Chaynnem scheff vertra nicht.
157 Männliche Figur, Seneca. 158 Jungfrau. 159 Drei Figuren (zwei Männer, eine Frau) bei der Getreideernte.
278
[07v]
K L Der erst herbst hat XXX tag
2 2 58 f September Gilg ain abt z 17 10 15 19 g 4 z 18 A 3 Z 19 5 18 11 18 b 2 A 20 c Nonas b 21 7 0 0 d 8 Magnus ain peichtiger c 22 15 20 9 e 7 d 23 f 6 Gepurd vnser frauen e 24 10 4 8 50 g 5 f 25 12 21 30 A 4 g 26 b 3 Prothi vnd Jacincti h 27 1 17 40 c 2 i 28 d Jdus k 29 15 9 6 40 e 18 Heiligen kreutzhebung l Libra 17 2 30 f 17 m ɤ 6 15 11 g 16 n 1 A 15 Lampertus ain pischolff o 2 14 3 52 b 14 p 3 20 c 13 q 4 3 0 1 d 12 Pan vast r 5 11 12 41 e 11 Matheus ain XIIpot § 6 f 10 Mauricius vnd sein gesellen s 7 19 8 51 g 9 t 8 25 8 21 32 A 8 Ruprecht pischolff v 9 b 7 v 10 16 17 32 c 6 x 11 d 5 Cosmas vnd domianus y 12 5 6 42 e 4 z 13 30 13 19 3 f 3 Michaell ain ertzengell z 14 2 15 12 g 2 Jeronimus ain priester Z 15
279
[08ra] {Abb. Gelehrtenporträt160}
ISayas der
maister sp=
richt, das
man schull in dem
5 herbst monadt pr=
ot aus gaýß vnd
Schaffmilch núch=
tern essen, vnd al=
le ding sein guet
10 z nyessen. Man sol auch lazzen. Dw macht aúch all wurtz=
en nutzen vnd macht auch all zeitig
frucht essen vnd semlich ding von obs.
[08rb] {Abb. Sternzeichen161}
LJbra est signúm calidum et humidum
aereum bonum Ylia dorsum renes
et achos Respiciens negans mede=
lam omnibus sciaticis renibus Et in eis
5 pacientibus valet tamen pro minucione sang=
winis specialiter luna in prima medieta=
te existente ipsius
{Abb. Alltagsszene162}
[08rc] GVetes mostes hab ich vill / Bem ich sein geren geben will / Jn disem monat
soltu nit gan / vnd zw der lebern ader lan
Jn der wag huet der gemácht, nýeren vnd arspacken, dem wirt recht.
Bilddw vill lauffen vber veld dw chúmbst vmb dein gluck vnd vmb deyn
5 geldt.
160 Männliche Figur, Jesaja. 161 Waage. 162 Drei männliche Figuren bei der Weinlese und an der Weinpresse.
280
[08v]
K L Der ander herbst hat XXXI
A October Remigius ain pischolff A 16 10 3 53 b 6 b 17 c 5 c 18 5 18 0 3 d 4 Franciscus peichtiger d 19 7 12 44 e 3 e 20 f 2 f 21 15 8 53 g Nonas Marcus ain pabst g 22 4 21 34 A 8 h 23 10 b 7 Dionisius vnd sein gesellen i 24 12 6 15 c 6 k 25 d 5 l 26 1 6 34 e 4 m 27 9 19 5 f 3 Kolmanus martrer n 28 15 17 14 14 g 2 o 29 A Jdus p Scorpio 6 3 55 b 17 Gallus peichtiger q 1 14 16 36 c 16 r 2 d 15 Lucas Ewangelist § 3 20 3 13 45 e 14 s 4 f 13 t 5 11 1 26 g 12 Der xj tausent maid v 6 19 21 37 A 11 v 7 b 10 x 8 25 8 10 16 c 9 y 9 d 8 Crispini vnd crispiniani z 10 16 6 21 e 7 z 11 5 19 6 f 6 Pan vast Z 12 g 5 Simon vnd Judas XIIpoten A 13 30 13 7 47 A 4 b 14 2 3 56 b 3 Pan vast c 15 10 16 37 c 2 Bolffgangus Bischolff d 16
281
[09ra] {Abb. Gelehrtenporträt163}
CAnstantinus
der maister
schreibt, man
schull in dem ande=
5 ren herbst mónad
Sweinen fleisch ge=
sotten essen vnd weyn=
most trincken, ban
das reiniget den
10 leib vnd macht di=
ch gesunt. Geflugell gaissen vnd scha=
ffen milich ist gesunt zw essen vnd zwe
trincken. Dein getranck seý ab pfefferr
vnd naglein. Du solt lazzen vnd aúch
15 getranck nemen.
[09rb] {Abb. Sternzeichen164}
SCorpio est signum frigidum et hu=
midúm aquaticum Jndifferens
anum et vesicam et totum locum
libidinis respicit Balneis obstat vulne=
5 ratis nocetur165 et pudendis núllum vult fieri
remediúm Tamen luna in secunda ipsius existente
permittatur minúcio sangbinis fieri
{Abb. Alltagsszene166}
[09rc] IN gottes namen / saé ich meinen samen / Jch pit dich herr sand galle / Daz
er mir woll gevalle
Der scorpian hat vber dý scham gewalt, far schón, wildu werden alt.
Auch far nicht z scheff n ch vber veldt. Der vall geit todlich wider gelt.
163 Männliche Figur, Constantinus. 164 Skorpion. 165 Möglicherweise überflüssige ur-Abbreviatur. 166 Zwei Figuren mit Pferd beim Säen.
282
[09v]
K L Der drit herbst hat XXX tag
d Nouem Aller heiligen tag e 17 18 12 47 e 4 Aller seln tag f 18 f 3 g 19 5 7 1 28 g 2 h 20 15 21 37 A Nonas i 21 b 8 Leonhardt ain peichtiger k 22 4 10 18 c 7 l 23 12 22 59 d 6 m 24 10 e 5 Theodorus martrer n 25 1 19 8 f 4 o 26 g 3 Martinus Pischolff p 27 9 7 49 A 2 q 28 17 3 58 b Jdus Briccius Pischolff r 29 15 6 16 39 c 18 § 1 Sagitarius d 17 s 2 14 5 20 e 16 Othmarus ain abt t 3 f 15 v 4 3 1 29 g 14 v 5 20 11 14 10 A 13 Elspet Bitib x 6 b 12 y 7 19 10 19 c 11 z 8 8 23 0 d 10 Cecilia Jungkfra z 9 e 9 Clemens Pabst Z 10 25 16 19 9 f 8 A 11 g 7 Katherina Jungkfraw b 12 5 7 50 A 6 c 13 13 20 21 b 5 Virgilius Pischolff d 14 2 16 42 c 4 e 15 30 d 3 Pan vast f 16 10 5 22 e 2 Andreas zwelffpot 17
283
[10ra] {Abb. Gelehrtenporträt167}
IN dem dri=
tten herb=
st monat
schreibt der mai=
5 ster Meste, das
man sull chain
sways pad haben,
das dein pluet
oder varb nit ver=
10 sert werde. Kayn
haubt soltú ezzen.
Vor vnlautrikait huet dich. Alles war=
mes ding hab lieb vnd was dich lýnde
mach. Seniff, pfeffer, knofflich, agrimo=
15 nien vnd zwiffell is in disem monadt.
Deinen leib soltú v ben. Getranck mach
est du nemen. Zw der leberen lazz vnd
zw der plateren.
[10rb] {Abb. Sternzeichen168}
SAgitarius est signum calidum et
siccum bonum fenora et crúra respi=
ciens Et luna in eo existente est
valens fle botamia walnea ingredi
5 gaudetque de rasione capitis Et vngbi=
um precisione sed crúribus et toxis ne=
gant fieri medicinam
{Abb. Alltagsszene169}
[10rc] ICh will scheitter hawen vill / Seint der winter chumen will / Mit seiner ke=
lten also sere / Das ich mich vor dem frost ernere
Der schutz schádet der húaff, bann der man scheynet darauff. Las an
dem arm schier das haúbt. Paden ist dir aúch erlaubt. D solt har vnd 5 nagell weschneýden. Só mácht dú vnrúe vermeýden.
167 Männliche Figur, Mesue. 168 Schütze. 169 Zwei Figuren bei der Holzarbeit (Holzhacken), Wagen mit Pferd (Holztransport).
284
[10v]
K L Bintermon hat XXXI tag
f December g 18 18 1 31 g 4 h 19 7 14 12 A 3 i 20 5 b 2 Barbara Jungkfraw k 21 15 10 21 c Nonas l 22 4 23 22 d 8 Nicolaus Pischolff m 23 e 7 n 24 12 11 43 f 6 Enphachnus marie o 25 10 g 5 p 26 1 7 50 A 4 q 27 9 20 33 b 3 r 28 17 16 42 c 2 § 29 d Jdus Lucia vnd otilia Jungkfrauen s Capricornus 15 6 5 23 e 19 t 1 14 18 4 f 18 v 2 g 17 v 3 3 14 13 A 16 x 4 b 15 y 5 20 11 2 54 c 14 z 6 19 23 3 d 13 Pan vast z 7 e 12 Thomas zwelffpot Z 8 8 11 44 f 11 A 9 g 10 b 10 25 16 7 53 A 9 Pan vast c 11 5 20 34 b 8 Gepurd ihu xpristi d 12 c 7 Steffan martrer e 13 13 9 15 d 6 Johannes zwelffpot f 14 2 5 25 e 5 Der kindlein tag g 15 30 10 18 6 f 4 Thomon ain pischolff h 16 g 3 i 17 18 14 15 A 2 Siluester ain pabst k 18
285
[11ra] {Abb. Gelehrtenporträt170}
PLato schr=
eibt in se=
ýnnem ca=
pitell, das
5 man in dem win=
ter monad alle
ding essen vnd
trincken schul, vnd
Dein wein vnd de=
10 yn wasser soll nit
z chalt sein. Ge=
tranck macht dw nemen. Dein haúbt
vnd dein fuezz soltu warm halten. Kúm=
póst vnd alle Chalte speis ist vngesunt.
15 Zw der leberen vnd zw dem haubt vnd
zw allen aderen gemaincklich ist gút
lassen. Vnd ob du wild agromonien,
soltu smecken vnd essen, das ist gesunt
dem hiren. Du solt deinen múnd wasch=
20 en vnd rain wehalten.
[10rb] {Abb. Sternzeichen171}
CApricornus est signum frigidum et
siccum aereum malum týbias et gé=
nua respiciens Et lúna in eo ex=
istente vitetur flewbotomia sed prosemina=
5 cionibus et agriculturis valet et ge=
núbus non debet fieri medicamen
{Abb. Alltagsszene172}
[10rc] MJt wursten vnd mit praten / will ich mein haws peraten / Also hat das iar
ain endt / Got vns sein gnad sendt
Der stainpock schadet dem knýen, darumb so huet ir mit treuen. Der siech
wirt, der mag woll genesen. Dw macht zw scheff nit schier wesen. Bas
5 dw paúest, das velt, kain ding sich státiglich stelt.
170 Männliche Figur, Plato. 171 Steinbock. 172 Drei Figuren mit Schwein bei der Fleischverarbeitung bzw. beim Schlachten.
286
[11v]
Aureus numerus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
y n c v l Z § h z p e v m a s i z q f Bider z o d v m a s i z q f x n b t k Z r g Guet z p e x n b t k Z r g y o c v l a § h 5 Z q f y o c v l a § h z p d v m b s i Stier A r g z p d v m b s i z q e x n c t k Póss b § h z q e x n c t k Z r f y o d v l Zwiling c s i Z r f y o d v l a § g z p e v m Póss d t k a § g z p e v m b s h z q f x n 10 Crebs e v l b s h z q f x n c t i Z r g y o mitell f v m c t i Z r g y o d v k a § h z p lebe g x n d v k a § h z p e v l b s i z q póss h y o e v l b s i z q f x m c t k Z r i z p f x m c t k Z r g y n d v l a § 15 Jungkfraw k z q g y n d v l a § h z o e v m b s Mittell l Z r h z o e v m b s i z p f x n c t Wag m a § i z p f x n c t k Z q g y o d v Guet n b s k Z q g y o d v l a r h z p e v Scorp o c t l a r h z p e v m b § i z q f x mittell 20 p d v m b § i z q f x n c s k Z r g y q e v n c s k Z r g y o d t l a § h z Schutz r f x o d t l a § h z p e v m b s i z Guet § g y p e v m b s i z q f v n c t k Z Stainpock s h z q f v n c t k Z r g x o d v l a Póss 25 t i z r g x o d v l a § h y p e v m b Wasserman v k Z § h y p e v m b s i z q f x n c gútt v l a s i z q f x n c t k z r g y o d Visch x m b t k z r g y o d v l Z § h z p e Mittell y n c v l Z § h z p e v m a s i z q f
287
[12r]
Tabula pro Jnteruallo
M CCCC LXIX A g VII O 7 n
M CCCC LXX g 2 IX VI 8 n
M CCCC LXXI f 3 VIII V 9 e
5 M CCCC LXXII e d VI IIII 1o k
M CCCC LXXIII c 1 IX II 11 i
M CCCC LXXIIII b 3 VIII I 12 a
M CCCC LXXV a 3 VI O 13 f
M CCCC LXXVI g f VIII VI 14 f
10 M CCCC LXXVII e 1 VII IIII 15 r
M CCCC LXXVIII d 2 V III 16 b
M CCCC LXXIX c 3 VIII II 17 b
M CCCC LXXX b a VII I 18 o
M CCCC LXXXI g 1 IX VI 19 n
15 M CCCC LXXXII f 2 VII V 1 l
M CCCC LXXXIII e 3 VI IIII 2 k
M CCCC LXXXIIII d c IX III 3 k
M CCCC LXXXV b 1 VII I 4 o
M CCCC LXXXVI a 2 VI O 5 f
20 M CCCC LXXXVII g 3 VIII VI 6 e
M CCCC LXXXVIII f e VI V 7 l
M CCCC LXXXIX d 1 IX III 8 k
M CCCC LXXXX c 2 VIII II 9 b
M CCCC LXXXXI b 3 VII I 1o o
25 M CCCC LXXXXII a g IX O 11 o
M CCCC LXXXXIII f 1 VII V 12 s
M CCCC LXXXXIIII e 2 VI IIII 13 k
M CCCC LXXXXV d 3 IX III 14 k
M CCCC LXXXXVI c b VII II 15 p
30 M CCCC LXXXXVII a 1 VI O 16 f
M CCCC LXXXXVIII g 2 VIII VI 17 f
M CCCC LXXXXIX f 3 VI V 18 l
An
no d
om
ini
Die iar zall
An
no d
om
i[ni]
Sum
tag p
u[stab
]
Sch
alck
iar
Dý w
och
en z[all]
Die u
brig
en t[a
g]
Die g
uld
en [za
ll]
Sch
lussel
288
[12v] Das sein póß vnd verworffen tág, so sy in dem Jar chumen, an den soll man weder
lassen, chauffen noch verchaúffen vnd aúch chainerlaý ertzney thún in den na=
ch geschriben tagen. Vnd daúon ist nót, das man ir eben warnem vnd mit
vleis merck.
5 DEr erst tag ist das eingent iar, der ander tag nach liechtmes, der drit
tag nach matheys tag. Der erst in dem mertzen, der vierd nach vnser
frawen tag in dem mertzen. Der zechnt tag in dem aprill, der vie=
rd tag vor gregorý, der drit tág in dem maýen. Der sibent tag,
wan der may will aussgen, der ne nt tag vor Johannes waptista, der sechst
10 tag vor margarethe an sand maria magdalena tag, der erst tag in dem aug=
ust. Der drit tag nach augustini, der sechst tag vor vnser frauen tag zw
herbst, an sand matheus tag. Der funfft tag nach michahelis, der sech=
st tag vor martini, der drit tag nach katherine. Der ander tag vor nico=
laý, der ander tag vor thome des heiligen zwelffboten.
15 Hie hebt sich an zw schreibenn von den zwelff zaichen des gestierns vnd
auch von ir krafft. Das sein dy zwelff strassen an dem himell, dý vnseren
leib entwegent vnd gebalt darvber haben. Vnd hebt sich das erst an
von dem zaichen des widers.
[13r] {Abb. Sternzeichen173} DEr wider hat an des men=
schen gelideren das haubt
vnd alle dý gelider, dý dem
haubt zw gehorent an
5 den hals: haubt, mund, nasen, óren,
lepsen, zend vnd zúngen vnd dý ge=
lider, dýe dem haúbt zw gehorent
obwendig des leibs. Vnd hat auch
all ir siechtagen, die den selbigen
10 gelideren geschaden múgen. Das ist
als vill gesprochen: Bann aries zw
siechtagen stet, das er siechtagen
173 Widder.
289
machen soll, so máchet er chaýner=
lay siechtagen mer dan an dem ha=
15 úbt vnd an seinen gelideren, ban
er an den anderen gelideren chayne
gewalt hat. Vnd das selb thuent
dý zaichen alle sampt den selbigen
gelideren, daruber sy dan gebalt habent. Aries ist ain eintruckent zaich=
20 en, der da viere sein: aries, thaúrus, capricornús, leo vnd sagittarius. Vnd
wan der mon ist in aries, so ist póss ertzneý zw geben vnd tranck zw ném=
en, wan es alles verleuset. Vnd das selbig soll man wissen zw wehálten
an allen anderen eintruckenden zaichen, das man chaýn ertzney tre=
yben scholl, vnd was vnde t, dás scholl man auch pehalten, so das auss=
25 get, ban der mensch enpfieng grossen scháden vnder seinem ausgangk.
Ditz zaichen wann es aúsget von orient, so geit es truckens vnd warbs we=
ter als vill vnd es an im ist. Ber auch in der zeit gepóren wirt nach ari=
stotelis red, der gewint aynnen krumpen leib vnd ainen chlaýnnen hals
vnd ain langs antlitz, grósse augen vnd klaynne óren. Vnd aýnnen hals
30 genúg zw reden, ainen klaynen part. Sy sein auch geren prawn, als sy
an der sunnen sein verprant. Sý sein auch geren vnfridsam, sy máchen
auch viell krieg vnd suchen zwischen der menschen vrleng vnd krieg.
Vnd rótte korner als dy se ren haben sy vnder dem antlitz vnd haben au
ch ainen gestossen174 krumpen leib vnd ist zw genaigt dem manen mit
35 seiner natur.
Hernach volget vonn dem czaichenn des Stiers geschribenn
[13v] {Abb. Sternzeichen175} DEr stier hat an des men=
schen gelideren den hals
vnd dy kelen pis an dye
achseln. Vnd was denn
5 selbigen gelideren an siechtagen
widerfert, als drús vnd gesweren,
174 Evtl. einen ‚gedrungenen‘ Leib haben. 175 Stier.
290
wie die versteen solst, ist vorma=
ls gesait. Das zaýchen hat aúch
den gepresten, der da haisset der
10 chrebs. Von dem zaichen Thau=
ro soll man ain regell versteenn.
Ban der man ist in dem thauro, der
gewalt hát vber meridiem oder
vber dás taill der welt Sunder,
15 vnd státes Zaichen ist von erde
vnd von Meloncolicen nature
ist, wan es ist chalt vnd trúck=
en vnd frauen geschlacht. Dan so ist g et garten z seen cker vnd
weingarten zw pauen vnd paúm peltzen, wann sy wachssen páld
20 vnd werdent lang. Dan so ist auch gúet hewser, purge vnd stet
anz v chen ze pa en, vnd ist dann guet alles das anzevachen, daz
man will, das lang werig seý. Es ist auch póss ertzneyen an dem h=
als vnd dý kelen mit eyssen weruren. Es ist aúch póss vrleúg an=
zwfachen vnd ausfaren zw vechten. Das zaichen, wan der mann
25 ne ist, so machet es chalt vnd trúcken zeit, vnd wirt dan peý der
erden nebell. Das selbig thuet es aúch an seinem aúffgang, so es auf=
get also vill vnd an im ist vnd stet. Ber aúch zw diser zeit geporen
wirt, der hat ain weitte praite lange násen vnd weitte naslocher
vnd grosse aúgen vnd schons kraús har, aynen gróssen hals. Er ist
30 auch geschamig, vnd wan er get, so siecht er vnder sich aúff dý erden.
Ditz zaichen geleicht sich mit seiner natur dem planeten Venus,
vnd aúch dem meloncolicús, vnd regnirendt geleich.
Hernach volget vonn dem czaich des zwilings geschribenn
[14r] {Abb. Sternzeichen176} DEr zwiling ist warm vnd fe=
ucht vnd hat dýe czaichen
an des menschen gelideren:
Achsell, arm, hent vnd sch=
176 Zwilling.
291
5 ulterplat vnd dý siechtagen, dý an
im geschechen oder geschechen schu=
llen, wan der man ne ist im zwi ling, der gewalt hat vber dy tail
der welt, dás da haisset occident
10 oder westen, dás aúch ain gemayn
zaichen oder zwifaltig zaichen ist
vnd lufftes natur. Ban es ist war=
me vnd feucht vnd aúch wan es
chalt ist, so ist dan gut freuntsch=
15 afft zw sámen. Crieg werden ver=
sonet. Es ist aúch dann gút vrleúg
anzwheben vnd aussvaren zw
vechten. Lassen ist póss vnd wesunder an den henten vnd an den armen,
es ist póss dý aderen mit eýssen perúren vnd wesunder zw lassenn,
20 wan man must zwierent schlachen. Bann das gut pluet get gar
cha m oder zemall nit. Der armm wirt aúch siech oder geswollenn
vnd vnderweillen sterben d le t. D s ist war, so der man so gar vn
gluckhafftig ist an dem himell, dann ist nit gút anzwheben chaynen
weg. Ban es mócht chómen, dás ain mensch zw der selbigen zeit sturb
25 in ainem hauss, es stúnd nit lang darnach, es stúrben mer leut in dem
selbigen hauss, wúrd ain siecher gesunt. Jn der selben stúnd er wedorft
woll glúcks, das er hin chám, das es nit widerumb sturb. Wurd ain
gefangener ledig an der weill er wedorfft woll glucks, dás er hin kám
vnd nit an der stúnd gefangen wurd. Doch ist gut dy ertzneý zw ne=
30 men. Dás zaichen, wann der monn darin ist, so geit es guete zeit, wan es
ist warm vnd luftig177. Vnd dás thúet es in seinem aúffgang. Wer aú=
ch vnder dem zaichen dann geporen wirt, der gewint ain gewainete178
gestalt, weder ze lanck noch ze churtz. Nit zw gross noch ze klain,
mit aýner weitten prúst. Es wirt auch ain erlich person vnd wirt
35 getre , st t vnd milt. Vnd ist z genaigt dem planeten mercurio vnd
meloncolico mit Jren naturen.
177 Anhand des Schriftbefundes f und Schaft-s nur schwer unterscheidbar. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab
(fol. 20r/S. 49): wann es ist warm und luefftig. 178 Dialektal bedingter b/w-Wechsel gebeinet gestalt (knochige Gestalt). Möglicherweise jedoch auch Verschreibung
(verhört oder verlesen). Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 20r/S. 49): gemeine gestalt.
292
Hernach volget vonn dem zaichenn des krebss geschribenn
[14v] {Abb. Sternzeichen179} DEr krebs ist feucht vnd cha=
lter natur vnd hat an des
menschen gelideren die prú=
st vnd dý lungen vnd
5 das obertaill des magens Vnd
der rýppn vnd das miltz. Wan der
man ist im krebs, der gewalt hat
vber das tail der welt Septem=
brion vnd norders, das aúch ain
10 wandelpars zaichen ist. Bann sich
dy sún wandelt vnd wo dan ir
auffgang ist, da get sy wider
ab, bann sý nit hocher chúmen
mág. Es ist aúch ain wasserigs
15 zaichen vnd flegmaticý natur: fe=
ucht vnd chalt. Es ist dann gút
anczwvachen vnd varen gegen dem taill der wélt, dás haisset
Septembrion oder norders. Es ist aúch gút alle ding gút ze tún,
dy man mit wasser volbringen soll vnd múess. Es seý mit
20 múlen, vischen oder auff dem wasser zw varen. Es ist aúch gút
dann ertzneý zetreiben vnd tranck zw némen, vnd also soll man
dann fre d haben in dem hauss, wan es géhort darz . Es ist aúch gúet alles dás anzwheben, das man snell enden soll. Es ist
aúch póss dý prúst ertznen, vnd auch he ser pa en, vnd von
25 aýnnem haúss in das ander zw ziechen, vnd von aýnem gút aúf
das ander. Es isst aúch póss anheben, was man will mit feuer
wurcken. Es ist póss elich leút máchen. Ditz zaichen geit chalt vnd
feúcht, so der man darin ist. Das selb thút es auch an seinen an=
fang. Ber in der zeit géporen wirt, der gewint aýnnen gro=
30 ssen leib vnd aýn dicke haút. Er wirt oberthalben der gurtell
179 Krebs.
293
chlaýnner vnd vnderthalben grosser. Er gwint aúch grúen
zend vnd stilt geren. Vnd ain aúg ist im grósser dann dás ander.
Vnd sein auch geren laúffer vnd landfarer vnd poten. Das ist ge=
spróchen von dem krebs, vnd ist z genaigt dem m nen mit 35 seiner natur vnd lauff, auch dem flegmatico.
Hernach volget vonn dem zaichenn des leo geschribenn
[15r] {Abb. Sternzeichen180} DEr leo hat an des menschenn
gelidern das vnttertail des
hertzen vnd aúch der lebe=
ren vnd dý adern, dý darumb
5 sein, vnd dý seitten vnd den rúckenn
vnd dý siechtagen, dý an im geschech=
en. Ban der mann in dem zaichen des
leo ist, das ist ain zaichen von orient
vnd ain vestes Zaichen ist feures
10 vnd cólera vnd mannes natúr ist,
so ist gút wandeln vnd z re
den mit gúeten leútten als mit kaý=
sern, kunigen, herczogen, Graúen
vnd prelaten. Es ist aúch gúet an=
15 zwvachen vnd wurckn allés
das man mit feuer wurcken sol
vnd dás man will das langbe=
rig seý. Es ist auch dan póss ertzneýen den mágen, dem ingewaý=
de, dem gedarme, der leberen vnd der lúng. Vnd darvmb, was man
20 thun oder lassen soll, so der mann in dem leó ist, dás soll man schier
thún, so der leo aúffget. Vnd soll man auch wissen von allen zaý=
chen, wás gúet oder póss ist, so der mann ist in dem zaichen, das ist au=
ch gút vnd schad, wan es auffgát. Súnderwár daúon spricht man
zw hinderist in dem zaichen, vnd thút es dann an seinem auffgang.
25 Der leo geit auch trúckne vnd haisse zeit. Etwen geit er auch regen
180 Löwe.
294
vnd nebell, aber dás ist nit von im selber. Ber vnder dem zaichen ge=
póren wirt, der hát oberthalben ainen gróssen leib vnd vndertha=
lben aýnnen claynnen leib. Er hat aúch aýnnen weitten múnd vnd kl=
aynes har vnd schnódes, aynnen grossen paúch, grósse pain. Dises za=
30 ýchen ist z genaigt mit seiner natur dem planeten satúrno vnd
dem flegmaticús.
Hernach volget vonn dem zaichenn der Junckfrauenn geschribenn
[15v] {Abb. Sternzeichen181} UJrgo, das zaichen hat an
des menschen gelideren den
nabell vnd auch den paú=
ch Jnerthalben des nabels
5 vnd was da enmitten ist von haý=
mlichen vnd inwendigen gelideren
als das ingewaid vnd dý gemá=
chte vnd iren siechtagen, wan der
mann ist in dem zaichen Virgo, daz
10 ain gemain zaichen ist, das au=
ch gewalt hat vber den taill der
welt Meridies oder sunder, vnd
das der erden meloncolicen vnd
frauen natur ist. Ban es chalt
15 vnd trúcken ist, so ist dan gút
seen garten vnd ácker vnd ist al=
les gúet ze tun, das von erden
werden soll vnd mag, wan in allen zwifaltigen Záichen, als dann
sein Sagittarius, piscis, dý dá gemain seýen, so ist g t z th n, waz
20 man geren zwifaltig hat. Es ist dan gut hausfra n z nemen
vnd witiben vnd nit iúngkfraúen, wann sy vnfruchper werden, oder
geperen sy, so geperen sy dóch nit vill. Es ist auch gút anzwhe=
ben weg zw machen vnd nách chaúffmanschátz zw varen gégen
dem taill der welt, das dá ist meridies. Es ist aúch gút zw wúr=
181 Jungfrau.
295
25 cken, wás man mit feúr wurcken soll. Vnd ist póß ertzneýen an den
gelideren des leibs darvber das zaichen gewalt hat. Vnd ist aúch
póss dý fues ertzneýen. Dás zaichen geit trúckne vnd chalte zeýt
vnd wint peý der erden vnd wolckn in den lufften an régen, so es
dann ain wenig régnet, das tuet es an seinen auffgang. Wer vnder
30 dem zaichen geporen wirt, der gewint ain prait antlitz vnd ain
erbergs. Er wirt aúch gútig vnd mannhafftig. Er hat aúch ain weý=
tten múnd vnd sein im dý lebssen nit zw dick nóch zw dún vnd hat
ain gemischte varb, nicht zw swartz noch zw weiss vnd ist zwge=
naigt dem planeten Jupiter mit seiner natur vnd meloncolico.
35 Hernach volget von dem zaichen der wág geschribenn
[16r] {Abb. Sternzeichen182} LJbra, das Zaichen hat an des
menschen Inerthalben des na=
bels herab gegen dem ge=
macht dýe nýeren, dýe g=
5 lider vnd dý grossen darme, dý ný=
eren vnd das gemacht, dý húff
vnd iren sichtúmb, ban der man
ist in dem zaichen der wag, das
auch lufftes pluetes vnd mannes
10 natur ist. Ban es warm vnd feu=
cht ist, so ist gút weg anzwheben
vnd auch nach chaúffman schátz ze
varn gegen dem taill der welt, daz
da haisset Occidens oder westen. Vnd
15 ist auch gút ader lassen vnd au=
ch gút anzwheben vnd zw tún,
was der erden z gehort vnd
was von erden chúmt, als acker paúen, seén vnd semlich ding vnd waz
da langberig sein soll. Das zaichen geit feúcht vnd warme zeýtt
20 vnd auch vnder weillen régen. Es geit aúch stillen wint, wan der man
182 Waage.
296
darin ist, darumb ist dann gut auff dem wasser z varen. Vnd das th
ut es aúch zw seinen aúffgang. Wer vnder dem zaichen geporen wirt,
der gewint ain geleichs antlitz vnd ain mittel gestalt. Vnd wirt
er ain man, so wirt er frauen lieb, vnd ist es ain fraw, so wirt sy den
25 mannen lieb. Sy sein aúch geren singer, springer, saittenspiler vnd liebh=
aber. Sý sein auch geren spiler vnd des spils maister. Vnd ir mútwil
vnd gelust sein vill an saittenspill vnd an gebant. Sý sein auch in se=
lber waich. Vnd dý vnder dem zaichen geporen werden, dás sein
gar schon menschen vnd rót vnder den aúgen vnd haben ain payn gro=
30 sser dan dás ander vnd sein auch vill chúndig. Das zaichen ist z
genaigt dem planéten venús mit seinr natur vnd krafft vnd gele=
icht sich dem Sangwineus.
Hernach vonn dem zaichenn des Scorpian geschribenn
[16v] {Abb. Sternzeichen183} DEr Scorpian hat an des
menschen glideren dý scham
an frawen vnd an manne
vnd auch, bas zw der sch=
5 ám gehort, vnd den aúffgang
vnd den sicht mb, die darcz ge
horent: Den stain in den augen vnd
dý augen trúb vnd das griess daz
in der plater leit. Ban der mann
10 ist in dem scorpian, das ain vestes
zaichen ist vnd stát vnd hat gew=
alt vber den taill der welt, das
da haisset septemtrio vnd nor=
ders, das wasser, fflegmatica
15 vnd fraúen natúr ist, wann es
chalt vnd feúcht ist. Ban der man
in dem scorpian ist, so ist es vnge=
luckhafftig an seinem valle. Vnd ist dann nit gút lassen vnd ertzney
183 Löwe.
297
nemen ist dann gut vnd anders nichtz nit. Es ist auch dann gút vber
20 velde zw gen, paúen oder púrg auffz heben oder z westeigen,
auch in scheff z gen. Aúch ist póss zw der zeit ertzneýen dý glider,
da es gewalt vber hát. Das selb soll man wissen, wan es auffget
als wan der mann darin ist. Ber vnder dem zaichen geporen wirt,
der ist clains vnd magers leibs vnd vnderweillen weiss. Es hat
25 auch ain clains spitzigs antlitz vnd klaine aúgen vnd lange pain,
claýn fúess. Sý sein auch vestes mútes vnd wenigs leibs geluckha=
fftig, schalckhafftig, vnkeusch vnd zornigs múets. Das zaichen
ist zwgenaigt dem planeten lúna mit seiner natur vnd dem flegm=
aticus mit seiner art.
30 Hernach volget vonn dem zaichen des schutzen geschribenn
[17r] {Abb. Sternzeichen184} DEr schutz hat an des me=
nschen glideren dý vbrig=
en gelider, als man offt
sicht ainen menschen,
5 der da hat sechss vinger an ayn=
er hant vnd an der andern au=
ch sechss vinger. Es hat auch dý
vnnaturlichen grosse der gelider,
als da aýnner aines vingers
10 oder aýnner hant ze wenig hat
von gepurd oder von geschick.
Er hat aúch den gepresten, der
davon chúmbt, als da ayn hunt
oder ain wolff oder ain ander
15 thier ainem ain glid abpiss.
Er hat aúch dý vnnatúrlichen
gewachss, als da sind wartzen
oder vberpaýn vnd semlichen siechtumb. Es hat auch den gepre=
sten als der glider, dý dávon einander gestóssen sein vnd wider zesa=
184 Schütze.
298
20 men gewachsen seýn oder peýeinander schullen sein vnd voneýnan=
der gewachsen sein. Wann der mann ist in dem sagittario, das der zwi=
faltigen Zaichen aýns ist vnd gewált hat vber das tail der welt
das da haisset orient, das feures vnd mannes natur ist, wann
es haiss vnd trúcken ist, so ist dann gút zwischen den leutten freunt=
25 schafft zw machen vnd suchen. Es ist aúch dan gút z der adern
lassen vnd g t z paden vnd gégen dem taill der welt, d s da h
aisset Orient weg anz heben vnd n ch chauffmanschatz zw
varen. Es ist aúch gút wechselen vnd wás man wechseln will vnd
vrleúg anzwvachen vnd was man mit feur wurcken will vnd
30 volpringen soll, wás zw schiffúng géhort als vischen vnd ácker
pauen vnd semlich ding. Auch ist póss dem viech ertzney z e geben, wann es vber dý thier gewalt hát. Das zaichen geit hai=
sse vnd truckne zeit, so der mann darin ist. Das ist a ch z wissen
an seinem aúffgang. Wér auch vnder dem zaichen geporen wirt,
35 der ist aússwezaichnét mit den zaichen, dý da vor genant seyn.
Darzw ist er róslat rót vnd vngetrew vnd hat dý vaderen zb=
en zend praitter in dem mund dan dý anderen. Das zaichen ist zu
genaigt mit seiner natur mercurio vnd geleicht sich auch dem
colericus.
40 Hernach volget vonn dem zaichen des stainpocks geschriben
[17v] {Abb. Sternzeichen185} CApricornus, das zaichen
hat an des menschen ge=
lider dý knýe vnd ir ader
vnd iren sichtumb. Bann
5 der man ist in dem staýnpóck, der
da gewalt hat vber Meridies oder
sunder, das auch ain wándelbars
zaichen ist vnd auch meloncolice
vnd erden natur ist vnd auch fra=
10 uen natur ist, wann es chalt vnd
185 Steinbock.
299
trúcken ist, so ist gút acker, garten
vnd weingarten paúen vnd alle
ding zw thún vnd anzwheben,
dý man mit erden volpringen wil
15 vnd múes. Es ist aúch gút weg
anz heben vnd nach chauffman=
schatz zw varen gegen dem
mitten tag. Es ist aúch gút ze túen vnd alles das anzwgreiff=
en, das man schnell volpringen will an dýe ding, die man mit
20 geding oder mit námen aússnýmbt. Es ist póss weg anzwhe=
ben vnd Váren gégen dem taill der wélt septentrio oder Norders.
Es ist auch póss vrleuch peginnen vnd was man mit feur wú=
rcken soll vnd thún soll. Auch ist nit gút lassen nóch ertzneý trei=
ben vnd ist póss in der zeit dý chnýe ertzneýen. Das zaichenn
25 geýt chalt vnd trúcken zeit. So der mann darin ist, so geit es wý=
ndt peý der erden vnd wolcken, in den lufften ain wasser vnd
vnderbeillen nébell. Dás selb thút es aúch an seinem aúffgang.
Ber auch vnder dem zaichen gepóren wirt, der gewint aynen
clugen leib vnd wirt doch rain vmb sich vnd gewint vill hars
30 vnd praits antlitz vnd claýnne paýn vnd redet geren mit im selber.
Das zaichen ist genaigt der súnnen mit irer natur Vnd dem me=
loncolicus.
Hernach volget vonn dem zaichenn des wassermans geschriben
[18r] {Abb. Sternzeichen186} DEr wassermann hat an
des menschen gelideren
dý pain ab vnd ab pis
auff dý knoden vnd dý
5 adern der payn vnd ir siechtúmb.
Bann der man ist in dem wasser=
mann, das ain senfftes zaichen
ist vnd das gewalt hat vber
186 Wassermann.
300
den taill der welt, das da ha=
10 ysset occident oder westen,
das auch lufftes plúetes vnd
mánnes natur ist. Bann es hais
und feucht ist, so ist gút in he=
sser Ze pawen vnd ha sfra
15 wen Z némen, lechen vnd
ander gróss ding enpfachen.
Auch ist gut zw der ader ze lassen. Vnd ist aúch guet alle ding
anz vachn, dy man werig will m chen. Es ist a ch dan p ß
dy pain ertzneyen vnd verr weg anzwheben vnd alles daz
20 anczwgreiffen, das man pald vollenden wólle. Das zaichenn,
wan der man darin ist, so geit es warm vnd feúcht vnd gúten
wint vnd ist dan a ch auff dem wasser z varen. Ber auch
vnder dem zaichen geporen wirt, der wirt hoffertig vnd ho=
chmúetig vnd Aýns hochen sýnnes vnd mútes vnd lernet au=
25 ch geren vnd ist genaigt z hocher ch nst. Vnd ist auch wesch
aiden vnd gút zw vnderweissen. So sein auch dýe, dý vnder dem
czaichen geporen werden, sch n le t vnd r t vnder dem antlitz
vnd haben aýn pain grósser dan das ander vnd sein auch vil
chundig. Ditz zaichn ist aúch zwgenaigt dem planeten Jup=
30 iter mit seiner natur vnd aúch dem Sangwineús.
Von dem zaichenn des visch volget hernach geschriben
DEr visch hat an dem menschen gar hin ab dý fúes vnd
iren siechtumb, wan der man darin, das auch gewált
hat vber den taill der welt Septemtrio oder norders,
35 das auch wasser, flegma vnd frawen natur ist. Wan
es chalt vnd feucht ist, so ist gút hausfrauen vnd fre ntschafft zwischen den lewten machen vnd ne e muntz slachen, Silber vnd
gold wechseln vnd ist alles das g t z t en, das da czw wasser gehort oder dás dá mit wásser soll volpracht als vischenn
40 oder múll máchen oder auff dem wasser varen vnd sunderlichen
gegen dem taill, das da haisset Norders. Es ist auch gút ertzney=
301
en vnd chaúffman schátz zw treiben. In der czeit ist póss dý fuess
ertzneýen vberall. Vnd ist aúch póß, wás man mit feur wurck=
en soll oder múes. Das czaichen, wann der mann darinnen ist,
[18v] {Abb. Sternzeichen187} so geit es chalte vnd feuchte zeit
oder régen. Das selbig vnd das
vodrest thúet es in seinem aúff=
gang. Ber aúch vnder dem zaich=
5 en gepóren wirt, der hat ayn=
en getruckten leib vnd ist weit
vmb dý prúst vnd wirt kúen vnd
fraidig vnd vbermútig. Vnd er
hat auch ain claýn haubt vnd
10 wirbet geren vmb guet vnd es
get Jm w ll z hant. Ditz za=
ychen ist zwgenaigt dem pl=
aneten mars mit seiner natur.
Vnd ist aúch flegmaticus mit
15 seýnnen wandell. Hye nach
saget der maister Partholomeús
von den siben planeten, wie die iren lauff durch dy zwelff zaichenn
der Súnnen haben. Vnd auch von iren natúren vnd welichs kind
vnder in geporen wirt vnd was natur das enphachet vnd in we=
20 lcher stund yetlicher planet regnirt
DJe siben planeten haben iren laúff vnd gang hinder sich als
dy haydnischen maister sprechent, das dye planeten reng=
nýren all tag vnd stund nacheinander vnd nement dar=
vmb aynen yetlichen tág Jn der wóchen der planeten nach, der dann
25 regnirt.
MErcúrius hebt sich an auff den samtztag zw nácht an der
ersten stund, dý ander luna, dý drit Saturnús, dy vierd
Iupiter, dý funfft Mars, dye sechst, dy Sún, dy sibent Ve=
nus, dy acht mercurius, dý newntte luna, dy zechent saturnus, dy
187 Fische.
302
30 ayndlefft Iupiter, dy zwelfft mars.
DArnach so chúmbt des sumtags anhebung als dý sún auff=
get. Soll, venús, mercúrius, luna, Saturnus, Iupiter, mars, sol,
Venus, mercúrius, luna, satúrnus. Das sein auch XII stúnden, also
vindestu dy siben planeten in den siben tagen vnd nachten in der
35 wochen. Auch ist zw wissen, der tag sey langk oder churtz von
der sunnen auffgang pis zw der sunnen nydergang, so rechet
man nit mer oder mynder wan zwelff stúnd vnd auch in der
nacht zwelff stunde.
303
[19r]
Stu
nd
d
es
tags
Sum
tag
Mon
tag
Erc
htag
Mit
woch
e
n
Pfi
ntzt
ag
Fre
ýtt
ag
Sam
tzta
g
1 Súnn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus
2 Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter 3 Mercurius Jupiter Venus Saturnús Súnn Mann Mars
5 4 Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Súnn 5 Saturnus Súnn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus
6 Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius 7 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Súnn Mann
8 Súnn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus 10 9 Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter
10 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann Mars 11 Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Sunn
12 Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter Venús S
tun
d
der
nacht
Sum
tag
Mon
tag
Erc
htag
Mit
boch
en
Pfi
ntzt
ag
frei
tag
Sam
tzta
g
15 1 Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius
2 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann 3 Súnn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus
4 Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter 5 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Súnn Mann Mars
20 6 Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Sunn 7 Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus
8 Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius 9 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Súnn Mann
10 Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus 25 11 Venus Saturnus Sunn Mann Mars Mercurius Jupiter
12 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Sunn Mann Mars
304
[19v] Satúrnus: alt vnd kalt, hitzig vnd vnrayn / neid vnd háss ich auch, also seyn /
alle meine chind / dye da vnder mir geporen sind
SAturnus ist der obrist plánet vnd der gróst vnd der vntúgent=
hafftigest, vnd ist chalt vnd trucken Saturnus vnder den pla=
5 neten, vnd seine chinder, dý vnder im geporen werden, sein gewon=
lich rauber vnd morder, vnd wan er regnirt, so ist gút reden mit vbeln
leutten. Der planet ist vnser natur veint albeg vnd stet gen Orient
vnd ist ain planet póser lewt vnd vntúgenthaffter, dý mager, swartz
vnd dur sein, vnd ist ain plánet der mannen, dý nit part haben vnd we=
10 ysse har, vnd dý ire claýder vnsa ber tr gen. D chinder, dý vnder dem
saturno werden geporen, dý werden prawn an dem leib vnd swartz
mit swártzem har vnd haben hért part aúff dem hawbt vnd wenig
har an dem part mit ayner smalen prúst, vnd wirt hassig vnd vn=
túgenthafft vnd auch traurig, vnd hort geren alle vnrayne ding vnd
15 trégt lieber vnsaubre claýder dan schóne. Vnd er ist aúch nit vnkeusch
vnd mag nit wóll mit frauen wandeln vnd churtzbeill treiben vnd
hat auch von nátur alle pósse ding an im. Saturnus erfullet seinen
lauff in dreýssig iaren vnd in etlichen monadten, vnd von seiner hó=
che wegen mag man in gar selten sechen. Vnd sein auch seynner natur
20 zaichen des saturnus: der staynpock vnd der wasserman, dy sein chalt
vnd trúcken vnd an irer natúr vnd gleicht sich aúch dem melon=
colicus mit seiner natur.
SAtur ain steren pin ich genannt. Der hóchste planet gar wól
erkant. Naturlich pin ich trúcken vnd chalt. Mit meýnen
25 wercken manigfalt. So ich in meinen hewsern stan. Jn dem
staynpock vnd wasserman. So chúm ich zw schaden der welt. Mit
wasser vnd grósser vbriger kelt. Mein erhochung in der wag ist.
Jm wider vall ich z der frist. Vnd mag dy zwelff zaichen
nachent in dreýssig Iarén erraichen.
[20r] {Abb. Planeten und Sternzeichen188} MEine chind sein durr, plaich vnd kalt, grob, trág, póß, neydig vnd
alt, dýebig, gierig, gefangn, lam vnd chalt. Tyeffe wang, ir ha=
188 Männliche Figur (Saturn), links unten Steinbock, rechts unten Wassermann.
305
wt ist hért, kainen párt. Gross lebssen vnd vngeschaffen gewant. Bu=
este týer sein in woll erkannt. Dás ertrich sý durch graben gerne. Vel=
5 de pauens sy auch nit enperne. Vnd wie man in not mit arbait soll
leben, das ist saturnus chinder gegeben, dýe anders ir natúre han,
allain von saturno soll man verstan.
{Abb. Planetenkinder189} [20v] Jupiter: túgenthafft vnd gueter sitten Pin ich / das wisset all gemayntlich /
Meine chinder dy kúnnen schreýben vnd lesen woll / vnd maniger chunst
sein sy geren alczeit voll
IVpiter, der ander planet, der ist gluckhafftig, tugenthafft, wa=
5 rme vnd frisch vnd etwen trág an seinem lauff vnd gehort den
zw, dý da tugenthafftig sein vnd herlichn mannen, dý da gr=
oss dick part haben vnd werden nit kall. Vnd wan er regnirt,
so get es frauen woll, dý mit knaben gent. Vnd ist dan gút vor fur=
sten frid vnd recht suchen. Dyser planet haltet aúch seinen lauff mit
10 den, dý da haissent Colerici, dý helffent aúch den le ten vnd den
iren, vnd thún dóch dem nit geleich vnd thún ir hilff haimlich vnd
vnuerporgenlich gegen den leúten vnd aller maniglich, vnd sein
auch vast getrew fre nt vnd nit offenlich. Das chind das vnder dem planeten geboren wirt, dás wirt gúetmássig vnd wirt ere
15 vnd recht lieb haben vnd hat aúch geren schone klaýder, vnd waz
da woll sméckt vnd raýn ist, das hat es geren. Es wirt auch nit
parmhertzig vnd frolich vnd hat dý zaichen der súnnen, den schú=
tzen vnd den visch. Jupiter erfullet seinen laúff in zwelff Iaren.
IVpiter soll ich nennen mich. Der ander plánet tugentlich.
20 Warm vnd feucht pin ich gar. Jn meiner natur n nemet war. Czway zaichen sein dy hewser mein. Der visch, der
schutz mit gúetem schein. Só man mich darin siecht. Nyem=
ant schaden dauon geschicht. Jm Crebs wird ich erhochet sere.
Jm stainpock ich abher chere. Mein vmblaúff durch dý zwelff
189 Fünf Figuren: zwei Männer graben in der Erde, eine Figur faulenzt, eine Person ist hinter Gittern eingesperrt, eine
Figur begeht einen Diebstahl.
306
25 czaichen ist. Jn XII iaren zw aller frist.
[21r] {Abb. Planeten und Sternzeichen190} ZVchtig, tugenthafft vnd slecht. Beyse, fridlich vnd gerecht. Geluck=
hafftig, woll geclaidet, adelich. Schón, vernemig vnd kúnstrich.
Ain schón róslat angesicht, als ob es war z lachen gericht. Pfarte, valcken vnd véderspill. Jágen mit hunden wildes vill. Rich=
5 ter, schiesser vnd studirer. Legisten, decrétisten vnd hoffirer. Cz disen
dingen genaigt sind, dýe da sein gantz Jupiters kind.
{Abb. Planetenkinder191}
[21v] Mars: zw streit vnd zw vnsalikait / Pin ich albegn geren perait / Als euch
das erczaigt mein klaid / Meine chind machen mangen haß / Sý enwissen
nit warumb, wie óder vmb was
MArs ist der drit planet, vnd der ist hais vnd trúcken vnd ge=
5 luckháfftig, pósse, dóch mittelmássig in seinem laúff, vnd ist
ain planet zornig le t vnd dy da geren kriegn vnd tóben
vnd kall sein vnd dý kraús har haben vnd wenig. Vnder dem pla=
neten ist gút in streit zw gen vnd stelen, raúben vnd prennen
vnd wuntten d le t. M rs ist ain p ß planet vnd darumb, wann
10 er régnirt vnder den siben pláneten, so spréchent dý maister, das
man in sech ob der Súnnen, so wedeut er grós nýderlegung vnder dem
adell, also das dý hern ritter vnd knécht dés selbigen Iáres nit
schullen kriegen, ban sy ligent darnýder. Aber des selben Iars ha=
ben dy pauren gút kriegen, wann als ding gét vást nách Jrem will=
15 en, vnd darumb dy menschen, dý da enpfangen werdent, bann mars
regnirt, dý werdent gar streytper. Vnd als vormáln gespróchen ist,
bann man in siecht ob der súnnen, so hát er etlich nátur mit den, dý
haissent sangwiney, wan dý sein gar streitper vnd verlirent do=
ch vill vnd dick an iren kriegen. Bann man in aber siecht vnder der
20 súnnen, só hat er etlich natúr mit den, dý da haissent melonco=
lici. Dy sein still vnd sweigent vnd streiten vnd gelýngt in wol
an iren kriegn vnd streiten. Vnd des iars, wan mars regnirt, so
190 Männliche Figur (Jupiter), links unten Schütze, rechts unten Fische. 191 Sieben Figuren: Jagdszene mit Hund und Falken, eine Figur zu Pferd, zwei mal zwei Figuren im Gespräch.
307
regnirt gewónlich ain stern, haist Cometa, vnd in welchem land
dann der stern wirt gesechen, in den selben land wirt an zweiffell grós
25 tewrung vnd húnger. Ban man mag in nit in allen landen gesechen, wan
er ist nýder an dem himell vnd náhet peý dem mannen, also des mánen
schaden in vmb geit, daz man in nit woll mag gesechen. Vnd wann
dý sun ist in dem zaichen Cancer oder leo vnd welchs Iars er re=
gnirt, so ist geren der mann vnd dy sún préchenhafftig. Der vnder
30 dem planeten geporen wirt, der wirt rot mit etlicher vinsternús,
als dy ander sun praún werden. Nach dem daz chind wirt vntugent=
hafft vnd vnschamig. Es wirt hoffertig vnd macht albeg krig
vnd v nsalikait vnder den leúten vnd hát vnder den zwelff zaichen
den wider vnd den scorpian vnd ir complexen vnd ir natur. Vnd Mars
35 erfullet seinen lauff in fúnff húndert vnd dreýssig tágen.
Mars, der drit planet vnd sterne Pin ich genant vnd zurn gerne
hais, vnd trúcken pin ich gar vil. Mit meiner krafft median
man will. Zway zaichen sein mir vndertan, der wider vnd auch
der scorpian. So ich mit chráfft wird darin sein, Crig wirt vnd
40 widerbertige pein. Mein erhóchung im staynpóck ist. Im Crebs verlur192 ich
meine chráfft, list. Dýe zwelff zaichen ich durchvar in zwáyenn
Jaren gantz vnd gar.
[22r] {Abb. Planeten und Sternzeichen193} Alle meine geporne chind czornig, mager, geitig sind, hassig, kriegig,
traurig, misseling194, stelen, raúben, liegen dick, stechn, slachen, leren
kriegen, prennen, morden alczeit triegen. Jr antlitz ist prawn, rót
vnd spitzig. Ein scharff gesicht mit póser witz. Claýn zend vnd ay=
5 nen claynne part. Jr leib ist lang, ir hent sein hert. Vnd was mit
fe r soll geschechen, dás múessen méine chinder verjechenn.
{Abb. Planetenkinder195} [22v] Sol: ich sag euch mit churtzer frist / Mein schein vber all planeten ist /
mein auffgang geit des tages schein / Mein vndergang erczaiget
dý steren vein
192 Vermutlich Verschreibung. In der Handschrift ver§ur oder verfur. 193 Männliche Figur (Mars), links unten Widder, rechts unten Skorpion. 194 misseling ‚schlechter Erfolg, Unglück‘ – im konkreten Fall Adjektivfunktion ‚erfolglos, glücklos‘. 195 Zehn Figuren: Kampfszene, Brandschatzen, Mord, Diebstahl.
308
DJe súnn ist der vierde planet, der ist haiss vnd trúcken vnd ist
5 lustlich vnd ist ain eynfliessends liecht vnd aýn leben allen den,
dy da lebent, vnd in allen natúrlichen dingen. Er ist ain pla=
net schon vnd lustlichen leúchten der lewt antlitz vnd aúch
den leútten, dye mit allen erberen gedencken vmb gent vnd mit erberen
le tten. Die súnn ist ain chuniglicher stern, ain liecht vnd aýn aug der
10 wélt ist sy genant, vnd scheinet durch sy selber. Vnd erleúchtet dý
andern stern vnd ist aúch vnder den siben pláneten der miltest vnd
zertailt dý zeit vnd erfult seinen laúff in ainem gantzen Iar. Vnd dý
Sún mácht den menschen z leib v ll vnd sein antlitz m chet sy im
gar schón vnd wóllgeschaffen mit gróssen aúgen vnd mit aynem
15 gróssen párt vnd mit langem har vnd máchet den menschen nách der
sele nách im geleich vnd machet In nách anderen sachen aúch weýs
vnd das man in gar lieb hat. Vnd mácht in kúnstreich vnd listig in
allen dingen. Vnd nách dem pláneten sein genant dý sangwineý, wann
dý selbigen leut sein gar wegriffen in allen kunsten. Vnd sein aber
20 an gotlichen dingen vnd articklen z eiffelhafftig, vnd sein a ch
Vnke sch le t vnd werdent gár leicht erczúrnet vnd nympt dóch gar
pald ab an yn. Dás chind, dás darvnder gepóren wirt des Iars vnd
dý súnn herr ist, das wirt fleischolt196 vnd gewint ayn schón antlitz
vnd grósse aúgen vnd aýn weisse várb mit aynem wenig róttes ge=
25 mischt vnd mit vill partes vnd háres nach der súnnen geleichnús
vnd scheinet aúswendig gár guet vnd sein leut nach Irem haúbt, daz
sprechent etlich maister. So spréchent auch dý anderen, dý vnder der
sún gepóren werden, sein gar weis vnd frólich vnd haben gúet
le t lieb vnd h ssen d p sen. Vnd hat vnder den zwelff zaichen
30 den leó mit seiner natur vnd aúch mit seiner Complexion.
DJe Súnn man mich haissen soll. Der miltest planet pyn
ich woll. Barm vnd trucken chann ich sein. Naturlich gantz
mit meinem schein. Der leo hat meynes hauss krais. Dar=
In pin ich vast trucken vnd haiss. Doch ist satúrnus statiglich
35 mit seiner chelten wider mich. Erhóchet wird ich im wider. Jn der
196 Bedeutung unklar, s. Glossar. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab: flaisch holt (fol. 29r/S. 67).
309
wag vall ich hernýder. Jn drewn hundert vnd LXV tagen mag
ich mich dúrch dý z elff zaichen tr genn. [23r] {Abb. Planeten und Sternzeichen197} ICh pin gluckhafftig edell vnd vein. Also sein auch dy chinder me=
yn. Rot weis gemengt schón angesicht. Bolgewort weýss, chla=
yn, har geslicht. Aynnen vaisten leib mit scharffen worten. Mittel
augen, ayn grosse stymme. Saittenspill vnd singen von múnde. Boll ezz=
5 en vnd grossen herren chunde. Vor mitten tag dýenen sy got voll. Dar=
nách sy leben wie man will. Stain stossen, schirmen, ringen. Jn gewa=
lt sy geluckes vill gewynnenn.
{Abb. Planetenkinder}198 [23v] Venus: mein pildnuss ist frólich / Nach neid vnd haß stell ich / Meine kin=
der sein genaygt zw vnlautrikait / Vnd singent frolich ane laid
UEnus der planet Jst chalt vnd feucht vnd volpringt seinen
lauff in dre nhundert vnd LIII t gen, vnd er ist auch ge
5 luckhafftig. Venús ist ain gueter vnd gemaýnner stern vnd
temperirt mars póshait vnd hat ain wolscheinende várb vnd
scheint vnder dem gestiren gar miltsamiglich. Vnd ist als der súnnen
anschein ist an I ngen le ten, vnd sein gelb le t vnd vnkeusch vnd
dý geren peý frauen wónen vnd aúch geren fraúen arbait thuen.
10 Wann venus regnirt, so ist g et ne e cla der cha ffen vnd an legen.
Jtem wann venús vor der súnne get, so haisset sy lucifer vnd wann sy
dann nách get, so haisset sy vesper. Vnd venus macht den menschen ay=
ner schónen person vnd mit vást gróssen aúgen vnd aúgprágen,
als dann der súnnen anschein ist. Vnd mácht den menschen mit der se=
15 le weitschaffen vnd aúch nách geistlichen dingen gierig. Vnd sein
dýe, dý da haissen Colerici, dý haben sýnne, dy da zwifeltig sind
vnd weleibent dóch nit aúff irem zweiffell vor dem ende. Vnd da=
von sein sý aúss geschaiden von den sangwiney. Dý peleibent
zwifaltig pis an ir endt. Wer darvnder geboren wirt, der wax=
197 Männliche Figur (Sonne), unten links Löwe. 198 Elf Figuren: Betender, Schwertkampfszene, zwei Figuren singen, zwei Figuren beim ‚Kugelstoßen‘, zwei Figuren
ringen miteinander.
310
20 et nit zw langk. Mittelmássig vnd mit grossen augen vnd aúg=
praúen nách der súnnen, als dann vor stet, vnd wirt senfftmútig
vnd woll redent vnd zúchtig. Vnd zeúcht sich aúch rayniglich
vnd hort géren saitenspill vnd tantzen. Der plánet hát vnder im
den ochssen vnd dý wag mit Irer natur.
25 UEnus der funfft planet vein. Haiß ich pin vndder mynen
schein. Feucht vnd kalt pin ich mit chrafft, naturlich dick
mit mayestat. Czway hewser sein mir vndertan: Der stier, dýe
wag, darin ich han frolichs leben vnd lústes vill, so márs
mit mir nit kriegen will. Jn dem visch erhoch ich mich. Jn der ma=
30 gt vall ich sicherlich. Jn dre nh ndert tagen vnd funff vnd sech=
zick. D rch lauff ich dy z elff zaichen dick.
[24r] {Abb. Planeten und Sternzeichen199} WAs chinder vnder mir geporen weren, dý sein frolich vnd singen ge=
ren. Ain zeit arm, dý andern reich. An miltikait ist in nýemant
geleich. Harpffen, laútten vnd alles saittenspill, horen sy geren vnd
chúnnen sein vill. Arglenpfeiffen vnd pusaunen, tantzn, kussen, hal=
5 sen, ra nen. Jr leib ist hubsch, ain h bsschen mund. An gewin gefúeg
ir antlitz rót, vnkeusch vnd dý mynne pflégen sein venús chinder
albegen.
{Abb. Planetenkinder200} [24v] Mercurius: feúrren ist mein natur / Als dan weczaichent mein figur / Mey=
ne chinder sein gar schón / Sy thuenen das schnell vnd kuenn
MErcurius, der planet, ist getemperirt mit seiner natur: Also kum=
pt er zw ainem gueten, so ist er g t, kumpt er z aynnem p
5 sen, so ist er póss. Mercurius machet den menschen enphenck=
lich an seinem leib vnd ayner starcken vnd herlichen person, vnd ma=
cht den menschen schón mit lutzell hars, vnd mácht Jn nách der sell gar
weiss vnd subtill vnd das er weishait gar lieb hat, vnd aynnes guten
siten, vnd aýnner gúten red, also das er wóll spréchent wirt vnd
199 Weibliche Figur (Venus), unten links Stier, unten rechts Waage. 200 Elf Figuren: tanzende Pärchen, Musikanten mit Saiten-, Blas- und Tasteninstrumenten.
311
10 doch nit vill rédet, vnd gewint vill fre de vnd wirt g tz r tz. Vnd nách der lere der weýsen maister vnd stern secher so get mercurius
der Sún nach vnd hat aynen schein, denn man selten siecht, darumb
er der súnnen also nahent ist. Dýe vnder dem planeten mercúrio
gepóren werden, dý gewynnen grós zend vnd werden red sprachig
15 vnd weis vnd leicht peý den lewten vnd plaich an der varb vnd
studiren geren. Vnd sein still vnd subtill, vnd wirt vill an in steen vnd
sein gútz rats vnd haben dóch nit vill gelucks vnd haben doch nit
póshait in In selber. Mercurius erfullet seine laúff Jn drewn hun=
dert vnd in acht vnd dreissig tagen, vnd dý meloncolicj sein gar
20 geturstig vnd aines gúeten rátz vnd gerécht an in selber vnd dý
lutzell reden vnd auch alle ding haýmlich volpringen. Vnd regnirt
vnder den zwélff zaichen mit der Junckfraúen vnd mit dem zwi=
ling vnd mit iren naturenn.
MErcurius, der sechst planet, haiss ich vnd macht wint he=
25 rt. Barm pin ich peý ainem warmen stern vnd chalt
peý ainem chalten géren. Dý zwiling vnd dý magt vein
sein gehaissen dy he ser mein. Darin gan ich gar tugend=
lich, so Iupiter nit irret mich. Mein erhochung ist in der magt. Jn dem
visch wirt ich verzagt. Durch dý zwelff zaichen ich lauff Iagen
30 in dre n h ndert vnd vier vnd sechzig tagen. [25r] {Abb. Planeten und Sternzeichen201} GEtrew wehent202 ich geren leren. Meine chinder sich zw hubschait ke=
ren. Boll zw eren vnd darczw weisse, frewde, chunst, subtill mit
preýsse. Jr angesicht das ist rot voll vnd plaich, ain hoch stern,
geluar har waich. Sy sein wóll gelert vnd gút schreiber. Golt schm=
5 id, maler vnd pildsnitzer. Orgeln machen vnd orgeln aúch vein. Zw
maniger hant sy listig sein. Jr fréwnt in hilffig sind. Arbaitsam seyn
mercurius kind.
{Abb. Planetenkinder203}
201 Männliche Figur (Merkur), unten links Jungfrau, unten rechts Zwilling. 202 b/w-Wechsel behent ‚behende, schnell‘. Möglicherweise aber auch Verschreibung, sinngemäß könnte ‚will‘ passen. 203 Vier Figuren: Maler, Schreiber, Bildhauer, eine Figur bei der Metallverarbeitung.
312
[25v] Der man: mein figur / Nymet aller planeten natur / Bisset auch, das alle mey=
ne kind / Nýemant geren vndertanig sind
DEr man ist der nidrest plánet. Er ist feúcht vnd chalt vnd
tugenthafft vnd ist herr aller feúchten ding vnd ist aúch
5 aller schnellest an seinem laúff. Bann er laúfft in aýnnem
mónad als vill als dy Sún in ainem Iar. Er vichtet aúch
an alle chalte lewt, dý da flussig sein vnd auch gesiecht haben vnd
churtzlich alle dýe, dý da pósse feuchtikait an in haben, bann er vber
alle feúchtikait regnirt vnd aller maist des menschen von seinem plúet.
10 Darvmb so ist es nútz, dás wir seinen laúff mer wissen vnd in welch=
em zaichen er gang, wann es ist gar sorcklich, das man seins laúffs nit
wár nýmpt, wann er der nýdrest plánet ist. Es ist er aúch als ain ri=
chter vnd aller pláneten natur an sich zeúcht ain taill, vnd darumb múe=
ssen wir seinen laúff mer wissen dann der anderen pláneten, wann er vber
15 alles das regnirt, das in vns ist. Der mann macht den menschen weitsch=
afft vnd also, das er nit mág peleiben an ayner stat, vnd macht auch
den menschen vnder weillen frolich vnd vnder weillen traúrig. Vnd
dóch des merern tails frolich, vnd mácht dem menschen ain krúmpe
nasen mit krumpen naslochern Vnd gar feúchter natur. Vnd haýssen
20 dý selben menschen flegmáticj vnd sein gar trág, vnd der selbig mensch
hat albég vngeleiche aúgen, also das im aýns grósser ist dann das
ander. Vnd erfúlt seinen laúff alle mónad vnd erleúcht dý nácht
vnd entlehet sein liecht von dér Súnnen vnd mert sich vnd mynn=
ert sich. Vnd dy chind, dý er máchet vnd gepirt, das werden gema=
25 yncklich knáben. Vnd gar vill gemaynschafft mit den menschen
vmb dy nachte, so der mann hat wó vnd mit der Súnnen. Vnd wann
der mann regnirt, so ist nit g t anz heben n ch anz vachen weder
paúen nóch kaynerlaý sachen, bann es ist vnstat vnd vnbeleiblich.
Vnd der mann macht auch plaich vnder dem antlitz, vnd mit fle=
30 cken gemischt vnd macht in gar vnsynnig, also das er gar póß
vnd czornig wirt. Vnd das ist von irs wandels wégen. Es ist z e wissen, das der man ist in aynem ýettlichen zaichen aýn mó=
nad vnd hat vnder Im den Crebs mit seiner natur.
313
DEr mann: der letzt plánet násse, haýss ich vnd wurch ding
35 sein lásse. Chalt vnd feúcht mein wurcken ist natúrlich
vnstat zw aller frist. Der krebs mein hauss wesessen hat, so
mein figur darInnen stát vnd Iupiter mich schaút an, chayn
Vbels ich gewúrcken chann. Erhóchet wird ich im stýer. Im sco=
rpian vall ich hernider schier. Dye z elff zaichen ich dúrch=
40 gang in siben vnd zwaynczig tagen lang.
[26r] {Abb. Planeten und Sternzeichen204} DEr steren wurcken get durch mich. Jch pin vnstat vnd wúnderli=
ch. Meiner chinder man kayns geczemen chann. Nyemant sein sý geren
vndertan. Ir angesicht ist plaich vnd rót, gruen vnd gra sam
Zend, ain dicken múnd, vbersichtig schelch, ainen engen ganck, gerenn
5 hoffertig, trag, der leib nit langk. Lauffer, vischer, scheffleut, gauckler,
varent, schúler, vógler, múller, páder. Vnd was mit wasser sich er=
neret, den ist des mannen schein pekeret.
{Abb. Planetenkinder205} [26v] Von der planeten lauff vnd auch vonn Irenn naturenn merck hernach
ES ist zw wissen von den siben planeten, das es got also geor=
dnet hat, der ob dem gestiren ist. Also welcher planet aýnen
stéren aller nágst get, von dem selbigen stern enphachet er
5 schein. Solich stern sein chalter natur, etlicher násser, etlich=
er trúckner, etlicher haisser. Dýe selben natúren zeúcht den
menschen von dem gestiren. Etlicher mensch ist chált vnd trúckner
natúr, der sweigt geren vnd ist ain vngetrewer mensch. Semlich sein ka=
lter vnd nasser natúr, dýe reden vill vnd sein lang ráchig vnd vnver=
10 trágenlich. Etlich menschen sein haýss vnd aúch trúckner natúr, dýe
sein gáchmútig vnd kúen vnd haben geren vill gewerbe vnd sein doch
an der lieb vnstát. Welcher haýsser vnd násser natúr ist, der ist der
pesten natur vnd ist geren milt vnd eren geytig vnd hat vást lieb
dý frauen vnd ist aúch stát an der lieb. Davon sprechent dý púcher,
15 das an dem steren, der dá haissett Mars, dás der vrlewg phlege, wan
204 Weibliche Figur (Mond), unten links Krebs. 205 Acht Figuren: Fischer, Vogelfänger, Müller, Schiffsleute, Bader oder Barbier mit einem Kunden.
314
er haýsser vnd kalter vnd trúckner natur ist. Dýe naturen chomen der
vnlauteren phlicht. Der man ist der aller mynst vnder den siben pla=
neten. Er lauffet aúch áller nydrést peý der erden. Dauon so richtet
sich dý welt alle nach dem mann. Cometa ist ain stern, der selber
20 erscheinet nymer, wann so sich dás reich verwandelen will, so er=
scheinet er. Den stern soll man kresen206 oder ansechen, das er von
dem schein, der von im scheinet, als der mann scheint. Der stern laú=
ffet nit vnder anderen steren. Dýe púcher wellent, dás es ain liecht
sey, das gót mit gewalt enczundet hat in den lufften zw webeý=
25 ssen kunfftig ding der welt.
Von der Sunnen lauff durch dýe zwelff zaichen in dem gantzen Iar
BEr well den laúff des morgens Recht wissen, wie dýe
Súnn dúrch dý zwelff zaichen in dem Iar lauffet, in
aynem iar durch alle czaichen, vnd peleibt in aynem
30 ýedlichen czaichen XXX tag. So sein auch zwelff zaichen:
Aries, thaurus, gemini, etcetera, vnd durch dise lauffet207 der mann in aynem mo=
nadt vnd dúrchlaúffet aúch alle zaichen in XXX tagen vnd
peleibt in aynem ýedlichen zaichen dritthalben tag. Vnd mit dem
dúrchlaúffen diser zaichen so kúmpt dann der mann zw dem zaý=
35 chen, da dý súnn Inne ist, vnd mit dem veraynet er sich. So wirt
dann der mann inprunstig, bann dá endet er seinen laúff. Wann aber
der mann sich schaidet von der súnnen XII gradús, das gepurt an
den himell LVI meýln, so vahet er an cz leichten vnd wirt dann
gesechen von den menschen vnd nýmpt aúch sein liecht von der
40 Sunnenn.
[27r] Hie hin nach stet geschribenn vonn den Sibenn planetenn, wie sy regnirent nach des
Mannen schein vnd wan sý schonn, feúcht oder náß weter gebenn
BJld wissen alle zeit regen oder sch n des iars, so wart eben, in we
lcher stúnd der mann new an dem himell seý. Jn welcher stúnd tágs
5 oder nachts, als dann darvor géschriben stet, so wart auch, welch=
206 Bedeutung unklar. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 31v/S. 72) kisen (mittels der Sinne untersuchen,
prüfen messen, erkennen). 207 Fehlendes Verb eingefügt. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 31v/S. 72): vnd durch diese zaichen layfet
der Mon.
315
er planet regnirt vnder den siben pláneten. Die Sunn
Jst es das dy súnn regnirt vnder den siben planeten, so wis das daz monadt
wirt haiß vnd aúch dúrr nach den vier zeitten des Iars, wan des plane=
ten furer ist der leo vnd sein natur. Der mann
10 Birt das new in dem planeten luna, so wirt der monadt winttig vnd
durr vnd auch ains tails regen, wan sein furer ist der Crebs, der ist
chalt vnd feucht als das wasser. Saturnus
Birt aber das ne in dem planeten Sat rnus, so wirt der monad hais oder chalt nach dem iar vnd halbs regen, wan sein furer ist der stainpock,
15 der ist gen turt als das fe r vnd der wassermann als der lúfft vnd Iúp=
iter gemischt auff paid seyttenn. Mars
Birt das ne in dem planeten mars, so wirt aber ain taill regen vnd
ain taill dúrr, wan sein furer ist der wider vnd der scorpian. Ban der wi=
der ist als daz fewr vnd der scorpian als daz wasser. Mercurius
20 Birt dás in dem planeten mercurius, so wirt der mónad vill régenn,
wann sein furer ist dy iungkfraw vnd der zwiling, wan der zwiling ist
als der luft vnd dy J ngfra als d erdenn. Jupiter
Birt das ne in dem pl neten Jupiter, so wirt der monad halber trú=
cken als das feúr vnd halber gemischt mit wint vnd mit regen. Bann
25 sein fúrer ist der schútz vnd der visch, wan der schutz ist als das feur
vnd der visch ist als das wásser. Venus
Birt das ne in dem planeten Venus, so wirt der monad sere hais vnd
durr oder chalt vnd dúrr vnd aúch das viertaill des iars albey regen,
wann sein furer ist der ochß vnd dý wag. Bann der wág natur ist als
30 der wint vnd der óchß als dý erden. Also ist der mónád gemischt von den
payden von dem wint vnd von dem wasser.
Von der Sunnen lauff durch dy zwelff zaichen in dem gantzenn Iar
HJe will der maister weissen, bie dýe súnne lauffet in den mónaden.
In dem Ienner ist dý súnne in dem zaichen des wassermans. Jn dem
35 hornung ist sy in dem záichen des visch. Jn dem mertzen ist sy in
dem czaichen des widers. Jn dem aprill ist sý in dem zaychenn
des stýers. Jn dem maýen laufft sy in dem zaichen dés zwilings. Jn dem
Brachmónad ist dý súnne im krebs. Jn dem hewmónad ist sy in dem leo.
316
In dem aúgsten ist sý in der Iúnckfraúen. Jn dem ersten herbst mónat
40 ist sý in der wág. Jn dem anderen herbst ist sy in dem scorpian. Jn dem
dritten herbst mónadt ist dý Súnn in dem schútzen. Jn dem wintermó=
nadt ist sy in dem Stainpóck.
[27v] {leer}
[28r] {Abb. Temperamente208}
Hie hin nach stet geschriben von denn
vier complexion vnd von Iren naturenn,
das sey der meloncolicus, Colericus, ffle=
gmaticús vnd sangwineus. Vnser com=
5 plexian ist von ertreich, darumb
wir sein swarmútikait geleich
ES sein vierhanden naturen
vnd complexian, die der me=
nsch hat. Etlicher mensch
10 hat zwo, etlicher dreý, et=
licher vier. Doch so nympt ains dýe
oberen hant. Das ist dýe der men=
sch aller máist hat. Vnd chain men=
sch hat allain aýnne. Dóch z e 15 hant von dem ersten: So schreibt
man vnd list von dem melonco=
licus. Dás der wirt geleichet
dem ertrich vmb sach warúmb, wann das ertrich ist chalt vnd trúckenn
als dy zaichen der ochss vnd d I ngfra vnd der sta npock vnd
20 ist zw genaigt mit allen sachen, aber dý kelten vnd dy trucken, dýe
vbertreffent in im. Er wirt a ch z geleicht dem herbst, wann der
ist chalt vnd trúcken, wann dý czeit des herbstz ist chalt, darvmb
das d s nn z der selben zeit an dem hinnegang an dem himell von
vns get in dy wintrigen zaichen. Es ist aúch trucken dy zeit vonn
25 sach wegen der trúckenhait dúrch den súmer vergángen, vnd das
darin geboren wirt. Er wirt aúch zw geleicht dem altar, wan so
208 Melancholiker.
317
der mensch alt wirt peý LXX Iaren, so vachet sich an sein arbait seiner
siechtagen. Vnd darumb, so spricht der prophet Dauid, ist der mensch do=
ch wolmúgent, wann er ist LXX Iar alt, so múes er doch arbait vnd
30 smertzen leýden. Cz dem andern m ll so merck vnd n mm wár, daz
der meloncolicús ist vorchtsam vnd nit getúrstig, wann er mangelt
der sach der geturstikait. Das ist offenbar an den haissen týern als
an dem leo, das gar ain turstig týer ist von der hitz wegen. Cz dem
dritten mall so ist der meloncolicus trág vnd aines trágen laúffs.
35 Darumb wann er ist ainer klaglichen vnd kalten natur, die im dý ge=
lider swár macht vnd sterckt im dý glýder, also das sy werden vn=
gelaitig z gen. Des geleichen macht d wirm dý glider ring
an dem menschen cz la ffen vnd zw gen. Cz dem vierden mal so ist der meloncolicus von der aigenschafft wegen der kelten há=
40 ssig vnd tra rig vnd vergessen. Cz dem funfften m ll so ist er von der aýgenscháfft wégenn der chelten wenig pégert209. Er pegert
lutzell vnd mag wenig. Er pegert wenig von seiner traúrigka=
ýtt wégen, dý er an im hát. Er mág aúch lúczell vnd wenig von
[28v] seiner kelten wegen, dý er in Im hat. Nú ným war: als vill ainem menschen der
aýgenschafft geprist, dý z a nner yedlichen n tur gehort, so er ye my
ner der nátúr hat, vnd so er ýee mer der aýgenschafft hat der anderen
nátúren, so der mann in im ist. Vnd régniret aúch mit mars vnd mit
5 der súnnen in Irem láuff.
{Abb. Temperament210}
fflegmaticus unser complexion ist
mit wasser mer getan. Darumb wir
subtilikait vnd hubschait nit múgen lan
DItz hie nach ist ge=
10 schriben von den, dý dá ha=
yssen flegmátici. Vnd au=
ch also nýmm war in disem púch, daz
209 In der Handschrift pe#:gern#-. Hier sollte ein Adjektiv ‚begert‘ stehen bzw. ein Part. Präs. ‚begehrend‘, aber ver-
mutlich hat sich der Schreiber durch die nachfolgende Verbform ‚er begehrt‘ irritieren lassen. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 34v/S. 78): begert.
210 Phlegmatiker.
318
der fflegmátic s wirt z gélei=
cht dem wásser, wann das wasser
15 dás ist feúcht, vnd aúch kalt.
Also der flegmaticús der geleich=
et sich auch dem zaichen mit sein=
er natúr. Das ist dem zwiling, der
wáge vnd aúch dem wássermann
20 vnd dem visch. Cz dem anderen
mall nempt wár der aigenschafft des flegmáticus, das dýe sein se=
nfftes sýnnes vnd schlaffet vill. Vnd sein auch vast grób mit irenn
synnen vnd sein trag und speýben vill vnd sein vaist leút vnd we=
ysß vnder dem antlitz. Vnd treiben aúch geren saittenspill vnd ge=
25 leichet sich aúch den planéten, dem Man vnd dem venús mit iren
náturen vnd mit seiner complexnn.
[29r] {Abb. Temperament211} Sangwineus vnser complexian seyn
von lufftes vill. Darvmb wir hóchmú=
tig sein an alle zill
DJe dritten, das sein dý sang=
5 wineý. Es ist z wissen, das der sangwineus ist milt. Dar=
vmb, wan er ist hitzig vnd feúcht
von der aigenscháfft der hitzigkait.
Dás sý doch albey sein stercker vnd
10 darvmb sein all lewt vast kran=
ck, wann sy sein vast chalt von der
aigenschafft wegen der kelten, dý sy
zw ir zeuchet. Cz dem andéren
mall, so wirt der sangwine s z
15 geleicht dem Glentzen, wann dye
czeit ist chalt vnd feucht. Vnd darumb so ist z wissen, d s d e san
gwiney Complexian ist an allen leblichen stéten vnd láng weren=
den, wann das leben ist in dem hertzen vnd in den feúchten. Z dem
211 Sanguiniker.
319
dritten mall so ist der sangwineus mer genaigt z spilen vnd zw der
20 púebereý bann der meloncolicús oder der flegmaticús, vnd gená=
ýgt gewonlich z der lére. Vnd ist sách war vmb, wann der sang=
wineus máslichen hitz hat vnd feúcht, vnd sein gaist sein subtill, al=
so was man in furleýtt, das sy das gar schir vnd gar páld pegrei=
ffen. Vnd sein aúch von nichte weisser wann dý meloncolici oder dý
25 flegmatici, wann d sangwine sein allermaist pe egt vnd vn
statig vnd ligen den dingen erenstlich ób. Aber dý meloncolici vnd
dý flegmátici, dý sein vnpebegenlich vnd sein stat an in selber vnd
ligent der lere statiglich ob vnd sein aúch weiss. Aúch sein sý mit
liebeháber vnd liebhaberin vnd sein frolich vnd lachent gerenn.
30 Vnd sein rótt vnder dem antlitz vnd singent geren vnd sein etzwás
kúen vnd haben vill fleisch an in vnd sein fréch vnd vntugenthafft vnd
sein z genaigt dem pláneten Jupiter mit seiner natur vnd
Complexiann.
[29v] {Abb. Temperament212} Colericus vnser complexian ist von fe=
wr. Kriegen, czúrnen, schlachen ist albeg
vnser anvechtigung
DJe vierden haissen dý cólerici. V=
5 nd ist z wissen, das der
colericus ist milt, ban dý
feuchtikait enczúndet Im dás plút
vnd das hertz vnd machet in aúch
gelb vnder dem antlitz, vnd darvmb
10 sein dý colerici gár geturstig von
der hitz wegen peý dem hertzen vnd
vmb d s hertz. Cz dem andernen
m ll so wirt der coleric s z ge
leichet dem Súmer, wann der hais
15 vnd aúch trúcken Ist, also ist auch
der colericús hais vnd trucken.
212 Choleriker.
320
Er wirt auch geleicht dér vntugent. Zw dem dritten mall so
wiss, das dy complexian Colera ist driualtig: dý erst, die ist hi=
tzig vnd dy leut haben ain plaichs antlitz vnd sein vast getur=
20 stig vnd mútig. Vnd wann sy trúncken sein, so erschrécken sý dýe
lewt vnd dý menschen gar leichtiglich. Dýe anderen sein gemi=
scht vnd dý leút haben ain rót antlitz, gemischt mit der gelb,
vnd dý sein kúndig. Vnd aúch vást zornig vnd swanger an dem leib,
vnd vmb sich nit vást gróß, vnd sein dúrr vnd dúrch rótt vnder
25 dem antlitz vnd an den pácken. Vnd sein aúch gewónlich pra n
an dem leib vnd ánderswo, vnd dóch nit alle. Der cólericús geleich=
et sich dem pláneten Mercúrio mit seiner natur vnd aúch Satúr=
no vnd aúch iren zaichen, das ist der wider, der leo vnd der
Schutz. Vnd dises seý gesaitt von den vier Complexiann.
[30r] {Abb. Aderlass213}
Hernach volget, wie man mit fr=
ewde vnd auch mit wolmút lassen
schull z der aderen
ES chúmpt dick vnd
5 offt also, dás ain sch=
ad alt ist An dem leib
oder aúff ainer seitten.
So soll man lassen aúff der se=
lben seitten so dy s cht ne ist 10 oder ain ander geprechen oder
schmertzen. Ban es dan wár
in der lencken seitten, so soll man
lassen an der rechten seitten. Oder
widerumb auch chúmpt es offt
15 von gewonhait, das etlicher
mensch swindelt vnd in amá=
cht vallet, só er lasset. Dem sol
man vor gúete wúrtzell geben,
213 Zwei Figuren: Arzt mit sitzendem Patienten beim Aderlass.
321
ee das er lasset, als Galie=
20 nús spricht. Es spricht a ch Constantin s, das alt le t albég s ll
en lassen, wann sy gessent vnd dy Júngen vnd dý starcken vor essens.
Etlich haben auch dick vnd als starcks pluet, so man dý aderen aúff
thút, das es nit gen will von der dick wégen. Dý selben schúllen auch
vor paden vnd wanderen, ee dann dás sý lassen. Gálienus spricht, wer da
25 hat ain chalten mágen, der scholl nit vill lassen an den armen nóch an
den fúessen. Der aderen an den armen der sein fúnff, zwó median dý leber
ader, dy miltz áder vnd dý haúbt ader. Man scholl aúch mércken vierr
ding an dem lassen, gewónhait, dás alter vnd dý chráfft dés leibs
vnd dés menschen, vnd z welcher zeit man lassen sch ll: so dy zeitt 30 vber haiss ist vnd vberchált ist, so soll ma nit lássen. Man soll aúch nit
lassen, wan der man zw Iungk ist. Er soll aúch vber fúnff tág alt sein
vnd wann er aúch chúmpt vber funfft vnd zwainczig tág, so soll man
auch nit lassen. Man soll aúch an sechen dy gewónhait, wann aýns chú=
mpt in das alter vnd hat sich nit gebéntt des lássen, so soll es aúch nit
35 anheben an dem alter. Dye sich aber nit gewént haben vnd sein starck,
dý múgen lassen. Aúch soll man aller maist ansechen dý chráfft des men=
schen. Jst er alt vnd amáchtig, so soll man wenig vnd seltten lassenn.
Jtem ist dás plut an dem menschen dés ersten swartz, so laß mann es
gen pis es rott varb werd. Ist es aber dick, so lass man es gen pis daz
40 es dúnn werd, dóch nit als lang, das dem menschen chain kranck=
hait daúon chóm. Jtem wie man das pluet versuchenn schull
MAn soll das pluet versuchen áuff der czung. Ist das pluet súess, so
ist es ain czaichen, das es woll gede t ist. Jst es aber pitter als ain gall vnd swartz, das ist ain pósses plúet. Man scholl es aúch
[30v] versuchen, wan es gestát mit dem gesmáck. Smeckt es vbell, so ist es ain
zaichen, das daz pluet vnrain ist. Hat es aber ainen gúten gesmáck, so
spricht Galienus, das der mensch gesúnt seý. Jtem von lassen, welcher
mensch das thún soll vnd welcher nit vnd im verpóten sey
5 DEr214 maister galienus spricht, das von lassen chummet grósserr
schád vnd vnfrumet sere dem leib, der es nit zw rechter zeitt
thút, vnd wann es im nót ist, so pringt es im grossen frúmen. Ist
214 Vermutlich Verschreibung: Her statt Der.
322
aber dir sein not, das soltu also erkennen: deyne glider sein dir swár, vber
allen deinen leib hastú hitz vnd der harm ist dir rótt vnd dick vnd deyn
10 púlss ist snel vnd gross, vnd ist dir vorn an der stýren wee. Ist es aber,
das sein ain mensch nit pedorff vnd ist máger, so ist es im schád vnd
velt davon in grosse súcht. Vnd sólt aúch wissen vor allen dingen: wirt
ain mensch kranck von lassen, so soll man im nit lassen, wann es hát des
plútes ze wenig. Birt es aber stercker von dem lassen, so soll man ým
15 offt lassen, wann es hat des pluetes z vill. D solt auch wissen, das man nit lass aýnnem kind, das peý zechen Iaren sey vnd aynnen alten
mann, der von nátur chált ist, der nit plúet hát. Hat er sich aber gew=
éntt vnd ist kranck an dem leib, so soll man im mit kopffen lassen. Man
soll aúch nit lassen, bann es zw hais ist. Wann so switzt der men=
20 sch geren vnd nýmpt man im das plúet, so wirt der mensch kránck
davonn. on gesuntten le tten nd andern, wann dý lassen sullen oderr nicht
MAister auicenna spricht vnd schreibt zwo zeit In
dem Iar, das ist in dem Glentzen vnd in dem herbst, vnd seýn
ausgénomen von anderen zeitten z lassen. Ges ntten leútten
25 soll man lassen an aynem liechten tag z der tertz zeit, pis sich der leib
gerainigt von den spaicheln des múnds vnd der násen. Es verpe t der maister Almansor, dás man nit schúll lassen in gár haisser zeitt
nóch in gar chalter zeitt. D solt wissen: wer gefallen oder geslagen
wirt, der scholl z hant lassen, das das pluet nit peý im sterbe.
30 Iung leut schullen lassen, wann der mann new ist vnd z n mpt. Man
soll wissen, an welchem taill der geprechen ist, daran soll man nicht
lassenn. D solt a ch d s wissen: wer d s aderlassen vbergett Vnd dás pós plúet pey im peleibt, der gewint dás gicht oder den
ritten óder er géwint fléck An dem antlitz óder er wirt aússetzig.
35 Darumb ist lassen g et, der es z réchterZeit th et. Hienách stet geschriben, in welchem zaýchen es wesunderlich gút lassen ist
vnd czw welchen glidern man nit lassen schúll, das dan das selbig zaychen pedewt
WAn215 dw lassen wild cz der aderen, so soltú merck=
en, das da sein vier zaichen, die da gúet sein zw lassen. Das
40 Ist der Bider, die wág, der schútz vnd der wassermann. Auch seýnn
215 Vermutlich Verschreibung. In der Handschrift Man.
323
[31r] vier gemayne Zaichen, dye sein weder guet noch pós: der Crebs, dy Iungkfráw,
der stainpock vnd dýe visch. Vnd sein auch vier zaichen, dýe sein pós: das ist
der Óchs, der scorpian, dye zwiling vnd der leo. In disen zaichen es z e máll pós ist zw lassen. Auch huet dich, das d nit lassest z dem glid, 5 das daz selb zaichen pedewt, wann dý maister sprechent, dás és gar
sorglich seý. Der wider pedewt das haúbt, der ochs den háls vnd dy kelen,
der zwiling dý arme vnd dý hent vnd dý schúltern, der Crebs dýe prúst,
den magen vnd dý rippen, dý nýeren vnd auch dás miltz vnd aúch dýe lu=
ngell. Der leo, der hat das hertz vnd dý seitten vnd aúch den rúcken, dýe
10 Iungkfraw den paúch vnd das ingewaid. Die wag dý lentt vnd aú=
ch den nabell, der scorpian dý scham, der schutz dý diecher, der stainpo=
ck dý knýe. Der wasserman dý schinpain, dye visch dy fúes, als dan
in diser figúr hernach gemált stet. D solt a ch mercken, in wélch=
em czaichen der mann lauffet vnd in welchem mónad, wan des menschen
15 leib ist getaillet. Jst, das d an dem taill icht lassest, wan da von k
mpt grosser schaden aýntweders grosser langberiger schád oder der
gach tod. D solt warten, das d nit wúnt werdest in dem selben tail
oder z der selben zeit, so der man darin la ffet. Item h et dich, daz
dw nicht lassest, wann sich der mann ne enzundet an dem himell oder
20 wan der man ist funff tag vor oder nách. Es seý dann gar sere not,
so m gst lassen cz aller Zeit in dem Iarr. Hýe hin nach sagett es
Von vier lassen in dem iar, an den pesunderlich gúet lassen ist, als dy natur=
lichen maister schreiben, der soll man woll eben wár nemen
ES ist zw wissen, das vier lássen: ist oder sein in dem iar, an den es
25 pesunderlich guet ist zw lassen. Der erst tag an sand Bla=
sy tág, der ander auff sand philipp vnd sand Iacobes
tág in dem máýen, der drit tag nach sand Bartholomeus
tág, der vierd an sand martans tág. Auch túen ain taill maister
darcz sand valenteins t g Vnd auch sand steffans t g in denn
30 weinachten. Vnd also weren der lass tag sechs. Dar zw so schreibt
vns der maister Bartholomeús in dem púch Centiloquio, dás
ain ýeder mensch, der vber zwainzig iar ist alt, der soll lassen
in den nách geschriben tágen: Der erst der sechczéchent tag in
324
dem mértzen an dem réchten arm von des gehóren wegen. Der an=
35 der ist der ainlifft tág im aprill an dem lencken arm von dés ge=
sichtz wegen. Der drit tág ist der fúnfft oder der sechst dés maý=
en an aynem yedlichen arm vmb dés febrés wegen. Auch huet
dich ze lassen aúff den XXV tág des mertzen vnd aúff den ersten
tag des Aúgsten vnd aúff den dritten herbst mónad an dem le=
40 sten tág. In disen dreýnn tagen Soll man weder menschen noch
[31v] {Abb. Tierkreiszeichenmann 216}
[32r] Viech lassen. Auch soltu wissen, das all aderen, dý da gend zw dem haubt, dýe
mag man lassen nách essens vnd aúch all aderen der pain vnd der fues
soll man nách essens slachen. Aber all ader der armen sol man nuchtern
lassen. Jtem von dem nútz der láß merck hin nách
5 ES ist zw wissen von dem nútz der láss. Jst dý lás ain mýnderung
póses pluets, das da nýmbt alle pósse vberflussikait póser
feuchtikait in dem menschen. Dauon scholl yeder mensch zw der
aderen lassenn aintweders von der vólle wégen des plúts
oder von der poshait wegen der feúchtikait. Vnd soll man d s z
10 zwain zeitten thuen in dem iar, darvmb das man peý gesunthaitt
peleib vnd nit mer oder sein voriger préchen mag vber werden: das
ist in dem glentzen vnd in dem herbst. In den zwain zeitten dý menschn
aller maist werden siech, vnd aúch in dem Glentzen vmb dy ostern, so nympt
das pluet z e, so soll man lassen fur d vberflussikait des pl ets. An dem
15 herbst soll man lassenn fur dý pósen feuchtikait des leibs.
Jtem von dem nútz der lás, was prechens der mensch davon ledig wirt, merck hin nách
ITem dy lass ist ain anfanck der gesunthait vnd kumpt dick, das der
mensch grosser kránckhait abchumt von lassens wegen. Es macht
im auch guete gedachtnus vnd auch guet sýnne vnd temperirt ainem
20 das hiren vnd mácht im warm das márck in den painen. Wáren
auch ainem dy óren verschoppt, dás thuet es im aúff vnd rainigt aýnnem
den magen vnd vertreibt im dý tráckhait vnd rainigt im dý plateren vnd
m cht in w ll de en vnd m cht im ain senffte red vnd sterckt im sein syn
216 Nackte männliche Figur mit über den Körper verteilten Sternzeichen.
325
vnd myndert im sein trawm vnd lengert im sein lebenn.
25 Jtem zw welcher zeitt dý lass verpotenn sey
DAs ist auch gar woll zw wissen, das dý maister schreibenn, das dýe
lass zw aller zeit verpóten ist. Das ist, wan der man ist funff
tag vnd zechen tag vnd XV tag vnd XX tag vnd XXV tag. An disen
tagen Sóll man pey nichte lassen, wann dý maister haben dý tág gehaisn
30 dý siechen tag. Vnd als vill dy maister schreibent, so sein etlich menschen
gestorbenn dauon, das sy zw vnrechter zeit vnd lauff des Mánnen z
der ader habent gelássenn. Jtem wie man fur ain yedlichen gepresten zw
der ader lassen schull
DEr maister Almansor spricht, dás die menschen, dý da gros aderen
35 haben vnd rótt lewt sein, dý sullen lassen zw der ader, wann sy
habenn pluetes ze vill vnd vill feúchtigkait. Wer den atenn vn=
sanfft zeucht, der soll lassen an dem lencken arm z der meng aderenn. Jst dir an der réchten seitten wee oder an dem leib, so soltu lassen an der
leberen ader an dem rechten arm. Jst dir wée an dem rucken, so lass an
40 der rúck aderen oberthalben der lenden. D soltt a ch wissen, das daz lass
eýssen grósser soll sein in dem wintter dann in dem Súmer. Dw solt wissen,
[32v] das man soll lassenn in dem Súmer an dem rechten arm vnd in dem wintter an dem
lencken arm. Merck aúch, wann d z der adern wild lassen, so schneid galgant
in den múnd vnd schlind dý spaicheln in dich. Dás wéhaltet dir das gút pluett.
Vnd das póß pluet das get von dir. Vnd darnach so d gelassen hast, so huet 5 dich vor vbriger hitz vnd vor haissen stúben vnd auch vor vbrigem essen vnd
trincken. D solt auch vbrigs liecht vermeiden vnd den lufft vnd an der s n
nen z gen, wann es swéchert dy aúgen vnd plendet sere, vnd darnach soll
man zimliche fre de haben vnd frolickait. Das westerckt den leib vnd all
leblich geist, dý der mensch hát in dem leib. Auicenna
10 Nw merck hernach geschriben, wie man ain yedliche aderen lassen schuld, nd rz e
es nútz vnd gút seý, das vindestu auch in geschrifft hie, vnd an yetweder ader sun=
derlichen vnd wo dw lassen wild, das suech nach der zall diser geschrifft
DIe erst aderen an der stýeren ist gúet fur ainen swaren schmertzenn
des haubtz gelássen vnd fur ámacht, vnd der ain tóbig hiren hatt,
15 vnd dem das ha pt alle zeit wée th et vnd a ch nicht woll
326
geschláffen mág.
DIe ander aderen: Nw petrácht vnd merck: Zwó aderen, die gend von dem
schlaff von paiden seitten des haubtz. Die soll man lassen fur dy gesúcht
der óren vnd fur den fluss der aúgen.
20 DIe drit aderen: Item z o aderen an dem hýndernn haúbt, dý soll man lassen,
dem das hiren gespaltenn ist vnd fur das flós des hirens vnd fur
all gesúcht des hauptes.
DIe vierd aderen: Zwo aderen vnder der zúng, dýe soltú frúe lassen fur das
flós des hauptz vnd auch gepresten der zend vnd geswern des hirns
25 vnd der kelen vnd fur dy huesten vnd aúch fur den gesmáck des múnds.
DIe fúnfft ader: Jtem ain ader vnder dem kynne, dý ist guet gelassen fur
dy geschbulst der wang vnd dem dý prúst geswollen sein vnd fur
den flus der n sen vnd a ch f r d re denn. DIe sechst ader: Item Zwó aderen vnder dem hals, dý schóll man lassen fur
30 dy geswúlst der kynpácken vnd fur vbriges rótzen vnd auch fur
den gepresten des hertzen.
DIe sibent ader: Item zwó aderen vnder dem gúemen sein gúet gelassen
fur d e pe len des antlitz vnd fur den grint. DIe acht adern: d ader auff dem da men soll man lassen fur das ge
35 súcht des haubtz vnd fur den pluet ganck vnd fur dy pewllen vnd
ander presten dés haubtz.
DIe ne nt ader: Item d mittleren aderen an paidenn armen, dy soltu lássen
zw dem hertzen vnd z der l ngell vnd z dem miltz vnd zw
den n eren vnd z dem tem. 40 DIe zechent aderen: Item z o haubt aderen aúff yedlichem arm vnd ha=
yssent Cepalica217 vnd haben den namen von dem haubt, vnd leýt
[33r] obnen in dem arm. Vnd wirt sy recht geschlagen, das ist guet fur dy faúlnus
des haupts vnd z dem hertzen vnd fur dý zacher der aúgen vnd fur allen sch=
mertzen der prúst. Vnd dy soll man sláchen auff sand ambrosy tag.
217 In der Handschrift steht Epalica, hierbei handelt es sich um eine Verschreibung, gemeint ist die vena cephalica
(Vene am Oberarm).
327
DIe aindlefft ader: zwo mittell ader haissent zw latein dý median vnd ligent
5 enmittell vber dy arme. Ber sy recht slachen kan, so macht sy dy wuntten
haill vnd ist auch gút fur das hertzen laid vnd pringt den menschen zw
vill chlúeghait vnd ist aúch gut fur allen smértzen der glider vnd des mag=
ens Vnd der rippen vnd der seitten. Dý soll man lassen an sand larentzen tág.
DIe zwelfft ader: Item z o ader an etweder seitten des arms vnd haist
10 Epatica218. Vnd wer sy récht sláchen chann, so ist sy guet fur all faulnus
vnd smertzen der lebern vnd der rippen vnd auch des mágens vnd des
miltz vnd fur das fliessent plúet aús der násen vnd fur allen gepresten
der nasen vnd stechnus in der seitten. Dý soll man lassen in dem maýen an
des heilgen Creutz tág.
15 DIe dreýczéchent ader: Die miltz ader hat den dón von dem miltz vnd
von der lungell. Dy las fur dy feule vnd fur das hertzen stechen vnd
fur dy posen fewchtikait vnd fur dy swáre des atems. Dý man slachenn
mag, wan man will.219
DIe vierzechent ader: Jtem zwó ader vber dý lenden sein gút gelassenn
20 fur allen gepresten des gemachtz vnd des stains in der platern
vnd gailen in den nyeren vnd fur dý pewlen vnd wassersucht vnd fur
das gesúcht des rucken.
DIe funffczechent ader: Jtem ain ader auff dem nábell ist gút gela=
ssen fur das flós des paúchs vnd fur dy geswúlst der gemácht
25 vnd fur das gicht vnd fur den grimmen vnd den harm staynn.
DIe séchczechent ader: Jtem aýn ader vorn aúff dem Zagell, dý soll
man lassen fur das paradeis vnd fur den reyssenden stain vnd fur
den zwang der gemácht vnd fur dý wassersucht.
DIe sibenczechent ader: An dem Zágell vnden ist ain ader, dý sol man
30 lassen fur den grimmen vnd fur dý geswulst der gemácht vnd
fur dy wassersucht.
DIe achczechent ader: Jtem z o ader an yet eder seitten der schinpain
sein guet gelassen fur dý wássecht220, ob sý von der pláterenn
218 Gemeint ist die vena hepatica (Lebervene). 219 Die Satzstellung ist verdreht: Dý mag man slachenn, wan man will.
328
ist, vnd fur dy zertemmrung der ader vnd fur dy máselsúcht, dávon der
35 mensch sein várb verleust. Dý wirt im wider.
DIe Ne nzechent ader: Jtem zw ader vnder den kn en an paiden pa
ynnen, dý soll man lassen fur das wee der dermen vnd grymmen
des paúchs vnd fur dý geswulst der paýnn.
[33v] DJe zwainczigest ader: Jtem zwo aderen obnen an den knoden auff paid=
en painen, dy soltu lassen aúff paiden paynnen fur dy platern vnd
fur dy raúden der painnen.
DIe XXI ader: Jtem zwo ader inwendig dem wádell, dý sein gút gelassen
5 fur das gésúcht vnd fur ander gepréchen dés leibes.
DIe XXII ader: Jtem zwó aderen an paiden enckeln sein gúet gelassen
fur den sandt in der plateren, der von den lenden chumpt. Vnd són=
derlichen fraúen ist és gút, dý nit gerainiget sein Nách der gepurt
vnd den dy ir zeit nit enthan.
10 DIe III. ader: Jtem z o adern pe den knodenn a swendig an paiden pa
ynnen sein gút gelassen fur dý gesúcht des rucken, der lenden,
der nýeren, dés ingewaides vnd fúr geswéllen vnd fur der vnnatur=
lichen gelider an fraúen vnd an mannen vnd fur hindernús des
harms vnd soll man da dester dicker lassen vnd nit vill.
15 DIe XXIIII ader: Jtem ain ader aúff der grossen zechen, dý soll man
lassen fur das flos der aúgen vnd der aúgsweren vnd flecken
vnd sweren peý den paynnen vnd fur den stain vnd fur dy fisteln
an den schinpain vnd w ain fra ir zeit nit h t. DIe funff vnd ader: Jtem z o ader, d haissent Sabsaka, d e
20 soll man nicht slachen, wánn wer sy slecht, dem get dý seel lachent aús.
DIe XXVI ader: Jtem zwó ader an yetweder seitten an der klaýnnen
zechen sein gut gelassen fur das gesucht der lenden, der plater
Vnd der múeter Vnd fur das paradeis vnd ander poß flús.
DIe XXVII ader: Ain ader an dem ende des rúcken, dy soll man lassen
220 Eventuell Schreibfehler, gemeint ist vermutlich ‚Wassersucht‘. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 50r/
S. 109) wassersucht.
329
25 fur das gesúcht der Lenden. Vnd stercket aúch.
DIe XXVIII ader: Jtem zwó rúck aderen zwischen den claýnen vingern
an paiden henden sein gút gelassen fur ain schoppen der prúst
vnd da fur, wan ains nit lustet zw essenn, vnd fur dy gesucht
vnd fur alle pose ding des miltzs.
30 DIe XXIX ader: Jtem ain ader aúff dem élpogen auff paiden ar=
men, dý soltú lassen fur alles gesucht des haubtz vnd fur
das flos der aúgen vnd fur das gesúcht der óren.
DIe XXX ader: Jtem ain aderen an dem réchten arm haisset púl=
matica, dý soltu lassen fur dý húesten. Vnd fur als wee des hertz=
35 en vnd auch der leberen.
DIe I ader: Jtem z o aderen an paidenn armen, haisset dy ain
dy leberen ader vnd dy ander dy miltz ader. Dy sein gút gela=
ssenn fur das zittern. Vnd aúch des miltz vnd fur den vberlauff
[34r] Der gallen auff dy leber vnd fur dy galle der gállen vnd fur das gesúcht
des rucken. Vnd der rippen vnd der seitten. Vnd aller glider vnd auch fur vbe=
rig pluetten der nasenn vnd fur den ritten. Vnd fur als zitteren soll man sy la=
ssen in dem maýen, vnd sein aúch alczeit gút gelassen in dem Iar.
5 DIe XXXII ader: Jtem zwo ader an den wangen, dy soll man lassenn fur
dy raúden vnd den grint vnd fur schebig des antlitz vnd fur
das weyeln der aúgen.
DIe XXXIII ader: Jtem zwó ader in der krúmppe der óren sol man lassen
fur das weiblen, vnd ist aúch gút fur das schútten des haúpts.
10 DIe IIII ader: z o aderen hinder den óren soll man lassen fur dy pl=
ateren des antlitz vnd fur das gesucht der zend vnd fur des
mundes gebrestenn.
DIe XXXV ader: Jtem dye ader auff der násen, dye soltú lássenn fur
das flós des haubtz vnd aúch der nasen vnd der aúgen.
15 DIe XXXVI ader: Jtem Zwo ader in den winckeln der augen neben der
nasenn, dy soltu lassen fur den nebell der aúgen vnd aúch fur das
flóss der augenn.
330
[34v] {Abb. Badehaus221} Nw merck furbas von dem padenn, wie das swaispad guet seý vnd auch wasser=
pad vnd wie man sich halten schull, ee das man in das pad gett oder auch
in dem pad vnd auch nách dem pad
ES schreibt vns der maister aquaro also: So man padenn will oder
5 scherpffen, so soll der man sein in dem abnémen. Dw solt dich auch hu=
etten, das d chain glid per rst Mit chainem eyssen, zw lassen
noch zw scherffen, so der man ist in dem zaichen, das dann dem
selben glid zw gehort. Ber paden will, der soll paden, wann der mann
ist in dem wider oder im scorpian oder im visch oder im schútzen
10 oder im stýer oder in der Wag oder im Crebs. Hali, der maister, spricht:
Man schull in káýnne haissen zaichen in dý pad stuben gen als in dem leo,
in der Iungfrauen, in dem zwiling vnd in dem stainpock. Es spricht
auch auicenna vnd galienus, das nyemant in dy pad stuben schúll gen
oder in chain wasserpad, so er geessen hat z hant, dy speys sey dann
15 vor verdewt als vmb dy vesper oder frúe nach der preým zeit, ee dás
dy vngede t speis lauff in d glider vmb vnd vmb. Auerrois der mai
ster spricht, es chomen grós siechtágen davon. Aúch soll der mensch
vor z st ell gen, ee das er in das pad get. Es spricht auch ga=
lienús, das dy pósen máterie réochent in dy glider von dem pad
20 vnd wirt hert in dem menschen vnd mácht den menschen faúl in dem
leib vnd faúlt dy glider. Auch soltú ain wenig dich ergen, ee das du
pádest. Es spricht auicenna, das aynn yedlicher mensch máslichen
[35r] soll paden, das nicht zw hais noch z lang se , wan dý zwaý wekrencken vnd
hitzigent zw sere. Vnd wer maslichn padet, dem pringt das pád natúrlichen
hitz vnd gúete feuchtikait. Chain mensch soll chalten wein nóch pýer noch
wasser oder ander, das chalt sey, trincken in dem pád. Ban das wekrenckt
5 dý glider schedlichen. Es spricht Auicenna, es schúll nyemant nach dem pad
pfeffer oder zwifell oder knofflách oder was da sere hitziget, wan es pr=
ingt dieticam, das ist daz abnemen an dem leib. Nyemant soll aúch nách dem
pad essen gróbe speis als rintfleisch oder sweinen fleisch nóch gesaltzenn
fleisch oder zw hant an den lufft gen, d s der leib nit z kalt werde. 10 Dw solt dich warm halten nach dem pád, vnd wann dw in dy pádstu=
221 Zwei Figuren: Badehausszene.
331
ben gést, so soltú nit an dem ersten grósse hitz leiden, dan ýe warm vnd
yee wermer soltú paden vnd doch nymer zw hais. Vnd solt deinen leib ze
dem ersten, wan d ger stest, erwermen, krátzen vnd nit vill reden no=
ch schreyen. Vnd wan dw zw dem ersten switzest vnd dich gereibest,
15 so soltú dich pégiessen mit wásser, dás nóch kelter ist. Wann es spricht
auicénna, dás dw nach dem chalten wásser, nach dem pád das nit zw
kalt sey, das d auff dich sch test deine glider zimlichen erkulet, vnd
wirt des leibes chráfft gesterckt vnd weleibt dy naturlich hitz in dem
leib vnd mácht dás der swais, der von dem hertzen was aúsgangen,
20 vnd der vnder der haút lag vnd nit heraús mócht, das der heraus=
gen múes darnach an dem petth. Vnd wann d dich wegeussest vnd
aus dem pad wild gen, so soltu deinen leib mit aynem waichen
túech trúcken machen vnd das selb vmb dich sláchen vnd dich warm
pedecken vnd peschaidenlich vnd darnach warm halten. Es spricht aúi=
25 cenna vnd almansor, das daz pád, wan man ordenlich padet, als dann
hinnách geschriben stet, pringt dem leib guete feuchtikait vnd thuet
dý glider nutzlichen aúff vnd ráinigt den leib auswendig vnd verswent
ain taill der speis vnd der p sen m terien, der du z vill hast, vnd ver
treibt dy wint in dem leib vnd mácht schlaffen. Auch list man, das daz
30 pad máchet den magen dester páß nútzen dy speis vnd vertreibt wee
vnd m cht vest in dem leib, das d nit zw vill scheissest. Aber padestu
anders, als dan hie vor geschriben stet, so wenympt es dir dein hertz
vnd also encz ndet, d s d vnderweillen in ámacht vallest vnd aúch
manigem menschen sein leben churtzet vnd mácht grób feúchtikait
35 in dir gen an dy st t, da es z schaden ch mpt. Kayn mensch scholl pa=
den, der dy súcht hat oder chain hitzigen presten. Da von spricht der
maister auicenna. Dýe menschen, dý vberladen sein mit vbriger feuchtikait,
das es im dý haút versper vnd verschópp, dás chain swais daraus
nit chómen mag, vnd laúfft aús aynnem glid in das ander. Vnd dar=
40 vmb so ist nit gúet padenn mit vollem leib, wan dy speis peleibett
[35v] vngede t vnd tailt sich in dy glider, dauon siechtagen choment. Der maister
galienus spricht, das man paden schull nach dem der leib geraini=
get ist worden, als der mensch z st ell bégett vnd gehármet hat, daz
der pós támpff vnd wint dauon gang. Ban welib der in dem leib, so
5 chóm der mensch in gezwang in dem leib, vnd darumb, wer vest wéll
332
werden in dem leib, der mág nách essens in dás pad gen vnd lang
darin ligen. Ist, dás er ain meloncolicus oder ain flégmaticús ist, óder
ist er aber ain Colericus óder ain Sangwineus, so mág er chuel
paden an grós hitz. Will er aber vást switzen, so soll er mét trincken
10 vor dem pád. Auch spricht auicenna, wer padet an streichen222, dás der
dester gesúntter seý. Dauon soll man sich húetten vor vbriger hitz vnd sól
nit lang in dem pád ligen. Es sey dan, dás er ain vaister mensch seye,
wann dise ding máchent ain menschen chránck vnd hitzig. Man soll
aúch nit vill chaltz tránck in dem pad nemen. Daúon der maister
15 auicenna spricht, das nách der hitz stee dy haútt offen, da der sw=
ais aús chúmpt. Bann da get dy chelten wider ein von dem tránck
vnd treibt ir chrafft aús den glideren in dás hiren. Wann das hiren
geit allen anderen glideren verstantnús, ban dy fúnff synne darin
ligen. Das hertz geit allen glideren hitz vnd ernert dy seell vnd au=
20 ch das leben. Dye lebern geit allen glideren feúchtikait ze trinckenn,
wann sy zeúcht alles getranck aús dem mágen an sich. Dý nýeren ge=
bent dý gepúrt, wánn der same von allen glideren in sy chúmt, vnd ku=
met dan an dý stát, das frucht dáuon chúmpt. Czwaý lócher sein
in dem múnd: in das ain get dy speis vnd das getranck in den má=
25 gen. Jn dás ander gett der lufft vnd der atem zw der lúngen, wann
sý als ain pláspalck ist ob dem hertzen, das sy den chalten lúfft an
sich zeúcht vnd dý hitz mit dem atenn wider auszeúcht. Vnd das
loch hat ain vberlid vnd als man dás essen vnd das tranck an sich
zeucht, so th t sich das lidlen wider z , vnd wann man den aten
30 wider áuss zeúcht, so thúet sich dás lid wider aúff, das der me=
nsch nit erstick. Der magen ist als ain haffen, das sich dy speis se t vnd de t darIn vnd ist als ain k ch vnd ain knécht, wann er all=
en glideren dý speis vor perait vnd raichet. Aber dý feuchtikait
hat er von dem trincken. Dy hitz vnd das feur hat er von dem
35 hertzen vnd aúch von der lebern.
Jtem von dem lassenn mit denn kópphenn in dem pad, dás man aúch nént scherphenn
Alles das lassenn, das man thuet auswendig an dem
leib mit den kopffen, das ist guet, wan man wirt dauon nit
222 Bedeutung unklar. Eventuell Schlag-, Hiebverletzung. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 47r/S. 103): wer
paden will an straiche.
333
als kránck áls man von adern lassenn thúet. Man soll merckn, dás
40 vill stett sein an dem leib, da man dý kópff oder dy hórner hinn
[36r] setzen soll als an dy stirenn fur den gepresten der augen vnd fur den swindel
vnd fur dy swáre vnd kránckhait des haupts. Man setzt sy aúch vnder das
kynne fur dy geswulst des múnds vnd des zand fleisch vnd fur den sch=
mertzen der zend. Man setzt aúch dý kopff auff dy prúst vmb des atens
5 willen. Man setzt sy aúch an dy stat der leber, das dy leber nit verprinne vnd
erstick vnd dúr werde. Man sétzt sý aúch an dý stát des mágens vnd wer=
met in vnd zeúcht dý vnrainigkait von im. Man setzt sy aúch auff dy
Riste vnd aúff dy hant fur allen geprésten des haubtz vnd der augenn
vnd der óren. Man setzt sý aúch enmitten an den rucken fur allen presten
10 des rucken vnd der aúgen. Man sétzt sy aúch aúff dy lenden vnd auff
dy arspackn fur dy geswére vnd fur dy raúdigkait vnd fur dy pósen
plateren vnd fur dy vbrigen vnlaútrikait, dye dy nýeren krencken.
Man setzt sý aúch an dý diecher pey dem gemacht fur allen gepresten
des harms. Man setzt sy aúch an dý enckeln der fues fur dy pewlen vnd
15 fur das swindeln des haúbts vnd fur das vensteren der augen, das da
dick pluet ziechet. Man setzt sy aúch vnder den nábel fur den gep=
resten des stechens vnd der permueter. Man soll auch wissen, ee man
dy kópff setzt, so soll man den leib rainigen in dem pad vnd dún mách=
en vnd dýe fues pis an dy knýe in warmen wasser paden, das mácht
20 das pluet subtill vnd dúnn.
[36v] {leer} [37r] {Abb. Harnschau223}
Merck hie, wie sich der mensch gesúnt schúll halten mit dem stúelgang
ES spricht Auicenna der maister, wer sich gesunt well halten
mit dem stuelgang, der soll dye ding nutzen, dy in zw stúelle
machent gen vnd vást saichen vnd die im swais pringen vnd
5 nit die ding, dy im schédlich sein, also das er den leib albeg rainig=
en schóll cz réchter zeit. Vnd welche ding dás sein, dás frag ay=
nen weissen artzt, der dein natur vnd deinen gepréchen woll erke=
nne. Vnd darumb pedórff der mensch, dás er etwan pade, dás er
223 Zwei Figuren: Arzt oder Apotheker mit Patienten bei der Harnschau.
334
switzen wird, so get von im vill feuchtikait, als ich dan hin nach
10 will sagen, vnd wederff vnderweillen wóll lassens. Vnd wann gút
seý zw lassen oder schád, dás will ich hin nách auch sagen. Es spricht
auicenna, dás der mensch chain vberflussige póse natur pey im schull la=
ssen peleiben. Wann wer das wasser lang pey im trégt vnd nit von
im lát gen, dem wirt der stain in der pláteren. Wer aber mácht
15 zw stúell gen vnd es nit thuet, dem chóment dy siechtagen dauon,
das er cha m zw st ell m g gen, vnd werden im wint in dem leib
vnd póse vbergalle vnd wirt vnlustig zw essenn. Vnd darvmb, wan
dw nicht macht z stuell gen, so soltu etzwas némen, dás dich leich=
tiglich zw stúel treib an allen schaden mit aines weissen artz rátt.
20 Nw merck hie vonn dem kristýrenn
ES spricht Almansor der maister, das Cristyren ain edle ertzneý
seý vnd treibt vill von dem menschen póser máterien. Vnd sprechen
[37v] auch andere menschen, das es rainige dy nyeren vnd dy plateren von dem
magen vnd dy oberen glider vnd vertreibt Colera, das ist dý vber gáll.
Es spricht Almansor der maister, so ain mensch dý speis newsset, dy in
z st ell m cht gen n ch ayns weissen artztes rat, dy dann gúet dar=
5 z ist vnd zw rechter zeit, das dás dy obrist ertzneý ist vnd sy ainen
menschen zw gesunt pey gesunthait wehalten. Das sein aber dye le t, dye des wedurffen mer dann ander le t, dye dann gros vnd vaist sein vnd
dy da sere vill speis vnd obs essen, vnd dý wénig lauffen vnd arbai=
ten. Es spricht auicenna, das der lufft dir nútz vnd gúet ist, der da
10 nit vermischt ist mit chainem tampff oder prunst, der da von pósem
oder von vill wassers auff get, von lacken oder súnst vermischt ist
mit raúch óder mit pósem gesmáck vnd der da nit enplosset ist mit=
ten oder zwischen perg vnd maúr. Jst aber, dás dw den nit geha=
ben mácht, so soltu in machen mit gúeten kreútern in deinem haws,
15 dý wóll smecken. Vnd dye derren vnd prennen vnd guten wein maslich trin=
cken, der da guet ist fur dy nebell vnd fur pósen lufft vnd auch wan
der lufft dick ist vnd wan es regnet oder dy wasser tempfent. Vnd
ist aúch gúet, das ain mensch newsset in speis vnd in getranck ain
wenig esseichs. Vnd wesunder wann der lufft vergifft ist in ainem ge=
20 maynen sterben, ist nutz den lewten, dy da hais vnd durr sein, das
335
dy trincken gersten wásser vnd súnsten wasser. Bisset, dás póser vnd
dicker lufft, spricht auicenna, vnd gróbes wasser des menschen speis
in dem leib verderbt vnd aúch dem menschen an seinem leib vnd an se=
ynnem gemúet schadet. Jtem ain andree ler von ertzney
25 DV scholt auch mercken, das etlich menschen ertzneý sere furch=
tenn, also das sy ir nit nemen geturren. Den soll man sy ge=
ben haymlich in ainem múes oder in wasser oder in weú224
es seý. Es sein aúch etlich menschen, die dý ertzney zw hant verliesent,
den soll man pátzprot fur den múnd haben vnd in zúe réden in mani=
30 gerlay hant weiss, hintz das sy dy ertzney wehaltenn.
Merck hin nach von dem lufft, wie der vnser natur vnd krafft auff enthaltet vnd auch
westercket
NVn merck, das vnder allen den dingen, dy vn=
seren leib nerten, das nutzest ist vnd das schedlichest sey, vnd
ee vnnser nátur verwandelt dann der lufft, wann wir den lufft stati=
35 glich mit dem múnd vnd mit den náslochern ziechen in dý lungell
vnd in das hertz vnd in dý aderen, dy darInne gend. Vnd wirt der lufft
mit den leblichen geisten dés plúets ingemischet, wann warvmb
ist der lufft g et, so erfre et er d natur. Ist er aber p ss, so m cht er sy swáre vnd traúrig. Der gúet lúfft ist aúch den sýnnen gúet,
[38r] {Abb. Winde225} Soll Venus Mercurius Lúna Saturnus Jupiter Mars Austner Bester Norter Ostner
[38v] ban alles, das werch vnser synn, was sich also zw wegreiffen zeuchet vnd
224 in weú es seý – vermutlich Adverb ‚worin‘, ‚in was‘. Parallelüberlieferung Kodex Schürstab (fol. 54r/S. 117) oder
wo jnn es seÿ. 225 Kreisschema: Figur mit Stock und Rosenkranz im Zentrum, eingefasst im Kreis der Planeten (beschriftet) und den
vier Himmelsrichtungen = Winde (beschriftet), symbolisiert durch Gesichter.
336
auch zw frólikait, das wirt ee vnd volchomenlicher volbrácht in guetem sch=
ónen lufft dan in trueben sw ren lufft. N merck, das Galienús spricht,
es ist nit allain offenwar von naturlicher lére der maister. Wir sechen es von
5 taglicher erweisung, das da truebung vnd grobikait swáres lufftes vnseren
synn vnd vnseren muet weswerent vnd vnser frolickait wetruebet. Vnd waz
das mensch thuen scholl, das im das nit als w ll z synnen ist in truebem
vnd swaren lufft, als sám wár der lufft schón vnd lautter.
Jtem mérck hie hin nach von den vier wintten vnd auch von irer chráfft, wie
10 sy vnser natur vnd leben auff enthalten In diser gegenburtigen zeit
NVn merck von der natúr der wint. Also der erst wint der haisset óstner
wint, der chumbt von orient, da die Súnn aúffgett vnd ist hais
vnd trucken, vnd ist geren schón vnd ist durch chalt. Der selb hát
z yettbeder seitten ainen wint. Dy selben wint sein gesunt vnd guet 15 vnd verendern vnseren leib nit, dauon ichtz z achten ist oder se . Der ander wint haisset Austner. Der wint ist chalt vnd feucht vnd get dúrch
die wuesten Ramoneý226 vnd durch dy lant, dy da warm vnd feucht sein.
Der wint thuet vnser nátur sere wee, wann er mácht vill swais vnd túet
dem haupt wee vnd mácht swindell in dem haubt vnd thuet siechen men=
20 schen wee. Vnd wás an vnserem leib ist, das verwirret er vnd thuet ka=
ynn gúet, wan er máchet zw stuell gan. Der dritt wint haisset wester.
Der chúmpt dáher, von dannen dy súnn nýder get, der hát auch ze yettbe=
der seitten ainen wint, der ist hais vnd feucht von seiner natur227 vnd ist doch
albeg peý vns warm. Das maynt er nicht anders, wan das er dúrch warms
25 land gett vnd thúet aúch vnser natúr nicht wée, daúon ichtz zw achten
ist. Der vierd windt haissett Nortwint. Der chúmpt von nórtbegen land, der
ist chalt vnd trúcken. Der hat auch z yettweder seitten ainen wint, dýe
chomen auss chalten vnd durch chalte land vnd dúrch gepirgische land
vnd thún vill gutz vnd vbels. Er thuet gúet, wan er starck machet all
30 vnser lebliche chráfft. Er tuet auch vbell, wann er macht dý huesten vnd
das flóss, vnd thuet alten leúten wee vnd máchet eng vmb dy prúst.
Vnd also wan dy wint chóment, der mag sich darnach halten warm,
wann es ist nútz das man sy erkenne vnd sich dárnach regir vnd halte.
226 Gemeint ist ‚Rumelien‘. 227 Fehlendes Substantiv eingefügt.
337
[39r] {Abb. Alltagsszene228} Merck hie von den zu vallenden des Synnes gedencken, wie dy vnsern synn vnd
auch gemuet oder vernufft verwandelnn
NVn gét ain Capittel an von denn zúuallenden gedencken des gemútz
vnd auch des synnes, da maint er vnnser vernúfft vnd will sagen,
5 wie vns zóren vnd leiden dés Sinnes sere hindert vnd entirret vnd
auch zw feuchten pringet vnd hindert dy werch des sýnnes. Vnd darumb
was schadpár ist als zóren vnd traurikait, dás sol man meidenn mit
vleýs, wann warumb zoren vberhitziget alle glider des leibs von der hitzig=
ung vnd pebegung des hertzen vnd schendet alle wérch der pesschaidenhait.
10 Vnd darumb wás von sýnnen edell ist, dás soll sich huetten vor allen sachn,
dý zóren vnd traurigkait pringen. Es sey dann, das man von réchtkait
zurnen mues, als sam wann man v nrecht ding siecht oder hórt. Es ist aú=
ch z wissen, w s tra rikait th et oder schaffet Tra rikait, vnd vnm
ett derret den leib vnd keltent yn, vnd darumb mácht es máger vnd derret
15 von kalter sach wégen vnd zwingt dás hertz zesámen vnd vinstert vnd
mácht es swáre vnd dy leblichen geist in dem plut vnd in der natur vnd
máchet dy synne grób vnd máchet den menschen verczágt vnd vnbe=
súnnen guet ding zw volbringen vnd zw pegreiffen. Vnd darvmb ist
traúren zw vermeiden, als verr man es von widerbartikait gelassenn
20 mag. Wér aber mit vill sorgen vnd wékúmernús vnderczógen ist, der sol
dick fre den vnd tr st suchen, d s es d n tur erleiden múg, also das man
mit erberen vnd frólichen dingen vnd trostnus dy chráfft vnd dý synne
múg wider pringen. Auch merck mit allem vleis, so man geessen hát, daz
man nit sytze gegen krefftigem feúrre oder in vbrigen haissenn stúbenn,
[39v] ban kranck leút werden pald irer kréfft peraubt von grosser hitz vnd werd=
ent dauon amáchtig. Ain mercklichs redlichs wort spricht Auicenna, dás
nichtz sey in der welt, das als sere gebúnscht werd als gesúnthait vnd
pegert werd von den, dý in der welt sein. Ban wenn wir dy gesúnthait nit
5 haben, so freút vns weder gúet nóch kúnst nóch fréwnt noch kainerlay
wollust der welt. Vnd wan man gesúnt ist, so gedenckt man kayns
228 Drei Figuren: Eine Figur mit Bart auf einer Bank sitzend, die von zwei Musikanten mit Saiteninstrumenten unter-
halten wird.
338
dings mýnderer wann, wie man dise gegenburtige gesúnthait vertribe. Also
das nýemant seinen múetwillen nit lásset durch gesúnthait willen vnd
wár dóch pesser, dás man dise gegenburtige gesunthait wéhielt, wann
10 mann chann dy verloren gesunthait Jn langer zeit nit wider pringen, dýe
in v ppikait vertriben ist. Vnd da mit ain ende. G t der herr vns in sein
reich sende Amenn.
339
19 Glossar
Das nachfolgende Glossar in alphabetischer Reihenfolge soll eine Hilfestellung zum Textverständ-
nis darstellen. Es beruht v. a. auf eigenen Texterfahrungen und auch den damit verbundenen
Schwierigkeiten während der Bearbeitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Übersetzt wurden Fachausdrücke sowie heute nicht mehr geläufige Begriffe, die Probleme bei
der Sinnerfassung aufwerfen können. Dabei wurden nicht alle Facetten der angeführten Begriffe
erläutert, sondern nur jene Bedeutungsaspekte, die für den vorliegenden Text relevant erschienen.
Die Begriffe sind alphabetisch angeordnet und in der Schreibweise der Lesefassung wiedergegeben
(aufgelöste Abbreviaturen sind in Klammern gesetzt). Die Belegstelle steht in runder Klammer. Die
Quellenangaben des jeweiligen Nachschlagewerks werden in Form von Kurztiteln bzw. Siglen in
eckige Klammern gesetzt. Die vollständigen bibliografischen Angaben finden sich im Literatur-
verzeichnis, Anmerkungen in den Fußnoten.
agrimonien (10ra14–15) – Ackerkraut, Odermenning (Agrimonia eupatoria) [B 182 odermenie, agrimonia]
ainlifft (31r35) – elfter (Zahlwort) [BMZ Bd. 1, Sp. 985b–988a einlift]
albeg (19v07) – immer, überall [B 6 alleweg]
amácht (30r16–17) – Ohnmacht [B 184 onmacht, amacht]
anvechtigung (29v03) – Versuchung, Nachstellung [B 9 anfechtung]
anheben (17r27) – sich aufmachen, anfangen, beginnen [B 9 anheben]
anváchen (13v21) – anfangen [B 8 an fachen, anfangen]
artickel (22v20) – Artikel, Inhalt, Abschnitt [B 13 artikel]
Argel (24r04) – Orgel [B 184 orgeln, argeln]
atenn (32r36) – Atem [B 14 atem]
aúgprágen, Pl. (23v13) – Augenbraue [B 232 überpraw]
aúgst (27r39) – August [B 17 august, augst, ougest]
a gswer(e)n, Pl. (33v16) – (Augen-) Schmerzen [Lexer Bd. 2, Sp. 1362–1365 swern]
ausgangk (13r25) – Gehörgang, Stuhlgang, Ausbruchstelle pathologischer Flüssigkeiten an der Körperoberfläche [B 18 ausgang]
Austner (38r) – Südwind, südl. Himmelspol [B 19 auster]
ayndlefft (18v30) – elfter [B 66 elf, ainlef]
Bester (38r) – Westwind [B 247 westener]
betánien, Pl. (03ra15) – Betonie/Schlüsselblume (Betonica officinalis L.) [B 31 betonie]
Brachmon (04v01) – Juni [B 40 brachmond]
Búrtz (03ra10) – Würze, Kraut, Wurzel [B 253 wurz]
340
buest (20r03–04) – wüst, unschön, unsauber, häßlich [B 253 wüst]
Cancer (21v28) – Krebs [B 139 cancer]
cháuffmanschátz (15v23) – Handel, Handelsgut [B 140 kaufmanschatz]
chlueg (04rc01) – klug, fein, schicklich [B 146 klug]
chundig (18r29) – klug, schlau, kund [B 153 kündig]
churtzbeill (19v16) – Vergnügen, Unterhaltung [B 155 kurzweil]
co(m)plex(e)n (21v34) – Konstitution, Temperament, Wesen [B 148 complexion]
colera (29v18) – Ruhr, einer der vier Körpersäfte (gelbe Galle) [B 147 colera]
Colerici, Pl. (23v16) – Choleriker [B 147 colericus]
decrétist (21r05) – Vertreter des kanonischen Rechts [B 49 decretist]
derr(e)n (37v15) – dörren, trocknen [B 50 derren]
de en (32r23) – verdauen, entleeren [B 48 dauen]
dick (32r17) – oft [B 52 dick]
diech (31r11) – Oberschenkel [B 52 diech]
dón (33r15) – Ton, Name229, Spannung, Elastizität (in der technischen Sprache der Medizin), Farbe [DWB Bd. 21, Sp. 749–752) don, Ton]
drús (13v06) – Drüse, Beule, Tumor [B 58 drüse]
d ebig (20r02) – diebisch, heimlich [Lexer Bd. 1, Sp. 429 diep-lich]
eben (12v03) – eben, sachgemäß, deutlich, genau [B 61 eben]
e (07rc03) – Ehe [B 62 Ehe]
eingent iar (12v05) – beginnen, anfangen [B 64 eingehen]230
elich (14v27) – ehelichen, heiraten, gesetzmäßig [B 62 ehelichen]
enckel (33v06) – Knöchel am Fuß [B 68 enkel]
enpern (20r05) – entbehren, mangeln [DWB Bd. 3, Sp. 492–495) entbehren, entberen
enthan (33v09) – zurück und aufrecht halten, aufhalten, enthalten [Lexer Bd. 1, Sp. 569–571 ent-haben, enthân]231
entirre (39r05) – irren, vom rechten Weg abbringen, hindern, hemmen, stören [DWB Bd.10, Sp. 2163–2167 irren]232
entwegen (12v17) – ein-, unterteilen [B 69 entwegen]
entwischen (01rc04) – mit Salbe bestreichen [B 65 entstrich]233
epich (01ra13) – unter diesem Namen sind unterschiedliche Pflanzen bekannt: Sellerie, Efeu, Petersilie, wilder Sellerie [Adelung Bd. 1, Sp. 416 –417) Eppich/Äppich]234
erberg (15v31) – ehrbar [B 70 ehrbar, erberig]
Erchtag (19r) – Dienstag (bair.-österr.-schwäb.) [B 72 eritag]
229 Kodex Schürstab Glossar S. 192: don – Ton, Name. 230 Kodex Schürstab (fol. 17v/S. 44): Der erst ist das eingend iar. Gemeint ist der Jahresbeginn/1. Januar. 231 Kodex Schürstab (fol. 50r/S. 109): di ir czeit nit haben zu rechten zeiten. 232 Kodex Schürstab (fol. 54v/S. 118): entteret. 233 Kodex Schürstab (fol. 7r/S. 23): ensalbe. 234 Baufeld führt unter dem Lemma eppich nur Sellerie an (S. 69).
341
ergen (34v21) – sich erholen, sich kräftigen [B 71 ergehen]
esseich (37v19) – Essig [B 74 essig, ezzeich]
etwen (20v05) – manchmal, zuweilen, früher [B 75 etwan]
fistel (33v17) – Fistel, Geschwür [B 90 fistel]
flegma (16v14)– Phlegma, einer der vier Körpersäfte (Schleim) [B 91 flegma]
fraidig (18v08) – keck, vermessen, kühn, übermütig [B 95 freidig]
fr ch (29r31) – lebhaft, kühn, dreist [B 95 frech]
furbas (34v01) – weiter, fortan [B 98 furbaß]
g chm tig (26v11) – jähzornig, ungestüm [B 100 gächmüetig]
gaile (33r21) – Neigung einer Wunde zur Bildung wilden Fleischs [B 104 geil, gayle]
galgant (32v02) – Galgant (Heil- und Gewürzpflanze) [DWB, Bd. 4, Sp. 1164–1173 galgan]
gebant (16r27) – Kleidung [B 111 gewand]
gechochet (02ra10) – zubereitet, gegart [B 146 kochen]
geding (17v20) – Bedingung, Vertrag [B 102 geding(e)]
geleich (16r23) – ebenmäßig [B 112 gleich]
gelemen (01rc05) – lähmen [B 159 lemen]
gelider, Pl. (13r03) – Gliedmaßen, Bewegungsapperat, innere Organe [B 113 glid]
geluar (25r04) – gelbfarbig [B 105 gelb, geel, gel]
gelust (16r27) – Lust, Begierde, Wollust [B 116 gelüst]
gemacht (16r06) – männl. Genitalien [B 106 gemächt]
gemaincklich (11ra16) – gewöhnlich [B 106 gemeiniglich]
gemay(n) (14r10) – gemein, gewöhnlich, niedrig [B 106 gemein]
gepresten (13v09) – Gebrechen, Krankheit, Beschwerden, Mangel [B 102 gebrest(en)]
ger sten (35r13) – rasten, (aus)ruhen [B 187 rasten, resten]
geren (07rc02) – verlangen, begehren, streben [B 107 geren]
gerste (05rc01) – Gerste [B 108 gerste(n)]
geschamig (13v30) – schamhaft [B 202 schämig]
geschant, Pt. Prät. (06rc04–05) – schelten, tadeln [B 204 schelten]
geschick (17r11) – Anordnung [B 108 geschick]
geslicht (23r03) – gerade, schlicht, aufrichtig, unbedeutend,schlecht [B 207 schlecht, schlet, sleht]
geswer (13v06) – Geschwür [B 109 geschwer]
getemperirt, Pt. Prät. (24v03) – in die gehörige Mischung bringen [DWB Bd. 21, Sp. 250– 252 temperieren]
geturstig (29v10) – (toll-)kühn, wagemutig, verwegen [B 110 geturstig]
gewainet, Pt. Prät. (14r32–33) – knochig [B 102 gebein]
gewalt (14v07) – Gewalt, Macht, Herrschaft [B 110 gewalt]
geytig (26v13) – gierig, geizig [B 104 geitig]
342
Glentz (29r15) – Lenz, Frühling [B 105 gelentz]
Graú (15r13) – Graf [DWB Bd. 8, Sp. 1698–1712 Graf]
griess (16v08) – Harngries, Harnsteine, Sand [B 115 grieß]
grimmen (33r25) – Kolik, kolikartige Schmerzen [B 115 grimmen]
grint (32v33) – Grind, Hautausschlag [B 115 grind]
grippen (07rc04) – greifen, bekommen, fühlen [B 115 greifen]
haffen (35v31) – Topf, Gefäß [B 118 hafen]
halsen (24r04–05) – unarmen, liebkosen, lieben [B 125 helsen]
harm (30v09) – Harn [B 121 harn, harm]
harmen (35v03) – harnen, urinieren [B 121 harnen, harmen]
Harpffe (24r03) – Harfe [B 121 harpf]
hawen (05rc01) – Hacke, Haue, hauen, hacken [B 121 haue(n)]
haymlich (37v27) – geheim (Vulva, Menstruation, Koitus) [B 124 heimlich/heimlichkeit]
herbst monad, der erst (07v01) – September [DWB Bd. 10, Sp. 1071–1072 Herbstmond]
herbst monad, der ander (08v01) – Oktober [B 125 herbstmon(t)]
herbst monad, der drit (09v01) – November [B 125 herbstmon(t)]
Heymon/Heymonad (05v01/06ra05) – Juli, Heumonat [B 126 heumoned]
hoch (18r24) – hoch, erhaben, vornehm [B 129 hoch]
hoffertig (18r23) – hoffärtig, stolzes anmaßendes Wesen haben [DWB Bd. 10, Sp. 1667–1668) hoffärtig]
hoffirer (21r05) – Höfling [B 130 hofierer]
h lerpl e (05ra14) – Holunderblüte [DWB Bd. 10, Sp. 1757–1758 Holler]
h rner, Pl. (35v40) – Schröpfkopf [B 211 schröpfhörnlein]
hornung (01ra06) – Februar [B 131 hornung]
hubschait (28v08) – Schönheit, fein gebildetes Wesen [B 132 hubscheit]
h aff (10rc03) – Hüfte [B 132 hüft]
hundisch(e) tag, Pl. (06ra20) – Hundstage, heiße Tage von 23. Juli bis 23. August [HWA, Bd. 4, Sp. 496 Hundstage]
icht (31r15) – Indef. Pron.: (irgend) etwas, nichts Adj.: irgendwie [B 134 icht]
Ienner (27r34) – Januar, Jänner [B 136 jenner]
ingewaid (15v07) – Eingeweide [B 111 geweid]
inwendig (15v06) – innerlich, innerhalb [B 135 inwendig]
irczen (02rc04) – heilen [Lexer Bd.1, Sp. 705 erzen(en)]
keren (05ra05) – kehren, richten [B 142 keren]
knoden (18r04) – Knöchel (Hand/Fußknöchel) [B 146 knoden]
knofflich (10ra14) – Knoblauch [B 146 knoflach]
k pff k pphenn (35v40/35v36) – Schröpfkopf [B 148 kopf]
343
kr tz(e)n (35r13) – kratzen, kraulen, zusammenraffen [B 150 kratzen]235
kresen (04ra12–13) – geweihtes Öl, Salböl, (lat. chrisma) [B 151 kresen, krisam, crisem]
kresen (26v21) – Bedeutung unklar, möglicherweise von mhd. kiesen – mittels der Sinne unter-suchen/prüfen, messen, erkennen [Adelung Bd. 2, Sp. 1571–1572; DRW kiesen]236
kristýrenn (37r20) – Klistier [B 145 klistere, cristire]
krúmppe (34r08) – Krümmung [B 72 erkrumpen]
kru(m)p (13r28) – krumm, schlecht, verkrüppelt [B 152 krumm, krumb]
kúmpóst (11ra13–14) – Eingemachtes, v. a. Sauerkraut; Kompott [Lexer Bd. 1, Sp. 1770 kumpost; B 148 compost]
kúndig (29v23) – klug, listig, schlau [B 153 kündig]
kytzen (01ra08–09) – Zickleinfleisch [Lexer Bd. 1, Sp. 1591 kitz-vleisch]
lab (02ra14) – lau [B 155 lab]
lacke (37v11) – Lache, Pfütze [B 155 lache, lackhe]
lactuck (05ra08) – Lattich, Gartensalat [B 157 lattich]
landfarer (14v33) – Landstreicher [Adelung Bd. 2, Sp. 1884–1885 Landfahrer]
lang berig (15r17–18) – lange lebend, lange andauernd [B 156 langwerig]
lassen (01ra17) – zur Ader lassen [B 157 lassen]
laúffer (14v33) – Läufer, Bediensteter, der den Wagen zu Fuß begleitet [Adelung Bd. 2, Sp. 1935–1937 Läufer]
laútt(e)r (04ra19) – rein, klar, hell [B 157 lauter]
lechen (18r15) – Lehen, Darlehen [B 158 lehen, lechen]
ledig (14r28) – frei [B 158 ledig]
legist (21r05) – Lehrer des weltlichen Rechts [B 158 lat. legist]
leicht (24v15) – leicht(fertig), gering(fügig) [B 159 leicht]
leo (06rc03) – Löwe [B 160 lewe]
lepsen, Pl. (13r06) – Lippen [B 158 lefze]
liecht (30v25) – hell [B 161 licht, liecht]
linden (04ra07) – lind, mild, angenehm machen, leichte Besserung bei Krankheit bringen [B 161 lind]
listig (22v17) – klug, schlau, geschickt [B 162 listig]
lucifer (23v11) – Morgenstern, Venus [B 163 lat. lucifer]
luna (16v28) – Mond [B 163 lat. luna]
lungell (33r16) – Lunge [B 163 lunge, lungel]
lustlich (22r05) – anmutig, vergnüglich, schnell [DWB Bd. 12, Sp. 1347–1348 lustlich]
lutzell (24v07) – klein, gering, wenig [B 163 lützel]
magt (24v26) – Jungfrau [B 164 magd]
235 Im Kontext des Bades vielleicht abreiben, damit die Durchblutung angeregt wird. 236 Kodex Schürstab (fol. 21v/S. 52): kisen.
344
man(n)hafftig (15v31) – mannhaft, tapfer [B 165 mannhafft]
manig (25r06) – viel, manch [B 165 manig]
máselsúcht (33r34) – Aussatz, Lepra [B 171 miselsucht, musilsucht]
maýensmáltz (04ra14) – aus Maibutter ausgelassenes Fett [B 164 maienschmalz]
mayestat (23v27) – Majestät [B 167 mayestat]
median (03ra16) –Ellenbeugevene (lat. vena mediana)[B 79 vena mediana]
melancoli(a) (17v08) – Melancholie, einer der vier Körpersäfte (schwarze Galle) [B 168 melancoli(a)]
meridies (13v13) – Süden [B 169 lat. meridies]
milt (22v11) – mild, lieblich, reich(lich) [B 171 mild]
miltikait (24r02) – das Mildesein [DWB Bd. 12, Sp. 2213–2216 mildigkeit]
misseling (22r02) – schlechter Erfolg, Unglück [Lexer Bd.1 Sp. 2167–2168 misse-linge]
mon (13r21) – Mond [B 173 mond, man, mon]
múes (37v27) – Mus, Brei, Heilmittelbrei [B 175 mus, muos]
múll (18r40) – Mühle [B 174 muellner]
mút (16v26) – Sinn, Gemüt, Absicht [B 175 mut]
mútwil (16r26) – Übermut, Willkür [B 176 mutwill(en)]
mu(n)tz slachen (18r37) – Münzen schlagen [B 174 münz]
myn(n)ern (25v23–24) – mindern, weniger werden [B 171 mindern, minnern]
nachent (19v21) – beinahe, nahe [B 176 nachend, nahent]
naglein (09ra14) – Nelken [B 178 negelein]
newssen (37v03) – genießen, einnehmen, essen, trinken [B 180 nießen, nyesen]
Norter (38r) – Nordwind, nördlicher Himmelspol [B 180 nordener]
nýd(er) (21v26) – niedrig, weiter unten (Westrichtung/Abstieg eines Sterns) [B 179 nider/nieder-gang]
nýderlegu(n)g (21v11) – Niederlage [B 179 niederlegung]
nyessen (06rc05) – einnehmen, verzehren, genießen [B 180 nießen]
obrist (37v05) – übergroß, übermäßig, überflüssig, wuchernd [B 233 übrig, obrig]
obs (37v08) – Obst [B 182 obs, öbsz]
obwendig (13r08) – außen, außerhalb [B 20 auswendig]
occident (14r09) – Westen [B 182 lat. occident]
ochss (28r19) – Stier [B 182 ochs(e)]
orient (15r08) – Osten [B 184 lat. orient]
Ostner (38r) – Ostwind [B 185 ostener]
páder (26r06) – Bader (Heilkunde, Badestube) [B 21 bader]
345
paradeis (33v23) – Paralyse, Lähmung, Apoplexie, Gichtbrüchigkeit [B 22 paralyß, parlas, barley] vermutlich Verballhornung von Paralyse. 237
páß (35r30) – besser, ehr, eher [B 23 baß]
pátzprot (37v29) – geröstetes Brot [Bunsmann-Hopf 1 (ab)bä(h)en, be(h)en]238
pelay s. polay (07ra16)
peltzen (03rc01) – pelzen, veredeln, propfen [B 27 peltzen]
peraten (11rc01) – versorgen [B 28 beraten]
permueter (36r17) – Gebärmutter, Uterus [B 29 permutter]
peschaidenlich (35r24) – vernünftig, angemessen, zurückhaltend [B 29 bescheiden(lich)]
pesund(er)lich s. sund(e)r (02ra22)
pfart (21r04) – Pferd [B 33 pferd, phardt]
pfintztag (19r) – Donnerstag [B 33 pfintztag]
pibnelle (03ra16) – Bibernelle (Pimpinella saxifraga L.) [B 34 bibernell, pipenelle]
plater (10ra18) – Harnblase [B 36 plater]
polay (02ra20) – Polei/Flöhkraut (Mentha pulegium L.)[B 38 polei]
póss (14v26) – schlecht, falsch, ungesund [B 39 böse]
préchenhafftig (21v29) – gebrechlich [B 41 bresthaftig]
prelat (15r14) – Prälat (kirchliches Amt) [B 41 prelat]
preým (34v15) – Prim (Gebetszeit, ca 6 Uhr)[B 131 hore]
prunst (37v10) – Glut, Hitze [B 43 prunst]
púebereý (29r20) – Büberei, Schlechtigkeit, Schurkerei [B 43 buberei]
púlmatica (ader) (33v33–34) – Lungenvene (lat. vena pulmonalis)
rátich (02ra13) – Rettich [B 192 rettich]
rauch (01rc01) – haarig, aus Fell/Pelz bestehend [B 88 rauh]
raúttn (2ra20) – Weinraute [B 188 raute]
ra nen (24r05) – flüstern [B 188 raunen]
regnirn (18v20) – regieren (lat. regnare), sich verhalten [B 190 regieren]
réochen (34v19) – dampfen, räuchern, Dampfbehandlung anwenden [B 192 reuchen, rauchen]
re denn (32v28) – Räude (allg. Hautkrankheiten) [B 188 räude]
ring (28r37) – leicht, leichtfertig, gering, schlecht [B 194 ring]
Riste (36r08) – Rist (erhöhter Teil der Hand oder des Fußes, Hand-/Fußrücken) [Adelung Bd. 3, Sp. 1130–1132 Rist]
ritig (01ra08) – fiebrig [DWB Bd. 14, Sp. 1078–1081 rittig]
ritten (30v34) – Ritten, kaltes Fieber mit Schüttelfrost [Adelung Bd. 3, Sp. 1131–1133 Ritten]
róslat (17r36) – rosig, rosenfarbig [B 195 röslocht, roslat]
237 Kodex Schürstab Glossar S. 193: parley, parleis, pareley – Apoplexie, Gichtbrüchigkeit 238 Kodex Schürstab (fol. 54r/S. 117): den sol man ein schniten protz prennen.
346
rótte korner, Pl. (13r33) – rote Körner, Gerstenkorn239
Sabsaka (33v19) – vermutlich Unterschenkelvene (vena saphena)240
saichen (37r04) – harnen, urinieren [B 215 seichen]
salua (05ra14) – Salbei (Salvia officinalis L.) [B 199 salbei, savei, salvi]
samen (14r15) – sammeln, vereinigen [B 199 sammeln, samen]
sanguis – Blut, einer der vier Körpersäfte [B 132 sanguis]
sangwiney, Pl. (21v18) – Sanguiniker [B 200 lat. sangwineus]
sat(ur)nus (18v27) – Saturn [B 200 lat. saturn(us)]
schad (15r23) – schädlich, verderblich, bedauerlich [B 201 schad]
schaden (02rc04) – Schaden, Verletzung, Erkrankung [B 201 schaden]
schalckhafftig (16v27) – nichtsnutzig, verrucht, boshaft [B 202 schalkhaft]
scham (09rc04) – Scham, Genitalien [B 202 scham]
scheff (07rc05) – Schiff [B 206 schiff]
scheitter, Pl. (10rc01) – Holzstück [B 204 scheit]
schelch (26r04) – seitlich, schräg, schief [B 204 schelch]
scherpffen (34v05) – schröpfen [B 211 schröpfen, schrepfen]
schieren (10rc04) – scheren, barbieren [B 205 scheren]
schier (15r20) – sogleich, bald [B 206 schier]
schiesser (21r05) – Bogen-, Büchsenschütze [B 206 schiesser]
schiffúng (17r30) – zur Schifffahrt gehörend [DWB Bd. 15, Sp. 104–106 schiffung]
schirmen (23r06) – beschützen, sich decken, fechten, [B 207 schirmen]
schlachen (14r20) – schlagen, töten, kämpfen [B 207 schlagen]
schlinden (32v03) – schlingen, (ver)schlucken [B 208 schlinden]
schnódes (15r29) – dünn, schütter [B 209 schnöde]
schoppen (33v27) – (ver)stopfen [B 210 schoppen]
schutz (10rc03) – Schütze [B 212 schütz]
semlich (8ra13) – ähnlich, so beschaffen [B 199 sämleich]
Seniff (10ra14) – Senf [B 217 senf]
Septembrion (14v08) – Norden [B 217 lat. septentrio]
se re (13r33) – fressende Krankheit am Kopf, bes. in der Ohrengegend [B 219 sirei]241
se den (35v31) – sieden, wallen, kochen [Lexer Bd. 2, Sp. 911–912 sieden]
siech (11rc03) – krank [B 218 siech]
siechtag (13r09) – Krankheit [B 218 siechtag]
slachen (31r35) – zu Ader lassen [B 207 schlagen]
239 Kodex Schürstab Glossar S. 193: korn – Körner, Gerstenkorn. 240 Kodex Schürstab (fol. 50v/S. 110): salsota. 241 Kodex Schürstab Glossar S. 195: sire – allg. Hautkrankheit.
347
slecht (21r01) – schlecht, schlicht, direkt, aufrichtig [B 207 schlecht]
sneiden (07rc04) – operativ entfernen [B 19 ausschneiden]
sóck (01rc01) – Socke, kurzer Strumpf [RhWB Bd. 8, Sp. 179–180 Socke]
sorcklich (25v11) – besorgniserregend, bedenklich [B 221 sorglich]
specerey (02ra17) – Gewürz [B 153 kuensel]
speýen (06rc05) – speien, bespeien, verspotten [B 222 speien]
spring(er) (16r25) – Springer, (Seil-)Tänzer, fahrendes Volk [Adelung Bd. 4, Sp. 240–241 Springer]
Stain stossen (23r06) – Sportart, ähnlich heutigem Kugelstoßen242
stát (14r35) – beständig [B 224 stätigkaytt]
statiglich (22v34) – beständig [DWB Bd. 18, Sp. 2576–2583 stetiglich]
stechen (36r17) – stechender Schmerz (im Auge, Seitenstechen) [B 225 steche]
stellen (23v01) – Blut stillen, zum Stehen bringen, beruhigen, beenden [B 227 stillen, stellen]
stertz (02rc01) – Pflugsterz [B 139 riester]
streitper (21v18) – kriegerisch, uneins, streitsüchtig [DWB Bd. 19, Sp. 1339–1373 streitbar]
stuell (37r18) – Stuhlgang, Darmausscheidung [B 229 stuhl]
subtill (24v08) – klein, fein, genau, gewissenhaft [B 230 subtil]
súcht (30r09) – Seuche, Krankheit [B 217 seuche, süche, B 230 sucht, sücht]
sumtag (12v33) – Sonntag [B 230 sunn]
sunder (07ra11) – besonders [B 220 sonderbar]
Sund(e)r (13v14) – Süden [B 230 sunder]
swaispad (34v01) – Schwitzbad [B 213 schweißbad]
tertz (30v25) – Terz (Gebetszeit, ca 9 Uhr)
tewru(n)g (21v25) – Teuerung [B 50 teure, teuri]
tóbig (32v14) – wahnsinnig, rasend, toll [B 53 töbig]
treyben (13r23–24) – umrühren, reiben [B 56 treiben, triben]
triegen (22r03) – betrügen [B 57 triegen]
ppikait (39v11) – Übermut, Maßlosigkeit, Verschwendung [B 238 üppigkait]
vaisten (23r03) – dick, feist, fruchtbar [B 78 feist]
valcken, Pl. (21r04) – Falke [DWB Bd. 3, Sp. 1269–1271 falk]
vberlid (35v28) – Behälter mit Deckel (Ventil) [B 232 überlid]
vbrig (17r02) – übergroß, übermäßig, wuchernd, überzählig [B 233 übrig]
vechten (13v24) – kämpfen, streiten [B 77 fechten]
véderspill (21r04) – Beizvogel, zum Vogelfang abgerichteter Falke [B 78 federspil]
velt, 3. P. Sg. (11rc05) – fallen [B 76 fallen]
242 Die Illustration fol. 23r zeigt mehrere Figuren bei sportlichen Freizeitaktivitäten, u. a. zwei Figuren beim Stein
stoßen.
348
venster (36r15) – Dunkelheit, Blindheit [B 89 finsterniß]
v(er)driessen (06rc05) – Verdruss, Ärgernis, Unwillen [B 81 verdries]
verjechenn (22r06) – bekennen, verkünden, erzählen [B 82 verjehen]
verleusen (13r22) – verlieren, geschwürig zerfallen [B 83 verlieren]
vernemig (21r02) – verständig, begreifend, vernehmend, anhörend [Lexer Bd. 3 Sp. 186–187 vernemen]
verr (18r19) – fern, weit [B 84 verr]
verschoppen (32r21) – verstopfen [B 85 verschoppen]
versteen (13r07) – verstehen [B 86 verstehen]
versuchenn (30r41) – versuchen, kosten, riechen [B 86 versuchen]
verswenden (35r27) – beseitigen, vernichten [B 85 verschwenden]
verworffen (12v01) – schändlich [B 87 verworffenhait]
vesper (23v12) – Abendstern, Venus [Adelung Bd. 4, Sp. 1192–1193, lat. vesper]
vesper (34v15) – Vesper (Abendgebet, ca. mit Einbruch der Dämmerung) [B 131 hore]
vierhand naturen (28r07) – viererlei243
vleis (12v04) – Fleiß, Sorgflat [B 91 fleiß]
vnbeleiblich (25v28) – nicht dauerhaft [B 234 vnbeleiblich]
vndewt (13r24) – unverdaut [DWB Bd. 2, Sp. 838–840 dauen, däuen]
vnfridsam (13r31) – kriegerisch [B 235 unfrid]
vnfrumen (30v06) – (nicht) nutzen, schaden [B 96 fromen, frumen]
vngelaitig (28r36–37) – (un)lenksam, (nicht) leicht zu leiten [DWB Bd. 5, Sp. 2999–3000 geleitig]
vngeschaffen (20r03) – übel, häßlich, ungestalt [B 235 ungeschaffen]
vngluckhafftig (14r22–23) – unglücklich, ungünstig [B 113 glückhaftig]
vnlauter (26v17) – unrein, undurchsichtig, trüb, verdorben [DWB Bd. 24, Sp. 1123–1126 unlauter]
vnlautrikait (07ra12–13) – der Mangel an Lauterkeit [DWB Bd. 24, Sp. 1124–1126 Unlauterkeit]
vnlustig (37r17) – appetitlos [B 236 unlustig]
vnscha(m)ig (21v32) – ohne Scham, schamlos, unkeusch [Lexer Bd. 2, Sp. 1931–1932 unschamic]
vnsynnig (25v30) – Wahnsinn, Bewusstlosigkeit [B 236 unsinnikeit]
vógler (26r06) – Vogelfänger [B 92 vogler]
vorchtsam (28r31) – furchtsam, gottesfürchtig [B 93 forchtsam]
vormáln (21v16) – vormals, früher, zuvor [DWB Bd. 26, Sp. 1304–1311 vormal]
vrleng (13r32) – Krieg, Kampf, Fehde [B 239 urleg, urleug]
vrleúg (13v23) s. vrleng
wandeln (15r11) – verwandeln, etwas gut machen [B 241 wandeln]
wássecht (33r33) – Wassersucht [B 243 wassersüchtig, wassersichtig]
wechsel (17r28) – Tausch, Handel [B 243 wechsel] 243 Kodex Schürstab Glossar S. 195: virhande – viererlei.
349
wedorffen (01rc01) – bedürfen, brauchen [B 61 dürfen, dorffen]
wegeussen (35r21) – begießen [B 71 ergiessen, ergiezen]
wegriffen, Pt. Prät. (22v19) – erfahren, bewandert, geschickt [B 25 begreifen]
weiagen (07rc03) – erwerben, sich beschäftigen, sein Leben führen [Lexer Bd. 1, Sp. 162–163 be-jagen]
weiblen (34r09) – sich hin und her bewegen, taumeln, schwanken [DWB Bd. 28, Sp. 379–381 weibeln]
weitschaffen (23v15) – Fernweh, Reiselust haben [B 245 weitschaft]
weitschafft (25v15–16) – weiter Raum, Weite, Entfernung [DWB Bd. 28, Sp. 1309 weitschaft]
wekrenck(e)n (35r01) – krank machen, schwächen [B 150 kränken]
werig s. langberig (18r18)
wesund(er) (14r18) – besonders [B 31 besunder]
weú (37v27) – Bedeutung unklar, vermutlich ‚worin‘/‚in was‘ (adverbialer Gebrauch der Instru-mentalform des Pronomens ‚wer‘) [DWB Bd. 29, Sp. 803–808 weu]244
weyeln der augen (34r07) – Beule, Gerstenkorn [Lexer Bd.1, Sp. 288–290 biule] 245
widerfarn (13v06) – geschehen [B 248 widerfarn]
widerbartikait (39r19) – Widerwärtiges, Unangenehmes [B 248 widerwart]
wintermonadt/bintermon (27r41–42/10v01) – Dezember [B 250 wintermonat]
winttusen (03ra13) – schröpfen, Schröpfköpfe setzten [Lexer Bd.3, Sp. 360–361 vintûse(n)]
witib (15v21) – Witwen [B 250 witib]
wollust (39v06) – Freude, Vergnügen, Lust, Wollust [B 251 wollust]
wolmút (30r02) – guter Wille, Wohlwollen [B 251 wolmütigkeit]
wónen (23v09) – wohnen, sich aufhalten, beisammen sein [B 251 wonen]
wúnderlich (26r01–02) – wunderbar, bewundernswert, seltsam [B 252 wunderlich]
wuntten (21v09) – verwunden [B 252 wunden]
wuntten, Pl. (33r05) – Wunde, Verletzung [B 252 wunde]
wurch (25v34) – wirken, arbeiten, schaffen [B 250 wirken, wurchen]
wurcken (14v27) – (be)wirken, tun, beeinflussen [B 250 wirken]
wurtzen, Pl. (08ra11–12) – Pflanze, Wurzel, Gewürz [B 253 wurz]
zacher, Pl. (33r02) – Tränen (pathol. Augenausfluss) [B 254 zaher]
Zagell (33r29) – Penis [B 254 zagel]
zeit (33v09) – Menstruation [B 256 zeitfluß]
zemall (14r21) – ganz, sehr, überhaupt [B 256 zemal]
zend, Pl. (24v14) – Zähne [B 254 zan, zand]
zertem(m)rung (33r34) – Verdauung246
244 Kodex Schürstab (fol. 54r/S. 117): oder wo jnn es seÿ. 245 Kodex Schürstab Glossar S. 191: bilelin, biulelin – Gerstenkorn. 246 Kodex Schürstab Glossar S. 195: zerdeuung – Verdauung
350
zetreiben (14v21) – zerreiben, vermischen [B 258 zertreiben]
zeucht, 3. P. Sg. (32r37) – ziehen, herleiten, beziehen auf, sich bewegen [B 258 ziehen, zeuchen]
zoren (39r05) – Wut, Heftigkeit [B 260 zorn, zoren]
zúuallenden (39r03) – zufällig [Lexer Bd.3, Sp. 1188–1189 zuo vallen)
zw hant (37v28) – sofort, sogleich [B 261 zu handt]
zwierent (14r20) – zweifach [B 263 zwifach]
zwifaltig (15v18) – zweifach, in zwei Teile gespalten, hinterhältig [DWB Bd. 32, Sp. 994–1006 zweifältig]
zwiffel (10ra15) – Zwiebel [B 263 zwiebel]
19.1 Namensverzeichnis
Almansor/Rasus (30v27, 06ra01) – persischer Arzt und Gelehrter Rhazes/Rasis (Al-Razi/Ibn Zakaria), * um 864 – † 925
Aquaro/Averrois (34v04, 05ra01) – arabischer Philosoph und Arzt Averroes (Ibn Rudschd), * 1126 – † 1198
Auicenna (04ra02) – persischer Arzt und Gelehrter Avicenna (Ibn Sina), * um 980 – † 1037
Bartholomeus (31r31) – italienischer Arzt und Lehrer (Bartholomäus von Salerno), 12. Jahrhundert
Canstantinus (09ra01) – vermutlich Constantinus Africanus, (arabischer Arzt und Gelehrter), * um 1017 – † 1087
Galienus (02r03) – griechischer Arzt und Anatom Galenus (dt. Galen), * um 130 – † um 200
Hali (34v10) – persischer Arzt und Chirurg Haly Abbas (Ali ibn Abbas al-Majusi), † um 982–994
Iohann (03ra02) – Johannes (unklar, um wen es sich handelt)
Isajas (08r01) – Esajas/Jesaja (vermutlich Prophet Jesaja AT)
Meste (10ra05) – persischer Arzt und Schriftsteller Johannes Mesue (Yuhanna ibn Masawahy), * um 777 – † um 857
Plato (11ra01) – griechischer Philosoph und Gelehrter Platon, * 428/427 v. Chr. – † 348/347 v. Chr.
Ramoneý (38v17) – gemeint ist ‚Rumelien‘ (Landstriche Thrakien und Makedonien) Seneca (07ra03) – römischer Philosoph und Gelehrter (Lucius Annaeus Seneca), * um 1 – † 65
Ypocras (01ra02) – griechischer Arzt und Gelehrter Hippokrates, * um 460 v. Chr. – † um 370 v. Chr.
19.2 Lateinische Namen der Sternzeichen
Aquarius247 – Wassermann
Aries (13r11) – Widder [B 13]
247 Da die Handschrift unvollständig überliefert ist, gibt es keine Belegstelle für die lateinische Bezeichnung des
Sternzeichens Wassermann, der Vollständigkeit halber ist die Bezeichnung trotzdem aufgeführt.
351
Cancer (21v28) – Krebs [B 139]
Capricornus (17v01) – Steinbock [B 139]
Gemini (03v13) – Zwilling [B 106]
Leo (15r01) – Löwe [B 160]
Libra (16r01) – Waage [B 160]
Piscis (15v19) – Fische [B 35]
Sagittarius (15v19) – Schütze [B 99]
Scorpius (21v34) –Skorpion [B 215]
Taurus (13v10–11) – Stier [B 48]
Virgo (15v01) – Jungfrau [B 92]
352
20 Terminologisches Glossar
Im Zuge dieser Arbeit sah ich mich mit dem Problem der unterschiedlichen Verwendung diverser
Fachtermini konfrontiert. Je nach Disziplin, aber auch innerhalb eines Fachgebietes, sind die Defi-
nitionen eines Begriffs oft unterschiedlich, was zu erheblichen Missverständnissen führen kann.
Daher habe ich mich entschlossen, der Arbeit ein terminologisches Glossar beizufügen, in dem die
von mir verwendeten Begriffe mit der für diese Arbeit benutzten Definition angeführt sind. Ich
hoffe damit, den ‚undurchschaubaren Dschungel‘ der Termini zumindest für die vorliegende Arbeit
etwas gelichtet zu haben.
Außenmotiv: Bei Buchstaben mit Binnenfeld: Besatzmotiv/Besatzornament, das außen am Buch-stabenkörper ansetzt. Bei Buchstaben ohne Binnenfeld sind alle Besatzmotive Außenmotive.248
Basisgraph: Monograph ohne Diakritikum.
Binnenfeld: Das vom Buchstabenkörper umschlossene Feld (bei B, D, O etc.).249
Diakritikum/diakritisches Zeichen: Unselbstständige Schriftelemente über, unter oder an einem Basisgraphen, deren Formenvarianz Punkte, Striche, Häkchen, Kringel etc. umfasst. Das Dia-kritikum steht für ein Merkmal eines Sprachlauts oder für eine besondere Betonung (beispiels-weise Zirkumflex als Kennzeichen der Vokaldehnung). Grafische Funktion kommt dem i-Punkt zu, der zur Unterscheidung ähnlich gebauter Buchstaben dient (c, n. m, etc.).
Morphogramm: Schriftzeichen, das ein (selbstständiges oder unselbstständiges) Morphem ersetzt (Kürzel).250
Illustration: Textbezogene Ausstattung einer Handschrift oder allgemein eines Buchs bzw. Textes mit Mitteln der Malerei, Zeichnung oder Druckgrafik.251
Initiale: (lat. initialis ‚am Anfang stehend‘) Gemäß der lateinischen Bedeutung versteht man unter Initiale jeden Buchstaben am Textanfang, der gegenüber der Textschrift bzw. – sofern vorhan-den – den Satzmajuskeln in Größe und Form herausgehoben ist. Meist versteht man darunter – zugleich – Zierinitiale.252
Initialmajuskel: Vergrößerte, ggf. farblich abgesetzte Initiale, ohne oder mit wenig Schmuck, die am Zeilenanfang bzw. Anfang eines Absatzes steht; meist ganz oder zum Teil eingerückt.253
primäre/sekundäre Initialen: Der Initialschmuck einer Handschrift ist üblicherweise zu Gliede-rungszwecken hierarchisch gestaffelt. Die primäre Kategorie können Initialen in Deckfarben-
malerei sein, die sekundäre Silhouetteninitialen, wie beispielsweise Fleuronné-Initialen, eine tertiäre Initialmajuskeln.
Sekundäre Initialen werden nach ihrer Position im Text unterschieden in Initialmajuskeln, Satzmajuskeln und Versalien.254
248 Vgl. ChristineJakobi-Mirwald: Buchmalerei. Terminologie in der Kunstgeschichte. 3., überarb. und erw. Aufl.
unter Mitarbeit von Martin Roland. Berlin: Reimer 2008, S. 53. 249 Vgl. ebda, S. 52. 250 Vgl. Hofmeister-Winter, Dynamische Edition, S. 357. 251 Vgl. Jakobi-Mirwald, Buchmalerei, S. 21. 252 Vgl. ebda, S. 22 und 49. 253 Vgl. ebda, S. 49.
353
Fleuronné: (frz. fleuronné‚ geblümt‘, frz. fleuron ‚Blümchen‘) Lineares, überwiegend mit der Feder gezeichnetes Ornament auf der Grundlage stilisierter vegetabiler Formen, bisweilen erwei-tert um naturalistisch-vegetabile, figürliche sowie geometrische Elemente.255
Kürzung/Abkürzung: Der Wegfall von einzelnen Buchstaben und Buchstabengruppen zwecks Zeit- und Raumersparnis beim Schreiben wird durch Kürzungsstriche und andere Zeichen ange-deutet. Am häufigsten ist der waagerechte Kürzungsstrich (Titulus planus).
Suspensionskürzung = Wegfall von Buchstaben am Wortende Kontraktionskürzung = Kürzungen im Wortinneren256
Lombarde: Einfache, bauchig gerundete, der Unzialschrift ähnliche Initialform. Meist einfarbig oder abwechselnd blau und rot.257 Der Begriff Lombarde sollte für Initialmajuskeln sowie Satzmajuskeln erst ab der Gotik verwendet werden, da er mit einer bestimmten Formvor-stellung verbunden ist.
Majuskel/Minuskel: (lat. [litterea] maiuscula/minuskula ‚etwas größerer/kleinerer [Buchstabe]‘) Majuskeln (lat. [littera] maiuscula] ‚etwas größerer [Buchstabe]‘ ( Großbuchstaben) sind in
ein Zweiliniensystem eingeschrieben. Minuskeln (lat. [littera] minuscula ‚etwas kleinerer [Buchstabe]‘ (= Kleinbuchstaben) sind in
ein Vierliniensystem eingeschrieben.258
Medaillon: Kleines rundes Bild, das in der Regel in einen größeren Zusammenhang (Initiale, Rah-men) eingeschlossen ist.259
Miniatur: Alle selbstständigen, d. h. nicht an Initialen gebundene figürliche Malereien, gerahmt oder ungerahmt, in der Kolumne oder am Rand.260
Monatsbild: Ganzseitige Darstellung der Monatstätigkeiten und Jahreszeiten, zum Teil mit Tierkreisbildern kombiniert. Bezüglich Kalendarien feste Illustrationsfolge der Monatsarbeiten. Januar: Festessen, Februar: Wärmen am Feuer, März: Baumbeschnitt, April: Gartenarbeit, Mai: Falkenjagd, u. a. Vergnügen der Herren, Juni: Heuernte, Juli: Getreiderente, August: Dreschen, September: Weinpressen, Oktober: Pflügen und Aussaat, November: Schweinemast, Dezember: Schweineschlachten/Brotbacken.261
Rubrizierung: (lat. rubrum ‚rot‘) Überschriften, Paragraphenzeichen, Strichelungen, Unterstrei-chungen in sekundären Initialen, die in roter Farbe ausgeführt wurden.262
Satzmajuskel: Kleine, nur wenig vergrößerte Majuskel am Satzanfang im fortlaufenden Text, häu-fig gestrichelt. Lombarden sind eine besondere Buchstabenform in gotischen Handschriften, die als Initial- oder als Satzmajuskeln Anwendung finden.263
Schlusszeichen (Terminator): Kombination von Punkten und Schnörkeln, die das Textende bzw. Abschnittsende anzeigen. Oftmals auch die et cetera-Abbreviatur, die nicht im heutigen Sinne für das Abbrechen eines eigentlich noch weiterlaufenden Textes steht, sondern als Schlusszeichen (teils in doppelter oder gar dreifacher Ausführung) gesetzt wurde.264
254 Vgl. ebda, S. 49 f. 255 Vgl. ebda, S. 52. 256 Vgl. ebda, S. 45. 257 Vgl. ebda, S. 63. 258 Vgl. ebda, S. 43. 259 Vgl. ebda, S. 77. 260 Vgl. ebda, S. 21. 261 Vgl. ebda, S. 27 f. 262 Vgl. ebda, S. 47. 263 Vgl. ebda, S. 50. 264 Vgl. Schneider, Paläographie und Handschriftenkunde, S. 91.
354
Strichelung: Majuskeln der Textschrift oder Auszeichnungsschriften in Texttinte sind gestrichelt, wenn sie mit roten Punkten oder Strichen leicht hervorgehoben werden.265
Subskript: (allg. Begriff) Formal isolierbares, unselbstständiges Schriftelement unter einem Basis-graphen, dem auf der grafischen, phonologischen, morphologischen oder grammatischen Ebene eine distinktive Funktion zukommt.
Superskript: (allg. Begriff) Formal isolierbares, unselbstständiges Schriftelement über einem Ba-sisgraphen, dem auf der grafischen, phonologischen, morphologischen oder grammatischen Ebene eine distinktive Funktion zukommt.266 D. h., auch Abbreviaturen und Diakritika fallen unter den Oberbegriff des Superskripts, insofern sie sich auf grafischer Ebene über dem Basis-graphen befinden.
Versalien – paläografisch: Allgemein für links ausgerückte, meist nur einzeilige, farblich abge-hobene, ggf. leicht verzierte Anfangsbuchstaben, im engeren Sinn auch nur für ausgerückte Anfangsbuchstaben von Psalmversen. – Fachsprache der Buchherstellung: Gebräuchliche Be-zeichnung für die Schriftart ‚GROSSBUCHSTABEN‘ im Gegensatz zu ‚gemeinen‘ Kleinbuch-staben und in Abgrenzung zu Kapitälchen (‚verkleinerte GROSSBUCHSTABEN mit normal großen Anfangsbuchstaben‘).267
Zeilen-Anschlusszeichen: Verweiszeichen in unterschiedlicher Form (meist winkelförmig, biswei-len verziert): Trennen einen Zeilenüberhang ab, der unter oder (bei bestehendem Leerraum) über der Zeile rechtsbündig eingefügt wurde, anstatt eine neue Zeile zu bilden.268
Zierbuchstaben: Oberbegriff für verzierte Buchstaben, ob sie am Wortanfang stehen (Initiale) oder zu einer Auszeichnungsschrift gehören (Ziermajuskeln).269
Zierinitiale: Oberbegriff für verzierte Initialen, wobei schon der Begriff Initiale allein meist in diesem Sinn verwendet wird. Stehen die verzierten Buchstaben nicht am Anfang eines Textes oder Textabschnittes, handelt es sich um Zierbuchstaben.270
265 Vgl. Jakobi-Mirwald, Buchmalerei, S. 47 f. 266 Vgl. Hofmeister-Winter, Dynamische Edition, S. 359. 267 Vgl. Jakobi-Mirwald, Buchmalerei, S. 50. – Ebenso: Helmut Hiller, Stephan Füssel: Wörterbuch des Buches. Mit
online-Aktualisierung. 7., grundlegend überarb. Aufl. Frankfurt a. Main: Klostermann 2006, S. 348. 268 Vgl. Jakobi-Mirwald, Buchmalerei, S. 48. 269 Vgl. ebda, S. 51. 270 Vgl. ebda, S. 51.
355
21 Literaturverzeichnis
21.1 Primärquellen
Codex 3085. 15. Jh./1475/1475. [Volldigitalisat.] Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Handschriften und Nachlässe. URL: http://archiv.onb.ac.at:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2945848.xml&dvs=1409123188308~253&locale=de&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=1&usePid1=true&usePid2=true [25.08.2014].
21.2 Sekundärquellen
Bergdolt, Klaus: ‚Temperamentenlehre‘. In: LexMa, Bd. 8, Sp. 533–543.
Bischoff, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin: Schmidt 1979. (= Grundlagen der Germanistik. 24.)
Boot, Christine: an aderlaszen ligt grosz gesuntheit. Zur Repräsentanz von Ortolfs Phlebotomie in deutschsprachigen Aderlaßtexten. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur lan-dessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Rei-chert 1993. (= Ortolf-Studien. 1. Wissensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 112–157.
Brévart, Francis B.: The German Volkskalender of the Fifteenth Century. In: Speculum: a journal of medieval studies 63 (1988), S. 312–342.
Brévart, Francis B; Keil, Gundolf: ‚Planetentraktate‘. In: 2VL, Bd 7, 1989, Sp. 715–723.
Crossgrove, William: Die deutsche Sachliteratur des Mittelalters. Bern [u. a.]: Lang 1994. (= Ger-manistische Lehrbuchsammlung. 63.)
Gross, Hilde-Marie: Illustrationen in medizinischen Sammelhandschriften. Eine Auswahl anhand Kodizes der Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte des ‚Arzneibuchs‘ Ortolfs von Baierland. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizini-schen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Reichert 1993. (= Ortolf-Studien 1. Wis-sensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 172–348.
Grotefend, Hermann: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 13. Aufl. Hannover: Hahn 1991.
Grotefend, Hermann: Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 2 Bde. Hannover: 1891–1898. HTML-Version von Horst Ruth. 2004. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/grotefend.htm [27.08.2014].
Haage, Bernhard Dietrich; Wegner, Wolfgang: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit. Unter Mitarbeit von Gundolf Keil und Helga Haage-Naber. Berlin: Schmidt 2007. (= Grundlagen der Germanistik. 43.)
Handschriftencensus. URL: http://www.handschriftencensus.de [27.08.2014].
Heinrich Laufenberg: Regimen der Gesundheit. Iatromathematisches Hausbuch. Michael Puff: Von den ausgebrannten Wässern. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Zürich, Zentralbib-
356
liothek, Ms C 102 b. Einführung zu dem astromedizinischen Hausbuch von Bernhard Schnell. Beschreibung der Handschrift von Marlis Stähli. München: Ed. Lengenfelder 1998. (= Codices illuminati medii aevi. 41.)
Hiller, Helmut; Füssel Stephan: Wörterbuch des Buches. Mit online-Aktualisierung. 7., grund-legend überarb. Aufl. Frankfurt a. Main: Klostermann 2006.
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich: Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Leipzig: Weidmann 1841, S. 323–324. URL: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10800306.html [09.09.2014].
Hofmeister-Winter, Andrea: Das Konzept einer ‚Dynamischen Edition‘ dargestellt an der Erst-ausgabe des „Brixner Dommesnerbuches“ von Veit Feichter (Mitte 16. Jh.). Theorie und prak-tische Umsetzung. Göppingen: Kümmerle 2003. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 706.)
Iatromathematisches Kalenderbuch. Die Kunst der Astronomie und Geomantie. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Tübingen, Universitätsbibliothek, Md 2. Beschreibung der Hs. von Gerd Brinkhus. Introd. to the astrological-divinatory ms. by David Juste. Verzeichnis der Federzeich-nungen, Rubriken und Initien der Abschnitte und Anmerkungen zu den Texten und Bildern von Helga Lengenfelder. München: Ed. Lengenfelder 2000. (= Codieces illuninati medii aevi. 63.)
Jakobi-Mirwald, Christine: Buchmalerei. Terminologie in der Kunstgeschichte. 3., überarb. und erw. Aufl. unter Mitarbeit von Martin Roland. Berlin: Reimer 2008.
Jugbauer, Gustav: ‚Hundstage‘. In: HWA, Bd. 4, Sp. 495–501.
Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Begonnen von Hella Frühmorgen-Voss. Fortgeführt von Norbert H. Ott zusammen mit Ulrike Bodemann und Gisela Fischer-Heetfeld. Bd. 2, Lfg. 1/2. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag Beck 1993, S. 81–82. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/?xdbdtdn!%22hsk%200619a%22&dmode=doc#|4 [27.08.2014].
Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Zuletzt geändert am 15.04.2014. URL: http://karl-sudhoff.uni-leipzig.de/karlsudhoff.site,postext,geschichte.html?PHPSESSID=ntpok2gid2kit8m2pqhibe7o47 [27.08.2014].
Keil, Gundolf: Die verworfenen Tage. In: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. 41 (1957), S. 27–48.
Keil, Gundolf: Prosa und gebundene Rede im medizinischen Kurztraktat des Hoch- und Spätmittel-alters. In: Poesie und Gebrauchsliteratur im deutschen Mittelalter: Würzburger Colloquium 1978. Hrsg. von Volker Honemann. Tübingen: Niemeyer 1979, S. 77–94.
Keil, Gundolf: Der medizinische Kurztraktat in der deutschen Literatur des Mittelalters. In: Bei-träge zur Überlieferung und Beschreibung deutscher Texte des Mittelalters. Referate der 8. Ar-beitstagung österreichischer Handschriften-Bearbeiter von 25.-28. 11. 1981 in Rief bei Salzburg. Hrsg. von Ingo Reiffenstein. Göppingen: Kümmerle 1983. (= Göppinger Arbeiten zur Germa-nistik. 402.) S. 41–114.
Keil, Gundolf: Die medizinische Literatur des Mittelalters. In: Artes mechanicae en Europe mé-diévale: Actes du colloque du 15 octobre 1987. Hrsg. von Ria Jansen-Sieben. Brüssel:Archives et bibliothèques de Belgique 1989. (= Archives et bibliothèques de Belgique. 34.) S. 73–112.
Keil, Gundolf: ‚Vierundzwanzig-Paragraphen-Text‘. In: 2VL, Bd. 10, 1999, Sp. 334–339.
Koch, Manfred Peter; Keil, Gundolf: ‚Konrad von Eichstätt‘. In: 2VL, Bd. 2, 1985, Sp. 162–169.
Lenhardt, Friedrich; Keil, Gundolf: ‚Iatromathematisches Hausbuch‘. In: 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 347–351.
357
Lenhardt, Friedrich: ‚Oberdeutsches Aderlaßbüchel‘. In: 2VL, Bd. 6, 1987, Sp. 1274–1276.
manuscripta.at – Mittelalterliche Handschriften in mitteleuropäischen Bibliotheken.[Online-Katalog]. Institut für Mittelalterforschung, Abteilung Schrift- und Buchwesen, vormals KSBM. Zuletzt aktualisiert: 20.08.2012. URL: http://manuscripta.at/_scripts/php/manuscripts.php [27.08.2014].
Mayer, Johannes Gottfried: Das ‚Arzneibuch‘ Ortolfs von Baierland in medizinischen Kompendien des 15. Jahrhunderts. Beobachtungen und Überlegungen zur Werktypologie medizinischer Kom-pendien und Kompilationen. In: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprach-lichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden: Reichert 1993. (= Ortolf-Studien. 1. Wissensliteratur im Mittelalter. 11.) S. 39–61.
Mayer, Johannes Gottfried; Lenhardt, Friedrich; Keil, Gundolf: ‚Temperamentenlehre‘. In: 2VL, Bd. 9, 1995, Sp. 682–689.
Mayer, Johannes Gottfried; Keil, Gundolf: ‚Tierkreiszeichenlehre‘. In: 2VL, Bd. 9, 1995, Sp. 923–930.
Menhardt, Hermann: Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 2. Berlin: Akademie Verlag 1961. (= Deutsche Akademie der Wissen-schaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. 13.) S. 872–874. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0750b.htm [27.08.2014].
Müller, Ute: Deutsche Mondwahrsagetexte aus dem Spätmittelalter. Berlin, Univ., Diss. 1971.
Parent, André: Das ‚Iatromathematische Hausbuch‘ in seiner bisher ältesten Fassung: die Buchauer Redaktion Heinrich Stegmüllers von 1443. Montreal, Univ., Diss. 1988.
Richtlinien Handschriftenkatalogisierung. Hrsg. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Unterausschuß für Handschriftenkatalogisierung. 5. erw. Aufl. Bonn-Bad Godesberg: Deutsche Forschungsgemeinschaft 1992. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSKRICH.htm [27.08.2014].
Riha, Ortrun: Wissensorganisation in medizinischen Sammelhandschriften. Klassifikationsprinzi-pien bei Texten ohne Werkcharakter. Wiesbaden: Reichert 1992. (= Wissensliteratur im Mittel-alter. 9.)
Saxl, Fritz: Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateini-schen Mittelalters II: Die Handschriften in der Nationalbibliothek in Wien. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 1925/26, 16/2. Heidelberg: Winter 1927. URL: https://archive.org/details/verzeichnisastro00saxl [Online-Ansicht des Heftes begin-nend mit: https://archive.org/stream/verzeichnisastro00saxl#page/1/mode/1up] [27.08.2014].
Schneider, Karin: Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung. Tübin-gen: Niemeyer 1999. (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte: B. Ergänzungs-reihe. 8.)
Schnell, Bernhardt: Die deutschsprachige Medizinliteratur des Mittelalters. Stand der Forschung – Aufgaben für die Zukunft. In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 12 (2000), S. 397–409.
Schönfeldt, Klaus: Die Temperamentenlehre in deutschsprachigen Handschriften des 15. Jahrhun-derts. Heidelberg, Univ. Diss. 1962.
Schuler, Peter Johannes: ‚Kalender, Kalendarium‘. In: LexMa Bd. 5, Sp. 866.
Seyferth, Sebastian: „Du solt wissen das gesunde Leüt nit sülen lassen noch kein Tranck nehmen […].“ Medizinisch-astrologische Wissenspräsentationsformen und deren Textsyntax in einem
358
Iatromathematischen Hausbuch von 1487. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 61 (2006), S. 247–271.
Stegemann, Viktor: ‚Planeten‘. In: HWA, Bd. 7, Sp. 36–294.
Sudhoff, Karl: Die gedruckten mittelalterlichen medizinischen Texte in germanischer Sprache. Eine literarische Studie. In: Sudhoffs Archiv 3 (1910), S. 273–303. Zitiert nach Schnell, deutschsprachige Medizinliteratur, S. 389.
Tabulaecodicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobo-nensi asservatorum. Hrsg. von Academia Caesarea Vindobonensis. Bd. II: Cod. 2001 – Cod. 3500. Wien: Gerold 1868. URL: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSK0751b.htm [27.08.2014].
Unterkircher, Franz: Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1451 bis 1500. Wien: VÖAW 1974. (= Katalog der datierten Handschriften in Österreich. 3.) URL: http://manuscripta.at/_scripts/php/cat2pdf.php?cat=CMDA3&ms_code=AT8500-3085 [27.08.2014].
Vom Einfluss der Gestirne auf die Gesundheit und den Charakter des Menschen. Hrsg. von Gundolf Keil unter Mitarbeit von Friedrich Lenhardt und Christoph Weißer mit einem Vorwort von Huldrych M. Koelbing. Bd. 1: Faksimile, Bd. 2: Kommentar zur Faksimile-Ausgabe des Manuskripts C 54 der Zentralbibliothek Zürich (Nürnberger Kodex Schürstab). Luzern: Faksi-mile-Verlag 1981–1983.
Weißer, Christoph: Wie benutzt man einen mittelalterlichen Kaldender? In: Vom Einfluss der Gestirne, Bd. 2, S. 147-155.
Welker, Lorenz: ‚Iatromathematisches Corpus’. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-fasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Hrsg. Kurt Ruh [u. a.]. Bd. 11. Berlin, New York: de Gruyter 2004, Sp. 703–707.
Zinner, Ernst: Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes. Mün-chen: Beck 1925.
21.3 Wörterbücher/Nachschlagewerke
Adelung = Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeut-schen. 2., vermehrte und verbesserte Ausgabe. Leipzig 1793–1801. Trier Center for Digital Humanities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. 2010–2014. URL: http://woerterbuchnetz.de/Adelung/ [27.08.2014].
B = Baufeld, Christa: Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Lexika aus Dichtung und Fachliteratur des Frühneuhochdeutschen. Tübingen: Niemeyer 1996.
BMZ = Mittelhochdeutsches Wörterbuch: Mit Benutzung des Nachlasses von Georg Friedrich Benecke, ausgearbeitet von Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. 3 Bde. Leipzig: Hirzel 1854–1866. Trier Center for Digital Humanities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschlie-ßungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. 1998–2014. URL: http://woerterbuchnetz.de/BMZ/ [27.08.2014].
Bunsmann-Hopf, Sabine: Zur Sprache in Kochbüchern des späten Mittelalters und der frühen Neu-zeit – ein fachkundliches Wörterbuch. Würzburg: Königshausen & Neumann 2003.(= Würzbur-ger medizinhistorische Forschungen. 80.)
359
Cappelli, Adriano: Lexicon Abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen wie sie in Urkunden und Handschriften besonders des Mittelalters gebräuchlich sind, dargestellt in über 14000 Holzschnittzeichen. 2. verb. Aufl. Leipzig: Weber 1928. URL: http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html [27.08.2014].
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde., in 32 Teilbänden. Leipzig: Hirzel 1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Trier Center for Digital Huma-nities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. 1998–2014. URL: http://woerterbuchnetz.de/DWB/ [27.08.2014].
HWA = Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. von Hanns Bächtold-Stäubli unter Mitwirkung von Eduard Hoffmann-Krayer. Bd. 4 und 7. Berlin: Directmedia 2006. (= Digitale Bibliothek. 145.)
Lexer = Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig: Hirzel 1872–1878. Trier Center for Digital Humanities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. 1998–2014. URL: http://woerterbuchnetz.de/Lexer [27.08.2014].
LexMa = Lexikon des Mittelalters. Hrsg. von Norbert Angermann [u. a.]. Bd. 5 und 8. München: Metzler 2000. [CD-ROM mit paralleler Druckausg.]
LWB = Luxemburger Wörterbuch. Hrsg. von der Wörterbuchkommission, auf Grund der Samm-lungen, die seit 1925 von der Luxemburgischen Sprachgesellschaft und seit 1935 von der Sprachwissenschaftlichen Sektion des Großherzoglichen Instituts veranstaltet worden sind. 5 Bde. Luxemburg: Linden 1950–1954. Projekt LexicoLux des Laboratoire de linguistique et de littératures luxembourgeoises der Universität Luxemburg, in Kooperation mit dem Kompetenz-zentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaf-ten an der Universität Trier. 2010. URL: http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HA00001 [27.08.2014].
RhWB = Rheinisches Wörterbuch. Bearb. und hrsg. von Josef Müller, ab Bd. VII von Karl Mei-sen, Heinrich Dittmaier und Matthias Zender. 9 Bde. Bonn, Berlin: Klopp 1928–1971. Trier Center for Digital Humanities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publi-kationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. 2002–2014. URL: http://woerterbuchnetz.de/RhWB [27.08.2014].
VL = Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Hrsg. von Kurt Ruh [u. a.]. Bd. 2. Berlin, New York: de Gruyter 1985. Bd. 4. Berlin, New York: de Gruyter 1983. Bd. 6. Berlin, New York: de Gruyter 1987. Bd. 7. Berlin, New York: de Gruyter 1989. Bd. 9. Berlin, New York: de Gruyter 1995. Bd. 10. Berlin, New York: de Gruyter 1999. Bd. 11. Berlin, New York: de Gruyter 2004.
Weddige, Hilkert: Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. 6. Aufl. München: Beck 2004.
360
Mein herzlicher Dank gilt Frau Prof. Andrea Hofmeister-Winter für ihre Unterstützung und Bera-tung während des Entstehens dieser Arbeit.
Weiters möchte ich mich für die finanzielle Unterstützung bedanken, die ich vom Staat Österreich erhalten habe, der aller Unkenrufen und Einsparungen zum Trotz das Grundrecht auf Bildung wahrt und somit auch mir ein Universitätsstudium ermöglicht hat.
Und ganz besonders möchte ich mich bei meiner Mutter bedanken, ohne die auch mit dem besten Zeitmanagement mein Studium in dieser Form nicht zu bewältigen gewesen wäre.