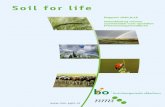„A Wall of Separation“. Die Vernichtung religiöser Ambiguität in Irland (ca. 1600–1640)
-
Upload
tu-dresden -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of „A Wall of Separation“. Die Vernichtung religiöser Ambiguität in Irland (ca. 1600–1640)
„A WALL OF SEPARATION“
Die Vernichtung religiöser Ambiguität in Irland (ca. 1600–1640)*
Von Matthias Bähr, Dresden
Thomas Wentworth, seit zwei Jahren Lord Deputy des englischen Königs inIrland und damit einer der wichtigsten Beamten der Britischen Inseln, musstesich im Sommer 1635 gegen einen merkwürdigen Vorwurf verteidigen. In derNähe von Galway an der irischen Westküste hatte sich Wentworth im Hauseines einflussreichen katholischen Landbesitzers aufgehalten.1 Dort hatteer sich angeblich in voller Jagdmontur – mit Reitstiefeln an den Füßen –auf das aufwendig gemachte Bett seines Gastgebers gelegt.2
Worum es Wentworths politischen Gegnern bei diesem Vorwurf ging, warallerdings nicht nur schmutziges Bettzeug. Vielmehr zielten sie auf die Miss-achtung der Gastfreundschaft, die man dem Lord Deputy in Galway gewährthatte. Und ein derartiger Vorwurf war, obwohl auf den ersten Blick banal,schwerwiegend. Wenige Monate zuvor hatte Geoffrey Keating, der wahr-scheinlich einflussreichste irische Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, Gast-freundschaft zum typisch irischen Charakterzug erklärt.3 Tatsächlich wardiese Tugend für die irische Identität bereits seit dem 16. Jahrhundert zentral:Im Oktober 1574 hatte der englische Gouverneur von Ulster, Walter Deve-reux, zum Schein eine Einladung des gälischen Fürsten Brian MacPhelimO’Neill angenommen und unter dem Deckmantel des Gastrechts ein Blutbadangerichtet. Seine Gastfreundschaft und Großzügigkeit waren Brian zum
* Dieser Aufsatz ist im Rahmen eines Forschungsaufenthalts am Institute for Bri-tish-Irish Studies in Dublin entstanden. Dem DAAD, der mir ein Stipendium zurVerfügung gestellt hat, danke ich für die großzügige Förderung. Mein besonderer Dankgilt außerdem Florian Kühnel (Berlin), der das komplette Manuskript gelesen undkritisch kommentiert hat.
1 Clarke, Old English, 95–97.2 British Library, Egerton MS 917, fol. 16v: casting himselfe in his riding bootes
uppon very rich bedds. Die Quelle, ein anonymer, handschriftlich überlieferter Dialogeines englischen und eines irischen Adligen, hält auch ansonsten fest: The rest of his[Wentworth’s] behavior was hateable (ebd., 16r). Zum Beispiel hatte Wentworth an-geblich das Wild in der Gegend rücksichtslos gejagt und seine Herden auf den Weidenseines Gastgebers grasen lassen.
3 Keating, Foras Feasa ar Éirinn, Bd. 1 [vor 1634; vgl. University College DublinArchives, MS A 14], 3–5, insbes. 5: „It cannot truthfully be said that there ever existedin Europe folk who surpassed them [die Iren], in their own time, in generosity or inhospitality according to their ability.“ (Ich zitiere nach der englischen Übersetzung:ders., The History of Ireland; zur Editionsgeschichte vgl. Anm. 59.)
Verhängnis geworden, weil er nicht mit dem Verrat der Engländer gerechnethatte. In der zeitgenössischen Historiographie wurde die Verletzung desGastrechts durch Devereux für ein gebildetes Publikum literarisch aufberei-tet und dadurch bekannt gemacht.4
Der Vorwurf, dem sich Wentworth ausgesetzt sah, wird vor diesem Hinter-grund verständlich: Indem er sich mit schmutzigen Schuhen auf das saubereBett seines Gastgebers gelegt hatte, hatte Wentworth nicht nur die landesty-pische Gastfreundschaft missachtet, sondern eben auch das, was die Irenselbst als irisch ansahen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn „verunrei-nigt“.5 Er hatte sich damit in die topische Tradition des englischen Verratseingeordnet.
Dieses Beispiel steht am Beginn einer Entwicklung, an deren Ende Went-worth, der sich anfangs noch betont kompromissbereit gegeben hatte, zumwichtigsten Feindbild der alten Eliten in Irland geworden war. Sowohl fürdie gälischen Iren als auch für die anglonormannischen Old English6 wurdeer zum paradigmatischen Fremden, von dem man das eigene Irisch-Sein ra-dikal abgrenzen wollte. Warum aber machte ausgerechnet Wentworth diesebemerkenswerte Karriere, während sich seine unmittelbaren AmtsvorgängerOliver St. John (1616–1622) und Henry Cary (1622–1629) dem irischen kol-lektiven Gedächtnis noch weitgehend entziehen konnten?
Zwar hatte Wentworth seit 1634 massiv in die irische Sozialstruktur einge-griffen. Unter dem Deckmantel der zuvor nahezu unbedeutenden Commis-sion for Defective Titles zog er systematisch Land zugunsten der Krone einund verschaffte der irischen Regierung damit den nötigen finanziellen Hand-
4 Annals of the Kingdom of Ireland, by the Four Masters, Bd. 5; eine Handschrift derAnnalen ist in den University College Dublin Archives überliefert (University CollegeDublin Archives, MS A 13). Als man bereits drei volle Tage und Nächte zusammengefeiert hatte, ließ Devereux Brians Gefolgsleute töten und Brian selbst gemeinsam mitseiner engsten Familie festnehmen und nach Dublin ausliefern. Dort wurden dieHäftlinge gevierteilt. Zu den Annalen der „Four Masters“ vgl. Cunningham, Annals ofthe Four Masters.
5 Bei Mary Douglas sind gerade Schuhe ein Beispiel dafür, dass Unreinheit relativist: Schuhe sind nicht aus sich selbst heraus schmutzig, sondern sie werden erst da-durch unrein, dass sie zum Beispiel auf einem Tisch stehen, also dort, wo sie nichthingehören (vgl. Douglas, Purity and danger, 35f.). Vor diesem Hintergrund könnteman sagen, dass der Wentworth-Fall gerade dadurch brisant wurde, dass die Jagd-stiefel eben nicht auf dem Pferd getragen wurden (wo sie hingehören), sondern im Bett.Bettwäsche – oder Wäsche generell – kann wiederum ein wichtiger Schlüssel zu denOrdnungsvorstellungen von Menschen sein, nicht nur mit Blick auf die Geschlech-terverhältnisse. Mit Jean-Claude Kaufmann gesprochen kann man gewissermaßen der„Spur der Wäsche“ folgen, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu erforschen(vgl. Kaufmann, La trame conjugale).
6 Als „Old English“ wird zeitgenössisch der Teil der irischen Bevölkerung be-zeichnet, der seine Herkunft in einer identitätsstiftenden und teilweise fiktiven Ge-nealogie – und im Unterschied zu den gälischen Iren – auf anglonormannische Siedleraus dem 12. Jahrhundert zurückführt. Der Begriff ist ansonsten relativ unscharf (vgl.dazu Finnegan, Old English views of Gaelic Irish history, 210).
Matthias Bähr90
lungsspielraum.7 Allerdings sorgte er gleichzeitig – zumindest auf den erstenBlick – für eine kurze Zeit praktischer religiöser Toleranz in Irland. Er veran-lasste, dass die so genannten Recusancy Laws, die alle Katholiken zum Be-such des Gottesdienstes der Church of Ireland verpflichteten, 1633 ausgesetztwurden. Diese Gesetze, die in der Praxis teilweise schärfer ausgelegt wurden,als es ihr Wortlaut eigentlich zuließ, waren immer wieder Gegenstand lang-wieriger Konflikte gewesen.8 Auch wenn nicht einmal annähernd die gesamteirische Bevölkerung von den Recusancy Laws betroffen war, war ihre symbo-lische Wirkung dennoch enorm. Die Frage bleibt also, warum Wentworth dieRolle des ungeliebten Fremden spielen musste, obwohl er dem Gottesdienst-zwang vorübergehend seine Sprengkraft genommen hatte. Meine These ist,dass sich in den 1630er Jahren, also während Wentworth’ Amtszeit, der Spiel-raum für Mehrdeutigkeit, Uneindeutigkeit, oder anders gesagt: „Ambigui-tät“, in Irland radikal verengte. Die irische Gesellschaft befand sich in einerUmbruchsituation, in derdie Identitäten dereinzelnen sozialen Gruppen kla-rer als jemals zuvor festgelegt wurden. Damit beschleunigte sich eine Ent-wicklung, die bereits um 1600 eingesetzt hatte, die jetzt aber wesentlich dy-namischer und konsequenter ablief. In diesem verdichteten Prozess wurdeWentworth für die etablierten Eliten in Irland gerade deshalb zum Feindbild,weil er wie kein Zweiter eine aus ihrer Sicht „fremde“, englische Identitätverkörperte.9
Diese grundsätzliche Fremdheit, die mit Wentworth verbunden wurde, warvor allem auch eine konfessionelle Zuschreibung: Er stand nicht zuletzt alsProtestant außerhalb der irischen Gesellschaft. Ute Lotz-Heumann sprichtfür die Jahre nach 1632, in denen Wentworth sein Amt ausübte, von einer„confessionalisation from outside“. In dieser Zeit hätten sich, nach einer Pha-se der inneren Konfessionsbildung und Konsolidierung, die europäischenTrends auch in Irland durchgesetzt und für ein klares konfessionelles Selbst-bewusstsein gesorgt.10 Die Konfession wurde auf diese Weise zu einer wich-tigen symbolischen und sozialen Grenze, an der sich die Identitäten auf derInsel ausrichteten.
Die irische Geschichtswissenschaft hat sich traditionell vor allem für dieFrage interessiert, warum (und wann) die Reformation in Irland scheiterte.11
Gerade die katholische Konfessionalisierung ist demgegenüber vergleichs-weise wenig beachtet worden. Allerdings wird dieses Defizit inzwischen auf-
7 Siehe dazu den klassischen Überblicksartikel von Clarke, The Government ofWentworth.
8 Ford, Force and Fear, 96; ders., Firm Catholics, 23.9 Traditionell wird Wentworth als mächtiger ,Staatsmann‘ interpretiert, der
rücksichtslos eine absolutistische Agenda gegen alle Widerstände durchsetzte unddadurch zur Hassfigur wurde. Zu dieser historiographischen Tradition vgl. Kane,Scandal. Die klassische Monographie über Wentworth ist Kearney, Strafford in Ire-land.
10 Lotz-Heumann, Confessionalisation in Ireland, 38.11 Canny, Why the Reformation Failed in Ireland; Bottigheimer, The Failure of the
Reformation in Ireland; Bottigheimer / Lotz-Heumann, Irish Reformation.
„A Wall of Separation“ 91
gearbeitet.12 Vor dem Hintergrund eines erweiterten Konfessionalisierungs-begriffs wäre jetzt nach Transkonfessionalität und konfessioneller Osmose zufragen, aber auch nach religiöser Devianz und konfessionellem Nonkonfor-mismus.13 Insbesondere die Perspektive der konfessionellen Ambiguität hatsich in der Frühneuzeitforschung bereits als fruchtbar erwiesen.14 Mehrdeu-tige religiöse Praktiken sind demnach keine Randphänomene, die quer zurKonfessionsbildung liegen, sondern sie sind im Gegenteil untrennbar mitder Konfessionsbildung selbst verbunden. Konfessionelle Grenzziehungensind erst die Voraussetzung für Grenzüberschreitungen, für religiöse „Dissi-mulatio“: „Orthodoxie produziert Heterodoxie“.15 Die historische Anthropo-logie hält in diesem Zusammenhang einen hilfreichen Ansatz bereit: Mit demArabisten Thomas Bauer – und im Anschluss an den Soziologen ZygmuntBauman – lässt sich die Entwicklung in Irland meines Erachtens am bestenals Vernichtung von Ambiguität beschreiben, als vorläufiges Ende einer rela-tiv starken „Ambiguitätstoleranz“ in der irischen Gesellschaft.16
Der Begriff „Ambiguitätstoleranz“ bezeichnet nach Bauer die Fähigkeit ei-ner Gesellschaft, kulturelle Ambiguität auszuhalten, also konkurrierendeoder sogar widersprüchliche Normen und Sinnzuweisungen zuzulassen.17
Wird von den Akteuren keine klare und nach außen sichtbare Zuordnungzu einer (zum Beispiel religiösen) Gruppe verlangt, wird Konflikten derNährboden entzogen. Allerdings kommt es unter bestimmten Umständenzu einer Disambiguierung, also zum Versuch verschiedener gesellschaftlicherAkteure, Ambiguität zu beseitigen und für Eindeutigkeit zu sorgen.18
In diesem Aufsatz möchte ich exemplarisch zeigen, wie der Prozess der Dis-ambiguierung im 17. Jahrhundert in Irland konkret ablief und warum die1630er Jahre in diesem Zusammenhang als Schlüsselzeit angesehen werdenmüssen. Dazu werde ich nacheinander vier Aspekte behandeln, die meinesErachtens für diese Entwicklung zentral oder zumindest besonders auf-schlussreich sind: die Bildungsmigration der irischen Eliten auf den europäi-schen Kontinent (I), die neue irische Historiographie (II), das veränderte Le-severhalten in der irischen Gesellschaft (III) und den tiefgreifenden Wandelder Bestattungskultur und der Nutzung des Kirchenraums (IV).
12 Zu diesem Forschungsstrang vgl. Ó hAnnracháin, The Consolidation of IrishCatholicism.
13 Vgl. Greyerz [u.a.] (Hrsg.), Interkonfessionalität; Schwerhoff, Gottlosigkeit undEigensinn; Hase, Nonkonformismus; Louthan / Cohen / Szabo (Hrsg.), Diversity andDissent.
14 Stollberg-Rilinger / Pietsch (Hrsg.), Konfessionelle Ambiguität.15 Stollberg-Rilinger, Einleitung, 12.16 Vgl. Bauer, Kultur der Ambiguität.17 Bauer, Kultur der Ambiguität, insbes. 26–53; ders., Normative Ambiguitätsto-
leranz.18 Bauman, Modernity and Ambivalence, insbes. 102–159.
Matthias Bähr92
I. Die Macht der langen Wege: Bildungsmigration auf den Kontinent
In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts veränderte sich die irische Gesell-schaft radikal. Nahezu die gesamte gälisch-irische Oberschicht wurde vonneuenglischen Siedlern verdrängt, nachdem sich 1607 im „Flight of theEarls“, einer in jeder Hinsicht abenteuerlichen Nacht-und-Nebel-Aktion,die beiden wichtigsten irischen Adeligen mit ihrem engsten Gefolge nach Eu-ropa abgesetzt hatten.19 Aber auch die Old English mussten einschneidendeVeränderungen bewältigen. Betroffen war vor allem die junge Generation.
Zwar hatte es bereits im 16. Jahrhundert nach dem Vorbild der adeligenGrand Tour immer wieder Erziehungsreisen junger Iren auf den Kontinentgegeben,20 um 1600 setzte allerdings ein Massenexodus ein. Die Karriereper-spektiven der irischen Eliten hatten sich verschoben. Ein Studium in Cam-bridge oder Oxford erschien zunehmend unerreichbar, weil sich dort die Zu-gangsbedingungen für Katholiken im Zuge der englischen Konfessionspoli-tik des 16. Jahrhunderts stark verschlechtert hatten.21 Für kurze Zeit wurdedann Glasgow zur wichtigsten Alternative, aber die schottische Reformationsetzte auch dieser Entwicklung ein Ende.22 Das Trinity College in Dublin, eineelisabethanische Gründung, war als protestantische Hochburg für viele ka-tholische Familien ohnehin keine Option.23 Die neuen Bildungsorte lagen da-her auf dem europäischen Kontinent: Salamanca, Douai, Paris, Bordeaux,Rouen, Rom, Lissabon und – vor allem – Löwen.24
Diese neuen Kollegs waren um die Jahrhundertwende (zum Beispiel Douai1594, Rouen 1612) mit dem Ziel gegründet worden, gälisch-irische und anglo-normannische Priester für die irische Mission auszubilden. Allein in Rom gabes zwei irische Priesterseminare, die von Franziskanern und Dominikanern
19 Bardon, Plantation of Ulster, 86–110.20 Ohlmeyer, Seventeenth-Century Ireland and Scotland, 464.21 Canny, Old English, 28. Katholische Juristen wurden allerdings nach wie vor in
der Regel erst in Cambridge oder Oxford und danach in London ausgebildet (vgl.Cunningham, Geoffrey Keating, 25).
22 Bardon, Plantation of Ulster, 197.23 Allerdings hat es dort zumindest bis in die 1630er Jahre kontinuierlich eine ka-
tholische Minderheit gegeben. Von 75 Studenten und 8 Fellows, die um 1605 an ge-meinsamen Mahlzeiten teilnahmen, lassen sich immerhin 10 als „Anglo-Irish“ und 16als „Native Irish“ einordnen. 1619 war das Verhältnis ähnlich (35 Prozent „Anglo-Irish“ bzw. „Native Irish“). Allerdings kam zumindest ein Teil dieser Studenten auskonvertierten Familien; außerdem ist eine statistische Analyse, die Identitäten odersogar „ethnische“ Zugehörigkeit aus Nachnamen ableitet, methodisch problematisch;zu den Zahlen vgl. Ford, Who went to Trinity?, insbes. 62–66.
24 Corish, Catholic Community, 25f.; Leerssen, Mere Irish, 255; Cregan, Counter-Reformation Episcopate, insbes. 103–117; Fenning, Irishmen Ordained at Lisbon;ders., Irish Dominicans at Lisbon; ders., Irish Dominicans at Louvain; Brockliss / Ferté,Prosopography of Irish Clerics (insgesamt sind in Paris und Toulouse 1500 Personennachgewiesen).
„A Wall of Separation“ 93
unterhalten wurden, in Löwen sogar drei.25 Als Kaderschmiede der katholi-schen Konfessionalisierung funktionierten die irischen Kollegs ausgespro-chen gut. In Salamanca wurden von 1592, dem Gründungsjahr, bis 1652 ins-gesamt 389 Priester geweiht, die dann in der Regel in Irland selbst Karrieremachten.26 Bis 1613 hatten fast 150 junge Iren das Kolleg in Douai besucht.27
Von Löwen in den spanischen Niederlanden aus wurden irische Klöster undPfarreien nicht nur mit Personal, sondern auch mit Liturgiegeräten, Devotio-nalien und geistlicher Literatur versorgt.28 Die Folge war eine Bildungsrevo-lution: Die insgesamt zwanzig Kollegs steckten einen breiten „Counter-Re-formation corridor“ ab, der sich von Spanien über Frankreich und Italienbis nach Flandern erstreckte.29 Innerhalb weniger Jahre war damit etwas ent-standen, was es seit dem Frühmittelalter nicht mehr gegeben hatte: ein funk-tionierendes irisches Bildungsnetzwerk in Europa.
Die Zeitgenossen waren sich darüber bewusst, dass man es dabei mit einerneuen Entwicklung zu tun hatte. 1613 hielt die protestantische Mehrheit imirischen Parlament fest, dass die ersten Absolventen der Priesterseminareteilweise noch am Leben seien und sich die katholischen Familien deshalbnicht auf das Herkommen berufen könnten.30 Tatsächlich waren die neuenKollegs so erfolgreich, dass die irische Verwaltung bereits 1604 ein Verbotder Bildungsmigration erwog.31 Lord Deputy Chichester (1605–1616) wollte
25 Clarke, Old English, 23–26; Leerssen, Mere Irish, 255. In Rom konnten jungeDominikaner an den Kollegs des heiligen Sixtus und des heiligen Clemens studieren(vgl. Fenning, Irish Dominicans at Rome).
26 Downey, Counter-Reformation, 101–103. Zwischen 1595 und 1619 legten 100Studenten in Salamanca ihre Eide ab und versprachen beispielsweise, nach ihremAbschluss tatsächlich der irischen Mission beizutreten. Die Gesamtzahl der Studentendürfte allerdings sogar noch höher gewesen sein: Für mehrere Zeugen, die jeweils selbstdem Kolleg angehören mussten, hat sich keine eigene Eidesurkunde erhalten. Manmuss also von einer hohen Dunkelziffer ausgehen (O’Doherty, Students of the IrishCollege Salamanca).
27 Vgl. das Verzeichnis irischer Geistlicher in Douai, in: Lambeth Palace Library,London, Carew MS 600, fol. 10 f.: 33 Jesuiten, 18 Kapuziner, 27 Franziskaner, 68Sacerdotes.
28 Gillespie, Irish Franciscans, insbes. 51f.29 Corish, Catholic Community, 41. Vgl. auch Downey, Counter-Reformation, 97;
Edwards, English Catholic Migration. Die Vorstellung, der zufolge die Old English vorallem auf Frankreich und die Gaelic-Irish auf Spanien hin ausgerichtet gewesen seien,hat sich als falsch erwiesen (vgl. Finnegan, Old English Views of Gaelic Irish History,insbes. 202f.).
30 Arthur Chichester, Bericht über das irische Parlament von 1613, in: LP, Carew MS600, fol. 226: Their sonns they send to be educated in Spayne, France, Italia, and theArchdukes dominions, more frequentlye then accustomed, which hathe hence no an-cient Custome amongst them, for Sir Patrike Barnewell (now Livinge) was the firstgentlemans son of qualitie, that was ever sent out of Irland to be broughte uppe inLearninge beyond the Sea.
31 Denkschrift zur Reform des Klerus, [1604], in: National Archives of the UnitedKingdom, 31/8/199 (Philadelphia Papers), 15: To p[ro]hibite the sending of Childrenbeyond sea, to studies or travell, but w[i]th lycence of the Lord Deputie. And to recallthose allready abroad. Vgl. dazu Ford, Force and Fear, 97.
Matthias Bähr94
stattdessen das Trinity College zu einer ernsthaften Alternative für katholi-sche Familien ausbauen.32 In den Folgejahren wurden diese Pläne immer wie-der aufgegriffen und neu formuliert, in der Regel dann aber entweder verwor-fen oder nicht konsequent umgesetzt.33 Der Sogwirkung der Kollegs hatte dieRegierung offenbar wenig entgegenzusetzen. Ein Verzeichnis irischer Kleri-ker, die in den Jahren vor 1619 in Bordeaux ausgebildet wurden, macht deut-lich, dass der Schritt auf den Kontinent für viele katholische Iren inzwischenzum biographischen Königsweg geworden war. Insgesamt sind dort über 200namentlich bekannte Geistliche verzeichnet – und die Liste erhebt nicht ein-mal Anspruch auf Vollständigkeit. Allein aus der Diözese Waterford und Lis-more im Südwesten Irlands, einem Kerngebiet der Old English, kamen fastdreißig Studenten und Dozenten nach Bordeaux. Zu ihnen gehörte auchder bereits erwähnte Geoffrey Keating, Docteur en Theologie.34 Das neue Bil-dungssystem war, sieht man von der englischen Siedlungspolitik ab, zumvielleicht dynamischsten Faktor in der irischen Gesellschaft geworden.
Das Beispiel des Pfarrers James Meagh aus Cork zeigt, unter welchen Um-ständen die Migranten nach ihrer Rückkehr wieder in Irland Fuß fassenkonnten: Meagh kam im Frühjahr 1615 auf direktem Weg aus Rom, bestiegvermutlich in Bordeaux ein Schiff und wurde heimlich auf den Klippen zwi-schen Cork und der Kleinstadt Youghal im Süden Irlands abgesetzt. In dennächsten Monaten war er für die irische Regierung praktisch unauffindbar,weil er von seinem Bruder und zwei befreundeten Kaufleuten verstecktund geschützt wurde. Meagh machte in der irischen Kirche schnell Karriere,stieg zum Titulargeneralvikar seiner Heimatstadt Cork auf und verfügte auchweiter über beste Beziehungen zum kontinentalen Europa.35 Aufschlussreichist auch der Fall Derby O’Callaghans aus Mallow nördlich von Cork: O’Cal-laghan hatte elf Wochen im Kolleg in Bordeaux verbracht, war dann nach Ir-land zurückgekehrt und hatte sich zum Priester weihen lassen. Später zog esihn wieder auf den Kontinent; er studierte vier Jahre lang in Paris. Es folgteein Leben als Wanderprediger. Immer wieder reiste O’Callaghan zwischen Ir-land und Bordeaux hin und her und versorgte seine irischen Glaubensbrüder
32 Brief Arthur Chichesters, 3. Juni 1606, in: National Archives, State Papers (SP)63/218, fol. 205.
33 Arthur Chichester an das Privy Council, 5. Februar 1609, in: National Archives,SP 63/226, fol. 62; Arthur Chichester an Lord Danvers, 9. August 1609, in: NationalArchives, SP 63/227, fol. 77; Gesetzesentwurf des Lord Deputy, 25. Dezember 1627, in:National Archives, SP 63/245, fol. 302; Instruktionen an die Lords Justices in Irland,30. Juli 1629, in: National Archives, SP 63/249, fol. 102. Auch England wurde später alsAusbildungsort für katholische Söhne wieder attraktiv. 1632 plante die irische Re-gierung, den Sohn des Earl of Antrim, des bedeutendsten katholischen Landeigentü-mers in Ulster, aus Europa zurückzuholen und zum Studium an eine englische Uni-versität zu schicken (Calendar of State Papers Relating to Ireland, 1625–1632, [1627],688–690).
34 Verzeichnis irischer Priester in Bordeaux, 1619, in: National Archives, SP 63/235,fol. 121. Keating stammte ursprünglich aus der ländlich geprägten Grafschaft Tip-perary.
35 Wentworth an Winwood, 18. März 1615, in: National Archives, SP 63/233, fol. 29.
„A Wall of Separation“ 95
mit popish bookes, Indulgences, and other things aus Europa.36 Geistliche wieMeagh und O’Callaghan blieben dem nachtridentinischen Katholizismus,wie sie ihn in den Priesterseminaren kennengelernt hatten, häufig ein Lebenlang verbunden. Für Wentworth war 1637 klar, dass der katholische Klerus inIrland keine Gelegenheit auslassen würde, seine Gegner in Europa mit conti-nual Intelligence zu versorgen.37
Tatsächlich waren die Folgen der kontinentalen Priesterausbildung in Ir-land bereits früh spürbar gewesen. Im Herbst 1607 behauptete man in katho-lischen Kreisen, man habe inzwischen mehr Geistliche auf der Insel als derKönig Soldaten.38 Die irische Regierung hatte beobachtet, dass der Priester-nachwuchs von sympathisierenden Kaufleuten in die Häfen geschmuggeltwurde und dort in großen Gruppen von Bord ging, um sich planmäßig aufdie Dörfer und Städte zu verteilen.39 Zwischen Februar und Anfang Mai1608 waren angeblich etwa dreißig neue Pfarrer und Mönche in Irland ange-kommen.40 Chichester erinnerten die Neuankömmlinge an Piraten, die zurselben Zeit die irische Westküste bedrohten, nur dass es diese Piraten nichtauf Handelswaren abgesehen hätten, sondern auf die loyalen Untertanender Krone.41 James I. sprach mit Blick auf die Kollegs von Semynaryes of Trea-son.42
Als Wentworth mehr als zwanzig Jahre später, im Juli 1633, sein Amt in Ir-land antrat, waren diese „Seminars of Treason“ fest etabliert. In einem Briefan den neuen Lord Deputy verglich der englische Staatssekretär John Cokedie Iren in Paris mit einer Landplage.43 Für bedeutende katholische Familiengehörte es inzwischen zum üblichen karitativen Engagement, Geld für dieAusbildung junger Kleriker auf dem Kontinent zu spenden. Coke sprach indiesem Zusammenhang von Extractions of Monies.44 Für den Erfolg des iri-schen Katholizismus waren derartige finanzielle Zuwendungen überlebens-wichtig. Wentworth nannte die Iren verächtlich eine Race of Sturdy Beggars
36 Zeugenaussage Derby O’Callaghans, 9. Januar 1636, in: National Archives, SP 63/255, fol. 171.
37 Brief Wentworths, 5. Oktober 1637, in: The Earl of Strafforde’s Letters and Dis-patches, Bd. 2, 110f., hier zitiert 111.
38 Arthur Chichester und die irische Regierung an das Privy Council, 27. Oktober1607, in: National Archives, SP 63/222, fol. 205.
39 Ebd.; Arthur Chichester an Salisbury, 11. Mai 1610, in: National Archives, SP 63/229, fol. 8.
40 Arthur Chichester an das Privy Council, 4. Mai 1608, in: National Archives, SP 63/224, fol. 83.
41 Arthur Chichester an das Privy Council, 5. Februar 1609, in: National Archives,SP 63/226, fol. 62.
42 Ansprache James’ I. im Council Chamber, 20. April 1614, in: LP, Carew MS 600,fol. 122: You put some [of] your Children to the Semynaryes of Treason.
43 Coke an Wentworth, 21. Januar 1634, in: The Earl of Strafforde’s Letters andDispatches, Bd. 1, 364f.: And for the Irish of all Sorts, how they pester Paris, and flockfrom all parts […].
44 Ebd.
Matthias Bähr96
und die Exulanten verarmte Impostors.45 Dabei flossen teilweise erheblicheSummen: Luke und Robert Plunkett aus Dublin hatten Mitte der 1620er Jahreinsgesamt 600 Pfund für den Unterhalt bedürftiger Priester in den Kollegs be-reitgestellt.46 Das System der mildtätigen Unterstützung – gepaart mit der Fi-nanzkraft der Orden – funktionierte so gut, dass der Wettstreit der Konfessio-nen in Irland zu einem ungleichen Kampf wurde. Die anglikanische Kirche inIrland, die Established Church, war chronisch unterfinanziert, schlecht aus-gestattet und sozial isoliert.47 Als ihr Verbündeter sah sich Wentworth aufverlorenem Posten, als Man going to Warfare without Munitions andArms.48 Der neue irische Katholizismus war dagegen wesentlich schlagkräf-tiger.
Was aber bedeutet das alles für die Frage nach der Vernichtung von Ambi-guität? Die weitreichende Bildungsmigration hatte meines Erachtens zweiKonsequenzen. Die erste ist naheliegend, wenn auch bisher nur wenig er-forscht:49 Irland wurde systematisch in das Netzwerk der katholischen Kon-fessionalisierung eingebunden. Das religiöse Umfeld der Migranten ermög-lichte ein klares konfessionelles Selbstbewusstsein.50 Außerdem brachtendie neuen Pfarrer einen relativ festen Kanon orthodoxer Frömmigkeit nachIrland. Pagane oder scheinbar pagane Rituale, etwa Pilgerreisen zu „heili-gen“ Steinen und Quellen aus vorchristlicher Zeit, wurden bekämpft oderin den eigenen konfessionellen Horizont eingeordnet, also zum Beispiel durchschriftliche Anweisungen normiert.51 Die religiöse Praxis wurde vereindeu-tigt, die konfessionelle Grenze weniger durchlässig gemacht.
Der große Trumpf der Migranten war dabei, dass sie nach ihrer Rückkehrkaum soziale Berührungsängste überwinden mussten: Sie sprachen irisch,waren ortskundig und improvisierten in der Regel geschickt, wenn es darumging, die Messe zu feiern. So kam man beispielsweise in Privathäusern oderunter freiem Himmel zusammen, wenn keine Kirche zur Verfügung stand.52
Außerdem waren die neuen Pfarrer häufig geschickte Prediger.53 All dieseFaktoren trugen dazu bei, dass die irische Mission in der Bevölkerung außer-
45 Wentworth an den Earl of Newcastle, 9. April 1635, in: The Earl of Strafforde’sLetters and Dispatches, Bd. 1, 410–412, hier zitiert 412; Brief Wentworths, 15. Mai1637, in: The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 2, 112.
46 Vgl. Informationen über den Unterhalt von Studenten auf dem Kontinent,10. Januar 1634, in: National Archives, SP 63/254, fol. 208. Zur Finanzierung derKollegs vgl. auch die Gravamina der Diözese Tuam, 12. Juni 1641, in: National Ar-chives, SP 63/259, fol. 205.
47 Vgl. Bottigheimer / Lotz-Heumann, Irish Reformation; Gillespie, ProtestantLaity; McCafferty, Reconstruction.
48 Wentworth an den Erzbischof von Canterbury, William Laud, 31. Januar 1633, in:The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 1, 187–190, hier zitiert 187.
49 Ó hAnnracháin, The Consolidation of Irish Catholicism, 38.50 Ó hAnnracháin, Political Ideology and Catholicism, 158.51 Cunningham, Geoffrey Keating, 46f.; Gillespie, Reading Ireland, 152.52 Corish, Catholic Community, 33–42.53 Cunningham, Geoffrey Keating, 48.
„A Wall of Separation“ 97
ordentlich erfolgreich war. Im Oktober 1613 las ein Franziskanerpater in derNähe von Derry angeblich vor mehr als tausend Gläubigen die Messe.54
Gleichzeitig gab es auch in der Church of Ireland wirksame Bemühungenum ein eindeutigeres konfessionelles Profil nach englischem Vorbild, die inden irischen „Canons“ von 1634 gipfelten.55 Innerhalb einer Generation er-eignete sich etwas, was man als konfessionelle Disambiguierung beschreibenkann: Die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Akteure wurde mehr undmehr von der Konfession bestimmt. Das ging so weit, dass sich das vonWentworth einberufene irische Parlament 1634 erstmalig nach konfessionel-len Lagern aufteilte. Der Lord Deputy sprach von einer Wall of Separation,56
und diese Formulierung kann man mit guten Gründen auch auf die irischeGesellschaft insgesamt beziehen.
II. Geoffrey Keating und die irische Identität
Die Bildungsmigration auf den Kontinent hatte allerdings noch eine zweiteKonsequenz. Das konfessionelle Umfeld in Europa brachte eine Art von Ge-schichtsschreibung hervor, die in vollkommen neuen Kategorien darübernachdachte, was es bedeutet, „irisch“ zu sein. Ein wichtiger Vertreter dieserGattung war der bereits erwähnte irische Schriftsteller Geoffrey Keating (ge-boren um 1580). Keating, der aus einer wohlhabenden anglonormannischenFamilie aus der Provinz Munster stammte, gehörte zu den ersten Migrantenund zum neuen Typus des engagiert schreibenden „priest-poet“.57 Um 1600hatte Keating in Reims und später in Bordeaux studiert und dort offenbar ei-nen theologisch gefestigten Standpunkt entwickelt. In einer seiner frühestenVeröffentlichungen, in der er den Charakter der heiligen Messe diskutierte(„Eochair-sgiath an Aifrinn“), suchte Keating Anschluss an den akademi-schen Stil des nachtridentinischen Katholizismus. Er behandelte seinen Ge-genstand in Form einer Disputatio und griff dabei auf Argumente des spani-schen Jesuiten Francisco de Suárez (1548–1617) und Robert Bellarmins(1542–1621) zurück.58 Auf diese Weise gelang es Keating, sich als zeitgemäßerkatholischer Gelehrter zu profilieren.
Um 1610 kehrte Keating nach Irland zurück. 1613 ist er als Priester in deririschen Diözese Waterford und Lismore nachgewiesen, wo er offenbar bis zuseinem Tod (vor 1644) blieb. In Keatings Zeit als aktiver Pfarrer fällt seinewichtigste Arbeit, das „Wissenskompendium über Irland“, das die irische
54 Zeugenaussage von Teag Modder M’Glone, 21. Oktober 1613, in: National Ar-chives, SP 63/232, fol. 137.
55 Lotz-Heumann, Die doppelte Konfessionalisierung in Irland, 160–176; McCaf-ferty, Reconstruction.
56 Ansprache Wentworths vor dem irischen Parlament, 15. Juli 1634, in: The Earl ofStrafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 1, 286–290, hier zitiert 289.
57 Ó Buachalla, Ideology of Irish Royalism, 17. Zu Keating vgl. Cunningham, Geof-frey Keating; dies., Representations; Garvin, Foras Feasa ar Eirinn.
58 Cunningham, Geoffrey Keating, 32f.
Matthias Bähr98
Geschichte von Adam bis zur Ankunft der Normannen erzählt. Das Manu-skript hat Keating vermutlich vor 1634 abgeschlossen. Bereits der Titel –im Original lautet er „Foras Feasa ar Éirinn“59 – ist aufschlussreich. Keating,immerhin Mitglied einer relativ prominenten anglonormannischen Familie,publizierte nicht etwa auf Englisch oder Latein, sondern auf Irisch. „ForasFeasa“ war für die irische Sprache stilbildend; in dieser Hinsicht ist KeatingsWissenskompendium mit Luthers Bibelübersetzung und den Werken Shake-speares verglichen worden.60
Keatings offensiver Umgang mit der irischen Sprache gehörte zu seinem li-terarischen Programm. Es ging ihm darum, die beiden wesentlichen sozialenGruppen Irlands, die Gaelic-Irish und die Old English, zu einer einzigen iri-schen Patria zu verschmelzen und gegen die protestantischen New Englishabzugrenzen.61 Dazu entwickelte er eine historische Meistererzählung, diedie normannische Eroberung Irlands im Jahr 1169 gälisierte: Irland sei nichtetwa unterworfen worden, sondern die neuen Siedler hätten sich friedlichund bruchlos in das Gefüge der irischen Gesellschaft eingeordnet.62 Zwarhabe es vereinzelt Verräter unter den Anglonormannen gegeben. Diese aberseien von Gott mit Kinderlosigkeit gestraft worden und von der Bildflächeverschwunden.63 Damit hatte Keating einen identitätsstiftenden Gründungs-mythos geschaffen: eine hiberno-englische Nation, die im 12. Jahrhundertentstanden war, die sich aber gleichzeitig auf die frühmittelalterlichen iri-schen Hochkönige zurückführen ließ und in der die katholische Orthodoxieden sozialen Zusammenhalt garantierte.64 Unter diesen Vorzeichen warenalle Binnendifferenzierungen aufgehoben; es gab für Keating nur noch Éi-reannaigh, Iren, die in Abgrenzung von den protestantischen Aggressorenrechtmäßig in Irland leben.65
Keatings historiographisches Sendungsbewusstsein war unter den speziel-len Bedingungen der irischen Kollegs auf dem Kontinent entstanden. Das in-tellektuelle Klima der Priesterseminare war die Voraussetzung dafür, irische
59 Keating, Foras Feasa ar Éirinn. Die englische Übersetzung, die in der Regel ver-wendet wird, ist diejenige von David Comyn und Patrick Dinneen: Keating, The His-tory of Ireland.
60 Leerssen, Mere Irish, 274; Cunningham, Geoffrey Keating, Preface, XIII.61 Allerdings bekannte sich Keating offensiv zu seiner anglonormannischen Ab-
stammung und bezeichnete sich und seine Familie – im Unterschied zu den Nua-Ghoill,also den „neuen Ausländern“ – als Sean-Ghoill („alte Ausländer“) (Keating, ForasFeasa ar Éirinn, Bd. 1, 77). Als „New English“ oder „Nua-Ghoill“ werden die schot-tischen und englischen Siedler bezeichnet, die sich seit dem frühen 17. Jahrhundert vorallem in der Provinz Ulster niedergelassen haben.
62 Ebd., Bd. 3, 369.63 Ebd., Bd. 3, 359–369.64 Ebd., Bd. 1, 5, 23–25, 197–225; ebd., Bd. 3, 297, 348–350.65 Cunningham, Geoffrey Keating, 6. Das war vor allem auch deshalb neu, weil
England in der traditionellen irischen Geschichtsschreibung nur eine untergeordneteRolle spielte. Das entscheidende Motiv der irischen Historiographie vor Keating wardie „Vorsehung“, die den Lauf der Geschichte bestimmte (vgl. Cunningham, NativeCulture and Political Change).
„A Wall of Separation“ 99
Identität und katholische Orthodoxiemiteinander zuverschmelzen: Für Kea-ting waren alle Iren katholisch und alle Katholiken, die auf der Insel geborenwurden, irisch. Keatings politische Sprache wurde grundlegend von der so-zialen Praxis beeinflusst. Der Alltag in Reims und Bordeaux ließ die Unter-schiedezwischen den Gaelic-Irish und den Old English unscharf werden. Bei-de Gruppen studierten nebeneinander und nahmen sich in einem fremdenUmfeld, in einer fremden Stadt mehr und mehr als „irisch“ wahr.66 DasMilieuder irischen Seminare bedeutete für beide Seiten „prolonged exposure to oneanother“ und damit ein Abschleifen der Differenzerfahrung.67 Vor diesemHintergrund muss Keatings Wissenskompendium als Versuch der Disam-biguierung gelesen werden. Es ging Keating darum, genealogische Uneindeu-tigkeiten – wer oder was ist gälisch, wer oder was ist englisch, wer oder was istschottisch? – zu beseitigen und eine einheitliche irische Identität gegen dieneuenglischen Siedler in Stellung zu bringen. Die Bildungsmigration hattederartige Vereindeutigungen überhaupt erst ermöglicht. In der Folgezeitblieben Keatings Ideen keineswegs eine rein akademische Angelegenheit,im Gegenteil: Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen irischen Histori-kern, etwa Peter Lombard, Richard O’Ferrall oder Conor O’Mahony, die inder Regel auf Latein und ausschließlich für die europäische Gelehrtenweltschrieben,68 hatte Keating eine enorme Wirkung auf die irische Gesellschaft.„Foras Feasa“ war ein Bestseller.69 Aus dem 17. Jahrhundert sind über dreißigManuskripte in irischer Sprache überliefert.70 Um diese Tatsache angemes-sen einschätzen zu können, muss man sich von bestimmten Vorannahmendarüber lösen, wie volkssprachliche Literatur im frühneuzeitlichen Europafunktionierte. Prinzipiell war zwar die Druckerpresse für den Verbreitungs-grad von Literatur entscheidend.71 Dichter, die auf Irisch schrieben, musstenallerdings grundsätzlich anderen Regeln folgen. Traditionell wurden für ein-zelne einflussreiche Familien repräsentative Manuskripte angefertigt, diesymbolisch außerordentlich bedeutsam waren und die ausschließlich inner-halb bestimmter Verwandtschaftsnetzwerke weitergegeben wurden.72 Diesebesondere kulturelle Prägung der irischen Literatur wirkte auch im 17. Jahr-hunderte noch nach: Wer – wie Keating – seine Identität vor allem daraus be-zog, ein irischer Dichter zu sein, der musste den Gattungsregeln folgen, seineArbeiten im Manuskript veröffentlichen und aufwendig kopieren lassen.
Keating traf allerdings mit „Foras Feasa“ auf ein Umfeld, das mit diesermittelalterlichen Tradition bereits teilweise gebrochen hatte. Um 1600herrschte in Irland eine Art literarische Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-gen. Auch wenn die Vorstellung dichterischer Exklusivität als Ideal wirksam
66 Cunningham, Native Culture and Political Change, 166.67 Finnegan, Old English Views of Gaelic Irish History, 203.68 Ó hAnnracháin, Political Ideology and Catholicism, 157.69 Cunningham, Representations, 132.70 Ebd.71 Siehe z.B. Richardson, Print Culture, insbes. 90–108.72 Gillespie, Material Culture, insbes. 57.
Matthias Bähr100
blieb, dienten Handschriften jetzt nicht mehr ausschließlich dazu, das sym-bolische Kapital einiger weniger Familien zu vermehren. Manuskripte wur-den zum Handelsgut, mit dem sich Geld verdienen ließ. Kopisten fertigten imgroßen Stil Abschriften an, private Sammler traten auf den Plan, Handschrif-ten wurden als persönliches Eigentum angesehen.73 Zwar blieb das Milieu, indem die Handschriften kursierten, nach wie vor vergleichsweise elitär – ge-druckte Literatur war einfach wesentlich günstiger –, aber das Leseverhaltenhatte sich bereits grundlegend verändert: Der konkrete Inhalt der Manu-skripte wurde umso wichtiger, je stärker sie ihre besondere symbolische Au-torität einbüßten.74 Es entstand eine neue Vorlesekultur, die überhaupt erstdadurch möglich wurde, dass jetzt Gebrauchskopien zur Verfügung stan-den.75 Vor diesem Hintergrund wird die besondere Wirkung von KeatingsWissenskompendium verständlich. Das Buch stand an einer Epochenschwel-le. „Foras Feasa“ war, in den Worten des niederländischen Literaturwissen-schaftlers Joep Leerssen, „the last important book in European literaturewhose influence and dissemination owed nothing to the printing press“.76
Es wurde auch deshalb zum viel beachteten Bestseller, weil Keating in sei-ner Diözese Teil einer einflussreichen Klerikerelite war. Von den über 200Studenten und Dozenten, diedasSeminar in Bordeauxbesucht hatten,hattennur sieben den Grad eines Doktors der Theologie erworben. Keating gehörtedazu.77 In Munster hatte er einflussreiche und wohlhabende Fürsprecher. EinSilberkelch mit der Inschrift „Galfridus Keatinge Sacerd[os] Sacrae Theolo-giae Doctor me fiere fecit, 23 Februarii 1634“ ist eigens für Keating angefertigtworden.78 Derartige Kelche gehörten zu den wichtigsten Kunstgegenständenim irischen Katholizismus – aufwendige Altäre oder Fresken gab es praktischnicht – und erhöhten das Sozialprestige ihrer Besitzer beträchtlich.79 SeineAnhänger dürfte Keating nicht zuletzt deshalb an sich gebunden haben,weil er gute Predigten hielt.80 Das war eine typische Eigenschaft der neuenPriestergeneration, die im konfessionell aufgeladenen Umfeld der kontinen-taleuropäischen Kollegs ausgebildet worden war. Die Zuhörer reagiertenhäufig emotional auf den ungewohnten Stil. In der Gemeinde Carrick-on-Suir, die in Keatings Diözese lag, provozierte der Gottesdienst eines Jesuitenlautes Seufzenund Wehklagen. In einem Dorf inder Nähetauchtennacheineroffenbar besonders gelungenen Predigt über die Qualen der Hölle eine Reihe
73 Caball, Lost in Translation; Gillespie, Material Culture, 57f.74 Gillespie, Material Culture, 57f.75 Caball, Lost in Translation, 47.76 Leerssen, Mere Irish, 274.77 Verzeichnis irischer Priester in Bordeaux, 1619, in: National Archives, SP 63/235,
fol. 121; vgl. Cunningham, Geoffrey Keating, 44.78 Der Kelch wird in der Mittelalterabteilung (!) des Waterford Museum of Treasures
gezeigt. Für wichtige Hinweise bedanke ich mich beim Herausgeber des „Journal of theWaterford Archaeological and Historical Society“, Donnchadh O’Ceallachain.
79 Krasnodebska-D’Aughton, Franciscan Chalice.80 Cunningham, Geoffrey Keating, 43.
„A Wall of Separation“ 101
gestohlener Gegenstände wieder auf.81 Zwar sind solche Erfolgsgeschichten,die sich – das muss man einschränkend sagen – an der Grenze zum Topischenbewegen, über Keating selbst nicht bekannt, aber seine Fähigkeiten als Pries-ter und Seelsorger stehen außer Frage. Es ist anzunehmen, dass Keating seineWerke zuerst im Kreis seiner Gönner in Umlauf brachte. Möglicherweise ver-dankte er den Priesterseminaren in Reims und Bordeaux also nicht nur seineThesen, sondern auch seinen literarischen Erfolg.
Tatsächlich zeigt eines der erhaltenen Manuskripte von „Foras Feasa“,welchen Eindruck Keating bei seinen Lesern hinterließ. Maurice King ausAntrim an der irischen Ostküste notierte auf seinem Exemplar – und zwar so-wohl auf Englisch als auch auf Irisch –, dass man es ihm unbedingt zurück-geben müsse, sollte er das Buch verlieren. Kings Besitzervermerk legt die Ver-mutung nahe, dass das Manuskript tatsächlich regelmäßig gelesen und mög-licherweise auf Reisen mitgenommen wurde. Später gehörte das Exemplardem Schotten Patrick McFarland, der Bücherdiebe daran erinnerte, dassman sie an den Bäumen aufhängen werde till the corbies [Krähen] pi[c]kout the eyes.82
Derartige Einblicke in den konkreten Umgang mit Handschriften sindzwar Ausnahmefälle, machen aber deutlich, dass sich einige Leser offenbarstark mit Keatings Wissenskompendium identifizierten, auch wenn mangleichzeitig berücksichtigen muss, dass Manuskripte generell als schützens-werte Wertgegenstände galten. Eindeutig nachweisbar ist Keatings Einflussbei zeitgenössischen Dichtern und Historikern, etwa John Colgan, JohnLynch, Peter Walsh, Seám Ó Conaill oder Dáibhí Ó Bruadair.83 Besonders be-merkenswert ist schließlich ein Brief des Bischofs von Ferns, John Roche, der1631 an den Franziskanerpater Luke Wadding in Rom schrieb: One DoctorKeating laboureth much, as I heare say, in compiling Irish notes towards a his-tory in Irish […].84 Die Tatsache, dass Roche über Keatings Werk zur irischenGeschichte bereits mehrere Jahre vor dessen Abschluss Bescheid wusste undman sich offenbar sogar in Rom für das Vorhaben interessierte, zeigt, dasssich Keatings Publikum früh auf das neue Buch eingestellt hatte. Vor demHintergrund der starken Verbreitung von „Foras Feasa“ ist klar, dass Kea-tings Versuch, Ambiguitäten in der irischen Gesellschaft durch eine einheit-liche, identitätsstiftende und konfessionell ,imprägnierte‘ Geschichtserzäh-lung aufzulösen, zumindest von den Eliten stark rezipiert wurde. Keatingsteht dabei lediglich stellvertretend für eine grundsätzliche und massive Ver-änderung der Lesegewohnheiten, die Anfang des 17. Jahrhunderts zu einerVereindeutigung der Identitäten führte.
81 Ebd., 48.82 Zitiert nach Ohlmeyer, Political Thought, 28.83 Vgl. Färber, Geoffrey Keating, insbes. 106–108.84 John Roche an Luke Wadding, 19. Juli 1631, in: Wadding papers, 542–544, hier
zitiert 544.
Matthias Bähr102
III. Zwischen Schreibfeder und Druckerpresse:Das Leseverhalten in der irischen Gesellschaft
Gedruckte Literatur auf Irisch war, wie gesagt, eine Rarität. Das lag nichtetwa an den technischen Voraussetzungen: Eine Druckerpresse mit irischenLettern wurde 1611 in Löwen angeschafft, später auch in Rom.85 Zumindesteinige Jahre lang konnte man sogar am Trinity College in irischer Schrift dru-cken.86 Außerdem war es prinzipiell möglich, irische Texte als Antiquadruckzu veröffentlichen. In Brüssel wurde 1630 ein irischer Katechismus in Anti-quatype hergestellt.87 Ein Exemplar von Keatings „Foras Feasa“ lag 1636 inLöwen, möglicherweise hat man also zumindest mit dem Gedanken gespielt,das Buch drucken zu lassen.88 Drucke auf Irisch hatten allerdings grundsätz-lich einen schweren Stand. Zwar hatte Elisabeth I. bereits 1570 verfügt, eineirische Bibelübersetzung herauszubringen.89 Das Ergebnis ist allerdings be-zeichnend: Ein irisches Neues Testament erschien erst 1602 in einer begrenz-ten Auflage von 500 Exemplaren, das Alte Testament zunächst überhauptnicht.90 Die besondere Manuskripttradition in Irland immunisierte die irischeLiteratur weitgehend gegen den technischen Mainstream.
Es war allerdings Teil der literarischen Gleichzeitigkeit der Ungleichzeiti-gen, dass sich bei lateinischen und englischen Drucken das genaue Gegenteilbeobachten lässt. Um 1600 geriet Irland verstärkt in den Sog der publizisti-schen Konfessionskämpfe in Europa. Zwar war das Leseverhalten der iri-schen Eliten bereits im 16. Jahrhundert auf den europäischen Kontinenthin orientiert, wenn es um gedruckte Literatur ging. Das erste mit bewegli-chen Lettern gedruckte Buch erschien in Irland allerdings erst sehr spät,1551, und auch danach konnte sich keine wirklich konkurrenzfähige Drucke-rei etablieren.91 Anglonormannische Bibliotheksbesitzer wie ChristopherNugent und Richard Stanihurst waren weitgehend auf Importe angewiesen.92
Im 16. Jahrhundert galt Irland im Vergleich zu anderen europäischen Län-dern als literarisch rückständig. Der englische Offizier und Schriftsteller
85 Ohlmeyer, Political Thought, 3; Leerssen, Mere Irish, 260.86 Pollard, Dublin’s Trade in Books, 35f. Der Drucker William Kearney hatte sich
vermutlich bereits 1592 in Dublin niedergelassen, war dort aber nicht auf Dauer er-folgreich. Nach 1597 verließ er Irland offenbar wieder (vgl. Pollard, Dictionary, 330f.).
87 Gillespie, Reading Ireland, 57.88 Caball, Lost in Translation, 51. Allerdings wurde schließlich nicht einmal die
englische Übersetzung, die 1635 von Michael Kearney angefertigt worden war, ge-druckt (vgl. Färber, Geoffrey Keating, 103).
89 Leerssen, Mere Irish, 282.90 Färber, Geoffrey Keating, 100. Bereits 1571 war in Dublin ein irischer Kate-
chismus veröffentlicht worden, der allerdings eine Ausnahme blieb und keine weiterenDrucke nach sich zog (Gillespie, Reading Ireland, 56).
91 Gillespie, Reading Ireland, 55.92 Ebd., 61f.
„A Wall of Separation“ 103
Barnabe Rich schrieb 1578, Irland sei ein Land where they have no maner ofbookes, neither yet the use of printing.93
Anfang des 17. Jahrhunderts stieg die Nachfrage nach gedruckter Literaturdann allerdings rasant an. 1612 wurde beispielsweise fast die fünffache Men-ge an Büchern nach Südirland eingeführt wie in den 1590er Jahren.94 Diewichtigsten Handelsrouten führten von Bristol nach Waterford, Limerickund Cork und von Chester nach Dublin, aber es wurden auch direkt Druckeaus Frankfurt, Lissabon, Paris und Antwerpen importiert.95 Ein wichtigerkatholischer Adliger, Richard Burke, Earl of Clanricarde, beschäftigte bei-spielsweise einen Unterhändler, der in Lissabon gezielt Literatur für ihn ein-kaufte.96 Von den urbanen Zentren Irlands aus brachten Hausierer dann eineReihe von einfacheren Druckerzeugnissen – etwa die beliebten Hornbooks, inHorn gebundene, knappe Textsammlungen – auch in die ländlichen Regio-nen.97 Auf diese Weise erschlossen die europäischen Druckereien mit Irlandeinen weitgehend neuen Markt.
Diese Entwicklung hatte zwei unmittelbare Konsequenzen: Erstens wur-den nach 1600 auch in Irland bedeutende Bibliotheken angelegt. Währendim 16. Jahrhundert selbst engagierte Autoren nur auf begrenzte Bibliotheks-bestände zurückgreifen konnten, brachte es Lord Edward Conway aus An-trim um 1630 auf 8000 Titel, die von einem professionellen Bibliothekar ka-talogisiert und verwaltet wurden.98 James Ussher, der spätere Erzbischof vonArmagh, baute bereits vor 1608 eine wichtige Bibliothek auf, die vor allemwegen Usshers Reputation als bedeutender protestantischer Gelehrter als„die vielleicht berühmteste Bibliothek des Jahrhunderts“ bezeichnet wordenist.99 Usshers Schwiegervater Luke Challoner konnte seinen Bücherbestandum 1600 ebenfalls erheblich erweitern (1595: 473 Titel, 1608: 885 Titel),und beide legten den Grundstock für die Bibliothek des Trinity College.100
Lange unterschätzt worden ist die Rolle der irischen Kathedralen, die insbe-
93 Rich, Allarme To England, fol. 25. Zu Rich vgl. Flanagan, Barnaby Rich.94 Gillespie, Book Trade, insbes. 2.95 Pollard, Dublin’s Trade in Books, 37f.; Gillespie, Book Trade, 12; ders., Irish
Franciscans, 52; ders., Reading Ireland, 66f.96 Thomas Goold an Philip Fagan, 28. September 1602, in: National Archives,
SP 63/212, fol. 73; Ohlmeyer, Political Thought, 29.97 Gillespie, Book Trade, 2, 7.98 Gillespie, Reading Ireland, 68. Conways Bibliothekar war der Lehrer Philip
Tandy (Philip Tandy an Rowdon, 26. Dezember 1635, in: National Archives, SP 63/255,fol. 161). Conway beschäftigte offenbar Agenten, die für Literaturnachschub sorgten(vgl. George Rawdon an Lord Conway, 8. Oktober 1634, in: National Archives, SP 63/254, fol. 460; Philip Tandy an Rawdon, 9. Mai 1636, in: National Archives, SP 63/255,fol. 321).
99 Pollard, Dublin’s Trade in Books, 62 („perhaps the most famous library of thecentury“). Der Bestand der Bibliothek lässt sich über ihren frühesten Katalog aus demJahr 1608 annähernd rekonstruieren (vgl. Boran, Libraries).
100 Boran, Libraries, 77f., 115.
Matthias Bähr104
sondere in den 1620er und 1630er Jahren ebenfalls in Bücher investierten. DieDombibliothek von Limerick besaß 1624 immerhin 216 Titel.101
Die Bibel wurde jetzt allgemein zugänglich, auch wenn Katholiken dabeieinige Hürden überwinden mussten: Am weitesten verbreitet war weiterhindie Vulgata, die englische Douay-Rheims-Bibel war selten, und die irischeÜbersetzung, die außerdem von protestantischen Gelehrten angefertigt wor-den war, kam erst verspätet und dann auch nur unvollständig auf den Markt(das Alte Testament erschien erst nach 1680). Trotzdem erreichte die Bibel im17. Jahrhundert konfessionsübergreifend einen wesentlich größeren Leser-kreis als noch im 16. Jahrhundert. Insgesamt war in der irischen Gesellschaftjetzt ein breiter Bestand an gedruckter Literatur verfügbar, der dazu beitrug,zumindest die Eliten nach und nach an die europäische Gelehrtenwelt anzu-binden.102
Eine zweite Entwicklung, die mit dem erweiterten Buchmarkt eng zusam-menhing, ist für die Frage nach der Vernichtung von Ambiguität besonderswichtig: Unter dem Deckmantel der neuen Handelsbeziehungen wurden ver-stärkt illegale Drucke mit klar katholischer Ausrichtung nach Irland ge-schmuggelt, die sonst der englischen Zensur zum Opfer gefallen wären. Be-sonders beliebt waren Heiligenviten. „The life of the glorious bishop Pat-ricke“ des irischen, nach Löwen emigrierten Franziskanerpaters RobertRochford war eines der ersten gedruckten Bücher, das eine breite Leserschaftfand. Rochford hatte verschiedene lateinische Vorlagen, etwa Jocelin vonGlasgow, zu einer Geschichte der irischen Nationalheiligen Patrick, Brigidaund Columban verschmolzen.103 Ihm ging es dabei vor allem darum, am Bei-spiel Patricks den päpstlichen Suprematieanspruch, die Realpräsenz Christiund die Reliquienverehrung gegen die reformatorische Lehre zu verteidi-gen.104 Rochfords Buch wurde wiederholt als illegale Ware beschlagnahmt.105
Der katholische Bibliotheksbesitzer Thomas Arthur aus Limerick besaß zweiAusgaben der Vita, die an das fünfbändige Werk „Flos sanctorum“ des Domi-nikaners Alonso de Villegas – ebenfalls eine Sammlung von Heiligenleben –angehängt worden waren. Rochfords Patrickvita muss in diesem Zusammen-hang vermutlich als selbstbewusste irische Ergänzung zu de Villegas’ Werkverstanden werden, dessen Anspruch es war, das Leben aller Heiligen umfas-send darzustellen.106 Auch Keating benutzte Rochford in seinem Wissens-kompendium als Quelle, um zu beweisen, dass Irland mehr Heilige hervorge-bracht habeals jedesandere Land in Europa.107 Rochford steht damit stellver-tretend für eine Gattung von Literatur, die in Irland häufig erst jetzt tatsäch-
101 Gillespie, Irish Cathedral Libraries, insbes. 180–183, 187.102 Gillespie, Reading Ireland, 68f., 133.103 Rochford, The Life of the Glorious Bishop Patricke.104 Ryan, Steadfast Saints, insbes. 258f.105 Zu Rochfords Heiligenvita und ihrer Verbreitung in Irland vgl. Gillespie, Book
Trade, 10; ders., Reading Ireland, 148f.106 Villegas, Flos santorum y historia general.107 Keating, Foras Feasa ar Éirinn, Bd. 1, 79f.
„A Wall of Separation“ 105
lich gelesen werden konnte: gedruckte Bücher mit einem eindeutig katholi-schen, nachtridentinischen Sendungsbewusstsein.
Die Bildungsmigranten aus den irischen Kollegs waren dabei in der Regeldie entscheidenden Grenzgänger, die immer wieder für Nachschub sorgten.Ein Sohn des katholischen Adeligen Christopher Plunkett brachte beispiels-weise illegale Literatur aus Douai nach London mit, um sie von dort aus nachIrland zu schmuggeln.108 Vor allem aus Löwen kamen kontinuierlich Flug-schriften nach Irland, die in der Regel von den Priestern selbst eingeführtoder von befreundeten Kaufleuten zwischen Waren wie Wein oder Tabak ver-steckt wurden.109 Einblattdrucke mit kurzen gedruckten Texten und einpräg-samen Bildern, die beispielsweise den heiligen Franziskus darstellten, warenbesonders beliebt und zielten gerade auch auf illiterate Kreise in der irischenGesellschaft.110 Diese Art von Druckerzeugnissen war – neben eindeutig ka-tholischen Balladen und Gedichten – bereits früh als Gefahr erkannt und1593 ausdrücklich verboten worden.111 Mit der Zeit entwickelten sich aller-dings Netzwerke, auf die die englischen Autoritäten kaum Zugriff hattenund die deshalb nur schwer zu kontrollieren waren. Anfang des 17. Jahrhun-derts konnte zum Beispiel in Rouen ein fester „Broker“ relativ frei agierenund die illegalen Handelswege organisieren.112 1609 wurde im englischenChester ein Zwischenhändler festgenommen, bei dem man zahlreiche, fürden irischen Markt bestimmte Drucke und Manuskripte fand. Der Mannwar in katholischen Kreisen offenbar bereits seit längerem als Schmugglerbekannt und wurde von seinen Kunden gezielt aufgesucht.113 Über das Aus-maß dieser Aktivitäten lassen sich zwar nur Vermutungen anstellen. Wennman allerdings berücksichtigt, dass in der Regel nur gescheiterte Versuche,Drucke in die irischen Häfen zu schmuggeln, quellenmäßig fassbar sind,dann muss man angesichts der relativ vielen bekannten Fälle von einem Mas-sengeschäft ausgehen.
Die Tatsache, dass im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ein blühenderSchwarzmarkt für illegale katholische Literatur entstand, führte zu einemveränderten Leseverhalten. DasPublikum integrierte seine Lektüre in den ei-genen konfessionellen Horizont, der bereits von der neuen Klerikergenerati-on und „priest-poets“ wie Keating geschärft worden war. In WentworthsAmtszeit war der negative Einfluss, den die konfessionell aufgeladenen Dru-cke angeblich auf junge Katholiken ausübten, bereits ein Allgemeinplatz. Ein
108 Arthur Chichester an Salisbury, 14. April 1609, in: National Archives, SP 63/226,fol. 185. Christopher Plunkett galt später als Ringleader der katholischen Partei imirischen Parlament von 1613 (A Note of the Lords and Recusants in the Houses ofParliment, 1613, in: LP, Carew MS 600, fol. 51).
109 Gillespie, Book Trade, 9–11.110 Gillespie, Irish Franciscans, 51.111 Gillespie, Book Trade, 6.112 Brief an Robert Cecil, in: National Archives, SP 12/283a, fol. 32; Gillespie, Book
Trade, 9.113 Arthur Chichester an Salisbury, 14. April 1609, in: National Archives, SP 63/226,
fol. 185.
Matthias Bähr106
Drucker begründete damit 1637 erfolgreich eine Petition an den König.114
Etwa zur selben Zeit erhielt Wentworth aus London den warnenden Hinweis,es habe noch nie so many strange Books auf den Britischen Inseln gegeben.115
Im Juni 1641, am Vorabend der Irish Rebellion, identifizierte die irische Re-gierung den illegalen Handel mit katholischer Literatur – neben der Bil-dungsmigration – als Hauptgrund für die fragile öffentliche Ordnung und be-schloss verstärkte Kontrollen.116
Auch die Church of Ireland reagierte auf die veränderte Lage. Abgesehenvon wenigen Ausnahmen117 wurden die irischen Kirchen konsequent mitdem „Book of Common Prayer“ versorgt, das 1621 in einer Neuauflage er-schienen war. In den 1630er Jahren war es dann allgemein verbreitet. Eine er-folgreiche irische Übersetzung war bereits 1608 herausgebracht worden.118
Daneben wurde verstärkt Erbauungsliteratur aus England importiert:„Schoole of Vertue“, eine illustrierte Sammlung von Gebeten und didakti-schen Ratschlägen (Howe to order thy selfe in the Churche etc.), die in Eng-land bereits seit den 1550er Jahren auf dem Markt war, entwickelte sich jetztauch in Irland zum Verkaufserfolg.119 Ein früher Klassiker war außerdem„The Practice of Piety“ des englischen Theologen Lewis Bayly.120 Es war al-lerdings vor allem das „Book of Common Prayer“, das für viele Gläubige An-fang des 17. Jahrhunderts zur Schlüssellektüre wurde, die sie eindeutig alsMitglieder der Church of Ireland auswies – und nicht einfach „nur“ als Pro-testanten. Nach dem Vorbild katholischer Flugschriften wurde es sogar stel-lenweise bebildert, um seine Reichweite zu erhöhen.121 Insgesamt wurde alsovor 1641, als die gesellschaftliche Ordnung in weiten Teilen Irlands zusam-menbrach, publizistisch stark aufgerüstet. Das neue Leseverhalten, das jetztüber weite Strecken konfessionell geprägt war, trug langfristig erheblich zurreligiösen Vereindeutigung bei. Allerdings verlief diese Entwicklung, die dieirische Literatur gewissermaßen konfessionell bereinigte, nicht bruchlos. Es
114 Petition des Druckers Francis Stewart an den König, 1637, in: National Archives,SP 63/256, fol. 34.
115 Brief eines anglikanischen Pastors an Wentworth, 28. April 1637, in: The Earl ofStrafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 2, 72–75, hier zitiert 74.
116 Die irische Regierung an den Secretary of State Henry Vane, 30. Juni 1641, in:National Archives, SP 63/259, fol. 198.
117 In der Diözese Down and Connor, die allerdings bereits von Presbyterianerndominiert wurde, gab es 1634 angeblich kaum Exemplare des „Book of CommonPrayer“: It would trouble a man to finde 12 common praier bookes in all them churches(Brief des Bischofs von Derry an Laud, 20. Dezember 1634, in: National Archives,SP 63/254, fol. 498).
118 Gillespie, Reading Ireland, 138f. Die erste Auflage des „Book of Common Pra-yer“ war bereits 1551 erschienen – als erstes Buch aus einer irischen Druckerpresseüberhaupt (Pollard, Dublin’s Trade in Books, 34).
119 Seager, The Schoole of Vertue, 345. Zwischen 1595 und 1612 wurden nach-weislich mindestens 150 Exemplare des Buchs von Bristol aus nach Südirland ex-portiert (Gillespie, Book Trade, 13).
120 Bayly, The Practice of Piety.121 Gillespie, Reading Ireland, 138, 142.
„A Wall of Separation“ 107
gab nach wie vor einen gewissen Spielraum für interkonfessionelle Leseer-fahrungen. Luke Challoner und James Ussher beispielsweise interessiertensich auch für katholische Autoren, etwa Robert Bellarmin, und unterhieltenAusleihbeziehungen zu literarisch gebildeten Katholiken.122 Ussher verliehnachweislich eineHeiligenvita an den bekanntenkatholischen Sammler Tho-mas Arthur und schenkte ihm offenbar auch Bücher.123 Die borrowing list derChrist Church Cathedral in Dublin belegt, dass auch hier an einen relativbreiten, teilweise konfessionsübergreifenden Leserkreis Literatur verliehenwurde.124 Aus der Bibliothek Edward Conways konnten sich interessierte Le-ser unter bestimmten Umständen ebenfalls Bücher besorgen.125 In Einzelfäl-len behaupteten sich katholische Werke auch auf dem protestantischenBuchmarkt. Eine gekürzte Sammlung von Gebeten des spanischen Domini-kaners Luis de Granada, die 1601 in London unter dem Titel „The flowersof Lodowicke of Granado126 erschienen war, wurde zum Beispiel auch vonProtestanten gekauft.127 Brutus Babington, seit 1610 Bischof von Derry, be-hauptete schließlich Anfang 1611, drei führende Katholiken durch eine ArtLesekreis, der in seinem Studierzimmer abgehalten wurde, von einer mode-raten Politik überzeugt zu haben.128
Thomas Wentworth selbst hatte bereits als junger Mann immer wieder Bü-cher ausgeliehen und auch verliehen.129 Als Lord Deputy behielt er diese Ge-wohnheit bei. 1636 zum Beispiel besorgte er sich aus London die „Kriegsre-geln“ des Duc de Rohan, „Le Parfait Capitaine“.130 Bemerkenswerterweiseliehen sich im Frühjahr 1638 offenbar auch Archibald Campbell, der Führer
122 Boran, Libraries, 109–115.123 Gillespie, Reading Ireland, 67, 74, Anm. 73.124 Gillespie, Irish Cathedral Libraries, 189.125 George Rawdon an Lord Conway, 8. Oktober 1634, in: National Archives, SP 63/
254, fol. 460. In diesem Fall verlieh Conway ein (unbekanntes) Manuskript als Ge-genleistung für einen Hundewelpen.
126 Granada, The Flowers of Lodowicke of Granado.127 Gillespie, Book Trade, 9. 1612 wurden sechs Exemplare des Buches legal nach
Südirland exportiert (ebd., 13).128 Babington an Salisbury, 20. Januar 1611, in: National Archives, SP 63/231,
fol. 20. Die drei erklärten sich angeblich bereit, sich zum Beipsiel dafür einzusetzen,dass die Katholiken in der Diözese wenigstens einmal im Jahr nach den Regeln derEstablished Church die Kommunion empfangen könnten. Leider ist nicht überliefert,was bei Babington genau gelesen wurde.
129 Siehe z.B. den Brief Wentworths an Henry Wooten, Botschafter in Venedig,8. November 1617, in: The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 1, 5: First togive you many thanks for the Books I have received.
130 Rohan, Le parfait capitaine; vgl. Lord Conway an Wentworth, 4. Januar 1636, in:The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 2, 45; Wentworth an Lord Conway,11. März 1637, in: National Archives, SP 63/256, fol. 71; Brief an Wentworth (Ab-schrift), 8. März 1637, in: National Archives, SP 63/256, fol. 75. Wentworth erhielt dasBuch von Edward Conway, der – wie gesagt – die umfangreichste Bibliothek in Irlandaufgebaut hatte. Conway verschickte es allerdings aus London, nicht aus Portmore imCounty Antrim.
Matthias Bähr108
der schottischen Covenanters, und Wentworth gegenseitig Bücher aus.131 Un-ter Umständen war Wentworth darin von William Chillingworth bestärktworden, der eine moderate Haltung gegenüber Nonkonformisten vertratund dessen 1637 erschienenes Buch „The Religion of Protestants“132 Went-worth kannte.133 Trotz aller konfessionellen Polarisierung gab es also auchin den 1630er Jahren nach wie vor Raum für vielfältige Leseerfahrungen.
Allerdings, und das ist die entscheidende Einschränkung, waren die Gren-zen zwischen interkonfessioneller Lektüre und konfessioneller Aufrüstungfließend. Die Ausleihbeziehungen dienten gerade auch der religiösen Selbst-vergewisserung, also dazu, sich entschieden von der fremden Konfession ab-zugrenzen und das eigenekonfessionelle Profil zu schärfen.134 Auf diese Weisekonnte selbst ein Leseverhalten, das auf den ersten Blick offen war für reli-giöse Ambiguität, langfristig zu einer Vereindeutigung der konfessionellenIdentitäten führen.
IV. Nur über meine Leiche:Konfessionelle Grenzziehungen im Kirchenraum
Die religiöse Praxis einer Gesellschaft lässt sich in der Regel dann beson-ders gut analysieren, wenn es um die ,letzten Dinge‘ geht, um Krankheit,Tod und Seelenheil. Besonders aufschlussreich ist dabei der Umgang mitdem toten Körper. In Irland war die Bestattungspraxis um 1600 vor allemin einem Punkt konfessionell mehrdeutig: Das traditionelle Begräbnis imKirchenraum, das seit dem Frühmittelalter üblich war, wurde von katholi-schen Familien auch dann beibehalten, wenn die Kirche selbst protestantischgeworden war – und das war die Regel. Daraus ergab sich die paradoxe Situa-tion, dass engagierte Katholiken, die sich zu Lebzeiten dem protestantischenGottesdienstzwang erfolgreich entzogen hatten, nach ihrem Tod quasi stän-dig am Gottesdienst teilnehmen mussten. Die anglikanischen Pfarrer predig-ten, wie die Ethnologin Clodagh Tait formuliert hat, quasi „über ihren Lei-chen“.135
Allerdings war es in Irland für katholische Familien nicht schwer, sich mitdiesem Problem abzufinden: Viel wichtiger als die eigentliche Beerdigung,also das,wasunmittelbaramGrab passierte, waren dieTotenritenund dasLei-
131 Wentworth an Campbell, 19. März 1638, in: The Earl of Strafforde’s Letters andDispatches, Bd. 2, 299f. Darin bedankt sich Wentworth für die Bücher, die ihm der Earlausgeliehen hatte.
132 Chillingworth, The Religion of Protestant.133 Brief eines anglikanischen Pastors an Wentworth, 9. November 1637, in: The Earl
of Strafforde’s Letters and Dispatches, Bd. 2, 128–130, hier zitiert 130: Here is newlypresented to the King a Book written by one Chillingworth […] a Book famous and longexpected, The Religion of Protestants a safe Way to salvation […]. I hope Mr. Rayltonwill send you one of them (Hervorhebungen im Original).
134 Boran, Libraries, 99, 103.135 Tait, Death, 79: Die Pfarrer hielten „Protestant services literally over their dead
bodies“, das heißt über den Körpern der katholischen Verstorbenen.
„A Wall of Separation“ 109
chenbegängnis. Während das Leichenbegängnis zumindest gelegentlich dieAutoritäten auf den Plan rief – etwa dann, wenn im Leichenzug ein Prozessi-onskreuz mitgeführt wurde–,blieben die Totenriten unsichtbar. Die Trauerge-meinde kam in der Regel im Haus des Verstorbenen zusammen, was auch dersonstüblichenPraxisentsprach, denndiekatholische Kirche verfügte inIrlandnur über wenige öffentliche Gebäude. In der sozialen Praxis störte sich kaumjemand daran, was im Verborgenen konkret passierte. Protestantische Pfarrerbemerkten lediglich, dass Katholiken ohne größeres Zeremoniell am Grab aus-kämen.136 Hier wurde also offenbar erfolgreich dissimuliert.
Entscheidend war aber vor allem eins: Im Kirchenraum selbst lagen Protes-tanten und Katholiken vielfach direkt nebeneinander, denn auch protestan-tische Familien legten Wert auf die Bestattung in der Kirche oder zumindestauf dem Kirchhof. Die traditionellen Begräbnisplätze, die in der Regel gene-rationenübergreifend genutzt wurden, bedeuteten symbolisches Kapital fürden Verstorbenen und seine Familie. Aus dieser Perspektive waren Kirchenparadigmatische Räume der Ambiguität: „Whatever conflicts were actedout in the landscape, the burial ground appears to have been a space wherethe wealthy and influential of all persuasions could expound their selectedidentities and claim.“137
In Extremfällen hatte das konfessionsübergreifende Bemühen um Prestigezur Folge, dass zum Beispiel neben einem Protestanten, der sich auf seinemGrabmal als Vorkämpfer für den eigenen Glauben inszenierte, ein katholischerPriester bestattet seinkonnte.138 In ehemaligenKlöstern, die alsBegräbnisplät-ze besonders beliebt blieben, entwickelten sich nach der Säkularisierung derGebäude häufig informelle Pachtverhältnisse. Die Gräber konnten gegeneine Gebühr weitergenutzt werden. Damit profitierten alle Seiten von der tra-ditionellen Bestattungspraxis: der protestantische Eigentümer finanziell, derkatholische Verstorbene und seine Hinterbliebenen spirituell und im Hinblickauf das Sozialprestige.139 In den 1630er Jahren gab es dann allerdings vermehrtVersuche, diese Praxis zu beenden. Der Bischof von Kilmore veranlasste bei-spielsweise Ende 1638, katholische Begräbnisse in den Kirchen seiner Diözesezu verbieten.140 Der Spielraum für Ambiguität wurde kleiner.
136 In diesem Absatz beziehe ich mich auf Tait, Death, 52f.137 Mytum, Archaeological Perspectives, 180. Allerdings kam es in Einzelfällen zu so
genannten „Funeral Riots“, bei denen vor allem Frauen, die weniger leicht zu bestrafenwaren als Männer, gegen umstrittene Praktiken vorgingen. 1608 wurde beispielsweiseeinem anglikanischen Pfarrer das „Common Book of Prayer“ aus der Hand geschlagen(Tait, Death, 54–58). 1604 wurde eine protestantische Beerdigung in Westmeath ge-stört (John Davies an Robert Cecil, 8. Dezember 1604, in: National Archives, SP 63/216,fol. 149).
138 Mytum, Archaeological Perspectives, 180.139 Tait, Death, 77f.140 Statuten der Synode von Kilmore, 19. September 1638, in: National Archives, SP
63/256, fol. 294; Brief des Bischofs von Derry an William Laud, 12. Januar 1639, in:National Archives, SP 63/257/1, fol. 1.
Matthias Bähr110
Auch Grabmäler wurden zunächst nicht als offensive Instrumente der kon-fessionellen Abgrenzung eingesetzt, allerdings kam es in diesem Bereich imersten Drittel des 17. Jahrhunderts zu weitreichenden Veränderungen: Zwi-schen 1604 und 1641 stieg die Zahl bildhauerisch bearbeiteter Gräber gegen-über dem späten 16. Jahrhundert um das Vierfache an.141 Diese Entwicklunglässt sich damit erklären, dass die irischen Eliten jetzt konfessionsübergrei-fend auf eine dauerhafte, „in Stein geschriebene“ Memoria setzten, die die fi-nanziell aufwendigen – aber eben nur kurzfristig wirksamen – Leichenbe-gängnisse ergänzte.142 Katholiken stifteten etwa dreißig Prozent der neuenGrabmäler.143 Dabei lässt sich stellenweise ein klar katholisches Bildpro-gramm identifizieren: In St. Patrick’s Cathedral wurden auf einem Grabvon 1616 unter anderem die Passionsinstrumente, das Christusmonogramm„IHS“, das Herz mit den drei Nägeln und ein „M“ als Verweis auf die katho-lische Marienfrömmigkeit gezeigt. In der Grafschaft Cork ist das Grabmal ei-nes katholischen Bürgermeisters erhalten, das eine Christusfigur mit Stan-darte zeigt und um Gebete für die Seele des Verstorbenen bittet.144 Insgesamtbewegten sich die katholischen Stifter im Rahmen der mittelalterlichen Dar-stellungstradition, die von Heiligenfiguren, der Jungfrau Maria und allegori-schen Darstellungen des Heiligen Geistes bestimmt wurde.145 Allerdings blie-ben diese Stilmittel häufig subtil genug, um keinen Anstoß zu erregen: Ob-wohl die Gräber in protestantischen Kirchen errichtet wurden, kam es – an-ders als in England und Schottland – nicht zu Ikonoklasmen.146 DerKirchenraum blieb also auch in diesem Punkt konfessionell mehrdeutig.
Nach und nach nutzte die anglikanische Kirche dann allerdings geradeGrabmäler dazu, den Kirchenraum zu normieren und konfessionell zu berei-nigen. Am Fall Richard Boyles (1566–1643) lässt sich das besonders gut zei-gen. Boyle, ein sozialer Aufsteiger aus England, der in Irland mit Bodenspe-kulationen ein Vermögen gemacht hatte, war 1603 nobilitiert worden und1620 zum Earl of Cork aufgestiegen, was an sich bereits eine Provokationfür die traditionellen Eliten darstellte. Boyle, der über umfangreiche Lände-reien verfügte, legte Wert darauf, sich an die irische Gesellschaft anzubinden:Er verschenkte immer wieder typisch „irische“ Gegenstände und Produktean sein soziales Umfeld, zum Beispiel Whiskey, ließ seine Kinder von irischenAmmen erziehen und sorgte für regelmäßigen Unterricht auf Irisch. Gleich-zeitig unterstützte er Schulen, die für Siedler und Iren gleichermaßen offenwaren.147 Boyle stand damit stellvertretend für Versuche, sich von herge-
141 Loeber, Sculptured Memorials, 271.142 Gillespie, Funerals and Society, insbes. 89f.; Canny, Kingdom and Colony, 54.143 Loeber, Sculptured Memorials, 271.144 Tait, Death, 79f.145 Loeber, Sculptured Memorials, 276f.146 Tait, Death, 80.147 Canny, Upstart Earl, insbes. 127–138; Ohlmeyer, Irish Peers, insbes. 169.
„A Wall of Separation“ 111
brachten Identitäten zu lösen und einer Art angloirischen „Hybridgesell-schaft“ den Weg zu bereiten.148
Mit diesem Anspruch geriet Boyle zunehmend in Konflikt mit denjenigengesellschaftlichen Akteuren, die gerade eine Vereindeutigung der Identitätenanstrebten. Das wurde deutlich, als Boyle für seine im Februar 1630 verstor-bene Frau Katherine ein prachtvolles, angeblich rund tausend Pfund teuresGrab im Chor der St. Patrick’s Cathedral errichten ließ.149 Auf den erstenBlick tat Boyle damit nichts anderes, als seine Frau dort zu beerdigen, wo be-reits ihr Vater und Großvater bestattet worden waren.150 Die Grabinschriftbetont die Familienkontinuität ausdrücklich: The said Ladie KatherineCountess of Corke, who lieth here interred with her said father and grand-fa-ther, whose vertues she inherited on earth and lieth here intombed with themall expecting a joyfull resurrection.151 Boyle folgte also der in Irland üblichenBestattungspraxis und brachte Katherines Leichnam mit den sterblichenÜberresten ihrer Familie zusammen. Trotzdem wurde das Grab nach seinerFertigstellung heftig kritisiert: Der Erzbischof von Canterbury, WilliamLaud, nahm Anstoß daran, dass das Grab genau dort aufgebaut wordenwar, wo sich vor der Reformation der Hochaltar befunden hatte. Eigentlichwäre das der Ort gewesen, an dem – folgt man Lauds Reformprogramm fürdie anglikanische Kirche – der Kommunionstisch hätte stehen müssen.152
Der 94. irische Canon von 1634 verfügte ausdrücklich, in allen Kirchen einen„fair table […] at the east end of church or chancel“ aufzustellen und ihn zumzeremoniellen Mittelpunkt des Gottesdienstes zu machen.153 Damit brach einKonflikt auf, in dem die konfessionelle Reinheit des Kirchenraums zur ent-scheidenden Frage wurde. Es ging darum, ob es der anglikanischen Kongre-gation unter diesen Umständen zuzumuten sei, in Richtung Kommunions-tisch niederzuknien, wie es der 18. irische Canon verpflichtend festschrieb,154
und damit letztlich vor Cork und seiner Frau auf die Knie zu fallen.
Die neue Vorstellung von konfessioneller Reinheit wurde gegen die irischeBegräbniskultur abgegrenzt, an die Boyle gerade Anschluss gesucht hatte.Auch hier hatte er sich ja als Teil einer neuen, angloirischen Hybridgesell-schaft inszeniert: Die Gebeine der Verstorbenen gehörten gemäß der vorre-formatorischen Tradition in die Familiengrablege. Diese Praxis genügte –wie im Fall Boyles – den normativen Ansprüchen der protestantischen Elitenin Dublin und England allerdings nicht mehr in allen Fällen. Der Kirchen-
148 Canny, Upstart Earl, 138 („hybrid Anglo-Irish society“).149 Boyle schildert die Details selbst im Februar 1634: National Archives, SP 63/254,
fol. 234.150 Ebd.151 Hervorhebung durch mich (die Inschrift habe ich im Februar 2013 gesichtet).152 Laud an Boyle, 21. März 1634, in: The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches,
Bd. 1, 222f.; Brief des Erzbischofs von Dublin an Laud, 19. Februar 1634, in: NationalArchives, SP 63/254, fol. 234.
153 McCafferty, Reconstruction, 98.154 Clarke, The Government of Wentworth, 252; McCafferty, Reconstruction, 99.
Matthias Bähr112
raum, der in dieser Beziehung jahrzehntelang uneindeutig gehalten wordenwar, wurde jetzt konfessionellen Regeln unterworfen. Damit wurde gleich-zeitig von den Akteuren verlangt, konfessionell „Farbe zu bekennen“.
Die Frage, was mit dem umstrittenen Grabmal geschehen sollte, war für dieZeitgenossen zunächst nicht leicht zu beurteilen. Im März 1634 hatte der Kö-nig noch verfügt, es vorerst im Chor der Kathedrale zu belassen.155 Bereits imApril wurde dann allerdings eine Kommission eingesetzt, der neben Went-worth mehrere anglikanische Geistliche angehörten. Sie sollte eine definitiveEntscheidung treffen.156 Verschärft wurde die Auseinandersetzung noch da-durch, dass Boyle seit seiner Ankunft in Irland eine Reihe von Kirchengüternenteignet hatte und deshalb nicht als „guter Freund“ der Kirche galt, wie sichLaud ausdrückte.157 Der Konflikt hatte also auch eine ökonomische Dimen-sion. Boyle, der soziale Aufsteiger, hatte sich wegen seiner rapiden wirt-schaftlichen Expansion in der ständischen Gesellschaft Feinde gemacht.Wentworth gab sich auch deshalb zuversichtlich, dass das Grabmal entferntwerden würde: There is an end to the Tomb before it come to be intombed in-deed.158
Tatsächlich gab die Kommission Boyle unmissverständlich zu verstehen,dass das Grabmal wieder abgebaut werden müsse. Dem Earl, der noch im Fe-bruar 1634 erklärt hatte, lieber sterben zu wollen,159 blieb nichts anderes üb-rig, als es nur ein Jahr später in seine Einzelteile zerlegen zu lassen.160 Vor-übergehend wurde alles in Kisten verpackt, bevor das Grab an einer wenigerprominenten, weniger stark religiös aufgeladenen Stelle wieder aufgebautwurde.161 Damit hatten Wentworth und die anglikanischen Eliten aber nichtnur Boyle selbst gemaßregelt, sondern auch die traditionelle Bestattungspra-xis aus einer Perspektive der konfessionellen Orthodoxie beurteilt. Der FallRichard Boyle verweist auf einen grundsätzlichen Trend zur konfessionellenNormierung der Begräbniskultur, der sich für die 1630er Jahre feststellen
155 Befehl des Königs an Wentworth, März 1634, in: National Archives, SP 63/254,fol. 256.
156 Befehl des Königs an Wentworth, April 1634, in: National Archives, SP 63/254,fol. 268.
157 Laud an Boyle, 21. März 1634, in: The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches,Bd. 1, 223: You have not been a very good Friend of the Church. Das war Laud angeblichvon seinem Umfeld wiederholt versichert worden. In der Diözese Waterford und Lis-more hatte sich Boyle angeblich unrechtmäßig bereichtert. Vgl. dazu den Brief desBischofs von Waterford an Laud, 7. März 1634, in: National Archives, SP 63/254,fol. 248; vgl. außerdem den Bericht über den Zustand der Diözese, 3. Mai 1634, in:National Archives, SP 63/254, fol. 272.
158 Wentworth an Laud, 23. August 1634, in: The Earl of Strafforde’s Letters andDispatches, Bd. 1, 298–301, hier zitiert 298.
159 Brief Richard Boyles, Februar 1634, in: National Archives, SP 63/254, fol. 234.160 Wentworth an Laud, 10. März 1635, in: The Earl of Strafforde’s Letters and
Dispatches, Bd. 1, 378–382.161 Zunächst wurde das Grabmal ins Innere der Sakristei verlegt, wo es die Ge-
meinde nicht mehr bei der Andacht stören konnte. Seit dem 19. Jahrhundert befindet essich westlich des Südportals und kann dort noch heute besichtigt werden.
„A Wall of Separation“ 113
lässt.162 Der Kirchenraum büßte seine Sonderstellung als relativ konfliktfrei-er Raum ein und geriet in den Sog der Ambiguitätsvernichtung.
Auch in katholischen Kreisen wurde teilweise darauf hingearbeitet, denUmgang mit dem toten Körper zu vereindeutigen. Stark in die Kritik gerietenvor allem die traditionellen Totenwachen (wakes), bei denen es aus der Sichtdes nachtridentinischen Katholizismus immer wieder zu obszönen Aus-schweifungen kam. Katholische Priester versuchten, die Kosten für die Hin-terbliebenen, die bei dieser Gelegenheit ökonomisches in soziales Kapitalumwandelten, einzudämmen, Trinkgelage zu verhindern und – vor allem –Geschlechtsverkehr zu unterbinden.163 Vorstellungen von Rechtgläubigkeit,die auf dem europäischen Kontinent entstanden waren, wurden hier gegendie irischen Verwandtschafts- und Freundschaftsnetzwerke und die Sorgeum die Familienkontinuität ausgespielt. Das laute, demonstrativ mit Gott ha-dernde Totenklagen (keening) wurde als besonders anstößig empfunden, weildarin angeblich eine Einstellung zum Ausdruck kam, die den göttlichenHeilsplan in Frage stellte.164 Derartige Praktiken wurden als pagan be-kämpft.165
Eine prominente Rolle spielte in diesem Zusammenhang wieder der Pries-ternachwuchs, der in den kontinentaleuropäischen Kollegs ausgebildet wor-den war. Für Bordeaux kann man beispielsweise nachweisen, dass die iri-schen Studenten in einer Art klerikaler Arbeitsteilung im Stadtgebiet vor al-lem für Bestattungen zuständig waren.166 Irische Geistliche aus diesem Um-feld waren deshalb Experten dafür, wie orthodoxe Begräbnisse ohne,volksreligiöse‘ Störungen auszusehen hatten. Bezeichnenderweise brachteGeoffrey Keating, der – wie gesagt – selbst Zeit in Bordeaux verbracht hatte,neben seinem Wissenskompendium noch ein zweites wichtiges Buch heraus:„Three Shafts of Death“ („Trí Bior-Ghaoithe an Bháis“), das vor 1631 in Um-lauf gebracht wurde. Darin behandelt Keating den Tod in den verschiedens-ten Hinsichten: den körperlichen Tod, das Auseinandertreten von Körper undSeele sowie den Tod der Seele, der die Gnade Gottes vorenthalten wird. Dabeisei es Aufgabe der Gläubigen, sich immer und überall mit dem ,guten‘ Todauseinanderzusetzen.167 Keatings umfassende Beschäftigung mit dem Themalässt vermuten, dass die Bildungsmigranten klare Vorstellungen über den an-gemessenen Umgang mit dem toten Körper in ihre Heimatdiözesen mitge-bracht haben dürften. In der religiösen Praxis vor Ort waren sie vermutlichentschiedene Verfechter einer konfessionellen Bereinigung der wakes.
162 Tait, Death, 84.163 Bossy, Counter-Reformation, 164f.; Corish, Catholic Community, 35–38. Zur
Kapitalsorten-Theorie vgl. Bourdieu, Macht, 49–80.164 Tait, Death, 37.165 Corish, Catholic Community, 38.166 Cunningham, Geoffrey Keating, 30f.167 Keating, Trí Bior-Ghaoithe an Bháis; vgl. auch Cunningham, Geoffrey Kea-
ting, 48f.
Matthias Bähr114
In der Bestattungspraxis kam es also auf zwei Ebenen zu einer Vernichtungvon Mehrdeutigkeit: Zum einen büßte die konfessionsübergreifende, relativkonfliktfreie Nutzungdes Kirchenraums in den 1630er Jahren ihre Selbstver-ständlichkeit ein. Die traditionellen Grablegen irischer Familien wurdenstärker als zuvor am Maßstab konfessioneller Orthodoxie gemessen. Das be-traf Katholiken und Protestanten gleichermaßen, wie der Fall Richard Boyleszeigt. Zum anderen wurden vorreformatorische Praktiken, etwa aufwendigeTotenwachen oder lautstarkes keening, gerade von den irischen Bildungsmi-granten als paganbekämpft. Durch diese beiden Entwicklungen wurdenVor-stellungen davon, was ein konfessionell ,richtiges‘ und was ein ,falsches‘ Be-gräbnis war, in der irischen Gesellschaft überhaupt erst salonfähig gemacht.Die Folgen waren schwerwiegend: In der Irish Rebellion 1641/42 wurdenzahlreiche protestantische Gräber in den – vorübergehend wieder katholi-schen – Kirchen geschändet.168 In Waterford und Kerry wurde verstorbenenProtestanten ein ordentliches, christliches Begräbnis verweigert.169 Der Zu-gang zu den traditionellen Bestattungsplätzen war jetzt umkämpft. Gewanneine Seite die Oberhand, wurden die toten Körper der jeweiligen Gegenparteiwilden Tieren überlassen oder verscharrt.170 In einer Reihe von Zeugenverhö-ren, die nach dem Ende der Rebellion durchgeführt wurden, ging es auch umdie Behandlung der Leichen: buried them both in a ditch, threw them […] intoa deepe hole, buried him alive in a hole with rubbish and stones, devoured &eaten by doggs, buryed in one hole in the highe way, covered with strawe – daswaren die Vorwürfe.171 Besonders drastisch liest sich die Behauptung einesprotestantischen Pfarrers, diekatholischenRebellenhätten ihre halb verwes-ten Gegner mit dem Gesicht nach unten bestattet, to the intent they mighthave a prospect and sight of hell only.172 Das eingespielte System der konfes-sionsübergreifenden Nutzung der Kirchenräume war, wie die irische Gesell-schaft insgesamt, zusammengebrochen.
168 Canny, Kingdom and Colony, 62.169 Tait, Death, 82.170 Ebd., 82f.171 Aussagen von Suzan Steele, 14. Juli 1645, in: Trinity College Dublin, MS 817,
fol. 213v; Ann Sherring, 10. Februar 1644, in: ebd., MS 821, fol. 180f.; Richard Taylor,21. Oktober 1645, in: ebd., MS 828, fol. 260v; Alice Champyn, 14. April 1642, in: ebd.,MS 835, fol. 197r; Honorah Beamond, 7. Juni 1643, in: ebd., MS 834, fol. 170r; DaniellMcGillmartin, 31. Mai 1653, in: ebd., MS 838, fol. 179v. Weil es in den Verhören darumging, Schadensersatzansprüche von Protestanten aufzuklären, handelt es sich auch beiden hier zitierten Zeugen ausnahmslos um Protestanten. Zu den Verhörprotokollen,die als „1641 Depositions“ bekannt sind, vgl. Ohlmeyer, Anatomy of Plantation;Coolahan, Orality, Print and the 1641 Depositions; Darcy / Margey / Murphy (Hrsg.),The 1641 Depositions.
172 Aussage Robert Maxwells, 7. Juli 1643, in: Trinity College Dublin, MS 809,fol. 12r.
„A Wall of Separation“ 115
V. Ergebnisse
Die Irish Rebellion war ein Wendepunkt in der irischen Geschichte. Mit ihrbrach – nach einer Inkubationszeit von mehr als dreißig Jahren – ein gewalt-samer Konflikt aus, dem sich keine soziale Gruppe in Irland entziehen konn-te. An eine relativ friedliche Koexistenz war danach nicht mehr zu denken:Die Insel geriet endgültig in den Sog der englischen Politik. Vorausgegangenwar diesem epochalen Ereignis eine Zeit der radikalen Ambiguitätsvernich-tung, die sich vor allem in den 1630er Jahren beschleunigt hatte.
Um 1600 waren die Identitäten in Irland noch vergleichsweise unscharf ge-wesen, Freund- und Feinbilder hatten sich noch nicht in der Eindeutigkeitherausgebildet, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestimmendwurde. Mehrere Prozesse, die sich zeitlich überlagerten, führten dazu, dassdiese kurzlebige „Kultur der Ambiguität“ beseitigt wurde: 1) Die Bildungs-migration junger Iren auf den europäischen Kontinent schärfte langfristigdas konfessionelle Profil katholischer Familien. Als gut ausgebildete, anden Beschlüssen des Konzils von Trient geschulte Klerikerelite gewannendie jungen Pfarrer schnell an Einfluss und Sozialprestige. Sie brachten festeFrömmigkeitsvorstellungen nach Irland mit und arbeiteten aktiv daran, inder irischen Gesellschaft sichtbare konfessionelle Grenzen zu ziehen.2) Gleichzeitig entstand in den europäischen Priesterseminaren eine Artvon Historiographie, die Iren und Engländer klar voneinander abgrenzte.Binnendifferenzierungen in der irischen Gesellschaft, also etwa zwischen gä-lischen Iren und anglonormannischen Old English, waren in dieser Ge-schichtsschreibung aufgehoben. Historiker wie Geoffrey Keating erklärtenkatholische Rechtgläubigkeit zum Lackmustest der neuen irischen Identitätund verorteten damit alle Protestanten außerhalb der legitimen irischen Pat-ria. 3) Veränderungen auf dem Buchmarkt sorgten für eine schnelle Verbrei-tung konfessionell eingefärbter Literatur: Manuskripte erreichten einen grö-ßeren Leserkreis als noch eine Generation zuvor, Drucke wurden verstärktimportiert und neue, bedeutende Bibliotheken angelegt. Das Leseverhaltenin der irischen Gesellschaft richtete sich neu aus: Der Fixpunkt waren jetztdie theologischen Debatten auf dem europäischen Kontinent und in England,die in leicht zugänglichen Flugschriften für eine größere Leserschicht aufbe-reitet wurden. 4) Der Umgang mit dem toten Körper wurde verstärkt konfes-sionellen Regeln unterworfen. Scheinbar pagane religiöse Praktiken, wie dievermeintlich obszönen Totenwachen oder das exzessive keening, wurden be-kämpft. Die gemeinsame, konfessionsübergreifene Nutzung der traditionel-len Begräbnisplätze musste jetzt Vorstellungen von konfessioneller Reinheitgenügen. Im Kirchenraum wurden neue, konfessionelle Grenzziehungen vor-genommen.
Die Folge dieser vielschichtigen Entwicklung war, dass sich die Identitätenin Irland vor allem in den 1630er Jahren polarisierten: auf der einen Seite ka-tholische Iren, auf der anderen Seite protestantische Engländer und Schot-ten. Der Spielraum für Mehrdeutigkeit war dermaßen geschrumpft, dass esjetzt für den Einzelnen vielfach unerlässlich war, sich einer Gruppe klar zu-
Matthias Bähr116
zuordnen. In der irischen Gesellschaft hatte ein Selbstbild die Oberhand ge-wonnen, für das gerade die katholische Orthodoxie entscheidend war und dasim Gegensatz zum konfessionell Fremden stand: den neu eingewandertenSiedlern, die eben jetzt nicht mehr als Iren galten. Thomas Wentworth – ob-wohl selbst ein wichtiger Akteur – war dabei zur falschen Zeit am falschenOrt. Weil er die irischen Eliten mit seiner rigorosen Wirtschaftspolitik gegensich aufbrachte, personifizierte er diese Fremdheit wie kein anderer. Das warder Grund dafür, dass er sich auch gegen scheinbar absurde Vorwürfe be-haupten musste. Stellvertretend für alle neuen Gruppen auf der Insel miss-achtete er als Engländer, als Protestant die irische Gastfreundschaft. Oderanders gesagt: Er lag mit Schuhen im Bett.
Damit ist aber nicht gesagt, dass die irische Gesellschaft seit den 1630erJahren auf klare, konfessionell imprägnierte Freund- und Feinbilder festge-legt war, die sich bruchlos bis ins 19. oder gar 20. Jahrhundert fortschreibenlassen. Es gab immer wieder lange Phasen, in denen die – religiösen, ethni-schen, sprachlichen – Identitäten wieder vergleichsweise uneindeutig waren,in denen zum Beispiel „Irisch-Sein“ wieder zu einer unscharfen, konfessio-nell nicht klar festgelegten Kategorie wurde. Das gilt etwa für den Aufstandder United Irishmen Ende des 18. Jahrhunderts oder das Repeal Movement im19. Jahrhundert. In beiden Fällen definierten sich auch Protestanten als Iren,und diese Selbstzuschreibung wurde in der Regel akzeptiert.173 Die Ambigui-tätsvernichtung in der irischen Gesellschaft zwischen 1610 und 1640 warzwar radikal, aber nicht unumkehrbar.
Summary
“A Wall of Separation”.The Destruction of Religious Ambiguity in Ireland (ca. 1600–1640)
Ambiguity is a fundamental human experience. But in recent years, research in thehumanities and social sciences has shown that societies have very different ways ofdealing with ambiguity, and with religious ambiguity in particular: they either tolerate,moderate or seek to destroy it. In this context, Ireland is an especially telling case, as thedenominational boundaries that were drawn in Early Modern Irish society seem re-markably impervious, long-lasting and hostile to any form of religious ambiguity.
In this article, I argue that one of the most drastic and most enduring attempts toeradicate ambiguity in Irish society took place in the 1630 s. Clear-cut identitiesemerged along the confessional divide which heavily impacted everyday life. Four de-velopments facilitated this process: 1) Educational migration to the continent led to areshuffling of religious elites and, in turn, to a heightened sense of denominational or-thodoxy. 2) A new way of writing history came to prominence which attempted to re-place established group identities (Gaelic-Irish, Old English, etc.) with an all-embrac-ing, religiously infused notion of “Irishness”. 3) The book market gradually expanded,significantly increasing its scope from a generation earlier, with new literature coming
173 Bartlett [u.a.] (Hrsg.), 1798. A Bicentenary Perspective (darin z.B. der BeitragGraham, Transformation); Garvin, Irish Nationalist Politics, insbes. 49–52.
„A Wall of Separation“ 117
in and with new libraries being established across the country. As a consequence, read-ers became more keenly aware of the theological debates in England and on the Euro-pean continent. 4) Long established funeral practices such us the trans-confessional useof burial plots in churches and former monasteries were disrupted, leading to newboundaries, symbolically as well as physically.
Ungedruckte Quellen
British Library, London, Egerton MS 917.
Lambeth Palace Library, London, Carew MS 600.
The National Archives of the United Kingdom, 31/8/199 (Philadelphia Papers).
The National Archives of the United Kingdom, State Papers (SP) 12 u. 63.
Trinity College Dublin, MS 809, 817, 821, 828, 834, 835, 838.
University College Dublin Archives, MS A 13, 14.
Gedruckte Quellen
Annals of the Kingdom of Ireland, by the Four Masters, from the Earliest Period to theYear 1616, Bd. 5, hrsg. v. John O’Donovan, Dublin 1851.
Bayly, Lewis, The Practice of Piety: Directing a Christian how to Walk, that He MayPlease God, ND London 1792.
Calendar of the State Papers Relating to Ireland, 1625–1632, hrsg. v. Robert PentlandMahaffy, London 1900.
Chillingworth, William, The Religion of Protestants a Safe Way to Salvation, or an Ans-wer to a Book Entitled Mercy and Truth, or Charity Maintained by Catholics whichPretends to Prove the Contrary, Oxford 1637.
The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches, 2 Bde., hrsg. v. William Knowler, Lon-don 1739.
Granada, Luis de, The Flowers of Lodowicke of Granado. The First Part. In which isHandled the Conversion of a Sinner. Translated out of Latine into English, by T[ho-mas] L[odge] Doctor of Phisicke, London 1601.
Keating, Geoffrey, Foras Feasa ar Éirinn, hrsg. v. Pádraig de Barra, Dublin 1982/83.
– The History of Ireland / Foras Feasa ar Éirinn, 4 Bde., übers. u. komm. v. David Co-myn / Patrick Dinneen, London 1902–1914.
– Trí Bior-Ghaoithe an Bháis, hrsg. v. Osborn Bergin, Dublin / London 1931.
Rich, Barnabe,Allarmeto England, Foreshewing what PerillesAre Procured, where thePeople Live without Regarde of Martiall Lawe, London 1578.
Rochford, Robert, The Life of the Glorious Bishop Patricke Apostle and Primate of Ire-land. Togeather with the Lives of the Holy Virgin Bridgit and of the Glorious AbbotSaint Columbe Patrons of Ireland, St. Omer 1625 (ND in: English Recusant Litera-ture 1558–1640, Bd. 210, hrsg. v. David M. Rogers, London 1974).
Rohan, Henri de, Le parfait capitaineou Abregé des guerres des commentaires de César,ND Paris 1757.
Matthias Bähr118
Seager, Francis, The Schoole of Vertue, London 1557 (ND in: The Babees’ Book: Medi-eval Manners for the Young, hrsg. v. Frederick J. Furnivall, London 1868, 333–355).
Villegas y Selvago, Alonso de, Flos santorum y historia general, de la vida y hechos deJesu Christo […] y de todos los santos, Toledo 1587.
Wadding papers, 1614–38, hrsg. v. Brendan Jennings, Dublin 1953.
Literatur
Bardon, Jonathan, The Plantation of Ulster. The British Colonisation of the North ofIreland in the Seventeenth Century, Dublin 2012.
Bartlett, Thomas [u.a.] (Hrsg.), 1798. A Bicentenary Perspective, Dublin 2003.
Bauer, Thomas, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Ber-lin 2011.
– Normative Ambiguitätstoleranz im Islam, in: Gewohnheit, Gebot, Gesetz. Norma-tiviät in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. Nils Jansen / Peter Oestmann, Tübingen2011, 155–180.
Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Oxford 1991.
Boran, Elizabethanne, The Libraries of Luke Challoner and James Ussher, 1595–1608,in: European Universities in the Age of Reformation and Counter Reformation, hrsg.v. Helga Robinson-Hammerstein, Dublin 1998, 75–115.
Bossy, John, The Counter-Reformation and the People of Catholic Ireland, 1596–1641,in: Historical Studies 8 (1971), 155–169.
Bottigheimer, Karl , The Failure of the Reformation in Ireland. Une Question Bien Po-sée, in: Journal of Ecclesiastical History 36 (1985), 196–207.
– / Ute Lotz-Heumann, The Irish Reformation in European Perspective, in: Archiv fürReformationsgeschichte 89 (1998), 268–309.
Bourdieu, Pierre, Die verborgenen Mechanismen der Macht, Hamburg 1992.
Brockliss, Laurence W. B. / Patrick Ferté, Prosopography of Irish Clerics in the Univer-sities of Paris andToulouse,1573–1792, in: Archivium Hibernicum 58 (2004), 7–165.
Caball, Marc, Lost in Translation: Reading Keating’s Foras feasa ar Éirinn, 1635–1847,in:OralandPrintCultures in Ireland,1600–1900,hrsg.v.dems. /AndrewCarpenter,Dublin 2010, 47–68.
Canny, Nicholas, The Formation of the Old English Elite in Ireland, Dublin 1975.
– Kingdom and Colony: Ireland in the Atlantic World 1560–1800, Baltimore / Lon-don 1988.
– The Upstart Earl. A Study of the Social and Mental World of Richard Boyle, FirstEarl of Cork, 1566–1643, Cambridge 1982.
– Why the Reformation Failed in Ireland: Une Question Mal Posée, in: Journal of Ec-clesiastical History 30 (1979), 423–450.
Clarke, Aidan, The Government of Wentworth, 1632–1640, in: A New History of Ire-land, Bd. 3: Early Modern Ireland, 1534–1693, hrsg. v. Theodore W. Moody / FrancisX. Martin / Francis J. Byrne, Oxford 1976, 243–269.
– The Old English in Ireland, 1625–1642, Dublin 2000.
„A Wall of Separation“ 119
Coolahan, Marie-Louise, „And this deponent further sayeth“: Orality, Print and the1641 Depositions, in: Oral and Print Cultures in Ireland, 1600–1900, hrsg. v. MarcCaball / Andrew Carpenter, Dublin 2010, 69–84.
Corish, Patrick J., The Catholic Community in the Seventeenth and Eighteenth Centu-ries, Dublin 1981.
Cregan, Donal F., The Social and Cultural Background of an Counter-ReformationEpiscopate, 1618–1660, in: Studies in Irish History Presented to R. Dudley Edwards,hrsg. v. Art Cosgrove / Donal McCartney, Dublin 1979, 85–117.
Cunningham, Bernadette, The Annals of the Four Masters: Irish History, Kingship andSociety in the Early Seventeenth Century, Dublin 2009.
– Native Culture and Political Change in Ireland, 1580–1640, in: Natives and New-comer Essays on the Making of Irish Colonial Society, 1534–1641, hrsg. v. CiaranBrady / Raymond Gillespie, Dublin 1986, 148–170.
– Representations of King, Parliament and the Irish People in Geoffrey Keating’sForas Feasa ar Éirinn and John Lynch’s Cambrensis Eversus (1662), in: PoliticalThought in Seventeenth-Century Ireland. Kingdomor Colony,hrsg. v. Jane Ohlmey-er, Cambridge 2000, 131–154.
– The World of Geoffrey Keating. History, Myth and Religion in Seventeenth-CenturyIreland, Dublin 2000.
Darcy, Eamon / Annaleigh Margey / Elaine Murphy (Hrsg.), The 1641 Depositions andthe Irish Rebellion, London 2012.
Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo,London / Henley 1966.
Downey, Declan M., The Irish Contribution to Counter-Reformation Theology in Con-tinental Europe, in: Christianity in Ireland. Revisiting the Story, hrsg. v. BrendanBradshaw / Dáire Keogh, Dublin 2002, 96–108.
Edwards, David, A Haven of Popers: English Catholic Migration to Ireland in the Age ofPlantations, in: The Origins of Sectarianism in Early Modern Ireland, hrsg. v. AlanFord / John McCafferty, Cambridge 2005, 95–126.
Färber, Beatrix, Bedeutung und Rezeptionsgeschichte des Foras Feasa ar Éirinn(c. 1634) von Geoffrey Keating (Seathrún Céitinn), in: Zeitschrift für celtische Phi-lologie 59 (2012), 97–117.
Fenning, Hugh, Irish Dominicans at Lisbon before 1700: A Biographical Register, in:Collectanea Hibernica 42 (2000), 27–65.
– Irish Dominicans at Louvain before 1700: A Biographical Register, in: CollectaneaHibernica 43 (2001), 112–160.
– Irish Dominicans at Rome, 1570–1699: A Biographical Register, in: Collectanea Hi-bernica 44/45 (2002/2003), 13–55.
– Irishmen Ordained at Lisbon, 1587–1625, 1641–60, in: Collectanea Hibernica 31/32(1989/90), 103–117.
Finnegan, David, Old English Views of Gaelic Irish History and the Emergence of anIrish Catholic Nation, c. 1569–1640, in: Reshaping Ireland, 1550–1700:Colonizationand its Consequences. Essays Presented to Nicholas Canny, hrsg. v. Brian Mac Cuar-ta, Dublin 2011, 187–213.
Matthias Bähr120
Flanagan, Eugene, The Anatomy of Jacobean Ireland: Captain Barnaby Rich, Sir JohnDavies and the Failure of Reform, 1609–1622, in: Political Ideology in Ireland, 1541–1641, hrsg. v. Hiram Morgan, Dublin 1999, 158–180.
Ford, Alan, „Firm Catholics“ or „Loyal Subjects“? Religious and Political Allegiance inEarly Seventeenth-Century Ireland, in: Political Discourse in Seventeenth- andEighteenth-Century Ireland, hrsg. v. George D. Boyce / Robert Eccleshal / VincentGeoghegan, Basingstoke / New York 2001, 1–31.
– „Force and Fear of Punishment“: Protestants and Religious Coercion in Ireland,1603–1633, in: Enforcing Reformation in Ireland and Scotland, 1550–1700, hrsg.v. Elizabethanne Boran / Crawford Gibben, Aldershot 2006, 91–130.
– Who Went to Trinity? The Early Students of Dublin University, in: European Uni-versities in the Age of Reformation and Counter Reformation, hrsg. v. Helga Robin-son-Hammerstein, Dublin 1998, 53–74.
Garvin, Tom, The Evolution of Irish Nationalist Politics, New York 1981.
– Foras Feasa ar Eirinn (1634) (in Vorbereitung).
Gillespie, Raymond, The Book Trade in Southern Ireland, 1590–1640, in: Books Beyondthe Pale. Aspects of the Provinical Book Trade in Ireland before 1850, hrsg. v. GeraldLong, Dublin 1996, 1–17.
– Funerals and Society in Early Seventeenth Century Ireland, in: The Journal of theRoyal Society of Antiquaries of Ireland 115 (1985), 86–91.
– Irish Cathedral Libraries before 1700, in: That Woman! Studies in Irish Bibliogra-phy. A Festschrift for Mary „Paul“ Pollard, hrsg. v. Charles Benson / Siobhán Fitz-patrick, Dublin 2005, 176–192.
– The Irish Franciscans, 1600–1700, in: The Irish Franciscans, 1534–1990, hrsg. v.Edel Bhreathnach / Joseph MacMahon / John McCafferty, Dublin 2009, 45–76.
– The Problems of Plantations: Material Culture and Social Change in Early ModernIreland, in:Settlement andMaterialCulture, c. 1550-c.1700,hrsg.v. JamesLyttleton/ Colin Rynne, Dublin 2009, 43–60.
– Reading Ireland. Print, Reading and Social Change in Early Modern Ireland, Man-chester 2005.
– The Religion of the Protestant Laity in Early Modern Ireland, in: Christianity in Ire-land. Revisiting the Story, hrsg. v. Brendan Bradshaw / Dáire Keogh, Dublin 2002,109–123.
Graham, Tommy, The Transformation of the Dublin Society of United Irishmen into aMass-Based Revolutionary Organization, 1791–6, in: 1798. A Bicentenary Perspec-tive, hrsg. v. Thomas Bartlett [u.a.], Dublin 2003, 136–146.
Greyerz, Kaspar von [u.a.] (Hrsg.): Interkonfessionalität – Transkonfessionalität – bin-nenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese,Heidelberg 2003.
Hase, Thomas, Nonkonformismus und europäische Religionsgeschichten. VorläufigeÜberlegungen, in: Religion, Staat, Gesellschaft 12 (2011), 307–315.
Kane, Brandan, Scandal, Wentworth’s Deputyship and the Breakdown of Stuart Ho-nour Politics, in: Reshaping Ireland, 1550–1700: Colonization and its Consequences.Essays Presented to Nicholas Canny, hrsg. v. Brian Mac Cuarta, Dublin 2011,147–162.
„A Wall of Separation“ 121
Kaufmann, Jean-Claude, La trame conjugale: Analyse du couple par son linge, Pa-ris 1992.
Kearney, Hugh F., Strafford in Ireland, 1633–41. A Study in Absolutism, Manchester1959 (ND Cambridge / New York 1989).
Krasnodebska-D’Aughton, Malgorzata, Franciscan Chalices, 1600–50, in: The IrishFranciscans, 1534–1990, hrsg. v. Edel Bhreathnach / Joseph MacMahon / JohnMcCafferty, Dublin 2009, 287–304.
Leerssen, Joep, Mere Irish and Fíor-Ghael. Studies in the Idea of Irish Nationality, itsDevelopment and Literary Expression prior to the Nineteenth Century, Cork 1996.
Loeber, Rolf, Sculptured Memorials to the Dead in Early Seventeenth-Century Ireland:A Survey from „Monumenta Eblanae“ and Other Sources, in: Proceedings of theRoyal Irish Academy. Section C: Archaelogy, Celitc Studies, History, Linguistics,Literature 81 (1981), 267–293.
Lotz-Heumann, Ute, Confessionalisation in Ireland: Periodisation and Character,1534–1649, in: The Origins of Sectarianism in Early Modern Ireland, hrsg. v. AlanFord / John McCafferty, Cambridge 2005, 24–53.
– Die doppelte Konfessionalisierung in Irland. Konflikt und Koexistenz im 16. und inder ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Tübingen 2000.
Louthan, Howard / Gary B. Cohen / Franz A. J. Szabo (Hrsg.), Diversity and Dissent.Negotiating Religious Difference in Central Europe, 1500–1800, New York 2011.
McCafferty, John, The Reconstruction of the Church of Ireland. Bishop Bramhall andthe Laudian Reforms, 1633–1641, Cambridge 2007.
Mytum, Harold, Archaeological Perspectives on External Mortuary Monuments ofPlantation Ireland, in: Settlement and Material Culture, c. 1550-c. 1700, hrsg. v.James Lyttleton / Colin Rynne, Dublin 2009, 165–181.
Ohlmeyer, Jane, Anatomy of Plantation: The 1641 Depositions, in: History Ireland 17(2009), 54–56.
– Introduction: For God, King or Country? Political Thought and Culture in Seven-teenth-Century Ireland, in: Political Thought in Seventeenth-Century Ireland.Kingdom or Colony, hrsg. v. ders., Cambridge 2000, 1–31.
– The Irish Peers, Political Power and Parliament, 1640–1641, in: British Interven-tions in Early Modern Ireland, hrsg. v. ders. / Ciaran Brady, Cambridge 2005,161–179.
– Seventeenth-Century Ireland and Scotland and their Wider Worlds, in: Irish Com-munities in Early-Modern Europe, hrsg. v. Thomas O’Connor / Mary Ann Lyons,Dublin 2006, 457–483.
Ó Buachalla, Breandán, James our True King. The Ideology of Irish Royalism on theSeventeenth Century, in: Political Thought in Ireland Since the Seventeenth Centu-ry, hrsg. v. George D. Boyce / Robert Eccleshall / Vincent Geoghegan, London / NewYork 1993, 7–35.
O’Doherty, Denis J., Students of the Irish College Salamanca, 1595–1619, in: Archivi-um Hibernicum 2 (1913), 1–36.
Ó hAnnracháin, Tadhg, The Consolidation of Irish Catholicism within a Hostile Impe-rial Framework: A Comparative Study of Early Modern Ireland and Hungary, in:Empires of Religion, hrsg. v. Hilary M. Cary, Basingstoke / New York 2008, 25–42.
Matthias Bähr122
– „ThoughHereticksandPoliticians ShouldMisinterpret TheirGoodeZeal“:PoliticalIdeology and Catholicism in Early Modern Ireland, in: Political Thought in Seven-teenth-Century Ireland. Kingdom or Colony, hrsg. v. Jane Ohlmeyer, Cambridge2000, 155–175.
Pollard, Mary, A Dictionary of the Members of the Dublin Book Trade, 1550–1800,London 2000.
– Dublin’s Trade in Books, 1550–1800, Dublin 1989.
Richardson, Brian, Print Culture in Renaissance Italy. The Editor and the VernacularText, 1470–1600, Cambridge 1994.
Ryan, Salvador, Steadfast Saints or Malleable Models? Seventeenth-Century IrishHagiography Revisited, in: The Catholic Historical Review 91.2 (2005), 251–277.
Schwerhoff, Gerd, Gottlosigkeit und Eigensinn. Religiöse Devianz in der Frühen Neu-zeit, in: Transzendenz und Gemeinsinn. Themen und Perspektiven des DresdnerSonderforschungsbereichs 804, hrsg. v. Hans Vorländer, Dresden 2010, 58–63.
Stollberg-Rilinger, Barbara, Einleitung, in: Konfessionelle Ambiguität. Uneindeutig-keit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. ders. / An-dreas Pietsch, Gütersloh 2013, 9–26.
– Andreas Pietsch (Hrsg.), Konfessionelle Ambiguität. Uneindeutigkeit und Verstel-lung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, Gütersloh 2013.
Tait, Clodagh, Death, Burial and Commemoration in Ireland, 1550–1650, Basingstoke /New York 2000.
„A Wall of Separation“ 123
















































![Sangakus. Àlgebra i Geometria al Japó de l'època EDO [1600-1868]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631386da3ed465f0570ab787/sangakus-algebra-i-geometria-al-japo-de-lepoca-edo-1600-1868.jpg)