Zu den Anfängen der Numismatik in Estland: Eduard Philipp Körber (1770–1850)
Transcript of Zu den Anfängen der Numismatik in Estland: Eduard Philipp Körber (1770–1850)
Schriften der Baltischen Historischen Kommission
Herausgegeben von
Konrad Maier, Matthias Thumser
und Ralph Tuchtenhagen
Band 17
Baltische Biographische Forschungen
Herausgegeben von
Norbert Angermann, Wilhelm Lenz
und Konrad Maier
Band 1
LIT
Geisteswissenschaften und Publizistik im Baltikum
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
Herausgegeben von
Norbert Angermann, Wilhelm Lenz und Konrad Maier
Berlin 2011
Inhalt Vorwort .......................................................................................... 9
Indrek Jürjo † Johann Wilhelm Ludwig von Luce (1756–1842). Ein Aufklärer auf der Insel Oesel ..................................................... 15
Ivar Leimus Zu den Anfängen der Numismatik in Estland: Eduard Philipp Körber (1770–1850) .............................................. 43
Mare Rand Karl Morgenstern (1770–1852) im Spiegel seiner Privatkorrespondenz ............................................ 65
Lea Leppik Zwei Vertreter des aufgeklärten Absolutismus – Generalgouverneur Philippo Paulucci (1779–1849) und Rektor Gustav Ewers (1779–1830) .......................................... 101
Ulrich Kronauer Erziehung bei Carl Gustav Jochmann (1789–1830) ........................ 121
Edward C. Thaden † Iurii Fedorovich Samarin (1819–1876) as a Baltic Historian ........... 137
Karsten Brüggemann Ein Russe in Riga: Evgraf Vasil’evič Češichin (1824–1888) als Journalist und Historiker im Dienst des Imperiums ................... 157
Kersti Lust Johann Köler (1826–1899), ein Vorkämpfer der estnischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert .................... 193
Wilhelm Lenz Carl Schirren (1826–1910) und seine „Lebensaufgabe“ ................... 217
6
Heinrich Wittram Alexander von Oettingen (1827–1905) – Theologe und Sozialethiker in Dorpat ............................................ 239
Kersti Taal Leo Meyer (1830–1899). Ein deutscher Gelehrter als Förderer der estnischen Kultur ........................................................ 265
Krzysztof Zajas Gustaw Manteuffel (1832–1916) – ein vergessener polnisch-livländischer Historiker ............................. 291
Michael Garleff Julius Eckardt (1836–1908) als baltischer Historiker und politischer Publizist in Riga ..................................................... 313
Klaus Neitmann Hermann von Bruiningk (1849–1927). Livländischer Landesarchivar und Landeshistoriker ......................... 337
Ieva Ose Karl von Löwis of Menar (1855–1930) als Erforscher der Denkmäler Alt-Livlands ...................................... 357
Anneli Lõuna Jüri Truusmann (1856–1930), Zensor und aktiver Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben in der Zeit der Russifizierung .............. 373
Manfred Klein Jonas Basanavičius (1857–1927) und sein Beitrag zur europäischen Folkloristik ................................ 397
Stephan Kessler Jonas Jablonskis (1860–1930) und die Genese der litauischen Nationalsprache .............................. 425
Sergej Isakov Michail Lisicyn (1862–1913) – ein russischer Journalist und Vertreter des öffentlichen Lebens in Estland am Ende des 19. Jahrhunderts ........................................ 455
7
Stephan Bitter Oswald Külpe (1862–1915) und die Dorpater religionspsychologische Schule ............................ 483
Ljudmila Dub’eva Ivan Ivanovič Lappo (1869–1944): „Ich möchte die Staatsordnung von Litauen untersuchen“ .............. 513
Personenregister .............................................................................. 541
Autorenverzeichnis .......................................................................... 553
Ivar Leimus
Zu den Anfängen der Numismatik in Estland: Eduard Philipp Körber (1770–1850)
Die Geschichte der Numismatik in Estland und Lettland ist schon viel-fach behandelt worden. Sowohl Kristīna Pelda-Ducmane1 als auch Ar-kadi Molvõgin2 richteten dabei ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Entstehung der öffentlichen Sammlungen. Andererseits betrachtete Franziskus Pärn die Tätigkeit der Privatsammler, seine Forschungen be-zogen sich jedoch eher auf Lettland3. Die Geschichte der Münzliebhabe-rei in Estland ist dagegen äußerst unzureichend behandelt. Einen der wenigen Beiträge zu diesem Thema bildet ein kleines Heft mit Münz-bildern und Erläuterungen von Eduard Philipp Körber. Es wurde mit Hilfe der Bestände des Estnischen Historischen Museums veröffent-licht4. Den Beginn privater Sammlungstätigkeit in Estland markiert für die meisten Forscher die Tätigkeit des berühmten Sammlers und Revaler (Tallinner) Apothekers Johann Burchard (1776–1838) im Jahr 1802 bzw. 18035. Doch muss man dabei berücksichtigen, dass seine Samm-lung erst 1822 so umfangreich geworden war, dass die Notwendigkeit
————————————
1 Kristīna PELDA-DUCMANE, Die Entwicklung der Numismatik in Lettland, in: Ham-burger Beiträge zur Numismatik 33/35 (1979/81), Hamburg 1988, S. 195–204.
2 Arkadi MOLVÕGIN, Die Funde westeuropäischer Münzen des 10. bis 12. Jahrhun-derts in Estland (Numismatische Studien, 10), Hamburg 1994, S. 5–21.
3 Franziskus PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik, in: Studia numis-matica. Festschrift Arkadi Molvõgin 65, Tallinn 1995, S. 132–146.
4 Tallinna linnas vermitud mündid, kirjeldanud ja illustreerinud Ed.Ph. Körber 1826 / Münzen in der Stadt Reval geprägt, beschrieben und abgebildet von Ed.Ph. Körber 1826, hg. v. Ivar LEIMUS, Tallinn 2006.
5 Johann BURCHARD, Geschichte meiner Sammlung, genannt: Mon Faible, aufgesetzt für meine geliebten Nachkommen im Jahre 1825, in: Mon Faible’ist ajaloomuuseu-miks [Mon Faible als Geschichtsmuseum], (Eesti Ajaloomuuseum. Töid ajaloo alalt, 4), Tallinn 2002, S. 77–86; Eve PEETS, Johann Burchardi kollektsioon Eesti Ajaloo-muuseumis [Die Sammlung Johann Burchards im Estnischen Historischen Muse-um], in: Ebenda, S. 61–70.
Ivar Leimus 44
eines Verzeichnisses seiner Gegenstände offensichtlich wurde. Im selben Jahr fand die erste öffentliche Ausstellung seiner Sammlung statt; zu die-sem Anlass erschien auch ein gedruckter Katalog6. Fast gleichzeitig wur-de sein Hausmuseum räumlich erweitert. Also können wir erst ab die-sem Zeitpunkt von einer bewussten und gezielten Sammeltätigkeit Bur-chards sprechen. Von den Münzen wusste er wenig, und obwohl seine Sammlung ihm sehr wichtig war, schien ihm diese Liebhaberei „sehr ge-fährlich und kostspielig“. Obgleich er sich im Jahr 1825 entschloss, eine eigene Münzsammlung anzulegen, zeigt sein in den 1830er Jahren zu-sammengestellter Katalog, dass diese Kollektion ziemlich zufällig zu-sammengesetzt war und daher unbedeutend blieb. Doch sind einige bemerkenswerte Stücke hier hervorzuheben, z.B. vier in Jewe (Jõhvi) ausgegrabene angelsächsische Denare aus der Wikingerzeit und ein Re-valer Dukat von 1670, der später, 1871, in die Sammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft gelangte7.
Gleichzeitig entwickelte ein weiterer bedeutender Sammler in Estland seine Tätigkeit. Eduard Philipp Körber (1770–1850), Sohn eines Pa-stors in Torgel (Tori), hatte zu Königsberg und Jena Theologie studiert und war von 1796 bis 1846 als Pastor in Wendau (Võnnu) bei Dorpat (Tartu) im Amt8. Anders als sein „Kollege“ in Reval begann er seine Sammelaktivität mit Münzen, und dies schon im Jahr 1800, wie dem Titel eines seiner Manuskriptsbände zu entnehmen ist9. Einige Jahre
————————————
6 [Johann BURCHARD], Verzeichniß der Antiquitäten und Seltenheiten die zum Besten der Armen im obern Saale des Schwarzenhaupter-Hauses ... gezeigt werden, in: Mon Faible’ist (wie Anm. 5), S. 157–169.
7 Johann BURCHARD, Antiquitaeten und Seltenheiten die ich seit dem Jahre 1802 ge-sammelt habe, in: Mon Faible’ist (wie Anm. 5), S. 97–155, hier S. 152–154.
8 Johann Friedrich v. RECKE & Karl Eduard NAPIERSKY, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, 4 Bde., Mitau 1827–1832, hier Bd. 2, Mitau 1829, S. 487.
9 Lieflaendische Muenz Sammlung enthaelt alle bisher entdeckte Muenzen die zur Zeit des Ordens und nachher gepraeget worden – beschrieben und gezeichnet durch Edu-ardt Philipp KÖRBER Im Jahr 1800. – Vaterländische Merkwürdigkeiten vierter Theil. Numismatik von Lief und Ehstland nebst einem Anhange von Russischen Courant Muenzen, die seit der Regierung Kayser Peter I, bis auf unsere Zeiten ge-praeget worden sint. Eesti Kirjandusmuuseum [Estnisches Literaturmuseum, EKM], Õpetatud Eesti Selts [Gelehrte Estnische Gesellschaft, ÕES], M.B. 59.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 45
später waren andere faibles hinzugekommen: 1802 und 1803 begann er, alte vaterländische Urkunden, Siegel, die Genealogie bemerkenswerter Geschlechter, Materialien zur Geschichte und Topographie der Bau-denkmäler und Städte sowie allerlei Miszellaneen über örtliche Altertü-mer usw. zu sammeln – ein überraschend weitläufiges Arbeitsfeld, wozu noch die Geschichtsforschung (Kirchen-, Bau- und Heimatgeschichte) kam, von den täglichen Pflichten eines Pastors ganz zu schweigen10. Sei-ne umfangreichen Sammlungen und Manuskripte vermachte er der Ge-lehrten Estnischen Gesellschaft; ein recht oberflächliches Verzeichnis seines Nachlasses umfasst zehn gedruckte Seiten11. Noch heute befinden sich im Estnischen Literaturmuseum sechs Teile seiner „Vaterländischen Merkwürdigkeiten“, Tausende Seiten von Zeichnungen, Abschriften, Forschungen usw.12. Daneben gehörte er zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften sowohl in der Heimat als auch im Ausland an und war Mitbegründer der Gesellschaft für die Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen in Riga sowie der Gelehrten Estnischen Gesell-schaft in Dorpat.
Zweifellos erhielt er die ersten Anregungen und Voraussetzungen zu seiner vielseitigen Tätigkeit während seines Studiums in Deutschland. Noch wichtiger scheint jedoch seine Bekanntschaft, ja fast Freundschaft mit dem Mentor der livländischen Heimatforschung Johann Christoph Brotze (1742–1823) gewesen zu sein. Schon ein flüchtiger Blick in das Werk „Brotze-Estonica“ beweist, dass die Estland betreffenden Zeich-nungen darin meist von Körber stammen13. Vice versa bekam Körber seine lettischen Materialien fast ausschließlich von seinen älteren Kolle-gen im Tausch, wie die entsprechenden Zeichnungen und Angaben in seinen Handschriften belegen. Ihre gegenseitige Korrespondenz hatte
————————————
10 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 487–488; Bd. 5: Nachträge und Fortsetzungen, Berlin 1966 (Neudruck der Originalausgabe Mitau 1859/1861), S. 327.
11 Emil SACHSSENDAHL, Zur Geschichte der Gesellschaft, vom 18. Januar 1847 bis zum 18. Januar 1853, in: Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dor-pat 3 (1854), S. 91–107, hier S. 95–105.
12 EKM, ÕES, M.B. 56–61. 13 Johann Christoph Brotze, Estonica, hg. v. Ants HEIN, Ivar LEIMUS, Raimo PULLAT
u. Ants VIIRES, Tallinn 2006, bes. Raimo PULLAT, Vorwort, S. XIV–XV.
Ivar Leimus 46
wohl 1799 den Anfang genommen, wenigstens ist der Beginn des Brief-wechsels im Verzeichnis der Hinterlassenschaft Körbers so datiert. Der vermutlich erste Brief Körbers an Brotze vom 14. Oktober 1799 ist ebenfalls erhalten14. Dort macht Körber seinem älteren Kollegen aus-drücklich den Vorschlag, gegenseitig vaterländische Antiquitäten betref-fende Angaben, Zeichnungen usw. auszutauschen. Brotze muss es gewe-sen sein, der den jungen wendauschen Pastor nicht nur zum bloßen Sammeln ermunterte, sondern auch die sich dahinter verbergenden For-schungsperspektiven eröffnete. Er selbst hatte bereits eine beträchtliche Anzahl von Aufsätzen publiziert, darunter auch die ersten quellenbeleg-ten Beiträge zur Münzgeschichte in den ehemaligen russischen Ostsee-provinzen15. Die ersten Anregungen zur Münzliebhaberei soll Brotze von Peter von Schievelbein, einem eifrigen Sammler aus Riga und Großonkel eines seiner Schüler, erhalten haben16. Brotze und Körber tauschten sich über Numismatik aus, wobei Brotzes Interesse für diesen Wissensbereich auch für den jungen Körber wegweisend war. Im Litera-turmuseum Estlands in Dorpat wird neben den Handschriften Körbers auch ein Manuskriptband von Brotze aufbewahrt, der hauptsächlich Bilder von Münzen, aber auch anderer Antiquitäten aufweist17. Dabei enthält der Band auch Zeichnungen, deren Vorbilder nur aus der
————————————
14 Obwohl auch dieser Briefwechsel im Jahr 1850 der Gelehrten Estnischen Gesellschaft vermacht wurde (SACHSSENDAHL, Zur Geschichte der Gesellschaft [wie Anm. 11], S. 97) und sich noch in den 1920er Jahren in Dorpat befand (B. HOLLANDER, Dr. Jo-hann Christoph Brotze als Pädagoge und als Geschichtsforscher, in: Mitteilungen aus der livländischen Geschichte 23 [1924–1926], S. 268–295, hier S. 290), ist es nicht gelungen, seinen gegenwärtigen Verbleib festzustellen. Der Brief Körbers an Brotze wird in der Lettischen Akademischen Bibliothek aufbewahrt, BM07232–07233, http://www3.acadlib.lv/broce/Vol_7_3.htm.
15 [Johann Christoph BROTZE], Bemerkungen über etliche in liefländischen Urkunden und historischen Nachrichten vorkommende, zum Teil schon unbekannt gewordene Ausdrücke; nebst Winken über ehemalige rigische Begebenheiten und Sitten. Dalen-sche Münze, in: Neue Nordische Miscellaneen 11–12 (1795), S. 450–459; DERS., Von dem Liefländischen Münzwesen des fünfzehnten Jahrhunderts, in: Ebenda 15–16 (1797), S. 507–509.
16 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 136. 17 Genauer Entwurf von verschiedenen Liefländischen Münzen, Monumente und Ge-
genden (abgefasst von Dr. J.Ch. BROTZE in Riga). EKM, ÕES, M.B. 64.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 47
Sammlung Körbers stammen können. Wohl nicht zufällig nahm sich Körber vor, dem Beispiel Brotzes folgend, einen eigenen Katalog „aller bisher entdeckten“ livländischen Münzen zu verfassen. Viele estnische Münzen, die in seinem 350-seitigen Werk dargestellt werden, stammen wohl aus seiner eigenen Sammlung, die rigischen und kurländischen Münzen jedoch sind wohl meistens anhand des Werks von Brotze ge-zeichnet.
So können wir in Bezug auf Körber nicht nur von Sammeln, sondern auch von Katalogisieren und, mit einem gewissen Vorbehalt, sogar vom Studium der Münzen sprechen. Als gut ausgebildeter Theologe und vor-züglicher Zeichner hatte Körber dafür beste Voraussetzungen. Seine Tä-tigkeit begann er sehr methodisch. Am Anfang seines Münzbandes be-findet sich eine Liste der ihm bekannten Sammlungen der livländischen Münzen18, die recht aufschlussreich ist und den allgemeinen damaligen Stand des Sammelns im Lande erhellt.
In Dorpat kannte Körber vier Sammlungen – die Petersohnsche, die von Stiernhelmsche, die Academische und seine eigene. Bei Petersohn ist höchstwahrscheinlich der Sekretär der Universitätsbibliothek Karl Fried-rich Ludwig Petersen (1775–1822) gemeint, dessen Sammlung später vom berühmten Petersburger Sammler Jakob Reichel (siehe unten) ak-quiriert wurde19. Jedenfalls konnte auch Körber einiges, darunter eine vergoldete Zinnmedaille von Herzog Magnus, erwerben20. Nach Johann Gotthard Dietrich Schweder (Näheres über ihn später) soll schon der Vater Petersens Münzen gesammelt haben21. Welcher Stiernhjelm bei Körber gemeint ist, bleibt unklar. 1831 erwarb Körber eine Münze, den Revaler Ferding vom Jahr 1532, aus dessen Sammlung, doch nicht von Stiernhjelm selbst, sondern von einem Goldschmied namens Eckert (Reinhold H. Eckert, Goldschmied in Dorpat 1820–1847)22. Das be-
————————————
18 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 2. 19 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 138. 20 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 142. 21 Schweder an Körber, 19.3.1823. EKM, ÕES, M 324:8.13. 22 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 33; über den Goldschmied siehe Kaalu KIRME, Eesti hõbe.
800 aastat hõbe- ja kullassepakunsti Eestis. – Estnisches Silber. 800 Jahre Silber- und Goldschmiedekunst in Estland, Tallinn 2000, S. 171, 192.
Ivar Leimus 48
deutet, dass Stiernhjelms Sammlung zu dieser Zeit schon zerstückelt war, wahrscheinlich nach dem Tode ihres ursprünglichen Besitzers. Die academische Sammlung gehörte zweifellos der Dorpater Universität, bei welcher im Jahr 1803 ein Kunstmuseum gegründet worden war, das ne-ben Kunstwerken auch Münzen sammelte.
Zu Riga listet Körber folgende Sammlungen auf: die v. Bergmansche, die Brotzische, die von Wrangelsche auf Lude, die Fehresche, die German-sche, Georg Kröger, Pastor Trey. Der Rigaer Pastor Liborius Bergmann (1754–1823) war einer der berühmtesten Sammler seiner Zeit in Liv-land, seine Münzen verkaufte er 1795 dem Himsel-Museum in Riga, blieb aber auch weiter der Numismatik verbunden23. Brotzes Person und seine Beziehungen zu Körber wurden weiter oben bereits behandelt. Von Wrangel auf Lude (Lugažu) ist vermutlich Carl Johann Wilhelm von Wrangel (1760–1818), obgleich in der Familiengeschichte über sei-ne Münzliebhaberei nichts vermeldet ist24. Doch soll seine Sammlung recht bedeutend gewesen sein, da Körber nur anhand dieser zwei seltene livländische Goldmünzen, eine aus Riga vom Jahr 1533, eine weitere aus Reval vom Jahr 1650 aufzeichnen konnte25. Auch ein späterer von Wrangel, Baron Friedrich Wilhelm (1840–1897), war als fleißiger und eifriger Sammler von die Familie betreffenden russischen Münzen, Por-traits und Kunstschätzen bekannt26. Die Fehresche Sammlung stammt vom Rigaer Kaufmann David Friedrich Fehre (1758–1803), der livlän-dische Münzen, Schriften und Altertümer sammelte27. Körber hat aus der Fehreschen Sammlung einen Revaler Ferding von 1528 notiert28.
Friedrich Germann (1786–1856) war, so Franziskus Pärn, der „be-deutendste private Sammler livländischer Münzen in Riga“ um die Mit-te des 19. Jahrhunderts. Mit ihm führte Körber ebenfalls einen Brief-
————————————
23 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 136. 24 Henry von BAENSCH, Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre zwölfhundert-
fünfzig bis auf die Gegenwart, Bd. 1, Berlin & Dresden 1887, S. 395. 25 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 18, 156. 26 BAENSCH, Geschichte der Familie von Wrangel (wie Anm. 24), S. 486. 27 Stammtafeln Deutsch-baltischer Geschlechter, bearb. v. Erich SEUBERLICH, Bd. 1,
Riga 1924, Sp. 81. 28 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 32.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 49
wechsel, von dem zwei Schreiben aus dem Jahr 1822 erhalten sind29. Im ersten beschrieb Germann seine Sammlung, die schon damals mehr als 4.800 Münzen umfasste, darunter 950 livländische, 300 russische und mehr als 400 antike Münzen. Die letzteren habe er aus Kopenhagen von einem Korrespondenten bekommen, der mittelalterliche Münzen (bis 1521) gesammelt habe. Es handelte sich um Christian Jürgensen Thom-sen (1788–1865), einen dänischen Archäologen deutscher Abstam-mung, ein Antiquar und Münzforscher von europäischem Rang30. Dem-entsprechend bietet Germann Körber die antiken Münzen an und will für diese von ihm die mittelalterlichen haben. Da aber Körber selbst an den letztgenannten besonders interessiert war, schlug er Germann vor, Taler und russische Tropfkopeken von Peter I. aus dem Fund von Rap-pin (Räpina) zum Austausch zu erhalten. Germann jedoch wollte keine Taler, wohl aber Tropfkopeken nehmen, gegen die er einige livländische Münzen anbot. Wie das ganze Geschäft endete, ist nicht bekannt. Eini-ge Münzen aus Germanns Sammlung hat Körber jedenfalls in einem seiner Manuskripte notiert31. Wer Georg Kröger gewesen sein mag, bleibt offen; bekannt ist nur, dass er in Riga das Revisoramt bekleidete und eine seltene halbe Notklippe von Ordensmeister Wilhelm Fürsten-berg in seiner Sammlung führte32. Möglicherweise handelte es sich um dieselbe Person, die später unter den Mitgliedern der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde auftaucht. Bei Pastor Trey handelte es sich um Johann Hermann Trey (1794–1849), Oberpastor an der letti-schen Kirche in Riga, Stifter und Mitglied des Direktoriums der Gesell-schaft für Geschichte und Altertumskunde. Auch er wechselte mit Kör-ber einige Briefe und versuchte Münzen zu tauschen33. Seine Sammlung
————————————
29 EKM, ÕES, M.B. 12/7. 30 Jørgen Steen JENSEN, Christian Jürgensen Thomsen og Jakob Reichel – en numisma-
tisk og etnografisk brevveksling mellem København og Sankt Petersborg 1821–1855, in: Danske Magazin 9 (2002), 1:3, S. 453, 463, 465, 473–474.
31 Vaterländische Alterthümer und Seltenheiten aus Pastor Körbers Sammlung von ihm selbst beschrieben und abgebildet, Wendau 1822. EKM, ÕES, M.B. 63, S. 9, 13, 15, 17.
32 Latvijas Akadēmiskā Bibliotēka (Lettische Akademische Bibliothek, LAB), J.Chr. BROTZE, Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente 2, S. 77.
33 Trey an Körber, 18.8.1841. EKM, ÕES, M 324:14, 3/5.
Ivar Leimus 50
verkaufte er später an einen anderen berühmten Numismatiker, an Au-gust Buchholtz (1803–1875)34.
Aus Walck (Gut Valgu in der Wiek) kannte Körber die Sammlung von Budberg, der auch unter den Subskribenten eines in Dorpat 1816 erschienenen numismatischen Werkes auftaucht35. Vermutlich haben wir es mit Freiherrn Karl Woldemar von Budberg (1778–1842) zu tun, dem stellvertretenden Präsidenten des Livländischen Evangelisch-Luthe-rischen Konsistoriums und Ritter des St. Annen-Ordens36. Der Gründer seiner Kollektion könnte wohl schon sein Vater, der vielseitig talentierte Woldemar Dietrich von Budberg (1740–1784) gewesen sein, ein Freund des bereits erwähnten Münzsammlers und Pastors Liborius Bergmann37.
Körber kannte einen weiteren hervorragenden baltischen Humani-sten, August Wilhelm Hupel (1737–1819), persönlich und verfasste über diesen sogar eine kurze Biographie. Unter anderem war Hupel auch ein Münzsammler und besaß eine schöne Kollektion von livländi-schen alten Münzen, wie er in einem Brief von 1780 selbst vermeldet38. Doch verkaufte er sie im Jahr 1805 an Heinrich August von Bock (1771–1863) auf Kersel (Loodi) (seine Sammlung führt Körber als eine Fellinsche an). Im selben Jahr tauschte Körber selbst eine Handvoll wi-kingerzeitlicher Münzen aus dem Werroschen (Võru) Fund „an H. v. Bock in Kersel gegen vaterländische alte Münzen“39. Bock hatte nach dem Abschied vom russischen Militärdienst 1790 viele wichtige Posten in Livland bekleidet, war u.a. auch pernauscher Landrichter und Kreis-Deputierter und wurde als solcher mehrfach ausgezeichnet. Von seinen
————————————
34 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 137. 35 O.G. Freiherr von ROSEN, Die Numismatik oder Geschichte der Münzen älterer,
mittlerer und neuerer Zeiten, Dorpat 1816, S. V. 36 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 292; Bd. 5, S. 99–100. 37 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 1, S.294–296. 38 Indrek JÜRJO, Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819, Tallinn 2004,
S. 284. Deutsche Ausgabe: Indrek JÜRJO, Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen Gelehrten August Wilhelm Hupel (1737–1819) (Quellen und Stu-dien zur baltischen Geschichte, 19), Köln, Weimar, Wien 2006.
39 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 172.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 51
kulturellen Interessen spricht die Tatsache, dass er zu den Mitstiftern der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga gehörte40.
Aus Reval kannte Körber vier bemerkenswerte Münzsammlungen, die Gebauersche, die Tiedebölsche, Riesenkampfsche und die v. Burchardsche. Die Gebauers waren ein Revaler Kaufmannsgeschlecht, das auch die Gildeälteste stellte oder sonst führende Posten in der Stadt bekleidete41. Welcher Gebauer von ihnen aber sich den Sammelfreuden gewidmet hatte, bleibt unklar. Hier kann auch Johann David (1729–1792), Pastor der St. Nikolai-Gemeinde in Reval, in Frage kommen42. Besser infor-miert sind wir über die Tiedebölsche Sammlung, die zunächst einem General Harpe gehört hatte43. Unter den Harpes gab es nur einen Gene-ral(major), August Wilhelm Theodor († 1815), dessen Mutter Anna Dorothea Kelch in zweiter Ehe den Professor der Ritterschule in Reval und Hofrat Johann Christian Tideböhl (1741–1807) geheiratet hatte44. Die Sammlung scheint nach dem Tod Harpes in die Familie Tideböhls geraten zu sein. Aus der Tideböhlschen Sammlung kannte Körber einen äußerst seltenen kupfernen viereckigen Abschlag eines Revaler Öre von 162245. Besonders aber hob Körber die Sammlung Riesenkampffs her-vor, die einem Doktor Riesenkampff, vermutlich dem in Reval gebore-nen Stadtphysicus Johann Georg Karl (1793–1835) gehörte46, der in Dorpat Medizin studiert, 1819 vom Ausland in seine Heimatstadt zu-rückgekehrt und die Münzen von seinem Vater als Nachlass geerbt hat-te47. Sein Vater war Carl Eberhard Riesenkampff (1758–1825), Gründer
————————————
40 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 197–199; Bd. 5, S. 65–67. 41 Z.B. Eesti Ajalooarhiiv (Estnisches Historisches Archiv, EAA), 3339/1/3384, 3385;
915/1/1561; 30/1/21527, 22180. 42 Liivi AARMA, Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885 [Kurzbiografien der
Geistlichen in Nordestland 1525–1885], Tallinn 2007, Nr. 262. 43 Körber an Burchard 9.12.1825. Eesti Ajaloomuuseum (Estnisches Historisches Mu-
seum, EAM), D 54/1/35, Fol. 22–23. 44 Otto Magnus von STACKELBERG (Bearb.), Genealogisches Handbuch der baltischen
Ritterschaften, Teil: Estland, Bd. 2/3, Doberan 1929, S. 113–114; RECKE, NA-PIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 4, Mitau 1832, S. 363.
45 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 153. 46 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 3, Mitau 1831, S. 546–547; Bd. 5, S.
148. 47 Körber an Burchard, 9.12.1825. EAM, D 54/1/35, Fol. 22–23.
Ivar Leimus 52
eines Tuch- und Manufakturgeschäfts in Reval, Ratsherr und Bürger-meister48, der auch ein Sammler gewesen sein könnte. In der Akademi-schen Bibliothek der Tallinner Universität befindet sich ein Manuskript, das den Titel „Abzeichnungen Russischer, Tatarischer, und unbekannter Münzen von Wasili Wasiljewitsch III 1425 bis Pawel Petrowitsch I 1801“ trägt und von einem Georg Riesenkampff 1811 in Moskau für seinen Bruder, einen „alten Numismathiker“ verfasst ist49. Der Autor der Handschrift war demzufolge ein aus Reval gebürtiger Kaufmann Georg Johann Riesenkampff (1752–1831, seit 1779 in Moskau)50. Mit seinem Bruder kann nur Justus Johannes (1758–1823) gemeint sein, der eine gute Bibliothek besaß, Urkunden und Manuskripte sammelte und diese später der Dorpater Universität hinterließ. Aber er hatte keine Söhne51. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass Körber zwei Riesenkampffs, Carl Eberhard und Georg Johann (mit fast gleichen Lebensdaten) mit-einander einfach verwechselt.
Die Münzliebhaberei Burchards ist schon behandelt worden. Später hat Körber zum Verzeichnis der revalschen Sammlungen noch zwei Ein-tragungen mit Bleistift hinzugefügt: die Hoppnersche, die Glehnsche Ca-binet. Eben die Sammlung eines von Glehn scheint Körber am meisten beeindruckt zu haben. Vor Jahren habe er einen Katalog dieser Kollekti-on erworben, der sogar einen ganzen und einen halben Revaler Taler verzeichnete (vermutlich Zwei- und Einmark-Stücke aus der Zeit Erichs XIV. oder Vier- und Zweimark-Stücke von Karl XI.)52. Deswe-gen interessierte sich Körber sehr für das Schicksal dieser wichtigen Sammlung, die vermutlich dem Revaler Kaufmann Heinrich von Glehn (1766–1825) gehört hatte, der zur Zeit des Briefwechsels zwischen Kör-ber und Burchard gestorben war. Übrigens erwähnt Burchard in Ver-bindung mit seiner Münzsammlung einen kleinen Mahagoni-Schrank,
————————————
48 Günther RIESENKAMPFF, Geschichte und Genealogie des Revaler Patriziergeschlech-tes Riesenkampff mit allen seinen Linien, Jüchen 1970, S. 21.
49 Inv. Nr. V–9277. 50 RIESENKAMPFF, Geschichte und Genealogie (wie Anm. 48), S. 19. 51 Ebenda. 52 Körber an Burchard, 9.12.1825. EAM, D 54/1/35, Fol. 22–23; EKM, ÕES, M.B.
59, S. 146, 148, 158.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 53
den er nach dem Tod Heinrich von Glehns von seinem Bruder Joachim geschenkt bekommen habe und der für die Münzen bestimmt gewesen sei53. Welcher Hoeppener von den zahlreichen Vertretern dieses Ge-schlechts in Reval Münzen gesammelt hat, ist leider nicht bekannt.
Aus Kurland wusste Körber nur zwei Münzsammlungen zu nennen – Graf von der Borgsche und die v. d. Recksche. Bei der Reckschen handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Kollektion von Johann Friedrich von der Recke (1764–1846), dem Mitstifter der Kurländischen Gesell-schaft für Literatur und Kunst, Stifter des Kurländischen Provinzial-Museums und ersten Direktor desselben54. Auch ein späterer von Recke, Otto, in Goldingen (Kuldiga) ansässig, sammelte Münzen und Aus-zeichnungen, korrespondierte mit dem Kustos der Münzsammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft seit 1843, Doktor Emil Sachssendahl (siehe unten), und bekam sogar von einem bedeutenden Sammler seiner Zeit, Adolph Preuss in St. Petersburg, einige Ordensmünzen im Tausch55. Seine Beziehung zu Johann Friedrich von der Recke bleibt je-doch unklar. Welcher Graf von der Borg von Körber erwähnt wurde, ist nicht sicher, aber an dieser Stelle darf Michel Johann von der Borch (1753–1810), der den Reichsgrafenstand erneut in die kurländische Li-nie brachte und vielseitige Interessen hatte, nicht ausgenommen werden, obgleich sein Erbbesitz das Gut Warkland (Varakļāni) in Lettgallen war56.
Zuletzt erwähnt Körber aus St. Petersburg die Sammlung des H[errn] Banco Directors J[acob] v. Reichel, der im Jahr 1821 die Sammlung liv-ländischer Münzen Bergmanns aus Riga gekauft hatte57. Wie oben ver-merkt, hatte Bergmann schon 1795 seine Sammlung dem Himsel-Museum verkauft58, aber anscheinend war davon noch etwas übrig ge-
————————————
53 BURCHARD, Geschichte meiner Sammlung (wie Anm. 5), S. 81, 91, Anm. 27. 54 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 485–491; Bd. 5, S. 136–137. 55 Otto Recke an Emil Sachssendahl, 4.10.1853, 27.2.1854, 26.8.1854. EKM, ÕES,
M.A. 170:36. 56 Heinrich KNESCHKE, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, Bd. 1, Leipzig
1859, S. 565; RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 219–223. 57 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 2. 58 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 136.
Ivar Leimus 54
blieben. Auch mit Reichel, dem bedeutendsten Sammler seiner Zeit in Russland, der in Wirklichkeit kein Bankdirektor war, sondern seit 1818 eine Abteilung für die Anfertigung staatlicher Wertpapiere leitete59, scheint Körber im Briefwechsel gestanden zu haben, wie die Angaben – dieser habe etwa 1.000 römische und griechische Münzen zum Verkauf angeboten – beweisen. Daneben registriert er aus der Reichelschen Sammlung eine Akzisemarke aus Riga von 157560. Andererseits könnte er die betreffenden Angaben von Emil Sachssendahl vermittelt bekom-men haben, da auch dieser mit Reichel im Briefwechsel stand61.
In Körbers Aufzeichnungen tauchen weitere Sammler auf. Mit Jo-hann Gotthard Dietrich Schweder (1790–1833), dem Pastor zu Loddi-ger (Lēdurga) und Treiden (Turaida) und Mitglied mehrerer wissen-schaftlicher Gesellschaften62, stand er in einem besonders regen Brief-wechsel. Unter anderem ergibt sich aus ihrer Korrespondenz, dass auch Schweder ein wenngleich nicht besonders eifriger Münzliebhaber war und die Sammlung Germanns recht gut kannte63. Seinem Amtsbruder hatte er jedoch wenig anzubieten, von den vaterländischen Münzen nur einen in Riga geprägten Ferding Gotthard Kettlers von 1561, der von Körber auch erworben wurde64. Auch der Kustos der Münzsammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, Emil Sachssendahl, hatte eine ei-gene Münzsammlung. Sein Großvater, der Werrosche Kreisarzt Urbahn, hatte seinerzeit 60 wikingerzeitliche Münzen aus dem am Ufer des Ta-mula-Sees bei Werro (Võru) gemachten Fundes erworben und könnte einige weitere besessen haben, die wohl seinem Enkel Anregung zum
————————————
59 Über ihn ausführlicher: Jakob Rejchel’, Medal’er, kollekcioner’, učenyj. 1780–1856. Gosudarstvennyj Ėrmitaž. Katalog vystavki [Jakob Reichel, Medailleur, Sammler, Gelehrter. 1780–1856. Staatliche Eremitage. Ausstellungskatalog], Sankt-Peterburg 2003.
60 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 71. 61 Jakob Reichel an Emil Sachssendahl, 14.10.1850. EKM, ÕES M.A. 170:40; Jorgen
Steen JENSEN, Zarubežnye korrespondenty Ja.Ja. Rejchelja [Die ausländischen Korre-spondenten Jakob Reichels], in: Jakob Rejchel’ (wie Anm. 59), S. 77–82, hier S. 79.
62 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 4, S. 166–167; Bd. 5, S. 187. 63 Schweder an Körber, 19.3.1823, 8.11.1823, 24.3.1824. EKM, ÕES, M324:8,
13/25–28, 14/29–30, 15/31–32. 64 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 26.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 55
Sammeln gaben65. Aus seiner Sammlung zeichnete Körber die Münzen eines anderen, in Kirumpää bei Werro gehobenen wikingerzeitlichen Fundes wie auch einen Dorpater Pfennig von Bischof Christian Bom-hower (1514–1518) auf66.
Darüber hinaus erwarb Körber Münzen von anderen Personen, von denen nicht bekannt ist, ob sie selbst Sammler waren. So erhielt er von einem von Gordoffsky auf Marienhoff (entweder Maarjamõisa bei Dor-pat oder möglicherweise Vanamõisa im Wendauschen Kirchspiel) 1825 einen Revaler Ferding aus dem Jahr 153467. Durch Propst Johann Phil-ipp Roth (1754–1818) in Kannapäh (Kanepi)68 kaufte Körber einen sel-tenen Goldabschlag des sog. Plettenberg-Talers von 152569 aus der Ga-debuscher Sammlung für 100 oder 125 Rub. Banco70. Später geriet die Münze mit dem übrigen Nachlass Körbers in die Sammlungen der Ge-lehrten Estnischen Gesellschaft71, gilt aber heute als verschollen. Dabei verdient eine Bemerkung Körbers besondere Aufmerksamkeit. Bei der Beschreibung der Münzvorderseite notierte er: „Auf der rechten Seite des Schwerts zeigt sich ein Kreuz, gegenüber aber eine Rose. Auf einigen wird die Rose durch einen Stempel bedeckt, da die Stadt Riga ihr kleines Wappen darüber zum Zeichen der Verhöhung darauf hat prägen las-sen“72. Die Gegenstempelung dieser Münzen ist nirgendwo sonst er-wähnt und ein Indiz dafür, dass sie wirklich für den Umlauf bestimmt und also geprägt, nicht etwa später gegossen waren. Ein gewisser Schöler in Fellin besaß eine damals noch nicht näher bestimmte, erst in den
————————————
65 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 21; über den Arzt siehe Isidorus BRENNSOHN, Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Riga 1905, S. 407.
66 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 119, 181; MOLVÕGIN, Die Funde westeuropäischer Mün-zen (wie Anm. 2), S. 150.
67 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 3, 33. 68 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 574–576. 69 Über diese Münze eingehender: Franziskus PÄRN, Der Plettenberg-Taler und seine
Abschläge in Gold, in: Studia numismatica II. Festschrift Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80 (Eesti Ajaloomuuseum, Töid ajaloo alalt, 3), Tallinn 2001, S. 186–205.
70 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 4; M.B. 63, S. 3. 71 SACHSSENDAHL, Zur Geschichte der Gesellschaft (wie Anm. 11), S. 99. 72 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 4.
Ivar Leimus 56
1980er Jahren erkannte rare Kleinmünze, einen Revaler sog. Seestling (1/6 eines Artigs)73.
Daneben registrierte Körber viele Münzen aus anderen Quellen, mei-stens nach Arndt, weil sowohl die von Arndt erwähnten Sammlungen von Jacob Gustav Clodt, Magnus von Torck als auch Georg Christoph Andreae schon am Ende des 18. Jahrhunderts den Besitzer gewechselt hatten74. Der Austausch der Angaben und Bilder mit Brotze wurde schon mehrfach erwähnt. Darüber hinaus gab es im 18.–19. Jahrhun-dert eine Vielzahl von numismatischen Büchern, von denen Körber ei-nige benutzte. Neben dem zweiten Teil der Arndt-Chronik75 scheinen damals die Bände der Thaler-Sammlung von Madai76 besonders populär gewesen zu sein. Auch die Münz-Belustigungen Köhlers waren Körber bekannt77. Zur selben Zeit begann Bernhard (Boris) Karl von Köhne (1817–1886), u.a. auch Kustos der numismatischen Abteilung in der Eremitage in St. Petersburg, seine Aufsätze über die livländische Nu-mismatik zu veröffentlichen, von denen zumindest einige Teile auch von Körber beachtet wurden78. Die dänischen Münzen wurden von Körber nach Erik Pontoppidans „Dänischem Atlas“ studiert und nachgezeich-net79. Einen in Reval 1837 eingehandelten deutschen Brakteaten be-stimmte er mit Hilfe des Beckerschen Katalogs über mittelalterliche
————————————
73 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 27; über die Münze siehe Mihhail NEMIROVITŠ-DANTŠENKO, Zur Datierung der Seestlinge, in: Studia numismatica (wie Anm. 3), S. 126–131.
74 PÄRN, Zur Geschichte der livländischen Numismatik (wie Anm. 3), S. 135. 75 Johann Gottfried ARNDT, Der Liefländischen Chronik Andrer Theil von Liefland
unter seinen Herren Meistern ..., Halle 1753. 76 David Samuel MADAI, Vollständiges Thaler-Cabinet aufs neue ansehnlich vermehrt,
in zweyen Theilen herausgegeben und mit nöthigen Registern versehen, Theil 1–2, Königsberg 1765, 1766.
77 Johann David KÖHLER, Historische Münz-Belustigung ..., Nürnberg 1729–1750. 78 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 55, 129; Bernhard KOEHNE, Münzgeschichte Livlands 1.
Das Bisthum Dorpat, in: Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde 1 (Ber-lin–Posen–Bromberg 1841), S. 355–374; DERS., Münzgeschichte Livlands 2. Das Erzbisthum Riga, in: Ebenda 2 (1842), S. 77–115, 144–166.
79 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 179; Erich PONTOPPIDAN, Den danske atlas, eller Konge-riget Dannemark: med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere ..., Kiøbenhavn 1763–1781.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 57
Münzen80. Zweifelsohne besaß und benutzte er auch andere numismati-sche Bücher, die von ihm nicht angegeben sind. So könnte eben Körber der Ungenannte aus dem Dorptschen Kreise gewesen sein, der unter den Pränumeranten und Subscribenten des numismatischen Werkes von O. G. Freiherrn von Rosen auftauchte und fünf Exemplare des Buches be-stellte81.
Aber nicht nur mit Hilfe verschiedener Personen konnte Körber seine Sammlung vervollständigen. Seine besondere Aufmerksamkeit erregten die in Livland und Estland gemachten Münzfunde, die er sowohl zu er-werben versuchte als auch registrierte. Seine ersten 21 wikingerzeitlichen Münzen aus einem Schatz, der 1799 bei Werro entdeckt wurde82, tauschte er 1805 mit Heinrich August von Bock gegen andere Münzen. Aber auch später blieb ihm das Glück treu, da am 12. Mai 1821 der Bauer Maxa Juhhan in Wendau unweit des Suithofschen (Krüüdneri) Kruges einen anderen wikingerzeitlichen Münzfund ausgepflügt hatte83. Mindestens 23 westeuropäische und drei kufische Prägungen scheint Körber aus diesem Schatz für seine Sammlung erworben zu haben, daneben sechs deutsche und angelsächsische Denare aus einem anderen Fund von Niggen (Nõo), der bereits vor 1822 entdeckt worden war84. Eine kufische Münze hat er auch aus dem Fund von Rathshof (Raadi bei Dorpat) erwerben können, die in den Sammlungen des Historischen In-stituts der Tallinner Universität noch erhalten zu sein scheint85.
————————————
80 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 180; Wilhelm Gottlieb BECKER, Zweihundert seltene Mün-zen des Mittelalters in genauen Abbildungen mit historischen Erläuterungen, Dres-den 1813.
81 ROSEN, Die Numismatik (wie Anm. 31), S. XII. 82 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 21–22; MOLVÕGIN, Die Funde westeuropäischer Münzen
(wie Anm. 2), Nr. 49. 83 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 19; MOLVÕGIN: Die Funde westeuropäischer Münzen (wie
Anm. 2), Nr. 24. 84 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 175–177; MOLVÕGIN: Die Funde westeuropäischer Mün-
zen (wie Anm. 2), Nr. 44. 85 SACHSSENDAHL, Zur Geschichte der Gesellschaft (wie Anm. 11), S. 99; Ivar LEIMUS,
Sylloge of Islamic Coins 710/1–10113/4. Estonian Public Collections. – Estonian History Museum. Thesaurus historie II, Tallinn 2007, S. 33.
Ivar Leimus 58
Als im Jahr 1831 auf Ösel beim Gut Piila ein Schatzfund aus der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert zutage gebracht wurde, gelang es Körber, acht Münzen zum Aufzeichnen an sich zu nehmen. Die größe-ren musste er später dem Besitzer, Schulinspektor Stäcker, in Arensburg (Kuressaare) zurücksenden, während er drei kleine und schlecht geprägte gotländische (Halb-)brakteaten behalten konnte86. Darüber hinaus ver-wendete Körber die Angaben und Zeichnungen Brotzes über einen im Dörptschen87 entdeckten Brakteatenfund von 1779 im dritten Band der „Merkwürdigkeiten“ und erwarb angeblich auch selbst einige Münzen davon88.
Auch mittelalterliche und frühneuzeitliche Funde erregten seine Auf-merksamkeit. Im Spätherbst 1820 grub ein Tier im Kirchspiel Harjel (Hargla) auf einem Pfad einige Silbermünzen aus; bei weiterem Suchen fanden die Viehhüter eine Menge von Münzen, die teilweise mit Mes-singdraht verbunden waren. Eine Halskette mit 10 Münzen, von denen die jüngste ein Rigaer Schilling von Sigismund III. war, schenkte Pastor Heinrich Georg Jannau (1788–1869)89 seinem Amtsbruder90. Der Rap-pinsche Kopekenschatz aus der Zeit Peters des Großen, um oder vor 1822 beim Sandgraben zum Dammbau gefunden, wurde bereits er-wähnt. Noch 1870 wurden ein paar hundert Tropfkopeken mit zwei ei-sernen Behältern, den sog. Grapen, aus demselben Fund für die Gelehrte Estnische Gesellschaft akquiriert91. Weiter berichtet Körber, dass im
————————————
86 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 180; Ivar LEIMUS, Kaarma Piila aardeleid 12. ja 13. sajandi vahetuselt [Der Schatzfund von Kaarma Piila an der Wende vom 12. zum 13. Jahr-hunderts], in: Eesti Arheoloogia Ajakiri 7 (2003), H. 2, S. 150–157.
87 D.h. in der Umgebung Dorpats. 88 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 23; Ivar LEIMUS, Das Münzwesen Livlands in der frühen
Hansezeit. 13. Jahrhundert und erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, in: Fernhandel und Handelspolitik der baltischen Städte in der Hansezeit. Beiträge zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handelsbeziehungen und -wege im europäi-schen Rahmen, hg. v. Norbert ANGERMANN u. Paul KAEGBEIN (Schriften der Balti-schen Historischen Kommission, 11), Lüneburg 2001, S. 44, Anm. 17; S. 67, Abb. 11–12; S. 68, Abb. 13.
89 RECKE, NAPIERSKY, Lexikon (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 381–382; Bd. 5, S. 294. 90 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 26–27. 91 Hermann Eduard HARTMANN, Das Vaterländische Museum zu Dorpat oder die
Sammlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft und des Central-Museum vater-
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 59
Frühjahr 1829 zu Rappin „im Hofs Viehgarten“ bei der Mistfuhr aber-mals Münzen gefunden worden seien, diesmal aus dem Mittelalter und hauptsächlich vom Dorpater Bischof Theodericus. Aber auch Revaler und Dorpater Kleinmünzen, die sog. Lübischen, die von ihm zeitgemäß Artige genannt wurden, befanden sich darunter. Am 4. August desselben Jahres kaufte er sechs Münzen für 1 Rubel von einem dortigen Bauern92, nach seinen Abbildungen zu urteilen Artige und Schillinge der Dorpater Bischöfe Dietrich III. Damerow, Bernhard II. Bülow und Dietrich IV. Resler93. Der Schatz muss also einige Jahre nach der livländischen Münzreform von 1422 vergraben worden sein.
Im Herbst 1831 wurde unter den Schlossruinen von Schwaneburg (Gulbene in Lettland) ein mit alten livländischen Münzen des Ordens-meisters Plettenberg und einiger Dorpater Bischöfe (Johann II. Bertkow und Dietrich V. Hake) gefülltes Ochsenhorn zutage gefördert, der Fund gehörte also zum Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts.
1836 wurden aus einer Opferquelle Uddo allik (Nebel-Quelle) bei Pillistfer (Pilistvere in Estland) mehrere alte livländische Münzen her-ausgefischt, von welchen Körber von Pastor Eugen von Mickwitz etwa 50 Stück als Geschenk erhielt94. Einige – ein Dorpater Schilling von 1544 und ein Revaler Pfennig von 1562 – wurden von Körber in seinem Münzband mit ihrem Fundort angeführt95. Später gelangte eine weitere Münze aus demselben Fund, ein Danziger Pfennig von 1557, zur Ge-lehrten Estnischen Gesellschaft96.
Weitere Funde nennt Körber in seinen Briefen an Burchard. So be-richtet er, im Juli 1825 habe ein Bauer im Dörptschen eine Zinnkanne gefunden, gefüllt mit alten livländischen Münzen und Talern sowie al-tem estnischen Brustschmuck. Von einem ungenannten Freund gelang
————————————
ländischer Alterthümer der Kaiserlichen Universität zu Dorpat (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 6, H. 3/4), Dorpat 1871, S. 183, BX:69.
92 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 2. 93 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 117, 120. 94 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 2. 95 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 127, 145. 96 Handschriftliche Bemerkung in dem Exemplar der Gelehrten Estnischen Gesellschaft
des Katalogs von HARTMANN, Das Vaterländische Museum (wie Anm. 91), BX 89b.
Ivar Leimus 60
es Körber einige Monate später, im Dezember, eine Anzahl von Münzen und eine estnischen Brustverzierung mit dem Text help Got wt aller noet aus dem Fund von Gut Forbushof (Vorbuse) zu erwerben97. Der Schatz dürfte auf das 17. Jahrhundert zu datieren sein. Ebenfalls in Dorpat sol-len im Sommer 1825 am Embachufer spielende Kinder einen silbernen Spielkuntor mit alten Silberkopeken gefunden haben98.
Im Jahr 1832 weiß Körber von einem Riesenschatz zu berichten, den ein Arrendator des Gutes Fianden (Lāzberģi) mit seinen vier estnischen Gehilfen im Morast am Marienburg-See (Alūksne in Nordlettland) aus-gegraben hatte. Nach Gerüchten lagen die alten Münzen und Taler in einer eisernen Kiste, die 2½ Fuß lang, 2 Fuß breit und 1 Fuß hoch war. Doch leugnete der Arrendator alles, obwohl vier Augenzeugen darüber unter Eid ausgesagt hatten99.
1833 soll ein Ochse auf dem Gut Teilitz (Tõlliste) im Kirchspiel Sa-gnitz (Sangaste in Südestland) mehrere alte Ordensmünzen, angeblich aus der Zeit Plettenbergs, aus der Erde herausgewühlt haben100. Später, wohl in den 1860er Jahren, wurden an derselben Stelle Münzen und Silberschmuck gefunden, die bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts, nach dem Jahr 1605/06, vergraben worden waren101. Bauern in Turnes-hoff (Turna in Lettland) förderten – ebenfalls 1833 – unter den Wur-zeln eines Baumes einen Schatz von Münzen aus der Ordens- und polni-schen Zeit, d.h. aus dem Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, zu-tage. Körbers Sohn erwarb davon 137 Stück und bot sie seinem Vater für 100 Rubel (ein unerhört hoher Preis für die damalige Zeit!) zum Kauf an. Unter den Münzen soll auch ein bronzenes Götzenbild (!) mit runden Ohren gewesen sein. Das weitere Schicksal des Fundes ist leider nicht bekannt.
————————————
97 Später in der Sammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Ebenda, S. 67, AXI:14.
98 Körber an Burchard, 12.8.1825. EAM, D 54/1/35, Fol. 16–17, 22–23. 99 EAM, D 54/1/35, Fol. 41–42. 100 EAM, D 54/1/35, Fol. 52–53. 101 Mauri KIUDSOO, Eesti mündiaarded 17. sajandist. Vääringud ja nende käibeareaalid
[Die Münzschätze Estlands aus dem 17. Jahrhundert. Die Währungen und ihre Um-laufsgebiete], Hauptseminararbeit, Universität Tartu, Lehrstuhl für Archäologie, Tar-tu 2000, Nr. 34 (Mscr.).
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 61
Auch ältere Funde fanden Körbers Aufmerksamkeit (vgl. den Dörpt-schen Brakteatenschatz von 1779). Im 18. Jahrhundert hatte man in Klein-Camby (Väike-Kambja) eine mit Münzen gefüllte Zinnkanne (sog. Hansekanne) ausgegraben. Die Kanne (ohne Münzen) wurde spä-ter von Körber erworben, die er aufgrund des Stempels im Deckel für eine augsburgische Arbeit hielt102. Ihrer Form nach dürfte die Kanne ins 16. Jahrhundert gehören.
Körber war für seine Zeit ein ausgezeichneter Münzkenner und konn-te die meisten livländischen Münzen wie auch die Prägungen aus Nach-barländern ohne Schwierigkeiten bestimmen. Anders verhielt es sich mit den wikingerzeitlichen Münzen. So schickte er sieben kufische Münzen aus dem Fund von Wendau an den weltberühmten Akademiker und damaligen besten Kenner orientalischer Münzen Christian Martin Frähn (1782–1851) nach St. Petersburg und bat ihn um Hilfe bei der Bestimmung. Frähn wollte die Münzen, falls Körber an ihnen nicht in-teressiert sein sollte, ankaufen und fragte nach den übrigen 23 Exempla-ren, die mit den von ihm bestimmten zusammen gefunden worden wa-ren. Es scheint jedoch, dass Körber die nach St. Petersburg gesandten Münzen alle zurückverlangte, zumindest wurden ihre Abdrücke in sei-nem Manuskript abgebildet103. Im Jahr 1826 erwarb er einen weiteren kufischen Dirham aus demselben Fund104. Hinsichtlich der angelsächsi-schen Pfennige empfahl Frähn, sich mit Reichel zu beraten. Ob Körber diesen Rat annahm, ist nicht bekannt; Professor Friedrich Kruse, Uni-versität Dorpat, bestimmte für ihn die westeuropäischen Münzen aus den Funden von Wendau und Niggen105.
Die Münzsammlung Körbers wuchs langsam: „Einiges – obwohl das Unbeträchtlichste mit Ausnahme der Medaille auf die Eroberung von Riga vom Jahr 1621 [...] haben ihm Gönner und Freunde verehrt. Das Meiste aber hat er gegen oft sehr hohen Preiß eingehandelt – auch man-ches – da die Sammlung anwuchs – durch Doubletter Tausch über-kommen.“ Im Jahr 1822 zählte seine Sammlung schon 400 verschiedene
————————————
102 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 49, 124. 103 EKM, ÕES, M 323:10, Fol. 1–2; ÕES, M.B. 63, S. 65–68. 104 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 175. 105 EKM, ÕES, M.B. 59, S. 177.
Ivar Leimus 62
vaterländische Münzen, „[...] welche in einem besonderen Fach – in Papp Tafeln ausgeschnitten“ lagen und nach einer Klassifikation syste-matisiert waren, die von Arndt stammte und in großen Zügen bis heute Verwendung findet: I. Ordensmünzen, in Wenden, Riga und Reval geprägt; II. Erzbischöfliche und bischöfliche, in Riga und Dorpat, Hapsal und
Arensburg geprägt; III. Münzen der Freistadt Riga; IV. Königlich polnische und schwedische Münzen, in Riga, Reval und
Narva geprägt106. Im Jahr 1825 bestand Körbers Sammlung aus etwa 500 livländischen Münzen (mit Dubletten)107. Doch scheint sein Eifer allmählich abge-nommen zu haben. Auch scheinen die Zeiten für das Sammeln ungün-stig gewesen zu sein. Im Jahr 1837 bot er seine Münzen, unter ihnen etwa 20 wikingerzeitliche, der Dorpater Universität für die Summe von 1.000 Rubel zum Kauf an. Der Universitätsrat billigte zwar sein Ange-bot, schob jedoch den endgültigen Beschluss bis zur allerhöchsten Ge-nehmigung hinaus108. Offensichtlich kam das Geschäft damals nicht zu-stande. Wenige Jahre später versuchte Körber seine Sammlung der Ge-lehrten Estnischen Gesellschaft zu verkaufen109. Aber auch dies scheiter-te. Erst nach Körbers Tod im Jahr 1850 gelangten seine reichen Samm-lungen, darunter auch die Münzen, in den Besitz der Gelehrten Estni-schen Gesellschaft. Zweifelsohne bildeten die Münzen Körbers damals den größten Teil der Münzsammlung der Gesellschaft. Bedauerlicher-weise präzisierte Emil Sachssendahl bei deren Auflistung110 die Herkunft der Münzen nicht, so dass mehrere Unklarheiten bestehen bleiben. Be-kannt ist die ungefähre Anzahl der livländischen Münzen, die 600 Stück beträgt. Von den ordensmeisterlichen, in Wenden geprägten Exempla-ren finden sich 17 Münzen, darüber hinaus vier in Schiefer geschnittene Kopien und ein Abguss. Übrigens war Körber ein ausgezeichneter Gra-
————————————
106 EKM, ÕES, M.B. 63, S. 5. 107 Körber an Burchard, 12.8.1825. EAM, D 54/1/35, Fol. 16–17. 108 Friedrich Kruse an Körber, 12.8.1837. EKM, ÕES, M 323:21. 109 Körber an Friedrich Kruse(?), 22.4.1839. EAA, Best. 2569/1/65, Fol. 77. 110 SACHSSENDAHL, Zur Geschichte der Gesellschaft (wie Anm. 11), S. 99–100.
Eduard Philipp Körber (1770–1850) 63
veur, der die seltensten, in seiner Sammlung fehlenden Münzen und Medaillen (sowie auch Grabsteine) immer in Schiefer kopierte, den ihm sein Freund Burchard aus der Nähe Revals beschafft hatte111. In Riga waren 50 Ordensmünzen geprägt und drei Schieferkopien, in Reval 72 und zwei Schieferkopien. Vom Erzbischof zu Riga besaß Körber 53 Münzen und drei Schieferkopien, vom Bischof zu Dorpat 95 Münzen und einen Abguss. Aus der Zeit der „Freistadt“ Riga stammen 33 Mün-zen, drei Schieferkopien und ein Abguss. Vom Herzog Magnus als Bi-schof zu Ösel-Wiek besaß Körber 15 Stücke, inklusive eine Medaille. Aus Riga unter der polnischen Regierung nannte er 32 Münzen und zwei Schieferkopien sein eigen, unter der schwedischen Regierung 45 Münzen und vier Schieferkopien. Zur schwedischen Zeit in Reval ge-hörten 60 Münzen und zwei Schieferkopien, in Narva fünf Münzen112.
Noch viel später, bei der Zusammenstellung eines Katalogs der Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft und des Zentralmu-seums der Universität Dorpat wurde der numismatische Teil der Samm-lungen, darunter auch die Münzen Körbers, bei weitem nicht vollstän-dig beschrieben, sondern einer gesonderten Edition vorbehalten113. Die-ses Vorhaben wurde jedoch nie verwirklicht. Die Münzen Körbers wur-den allmählich mit den anderen in der Sammlung vermischt. Gegenwär-tig ist es nur noch in einzelnen Fällen möglich, sie in den Beständen ver-schiedener Institutionen festzustellen.
————————————
111 Körber an Burchard, 25.1.1832, 13.8.1833, 12.9.1833. EAM, D 54/1/35, Fol. 29–30, 56–57, 58–59.
112 E. SACHSSENDAHL, Bericht über die von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft ak-quirirten Sammlungen des verstorbenen Consistorial Raths Körber sen. 1850, vorge-lesen am 4. Juni 1850. EKM, ÕES, M.A. 170:31.
113 HARTMANN, Das Vaterländische Museum (wie Anm. 91), S. VI.


























![(3) Gufeld,Eduard - Levin,Mikhail [A80] (6) Serebrisky,A](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633298e63108fad7760eb219/3-gufeldeduard-levinmikhail-a80-6-serebriskya.jpg)










![«Η λογοτεχνία 1830-1880», Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, τ. 4, Ελληνικά Γράμματα, [Ιανουάριος] 2004, σ. 195-210.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631274fcb033aaa8b20fa5cb/i-logoteni-1830-1880-istori-tou-neou-ellinismou.jpg)
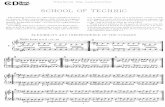


![Campagne e agricoltura attraverso il «Magazzino toscano» (1770-1782) [RSA 2010-2]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fbd765e4a6af370f9947/campagne-e-agricoltura-attraverso-il-magazzino-toscano-1770-1782-rsa-2010-2.jpg)





