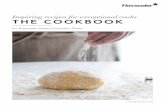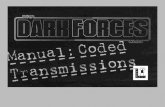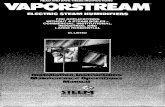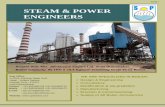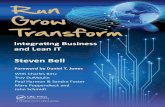Characterizations of long-run producer optima and the short-run
Why has Latour run out of steam?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Why has Latour run out of steam?
Why has Latour run out of steam?
Imperialismus und infiniter Regress
„Overkill, my sweet love, is what drove us crazy, the aphrodisiac overkill of discourse, notours but the arsenals of reasons, the logistics with which we were armed. […] The otherstoo. We have never been right, nor vanquished anything. It is so sad, to be right I mean.“1
– Jacques Derrida
Dies ist kein Text über Latour. Es ist ein Text über Kritik und über Dekonstruktion.
I) Set Up:
a) Latour zufolge ist es an der Zeit, die Instrumente der „Kritik“ einer gründlichen Re-evaluation zu
unterziehen.2 Zwei Probleme zeitgenössischer Kritik macht Latour in seinem Text aus:
b) Reservoirkritik:
„The mistake we made, the mistake I made, was to believe that there was no efficient way tocriticize matters of fact except by moving away from them and directing one's attention toward theconditions that made them possible. But this meant accepting much too uncritically what matters offact were.“3
Die erste Version von „Kritik“ ist eine Delegitimierung der Voraussetzungen (des „Reservoirs“4) von
Urteilen und Verhältnissen. Diese Voraussetzungen können transzendental (Kant), historisch (Foucault),
linguistisch (Benveniste) oder anders gefasst werden.
c) Objektkritik:
Eine zweite Variante nenne ich „Objektkritik“: Es handelt sich um Kritiken der Form „X ist falsch, weil
…“. In diesem Fall richtet sich die Kritik nicht an Konstruktions- oder Konzeptionsbedingungen, die
hier als stabil angenommen werden, sondern an ein zu kritisierendes Objekt. Die Basis auf der Objekte
kritisiert werden gibt die Spielart der Kritik an – „das ist sexistisch“ (feministische Kritik), „das folgt
nicht“ (logische Kritik, „non sequitur“), „das ist hässlich“ (ästhetische Kritik), etc.
1 Postcards, S.572 Latour 2004, S.225ff. 3 Latour 2004, S.231f. 4 Mit Dank an JPK für den Begriff.
d) Das Problem:
Latour zufolge hängt das Problem an der Auffassung dessen, was ein „reales Objekt“ sei. Mit „Objekt“
ist hier generell die Beschaffenheit der „Wirklichkeit“, „Realität“, „Summe der Tatsachen“, des
„Gegenstands der Naturwissenschaften“, „Seins“ etc. gemeint. Latour unterscheidet dabei prinzipiell
zwei Versionen:5
Status des (realen) “Objekts” : Fairy-Position6 Fact-Position7
Gegenstand der Kritik: Objekt ReservoirAuffassung “reales Objekt”
[fact]: Stummes Objekt qua Leinwandfür Projektionen[fact 1], kein
Widerstand des Materials
„Wirklich wahre Wirklichkeit“als unhintergehbares,
unumstößliches und tongebendesFaktum[fact 2]
“Kritik” als: Anti-Fetischismus (fairy-critique) Realismus (fact-critique)“Objekt der Kritik”: Ideologische Projektionen,
Wunschprodukte (“Work of [her]hands”) [fairy-objects]
Falsche Voraussetzungen,imaginäres „Reservoir“,
Reservoir 1Reservoir der Kritik: Die richtige (objektive)
Perspektive [fact2], Reservoir 2“pet facts”8, überlegenes
Reservoir, Reservoir 2(Unterdrückung wahlweise durch„Kapitalismus“, „Patriarchat“,
„weiße Hegemonie“ etc.)Exemplarisches Statement: “Das ist ideologischer Quatsch.” “Hier ist sie – die wirklich wahre
Wirklichkeit der Gründe (desReservoirs) deines Handelns,
Denkens, Begehrens etc.”Zu Überzeugen: “naive believers” “blind idiots”
Es handelt sich hierbei um zwei Strategien von „Kritik“, die sich maßgeblich in der Verteilung und
Deutung „objektiver Wirklichkeit“ unterscheiden. Dieser Unterschied ist perspektivisch:
„Anti-Fetisch-Kritik“ setzt ein „dummes“, leeres Objekt ohne Eigenschaften, das der (ideologischen)
Projektion hilflos ausgeliefert ist („fact 1“). „Realistische Kritik“ setzt ein agierend-determinierendes
Objekt, dessen Eigenlogik die „blinde Idiotin“ unterschätzt („fact 2“) und aus deren Gegebenheit die
Kritikerin ein Set von Voraussetzungen zieht, die demjenigen der „blinden Idiotin“ überlegen ist.
Während die “fairy-position” des „Objekts“ in eine niedrigstufige Ideologiekritik mündet,9 behauptet5 Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der Seiten 237 bis 243. 6 „The fairy position is very well known and is used over and over again by many social scientists who associate criticism
with antifetishism. The role of the critic is then to show that what the naive believers are doing with objects is simply a projection of their wishes onto a material entity that does nothing at all by itself.“, ibid., S.237
7 „This time it is the poor bloke, again taken aback, whose behavior is now 'explained' by the powerful effects of indisputable matters of fact.“, ibid., S.238
8 Ibid., S.2389 Mit einer komplexeren Version werde ich mich später kurz auseinandersetzen.
die „fact-position“ einen größeren Einfluss derjenigen „objektiven Fakten“, die gerade am liebsten zur
Hand sind („pet facts“). „Fairy-Critique“ wäre also „negativ“ im Sinne der Verneinung bestimmter
Meinungen. „Fact-Critique“ wäre „positiv“, indem sie die falschen Auffassungen der (objektiven)
„Realität“ mit einer besseren, schöneren, bunteren oder richtigeren konterkariert.10
„Fact-Critique“ und „Fairy-Critique“ werden dann besonders schlagfertig, wenn sie gemeinsam
auftreten: der als Unsinn entlarvten „Ideologie“ folgt der Auftritt der leuchtenden Realität.11 So weit, so
uninteressant. Puzzlestück in unserer Linie wird Latours Rekonstruktion, weil sie auf eine wichtige
Verschiebung der Binnenebene dieser Operationen zielt:
In dieser Kombination wird deutlich, dass sowohl im Verständnis des „Objekts der Kritik“ als
„ausgedachte Illusion“ (fairy-object) wie auch in Form eines falschen Reservoirs (basierend auf dem
richtigen Reservoir auf Basis des fact-objects) Probleme entstehen: Das „fairy-object der Kritik“ greift
auf einen überaus flachen Objektbegriff („fact 1“ als „Leinwand“) zurück. „Objekt“ heißt hier nichts
anderes als in sich leeres, logisches Element, „Zeichen“, „Fetisch“ – eine Struktur die bloß auf die
nächstbessere Variante verweist.
Das „fact-object der Kritik“ muss seine bessere Perzeption mit fairy-power erkaufen („pet facts“ und
„überlegenes Reservoir“ als theorieabhängige Konstellation). Was Latour selbst nicht klar
herausarbeitet ist, dass jedes Reservoir 2 selbst wieder zum Objekt der Kritik (Reservoir 1) suspendiert
werden kann – auf Basis eines alternativen „fact objects“. Da aber das „fact object“ selbst als
theorieunabhängig gedacht wird („mathematische Urteile sind wahr“, „Mispronomisierung ist
schlecht“, „Gerhardt Richter ist langweilig“ etc.) bleibt eine Evaluation unterschiedlicher Reservoire
(„Reservoir 2“) abhängig vom Gusto.
„Fairy-critique“ also arbeitet auf Kredit einer Autorität gänzlich unschuldiger Objekte; „fact-critique“
spielt auf die Autorität einer Welt, gerahmt von durchweg determinierenden Dingen. Beide
„Autoritäten“ vertrauen auf die Plausibilität ihrer Konzeption von „Gegenstand“, deren Ausarbeitung
aber nicht nur nicht aufrechterhalten, sondern als falsch ausgewiesen werden kann: Während dem
„leeren Objekt“ („fact 1“) der „Widerstand des Materials“ entgegentritt, fällt das „determinierende
10 Wie bereits in die Tabelle eingewoben basieren beide Formen von Kritik freilich selbst auf dem Spiel zwischen „Reservoir“ und „Objekt“: Denn jede Kritik speist sich aus einem Set von Annahmen („Reservoir“) und bedarf irgendeiner Auffassung von „Objekten“ - sei es als Basis ihrer Reflektion („mathematische Urteile“ im Falle Kants, dasje „aufzuhebende“ im Falle Hegels etc.) oder als Gegenstand ihrer Diskreditierung („Produktionsverhältnisse“ in Kapitalismuskritik, „Geschlechterverhältnisse“ in feministischer Kritik, „Rassismen“ in Rassismuskritik etc.).
11 Ibid., S.239
Objekt“ („fact 2“) unter der Beweislast perspektivierender Theorieelemente („fairy-power“).
II) Fakten, Feen und Regresse
Nach dieser kurzen Einführung werde ich versuchen, eine dekonstruktive Herangehensweise an
„Kritik“ zuerst als Anwendung auf Latour zu skizzieren, um diese dann im folgenden abstrakt
darzustellen und zu begründen.
0) Einige Thesen, die es zu demonstrieren gilt:
i) In Latours Text wird die Möglichkeit eines unhintergehbar bedeutungs-losen Signifikanten
zugunsten der Proliferation von mehr einholbarer und produktiv-zu-machender „Bedeutung“
verworfen. Sie taucht nicht explizit auf.
ii) Um aber andererseits diejenigen abzustrafen, die eine „bedeutungs-lose“ „Kritik“ üben,
verwendet Latour den Begriff „kritische Barbarei“.
iii) Diese Verwerfung wird durch eine Ersetzung erkauft: Latour wechselt stillschweigend eine neue
Ebene von Kritik ein. Das Prädikat „absurd“ wird zum Derrida'schen „Supplement“ und führt
damit in einen infinite Regress.
a) Latours Text schließt die Möglichkeit eines infiniten Regresses aus, und zwar genau hier:
“All the while being intimately certain that the things really close to our hearts would in no way fitany of those roles [fact or fairy position]. Are you not all tired of those 'explanations'? I am, I havealways been, when I know, for instance, that the God to whom I pray, the works of art I cherish, thecolon cancer I have been fighting, the piece of law I am studying, the desire I feel, indeed, the verybook I am writing could in no way be accounted for by fetish or fact, nor by any combination ofthose two absurd positions.”12
Erinnern wir uns was bisher geschah: Wir hatten mit Latour nachvollzogen, wie eine bestimmte
Aufstellung von „Kritik“ konsequent zu Problemen führt. Im Wechselspiel zwischen dem
leinwandartigen Charakter eines eigentlich leeren „Objekts“, dem illusionären Wirken einer feenartig-
ideologischen „Illusion“ und einem dem entgegenstehenden Gefüge aus re-konstruierten,
determinierenden „Fakten“ qua „Reservoir 2“ erkannten wir ein Problem auf Objektebene („leeres
Objekt“) und eines auf Reservoir-2-Ebene („Unvergleichbarkeit von determinierenden Objekten“).
Jetzt singt uns Latour: „Das ist alles Quatsch“. „Fact-object“ und „Fairy-object“ sind beide „absurd“.
12 Latour, S.243, Hervorhebung von mir.
Sein Lösungsvorschlag: Wir müssten „Realistinnen“ werden.13 „Realistinnen“ im Sinne eines durch
Heidegger und Serres inspirierten Begriffs von „Ding“, der sowohl die versammelnden Attribute
parlamentarischer Auseinandersetzung einbegreift14 (ab jetzt: „Ding*“) als auch den klassischen
„Objektcharakter“ (ab jetzt: „Objekt“), allerdings als eine Art verfestigtes „Ding*“. „Ding*“ legt dabei
den Fokus eher auf den vielfältigen „Konstruktionsprozess“ eines Gegenstandes, während „Objekt“ die
außer-epistemologische, vor-perzeptionelle und gegebenenfalls un-alterierbare Existenz eines solchen
Gegenstandes behauptet.15
b) Was hat es mit dieser „Absurdität“ auf sich, und wie ist Latour bis dahin gekommen? Kluges
etymologisches Wörterbuch verrät:
„absurd Adj »widersinnig« std. (16. Jh.) Entlehnt aus l.
absurdus (eigentlich »mißtönend«), das zu einem
lautmalerischen l. Susurrus »Zischen« gestellt wird.
Früher vor allem üblich in der Sprache von
Philosophie und Logik (vgl. ad absurdum führen).
Abstraktum: Absurdität.“16
Das Oxford English dictionary kennt „absurd“ als „completely ridiculous; not logical and [not]
sensible“.17 Latours „Absurdität“ scheint von deren Realitätsferne („widersinnig“18, „not logical and
[not] sensible“) nicht signifikant abzuweichen. Latour sagt uns, dass beide Positionen („fact“ und
„fairy“) „absurd“ („widersinnig“, „not logical and [not] sensible“) seien. Interessanterweise nun lautet
die Defintion der „fairy position“:
„The role of the critic is then to show that what the naive believers are doing with objects is
13 Ibid. 14 „Ding“ rührt etymologisch vom Ort der politischen Verhandlung her. So heißen das dänische, norwegische und
isländische Parlamentsgebäude bis heute Folketing, Storting und Alþingi. 15 Latour, S.232ff. 16 Kluge, Etymologisches Wörterbuch, S.1117 Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press 2003, S.518 Der „Sinn“ in „widersinnig“ kann sowohl als „Perzeption“ („die fünf Sinne“) als auch von „Bedeutung“ her („Sinn“ vs.
„Bedeutung“ bei Frege zum Beispiel, aber auch genreller „Sinn“ als Kohärenzkriterium in „das macht Sinn“) verstanden werden. Daher bleibe ich bei der schärferen Bestimmung in „not logical and not sensible“. Auch die vielleicht bekannteste Philosophie „des Absurden“ – Camus Existentialismus – begreift „absurd“ gerade in Differenz zur doppelten „Sinnhaftigkeit“ einer selbstgültigen Welt: „Dann stürzen die Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Diesntag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus – das ist sehr lange ein bequemer Weg.“ (Albert Camus, Der Mythos von Sisyphoss – Ein Versuch über das Absurde, Rowohlt, Hamburg 1988, S.16) „[...] sie [Naturgegenstände] verlieren im Augenblick den trügerischen Sinn, mit dem wir sie bedachten, und liegen uns von nun an ferner als ein verlorenes Paadies. Die primitive Feindseligkeit der Welt, die durch die Jahrtausende besteht erhebt sich wieder gegen uns. Eine Sekunde lang verstehen wir die Welt nicht mehr […].“ (ibid., S.17f.)
simply a projection of their wishes onto a material entity that does nothing at all by itself.“19
Die Prädikate „absurd“ und „fairy“ scheinen einander zu konvergieren:
Absurd FairyNot logical Projection of their wishesNot sensible A material entity that does nothing at all by itself.
Diese Konvergenz mag nicht völlig offensichtlich sein. Jedoch haben „Wünsche“ traditionell die
Eigenschaft, die Regeln der Logik bis zu deren Verwerfung oder Ausfall biegen zu können.20 Und was
Latour mit seinem Objekt ohne Eigenleben meint ist eben gerade eines, das selbst jeder Erkennbarkeit
entbehrt und genau deshalb als Lichtspielfläche kognitiver Zuschreibungen interpretiert (oder gerade
ignoriert) werden kann. „Absurd“ und „fairy“ wären unterschiedliche Bezeichnungen desselben
Sachverhalts.
Während also Latour den Vorhang hebt und diesen „two absurd positions“ qua beschwörenden Aktes21
die Schranken der Unvernunft weist, muss er sich selbst einer Logik der feen-positionierten
„(Wunsch-)Projektion“ bedienen. Er tut das auf mindestens zwei Ebenen:
i) Implizit tut er das, indem er der Unterscheidung in „fact“ und „fairy“ selbst die Validität
entzieht wenn er sie „absurd“ nennt. Er macht mithin die ganze Unterscheidung zur Leinwand
eigenartiger Projektionen.22
ii) Explizit tut er das, wenn er, um die Wirksamkeit des im ersten Teil dieses Kapitels
beschriebenen Schemas der Kritiken zu plausibilisieren, auf deren Traditionsverwobenheit
verweist:
„If you think I am exaggerating in my somewhat dismal portrayal of the critical landscape,it is because we have had in effect almost no occasion so far to detect the total mismatch ofthe three contradictory repertoires – antifetishism, positivism, realism – because[traditionally] we carefully manage to apply them on different topics. We explain the objectswe don't approve of by treating them as fetishes [or: We project our dislike on specific
19 Latour., S.23720 Gerade deshalb bedürfen sie, so die klassisch philosophische Auffassung, einer Form von Disziplinierung, Training,
Angleichung, Test, Prüfung, Adjustierung etc.21 „Are you not all tired of those 'explanations'? I am, I have always been […].“22 Beispielsweise zur Projektionsfläche für den Wunsch nach sozialem Aufstieg oder unendlicher Rechthaberei, Lacan
würde vielleicht sagen: das Ende der Kastrationsdrohung: „Do you see now why it feels so good to be a critical mind? Why critique, this most ambiguous pharmakon, has become such a potent euphoric drug? You are always right! […] Isn't this fabulous? Isn't it really worth going to graduate school to study critique? 'Enter here, you poor folks. After arduous years of reading turgid prose, you will be always right, […] with the salvo of antifetishism in one hand and the solid causality of objectivity in the other.'“ (Ibid., S.239)
„fairies“]; we account for behaviors we don't like by discipline whose makeup we don'texamine [We take certain methodologies and contents that belong to the field of study weare situated in for „facts“]; and we concentrate our passionate interest [we project ourwishes] on only those things that are for us worthwhile matters of concern [fairies].“23
Wir projizieren also Misbilligung auf Objekte die wir nicht mögen, indem wir sie „Fetisch“ nennen.
Wir nehmen Methodologie und Lieblingswahrheiten bestimmter akademischer Disziplinen für bare
Münze. Und wir verlegen unsere Wünsche („leidenschaftliches Interesse“ verweist gar auf eine Art
„Begehren“) auf ganz bestimmte Gegenstände, deren Eigenwirksamkeit („fact-ness“) daher freilich
nicht zu groß sein darf. Latour unterstellt der „absurden“ Kritik mithin, dass sich die unterschiedlichen
Positionen „fact“ und „fairy“ nur deshalb nicht überlagern (und damit ihre „Absurdität“ zur Schau
stellen), weil es (mindestens) drei verschiedene Klassen von „Gegenständen“ einer solchen „Kritik“
gibt, die jeweils selbst mit positiven oder negativen Wünschen belegt werden. Mindestens an dieser
Stelle bedarf daher Latour einer Unterscheidung von „fact“ und „fairy“ (und ganz besonders einer
bedeutungsvollen Idee von „fairy“), um seine eigene Position (nämlich, dass „fact“ und „fairy“ beide
„absurd“ sind) zu plausibilisieren.
c) Innerhalb der Logik dieses Textes lässt sich damit behaupten, dass Latour die „absurde“ Logik von
„fact“ und „fairy“ nur überwinden kann, indem er sich ihrer selbst bedient: indem er nämlich die ganze
Unterscheidung auf eine „fairy-position“ verweist. „Außerhalb“ dieses „Textes“ stoßen wir damit (mal
wieder) auf eine generelle Schwierigkeit. Bleiben wir aber kurz bei Latour: Was heißt diese
Anwendung der „fairy-position“ auf „sich selbst“ und ihren Widerpart für Latours These, wir müssten
die ganze Unterscheidung (fact und fairy) loswerden?
d) Zuerst müssen „fairy“ und „fairy*“ unterschieden werden. Denn natürlich glaubt Latour nicht
(so flüstert das „principle of charity“), dass er dassselbe „absurde Feen-Fantasiegebilde“ attestierte,
noch, dass er mit seinem „Ding“ ein simples „fact object“ dagegenhielte. Wenn wir Latour ernst
nehmen wollen, kann es sich nicht einfach um einen „performativen Widerspruch“ handeln.24 Wenn wir
Latour ernst nehmen wollen, dann muss er auf eine qualitativ unterschiedene „fairy-position“
verweisen – ein „fairy*“ zum Beispiel.
Bis jetzt hatte Latour sich viel Mühe gegeben, „fact“ und „fairy“ brav einander zu entfernen. Sämtliche
Erwähnungen sind Unterscheidungen.25 In dem Moment nun, da Latour deren Ähnlichkeit miteinander
feststellt, stoßen wir auf ihre gemeinsame „Absurdität“: ein anderes „fairy“ – „fairy*“ – das nicht
selbst „fact“ noch „fairy“ („absurdes Feen-Fantasiegebilde“) sein kann, aber irgendwie sowas
23 Ibid., S.241, Hervorhebungen von mir, außer „different“. 24 Apel / Habermas25 Mit Ausnahme eines Hinweises auf ihre Etymologie, der er aber nicht nachgeht. Latour, S.237
ähnliches sein muss.26 „Absurd“ kann hier also nicht mehr einfach „not logical and [not] sensible“
bezeichnen, denn die Konvergenz mit der „fairy-position“, dem „Feen-Fantasiegebilde“ würde einen
performativen Widerspruch zeitigen. Was aber heißt „absurd“ hier, wenn es nicht einfach äquivalent zu
„fairy“ sein kann?
„I am, I have always been […] [tired of] those two absurd positions.“ Heißt: „Ich habe es immer
gewusst: Diese Unterscheidung ist Unsinn.“ Um den performativen Widerspruch zu vermeiden, „fact
vs. fairy“ selbst zum fairy-object zu machen, müssen wir (in Latours favour) eine andere Variante von
„Objekt der Kritik“ voraussetzen (denn Latour „kritisiert“ hier „fact vs. fairy“). Dieses Objekt soll
selbst keine Bedeutung haben. Es ergibt sich ein komplexes Geflecht von Referenzen und
Referenzlosigkeiten:
1. Semantisch: Auf einer Ebene behauptet „absurd“ die Referenzlosigkeit („das ist Unsinn“) seiner
Gegenstände – was „absurd“ ist verweist auf nichts („not logical“, nicht intelligibel, nicht erkennbar;
„not sensible“, nicht wahrnehmbar). Diese semantische Ebene aber kann hier nicht durch eine einfache
Definition zustande kommen.
2. Syntaktisch: Denn obwohl „absurd“ weder „fact“ noch „fairy“ sei können darf (hier lauert der
performative Widerspruch), muss „absurd“ beidem ähnlich sein: Einerseits soll „absurd“ sowohl „fact“
als auch „fairy“ ihren realen Gehalt, ihre Referenz absprechen, mithin eine „fairy-function“ erfüllen.
Andererseits aber soll „absurd“ eine apodiktische Überzeugungskraft entfalten, die jeder Befragung
enthoben ist („I have always been tired …“), mithin eine Art negativer „fact-function“erfüllen.
„Absurd“ muss funktional wie „fact“ und „fairy“ agieren, ohne je eines von beiden (oder gar beides)
sein zu dürfen. Der spezifische semantische Effekt (siehe 1.) muss mithin so gefasst werden, dass
„absurd“ gleichzeitig in negativer („anders als“) und positiver („irgendwie so wie“) Relation zu „fact“
und „fairy“ steht. Tatsächlich handelt es sich daher bei der „Signifikation“ von „absurd“ („nichts“)
nicht um eine eigentlich semantische Verweisungsstruktur; vielmehr entsteht dieser Effekt nur aufgrund
der syntaktischen Positionierung von „absurd“ als Überschreibung von „fact“ und „fairy“: Es findet
eine Art „Bedeutungsübertragung“ von „fact“ und „fairy“ auf „absurd“ statt. Diese muss aber
gleichzeitig suspendiert bleiben, weil „absurd“ weder gleichbedeutend mit „fact“ noch mit „fairy“ noch
mit beiden sein kann – denn andernfalls widerspräche die Absurdifizierung von „fact“ und „fairy“ sich
selbst. Sie würde ihre Abschaffung nur um den Preis ihrer Aufrechterhaltung behaupten.27 Mithin muss
26 Die Ausfaltung der möglichen Komination von „fact“ und „fairy“ an dieser Stelle entsprechen denjenigen von „M1“ und „M2“ in I.c.i.a. bis I.c.i.d. Ich spare die hier.
27 Könnte es nicht sein, dass „Elfen-Ideologem“ (M3) etwa ganz anderes ist als „Feen-Fantasiegebilde“ (M2)? Ist nicht „Elfen-Ideologem“ (M3) gerade eine „referenzlose Wiederholung“, während „Feen-Fantasiegebillde“ (M2) eher eine „Projektion von Wünschen“ bezeichnet? Ließe sich also nicht sagen, dass die beiden Konzepte einfach eigentlich
(in Latours Logik) „fairy*“ bzw. „absurd“ syntaktisch definiert gedacht werden: Nämlich durch die
differierende Ähnlichkeit, Mimesis, Wiederholung von / zu sowohl „fairy“ als auch „fact“ – und durch
nichts anderes. Erste Konsequenzen dieser „Absurdifizierung“ von „fact and fairy“:
ι) Es entsteht ein dritter Begriff: „fairy*“.
ιι) „fairy*“ ist eine Überlagerung von „fact“ und „fairy“, eine „faktische Referenzlosigkeit“.
ιιι) „fairy*“ ist aussschließlich durch ihr repetierendes, syntaktisches Verhältnis zu „fact“ und
„fairy*“ bestimmt – „fairy*“ soll „anders sein als“ (fact und fairy), dabei aber „die gleiche
Funktion erfüllen wie“.
ιϖ) „Fairy*“ differiert und wiederholt in rein syntaktisch produzierter Referenzlosigkeit.
e) Bleiben wir einen Moment bei diesem „fairy*“: Woher wissen wir, ob es sich hierbei nicht auch um
irgendeine Form von Quatsch handelt? Um das zu Überprüfen müssten wir annehmen, dass es
zumindest möglich wäre, dass „fairy*“ selbst absurd wäre. Was für eine „Absurdität“ ist dieses
„absurd“?
i) Handelt es sich vielleicht selbst um einen „projezierten Wunsch“ Latours (fairy-position) oder
eine „erklärungsbedürftige Unbestreitbarkeit“ (fact-position)? Das scheint schwerlich möglich,
denn beide sind soeben als „absurd“ (dis-)qualifiziert worden.
ii) Kann das „fairy*“ als „fairy-fact“ sich selbtreferenziell ad absurdum führen? Es wäre dann
selbst absurd, also wirkungslos, also nicht absurd, also valide, daher absurd, daher wirkungslos,
etc.
iii) Um festzustellen, ob „fairy*“ potentiell Unsinn ist, braucht es mithin einen neuen Term.28 Wir
stoßen auf die Möglichkeit eines „fairy**“. Es ergibt sich dann aber unmittelbar dasselbe
Problem erneut, ad infinitum.
garnichts miteinander zu tun haben? Nein. Der Witz ist, dass auch die „Projektion von Wünschen“ mit ihrer Annahme eines „leeren Objekts“ gerade darauf spielt, dass der fragliche Gegenstand keine Referenz zur „Wirklichkeit“ hat. Diese „Wirklichkeit“ kann beliebig gestrickt sein, beispielsweise simpel materielle Ewigkeit, fließend historisch mit kulturellen Prozessen verflochtenes Gewordensein oder unerreichbares doch wirksames Irgendwas. In jedem Falle ist das Charakteristikum, dass diese irgendwie wirksamen und relevanten Konstellation „Wirklichkeit“ etwas ausspart, ihr etwas total fremd ist. Und gerade diese Un-Wirklichkeit ist das Verbindungsstück zwischen „Elfen-Ideologem“ und „Feen-Fantasiegebilde“.
28 Hypothetisch wäre es auch möglich, dass „Elfen-Ideologem aus der Anderwelt“ und „Feen-Fantasiegebilde“ die einander ausschließenden einzigen Optionen wären. In diesem Falle ließe sich von „~Elfen-Ideologem aus der Anderwelt“ direkt auf „Feen-Fantasiegebilde“ schließen. Aber warum sollte das so sein?
f) Vier Konsequenzen der „Absurdifizierung“ von „fact and fairy“:
i) Es entsteht ein dritter Begriff: „fairy*“.
ii) „fairy*“ ist eine Überlagerung von „fact“ und „fairy“, eine „faktische Referenzlosigkeit“.
iii) „fairy*“ erhält Bedeutung (ii) nur über die syntaktische Position im Verhältnis zu „fact“ und
„fairy“.
iv) Der Versuch, „fairy*“ auf theoretische Haltbarkeit zu prüfen („Referenz“) erzeugt die
Konsequenzen i) – iii) erneut, ad infinitum: „fairy*- n“.
g) Es wiederholt sich die Logik der „Iterationen“: Die von Latour vorgetragene und von mir
spezifizierte Annahme, diese Unterscheidung sei, was ich provisorisch „fairy*“ („absurd“) genannt
habe, spielt das Spiel der „Iterationen“ als doppelter Wiederholung +X. Dies dient im weiteren Verlauf
der Argumentation dazu, die bis jetzt nur angespielte Problematik der Kritik über ihren lokalen Kontext
in Latours Text hinauszutreiben.
In „The Double Session“ argumentiert Derrida wie folgt:
i. Die „Geschichte der Metaphysik (der Präsenz)“29 kennt zwei Formen von „Mimesis“ : M1
(akzidentielle Mimesis) und M2 (essentielle Mimesis).
ii. Die Frage nach der „Mimetizität“ dieser Mimesen verweist auf ein drittes Konzept von
Mimesis: M3.30 Es ist dadurch definiert, „anders als M1/M2“ und „so wie M1/M2“ zu sein.
29 “Derrida uses the word 'metaphysics' very simply as shorthand for any science of presence.“ Gayatri Chakravorty Spivak, “Translator's Preface“, in: Derrida 1967a [Spivak 1967] S.xxi. Mit “Metaphysik der Präsenz“ bezeichnet Derrida ein Paradigma des Philosophierens, dass der “Anwesenheit“ oder “Präsenz“ einen Vorrang gegenüber der “Abwesenheit“ einräumt. Hieraus resultiert auch der Vorrang der “Sprache“ vor der “Schrift“, weil “Sprache“ als dem sich-selbst-präsenten “Selbstbewusstsein“, “Ich“ etc. gedacht und dementsprechend hierarchisiert wird. Siehe hierzu: Derrida 1967a, S.6ff.
30 Es lässt sich zeigen, dass die Art, wie “M1“ “M2“ nachahmt weder von der Art “M1“ noch “M2“ sein kann, vice versa: I. Gesetzt, M1 „ähnelte“ M2 nach Art von M1 – wie ein Foto, zum Beispiel. M2 wäre die „originale Mimesis“, von der M1 nur ein Abbild darstellte. Das würde bedeuten, dass es ein „Original“ von M1 gäbe, das M2 wäre. Das hieße: i) Es gäbe eigentlich keinen Unterschied zwischen M1 und M2. M1 wäre einfach eine andere Version von M2. In diesem Fall wäre M1 tatsächlich nicht „wie“ M2; vielmehr wären beide eigentlich dasselbe (nämlich M2) und M1 nur eine defizitäre Version von M2. ii) Wenn M1 wie M2 wäre nach Art von M1, wäre sie eigentlich nicht „wie M2 nach Art von M1“, denn „nach Art von M1“ bedeutete gerade „so wie M2“. „M1 ähnelt M2 nach Art von M1“ bedeutete daher eigentlich „M1 ähnelt M2 nach Art von M2“. Das aber ist eine andere These. II. Gesetzt M1 „ähnelte“ M2 nach Art von M2. Wie Kants „Einbildungskraft“ wäre M1 (akzidentielle Mimesis) notwendig, damit M2 (essentielle Mimesis) M2 sei. M1 wäre Bedingung für M2. Das führt zu zwei Problemen: i) Diese Ähnlichkeitsrelation widerspräche der Definition von M2 als essentieller Mimesis und M1 als akzidentieller Mimesis. Sie würde bedeuten, dass die akzidentielle Mimesis plötzlich essentiell wäre, denn das wäre die Funktion, die M1 gegenüber M2 einnähme. Sie wäre also tatsächlich eben keine „akzidentielle“ mehr, sondern essentiell. Das führt dann in eine Tautologie: „M2 'ähnelt' M2 nach Art von M2.“ ii) Darüber hinaus führte dies zu der These, dass die „essentielle Ähnlichkeit“ selbst der akzidentiellen bedürfe, womit sie nicht mehr selbstgültige Notwendigkeit im Verhältnis zum von ihr Abgebildeten sein könnte. III. Gesetzt. M2 „ähnelte“ M1 nach Art von M1. Das bedeutet dann: M2 sieht nur ganz zufällig so ähnlich aus wie M1
iii. Diejenige Operation, die von M1/M2 zu M3 führt, lässt sich beliebig wiederholen und
produziert dann die „Begriffe“ „M3—n“.31 Sie führt in einen infiniten Regress.
iv. “Iteration“ ist ein Name des infiniten Regresses, der innerhalb des Konzepts „Mimesis“ der
“Metaphysik der Präsenz“ auftaucht.
v. Weil das, was unter „Iteration“ verstanden werden kann, nicht etwa auf etwas „verweist“,
sondern nur aus dem Unterschied von „M3“ zu „M1“ und „M2“ besteht, sagt Derrida: „[T]his
reference is discretely but absolutely displaced in the working of a certain syntax […].“32,33
„Syntaktisch“ bezeichnet hier die Tatsache, dass die „Bedeutung“ von „M3–n“, „Iteration“ etc.
aus ihrer Position zu anderen Signifikanten („M1“, „M2“) resultiert.
vi. „Iteration“ manifestiert aber, was zu bedeuten „wäre“ : Nämlich das unendliche Ineinander von
„Wiederholung und Differenz“, die auch „Iteration“ von sich selbst trennt – „Iterationen“.
Im Falle der „Mimesis“ haben wir mithin eine Menge von zwei Elementen vor uns: „Mimesis 1“ und
„Mimesis 2“. Die konstituierende Operation dieser Elemente ist „nachahmen“, „sich ähneln“
beziehungsweise „wiederholen“. Die Frage ist: „Wie ähnelt ein ähneln dem andern?“ Es handelt sich
um eine Selbstreferenz. Auf sich selbst angewendet ergibt diese Operation ein neues Element „M3“,
dessen Status zu „M1“ und „M2“ unklar ist. Deren „Bedeutung“ ergibt sich aus ihrer „Position“, mithin
aus ihrer „Syntax“. Die Operation lässt sich beliebig wiederholen und ergibt in operationalisierter Form
„Iteration“. Weil der Regress zwar jederzeit auftauchen kann, aber nie abgeschlossen ist (dazu mehr
weiter unten) spricht Derrida folgerichig von „Iterabilität“ – allerdings nicht als bloße Voraussetzung,
sondern als Ergebnis eines Arguments über selbstreferenzielle Strukturen.
und auch ohne M1 wäre M2 noch M2. Das aber hieße, dass M2 eben gerade nicht wäre, als was sie definiert ist: Nämlich eine essentielle Mimesis. Sie wäre dann für alles mögliche „essentiell“, nur eben nicht (seltsam seltsam) für dasjenige, was ihr selbst am meisten ähnelt: M1 nämlich. IV. Gesetzt M2 „ähnelte“ M1 nach Art von M2. Das hieße: M2 wäre notwendig, damit M1 M1 sei. Die akzidentielle Mimesis bedürfte der essentiellen, damit sie wäre was sie ist – akzidentiell nämlich. Dies führt wiederum zu zwei Problemen: i) Auch in diesem Fall gäbe es – wie bereits in i.a. – eigentlich nur eine einzige „Mimesis“, und zwar M2 (die essentielle). M1 wäre wiederum nur eine Version von M2 und die „Ähnlichkeit“ nur eine Tautologie: „M2 'ähnelt' M2 nach Art von M2.“ ii) M1 wäre dann nicht wirklich „akzidentiell“, weil nur ein Abzug von M2. M1 bezeichnete dann eher eine „defizitär-essentielle“ denn eine „qualitativ unterschiedene“ Mimesis. Sollte M1 dann noch etwas anderes sein als M2, so müsste sie so wie M2 sein und anders. M1 wäre eine contradictio in adjecto. (Ich verdanke das einer Email-Konversation mit CC und JW. Dankesehr).
31 Es handelt sich dann um eine Wiederholung der Argumente in der vorigen Fußnote. 32 Derrida 1972aa, S.193, Hervorhebung von mir. 33 Gasché schreibt: “Yet, what does Derrida mean by syntax? As opposed to semantics (and pragmatics), as another major
aspect of the grammatical construction of sentences (and of the general theory of signs), syntax refers traditionally to the formal arrangements of words and signs, to their connection and relation in phrases or sentences, as well as to the established usages of grammatical construction and the rules deduced therefrom.“ Gasché 1987, S.11
Analog dazu lässt sich sagen:
Im Falle von „fact and fairy“ haben wir eine Menge von zwei Elementen vor uns: „fairy object“ und
„fact object“. Die konstituierende Eigenschaft dieser Elemente ist „Referenzlosikeit“: Apodiktizität im
Falle des „fact objects“, semantische Leere im Falle des „fairy objects“. Die Frage ist: „Wie zeigen wir,
dass es sich um Unsinn („Referenzlosigkeit“) handelt?“ Es handelt sich um eine Selbstreferenz. Auf
sich selbst angewendet ergibt diese Operation ein neues Element „fairy*“, „absurd“ (äquivalent zu
„M3“), dessen Status zu „fact“ und „fairy“ unklar ist. Deren „Bedeutung“ ergibt sich aus ihrer
„Position“, mithin aus ihrer „Syntax“. Die Operation lässt sich beliebig wiederholen und ergibt in
operationalisierter Form „fairy*-n“. Weil der Regress zwar jederzeit auftauchen kann, aber nie
abgeschlossen ist (dazu mehr weiter unten) sprächen wir besser von „Fairizität“, „Aferenzialität“ oder
„unvermeidbare Möglichkeit der Absurdität“ – allerdings nicht als bloße Voraussetzung, sondern als
Ergebnis eines Arguments über selbstreferenzielle Strukturen.
Dem entgegen steht Latours „Ding“ als neue „stubbornly realist attitude“34, deren (sprachliche)
„Wiederholung“ ihr natürlich äußerlich sein müsste, obwohl sie sich von derjenigen der Repetition
seitens „fact“ und „fairy“ nicht unterscheidet.35
Weitere Konsequenz der „Absurdifizierung“ von „fact and fairy“:
ϖ) „fairy*“ entspricht qua einer gewissen selbstreferenziellen Struktur der Derrida'schen
„Iterationen“ / „Iterabilität“.
ϖι) Und insofern „différance“ in Bezug auf „Differenz“ dasselbe Spiel spielt: „Ein“ „Name“ „der“
„différance“ in Latours Text wäre „absurd“.36
34 Ibid., S.23135 Diese „Absurdität“ als „fairy*“ ist selbst eine „Wiederholung“ von der wir „müde“ werden und die „offensichtlich“ sein
soll. Denn „Are you not all tired“ liest sich als „Haben wir nicht alle schon immer gewusst, dass …“: „Haben wir nicht alle schon immer gewusst, dass die ganze Unterscheidung in 'fact' und 'fairy' ohne jeden Gehalt, dass sie absurd ist?“. Warum müssen wir es nochmal sagen? Nochmal wiederholen? Seltsame „Absurdität“, deren Gehalt-, Referenz- und Überzeugungs-losigkeit eine allen bekannte Wahrheit und völlig offensichtlicher Gemeinplatz sein soll und dennoch nochmal und immer wieder gesagt werden muss …
36 Jemand könnte auf die Idee kommen, dem operationalisierten Regress die notwendige Überzeugungskraft zusprechen zu wollen: „Dann lassen wir 'absurd' ein Name der 'différance' sein und sagen – wie überzeugend gezeigt wurde – dass die Opposition in 'fact' und 'fairy' deshalb nicht überzeugen, weil sie auf einem gegenstands-losen Regress beruht. Das Wort 'absurd' wäre dann kein Prädikat der Begriffe 'fact' und 'fairy'; 'fact' und 'fairy' wären vielmehr sequentielle Verschiebungen dessen, was in operationalisierter Form als 'absurd' bezeichnet werden kann.“ Diese Argumentation übersähe allerdings den notwendigen Charakter dieser différanciellen Bewegung, die sich eben nicht zufällig im Unternehmen kritischen Denkens (und gerade in „sozialem Konstruktivismus“ etc.) zeigt. Die uneinlösbare Wette dekonstrutiver Kritik wäre: Ein anderes System produzierte einen ähnlichen Regress an anderer Stelle unter anderem Namen.
b.ii. Außerhalb der Logik dieses Textes37 können wir folgendes sagen: Gesetzt den Fall, Latour läge
falsch und die „'Absurdifizierung' von 'fact and fairy'“ wäre entweder falsch38 oder im klassischen
Sinne „absurd“39.
Um überhaupt die kritische Maschinerie in Gang zu bringen,40 bedarf es der Annahme einer
(effektiven) Möglichkeit einer gewissen „Bedeutungs-losigkeit“, „Iterationen“, „différance“,
„Absurdität“, „Elben-Phantasmagorie“ etc. Derrida konstatiert in diesem Sinne für „Dekonstruktion“:
„Wann immer die Dekonstruktion einem Axiom den Kredit entzieht oder aufkündigt (diesist ein strukturell notwendiges Moment), […] [handelt es sich um ein beängstigendes]Moment der […] Suspension, […] Zeit der Epoché, ohne die in der Tat keineDekonstruktion möglich ist, […].41 Das Moment beängstigender Suspension, das [ist] auch[,was] den Zwischenraum der Verräumlichung darstellt, […] “42
Die Reihe dieser Operationen beziehungsweise „Zustände“ – „den Kredit entziehen“, „Aufkündigung“,
„Suspension“, „Epoché“, „beängstigende Suspension“, „Zwischenraum der Verräumlichung“ –
umspielen sämtliche die bereits von uns in Augenschein genommenen „regresshaften“ Momente.43
Der Anschluss sieht dann etwa so aus:
„The epokhe and the Ansichhalten which essentially scan or set the beat of the 'destiny' ofBeing, or its appropriation' (Ereignis), is the place of the postal, this is where it comes to beand that it takes place (Iwould say ereignet), that it gives place and also lets come to be.“44
37 Es versteht sich von selbst, dass die Unterscheidung in „Innerhalb“ und „Außerhalb“ hier eigentlich keinen Sinn macht, weil es ja gerade darum geht, dass sich das „außerhalb“ im Text abspielt – dieses „außen“ also „innen“ stattfindet. Und wo sollte eine „generelle Struktur“ auch zu finden sein, wenn nicht in einem konkreten Fall?
38 Das wäre der Fall, in dem wir b.i.c.) Bleiben wir einen Moment Abschnitt i) für nicht überzeugend hielten. 39 Das wäre der Fall, in dem wir b.i.c.) Bleiben wir einen Moment Abschnitt ii) für nicht überzeugend hielten. 40 Es wird sich gleich zeigen, dass diese „Maschine“ freilich nicht „in Gang gebracht“ werden kann, sondern immer schon
läuft. 41 „[...] doch wer wird behaupten, daß er gerecht ist, wenn er die Angst ausspart?“42 Derrida, Gesetzeskraft, S.42, Hervorhebungen von mir, außer „Epoché“. Es geht weiter: „[...] in denen juridisch-
politische Verwandlungen, ja Revolutionen stattfinden, vermag einzig in der Forderung nach einem Zuwachs an Gerechtigkeit, nach einem Gerechtigkeits—Supplement (also einzig in der Erfahrung einer Unangemessenheit, eines Sich-nicht-Anpassens, einer unberechenbaren Disproportion) seinen Grund haben und den ihm eigenen Zug oder die ihm eigene Stoßkraft finden.“
43 So schreibt Derrida in „différance“ über „Urschrift“ und „Urspur“ (selbst Namen der „différance“): „Dieses dynamisch sich konstituierende, sich teilende Intervall ist es, was man Verräumlichung nennen kann, Raum-Werden der Zeit oder Zeit-Werden des Raumes (Temporisation).“ (Différance, S.91. Für eine genauere Analyse dieser Problematik der „Verräumlichung“ bei Derrida mit ihrer ersten Erwähnung in [WHAT HEIDEGGER TEXT??] siehe HÄGGLUNd!. )Diese „Verräumlichung“ als „sich teilende[s] Intervall“ (der Regress der différance) kann freilich selbst nicht ganz „räumlich“ „sein“, weil es zwar „Räumlichkeit“ bedingt und in Abgrenzung zur „Räumlichkeit“ besteht, „Räumlichkeit selbst“ aber erst schafft. Deshalb handelt es sich auch um den „Zwischenraum der Verräumlichung“.
44 Postcards, S.65f. Fortsetzung: „This is serious because it upsets perhaps Heidegger's still 'derivative' schema (perhaps), upsets by giving one to think that technology, the position, let us say even metaphysics do not overtake, do not come to determine and to dissimulate an 'envoi' of Being (which would not yet be postal), but would belong to the 'first' envoi – which obviously is never 'first' in any order whatsoever, for example a chronolgical or logical order, nor even the order
Dieses „Epoché“ oder „epokhe“ ist eben genau diejenige „Un/Möglichkeit von Bedeutung“, die nicht
abschließend definiert und nicht definierbar ist. „[T]he place of the postal“ verweist hier auf das
Moment des „Aus-sendens“, des „Verschickens“, das ankommen kann oder nicht, verstanden werden
kann oder nicht etc. – vielleicht. Und dieses „vielleicht“ ist nicht flapsig, es ist exakt, wie Derrida in der
„Politik der Freundschaft“ bemerkt. Es bezeichnet – am Ort zwischen „Richtig“ und „Falsch“ – eben
diese „Un/Möglichkeit“ von „Bedeutung“. Und genau diese „Un/Möglichkeit“ zuzulassen, und damit
die aktuelle „Bedeutung“ zu suspendieren, ist (so Derrida) unentbehrlicher Bestandteil von
„Dekonstruktion“. Allerdings lässt sich sagen, dass dies auch für (beispielsweise) „Kritik“ gilt: Denn
freilich muss jede „Kritik“ einem Urteil, einer Intuition, einer Institution, einer Installation oder einem
Begründungszusammenhang, einem beliebigen Objekt oder Reservoir, einer gegebenen Autorität „den
Kredit entziehen“, die Plausibilität seiner Bedeutung und Rechtfertigungsstrategien zumindest
zeitweise nehmen, um die Prüfung, den Test, das Experiment, den Versuch beginnen zu können. Die
Nase zeigt dabei immer in Richtung „Wahrheit“ – noch. Nennen wir das für den Moment eine
„kritische Suspension“.
Aber „[t]he place of the postal“ ist auch der Einstiegspunkt in „the postal system“, das postalische
System. Dies bezeichnet die (unmögliche) sich konstant verlagernde „Gesamtheit“ der ständigen
Aufschübe, Aussendungen, Um-, Ver- und Weiterleitungen, die manchmal ankommen und manchmal
irgendwo anders oder garnicht wieder auftauchen.45 Der entzogene Kredit lässt sich tatsächlich nicht so
einfach „auslösen“. Die effektive Un/Möglichkeit unendlich suspendierter oder anderer „Bedeutung“
kann eigentlich nicht einfach „ausgeschlossen“ werden: Sie verschiebt sich nur immer weiter. Nennen
wir diese potentiell endlose Schwebephase eine „dekonstruktive Suspension“. Von dieser
„dekonstruktiven Suspension“ ist die „kritische Suspension“ dann freilich nur ein Zwischenstadium.
Und jeder Versuch einer „Stabilisierung“ dieser postalischen Weiterleitung muss sich besonderer
Strategien bedienen, um die volle Problematizität ihrer originären Verstellung zu umgehen.
Halten wir kurz fest:
i) „Kritik“ (oder jede andere Form der Hinterfragung) bedarf der Suspension von Bedeutung.
of logos (this is why one cannot replace, except for laughs, the formula 'in the beginning was the logos' by 'in the beginning was the post'). If the post (technology, position, 'metaphysics') is announced as the 'first' envoi, then there is no longer A metaphysics, etc. (I will try to say this one more time and otherwise), nor even AN envoi, but envois without destination.“ (ibid.)
45 Vergleiche „Delay call forwarding system“ in Avital Ronell, Telephone book
ii) Diese „Suspension“ entspricht der „Aktivierung“ unserer „effektiven Un/Möglichkeit von
Bedeutung“.
iii) „Kritische Suspension“ heißt der temporäre Entzug von „Bedeutung“.
iv) Diese „Suspension“ kann nie völlig aufgelöst werden. Sie ist ein Moment der Verschiebungen
im „postalischen System“.
v) „Dekonstruktive Suspension“ heißt der potentiell endlose Entzug von „Bedeutung“.46
vi) Innerhalb von Latours Text tauchen beide sich überlagernd als „Absurdität“ auf.
c. „Absurdität“ wäre der Ort des Regresses, mithin der „différance“.
„Are you not all tired of those 'explanations'? I am, I have always been, […].“
Ein Moment der Müdigkeit, der Erschöpfung schleicht sich hier ein, auf das wir noch zurückkommen
werden.47 Für den Moment halten wir fest:
i) Wie in jeder Konstellation, so muss auch Latour in seinem Text den „infiniten Regress“ (der
Autoritäten – wie oben gezeigt) überspielen.
ii) Er tut das, indem er eine neue „Autorität“, nämlich das „Ding“ einzusetzen sucht.
iii) Dabei bedient er sich aber gerade (mindestens!) „einer“ „Figur“ „der“ „différance“: Sie heißt
„absurd“.48
46 Es müsste ergänzt werden, dass aus dieser Perspektive, „Bedeutung“ im starken Sinne freilich nie existiert hat – aber das ist ein anderer Aspekt dieses Gedankens und würde hier nur die Linienführung vermatschen.
47 Ich möchte nur kurz festhalten, das hier – am Ort der „différance“, an dem der Regress gekittet werden soll, eine „Erschöpfung“ auftritt, die immer schon bestanden hat. „I have always been [tired of those 'explanations'].“ Jetzt endlich soll diese „Erschöpfung“, diese „Müdigkeit“ vorbei sein – wir befinden uns am Punkt des Endes einer Äone [„always“] währenden Schwächung der Kräfte, die gar in einer Dopplung auftritt: „I am, I have always been […].“ Ich bin versucht zu sagen, dass die schiere Existenz dieser „Erschöpfung“ scheinbar der doppelten Markierung, eines Supplements bedarf. In PoMo-Sprech bedeutete dies: Es gibt keine Erschöpfung, weil nichts erschöpft ist. Es handelt sich um einen „Regress“, der tatsächlich „immer schon“ bestanden hat, eine „Auszehrung“, die deshalb doppelt markiert werden muss, weil es sie „nicht einmal“ „gibt“ – was sie aber umso wirksamer macht. Aber dazu später …
48 Und es ließe sich vielleicht noch zusätzlich behaupten, dass „différance“ hier nicht nur als „Epochè“ oder „Suspension“ passiert, sondern auch als promiske Unaufhaltsamkeit der syntaktischen Struktur selbst. Schauen wir noch einmal hin: „I am, I have always been, when I know, for instance, that the God to whom I pray, the works of art I cherish, […].“ Warum, frage ich mich, ist hinter „I have always been“ kein Punkt – warum stoppt der Satz nicht nach dieser zentralen Aussage in ihrer doppelten Ausführung, wo doch gerade Latour ansonsten ein ziemlich gutes Gefühl für Pointen und Punchlines zu haben scheint? Warum gehen hier zwei recht unterschiedliche Bedeutungsebenen direkt ineinander über, als wären sie „eine“? Ist das ein umgkehrtes Anacoluthon (plötzlicher Sprung im Satz? Ist es die Notwendigkeit, über etwas hinwegzutäuschen und das lesende Auge schnell vom Ort des Geschehens wegzuführen? Ist es „différance“ als Überproduktion von „Syntax“, die das schnelle Gleiten souffliert? Ist es nur Latour als begabte Rhetorikerin, der hier ein kleiner Coup gelingt? Aber warum sollte er sich dann die ganze Mühe machen, wenn er doch wüsste, was ihm hier unter-läuft?
Diejenige Strategie, die die hier unmögliche (aber erstrebte) argumentative Kohärenz überspielt, ist die
plausibilisierende Wirkung des guten alten „Wir/Ihr“: „[...] [T]he things really close to our hearts
would in no way fit any of those roles [fact or fairy position]. Are you not all tired of those
'explanations'? I am, I have always been, […].“49 „JA!“ möchte ich ausrufen: „JA! Auch ich bin müde
vom ewigen Hin- und Her-geschiebe zwischen Dummy-Objekten und Feen-Wirrwarr!“ Die Autorität
qua „vorentschiedener Signifikanten“ ist hier, dass wir als Gruppe zusammengehören, dass wir uns
einig sind. Nun fragt sich (wie immer) : „Wer ist dieses wir?“ Und tatsächlich hat sich Latour
besondere Mühe gegeben, dieses „Wir“ durch die ganzen 18 vorhergehenden Seiten seines Textes
hindurch sorgfältig aufzubauen, um dem „Ihr“ hier – sozusagen am Ende des vierten Aktes in
klassischer Dramatugie, kurz vor den entscheidenden dreieinhalb Seiten, die den Triumph der post-
ikonoklastischen-Kritik besiegeln sollen – einen Namen zu geben:
„To accuse something of being a fetish is the ultimate [sic] gratuitous, disrespectful, insane,and barbarous gesture.“50
III) Barbarei, Regress und Imperialismus
a. Diese „barbarous gesture“ speist sich aus zwei vormaligen Vorkommnissen ähnlicher Syntagmata:
„On both accounts [„social explanation“ und „to use the results of one science uncritically“]matters of concern never occupy the two positions [fact and fairy] left for them by criticalbarbarity.“51
„And yet this is not the only way because the cruel treatment objects undergo in the hands
49 Im Akkord mit den letzten zwei Fußnoten ließe sich wiederum bemerken, dass „différance“ hier nicht irgendwo auftaucht, sondern „zufällig“ im Herzen: „close to our hearts“.
50 Latour, S.24351 Ibid., S.242 – Ziemlich interessant ist an dieser Stelle Latours Beispiel für Wissenschaftsgläubigkeit: „You can try to
play this miserable game of explaining aggression by invoking the genetic makeup of violent people, but try not to do that while dragging in, at the same time, the many controversies in genetics, including evolutionary theories in which geneticists find themselves so thoroughly embroiled.“ (Hervorhebungen von mir). Ich werde darauf hier nicht viel weiter eingehen, aber es ließe sich überlegen: Wer sind diese „violent people“ mit „makeup“? Und mit nur einer kleinenVerschiebung der Diacritica (Komma zu Punkt) ließe sich lesen: „[B]ut try not to do that while dragging in“ – „Versuche nicht, in drag zu gehen! Dich hinein-zu-drag-en! Gehe nicht in drag zu den gewalttätigen Leuten mit Makeup!“ Heißt das: „Lass dich nicht mit Transfrauen ein“? Insbesondere, wo es doch hier um Aggressionen geht, mithin nicht nur eine Eigenschaft, die oft maskulin etikettiert wird. Mehr noch eine Eigenschaft, die Transfrauen oft vorgeworfen wird – unter anderem unter Aberkennung ihrer Weiblichkeit. Ist es Zufall, dass es hier um „Genetik“ geht, also das alte Spiel von Hase und Igel zwischen „Queer Theory“ [„social explanation“] und „Biologie“ [„to use the results of one science uncritically“], in dem insbesondere Trans*menschen und (in Folge von Judith Butlers bekanntem Essay [BUTLER GENDER TROUBLE PERFORMANCE]) zumeist Transfrauen oder -weiblichkeiten (übrigens ungefragt) als „Beweise“ der In/stabilität von Geschlechternormen herhalten müssen? Und spielt das nicht (im weiteren Verlauf meiner Analyse) in ein weiteres altes Pattern hinein: Nämlich den „Anderen“ die „Männlichkeit“ abzusprechen?
of what I'd like to call critical barbarity is rather easy to undo.“52
Eine gewisse Verteilung ist also „rather easy to undo“. Es ist nicht schwer, das Spiel der
Objektverschiebungen zu durchschauen – eigentlich ist es sogar ziemlich einfach. Was sagt uns das
über die „kritische Barbarei“? Es sagt uns, dass die „kritische Barbarei“ eine ziemlich dumme
Angelegenheit sein muss. Was sind das für Menschen, die dieses „cruel treatment“ nicht durchschauen
können? Hierhin passt auch wiederum seine Wahl von „absurd“ als Disqualifikationsprädikat: Denn
eine mögliche Bedeutung scheint „completely ridiculous“ zu sein – und was wäre lächerlicher als die
Dummheit? Interessanterweise ist das ganz und gar keine Ausnahmedefinition von „Barbarei“. Vom
griechischen „bárbaros“ stammend, bezeichnete der Term einmal Mensch/innen und /außen mit
begrenzten oder keinen Griechischkenntnissen. In „Stupidity“ notiert Avital Ronell: „For the Athenians,
the stupidest were their […] neighbors; for them, the notion of idiocy had to be invented. Ever since the
strategic decision of Pericles, if you were not an Athenian, you were an idiot.“53 Das gilt wohl
besonders für die „bárbaros“. Anschließend an unsere Diskussion um „Autorität“ können wir sagen,
dass diejenigen, die die bereits entschiedenen Signifikanten nicht „verstehen“ natürlich „dumm“ sein
müssen. „Dummheit“ ist die primäre Drohung der Autorität. Was Latour demzufolge hier sagt ist
eigentlich primär: „Diejenigen, die der falschen (oder keiner?) Autorität folgen, haben die richtigen
Signifikanten nicht verstanden. Sie sind dumm. Das heißt: Wer der falschen (oder keiner?) Autorität
folgt, folgt der falschen (oder keiner?) Autorität. Wir mögen sie nicht, weil sie nicht verstehen was wir
verstehen.“
Halten wir fest:
Nr. Inhalt: Aus: I) Es gibt „kritische Barbarei“. Definition Latour
ii) „Kritische Barbarei“ heißt der Glaube an die allzu einfache Verteilung der
Objektpositionen als „fact and fairy“.
Definition Latour
iii) Wer diese nicht als unsinnig zu entlarven weiß, ist dumm. Definition Latour.
iv) → „Kritische Barbarei“ ist „dumm“. i), ii), iii)
v) „Dummheit“ ist in diesem Falle „nicht unsere Sprache sprechen“, „die
Signifikanten nicht verstehen“.
Definition Ronell.
vi) „Autorität“ ist die Fähigkeit, bereits über die Signifikanten entschieden zu
haben.
Definition aus Kapitel I.
vii) Wer die Signifikanten nicht versteht, ist dumm. = v)
52 Ibid., S.24053 „Indeed the only internal [, domestic] 'idiots' that Athens produced were the Cynics.“ Ronell, Stupidity, S.40
viii) Wer der Autorität nicht folgt, versteht die Signifikanten nicht. vi), ~
ix) → Wer der Autorität nicht folgt, ist dumm. Viii), vii)
x) Die Verteilung der Objektpositionen in „fact“ und „fairy“ ist dumm. ii), iii)
xi) Die Verteilung der Objektpositionen in „fact“ und „fairy“ folgt nicht der
Autorität.
ix), x)
xii) Die „Dummheit“ der „kritischen Barbarei“ speist sich aus dem Unverständnis
den (sprachlichen?) Signifikanten gegenüber.
ii), ix), x)
xiii) Es handelt sich um eine Frage der Autorität. Die anderen sind doof, weil sie
die anderen sind.
xi), Xii)
b. Die Geschichte der „Barbarei“ als Signifikant ist allerdings nicht nur griechisch und damit
(imaginär) proto-europäische Geschichte, sondern auch koloniale:
So verfolgt „Postcolonial Studies – The key concepts“ die Dichotomie „savage/civilized“ in Form von
„civilizing cultures“ im OED bis 1601 mit folgendem Zitat: „To make civil. To bring out a state of
barbarism; to instruct in the arts of life; to enlighten and refine.“54 „The civilizing mission“ ist der
sprechende Name der europäischen, französischen und anderer kolonialen Projekte. „Barbarei“ darf
damit wohl rechtens in einer Linie mit „wild“, „unzivilisiert“, „nicht aufgeklärt“, „primitiv“55,
„kannibalistisch“56 und ähnlichen Prädikaten stehen. Deren abwertender Charakter straft nicht nur
Mensch/innen wie /außen, Institutionen, Güter und Praktiken mit Verachtung. Er organisiert vor allem
qua Wissensproduktion die Strukturen der kolonialisierenden Macht als Autorität und mithin das Leben
in der Kolonie teleologisch in Richtung der Okkupatorinnen. Denn sobald ich mich selbst als
„Barbarin“, „dumm“ etc. begreife, habe ich die Normierung durch meine Autorität bereits akzeptiert.
„Barbar/in“ bedeutet, sich an einem „Soll“ zu orientieren, dass mich selbst von vorn herein
benachteiligt. Aber auch als „Barbar/auße“, als potentielle „Barbar/in“, als „zivilisierte“ bleibe ich
immer in Hörweite meiner Referenzientinnen. Und auch wenn ich gleichauf ziehen sollte, werde ich
niemals „so wie sie“ sein, denn sie behalten die Weisungsbefugnis. Bhabha beschreibt das als „[...] a
separation between before and after that repeats obsessively the mythical moment of the disjunction.
[…] It is the visibility of this separation which, in denying the colonized the capacities of self-
government, independene, Western modes of civility, lends authority to the official version and mission
54 Postcolonial Studies, S.192, Hervorhebung von mir. 55 „In broader use defines a form or style perceived to represent an early stage of human cultural endeavor. Thus early
human art is often described as primitive art. The prooblem with the term used in ths way is that it assumes a linear, teleological unfolding of human history from simple to complex.“, ibid., S.179
56 Ibid., S.26f.
of colonial power.“57
Wer etwas nicht kann, kann es gegebenenfalls lernen. Dieses „Lernen“ geschieht immer mit Blick auf
die Kolonialmacht und stärkt damit ihre Deutungshoheit. Die entsprechenden Diskurse nennen das
„Zivilisierung“ – ein Euphemismus für die Installation und Auto-Re-Produktion eines kulturell
enteignenden Herrschaftssystems.
Ein Beispiel für den Einzug solch „kultivierender“ Großprojekte ist das Werk Sigmund Freuds, das
konsequent nicht-europäische Gesellschaften als „zu überwindende“ Menschheitsstufen rahmt. Darüber
hinaus analogisiert Freud beispielsweise in „Zur Einführung des Narzißmus“ die „Seelenleben von
Kindern und von primitiven Völkern“58 qua „eine[r] Überschätzung der Macht ihrer Wünsche“.59 Dies
ist nicht nur anthropologisch äußerst fragwürdig, sondern widerspricht auch Freuds späteren
Überlegungen bezüglich der potentiellen „Unendlichkeit der Analyse“.60 Der Effekt dieser
„Überschätzung“ ist der „Fetisch“, der selbst wiederum eine „Überwindung“ verlangt:
Auf Ebene der Entwicklung männlicher Kinder ist der Schock bei der Erkenntis, dass Frauen keinen
Penis haben zentral. Denn der bedroht auch potentiell „den kleinen Penis des kleinen Jungen“.61 Wer
damit nicht klarkommt wird entweder Homosexuell oder symbolisiert den verlorenen femininen
Phallus im Fetisch, der daher als zu überwindende Pathologie gilt.62 Der Begriff „Fetisch“ ist dabei
selbst schon eine Aneignung. Das ganze Konzept der „Wunschprojektion“ auf einen „Gegenstand“,
dessen pathologische Besetzung es hinter sich zu lassen gilt, ist daher intergral von der Vorstellung
einer allgemeinen Teleologie getragen, an dessen Spitze die europäische Vorhaut sich den Weg in die
Unendlichkeit bahnt. Ohne diesen Vorstellungshintergrund wären weder die Wahl des Begriffes noch
seine Pathologisierung in irgend einer Weise plausibel – es handelte sich nur um eine mögliche
libidinöse Besetzung unter anderen; eine Ökonomisierung der „polymorven perversion“63 kindlichen
Lustempfindens. Das mag wie eine eingeschobene Überdetermination klingen. Suspendieren wir dieses
Urteil für den Moment und kehren wir zu Latour zurück.
c. „Wars. So many Wars. Wars outside and wars inside. Cultural wars, science wars, and wars against
terrorism.“64 So lauten die ersten Zeilen von Latours Text: Welche Kriege mögen gemeint sein? Wenige
Seiten weiter lesen wir die Warnung: „We migt still be directing our arsenal east or west while the
57 Homi Bhabha, The Location of Culture, S.11858 Sigmund Freud, „Zur Einführung des Narzißmus“, in: Studienausgabe Band III, Fischer 1982 [Freud 1914], S.43 59 Wenn wir wollen, erkennen wir hier Latours „Fetishismus“. 60 Siehe hierzu Spivak/Echo61 Luce Irigaray, Speculum, 62 Sigmund Freud, „Fetischismus“, in: Studienausgabe Band III, Fischer 1982 [Freud 1927], S. 38563 FREUD / DREI ABHANDLUNGEN64 Latour, S.225
enemy has now moved to a very different place.“65 Um welchen Krieg mag es sich handeln, bestimmt
durch seine Folge auf die Frontlinie „east or west“? Wo ist dieser „very different place“? Nun mag das
noch immer eine ganz zufällige Metaphorik sein – obwohl der Zusammenhang zwischen „Kultur“,
„Terrorismus“ und den „neuen Kriegen“ nach dem „Ost-West-Konflikt“ bereits für sich sprechen
könnte. Schauen wir auf das Datum des Textes, so sehen wir: „Critical Inquiry“, Winter 2004. Lesen
wir den Text selbst werden wir bemerken, dass beide Beispiele für Latours wichtigstes Konzept –
nämlich das „Ding“ – mit dem Konflikt im Irak verquickt und auf Frühjahr 2003 datiert sind:
i) Der Absturz der Raumfähre „Columbia“ am 01.02.2003 über der texanischen Wüste, von dem
Amit Ray und Evan Selinger scharf bemerken:66
„Consider that in those televised images of searchers combing the North Texas countryside, most ofthe footage was concentrated around a small town. As the United States ramped up its war efforts inthe Middle East, millions of Muslims around the globe also watched and also registered the shuttleas a thing: an auratic entity--carrying six Americans and an Israeli--whose fall from grace, not farfrom the U.S. President's ranch, had come to lie in Palestine, Texas.“67
ii) Der Versuch der Vereinten Nationen und der USA, den Einsatz im Irak eben nicht zur Debatte,
zum „Ding*“ werden zu lassen, sondern ihn als Naturgewalt, als „Objekt“ zu verkaufen.
Der Ort dieses neuen Krieges ist daher mindestens in „Nahost“ zu suchen. Es ist die Rhetorik des
„Krieges gegen den Terror“ die hier den „kalten Krieg“ ablöst und sich an ein uns richtet, das klar auf
der richtigen – das heißt: auf westlicher, wenn nicht US-amerikanischer – Seite stehen soll. Das wird
vielleicht besonders an einem der ersten Höhepunkte des Textes deutlich: Nämlich am Auftritt eines
namhaften französischen Philosophen, der natürlich auf die Seite der „critical barbarity“ gehört und
ganz besonders verwerflich agiert, indem er in Bezug auf 9/11 nicht auf der richtigen Seite steht:
„What has critique become when a French general, no, a marshal of critique, namely, JeanBaudrillard, claims in a published book that the Twin Towers destroyed themselves undertheir own weight, so to speak, undermined by the utter nihilism inherent in capitalism itself– as if the terrorist planees were pulled to suicide by the powerful attraction of this black
65 Ibid., S.230 Hervorhebung von mir. 66 Amit Ray und Evan Selinger, “Jagannath's Saligram: On Bruno Latour and Literary Critique After Postcoloniality “,
http://pmc.iath.virginia.edu/text-only/issue.108/18.2ray_selinger.txt 2008. Der Text gibt unter anderem eine detailreiche Lektüre des Romans ??? von ???, der Latour in „Pandora's Hope“ zur Ilustration der „fairy-position“ dient. Ray und Selinger zeigen, wie ??? selbst das Problem mit der Ideologiekritik bereits dreißig Jahre vor Latour verhandelt, was von Latourin guter Tradition weißer Superiorität schlicht ignoriert wird. Auch hier bedient sich Latour nicht nur selbst einer billigen „fairy-critique“; er verwendet auch klassische koloniale Techniken um seine Argumente zu stützen: Nämlich die Reproduktion von Wissen, ohne Quellen anzugeben und damit die Fortschreibung einer eurozentrischen, weißen und imperialen Geschichte.
67 „In light of such lack of contextualization, Latour's claim rings hollow: 'Frightening omen, to launch such a complicatedwar, just when such a beautifully mastered object as the shuttle disintegrated into thousands of pieces of debris raining down from the sky--but the omen was not heeded; gods nowadays are invoked for convenience only'(236)“.
hole of nothingness.“68
Es gibt also einen neuen Krieg und es ist der „Krieg gegen den Terror“. Nun könnte es sich noch immer
um akzidentielles Colorit einer eigentlich in sich funktionalen Theorie handeln. Dass dem nicht so ist,
werde ich versuchen zu skizzieren.
d. Die Schlüsselkonzepte in Latours Text scheinen „fact“, „fairy“ und „Ding“ in seinen zwei
Schattierungen als „Ding*“ und „Objekt“ zu sein. Nun definiert Latour „fairy position“ nicht nur als
das Komplement zu „antifetishism“, sondern „[t]he role of the critic“ als „to show that what the naive
believers are doing […] is simply a projection of their wishes […].“69 Die „fairy position“ kann daher
als von „Fetischen“ besetzt gefasst werden. Nun handelt es sich hierbei nicht um irgendein Konzept
von „Fetischismus“, sondern um ein teleologisch zu überwindendes:
„To accuse something of being a fetish is the ultimate [sic] gratuitous, disrespectful, insane,
and barbarous gesture.“70
Wie vorhin gezeigt bedient sich eine solche Definition von „Fetisch“ der europäischen
Vormachtphantasie. An dieser Stelle aber soll nicht nur der einzelne „Fetisch“, sondern die ganze
Vorstellung eines möglichen „Fetischismus“ bald der Vergangenheit angehören, und zwar zusammen
mit der Abschaffung der „Barbarei“. Wäre das vielleicht noch arbiträr zu nennen, ist es die Verbindung
mit dem „Ding“ nicht: Denn wie bereits erwähnt wird der „versammelnde“ Charakter des „Dings“
68 Latour, S.228, Baudrillard dient hier vor allem dazu, „social criticism“ und „conspiracy theory“ einander anzunähern: „In both cases you have to learn to become suspicious of everything […].“ (Ibid., S.229) Deren einziger Unterschied bestünde in der Wahl der „powerful agents hidden in the dark“: „society, discourse, knowledge slash power, fields of forces, empires, capitalism“ einerseits und „a miserable bunch of greedy people with dark interests“ (Und gegebenenfalls „the deep dark below“. ) andererseits.(Latour, S.229) „French general[s]“ stehen so in einer rhetorischenLinie mit „the bad guys“ (Ibid., S.227), „the worst possible fellows“ (Ibid.), „dangerous extremists“ (Ibid.) und „mechanical toys“ (Ibid., S.225), deren Automatizität (Ibid., S.229) sie innerhalb klassischer Dichotomien in Richtung des Unbelebten, des Todes rückt.
Es bietet sich an dieser Stelle an, eine andere Lesart von „différance“ zu exemplifizieren, die ich eine „semantischeInterpretation“ nennen will: Sie hebt nicht auf den exzessiven Charakter des Signifikanten ab, sondern auf dieprinzipielle Mehrdeutigkeit, Überdeterminierbarkeit, Polysemie (statt „Dissemination“) von „Bedeutung“. Das ist – wieich kurz zeigen will – richtig, wenn auch nicht das meines Erachtens zentrale Moment „dekonstruktiver Kritik“:
In der soeben skizzierten Linie erscheint ein doppelt belegtes Prädikat, dessen Mehrdeutigkeit die klarenUnterscheidungen verwischt. Es handelt sich um das Wörtchen „gullible“ - „leichtgläubig“. Denn dieses erscheinteinerseits in der Figur des „naive hillibillie['s]“ (Ibid., S.229), „naive believer“, „ the great unwashed“ (Ibid.,Hervorhebung von mir.), der „too unsophisticated to be gullible“ auftritt. Es handelt sich hier um eine negativeEigenschaft, die ihn glauben macht, das CIA habe die Twin Towers gesprengt. Latour selbst findet sich plötzlich„positiv leichtgläubig [gullible]“ an „Fakten“ orientiert (Ibid., S.228). Eine zweite Verwendung dieses Signifikantenfindet sich als „the most gullible sort of critique“ (Ibid., S. 230) für die „gullibe masses“ (Ibid.) – „social criticism“natürlich, „radicalism gone mad“, „revolution swallow[ing] its pregoncy“ etc. Im Verhältnis der unterschiedlichenKriege – des alten „Ost-West“ Konflikts einerseits und des neuen „Kriegs gegen den Terror“ andererseits – taucht die„Leichtgläubigkeit“ daher in positiver wie negativer Belegung auf beiden Seiten auf.
69 Ibid., S.23770 Latour, S.243
explizit an parlamentarische Architektur gebunden.71 Und der Überschritt Richtung „post-
ikonoklastischer Kritik“ soll eben genau durch die Überwindung der „barbarischen Fetischisierung“ hin
zur „parlamentarschen Dinghaftigkeit“ geschehen. Es ist dies der Konflikt parlamentarischer
Demokratie mit vormoderner Unwissenheit – die Rhetorik des „Kriegs gegen den Terror“ in Reinform.
Ohne diesen rhetorischen Kitt gäbe es keine Linie im Text, keine irgendwie geartete Notwendigkeit,
den Fetisch-charakter der „fairy position“ hin zur demokratisierenden Wirkung des „Dings“ zu
entwickeln. Das heißt nicht, dass Latours Konzepte selbst keinen „Sinn“ machten, noch dass was er
sagt genuin falsch wäre: Ich halte seine Schematisierung der „kritischen Szene“ als in
Verschiebungsbewegungen zwischen „Objekten“ befangen für durchaus überzeugend. Allerdings kann
der Zusammenhang zwischen den Elementen seines Textes nicht standhalten:72 Denn der Übergang von
„fact and fairy“-Kritik zur „Ding“-Kritik hängt einerseits am Versuch der Überwindung eines
Regresses, dessen unausweichliche Wiederkehr ich zu zeigen versucht habe. Diese Überwindung
bedient sich der plausibilisierenden Wirkung eines anderen Registers von „Autorität“: Es kommen
imperiale und koloniale Rhetoriken des „Kriegs gegen den Terror“ zum Einsatz, die ein westlich-
akademisches „Wir“ herstellen sollen-können. Dessen Einschwörung auf einen ideologischen Kampf
wird damit zumindest begünstigt. Dass dieses „Wir“ als Autorität in seiner sachlichen Rechtfertigung
wenig Bestand haben kann, ist mannigfach gezeigt worden.73 Dass es „qua Autorität“ (formal) erneuten
Regressen unterliegt, sehe ich für den Moment als gegeben an.
e. Meine These ist mithin: Die Plausibilität von Latours Manöver der Ummantelung seines Regresses
speist sich aus einer Polarisierung, die zum Nachteil der Irakerinnen und zum Vorteil von US-
Amerikanerinnen ausgeht. Mehr noch: Qua seiner Autorisierung einer „zivilisierten Kritik“ schwört er
seine Adressatinnen mit auf den ideologischen Kampf für „Freiheit und Demokratie“ gegen die
„unwashed“74 „Barbarinnen“ ein. „Why Has Critique Run out of Steam?“ darf sich mithin nicht nur
glücklich schätzen, vom zweiten Golfkrieg und einer gewissen „Rhetorik gegen den Terror“ zu
profitieren, sondern mauert noch fleißig mit an der implizieten Plausibilisierung der „civilizing
mission“ westlicher Mächte. Ohne das jetzt noch genauer auszuführen (denn es handelt sich hier ja
nicht um eine literaturwissenschaftliche Arbeit), strukturiert diese Metaphorik den gesamten Text. Es
könnte gezeigt werden, wie eine ganze Palette klassischer Stereotype Latours Argumente an allen
71 Ibid., S.232 ff. 72 Was das genau heißt und wie „dekonstruktive Kritik“ sich hier von anderen Kritikformen unterscheidet werde ich im
nächsten Kapitel ausgiebig besprechen. 73 Generell: Derrida, „Ends of Man“, Christentum: Nancy, Demokratie: Ronell later text / test drive, Mouffe/laclau??, 74 Quote „unwashed“
wichtigen Stellen colorieren und stützen. Für unsere Zwecke reicht es aber, folgendes festzuhalten:
i) Die Stelle, an der der infinite Regress unausweichlich wird, provoziert einen bestimmen
rhetorischen Apparat. Bhabha fasst das als „stereotype-as-suture“, „a recognition of the
ambivalence of that authority and those orders of identification.“75 Interessant an dieser Fassung
ist genau ihre politische Ausrichtung: „Stereotype“ tauchen als Vernähungen regresshafter
Autoritätsschwierigkeiten auf. Sie bezeichnen die Notwendigkeit, „Differenzen“ in ein soziales
Feld einzuführen, die qua ihrer Ausrichtung an der jeweilige „Autorität“ dieser ihre (positive
wie negative) Deutungsmacht sichern. Bei Latour heißt dieser „Stereotyp“ „Barbar/in“.
ii) Dieser Apparat dient der Plausibilisierung der (notwendig) schwachen Argumentation. Es mag
auch andere rhetorische Register in einem Text geben, aber dieses ist es, was die Argumentation
in ihren Grundzügen zusammenhält.
iii) Er verweist gegebenenfalls auf vorhandene Stereotypen, um autoritativ ein „Wir“ herzustellen,
das ganz bestimmte Ausschlüsse produziert.
iv) Diese Ausschlüsse sind in diesem Falle mindestens imperialistisch, gegebenenfalls rassistisch
und transphob76.
IV) Anhang
„Iteration“ kann in diesem Sinne und entgegen der meist auf „Signatur, Ereignis, Kontext“ fußenden
Auslegungen ebenfalls als ein solcher „Regress“ begriffen werden. In „The double Session“77
argumentiert Derrida in etwa wie folgt:
Die Geschichte der Metaphysik kennt zwei verschiedene Versionen von „Mimesis“: Gemein ist ihnen
folgendes:78
i) Ihr Maßstab ist „die Wahrheit“.
ii) Beide sind Bilder voneinander, können einander also ersetzen.
iii) Beider verweisen auf „etwas“ „gemeinsames“.
75 Bhabha, S.115. Was hier als „ambivalence“ gefasst wird, heißt in diesem Text „Regress“ [etc.]. 76 Siehe Fußnote 59. 77 Jaques Derrida, „The Double Session“, in: ders. Dissemination, 78 Double Session, S.190
Eine ist bloßes Ornament (M1), die andere essentielle Bedingung (M2) von
Denken/Perzeption/Erkenntnis etc. Wie das?79
M1) Das Konzept der „akzidentiellen Mimesis“ besagt, dass Mimesis als Wiederholung,
Literatur, Kunst etc. immer auf die wirklich wahre Wirklichkeit des lebendigen Entwurfs
bezogen bleibt.80 „Mimesis“ ist daher selbst immer mangelhaft, defizitär – selbst wenn sie selbst
zum Entwurf einer besseren Realität werden sollte. In jedem Falle bleibt der Bezugspunkt eine
79 Die folgende kurze Schematisierung ließe sich auch etwas länger formulieren. Zum Beispiel so: In „The Double Session“ beschreibt Derrida ein historisches Paradigma. Er findet es bei Platon und exemplifiziert es an einem Ausschnitt aus dem „Philebus“. Hier sagt sokrates: [QUOTE]. Oder in kürzer: „Denken ist wie Schreiben. Und dann kommt die Malerin und ornamentiert das Ganze.“ Warum ist das so? Derrida rekonstruiert ungefähr folgende Geschichte (Double Session, S.189ff.):
1. Alles fängt an mit der doxa: der wirklich wahren Wirklichkeit der totalen Meinung die mir aus den Eingeweiden springt. „Doxa“ tritt in den kommerzhaften Austausch der meinungen im diskurs (logos). Ihr Ziel ist die Aufdeckung der Wirklichkeit – des Eidos. Diskurs passiert mit dem Mund: durch Sprache nämlich. Manchmal aber sehen sich Mensch/innen und /außen dazu gezwungen mit sich selbst zu reden (manchmal in Höhlen, zum Beispiel). Und dann müssen sie Kommerz mit sich selber machen. Dieser Austausch von „doxa“ mit sich selbst durch Sprache heißt „denken“ (dinoia). „Denken“ ist also „Sprechen ohne Stimme“, „Austausch von Meinungen mit mir selbst“. Wenn „Denken“ sich vom „lebendigen“ diskurs in Fleisch und Sprache primär durch die Amputation der Stimme unterscheidet, und „Schrift“ primär Sprache ohne das Sprechen/die Stimme ist, dann verhält sich „Denken“ zu „Diskurs“ wie „Schrift“ zum „Sprechen“: Beide sind nämlich durch die Abwesenheit des „lebendigen“ Elements gekennzeichnet. Daher die Analogie: „Denken“ ist „Schreiben“, allerdings immer akzidentiell und irgendwie defekt, amputiert. Nochmal in ganz kurz: Sprechen -» Austausch von “Doxa”. // Diskurs -» Ort des lebendigen Sprechens. // Denken -» Sprechen ohne Stimme // Schrift -» Sprache ohne Sprechen, Stimme // Denken -» Diskurs // Schrift -» Sprechen // - » Denken ist wie Schreiben. //
2. Nach der Schreiberin kommt die Frau mit dem Farbtopf. Warum das? Derrida sagt: „'Malen', 'Image', 'Piktorialität' kommt in zwei verschiedenen Beziehungen zum Denken/Schreiben vor:
2.a) „zographia“: von zoe (materielles leben) [im unterschied zum bios, dem verhandelbaren leben] und graphia (Zeichen). Es geht also darum, das Leben abzubilden. „Zographia“ ist damit immer nachgängig, abgeleitet, akzidentiell, unselbständig etc. Warum? Weil es seinen eigenen wert nur von der adequatio, der Ähnlichkeit mit demLeben selbst, dem Model bezieht. „Zographia“ ist damit eine akzidentielle Malerei. Sie ist dem, was abgebildet wird, vollkommen äußerlich – ob ich meine Knie male oder nicht, ändert an den Knien selbst rein garnichts.
2b): „zographia-demiurgos“: Es handelt sich hierbei um eine essentielle Malerei, die mit der Erkenntnis notwendig einhergeht. Und wie das? Nun, logos/diskurs ist (genauso wie zographia) auf das Leben, die wirklich wahre Wirlichkeit der totalen Realität in ihrer total lebendigen Lebendigkeit bezogen. Die zeigt sich als eidos – als Bild nämlich. So gesehen ist logos – definiert als die Aufdeckung des „Eidos“ – die Repräsentation der wirklich wahren Wirklichkeit des totalen Lebens als Bild. Insofern „Reproduktion von Visuellem“ „Malerei“ genannt wird, ist „Logos“ als „Reproduktion des Eidos“ „Malerei“. Es muss natürlich als eine spezielle Malerei gefasst werden, unsichtbar nämlich. Strukturell jedoch wird hier gemalt.. Eine ähnliche Figur findet sich beispielsweise auch in Kants „Kritik der reinen Vernunft“, wenn die Einbildungskraft als Organ der Repräsentation essentieller Bestandteil der Herstellung dessen ist, was wir „Realität“ nennen, die dann bei Kant nur „Erscheinung“ sein kann. Und die ganze Debatte über und nach dem „linguistic turn“ bedient ein ähnliches Paradigma: Insofern „sprachliche“ Reproduktion Bedeutungsbildender Bestandteil der Erfassung von „Realität“ sein soll, handelt es sich auch hier um „Malerei“ im Sinne von „Reproduktion von Visuellem“.
Lange Rede kurzer Sinn: Es gibt zwei Formen von Mimesis oder Repräsentation: eine akzidentielle und eine essentielle.
80 „[M]imesis sets up a relation of homoiosis or adequatio betwenn two (terms). In that case it can more readily be translated as imitation. This translation seeks to exress (or rather historically produces) the thought about this relation.
„präsentische“, unwiederholte Realität, die entweder vorausgehend oder noch zu schaffen wäre.
M2) Das Konzept der „essentiellen Mimesis“ besagt, dass Wissen, Erkenntnis, Perzeption
etc. eines mimetischen Bezugs zum Original, Ding-an-sich, Eidos, Realität etc. bedarf.81 Dieser
Zugang nutzt eine repräsentierende Apparatur, die den Bezug zum „Original“ (etc.) erst
herstellt. Es gäbe dann eine Form von „Mimesis“, die als notwendiges Verbindungsstück zur
Welt fungiert – zum Beispiel, wenn die Wahrnehmung von „Welt“ vor ihrer künstlerischen
Wiederholung synthetisiert werden muss. Damit ist sie nicht einfach nur deren Nachahmung,
sondern Bedingung ihrer Herstellung. Als „anamnesia“ besetzt sie den Ort eines „return to
eternal past that streches into the future“ als „faithful reproduction“.82
Es entsteht ein besonderes Problem: Denn M1 (akzidentielle Mimesis) ähnelt M2 (essentielle Mimesis)
auf eine bestimmte Weise, vice versa. In welcher Weise aber ähneln M1 (akzidentielle Mimesis) und
M2 (essenzielle Mimesis) einander? Es gibt zwei Wege, diese Frage zu beantworten:
i) „ähneln“ ist eine Eigenschaft von M1/M2
ii) „ähneln“ steht zwischen M1/M2.
c.i.a. M1 „ähnelt“ M2 nach Art von M1 – wie ein Foto, zum Beispiel. M2 wäre die „originale
Mimesis“, von der M1 nur ein Abbild darstellte. Das würde bedeuten, dass es ein „Original“ von M1
gäbe, das M2 wäre. Das hieße:
i) Es gäbe eigentlich keinen Unterschied zwischen M1 und M2. M1 wäre einfach eine andere
Version von M2. In diesem Fall wäre M1 tatsächlich nicht „wie“ M2; vielmehr wären beide
eigentlich dasselbe (nämlich M2) und M1 nur eine defizitäre Version von M2.
ii) Wenn M1 wie M2 wäre nach Art von M1, wäre sie eigentlich nicht „wie M2 nach Art von M1“,
denn „nach Art von M1“ bedeutete gerade „so wie M2“. „M1 ähnelt M2 nach Art von M1“
bedeutete daher eigentlich „M1 ähnelt M2 nach Art von M2“. Das aber ist eine andere These.
c.i.b. M1 „ähnelt“ M2 nach Art von M2. Wie Kants „Einbildungskraft“ wäre M1 (akzidentielle
The two faces are separated and set face to face: the imitator and the imitated […].“ Double Session, S.19381 „[Even] before it can be translated as imitation, mimesis signifies the presentation of the thing itself, of nature, of the
physis that roduces itself, engenders itself, and appears (to itself) as it really is, in the presence of its image, its visible aspects, its face: […]. Mimesis is then the movement of the phusis, a movement that is somehow natural (in the nonderivative sense of this word), through which phusis, having no outside, no other, must be doubled in order to make its appearance, to appear (to itself), to produce (itself), to unveil (itself) […].“ ibid.
82 Double Session, S.191
Mimesis) notwendig, damit M2 (essentielle Mimesis) M2 sei. M1 wäre Bedingung für M2. Das führt
zu zwei Problemen:
i) Diese Ähnlichkeitsrelation widerspräche der Definition von M2 als essentieller Mimesis und
M1 als akzidentieller Mimesis. Sie würde bedeuten, dass die akzidentielle Mimesis plötzlich
essentiell wäre, denn das wäre die Funktion, die M1 gegenüber M2 einnähme. Sie wäre also
tatsächlich eben keine „akzidentielle“ mehr, sondern essentiell. Das führt dann in eine
Tautologie: „M2 'ähnelt' M2 nach Art von M2.“
ii) Darüber hinaus führte dies zu der These, dass die „essentielle Ähnlichkeit“ selbst der
akzidentiellen bedürfe, womit sie nicht mehr selbstgültige Notwendigkeit im Verhältnis zum
von ihr abgebildeten sein könnte.
c.i.c. M2 „ähnelt“ M1 nach Art von M1. Das bedeutet dann: M2 sieht nur ganz zufällig so ähnlich aus
wie M1 und auch ohne M1 wäre M2 noch M2. Das aber hieße, dass M2 eben gerade nicht wäre, als
was sie definiert ist: Nämlich eine essentielle Mimesis. Sie wäre dann für alles mögliche „essentiell“,
nur eben nicht (seltsam seltsam) für dasjenige, was ihr selbst am meisten ähnelt: M1 nämlich.
c.i.d. M2 „ähnelt“ M1 nach Art von M2. Das hieße: M2 wäre notwendig, damit M1 M1 sei. Die
akzidentielle Mimesis bedürfte der essentiellen, damit sie wäre was sie ist – akzidentiell nämlich. Dies
führt wiederum zu zwei Problemen:
i) Auch in diesem Fall gäbe es – wie bereits in i.a. – eigentlich nur eine einzige „Mimesis“, und
zwar M2 (die essentielle). M1 wäre wiederum nur eine Version von M2 und die „Ähnlichkeit“
nur eine Tautotologie: „M2 'ähnelt' M2 nach Art von M2.“
ii) M1 wäre dann nicht wirklich „akzidentiell“, weil nur ein Abzug von M2. M1 bezeichnete dann
eher eine „defizitär-essentielle“ denn eine „qualitativ unterschiedene“ Mimesis. Sollte M1 dann
noch etwas anderes sein als M2, so müsste sie so wie M2 sein und anders. M1 wäre eine
contradictio in adjecto.
c.ii) „Ähneln“ steht zwischen M1/M2. Diese „Ähnlichkeit“ kann freilich wiederum weder M1 noch
M2 sein, denn dann resultierten dieselben Probleme wie in i).
c.iii) Eine dritte Möglichkeit, souffliert von der Frage „wie ähneln sich M1 und M2, vice versa?“
scheint sich aufzutun. Dieses „M3“ wäre definiert durch die folgenden Eigenschaften:
• „M3“ „ist wie“ M1 und M2, indem sie selbst eine Form von „Mimesis“ ist.
• „M3“ „ist unterschieden von“ M1 und M2, denn andernfalls wäre sie M1/M2 und die Probleme
aus c.i) griffen erneut.
Wir begegnen hier einer seltsamen Form von „Mimesis“, die definiert ist als „dasselbe, aber anders“.
Hierzu ein paar Punkte:
c.iii.a. Ein möglicher Einwand wäre, ob dieses „dasselbe, aber anders“ nicht wortklauberische
Sophisterei sei, die auf Eigenschaften referierte, die schlicht in ganz unähnlichen Verhältnissen
zueinander stünden. Tatsächlich aber glaube ich nicht, dass hier „ähnlich“ und „unterschieden von“
M1/M2 in unterschiedlichen Verhältnissen vorkommt, so wie ein Kreisel sich gleichzeitig „bewegt“
und „nicht bewegt“.83 Denn M3 ist „unterschieden von“ M1/M2 einfach durch die Möglichkeit einer
anderen Form von „Mimesis“, die qua Fragestellung „wie ähneln sich M1/M2?“ notwendig gemacht
wird: Wenn M1/M2 sich auf nicht-wiedersprüchliche Weise ähneln sollen, muss es eine andere
Möglichkeit geben, sich zu ähneln, als M1/M2. Dieser Anspruch auf eine nicht-widersprüchliche dritte
Mimesis produziert aber gerade einen Term, der sich in seiner Minimaldefinition „eine Form von
Mimesis, die nicht M1/M2 ist“ widerspricht. Beide Teile dieses Widerspruchs beziehen sich auf die
bloße Existenz der vorhergehenden Terme M1/M2.
c.iii.b. Die „Bedeutung“ des Terms „M3“ erscheint uns aber nicht als ein „Inhalt“ oder ein
„Signifikat“, ein „Bezeichnetes“ auf semantischer Ebene, ein „Gegenstand in der Welt“, ein
„Gedankenbild“ oder ähnliches.84 Vielmehr besteht der „semantische Wert“ von „M3“ in einer
syntaktischen Notwendigkeit. „Now, this reference is discretely but absolutely displaced in the working
of a certain syntax […].“85 Was heißt das? Es heißt, dass die „Bedeutung“ von „M3“ („Wiederholung
und Unterschied“) aus der Stellung zwischen M1 und M2 entsteht. Es ist diese Position in ihrer
Differenz zu gegebenen „Bedeutungen“, die eine „neue Bedeutung“ generiert:
M1 ↔ M3 ↔ M2
Diese „neue Bedeutung“ „verweist“ aber (im Sinne signifizierender „Bedeutung“ á la
„Signifikant→Signifikat“) zuerst einmal auf „nichts“: Während nämlich M1 und M2 in unserem Fall
auf überlieferte Theorien der Bedeutungsproduktion referieren (M1: Foto → Zustand der Welt; M2:
Reproduktive Kraft zur Herstellung von Wirklichkeit; Projektskizze und Blaupause), resultiert „M3“
83 Dies antwortet wiederum auf einen Einwand von A.L.84 Das ist auch der Unterschied zu M1 in i.d.ii)85 Double Session, S.193, Hervorhebung von mir.
nur aus den ihnen inhärenten Problemen. Dieses „nichts“ bedeutet aber wiederum (wie schon im Falle
der „Différance“) nicht einfach „Referenzlosigkeit“, sondern qua ihres Charakters als Signifikant die
Möglichkeit von Referenz. In diesem Sinne lässt sich auch über „M3“ sagen: Sie „bedeutet“ „(noch)
nichts“.
c.iii.c. Hinzu kommt, dass die Frage, inwiefern nun dieses „M3“ M1 und M2 „ähnelt“, wiederum eine
neue „Mimesis“ produziert/aufdeckt – „M4“. Diese Operation lässt sich beliebig wiederholen. „[A]n
internal division within mimesis, a self-duplication of repetition itself; ad infinitum, since this
movement feeds its own proliferation.“86 Wir haben es erneut (wie schon in der „Différance“) mit
einem infiniten Regress „M3—n“87 zu tun haben.
MnX ↔ MnY ↔ Mn+n1 ↔ MnZ ↔ MnZZ
c.iii.d. Operationalisieren wir diesen Regress, geht es nicht mehr einfach um eine „Bedeutung“ unter
anderen. Vielmehr manifestiert sich eine solchen „Bedeutung“ : Verstehen wir unter „M3—n“ die je
einzelnen Positionen und nennen wir „Iteration“ den „Regress“ „M3—n“ „als Ganzes“88, „the strange
mirror that reflects but also displaces and distorts one mimesis into the other, as though it were itself
destined to mime or mask itself […].“89 Die widersprüchlich-syntaktische Positionalitäten von „M3—
n“ sind nun jeweils qua Differenz definiert als „Wiederholung und Differenz“.
MnX ↔ MnY ↔ Mn+n1 ↔ MnZ ↔ MnZZW90 & D91 W & D W & D W & D W & D
Der „Regress“ „M3—n“ als unabschließbare Kette von Signifikanten „produziert“ nun genau was er
„bezeichnen“ soll: „Wiederholung [„so wie“ M1, M2, MnX, MnY, MnZZ etc.] und Differenz [„anders
als“ Mn-192 etc.]“.93
86 Double Session, S.19187 Der Geviertstrich „—“ bezeichnet an dieser Stelle die Proposition „bis“.88 Obwohl wir wissen, dass dieser „Regress“ niemals „ganz“ wird sein können – es handelt sich (wie gesagt) um eine
Operationalisierung, nicht um einen „Begriff“. 89 Double Session, S.19190 „Wiederholung“91 „Differenz“92 Der Viertelgeviertstricht „-“ bezeichnet an dieser Stelle das mathematische Subtraktionszeichen „Minus“. 93 An dieser Stelle wird auch klar, worin der Unterschied zwischen dieser Interpretation und den vielen anderen besteht,
die sich auf Derrida in Sec stützen: „Iteration“ ist hier eigentlich kein „Begriff“ und zwar genau deshalb nicht, weil er nichts „bezeichnet“.
MnX ≠ MnY ≠ Mn+n1 ≠ MnZ ≠ MnZZW94 & D95 W & D W & D W & D W & D
Wie aber bereits erwähnt, besteht der semantische Wert von „M3—n“ nicht in der Verbindung des
Signifikanten mit einem Signifikat. Er resultiert aus der syntaktischen Verknüpfung der Zeichen: Denn
„M3—n“ bezeichnen tatsächlich weder Gegenstände, noch durchführbare oder abschließend denkbare
Operationen. „M3—n“ „als Ganzes“ (oder: „Iteration“) bezeichnet die unabschließbare Summe
derjenigen Signifikanten, die als mögliche Formen von „Mimesis“ in Abgrenzung von anderen
Mimesis-begriffen an deren „Bedeutung“ und „Problem“ partizipieren (ohne sie allerdings zu lösen).
Es folgt, dass die Kette „M3—n“ (“Iteration“) die regresshafte Produktion von „Wiederholung und
Differenz“ ist: Zwar bezeichnet „M3—n“ (“Iteration“) nur eine Menge von Signifikanten; diese
Signifikanten aber sind durch Anlehnung-an und Abgrenzung-von „M1“ und „M2“ gezeichnet und
produzieren dadurch einen „Sinn“, der zwar keine „Semantik“ kennt, wohl aber als „Wiederholung und
Differenz“ lesbar ist. “Through the re-marking of its semantic void, it in fact begins to signify.”96
Der „Name“ dieses operationalisierten Regresses kann (der Übersicht halber) „Iteration“ sein.
„Iteration“ „bezeichnet“ dann aber nicht einfach „Wiederholung und Differenz“. „Iteration“ ist der
operationalisierte Regress der klassischen Wiederholungsbegriffe der Metaphysik der Präsenz selbst.
Das heißt: „Iteration“ „ist“ „Wiederholung und Differenz“ und „Wiederholung“ „und“ „Differenz“.
„This double mark escapes the pertinence or authority of truth: it does not overturn it but ather
inscribes it within its play as one of its functions or parts“, weil „Wahrheit“ ebene einer mehr oder
minder sicheren „Signifikation“ bedarf – es muss um „etwas“ gehen, und sei das nur die Relation zu
einem System von „Axiomen“. Dieses „System“ könnte aber nur bereits im „Spiel“ der „möglichen
Iterationen“ überhaupt erstellt werden – weshalb „Iteration“ jeder möglichen „Wahrheit“ vorgängig
ist.97 Das ist auch der Grund, warum Derrida der definitorischen Dimension der philosophischer
Disziplin und Disziplinierung konsequent widersteht: Jede Frage nach „Was ist … ?“ kann nur in einem
Verhältnis der „Mimesis“ zum „Objekt“ stehen. Sie wird mithin von der Problematik der „Iteration“
konsequent unterminiert. „Was ist …?“ bedarf daher eines Konzepts, das die hier geschilderte
Problematik konsequent umgehen, verhindern, abschließen und/oder entschlossen verschließen muss –
„Mimesis“ zumindest. Und insofern dies auch für „Iteration“ gilt und „Iteration“ damit niemals sicher
vereinzelt sein kann, sprächen wir besser von „Iterationen“.
94 „Wiederholung“95 „Differenz“96 Derrida, Double Session, S.22297 Aber als Rückprojektion, versteht sich, denn „Wiederholung“ ohne mögliches Etwas, das wiederholt würde, wäre
widersprüchlicher Quatsch.
c.iii.e. Zusammenfassend lässt sich festhalten:
i) Die Geschichte der Metaphysik (der Präsenz) kennt zwei Formen von „Mimesis“ : M1 (akzidentielle
Mimesis) und M2 (essentielle Mimesis).
ii) Die Forderung nach widerspruchsfreier Konzeptualisierung führt zu einem dritten Konzept von
Mimesis: M3. Dessen Eigenschaften sind „anders als M1/M2“ und „so wie M1/M2“.
iii) Diejenige Operation, die von M1/M2 zu M3 führt, lässt sich beliebig wiederholen und produziert
dann die „Begriffe“ „M3—n“. Sie führt in einen infiniten Regress.
iv) “Iteration” ist der Name des infiniten Regresses, der innerhalb des Konzepts „Mimesis“ der
“Metaphysik der Präsenz” auftaucht.
iv) “Iteration” ist ein leerer Signifikant.
v) “Iteration ” „bedeutet“ “(noch) nichts”.
vi) „Iteration“ manifestiert aber, was zu bedeuten „wäre“ : Nämlich das unendliche Ineinander von
„Wiederholung und Differenz“, die auch „Iteration“ von sich selbst trennt – „Iterationen“.