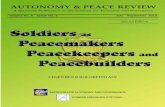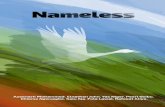Up-date Wachstumspol Stettin_deutsch - Hans-Böckler-Stiftung
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Up-date Wachstumspol Stettin_deutsch - Hans-Böckler-Stiftung
www.boeckler.de – August 2010 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Klaus Maack Wachstumspol Stettin: Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion Aktualisierung der Studie "Wachstumspol Stettin und Auswirkungen auf die Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion" (2004) Abschlussbericht
Auf einen Blick…
Stettin und Umland haben zwischen 2004 und 2008 eine sehr positive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung genommen. Der starke Rückgang der Arbeitslosigkeit ist allerdings auch auf Abwanderung von Arbeitskräften zurückzuführen. Insgesamt ist die Entwicklung jedoch hinter der der Wojewodschaft und Polens zurückgeblieben. Durch die Finanzkrise und den Zusammenbruch der Stettiner Werft ist die Arbeitslosigkeit in Stettin stark gestiegen. Die Beschäftigungssituation in der deutschen Grenzregion hat sich erst seit 2007 leicht positiv entwickelt.
Es gibt eine Reihe deutscher Direktinvestitionen im Stettiner Raum.
Besonders die Sonderwirtschaftszonen der Region haben davon profitiert, wobei die Investoren jedoch nicht aus der deutschen Grenzregion stammen. Größere polnische Investitionen in Vorpommern gab es kaum. Insgesamt gibt es nur kleine Fortschritte bei der deutsch-polnischen Stadt-Umland Kooperation. Ein Integrationsprozess hat bisher nicht stattgefunden. Insgesamt ist Stettin seit 2004 in seiner Entwicklung hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zurückgeblieben.
Studie
im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung
WACHSTUMSPOL STETTIN Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion
Aktualisierung der Studie „Wachstumspol Stettin und Auswirkungen auf die Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion“ (2004)
Hamburg Juli 2010
Wilke, Maack und Partner
Wilke, Maack und Partner
2
Projektleitung: Klaus Maack (Wilke, Maack und Partner)
Projektbearbeitung: Katrin Schmid (Wilke, Maack und Partner)
Stefan Schott (Wilke, Maack und Partner)
Wilke, Maack und Partner
3
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung .................................................................................................................. 6
1.1. Untersuchungsrahmen .................................................................................................... 6
1.2. Die deutsch-polnische Grenzregion ................................................................................ 7
2. Allgemeine Entwicklungen seit 2004 .......................................................................... 9
2.1. Veränderte Rahmenbedingungen – Polen ist EU-Mitglied ............................................. 9
2.2. Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Polen .................................................... 10
3. Charakteristische, soziostrukturelle Entwicklungen in der deutsch-polnischen
Grenzregion seit 2004 ..................................................................................................... 13
3.1. Demographische Entwicklung und Migration ............................................................... 13
3.1.1. Polnische Grenzregion ............................................................................................... 13
3.1.2. Planungsregion Vorpommern ................................................................................... 16
3.2. Pendleraufkommen ....................................................................................................... 18
4. Wirtschaftskraft-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung ............................ 19
4.1. Wirtschaftliche Entwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion .......................... 19
4.1.1. Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der Planungsregion Vorpommern .......... 19
4.1.2. Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der polnische Grenzregion ...................... 21
4.1.3. Resümee zur wirtschaftlichen Entwicklung ............................................................... 24
4.2. Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklung ............................................................ 25
4.2.1. Beschäftigungsentwicklung ....................................................................................... 25
4.2.2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit ............................................................................... 31
4.2.3. Resümee zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklung................................... 34
4.3. Einflüsse der regionalen Entwicklung auf die Beschäftigtensituation und die Lohn- und
Gehaltssituation ....................................................................................................................... 34
5. Verflechtungsbeziehungen und Potenzialbestimmung ............................................. 37
5.1. Verflechtungen auf administrativer Ebene ................................................................... 38
5.2. Wirtschaftliche Verflechtungen .................................................................................... 42
5.3. Kulturelle Verflechtungen ............................................................................................. 46
5.4. Verflechtungen im Bereich Bildung und Ausbildung .................................................... 46
5.5. Stand und Entwicklung grenzüberschreitender Verflechtungen .................................. 49
6. Zusammenfassung ................................................................................................... 52
7. Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................ 56
Wilke, Maack und Partner
4
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Deutsch-polnische Grenzregion ............................................................................ 8
Abbildung 2: Personen im nicht erwerbsfähigen Alter (0-17Jahre) nach Subregionen in
Westpommern ......................................................................................................................... 15
Abbildung 3: Personen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) nach Subregionen in
Westpommern ......................................................................................................................... 15
Abbildung 4: Personen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter (Frauen ab 60 Jahre; Männer ab
65 Jahre) nach Subregionen in Westpommern........................................................................ 15
Abbildung 5: Prognose Bevölkerungsentwicklung Westpommern bis 2035 ........................... 15
Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion
Veränderungen in % im Zeitraum 2004-2008 .......................................................................... 16
Abbildung 7: Beschäftigungsveränderung in der Grenzregion von 2000 bis 2004 .................. 26
Abbildung 8: Beschäftigungsveränderung in der Grenzregion von 2004 bis 2008 .................. 28
Abbildung 9: Lohn- und Gehaltsindex polnische Grenzregion (2002-2008) ............................ 36
Abbildung 10: Standorte Deutscher Firmen mit Direktinvestitionen in Stettin und Umland . 42
Abbildung 11: Sonderwirtschaftszonen in Polen ..................................................................... 45
Abbildung 12: Kooperation und Integration in der deutsch-polnischen Grenzregion ............ 51
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bruttowertschöpfung der Planungsregion Vorpommern (2000 bis 2004) ............. 19
Tabelle 2: Bruttowertschöpfung der Planungsregion Vorpommern (2004 bis 2007) ............. 20
Tabelle 3: Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in der deutschen
Grenzregion (2000/2004/2007) ............................................................................................... 21
Tabelle 4: Bruttowertschöpfung der polnischen Landkreise (2000 bis 2004) ......................... 22
Tabelle 5: Bruttowertschöpfung der polnischen Landkreise (2004 bis 2008) ......................... 23
Tabelle 6: Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in der polnischen
Grenzregion (2000/2004/2007) ............................................................................................... 23
Tabelle 7: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2000 bis 2004) 26
Tabelle 8: Beschäftigungsentwicklung in den polnischen Landkreisen (2000 bis 2004) ......... 27
Tabelle 9: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2004 bis 2008) 28
Tabelle 10: Beschäftigungsentwicklung in den polnischen Landkreisen (2004 bis 2008) ....... 29
Wilke, Maack und Partner
5
Tabelle 11: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2008 bis 2009)
.................................................................................................................................................. 30
Tabelle 12: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2000 bis
2004) ......................................................................................................................................... 32
Tabelle 13: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2004 bis
2008) ......................................................................................................................................... 32
Tabelle 14: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2008 bis
2009) ......................................................................................................................................... 33
Tabelle 15: Entwicklung der Arbeitslosenzahl der polnischen Landkreise (2000 bis 2004) .... 33
Tabelle 16: Entwicklung der Arbeitslosenzahl der polnischen Landkreise (2004 bis 2008) .... 34
Tabelle 17: Bruttolöhne und -gehälter je ArbeitnehmerIn in ausgewählten
Wirtschaftsbereichen (Mecklenburg-Vorpommern) ............................................................... 35
Tabelle 18: Übersicht deutsche Firmen mit Direktinvestitionen in Stettin und Umland nach
Standorten und Branche .......................................................................................................... 43
Wilke, Maack und Partner
6
1. Einleitung
1.1. Untersuchungsrahmen
In den Jahren 2003 und 2004 wurde unter Berücksichtigung der besonderen geographischen
Lage Stettins (Szczecin) im Rahmen der Studie „Wachstumspol Stettin“1 eine
soziökonomische Potentialanalyse zu den Entwicklungsperspektiven der deutsch-polnischen
Grenzregion Pomerania durchgeführt und Handlungsempfehlungen herausgearbeitet2.
Seither haben sich einige für die Region grundlegende Veränderungen ergeben: Polen ist
inzwischen der Europäischen Union beigetreten und die Grenze zwischen den
Nachbarländern Deutschland und Polen ist geöffnet. Im Zuge dieser EU-Osterweiterung und
der Grenzöffnung zu Polen wurde die periphere Lage der Planungsregion Vorpommern
innerhalb der Europäischen Union aufgelöst.
Gleichzeitig sind die Hoffnungen, die in Stettin als Entwicklungsmotor der Region gesetzt
werden, vielfältiger geworden. Die Stadt soll ihre historisch bedingte Rolle als „natürliches
Zentrum“ der Grenzregion wieder einnehmen. Außerdem soll sie als international attraktiver
Wirtschaftsstandort die ökonomische Entwicklung der Region vorantreiben. Stettins
Stadtpräsident ist 2007 mit der Vision angetreten, die Stadt in wenigen Jahren zur
„verbindenden Metropole“ zu machen, für welche die nahe Grenze keine Rolle mehr spielen
soll.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen sollen in der vorliegenden Untersuchung die
zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der Studie aus dem Jahr 2004 überprüft und
aktualisiert werden. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die Entwicklungen der Stadt
Stettin und ihre Ausstrahlung auf die Region.
Zentrales Ergebnis der Studie von 2004 war, dass es einen langfristig erfolgreichen
Wachstumspol Stettin hin zu einer Zentrumsregion nur in Kooperation mit der deutschen
und polnischen Umlandregion geben kann. Sowohl für die deutsche als auch für die
polnische Teilregion ist ein solcher Integrationsprozess ohne Alternative, wenn die Region
nicht weiter zu den ärmsten und strukturschwächsten Regionen der Europäischen Union
zählen will.
1 Klaus Maack, Martin Grundmann, Eckhard Voß u.a.: Wachstumspol Stettin und die Auswirkungen auf die Entwicklung der deutsch-polnischen Grenzregion, Edition der Hans-Böckler-Stiftung, 2005 2 Die Stadt Stettin (Szczecin) ist die Hauptstadt der Wojewodschaft Westpommern (Zachodniopomorskie) und liegt nur 12 km von der deutsch-polnischen Grenze im Nordwesten Polens - 130 km von Berlin, 450 km von Warschau und 250 km von der Öresundregion - entfernt.
Wilke, Maack und Partner
7
Die Studie aus dem Jahr 2004 bescheinigte der Stadt Stettin das Potenzial, die
Entwicklungsfähigkeit der gesamten Region (also sowohl auf polnischer als auch auf
deutscher Seite) befördern zu können. Ausschlaggebend dafür ist jedoch die Qualität der
grenzüberschreitenden Stadt-Umland-Kooperation. In der damaligen Studie wurden zwei
Entwicklungshypothesen aufgestellt:
o Ein Wachstumspol Stettin entsteht, wenn grenzüberschreitende
Kooperationsmöglichkeiten genutzt und die Verflechtungen innerhalb der
Grenzregion intensiviert werden (Integrationshypothese).
o Bleiben diese Verflechtungen aus, wird die deutsch-polnische Grenzregion von
Entwicklungen der Stadt Stettin nicht profitieren und lediglich zur Transitregion für
die Achse Berlin-Stettin-Öresund. Umgekehrt wird die Stadt Stettin ohne das
deutsch-polnische Umland keine Zentrumsrolle in der Region einnehmen
(Übersprungs- oder Transithypothese).
Um aufzuzeigen, in welche Richtung sich die deutsch-polnische Grenzregion seit 2004
entwickelt hat, nimmt die vorliegende Untersuchung ausgewählte soziostrukturelle und
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Veränderungen der Region ins Blickfeld. Außerdem
werden grenzüberschreitende Kooperationen aus unterschiedlichen Bereichen exemplarisch
vorgestellt und dahingehend analysiert, inwieweit sie zur Integration der deutsch-polnischen
Grenzregion beitragen. Die nachfolgende Aktualisierung (up-date) ausgewählter Aspekte der
Studie aus dem Jahr 2004 wird im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung und mit Unterstützung
des DBG Bezirks Nord durchgeführt.
1.2. Die deutsch-polnische Grenzregion
Der in dieser Aktualisierung untersuchte Teil der deutsch-polnische Grenzregion, liegt im
Gebiet der Euroregion Pomerania, ist aber nicht identisch mit dieser. Die Euroregion
Pomerania umfasst neben den östlichen Landkreisen von Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg die ganze Wojewodschaft Zachodniopomorskie (im folgenden Wojewodschaft
Westpommern) und die südschwedische Region Skåne. Für die vorliegende Untersuchung
wurde die deutsch-polnisch Grenzregionen wie folgt eingegrenzt:
• Der deutsche Teil der Untersuchungsregion umfasst die Planungsregion Vorpommern,
bestehend aus den Landkreisen Nordvorpommern, Ostvorpommern, Rügen und Uecker-
Randow sowie den kreisfeien Städten Stralsund und Greifswald. Die Entwicklungen in
Wilke, Maack und Partner
8
den brandenburgischen Landkreise Barnim und Uckermark wurden in der Aktualisierung
nicht berücksichtigt (siehe Abb.1).
• Zum polnischen Teil der Grenzregion gehören neben der Stadt Szczecin (im Folgenden
Stettin) die Subregionen Szczeciński und Stargardzki. Die beiden Subregionen umfassen
das direkte Stettiner Umland und bilden den westlichen Teil der Wojewodschaft
Westpommern. Der östliche Teil Westpommerns, die Subregion Koszaliński, wird nicht in
die Untersuchungen mit einbezogen. Einzelne Kreise in der Wojewodschaft bilden die
Subregionen, die für sich genommen keine administrativen Einheiten sind. Die Ebenen
der Subregionen sind statistisch gut erfasst und eignen sich daher als Basis für die
Untersuchung (siehe Abb.1).
Abbildung 1: Deutsch-polnische Grenzregion
Szczecin
SubregionSzczeciński
PlanungsregionVorpommern
Subregion Stargardzki
Rügen
Stralsund
Greifswald
Nord-vorpommern
Ost-vorpommern
Uecker-Randow
Mecklenburg-Vorpommern
Wojewodschaft
Zachodniopomorskie
Brandenburg
Subregion
Koszaliński
Quelle: Eigene Darstellung Wilke Maack und Partner
Wilke, Maack und Partner
9
2. Allgemeine Entwicklungen seit 2004
2.1. Veränderte Rahmenbedingungen – Polen ist EU-Mitglied
Polen ist mit dem Beitritt am 1. Mai 2004 sowohl stimmberechtigtes Mitglied der
Europäischen Union als auch Teil des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes geworden.
Damit gelten grundsätzlich auch für Polen die Prinzipien des freien Waren-, Personen-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs innerhalb der Europäischen Union. Allerdings muss hier
differenziert werden, zwischen Regelungen, die schon vorher oder seit dem Zeitpunkt des
Beitritts greifen und solchen, die derzeit noch als Übergangsbestimmungen gültig sind.
Der uneingeschränkte Handel zwischen Polen und den alten Mitgliedsländern wurde bereits
mit dem Europaabkommen von 1994 zu großen Teilen eingeführt und im Zuge des EU-
Beitritts vollständig umgesetzt. Zölle, Abgaben und sonstige den Handel beschränkende
Maßnahmen sind seither zugunsten des freien Warenverkehrs verboten. Die Einführung der
vollen Personenfreizügigkeit ermöglicht es seit 2004 allen polnischen Staatsbürgern, sich
ungehindert auf dem Gebiet der Mitgliedsstaaten zu bewegen.
Langfristig wird das auch für die ArbeitnehmerInnen aller Mitgliedsländer gelten. Die
Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit wird allerdings begleitet von der Angst vor
„Billigkonkurrenz“ und Befürchtungen, der Zustrom von Beschäftigten des Nachbarlandes
könnte sich negativ auf den eigenen Arbeitsmarkt auswirken. Deutschland nutzt daher bis
2011 die Möglichkeit zur Beschränkung der Freizügigkeit für polnische ArbeitnehmerInnen,
indem es die jeweiligen nationalen Regelungen vorerst beibehält. Polen verwendete die
Übergangsregelung nur in den ersten drei Jahren nach dem Beitritt reziprok. Seit 2007
allerdings verzichtet Polen auf diese Gegenseitigkeitsklausel und öffnete seinen Arbeitsmarkt
uneingeschränkt für ArbeitnehmerInnen aus allen EU-Ländern.
Eine ähnliche Form des Übergangs regelt die Umsetzung der Dienstleistungsfreiheit. Die
Dienstleistungsfreiheit beinhaltet das Recht, als Selbstständiger vorübergehende,
grenzüberschreitende Dienstleistungen zu erbringen oder durch MitarbeiterInnen erbringen
zu lassen (z.B. Reparaturen, Taxifahrten etc.) bzw. Dienstleistungen aus einem anderen
Mitgliedsland zu empfangen. Die Niederlassung des Anbieters bleibt dabei im Heimatland3.
Deutschland hat für bestimmte sogenannte „sensible Gewerbe“ (Bausektor,
Gebäudereiniger, Innendekorateure) die Dienstleistungsfreiheit beschränkt. Der Einsatz von
3 Darin unterscheidet sich die Dienstleistungsfreiheit von der Niederlassungsfreiheit.
Wilke, Maack und Partner
10
ArbeitnehmerInnen eines Dienstleisters dieser Branchen mit Sitz in Polen ist bis 2011 in
Deutschland nur beschränkt möglich.
2.2. Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Polen
Nach dem Beitritt zur EU erlebte die polnische Wirtschaft einen deutlichen
Wachstumsschub. Gestiegener Konsum und erhöhte Investitionsnachfragen führten zu
steigenden Wachstumsraten mit dem Höhepunkt von 6,6% Zuwachs des
Bruttoinlandprodukts (BIP) im Jahr 2007. Danach wurde Polen stärker von den Auswirkungen
der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen als von vielen Seiten erwartet.
Der polnische Złoty hat in den vergangenen Monaten stark an Wert gegenüber Dollar und
Euro verloren. Die geplante Übernahme der europäischen Gemeinschaftswährung im Jahre
2012 ist daher fraglich. Das Wachstum des BIP brach im Jahr 2009 auf etwa 1% ein und die
Prognosen für das laufende Jahr 2010 rechnen mit nicht mehr als 2% Wachstum4.
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern hat Polen als Reaktion auf die
Wirtschaftskrise kein staatliches Ausgaben- und Konjunkturprogramm aufgelegt. Neben
Kredithilfen und Steuererleichterungen für Unternehmen soll ein stärker liberalisierter
Arbeitsmarkt die negativsten Auswirkungen der Wirtschaftskrise abfangen. Gleichzeitig soll
mit einem umfassenden Sparprogramm ein Anstieg der Staatsverschuldung vermieden
werden5.
Eine wichtige Säule des wirtschaftlichen Aufschwungs Polens in den Jahren 2004 bis 2009
war die Verfügbarkeit von EU-Mitteln. Bis Ende 2008 erhielt Polen (bei einer
Haushaltsbeteiligung von 12,5 Mrd.€) insgesamt 26,5 Mrd.€ von der EU.
Eine weitere Säule des polnischen Aufschwungs der letzten Jahre waren die ausländischen
Direktinvestitionen. Der Beitritt ging einher mit gesamtwirtschaftlicher Stabilität und einer
gewachsenen Attraktivität des Landes für Investoren. Im Jahr 2007 wurde der Rekordwert
von 16,6Mrd.€ an ausländischen Direktinvestitionen in Polen erreicht. Nach Angaben der
Polnischen Nationalbank waren 2009 die ausländischen Direktinvestitionen in Polen im Zuge
der Finanzkrise bereits um rund 53% auf 7,7 Mrd.€ zurückgegangen. Der Größte Anteil
davon mit rund 16,2% stammte 2009 aus Deutschland6.
4 Vgl. Sachverständigenrat 2009, S.44 5 Polen versucht mit dieser Politik in erster Linie die Defizitkriterien der EU einzuhalten, um 2012 die Einführung des Euro nicht zu gefährden. 6 Vgl. Website PAIZ [1] Foreign Direct Investments in Poland
Wilke, Maack und Partner
11
Der Boom der polnischen Wirtschaft in den ersten Jahren nach dem EU-Beitritt hatte
Auswirkungen auf den polnischen Arbeitsmarkt. Zwischen 2003 und 2008 wuchs die
Arbeitsproduktivität in Polen von 31,21 PLN auf 41,57 PLN pro Stunde. Das entsprach 2008
51% des Durchschnitts-Wertes der EU-15 Länder, gegenüber noch 43% im Jahr 2003. Die
Erwerbsquote stieg und die Zahl der Arbeitslosen ging zurück. Die Arbeitslosenquote, die
2003 noch bei rund 20% lag, sank bis 2008 um mehr als die Hälfte auf etwa 7%. Durch die
zeitlich verzögerten Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt wird für 2010
ein erneuter Anstieg der Arbeitslosenquote auf etwa 10% erwartet7.
Wesentlich für diese Entwicklung war eine Welle der Migration polnischer
ArbeitnehmerInnen in verschiedene europäische Länder. In den Jahren zwischen 2004 und
2007 wuchs die Zahl der im europäischen Ausland beschäftigten Polen von 1 Million auf 2,3
Millionen. Die meisten polnischen ArbeitnehmerInnen arbeiteten in dieser Zeit in
Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden und Italien. Mit Beginn der
Wirtschaftskrise 2007 stagnierte die Zahl der Abwanderungen zunächst, bis 2008/2009
schließlich eine wachsende Zahl von ArbeitnehmerInnen, vor allem aus Großbritannien und
Irland, nach Polen zurückkehrte8.
Die Arbeitsmigration trug dazu bei, dass die Arbeitslosenquote zurückging. Der Umstand,
dass eine große Zahl an Polen das Land in Richtung europäisches Ausland verließ, führte
einerseits zu einer verbesserten Einkommenssituation der polnischen Haushalte und zum
Anstieg des Lohnniveaus; andererseits auch zu neuen Formen prekärer Erwerbsbiographien
und zu einem Problem für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft, da in hohem Maße
gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen an das Ausland verloren gingen (vor allem im
Gesundheits- und Pflegebereich).
In den ersten vier Jahren nach dem Beitritt gab es in Polen einen nominalen Anstieg der
Löhne um 58%. Der wirtschaftliche Aufschwung, der Anstieg der Direktinvestitionen und
eine wachsende Nachfrage nach Arbeitskräften beschleunigten den allgemeinen
Lohnanpassungsprozess von Polen und anderen Mitgliedstaaten. Die ausgeprägte
Arbeitsmigration führte vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen zu einem
„Arbeitskräftewettbewerb“ und in vielen Branchen zu einem wachsenden Lohndruck auf die
Arbeitgeber.
7 Vgl. Office of the Committee for European Integration (OCEI) 2009, S. 14-30 8 Vgl. Office of the Committee for European Integration (OCEI) 2009, S. 16-17
Wilke, Maack und Partner
12
Neben dem Beitritt zur Europäischen Union gab es in den letzten Jahren eine Reihe weiterer
Faktoren, die Auswirkungen auf die Entwicklung des polnischen Arbeitsmarktes hatten. Trotz
regional erheblicher Unterschiede ist der polnische Arbeitsmarkt insgesamt gekennzeichnet
von einem strukturellen „Mismatch“ zwischen Arbeitskräfteangebot und Nachfrage. Einer
nach wie vor großen Zahl von Arbeitslosen steht eine extrem niedrige Erwerbsquote und in
einigen Wirtschaftsbereichen sogar ein Mangel an Arbeitskräften gegenüber.
Hinzu kommen hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine niedrige Erwerbsquote älterer
Menschen. Der demographische Wandel spielt in Polen eine gewichtige Rolle. Wie in vielen
anderen europäischen Ländern, wird auch in Polen in den kommenden Jahren die
Bevölkerung insgesamt älter werden, mit entsprechenden Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt und die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme9.
9 Vgl. Office of the Committee for European Integration (OCEI) 2009, S. 239ff.
Wilke, Maack und Partner
13
3. Charakteristische, soziostrukturelle Entwicklungen in der deutsch-
polnischen Grenzregion seit 2004
3.1. Demographische Entwicklung und Migration
3.1.1. Polnische Grenzregion
In der Wojewodschaft Westpommern lebten 2009 insgesamt rund 1,694 Mio. Menschen,
wovon knapp zwei Drittel in den zur Grenzregion zugehörigen Subregionen Stargardzki,
Szczeciński und Stettin wohnen. Die Wojewodschaft hatte in den vergangenen Jahren einen
Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen, der etwa dem durchschnittlichen
Bevölkerungsrückgang Gesamt-Polens entspricht (-0,29% bzw. –0,31%, 2000-2008)10.
Stettin ist mit über 400.000 Einwohnern das größte urbane Zentrum der Region. Im direkt
angrenzenden polnischen Umland befinden sich die deutlich kleineren Städte Goleniow,
Gryfino (jeweils ca. 20.000 Einwohner), Police (ca. 35.000 Einwohnern), Swinoujscie (ca.
40.000 Einwohner) und Stargard Szczeciński mit ca. 70.000 Einwohnern.
Innerhalb der Wojewodschaft hat die Stadt Stettin im Zeitraum 2000-2008 die meisten
Einwohner verloren. Im Jahr 2008 lebten rund 407.000 Menschen in Stettin. Seit 2000 hat
sich damit die Zahl der Bewohner um knapp 10.000 Einwohner (-2,33%) reduziert. Die
starken Wanderungsbewegungen der polnischen ArbeitnehmerInnen ins europäische
Ausland können dafür nur bedingt zur Erklärung herangezogen werden, da es sich dabei
vermutlich meist um temporäre Aufenthalte handelt (bis zu drei Monaten), die Personen
also oft im Heimatland gemeldet bleiben. Auffälliger sind die Stadt-Umland-Wanderungen
der letzten Jahre. Während Stettin den größten Bevölkerungsverlust hinnehmen musste,
haben die direkt angrenzenden Umlandregionen Szczeciński und Stagardzki einen leichten
Zuwachs an Einwohnern zwischen 2000 und 2008 zu verzeichnen. Die Anzahl an Personen,
die von Stettin in ländliche Regionen Westpommerns gezogen sind, hat sich zwischen 2000
und 2008 um zwei Drittel erhöht11.
Der Trend einer alternden Bevölkerungsstruktur in der polnischen Grenzregion war in den
letzten Jahren anhaltend. Die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung in Westpommern
gehen bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2002 von einem Bevölkerungsverlust von ca. 1,3% aus,
mit einem anhaltend negativen Trend bis zum Jahr 2035 (siehe Abb.5). Während die Zahl der
10 Vgl. Statistisches Amt Stettin- Onlinedatenbank, Population and Vital Statistics, Februar 2010 11 Vgl. Statistisches Amt Stettin- Onlinedatenbank, Internal and Foreign Migrations, Februar 2010
Wilke, Maack und Partner
14
jüngeren Personen im noch nicht erwerbsfähigen Alter (0-17 Jahre) seit 2000 in allen
Teilregionen zurückgegangen ist (siehe Abb.2), ist die Zahl der Einwohner im erwerbsfähigen
und post-erwerbsfähigen Alter (ab 60 bei Frauen, ab 65 bei Männern) angestiegen (siehe
Abb.3). Grund dafür sind geburtenstarke Jahrgänge, die derzeit vor allem in den
Altersklassen 25 bis 35 Jahre zu finden sind12. Gleichzeitig macht sich bei der Anzahl der
Geburten in den Subregionen Westpommerns ein Umkehrtrend bemerkbar. Nach
rückläufigen Zahlen in den Jahren zuvor, steigt seit 2004 die Anzahl der Geburten in
Stargardzki, Szczeciński und Koszalinski erstmals wieder an. In Stettin setzte dieser Trend
sogar ein Jahr früher ein und verzeichnete mit einem Anstieg von 29% die größte
prozentuale Veränderung zwischen 2002 und 2008 – allerdings absolut gesehen auf
niedrigerem Niveau13.
Die Zahl der Personen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter nimmt in allen Subregionen
Westpommerns in den letzten Jahren kontinuierlich zu (siehe Abb.4). Lag ihr Anteil
beispielsweise in Stettin im Jahr 2002 noch bei 24,5% der Erwerbsfähigen war er im Jahr
2008 auf 27% angestiegen. Der Anteil Älterer im Vergleich zu den Personen im
erwerbsfähigen Alter liegt in der Wojewodschaft Westpommern dennoch unter dem
polnischen Durchschnitt. Westpommern gehört zu den Wojewodschaften in Polen mit dem
höchsten prozentualen Anteil von Personen im erwerbsfähigen Alter an der
Gesamtbevölkerung.
Das Qualifikationsniveau der Bevölkerung in Westpommern liegt gemessen am Anteil der
Personen mit einem hochschulberechtigenden Schulabschluss im Mittelfeld der polnischen
Wojewodschaften. Im Jahr 2008 betrug der Anteil der Bewohner mit höherer Schulbildung in
Westpommern 462 je 10.000 Einwohnern (Gesamtpolen: 501 je 10 Tsd. €)14.
Entsprechend der im europäischen Vergleich insgesamt hohen Studierendenquote in Polen
verfügt auch Stettin mit rund 60.000 (an öffentlichen und privaten Hochschulen) über eine
große Anzahl an Studenten; zum Vergleich: Hamburg hat knapp 70.000 Studierende.
Allerdings nimmt die Zahl der Studierenden in Stettin, nach einem kurzen
12 Vgl. Statistisches Jahrbuch Stettin 2008, S.73 13 Vgl. Statistisches Amt Stettin- Onlinedatenbank, Population and Vital Statistics, Februar 2010 14 Vgl.Statistisches Amt Stettin- Onlinedatenbank, Higher school students per 10 thousand capita, Februar 2010
Wilke, Maack und Partner
15
1.520.000
1.540.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
1.640.000
1.660.000
1.680.000
1.700.000
1.720.000
2000 2004 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035
*Prognose
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Koszaliński Stargardzki Szczecin Szczeciński
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Koszaliński Stargardzki Szczecin Szczeciński
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Koszaliński Stargardzki Szczecin Szczeciński
Abbildung 2: Personen
im nicht erwerbsfähigen
Alter (0-17Jahre) nach
Subregionen in
Westpommern
Quelle: Daten Statistisches Amt
Stettin; eigene Darstellung Wilke
Maack und Partner
Abbildung 3: Personen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) nach Subregionen in Westpommern
Quelle: Daten Statistisches Amt
Stettin; eigene Darstellung Wilke
Maack und Partner
Abbildung 4: Personen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter (Frauen ab 60 Jahre; Männer ab 65 Jahre) nach Subregionen in Westpommern
Quelle: Daten Statistisches Amt
Stettin; eigene Darstellung Wilke
Maack und Partner
Abbildung 5: Prognose Bevölkerungsentwicklung Westpommern bis 2035
Quelle: Daten und Prognose
Statistisches Amt Stettin; eigene
Darstellung Wilke Maack und
Partner
Wilke, Maack und Partner
16
Anstieg im Jahr 2004, kontinuierlich ab15. Ein wesentlicher Grund dafür sind die seit dem EU-
Beitritt erleichterten Studienmöglichkeiten für polnische Studenten im europäischen
Ausland.
Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion
Veränderungen in % im Zeitraum 2004-2008
Szczecin -1,2%
SubregionSzczeciński+2,1%
PlanungsregionVorpommern
-3,6%
Mecklenburg-
Vorpommern -3,2%
(Deutschland -0,6%)
Zachodnio-
pomorskie-0,1%
(Polen -0,1%)
Subregion Stargardzki-0,5%
Rügen-4,6%
Stralsund-1,7% Greifswald
+2,8%
Nord-vorpommern
-5,2%
Ost-vorpommern
-1,7%
Uecker-Randow
-5,8%
Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, April 2010, eigene
Darstellung Wilke Maack und Partner
3.1.2. Planungsregion Vorpommern
Die Landkreise der Planungsregion Vorpommern sind schwach besiedelt und durch einen
hohen Anteil an landwirtschaftlichen Nutzflächen stark ländlich geprägt. Im Jahr 2009 lebten
ca. 466.000 Menschen in der Planungsregion Vorpommern. In den kreisfreien Städten der
Planungsregion Stralsund und Greifswald leben ca. 60.000 Einwohner bzw. 53.000
Einwohner. 15 Vgl.Statistisches Amt Stettin- Onlinedatenbank, Higher school students per 10 thousand capita, Februar 2010
Wilke, Maack und Partner
17
Bevölkerungsrückgänge waren im Zeitraum 2000-2009 in allen Teilregionen der deutschen
Grenzregion zu beobachten. Der Rückgang im Zeitraum 2004-2008 verlief in Vorpommern
geringfügig schwächer als im Zeitraum 2000-2004. 2009 stieg der Rückgang im Vergleich zum
Vorjahr wieder an. Die Bevölkerung der Planungsregion Vorpommern ist zwischen 2004 und
2008 um rund 3,6% geschrumpft (siehe Abb.6).
Der Bevölkerungsrückgang in den Landkreisen der deutschen Grenzregion wird sowohl von
einer natürlichen Bevölkerungsbewegung durch niedrige Geburtenraten, als auch von
Wanderungsbewegungen über die Regionsgrenzen hinweg bestimmt.
Vor allem in der Altersklasse 25 bis unter 30 Jahre sind die Wanderungssalden in den
Landkreisen der Planungsregion Vorpommerns als auch den Kreisfreien Städten Greifswald
und Stralsund durchweg negativ16. Der Trend zur Abwanderung junger, vor allem
hochqualifizierter Menschen (davon rund 60 % Frauen), aus der deutschen Grenzregion hielt
also auch in den letzten Jahren an. Vor allem Unternehmen der Tourismusbranche und des
Verarbeitenden Gewerbes in der Grenzregion beklagen einen zunehmenden
Fachkräftemangel17.
Die Prognosen des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern zur
Bevölkerungsentwicklung gehen bis 2020 von keiner signifikanten Veränderungen bei den
Zu-und Fortzügen über nationale Grenzen hinaus aus. Durch die vollständige Umsetzung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit wird mit einem Anstieg der Zuzüge aus dem Ausland um etwa
10% gerechnet, was derzeit etwa einem Anstieg um 500 Personen pro Jahr entspricht18.
Anders bei den Wanderungsbewegungen zwischen den Bundesländern: Ab 2015 werden die
Zuzüge die Fortzüge über die Mecklenburg-Vorpommerschen Landesgrenzen hinweg
erstmalig wieder übersteigen - zum einen, weil die geburtenstärkeren Jahrgänge dann nicht
mehr zu den besonders wanderfähigen Altersklassen der 18-30 Jährigen gehören - zum
anderen, weil bei unveränderter Nachfrage nach jungen Arbeitskräften ein wesentliches
Motiv für Abwanderung, nämlich das Fehlen eines Ausbildungsplatzes, deutlich
abgeschwächt sein wird19. Allerding sorgt laut Prognose eine weiterhin rückläufige natürliche
Bevölkerungsentwicklung dafür, dass die Zahl der Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern
16 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern Online-Datenbank, Februar 2010 17 Vgl. dazu etwa Fachkräfteinitiative der IHK Neubrandenburg 18 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Statistisches Heft 2009, S.2 19 Vgl. Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Statistisches Heft 2009, S.47
Wilke, Maack und Partner
18
dennoch bis 2020 im Vergleich zu 2002 um ca. 14% zurückgehen wird20. Alle Landkreise der
deutschen Grenzregion, mit Ausnahme der Stadt Greifswald, werden in den kommenden
Jahren weiter Einwohner verlieren und in ihrer Altersstruktur älter werden.
3.2. Pendleraufkommen
Das Pendleraufkommen in der Grenzregion ist von Polen nach Deutschland höher als
umgekehrt, wenn auch insgesamt nur auf sehr niedrigem Niveau. Es ist davon auszugehen,
dass der grenzüberschreitende Pendlerverkehr seit der Grenzöffnung zugenommen hat,
genaue Zahlen existieren allerding nicht. Beispielsweise pendeln nach Expertenmeinung
schätzungsweise etwa 1.000 Polen zum Arbeiten in den Landkreis Uecker-Randow.
Deutsche, die in Stettin und der polnischen Grenzregion arbeiten sind nach wie vor
Einzelfälle. Gleichzeitig war in den letzten Jahren zu beobachten, dass aufgrund niedrigerer
Immobilien- und Mietpreise vermehrt Polen in den deutschen Teil des Stettiner Umlandes
gezogen sind und zum arbeiten nach Stettin einpendeln. Die Zahl der Polen, die sich seit
2004 im deutschen Grenzraum niedergelassen haben wird auf 1.200-1.500 geschätzt.
20 Vgl. Europäischer Sozialfonds (ESF) 2007, S.10
Wilke, Maack und Partner
19
4. Wirtschaftskraft-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung
4.1. Wirtschaftliche Entwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion
4.1.1. Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der Planungsregion Vorpommern
Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung21 wird im Folgenden anhand der Zeiträume vor
(2000 bis 2004) und nach dem EU-Beitritt Polens (2004 bis 2007) beschrieben. Im Zeitraum
von 2000 bis 2004 ist die Bruttowertschöpfung in der Planungsregion Vorpommern um 6,0%
gestiegen und lag damit nur leicht unterhalb des Landesdurchschnitts Mecklenburg-
Vorpommerns (6,4%). Ausschlaggebend für die im Landesvergleich unterdurchschnittliche
Entwicklung war der starke Rückgang der Bruttowertschöpfung im Landkreis Uecker-Randow
(-7,1%) (siehe Tab.1).
Tabelle 1: Bruttowertschöpfung der Planungsregion Vorpommern (2000 bis 2004)
Quelle: Daten Statistische Ämter des Bundes und der Länder, April 2010, eigene Darstellung Wilke, Maack und
Partner
Im Zeitraum von 2004 bis 2007 nahm sowohl in der Planungsregion als auch in Mecklenburg-
Vorpommern die Wachstumsdynamik der Bruttowertschöpfung deutlich zu (siehe Tab.2).
Lag in den Jahren von 2000 bis 2004 das Wachstum der Bruttowertschöpfung in der
Planungsregion Vorpommern im Durchschnitt bei rund 1,5% p.a., und damit unterhalb des
durchschnittlichen bundesweiten Wachstums (rund 1,9% p.a.), so stieg die Wachstumsrate
zwischen 2004 und 2007 auf durchschnittlich rund 3,2% p.a. und lag damit um rund 0,3 %-
Punkte über dem bundesweiten Durchschnitt der Jahre. Diese überdurchschnittliche
21 Die Bruttowertschöpfung umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes für einen bestimmten Zeitraum erbrachte wirtschaftliche Leistung. Sie dient als zusammenfassende Leistungsgröße, mit der die wirtschaftliche Leistung aller Wirtschaftsbereiche gleichermaßen gemessen werden kann. Das Statistische Amt bemisst die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, d.h. Gütersteuern und Gütersubventionen werden nicht berücksichtigt. Bruttowertschöpfung = Produktionswert – Vorleistungen; Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/abisz/BIP,templateId=renderPrint.psml
Region2000
(in Mio. €)
2001
(in Mio. €)
2002
(in Mio. €)
2003
(in Mio. €) 2004
(in Mio. €)
Veränderung
2000 bis 2004
Greifswald 919.974 938.551 968.190 1.014.798 1.027.751 11,7%
Stralsund 1.139.167 1.123.492 1.181.100 1.179.109 1.240.592 8,9% Nordvorpommern 1.310.633 1.310.895 1.332.550 1.357.929 1.401.193 6,9% Ostvorpommern 1.329.331 1.385.752 1.394.736 1.378.077 1.395.671 5,0% Rügen 986.028 1.058.605 1.084.439 1.090.693 1.104.321 12,0%
Uecker-Randow 1.111.928 1.094.407 1.062.072 1.029.364 1.032.839 -7,1% Planungsregion Vorpommern 6.797.061 6.911.702 7.023.087 7.049.970 7.202.367 6,0%
Mecklenburg-Vorpommern 27.053.735 27.630.546 27.852.454 28.035.126 28.776.716 6,4%
Deutschland 1.856.200.000 1.904.490.000 1.933.190.000 1.949.410.000 1.998.360.000 7,7%
Wilke, Maack und Partner
20
Wachstumsrate konzentriert sich allerdings auf das Jahr 2007 mit einem Wachstum der
Bruttowertschöpfung in der Planungsregion Vorpommern von rund 6,3%, wobei besonders
die Entwicklungen in den Städten Greifswald und Stralsund sowie im Landkreis Uecker-
Randow hervorstechen. Das Wachstum der Bruttowertschöpfung in der Planungsregion lag
damit 2007 auch deutlich über dem des Landes Mecklenburg-Vorpommern insgesamt.
Erheblich an Dynamik verloren hat andererseits die Entwicklung der Bruttowertschöpfung im
Landkreis Rügen, der die herausragende Wachstumsdynamik des Jahres 2001 in den
Folgejahre nicht wieder erreicht hat.
Tabelle 2: Bruttowertschöpfung der Planungsregion Vorpommern (2004 bis 2007)
Region2004
(in Mio. €)
2005(in Mio. €)
2006(in Mio. €)
2007(in Mio. €)
Veränderung
2004 bis 2007
Greifswald 1.027.751 1.093.097 1.136.746 1.225.205 19,2%
Stralsund 1.240.592 1.249.275 1.280.476 1.381.093 11,3%
Nordvorpommern 1.401.193 1.379.676 1.442.241 1.534.810 9,5%
Ostvorpommern 1.395.671 1.363.842 1.408.230 1.461.064 4,7%
Rügen 1.104.321 1.140.748 1.115.993 1.163.026 5,3%
Uecker-Randow 1.032.839 1.024.017 1.038.807 1.123.063 8,7%
Planungsregion Vorpommern 7.202.367 7.250.655 7.422.493 7.888.261 9,5%
Mecklenburg-Vorpommern 28.776.716 28.990.099 29.717.021 31.168.737 8,3%
Deutschland 1.998.360.000 2.024.890.000 2.093.300.000 2.171.210.000 8,6% Quelle: Daten Statistische Ämter des Bundes und der Länder, April 2010, eigene Darstellung Wilke Maack und
Partner Die Bruttowertschöpfung unterteilt nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen wie
„Verarbeitendes Gewerbe“, „Baugewerbe“, „Handel, Gastgewerbe und Verkehr“ sowie
„öffentliche und private Dienstleistungen“ bietet erste Hinweise hinsichtlich der
strukturellen Veränderung in der Grenzregion. In der Planungsregion Vorpommern ist im
Zeitraum von 2000 bis 2004 die insgesamt schwache Entwicklung der Bruttowertschöpfung
u.a. auf einen stark rückläufigen Anteil der Bauwirtschaft zurückzuführen. Deutlich
zugenommen hat der Anteil der privaten, unternehmensorientierten Dienstleistungen (siehe
Tab.3).
Eine abweichende Entwicklung zeigt sich im Zeitraum von 2004 bis 2007. Während die
Anteile Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie öffentliche und private Dienstleistungen an
der Bruttowertschöpfung weitgehend stagnieren, wächst der Anteil des Verarbeitenden
Gewerbes überdurchschnittlich um fast 2 %-Punkte – allerdings von einem sehr niedrigen
Niveau ausgehend (siehe Tab.3).
Wilke, Maack und Partner
21
Tabelle 3: Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in der
deutschen Grenzregion (2000/2004/2007)
Ausgewählte Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in Prozent
2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007
Greifswald 6,7 7,2 15,2 6,1 3,0 2,8 17,2 15,5 15,7 67,2 71,8 64,1
Stralsund 6,3 5,9 7,1 6,3 4,0 3,8 21,9 20,1 19,6 62,8 66,9 66,9
Nordvorpommern 4,8 5,4 5,5 12,8 8,6 7,6 18,1 18,1 18,5 54,2 58,7 62,2
Ostvorpommern 8,4 8,0 7,5 8,4 5,5 5,6 21,2 22,8 23,0 52,6 56,2 58,2
Rügen 3,3 4,3 4,2 7,6 4,7 4,5 32,2 31,7 34,0 48,6 52,6 49,8
Uecker-Randow 3,5 3,5 7,1 8,8 5,5 5,5 14,2 13,9 11,4 65,9 70,2 71,3
Planungsreg. Vorp. 5,6 5,8 7,7 8,5 5,4 5,1 20,6 20,5 20,4 58,2 62,2 62,0
Mecklenburg-Vorp. 9,5 10,0 12,6 8,8 5,9 5,6 20,1 20,1 19,5 55,0 57,8 57,5
Deutschland 22,9 22,6 23,9 5,2 4,2 4,0 18,2 17,7 17,6 50,3 52,0 51,1
Verarbei tendes Gewerbe BaugewerbeHandel , Gastgewerbe
und Verkehr
Öffentl iche und private
Dienstlei s tungsbereiche
(inkl . unternehmensorienter
DL)
Quelle: Daten Statistische Ämter des Bundes und der Länder, April 2010, eigene Darstellung Wilke, Maack und
Partner
Eine Schlüsselbranche im Verarbeitenden Gewerbe in der Planungsregion ist die
Ernährungswirtschaft. Fast jeder dritte Betrieb im Verarbeitenden Gewerbe entfällt auf diese
Branche (in Mecklenburg-Vorpommern knapp jeder vierte Betrieb). Die Zahl der Betriebe hat
sich in der Planungsregion seit 2004 leicht erhöht. Allerdings deuten die nachfolgenden
Zahlen zur Entwicklung der Beschäftigung darauf hin, dass die Ernährungswirtschaft in der
Planungsregion voraussichtlich nicht die treibende Kraft des überdurchschnittlichen
Wachstums des Verarbeitenden Gewerbes gewesen ist.
Eine Interpretation der Zahlen dahingehend, dass die positive Entwicklung der
Bruttowertschöpfung in der Planungsregion Vorpommern durch die Nähe zu Polen bzw. die
Integration Polens in die EU zusätzliche Impulse bekommen hat, erscheint naheliegend, ist
aber nicht zu belegen. Unstrittig dürfte hingegen sein, dass die Region vom allgemeinen
wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und Europa sowie der erfolgreichen
Operationalisierung spezifischer Förderprogramme stark profitiert hat.
4.1.2. Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der polnische Grenzregion
Von 2000 bis 2004 ist die Bruttowertschöpfung in der polnischen Grenzregion um 8,7% bzw.
im Durchschnitt um rund 2,2% p.a. gewachsen22. Die gesamte Wojewodschaft
Westpommern weist für den gleichen Zeitraum ein Wachstum von 13,2%, also im
Durchschnitt 3,3% p.a. auf. Damit hat sich die Bruttowertschöpfung im grenznahen Teil
22 Die Bruttowertschöpfung wird auf polnischer Seite zu Marktpreisen und nicht, wie auf deutscher Seite, zu Herstellungspreisen ausgewiesen.
Wilke, Maack und Partner
22
Westpommerns schwächer entwickelt als im östliche Teil bzw. in der Wojewodschaft
insgesamt. Polen konnte von 2000 bis 2004 die Bruttowertschöpfung sogar um 24,1%
steigern, also im Durchschnitt um 6,1% p.a. (siehe Tab. 4). Auffällig ist, dass die Stadt Stettin
in diesem Vierjahreszeitraum in Summe keine positive Entwicklung der Bruttowertschöpfung
ausweisen konnte. Ausschlaggebend ist der Rückgang der Bruttowertschöpfung in Stettin im
Jahr 2003.
Tabelle 4: Bruttowertschöpfung der polnischen Landkreise (2000 bis 2004)
Region2000
(in Mio. €)
2001(in Mio. €)
2002(in Mio. €)
2003(in Mio. €)
2004(in Mio. €)
Veränderung
2000 bis 2004
Subregion Stargardzki 4.610 4.760 4.817 4.927 5.468 18,6%
Szczecin 11.474 11.362 11.649 11.201 11.503 0,3%
Subregion Szczeciński 5.176 5.432 5.493 5.618 6.137 18,6%
Polnische Grenzregion 21.260 21.554 21.959 21.746 23.108 8,7%
Woiwodschaft Westpommern 29.891 30.690 31.159 31.320 33.842 13,2%
Polen 662.224 695.255 715.072 744.357 821.665 24,1%
Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
In der Betrachtungsperiode 2004 bis 2007, also in der Zeit nach dem EU-Beitritt Polens, stellt
sich die Entwicklung anders dar (siehe Tab.5). In der grenznahen Region – d.h. in den
Subregionen Stargardzki, Szczeciński und Stadt Stettin – hat sich die Bruttowertschöpfung
deutlich verbessert, da Stettin mit einem Anstieg der Bruttowertschöpfung im Zeitraum von
2004 bis 2007 von 22,9%, also im Durchschnitt 7,6% p.a., stark aufgeholt hat. Mit 21,6% (im
Durchschnitt 7,2% p.a.) steigt die Bruttowertschöpfung in der polnischen Grenzregion
ähnlich wie in der Wojewodschaft Westpommern insgesamt. Ausschlaggebend ist das Jahr
2007, in dem die Grenzregion ein deutlich höheres Wachstum der Bruttowertschöpfung
realisiert hat als der Rest der westpommerschen Wojewodschaft. Im Jahr 2007 lag das
Wachstum der Bruttowertschöpfung mit 9,6% auch „nur“ noch um 0,9%-Punkte unter der
Wachstumsrate in Polen insgesamt.
Wilke, Maack und Partner
23
Tabelle 5: Bruttowertschöpfung der polnischen Landkreise (2004 bis 2008)
Region2004
(in Mio. €)
2005(in Mio. €)
2006(in Mio. €)
2007(in Mio. €)
Veränderung
2004 bis 2007
Subregion Stargardzki 5.468 5.685 5.851 6.497 18,8%
Szczecin 11.503 12.528 13.239 14.139 22,9%
Subregion Szczeciński 6.137 6.401 6.538 7.467 21,7%
Polnische Grenzregion 23.108 24.614 25.628 28.103 21,6%
Wojewodschaft Westpommern 33.842 35.712 37.674 41.033 21,2%
Polen 821.665 866.329 931.179 1.029.442 25,3% Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
In den ausgewählten Bereichen Industrie, Baugewerbe, Handel, Gastgewerbe und Verkehr
sowie öffentliche und private Dienstleistungen gab es in der polnischen Grenzregion im
Zeitraum von 2000 bis 2004, wie auch in Polen insgesamt, einen extrem starken Rückgang im
Anteil der Wertschöpfung der Bereiche Handel, Gastgewerbe und Verkehr (siehe Tab. 6).
Auch die Anteile von Industrie und Baugewerbe an der Bruttowertschöpfung waren
rückläufig. Dagegen war der Anteil der Dienstleistungen deutlich gestiegen. Nach dem EU-
Beitritt stieg der Anteil des Bereichs Handel, Gastgewerbe und Verkehr erneut an.
Überdurchschnittlich wuchs darüber hinaus das Baugewerbe. Die Wachstumsraten der
Industrie in der Grenzregion waren nur in Stargardzki überdurchschnittlich. Anders als in
Polen insgesamt stiegen weder in der polnischen Grenzregion noch in Westpommern
insgesamt die Anteile der privaten und öffentlichen Dienstleitungen weiter an.
Tabelle 6: Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in der
polnischen Grenzregion (2000/2004/2007)
2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007
Subregion Stargardzki 21,0 17,9 19,2 8,0 5,7 7,4 28,5 16,2 25,6 31,3 38,8 38,5
Szczecin 15,6 13,5 13,6 7,6 5,9 7,7 35,1 23,0 33,1 41,6 45,8 45,5
Subregion Szczeciński 28,5 28,8 27,5 6,6 5,4 6,5 29,3 13,4 28,3 28,4 32,8 32,8
Polnische Grenzregion 19,9 18,6 18,6 7,5 5,7 7,3 32,2 18,9 30,1 36,2 40,7 40,5
Wojewodschaft Westpommern 19,5 18,4 18,5 7,1 5,8 7,3 32,0 18,0 29,6 36,4 40,4 40,3
Polen 23,3 25,0 24,3 7,1 5,3 6,5 28,8 17,4 27,1 35,8 36,6 37,8
Industrie Baugewerbe
Handel,
Gastgewerbe
und Verkehr
Öffentl i che und priva te
Dienstleis tungsbereiche (inkl .
unternehmensorienter DL)
Ausgewählte Anteile einzelner Wirtschaftszweige an der Bruttowertschöpfung in Prozent
Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Wilke, Maack und Partner
24
4.1.3. Resümee zur wirtschaftlichen Entwicklung
Die Bruttowertschöpfung hat sich in der deutschen und der polnischen Grenzregion nach
dem EU-Beitritt Polens positiv entwickelt. Im Durchschnitt stieg die Bruttowertschöpfung in
der Planungsregion Vorpommern von 1,5% auf 3,2 % p.a. und in der polnischen Grenzregion
(Stettin, Stargardzki und Szczeciński) von 2,2% auf 7,2% p.a. im Zeitraum nach dem EU-
Beitritt Polens. Die Stadt Stettin auf der polnischen Seite und der Landkreis Uecker-Randow
auf der deutschen Seite verzeichneten die größte Dynamik nach 2004, jeweils nach
schwierigen Entwicklungsphasen in der Periode 2000 bis 2004. Allerdings blieb auf der
polnischen Seite die Entwicklung in der Grenzregion auch nach dem EU-Beitritt hinter den
gesamtpolnischen Wachstumsraten zurück, wenngleich der Abstand zu den
gesamtpolnischen Wachstumsraten insbesondere 2007 deutlich kleiner geworden ist.
In der Planungsregion Vorpommern ging ab 2004 die größte Dynamik in der Entwicklung der
Bruttowertschöpfung vom Verarbeitenden Gewerbe aus, allerdings von einem relativ
niedrigen Niveau ausgehend. In der polnischen Grenzregion konnten das Baugewerbe und
insbesondere die Bereiche Handel, Gastgewerbe und Verkehr überdurchschnittliche
Wachstumsraten in der Bruttowertschöpfung aufweisen. Der industrielle Bereich wuchs nur
in der Subregion Stargardzki überdurchschnittlich. Allerdings ist der Anteil der Industrie an
der Bruttowertschöpfung in der polnischen Grenzregion mit knapp 19% mehr als doppelt so
hoch wie in der Planungsregion Vorpommern, die nur einen Anteil an der
Bruttowertschöpfung von rund 8% (inklusive Produzierendes Gewerbe rund. 9,5%)
aufweisen kann. Entsprechend liegt zum Beispiel der Anteil der privaten und öffentlichen
Dienstleistungen auf der deutschen Seite der Grenze mit mehr als 60% deutlich über dem
polnischen Anteil von knapp 40%.
Wilke, Maack und Partner
25
4.2. Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklung
4.2.1. Beschäftigungsentwicklung
Die Beschäftigungsentwicklung wird in der deutschen Grenzregion anhand der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort23 analysiert. Für die polnische
Grenzregion werden die „employed persons in the main place of work“24 betrachtet. Eine
Vergleichbarkeit ist aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsgrundlagen nur eingeschränkt
möglich – die Gegenüberstellung der Beschäftigtenzahlen geben allerdings Aufschlüsse über
die jeweilige Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Wie zuvor bei der Darstellung und Auswertung der wirtschaftsstrukturellen Entwicklung,
wird auch hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung eine Betrachtung vor und nach dem
EU-Beitritt Polens vorgenommen. D.h. es werden die Zeiträume von 2000 bis 2004 und von
2004 bis 200825 separat betrachtet. Für die deutsche Grenzregion liegen darüber hinaus
aktuelle Zahlen für das Jahr 2009 vor.
Sowohl im deutschen als auch im polnischen Teil der Grenzregion war die Beschäftigung
zwischen den Jahren 2000 und 2004 rückläufig (siehe Abb. 7 und Tab. 7 und 8).
23 Zu diesem Personenkreis zählen alle ArbeitnehmerInnen einschließlich der Auszubildenden, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die von Arbeitgebern Beitragsanteile nach dem Recht der Arbeitsförderung zu entrichten sind. Wehr- und Zivildienstleistende gelten dann als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, wenn sie ihren Dienst aus einem weiterhin bestehenden Beschäftigungsverhältnis heraus angetreten haben und nur wegen Ableistung dieser Dienstzeiten kein Entgelt erhalten. Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige; Bundesagentur für Arbeit 24 Alle Personen, die angegeben haben, dass der jeweilige Ort der Arbeitsort ist; Vgl. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_ENG_HTML.htm?id=ANG-629.htm 25 Anders als bei der Bruttowertschöpfung liegen hier Zahlen für das Jahr 2008 vor.
Wilke, Maack und Partner
26
Abbildung 7: Beschäftigungsveränderung in der Grenzregion von 2000 bis 2004
Szczecin -15,5%
SubregionSzczeciński-16,6%
PlanungsregionVorpommern
-14,7%
Mecklenburg-
Vorpommern -13,4%
(Deutschland -4,7%)
Zachodnio-
pomorskie-12,8%
(Polen -6,1%)
Subregion Stargardzki-6,3%
Rügen-9,4%
Stralsund-13,0%Greifswald
-7,1%
Nord-vorpommern
-19,4%
Ost-vorpommern
-14,8%
Uecker-Randow-22,7%
Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und
Partner
Tabelle 7: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2000 bis 2004)
Region 2000 2001 2002 2003 2004Veränderung
2000 bis 2004
Greifswald 23.140 22.678 22.163 21.570 21.497 -7,1%
Stralsund 25.451 24.503 23.962 22.800 22.142 -13,0%
Nordvorpommern 31.159 28.785 28.010 26.192 25.127 -19,4%
Ostvorpommern 33.479 31.347 31.302 29.521 28.509 -14,8%
Rügen 24.536 23.655 23.547 22.824 22.241 -9,4%
Uecker-Randow 24.183 22.540 21.032 19.969 18.690 -22,7%
Planungsregion Vorpommern 161.948 153.508 150.016 142.876 138.206 -14,7%
Mecklenburg-Vorpommern 590.661 565.797 548.830 526.476 511.732 -13,4%
Deutschland 27.825.624 27.817.114 27.571.147 26.954.686 26.523.982 -4,7%Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auf deutscher Seite hat sich die Beschäftigung in den Kreisen und kreisfreien Städten von
2000 bis 2004 wie folgt entwickelt: In Greifswald und Rügen blieb der
Beschäftigungsrückgang mit -7,1% bzw. -9,4% im einstelligen Prozentbereich. Stralsund mit -
Wilke, Maack und Partner
27
13,0%, Nordvorpommern mit -19,4% und insbesondere Uecker-Randow mit -22,7% mussten
relativ betrachtet deutlich höhere Rückgänge verzeichnen. In Summe verzeichnet die
Planungsregion Vorpommern für diesen Zeitraum einen Beschäftigungsrückgang von 14,7%
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und lag damit noch um 1,3%-Punkte über der
negativen Beschäftigungsentwicklung im Land Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt hat die
Planungsregion Vorpommern von 2000 bis 2004 fast 24.000 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte verloren (siehe Tab.7).
Tabelle 8: Beschäftigungsentwicklung in den polnischen Landkreisen (2000 bis 2004)
Region 2000 2001 2002 2003 2004Veränderung
2000 bis 2004
Subregion Stargardzki 55.884 53.868 52.183 50.890 52.357 -6,3%
Szczecin 125.266 118.927 107.337 105.277 105.885 -15,5%
Subregion Szczeciński 57.801 56.628 52.361 48.431 48.216 -16,6%
Polnische Grenzregion 238.951 229.423 211.881 204.598 206.458 -13,6%
Wojewodschaft Westpommern 347.044 329.952 307.750 299.439 302.765 -12,8%
Polen 8.170.747 7.974.606 7.685.524 7.572.263 7.670.167 -6,1% Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auf polnischer Seite war relative betrachtet der Verlust an Beschäftigten zwischen 2000 und
2004 insbesondere in der Subregion Szczeciński (-16,6% entsprechend rund -10.000
Beschäftigte) und der Stadt Stettin (-15,5% entsprechend rund -20.000 Beschäftigte) höher
als in der Wojewodschaft Westpommern und vor allem als in Polen insgesamt (siehe Tab. 8).
Nur die Subregion Stargardzki verzeichnet innerhalb der vier Jahre mit -6,3% (Polen -6,1%)
einen geringeren Rückgang als die Wojewodschaft Westpommern im Durchschnitt.
Insgesamt hat die polnische Grenzregion zwischen den Jahren 2000 und 2004 mehr als
32.000 Beschäftigte verloren.
In der gesamten deutsch-polnischen Untersuchungsregion sank damit von 2000 bis 2004 die
Zahl der Beschäftigten um rund 56.000.
Im Zeitraum von 2004 bis 2008 entwickelten sich die Beschäftigtenzahlen in der polnischen
wie auch in der deutschen Untersuchungsregion, mit Ausnahme Nordvorpommerns, positiv
(siehe Abb. 8 und Tab. 9 und 10).
Wilke, Maack und Partner
28
Abbildung 8: Beschäftigungsveränderung in der Grenzregion von 2004 bis 2008
Szczecin +8,4%
SubregionSzczeciński+7,1%
PlanungsregionVorpommern
+1,8%
Mecklenburg-Vorpommern
+1,7%(Deutschland +3,5%)
Zachodnio-pomorskie
+10,3%(Polen +12,4)
Subregion Stargardzki+8,7%
Rügen+0,7%
Stralsund+4,7% Greifswald
+6,9%
Nord-vorpommern
-2,9%
Ost-vorpommern
+1,4%
Uecker-Randow
+0,5%
Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und
Partner
Tabelle 9: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2004 bis 2008)
Region 2004 2005 2006 2007 2008Veränderung
2004 bis 2008
Greifswald 21.497 20.909 21.314 22.112 22.978 6,9%
Stralsund 22.142 21.940 22.195 23.148 23.178 4,7%
Nordvorpommern 25.127 24.423 23.966 24.129 24.398 -2,9%
Ostvorpommern 28.509 27.876 27.822 28.463 28.917 1,4%
Rügen 22.241 21.753 21.001 21.491 22.394 0,7%
Uecker-Randow 18.690 17.963 18.085 18.188 18.777 0,5%
Planungsregion Vorpommern 138.206 134.864 134.383 137.531 140.642 1,8%
Mecklenburg-Vorpommern 511.732 498.993 503.624 511.606 520.618 1,7%
Deutschland 26.523.982 26.178.266 26.354.336 26.854.566 27.457.715 3,5%Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auf deutscher Seite konnten die kreisfreien Städte Greifswald (rund +1.500 Beschäftigte)
und Stralsund (rund +1.000) mit 6,9% bzw. 4,7% den größten Beschäftigungszuwachs
Wilke, Maack und Partner
29
verzeichnen (siehe Tab. 9). Beide konnten im Jahr 2006 den Negativtrend umkehren, d.h. ab
2006 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder an. In
Ostvorpommern, Nordvorpommern und Rügen vollzog sich die Trendumkehr erst im Jahr
2007. In Nordvorpommern blieb dadurch auch die Zahl der Beschäftigten bis einschließlich
2008 unterhalb des Niveaus des Jahres 2004. Der Beschäftigungszuwachs in der
Planungsregion Vorpommern betrug von 2004 bis 2008 rund 2.500 Personen, davon ca.
1.200 im Verarbeitenden Gewerbe trotz eines leichten Rückgangs der Beschäftigung (-178
Beschäftigte) in der regionalen Schlüsselbranche des Verarbeitenden Gewerbes, der
Ernährungswirtschaft. Insgesamt hat sich damit die Region mit einem
Beschäftigungszuwachs von 1,8 % in diesem Zeitraum in etwa auf demselben Niveau wie
Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Allerdings geben die Zahlen keine Auskunft über die
Art und Qualität der Beschäftigung. Da es sich jedoch um sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte handelt, beinhalten die Zahlen keine geringfügige Beschäftigung.
Tabelle 10: Beschäftigungsentwicklung in den polnischen Landkreisen (2004 bis 2008)
Region 2004 2005 2006 2007 2008Veränderung
2004 bis 2008
Subregion Stargardzki 52.357 52.954 53.408 55.194 56.931 8,7%
Szczecin 105.885 107.684 112.590 114.087 114.803 8,4%
Subregion Szczeciński 48.216 48.841 49.635 51.848 51.622 7,1%
Polnische Grenzregion 206.458 209.479 215.633 221.129 223.356 8,2%
Wojewodschaft Westpommern 302.765 308.422 317.304 326.915 334.061 10,3%
Polen 7.670.167 7.835.758 8.038.145 8.372.169 8.624.189 12,4% Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auf polnischer Seite konnten insbesondere die Subregion Szczeciński (rund +3.500
Beschäftigte) und die Stadt Stettin (rund +10.000 Beschäftigte) aufholen, die zwischen 2000
und 2004 noch den stärksten Beschäftigungsrückgang verzeichnen mussten (siehe Tab. 10).
In der Subregion Stargardzki (rund +4.500) verbesserte sich die Beschäftigtensituation in
diesen vier Jahren um 8,7 %. In Stargardzki und Szczeciński trat die Trendwende bereits
2004 ein, in Stettin erst im Jahr 2005. Rund die Hälfte der in den Jahren 2000 bis 2004
verlorenen Beschäftigung konnte damit wieder aufgebaut werden. Das
Beschäftigungswachstum entwickelte sich jedoch in den drei grenznahen polnischen
Subregionen schwächer als in der Wojewodschaft Westpommern (+10,3%) insgesamt und
Wilke, Maack und Partner
30
als in Polen (+12,4%). Für das Jahr 200926 ist davon auszugehen, dass sich die Beschäftigung
in der polnischen Grenzregion voraussichtlich vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise
eher negativ entwickelt hat. 2010 kommt erschwerend der Zusammenbruch der Stettiner
Werft und der damit verbundene Verlust von bis zu 4.000 Arbeitsplätzen plus der
Arbeitsplätze bei Zulieferern und Dienstleistern hinzu.
Für die deutsche Region sind bereits die Beschäftigungszahlen 2009 verfügbar (siehe Tab.
11) In 2009 ist die Beschäftigung in allen Städten und Kreisen der Planungsregion
Vorpommern gegen den allgemeinen Trend um gut 1% angestiegen. Auch in Mecklenburg-
Vorpommern war die Beschäftigung nicht rückläufig, sondern hat 2009 stagniert. Der
Hintergrund dieser vergleichsweise positiven Beschäftigungsentwicklung 2009 dürfte
allerdings weniger in der besonderen Wettbewerbsfähigkeit der Region, als vielmehr in den
verhältnismäßig geringen nationalen und besonders internationalen Verflechtungen der
regionalen Wirtschaft liegen. Die negativen Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und
Finanzkrise waren dadurch in der deutschen Grenzregion weniger spürbar.
Tabelle 11: Beschäftigungsentwicklung in der Planungsregion Vorpommern (2008 bis 2009)
Region 2008 2009Veränderung
2008 bis 2009
Greifswald 22.978 23.191 0,9%
Stralsund 23.178 23.221 0,2%
Nordvorpommern 24.398 24.571 0,7%
Ostvorpommern 28.917 29.371 1,6%
Rügen 22.394 22.673 1,2%
Uecker-Randow 18.777 19.100 1,7%
Planungsregion Vorpommern 140.642 142.127 1,1%
Mecklenburg-Vorpommern 520.618 520.773 0,0%
Deutschland 27.457.715 27.380.096 -0,3% Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Zusammenfassend ist zur Beschäftigungsentwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion
festzuhalten, dass die hohen Beschäftigungsverluste der ersten Periode nach 2004 nicht
kompensiert werden konnten. Insbesondere in der Planungsregion Vorpommern konnten
nur gut 10 % des Verlustes zurückgewonnen werden, u.a. weil der negative
Beschäftigungstrend erst zwei bis drei Jahre später als auf der polnischen Seite gestoppt
26 Die Beschäftigungsstatistik für die polnische Grenzregion liegt noch nicht vor, April 2010.
Wilke, Maack und Partner
31
werden konnte. Positiv ist, dass auch im Jahr 2009 weiter Beschäftigung aufgebaut werden
konnte.
Auf polnischer Seite haben Stettin und die Subregionen zwischen 2004 und 2008
Beschäftigung im Umfang von knapp 17.000 Arbeitsplätzen aufgebaut. Gegenüber dem
Ausgangsjahr 2000 gibt es dennoch in Stettin, und den Subregionen Stargardzki und
Szczeciński – also im westlichen Teil der Wojewodschaft Westpommern - rund 16.000
Beschäftigte weniger, während Westpommerns östliche Subregion Koszaliński die
Beschäftigungsverluste aus dem Zeitraum von 2000 bis 2004 inzwischen, ähnlich wie in
Polen insgesamt, kompensieren konnte. Koszaliński kann über den Gesamtzeitraum von acht
Jahren einen Zuwachs von rund 3.000, Polen von insgesamt von rund 450.000 Beschäftigten
aufweisen.
4.2.2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosenquote27 in Mecklenburg-Vorpommern ist von 2000 bis 2004 um 2,7 %-
Punkte angestiegen, danach bis 2008 um 6,4 %-Punkte auf 14,1 % zurückgegangen (siehe
Tab. 12 und 13). Der Negativtrend konnte im Jahr 2005 gestoppt werden. In allen
Landkreisen und kreisfreien Städten der Planungsregion Vorpommern lag die
Arbeitslosenquote konstant über der Quote in Mecklenburg-Vorpommern, zeitweilig um bis
zu 10 bis 12 %-Punkte. Erstmals 2008 lag die Arbeitslosenquote in einem Teil der
Planungsregion Vorpommern, nämlich im Landkreis Rügen, niedriger als im Durchschnitt
Mecklenburg-Vorpommerns. Insgesamt ist der Abstand zwischen den Arbeitslosenquoten
einerseits der Kreise und kreisfreien Städte der Planungsregion Vorpommern und
andererseits Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren deutlich kleiner geworden
(siehe auch Tab. 14). Der Negativtrend in der Arbeitsmarktentwicklung konnte in der
Planungsregion 2005 gestoppt werden und damit, wie auch auf der polnischen Seite, bereits
ein bis zwei Jahre bevor die Beschäftigtenzahlen gestiegen sind. Die Analyse der
Altersstruktur der arbeitslos gemeldeten Personen verdeutlicht, warum die Arbeitslosigkeit
27 Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) in Beziehung setzen. Arbeitslos sind nach dem Sozialgesetzbuch Personen, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das 15 Wochenstunden und mehr umfasst, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung zur Verfügung stehen und sich dort persönlich arbeitslos gemeldet haben. Vgl.: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/interim/grundlagen/berechnung-aloquote/index.shtml
Wilke, Maack und Partner
32
bereits ein bis zwei Jahre vor dem Aufbau zusätzlicher Beschäftigung zurückgegangen ist. Ein
Rückgang der Zahl der Arbeitssuchenden ist vor allem bei den unter 25-Jährigen und über
54-Jährigen festzustellen. Der Grund liegt in der Abwanderung junger, mobiler
Arbeitssuchender und dem frühzeitigen, freiwilligen, aber auch unfreiwilligen Ausscheiden
älterer, geburtenstarker Jahrgänge aus dem Erwerbsleben (u.a. die sogenannte 58er-
Regelung). Hinzu kommen statistische Effekte durch das temporäre Ausscheiden
Arbeitsuchender aus der Arbeitslosenstatistik, die einen sogenannten „1-Euro-Job“ ausüben
(bundesweit zurzeit rund 300.000 Personen).
Tabelle 12: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2000
bis 2004)
Region 2000 2001 2002 2003 2004Veränderung
2000 bis 2004
Greifswald 18,1 18,5 18,3 20,5 21,3 18,1%
Stralsund 20,1 20,4 20,6 22,9 23,9 18,8%
Nordvorpommern 20,3 21,5 21,1 23,7 24,3 19,5%
Ostvorpommern 19,1 20,1 20,4 22,0 22,7 18,7%
Rügen 17,5 18,7 18,9 20,5 20,6 17,9%
Uecker-Randow 22,9 24,8 25,7 27,1 29,3 27,6%
Mecklenburg-Vorpommern 17,8 18,3 18,6 20,1 20,5 14,7%
Deutschland 9,6 9,4 9,8 10,5 10,5 9,4% Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner Tabelle 13: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2004
bis 2008)
Region 2004 2005 2006 2007 2008Veränderung
2004 bis 2008
Greifswald 21,3 21,5 19,0 17,0 14,5 -32,1%
Stralsund 23,9 22,1 21,2 18,9 16,2 -32,2%
Nordvorpommern 24,3 23,5 21,8 18,3 15,7 -35,3%
Ostvorpommern 22,7 24,4 21,5 19,7 16,3 -28,1%
Rügen 20,6 19,4 18,7 15,8 13,7 -33,4%
Uecker-Randow 29,3 27,6 25,0 21,6 18,7 -36,1%
Mecklenburg-Vorpommern 20,5 20,3 19,0 16,5 14,1 -31,1%
Deutschland 10,5 11,7 10,8 9,0 7,8 -25,7% Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Wilke, Maack und Partner
33
Tabelle 14: Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Planungsregion Vorpommern (2008
bis 2009)
Region 2008 2009Veränderung
2008 bis 2009
Greifswald 14,5 13,7 -5,5%
Stralsund 16,2 15,1 -6,8%
Nordvorpommern 15,7 14,9 -5,1%
Ostvorpommern 16,3 15,9 -2,5%
Rügen 13,7 12,4 -9,5%
Uecker-Randow 18,7 17,2 -8,0%
Mecklenburg-Vorpommern 14,1 13,6 -3,5%
Deutschland 7,8 8,2 5,1% Quelle: Daten Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auf polnischer Seite ist die Arbeitslosigkeit28 in den Jahren 2000 bis 2003 in allen Teilen der
Grenzregion massiv gestiegen, vor allem in der Stadt Stettin. Seit 2003 fällt sie, besonders in
der Stadt Stettin (siehe Tab. 15). Bis 2008 ist die Arbeitslosigkeit wieder weit unter das
Niveau des Jahres 2000 gesunken (siehe Tab.16).
Tabelle 15: Entwicklung der Arbeitslosenzahl der polnischen Landkreise (2000 bis 2004)
Region 2000 2001 2002 2003 2004Veränderung
2000 bis 2004
Subregion Stargardzki 40.231 45.739 49.696 49.669 46.648 16,0%
Szczecin 16.365 21.420 28.162 29.423 27.605 68,7%
Subregion Szczeciński 24.343 30.035 32.846 33.833 32.781 34,7%
Polnische Grenzregion 80.939 97.194 110.704 112.925 107.034 32,2%
Wojewodschaft Westpommern 150.084 175.341 189.643 190.864 182.692 21,7%
Polen 2.702.576 3.115.056 3.216.958 3.175.674 2.999.601 11,0% Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Auch auf der polnischen Seite liegt der Zeitpunkt des Rückgangs der Arbeitslosigkeit vor dem
Zeitpunkt der Trendwende hin zu mehr Beschäftigung. Ausschlaggebend dürfte die
Abwanderung vieler polnischer Arbeitssuchender aus der Region ins EU-Ausland, speziell
Großbritannien, Irland, aber auch Skandinavien sein. Im Zuge der weltweiten Wirtschafts-
und Finanzkrise ist inzwischen ein erheblicher Teil dieser Personen zurückgekehrt. Auch vor
diesem Hintergrund ist die Arbeitslosigkeit in Polen und in der Untersuchungsregion aktuell
wieder gestiegen. Hinzu kommt die Schließung der Stettiner Werft. Insbesondere in der 28 Dazu zählen Personen die nicht beschäftigt sind und keine andere gewinnbringende Tätigkeit ausüben und in der Lage sind eine Vollzeitarbeitsstelle aufzunehmen und älter als 18 Jahre und jünger als 60 (Frauen) bzw. 65 (Männer) Jahre alt sind; Vgl. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_ENG_HTML.htm?id=ANG-1258.htm
Wilke, Maack und Partner
34
Stadt Stettin ist die Arbeitslosigkeit dadurch stärker gestiegen als in allen anderen
Großstädten ab 300.000 Einwohnern in Polen29.
Tabelle 16: Entwicklung der Arbeitslosenzahl der polnischen Landkreise (2004 bis 2008)
Region 2004 2005 2006 2007 2008Veränderung
2004 bis 2008
Subregion Stargardzki 46.648 44.222 35.303 28.161 21.805 -53,3%
Szczecin 27.605 25.484 21.550 11.474 7.394 -73,2%
Subregion Szczeciński 32.781 30.526 24.273 18.548 16.467 -49,8%
Polnische Grenzregion 107.034 100.232 81.126 58.183 45.666 -57,3%
Wojewodschaft Westpommern 182.692 168.814 138.866 103.241 82.520 -54,8%
Polen 2.999.601 2.773.000 2.309.410 1.746.573 1.473.752 -50,9% Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
4.2.3. Resümee zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktentwicklung
Nachdem sich auf der deutschen und polnischen Seite der Untersuchungsregion die
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation vor dem EU-Beitritt Polens unter dem Einfluss
einer – auch insgesamt in Deutschland und Polen – schwachen konjunkturellen Entwicklung
in den Jahren vor der EU-Osterweiterung massiv verschlechtert hatte, gab es auf beiden
Seite der Grenze danach eine Trendwende mit sinkender Arbeitslosigkeit und einer
steigenden Zahl Beschäftigter. Die Trendwende setzte in der polnischen Grenzregion um
zwei bis drei Jahre früher ein als in der deutschen Grenzregion. Insbesondere auf der
deutschen Seite konnte der Beschäftigungsaufbau den Abbau der Vorjahre nicht annähernd
kompensieren. Auch auf der polnischen Seite der Grenze ist dieses nicht in dem Maße
gelungen wie z.B. in der Wojewodschaft Westpommern oder in Polen insgesamt. Aktuell hat
der positive Trend auf der deutschen Seite Bestand. Auf der polnischen Seite haben die
Einflüsse und Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise den positiven Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungstrend gedämpft. Insbesondere in Stettin hat sich die Arbeitsmarktlage durch
die Schließung der Stettiner Werft spürbar verschlechtert.
4.3. Einflüsse der regionalen Entwicklung auf die Beschäftigtensituation und die Lohn- und Gehaltssituation
Wie bereits vorstehend angedeutet, waren die Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise in Mecklenburg-Vorpommern wie auch in der Planungsregion Vorpommern
weniger einschneidend, was sich auch in der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter im
29 Vgl. IHK Neubrandenburg: http://www.neubrandenburg.ihk.de/ihk/index.php?id=4021
Wilke, Maack und Partner
35
Jahr 2009 wiederspiegelt (siehe Tab. 17). Im Gegensatz zur bundesweiten Entwicklung sind
die Bruttolöhne und -gehälter in Mecklenburg-Vorpommern 2009 nicht gesunken,
wenngleich Mecklenburg-Vorpommern bezüglich des Lohnniveaus nach wie vor bundesweit
an letzter Stelle liegt.
Tabelle 17: Bruttolöhne und -gehälter je ArbeitnehmerIn in ausgewählten
Wirtschaftsbereichen (Mecklenburg-Vorpommern)
Wirtschaftsbereich1999EUR
2009EUR
2009Deutschla nd = 100
Verarbeitendes Gewerbe 21.150 23.314 64,3
Baugewerbe 18.452 20.982 83,3
Handel, Gastgewerbe und Verkehre 15.914 17.173 75,4
Finanzierung, Vermietung und
Unternehmensdienstleister19.492 21.098 73,2
Öffentliche und private Dienstleister 21.700 25.297 98,7 Quelle: Daten Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Besonders im Verarbeitenden Gewerbe lagen die Bruttolöhne und -gehälter auch 2009 noch
um rund ein Drittel niedriger als im Durchschnitt des Bundesgebiets. Lediglich im Bereich
öffentlicher und privater Dienstleistungen hat sich der Lohnabstand in den letzten zehn
Jahren auf 1,3 % verringert. Zu berücksichtigen ist, dass die gesamtwirtschaftlichen
Bruttolöhne und -gehälter je ArbeitnehmerIn durch den Einfluss der marginal
Beschäftigten30 gedämpft werden. In 200831 lag der Anteil der marginal Beschäftigten in
Mecklenburg-Vorpommern bei 13,7 % und damit sogar um 1 %-Punkt unter dem
Bundesdurchschnitt. Insofern sind die vergleichsweise niedrigen Bruttolöhne und -gehälter
nicht auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil an marginaler Beschäftigung
zurückzuführen, vielmehr werden in Mecklenburg-Vorpommern auch Qualifizierte in
Normalarbeitsverhältnissen im Durchschnitt um rund 20 % niedriger entlohnt. Dadurch sind
die Bindung und insbesondere die Rekrutierung qualifizierter Beschäftigter in Mecklenburg-
Vorpommern wie auch in der Planungsregion Vorpommern weiterhin schwierig.
Auf polnischer Seite weicht das Lohn- und Gehaltsniveau nicht in dem Maße vom
Landesdurchschnitt ab wie auf deutscher Seite. Stettin lag in 2008 sogar um 4,2 % über dem
30 Marginal Beschäftigte sind Beschäftigte die keine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, jedoch als Erwerbstätige nach dem Labour-Force-Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation gelten, wenn sie in einem einwöchigen Berichtszeitraum wenigstens eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet haben; Vgl. Herrmann, M. (2009): Gesamtwirtschaftliche Bruttolöhne und -gehälter – erreichter Stand in Mecklenburg-Vorpommern 20 Jahre nach der Wende. 31 Für 2009 liegen noch keine Daten vor.
Wilke, Maack und Partner
36
durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsniveau Polens. Allerdings ist das Lohn- und
Gehaltsniveau der Subregion Szczeciński seit 2004 gegenüber dem polnischen Durchschnitt
gesunken und lag in 2008 5,9 %-Punkte unterhalb des Landesniveaus. Die Subregion
Stargardzki liegt sogar um 21,9 %-Punkte unterhalb des polnischen Lohn- und
Gehaltsniveaus.
Abbildung 9: Lohn- und Gehaltsindex polnische Grenzregion (2002-2008)
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Po
len
= 1
00
Szczecin Subregion Szczeciński Subregion Stargardzki Zachodniopomorski
Quelle: Daten Statistisches Amt Stettin, eigene Darstellung Wilke, Maack und Partner
Für 2009 wird ein weiterer Rückgang des Lohn- und Gehaltsniveaus in der polnischen
Grenzregion und insbesondere in Stettin erwartet. Grund hierfür ist die Schließung der
Stettiner Werft, die als staatliche Institution überdurchschnittlich hohe Löhne und Gehälter
gezahlt hat. Ein Einstieg in die Privatwirtschaft der Region bedeutet daher für die meisten
ehemaligen Beschäftigten der Stettiner Werft einen Lohnverlust. Aus diesem Grund wird
befürchtet, dass vor allem hochqualifizierte Kräfte verstärkt in andere Regionen bzw. ins
europäische-Ausland abwandern. Auf der Werft waren zuletzt 4.000 Personen beschäftigt.
Davon sind derzeit ca. 1.500 beim Arbeitsamt gemeldet. Rund 500 ehemalige Mitarbeiter
nehmen an Umschulungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen teil. Die Folgen für den
Arbeitsmarkt und die Zulieferer sind zurzeit noch nicht absehbar.
Wilke, Maack und Partner
37
Deutlich wird jedoch, dass durch das möglicherweise sinkende Lohniveau im Stettiner Raum
und das ohnehin sehr niedrige Lohn- und Gehaltsniveau in der Subregion Stargardzki
nennenswerte grenzüberschreitende Verflechtungen der Arbeitsmärkte in der deutsch-
polnischen Grenzregion vorerst weiter unwahrscheinlich bleiben. Andererseits könnte
erstmals ab 2011 bei einem anhaltenden Wachstum, insbesondere des Verarbeitenden
Gewerbes in der Planungsregion Vorpommern, und einem großen Angebot qualifizierter
Kräfte auf dem Stettiner Arbeitsmarkt, u.a. durch die Schließung der Werft, eine stärkere
deutsch-polnische Verflechtung auf dem Arbeitsmarkt in der deutsch-polnischen
Grenzregion und darüber hinaus entstehen.
5. Verflechtungsbeziehungen und Potenzialbestimmung
Die Entwicklung Stettins hin zu einem langfristig erfolgreichen Wachstumspol mit
Zentrumsfunktion kann nur in Kooperation mit dem deutsch-polnischen Umland gelingen.
Dieses Kernergebnis, die sogenannte Integrationsthese, aus der Studie „Wachstumspol
Stettin“ von 2004 bildet die Grundlage für die vorliegende Untersuchung der
Verflechtungsbeziehungen in der Grenzregion. Die Entwicklung der Integration und die
Verflechtungsbeziehungen geben Hinweise auf den Entwicklungsstand bzw. die Nutzung von
Potenzialen und Synergien in der Grenzregion.
Um es vorwegzunehmen: Die großen, wegweisenden „Meilensteine“ in der Kooperation
zwischen den Teilregionen der Grenzregion seit 2004 sind bisher ausgeblieben. Umfassende
Strategien oder Zielsetzungen in Richtung einer gemeinsamen Entwicklung der Grenzregion
wurden seither nicht vereinbart. Stattdessen lassen sich aber Verflechtungen z.B. anhand
einer Reihe kleinteiliger Kooperationen und grenzüberschreitender Initiativen feststellen, die
in verschiedenen Bereichen von Wirtschaft, Kultur oder auf Verwaltungsebene stattfinden.
Einige dieser Verflechtungen lassen sich ganz konkret benennen, da sie in die Form von
Projekten oder Kooperationsinstrumenten gegossen worden sind oder quantitativ erfasst
werden (wie z.B. die ausländischen Direktinvestitionen). Andere Verflechtungen werden
mehr durch Tendenzen und Einschätzungen über das Zusammenwachsen in der Grenzregion
skizziert. Diese Verflechtungsbeziehungen sind zwar weniger greifbar, aber dennoch
unverzichtbar für die Potenzialbestimmung in der Region. Im Folgenden sollen einige dieser
Verflechtungen aus den verschiedenen Bereichen exemplarisch vorgestellt werden.
Wilke, Maack und Partner
38
5.1. Verflechtungen auf administrativer Ebene
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf Landes- bzw. Wojewodschaftsebene wurde
von deutscher und polnischer Seite im Jahr 2000 erneut (nach 1991) durch die sogenannte
„Gemeinsame Erklärung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ bekräftigt. Auf
fachlicher Ebene steht vor allem die Kooperation im Rahmen der Euroregion Pomerania im
Fokus, deren Aufgaben vordergründig die Initiierung und Abstimmung von Projekten und
Aktivitäten im Grenzraum sind. Die Mitglieder der Euroregion sind Gemeindeverbände der
polnischen, deutschen und schwedischen Teilregionen.
Ebenfalls beim Land Mecklenburg-Vorpommern und der Wojewodschaft Westpommern
angesiedelt ist das Arbeitsgremium „Gemeinsame Umweltkommission“ (GUK), in dessen
Rahmen die deutsch-polnische Zusammenarbeit bereits seit 1991 besteht. Die GUK gilt bei
regionalen Akteuren als ein Beispiel für gelungene Kooperation auf administrativer Ebene.
Die GUK besteht aus mehreren Arbeitsgruppen und befasst sich mit konkreten Themen des
Umweltschutzes oder der Ver- und Entsorgung, für die es der gegenseitigen Abstimmung in
der Grenzregion bedarf.
Neben der GUK war die Gemeinsame Raumordnungs- und Arbeitsmarktkommission (GRAK)
von Mecklenburg-Vorpommern und Westpommern für Veranstaltungen, Projekte und
Partnerschaften vordergründig im Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigung (z.B. mit der
Umsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL) und für den gegenseitigen Austausch im
Bereich Raumordnung und Regionalplanung zuständig. Die GRAK wurde im Jahr 2008
aufgelöst. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gibt in ihrem Jahresbericht 2008
an, dass die von der GRAK initiierten Kooperationen weitgehend selbstständig
weiterlaufen32.
Die Planungsregion Vorpommern hat im Rahmen des „Bündnis für Arbeit und
Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommern“ die Arbeitsgruppe „Regionale
Entwicklung Vorpommern“ gegründet. Die Arbeitsgruppe hat vor allem zum Ziel, Akteure
aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften zusammenzubringen und sich über
Projekte in der deutschen Grenzregion auszutauschen.
Auf der übergeordneten Ebene solcher Arbeitsgemeinschaften bezeichnen das Land
Mecklenburg-Vorpommern und die Wojewodschaft Westpommern als Kernstück ihrer
Zusammenarbeit die sogenannten „gegenseitigen Präsentationen“. In deren Rahmen
32 Vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2008, S.56
Wilke, Maack und Partner
39
werden zu den Themen Kultur, Wirtschaft und der Euroregion Pomerania mehrmals jährlich
Informationsveranstaltungen unter der Koordination des Marschallamtes und der
Staatskanzlei durchgeführt33.
Das Konzept dieser Zusammenarbeit wird gleichzeitig von regionalen Akteuren als
symptomatisch für die Defizite in der Kooperation in der Grenzregion angesehen, da der
Kern der Kooperation nur in der gegenseitigen Information, nicht aber in der Abstimmung
und Zusammenarbeit bereits im Entwicklungsprozess, liegt. Als Beispiele für unzureichende
Kooperation und Abstimmung gelten z.B. die Planungen für das Kohlekraftwerk von DONG
Energy in Lubmin (Pläne wurden im Dezember 2009 aufgegeben), oder der aus Mitteln der
Europäischen Union und der Weltbank finanzierte Containerterminal in Stettin-Swinemünde.
Die Stettiner Stadtpolitik hat in den letzten Jahren ihre eigenen Strategien neu formuliert
und das städtische Leitbild hinsichtlich einer internationaleren Ausrichtung gestrafft. Seit
2006 wirbt Stettin mit der Kampagne „Stettin ist offen“ vor allem gegenüber Investoren und
Arbeitskräften aus dem Ausland für die Attraktivität und Standortvorteile der Stadt. Darüber
hinaus hat Stettin mit der Marke „Szczecin Floating Garden 2050“ zwischen 2008 und 2009
eine Stadtvision entwickelt, die langfristig für Stettin mit den Schwerpunkten Wasser, Grün
und Freiraum werben will. Mit diesem neuen Konzept des Stadtmarketing möchte sich
Stettin vor allem im internationalen Standortwettbewerb der Städte besser positionieren.
„Floating Garden“ ist in erster Linie ein Konzept zur Vermarktung der Stadt Stettin. Die
Entwicklung der Grenzregion als Gesamtheit und die Stärkung der Stadt-Umland-
Beziehungen spielen dabei keine vordergründige Rolle.
Dennoch hat sich die Stettiner Stadtpolitik in den letzten Jahren verstärkt der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gewidmet. Auf Initiative der Stadt Stettin wird seit
zwei Jahren die Konferenz „Stettin- Unser Grenzraum“ mit regionalen Akteuren der
deutschen und polnischen Seite durchgeführt. Die Konferenz wird von der Stettiner
Stadtverwaltung und der Euroregion Pomerania organisiert. Ziel der Konferenz ist es,
Leitprojekte für die Region zu erörtern und Handlungsempfehlungen zur Lösung aktueller
Problembereiche auszuarbeiten.
Darüber hinaus wird ganz allgemein auf gute Erfahrungen in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus hingewiesen (z.B. grenzüberschreitendes
33 Vgl. Website Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/start/index.jsp
Wilke, Maack und Partner
40
Radwegekonzept, Partnerschaften der regionalen Tourismusverbände). Eine weitere Facette
ist seit Anfang 2010 die Partnerschaft der Städte Greifswald und Stettin für die Bewerbung
um den Titel Europäische Kulturhauptstad 2016.
Zu den Verflechtungen auf administrativer Ebene gehören auch die Kooperationen im
öffentlichen Bereich der Wirtschaftsförderung und der Standortpolitik. Das Regionale
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (Entwurf 2009) formuliert als Ziel eine verstärkte
Öffnung hin zur polnischen Nachbarregion, indem die Nähe zum Oberzentrum Stettin in
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht „offensiv genutzt werden“ soll.34
Dem Wirtschaftsverbund PAPS der Städte Pasewalk, Anklam und Prenzlau ist Stettin seit
2006 beigetreten, ebenso Police im Jahr 2009. Auch hier stehen gemeinsame
Marketingstrategien zur verbesserten Außendarstellung des Wirtschaftsraumes der
Grenzregion im Vordergrund. Aufgrund der Größe seines Einzugsraumes und der beteiligten
Akteure ist PAPS wohl das derzeit wichtigste grenzüberschreitende Projekt zur
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf administrativer Ebene35.
Die Europäische Kommission hat zu Beginn des Jahres 2008 das „Enterprise Europe
Network“ als Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen
in Stettin ins Leben gerufen. Ein Schwerpunkt der Beratungseinrichtung ist die Unterstützung
von polnischen und deutschen Existenzgründern in der Grenzregion.
Dagegen spielen Kooperationen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur in der Grenzregion
derzeit kaum eine Rolle. Ausschlaggebend dafür sind die unterschiedlichen
Ausgangssituationen in denen sich jeweils die deutsche und die polnische Teilregion
befinden. Seit der Grenzöffnung zwischen Deutschland und Polen 2007 hat der Grenzverkehr
in der Region zwar zugenommen. Vor dem Hintergrund der Fertigstellung der Autobahn A20
und der demographischen Entwicklung wird auf der deutschen Seite allerdings derzeit kein
besonderer Bedarf im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gesehen. Gleichzeitig steht Stettin
vor einer Reihe wichtiger Vorhaben zum Ausbau seiner Verkehrsinfrastruktur:
o Ausbau der Ortsumgehungsstraßen um Szczecin und Stargard
o Ausbau der Schnellstrasse S-3 Szczecin-Gorzow
o Ausbau des Flughafens Szczecin-Goleniow
34 Vgl. Regionaler Planungsverband Vorpommern (2009), S.41 35 PAPS ist Teil des Projektes des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung „Modellregion Stettiner Haff“. Weiterführende Informationen unter http://www.region-schafft-zukunft.de/nn_252590/DE/ProjekteStettinerHaff/projekte__stettiner__haff__node.html?__nnn=true
Wilke, Maack und Partner
41
Darüber hinaus ist der Bereich Verkehrsinfrastruktur in manchen Belangen von
Konkurrenzsituationen zwischen dem deutschen und dem polnischen Teil der Grenzregion
geprägt. Beispielsweise wird es in der Fortschreibung der vorrangigen europäischen
Verkehrsnetzte (TEN-T) eine Nord-Süd-Verbindung zwischen dem südlichen Mittelmeerraum
und Skandinavien geben. Die Ostseehäfen Rostock und Stettin/Swinemünde stehen
aufgrund ihrer ähnlichen Größe und Umschlagskapazitäten in der Region diesbezüglich in
Konkurrenz zueinander36.
36 Vgl. dazu weiter Initiativen zum Nord-Süd-Korridor, wie „South North Axis“ und „Central European Transport Corridor“
Wilke, Maack und Partner
42
5.2. Wirtschaftliche Verflechtungen
Gemessen an der Investorentätigkeit hat der polnische Teil der Grenzregion seine
wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen europäischen Regionen seit 2004 ausgebaut.37
Neben deutschen Investoren haben vor allem skandinavische Investoren, darunter
dominierend die Dänen, in den letzten Jahren ihr Engagement in der polnischen Grenzregion
ausgeweitet.
Abbildung 10: Standorte Deutscher Firmen mit Direktinvestitionen in Stettin
und Umland
37 Die Polnische Agentur für Auslandsinformationen und Investitionen (PAIZ) listet jährlich die wichtigsten ausländischen Investoren nach Region auf („List of Major Foreign Investors in Poland 2008“).
Quelle: Daten Haus der Wirtschaft Stettin, PAIZ; Eigene Darstellung Wilke Maack und Partner
Wilke, Maack und Partner
43
Tabelle 18: Übersicht deutsche Firmen mit Direktinvestitionen in Stettin und Umland nach
Standorten und Branche Baden-Württemberg
Altrad-Baumann GmbH Laupheim – Szczecin Bautechnik, Gerüstbau
Elbe Holding Bietigheim – Szczecin Maschinenbau
Bayern
Ehrle Reinigungstechnik GmbH Illertissen - Szczecin Reinigungstechnik
Max Bögl GmbH & Co. KG Sengenthal - Szczecin Bauunternehmen
Berlin
Fliegel Textilservice Sp. z o. o. Berlin - Nowe Czarnowo Dienstleistung
SCHENKER DB Logistics Spolka z o.o. Berlin - Szczecin Logistik
Town & Country HS Solid Polska Sp. z o.o. Berlin - Szczecin Immobilien
WKI Isoliertechnik Sp. z o.o. Berlin - Gryfino Isoliertechnik, Baustoffe
Hamburg
Frachtkontor Junge & Co. GmbH Hamburg - Szczecin Reederei
Josef Möbius Bau AG Hamburg - Szczecin Hafen,- Wasserstraßenbau
Mühlhan Steel Services Sp. z o.o. Hamburg - Szczecin Schiffbau, Industrieservice
Nordische Futterfette CARROUX Hamburg – Stepnica Agrarwirtschaft
TCHIBO Kaffe Hamburg - Szczecin Einzelhandel
Mecklenburg-Vorpommern
GF Energia (Fromholz GmbH) Labömitz - Szczecin Treibstoff-Großhandel
HANSA DOMAPOR Vertriebs-GmbH Parchim - Szczecin Baustoffe
Heinrich Schütt KG GmbH Neubrandenburg - Szczecin Stahlhandel
ME-LE Energietechnik GmbH Torgelow - Szczecin Biogasanlagenbau
Wittenberg Metall Sp. z o.o. Torgelow - Debno Metallbau
Niedersachsen
Fuhrpark EURO-Leasing GmbH Sittensen - Kolbaskowo Fahrzeugvermietung
HERO-GLAS GmbH Delmenhorst - Szczecin Baustoffe
OEKO Tech GmbH Oil Water Separation Oldendorf – Szczecin Umwelttechnik
PHW Gruppe Lohmann AG Geflügel Visbek - Szczecin Ernährungswirtschaft
Nordrhein-Westfalen
Brenntag Intern. Chemical GmbH Mühlheim - Szczecin Industriechemikalien
Gerhard Weber Kunststoffverarbeitung Minden - Szczecin Kunststofftechnik
Kewes Floristik Elsdorf - Nowogard Floristikgroßhandel
Kränzle GmbH Hochdruckreiniger Bielefeld - Szczecin Reinigungstechnik
Schmittenberg Pol Sp. z o.o. Wuppertal - Szczecin Metallverarbeitung
RABEN Group Wuppertal - Szczecin Logistik
Schleswig-Holstein
MAX Schön AG Stahl+Rohr Sp. z o.o. Luebeck - Szczecin Maschinen, Werkzeuge
Thomas Beton Sp. z o.o. Kiel - Szczecin Baumstoffe
AHLMANN Zerssen Sp. z o.o. Rendsburg - Szczecin Schifffahrt, Logistik
Sport-Creativ Nusse - Maszewo Sportartikelhandel
Vosschemie GmbH Uetersen - Goleniow Lackhersteller
Quelle: Haus der Wirtschaft Stettin38
, PAIZ 2008
38Aufgelistet sind Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die in den letzten Jahren in der polnischen Grenzregion investiert haben. Die Auflistung bezieht sich auf Angaben des Haus der Wirtschaft in Stettin von Januar 2010 und Angaben der PAIZ in der Studie „Invest in Poland“ von 2008. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wilke, Maack und Partner
44
Betrachtet man die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Deutschland, dann betrifft dies in
erster Linie die nord- bzw. westdeutschen Regionen Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der überwiegende Teil
der deutschen Unternehmen die in den Jahren seit dem EU-Beitritt in der polnischen
Grenzregion, vor allem im direkten Stettiner Umland investiert haben, haben ihren Hauptsitz
in einem dieser Bundesländern (siehe Abb.10). Die Direktinvestitionen wurden zum großen
Teil in den Branchen Logistik, Bauwirtschaft und Metallverarbeitung getätigt. Unternehmen,
die direkt aus dem deutschen Teil der Grenzregion stammen, sind allerdings nur vereinzelt
zu finden.
Die PAIZ39 erfasst nur Direktinvestitionen ab einer Größenordnung von 1 Mio. US$. Es gibt
im deutsch-polnischen Grenzraum allerdings auch Verflechtungen im „kleineren Stil“, wie
z.B. eine Reihe von in Deutschland ansässigen Rechtskanzleien oder Steuerberatungen, die
Niederlassungen im polnischen Grenzraum eröffnet haben.
In der Region um Stettin haben sich die Städte Police, Stargard, Goleniow und Gryfino als
Investitionszentren etabliert, zum Teil weit erfolgreicher als die Stadt Stettin bei der
Gewerbeansiedlung sowie der Öffnung hin zu anderen Zentren Polens.
Ein wichtiger Grund dafür sind die polnischen Sonderwirtschaftszonen, denn laut PAIZ
werden in Polen die meisten ausländischen Direktinvestitionen in Sonderwirtschaftszonen
getätigt. Zwar ist keine der polnischen Sonderwirtschaftszonen direkt in Westpommern
angesiedelt, allerdings haben Police, Stargard, Goleniow und Gryfino sogenannte
Unterzonen ausgewiesen. Die Gewerbegebiete dieser Sub-Sonderwirtschaftszonen bieten
dieselben Bedingungen für Investoren wie die Haupt-Sonderwirtschaftszonen (siehe Abb.11)
und konnten in den letzten Jahren eine Reihe neuer Investitionen gewinnen. Stettin selbst
hat bisher keine Gewerbegebiete als Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen. Derzeit wird
aber über die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone auf Stettiner Stadtgebiet verhandelt.
Auch das Gelände der ehemaligen Stettiner Werft ist als mögliches Gebiet dafür im
Gespräch. Nicht zuletzt durch die Entwicklung in den Sonderwirtschaftszonen, hat sich das
Verarbeitende und Produzierende Gewerbe in den letzten Jahren besser in den
Umlandgebieten von Stettin platziert.
39 PAIZ = polnische Agentur für Auslandsinformationen und Investitionen
Wilke, Maack und Partner
45
Koszalin
Stargard
Police
Goleniow
Gryfino Barlinek
Stettin
Abbildung 11: Sonderwirtschaftszonen in Polen
Polnische Sonderwirtschaftszonen (SWZ) Es gibt in Polen insgesamt 14 Sonderwirtschaftszonen (siehe Karte)
Vorteile für Unternehmen in einer SWZ:
• Freistellung von der Körperschaftssteuer
• Freistellung von der Immobiliensteuer
• Erschlossene Gewerbegebiete
• Unterstützung durch die Verwaltungsagenturen während der
Investitionsphase
Unterzonen in der Wojewodschaft Westpommern
Nach der Konzentration von Investitionen im südpolnischen Industrieraum gibt es vermehrt Ansiedlungen in den Unterzonen (z. B.
im Umland von Szczecin).
Die Unterzonen Goleniow, Police, Barlinek, Karlino und Gryfino gehören zur Haupt-Sonderwirtschaftszone in Kostrzyn.
Die Unterzonen Stargard und Koszalin gehören zur Haupt-Sonderwirtschaftszone in Sopot.
In Stettin wird derzeit über die Einrichtung einer SWZ verhandelt. Es besteht die Möglichkeit eine Unterzone der
SWZ Euro-Park Mielec auszuweisen.
Umgekehrt sind die wirtschaftlichen Verflechtungen gemessen an den Direktinvestitionen
noch schwächer ausgeprägt. Polnische Unternehmen, die in der deutschen Grenzregion
investieren, sind die Ausnahme. Dazu gehörte z.B. das Metallverarbeitungsunternehmen
ROMAG aus Poznan, das sich 2007 in Pasewalk niedergelassen hat und dort, bis zur Insolvenz
im Jahr 2009, etwa 20 Mitarbeiter beschäftigte. Darüber hinaus finden sich einzelne
Investitionen in der Lebensmittelbranche, wie etwa der polnische Gewürzproduzent
Fleischmann AG der seit 2008 in Löcknitz eine Produktionsstätte mit sechs Beschäftigten
betreibt40. Einerseits ist die deutsche Grenzregion aufgrund der niedrigen Immobilienpreise,
der unmittelbaren Anbindung an den deutschen Markt und der Möglichkeit, in Deutschland
zu produzieren („made in Germany“) für polnische Unternehmer interessant. Andererseits
sind die Schwächen der deutschen Grenzregion – niedrige Kaufkraft und vor allem der
Mangel an Fachkräften – wichtige Gründe dafür, dass die Anzahl der polnischen
Direktinvestitionen in den letzten Jahren auf niedrigstem Niveau geblieben ist.
40 Vgl. MV-Schlagzeilen Februar 2008
Eigene Darstellung
Wilke Maack und Partner
Quelle: Ernst&Young 2007
Wilke, Maack und Partner
46
Darüber hinaus ist der Stand der wirtschaftlichen Verflechtungen auch dadurch geprägt, dass
sich einige deutsche Unternehmen mit dem Aufkommen der Wirtschafts- und Finanzkrise
wieder vom polnischen Markt zurückgezogen haben. Vor allem Unternehmen im Bereich des
Kfz- und Autohandels und des Baustoffgroßhandels haben nach den anfänglichen Boom-
Jahren kurz nach dem EU-Beitritt ihr Engagement im polnischen Grenzgebiet wieder
beendet. Ein weiterhin wachsender Wirtschaftszweig im Grenzgebiet, der vom gewachsenen
Grenzverkehr profitiert, bleibt der (Lebensmittel-) Einzelhandel.
5.3. Kulturelle Verflechtungen
Anders als bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Verflechtungen kann man dem
Zusammenwachsen der Grenzregion im kulturellen Bereich seit 2004 eindeutige Fortschritte
attestieren. In den letzten Jahren hat sich in der Region so etwas wie eine
„Grenzgesellschaft“ herausgebildet. Während Stettin vor allem von deutschen
Unternehmern noch nicht als Zentrum mit Ausstrahlungskraft wahrgenommen wird,
etabliert sich die Stadt allmählich als wichtiger Anlaufpunkt für kulturelle Angebote in der
Region. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der insgesamt angewachsene Tourismus
zwischen Polen und Deutschland. Stettin setzt große Hoffnungen darin, mit dem Bau der
neuen Philharmonie einen weiteren Anziehungspunkt für Reisegruppen und kulturell
Interessierte aus der Region zu erhalten.
Ein weiterer entscheidender Punkt, der sich zwar kaum messen lässt, der aber im Gespräch
mit den Akteuren in der Region deutlich wurde, ist, dass sich das Verhältnis zwischen
Deutschen und Polen in der Grenzregion in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat.
Insgesamt hat sich die Denkweise über den jeweiligen Nachbarn in der Grenzregion insofern
verändert, dass negative Vorurteile und Berührungsängste auf dem Rückzug sind.
5.4. Verflechtungen im Bereich Bildung und Ausbildung
Einer der wichtigsten Eckpfeiler für ein nachhaltiges Zusammenwachsen in der deutsch-
polnischen Grenzregion sind die Verflechtungen in den Bereichen Bildung und Ausbildung.
Auch hier haben sich seit dem EU-Beitritt einige Fortschritte ergeben, wenngleich sich viele
der Ansätze noch in der Anfangsphase befinden. Kooperationen finden in der Grenzregion
im interkulturellen Bereich verstärkt im Rahmen von Sprachkursen und der Entstehung einer
deutsch-polnischen Bildungslandschaft statt. Die Bedeutung des gegenseitigen
Wilke, Maack und Partner
47
Spracherwerbs wurde auch 2006 in der Koalitionsvereinbarung für die 5. Legislaturperiode
des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern explizit festgehalten, indem es heißt: „Das
Erlernen von Polnisch durch zweisprachige Angebote in Kindergärten und Schulen, aber auch
Einrichtungen der beruflichen Aus- und Fortbildung in der Grenzregion wird unterstützt“41.
Daraus hervorgegangen ist beispielsweise das Modellprojekt zur „Mehrsprachigen Erziehung
in Kindergärten und weiterführenden Einrichtungen“ der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
e.V.. Darüber hinaus bieten einzelne Schulen in der Grenzregion einen polnischen
Schwerpunkt im Sprachunterricht an42.
Noch ganz am Anfang stehen die Initiativen und Projekte zu einer grenzüberschreitenden
beruflichen Ausbildung, die langfristig für einen gemeinsamen deutsch-polnischen
Arbeitsmarkt in der Region unerlässlich sind. Es wurden bereits Pilotprojekte für eine bi-
nationale Ausbildung in den Berufsfeldern Gastronomie, Mechatronik und Bauhandwerk
durchgeführt. Die Berufsberatung der Arbeitsämter ist verstärkt auf den deutsch-polnischen
Berufsraum ausgerichtet um Arbeits-Möglichkeiten jeweils jenseits der Grenze aufzuzeigen.
Wichtige Themenfelder mit denen sich vor allem die deutsch-polnische IHK in der Region
auseinandersetzt, sind z.B. die beidseitige Anerkennung der jeweiligen Abschlüsse, die
Zweisprachigkeit der Abschlusszeugnisse oder die Einrichtung deutsch-polnischer
Ausbildungsgänge. Neben den bereits punktuell erfolgreichen Zusammenarbeiten bei der
Berufsausbildung, gibt es vor allem ein wachsendes Interesse von Unternehmen, die in Polen
nach dem Vorbild des dualen Ausbildungssystems ausbilden möchten. Andererseits
interessieren sich viele Betriebe auf deutscher Seite für polnische Fachkräfte. Die
beschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit und das, verglichen mit Hamburg oder Berlin,
geringere Lohnniveau machen die deutsche Region allerdings weniger attraktiv für
Fachkräfte und Hochqualifizierte aus Polen. Der Regionale Planungsverband Vorpommern
konzentriert sich zurzeit im Rahmen des Projekts „Modellvorhaben der Raumordnung“
(MORO) auf Vernetzungen in der Region zum Thema Fachkräftesicherung43.
Für polnische und deutsche Studenten hat sich mit dem Beitritt zur EU der Zugang zu den
Hochschulen des jeweiligen Nachbarlandes erleichtert. Dieser Austausch findet allerdings 41 Siehe Koalitionsvertrag der 5. Legislaturperiode MV : http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=12147 42 Vgl. Website Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V. MV 43 Vgl. dazu „READER über Netzwerke und Projekte der Fachkräftesicherung im Nordosten“ 2010, online verfügbar unter: http://www.rpv-vorpommern.de/fileadmin/dateien/dokumente/pdf/Projekte/MoRo_Metropolregionen/Reader_Fachkraeftesicherung_27_04_10.pdf
Wilke, Maack und Partner
48
stärker überregional als innerhalb der Grenzregion statt. Für die Kooperationen im
Hochschulbereich innerhalb der Grenzregion sind das Angebot deutsch-polnischer
Studiengänge sowie gemeinsame Forschungsvorhaben von größerer Bedeutung.
Partnerschaften und Hochschulkooperationen zwischen der Universität Stettin und den
Universitäten und Fachhochschulen der deutschen Grenzregion bestehen bereits seit den
1990er Jahren. Seit dem EU-Beitritt hat sich die Intensität der Forschungszusammenarbeit
zwischen den Hochschulen allerdings nicht signifikant erhöht. Zu den
Forschungskooperationen gehören z.B. die Zusammenarbeit der Fachhochschule Stralsund
und der Universität Stettin im Forschungsbereich der Nutzung alternativer Energien, oder
das Kooperationsprojekt „Study of Health in Pomerania“ zwischen den Universitäten
Greifswald und Stettin.
In der Studie „Wachstumspol Stettin“ von 2004 wurde der fehlende Wissenstransfer
zwischen Forschung und Wirtschaft in der deutsch-polnischen Grenzregion bemängelt.
Einige private Bildungs- und Forschungseinrichtungen betreiben heute Wissenstransfer in
Form von Netzwerken oder gemeinsamer Forschung in der Region im grenzübergreifenden
Kontext, dazu gehören z.B.:
o InBIT gGmbH aus Greifswald (Bildung)
o Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej aus Szczecin (Bildung)
o BioCon Valley aus Greifswald (Life Science)
o West Pomeranian Center of Advanced Technologies (Life Science)
Eine wichtige Rolle spielen auch die von der Europäischen Union initiierten und (mit-)
finanzierten Forschungsprojekte in der Grenzregion, wie etwa das deutsch-polnische
Telemedizin Netzwerk für die Region Pomerania44.
44 Vgl. Telemedizin-Modellregion POMERANIA: http://idw-online.de/pages/de/news351549
Wilke, Maack und Partner
49
5.5. Stand und Entwicklung grenzüberschreitender Verflechtungen
Die Kooperationen innerhalb der Grenzregion sind je nach Bereichen unterschiedlich
ausgeprägt, wenngleich davon ausgegangen werden kann, dass sich seit dem EU-Beitritt im
Jahr 2004 in den meisten Bereichen eine Intensivierung der grenzüberschreitenden
Verflechtungen ergeben hat. Dennoch gibt es Defizite bzw. es werden nach wie vor viele
Potenziale die sich aus einer grenzüberschreitenden Kooperation ergeben nicht genutzt.
Die Kooperationen im administrativen Bereich sind geprägt von der Zusammenarbeit auf
Landes- bzw. Wojewodschaftsebene und von Städtepartnerschaften in der Grenzregion. Die
Defizite liegen hier allerdings in der Form der Zusammenarbeit, die weniger gemeinsame
Zielsetzungen entwickelt und umsetzt, als sich vielmehr auf einen gegenseitigen
Informationsaustausch beschränkt.
Entscheidend für die Intensität der Kooperationsbeziehungen ist das Thema der
Zusammenarbeit. Eindeutige Konsensthemen in der Grenzregion, bei denen die
Zusammenarbeit auf vergleichsweise hohem Niveau funktioniert, sind die Bereiche Ökologie
und Tourismus. Allerdings gibt es auch hier Vertiefungsbedarf, z.B. gibt es nach wie vor noch
keinen deutsch-polnischen Tourismusverband in der Grenzregion. Kooperationen
vereinfachen sich außerdem wenn die Finanzierung über einen Dritten, wie in diesem Fall
häufig die Europäische Kommission, angeschoben oder getragen wird. Eine Reihe erfolgreich
durchgeführter EU-finanzierter Projekte in der Region bestätigen dies. Vor dem Hintergrund,
dass Mecklenburg-Vorpommern nach 2013 mit großer Wahrscheinlichkeit aus der höchsten
Förderpriorität der Europäischen Kohäsionspolitik herausfallen wird und dadurch deutlich
weniger Fördermittel zur Verfügung stehen werden, bedarf es diesbezüglich mittelfristig
veränderter Strategien. Langfristig müssen sich die Kooperationen in fast allen Bereichen
von der Beschränkung auf EU-subventionierte Projekte loslösen, um ein nachhaltiges
Zusammenwachsen der Region zu garantieren.
Hervorzuheben ist das gesteigerte Interesse der Stettiner Stadtpolitik an einer
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Initiativen wie die Konferenz „Stettin- Unser
Grenzraum“, die von der Stadt selbst ausgehen, sind grundlegend für die Stärkung der Rolle
Stettins als Zentrum der Region und müssen sich etablieren und langfristig beibehalten
werden.
Wilke, Maack und Partner
50
Seit dem EU-Beitritt gab es verstärkt Direktinvestitionen deutscher Firmen im Stettiner
Raum. Besonders die Sonderwirtschaftszonen im Stettiner Umland haben davon profitiert.
Dagegen gab es im gleichen Zeitraum kaum polnische Investitionen in der deutschen
Grenzregion. Insgesamt gibt es aus ökonomischer Perspektive nur kleine Fortschritte bei der
deutsch-polnischen Stadt-Umland Kooperation. Ein Integrationsprozess hat insofern bisher
nicht stattgefunden, als dass der überwiegende Teil der Investoren, die sich in Stettin und
Umland niedergelassen haben nicht aus der deutschen Grenzregion, sondern vor allem aus
den norddeutschen Bundesländern stammt. Sowohl das Interesse der Unternehmen aus
Mecklenburg-Vorpommern in Polen zu investieren, als auch umgekehrt, ist nach wie vor
gering. Zwar haben polnische Unternehmer die Wichtigkeit des deutschen Marktes längst
erkannt, allerdings überspringen sie bei ihren Entscheidungen die deutsche Grenzregion.
Die Entstehung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes in der Region setzt die
Arbeitnehmerfreizügigkeit, den Abbau von Sprachbarrieren sowie die gegenseitige
Anerkennung von Abschlüssen voraus. Das gewachsene Interesse an deutsch-polnischen
Bildungsangeboten und Sprachkursen in der Grenzregion weisen diesbezüglich in die richtige
Richtung. Gleichzeitig können der Abbau von Sprachbarrieren und die grenzüberschreitende
Ausbildung die Identifikation mit der Region stärken; ein entscheidender Punkt, um der
Abwanderung, vor allem des jüngeren Teils der Bevölkerung entgegenzuwirken.
Die Abbildung 12 fasst die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchung nochmals grafisch
zusammen. Auf den Balken wird jeweils der Stand der Verflechtungen zwischen „sehr
niedrig“ und „sehr hoch“ für die Jahre 2004 und 2009 abgebildet. Dadurch lässt sich
erkennen, in welche Richtung sich die Intensität der Verflechtungen in den unterschiedlichen
Bereichen seit 2004 verändert hat. Es werden die Kooperationen sowohl aus der Perspektive
„Polen nach Deutschland“, als auch von „Deutschland nach Polen“ betrachtet.
Wilke, Maack und Partner
51
Abbildung 12: Kooperation und Integration in der deutsch-polnischen
Grenzregion45
Darstellung von Entwicklungstendenzen anhand von Expertengesprächen und eigenen Analysen
Polen Deutschland Deutschland Polen
Verflechtungsgrad
Migration innerhalb der Grenzregion
Pendlerverflechtungen innerhalb der Grenzregion
Kooperationen auf administrativer Ebene,
Städtepolitik, gemeinsame Raumordnung
Direktinvestitionen
Kulturelle Verflechtungen,
deutsch-polnische Nachbarschaft, Tourismus
Kooperationen im Schul-, Ausbildungs-,
Hochschul-und Forschungsbereich
sehr niedrig sehr hoch
45 Die Darstellung ist nicht das Ergebnis von Berechnungen, sondern der Versuch Einschätzungen und
Entwicklungstendenzen, die vor allem in Kapitel 5 identifiziert wurden auf einer Skala abzubilden.
Mathematische Berechnungen spielen dabei keine Rolle.
2004
2009
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009
2009*
2009
2009
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009
2009
2009
2009
2009
*Der überwiegende Teil der Direktinvestitionen stammt nicht aus dem
deutschen Teil der Grenzregion, sondern aus den norddeutschen
Bundesländern (siehe Kapitel 3.2)
Wilke, Maack und Partner
52
6. Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Aktualisierung der Studie „Wachstumspol Stettin“ war es, zu
untersuchen, ob und welche Anzeichen es dafür gibt, dass seit dem EU-Beitritt 2004 ein
Entwicklungsprozess in der deutsch-polnischen Grenzregion im Sinne einer wachsenden
grenzüberschreitenden Verflechtung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
(Integrationshypothese) in Gang gesetzt wurde. Die Ergebnisse sind ambivalent, spiegeln
aber nach Meinung der Autoren damit die momentane Situation der deutsch-polnischen
Grenzregion wieder. Einerseits haben sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der deutsch-
polnischen Grenzregion zumindest von 2004 bis 2008 überwiegend positiv entwickelt;
andererseits zeigt die Untersuchung, dass die Ursachen und Impulse dafür oftmals nicht auf
Initiativen aus der Region heraus, sondern auf Einflüsse und Rahmenbedingungen, die von
außerhalb auf die Region gewirkt haben, zurückzuführen sind.
Nachdem sich sowohl auf der deutschen, als auch auf der polnischen Seite der Grenzregion
die wirtschaftliche Situation und die Beschäftigungslage vor dem EU-Beitritt Polens massiv
verschlechtert hatten, stellte sich zum Teil bereits 2003 – zum Teil erst 2007 – auf beiden
Seiten der Grenze eine Trendwende mit wirtschaftlichem Wachstum, sinkender
Arbeitslosigkeit und steigenden Beschäftigungszahlen ein. Die Gründe dafür lagen vor allem
in einer allgemein positiven konjunkturellen Entwicklung in der EU, einer erfolgreichen
Nutzung der EU-Förderkulisse auf der deutschen und ab 2005 auf der polnischen Seite, aber
auch in der Abwanderung von Arbeitskräften bzw. deren vorzeitigem Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben und der Wirkung statistischer Effekte (siehe Kapitel 4).
Die Beschäftigungs-Trendwende setzte in der polnischen Grenzregion um zwei bis drei Jahre
früher ein als in der deutschen Grenzregion. Insbesondere auf der deutschen Seite konnte
der Beschäftigungsaufbau den massiven Abbau der Vorjahre nicht annähernd kompensieren.
Auch auf der polnischen Seite der Untersuchungsregion ist dieses nicht in dem Maße
gelungen wie z.B. in der Wojewodschaft Westpommern oder in Polen insgesamt. Aktuell hat
der positive Trend auf der deutschen Seite Bestand. Auf der polnischen Seite haben die
Einflüsse und Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise den positiven Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungstrend stark gedämpft. Insbesondere in Stettin hat sich die Arbeitsmarktlage
durch die Schließung der Stettiner Werft erneut spürbar verschlechtert.
Wilke, Maack und Partner
53
Die positiven Entwicklungen im Untersuchungszeitraum haben zusammenfassend betrachtet
den Abstand der deutsch-polnischen Grenzregion zu den jeweiligen anderen Regionen
Deutschlands bzw. Polens nicht größer werden lassen, diesen aber auch nur partiell
verringert. Die Planungsregion Vorpommern etwa, hat aufgrund ihrer regional orientierten
Wirtschaftsstruktur die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise im Vergleich zu
anderen Regionen Deutschlands weniger zu spüren bekommen.
Die Analyse der Kooperationen hat gezeigt, dass in vielen Bereichen eine Intensivierung der
grenzüberschreitenden Verflechtungen im Kleinen stattgefunden hat. Basis für viele dieser
Initiativen und Projekte war die Förderung durch die Europäische Union.
Die Auswertung der Direktinvestitionen ab 1 Mio.€ verdeutlicht, dass nahezu alle Investoren
auf diesem Niveau, die sich in Stettin und Umland niedergelassen haben, nicht aus der
deutschen Grenzregion, sondern vor allem aus den nord- und westdeutschen Bundesländern
oder anderen Staaten der Europäischen Union stammen (siehe Kapitel 5.2). Umgekehrt sind
größere polnische Investitionen in der Planungsregion Vorpommern kaum zu verzeichnen.
Die Mehrzahl der grenzüberschreitenden substanziellen wirtschaftlichen Verflechtungen der
polnischen Grenzregion konzentriert sich nicht auf die Planungsregion Vorpommern, nicht
zuletzt aufgrund fehlender wirtschaftsstruktureller bzw. investiver Potenz auf der deutschen
Seite. Insofern ist aus Sicht der deutschen Grenzregion heute eher die Tendenz in Richtung
Transit- und Übersprung als in Richtung Integration zu verzeichnen. Hinzu kommt, dass sich
im Untersuchungszeitraum neben Stettin vor allem die kleineren Städte des Stettiner
Umlands als Investitionszentren im Zuge der Einrichtung von sogenannten
Sonderwirtschaftszonen etabliert haben.
Insgesamt ist Stettin seit 2004 in seiner Entwicklung hinter den Erwartungen und
Möglichkeiten, die Rolle als urbanes Zentrum der gesamten deutsch-polnischen Region
auszufüllen, zurückgeblieben. Die Stettiner Stadtpolitik ist nach wie vor von mangelnder
Kontinuität geprägt, langfristig angelegte Strategien sind dadurch nur schwer beizubehalten.
Stettin hat sich erst nach Abschluss des Prozesses zur eigenen Leitbildfindung 2008/20009
der Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zugewandt. Folglich ist
Stettin dem Ziel ein Zentrum oder gar eine Metropole für die gesamte deutsch-polnische
Region zu sein, bisher kaum näher gekommen. Trotz der zeitweise positiv verlaufenden
Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Beschäftigung seit 2004 und
den durch die Grenzöffnung vereinfachten Möglichkeiten zu einer grenzüberschreitenden
Wilke, Maack und Partner
54
Kooperation, sind die großen „Meilensteine“ im Zusammenwachsen der deutsch-polnischen
Grenzregion im Untersuchungszeitraum ausgeblieben.
Vision Zentrumsregion Stettin 2015?
In der Studie „Wachstumspol Stettin“ von 2004 wurden Eckpunkte für die Entwicklung einer
deutsch-polnischen Region mit einem starken Zentrum Stettin bis 2015 formuliert. Mit der
vorliegenden Untersuchung wurde versucht, nach der Hälfte der Zeit Bilanz zu ziehen. Die
vorhandenen Ansätze haben bisher keinen substanziellen Integrationsprozess eingeleitet. Es
gilt weiterhin, dass die erwartete grenzüberschreitende Zentrumsfunktion bisher weder von
der Stadt Stettin ausreichend verfolgt, noch von den Regionen des deutsch-polnischen
Umlands aktiv eingefordert wird. Vor diesem Hintergrund haben die Kernaussagen der
Studie von 2004 weiterhin Bestand. Für einen Integrationsprozess in der deutsch-polnischen
Grenzregion mit dem gemeinsamen Zentrum Stettin im Mittelpunkt bedarf es strategischer
Maßnahmen und Initiativen mit dieser Zielsetzung. Um die Qualität und das Funktionieren
der Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion nicht vordergründig von
„äußeren“ Einflüssen abhängig zu machen, sind arbeitsfähige Kooperations- und
Prozessstrukturen und Instrumente innerhalb der Region nach wie vor die
Grundvoraussetzung für die Entwicklung hin zu einer Zentrumsregion Stettin.
Eine der zentralen Handlungsempfehlungen aus der Studie des Jahres 2004 ist die Bildung
einer „Arbeitsgruppe deutsch-polnische Zentrumsregion Stettin“. Im Unterschied zu
bestehenden Initiativen und Gruppen darf die Zielsetzung einer solchen Gruppe nicht nur in
der Bündelung und Auswertung von Informationen liegen, sondern sie muss
Entwicklungskompetenz aufweisen und prozessorientiert arbeiten. Knapp gesagt, es fehlt an
einem Entwicklungsauftrag auf der Basis gemeinsamer deutsch-polnischer Zielsetzungen für
die Region. Hierzu gehören langfristige Prozessziele wie Stadt-Umland-Integration,
Internationalisierung und Identitätsbildung ebenso wie eher mittelfristige
Kooperationsinitiativen zur Herausbildung regionaler Kompetenzen.
In der Studie „Wachstumspol Stettin“ von 2004 wurden Ansätze zur Entwicklung einer
Zentrumsregion Stettin in drei Phasen für einen Zeitraum von rund zehn Jahren skizziert. Die
Aktualisierung der Studie zeigt, dass die Integration der deutsch-polnischen Grenzregion im
eigentlichen Sinne nicht stattgefunden hat. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen
sowohl auf der sozialen, kulturellen und politischen, als auch auf der operativen Ebene eher
Wilke, Maack und Partner
55
verbessert. Bestärkt durch die diesbezüglich positive Resonanz regionaler Akteure der
deutsch-polnischen Grenzregion, halten die Autoren dieser Studie an den Empfehlungen aus
dem Jahr 2004 zur Etablierung eines langfristig angelegten Prozesses zur Schaffung einer
Zentrumsregion Stettin fest – ein Integrationsprozess, der sowohl für die deutsche als auch
für die polnische Teilregion ohne Alternative ist, wenn die Region nicht auch in diesem
Jahrzehnt zu den ärmsten und strukturschwächsten Regionen der Europäischen Union
zählen will.
Wilke, Maack und Partner
56
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
Central Statistical Office Warsaw (2009): Demographic Yearbook of Poland
Europäischer Sozialfonds (2007): Operationelles Programm des Landes Mecklenburg-
Vorpommern im Ziel Konvergenz, Förderperiode 2007-2013
Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht der Landesregierung zur
Zusammenarbeit im Ostseeraum und zur maritimen Sicherheit für den Zeitraum 2007/2008.
Drucksache 5/1464
Maack, Klaus et al. (2005): Wachstumspol Stettin und Auswirkungen auf die Entwicklung der
deutsch-polnischen Grenzregion. Edition der Hans-Böckler-Stiftung Nr.132
MV-Schlagzeilen „ Zweite polnische Firma investiert in Mecklenburg-Vorpommern“ vom
22.Februar 2008, Online unter http://www.schlagzeilen.de/zweite-polnische-firma-
investiert-in-mv/1701/
Office of the Committee for European Integration (OCEI) (2009): 5 years of Poland in the
European Union. Department of Analyses and Strategies, Warsaw
Regionaler Planungsverband Vorpommern (2009): Regionales Raumentwicklungsprogramm
Vorpommern - Entwurf 2009
Sachverständigenrat (2009): Die Zukunft nicht aufs Spiel setzten- Jahresgutachten 2009/10
Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2009): Statistische Hefte 1/2009
Statistisches Amt Stettin (2008): Statistical Yearbook of Szczecin 2008
Website PAIZ (Polish Agency for foreign investment) [1] Foreign Direct Investements in Poland
http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures/foreign_direct_investment (Zugriff März 2010)
Statistische Datenbanken Bundesagentur für Arbeit http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/interim/statistik-
themen/index.shtml
Statistisches Amt Stettin- Online-Datenbank http://www.stat.gov.pl/szczec/index_ENG_HTML.htm Statistisches Bundesamt- Online-Datenbank http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
Statistisches Ämter des Bundes und der Länder- Online-Datenbank https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon