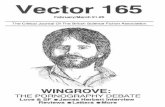Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert. Château Gaillard 26, 2012 (Aabenraa) 159-165
Transcript of Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert. Château Gaillard 26, 2012 (Aabenraa) 159-165
u
Château Gaillard 26…, Caen, PUC (Publications du CRAHAM), 2014, p. 159-165
Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert
Peter Ettel*
Fünfzig bis sechzig Jahre lang, bis 955, haben die ungarischen Reiterscharen wiederholt die Regionen
des Ostfränkischen Reichs im heutigen Deutschland, Ita-lien, Frankreich und Spanien überfallen und als „Geißel des Abendlandes“ große Not und Schrecken hervorgerufen. Davon zeugen die historischen Berichte, z.B. des Regino von Prüm und des Widukind von Corvey. Die Ungarn waren wegen ihrer für Reitervölker typischen Kampfesweise und Bewaffnung gefürchtet. Sie waren auf den Kampf zu Pferde spezialisiert, der es ihnen ermöglichte, im Gefecht und bei Überfällen schnell und wendig zu sein, nach erfolgtem Angriff sich schnell zurückziehen und große Entfernungen zurück-legen zu können. Der Reflexbogen versetzte sie zudem in die Lage, einerseits aus dem Sattel heraus, andererseits aus relativ großer Distanz den Gegner zu beschießen, z.B. auch mit Brandpfeilen Siedlungen und Klöster, Städte sowie Befes-tigungen und Burgen anzugreifen1.
Historische Überlieferung zum Befestigungsbau gegen die Ungarn
Welche Art von Burgen haben die Ungarn auf ihren Zügen im ostfränkischen Reich nun angetroffen und angegriffen? Stellen die sogenannten Ungarnrefugien oder -wälle ihrerseits als Reaktion auf die Ungarneinfälle indirekt einen archäolo-gischen Nachweis der Ungarneinfälle dar? Sicherlich besaßen die Burgen weder eine einheitliche Bauart noch einen genorm-ten Grundriss, wie früher noch vermutet. So sollten nach
der Wormser Burgenbauordnung zur Abwehr der Ungarn die bereits vorhandenen Burgen ausgebaut werden, ständig besetzt und mit Proviant versehen sein. Aber es sollten auch ganz neue Befestigungen errichtet werden, die vor Jahrzehnten in der Forschung mit den sog. Heinrichsburgen über- und falsch bewertet wurden2. In Süddeutschland wurden, von Paul Reinecke angeregt, hohe Wälle als typische Ungarnburgen bzw. -refugien herausgestellt, die bis heute in der Forschungs-geschichte eine wichtige Rolle spielen3.
Best bekanntes, auch historisch belegtes Beispiel für ein Ungarnrefugium ist St. Gallen (Abb. 1.1). Hier wurde 926 nach dem Bericht von Ekkehard IV. im Zuge der Ungarngefahr ein Wall mit Graben und Verhau, die Waldburg bei Häggenschwil aufgeschüttet, die aber von den Ungarn dann doch nicht angegriffen wurde4. Sie diente mit etwa 1,4 ha Umfang als Refugium für die mehr als 100 Mönche des ca. 6,5 km entfernt liegenden Klosters St. Gallen, in dessen Kapelle auch Kreuze, Kapseln mit den Totenverzeichnissen und der Klosterschatz gebracht wurden.
Eichstätt wurde 741 von dem heiligen Willibald als Benediktinerkloster gegründet und schon bald, zwischen 741 und 750, zum Bistumssitz erhoben, der allerdings nicht, wie die etwa zeitgleich gegründeten Bistumssitze Würzburg, Büraburg mit oder gar auf einer Burg eingerichtet, sondern erst 908 im Zuge der Ungarngefahr befestigt wurde. Bischof Erchanbald erhielt 908 für Eichstätt von König Ludwig dem Kind die Erlaubnis, bei seinem Kloster einen Markt einzu-richten mit Zoll- und Münzrecht sowie einen befestigten Ort herzustellen – urbem que construere contra paganorum
* Bereich für Ur- und Frühgeschichte, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland.
1. Zu Ungarn allgemein: Anke et al. 2008; Schulze-Dörrlamm 2007.
2. Jankuhn 1965.3. Reinecke 1930; Reinecke 1952.4. Eccardus/Helbling 1958; Schwarz 1989.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
Peter Ettel160
incursus moliri. Grabungen 1984 und 1985/86 erbrachten ein stellenweise wohl zweiphasiges Grabenwerk von 12 m Breite mit zweifacher Abtreppung und 4 m breiter Sohle sowie einen Palisadenzaun, der im Abstand von durchschnittlich 1 m von der inneren Grabenkante verlief und von der Grabenseite her abgestützt war5. Anzunehmen, aber nicht belegt ist, dass der Grabenaushub als Wall aufgeschüttet wurde (Abb. 1.2 & 1.3). Diese Befestigung von ca. 700 m Länge und auffallend runder Form wird mit der Nennung von 908 in Zusammenhang stehen und unter Bischof Erchanbald entstanden sein.
Archäologisch untersuchte Ungarnburgen
Die inzwischen seit Paul Reinecke über 80 Jahre andauernde Forschung zu Abwehr- und Befestigungsmaßnahmen gegen die Ungarn zeigt deutlich, dass in erster Linie topographische Merkmale zur Definition dieser Befestigungen und Burgen herangezogen wurden. Dazu gehören hohe, geschüttete Wälle, teils ältere Befestigungen überlagernd mit vorgela-gertem Graben. Charakteristisch scheinen geschüttete, heute teils noch 4-6 m hoch erhaltene Wälle. Die Gräben sind bei diesen Wallanlagen mit einer durchschnittlichen Breite von 10-12 m sehr groß dimensioniert. Kennzeichnend ist oftmals ein mehrfach gestaffeltes Wallgrabensystem, das, meist als Abschnittsbefestigung ausgeführt, Spornlagen abriegelt. Ring-wälle sind hingegen untypisch6. Den Zugang zum Innenraum stellten einfache Tordurchlässe oder solche mit einbiegenden Torwangen am Rand der Befestigung bzw. am Steilhang dar. Von den in der Literatur als Ungarnburgen angesprochenen Anlagen wurden jedoch nur wenige wie Karlburg und Veits-berg tatsächlich mit Grabungen archäologisch untersucht.
Die zunächst königliche Burg Karlburg befand sich seit 751/753 im Besitz der Würzburger Bischöfe. In der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts wurde die karolingische Befestigung aufgegeben, der Graben eingefüllt und planiert, als man eine neue, größere Anlage auf bisher ungenutztem Gelände davor errichtete, die jetzt mit 170 x 120 m eine vergrößerte Innenflä-che von 1,7 ha besaß7. Auch die neue Befestigung grenzte den Sporn bogenförmig ab (Abb. 2). Die Befestigung setzte sich aus einem mit Steinen und Erdreich geschütteten Wall von etwa 9-10 m Breite und einem ohne Berme vorgelagerten Graben zusammen. Nach den 14C-Daten aus dem Pfostenhaus am Wallfuß dürfte der Wall tatsächlich in der Ungarnzeit errichtet worden sein. Zu dieser Befestigungsphase gehört vermutlich der nördlich in 100 m Entfernung vom Osthang abgehende, bogenförmige, kleine Wall mit Graben von etwa 150 m Länge. Der 5,5 m breite und noch 0,8 m hoch erhaltene Wall mit dem ohne Berme vorgelagerten Graben von 5,5 m Breite und 1,7 m Tiefe ist ebenfalls geschüttet und so in gleicher Art und Weise wie der große Wall mit Graben ausgeführt. Nochmals 100 m
vorgelagert befindet sich eine weitere Wall-Graben-Sperre von noch 40 m erhaltener Länge. Beide Sperren stellen auf dem nach Norden hin ansteigenden Vorgelände wirksame Annäherungshindernisse gerade für Reiter dar.
Wie Karlburg ist wohl auch Salz, Bad Neustadt a. d. Saale aus einem Königshof als Mittelpunkt eines fiscus hervorge-gangen. Mit seiner Konzentration von frühmittelalterlichen Anlagen, darunter drei Burgen, zugehörigen Siedlungen im Tal sowie einem Gräberfeld, ist der Ort als mehrgliedriger Siedlungskomplex ausgewiesen. Mehrfache Herrscherauf-enthalte sind belegt und zeigen die Bedeutung dieser Pfalz, allein Otto der Große hielt sich 940 bis 948 viermal in Salz auf. Seit 2010 wird der Veitsberg als mutmaßlicher Standort der Pfalz, auf jeden Fall fortifikatorischer Mittelpunkt des Pfalzkomplexes, in einem Projekt mit geophysikalischen Prospektionen, Luftbild- und Laserscananalysen sowie wei-teren Ausgrabungen untersucht, die schon 1983 bis 2006 eine komplexe Innenbebauung u.a. mit mehreren Bauten und einer jüngeren Turmburg, erbrachten8. Die laufenden Grabungen (Abb. 3) bestätigen das Bild, dass hier eine Burg mit ausgeprägter mehrphasiger Befestigung stand – wobei die relative Abfolge und insbesondere die Datierung der einzelnen Bauphasen noch geklärt und abgesichert werden müssen –, darunter ein Erdwall, bei dem es sich ebenfalls um eine ungarnzeitliche Befestigung wie auf der Karlburg handeln könnte.
Annäherungshindernisse bei Burgen
Annäherungshindernisse spielten als wirksame Abwehr gegen die Reiterheere der Ungarn sicherlich eine wichtige Rolle. Dies wurde in der Forschung auch in den letzten Jahrzehnten mehrfach herausgestellt. Dazu gehören dem Abschnittswall vorgelagerte Annäherungshindernisse, so etwa einfache Gräben mit Wall dahinter, wie auf der Karlburg, bzw. vor-gelagerte Grubenfelder, wie bei Schäftlarn, oder Erdriegel wie bei der Haldenburg, deren Interpretation, insbesondere Zeitstellung allerdings ohne Grabungen bislang noch nicht endgültig gesichert ist.
Das Kloster Schäftlarn wurde zwischen 760 und 764 im Isartal im Voralpenland gegründet. Auf der gegenüberliegen-den Isarseite liegt im Wald, etwa 1 km nördlich des Klosters die Birg (Abb. 4.2). Hierbei handelt es sich um einen auf drei Seiten steil abfallenden 90 m hoch aufragenden Bergsporn, der zur Befestigung nahezu prädestiniert ist. Der Innenraum von ca. 8 ha wird durch eine 300 m lange Abschnittsbefestigung geschützt, die sich aus einem 10 m hoch erhaltenen Wall mit doppeltem Grabenwerk und einer im Südwesten vorgelagerten Zone aus in mehreren Reihen versetzt angeordneten Gruben zusammensetzt9.
5. Rieder 1987; Rieder 2010.6. Ettel 2001, 227, Abb. 84 und 206.
7. Ibid., 32ff.; Ettel 2012, 55f.8. Wamser 1984; Ettel et al. 2011.9. Haberstroh 1999; Schwarz 1971 mit weiterer Literatur.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
161Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert
Abb. 1 – 1) Topografischer Plan der Waldburg bei Häggenschwil (Schwarz 1975, Beil. 40,6); 2) Eichstätt: Plan der Befestigung im 10. Jahrhun-dert nach 908 (Rieder 1987, 44); 3) Rekonstruktion von Eichstätt im 10. Jahrhundert (Rieder 2010, 8, Abb. 6).
Abb. 2 – Karlburg: 1) Topografischer Plan mit den Grabungsflächen von 1971-1972, 1974-1975 und 1994 (Ettel 2001, Taf. 1); 2) Fläche 4 Profil 8, Mittelteil der Wallschüttung (von Ost nach West) (Ettel 2001, Taf. 249,2); 3) Rekonstruktionen der karolingischen Mauer (Doku-ment P. Ettel).
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
Peter Ettel162
Abb. 3 – 1) Veitsberg: Gesamtplan der Befestigung mit Grabungsflächen 1983-2012. Luftbild BLfD-Luftbilddokumentation, Aufnahmedatum 20.06.2000; Foto K. Leidorf, Archiv-Nr. 5726/029, Dia 8264-20; Kartographie P. Wolters, Universität Jena; 2) Veitsberg: Digitales Gelän-demodell (Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung 2010 Hillshade, Beleuchtung Azimuth 270 Grad, Altitude 25 Grad). Kar-tographie L. Werther, Universität Jena.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
163Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert
0 100 m
Abb. 4 – 1) Verbreitung der geschütteten Wälle: 1) geschütteter Wall; 2) eventuell geschütteter Wall; 3) nach Literatur; 4) historisch belegt; 5) Annä-herungshindernisse. Kartierung P. Ettel; 2) „Birg“ bei Hohenschäftlarn (Haberstroh 1999, 114); 3) Haldenburg (Geobasisdaten Bay-erisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation). Bearbeitung H. Kerscher, Bayererisches Landesamt für Denkmalpflege.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
Peter Ettel164
Die Haldenburg mit ihren ausgeprägten Erdriegeln (Abb. 4.3) reiht sich in eine Gruppe von Burgen mit gestaffel-ten Annäherungshindernissen ein10 (Abb. 4.1). Vergleichbare Erdriegel finden sich auf dem Buschelberg, in Kleinhöhenkir-chen und Aiterndorf. 2011 wurden solche auch am Ringwall Vogelherd (Kruckenberg) mittels eines digitalen Geländemo-dells entdeckt, die an der höchsten Stelle des Geländerückens als hohlwegartige Rinnen der Befestigung im Norden vorgelagert sind. Die Reihe von 1 m hohen Erdrippen verlaufen im Abstand von 10 m bei einer Länge von 20-30 m. Auffallend ist die iden-tische Ausführung dieser Erdrippen oder Erdriegel, auch als Reitergassen bezeichnet, die schon nahezu genormt wirken.
Schluss
Die neuere Forschung (Abb. 4.1) zeigt, dass von den etwa 50 in der Literatur teilweise seit langem postulierten Ungarnwällen nur eine Handvoll von Burgen übrigbleibt, die man nach den Grabungsergebnissen tatsächlich als geschütteten Wall inter-pretieren und dazu mit großer Wahrscheinlichkeit auch in die Zeit der Ungarneinfälle, ausgehendes 9. und v.a. erste Hälfte 10. Jahrhundert datieren kann11. Karlburg, der Veitsberg und wohl auch der Wolfgangswall über Weltenburg gehören dazu, schon andere Befunde vom Schwanberg, Castell, Mörnsheim, Rauher Kulm und Buschelberg lassen Fragen offen. Die große Mehrzahl der sogenannten Ungarnwälle, muss auch infolge fehlender archäologischer Untersuchungen bislang in ihrer
Deutung und Datierung unsicher bleiben, einige Fundplätze sind ganz sicher zu streichen.
Die Interpretation der Anlagen als ein gegen die Ungarn-einfälle errichtetes System von Burgen ist schon seit der Dis-kussion um die sächsischen Rundwälle abzulehnen. Eher wird man überlegen müssen, dass geschüttete Wälle und Annähe-rungshindernisse als befestigungstechnische Elemente, eine zeitspezifische Reaktion auf die Ungarnbedrohung waren, die leicht und schnell, ohne große Vorkenntnisse zu bewältigen war. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielten möglicher-weise Klöster bzw. die klösterlichen Schutzmaßnahmen gegen die Ungarneinfälle – auf St. Gallen mit der Schilderung von Wall, Graben und Verhau ist zu verweisen. Die Deutung als Ungarnrefugien ist ebenfalls kritisch zu sehen und jeweils im Einzelfall zu prüfen. Karlburg, Veitsberg und auch Weltenburg sind von ihrer Bedeutung sowie den zahlreichen Siedlungsbe-funden und Funden im Innenraum her mit Sicherheit nicht nur Refugien in Notzeiten gewesen. Topographische Merk-male wie hohe Wälle reichen jedenfalls für eine Interpretation als Ungarnrefugium auf keinen Fall aus. Im Analogieschluss zur historischen Schilderung von St. Gallen alle Burgen mit geschütteten Wällen12 und Annäherungshindernissen in die Ungarnzeit zu datieren und als Refugium zu interpretieren, ist sicherlich zu einfach, zumal wenn keine archäologischen Untersuchungen im Befestigungs- und Innenbereich vorlie-gen. Auf der anderen Seite ist die Existenz von Ungarnburgen unzweifelhaft, sie ist aber im Einzelfall mit entsprechenden Grabungen zu prüfen und zu belegen.
10. Schneider 1977; Kerscher 2010; Sage 1990.11. Ausführliche Darstellung in: Ettel 2012.
12. Geschüttete Wälle waren in der gesamten Vor- und Frühgeschichte, gerade zu Beginn und auch in den jüngeren Perioden, noch gebräuchlich und kennzeichnen sicherlich kein fortschrittliches Element in der Entwicklung der frühmittelalterlichen Befestigungstechnik, sondern eher das Gegenteil, wenn man sich die zeitgleiche Entwicklung im 10. Jahrhundert mit Errich-tung von Mörtelmauern und Türmen vor Augen hält.
Literatur
Anke B. et al. (2008), Reitervölker im Frühmittelalter. Hunnen, Awaren, Ungarn. Archäologie in Deutschland Sonderheft, Stutt-gart, Theiss.
Eccardus/Helbling (1958), Die Geschichten des Klosters St. Gallen. Gesamtausgabe 3, Köln, Böhlau.
Ettel P. (2001), Karlburg – Rossthal – Oberammerthal. Studien zum frühmittelalterlichen Burgenbau in Nordbayern, Rahden, Leidorf (Frühgeschichtliche und provinzialrömische Archäo-logie. Materialien und Forschungen; 5).
– (2012), „‚Ungarnburgen – Ungarnrefugien – Ungarnwälle‘. Zum Stand der Forschung“, in Zwischen Kreuz und Zinne. Festschrift für Barbara Schock-Werner zum 65. Geburtstag, T. Bitterli- Waldvogel (hrsg.), Braubach, Deutsche Burgenvereini-gung (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung, Reihe A; 15), 45-66.
Ettel P. et al. (2011), „Der Veitsberg – Forschungen im karolingisch- ottonischen Pfalzkomplex Salz, Stadt Bad Neustadt a.d. Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken“, Das archäologische Jahr in Bayern, 2011, 129-131.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen
165Ungarnburgen in Süddeutschland im 10. Jahrhundert
Haberstroh J. (1999), „‚Birg‘. Ringwallanlage und Abschnittsbe-festigung“, in Burgen in Bayern. 7000 Jahre Burgengeschichte im Luftbild, K. Leidorf & P. Ettel (hrsg.), Stuttgart, Theiss, 114-115.
Jankuhn H. (1965), „‚Heinrichsburgen‘ und Königspfalzen“, in Deut-sche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäo-logischen Erforschung. Zweiter Band, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte; 11/2), 61-69.
Kerscher H. (2010), „Gegen die Steppenreiter? – Neue Beobach-tungen am Ringwall Vogelherd bei Kruckenberg. Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Oberpfalz“, Das archäologische Jahr in Bayern, 2010, 113-116.
Reinecke P. (1930), „Spätkeltische Oppida im rechtsrheinischen Bayern“, Bayerischer Vorgeschichtsfreund, 9, 29-52.
– (1952), „Der Ringwall Staffelberg bei Staffelstein“, Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken, 36, 12-32.
Rieder K. H. (1987), „Eichstätt“, Führer zu archäologischen Denk-mälern in Deutschland, 15, 36-45.
– (2010), „Neue Aspekte zur ‚Urbs‘ der Eichstätter Bischöfe“, in Verwurzelt in Glaube und Heimat. Festschrift für Ernst Reiter, K. Kreitmeir & K. Maier (hrsg.), Regensburg, Pustet (Eich-stätter Studien; 58), 1-21.
Sage W. (1990), „Auswirkungen der Ungarnkriege in Altbayern und ihr archäologischer Nachweis“, Jahresbericht der Stiftung Aventinum, 4, 5-41.
Schneider O. (1977), „Frühe Burganlage ‚Haldenburg‘ bei Schwa-begg“, in O. Schneider et al., Archäologische Wanderungen um Augsburg, Stuttgart, Theiss (Führer zu archäologischen Denkmälern in Bayern. Schwaben; 1), 54-58.
Schulze-dörrlamm M. (2007), „Spuren der Ungarneinfälle des 10. Jahrhunderts“, in Heldengrab im Niemandsland. Ein frühun-garischer Reiter aus Niederösterreich, F. Daim (hrsg.), Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mosaiksteine; 2), 43-63.
Schwarz K. (1971), „Die Birg bei Hohenschäftlarn – eine Burganlage der karolingisch-ottonischen Zeit“, in Führer zu vor- und frühge-schichtlichen Denkmälern, Bd. XVIII: Miesbach, Tegernsee, Bad Tölz, Wolfratshausen, Bad Aibling, Mainz, Von Zabern, 222-238.
– (1975), „Der frühmittelalterliche Landesausbau in Nordostbayern – archäologisch gesehen“, in Ausgrabungen in Deutschland, Teil II: Römische Kaiserzeit im Freien Germanien, Frühmittelalter, Mainz, Verl. des römisch-germanischen Zentralmuseums (Monogra-phien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums; 1), 338-409.
– (1989), Archäologisch-topographische Studien zur Geschichte frühmit-telalterlicher Fernwege und Ackerfluren im Alpenvorland zwischen Isar, Inn und Chiemsee, Kallmünz/Opf, Lassleben (Materialhefte zur bayerischen Bodendenkmalpflege. Reihe A; 45).
Wamser L. (1984), „Neue Befunde zur mittelalterlichen Topographie des fiscus Salz im alten Markungsgebiet von Bad Neustadt a. d. Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken“, Das archäo-logische Jahr in Bayern, 1984, 147-151.
© P
ress
es u
nive
rsita
ires d
e C
aen