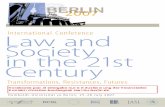Einführung und Nachschlagewerk - Deutsche Gesellschaft für ...
Umbruchzeit? Die westdeutsche Gesellschaft in den 1960er Jahren
Transcript of Umbruchzeit? Die westdeutsche Gesellschaft in den 1960er Jahren
Historisches SeminarLehrstuhl für Neuere undNeueste GeschichteDr. Patrick Bernhard E-Mail:[email protected] MüllerE-Mail: [email protected]
Proseminar im Wintersemester 2011 mit Tutorat
Umbruchzeit?Die westdeutsche Gesellschaft in den1960er Jahren
Zeit und Ort:Seminar: Montag, 14-16 Uhr, Raum: Peterhof / HS 2Tutorat: David Zimmermann ([email protected] )Sprechstunde: Montag, 12:00-14:00 oder n.Vb., Erprinzenstr. 13,1. OG Raum 09Passwörter für den Online-Semesterapparat:
Benutzername: BRD; Passwort: Sechziger; PDF: BrandtBei Problemen wenden Sie sich bitte an Herrn Ella Müller([email protected])
INHALT
KURZBESCHREIBUNG 2
ÜBERSICHT SEMINARPLAN 3
ÜBERSICHT DER STUDIEN- UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN 4
Detaillierter Seminarplan Fehler! Textmarke nicht definiert.
Kurzbeschreibung
Sie gelten als eine der wichtigsten Zäsuren im 20.Jahrhundert: die sog. langen 1960er Jahre. Zwischen dem Endedes Wiederaufbaus in den späten 1950er Jahren und der 1974einsetzenden Weltwirtschaftskrise veränderte sich diewestdeutsche Nachkriegsgesellschaft tiefgreifend. In derBoomzeit der Bundesrepublik etablierten sich nicht nur neueFormen von Öffentlichkeit. Es kam zudem zu einemEinstellungswandel etwa in Fragen von Sexualität und zuweitreichenden gesellschaftspolitischen Reformen, so nichtzuletzt im Bildungsbereich. Das Seminar fragt nach denAntriebskräften und Akteuren des Umbruchs und bilanziertdessen langfristige Folgen für Gesellschaft und Politik derBundesrepublik.
Literatur:Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland -Westeuropa - USA, München 2001, 4. Aufl. 2008; Ulrich Herbert,Liberalisierung als Lernprozess. Die Bundesrepublik in derdeutschen Geschichte. Eine Skizze, in: Wandlungsprozesse inWestdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980, hrsg. v. Ulrich Herbert, Göttingen 2002, S. 7-49; AnneRohstock und Patrick Bernhard, Writing about the “revolution”.Nuovi studi internazionali sul movimento del ‘68, in: Ricerchedi Storia Politica 11 (2008), S. 177-192 (wird in deutscherÜbersetzung zugänglich gemacht)
Zuordnungen für BA-Studiengänge:Grundlagen Neuzeit (20. Jahrhundert); außerhalb der deutschenGeschichte; 10 ETCS- für BA-Studiengänge 2011: Grundlagen Neuzeit (20.-21. Jh.);10 ETCS- für Lehramts-Studiengänge PO 2011: Grundlagen Neuzeit (20.-21. Jh.); 10 ETCS
Übersicht Seminarplan
Nr.01 24.
OktoberEinführung
02 31.Oktober
Westernisierung – Liberalisierung – 1968erJahre? Auf der Suche nach dem richtigenEtikett
03 07.November
Vorgeschichte: die frühe Nachkriegszeit
04 14.November
Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit
05 21.November
Medien und neue Öffentlichkeit
06 28.November
Zwischen „Notstand“ und „Boom“:Universitäten und Bildungspolitik
07 05.Dezember
Säkularisierung? Wandlungen im Verhältnis zuden Kirchen und zur Religion
08 12.Dezember
Sexuelle Revolution? Geschlechterbeziehungenund Liebesleben in Westdeutschland
09 19.Dezember
Pazifistische Wende? Zum Verhältnis zwischenMilitär und Zivilgesellschaft
Weihnachten
10 09. Januar Entfällt11 16. Januar Wie wurde der Papa demokratisch? Wandlungen
im familiären Bereich12 23. Januar Zwischen Dosenravioli und Beatmusik. Neue
Konsummuster 13 30. Januar Die Schattenseiten des Wandels: Verschuldung
und ökologische Probleme14 06.
FebruarResümee: Was bleibt von den Umbruchjahren?
15 13.Februar
Klausur
Übersicht der Studien- und Prüfungsleistungen
Studienleistungen Umfang Abgabetermin1 Rezension 750 Wörter 30. Januar2 Klausur (im Tutorat) zweistündig 13. Februar3 Exposé 1000 Wörter 23. Februar4 Gruppenarbeit
PrüfungsleistungHausarbeit oder mündlichePrüfung
15 Seiten/20 Minuten
04. April
Detaillierter Seminarplan
01 24.Oktober
Einführung
Gemeinsame VorstellungÜberblick über den SeminarfahrplanAnforderungen
02 31.Oktober
Westernisierung – Liberalisierung – 1968erJahre? Auf der Suche nach dem richtigenEtikett
Literatur:► Ulrich Herbert, Liberalisierung als Lernprozess. DieBundesrepublik in der deutschen Geschichte. Eine Skizze, in:Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration,Liberalisierung 1945-1980, hrsg. v. Ulrich Herbert, Göttingen2002, S. 7-49.► Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland -Westeuropa - USA, München 2001, 4. Aufl. 2008, S. 11-24 und111-126.► Rezension von Winfried Süß zu Wandlungsprozesse inWestdeutschland, in: http://www.sehepunkte.de/2004/01/4886.html
Wichtig: Bitte recherchieren Sie bei jeder Textlektüre immerauch nach dem Autor! Schlagen Sie Begriffe, die Sie nichtkennen, in einem guten Lexikon nach!
Leitfragen:1. In welchen Bereichen wandelte sich nach Gilcher-Holtey und
Herbert die Bundesrepublik besonders stark? Wann genauvollzog sich der Wandel und wie ordnen ihn die beidenForscher in längerfristige historische Entwicklungen ein?
2. Was waren die Voraussetzungen des Wandels und wer warendessen Trägergruppen? Arbeiten Sie die gemeinsamen, aberauch unterschiedlichen Positionen bei Herbert und Gilcher-Holtey heraus!
3. Wie schätzt Gilcher-Holtey die Folgen der „68er“-Protestbewegung ein und welche methodischen Überlegungenstellt sie an, um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zubestimmen?
4. Was sind nach der Rezension von Süß die Stärken des Buchesvon Herbert und seiner Arbeitsgruppe? Was dagegenkritisiert Süß?
5. Wie ist die Rezension von Süß im Einzelnen aufgebaut?
1. Studienleistung: Schreiben Sie eine Rezension zu einer Darstellung Ihrer Wahlzum Thema. Für die besten Arbeiten besteht die Möglichkeit, siein einer Fachzeitschrift zu publizieren.
Eine Auswahl möglicher aktueller Monographien finden Sie imLiteraturverzeichnis; sie sind mit * gekennzeichnet.
Ihr Text sollte einen Umfang von 750 Wörtern nichtüberschreiten.
Abgabetermin ist die 13. Sitzung am 30. Januar.
03 07.November
Vorgeschichte: die frühe Nachkriegszeit
Literatur:► Hans Günter Hockerts, Integration der Gesellschaft:Gründungskrise und Sozialpolitik in der frühen Bundesrepublik,in: Ders., Der deutsche Sozialstaat. Entfaltung und Gefährdungseit 1945, Göttingen 2011, S. 23-42.► Axel Schildt, Vom christlichen Abendland zum modernenPluralismus – eine Skizze der ideologischen Landschaft derfünfziger und sechziger Jahre, in: Ders., Ankunft im Westen.Ein Essay zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, Frankfurtam Main 1999, S. 149-180.
Leitfragen:1. Was versteht Hockerts unter „Gründungskrise“, was sind
deren wesentlichen Merkmale und warum akzentuiert er dieKrise so stark?
2. Wie begegnete die westdeutsche Politik dieser Krise? Wiesahen die parteipolitischen Konstellationen nach 1945 inder Sozialpolitik aus? Welche Probleme galten alsbesonders dringend?
3. Welche Funktion hatte die Sozialpolitik in Adenauersaußen- und verteidigungspolitischen Konzeptionen? WelcheErgebnisse zeitigte die Sozialpolitik der frühenNachkriegsjahre? Inwiefern ist nach Hockerts die Ende der1950er Jahre einsetzende Stabilisierung Voraussetzung fürdas Aufkommen der „68er“-Protestbewegung?
4. Wie charakterisiert Schildt die publizistischeGrundstimmung der Jahre um 1950 und von welchen globalenEinflüssen wurde sie geprägt? Von welchengesellschaftlichen Gruppen wurde die Stimmung getragen? Anwelchen kulturellen Strömungen richtete man sich nach 1945aus? Wie wurde die Moderne aufgenommen, wie viel Neuanfanggab es damals?
5. Was verstand man damals unter „Abendland“ und„Restauration“ und wogegen richteten sich diese Konzepte?Wann und warum kamen diese Konzepte schließlich außerMode?
04 14.November
Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit
Literatur:► Wilfried Mausbach, Wende um 360 Grad? Nationalsozialismus undJudenvernichtung in der „zweiten Gründungsphase“ derBundesrepublik, in: Wo 1968 liegt. Reform und Revolte in derGeschichte der Bundesrepublik, hrsg. v. Christina von Hodenbergund Detlef Siegfried, Göttingen 2006, S. 15-47.► Norbert Frei, Nach der Tat. Die Ahndung deutscher Kriegs- undNS-Verbrechen in Europa – eine Bilanz, in: TransnationaleVergangenheitspolitik: der Umgang mit deutschenKriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, hrsg.v. Norbert Frei, Göttingen 2006, S. 7-36.
Leitfragen:1. Wie kennzeichnet Mausbach den Umgang der westdeutschen
Gesellschaft mit Nationalsozialismus und Weltkrieg in den1950er Jahren? Woran erinnerte man sich, was hingegenwurde ausgeblendet?
2. Wann veränderte sich nach Mausbach der Umgang mit der NS-Vergangenheit und was waren die Voraussetzungen hierfür?Auf welchen Feldern lässt sich dieser veränderte Umgangablesen und wer machte sich insbesondere für das Thema„Vergangenheitsbewältigung“ stark?
3. Wie kennzeichnet Mausbach die Auseinandersetzung der„68er“ mit dem Nationalsozialismus? Wo sieht er derenVerdienste, wo hingegen die Blindstellen undUnzulänglichkeiten?
4. Was ist Freis Hauptthese zum Zusammenhang von deutscherund internationaler Vergangenheitsbewältigung?
5. Welche unterschiedlichen Einflussfaktoren nennt Frei, diedie strafrechtliche Ahndung deutscher Verbrechen imAusland bestimmten?
05 21.November
Medien und neue Öffentlichkeit
Literatur:►Christina von Hodenberg, Mass Media and the Generation ofConflict: West Germany’s Long Sixties and the Formation of aCritical Public Sphere, in: Contemporary European History 15(2006), S. 367-395.► Anja Kruke, Der Kampf um die politische Deutungshoheit.Meinungsforschung als Instrument von Parteien und Medien in denSiebzigerjahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 44 (2004), S.293-326.
Leitfragen:1. Wie charakterisiert von Hodenberg die Medienlandschaft der
Bundesrepublik in den frühen 1950er Jahren? Wie ist dasSelbstverständnis vieler Journalisten zu dieser Zeit?
2. Wann genau wandelte sich nach von Hodenberg dieMedienlandschaft? Welche Rolle spielte ihrer Ansicht nachhierbei die sog. Spiegelaffäre? Warum ist es falsch, voneiner Affäre des Spiegel zu sprechen? Welche anderen,medial gespiegelten Affären nennt von Hodenberg noch?
3. Welches Selbstverständnis besaßen Journalisten zu Beginnder 1970er Jahre? Welche Gründe nennt von Hodenberg fürden von ihr diagnostizierten Wandel?
4. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den medialenAufbrüchen und „1968“? Wie war das Verhältnis von
„kritischem Journalismus“ zu den „68ern“? HerrschteGenerationskonflikt oder letztlich generationelle Harmonievor?
5. Inwieweit veränderte nach von Hodenberg der mediale Wandeldie politische Kultur dieser Zeit?
06 28.November
Zwischen „Notstand“ und „Boom“: Schulen,Universitäten und die Bildungspolitik
Literatur:►Anne Rohstock, Nur ein Nebenschauplatz. Zur Bedeutung der„68er“-Protestbewegung für die westdeutsche Hochschulpolitik,in: Reform und Revolte. Politischer und gesellschaftlicherWandel in der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1968,hrsg. v. Udo Wengst, München 2011, S. 45-60.►Wilfried Rudloff, Bildungsplanung in den Jahren desBildungsbooms, in: Demokratisierung und gesellschaftlicherAufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik,hrsg. v. Matthias Frese, Julia Paulus und Karl Teppe, Paderborn2003, S. 259-282.► Torsten Gass-Bolm, Das Ende der Schulzucht, in:Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration,Liberalisierung 1945-1980, hrsg. v. Ulrich Herbert, Göttingen2002, S. 436-466.
Leitfragen:1. Wo sieht Rohstock den eigentlich zentralen Konflikt um die
westdeutsche Hochschulreformen seit den 1960er Jahren?Stellen Sie die unterschiedlichen Positionen dar, diedamals aufeinander prallten!
2. Welche Gründe nennt Rohstock für den zu Ende der 1950erJahre einsetzenden bildungspolitischen Paradigmenwechsel?
3. Welche Rolle spielten nach Rohstock die Studentenunruhenund welche längerfristigen Ergebnisse zeitigten dieBildungsreformen?
4. Die Politik setzte in den 1960er Jahren im Bildungsbereichverstärkt auf politische Planung. Was erhoffte man sichvon diesem Instrument, was machte damals dessen Reiz aus?
5. Auf welche inneren Entwicklungen und Probleme reagiertePlanung? Welche äußeren, globalen Faktoren spieltenebenfalls hinein? Welcher internationale Player besaß inBildungsfragen nach Rudloff eine herausragende Rolle?Recherchieren Sie über den Text hinaus nach der Geschichtedieser Organisation!
6. Welche Bedeutung kam der Prognostik bei der Planung zu?Mit welchen methodischen, aber auch politischenSchwierigkeiten sahen sich Planer bei ihrer Arbeitkonfrontiert und welche Folgen hatte das für dieWissenschaft wie für die Politik in den 1970er Jahreninsbesondere in Baden-Württemberg?
7. Welche Anknüpfungspunkte bietet die Bildungsplanung zumThema der letzten Stunde, als es um Demoskopie ging?
8. Wann und wie veränderte sich nach Gass-Bolm das Verhältnisvon Lehrern und Schülern? Wie ordnet er die 1960er Jahrein größere historische Entwicklungen ein?
9. Welche Rolle spielte nach Gass-Bolm die Schülerbewegung?
07 5.Dezember
Säkularisierung? Wandlungen im Verhältnis zuden Kirchen und zur Religion
Literatur:►Karl Gabriel, Zur Bedeutung der Religion für Gesellschaft undLebensführung in Deutschland, in: Koordinaten deutscherGeschichte in der Epoche des Ost-West-Konflikts, hrsg. v. HansGünter Hockerts und Elisabeth Müller-Luckner, München 2004, S.261-276.► Hugh McLeod, The Crisis of the Church, in: Ders., TheReligious Crisis of the 1960s, Oxford u.a. 2008, S. 188-214.
Leitfragen:1. Nach McLeod steckten die Kirchen in ganz Europa seit Ende
der 1950er und dann noch einmal verstärkt seit 1965 ineiner tiefen Krise. Was waren nach McLeod die Anzeichendieser Krise?
2. Wie ordnen er und andere Historiker die Krise inlängerfristige Tendenzen ein?
3. Welche Gründe und Bedingungsfaktoren nennen McLeod undandere Historiker für den Wandel? Unterscheiden Siehierbei zwischen Laien und Klerus, zwischen Katholiken undProtestanten, zwischen Stadt und Land und nachAltersgruppen!
4. Wo ergeben sich bei den Einflussfaktoren Bezüge zum Themader letzten Stunde? Recherchieren Sie über den Text hinausnach dem Buch des Politologen Ronald F. Inglehart, das fürdas Thema hier interessant sein könnte und fassen Sieseine zentrale These ganz knapp zusammen!
5. Welche Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften erlebten nachMcLeod in dieser Krisenzeit sogar Zulauf? Was sind diedrei Faktoren, die McLeod für deren Erfolg nennt? Wassagen Sie vor diesem Hintergrund zu dem von McLeodgewählten Titel seines Buches?
6. Jetzt noch ein Perspektivenproblem: Inwieweitunterscheidet sich eigentlich die Krisendiagnose, dieMcLeod und anderer Historiker anstellen, von derKrisenwahrnehmung der damaligen Zeitgenossen?
08 12.Dezember
Sexuelle Revolution? Geschlechterbeziehungenund Liebesleben in Westdeutschland
Literatur:► Dagmar Herzog, Die sexuelle Liberalisierung derBundesrepublik zwischen Säkularisierung undVergangenheitsbewältigung, in: Wo „1968“ liegt. Reform undRevolte in der Geschichte der Bundesrepublik, hrsg. v.Christina von Hodenberg und Detlef Siegfried, Göttingen 2006,S. 79-112.► Elizabeth Heinemann, Sexuality in West Germany. Post-Fascist,Post-War, Post-Weimar, or Post-Wilhelmine?, in: Mit dem Wandelleben: Neuorientierung und Tradition in der Bundesrepublik der1950er und 60er Jahre, hrsg. v. Friedrich Kiessling undBernhard Rieger, Köln u.a., S. 229-??
Leitfragen:1. Was machten nach Herzog die zwei Besonderheiten im Umgangmit Sexualität in der frühen Bundesrepublik im Vergleich zuanderen westlichen Staaten aus?2. Wie wurde in der Nachkriegszeit das ThemaNationalsozialismus und Sexualität diskutiert und welche
Absichten standen dahinter? Wo ist der Bezug zur letztenStunde?3. Welche Faktoren nennt Herzog, die die Liberalisierung in den1960er Jahren vorantrieben? Wie wurde in dieser Zeit Sexualitätim Nationalsozialismus gesehen und in der politischen Arenabenutzt? Wo verliefen die Frontlinien zwischen Befürwortern undGegnern einer sexuellen Liberalisierung? 4. Veränderte das Reden über Sexualität die sexuelle Praxis?5. Eine Perspektivenfrage: Wie würden Sie das Vorgehen Herzogsals Historikerin beschreiben? Ist sie eher Anklägerin, die wieNorbert Frei das Verhalten der Zeitgenossen kritisiert, odereher Moderatorin, die versucht, die unterschiedlichenStandpunkte miteinander in Dialog zu bringen?
Herzog schreibt die Geschichte der Sexualität in derBundesrepublik als eine Nachgeschichte des Dritten Reichs. Gehtdie Geschichte darin tatsächlich völlig auf?
5. Was ist die Kritik Heinemanns am Vorgehen und den ThesenHerzogs? Welchen Weg schlägt sie selbst ein? Zu welchenabweichenden Ergebnissen kommt sie? Wo unterscheidet sich dieEntwicklung in Westdeutschland von der in anderen westlichenStaaten?
09 19.Dezember
Pazifistische Wende? Zum Verhältnis vonMilitär und Zivilgesellschaft
Literatur:► Michael Geyer, Der Kalte Krieg, die Deutschen und die Angst.Die westdeutsche Opposition gegen Wiederbewaffnung undKernwaffen, in: Nachkrieg in Deutschland, hrsg. v. KlausNaumann, Hamburg 2001 , S. 267-318.
Leitfragen:1. Welche Quellen zieht Geyer heran, um die Einstellung der
Westdeutschen zu Militär und Wiederbewaffnung in den1950er Jahren zu erkunden? Wo liegen nach Geyer selbst dieProbleme mit der von ihm benutzten Quellengattung? LesenSie noch einmal den Aufsatz von Anja Kruke und ergänzenSie gegebenenfalls Geyers Problemanalyse!
2. Aus welchen unterschiedlichen Motiven speiste sich nachGeyer die Ablehnung des Militärs? Gab es nach Geyer eineStunde Null des Pazifismus?
3. Daran anschließend eine Einschätzungsfrage: Berühren dieErgebnisse Geyers das Selbstverständnis der Deutschen?
10 16. Januar Wie wurde der Papa demokratisch? Wandlungenim familiären BereichHils, Ruppert, Racke
Literatur:► Till van Rahden, Wie Vati die Demokratie lernte: Religion,Familie und die Frage der Autorität in der frühenBundesrepublik, in: Demokratie im Schatten der Gewalt.Geschichten des Privaten im deutschen Nachkrieg, hrsg. v.Daniel Fulda u.a., Göttingen 2010, S. 122-151.
Leitfragen:1. Nach von Rahden wurde die Frage der väterlichen Autorität
in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft geradezuobsessiv diskutiert. Welche beiden Problemkreise lassensich nach Van Rahden über diese Diskussion erschließen,auf welchen Problemkreis konzentriert sich der Autor imFolgenden dann selbst?
2. Was ist seine Hauptthese? Erklären Sie diese in drei bisvier Sätzen! Halten Sie die These für plausibel?
3. Auf welche Quellen stützt sich van Rahden und über welchegesellschaftlichen Gruppierungen erfahren wir durch dieseQuellen etwas? Was gerät nach van Rahden durch dieseQuellen erstmals in den Blick?
4. Geben die von ihm benutzten Quellen eher über die realenMachtverhältnisse in den Familien Auskunft oder eher überdie Wunschvorstellungen von Vaterschaft? Erklären Sie IhreAntwort!
5. Wenn Sie die Befunde van Rahdens mit dem vergleichen, waswir letzte Stunde erarbeitet haben: Wo sehen SieBerührungspunkte bzw. vergleichbare Tendenzen?
11 23. Januar Zwischen Dosenravioli und Beatmusik. NeueKonsummuster Göde, Breitenfeld, Liolios, Geng
Literatur:► Detlef Siegfried, Protest am Markt. Gegenkultur in derKonsumgesellschaft um 1968, in: Wo „1968“ liegt. Reform undRevolte in der Geschichte der Bundesrepublik, hrsg. v.Christina von Hodenberg und Detlef Siegfried, Göttingen 2006,S. 48-78.
Leitfragen:1. Nach Siegfried war der wirtschaftliche Boom die
Voraussetzung für die „kulturelle Revolution“ der 1960erJahre. Wie aber genau veränderte der Boom dieRahmenbedingungen hierfür?
2. Was war eigentlich Gegenkultur? Vor allem: Was war dasSpezifische der gegenkulturellen Wirtschaftsform?Informieren Sie sich jenseits des Textes über das Konzeptder moral economy! Wie wichtig war nach Siegfried derAspekt Konsum für die „68er“-Bewegung als ganzes?
3. In welchem Zusammenhang standen nach Siegfried dieGegenkultur und die etablierte Konsumindustrie? WelcheAkteure popularisierten nach Siegfried die Gegenkultur?
4. Eine Frage zur letzten Stunde: Stützt das auf Seite 69abgedruckte Umfrageergebnis die These van Rahdens oderwerden dadurch seine Befunde widerlegt?
12 30. Januar Die Schattenseiten des Wandels: Verschuldungund ökologische Probleme
Literatur:
► Anselm Doering-Manteuffel, Nach dem Boom. Brüche undKontinuitäten der Industriemoderne seit 1970, in:Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 54 (2007), S. 559-581.
Leitfragen:1. Nach Doering-Manteuffel lag der Zeit nach demWirtschaftsboom ein grundlegender Widerspruch zugrunde.Bezeichnen Sie diesen Widerspruch näher und legen Sie diedar, warum da zwei Entwicklungsstränge nicht mehr zusammenpassten! 2. Welche langfristigen Folgen hatte dieser Widerspruch fürden Staatshaushalt? Informieren Sie sich über den Texthinaus, welchen Verlauf Ausgaben und Einnahmen deröffentlichen Hand in Deutschland seit 1969 genommen habenund suchen Sie nach aussagekräftigen Grafiken!3. Welcher Art war der Paradigmawechsel, den Doering-Manteuffel für die Zeit nach 1974 ausmacht?4. Der Text ist aus der Perspektive eines älterenwestdeutschen Historikers geschrieben, den die Boomperiodegeprägt hat; sie dagegen sind in die Zeit nach dem Boomgeboren: An wen richtet sich eigentlich sein Plädoyer füreine konsequente Historisierung der 1960er Jahre? 5. Doering-Manteuffel glaubt nicht, dass die von ihm selbstgeprägten Meistererzählungen von der Liberalisierung undWesternisierung für die Erforschung der Zeit nach 1974taugen. Welche Gründe nennt er hierfür und was ist seinGegenvorschlag?
13 06.Februar
Resümee: Was bleibt von den Umbruchjahren?
Literatur:►
Leitfragen:
Literaturliste
Überblicksdarstellungen, methodische Fragen undForschungsberichteDas alternative Milieu: antibürgerlicher Lebensstil und linkePolitik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa, 1968-1983, hrsg. von Sven Reichardt und Detlef Siegfried, Göttingen2010.Bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral und solidarischerProtest in den sechziger und siebziger Jahren, hrsg. v. HabboKnoch, Göttingen 2007.Bayern im Bund, Bd. 2: Gesellschaft im Wandel 1949–1973, hrsg.v. Thomas Schlemmer und Hans Woller, München 2002.Patrick Bernhard und Anne Rohstock, Writing about the“revolution”. Nuovi studi internazionali sul movimento del ‘68,in: Ricerche di Storia Politica 11 (2008), S. 177-192 (wird indeutscher Übersetzung zugänglich gemacht).Demokratie im Schatten der Gewalt. Geschichten des Privaten imdeutschen Nachkrieg, hrsg. v. Daniel Fulda u.a., Göttingen2010.Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechzigerJahre als Wendezeit der Bundesrepublik, hrsg. v. MatthiasFrese, Julia Paulus und Karl Teppe, Paderborn 2003.Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschenGesellschaften, hrsg. v. Axel Schildt, Detlef Siegfried undKarl Christian Lammers, Hamburg 2000.Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte,hrsg. v. Konrad H. Jarausch, Göttingen 2008.Philipp Gassert, Das kurze „1968“ zwischenGeschichtswissenschaft und Erinnerungskultur: NeuereForschungen zur Protestgeschichte der 1960er-Jahre, in: H-Soz-u-Kult, 30.04.2010.http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2010-04-001Die Geschichte des Erfolgsmodells BRD im internationalenVergleich, hrsg. v. Jörg Callies, Loccum 2005.Anselm Doering-Manteuffel, Im Westen angekommen? DieWesternisierung der Bundesrepublik seit 1945, in: Vorgänge 40(2001), S. 4-14.
Hans Günter Hockerts, Deutung der Deutung von Deutung. Chancenund Risiken der Kulturgeschichte, in: Was heißt und zu welchemEnde studiert man Geschichte des 20. Jahrhunderts? Hrsg. vonNorbert Frei, Göttingen 2006, S. 92-98.Hans Günter Hockerts, Zeitgeschichte in Deutschland. Begriff,Methoden Themenfelder, in: Historisches Jahrbuch 113 (1993), S.98 - 127.Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland -Westeuropa - USA, München, 4. Aufl. 2008.Detlef Siegfried, Furor und Wissenschaft: vierzig Jahre nach„1968“, in: Zeithistorische Forschungen 5 (2008), S. 120-141.Reform und Revolte. Politischer und gesellschaftlicher Wandelin der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1968, hrsg. v.Udo Wengst, München 2011.Andreas Rödder, Die Bundesrepublik Deutschland 1969-1990,München 2004.Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration,Liberalisierung 1945-1980, hrsg. v. Ulrich Herbert, Göttingen2002, S. 436-466.Auf dem Weg in eine neue Moderne? Die BundesrepublikDeutschland in den siebziger und achtziger Jahren, hrsg. v.Thomas Raithel, Andreas Rödder und Andreas Wirsching, München2009.Wo „1968“ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte derBundesrepublik, hrsg. v. Christina von Hodenberg und DetlefSiegfried, Göttingen 2006.
Bibliographische PortaleBücher und Aufsätze zur deutschen Zeitgeschichte lassen sich ambesten über den Karlsruher Virtuellen Katalog recherchieren:www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html. Wählen Sie nicht nur diedeutschen, sondern auch amerikanischen und britischen Katalogeaus!
Über die Universität Freiburg haben Sie zudem Zugang zu JStor,einem Portal, das vor allem englischsprachigeZeitschriftenbeiträge zum Download bereitstellt: www.jstor.org.Nützliche Suchbegriffe sind etwa „1968“, „student protests“,„1960s“.
Rezensionen speziell zu deutscher Zeitgeschichte finden sichbei:
a) H-Net-Germany: www.h-net.org/~german/ (wählen Sie unterreviews „H-German” aus)b) in den Sehepunkten: www.sehepunkte.de (Schlagworte „1960erJahre“, „1968“, Studentenproteste)c) auf der Homepage von H-Soz-u-Kult:http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/ Geben SieSuchbegriffe wie „1960er Jahre“ ein.d) Sammelrezensionen nicht nur zu einzelnen Büchern, sondernauch zu ganzen Forschungsgebieten und Problemstellungen bietetdie Neueste Politische Literatur (NPL). Sie finden dieeinzelnen Hefte unter www.ifs.tu-darmstadt.de/index.php?id=npl.Leider ist keine thematische Suche möglich.
Quellensammlungen und Links zu QuellenEinen Überblick über gedruckte Quellen zu den 1960er Jahrengibt grundsätzlich der entsprechende Band der Reihe „OldenbourgGrundriss der Geschichte“. In unserem Fall ist das das Band vonAndreas Rödder, Die Bundesrepublik Deutschland 1969-1990,München 2004, S. 228-238. Nachteil: Hinweise auf digitaleQuellenbestände fehlen darin.
Es gibt jedoch mittlerweile sehr viele Quellen online:1. Eine der besten Online-Editionen zur ZeitgeschichteDeutschlands sind die „100(0) Schlüsseldokumente zur deutschenGeschichte im 20. Jahrhundert“: www.1000dokumente.de. Dortfinden Sie textliche, aber auch audiovisuelle Quellen u.a. zuden 1960er Jahren, die von Experten einzeln erklärt werden.Darüber hinaus finden Sie weiterführende Literatur und einFaksimile der Quelle. Für uns interessant sind etwa: „Warumbrennst Du, Konsument? - Das Flugblatt Nr. 7 der Kommune 1“,„Rede von Helke Sander (Aktionsrat zur Befreiung der Frauen)auf der 23. Delegiertenkonferenz des "Sozialistischen DeutschenStudentenbundes" (SDS) in Frankfurt/Main“ oder „Willy BrandtsRegierungserklärung“2. Das Deutsche Historische Institut in Washington besitztebenfalls eine Online-Edition von Quellen zur deutschenGeschichte, die „German History in Documents and Images(GHDI)“. Sie finden sie unter: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm. Die Sammlung ist sehr groß und dann innerhalbder Epochen in unterschiedliche thematische Blöcke gegliedert(etwa Konsum, Bildungsreform, Geschlechterrollen undFamilienbeziehungen). Es gibt allerdings nur eine allgemeine
Einführung in die Zeit und keine spezielle Erklärung dereinzelnen Quelle, außerdem fehlen audiovisuelle Quellen. 3. Zentral für das Verständnis politischer Reaktionen aufgesellschaftlichen Wandel sind „Die Kabinettsprotokolle derBundesregierung”, die Sie finden unter:http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/k/index.html. Sieliegen für die Zeit von 1949 bis 1965 vor. 4. Drucksachen und Plenarprotokolle des Bundestags finden Sieunter: http://drucksachen.bundestag.de/drucksachen/index.php 5. Speziell für Lehrer empfehlen sich die „MultimedialeQuellensammlungen zur deutschen Geschichte“, die sie findenunter: www.lehrer-online.de/links-deutsche-geschichte.php. Hierfinden Sie eine größere Sammlung von Links auf andereHomepages, die textliche wie bildliche Quellen bereitstellen(etwa das LeMO-Archiv des Deutschen Historischen Museums:www.dhm.de/lemo/suche/videos.html, das allerdings momentannicht online verfügbar ist)6. Eine sehr heterogene Mischung von schriftlichen wienichtschriftlichen Quellen aus seinen Beständen bietet dasBundesarchiv:http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/index.html.de?cat_id=&org_id=&max=50. Sie finden dort etwadas Amnestiegesetz von 1949, Dokumente zur Bildung der GroßenKoalition von 1966 und den handgeschriebenen Lebenslauf vonElisabeth Schwarzhaupt, der ersten Bundesministerin.
Vorgeschichte: die frühe NachkriegszeitFrank Biess, Homecomings. Returning POWs and the Legacies ofDefeat in Postwar Germany, Princeton 2006.Svenja Goltermann, Zwischen den Zeiten. Deutsche Soldaten undihre Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg, in: Figurationen derHeimkehr, hrsg. v. Sünne Juterczenka und Kai Sicks, Göttingen2011.Svenja Goltermann, Die Gesellschaft der Überlebenden: deutscheKriegsheimkehrer und ihre Gewalterfahrungen im ZweitenWeltkrieg, München 2011.Hans Günter Hockerts, Integration der Gesellschaft:Gründungskrise und Sozialpolitik in der frühen Bundesrepublik,in: Ders., Der deutsche Sozialstaat. Entfaltung und Gefährdungseit 1945, Göttingen 2011, S. 23-42.The Miracle Years: A Cultural History of West Germany 1949 to1968, hrsg. v. Hannah Schissler u.a., Princeton 2001.
The 1950s in European Society, Politics and Culture, hrsg. v.Kevin Passmore, Heiko Feldner und Claire Gorrara, Newcastle2011.Rückblickend in die Zukunft. Politische Öffentlichkeit undintellektuelle Positionen in Deutschland um 1950 und um 1930,hrsg. v. Alexander Gallus und Axel Schildt, Göttingen 2011.Axel Schildt, Vom christlichen Abendland zum modernenPluralismus – eine Skizze der ideologischen Landschaft derfünfziger und sechziger Jahre, in: Ders., Ankunft im Westen.Ein Essay zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, Frankfurtam Main 1999, S. 149-180.
Zum Umgang mit der NS-VergangenheitNicolas Berg, Der Holocaust und die westdeutschen Historiker.Erforschung und Erinnerung, Göttingen 2003.Hartmut Berghoff, Zwischen Verdrängung und Aufarbeitung. Diebundesdeutsche Gesellschaft und ihre nationalsozialistischeVergangenheit in den Fünfziger Jahren, in: Geschichte inWissenschaft und Unterricht (1998), S. 96-114.Jan Eckel und Claudia Moisel, Nachgeschichte und Gegenwart desNationalsozialismus in internationaler Perspektive, in: Das„Dritte Reich“ Eine Einführung, hrsg. v. Dietmar und WinfriedSüß, München 2008, S. 333-352.Norbert Frei, Amnestiepolitik der Bonner Anfangsjahre. DieWestdeutschen und die NS-Vergangenheit, in: Kritische Justiz 29(1996), S. 484-494.Konstellationen über Geschichte, Erfahrung und Erkenntnis.Festschrift für Dan Diner zum 65. Geburtstag, hrsg. v. NicolasBerg, Göttingen 2011.Christian Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeitdes Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmerVergangenheit, München 2010.Performing the past: memory, history, and identity in modernEurope, hrsg. v. Karin Tilmans und Aleida Assmann, Amsterdam2010.Transnationale Vergangenheitspolitik: der Umgang mit deutschenKriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, hrsg.v. Norbert Frei, Göttingen 2006, S. 7-36.Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur undGeschichtspolitik in internationaler Perspektive, Göttingen2008, hrsg. von Claudia Moisel und Jan Eckel, Göttingen 2008.Annette Weinke, Transnationale „Übergangsjustiz“ und nationale„Vergangenheitsbewältigung“. Strafverfolgung und
Liberalisierungsprozesse in Westdeutschland nach 1945, in: NachKrieg, Gewalt und Repression. Der schwierige Umgang mit derVergangenheit, hrsg. v. Susanne Buckley-Zistel und ThomasKater, Baden-Baden 2010, S. 113-130.
Medien und neue ÖffentlichkeitChristina von Hodenberg, Der Kampf um die Redaktionen. „1968“und der Wandel der westdeutschen Massenmedien, in: Wo „1968“liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik,hrsg. v. Christina von Hodenberg und Detlef Siegfried,Göttingen 2006, S. 139-163.Anja Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland:Meinungsforschung, Parteien und Medien 1949-1990, Düsseldorf2007.Anja Kruke, Der Kampf um die politische Deutungshoheit.Meinungsforschung als Instrument von Parteien und Medien in denSiebzigerjahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 44 (2004), S.293-326.Nina Verheyen, Eifrige Diskutanten: Die Stilisierung des„freien“ Meinungsaustausches zu einer demokratischenKulturtechnik in der westdeutschen Gesellschaft der fünfzigerJahre, in: Demokratie im Schatten der Gewalt. Geschichten desPrivaten im deutschen Nachkrieg, hrsg. v. Daniel Fulda u.a.,Göttingen 2010, S. 99-121.Nina Verheyen, Diskussionslust: eine Kulturgeschichte des„besseren Arguments“ in Westdeutschland, Göttingen 2010.Feind-Bild Springer. Ein Verlag und seine Gegner, hrsg. v.Jochen Staadt, Tobias Voigt und Stefan Wolle, Göttingen 2009.
Zwischen „Notstand“ und „Boom“: Universitäten undBildungspolitikTorsten Gass-Bolm, Das Ende der Schulzucht, in:Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration,Liberalisierung 1945-1980, hrsg. v. Ulrich Herbert, Göttingen2002, S. 436-466.Anne Rohstock, Nur ein Nebenschauplatz. Zur Bedeutung der„68er“-Protestbewegung für die westdeutsche Hochschulpolitik,in: Reform und Revolte. Politischer und gesellschaftlicherWandel in der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1968,hrsg. v. Udo Wengst, München 2011, S. 45-60.
Anne Rohstock, „Rotes“ Hessen – „Schwarzes“ Bayern? DieHochschulreformen der 'langen 1960er Jahre' im Ländervergleich,Westfälische Forschungen 60 (2010), S. 401-423.Anne Rohstock, Ist Bildung Bürgerrecht? - Wege zurBildungsexpansion im doppelten Deutschland, in: Das doppelteDeutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, hrsg. v. Udo Wengst undHermann Wentker, München 2008, S. 135-159.Themenschwerpunkt: Regionale Bildungs- undWissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, hrsg. von WilfriedRudloff, Münster 2010.Wilfried Rudloff, Bildungspolitik als Sozial- undGesellschaftspolitik: die Bundesrepublik in den 1960er- und1970er-Jahren im internationalen Vergleich, in: Archiv fürSozialgeschichte 47 (2007), S. 237-268.
Säkularisierung? Wandlungen im Verhältnis zu denKirchen und zur ReligionPascal Eitler, „Gott ist tot – Gott ist rot“. Max Horkheimerund die Politisierung der Religion um 1968, Frankfurt a. M.2009. Pascal Eitler, Zwischen „großer Verweigerung" und „sanfterVerschwörung". Eine religionshistorische Perspektive auf dieBundesrepublik Deutschland 1965-1990, in: Tel Aviver Jahrbuchfür deutsche Geschichte 38 (2010), S. 213-229.Pascal Eitler, „Alternative" Religion.Subjektivierungspraktiken und Politisierungsstrategien im „NewAge" (Westdeutschland 1970-1990), in: Das Alternative Milieu.Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in derBundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983, hrsg. v. SvenReichardt und Detlef Siegfried, Göttingen 2010, S. 335-352.Karl Gabriel, Zur Bedeutung der Religion für Gesellschaft undLebensführung in Deutschland, in: Koordinaten deutscherGeschichte in der Epoche des Ost-West-Konflikts, hrsg. v. HansGünter Hockerts und Elisabeth Müller-Luckner, München 2004, S.261-276.Hugh McLeod, The religious crisis of the 1960s, Oxford u.a.2008.Die Politisierung des Protestantismus. Entwicklungen in derBundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er Jahre,hrsg. v. Klaus Fitschen u.a. Göttingen 2011.Religion und Gesellschaft: Europa im 20. Jahrhundert, hrsg. v.Klaus Grosse Kracht
Benjamin Ziemann, Sozialgeschichte der Religion. Von derReformation bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main und New York2009.Benjamin Ziemann, Säkularisierung und Neuformierung desReligiösen: Religion und Gesellschaft in der zweiten Hälfte des20. Jahrhunderts, in: Archiv für Sozialgeschichte 51 (2011), S.3-36 (siehe auch die anderen Beiträge in diesem Band!)Benjamin Ziemann, Katholische Kirche und Sozialwissenschaften1945-1975, Göttingen 2007.
Sexuelle Revolution? Geschlechterbeziehungen undLiebesleben in WestdeutschlandSybille Buske, Fräulein Mutter und ihr Bastard: eine Geschichteder Unehelichkeit in Deutschland 1900-1970, Göttingen 2004.Pascal Eitler, Sexualität als Ware und Wahrheit –Körpergeschichte als Konsumgeschichte, in: DeutscheKonsumgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, hrsg. v. Heinz-Gerhard Haupt und Claudius Torp, Frankfurt 2009, S. 370-388.Elizabeth D. Heinemann, Sexuality in West Germany. Post-Fascist, Post-War, Post-Weimar, or Post-Wilhelmine?, in: Mitdem Wandel leben: Neuorientierung und Tradition in derBundesrepublik der 1950er und 60er Jahre, hrsg. v. FriedrichKiessling und Bernhard Rieger, Köln u.a., S. 229-??.Elizabeth D. Heinemann, The Economic Miracle in the Bedroom.Big Business and Sexual Consumption in Reconstruction WestGermany, in: The Journal of Modern History 78, 2006, S. 846–877.Elizabeth D. Heinemann, Before Porn Was Legal: The EroticaEmpire of Beate Uhse, Chicago 2011.Dagmar Herzog, Die sexuelle Liberalisierung der Bundesrepublikzwischen Säkularisierung und Vergangenheitsbewältigung, in: Wo„1968“ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte derBundesrepublik, hrsg. v. Christina von Hodenberg und DetlefSiegfried, Göttingen 2006, S. 79-112.Sybille Steinbacher, Wie der Sex nach Deutschland kam: DerKampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik,München 2011.
Pazifistische Wende? Zum Verhältnis zwischen Militärund ZivilgesellschaftPatrick Bernhard, „Make love not war!“ Die APO, der Zivildienstund die sozialliberale Koalition, in: Reform und Revolte.
Politischer und gesellschaftlicher Wandel in der BundesrepublikDeutschland vor und nach 1968, hrsg. v. Udo Wengst, München2011.Michael Geyer, Der Kalte Krieg, die Deutschen und die Angst.Die westdeutsche Opposition gegen Wiederbewaffnung undKernwaffen, in: Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der ZweiteWeltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik, hrsg.v. Michael Th. Greven, Opladen 2000, S. 267-318.Thorsten Loch, Das Gesicht der Bundeswehr.Kommunikationsstrategien in der Freiwilligenwerbung derBundeswehr 1956-1989, München 2008.Rudolf J. Schlaffer, Der Wehrbeauftragte 1951 bis 1985: AusSorge um den Soldaten. München 2006.
Wie wurde der Papa demokratisch? Wandlungen imfamiliären BereichIsabel Heinemann, „Concepts of Motherhood“. ÖffentlicheDebatten, Expertendiskurse und die Veränderung vonFamilienwerten in den USA (1890–1970), in: ZeithistorischeForschungen/Studies in Contemporary History, Heft 2011/8,1, S.60-87. Online-Ausgabe, 8 (2011), H. 1:http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40209109/default.aspxLieschen Müller wird politisch. Geschlecht, Staat undPartizipation im 20. Jahrhundert, hrsg. v. Nicole Kramer,Christine Hikel und Elisabeth Zellmer, München 2009.Jürgen Martschukat und Olaf Stieglitz, Geschichte derMännlichkeiten, Frankfurt am Main 2008.Merith Niehuss, Familie, Frau und Gesellschaft. Studien zurStrukturgeschichte der Familie in Westdeutschland 1945 - 1960,Göttingen 2001.Merith Niehuss, Familie und Geschlechterbeziehungen von derZwischenkriegszeit bis in die Nachkriegszeit, in:Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts,hrsg. v. Anselm Doering-Manteuffel, unter Mitarbeit vonElisabeth Müller-Luckner, München 2006, S. 147-165.Till van Rahden, Wie Vati die Demokratie lernte: Religion,Familie und die Frage der Autorität in der frühenBundesrepublik, in: Demokratie im Schatten der Gewalt.Geschichten des Privaten im deutschen Nachkrieg, hrsg. v.Daniel Fulda u.a., Göttingen 2010, S. 122-151.
Kristina Schulz, Der lange Atem der Provokation: dieFrauenbewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich 1968-1976, Frankfurt am Main u.a. 2002.
Zwischen Dosenravioli und Beatmusik. Neue KonsummusterBetween Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing EuropeanSocieties, 1960-1980, hrsg. v. Axel Schildt und DetlefSiegfried, Oxford 2006.Patrick Bernhard, Dolce Vita, „Made in Italy“ undGlobalisierung, in: Dolce Vita? Das Bild der italienischenMigranten in Deutschland, hrsg. v. Oliver Janz und RobertoSala, Frankfurt und New York 2011, S. 62-81.Stephan Malinowski und Alexander Sedlmaier, Keine richtigeRevolution in der falschen. „1968“ als Avantgarde derKonsumgesellschaft, in: 68er-Spätlese. Was bleibt von 1968?,Münster 2007, S. 183-209.Till Manning, Die Italiengeneration. Stilbildung durchMassentourismus in den 1950er und 1960er Jahren, 2011.Maren Möhring, Dönerkebab and West German Consumer(Multi)Cultures, in: Hybrid Cultures, Nervous States.Insecurity and Anxiety in Britain and Germany in a(Post)Colonial World, hrsg. v. Ulrike Lindner, Maren Möhring,Mark Stein und Silke Stroh, Amsterdam und New York 2011, S.151-165.Maren Möhring, Veränderungen der bundesdeutschen (Ess-)Kulturdurch Migration und Tourismus, in: Mit dem Wandel leben.Neuorientierung und Tradition in der Bundesrepublik der 1950erund 1960er Jahre, hrsg. v. Friedrich Kießling und Bernd Kölnu.a. 2011, S. 157-183.Detlef Siegfried, Prosperität und Krisenangst: die zögerlicheVersöhnung der Bundesbürger mit dem neuen Wohlstand, in: Mitdem Wandel leben. Neuorientierung und Tradition in derBundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre, hrsg. v. FriedrichKießling und Bernd Köln u.a. 2011, S.63-78.Detlef Siegfried, „... als explodierte gerade einElektrizitätswerk“: Klang und Revolte in der Bundesrepublik um1968, in: Zeithistorische Forschungen 8 (2011), S. 239-259.Detlef Siegfried, White negroes: the fascination of theauthentic in the West German counterculture of 1960s, in:Changing the world, changing oneself: political protest andcollective identities in West Germany and the U.S. in the 1960sand 1970s, hrsg. v. Belinda Davis, New York u.a. 2010, S. 191-215.
Die Schattenseiten des Wandels: Verschuldung, neueUngleichheiten und ökologische ProblemeJens Ivo Engels, Naturpolitik in der Bundesrepublik. Ideenweltund politische Verhaltensstile in Naturschutz undUmweltbewegung 1950-1980, Paderborn 2006.Jens Ivo Engels und Franz-Josef Brüggemeier, Den Kinderschuhenentwachsen: Einleitende Worte zur Umweltgeschichte der zweitenHälfte des 20. Jahrhunderts; in: Natur- und Umweltschutz inDeutschland nach 1945. Konzepte, Konflikte, Kompetenzen, hrsg.v. denselben, Frankfurt am Main 2005, S. 10-19.Hans Günter Hockerts, in: Vom Nutzen und Nachteilparlamentarischer Parteienkonkurrenz: Die Rentenreform 1972,Ders., Der deutsche Sozialstaat. Entfaltung und Gefährdung seit1945, Göttingen 2011, S. 150-180.Tim Schanetzky, Die große Ernüchterung. Wirtschaftspolitik,Expertise und Gesellschaft in der Bundesrepublik 1966 bis 1982,Berlin 2007.Wilfried Rudloff, Im Schatten des Wirtschaftswunders: sozialeProbleme, Randgruppen und Subkulturen 1949 bis 1973, in: Bayernim Bund, Bd. 2: Gesellschaft im Wandel 1949–1973, hrsg. v.Thomas Schlemmer und Hans Woller, München 2002, S. 347-468.Wilfried Rudloff, Im Souterrain des Sozialstaats: neuereForschungen zur Geschichte der Fürsorge und Wohlfahrtspflege im20. Jahrhundert, in: Archiv für Sozialgeschichte 42 (2002), S.474-520.