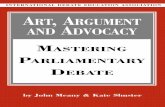Typologische Unterschiede zwischen Sprachen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Typologische Unterschiede zwischen Sprachen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und...
141
Typologische Unterschiede zwischen Sprachen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und Sprachpflege?
Jana Valdrová
Das für das gegenwärtige Deutsch wie für die englische Sprache mittlerweile gut erforschte Gebiet der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern (gender-fair language) ist inzwischen auch für den tschechischen Sprachraum ins Gespräch gekommen. Ähnlich wie in anderen Ländern gehen in Tschechien die meisten Bemühungen um gender-fair language heute von Sprachkritiker/ -innen und (im öffentlichen Raum) von Organisationen, Verwaltungsorganen und einzelnen Medien aus, die sich zum Teil auch bei der Forschung Hilfe und Rat holen. Die erste sprachwissenschaftliche Frage dazu lautet „Co jazyky mohou či musejí vyjádřit“1 (Was die Sprachen zum Ausdruck bringen können oder müs-sen), vgl. Nádeníček und Žídková in diesem Band. In dem vorliegenden Beitrag geht es darum, zu differenzieren und Phänome der Sprachtypenbildung und der Sprachstrukturbildung von denen des Sprachgebrauchs zu trennen. Es werden Argumente analysiert, die oft als „typologische Unterschiede“ zwischen dem Tschechischen und westeuropäischen Sprachen bezeichnet werden, sich aber in der Regel auf die grammatische Kongruenz beschränken (ein Phänomen der langue) und beweisen sollen, dass die tschechische Sprache keinen geschlech-tergerechten Sprachgebrauch zulasse und das generische Maskulinum erforde-re. Im Vordergrund der geschlechtergerechten Sprachkritik steht das aktuelle Sprachverhalten, das sich in den einzelnen Sprechakten und ihren Konventionen, z. B. in Schlagzeilen, Annoncen, Gesetzesformulierungen, Schulbüchern und Ver-waltungstexten usw. manifestiert, und die Frage, ob ein geschlechtergerechter Sprachgebrauch auch im Tschechischen möglich ist.
1. Einführung
Ein Sprachenvergleich wäre unvollständig, wenn er den Kulturenvergleich ausklammern würde. Soziolinguistische Analysen von Personenbezeichnun-
1 Vgl. Seminar zum Thema Genus in der Sprachwissenschaft, Jazykovědné sdružení AV ČR (Linguistische Vereinigung der Wissenschaftsakademie der Tschechischen Republik), Prag 08.12.11.
Nekula, Marek/ Šichová, Kateřina/ Valdrová, Jana (Hgg.) (2013): Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Tübingen: Stauffenburg/Julius Groos. (= IDS-Reihe Deutsch im Kontrast, 28) (ISBN: 978-3-87276-893-3)
142
Jana Valdrová
gen und insbesondere der Benennungspraxis bringen Erkenntnisse über Struk-tur, Werte und Normen der Gesellschaft. Eine pragmatische Untersuchung der Personenbezeichnungen im aktuellen Sprachgebrauch zeigt, welche Erwartun-gen, Normen und Einschränkungen das Leben ihrer Mitglieder prägen können und welche es tatsächlich auch durch die Sprache beeinflussen.
Zu den Schwerpunkten der pragmatischen Sprachanalysen gehört seit den 1970er Jahren die Verwendung des generischen Maskulinums (GM), das als Oberbegriff für die Bezeichnung von Männern und Frauen dient. „Der linguis-tisch und soziologisch brisanteste Punkt ist die Frage, ob grammatikalisch mas-kuline Personenbezeichnungen in traditio nell androzentrischer Weise (z. B. 99 Lehrerinnen und 1 Lehrer sind 100 Lehrer) als ge nerisch verstanden werden/müssen/dürfen“ oder ob sie „als hintergründiges, aber sehr wirksames Mittel der Männerherrschaft […] Frauen nur als ‚Mitgemeinte‘ behandeln“, schreibt Peter von Polenz (1999, S. 329). Auch die Reflexion dieser Problematik in der deutschen Grammatikographie wie in DUDEN 4 (1997, 2005), den Grammati-ken von Götze/Hess-Lüttich (1999), Eisenberg (2006) und anderen zeigt, dass es sich auch um ein wichtiges Forschungsfeld der Grammatik handelt, sobald sie die Pragmatik des Sprachgebrauchs mit einschließt. Es wurde wiederholt durch Experimente und Umfragen belegt, dass generische Maskulina zu einer geringeren gedanklichen Einbeziehung von Frauen als von Männern führen (Irmen/Linner 2005, tschechisch mit Kommentar von Valdrová 2010).
Vor diesem Hintergrund entfaltet sich die Thematik des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs (gender-fair language). Sie wurde in den späten 1990er Jah-ren als neue Erfahrung in die Diskussionen der tschechischen Linguistik und Soziologie aufgenommen. Allerdings wurden sowohl die Kritik des bestehen-den Sprachgebrauchs, als auch die Empfehlungen zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch (guidelines for gender-fair language) in tschechischen Publi-kationen zunächst eher abgelehnt, vgl. „bitva mezi he und she“ (die Schlacht zwischen he und she) in Čmejrková (1995, S. 50–51). Die feministische Sprachforschung wurde lediglich für eine Modewelle gehalten (Hoffmannová 1995).
Im Jahre 1996 veranstaltete die Pädagogische Fakultät in Ústí nad Labem die Konferenz Žena – jazyk – literatura – die erste Veranstaltung ihrer Art zum Thema Gender in Sprache und Literatur. Nach Nekula (1998, S. 215ff.), der den Sammelband der Konferenz rezensierte, stellen die Problembereiche der feministischen Linguistik ein „groβes intellektuelles Potential“ für tsche-chische Forschende dar. Eine der Aufgaben ist nach Nekula, „die Sprache als ein selbst in seiner Konstruiertheit gesellschaftliches Phänomen zu zeigen und je nach Bedürfnissen und Möglichkeiten Milderungen einer eventuellen Dis-
143
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
kriminierung in der sprachlichen Handlung anzubieten“. Die Frage sei hier, „ob das Problem nicht auf dem Sprachsystem beruht, auf den sprachlichen Kategorien und ihren Relationen“. Diese reflektieren und bestimmen „unsere Denkweise und Wertungen der Wirklichkeit, also unsere Wertklassifikation“ mit (ebd., S. 217).
In diesem Sinne bezieht der öffentliche Diskurs über Geschlechterrollen und Arbeitsteilung im Tschechischen die lexikalische, morphologische und stilisti-sche Markierung von Personenbezeichnungen ein, wie sie in anderen Sprachen zum Gegenstand der feministischen Sprachforschung wurde (Stölzel/Wenge-ler 1995, Wierlemann 2002, van Leeuwen-Turnovcová et al. 2002 u. a.). Im Sprachgebrauch äußert sich dies als
• Verwendung von Rollenmustern, die durch Aussagen wie etwa „Muži mají nevěru v genech“ (Männer haben die Untreue in ihren Genen) zum Ausdruck kommen, als geschlechtsstereotypische Bezeichnung von Personen, z. B. Bezeichnung von Frauen als „něžná stvoření“ (zärtli-che Wesen) auch in einem „seriösen“ Zeitungsartikel über weibliche Angestellte in einer schweizerischen Firma2 und als andere Verfahren, die dank ihrer besonders guten „Vermarktungsfähigkeit“ vor allem in Medien auftreten;
• semantische Asymmetrien von Genuspaaren in der Personen bezeich-nung, wie hlavní sestra (Hauptschwester), eine höhere Position als vrchní sestra (Oberschwester) und náměstek pro ošetřovatelskou péči (Vizedirektor für Behandlungspflege)3;
• fehlendes Maskulinum bei einigen als typisch geltenden weiblichen Berufen, obwohl diese zunehmend auch von Männern ausgeübt wer-den: všeobecná sestra / 0 (allgemeine Schwester / 0), kosmetička / kos-metické služby (Kosmetikerin / Dienstleistungen in Kosmetik).4 Das Femininum wird (bzw. wurde noch vor Kurzem) generisch verwendet;
• die im Sprachgebrauch des Tschechischen viel häufiger als im Deutschen vorkommende Verwendung von maskulinen Personen- und Berufsbezeichnungen, die zur Bezeichnung von Frauen dient: učitel
2 Plesník in der Tageszeitung Právo (10.11.11, S. 2).3 Es geht um Bezeichnungen für denselben Beruf und dieselben Funktionen. Überprüft am
Ministerium für Gesundheitswesen, 30.01.11.4 Vgl. aber die deutsche Sprachform Kosmetiker als ein nach dem Berufsbildungsgesetz
anerkannter Ausbildungsberuf (vgl. JOBBOERSE; online). In der Tschechischen Republik gibt es einige Ausbildungsstellen und das Interesse der Männer für diesen Beruf besteht. Überprüft an der Oberschule für Bekleidung und Dienstleistung Vizovice, 30.01.11.
144
Jana Valdrová
(Lehrer), vědec (Wissenschaftler), psycholog (Psychologe), auch in öf-fentlichen Texten und Reden.
Bislang gibt es weder wissenschaftliche Abhandlungen noch Materialien für die tschechische Öffentlichkeit, in denen maskuline und feminine Berufsbe-zeichnungen systematisch aufgeführt werden. Dasselbe gilt für offizielle und international anerkannte Berufsbezeichnungslisten des tschechischen Ministe-riums für Arbeit.5 Auch das SSČ (Slovník spisovné češtiny) registriert die Be-rufsbezeichnungen lückenhaft: oft fehlt das Femininum (dazu Dickins 2001).
2. Argumente gegen die Praktikabilität der gendergerechten Sprache
Von manchen Vertretern der strukturellen Bohemistik (siehe weiter unten) wurden Empfehlungen für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch des Tschechischen seit 1990 generell abgelehnt: „Tschechisch wird [den Bemü-hungen um sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern] hoffent-lich widerstehen“ (Čmejrková 1995, S. 53); „die Struktur des Tschechischen wird solche Reformen nicht auf uns zukommen lassen“ (Daneš 1997, S. 259). Zum Teil werden die Bemühungen um die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern heute noch abgelehnt, denn sie seien „von Ansich-ten abhängig, die auf den Eigenschaften typologisch verschiedener Sprachen basieren“.6
2.1. Die Flexions- und Satzkongruenzpflicht hindere an sprachlicher Gleichbe-handlung von Mann und Frau.
Zu Beginn ein Beispielsatz von Čmejrková: „Čtenář/i/ky (m/f) jsou vyzýváni/y (m/f), aby sam/i/y (m/f) odhalil/i/y (m/f) důsledky revidování ja-zykového paradigmatu pro text“ (Die Leser/Leserinnen werden aufgefordert, die Folgen der Revision des sprachlichen Paradigmas für den Text selber zu enthüllen), vgl. Čmejrková (1995, S. 46), durch den die Autorin die Nicht-praktikabilität der Verdoppelung von männlichen und weiblichen Derivations- und Flexionsformen mithilfe des Schrägstrichs, wie man sie auch aus dem Deutschen kennt, zeigen möchte. Dieselbe Konstruktion (in Čmejrková 2003, S. 50, zitiert von Daneš 1995, auch in 2001, 2007a und 2007b) wirkte auf englischsprachige LeserInnen, an die sie adressiert war, sicher abschreckend.
5 Das ist eine ganz andere Praxis als im Deutschen (vgl. DKZ; online). 6 Uličný (2010), ohne nähere Erklärung.
145
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
Die Autorin kommentiert ihr Beispiel „However, in Czech, plural forms are no option because they would result in equally clumsy utterances“.
Hinsichtlich der Beidnennung kann der Autorin zugestimmt werden. We-der Singular- noch Pluralformen lösen das Problem der Kongruenz, wie sie überzeugend gezeigt hat. Allein aus diesem Beispiel brauchen allerdings keine fatalen „Folgen der Revision des sprachlichen Paradigmas für den Text“ ab-geleitet zu werden; und es sollte schon gar nicht deswegen auf die geschlech-tergerechte Sprache verzichtet werden. Derselbe Satz kann nämlich unkom-pliziert umformuliert werden, z. B. „Vyzýváme čtenářskou obec, aby sama odhalila…“ (Wir fordern die Lesergemeinde auf, selbst ... zu entdecken…).7
2.2. Bei generisch verwendeten Pronomen wie kdo (wer) könne kein Nonse-xismus zum Ausdruck kommen.
Zu den typologischen Unterschieden zwischen dem Englischen und dem Tschechischen führt F. Daneš (2001, S. 43, vgl. auch Daneš 1995) noch an:
„Jsou však případy, v kterých se nonsexismus uplatnit nemůže, např. u zájmena kdo: Kdo to udělal?“ (Es gibt aber Fälle, in denen kein Nonsexismus zum Ausdruck gebracht werden kann, z. B. bei dem Pronomen wer: Wer hat es gemacht?).
Im Unterschied zum Englischen und Deutschen kommt die grammatische Kongruenz im Tschechischen bei Prononem wie kdo, někdo, kdokoli (wer, je-mand, wer auch immer) etc. und každý, žádný (jeder, keiner) tatsächlich als die maskuline Flexion des l-Partizips (udělal u. a.) zur Geltung.
Ganz unproblematisch ist der Gebrauch von Konstruktionen mit den oben genannten generisch gemeinten Pronomina aber nicht, wie noch an den Bei-spielen 3a, b gezeigt wird. Die feministische Linguistik setzte sich übrigens bereits vor drei Jahrzehnten mit authentischen Formulierungen (d. h. keinen konstruierten Beispielen) wie „Die Menstruation ist bei jedem ein bisschen anders“ auseinander (Puschs Glosse vom Jahr 1982, erwähnt von der Autorin in Pusch 2008, S. 7).
2.3. Das substantivierte Partizip weist im Maskulinum und Femininum unein-heitliche Deklinationsparadigmen auf.
Im Tschechischen sind seit Jahrzehnten Sprachformen wie pracující (r/e Werktätige), cestující (r/e Reisende), kupující (r/e Kaufende), prodávající (r/e Verkaufende) u. v. a. im Gebrauch. Daneš (1997, S. 258) nennt diese Alterna-tive „z bláta do louže“ (vom Regen in die Traufe), da sie „viele Schrägstriche oder Klammern“ fordere. Vier Jahre später lehnt er sogar auch die „vermutlich
7 „Korrekturen“ wie LeserInnengemeinde wären nach meiner Ansicht übertrieben.
146
Jana Valdrová
unmarkierte Umschreibung osoba kupující“ ab, die ja „evident feminin“ ist, was wiederum „Männer beleidigen kann“ (2001, S. 45).
Das substantivierte Partizip weist in bestimmten Fällen tatsächlich genus-spezifische Endungen auf. Im Singular ist die Nominativform für beide Genera identisch und das Geschlecht wird durch das Genus spezifiziert, pracující (der/die Werktätige), mask. oder fem., in obliquen Fällen wird das Geschlecht durch die Flexion spezifiziert. Im Plural werden beide Genera ähnlich wie im Deutschen identisch dekliniert. Eine evtl. morphologische Kongruenz fordert die Spezifizierung der Flexion auch bei ergänzenden Pronomen und Attributen, z. B. obě mladé cestující (f.) / oba mladí cestující (m.) (beide jun-gen Reisenden), im Tschechischen sogar mit genusspezifischen Formen des Zahladjektivs beide.
Bei generisch gemeinten Personenbezeichnungen wird allerdings – wie in anderen solchen Fällen – die maskuline Form verwendet. Dann wird ein gene-risches Maskulinum, z. B. student, učitel (Student, Lehrer, siehe weiter unten), eigentlich durch ein anderes generisches Maskulinum studující, vyučující (der/die Studierende, der/die Lehrende)8 ersetzt. Kann aber dann überhaupt noch von Alternativen des GM die Rede sein?
Nach meiner Meinung kann das Partizip auch in solchen Fällen als geschlech-tergerechte Alternative der substantivischen Personenbezeichnungen fungieren. Insbesondere im Plural kommen substantivierte Partizipien der geschlechter-gerechten Bezeichnungsweise näher als andere Substantive. Außerdem gibt es Konstruktionen, die keine weiteren, vom Partizip geleiteten Satzglieder enthal-ten, so dass ihre maskuline Kongruenz nicht wahrgenommen wird. Dies betrifft Überschriften wie Rozvrhy vyučujících (Stundenpläne der Lehrenden)9 statt Rozvrhy učitelů (Stundenpläne der Lehrer), Kupé pro cestující s dětmi (Abteil für Reisende mit Kindern) statt der früher geläufig verwendeten Überschrift Kupé pro matky s dětmi (Abteil für Mütter mit Kindern) u. v. a.
2.4. Durch die konkretere Personenbezeichnung und -differenzierung würden männliche Subjekte kommunikativ ausgeschlossen.
„Nejlepším učitelem naší školy je Anna Nováková“ (Der beste Lehrer unserer Schule ist Anna Nováková), so Štícha (2003, S. 197), vgl. auch Chromýs Beispiel mit Parkanová als dem besten Politiker (2008, S. 198). Die Formulierungen mit der maskulinen Form „Lehrer“ bzw. „Politiker“ seien
8 Im Nominativ Sg. und Pl. beider Genera ist die Sprachform identisch; die maskuline grammatische Kongruenz kommt erst im Kontext zur Geltung, hier durch die Endung des Verbs: „Studující jsou povinni …“ (Studierende sind verpflichtet, …).
9 Auf meinen Vorschlag hin auf der Webseite der Pädagogischen Fakultät in Budweis geändert (vgl. ROZVRHY; online).
147
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
nach beiden Autoren „die einzig richtigen“. Eine eventuelle Genus-Sexus- Kongruenz (Nováková – Lehrerin, Parkanová – Politikerin) müsse nach Štícha und Chromý zu Missverständnissen führen, denn es wäre nicht geklärt, ob Nováková die beste unter den Lehrerinnen oder unter den Lehrerinnen und Lehrern sei.
Aus strukturalistischer Perspektive besteht kein Zweifel daran, dass das ge-nerische Maskulinum die Menge von Frauen und Männern umfasst, während das Femininum nur die von Frauen. Richtig sind nach dieser Regel auch Aus-sagen wie die Überschrift eines Zeitungsartikels über die letzte Überlebende der Titanic wie „Poslední pasažér Titanicu uveřejnil své paměti“ (Der letzte Titanic-Passagier veröffentlichte seine Memoiren), obwohl der betreffende Passagier eine Frau war.10 Genauso richtig ist aber auch „Die letzte Titanic-Passagierin veröffentlichte ihre Memoiren“; höchstwahrscheinlich werden Le-serinnen und Leser nicht unbedingt die Information verlangen, wer der letzte überlebende Mann war.
Die rein strukturalistische und die pragmatische Perspektive gehen nämlich dort auseinander, wo Sprechende nicht beabsichtigen zu kategorisieren. Aus-sagen wie „Nejlepší kuchařka je moje žena“ (Die beste Köchin ist meine Frau) und „Paní Jaterková byla nejlepší učitelka, kterou jsem kdy potkala“ (Frau Ja-terková war die beste Lehrerin, der ich je begegnet war) statt „… byla nejlepší učitel, kterého jsem kdy potkala“ (…war der beste Lehrer, dem ich je begeg-net war) werden auch in Kontexten ausgesprochen, in denen Lieblingsspeisen oder Vorbilder thematisiert werden sollen. Die eventuelle Eingliederung der Personen in die Menge von Frauen und Männern liegt an den Sprechenden und weiteren Kommunizierenden.
3. Argumente für eine gendergerechte Sprache
„Die Grundlage der feministischen Linguistik ist ein Sprachverständnis, das davon ausgeht, dass Sprache Bewusstsein sowohl reproduziert als auch pro-duziert. Diese enge Beziehung von Sprache, Denken und Handeln beinhaltet, dass sich Sprache und außersprachliche Realität gegenseitig beeinflussen und verändern. Der Sprache als Sprachgebrauch kommt demnach eine wichtige gesellschaftliche Rolle zu.“ (Horny in Wierlemann 2002, S. 145).
Der juristische Kontext hat sich auch in Bezug auf die sprachliche Praxis der Gleichbehandlung geändert. Im Jahre 1990 forderte der Europarat die Mitgliedstaaten zu einer Eliminierung der sexistischen Sprache auf (dazu
10 Authentisches Beispiel aus Valdrová (2001). Fettdruck-Markierung maskuliner Formen: JV.
148
Jana Valdrová
Richtlinien des Europarates Nr. 4).11 In der Deklaration wurde die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Rechts- und Amtssprache, im Sprachgebrauch im öffentlichen Raum, Schulwesen und in den Medien und Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene hervorgehoben.
Im Tschechischen (Valdrová 2008) bzw. Slowakischen (Maceková 2007) wurden genauso wie im Deutschen (Klein 2004, Irmen/Linner 200512 u. a.) Tests durchgeführt, die zeigen, dass das GM in vielen Kontexten doch nicht genderneutral, d. h. ohne negative oder positive Konnotationen gelesen wird. Es wurde festgestellt, dass das GM selektiv, für Männer statusaufwertend und somit sozial hierarchisierend distribuiert wird, wie Baslarová/Binková (2007), Kynčlová (2006) u. a. auf Grund ihrer Diskursanalysen berichteten. Auch im Tschechischen werden die Begriffe Frau und Mann konzeptua-lisiert (Vybíral 2005) und die Wirklichkeit durch die lenses of gender, auch Genderbrille genannt (dazu Bem 1994), angesehen. Die Ergebnisse der Tests im Tschechischen machen die Empfehlungen zur Eliminierung des GM im öffentlichen Sprachgebrauch vom Jahr 1990 auch für das Tschechische re-levant. An einigen Beispielen wird gezeigt, welche Textsorten und welche sprachlichen Phänomene dies betrifft.
Beispiel 1Im Jahre 2008 veranstaltete das Prager Pädagogische Forschungsinstitut die natio-na le Konferenz „Lehrer 21“ – eine Konferenz für „Pädagogen“, die „Lehrer“ ausbilden. Unter anderem sollte dort darüber diskutiert werden, wie die „Lehrer“ sein sollen, die unsere „Schüler“, „Studenten“ und die künftigen „Bürger“ brauchen. Das Plakat enthält insgesamt 12 maskuline Personen- bzw. Berufsbezeichnungen im Singular und Plural: učitel (Lehrer) (achtmal), pedagog
11 In WCD; online.12 Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse mit der Beschreibung von Methoden.
Bild Nr. 1: Konferenz Lehrer 21
149
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
(Pädagoge), žák (Schüler), student (Student), občan (Bürger). Der junge männliche Lehrer auf dem Bild korreliert „logisch“ mit dem Maskulinum, semantisiert es und verkörpert so das erwünschte Lehrerbild.
Kommentar: Der Ausdruck Lehrer (und andere generische Maskulina im Text) soll sicherlich Lehrer und Lehrerinnen bezeichnen; auch unter der männlichen Ikone wurden wahrscheinlich weibliche und männliche Lehrkräfte gemeint. Assoziationstests und Analysen (weiter unten) aber zeigen, dass das Masku-linum vor allem im öffentlichen Raum nicht immer genderneutral wahrge-nommen wird. Geschlechtergerechter hätte die betreffende Veranstaltung statt durch „Lehrer 21“ (und auch nicht „Lehrer/Lehrerin 21“), sondern z. B. „Škola 21“ (Schule 21) o. ä. benannt werden können.13
Das Hauptargument für eine geschlechtergerechte Sprache wäre hier, im Ein-klang mit Grices Maxime der Quantität (vgl. Grice in Rolf 1994), die sprach-liche Sichtbarmachung von Frauen, zumal es sich um einen Text handelt, der sich an die breite Öffentlichkeit wendet: der reale Anteil der Lehrerinnen an Grundschulen macht 95 % in der 1. bis 4. Klasse, 75 % in der 5. bis 9. Klasse und 55 % an Oberschulen aus.14
Beispiel 2„Vážený pane Jankovský, Vámi iniciovaná schůzka se bude konat 22.04.2009 v 11.00 hodin v kanceláři zástupce starosty Ing. Bláhové. S přáním příjemného dne Monika Hajná, asistent starosty.“ (Sehr geehrter Herr Jankovský, das von Ihnen initiierte Treffen wird am 22.04.2009 um 11.00 Uhr im Büro des Vertreters des Bürgermeisters, Ing. Bláhová, stattfinden. Mit dem Wunsch eines angenehmen Tages Monika Hajná, Assistent des Bürgermeisters.)15
Kommentar: Eine sprachliche Gleichbehandlung ist in manchen Fällen leicht erreichbar, hier mit Movierungssuffixen (vgl. Nádeníček und Žídková in die-sem Band). Das Problem liegt also auch in diesem Fall nicht in der Typologie, sondern es ergibt sich aus dem Stand der Sprachpflege, -kritik und -kultur und daraus, ob das (Nicht)Beachten der geschlechtergerechten Ausdrucksweise in der einen und der anderen Sprache beabsichtigt ist oder nicht.
13 Weitere Alternativen in Valdrová/Knotková-Čapková/Paclíková (2010).14 Quellen: Genderová analýza českého školství, Daten vom Januar 2006 (vgl. PROEQUALITY;
online) und Statistická ročenka školství 2005. 15 Ein Brief aus meiner Beratungspraxis, 2009; eine Beamtin schreibt eine Email an einen
Bürger. Namen sind geändert.
150
Jana Valdrová
Beispiele 3a, 3ba) „Kdyby se mě někdo jiný zeptal, kde rodit, řekla bych mu, aby šel do porodnice. Protože už jen to, že se ptá, ukazuje, že není na porod doma zralý.“ (Sollte mich jemand anderer fragen, wo [das Kind] gebären, würde ich ihm sagen, er soll ins Krankenhaus gehen. Weil allein das, dass er fragt, zeigt, dass er dafür nicht reif ist, [das Kind] zu Hause zu gebären.)16
b) „Mateřství není pro každého. Pro mne ale ano.“ (Die Mutterschaft ist nicht für jeden. Aber für mich schon.).17
Kommentar: Die feminine Form des Pronomens (jede anstelle von jeder: „Die Mutterschaft ist nicht für jede.“) ist in solchen tschechischen Aussagen (noch) nicht Standard bzw. Norm. Für die durchschnittliche Sprecherin oder den durchschnittlichen Sprecher wäre das Femininum hier geschlechtsmarkiert, d. h. semantisch durch Gender aufgeladen und könnte ungewohnt klingen, wie logisch es auch in Verbindung mit Mutterschaft und Geburt sein mag. Hier wäre eine Umformulierung, z. B. „Mateřství není pro každou ženu.“ (Die Mut-terschaft ist nicht für jede Frau.) gut vorstellbar, und im breiteren Kontext wäre auch die feminine Form des Pronomens každá bzw. každá z nás (jede bzw. jede von uns) an Stelle des generischen Maskulinums möglich. Eines der Prinzipien der gender-fair language – „Kreativ formulieren“ – steht sogar im Titel einer Broschüre des österreichischen Frauenministeriums (Kargl/Wetschanow/Wo-dak/Perle 1997).
Beispiel 4„Svět výhod karet ISIC / ITIC / IYTC. Už jsi začal sportovat? Ještě ne. Tak to bys měl hodně rychle napravit.“ […]. (Hast du schon mit dem Sport angefangen? Noch nicht. Dann solltest du es ganz schnell gutmachen. […].)18
Kommentar: Obwohl die Vorteilskarten für weibliche und männliche Studie-rende bzw. Lehrende bestimmt sind (referentielle Bedeutung), wendet sich das Angebot sprachlich nur in maskuliner Form an sie. So kann dieser Sprachusus falsche Vorstellungen forcieren und den Mythos unterstützen, dass Sport eine Männerdomäne sei (dazu Feststellungen in Valdrová/Smetáčková/Knotková-Čapková 2005). Als Alternative wären Splittingformen gut möglich: „už jsi začal/a“, „to bys měl/a“ (hast du schon angefangen, das solltest du) bzw. Plu-ralformen, die unter Umständen die Wahrnehmung des Maskulinums als ge-schlechtsspezifischer Form reduzieren könnten (dazu Tests in Valdrová 1998).
16 Mandausová, K. 2009. Je porod doma hazard? In MF Dnes, 06.08.09.17 Salma Hayek in der kostenlosen tschechischen Tageszeitung metro, 30.11.07, S. 7. 18 Werbetext in Google (vgl. GOOGLE; online).
151
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
Ob bzw. wie eine Werbung an die Adressatinnen und Adressaten zukommt, darüber entscheidet u. a. die Ansprache der Zielgruppe. Dies ist eindeutig einer der Gründe, warum Frauen in der Ansprache sichtbar gemacht werden sollten.
Beispiele 5a, 5b, 5ca) „Chceš pokračovat nepřihlášený?“ (Möchtest du unangemeldet weiterfahren?, das Adjektiv steht im Maskulinum)19
b) Interaktive Computerspiele für das Vorschulalter: „To jsi hezky zvládl. Jsi šikovný.“ (Du hast es gut geschafft. Du bist gescheit!, mit maskulinen Endungen des l-Partizips und des Adjektivs)20 c) Google-Annonce, 26.09.11: „MUDr. Výborná Daniela je doporučený jako Velmi dobrý gynekolog České Budějovice. www.znamylekar.cz/.../mudr-vyborna.../gynekolog/ceske-budejovice“ (MUDr. Výborná Daniela wird als ein Sehr guter Gynäkologe empfohlen. www.bekannterarzt.cz/.../mudr-vyborna.../gynäkologe/ceske-budejovice.)21
Kommentar: Eine sprachliche Gleichbehandlung der Internettexte (als eine der Aufgaben für linguistische und IT-qualifizierte Fachleute) kann zu einer bes-seren Adressiertheit und zu einem benutzerfreundlicheren Verhandlungsklima beitragen. Für alle drei Fälle gibt es sprachliche Alternativen, z. B.:
Im Falle a) gibt es keine sprachlichen Gründe dafür, alle die das Internet benut-zen, lediglich im Maskulinum anzureden. Das Duzen kann eliminiert und Frauen können z. B. wie folgt angeredet werden: „Chcete pokračovat nepřihlášen/a?“.
Der Befund b) deutet an, wie der Prozess der Gewöhnung an die maskulinen Sprachformen in Mädchenköpfen etwa abläuft. Die Reaktion des Mädchens zeigt, dass Anreden im Maskulinum die sich entwickelnde weibliche sprachli-che Identität des Mädchens verletzen können. Ein Ausweg wären geschlechts-neutrale Bezeichnungen wie „Jsi šikulka!“ (das Substantiv šikulka (gescheites Mädchen/gescheiter Junge) kann u. U. Maskulinum sowie Femininum sein), ebenso Kommentare wie „Výborně!“, „Musím tě pochválit!“ (Ausgezeichnet!, Ich muss dich loben!).
Der Eintrag c) besteht aus einem Satz, in dem es zwar mehrere Fehler gibt (Orthographie, Kommasetzung), die Verletzung der Kongruenz des biologi-schen und grammatischen Geschlechts wirkt aber besonders tollpatschig. Auch hier gibt es Lösungen: die Überschrift gynekolog könnte je nach Ko(n)-
19 Anfrage nach dem Herunterfahren des Emailprogramms im Portal Centrum (vgl. CENTRUM; online).
20 Belege in Valdrová/Smetáčková/Knotková-Čapková (2005). Die 5-jährige Tochter einer Kollegin empörte sich über die Anrede im Maskulinum, sie sei doch kein Junge.
21 Authentische Eintragung mit allen Fehlern.
152
Jana Valdrová
text in eine Konstruktion mit „gynekologie“ umformuliert werden. Und um auf das Attribut „bekannt“ nicht verzichten zu müssen, könnte die Namensliste mit „Doporučujeme Vám tyto známé lékaře a lékařky“ (Wir empfehlen Ihnen folgende bekannte Ärzte und Ärztinnen) eingeleitet werden.
Beispiel 6An stichprobenartig gewählten Paragraphen aus der Studienordnung der Pädagogischen Fakultät in Budweis (Seznam přednášek PF JU pro studijní rok 1995–1996) wird die Reduzierung von maskulinen Sprachformen in einem juristischen Text demonstriert. In dem Text waren insgesamt 205 generische Maskulina und ein Femininum (werdende Mutter). Das GM wurde durch Konversion (Partizip I), Pluralformen und Paraphrasierung alterniert:
Tabelle 122
Ursprüngliche Formulierungen Alternativen von 1996 und 2008§8: „Student, který nezískal zápočet nebo klasifikovaný zápočet v uvedených ter-mínech, nesplnil podmínky pro zápis do vyššího ročníku.“
1996: „Studující, který/á nezískal/a zápočet nebo klasifikovaný zápočet v uvedených termínech, nesplnil/a podmínky pro zápis do vyššího ročníku.“
2008: „Studující, kteří nezískají zápočet nebo klasifikovaný zápočet v uvedených termínech, nesplní podmínky pro zápis do vyššího ročníku.“22
§14: „Studentovi, který studium neukončil, vydá studijní oddělení na jeho žádost potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách a počtu uzavřených semestrů, kde současně uvede, že student studium neukončil.“
1996: „Studující/mu, který/á studium ne-ukončil/a, vydá studijní oddělení na po-žádání potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách a počtu uzavřených semestrů, kde současně uvede, že studující studium neukončil/a.“
2008: „Studujícím, kteří studium neukon-čili, vydá studijní oddělení na požádání potvrzení o úspěšně vykonaných zkouš-kách a počtu uzavřených semestrů, kde současně zaznamená neukončení studia.“
Kommentar: Die Problematik der Flexion der von dem generisch verwendeten Partizip geleiteten Satzglieder wurde bereits oben aufgegriffen. Der Ersatz des
22 Mit Pluralformen ist es gelungen, die Schrägstriche vom 1996 wesentlich zu reduzieren.
153
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
Substantivs student durch das Partizip im Plural reduziert die Anzahl der mas-kulin zu kongruierenden Stellen im Text, was m. E. Einfluss auf die Semanti-sierung des generischen Maskulinums üben könnte.
4. Das Deutsche als Ansatzpunkt für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Tschechischen
Nach einem gründlichen Studium potentieller sprachlicher Mittel zur Gleich-behandlung von Frauen und Männern im gegenwärtigen Sprachgebrauch des Russischen, Deutschen, Englischen, Polnischen und Slowakischen (Bruns 2007, Doleschal 2004, Běličová 1998, Roelcke 1997, Hellinger 1990, Jiráček 1986, Dvonč 1966 u. a.) wurden im Tschechischen als der ersten slawischen Sprache (unverbindliche) Alternativen zum bestehenden Sprachgebrauch ins-titutionell publiziert (Valdrová/Knotková-Čapková/Paclíková 2010).23
Im Tschechischen gibt es mehrere Alternativen zum generischen Maskuli-num (ausführlich dazu Valdrová 2001), wobei eines der wichtigsten Mittel der sprachlichen Sichtbarmachung von Frauen die Movierung ist.24 Die im Deut-schen mittlerweile erprobten Methoden zur Sichtbarmachung von Frauen im öffentlichen Sprachgebrauch lassen sich mit einigen Ausnahmen (siehe weiter unten) auch im Tschechischen anwenden. Diese Verfahren sind mit Beispielen in der Tabelle 2 angeführt:
23 Veröffentlicht im Auftrag des Ministeriums für Schulwesen auf dessen Internetseiten (MSMT; online), heute unter dem Publikationstitel abrufbar.
24 In dem Sinne erwies sich das gegenwärtige Russische und Polnische für die Formulierung von sprachlichen Empfehlungen als ungeeignet, denn die movierten Personenbezeichnungen werden in diesen Sprachen meist pejorativ empfunden. Eine komparative Studie des Tschechischen und Slowakischen aus der Perspektive der sprachlichen Gleichbehandlung wurde m. W. noch nicht veröffentlicht.
154
Jana Valdrová
Tabelle 2Sprachliche Verfah-ren zur Gleichbe-handlung von Frauen und Männern
Beispiele Deutsch Beispiele Tschechisch
Konkretisierung, vor allem Movierung u. Beidnennung
L. Irmen ist PsycholinguistinSehr geehrte Wählerinnen und Wähler
Sie ist eine erfolgreiche Wissenschaftlerin (statt Sie ist ein erfolgreicher Wissen-schaftler)
Kfz-Mechaniker/-in
L. Irmen je psycholingvistka Vážené voličky, vážení voliči
Ona je úspěšná vědkyně (statt Ona je úspěšný vědec)
automechanik/-čkaNeutralisierung die/der Studierende studujícíAbstraktion Person, Personal, Team,
Kraft, Dekanat, Professur,Schule in XY organisiert… (statt Schüler in XY organi-sieren)
osoba, personál, tým, síla, děkanát, profesura,škola v XY organizuje… (statt školáci v XY organi-zují)
Umschreibungen Ihre Unterschrift (statt Un-terschrift des Bewerbers)
Váš podpis (statt podpis uchazeče)
Weglassung des Mas-kulinums
Eine Maßnahme für Be-hinderte (statt behinderte Mitbürger)
Opatření pro postižené (statt postižené spolu ob čany)
Verschiedene Alternativen sind auch in Kombinationen mit anderen sprach-lichen Mitteln zu verwenden: „Většina našich zaměstnanců jsou projektoví manažeři – vysokoškolsky vzdělaní specialisté s odbornými zkušenostmi z praxe“ (Die meisten von unseren Arbeitnehmern sind Projektmanager – hochschulgebildete Spezialisten mit praktischen Erfahrungen in ihrem Fach). Die alternative Formulierung könnte hier etwa sein „Většinu našeho týmu tvoří/Většina z nás jsou projektové manažerky a manažeři s vysokoškolským vzděláním a odbornými zkušenostmi z praxe“ (Die Mehrheit unserer Teams bilden / Die meisten von uns sind Projektmanagerinnen und -manager mit Hochschulausbildung und praktischen Erfahrungen in ihrem Fach).25
25 Beispiel aus Valdrová/Knotková-Čapková/Paclíková 2010.
155
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
5. Fazit
Mehrere Tests und Analysen haben gezeigt, dass das Problem des geschlech-tergerechten Sprachgebrauchs vor allem in dem Sprachgebrauch – d. h. in der fehlenden Rücksicht auf die Betroffenen und dem fehlenden Willen der Sprechenden zu respektvollem Sprachgebrauch liegt. Schon im Prinzip scheint es methodisch falsch zu sein, über Fragen der Angemessenheit des Sprach-gebrauchs und der Sprachkritik anders als in Kategorien der Pragmatik und Stilistik zu sprechen.
Ein Vergleich von Methoden der sprachlichen Sichtbarmachung von Frauen im Deutschen und Tschechischen hat gezeigt, dass die tschechische Sprache genauso wie die deutsche über viele Möglichkeiten verfügt, der Gleichbehand-lung von Männern und Frauen sprachlich Rechnung zu tragen, insbesondere durch Neutralisierung, Abstraktion vom Geschlecht und verschiedene Arten der Umschreibung, ganz abgesehen von anderen Stilmitteln (z. B. der Met-onymie). Unter der Neutralisierung sind u. a. die Alternativen mit dem Parti-zip I in ihren Pluralformen zu verstehen (studující etc.). Sie weisen zwar kein „vollständig neutrales“ Paradigma auf, können aber durchaus zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter beitragen.
Bei der Formulierung der Empfehlungen für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch des Tschechischen sind allerdings – wie übrigens in jeder an-deren Sprache – einige typologisch bedingte Spezifika, die bestimmte Aus-drucksweisen blockieren, zu beachten. In der Flexion werden genusspezifische Endungen (mit Konsequenzen für die Satzkongruenz) bei fünf Wortarten un-terschieden: bei Substantiven, Adjektiven, (mit wenigen Ausnahmen) bei Pro-nomen, Zahladjektiven und bei den sog. l-, n-, t-Partizipien der Verben. Diese Tatsache und die Kongruenzpflicht erschweren es, in kontinuierlichen Texten die Beidnennung zu verwenden. Auf der anderen Seite zeigte das Beispiel Nr. 6, Version 1996, dass die Beidnennung in der geschriebenen Rechtssprache denkbar ist. Ansonsten gibt es genügend stilistische Alternativen.
Die anfangs ablehnende Einstellung der Öffentlichkeit zur sprachlichen Sicht-barmachung von Frauen ändert sich heute zu Gunsten eines eher geschlech-tergerechten Sprachgebrauchs. Die Anzeigen zur Arbeitsstellensuche werden korrekter formuliert als vor Jahrzehnten. Im Jahre 2010 hat das tschechische Schulministerium die Bezeichnungen der Rubriken auf seiner Homepage (vgl. MSMT; online), die ursprünglich alle im generischen Maskulinum standen, durch gleichbehandelnde Ausdrücke ersetzt: z. B. Média (Medien) statt Novinář (Jour-nalist). Im Sommer 2011 wurde ein Abgeordneter im Senat öffentlich gemahnt, die Anwesenden nicht „machoid“ mit „Vážení páni senátoři“ (Sehr geehrte Herren Senatoren) anzusprechen, sondern auch die weiblichen Abgeordneten zu beachten.
156
Jana Valdrová
Die soziologische und linguistische Erforschung der Geschlechterkons-truktionen und Geschlechterhierarchien in Geschichte und Gegenwart des Tschechischen hat neue Aussagen über das Zusammenspiel zwischen Ge-schlechterrollen und Machtmechanismen in der Gesellschaft erbracht. Von ihren Erkenntnissen profitiert auch eine angewandte tschechische Sprach-wissenschaft, in deren Fokus nicht die Sprachstruktur, sondern die Pragma-tik des realen Sprachgebrauchs und dessen Funktionen in den Medien steht. Die typologischen Unterschiede zwischen dem Tschechischen und Deutschen können einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch des Tschechischen nicht blockieren.
Literatur
Baslarová, Iva/Binková, Pavlína (2007): Mediální obraz českých političek v období vo-leb do Poslanecké sněmovny v roce 2006: Rovné příležitosti vs. promeškaná příleži-tost? Analýza diskurzů. Občanské sdružení Fórum 50 %. Brno.
Běličová, Helena (1998): Nástin porovnávácí morfologie spisovných jazyků slovan-ských. Praha.
Bem, Sandra (1994): The lenses of gender. Transforming the debate of sexual inequa-lity. Yale.
Bruns, Thomas (2007): Einführung in die russische Sprachwissenschaft. Tübingen.CENTRUM: www.centrum.cz [26.09.11].Chromý, Jan (2008): K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“
In: Naše řeč, 91/4, 197–200.Čmejrková, Světla (1995): Žena v jazyce. Slovo a slovesnost, 56, Praha, 43–55.Čmejrková, Světla (2003): Communicating gender in Czech. In: Bußmann, Hadumod/
Hellinger, Marlies (Hgg.), Gender across Languages. Amsterdam/Philadelphia, 27–57.
Daneš, František et. al. (1997): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha.Daneš, František (2001): Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních pro-
měn. In: Čeština – univerzália a specifika, 3, Brno, 37–47.Daneš, František (2007a): Ještě jednou „feministická lingvistika“. Online: http://nase-
-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7412 [11.03.11].Daneš, František (2007b): Genderová lingvistika se do práva nehodí. In: Lidové noviny,
16.10.07, 7.Dickins, Tom (2001): Gender Differentiation and the Contemporary Czech. In: The
Slavonic and East European Review, Bd. 79, 2, London, 212–247. DKZ: http://www.dkz.arbeitsagentur.de/berufe/berufe-beschreibungen.html [26.09.11].Doleschal, Ursula (2004): Genus als grammatische und textlinguistische Kategorie:
eine kognitiv-funktionalistische Untersuchung des Russischen. München. DUDEN 4 (72005): Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Mannheim
u. a.
157
Typologische Unterschiede als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachpflege?
Dvonč, Ladislav (1966): Morfológia slovenského jazyka. Bratislava. Eisenberg, Peter (22006): Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart. GOOGLE: www.google.com [26.09.11].Götze, Lutz/Hess-Lüttich, Ernest W. B. (1989): Knaurs Grammatik der deutschen
Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. München.Hellinger, Marlis (1990): Kontrastive feministische Linguistik. Mechanismen sprachli-
cher Diskriminierung im Englischen und Deutschen. Ismaning. Hoffmannová, Jana (1995): Feministická lingvistika? In: Naše řeč, 78/2, 80–91.Irmen, Lisa/Linner, Ute (2005): Die Repräsentation generisch maskuliner Personenbe-
zeichnungen: Eine theoretische Integration bisheriger Befunde. In: Zeitschrift für Psychologie, 213, 167–175.
Jiráček, Jiří (1986): Morfologie ruského jazyka. Praha. JOBBOERSE: www.jobboerse.arbeitsagentur.de [02.01.12].Kargl, Maria/Wetschanow, Karin/Wodak, Ruht/Perle, Néla (1997): Kreatives Formuli-
eren. Anleitungen zu geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Wien. Klein, Josef (2004): Der Mann als Prototyp des Menschen – immer noch? Empirische
Studien zum generischen Maskulinum und zur feminin-maskulinen Paarform. In: Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung. Bd. 5. Mannheim, 292–307 (Duden Thema Deutsch).
Kynčlová, Tereza (2006): Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně „Žiješ, protože tě rodiče chtěli“ z hlediska kritické diskurzívní analýzy. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum, 7/2, 51–57.
LIDOVKY: http://www.lidovky.cz [19.02.10].Maceková, Johanka (2007): Rodové stereotypy v pracovných inzerátoch. Bratislava.MSMT: www.msmt.cz [15.01.10].Nekula, Marek (1998) [Rezension]: D. Moldanová: Žena – jazyk – literatura. In:
SPFFBU, A 46, 215–219.Plesník, Vladimír (2011): Rejdař zaměstnává jen ženy a neměnil by za nic na světě. In:
Právo, 10.11.11, 2.Polenz, Peter von (1999): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Ge-
genwart. Bd. 3. Berlin.Pusch, Luise (2008): Die Eier des Staatsoberhaupts und andere Glossen. Göttingen.PROEQUALITY: www.proequality.cz [30.07.12].Roelcke, Thorsten (1997): Sprachtypologie des Deutschen. Berlin u. a. Rolf, Eckard (1994): Sagen und Meinen. Paul Grices Theorie der Konversations-Im-
plikaturen. Opladen.ROZVRHY: www.home.pf.jcu.cz/~rozvrhpf/?page=vyhledavani [02.01.12].SSČ: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (32007). Praha. Statistická ročenka školství (2005): Základní vzdělávání. Střední vzdělávání. Praha.Štícha, František (2003): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha.Stölzel, Georg/Wengeler, Martin (1995): Kontroverse Begriffe, Geschichte des öffentli-
chen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/New York. Trávníček, František (21949): Mluvnice spisovné češtiny. Praha.Uličný, Oldřich (2010): Periferní jazykový jev v ohnisku zájmu. In: Lidové noviny,
19.02.10. Online: http://www.lidovky.cz [15.01.12].
158
Jana Valdrová
Valdrová, Jana (1998): Kontrastivní genderová lingvistika. Téma zviditelnění ženy v současném německém a českém jazyce. Disertační práce. Brno.
Valdrová, Jana (2001): Novinové titulky z hlediska genderu. In: Naše řeč, 84/2, 90–96.Valdrová, Jana (2008): „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického
maskulina v českém jazyce. In: Naše řeč, 91/1, 26–38.Valdrová, Jana (2010): Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. Teoretická
intergrace dosavadních poznatků (Komentář ke stati Lisy Irmen a Ute Linner). In: Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11/2, 3–15.
Valdrová, Jana/Smetáčková-Moravcová, Irena/Knotková-Čapková, Blanka (2005): Pří-ručka posuzování genderové korektnosti učebnic. In: Ročenka genderových studií FHS UK, 03/04. Praha, 173–196.
van Leeuwen-Turnovcová, Jiřina (2002): Gender-Forschung in der Slawistik. Beiträge der Konferenz Gender – Sprache – Kommunikation – Kultur. Wien.
Vybíral, Zbyněk (2005): Psychologické dny 2004 – Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Olomouc.
WCD: http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(90) [22.02.11].Wierlemann, Sabine (2002): Political Correctness in den USA und in Deutschland.
Berlin.
Jana ValdrováSüdböhmische Universität in České Budějovice, Pädagogische Fakultät, Lehrstuhl für [email protected]