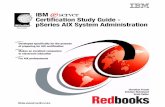Ristow 2013 News about Early Christian Rhineland and Aix-la-Chapelle
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ristow 2013 News about Early Christian Rhineland and Aix-la-Chapelle
H A B E L T V E R L A G
H E R A U S G E B E R :
M . G R O T E N
A . P L A S S M A N N · C . W I C H - R E I F
V E R Ö F F E N T L I C H U N G
D E R A B T E I L U N G F Ü R R H E I N I S C H E L A N D E S G E S C H I C H T E
D E S I N S T I T U T S F Ü R G E S C H I C H T S W I S S E N S C H A F T D E R U N I V E R S I T Ä T B O N N
Sonderdruck
J A H R G A N G 7 7 2 0 1 3
Inhalt des siebenundsiebzigsten JahrgangsVIII und 516 S., 31 Abb.
Aufsätze:Sebastian R i s t o w : Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion im Rheinland .................................................................................................................................................. 1Ingo R u n d e : ‚Ranges, Rivers and Roads‘ – zur Funktion und Bedeutung topographischer Aspekte bei Grenzkonflikten im früh- und hochmittelalterlichen XantenerRaum ...................................................................... 25Max P l a s s m a n n : Zur Funktion der Prophetenkammer im Kölner Rathaus ................................................... 59Rouven P o n s : Ein ungewisser Friede. Zum Friedensvertrag von Xanten (1614) .............................................. 73Wolfgang S c h m i d : Die Wallfahrt zum Heiligen Rock (1844) und die evangelischen Gemeinden im Rhein-land (Bonn, Koblenz, Trier, Winningen) ................................................................................................................... 86Michael K i ß e n e r : Katholisches Rheinland – Widerständiges Rheinland? ....................................................... 118Carlo L e j e u n e : Matthias Zender als Kriegsverwaltungsrat und seine Akte: ein Helfer Hitlers oder auf-rechter Humanist? ......................................................................................................................................................... 130Michael H e r k e n h o f f : Die Sammlung „Kriegsbriefe“ der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn ........ 158Martin S c h l e m m e r : … anders als noch vor Jahren. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und die Energiefrage in den Jahren 1975 bis 1980 .................................................................................................................. 178Jozef M e r t e n s und Udo A r n o l d : 25 Jahre „Historische Studiecentrum“ Alden Biesen. Grenzübergrei-fende Deutschordensforschung in Belgien ............................................................................................................... 231Frens B a k k e r und Roeland v a n H o u t : Die gegenseitige Abgrenzung der nord- und südniederfrän-kischen Dialekte in der niederländischen Provinz Limburg .................................................................................. 266
Kleine Beiträge: Johannes M ö t s c h : Zum Erscheinen des Handbuchs „Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren“ .......................................................................................................................................... 296Wolfgang L ö h r : Balderich von Friaul = Balderich von Gladbach? ..................................................................... 301Manuel H a g e m a n n und Andreas R u t z : Das digitale Historische Archiv Köln Digitale Präsentation der Archivalien und virtuelle Rekonstruktion der Bestände des Historischen Archivs der Stadt Köln“. Ein neues DFG-Projekt der Abteilung für Rheinische Landesgeschichte ................................................................... 309
Besprechungen:Deutsches Ortsnamenbuch, hg. von M. Niemeyer (P. Ewald) ............................................................................... 315Vocabularius Theutonicus, bearb. von R. Damme (L. de Grauwe) ....................................................................... 317F. Ravida: Graphematisch-phonologische Analyse der Luxemburger Rechnungsbücher (B. Weimann)....... 320J. E. Schmidt – J. Herrgen: Sprachdynamik (C. Wich-Reif) ..................................................................................... 322H. Siemens: Plautdietsch (I. Schröder) ....................................................................................................................... 325G. Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler – Nordrhein-Westfalen II: Westfalen, Neubearb. (H. Kier) .......................................................................................................................................................................... 327R. Holbach – M. Pauly (Hg.): Städtische Wirtschaft im Mittelalter. FS Franz Irsigler (G. Fouquet) ................ 328Historie über Herkunft und Jugend Constantins des Großen und seine Mutter Helena von einem unbe-kannten Verfasser, bearb. von P. Dräger (G. Berndt) .............................................................................................. 330Kr. Matijevic: Römische und frühchristliche Zeugnisse im Norden Obergermaniens (H. Ament) ................. 331Quellen zur Geschichte der Franken und Merowinger, hg. von R. Kaiser – S. Scholz (A. Plassmann) ........... 333M. Becher – S. Dick (Hg.): Völker, Reiche und Namen im frühen Mittelalter (G. Lubich) ................................ 335K. Herbers: Geschichte des Papsttums im Mittelalter (R. Schieffer) ..................................................................... 336D. C. Pangerl: Die Metropolitanverfassung des karolingischen Frankenreiches (E. Boshof) ............................ 337U. Nonn: Mönche, Schreiber und Gelehrte (A. Stieldorf) ....................................................................................... 339W. Hartmann: Karl der Große (Ph. Depreux) ........................................................................................................... 340K. Weber: Die Formierung des Elsass im Regnum Francorum (R. Schieffer) ...................................................... 341K. J. Heidecker: The divorce of Lothar II. (M. Groten) ............................................................................................ 342S. B. Montgomery: St. Ursula and the eleven thousand virgins of Cologne (M. Groten) .................................. 343M. Gaillaird u.a. (Hg.): De la mer du Nord à la Méditerranée (L. Böhringer) ..................................................... 344M. Chazan – G. Nauroy (Hg.): Écrire l’histoire à Metz au Moyen Âge (D. Heckmann) .................................... 347G. Blennemann: Die Metzer Benediktinerinnen im Mittelalter (F. G. Hirschmann) .......................................... 350M. Hartmann: Studien zu den Briefen Abt Wibalds von Stablo und Corvey sowie zur Briefliteratur in der frühen Stauferzeit (W. Petke) ...................................................................................................................................... 351De oorkonden der graven van Vlaanderen. Bd. 3. Regering van Filips van de Elzas, bearb. von Th. de Hemtpinne, A. Verhulst (L. Falkenstein) ................................................................................................................... 352Die Urkunden Friedrichs II. 1218–1220, bearb. von W. Koch (A. Stieldorf) ......................................................... 354Regesten der Reichsstadt Aachen (einschliesslich des Aachener Reiches und der Reichsabtei Burtscheid). Siebenter Band. Nachträge 1251–1400, bearb. von T. Kraus (T. Herrmann) ........................................................ 355
Die Inschriften der Stadt Trier II, bearb. von R. Fuchs (J. Mötsch) ........................................................................ 357W. Freitag – W. Reinighaus (Hg.): Burgen in Westfalen (St. Frankewitz) ............................................................ 358F. J. Felten (Hg.): Befestigungen und Burgen am Rhein (J. Mötsch) ...................................................................... 360M. Uhrmacher: Lepra und Leprosorien im rheinischen Raum vom 12. bis zum 18. Jahrhundert(K. Militzer) 363D. Berger: Stift und Pfründe (O. Auge)...................................................................................................................... 364J. Voigt: Beginen im Spätmittelalter (M. Wehrli-Johns) .......................................................................................... 366B. Neidinger: Prädikaturstiftungen in Süddeutschland (1369–1530) (A. Schmid) .............................................. 371D. Raths: Sachkultur im spätmittelalterlichen Trier (K. Militzer) .......................................................................... 372Repertorium poenitentiariae Germanicum VIII. Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pöniten-tiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches 1492–1503 1. Teil Text, bearb. von L. Schmugge, 2 Teil. Indices, bearb. von H. Schneider-Schmugge und L. Schmugge (B. Roberg) ........... 373D. Geuenich – J. Lieven (Hg.): Das St. Viktor-Stift Xanten (Th. Vogtherr) ........................................................... 374Th. Schilp – B. Welzel (Hg.): Mittelalter und Industrialisierung. St. Urbanus in Huckarde (E. Bünz) ........... 376Th. Schilp – B. Welzel (Hg.): St. Johannes in Brechten als Erinnerungsort des Ruhrgebietes (E. Bünz) .......... 376M. van Eekenrode: Les états de Hainaut sous le règne de Philippe Le Bon (1427–1467) (K. Oschema) .......... 379Glanz und Größe des Mittelalters. Kölner Meisterwerke aus den großen Sammlungen der Welt, hg. von D. Täube u.a. (W. Schmid) ........................................................................................................................................... 381R. Urbanek: Die Goldene Kammer von St. Ursula in Köln (W. Schmid) .............................................................. 384S. Ruf: Die Stiftungen der Familie Hardenrath an St. Maria im Kapitol zu Köln (um 1460 bis 1630) (M. Groten) ..................................................................................................................................................................... 385Ph. Dollinger: Die Hanse 6. Aufl. (J. Deeters) ........................................................................................................... 386D.W. Poeck: Die Herren der Hanse. Delegierte und Netzwerke (N. Jörn) ........................................................... 388M. Szameitat: Konrad Heresbach. Ein niederrheinischer Humanist zwischen Politik und Gelehrsamkeit (P.A. Heuser).................................................................................................................................................................. 389H. O. Brans: Der Orden der Cellitinnen zur hl. Gertrud in Düren 1521–2009 (R. Haas).................................... 390W. Wüst – M. Müller (Hg.): Reichskreise und Regionen im frühmodernen Europa (G. Schmidt) .................. 392 W. Kleinschmidt: Essen und Trinken in der frühneuzeitlichen Reichsstadt Speyer (G. Hirschfelder) ........... 393M. Groten – C. von Looz-Corswarem – W. Reininghaus (Hg.): Der Jülich-Klevische Erbstreit 1609 (M. Rohrschneider) ....................................................................................................................................................... 395F. Pohle: Glaube und Beredsamkeit. Katholisches Schultheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817) (H. Molitor)............................................................................................................................................... 397R. Schwindt (Hg.): Das Kapuzinerkloster in Koblenz-Ehrenbreitstein (D. Flach) .............................................. 398R. Schlüter: Calvinismus am Mittelrhein. Reformierte Kirchenzucht in der Grafschaft Wied-Neuwied 1648–1806 (Chr. Strohm) .............................................................................................................................................. 400U. Schmidt-Clausen: Das lateinische Gedicht des Franz Xaver Trips über den Gülich-Aufstand in Köln. Untersuchungen und Teiledition mit Übersetzung und Erläuterungen (M. Groten) ........................................ 402P. Brommer – A. Krümmel (Hg.): Höfisches Leben am Mittelrhein unter Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Trier (1739–1812) (K. Eiler) ................................................................................................................................... 403T. Klupsch: Johann Hugo Wyttenbach (H. Klueting) .............................................................................................. 404F. Henryot – L. Jalabert – Ph. Martin (Hrsg.): Atlas de la vie religieuse en Lorraine à l’époque moderne (W.H. Stein) .................................................................................................................................................................... 405Räuberbanden beiderseits des Rheins, zweiter Teil, aus Kriminalprotokollen und geheimen Notizen des Br. Keil, ehemaliger öffentlicher Ankläger im Ruhr-Departement/zusammengetragen von einem Mitglied des Bezirks-Gerichts Köln, bearb. von W. Guting (W. H. Stein) ............................................................................ 407A. Becker: Napoleonische Elitenpolitik im Rheinland (W.H. Stein) ..................................................................... 408H. Hömig: Carl Theodor von Dalberg (G. Schmidt) ................................................................................................ 409H. Fenske: Freiherr vom Stein (H. Duchhardt) ......................................................................................................... 411Acta Borussica. Neue Folge 2. Abt. 1, Bd. 3 / 1 und 2, bearb. von W. Neugebauer (D. Höroldt) .................... 411B. Walcher: Vormärz im Rheinland (S. Freitag) ....................................................................................................... 413J. Werquet: Historismus und Repräsentation. Die Baupolitik Friedrich Wilhelms IV. in der preußischen Rheinprovinz (J. Krüger) .............................................................................................................................................. 414C.-H. Hentsch: Die Bergischen Stahlgesetze (1847/54) (J. Reulecke) .................................................................... 416A. Weller: Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs im französischen Rechtsgebiet der preußischen Rheinprovinz (W. Schubert) ........................................................................................................................................ 417S. Fehlemann: Armutsrisiko Mutterschaft. Mütter- und Säuglingsfürsorge im rheinisch-westfälischenIndustriegebiet 1890–1924 (S. Stöckel) ....................................................................................................................... 418H. Roland – M. Beyen – G. Draye (Hg.): Deutschlandbilder in Belgien 1830–1940 (C. Lejeune) ...................... 420S. Scharte: Preußisch – deutsch – belgisch. Nationale Erfahrung und Identität (C. Lejeune) ........................... 421R. Hombach: Landschaftsgärten im Rheinland (G. Gröning) ................................................................................ 422H.-W. Herrmann – S. Nimmesgern: Evangelische Frauenhilfe im Saarland – mehr als 100 Jahre (J. Rauber) 427C. Nonn: Kleine Migrationsgeschichte von Nordrhein-Westfalen (J. Reulecke) ................................................. 428Ch. Kuhl: Carl Trimborn, 1854–1921 (Th. Bredohl) ................................................................................................. 430„Wir suchen alle nach seelischem Halt und Aufbau“. Quellen zur Bergisch Gladbacher Stadtgeschichte; 1914– 1933, bearb. von M. Dziak-Mahler, A. Esser, L. Speer (St. Schröder) ......................................................... 431D. Lukaßen: Grüne Koalitionen. Naturkonzepte und Naturschutzpraxis in der Weimarer Republik (P. Neu) 432Lageberichte rheinischer Gestapostellen, bearb. von A. Faust, B. A. Rusinek und D. Dietz (J. Kuropka) ..... 433Th. Gebauer: Das KPD-Dezernat der Gestapo Düsseldorf (H. Matzerath) .......................................................... 435
ISSN 0035-4473 ISBN-10: 3-7749-3463-0 ISBN-978-3-7749-3867-0
W. Spiertz: Die Hitlerjugend in Köln (Th. Roth) ...................................................................................................... 437A. Ostermann: Zwangsarbeit im Erzbistum Köln (M. Kißener) ............................................................................ 439M. Löffelsender: Strafjustiz an der Heimatfront. Die strafrechtliche Verfolgung von Frauen und Jugend-lichen im Oberlandesgerichtsbezirk Köln 1939–1945 (R. Pommerin) ................................................................... 440J. Fibich: Die Caritas im Bistum Limburg in der Zeit des „Dritten Reiches“ (A. Henkelmann) ....................... 441H. Vogt: Bierbaum-Proenen 1929–1952. Ein Familienunternehmen während Weltwirtschaftskrise, Natio-nalsozialismus und Wiederaufbau (H. A. Wessel) .................................................................................................. 443S. Haumann: „Schade, daß Beton nicht brennt“. Planung, Partizipation und Protest in Philadelphia und Köln 1940–1990 (N. Finzsch) ....................................................................................................................................... 444Akten deutscher Bischöfe seit 1945, Westliche Besatzungszonen 1945–1947, bearb. von U. Helbach (W. Werner) .................................................................................................................................................................... 445Bei den Menschen bleiben. Kölner Pfarrer und das Ende des Zweiten Weltkriegs, bearb. von M. Albert, R. Haas (B. Bernard) ..................................................................................................................................................... 447S. Okunlola: „Dem Volk dienen“. Ein Lesebuch zur Geschichte der Polizei Rheinland-Pfalz 1945–2008 (St. Schröder) ........................................................................................................................................................................ 448C. Defrance – U. Pfeil: Eine Nachkriegsgeschichte in Europa. 1945 bis 1963 (E. Wolfrum) .............................. 450A. Weißer: Die „innere“ Landesgründung von Nordrhein-Westfalen (M. Schumacher) .................................. 451Ch. von Hehl: Adolf Süsterhenn (1905–1974). Verfassungsvater, Weltanschauungspolitiker, Föderalist(M. Kißener) ................................................................................................................................................................... 454J. Schäfer: Das autonome Saarland. Demokratie im Saarstaat 1945–1957 (P. Burg) ............................................ 456A. Ingenbleek: Die britische Gewerkschaftspolitik in der britischen Besatzungszone 1945–1949 (S. Mielke) 457N. Trippen: Joseph Kardinal Höffner (1906–1987). II. Seine bischöflichen Jahre 1962–1987 (H.-J. Große Kracht) ............................................................................................................................................................................ 459Das Schatzhaus der Bürger mit Leben erfüllt. 150 Jahre Überlieferungsbildung im Historischen Archiv der Stadt Köln (C. von Looz-Corswarem) ........................................................................................................................ 464F.-J. Radmacher (Hrsg.): Archiv und Erinnerung im Rhein-Kreis Neuss. Festschrift für Karl Emsbach (G. Bers) ................................................................................................................................................................................. 465H. Lademacher: Grenzüberschreitungen. Mein Weg zur Geschichtswissenschaft (H. Fenske) ....................... 465U. Stevens – U. Heckner – N. Nußbaum (Hrsg.): Denkmal-Kultur im Rheinland. Festschrift für Udo Main-zer zum 65. Geburtstag (H. Kier) ................................................................................................................................ 467R. Pons (Hg.): Weltsicht und regionale Perspektive. Beiträge zur Geschichte des nassauischen Raumes. Jubiläumsband zum 200jährigen Bestehen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichts-forschung (V. Rödel) ..................................................................................................................................................... 469S. Schüler: Bewahren – Erleben – Verstehen. 200 Jahre Verein für NassauischeAltertumskunde und Geschichtsforschung (V. Rödel) .................................................................................................................................. 469W. Schenk: Historische Geographie (G. Henkel) ..................................................................................................... 474J. Dolle – D. Knochenhauer (Hg.): Niedersächsisches Klosterbuch. 4 Bde. (H. Flachenecker).......................... 475Aachen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1: Die natürlichen Grundlagen. Von der Vorgeschichte bis zu den Karolingern, hg. von Th. Kraus (T. Herrmann) .................................................................................... 477Olpe: Geschichte von Stadt und Land. Bd. 2. Von der Weimarer Republik bis zur Gegenwart, hg. vonJ. Wermert (C. von Looz-Corswarem) ....................................................................................................................... 480F. Konersmann – H. Ammerich (Hg.): Historische Regionalforschung im Aufbruch. Studien zur Ge-schichte des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken anlässlich seines 600. Gründungsjubiläums (V. Rödel) .......... 481W. Baumgart: Bücherverzeichnis zur deutschen Geschichte. Hilfsmittel, Handbücher, Quellen, 17. A. (T. Weller) ....................................................................................................................................................................... 483R. Mechthold: Landesgeschichtliche Zeitschriften 1800–2009. Ein Verzeichnis deutschsprachiger landes-geschichtlicher und heimatkundlicher Zeitschriften, Zeitungsbeilagen und Schriftenreihen (V. Henn)........ 484R. Laurent: Sceaux de chartriers luxembourgeois (1079–1789) (A. Stieldorf) ...................................................... 486T. Diederich: Siegelkunde. Beiträge zu ihrer Vertiefung und Weiterführung (D. Wallenhorst) ...................... 486N. Klüßendorf: Kleine Münz- und Geldgeschichte von Hessen in Mittelalter und Neuzeit (S. Steinbach) ... 488D. Schwennicke (Hrsg.): Europäische Stammtafeln. Bd. 26, 27 und 28 (J. Mötsch) ............................................ 489Th. Wieczorek – M. Gädtke: Die Ahnentafeln der Turnierteilnehmer bei der Jülicher Hochzeit 1585 (H. J. Domsta) .......................................................................................................................................................................... 491
Bericht über die Herbsttagung der Abteilung für Rheinische Landesgeschichte des Instituts für Geschichts-wissenschaft der Universität Bonn im Jahre 2012 .................................................................................................... 496
Inhaltsverzeichnis alphabetisch .................................................................................................................................. 510
Verzeichnis der Mitarbeiter ......................................................................................................................................... 516
FORSCHUNGSSTAND UND FORSCHUNGSSTANDPUNKTE ZU DEN ANFÄNGEN DER CHRISTLICHEN RELIGION IM RHEINLAND
Von S e b a s t i a n R i s t o w
Schon seit dem 19. Jahrhundert führte man die frühesten modern zu nennen-den Ausgrabungen in und bei Kirchen durch, wie z. B. in Aachen oder Trier, und legte erste Kataloge der frühchristlichen Funde an, anfangs besonders zu den Grabinschriften. Seit dieser Zeit ist bekannt, dass das Rheinland – kleinräumig betrachtet – eine der reichsten Fundprovinzen der frühchristlichen Welt über-haupt ist. Analytische Sammelwerke bündelten die Quellen seit der ersten um-fassenden Arbeit dazu von Wilhelm Neuss1.
In den letzten rund 30 Jahren ist ein Großteil der Befunde und Funde früh-christlicher Zeit aus dem Rheinland umfangreichen archäologischen Aufarbei-tungen und Neubewertungen unterzogen worden. Hier kam es sowohl bei den Ergebnissen als auch methodisch zu gravierenden Veränderungen.
Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verwischte man in archäolo-gischen und historischen Publikationen Beschreibung und Interpretation und füllte Überlieferungslücken, teils mit mangelhafter Quellenkritik vorgetragen, durch gemischte Argumentation mit historischen Quellen zur Ergänzung ar-chäologischer Sachquellen und andersherum2. An dieser Stelle sollen aber keine einzelnen Fehler moniert werden, sondern lediglich betont werden, dass eine möglichst objektive Betrachtung der unterschiedlichen Quellengattungen nur durch die den Eigenwert der Quellen beachtende Einzelanalyse erfolgen kann. Schriftquellen müssen am Original belegt werden und in Hinsicht auf hinter der Abfassung stehende Intentionen und die zeitliche Stellung quellenkritisch ge-prüft werden. Sachquellen sind in Bezug auf ihre absolute und relative Chrono-logie, aber auch auf ihre Aussagefähigkeit hin unabhängig zu untersuchen. Dabei muss strikt darauf geachtet werden, dass nur die aus den Quellen direkt abzuleitenden Schlussfolgerungen in den beschreibenden Teil einer Publikation eingehen sollten. Alle aus moderner Anschauung gespeisten Analysen, indirekte Schlussfolgerungen und die Hinzuziehung von Schriftquellen zur Erklärung des archäologischen Befundes sollten in einem zweiten, unabhängigen Teil der Pub-likation Eingang finden. Nur so ist es möglich zu erkennen, welcher Teil Befund-vorlage ist und welcher Interpretation. Auf diese Art kann auch bei später verän-
1 Wilhelm N e u s s , Die Anfänge des Christentums im Rheinlande (Rhein. Neujahrsbl. 2), Bonn 1923 und ²1933.
2 Zur Problematik mit Beispielen: Sebastian R i s t o w , Christliches im archäologischen Befund – Terminologie, Erkennbarkeit, Diskussionswürdigkeit, in: Niklot K r o h n , Sebastian R i s t o w (Hrsg.), Wechsel der Religionen – Religionen des Wechsels (Tagungsbeiträge der AG Spätantike und Früh-mittelalter 5. Stud. zu Spätantike und Frühmittelalter 4), Hamburg 2012, S. 1–26.
Sebastian Ristow2
derter Sichtweise im interpretatorischen Teil der Befund zweifelsfrei erkannt werden und ist im Rahmen der Publikation weiterhin von Nutzen.
An und für sich sollte eine solche Arbeitsweise selbstverständlich sein, etwa so, wie in den Kunstwissenschaften schon seit Jahr und Tag zwischen Beschrei-bung und Interpretation getrennt wird. Im Rahmen archäologischer und histori-scher Untersuchungen und besonders in der Forschung zum frühen Christentum blieben diese wissenschaftlichen Grundprinzipien aber allzu oft auf der Strecke. Dies führte dazu, dass beliebige Architekturreste unter späteren Kirchen zu frü-hen Vorgängern stilisiert wurden, ohne dass eine entsprechende Funktionsdeu-tung am archäologischen Befund überhaupt belegt werden kann (Neuss; Köln, St. Pantaleon, St. Severin; Bonn; „Kastellkirchen“ von Alzey, Bad Kreuznach etc.). Gelegentlich datierte man auch Baureste unter Kirchen bewusst oder un-bewusst zu früh, um eine möglichst lange und ungebrochene Kontinuität zu er-weisen (Xanten, Köln, Bonn, Neuss, Boppard, Mainz). Aus sich heraus nicht christlich zu deutende Funde wurden mit frühchristlichem Sinngehalt unterlegt(Königswinter-Niederdollendorf), der aus moderner Sichtweise gespeist ist. Schriftquellen wurden ungeprüft auf ihre Chronologie und unter Auslassung von Quellenkritik bei der Konstruktion historischer Modelle als Belege für früh-christliche Sachverhalte herangezogen (Ausführungen des Irenäus von Lyon zu Christen im 2. Jahrhundert, so genanntes Konzil von Köln des 4. Jahrhunderts). Sogar naturwissenschaftliche Analysen werden ohne die Erwähnung von Datie-rungsspielräumen und Unsicherheiten in der Interpretation eingesetzt, umLücken in der Befundüberlieferung zu schließen (karolingerzeitliches Erdbeben, das Köln angeblich betroffen haben soll, jedoch an den Befunden nicht ablesbar ist3).
2006 hatte sich eine Ausstellung im Landesmuseum Bonn zum Ziel gesetzt, den aktuellen Erkenntnisstand zu bündeln und der Öffentlichkeit zu vermitteln, 2007 erschien ein umfangreicher Katalog, in dem kurzgefasst die Aufarbeitungen zu den archäologischen Fundstellen wie die relevanten historischen Quellen vor-gestellt sind4. Grundzüge des hier Benannten werden im vorliegenden Beitrag
3 Alle übrigen einleitend genannten Probleme werden im folgenden Text wiederaufgegriffen; zu einem angeblichen Beben von 789/90, angenommen von Sven S c h ü t t e , Marianne G e c h t e r mit Beitr. v. Astrid B a d e r u. a., Von der Ausgrabung zum Museum – Kölner Archäologie zwischen Rathaus und Praetorium. Ergebnisse und Materialien 2006–2012, Köln 2012, S. 59, 66 f. und weitere Erwähnungen, zeigen neueste Untersuchungen, dass die zum Beleg des naturwissenschaftlich für Köln nicht nachgewiesenen Bebens angeführten archäologischen Befunde nicht auf Erdbebenschä-den zurückgehen müssen: Stephan S c h r e i b e r , Die Verwendung virtueller 3D-Modelle und quan-titativer Untersuchungsmethoden in der Archäoseismologie am Beispiel der Archäologischen Zone Köln. Phil.-Diss. Univ. Köln 2012. Den von archäologischer Seite angeführten Hypothesen zu einem solchen Beben in Köln ist somit jeglicher Grund entzogen. – Vgl. schon Sebastian R i s t o w , Ergebnis-se der Ausgrabungen unter dem Kölner Dom. Zu den spätantiken bis karolingischen Perioden, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 44 (2001), S. 185–192, hier S. 191 f., bes. mit Anm. 14.
4 Thomas O t t e n , Sebastian R i s t o w (Red.), Von den Göttern zu Gott. Frühes Christentum im Rheinland, Ausstellungskat. Bonn, Tübingen 2006; Sebastian R i s t o w , Frühes Christentum im
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 3
nur knapp referiert, neu Hinzugekommenes nachgetragen und auf ergänzende Literatur hingewiesen.
Abschnitte der Christianisierung
Historisch zerfällt die Christianisierung des Rheinlandes in mehrere Ab-schnitte:
1) Die Bekehrungszeit mit der Einflussnahme einzelner charismatischer Perso-nen auf Teile der Bevölkerung in der Spätantike, also der Zeit seit dem ausge-henden 3. Jahrhundert. Damit verbunden sind die Ausbildung erster kirch-licher Strukturen und die Einrichtung von Versammlungsstätten in den zent-ralen Orten. Eine Quantifizierung des christlichen Anteils der Bevölkerung oder das Abschätzen ihres Einflusses im Alltag kann nicht vorgenommen wer-den.
2) Der ungewisse Bestand der frühen christlichen Strukturen über die Periode der Mitte des 5. Jahrhunderts hinaus, also nach dem Machtwechsel zwischen dem jetzt christlich geprägten römischen Staat und den zunächst sicher mehr-heitlich nicht christlichen Franken. Die Intensität des Rückfalls in die Bedeu-tungslosigkeit für die christlichen Gemeinden kann nicht abgeschätzt werden. Eine Überlieferung zu entscheidenden Personen (Bischöfe, Kleriker) fehlt größtenteils.
3) Die nach der Taufe des fränkischen Königs Chlodwig um 500 erneut voran-schreitende und zielgerichtet von der fränkischen Herrschaft geförderte christliche Institutionalisierung im östlichen Frankenreich. Zumindest formal muss ab dem 6. Jahrhundert die gesamte Oberschicht dem christlichen Glau-ben zugerechnet werden. Inwieweit und ab wann die Bevölkerung in Stadt und Land mehrheitlich als christlich zu bezeichnen ist, bleibt unsicher. Der Prozess der dann endgültigen Christianisierung des Frankenreiches links des Rheins ist vorkarolingerzeitlich weitgehend abgeschlossen.
Quellenlage und Interpretationsfragen
Christen im Rheinland
Früheste Anfänge aus der Zeit vor der Tolerierung des neuen Glaubens, die im Westen des Römischen Reiches seit 313 Rechtssicherheit besaß, scheinen in den Quellen kaum auf. Die frühe schriftliche Überlieferung bleibt in ihrer Genauig-keit und Interpretationsmöglichkeit in Bezug auf das Rheinland unsicher. So wird die Beurteilung des ältesten Textes bis heute immer wieder in seinen Detail-bezügen überschätzt. Es handelt sich um die Ausführungen des Bischofs Irenäus
Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel, Münster 2007.
Sebastian Ristow4
von Lyon. Irenäus erwähnt zum Ende des 2. Jahrhunderts Christen, die in ver-schiedenen Provinzen des römischen Reiches leben5. Dabei zählt er auch ent-legene Gebiete an den äußeren Grenzen des Imperiums auf, um zu verdeut-lichen, dass sich das Christentum bis in dessen letzte Winkel verbreitet habe6. Neben der daraus abzuleitenden, nur sehr allgemeinen Gültigkeit der Aussage des Irenäus bleibt noch ein zweites Problem, das bei quellenkritischer Bewertung die Heranziehung des Irenäus zu sonst nicht nachgewiesenem Christentum im Rheinland mehr oder weniger ausschließt. Erhalten sind die Ausführungen des Bischofs von Lyon in einer griechischen und in einer lateinischen Abschrift, also nicht in einer einzigen authentischen Version des Autors selbst oder einer einzi-gen Abschrift davon. Die beiden Versionen unterscheiden sich an der entschei-denden Stelle zum Rheinland. Die griechische Abschrift verortet Christen in den Germanien (εν Γερμαν�ας), also wohl den germanischen Provinzen, so wie es für die Germania I und II gelten müsste, in der lateinischen Fassung ist von Germania die Rede. Stünde die griechische Fassung – also die wohl muttersprachliche des Autoren – dem Original näher, könnte dem Irenäus genauere Ortskenntnis un-terstellt werden und damit verbunden vielleicht tatsächlich auch dem Bischof von Lyon bekannte Christen etwa in den großen Städten wie Köln oder Mainz. Schon dies ist aber nur eine vage Vermutung. Stünde die lateinische Fassung – also die in der Sprache seines Wirkungsortes – dem Ausgangstext näher, wären die Ausführungen zu Germanien eher als Topos für die Grenze der römischen Welt anzusehen. Obwohl diese Hintergründe lange bekannt sind, wird das Text-zeugnis oft und gerne losgelöst von diesen Einschränkungen herangezogen, um frühe Christen im Rheinland zu benennen7.
Spätantike und merowingerzeitliche Quellen aus Köln und ihr Aussagewert
Ganz ähnlich wie zuvor geschildert verhält es sich mit der Auslegung zu ver-schiedenen Quellen des 4. Jahrhunderts. Für Köln etwa sind hier zwei Punkte relevant. Zum einen das so genannte Konzil von Köln, das angeblich 346 stattge-funden haben soll, zum anderen die Nennung eines conventiculum ritus Christiani zum Jahr 355 durch Ammianus Marcellinus8.
5 Griech.: Epiph. panar. 31, in: Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 25,1, bearb. von Karl H o l l , Leipzig 1915, S. 432, Z. 19–22; lat.: Iren. adv. haer. 1, 10, 2, in: Sources Chrétiennes 263, be-arb. von Adelin R o u s s e a u , Paris 2006, S. 2, Z. 158–160.
6 Zum Thema ausführlich: Ursula M a i b u r g , Und bis an die Grenzen der Erde ... Die Ausbrei-tung des Christentums in den Länderlisten und deren Verwendung in Antike und Christentum, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 26 (1983), S. 38–53.
7 Zuletzt so bei Dietrich H ö r o l d t , Christoph K e l l e r , Ulrike M ü s s e m e i e r , Das frühchrist-liche Bonn von der Spätantike bis ins Hohe Mittelalter, in: Bonner Geschichtsblätter 60 (2010), S. 11–61, hier S. 11.
8 Conc. Colonia Agrippinae, in: Corpus Christianorum Series Latina 148, bearb. von Charles de C l e r c q , Turnhout 1968, S. 26–29; Conc. Gall. I., in: Sources Chrétiennes 241, bearb. von Jean G a u d e m e t , Paris 1977, S. 68–79. – Ammianus Marcellinus, 15,5,31, bearb. von John C. R o l f e (The Loeb Classical Library), Cambridge (Mass.) 1950, Bd. 1, S. 152.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 5
Zum 12. Mai 346 soll nach Berichten des 8. bis 10. Jahrhunderts9 aus Trier in Köln ein Konzil unter dem Vorsitz des Trierer Bischofs Maximin zusammen-getreten sein, um im Beisein von insgesamt 14 Bischöfen den Kölner Amtsbruder Euphrates abzusetzen10. Quellenkritisch betrachtet ist die gesamte Schrift als vor dem Hintergrund der Rangstreitigkeiten zwischen den Bistümern Köln und Trier in der Karolingerzeit entstanden zu sehen und insofern wohl weitgehend wertlos, um daraus historische Fakten für ihre durch die Verfasser vorgegebene Entstehungszeit abzuleiten. Die Unterschriftenliste des Konzils setzt sich aus Bischofsnamen zusammen, die neben anderen in den Akten der Synode von Ser-dica im Jahr 343 gefunden werden können11. Die Trierer Fälscher der so genann-ten Kölner Akten haben sich also aus Quellen des 4. Jahrhunderts bedient. Den Bischofsnamen in der originalen Überlieferung von Serdica sind jedoch keine Ortsnamen hinzugefügt. Diese wurden erst im Mittelalter zugesetzt. Insofern kann das hier nur kurz besprochene Konzil nicht zum Beweis herangezogen werden, um zum Jahr 346 sonst nicht bekannte Bischöfe etwa in Worms, Speyer, Straßburg oder Kaiseraugst zu belegen12. Da auch spätere Namen in der Liste von Trier vorhanden sind, die in Serdica fehlen, zeigt dies, dass die Annahme einer dritten – nicht erhaltenen – Quelle mit Namen und Orten aus dem 4. Jahr-hundert nicht unbedingt angenommen werden muss. Man bediente sich in Trier ohnehin aus mehreren Quellen, ohne auf Authentizität Wert zu legen.
Im Zusammenhang mit der Usurpation des Silvanus berichtet der nichtchrist-liche Schriftsteller Ammianus Marcellinus zum Jahr 355 von einem christlichen Kultraum in Köln, in den sich der Usurpator angeblich flüchten wollte, als man ihn umbrachte. Dabei ist zu beachten, dass Ammianus nur erwähnt, dass Silva-nus auf dem Weg zu einem „Kirchenasyl“ war, und nicht, wo genau diese Kirche lag. In der älteren Forschung wurde der dem Praetorium als Amtssitz des Silva-nus benachbarte Dom als Kirche mit der wohl ältesten frühchristlichen Tradition
9 Zuerst taucht das angebliche Konzil in der Vita Maximini episcopi Treveriris auf (MGH SS rer Merov 3, bearb. von Bruno K r u s c h , Hannover 1896, S. 71–82).
10 Dazu: R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 108.11 Cuthbert H. T u r n e r , Ecclesiae Occidentalis Monumenta Iuris Antiquissimi 1,2, Oxford 1913,
S. 546–559.12 Zum Ganzen vergleiche unter den jeweiligen Orten in R i s t o w , Frühes Christentum im Rhein-
land (wie Anm. 4); Michael D u r s t , Euphrates, die gefälschten Akten der angeblichen Kölner Synode von 346 und die frühen Bischofssitze am Rhein, in: Siegfried S c h m i d t (Hrsg.), Rheinisch – Köl-nisch – Katholisch. Beiträge zur Kirchen- und Landesgeschichte sowie zur Geschichte des Buch- und Bibliothekswesens der Rheinlande. Festschrift für H. Finger zum 60. Geb. (Libelli Rhenani 25), Köln 2008, S. 21–62. – Zu Straßburg: Gertrud K u h n l e in Zusammenarbeit mit Sebastian R i s t o w , Kon-tinuität in Straßburg von der Spätantike zum Frühmittelalter, in: Michaela K o n r a d , Christian W i t s c h e l (Hrsg.), Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. 138), München 2011, S. 287–306, bes. 301 f. – Zu Kaiseraugst jetzt zusammenfassend: Guido F a c c a n i , Die Pfarrkirche Sankt Gallus in Kaiseraugst. Spätrömische Kastellkirche – römische Vor-gängerbauten – nachfolgende Kirchen (Forschungen in Augst 42), Augst 2012, S. 141–143.
Sebastian Ristow6
in Köln gelegentlich mit dem conventiculum zusammengebracht13, ohne dass es dazu aber irgendeinen belastbaren Hinweis gäbe; besonders da eine örtliche Spe-zifikation oder eine irgendwie geartete Beschreibung fehlen. Kürzlich ist noch eine andere, ältere Hypothese dazu erneut vorgetragen worden, die aber ebenso wenig zu erhärten ist: Angeblich hätte der Versammlungsraum innerhalb der regia liegen müssen, weshalb die ab dem 10. Jahrhundert in der Rathausumge-bung bekannte Laurentiuskirche ursprünglich dieser Kirchenbau gewesen sei, schließlich sei Laurentius ein spätantiker Heiliger14. Die einzige quellenkritisch betrachtet gültige Information an dieser Quelle ist aber im Gegensatz zu all die-sen Vermutungen und Schlussfolgerungen im Rahmen historischer Überlegun-gen, dass es in Köln in der Mitte des 4. Jahrhunderts eine Kirche, für den Nicht-christen Ammianus ein pejorativ benanntes conventiculum gegeben hat. Wo dieses gelegen hat, ist nicht zu erschließen.
Je nach Interpretation ergibt sich für die folgende Zeit zum Bischofssitz von Köln eine annähernd quellenleere Periode. Nach Euphrates ist nur noch Severin als spätantiker Amtsträger belegt. Seine Überlieferung ist zwar unabhängig von den Kölner Bischofslisten, jedoch ist sie nicht zeitgenössisch. Gregor, Bischof von Tours und Geschichtsschreiber der Franken, berichtet erst fast zwei Jahrhunderte später über eine auditio, die Bischof Severin von Köln am Todestag des Heiligen Martin, also am 8.11.397, beim Besuch der „heiligen Stätten“ in Köln hatte15. Da-mit ist die noch mit gutem Willen als „zeitnah“ zu bezeichnende Überlieferung zu Severin bereits erschöpft. Da ein Severin von Köln weder als Teilnehmer an Konzilien noch in sonst irgendeinem Zusammenhang erwähnt wird und auf-grund des Zeitunterschieds eine nähere Personenkenntnis des Gregor sicher auszuschließen ist, muss die Wundergeschichte von der auditio, die bis in den äußersten Winkel des fränkischen Reichs – nämlich bis in das weit im Osten lie-gende Köln – wirkte, kritisch betrachtet werden. Deshalb ist auch keine „enge persönliche Beziehung zwischen dem Bischof Martin von Tours und Bischof Severin von Köln“16 zu rekonstruieren und es kann auch keine Severinsvereh-rung in Köln oder gar „der Kölner Bucht“ schon ab dem 6. Jahrhundert daraus abgeleitet werden17. Für die Existenz eines Kölner Bischofs Severin spricht pri-mär das frühe Einsetzen seiner Verehrung, die historisch längstens bis in das
13 Vgl. Diskussion zu Josef E n g e m a n n , Spätantike Kirche und Baptisterium, in: Arnold W o l f f (Hrsg.), Die Domgrabung Köln. Altertum – Frühmittelalter – Mittelalter. Kolloquium zur Bauge-schichte und Archäologie. 14.–17.3.1984 in Köln, Vorträge und Diskussionen (Studien zum Kölner Dom 2), Köln 1996, S. 86–98, hier S. 95.
14 S c h ü t t e , G e c h t e r (wie Anm. 3), S. 63 f.15 Gregor von Tours, Virt. S. Martini 1,4, in: MGH SS rer Merov 1, 2, bearb. von Bruno K r u s c h ,
Wilhelm L e v i s o n , Hannover 1951, S. 140.16 Bernd P ä f f g e n , Der hl. Severin im Spiegel der frühen historischen Überlieferung. In: Joachim
O e p e n u. a. (Hrsg.), Der hl. Severin von Köln. Befunde und Forschungen zur Schreinsöffnung von 1999 (Studien zur Kölner Kirchengeschichte 40), Siegburg 2011, S. 441–534, hier S. 478.
17 Ebd., S. 499.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 7
7. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann18. Ob sich die Amtszeit des Severin genauer bestimmen lässt, wie sie Bernd Päffgen aus hochmittelalterlichen Quel-len ableiten will19, ist aber mehr als fraglich, denn Gregor wollte eine Geschichte zum Tod des Heiligen Martin erzählen und keinen Bischof von Köln chrono-logisch verzeichnen.
Nur kurz soll an dieser Stelle eingeschoben werden, dass die Untersuchung der Inhalte des Severinsschreins nach seiner Öffnung im Jahre 1999 ergeben hat, dass der Schrein die sterblichen Überreste eines zwischen 200 und 400 n. Chr. verstorbenen, etwa 55-jährigen Mannes beinhaltete20. Lässt man die Unsicherhei-ten der Strontium-Isotopenanalyse in Hinsicht auf das mehrfache Vorhanden-sein vergleichbarer Strontium-Isotopiewerte in zum Teil weit entfernten Regio-nen außer Acht, könnten die Reste des im Schrein aufbewahrten Individuums darauf hindeuten, dass die Person am Niederrhein gelebt hat. Die Textilreste im Schrein beginnen zeitlich mit dem einem Oberschenkelknochen anhaftenden Kleinstfragment eines spätantiken Blöckchendamasts, wohl eines Restes der ur-sprünglichen textilen Ausstattung der demnach sozial herausgehobenen Bestat-tung21. Ferner konnten zwei Seidenstoffe zwischen 600 und 720 sowie zwischen 610 und 780 datiert werden22. Die naturwissenschaftlichen Ergebnisse erweisen also, dass zu irgendeinem Zeitpunkt die sterblichen Überreste eines sozial her-ausgehobenen, spätantiken Männergrabes zur Ehre der Altäre erhoben wurden. Für den Beginn der Severinsverehrung liegt bei freier Interpretation des Befun-des mit der Datierung der Seidenstoffe ein Datum um 600 vom Range eines ter-minus post quem vor, wobei nicht ausgeschlossen bleibt, dass die Knochen der Männerbestattung nicht auch schon vorher Gegenstand reliquiarer Verehrung gewesen sein könnten. Angesichts der schier unüberschaubaren Zahl von spätantiken Bestattungen auf der in ihrer vollen Ausdehnung nicht bekannten Kölner Südnekropole sind die Untersuchungsergebnisse sicher keine Über-raschung. All dies deckt sich mit den Ergebnissen der archäologischen Ausgra-bungsbefunde unter der späteren Kirche St. Severin. Angefangen beim mit einer Westapsis versehenen Saalbau (Bau A nach Päffgen23) des 4. Jahrhunderts auf
18 Ebd., S. 484 f.; vgl. auch R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 137 mit Hinweis auf das Fehlen jeglicher Erwähnung einer Severinsverehrung in Köln in den zeitgenössi-schen Quellen, wie dem Martyrologium Hieronymianum, was ebenfalls auf ein Einsetzen der Ver-ehrung erst im Lauf des 7. Jahrhunderts bzw. der ausgehenden Merowinger- oder frühen Karolin-gerzeit hindeutet.
19 Ebd., S. 478.20 Ursula T e g t m e i e r u. a., Die AMS-Datierungen an Materialien aus dem Holzschrein des hl.
Severin, in: O e p e n (Hrsg.), Severin (wie Anm. 16), S. 127–155; Birgit G r o s s k o p f , Anthropologi-sche Untersuchung der Gebeine aus dem Schrein des hl. Severin. Ebd., S. 157–170, hier S. 166.
21 Sabine S c h r e n k , Ulrike R e i c h e r t , Die Textilien aus dem hölzernen Schrein in St. Severin, in: O e p e n (Hrsg.) Severin (wie Anm. 16), S. 215–371, hier S. 220–225.
22 Ebd., S. 226–254.23 Bernd P ä f f g e n , Die Ausgrabungen in St. Severin zu Köln (Kölner Forschungen 5,1–3), Mainz
1992; vgl. zur Auswertung der hier katalogisierten Befunde: D e r s . , Die Ausgrabungen in St. Severin zu Köln und ihre Bedeutung für die Christliche Archäologie im Rheinland, in: Sebastian R i s t o w
Sebastian Ristow8
dem römischen Großfriedhof, der im 5. Jahrhundert von den Angehörigen der neuen Kölner Eliten zu Bestattungszwecken genutzt wurde, über die Erweite-rung dieses Gebäudes in der Zeit um 600 (Bau B/C), wohl gleichzusetzen mit dem Beginn der Severinsverehrung an diesem Ort, hin zur Stiftskirche der Karo-lingerzeit.
Im auf das mögliche Episkopat des Severin folgenden 5. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts sind keine Quellen mehr zu Bischöfen in Köln vorhanden. Je nach historischem Modell kann man dies als schwache Überliefe-rungslage interpretieren und annehmen, dass es trotzdem Bischöfe gegeben habe24, oder dass es in der von den zunächst nichtchristlichen Franken beherrsch-ten Stadt eine Unterbrechung in der Sukzession und vielleicht auch im Gemein-deleben gegeben habe25. Wissenschaftlich ist weder das eine noch das andere weitergehend zu untermauern. Faktum ist jedoch das Fehlen der schriftlichen Quellen. Da eine Argumentation nur schlecht auf fehlenden Überlieferungen auf-gebaut werden kann, muss eine Plausibilitätsprüfung für das eine oder andere Szenario erfolgen. Bemerkenswert ist dabei, dass zu Beginn des 6. Jahrhunderts vom Frankenkönig Theuderich I. Kleriker aus der Auvergne nach Trier geschickt werden, um den Bischof bei der Verbreitung des Glaubens zu unterstützen. Am ehesten lässt dies mindestens auf den Niedergang des christlichen Lebens im Rheinland schließen. Jedenfalls werden in Köln und Mainz große kirchliche Bau-vorhaben erst in den 560er Jahren in den Schriftquellen erwähnt26. Frühchrist-liche Funde, die sicher in das 5. Jahrhundert zu verweisen wären, fehlen eben-falls. Abgesehen davon erlauben archäologische Funde in der Regel auch keine Aussagen zur Existenz einer christlichen Gemeinde oder eines Bischofssitzes.
(Hrsg.), Neue Forschungen zu den Anfängen des Christentums im Rheinland (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergbd., Kleine Reihe 2), Münster 2004, S. 173–186; R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 130–144; Bernd P ä f f g e n , Grab und Schrein des hl. Severin in ihrem architektonischen Kontext vom 5. bis 13. Jahrhundert, in: O e p e n (Hrsg.) Severin (wie Anm. 16), S. 373–439, dazu Sebastian R i s t o w (Rez.) in: Geschichte in Köln 58 (2011), S. 260–263.
24 Zuletzt so: Werner E c k , Köln im Übergang von der Antike zum Mittelalter, in: Geschichte in Köln 54 (2007), S. 7–25; vgl. d e r s ., Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum (Geschichte der Stadt Köln 1), Köln 2004, hier S. 648–651.
25 R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 55. – D e r s . , Frühes Christentum in Gallien und Germanien – Nachhaltige und unterbrochene Christianisierung in Spätantike und Frühmittelalter, in: Orsolya H e i n r i c h - T a m á s k a , Niklot K r o h n , Sebastian R i s t o w (Hrsg.), Christianisierung Europas. Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Be-fund/Christianisation of Europe: Archaeological Evidence for it’s Creation, Development and Consolidation. Internationale Tagung im Dezember 2010 in Bergisch Gladbach, Regensburg 2012, S. 73–94. – Jüngst unterstellt andererseits z. B. P ä f f g e n , Severin im Spiegel (wie Anm. 16), S. 499 der Elite der neuen fränkischen Machthaber, sie sei christlich gewesen und hätte die Gräber zweier Jungen im Grabbau der römischen Südnekropole bewusst in einem „christlichen Memorialbau für Bischof Severin“ angelegt. Für ein Christentum bei den Franken vor 500 fehlen aber, ebenso wie für die christliche Funktion der memoria von St. Severin, alle Anhaltspunkte in der historischen und archäologischen Überlieferung.
26 Zu Köln: Venantius Fortunatus carm. 3,14, in: MGH AA 4, bearb. von Friedrich L e o , Berlin 1881, S. 67 f.; zu Mainz: Ebd., 2,11 f.; 9,9,1–6, in: MGH AA 4, S. 40 f.; S. 215).
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 9
Einzig die Baubefunde könnten hier weiterhelfen. In Mainz wird die Grün-dung der Kirche St. Alban ohne stichhaltige Begründungen in das 5. Jahrhundert verlegt. Eine Gründung im 6. Jahrhundert ist nach den Befunden zu urteilen wahrscheinlicher27. Die neuen Ausgrabungen unter der Kathedrale von Ton-geren erweisen einen großen spätantiken Apsidenbau mit einem rätselhaften achtseitigen Podest unbekannter Bestimmung und unbekanntem Zeitpunkt sei-ner Errichtung im Zentrum der Apsidenfläche (Abb. 1). Die Funktion des spät-konstantinischen Gebäudes ist im Ganzen einstweilen unklar. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurde seine Apsis erneuert und dabei vergrößert. Im Inneren gab es eine Sitzbank, vielleicht genutzt als ,subsellium‘. Möglicherweise liegt hier ein kirchlich vereinnahmter repräsentativer Gedächtnisort vor. Im 6. Jahrhun-dert folgt die baulich erkennbare kirchliche Umgestaltung28.
In Köln steht beim Dom ebenfalls ein Apsidenbau am Beginn der Bauge-schichte, für den es fraglich ist, ob er von Anfang an als Kirche genutzt worden ist. Dieser Bau 1 nach der Phasengliederung von 2002 ist mit einem terminus post quem von 367 durch eine darunterliegende Münze des Kaisers Valens
27 Dazu ausführlich R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 240–243.28 Die Publikation der Ausgrabung ist in der Reihe der Relicta Monografi en geplant. – <http://
www.vioe.be/aanbod/publicaties/categorie/relicta-monografi e>[23.9.2012]; für Informationen danke ich Alain Vanderhoeven/Tongeren.
Abb. 1: Kirchengrabung in der Kathedrale von Tongeren mit spätantikem Apsidenbau und Podest in der Apsis. – Bild: Agentur für Kulturerbe Flanderns.
Sebastian Ristow10
(367–375) versehen29. Den Baubefunden in Köln und Tongeren fehlen für sich genommen klare Anzeichen der originären kirchlichen Nutzung der Architek-tur. Diese kommen erst im Verlauf der Baugeschichte hinzu. In Köln sind es die beiden königlichen Gräber aus dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts, die an-zeigen, dass es sich zum Zeitpunkt der Einbringung um eine Kirche gehandelt haben muss30. In dieser Zeit sind also, trotz fehlender Bischofsüberlieferung, ein bedeutendes Gotteshaus und damit verbunden sicher auch hochrangige Kleriker in Köln anzunehmen. Sicherlich ist es für beide Bauten vorstellbar, wenn auch nicht zu beweisen, dass sie bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts als Kirche in Benutzung standen. In Köln würde eine Deutung als Kirche mit der historischen Überlieferung zwischen dem eindeutig als Bischof um die Mitte des 4. Jahrhun-derts zu identifizierenden Euphrates und dem unsicheren Severin zu korrelieren sein. Für den Civitas-Hauptort Tongeren ist die Existenz des Bistums schon im 4. Jahrhundert generell nur unsicher belegt, wenn auch vom Grundsatz her an-zunehmen. Im 5. Jahrhundert sind dort Bischöfe bekannt31. Gesicherten Boden in Hinsicht auf die Existenz kirchlicher Baubefunde und einer bischöflich verfass-ten Gemeinde betritt man in Tongeren dann mit dem 6. Jahrhundert. Für Köln ist es fraglich, ob die spätantike Gemeinde und deren Kirche das 5. Jahrhundert überstanden haben. Im fortgeschrittenen 6. Jahrhundert sind Bischöfe und Be-funde bekannt.
Die Baubefunde am Kölner Dom legen nahe, dass die auf den spätantiken Bauphasen fußende Kirche der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts die dritte Bauphase am Ort ist. Insofern überrascht es, dass in der „Konkordanz“, die als Schluss-übersicht der aktuellen Publikation zum Alten Dom erscheint, die zweite Bau-phase vergessen wurde32, wohl aufgrund der Zusammenlegung der Böden B214 und B224 im Befundbearbeitungsteil des Buches, weil sie „kaum voneinander zu trennen sind“33. Dies ist zwar richtig, jedoch bedürften Profile wie Z287 der Domgrabung einer erneuten Erklärung, die drei Böden, in der Grabungsdoku-mentation identifiziert mit B224, B214 und B244, von drei Nutzungsphasen zei-
29 Sebastian R i s t o w , Die frühen Kirchen unter dem Kölner Dom. Befunde und Funde vom 4. Jahrhundert bis zur Bauzeit des Alten Domes (Studien zum Kölner Dom 9), Köln 2002, S. 46; zu den Bauten 1 und 2 s. ebd., S. 51–57.
30 Sebastian R i s t o w , Gräber der merowingerzeitlichen Elite in und bei Kirchen, in: Egon W a m e r s , Patrick P é r i n (Hrsg.), Königinnen der Merowinger. Ausstellungskat. Frankfurt, Regens-burg 2012, S. 59–76; D e r s ., Prunkgräber des 6. Jahrhunderts in einem Vorgängerbau des Kölner Domes, in: Ebd., S. 79–98.
31 Zusammenfassend: R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), S. 61–63.32 Georg H a u s e r , Der Alte Dom und seine Vorgeschichte. Grundzüge der Forschung 1946–2012,
in: Ulrich B a c k , Thomas H ö l t k e n , Dorothea H o c h k i r c h e n mit Beitr. v. K. H. Wedepohl u. a. (Hrsg.), Der Alte Dom zu Köln. Befunde und Funde zur vorgotischen Kathedrale (Studien zum Köl-ner Dom 12) Köln 2012, S. 231–250, hier 249, Tab. 1.
33 Ulrich B a c k , Archäologische Befunde zum Alten Dom und seinen Vorgängerbauten, in: Ebd., S. 9–91, hier S. 15 Anm. 45.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 11
gen34. Möglicherweise muss an dieser Stelle konstatiert werden, dass nach heuti-ger Kenntnis der Befunde keine sichere Unterscheidung möglich ist, ob zwischen Bau 1 und Bau 3a/b mehr als eine Ausstattungsphase liegt. Einstweilen möchte man aber doch weiterhin eine Zwischenphase für wahrscheinlich halten. Von Interesse ist in dieser Hinsicht ein neu in die Diskussion eingebrachtes Gra-bungsfoto. Es zeigt, dass die Aushubgrube für das Königinnengrab B808 über die Mauer B805 reicht35. Dies war bisher immer nur zu vermuten36, belegt aber jetzt sicher, das die fränkischen Gräber, schon aufgrund ihrer Ausstattungsqua-lität nur denkbar innerhalb einer Architektur, in eine veränderte (erweiterte oder abgerissene) Architektur eingesetzt wurden. Man änderte also Phase 1 in Phase 2. Darüber entstand dann die Kirche mit dem schlüssellochförmigen Ambo-Solea-Unterbau und ihrem Boden B244.
Mit dem Abschluss der Publikation der Kölner Domgrabung, die immerhin rund 50 Jahre umfasst hat, kann die Diskussion über die Befunde der Domgra-bung nun – 16 Jahre nach dem Grabungsende – endlich einsetzen. Was die vor-karolingische Zeit angeht, sind dabei besonders die Fragen nach der Zugehörig-keit des Mauerbefundes B1225 und des Bodenfragments B844 zur Phase 3d zu klären, aufgeworfen durch die Zuweisung zu den früheren, merowingerzeit-lichen Phasen durch Ulrich Back37. Und schließlich wird ein Modell zu ent-wickeln sein, das die dokumentierten Befundbereiche zwischen Mauerfragment B1225 im Osten und den Bereichen der älteren Kirche mit Ursprüngen im 6. Jahr-hundert sowie dem gestelzt ringförmigen Eingangsbereich (so genanntes Sankt-Galler-Ringatrium) im Westen mit den Befundnummern B42, B74 und B35 er-klärt. Schlüssel dazu ist die Frage nach der Identität der Estriche B1104 und B1124 sowie das Verständnis der Situation um die Gestaltung des verehrten Gra-bes B1135 im Zentrum der Kirche. Bis zu einer erneuten Grabung, nördlich der bisherigen Grabungsgrenze von B192 bei Nord 4,9 im Maßsystem des Domes wird die Frage kaum zu entscheiden sein, wie man sich die Entwicklung von Bau 3c nach Westen vorzustellen hat bzw. ob hier nicht von Osten, sondern eventuell von Westen aus zu denken ist. Hat man also den Bauteil mit dem gestelzt ring-förmigen Eingang zunächst für sich konzipiert, und – ähnlich wie später den gotischen Chor – gegen ein bestehendes Gebäude gesetzt? Sind mit dieser Archi-tekturphase auch unterschiedliche – eventuell auch nichteucharistische – Nut-zungskonzepte verbunden? Mit der Suche nach Analogien im Kirchenbau oder im Bau bischofskirchlicher Zentren kommt man an dieser Stelle derzeit nicht weiter. Einerseits gibt es auch im 8. Jahrhundert Kirchen dieser Größenordnung, wie etwa in St-Denis bei Paris, andererseits sind auch Szenarien vorstellbar, in
34 R i s t o w (wie Anm. 29), S. 70 Abb. 37; vgl. auch zum Anschluss von drei Böden an die westliche Schwelle der Bauten 1–3a/b, ebd., S. 258, Nr. B822.
35 B a c k (wie Anm. 33), S. 19, Abb. 6.36 Vgl. R i s t o w (wie Anm. 29), S. 57 Abb. 28.37 B a c k (wie Anm. 33), S. 20 f. Abb. 7–10.
Sebastian Ristow12
denen ein Teil eines Bischofskirchenensembles etwa als Bischofspalast38, Wohn-bereiche für Kleriker o. Ä. in älteren Bebauungsresten installiert wurde. Schließ-lich ist die ringförmige Architektur ein Solitär und tritt außer 30 Jahre später auf dem Klosterplan von St. Gallen sonst nicht auf. Zu diesen Fragen wäre eine Ta-gung mit den maßgeblichen Fachleuten auf dem Gebiet der karolingerzeitlichen Architektur sinnvoll, damit der nächste Schritt zur Klärung der Problematik der Grabungsergebnisse unter dem Kölner Dom getan werden kann.
Interpretations- und Datierungsprobleme am unteren Niederrhein und im Maasgebiet
Das Gebiet nördlich von Köln scheint erst relativ spät durch das Christentum erreicht worden zu sein. Nur wenige Funde mit persönlichem Charakter, wie das Glaskästchen von Neuss oder die Haarspange aus Nijmegen erweisen die Anwe-senheit einzelner Christen am unteren Niederrhein in der spätrömischen Zeit39. Der kleine Grabbau, den der Ausgräber Hugo Borger in den 1960er Jahren als spätantik publiziert hatte, um die Kultkontinuität für St. Quirinus in Neuss bis in diese Zeit postulieren zu können, hat sich nach der erst kürzlich abgeschlossenen Bearbeitung der Grabungsbefunde und -funde durch Tanja Potthoff als karolin-gerzeitlich erwiesen40. Erst mit dem 7. Jahrhundert steigen die Wahrscheinlich-keiten für christliche Funde und Architektur an, auch wenn archäologische Indi-zien rar gesät sind41.
Nach Westen scheint sich die in Bezug auf Frühchristliches fundarme Region bis nach Aachen hinzuziehen. Dort hat aber die Aufarbeitung der letzten Jahre zu den Grabungen von Dom und Pfalz und damit in Verbindung stehenden Bodenuntersuchungen immerhin einen neuen Fund erbracht, der nun der frü-heste Beleg für christliche Motive auf Alltagsgegenständen aus Aachen ist. Die bisher in diesem Zusammenhang angeführten Grabinschriften sind entweder nicht gesichert christlich oder erst später zu datieren.
38 So schlägt B a c k als alternative Deutung vor: ebd., S. 37 f.39 Zu allen Funden vgl. R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), im Katalogteil
unter den Ortsnamen.40 Tanja P o t t h o f f , Neues zur Archäologie und Geschichte von St. Quirin – Bericht über das
Kolloquium „St. Quirinus in Neuss – Aktuelle Forschungen“ (Novaesium) Neuss 2011, S. 235–240; d i e s ., Capella statt Cella? – Neue Forschungen zu St. Quirinus, in: Jürgen K u n o w (Hrsg.), 25 Jah-re Archäologie im Rheinland 1987–2011, Stuttgart 2012, S. 153–155. – Weshalb Borger den Bau als spätantik ansehen wollte, bleibt rätselhaft. Grabungstechnisch ist die mittelalterliche Einordnung des Befundes leicht zu erkennen und durch Potthoff jetzt eindeutig nachvollziehbar erwiesen.
41 Für den Raum Krefeld wurden jüngst – wenige, schwach belegte – Hinweise auf mögliche frühchristliche Ursprünge im 7. Jahrhundert zusammengetragen: Christoph R e i c h m a n n , Die Anfänge des Kirchenbaus im Umfeld des fränkischen Fürstensitzes von Krefeld-Gellep, in: Titus A. S. M. P a n h u y s e n (Hrsg.), Transformations in North-Western Europe (AD 300–1000). Procee-dings of the 60th Sachsensymposion 19.–23. September in Maastricht (Neue Studien zur Sachsenfor-schung 3), Hannover 2011, S. 101–118.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 13
Aus der Verfüllung eines spätantiken Grabens südlich des heutigen Aachener Rathauses, das Ursprünge in der Karolingerzeit besitzt und wohl einer spätanti-ken Befestigung folgt, stammt eine Scherbe von Argonnen-TS mit christlichen Motiven in seiner Rollstempelverzierung42. Die Scherbe ist in das zweite Viertel des 5. Jahrhunderts zu datieren. Ihre Verzierung mit den kleinen Rollstempelfel-dern mit Traube, Christogrammkreuz, Kelch und Taube erweist natürlich keine christliche Gemeinde in Aachen im 5. Jahrhundert, belegt aber sehr wohl, dass hochpreisige Keramik mit christlichen Motiven so verhältnismäßig spät noch – sicherlich nach römischer Kultur lebende – Abnehmerkreise in Aachen fand. Nach Köln oder an den Niederrhein gelangten diese Produkte aus den Ardennen nicht mehr, sei es, weil die Wege dorthin zu gefährlich geworden waren, sei es, weil es dort keine Kunden gab, die solcherart verzierte TS nachfragten. Ab dem 6./7. Jahrhundert zeigen dann Grabinschriften, spätestens ab dem 8. Jahrhundert die historischen Quellen und die Baubefunde der vorkarolingischen Zeit, dass das Christentum wieder in Aachen Fuß gefasst hatte43. Aus der Zeit vor Karl dem Großen lassen sich vor allem Gräber und Funde von Grabinventar anführen. Neben einem Baumsarg des 8. Jahrhunderts in der Nordwestecke des Atriums sind im Gelände des Dombaus außer spätantiken Körpergräbern und den Reli-quien- und Königsbestattungen der ottonischen Zeit (Abb. 2) vor allem ein sil-bernes Ohrringfragment des späten 7. oder 8. Jahrhunderts (FrankenAG Stufe 9/1044) und eine gleicharmige Fibel des 8. oder 9. Jahrhunderts zu erwähnen45. Ab der endenden Merowingerzeit ist das Gelände am Aachener Dom also als Friedhof genutzt worden.
Vielleicht schon ab dieser Zeit, also dem zweiten Viertel des 8. Jahrhunderts, ist mit der Anwesenheit der letzten Merowingerherrscher in Aachen zu rechnen. So erwähnt die allerdings erst in einer Abschrift des 11. Jahrhunderts überlieferte Legende der Hl. Deodat und Hidulf den Merowingerkönig Childerich den Jün-geren in Aachen46. Auf sichererem Fundament steht die Überlieferung zum Auf-
42 Sebastian R i s t o w , Ältester frühchristlicher Fund aus Aachen. Eine spätantike Sigillata-scherbe mit christlicher Symbolik vom Katschhof, in: Jahrbuch für Antike und Christentum 54 (2011), S. 142–145.
43 Zur Aufarbeitung der Grabungen zwischen Dom und Rathaus in Aachen und zu den Bauten aus der Zeit vor Karl dem Großen: Sebastian R i s t o w , Die Pfalz in Aachen. Nicht nur Karls Werk, in: Archäologie in Deutschland 6 (2012), S. 6–7; D e r s ., Alles Karl? Zum Problem der Bauphasenabfolge der Pfalzanlage Aachen, in: Orte der Macht, Ausstellungskat. Aachen 2014, in Vorbereitung.
44 Ulrike M ü s s e m e i e r , Elke N i e v e l e r , Ruth P l u m , Heike P ö p p e l m a n n , Chronologie der merowingerzeitlichen Grabfunde vom linken Niederrhein bis zur nördlichen Eifel (Materialien zur Bodendenkmalpfl ege im Rheinland 15), Köln 2003.
45 Beide mit abweichender Datierung erwähnt in: Andreas S c h a u b , Gedanken zur Siedlungs-kontinuität in Aachen zwischen römischer und karolingischer Zeit, in: Bonner Jahrbücher 208 (2010), S. 161–172. – Zur Fibel vgl. Stefan T h ö r l e , Gleicharmige Fibeln des frühen Mittelalters (Univer-sitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 81), Bonn 2001, hier Gruppe XII A I (Typ Dom-burg u. Varianten).
46 Acta Sanctorum 4, S. 727, S. 735; vgl. Walter K a e m m e r e r , Aachener Quellentexte (Veröffent-lichungen des Stadtarchivs Aachen 1), Aachen 1980, S. 16 f.
Sebastian Ristow14
Abb. 2: Phasenplan auf dem Stand von April 2013 zu den Befunden aus der Zeit Karls des Großen und der Gräber im Gelände zwischen Dom und Rathaus in Aachen. –
Plan: Sebastian Ristow/Alexander Kobe (unter Verwendung von älteren Plangrundlagen und neuen Aufmaßen von: Gesellschaft für Bildverarbeitungen, Mülheim, Dombauleitung Aachen,
Judith Ley, Tanja Kohlberger-Schaub, Daniel Lohmann, Jan Richarz, SKArchaeoconsult, Stadtarchäologie Aachen, Marc Wietheger). – Grafik: Alexander Kobe/Sebastian Ristow.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 15
enthalt Pippins d. J., der 765 Weihnachten und am 6. April 766 in Aachen das Osterfest beging47. Spätestens zu diesem Datum müssen Bauten vorhanden ge-wesen sein, die einen adäquaten Ablauf einer königlichen kirchlichen Feier die-ser Art ermöglichten.
Die Pfahlgründung des Oktogons der Marienkirche ist im Jahr 2009 durch eine dendrochronologische Datierung auf 798 ± 5 festgelegt worden48. In den Jahren 2003 und 2004 sind Reste eines hölzernen Ringankers der Marienkirche aus einer Höhe von 25,90 m auf 803 ± 10 datiert worden. Die Marienkirche Karls des Gro-ßen entstand also ab oder kurz nach 793 und war bis spätestens 813 in nennens-wertem Maß vollendet. Zwischen diesen beiden Daten wurde der Bau durch ein Erdbeben erschüttert, das sich anhand von Bodenverflüssigung in den Schichten der Zeit um 800 nachweisen lässt49. Eine gelegentlich für das Jahr 794 herangezo-gene Münze hat sich nach Sichtung der Grabungsdokumentation als Streufund erwiesen; ferner kann sie zwischen 793 und 813 für Karl den Großen oder zwi-schen 840 und 865 für Karl den Kahlen geprägt worden sein, zu klären ist dies nur mittels einer Materialanalyse.
Für die übrigen Bestandteile der Kernpfalz fehlen solch genaue Anhaltspunkte um die Gebäude der Zeit Karls des Großen zu datieren. Lediglich für den Gra-nusturm gibt es drei dendrochronologische Daten aus der Erbauungszeit, bisher zwischen 777 und 801 ± 8 datiert50. Die beiden älteren Hölzer mit den Proben-nummern 6 und 7 ergeben nach den revidierten Analysen des Trierer Labors eine Fällungs- und Verarbeitungszeit des Holzes nach 800, Probe 3 sogar erst nach 81551. Zwei der Proben stammen aus 14 m Höhe. Während der Baubeginn von Granusturm, Aula und Verbindungsgang nicht genau bestimmt werden kann, hatte man also ab oder nach 800 bereits mindestens 14 m Bauhöhe erreicht. Dass Karl der Große die Fertigstellung des Turmes nicht mehr erlebt hat, legt die spä-ter zu datierende Probe 3 nahe. Natürlich schließt dies nicht aus, dass die unteren Partien des Turms, die Aula und der südlich gelegene nördliche Abschnitt des Verbindungsgangs zu Zeiten Karls nicht nutzbar gewesen wären.
47 Annales Laurissenses, bearb. von Georg H. P e r t z , in: Monumenta Germaniae Historica. Scrip-tores 1, Hannover 1826, S. 124–218, hier ad a. 765, S. 145; Ann. regn. Franc. zum Jahre 765, bearb. von Georg H . P e r t z , Friedrich K u r z e (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germani-carum 6), Hannover 1895, S. 22f.; vgl. K a e m m e r e r (wie Anm. 39), S. 16 f.
48 Helmut M a i n t z , Dendrochronologische Datierung Holzringanker. Oktogonkuppel und Fundamentholz Oktogonpfeiler Nr. 7, in: Schriftenreihe des Karlsverein-Dombauverein 13 (2011), S. 93–100, hier S. 96 f.
49 Andreas S c h a u b , Zum Baubeginn der karolingischen Marienkirche Karls des Großen in Aachen, in: Thomas O t t e n u. a. (Hrsg.), Fundgeschichten – Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Ausstellungskat. Köln (Schriften zur Bodendenkmalpfl ege in Nordrhein-Westfalen 9), Mainz 2010, S. 207–209.
50 Ernst H o l l s t e i n , Mitteleuropäische Eichenchronologie. Trierer dendrochronologische For-schungen zur Archäologie und Kunstgeschichte (Trierer Grabungen und Forschungen 11), Mainz 1980, S. 44, Proben 7, 3 und 6.
51 So die vorab erteilte Auskunft der Bearbeiterin Mechthild Neyses-Eiden aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier.
Sebastian Ristow16
Dass es auch in der Zeit nach Karl dem Großen Baumaßnahmen und substan-zielle Veränderungen der Kernpfalz gegeben haben muss, erweisen die AMS-Datierungen der Buchenpfähle, die als Gründung des Mittelbaus gedient hatten. Eine Untersuchung der 2012 geborgenen Pfähle ergab eine wahrscheinliche Datierung zwischen 859 und 90352. Damit ist die schon 2005 durch Wolfram Giertz erarbeitete Ansetzung des Mittelbaus in die zweite Hälfte des 9. Jahrhun-derts bestätigt worden53.
Für die Interpretation der älteren Bauten von Bedeutung ist ein Altarfunda-ment in unmittelbarer Nähe zum Altar der Marienkirche Karls des Großen, die-sem jedoch eindeutig chronologisch vorausgehend (Abb. 2). Von seiner Ausrich-tung her gehört es nicht in den Kontext der römischen bzw. spätantiken Baureste und auch noch nicht zu denen aus der Zeit Karls des Großen und späterer Perio-den. Vielleicht stand es in Zusammenhang mit einem kleinen Zentralbau südlich der ebenfalls aus der Zeit vor Karl dem Großen stammenden Nordbasilika von Aachen. Ein Rundbau mit mindestens einer Apsidiole aus der Karolingerzeit konnte erst kürzlich in Bonn ausgegraben werden54 (Abb. 3).
In Tongeren ist durch neue Grabungsbefunde die Siedlungskontinuität zwi-schen dem 4. und 6. Jahrhundert wenigstens außerhalb der Kirchenarchitektur zunehmend erkannt55, Ähnliches gilt für Maastricht56. Aufarbeitungen bedeuten-der Befunde fehlen hier aber noch. Nachdem nun wichtige frühmittelalterliche Gräberfelder vorgelegt sind, steht vor allem die Bearbeitung der maßgeblichen Grabungen unter und um St. Servatius aus57. Bisher wurden hier in Vorberichten
52 Analyse: Janet Rethemeyer, Institut für Geologie und Mineralogie der Universität Köln, die dendrochronologischen Daten bearbeitet derzeit Thomas Frank.
53 Wolfram G i e r t z , Zur Archäologie von Pfalz, vicus und Töpferbezirk Franzstraße in Aachen. Notbergungen und Untersuchungen der Jahre 2003 bis 2005, in: Zeitschrift des Aachener Geschichts-vereins 107/8 (2005/6), S. 7–89, hier S. 69 f.
54 Gary W h i t e , Erste Ergebnisse der Ausgrabungen am Bonner Brassertufer, in: Archäologie im Rheinland (2010), S. 185–187.
55 Alain V a n d e r h o e v e n , Changing urban topography in late Roman and early medieval Ton-geren, in: P a n h u y s e n (Hrsg.), Transformations (wie Anm. 34), S. 128–138.
56 Zusammenfassend: Frans T h e u w s , Where is the 8th century in the towns of the Meuse valley?, in: Joachim H e n n i n g (Hrsg.), Post Roman Towns, Trade and settlement in Europe and Byzantium (Millenium Studien zu Kultur und Geschichte des 1. Jahrtausends n. Chr. 5,1), Berlin 2007, S. 153–164, bes. S. 158–160. – Generell erweist sich im Rhein-Maas-Gebiet fehlende Kontinuität zunehmend nicht als Überlieferungslücke, sondern scheint auf bisher nicht erkannten oder bearbeiteten Funden des 5. Jahrhunderts zu beruhen, so etwa jüngst erbracht für Worms: Mathilde G r ü n e w a l d mit Beitr. v. Lothar B a k k e r u.a., Unter dem Pfl aster von Worms. Archäologie in der Stadt, Lindenberg im Allgäu 2012.
57 Zu den Gräberfeldern: Mareike K a r s , A Cultural Perspective on Merowingian Burial Chrono-logy and the Grave Goods from the Vrijthof and Pandhof Cemeteries in Maastricht. Phil.-Diss. Ams-terdam 2011. – Generell: Frans T h e u w s , Maastricht as a centre of power in the early middle ages, in: D e r s ., Mayke d e J o n g , Carine v a n R h i j n (Hrsg.), Topographies of Power in the Early Middle Ages (Transformation of the Roman World 6), Leiden 2001, S. 155–216; zu Servatius zuletzt mit einer
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 17
historische und archäologische Quellen unzulässig vermischt, sodass der Befund derzeit nicht beurteilt werden kann. Eine gelegentlich angenommene spätantike Kirche im Inneren der Befestigung von Maastricht, etwa in den horrea, lässt sich nicht aus den Befunden herauslesen. Überhaupt erweisen sich die so genannten Kastellkirchen, wie sie auch für Alzey, Bad Kreuznach und andere Orte rekonst-ruiert wurden, als für die spätantiken Phasen dieser Befestigungen nicht beleg-bare Annahmen58.
Interpretationsfragen zu frühchristlichen Funden und Befunden der Merowinger- und Karolingerzeit im Rheinland
Immer wieder kommt es bei der inhaltlichen Bewertung von Funden und Be-funden zu unterschiedlichen Auslegungen, je nach zeitlichem Kontext, in dem die Bewertung steht, und je nach den Sachzeugnissen unterstelltem Hintergrund. Während in der Spätantike christliche Verzierungen von Alltagsgegenständen
Chronologie, die nicht durch Funde belegt wird, und einer Frühdatierung der bisher für karolinger-zeitlich gehaltenen Bauphase: Titus A. S. M. P a n h u y s e n , Wendepunkte in der Frühgeschichte der Maastrichter Servatiusabtei, in: D e r s . (Hrsg.), Transformations (wie Anm. 34), S. 67–89.
58 Zu der Problematik: R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4), bes. S. 248, 251; Roland P r i e n , Spätantikes Christentum in den Nordwestprovinzen – Eine kritische Bestandsauf-nahme, in: K r o h n , R i s t o w (Hrsg.), Wechsel (wie Anm. 2), S. 27–67.
Abb. 3: Rekonstruktion der kleinen karolingerzeitlichen Rundkirche aus Bonn. – Bild: Gary White und Victor Chaw.
Sebastian Ristow18
leicht verständliche Bildthemen oder Beschriftungen zum Inhalt hatten, wurden solche Motive in der Merowingerzeit nicht mehr in diesem Maße nachgefragt – vielleicht auch nicht mehr verstanden. Bibelszenen und selbst Christogramme oder Ähnliches stellen unter den frühchristlichen Funden aus dem Rheinland ab dem 6. Jahrhundert eine Seltenheit dar. Dies, obwohl seit dieser Zeit bereits der Prozess einer christlichen Institutionalisierung eingesetzt hat, gekennzeichnet durch ein flächig wirksames Kirchenbauprogramm und durch entsprechende Aktivitäten der merowingischen Könige. Damit ist anzunehmen, dass zumindest die Oberschicht sich weitgehend dem christlichen Glauben zurechnete. Dennoch findet sich auch in deren Gräbern nur höchst selten christliches Bild-, Schrift- und Symbolgut. Inwieweit auch andere Glaubensvorstellungen noch gesellschaftlich relevant waren, kann nur selten aus den Funden abgeleitet werden. Je nach kulturgeschichtlichem Hintergrund der Bearbeiter ist z. B. die Stele von Königs-winter-Niederdollendorf in germanische, christliche oder sogar koptische Ver-wandtschaft gerückt worden59. Tatsächlich fehlen bei den Reliefs der Stele alle Möglichkeiten, diese unter Heranziehung eindeutig vergleichbarer Schrift- oder Bildzeugnisse gesichert als christlich oder nichtchristlich-germanisch zu qualifi-zieren60. Vielmehr scheinen die Reliefs allgemein symbolhaft den Sieg des Guten über das Böse zu thematisieren. Sie könnten, genauso wie es möglich ist, dass sie ikonografisch aus unterschiedlichen Quellen gespeist sind, auch unterschied-liche inhaltliche Ebenen transportieren. Moderne Einordnungen vermögen in diesem Fall dem Fund des 7. Jahrhunderts nicht zu genügen.
Neben den Interpretationsfragen zu Funden stehen auch bei der Architektur Fragen nach der Funktionsdeutung und der Kontinuität immer wieder im Fokus. Christliche Funktionen von Bauten werden oft auch heute noch regressiv er-schlossen. So wurde versucht, in einem römischen Holzkellerbefund hinter einer ,villa suburbana‘ im Südwesten des römischen Köln ein Baptisterium zu sehen, weil in der Karolingerzeit dort ein Zentralbau errichtet worden war61. Um diese Behauptung zu stützen, wurde gar der gesamte Villenbefund als frühe Kirche gedeutet und eine kontinuierliche Entwicklung bis hin zur ottonenzeitlichen Stiftskirche St. Pantaleon postuliert. Die Befunde können so jedoch weder datiert noch gedeutet werden62. Vielmehr ist im 7. Jahrhundert anstelle der Ruinen der
59 Zuletzt mit vehement christlicher Ausdeutung: Jochen G i e s l e r , Der Griff nach der Ewigkeit. Zur Interpretation der Stele von Niederdollendorf (1), in: Berichte aus dem Rheinischen Landes-museum Bonn 4 (2006), S. 81–91 und Ulrike G i e s l e r , Landelinus fi cit Numen. Zur Interpretation der Stele von Niederdollendorf (2), in: Ebd., 1 (2007), S. 1–13.
60 Sebastian R i s t o w , Persönliche Glaubenshaltungen in der Archäologie – Problemfälle aus Spätantike und Frühmittelalter, in: Hephaistos – Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Archäologie und angrenzender Gebiete 28 (2011), S. 167–183.
61 Sven S c h ü t t e , Geschichte und Baugeschichte der Kirche St. Pantaleon, in: Colonia Romanica 21 (2006), S. 81–136.
62 Sebastian R i s t o w , Ausgrabungen von St. Pantaleon in Köln. Archäologie und Geschichte von römischer bis in karolingisch-ottonische Zeit (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beihefte 21), Bonn 2009, zgl. Habilitationsschr. Univ. Köln 2008.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 19
römischen ,villa‘ und unter Nutzung von deren Bausubstanz ein Saalbau mit eingezogenem Rechteckschluss entstanden, in dem gut ausgestattete Gräber der Kölner Elite dieser Zeit ihren Platz fanden. Erst im Laufe der Baugeschichte ent-wickelte sich, spätestens im 9. Jahrhundert, aus diesem Grab- und Memorialbau die Kirche, aus der später das berühmte Stift St. Pantaleon hervorging. Zwischen den römischen und der frühmittelalterlichen Bausubstanz besteht also weder eine bauliche noch eine funktionale Kontinuität63.
Ganz ähnlich lagen die Probleme bei den Interpretationsfragen zu Befunden in Bonn und Boppard. Während sich in Bonn überwiegend die Erkenntnis durch-gesetzt hat, dass die römische cella memoriae archäologisch nichts mit dem mero-wingerzeitlichen Saalbau zu tun hat, insofern sie bereits lange eingeebnet und abgedeckt war, als letzterer gebaut wurde, wird die quellenkritisch einwandfreie Befundansprache des Grab- und Memorialbaus, der in den 1930er Jahren unter dem Chor des romanischen Bonner Münsters gefunden wurde, meist nicht ange-wandt. Bis in jüngste Zeit wird der Saalbau als „Kirche“ tituliert64, obwohl dazu alle erkennbaren baulichen Merkmale fehlen. Historische Konstrukte bemühen hier sogar wiederum die cella memoriae mit der doppelten Mensaanlage, deren Zweizahl angeblich in Verbindung mit Cassius und Florentius stehen solle65. Tatsächlich muss die Frage erlaubt sein, ob die historisch gegen Ende des 7. Jahr-hunderts überlieferte Kirche für Cassius und Florentius bisher überhaupt ent-deckt ist, oder ob sie nicht vielleicht noch z. B. unter dem Hauptraum des Müns-ters gefunden werden könnte66. Auch in der jüngsten Zusammenfassung zum Thema wird versäumt, explizit darauf hinzuweisen, dass es nicht möglich ist, die historische Quelle von der basilica für Cassius und Florentius auf den archäolo-gisch bekannten Befund des Saalbaus zu beziehen67. Diese methodisch notwen-dige Trennung zu ziehen fällt in Bonn aufgrund der relativ gegebenen örtlichen Nähe zwischen Befund und Überlieferungstradition schwerer als beim oben besprochenen Kölner conventiculum. Bevor der gesamte Münsterbereich jedoch nicht ergraben ist, wird man um eine neutrale Funktionsansprache nicht herum-kommen.
63 Dennoch sprechen S c h ü t t e , G e c h t e r (wie Anm. 3), S. 89 merkwürdigerweise von der „Weglassung einer entscheidenden Bauphase“. Was damit gemeint ist, bleibt unklar. Offensichtlich wird von Schütte und Gechter eine Kontinuität gewünscht, sie kann jedoch am Befund nicht belegt werden.
64 Zuletzt von Dietrich H ö r o l d t , in: H ö r o l d t , K e l l e r , M ü s s e m e i e r (wie Anm. 7), S. 59, der von „Grabkirche“ anstatt von Grabbau spricht.
65 Ebd., S. 32 und 59.66 Sebastian R i s t o w , Liturgie wo und wann? Zur Deutung der frühen Architekturbefunde unter
dem Bonner Münster, in: Andreas O d e n t h a l , Albert G e r h a r d s (Hrsg.), Märtyrergrab – Kirchen-raum – Gottesdienst II. Interdisziplinäre Studien zum Bonner Cassiusstift (Studien zur Kölner Kir-chengeschichte 36), Siegburg 2008, S. 13–31.
67 H ö r o l d t , K e l l e r , M ü s s e m e i e r (wie Anm. 7), S. 32 f. mit der Vermutung, dass die Ver-ehrung von Cassius und Florentius schon vor der Überlieferung von 691/92 in einer „Kirche“ statt-gefunden habe, und dem implizierten Bezug auf Saalbau D und seine Erweiterungsphasen.
Sebastian Ristow20
Auch für die Kirche St. Severus in Boppard wurde früher eine direkte Kon-tinuität angenommen. Es scheint jedoch hier durch die spezielle Bauform des schlüssellochförmigen Ambounterbaus und des Taufbeckens mit einschwingen-den Seiten und Vorsätzen für Ziboriumsstützen, schon ohne dass die Funde der Grabung vorgelegt worden wären, eine Datierung in die zweite Hälfte des
Abb. 4: Beckenwandung von Boppard mit der erneuerten und verkleinerten Innenfassung des Beckens. – Bild: Sebastian Ristow.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 21
6. Jahrhunderts wahrscheinlicher zu sein. Dies legen die Vergleiche für solche kirchliche Innenarchitektur in Köln und Trier nahe. Dass das Bopparder Tauf-becken lange genutzt worden ist und vielleicht bis in die Zeit der beginnenden Kindertaufe seinen Dienst versehen haben könnte, belegt die Beckenverkleine-rung, kenntlich an dem gespitzten Oberputz der ältesten Beckenwandung, in den mindestens eine verkleinerte Fassung eingezogen wurde (Abb. 4). So er-scheinen nicht nur der Anfang des Bopparder frühchristlichen Kirchenbaus, sondern auch seine letzte Phase und der Übergang zu den hochmittelalterlichen Bauten im Moment noch untersuchungsbedürftig. Die Aufarbeitung der Gra-bungen und Funde von Boppard aus den 1960er Jahren ist eines der spannends-ten Desiderate der frühchristlichen Kirchenarchäologie Deutschlands, das in den kommenden Jahren hoffentlich geschlossen werden kann.
Ergebnis
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den frühchristlichen Kirchenbau-ten an unterer Maas und Mosel sowie am Ober- bis Niederrhein (Tab. 1). Nicht genannt sind hier Orte mit sehr unsicheren Indizien für einen kirchlichen Vor-gängerbau wie Remagen, dessen Schrankenfragmente auch zu anderen christ-lichen Gebäuden gehört haben könnten, oder St. Michael in Köln-Zündorf. Das hier vorhandene Fragment christlicher Bauausstattung stammt zwar mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Schrankenpfosten oder einer Altar- oder Ambo-konstruktion der Zeit um 800. Es könnte aber auch sekundär verbracht worden sein68.
Abschließend sei der Blick noch kurz auf einige frühchristliche Neufunde ge-richtet, die in der Zusammenstellung von 2007 noch nicht berücksichtigt werden konnten69. So wurde im luxemburgischen Moersdorf-Sartdorf ein spätantiker Ziegel mit Christogrammverzierung geborgen70. Er stammt aus den Fundzusam-menhängen einer antiken ,villa‘ und ist demnach nicht wie wohl die gestempel-ten Ziegel des Bischofs Arbogast von Straßburg zwingend vor kirchlichem Hin-tergrund zu sehen71. Der Fundort der frühchristlichen Schranke von Wasserbil-
68 Sebastian R i s t o w , Neues zu St. Michael in Zündorf, in: Rechtsrheinisches Köln 38/39 (2012/2013), S. 11-17.
69 R i s t o w , Frühes Christentum im Rheinland (wie Anm. 4). – Hingewiesen werden soll andieser Stelle auch auf die Zweifel zur Echtheit des so genannten Brotstempels von Alzey: MathildeG r ü n e w a l d , Der vermeintliche frühchristliche Brotstempel aus Alzey, in: Patrick J u n g , Nina S c h ü c k e r (Hrsg.), Utere felix vivas. Festschrift für Jürgen Oldenstein (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 208), Bonn 2012, S. 71–75.
70 Jean K r i e r , Ein frühchristlicher Ziegelstempel aus der römischen Villa von Moersdorf-„Sartdorf“, in: Empreintes 3 (2010), S. 80–93, hier S. 86–93. – Für den Hinweis auf eine noch nicht publizierte neue spätantike Argonnen-TS, verziert mit christlicher Motivik aus der römischen Villa von Schieren-‘Wieschen‘ danke ich Jean Krier/Luxemburg.
71 Zur Problematik des Arbogast von Straßburg und der Entstehung der Kirche St-Etienne: K u h n l e , R i s t o w (wie Anm. 12).
Sebastian Ristow22
lig, der auf die Existenz einer Kirche schließen lässt, ist aber gerade 4 km von Moersdorf entfernt. Vielleicht wird sich die Baustelle einer zu diesen Funden passenden spätantiken Kirche irgendwo an der Sauer zwischen Wasserbillig und Moersdorf befunden haben. Die christlich verzierte Argonnen-TS aus Aachen ist bereits oben besprochen worden. Bei St. Gereon in Köln konnte die spätantike christogrammverzierte Grabinschrift für den Knaben Vitus geborgen werden72. Aus Andernach stammt ein merowingerzeitlicher Grabstein mit Stabkreuz, wohl aus dem 7. Jahrhundert. Weitere Grabsteine und Schmuck mit Christogrammen und anderen christlichen Verzierungen sind von der unteren Mosel bekannt ge-worden73. Die Geschichte des frühen Christentums wird also fortzuschreiben sein. Dabei sollte aber trotz aller Begeisterung für das Thema nie die quellenkri-tische Arbeitsweise vernachlässigt werden und immer zuerst die archäologi-schen Quellen für sich genommen geklärt werden, ehe die historische Überliefe-rung hinzugezogen wird.
72 <http://gerling-quartier.com/media/infoletter/2012-april-en/page7.html#/6> [23.9.2012]; Publikation in Vorbereitung durch Marcus T r i e r .
73 Axel von B e r g , Sebastian R i s t o w in Vorbereitung.
Forschungsstand und Forschungsstandpunkte zu den Anfängen der christlichen Religion 23
Kirchen im Rhein-Maas-Gebiet mit archäologisch bekannten frühchristlichen Bauphasen
Profaner bzw. nichtchristlicher Vorgänger oder Grabbau oder nicht sicher als christlich bestimmbar
Ort Älteste Bauphase
Als Kirche erkennbar ab
Älteste schriftliche Erwähnung einer Kirche
Christentum gesichert im Ort anzunehmen nach Funden oder historischen Quellen ab
Tongeren spätantik 6. Jh. hochmittel-alterlich
4. Jh. (?)
Maastricht spätantik 6./7. Jh. 6. Jh. 6. Jh.
Xanten spätantik 6. Jh. 6. Jh. 6. Jh.
Köln (Ursula) spätantik 6. Jh. 6. Jh. 4. Jh.
Köln (Gereon) spätantik (?) 6. Jh. 4. Jh.
Köln (Dom) spätantik 6. Jh. 6. Jh. 4. Jh.
Köln (Kolumba)
antik (?) hochmittel-alterlich
4. Jh.
Köln (Cäcilien) antik (?) hochmittel-alterlich
4. Jh.
Köln (Groß St. Martin)
antik 10. Jh. 10. Jh. 4. Jh.
Köln (St. Mariaim Kapitol)
antik 7./8. Jh. hochmittel-alterlich
4. Jh.
Köln (St. Pantaleon)
antik 9. Jh. 9. Jh. 4. Jh.
Köln (St. Severin)
spätantik 7. Jh. (?) hochmittel-alterlich
4. Jh.
Bonn (Münster) spätantik 6. Jh. 7. Jh. 4. Jh.
Bonn (Dietkirche) (?)
antik (?) 8. Jh. 4. Jh.
Koblenz (St. Kastor)
antik 9. Jh. 9. Jh. (?)
Trier(Dom/Liebfrauen)
antik 4. Jh. 4. Jh. 4. Jh.
Trier (St. Maximin)
spätantik 4./5. Jh. 6. Jh. 4. Jh.
Trier (St. Matthias)
spätantik (?) 6. Jh. 4. Jh.
Diekirch spätantik 7. Jh. (?) hochmittel-alterlich
merowingerzeitlich
Arlon spätantik merowinger-zeitlich (?)
hochmittel-alterlich
merowingerzeitlich
Boppard spätantik 6. Jh. hochmittel-alterlich
spätantik
Mainz (St. Alban)
(?) spätantik/merowinger-zeitlich (?)
8. Jh. 4. Jh.
Sebastian Ristow24
Utrecht (?) (?) 7. Jh. 7. Jh.
Lüttich 8. Jh. 8. Jh. 8. Jh. spätmerowingerzeitlich
Stablo (Stavelot) spätmero-wingerzeitlich
7. Jh. 7. Jh. 7. Jh.
Amay 7. Jh. 7. Jh. 7. Jh. 7. Jh.
Aachen spätmero-wingerzeitlich
8. Jh. (?) 8. Jh. 5./6. Jh.
Inden-Pier spätmero-wingerzeitlich
7./8. Jh. 12. Jh. 7. Jh.
Düren spätmerowin-ger-/frühkaro-lingerzeitlich
8. Jh. hochmittel-alterlich
7./8. Jh.
Neuss karolinger-zeitlich
9. Jh. hochmittel-alterlich
4. Jh.
Köln (Kunibert) merowinger-zeitlich
7. Jh. 7. Jh. 4. Jh.
Mayen merowinger-zeitlich
7. Jh. (?) hochmittel-alterlich
spätantik (?)
Koblenz (Liebfrauen)
merowinger-zeitlich
(?) hochmittel-alterlich
(?)
Kobern-Gondorf merowinger-zeitlich
(?) hochmittel-alterlich
spätantik
Karden(St. Kastor)
(?) (?) hochmittel-alterlich
spätantik
Karden(St. Marien)
(?) (?) hochmittel-alterlich
spätantik
Trier (St. Paulin)
Echternach (Abtei)
s.o.
spätmero-wingerzeitlich
(?)
8. Jh.
hochmittel-alterlichspätmero-wingerzeitlich
4. Jh.
spätmerowingerzeitlich
Ursprungsbau gesichert mit christlich-kirchlicher Nutzung