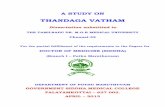Pflanzenreste aus Gruben der keltischen Siedlung am Ohrenberg bei Benzenzimmern, Gde. Kirchheim am...
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pflanzenreste aus Gruben der keltischen Siedlung am Ohrenberg bei Benzenzimmern, Gde. Kirchheim am...
TOBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN I H. 130 I 2004 I s. 287- 30 I I TüBINGEN
RODIGER KRAUSE & KARL-HEINZ PFEFFER (HRSG.)
STUDIEN ZUM ÖKOSYSTEM EINERKELTISCH-ROMISCHEN SIEDLUNGSKAMMER AM NORDLINGER RIES
Pflanzenreste aus Gruben der keltischen Siedlung
am Ohrenberg bei Benzenzimmern, Gde. Kirchheim am Ries, Ostalbkreis 1
von
Manfred Rösch, Hemmenhofen
mit 9 Abbildungen und 2 Tabellen
Aus der Fllllung eines eisenzeitlichen Grubenhauses (Vgl. Abb.5 im Beitrag Krause 2 -
dieser Band) vom Fundplatz Ohrenberg, Gemeinde Kirchheim-Benzenzimmern (Ostalb
kreis) erhielten wir am 14. 7. 1989 zwei Bodenproben zur Untersuchung auf Ptlanzenreste.
Die Grube datiert nach freundlicher Auskunft des Ausgräbers in die Stufe Latene B/C, also
in die Zeit der ausgehenden FrUhlatene- zur Mittellatenezeit (KRAUSE 1990: 112ft). Die
beiden Proben hatten ein Gewicht von 856 bzw. 783 gundein Verdrängungsvolumen von
510 bzw. 480 ml. Da sie aus dem seihen Befund stammten und sich in ihrer Zusammenset
zung nicht voneinander unterschieden, wurden sie in der Auswertung zu einer Probe zu
sammengefaßt. In jüngster Zeit wurden· weitere sechs Proben von diesem Fundplatz al,ls der
Grabungskampagne 1994 (MENZEL, BAUER 1994: 94f) untersucht.
Alle Proben bestanden aus humosem durch Holzkohle dunkel geflirbtem Lehm mit
hohem Gehalt an Sand und Feinkies (Abb. 1).
Daneben konnten geringe Mengen an Molluskenschalen und Knochensplittern re
gistriert werden. Das Material wurde nass gesiebt und zwar Probe I mit einem fllnfteili.gen
Siebsatz, dess~n Maschenweiten zwischen 0,25 und 4 mm lagen. Bei den Proben 2 bis 7
wurde ein Sieb mit 0,5 mm als feinster Maschenweite verwendet.
11m Februar 2000 Oberarbeitete Fassung eines Manuskripts vom Juli 1991
288 TOBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN -BAND 130 BEITRAG ROSCH
• <0,25
II 0,25
[] 0,5
• 1
II 2
• 4
74 102 107 121 122 125 108 Befund-Nr.
Abb. I: Gewichtsanteile der Korngrößenklassen
Durch Wiegen der Siebrückstände ist es möglich, die Körnung des Materials anzugeben2•
Die Körnungscharakteristik entspricht etwa einem sandig - kiesigen Lehmboden. Dabei
sind die Befunde 74 und 102 etwas grobkörniger und 122 am feinkörnigsten.
Die beim Schlämmen in Größenklassen sortierten Pflanzenreste wurden aus den
Siebfraktionen ausgelesen und bestimmt. Das Ergebnis geht aus Tab. 1 (alphabetische Ar
tenliste) hervor.
Alle Proben enthielten ausschließlich verkohlte Pflanzenreste3•
2Für Korngrößen > 0,25 mm. Auf diesen Parametern beruht Abb. 1.
3Bei der Auswertung blieben rezente unverkohlte Diasporen sowie Holzkohlen unberücksichtigt. Bei den unverkohlten Diasporen handelte es sich um gängige Acker- Wildkräuter, die als Bestandteil der rezenten bis subrezenten Diasporenbank des Bodens angesehen werden müssen. Sie können bei der weiteren Betrachtung vernachlässigt werden. Eisenzeitliches Alter ist lediglich filr die verkohlten Pflanzenreste anzunehmen.
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 289 .. Tabelle 1: Alphabetische Artenliste
Kircbheim_Benzenzimmern, Ohrenberg
Ostalbkreis
Siedlung, Ha D/LT 8/C
Pflanzenreste
Lfd. Nr. I
Labor_Nr. I 2 3 4 5 7 6
Flache 8 2030 2031 2031 2229 2032 2030
Befund 74 107 121 122 102 125 108
Fund Nr. 160
Planum 3 4 I 2 5 6 I -2
Datierung FLT FLT FLT FLT FLT LT LT/rom
Gewicht (g) 1639 9172 9744 9142 11502 11760 9312 52959
Volumen (ml) 990 5300 5500 7800 9900 9500 7400 38990
Taxon Organ Anzahl
0. G. verkohlt:
2 I Aphanes arvensis Nüßchen 2 I 3
I I Avena Karyopse I I
3 Carex hirta Innen
I I frucht
10 Carex leporina Innen I I frucht
2 I Bromus cf. secali-Karyopse I I I 3
nus
I 2 Camelina Same I I
I 1 Cerealia indet. Karyopse 7 2 6 4 4 2 5 30
20 Chenopodium Same 3 1 1 5
2 Chenopodium al-Same I 2 2 5 bum
5 Chenopodium glau-
Same 21 I I 23 cum
2 2 Chenopodium hy-Same I I
bridum
2 I Chenopodium poly-Same 4 4
spermum
2 Eragrostis minor Karyopse I I
II Galium aparine Same I 2 3
9 Galium cf. mollogo Same I I
290 ""'<.' TüBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN -BAND 130 BEITRAG RöSCH /
• 2 Galium spurium Same I I I 3 6
I I Hordeum vulgare Karyopse 6 19 I 8 3 4 41
I 3 Lens culinaris Same 2 I I 4
I 2 Linum usitatissi- Same I 1 mum
2 Malva cf. neclecta Same 2 2
9 Medicago lupulina Same I I
20 Panicum/Setaria Karyopse I I
I 2 Papaver somnife- Same 3 3
8 Plantago media Same 1 I
20 Poa Karyopse 1 1
3 Poa annua Karyopse 1 1
9 Poa trivialis Typ Karyopse I I
2 Polygonum convol- Frucht 3 1 I 5 vulus
2 Polygonum persi- Frucht 1 1 caria
I 5 Prunus spinosa Frucht 1 1 stein
20 Ranunculus sect. Frucht I I Ranunculus
16 3 Sium erectum Teilfrucht 1 1
8 Trifolium campestre Same I I
I I Triticum aesti- Karyopse 1 I vum/durum
I I Triticum dicoccum Ährchen 1 1 2
I I Triticum monococ- Ährchen 1 2 3 cum gabel
I I Triticum monococ- Karyopse I I
I I Triticum spelta Karyopse 2 2
I I Triticum spelta Ährchen
I 2 3 lgabel
20 Vicia Same 1 1 2
Summe 23 12 69 7 19 13 27 170
Konzentration 23.2 2.3 12.5 0.9 1.9 1.4 3 .6 3.7
Typenzahl 10 10 15 4 8 10 15 40
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 291 •
Insgesamt wurden I70 Reste von Kulturpflanzen und Wildpflanzen gefunden4 (RÖSCH
I995: 43ft), was einer mittleren Konzentration von 3, 7 Resten je Liter Sediment entspricht.
Das bewegt sich im Rahmen dessen, was bei offenen Fundkomplexen und Siedlungsgra
bungen ohne Feuchtbodenerhaltung zu erwarten ist. Alle Proben bis auf Befund I08 kön
nen nach Auskunft des Ausgräbers ins Frühlatene gestellt werden5. Lediglich bei Befund
I08 liegt eine Vermischung mit römischem Material vor, der sich auch im Pflanzenspekt
rum niederschlägt6• Aufgrund der geringen Fundzahlen werden die Frühlatene-Befunde un
ter Ausschluss von Befund I08 nachfolgend zusammenfassend ausgewertet (vgl. Tab. 2).
Tabelle 2: Verkohlte Pflanzenreste vom Ohrenberg, Kirchheim-Benzenzimmern. Ökologisch geordnet.
Kirchheim-Benzenzimmern, Ohrenberg
Ostalbkreis
Siedlung, Ha D/L T 8/C
Pflanzenreste
Labor Nr. I 2 3 4 5 7 6 Fläche 8 2030 2031 2031 2229 2032 2030 Befund 74 107 121 122 102 125 108 Fund Nr. 160 Planum 3 4 I 2 5 6 I 2 Datierung FLT FLT FLT FLT FLT LT FLT LT /röm
Gewicht (g) 1639 9172 9744 9142 1150 ll760 52959 9312
yolumen (ml) 990 5300 5500 -
7800 9900 9500 138990 7400
4Die aus einem Proben-Gesamtvolumen von ca. I I resultierende Konzentration von 23 Resten je Liter in der reichsten Probe I (Befund 74) ist filr offene Fundkomplexe mit ausschließlich verkohlter Materialerhaltung überdurchschnittlich hoch. Die dennoch vor allem in statistischer Hinsicht unbefriedigende Fundzahl resultiert allein vom zu geringen Probenumfang, der ansonsten standardmäßig bei I 0 Litern liegt.
5Für diese Information danke ich Herrn PD Dr. R. KRAUSE.
6So wurden nur in dieser Probe Dinkel-Körner und einige Grünland-Arten gefunden.
292 . TüBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN - BAND 130 BEITRAG ROSCH~ ~~
Taxon Organ Anzahl
ö. G. verkohlt:
Getreide/
Kllmer
I I Hordeum vulgare Karyopse 6 19 I 8 3 37 4 Mehrzeilige Spelzgerste
I I Cerealia indet. Karyopse 7 2 6 4 4 2 25 5 Getreide
I I Triticum spelta Karyopse 2 Dinkel
I I Avena Karyopse I I Hafer
I I Triticum aesti-Karyopse I I
Nacktwei-vum/durum zen
I I Triticum mono-coccum
Karyopse I I Einkorn
Drusch
I I Triticum mono-
Ährchengabel I 2 3 Einkorn coccum
I I Triticum spelta Ährchengabel I 1 2 Dinkel
I I Triticum dicoccum Ährchengabel I I 2 Emmer
Öl- und Faserpßanzen
I 2 Papaver somnife-rum
Same 3 3 Schlafmohn
I 2 Camelina Same I I Leindotter
I 2 Linum usitatis-Same I I
Gebauter simum Lein
HOlsenfrUchte
I 3 Lens culinaris Same 2 I 3 I Linse
Sammetobst
I 5 Prunus spinosa Fruchtstein I Schlehe
Uogenulzte Wildpßanzenl Ackerunkrluter
bodenvag
2 Galium spurium Same I I I 3 3 Saat-Labkraut
2 Chenopodium Same I 2 3 2
Weißer album Gansefuß
2 Polygon um con-
Frucht 3 I 4 I Winden-
volvulus Knöterich
2 Malva cf. neclecta Same 2 2 wohl Weg_ Malve
2 Eragrostis minor Karyopse I I Kleines Liebesgras
Polygonum persi-Pfirsi-
2 Frucht I chblättr. caria Knöterich
slurehold
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 293 •
2 I Chenopodium
Same 4 4 Vielsamiger
tpolyspermum Gänsefuß
2 I Aphanes arvensis Nüßchen 2 I 3 Acker Frau-enmantel
2 I Bromus cf. secali-
Karyopse I I I 3 wohl Rog-
nus gen Trespe
basenhold
2 2 Chenopodium
Same I 1 Hybrid
hybridum Gänsefuß
Trittfluren
3 Carex hirta Innenfrucht I 1 Raube Seg-ige
3 Poa annua Karyopse I 1 Einjähriges Rispengras
Schlammuferfluren
5 Chenopodium
Same 21 I 22 I Blaugrüner
iglaucum Gänsefuß
Rasen/ Heiden
8 Plantago media Same I Mittlerer Wegerich
8 Trifolium
Same I Feldklee campestre
Galium cf. mol-wohl Wie-
9 lugo
Same I sen-Labkraut
9 Medicago lupulina Same I 1 Hopfenklee
9 Poa trivialis Typ Karyopse I 1 Rispengras
10 Carex leporina Innenfrucht I 1 Hasen-Segge
ruderal
Klet-II Galium aparine Same I 2 3 ten_Labkrau
t
Bachröhricht
16 3 Sium erectum Teilfrucht I 1 Aufrechter Merk
Sonstige
20 Chenopodium Same 3 I 4 I Gänsefuß
20 Vicia Same I I 2 Wicke
20 Panicum/Setaria Karyopse 1 1 Hirse
20 Poa Karyopse 1 1 Rispengras
20 Ranunculus sect.
Frucht 1 1 Hahnenfuß Ranunculus
Su mme 23 12 69 7 19 13 143 27
Konzentration 23.2 2.3 12.5 0.9 1.9 1,4 3.7 3.6
Type_ozahl 10 10 15 4 8 10 34 15
294 ~y
}'DBINGER GEOGRAPHISCHE STilDIEN-BAND 130 BEITRAG ROSCJI
Unter den Kulturpflanzen, die mit 79 Resten, verteilt auf mindestens zehn Arten, mehr als
die Hälfte der Funde ausmachen (Abb. 2)', waren die Getreide, und hier wiederum die Kör
ner am häufigsten (Abb. 3, 4).
160 -
140----
120 - --
100 ---
60
O+ Abundanz Artenzahl
,. Kulturpflanzen Wildpflanzen
Abb. 2: Stück- und Artenzahlen von Kultur- und Wildpflanzen
Hier ist Mehrzeitige Spelzgerste (Hordeum vulgare) mit mehr als 50% klar dominierend
(Abb. 5)7• Von Hafer (Avena), Nacktweizen (Triticum aestivum/durum) und Einkorn (Triti
cum monococcum) wurde jeweils nur ein Korn gefunden, weshalb die wirtschaftliche Be
deutung dieser Arten offen bleiben muss8•
7Berechnung unter Einschluss der nicht näher bestimmbaren Körner. Bei deren Ausschluss stiege der Anteil der Gerste auf über 90%.
8Sie war jedenfalls viel geringer als die der Gerste. Beim Hafer ist zudem ungewiss, ob eine Kulturpflanze oder ein Unkraut vorliegt.
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 295 •
60 +----
40-+----
20
0 +--~ Abundanz Artanzahl i. Getreide 01-/Fasarpllanzan ,. Unsa
Abb. 3: StUck- und Artenzahlen von Kulturpflanzengruppen
80 ,--------------,-------------~
60
• Drusch 40 • Körner
20
0 Abundanz Artenzahl
Abb. 4: StUck- und Artenzahlen von Körnern und Druschresten bei den Getreidefunden
296 TüBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN -BAND 130 BEITRAG ROSCH
Getreide (38,46~.) - · ·
- Met e. ge Spelzgerste (56,92%)
Abb. 5: Mengenanteile der Getreidearten bei den Körnern
Dinkel (16,67%)
Einkorn (50,00%)
Emmer (33,33%) -
Abb. 6: Mengenanteile der Getreidearten beim Drusch
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 297 .. Bei den Druschresten waren die Spelzweizen Einkorn (Triticum monococcum), Emmer
(Triticum dicoccum) und Dinkel (Triticum spelta) durch drei, zwei und eine Ährchengabel
vertreten (Abb. 6).
Als weitere Kulturpflanzen konnten neben der Linse (Lens cu/inaris) die Öl- und
Faserpflanzen Schlafmohn, Gebauter Lein und Leindotter gefunden werden (Abb. 7).
Gebauter Lein (20,00%)--
Leindotter (20,00%)--· Schlafmohn (60,00%)
Abb. 7: Mengenanteile bei den Öl- und Faserpflanzen
Die Wildpflanzen wurden in üblicher Weise in ökologische Gruppen eingeteilt
(Abb. 8l (RÖSCH 1996: 65ft). Sowohl bei der Artenzahl als auch bei der Abundanz
(Stückzahl) bilden Ackerunkräuter die größte Gruppe.
Die ähnlich häufige Gruppe der Schlammufer-Fluren besteht nur aus dem Blaugrü
nen Gänsefuß (Chenopodium glaucum), der allein in Befund 121 mit 21 Samen vertreten ist
und wohl dem Bewuchs nasser Stellen im Siedlungsgelände entstammt. Sowohl die Rasen
gruppe mit Hopfenklee (Medicago lupu/ina), Rispengras (Poa trivialis Typ) und Hasenseg
ge (Carex /eporina) als auch das Kletten-Labkraut (Ga/ium aparine), das nach heutigem
Verbreitungsschwerpunkt als Ruderalpflanze eingestuft wird, dürften mit den Ackerunkräu
9Die Einteilung stimmt mit der von STIKA (Beitrag in diesem Band) verwendeten überein.
298 TüBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN • BAND 130 BEITRAG RöSCH •
II Sonstige
• Bachröhricht
• ruderal
Rasen/Brache
• Schlammuferfluren
• Trittfluren
• Ackerunkräuter
Abb. 8: Stück- und Artenzahlen von ökologischen Gruppen bei den Wildpflanzen
tern zusammen im Getreide gewachsen sein und können als Hinweis auf wenig intensive
Bodenbearbeitung, sowie Brachephasen und Beweidung gelten. Rauhe Segge (Carex hirta)
und Einjähriges Rispengras (Poa annua) wachsen vor allem in Trittfluren, die sowohl im
Siedlungsbereich, als auch in oder am Rand von Äckern zu suchen sind. Außer nicht näher
klassifizierbaren Wildpflanzen wurde weiterhin eine Teilfrucht des Breitblättrigen Merk
(Sium erectum) gefunden, einer Art des Bachröhrichts, die am nahegelegenen Bach östlich
des Fundplatzes gewachsen sein könnte10•
Unter den Ackerunkräutern überwiegen die bodenvagen Arten (Abb. 9). Neben den
früher weit verbreiteten Arten Saat-Labkraut (Galium spurium), Weißer Gänsefuß (Cheno
podium a/bum), Windenknöterich (Polygonum convolvulus), Weg-Malve ((Ma/va nec/ecta)
und Pfirsichblättriger Knöterich (Po/ygonum persicaria) ist hier das Kleine Liebesgras (E
ragrostis minor) zu erwähnen, von dem erst wenige Nachweise aus Eisenzeit und Früh-
'oreilfrüchte des Aufrechten Merk wurden in größerer Menge auch in den Torfen am Fuß des Ohrenbergs gefunden, vgl. H. STIKA, in diesem Band.
PFLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 299 •
20
• 15 basenhold
• &llurehold
10 • bodenvag
5
Artenzahl
Abb. 9: Stück- und Artenzahlen von edaphischen Gruppen bei den Ackerunkräutern
Mittelalter im Land vorliegen. Vielsamiger Gänsefuß (Chenopodium po/yspermum), Acker
Frauenmantel (Aphanes arvensis) und Roggentrespe (Bromus cf. seca/inus) finden sich e
her auf sauren Böden, bevorzugt auf oberflächlich entkalktem Lehm. Alle drei wurden in
Südwestdeutschland in eisenzeitlichem Kontext schon gefunden, der Vielsamige Gänsefuß und die Roggentrespe jedoch mit höherer Stetigkeit als der Acker-Frauenmantel (RÖSCH
1998, 120). Als basenhold unter den Ackerunkräutern kann nur der Hybrid-Gänsefuß be
zeichnet werden. Bei zwei Karyopsen von Hirse (Panicum/Setaria) und von Wildgras (Po
aceae) war keine genauere Artbestimmung mehr möglich. Auch hier könnte es sich um
Vertreter der Acker-Begleitflora handeln. Bei der Hirse ist jedoch eine Kulturhirse nicht
auszuschließen. Das gesamte Ackerunkrautspektrum deutet nicht auf besonders kalk- und
basenreiche Böden hin, sondern auf zumindest oberflächlich entkalkte, etwas versauerte
Lehmböden.
Die Menge des untersuchten Materials und die Zahl der gefundenen Reste ist in kei
ner Weise geeignet, allgemeine wirtschaftsarchäologische Schlüsse abzuleite~. Immerhin kann man feststellen, dass das gefundene Nahrungspflanzenspektrum sich gut in das bisher
von der vorrömischen Eisenzeit bekannte Bild einfilgt (KÖRBER-GROHNE 1981: Abb.
24): In dieser Periode tritt Gerste unter den Getreiden mit der höchsten Stetigkeit auf, ge-
300 TüBINGER GEOGRAPHISCHE STUDIEN -BAND 130 BEITRAG ROSCH,
folgt von Dinkel und den anderen beiden Spelzweizen und von Nacktweizen. Roggen, Hir
sen und Hafer sind dagegen seltener zu finden. Unter den Hülsenfrüchten hat die Linse die
höchste Stetigkeit, gefolgt von Erbse und Ackerbohne.
Hier schließt sich die Frage an, wo in der Umgebung des Fundplatzes die geologi
schen Voraussetzungen für azidophytische Lehmacker-Fluren gegeben wären. Um den
Fundplatz am Ohrenberg stehen Riessee-Ablagerungen, Bunte Brekzie und kleinflächig
kristallines Grundgebirge an, weiter westlich außerhalb des Kraters Brauner und Schwarzer
Jura, unmittelbar südlich und östlich im Krater Löß und Verwitterungslehm
(REICHERTER, 1994). Bei entsprechender oberflächlicher Entkalkung des Verwitterungs
lehms ist dieser für die Entwicklung azidophytischer Lehmackerfluren in der Eisenzeit der
wahrscheinlichste Standort.
Neue botanische Untersuchungen im Oppidum Heidengraben bei Grabenstetten in
einer Umgebung mit ausschließlich basischem Weißjura-Gestein zeigen jedoch gleichfalls
ein starkes Übergewicht acidophytischer Unkräuter was durch Versaurung der alten Ober
böden zu erklären ist, ein Modell, das ohne weiters auf das Ries Obertragbar scheint. Vergl.
M. RöSCH, Eisenzeitliche Pflanzenreste aus dem keltischen Oppidum Heidengraben bei
Grabenstetten KJ:eis Reutlingen. (Materialhefte zur Archäologie in Baden-WOrtlernberg im Druck).
Die verkohlten Diasporen der ökologischen Gruppen Trittfluren, Rasen, Heiden und
Roderalfluren dürften überwiegend ebenfalls Bestandteile der eisenzeitlichen Segetalvege
tation gewesen sein. Sie weisen auf wenig intensive Bodenbearbeitung und periodische
Beweidung hin. Pflanzen der Trittfluren und der Schlammuferfluren, ebenso wie Rude
ralpflanzen könnten jedoch auch auf ungenutztem, mehr oder weniger oft betretenem Of
fenland im Siedlungsbereich gewachsen sein.
Angesichts des vergleichsweise schlechten Forschungsstandes der Archäobotanik
filr die vorrömische Eisenzeit hat man mit diesen Gruben aus Kirchheim-Benzenzimmern
immerhin einen weiteren Fundpunkt, der jedoch keineswegs von der Notwendigkeit ent
hebt, künftig begleitend zu großen eisenzeitlichen Siedlungsgrabungen systematische ar
chäobotanische Untersuchungen größeren Stils durchzuführen.
Literatur:
KöBER-GROHNE 1981: Pflanzliche Abdrücke in eisenzeitlicher Keramik - Spiegelbild der
damaligen Nutzpflanzen? Fundber. Bad.-Württ. 6, 1981, Abb. 24.- M. Rösch, The
history of crops and crop weeds in south-western Germany from the Neolithic pe
riod to modern times, as shown by archaeobotanical evidence. Veget. Hist. Ar
chaeobot. 7, 1998, 109flf.
~)I
FLANZENRESTE AUS GRUBEN DER LATENEZEIT VON BENZENZIMMERN 301 •
KRAUSE 1990: Ein keltischer Siedlungsplatz am Westrand des Rieses bei Kirchheim
Benzenzimmern, Ostalbkreis. Archäol. Ausgr. Bad.-Württ. 1989 (Stuttgart 1990)
112ff.
MENZEL & BAUER 1995: Neue Untersuchungen am keltischen Siedlungsplatz "Ohrenberg"
bei Kirchheim-Benzenzimmern, Ostalbkreis. Archäol. Ausgr. Bad.-Württ. 1994
(Stuttgart 1995) 94f.
REICHERTER 1994: Geologische Daten und Informationen zur digitalen vorläufigen geolo
gischen Karte von Baden-Württemberg 1:25000, Blatt 7128 Nördlingen. Freiburg
1994.
RöSCH 1994: Botanische Untersuchungen in der linearbandkeramischen Siedlung von Vai
hingen-Ensingen, Kreis Ludwigsburg. Archäol. Ausgr. Bad.-Württ. 1994 (Stuttgart
1995) 43fT.
RöSCH 1996: New approaches to prehistoric Iand-use reconstruction in south-western Ger
many. Veget. Hist. Archaeobot. 5, 1996, 65ff.- Dort weiterfUhrende Literatur!-
RöSCH I.Dr.: Botanische Untersuchungen im völkerwanderungszeitlichen Fundplatz Aalen
Hofherrenweiler, Sauerbach (Ostalbkreis). In: Fundberichte Bad.-Württ. (I. Dr.).
Anschrift des Verfassers
Priv. Doz. Dr. Manfred Rösch
Landesdenkmalamt Baden-W ürttemberg
Archäobotanik
Fischersteig 9
78343 Graienhofen-Hemmenhofen