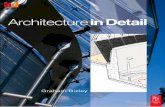Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)
-
Upload
uni-weimar -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)
1
Stadtbaukunst:Ornament und Detail
DortmunderArchitekturtage
2011
Das vorliegende 24. Dortmunder Architekturhefterscheint als Katalog zu den Dortmunder Architekturtagen und der
Dortmunder Architekturausstellung No.13, die am 18.11.2011 im LWL Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund stattgefunden haben.
2 3
Dortmunder Architekturheft No. 24
Stadtbaukunst: Ornament und Detail
© 2012, Institut für Stadtbaukunst, TU DortmundHerausgeber: Christoph MäcklerRedaktion: Dipl. Ing. Frank Paul Fietz Dipl. Ing. Saskia GökeSatz: Ermina MesanovicTitelfoto: Barbara KlemmDruck: Demmedia GmbH Druckerei Demming RhedeDistribution: Buchhandlung Walther König, KölnVerlag: Institut für Stadtbaukunst, TU DortmundReihe: Dortmunder Architekturheft No. 24ISBN: 978-3-88364-065-5
4 5
Inhalt
VorwortChristoph Mäckler
„Ranken und Regenwürmer“: Zur Bedeutung des Ornaments in Otto Wagners Wienzeilenhäusern Ruth C. Hanisch
Magie und WirklichkeithEHU�.RQ¿JXUDWLRQHQ�LQ�*HWUHLGHIHOGHUQ��GLH�LQ�einer einzigen Nacht entstehen.Jean-Christophe Ammann
Ornament und DetailArno Lederer
Stadtbaukunst: Ornament und DetailChristoph Mäckler
Ornament ist kein DetailJasper Cepl
Architektur und Bild – das Bild als OrnamentRainer Morawietz
Auch Ornament – Ein BeispielMeinrad Morger
„Das architektonische Minimum“Wouter Suselbeek
6
10
22
32
44
54
76
86
92
4 5
105
180
Dortmunder Architekturausstellung No. 13 Das Lieblingsdetail und ein eigenes Detail
Bildnachweis
52 53
Ornament ist kein DetailJasper Cepl
Wie Äpfel und Birnen – hier in einem Stillleben von Paul Cézanne (Abb. 58) – so sind auch Ornament und Detail. Eine Ähnlichkeit ist unübersehbar, aber trotz-dem sind Äpfel und Birnen nicht dasselbe. Ich will nicht unterstellen, dass für Sie Ornament und Detail gleichbedeutend sind, aber der Titel dieser Dortmunder Architekturtage lässt doch vermuten, dass es zumindest nicht darum geht, die Unterschiede stark zu machen.Gerade das möchte ich aber tun. Die Begriffe sind näm-lich nicht so einfach austauschbar. Es gibt vor allem ei-nen ganz wesentlichen Unterschied: Das Detail spricht nur vom Bau, anders als das Ornament: Es beginnt da, wo die Architektur aufhört, von sich selbst zu reden. Das Detail ist selbstreferentiell; es verweist auf die (möglichst kunstvolle) Machart. Was das bedeutet, kann man sich vor Augen führen, wenn man – beispielsweise – Bauten von Renzo Piano betrachtet, etwa die Menil Collection in Houston (Abb. 59). Im Ornament geht die Architektur über in Skulptur oder Malerei (oder in andere Formen freier Gestaltung, etwa mit Licht); sie befreit sich in Form und Inhalt vom Bau-gefüge. Wenn es diesem verbunden bleibt, dann doch in freier Form, die aus Themen wie Tragen und Lasten, Fügen und Verbinden ein Schau-Spiel macht (wie in der Ionischen Ordnung; Abb. 60). Aber selbst im Kapitell lässt sich mehr zum Ausdruck bringen als das. Auch hier eröffnet sich ein Spielraum, in dem die Architektur zur Erzählerin wird, und da spricht sie nicht nur vom Bau selbst, sondern auch von dessen Bestimmung –wenn etwa am Berliner Schloss Korinthische Kapitelle mit Preußischen Adlern ausgestattet werden (Abb. 61). Ornament muss aber nicht – wie hier – allegorisch sein, es kann auch Formen und Inhalte annehmen, die nur lose mit dem Sinn des Baus verbunden sind; und es muss nicht einmal gegenständlich sein. Es kann auch
57 Jasper Cepl
52 53
abstrakt bleiben, aber es darf eben nicht allein aus dem Konstruktiven gedacht werden. Denn der Sinn des Or-naments liegt ja gerade in der zusätzlichen Ebene, die es dem Bau gibt.
Dass im Ornament mehr steckt als im Detail, zeigt sich bereits in der (verloren gegangenen) Bedeutung des Wortes. Ein kurzer Verweis auf Leon Battista Alberti hilft vielleicht zu klären, wie umfassend Ornament einmal verstanden wurde. In de�UH�DHGL¿FDWRULD, den Zehn Bü-
chern über die Baukunst, die er Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts geschrieben hat, hat Alberti das Thema wohl so eingehend und tiefgreifend behandelt wie sonst keiner vor oder nach ihm.Ich möchte dazu etwas ausholen, auch wenn ich anneh-men darf, dass Ihnen Alberti kein Unbekannter ist. Sie werden im Großen und Ganzen im Bilde sein und mir vielleicht sogar vorwerfen, dass ich im folgenden mit Alberti allzu frei umspringe. Und da müsste ich Ihnen ohne weiteres Recht geben. Wollten wir ernsthaft versu-chen, sein Architekturdenken aus seiner Zeit heraus zu verstehen, dann wäre es geboten, an das Rechtsdenken der Renaissance zu erinnern und an Albertis Auseinan-dersetzung mit der Rhetorik der Antike.1 Wenn ich auf beides nicht weiter eingehe und es mithin an der gebo-tenen Sorgfalt mangeln lasse, dann nicht zuletzt, weil mir vor allem daran liegt, die Fragen, die er aufwirft, vor Augen zu führen – wenn ich dabei Alberti gelegent-lich etwas frei auslege, bitte ich dafür vorweg um Ent-schuldigung. Zu meiner Verteidigung möchte ich aber noch Alber-ti selbst als Zeugen anführen: Wenn dieser eingesteht, dass schwerer zu sagen als zu denken sei, was pulchri-
tudo und ornamentum – also Schönheit und Schmuck
58 Paul Cézanne, Stillleben: Äpfel und Birnen, ca. 1885–87, New York, The Metropolitan Museum of Art
59 Renzo Piano, Menil Collection, Houston, 1982–1986
54 55
– seien und worin sie sich unterschieden,2 dann ist das keine bloße Geste der Bescheidenheit: Es fällt ihm in der Tat schwer. Und so wie Alberti vielleicht nicht immer in Worten zu fassen bekommt, was ihm in Ge-danken vorschwebt, so mag es mir unterkommen, dass ich nicht immer genau das treffe, was Alberti hat sagen wollen.Werfen wir also einen Blick in die Vorrede, an deren Ende Alberti erläutert, was er in welcher Folge abhan-deln wird (Abb. 62). Ganz kurzgefasst nennt er dort die Themen seiner Zehn Bücher. Im ersten Buch geht es demnach um lineamenta, im zweiten um materia; es geht also zuerst um die Form und dann um den Stoff.3 Alberti befasst sich zuerst mit dem gedanklichen Weg zum Entwurf, zum Liniengefüge (das festzulegen Auf-gabe des Architekten ist); dann mit dem, was zu dessen Ausführung zur Verfügung steht. Im dritten Buch be-schreibt er, wie man daraus ein Bauwerk (opus) macht; er behandelt zum Beispiel, was beim Legen der Funda-mente oder beim Bau der Mauern zu beachten ist. Das vierte Buch behandelt grundlegende Forderungen an die Bauten für die Allgemeinheit (universorum opus) und das fünfte die für die Einzelnen (singulorum opus). Das sechste Buch widmet Alberti dem ornamentum, die folgenden Bücher sieben bis neun differenzieren das Thema im Hinblick auf die Sakralbauten (sacrorum or-
namentum), die öffentlichen Profanbauten (publici pro-
fani ornamentum), beziehungsweise die privaten Bau-ten (privatorum ornamentum). Alberti beschäftigt sich also in immerhin vier seiner zehn Bücher mit dem or-
namentum. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es im zehnten – zumindest dem Namen nach – um die Ausbesserung der Bauten (operum instauratio) geht. Nun wäre die Frage nur, was Alberti unter ornamentum
versteht. In der deutschen Übersetzung von Max Theu-
60 Die Nordhalle des Erechtheion auf der Akropolis in Athen, erbaut ca. 420–406 v. Chr.
54 55
er wird ornamentum mit Schmuck übersetzt, aber für Alberti geht es um mehr als zierendes Beiwerk. Wenn man sieht, was er alles abhandelt, muss man sagen, dass ornamentum die gesamte Ausgestaltung des besonde-ren Bauwerks betrifft, einschließlich, beispielsweise, der besonderen Anforderung an seine Räumlichkeiten. Ornamentum bedeutet für Alberti eben auch so viel wie Ausstattung; er verwendet das Wort in der ganzen Brei-te seiner Bedeutung – an die uns ein Blick ins Ausführ-
liche lateinisch-deutsche Handwörterbuch von Karl Ernst Georges erinnern mag (Abb. 63).Wenn wir uns das vor Augen halten und die Verengung, die das Wort im Laufe der Geschichte erfahren hat, auf-geben, dann verstehen wir vielleicht besser, worauf Al-berti hinaus will, nämlich im ursprünglichen Sinne auf ein ganzheitliches Verständnis der Fragen, die im Ein-zelfall bei der Ausgestaltung eines Bauwerks auftreten. Spätestens jetzt müssen wir daran erinnern, dass Al-berti ornamentum als Ergänzung eines vordergründig schwergewichtigeren Begriffs, nämlich der pulchritu-
do, also der Schönheit, einführt, und zwar im sechsten, dem ornamentum im Allgemeinen gewidmeten Buch. Zunächst stellt Alberti fest, „daß die Schönheit eine bestimmte gesetzmäßige Übereinstimmung aller Teile, was immer für einer Sache, sei, die darin besteht, daß man weder etwas hinzufügen noch hinwegnehmen oder verändern könnte, ohne sie weniger gefällig zu ma-chen“4. So weit, so gut. Solche Formulierungen sind QLFKW�RKQH�9RUELOG��bKQOLFKHV�¿QGHW�VLFK�DXFK�EHL�&LFH-ro,5 aber auch mehr als einmal im Alten Testament. Dort heißt es zum Beispiel im Buch Kohelet: „Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, endgültig ist. Nichts ist ihm hinzuzufügen, und nichts ist davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürch-tet.“6 Zweifellos kannte Alberti nicht nur seinen Cicero,
61 Berliner Schloss: Korinthisches Kapitell mit Preußischen Adlern am Portalrisalit I
56 57
sondern auch die Bibel gut. Die Ehrfurcht, mit der dort von Gottes Werk gesprochen wird, legt Alberti wohl nicht von ungefähr bei der Betrachtung des Schönen an den Tag. Bei ihm heißt es weiter: „Das“ – also das Er-reichen dieses Zustands der Vollkommenheit – „ist eine gewaltige und göttliche Sache, bei deren Ausführung es der Anspannung aller künstlerischen und geistigen Kräfte bedarf und sogar der Natur ist es selten vergönnt, etwas hervorzubringen, das absolut und in allen Teilen vollkommen ist.“7
Der Natur gelingt es also auch nicht immer, Gottes Plan zu erfüllen. Mehr als eine Ahnung von Vollkommenheit ist im Diesseits nicht zu haben. Die Welt ist nicht der Himmel; sie ist Fragment. So bleibt die Natur in Wirk-lichkeit unter ihren Möglichkeiten, und das Schöne, das Alberti vorschwebt, bleibt zumeist unerreicht. Alberti belegt das mit Hinweis auf eine Stelle aus Cice-ros Dialog De natura deorum (I, 79), an der dieser den Skeptiker Gaius Aurelius Cotta vorbringen lässt, dass es in Athen kaum schöne Jünglinge gebe. „Jener Kenner der Formenschönheit“ – so erläutert Alberti – „merkte, daß denen, welche er nicht billigte, etwas fehlte oder daß etwas bei ihnen zuviel war, was mit den Regeln der Schönheit nicht übereinstimmte.“8 Er spinnt den Ge-danken wie folgt weiter: „Bei diesen wäre, täusche ich mich nicht, die Anwendung von Schmuck sehr vorteil-haft gewesen; durch Färben und Verdecken aller etwai-gen Unförmigkeiten, durch Kämmen und Glätten wären sie schöner geworden, so daß das Unerwünschte weni-ger abgestoßen und das Anmutige mehr ergötzt hätte.“9
Mit dieser Wendung hat Alberti selbst dazu eingeladen, seine Idee von ornamentum zur kosmetischen Korrek-tur zu verkürzen und so gering zu schätzen, dabei hat es hier gar nichts anrüchiges, wenn Schmuck überspielt, was an Schönheit mangelt – das ist, im Gegenteil, ein
62 Eine Seite aus dem Erstdruck von Leon Battista Albertis Traktat de
UH�DHGL¿FDWRULD, Florenz 1485: Das Ende der Vorrede und der Beginn des ersten Buches
56 57
Gebot gesellschaftlichen Anstandes. Missverstanden wurde zumeist auch die anschließende Bestimmung, der Schmuck sei „gleichsam ein die Schönheit unterstützender Schimmer und etwa deren Ergänzung“, zu der Alberti hinzufügt: „Daraus erhellt, meine ich, daß die Schönheit gleichsam dem schönen Körper eingeboren ist und ihn ganz durchdringt, der Schmuck aber mehr die Natur erdichteten Scheines und äußerer Zutat habe, als innerlicher Art sei.“10 Oft wur-de überlesen, dass Alberti von einer Ergänzung (com-
plementum) spricht; und weil er von der pulchritudo sagt, dass sie von innen komme, hat man angenommen, dass sie ihm mehr wert sei als das ornamentum. Dabei ist ihm dieses nicht minder wichtig, schließlich ist es der Schmuck, in dem die Gesellschaft der naturhaften Grundform kulturelle Bedeutung gibt. Auch wenn – oder gerade weil – ornamentum�QLFKWV�LVW�DOV�À�FKWLJH�PHQVFKOLFKH� (U¿QGXQJ�� NRPPW� GDV� JHVHOOVFKDIWOLFKH�Miteinander – und um dieses geht es Alberti ja vor allem – nicht ohne ornamentum aus.Dennoch sind Aussagen wie die zuletzt zitierten oft so verstanden worden, als gäbe Alberti der reinen, unge-schmückten Form den Vorzug. Gerne zitiert wird auch die Wendung: „Denn nackt soll man ein Bauwerk zu Ende führen, bevor man es bekleidet.“11 Dabei mahnt $OEHUWL� KLHU� OHGLJOLFK�� GLI¿]LOH�$XVVFKP�FNXQJHQ� HUVW�auszuführen, wenn der Rohbau fertig ist und keine Ge-fahr mehr droht, dass die Schmuckformen beschädigt werden.Ornamentum ist für Alberti also nichts, was erst im nachhinein dazukommt, und als eigentlich unwe-sentliche Zutat zu verstehen wäre. Im Gegenteil: Ein Ganzes ohne ornamentum macht für ihn keinen Sinn: Ornamentum ist, wie Alberti sagt, die Ergänzung zur Schönheit, zur pulchritudo. Diese aber unterliegt einem
63 Eintrag »ornamentum« im Ausführlichen lateinisch-deutschen
Handwörterbuch von Karl Ernst Georges
58 59
Naturgesetz, das ganz allgemein für alle Körper gilt, nicht nur für Bau-Körper. Und gerade deswegen macht Schönheit – wie wir gesehen haben, ist es mit der ja ohnehin so eine Sache; auf Erden ist auf sie jedenfalls kein Verlass – deswegen macht Schönheit allein noch keine Stadt. Denn da gelten die Gesetze der Kultur, die sich eben nicht so grundsätzlich und dauerhaft festlegen lassen. Jede Stadt ist anders, jede Zeit hat ihre Konven-tionen, oder auch nicht, kurz: da regiert der Einzelfall, da geht es ums Konkrete, und dem kann nur mit Hilfe einer genau abgewogenen, passenden Ausgestaltung entsprochen werden. Vielleicht wird das klarer, wenn wir uns ansehen, was Alberti im neunten, der Ausgestaltung der Privatbauten gewidmeten Buch weiter ausführt. Zusätzlich erläutert er hier die concinnitas, das Ebenmaß. Er gibt folgende ZRKOEHNDQQWH�'H¿QLWLRQ�� Ä'LH� 6FK|QKHLW� LVW� HLQH�$UW�Übereinstimmung und ein Zusammenklang der Teile zu einem Ganzen, das nach einer bestimmten Zahl [numerus], einer besonderen Beziehung [¿QLWLR] und Anordnung [collocatio] ausgeführt wurde, wie es das Ebenmaß, das heißt das vollkommenste und oberste Naturgesetz fordert.“12 Schönheit verlangt demnach, dass die Teile selbst und ihr Zusammenhang einer – nach QXPHUXV��¿QLWLR��FROORFDWLR – geradezu mathema-tisch genauen Ordnung unterliegen. An dieser Ordnung gibt es nichts zu rütteln; die Regeln sind eindeutig, eben gewissermaßen naturgesetzlich festgelegt. Gerade das NDQQ�PDQ�MD�YRQ�GHQ�*HSÀRJHQKHLWHQ�LP�PHQVFKOLFKHQ�Miteinander nicht sagen.Um zu verdeutlichen, welches Feld Alberti aufspannt, könnte man auch sagen: Mit pulchritudo bauen wir für Gott und Natur, mit ornamentum für den Menschen und seine Kultur. Pulchritudo bezieht sich auf das, was im-mer gilt, weil es den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
64 Leon Battista Alberti, Palazzo Rucellai, Florenz, entworfen um 1450, Ansicht
58 59
der Schöpfung entspricht; ornamentum auf das, was fallweise gilt und vom menschlichen Zusammenleben abhängt. Und weil ornamentum eben nicht (anders als pulchritudo��PLW�HLQHU�HLQIDFKHQ�'H¿QLWLRQ�HUNOlUW� LVW��eben deshalb braucht Alberti vier von zehn Büchern, um mit den vielen Einzelfällen einigermaßen zu Rande zu kommen.Wie Alberti pulchritudo und ornamentum miteinander verwebt, zeigt sich besonders in einem Passus, der mit seiner Bestimmung der concinnitas zunächst unver-einbar scheint – wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, dass ornamentum mindestens so wichtig ist wie pulch-
ritudo. Weil beide einander ergänzen, kann Alberti widerspruchsfrei erklären, Sakralbauten seien so her-zustellen, „daß man zu ihrer Hoheit und zur Bewunde-rung ihrer Schönheit [ad maiestatem et pulchritudinis admirationem] nichts mehr hinzufügen könnte“, Pri-vatbauten dagegen so, „daß man ihnen dagegen nichts scheint wegnehmen zu können, was mit ausnehmender Würde [eximia cum dignitate] verbunden wäre“13. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass Alberti im einen Fall von Schönheit, im anderen von Würde spricht: Wenn es um Gott geht, tritt die Schönheit in den Vordergrund, geht es um die Menschen, dann zählt das Angemessene im Miteinander. (Dass er damit keinen Gegensatz auf-baut, sondern eher die Bandbreite der Zielsetzungen vor Augen hält, zeigt sich darin, dass er für die öffentlichen 3URIDQEDXWHQ�HLQH�0LWWHOVWHOOXQJ�HPS¿HKOW��Was Alberti vorschwebt, lässt sich verdeutlichen, wenn wir zwei seiner Bauten nebeneinander stellen. Sowohl der Palazzo Rucellai in Florenz (Abb. 64) als auch St. Andrea in Mantua (Abb. 65) gleichen sich natürlich hinsichtlich der in ihnen waltenden Proportionsgesetze und Anordnungsprinzipien. Beide gehorchen den sel-ben allgemeinen Schönheitsprinzipien von numerus,
65 Leon Battista Alberti, St. Andrea, Mantua, entworfen 1470, An-sicht
60 61
¿QLWLR und collocatio. Worin sie sich unterscheiden, ist ihr ornamentum, das heißt ihre konkrete Ausgestaltung, nicht nur in ihrer Ausschmückung, sondern eben auch im konkreten baulichen und räumlichen Gefüge. Das Haus der Rucellai ist – mit seinem zarten Relief in der Fassade – nicht mehr als das, was Robert Venturi ei-nen decorated shed genannt hat, dagegen ist St. Andrea, ihrem gesellschaftlichen Rang entsprechend, nicht nur im Schmuck, sondern insbesondere in der körperlichen Durchgestaltung ungleich aufwendiger.
Die Architektur ist nicht oft so gedacht worden. Vor allem hat man Ornament zumeist verkürzt als einen Schatz von Schmuckformen begriffen, und nicht wie bei Alberti als grundlegendes Konzept, das zwar we-sentlich durch die Ausschmückung des Baues bestimmt ist, sich darauf aber nicht beschränkt.Wenn wir heute nach einem neuen Verständnis für das Ornament suchen, dann mag es zwar sein, dass wir Al-berti mit Vorsicht genießen müssen – zumindest dürfen wir nicht vergessen, dass er auf eine gesellschaftliche Hierarchie aus ist, die es so nicht mehr gibt – aber freier aufgefasst bieten seine Ideen doch Anknüpfungspunkte, die eine stärker auf das Schmückende eingeschränkte Auffassung vom Ornament nicht zu bieten hätte. Denn Alberti vermittelt ein Bewusstsein für die schwierige Suche nach der angemessenen Ausgestaltung, also dem ornamentum eines Gebäudes, und da geht es um die Art der Öffnungen oder die Anordnung von Säulenhal-len ebenso wie um die eigentlichen Schmuckformen. Wichtiger noch: seine Herangehensweise fordert dazu auf, pulchritudo und ornamentum zusammenzuden-ken und nach dem Schönen ebenso wie nach dem Pas-senden zu suchen. Um nochmals zu verdeutlichen, was damit gewonnen ist, könnte man dieses Doppel auch in
66 Eine Zimmereinrichtung 1883 (nach einem Aquarell von Georg Rehlender)
60 61
eine Reihe weiterer, ähnlicher Begriffspaare fassen: Es geht um eine gedankliche Aussöhnung von Natur und Kultur, oder auch um das Abstrakte eines Weltbildes (oder eben einer Schönheitsvorstellung) und das Kon-krete des menschlichen Miteinanders im Hier und Jetzt. – Und es geht nicht darum, dass beides genau festge-legt ist, sondern darum, dass wir uns darüber im klaren sind, dass beides gleich berechtigt ist. Wenn wir heute eine Formensprache suchen, dann eine, die uns etwas über die Natur und die Schönheit sagt, die aber zugleich unserer Gesellschaft entspricht und beides miteinander versöhnt.Sollten wir also für unsere Zeit so etwas wie das orna-
mentum des Bürohauses oder des Mehrfamilienhauses durchdenken, dann hätten wir uns eben nicht gleich mit der Ausschmückung zu befassen, sondern zuerst mit der Frage, welchen gesellschaftlichen Rang wir diesen Bauten zumessen und wie wir den angemessen zum Ausdruck bringen könnten. Wir wären schon auf dem richtigen Weg, wenn wir uns fragen, wie wir die Fenster in die Fassade setzen, oder wie der Eingang gestaltet werden sollte. Das kann dann bis ins Ornament gehen, muss es aber nicht im-mer. Zu meiden hätten wir vor allem ein doppeltes Missverständnis: Zum einen sollten wir daran denken, dass die Schönheit der reinen – oder meinetwegen auch der komplexen, computergenerierten – Form nicht das oberste Ziel ist, sondern nur ein Ideal; zum anderen sollten wir Schmuck nicht als verzichtbare Zutat be-trachten. Weder ist Schönheit das allein entscheidende, noch erübrigt sich Schmuck in dem Maße, in dem wir ihr näher kommen. Die Frage ist letztlich, was wir heu-te für eine Sprache für die Stadt brauchen und welche Bandbreite von ornamentum und pulchritudo wir dabei vor uns sehen.
67 Walter Gropius, Meisterhaus Moholy-Nagy, Dessau, 1925–26, Blick ins Wohnzimmer
68 Tafel I b aus den anonym veröffentlichten Untersuchungen über
den Character der Gebäude (Dessau 1785). Sie soll zeigen, wie die Wirkung des Baukörpers von seinem Umriss, sowie von seiner Glie-derung und den Öffnungen bestimmt wird.
62 63
Zumeist hat man sich zu sehr mit dem einen oder mit dem anderen befasst – und entweder für Schmuck ohne Schönheit oder für Schönheit ohne Schmuck gesorgt. Im neunzehnten Jahrhundert haben wir das eine Ex-trem, im zwanzigsten das andere.Auf das unkontrollierte, ja unschöne Spiel mit schmü-ckenden ›Motiven‹ im neunzehnten Jahrhundert (Abb. 66) folgte im zwanzigsten die Auskehr des Ornaments, und eine Hinwendung zur Primärform (Abb. 67) oder später zum Blob – der sich von der Box aber letztlich nur dadurch unterscheidet, dass in ihm die euklidische Geometrie einer komplexeren, vermeintlich zeitge-mäßeren Vorstellung von Mathematik Platz macht. So oder so werden aber die althergebrachten Ausdrucks-formen von Schmuck und Auszeichnung verworfen – ob dafür neue gewonnen werden, sei vorerst dahinge-stellt. Doch zu beklagen, was verloren wurde, ist hier nicht die Zeit. Verfolgen wir lieber, wie es soweit gekom-men ist. Denn verdächtig wird das Ornament schon vor der „Moderne“. Anfangs geht es allerdings nur gegen den Schmuck, aber nicht gegen die Angemessenheit. In gewisser Weise ist es gerade die Suche nach ihr, die Anstoß zum Umdenken gibt – als in der zweiten Hälf-te des achtzehnten Jahrhunderts das alte Thema vom rechten Ausdruck für die Zweckbestimmung des Baus in den Denkbildern „Charakter“ und „Typus“ neu ge-fasst wird: Da beginnt die Suche nach einer Architektur sprechender Formen, die des Ornaments nicht mehr be-dürfen, weil sie selbst schon alles sagen.Ich verweise nur auf die 1785 anonym veröffentlichten Untersuchungen über den Character der Gebäude. Sie kennen daraus wohl zumindest die Tafeln, mit denen der Autor seine Theorie veranschaulicht. Es sind ein-fache Abbildungen von Häusern, teils nur im Umriss
69 Tafel VII aus den Untersuchungen über den Character der Gebäu-
de: Sie soll zeigen, wie sich durch die Veränderung der Säulenstel-lungen an ein und demselben Baukörper dessen Charakter entschei-dend verändert.
70 Die erste Tafel aus J. N. L. Durands Précis des leçons d’architecture
��������PLW�GHU�*HJHQ�EHUVWHOOXQJ�YRQ�6RXIÀRWV�6W��*HQHYLqYH�XQG�Durands Alternativprojekt
62 63
dargestellt (Abb. 68). Für den Autor ist es der erste Blick, der uns eine Vorstellung vom Gebäude vermittelt und unser Urteil bestimmt, lange bevor irgendwelche Schmuckformen, die über dessen Inhalt Aufschluss ge-ben wollen, überhaupt wahrgenommen werden. Wenn er – wie in Abb. 69 – Säulenstellungen betrachtet, dann um zu zeigen, dass der Abstand zwischen den Säulen mehr Eindruck macht als deren Ausschmückung nach dem konventionellen System der Säulenordnungen.„Von den Verzierungen“ handelt erst das sechste Kapi-tel. Der Autor erläutert darin zu Beginn, warum er sich nicht früher mit dem Thema beschäftigt hat. Ich zitiere: „Ich habe bisher den nackenden Körper des Gebäudes aufgestellt, um zu zeigen, welche Wirkung sich von den wesentlichen Theilen desselben erwarten läßt. Die Ver-zierungen sind nur die Bekleidung dieses Körpers, und dies bestimmt schon im voraus ihren Werth. Sie können den Charakter des Gebäudes entstellen, aber ihm eine Bedeutung zu geben, die nicht in den Bau seines Kör-pers fest verwebt ist, das vermögen sie eben so wenig, als ein Kleid dem Würde und Adel geben kann, den die Natur nicht damit ausgerüstet hat.“14
Es ist doch auffällig, wie hart hier die Linien gezogen sind, wenn wir das mit Alberti vergleichen: Erinnern wir uns an die Wendung, dass nicht alle Athener schö-ne Jünglinge seien. Alberti gibt dem Schmuck durch-aus seine eigene Berechtigung. Er spielt ihn nicht ge-gen den Baukörper aus. Gerade weil es nicht immer gelingt, vollendete Schönheit zu erreichen — dazu unterliegt das tatsächliche Bauen zu vielen Zwängen. Die bauenden Architekten unter uns werden davon ein Lied singen können. Bei Alberti gibt es kein Entweder/Oder, vielmehr treffen sich da zwei Welten: Die der na-turgesetzlich bestimmten Form, und die der kulturellen Konventionen unterworfenen Ausgestaltung des Bau-
71 J. N. L. Durand, Idealentwurf für ein Museum, 1805
64 65
körpers. Und diese kann auf Schmuck nicht verzichten. Gerade das erhofft man sich aber gegen Ende des acht-zehnten Jahrhunderts. Auch andere Autoren stellen damals die Frage, ob die Architektur nicht über eigene Mittel verfüge, um einem Haus Charakter zu geben; ob nicht die Form allein die Bestimmung eines Baues – wir können auch sagen: seine Funktion – zum Ausdruck bringen könne.In Frankreich zeigt sich diese Herangehensweise bei Étienne-Louis Boullée, und schärfer noch bei des-sen Schüler Jean-Nicolas-Louis Durand: In seinen 1802 erstmals veröffentlichten Précis des leçons
d’architecture données à l’École Polytechnique wen-det sich Durand scharf gegen jede Verschwendung von Schmuck.Sie kennen sicher die berühmte erste Tafel (Abb. 70), DXI� GHU� HU� -DFTXHV�*HUPDLQ� 6RXIÀRWV� �GDPDOV� EHUHLWV�in ein weltliches Panthéon français umgewidmete) Kir-FKH� 6W�� *HQHYLqYH� VHLQHP� HLJHQHQ� $OWHUQDWLYSURMHNW�gegenüberstellt, wozu er dann im Text erklärt, wieviel Säulen, die man gar nicht alle gleichzeitig sehen kön-ne, da verschwendet würden, wobei doch zudem – und das ist entscheidend – sein Entwurf, der natürlich mit deutlich weniger Säulen auskommt, auch noch der ein-drucksvollere sei. Darum geht es Durand nicht zuletzt: Er will, dass man sich über die eigentlichen Mittel der Architektur klar wird und sie ökonomisch einsetzt; er will es nicht einfach nur billiger haben. Das hauptsäch-liche Mittel, mit dem der Architekt gestaltet, aber ist die Anordnung (disposition), also der Grundriss, aus dem sich dann eine ganz bestimmte Raumzusammenstellung ergibt, und damit auch ein für die Bauaufgabe charakte-ristischer Baukörper. Ich zitiere dazu (nach der deutschen Ausgabe von 1831) aus einer Zusammenfassung des Stoffes, den er in sei-
72 J. N. L. Durand, Idealentwurf für ein Hospital, 1805
64 65
nem Lehrbuch abhandelt. Durand erklärt da, dass „die Anordnung überall das Einzige sey, womit der Bau-künstler sich zu befassen habe, weil aus dieser Anord-nung, wenn sie so zweckmäßig und so ökonomisch ist, als sie seyn kann, ganz natürlich eine Art von architek-tonischer Verzierung hervorgeht, die wahrhaft gemacht ist, uns zu gefallen, weil sie uns das treue Bild befrie-digter Bedürfnisse zeigt, eine Befriedigung, woran die Natur unsere wahresten Vergnügungen geknüpft hat.“15
Und weiter heißt es, dass es „eben so lächerlich als fruchtlos sey, wenn man die Gebäude durch eingebil-dete und kostspielige Mittel zu verzieren suche, wäh-rend die Natur und die gesunde Vernunft uns so sichere und so einfache Mittel sogar in der blosen Konstruktion darbiethen.“16
Durand richtet sich nicht einfach gegen das Ornament, vielmehr sagt er: Die Architektur kann das allein. Man könnte auch sagen: Die Gleichung ist eleganter gelöst, wenn die Architektur aus ihrer Anordnung spricht; heute würden wir sagen: wenn starke Formen aus sich heraus wirken, und wir der Hilfe des Ornaments nicht mehr bedürfen. Wie Durand sich das vorstellt, zeigen die Typenentwürfe, die er im zweiten Band seiner Pré-
cis ausarbeitet etwa für Museen (Abb. 71), Hospitäler (Abb. 72) oder Gefängnisse (Abb. 73). Durand versteht sie als exemplarische Ergebnisse eines schematisch festgelegten Vorgehens, nach dem jedweder Entwurf hervorzubringen ist. Das zeigen zwei Tafeln, die er 1813 in eine Neuausgabe seiner Précis aufnimmt. Die eine veranschaulicht, welche Baukörper dabei heraus-kommen können (Abb. 74); die andere zeigt den „Gang, ZHOFKHU�EH\�(U¿QGXQJ�LUJHQG�HLQHV�(QWZXUIH�]X�EHIRO-gen“17 sei (Abb. 75).Da wäre nur die Frage: Was bedeutet das für die Stadt? Letzten Endes führt diese Auffassung in eine Ansamm-
73 J. N. L. Durand, Idealentwurf für ein Gefängnis, 1805
66 67
lung von Solitären, die alle damit beschäftigt sind, ihre eigene Bedeutung im Großen aufzutischen. Die feinen Unterschiede gehen verloren. Der städtische Zusam-menhalt auch. – Und die Zweckbestimmung, die zuvor durch eine Differenzierung im Ornamentalen Ausdruck fand, soll nun an der unverwechselbaren Gestalt der Gesamtanlage ablesbar werden.
Damit kommen wir zum Detail. Dessen Bedeutung nimmt in dem Maße zu, wie die des Ornaments ab-nimmt. Das geht bis in die Detail-Orgien des High-Tech, und dafür geben wir am Ende genauso viel Geld aus wie früher für den Schmuck der Gebäude.Nun kann sich natürlich jeder, der heute die Konstruk-tion zelebriert, darauf berufen, dass doch das Ornament im Grunde auch ein konstruktives Detail darstelle. Er wird dann für sich in Anspruch nehmen, dass er genau das tue, was Architektur immer getan habe: Die Vorstel-lung, dass das Ornament aus der Konstruktion hervor-geht und diese überhöht, ist schließlich uralt. Sie steckt schon – nur ein Beispiel – in Vitruvs Erklärung der do-rischen Gebälkform als Übertragung aus der Holzkon-struktion. Demnach hätten die Triglyphen ursprünglich dazu gedient, die dahinter liegenden Balkenköpfe ab-zudecken. Nur ob das so stimmt, bleibt fraglich.18 Selbst wenn etwas Wahres daran sein mag, schafft diese Herange-hensweise doch einen Begründungszusammenhang, der mehr ausblendet, als er erklärt. Dennoch erfreut sich solches Denken großer Beliebtheit, vor allem im 19. Jahrhundert, als die geistigen Grundlagen für die Moderne gelegt werden – erinnert sei nur an Karl Bo-etticher mit seiner Tektonik der Hellenen (1844–1852) oder an Gottfried Semper mit seiner Studie über Die
vier Elemente der Baukunst (1851) und seinem Haupt-
74 J. N. L. Durand, »Ganze Gebäude. Aus verschiedenen Horizontal- und Vertikal-Verbindungen entstehend« — so die Bezeichnung der Tafel in der deutschen Ausgabe von 1831. Durand veröffentlicht sie erstmals in der 1813 als Nouveau Preçis«�HUVFKLHQHQHQ�1HXDXÀDJH�seiner Vorlesungen (hier ist sie der Ausgabe von 1819 entnommen).
���'XUDQGV�(QWZXUIVYHUIDKUHQ��ª*DQJ��ZHOFKHU�EH\�(U¿QGXQJ�LUJHQG�eines Entwurfe zu befolgen« so der deutsche Titel dieser ebenfalls zuerst 1813 veröffentlichten Tafel.
66 67
werk Der Stil (1860–1863). Dies sind nur zwei von de-nen, die das Ornamentale – nicht nur, aber vor allem – als Form-Werden von Konstruktion erklären. Ich will darauf nicht weiter eingehen.19 Entscheidend ist, dass Ornament nicht ohne konstruk-tiven Hintergrund denkbar erscheint, und sei es am Ende auch noch so frei gestaltet. Den Schlüssel zum Verständnis des Ornamentalen sucht man in die Kraft der inneren Struktur, die das Ornament wie eine Blü-te hervortreibt. Treffend in Worte gefasst hat diese 'HQN¿JXU�:ROIJDQJ� 3ÀHLGHUHU�� XQG� GDV� DXVJHUHFKQHW�in einer 1924 erschienenen Veröffentlichung, die der Form ohne Ornament�JHZLGPHW�LVW��3ÀHLGHUHU�HUNOlUW��„Verzierung“ sei zwar „ein Spiel mit der Form“, aber nicht „im Sinne einer lustigen Dreingabe“: vielmehr sei sie „ein Weiterschwingen des Formspieles an den äußeren Rändern, gleichsam die Schaumkrone auf dem Wellenkamm“.20 Das Bild ist wunderbar, doch es sagt mehr über den Ort des Ornaments, als über das Orna-ment selbst. Dessen Sinn liegt eben nicht allein darin, bestimmte Teile der Architektur hervorzuheben. Verste-hen Sie mich nicht falsch: Wichtig ist schon, dass das Ornament am rechten Platz ist. Das ist heute so gut wie nie der Fall. Da wird dann irgendein Muster über die Fläche gezogen, und es bleibt doch fraglich, ob das den Namen Ornament verdient. Natürlich gibt es im Bau-gefüge Stellen, an denen Ornament einen Platz hat und andere, an denen es nicht hingehört, aber damit bleibt doch die Frage, ob es an den Stellen, an denen es dann auftreten darf, wirklich nur etwas über die Konstruktion sagt. Das wäre doch etwas dürftig. Hervorgebracht wird Ornament nicht allein von den Kräften, die in der Kon-struktion walten, sondern auch und vor allem vom Be-dürfnis danach, das Gebaute kunstvoll auszugestalten und damit eben über dieses hinauszugehen — sei es um
76 Andrea Palladio, Basilika, Vicenza, 1549
68 69
zur Gesellschaft zu sprechen oder um ihr einfach nur Freude zu machen. Also: Die Konstruktion weist dem Ornament wohl den Ort an – etwa dort, wo der Dienst geleistet ist und freies Spiel möglich wird, oder dort, wo eine Fügung der Teile verdeutlicht werden soll. Aber auch dies ist nur eine Regel, und kein Gesetz. Ein paar Beispiele mögen das zeigen.Werfen wir zunächst einen Blick auf den Regelfall, wie ihn Palladios Basilika in Vicenza (Abb. 76) zeigt. Na-türlich sind es da die Metopen, die mit schmückenden, erzählerischen Reliefs gefüllt werden, und nicht die Tri-glyphen. Natürlich stehen die Statuen auf dem Dach-rand, wo es nichts mehr zu tragen gibt und sich die ver-tikale Gliederung aus dem Wandverband befreit. Aber Palladio kann auch anders: Denken Sie nur an den Palazzo Valmarana (Abb. 77), wo gerade die äußersten Pilaster der Kolossalordnung, die die Fassade visuell stabilisiert hätten, wegfallen und einem kleinteiligeren, weit weniger kraftvollen Abschluss weichen: Da wer-den unten die Pilaster, die sonst die Fenster rahmen, aufgedoppelt, und oben werden sie gar in halbplastische .ULHJHU¿JXUHQ� YHUZDQGHOW��:HQQ� GDV� NRQVWUXNWLY� JH-dacht ist, dann allenfalls als Spiel mit unseren Erwar-tungen an Festigkeit. Dass die Ecken derart nachgeben, erklärt sich aber wohl treffender aus dem Verlangen nach einem Schulterschluss mit den Nachbarn, zu de-ren Maßstäblichkeit sie vermitteln (Abb. 78). Schwer vorstellbar, dass dieses Anbauen anders als auf Ebene GHU�6FKPXFNIRUPHQ�KlWWH�VWDWW¿QGHQ�N|QQHQ��Aber es geht auch subtiler. Wie man das Konstruktive geradezu hintertreiben kann, zeigt wunderbar Schin-kels Neue Wache (Abb. 79) mit ihrem eigentümlichen Fries, in dem ja bekanntermaßen Siegesgöttinnen dort angebracht sind, wo eigentlich die Triglyphen hingehö-
77 Andrea Palladio, Palazzo Valmarana, Vicenza, 1565. Idealisierte Teilansicht der Fassade, aus Palladios Qvattro libri von 1570.
78 Andrea Palladio, Palazzo Valmarana: Die Palastfassade im Stra-ßenzusammenhang
68 69
ren (Abb. 80). Da haben wir – wider Erwarten – alles andere als eine konstruktive Form, die die Regel hier vorsieht. Und: im Extrem ist Ornament ganz ohne Bezug zur Konstruktion denkbar, so wie hier (Abb. 81-83) in einem Versuchsraum, den Joachim Teichmüller – ein Pionier der Lichtplanung – 1926 zur Ausstellung Ge-SoLei in Düsseldorf eingerichtet hatte. Teichmüller träumt damals von einer „Lichtornamentik“21, mit de-ren Hilfe sich öffentliche Räume, die sich – wie der von ihm testweise errichtete kreisrunde Festsaal – je nach GHP��ZDV�LQ� LKQHQ�VWDWW¿QGHQ�VROO�� LQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�Stimmungen versetzen lassen. Der Raum selbst nähert sich dabei dem ›white cube‹: Ideal erscheint es Teich-müller, wenn Wände und Decken „möglichst glatt und einfarbig hell angestrichen“22 sind. Selbst wenn wir es YLHOOHLFKW�QLFKW�EHVRQGHUV�JHJO�FNW�¿QGHQ��ZDV�7HLFK-müller – der den Raum selbst „recht unvollkommen“23 ¿QGHW�±�GD�JHVFKDIIHQ�KDW�� VR�ZLUIW�GDV�%HLVSLHO�GRFK�zumindest die Frage auf, ob wirklich alles Ornament aus der Konstruktion erklärt werden kann. Ob es nicht auch ohne ›Kraft‹ da sein kann – wie hier in Teichmül-lers Wandgliederungen mithilfe von Lichtbildern (in einem anderen Raum der Ausstellung; Abb. 84).Und vielleicht erinnert uns ein Blick auf diese Bilder auch daran, welche Gestaltungsspielräume wir aufge-ben, wenn wir zum Grundsatz machen, dass sich alles Ornament aus dem Baugefüge ergeben müsse. Wenn wir es so sehen, dann haben wir letztlich nur konstruk-tive Details, bei denen bloß die Frage ist, wie sie ge-löst sind, und nicht, was sie erzählen. Da sind wir ganz schnell bei einer Detailversessenheit, die im Blick auf das Konstruktive den Sinn für das erzählerische Poten-tial von Architektur verliert.Denken wir nur an den Eupalinos von Paul Valéry
79 Karl Friedrich Schinkel, Neue Wache, Berlin, 1816–1818
80 Karl Friedrich Schinkel, Neue Wache, Detail des Gebälks mit den Siegesgöttinnen anstelle von Triglyphen
70 71
(1921). Sie kennen dieses Gespräch sicher; ich rufe dennoch in Erinnerung, worum es da geht. – Ort der Handlung ist das Reich der Toten. Die Handlung selbst beginnt damit, dass sich Sokrates und Phaidros (den be-reits Platon in seinen Dialogen hatte auftreten lassen) dort wiedertreffen und miteinander ins Gespräch kom-men. Die Unterhaltung entfaltet sich im Nachsinnen über Schauplätze des gemeinsamen Lebens. Die Rede ist unter anderem von einem Artemis-Tempel in Piräus. Als Architekten dieses Tempels nennt Phaidros den Eu-palinos von Megara (den es auch wirklich gab, der aber Ingenieur war, und von dem sich Valéry nur den Na-men borgt, um dann seine eigene Figur zu erschaffen). Valérys Sokrates ist dieser Eupalinos unbekannt und so bittet er Phaidros, ihn ins Bild zu setzen.So ziemlich das erste, was Phaidros erinnert, ist Eu-palinos’ Wendung „Il n’y a point de détails dans l’exécution.“24 Rainer Maria Rilke hat das so übersetzt: „Es gibt keine Einzelheiten in der Ausführung.“25 Aber das ist vielleicht schon zu allgemein. Valéry lässt hier den Architekten Eupalinos sprechen, und in dessen Handwerk geht es auch im Deutschen um Details, und nicht um Einzelheiten. Doch zurück zum Text: Der Satz bedarf der Erläuterung, und so fragen sich Sokrates und Phaidros, wie das wohl zu verstehen sei. Sokrates gibt zur Erläuterung ein Beispiel aus der Me-dizin: Er verweist auf den Arzt, der den Kranken, den er sonst geheilt hätte, am Ende doch umbringt, weil er in einem Detail nachlässig war. Ich zitiere: „Der geschickteste Operateur der Welt kann seine geübten Finger an deine Wunde legen, und mögen seine Hände noch so leicht, so weise, so hellsehend sein wie immer; mag seine Sicherheit, was die Lage der Organe und der Venen angeht und ihre Beziehungen und ihre Tiefe, noch so groß sein; wie groß dann auch die Gewißheit
81 Joachim Teichmüller, Versuchsraum »Festsaal« auf der Ausstel-lung »Gesolei«, Düsseldorf 1926: Schnitt mit schematischer Darstel-lung der Lichtführung
83 Joachim Teichmüller, Versuchsraum »Festsaal« auf der Ausstel-lung »Gesolei«, Düsseldorf 1926: Beispiel für die ornamentale Aus-leuchtung der Kuppel
82 Joachim Teichmüller, Versuchsraum »Festsaal« auf der Ausstel-lung »Gesolei«, Düsseldorf 1926: Blick in den Saal
70 71
der Handlungen sei, die er an deinem Fleische auszu-führen gedenkt, um etwas zu beschneiden oder etwas zu vereinen – wenn dann durch irgendeinen Umstand, mit dem er sich nicht abgegeben hat, ein Faden, eine Nadel, die er benutzt, irgend etwas, was er während der Operation gebraucht, nicht durchaus rein ist, nicht hin-reichend gereinigt, tötet er dich.“26
Worauf Phaidros erwidert, genau das sei ihm widerfah-ren: Er ist unter den Händen eines Arztes gestorben. –Was lernen wir daraus? Vor allem, dass wir es mit einer todernsten Angelegenheit zu tun haben. Wenn Valéry den Eupalinos sagen lässt, es gäbe keine Details, dann heißt das: Alles bedarf der sorgfältigsten Beachtung. Es gibt keine Hierarchie. Alles hängt zusammen, nichts ist nebensächlich. Alles ist Konstruktion.Man muss sich den Eupalinos wohl vorstellen wie Au-guste Perret, der mit Valéry gut bekannt war und der in der Tat ganz genauso gedacht hat. Es gibt wohl wenige Architekten, die das Detail und die Konstruktion so ernst genommen haben wie Perret. „Technik, dichterisch ge-sprochen, führt uns zur Architektur.“27 So lautet einer seiner Lehrsätze. In diesem Sinne spricht er auch da-von, dass sich „um den einzig legitimen und schönsten Schmuck der Architektur“ bringe, wer „irgend einen Teil des Gerüstes“ verberge.28 Untermauert hat er das immer wieder mit Hinweis auf François Fénelon und dessen Satz: „Man darf in einem Gebäude kein einziges Teil zulassen, das nur als Ornament bestimmt ist; hin-gegen muß man, stets die schönen Verhältnisse im Auge behaltend, alle Teile, die nötig sind, um ein Gebäude zu tragen, in Schmuck umwandeln.“29 Das sagt Fénelon bereits 1693, und zwar in der Rede, die er bei seiner Aufnahme in die Académie Française hält (er spricht da im übrigen nicht über Architektur, sondern über Rheto-rik und benutzt das Bauwerk nur als Bild); und wie wir
JHVHKHQ� KDEHQ�� ¿QGHW� VLFK� GLH� JHGDQNOLFKH� 9HUNQ�S-fung von Ornament und Tragstruktur auch schon früh im Nachdenken über Architektur. Aber wer eben alles aus dem Baugefüge begründen muss, dem fehlt am Ende die Freiheit zum Ornament; und so krankt gerade Perrets späte Architektur (Abb. 85) daran, dass sie es nicht zulassen kann. Das scheint mir auch das Tragische an all dem, was in dessen Nachahmung gemacht wird. 3HUUHW� LVW� MD� VR� HWZDV�ZLH� HLQH�9DWHU¿JXU� I�U� DOOH�� GLH�sich um eine wohlgefügte, mit Sorgfalt gemachte, dau-erhafte, städtische Architektur bemühen – aber wie Per-ret scheuen sie sich vor dem Ornament. Es scheint fast, als hätten sie davor mehr Berührungsängste als solche, die ihre Bauten aus allem möglichen zusammenbasteln und sich nicht scheuen, diese mit irgendwelchen Mu-stern zu tapezieren.Auf der einen Seite stehen die Architekten, die wieder wirklich bauen wollen, sich aber dem Bild, und damit dem Ornament nicht öffnen können. Auf der anderen Seite stehen die Bildermacher, die viel weiter sind, was die Rückkehr des Ornamentalen angeht, aber das Bauen nicht ernst nehmen. In gewisser Weise gibt es hier wieder ein Entweder/Oder: Vielleicht nicht direkt von Schönheit oder Schmuck, aber doch von Bau oder Bild. Wenn beides zusammengeht, dann bekommen wir vielleicht einmal wieder ein Ornament, das den Namen verdient. Wenn wir wieder eine dichte, lebendige, lebenswerte Stadt haben wollen, dann sollten wir uns darum bemü-hen. Und dass nicht nur, weil die Bauten sich hier ja meistenteils einreihen und gar nicht anders zum Spre-chen gebracht werden können, sondern auch, weil erst das Verschwenderische des Ornaments dafür sorgt, dass wir auch noch nach Jahren immer wieder etwas entde-cken, das unerwartet zu uns spricht und an dem man
72 73
VLFK� QLFKW� VDWW� VLHKW�� (V� LVW� DOVR� QLH� �EHUÀ�VVLJ�� DXFK�wenn es manchmal Zeit braucht, bis wir die im Orna-ment eingeschlossenen Bilder bemerken.Zu wünschen wäre, dass wir dabei im Auge behalten, was Alberti uns auf den Weg geben kann. Er mag uns lehren, dass Ornament mehr ist als die Auszierung des Gebauten, und ebenso, dass wir früher anfangen müs-sen, über das Ornament nachzudenken, um es gedank-lich tiefer zu verwurzeln.
84 Joachim Teichmüller, Versuchsraum »Rotunde« auf der »Gesol-ei«. Die in die Wand eingelassenen Kabinette sollen zeigen, wie ein und dieselbe Skulptur in unterschiedlicher Beleuchtung erscheint; da-rüber: Beispiele für projizierte »Lichtornamentik«.
85 August Perrets Spätwerk (hier der Wiederaufbau von Le Havre) — Vorbild für eine Tektonik ohne Ornament
Endnoten:1 Vgl. dazu vor allem: Heiner Mühlmann: Ästhetische Theorie der Re-naissance. Leon Battista Alberti, Diss. Münster 1968, Bonn: Rudolf Habelt, 1981; bzw. Veronica Biermann: Ornamentum. Studien zum 7UDNWDW�ª'H�UH�DHGL¿FDWRULD©�GHV�/HRQ�%DWWLVWD�$OEHUWL��+LOGHVKHLP�Zürich/New York: Georg Olms, 1997 (= Studien zur Kunstgeschichte, 11), sowie dies.: »Ornamentum und seine rhetorischen Grundlagen in Albertis Architekturtraktat«, in: Leon Battista Alberti. Humanist – Architekt – Kunsttheoretiker, hg. v., Joachim Poeschke und Candida Syndikus, Münster: Rhema-Verlag, 2008, S. 227–2422�9JO��/HRQ�%DWWLVWD�$OEHUWL��GH�UH�DHGL¿FDWRULD��9,���3 Wir lassen hier außer acht, dass die Forschung bisher nicht darin übereingekommen ist, was unter lineamenta genau zu verstehen ist, und nehmen dabei in Kauf, dass Alberti etwas vergröbert dargestellt wird. Eine Diskussion der verschiedenen Interpretationen zuletzt bei: Caspar Pearson: »Philosophy Defeated: Truth and Vision in Leon Battista Alberti’s Momus«, in: Oxford Art Journal, 34. Jg., H. 1, März 2011, S. 1–12, hier 7ff. 4 Leon Battista Alberti: Zehn Bücher über die Baukunst, ins Deutsche übertragen, eingeleitet und mit Anmerkungen und Zeichnungen ver-sehen durch Max Theuer, Wien/Leipzig: Hugo Heller, 1912, S. 2935�=X�GHVVHQ�(LQÀXVV�DXI�$OEHUWL�YJO��LQVEHVRQGHUH�GLH�LQ�$QP����JH-nannten Arbeiten von Veronica Biermann. 6 Das Buch Kohelet (Der Prediger), 3, 14. Hier nach der neuen Zür-cher Bibel 20077 Alberti 1912 (wie Anm. 4), S. 2938 Ebd.9 Ebd., S. 293f. Vgl. zu Drastik dieser Formulierung auch Biermann
72 73
1997 (wie Anm. 1), S. 142, die argumentiert, dass Alberti hier den Unterschied zur pulchritudo überspitzt deutlich machen wolle.10 Ebd., S. 29411 Ebd., S. 51012 Ebd., S. 49213 Ebd., S. 47514 Anonym: Untersuchungen über den Character der Gebäude; über die Verbindung der Baukunst mit den schönen Künsten, und über die Wirkungen, welche durch dieselbe hervorgebracht werden sollen, Dessau, Verlagskasse für Gelehrte und Künstler; Leipzig, Buchhand-lung der Gelehrten, 1785, S. 8715 J. N. L. [Jean-Nicolas-Louis] Durand: Abriß der Vorlesungen über Baukunst gehalten an der königlichen polytechnischen Schule zu Pa-ULV��1DFK�GHU�QHXHVWHQ�$XÀDJH�DXV�GHP�)UDQ]|VLVFKHQ��EHUVHW]W����Bände, Carlsruhe und Freiburg: Herder’sche Kunst- und Buchhand-lung, 1831, Band 2, S. VI.— Im Original: J. N. L. Durand: Précis des leçons d’architecture données à l’Ecole polytechnique, 2 Bände, Paris: chez l’auteur, an X (1802) und an XIII (1805), hier Band 2, S. 7: »Que la disposition est dans tous les cas la seule chose dont doive s’occuper l’architecte, puisque si cette disposition est aussi convena-ble et aussi economique qu’elle peut l’être, il en naitra naturellement une autre espéce de décoration architectonique véritalement faite SRXU�QRXV�SODLUH��SXLVTX¶HOOH�QRXV�SUpVHQWHUD�O¶LPDJH�¿GHOOH�GH�QRV�besoins satisfaits, satisfaction à laquelle la Nature a attaché nos plai-sirs les plus vrais.«16 Ebd., S. VII; im Original, ebd. S. 8: »Qu’il était par conséquent DXVVL� ULGLFXOH� TX¶LQIUXFWXHX[�GH� FKHUFKHU� j� GpFRUHU� OHV� pGL¿FHV�SDU�des moyens chimériques et dispendieux, tandis que la Nature et le bon sens nous en offrent de si surs et de si simples, même dans la seule construction.«17 Im Original: »Marche à suivre dans la composition d’un projet quelconque«; vgl. J. N. L. Durand: Précis des leçons d’architecture données à l’Ecole a l’école royale polytechnique, Paris: chez l’auteur, 1817 (Band 2) und 1819 (Band 1), hier Band 1, 2.eme Partie, Planche 2118 Vgl. dazu Hermann J. Kienast: »Zum dorischen Triglyphenfries«, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, Bd. 117, 2002, S. 53–68.
19 Zumindest angemerkt sei aber an dieser Stelle, dass insbesondere Semper natürlich viel komplexer argumentiert.20�:ROIJDQJ� 3ÀHLGHUHU�� ª'LH� )RUP� RKQH�2UQDPHQW©�� LQ��'LH� )RUP�ohne Ornament. Werkbundausstellung 1924 (= Bücher der Form, im Auftrage des deutschen Werkbundes hg. v. Walter Riezler, 1), Stuttg-art/Berlin/Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt, 1924, S. 1–22, hier S. 4. – Der Band erschien als Katalog zu einer Ausstellung der Stuttgarter Werkbund-Abteilung. Die Ausstellung selbst trug nur den Titel »Die Form«.21 Joachim Teichmüller: »Lichtarchitektur«, in: Licht und Lampe, 16. Jg., 1927, H. 13 u. 14, S. 421–422, 449–458, hier S. 45622 Ebd., S. 45523 Ebd.24 Paul Valéry: Eupalinos ou l’architecte, in: Oeuvres de Paul Valéry, hg. v. Jean Hytier, 2 Bände, Paris: Gallimard, 1957 und 1960, hier Band 2, S. 79–147, hier S. 8425 Paul Valéry: Eupalinos oder der Architekt. Eingeleitet durch: Die 6HHOH�XQG�GHU�7DQ]��hEHUWUDJHQ�YRQ�5DLQHU�0DULD�5LONH��'ULWWH�$XÀD-ge, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995 (= Bibliothek Suhrkamp, 370), S. 46 (Erste Ausgabe: Leipzig: Insel-Verlag, 1927)26 Ebd., S. 47f.27 Auguste Perret: Zu einer Theorie der Architektur, Berlin: Verlag der Beeken, 1986, unp. — Französische Originalveröffentlichung: Contribution à une théorie de l‘architecture, Paris: André Wahl, 195228(EG��,P�2ULJLQDO��ª,O�QH�IDXW�DGPHWWUH�GDQV�XQ�pGL¿FH�DXFXQH�SDUWLH�destinée au seul ornement; mais visant toujours aux belles propor-tions, on doit tourner en ornement toutes les parties nécessaires à sou-WHQLU�XQ�pGL¿FH�©�>)UDQoRLV�GH�6DOLJQDF�GH�OD�0RWKH@�)pQHORQ��ª'LV-FRXUV� SURQRQFp� GDQV� O¶$FDGpPLH� )UDQoDLVH� OH�PDUGL� WUHQWH�XQLqPH�mars MDCLXXXXIII à la réception de Monsieur l’Abbé de Fénelon, précepteur de Monseigneur le Duc de Bourgogne et de Monseigneur le Duc d’Anjou«, in: Ders.: Oeuvres, hg. von Jacques Le Brun, 2 Bän-de, Paris: Gallimard, 1983 und 1997, hier Band 1, S. 531–539, hier S. 536. — Perret verwendet das Zitat seit 1923. Vgl. dazu Christian Freigang: Auguste Perret, die Architekturdebatte und die »Konser-vative Revolution« in Frankreich: 1900–1930, München: Deutscher Kunstverlag, 2003, S. 322, Anm. 369.
![Page 1: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/1.webp)
![Page 2: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/2.webp)
![Page 3: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/3.webp)
![Page 4: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/4.webp)
![Page 5: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/5.webp)
![Page 6: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/6.webp)
![Page 7: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/7.webp)
![Page 8: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/8.webp)
![Page 9: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/9.webp)
![Page 10: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/10.webp)
![Page 11: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/11.webp)
![Page 12: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/12.webp)
![Page 13: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/13.webp)
![Page 14: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/14.webp)
![Page 15: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/15.webp)
![Page 16: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/16.webp)
![Page 17: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/17.webp)
![Page 18: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/18.webp)
![Page 19: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/19.webp)
![Page 20: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/20.webp)
![Page 21: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/21.webp)
![Page 22: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/22.webp)
![Page 23: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/23.webp)
![Page 24: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/24.webp)
![Page 25: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/25.webp)
![Page 26: Ornament ist kein Detail [Ornament is no Detail] (2012)](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051603/6345424d38eecfb33a067963/html5/thumbnails/26.webp)