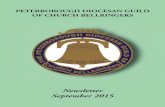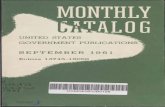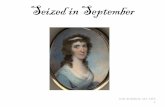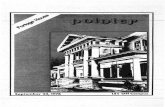Mediale Inszenierungen im Kontext des 11. September 2001
-
Upload
euv-frankfurt-o -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Mediale Inszenierungen im Kontext des 11. September 2001
UNIVERSITÄT PASSAU – PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
Hauptseminararbeit
Mediale Inszenierungen
im Kontext des 11.September 2001
Eine Analyse ausgewählter Fallbeispiele
Verfasserinnen:
Anne Gottwald, BA Medien und Kommunikation,
Matrikelnr.: 57811, Prüfungsnr.: 381054
Kontakt: [email protected]
Larissa Meltem Ordu, BA European Studies,
Matrikelnr.: 56451, Prüfungsnr.: 101843
Kontakt: [email protected]
Theresa Frank, BA Kulturwirtschaft,
Matrikelnr.: 56881, Prüfungsnr.: 101843
Kontakt: [email protected]
Seminartitel: HS Medien und Terrorismus
Dozent: Prof. Dr. Oliver Hahn
Semester: Wintersemester 2012/13
Abgabetermin: 31.03.2013
1
I. Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG ......................................................................................................................... 2
2. THEORIEANSÄTZE ............................................................................................................. 3
2.1 AGENDA-SETTING .................................................................................................................. 3
2.2 MEDIEN-FRAMING ................................................................................................................. 4
2.3 MEDIEN-PRIMING .................................................................................................................. 5
3. ANALYSE AUSGEWÄHLTER EPISODEN DES WAR ON TERROR .......................... 5
3.1 ERSTE EPISODE: DER 11.SEPTEMBER 2001 .......................................................................... 6
3.1.1 DAS EREIGNIS DES 11.SEPTEMBER 2001 UND SEINE MEDIALE DARSTELLUNG .................... 6
3.1.2 ERSTE ERKLÄRUNGSVERSUCHE UND LEGITIMATIONSANSÄTZE DER FOLGEHANDLUNGEN
DES 11.SEPTEMBER ........................................................................................................................ 7
3.1.3 „GROUND ZERO SPIRIT“ - BEISPIEL EINER VISUELLEN INSZENIERUNG ................................ 9
3.1.4 DAS „RALLY AROUND THE FLAG“-PHÄNOMEN UND DIE ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES
AMERIKANISCHEN JOURNALISMUS SEIT DEM 11. SEPTEMBER .................................................... 10
3.2 EPISODE ZWEI: DIE POLITISCHE INSZENIERUNG DES IRAKKRIEGS ................................. 11
3.2.1 DER WEG ZUM IRAKKRIEG ................................................................................................. 11
3.2.2 DIE REDE VON US-AUßENMINISTER COLIN POWELL VOR DEM UN-SICHERHEITSRAT ..... 12
3.2.3 DER EFFEKT VON COLIN POWELLS REDE AUF DEN UN-SICHERHEITSRAT, DIE US-
BEVÖLKERUNG UND DIE US-MEDIEN ......................................................................................... 15
3.3 DRITTE EPISODE: MISSION ACCOMPLISHED ..................................................................... 18
3.3.1. AUSGANGSSITUATION DER REDE ...................................................................................... 18
3.3.2 MEDIALE INSZENIERUNG ALS EIN INSTRUMENT DER POLITISCHEN ZIELERREICHUNG ...... 18
3.3.3 EFFEKTE DER MEDIALEN INSZENIERUNG AUF MEDIEN UND REZIPIENTEN ........................ 24
4. SCHLUSSBETRACHTUNG UND ÜBERSICHT DER ANALYSEERGEBNISSE ...... 25
II. LITERATURVERZEICHNIS ......................................................................................... 27
III. ANHANG.......................................................................................................................... 33
REDE DES US-PRÄSIDENTEN GEORGE W. BUSH AM 01.05.2003 ................................................ 33
2
1. Einleitung
Der 11. September 2001 ist als ein Tag des Schreckens in die Weltgeschichte eingegangen, der
weitreichende politische Konsequenzen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene mit sich brachte. Die Anschläge, bei denen circa 3000 Menschen ums Leben kamen,
veranlassten Staaten auf der ganzen Welt zur Verschärfung ihrer bestehenden Terrorgesetze
(vgl. Sarre 2012). Die Bush-Administration formulierte als direkte Reaktion auf das Attentat
den Krieg gegen den Terror als oberste politische Priorität. Nach dem Einmarsch in Afghanistan
kam es im März 2003 zum Irakkrieg. Erst neun Jahre danach, unter der Führung von Präsident
Obama, sollten die letzten US-amerikanischen Truppen wieder aus dem Irak zurückkehren (vgl.
Spiegel 2011a). Der Krisenregion nach dem Sturz Saddam Husseins zu Stabilität und
Demokratie zu verhelfen scheint jedoch nicht geglückt zu sein, Berichten zufolge ist die
Sicherheitslage im Land heute immer noch sehr schlecht (vgl. Spiegel 2011b). Dass Saddam
Hussein nicht mit der sich zu den Anschlägen bekennenden Al Qaida kooperiert hatte gilt längst
als erwiesen (vgl. Welt 2008), die Existenz von Massenvernichtungswaffen als unwahr. Trotz
allem schaffte es die US-Regierung diesen Krieg vor der Bevölkerung zu legitimieren.
Im Folgenden wird veranschaulicht, wie US-amerikanische mediale und politische Akteure
nach dem 11. September bewusst mediale Inszenierungsstrategien einsetzten, um bestimmte
Ziele, wie die Legitimation des Irakkriegs, zu erreichen. Durch die bewusste Inszenierung auf
visueller und verbaler Ebene werden die Rezipienten – die internationale und US-amerikanische
Öffentlichkeit – in ihrer kognitiven und affektiven Wahrnehmung beeinflusst, was sich
wiederum auf ihre Urteilsbildung auswirkt.
Diese Arbeit widmet sich nun der Frage, in welcher Weise die ausgewählten Ereignisse um den
11.September verbal und visuell inszeniert wurden. Es wird analysiert, welche Instrumente
herangezogen bzw. welche Mechanismen durch die Inszenierungsstrategien ausgelöst wurden.
Um dies zu beantworten, wird in drei Fallbeispielen (Episoden) die Verwendung medialer
Inszenierungsstrategien untersucht. Betrachtet werden die Akteure, die hinter der Inszenierung
stehen und die Rezipienten, die von dieser betroffen sind. Darüber hinaus werden die bewusst
eingesetzten Mittel der jeweiligen Akteure aufgezeigt. Anschließend wird auf die
hervorgerufenen Effekte auf Rezipienten Seite eingegangen. Am Ende der Arbeit werden in
einer Übersicht die verschieden Episoden mit den jeweiligen Akteuren, Inszenierungsmitteln
und ausgelösten Effekten veranschaulicht.
In den ausgewählten Episoden wurden im Rahmen der Analyse neben literarischen Werken,
mediale Darstellungsformen wie Zeitungsartikeln, Bildmaterialien und Videobeiträge
einbezogen. Den theoretischen Rahmen für die Arbeit bilden Ansätze aus der
Medienwirkungsforschung, welche zu Beginn dargelegt werden.
3
2. Theorieansätze
Den für diese Arbeit übergeordneten Theorieansatz stellt das sogenannte Agenda-Setting dar. Es
erklärt den Prozess, wie Nachrichten auf die Agenda des öffentlichen Diskurses gelangen. Bei
den beiden anderen Ansätzen, dem Medien-Framing und -Priming, handelt es sich um
Erweiterungen des Agenda-Settings, wobei ersteres die Themen interpretatorisch einordnet und
letzteres die affektive Auswirkung der Medien auf den Rezipienten beschreibt. Im Folgenden
werden die drei Theorieansätze und deren Funktionsweise näher erläutert.
2.1 Agenda-Setting
von Anne Gottwald
Die Theorie des Agenda-Settings basiert auf der Annahme Bernhard C. Cohens (1963), nach der
die Medien bestimmen, mit welchen Themen sich die Menschen auseinandersetzen und somit
festlegen, welche Themen auf die Tagesordnung (Agenda) dieser gelangen. Der Fokus liegt
hierbei auf dem kognitiven Effekt der Massenmedien auf den Rezipienten (vgl. Schenk 2002:
399). Nach Schenk besteht die Agenda-Setting-Funktion der Massenmedien in der Fähigkeit,
„das Wissen und Denken des Publikums zu strukturieren und auch Wandlungsprozesse in den
Kognitionen zu bewirken.“ (ebd.: 400). Bei dieser ersten Komponente, dem sogenannten
Medien-Agenda-Setting, werden durch die Medienakteure Aspekte, bzw. Eigenschaften eines
Gegenstandes/Person hervorgehoben, wohingegen andere nicht thematisiert werden.
Die Themenauswahl und -strukturierung durch die Medien soll eine Dezimierung der auf den
Rezipienten einwirkenden Informationsflut herbeiführen und es dem Rezipienten erleichtern ein
eigenes Bild von der Realität zu entwickeln. Es kommt zu einer Komplexitätsreduzierung.
Durch die Selektion und die gegebenen Anstöße wird dem Rezipienten eine bestimmte
Richtung innerhalb der Informationsverarbeitung vorgegeben (vgl. ebd.: 400ff.). McCombs und
Shaw stellten 1972 mittels der Chapel-Hill-Studie fest, dass Parallelen zwischen den
Themenschwerpunkten der Medien (Medienagenda) und den präferierten Themen der
Rezipienten (Publikumsagenda) zu beobachten sind. Diese Verbindung zwischen den in den
Medien porträtierten Themen und den auf die Publikumsagenda gelangenden Themen fällt unter
die Komponente des Publikums-(Public) Agenda Settings. Als dritte Komponente ist das
Policy-Agenda-Setting zu nennen, welches den Zusammenhang von öffentlicher Meinung und
den Entscheidungen der führenden Politiker darstellt und gemeinsam mit den vorherigen
Komponenten das Dreieck der politischen Kommunikation bildet. Diese drei Bereiche stehen
zueinander, sowie auch zu den Indikatoren und Ebenen ihrer Umwelt, in komplexen
Wechselverhältnissen (vgl. ebd.: 404).
Beim eigentlichen Agenda-Setting steht die Relevanz von Themen und Objekten im
Vordergrund. Unter den Kommunikationswissenschaftlern ist darüber hinaus häufig von einer
zweiten Ebene des Agenda-Settings (Second-Agenda-Setting) die Rede, auf welcher die
Attribute und Eigenschaften von Objekten, Personen etc. ausschlaggebend sind. Darunter fallen
die Aspekte des Framings und Primings, welche kognitive und affektive Auswirkung der
4
Medien herbeiführen und in den folgenden Punkten dieser Arbeit von Relevanz sein werden
(vgl. Schmid-Petri 2011: 60).
2.2 Medien-Framing
von Larissa Meltem Ordu
Das Framing-Konzept knüpft an das Agenda-Setting an. Während letzteres durch Selektion
bestimmt, über welche Themen Rezipienten nachdenken und somit die wahrgenommene
Wichtigkeit von Sachverhalten beeinflusst (vgl. Dahinden 2006: 84), wird durch das Framing
(englisch frame: Rahmen) den zuvor selektierten Themen ein Bezugs- oder Interpretations-
rahmen gegeben (vgl. Maurer 2010: 77). Beide Ansätze sind dem Sozialkonstruktivismus
zuzuordnen, da sie die Realitätswahrnehmung beeinflussen (vgl. Dahinden 2006: 85). Genauer
definiert Entmann den Begriff des Medien-Framing als einen „[...] Prozess, bei dem einzelne
Realitätsausschnitte so hervorgehoben werden, dass den Rezipienten bestimmte
Problemdefinitionen, kausale Interpretationen, moralische Bewertungen oder Handlungs-
empfehlungen nahegelegt werden.“ (Maurer 2010: 78). Auch die Auslassung bestimmter
Aspekte ist eine Form des Framings (vgl. Schmid-Petri 2012: 63) und schmälert somit
alternative Sichtweisen des Individuums (Schenk 2007: 315). Generell sollen frames dem
Rezipienten die Informationsaufnahme und -verarbeitung in einer vielfältigen Medienlandschaft
erleichtern (vgl. ebd.). Wie auch beim Agenda-Setting und Medien-Priming werden bestimmte
Realitätsaspekte hervorgehoben, um dem Rezipienten das Thema leichter zugänglich zu machen
(Accessibility-Effekt). In einem zweiten Schritt aktiviert die vorgegebene Perspektive (frame)
bestimmte Gedanken und Interpretationen beim Rezipient, welche wiederum dessen
Urteilsbildung beeinflussen (Applicability-Effekt) (vgl. Maurer 2010: 79). So wird der Irakkrieg
als gerechter Krieg gegen den Terror geframet. Dieser Deutungsrahmen kann durch die direkte
Verwendung des Bergriffs War on Terror1 entstehen. Auch die Berichterstattung über die Opfer
vom 11. September kann die Befürwortung des Irakkrieg steigern, da durch den Bezugsrahmen
zu den Opfern eine eindeutig negative Konnotation des Iraks hervorgerufen wurde (vgl. ebd.).
Sowohl mediale als auch politische Akteure können durch frames dem Rezipienten eine
bestimmte Sichtweise auf Sachverhalte nahelegen. Frames können als roter Faden für
aufeinanderfolgende Ereignisse dienen und diese in einen größeren Sinnzusammenhang setzen,
was durch Metapher- und Bildverwendung zusätzlich verstärkt wird (vgl. Schenk 2007: 315).
Folgende generische frames2 werden in den Medien in Verbindung mit Kriegsberichterstattung
häuft verwendet: Konfliktframes, in deren Mittelpunkt der Konflikt zweier oppositionärer
Gruppen stehen; Personalisierungsframes, die ihren Fokus auf bestimmte, in das Geschehen
involvierte Personen legen; Konsequenzframes, die Folgen einer Entscheidung oder Handlung
1 Der War on Terror wurde nach dem 11.Septmeber zu einem Eigenbegriff, mit dem die Bush-
Administration den Kampf gegen Staaten wie Afghanistan oder den Irak begründeten (vgl. Vultee 2007:
1). Daher wird der Begriff im Folgenden groß geschrieben. 2 Generische frames sind themenunabhängig und finden in der gesamten Medienberichterstattung
Anwendung (vgl. Maurer 2010: 80).
5
thematisieren und Verantwortungsframes, die einem Subjekt Verantwortung für ein Problem
zuweisen (vgl. Maurer 2010: 80; Schenk 2007: 316).
2.3 Medien-Priming
von Theresa Frank
Der Priming-Ansatz kann als zweite Erweiterung des Agenda-Setting Ansatzes verstanden
werden. Während durch das Agenda-Setting die Medienkonsumenten kognitiv beeinflusst
werden, erklärt der Priming-Ansatz die affektive Auswirkung der Medien auf den Rezipient. Im
psychologischen Kontext bezeichnet Priming (englisch: Vorbereitung) allgemein die
Auswirkung eines wahrgenommenen Ereignisses auf die Rezeption und Bewertung eines
zeitlich späteren Umweltereignisses (vgl. Schenk 2007: 305). Im Falle des Medien-Primings
aktivieren die Medieninhalte andere, inhaltlich in Bezug stehende Wissenseinheiten des
Rezipienten, die dann zur späteren Beurteilung, etwa von politischen Akteuren oder
Ereignissen, herangezogen werden (vgl. Schenk 2007: 305f.). Bedeutend ist, dass dieser
Einfluss von kurzfristiger Dauer ist, im politischen Kontext etwa über zwei Monaten anhalten
kann (vgl. Roskos-Ewoldson et al. 2009: 74f.).
Die US-amerikanischen Politikwissenschaftler Shanto Iyengar und Donald R. Kinder
untersuchten den Priming-Effekt erstmals in einer Studie, in der neben der Agenda-Setting
Hypothese auch der Einfluss der TV-Medienagenda auf die politischen Bewertungskriterien der
Fernsehzuschauer zum Teil belegt wurde (vgl. Iyengar et al. 1987: 63ff.). Sahen die Probanden
überwiegend Fernsehberichte zum Thema Verteidigung, bewerteten sie anschließend die
Gesamtperformance des damaligen Präsidenten Carter verstärkt unter diesem Gesichtspunkt
(vgl. Iyengar et al. 1987: 65-69). Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Auswahl der
Medieninhalte durch das Agenda-Setting weiterreichende Auswirkungen auf den Rezipienten
hat: „By calling attention to some matters while ignoring others, television news influence the
standards by which governments, presidents, policies, and candidates for public office are
judged.“ (Iyengar et al. 1987: 63).
Im Rahmen dieser Arbeit erklärt der Priming-Effekt insbesondere die Auswirkungen der von
der Bush-Regierung eingesetzten Instrumente wie Emotionalisierung und Egostereotypisierung.
3. Analyse ausgewählter Episoden des War on Terror
In den folgenden Abschnitten werden drei Episoden medialer Inszenierungen analysiert, die im
Kontext des 11.September als Schlüsselereignisse gesehen werden können und starken Einfluss
auf den Verlauf des War on Terror hatten. Die erste Episode analysiert das Ausgangsereignis
des War on Terror, den Tag der Terroranschläge am 11.September 2001. Dieser wird bezüglich
der von ihm ausgehenden signifikanten Veränderungen in der Welt auch mit der Metapher der
„Zeitenwende“ umschrieben, welche an späterer Stelle (vgl. 3.3.2) näher erläutert wird. Der 11.
September ist der Auslöser des Kriegs gegen den Terror, den die US-Regierung einleitete. Die
zweite und dritte Episode untersuchen zwei politische Reden, die für den Verlauf des War on
6
Terror von großer Bedeutung waren. Zum einen handelt es sich hierbei um die Rede des
Außenministers Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat am 05.02.2003 und zum anderen um
die Rede des damaligen US-Präsidenten George W. Bush auf dem Flugzeugträger USS
Abraham Lincoln am 01.05.2003.
3.1 Erste Episode: Der 11.September 2001
von Anne Gottwald
Die erste Episode behandelt die Darstellung der Terrorangriffe vom 11.September 20013 in den
amerikanischen Medien. Die Berichterstattung über das Ereignis war am Tag selbst sowie in
den darauf folgenden Tagen und Wochen von symbolträchtigen Inszenierungen und besonderer
Rhetorik geprägt. Dies soll im Folgenden veranschaulicht werden. In dieser ersten Episode liegt
der Fokus primär auf den visuellen Inszenierungsstrategien der Medien.
3.1.1 Das Ereignis des 11.September 2001 und seine mediale Darstellung
Am 11. September 2001 steuerten islamistische Attentäter zwei entführte Flugzeuge in die
Türme des World Trade Centers (WTC) in New York. Eine dritte Maschine wurde in das
Pentagon gelenkt und eine vierte stürzte über Pennsylvania ab. Bei den Anschlägen kamen ca.
3.000 Menschen ums Leben (vgl. Hen/dpa/dapd 2012).
Am Tag der Anschläge ging von den medial verbreiteten Bildern eine enorme Wirkung aus,
welche durch die Verwendung von Symbolen zusätzlich verstärkt wurde. Zu beobachten war,
dass in den Tagen nach dem 11.September in der amerikanischen Presse lediglich sechs
verschiedene Fotomotive auf den Titelseiten verwendet wurden. Dieses Phänomen hatte den
Effekt, dass ein kollektives Bildgedächtnis erschaffen und ein beinahe identisches Narrativ des
Ereignisses entworfen wurde (vgl. Scholz 2011). Durch den einheitlichen Mediendiskurs wurde
eine bestimmte Sichtweise eingenommen, welche die unterschiedlichen Mediengattungen
übernahmen. Die visuelle Rhetorik der Bilder wurde durch die verbale Rhetorik4 in den Medien
verstärkt und bewirkte, dass sich die Bilder und die mit ihnen verbundenen Gefühle fest im
Gedächtnis der Rezipienten verankerten. Es ist anzunehmen, dass die Anschläge vom 11.
September auf ihre Medienwirkung hin kalkuliert wurden und auf die Symbolhaftigkeit ihrer
Bilder hin ausgerichtet waren. Die Intention der Terroristen, ihren Gegner gezielt zu demütigen
und Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung zu schüren, wurde erfüllt (vgl. Brosda 2002:
56). Die von den Terroranschlägen getroffenen Gebäude waren symbolische Stellvertreter
gewisser Machtkomplexe und galten als „globale Symbole“ Amerikas. Das WTC symbolisierte
den westlichen Kapitalismus und stand für die finanzielle und wirtschaftliche Potenz der USA.
Es kann im Bezug auf die Anschläge des 11. September als die zivile Seite der Katastrophe
gesehen werden, wohingegen das Pentagon als Symbol der US-Militärmacht zu verstehen ist
und an diesem Tag als militärisches Ziel fungierte (vgl. Hartwig 2011: 32). Der gezielte
3 Im Folgenden abgekürzt mit 11.September. 4 Die einheitliche Verwendung bestimmter Begriffe wird im Folgenden noch verdeutlicht.
7
Versuch, jene amerikanischen Machtzentren zu zerstören, kann als symbolischer Angriff
gewertet werden (vgl. Brosda 2002: 56).
Durch sogenannte Loops, pausenlose Wiederholungen immer gleicher Bilder und Videos,
verankerten sich die Fernsehbilder tief im Bewusstsein der Rezipienten. Dies führte dazu, dass
mit dem Motiv der Zerstörung der Türme ein ikonisches Bild der Anschläge entstand (vgl. ebd.:
56f.). Bei den Ereignissen des 11. Septembers lässt sich zudem das kognitionspsychologische
Phänomen der Blitzlichterinnerung beobachten. Hierbei wird durch die emotionale
Bedeutsamkeit der Bilder das visuell Wahrgenommene zu einer kollektiv geteilten Erfahrung,
welche sich im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung verankert. Auslöser der
Blitzlichterinnerung sind die Aufnahmen der Zerstörung der Zwillingstürme, die das zentrale
Motiv der Medienberichterstattung des 11.Septembers darstellten. Ein wiederholter Anblick
dieser Bilder ruft bei den Menschen genau jene Gefühle hervor, welche sie zum Zeitpunkt des
Ereignisses empfunden haben (vgl. Hartwig 2011: 32).
Am Ereignistag selbst sowie in den darauf folgenden Tagen war das Fernsehen das am stärksten
frequentierte Medium. Es fungierte durch seine dominante Rolle bei der Erstinformation als
„Alarmmedium“ und vermittelte den Eindruck einer scheinbar ungefilterten Wiedergabe der
Wirklichkeit. Das Fernsehen erweckt bei den Rezipienten den Eindruck hoher Glaubwürdigkeit,
Authentizität und Aktualität und impliziert mittels seiner Bilder eine starke emotionale
Wirkung. Dem Medium Fernsehen kommt hierbei eine Verstärkerfunktion zu (vgl. Brosda
2002: 63ff.). Die Analogie der Schreckensbilder des 11.September zur Bilderwelt Hollywoods
und das aus diesen herrührende „Déjà-vu“-Erlebnisses seitens vieler Rezipienten forcierte die
Fassungslosigkeit jener zusätzlich (vgl. ebd.: 59). Das starke Bedürfnis nach einer
Visualisierung und somit möglichen Realisierung der Ereignisse aufgrund des Schocks wurde
durch das Fernsehen gestillt. Durch die zeitliche Unmittelbarkeit der Medienberichterstattung
entstand eine „Illusion des Dabeiseins“ und der Begriff des „universalen Augenzeugen“ wurde
geschaffen (vgl. ebd.: 67). Nach Brosda reduziert „Die dichte Verknüpfung von optischen und
akustischen Reizen, Einstellung und Bewegung, symbolischen und ikonischen Zeichen [...] die
Distanz zum Gesehenen.“ (ebd.). Dieser geschaffene Eindruck physischer und zugleich
psychischer Nähe verstärkt die Illusion des Rezipienten Teil des Geschehens zu sein.
3.1.2 Erste Erklärungsversuche und Legitimationsansätze der Folgehandlungen des
11.September
Unmittelbar nach den Anschlägen auf das WTC war das Problem einer verbalen
Unzugänglichkeit (typisches Symptom für psychoanalytische Traumata) auf Seiten der
Medienakteure und Politiker, als auch in der Bevölkerung zu bemerken. Es bedurfte einer
unmittelbaren Erklärung des Geschehenen. Um die Schwierigkeit einer Einordnung und
Erklärung der Ereignisse zu überwinden, wurde versucht einen historischen Bezug herzustellen
8
und die folgenden Handlungen der US-Regierung durch Erklärungsmuster aus der
Vergangenheit zu legitimieren. So referierten die Medien kurz darauf auf das Ereignis Pearl
Harbor und den zweiten Weltkrieg und versuchten auf diesem Wege das Geschehnis des
11.Septembers als Angriff bzw. Kriegserklärung darzustellen (vgl. Hartwig 2011: 34ff.). Dieser
Bezug auf die amerikanische Historie wurde in allen Medien kritiklos in Sprache und
Sendeprogrammen übernommen und es wurde von einem „Zweiten Pearl Harbor“ und einem
„Neuen Tag der Schande“ getitelt (vgl. ebd.). Die im amerikanischen Gedächtnis fest verankerte
Ikonografie um Pearl Harbor und die damit verbundene Vorstellung eines heimtückischen
Angriffs, verstärkte die Bedeutungskraft der Bilder vom 11.September und hatte in der
amerikanischen Bevölkerung erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung von Selbst- und
Feindbild. Die Konstruktion eines Feindlich-Fremden führte zu einer Bestärkung des
amerikanischen Nationalgefühls und förderte den Zusammenhalt gegen den neu definierten
Feind. Pearl Harbor und der 11.September können als nationale Traumaerfahrungen gesehen
werden, welche einen identitätsstiftenden Effekt mit sich brachten. Im Fall des 11. Septembers
wurde der Rückgriff auf die Terminologie von Pearl Harbor und dem zweiten Weltkrieg gezielt
eingesetzt und die damit einhergehende Traumaerfahrung funktionalisiert, um den
anschließenden Krieg gegen den Terror zu rechtfertigen (vgl. ebd.). Durch das Erschaffen eines
Deutungsrahmens (Framing) mittels der Begriffe Krieg und Verbrechen wurde das Ereignis
bewusst mit einem bestimmten Interpretationsansatz versehen. Darüber hinaus wurden die
Dämonisierung des Gegners und die Definition eines Feindbildes, geprägt durch Dichotomien
und Stereotype, als Legitimationsstrategien herangezogen (vgl. Kirchhoff 2010: 32ff.). Auf die
verbalen Inszenierungsstrategien und den gezielten Einsatz von Rhetorik, vor allem auf Seiten
der amerikanischen Regierung, wird in den folgenden Episoden verstärkt eingegangen.
Durch die stark ereignisorientierte Berichterstattung über den 11. September und seine Folgen
kann von einem medialen Großereignis gesprochen werden. Zusätzlich kann aufgrund der
Kohärenz zwischen den Fernsehbildern und der Ästhetik von Hollywood-Filmen sowie einer
spezifischen Rhetorik auf Seiten von Medien und Politik, eine bewusste Inszenierung des
Ereignisses unterstellt werden (vgl. ebd.: 21ff.).
Die Kommunikations- und Medienwissenschaftler Elihu Katz und Daniel Dayan entwickelten
den Theorieansatz des sogenannten Medienereignisses (Media Event). Ihnen zufolge handelt es
sich hierbei um besondere Geschehnisse, welche die alltägliche Routine der Menschen sowie
die Medienberichterstattung unterbrechen (Breaking News) und weltweite Aufmerksamkeit
erlangen. Sie werden live übertragen, sind zumeist medienextern strukturiert und in ihrer
Produktion im Voraus geplant (vgl. Dayan/Katz 1994: 5ff.). Darüber hinaus haben
Medienereignisse die Eigenschaften eine große öffentliche Reichweite zu erlangen und
kommunikativ verdichtet dargestellt zu werden. Sie bringen eine gemeinschaftsbildende Kraft
mit sich und erzeugen durch ihre spezifische „Aura“ emotionale Ergriffenheit auf Seiten der
Rezipienten (vgl. Bösch 2010). Zudem werden sie nicht als gewöhnliche Nachrichten
9
aufgefasst, da sie von den Medien mit historischer Bedeutung aufgeladen und somit in gewisser
Weise von diesen inszeniert werden. Dayan und Katz beschreiben jenen Vorgang mit dem
Ausdruck „live broadcasting of history“ (vgl. ebd.). Nach den Beobachtungen des
Medientheoretikers Jean Baudrillard kommt es gegenwärtig vermehrt dazu, dass „medial ein
mediales Ereignis produziert wird und zwar völlig unabhängig davon, ob ein reales
Referenzereignis existiert oder nicht.“ (ebd.: 198) Hierbei sind es die Medien, die Realität
produzieren. Abschließend kann festgehalten werden, dass bestimmte Ereignisse erst zu einem
Medienereignis werden indem sie narrativiert werden. Durch die Eingliederung in einen
bestimmten Kontext gewinnen sie an Bedeutung und werden mittels bestimmter Medienformate
und medialer Erzählformen zu einem außergewöhnlichen Ereignis geformt (vgl. Bösch 2010).
3.1.3 „Ground Zero Spirit“ - Beispiel einer visuellen Inszenierung
Bei dem Bild „Ground Zero Spirit“ (Abb.1) handelt es sich um eine Fotografie von Thomas E.
Franklin, welche drei Feuerwehrmänner zeigt, die auf den Trümmern des WTC die US- Flagge
hissen. Jene Fotografie entstand am 11. September und stellt eine Analogie zu dem Bild „Hissen
der Flagge auf Iwojima“ (Abb.25) von Joe Rosenthal aus dem Jahr 1945 dar. Die Fotografie
Rosenthals zeigt sechs Marinesoldaten, die während der Schlacht um Iwojima/Japan die US-
Flagge auf einem Berg hissen. Jene Soldaten werden in den USA seither als Kriegshelden
verehrt und die Fotografie Rosenthals wurde zu einer Ikone erhoben, welche einen bedeutenden
Platz im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner einnimmt. Sie gilt als „eine der meist
reproduzierten Fotografien in der Geschichte der USA“ und symbolisiert nach Chéroux
„gleichzeitig den Sieg über Japan und die Revanche für Pearl Harbor“ (Scholz 2011).
Abb. 1 Abb.2
Die visuelle Rhetorik der beiden Bilder verbirgt sich in ihrer Beziehung zueinander und in der
gleichartigen Verwendung von Zeichen. Der zentrale Symbolcharakter dieser Bilder steckt in
der Handlung des Flaggehissens, welche in beiden Fällen als bewusst symbolischer Akt
gewertet werden kann, da sich dahinter das Zeichen für Sieg verbirgt (vgl. Dülffer 2006). Die
amerikanische Fahne ist Kulturgut und steht als Symbol für Freiheit, Toleranz und Demokratie.
Sie ist in Amerika von hoher symbolischer Relevanz und mobilisiert bei nationalen Krisen ein
Gefühl von Gemeinschaft. Gleichzeitig erzeugt die US-Flagge in der Bevölkerung die Vision
5 Quelle Abb. 1 sowie Abb. 2: Tagesspiegel (2011).
10
einer kollektiven Identität (Schicha 2007: 177ff.). In Anbetracht des Kontextes der jeweiligen
Fotografien handelt es sich jedoch in beiden Fällen um eine verfrühte Siegespräsentation der
Amerikaner, da 1945 zu diesem Zeitpunkt der Ausgang der Schlacht noch nicht entschieden war
und 2001 in der abgelichteten Situation der Krieg noch nicht einmal begonnen hatte. Im Fall des
11.September kann jene verfrühte Siegeshandlung als bewusste Provokation Amerikas
gegenüber den Terroristen interpretiert und gleichzeitig als ein Wiedererstarken nach der tiefen
Demütigung durch die Terrorangriffe gesehen werden (vgl. Scholz 2011).
Die Fotografie Franklins erlangte volle mediale Aufmerksamkeit und war in der nationalen und
internationalen Presse vertreten. Die Inszenierung des Bildes liegt in der Referenz auf den
zweiten Weltkrieg und der in diesem Zusammenhang durchgeführten Schlacht der Amerikaner
um die japanische Insel Iwojima. Jener Bezug macht nach Chéroux deutlich, „dass man die
Absicht hatte, über den 11. September als Kriegshandlung zu berichten“, bei welcher man auf
„ein vergleichbares Ende hoffte“. (ebd.). Anhand dieses Beispiels wird die Signifikanz von
Ikonen deutlich. Indem Bildern in Relation mit historischen Ereignissen eine bestimmte
Bedeutsamkeit zukommt und diese Bilder zudem mit Empfindungen und Werten aufgeladen
werden, verankern sie sich fest im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Solche Ikonen stellen
in unerklärlich anmutenden Situationen wie dem 11. September eine Orientierungshilfe dar und
bieten den Menschen eine erste Möglichkeit zur Interpretation des Geschehenen (vgl. ebd.).
3.1.4 Das „Rally around the flag“-Phänomen und die Entwicklungstendenzen des
amerikanischen Journalismus seit dem 11. September
Vor allem in Krisenzeiten ist der Einfluss der Politik auf die Medienberichterstattung deutlich
zu bemerken. Der amerikanische Politologe John Mueller erforschte das sogenannte Rally
around the flag-Phänomen, welches sich durch eine Veränderung des Wechselspiels zwischen
politischer Elite und Medien im Zusammenhang mit internationalen Krisen äußert. Zu
beobachten ist, dass die Medien in diesen Zeiten oftmals verstärkt der Regierungsmeinung
folgen, „was einerseits auf einen eingeschränkten Informationsfluss und andererseits auf
patriotische Motive zurückgeführt werden kann.“ (Löb/Weinmann 2003: 1)
Pearl Harbor und der 11. September können als prototypische Beispiele für diesen Effekt
gesehen werden. Nach Mueller müssen drei Faktoren vorliegen, damit von einem Rally around
the flag-Effekt gesprochen werden kann: Erstens muss das Ereignis international sein, zweitens
müssen die USA und der US-Präsident involviert sein und drittens muss es im Fokus der
öffentlichen Aufmerksamkeit liegen (vgl. Perrin/Smolek 2009). Laut Mueller nimmt durch das
besagte Phänomen die Beliebtheit des Präsidenten kurzzeitig stark zu. So stieg der
Beliebtheitsgrad von Präsident George W. Bush unmittelbar nach den Terroranschlägen vom
11. September um 35 Prozent an und Bush erreichte 11 Tage darauf mit 90 Prozent
Zustimmungsrate das höchste Ergebnis in der Wahl-Geschichte der USA. Im November 2002
11
war der Wert zwar wieder um 22 Prozent gesunken, lag jedoch mit 68 Prozent immer noch über
dem Wert der Zeit vor dem 11. September (51 Prozent). Mit einer Dauer von über einem Jahr
war dies der bis dato am längsten anhaltende Rally around the flag-Effekt (vgl.
Hetherington/Nelson 2003: 37). In Krisenzeiten wird der amerikanische Präsident von der
Bevölkerung als lebendes Symbol für nationale Einheit und Macht gesehen. Das Volk
unterstützt den Präsidenten durch Zustimmung und bringt dadurch seinen Patriotismus zum
Ausdruck (vgl. ebd.).
Die Berichterstattung des 11. Septembers hat die amerikanischen Medien nachhaltig verändert.
Durch den oben beschriebenen einheitlichen Mediendiskurs und die sichtliche Orientierung an
der Regierungslinie brachen die Medien deutlich mit „[...] den publizistischen Grundsätzen von
Objektivität, Ausgeglichenheit, Wahrheit und Transparenz der Quellen.“ (Gross/Stapf 2002:
137) Durch eine kritiklose Übernahme von Regierungsinformationen sowie mangelnder
Selbstreflexion und fehlender Hintergrundanalysen der Medien wurde die Herausbildung eines
freien öffentlichen Diskurses bewusst unterbunden (vgl. ebd.: 135). Zensurbestrebungen der
Regierung wurden von den Medienakteuren befolgt und ihre patriotisch geprägte Sprache
übernommen. Die regelrechte Gleichschaltung der amerikanischen Presse basierte auf dem
Hintergrund wirtschaftlicher und politischer Abhängigkeiten der Medienakteure und damit
einhergehenden Profitbestrebungen (vgl. Arnold 2008). Ein Meinungs- und
Perspektivenpluralismus blieb aus (vgl. Gross/Stapf 2002: 136f.). Diese unübersehbare Nähe
des amerikanischen Journalismus zu den politischen Akteuren und deren Folgen ist ein
Phänomen, welches sich in besonderer Form seit dem 11. September 2001 in den USA
beobachten lässt.
Nachdem in diesem Teil die Medien als Akteure im Mittelpunkt der Betrachtung standen soll in
der folgenden Episode der Fokus auf die verbalen Inszenierungsstrategien der amerikanischen
Politiker gerichtet werden.
3.2 Episode zwei: Die politische Inszenierung des Irakkriegs
von Larissa Meltem Ordu
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie politische Akteure in den USA die Ereignisse des 11.
September so inszenierten, dass der Irakkrieg von einer breiten Mehrheit der US-Bevölkerung
befürwortet wurde. Dazu wird die Rede des US-Außenminister Colin Powell vor dem UN-
Sicherheitsrat im Februar 2003 als Fallbeispiel analysiert und die Darstellung dieses politischen
Ereignisses in den US-amerikanischen Medien untersucht.
3.2.1 Der Weg zum Irakkrieg
Als direkte Reaktion auf den 11. September formulierte die US-Regierung den War on Terror
als politisches Ziel, und bereits 26 Tage nach den Anschlägen begann die Operation Enduring
12
Freedom6 in Afghanistan (vgl. Viehrig 2008: 135). Sie endete mit dem Sturz der Taliban und
der Installation einer demokratischen, US-freundlichen Regierung. Auch ein Vorgehen gegen
den Irak wurde bereits am 12. September 2001 von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld
angesprochen, jedoch zeigten sich US-Außenminister Collin Powell und Bushs Berater
skeptisch, da gegen den Irak und für dessen Beteiligung an den Anschlägen des 11. September
bis dato keine Beweise vorlagen. Trotzdem ließ Bush diesbezüglich genauere Untersuchungen
anstellen, da er plante, auf das Irakthema zu einem späteren, ihm passenderen Zeitpunkt zurück
zu kommen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz und Vizepräsident Cheney
bemühten sich besonders, das Irakthema immer wieder auf die politische Agenda zu bringen
und beeinflussten die US-Außenpolitik diesbezüglich stark. Cheney betonte, wenn auch nur die
einprozentige Chance bestehe, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besäße, so müsse
umgehend gegen ihn vorgegangen werden. Diese Aussage wurde später als Cheney-Doktrin
bezeichnet. In seiner Rede zur Lage der Nation im November 2001 nannte Bush Saddam
Husseins Namen zum ersten Mal in Verbindung mit atomaren Waffen und machte deutlich,
dass sein Krieg gegen den Terror sich nicht nur an Gruppen wie Al Qaida oder die Taliban
richte, sondern auch an Staaten, die solche unterstützen. Ermutigt von dem raschen
Regimewechsel in Afghanistan kam es am 20. März 2003 zur Invasion des Iraks unter dem
Namen Operation Iraqi Freedom7 (vgl. Bierling 2010: 32ff.).
3.2.2 Die Rede von US-Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat
Am 5. Februar 2003 klagt Powell den Irak vor dem UN-Sicherheitsrat an, gegen die UN-
Resolution 1441 verstoßen zu haben, welche die Abrüstung des Iraks vorsieht und wirft dem
Land zusätzlich den Besitz von Massenvernichtungswaffen vor (vgl. Bierling 2010: 60f.). Des
Weiteren behauptet Powell, Saddam Hussein arbeite mit terroristischen Gruppen wie der Al
Qaida zusammen und beliefere diese mit atomaren Waffen. Somit stünde, laut Powell, der Irak
in direkter Verbindung mit dem Ereignis des 11. September. Saddam Hussein verstoße
außerdem gegen Menschenrechte und gehe gewaltsam gegen sein eigenes Volk vor (vgl.
Lütterfelds 2008: 113). All diese Anklagen, so versichert Powell, seien „[…] facts and
conclusions based on solid intelligence.“ (Powell 2003)
Powells Anstrengung, die UNO von der Notwendigkeit eines Irakkrieges zu überzeugen, lässt
sich mit dem Analyseansatz der Securitization von Buzan und Weaver erklären. Securitization
wird definiert als
„[…] der subjektive Prozess, durch den ein gegenseitiges Verständnis zwischen
Subjekten einer Gemeinschaft hergestellt wird, etwas als existentielle Bedrohung eines
wertvollen Gegenstandes zu behandeln und die Einforderung dringender und
6 Die Operation Enduring Freedom war neben der Internationalen Schutzgruppe Isaf ein militärisches
Operationsfeld in Afghanistan, die sich dem Kampf gegen den Terror widmete (vgl. Spiegel 2007). 7 Die Operation Iraqi Freedom hatte den Sturz von Saddam Husseins Regime und die Beseitigung
atomarer Waffen im Irak zum Ziel (vgl. Dale 2009: 1).
13
außerordentlicher Maßnahmen zu ermöglichen, um mit dieser Bedrohung fertig zu
werden.“ (Buzan/Weaver 2003: 491)
In diesem Fall sind die Subjekte einer Gemeinschaft die Vereinten Nationen, zwischen denen
Powell ein gegenseitiges Verständnis darüber schaffen will, dass der Irak und seine
Massenvernichtungswaffen eine existentielle Bedrohung des wertvollen Gegenstandes der
amerikanischen, aber auch der internationalen Sicherheit darstellen. Damit will er das Ziel der
US-Regierung erreichen, die dringende und außerordentliche Maßnahme des War on Terror zu
legitimieren. Securitization dient also der Legitimierung und Begründung von Sicherheits- und
Außenpolitik (vgl. Werner 2011: 434).
Die (inter)nationale Sicherheit wird in dieser Definition dem Sozialkonstruktivismus
zugeordnet, da es sich um ein subjektiv wahrgenommenes Gut eines politischen Akteurs, in
diesem Fall der US-Regierung, handelt (vgl. ebd). Die Bedrohung der Sicherheit durch den Irak
betont Powell in seiner Rede mehrmals explizit: „Let me now turn to those deadly weapons
programs and describe why they are real and present dangers to the region and the world.“
(Powell 2003) Er konkretisiert die vom Irak ausgehende Gefahr durch die angebliche
Verbindung Saddam Husseins zu Terroristen:
„Our concern is not just about these elicit weapons. It's the way that these elicit
weapons can be connected to terrorists and terrorist organizations that have no
compunction about using such devices against innocent people around the world.“
(ebd.)
Powell spitzt die Bedrohung durch den Irak, der in Besitz von Massenvernichtungswaffen sei,
durch dessen angebliche Kooperation mit Terrornetzwerken zu. Er setzt einen ‚Gut-Böse-
Frame‘, der die unschuldigen Menschen den gefährlichen Terroristen gegenüberstellt. Wie in
Kapitel 2.2 dargelegt wurde, ist diese wertende Gegenüberstellung zweier oppositionärer
Gruppen dem Konfliktframe zuzuordnen. Des Weiteren verweist Powell auf die Dringlichkeit
des Vorgehens gegen Saddam Hussein:
„The United States will not and cannot run that risk to the American people. Leaving
Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction for a few more months
or years is not an option, not in a post-September 11th world.“ (ebd.)
Powell benutzt den Ausdruck einer metaphorischen Zeitenwende nach dem 11. September und
versucht so, den UN-Sicherheitsrat von der Notwendigkeit eines schnellen militärischen
Handelns zu überzeugen. Das traumatische Ereignis des 11. September teilt demnach die Welt
in ein Vorher und ein Nachher und legitimiert außerordentliche Maßnahmen (vgl. Kirchhoff
2010: 179). Die Bush-Regierung zieht aus den Anschlägen vom 11. September also die
Konsequenz, einen War on Terror zu führen. Dieser Konsequenzframe (vgl. 2.2) wird von
Powell durch den Aspekt der Dringlichkeit (Urging) noch verstärkt. So macht der US-
Außenminister im obigen Zitat klar, dass der War on Terror der USA gegen den Irak bereits
beschlossen ist und passives Abwarten keine Option darstellt. Dieses von Powell eingesetzte
Prinzip des Urging dient der Legitimation eines raschen Beginns des Irakkrieges, da es die
14
dringende Pflicht der USA sei, Unschuldige vor einem Attentat zu retten. Die Metaphern ‚time
as no ressource‘ oder ‚time as menace‘ werden auch von Bush und Cheney als Grund für
schnelles militärisches Handeln angeführt (vgl. Dirks 2008: 252). So sagte Bush im Januar 2002
in seiner Rede zur Lage der Nation: „Time is not with us.“ (Bush 2002b) Sicherheitspolitik geht
laut dem Securitization-Ansatz immer mit dem Aspekt der Dringlichkeit einher und deshalb
lassen sich in diesem Bereich besonders effektiv außergewöhnliche Maßnahmen wie Krieg
legitimieren (vgl. Werner 2011: 434).
Die Kriegsphilosophie nach dem 11. September basiert auf der National Security Strategy
(NSS), auch Bush Doktrin genannt, welche die Grundpfeiler der US-Sicherheitspolitik neu
definierte. Mit der NSS berechtigen sich die USA dazu, einen Präventivkrieg8 zu führen. Des
Weiteren besagt sie, dass die USA sich durch internationale Organisationen wie die UNO nicht
in ihrem militärischen Handeln einschränken ließe und schreibt ausschließlich sich selbst die
Rolle des globalen Sicherheitsverteidigers zu (vgl. Bierling 2010: 39f.). Definiert man
Securitization nämlich in einem weiteren Sinne (macro Securitization), versteht man darunter
den eigenen Führungsanspruch in der Sicherheitspolitik langfristig zu legitimieren (vgl.
Gadinger et al. 2008: 739).
Am Ende seiner Rede betont Powell die Verpflichtung der UNO gegenüber der
Weltbevölkerung: “My colleagues, we have an obligation to our citizens, we have an obligation
to this body to see that our resolutions are complied with. We wrote the resolution not in order
to go to war, we wrote it to try to preserve the peace.“ (Powell 2003) Er beschwört das Wir-
Gefühl einer Organisation, die freiheitlich-demokratische Werte vertritt und die es im Ernstfall
auch durch Krieg zu verteidigen gilt, um den Frieden dauerhaft zu sichern. Damit stellt er den
demokratischen Westen nochmals in Kontrast zu dem bedrohlichen Osten. Dieser Frame basiert
auf der Orientalismus-These, formuliert von Edward Said im Jahre 1981. Laut dieser sehe der
demokratische und fortschrittliche Westen den unzivilisierten, dunklen Osten als Feind an (vgl.
Dirks 2008: 252). Bush bezeichnete 2001 in diesem Zusammenhang Staaten wie den Irak, Iran
oder auch Nordkorea als ‚Schurkenstaaten‘ oder ‚Achse des Bösen‘ (vgl. Bierling 2010: 37) und
konstituierte somit eine Ingroup (die USA und ihre Unterstützer im Kampf gegen die Achse des
Bösen) und Outgroup (die Achse des Bösen selbst) (vgl. Dirks 2008: 252). So sagte Bush nach
dem 11. September „Either you are with us or with the terrorists.“ (CNN 2001) und definierte
mit dieser Entweder-Oder-Konstruktion die gegnerische Seite des War on Terror (vgl. Dirks
2008: 252). Erneut werden Konfliktframes zur Vereinfachung von Sachverhalten eingesetzt, um
die Urteilsbildung der Rezipienten im Sinne der Bush-Administration zu beeinflussen und den
Krieg zu legitimieren. Der Regimewechsel im Irak ist der Bush-Administration zufolge als
8 Präventivkrieg meint einen militärischen Angriff, der lediglich auf dem Verdacht einer Bedrohung,
nicht auf einem Beweis, basiert. Er ist völkerrechtlich deshalb nicht legitimierbar (vgl. Bierling 2010: 40).
15
gerechter Krieg zu verstehen, der die Welt sicherer macht (vgl. Kuntz 2007: 28) und
demzufolge mit dem Securitization-Ansatz erklärbar.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich anhand des Securitization-Ansatzes drei
Argumentationslinien der US-Regierung herauskristallisieren. Erstens stellt der Irak eine direkte
Bedrohung für die USA und die Welt dar. Zweitens ist er durch militärische Mittel bezwingbar,
was zu drittens, der dringlichen Einleitung eines Krieges als einzigen, aktiven Ausweg aus der
prekären Situation führt (vgl. Viehrig 2008: 146). Um diese Argumente zu stützen, bedient sich
Powell zusätzlich visueller Mittel wie Graphiken und Satellitenaufnahmen, die den Irak bei der
Produktion von Massenvernichtungswaffen überführen sollen. Der Wahrheitsgehalt dieser
Aufnahmen, so Powell, sei sowohl durch Bildspezialisten des CIA als auch durch
Augenzeugenberichte bestätigt (vgl. Bierling 2010: 60f.).
3.2.3 Der Effekt von Colin Powells Rede auf den UN-Sicherheitsrat,
die US-Bevölkerung und die US-Medien
Um von einer erfolgreichen Securitization sprechen zu können, müssen folgende Bedingungen
erfüllt sein: Powell, der Urheber des Sprechakts stuft das wertvolles Referenzobjekt Sicherheit
als bedroht ein. Gleichzeitig bietet er einen Ausweg für die Notfallsituation durch die
außerordentliche politische Maßnahme der militärischen Intervention des Iraks. Letztendlich ist
dieser Securitization move aber von der Akzeptanz der Bezugsgruppe, dem UN-Sicherheitsrat,
abhängig um als erfolgreiche Securitization bewertet zu werden (vgl. Werner 2011: 435).
Jedoch ließ sich der UN-Sicherheitsrat nicht geschlossen von Powells Rede überzeugen, vor
allem Deutschland und Frankreich sprachen sich für verstärkte Inspektionen im Irak und eine
friedliche Lösung aus (vgl. Spiegel 2003a). Als Russland und Frankreich ihr Veto einlegten
(vgl. Spiegel 2003b) begann die USA ohne UN-Legitimation mit einer „Koalition der
Willigen“ aus 49 Ländern einen eigenständigen Irakkrieg (Spiegel 2003c). Die Securitization ist
auf internationaler Ebene nur teilweise als erfolgreich zu bewerten.
Da die US-Regierung schon zuvor in der NSS den War on Terror im Alleingang beschlossen
hatte, kann vermutet werden, dass Powell mit seiner Rede nur zweitrangig die internationale
Öffentlichkeit von einer Invasion des Iraks überzeugen wollte. Vielmehr wurde durch seine
Rede eine erneute Polarisierung der US-Bevölkerung ausgelöst (vgl. Viehrig 2008: 149).
Während nach Bushs Rede zur Lage der Nation im Januar 2002 57 Prozent der US-Amerikaner
mehr Beweise gegen den Irak forderten, bevor es zu einer endgültigen Invasion kommen
könnte, waren am 5. Februar 2003 71 Prozent der US-Zuschauer, die Powells Rede im
Fernsehen verfolgt hatten, davon überzeugt, der Außenminister habe triftige Gründe für die
Invasion geliefert. 56 Prozent der Zuschauer glaubten, der Irak sei im Besitz von
Massenvernichtungswaffen. Von den US-Bürgern, die Powells Rede nicht im Fernsehen
verfolgt hatten, glaubten dies jedoch nur 21 Prozent (vgl. Bierling 2010: 62). Es lässt sich
16
daraus schließen, dass neben Powells Rhetorik die Wirkung der Bilder zusätzlich einen großen
Einfluss auf die Urteilsbildung der US-amerikanischen Rezipienten hatten und es einen
Unterschied machte, ob das Publikum lediglich verbal adressiert wurde oder aber visuell (vgl.
Werner 2011: 436). Die Bilder verstärkten also die Wirkung der frames, die Powell in seiner
Rede anführte (vgl. 2.2). Außerdem sind Bilder neben Sprache ein effektives Mittel, um
Sicherheitspolitik gekonnt zu kommunizieren (vgl. Werner 2011: 436). Was mit eigenen Augen
gesehen wird hat eine höhere Glaubhaftigkeit, dadurch konnte die Interpretation von Bildern als
Beweis ausgelegt werden (vgl. Palm 2003).
Auch der Mediendiskurs spielte bei der Wiedergabe der Rede Powells eine entscheidende Rolle.
Laut Editor & Publisher9 gab es drei Gruppen von Tageszeitungen, klassifiziert nach ihrer
Haltung zum Irakkrieg: zur ersten Gruppe zählten 15 Tageszeitungen, die den Irakkrieg
befürworteten (u.a. die Washington Post). Die zweite Gruppe, unter die 14 Tageszeitungen
fielen, befürworteten den Irakkrieg unter Vorbehalt. Die New York Times gehörte mit 10
anderen Tageszeitungen der dritten Gruppe an, die den Krieg ablehnte. Mehrheitlich wurde der
Krieg zumindest unter Vorbehalt von den amerikanischen Tageszeitungen befürwortet (vgl.
E&P Staff 2007). So wurden von Editor & Publisher die Artikel der kriegsbefürwortenden
Washington Post am Tag der Rede Powells genauer betrachtet. „Irrefutable“ lautet der Titel
eines Artikels, der Powells Beweise gegen den Irak als unwiderlegbar darstellt:
„[…] it is hard to imagine how anyone could doubt that Iraq possesses weapons of mass
destruction. […] Mr. Powell’s evidence, including satellite photographs, audio
recordings and reports from detainees and other informants, was overwhelming.”
(Mitchell 2004)
Hier wird erneut deutlich, dass die bildhaften angeblichen Beweise, die Powell präsentierte,
auch von den Medien als einschlägiger Beweis gegen den Irak bewertet wurden und seine
Rhetorik effektiv unterstützen. Ein anderer Artikel “A Winning Hand for Powell” greift
Frankreichs anti-kriegerische Haltung zum Thema Irak scharf an, da es Powells angeführte
Beweisen keinen Glauben schenkte.
“The evidence he presented to the United Nation […] had to prove to anyone that Iraq
not only hasn’t accounted for its weapons of mass destruction but without a doubt still
retains them. Only a fool, or possibly a Frenchman, could conclude otherwise.” (ebd.)
Die USA Today, die den Krieg unter Vorbehalt befürwortete, plädierte gegen einen
Alleinfeldzug der USA und verwies auf die Notwendigkeit breiter internationaler
Unterstützung, die es durch die Rede Powells zu erhoffen gelte (vgl. Mitchell 2008). Andere
Zeitungen der gleichen Gruppe (u.a. Newsday in Melville, N.Y., The Detroit Free Press)
verlangten nach einer zweiten UN-Resolution, um den Einsatz von militärischen Mitteln
legitimiert zu wissen. Auch die Zeitungen, die grundsätzlich eine Anti-Kriegshaltung vertraten,
9 Editor& Publisher ist eine US-amerikanische, monatlich erscheinende Zeitung, die 1901 gegründet
wurde. E&P hat mehrere Auszeichnungen, u.a. für die kritische Berichterstattung über den Irakkrieg,
erhalten (vgl. Editor & Publisher 2013).
17
konnten nur vage alternative Lösungsansätze für das Irak-Problem vorschlagen. So schrieb The
Boston Globe, man hoffe auf einen Staatstreich oder auf eine Flucht Husseins ins Exil. Die New
York Times und die San Francisco Chronical drängten den US-Präsidenten, diplomatische
Wege einzuschlagen (vgl. E&P Staff 2007). Diese Untersuchung zeigt, dass mehr als zwei
Drittel der US-Tageszeitungen Powells Rede für überzeugend und seine Beweise für so
einschlägig hielten, dass sie einem Krieg entweder sofort oder nach dem erneuten Scheitern
diplomatischer Mittel zustimmen würden. Sie berichteten also nicht objektiv, sondern vielmehr
aus der Sicht der US-Regierung, die im laut des Securitization-Modells den Irak als subjektive
Bedrohung einstufte. So verhalfen die Medien der Bush-Administration erfolgreich zu ihrem
Ziel. Durch eine bewusst einseitige Berichterstattung unter Anwendung von Strategien wie dem
Agenda-Setting und Framing stieß der War on Terror mit Hilfe der Medien in der US-
Bevölkerung auf breite Akzeptanz. Einer Umfrage zufolge waren Anfang März 2003 59 Prozent
der US-Amerikaner für einen Krieg auch ohne UN-Legitimation und nur 37 Prozent befanden
dieses Vorgehen als unangemessen (vgl. Bierling 2010: 63).
Der Grund, wieso der beabsichtigte Effekt der US-Regierung bei der Bevölkerung eintrat, kann
erneut mit dem Securitization-Ansatz erklärt werden. Dem Sprechakteur Powell wurde aufgrund
seines wichtigen politischen Amtes als US-Außenminister genügend Autorität zugestanden, was
eine wichtige Bedingung einen erfolgreichen Securitization move ist. Außerdem wurden die
Erfolgschancen Powells dadurch erhöht, dass ein historischer Bezug zur aktuellen bedrohlichen
Lage herangezogen werden konnte (vgl. Werner 2011: 435). Wie in Episode 3.1 bereits
erläutert, wurde das Geschehnis des 11. September in direkten Bezug zu Pearl Harbour gestellt
um erste Erklärungs- und Legitimationsansätze für das traumatische Ereignis zu liefern. Durch
den Irakkrieg sollte einem zukünftigen vergleichbaren Ereignis vorgebeugt werden
(Präventivkrieg).
Ein weiterer Grund war, dass Bush seit dem 11. September eine herausragende Stellung als
Krisenmanager genoss, was wiederum auf das Rally around the flag-Phänomen zurückzuführen
ist (vgl. 3.1). Die amerikanische Bevölkerung und die Medien versammelten sich größtenteils
geschlossen hinter der Bush-Administration. Dadurch vergrößerte sich die Macht der Exekutive
und ihr Handlungsspielraum (vgl. Viehrig 2008: 141). Das System der Checks and Balances10
war vorübergehend gelähmt, da auch die politische Opposition keine alternativen Vorschläge
vorweisen konnte. Die US-Regierung konnte das Feindbild Irak schaffen, indem es
kontrollierte, was auf die Agenda der öffentlichen Diskussion gelangte und vor allem die von
ihr veröffentlichen Informationen fanden Verwendung. Der Autorität der Administration wurde
mehr Glaubwürdigkeit entgegengebracht als unabhängigen Experten, die das Thema anders
10 US-amerikanisches Verfassungsprinzip, welches die Machtverteilung und gegenseitige Kontrolle
zwischen Exekutive, Judikative und Legislative garantiert (vgl. Braml 2008).
18
beleuchtet hätten (vgl. Lütterfelds 2008: 118). Durchdachte Rhetorik und gezieltes Framing
machten es der US-Regierung möglich, auch fragliche Informationen als Beweise zu verkaufen.
All dies geschah vor dem Hintergrund der Angst nach dem 11. September, die es unmöglich
machte, sich auf rationaler Ebene mit diesem Thema auseinander zu setzen (vgl. ebd.). Durch
mediale Frames wurde die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik im Sinne der
Regierung an die Bevölkerung weitergetragen, welcher es oft an Vorkenntnissen über solch
abstrakte Themen fehlte und die somit auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen politischer
Akteure angewiesen waren (vgl. Viehrig 2008: 138).
3.3 Dritte Episode: Mission Accomplished
von Theresa Frank
In der folgenden Episode wird der Auftritt George Bushs vom 01.05.2003 untersucht, in dem er
das Ende der Hauptkampfhandlungen im Irak verkündet. Dieses Fallbeispiel stellt nach dem 11.
September und der Kriegserklärung durch Powell eine vorerst abschließende Frequenz des War
on Terror dar. Schwerpunktmäßig wird die bewusste Verwendung visueller und rhetorischer
Mittel der medialen Inszenierung analysiert sowie mögliche Effekte erörtert.
3.3.1. Ausgangssituation der Rede
Nur knapp zwei Monate nach der Rede Powells vor dem UN-Sicherheitsrat beginnt mit der
Bombardierung Bagdads in der Nacht vom 19. auf den 20. März 2003 der Irakkrieg. Wenige
Tage später wird der Sturz der Saddam Hussein Statue in der irakischen Hauptstadt als ein erster
Sieg über das Regime und den Terror inszeniert.11
Am ersten Mai 2003 landet George W. Bush
in einem Kampfjet auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln vor der kalifornischen
Küste, um die heimkehrenden Soldaten zu empfangen. Er lässt sich dort mit den Marine-
Soldaten in Pilotenmontur fotografieren. Anschließend verkündet er vor der Besatzung – und
nun im Anzug – die Beendigung der wesentlichen Kampfhandlungen im Irak. Im Hintergrund
ist ein Banner mit der Aufschrift „Mission Accomplished“ angebracht.
3.3.2 Mediale Inszenierung als ein Instrument der politischen Zielerreichung
Oberstes Ziel der US-Regierung ist es zu diesem Zeitpunkt, die Weltöffentlichkeit und die US-
Öffentlichkeit von der Sinnhaftigkeit und Legitimität des Irakkriegs zu überzeugen. Da die
Meinung der US-Bevölkerung die bedeutendste Rechtfertigungsgrundlage der Irakinvasion
darstellt, galt es, die amerikanischen Bürger über den erfolgreichen Ausgang der
Kampfhandlungen zu informieren und so ihre Zustimmung aufrecht zu halten (vgl. Jäger 2008:
15,19). Aus diesem Grund wird die Rückkehr der Soldaten auf dem Flugzeugträger der
Abraham Lincoln als Meilenstein des Erfolgs inszeniert. Darüber hinaus ist es ein ständiges
Anliegen der Bush-Administration, das herrschende Meinungsbild vom Präsidenten zu
11 Weiterführende Daten und Hintergründe zum Ablauf des Irakkriegs in: Stephan Bierling (2010):
„Geschichte des Irakkriegs“. München: Verlag C.H.Beck.
19
verbessern und seine Wiederwahl im Jahr darauf zu garantieren. Dies geschieht, indem sich
George W. Bush auf der USS Abraham Lincoln als erfolgreicher Staatsmann und Commander
in Chief präsentiert und den War on Terror als einen Triumph seiner Amtszeit feiert.
Die Inszenierung der Bush-Rede ist ein Beispiel der kommunikativen Strategie der US-
Regierung, die auf die bewusste Steuerung der öffentlichen Meinung abzielt. Die
Massenmedien werden in diesem Zug als Steuerungsinstrument herangezogen, da sie in den
vergangenen Dekaden als Kanal politischer Kommunikation an Einfluss gewonnen haben.
Dadurch sind sie für den Machterwerb und Machterhalt politischer Akteure relevanter geworden
(vgl. Dylla 2008: 53). Medien fungieren zunehmend als Bühne der Politikdarstellung und die
Zuschauer als Publikum, dessen Handeln und Denken von medial vermittelten Bildern
beeinflusst wird (vgl. Kafka 2010: 20). Das Medium Fernsehen hat dabei eine übergeordnete
Position, da es die wichtigste Informationsquelle der US-Bevölkerung und somit der
Wählerschaft darstellt). Durch die Relevanz für die Politikdarstellung und -wahrnehmung wird
das Fernsehen als Leitmedium der politischen Kommunikation angesehen (vgl. Dylla 2008: 58).
Darüber hinaus gelingt es, durch die Mischung von Informations- und Unterhaltungsformaten
ein Millionenpublikum zu erreichen, welches nicht immer primär politisch interessiert ist (vgl.
Kafka 2010: 23). Aus diesen Gründen wird das Fernsehen als bevorzugter Ort medialer
Inszenierungen herangezogen (vgl. ebd: 22). Auch die Erkenntnisse aus dem Agenda-Setting,
Framing und Priming (vgl. 2.1 bis 2.3) verdeutlichen das Einflusspotential des Fernsehens auf
die Wählerschaft und die amerikanische Öffentlichkeit als Legitimationsbasis: „Für die
politischen Entscheidungsträger bedeuten diese Befunde, dass sie mithilfe einer geschickten
Lancierung der für sie günstigeren Themen […] und der Festlegung ihrer Interpretationsmuster
die Wählerentscheidungen beeinflussen können.“ (Dylla 2008: 67)
Da sich die politischen Eliten dieses bedeutenden Einflusses der Medien bewusst sind,
instrumentalisieren sie sie zu einer Plattform ihres ständigen Wahlkampfes und Sprachrohr ihrer
politischen Entscheidungen. Es wird in diesem Fall von der Mediatisierung bzw. (Selbst-)
Medialisierung12
der Politik gesprochen (vgl. Schulz 2003; Dylla 2008), der sich auch der
damalige Präsident Bush bedient. Er macht sich den Einflussfaktor des Fernsehens zu nutzen,
indem er das Ende der „Major Combat Operations“ (Bush 2003) nicht in einer gewöhnlichen
Rede verkündet, sondern diese medienwirksam inszeniert. Analysiert man Bushs Auftritt vom
01.05.2003, erkennt man, dass seine kommunikative Strategie an die Medienlogik angepasst
wurde. Dieser Prozess der Akkomodation zeigt sich beispielsweise in der Art und Weise, wie er
12 Mediatisierung (auch Medialisierung), bezeichnet generell Veränderungen, die durch die Medien in
anderen gesellschaftlichen Bereichen ausgelöst werden, z.B. die Mediatisierung der Politik. Zum einen
herrscht die Auffassung, dass sich gesellschaftliche Akteure der Medienlogik anpassen müssen, wenn sie
erfolgreich handeln wollen. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass jene Akteure
Mediatisierungsprozesse selbst initiieren, da sie sich davon einen Nutzen versprechen. Hier handelt es
sich um Selbstmediatisierung (vgl. Donges 2012: 200f.).
20
seine politische Nachricht formuliert, um ihren Nachrichtenwert zu steigern oder sein Handeln
unter dem Gesichtspunkt visueller Ausstrahlungskraft inszeniert (vgl. Schulz 2003: 4). Unter
dem Prozess der Anpassung an die Medienlogik subsumieren sich die Regelsysteme der
Selektions- und Präsentationslogik, die im Folgenden dargestellt werden (vgl. Meyer 2002: 7).
Anpassung an die Selektionslogik
Damit ein Ereignis auf die Medienagenda gesetzt, also nach der Selektionslogik der Medien
ausgewählt wird, ist es nötig, seinen Nachrichtenwert zu erhöhen. Dies geschieht, indem die
Nachrichtenfaktoren, also die Aufmerksamkeit erregenden Merkmale einer Nachricht, verstärkt
werden (vgl. ebd.). Unter anderem haben die Medienwissenschaftler Galtung und Ruge zwölf
Nachrichtenfaktoren festgelegt.13
Zu ihnen zählen Frequenz, Überschreitung von
Schwellenwerten, Eindeutigkeit, Bedeutsamkeit (in individueller und kultureller Hinsicht),
Konsonanz mit Erwartungen und Wünschen, Kontinuität, Variation, Überraschung, Bezug auf
Elite-Nation und Elite-Person, Personalisierung und Negativismus (vgl. Hagen 2012: 241). Die
Erhöhung dieser Nachrichtenwerte geschieht im Rahmen der Bush Rede unter anderem durch
die Steigerung des Überraschungswerts, indem Bush als Staatsmann in einem Kampfjet landet.
Dadurch wird gleichzeitig der Bezug auf eine Elite-Person, hier der US-Präsident, und eine
Elite-Nation, die USA, gezogen. Neben diesen Aspekten steigert die Personalisierung der
Thematik den Nachrichtenwert. Themen und Geschehnisse ziehen eher die Aufmerksamkeit der
Medien und Zuschauer auf sich, wenn einzelne Personen handeln oder von Handlungen
betroffen sind oder wenn gesellschaftlich bedeutende Prozesse an Einzelpersonen festgemacht
werden (vgl. Blöbaum 2012: 263). Bush stellt in seiner Rede den Bezug zu einzelnen
Persönlichkeiten her, indem er Namen einzelner Opfer oder deren Familien nennt. Darüber
hinaus erregt das Ereignis durch seine Thematik vermehrt Aufmerksamkeit. Der Irakkrieg wird
in der US-Bevölkerung als ein konfliktreich Thema wahrgenommen, auch durch den starken
Bezug zum War on Terror-Frame (vgl. 2.2). Die Nachricht erhält dadurch vermehrt
Aufmerksamkeit in den Medien und der Bevölkerung, was zudem durch eine emotional
aufgeladene Sprache und die Verwendung binärer Oppositionen unterstützt wird (s. Rhetorische
Mittel). Des Weiteren wird der Zeitpunkt der Rede unter Berücksichtigung der Selektionslogik
bewusst gewählt, da Bush seine Ansprache passend zum Beginn der abendlichen
Hauptnachrichten verkündet (vgl. Rennie 2003). Jene privilegierte Sendezeit erhöht den
Betonungsgrad der Nachricht und lenkt die Aufmerksamkeit der Fernsehzuschauer direkt auf
das Ereignis (vgl. Dylla 2008: 68).
In der Anpassung des Auftritts an die Selektionslogik zeigt sich, wie die Bush-Regierung durch
ihre Kommunikationsstrategie zu einem gewissen Grad selbst Agenda Setting betreibt, also die
Medien in ihrer Themenwahl beeinflusst.
13 In der Literatur existieren weitere Auflistungen von Nachrichtenfaktoren, die sich jedoch häufig ähneln
(vgl. Hagen 2012: 241).
21
Anpassung an die Präsentationslogik
Viel stärker noch als die Anpassung an die Selektionslogik ist in Bushs Auftritt die Übernahme
medienspezifischer Präsentationsregeln, also die Anpassung an die Darstellungslogik, zu
erkennen. Darunter fallen eine bewusst gewählte Rhetorik, Mimik und eine inszenierte
Selbstdarstellung. Aber auch die Präsentationsweise der politischen Botschaft ist unter
Beachtung der Kriterien Visualisierung, Inszenierung und Personalisierung auf das Medium
Fernsehen zugeschnitten (vgl. Dylla 2008: 53f.).
Vor allem die Landung im Kampfjet zeigt offensichtlich, dass Bushs Auftritt bis ins letzte
Detail medienwirksam geplant war (vgl. Bash 2003). Die Begründung, Bush hätte mit einem
Kampfjet statt eines Helikopters auf dem Flugzeugträger landen müssen, da dieser zu weit von
der kalifornischen Küste entfernt gewesen sei, wurde im Nachhinein vom Weißen Haus
revidiert. Angeblich hätte sich das Schiff schneller der Küste genähert, als angenommen (vgl.
Spiegel 2003d). Darüber hinaus trug der Kampfflieger die Aufschrift „George W. Bush
Commander in Chief“ (vgl. Bash 2003). Hier wird die Symbolträchtigkeit seines Auftritts
deutlich: während der Landung im Kampfjet und des anschließenden Fotoshootings in
Pilotenmontur verkörpert Bush die Rolle des Commander in Chief. Die anschließende Rede hält
er jedoch im Anzug, um der Rolle des Staatsmannes gerecht zu werden. „In den Köpfen der
Bevölkerung und der Medien blieben jedoch jene Bilder hängen, welche den Präsidenten in der
Rolle des „Commander in Chief“ in Kostüm zeigten.“ (Kafka 2010: 93) Hiermit wird auf eine
vorteilhafte Egostereotypisierung George W. Bushs abgezielt, also die Verbreitung des
positiven Images eines Staatsmannes, der den militärischen Herausforderungen des War on
Terror gewachsen ist (vgl. Jäger 2008: 33).
Neben der inszenierten Landung wurde auch der Ort der Rede bewusst ausgewählt. Bush landet
auf dem Flugzeugträger mit Namen USS Abraham Lincoln, wodurch die Verbindung zu der
historischen, positiv konnotierten Figur Abraham Lincoln gezogen wird, die ebenso einen
Krieg, wenn auch einen Bürgerkrieg, führen und ihr Volk einen musste (vgl. Kafka 2010: 93).
Um den Auftritt effektvoller zu gestalten, wurden weitere, übertrieben scheinende Maßnahmen
ergriffen. Beispielsweise musste sich der Flugzeugträger drehen, damit Bush vor dem
Hintergrund des Sonnenuntergangs seine Rede verkünden konnte (vgl. Rennie 2003).
Die Bush-Regierung wurde vor allem anlässlich des umstrittenen Banners mit der Aufschrift
„Mission Accomplished“ kritisiert, das während der Rede des Präsidenten im Hintergrund zu
sehen ist. Neben der Aufschrift ziert die US-Flagge das Banner, welche als Symbol des
Nationalstolzes der US-Bevölkerung gilt. Das Banner wird von Kritikern im Nachhinein als
„Angeberei“14
bezeichnet, welche einen bereits errungenen Sieg suggeriere und kein
sonderliches Gespür der US-Regierung für die noch folgenden Komplikationen des Irakkriegs
zeige (vgl. Bash 2003). So mahnte der Senator Byrd, der Irakkrieg „dürfe nicht dafür
14 Eigene Übersetzung: „evidence of bravado” (CNN 2003).
22
missbraucht werden, einen fernsehtauglichen Hintergrund in einer Wahlkampfwerbung zu
liefern.“ (Spiegel 2003d)
Durch den Einsatz dieser starken visuellen Inszenierung kann von einem Pseudoereignis
gesprochen werden, welches „erst im Hinblick auf die Medien in Szene gesetzt“ (Vowe 2012:
128f.) wurde. Auch der Begriff des Media Events (vgl. 3.1) findet im Zusammenhang mit Bushs
effektvoller Inszenierung Erwähnung. Die für ein Event charakteristische emotionale und
unterhaltsame Komponente wird hier zur Verkündung einer politischen Nachricht herangezogen
(vgl. Bentele 2012: 77). Der Politikwissenschaftler Andreas Dörner nennt jene Kopplung von
Politik und Unterhaltung Politainment und definiert sie als „[…] eine bestimmte Form der
öffentlichen, massenmedial vermittelten Kommunikation, in der politische Themen, Akteure,
Prozesse, Deutungsmuster, Identitäten und Sinnentwürfe im Modus der Unterhaltung zu einer
neuen Realität des Politischen montiert werden.“ (Dörner 2001: 31) Der Auftritt Bushs hatte
somit sicherlich einen hohen Unterhaltungswert für den Zuschauer, jedoch wurde er wegen
seiner offensichtlichen Inszenierung von den Medien und der Opposition kritisiert (vgl. Bash
2003; CBSNews 2009; Spiegel 2003d).
Verwendung rhetorischer Mittel
Neben der visuellen Inszenierung bedient sich Bush rhetorischer Mittel, um die genannten Ziele
zu erreichen. Er verwendet dafür, wie schon in der vorhergehenden Episode 3.2 erwähnt, einen
Gut-Böse-Frame bzw. eine Kategorisierung durch das Freund-Feind-Schema, welches nach den
Anschlägen vom 11.September häufig angewendet wurde (vgl. Schicha 2002: 100). Nicht nur
die Pilotenmontur, auch die Wortwahl des Präsidenten soll eine positive Egostereotypisierung
seiner Person und der USA auslösen. Im Gegensatz dazu, soll der Gegner – der Irak und die
Terroristen – durch negative Alterstereotypisierung definiert und sein feindliches Image
intensiviert und untermauert werden. Analysiert man die Rede, so fällt auf, dass dem Irak und
den Terroristen zahlreiche nachteilige Attribute zugeschrieben werden15
. Bush spricht in diesem
Zusammenhang von „dictatorship“, „tyrant”, einem “dangerous and aggressive regime”, von
den “oppressors” und dem von ihnen ausgehenden “enslavement“ der Bevölkerung. Der Irak ist
„enemy“ und „murder of the innocent“. Darüber hinaus sind in etlichen Abschnitten
komplementäre Begriffspaare, sogenannte Dichotomien, zu finden, die das Freund-Feind-
Schema bzw. den Gut-Böse-Frame verdeutlichen. In der folgenden Tabelle sind diese
gegenübergestellt.
15 Die folgenden Zitate sind der Bush-Rede vom 01.05.2003 entnommen, die im Anhang einzusehen ist.
Bezug auf: Irak, Terroristen Bezug auf: USA
guilty innocent
enslavement, oppressors, tyrant liberty, human freedom, humanity
dictatorship democracy
23
Quelle: Bush 2003
Durch einzelne Argumente vergrößert Bush “den kursierenden Faktor der Angst und
Unsicherheit“ (Kafka 2010: 92). Immerhin nennt er viermal die Bedrohung, die von
Massenvernichtungswaffen ausgeht sowie die Ausbreitung der Terror-Gefahr von Pakistan bis
zum Horn von Afrika. Ganz im Sinne der Securitization-Theorie (vgl. 3.2) legitimiert die
andauerndw Terror-Bedrohung den Kriegseinsatz im Irak, wie folgendes Zitat deutlich macht:
„Our mission continues. Al Qaeda is wounded, not destroyed. The scattered
cells of the terrorist network still operate in many nations, and we know from
daily intelligence that they continue to plot against free people. The
proliferation of deadly weapons remains a serious danger. The enemies of
freedom are not idle, and neither are we. Our government has taken
unprecedented measures to defend the homeland. And we will continue to hunt
down the enemy before he can strike.“ (Bush 2003)
Außerdem betont Bush die friedliche Intention des Kriegseinsatzes: „In this battle, we have
fought for the cause of liberty, and for the peace of the world.” (ebd.) Er nennt den Kriegsgrund,
seinen Worten nach die Befreiung des Iraks, einen “noble cause“ und bettet ihn in den
historischen Kontext Amerikas ein: “Our commitment to liberty is America's tradition --
declared at our founding; affirmed in Franklin Roosevelt's Four Freedoms; asserted in the
Truman Doctrine and in Ronald Reagan's challenge to an evil empire.” (ebd.)
Diesen und weitere Abschnitte im Mittelteil seiner Rede durchzieht die Verwendung des War
on Terror-Frames. Um den Irakkrieg mit dem War on Terror zu assoziieren, verwendet Bush
insgesamt 19-mal einen Terrorbegriff, davon zweimal terror, vierzehnmal terrorist(s) und
dreimal war on terror bzw. war against terror16
. Der Irakkrieg wird als positiver Meilenstein
gegen den Terrorismus gefeiert, als „turning of the tide“ (ebd.), für dessen Inszenierung sich die
Rückkehr der heimkehrenden Soldaten bestens eignet. Um seinen Aussagen noch mehr Gewicht
zu verleihen, erinnert Bush zum einen an den Schrecken des 11.September und wählt zum
anderen eine emotional aufgeladene Sprache, wie im folgenden Zitat beispielhaft deutlich wird:
„We have not forgotten the victims of September the 11th -- the last phone calls, the cold
murder of children, the searches in the rubble.“ (ebd.) Im folgenden Zitat wird neben der
Verwendung emotionalisierender Inhalte der Nationalstolz der Besatzung angesprochen: „Some
of you will see new family members for the first time -- 150 babies were born while their
fathers were on the Lincoln. Your families are proud of you, and your nation will welcome
you.” (Bush 2003)
16 Siehe Anhang: rot markierte Textstellen.
hateful ideology America and the civilized world
evil empire, hatred hope, freedom, peaceful pursuit of a better life
threats to our security peace
toe friend
great evil liberty
24
Die Analyse der Rede zeigt, dass sich Bush durch seine Wortwahl des Gut-Böse- sowie des War
on Terror-Frames bedient. Er transmittiert seine Botschaft durch eine emotional aufgeladene
und antithetische Sprache und unterstützt somit die visuelle Inszenierung des Auftritts.
3.3.3 Effekte der medialen Inszenierung auf Medien und Rezipienten
Die Anpassung an die mediale Selektions- und Darstellungslogik soll eine Aufnahme der Bush
Rede in die Medienagenda garantieren. Durch den gesteigerten Nachrichtenwert sowie die
verstärkte Visualisierung, Inszenierung und Emotionalisierung soll das Ereignis vielfach
wiedergegeben werden. Es wird versucht, das Ende der Hauptkampfhandlungen im Irak über
die Medien zu verbreiten und das Image des Präsidenten in seiner Rolle als Commander in
Chief zu verbessern.
Auf Rezipienten-Seite sind folgende Effekte zu vermuten. Durch das Agenda Setting-Prinzip
setzt sich der Medienkonsument verstärkt mit dem Ereignis auseinander. Dies geschieht durch
eine Vielzahl an Sendebeiträgen zu dieser Thematik, wodurch der Zuschauer den Irakkrieg
verstärkt wahrnimmt. Durch das Framing verbindet der Rezipient die USA und Präsident Bush
mit positiven Attributen, den Irak und den Terrorismus mit durchweg negativen. Eine besondere
Bedeutung erhält das Ereignis, da es als Wendepunkt der Kampfhandlungen inszeniert wird.
Somit sollen die negativen Vorkommnisse im Irak ausgeblendet und Erfolge hervorgehoben
werden. Dadurch soll wiederum die Zustimmung der US-Bevölkerung zum Irakkrieg aufrecht
gehalten werden. Der Einfluss des Primings ist noch wenig untersucht und schwer zu messen.
Wie in der eingangs unter 2.3 beschriebenen Studie von Iyengar und Kinder, ist es möglich,
dass sich die positive Darstellungsweise des Präsidenten auf die Wahrnehmung und Beurteilung
der Wählerschaft auswirkt, bzw. dass diese ihren Präsidenten verstärkt unter dem Aspekt der
Sicherheitspolitik bewertet.
Durch die kommunikative Strategie der US-Regierung schafft Bush es, die generelle
Zustimmung zum Irakkrieg in der US-Bevölkerung aufrecht zu halten, auch wenn die
andauernden Konflikte in den kommenden Monaten zunehmend kritisch betrachtet werden (vgl.
Norpoth 2005: 5). Dass die US-Wählerschaft Bush trotzdem weiterhin unterstützt, wird durch
seine Wiederwahl im Jahr darauf deutlich. Es scheint so, als hätte am Wahltag „[…] der Unmut
über die Konsequenzen weniger gezählt als die Zustimmung zur Invasion in den Irak.“ (ebd.) In
der Öffentlichkeit wird George W. Bushs Amtsperiode eng mit dem War on Terror verbunden
und er als „war president“ oder „wartime president“ wahrgenommen (vgl. ebd: 4, 8). Die
erfolgreiche Kommunikation der Antiterrorpolitik und des Irakkriegs durch medial inszenierte
Auftritte kann somit als entscheidender Faktoren für den Wahlsieg im Jahr 2004 angesehen
werden.
25
4. Schlussbetrachtung und Übersicht der Analyseergebnisse
Die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorgenommenen Analysen zeigen, dass in allen drei
Episoden mediale Inszenierungsstrategien zum Einsatz kamen. Durch die sehr unterschiedlichen
Akteure und Ereignisse fielen jedoch die Wahl der Mittel und die ausgelösten Effekte nicht
immer gleich aus. Festzuhalten ist, dass in allen drei Fällen mediale oder politische Akteure
bewusste Inszenierungen vornahmen, die wiederum Auswirkungen auf die kognitive und
affektive Wahrnehmung der Rezipienten hatten. Die Medienwirkung kann schlussfolgernd als
eine mehrstufige Wirkungskette gesehen werden, die von der einfachen Wahrnehmung und
Gewichtung der Themen, bis hin zu einer tiefgehenden Einstellungs- und Meinungsänderung
der Rezipienten reichen kann (vgl. Dylla 2008: 69). In den ausgewählten Fallbeispielen waren
es zunächst die Medien, die bewusst inszenierten und beispielsweise durch den Einsatz von
Loops und die Verwendung immer gleicher Bilder das Ereignis des 11. September für die
Rezipienten zu einem unvergesslichen Ereignis werden ließen. In den anschließenden Episoden
fand eine Mediatisierung von Botschaften seitens der Politiker Colin Powell und George W.
Bush statt. Sie passten ihre Auftritte der Medienlogik an und verwendeten rhetorische und
visuelle Mittel unter Beachtung des War on Terror-Frames und des Freund-Feind-Schemas. Ziel
dabei war es, einen erfolgreichen Securitization move zu garantieren und die Zustimmung der
US-Öffentlichkeit zu erlangen.
In der folgenden Tabelle sollen abschließend alle von uns herausgearbeiteten Akteure, Ziele,
Mittel und Effekte der einzelnen Episoden veranschaulicht werden und somit den
Analyseprozess dieser Arbeit zusammenfassen.
Erste Episode
Der 11. September
Zweite Episode
Powell vor dem UN-Rat
Dritte Episode
Mission Accomplished
Akteur(e)
a) Medien
b) Terroristen
politischer Akteur:
Colin Powell
politischer Akteur:
George W. Bush
Ziel(e)
a) Bevölkerung
Orientierungshilfe bieten,
nationale Einheit stärken
b) Demütigung, Angst,
Unsicherheit auslösen
Legitimation des Irakkriegs
auf internationaler Ebene
(UN-Sicherheitsrat) und
nationaler Ebene (US-
Bevölkerung)
Legitimation des Irakkriegs,
positive Darstellung seiner
Person und Zuspruch der
Wählerschaft
Mittel
a)Visuelle und verbale
Inszenierung durch:
-Verwendung gleicher
Bildmotive (visuelle
Rhetorik: Presse und
Fernsehen)
- Wiederholung im gleicher
Bilder/Videos (Loops)
- Verwendung gleicher
sprachlicher Mittel (verbale
Rhetorik: Metaphern,
Dichotomien, Begriffe,
Redewendungen)
- Referenz auf Pearl
Harbor/Zweiter Weltkrieg:
Framing
1) Verbale Inszenierung:
- Bezugsrahmen (Frames)
vereinfachen Sachverhalte;
Konfliktframes: Freund-
Feind/ Ost-West /Gut-Böse
Dichotomien
Konsequenzframes:
- Zeitenwende, Urging
- Bezug auf die National
Security Strategy
Berechtigung zum
Präventivkrieg
USA als globaler
Sicherheitsverteidiger
2) Visuelle Inszenierung:
Anpassung an Selektions- und
Präsentationslogik der
Medien
Erhöhung des
Nachrichtenwertes,
Übernahme
medienspezifischer
Präsentationstechniken
1) Visuelle Inszenierung:
Pilotenmontur zur
Verkörperung des
Commander in Chief, Bezug
zu Abraham Lincoln, Zeigen
der amerikanischen Flagge,
Rede vor Sonnenuntergang.
26
- Konstruktion eines Media
Events
Schaffung eines
einheitlichen
Mediendiskurses (Agenda
Setting)
b) Inszenierung durch:
- gezielte Auswahl der
Anschlagsziele: Gebäude
mit symbolischer Funktion
- gezieltes auf mediale
Wirkung ausgerichtetes
Vorgehen
Unterstützung der
Argumentation durch Bilder,
die als Beweise ausgelegt
werden Verstärkung der
frames
Securitization:
wertvolles Referenzobjekt
Sicherheit ist bedroht, deshalb
ist Irakkrieg ein gerechter
Krieg, der den einzigen
Ausweg aus der bedrohlichen
Lage bietet
2) Verbale Inszenierung:
- Verwendung des war on
terror-Frames / Gut-Böse-
Frames
- Dichotomien, positive
Egostereotypisierung,
negative
Alterstereotypsierung
- Emotionalisierung,
Konfliktorientierung,
Patriotisierung der Inhalte
Effekte a) - ikonisches Bild der
Anschläge entsteht (Loops)
- Eindruck psychischer und
physischer Nähe durch
zeitl. Unmittelbarkeit der
Medienberichterstattung
- Blitzlichterinnerung
- Verankerung des
Ereignisses im kollektiven
Gedächtnis der US-
Bevölkerung
- Gefühle auslösen
(Emotionalisierung),
Nationalgefühl/Patriotismus
erzeugen (Identifikation)
- Rally around the flag-
Phänomen: Medien folgen
in Krisenzeit verstärkt
Regierungsmeinung
b) - Verletzung des
amerikanischen
Ehrgefühls/Stolzes
- traumatisches Erlebnis
- verbale Unzugänglichkeit
auf Seiten von Politik,
Medien und Bevölkerung
- UN-Sicherheitsrat: Veto
- US-Bevölkerung nach
Powells Rede zu 59% für den
Irakkrieg ohne UN-
Legitimation
- Medien schenken Powells
Argumentation
Glaubhaftigkeit und geben
diese mehrheitlich kritiklos
wieder
- Durch Anpassung an die
Medienlogik: Einfluss auf
Agenda Setting Prozess der
Medien (erhöhte
Aufmerksamkeit)
- Effekte des Framings und
Primings:
Einfluss auf Wahrnehmung
und Bewertung der USA und
des Iraks durch die
Rezipienten, indem
Interpretationsmuster und
Bewertungskriterien von
Bush vorgegeben werden
Erzeugung eines Freund-
Feind-Schemas
positive
Egostereotypisierung,
negative
Alterstereotypsierung
verstärkter Patriotismus
Ziel
erreicht?
a) - steigender Patriotismus
und Gemeinschaftsgefühl in
der Bevölkerung zu
beobachten
- durch Rally around the
flag-Effekt nahm
Beliebtheit des US-
Präsidenten nachweisbar zu
b) Unsicherheit und Angst
sowie verbale
Unzugänglichkeit in der
(Welt-) Bevölkerung
erkennbar
Keine Zustimmung des UN-
Sicherheitsrates, trotzdem
Irakkrieg unter eigener
Führung mit Koalition der
Willigen;
Mehrheitliche Befürwortung
des Irakkriegs durch US-
Bevölkerung Secutirization
move auf nationaler Ebene
erfolgreich vollzogen
Andauernde Zustimmung
zum Irakkrieg, wenn auch die
dortigen Konflikte
zunehmend kritisch
hinterfragt werden.
Bush kann den Zuspruch
seiner Wählerschaft aufrecht
halten: dies bestätigt der
Wahlsieg 2004 mit 52% der
Stimmen.
In der Öffentlichkeit wird er
eng mit dem war on terror
verbunden und als „war
president“ wahrgenommen.
27
II. Literaturverzeichnis
Literatur:
Bentele, Günter (2012): Eventmanagement. In: Bentele, Günter / Hans-Bernd Brosius /
Otfried Jarren [Hrsg.]. Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Wiesbaden: Springer VS, S.77f.
Bierling, Stephan (2010): Geschichte des Irakkriegs. Der Stur Saddams und Amerikas
Albtraum im Mittleren Osten. München: Verlag C.H.Beck oHG.
Blöbaum, Bernd (2012): Personalisierung. In: Bentele, Günter / Hans-Bernd Brosius /
Otfried Jarren [Hrsg.]. Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Wiesbaden: Springer VS, S. 263.
Brosda, Carsten (2002): Sprachlos im Angesicht des Bildes. Überlegungen zum
journalistischen Umgang mit bildmächtigen Ereignissen am Beispiel der
Terroranschläge vom 11.September 2001. In: Schicha, Christian / Brosda, Carsten
(2002): Medien und Terrorismus. Reaktionen auf den 11.September 2001.
Münster/Hamburg/London: LIT Verlag.
Buzan, Barry / Ole Waever (Hrsg.) (2003): Regions and Powers: The Structure of
International Security. Cambridge University Press.
Dahinden, Urs (2006): Framing. Eine integrative Theorie der Massenkommunikation.
Zürich: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
Dayan, Daniel / Katz, Elihu (1994): Media Events. The Live Broadcasting of history.
Harvard: Harvard University Press.
Dirks, Una (2008): Die Mediatisierung der Kriegsgründe im Irak-Konflikt: Story
Telling und evidenzbasierte Diskursfragmente im Widerstreit. Ein Vergleich der
deutschen und US-amerikanischen ,Qualitäts’-Presse. In: Bonfadelli, Heinz / Kurt
Imhof / Roger Blum et al.: Seismographische Funktionen von Öffentlichkeit im
Wandel. Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH,
S. 247-278.
Dörner, Andreas (2001): Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Donges, Patrick (2012): Mediatisierung. In: Bentele, Günter / Hans-Bernd Brosius /
Otfried Jarren [Hrsg.]. Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Wiesbaden: Springer VS, S. 200-201.
Dylla, Daria W. (2008): Der Einfluss politischer Akteure auf die
Politikberichterstattung. Selbstmedialisierung der Politik? In: Thomas Jäger / Henrike
Viehrig (Hrsg.): Die amerikanische Regierung gegen die Weltöffentlichkeit?
28
Theoretische und empirische Analysen der Public Diplomacy zum Irakkrieg.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 53-78.
Gross, Andrew/ Stapf, Ingrid (2002): Terror und Konsens. Reaktionen der US-Medien
infolge des Terroranschlags am 11.September. In: Schicha, Christian / Brosda, Carsten
(2002): Medien und Terrorismus. Reaktionen auf den 11.September 2001.
Münster/Hamburg/London: LIT Verlag, S. 135-138.
Hagen, Lutz M. (2012): Nachrichtenfaktoren. In: Bentele, Günter / Hans-Bernd
Brosius/ Otfried Jarren [Hrsg.]. Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Wiesbaden: Springer VS, S. 240f.
Iyengar, Shanto / Donald R. Kinder (1987): News That Matter. Television and
American Opinion. Chicago: The University of Chicago Press.
Jäger, Thomas (2008): Die Rolle der amerikanischen Öffentlichkeit im unipolaren
System und die Bedeutung von Public Diplomacy als strategischer und taktischer
Kommunikation. In: Jäger Thomas / Henrike Viehrig (Hrsg.): Die amerikanische
Regierung gegen die Weltöffentlichkeit? Theoretische und empirische Analysen der
Public Diplomacy zum Irakkrieg. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.
15-38.
Kafka, Matthias (2010): Wahlkampf als Schaukampf. Wien: Diplomarbeit Universität
Wien.
Kirchhoff, Susanne (2010): Krieg mit Metaphern. Mediendiskurse über 9/11 und den
„war on terror“. Bielefeld: transcript.
Lütterfelds, Johanna (2008): Das Konzept der Sicherheit als Mittel und Zweck der
Konstruktion Öffentlicher Meinung. Die Bushdoktrin und der Irakkrieg in den USA.
Hamburg. Diplomica Verlag GmbH.
Maurer, Marcus (2010): Agenda-Setting. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Norpoth, Helmut (2005): Mission Accomplished: Die Wiederwahl von George W.
Bush. In: Politische Vierteljahresschrift, 46. Jg. (2005), Heft 1. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, S. 3–13.
Roskos-Ewoldson, David R. / Beverly Roskos-Ewoldson / Francesca Dillmann
Carpentier (2009): Media Priming. An updated Synthesis. In: Bryant, Jennings / Mary
Beth Oliver (Hrsg.): Media Effects. Advances in Theory and Research. Dritte Auflage.
New York: Routledge, S. 74-93.
Schenk, Michael (2002): Medienwirkungsforschung. Tübingen: Mohr Siebeck.
Schenk, Michael (2007): Medienwirkungsforschung. Tübingen: Mohr Siebeck.
Schicha, Christian (2002): Terrorismus und symbolische Politik. Zur Relevanz
politischer und theatralischer Inszenierungen nach dem 11.September 2001. In:
Schicha, Christian / Carsten Brosda (Hrsg.): Medien und Terrorismus. Reaktionen auf
den 11. September 2001. Münster: LIT Verlag, S.94-113.
29
Schicha, Christian (2007): Der 11. September 2001- Symbolische Politikvermittlung in
den Medien. In: Glaab, Sonja (Hrsg.) (2007): Medien und Terrorismus. Auf den Spuren
einer symbiotischen Beziehung. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. S. 175-
185.
Schmid-Petri, Hannah (2011): Das Framing von Issues in Medien und Politik. Eine
Analyse systemspezifischer Besonderheiten. Wiesbaden: Springer VS.
Viehrig Henrike (2008): Die öffentliche Kommunikation der Entscheidung zum
Irakkrieg 2003. In: Jäger, Thomas / Henrike Viehrig (Hrsg.): Die amerikanische
Regierung gegen die Weltöffentlichkeit? Theoretisch und Empirische Analysen zum
Irakkrieg. Wiesbaden .VS Verlag für Sozialwissenschaften. GWV Fachverlag GmbH,
S. 135-163.
Vowe, Gerhard (2012): Inszenierung. In: Bentele, Günter / Hans-Bernd Brosius /
Otfried Jarren [Hrsg.]. Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Wiesbaden: Springer VS, S. 128-129.
Werner, Andreas (2011): Von Manhatten nach Bagdad: Die Legitimation des
Irakkrieges im Licht des 11. September. In: Jäger, Thomas (Hrsg.): Die Welt nach 9/11.
Auswirkung des Terrorismus auf Staatenwelt und Gesellschaft. Wiesbaden. VS Verlag
für Sozialwissenschaften. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S. 432-450.
Online-Quellen:
Arnold, Anne-Katrin (2008): Medienkrieg, Kriegsmedien. Eindrücke zum
amerikanischen Journalismus nach dem 11. September. In: Neue Gegenwart, Ausgabe
54, Titel: Der Markt der Themen, erschienen: 14.2.2008.
http://www.neuegegenwart.de/ausgabe54/medienkrieg.htm, abgerufen am 12.01.2013.
Bash, Dana (2003): White House pressed on 'mission accomplished' sign. CNN Artikel
vom 29.10.2003.
http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/10/28/mission.accomplished/, abgerufen
am 22.01.2013.
Bösch, Frank (2010): Europäische Medienereignisse, in: Europäische Geschichte
Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG). http://www.ieg-
ego.eu/de/threads/europaeische-medien/europaeische-medienereignisse/frank-boesch-
europaeische-medienereignisse, abgerufen am 12.01.2013.
Braml, Josef (2008): Die Grundlagen des politischen Systems der USA. 10.10.2008.
http://www.bpb.de/internationales/amerika/usa/10662/grundlagen-des-politischen-
systems, abgerufen am 25.02.13.
Bush, George W. (2002a): Bush ruft Absolventen der Militärakademie zum Dienst im
Kampf gegen den Terror auf. Die West-Point-Rede des Präsidenten vom 1. Juni 2002
30
im Wortlaut. http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/USA/west-point-rede.html,
abgerufen am 21.12.12.
Bush, George W. (2002b): Text of President Bush's 2002 State of the Union Address.
29.01.2003.
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm,
abgerufen am 21.12.12.
Bush, George W. (2003): Rede des US-Präsidenten George W. Bush am 01.05.2003.
„President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended.”
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html,
abgerufen am 22.02.2013.
CBSNews (2009): ‚Mission Accomplished‘ Whodunit. 11.02.2009.
http://www.cbsnews.com/stories/2003/10/29/iraq/main580661.shtml, abgerufen am
20.02.2013.
CNN (2001): Transcript of President Bush’s address. Transcript of President Bush's
address to a joint session of Congress on Thursday night, September 20, 2001.
21.09.2001. http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/, abgerufen am
29.02.2013
Dale, Catherine (2009): Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results and
Issues for Congress. 2.04.2009. http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL34387.pdf,
abgerufen am 25.02.13.
Dülffer, Jost (2006): Über-Helden–Das Bild von Iwo Jima in der Repräsentation des
Sieges. Eine Studie zur US-amerikanischen Erinnerungskultur seit 1945, in:
Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 3
(2006) H. 2. http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208650/default.aspx,
abgerufen am 03.01.2013.
Editor & Publisher (2013). About Us. http://www.editorandpublisher.com/About/,
abgerufen am 25.02.13
Editor & Publisher Staff (2007): FLASHBACK: 4 Years Ago Editorials Hailed
Powell’s Iraq Speech. 5.02.2007.
http://www.editorandpublisher.com/Article/FLASHBACK-4-Years-Ago-Editorials-
Hailed-Powell-s-Iraq-Speech, abgerufen am 21.12.12.
Hen/dpa/dapd (2012): Terroranschläge von 2001. USA gedenken der 9/11-Opfer.
11.09.2012. http://www.spiegel.de/politik/ausland/terroranschlaege-usa-gedenken-der-
opfer-vom-11-september-2001-a-855238.html, abgerufen am 28.12.2012.
Hartwig, Marcel (2011): Der 11.September im nationalen Bewusstsein der USA. In:
Politik und Zeitgeschichte. 61.Jahrgang, Heft 27/2011. Frankfurt: Societäts-Verlag,
S.32. http://www.bpb.de/apuz/33238/der-11-september-im-nationalen-bewusstsein-der-
usa?p=all, abgerufen am 30.12.2012.
31
Hetherington, Marc J./Nelson, Michael (2003): Anatomy of a Rally Effect: George W.
Bush and the War on Terrorism. In: Political Science and Politics, Vol. 36, No. 1, S. 37-
49. http://www.uvm.edu/~dguber/POLS234/articles/hetherington2.pdf, abgerufen am
06.01.2013.
Gadinger, Frank/ Axel Heck/ Herbert Dittgen (2008): Amerikanische Außenpolitik im
Zeichen des „Krieges gegen den Terror“. In: Politische Vierteljahresschrift, Volume
49/2008, S. 726-756. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11615-008-0121-
2?LI=true#page-1, abgerufen am 26.01.13.
Löb, Charlotte/ Weinmann, Carina (2003): Indexing und Rally-Effekt in der
Irakkriegsberichterstattung 2003. http://dfpk.de/2010/programm/, abgerufen am
05.01.2013.
Meyer, Thomas (2002): Mediendemokratie – Auf dem Weg in eine andere Demokratie?
In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 15-16/2002. Berlin: Bundeszentrale für politische
Bildung, S. 7-14. http://www.bpb.de/apuz/26977/mediokratie-auf-dem-weg-in-eine-
andere-demokratie, abgerufen am 19.01.2013.
Mitchell, Greg (2004): How the ‘Washington Post’ Promoted a War –Part II.
22.08.2004. http://www.editorandpublisher.com/Article/How-the-Washington-Post-
Promoted-a-War-Part-II, abgerufen am 21.12.12.
Mitchell, Greg (2008): 5 Years Ago: When the Press Helped Colin Powell to Sell the
War. 6.02.2008. http://www.editorandpublisher.com/Article/5-Years-Ago-When-the-
Press-Helped-Colin-Powell-Sell-the-War, abgerufen am 21.12.12.
Palm, Geodart (2003): Nichts als die Wahrheit oder Onkel Powells Märchenstunde?
Endlich präsentiert die US-Regierung dem UNO-Sicherheitsrat „Beweise“. 6.02.2003.
http://www.heise.de/tp/artikel/14/14127/1.html, abgerufen am 21.12.12.
Perrin, Andrew J./Smolek, Sondra J. (2009): Who Trusts? Race, Gender, and The
September 11 Rally Effect Among Young Adults.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662604/, abgerufen am 06.01.2013.
Powell, C. (5.02.2003): Full Text of Colin Powell’s speech. 5.02.2003.
http://www.guardian.co.uk/world/2003/feb/05/iraq.usa , abgerufen am 30.11.12.
Rennie, David (2003): Bush gets tangled in row over Iraq victory banner. Artikel in The
Telegraph vom 30.10.2003.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1445494/Bush-gets-
tangled-in-row-over-Iraq-victory-banner.html, abgerufen am 03.12.2012.
Scholz, Anna-Lena (2011): Ikonografie des 11.Septembers. Gewalt, Panik Flagge.
http://www.tagesspiegel.de/wissen/ikonografie-des-11-septembers-gewalt-panik-
flagge/4573258.html, abgerufen am 30.12.2012.
Schulz, Winfried (2003): Mediatisierung der Politik oder Politisierung der Medien?
Beitrag zum Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung „Politische Kommunikation in
32
der globalen Welt – Know-How-Transfer als Sackgasse?“ in Mainz am 30./31.Oktober
2003. http://www.kas.de/upload/dokumente/einbahnstrasse/schulz_-
_mediatisierung_der_politik_oder_politisierung_der_medien.pdf, abgerufen am
22.02.2013.
Spiegel (2003a): Reaktionen auf Powell Rede. Fischer forderte intensivere
Inspektionen. 5.02.2003. http://www.spiegel.de/politik/ausland/reaktion-auf-powell-
rede-fischer-forderte-intensivere-inspektionen-a-233897.html, abgerufen am 21.12.12.
Spiegel (2003b): Irak-Politik. Powell droht Frankreich. 23.04.2003.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/irak-politik-powell-droht-frankreich-a-
245719.html, abgerufen am 22.12.12.
Spiegel (2003c): Irak-Krieg ohne Uno-Mandat. „Koalition der Willigen“ formiert sich.
18.03.2003. http://www.spiegel.de/politik/ausland/irak-krieg-ohne-uno-mandat-
koalition-der-willigen-formiert-sich-a-240801.html,abgerufen am 2.01.13.
Spiegel (2003d): Bushs Flugzeugträger-Show: Kritik an der knalligen Inszenierung.
07.05.2003. http://www.spiegel.de/politik/ausland/bushs-flugzeugtraeger-show-kritik-
an-der-knalligen-inszenierung-a-247681.html, abgerufen am 13.02.2013.
Spiegel (2007): Afghanistan: Schutztruppe Isaf und Operation „Enduring Freedom“.
19.05.2007. http://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-schutztruppe-isaf-und-
operation-enduring-freedom-a-483686.html, abgerufen am 25.02.13.
Vultee, Fred (2007): Securitization as a Result of Media Effects: The Contest over the
Framing of Political Violence.
https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/4792/short.pdf?sequence
=2, abgerufen am 25.02.13.
Abbildungsverzeichnis:
Abb1: Tagesspiegel (2011): 04.09.2011.
http://www.tagesspiegel.de/wissen/ikonografie-des-11-septembers-gewalt-panik-
flagge/4573258.html, abgerufen am 30.11.2012.
Abb2: Tagesspiegel (2011): 04.09.2011.
http://www.tagesspiegel.de/wissen/ikonografie-des-11-septembers-gewalt-panik-
flagge/4573258.html, abgerufen am 29.11.2012.
33
III. Anhang
Rede des US-Präsidenten George W. Bush am 01.05.2003
Legende:
Grün – positive Attribute USA
Gelb – negative Attribute Irak und Terroristen
Rot – Terrorbegriffe
Pink – Kriegsgrund
May 1, 2003
President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended
Remarks by the President from the USS Abraham Lincoln
At Sea Off the Coast of San Diego, California
THE PRESIDENT: Thank you all very much. Admiral Kelly, Captain Card, officers and sailors
of the USS Abraham Lincoln, my fellow Americans: Major combat operations in Iraq have
ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. (Applause.) And
now our coalition is engaged in securing and reconstructing that country.
In this battle, we have fought for the cause of liberty, and for the peace of the world. Our nation
and our coalition are proud of this accomplishment -- yet, it is you, the members of the United
States military, who achieved it. Your courage, your willingness to face danger for your country
and for each other, made this day possible. Because of you, our nation is more secure. Because
of you, the tyrant has fallen, and Iraq is free. (Applause.)
Operation Iraqi Freedom was carried out with a combination of precision and speed and
boldness the enemy did not expect, and the world had not seen before. From distant bases or
ships at sea, we sent planes and missiles that could destroy an enemy division, or strike a single
bunker. Marines and soldiers charged to Baghdad across 350 miles of hostile ground, in one of
the swiftest advances of heavy arms in history. You have shown the world the skill and the
might of the American Armed Forces.
This nation thanks all the members of our coalition who joined in a noble cause. We thank the
Armed Forces of the United Kingdom, Australia, and Poland, who shared in the hardships of
war. We thank all the citizens of Iraq who welcomed our troops and joined in the liberation of
their own country. And tonight, I have a special word for Secretary Rumsfeld, for General
Franks, and for all the men and women who wear the uniform of the United States: America is
grateful for a job well done. (Applause.)
The character of our military through history -- the daring of Normandy, the fierce courage of
Iwo Jima, the decency and idealism that turned enemies into allies -- is fully present in this
generation. When Iraqi civilians looked into the faces of our servicemen and women, they saw
strength and kindness and goodwill. When I look at the members of the United States military, I
see the best of our country, and I'm honored to be your Commander-in-Chief. (Applause.)
In the images of falling statues, we have witnessed the arrival of a new era. For a hundred of
years of war, culminating in the nuclear age, military technology was designed and deployed to
inflict casualties on an ever-growing scale. In defeating Nazi Germany and Imperial Japan,
34
Allied forces destroyed entire cities, while enemy leaders who started the conflict were safe
until the final days. Military power was used to end a regime by breaking a nation.
Today, we have the greater power to free a nation by breaking a dangerous and aggressive
regime. With new tactics and precision weapons, we can achieve military objectives without
directing violence against civilians. No device of man can remove the tragedy from war; yet it is
a great moral advance when the guilty have far more to fear from war than the innocent.
(Applause.)
In the images of celebrating Iraqis, we have also seen the ageless appeal of human freedom.
Decades of lies and intimidation could not make the Iraqi people love their oppressors or desire
their own enslavement. Men and women in every culture need liberty like they need food and
water and air. Everywhere that freedom arrives, humanity rejoices; and everywhere that
freedom stirs, let tyrants fear. (Applause)
We have difficult work to do in Iraq. We're bringing order to parts of that country that remain
dangerous. We're pursuing and finding leaders of the old regime, who will be held to account
for their crimes. We've begun the search for hidden chemical and biological weapons and
already know of hundreds of sites that will be investigated. We're helping to rebuild Iraq, where
the dictator built palaces for himself, instead of hospitals and schools. And we will stand with
the new leaders of Iraq as they establish a government of, by, and for the Iraqi people.
(Applause.)
The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our
coalition will stay until our work is done. Then we will leave, and we will leave behind a free
Iraq. (Applause)
The battle of Iraq is one victory in a War on Terror that began on September the 11, 2001 -- and
still goes on. That terrible morning, 19 evil men -- the shock troops of a hateful ideology -- gave
America and the civilized world a glimpse of their ambitions. They imagined, in the words of
one terrorist, that September the 11th would be the "beginning of the end of America." By
seeking to turn our cities into killing fields, terrorists and their allies believed that they could
destroy this nation's resolve, and force our retreat from the world. They have failed. (Applause.)
In the battle of Afghanistan, we destroyed the Taliban, many terrorists, and the camps where
they trained. We continue to help the Afghan people lay roads, restore hospitals, and educate all
of their children. Yet we also have dangerous work to complete. As I speak, a Special
Operations task force, led by the 82nd Airborne, is on the trail of the terrorists and those who
seek to undermine the free government of Afghanistan. America and our coalition will finish
what we have begun. (Applause.)
From Pakistan to the Philippines to the Horn of Africa, we are hunting down al Qaeda killers.
Nineteen months ago, I pledged that the terrorists would not escape the patient justice of the
United States. And as of tonight, nearly one-half of al Qaeda's senior operatives have been
captured or killed. (Applause.)
The liberation of Iraq is a crucial advance in the campaign against terror. We've removed an ally
of al Qaeda, and cut off a source of terrorist funding. And this much is certain: No terrorist
network will gain weapons of mass destruction from the Iraqi regime, because the regime is no
more. (Applause.)
In these 19 months that changed the world, our actions have been focused and deliberate and
proportionate to the offense. We have not forgotten the victims of September the 11th -- the last
phone calls, the cold murder of children, the searches in the rubble. With those attacks, the
terrorists and their supporters declared war on the United States. And war is what they got.
(Applause.)
35
Our war against terror is proceeding according to principles that I have made clear to all: Any
person involved in committing or planning terrorist attacks against the American people
becomes an enemy of this country, and a target of American justice. (Applause.)
Any person, organization, or government that supports, protects, or harbors terrorists is
complicit in the murder of the innocent, and equally guilty of terrorist crimes.
Any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass
destruction is a grave danger to the civilized world -- and will be confronted. (Applause.)
And anyone in the world, including the Arab world, who works and sacrifices for freedom has a
loyal friend in the United States of America. (Applause.)
Our commitment to liberty is America's tradition -- declared at our founding; affirmed in
Franklin Roosevelt's Four Freedoms; asserted in the Truman Doctrine and in Ronald Reagan's
challenge to an evil empire. We are committed to freedom in Afghanistan, in Iraq, and in a
peaceful Palestine. The advance of freedom is the surest strategy to undermine the appeal of
terror in the world. Where freedom takes hold, hatred gives way to hope. When freedom takes
hold, men and women turn to the peaceful pursuit of a better life. American values and
American interests lead in the same direction: We stand for human liberty. (Applause.)
The United States upholds these principles of security and freedom in many ways -- with all the
tools of diplomacy, law enforcement, intelligence, and finance. We're working with a broad
coalition of nations that understand the threat and our shared responsibility to meet it. The use
of force has been -- and remains -- our last resort. Yet all can know, friend and foe alike, that
our nation has a mission: We will answer threats to our security, and we will defend the peace.
(Applause.)
Our mission continues. Al Qaeda is wounded, not destroyed. The scattered cells of the terrorist
network still operate in many nations, and we know from daily intelligence that they continue to
plot against free people. The proliferation of deadly weapons remains a serious danger. The
enemies of freedom are not idle, and neither are we. Our government has taken unprecedented
measures to defend the homeland. And we will continue to hunt down the enemy before he can
strike. (Applause.)
The War on Terror is not over; yet it is not endless. We do not know the day of final victory, but
we have seen the turning of the tide. No act of the terrorists will change our purpose, or weaken
our resolve, or alter their fate. Their cause is lost. Free nations will press on to victory.
(Applause.)
Other nations in history have fought in foreign lands and remained to occupy and exploit.
Americans, following a battle, want nothing more than to return home. And that is your
direction tonight. (Applause.) After service in the Afghan -- and Iraqi theaters of war -- after
100,000 miles, on the longest carrier deployment in recent history, you are homeward bound.
(Applause.) Some of you will see new family members for the first time -- 150 babies were born
while their fathers were on the Lincoln. Your families are proud of you, and your nation will
welcome you. (Applause.)
We are mindful, as well, that some good men and women are not making the journey home.
One of those who fell, Corporal Jason Mileo, spoke to his parents five days before his death.
Jason's father said, "He called us from the center of Baghdad, not to brag, but to tell us he loved
us. Our son was a soldier."
Every name, every life is a loss to our military, to our nation, and to the loved ones who grieve.
There's no homecoming for these families. Yet we pray, in God's time, their reunion will come.
36
Those we lost were last seen on duty. Their final act on this Earth was to fight a great evil and
bring liberty to others. All of you -- all in this generation of our military -- have taken up the
highest calling of history. You're defending your country, and protecting the innocent from
harm. And wherever you go, you carry a message of hope -- a message that is ancient and ever
new. In the words of the prophet Isaiah, "To the captives, 'come out,' -- and to those in darkness,
'be free.'"
Thank you for serving our country and our cause. May God bless you all, and may God
continue to bless America. (Applause.)
END 6:27 P.M. PDT
Quelle: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
01.05.2003, abgerufen am 22.02.2012