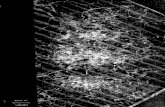Manuels de vocabulaire: Revue de détail
-
Upload
uni-osnabrueck -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Manuels de vocabulaire: Revue de détail
FranzösischPETER BREITHAUER
Nochmals zur Krücke des ÜbersetzersEine Replik auf Klaus E. W. Fleck: „Beschuldigte Fachwörterbücher auf der Anklagebank"in LES 4/2000, S. 171-172Es ist außerordentlich begrüßenswert, dass mein Artikel „Das zwei-sprachige Wörterbuch: die Krücke des Übersetzers" in LES 3/2000,S. 121-123, eine so ausführliche Reaktion ausgelöst hat. Mein primä-res Anliegen war es ja, Wörterbuchbenutzer, und ich denke dabei inerster Linie an die Übersetzer als professionelle Nutzer, zu sensibili-sieren, damit sie zweisprachigen Wörterbüchern grundsätzlich miss-trauen, auch wenn es sich, wie im Falle von Potonnier (1990) undDoucet/Fleck (1997), um gute Wörterbücher handelt. Ein Fachwör-terbuch wird niemals in der Lage sein, sämtlichen Anforderungen zugenügen. Soweit wird mir Klaus E. W. Fleck sicher zustimmen.
Mit seinen Ausführungen hat Fleck demonstriert - und dafür binich ihm sehr dankbar -, wie wichtig Fachwissen ist, wieviel Fachwis-sen notwendig ist, um Äquivalente für ganze drei Ausgangsterminianbieten zu können, und wie kompliziert es auch dann immer nochist, auf der Grundlage dieses Fachwissens einigermaßen zuverlässigeEntsprechungen zu finden, die dem Benutzer Entscheidungshilfenan die Hand geben. Ich habe mich in meinem Beitrag in die Lage ei-nes Übersetzers versetzt, dem das nötige Fachwissen fehlt. Es hatsich gezeigt, dass die Eintragungen in den oben genannten Wörter-büchern unzulänglich waren. Also mussten eigene Recherchen wei-terhelfen. Ich habe mich - aus Zeitgründen, wie das bei Übersetzernnicht anders zu erwarten ist - dabei auf einige wenige einsprachigeRechtswörterbücher gestützt. Dass dies problematisch ist, ist unbe-stritten, denn die Autoren sind gezwungen, aus Platzgründen ihreDefinitionen sehr kurz zu halten. Damit entsteht die Gefahr, dassunter Umständen Informationen weggelassen werden, die die Äqui-valenzsuche erschweren können.1 Doch denke ich nach wie vor, dassdas Ergebnis der Kurzrecherche deutlich besser ist als das, was ichvorgefunden habe. Dass auch mein Ergebnis zu verbessern ist, daranzweifle ich nicht. „Le mieux est Tennemi du bien" (Voltaire). Ichwarte daher gespannt auf die nächste Auflage des Doucet/Fleck.
Es ist nicht schwer, in einem zweisprachigen Fachwörterbuch Feh-ler zu entdecken. Mir lag es aber fern, durch meine sehr punktuelleKritik die Wörterbuchverfasser etwa zu „beschuldigen", schlechteArbeit geleistet zu haben. Ich habe vielmehr allergrößten Respektvor deren Leistung. Sie sind in meinen Augen gewissermaßen Her-kules und Sisyphus in einer Person. Ihre Arbeitsleistung kann vondaher gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Nur: Eine solche Ar-beit überfordert, wenn das Fachgebiet weit gesteckt ist, das Wissenund die Arbeitskraft des Einzelnen. Doch Teamarbeit ist leider sel-ten anzutreffen. Zum einen ist es für den Verlag eine Kostenfrage.Zum anderen ist es schwer, Experten zu finden, die ein größeresFachgebiet in zwei Kulturräumen überblicken. Auch das sollte demBenutzer bewusst sein, dann geht er mit größerer Vorsicht an dasWörterbuch heran.
Ich möchte im Folgenden nicht auf Details im Beitrag von Fleckeingehen. Damit kann sich der kritische Leser selbst auseinanderset-zen. Ich möchte mich vielmehr mit einigen grundsätzlichen Fragenbefassen, die er aufgeworfen hat.
Unter begriffssystematischer Terminologiearbeit verstehe icheinen Vorgang in drei Phasen (s. dazu Arntz/Picht 1989: 155 ff.). Ineiner ersten Phase wird ein Teilgebiet eines Kulturraums abgesteckt.In unserem Fall das Teilgebiet Strafprozessordnung. In diesem Teil-gebiet werden dann u.a. alle Personenbezeichnungen ermittelt: An-geklagter, Angeschuldigter, Beschuldigter. Diese werden definiertund durch ihre Definitionsmerkmale systematisch gegeneinanderabgegrenzt. In der zweiten Phase wird analog das Begriffsystem imanderen Kulturraum erstellt, hier aus dem Teilgebiet Code deproce-durepenale. Erst in der dritten Phase erfolgt die Gegenüberstellung,die Aufschluss darüber gibt, wo volle, teilweise oder gar keine Äqui-valenz besteht.
Für den Lexikographen unproblematisch ist der Fall der vollenÄquivalenz, bei dem die Termini in Ausgangs- und Zielsprache in al-len Merkmalen begrifflich übereinstimmen. Das andere Extrem ist
168
die Null-Äquivalenz. Hier bietet sich als Lösung die Entlehnung, dieLehnübersetzung, die terminologische Neuprägung oder eine er-klärende Umschreibung in der Zielsprache an (auch dazu Arntz/Picht: 159-164). Am interessantesten ist aus meiner Sicht die Teil-äquivalenz, mit der wir es im obigen Beispiel weitestgehend zu tunhaben. Hier kommt der Glosse eine ganz besondere Bedeutung zu.Sie soll die Unterschiede, das Sich-nicht-Deckende herausarbeiten.Der von mir gewählte Ansatz waren Kurzdefinitionen hinter den je-weiligen Termini. Wichtig ist dabei, dass diese Kurzdefinitionen inder Sprache des Terminus abgefasst werden. Also: Angeschuldigterwird auf Deutsch und accuse auf Französisch definiert. Dies wird we-der im Potonnier noch im Doucet/Fleck hinreichend beachtet. DieFolge: Man verwendet zur Erklärung eines Terminus der Ausgangs-sprache Termini und Begrifflichkeiten aus einem fremden Kultur-raum, und das muss schiefgehen. In meiner Neufassung der Wörter-bucheinträge gerät Angeklagter nicht ~ wie Fleck unterstellt - in diebegriffliche Nähe von contravention. Contravention erscheint viel-mehr in der Glosse zuprevenu. Die Kurzdefinition zuprevenu deutetihrerseits an, dass prevenu im Zusammenhang steht mit einem delitoder einer contravention^ alle weiteren Informationen müsste derBenutzer dann unter delit und convention finden. So betrachtet,macht der Wörterbücheintrag, wie ich ihn vorgeschlagen habe, deut-lich, dass die Definition im deutschen Recht an das Verfahren an-knüpft, im französischen Recht dagegen an Straftaten. Was daran ir-reführend sein soll, vermag ich nicht zu erkennen.
Nun findet sich noch eine Personenbezeichnung, die weitere Prob-leme aufwirft: contrevenant, „celui qui commet une contravention"(Cornu 1996).2 Zunächst ein Abgrenzungsproblem: Geht man vomdeutschen Strafrecht aus, fällt contrevenant aus der Betrachtung he-raus, da die Rechtsverletzungen des contrevenant zwar im französi^sehen System dem Strafrecht zuzuordnen sind, im deutschen Systemaber weitestgehend in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten fallen.Geht man vom französischen Strafrecht aus, ergibt sich auf deut-scher Seite strafrechtlich eine Null-Äquivalenz. Aber auch wenn dasTeilgebiet geöffnet wird und die Ordnungswidrigkeiten mit erfasstwerden, ist das Problem nicht aus der Welt. Fleck verweist auf daselektronische Rechtslexikon (1996), in dem derjenige, der^eine Ord-nungswidrigkeit begangen hat, als Betroffener bezeichnet wird. EineLegaldefinition gibt es meines Wissens nicht. Die Definition stimmtnicht mit dem überein, was im Creifelds (2000) dazu unter demStichwort Ordnungswidrigkeiten zu finden ist. Dort ist vom Täter dieRede, während Betroffener verwendet wird, wenn es um die Konse-quenzen aus der Tat geht. Der Täter ist demnach von den Folgen sei-ner Tat in dem Sinne „betroffen", dass er z. B. ein Verwarnungsgeldoder eine Geldbuße zu gewärtigen hat.3 Hier bewahrheitet sichFlecks Aussage, dass es sich lohnt, mehrere Quellen zu konsultieren.Doch was, wenn wie hier die Rechtsexperten sich nicht einig sind?
Ich möchte das terminologische Problem hier aber nicht weitervertiefen, sondern am Beispiel contrevenant aufzeigen, dass die Be-schränkung der zweisprachigen Wörterbücher auf die Wortebenesehr problematisch sein kann. Die Lösung für ein terminologischesProblem ist oftmals nicht auf der Wortebene, sondern vielmehr aufder Satz- oder Textebene zu suchen.
L'artide 1789 CG./, prevoit que le contrevenant awc regles dupaiement de la faxe sur la valeur ajoutee sera puni d'une amendefiscale.
Nach § 1789 des C.G.L (Steuergesetzbuch) werden Verstöße ge-gen die Vorschriften zur Entrichtung der Umsatzsteuer mit einerGeldbuße geahndet.
In diesem Beispiel helfen uns weder Betroffener noch Täter weiter.Die Betrachtungsweise muss vom Hancfiiingsträger auf die Hand-
Lebende Sprachen Nr. 4/2001
Bereitgestellt von | Universität OsnabrückAngemeldet | 131.173.17.161
Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
lung verlagert werden. In der deutschen Fassung steht der Tatbe-stand im Vordergrund und nicht der Täten
Ist ein Verweis auf den Täter gewünscht, kann auch eine täterzen-trierte Lösung gefunden werden, wobei die Wörterbuchcinträge wie-der nicht weiterhelfen:
Wer gegen die Bestimmungen des § 1789 CG./. (Steuergesetz-buch) zur Entrichtung der Umsatzsteuer verstößt, wird mit einerGeldbuße4 bestraft/belegt.
Problematisch ist hier die Kollokation am Satzende: jrndn mit einerGeldbuße bestrafen/belegen. Bessere Kollokationen, d. h. konventio-nellere, wären wohl://mftn eine Geldbuße auferlegen/gegen jmdn eineGeldbuße verhängen. Doch vertragen diese sich syntaktisch nicht mitdem Satzanfang. Außerdem entspräche eine tatzentrierte Überset-zung eher den Vertextungskonventionen. Die Lösung könnte dem-nach wie folgt lauten:
Wer gegen die Bestimmungen des § 1789 CG./. (Steuergesetz-buch) zur Entrichtung der Umsatzsteuer verstößt, begeht eineOrdnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet wird.
In Bezug auf Vertextungskonventionen würden uns die Wörter-buchangaben also ebenfalls nicht weiterhelfen.
Diese Überlegungen zeigen jedenfalls die Grenzen des zweispra-chigen Wörterbuchs auf, von dem keine großen Hilfen für Problemeoberhalb der Wortebene zu erwarten sind.
Dass das Äquivalent oftmals nicht auf der Wortebene, sondernauf der Satzebene in Gestalt einer anderen syntaktischen Konstruk-tion zu finden ist, zeigt auch das folgende Beispiel.
Für den steuerrechtlichen Terminus assujetti (m) geben sowohlPotonnier als auch Doucet/Fleck als Entsprechung Steuerpflichtigeran. Assujetti ist ein Terminus aus dem Bereich der indirekten Be-steuerung und kommt vor allem im Zusammenhang mit der Mehr-wertsteuer (TVA) vor. Definition: „expression utiliseepour designerles redevables des droits indirects ou des tax.es sur le chiffre d'affaires.(...). En mauere de laxes sur le chiffre d'affaires, sont considerescomme assujettis toutes les personnes physiques ou morales qui effec-tuent, d'une moniere independente, a titre habituel ou occasionnelt uneou plusieurs livraisons de biens ou de prestations de Services relevantd'une activita economique." (Barilari/Drap6 1987). Diese Definitiondeckt sich weitestgehend mit der Definition des Unternehmers im^deutschen Umsatzsteuergesetz. Nun ist der Unternehmer in Bezugfcuf die Umsatzsteuer nicht als Steuerpflichtiger definiert. Steuer-pflichtig ist vielmehr der Umsatz, denn die Umsatzsteuer zählt zuden Objekt- und nicht zu den Subjektsteuern. Der Unternehmer istim Rahmen der Umsatzsteuer als Steuerzahler zu bezeichnen, weiler die Steuer eintreibt und konkret zahlt, d. h. an die Finanzkasse ab-führt. Soweit er dieser Pflicht (noch) nicht nachgekommen ist, ist erSteuerschuldner (§ 13 UStG 1980). Der Endverbraucher ist derje-nige, der die Steuerlast tragen soll, der Steuerdestinatar, und soferner dies tatsächlich tut, ist er der Steuerträger. Soweit die terminologi-sche Abklärung aus der Sicht der Umsatzsteuer. Lediglich in der Ab-gabenordnung taucht der Unternehmer als Steuerpflichtiger auf(§ 33 AO 1977). Der Wörterbucheintrag müsste also erweitert wer-den um die Termini Steuerzahler, Steuerschuldner und Unternehmer,wobei dem Benutzer durch Glossen Anwendungshinweise zu gebenwären.
Interessanter ist allerdings der Aspekt, der im Zusammenhang mitBetroffener angesprochen wurde: In französischen Texten zur Um-satzbesteuerung besetzen häufig Personen die Subjektstelle des Sat-zes, in analogen deutschen Fachtexten dagegen der Umsatz (Liefe-rungen und sonstige Leistungen). Dem Übersetzer würde es daherwenig nützen, wenn er im Wörterbuch als Entsprechung für assujettidie Termini Unternehmer, Steuerzahler, Steuerschuldner und Steuer-pflichtiger fände. Die Benutzung des Wörterbuchs verleitet ihn zurAusfüllung einer Vokabellücke, mit anderen Worten zu einer wörtli-chen Übersetzung. Jeder Übersetzer weiß aber aus Erfahrung, dassdie wörtliche Übersetzung nicht immer möglich ist, und wenn doch,nicht unbedingt zu einem stilistisch adäquaten Text führt. Dahersucht er beispielsweise über die Paraphrasierung ans Ziel zu kom-men. Dazu ist oft ein erheblicher Umbau der Oberflächenstrukturerforderlich.5 Die Vertextungskonventionen eines Fachgebiets kanner jedenfalls nicht im Wörterbuch finden. Da muss er sich schon dieMühe machen, Fachtexte zu studieren, womit wir wieder beim An-fangspunkt angelangt wären: bei der Forderung nach Aneignung vonFachwissen und damit nach Lektüre von Fachtexten und deren Aus-
wertung. Das Fachwörterbuch könnte ihm aber durch eine Glosseeinen Fingerzeig geben und ihn auf die Veränderung der Perspektivehinweisen, ein Desiderat, von dem wir noch weil entfernt sind. Hiersetzt die eigene Terminologiearbeit des Übersetzers an (Erfassungvon Kontexten, Kollokationen, Phraseologismen, Anmerkungenusw.). Terminologische Datenverarbeitungsprogramme bieten ihmheutzutage dafür eine gute Arbeitsgrundlage. Zur Erläuterung desGesagten einige Beispiele:
assujetti obligatoire
nicht:
*obligalorischerSteuerpflichtiger/Unternehmer/Steuerzahler/Steuerschuldner,
sondern:
steuerpflichtige Umsätze
Assujetti in der Wortart des Partizips:
les ve^rinaires sont assujettis a la TV A pour les operationssuivantes:...
Folgende Umsätze der Veterinäre unterliegen der Umsatzsteuer:
Die Umsätze, die im Französischen in einem präpositionalen Gefügeangeschlossen werden, rücken im Deutschen in die Subjektstellung.Das Subjekt im Französischen erscheint in der deutschen Version alsGenitivattribut. Nach diesem Muster erhält man Übersetzungen, dieden Vertextungskonventionen der Experten entsprechen. Nun zeigtsich beim Studium französischer Texte noch ein gewisser Gestal-tungsspielraum. Statt assujetti wird z.B. auch imposable, taxable,soutnis, passible de verwendet, die als Kollokationen interessantwerden bei der Übersetzungsrichtung DE-FR. Auch im Bereich derPräpositionen gibt es Alternativen zu pour.
Sont exoneres a raison de leurs prestations suivantes les profes-sionnels suivant:...
Folgende freiberufliche Leistungen sind umsatzsteuerfrei:... /diefreiberuflichen Leistungen folgender Berufsgruppen sind um-satzsteuerfrei: ...
(Je nach Texterfordernissen also mal mit, mal ohne Nennung vonPersonen.)6 Solche Informationen, die sich aus der Lektüre vonFachtexten ergeben, muss der Übersetzer in seiner terminologischenDatei festhalten.
Abschließend noch einige Gedanken zur Glosse in zweisprachigenWörterbüchern. Die Glosse erfüllt einen wichtigen Zweck. Zunächsteinmal signalisiert sie dem Benutzer, dass es Äquivalenzproblemegibt. Sie mahnt ihn somit zur Vorsicht. Dann beschreibt sie die Prob-leme, als Desiderat auch solche, die über die Wortgrenze hinausrei-chen. Der Benutzer kann/muss u.U. selbst weiter recherchieren,wenn die Informationen nicht ausreichen. Natürlich hat Fleck Recht,wenn er sagt, dass Printwörterbücher umfangreiche Erläuterungennicht zulassen. Sie lassen aber durchaus kurze Erläuterungen zu, diedie Qualität des Wörterbuchs deutlich steigern können. Jede Glosseist prinzipiell ein Qualitätsgewinn. Als Beispiel sei das Wörterbuchvon Schäfer (1998) genannt, in dem z.T. hervorragend glossiert wird.Elektronische Wörterbücher bieten zwar tendenziell unbeschränk-ten Raum, doch auch bei der Verfassung von elektronischen Wörter-büchern kann der Lexikograph nicht sein ganzes Wissen ausbreiten.Er muss es im Hinblick auf den Benutzer selektieren. Der professio-nelle Übersetzer steht unter Zeitdruck. Er will eine schnelle, zuver-lässige Auskunft, die ihm seine Entscheidungsfindung erleichtert.
Insofern erwartet den Lexikograph hinsichtlich der Glossierungeine riesige Aufgabe, auf die dankenswerterweise Frank Schneider(1998, 1999, 2000) immer wieder durch seine Publikationen auf-merksam macht.
Anmerkungen1 Wie zuverlässig sind Informationen von Experten? Wenn man selbst
kein Experte ist, muss man sich in gewisser Weise auf deren Wissenverlassen. Doch wenn die Experten sich selbst nicht einig sind, was
Übende Sprachen Nr. 4/2001 169
Bereitgestellt von | Universität OsnabrückAngemeldet | 131.173.17.161
Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
durchaus nicht ungewöhnlich ist, steht der Lexikograph oder der Über-setzer zwangsliiufig vor einem Dilemma.
2 Auf das Problem der Glcichsetzung von contravemion und Ordnungs-Widrigkeit hat Fleck bereits hingewiesen. Ein « wäre demnach ange-brachter als ein =. Worin der Unterschied bestellt, bliebe noch zuklären und dem Wörterbuchbenutzer durch Glossierung zu verdeutli-chen.
3 Das scheint mir auch sprachlich schlüssig zu sein. So definiert der Du-den (1993) den Betroffenen als jemanden, der von einer Sache betrof-fen, in Mitleidenschaft gezogen ist.
4 Die Entsprechung Steuerstrafe für amende fiscale, die Potonnier undDoucet/Fleck anbieten, ist zweifelhaft. Amende fiscale grenzt sich abvon amende penale, was dem Gegensatz von Geldbuße und Geldstrafeentspricht. Der Zusatz fiscale hat hier disambiguierende Funktion.Außerdem ist der Hinweis auf das Gebiet Steuern kontextuell überflüs-sig.
5 Standardisierte Wendungen bieten dafür gute Beispiele. Der amerika-nische Autofahrer liest die Warnung „Do not drink and drive", derdeutsche liest die gleiche Warnung in ganz anderer Form: „Kein Alko-hol am Steuer!"
6 Dass aber auch im Französischen der Sachverhalt in die Subjektstel-lung des Satzes rücken kann, zeigt folgendes Beispiel: Les honorairesperqus par les notaires au titre d'operations relevant de leur activite speci-fique sont imposables a la TV A - Die Honorare der Notare aus ihrerfreiberuflichen Tätigkeit unterliegen der Umsatzsteuer.
LiteraturverzeichnisArntz, Reiner/Picht, Heribert (1989): Einführung in die Terminologiear-
beit. Hildesheim, Zürich, New York.Barilari, AndreVDrapo, Robert (1987): Lexique fiscal. Paris.Cornu, G£rard (1996): Vocabulaire juridique. 6e Edition revue et aug-
mentoe. Paris.Creifelds, Carl (2000): Rechtswörterbuch. 16., neu bearb. Aufl. München.Doucet, Michel/Fleck, Klaus E. W. (1997): Dictionnaire juridique et 6co-
nomique, tome 1: Frangais-Allemand. 54meEdition. Paris.Duden (1993): Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 2., völlig
neu bearb. u. stark erw. Aufl. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.Potonnier, Georges EdTPotonnier, Brigitte (1990): Dictionnaire de l'eco-
nomie, du droit et du commerce, tome 2, Frangais-Allemand. 2e edition.Wiesbaden.
Schäfer, Wilhelm (1998): Wirtschaftswörterbuch. Bd. 1: Englisch-Deutsch.6., überarb. u. erw. Aufl. München.
Schäfer, Wilhelm (1997): Wirtschaftswörterbuch. Bd. 2: Deutsch-Englisch.5., überarb. u. erw. Aufl. München.
Schneider, Franz (1998): Studien zur kontextuellen Fachlexikographie.Das deutsch-französische Wörterbuch der Rechnungslegung. Tübingen.
Schneider, Franz (1999): „Vom Terminologievergleich zum adressaten-adäquaten Übersetzungsprodukt. Französisch-deutsche Steuerkon-zepte". Lebende Sprachen XLIV, Heft 2,78-83.
Schneider, Franz (2000): „Die Glosse im zweisprachigen Wirtschaftswör-terbuch (2. Teil). Ein Instrument zur Erreichung von interkulturellerVerstehenssouveränität und zum flexiblen Gebrauch von Äquivalen-ten". Lebende Sprachen XLV, Heft 2,68-72.
DlRK SlEPMANN'\
Recueils de vocabulaire1 «Lemwörterbücher»:revue de detailLa lexicographie a le vent en poupe. Ce constat vaut pour lesdictionnaires generaux comme pour les ouvrages ä vocationpedagogique. II suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coupd'oeil sur les grands dictionnaires allemand-frangais2, entie-rement refondus en 1995, et les recueils de vocabulaire, quine cessent de se multiplier. Parmi ces derniers, quatre ouvra-ges retiendront notre attention dans le present compte-rendude synthese. Notre analyse comprendra deux temps: unepremiere section offrira une vue panoramique sur les acquispertinents de la recherche. Ce rapide aper$u debouchera surun faisceau de criteres d'appreciation. Partant de ceux-ci, ladeuxieme partie de l'article presentera un examen detaille dechaque lexique.
Interrogeons-nous d'abord sur les caracteristiques d'undictionnaire ideal ä l'usage de nos eleves et etudiänts.
Comme Pattestent certaines recherches en psycholinguis-tique (p.ex. Krings 1986), les apprenants, mSme avances, dufranc.ais iangue etrangere ont tendance ä se servir presqueexclusivement du dictionnaire bilingue pour resoudre leursproblemes de traduction. Ce genre d'ouvrage se doit donc derefleter aussi fidelement que possible toute l'etendue duvocabulaire des deux langues qu'il decrit. Or, comme chacunsait, tous les dictionnaires bilingues presentent de graveslacunes. Celles-ci sont de deux ordres (Meyer 1988): ellesconcernent, d'une part, la selection du mot juste dans laIangue d'arrivee et, d'autre part, la combinaison adequate dedeux ou plusieurs unites lexicales. Le premier type de diffi-culte provient soit de l'absence de certaines entrees dans laIangue source ou dans la Iangue cible, soit d'une discrimina-tion insuffisante entre les traductions proposoes. Le deu-xieme type de difficulto, lie ä la combinatoire des mots, semanifeste ä tous les niveaux (morphologie, syntaxe, colloca-tions). Nous illustrerons ces defauts dans la deuxieme partiedu present article.
Comment un dictionnaire ideal comblerait-il les lacunesque nous venons de constater ? C'est le travail sur corpus
informatise qui poufrait apporter des reponses ä cette inter-rogation. Dans ce domaine, ne nous le cachons pas, leRoyaurne-Uni a plus d'une longueur d'avance sur les autrespays. De ceci temoignent les excellentes reeditions desquatre principaux dictionnaires d'apprentissage de Tanglaisainsi que la publication d'un dictionnaire de collocations,moins bon celui-lä3, qui sont tous fondes sur le depouillementde vastes corpus de textes electroniques. Devant les oceansd'informatioris s'offrant aux linguistes de corpus, d'une part,et les contraintes de place imposoes par un recueil de voca-bulaire de l'autre, la seule question qui se pose est de savoircomment operer des choix justifiables. Plus concretement,comment decider laquelle de deux collocations de m6rne fre-quence (p.ex. parvenir a + compromis vs. aboutir a + compro-mis) merite d'etre inclüe dans un recueil de vocabulaire ?
La lexicographie pedagogique des langues autres quel'anglais n'en est qu'ä ses balbutiements (cf. Bogaards 1998),mais Texperience britannique ne manquera pas, du moinsTesperons-nous, de faire des emules dans un päys aussi ferude lexicographie que la France. Font cruellement defaut,jusqu'ä prosent, des dictionnaires d'apprentissage et desmanuels de vocabulaire du frangais Iangue eträngere quipuissent e*galer leurs pendants anglais. Seule exception: deuxlexiques destines en priorite au superieur et qui regroupentune multitude de collocations utiles (Gusdorf 1991, Siep-mann 1997).
Qui dit acquisition du lexique, dit momoire. Rappeionsdonc rapidement un certain nombre de rosultats et d'ihypo-th^ses plausibles auxquels sont parvenus les psychologuescognitifs (cf. p.ex. Aitchison 1996, Carter 1998):
• Ce li'est qu'aux premiers stades de renseignement quel'apprenant peut s'accomnioder de listes de vocabulairebilingues; plus il est avance, et plus il profite d'une mise encontexte du lexique. v *
170Übende Sprachen Nr. 4/2001
Bereitgestellt von | Universität OsnabrückAngemeldet | 131.173.17.161
Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
• Les recherches sur l'aphasie indiquent que le lexique eststockt sous forme de champs somantiques. Les connec-tions les plus fortes sont celles qui existent entre les collo-cations et les binömes (le sei et le poivre, la faucille et lemarteau), alors que les relations unissant les hyponymes äleurs hyperonymes sont en gon&ral moins £troites.
• Les lexies sont retenues comme des touts, un mot tel que«inimitable», par exemple, n'£tant pas segmento en lesmorphemes qui le composent.
• Le lexique est la composante centrale de notre grammaireintorieure. A un motif enonciatif correspondent d'abordun certain nombre d'unitos lexicales, qui construisent äleur tour un environnement syntaxique dotermino.
• La probabilite d'accfcs ä un souvenir est fonction de lafrequence et de la rocence de son utilisation. Un mot devocabulaire qui ne fait pas l'objet d'un rebrassage rogulierse perdra donc rapidement. Moyen mnomotechniqueconnu depuis des si&cles, la rocitation mentale d'un mot oud'une phrase en favorise la memorisation.
• Loin d'etre des roceptacles passifs comparables auxfichiers informatiques, nos momoires ont besoin de traiteractivement Information afin de la retenir sur la dur£e (cf.p.ex. Schunk 1990). II importe donc de relier les acquisi-tions nouvelles aux connaissances pr6alables (assimilationpar elaboration). U n mot a d' au tan t plus de chancesd'dtre retenu qu'il se rattache ä des structures d'ensembleetablies anterieurement. Ce qui compte, c'est donc nonseulement la r6gularit£ du rebrassage, mais encore säsystomaticite, l'activito structurante du sujet et l'intensit£des impressions qu'il regoit.
Que pouvons-nous conclure de ce bref tableau des acquis dela recherche ? Voici quelques suggestions qui recueilleront,croyons-nous, Padhesion de tout le monde.
• II est tout indique de regrouper les unites lexicales parcentres d'interet. Ceux-ci devraient correspondre, autantque faire se peut, ä des realites psychologiques.\ Les lexemes devraient faire l'objet d'un regroupement
associatif ayant la collocation comme unite de base. Danscet ordre d'idees, on n'insistera jamais assez sur la combi-natoire des substantifs et des adjectifs, encore trop souventnegligee par les lexicographes.
• Afin d'aider l'apprenant ä comprendre des subtilitesreforentielles qui, autrement, risqueraient de passerinapergues, un dictionnaire ideal devrait intägrer des motset expressions propres ä une civilisation donnoe dans ledomaine de ce qu'il est convenu d'appeler «wiederholteRede» (Coseriu). En ce qui concerne la langüe par!6e, parexemple, il y aurait avantage ä recenser ces enonces toutprets qui jouent un röle primordial dans la communicationau quotidien (premiere nouvelle\ fausse joie\ ni vu, niconnu; minute, papillon', en voiture, Simone; glisse, Alice',je te dis les cinq lettres; tu m'en dir äs des nouvelles etc.)Meißner (1992) et Cellard (1982) sont les seuls ä recenserun nombre consequent de ces formules routinisees. Autremanifestation de ce phonomene: les citations bibliques,auxquelles Ettinger (1977) a consacro une etude fort in-teressante. Vingt ans plus tard, dans une sociote de moinsen moins imprognee du christianisme, c'est d'abord etavant tout la publicite qui apparait comme une source inta-rissable d'expressions toutes faites. Prenons comme Illus-tration les propos suivants tenus par John Sinclair le 5f6vrier 1990 lors d'une conforence ä l'universito de Dur-ham en Angleterre:(...) Let's look at some examples. Ahm, this is one from a publisheddictionary to illustrate the use of the word <creepy>: <The ghost storymade us all creepy.> Ahm, looks good, smells good, tastes good and soon, but nobody would ever say it. (...)
Pour un locuteur non natif qui ne dispose pas d'uneconnaissance intime de la culture britannique de ces vingtdernifcres annoes, Tallusion ä un slogan publicitaire con-tenue dans cet extrait est loin d'etre evidente. II s'agit, biensür, du cofebre slogan de la brasserie britannique Guin-ness: // looks good, it tastes good, and by golly it does yougood. Ce phonomene de roförence subtile ä un savoir cul-turel partage est aussi froquent en France. Qu'il suffise dementionner les diverses variations que peut subir lecolebre aphorisme En France, on n'a pas de petrole, maison a des idees ou le slogan de POr£al parce que je le vauxbien. Nombre de formules percutantes de ce genre finis-sent par s'implanter dans l'inconscient collectif. On peuten donner l'ülustration suivante. Si, encore aujourd'hui,tout jeune Allemand connait l'expression Keine Experi-rnentel, personne, ou peu s'en faut, ne se souviendra qu'onl'attribue ä Tancien chancelier föderal Konrad Adenauer.
• Enfin, s'agissant des langues de spocialito, il y aurait inte-r6t ä expliciter les relations d'hyperonymie et d'hyponymiepour des mots passe-partout tels que activite (sur cesubstantif et ses multiples emplois, cf. Fandrich 1996).
II va sans dire que certains problemes restent, pour l'instant,difficiles ä rosoudre. Ainsi, par exemple, des restrictionstransformationnelles portant sur les locutions idiomatiques.Face ä jeter un pave dans l a märe, par exemple, on ne peutavoir jeter änquante paves dans la märe, alors que d'autrestransformations sont parfaitement conformes au genie de lalangüe: le ministre des Affaires etrangeres a jete un nouveaupave dans la märe, ilajete un pave dans la märe diplomatique,il adore jeter des paves dans la märe, c'est un peut pave dans lamäre de Jacques Chirac. Dans ce domaine, les dictionnairesdoivent se contenter de donner des exemples.
Pour clore cette reflexion theorique, encore un mot sur lavisee du present compte-rendu. Alors que les recherches surl'utilisation des dictionnaires, et plus particulierement desdictionnaires d'apprentissage, ont connu un essor importantau cours de ces dernieres annoes (cf. p.ex. Zöfgen 1994 et levolume numero l [1999] du International journal of Lexico-graphy), il n'en va pas de meme pour les recueils de voca-bulaire, de sorte que nous nous abstiendrons de porter desjugements dans ce domaine. II convient de ne pas oublier queles recueils de vocabulaire constituent un prolongementnaturel4 de la section «vocabulaire» des manuels de frangaiset ressemblent d'ailleurs beaucoup ä celle-ci. Les strategiesd'apprentissage et d'utilisation ä employer restent donc lesm§mes.
Nous aboutissons donc ä la liste suivante de criteres surlesquels seront juges les ouvrages sous recension:
• regroupement du vocabulaire• informations grammaticales (morphologie, syntaxe)• collocations• formules routinisees• unitos lexicales propres aux civilisations en question• utilite des exemples• niveau de fiabilite• niveau de representativite
La table suivante präsente sommairement des approciationsqui se fondent sur les comptes-rendus elaboros ci-dessous.Pour chaque critere, nous avons attribuo une note de zero (laplus mauvaise note) ä vingt (la meilleure note).
Critereregroupementdu vocabulaireinformationsgrammaticales
Haas/Tunc18
10
Niemann18
8
Fischer/Moneger5
l
Buffard17
11
Usbende Sprachen Nr. 4/2001 171Bereitgestellt von | Universität Osnabrück
Angemeldet | 131.173.17.161Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
Critcrccollocntionsformulcsroutinisocsunites lexicalcsculturellementmarqu^esexemplesniveau de fiabilitoniveau dereprosentativite
Haas/Tanc1415
10
161816
Niemann8
14
12
71814
Fischer/Monegcr23
3
31510
Buffard109
13
141915
Joachim Haas/Danielle Tanc, Französischer Wortschatz:Lernwörterbuch , Frankfurt: Diesterweg 1996.
Ce recueil de vocabulaire vise en premier lieu ä developperles moyens d'expression de Petudiant du superieur et dePapprenant ayant acquis une bonne connaissance du frangaisde base. L'ouvrage recense 5445 entrees, 2670 phrases-exem-ples, 340 collocations en dessous du niveau de la phrase et270 locutions. Ce materiel linguistique a ete rassemble defagon logique sous des rubriques eprouvees telles que DieKörperpflege, Die Gefühle, Einkaufen, Soziale Sicherheit,Seine Meinung sagen, dont chacune renferme un ensemblelexical limite et homogene.
Soucieux d'aider Papprenant ä inserer correctement lesmots nouveaux dans un contexte, les auteurs fournissent desindications utiles^concernant les combinatoires de toutes lescategories grammaticales. Ainsi, le verbe se situer est pre-sente, entre autres, avec les locutions prepositives au nord,dans le Nord, sur la cote, a VOcean et a l'embouchure de laSeine. Sont egalement indiques les verbes n'entrant pas dansles meines constructions que leurs equivalents aUemands(p.ex. s'abonner a qqc, apprendre qqc a qqn). L'apprenantdesireux d'en savoir plus sur les conditions d'emploi desverbes pourra proceder ä une analyse des phrases-exemples.A labourer, par exemple, on apprend quel type de sujetforme collocation avec ce verbe: les champs sont laboures auprintemps et en automne. A colorier, l'utilisation de la prepo*·sition en avec une indication de couleur est illustree par laphrase pourquoi as-tu colorie les arbres en bleu ? Qui plus est,les auteurs ont accorde une attention toute particuliere äPusage correct des prepositions avec les substantifs. Citonsquelques exemples: pendant la journee, les vaches sont dansles pres/au päturage, ils ont löge a la ferme, par cheque, a mesfrais. Autre atout de ce lexique: la forme feminine des adjec-tifs est systematiquement indiquee. Toutes ces precisioiissont d'un grand secours ä Papprenant de niveau interme-diaire. Au reste, les auteurs semblent partir du principe queleurs lecteurs possedent des connaissances de base en gram-maire frangaise, car ils omettent de donner des informationssur la place des adjectifs et de signaler Pemploi du subjonctifapres certains verbes tres courants tels que vouloir.
Si tient compte des exemples d'illustration, Pouvragesous recension s'avere tres riche en collocations. Ainsi, ausein du champ lexical das Recht, das Gesetz, on trouve, entreautres, respecter + loi, enfreindre/violer + loi, affaire + venirdevant le tribunal, etre cite comme temoin, bien meriter + pu-nition, sanctionner + severement.
Fait significatif, les auteurs ont reserve une placed'honneur aux formules routinisees. En voici Pun ou l'autreexemple: tupeux toujours courir!, etre tafele!, minute,papillonl·, Va te faire cuire un oeufl, tant quCily a de la vie, ilya de l'espoir, U faut prendre la vie comme eile vient, etc.Autant ces elements classiques de la «wiederholte Rede»sont nombreux, autant on peut regretter Pabsence du dis-cours politico-social (p.ex. touche pas a mon pole) et desSlogans publicitaires.
Quant aux oquivalents proposes dans Pouvrage, s'ils nesont souvent pas les seuls possibles, ils sont presque toujours
172
de bon aloi. Signalons toutefois quelques traductions discu-tables: ce n'est pas demain la veitte a e*to incorrectementrendu par das wird sicher nie wahr au lieu de so schnell gehtdas nicht ou das ist (vorerst) noch Zukunftsmusik. II en va dem£me pour lock-out qui se dit Aussperrung et non Ausschlußvon der Arbeit. L'adjonction de la particule da (et, le casochoant, de aber) ä P6nonce allemand du kannst lange wartentraduira mieux Pintensite de tu peux toujours courir!: dakannst du (aber) lange warten. Pour certaines entre*es, lesauteurs eussent bien inspires de donner les Äquivalents enlangue parloe de termes aux allures plus techniques. Cette re-marque s'applique non seulement ä Pecourtement des for-mes (heures supplementaires -> heures sup', le correspondant--> le corres') mais encore au langage administratif (renvoyer-> mettre a laporte) et mathematique (la representation gra-phique -> le graphique). En outre, les auteurs passent soussilence Pexpression par le passe, qu'ü y aurait intor^t ä con-traster avec dans le passe (cf. Siepmann 1997: 426). Enfin, ilmanque ä un certain nombre d'entrees un equivalent impor-tant. Ainsi, la telecarte cousine depuis un bon moment avec laplus ancienne carte de telephone et le mot fax rernplace com-munement le terme officiel telecopieur.
Lernwortschatz Französisch est assez represeritatif dufran9ais tel qu'il se parle et s'ecrit au seüil du XXIe siecle.L'enregistrement d'unites lexicales relativement recentes tel-les que sprays sans CFC temoigne de Pactualite de Pouvragerecense. Lorsqu'on constate Pinclusion de coliocations tellesque prendre des teintes variees, regulariser (un fleuve) ou larencontre du 3e type, il est neanmoins permis de faire quel-ques reserves sur les criteres de selectiön appliques par lesauteurs.
Hormis ces reserves, on ne recommendera jafnais assez cetouvrage qui repond parfaitement aux besoins du public-cibleenvisage.
Raymond-Fred Niemann, Les mots allemands. Editioncomplete. Deutsch-französischer Wortschatz nach Sach-gruppen. Paris: Hachette 1998.
Raymond-Fred Niemann a procede ä une mise ä jourgenerale de ce celebre recueil de vocabulaire. Destine ini-tialement aux germanistes francophones, il a ogalementrendu d'eminents Services ä des gerierations entieres de fran-cistes germanophones. Les traducteurs ayant Pallemand et lefrangais comme langues de travail pouiront ogalement enfaire leur profit. A la fois dictiönnaire de consultation etmanuel de vocabulaire, cette nouvelle edition des mots alle-mands repertorie quelque 42000 unites lexicales recouvrantpresque tous les aspects de la vie contemporaine. Une grandeportion du lexique recenso se compose de terrnes issus deslangues de specialite. Le vocabulaire est grpupo par famillesde sens. A Pinterieur de celles-ci, un classement onomasiolo-gique met Paccent sur les relations qu'entretiennent les lexiesentre elles. Les verbes, substantifs et adjectifs appartenant äune meme aire semantique sont places ensemble. Seuls cer-tains chapitres particulierement refractaires ä ce genre deciassement, comme celui sur la Zoologie et la botanique, sui-vent Pordre alphabotique. II n'y a rien ä redire ä cette pre*-sentation du vocabulaire.
Outre les indications de genre, Pouvrage ne fournit pas derenseignements grammaticaux. Ceci est d'autant plus regret-table que les collocations y sont re"duites ä la portion con-grue. Assuroment, certaines coliocations:y figurent, commepar exemple manquer sä replique, tenir la bride haute, unplombage est tombe, le bateau a ete pris dans les glaces du lac.Assuroment, celles-ci pr^senterit un grand int6r6t pour P6tu-diant avance. Force est pourtant de constater un manquecruel d'informations sur la combjiitatoire usuelle des unit6slexicales les plus courantes. Ainsi* bn trouve les tournures ä
Lebende Sprachen Nr. 4/2001Bereitgestellt von | Universität Osnabrück
Angemeldet | 131.173.17.161Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
la consonance littoraire comme dureta de coeur, alors que duravec qqn ou dur avec soi-m$me brillent par leur absence. APentre*e la meteo(rologie), il serait utile d'ajouter un patronde phrase du type a la matlo, ils ont dit que .../im Wetterbe-richt hieß es, daß; a genre il faudrait indiquer des collocationscomme de quel genre est ce mot ?.
Cette pauvreto en mattere de collocations contraste avecPabondance de routines langagferes et d'expressions cultu-rellement marquoes que nous offre Pouvrage sous recension.Prenons quelques exemples caractoristiques: on n'en croitpas ses oreilles / hast Du da noch Worte?, quel imbecile! / soein Kamel J', c'est du Sport! / Es geht hart auf hart!, on ne peutsatisfaire tout le monde / man kann es nicht jedem recht ma-chen, L'homme propose, Dieu dispose / der Mensch denkt,Gott lenkt, il n'y a que la foi qui sauve/ Wer's glaubt, wird se-lig, Je pense, donc je suis / Ich denke, also bin ich, Et pourtanteile tourne! / Und sie dreht sich doch!. En prime, Niemannnous propose un grand nombre de titres de films en allemandet en frangais ainsi qu'une liste de specialitos allemandesaccompagn6es de gloses explicatives. Notons cependant quePauteur privilogie les expressions dejä anciennes, de sortequ'on cherchera en vain des Slogans publicitaires du genreCoup de barre, Mars, et repart! / Mars macht mobil, beiArbeit, Sport und Spiel.
Les mots allemands n'enregistre pas systömatiquement dephrases-exemples. On y trouve neanmoins quelques phrasesutiles, comme par exemple eile est bien fichue ou // approchede la cinquantaine.
L'ouvrage recense presente un tres haut degre de fiabilite.Qä et lä, on rel&vera pourtant quelques traductions erronoes.Ainsi, ä la locution figee suer sang et eau (170) Niemanndonne comme equivalent Blut schwitzen. Or, comme Ettin-ger (1994) le fait remarquer, nous sommes ici en presenced'un faux ami phraseologique auquel correspond en alle-mand une locution comme arbeiten, was das Zeug hält (plusimagee que Pequivalent propose par Ettinger sich abmühen).L'idiomatisme Blut (und Wasser) schwitzen, lui, pourrait setraduire par avoir des sueurs froides. De m£me, Pusage con-femporain veut qu'on dise in den Bahnhofeinfahren au lieude in den Bahnhofeinlaufen. Mais il ne s'agit lä que de detailssomme toute insignifiants.
A nombre d'entrees il rnanque Pequivalent le plus usuel,surtout dans le sens frangais-allemand. Puisque la taille dePouvrage ne nous pennet d'en faire le tour que superficielle-ment, voyons quelques exemples un peu au hasard. A cloche(327), on trouve Fallbirne, mais non Abrißbirne. De m§me,pour pince (335) on trouve Kombinationszange, mais nonKombizange, pour äge mental (50) on trouve Intelligenzalter,mais non geistiges Alter, pour courner du coeur (253), on
, trouve Seufzerecke, mais non Kummerspalte, pour Rezensent(260), on trouve l'auteur d'un compte-rendu, mais non re-censeur et, enfin, pour Starter automatique (274) on trouveStartautomatik, mais non Choke. Inutile de multiplier lesexemples.
Pour ce qui est de la representativite, Les mots allemandsreflete assez bien Petat du vocabulaire frangais et allemand äPaube du troisieme millonaire. Ceci vaut presque dans lam§me mesure pour les langues de specialite que pour la lan-gue parlee. Le chapitre consacre ä la circulation routiere enfournit une bonne Illustration. A cöte d'un foisonnement determes techniques tels que refus depriorite, passage a niveatigarde et bareme des amendes figurent aussi des vocablescomme lever le pied, faire un tete-a-queue et aller dans ledecor. Des variantes diastratiques tels que appuyer sur leChampignon et accelerer a fond apparaissent cote ä c6te.Pour autant, un examen dotailte revele que cette juxtaposi-tion des registres n'est pas syst matique. La lexie serrer depres (la voiture qui precede), pour ne citer qu'un exemple,devrait etre concurrenco par coller au cul a qqn et peter les
couilles a qqn. Un second £16ment de critique s'impose. Eneffet, certains pans de la societe moderne ne sont pas traitesde fagon aussi minutieuse que d'autres. Dans le chapitre surPinformatique, par exemple, le vocabulaire relatif ä Internet,technologie porteuse s'ü en est, ne compte que dix items. Unrecueil de vocabulaire qui se veut rosolument modernedevrait enregistrer le site/der Site; talechargeable/herunterlad-bar; se connecter (se brancher) sur Internet/sich ans Internetanschließen-, le serveur/der Server, le moteur de recher ehe/dieSuchmaschine; placer un signet/ein Lesezeichen setzen; lessmileys, les souriants, les binettes/die Emoticons, die Smileys;la revue electronique/die elektronische Zeitschrift, etc. (cf.Burnand et al. 2001).
En r6sum6, on peut dire que Niemann nous livre, aveccette nouvelle edition des mots allemands, le manuel de vo-cabulaire le plus complet disponible sur le marche. Malgreson regime pauvre en collocations, c'est un livre ä mettreentre les mains de tous ceux qui, ayant acquis une bonnepratique du frangais ou de Pallemand primordial, se sententprets ä viser des objectifs plus ambitieux.
Walter Fischer/Dominique Monoger, Französischer Wort-schatz in Sachgruppen. München: Hueber 1996.
Cet ouvrage, dont la premiere edition remonte ä 1962, a faitpeau neuve, tant dans sä presentation que dans son contenu.Dosormais d'un format plus maniable, il a pour vocationd'aider Papprenant ä apprendre ou ä reviser un vocabulairede base comptant 12000 lexies. A Pinterieur des chapitres,consacres chacun ä un thfcme different, les auteurs traitent lesentrees selon Pordre alphabetique. Ce dernier choix lesexpose ä la critique de n'avoir pas tenu compte des acquisprecitos de la didactique des langues etrangeres. En effet,comme nous avons pu le constater, le regroupement al-phabetique des mots nouveaux n'en favorise pas la memori-sation.
A Pexception des indications du genre et du nombre dessubstantifs, Pouvrage sous recension ne comporte ni rensei-gnements grammaticaux ni entrees ä pertinence combina-toire. Semblablement, les auteurs n'ont enregistre que quel-ques rares collocations. Plus grave encore, les expressions fi-gees ont ete totalement nogligees.
On releve un certain nombre de traductions defectueuses.Le cas de Energiesparen est exemplaire ä cet egard. Le singu-lier economie d'energie (15) ne saurait rendre le terme alle-mand qu'en cas d'exception, ä savoir dans les noms composestels que problemes d'economie d'energie (Probleme beimEnergiesparen, Energiesparprobleme). Cette difficulte de tra-duction vient du fait que le nom allemand designe une notionabstraite et generale, qui se trouve particularisee par Pequi-valent propose. Economie d'energie correspond donc plutöt äEnergieersparnis (cf. p.ex. l'economie d'energie realisee parcette mesure). II faut mettre economie d'energie au plurielpour traduire avec justesse Energiesparen (cf. p.ex. dans ledomaine des economies d'energie). A ankücken/cliquer, ilconviendrait de signaler que le verbe frangais s'emploie leplus souvent avec la proposition sur. Meme remarque pourbrancher, embarquer (sur un bateau/dam un'avion), ajouter(a), etc. Dans Pusage contemporain, Hobby n'est equivalentni ä distraction ni ä centre d'interet. On dira tout bonnementhobby, dada ou violon d'Ingres. Nous ne multiplierons pasles exemples.
On peut reprocher qu'il manque des equivaients im-portants a nombre d'entroes. Citons quelques exemples:comestible (-> mangeable), contagion (-> infection, contami·nation), bonnes mceurs (-> us et coutumes), papier peint(-> tapisserie), mourir de mort naturelle (-> mourir de säbelle mort), detente (-> delassement, relaxation), etc.
Quant ä la reprosentativite de Pouvrage, il convient de
Lebende Sprachen Nr. 4/2001 173Bereitgestellt von | Universität Osnabrück
Angemeldet | 131.173.17.161Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
signaler qu'on cherchera en vain des noologismes courantstels que (talephone) portable/Handy (on dit aussi tolephonemobile/Mobiltelefon ou telephone cellulaire/Funktelefon),aliments genetlquemcnt modifies, aliments manipules gene-tiquement/genmanipulierte Lebensrnittel, graveur de CD-ROMs/CD-ROM-Brenner, CD-ROM vierge/Rohling, etc.
Les choses ne se prosentent pas mieux pour la languecourante familiere, etrangement absente du livre dont il estici rendu compte.
Malgre toute notre bienveillance, nous sommes biencontraints de deconseiller Französischer Wortschatz in Sach-gruppen aux professeurs et aux apprenants.
Therese Buffard, Hueber Großer Lernwortschatz Franzö-sisch, München: Hueber 1998.Congu comme manuel de vocabulaire ä l'attention des fran-cistes germanophones, ce livre se propose d'etre un outilnouveau pour l'apprentissage du vocabulaire frangais. 20chapitres portant sur les principales zones lexicales en for-ment Possature. Outre les unites lexicales proprement dites,l'ouvrage apporte, sous forme d'encadres, une manne derenseignements directement exploitables par l'apprenant delangue maternelle allemande. Cela va des faits de civilisationaux informations grammaticales, en passant par des indica-tions sur la prononciation. Ainsi, dans le chapitre intitule«manger ä Pexterieur» le lecteur trouvera des conseils judi-cieux sur le reglement d'une addition de restaurant. Dans lechapitre consacre au pouvoir legislatif, un encadre informe lelecteur sur la composition du parlement frangais. II s'agit läd'une approche novatrice et tres instructive. L'auteur auraitmeme pu aller plus loin en integrant, par exemple, lesmetonymies de lieu cheres aux journalistes (p.ex. au palaisBrongniart = a la Bourse de Paris).
Les informations grammaticales donnees dans Pouvrage,quoique rares, presentent une grande utilite. Une reserve,cependant: le resume succinct portant sur la feminisation desnoms de profession (p. 155-156) devrait 6tre mis ä jour dansune edition ulterieure. En effet, et nonobstant l'avis des Aca-demiciens, les salutations du type Madame la ministre vien-nent concurrencer celles qui emploient la forme masculine.
Therese Buffard a su integrer bon nombre de collocationsfrequentes. A examen, par exemple, on trouve passer unexamen, echouer a un examen, &tre colle a un examen, reussirun examen et etre requ a un examen. Les entrees de cettenature sont completees ä merveille par une ribambelle dephrases-exemples telles que eile est en rea, eile s'engage danstoutes sortes d'activites benevoles, allons voir les curiositestouristiques, ils ont lance des bombes sur l'aerodrome, etc.D'un ouvrage comme celui-ci, on serait pourtant en droitd'attendre qu'il fasse une plus large place ä la combinatoiredes noms. Pour amour, par exemple, on trouve il n'y a pasd'amour entre eux mais on cherchera en vain amour + de +syntagme nominal. De m6me, ä regard, on a eile a jete unregard dans la vitrine, mais il manque des exemples du genred'un regard + adjectif, regard(s) + sur. (survoler/fixer/...) duregard, sous le regard (de la television/attendri de Pierre),(avec beaucoup de tristesse) dans le regard, sans parier dePemploi figure de regard.
Les expressions figees que recense Großer LernwortschatzFranzösisch sont en nombre restreint et relevent dans leurquasi totalite du domaine des idiotismes. Exemples: mettreles boeufs devant la charrue, nous sommes tous dans le memebateau, contre vents et marees. Aucune mention n'est faited'expressions de creation recente telles que iln'y apasphotoou avoir le beurre et l'argent du beurre. Les unites lexicalesculturellement marquees sont, elles aussi, en nombre limite.
La plupart des traductions proposees sont fort heureuses.Exemples: apprendre ses leqons/seine mündlichen Hausauf-
174
gaben machen, ta chemise rouge est au linge sale/dein rotesHemd ist in der Wäsche, Souriez Gibbs!/Bitte recht freund-lich!, un incendie monstre/eine Brandkatastrophe, ils sontsortis indemnes du dosastre/Sie überlebten die Katastropheunversehrt, le petit Poucet a ete abandonna dans la for$t/derDäumling wurde im Wald ausgesetzt. II n'en reste pas moinsqu'en observant avec plus d'attention Tusage allemand,Tauteur aurait pu obtenir un meilleur rendu de certains itemslexicaux. Ainsi, eile traduit un choc emotionnel par einSchock für die Gefühle (29). A cettfe1 traduction bogayante,on prdfirera l'equivalent litteral ein emotionaler Schock. Al'inverse, je ne suis pas d'humeur a plaisanter a 6te rendu lit-teralement par ich bin nicht in der Stimmung zu scherzen aulieu de mir ist nicht nach Scherzen/Spaßen/Lachen zumute.La plupart des Allemands disent im Urlaub, et non auf Ur-laub (208). Cette derniere expression s'emploierait plutötpour un detenu en permissiori. Le terme didactique ap-prenant se dit Lerner et non Lernender en allemand. Enfin, ilfaudrait signaler mettre en examen comme equivalent officield'inculper. Toutes ces erreurs ne sont cependant pas bienmechantes.
Venons-en ä la representativito du vocabulaire repertoriedans l'ouvrage sous recension. En positif, il inclut certainsneologismes au sens large tels que oeufs de poules en liberte,telecharger un fichier, acces a Internet, faire du scrollinghaut/bas, faire glisser et lächer, interactif, enfants a la derive.En negatif, le lecteur restera sur sä soif eri ce qui conceraeförce expressions ayant marque notre epoque. Les exemplessontlegion: (
le paparazzo/der Paparazzo', le chasseur d'images/der Sen-sationsfotograf, le club de gym> le gymnase-club/das Fitneß-studio', le capitalisme sauvage/der Kasino-Kapitalismus', l'allo-cation-dependance/der Pflegezuschuß', un joueur pathologi-que/ein Spielsüchtiger (ainsi que le demon du jeu/die Spiel-sucht', ötre accro au jeu/spielsüchtig sein)\ le lest de la bäion-nette, le test de l'elan/der Elchtest', un accordeon (p.ex. il y adeux accordeons sur le peripherique)/Stop-änd^go\ la demis-sion des parents/das Versagen des Elternhauses
L'accueü fait ä ia langue couränte familiere est plutöt dece-vant. Ainsi, on cherchera en vain des mots qui reviennentsans cesse dans la bouche des Frangais. Exemples:
vachement (sympa)/sehr (sympathisch)', chiaiit(e)/nervig\foutre en l'air/kaputtmachen, zerstören (p.ex. foutre sä vie enVair); se foutre de la gueule de qqn/j-m veräppeln (p.ex. tu tefous de ma gueule?)', assumer/mit etw. fertigwerden, mit etw.zurechtkommen (p.ex. Tes grande. Tu assumes.)', assurer/etw.draufhaben (II assure vachementf/Der hat ganz schön wasdrauf!)', se prendre la töte (avec qqc)/sich aufregen-, sich denKopfzerbrechen (teprendspas la töte a cause de moi)
Cela dit, les defauts incrimines ne sont pas rodhibitoires.L'etudiant desireux de decouvrir le fraügais parle pourra setourner vers d'autfes livres tels que Meißner (1992) etRichard (1987).
Toutes reserves faites, on ne peut que souhaiter ä GroßerLernwortschatz Französisch une tres large diffusion. Repo^·sant sur un corpus fourni de textes authentiques, congu avecun souci podagogique ovident et agreablement presente, ilpermet ä Papprenant travaillant seul d'entrer de plain-pieddans un autre univers de discours.
Apr^s lecture des ouvrages ci-dessus, quelques remarquesfinales s'imposent.
Premferement, nous avons vu que la lexicographie peda-gogique a fait d'enonnes progr^s. jPasse le temps ou on ap-prenait par coeur des listes de ypcabulaire alphabotiques;revolue Pepoque ou le frangais litt^raire servait de norme ä
Lebende Sprachen Nr. 4/2001
Bereitgestellt von | Universität OsnabrückAngemeldet | 131.173.17.161
Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50
Tenseignement. Tous les manuels examinos - avec quelquesroserves pour l'ouvrage de Fischer et Monoger - reflfctentTotal acluel du frangais Standard. Les erreurs de traduction6tant en nombre limito, ces ouvrages prosentent ogalementun tres haut degro de fiabilito.
Deuxifcmement, comme nous l'avons fait remarquer ä plu-sieurs reprises, les manuels de vocabulaire et les dictionnai-res d'apprentissage sont encore perfectibles, et ce sous deuxaspects principaux: la reprosentation de ia langue courantefamiliäre ainsi que les possibilitos combinatoires de toutes lescat6gories grammaticales.
Troistemement, il y aurait intor§t ä comploter les manuelsde vocabulaire par des carnets d'exercices.
Notes1 A ne pas confondre avec les dictionnaires d'apprentissage (Lernerwör-
terbücher). A la diffdrence de ceux-ci, les recueils de vocabulaire sontbilingues ei servent moins ä la consultation ponctuelle qu'ä l'apprentis-sage du vocabulaire.
2 Langenscheidfs Handwörterbuch Französisch et Pons GroßwörterbuchFranzösisch.
3 Cf. notre compte-rendu de Pouvrage (Siepmann 1998).4 Bien entendu, il existe d'autres fagons d'acque*rir du vocabulaire, p.ex.
la construction d'un lexique personnel. Mais le facteur temps joue enfaveur des recueils de vocabulaire.
BibliographieAitchison, Jean (1996), Words in the Mind: An Introduction to the Mental
Lexicon. 2eme e*d. Oxford: Blackwell.Bogaards, Paul (1998), Des dictionnaires au service de Tapprentissage du
frangais langue e*traogere, Cahiers de lexicologie 72 (1): 127-167.
Burnand, Caroline et al. (2001), Wörter. Mediascopie du vocabulaireallemand. Paris: Ellipscs.
Carter, Ronald A. (1998), Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives.2eme 6d. Londres: Routledge.
Cellard, Jacques (1982), Qa niangepas depain. Paris: Hachette.Ettinger, Stefan (1977), „Wiederholte Rede" und Bibelsprache. Bemer-
kungen zur deutsch-französischen Übersetzung biblischer Zitate, Lin-guistica Biblica 4:1-20.
Ettinger, Stefan (1994), Phraseologische faux amis des SprachenpaaresFranzösisch-Deutsch, in: Sandig, Barbara (od.), Tendenzen der Phra-seologieforschung. Bochum: Brockmeyer 1994:109-138.
Fandrich, Brigitte (1996), Activito(s): un substanlif qui a beaucoupd'acti viles. Lebende Sprachen 2: 72-77.
Gusdorf, Florent (1991), Words. Mediascopie du vocabulaire anglais.Paris: Ellipses.
Krings, Hans P. (1986), Was in den Köpfen von Übersetzern vorgeht. Eineempirische Untersuchung zur Struktur des Übersetzungsprozesses anfortgeschrittenen Französischlernern. Tübingen: Narr.
Meißner, Franz-Joseph (1992), Langenscheidts Wörterbuch der Um-gangssprache Französisch. Wörterbuch des unkonventionellen Franzö-sisch. Berlin/Munich: Langenschcidt.
Meyer, I. (1988), The General Bilingual Dictionary äs a WorkingTool inTheme. Meta 3:227-244.
Richard, Picrre-Maurice (1987), Decouverte du frangais familier et argo-tique. Umgangsfranzösisch verstehen lernen. Munich: Hueber.
Schunk, Dale H. (1991), Learning Theories: An Educational Perspeclive.New York: Macmillan.
Siepmann, Dirk (1997), The Advanced Learner's Trilingual Lexicon. Dic-tionnaire thematique anglais-franqais-aüemand. Politique-Economie-Expression du temps et de la quantiflcation. Paris: Ellipses.
Siepmann, Dirk (1998), Compte-rendu de John Sinclair (ed.), CollinsCobitild Collocations CD-ROM. Fremdsprachen und Hochschule 53:134-137.
Zöfgen, Ekkehard (1994), Lernerwörterbücher in Theorie und Praxis.Tübingen: Niemeyer.
.SpanischGREGORIO CALLISAYA / CARLOS #ACA PRADO
Danzas folcloricas bolivianas0. IntroduccionEl trabajo que presentamos a continuacion ha sido realizado en elmarco del proyecto Diccionarios Contrastivos del Espanol deAmerica, con sede en la Cätedra de Lingüistica Aplicada (LenguasRomänicas) de la Universidad de Augsburgo. Tras un listado de lasabreviaturas y simbolos empleados en los articulos se ofrece una sel-eccion de danzas o bailes folcloricos de Bolivia. El Ultimo apartadode este trabajo es un glosario de unidades loxicas pertenecientes alespanol de Bolivia que han sido empleadas en las definiciones de losarticulos y que aparecen en 6stos antecediondolas el signo de remi-sion. La forma de los articulos que aparecen en este trabajo no esidontica con la forma de los articulos del Diccionario del espanol deBolivia que se viene realizando en el marco del proyecto arriba men-cionado. Informacion sobre dicho proyecto y sobre los diccionariosya publicados se puede encontrar bajo la direccion de inlernet:www.answer.uni-augsburg.de/dcea.
1. Abreviaturas y simbolosai.: efimo aimaraAlt: Altiplano (LP, Or, Pt)Bn: BeniCbb: CochabambaChuq: Chuquisacacoloq: lenguaje coloquialesp.: espanolf'.femeninofpl: femenino pluralhisi: hütoricismoLP:LaPaz
m: masculinom/f: sustanlivo masculino y femenino, segun la terminacionmpl: masculino pluralOr: Oruroqu.: etimo quechuaSin : sinonimo(s)StaCr: Santa CruzTj: TanjaV al: V allesVor: variante(s)Yu: Yungas
[xxx] (corchetes en redonda): encierran las indicaciones etimologicas-^ : signo de remision
2. Danzas folcloricas bolivianasaguatinas mpl -> ahuatinas.
aguatiris./p/—> ahuatiris.
ahuatinas [ai. awaliri *pastor'] mpl Alt Danza autoctona de la regionandina que representa el pastoreo y en la que participan hombres ymujeres. Los varones llevan sombreros de copa aplastados por loscostados y terminados cn punta en la parte superior y en dos picosencorvados en la inferior, ponchillos de colores, pantalones cortoshasta la pantorrilla y -» abarcas. Las mujeres llevan sombreros, blu-sas y ~»polleras adornadas con lentejuelas. El vestuario se comple-menta con una honda que tanto hombres como mujeres llevan cn las
Lebende Sprachen Nr. 4/2001 175Bereitgestellt von | Universität Osnabrück
Angemeldet | 131.173.17.161Heruntergeladen am | 18.07.14 11:50