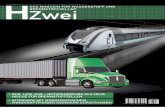Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren
Transcript of Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren
© 2012 Narr Francke Attempto Verlag 41 (2012) • Heft 1
MARIA GIOVANNA TASSINARI * Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren Abstract. Which competences are necessary for learner autonomy? How can they be modelled for the learning and teaching practice? As an answer to this question I propose a dynamic model of learner autonomy with descriptors, a tool for supporting self-assessment and evaluation of learner autonomy. This model accounts for cognitive, metacognitive, action-oriented and affective components of learner autonomy and provides descriptors of learners’ attitudes, competencies and behaviours. It is dynamic in order to allow learners to focus on their own needs and goals. Learners can choose to assess them-selves in some components. Their answers are then discussed in an advising session, in order to com-pare the learner’s and the advisor’s perspectives, focus on single aspects of the learning process and set goals for further learning. The students’ feedback shows that they are able to benefit from this evalua-tion; their awareness, self-reflection and decision-making in the autonomous learning process improve. 1. Einleitung
Im Hinblick auf das lebenslange Lernen ist die Förderung von Lernkompetenzen und von Lernerautonomie heutzutage ein wichtiger Bestandteil des gesamten Bildungs-wesens und damit auch des Fremdsprachenunterrichts. Um aber Lernerautonomie beim Fremdsprachenunterricht fördern zu können, müssen wir uns vorher klar machen, wie wir Lernerautonomie definieren und welche Kompetenzen im Einzelnen auf sie be-zogen sind. Als Antwort auf diesen Fragen habe ich in meiner Dissertation (TASSINARI 2010) ein dynamisches Modell von und Deskriptoren für Lernerautonomie entwickelt, die die Kompetenzen des Lerners abbilden und modellieren. Dieses dynamische Autonomie-modell und die Deskriptoren sind als wissenschaftlich basiertes und praxisorientiertes Instrument zur Unterstützung von Lernenden und Lehrenden in autonomisierenden Lernprozessen gedacht. Somit sind sie als operationelle Modellierung von Lernerauto-nomie zu verstehen. Sie wurden auf der Basis einer kritischen Analyse der Literatur entwickelt und von zwei Expertengruppen, jeweils am CRAPEL (Centre de Recherche et d’Applications Pédagogiques en Langues) der Université Nancy 2 und am Sprachen-zentrum der Freien Universität (FU) Berlin, intersubjektiv validiert. Außerdem wurden sie von Studierenden, Sprachlernberatern und Lehrenden getestet. Heute werden sie sowohl in selbstgesteuerten Lernkontexten als auch im Unterricht verwendet.
* Korrespondenzadresse: Dr. Maria Giovanna TASSINARI, Freie Universität Berlin, ZE Sprachenzen- trum, Habelschwerdter Allee 45, 14195 BERLIN. E-Mail: [email protected] Arbeitsbereiche: Lernerautonomie, Lernberatung, Mehrsprachigkeit.
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 11
41 (2012) • Heft 1
In diesem Beitrag präsentiere ich zunächst einige Überlegungen zur Modellierung der Kompetenzen für Lernerautonomie (Abschnitt 2) und definiere Lernerautonomie (Abschnitt 2.1). Danach stelle ich das dynamische Autonomiemodell und die De-skriptoren vor (Abschnitt 2.2) und beschreibe, wie es zu Zwecken der Evaluation und zur Förderung von Lernerautonomie in autonomisierenden Lern- und Lehrsituationen verwendet werden kann (Abschnitt 3). Außerdem gehe ich auf das Feedback von Studierenden und Beratern ein (Abschnitt 4). Darüber hinaus stelle ich ausgehend von meiner Untersuchung einige Schwierigkeiten und Prioritäten von Studierenden im Hin-blick auf Lernerautonomie dar. 2. Zur Modellierung der Kompetenzen für Lernerautonomie
In der Literatur existieren verschiedene Ansätze zur Beschreibung und Modellierung der Kompetenzen für Lernerautonomie. Die meisten fokussieren auf die Kompetenzen des Lerners. Erst in den 1990er Jahren fing man an, unter dem Stichwort Lehrerauto-nomie (teacher autonomy) auch die Kompetenzen des Lehrers in Betracht zu ziehen (vgl. CRABBE 1999 oder LAMB/REINDERS 2007). Für meine Dissertation habe ich vor-wiegend die Beiträge analysiert, die die Lernerkompetenzen in den Mittelpunkt stellen. Diese Ansätze unterscheiden sich insofern, als sie in verschiedenen Kontexten, aus ver-schiedenen Ausgangsperspektiven und mit verschiedenen Zielen erarbeitet worden sind. Zum Beispiel beschreibt HOLEC (1979) die Kompetenzen, die zur Auto-nomisierung des Lernenden gehören, als Handlungen, die der Lerner in einem selbst-gesteuerten, wenn auch begleiteten, Lernprozess ausführt: Ziele definieren, Lernmate-rialien aussuchen, Methoden und Strategien auswählen, Zeit, Ort und Rhythmus des Lernens festlegen, den Lernfortschritt und den Lernprozess evaluieren. OXFORD (1990) und CHAMOT [et al.] (1999) modellieren sie als Strategien, die zum Lernen einer Fremdsprache eingesetzt werden können und berücksichtigen dabei, neben direkten Strategien, auch indirekte bzw. Managements- und Regulierungsstrategien, die in selbstgesteuerten Lernprozessen relevant sind, darunter metakognitive, soziale und affektive Strategien. WENDEN (1991) beschreibt diese Kompetenzen im Wesentlichen als metakognitives Wissen des Lerners (Wissen über die Person, Strategiewissen und Aufgabenwissen) sowie als Strategien, die der autonome Lerner einsetzt. Doch werden die Beschreibung bzw. die Modellierung dieser Kompetenzen durch einige Spannungsfelder erschwert. Einerseits sind die Kompetenzen, Einstellungen und Strategien der Lerner potenziell unendlich viele; von daher sind deren ausführliche Be-schreibung bzw. Modellierung nicht möglich bzw. laufen Gefahr, unübersichtlich zu sein. Andererseits sind viele der infrage kommenden Kompetenzen nicht immer direkt auf beobachtbare Verhaltensweisen zurückzuführen und somit schwer zu beschreiben. Darüber hinaus können je nach Lern- und Lehrkontext unterschiedliche Kompetenzen erforderlich bzw. relevant sein. Nicht zuletzt lassen sich die einschlägigen Einstel-lungen, Kompetenzen, Kenntnisse und Strategien verschiedenen Bereichen der Lerner-person, wie kognitiven, metakognitiven, aber auch sozialen, psychologischen und
12 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
persönlichen Aspekten zuordnen. Daher erfordert deren Modellierung einen inter- disziplinären Ansatz. Da ich die oben erwähnten sowie weitere Ansätze in meiner Dissertation bereits be-handelt habe (vgl. TASSINARI 2010: Kapitel 3 und 4), gehe ich an dieser Stelle nicht näher auf sie ein. Dennoch gehe ich kurz auf den Ansatz von MARTINEZ (2008) ein, die sich zum gleichen Zeitpunkt wie ich, aber aus einem anderen Blickwinkel, der Frage der Beschreibung und Modellierung dieser Kompetenzen widmete. Ihr Ansatz ist meines Erachtens insofern bemerkenswert, als er die Modellierung von Lernerauto-nomie aus einer dreifachen Perspektive unternimmt: der Lernerperspektive, der Lehrer- perspektive und der Perspektive der pädagogischen Maßnahmen für den Autono-misierungsprozess. Sowohl in der Lernerperspektive als auch in der Lehrerperspektive gilt es für MARTINEZ, Wissensinhalte und prozedurale Kompetenzen zu identifizieren, welche Lerner und Lehrer in autonomisierenden Prozessen einbringen bzw. entwickeln sollten. So erarbeitet MARTINEZ für die Lernerperspektive eine Aufstellung von Anwen-dungsbereichen sowie erforderlichen Kompetenzen mit entsprechenden Beispielen von Lernerverhaltensweisen. Für die Lehrerperspektive ergänzt sie eine Darstellung der Prozesse, die die Lehrer in Gang setzen sollten, um diese Kompetenzen bei den Lernern zu fördern. Daraus lassen sich zugleich jene Kompetenzen definieren, die die neue Lehrerrolle in Autonomisierungsprozessen erforderlich macht. Ihre Erkenntnisse haben einen heuristischen Wert, vor allem im Hinblick auf die (Handlungs-)Forschung autonomer Lernprozesse und auf die Lehrer(aus)bildung. Dennoch erkennt MARTINEZ selbst, dass die umfangreichen Aufstellungen gleichzeitig sehr allgemein bleiben und eher als „Grundlage zur Aufdeckung von weiteren, spezifischen Strategien mit Bezug auf ein spezifisches Publikum und einen spezifischen Lernkontext“ (ebd.: 83) dienen. Dasselbe gilt für die umfangreichen Kompetenzen der Lehrer, die diese Auto-nomisierungsprozesse begleiten sollten. So wertvoll diese Aufstellungen auch sind, für die unmittelbare Anwendung in der täglichen Lern- und Lehrpraxis sind Instrumente gefragt, die sich besser handhaben lassen. Die Modellierung, die ich durch das dynamische Autonomiemodell und die De-skriptoren erarbeitet habe, fokussiert hingegen die Lernerperspektive und soll als Instrument dienen, in autonomisierenden Lern- und Lehrprozessen die Reflexion des Lerners über die eigenen Kompetenzen zu fördern. Bevor wir uns dem dynamischen Autonomiemodell und den Deskriptoren zuwenden, definiere ich mein Verständnis von Lernerautonomie.
2.1 Lernerautonomie: eine Definition
Die Definition von Lernerautonomie, die ich vorschlage, ist wissenschaftlich begründet und operationell. Sie ist wissenschaftlich begründet, weil ich zu ihrer Erarbeitung zahl-reiche existierende Definitionen kritisch analysiert und die wesentlichen Aspekte zu-sammengefasst und neu modelliert habe (TASSINARI 2010, Kapitel 3). Sie ist operationell, weil sie das Konstrukt in seinen verschiedenen Bestandteilen so definiert,
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 13
41 (2012) • Heft 1
dass es ausreichende Ansatzpunkte für die Lern- und Lehrpraxis bietet. Zu diesem Zweck ist es wichtig anzumerken, dass Lernerautonomie nicht als abstraktes Ideal auf-gefasst wird, sondern dass sie auf allgemeinen Kompetenzen, Fertigkeiten und Hand-lungen beruht, die Lerner in verschiedenen Lernkontexten und -situationen tatsächlich aufweisen und ausüben können (vgl. BENSON 2001: 59). Von dieser Prämisse ausgehend definiere ich Lernerautonomie als die komplexe Metafähigkeit des Lerners, in verschiedenen Situationen und Formen Kontrolle über das eigene Lernen auszuüben. Sie besteht aus wissensbasierten und handlungs-orientierten Kompetenzen, Fertigkeiten und Strategien sowie aus motivationalen und affektiven Einstellungen und Kompetenzen und ist somit als ein komplexes Konstrukt zu verstehen. Sie stellt insofern eine Metafähigkeit dar, als sie die Fähigkeit des Ler- ners ist, seine eigenen Kompetenzen bzw. Fertigkeiten miteinander zu kombinieren, zu koordinieren und in verschiedenen Situationen kritisch und angemessen einzusetzen. Das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Aspekte ist meines Erachtens ein wesent-liches Merkmal von Lernerautonomie. Lernerautonomie wird durch bewusste Ent-scheidungen und Handlungen im sozialen Lernumfeld von verschiedenen Lernern unterschiedlich realisiert. Das Risiko, Lernerautonomie als Optimierung der Lernerleistung zu sehen, ist mir bewusst. In unserer Gesellschaft und im Bildungswesen bewegen wir uns zunehmend in einem Spannungsfeld, zwischen Freiheit (Autonomie) und Zwang (Heteronomie), zwischen Entfaltung des Individuums und Leistungsdruck (vgl. SCHMENK 2008). Dennoch ist es nicht meine Absicht, durch diese Definition und durch das dynamische Autonomiemodell bei Lernenden einen Leistungsdruck aufzubauen. Vielmehr geht es mir darum, den Akteuren des Lern- und Lehrprozesses ein Instrument für die Reflexion zu geben, das sie frei und entsprechend ihren Bedürfnissen bewusst verwenden können.
2.2 Das dynamische Autonomiemodell
Das dynamische Autonomiemodell (Abbildung 1 [S. 14]) umfasst Kompetenz- und Handlungsbereiche des Lerners, welche durch folgende Verben gekennzeichnet sind: „sich motivieren wollen“, „mit den eigenen Gefühlen umgehen“, „Wissen strukturieren“, „planen“, „Materialien und Methoden aussuchen“, „durchführen“, „überwachen“, „evaluieren“, „kooperieren“, und „das eigene Lernen managen“. Sie betonen den handlungs- und prozessorientierten Charakter von Lernerautonomie und stehen in einer nicht hierarchischen Beziehung zueinander, mit Ausnahme von „das eigene Lernen managen“, welches alle anderen Komponenten zusammenfasst und diesen daher übergeordnet ist. Die funktionelle Dynamik des Autonomiemodells besteht darin, dass es dynamisch verwendet werden kann. Jeder Lerner kann es den eigenen Bedürfnissen bzw. einer ge-gebenen Lernsituation entsprechend für seine Reflexion individuell unterschiedlich verwenden. Er kann z.B. eine beliebige Komponente auswählen, um in den Prozess der Lernregulation einzusteigen, sich von einer Komponente zur anderen in verschiedene Richtungen frei bewegen und den Zirkel dann wieder verlassen, wenn er alle für ihn
14 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
relevanten Komponenten bearbeitet hat. Diese Dynamik ist ein wesentliches Merkmal des Modells.
Abb. 1: Das dynamische Autonomiemodell (TASSINARI 2010: 203) Jeder der im Modell ausgewiesenen Komponenten sind Deskriptoren zugeordnet. Diese sind in Form von Kann-Beschreibungen formuliert und unterscheiden sich in Makro-deskriptoren, welche allgemeine Kompetenzen, Handlungen und Strategien be-schreiben und einer ersten Orientierung des Lerners dienen, und Mikrodeskriptoren, welche Teilkompetenzen, -handlungen und Strategien beschreiben, Beispiele und An-regungen für eine Ausdifferenzierung der Kompetenzen enthalten und einer genaueren, punktuellen Beschreibung dienen.1 Um die Beschreibung in einem überschaubaren 1 Diese Ausdifferenzierung ist keineswegs eine Abstufung der Kompetenzen. Obwohl die Literatur viele Ansätze zur Beschreibung von ‚Stufen‘ und Implementierungsniveaus von Lernerautonomie bietet, handelt
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 15
41 (2012) • Heft 1
Rahmen zu halten und sie gleichzeitig in verschiedenen Lern- und Lehrsituationen ein-setzen zu können, sind die Deskriptoren sprach-, situations- und aufgabenübergreifend. Diese Deskriptoren wurden auf der Basis existierender Ansätze in der Literatur (Be-schreibungen von Lernerautonomie und deren Komponenten, von Merkmalen auto-nomer Lerner, von lernregulierenden Strategien) und nicht aus der Beobachtung von Lern- und Lehrprozessen entwickelt. Dadurch sollte der Kompetenzenkatalog eine größere Reichweite erhalten und weniger kontextabhängig sein. Dennoch sind diese Deskriptoren für Lernerautonomie weder erschöpfend, noch stellen sie den Anspruch auf die Beschreibung einer Norm bzw. eines zu erlangenden Kompetenzstandes dar. Vielmehr bieten sie ein möglichst umfangreiches Spektrum an möglichen Kompe- tenzen und Handlungen, das als Anregung zur Reflexion dienen soll. Die vollständigen Deskriptoren stehen online zur Verfügung: http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/v/ autonomiemodell/index.html. 3. Ansätze zur Förderung von Lernerautonomie
Zentrale Aspekte dieser Förderung sind die Bewusstmachung und die Reflexion über das eigene Lernen und den eigenen Lernprozess: Einstellungen, Vorlieben, Ziele, Strategien, Entscheidungen, die Sprache als Lerngegenstand u.a. Die Zentralität der Bewusstmachung und Reflexion wird in nahezu allen Ansätzen zur Autonomisierung der Lerner hervorgehoben, vom Lerner- bzw. Strategietraining (ELLIS/SINCLAIR 1989, DICKINSON 1992, WENDEN 1991) zum experiential learning (KOLB/KOLB 2009) bis zu postmethodologischen pädagogischen Ansätzen, (z.B. dem macrostrategic framework von KUMARAVADIVELU 2003). Bewusstmachung und Reflexion können sowohl in unterrichtlichen als auch bei selbstgesteuerten Lernprozessen mittels verschiedener Instrumente gefördert werden: gezielt erarbeitete Lernmaterialien und -aufgaben, prozessorientierte Arbeitsphasen, Gruppen- und Partnerarbeit, Lerntagebücher und vieles mehr. Die Ansätze in der Literatur sind nahezu unzählig (vgl. z.B. NUNAN 1997, SCHARLE/SZABÓ 2000). Die Arbeit mit dem dynamischen Autonomiemodell und den Deskriptoren ist eines dieser Instrumente und kann allein oder zusammen mit anderen verwendet werden. Insbesondere kann es zur Förderung der Selbsteinschätzung und der Reflexion über die eigenen Kompetenzen und Einstellungen zu Lernerautonomie genutzt werden. Bevor ich konkret beschreibe, wie dieses Instrument eingesetzt werden kann, ist eine Vor-überlegung zur Selbsteinschätzung und Evaluation von Lernerautonomie notwendig. Es gibt in der Literatur keinen Konsens darüber, ob Lernerautonomie gemessen oder evaluiert werden kann bzw. soll. Einerseits sind dafür genauere Kriterien und Ver-fahren notwendig, um festzustellen, ob ein Lerner autonom(er) geworden ist, anderer-seits ist genau zu überlegen, zu welchem Zweck Lernerautonomie evaluiert werden
es sich hierbei lediglich um Beschreibungen von praxisbedingten Progressionen von Lernerautonomie, die jedoch nicht als allgemeingültig anzusehen sind (vgl. TASSINARI 2010: 112–118).
16 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
soll. In dieser Hinsicht analysiert BENSON (2010) unterschiedliche Ansätze, Kriterien und Instrumente zur Messung bzw. zur Prüfung von Faktoren, die Lernerautonomie ausmachen; gleichzeitig weist er auf die pädagogische und bildungspolitische Gefahr hin, wenn die aktuelle bildungspolitische Tendenz, alles zu testen und zu messen, auch auf Lernerautonomie übertragen wird. Viel wichtiger, als die Kompetenzen für Lernerautonomie anhand festgelegter Kriterien und Maßstäbe von außen zu messen, ist jedoch meines Erachtens, dass der Lerner es lernt, seine eigenen Einstellungen, seine Kompetenzen und sein Lernver-halten in einem bestimmten Lernprozess einzuschätzen bzw. zu evaluieren. Diese Fähigkeit zur Selbsteinschätzung und Evaluation ist in autonomisierenden Lern- und Lehrprozessen zentral, weil sie der Bedarfsanalyse, der Reflexion und der Steuerung des Lernprozesses dient. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Fähigkeit besonders gefördert und geübt werden muss, weil Lerner leicht dazu tendieren, die eigenen Kompetenzen zu über- oder zu unterschätzen und oft Unterstützung und Hilfestellung benötigen, u.a. dafür, Kriterien für ihre Selbsteinschätzung zu definieren. Wie eine Studentin in meiner Untersuchung sagte: „[…] eine gute Selbsteinschätzung […], die kann man nicht von vornherein mitbringen, die muss man lernen“ (I.P.). Eine weitere terminologische und didaktische Präzisierung ist an dieser Stelle not-wendig. Ich bezeichne die Begriffe Selbsteinschätzung und Evaluation nicht als synonym. Während Selbsteinschätzung (self-assessment) die eigenverantwortliche Be-urteilung bzw. Überprüfung der eigenen Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten in Bezug auf festgelegte Kriterien bezeichnet (vgl. auch KLEPPIN 2005: 107), ist eine Evaluation ein umfangreicherer Reflexionsprozess, in dem Lerner und Lehrer bzw. Be-rater über die Lernerfahrung bzw. den Lern- und Lehrprozess reflektieren, sich be-stimmter Aspekte bewusst werden und daraus Schlüsse ziehen, um Entscheidungen für das weitere Lernen (bzw. Lehren) zu treffen:
„Evaluation implies that learners and teachers reflect on the experience gained in language learning and teaching, which will lead to awareness raising and prepare the ground for decision making“ (DAM/LEGENHAUSEN 2010: 121).
Mit Evaluation bezeichne ich von daher den pädagogischen Prozess, der stattfindet bzw. stattfinden soll, um Lernerautonomie zu fördern. Die Dreh- und Angelpunkte dieses Prozesses (reflecting, awareness raising und preparing ground for decision making) sind gleichzeitig zentrale Aspekte in der Beratung für Lernerautonomie. Das dynamische Autonomiemodell und die Deskriptoren liefern sowohl für die Selbstein-schätzung als auch für den Evaluationsprozess von Lernerautonomie Anhaltspunkte. Wie dieser Prozess gestaltet werden kann, beschreibe ich kurz im nächsten Abschnitt. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht der Lerner. Eine wichtige Voraussetzung für die Selbsteinschätzung ist von daher die Bereitschaft des Lerners, diese Selbstein-schätzung vorzunehmen. Selbsteinschätzung und Evaluation sollten vorgeschlagen, jedoch nicht aufgedrängt werden. Dabei sollten die individuellen Unterschiede bei den Lernern berücksichtigt werden: Während einige von einer systematischen und durch-gängigen Reflexion über den Lernprozess profitieren, ziehen es andere vor, sich auf das
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 17
41 (2012) • Heft 1
Lernen und auf den Lerngegenstand zu konzentrieren. In selbstgesteuerten Lern-prozessen sollte die Entscheidung, ob und in welchem Maß eine solche Evaluation durchzuführen ist, vom Lerner getroffen werden. Aufgabe des Beraters ist dann, diesen Prozess zu unterstützen und zu begleiten. Im Unterricht hingegen kann dies auch schrittweise vom Lehrenden eingeführt werden. Die Schritte zur Selbsteinschätzung und Evaluation sind:
1. Einstiegsphase: Elizitierung von Einstellungen über und Erfahrungen mit Ler-nerautonomie
2. Auswahl von Komponenten und Deskriptoren für die Selbsteinschätzung 3. Selbsteinschätzung 4. Feedback zur Selbsteinschätzung 5. Entscheidungen fürs weitere Lernen.
In selbstgesteuerten Lernkontexten können die Phasen 2 und 3 vom Lerner allein über-nommen werden; die Phasen 1, 4 und 5 sollten hingegen zusammen mit einem Berater durchgeführt werden. In unterrichtlichen Lernkontexten können alle Phasen im Unter-richt als Partner- oder Gruppenarbeit mit anschließender Diskussion im Plenum ge-staltet werden. Der Austausch zwischen Lernern und Berater einerseits, zwischen Mit-lernern untereinander und mit dem Lehrer andererseits, ist wichtiger Bestandteil dieses Evaluationsprozesses (siehe Abschnitt 5). Sehen wir uns nun die verschiedenen Phasen etwas näher an. Ich beschreibe sie aus-gehend von den selbstgesteuerten Lernprozessen und überlasse es dabei dem Leser, diese auf unterrichtliche Kontexte zu übertragen. Phase 1 – Einstiegsphase: Die Einstiegsphase dient dazu, frühere Erfahrungen des Lerners zu elizitieren. Dies ist meistens sowohl für den Lerner als auch für den Berater vorteilhaft: Der Lerner kann über positive oder problematische Aspekte früherer Lern-erfahrungen reflektieren, die möglicherweise sein späteres Lernen beeinflussen; der Berater kann nützliche Informationen erhalten und ggf. im Laufe des Evaluations-prozesses darauf zurückkommen. Phase 2 – Auswahl von Komponenten und Deskriptoren: Der Lerner ist frei, die Komponenten und Deskriptoren auszuwählen, die er im Hinblick auf sein augenblick-liches Lernen für relevant hält. Diese freie Auswahl ist auch ein wichtiger Schritt im Bewusstmachungsprozess, weil der Lerner überlegen muss, wo seine Prioritäten liegen. Phase 3 – Selbsteinschätzung: Bei jedem Deskriptor kann der Lerner unter drei Möglichkeiten wählen: „Ich kann das“ „Das möchte ich lernen“ oder „Nicht wichtig für mich“. Falls er möchte, kann er außerdem selbst eigene Deskriptoren zu Kom- petenzen, Einstellungen oder Lernverhaltensweisen, die für ihn bezeichnend sind, for- mulieren. Eine numerische Auswertung der Antworten ist nicht vorgesehen. Zum einem widerspräche eine solche Auswertung der Dynamik des Autonomiemodells, weil sie nur möglich wäre, wenn der Lerner sich in allen Komponenten einschätzte. Außerdem wäre ein numerisches Ergebnis insofern irreführend, als es die Idee vermitteln würde, es sei wie bei einem (Sprach-)Test eine volle Punktzahl zu erreichen. Ziel der Selbst-einschätzung ist hingegen nicht das Messen der bereits erreichten Kompetenzen im
18 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
Hinblick auf eine ideale Kompetenz, sondern vielmehr, dass der Lerner sich seiner eigenen Einstellungen, Handlungen und Kompetenzen beim Fremdsprachenlernen bewusst wird, um sein Lernverhalten autonom(er) zu gestalten.2 Phase 4 – Feedback zur Selbsteinschätzung: Die qualitative Auswertung der Selbst-einschätzung erfolgt in einem Gespräch, in dem der Lerner seine Antworten mit einem Berater bespricht. Dieses Gespräch ist der Kern des Evaluationsprozesses. In diesem pädagogischen Dialog wird die Perspektive des Lerners auf sein eigenes Lernen mit der des Beraters konfrontiert und abgeglichen. Der Dialog wird nach den Regeln eines Beratungsgesprächs durchgeführt (vgl. KELLY 1996: 96). Der Berater hört zu, fragt nach, reformuliert, fasst zusammen, generalisiert und hinterfragt die Aussagen des Lerners, er fragt nach Prioritäten und nach weiteren Schritten. Dadurch wird die Selbsteinschätzung validiert und der Lern-prozess evaluiert. Phase 5 – Entscheidungen fürs weitere Lernen: Im Beratungsgespräch reflektieren Lerner und Berater gemeinsam über Entscheidungen fürs weitere Lernen. 4. Erhebung der Selbsteinschätzung von Studierenden
4.1 Der Untersuchungskontext
Ich erprobte die Selbsteinschätzung mit dem dynamischen Autonomiemodell und den Deskriptoren qualitativ mit sechs Studierenden am Selbstlernzentrum sowie mit 15 Studierenden in einem Französischkurs am Sprachenzentrum der FU Berlin. Das Selbstlernzentrum steht allen Studierenden zur Verfügung, die eine Sprache (weiter)lernen möchten. Dort finden Lerner eine Vielfalt an Materialien und Ressourcen zum Sprachenlernen, die sie selbständig, einzeln, in Partner- oder in Grup- penarbeit, nutzen können. Auch viele Lehrende kommen mit ihren Sprachkursen regelmäßig ins Selbstlernzentrum. Obwohl das Erkenntnisinteresse meiner Untersuchung in der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit des Autonomiemodells und der Deskriptoren lag, sind deren Ergeb-nisse auch im Hinblick auf die Fragen der Selbsteinschätzung und der Lernerkom-petenzen im Autonomisierungsprozess relevant. Ich fasse hier das Feedback der Studierenden am Selbstlernzentrum zusammen. Die Untersuchung im Französischkurs ergab aber ähnliche Resultate. Die sechs Studierenden, die an der Untersuchung teilnahmen, hatten verschiedene Nationalitäten und Muttersprachen (Deutsch, Chinesisch, Italienisch, Persisch), lernten verschiedene Sprachen (Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Englisch) und studierten unterschiedliche Fächer (philologische Fächer, Geschichte und Kulturwissenschaften, Chemie). Viele hatten erstmals in der Schule eine oder 2 Dass die Selbsteinschätzung kein Test ist und somit deren Ergebnisse nicht „benotet werden“, wurde von den Studierenden, die an meiner Untersuchung teilnahmen, als Vorteil gesehen, weil sie dadurch aufrichtig und frei antworten konnten.
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 19
41 (2012) • Heft 1
mehrere Fremdsprachen gelernt (Englisch, Französisch, Deutsch), diese dann im Lauf von Schul- und/oder Universitätsaustausch und später selbstständig (z.T. ergänzend zu einem Kurs) durch Bücher, durch Filme, mit Tandempartnern weitergelernt. Zwei von ihnen lernten auch eine weitere Sprache völlig selbstständig (Polnisch, Portugiesisch). Sie besuchten das Selbstlernzentrum entweder aus eigener Initiative oder auf Anregung ihrer Dozenten und lernten dort eine oder mehrere Sprachen. Einige unter ihnen hatten schon vor der Untersuchung die Sprachlernberatung aufgesucht oder an Workshops zum autonomen Fremdsprachenlernen am Selbstlernzentrum teilgenommen. Alle Studierenden führten die Selbsteinschätzung freiwillig durch. Sie wurden darauf hingewiesen, die Selbsteinschätzung nur für die Komponenten bzw. De-skriptoren durchzuführen, die sie für relevant hielten. Ihr Feedback zur Selbstein-schätzung wurde mittels eines Interviews noch vor dem Beratungsgespräch eingeholt. Die Daten wurden qualitativ ausgewertet. Näheres über diese Untersuchung kann in TASSINARI (2010, Kapitel 8) nachgelesen werden.
4.2 Ergebnisse der Untersuchung
Alle befragten Studierenden außer einem berichteten, die Selbsteinschätzung habe ihnen geholfen, Bewusstheit über das eigene Lernen zu erlangen und über andere Möglichkeiten für ihr Fremdsprachenlernen nachzudenken. Bewusstheit, Reflexion, Nachdenken sind die Schlüsselwörter, die sie in ihrem Feedback erwähnen. Darüber hinaus nahmen sich die meisten Studierenden nach der Selbsteinschätzung vor, ihre Lernorganisation oder ihre Lernstrategien zu verbessern. Die zentrale Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist von daher die reflexions- bzw. bewusstheitsfördernde Wirkung der Selbsteinschätzung bei Studierenden, die in einen autonomen bzw. einen autonomisierenden Lernprozess involviert sind. Diese Erkennt-nis wurde von allen Studierenden bestätigt. In einem einzigen Fall zog ein Lerner keinen Gewinn aus der Selbsteinschätzung. Die Analyse der von ihm erhobenen Daten zeigt jedoch, dass hier bereits die Bereitschaft fehlte, den eigenen Lernprozess und somit die eigene Autonomie als Lerner bewusst zu reflektieren bzw. zu entwickeln (vgl. TASSINARI 2010: 243–245). Die Reflexion fand bei den einzelnen Lernern in unterschiedlichen Formen statt. Einige dachten systematischer über ihr Lernen nach, andere wurden sich anderer Lernmöglichkeiten bewusst, als derer, die sie regelmäßig nutzten, einige wurden sich bestimmter Problemstellungen bewusst, viele setzten sich neue Ziele für ihr weiteres Lernen. Folgende Zitate geben einen kleinen Einblick in ihre Antworten:
„Ich bin mir vor allem bewusst darüber geworden, dass ich konsequent über mein Lernen nachdenken muss, weil man theoretisch immer viel weiß, viele Strategien kennt, aber man setzt zu wenig um, und wenn man aufhört, darüber nachzudenken, dann glaube ich, ist es ein sehr großer Fehler […]. Diese Deskriptoren haben mich daran erinnert, was ich eigentlich machen könnte und sollte und worüber ich nachdenken sollte“ (R.S.).
„Ich fand [die Selbsteinschätzung] ganz wichtig für die Selbstreflexion. […] Diese Selbstreflexion ist etwas ganz wichtiges [für autonomes Fremdsprachenlernen, MGT]. […]
20 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
Deskriptoren sind sehr gut, um überhaupt Problembewusstsein zu bekommen, und dann auch wirklich gezielt auf die Probleme einzugehen, die man dann mit dem autonomen Lernen im jeden Fall hat“ (I.P.).
Da die Untersuchung nicht longitudinal war, wurden keine weiteren Daten zum darauf folgenden Lernprozess erhoben. Dennoch hatte ich Gelegenheit, die Beratungs-gespräche, an denen ich als Beraterin teilnahm, zum Abgleich der Selbsteinschätzung zu analysieren3 und Folgendes festzuhalten: Die Gespräche waren besonders ergiebig. Durch die Selbsteinschätzung hatten sich die Studierenden die Art und Weise, wie sie lernten, vergegenwärtigt und konnten ge-zielt über ihre Stärken und Schwächen sprechen. Sie reflektierten scharfsinnig über einzelne Strategien, sie bewerteten diese und entschieden, ob sie für ihre Ziele ange-messen bzw. nützlich waren. Die Studierenden bezogen in vielen Fällen auch frühere Lernerfahrungen in ihre Reflexion mit ein und nutzten sie für ihre Entscheidungen. Zum Beispiel wurden Strategien und Lernerfahrungen aus der Schulzeit (wie ein Sprachlernheft zu führen) im Hinblick auf ihre Angemessenheit und Nützlichkeit für ihren aktuellen Lernkontext bzw. ihre aktuellen Lernziele kritisch reflektiert. Ein weiterer Aspekt dieser Gespräche war es, dass die Studierenden proaktiver auf das Ge-spräch eingingen, als es in anderen Beratungsgesprächen üblich ist. Anstatt Fragen zu stellen, brachten sie oft von selbst Themen ein und setzten selbst Prioritäten. Ein Grund dafür kann sein, dass bei der Selbsteinschätzung bereits eine Reflexionshaltung akti- viert war und nicht erst im Beratungsgespräch in Gang gesetzt werden musste. Motivierend sowohl für die Studierenden als auch die Beraterin war es, dass die Studierenden in allen diesen Gesprächen zu einer Entscheidungsfindung kamen. Für einige war es die Entscheidung, bestimmte Lernphasen besser zu planen, z.B. indem auch die eigenen sprachlichen Voraussetzungen mitberücksichtigt wurden (anstatt wieder anzufangen, pauschal Grammatik zu wiederholen, nahm sich eine Studierende vor, mit den Themen anzufangen, die ihr Schwierigkeit bereiteten bzw. die für eine be-stimmte Aufgabe relevant waren); für andere ging es darum, negative Gefühle und Ängste besser einzugrenzen und zu kontrollieren. Andere beschlossen, mehr mit authentischen Materialien oder mit dem Tandempartner zu arbeiten, weil sie erkannten, dass ihre Sprachkompetenzen so weit entwickelt waren, dass sie nicht mehr das strukturierte Lernen in einem Kurs benötigten. Es lohnt sich auch, einen kurzen Blick auf die Schwerpunktsetzung der Studierenden nach der Selbsteinschätzung zu werfen. Sie konnten einige ihrer Stärken und Schwächen identifizieren und daraus Prioritäten für die Weiterentwicklung ihrer Lernkompetenzen ableiten. Zu ihren Schwächen zählten sie insbesondere die Schwierigkeit, die eigenen Sprachkompetenzen realistisch einzuschätzen, geeignete Materialien auszuwählen, einen guten Lernplan zu entwerfen und umzusetzen. Einige hatten außerdem
3 Grundlage für die Analyse dieser Gespräche waren ein Protokoll sowie ein Postskriptum der Forscherin. Da sie nicht im Zentrum der Untersuchung standen, wurden diese Gespräche nicht aufgenommen. Zur Frage der Trennung meiner Rolle als Forscherin und als Beraterin vgl. TASSINARI (2010: 258–259).
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 21
41 (2012) • Heft 1
Schwierigkeiten damit, ein gutes Zeitmanagement einzuhalten und ihren Lernfortschritt zu evaluieren. Obwohl der Rahmen der Befragung zu klein war, um daraus allgemein-gültige Schlüsse zu ziehen, bestätigt meine Erfahrung als Beraterin, dass diese Pro- blemstellungen immer wieder im Beratungsgespräch von Studierenden angesprochen werden und somit als wichtige Schwerpunkte des autonomen Fremdsprachenlernens betrachtet werden können. Die Selbsteinschätzung der Sprach- und Lernkompetenzen wird von mehreren als Schlüsselkompetenz betrachtet, die es zu lernen bzw. zu üben gilt:
„Ich habe ein persönliches Problem mit der Selbsteinschätzung, das ich aber auch an anderen festgestellt habe […]. Ich glaube, es ist ein großes Problem, sich selbst einschätzen zu können, ohne Programme wie DIALANG, oder ohne jemand, der einem sagt, ich bin ehrlich, so toll sprichst du nicht: du musst noch einiges an dir arbeiten“ (I.P.).
„Vielleicht bin ich nicht dafür genug selbstbewusst, sagt man so? confident, um meine Sprachkompetenzen einzuschätzen“ (J.C.).
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die bewusste Auswahl geeigneter Lern-materialien und Arbeitsformen. In dieser Hinsicht scheinen die Vorstellungen der be-fragten Studierenden, mit welchen Materialien und Aufgaben man Sprachen lernen kann, einerseits von ihrer Schulerfahrung geprägt zu sein. Andererseits haben die Studierenden ganz individuelle Vorlieben und Arbeitsweisen (Lernen von Liedern, von Alltagstexten, wie z.B. Zeitungsartikeln, Lebensmitteletiketten, aufgeschnappten Ge-sprächen), die sie in unterschiedlichen Lebens- bzw. Lernphasen einsetzen. Der Selbst-einschätzung entnahmen die Studierenden auch Anregungen, um ihr Materialien-bzw. Aufgaben- und Strategienrepertoire zu erweitern.
„Es ist ganz einfach zu sagen, ich kann Lernmaterialien aussuchen. Man findet etwas, z.B. da ist subjuntivo, schön, und man stürzt sich darauf, ohne sich zu fragen: Ist das richtig für mich? Ist es wirklich das, was ich brauche? Es ist auch schwierig zu berücksichtigen, was ich richtig brauche. Man freut sich, dass man etwas gefunden hat, und vielleicht ist es gar nicht für einen das Richtige“ (R.S.).
„Die Selbsteinschätzung hat mich auf die Idee gebracht, dass ich auf jeden Fall auch noch mehr Möglichkeiten nutzen möchte, um Sprachen zu lernen, bisher habe ich eigentlich fast nur Sprachtandem gemacht, und einen Sprachkurs, aber z.B. habe ich immer noch sehr wenig das Internet oder CD-ROMs benutzt […]. Es hat mir viele neue Ideen gegeben, so z.B. […], dass ich mehr mit Filmen und Zeitschriften in Zukunft lernen möchte“ (C.G.).
4.3 Reflexion der Sprachlernberaterin
Sowohl die Untersuchung als auch meine Erfahrung als Sprachlernberaterin bestätigen, dass von einer solchen Selbsteinschätzung und Evaluation von Lernerautonomie sowohl Lerner als auch Berater bzw. Lehrer profitieren. Der Lerner profitiert von der Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen und Einstellungen sowie das eigene Lernver-halten zu reflektieren; die Bewusstheit und die Reflexion unterstützen die Steuerung des Lernprozesses und somit den Autonomisierungsprozess. Der Berater bzw. der
22 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
Lehrer erhalten einen tieferen Einblick in die Kompetenzen des Lerners und identi-fizieren Bereiche, in denen sie den Lerner in seinem Lernprozess unterstützen können. Darüber hinaus profitieren sie von der stärkeren Bewusstheit des Lerners, der somit selbst Wege finden kann, um sein Lernen autonomer zu gestalten. Sicherlich reicht eine einmalige Evaluation nicht, um ggf. erkannte Schwächen zu beseitigen und die Lernkompetenzen auszubauen. Vielmehr sollte der Evaluations-prozess rekursiv durchgeführt werden. Eine Evaluation kann und sollte mehrmals im Laufe des Lern- und Lehrprozesses unternommen werden, ggf. mit unterschiedlichem Fokus, unterschiedlicher Zielsetzung und möglicherweise auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Auch das gehört zur Dynamik des Autonomiemodells. Gerade weil es für Lerner so schwer ist, sich selbst zu evaluieren, muss dieser Prozess in einen pädagogischen Rahmen eingefügt und begleitet werden. Von daher ist der pädagogische Dialog ein wesentlicher Aspekt dieses Evaluationsprozesses. In selbstgesteuerten Lernprozessen ist dies hauptsächlich der Dialog zwischen Lerner und Berater, im unterrichtlichen Lernen ist es der Dialog zwischen Lerner und Lehrer. Zum pädagogischen Dialog gehört aber auch der Austausch mit Mitlernenden, mit peers, mit Tutoren. Schließlich gehört auch die innere Perspektive, die innere Reflexion, der Dialog des Lerners mit sich selbst dazu. Das Beratungsgespräch dient dazu, die Selbsteinschätzung des Lerners zu validieren und seine innere Perspektive mit der äußeren Perspektive des Beraters abzugleichen. Der Berater kann ggf. helfen, einige Einschätzungen und Vorstellungen des Lerners zu verorten, zu ergänzen oder zu relativieren. Das Beratungsgespräch bringt somit neue Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung. Eine solche Evaluation kann nur in einem Kontext erfolgreich sein, in dem Lernerautonomie explizit gefördert wird. Die Unter-suchung hat gezeigt, dass Selbsteinschätzung und Evaluation nur dann als sinnvoll be-trachtet werden, wenn die Studierenden in Lernerautonomie eines der Ziele ihres Lern-prozesses sehen, andernfalls tritt das Gegenteil ein (vgl. auch Abschnitt 4.2). Im Lern- und Lehrprozess sollte auch darauf geachtet werden, ein Gleichgewicht zwischen dem Fokus auf Lernkompetenzen und dem auf Sprachkompetenzen zu er-zielen. Dabei sollten die Bedürfnisse und die Prioritäten der Lerner immer berück-sichtigt werden. Da die Erhaltung dieses Gleichgewichts von Kontext zu Kontext und von Lerner zu Lerner unterschiedlich gehandhabt werden kann, empfiehlt es sich, dies zwischen Lerner und Berater bzw. Lehrer immer wieder zu verhandeln. Ab einem be-stimmten Kompetenzniveau kann die Evaluation durchaus auch in der Fremdsprache geführt werden. 5. Fazit
Die Ergebnisse meiner Untersuchung sowie meine Erfahrung als Sprachlernberaterin zeigen, dass die Selbsteinschätzung und die Evaluation von Lernerautonomie dazu dienen, die eigenen Kompetenzen, Einstellungen und das Lernverhalten besser zu reflektieren und somit den eigenen Lernprozess bewusster zu steuern.
Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren 23
41 (2012) • Heft 1
Dabei stellen das dynamische Autonomiemodell und die Deskriptoren ein nützli-ches Instrument dar, um den Reflexionsprozess zu unterstützen, Bewusstheit zu fördern und Entscheidungen fürs weitere Lernen zu ermöglichen. Der Evaluationsprozess sollte jedoch in einen pädagogischen Dialog integriert werden, in dem Lerner und Berater bzw. Lehrer ihre Perspektiven abgleichen. In einem pädagogischen Rahmen, in dem Lernerautonomie explizit gefördert wird, ist es die Aufgabe des Beraters bzw. des Lehrers, eine solche Evaluation in verschiedenen Kontexten und zu verschiedenen Zeitpunkten des Lernprozesses anzuregen und zu gestalten. Denkbar ist es, das dynamische Autonomiemodell als Instrument in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln: Es könnte z.B. in ein Sprachenportfolio integriert oder um einen Leitfaden zum autonomen Lernen ergänzt werden. Die Deskriptoren könnten auch für verschiedene Lernkontexte und Lerngruppen adaptiert werden. Die Erforschung der Kompetenzen zu Lernerautonomie und deren Förderung kann und sollte unter verschiedenen Gesichtspunkten weitergeführt werden. Insbesondere erge-ben sich aus meiner Untersuchung zwei Bereiche zur weiteren Erforschung: die Ana-lyse autonomisierender Lernprozesse sowie die Analyse von Beratungsprozessen und deren pädagogischem Potenzial.
Literatur BENSON, Phil (2001): Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. London: Long-
man. BENSON, Phil (2010): „Measuring autonomy: Should we put our ability to the test?“ In: PARAM/
SIERCU (Hrsg.), 77–91. CHAMOT, Anna U. / BARNHARDT, Sarah / EL-DINARY, Pamela B. / ROBBINS, Jill (1999): The Learning
Strategies Handbook. London: Longman. CRABBE, David (1999): „Learner autonomy and the language teacher“. In: WARD, Christopher /
RENANDYA, Willy (Hrsg.): Language Teaching: New Insights for the Language Teacher. Singa-pore: SEAMEO Regional Language Centre, 241–258.
DAM, Leni / LEGENHAUSEN, Lienhard (2010): „Learners reflecting on learning: evaluation vs testing in autonomous language learning“. In: PARAM/SIERCU (Hrsg.), 120–139.
DICKINSON, Leslie (1992): Learner Autonomy 2: Learner Training for Language Learner. Dublin: Authentik.
ELLIS, Gail / SINCLAIR, Barbara. (1989): Learning to Learn English. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
HOLEC, Henri (1979): Autonomie et apprentissage des langues étrangères. Strasbourg: Conseil de l’Europe [Englisch 1981: Autonomy in Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon].
KELLY, Rena (1996): „Language counselling for learner autonomy: the skilled helper in self-access language learning“. In: PEMBERTON, Richard. / LI, Edward, S.L. / OR Winnie, W.F. / PIERSON, Herbert D. (Hrsg.): Taking Control: Autonomy in Language Learning. Hong Kong: Hong Kong UP, 93–113.
KLEPPIN, Karin (2005): „Die Förderung der Fähigkeit zur Selbstevaluation beim Fremdsprachen-lernen“. In: BURWITZ-MELZER, Eva / SOLMECKE, Gert (Hrsg.): Niemals zu früh und selten zu spät: Fremdsprachenunterricht in Schule und Erwachsenenbildung. Festschrift für Jürgen Quetz.
24 Maria Giovanna Tassinari
41 (2012) • Heft 1
Berlin: Cornelsen, 107–118. KOLB, Alice. Y. / KOLB, David. A. (2009): „Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach
to management learning, education and development“. In: ARMSTRONG, Steve / FUKAMI, Cynthia J. (Hrsg.): Handbook of Management Learning, Education and Development. London: Sage, 42–68.
KUMARAVADIVELU, Barbara (2003): Beyond Methods. Macrostrategies for Language Teaching. New Haven: Yale UP.
LAMB, Terry / REINDERS, Hayo (Hrsg.) (2007): Learner and Teacher Autonomy: Concepts, Realities and Responses. Amsterdam: John Benjamins.
MARTINEZ, Hélène (2008): Lernerautonomie und Sprachenlernverständnis. Eine qualitative Unter-suchung bei zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern romanischer Sprachen. Tübingen: Narr.
NUNAN, David (1997): „Designing and adapting materials to encourage learner autonomy“. In: BENSON, Phil / VOLLER, Peter (Hrsg.): Autonomy & Independence in Language Learning. Lon-don: Longman, 192–203.
OXFORD, Rebecca L. (1990): Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Eng-lewood Cliffs, NJ: Newbury House.
PARAM, Amos / SIERCU, Lies (Hrsg.) (2010): Testing the Untestable in Language Education. Bristol: Multilingual Matters
SCHARLE, Ágota / SZABÓ, Anita. (2000): Learner autonomy. A guide to developing learner responsi-bility. Cambridge: Cambridge UP.
SCHMENK, Barbara (2008): Lernerautonomie. Karriere und Sloganisierung des Autonomiebegriffs. Tübingen: Narr.
TASSINARI, Maria Giovanna (2010): Autonomes Fremdsprachenlernen: Komponenten, Kompetenzen, Strategien. Frankfurt/M.: Lang.
WENDEN, Anita L. (1991): Learner Strategies for Learner Autonomy. Hemel Hempstdead: Prentice Hall.